MÄRCHEN AUS ÖSTERREICH ...
"Die drei Raben"
"Der blöde Peter"
"Die faule Katl"
"Winterkölbl"
"Die neun Vögel"
"Geschwind wie der Wind"
"Das Alpenglühen"
"Der Schmied in Rumpelbach"
"Notwendigkeit des Salzes"
"Der arme Spielmann und die goldenen Schuhe"
"Der Königssohn"
"Der erlöste Zwerg"
"Die wunderbare Rettung"
"Die zwei Schächtelchen"
"Der Zaubertopf und die Zauberkugel"
"Der Graf mit dem steinernen Herzen"
"Wie ein Schafhirt reich wurde"
"Die weisse Rose"
"Der Drachentöter"
"Cistl im Körbl"
"Laurins Rosengarten"
"Der tote Schuldner"
"Der verzauberte Grafensohn"
"Der kleine Schneider"
"Der Messnersohn"
"Hyacinth und Rosenblüte"
"Der blinde König"
"Die drei Pomeranzen"
"Das Totenköpflein"
"Gottes Lohn"
"Das Mädchen ohne Hände"
"Ostermärl"
"Der gescheite Hans"
"Die drei Königskronen"
"Der Müllerbursche und die Katze"
"Der gescheite Hans´l"
"Der Knabe und die Riesen"
"Das kluge Ehepaar"
"Wie ein armes Mütterchen zur vieler Wäsche kam und dieselbe wieder verlor"
"Der Holzhacker"
"Der gläserne Berg"
"Purzinigele"
"Die zwei Fischersöhne"
"Nadel, Lämmlein und Butterwecklein"
"Der tapfere Ritterssohn"
"Goldener"
"Riese und Hirte"
"Werweiss"
"Was ist das Schönste, Stärkste und Reichste"
"Die singende Rose"
"Der Fischer"
"Müllers Töchterlein"
"Unser Herr als Bettler"
"St. Petrus"
"Bauer und Bäuerin"
"Die drei Schwestern"
"Die zwei Jäger"
"Der starke Hans´l" - Geschichte I
"Starker Hans´l" - Geschichte II
"Der Krämer"
"Hennenpfösl"
"Luxehales"
"Vom armen Schuster"
"Mädchen und Bübchen"
"Der Bärenhansl"
"Der höllische Torwartel"
"Teufel und Näherin"
"Vom reichen Grafensohne"
"Fischlein kleb an!"
"Die Krönlnatter"
"Die drei Soldaten"
"Der daumenlange Hansl"
"Der gehende Wagen"
"Das verzauberte Schloss"
"Der Grindkopf"
DER GRINDKOPF ...
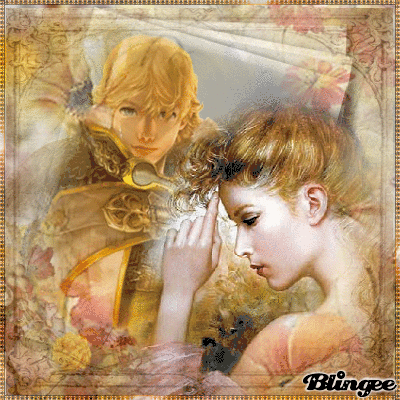
Es war einmal ein recht armes Bäuerlein, das oft nicht wußte, wie es sich und seinem Weib den Hunger stillen sollte. Da ging es nun einmal in den Wald hinaus und klaubte Holz. Da stapfte ein großer fremder Mann daher, der hatte einen grünen Hut und eine lange Hahnenfeder darauf, und sein Gesicht schaute recht wild aus.
»Du«, sagte er zum Bäuerlein, »ich weiß, daß du dich sehr hart durchschlagen mußt, und ich habe Mitleid mit dir. Wärst du nicht froh, wenn dir jemand helfen würde?« »Ja, freilich wäre ich froh«, antwortete das Bäuerlein, »aber wer wird mir auch helfen können?« »Oh, das kann ich ganz leicht«, versetzte der Fremde, »ich habe mir vorgenommen, dir zu helfen, und weil es mich nicht viel kostet, verlange ich auch nicht viel dafür. Schau, gib mir das, was du in deinem Haus nicht weißt, und dein Glück ist gemacht. Ist es dir so recht, dann schlag ein.«
Da dachte das Bäuerlein: Es kann gewiß nichts Kostbares sein, wenn ich es in meinem Haus nicht einmal weiß, und topp, schlug er ein. »Heute nach vierzehn Jahren«, fuhr der Fremde fort, »mußt du mir das Versprochene auf diese Stelle bringen. Jetzt geh nur nach Hause und sei lustig; im Keller wirst du alles finden, was du nur wünschst.« Und mit diesen Worten war der unheimliche Mann verschwunden.
Der Bauer kümmerte sich jetzt nicht weiter um das Holz und eilte mit freudestrahlendem Gesicht heim, um seinem Weib das große Glück, das ihnen zuteil geworden war, zu verkünden. »Grete«, rief er schon unter der Tür, »Grete, geh nur gleich in den Keller und bring uns zu essen und zu trinken, was einem schmeckt, wenn man durch lange Zeit Hunger und Durst gehabt hat.«
Das Weib stutzte und meinte, Hans sei närrisch geworden, ging aber doch aus Neugierde in den Keller hinab. Und siehe, alles war im Überfluß vorhanden, wie man es sonst nur bei steinreichen Leuten findet. Ganze Kisten voll Geld standen herum, und der Duft der herrlichsten Speisen stieg ihr in die Nase.
Neben den vollen Schüsseln sah sie große Flaschen voll funkelnden Weines, und in großen Truhen waren die schönsten Kleider aufgehäuft. Grete sah nun wohl, daß ihr Mann vernünftig und wahr geredet hatte. Sie nahm ein paar Schüsseln und etliche Flaschen mit sich und ging damit hinauf zu ihrem Mann. Dann setzten sich beide zu Tisch und aßen und tranken und ließen es sich wohl sein.
Als der ärgste Hunger gestillt war, fingen sie wieder an zu plaudern, und Grete sagte: »Aber, lieber Mann, wie ist denn das zugegangen, daß auf einmal der Keller voller Zeug und Sachen ist? Da muß doch etwas anderes dahinter sein?« »Gelt«, antwortete Hans, »jetzt sind wir reiche und vornehme Leute, brauchen uns nicht mehr zu schinden und zu plagen, und die Vögel fliegen uns gebraten ins Maul. Und sieh, wie wohlfeil wir zu all dem Glück gelangt sind: Wir haben keine andere Verpflichtung als das, was ich nicht weiß, in vierzehn Jahren herzugeben.«
Und dann erzählte er ihr den ganzen Hergang im Wald mit jenem fremden Mann.
Als das Weib das hörte, wurde es ganz traurig und sagte: »Oh, wie unbesonnen hast du gehandelt! Was für ein Unheil hast du über uns gebracht. Das Kind, das wir bekommen werden, hast du
verkauft.« Da wurde auch der Mann traurig und niedergeschlagen, und von der Stunde an sah man keines von beiden jemals wieder fröhlich.
Als das Kind auf die Welt kam, war es ein wunderschönes Knäblein, aber auf der Stirne hatte es schon ein Zeichen. Die Mutter konnte es nie anders als unter Tränen ansehen, und wenn der Vater den schönen Knaben erblickte und an sein künftiges Schicksal dachte, so mußte er allemal weinen.
Als der Knabe etwas älter war und reden konnte, fragte er die Mutter oft, warum sie so traurig sei. Sie sagte ihm aber nie den Grund, sondern erwiderte ihm immer nur: »Du wirst es zeitig genug erfahren.« Die unglücklichen Leute genossen wenig von ihrem Reichtum und dachten nimmer an Geld und Gut, sondern nur an die vierzehn Jahre.
Statt des Geldes zählten sie Jahre und Stunden, und ehe sie sich versahen, war das vierzehnte Jahr vorüber. Da nahm nun die Mutter laut weinend Abschied von ihrem Kind, segnete es, und der Vater machte sich trauernd mit dem Knaben auf den Weg in den Wald.
Als sie sich an der Stelle befanden, wo der Tausch geschehen war, stapfte schon der Mann daher mit dem grünen Hut und der langen Hahnensichel drauf. »Sehen wir uns wieder!« rief er schon von weitem. »Nun, das ist recht, daß du dein Versprechen hältst. Wärst du nicht gekommen, hätte ich zwar auch nichts machen können, aber so ist es besser. Der Kleine soll es gut haben bei mir; zu arbeiten gibt es wenig, und zu essen und zu trinken bekommt er vollauf.«
Mit diesen Worten nahm er den Knaben zu sich und führte ihn fort. Der Vater sah ihnen betrübt nach und ging dann betrübt und traurig nach Hause. Der Fremde war ein Schwarzkünstler und führte den Knaben auf einem fast unentdeckbaren Pfad durch den grünen Wald, bis sie nach langer Zeit zu einem Schloß kamen, in dem der Zauberer wohnte.
Vor dem Schloß waren eine Lache und ein Stall, und in dem Stall waren eine Löwin und ein Schimmel. Der Schwarzkünstler wandte sich zum Knaben und sagte: »Du darfst in meinem Schloß alles gebrauchen, was du willst, darfst essen und trinken, was du willstt, darfst Kleider anlegen, die du willst, nur darfst du mir ja nicht in die Lache tauchen und mußt mir die Löwin und den Schimmel pflegen.
Der Löwin gibst du das, was du selbst ißt, dem Schimmel aber nichts anderes als trockenes Heu. Ich werde nun auf eine Zeit lang fortreisen, und wenn du dich brav hältst und tust, wie ich gesagt habe, so wird es dir gut gehen, sonst ist es um dich geschehen.«
Der Zauberer ging fort, und der Knabe tat alles, wie es ihm befohlen war: der Löwin gab er, was er aß, dem Schimmel trockenes Heu, und er ging nie zu nahe an die Lache. Als der Mann wieder zurückkam und sah, wie die Löwin fett und der Schimmel mager geworden war, da lobte er den Knaben und sagte, er solle nur so fortfahren, und dann ging er wieder fort.
Wie nun der Bursche wieder einmal in den Stall ging, fing der Schimmel an zu reden und sagte: »Warum gibst du denn mir schlechtes Futter und der Löwin das, was du ißt? Versuch es einmal und gib mir das, was du der Löwin gibst, und der Löwin trockenes Heu, daß sie mager wird und ich fett. Fürchte deinen Herrn nicht, tu, was ich dir sage, tunke deine Finger in die Lache vor dem Stall und sei unbesorgt.«
Dem Knaben kam es seltsam vor, daß das Roß auf einmal reden konnte. Ja, versuchen kann ich es wohl einmal, dachte er. Es wird etwa doch nicht gar so gefehlt sein. Er gab nun dem Schimmel das, was er selbst aß, und bald war dieser fett; die Löwin hingegen war bald ganz abgemagert, weil sie nichts als trockenes Heu bekam.
Einmal ging er auch zur Lache, tauchte den Finger ein, und wie er das getan hatte, siehe, da zog er ihn ganz golden heraus. Er mochte reiben und schaben, wie er wollte, das Gold blieb haften. Da war er nun voll Angst und Sorge und band sich das Fingerlein ein, als hätte er sich beschädigt. Nicht lange darauf kam der Zauberer, und als er die magere Löwin und den fetten Schimmel und das eingebundene Fingerchen sah, da wußte er gleich alles, was geschehen war, und fuhr den Knaben zornig an:
»Warum hast du mir nicht gefolgt? Hättest du das vorige Mal deine Pflicht nicht fleißig erfüllt, so würdest du jetzt nicht mehr lange leben. Dieses Mal will ich noch nachsichtig sein, doch wenn du in Zukunft dich nicht ordentlich hältst, so bist du des Todes.« Bald ging der Zauberer wieder fort, und der Knabe tat ganz nach dessen Vorschrift, so daß die Löwin fett und der Schimmel mager wurde.
Da hob der Schimmel wieder einmal zu reden an und sprach: »Gib mir wieder das, was du ißt, und der Löwin trockenes Heu, und tauche deinen Kopf in die Lache! Fürchte den Zauberer nicht! Wenn er zurückkommt, so nimm den Sack hinter dem Tennentor und setz dich auf mich, ich werde dich fort tragen. Der Mann wird uns wütend nacheilen, aber wenn du meinst, er faßt dich, so schlage den Sack über die Schultern zurück, und er kann dir nicht mehr schaden.«
Der Knabe traute den Worten des Schimmels und gehorchte ihm. Er gab der Löwin trockenes Heu und dem Schimmel, was er selbst aß, und tauchte den Kopf in die Lache. Und als er den Kopf aus der Lache zog, siehe, da rollten Locken über sein Haupt herab, die waren von hellem Gold! Während er aber erfreut um sich blickte, sah er den Zauberer von weitem daher kommen mit lautem Schelten und Toben.
Er gedachte der Worte des Schimmels, lief sogleich hinter das Tennentor und holte den Sack. Dann sprang er in den Stall und schwang sich auf den Schimmel. Dieser flog eiligst zur Stalltür hinaus, und im vollen Galopp ging es dann über Stock und Stein durch des Waldes Dickicht. Der wilde Mann war bald hinterher und wollte den Reiter ergreifen, aber da schlug dieser gleich den Sack über die Schultern, und der Zauberer mußte zurück fliehen.
Das Roß und sein Reiter legten in kurzer Zeit einen langen Weg zurück und kamen in einen Wald, wo sie einen Stall antrafen. Da sagte der Schimmel: »Ich werde hier in diesem Stall bleiben; du gehst den Berg da hinauf und wirst zu einem Königsschloß kommen. Dort versuche als Küchenjunge aufgenommen zu werden; man wird dich gewiß nicht abweisen. Aber laß ja deine goldenen Locken nicht sehen, bevor ich es dir erlaube. Wenn dir aber etwas zustößt, wo guter Rat teuer ist, so komm nur zu mir herab, ich werde dir schon helfen.«
Da ging der Knabe den Berg hinauf und kam zu dem Schloß und wurde als Küchenjunge angestellt. Es ging ihm droben ganz gut, und man hatte ihn gern, weil er so schön war. Die goldenen Locken ließ er aber nie sichtbar werden und verbarg sie mit der größten Sorgfalt.
Auf dem Schloß wohnte ein König, der hatte wunderschöne Töchter. Da geschah es einmal, daß die älteste Hochzeit hielt, und man fragte den Küchenjungen, der nun ein hübscher Jüngling geworden war, ob er sich das Kochen des Hochzeitsessens zutraue. Er sagte, versuchen wolle er es schon einmal, ging dann zum Schimmel hinab und fragte, wie er es anstellen sollte.
Der Schimmel zeigte ihm ein Pulver und sagte: »Nimm dies und schütte es eine Stunde vor der Mahlzeit in heißes Wasser, dann werden zeitgerecht nacheinander die besten Speisen erscheinen.« Der Junge nahm das Pulver mit sich in das Schloß und traf weiter gar keine Vorbereitungen zum Mahl. Alle lachten oder ärgerten sich über seine Fahrlässigkeit, und jedermann meinte: »Das wird etwas Sauberes werden von einem Hochzeitsschmaus.«
Aber er ließ sie sagen, was sie wollten, und kümmerte sich um niemand. Eine Stunde bevor das Mahl beginnen sollte machte er Wasser heiß und schüttete sein Pulver hinein. Wie nun die Essenszeit kam, siehe, da stiegen nacheinander die herrlichsten Speisen aus dem Wasser hervor, und alle, die sie kosteten, sagten, sie hätten ihr Lebtag nichts Besseres in den Mund gebracht.
Der König war über die Maßen zufrieden und befahl, die letzten drei Speisen solle der Koch selbst auftragen. Allein dieser wollte nicht folgen, bis er endlich, weil man durchaus nicht nachgab, die letzte Speise selbst auf den Tisch brachte. Er nahm jedoch selbst im Speisesaal die Mütze nicht vom Kopf.
Da wurde er aufgefordert, wenigstens aus Ehrfurcht vor dem König sein Haupt zu entblößen, wenn er es schon der übrigen Gäste wegen nicht tun wollte. Er weigerte sich aber durchaus, und da man drohte, ihm mit Gewalt die Kappe herab zu reißen, sagte er: »Wenn ich euch sage, wie mein Kopf aussieht, so werdet ihr froh sein, daß er bedeckt ist, denn ich bin grindig.«
Auf dieses Wort stoben die Gäste auseinander, als ob ein Sturm drein gefahren wäre. Der Küchenjunge wurde augenblicklich verjagt und ging wieder hinab zu seinem Schimmel. Diesem erzählte er alles und fragte ihn, was jetzt zu machen sei. Der Schimmel sagte: »Geh nur wieder in das Schloß hinauf und schau, daß man dich als Gärtner anstellt.«
Zugleich wies er ihm einen Samen an, den er ausstreuen solle; daraus würden dann die schönsten Blumen hervorsprießen, sobald er deren bedürfe. Der Jüngling gehorchte, ging auf das Schloß und wurde als Untergärtner angestellt, da man gerade einen brauchte. Er säte den Samen aus und tat redlich seine Pflicht; aber jedermann scheute den vermeintlichen Grindkopf und wich ihm aus.
Als er einmal Bäume putzte, da geschah es, daß ihm ein Ast die Mütze etwas in die Höhe streifte und dadurch die goldenen Locken sichtbar machte. Dabei hatte ihn die jüngste Königstochter beobachtet, und weil er auch sonst ein hübscher Bursche war, gewann sie ihn sogleich lieb. Auch er schaute nicht ungern auf die Prinzessin und hatte immer seine herzliche Freude, wenn sie durch den Garten ging und Pflanzen und Bäume anschaute. So ging es lange Zeit fort.
Da hielt einmal die zweite Tochter Hochzeit, und jeder Gärtner mußte einen Blumenstrauß bringen. Auf das Verlangen des Untergärtners schossen aus dem Beet, in das er den wunderbaren Samen gesät hatte, sogleich die herrlichsten Blumen empor, die er zu einem wunderschönen Strauß band. Sein Strauß war weit schöner als alle übrigen, aber dessen ungeachtet wollte ihm die Blumen niemand abnehmen, bis auf die jüngste Prinzessin, welche sogleich danach griff.
Sie bog die Blumen etwas auseinander - da sah sie drinnen helles Gold blinken, und wie sie ein wenig schüttelte, rollten eine Menge Goldstücke auf den Boden. Da erstaunten alle im ganzen Saal, und jeder hätte gern den kostbaren Strauß gehabt. Der Untergärtner blieb aber dennoch verachtet und hieß nur der Grindkopf.
Die Königstochter und der Untergärtner versuchten von jetzt an oft beisammen zu sein und hatten sich von Tag zu Tag lieber. Dem König blieb alles verborgen, bis endlich die Prinzessin sich den Mut nahm, dem Vater zu eröffnen, daß sie den Untergärtner gern habe und zum Gemahl möchte; von seinen vergoldeten Locken aber sagte sie nichts, weil es ihr verboten war.
Da war der König sehr zornig, daß seine Tochter einen Grindkopf gern habe, und schalt und schmähte sie. Weil aber die Tochter auf ihrer Liebe bestand und ihn bat, er möchte ihr den Gärtner zum Gemahl geben, da sprach er: »Nun, so tue, wie du willst, du eigensinniges Ding, und nimm ihn zum Mann. Jedoch wird keine Hochzeit gefeiert werden, und ihr müßt, wenn ihr euch geheiratet habt, im Hennenhaus wohnen.«
Die Tochter ging mit diesem Bescheid zum Untergärtner. Sie heirateten einander, bezogen das Hennenhaus und hatten sich lieb. So lebten sie lange Zeit recht vergnügt und glücklich, und die Tage vergingen ihnen wie Sekunden.
Da geschah es einmal, daß der König einen Krieg führen mußte. Alle seine Kriegsmannen rückten ins Feld, nur den Untergärtner wollte man nicht mitziehen lassen. Da ging dieser zum Schimmel hinab und fragte, was er tun solle. Der Schimmel gab ihm eine Rüstung und ein Schwert und sagte: »Zieh nur ins Feld! Man wird dich in dieser Rüstung gewiß nicht erkennen. Das Schwert ist gut, und auf jeden Streich, den du damit tust, wird ein Mann fallen. Wenn der Krieg aus ist, dann bring mir alles wieder zurück!«
Der Gärtner war darüber voll Freude, nahm noch von seiner Gemahlin Abschied und rückte dann in den Krieg. Niemand vermutete unter dem schönsten aller Ritter den Grindkopf. Wie es nun zum Kampf kam, tat dieser Wunder der Tapferkeit, und der Sieg war beinahe ihm allein zu verdanken.
Das sahen zwei Ritter mit neidischen Augen und wollten selbst als Urheber des Sieges gelten. Sie wollten ihn töten und schossen nach ihm, trafen ihn jedoch nur an einem Fuß. Die Diener des Königs eilten sogleich herbei und verbanden die Wunde mit Binden, die mit dem Namen des Königs bezeichnet waren.
Die Wunde gab dem schönen Ritter nicht viel zu schaffen, und er eilte schnell zum Schimmel und stellte ihm Rüstung und Schwert zurück. Der Schimmel sagte ihm, jetzt dürfe er gelegentlich die goldenen Locken sehen lassen. Der Untergärtner kehrte nun in das Schloß zurück und ging in das Hennenhaus.
Der König ließ eifrigst nach dem Ritter fragen, dem seine Diener die Wunde verbunden hatten. Da trat der Grindkopf vor ihn und sagte: »Der Ritter, den du verlangst, bin ich gewesen.« Der König wollte dies nicht glauben, bis ihm der Grindkopf die Binde zeigte, worauf sein Name gezeichnet war, und zugleich die Mütze vom Haupt zog, so daß die reichen goldenen Locken sichtbar wurden.
Obwohl ihn der König anfangs schalt, daß er sich ihm nicht früher anvertraut hatte, war er doch über die Maßen erfreut, daß der tapfere Ritter mit den schönen goldenen Locken sein Schwiegersohn war, und veranstaltete eine gar prächtige Hochzeit.
Und wie die Gäste beisammen saßen und guter Dinge waren, da trat die Mutter des Grindkopfs, schön gekleidet, in den Saal. Sie war vom Schwarzkünstler, der sie noch vor ihrem Knaben in den Wald gebracht hatte, in den Schimmel verwandelt worden und war nun durch ihr Kind erlöst.
Mutter und Sohn, König und Prinzessin lebten nun lange Zeit glücklich beisammen, und nach dem Tod des Königs erhielt der Grindkopf die Krone und herrschte milde und gerecht, bis auch er starb.
Dann hab' ich ein Eiszapf'n angezund'n,
Dann ist er abgloschen,
Dann bin ich auf und davon gloffen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DAS VERZAUBERTE SCHLOSS ...
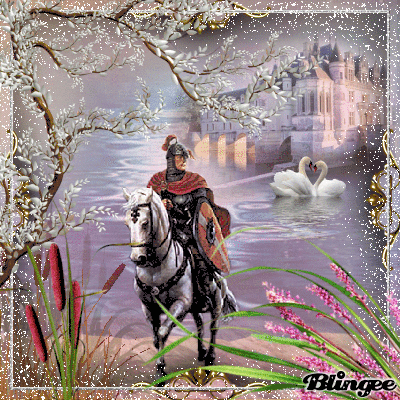
Es lebte einstens ein reicher, mächtiger Graf. Dieser hatte drei Söhne, von denen die älteren zwei ziemlich herangewachsen waren, als ihre liebe Mutter starb; der dritte war aber noch sehr jung und klein. Die älteren beiden hatten keine größere Freude, als auf die Jagd zu gehen oder mit den Pferden sich herumzutummeln und den jüngsten Bruder zu necken; denn dieser blieb den ganzen Tag bei seinem trauernden Vater zu Hause und fand nur Freude an dessen schönen Geschichten und angenehmen Erzählungen. Deshalb liebte ihn auch der Vater gar sehr.
So ging es mehrere Jahre fort. Der jüngste war auch größer geworden, und der Vater hatte allmählich die Trauer um sein geliebtes Weib gemäßigt; aber dafür kam jetzt ein anderes großes Unglück über ihn, er wurde sehr krank und bekam einen häßlichen Ausschlag. Von weit und breit wurden die berühmtesten Ärzte berufen, doch keiner kannte ein Kräutlein oder ein Wässerlein gegen diese häßliche Krankheit.
Da erzählte eines Tages ein altes Weiblein, daß weit von hier sich ein Schloß befinde mitten in einem See, und darinnen schlafe eine verzauberte Königstochter. Dort könnte man ein Wässerlein bekommen, das alle Krankheiten heile und von dem der alte Graf ganz gewiß gesund würde.
Wie dies der älteste Sohn hörte, sattelte er sogleich sein Pferd, versah sich wohl mit Gold und Silber, schwang sich in den Sattel und sprengte auf und davon, um seinen Vater zu retten und die Jungfrau zu befreien. Wie er etliche Tage so fort geritten war, kam er an ein Wirtshaus, darin schien es sehr lustig zuzugehen, denn es wurde getanzt, gesungen und gesprungen, daß es eine Freude war und man den Lärm weithin hören konnte.
Er machte verwundert und ermüdet halt. Sogleich sprangen etliche der lustigen Brüder mit der vollen Weinflasche aus der Schenke und hießen den schmucken Reiter herzlich willkommen. Dieser ließ es sich auch nicht zweimal sagen; er sprang aus dem Sattel, übergab das Pferd dem Knecht zur Versorgung und eilte mit den anderen in die Gaststube hinein. Hier wurde er von allen in die Mitte genommen und nicht mehr losgelassen; er mußte alles mitmachen, so zwar, daß er bald all sein Geld samt dem Pferd vertan hatte.
Als nun der älteste Sohn zur bestimmten Zeit nicht kam, da sattelte der jüngere Sohn sein Roß, nahm viel Silber und Gold mit sich und sprengte auf und davon, um so bald als möglich den See samt dem Schloß zu erreichen.
Nach etlichen Tagen kam er auch zum Wirtshaus, worin sein älterer Bruder sitzen geblieben war. Wie dieser seinen jüngeren Bruder daher reiten sah, eilte er ihm mit seinen Zechbrüdern entgegen und nötigte ihn, auch ins Wirtshaus zu gehen. Da erging es ihm geradeso wie dem älteren; er blieb freiwillig so lange, bis er all sein Geld und Gut verpraßt hatte, so daß beide wider Willen bleiben mußten. Zu Hause wartete man mit Sehnsucht auf ihre Rückkehr, jedoch vergebens.
Da machte sich der jüngste Bruder auf und versprach seinem Vater, das Heilwasser zu erobern, seine Brüder dann aufzusuchen und mit sich zurück zu bringen. Er sprengte immer fort, Tag und Nacht, ohne Unterlaß. Wie er zum Wirtshaus kam, hörte er wohl seine Brüder von weitem schon lärmen, er gab aber dem Pferd die Sporen und flog mit Windeseile am Wirtshaus vorbei. Alles Rufen der Brüder und der anderen tollen Zecher war vergebens, er ritt unaufhaltsam fort.
Endlich kam er an einen großen See, und in dessen Mitte sah er ein schönes Schloß. Der Beschreibung nach mußte es das Schloß sein, das er aufsuchte. Wie er nun am Ufer auf und ab ritt und forschte, wie er wohl ins Schloß kommen könnte - denn er sah weder Brücke noch Schiff -, da erblickte er ein altes Weiblein, das im See mit dem Wasser kämpfte und dem Ertrinken sehr nahe war.
Voll Mitleid sprang er ins Wasser und zog das alte Weiblein ans Ufer. Dies dankte ihm für die Rettung und fragte ihn, was er denn am See wolle. Da erzählte er ihr sein Anliegen. »Da ist bald geholfen«, sagte das Weiblein. »Weil du gegen mich so barmherzig gewesen bist und mich von der scheinbaren Gefahr des Ertrinkens gerettet hast, so will auch ich dich unterstützen.
Ich bin zur Wächterin über das Schloß und die schlafende Prinzessin aufgestellt worden von dem mächtigen Zauberer. Aber diese Beschäftigung wird mir zu langweilig, und die holde Jungfrau erbarmt mir gar zu sehr, deshalb will ich dich unterstützen. Aber du mußt auch erfüllen, was ich von dir verlange.
Du mußt dein Pferd in viele Stücke zerhacken und mich an diesem Platz morgen um elf Uhr erwarten. Die Stücklein nimmst du mit, wenn ich dich ins Schloß führe; denn drinnen wimmelt es von den verschiedensten Tieren, kleinen und großen, wilden und zahmen. Wenn ich dir winke, so wirfst du ihnen ein Stück vor, damit du ungehindert durchgehen kannst; ebenso auf dem Rückweg.
In dem Zimmer, wo sich die schlafende Prinzessin befindet, nimmst du die mittlere von drei auf einem Tisch stehenden Flaschen und dann eile wieder hinweg, denn um zwölf Uhr dreht sich alles im Schloß herum. Du wärst verloren, wenn du dich noch im Schloß befändest, und die Prinzessin wäre dann unerlösbar.« Hierauf entfernte sich das Weiblein.
Er erfüllte getreulich, was ihm befohlen war. Mit den Stücklein seines Pferdes harrte er schon in aller Frühe auf seine Führerin. Um elf Uhr erschien sie in einem Kahn und brachte ihn ins Schloß. Hier begegneten ihnen die seltsamsten Tiere, kleine wie große, zahme wie wilde, an den Türen aber hielten Löwen Wache, von denen er einem jeden ein Stück Pferdefleisch hinwerfen mußte.
So kam er von einem Zimmer in das andere, und das Weiblein öffnete immer mit einem goldenen Schlüssel. Endlich kamen sie ins Zimmer, wo die Prinzessin war; diese war eine wunderschöne Jungfrau und schlief fest auf einem herrlichen Bett. Der Jüngling war ganz entzückt von der holden Gestalt, er konnte sich daran nicht satt sehen; gerne wäre er geblieben, aber der nahe Glockenschlag und die Führerin mahnten ihn zur Eile.
Schnell ergriff er die mittlere von drei Flaschen, die auf einem Tisch standen, warf noch einen Blick auf die Schläferin, die die Augen zu öffnen schien, und eilte dann blitzschnell aus dem Schloß, in dem er auf den Wink der Führerin seine Stücklein verteilte. Kaum hatte er das Schloß hinter sich, als auch die Glocke zwölf schlug und im Schloß ein Gepolter und Lärm entstand, als drehe sich alles nach oben und unten.
Doch plötzlich wurde es still. Glücklich brachte ihn das Weiblein mit der Flasche ans Ufer. Hier fand er zu seinem größten Erstaunen ein schön gesatteltes Pferd, das ihm froh entgegen wieherte; er schwang sich hinauf und sprengte wohlgemut der Heimat zu. Nach einigen Tagen spätabends kam er beim Wirtshaus an, wo seine zwei Brüder sitzen geblieben waren. »Jetzt«, sagte er zu sich selbst, »kannst du dich wohl gütlich tun, nachdem du ein so schönes Stück Arbeit vollbracht hast.«
Er stieg deshalb ab und ging zu seinen Brüdern hinein. Diese waren mit dem Abgang ihres Geldes auch allmählich stiller geworden und saßen ganz trübsinnig in einem Winkel. Wie sie ihn nun eintreten sahen, sprangen sie vor Freude auf und baten ihn, doch zu erzählen, wie es ihm ergangen war. Er erzählte ihnen die ganze Geschichte und zeigte ihnen die Flasche mit dem Heilwasser.
Damit sie am anderen Tag mit ihm nach Hause könnten, kaufte er ihnen die Pferde los und legte sich dann wohlgemut und ohne allen Argwohn schlafen. Nicht so die Brüder. Diese wollten es ihm durchaus nicht gönnen, daß er das Heilwasser erobert hatte und dadurch seinen Vater retten konnte. Sie schlichen deshalb ganz leise an sein Lager, um zu lauschen, ob er wohl tief schlafe. Ihn umgaukelten die süßesten Träume.
Währenddessen aber nahmen seine Brüder ihm heimlich die Flasche weg, teilten den Inhalt unter sich, füllten sie dann mit Quellwasser, stellten sie an ihren früheren Ort und schliefen dann fest bis an den Morgen. Ohne allen Argwohn sattelte der jüngste sein Pferd und verwahrte seine Flasche wohl; auch die älteren zwei brachen auf und ritten froh mit ihm der Heimat zu.
Kaum angekommen, erzählte der jüngste die ganze Geschichte, die er erlebt hatte, zog dann seine Flasche hervor und wusch den Vater; doch blieb dieser krank wie zuvor. Da fragte er seine anderen zwei Söhne, ob etwa sie das wahre Heilwässerlein gefunden hätten. »Wir haben wohl eines«, sagten sie, und ein jeder zog seine Flasche hervor; und während sie den Vater wuschen, erzählten sie eine erdichtete Geschichte, wie sie dazu gekommen waren, und nachdem sie zu erzählen und zu waschen aufgehört hatten, wurde der Vater plötzlich gesund und blühend und schön wie ein Jüngling.
Da gingen dem jüngsten die Augen auf, und er beteuerte, daß ihm die älteren Brüder die Flasche gestohlen hätten. Aber er konnte das nicht beweisen, und deshalb wurde sein Vater sehr zornig auf ihn. Da schlich er gar einsam und traurig durch die Hallen der Burg, und jetzt erst dachte er an die holde Prinzessin, die ihm wegen seines Vaters ganz aus dem Gedächtnis entfallen war.
Wie er so herumirrte und nur an sie dachte, kam ein mit sechs Schimmeln bespannter Wagen daher gefahren; darin saß eine schöne Jungfrau, die von einer zahlreichen Dienerschaft umgeben war. Der Graf eilte mit seinen drei Söhnen der Unbekannten entgegen und hieß sie aufs freundlichste willkommen.
Da erkannte der jüngste in ihr die schlafende Prinzessin und konnte seine Freude nicht mehr mäßigen. Er eilte auf sie zu und bot ihr seine Rechte. Sie aber erzählte dem Grafen, wie sie durch den jüngsten gerettet wurde und jetzt da sei, ihn als ihren Bräutigam abzuholen.
Als dies der jüngste hörte, nahm er von seinem Vater und den beschämten Brüdern sogleich Abschied, stieg mit seiner Braut in den Wagen und fuhr mit ihr ins Schloß zurück. Dort hielt er Hochzeit und lebte viele Jahre mit ihr recht glücklich und zufrieden.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DER GEHENDE WAGEN ...
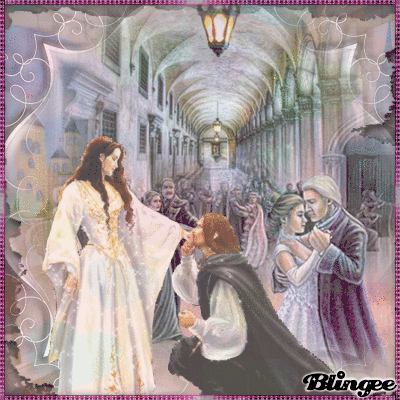
Es lebte einmal in einer großen, schönen Stadt ein reicher Mann mit einer Tochter, die er sehr liebte. Alles, was sie nur wünschte, gewährte er ihr; nie hatte sie von ihm oder von den Dienstboten eine abschlägige Antwort erhalten.
Wie sie größer geworden und zu einer schönen Jungfrau herangewachsen war, bat sie der Vater, sie sollte sich doch aus den ersten Häusern der Stadt einen Jüngling zum Mann wählen. Sie aber wollte das nicht. Da aber der Vater mit seinen Bitten nicht nachließ, erklärte sie endlich, daß sie dazu bereit sei, aber nur unter Bedingungen:
Sie müßte einen Wagen erhalten, der nur von ihr geleitet sich vorwärts bewege, dann vier Kleider, ein himmelblaues, mit goldenen Sternen besätes, ein silbergewirktes und ein golddurchwirktes und eins, das aus den Bälgen der Feldmäuse gefertigt ist; und alle verlangten Sachen müßten in drei Tagen fertig sein.
Wie der Vater die Forderungen seiner Tochter hörte, war er sehr bestürzt; doch er durfte ihr diese nicht abschlagen, um sie nicht zu betrüben. Er ließ deshalb die besten Schmiede der Stadt kommen und bat sie, innerhalb von drei Tagen einen Wagen anzufertigen, wie ihn die Tochter verlangte; ebenso wurden die kostbarsten Stoffe zu den drei Kleidern gekauft und zum vierten alle Mausfänger aufgeboten, um an Mäusebälgen keinen Mangel zu leiden.
Am dritten Tag waren auch wirklich zur größten Freude des Vaters die Wünsche der Tochter erfüllt. Der Wagen hielt vor der Tür, und auf ihm lagen die vier verlangten Kleider. Die Tochter setzte sich in den Wagen und wollte sogleich eine Probefahrt machen. Wie sie im Wagen saß, drehten sich die Räder, und er rollte und rollte unaufhaltsam fort, und die Tochter kam mit ihren Kleidern in ein ganz unbekanntes, fremdes Land.
Nicht weit vor einer großen Stadt zerbrach der Wagen. Sie stieg ab und sah sich eine Zeit lang die Gegend an. Sie erblickte eine hohle Eiche, und in dieser verbarg sie die drei Prachtkleider, das aus Mausfellen aber zog sie an und ging in die Stadt.
Hier suchte sie vergebens nach einem Unterkommen, denn nirgends wollte man die Unbekannte im grauen Pelzkleid dulden; nach langem Herumfragen bekam sie endlich doch bei einem Grafen einen Dienstplatz in der Küche. Hier mußte nun die schöne Jungfrau in Schmutz und Asche herumkriechen, die Fußböden fegen, Schüsseln und Teller reinigen und alle Geschäfte der niedrigsten Küchenmagd verrichten. Die Nacht schlief sie in einem schlechten Kämmerlein auf halb faulem Stroh und hatte nichts darin als einen Stuhl und einen kleinen Kleiderkasten.
Lange Zeit hatte sie schon im Grafenhaus gedient, als der Herr einen großen Ball gab, der mehrere Tage dauern sollte; eigentlich wollte er sich aber unter den schönen Jungfrauen der Stadt eine Braut wählen. Jetzt hatte die Küchenmagd harte Tage; immerfort mußte sie Wasser tragen, alles säubern und reinigen, Hühner rupfen und dergleichen mehr.
Als alles bereitet war, erschienen die vornehmsten Gäste aus der Stadt. Da erinnerte sich die verlassene Magd an ihren Vater und wie sie zu Hause bei solchen Festlichkeiten immer dabei gewesen war, wie sie getanzt hatte und wegen ihrer Schönheit allen anderen vorgezogen wurde. Sie bat deshalb die Köchin, hinter der Tür alle beim Herein- und Herausgehen beobachten zu dürfen. Nach langem Bitten und nachdem sie ihre Arbeiten verrichtet hatte, wurde es ihr gestattet.
Sie aber ging in ihr Kämmerlein, wusch und putzte sich und eilte dann zur hohlen Eiche, zog hier das himmelblaue, mit goldenen Sternen übersäte Kleid an und eilte ins Haus zurück. Alles machte der schönen Unbekannten ehrerbietig Platz, und sie gelangte unerkannt und ohne Hindernis in den Saal. Da erstaunten alle, die sie sahen, über ihr prächtiges Kleid, noch mehr aber über ihre Schönheit; der Graf war aber ganz überrascht. Er ging ihr entgegen, führte sie auf den ersten Platz und tanzte nur mit ihr allein.
Nach einer Stunde aber verschwand sie aus dem Saal, eilte nach der hohlen Eiche, zog die gewöhnliche Kleidung an und erschien dann unbemerkt hinter der Tür, um zu sehen und zu beobachten, was sie für einen Eindruck hinterlassen hatte. Die Gäste gingen bald auseinander, denn der Graf, tief betrübt wegen ihres Verschwindens, hatte für diesen Tag die Festlichkeit bald beendet und alle auf den folgenden Tag wieder eingeladen.
Alle erschienen auch wieder im schönsten Schmuck und bemühten sich, den Grafen, der sehr traurig nach der holden Unbekannten im blauen Kleid herumsuchte, aufzuheitern; aber alle Bemühungen waren vergebens. Sollte er fröhlich werden, so mußte die so sehnlich Erwartete erscheinen.
Diese ging auch, nachdem sie alle ihre Arbeiten verrichtet hatte, die Köchin mit der Bitte an, hinter der Tür alles sehen zu dürfen. Es wurde ihr gestattet. Sie aber eilte in ihr Kämmerlein, wusch und putzte sich, eilte zur hohlen Eiche, legte das silberdurchwirkte Kleid an und eilte ins gräfliche Haus zurück.
Wie sie durch die geöffneten Saaltüren eintrat, eilte ihr der Graf freudetrunken entgegen, führte sie auf den ersten Platz, sprach und tanzte nur mit ihr allein und war ganz selig in ihrer Gegenwart. Nach einer Stunde aber verschwand sie aus dem Saal.
Der Graf hatte jedoch an die Tore treue Wächter gestellt, welche der Unbekannten nachschleichen sollten. Sie wußte es, weshalb sie durch ein Hinterpförtchen zur hohlen Eiche eilte, dort die gewöhnliche Kleidung anzog und dann nach Hause zurückkehrte.
Mit ihr war aber auch alle Freude verschwunden. Der Graf, von ihrer Schönheit bezaubert und wegen ihres Verschwindens ganz untröstlich, entließ die Gäste bald, nachdem er sie alle auf den folgenden Abend wieder eingeladen hatte; denn er hoffte, daß die Unbekannte, wenn sie wieder erscheinen sollte, am Entweichen durch Umringung des Hauses verhindert werden könnte.
Wie er gehofft hatte, so geschah es auch. Die Magd eilte am folgenden Abend nach erhaltener Erlaubnis zur Eiche, zog dort das golddurchwirkte Kleid an und ging ins Schloß zurück. So schön wie diesmal war sie noch nie gewesen. Der Graf empfing sie mit Jubel und Freude; er sprach und tanzte nur mit ihr; für alles andere war er taub und blind.
Doch wie die Stunde um war, wollte sie auch wieder zur hohlen Eiche entfliehen. Aber es war nicht möglich, denn das ganze Haus war mit Dienern umringt. Sie schlüpfte deshalb in ihr Kämmerlein, zog das kostbare Kleid aus und wollte es verbergen. Ein Diener hatte aber die Unbekannte in die Kammer der Küchenmagd entfliehen gesehen. Dies hinterbrachte er gleich dem Herrn.
Als dieser hörte, daß die Unbekannte in die Kammer der Küchenmagd entflohen war, ließ er die Tür sogleich öffnen, und hier fand er seine Küchenmagd, wie sie eben im Begriffe war, das Kleid im Kasten zu verbergen. Er fiel ihr sogleich um den Hals und bat sie dann, das Kleid wieder anzuziehen und mit ihm in den Saal zurückzukehren.
Wie er mit ihr dort erschien und sie vor allen seine Braut nannte, da gab es Jubel und Freude, und gleich am anderen Tag wurde Hochzeit gehalten. Beide aber lebten froh und glücklich recht viele Jahre im Kreis schöner Kinder und Enkel.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DER DAUMENLANGE HANSL ...
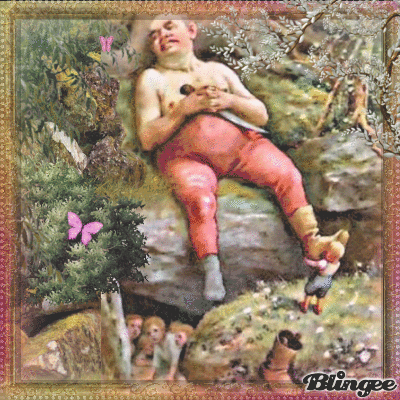
An dem Saum eines großen Waldes stand eine elende Hütte, worin zwei arme Eheleute mit ihren elf Söhnen wohnten; diese waren aber sehr klein und der älteste von ihnen nicht viel größer als eines Mannes Daumen, so daß man ihn allgemein den Daumenlangen Hansl nannte.
Da die Eltern sehr arm waren und das nötige Brot nicht mehr auftreiben konnten, so dachten sie daran, sich die Kinder vom Hals zu schaffen. In einer Nacht besprachen sie diese Sache und beschlossen, die Kinder am anderen Tag in den Wald zu führen und dort sich selbst zu überlassen.
Hansl hatte aber die ganze Beratung der Eltern heimlich gehört und sann nun auf ein Mittel, wie er mit seinen Brüderchen wohl allein den Weg aus dem Wald nach Hause finden könnte. Zu diesem Zweck stopfte er sich am anderen Tag seine Taschen voll mit kleinen, runden Kieselsteinen und ging dann mit seinen Eltern und Brüdern ganz sorgenfrei in den Wald hinein.
Nach einiger Zeit entfernten sich die Eltern von ihnen unter dem Vorwand, sie suchten Holz, gingen aber schnell auf einem anderen Weg nach Hause zurück. Die Brüderchen warteten lange, aber vergebens; da machte Hansl, der nicht wußte, warum sie so lange warten sollten, ihnen den Vorschlag, nach Hause zurückzukehren, er werde den Weg schon finden.
Wirklich brachte er alle glücklich nach Hause; denn auf dem Weg in den Wald hatte er in einiger Entfernung ein Steinchen nach dem anderen fallen lassen; diese Steinchen suchte er nun auf, und so
gelangte er auch glücklich zu Hause an.
Die Eltern erschraken zwar, wie die Kinder ganz wider ihr Hoffen kamen, mußten jedoch Freude heucheln; sie beschlossen aber, die Sache doch noch einmal zu versuchen.
Sie führten deshalb am anderen Tag die Kinder in den Wald an einen ganz unbekannten Ort hin. Hansl hatte diesmal kleine Häufchen von Sand gebildet, um so den Rückweg zu finden. Die Eltern machten sich wieder davon und eilten nach Hause; die Kinderchen warteten lange, aber vergebens auf ihre Rückkehr, deshalb wollten sie allein nach Hause gehen.
Da hatte sich ein starker Wind erhoben, der die Sandhäufchen des Hansl vernichtete, so daß sie bald den Weg verloren. Eine Zeit lang irrten sie im Wald umher; endlich stieg Hansl auf eine hohe Tanne, um zu sehen, ob nicht in der Nähe ein Haus oder eine Hütte wäre.
Da sah er wirklich in nicht gar großer Entfernung aus einer Hütte Rauch aufsteigen. Er stieg eilig herab und ging mit seinen Brüderchen auf die Hütte zu; sie war aber versperrt. Hansl klopfte leise an. Da öffnete ein altes Weiblein und fragte, was sie wollten.
»Ach bitte«, flehte Hansl, »schenkt uns doch ein Stücklein Brot und laßt uns über Nacht bleiben, damit uns nicht die Tiere fressen.« Das mitleidige Weiblein gab einem jeden ein Stücklein Brot und verbarg dann alle unter dem Ofen; denn der Herr der Hütte war ein Menschenfresser und konnte von seinem Raubzug bald zurückkommen.
Wirklich kam er auch bald und rief, sowie er in die Stube getreten war: »I schmeck', i schmeck' a Menschenblut.« Er schnupperte in der Stube herum und hatte die Kleinen hinter dem Ofen bald gefunden. »Ihr seid gerade recht für Mitternacht«, sagte er und legte sich dann auf die Bank, wo er bald einschlief.
Als das Weiblein die Worte des Menschenfressers gehört hatte, erschrak sie sehr, denn die kleinen Kinder hatte sie lieb. Sie befahl ihnen deshalb, als der Menschenfresser fest schlief, unter dem Ofen hervorzukommen, und führte sie in eine Kammer.
In dieser aber schliefen die elf Töchter des Menschenfressers, und jede hatte ein goldenes Krönlein auf dem Haupt. Die Krönlein nahm nun das Weiblein heimlich weg und setzte sie dem Hansl und seinen Brüderlein auf, ihre leinenen Zipfelkäpplein aber den Töchtern des Menschenfressers.
Um Mitternacht stand dieser auf und hatte bald herausgefunden, daß die fremden Kinderlein in der Kammer seiner Töchter waren. Schon wollte er den Hansl fassen, als er das goldene Krönlein bemerkte und deshalb irregeführt wurde. Er griff daher nach den leinenen Zipfelkäpplein und biß so seinen Töchtern den Kopf ab.
Hansl aber machte sich mit seinen Brüderlein aus dem Staub, und sie liefen und liefen, bis sie vor Müdigkeit nicht mehr weiter konnten und sich deshalb in einer Höhle verkrochen, um da sicher zu sein. Mit Tagesanbruch hatte der Menschenfresser seinen Irrtum bemerkt; zornig zog er seine Stiefel an, um den flüchtigen Kindern nachzueilen.
Die Stiefel aber hatten die Eigenschaft, daß sie einen hin trugen, wohin man wollte. Deshalb hatte er die Kinderlein, die ihm mit den goldenen Krönlein entflohen waren, auch bald gefunden. Er lachte hellauf vor Freude, als er sie sah, und legte sich dann vor die Höhle hin, um ein wenig auszuruhen.
Hansl aber kroch heimlich mit seinen Brüdern aus der Höhle hervor und zog dem Schläfer seine Stiefel aus. Diese waren sehr groß, so daß alle darin Platz hatten. Hansl dachte: Ach, kämen wir nach Hause! Und siehe, kaum hatte er es gedacht, da sprangen die Stiefel nebeneinander fort und fort, bis sie zu Hause ankamen.
Jetzt hatten die Eltern große Freude an ihnen; denn aus den goldenen Krönlein lösten sie viel Geld, und Hansl verdiente sich auch viel, denn er wurde Bote, und zwar der beliebteste und bald auch der reichste, weil er mit seinen Stiefeln die Geschäfte am schnellsten besorgen konnte.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Deutsch-Tirol
DIE DREI SOLDATEN ...
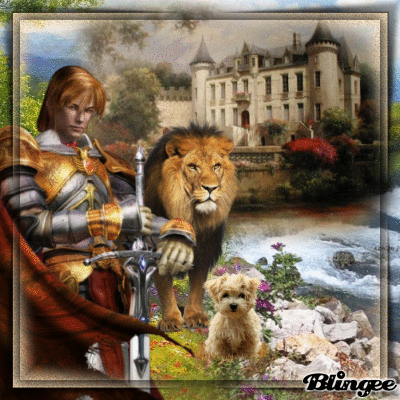
Es waren einmal drei Burschen bei der Kavallerie, denen das Soldatenleben gar nicht nach ihrem Sinn war. Sie beschlossen zu desertieren, und bei guter Gelegenheit machten sie sich alle drei aus dem Staub. Sie wanderten lange durch abgelegene Täler und Wälder und wußten sich nirgends recht sicher.
Einmal fanden sie tief in einem Wald ein Schloß, und weil sie gerade Hunger hatten, so besannen sie sich nicht lange und gingen hinein. Sie trabten die Stiege hinauf und schauten überall hinein, ob sich denn niemand sehen ließe, von dem sie eine warme Suppe betteln könnten. Sie durchwanderten einen Gang nach dem anderen und schauten in ein Zimmer nach dem anderen. Aber sie mochten schauen, wie sie wollten, es ließ sich niemand sehen.
Endlich sahen sie in einem Saal den ganzen Tisch voll Speisen, als ob er eben für die Herrschaft gedeckt wäre. Sie schauten einander an und sagten: »Da wird es am besten sein, zuzugreifen, weil niemand da ist, der uns etwas schenkt. Und das Zeug da drinnen geht ohnehin zugrunde, wenn nicht wir es aufessen.« Gesagt, getan. Sie gingen alle drei hinein und aßen mit einem solchen Appetit, daß eine Schüssel nach der anderen leer wurde. Das gefiel ihnen ganz gut, und sie meinten, da wäre jetzt gerade für sie der rechte Platz.
Als sie endlich die Löffel fortlegten und sich den Mund abwischten, kam auf einmal eine schöne Frau auf sie zugegangen und wollte sie anreden. Die drei Kameraden aber ließen sie nicht gleich zu Wort kommen und entschuldigten sich, daß sie sich selbst eingeladen hatten, und dankten lange für die guten Brocken, die sie bekommen hatten.
Die Frau sagte: »Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Mir ist es recht, wenn ihr hier bleibt. Zu essen und zu trinken werdet ihr haben, soviel ihr wünscht, und ihr könnt da ein Leben führen wie Grafen. Aber das müßt ihr mir versprechen, daß ihr drei Jahre bleibt und daß in dieser Zeit jeder von euch tagtäglich drei Stunden betet. Wollt ihr auf diese Abmachung eingehen, so könnt ihr mir heute Abend die Antwort sagen, und ihr fangt dann morgen mit eurem Beten an.«
Die Frau ging fort, und die Soldaten hielten Rat, was etwa zu tun sei. Sie kamen darin überein, daß es doch ein wohlfeiler Aufenthalt sei, wenn man nur drei Stunden zu beten brauche und dann alles im Überfluß habe. Und weil sie auch an ihre Sicherheit denken mußten, so gefiel ihnen das Schloß im Wald gar gut, so daß sie alsbald entschlossen waren, den Antrag anzunehmen und die drei Jahre hier zu bleiben.
Als abends die Frau erschien und sie fragte, wie sie sich besonnen hätten, da sagten sie ihr, daß sie entschlossen seien, im Schloß zu bleiben und alle Tage die drei Stunden zu beten. Die Frau war damit zufrieden und ging wieder ihre Wege.
Da hätten es nun die drei Burschen fein genug gehabt, wenn sie es nur ausgehalten hätten. Sooft sie Hunger hatten, konnten sie sich an den gedeckten Tisch setzen, und sooft sie Bewegung haben wollten, konnten sie in dem schönen Lustgarten neben dem Schloß ihren Spaziergang machen. Nebenbei hatten sie den ganzen Tag nichts zu tun, als drei Stunden zu beten, und außerdem brauchten sie für nichts zu sorgen und an nichts zu denken. Aber zweien von ihnen behagte das Leben doch nicht recht, weil es ihnen zu langweilig war, und sie fingen wieder an, ans Desertieren zu denken.
Es dauerte auch nicht lange, da fand sich der dritte mutterseelenallein im ganzen Schloß und suchte umsonst alle Schlupfwinkel aus, um seine Kameraden zu finden. Als er so herumsuchte und nebenher ein bißchen schalt und brummte, stand auf einmal die schöne Frau wieder vor ihm und fragte ihn, wo er seine Kameraden habe. »Die müssen davongelaufen sein«, erwiderte er, »ich habe schon das ganze Schloß durchsucht und keine Spur von ihnen entdeckt.«
»Nun denn, wenn sie aus dem Staube sind«, antwortete die Frau, »dann ist es euer Glück, daß wenigstens einer zurückgeblieben ist. Wärst du auch fort, so würde ich euch schon bekommen haben und hätte alle drei in Stücke zerrissen. Jetzt kannst du es anfangen, wie du willst. Entweder bleibst du neun Jahre da und betest alle Tage drei Stunden, oder du bleibst drei Jahre da und betest alle Tage neun Stunden. Ist deine Zeit um, so wirst du schon einen Lohn kriegen, daß du gewiß damit zufrieden bist.«
Der Soldat kratzte sich ein paarmal hinter den Ohren und besann sich ein wenig, war aber als bald mit sich eins. »Neun Jahre«, sagte er, »das ist doch eine gar zu lange Zeit, und wenn ich es in drei Jahren abmachen kann, so will ich lieber frisch darangehen und alle Tage neun Stunden beten.« »Ist mir auch recht«, antwortete die Frau, »und in drei Jahren will ich als dann wiederkommen, und wenn du ausgehalten hast, dir deinen Lohn geben.« Hiermit ging sie fort, und der Soldat stand wieder mutterseelenallein im Schloß da.
Am anderen Tag in aller Frühe kniete er sich hin und fing an zu beten und betete neun Stunden lang, und so machte er es am zweiten Tag wieder und am dritten auch, und so ging es fort alle drei Jahre. Als die Frist verstrichen war, trat die Frau vor ihn und sagte: »Du hast dein Versprechen treulich gehalten, aber noch ist nicht alles zu Ende, und du mußt noch eine Probe bestehen.«
»Und was denn für eine«, fragte der Soldat, »kann ich sie wohl auch aushalten?«
»Aushalten kannst du sie schon, aber merke genau, was ich dir sage. Fürchten darfst du dich vor gar nichts, denn es mag kommen, was da will, ich werde dich allemal retten. Siehst du, da ist ein
Kübel, in diesen steige hinein und geh um alles in der Welt nicht heraus. Du mußt dich darin stoßen lassen, aber das macht alles nichts. Es wird nur sein wie ein Traum, und wenn alles vorbei ist,
werde ich kommen und dich wieder zurechtrichten.«
Der Soldat stieg in den Kübel hinein und versprach, drinnen zu bleiben, bis sie wieder käme. Sie ging fort, und kaum war sie weg, bekam der Soldat schon andere Gesellschaft. Drei abscheuliche
Geister schritten zur Tür herein, stellten sich um den Kübel und riefen: »Heraus da, was darinnen ist.« Wie da dem Burschen zumute war, das weiß man wohl, aber er regte sich nicht und blieb
drinnen.
»Geh jetzt gleich heraus, oder wir machen dir den Garaus.«
Der Soldat rührte sich wieder nicht und hockte ruhig im Kübel. Da wurden die drei zornig, hoben ihre Eisenstecken auf und fingen an, auf ihn los zu stoßen, daß es ein Elend war. Sie stießen so lange zu, bis sie ihn zu kleinen Stücken zerstoßen hatten. Hierauf stürzten sie den Kübel um, leerten alles auf den Boden, nahmen dann wieder ihre Eisenstecken und gingen fort.
Kaum waren sie zur Tür hinaus, kam die Frau herein, kniete sich hin, tat alles, was auf dem Boden lag, in ihre Schürze zusammen und schüttelte es wieder in den Kübel. Augenblicklich stand der Soldat wieder ganz und unverletzt darinnen und konnte sich selbst nicht genug wundern über das, was eben mit ihm vorgegangen war. Die Frau lobte ihn, weil er so treulich ausgehalten hatte, und fragte ihn dann, wie ihm alles vorgekommen sei.
»Gerade wie ein Traum«, sagte er. »Siehst du, ich habe die Wahrheit gesagt«, erwiderte die Frau. »Aber noch ist es auch nicht zu Ende. Siehst du, da ist ein Fleischstock. Leg dich darauf, und wenn sie wiederkommen und dich wegjagen wollen, so geh nicht. Sie werden dich zu Brät hacken, aber das macht alles nichts; es wird nur sein wie ein Traum, und wenn du brav aushältst, werde ich wiederkommen und dich herstellen.«
Der Soldat legte sich bereitwillig auf den Fleischstock, versprach ihr in allem zu gehorchen und sie ging wieder fort. Als bald schritten die drei Geister zur Tür herein, jeder hatte ein Fleischbeil unter dem Arm, und machten sich an den Fleischstock: »Herab da, oder wir fangen an zu hacken.« Der Soldat tat wie ein Toter und blieb liegen. »Jetzt sagen wir es zum letzten Mal, geh herab, oder wir hacken.«
Der Soldat rührte sich wieder nicht, und augenblicklich huben die drei an, ihre Beile zu schwingen, und schwangen sie so lustig, daß man dazu hätte tanzen können. Sie hackten den Kerl zum feinsten Brät; als sie ihre Arbeit fertig hatten, gingen sie wieder. Augenblicklich erschien die Frau, trat an den Hackstock, wischte alles in ihre Schürze und trug es zu dem Kübel. Kaum hatte sie das Brät hineingeleert, stand der Soldat ganz und unversehrt darinnen.
Er mußte sich wundern über das, was mit ihm vorgegangen war, und es kam ihm gerade vor, als ob er geträumt hätte. Sie lobte ihn, daß er so unerschütterlich ausgehalten habe, und redete ihm aufs neue zu: »Noch sind wir nicht ganz fertig. Du mußt noch etwas aushalten, und das ist das Ärgste. Setz dich da auf den Herd und geh nicht fort, mögen sie tun, was sie wollen.
Sie werden sagen, du sollst mit ihnen gehen, aber bleib du nur sitzen und geh ja keinen Schritt. Dann werden sie drohen, dich zu verbrennen, und werden dir einreden, daß du das nimmermehr aushalten könntest. Geh du aber nicht fort und laß dich nur verbrennen. Alles wird sein wie ein Traum, und wenn es vorbei ist, will ich wiederkommen und dich herstellen.«
Der Soldat stieg aus dem Kübel, setzte sich auf den Herd und versprach, um alle Welt nicht von seinem Platz zu gehen. Die Frau ging fort, und es dauerte nicht lange, so kamen die drei wieder zur Tür herein. Sie machten sich an den Herd und redeten dem Burschen zu, er sollte die Dummheiten lassen und mit ihnen gehen. Der Soldat tat, als ob er nichts hörte. Jetzt fingen sie an, ganz arg vorzugehen.
»Warte nur, wenn du nicht gehst, so wollen wir dich schon kleinkriegen. Sogleich machen wir ein Feuer an und werfen dich hinein, daß du zu Pulver verbrennst, solange die Welt steht.« Der Soldat hörte wieder nichts, und die drei schritten an das Werk. Sie gingen fort, trugen Holz herbei und häuften es auf dem Herd auf. Dann machten sie Feuer an, und als der ganze Haufen lustig emporloderte, faßten sie den Soldaten und hielten ihn in die Flammen hinein.
Weil er sich aber noch nicht entschloß, mit ihnen zu gehen, so schmissen sie ihn mitten in das Feuer hinein und ließen ihn braten und brennen, bis er zu Asche zusammen gebrannt war. Dann ließen sie alles liegen und stehen und gingen wieder fort. Sogleich kam die Frau zur Tür herein, trat an den Herd, kehrte die Asche fleißig in ihre Schürze und trug sie zu dem Kübel. Kaum hatte sie diese hineingeleert, da stand der Soldat ganz und unversehrt darinnen. Es kam ihm wieder vor, als ob er von einem Traum erwache, und er atmete recht leicht auf, weil die schwere Probe zu Ende war.
Die Frau redete ihn an und sagte: »Du hast nun alles ausgehalten, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Du kannst jetzt indessen vorausgehen, ich muß noch ein wenig warten. Geh nur den Weg da hinüber durch den Wald, bis du zu dem kleinen Häuslein kommst. Vor diesem warte auf mich, aber geh ja nicht hinein und nimm nichts an, mag man dir anbieten, was immer man will. Auch gib recht acht, daß du nicht einschläfst, denn es könnte sonst nicht gut ausgehen. Ich werde bald nachkommen, und dann wollen wir den Weg miteinander fortsetzen.«
Der Soldat versprach, ihr zu gehorchen, und schlug den Weg ein, den sie ihm gezeigt hatte. In kurzer Zeit kam er zu dem Häuschen und dachte sich, da muß ich jetzt warten. Er setzte sich auf die Bank vor dem Haus und schaute immer gegen das Schloß hinüber, ob denn die Frau nicht bald nachkomme. Während er so verloren dreinschaute, kam ein altes Weib aus dem Haus, trat vor ihn und fragte, ob er vielleicht müde sei und etwas zu trinken möge.
»Nein«, sagte er, »müde bin ich nicht, und ich mag auch nichts zu trinken, nur auf jemand warten soll ich da.« »Oh«, erwiderte die Alte, »ein bißchen Milch geht wohl doch«, und sogleich ging sie in das Haus und brachte eine Schüssel schöne, rahmige Milch. »Da«, sagte sie, »trinkt einmal. Weiß Gott, wie weit Ihr noch gehen müßt, und dann seid Ihr froh, etwas im Magen zu haben.«
Der Soldat sah die schöne Milch, und weil er einen großen Durst hatte, dachte er sich: Was wird denn dahinter sein, wenn ich die Milch trinke? Ich brauche es der Frau nicht zu sagen, und wenn ihr gar so daran gelegen wäre, sollte sie einmal herkommen. Er dankte der Alten, nahm die Schüssel und schlürfte die Milch bis auf den letzten Tropfen aus.
Kaum hatte er die Schüssel zurückgegeben, fühlte er eine ungeheure Schläfrigkeit, ließ als bald den Kopf sinken und schlief ein. Die Alte hatte nämlich Schlafpulver in die Milch getan und freute sich jetzt recht herzlich, als der Bursche zu schnarchen anfing, daß man es im ganzen Haus hörte. So schlief er lange Zeit und wußte um nichts, was neben ihm vorging.
Als er aufwachte, fiel ihm sogleich ein, warum ihn die Frau gewarnt haben mochte, in diesem Haus etwas zu nehmen. Er bekam eine gewaltige Reue, weil er ihr nicht gehorcht hatte, und war über die alte Hexe nicht wenig erzürnt. Er wollte nicht länger vor dem Haus warten, denn er dachte, die Frau ist doch lange schon vorbei, und wenn ich länger bleibe, so spielt mir die Hexe noch einen üblen Streich.
Er ging also langsam weiter und dachte unterwegs immer darüber nach, wie töricht er gewesen war, daß er der Frau nicht gehorcht habe. Sie hatte ihm ja einen großen Lohn versprochen, jetzt aber war sie fort, und er wußte nicht, wohin er ihr nachfolgen sollte. Während er so in trüben Gedanken dahinschritt, begegnete ihm ein kleines, nettes Hündchen, das hüpfte lustig an ihm hinauf, als ob sie alte Bekannte wären, und ließ sich nicht abhalten, mit ihm zu gehen.
Er nahm es denn als neuen Kameraden mit sich und machte allerlei Spaß mit ihm, um sich die Zeit und die Sorgen zu vertreiben. Von ungefähr fuhr er einmal in den Sack, da griff er ein Stück Papier, wunderte sich, was das zu bedeuten habe, und zog es heraus. Tatsächlich war etwas darauf geschrieben, und was denn? Es hieß: »Wenn du in die Hauptstadt kommst, so frage, wo der Weg nach Neuholland geht.«
Er merkte wohl, daß man ihm den Brief während des Schlafes in die Tasche gesteckt hatte, griff daher so gleich noch einmal hinab, um zu sehen, ob denn der Brief allein hineingeraten war. Auf den ersten Griff zog er eine Bürste heraus und schaute sie von allen Seiten an, ob es denn bloß eine gewöhnliche Bürste sei. Er fand nichts Besonderes daran, wurde aufs neue unwillig und dachte: Da hast du einen schönen Lohn für dein langes Beten und Alleinsein.
Während er so dachte, strich er mit der Bürste über die Hand, um zu versuchen, ob sie fein sei. Aber was machte er da für Augen, als nach den ersten Strichen fünf funkelnagelneue Dukaten der Reihe nach auf der Hand lagen. Da wurden seine Gedanken auf einmal freundlicher und er steckte die Dukaten zu sich. Dann strich er noch einmal, und richtig lagen wieder fünf Dukaten da. Noch einmal - und wieder fünf. Wieder einmal - und noch fünf. »Jetzt kann es ja nimmer fehlen«, jauchzte er, steckte Geld und Bürste zu sich und ging seinen Weg weiter.
Es dauerte nicht mehr lange, da sah er in nicht gar weiter Ferne Turmknöpfe und Kuppeldächer glänzen, und er zweifelte keinen Augenblick, daß dies die Hauptstadt war. Er marschierte jetzt aus Leibeskräften darauf los, denn es war ihm darum zu tun, ein Wirtshaus zu erreichen und von seinen Dukaten Gebrauch zu machen. Das Hündlein bellte lustig voraus, und in kurzer Frist waren sie in der Stadt.
Da fragte nun der Soldat die ersten, die ihm begegneten, wo denn in dieser Stadt das beste und nobelste Wirtshaus sei. Sie zeigten es ihm, und er ging in seinem alten militärischen Rock hinein. Da schenkten sie ihm nicht viel Aufmerksamkeit, weil sie glaubten, wer einen so schlechten Rock trägt, kann auch nicht gut bei Kassa sein. Er schaffte nun für sich und das Hündlein ein vornehmes Essen an und verlangte dann, man solle ihm das schönste Zimmer zurechtrichten.
Die Kellnerin sagte: »Zu essen will ich dir bringen, aber das schönste Zimmer brauchen wir für noblere Leute, als du bist.« Er gab aber nicht nach, sie mochte Ausreden bringen oder es ihm geradezu abschlagen. Da ging die Kellnerin zum Wirt und sagte ihm, daß ein zerlumpter Soldat das vornehmste Zimmer wolle, was sie da tun solle. »Sage nur, du willst ihm das Zimmer schon geben, begehre aber einen tüchtigen Haufen Geld dafür. Weiß Gott, wer er ist, vielleicht zahlt er ebenso gut wie ein anderer.«
Die Kellnerin kam in die Wirtsstube zurück und richtete dem Soldaten aus, daß ihm der Wirt das vornehmste Zimmer schon geben wolle, wenn er bezahlen wolle, soviel sie begehre. »Und wieviel ist das?« fragte der Soldat. Da begehrte die Kellnerin eine unverschämte Summe, und meinte, jetzt werde der ärmliche Gast schon nachgeben.
Er tat aber, als ob ihn das gar nicht viel dünke, verlangte aber, sie sollte den Wirt holen. Sie tat es, und als der Wirt kam, zog der Soldat seine Bürste heraus, strich sie über die Hand und zählte fünf Dukaten herab. »Da«, sagte er, »hast du ein bißchen Vorschuß, damit du siehst, daß ich ein ordentlicher Zahler bin.«
Der Wirt war sehr erfreut über diesen Gast und sagte zur Kellnerin: »Siehst du, daß ich recht gehabt habe. Man kann den Leuten nicht immer am Rock ansehen, wer sie sind. Für das nächste Mal laß dir das gesagt sein und besinne dich ein bißchen, ehe du einem etwas abschlägst.«
Der Soldat ließ es sich nun wohl sein, vergaß dabei aber nicht, was auf seinem Zettel stand. Während er mit dem Wirt plauderte, ließ er daher auch die Frage fallen, wo der Weg nach Neuholland gehe. »O ja«, sagte der Wirt, »den Weg weiß ich wohl, aber du wirst ihn doch nicht selbst machen wollen.« »Warum denn nicht?« fragte der Soldat. »Nun ja. Es kommt ja doch niemand hinüber über die drei Gewässer, die dazwischen liegen. Denn man muß sich von hier bis zur ersten Insel und von dieser bis zur zweiten und von dort bis zur dritten von drei Riesen führen lassen, die keinen lebendig ans Land bringen, sondern jeden auffressen, der sich ihnen anvertraut.«
Der Soldat nahm sich das zu Herzen, ließ sich aber doch nicht abschrecken, weiter an die Fahrt zu denken. Da ging er einmal zum Hafen hinaus, schaute hin über das weite Meer und dachte an die Fahrt, die er unternehmen sollte. Da sah er auf einmal nicht weit von sich am Ufer einen Löwen, der ruhig da lag und auf jemanden zu warten schien. Eine Tatze streckte er weit hinaus und schaute sie von Zeit zu Zeit mit trauriger Miene an.
Der Soldat bemerkte, daß er in der Tatze einen Werchnagel stecken hatte, und hatte großes Mitleid mit dem Tier. Das Hündlein, das der Soldat immer bei sich hatte, lief sogleich hin und beleckte die durchstochene Tatze. Der Löwe ließ es gerne geschehen, und bald bekam auch der Soldat mehr Mut und ging näher hinzu. »Wenn du mir nichts zuleid tätest, wollte ich dir den Nagel gerne herausziehen«, sagte er zum Löwen. »Allein ich fürchte, du könntest mir das Mitleid schlecht bezahlen.«
Da reichte der Löwe, als ob er diese Rede verstanden hätte, die verwundete Tatze dem Soldaten dar und hielt den Kopf ein wenig schief, gerade so, als ob er ihn bitten wollte. Der Soldat faßte sich ein Herz, ergriff die dargebotene Tatze und zog den Nagel mit großer Leichtigkeit heraus.
Da machte der Löwe auf einmal ein ganz anderes Gesicht, stand auf und verneigte sich dankbar vor seinem Wohltäter. Der Soldat kehrte um und wollte wieder in das Wirtshaus gehen. Der Löwe aber folgte ihm nach und ließ sich nicht zurückhalten. Dem Soldaten war seine Begleitung auch nicht zuwider, und er dachte: Geld habe ich genug, warum soll ich das arme Tier nicht bei mir behalten und seinen Hunger stillen? Weiß Gott, ob es nicht einmal dankbar sein wird!
Als er in das Wirtshaus kam und den Löwen mit sich führte, kriegten die Leute einen gewaltigen Schrecken und wollten das Tier nicht hereinlassen. Da erzählte der Soldat, wie er zu dem Löwen gekommen war, und versprach, ordentlich zu zahlen, wenn er ihn in seinem Zimmer behalten dürfe. Der Wirt wollte lange nicht ja sagen und wollte noch immer das Tier zurückscheuchen. Es ließ sich aber nicht abhalten, ging seinem Herrn nach, und Hund und Löwe wohnten nun mit dem Soldaten in einem Zimmer.
Da trug es sich zu, daß jemand einbrach und dem Soldaten sein Geld rauben wollte. Der Löwe aber verstand keinen Spaß, fiel über den Spitzbuben her und zerriß ihn zu kleinen Fetzen. Die Leute hörten den Lärm und liefen alle in das Zimmer. Da sahen sie nun, was der Löwe für ein treues Tier war, und verlangten nimmermehr, daß man ihn aus dem Haus jagen sollte.
Als drei Tage um waren, fragte der Soldat, was er schuldig sei, und zahlte noch weit mehr, als der Wirt begehrte, obwohl das auch nicht wenig war. Als er gezahlt hatte, sagte er, daß es jetzt sein voller Ernst sei, nach Neuholland zu reisen, der Wirt sollte ihm nur genau sagen, wie er hinkommen könne.
»Ja, wenn du halt unbedingt hin willst«, sagte der Wirt, »dann will ich dir wohl sagen, wie du es anfangen mußt. Ich habe eine Fahne, die man schwingen muß, wenn man will, daß der Riese von der Insel da drüben herkommt und einen hinüberbringt. Diese Fahne schwingt man auch dann, wenn man den zweiten und dritten Riesen herbeilocken will, daß sie einen abholen. Aber ich denke, wenn dich der erste geholt hat, so ist es genug, und du ersparst dir auf den zwei Inseln das Fahnenschwingen.«
Der Soldat merkte sich alles gut, ließ aber die furchtsamen Ermahnungen zum einen Ohr hinein und zum anderen heraus. Am anderen Tag lieh er sich von dem Wirt die Fahne und ging damit hinab zu dem Hafen. Da schwang er sie drei-, viermal hoch in der Luft, und sogleich sah er, daß sich jenseits des Meeres ein Segel regte und zu ihm herüber fuhr. Inzwischen ging er noch hinauf in das Wirtshaus, nahm eine kleine Wegzehrung und handelte dem Wirt die Fahne ab, damit er auch auf der ersten und zweiten Insel damit Zeichen geben könnte.
Als er zum Hafen zurückkam, war das Schiff schon da, und darauf saß ein ungeheurer Riese, der ihn zu sich herankommen hieß. Der Soldat wollte die zwei Tiere vorausgehen lassen, der Riese aber sagte: »Den Löwen lasse ich nicht mit, und eher mußt auch du da bleiben.« Der Soldat bat eine Zeit lang, als aber der Riese nicht nachgab, setzte er sich mit dem Hündchen allein ins Schiff und hieß ihn abfahren.
Der Riese nahm eine gewaltige Stange, stemmte sie in den Grund, und bald glitt das Schiff ein gutes Stück hinein in das Meer. Da konnte es auch der Löwe nimmer aushalten, hüpfte mit einem frischen Satz in das Wasser und schwamm seinem Herrn nach. Als er das Schiff erreichte, sprang er lustig hinein. Der Riese konnte nun nichts mehr machen, denn über das Tier herzufallen getraute er sich doch nicht recht, weil er nicht wußte, wer dabei den kürzeren ziehen würde. Er fuhr nun rüstig vorwärts, und in kurzer Zeit erreichten sie das Ufer der Insel.
Vor dem Aussteigen fragte der Soldat den Schiffer nach der Schuldigkeit.
»Oh, die Schuldigkeit ist klein«, bekam er zur Antwort. »Ich zerreiße dich, und dann ist alles bezahlt.« Kaum hatte er das gesagt, sprang der Löwe ihm aufs Genick, warf ihn um und zerriß ihn
zu kleinen Fetzen. Der Soldat war froh, den unehrlichen Schiffsmann los zu sein, stieg wohlgemut aus dem Schiff und durchwanderte mit seinen Tieren die Insel der ganzen Breite nach.
Als er am anderen Ufer ankam, schwang er wieder seine Fahne, da regte sich augenblicklich ein Segel jenseits des Meeres, und ein Riese kam mit einem geräumigen Schiff angefahren. »Willst du mich für Geld und gute Worte nicht hinüberführen?« fragte der Soldat. »O ja«, antwortete der Riese, »aber den Löwen mußt du zurücklassen.«
Der Soldat weigerte sich nicht lange, ließ den Löwen zurück und setzte sich mit dem Hündlein ins Schiff. Sie fuhren ab, und bald hüpfte der Löwe ins Wasser, schwamm dem Schiff nach und sprang
hinein. Der Riese schien sich jetzt nichts mehr daraus zu machen, ließ den Löwen und fuhr weiter. Als sie ans Ufer kamen, fragte der Soldat: »Was bin ich schuldig?« »Oh, ganz wenig. Ist
schon lange Zeit, daß der andere einen herüber gelassen hat. Komm nur, ich will dich zerreißen.«
Das war noch nicht völlig gesagt, da hing ihm schon der Löwe am Rücken, warf ihn um und zerriß ihn zu kleinen Fetzen.
Nun stieg der Soldat aus, durchwanderte mit seinen Tieren die ganze Insel der Breite nach und kam an das andere Ufer. Hier schwang er wieder seine Fahne, und sogleich regte sich ein Segel jenseits des Meeres. Auf einem geräumigen Schiff kam ein Riese angefahren, der so wild dreinschaute, daß der Soldat etwas Wilderes sein Lebtag nicht gesehen hatte. Da waren die anderen zwei noch nichts gewesen gegen diesen Kameraden. Er vertraute aber auf seinen Löwen und fragte ruhig: »Wie ist es, kann man überfahren?« »Das schon«, war die Antwort, »aber den Löwen mußt du zurücklassen.«
Der Soldat widersprach nicht lange, setzte sich mit dem Hund hinein und ließ ihn abfahren. Sie waren ein kleines Stück vom Land, da hüpfte der Löwe ins Wasser, schwamm dem Schiff nach und sprang hinein. Der Riese machte nur ein noch wilderes Gesicht, sagte aber nichts mehr und ließ die Bestie mitfahren. Als sie ans Ufer kamen, fragte der Soldat: »Nun, was ist meine Schuldigkeit?« »Oh, die Schuldigkeit ist gering. Ich erinnere mich schon fast nimmer, daß mir die anderen zwei einen herüber gelassen haben. Darum komm nur her, ich will dich zerreißen.«
Kaum hatte er das gesagt, da sprang der Löwe wütend auf, packte ihn beim Kragen und zerriß ihn zu kleinen Fetzen. Der Soldat war über die Maßen froh, daß endlich auch dem letzten der Garaus gemacht war, und er wunderte sich sehr, wie etwa Neuholland ausschauen würde. Er stieg darum schnell aus dem Schiff und ging mit seinen Tieren rüstig landeinwärts.
Er ging einige Tage vorwärts und kam endlich zu einer Schäferhütte. Da war ein Schäfer, der für den König und die benachbarte Stadt viel zu hüten hatte. Der Soldat kehrte ein, redete allerlei mit dem Schäfer und fragte ihn, ob er nicht noch einen Hirten brauche.
»Nein«, sagte der Schäfer, »wo ich beim Hüten Gehilfen brauchen kann, da habe ich ihrer schon genug, und an einem Ort muß ich doch immer selbst sein, weil ich es dort einem Fremden nicht anvertrauen kann. Zudem ist mein eigentliches Handwerk die Schneiderei und das kann ich beim Hüten nebenbei betreiben, so daß ich nicht einen anderen bezahlen muß, damit ich selber zu Hause bleiben kann.«
»Vom Bezahlen ist ja keine Rede«, fiel ihm der Soldat ins Wort, »ich hüte ja nur, weil ich eine Freude daran habe, nicht damit ich einen Lohn verdiene. Laß du mich mit der Herde gehen, und ich will dir mein Kostgeld allmonatlich blank ausbezahlen. Schau, da hast du ein bißchen Vorschuß.« Hiermit fuhr er in den Sack und zog fünf blanke Dukaten heraus.
Da bekam der Schneider Respekt und sagte ihm gleich, daß er als Hirt da bleiben dürfe. »Du mußt dir aber etwas merken und es genau befolgen, sonst könnte es uns beiden nicht gut gehen.« »Und was wäre das?« fragte der Soldat.
»Paß nur auf: Oberhalb des Waldes, in welchem du hüten darfst, sind drei Almen übereinander, jede Alm gehört einem Riesen. Die drei Riesen sind aber so wilde Kerle, daß sie alles abgrasen, was aus ihrem Boden kommt, und wenn du ein Stück Vieh auf eine solche Alm läßt, so ist es sicher verloren. Gib also acht, damit nichts hinkommt, sonst könnte ich dich nimmer brauchen.«
Der Soldat versprach, gut achtzugeben, und wurde als Hirt angenommen. Er zog alle Tage mit seiner Herde und mit den zwei Tieren, die er mitgebracht hatte, hinaus in den Wald und hatte die besten Zeiten, weil das Hündlein anstatt seiner hütete und er nur mitzugehen brauchte, damit es besser aussehe. Das Hündlein machte aber seine Sache so gut, daß nie ein Stück verloren ging, und der Soldat, der die anderen Hirten gern los haben wollte, sagte einstmals zum Schneider:
»Du kannst die anderen Gehilfen jetzt gehen lassen, ich will alles allein tun, und wenn dabei etwas verloren gehen sollte, so kannst du von mir Ersatz verlangen.«
Der Schneider ließ sich das nicht zweimal sagen, weil er wußte, daß der Soldat Geld genug hatte und daher wohl ersetzen könnte, was etwa zugrunde ging. Er gab den übrigen Hirten ihren Abschied,
und der Soldat mit seinem Hündlein hütete jetzt die ganze Herde allein.
Da kam ihm eines Tages die Lust, auf die verbotenen Almen hinaufzugehen, und er stand lange Zeit an der Markung, ohne recht zu wissen, ob er es wagen sollte oder nicht. Der Löwe merkte, was er wollte, und ging voraus. Der Soldat aber getraute sich noch immer nicht nach und dachte sich: Ich will einmal sehen, wie es dir geht. Du erwehrst dich leichter als unsereiner.
Während er so dachte, sah er einen ungeheuren Riesen, der auf den Löwen losmarschierte und schon wohlgefällig die großmächtigen Hände rieb, als ob es jetzt an einem guten Schmaus nimmer fehlen könnte. Der Löwe aber schaute ihn fest an, und als der große Kerl schon ganz nahe war, sprang er auf ihn los, packte ihn bei der Kehle und zerriß ihn, daß es zum Fürchten war.
Da getraute sich auch der Soldat hinein, schnitt dem Leichnam die Zunge heraus und steckte sie in seine Hirtentasche. Das übrige ließ er liegen und wollte wieder umkehren. Der Löwe aber ging weiter und deutete ihm mit dem Kopf, auch mitzugehen. Er folgte dem braven Tier und ging mit.
Da kamen sie zu einem großmächtigen Schloß, darin waren ganze Haufen von Kostbarkeiten und allerlei Zeug, das der Riese zusammengeraubt hatte. Das freute den Soldaten über die Maßen, und er wünschte nur, daß der Löwe mit den anderen zwei Riesen einen ebenso kurzen Prozeß mache wie mit ihrem Kameraden. Nachdem er alles genug angeschaut hatte, ging er mit dem Löwen wieder zurück, um zu sehen, ob der Herde indes nichts widerfahren war.
Als sie in den Wald kamen und der Soldat die Stücke zusammenzählte, fand er, daß das Hündlein ordentlich gehütet hatte und kein einziges Stück fehlte. Er fuhr heim, sagte aber weder dem Schneider noch sonst jemandem ein Wörtchen von der Erlegung des Riesen und dem Entdecken des Schlosses.
Am anderen Tag, als er die Herde in den Wald getrieben hatte, ließ er wieder das Hündlein Wache halten und ging hinein zu dem Schloß. Der Löwe aber ging noch weiter und kam ein Stück auf die zweite Alm. Der Soldat schaute ihm nach, denn er wollte wissen, ob nicht auch der zweite Riese Lust bekäme, das Tier aufzufressen.
Richtig kam bald ein ungeheurer Riese auf den Löwen losmarschiert und rieb sich wohlgefällig die Hände. Der Löwe aber sprang ihn an, ehe er sich versah, und zerriß ihn, daß es zum Fürchten war. Nun getraute sich auch der Soldat hinzu, schnitt die Zunge aus dem Leichnam und steckte sie in seine Hirtentasche. Dann führte ihn der Löwe noch weiter, und sie kamen zu einem herrlichen Schloß, in welchem so viele Schätze aufgehäuft lagen, daß man Jahr und Tag Arbeit gehabt hätte, alles genau anzuschauen.
Nun gingen sie zurück, und das Hündlein hatte inzwischen brav gehütet, so daß kein Stück fehlte. Nun blies der Soldat die Herde zusammen und zog heim.
Beim Nachtessen sagte er zum Schneider: »Morgen muß ich schon ein wenig früher weggehen, denn ich will die Herde doch einmal ein wenig weiter treiben als bisher.« Dies sagte er zum
Schneider, eigentlich aber wollte er deswegen früher auf dem Weg sein, damit er mit dem Löwen auf die dritte Alm gehen und auch dem letzten Riesen den Rest geben könnte.
Der Schneider wollte von dem Weitertreiben nichts hören und sagte: »Bleib du nur am alten Ort, du könntest leicht zu weit gehen; wenn etwas zugrunde ginge, müßtest du es zahlen!« »Zahlen will ich alles, was zugrunde geht«, rief der Soldat und ließ sich in seinem Vorhaben nicht irremachen.
Am anderen Tag war er schon in aller Frühe auf und zog hinaus auf die erste Alm. Da ließ er die Herde mit dem Hündlein zurück und ging mit dem Löwen auf die zweite. Bei dem Schloß blieb er stehen und schaute dem Löwen nach, der über die Grenze auf die dritte hinüberging. Es dauerte nicht lange, da kam ein Riese, der hatte schon graue Haare, und der Soldat sah es ihm sogleich an, daß er unter allen dreien der älteste sein müsse. Oh, mein liebes Mandl, dachte er sich, du wärst wohl auch besser in deinem Schloß geblieben und hättest die alten Tage angenehmer verbracht.
Während er so dachte, hatte der Löwe den alten Kerl schon auf den Boden geworfen und zerriß ihn so jämmerlich, daß selbst der Soldat anfing, Grausen und Mitleid zu spüren. Als aber der Riese gar keinen Zappler mehr machte, ging er hin, schnitt die Zunge aus dem Leichnam und steckte sie zu den anderen beiden in die Hirtentasche. Dann folgte er dem Löwen, der ihm weiterzugehen winkte, und sie kamen in ein Schloß, das noch weit herrlicher war als die anderen zwei und worin so viele und so schöne Kostbarkeiten aufgehäuft lagen, daß dagegen alles ein Pfifferling war, was der Soldat bisher gesehen hatte.
Man weiß aber, daß der älteste Riese auch mehr zusammengebracht hat als die anderen zwei, die in ihren jungen Jahren ins Gras beißen mußten. Als der Soldat alles ein bißchen angeschaut hatte, kehrte er wieder um und kam auf die erste Alm. Als er sah, daß das Hündlein brav gehütet hatte und kein Stück fehlte, da blies er die Herde zusammen und trieb sie heim. Von nun an ließ er sein Vieh immer auf die Almen, sagte aber keinem Menschen etwas davon.
Alle Leute staunten, wie schleunig das Vieh jetzt zunahm, und sie hätten gern gewußt, was etwa der neue Hirt für ein Mensch war. Sie fragten daher den Schneider; der wußte ihnen aber nichts anderes zu sagen, als daß er ein landfremder Mensch sei, der immer Geld genug habe und nie ein saures Gesicht mache.
Zwei Jahre hütete der Soldat bei dem Schneider und war in allen Dingen so brav, daß ihn sein Herr immer gerne bei sich behalten hätte. Da kam eines Tages die Kunde, daß in der Residenz ein Ringelreiten ausgeschrieben sei und daß derjenige, der im Vorbeireiten das erste Ringlein herab stäche, die erste, und wer das zweite herab stäche, die zweite Tochter des Königs zur Gemahlin bekommen sollte.
Der Soldat hörte auch von dem Ringelreiten, und weil er das Reiten beim Militär von Grund auf gelernt hatte, bekam er große Lust, sich als Mitwerber einzufinden. Er fragte den Schneider, ob er nicht zu der Feierlichkeit in die Residenz gehen dürfe, denn er habe so etwas sein Lebtag nicht gesehen und möchte doch gern zuschauen.
Der Schneider aber schlug es ihm ab und sagte: »Ich will selbst in die Stadt gehen und das Ringelreiten ansehen, daher kann ich dich beim Hüten nicht ablösen, und du mußt dich schon bequemen, an diesem Tag selber auf die Herde zu schauen.« Der Soldat schwieg still, dachte aber: Hüten wird schon mein Hündlein, deswegen kann ich hineingehen. Wenn ich aber nur ein Pferd hätte, damit ich auch mitreiten könnte, das bloße Zuschauen ist doch zu langweilig. Mit diesem Gedanken ging er immer umher, wußte sich aber lange nicht zu helfen.
Der bestimmte Tag kam heran, und er trieb in aller Frühe seine Herde hinaus. Als er zu den Almen kam, fiel ihm auf einmal sein Löwe ein, er lockte ihn und fragte: »Treuer Löwe, könntest beim Ringelreiten nicht du mich tragen?« Auf diese Frage hub der Löwe an zu reden und antwortete: »Du hättest mich nur früher um etwas fragen sollen, ich hätte dir oft guten Rat geben können. Frage nur, sooft du etwas auf dem Herzen hast, und ich will dir allemal Auskunft geben.
Jetzt aber geh in das erste Riesenschloß und hole dort für dich Speer und Harnisch und für mich Zaum und Sattel. Bin ich gezäumt und gesattelt, so werde ich als Pferd vor dir stehen und dich zum Ringelreiten tragen. Du wirst zwar Sieger sein, und kein einziger außer dir wird einen von den zwei aufgesteckten Ringen bekommen. Aber ich befehle dir, sobald als möglich wieder fortzureiten und dich beileibe nicht als Bräutigam anzubieten.«
Der Soldat freute sich über diese Antwort, versprach, in allem treu zu gehorchen, und ging sogleich in das Riesenschloß. Bald kam er mit Speer und Harnisch zurück, trug Zaum und Sattel in der linken Hand und legte es dem Löwen an. Im nämlichen Augenblick hatte er anstatt des Löwen das allerschönste Roß vor sich, schwang sich auf und ritt wie der Wind von dannen. Als er in der Residenz ankam, hieß es, alle Ritter seien schon geritten, aber kein einziger habe ein Ringlein herab gestochen.
Da ritt er auf den Kampfplatz, und alles schaute auf ihn, weil er der schönste von allen Rittern war. Er spornte das Pferd, kam im Flug ans Ziel, stach ein Ringlein herab, und es entstand ein großes Freudengeschrei, als man sah, daß der schönste Ritter ein Ringlein herab gestochen habe. Während die Leute jubelten, war aber der Sieger schon wieder auf und davon, und kein Mensch wußte, wo er hingekommen war.
Der Soldat ritt auf die Alm zurück, legte wieder seine Kleider an, zog dem Pferd Sattel und Zaum ab, und also gleich stand der Löwe wieder vor ihm. Abends ging er heim, tat, als ob er gar nichts wüßte, und ließ den Schneider, der inzwischen auch zurückgekommen war, vom Ringelreiten erzählen.
Der Schneider berichtete ihm alles genau, daß zuerst keiner ein Ringlein herab gebracht habe, daß aber zuletzt ein wunderschöner Ritter gekommen sei, dieser habe flink ein Ringlein herab gestochen und sei dann schleunigst davon geritten - niemand wisse, wohin. In drei Tagen sei wieder ein Ringelreiten, und jedermann sei gespannt, ob der schöne Ritter wieder erscheine.
Der Soldat stellte sich über das alles verwundert und bat den Schneider, das nächste Mal sollte er doch ihn zur Feierlichkeit gehen lassen, damit er auch einmal den schönen Ritter sehe. »Ach was«, schnarrte der Schneider, »du kannst dich mit deinen schmutzigen Kleidern in der Residenz ja nicht sehen lassen.« Der Soldat gab sich zufrieden, ging am bestimmten Tag wieder zu seinem Löwen und fragte ihn, wie er es diesmal anfangen müsse.
Der Löwe sagte: »Heute nimmst du Speer, Harnisch, Zaum und Sattelzeug vom zweiten Schloß, aber alles von Silber. Habe ich Zaum und Sattel an, so werde ich wieder zum Pferd. Du reitest dann auf mir hinein und wirst gewinnen. Aber biete dich beileibe nicht als Bräutigam an, sondern reite schleunigst davon.«
Der Soldat ging in das Schloß, kam bald im silbernen Harnisch und brachte Speer, Zaum und Sattelzeug mit sich. Kaum hatte er den Löwen gezäumt und gesattelt, da hatte er das schönste Roß vor sich stehen, schwang sich auf und ritt im Fluge hinein. Als er auf dem Kampfplatz ankam, waren alle schon geritten, aber keiner hatte ein Ringlein gewonnen.
Da freuten sich die Leute, als sie den schönen Ritter sahen, und jauchzten laut auf, als er wie der Wind an das Ziel flog und ein Ringlein herab stach. Er wollte nun davonreiten und bemerkte, daß der Kampfplatz mit einer Wand umgeben war. Aber das erschreckte ihn nicht, er gab dem Roß die Sporen, und es sprang mit ihm in einem lustigen Satz über die Mauer hinweg. Die Leute schauten ihm nach, aber da war er schon im Wald verschwunden, und kein Mensch wußte, wo er etwa zu suchen war.
Als er auf die Alm kam, zog er sein Schäferkleid wieder an, nahm dem Roß Zaum und Sattelzeug ab, und der Löwe bekam augenblicklich seine frühere Gestalt.
Beim Abendessen ließ er sich wieder vom Schneider alles erzählen, als ob er gar nicht dabeigewesen wäre, und erfuhr auch, daß bald wieder ein Ringelreiten sein werde. Am bestimmten Tag, als er
mit seiner Herde hinausgegangen war, fragte er den Löwen, wie er es dieses Mal anstellen müsse.
Der Löwe sagte: »Du nimmst jetzt Speer, Harnisch, Zaum und Sattelzeug von dem dritten Schloß, alles von Gold. Du wirst heute wieder das Ringlein herab stechen, aber mit dem Davonreiten mußt du dich diesmal in acht nehmen. Der König hat jetzt den Platz nicht nur ummauert, sondern auch Militär aufgestellt, damit es auf dich feuere, wenn du fort willst. Ich will aber schon einen günstigen Augenblick abwarten und ein Zeichen geben.«
Der Soldat ging in das dritte Schloß, kam im goldenen Harnisch zurück und brachte Speer, Zaum und Sattelzeug, alles von Gold. Beim Satteln und Zäumen verwandelte sich der Löwe in ein stattliches Roß, der Soldat schwang sich auf und ritt im Flug auf den Kampfplatz. Alle Ritter waren schon geritten, aber keiner hatte ein Ringlein bekommen.
Alles freute sich, als der schöne Ritter im goldenen Harnisch erschien, und es entstand ein lauter Jubel, als er wie der Wind zum Ziel flog und ein Ringlein herab stach. Er gab jetzt nicht auf die Leute acht, sondern auf das Roß, und als er merkte, daß es gern davon liefe, richtete er sich zum schnellen Ritt zurecht, gab ihm die Sporen, und ehe man die Hand umkehrte, trug es ihn mitten durch die Soldaten hinaus.
Sie feuerten ihm nach, fehlten aber alles, und bis sie wieder geladen hatten, war er schon tief in dem Wald. Kein Mensch wußte, wo er zu suchen war, und er konnte ungestört wieder seine alten Kleider anziehen und dem Roß Sattel und Zaum abnehmen. Da hatte er nun wieder seinen alten Löwen vor sich, dankte ihm und zog dann wohl bald mit der Herde heim. -
Beim Abendessen erzählte ihm der Schneider von dem Ritter im goldenen Harnisch und von den Soldaten, die ihm nachfeuerten. Der Soldat tat nichts dergleichen, als ob er davon etwas wüßte, und wartete ruhig ab, was da kommen sollte.
Dem König war es ganz und gar zu dumm, daß er seine Töchter in einem dreimaligen Ringelreiten gar nicht los gebracht hatte, und er sann Tag und Nacht darauf, wie etwa der hoch gesehene Ritter erwischt werden könnte. Er ließ im ganzen Reich ausschreiben, daß sich alle Ritter bei Hof stellen sollten, und ebenso alle Fremden, die bisher ihre Heimat nicht angegeben hatten. Wer diesem Gesetz nicht nachkomme, der müsse es mit dem Tod büßen. Auf diese Weise meinte er den Ritter zu ertappen und so wenigstens für eine seiner Töchter einen Bräutigam zu kriegen.
Der Schneider hörte auch von diesem Befehl und dachte sich: Meinen Hirten sollte ich halt auch anzeigen. Aber was wird schon wegen dieses Soldaten sein, den wird der König doch nicht sehen wollen? So besann er sich lange, aber schließlich bekam doch die Furcht das Übergewicht, und er zeigte ihn an. Da kam sogleich vom König der Befehl, der Fremde habe sich in der Residenz einzufinden, und möge er auch ein noch so übles Aussehen haben.
Der Soldat ging nun der Stadt zu, und der Löwe begleitete ihn. Da fragte der Soldat: »Aber wie muß ich es denn heute machen, damit ich davon komme?«
»Heute wirst du nimmer davon kommen«, antwortete der Löwe. »Aber ich will mit dir bis vor die Residenz gehen, will dort warten, und wenn du verraten bist, so komm heraus und frage mich, was du zu
tun hast.«
Das merkte sich der Soldat, ging in die Residenz und ließ den Löwen vor dem Tor zurück. Als er hinein kam, wurde er vor allem gefragt, woher er sei. Er gab seine Heimat ordentlich an und erzählte auch, wie er hierher gekommen war. Als er damit fertig war, wurden die zwei Prinzessinnen herein geführt, und da meinte die ältere sogleich, sie hätte diesen Menschen schon einmal gesehen. Sie besann sich ein wenig und meinte, es müsse derjenige sein, der die drei Jahre im Schloß gebetet habe.
Um Gewißheit zu erlangen, fragte sie ihn, und er gab sich auch als der Richtige zu erkennen. Zum Wahrzeichen zeigte er die Bürste und den Zettel vor, und die Prinzessin erkannte sogleich ihre eigene Schrift. Als er nun doch einmal erkannt war, erzählte er auch, daß er der Ritter sei, der alle dreimal gesiegt habe, und zeigte die Ringe vor. Die Prinzessin hätte nun schon eine rechte Freude gehabt, allein sie wunderte sich, warum er jedesmal davon geritten sei, ohne sich zu melden, und sie fragte um die Ursache.
Da mußte nun der Soldat freilich leere Ausreden suchen, aber darum war er eben nicht verlegen, und die Prinzessin ließ sich bald wieder besänftigen. Sie fragte ihn nun auch, woher er die kostbaren Waffen habe, und er erzählte von den drei Almen, wo er nicht hätte hüten sollen, wo aber gar nichts Furchtbares anzutreffen sei.
Als die Prinzessin ihre Neugier befriedigt hatte, erzählte sie ihm, daß sie, während er vor dem Haus schlief, mit ihrer Schwester vorbei gegangen sei. »Der Bruder«, sagte sie, »hat zurück bleiben müssen, weil du meinen Befehl nicht befolgt hast und der Alten einen Trunk abgenommen hast. Denn ebendiese Alte war unsere Base, die uns und das Schloß verzaubert hatte, und weil du ihr etwas abgenommen hast, so blieb ihr noch so viel Gewalt, unseren Bruder zurückzubehalten.«
Nachdem sie ihm das erzählt hatte, forderte sie ihn auf, da zu bleiben und mit ihr Hochzeit zu halten. Er sagte, er sei gern bereit dazu, nur wolle er bis morgen noch Urlaub haben, damit er ein
wichtiges Geschäft erledigen könnte. Die Prinzessin wollte ihn auf so lange Zeit nicht mehr fortlassen und sagte: »Könntest du das Geschäft nicht in kürzerer Zeit erledigen und in zwei
Stunden wiederkommen?«
»Nun denn«, antwortete der Soldat, »ich will sehen, daß ich bald fertig werde und heute noch zurückkommen kann.«
Er nahm nun einstweilen Abschied von der Prinzessin und ging vor die Residenz hinaus zu seinem Löwen. Diesem erzählte er alles, was drinnen vorgegangen war, und fragte ihn, was jetzt zu tun sei. Der Löwe antwortete: »Ich habe dir nun nichts mehr zu sagen, du hast alles richtig gemacht.« Da fragte der Soldat den Löwen weiter: »Aber bevor ich die Prinzessin heirate, möchte ich doch meinen Dank bezeugen für die vielen Wohltaten, die du mir erwiesen hast. Denn wenn ich dich nicht gehabt hätte, so wäre ich nicht weit gekommen, und die Riesen hätten mich zehnmal aufgefressen.«
»Wenn du mir dankbar sein willst, so schlage mir den Kopf ab«, antwortete der Löwe. Der Soldat war über diese Antwort nicht wenig erstaunt und sagte: »Das wäre ein schöner Dank, wenn ich
meinem größten Wohltäter den Kopf abschlüge. Für so dumm wirst du mich doch nicht ansehen, begehre nur etwas anderes.«
Der Löwe aber beharrte darauf und verlangte wieder, er sollte ihm den Kopf abschlagen. Als der Soldat sah, daß es ihm ernst war, entschloß er sich endlich und sagte es zu.
»Aber ich will dir auch sagen, wo und mit welcher Waffe du es tun sollst«, sprach der Löwe. »Du mußt mir im königlichen Hof mit jenem Schwert den Kopf abhacken, das du bei dem letzten Ringelreiten geführt hast.« Der Soldat versprach auch das und sagte: »Du mußt nur hier ein wenig warten, bis ich um Urlaub gebeten und dann das Schwert aus dem Riesenschloß geholt habe.«
Hierauf ging er hinauf zur Prinzessin und sagte, sie solle ihm noch ein bißchen Urlaub geben, denn er müsse zuerst auf die Alpe gehen, ein Schwert holen, um damit dem Löwen, seinem größten Wohltäter, den Kopf abzuhacken. Die Prinzessin suchte ihn von diesem Vorhaben abzubringen, als sie aber hörte, daß es der Löwe durchaus nicht anders wolle, da gab sie nach und ließ ihn auf die Alpe gehen.
Er eilte in das dritte Schloß, holte das Schwert, das er das letztemal getragen hatte, ging dann, als er zurückkam, mit dem Löwen in den Schloßhof und haute ihm mit einem Streich den Kopf ab. Da stand statt des Löwen auf einmal ein schöner Jüngling vor ihm, tat seinen Mund auf und sagte: »Ich bin der Bruder deiner Braut, dessen Zauber nicht gelöst wurde, weil du meiner Schwester nicht gehorcht hast. Dadurch, daß du mir den Kopf abgeschlagen hast, ist der Base, die uns verhext hatte, der Garaus gemacht worden.«
Sie gingen nun zusammen hinauf in den königlichen Palast, da wurde der Prinz gleich erkannt, und es war eine Freude im ganzen Schloß, daß man sich es nicht vorstellen kann. Der Soldat heiratete die Prinzessin und blieb bei Hof, der Prinz aber setzte nach dem Tod seines Vaters die Krone auf.
Du fragst nun, was mit den Riesenzungen und dem Hündlein weiter geschehen ist, aber davon kann ich dir nichts sagen. Ich denke, das Hündlein wird mit der Zeit der Schneider gekriegt haben, und die Riesenzungen werden in der königlichen Schatzkammer hinterlegt worden sein.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DIE KRÖNLNATTER ...
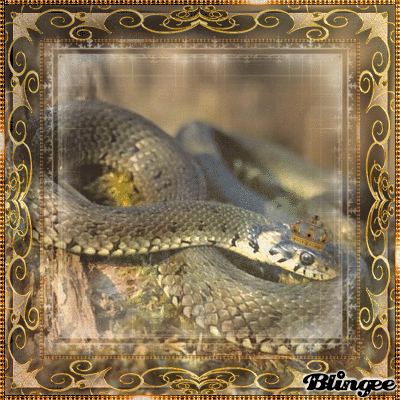
Die Krönlnatter ist eine Natter, so gescheckt und kriechend wie die anderen ihres Geschlechtes, aber auf dem Kopfe trägt sie ein gar hübsches Krönlein und davon heißt sie die Krönlnatter. Das Krönchen glänzt wie Gold und die Spitzen desselben funkeln wie Edelsteine.
Kommt die Krönlnatter zu dir und begegnest du ihr recht lieb und freundlich, so ist dein Glück gemacht, denn früher oder später wird sie dir das Krönlein schenken und das Krönlein macht alles, was du immer willst, unversieglich. Legtest du das zackige Reiflein zu deinem Schatztaler, den dir die liebe Mutter aufbewahrt, so könntest du dir um 100 Gulden Soldaten, Pferde und Bilder kaufen und dein Taler wäre doch als Hecktaler im Beutelchen.
Würdest du das Krönlein zu den Soldaten legen, so würdest du Soldaten ohne Maß und Ziel bekommen, so daß dein Füßchen in der Stube vor lauter Soldaten nicht mehr Platz fände.
Einmal vor alten Zeiten war ein armes Bauernmädel, das von seiner bösen Stiefmutter gar hart behandelt wurde. Es mußte früh aufstehen und in den Stall gehen und arbeiten früh und spät, und war spätabends alles abgetan, so bekam es von seiner Mutter noch Schläge und Scheltworte und höchstens ein wenig Wirler, um den Hunger zu stillen.
Das Mädchen war aber immer heiter und wohlgemut, denn so oft es in den Stall ging, kam eine Natter mit einem Krönlein daher und blickte dem netten Kinde so lieb in die dunklen Äugelein, daß es Weh und Ach vergaß und des Lebens froh wurde.
Das Mädchen gab dem zutraulichen Tiere, weil es in die Butte äugelte, einmal ein wenig Milch und es trank und trank und sah die kleine Dirne so lieb an, als ob es danken wollte. Das Mädchen brachte aber die Milch voll Bangen der Stiefmutter, denn diese zählte jeden Tropfen und forderte von jedem fehlenden Rechenschaft.
Wie groß war aber das Staunen der Melkerin, als zwei Schüsseln mehr als gewöhnlich voll wurden und selbst die herbe Mutter ein süßes Gesicht schnitt.
Seitdem kam die Natter immer und das Mädchen gab ihr tagtäglich von der Milch und das Tier blickte sie immer mit seinen klugen schwarzen Äugelein so lieb an, als ob es hätte sagen wollen:
»Maidele, ich will dir dankbar sein.«
So ging es viele, viele Jahre. Die Natter kam morgens und abends und trank Milch und das Mädchen wuchs und wuchs und ward immer schöner und lieber, so daß es die schönste Dirne im Dorfe war und von allen gern gesehen wurde.
Die Dirne war endlich Braut und hielt eine lustige Hochzeit. Die Schüsseln dampften, die Böhmen musizierten und die Böller krachten, daß es eine Lust war, und alles war laut und fröhlich. Als das Fest dem Ende sich zuneigte, war es plötzlich stille, stille - denn die Krönlnatter schlängelte sich durch den Saal, bis sie zum Sitze des Brautpaares kam.
Hier kroch sie an der Sessellehne empor auf die rechte Schulter der Braut, sah ihr ins freudennasse Auge, schüttelte das goldene Krönlein vom Kopfe auf den blanken Teller - und verschwand, ohne je wieder zu kommen. Die Braut nahm aber das funkelnde Andenken zu sich und legte es zu ihrem Gelde.
Dies nahm aber nie mehr ab, mochte sie davon nehmen, so viel sie wollte, und seitdem war sie die reichste und stattlichste Bäuerin im ganzen Dorfe.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Unterinntal
FISCHLEIN KLEB AN! ...
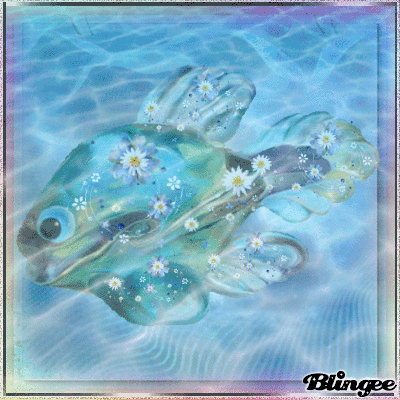
Es waren einmal drei Knaben, denen war ihre Mutter gestorben, und an ihrer Stelle hatte ihnen der Vater eine recht herbe Stiefmutter in die Hütte gebracht. Sie mochten tun und treiben, was sie wollten, nie war es recht. Anstatt des Morgensegens bekamen sie Scheltworte und anstatt des Brotes erhielten sie Schläge und nachts konnten sie froh sein, wenn sie vor Hunger die müden Augen schließen konnten.
Da dachten sich die Knaben wohl oft: »Wenn die rechte Mutter noch lebte!« Allein keiner wagte es zu sagen; nur der jüngste, Hans, ließ hin und wieder einen solchen Gedanken halblaut werden. Aber gerade deshalb konnte ihn die neue Mutter nicht leiden und ausstehen und bekamen die übrigen zwei an Festtagen zwei Kuchen, so bekam er einen; und schnitt den anderen die Mutter alle heiligen Zeiten einmal ein freundliches Gesicht, so sah er immer nur ein finsteres und saures.
Hans mußte die schwersten Arbeiten tun und konnte er sie nicht vollbringen, so wurde er verlacht, gescholten und geschlagen. Einmal, es war gerade Frühling und die Veilchen guckten hervor und die Vögel sangen, gab ihm die böse Stiefmutter eine Reiter (grobes Sieb) und sagte: »Geh zum Brunnen und hol mir darin Wasser!«
Hans blickte bald das Geflecht, bald die barsche Machthaberin an und die schwarzen Augen gingen ihm über; denn er sah die Unmöglichkeit des Befehles und kannte seine Mutter. »Willst du gehen oder nicht?« barschte sie den Zögernden an, daß der arme Knabe zusammenfuhr wie das zitternde Espenlaub, »oder soll ich den Hund dir nachhetzen?«
Weinend und trostlos schwankte Hans mit seinem durchsichtigen Gefäße hin zum Nußbaum, in dessen Schatten der Brunnen rauschte. Hoffnungslos hob er die Reiter hinauf und ließ den Wasserstrahl hineinplätschern; dieser brach sich aber an den Stäbchen und sprang und sickerte durch - und heftiger weinte Hans, daß es ihm fast das Herz abstieß. Obwohl er keine Hoffnung auf ein gutes Ende hatte, stund er doch, um dem Gewitter, das seiner zu Hause wartete, solange als möglich zu entgehen: aber das Wasser sprang und sickerte durch und nicht ein Tröpflein blieb an einem Stabe hängen.
Wie der Arme so da stund, kam plötzlich an einer Krücke gebückt ein Mütterchen daher, das er noch nie gesehen hatte und das ihm fast unheimlich vorkam. Das Angesicht war runzelig wie ein Apfel im Mai, die pechschwarzen Augen guckten unstet und durchbohrend hin und wieder und ihre Nase zog sich Hacken ähnlich über den zahnlosen Mund herunter.
»Was machst du da, Hans?« sprach sie mit kreischender Stimme. Hans erbebte, als er seinen Namen von der nie Gesehenen nennen hörte. »Brauchst dich nicht zu fürchten. Ich mein es gut mit dir. Was machst du?« frug sie im vertraulichen Tone. Hans faßte sich ein Herz und sagte, er müsse hier in der Reiter Wasser holen, das Wasser laufe aber immer davon und ohne Wasser dürfe er der Stiefmutter nicht unter die Augen kommen.
Hier brach er ab; das Weinen erstickte seine Stimme; Tränen rollten über die blassen, eingefallenen Wangen des Knaben und netzten das zerlumpte Lodenwams. »Laß das Weinen!« fiel tröstend die Alte ein. »Ich will dir helfen, und wenn du immer gut und brav sein wirst, sollst du ein großer Herr werden, vor dem sich alles bückt. Ich habe deine Tränen gezählt und will sie abtrocknen.«
»Fischlein, Fischlein«, rief sie darauf mit erhöhter, fast gebieterischer Stimme; dabei tat sie einen raschen Griff in den Trog und husch! zappelte ein winziges, blaues Fischlein mit goldroten Blümlein betupft in der runzligen Hand der Alten.
»Da nimm das Fischlein kleb an,« begann die Alte zum verblüfften Knaben, der schluchzend noch die Hände, mit denen er so eben die Augen ausgewischt, über die Stirne hielt, - »und bewahre es wohl! Das Fischlein hat Wunderkräfte und sie sind in deiner Hand. Benütze sie klug und redlich! - Sprichst du zum Fischlein: 'Fischlein kleb an!', so wird alles, was es berührt, daran kleben bleiben und niemand, selbst der Kaiser nicht, könnte sich davon losmachen. Alles muß dir folgen.
Willst du aber jemanden freilassen, so berühre ihn mit dieser Nadel« - hier zog sie eine funkelnde Brustnadel aus ihrem Mieder - »und er ist frei.« »Aber die Mutter, wenn ich heute kein Wasser bringe?! - und ich bin schon so lange aus!« seufzte Hans noch beklommen.
»Dem soll gleich geholfen werden!« erwiderte das Mütterchen, warf das blaue, goldbeblümte Fischlein in die Reiter und das Wasser plätscherte und plätscherte hinein und kein Tropfen rann durch die Spalten, und bald war das Gefäß voll und das Wasser lief über.
»Nun nimm dein Zeug und geh!« sprach freundlich das Mütterchen. Der Knabe sah sie mit halb geöffnetem Munde an, hob die Reiter auf den Kopf und wollte der guten Frau danken; aber Mütterchen und Krücke waren verschwunden, nur ein rötlicher Dunst entstieg jener Stelle und verzog sich in die Luft.
Hans trottete nun über Stock und Stein nach Hause. Die Stiefmutter staunte und staunte, konnte aber dem Knaben, der ihr die Geschichte erzählte, nur vom Fischlein schwieg, nicht böse sein, verkochte das Wasser und gab ein andermal dem Knaben das Schäfflein, das er bei Lebzeiten der rechten Mutter zu tragen gewohnt war. Hans trug das Fischlein immer bei sich im Sacke und in der Nacht ließ er es unter seinem Strohpolster schlafen und hatte es recht lieb.
So ging es geraume Zeit; der Knabe trug das Fischlein bei sich, sagte aber nie »kleb an« und das Fischlein verhielt sich ruhig und klebte nie an. Als einige Jahre vorüber gestrichen und die Stiefmutter schon alterte, lud Hans, der nun ein weidlicher Bursche war, die Kohlköpfe auf den Wagen, um sie nach Hause zu führen.
Des Nachbars Gänse leisteten ihm Gesellschaft und schnatterten ihm vor und schnappten nach manchem Kohlkopf. Als er geladen hatte und weiterlenkte, folgte die Gansherde dem Fuhrwerke und schnatterte ihr kra, kra, kra und der Gänserich langte seinen roten Schnabel nach der Fracht. Hans wurde endlich der Begleitung überdrüssig und dachte: »Ich will es euch dummen Gänsen schon machen.«
»Fischlein kleb an!« lispelte er und der Gänserich hing am Kohlkopf und die Gänse hingen in einer langen Reihe an ihm, so daß der Schnabel der einen am Schweife der anderen hing. Kra, kra, kra schnatterten die fünfundzwanzig Gänse.
Wie es so weiter ging, kamen sie zu des Nachbars Hof. Die Bäuerin hörte das Geschnatter, eilte mit einem Besen heraus und erstaunte nicht wenig über diesen Zug. Mürrisch wollte sie die Gänse weg und in den Stall treiben, Hans lispelte aber: »Fischlein kleb an!« und die Bäuerin hing mit dem Besen an der letzten Gans und konnte nicht weiter. Kra, kra, kra ging es nun weiter, Hans voraus, dann kamen die grünen Kohlköpfe, die weißen Gänse und die schmähende Bäuerin.
Wie es so weiter ging, kam der Zug zu einem Müller, der seinen Esel am Halfterband daher führte. »Hilf mir!« rief die Bäuerin und streckte die Hand nach dem Mehl bestäubten Eselsführer. Mitleidig langte dieser ihr zu, aber in dem selben Augenblicke hieß es: »Fischlein kleb an!« und Müller und Esel hingen an Zuge.
Kra, kra, kra ging es nun weiter dem Dorfe zu, Hans voraus dann die grünen Kohlköpfe, die weißen Gänse, die schmähende Bäuerin, der fluchende Müller und der graue Esel, der in das Geschnatter der Gänse sein betontes Iah, Iah eintönen ließ. - Die Fahrt ging weiter; da begegnete dem Zuge der Schullehrer mit seinem spanischen Rohre einher stolzierend.
»Jagen Sie doch den Esel weg, damit ich frei werde«, rief flehend der Müller dem Herrn mit den Vatermördern zu. Die Bitte fiel nicht auf taube Ohren, gravitätisch trat der Lehrer hinzu und suchte den Esel weg zutreiben. »Fischlein kleb an!« schmunzelte Hans, und Stock und Meister klebten.
Kra, kra, kra ging es nun weiter dem Dorfe zu, Hans voraus, dann die Kohlköpfe, die Gänse, die Bäuerin, der Müller, der Esel das spanische Rohr und der Schulmeister mit den Vatermördern.
Als der bunte Zug zum Dorfe gekommen, stund gerade der Bäcker am Ofen und wollte die Laibe hineinschießen. »Kra, kra, kra, iah, iah verflucht und verhext!« scholl es so wirr von der Straße herein, daß er neugierig, die Schalter mit den Laiben tragend hinaus stürzte, um das tolle Schauspiel zu sehen. »Reicht mir Eure Hand!« bat der Lehrer. - Es geschah, »Fischlein kleb an!« sprach Hans und der Bäcker klebte am Zuge.
Die lange, lange Reihe zog und lärmte durch die Gasse, daß die Fenster von allen Seiten aufflogen und helles Gelächter von allen Seiten erscholl. Wie der Zug so daher kam, fuhr plötzlich eine Kutsche an, die sechs Schimmel zogen, und in der eine wunderschöne Jungfrau saß. Diese war die ernste Königstochter, die nie, seitdem sie das Tageslicht erblickt hatte, ihre roten Lippen zu einem Lächeln verzogen hatte.
Durch den Lärm neugierig gemacht sah sie zum Fenster hinaus, und wie sie das Kra und Iah, das Fluchen und Beten hörte und den Hans, die Kohlköpfe, die Bäuerin, den Esel, den Schulmeister usw. in engster Verbindung sah, schlug sie ein lautes Gelächter auf und ihre Augen funkelten vor Freude. -
»Die Prinzeßin lacht«, flog es durch die Reihen der Begleiter und Begleiterinnen. Hans aber lispelte, als der Bäcker mit der Schalter zufällig an der Deichsel des königlichen Wagens anstieß, »Fischlein kleb an!« und der Wagen klebte an. So kamen sie zur königlichen Villa, die am Dorfe stund; der König eilte an das Fenster, als er den Lärm und das Gelächter hörte, und wie er den wunderbaren Zug vom Kohlkarren bis zur königlichen Equipage und seine lachende Tochter sah, begann er auch zu lachen und rief den Führer zu sich.
Hans kam und erzählte, wie es gegangen sei. Der König sprach freundlich: »Du hast meine Tochter zum Lachen gebracht, wähle dir eine Belohnung! Du sollst erhalten, was du willst!« - Hans kratzte sich hinter den Ohren und meinte: »das hinterste Fischlein Kleban«.
Als dem Könige dieser Wunsch nicht ganz gefällig schien, machte Hans Miene weiterzuziehen. Der König mußte zum üblen Spiel eine gute Miene machen und froh sein, wenn seine Prinzeßin frei würde. Hans eilte hinunter: tupf, tupf, tupf ging es mit der hellen Stecknadel und es stob auseinander, wie wenn der Wind in die Spreu gefahren wäre.
Die Königstochter lachte wieder und Hans führte sie zum königlichen Vater hinauf und freute sich des letzten »Fischleins Kleban«. Der König behielt den Hans bei sich und bekam ihn immer lieber und lieber und die Königstochter lächelte, so oft sie den einstigen schönen Führer sah.
Hans wurde endlich Herzog und die lachende Prinzessin seine Braut und da gab es eine lustige schöne Hochzeit, und Herzog Hans und die Braut lächelten sich gar fröhlich an und niemand hätte geglaubt, daß die Prinzeßin einst so ernst gewesen wäre und nie gelacht hätte.
Hans nahm zu seinem Wappen ein blaues Fischlein mit rotgoldenen Blümchen und das haben noch seine Nachkommen bis auf den heutigen Tag. Als der alte König starb, wurde Hans auch König und war ein guter König, der sein Volk nicht quälte, denn er hatte selbst so etwas erfahren.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Absam und Eben
VOM REICHEN GRAFENSOHNE ...
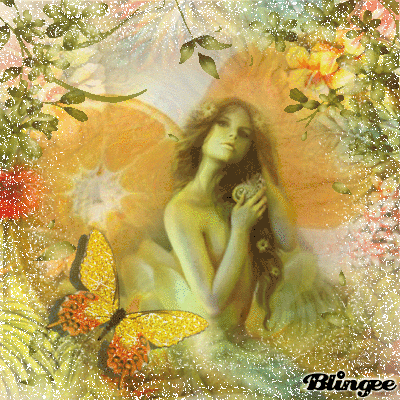
Der reiche Grafensohn war schon ein stattlicher, schöner, junger Mann und seine Eltern wollten, daß er sich verheiraten sollte. Die Mutter sprach ihm morgens und abends zu, er solle sich eine schöne Braut und ihr eine Tochter holen; allein alles Reden und Mahnen war vergebens.
Der gute Grafensohn hatte sich ein für allemal in den Kopf gesetzt, keine Braut, die von einer Mutter geboren worden, heimzuführen, und eine andere, wie er sie wollte, konnte er nicht finden. Er wollte sich dennoch eine solche suchen, ließ sich das Roß satteln, nahm von den traurigen Eltern Abschied und ritt in die Fremde.
Er war schon lange, sehr lange geritten und hatte noch die erwünschte Braut nicht finden können, da kam er zu einem Zwiewege, und wo sich die Wege kreuzten, da stand ein altes, altes Weiblein, krumm und klein und gebückt, und das hatte nur mehr einen Zahn im Munde und seine Augenwimpern waren gar so lang.
Der reiche Grafensohn fragte das betagte Weiblein, wohin diese zwei Wege führten; da hatte er schreien müssen, denn das alte Weibchen war vor Alter fast taub, und dann erzählte er ihr auf ihre Frage auch sein Vorhaben. - Sie nickte und wackelte dann beifällig mit dem grauen Kopfe und wies mit dem Haselstöckchen auf den Weg, der rechts führte, und zugleich fing sie mit kreischender Stimme an, so daß er sie nur schwer verstehen konnte:
»Schmucker Knabe! geh den Weg und du wirst ein großes, großes Haus finden; in das geh, schmucker Knabe, hinein und hinter der Türe wirst du einen Kehrbesen finden. Diesen nimm und kehre die Stiege, und hast du die Stiege gekehrt, dann wirst du zu einem großen Löwen kommen, schmucker Bube! und der hält einen goldenen Schlüssel in seinem Rachen.
Den Schlüssel mußt du mit Gewalt dem Löwen aus dem Rachen reißen und damit die Zimmertüre, vor der er steht, aufsperren; dann wirst du in ein prächtiges Zimmer kommen und wieder zu einem Löwen mit einem Schlüssel, der vor einer Türe steht. Und diesen Löwen mußt du, schmucker Knabe!
Erlegen und ihm wieder den Schlüssel nehmen und mit diesem mußt du die andere Türe aufschließen, und dann kommst du in die Küche und in der Küche wirst du drei schöne rotgelbe Pomeranzen und ein Messer mit einem Griffe aus Ebenholz finden.
Nimm dann das Messer und schneide eine der drei Pomeranzen auf und es wird ein wunderschönes Fräulein, so schön wie die Sonne, herauskommen. Du mußt aber damit gleich zu dem frischen Brunnen, der vor dem Haustore unter den zwei Linden steht, eilen und deine Braut unter das Wasser halten, denn sonst wird sie gleich zusammenwelken und sterben.«
Der reiche Grafensohn nahm sich die Worte zu Herzen, ritt in den kühlen, dunklen Wald hinein und kam immer tiefer und tiefer, bis er plötzlich vor einem großen Schlosse stand, das aus weißem Marmor erbaut war. Er trat durch das schöne Portal ein und fand hinter der Haustüre den Besen und diesen nahm er und vollzog den Auftrag der geheimnisvollen Wegweiserin.
Als er dies getan hatte, kam er zum Löwen und diesem nahm er den goldenen Schlüssel aus dem Munde, sperrte die ebenholzene Saaltüre auf und durchschritt den weiten Saal, bis er zum zweiten Löwen kam, der wieder einen goldenen, noch schöneren Schlüssel im Rachen hielt.
Er erlegte diesen Wächter, nahm ihm den Schlüssel aus dem Rachen, öffnete damit die anstoßende Türe und kam in die Küche, wo er das Messer und drei wunderschöne Pomeranzen fand; die waren so gelb wie das reinste Gold und glänzten wie die Sonne.
Er wagte es kaum, die wunderschönen Früchte anzugreifen, denn sie waren gar zu glänzend. Endlich übermannte er sich doch und griff nach der nächsten und ersten Pomeranze und nach dem blanken Messer und schnitt den goldenen Apfel entzwei, denn er hatte sich den Rat des alten Weibleins gar wohl gemerkt.
Aber kaum hatte er die obere Hälfte der Schale abgelöst, als ein wunderschönes Mädchen vor ihm in der untern Hälfte der Pomeranze, die er in den Händen hielt, stand, und es war so schön als der Tag und seine Augen so blau als der heitere Himmel im Sommer.
Dem reichen Grafensohne war es gar wunderlich ums Herz und er vergaß der Mahnung des alten Mütterchens ganz und gar und schaute und schaute nur die schöne Jungfrau an und dachte nicht an den Brunnen. Wie er so da stund, da welkte das schöne Bild zusammen und die Jungfrau starb vor seinen Blicken.
»Warte nur, mit der zweiten will ich es gescheiter machen«, dachte sich der reiche Grafensohn, nahm die zweite Pomeranze und das blanke Messer und stieg die weiße Marmorstiege hinab in den Hof. Als er bei dem Brunnen unter den zwei Linden angelangt war, schnitt er die goldene Frucht entzwei und, es blendete ihm fast die Augen, eine Jungfrau stand vor ihm, so schön, wie die Sonne noch nie eine beschienen hat.
Er hielt das schöne Wesen unter den Strahl des Wassers und es wurde immer größer und größer, so daß seine Hände sie nicht mehr halten konnten und sie auf dem Boden stand und endlich so groß war wie der reiche Grafensohn.
Da nahm er sie bei den weißen Armen und führte sie in das weiße Marmorhaus und hieß sie dort bleiben, bis er wieder mit Roß und Wagen kommen würde, und dann nahm er von der schönen Jungfrau Abschied, küßte sie und wanderte weiter zu seinen Eltern, um von ihnen Roß und Wagen zu holen.
Die schöne Pomeranzenjungfrau aber wohnte nun allein im Palaste und mußte sich selbst das Wasser holen und das Essen bereiten und hatte so ganz allein wohl oft Langweile. Neben dem großen, schönen Marmorhause stund aber auch ein kleines Häuschen und in dem wohnte eine Hexe mit ihren zwei Töchtern.
Diese sahen die schöne Jungfrau öfters zum Brunnen unter den Linden gehen und kamen auch zu ihr herauf und fragten und forschten um dies und das, und das Pomeranzenkind war gar unschuldig, kindlich und einfältig und erzählte ihnen alles unverhohlen, gerade wie es Kinder tun.
»Komm mit uns,« sagte einmal die ältere der beiden Hexentöchter, »die Mutter hat Kuchen gebacken und die sind gar gut.« - Das arglose Kind ließ sich bereden und ging mit den beiden Schwestern.
Sie spielten allerlei Spiele, und da sollte das Mädchen einmal Königin werden und mußte sich umkleiden und die Haare flechten lassen, und wie es so da saß, da drückte ihm eine der beiden Schwestern eine Nadel in den Kopf, das war eine Zaubernadel, und das arme Kind ward in eine Taube verwandelt. -
Eine der zwei häßlichen Schwestern ging nun in das große Haus hinüber und wartete, bis endlich der Bräutigam kam. Dieser kam angefahren, staunte aber nicht wenig, als er anstatt seiner schönen Braut die garstige Hexentochter fand.
Allein diese wußte allerlei Ausreden und er wollte sein gegebenes Versprechen halten und meinte, ihn könnten doch nur die Augen täuschen, und nahm also die garstige Braut zu sich in den Wagen und fuhr sinnend damit fort.
Während sie auf dem Wege waren kam der alten Hexe die Taube aus und flog dem Wagen nach und schlug die weißen Flügelchen, daß es schwirrte, und der reiche Grafensohn hatte Mitleid mit dem armen Tierchen und streckte die Hand aus, um es hereinzulangen.
Allein seine Braut war darüber sehr böse, denn sie kannte das Tierchen. Der reiche Grafensohn hatte aber Erbarmen und ließ sich es nicht nehmen, sondern nahm das Täubchen herein, hielt es auf seinem Schoße und streichelte es, daß es zu girren anfing. -
Und wie er es so streichelte und das Täubchen ihn mit seinen schwarzen, klugen Äuglein anblickte, griff er eine Nadel auf dem Köpflein des Tierchens und er zog sie voll Mitleid heraus und das schöne Fräulein stund wiederum vor ihm in dem Wagen.
Da freute sich der reiche Grafensohn erst recht und hatte sie noch einmal so lieb; die böse garstige Hexentochter warf er aber zum Wagen hinaus, daß sie beide Beine brach. Das Brautpaar fuhr nun voll Freude nach Hause und die alten Eltern freuten sich mit ihrem Sohne und es gab eine gar stattliche Hochzeit.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
TEUFEL UND NÄHERIN ...
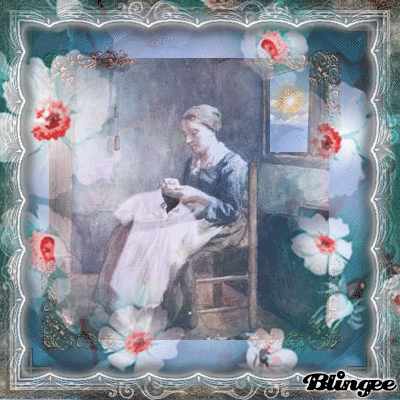
Es ist schon lange her, da war einmal eine Näherin und diese war so geschickt, daß man zuvor und darnach keine bessere erfragt hätte, so weit der Himmel blau und die Erde grün ist.
Allein sie bildete sich auch ihren Teil auf ihre Geschicklichkeit ein und einmal sagte sie gar halb im Spaß, halb im Ernst, sie wollte mit dem Teufel zu Neid und um die Wette nähen. Der Schwarze sollte ihr es gewiß nicht abspielen.
Der Teufel hatte aber dünnere und feinere Ohren, als man meint, und hört in der tiefen Hölle drunten alles, was wir Menschenkinder da oben reden und wispern. Er hatte die Rede der Näherin auch nicht überhört und kam in seinem Staat zu ihr, sie beim Worte zu nehmen.
Die Näherin wollte nun das Blatt wenden, allein damit kam sie nicht zurecht. Sie mußte mit ihm die Wette eingehen, wer von ihnen beiden zuerst ein Hemd fertig machen würde. Würde es die Näherin später vollenden, so sollte sie dem Teufel gehören.
Die Wette begann nun sogleich und zwar mit dem Zuschneiden. Dazu brauchten aber beide fast gleichviel Zeit und niemand war dem anderen voraus. - Allein, als es zum Nähen kam, da hättest du dabei sein und es sehen sollen!
Der Teufel, um ja später keinen Augenblick zu verlieren, fädelte sich schier einen ganzen Zwirnknäuel auf einmal ein. Das war sehr ungeschickt getan und dazu kam noch, daß er auch weit längere Arme hat als die Leute, und deswegen mußte er bei jedem Stich dreimal ums Haus herumlaufen, und weil er vergessen hatte, gleich anfangs einen Knopf zu machen, lief er noch dazu die drei ersten Male vergebens.
Die Näherin fädelte wie andere Male ein und machte auch alleweil einen hebigen Knopf, weil sie es so gewohnt war, und nähte und nähte, ohne aufzuschauen, bis sie mit dem Hemde fertig war; und wie sie es vollendet hatte, warf sie es dem Teufel, der gerade in aller Eile daher kam, in die pechkohlrabenschwarze Schnauze.
Er schämte sich aber, daß er feuerrot wurde und sich in die Erde hätte verkriechen mögen, denn er hatte noch nicht eine ganze Naht zusammen gebracht. Er hatte nun die Wette verspielt und man hat auch seitdem nicht mehr gehört, daß er nochmals mit einer Näherin zu Neid gearbeitet hätte.
Nur heißt es jetzt noch oft, wenn einer recht ungeschickt die Arbeit angreift, er mache es wie jener Teufel, der bei jedem Stiche dreimal um das Haus herumgelaufen ist.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Unterinntal
DER HÖLLISCHE TORWARTEL ...
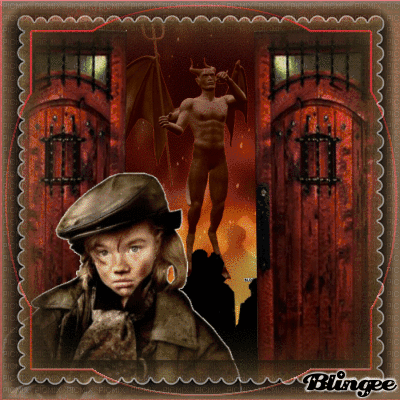
Es wollte sich ein recht schmutziger Knabe gar nie waschen lassen und ging immer mit seinem unsauberen Gesichte herum. Kein Warnen und Zureden half hier, und so wurde der Schmutzige täglich noch schmutziger. Wenn aber die Leute recht unrein sind und so ungewaschen herumwandern, bekommt der Böse über sie Gewalt. Das hat schon mancher zu bitterem Leide erfahren und zu spät bereut. So ging es auch diesem Knaben.
Auf einmal war er verschwunden, man konnte von ihm weder Laub noch Staub sehen und kein Mensch konnte ihn mehr erfragen. Sieben Jahre waren seit dem Verschwinden des Knaben vergangen und er war fast ganz vergessen, als er nach so langer Zeit auf einmal wieder um die Wege war.
Er war aber so verändert und gealtert, daß ihn seine besten Bekannten nur mehr mit Mühe erkennen konnten. Seine Hautfarbe war ganz schwarz und sein Haar ganz struppig. Auch war er sehr stille und einsilbig geworden und man brachte nicht viel aus ihm heraus. Nur das erzählte er öfters, besonders den Kindern, daß er wegen seiner Scheu vor dem Waschen in die Gewalt des Teufels gekommen sei und deshalb als Torwartel am Höllentor habe dienen müssen.
Da hat er nun alle gesehen, welche in dieser ganzen Zeit durch dies feurige Tor eingezogen waren, und es waren ihrer so viele, daß sie niemand hätte zählen können. Reiche und Vornehme, Arme und Niedrige, Männer und Weiber mußten am Torwartel vorüberziehen und er wußte Gott Dank, daß er nicht selbst durch das Tor gemußt und seine Dienstzeit nur sieben Jahre gedauert hatte.
Ach hatte er gute Vorsätze gemacht, sich fleißig zu waschen und nicht mehr den Schmutz an sich zu leiden. - Und diese hat er auch fleißig erfüllt, denn er wollte nie und nimmermehr höllischer Torwartel werden und die Verdammten vorbeiziehen sehen.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
DER BÄRENHANSL ...
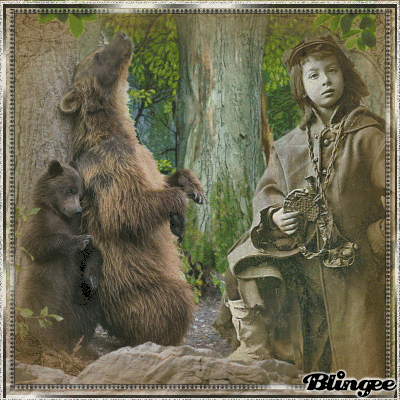
Eine arme Mutter wußte sich mit ihrem schwachen, armseligen Kinde nicht zu helfen und zu raten. Da nahm sie es und trug es hinaus in den Wald zu einer Höhle, in der eine Bärin hauste, warf es hinein und empfahl es dem Schutze Gottes. Dann kehrte sie weinend heim.
Die Bärin fühlte aber Mitleid mit dem kleinen Kinde und hielt es wie ihre Jungen, - und der Knabe erholte sich und wuchs heran. Anfangs strich er mit den Bären durch die Wälder, später aber verließ der Junge die Wildnis und begab sich in das Land.
Er war so stark, daß er ein Schwert von 9 Pfund trug und das selbe ritterlich führte. Auf seiner Wanderung kam er zu einem Kohlenbrenner, der die größten Bäume samt den Wurzeln aus der Erde riß, die Stämme mit den Händen zerstückelte und aus den so gemachten Prügeln Kohlen brannte.
Als der Bärenhansel den starken Kohlenbrenner sah, sprach er zu ihm: »Kamerad! geh mit mir in die weite Welt, wir wollen mitsammen unser Glück machen. Sieh, ich bin auch ein Mordskerl und wir wollen uns ordentlich durchschlagen.«
Der Kohlenbrenner ließ sich dies nicht zweimal sagen, schlug ein und beide wanderten nun weiter. Auf dem Wege kamen sie zu einem Müller, der an einer Anhöhe stund und mit seinem Atem sieben Mühlen auf einmal trieb.
»Dieser paßte zu uns,« dachte der Bärenhansel, ging auf den Müller zu und sprach: »Meister, Ihr seid ein tapferer Patron und zu etwas Besserem geboren, als hier Euren Atem zu verschwenden. Kommt, geht mit uns, und wir werden unser Glück in der Welt machen.«
Dem Müller gefiel der Vorschlag nicht übel und er ging mit ihnen. Auf ihrem Wege kamen sie bald zu einem halb verfallenen Schlosse, das ganz unbewohnt war. Da beschlossen sie, einige Tage darin Rast zu halten und im nahen Wald zu jagen.
Am ersten Tage ruhten alle drei aus und schliefen um die Wette. Am zweiten zog der Bärenhansel mit dem Kohlenbrenner auf die Jagd und der Müller mußte im Schlosse bleiben, um zu kochen. Als dieser aber bei seiner Arbeit am Herde stund, kamen aus dem Kamine Geister herab und prügelten den verlassenen Koch derartig durch, daß er halbtot auf dem Boden liegen blieb.
Bald darauf kehrten die zwei Kameraden mit großer Beute und noch größerem Hunger von ihrer Jagd zurück und fanden kein Mittag bereitet. »Verfluchter Kerl!« schrie der Bärenhansel, »was hast du gemacht? Wir haben Hunger, daß wir die Sterne am hellichten Tage sehen, und freuten uns auf deine Mahlzeit - und nun hast du uns so arg betrogen!«
Der Müller schämte sich die Wahrheit zu sagen und sprach: »Als ihr fort wart, befiel mich ein solches Grimmen, daß ich mich wie ein Wurm wand und nicht arbeiten konnte.« Sie stillten nun ihren Hunger mit kalten Speisen, legten sich dann zur Ruhe und schliefen die ganze Nacht tief und fest wie Murmeltiere.
Am folgenden Morgen zog der Müller mit dem Bärenhansel auf die Jagd und der Kohlenbrenner mußte im Schlosse bleiben, um das Essen zu bereiten. Ihm ging es aber nicht besser als dem Müller. Denn es kamen wieder die Geister aus dem Kamin herab und prügelten den Koch derartig durch, daß er wie tot nieder fiel.
Als die zwei Jäger nach Hause kamen, fanden sie kein Mahl bestellt und der Kohlenbrenner beteuerte hoch und fest, daß er vor Grimmen nicht imstande gewesen war, etwas zu kochen. Dies kam dem Bärenhansel gar seltsam vor und er dachte sich, morgen werde ich hier bleiben und dann werde ich der Sache auf den Grund kommen.
Am dritten Morgen zogen der Müller und der Kohlenbrenner hinaus in den Forst und der Bärenhansel ging in die Küche, um seine Arbeit zu verrichten. Er begann Knödel zu kochen, und als er die selben in die Pfanne hineinmachte, fuhr plötzlich ein Geist aus dem Kamin herunter.
Hansel kehrte sich aber nicht daran und sprach: »Auch für diesen einen Knödel!« Gleich darauf kam ein zweiter Geist heruntergefahren und Hansel sagte wieder gleichgültig: »Auch für diesen einen Knödel!« Als aber sogleich danach ein dritter Geist kam, wurde Hansel zornig, legte die Kelle beiseite, packte alle drei Geister und warf sie in einen Winkel, daß ihre Gebeine klapperten und sie sich nicht mehr zu rühren wagten.
Dann ging er wieder an seine Arbeit und bereitete die Knödel, als ob gar nichts geschehen wäre. Als die beiden Jäger heimkehrten, lachte er sie aus und sagte: »Nun weiß ich, was euer Grimmen zu bedeuten hatte. Seht, so kuriert man es«, und wies auf die Geister, die noch schlotternd in der Ecke stunden. Da hatten die zwei Gefährten eine noch größere Achtung vor dem Bärenhansel und seiner furchtbaren Stärke.
Hansel trug ihnen aber nun die Knödel auf und alle drei aßen, als ob es Drescher wären. Neu gestärkt zogen sie dann weiter und vollführten große Taten. Nachdem sie lange durch die Welt gewandert waren, dachten sie daran, sich ein festes Hauswesen zu gründen und sich Frauen zu nehmen.
Da war aber die Wahl schwer, denn die Mädchen, wie sie auf dieser Erde wachsen, schienen den starken Kerlen viel zu klein und zu schwach. Endlich kamen sie auf den Gedanken, sich Mädchen aus der Unterwelt heraufzuholen und die selben zu heiraten. Gedacht, getan.
Der Bärenhansel und der Müller ließen sich vom Kohlenbrenner in die Tiefe seilen, um für sich zwei Bräute zu suchen. Der Kohlenbrenner sollte dann den Müller und die zwei Mädchen heraufseilen und sich als dann selbst hinunterseilen lassen, um sich in Begleitung des Bärenhansels auch eine Lebensgefährtin zu suchen.
Die beiden Gefährten wanderten nun durch die Unterwelt, bis sie zwei baumstarke Dirnen fanden, die ihnen gefielen. Mit diesen machten sie ihren Handel richtig und gingen dann zur Stelle, wo das Seil aus der Oberwelt herab hing. Es wurde nun das verabredete Zeichen gegeben und der Kohlenbrenner zog zuerst die Mädchen und dann den Müller auf die Erde herauf.
Als er aber die zwei Bräute sah, dachte sich der Kohlenbrenner: »Ich nehme mir die Braut des Bärenhansels und lasse ihn drunten, denn käme ich in die Unterwelt hinab, so möchte mich keine zum Manne nehmen, weil ich so schwarz bin.« Er besann sich nicht lange, hieb den Strick ab und dem Bärenhansel blieb nichts anderes über als das Zuwarten.
Endlich ging ihm die Geduld aus und er wanderte nun in der Unterwelt herum, um einen anderen Rückweg auf die Erde zu finden. Da begegnete ihm ein altes Weib und dieses fragte ihn, was er wolle. Darauf erwiderte er: »Ich habe mich hierher verirrt und suche nun seit langem einen Weg, der zur Oberwelt führt«.
»Da kann ich dir leicht helfen«, antwortete die Alte. »Ich will dich hinauftragen unter der Bedingung, daß du mir genug Fleisch zu essen gibst.« Der Bärenhansel war über diesen Vorschlag seelenfroh und sprach: »Fleisch sollst du haben, so viel du willst, nur trage mich bald hinauf, daß ich die liebe Sonne wieder sehe.«
Er ging nun auf die Jagd und jagte zwei Tage und zwei Nächte in einem fort und machte so viel Beute, daß man zwei Wagen hätte damit voll laden können. All das Wild schleppte er am dritten Tage zur Stelle hin, wo seiner die Alte wartete. Diese begann aber zu essen und aß, bis sie satt war.
Dann sprach sie: »Das Fleisch, das noch übrig ist, nimm mit auf die Reise und nun hocke auf.« Der Hansel nahm das Fleisch, schwang sich auf den Rücken der Alten und diese trug ihn empor. Sie hatte aber noch nicht den halben Weg zurückgelegt, da verlangte sie neuerdings Fleisch und verzehrte alles bis auf den letzten Knochen.
Dann ging die Fahrt wieder vorwärts. Jedoch bald rief die Alte: »Fleisch her, oder ich lasse dich fallen!« - Nun war Hansel in der größten Verlegenheit und er wußte nicht, sich zu helfen. Da kam ihm ein guter Gedanke, er nahm sein Sackmesser, schnitt sich ein tüchtiges Stück Fleisch aus dem Leibe und gab es der Alten, die es mit der größten Gier verzehrte.
Nun trug sie ihn wieder weiter, heischte aber bald neuerdings Fleisch. Er tat wie das erste Mal und befriedigte ihren Hunger. Das Merkwürdige an der Sache aber war, daß das herausgeschnittene Fleisch sogleich wieder nach wuchs und er, ohne Schaden zu leiden, immer den Hunger der Alten stillen konnte, bis sie auf die Oberwelt kamen.
Da stürzte das alte Weib pfeilschnell in die Tiefe und Hansel hüpfte vor Freude hoch auf, als er wieder auf der Erde war. Er suchte nun den Kohlenbrenner, den er jedoch nirgends finden konnte. Dagegen traf er bald den Müller und die zwei unterirdischen Mädchen.
Sie hielten nun zugleich ihre Hochzeit, bei der mehr gegessen wurde als sonst jemals bei einem Brautessen. Beide Paare bekamen viele Kinder und diese alle waren Riesen; denn alle Riesen, die jemals auf Erden waren, stammten von diesen zwei Paaren ab.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Proveis im Nonsberge
MÄDCHEN UND BÜBCHEN ...
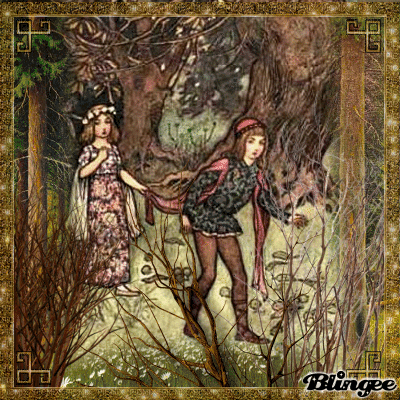
Es lebte einmal nahe bei einem dichten Walde ein Holzhauer, der hatte ein böses Weib und zwei nette Kindlein: ein Mädchen und ein Bübchen. Der Holzhauer aber war sehr arm und hatte kaum Brot genug, um sich und den Seinigen den Hunger zu stillen.
Eines Tages war der Vater wieder in den Wald gegangen und die böse Mutter war allein in der niedrigen Hütte zurück geblieben. Da sagte die böse Mutter zu den Kindern: »Nun geht hinaus in den Wald Holz sammeln, und wer zuerst von euch heimkehrt, bekommt einen recht schönen Apfel.«
Mädchen und Bübchen sind nun in den Wald hinausgegangen, um Holz zu sammeln, und beeilten sich, bis sie zwei Bündel Reisig beisammen hatten. Und als sie das Holz gelesen hatten, gingen sie raschen Schrittes nach Hause. Aber je näher sie zur Hütte kamen, desto seltsamer wurde ihnen zumute und es war ihnen gerade, als ob ein Stein auf ihren Herzen lastete.
Während des Gehens brach dem Bübchen das Achselband, und da bat es das Schwesterchen: »Warte mir, mir ist das Achselband gebrochen und ich muß es zusammenbinden.« Das Mädchen dachte aber an den schönen Apfel, den ihr die Mutter versprochen hatte, und eilte vorwärts.
Kaum war aber das Mädchen eine Strecke Wegs gegangen, da brach auch ihm das Achselband und der Knabe kam ihm nachgelaufen und keuchte unter der schweren Holzbürde. Das Mädchen bat ihn nun: »Warte mir, es ist mein Achselband gebrochen; ich muß es mir zusammenbinden.«
Das Bübchen hatte aber keine Ohren für das Bitten seines Schwesterleins und erwiderte: »Du hast mir auch nicht gewartet; jetzt bekomme ich den Apfel.« - Der Knabe lief und lief und kam endlich nach Hause und bat die Mutter um den versprochenen Apfel und warf das Bündel Holz in die leere Küche hinein. -
»Gehe nur hinauf in die Kammer, dort sind die Äpfel in der Truhe, davon kannst du dir drei heraussuchen«, sprach die Mutter. - Das Büblein wollte mit diesem Bescheid nicht zufrieden sein und bat die Mutter, es möchte doch sie die Äpfel heraussuchen und ihm geben, wie andere Male. -
Die Mutter gab endlich den Bitten des Bübchens nach und sie gingen nun beide in die Kammer und zur Truhe, in der die Äpfel waren. Der Knabe war voll Freude und konnte sich an den Äpfeln, die da lagen, nicht satt sehen und bückte sich in die Truhe hinein, um sich die Äpfel herauszuholen.
Wie er freudig so hineinsah, schlug die böse Mutter plötzlich den Deckel zu, daß der Kopf des armen Bübchens in die Tiefe der Truhe hineinkugelte, der Leib aber auf dem Boden leblos da lag. Die böse Mutter nahm den Leichnam und hängte ihn hinter der Kammertür auf einen Nagel.
Indessen war das Mädchen, das sich das zerbrochene Achselband zurecht gerichtet hatte, mit seinem Holzbündel gekommen, leerte diesen in der Küche ab und bat die Mutter auch um einen Apfel. Die Mutter war sehr freundlich, nickte ihr zu und gab ihr einen roten Apfel.
Das Mädchen biß in den Apfel und die Mutter ging zum Herde, um für den Vater, der im Walde Holz haute, das Mittagessen zu bereiten. »Geh in die Kammer hinauf und hole mir Mehl und Schmalz,« sagte die Mutter zum Mädchen, »schaue aber ja nicht hinter die Türe hinein.«
Das arme Schwesterchen ging nun in die Kammer hinauf und schaute doch hinter die Türe hinein und da sah es sein armes, totes Brüderchen hängen. Das Mädchen weinte nun so bitterlich, daß es hätte einen Stein erbarmen mögen und Zähren auf den Boden tropften.
Endlich mußte es doch zur Mutter hinunter und brachte ihr weinend das verlangte Mehl und das Schmalz. »Hast du wohl nicht hinter die Türe hinein geschaut?« fragte die böse Mutter das weinende Mädchen. »O nein«, erwiderte das arme Kind und weinte noch heftiger und hielt das blaue, zerlumpte Fürtuch vor das Antlitz.
Die Mutter war der Antwort zufrieden und schickte das schluchzende Kind mit dem Mittagessen für den Vater hinaus in den dunkeln Wald. Das Mädchen hatte heute keine Freude an den Eichkätzchen, die auf den Fichten herumkletterten und ihre Männchen machten, noch an den Tannenzapfen und Feldblumen, sondern ging still und weinend seiner Wege.
Endlich kam es zum Vater und dieser nahm die Suppe hastig, denn es hungerte ihn. Er war aber ganz erstaunt, als er Fleisch in der Suppe sah, denn er hatte seit langer Zeit kein Stückchen mehr gesehen, noch viel weniger in den Mund gebracht. Er setzte sich unter eine große, schöne Buche und begann zu essen.
Er hatte aber gerade das erste Stückchen Fleisch auf dem beinernen Löffel und wollte es zum Munde führen, als ein Vögelchen auf dem Baum zu singen anfing:
Zwie zwei, meine Mutter ist a znicht's Weib,
Meine Mutter hat mich abg'schlagen,
Meine Schwester hat mich 'nausg'tragen,
Mein Vater hat die Beinlein abg'nagen,
Zwie zwei, meine Mutter ist a znicht's Weib.
Dem Holzhauer kam alles so wunderlich vor und das Vögelein ließ ihm keine Ruhe und sang und sang immer aufs neue:
Zwie zwei, meine Mutter ist a znicht's Weib,
Meine Mutter hat mich abg'schlagen,
Meine Schwester hat mich 'nausg'tragen,
Mein Vater hat die Beinlein abg'nagen,
Zwie zwei, meine Mutter ist a znicht's Weib.
Da wurde es dem Vater immer unheimlicher, so daß ihn selbst das Rascheln der Blätter erschreckte, und er ging mit dem armen Mädchen, das recht traurig war und kein Wort redete, nach Hause.
Unterdessen war die böse Mutter vollauf beschäftigt, den toten Knaben zu verbergen und zu verpacken; allein da kamen viele, viele Vögelchen, flatterten um sie herum, ließen ihr keine Ruhe und sangen in gar wehmütigem Tone:
Zwie zwei, meine Mutter ist a znicht's Weib,
Meine Mutter hat mich abg'schlagen,
Meine Schwester hat mich 'nausg'tragen,
Mein Vater hat die Beinlein abg'nagen,
Zwie zwei, meine Mutter ist a znicht's Weib.
Sie wollte nun die unschuldigen Tierlein verjagen; wie sie aber die selben durch die Stubentüre hinausscheuchte und ihnen nacheilte, fiel die schwere Stubentüre zu und schlug der bösen Mutter den Kopf entzwei. Der Vater kam nach Hause, darin war alles stille, nur die Vögel sangen:
Zwie zwei, meine Mutter ist a znicht's Weib,
Meine Mutter hat mich abg'schlagen,
Meine Schwester hat mich 'nausg'tragen,
Mein Vater hat die Beinlein abg'nagen,
Zwie zwei, meine Mutter ist a znicht's Weib.
Der Vater ging nun die Stiege hinauf und in die Stube, und wie er die Türe öffnete, fand er sein böses Weib und sein armes Söhnchen tot auf dem Boden liegen.
Und das Märlein ist aus,
Drum geht nun nach Haus!
Oder soll ich euch noch was erzählen
Von den Erbsen und den Fisälen?
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
VOM ARMEN SCHUSTER ...
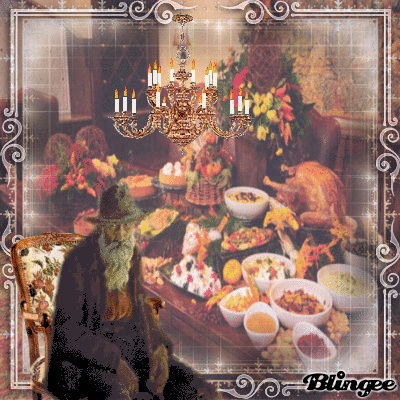
Dieser Schuster war sehr arm und war Vater von acht Kindern und die Frau war ihm gestorben. Er hatte sehr schlimme Tage und wenig Verdienst und die armen Würmchen wollten doch ihr Brot haben und schrien oft wie die Raben vor Hunger.
So ging es lange Zeit und der arme Schuster versetzte seinen letzten Leisten, um den Hunger der Kinder zu stillen. Allein, als der morgende Tag anbrach, stellte sich auch der Hunger wieder ein und die Kinder weinten, und da wußte sich der Schuster gar nicht zu helfen. Endlich fiel ihm ein Ausweg ein.
Er ging zu seinem Nachbar, der sehr reich, dabei aber auch sehr geizig war, und bat ihn, er möchte ihm doch einige Kreuzer leihen, damit er seinen Kindern Brot kaufen könnte, denn sonst müßten sie Hungers sterben. Der geizige Mann schnauzte aber den Armen an und schrie: »Wenn deine Kinder verhungern, was geht das mich an? - Ich gebe dir keinen gespaltenen Heller, geschweige einen ganzen. Ich bin nicht der Narr, der das Geld hinauswirft ohne Hoffnung, es je wieder zu bekommen.«
Der arme Schuster sah nun, daß sein Bitten umsonst sei, und ging ohne Geld und ohne Trost vom reichen Nachbar weg zu seinen hungernden Kindern. Diese meinten, der Vater würde mit Brot kommen, und warteten mit größter Sehnsucht auf ihn. Der Vater kam nun, und als er die armen hungernden Kindlein sah, ging es ihm ans Herz und er fing auch an zu weinen. Die Kinder, wie sie dies sahen, weinten noch mehr und wurden immer trostloser und trauriger. So ging es zwei Tage, daß sie einander ansahen und weinten, und der Hunger wurde immer größer und größer.
Da dachte sich der arme Schuster: »Ich will es noch einmal probieren und zum Nachbar gehen und ihn um etwas bitten; vielleicht erweichen Gott und meine Tränen sein hartes Herz.« Der Schuster begab sich nun zum Nachbar und weinte und bat ihn auf den Knien recht inständig um etwas. »Ja,« erwiderte der geizige Nachbar, »einen Strick will ich dir geben, damit du deinem elenden Leben ein Ende machen kannst«, und gab ihm einen Strick.
Der arme Schuster nahm den Strick und dachte an seine bereits verhungerten Kinder und an die noch lebenden, zu denen er aber ohne Brot nimmer zurückkehren mochte, und beschloß, wenn der himmlische Vater keine Hilfe senden würde, sich aufzuhängen.
Er ging nun in den Wald hinaus und ging recht tief in den selben hinein, damit kein Mensch ihn sehen möchte. Und wie er im dichten Walde so da stund und sich aus Hunger aufhängen wollte, wurde es ihm so schwer um das Herz, daß er von der Welt scheiden sollte, und dachte: »Bevor ich sterbe, will ich die schöne Welt doch noch anschauen«. Er suchte nun einen recht hohen Baum und stieg bis zum Wipfel hinauf, und wie er droben war, sah er recht weit herum und es kam ihm noch schwerer vor, sich aufzuhängen.
Wie er nun so herumschaute, siehe, da erblickte er tiefer in dem Walde ein großes, großes Haus, das war so schön, daß er nie ein solches gesehen hatte. Er kletterte nun eilig wie ein Eichkätzchen vom Baum herunter, ließ den Strick liegen, wo er lag, und eilte dem schönen, großen Hause zu, um dort Hilfe und Trost zu suchen, denn zum Hängen, meinte er in seinem Sinne, ist es noch Zeit.
Wie er zum Hause kam, fand er es offen. Er ging hinein und kam in einen weiten, lichten Saal, in dem viele, viele Tafeln stunden, und alle waren gedeckt und mit den herrlichsten Speisen beschwert - aber keine Seele war im ganzen Gebäude zu finden. Da war ein Glühen und Duften, daß der arme Schuster glaubte, er sei bei der himmlischen Hochzeit. -
Wie sich lange Zeit niemand sehen ließ, setzte sich der hungrige Schuster endlich zu einer Tafel hin, kostete von jeder Speise und trank von jedem Weine. Er war schon fast satt, da hörte er plötzlich Stimmen und es war, als ob Leute kommen würden. Der arme Schuster fürchtete sich und versteckte sich eilig in das Ofenloch.
Wie er dort horchte und zitterte, kamen zwölf Herren, setzten sich zu Tische und als sie sahen, daß alles angenascht war, murmelten sie: »Wer hat von meiner Suppe gegessen?« »Wer hat von meinem Fleische gekostet?« »Wer hat von meinem Brote geschnitten?« »Wer hat von meinem Weine getrunken?« »Wer hat mit meinem Löffel geschöpft?« »Wer hat mit meinem Messer geschnitten?« So murmelten und murrten sie, bis der erste, der gekommen war, fragte, was es Neues gebe.
Da sagte der zweite, er wisse nichts und so ging es der Reihe nach; alle bis auf den letzten wußten nichts. Als die Reihe zum letzten gekommen war, erzählte er, in der Königsstadt liege die Königstochter schwer krank und leide am rechten Fuße fürchterliche Schmerzen. Kein Doktor könne ihr helfen und die schöne Prinzeßin sei ohne Rettung verloren, wenn nicht bald geholfen würde.
»Und kann ihr niemand helfen? Und können wir ihr nicht helfen?« fragten alle auf einmal. Da antwortete der letzte: »Ich wüßte schon ein Mittel. Es darf nur jemand zum weißen Felsen hingehen. Um Mitternacht bewegt sich dort der große Stein und ein gräßlicher Wurm kommt zum Vorschein. Diesen muß man erschlagen, ihm das Fett nehmen, damit den rechten Fuß der Königstochter einschmieren, und sie wird in acht Tagen ganz gesund sein.«
Als die zwölf Herren dieses gehört und gegessen hatten, stunden sie von ihren Sitzen auf und gingen wieder weg. Der arme Schuster war darüber froh, schlüpfte aus dem finstern Ofenloch hervor, stillte vollends seinen Hunger und ging dann fort, denn er wollte die schöne Königstochter heilen und sich auf diese Weise Geld verschaffen.
Kaum war er einige Schritte gegangen, kam er zu einer schönen Straße, und diese führte schnurgerade zur Königsstadt und zur prächtigen Königsburg. Er ging gerade auf die Burg zu und zum König und sagte zu diesem, er wolle seine Tochter heilen, wenn er ihm sechs starke Männer mitgeben würde.
Die Prinzeßin hatte gerade so große Schmerzen, daß sie laut aufschrie; da war der König gleich bereit und ließ sechs baumstarke Männer holen, und die übergab er dem armen Schuster. Der Schuster ging nun wieder in den Wald hinaus und zum weißen Felsen hin und wartete dort mit seinen sechs Gesellen bis Mitternacht.
Als es Mitternacht war, bewegte sich wirklich der Stein und ein fürchterlich großer Wurm kam hervor - da stürzte sich der Schuster mit den sechs starken Männern auf das Untier los und alle sieben schlugen so lange mit Keulen und Äxten darauf, bis es mausetot war. Der Schuster nahm nun das Fett aus dem Leibe des Wurmes, ging zum Könige zurück und beschmierte den rechten Fuß der Prinzeß. Diese ward besser und besser und in acht Tagen war sie wieder frisch und gesund und sah aus weiß und rot wie ein Apfel. -
Der alte König war ganz erfreut, umarmte den armen Schuster und führte ihn in die Schatzkammer. Der Schuster war über die Pracht und Herrlichkeit der Schätze ganz außer sich, und wie er so staunte und schaute, sagte der König: »Nimm so viel Gold, als du willst!« Der Schuster ließ sich das nicht zweimal sagen und steckte sich alle Taschen voll Gold ein, so daß er nicht mehr tragen konnte, und dankte dem König dafür.
Der König war aber damit noch nicht zufrieden, denn ihm hatte der Schuster zu wenig genommen, und gab ihm noch einen so großen Sack voll Gold, daß der Schuster einen Esel leihen mußte, um das
viele Gold nach Hause zu bringen.
Als der Schuster mit dem Schatze nach Hause kam, fand er die Kinder noch am Leben, denn sie hatten indessen etwas zu essen bekommen.
Die waren so froh, ihren Vater wieder zu haben, und lebten mit ihm, der nun ein steinreicher Mann war, vergnügt und glücklich viele Jahre hindurch und von einer Not war gar keine Rede mehr.
Wie der geizige Nachbar sah, wie der arme Schuster mit seinen noch lebenden Kindern gut aß und trank und glücklich lebt, da wunderte es ihn, wie es zugegangen sei. Er ging deshalb zum Schuster hin und fragte ihn, wie es denn gekommen wäre, daß er nun so gut fort komme. Der Schuster machte kein Hehl und erzählte dem Geizigen aufrichtig, wie es ihm ergangen sei. -
Da dachte sich der Geizige: »Ich muß es auch so machen,« ging in den Wald hinaus, stieg auf den Baum, sah in die Weite, sah das schöne große Haus und stieg wieder herunter. Er eilte nun der Gegend zu, wo das Haus stund, ging in das selbe hinein, fand die Tische gedeckt, aß von den Speisen und versteckte sich endlich, als er jemanden kommen hörte, ins Ofenloch.
Die zwölf Herren kamen wieder und es ging wie beim ersten Male zu und der letzte erzählte wieder folgende Geschichte: »Es war einmal ein armer Mann hier, den die bitterste Not hierher getrieben hatte und den wir glücklich gemacht haben; heute aber steckt ein reicher, sehr reicher Mann im Ofenloch, den nur der Geiz und die Habsucht hergeführt haben, und auf diesen dürfen wir alle los schlagen.« -
Auf diese Rede fuhren alle zwölf sogleich von ihren Sitzen auf, stürzten auf das Ofenloch zu und stachen und stachen in das selbe hinein, bis der Geizige erstochen und mausetot war.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
LUXEHALES ...

Auf einem Hügel nahe bei einem Dorfe stund vor alten Zeiten ein gar prächtiges Schloß mit hohen Türmen und stolzen Zimmern, das reich an Gold und Silber und allen Schätzen dieser Welt war. Aber jene, die es bewohnten, waren gottlos und unbarmherzig und lebten dahin in Saus und Braus und ließen den Armen nicht einmal ein Stücklein harten Brotes zukommen, während sie selbst im Überflusse schwelgten.
Da hatte der Herr die Vertilgung dieses sündhaften Geschlechtes beschlossen; nur die Köchin allein sollte gerettet werden, denn sie war fromm und mitleidig und tröstete die Kranken und teilte den Hungernden mit, was von der reichen Tafel ihrer Herrschaft abfiel. Als nun die Stunde der Vergeltung gekommen war, da lief ein weißes Mäuslein durch die Küche und schmiegte sich an den Fuß der Köchin und dies Mäuslein trug einen Zettel um den Hals; auf dem stund geschrieben: »Flieh, flieh, flieh!«
Als die Köchin dies Zeichen gesehen hatte, packte sie schnell ihre geringe Habe zusammen und eilte davon. Kaum hatte sie das Schloß verlassen, so stürzte es mit furchtbarem Getöse und Krachen zusammen, rote Flammen zuckten aus dem Gemäuer, die Erde öffnete sich und verschlang das Schloß und alle die reichen Schätze samt den gottlosen Leuten; nur die fromme Köchin allein war gerettet worden.
Viele hundert Jahre waren seit dem vergangen und man wußte kaum mehr etwas vom versunkenen Schlosse und die Namen derjenigen, welche es einst bewohnt hatten, waren vergessen. So viel aber war jedem Kinde im Dorfe bekannt, daß viel Gold und Silber auf dem Schloßhügel vergraben sei und daß man diesen Schatz wohl heben könne, wenn man den rechten Schlüssel hierzu finde.
Da waren im Dorfe drei lustige Burschen, welche auch lieber im Wirtshaus gesessen als mit harter Arbeit sich ihr Brot verdient hätten, und denen fiel es einmal ein, sie wollten den reichen Schatz auf dem Hügel in aller Stille heben und dann in die weite Welt gehen und auch die großen Herren spielen, anstatt zu Hause hinter dem Pflug zu gehen und hartes Brot zu essen. Das rechte Mittel dazu hatten sie schon gefunden.
Ein steinaltes Männlein, das gar wunderbare Geschichten zu erzählen wußte und viele verborgene Dinge kannte, hatte ihnen ein altes Büchlein mit seltsamen Sprüchen geschenkt und ihnen anvertraut, daß man damit, wenn man es recht zu gebrauchen verstehe, Gold und Silber und reiche Schätze gewinnen könne. Dies Büchlein nämlich war ein Gertraudenbüchlein und wer ein solches Büchlein hat, der kann sich unsichtbar machen, wenn er es bei sich trägt, und kann den Teufel vergrabene Schätze bringen machen; auch für viele andere Dinge noch soll dies Büchlein vornehmlich gut sein.
An einem Feierabend, als es schon dunkel zu werden begann, gingen nun die drei Burschen auf den Bühl und beratschlagten unterwegs, welchen Teufel sie nun eigentlich beschwören sollten, den Urian, den Beelzebub oder den Luxehales. Nach langem Disputieren kamen sie endlich überein, den letzten zu wählen, weil er doch der gemütlichste sei und nicht so eigennützig wie die beiden anderen, welche schon oft für einen kleinen Liebesdienst auf Erden eine arme Seele für die ganze Ewigkeit haben wollten.
So waren sie an die Stelle gekommen, wo der Schatz vergraben sein mußte, und der Älteste, welcher das Ding am besten verstand, auch sonst der pfiffigste und mutigste unter ihnen war, schlug nun das Gertraudenbüchlein auf und las beim Scheine eines brennenden Holzspans die wunderkräftigen Sprüchlein, während die beiden anderen mit klopfendem Herzen und aufgesperrtem Munde zuhorchten.
Kaum war noch das dritte Sprüchlein zu Ende gelesen, so hörte man schon unter seinen Füßen ein furchtbares Geräusch, daß der Leser erschreckt ein paar Schritte zurückwich; die Erde tat sich auf, rote Flammen zuckten empor und Luxehales fuhr aus der Tiefe herauf mit einem großen Sacke, in welchem die Taler und Goldstücke klingelten.
Die drei Burschen wußten nun wohl nichts Eiligeres zu tun als ihre Hände nach dem goldenen Schatze auszustrecken; aber Luxehales, der nichts vom Hingeben wissen wollte, legte sich den Sack zurecht, setzte sich darauf und blickte nun die drei Beschwörer so furchtbar an, daß es ihnen eiskalt über den Rücken lief.
Da fiel es dem Ältesten, der auch der pfiffigste war, ein, daß man, um den Teufel, den man beschworen, wieder los zu werden, die Sprüchlein nach rückwärts lesen müsse. Wie oft er aber auch lesen und weiter zurück lesen mochte, Luxehales blickte nur um so wilder drein, seine Augen rollten wie Feuerräder in der dunklen Nacht und seine Zunge hing wie ein gewaltiger Glühwurm aus dem weit geöffneten Rachen, der dem Leben der armen Burschen auf einmal ein Ende machen zu wollen drohte.
Was war nun in dieser Not zu tun? Auf die blanken Taler und goldenen Füchse, deren Ton ihnen so süß in die Ohren geklungen, hatten sie längst schon verzichtet, aber selbst zu entfliehen getrauten sie sich nicht. Luxehales aber saß schweigend auf seinem goldenen Stuhle und schnitt immer wildere und grauenvollere Gesichter.
Als nun ihre Angst auf das höchste gestiegen war, sieh! da kam durch den stillen Wald ein frommer Pater dahergewandelt und ging auf sie zu. Inbrünstig flehten sie den frommen Mann an, sie in dieser Not nicht zu verlassen. Anfangs wollte nun freilich der Pater von diesem schlimmen Handel nichts wissen; als die Burschen aber nicht zu bitten aufhörten, machte der Pater Ernst, fing an zu beten und wies den Schwarzen dorthin, woher er gekommen war.
Luxehales fuhr willig in den Schlund zurück, aus dem er herausgefahren war. Der schwere Sack aber mit den Talern und Goldstücken blieb auf der Erde liegen, denn der Pater hatte seine Beschwörung schon so eingerichtet, daß Luxehales ihn nicht mitnehmen konnte.
Wie die drei Burschen sahen, daß der Teufel davongefahren sei, waren sie seelenfroh, dankten ihrem Helfer und ließen ihm den ganzen Sack allein, denn sie wollten vom »Teufelsgeld« gar nichts mehr wissen.
Der Pater freute sich aber seines Fundes und schleppte den vollen schweren Sack mit Not und Mühe ins Kloster. Dort ließ er von diesem Gelde gar schöne Bilder malen, die heute noch die Kirche zieren und die frommen Beter erbauen.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Schwaz
HENNENPFÖSL ...
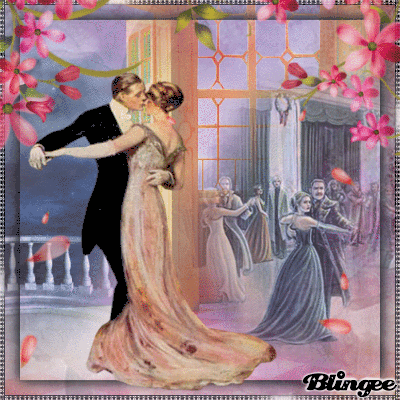
Es ist schon lange her, da lebte einmal in einem prachtvollen Schlosse ein Graf mit seiner Frau und mehreren Kindern. Die Kinder waren den Eltern so recht ins Herz hineingewachsen und bekamen alles, was sie nur wünschten. Nur die jüngste Tochter, die weit schöner war als alle ihre Schwestern, konnten der Graf und die Gräfin nicht ausstehen und taten ihr Leides an, wo sie nur konnten.
Das tat ihr nun recht wehe in ihrem Herzen und sie weinte bei Nachtzeit die hellen Tränen auf ihr Bett. Wenn sie dann in der Frühe mit verweinten Augen vor ihren bösen Eltern erschien, bekam sie Scheltworte und Schläge die schwere Menge. Das verdroß endlich das Mädchen so sehr, daß es beschloß, die Heimat zu verlassen und bei fremden Leuten Unterkunft zu suchen. »Schlimmer,« dachte es sich, »kann es mir nimmermehr gehen als hier bei meinen Eltern; denn weniger lieb haben kann mich niemand als Vater und Mutter!«
Es ging also zu seinem Schranke, packte sich drei schöne Kleider in sein Bündel, ein blaues, ein rotes und ein weißes, legte sich ein kostbares Gewand an und so machte es sich eiligst aus dem Staube. Es war ihm recht wohl, als es einmal die unliebe Heimat eine gute Strecke hinter sich sah, und immer froher und flinker ging es seines Weges.
Bald kam ein Bauernweib daher, das hatte ärmliche Kleider an, die alt und zerlumpt aussahen. »Wollt Ihr nicht mit mir das Gewand tauschen?« redete die Grafentochter das Bauernweib an. Dieses meinte, das schöne Mädchen sei leichtsinnig und wolle nur arme Leute zum besten haben, schaute ihm daher ernst ins Angesicht und wollte frisch vorwärts gehen.
Die Grafentochter aber beteuerte, daß es ihr voller Ernst sei, und da schlug das Bauernweib keinen Handel mehr aus, sondern gab seine Kleider her und legte sich das herrliche Gewand des schönern Mädchens an. Dieses hüllte sich nun in die ärmlichen Kleider des Bauernweibes und ging vergnügt wieder vorwärts.
Es dauerte nicht lange, da stund es vor einem steilen Felsen, von dem ein großes, großes Schloß ins Tal herabschaute. »Wer weiß,« dachte sich das Mädchen, »ob ich im Schlosse nicht zu etwas zu brauchen bin, wofür ich mein Brot verdienen kann?« Weil am Fuße des Felsens eine Höhle war, trug es sein Bündel in die selbe, versteckte es dort, und nachdem es so sein Hab und Gut aufgehoben hatte, stieg es wohlgemut auf einem engen Pfade zum Schlosse hinauf.
Es zog nun ganz leise an der Klinke und bald ging die Türe auf und der Schloßvogt trat heraus. Dieser war ein gar finsterer Mann und fragte das Mädchen mit barschen Worten, was es wolle. Die Grafentochter, wie sie den finsteren Mann sah und die barschen Worte hörte, wurde fast verzagt und antwortete schüchtern: »Ich möchte einen Dienst bekommen; sind denn in diesem Schlosse hier alle Plätze schon besetzt?«
Wirst schon wieder abziehen müssen, erwiderte der Vogt, »da stehen wir auf dich nimmer an, denn es ist alles schon besetzt. Aber richtig, das Hennenpfösl ist uns neulich durchgegangen, und wenn du etwa an seine Stelle treten willst, kannst du meinetwegen hier bleiben.« »Ei,« erwiderte das Mädchen mit Freude, »wenn ich nur einen Dienst bekomme, so will ich mir es nicht zu schlecht sein lassen, die Hähnchen und Hühnchen zu hüten und zu füttern.«
Nun wurde die Grafentochter in das Schloß gelassen und das Geflügel wurde ihrer Obsorge übergeben. Sie verrichtete fleißig ihre Arbeiten und war bei dem Gackern der Hennen viel fröhlicher als daheim bei den Scheltworten der Eltern.
Der Besitzer des Schlosses war noch unverheiratet und dachte daran, sich eine Braut zu wählen. Er veranstaltete daher einen glänzenden Ball, wozu er alle Herren, Frauen und Fräulein aus der ganzen Nachbarschaft einlud, und das schönste von allen Fräulein wollte er sich dann zur Frau nehmen.
Wie nun der Tag des Festes herankam, da zogen viele Ritter und Grafen mit ihren Frauen und Töchtern in das Schloß. Da war ein Hin- und Wiedergehen in den Sälen, ein Glänzen und Glitzern an den Kleidern, daß einem Hören und Sehen verging. Bald begann die Musik, und wie das Hennenpfösl die Hörner und Trompeten hörte, da konnte es sich nimmer halten, sondern ging zum Pförtner und bat ihn um die Erlaubnis, nur auf einige Augenblicke in den Ballsaal treten zu dürfen.
»Was denn etwa nicht noch?« erwiderte zornig der Pförtner, »so ein schmutziges Ding wird man zu den vornehmen Leuten in den Saal lassen! Bist du denn nicht gescheit?« »O, Ihr braucht Euch meiner nicht zu schämen,« antwortete etwas schnippisch das Mädchen, »ich will mich schon reinigen und putzen, bevor ich in den Saal gehe; dann laßt Ihr mich aber hinein, nicht wahr?« »Ja nun, so sollst du halt deinen Vorwitz büßen und auf einen Augenblick hineinkommen.«
Das Hennenpfösl eilte nun freudig davon, putzte und reinigte sich, ordnete sich das goldgelbe Haar zu schönen Flechten und lief dann den Schloßberg hinab zu jener Höhle, wo es sein Hab und Gut verborgen hatte. Es öffnete nun das Bündel und nahm das himmelblaue Gewand heraus. Dieses tat es sich an, den armseligen Bauernkittel aber ließ es in der Höhle liegen.
Nun stieg Hennenpfösl wieder zum Schlosse hinauf und trat in den herrlich beleuchteten Saal. Eben fingen die Musikanten an zu einem neuen Tanze aufzuspielen und die Herren suchten sich neue Tänzerinnen. Wie der Schloßbesitzer die Jungfrau im blauen Gewande eintreten sah, eilte er auf sie zu; denn sie war bei weitem die schönste unter allen Mädchen, die beim Balle zugegen waren.
Er tanzte nun mit ihr und während des Tanzes schaute er ihr immer in die schönen blauen Augen und er konnte sich nicht satt daran sehen. Aber kaum war dieser Tanz vorbei, so war die schöne Jungfrau schon zur Türe hinaus geflogen und niemand wußte zu sagen, wer oder woher sie sei. Das tat dem Schloßherrn sehr wehe und während des ganzen Balles konnte er nimmer fröhlich sein.
Hennenpfösl aber war in des wieder zur Höhle hinab gelaufen, hatte das himmelblaue Kleid ausgezogen und den armseligen Bauernkittel angetan und war so in die Burg zurückgekehrt.
Der Schloßherr dachte von nun an immer nur an die schöne Jungfrau im blauen Kleide und wie er die selbe erfragen und zur Braut bekommen könnte. Er gab daher bald wieder einen glänzenden Ball in der Hoffnung, die schöne Jungfrau möchte auch diesmal erscheinen; und daß sie ihm nimmer entrinnen könne, gab er den Wächtern den Auftrag, niemanden aus dem Schlosse zu lassen.
Wie das Hennenpfösl die Tanzmusik hörte, da hatte es wieder keine Ruhe, sondern ging zum Pförtner und bat ihn um die Erlaubnis, auf einige Augenblicke in den Ballsaal treten zu dürfen. »Ihr braucht Euch nicht zu schämen,« sagte es, »ich will mich schon reinigen und putzen, bevor ich in den Saal gehe.«
Der Pförtner gab ihm die Erlaubnis und Hennenpfösl eilte freudig davon, putzte und reinigte sich, ordnete sich das goldgelbe Haar zu schönen Flechten und lief dann den Schloßberg hinab zu jener Höhle, wo es sein Hab und Gut verborgen hatte. Es öffnete sein Bündel und nahm das rosenrote Gewand heraus. Dieses tat es sich an, den armseligen Bauernkittel aber ließ es in der Höhle liegen. Nun lief Hennenpfösl wieder zum Schlosse hinauf und trat in den herrlich beleuchteten Saal.
Wie der Schloßbesitzer die schöne Jungfrau eintreten sah, erkannte er sie sogleich wieder, eilte auf sie zu, nahm sie bei der Hand und führte sie zum Tanze. Kaum war der erste Tanz vorbei, so flog die schöne Jungfrau zur Türe hinaus, unter die Wächter aber, die sie zurückhalten wollten, warf sie Geld aus, und während sie das Geld auflasen, war Hennenpfösl schon auf und davon und lief zur Höhle hinab. Hier zog es das rosenrote Kleid aus, tat sich den armseligen Bauernkittel an und kehrte so in die Burg zurück.
Der Besitzer des Schlosses aber wurde mißgestimmt und traurig, weil ihm niemand sagen konnte, wer oder woher die schöne Jungfrau sei. Immer und immer dachte er nur an sie und seine einzige Sorge war, wie er sie erfragen und zur Braut bekommen könnte. Er gab daher zum dritten Male einen glänzenden Ball, in der Hoffnung, die schöne Jungfrau möchte auch diesmal wieder erscheinen.
Wie das Hennenpfösl die Tanzmusik hörte, hatte es wieder keine Ruhe, sondern ging zum Pförtner und bat ihn um die Erlaubnis, auf einige Augenblicke in den Ballsaal treten zu dürfen. »Ihr braucht Euch nicht zu schämen,« sagte es, »ich will mich schon reinigen und putzen, bevor ich in den Saal gehe.« Der Pförtner gab ihr die Erlaubnis und Hennenpfösl eilte freudig davon, putzte und reinigte sich, ordnete das goldgelbe Haar zu schönen Flechten und lief dann den Schloßberg hinab zu jener Höhle, wo es sein Hab und Gut verborgen hatte.
Es öffnete sein Bündel und nahm das weiße Gewand heraus. Dieses tat es sich an, den armseligen Bauernkittel aber ließ es in der Höhle liegen. Nun stieg Hennenpfösl wieder zum Schlosse hinauf und trat in den herrlich beleuchteten Saal. Wie der Schloßbesitzer die schöne Jungfrau sah, erkannte er sie sogleich wieder, eilte auf sie zu, nahm sie bei der Hand und führte sie zum Tanze.
Während des Tanzes steckte er ihr heimlich einen goldenen Ring an den Finger; als aber der erste Tanz vorbei war, flog die schöne Jungfrau zur Türe hinaus, warf unter die Diener, die sie zurückhalten wollten, Geld aus, und während sie das Geld auflasen, war Hennenpfösl schon auf und davon und lief zur Höhle hinab. Hier zog es das weiße Gewand aus, tat sich den armseligen Bauernkittel an und kehrte in die Burg zurück.
Eines Tages befahl der Schloßherr seiner Köchin, auf Mittag Strauben zu kochen. Als die Köchin die Strauben buk, war Hennenpfösl gerade in der Küche und rührte einen Hennenkoch. Wie es das Schmalz in der Pfanne brodeln hörte, schaute es, was es gebe, und da es die Köchin Strauben backen sah, bat es die selbe, sie möchte ihm doch erlauben, eine einzige Straube für den Schloßherrn zu backen.
Die Köchin wollte anfangs nicht »ja« sagen; als aber Hennenpfösl nicht nachgab, so gewährte sie ihm endlich seine Bitte. Hennenpfösl ließ nun den Teig zu der Straube in das brodelnde Schmalz laufen, und als die Köchin einen Augenblick wegschaute, warf es auch den Ring, den ihm der Schloßherr an den Finger gesteckt hatte, in den Teig und buk ihn ein.
Mittags wurden die Strauben aufgetragen und der Schloßherr aß mit großem Appetit, denn sie waren seine Leibspeise. Als er die erste Straube gegessen hatte, nahm er die zweite heraus und dann die dritte, und wie er diese auseinander riß, guckte ein Ring heraus. Er schaute den goldenen Reif genau an und war wie vom Himmel gefallen, als er sah, daß der selbe kein anderer sei als jener, welchen er der schönen Jungfrau an den Finger gesteckt hatte.
Augenblicklich ließ er die Köchin vor sich kommen und fragte sie, wer die Strauben gebacken habe. Die Köchin aber wollte nicht sagen, daß sie das schmutzige Hennenpfösl zum Kochen zugelassen hatte, und behauptete kurzweg, sie selbst habe alle Strauben gebacken, von der ersten bis zur letzten. Der Schloßherr aber gab nicht nach und drohte ihr sogar mit Blut und Leben, wenn sie nicht bekennen würde, wer denn die Strauben gebacken habe.
Sie gestand endlich ein, daß das Hennenpfösl nicht nachgegeben habe, und da habe sie ihm erlaubt, eine Straube zu backen. Wie der Schloßherr das hörte, ließ er das Hennenpfösl rufen, dieses aber putzte sich recht hübsch auf und trat in das Zimmer. Auf den ersten Blick erkannte der Schloßherr im Hennenpfösl die schöne Jungfrau, die im himmelblauen, dann im rosenroten, dann im weißen Kleide zum Balle gekommen war und um deren Willen er so viel Herzenspein hatte erdulden müssen.
Er stund rasch von seinem Sitze auf, nahm die errötende Jungfrau bei der Hand und sagte: »Du bist meine Braut!« In wenigen Wochen wurde Hochzeit gehalten und dabei wurde musiziert und getanzt und gegessen, daß es eine Art hatte.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol. Passeier
DER KRÄMER ...
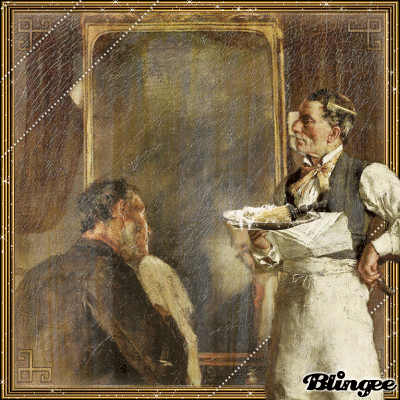
Ein Krämer war in die Stadt gegangen und wollte im Wirtshaus, in dem er gewöhnlich einkehrte, eine Herberge finden. Allein da waren alle Zimmer schon besetzt und in der Schenkstube und auf den Gängen schwärmte es wie in einem Bienenstock. Der Wirt war, als er den Krämer sah, in der größten Verlegenheit; denn er wollte den alten Stammgast nicht aus dem Hause lassen und im Hause stund kein Fleck Boden mehr zu Gebote.
»Ja,« fing er an, »heute ist alles so überfüllt, daß ich nicht weiß, wo ich Euch hintun soll. Es ist kein Zimmer mehr leer als eines, aber in das mag ich Euch nicht tun, weil es darin unheimlich ist.« »Ach, was unheimlich! Wenn ich nur ein ordentliches Bett habe und einmal auf dem Ohr liege, weckt mich weder Geist noch Gespenst. Bettet mich nur in das Zimmer hinüber!«
Dem Wirte war nun ein Stein vom Herzen genommen. Er sagte es dem Hausmädel und es machte dem Krämer ein Bett zurecht. Dieser saß aber in der Schenkstube bei seinem Seidel Etschländerwein und war guter Dinge. Als er nun schläfrig wurde, nahm er das Licht und ging auf sein Zimmer. Dort legte er sich ins Bett und schlief, weil er müde war, bald ein.
Er mochte etwa zwei Stunden geschlafen haben, als es vor der Türe plötzlich laut wurde und der Krämer in seinem süßen Schlafe gestört wurde. Er richtete sich im Bette nun auf und schaute auf die Türe hin. Wie erstaunte er aber, als sich diese trotz des vorgeschobenen Riegels öffnete und ein altes Männchen mit einem langen grauen Bart ins Zimmer trat!
Es ging zu einer Wand hin, zog aus seiner Tasche einen Schlüssel hervor und öffnete damit einen verborgenen Wandkasten. Im Kasten war ein Rasierzeug und dieses nahm das Männchen heraus, rieb Seife ins Wasser und winkte dann dem Krämer, er solle kommen.
Den Krämer gruselte nun wohl ein bißchen, er stieg aber dennoch aus dem Bette, zog sich die Hosen an und setzte sich auf den vom Männchen ihm angewiesenen Sessel. Dann nahm das Männchen die Seife und das Wasser, seifte des Krämers Bart ein, und als dieses geschehen war, nahm es das Schermesser und barbierte den Krämer, daß auch kein einziges Härchen mehr am Gesichte sitzen blieb. Nun packte das Männchen das Zeug zusammen, blickte dann den Krämer traurig an und wollte weitergehen.
Der Händler war aber ein gescheiter Mann und dachte sich, ich habe immer gehört, man solle Gleiches mit Gleichem vergelten. Er sagte nun zum Männchen, es solle sich setzen, und das Männchen willfahrte ihm. Dann packte er das Rasierzeug aus, nahm Seife und Wasser, seifte den langen, grauen Bart des Männchens ein und rasierte ihn so glatt, daß kein einziges Härchen mehr am Gesichte saß. Dann packte er das Zeug genau so, wie es früher war, zusammen und legte es auf den Tisch.
Das Männchen war, als es sich barbiert sah, gar froh, lächelte und nickte dem Krämer zu, als ob es danken wollte. Dann schickte es sich zum Weggehen an, gab aber dem Krämer zuvor den Schlüssel zum Wandkasten.
Der Händler öffnete nun den Kasten und fand dort einen elend großen Schatz. Er war nun ein gar reicher Herr und wurde ein großer Kaufmann, wie man keinen zweiten im ganzen Lande fand.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Hall
STARKER HANS'L

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Bauer und dieser hatte drei Söhne. Einer von diesen hieß Hans und war so stark, daß er alles, was ihm in den Weg kam, zugrunde richtete, und deshalb hieß er nur der starke Hans'l. Der Vater konnte ihn nicht mit den zwei andern Söhnen aufs Feld hinausschicken, um dort das Vieh zu hüten, denn Hans'l hätte die Herde bis auf das letzte Stück zugrunde gerichtet. Nur zu einem Dienste konnte man Hans verwenden: man brauchte ihn dazu, das Essen den Arbeitern aufs Feld hinauszutragen; aber auch das währte nicht ewige Zeiten. -
Bald verwarf er im Übermute das Essen, bald trug er es an den unrechten Ort, bald verzehrte er die für andere bestimmten Speisen und kam, ohne ein bißchen Brot mit sich zu tragen, zu den hungernden Leuten auf den Acker. Einmal sollte er wieder das Essen auf die Wiese hinaustragen, wo die Brüder »heuten«. Hans'l nahm den Topf Speisen und trollte wohlgemut mit weit aufgesperrtem Munde durch die Felder und Wiesen und wußte selbst nicht, was und woran er dachte.
Es dauerte aber nicht gar lange, da bekam er Hunger und setzte sich auf einen Stein, der am Wege stund und den Wanderern oft zur Rast diente. Hans'l aß sich satt, und als er den kleinen Rest der Speisen sah, meinte er, es wäre nicht der Mühe wert, ihn weiterzutragen, und schüttete ihn den Ziegen vor, die auf der Wiese neben dem Steige grasten oder lagen. Diese machten sich ganz lustig über die seltene Kost her und aßen und käuten nach Herzenslust.
Als aber Hans'l die lieben Tiere so munter käuen sah, glaubte er, sie spotteten seiner, wurde erbost und schnitt in seinem Ingrimme jeder Geis das halbe Maul fort. Hans'l lachte, wie die armen Tiere so bluteten, und meinte schadenfroh: »Ich hätt es euch wohl gemacht« und kehrte wieder heim.
Als Hans'l zu Hause angekommen war, erzählte er seinem Vater mit der größten Freude, wie er es den bösen »Viechern« gemacht habe. Als der alte Vater dies hörte, wurde er verzagt und wußte nicht, was er mit dem dummen, starken Hans'l anfangen sollte. Endlich fiel ihm ein, er könnte den Buben wohl in den Wald schicken, bei den Bären und Wölfen würden dem selben die Flausen schon vergehen. Gedacht, getan.
»Hans'l, jetzt kannst in den Wald hinaus gehen, Prügel aufladen und heimführen«, sagte der Vater. Ohne ein Wort zu erwidern, ging Hans'l in die Schupfen, zog den großen Leiterwagen heraus, spannte die zwei Ochsen an und fuhr gegen den Wald. Im Walde lud er so viel Holz auf, als gehauen war. Als der Wagen ganz geladen war, wollte er nach Hause fahren und trieb mit Hio, hio und Peitschengeknalle die Ochsen zum Ziehen an.
Die armen Zugtiere taten ihr Möglichstes, griffen aus und zogen an - allein der Wagen war zu überladen und wich keine Handbreit von der Stelle. Hans'l war darüber zornig und erschlug beide Ochsen und band sie, daß sie alle viere in die Höhe streckten, auf die Bäume, die nach Hause geführt werden sollten. Der Wagen war nun noch schwerer geladen und niemand da, der ihn weiter gezogen hätte.
Was tat nun Hans'l? Hans'l ließ das Fuhrwerk stehen und ging tiefer in den Wald, wo die Bären hausten. Dort fing er einen stattlichen Brummbären ein und führte ihn an einem Seile zum Wagen, spannte ihn vor und machte ihn ziehen. Weil aber die Last für den Bären allein zu schwer war, half er selbst dem Braunen und so ging das Fuhrwerk seiner Wege und kam nach Hause.
Als der Vater das seltsame Gespann und die toten Ochsen sah, wußte er nicht, was er mit dem Buben anfangen sollte, um seiner los zu werden. Als Hans'l abgeleert und den Bären ausgespannt hatte, ging er in die Stube und aß dort nach Ungnaden.
Dem Vater war indes ein Weg eingefallen, um sich von Hans'l zu befreien, und er sagte zu ihm: »Hans'l, ich brauche ein Teufelshaar, morgen mußt du in die Hölle gehen und eines holen.« »Warum nit?« meinte Hans'l und ging in seine Kammer und schlief und schnarchte die ganze Nacht durch, denn das Tagewerk hatte ihn müde gemacht.
Des anderen Tages machte sich Hans'l in aller Frühe auf den Weg zur Hölle. Wohlgemut, als ob er aufs Mahd zöge, wanderte er bergab durch den dunklen Wald und kam immer tiefer und tiefer. Er hatte schon eine ziemliche Strecke im Rücken, als ihm ein bärtiger Mann begegnete, der grün wie ein Jäger gekleidet war und zwei rote Federn auf dem Hut hatte.
»Wes Weges, Landsmann, schon so frühe?« fragte der Fremde. »Ja, ich muß in die Hölle, um vom Teufel ein Haar zu holen«, erwiderte Hans'l. »Gerade recht, daß du mir begegnest,« fuhr der Jäger fort. »Wenn es nur das ist, brauchst nicht so weit zu gehen, denn ein Teufelshaar kann ich dir auch geben.« »Das wäre mir gar gelegen, ich käme dann früher nach Haus und die Füße hätten auch nichts dagegen«, meinte Hans'l.
Der Jäger fuhr weiter: »Ich gebe dir ein Haar, aber wohlgemerkt! nur unter drei Bedingungen. Wenn du diese erfüllst, bekommst du das Haar, sonst bist du mit Kopf und Schopf mein!« Hans'l war mit dem Antrage einverstanden und freute sich, daß er so leichten Kaufes zum Teufelshaar kommen würde.
Der Teufel holte nun unter einem Steine einen schweren, eisernen Hammer hervor und sprach: »Ich werfe diesen Hammer bis zu den Wolken hinauf, du mußt ihn auch, aber noch höher werfen, sonst bist du mein.« »Ja,« dachte Hans'l, »das wird so ein Spaß sein!«
Der Teufel warf nun und der Hammer flog und flog bis zu den Wolken hinauf und fiel erst dann wieder zurück. Hans'l schaute zu, und als er es gesehen hatte, lachte er und dachte, das kann ich
auch. »Jetzt mußt du werfen«, sagte der Jäger.
»Warte nur ein bißchen!« antwortete Hans'l, legte sich auf den Rücken und sah mit forschenden Blicken zum Himmel empor.
»Was schaust du so?« fragte neugierig der Jäger. Hans'l antwortete: »Ich muß zuvor schauen, daß ich wohl keinen Stern herunterwerfe«, und stand auf und wollte werfen, allein der Teufel erschrak und ließ ihn den Hammer nicht mehr schleudern.
Der Jäger holte nun ein riesiges Hifthorn und blies in das selbe, daß es weit um hallte und von allen Felsen wider gellte. Als er sein Blasestück abgelegt hatte, wollte er das Horn dem Hans'l reichen. Dieser hatte aber, während der Jäger blies, eine riesige Fichte entwurzelt und drehte sie zu einer Wiede.
»Was machst du da, Hans'l?« fragte ihn der Jäger, als er dieses sah. »Ich mache eine Wiede,« antwortete Hans'l, »um sie ums Horn zu winden, damit es nicht zerspringe, wenn ich aus Leibeskräften hineinblase.« Der Jäger hatte daran genug und sich verrechnet. Er ließ ihn nicht blasen, sprach aber zum Hans'l: »Du mußt nun doch in die Hölle und mit mir auf dem eisernen Ofen tanzen.« Hans'l war damit nicht unzufrieden, denn er schien die Hölle nicht ungern noch bei Lebzeiten zu sehen.
Beide wanderten anfangs durch Fichten- und Föhrenwälder und dann durch baumlose Schlüfte weiter. Als sie in der Hölle angekommen waren, ließ der Teufel den eisernen Ofen so einfeuern, daß der selbe glühend wurde und man es vor Hitze in seiner Nähe nicht aushalten konnte. -
Als dem verkappten Jäger die Hitze groß genug schien, sprach er: »Nun gilt es« und Hans'l mußte die Schuhe ausziehen und mit dem Teufel auf dem glühenden Ofen tanzen. Der Teufel tanzte und der Hans'l nicht minder und dieser schnalzte noch immer mit den Fingern und schrie: »Kalt, kalt!«
Dem Teufel wurde der Tanz zu heiß, er stieg vom Ofen, und als Hans'l noch immer forttanzte, als ob er den Veitstanz hätte, und dabei vor Kälte zu schnattern schien, ward der Teufel des Handels überdrüssig, gab dem Hans'l das versprochene Haar und jagte ihn zur Hölle hinaus; denn sonst, meinte er, brauchen wir all unser Holz an einem Tage.
Der Hans'l ging mit dem Teufelshaar seelenvergnügt nach Hause und brachte es seinem Vater. Dieser machte anfangs, als er seinen Buben sah, große Augen, war aber heimlich auf den Hans'l und seine Stärke stolz. Nach dem Tode des Vaters erbte Hans'l Haus und Hof und ward, weil er so stark war, von allen Leuten weit und breit gefürchtet.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
DER STARKE HANSL ... Geschichte I ...
Ein armes Bäuerlein hatte viele Knaben, mit denen er sich hart durcharbeitete; denn ein jeder hatte einen großen Löffel, keiner aber konnte etwas verdienen. Nachdem sie aber größer geworden waren, mußten sie aus dem Haus, um sich ihr Brot durch der Hände Arbeit selbst zu verdienen.
Der älteste davon, Hansl genannt, war ein sehr starker Bursche, der bald bei einem Bauern einen Platz fand; denn dieser glaubte dadurch einen zweiten Knecht zu ersparen, wenn er den starken Hansl ins Haus brächte.
Gleich am ersten Tag mußte Hansl dreschen, aber siehe! Alle Dreschflegel waren dem Hansl zu leicht, er schlug sie alle auf den ersten Streich entzwei. Er ging deshalb in den Wald hinaus und machte sich von zwei großen Bäumen einen, der für ihn paßte. Aber mit diesem Dreschflegel hatte er bald die Tenne durchgeschlagen, so daß jetzt schon der Bauer Sorgen bekam, wie es etwa wohl das ganze Jahr mit einem solchen Knecht gehen werde.
Er machte jedoch für diesmal bloß ein saures Gesicht und sagte zum Hansl, er sollte jetzt mit den anderen Dienstboten essen gehen, damit er hernach in den Wald fahren könnte, um Holz für eine neue Tenne zu holen. Beim Essen waren aber dem Hansl die gewöhnlichen Löffel viel zu klein; er ging deshalb in die Küche, nahm den Schöpflöffel und fischte damit den anderen Tischgenossen die Nudeln in einigen Minuten weg.
Da fing die Bäuerin zu jammern an, als sie für die anderen Leute noch einmal kochen mußte; aber es war umsonst, denn Hansl war für ein ganzes Jahr gedungen worden, und die Bäuerin mußte bald still sein, um die Sache nicht noch ärger zu machen.
Hansl war unterdessen mit zwei Ochsen und einem großen Wagen in den Wald hinausgefahren, um Bäume für die neue Tenne zu holen. Hier riß er die größten Bäume samt den Wurzeln aus der Erde und lud sie auf den Wagen. Die Ochsen waren aber nicht imstande, die ungeheure Last vom Fleck zu bringen. Er band die Ochsen deshalb auch auf den Wagen und zog alles selbst nach Hause, wo er die neue Tenne bald fertig hatte.
Der Bauer sann nun auf eine List, sich den unlieben Knecht vom Hals zu schaffen. Er befahl ihm, einen Ziehbrunnen zu graben. Wie Hansl bei dieser Arbeit etliche Klafter tief in der Erde war, da trug der Bauer wetteifernd mit seiner Frau große Steine herbei und wälzte sie auf ihn hinab. Er aber rief von unten herauf, man solle doch die Hühner weg treiben, die ihm immer Sand in die Grube hinein scharrten, sonst komme er mit der Arbeit nicht weiter.
Wie die zwei an der Grube das hörten, da wußten sie sich gar nicht zu helfen. Sie blickten lange ratlos herum und sahen endlich einen großen Mühlstein, den sie herbeizuschaffen und hinabzuwälzen beschlossen. Es kostete sie viel Mühe, den großen, schweren Stein von seinem Platz bis an den Rand des Brunnens zu bringen, aber nach längerer Anstrengung gelang es ihnen doch.
Wie sie ihn hinab warfen, fiel der Stein so auf, daß der Kopf des Hansl mitten durch das Loch fuhr und ihm der Stein auf den Schultern fest sitzen blieb.
»Juchei!« rief Hansl und stieg aus der Grube herauf. »Juchei, jetzt hab' ich einen Sonntagskragen, wie ich noch nie einen so schönen hatte.« Vor Freude hüpfte und tanzte er wie rasend eine Zeit
lang herum, legte dann seinen Sonntagskragen ab und stieg wieder in die Grube hinab, wo er nun ungehindert fortarbeiten konnte.
Da fiel den geängstigten Bauersleuten noch ein Mittel ein, sich den Knecht vom Hals zu schaffen. Nicht gar weit vom Dorf war eine einsam stehende Mühle, deren letzter Eigentümer, ein rechter Geizhals, sich um eine große Summe Geldes mit Leib und Seele dem Teufel verschrieben hatte.
Auf einmal war aber der Müller verschwunden, die Mühlen standen, und niemand wagte sich in deren Nähe, denn es war nicht geheuer darin, und man sagte allgemein, die Teufel hätten dort ihren Wohnsitz genommen. Nach dieser Mühle nun sandten die Bauersleute den Hansl, der von der ganzen Geschichte nichts wußte, mit einem großen Wagen voll Getreide, um es zu mahlen.
Wie er bei der Mühle ankam, war die Tür fest verschlossen; drinnen aber lärmte und polterte es fürchterlich herum. Hansl sprengte die Tür; da hüpften und sprangen Dutzende schwarzer Teufel von einer Ecke in die andere, grinsten und bleckten mit den Zähnen. Das erzürnte den Hansl gar sehr.
Gleich ließ er das Wasser ein, daß die Mühlsteine blitzschnell sich drehten und die Funken auseinander flogen. Er packte dann einen Teufel nach dem anderen und mahlte sie alle samt dem Getreide herunter, so daß das Mehl ganz schwarz wurde, und kehrte dann nach vollbrachtem Geschäft zum Bauern zurück. Jetzt hatte Hansl vor Nachstellungen Ruhe; er mußte den ganzen Winter hindurch Steine brechen, zu anderen Dingen wagte der Bauer ihn nicht zu verwenden.
Im Frühjahr fragte er den Knecht, ob er gehe, wenn er ihm den ganzen Jahreslohn zahle. »O ja«, sagte Hansl. Der Bauer bezahlte ihn voller Freude aus, und Hansl suchte und fand bald bei einem
anderen Bauern ein Unterkommen.
Dieser hatte aber schon von Hansls Stücklein gehört und glaubte deshalb die Sache recht klug anstellen zu müssen.
Er nahm ihn deshalb unter der Bedingung als Knecht an, daß er alle Arbeiten verrichten müsse, die man ihm auftrage; werde er deshalb zornig, so solle er die Ohren und den Jahreslohn dazu verlieren; werde aber der Bauer zornig, so bekomme Hansl des Bauern Ohren, den doppelten Lohn, und das Jahr sei dann zu Ende. Hansl ging gern auf den Vorschlag ein.
In den ersten Tagen ging alles gut vonstatten; der Knecht arbeitete recht brav, nur der Bäuerin war er bei Tisch gar zu schnell. Die zweite Woche mußte er mit den anderen Dienstboten auf die Wiesen hinaus, um zu mähen. Hier arbeitete er soviel wie zehn andere.
Als aber die Zeit des Essens heranrückte, sagte der Bauer zu ihm: »Wir gehen jetzt essen, aber du sei unterdessen nicht faul, sondern arbeite fein brav.« Hansl machte über diesen Befehl große Augen. »Bist du etwa zornig?« fragte der Bauer mit einem spöttischen Lächeln. »Gar nicht«, meinte Hansl und arbeitete unverdrossen weiter.
Als aber der Bauer mit den Seinen beim Mittagessen saß, eilte Hansl in den Stall, holte zwei der schönsten Kühe heraus, trieb sie zum Metzger und verkaufte ihm die Kühe; von dem Erlös ließ er sich beim Wirt was Ordentliches geben und eilte dann wohl gestärkt wieder zur Arbeit aufs Feld zurück.
»Ich habe zwei Kühe verkauft«, sagte er zum Bauern, »und mir was zu essen geben lassen. Hier hast du das übrige Geld.« Und er reichte dem Bauern noch etliche Gulden hin. Diesem stieg das Blut in den Kopf, und er griff nach einem Rechen. »Bist du etwa zornig?« fragte Hans. »Gar nicht«, antwortete der Bauer, in dem er den Rechen fallen ließ und schnell nach den Ohren griff.
Einmal verkaufte Hansl die Pferde, ein anderes Mal wieder die Schweine, und so trieb er es fort, bis alle Ställe leer standen. Der Bauer jammerte zwar, durfte aber nicht zornig werden. Da fiel ihm ein Mittel ein. Er hatte bestimmt, daß das Jahr zu Ende sei, wenn der Kuckuck schreie. Er befahl deshalb seiner Frau, sich mit Teig zu bestreichen, sich dann in einem Federbett herumzuwälzen und auf einen Baum zu steigen, wo sie das Geschrei des Kuckucks nachahmen sollte.
Als Hansl den Kuckuck hörte, lief er in die Kammer, lud seine Flinte und schoß den Kuckuck vom Baum. Wie dies der Bauer sah, da schlug er die Hände über dem Kopf zusammen und schrie und fluchte,
daß man es im ganzen Haus hörte.
»Bist du etwa zornig?« fragte Hansl. »Wer sollte nicht zornig werden«, antwortete der Bauer, »zuerst verkaufst du mir mein Vieh, und jetzt schießt du mir gar das Weib tot.«
»Jetzt gib mir nur also gleich die Ohren und den doppelten Lohn her«, meinte Hansl, »und das Jahr ist zu Ende.« Der Bauer bat und flehte, ihm doch die Ohren zu lassen, er wolle sie teuer bezahlen. Alles umsonst. Hansl schnitt ihm ohne Umstände die Ohren ab, nahm den doppelten Lohn und ging dann singend und pfeifend seines Wegs, um anderswo ein Plätzchen finden.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DIE ZWEI JÄGER ...
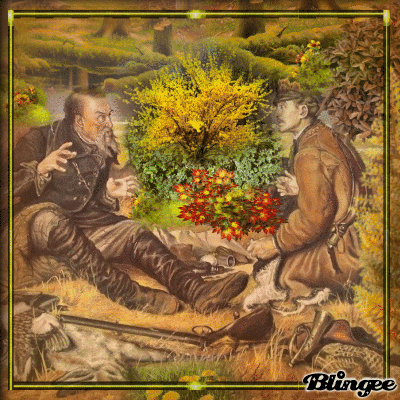
Es waren einmal zwei verabschiedete Kaiserjäger, die in ihre Heimat zurückkehrten und verabredet hatten, immer beieinander zu bleiben und alles redlich zu teilen. Der eine von ihnen war krumm, denn es war sein Fuß in einer Schlacht beschädigt worden. Der andere aber war ein gerader, flinker Bursche. »Ha! ich kann wohl vorausgehen, der krumme Schellunter wird mich wohl einholen, wenn ich im Walde übernachten werde,« dachte sich der Gerade, sagte es dem Kameraden, dem dieser Vorschlag ganz einleuchtete, und machte sich voraus.
Er wanderte nun schnell und rasch seinen Weg und konnte bald seinen frühern Begleiter in der Ferne nicht mehr sehen. Als es Abend war und es schon zu dunkeln begann, war der Gerade auch müde und legte sich im Walde unter einer bebarteten, riesigen Fichte nieder, um dort die Nacht durch auszuruhen. Er war bald eingeschlafen und hatte schon ein gutes Stück geträumt, als er plötzlich - es war gerade Mitternacht - durch ein nie gehörtes, furchtbares Geräusch aus seinem Schlummer aufgeschreckt wurde.
Der Jäger rieb sich den Schlaf aus den Augen, kehrte sich unwillig um und schaute zum Baum empor, auf dem er zu seinem Schrecken drei leibhaftige Teufel mit hell flackernden Pechfackeln sitzen sah. »Das ist kein Spaß mehr, mit den Teufeln die Nachtherberge teilen«, dachte sich anfangs der Erwachte; doch bald faßte er sich und harrte der Dinge, die da kommen würden.
Er legte sich wieder auf ein Ohr und hielt sich mäuschenstill und horchte auf das, was die schwarzen Höllenwirte auf den knarrenden Ästen droben sprachen. »Was freut dich am meisten?« fragte ein Teufel den anderen. »Mich freut am meisten der Kaufmann, der die giftige Krankheit hat und dem niemand zu helfen weiß. Der Kerl verzweifelt fast, weil er von seinem Gelde soll.« »Und täte nichts mehr nützen?« fragte der dritte.
»Pah!« antwortete der Befragte. »Wenn man ein giftiges Tier unter seine Bettstätte stellen würde, wäre ihm gleich geholfen. Allein dieses weiß niemand und so muß der geizige Filz vielleicht morgen schon in meinen Rachen.« »Und was gefällt dir am besten?« fragte dieser den Vorredner. »Mir! - nun der Barbier, der schwer krank darnieder liegt und der vor dem Tode zappelt wie ein Fisch an der Angel. Der kommt mir nicht mehr aus und ist ein fetter Bissen.«
»Und wäre ihm nicht zu helfen?« »Jawohl. Aber die Leute wissen es nicht. In der Ritsche gerade vor dem Hause des Kranken sitzt eine Schildkröte. Wenn man diese mit einer Angel, deren Widerhaken goldene Spitzen haben, fangen und den Kranken mit ihrem Fette auf der Brust schmieren würde, würde er gesund werden. Allein es hilft ihm nichts, denn keine sterbliche Seele weiß dieses Mittel und der Fettwanst kommt dieser Tage noch in die höllische Küche.«
»Und was freut dich am meisten?« wandten sich die zwei Schwarzen an den dritten Gesellen. »Das ist eine Frage,« antwortete mit grinsendem Lachen der dritte. »Was sollte mir einen größeren Spaß machen als der tolle König, der noch vor Ärger und Zorn sich selbst verzehrt und ein königlicher Braten für unsereinen wird? Da war ihm die alte Königsstadt zu schlecht und er mußte sich eine neue aus Gold und Marmor bauen.
Die Stadt ist nun vollendet und er stolziert durch die schönen, breiten Gassen und staunt die herrlichen Paläste an - aber eines hat er vergessen: in der ganzen Stadt ist kein Brunnen und Menschen und Tiere müssen verdursten. Jetzt hat er deshalb keine Rast und Ruhe und verzehrt sich im stillen Ärger und niemand kann ihm helfen, wenn er auch dem Entdecker eines Wassers die Hand seiner Tochter und die Nachfolge auf dem Throne versprochen hat. Und es wäre so leicht zu helfen, du brauchtest nur den großen Stein auf dem Burgplatz von der Stelle zu heben und es springt Wasser, daß die halbe Stadt darin ersaufen könnte.«
Die Teufel sprachen noch mancherlei, allein der Jäger hatte genug. Er merkte sich diese drei Dinge recht gut und hielt sich fein stille, daß kein Schwarzer seiner inne wurde. So dauerte es bis zum Morgen. Als es aber im Osten zu dämmern und aus dem alten grauen Kloster im Tal drunten das Aveglöcklein zu klingen begann, löschten die drei ihre Fackeln, breiteten ihre Fledermausflügel aus und flogen mit wildem Flügelschlag von dannen.
Als der Jäger dieses gesehen hatte, besann er sich auch nicht mehr lange, machte sich auf die Beine und wanderte lustig seines Weges dem Ausgang des Waldes zu. Er mochte zwei Stunden gegangen sein, als sich das Dickicht zu lichten begann und vor seinen Augen eine schöne Stadt lag.
Die Stadt war aber die selbe, in welcher der Kaufmann, von dem die Teufel gesprochen hatten, auf dem Totenbett lag. Der Jäger hatte dieses bald erfahren und ging mit einer Viper, die er in einer Grube vor der Stadt gefunden hatte, in das stattliche Haus des reichen Kaufherrn, wo es gar trübe und traurig aussah, weil der Herr dem Tode so nahe war.
»Wohnt nicht hier der kranke Kaufherr?« fragte der Jäger einen Bedienten, der mit einer vollen Schale an ihm vorübereilte. »Ja,« erwiderte mürrisch der Angesprochene. »Was willst du mit
meinem Herrn? Packe dich, du Bettlerhund! - Der Herr kann nicht mehr geben.« »Helfen wollte ich ihm«, antwortete der Jäger.
»Was, du wolltest ihm helfen?« entgegnete der Diener. »Alle Doktoren von weit und breit waren hier und konnten die Sache nicht anders machen und du solltest es -?« »Ja, ich will es, weil ich
es kann«, sprach mit Entschiedenheit der Jäger. »Nun,« dachte sich Johann, »wenn es nicht hilft, schadet es doch nicht,« und nickte dem Soldaten zu folgen.
Dieser stieg die Stiegen empor in das Zimmer des Kaufmanns, der todesschwach dahin lag, nahm die Viper und legte sie unter die Bettstätte des Kranken. Die Anwesenden rümpften über dieses Vorgehen nur die Nase und lächelten hämisch; allein kaum war das giftige Tier unter der Bettstätte, als der Kranke seine Augen aufschlug, ganz gesund um sich blickte und nach seinem Retter fragte.
Erstaunt blickten die Umstehenden auf den Jäger und der Kaufmann dankte und versprach ihm reichen Lohn. Abends noch stieg der früher Todkranke aus seinem Lager und scherzte und lachte mit seinem Arzt und wollte, dieser sollte immer bei ihm bleiben. Der Jäger sprach aber, es sei ihm dieses nicht möglich.
Es warte ein sterbenskranker Barbier seiner in der nächsten Stadt, und wenn er diesen nicht am folgenden Tage sehen und heilen könnte, wäre es um den Kranken geschehen. Der Kaufmann hielt nun seinen Retter nicht länger zurück und ließ ihn am nächsten Morgen weiterziehen. Ehe der Jäger aber weiterwanderte, belohnte ihn der Kaufmann ritterlich und so war der früher Arme ein wohlhabender Mann.
Der Wunderdoktor wanderte nun weiter und kam schon mittags in die Stadt, wo der Barbier wohnte. Es war ihm nicht schwer, die Wohnung des Kranken ausfindig zu machen, denn der steinreiche Barbier war allbekannt und die Stadt nicht groß. Als er zum Kranken gekommen war, versprach er ihm Rettung und Genesung, wenn er nur erst eine Angel mit goldenen Widerhaken haben würde. Gesagt, getan. Des Kranken Frau ließ gleich einen Goldschmied rufen und dieser mußte die besagte Angel verfertigen.
Kaum hatte der Jäger die Angel, als er vor das Haus zur Ritsche hinunterging, dort den steinernen Deckel weg hob und die Schildkröte, die dort saß und gleich an die goldene Angel anbiß, herauszog. Der Jäger tat nun, wie der Teufel gesagt, er schnitt der Schildkröte das Fett aus dem Leibe, schmierte damit den Kranken ein und der todkranke Barbier ward auf der Stelle gesund.
Der gerettete Barbier wollte den Wunderdoktor bei sich behalten und ihn nicht weiterziehen lassen. Der Jäger ließ sich aber nicht zurückhalten, erhielt vom Barbier großen Lohn und zog am anderen Tage weiter, bis er zur großen, schönen Königsstadt kam.
In der großen Königsstadt war alles herrlich gebaut, Kirchen, Paläste und Häuser entzückten durch ihre Pracht das Auge des Beschauers, aber es gebrach an einem - am Wasser. In der ganzen großen Stadt plätscherte kein Brunnen, in all den schönen Gärten stieg keine stolze Wassersäule. Das Wasser, das man zum Trinken, Kochen und Waschen brauchte, mußte in großen Fässern aus weiter Ferne herbeigeführt werden.
Der König hatte schon alles aufgeboten, um diesem Mangel zu steuern, allein alles half so viel als leeres Stroh dreschen. Am Ende war er auf den Gedanken gekommen, die Hand seiner einzigen Tochter demjenigen, der ein Wasser entdecken würde, zu versprechen. Allein auch dieses war umsonst. Nun grämte sich der König Tag und Nacht; denn seine neugebaute Stadt, die sein Stolz war, entvölkerte sich mehr und mehr, weil niemand in dem wasserlosen Gebiete wohnen wollte.
Als der Jäger in die Stadt gekommen war, ließ er sich gleich beim König anmelden, der wieder heiter wurde, als er vom Ankömmlinge und dessen Vorhaben hörte. Der König ließ den Fremden gleich vor sich und nahm ihn recht freundlich auf und versprach ihm die Hand seiner Tochter, wenn er der Stadt einen Brunnen schaffen würde.
Der Jäger ließ sich das nicht zweimal sagen und ging hinunter auf den Burgplatz und wälzte den Stein, der sich dort fand, von der Stelle. Und sieh! Es begann darunter zu quellen und zu sprudeln
und das klarste Wasser perlte empor und wallte dichter und dichter, so daß ein tüchtiger Quell nun auf dem Stadtplatz floß.
Der König stund droben auf dem Söller, und als er dieses sah, war er fast außer sich vor Freude und eilte dem Brunnenfinder entgegen und drückte ihn in Lust und Liebe an sein Herz.
Und als er ihn so freundlich empfangen und ihm gedankt hatte, führte er ihn in die Gemächer, wo seine Tochter wohnte, und stellte ihr den Bräutigam vor. Der Jäger war ein schmucker Bursche und gefiel der Prinzeßin so, daß sie am schönen Manne ihre Freude hatte.
Der König ließ seine Herolde rufen und sandte sie durch alle Gassen und Straßen, um die Hochzeit seiner Tochter dem Volke kundzutun und den Jäger als Mitregenten auszurufen. Die Herolde zogen mit ihren Posaunen aus, und wo sie hin kamen, herrschte die tollste Freude und in der ganzen Stadt wurde ein großes Fest gefeiert, von dem die Einwohner jetzt noch zu erzählen wissen.
Der Jäger und die schöne Königstochter hatten noch am selben Tage Hochzeit im goldenen Thronsaale und da herrschte ein solche Pracht, daß kein Auge sich satt sehen konnte. Da floß der Wein aus silbernen Brunnen und die köstlichsten Braten wuchsen wie aus der Erde. Das gekrönte Brautpaar saß ganz selig auf dem Throne droben, und als das Mahl geendet war, begann es den Tanz so leicht und fein, daß man sie für Elben gehalten hätte. Das Fest dauerte bis morgens und dann ging man freudig und froh auseinander.
Der Jäger war nun König und hatte die schönste Frau weitum in allen Landen und lebte geliebt und glücklich. Alle Morgen ging er im großen, schönen Garten spazieren und da durfte kommen wer wollte und ihm sein Anliegen vortragen. Eines Tages ging der junge König wiederum spazieren und da kam zu ihm ein Bettler, der krumm war, und bat ihn um ein Almosen. Der König gab ihm einen neuen funkelnden Taler und der Krumme hinkte danksagend von dannen.
Der König ging auch seine Wege und dachte nicht weiter des Bettlers, dem er den Taler gegeben. Nach zwei Tagen, als der König wieder lustwandelte, kam der Bettler wieder und bat um einen
Liebespfennig. »Hast du nicht erst neulich einen Taler bekommen? Und heute kommst du schon wieder?« fragte barsch der König.
»Jawohl, Herr König!« erwiderte der Angefahrene, »allein ich habe den ganzen Taler bei Putz und Stiel verbraucht und habe doch versprochen, mit meinem Kameraden das Erworbene treu und redlich zu
teilen. Deswegen muß ich noch um einen Taler bitten, der wird aber dem Kameraden aufbehalten.«
Der König war über diese Rede des Bettlers nachdenkend geworden, denn ihm kam die Stimme des selben so bekannt vor und die Züge des selben mahnten ihn immer deutlicher an seinen verlorenen Gefährten. »Und wo weilt dein Kamerad?« forschte sinnend der König. »Ja, das weiß ich selbst nicht,« entgegnete der Befragte. »Er ist mir einmal vorausgegangen in den Wald und seitdem konnte ich kein Sterbenswörtchen mehr von ihm erfahren; aber was ich mit ihm ausgemacht, das halte ich redlich und lege ihm die Hälfte des Erhaltenen treu beiseite«.
Der König hatte sich nicht getäuscht. - Er hatte seinen einstigen treuen Gefährten bei sich, breitete seine Arme aus und schlang sie um den Hals des Wiedergefundenen. »Du hast mich ja gefunden, treue Seele,« rief er bewegt und küßte ihn dreimal auf den Mund.
Der Bettler konnte sich erst allmählich in die überraschende Wirklichkeit hineinfinden und konnte nicht Fragen genug an seinen Genossen, der nun König war, stellen. Der König führte ihn aber in seine Burg, schenkte ihm dort schöne Kleider und gab ein Freudenmahl zu Ehren des Wiedergefundenen und das dauerte bis spät in die Nacht.
Als am anderen Tage König und Soldat wieder im Garten lustwandelten, sprach der König: »Du mußt nun bis zu deinem Ende bei mir bleiben und sollst gar gut aufgehoben sein. Ich mache dich zu meinem Rate und mit der Zeit zu einem Fürsten.«
»Na, was ausgemacht ist, dabei bleibt's,« antwortete der andere. »Wir haben uns verabredet, alles zu teilen, und so mußt du auch den Thron mit mir teilen.« »Daraus wird nichts!« sagte der König. »Willst du bei mir bleiben, ist es gut und recht, aber einen Thron mußt du anderswo suchen.« »Dann gehe ich weiter; allein zuvor möchte ich wissen, wo du die Krone gefunden hast«, sprach der Freund.
»Ja, das kannst wohl wissen«, gab der König zur Antwort und erzählte ihm alles, was ihm seit ihrem Abschiede begegnet war, und beschrieb ihm auch den Teufelsbaum in Walde. »Jetzt weiß ich schon genug,« schloß der Jäger. »Ich will auch hingehen und mein Glück versuchen.«
Der König wollte seinen Freund von seinem Vorhaben abbringen, allein all sein Reden blieb vergebens. Der Jäger verabschiedete sich und wanderte rüstig weiter, bis er nach sieben Tagen in den Wald und zu dem Baum kam. Es war schon Abend und die Vögelchen setzten sich auf die Zweige und Äste, um zu schlafen, und ließen ihr Lied verstummen, als er auch beim Baum sich ins Moos legte und lauerte.
Er lag schon viele Stunden, als es endlich zwölf Uhr schlug und ein feuerroter Streifen am schwarzen Himmel sichtbar wurde. Der Streifen wurde lichter und lichter und endlich saßen wieder die drei Teufel leibhaftig auf der alten bärtigen Fichte. Schon glaubte der Lauscher, nun werde er den Weg zu seinem künftigen Glücke erfahren, als der älteste Teufel fragte:
»Ist kein Horcher an der Wand,
Der uns stiehlt Seelen und Land?«
Hu, hu, hu! schwirrten alle drei Teufel mit ihren Fledermausflügeln und Pechlichtern auf und umflogen den Baum und beschauten ihn von der Wurzel bis zum Wipfel. Und als sie zum Boden herabgekommen, fanden sie den lauschenden Jäger, nahmen ihn und zerrissen ihn in drei Teile und flogen dann jubelnd durch die Lüfte von dannen; denn sie glaubten, sie hätten den Lumpen, der sie um Kaufmann, Barbier und König gebracht hätte, nun endlich ertappt und sich an ihm gerächt.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
DIE DREI SCHWESTERN ...
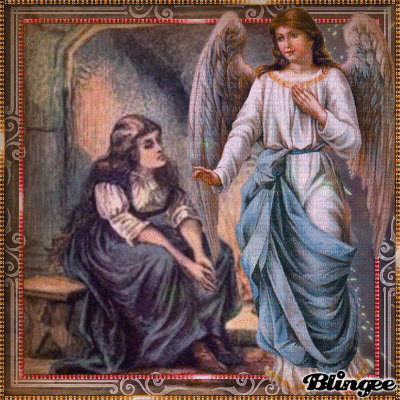
Es waren einmal drei Schwestern bei einer Stadt. Zwei der selben waren gar stolz und hochfahrend, die Jüngste war aber ein braves, stilles, bescheidenes Mädchen, das gerade deswegen von den zwei älteren Schwestern verachtet und gehaßt wurde.
Das arme Kind hatte bei den zwei Obenhinaus ein gar schlimmes Leben, es mußte alle Arbeiten verrichten, die den zwei anderen zu gemein waren, und wurde auf jede Weise herumgepudelt und geneckt. War irgendwo ein Ball oder eine andere Unterhaltung, so gingen die zwei in ihrem Putze und Staate dahin und die Jüngste mußte indessen das Haus hüten, die Zimmer kehren, die Küche scheuern und die schwersten Arbeiten verrichten.
Da war denn auch einmal ein großer, prächtiger Ball, den der König gab und der alles, was man bisher derartiges gesehen, übertreffen sollte. Die Geladenen strömten von fern und nah zum Königsschlosse, um dem Feste beizuwohnen, und auch die zwei Schwestern wollten ihn besuchen und schmückten sich mit aller erdenklichen Sorgfalt.
Die dritte, die arme Magd, hätte wohl auch die Herrlichkeit im Königsschlosse sehen mögen; allein alles Bitten und Flehen war umsonst. Die zwei Schwestern verließen im schönsten Putze das Haus und das arme, verachtete Mädchen mußte im dünnen Werktagskleidchen daheim sitzen und arbeiten.
Wie sie nun so traurig und verstimmt ihre Arbeit tat, kam plötzlich ein Engel vom Himmel, lächelte die arme, verachtete und zurückgestoßene Jungfrau an und gab ihr ein Sonnenkleid und allerlei Geschmeide, das aus dem schönsten Golde und den glänzendsten Edelsteinen verfertigt war. Das schüchterne Kind wußte nichts zu sagen und zu tun, denn es schämte sich vor dem Engel.
Der himmlische Bote begann aber, nachdem er eine Zeit lang das unschuldige Mädchen mit Wohlgefallen betrachtet hatte, also: »Kleide dich an und geh hin, wo deine Schwestern sind! Sobald aber der Morgen graut und der Tanz geendet, eile nach Hause und kleide dich um, damit niemand merkt, daß du im Königsschlosse gewesen seiest.«
»Aber meine Arbeit!« sprach nachdenkend das Mädchen, das indessen wieder Mut gewonnen hatte. »Kümmere dich nicht darum, der das Sonnenkleid dir aus dem Himmel hergebracht hat, wird auch für die Arbeit sorgen«, erwiderte der glänzende Engel.
Das Mädchen folgte nun mit der größten Freude den Worten des Engels, tat das Sonnenkleid und das kostbare Geschmeide an und ging in die Königsburg. Wie sie im Saale erschien, waren aller Augen auf sie gerichtet, denn sie war die schönste unter allen.
Der König selbst nahm sie bei dem Arm und tanzte mit ihr, und weil es die beste Tänzerin war, tanzte er mit keiner anderen mehr. So ging es die ganze Nacht hindurch. Das Mädchen tanzte mit dem König und wurde von allen bewundert und von vielen beneidet, von niemand aber erkannt.
Als der Ball zu Ende ging und durch die großen Fenster des Saales schon der Morgen hereindämmerte, eilte die schöne Unbekannte plötzlich fort und niemand wußte wohin.
Sie zog ihr Kleid und ihr Geschmeide ab, und wie sie es abgelegt hatte, war Schmuck und Kleid verschwunden. Sie wollte sich nun an die Arbeit machen, allein wie staunte sie, als sie ihre Arbeit ganz und gar besorgt fand. Nach einer Stunde kamen auch die Schwestern und erzählten von der Pracht des Balles, daß der Jüngsten hätte der Mund vor Lust und Neugierde wässern müssen, wenn sie nicht selbst dabei gewesen wäre.
Sie erzählten auch, wie eine schöne unbekannte Dame gekommen sei und sich durch ihre Liebenswürdigkeit, durch ihre Kleidung und ihren Tanz so ausgezeichnet habe, daß der König mit keiner anderen mehr tanzen mochte. Das Mädchen lachte im Herzen zu dieser Redseligkeit der Schwestern und ließ von seiner Anwesenheit nicht im mindesten etwas merken.
Der König hatte aber seit diesem Balle keine ruhige Stunde mehr. Die schöne Tänzerin hatte sein Herz mitgenommen und er wußte nicht, wer und wo sie sei. Als er so nachdachte, wie er von ihr Kunde erhalten könnte, kam er auf den Gedanken, wieder einen Ball zu veranstalten.
»Vielleicht,« dachte er, »erscheint die Unbekannte wieder« - Er veranstaltete nun wieder einen Ball, der viel glänzender als der frühere werden sollte, und lud dazu aus fern und nah alle Edlen ein.
Die beiden Schwestern putzten und schmückten sich wieder zum Tanze und gingen auf das Königsschloß. Die Jüngste mußte aber wieder zu Hause bleiben und ihre Arbeit tun.
Wie sie wieder so traurig da saß und für ihre Schwestern Strümpfe stopfte, erschien wieder der Engel und brachte der Verachteten ein Mondkleid und herrliches Geschmeide. Sie dankte dafür, zog sich an und ging auf das Königsschloß.
Als sie im Saale eintrat, erstaunten alle ob ihrer Schönheit und der König verhüpfte fast vor Liebe und Freude. Er ging gleich auf sie zu, bewillkommte sie und tanzte mit der schönen Prinzessin, wie man sie nannte, die ganze Nacht.
Heute gefiel sie ihm noch besser als das vorige Mal, denn das blaßgelbe Mondkleid stund dem bescheidenen Kinde gar so schön. Als aber der Tanz zu Ende ging und im Tal schon der Morgen graute, war die Geliebte des Königs plötzlich verschwunden und niemand wußte wohin.
Sie war aber nach Hause geeilt, zog das Kleid aus, und als die zwei Schwestern nachkamen und von der schönen Dame im Mondkleid erzählten, saß diese schon in ihrem grauen Werktagkleidchen bei ihrer Arbeit.
Der König hatte nach diesem zweiten Balle noch weniger Ruhe als nach dem ersten und konnte selbst nachts nicht schlafen, denn die wunderschöne Tänzerin stund bei Tag und Nacht vor seinem Geiste. Er wußte kein anderes Mittel, um sie wieder zu sehen, als einen Ball zu veranstalten. »Diesmal soll mir der Vogel nicht aus der Schlinge kommen,« dachte er bei sich, »ich will ihm den Namen und den Stand schon herauslocken«.
Er veranstaltete also wieder ein Fest, das an Pracht und Herrlichkeit alle früheren verdunkeln sollte. Aus nah und fern eilten die Gäste herbei und strömten durch das reich bekränzte Schloßtor in den prächtig geschmückten Burgsaal, der so beleuchtet war, daß es darin heller als bei Tage war.
Die zwei Schwestern gingen wieder geschmückt auf das Schloß des Königs, die verachtete dritte mußte aber zu Hause bleiben und arbeiten. Wie sie so traurig und sinnend da saß, kam abermals der Engel und brachte ihr ein Sternenkleid und einen Beutel voll Geld, damit sie es, wenn ihr Diener des Königs folgen würden, auswerfen könnte.
Sie dankte, zog das Sternenkleid an, nahm das Geld zu sich und eilte dem Tanzsaale zu, aus dem ihr ein Strahlenmeer und die herrlichste Musik entgegen strömte. Wie sie auf der Schwelle des Saales erschien, eilte ihr der König schon entgegen und bewillkommte sie. Er führte sie zum Throne und dort mußte sie sich an seine Seite setzen und er gab ihr allerlei verfängliche Fragen, um ihr den Namen und den Wohnort zu entlocken.
Das Mädchen war aber viel zu klug und gab dem Könige solche Antworten, daß er am Ende beinahe noch weniger wußte als anfangs. Als die Musik zu einem neuen Reigen lud, nahm der König die Fremde im Sternenkleide an die Rechte und tanzte mit ihr, daß alle über das schöne Paar und die Leichtigkeit, mit der sie den Reigen schlangen, staunten.
Der König konnte sich an der fremden Prinzessin nicht satt sehen; denn so schön wie im Sternenkleide war sie noch nie gewesen, und es schwoll sein Herz vor Liebe und Sehnsucht. So oft ein neuer Tanz begann, schwebte das schöne Paar voran, und schwieg die Musik, so mußte das Mädchen neben dem Könige sitzen, dessen Fragen es aber immer klug auswich.
So wechselte es die ganze Nacht durch, bis der Morgenwind in den Baumzweigen draußen spielte und an die Fenster klopfte. Als der letzte Tanz vollendet war, wollte Else zur Doppeltür hinaus und nach Hause eilen; allein kaum hatte sie den Saal verlassen, so eilten ihr schon auf den Wink des Königs die Diener nach, um ihre Fährte zu verfolgen.
Sie langte nun nach den Geldstücken und warf sie aus und da stürzten sich die Diener auf das Geld und folgten der Frau im Sternenkleid nicht länger. Nur einer ließ sich durch das Geld nicht irremachen und wollte die Wohnung der Prinzessin entdecken, möge es kosten, was es wolle.
Da wußte sich das Mädchen nicht anders mehr zu helfen und ließ im Laufe einen der goldenen Schuhe zurück; denn sie dachte: vielleicht findet er es der Mühe wert, den Schuh aufzuheben, und indessen enthusche ich und komme in die Heimat.
Kaum hatte der Diener den goldenen Schuh bemerkt, bückte er sich und hob die schimmernde Fußbekleidung auf. Voll Freude über diesen unerwarteten Fund eilte er wie im Triumphe in die Burg zurück und brachte dem König die seltene Gabe.
Der König lächelte, als er den Schuh sah, und meinte, wenn nun erst der Schuh da sei, werde sich die Trägerin des selben schon finden lassen. Er stellte dem Diener den Schuh wieder zurück und sandte ihn in der ganzen Stadt herum mit dem Geheiße, er solle jedem Mädchen den Schuh anmessen, und wenn einem der Schuh anpassen würde, so solle man es als die Königin des Balles ansehen und in die Burg führen.
Der Diener ging nun dem Auftrage des Königs gemäß Stadt auf, Stadt ab, Haus ein, Haus aus und maß und maß die Füße aller Schönen, konnte aber lange keine finden, welcher der goldene Schuh paßte. Endlich kam er auch in das Haus der drei Schwestern. Die beiden älteren hatten die größte Freude und dachten, wir lassen den Schuh nicht mehr weg. Soll der Schuh nicht dem Fuße anpassen, so wird der Fuß dem Schuh nachgeben müssen.
Kaum war der Diener in das Zimmer getreten und hatte seinen Auftrag entrichtet, nahm die Älteste den Schuh und ging damit in das Nebenzimmer. Wie sie aber den Schuh besichtigte, sah sie zu ihrem größten Verdrusse, daß er für ihren Fuß zu klein sei.
»Ha, dem läßt sich schon helfen,« dachte sie, nahm das Messer und schnitt sich drei Zehen fort. Nun legte sie den Schuh an, und obwohl ihr der Schmerz das Wasser in die Augen trieb, ging sie doch scheinbar wohlgemut in die Stube. Der Diener hatte die größte Freude, daß er die Gesuchte endlich gefunden hatte, und bat sie, gleich zum Könige aufs Schloß zu kommen.
Sie willfuhr mit größter Freude dieser Bitte und ging stolz und triumphierend durch die Stadt und der Diener folgte ihr in bescheidener Entfernung. Sie hatte schon ein gutes Stück des Weges zurückgelegt, als sie auf den Stadtplatz kam. Dort saß aber auf der alten Linde, unter der die Altvorderen tagten, ein rotes Vögelein und sang:
»Königin Eisenhut,
Der Schuh ist voller Blut.«
Wie dies der Diener hörte, schaute er dem Fräulein auf die Füße und sah das Blut aus dem goldenen Schuh quellen. »Du bist nicht der rechte Vogel,« dachte er und hieß sie wieder nach Hause kehren, wohin er sie auch begleitete. Dort nahm er der Falschen den goldenen Schuh, reinigte ihn vom Blute und gab ihn dann der Zweiten.
Diese nahm ihn und ging damit auf ihr Zimmer. Als sie ihn aber anziehen wollte, da sah sie, daß er für ihren Fuß zu groß sei. »Lieber zu groß als zu klein,« dachte sie sich, nahm alte Lappen und stopfte so viele hinein, daß ihr der Schuh fest ansaß.
Als sie in das Zimmer trat, hatte der Diener die größte Freude, denn er wähnte die Gesuchte gefunden zu haben. Sie gingen nun aus dem Hause und eilten der königlichen Burg zu. Als sie aber über den Stadtplatz gingen, saß wieder das rote Vögelchen auf einem Lindenzweige und sang:
»Königin Eisenschnuder,
Der Schuh ist voller Huder.«
Da blickte der Diener der Vorausstolzierenden auf die Füße und sah, wie ein Lumpen aus dem Schuh emporstieg. »Du bist auch nicht der rechte Vogel,« dachte er bei sich und hieß die Falsche wieder umkehren und begleitete sie in ihr Haus zurück.
Nun war nur mehr die Jüngste übrig. Der königliche Diener wollte ihr den Schuh geben, damit sie ihn probieren möchte, allein die zwei älteren Schwestern wollten es durchaus nicht zulassen und schmähten und schimpften das arme Kind wie einen Wechselbalg.
Der Diener ließ sich dadurch nicht im mindesten irremachen und Else mußte den goldenen Schuh anmessen. - Und siehe da, ihr Füßchen schlüpfte hinein so leicht und frisch wie ein Pfeifer ins Wirtshaus und der Schuh stand ihr wie angegossen.
»Das ist die Rechte,« dachte sich der Diener und wollte das Mädchen mit sich auf die Burg nehmen, allein es hatte ein gar so armes Kleidchen an und mußte sich deshalb zuvor umkleiden. Als sie ihr Festtagskleid angezogen hatte, da gingen sie nun durch die Stadt der Burg zu, das Mädchen voraus, der Diener drei Schritte hintendrein.
Sie kamen auf ihrem Wege auch auf den Stadtplatz und zur alten Linde, da sang das rote Vögelein auf einem Lindenzweige gar fröhlich:
»Königin Eisenknecht,
Der Schuh geht eben recht.«
Wie sie auf das Schloß ankamen, eilte der König ihnen schon entgegen und bewillkommte sie; denn kaum hatte er von ferne die Schöne gesehen, so hatte er sie schon als seine Tänzerin im Sternenkleid erkannt. Er war fast außer sich vor Freude und ließ am folgenden Tage ein großes Fest feiern.
Und wie alle im hohen Saale saßen und guter Dinge waren, trat ein Herold auf und gebot Schweigen, und als alles still war, stund der König auf und erklärte die schöne Jungfrau als seine Königin. - Es folgten dann Paukenwirbel und Trompetenstöße, und als die Nacht folgte, wurde der Tanz begonnen und dauerte bis morgens.
Die verachtete Schwester war nun Königin und lebte mit dem König recht lange vergnügt und glücklich. Und diese Geschichte ist buchstäblich wahr; denn der sie erzählte, hat den Mund noch warm.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
BAUER UND BÄUERIN ...
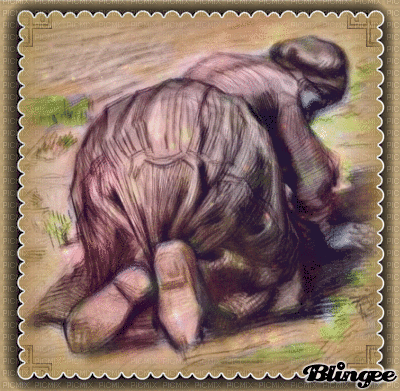
Es war einmal eine Bäuerin, die war sehr reich, aber auch sehr dumm, so dumm wie die Nacht. Einmal hatte man nun ein Schweinchen abgeschlachtet und der Bauer, der mit seinem Weibe viel Kreuz und Leiden hatte, sollte gerade auf das Feld gehen.
Die Bäuerin fragte ihn da, was sie mit dem toten Schwein machen sollte. Der Bauer antwortete, sie solle mit einem Stücke den Kappes spicken und das übrige solle sie für den Fürpaß aufbehalten. Der Bauer ging unwillig darüber, daß eine Hauswirtin sich nicht einmal bei einem geschlachteten Schweine zu helfen wisse, auf das Feld und machte dort noch ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter.
Die Bäuerin nahm sich die Worte ihres Mannes zu Herzen, nahm das halbe Schwein, trug es auf den Kappesacker hinaus, zerhackte es zu kleinen Streiflein und spickte mit diesen alle Krautköpfe, die mit den Speckschnittchen geziert gar sonderlich aussahen. Als sie mit dieser Arbeit fertig war, ging sie nach Hause und dachte immer an den Fürpaß und wo er etwa stecken möchte.
Sie weilte schon lange in der getäfelten Stube und konnte sich nicht genug darüber wundern, daß der Fürpaß so lange nicht komme, um sein Teil zu holen, als ein armes, altes Männchen mit einem Bettelranzen kam und um ein Almosen bat. »Bist du etwa der Fürpaß?« fragte hastig die Bäuerin.
»Warum denn?« fragte wieder das durch die Frage überraschte alte Männchen.
»Ja weißt wohl, mein Mann hat mir aufgetragen, dem Fürpaß das halbe Schwein, das wir heute morgens geschlachtet haben, zu behalten, und da warte ich schon lange auf den Fürpaß und er will nie
kommen und der Bauer ist heute schon zuvor herb.« »Ja, ja,« erwiderte der Bettler, »freilich bin ich der Fürpaß und das ist brav, daß ich nicht zu früh komme.«
Die Bäuerin war des froh, eilte in die Küche, holte das halbe Schwein und lud es dem Bettler auf den Rücken. »Hast wohl schwer zu tragen,« dachte sie und bemitleidete das belastete Männlein. Dem schien es aber zu gefallen und er machte sich auf die Füße und lief davon, daß der Boden unter ihm dampfte.
Es dauerte nicht lange und der Bauer kam nach Hause. Er fragte die Bäuerin, ob sie das Schwein besorgt hätte. »O ja, der Kappes ist schon gespickt, geh nur auf das Feld hinaus schauen und der Fürpaß ist auch da gewesen.«
Der Bauer wollte seinen Ohren nicht trauen und ging auf das Feld hinaus. Dort fand er die grünen Kappesköpfe samt und sonders mit Speck geschmückt. Da wurde er gar zornig, lief nach Hause und wollte sein dummes Weib, das die Sachen so zugrunde gerichtet hatte, fortjagen.
Allein mit einem dummen Weibe wird man nicht so bald fertig; sie bat um Verzeihung, weinte und versprach so lange Besserung, bis der Bauer ihr nachgab, und so war alles wieder gut.
Nach einigen Tagen hatte der Bauer seine Hosen zerrissen und da sagte er zur Bäuerin, sie möchte ihm doch die Hosen flicken, aber ordentlich und recht. - Der Bauer ging indessen seiner Arbeit nach. Die dumme Bäuerin aber stund vor den zerrissenen Hosen wie der Ochs am Berge und wußte nicht, wie sie das Ding anstellen sollte.
Endlich fiel ihr ein Rat ein. Sie ging in die Schlafkammer, holte dort aus der Truhe die Festtagshosen, zerschnitt die selben und flickte damit die Werktagshosen. - Als der Bauer nach einigen Tagen die Festtagshosen anziehen wollte, fand er sie nicht, und als er fragte, hörte er vom Geschehenen. Da war wieder das Feuer im Hause und Bauer und Bäuerin sahen sich so lieb an wie Hund und Katze.
Nach und nach kam aber wieder alles ins Geleise und Bauer und Bäuerin sprachen wieder miteinander, ohne nebenaus zu sehen. Da meinte einmal der Bauer, daß sein Bett nicht viel tauge. Andere Leute hätten so nette und reinliche Betten, daß es eine Lust wäre, nur das seine wäre wie ein dumpfes Nest. Er bat die Bäuerin, sie möchte doch einmal das Bett reinigen und auslüften.
Der Bauer ging nun in die Stadt, die Bäuerin nahm aber die Betten, trug sie auf das Dach, zerschnitt sie dort und schüttete die Federn auf ein Leintuch. Es stund aber nicht lange an, da kam der Wind daher, blies recht lustig in die luftigen Federn, so daß diese Flügel bekamen und dahin und dorthin flogen, und die Nachbarn meinten, es schneie bei heiterem Himmel.
Als nun der Bauer müde und matt abends nach Hause kam und sich ins Bett legen wollte, fand er die leere Bettstätte und kein Federchen darin. Die Bäuerin erzählte nun, wie es zugegangen sei, und da wurde der Bauer so zornig und wild, daß er die Bäuerin umbringen wollte. Sie bat aber und bat so lange, bis er ihr das Leben schenkte, aber bei ihr bleiben wollte er um keinen Preis mehr.
Er packte sich nun ein Bündel zusammen und wollte so weit gehen, bis er jemand finden würde, der noch dümmer als sein Weib wäre. Würde er keinen Dümmeren finden, wollte er wieder nach Hause kehren und sein Weib ohne Schonung umbringen. -
Er ging nun weiter und weiter über Berg und Tal und kam endlich in eine große, große Stadt. Wie er nun so durch die schönen, weiten Gassen wanderte und, den Mund weit offen, die prächtigen Häuser anschaute, rief eine Frau aus einem Fenster herab: »Hansl! was schaust du denn so in die Höhe?« - »Was schau ich?« antwortete er, »vom Himmel bin ich herabgefallen und jetzt muß ich das Loch suchen, damit ich wieder hinaufkomme.« -
Die Frau war voll Freude über diese Antwort und fragte gleich, wie es ihrem seligen Herrn im Himmel droben gehe. »Schon gut,« erwiderte Hansl, »aber kein Geld und kein Gewand hat er und da leidet er halt Kälte und Langweile.« »Ach, wenn nur das ist,« rief die Frau, »so will ich ihm schon helfen. Gewand und Geld will ich dir mitgeben, soviel du willst.« -
Der Bauer mußte nun in das Haus hinaufgehen und dann gab sie ihm so viel Geld und Gewand, daß er es fast nicht ertragen konnte, und Hansl war froh und ging geschwind weiter.
Als Hansl weg war und die Frau sich über das Wohlsein ihres ersten Herrn im Himmel droben freute, kam ihr zweiter Herr und diesem erzählte sie, daß es ihrem Herrn gut gehe und daß sie ihm, da sich gerade gute Gelegenheit geboten habe, Geld und Gewand geschickt habe. -
Als ihr Herr das hörte, ward er zornig wie ein Göckelhahn, schmähte seine Frau aus, ließ sich das Pferd satteln und ritt spornstreichs dem Hansl nach. Sobald aber dieser gewahr wurde, daß ein Reiter nachgesprengt komme, legte er sein Bündel ab, versteckte es im Gesträuche und legte sich wie schläfrig in das Gras.
Der Herr kam indessen heran geritten und fragte den Hansl, »ob er nicht einen Mann mit einem Bündel gesehen habe?« - »Jawohl,« erwiderte er, »gerade ging einer mit einem Bündel vorbei; man kann ihn leicht einholen, wenn man ihm schnell nachgeht, aber,« setzte er klug hinzu, »wenn der Mann das Getrabe des Pferdes hört, versteckt er sich vielleicht.«
Dem Herrn ging dieser Gedanke ein, er stieg vom Pferde, ließ das selbe beim Hansl zurück und eilte zu Fuß weiter. Kaum war der Herr weg, dachte sich Hansl: »Nun habe ich auch noch ein Pferd«, schwang sich flink auf das selbe hinauf und sprengte damit fort.
Er war eine Weile geritten, da kam er zu einem einsamen Hause, neben dem eine Scheune stund. Er stieg nun ab, denn es war Abend und er suchte ein Nachtlager und ging in das Haus hinein; da fand er zwei greisgraue Jungfrauen und die bemühten sich mit zwei Heugabeln frische Nüsse auf die Bühne zu schöpfen. -
Wie Hansl dieses sah, fing er laut an zu lachen, denn er sah, daß noch dümmere Leute als sein dummes Weib auf Gottes Erdboden lebten, bestieg wieder sein Pferd und ritt und ritt, bis er wieder zu seinem Weibe nach Hause kam. Diese hatte aber eine Freude, als ihr Mann wiederkam, und versprach ihm recht gescheit zu tun.
Beide lebten nun mitsammen glücklich und froh und der Bauer freute sich immer, so oft er daran dachte, daß es noch dümmere Leute als sein Weib auf der Erde gebe.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Etschland
ST. PETRUS ...

Als unser Herrgott noch auf Erden wandelte, ging er einmal durch ein schönes, weites Tal. Er war sonst allein, nur der heilige Petrus begleitete ihn. So wanderten sie den ganzen Vormittag; Christus sprach in Parabeln und der Apostel hörte zu.
Als aber die Mittagsstunde gekommen war und es auf den Hütten zu Mittag läutete, da war dem St. Petrus die Aufmerksamkeit vergangen; denn die Magenuhr ließ ihm keine Ruhe mehr und der Hunger rief immer: »Es ist Zeit zum Essen.«
Der liebe Heiland merkte bald, wo seinen Jünger der Schuh drückte, und sprach zu ihm: »Siehst du da drüben aus dem Kamin den Rauch aufsteigen? - Es dampft und raucht so stark, daß wohl etwas Besseres dort gekocht wird. Geh hinüber und bitte die Bäuerin für dich und mich um einen Kuchen, denn es hungert uns.«
St. Petrus ließ sich das nicht zweimal sagen. Er ging zum Bauernhofe hin und fand die Bäuerin gerade in der Küche, wo sie Kuchen buk. Sie war ein gar mildtätiges Weib und gab dem bittenden Apostel anstatt zweier Kuchen ihrer drei. Das gefiel dem Hungerigen und er dachte: »Den dritten kannst du für dich allein behalten.« Er nahm den dritten unter die Achsel und verbarg ihn.
So kehrte er nun zum göttlichen Meister, der auf einem Steine saß und seiner harrte, zurück und zeigte ihm die zwei Kuchen. Der Heiland wußte wohl um den dritten, den Petrus verborgen unter der Achsel hielt, verlor aber kein Wort darüber. Er nahm den einen Kuchen und den anderen ließ er dem Petrus. So aßen sie nun und stillten sich den Hunger.
Als sie aber die Kuchen verzehrt hatten, sprach der göttliche Lehrer: »Der himmlische Vater hat uns gespeist, wir wollen ihm nun auch danken, und weil er heute mit uns besonders gut war, wollen wir mit ausgespannten Armen zu ihm beten.«
Christus kniete nun nieder, breitete seine Arme aus und betete. Und Petrus mußte es, weil es sein Meister tat, auch tun. Wie er aber die Arme ausbreitete, fiel der verheimlichte Kuchen zu Boden. Da wurde der Apostel vor Scham feuerrot. Und so wird es auch dir gehen, mein Kind, wenn du Dinge verheimlichst und sie dann aufkommen.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Inntal
UNSER HERR ALS BETTLER ...
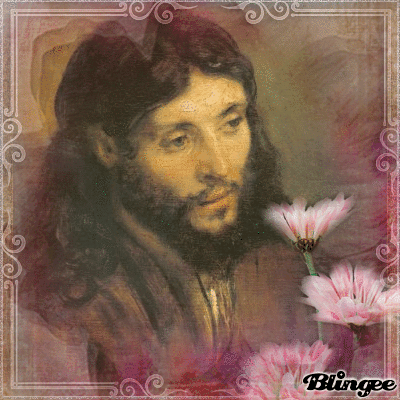
Es ist schon lange her, da lebte einmal ein altes Weiblein, das entsetzlich arm und nötig war. Sie konnte sich wenig verdienen und betteln gehen wollte sie nicht, denn sie dachte immer: »Lieber als daß ich betteln gehe, verkaufe ich meinen Löffel«. -
Wie das arme Weiblein nun einmal in ihrem Stübchen so da saß und über ihre Not nachdachte, kam ein Bettelmann, der war recht zerlumpt und sah so bleich und mager aus wie die teure Zeit. Der Bettler bat gar schön und um Gotteswillen um ein kleines Almosen und das Weiblein wußte fast nicht, was sie tun sollte, denn sie hatte nichts als eine Henne, und den Bettler ganz leer weg gehen lassen wollte sie auch nicht. -
Sie wurde endlich mit sich einig und hieß den Bettler sich setzen und ein wenig ausrasten; dann ging sie in die Küche, stach die Henne ab, kochte sie und setzte die selbe und eine kräftige Suppe dem Bettler vor. Der Alte ließ sich Suppe und Henne gefallen, aß recht wacker los, und als er weg ging, konnte er fast nicht aufhören zu danken.
Als der arme Mann schon zur Türe hinaus war, erinnerte sich das Weiblein, daß sie noch ein wenig Tuch im Kasten habe, und holte gleich ein Stückchen vom Tuch für den Bettler, damit er sich ein Hemd machen könnte. Mit dem Tuche lief sie nun dem Bettler nach und schenkte es ihm.
Der Arme nahm es lächelnd mit Dank an und sprach: »Weil du mit mir so gut gewesen bist, so schneide Tuch herab, bis die Sonne untergeht«. Er sprach es und verschwand glänzend wie eine Wolke, die bei Sonnenuntergang am Himmel hängt.
Das Weiblein ging nun eilig nach Hause und fing an Tuch herab zu messen und nahm sich den ganzen Tag durch kaum Zeit zu atmen, so beschäftigt war sie. Und wie die liebe Sonne hinter den Bergen zur Ruhe ging, da war das ganze Häuslein, in dem sie wohnte, gesteckt voll weißer Leinwand, die so schön war, daß sich der Kaiser daraus hätte das Festtagstischzeug machen lassen können. -
Sie maß noch fort, und als die schwarze Nacht kam, hatte sie keinen Platz mehr für ihr Tuch und mußte viele, viele Stücke bei guten Nachbarn aufbehalten lassen. Da machte wohl manche Bäuerin Augen auf das schöne Tuch, daß man ihr es leicht ansah, wie gern sie es gehabt hätte.
Dem Weiblein fehlte es aber nie mehr, solange es lebte, an Gottes Segen und es tat auch den Armen immerfort gar viel Gutes.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Inntal
MÜLLERS TÖCHTERLEIN ...

Des Müllers Töchterlein war ein keckes Mädchen und hätte es wohl auch mit Männern aufgenommen. Einmal mußte es, während die andern Bewohner in der entlegenen Kirche waren, im einsamen Häuschen zurückbleiben, um es zu hüten. Das Mädchen sperrte sich brav ein, und weil ihm das Alleinsein so langweilig vorkam, wartete es mit Sehnsucht auf die Ankunft der übrigen, die doch nicht lange mehr ausbleiben konnten.
Wie sie so durchs Fenster sah und auf die Kirchgänger harrte, sah es von weitem drei wilde Männer daher kommen, die gar verdächtig aussahen. Die Männer gingen gerade auf das Müllerhaus zu, als ob es sich so gehörte, besichtigten alles und jedes und klopften endlich an die Haustüre.
Der Maria, so hieß das Mädchen, gefiel der ganze Handel nicht und es hätte sie beinahe gegruselt, doch bald hatte sie sich gefaßt, hielt sich mausestill und öffnete nicht. Da fiel ihr ein, daß auch aus dem Keller eine Hintertüre auf die Straße führe und daß in der selben ein großes Lugloch sei. Gleich vermutete sie, die drei wilden Männer könnten dort hereinkommen, holte sich ein Beil und ging in den Keller hinunter.
Sie war noch nicht lange auf der Lauer, als einer von den dreien den Schieber beiseite schob und durch die Öffnung hereinzukriechen versuchte. Maria, die stramm hinter der Türe sich verbarg, war nicht faul und hieb mit einem Streiche dem Einbrechenden den Kopf ab, daß er weit von dannen kugelte, packte dann gleich den Rumpf und zog ihn zu sich herein.
Wie der erste so durch die Luke verschwunden war, glaubten die beiden anderen, es sei dem ersten gelungen, in den Keller zu steigen, und der zweite machte sich an die Reihe. Er steckte seinen Kopf durchs Loch hinein und die kecke Maria stund hinter der Türe bereit und machte es ihm wie dem ersten.
Der dritte wollte auch hinein, allein Maria war dieses Mal zu voreilig; denn kaum hatte sein Kopf zum Loche hineingeguckt, als sie mit dem Beile los schlug und ihm nur eine kleine Wunde beibrachte. Er zog rasch den Kopf zurück und wußte nun, wie es seinen zwei Kameraden ergangen sei. Ohne zu säumen, eilte er mit blutigem Kopfe zu seinen Kameraden, den Räubern, in den Wald zurück und ließ sich dort die Wunde heilen.
Maria war nach diesem Besuche nicht mehr lange allein; denn bald war der Gottesdienst geendet und die Kirchgänger kamen nach Hause. Mit pochendem Herzen und doch mit Freude eilte sie ihnen entgegen und erzählte ihren Leuten das, was sich zugetragen hatte. Alle verwunderten sich über die Geistesgegenwart des Mädchens und konnten seine Tat nicht genug loben. Die zwei erschlagenen Räuber wurden dann dem Gerichte ausgeliefert und unter dem Galgen begraben.
Die Felder waren seit dieser Begebenheit zweimal fahl und wieder grün geworden, als eines Morgens ein schmucker Müllergeselle in die Mühle kam und sich dort um einen Dienst erkundigte. Dem Meister gefiel der schöne Bursche und er nahm ihn als Gesellen an.
Der neue Müller arbeitete sehr fleißig und hatte sich bald das Zutrauen und die Liebe aller Bewohner der Mühle erworben. Man hatte vor ihm kein Hehl und alle Geheimnisse und Geschichten der Mühle, somit auch die Tat der Tochter, wurden ihm, wenn nicht heute, doch morgen mitgeteilt.
Maria selbst erzählte ihm von jenem Besuche öfters mit der größten Freude und nur, wenn sie vom dritten zu sprechen kam, unterdrückte sie eine gewisse Furcht und Angst nie ganz. »Den, der mir so durchkam, fürchte ich noch immer«, gestand sie öfters.
Der Geselle lächelte dann und schob dann auch zuweilen das rote Häubchen, das nie von seinem Kopfe kam, etwas in die Runde. Oft erzählte er auch, was er für ein reicher Müllerssohn sei und wie viele Gründe sein Vater besitze. Maria glaubte alles und gewann nach und nach den Gesellen so lieb, daß er ihr über alles ging, und er behauptete auch, daß er die Maria recht lieb habe.
Es dauerte nicht mehr lange und er hielt beim Müller um die Hand der Tochter an, die ihm der alte Meister nicht versagte. Einige Tage vor der Trauung wollte er seine Braut auf den Beschau führen und ihre Eltern hatten nichts dagegen einzuwenden. Der Geselle führte die liebe Maria nun eines Tages weiter und sie war voll Freude, daß sie ihre künftige Heimat bald sehen sollte.
Der Weg führte sie durch einen Wald. Wilde Rosenhecken, riesige Farnblätter und altersgraue Tannen standen nur in dieser Wildnis, sonst sah man nichts und keines Menschen Tritt oder Stimme schlug an das Ohr der Wanderer. Wie sie so einsam, allen Menschen ferne, durchs Dickicht wanderten, stund der Geselle plötzlich stille, maß das Mädchen mit wildem Blicke, zog das rote Häubchen ab und fragte:
»Kennst du dieses Zeichen?« Dabei deutete er auf die Schramme, die ganz jener glich, die sie dem wilden Räuber beigebracht hatte. »Jesus Maria!« entfuhr der Kehle der armen bleichen Dirne, die vor Schrecken fast zusammen sank. »Zwei meiner Kameraden hast du getötet und gegen mich hattest du schon das Beil erhoben, dafür soll dir der Tod nicht ausbleiben,« fuhr ihr Begleiter weiter.
Maria flehte und weinte, allein es half alles nicht und er schleppte und zerrte sie weiter, wie ein Tier, das man zur Schlachtbank führt. Sie waren nicht mehr lange gegangen, als der Räuber bei einem Haus halt machte. Wie sie nun dort stunden, stürzten viele, viele wilde Kerle aus der Türe, bewillkommneten ihn und fragten, ob die es sei. Er nickte ja und alle frohlockten und führten das Paar in die Stube, in der ein großer, großer Ofen stand.
Der Häuserin wurde nun befohlen, recht stark einzuheizen, denn man wollte einen guten Braten bereiten. Die Wirtschafterin feuerte nun ein und dann brachte sie den polternden Räubern Wein und Gesottenes und Gebratenes, an dem sich die bärtigen Waldmenschen gütlich taten. Maria hängten sie aber beim heißen Ofen an und lachten, wenn sie sich vor Hitze wie ein Wurm krümmte und bog.
Schon glaubte sie vor Hitze vergehen zu müssen, als ein Bote mit der Nachricht kam, daß im Walde Kaufleute sich verirrt hätten. - Wie auf einen Zauberschlag stunden nun alle auf, stürzten die Gläser aus und eilten aus der Stube. Die alte Häuserin und die geängstigte Maria waren nun allein zu Hause.
Da bat des Müllers Töchterlein die Alte, sie solle ihr doch zur Flucht behilflich sein, sie würde ihr dafür ewig dankbar sein, und Tränen so hell und klar wie der Morgentau kugelten über die roten feinen Wangen des Mädchens so zahlreich, daß eine die andere schlug.
Die Alte erbarmte sich endlich des jungen Blutes, band Marien los und eilte mit ihr fort; denn wäre sie allein zurückgeblieben, so wäre es um sie geschehen gewesen. Häuserin und Müllers Töchterlein gingen stille durch den Wald, um dem Tode zu entrinnen und das Freie zu suchen. Sie hatten aber kaum die Hälfte des Weges zurückgelegt, als sie die Räuber von ferne daherkommen und lärmen hörten. Was war nun zu tun, wenn nicht beide dem Tode in den Rachen laufen wollten?
Maria war gleich entschlossen, sie sah in der Nähe einen großen, hohen Baum und den kletterte sie so behend und leicht wie ein Eichhorn hinan. Die Räuberwirtschafterin war auch nicht faul und folgte ihrer Vorgängerin und so schwebten beide auf den schwanken Ästen droben, die sich unter ihnen auf und nieder bogen.
Indessen waren die zweiundzwanzig Räuber bis zum Baume gekommen, ließen sich am Fuße des selben nieder und hielten Rast. Zur Kurzweile verabredeten sie, wie sie des Müllers Tochter im Ofen braten werden. Die beiden Gäste auf dem Baum droben hörten jede Silbe und gerieten in eine so große Furcht, daß der Angstschweiß vom Baume niedertropfte. -
Als die Räuber dies Tropfenfallen merkten, fürchteten sie einen nahenden Regen, griffen hastig nach ihren Waffen und eilten spornstreichs nach Hause. - Kaum hatten die beiden Flüchtigen das gesehen, als sie eiligst herunter stiegen und, ohne sich jemals umzusehen, durch den Wald eilten, bis sie die Lichtung erreicht hatten. Auch dort rasteten sie noch nicht, sondern eilten dem nächstgelegenen Dorfe zu, in dem Bekannte der Maria wohnten.
Zu diesen nahmen sie ihre Zuflucht und erzählten ihnen alles. Die Sache wurde nun im Dorfe gleich laut, die Bewohner des selben scharten sich zusammen und eilten bewaffnet dem Waldhause zu. Sie fanden die Räuber alle beisammen und töteten sie bis auf den letzten.
Maria kam aber mit ihrer Begleiterin noch am nämlichen Tage zu ihren Eltern zurück und die alte Häuserin lebte bei ihnen, bis sie starb.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Meran
DER FISCHER ...
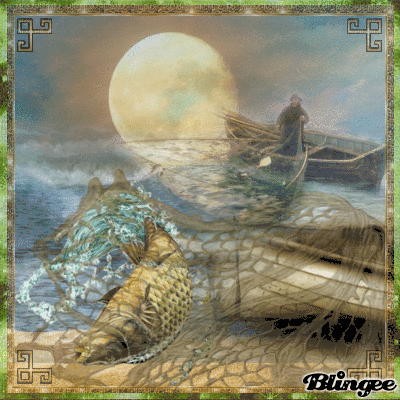
Es war einmal an einem See ein Fischer, der hatte eine liebe, liebe Frau und Geld genug, allein er hatte keine Kinder, was ihm sehr leid tat. Eines Tages ging er hinaus ans Ufer des bläulich - grünen Sees und senkte seine Angel hinunter ins Wasser und pfiff sein Liedchen dabei. Er hatte nicht lange geangelt, da biß ein so ungeheurer Fisch an, daß fast die Schnur abriß.
»Das ist einmal ein fetter Fang,« dachte sich der Fischer und schnellte das Seeungeheuer aufs Trockne heraus. Wie es so da lag, öffnete es sein Maul, fing an zu reden und sprach: »Du hast heute dein Glück in den Händen, wenn du das tust, was ich dir sage.
Gib mein Mitterstück deiner Frau und sie wird dir drei Söhne gebären. Gib das Eingeweide deinem Pferde und es wird drei Fohlen dir bringen; den Kopf gib deinem Hunde und er wird drei Junge bekommen, und den Schweif endlich, den grabe im Garten in die Erde und dann werden drei Bäume aus dem Grunde wachsen und grünen und blühen, daß es eine Lust ist.
Die drei Bäume werden dann mit den Söhnen, Fohlen und Hunden aufwachsen und wie diese gedeihen. Neigt sich aber einer von den Bäumen, so droht einem deiner Söhne ein Unglück, und wenn einer sich ganz senkt oder gar nieder fällt, dann raubt der Tod einen deiner Söhne.«
So sprach der Fisch und blieb dann stumm wie jeder andere. Der Fischer war aber über seinen Zug und diese Kunde hoch erfreut, nahm den Fisch und trug ihn in sein Häuschen, das von Reben bis zum Giebel hinauf übergrünt war. Dort machte er es, wie es der Fisch gesagt hatte.
Er legte ihn auf die Anrichte, schnitt das noch zappelnde Tier auf, nahm das Eingeweide heraus, zerstückelte es und gab das Mitterstück seiner Frau, den Kopf seinem Hund, das Eingeweide dem Pferd, und den Schweif trug er in den Garten hinaus und grub ihn dort ein.
Es stund nicht lange an und alles ging in schönster Ordnung in Erfüllung. Dem Fischer wurden drei Söhne geboren, die Stute brachte drei Fohlen auf die Welt, die Hündin warf drei schwarz und weiß gescheckte Junge und an der Stelle, wo das Schweiflein vergraben lag, keimten bald drei Pflänzchen, die immer höher und höher wuchsen, bis endlich drei Bäumchen ihre zarten Zweige in den Lüften hin und her wiegten.
Fischer und Fischerin, Söhne und Fohlen, Hündchen und Bäumchen befanden sich ganz wohl und gesund und der Segen des Himmels schien auf ihnen zu ruhen. Das ging lange, lange Zeit so fort. Wie schon viele Jahre verstrichen waren und einmal wieder der Frühling kam, fiel es plötzlich dem ältesten der Söhne ein, weiterzuwandern und die schöne Welt zu schauen.
Der alte Fischer hatte gegen dieses Vorhaben seines Sohnes nichts einzuwenden, gab ihm gute Ermahnungen und seinen Segen mit auf den Weg. Der Sohn nahm eines der drei jungen Pferde und einen jungen Hund mit sich und ritt von dannen.
Er war schon eine weite Strecke geritten, hatte manche Abenteuer bestanden und gesehen, daß die Welt kein Ochsenauge sei, als er tief, tief in einen wilden, Pech finsteren Wald hinein geriet. Da hatten die dunklen Bäume gar seltsame Gestalten und Käuzlein und Uhu glotzten mit ihren großen, roten Augen gar so fürchterlich von den Föhren auf den schönen Reiter herab, daß es ihm ungeheuer wurde und er sich aus dem Gehölze in das Fischerhaus zurücksehnte.
Wie er aber so fürbaß ritt und dem Rosse die Sporen einsetzte, um schneller aus dem unheimlichen Wald zu kommen, verfinsterte sich der Himmel, schwarze Wolken jagten wie losgelassene Hunde am Himmel hin und her und bläuliche Blitze zeichneten ihre Zickzacke auf den dunklen Hintergrund. Der Regen rauschte in Strömen nieder und dem Jüngling blieb nichts übrig, als nach allen Seiten zu spähen und ein Obdach zu suchen.
Er suchte noch nicht lange, da sah er eine Hütte am Wege stehen, stieg von seinem Rappen, band ihn an den nächsten Baum und trat in die Hütte. In dieser wohnte aber zum Unglück eine alte, alte Hexe, der im spitzigen Mund nur mehr ein Zahn wackelte, und wie sie den schönen Reitersmann sah, ging sie ihm entgegen und verwandelte ihn in einen Stein. Dann ging sie vor die Hütte und verzauberte auch das Pferd, daß es leb- und regungslos da stund wie ein Felsblock.
Das erste Bäumchen im Garten des Vaters, das am Morgen des Unglückstages noch frisch und grün war und dessen Zweige in dem Morgenwind sich gar lustig hin und her bewegten, neigte sich abends tief und ließ wie in stiller Trauer seine Zweige nieder hangen. Am anderen Morgen waren die Blätter gelb und fahl und das Bäumchen lag der Länge nach auf dem Boden dahin gestreckt.
Wie die Fischersleute das Bäumchen in diesem Zustande sahen, dachten sie an die Worte des weissagenden Fisches und es ahnte ihnen nichts Gutes. Sie glaubten, daß der Erstgeborene gestorben sei, und weinten vom Abend bis zum Morgen und vom Morgen bis zum Abend wieder.
Als aber der zweite Morgen hinter den Bergen aufstieg und der Morgennebel aus dem Tale wich, sattelte der zweite Sohn sein Pferd, empfing von seinen alten Eltern den Segen und machte sich auf den Weg, um den armen verlorenen Bruder zu suchen. Die Eltern sahen ihm vom Söller noch lange, lange nach, und wie sie ihn so in der Ferne verschwinden sahen, wurde es ihnen ums Herz so schwer, als ob ein Zentnerstein draufläge und sie den lieben Sohn nicht wieder sehen sollten.
Der zweite Sohn ritt aber schnell durch Feld und Au, daß der Staub aufflog und das Roß dampfte, denn er hatte keine Ruhe, ehe er seinen Bruder finden würde. Als aber die Sonne zur Rüste ging und ihre letzten goldenen Strahlen in das Tal sandte, kam er zum dunklen Forst, in dem die alte Hexe wohnte und sein Bruder versteinert war.
Er besann sich nicht lange und lenkte sein Roß in die finstere Waldung hinein. Er war noch nicht lange geritten, so verfinsterte sich der Himmel, die Nebel huschten wie Gespenster hin und wieder und ein entsetzlicher Regen schien heranzuziehen. Der Reiter setzte seinem Pferde die Sporen ein, daß es sich bäumte, und sprengte in wilder Eile weiter, denn er wollte ein Obdach vor dem Gewitter finden.
Es dauerte nicht lange, so kam er zu einer Hütte und er schwang sich vom Pferde und trat in die Behausung. Diese war aber keine andere als die der alten Hexe, und als diese den schmucken Jüngling sah, verzauberte sie ihn und er stand neben seinem Bruder ebenfalls als Stein da.
Am Tag darauf, als es noch früher Morgen war, gingen der Fischer und seine Frau in den Garten, und da hatte sich auch das zweite Bäumchen über Nacht geneigt und als es Mittag war, hatte es sich ganz zur Erde gebeugt und die Blätter waren dürr und rostgelb wie die Eichenblätter im Winter.
Den Eltern wurde aber gar traurig um das Herz und sie setzten sich neben dem Bäumchen auf die Rasenbank und hier weinten sie von Mittag bis Mitternacht und von Mitternacht bis wieder Mittag, und als der dritte Tag anbrach, waren ihre Augen noch nicht trocken.
Als aber der dritte Tag anbrach, hatte der jüngste der Brüder sein Pferd gesattelt und gezäumt und wollte von dannen reiten, um seine beiden Brüder zu suchen. Die Eltern wollten ihn aber nicht ziehen lassen, denn sie fürchteten das gleiche Los auch für den dritten, und dann hätten sie kein Kind und keinen Erben mehr gehabt.
Er gab nicht nach und bat und flehte, bis er ihren Segen erhielt und ziehen durfte. Froh und kühn sprengte er vom Hause seiner Eltern weg und ritt und ritt, bis er zum Wald kam, in dem seine Brüder verzaubert stunden. Er sprengte auf dem Wege vorwärts in den Forst hinein und war guter Dinge.
Da trübte sich plötzlich der Himmel, es wurde dunkel und dunkler und endlich rauschte der Regen in Strömen nieder. Der Fischersohn hätte wohl im Trocknen sein mögen, allein ihm kam es in diesem Walde so unheimlich vor, daß ihm der Boden unter dem Pferde zu brennen schien, und als er das einsame Häuschen sah, in dem die Hexe wohnte, wurde es ihm noch unheimlicher und er sprengte trotz alles Regens spornstreichs in die nächste Stadt.
Wie groß war aber sein Staunen, als er durchs Tor eingeritten war! Die Stadt, die von weitem so stolz und prächtig schien, war still und öde wie ein Grab und die Paläste hatten gar ein düsteres Aussehen, denn sie waren samt und sonders mit schwarzen Tüchern behängt. Und wie die Häuser sahen auch die Leute aus, sie schlichen schwarz gekleidet wie Gespenster durch die weiten, traurigen Straßen und Gassen.
Als der Fischersohn dies sah, war er anfangs verdutzt, doch bald erholte er sich vom ersten Staunen und dachte sich: »Was das Ding zu bedeuten hat, mußt du auch wissen.« Bald begegnete er einem Burschen, der so durch die Gasse einherschlenderte, und fragte ihn, warum die Häuser hier schwarz bekleidet seien.
Der Bursche sah den Fremdling mit großen Augen an und meinte, das sei doch kurios, daß ein Mensch kein Wörtchen vom Drachen wisse, der da oben auf dem Berge wohne. Als der Knabe sah, daß der Reiter sich nicht bloß unwissend stelle, sondern es wirklich sei, erzählte er weiter, daß man täglich dem Drachen einen Menschen vorwerfen müsse, um seinen Hunger zu stillen, und daß heute das Los die schöne Königstochter getroffen habe. -
»Da gibt es eine Gelegenheit, deinen Mut zu zeigen,« dachte sich der Fischersohn und ließ sich den Berg zeigen, wo der scheußliche Drache wohnte und auf seine Beute harrte. Er stieg nun mit Schwert und Lanze den schmalen Felssteig hinan, bis er zu einer alten, grauen Kapelle kam, bei der der siebenköpfige Drache seine Beute zur Mittagszeit holte. Bewaffnet wartete er auf das Untier und empfahl sich dem Schutze Gottes.
Als der Mittag angenaht war, wurde die schöne Königstochter herbeigeführt. Sie war gar traurig und trug ein schwarzes Kleid. Wie sie bei der Kapelle war, kniete sie nieder und betete und große Tränen kugelten über ihre feinen Wangen, denn es kam sie das Sterben gar zu schwer an.
Kaum hatte aber der siebenköpfige Drache sein Opfer entdeckt, so donnerte er auf die Prinzessin los und wollte sie verschlingen. Da schleuderte der Fischersohn seine Lanze auf das Untier und es sank blutend zu Boden und ringelte vor Schmerz sich zusammen. Er war aber nicht träge, eilte herbei, tötete das Untier mit dem Schwert vollends und riß ihm aus jedem Rachen die Zunge heraus und nahm alle sieben zu sich.
Die schöne Königstochter war nun befreit und weinte vor Freude. Sie fand nicht genug Worte, um ihrem Retter zu danken, und gab ihm ihren schwarzen Schleier zum Pfand. Er war darüber hoch erfreut und eilte von dannen, denn er dachte wieder an seine Brüder.
Indessen hatte es den Laternanzünder und den Nachtwächter gewundert, wie es etwa der Königstochter ergangen sei, und sie stiegen zur Kapelle hinan. Wie sie dort angekommen waren und die schöne Prinzessin lebend, den Drachen aber tot fanden, verabredeten sie sich untereinander und machten die Erlöste schwören, daß sie bei ihrem Vater den Laternanzünder als ihren Retter nennen wolle.
Die Königstochter tat es, weil sie keine Ausflucht sah, und ging mit dem Laternanzünder in die Stadt und zu ihrem Vater. Der alte König konnte sich vor Freude nicht fassen, als er seine liebe Tochter noch am Leben sah, und fiel bald ihr und bald dem Laternanzünder um den Hals, denn er glaubte, daß dieser der Erretter sei, weil er die sieben Köpfe des Drachen aufwies.
Der König wußte ihn nicht besser zu belohnen, als wenn er ihn zu seinem Eidame machen würde, und versprach ihm die Hand seiner Tochter. Allein die schöne Prinzessin hatte an diesem Bräutigam gar keine Freude, weil er nicht der rechte war, und war sinnend und traurig. Ihre roten Wangen wurden blasser und ihre Augen blickten nicht so freudig in die Welt wie sonst.
Der alte König fragte wohl oft, was ihr fehlte. Allein sie schwieg und war nachdenkend, denn der Schwur lag ihr am Herzen und lähmte ihre Zunge. So verstrichen Wochen auf Wochen, der Tag der Hochzeit brach endlich an und der Laternanzünder sollte König werden.
»Wo war aber indessen der Fischersohn?« fragst du mich, mein Kind.
Nun, der war in den Wald, in dem die Hexe wohnte, zurück geritten, denn er war ihm so unheimlich vorgekommen, daß er meinte, es müssen dort seine Brüder zugrunde gegangen sein. Er sprengte durch
den düstern Föhrenwald, bis er zur Hexenhütte kam, und als er vor der Hütte die steinernen Pferde sah, die er das erste Mal in der Eile übersehen hatte, dachte er sich: »Holla, da geht es nicht
mit rechten Dingen zu,« und hielt sein Roß an.
Er ließ nun die graue, meeralte Hexe herauskommen und drohte ihr, wenn sie ihm die zwei Brüder nicht herausgeben würde, mit dem Tode. Die schlaue Alte wollte lange von den Brüdern nichts wissen und suchte allerlei Ausflüchte. Als sie aber sah, daß der Reiter das Schwert zog und puren Ernst machen wollte, zog sie ein Fläschchen aus ihrem Sack hervor und gab es dem Fischersohn.
»Wenn du deine Brüder wieder haben willst, so befeuchte mit diesem Saft die Steine, die du hier siehst,« raunte die böse Alte und schwieg. Der Fischersohn ließ sich das nicht zweimal sagen, befeuchtete die Steine und der Zauber war gelöst. Die zwei Brüder stunden samt Pferden und Hunden neben ihm und umarmten und küßten ihren Bruder und Retter.
Alle drei Brüder waren hocherfreut, schwangen sich auf ihre Pferde und ritten zu den lieben Eltern zurück. Welche Freude diese hatten, als sie ihre drei Kinder wieder sahen, kann man sich vorstellen. Vater, Mutter und alle drei Söhne waren schon einige Tage beisammen geblieben, da kam dem Jüngsten wieder die schöne Königstochter in den Sinn und es ließ ihn zu Hause nicht mehr stille sitzen.
Er sattelte wieder sein Pferd, schwang sich auf dasselbe und ritt, wie sehr ihn auch die Eltern baten, zu Hause zu bleiben, dem Hexenwalde und der Königsstadt zu. Es begegnete ihm auf dem Wege nichts Mißgünstiges und er kam gesund und froh in der stolzen Stadt an.
Was für Augen machte er aber, als er durch die schönen Gassen ritt und alle Häuser mit roten Teppichen behängt sah! Die Leute waren auch überall guter Dinge und sangen und tanzten und lachten um die Wette. Darob neugierig, fragte er ein Mädchen, das ihm mit einer Kanne begegnete: »Was haben diese Festlichkeiten zu bedeuten?«
»Ja,« entgegnete sie, »die Königstochter hat heute Hochzeit mit dem Laternanzünder, der sie vom Tode befreit hat. Deshalb ist heute ein großes Fest in der Stadt und wir freuen uns mit ihr.« »Da hab ich auch ein Wörtchen dreinzureden,« dachte sich der Fischersohn und ritt schnurstracks zur Königsburg, sprang dort vom Rosse und eilte die silberne Stiege hinauf zum König, dem er alles haarklein erzählte.
Der König sagte: »Du mußt dem Laternanzünder gegenüber beweisen, daß du den siebenköpfigen Drachen getötet hast. Bist du dieses zu tun imstande, so wird meine Tochter deine Braut und der andere kommt an den Galgen.« So sprach der König und führte den Fischersohn in ein gar prächtiges Zimmer, das vor Gold und Silber glänzte.
Im Zimmer stand aber der stolze Bräutigam und neben ihm saß die traurige Braut, die ihn verächtlich ansah und nach dem Fremdling sich sehnte. Als der alte König und der Fischersohn eingetreten sind, lächelte die Prinzessin freundlich, allein sagen durfte sie nichts von wegen des Schwures.
»Beweise,« sprach der König zum Laternanzünder, »daß du meine Tochter gerettet hast, denn dieser, der mir zur Seite steht, leugnet es.« »Es wird wohl Zeugnis genug sein, daß die sieben Köpfe, die ich dem Drachen abgeschlagen hatte, hier liegen,« antwortete stolz der falsche Bräutigam.
Da ging der Fischersohn hin, öffnete die sieben Drachenköpfe und sagte: »Es sind hier wohl die Köpfe, aber es fehlen die Zungen. Nun sprich du, Herr König! aus, wer von uns der Drachentöter sei. Ich habe die Zungen, dieser da die Köpfe ohne Zungen«. »Der die Zungen besitzt, hat das Untier erlegt und soll mein Sohn sein,« entschied der alte König.
Der Fischersohn zeigte nun die Zungen und den schwarzen Schleier vor und wurde als der Drachentöter erkannt. Der Königstochter fiel nun der Stein vom Herzen und sie wurde noch in der selben Stunde mit dem stattlichen Ritter getraut. Der Laternanzünder wurde aber wegen seines Betruges noch am nämlichen Tage erhängt und hängt noch, denn er wurde noch nie herab genommen.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
DIE SINGENDE ROSE ...
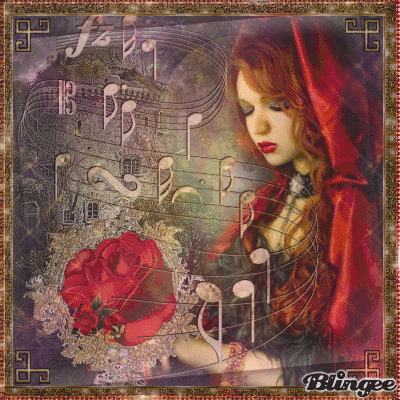
Ein König hatte drei Töchter, die waren alle drei weit schöner als die Jungfräulein heutzutage, und jede von ihnen hatte schon das sechzehnte Lebensjahr überschritten. Da dachte der König daran, eine von den drei Töchtern zur Königin zu machen. Er wußte aber nicht, welche er den übrigen zweien vorziehen sollte.
Eines Tages ließ er nun alle drei vor sich kommen und sagte zu ihnen: »Meine lieben Kinder, ich bin jetzt alt und gebrechlich und jeder Tag ist mir von Gott geschenkt. Bevor ich aber sterbe, möchte ich alles in meinem Reiche in Ordnung bringen und eine von euch zur Erbin des Königreichs ernennen. Geht nun hinaus in die weite Welt und diejenige von euch, welche bei ihrer Rückkehr eine singende Rose mitbringt, soll meinen Thron erben und Königin sein über das ganze Land.«
Als die drei Töchter dies gehört hatten, nahmen sie weinend Abschied von ihrem alten Vater und gingen aufs Geratewohl hinaus ins fremde Land, jede auf einem anderen Wege.
Einmal traf es sich, daß die jüngste und schönste von ihnen durch einen finsteren Tannenwald zu gehen hatte. Da sangen allerlei Vögel durcheinander, es war eine rechte Freude ihnen zuzuhören. Bald aber fing es an zu dämmern und die Vöglein flogen in ihre Nester und nach und nach wurde es mäuschenstille. Da fing es auf einmal an zu tönen, so hell und laut und schön, wie es die Königstochter weder von Vögeln noch Menschen jemals gehört hatte, und sie dachte sich sogleich: »Das ist nichts anderes als die singende Rose.«
Sie ging nun eiligst auf die Stelle los, woher der Gesang zu tönen schien. Sie war noch nicht lange gegangen, da sah sie auf einem Felsen ein großes altertümliches Schloß, von dem die herrlichsten Töne in den Wald herab klangen. Mit allem Eifer stieg sie zum Schlosse hinan und zog einigemal an der Klinke. Da öffnete sich endlich knarrend das Tor und ein alter Mann mit langem, eisgrauem Barte schaute heraus.
»Was ist dein Begehren?« fragte er griesgrämig die erschrockene Jungfrau. »Ich möchte eine singende Rose,« antwortete diese, »habt ihr nicht eine solche in Eurem Garten?« »Jawohl«, antwortete der Alte. »Nun was verlangt Ihr dafür, wenn Ihr mir die selbe mitgebt?«
»Zu geben brauchst du mir gar nichts für die singende Rose. Du kannst die selbe heute noch haben, aber dafür werde ich in sieben Jahren kommen und dich mit mir in dieses mein Schloß nehmen.« »So bringt mir nur schnell diese kostbare Blume,« rief die Jungfrau erfreut, denn sie dachte nur an die singende Rose und an das Königreich, nicht aber an das, was nach sieben Jahren geschehen sollte.
Der Alte begab sich in das Schloß zurück und kam bald wieder mit einer vollen, glühenden Rose zurück, die sang so schön, daß der Jungfrau vor Freuden das Herz hüpfte. Sie streckte begierig die Hand danach aus und als sie die Blume in ihren Händen hatte, sprang sie wie ein Reh den Berg hinab, der Greis rief aber noch mit ernster Stimme nach: »Auf Wiedersehen in sieben Jahren.«
Die Jungfrau wanderte nun mit ihrer Rose die ganze Nacht durch den finstern Wald, denn die Freude über die singende Blume und das erworbene Königreich ließ sie alle Furcht vergessen. Die Rose sang aber auch auf dem ganzen Wege unausgesetzt fort und je lauter sie sang, desto freudiger und schneller eilte die Königstochter der Heimat zu.
Als sie da selbst angelangt war und dem Vater alles erzählte, was ihr begegnet war, und die Rose so herrlich sang, da war eine unermeßliche Freude im Schlosse und der König ließ ein Fest nach dem anderen anstellen. Bald kamen auch die beiden älteren Schwestern, allein sie hatten nichts gefunden und unverrichteter Sache wieder umkehren müssen.
Jetzt wurde die jüngste Tochter, welche die Rose gebracht hatte, Königin; der alte Vater aber führte noch die Regierung fort. Die königliche Familie lebte nun recht schöne, fröhliche Tage, -
allein schleunig verstrich Tag um Tag und Jahr um Jahr.
Endlich ging auch das siebente Jahr zu Ende und am ersten Morgen des achten erschien schon der Alte aus dem Schlosse vor dem Könige und verlangte von ihm diejenige von seinen Töchtern, welche die
singende Rose nach Hause gebracht habe.
Da stellte ihm der König die älteste Tochter vor, der Alte aber schüttelte unwillig den Kopf und murrte: »Das ist nicht die rechte.« Wie nun der König sah, daß da mit Betrug nichts auszurichten sei, übergab er ihm mit blutendem Herzen das jüngste und liebste seiner Kinder.
Die Königstochter mußte nun mit dem griesgrämigen Graubart in jenes Schloß wandern, aus dem sie einst die singende Rose geholt hatte. Das war für die schöne Jungfrau ein sehr trauriger Aufenthalt, denn sie hatte niemanden um sich als den alten Gebieter, und Tag und Nacht dachte sie mit großem Herzeleid an ihren Vater und ihre Schwestern.
Andere Freuden hatte sie freilich im Schlosse vollauf, aber nichts konnte sie trösten, weil sie keine liebe Gesellschaft um sich hatte und ihre Gedanken immer in der Heimat waren. Zudem waren ihr alle Türen und Kästen im Schlosse versperrt und der Alte gab ihr keinen einzigen Schlüssel in die Hände.
Einmal vernahm sie - weiß Gott wo! - ihre älteste Schwester wolle sich mit einem benachbarten Fürsten vermählen und in wenigen Tagen solle die Hochzeit sein. Da ließ es ihr nun keine Ruhe mehr, sie ging zu dem Alten und bat ihn um die Erlaubnis, bei der Hochzeit ihrer Schwester zugegen sein zu dürfen.
»Nun, so geh halt!« brummte der Alte. »Aber das sag ich dir zum voraus, den ganzen Hochzeitstag hindurch sollst du mir nicht lachen. Übertrittst du mein Gebot, so zerreiße ich dich in tausend Stücke. Ich selbst werde in einem fort an deiner Seite bleiben und sobald du nur zum Lachen den Mund verziehst, ist es um dich geschehen. Also wohlgemerkt!«
Der Königstochter schien dies ein leichtes und am bestimmten Tage erschien sie mit dem alten Graubart bei der Hochzeit ihrer Schwester. Es war große Freude im Königsschloss, als man die lange vermißte Königin wieder herankommen sah. Diese war recht fröhlich und machte sich den Tag wohl zunutze, aber sie vergaß auch das Gebot des Alten nicht und verzog nicht einmal den Mund zum Lachen.
Abends mußte sie wieder Abschied nehmen von den Ihrigen und trübselig ging sie mit ihrem Begleiter in das einsame Schloß zurück. Da fingen nun wieder langweilige Zeiten an, so daß die arme Königstochter immer froh war, wenn wieder ein Tag heimging.
Da kam nun einmal das Gerücht zu ihren Ohren, die andere Schwester werde auch in Kürze Hochzeit haben. Da ließ es ihr wieder keine Ruhe und sie fragte den Alten, ob sie denn nicht bei der Hochzeit ihrer zweitgeborenen Schwester zugegen sein dürfte. »So geh denn,« brummte der Alte, »aber diesmal darfst du den ganzen Tag kein Wort reden. Ich werde wieder mit dir gehen und dich fleißig beobachten.«
Der Königstochter schien das ein leichtes und am bestimmten Tage erschien sie mit dem alten Graubarte bei der Hochzeit ihrer Schwester und es war große Freude im Königsschloss, als man die lange vermißte Königin wieder einmal herankommen sah. Alles eilte ihr entgegen und begrüßte und bewillkommte sie und fragte sie um allerlei Dinge. Sie aber tat, als ob sie stumm wäre, und ließ kein Sterbenswörtlein über ihre schönen Lippen fahren.
Es war ihr dabei freilich auch nicht so wohl zumute wie das vorige Mal und abends, als alles ineinander schwätzte, so daß es ein Summen abgab wie in einem Bienenkorb, da entschlüpfte auch ihr ein Wörtlein. Der Alte stand rasch auf, nahm sie bei der Hand und führte sie aus dem Saale in sein einsames Schloß. Hier hatte nun wieder die Königstochter andere Dinge in Hülle und Fülle, aber alle liebe Gesellschaft mußte sie vermissen und es kam ihr wieder recht langweilig vor.
Eines Tages als sie eben traurig durch den Garten ging, in welchem einst jene Rose geblüht und gesungen hatte, kam der Alte auf sie zu und sagte mit ernster Miene: »Königliche Jungfrau! wenn du morgen, während es zwölf Uhr schlägt, in drei Streichen meinen Kopf abschlägst, so ist alles dein, was du im Schlosse findest, und du bist frei für immer!«
Die Königstochter faßte sich bei der Rede des Alten ein Herz und sie entschloß sich, das Wagestück auszuführen. Am anderen Tage - es war Samstag - ein wenig vor zwölf Uhr erschien der Alte vor ihr und entblößte seinen Nacken. Sie zog das Schwert, das sie sich umgehängt hatte, und als die Schloßuhr den ersten Streich hören ließ, schwang sie das Schwert zum ersten Mal, dann rasch nacheinander noch zweimal und der Kopf des Alten kugelte auf den Boden hin.
Aber sieh da, statt des Blutes hüpfte aus dem Kopf ein Schlüssel heraus, der alle Kästen und Türen im ganzen Schlosse öffnete. Da fand nun die Königstochter viele, viele Kostbarkeiten und war steinreich und frei für immer.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
WAS IST DAS SCHÖNSTE, STÄRKSTE UND REICHSTE ...

Stunden einmal zwei Bauern vor Gericht, ein reicher und ein armer. Sie zankten und schalten eine geraume Weile, bis endlich der Spaß dem Richter verleidete. Dieser war ein sehr kluger Herr und wußte sich oft durch einen geschickten Einfall die Leute vom Halse zu schaffen.
»Wißt ihr was?« sagte er zu den beiden Bauern, »laßt des Streites ein Ende sein und derjenige von euch, der bis morgen zu sagen weiß, was das Schönste, Stärkste und Reichste auf der Erde sei, der hat den Prozeß gewonnen.«
Wie der reiche Bauer das hörte, machte er sich voll Freude auf den Weg und sprach zu jedem, der ihm begegnete, höchst vergnügt von der Weisheit und Gerechtigkeit des Richters. »Denn,« dachte er in seinem törichten Sinne, »daß mein Weib das Schönste auf der Erde ist und daß meine Ochsen das Stärkste sind und ich selber der Reichste bin, das ist so klar wie die Sonne.«
Der arme Bauer hingegen schnitt bei dem Spruche des Richters ein langes Gesicht, blieb eine Weile stehen und machte sich endlich langsam und verdrießlich auf den Weg. Er murrte bei sich selbst über die Torheit und Ungerechtigkeit des Richters, und wenn ihn jemand ansprach und fragte, warum er so unwillig dreinschaue, so ging jedesmal das nämliche Donnerwetter los.
Bald hatte er seinen Hof erreicht. Die Tochter arbeitete eben im Garten, und als sie den Vater mit hängendem Kopfe daher schlottern sah, dachte sie sich sogleich: »Holla, heut ist es nicht gut ausgegangen.« Denn sie hatte die Wetterzeichen an der Stirne des Alten von Kindheit auf genau kennen gelernt. »Schau Vater,« rief sie mit scheinbarer Gleichgültigkeit, »so herrlich sind uns die Krautköpfe noch nie geraten. Sieh da, so große Kugeln und kein Würmlein darauf!«
»Was Krautköpfe,« schrie der Alte zornig, »der Richter ist ein Krautkopf.« »Habt ihr es verspielt, Vater?« fragte das Mädel. »Verspielt hab ich es nicht, aber bis morgen soll ich dem Richter sagen, was das Schönste sei auf der lieben Erde und was das Stärkste und was das Reichste. Errate ich es nicht auf ein Haar, so ist alles hin.«
»Seid gescheit, Vater,« rief freudig die Tochter, »das Schönste ist ja der Frühling, das Stärkste der Erdboden und das Reichste der Herbst.« »Du magst recht haben,« meinte der Alte, nachdem er, auf den Gartenzaun gestützt, eine Zeit lang nachgedacht hatte.
Am anderen Tage traten die beiden Bauern wieder vor den Richter. Noch bevor dieser Zeit hatte zu fragen, platzte der Reiche heraus: »Das Schönste, Herr Richter, ist mein Weib, das Stärkste sind meine Ochsen und das Reichste bin ich selbst. Den Preis habe ich gewonnen!«
»Und was sagst du auf meine gestrige Frage?« so sagte der Richter, zum Armen sich wendend. »Heraus mit der Sprache!« »Ich meine, das Schönste sei der Frühling, das Stärkste der Erdboden, und das Reichste der Herbst.« »Brav,« rief der Richter und klopfte ihm auf die Achsel, »du hast es erraten und den Prozeß gewonnen. Aber bevor du nach Hause gehst, mußt du mir sagen, ob das dein eigener Einfall ist oder nicht.«
»Nicht der meinige,« sagte der Bauer, »sondern meine Tochter daheim hat mir so gut geraten!« »Nun so sage deiner klugen Tochter, wenn sie imstande ist, unangekleidet und doch nicht nackt, nicht bei Tage und nicht bei Nacht, nicht auf Straßen und nicht auf Seitenwegen von der Heimat zu mir in die Stadt zu kommen, so soll sie meine Frau werden!« Dem armen Bauer schaute die Freude aus den Augen heraus und er versprach, seiner Tochter alles getreulich auszurichten.
Beide Bauern machten sich auf den Weg nach Hause. Aber heute war es anders als gestern. Der Arme sprach zu jedem, der ihm begegnete, fröhlichen Mutes von der Weisheit und Gerechtigkeit des Richters, der Reiche hingegen murrte bei sich selbst über dessen Torheit und Ungerechtigkeit, und wenn ihn jemand ansprach und fragte, warum er so unwillig dreinschaue, so ging jedesmal das nämliche Donnerwetter los.
Als der Arme nach Hause kam, hörte er seine Tochter schon zum Fenster heraus rufen: »Nicht wahr, Vater, ich habe es erraten!« »Freilich hast du es erraten, du Blitzmädel. Und dann noch etwas!« »Was denn, Vater!« »Der Herr Richter läßt dir sagen: Wenn du imstande bist, unangekleidet und doch nicht nackt, nicht bei Tage und nicht bei Nacht, nicht auf der Straße und nicht auf Seitenwegen von der Heimat zu ihm in die Stadt zu kommen, so sollst du seine Frau werden!«
»Ich Frau Richterin werden!« rief überrascht das Mädel, »das wäre gar nicht übel, da muß ich meine Klugheit schon recht zeigen!« Sie dachte nun nach, wie sie die Sache recht gescheit anfangen sollte, und kam bald auf einen klugen Einfall.
Ein paar Stunden, bevor der Tag heimging, ließ sie den Weg von der Heimat bis zur Stadt mit Brettern belegen, warf sich ein Fischernetz um und so ging sie bei der Abenddämmerung über den Bretterweg zum Richter. Dieser, hocherfreut über die Klugheit des Mädchens, hielt getreulich sein Wort und in einem Monat wurde die Hochzeit mit aller Pracht gefeiert.
Nur eine einzige Bedingung hatte der Bräutigam seiner Braut gesetzt: sie sollte nämlich niemandem, der vor ihm einen Prozeß zu führen habe, irgendeinen Rat erteilen.
Da kam eines Tages ein Bauer zur Frau Richterin und erzählte ihr, daß er mit seinem Nachbar viel zu streiten habe und daß er eben jetzt deswegen in großer Verlegenheit sei. Er bat sie daher, sie möchte ihm einen weisen Rat geben. Die Richterin weigerte sich anfangs standhaft und erklärte dem Bauer weitläufig, daß sie durch einen solchen Beistand ihren Rang und ihren Mann verlieren würde.
Da fing der Bauer an, alle weisen Räte und Aussprüche, die er je von ihr gehört hatte, aufzuzählen, und nun hatte er den rechten Fleck nicht verfehlt. Die Frau ließ nun ein Wort nach dem anderen fallen und endlich sagte sie ihre Meinung rund heraus. »Aber sage beileibe niemandem, wer dir geraten hat! - Hörst du!« rief sie dem Bauer noch nach.
Dieser stellte sich nun vor Gericht und sein Gegner mußte der Weisheit der Frau Richterin unterliegen. Dem Richter aber kam es gleich in den Sinn, woher etwa der Bauer seine Klugheit geholt haben möchte. Er nahm ihn daher beiseite und fragte so lange hin und her, bis er gestand, daß des Richters Gemahlin seine Ratgeberin gewesen sei. »Mein Weib muß im Augenblick aus dem Hause!« schrie der Richter im grimmigsten Zorne.
Seine Frau aber, die dies gehört hatte, ließ sich nicht so leicht irre machen, trat mutig in die Gerichtsstube und bat ihren Mann recht liebreich, er möchte sie doch noch einmal an seiner Seite essen und dann beim Weggehen das Liebste mit sich nehmen lassen. Das wurde ihr gestattet.
Als es Essenszeit war, setzten sich die beiden Eheleute zusammen; sie konnte hie und da ein spöttisches Lächeln nicht verhalten, er aber suchte seinen Zorn mit Wein zu mildern. Er tat aber des Guten zu viel, nickte bald einigemal mit dem Kopfe und begann endlich ganz kräftig zu schnarchen.
Nun packte die Richterin ihren Mann - der war ja ihr Liebstes - auf den Wagen und fuhr damit auf und davon. Als die holprige Straße das Räuschchen herausgerüttelt hatte, erwachte der Richter und er durfte nicht erst seine Frau fragen, was geschehen sei.
Er merkte schon, daß sie einmal wieder die klügere gespielt habe, bat sie um Verzeihung und führte sie wieder nach Hause. Sie lebten noch viele, viele Jahre in Frieden und Eintracht beisammen und der das Geschichtlein erzählt hat, möchte nicht wünschen, daß alle Weiber so klug wären wie die Frau Richterin.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
WERWEISS ...

Vor undenklichen Zeiten hauste einmal ein Wirt nahe bei einem Walde. Er war sehr geizig und tat mit dem kleinsten Dinge, als ob es Goldes wert wäre. Zur selben Zeit lebte ein mächtiger, reicher König, und der schaute das Geld nicht an, sondern lebte in Saus und Braus.
Einmal schrieb der König eine Jagd aus und setzte für das beste Weidstück einen herrlichen Lohn aus. Wenn einer von Adel das beste Wild erjagen würde, sollte er des Königs Tochter zur Frau erhalten, wenn ein Gemeiner, so sollte dieser mit Gold reichlich belohnt werden.
Der Tag der Jagd brach an und auch unser Wirt war dabei, denn die Belohnung stach ihm zu sehr in die Augen. Den ganzen Tag wurde gejagt und geblasen und die Hunde bellten, daß es in den Wäldern einen Höllenlärm gab. Abends war die Jagd vollendet und den Preis erhielt ein Graf, der einen stolzen Hirsch mit goldenem Geweih erjagt hatte. Der Wirt war aber mit seinem Tagewerk auch nicht unzufrieden, denn er hatte ein wildes Männlein, das ein goldenes Schwert trug, eingefangen und mit sich heimgebracht.
Das Männlein war so lieb und nett, daß der Wirt einen Glaskasten über das selbe machen ließ und ihn auf den Kasten stellte, und wenn Jemand den Wirt besuchte, so mußte er auch das wilde Männlein im Glaskasten sehen.
Die Wirtsleute hatten auch ein Söhnlein. Das war ein munterer, feiner Knabe und das einzige Kind im Wirtshaus. Das wilde Männlein gefiel ihm gar über die Maßen wohl und stundenlang stand er vor dem Kasten und konnte sich an dem kleinen Wichte und an dem funkelnden Schwert nicht satt sehen.
»Wenn ich nur auch so ein schönes, goldenes Schwert hätte,« dachte sich immer der Knabe, denn laut zu sagen, wagte er es nicht seines geizigen Vaters wegen. Als er einmal allein in der Kammer war und das Männlein im Glaskasten gar lieb und freundlich tat, gewann der Knabe ein Herz und sagte: »O liebes Mannl! schenke mir doch dein goldenes Schwert! Ich bitte dich gar schön.«
»Gerne gebe ich es dir,« antwortete das Männlein, »doch nur unter einer Bedingung. Du mußt mich aus dem Kasten lassen und es niemandem sagen. Tust du das, so sollst du mein Schwert haben.« Der Knabe war mit dieser Antwort zufrieden und versprach dem Männlein, was es verlangte.
Aber nun fragte es sich, wie er zum Schlüssel des Glaskastens gelangen könnte, denn die Mutter mußte ihn wie einen Schatz bewahren und trug ihn immer bei sich. Der Knabe war gescheit und wußte bald Rat. Er ging zur Mutter und bat sie, ihm Läuse zu suchen.
Die Mutter hatte heute am willigen Kinde die größte Freude, denn sonst wollte der Knabe sich diese Arbeit nie gefallen lassen. Die Mutter kämmte ihm nun das Haar aus und suchte und suchte, und während sie ihr ganzes Augenmerk auf die kleinen Tierlein gerichtet hatte, huschte der Knabe mit seiner Hand in die Rocktasche der Mutter und nahm ihr unbemerkt den Schlüssel heraus.
Der Bursche war nun froher Dinge, lief in die Kammer, wo das kleine Männlein stund, und ließ es aus dem Kasten. Das Männlein hielt auch sein Wort, dankte seinem kleinen Befreier und schenkte ihm das goldene Schwert. Darauf sprang es zum Fenster hinaus und war in einem Nu in den Wald verschwunden.
Der Wirtsknabe mit dem goldenen Schwert wußte nun vor Freude fast nicht, was er anfangen sollte, stellte sich in den gläsernen Kasten hinein und tat gerade so, wie das Männchen. Da kam aber die Mutter dazu und die erschrak nicht wenig, als sie ihren Buben im Glaskasten und vom Männlein keine Spur mehr sah.
Sie rief gleich den Vater herbei, und als dieser sah, was geschehen war, holte er sich Birken Ruten, nahm den Knaben aus dem Kasten und schlug ihn so, daß er keinem Menschen mehr glich. Den so übel zugerichteten Kleinen warf er dann über die Mauer in den Anger hinaus mit den Worten: »Nun packe dich und geh zu deinem wilden Mannl hinaus!«
Der Knabe lag nun lange, lange im grünen Grase draußen, ohne zu sich zu kommen. Als er endlich die Augen aufschlug, stund das Männchen vor ihm, hielt ihn und nahm ihn zu sich. Es führte ihn in den kühlen Wald hinaus, gab ihm alles, was er brauchte, und zog ihn auf wie sein eigenes Kind.
Der Knabe wuchs zusehends und ward immer schöner und stärker. Als er groß und stark genug war, um eine Lanze schwingen zu können, lehrte ihn das Männlein die Ritterspiele und der Bube hatte seine größte Freude daran und lernte, daß es eine Lust war.
Als er nun ausgelernt hatte, gab ihm das Männlein ein neues gar läppisches Kleid und ein Schwert und sagte zu ihm: »Du bist nun erwachsen und sollst auch die Welt sehen. Geh nun aus dem Walde und suche die Königsstadt. Hast du diese gefunden, so diene an dem Hofe des Königs. Wenn dich aber jemand fragt, wer du seiest, so sage immer: 'Wer weiß?' und schweige sonst. Wenn dir aber etwas fehlt, so rufe mich. Ich werde dann gewiß kommen und dir helfen.«
Mit diesen Worten entließ er den Wirtssohn aus dem Walde. Der war gar wunderlich aufgelegt, als er wieder ins Freie hinaus kam. Er war traurig und froh zugleich und so wanderte er weiter, bis er zur Königsburg kam.
Als ihn dort der Wächter sah, mußte dieser laut auflachen, denn der Junge war gar absonderlich gekleidet und sah aus wie ein Narr. Der Knabe wollte nun durchaus zum Könige, die Wächter aber ließen ihn nicht und hatten ihn zum besten. Sie taten ihm allerlei Fragen und er antwortete immer nur: »Wer weiß?« und deswegen hießen sie ihn nur Werweiß.
Einem Diener gefiel aber der schöne, rätselhafte Jüngling und dieser meldete ihn dem König, der nun den Werweiß zu sich kommen ließ. Der König gewann nun den wunderlichen Jungen lieb und ließ ihn in der Küche anstellen. Werweiß tat nun Dienste als Küchenjunge, mußte Wasser tragen, Feuer machen, Holz spalten und Töpfe und Teller spülen.
Das war aber dem Werweiß zu schlecht und er hätte aus der Küche wegkommen mögen. Deswegen zerschlug er, als er einmal allein war, alles Küchengeschirr und trat die Scherben mit Füßen. Da kam aber das kleine Waldmännlein, verwies ihm dieses Treiben und machte alles wieder ganz.
Werweiß war aber damit nicht zufrieden und zertrümmerte noch zweimal das Küchengeräte, Teller, Töpfe, Schüsseln, Häfen, Pfannen und Pfännlein. Aber immer kam das winzige Männlein und machte das Zertrümmerte wieder ganz. Das dritte Mal hatte ein Küchenjunge gesehen, wie Werweiß das Geschirr zu Stücken schlug, und dieser sagte es dem Koche. Der Koch war aber darüber böse und jagte den Werweiß aus der Küche in den Stall hinunter.
Der frühere Küchenjunge war nun Stallknecht und mußte die Pferde füttern und tränken, sie striegeln und waschen. Das gefiel aber dem Werweiß gar nicht, denn er wäre lieber darauf herumgeritten und hätte lieber Ritterspiele getrieben.
In dieser Zeit war der König in den Krieg gezogen, denn seine Feinde waren in das Land eingefallen und verbrannten die Dörfer und verwüsteten die Saatfelder. Da kam es zu einer großen Schlacht und der König hätte bald den kürzeren gezogen.
Wie der Werweiß im Stalle hörte, daß eine sehr bedenkliche Schlacht geschlagen werden sollte, rief er dem Waldmännlein und Waldmännlein kam und brachte dem Werweiß fürstliche Kleider und ein ganzes Heer von Männlein. Werweiß zog die schönen Kleider an, schwang sich auf ein mutiges Roß und kam dem Könige zu Hilfe.
Als die Feinde den unerwarteten Helfer des Königs und das neue Heer sahen, verloren sie den Mut und warfen sich in die Flucht. Sobald aber die Feinde flüchtig wurden, gab der Werweiß seinem Rosse die Sporen und jagte fort nach Hause und die kleinen Männlein mit ihm. Der König wollte dem unbekannten Retter danken, allein er war samt Roß und Rüstung nicht mehr zu sehen. Wie der König als Sieger nach Hause kam, war Werweiß schon wieder im Stalle und putzte die Pferde.
Bald brach ein neuer Krieg aus und das Männlein brachte ein Heer und Werweiß kam damit dem Könige zu Hilfe und verhalf ihm zum Siege. Nach vollendeter Schlacht wollte der König dem Retter danken, allein er war nirgends mehr zu sehen, denn er war wie im Sturm davon geeilt. Den König wunderte es wohl oft, wer seine Helfer gewesen waren, allein er mochte forschen und fragen wie er wollte, nirgends konnte er eine Spur von den schönen Fürsten, die ihm zu Hilfe gekommen waren, entdecken.
Und wie es diese Zweimal gegangen war, so ging es auch das dritte Mal. Es kam wieder ein Fürst mit seinem Heere und schlug die Feinde und ritt dann mit seinen Mannen so schnell als ein Wetter davon. - Werweiß war aber, als der König heimkehrte, schon wieder im Stalle und putzte die Pferde.
Allein das Stallknechtsein wollte ihm gar nicht behagen und er dachte: »Wenn ich doch aus dem verfluchten Stall draußen wäre!« Wie sollte er aber da hinaus kommen?! - Er ließ alle Pferde los und trieb sie gegeneinander. Da schlugen und traten sie sich blutig, daß es ein Grausen war. »Wenn die anderen das sehen, wird mich der Stallmeister aus dem Stalle jagen«, meinte Werweiß.
Allein der Junge hatte sich verrechnet. Denn es kam das Waldmännlein und machte alle Pferde wieder gesund, als ob ihnen gar nichts geschehen wäre.
Werweiß war aber deswegen im Stalle nicht zufriedener und ließ die Pferde noch zweimal los und diese schlugen sich mit den Hufen so blutig, daß das Blut über den Boden rann.
Allein es half ihm nichts, denn es kam immer das kleine Waldmännlein und machte die Pferde gesund und heilte die Wunden. Das dritte Mal hatte aber der Stallmeister den Höllenlärm, den die los gelassenen Pferde im Stalle machten, gehört, wurde böse und jagte den Werweiß aus dem Stalle.
Der Junge war nun ohne Dienst und wußte nicht, wo an und wo aus. Da erbarmte sich seiner der Gärtner und nahm ihn als Gartenjungen an. Werweiß mußte nun im Garten helfen, die Pflanzen bewässern, die welken Blätter abpflücken und die Blumen pflegen, und das gefiel ihm besser als in der Küche helfen und die Rosse striegeln.
Da stund er wohl oft bei den Rosen, und wenn er in ihren Kelch sah und ihren Duft einatmete, wurde ihm so wohl, daß er mit keinem König getauscht hätte. Er trug, wenn er im Garten war, immer einen Strohhut und hatte ihn so in das Gesicht gedrückt, daß seine schönen, goldenen Haare fast gar nicht gesehen wurden.
Und wenn Werweiß so die Blumen begoß oder bei ihnen sinnend stand oder jätete, da saß die älteste Königstochter wohl auf dem marmornen Söller droben und schaute in den Garten hernieder. Und so oft sie den Gartenjungen sah, konnte sie fast ihre Augen nicht wieder wegwenden, denn er gefiel ihr so wohl, weil er so schön wie der Mai war.
Hatte sie ihn bei Tage gesehen, dann kam er ihr auch im Schlafe vor und es träumten ihr vom Gärtnerknaben die wunderlichsten Dinge. Einmal sah sie ihn wieder im Garten drunten bei den Blumen und da konnte sie nicht mehr droben bleiben, sondern mußte hinuntersteigen.
Sie ging zu ihm hin und bat um einen Blumenstrauß. Allein wie sie auch bat, Werweiß gab ihr keine Blumen, denn er wollte ihnen nicht das Leben nehmen, und gab ihr auch keine Antwort. Wie alles Bitten und Flehen nichts half, da wurde die Königstochter böse und ging zu den Rosen hin und riß die schönsten davon ab.
Als Werweiß dies sah, vergaß er das Gebot des Waldmännleins und sprach: »Reiße nicht die Rosen ab, denn« - - da fiel ihm aber die Rede des Männleins, die er im Zorne vergessen hatte, wieder ein und er schwieg und tat, als ob er sich schämte. Wie er so dastund und leicht errötet war, konnte ihm die Königstochter nicht mehr böse sein.
Sie ging ihm näher und sprach: »Junge, nimm doch einmal deinen Hut ab, damit ich deine Haare sehen kann, ich bitte dich gar schön.« Werweiß stellte sich aber, als ob er kein Wort verstünde. Als die schöne Königstochter das sah, meinte sie wirklich, er verstehe ihre Rede nicht, ging auf ihn zu und wollte ihm den Strohhut lüften. Das ließ aber der schöne Gärtnerjunge nicht geschehen und lief auf und davon, denn er fürchtete, an seinen Locken erkannt zu werden.
Traurig und sinnend stund die Prinzeß bei den Rosen und ging dann auf ihr Zimmer zurück, um vom rätselhaften Jüngling zu träumen. Sie stund seit dieser Zeit noch öfter als früher auf dem Söller oder am Fenster und sah in den Garten. Und wenn sie den Jungen drunten sah, vergaß sie Leid und Weh und fühlte sich gar glücklich.
Indessen war seit den Kriegen fast ein Jahr vorübergegangen, und es stunden die Bäume wieder mit goldenen oder roten Blättern da und schüttelten sie in das bereifte Gras. Da dachte der König wieder an die drei Schlachten und an die drei Könige, die ihm zu Hilfe gekommen waren. Wohl oft hatte er an die schönen Helden gedacht und Boten ausgesandt, um sie aufzufinden, allein alles Suchen war vergebens.
Da fiel ihm ein, ein großes Hochzeitsfest zu veranstalten, und wenn die drei Könige kommen würden, jedem von ihnen eine seiner schönen Töchter zu geben. Er bereitete also ein großes königliches Fest, das zwei Tage dauern sollte, und lud aus nah und fern Gäste ein. Selbst in die Nachbarländer sandte er Herolde und ließ Fürsten und Grafen zur Hochzeit laden.
Seinen Töchtern aber gab er wundervolle prächtige Geschenke. Diese sollten sie den Königen als ihren Erwählten geben. Wie der Tag des Festes anbrach, gab es ein Reiten und Fahren, als ob die wilde Fahrt los wäre. Droben im Königsschloss waren alle Türen und Tore bekränzt und im Saale wurde musiziert, als ob man im Himmel wäre.
Der König und seine drei schönen Töchter empfingen oben im Saale die Ankommenden und waren so schön gekleidet, daß man nichts Schöneres sehen mochte. Es kam der Mittag, allein die drei Könige kamen nicht. Man setzte sich zur Tafel und aß und trank, aber der König war schwermütig und konnte nicht heiter werden. So ging es bis zum Abende.
Da gingen die zwei jüngeren Töchter zum Vater und sagten: »Was sollen wir mit den prächtigen Geschenken tun? Die Könige kommen doch nicht mehr.« Da erwiderte der König: »Wegen meiner was ihr wollt, arme Kinder.«
Die Älteste saß aber ruhig und ernst da und gab ihr Geschenk keinem. Sie dachte an den schönen Gärtner, der ihr so wohl gefiel und den sie heute noch nicht gesehen hatte. Die Schwestern merkten das und neckten sie mit dem Gärtnertroll, wie sie ihn nannten. Sie erwiderte kein Wort.
Als man vom Tische aufgestanden war, holte sie das Geschenk und stieg in den Garten hinunter. Dort stund Werweiß sinnend bei den Rosen und war gar traurig. Wie sie ihn sah, hatte sie die größte Freude und gab ihm das prächtige Geschenk. Er küßte ihre Hand und wollte danken, aber da fiel ihm die Rede des Waldmännleins ein und er schwieg. -
Traurig gingen Werweiß und die Königstochter voneinander, denn es war ihnen gar schwer ums Herz. Noch trauriger war aber der alte König und es fraß ihm der Gram fast das Herz ab, weil morgen Hochzeit sein sollte und kein Bräutigam sich sehen ließ. Er konnte die ganze Nacht kein Auge schließen und seine Haare bleichten vor Kummer und Sorge über Nacht.
Während aber der König so ohne Schlaf in seinem Bette lag, kam das Waldmännlein zum Werweiß in die Schlafkammer und brachte gar prächtige, goldgestickte Kleider, wie sie nur Könige tragen. Werweiß mußte gleich aufstehen und sich ankleiden. Dann führte ihn das graue Männlein in den Hof hinaus und da saßen hundert und hundert Reiter auf stolzen Rossen.
»Das ist alles dein«, sprach das Männchen. »Nun melde dich dem Könige und wirb um seine Tochter.« So sprach das Männlein und verschwand. Da bliesen einige Reiter in die Trompeten, und wie dies der König hörte, eilte er ans Fenster. Da sah er den König, der ihm die Schlachten gewonnen hatte, und seine Mannen und er hätte vor Freude und Staunen vergehen mögen.
Er setzte sich nun gleich die Krone auf, eilte in den Hof hinunter und umarmte den Werweiß. Dieser entschuldigte sich aber, daß er erst heute habe kommen können, und der König war des zufrieden. Er führte nun den schönen Ritter hinauf in den Saal und bot ihm eine seiner Töchter an.
Werweiß wählte sich die Älteste und da mußte sie neben ihm sitzen und war so glücklich, daß sie selbst mit den Engeln im Himmel droben nicht getauscht hätte, weil ihr Bräutigam dem Gärtnerjungen so glich wie ein Apfel dem anderen. Es gab nun eine lustige Hochzeit, wie noch nie eine gefeiert worden ist, so lange der Himmel blau und das Gras grün war.
Und wie man so beisammen saß, sich Gesundheit trank und die Braut nie einen Blick von ihrem schönen Bräutigam wandte, öffneten sich plötzlich die Tore und ein schöner, stolzer König, dem der graue Bart bis auf die Brust niederwallte, trat mit einem großen Gefolge ein. Er eilte auf Werweiß zu und küßte ihn.
Der König mit dem Barte war aber niemand anderer, als das Waldmännlein, das endlich erlöst war, weil Werweiß sein Gebot so treu befolgt hatte. Nun ging es noch lustiger her als früher und die Freude hatte kein Maß.
Werweiß und die älteste Königstochter gaben aber ein recht glückliches Paar ab und lebten bald beim Waldkönig, bald auf der Burg des Vaters. Als die Könige aber starben, erbte Werweiß beide Königreiche und war der reichste und glücklichste Fürst, der je lebte.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
RIESE UND HIRTE ...
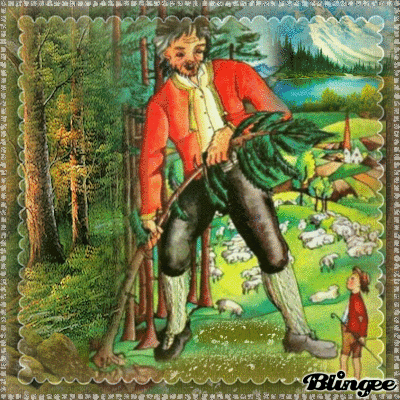
In alter grauer Zeit kam einmal ein Riese in ein Tal und der war so stark, daß ihm fast alles möglich war. Er hob ganze Felsen auf und schleuderte sie wie einen kleinen Stein so weit, daß man sie fast nicht mehr sah. Einmal kam er zu einem Hirten und fragte ihn: »Kannst du einen Baum samt den Wurzeln ausreißen?« Und mit diesen Worten riß er eine Fichte, die einzeln da stand, aus dem Boden und kehrte das Unterste zu oberst.
Der Hirte, der dies sah, besann sich nicht lange und antwortete: »Das ist keine Kunst, ich kann es auch.« Wie dies der Riese gehört hatte, ließ er das gut sein und fragte weiter: »Kannst du
aber auch aus einem Stein Wasser herauspressen?«
Bei diesen Worten nahm er einen aschtrockenen Stein her und preßte und preßte so lange, bis endlich das klarste Wasser aus dem Stein heraus rann.
Der Hirte sah zu und sagte: »Ja, das ist keine Kunst, ich kann es auch«. Da ließ der Riese das Stein pressen wieder gut sein und fragte zum dritten Male: »Kannst du einen Stein so hoch werfen, daß er erst nach einer Viertelstunde wieder zurückkommt?«
Und er warf einen Stein so hoch in die Luft, daß er erst nach einer Viertelstunde wieder auf die Erde fiel. Der Hirte hatte zugesehen und sprach lächelnd: »Das ist keine Kunst, ich kann es auch. Morgen will ich dir alles auch machen und vielleicht noch besser.« Mit diesen Worten gingen sie auseinander.
Der Hirte kehrte aber wieder zurück und höhlte fürs erste den Baum aus, den er ausreißen wollte, deckte ihn aber mit der Rinde so fleißig zu, daß man gar nichts merkte. Fürs zweite schaute er sich um ein großes Stück alten Käses und fürs dritte fing er sich einen Vogel.
Als es am anderen Tage noch früh am Morgen war, da kamen schon beide am verabredeten Platze zusammen. Da sprach der Hirte: »Ich kann den Baum nicht bloß ausreißen, sondern ihn auch umbiegen.« Er bog nun den ausgehöhlten Baum um, bis er endlich krachte und brach.
Dann sagte er: »Nun will ich aus einem Stein das hellichte Wasser pressen.« - Er nahm nun statt des Steines den alten grauen Käslaib und drückte ihn, bis das hellichte Naß ihm an den Fingern herab rann. Da machte der Riese große, weite Augen und sprach: »Du bist stärker, als ich gemeint habe. Aber nun mache auch das dritte!«
Da antwortete der Hirte: »Ich kann den Stein noch höher werfen als du. Der deinige ist in einer Viertelstunde wieder herabgefallen. Wenn ich aber aus vollen Leibeskräften einen Stein werfe, kehrt er gar nicht mehr wieder.« Nach diesen Worten bückte er sich nieder und tat, als ob er einen Stein aufheben würde. In der Tat nahm er aber den Vogel, griff aus und warf ihn empor. Dieser spreizte aber seine leichten braunen Flügel aus und flog und flog und kehrte nie mehr wieder.
Der dumme Riese glaubte aber, es sei wirklich ein Stein gewesen und wartete mit aufgespanntem Munde aufs Zurückfallen des selben. Als er aber nie zur Erde fiel, glaubte er, der Hirt sei stärker als er und gab sich besiegt.
Hier hat auch das Märchen ein Ende und sagt nicht, was nachher der Riese getan hat.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Inntal
GOLDENER ...
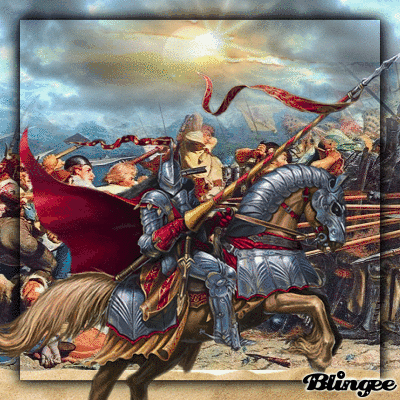
Ein armer, armer Knabe ging einmal durch den grünen Wald. Er war sehr traurig und in den Augen stunden ihm Tränen. Wie er so hinwanderte und es ihm ums Herz recht schwer war, stund plötzlich ein uraltes Weibchen vor ihm. Ihre Haare waren grau wie der Baumbart und in ihrem Munde wackelte kein Zahn mehr.
»Warum bist du so traurig, mein Kind?« fragte im traulichen Tone das Mütterchen und blickte den Knaben mitleidig an. Der Junge faßte sich nun ein Herz und erwiderte: »Ja, das ist leicht zu erraten. Mein Vater ist tot und meine Mutter kann nicht so viel verdienen, um uns beiden den nötigen Unterhalt zu verschaffen. Deswegen muß ich betteln gehen und das tue ich so ungern, denn die Leute schauen mich dann oft wie einen Schelm an.«
Das alte Mütterchen schien noch mehr Mitleid mit dem armen Knaben zu fühlen und sprach: »Wenn nur das ist, so soll dir bald geholfen sein. Komm nur mit mir.« Und sie nahm den Knaben mit sich und führte ihn waldein. Sie mochten miteinander eine halbe Stunde gegangen sein, als sie zu einem großen, schönen Haus kamen, das ganz aus Marmelsteinen gebaut und so weiß wie Schnee war.
Das Mütterchen ging voraus hinein und der Knabe folgte. Er hatte die größte Freude, denn ein so schönes Haus hatte er noch nie gesehen. Sie kamen in einen großen Saal und da sprach das Mütterchen zum neugierigen Knaben, der Augen machte, als ob er aus dem Himmel gefallen wäre: »Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Du hast sonst nichts zu tun, als das Feuer unterm Kessel in der Küche nachzuschüren.
Zwei Dinge mußt du mir aber hoch und teuer versprechen. Du darfst nie in den Kessel hineinsehen und auch nie das Kästchen öffnen, das neben dem Herd an der Mauer sich befindet. Befolgst du alles getreulich, so wirst du am Ende des Jahres einen großen Lohn bekommen, denn nach einem Jahre wirst du mich wieder sehen.«
Der Knabe war mit dem Antrage ganz zufrieden und versprach, alles fleißig zu befolgen. Das Mütterchen führte ihn nun in die Küche, zeigte ihm den Kessel und das Kästchen und ging dann fort.
Der Knabe war nun allein im Schlosse und lebte wie ein Graf. Er hatte Speise und Trank im Überfluss und in der Nacht ein weiches Bettlein. Er kam aber auch getreulich seinem Dienste nach und schürte, daß es eine Lust war. Das Feuer brannte und prasselte immer munter fort und im Kessel sott und brodelte es wie an einem Kirchtage.
So verging ein Tag nach dem anderen und ehe es der Knabe dachte, war ein Jahr vorüber gegangen und das alte Mütterchen stand vor ihm. »Du hast brav gedient,« sprach sie und gab dem Knaben hundertundfünfzig Goldgulden. »Wenn du so fortfährst und fleißig bist, werde ich dir, wenn ich wieder komme, noch so viel geben.«
Kaum hatte sie dieses gesagt, so war sie wieder fort und der Knabe wußte nicht, wohin sie gegangen war. Er war über seinen Lohn hoch erfreut und kochte fleißiger als im ersten Jahre. Er schürte und schürte und lebte sonst froh und glücklich. So verging ein Tag nach dem anderen und ehe er es meinte, war ein Jahr vorüber und das Mütterchen stund vor ihm.
Sie schien eine große Freude zu haben und sprach: »Du hast dich brav gehalten, mein Kind! Wenn du so fortfährst und so fleißig bist, werde ich dir in Zukunft das Doppelte geben.« Sie gab ihm dann die dreihundert Goldgulden und verschwand wieder.
Der Knabe diente wieder im Schlosse fort und schürte, daß das Feuer lustig aufloderte und an ein Auslöschen gar nicht zu denken war. So verging wieder ein Jahr und am letzten Tage des selben kam das Mütterchen, sah alles wohl bestellt und sprach Beifall lächelnd: »Du bist ein braver Junge. Nimm hier die sechshundert Goldgulden und wenn du noch ein Jahr mir so treulich und redlich dienst, werde ich dir noch zweimal soviel Geld geben.«
Das Mütterchen hatte es gesagt und verschwand. Der Knabe war über die sechshundert Goldstücke hoch erfreut und nahm sich vor recht fleißig zu sein. Allein so sehr er sich auch befliss, recht folgsam und treu zu sein, so kam ihm doch immer der Gedanke, was etwa im Kessel und im Kästchen sein möchte.
»Was würde auch dahinter sein, wenn ich hineingucken täte,« dachte er sich oft, tat es aber dennoch nicht. Einmal aber kam ihm der Gedanke immer von neuem und er sah endlich in den Kessel hinein. Allein er konnte nichts sehen. Da langte er den Finger hinein und sah, als er ihn herausgezogen hatte, daß dieser ganz golden war.
Was war nun zu tun? Er wusch ihn ab, schabte ihn ab - allein alles war umsonst. Da wußte er kein anderes Mittel und verband mit einem kleinen Stückchen Leinwand den goldenen Finger, damit ihn die Alte nicht sehen sollte. Dann öffnete er das Kästchen, das neben dem Herde an der Mauer war, und da fand er ein Buch, in dem geschrieben war: »Wer das Buch hat, kann verlangen, was er mag und will.«
Er nahm nun das Zauberbuch heraus und steckte es in den Hosensack, denn er dachte: »Das kann ich gewiß auch brauchen.« Kaum hatte er aber das Buch zu sich gesteckt, da stund das alte Mütterchen vor ihm und war gar zornig. Ihre Augen waren vor Zorn ganz feuerrot. Sie jagte ihn aus der Küche und warf ihm den Kessel nach, gerade auf den Kopf. Davon wurden seine Haare so schön gelb, daß man meinte, sie seien eitel Gold.
Der Knabe ging nun durch den Wald und wollte sich anderswo ein Unterkommen suchen. Damit aber sein Haar nicht beschmutzt werde, bedeckte er sein Haupt mit einer Baumrinde, die er nie mehr abnahm.
Er war schon lange gegangen und der Abend dunkelte schon ins Tal herein, als er endlich ins Freie kam. Da sah er nun die schönsten Gärten und in der Mitte stand ein stolzes Schloß. Das Schloß gehörte dem König und dieser wohnte darin mit seiner Tochter und vielen, vielen Dienern und Dienerinnen.
Der Knabe ging auf das Schloß zu und fragte sich dort um einen Dienst an. Er gefiel dem Schaffner und wurde anfangs zum Schafe hüten angestellt. Er war zufrieden und hütete am Hügel draußen die Schafe und Lämmlein. Und sieh, die Tiere wurden immer schöner und nie ging eines davon verloren. Als der Schaffner dieses sah, lobte er den Goldener und machte ihn zum Gärtner.
Goldener arbeitete nun im Garten und pflegte die Pflanzen und Blumen und hatte seine Freude daran. Die schöne Königstochter kam oft in den Garten herunter und freute sich, wenn alles so sauber und reinlich und die Blumen so gut gepflegt waren. Sie war dem Gärtner von Tag zu Tag mehr geneigt, weil er so fleißig auf den Garten schaute.
Als eines Tages sie wieder im Garten war, sah sie sein schönes goldenes Haar und seitdem gefiel ihr der Gärtner noch besser und sie konnte ihn nicht genug ansehen.
Um die selbe Zeit wollte der König sich einen Nachfolger und der Tochter einen Gemahl suchen, denn er war schon alt und des Herrschens satt geworden. Er dachte nun hin und her und konnte keinen finden, der ihm und seiner Tochter recht gewesen wäre.
Besonders wollte der schönen Prinzeß keiner gefallen, denn sie dachte immer an den Gold lockigen Gärtner. Da war endlich der alte König des Wählens überdrüssig und sprach: »Wenn dir von den Vorgeschlagenen keiner gefällt, so nenne du mir einen, den du gerne haben möchtest.« Die Königstochter besann sich nicht lange und nannte den Gärtner mit den goldenen Haaren.
Da wurde der König so böse und zornig, daß er die Tochter von sich jagte und sie nicht mehr als sein eigen Kind anerkannte. Er wollte sie aus dem Schlosse jagen. Allein sie bat und flehte so lange, bis sie im Schlosse noch bleiben durfte. Dafür mußte sie aber wie eine Magd in der Küche bleiben und die schwersten Dienste tun.
Der König alterte nun zusehends, denn der Gram zehrte an seinem Herzen.
Nicht lange Zeit darauf brach ein Krieg aus und der König mußte sich rüsten. Bald hatte er ein großes Heer beisammen und er musterte es vor dem Schlosse.
Wie Goldener die Helme und Panzer so funkeln und die Fahnen im Winde flattern sah, kam ihm die Lust an, auch mitzuziehen. Er ging nun zum Könige und bat um die Erlaubnis auch ausziehen zu dürfen. Der König war recht böse, als er den Gärtner sah, gewährte ihm aber doch die Bitte.
»Ich werde für dich schon ein Kräutlein finden,« dachte er sich und gab dem Goldener ein Pferd, das nur drei Füße hatte, und ein Schwert, das um und um vom Roste zerfressen war. Die Krieger lachten ihn aus, aber Goldener machte ein ernstes Gesicht, als ob alles so sein müßte.
Das Heer zog nun fort, der König ritt an der Spitze des selben, Goldener hinkte am Ende des selben auf seiner dreibeinigen Gurre nach. So ging es eine Zeit lang fort, bis der Weg durch eine sumpfige Gegend führte. Da ritt das Heer weiter; das dreifüßige Pferd des Goldener blieb aber im Moore stecken und konnte unmöglich vorwärts kommen.
Das Heer war noch nicht weit entfernt, da rückte der feindliche König heran und es kam zur entscheidenden Schlacht. Wie Goldener das sah und den Lärm hörte, dachte er an sein Buch und wünschte sich ein schnelles, starkes Pferd, ein schönes, scharf geschliffenes Schwert und ein purpurrotes, mit Silber durchwirktes Gewand.
Er hatte kaum den Wunsch getan, so saß er auf einem mutigen Rosse, hatte ein herrliches, scharfes Schwert in der Hand und hatte ein so prächtiges Purpurkleid an, daß man sich nichts Schöneres denken kann. Nun gab er dem Ross die Sporen und im Nu trug es ihn hinein in die Schlacht und die goldenen Locken flogen hoch auf.
So schnell wie der Blitz sprengte er nun bald dahin, bald dorthin und überall verbreitete er Blut und Wunden. Es stund nicht lange an und die Feinde stürzten sich heulend in die Flucht und der glänzendste Sieg war errungen. - Der König wußte nicht, ob er wache oder träume, ob der unbekannte Retter ein Mensch oder ein Engel sei.
Wie er so nach sann, ritt Goldener an ihm vorüber und weil er auf des Königs Wort nicht anhielt, schleuderte dieser ihm das Schwert nach, um ihn zu kennzeichnen. Die Waffe verwundete den Reiter an der Ferse, die Klinge sprang und ihre Spitze blieb im Fuße des Goldener stecken.
Goldener kümmerte sich aber nicht darum und sprengte von dannen zu seinem dreifüßigen Gaul. Dort zog er sein Kleid aus, setzte sich auf das alte Roß - und Schwert, Purpurmantel und das schöne Pferd waren verschwunden. Wie er vor der Schlacht da saß, saß Goldener wieder da und Heer und König ritten an ihm vorüber und verlachten ihn.
Als alle vorüber waren, wollte er auch nach Hause kommen und ritt weiter und kam endlich zwei Tage nach der Ankunft des Königs im Schlosse an. Die Wunde hatte sich aber um vieles verschlimmert und der Gärtner bat um einen Arzt. Als der König dieses hörte, mußte er hell auflachen.
Es kam ihm so wunderlich vor, daß der Gärtner, der nur ferne dem Kampf zusah; verwundet sein sollte. Er konnte es kaum glauben und stieg aus Neugierde, der Sache auf den Grund zu kommen, in die Stube des Gärtners hinab. - Was machte aber der König für Augen, als er die Wunde sah und die Spitze des Schwertes, auf dem sein königlicher Name geschrieben stand, aus der Wunde gezogen wurde!
Der König fragte den Verwundeten nun aus, ob er auch im Kampfe gewesen wäre, und der Gärtner erzählte ihm nun alles haarklein. Da küßte der alte König den Kranken, ließ seine Tochter holen und hatte sie noch lieber als je. Goldener wurde aber gepflegt, als ob er der Sohn des Königs wäre. Und als die Wunde geheilt war, wurde Hochzeit gehalten und der König hatte am Paare die größte Freude.
So lebten alle drei viele Jahre glücklich beisammen. Als der alte König gestorben, wurde Goldener König und war so mächtig, weise und fromm, wie weder vor noch nach ihm einer zu sein das Glück hatte.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
DER TAPFERE RITTERSSOHN ...

Es war einmal ein Ritter, der hatte drei Söhne, von denen er viele Freude zu erleben hoffte. Als der älteste davon achtzehn Jahre alt war, mußte er hinaus in die weite Welt, um seinen Mut und sein Glück zu versuchen.
Da ritt er nun eines Tages durch einen finsteren Wald und auf einmal kam ein furchtbares Ungeheuer auf ihn zugelaufen. Er setzte sich tapfer zur Wehr und streckte das Ungetüm mit seiner Lanze zu Boden. Dann schnitt er aus dem abscheulichen Rachen die Zunge heraus und ritt eiligst in seine Heimat zurück.
Der Ritter war vor Freude fast außer sich, als er von der Heldentat seines Sohnes hörte und die Zunge als Wahrzeichen sah. Er ließ im Schlosse ein herrliches Fest veranstalten und erzählte allen Geladenen unermüdlich von dem kecken Mute seines ältesten Kindes.
Als der zweite Sohn das achtzehnte Jahr erreicht hatte, mußte auch er hinaus in die weite Welt. Er ritt eines Tages gemach durch einen dichten Wald, da kam ein furchtbares Untier auf ihn los gerannt und machte Miene, ihn samt seinem Ross zu verschlingen. Er aber verlor seine Besinnung nicht, wehrte sich tapfer, und als er das Ungetüm erlegt hatte, schnitt er aus dem abscheulichen Rachen die Zunge heraus und brachte sie als Wahrzeichen nach Hause.
Der alte Ritter hatte wieder eine unermeßliche Freude, ließ sich die kecke Tat drei- und viermal erzählen und versammelte dann wieder seine Nachbarn zu einem glänzenden Fest. Ja, - diesmal war die Festlichkeit noch weit größer als bei der Rückkehr des ersten Sohnes.
Der jüngste von den dreien war ein überaus kecker Junge und er wartete nicht bis zu seinem achtzehnten Geburtstag. Schon im siebzehnten Jahre machte er sich auf und zog auf Wag und Gefahr in die weite Welt hinaus. Bald begegnete ihm in einem Walde ein Ungeheuer, das nicht viel schöner aussah als jene, welche seine Brüder erlegt hatten. Er machte dem Ungeheuer mit seiner Lanze den Garaus, aber das wollte ihm nur ein Spaß scheinen und er ritt wieder gemach vorwärts.
Aber bald kam es ärger. Der Wald, in dem er sich befand, war sehr dunkel und es hielten sich gerne Räuber in dem selben auf. Auf einmal brach eine ganze Rotte aus dem Dickicht hervor und hielt den Ritterssohn an. Dieser fragte nicht lange: »Was?« und »Warum?«, sondern schoß frisch einen Pfeil ab und traf einen Räuber grade auf dem Herzen, so daß er augenblicklich tot nieder fiel.
Einen zweiten durchbohrte er mit der Lanze, da schwang aber schon ein dritter das Schwert gegen ihn. Hurtig riß er ihm das aus der Hand und rannte es ihm in den Leib. Auch seine Lanze hatte nebenbei nicht gefeiert, sondern stak schon in der Brust eines anderen Räubers, und das Schwert, nachdem es einmal die Probe abgelegt hatte, tat auch zum zweiten Male seine Dienste.
So waren fünf Räuber gefallen, die übrigen aber hatten am Zuschauen genug und liefen davon, als ob sie der Wind weg bliese. Der Ritterssohn dachte noch nicht ans Heimgehen, sondern ließ seinen Gaul vorwärts traben, als ob gar nichts geschehen wäre.
Bald sah er vor sich eine Höhle, darin saßen drei Riesen und jeder von ihnen hielt ein gutes Stück Braten in den Händen und nagte daran. Da ließ der Mutwille dem jungen Ritter keine Ruhe, bis er nicht seinen Bogen anlegte, um sich einen Spaß zu machen. Der Pfeil flog weg und husch! mit ihm das Stück Braten vom Maul eines Riesen.
Zornig sprang der Riese auf und brüllte mit fürchterlicher Stimme in den Wald hinein: »Wer hat mir meinen Braten weg geschossen?« Endlich sah er einen Jüngling mit Bogen und Köcher rasch auf die Höhle los gehen. »Hast du mir meinen Braten weg geschossen?«
»Ja, ich hab es getan.« »Wer hat dir es erlaubt?« Der Jüngling lachte über diese Frage und es setzte nun einen kurzen Streit zwischen ihm und dem Riesen ab. Aber bald war wieder Frieden gemacht, denn »mit diesem,« raunten sich die Riesen ins Ohr, »ist nicht gut Nüsse knacken.«
»Gerade recht, daß Ihr da seid,« sagte einer von den dreien, »Ihr könntet uns mit Eurer Kunst einen kleinen Gefallen tun. Da drüben jenseits des Waldes ist ein großes Schloß, darin wohnt eine wunderschöne Königstochter. Die hätten wir lange schon in unsere Gewalt gebracht, wenn nicht der Schloßhund allemal, so oft wir den Mauern nahe kamen, einen so furchtbaren Lärm gemacht hätte, daß das ganze Schloß zusammenlief, um zu sehen, was es gebe.«
»Dem Hunde will ich das Bellen schon austreiben,« fiel der Ritterssohn ein.
»Nur nicht so voreilig,« meinte der Riese, »das ist nicht so leicht wie einen Braten vom Maule wegschießen.« »Was schert mich ein Hund?« erwiderte rasch der Ritterssohn, »habe ich ja schon
einem ärgeren Untier den Garaus gemacht. Könnt Euch drauf verlassen, morgen legt Euch der Schloßhund nichts mehr in den Weg.«
Richtig! am folgenden Tage abends rührte sich der Hund nimmer und die drei Riesen hoben ihre lange Füße rüstig auf und liefen dem Schlosse zu. Dem Ritterssohn tropfte auf allen Seiten der Schweiß herab, denn er wollte auch nicht der letzte sein.
Als alle vier vor dem Schlosse standen und an der Mauer herumsuchten, da fanden sie in der selben ein nicht gar großes Loch und es war beschlossen, daß der Ritterssohn, weil er der kleinste war, zuerst durch das selbe hineinschlüpfen sollte.
Wie er drinnen war, steckte der erste Riese den Kopf durch das Loch hinein und wollte hinein kriechen. Wie aber der große Kopf hinter der Mauer ankam, zog der Ritterssohn sein Schwert und hieb den selben mit einem Streiche herunter. Den ungeschlachten Leichnam zog er herein, so daß die zwei anderen Riesen nichts anders meinten, als ihr Geselle spaziere nun im Schloß herum.
Der zweite Riese wollte nun nachfolgen, aber es ging ihm nicht besser als dem ersten. Nun war der dritte noch allein übrig und wollte seinen Kameraden folgen. Wie sein Kopf hinter der Mauer war und die Beine noch draußen waren, ging es ihm ebenso wie seinen Gesellen.
Nun schlich der Ritterssohn durch die Gänge und Säle des Schlosses, schaute sich alles genau an und kam endlich in das Gemach der Königstochter. Hier mußte er fast die Hand vor die Augen halten, so sehr glitzerte es von Gold und Edelsteinen und Geschmeide aller Art, das auf Tischen und Kästen herumlag.
Er steckte schnell einen königlichen Schmuck und allerlei Kostbarkeiten zu sich und suchte dann, so schnell er nur konnte, ins Freie zu kommen. Bevor er zum Loch hinaus kroch, schaute er noch die drei toten Riesen an. »Nun habe ich ein schönes Stück Arbeit getan,« dachte er sich, »und kann mich ohne Schande in der Heimat sehen lassen.«
Mit großer Eile ritt er nun nach Hause und lauter Jubel erscholl im väterlichen Schlosse, als es hieß, der jüngste Sohn sei als ein rechter, erprobter Ritter wiedergekommen. Als er aber fragte, warum sein alter Vater nicht erscheine, um ihm zum Willkomm die Hand zu drücken, da zeigte man auf die Familiengruft. Er wußte wohl, was das zu bedeuten habe, und die hellen Tränen kugelten ihm über die Wangen herab.
Als man im Schlosse, in welchem die schöne Königstochter wohnte, die Leichname der drei Riesen gefunden hatte, wunderte man sich darüber, wer es wohl gewagt habe, den drei großen Kerlen den Garaus zu machen. Es ward beschlossen, die Königstochter solle ihrem Retter die Hand anbieten, und man dachte hin und her, wie man etwa den selben ausfindig machen könnte.
Da kam der Königstochter ein kluger Gedanke in den Sinn. Sie ließ in dem Walde, worin früher die Riesen gewohnt hatten, ein Wirtshaus bauen und unter der Türe einen Schild anbringen mit der Aufschrift: »Heute umsonst, morgen ums Geld.« Statt des Bezahlens aber mußte jeder, der im Wirtshaus einsprach, seine Lebensgeschichte erzählen. Die schöne Königstochter verkleidete sich und bediente als Kellnerin die Gäste.
Da reisten nun einmal jene drei Ritterssöhne mit ihrer Mutter durch diesen Wald und sahen das stattliche Wirtshaus. Als die Rittersfrau die Aufschrift über der Türe las, war sie ein wenig von Neugierde geplagt. Sie ließ also Halt machen und trat mit ihren drei Söhnen in die Wirtsstube. Die drei Brüder zechten nach gutem Ritterbrauch und bald forderte die Kellnerin von den werten Gästen ihre Lebensgeschichte.
Da erzählten nun die zwei ältesten Ritterssöhne lang und breit von der Erlegung eines Ungetüms und von allerlei kleineren Streichen, die sie für große Heldentaten hielten. Als die Reihe an den jüngsten gekommen war und er zu erzählen anfing, wie er in der Ritterburg da droben drei Riesen getötet und aus dem Gemach der schönen Königstochter viele Kostbarkeiten mit sich genommen habe, - und als er nun gar das Geschmeide aus seinem Wams zog und der Kellnerin vorzeigte, da verließ diese ihre Gäste und kam erst in einer Viertelstunde wieder in die Wirtsstube.
Das hatte aber jetzt ein anderes Ansehen. Die Kellnerin stand in königlichem Schmucke vor ihren Gästen. Diamanten strahlten auf ihrem Haupte, als wollten sie mit den hellen Äuglein wetteifern, und ihr blaues Kleid glänzte von Gold und Edelsteinen wie der Himmel in einer sternenhellen Nacht. So trat sie vor den jüngsten Ritterssohn und ihm freundlich in die Augen schauend sagte sie:
»Wisst, daß ich diejenige bin, die Ihr von den drei Riesen befreit habt. Nehmt, wenn Ihr wollt, meine Hand zum Danke!« Da wußte sich der junge Ritter vor Freude fast nicht zu fassen, er drückte seine Hand fest in die ihm dargebotene Rechte der schönen Jungfrau und Mutter und Brüder wünschten ihm herzlich Glück zu seiner holdseligen Braut.
Nach wenigen Wochen wurde in dem Schlosse, in welchem den drei Riesen der Garaus gemacht worden war, die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert und die neuen Eheleute lebten glücklich beieinander bis an ihr spätes Ende.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
NADEL, LÄMMLEIN UND BUTTERWECKLEIN ...
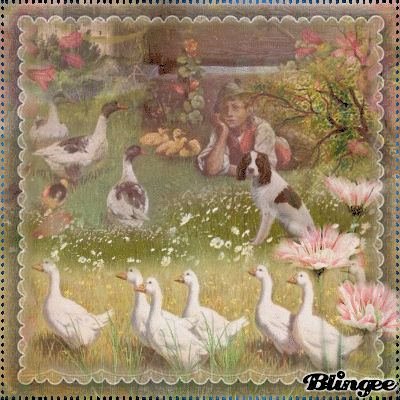
Es war einmal ein Vater und der hatte drei Söhne. Der Vater war aber arm und da klopfte die Not manchmal an die Türe des Hüttchens und der Hunger war oft ihr Schlafgeselle. -
Einstens ging es dem Vater und den drei Knaben gar hart und da sagte der Älteste: »Ich will mich aufmachen und in die weite Welt ziehen, um etwas zu verdienen; wer weiß, wo mir mein Glücksstern aufgeht.« Der alte Vater war damit zufrieden und der älteste Sohn machte sich auf den Weg und wanderte gar weit fort, und wohin er immer kam, frug er sich um einen Dienst um, konnte aber lange, lange Zeit keinen finden.
Endlich traf er einen steinreichen Herrn an, der Geld wie Laub hatte, und dieser stellte den bittenden Jungen als Gänsehirten an. »Aber eines mußt du mir versprechen,« sagte der alte, reiche Herr. - Der läppische Junge sagte hastig »ja«, ehe er noch von dem, was er versprechen sollte, etwas wußte.
»Wenn du draußen in der Au die Gänse hütest und aus dem nahen Waldschlößchen Gesang hörst, so laß es dir beileibe nicht einfallen lauschen zu gehen,« fuhr der Herr fort. »Wenn du nur einmal horchtest, müßte ich dich aus dem Dienste jagen.«
Bei allen Heiligen im Himmel versprach der Gänsehirte nun, in alle Ewigkeit nie zu lauschen. Es hüpfte ihm vor Freude nun das Herz, als er sein Brot gefunden hatte, und froh und munter trieb er die schwarzen und weißen Gänse auf die Weide in die Nähe des Waldes hinaus.
Der neue Hirte hatte an den vielen Gänsen seine Freude und dachte, er wolle sich schon gut aufführen, damit er immer hier bleiben könne. Als der Mittag nahte und es immer heißer und heißer zu werden begann, ging er zum Walde hin und legte sich unter der ersten Tanne ins Gras.
Er hatte noch nicht lange im kühlen Schatten geruht, als die Äste des Baumes gar wundersam zu säuseln anfingen, und aus der Tiefe des Waldes klangen so süße Zaubertöne, daß dem Knaben gar seltsam um das Herz wurde. Es kam ihm vor, als ob er die himmlische Musik hörte, und er lauschte und lauschte, so daß ihm am Ende die Sinne vergingen und er nimmer wußte, wo er weilte.
So lag er im Klee da, bis es Abend wurde. Als es schon anfing zu dunkeln und es Ave-Maria läutete, wachte er erst auf. Allein o Schrecken und Jammer! - Da wackelten auf der Wiese wohl einige Gänse herum, allein die meisten waren verschwunden. Der Hirte lief nun nach allen Seiten, um die fehlenden Tiere zu suchen und sie zusammenzutreiben. Allein umsonst.
Er mochte laufen und springen, beten und fluchen - es half alles nichts und die Gänse kamen nicht wieder zum Vorschein. - Dem Knaben war nimmer wohl, er weinte sich die Augen rot, und als er kein Mittel sah, beschloß er endlich, die noch vorhandenen Gänse nach dem Schlosse zu treiben. Da ward es ihm immer trauriger zumute, je näher er zum Schlosse kam.
Kaum war er dort angekommen und hatte die Gänse eingetan, so ließ ihn der alte Herr rufen. Zitternd stieg der arme Junge die Stiege empor und trat noch zitternder in den prachtvollen Saal, wo der Gebieter seiner wartete. - Kaum war er eingetreten, so fuhr ihn der Herr mit barscher Stimme an: »Ich hatte Mitleid mit dir, aber du hast es mir mit Undank und Untreue gelohnt. Wir sind geschieden, du mußt heute noch aus dem Schlosse!« -
Der Knabe fing an zu bitten und zu flehen, daß es hätte einen Stein erweichen mögen; allein der Herr fühlte kein Erbarmen, nur eine goldene Stecknadel nahm er aus einem Kästchen hervor und gab sie dem weinenden Jungen zur Erinnerung. - Der arme Knabe steckte die goldene Stecknadel an seine Juppe und sagte mit schwerem Herzen dem Schlosse Lebewohl.
Er wollte nun wieder nach Hause, um seinem Vater die goldene Stecknadel zu zeigen, und wanderte durch Feld und Tal. Einmal kam er zu einem Wege, der steil den Berg hinan stieg und zu einem einsamen Gehöfte führte. »Ah, da oben kann ich einen Schluck Milch bekommen,« dachte sich der durstige Wanderer und stieg bergan.
Wie er ein Stück gegangen war, kam er zu einem Bauern, der ein Heufuder hinaufführen wollte, und dieses rückte nicht von der Stelle. Der Bauer schalt und fluchte und schlug die armen Öchslein, allein diese brachten den Wagen nicht weiter. »Ha, hilf mir ein wenig schieben!« bat der Bauer. -
Unser Junge war nicht ungefällig, schob aus Leibeskräften und das Fuder ging weiter. Als man beim Hofe angekommen war, bekam er Milch, soviel er wollte, und trank in voller Lust. Wie er aber wegging, da merkte er, daß er seine Goldnadel verloren hatte, und war gar traurig und niedergeschlagen. So ging er seine Wege fort und wanderte und wanderte, bis er nach Hause kam.
Als er daheim war und in der Stube saß, da sahen seine Leute, daß er so traurig war, und niemand konnte sich seine Niedergeschlagenheit erklären. Endlich fragte ihn der Vater: »Was fehlt dir, daß du so sauer darein siehst wie ein Apfel um Jakobi?« - Da erzählte er nun, daß er eine gar so schöne goldene Nadel gehabt habe, und da sei er zu einem Heufuder gekommen, das sei aber stecken geblieben. Da habe er mit der Stecknadel schieben geholfen und habe dieselbe im Heu verloren.
Wie sein jüngerer Bruder das gehört hatte, wurde dieser böse und sagte: »Hättest du dir die Nadel doch auf den Hut gesteckt! - Jetzt gehe ich hin zu deinem Herrn, und was er mir zum Lohne gibt, mache ich mir auf den Hut, damit ich es ganz sicher und gewiß heimbringe.«
Am anderen Tage frühmorgens machte er sich auf und wanderte lustig fort, bis er zum steinreichen Herrn kam. Er hielt bei ihm um einen Dienst an und der Herr stellte ihn wie seinen Bruder als Gänsehirt an.
»Aber eines mußt du mir versprechen,« sprach der reiche Mann. »Wenn du draußen auf der Au die Gänse hütest und du aus dem nahen Waldschloss Gesang hörst, so lasse es dir beileibe nicht einfallen lauschen zu gehen, denn sonst muß ich dich aus dem Dienste jagen.«
Der Bursche versprach es hoch und teuer und trieb nun die Gänse auf die Au hinaus, die an den Wald grenzte. Er hatte seine Freude daran, wenn die fetten Gänse so vor ihm herwackelten, und deuchte sich reich wie ein König. So hatte er es schon einige Tage getrieben und ihm war nichts Ungewöhnliches begegnet.
Wie er aber wieder einmal draußen unter dem Tannenbaum lag und so in den blauen Himmel hinaufschaute, da hörte er plötzlich eine gar schöne Musik. Anfangs schien sie gar ferne zu sein, allein immer kam sie näher und näher und war schöner und voller. Der Knabe dachte wohl an die Worte seines Herrn und wollte nicht auf die Klänge hören.
Als die Musik aber immer herrlicher ward, konnte er der Lockung nicht mehr widerstehen und lauschte nach Herzenslust. Es kam ihm vor, als ob Gott-Vater selbst nicht schöner musizieren könnte, und er vergaß darüber Gänse und Wiesen, Hüten und Essen. Als er wieder zu sich kam, war die Sonne schon untergegangen und es begann schon dunkel zu werden.
Da dachte er gleich an seine Gänse, aber diese waren dahin und dorthin verlaufen. Er suchte nun an allen Ecken und Enden, konnte aber die Verlorenen nicht finden. Da wurde es ihm gar schwer ums Herz und die Tränen kugelten über seine Wangen herunter. Er trieb die noch übrigen Gänse zusammen und dem Schlosse zu. Er hatte die Herde noch nicht in den Stall getrieben, als ein Diener ihm entgegenkam und ihm sagte, er solle gleich zum Herrn kommen.
Mit schlotternden Füßen stieg der arme Bursche die Stiege empor und trat in den prachtvollen Saal, wo ihn der Gebieter erwartete. Kaum war er eingetreten, so fuhr ihn der Herr mit barscher Stimme an: »Ich erbarmte mich deiner und habe dich in den Dienst genommen, aber du hast es mir mit Undank und Untreue gelohnt. Wir sind geschiedene Leute. Du mußt heute noch aus dem Schlosse.«
Der Knabe fing nun zu weinen und zu bitten an, daß es einen Felsen hätte rühren mögen. Der Schloßherr war aber von seinem Entschluss nicht abzubringen. »Ich kann und darf dich nicht mehr im Schloss behalten,« sprach er. »Doch, daß du nicht ganz leer von mir gehst, gebe ich dir ein Lämmlein mit.« - Er klingelte einem Diener und befahl diesem, dem Knaben das Lämmlein zu geben.
Der Diener ging und der weinende Junge mit ihm. Im Hofe drunten bekam er nun ein Lämmlein. Das war so weiß wie der frisch gefallene Schnee und hatte eine Wolle so fein wie die feinste Seide. Er dankte und ging nun mit dem schönen Lämmlein aus dem Schlosse.
Wie er aber vor dem Tore war, fiel ihm ein, daß sein Bruder die Goldnadel nicht verloren hätte, wenn er sie auf seinen Hut gesteckt hätte. Er nahm nun das Lämmlein und setzte es auf seinen Hut. So wanderte er nun der Heimat zu und freute sich seines Lämmleins.
Da kam er zu einem Bach, über den nur ein schmaler Steg führte. Er ging nun über den Steg, allein ein Tannenast, der hernieder hing, streifte ihm Lämmlein und Hütlein ab und beides fiel in den Bach und dieser trug es fort. Da war der Junge gar traurig und wußte sich nicht zu trösten. Er ging und ging, bis er nach Hause kam.
Da fragte ihn aber der Vater: »Wo hast du deinen Lohn?« - Der Knabe begann nun zu weinen und erzählte dem Vater und den Brüdern, wie er das Lämmlein verloren habe, obgleich er es auf dem Hut gehabt hätte. Da lachte der Älteste ihn aus und der jüngste Bruder sagte: »Hättest du dir ein Stricklein gekauft und das Lämmlein daran gehängt und geführt, hättest du es gewiß nicht verloren.
Jetzt mache ich mich auf und werde gewiß nicht aufs Singen hören. Und was ich verdiene, das werde ich gewiß an einem Strick heimführen, daß ich es gewiß nicht verliere. Dann wollen wir uns gütlich tun und wohl sein lassen.«
Tags darauf machte sich der Jüngste nun auf die Beine und wanderte, bis er zum Schloss kam. Dort ließ er sich bei dem Grafen melden und bat um einen Dienst. »Ja,« sprach der Graf, »du kannst mein Gänsehirt werden. Allein eines mußt du mir versprechen. Wenn du im nahen Walde eine Musik hörst, so horche nicht darauf! Denn horchst du zu, so mußt du auf der Stelle aus dem Dienste und aus dem Schloss.«
Bei allem, was heilig ist, versprach der Gänsehirt, in alle Ewigkeit nie zu lauschen. Er ging nun in den Hof, ließ die Gänse aus dem Stall und trieb sie hinaus auf die grüne Au neben dem Walde. Er hatte die größte Freude an den weißen und grauen Gänsen und deuchte sich so reich wie ein Kaiser, wenn die fetten Vögel so vor ihm hertrottelten.
Draußen hütete er fleißig und gab auf seine Tiere genau acht. Und wenn er abends heimfuhr, brachte er alle Tiere nach Hause. So ging es einige Wochen und der Schloßherr war mit dem Knaben zufrieden.
Da war dieser wieder einmal auf dem Felde draußen und es war so heiß, daß selbst die Gänse den Schatten suchten. Er ging nun zum Walde hin und streckte sich im Schatten der nächsten besten Tanne ins Gras. Er hatte noch nicht lange ausgeruht, als eine gar schöne Musik sich hören ließ. Sie wurde immer schöner und schöner, so daß dem Hirten Sehen und Denken vergingen und er auf alles andere vergaß.
Er lauschte und lauschte und konnte sich nicht satt hören, bis endlich die Musik verstummt war. Da kam er endlich zu sich. Es stand aber der Mond schon hoch am Himmel und die Sterne glänzten wie goldene Punkte am Firmamente. Da machte er sich nun hastig auf und wollte die Gänse zusammen und nach Hause treiben.
Doch da war es eine Not! Es schnatterten nur mehr zwei auf der ganzen Wiese, alle übrigen waren längst schon auf und davon. Er suchte nun links und rechts und klopfte in die Stauden, doch nirgends konnte er eine dritte mehr finden. Es blieb ihm endlich nichts mehr übrig, als die zwei Gänse heimzutreiben. Das war aber eine traurige Fahrt!
Er weinte, daß es ihm fast das Herz abstieß, denn er fürchtete gar so sehr den Schloßherrn. Er war noch nicht zum Schloßtor gekommen, als ihm schon ein Diener entgegenkam und ihm sagte, er solle gleich zum Herrn kommen. Da ward ihm noch trauriger zumute und dazu schnatterten die zwei Gänse so laut und machten einen solchen Lärm, daß er ihnen hätte die Krägen umdrehen mögen.
Kaum war er im Schloss angekommen und hatte die Gänse eingetan, so ging er zum Herrn in den Saal hinauf. Der Graf war aber sehr böse und empfing ihn ganz zornig. »Ich hatte Mitleid mit dir und du hast das selbe mit Untreue und Undank gelohnt,« sprach er. »Packe dich fort und geh dahin, woher du gekommen bist.«
Der Junge fing nun an zu bitten und zu weinen, daß es hätte einen Eisklotz rühren mögen. Da sprach der Graf: »Daß du auf dem Wege nicht verhungerst, kannst dir in der Küche einen Butterweck geben lassen.« Der Knabe stieg weinend die Stiege hinunter, ging in die Küche und meldete, was der Herr gesagt hatte. Da gab ihm der Koch einen Butterweck und der Junge nahm nun vom Schloss Abschied und wanderte der Heimat zu.
Als er aber vor dem Burgtor war, dachte er an das Schicksal seines Bruders, der das Lämmlein verloren hatte, weil er es nicht an einem Stricke geführt hatte. Er wollte seinen Butterweck nicht auch verlieren, nahm deswegen ein Stricklein aus seinem Juppensacke und band den Weck daran. So wanderte er nun eine Strecke weiter und zog das Stück Brot über Stock und Stein nach.
Bald wurde er aber schläfrig und müde. Da legte er sich unter eine Eiche und nahm den Weck in seinen Arm. Er schlief, bis die Vögel ihr Morgenlied sangen und es im Walde lebendig wurde. Da machte er sich wieder auf die Füße und wanderte der Heimat zu. Nicht lange war er so fortgegangen, als er zu einem Meierhofe kam. Da stund ein großer, großer Hund und bellte schon von ferne aus Leibeskräften. Als der abgedankte Gänsehirt mit dem Butterweck vorüberzog, machte das ungezogene Tier einen Satz auf den Weck, faßte ihn und verschluckte ihn, ohne erst um die Erlaubnis zu fragen.
So hatte denn auch der dritte Sohn seinen Lohn verloren und hatte nichts als einen Stock, den leeren Sack und ein trauriges Herz. So wanderte er nun weiter, bis er endlich müde und hungrig in die Heimat zurückkam. Hier saßen die Brüder und der Vater am warmen Ofen bei der Abendsuppe. Wie sie den Jüngsten sahen, stunden sie auf und grüßten ihn.
»Und was hast du denn mitgebracht?« fragte der Älteste. »Nichts,« sagte der Jüngste. »Ah so, auch nichts, da bist du freilich gescheiter als unsereins,« sprachen die Brüder und fingen an zu lachen. Und der Jüngste lachte auch mit, und wenn sie zu lachen nicht aufgehört haben, lachen sie heute noch fort.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Meran
DIE ZWEI FISCHERSÖHNE ...
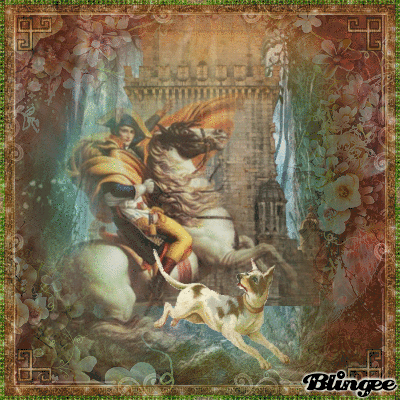
An einem See wohnte ein Fischer mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Als die Söhne volljährig geworden waren und Vater und Mutter und Kinder eben einmal beim Essen saßen, fing der Vater an: »Liebe Söhne, ihr seid jetzt in einem Alter, wo ihr die Welt kennen lernen und ihr Glück erproben müßt. Seid ihr ein wenig in der Welt herum gekommen, so könnt ihr wieder heimkehren, denn meine alten Tage will ich an eurer Seite zubringen.«
Wie die Söhne das hörten, machten sie kurze Anstalten zur Abreise und am anderen Tag in aller Frühe waren sie schon auf dem Weg. Es dauerte nicht lange, da teilte sich die Straße und der ältere Bruder begann: »Wie wäre es, Bruder, wenn wir uns trennen würden; wir können ja mehr erfahren, wenn wir nicht beieinander sind.« »Ist mir auch recht,« erwiderte der Jüngere. »Dann gehst du rechts aus und ich links.«
Der Ältere hatte nichts dagegen zu sagen und die beiden nahmen Abschied voneinander. Bevor sie sich aber trennten, steckte jeder sein Messer in einen großen alten Baum, der gerade an der Wegscheide stand. Sobald einer von ihnen zurückkehren würde, sollte er erfahren, ob es seinem Bruder gut oder schlimm ergehe, je nachdem dessen Messer blank oder rostig wäre.
Der ältere Bruder wanderte rüstig vorwärts, Weg hin und Weg her, Hügel auf und Hügel ab, bis er endlich eine großmächtige Stadt vor sich sah. Wie er in die selbe eintrat, sah er alle Häuser schwarz behangen und alle Leute, die ihm begegneten, waren schwarz gekleidet. Da kam es ihm völlig unheimlich vor und er fragte ein altes Männlein, was denn die allgemeine Trauer zu bedeuten habe.
Das erzählte ihm, daß in der Nähe der Stadt ein See sei und in dem selben wohne ein ungeheurer Drache, dem man jeden Monat zwei Lämmlein und eine Jungfrau zum Fraß geben müsse. Der Drache habe bereits alle Jungfrauen der Stadt gefressen und nur die Königstochter sei noch übrig. Morgen müsse die selbe eine Speise des Ungetüms werden.
Der Fischersohn fragte weiter, ob denn da gar nicht zu helfen wäre. »Wie denn zu helfen?« sagte das Männlein. »Der König hat wohl demjenigen, der den Drachen erlegt haben wird, den Thron und die Hand seiner Tochter versprochen, - allein wer wird sich denn einen so kecken Versuch einfallen lassen?«
Der Fischersohn fragte nun genauer danach, an welchem Orte denn der Drachen erscheine, und hörte, daß neben dem See eine Kapelle stehe, daß in der selben die Lämmer gebunden liegen und die Jungfrau knien müsse, bis das Ungetüm herankomme und seinen Fraß zu sich nehme. Der Fischersohn sagte nun »Lebe wohl!« zum Männlein und ging weiter.
»Da hast du nun Gelegenheit, dein bißchen Mut auf die Probe zu stellen,« dachte er sich und am anderen Tag in aller Frühe schnallte er sich sein Schwert um und nahm eine Lanze in die Hand und ging außer die Stadt hinaus zum See. Hinter der Kapelle verbarg er sich und blieb mäuschenstill.
Die Königstochter kniete aber schon in der Kapelle und wartete zitternd auf die Ankunft des Ungetüms. Auf einmal entstand ein Plätschern und Platschen im See, daß das Wasser hoch aufspritzte, und das Plätschern und Platschen kam immer näher und näher.
Der Fischersohn dachte sich wohl, was dahinter sei, schaute heimlich aus seinem Verstecke auf den See und da sah er einen Drachen heranschwimmen mit einem fürchterlichen Rachen und großen, großen Krallen. Da bebte ihm auch ein wenig das Herz, aber er nahm sich zusammen, und kaum war das Untier ans Ufer gekommen, so stürzte er hinter der Kapelle hervor und rannte ihm mit ganzer Gewalt seine Lanze in den Leib.
Der Drache erhob ein fürchterliches Geheul und sperrte den scheußlichen Rachen gegen den Fischersohn auf, um ihn mit Haut und Haaren zu verschlingen. Der Fischersohn aber verlor das Herz nicht so geschwind, sondern zog schnell sein Schwert und stieß es dem Ungetüme in den aufgesperrten Rachen. Da konnte sich der Drache nicht mehr erwehren, schlug noch eine Weile mit dem Schweife im Wasser herum - aber in wenigen Minuten rührte er sich nimmer.
Der Jüngling trat nun in die Kapelle, brachte die Königstochter welche vor Schrecken die Besinnung verloren hatte, wieder zu sich, begrüßte sie als seine Braut und führte sie an seiner Hand nach Hause. Jetzt war überaus große Freude in der Stadt, die schwarzen Tücher und Kleider wurden weg gelegt und man erzählte sich nur von dem tapferen Jünglinge und von seinem Kampf mit dem Drachen.
In wenigen Tagen war aber eine große Festlichkeit in der Stadt, denn der König hielt getreulich sein Wort und der Fischersohn hatte Hochzeit mit der geretteten Königstochter. Eine gute Weile lebten sie fröhlich beisammen, wie es sich für rechte Eheleute gebührt, und der junge König regierte nach Recht und Gerechtigkeit über seine Untertanen.
Eines Abends saß er wieder mit seinen Freunden bei Tische und war heiter wie immer. Da schaute er zufällig zum Fenster hinaus und sah ein helles Licht aus dem nahen Walde hereinglänzen. »Was soll doch das Licht da draußen bedeuten?« fragte er die Gäste und schaute immer aufmerksamer auf das seltsame Flimmern.
»Ja, wer das wüßte!« antwortete einer, der gerade neben ihm saß. »Aber das kann Euch kein Mensch sagen; denn gar viele hat der Vorwitz in den Wald getrieben, um zu sehen, was etwa das für ein Licht sei. Aber keiner von allen ist jemals wieder herausgekommen.«
»So will ich selbst hin und sehen, was das ist,« sagte der König und stund vom Tische auf. Alle Anwesenden baten, er möchte sich doch nicht selbst in die Gefahr stürzen, denn es könnte ihm ebenso ergehen wie den übrigen. Er aber blieb fest bei seinem Vorhaben, ließ sich sein Pferd satteln und ritt von dannen.
Sein Hund lief neben dem Pferde her und schrie und bellte, daß die Felsen widerhallten. Es wurde immer dunkler und dunkler, und je mehr es nachtete, desto heller glänzte das Lichtlein zwischen den finstern Tannen hervor. Bald hielt der König vor einem großen Schlosse, das stund an der Stelle, wo früher das Lichtlein geleuchtet hatte. Dieses war aber, wie von einem Windhauch ausgeblasen, auf einmal erloschen.
Der König klopfte nun an dem Tore des Schlosses. Die Türe ging auf und ein altes Mütterchen trat heraus mit runzligem Gesicht und wackelndem Kopf. »Bekomme ich hier Nachtherberge?« fragte der König, sobald er des Mütterchens ansichtig wurde. »Müßt schon ein wenig gedulden,« erwiderte freundlich die Alte, »muß erst meinen Herrn fragen. Setzt Euch ein wenig auf die Bank da, Ihr seid gewiß müde.«
Der König ließ sich das nicht zweimal sagen, stieg vom Pferde, setzte sich auf die Bank neben der Türe und spielte zur Kurzweil mit seinem Hunde. Bald ging die Türe wieder auf und das Mütterchen kam zum Vorschein. Es tat recht freundlich und sagte: »Könnt hier bleiben, wie lange Ihr wollt. An guter Bewirtung wird es Euch nicht fehlen.«
Während sie dies sagte, zog sie eine Rute unter dem Vortuch hervor, schlug damit dreimal auf den Stein, der neben dem König auf der Bank lag, und Hund und Roß und König waren in demselben Augenblicke in Stein verwandelt.
Im Königsschloss wartete und wartete man und die Hoffnung wurde von Tag zu Tag kleiner, die Furcht aber von Tag zu Tag größer. Wer immer und immer nicht kam, das war der Herr König. Wie endlich auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf seine Wiederkehr erlosch, war großer Jammer in der Stadt, denn alle Leute hatten den König liebgehabt wie einen Vater.
Der jüngere von den zwei Fischersöhnen hatte auch in der Welt allerlei erfahren und sich nebenbei ein gutes Schwert erobert und bekam endlich Lust wieder heimzugehen. Er machte sich also auf den Weg und ging und ging, bis er endlich zu dem Baum kam, in welchen die zwei Brüder ihre Messer gesteckt hatten. Sein erster Blick fiel auf das Messer seines Bruders und er wurde ganz blaß vor Schrecken, als er das selbe von Rost ganz rot gefärbt sah.
»O weh,« dachte er sich, »meinem Bruder ist etwas Schlimmes begegnet, ich muß ihn aufsuchen und ihm helfen.« Er dachte nun nicht mehr ans Nachhausegehen, sondern schlug die rechte Straße ein, auf der sein Bruder fort gegangen war. Er dachte nicht viel ans Essen und Schlafen und wanderte rüstig vorwärts bei Tag und bei Nacht.
Es wollte eben wieder dunkel werden, da sah er eine großmächtige Stadt vor sich, und wie er in die selbe eintrat, sah er die Leute traurig herumstehen, lange Gesichter machen und die Köpfe fast bis auf die Zehen hängen. »Was mag doch dahinter sein?« dachte er sich und fragte einen der Umstehenden, was denn der Stadt für ein Unglück begegnet sei.
»Wie soll es uns nicht zu Herzen gehen,« antwortete dieser, »da wir unseren jungen König, den wir alle so lieb hatten, verloren haben! Da ließ er sich neulich nicht aufhalten, sondern ritt dort hinüber in den dunkeln Wald, aus dem das Lichtlein herüberglitzert und woraus noch keine Menschenseele, die sich hinein wagte, zurück gekommen ist.«
»So also ist es?« erwiderte der Fischersohn und ging weiter. Aber was er gehört hatte, das schrieb er sich hinter die Ohren und geraden Weges ging er hinaus in den Wald, aus dem der König nicht wiedergekehrt war. Er verlor das Lichtlein nicht aus den Augen und schritt tapfer drauf los.
Bald kam er zu einem großen Schlosse, das stund an der Stelle, woher früher das Lichtlein geleuchtet hatte. Dieses aber war, wie von einem Windhauch ausgeblasen, auf einmal erloschen. Der Fischersohn klopfte nun an das Tor des Schlosses.
Die Türe ging auf und ein altes Mütterchen trat heraus mit runzligem Gesicht und wackelndem Kopf. »Bekomme ich hier Nachtherberge?« fragte der Fischersohn, sobald er des Mütterchens ansichtig wurde. »Müßt schon ein wenig gedulden,« war wieder die Antwort, »muß erst meinen Herrn fragen, setzt Euch ein wenig auf die Bank da, Ihr seid gewiß müde.«
»Was gedulden, was Herrn fragen?« schrie zornig der Fischersohn. »Laß mich durch alle Gänge und Säle des Schlosses, oder -!« Bei diesen Worten zog er sein großes Schwert und schwang es um den Kopf der Alten. Diese fuhr vor Schrecken zusammen und schien wohl zu verstehen, wo das hinaus wolle. »Ums Himmels willen, laßt mich!« kreischte sie mit heiserer Stimme, »ich will den König schon wieder lebendig machen.«
Und schnell lief sie in das Schloß und kam augenblicklich mit einem Rütlein wieder und schlug damit dreimal auf den Stein, der auf der Bank lag. Beim ersten Streiche sprang des Königs Hund auf und lief wie närrisch herum und bellte, beim zweiten erhob sich des Königs Pferd und schaute verwundert um sich her und wieherte, - beim dritten Streiche aber stund der König selbst auf und schaute seinem Bruder in die Augen und erkannte und küßte ihn.
Auch der jüngere Fischersohn erkannte, daß der König sein Bruder sei, und die zwei Brüder hatten eine Freude, wie sie nur die Engel im Himmel haben können. Sie gingen nun mitsammen in die Stadt und da war ein Jubel, der gar nimmer aufhören wollte.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
PURZINIGELE ...

Vor alter, alter Zeit lebte ein reicher, mächtiger Graf. Alles Land weit und breit gehörte ihm und er hatte alles, was sein Herz begehrte. Seinen Reichtum und sein Glück teilte eine gute Frau, die so schön war wie der Tag und so lieb wie ein Engel. So lebten sie schon einige Monate glücklich beisammen und die Tage kamen ihnen so kurz wie Minuten vor.
Da ging der Graf eines Tages auf die Jagd und drang immer tiefer und tiefer in den Wald. Er war in der Hitze der Jagd so weit gekommen wie noch nie und hatte sich von seinen Begleitern eine große Strecke entfernt. Wie er so allein im Walde sich fand, stund plötzlich ein Nörglein vor ihm. Der kleine Waldbewohner war nur drei Schuhe lang und sein Bart reichte ihm bis auf die Knie.
Zornig rollte er seine glutroten Augen und sprach: »Was hast du hier zu tun? Das ist mein Gebiet und das sollst du mir büßen. Du kommst nicht mehr lebend aus dem Wald oder du mußt mir deine Frau lassen.«
Der Graf erschrak nicht wenig über die Erscheinung des Nörgleins und über seine zornigen Worte. Denn er hatte oft vom Waldmännlein, seiner Stärke und seiner Bosheit allerlei schaurige Geschichten gehört, als er noch ein Kind war und die alte Kindsmagd ihm erzählen mußte. Was war nun zu tun? - Da war guter Rat gar teuer und der erschrockene Graf wußte kein anderes Mittel wegzukommen als Bitten und gute Worte.
»Verzeih mir,« sprach der Graf, »daß ich dein Gebiet betreten habe. Ich habe es nicht gewußt und werde es gewiß nie mehr tun.« Das wilde Nörglein ließ sich aber nicht besänftigen und sprach: »Wie ich dir gesagt habe, muß es geschehen. Entweder du oder sie.« »Verlange was du willst und ich gebe es dir,« sprach der Graf, »aber laß nur von dieser Forderung!«
Da schien sich das Männlein zu besinnen und sagte: »Wenn es so sein muß, so will ich Euer Schicksal in die Hand Eurer Frau legen. Ich lasse Euch einen Monat Zeit. Wenn sie imstande ist, in dieser Zeit unter dreimal meinen Namen zu erraten, soll sie frei und Euer sein - sonst gehört sie mir.«
Der Graf war etwas getrösteter, aber doch lag es ihm noch so schwer auf dem Herzen. Er ging nun zurück und das Waldmännlein begleitete ihn. Beide waren ernst und sprachen kein Wort. Wie sie eine Weile gegangen und zu einer uralten, graubärtigen Tanne gekommen waren, stund das Zwerglein still und sprach:
»Hier ist die Grenze meines Gebietes. Bei dieser Tanne, die neunmal so alt ist als die übrigen Bäume, werde ich deine Frau erwarten. Dreimal kann sie unter dreimal raten! Haltest du aber nicht
dein Wort, so soll es dir schlecht gehen.«
So sprach das Männlein und war bald wieder waldein verschwunden.
Der Graf ging nun langsam nach Hause, denn es war ihm so schwer ums Herz und je näher er dem Schlosse kam, desto trüber und trauriger war ihm zumute. Als er dem Tore schon nahe war, kam ihm die Gräfin, die ihn vom Fenster aus gesehen hatte, entgegen und war gar froh und heiter, weil ihr Gemahl wieder da war. Allein bald sah sie, daß er nicht froh war wie sonst, sondern eine gar trübe Miene machte. Sie war nun auch traurig und besorgt und fragte den Grafen, was ihm fehle.
Indessen waren sie ins Schloß und in die Stube gekommen und der müde, traurige Graf erzählte ihr nun alles, wie das Nörglein ihm begegnet sei und ihm die Gräfin habe nehmen wollen, und welche
Bedingung es zuletzt gemacht habe.
Wie die Gräfin dies hörte, wurde sie bleich wie eine Leiche und ihre schönen feinen Wangen waren von Tränen benetzt. Die Lust und Freude waren nun aus dem Schlosse verschwunden und es ging droben
gar stille und traurig her.
Die Gräfin saß gewöhnlich im Erker und sann und sann, wie kurz ihr Glück gewesen war, oder sie betete und weinte in der Burgkapelle. Der Graf zog auch nicht mehr auf die Jagd oder zum Kampfspiele, sondern saß auf seinem alten, reich mit Schnitzwerk versehenen Lehnstuhl, auf dem schon sein Urahn gesessen war, stützte sein Haupt in die rechte Hand und dachte nach, er wußte selbst nicht worüber.
So vergingen Tage auf Tage und Wochen auf Wochen und endlich waren nur mehr drei Tage vom Monate übrig. Da gingen nun der Graf und die Gräfin hinaus in den Wald und weiter und weiter, bis sie die alte greisbärtige Tanne von ferne sahen. Da blieb der Graf zurück und die Gräfin ging allein weiter.
Es war sonst so lustig im Walde, die Vöglein jubelten, die Eichkätzchen sprangen und die Hagröslein blühten weiß und rot, allein der Gräfin war so schwer ums Herz wie noch nie und traurig ging sie, bis sie endlich zur Tanne kam. Dort erwartete sie schon das Nörglein, das grün und rot gekleidet war. Es hatte eine närrische Freude als es die Gräfin sah, denn sie gefiel ihm gar wohl.
»Nun errate meinen Namen, Frau Gräfin!« sprach er eilig, als ob er es kaum erwarten könnte. Da riet die Gräfin: »Tanne, Fichte, Föhre«, denn sie dachte, weil er im Walde wohnt, hat er gewiß den Namen eines Baumes. Das Nörglein hatte es aber kaum gehört, als es laut auflachte und jauchzte, daß es im ganzen Walde widergellte.
»Du hast es nicht erraten!« sprach er jubelnd. »Schaue, ob es morgen besser geht als heute, sonst wirst du noch meine Frau!« Die Gräfin war aber noch trauriger und ging mit niedergeschlagenen Augen von der Tanne weg, an der das Nörglein noch immer stand und schadenfroh ihr nachlächelte. Sie fand bald ihren Gemahl und erzählte ihm, wie sie so schlecht geraten hätte, und beide kehrten nun noch trauriger als sie gekommen waren auf ihr Schloß zurück.
Der noch übrige Tag verging, obwohl es ein trauriger war, doch zu schnell und es war bald der Abend da, dem die Nacht folgte. Das war wieder eine traurige, trostlose Nacht, in der Schlaf und
Traum in der Grafenstube nicht einkehrten.
Als morgens die ersten Lerchen sangen, waren schon Graf und Gräfin auf den Beinen und klagten sich ihre Not.
Darauf gingen sie in die Burgkapelle und beteten dort und dann gingen sie in den grünen Wald hinaus und weiter und tiefer, bis sie die alte greisbärtige Tanne von ferne sahen. Da blieb der Graf zurück und die Gräfin ging allein weiter. Es war sonst so lustig im Walde draußen, die Vöglein sangen, die Blumen lachten und dufteten und die Eichkätzchen machten ihre Männchen, allein der Gräfin war so schwer ums Herz wie noch nie und mit Tränen in den Augen ging sie, bis sie zur Tanne kam.
Kaum war sie dort, so kam auch schon das Waldmännlein und war gar schön, blau und rot gekleidet. Es hatte eine närrische Freude als es die Gräfin wieder sah, denn sie gefiel ihm gar zu wohl. »Nun errate meinen Namen, Frau Gräfin!« sprach er eilig und lächelte.
Da riet die Gräfin: »Hafer, Plenten, Türken,« denn sie dachte, vielleicht habe es einen Namen vom Getreide. Der kleine Wicht hatte es aber kaum gehört, als er laut auflachte und jauchzte, daß es im ganzen Walde widergellte. »Du hast es nicht erraten«, sprach er jubelnd. »Morgen muß es besser gehen oder du gehörst mir, und dann habe ich morgen noch Hochzeit.«
Die Gräfin war aber noch trauriger als je und ging mit nassen Augen von der alten Tanne weg, an der das Nörglein noch immer stand und schadenfroh ihr nachlächelte. Sie fand bald ihren Gemahl und erzählte ihm, wie es ihr so schlecht ergangen sei, und beide kehrten nun noch betrübter als sie gekommen waren auf ihr Schloß zurück.
Der noch übrige Tag verging unter Trauer und ehe man sich dessen versah kam der Abend und alsbald folgte die dunkle Nacht. Das war wieder eine traurige Nacht, in der weder Graf noch Gräfin ein Auge schließen konnte. Als der Morgen andämmerte, waren Graf und Gräfin schon auf den Füßen und gingen in die Burgkapelle und beteten dort recht inständig. Dann wanderten sie hinaus in den schönen, grünen Wald.
Es war noch früher, früher Morgen und viele Vöglein lagen noch in ihren Nestchen und schliefen. Nur die Bächlein rieselten und murmelten und die Morgenwinde lispelten in den Baumzweigen, sonst war es noch ganz stille, so stille wie in einer Kirche.
Graf und Gräfin gingen nun hinaus, bis sie die alte, greisbärtige Tanne von ferne sahen. Da küßte der Graf seine schöne Gräfin und eine Träne träufelte auf seinen Bart, denn er wußte nicht, ob er sie noch einmal sehen werde. Die Gräfin war aber heute gefaßter und ihr Herz schlug nicht so sehr wie die früheren Male. Sie nahm auch Abschied von ihrem Gemahl und wanderte zur Tanne.
Da stund sie aber ganz mutterseelenallein bei dem alten Baum und kein Nörglein ließ sich sehen. Da ging sie weiter und kam bald zu einem gar schönen Steige, wie sie noch keinen gesehen. Es waren an beiden Seiten wilde Rosensträuche und bildeten einen schönen Zaun. Sie ging dem Wege nach und kam bald zu einem schönen Tälchen. Da waren die schönsten Blumen und an den Hügeln standen Reben und Feigenbäumchen.
Mitten im Felde aber stund ein Häuschen und das war gar so nett. Es hatte kleine Fensterchen und die glitzerten im Scheine der Morgensonne gar lustig. Aus dem kleinen Kaminchen wirbelte blauer
Rauch auf und innen erklang ein Liedchen.
Die Gräfin vergaß Ach und Weh, als sie das Tälchen und das Häuschen sah, und schlich auf den Zehen zu einem Fensterchen, um zu sehen, ob es im Innern auch so schön sei.
Wie sie dabei war, sah sie in eine allerliebste Küche und drinnen sott und brodelte es in Häfelein und Töpfchen. Am Herde stand aber das Waldmännlein, rührte bald da bald dort auf und sang mit lächelndem Munde:
»Siede mein Hafele, plapper' mein Kraut,
's ist gut, daß die Frau Gräfin nit weiß,
Daß ich Purzinigele heiß.«
Die Gräfin hatte nun genug gehört. Leise, wie sie sich zum Hause geschlichen hatte, schlich sie wieder fort und eilte dann rasch zur Tanne hin, damit das Nörglein sie nicht einhole. Wie sie dort stund, konnte sie vor Freude fast nicht die Ankunft des Waldmännleins erwarten. Sie hatte noch nicht lange geharrt, als das Männlein kam. Heute war es noch schöner geschmückt als sonst und hatte ein rotes, golddurchwirktes Kleid an, das glänzte wie die Morgenröte.
»Nun rate heute zum letzten Male,« sprach der kleine Wicht die Gräfin an und blickte sie an, als hätte er sagen gewollt: »Du, Vogel, kommst mir nicht mehr aus den Schlingen.« Die Gräfin fing nun an »Pur« und schaute dabei den Frager mit beobachtendem Blicke an. »Nicht getroffen; nun darfst du noch zweimal raten!« sagte das Männchen.
»Ziege«, sprach wieder die Gräfin. Da überflog eine leise Röte das Nörglein und es schien nachdenklich zu werden. Doch sagte es: »Rate schnell - noch einmal steht es dir frei.« »Purzinigele!« rief die Gräfin voller Freude. Wie das Nörglein seinen Namen gehört hatte, rollte es zornig seine glühenden Augen, ballte krampfhaft die Fäuste und verschwand dann brummend in das Dickicht.
Die befreite Gräfin eilte aber der Stelle zu, wo der Graf in Ungeduld ihrer harrte. Das war aber eine Freude, als sich beide wieder fanden. Graf und Gräfin zogen nun auf ihr Schloß zur Freude der Ihrigen und lebten dort noch viele, viele Jahre als das glücklichste Paar, das man je gekannt.
Und wo ist das Purzinigele?
Das war so zornig, daß es auf und davon lief, und wurde seitdem nie mehr gesehen.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Meran
DER GLÄSERNE BERG ...
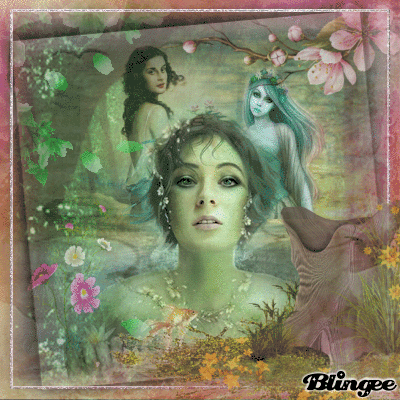
Ja, mein Kind, es ist schon lange her, - du denkst es nicht und ich auch nicht, da lebte einmal tief in einem Walde ein Förster, der hatte einen Sohn, der sich aufs Waidwerk ordentlich verstund. Der ging einmal hinaus auf die Jagd und schoß Hirsche und Rehe zusammen, als ob alles Wild nur da wäre, um von ihm geschossen zu werden.
Er wollte eben heimkehren, da ließ sich ein wunderschönes Reh sehen, und das wollte er noch schießen, bevor er nach Hause ginge. Das Reh lief immer weiter, und wenn er wieder anschlagen wollte, so war es hinter zehn Bäumen verschwunden. Er aber gab auch nicht nach und dachte: »Nachlaufen tue ich, so lange mich die Beine tragen.«
Auf einmal sah er einen großen, Spiegel hellen See vor sich, darin die Fischlein recht wonniglich aufhüpften, als ob ihr Kirchtag wäre. Der Försterssohn schaute sich den See ordentlich an, denn er war ihm ganz neu, und er dachte sich: »Daher komm ich nicht alle Tage.«
An einer Ecke nicht weit von dem Platze, wo er gerade zu stehen gekommen war, sah er drei Badende und an den langen Haaren, die über den See hin schwammen, erkannte er leicht, daß es Frauen waren. Hinter einer Hecke sah er ihre Überkleider liegen. Diese nahm er und lief davon. Er war noch nicht weit im Walde, da kamen die drei Jungfrauen heran gelaufen und baten um ihre Überkleider.
Nach langem Bitten stund der Förstersohn stille und nahm die entwendeten Kleider vom Rücken. Zuerst gab er der ältesten der Jungfrauen, dann endlich auch der zweiten das ihrige zurück. Sobald sie ihre Kleider hatten, waren beide weg, als ob sie der Wind vertragen hätte.
Die dritte aber, welche die jüngste und schönste war, ging noch lange nach und bat in einem fort den Jüngling um ihr Überkleid. Er aber tat, als ob er gar nichts hörte, ging vorwärts und ließ die Bittende neben sich herlaufen. Als er nach Hause kam, gab er ihr ein Kleid von seiner verstorbenen Mutter und hieß sie mit dem zufrieden sein.
Das Mädchen aber war bildschön und gefiel dem Jüngling, der eben ans Heiraten dachte, so sehr, daß er sich in den Kopf setzte, das selbe zur Frau zu nehmen. Er fragte jedoch alle Leute in der ganzen Umgegend, ob sie ihm denn nichts Näheres von dem schönen Mädchen oder von seinen Eltern zu sagen wüßten. Niemand wußte etwas anderes, als daß die Jungfrau eben achtzehn Jahre alt sei.
»Das ist ja gerade recht,« dachte sich der Försterssohn, »ich bin zwanzig Jahre alt, sie achtzehn, besser könnten wir ja nimmer zusammenpassen«. Er ging also schnurstracks zum schönen Mädchen und fragte es: »Magst mich heiraten?« Das Mädchen besann sich nicht lange und sagte: »Ja.«
Nun wurde zur Hochzeit alles vorbereitet. Der alte Förster verzierte sein Haus mit allen Hirschgeweihen, die er sein Lebtag zusammengebracht hatte, der junge aber ging in die Stadt und kaufte seiner Frau das schönste Gewand, das er nur aufbringen konnte.
In einigen Wochen kam es zur Hochzeit, da wurde gesungen und gejodelt, als wäre der Himmel voll Baßgeigen. Friedsam und fröhlich lebte der junge Förster mit seiner Frau im kleinen Försterhause. Der alte aber blieb auch bei ihnen und hatte sie gern wie ein Vater seine Kinder haben soll.
Wenn so der Förster mit seiner Frau allein im Garten saß oder im Walde ging, so bat sie ihn oft, er möchte ihr doch einmal jenes Gewand wieder geben, welches er ihr beim See entwendet hatte. Er aber wußte immer eine Ausrede und behielt den Schlüssel zum Schranke, worin das Gewand lag, fleißig bei sich.
Eines Tages ging er mit seinem Vater hinaus in den Wald auf die Jagd und hatte den Schlüssel zu Hause vergessen. Seine Frau sah den selben auf dem Kasten liegen und war über die Maßen froh, wieder zu ihrem Gewand kommen zu können. Eiligst sperrte sie den Kasten auf, nahm ihr Gewand heraus, legte es sich an, - und husch! war sie auf und davon.
Abends kam der Förster nach Hause, rief in allen Ecken und Enden nach seiner Frau, - aber sie gab keine Antwort. Er glaubte, es sei ihr ein Leides begegnet, und trübselig schlich er im Hause hin und her. Endlich warf er zufällig einen Blick auf den Kasten, in dem er das Kleid seiner Frau verborgen hatte, und wie er an dem selben den Schlüssel stecken sah, dachte er sich sogleich: »Holla, da hast du das Rechte getan!«
Er wollte nun nachsehen, ob das Gewand seiner Frau wirklich verschwunden sei, und riß unwillig über sich selbst die Schublade auf, an welcher der Schlüssel stak. Mit einem Blicke sah er, daß kein Kleid mehr in der Schublade sei, aber daß dafür ein Brief auf dem Kasten lag.
An den schönen Buchstaben erkannte er sogleich die Schrift seiner Frau und er las mit klopfendem Herzen folgende Worte: »Wenn mich mein Mann liebt und wieder finden will, so soll er mich auf dem gläsernen Berge suchen.« Der Förster besann sich keinen Augenblick, öffnete die Geldkiste, die in einer Ecke der Kammer stand, und steckte einen Haufen Goldstücke zu sich, um auf der weiten Reise keine Not zu leiden.
Dann ging er zu seinem Vater und erzählte ihm von dem sonderbaren Brief und von seinem Vorhaben, die verschwundene Frau auf dem gläsernen Berge zu suchen. Der alte Vater machte freilich großmächtige Augen bei der ganzen Erzählung, aber ehe er recht zu Worten kam, hatte ihm der Sohn schon die Hand zum Abschied gedrückt und war im nahen Wald verschwunden.
Der junge Förster ging nun aufs Geratewohl bis in die späte Nacht, und als am anderen Tage der erste Vogel pfiff, war er schon wieder auf den Beinen und schlenderte mutig fort, bis es wieder stockdunkle Nacht war. So ging es tagaus, tagein, bald durch finstere Wälder, bald über lichte Wiesen, bald auf, bald ab, bald hin und bald her.
Der junge Wandersmann ging und ging und es wunderte ihn recht sehr, wann er etwa zum gläsernen Berge kommen werde. So oft er in einem Hause zu Mittag aß oder übernachtete, fragte er die Leute, ob sie denn nie etwas gehört hätten, wo der gläserne Berg sei. Da schauten ihn die Leute groß an und manche meinten wohl gar, der junge Bursche habe sich in den April schicken lassen.
Begegnete ihm auf dem Wege ein altes runzliges Mütterchen, so war immer nach dem »Grüß Gott« die erste Frage: »Mütterchen, wo ist etwa der gläserne Berg?« Aber kein Mütterchen wußte, wo der gläserne Berg sei, und halb verdrießlich wanderte der Förster wieder weiter.
Eines Tages war er lange, lange durch einen dunklen Wald gegangen, und als es anfing zu dämmern, war er recht froh, ein Haus vor sich zu sehen, um darin über Nacht liegen zu können. Ohne sich lange zu besinnen, ging er hinein und es kam ihm ein Mann entgegen, der ihn fragte, wes Weges er sei. Der Förster antwortete, er wolle den gläsernen Berg finden, allein bisher sei all sein Fragen und Suchen vergeblich gewesen.
Wie der Mann von diesem Plane hörte, wurde er recht freundlich und höflich, führte den Wanderer in ein hübsches Zimmer und lud ihn ein, da über Nacht zu bleiben. Der Förster ließ sich nicht lange laden, aß zuerst ein gutes Nachtmahl, das man ihm vorstellte, und legte sich dann in das weiche Federbett, das in einer Ecke des Zimmers stand, und kaum lag er auf einem Ohr, so fing er auch schon an knietief zu schlafen, ohne nur ein einziges Mal aufzuwachen schlief er, bis der hellichte Tag in die Kammer schien.
Da erwachte der Förster, rieb sich zuerst die Augen aus, machte sich wieder reisefertig und ging nun zum Mann, um ihm für die freundliche Aufnahme zu danken. Nachdem er lange Zeit gedankt hatte, fragte er: »Aber mein lieber Mann, weißt du denn auch nicht, wo etwa der gläserne Berg ist und wie lange ich noch gehen muß, bis ich dahin komme?«
Der Mann, der ein Hexenmeister war, antwortete: »Ja, bis dahin ist es noch ein gutes Stück Weg. Aber damit du schneller an End und Ort kommst, will ich dir ein Mittel geben, für das du mir gewiß sehr dankbar sein wirst.«
Da ging der Hexenmeister weg und nach einigen Minuten kam er mit zwei ungeheuren Stiefeln zurück. »Da zieh diese Stiefel an und laß die selben nur gehen wohin sie wollen. Heute abends noch wirst du zum gläsernen Berg kommen, dann zieh die Stiefel aus und sieh zu, was weiter geschieht!«
Der Förster dankte aus Leibeskräften, schlüpfte in die Stiefel und flugs ging es zur Haustüre hinaus und dann über Stock und Stein, durch Wald und Feld so schnell, daß dem armen Förster beinahe der Atem versagte. Eine Stunde verging um die andere, ein Stiefel trat immer vor den anderen, - aber der gläserne Berg wollte sich noch immer nicht zeigen.
Schon war die Sonne dem Heimgang nahe, da sah der Wanderer vor sich etwas glänzen und flimmern und das Glänzen und Flimmern kam immer näher und näher, so daß sich der Förster bald überzeugt hatte, er nahe jetzt dem Ziele seiner Reise. Die Stiefel griffen noch einige Male kräftig aus, bis sie am Fuße des gläsernen Berges Halt machten.
Der Förster mußte nun zuerst die Augen zudrücken, ein solcher Schimmer leuchtete ihm von dem vielen Glase entgegen. Sobald er wieder die Augen aufzutun wagte, war das erste, daß er sich die großmächtigen Stiefel abzog, so wie es ihm sein Wirt aufgetragen hatte. Kaum hatte er das riesige Paar vor sich hingestellt, so hatte er es auch zum letzten Male gesehen.
Mit blinzelnden Augen ging nun der Förster am Fuße des Berges herum, um sich so viel möglich alles zu beschauen. Der Berg, der vor ihm stund, war wirklich von unten bis oben ganz vom hellsten Glase, und die Bäume und Sträucher und Gräser, die darauf und daneben stunden waren alle von purem Glas. Und weil eben die Abendsonne darauf schien, bot es den herrlichsten Anblick.
Die gläsernen Baumblätter flimmerten noch viel schöner als zitternde Birkenblätter im Sonnenglanze. Und die Gräser neigten und beugten sich im leisen Abendwinde und mit ihnen neigten und beugten sich die vielen Farben, die sie widerstrahlten. Der Berg selbst aber spiegelte die Sonne ab beinahe noch schöner und heller als sie am blauen Himmel stand.
Das alles gefiel freilich dem Förster gar wohl und er hätte sich nur gewünscht, daß seine Augen den Glanz recht vertrügen, und daß er auch wüßte, wie über den glatten Berg hinaufzukommen sei. Doch er dachte sich: »Kommt Zeit, kommt Rat,« und schaute einmal ganz gemächlich nach allen Seiten.
Da hörte er nicht weit von sich ein Geschrei, und wie er dem selben näher kam, bemerkte er, daß sich zwei Knaben um einen Sattel stritten. »Aha,« dachte er sich so gleich, »da hab ich es schon, der Sattel ist offenbar auch so ein Reitpferd wie die zwei Stiefel.«
Mit großen Schritten ging er auf die Knaben zu, zog ein Goldstück aus der Tasche und warf es ihnen hin. Beide stürzten gierig auf das Goldstück los, der Förster aber setzte sich schnell auf den Sattel und husch! war der Sattel mit dem Reiter auf der Höhe des gläsernen Berges.
Der Reiter stieg ab und sah um sich eine schöne gläserne Ebene und darauf ein prachtvolles gläsernes Schloß. Ohne sich lange zu besinnen, ging er in das Schloß und über die Stiege hinauf. Auf der Stiege begegnete ihm eine Frau, die er so gleich für seine Gemahlin erkannte.
Sie hieß ihn herzlichst willkommen, fügte aber ihrer Einladung bei: »Schwere Prüfungen wirst du bestehen müssen, bis dir dein Leben gesichert ist; denn meine Mutter, der dieses Schloß und der Berg gehört, legt jedem, der hierherkommt, allerlei schwere Proben auf, und wer die selben nicht zu lösen vermag, den richtet sie zugrunde.
Sei aber unverzagt, denn ich will dir durch jede Gefahr glücklich durchhelfen! Wisse übrigens, daß jene zwei Jungfrauen, die du bei mir am See gesehen hast, meine zwei Schwestern sind und ebenfalls in diesem Schlosse wohnen. Du wirst aber die selben nicht zu Gesichte bekommen, denn die Bedienung der Fremden ist mir allein überlassen.«
Kaum hatte sie dies gesagt, da kam ihre alte, greisgraue Mutter heran, begrüßte den Ankömmling mit aller Freundlichkeit und lud ihn ein, im Schlosse seine Herberge zu nehmen. Der Förster nahm die Einladung dankbar an und nachdem er sich mit einem Abendessen gütlich getan hatte, begab er sich zu Bette.
Kaum hatte er am anderen Morgen sein Lager verlassen, da ging die Türe seines Schlafgemaches auf und die Alte trat herein. Mit der widerlichsten Baßstimme brummte sie ihn an: »Weil du dich unterstanden hast hierherzukommen, mußt du heute alle Bäume des gläsernen Berges umhauen und vor das Schloß bringen. Ist die Arbeit abends nicht vollendet, so sieh zu, wie es dir ergehen wird. An ein Davonkommen darfst du nicht denken, denn ohne meinen Willen kommt niemand über die Grenzen dieses Berges. Da hast du ein Werkzeug für deine Arbeit.«
Mit diesen Worten warf sie ihm eine gläserne Hacke vor die Füße und so gleich wackelte sie wieder zur Türe hinaus. Dem Förster wäre bei der Rede der Alten ein wenig bange geworden, hätte er sich nicht an das freundliche Versprechen seiner Frau erinnert. Er ging nun mit seiner Hacke hinaus und warf vor allem einen Blick über den ganzen Berg.
»Holla,« dachte er sich, »das wird nicht so leicht gehen. Aber, du Narr, die Bäume sind ja von Glas und Glas bricht leicht.« So dachte er sich und wollte nun an den ersten Baum Hand anlegen. Aber er mochte sich anstrengen, wie er wollte, der Baum fiel nicht um. Er wäre nun noch verzagter geworden, hätte er sich nicht wieder an die freundlichen Worte erinnert, die seine Frau gestern zu ihm gesprochen.
Er spazierte den ganzen Vormittag auf und ab und seine ganze Arbeit bestand darin, daß er den Berg von allen Seiten genau anschaute. Als die Sonne mitten am Himmel stand, brachte ihm seine Frau das Essen, sprach ihm Mut zu und machte sich anstatt seiner an die Arbeit.
Das Werk ging so schnell vonstatten, daß der Förster gerade einmal schauen und sich über die Geschicklichkeit seiner Gemahlin freuen mußte. Die Bäume purzelten um wie die Mücken und in einer halben Stunde lagen sie alle vor dem Schlosse aufgehäuft. Abends kam die Alte, um zu schauen, wie es mit der Arbeit stehe. Sie zeigte sich ganz zufrieden, als sie die Bäume alle auf einem Haufen liegen sah.
Am anderen Morgen kam sie wieder in des Försters Zimmer, als er kaum aufgestanden war. »Heute,« brummte sie, »mußt du allen Bäumen die Äste abhauen und Baumstämme und Äste klein hacken, so daß sie zum Brennen tauglich werden.« Nach diesen Worten wackelte sie wieder zur Türe hinaus.
Der Förster nahm seine gläserne Hacke und ging hinaus zu den gläsernen Bäumen. Allein der ganze Vormittag ging vorbei, ohne daß auch nur ein einziger Baum gespalten wurde. Als die Sonne mitten am Himmel stand, brachte ihm seine Frau wieder das Essen und griff dann rüstig die Arbeit an.
Da flogen die Äste von den Bäumen herab und die Bäume und Äste in Prügel und Scheiter auseinander, daß es eine wahre Freude war zuzuschauen. Als die Arbeit vorbei war, trat die Frau zu ihrem Manne, drückte ihm ein Fläschchen in die Hand und sagte: »Heute nachts wird dein Zimmer voll Rauch werden, so daß du ersticken müßtest, wenn du kein Gegenmittel zur Hand hättest. Trinkst du aber den Inhalt dieses Fläschchens, so wird dir der Rauch nicht schaden.« Mit diesen Worten ging sie wieder von dannen.
Abends kam die Alte aus dem Schlosse, um nachzusehen, ob die Arbeit vollbracht sei. Als sie sah, wie fleißig Bäume und Äste klein gehackt waren, zeigte sie sich ganz zufrieden und kehrte wieder in das Schloß zurück.
Es war wieder dunkel geworden und der Förster begab sich in sein Schlafzimmer zur Ruhe. Kaum hatte er sich niedergelegt, so drang ein Rauch in das Zimmer, der immer dichter und dichter wurde, so daß dem Förster das Ersticken nicht ausgeblieben wäre, hätte er nicht schnell nach dem Fläschchen gelangt und dasselbe ausgetrunken. Nachdem aber dies geschehen war, kam ihm der Rauch gar nicht mehr beschwerlich vor, sondern er schlief so frisch und gesund wie nicht leicht in seinem Leben.
Am folgenden Morgen trat wieder die Alte ins Zimmer in der festen Meinung, der fremde Mann werde tot im Bette liegen. Wie ihr aber der selbe fröhlich entgegen trat, begrüßte sie ihn mit freundlichster Miene und drückte ihm ihre Freude darüber aus, daß er alle drei Proben glücklich überstanden habe. Dann bat sie ihn, er möchte ihr seine Lebensgeschichte erzählen.
Der Förster fing nun seine Erzählung an und kam endlich auch darauf zu sprechen, wie er seine Frau geholt habe und wer die selbe sei. Wie die Alte vernahm, der Fremdling sei der Gemahl ihrer jüngsten Tochter, da wußte sie fast nicht, was sie anstellen sollte vor lauter Freude, bewirtete das Ehepaar aufs kostbarste und nahm erst nach drei Tagen von dem selben Abschied.
Förster und Försterin kehrten zu ihrem Vater zurück und dieser hatte eine Freude, die der Erzähler nicht beschreiben kann.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
DER HOLZHACKER ...

Es war einmal ein Holzhacker, der nicht viel zu beißen und zu brechen hatte, aber dafür ein frisches Blut und Freude zur Arbeit. Der ging eines Morgens wieder hinaus in den Wald, schnalzte mit den Fingern und pfiff ein Lied vor sich hin, als ob die ganze Welt ihm gehörte.
Wie er so fort trollte, begegnete ihm ein altes Weiblein, das auf einer Krücke daherhinkte. »Guten Morgen,« rief ihn die Alte an, »auch schon auf den Beinen? Und du pfeifst ja und schnalzest und tust, als ob dir gar nichts abginge. Fehlt es aber ja doch manchmal am Geldbeutel und in der Küche und im Keller!«
Wie der Holzhacker das hörte, machte er große Augen, denn es nahm ihn wunder, woher wohl die Alte, die er sein Lebtag nicht gesehen hatte, dies alles wissen könnte. Während er so dies Mütterchen groß anschaute, sprach es weiter: »Willst du es aber gut haben, mein lieber Holzhacker, so geh mit mir und werde mein Diener, bei mir sollst du ein Leben haben wie ein Fürst.«
»Warum nicht?« sagte der Holzhacker, denn er dachte sich: Zu Hause habe ich doch nichts als die liebe Not und die kann ich überall haben. Er ging also mit dem krummen Mütterchen einen weiten, weiten Weg, bald durch pechschwarze Wälder, bald über struppige Heiden, und er verwunderte sich nicht wenig, daß die Alte auf ihren Krücken die lange Wanderung aushielt. -
Am zwölften Tage endlich kamen sie zu einer Höhle und gingen auf diese los. »Siehst du,« sprach die Alte, »durch diese Höhle kommen wir in meinen Palast. Der Eingang könnte zwar etwas schöner sein, aber du wirst sehen, desto prächtiger ist es inwendig.«
Sie gingen nun in die Höhle und kamen immer tiefer und tiefer hinein, bis sie endlich vor einer Türe anlangten, die von hellichtem Golde war. Die Alte zog einen goldenen Schlüssel aus dem Sacke und sperrte die Tür auf.
Sie traten nun in einen Saal, dessen Wände ganz mit Gold und Edelsteinen verziert waren. Der Holzhacker traute kaum seinen Augen, wie er all die Pracht sah und es kam ihm sonderbar vor, daß mitten in dem goldenen Gemach ein Löwe lag, der furchtbar heulte und winselte. Die Alte hinkte an dem Tiere vorbei, als ob sie es gar nicht sähe, und der Holzhacker hielt es auch für rätlicher zu schweigen.
Sie gingen nun aus dem prachtvollen Zimmer in ein anderes Gemach und von diesem wieder in ein anderes und so immer fort. In jedem Gemach aber war ein Löwe gelagert.
Endlich sprang auf den Wink der Alten eine Türe auf, durch welche sie in einen Saal traten, der ebenso prächtig war wie der erste. In der Mitte des Saales lag eine Löwin, die heulte und winselte und schaute den Holzhacker an, als ob sie ihm ihr Leid klagen wollte.
Dem Manne ging ihr Laut und ihr Blick tief zu Herzen und er sprach zur Alten: »Die armen Tiere müssen einen Wolfshunger haben. Soll ich ihnen nicht etwas zu fressen vorwerfen?« »Für das Fressen dieser Bestien hast du nicht zu sorgen,« schnarrte die Alte, »wohl aber dafür, daß sie täglich ihre Schläge bekommen.
Siehst du, dort drüben hängt die Peitsche, mit der du die Bestien tagtäglich aus Leibeskräften abklopfen mußt. Geschieht es fleißig, so wird dir dein Lohn nicht ausbleiben, bist du aber nachlässig im Dienste, so sollst du deine Strafe schon empfangen.«
Der Holzhacker sah wohl ein, daß es da nicht geraten sei zu widersprechen und versicherte, in allem pünktlich zu gehorchen. Jetzt hieß die Alte den Holzhacker ein wenig warten, hinkte davon, so schleunig es gehen wollte, kam aber bald wieder. »So, hier hast du dein gewöhnliches Frühstück,« sagte sie und stellte ihm einen Teller voll Obst vor.
»Schönen Dank,« erwiderte der Holzhacker und griff wacker zu. »Es ist doch schöner,« dachte er bei sich, »wenn in der Frühe eine Schüssel voll Pfirsiche und Feigen vor einem steht, als wenn man morgens vor der Arbeit gar nichts zu beißen hat.« Während er sich so seine Gedanken machte, waren die schönen Früchte allmählich zu Ende gegangen und der Holzhacker freute sich des Frühstücks wegen schon wieder auf den folgenden Morgen.
Was er dann den ganzen Tag hindurch getan hat, das weiß der Erzähler nicht zu sagen. Abends führte ihn die Alte in ein schönes Zimmer, worin ein Bett für ihn hergerichtet war. Er sagte nun der Alten »Gute Nacht,« legte sich in sein Bett und schlief bald ein. Er hatte noch nicht lange geschlafen, da wurde er durch ein Klopfen an die Zimmertür geweckt.
Neugierig sprang er aus dem Bette, zündete sein Licht an und schaute zur Türe hinaus, was es gebe. Und wer war draußen? Der Löwe war es, den er im ersten Saale gesehen hatte, und deutete durch klägliches Gewinsel an, daß er zu dem Holzhacker hinein wolle.
Dieser war voll Mitleiden mit dem armen Tiere und ließ das selbe ungehindert hereingehen. Wie der Löwe drinnen war, fing er an zu reden wie ein Mensch und sprach zum Holzhacker:
»Du hast dich vielleicht schon lange über die sonderbaren Bewohner dieser prachtvollen Gemächer verwundert. So wisse denn, daß ich selbst ein verzauberter Prinz bin, und daß alle Löwen und Löwinnen, die du in dem Palast sahst, meine verzauberte Dienerschaft sind.
Die Löwin aber, die du in dem letzten Saale erblicktest, ist meine Verlobte und die Alte, die dich hieher geführt hat, ist ihre Mutter. Diese wollte unsere Verbindung hintertreiben und hat uns deswegen in so abscheuliche Bestien verwandelt. Du bist der einzige, der uns befreien kann. Die Alte schläft ja wie eine Ratte und du hast jetzt die beste Gelegenheit, ihr den Garaus zu machen. Uns allen aber mußt du die Halsbänder lösen und der Zauber hat ein Ende.«
Der Holzhacker war wie vom Himmel gefallen, als er dies hörte, und versprach hoch und teuer, alles zu tun, was zu ihrer Rettung notwendig wäre. Der Löwe ging wieder aus dem Zimmer, der Holzhacker aber griff nach seiner Hacke und schlich sich auf den Zehen in das Schlafgemach der Alten. Er trat zum Bette hin und schaute ihr recht scharf ins runzlige Angesicht, um sich zu überzeugen, ob sie wohl schlafe.
Wie er sah, daß sie keine Miene veränderte und die Augen fest zugeschlossen hatte, nahm er sich ein Herz, faßte die Hacke und tat einen so kräftigen Schlag auf den Kopf der Alten, daß sie nur noch einen Schrei ausstieß und dann mausetot war.
Er ließ die Alte in ihrem Blute liegen und ging zu den Löwen herum, löste allen nacheinander die Halsbänder, zuerst dem verzauberten Prinzen, dann der Prinzessin und dann der Dienerschaft, und in kurzem wimmelte es um ihn her vor lauter Leuten, die ihm für die Befreiung vom Zauber zu danken nicht aufhören wollten.
Prinz und Prinzessin machten sich nun mit ihrer Dienerschaft und dem Holzhacker auf die Reise und in sechs Tagen kamen sie wieder in ihrem Königreiche an, das sie so lange nicht mehr gesehen hatten. Sie fanden alle Leute wegen ihrer langen Abwesenheit in der größten Bestürzung, denn niemand wußte, wo sie eigentlich hingekommen waren.
Allein als sie erkannt wurden und sich die Nachricht von ihrer Zurückkunft verbreitete, da war eine Freude im ganzen Königreiche, als ob sie vom Grabe auferstanden wären. In wenigen Tagen wurde die Hochzeit gehalten und dabei ging es so lustig her, daß man noch in späten Zeiten von der schönen Feierlichkeit erzählte.
Und der Holzhacker? Der Holzhacker blieb am Hofe so lange er lebte und hatte alles, was er sich nur wünschen mochte, in Hülle und Fülle.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Bozen
WIE EIN ARMES MÜTTERCHEN ZU VIELER WÄSCHE KAM UND DIESELBE WIEDER VERLOR ...
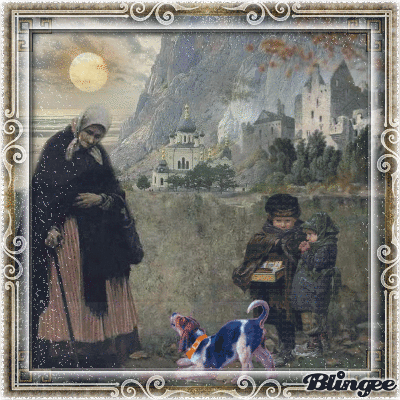
In einem abgelegenen Dorfe auf einem hohen Berge lebte einmal ein gar armes Mütterchen, das den bittersten Mangel litt. Eines Tages nahm es einen Stock und machte sich auf den Weg ins Tal hinunter, um bei guten Leuten Almosen zu erbetteln.
Als es durch den dichten Weißtannenwald ging, kam es zu einer Felswand in der wilde Weiblein wohnten, und der Duft frischgebackenen Brotes wehte dem Mütterchen entgegen. Da dachte sich die Arme: »O, hätte ich nur ein Stücklein Brot, um meinen ärgsten Hunger zu stillen!«
Kaum hatte sie dies gewünscht, stand ein wildes Weiblein mit einem großen Brotlaib vor ihr und sprach: »Da hast du's, hungeriges Ding!« und gab ihr das Brot. Das erstaunte Mütterchen wollte danken, allein das Weiblein war blitzschnell im Felsen verschwunden. Das Mütterchen stillte nun seinen Hunger und wanderte dann neugestärkt weiter, bis es in das Tal kam. Hier hausten aber sehr böse und übermütige Leute, welche der Armen nichts gaben und sie verhöhnten und mißhandelten.
Und wenn das Mütterchen am Tage sich müde gegangen hatte, mußte es nachts auf offenem Felde liegen, so daß es vor Frost nicht schlafen konnte. Da dachte es: »Mein Bleiben dahier ist vergebens, ich gehe wieder heim.« Als es sich aber auf den Heimweg machte, war es sehr kalt und das Mütterchen zitterte vor Frost, denn sein Gewand war zerrissen und zerschlissen.
Die Arme wäre wohl auf dem Wege erlegen, wenn nicht das Brot, welches nie zu Ende ging, sie wunderbar gestärkt hätte. Als der Weg sie zum Felsen der wilden Weiblein führte, sah sie dort ganze Leinwandballen auf der Bleiche liegen. Da seufzte das Mütterchen, welches vor Kälte zitterte: »Oh hätte ich nur ein Stück solcher Leinwand! Dann könnte ich mir gute Hemden machen und es würde mich nimmer so frieren.«
Als es diesen Wunsch getan hatte, stund wieder das wilde Weiblein vor ihr, trug einen Garnsträhn in der Hand und sprach mitleidig: »Da hast du einen Garnkranz, nacktes Ding! Er wird nimmer zu Ende gehen, wenn du nicht selbst es wünschest. Darum sage nie, wenn du den selben in die Hand nimmst: 'Oh, wärest du zu Ende!'«
Mit diesen Worten verschwand das wilde Weiblein wieder und das beschenkte Mütterchen ging freudig seinen Weg, bis es nach Hause kam. Da setzte es sich müde auf einen Stuhl und begann Garn zu winden und soviel es wand und wand, das Garn ging nicht zu Ende.
Das Mütterchen gab nun dem Weber vollauf zu tun, bezahlte ihn zuerst mit Leinwand, machte sich dann Hemden und verkaufte dann die übrigen Stücke. Der Leinweber war vom Mütterchen allein in einem fort beschäftigt und dieses löste aus dem schönen Tuche so viel Geld, daß es ganz sorgenfrei und glücklich leben konnte.
So ging es lange Zeit hindurch und das Mütterchen wurde immer wohlhabender. Die Leute verwunderten sich darüber, woher es soviel Garn und Geld nehme, konnten aber ihr nichts Böses nachsagen. Einmal kam aber das Mütterchen in einen Wortwechsel mit einer bösen Nachbarin und beide erzürnten sich gar sehr.
Da sagte die Nachbarin: »Schweig du, alte Hexe! - Wir wissen alle, daß der Selbander dir das Garn bringt,« und so zankten und haderten sie lange Zeit hindurch. Endlich ging das Mütterchen ergrämt nach Hause und begann wiederum Garn zu winden.
Als es aber mißmutig einige Zeit lang gewunden hatte, sagte es unwillig: »Du verwünschtes Garn, wärst du doch einmal zu Ende!« Kaum gesagt, war der Wunsch auch erfüllt und Garn, Leinwand und Geld waren verschwunden.
Selbst das Gewand, das aus solchem Garn gewoben war, war verflogen und zerstoben, und splitternackt saß das alte Mütterchen auf dem Stuhle und war ärmer als zuvor.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Luserna
DAS KLUGE EHEPAAR ...
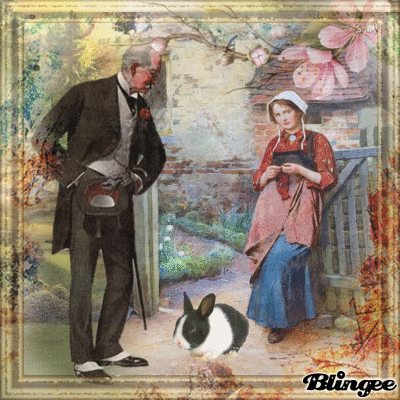
Es war einmal ein Mann, der zwar kein Haus, aber ein kluges Weib hatte. Da bezog er ein kleines Haus, das einem reichen Herrn gehörte, gegen einen bedeutenden Mietzins. Mann und Weib arbeiteten und sparten das Jahr hindurch wohl fleißig, allein da es zu Ende ging, war dennoch nur wenig Geld in ihrem Schreine und sie sahen mit Angst und Furcht dem Zinstage entgegen.
Als dieser angebrochen war, blieb auch der Hausherr nicht lange aus, um die Miete einzutreiben. Wie aber das arme Weib ihn kommen sah, trug sie einen großen Kessel mit siedendem Wasser auf den Söller hinaus. Der Herr, welcher die Bäurin von der Straße aus gesehen hatte, ging zuerst auf die Laube und fragte den Mann, der auch bei dem Kessel stund: »Was machst du hier?«
Der Bauer antwortete: »Mein Weib will waschen und siedet hier Wasser.« Da erwiderte der Herr: »Du Narr, wie wird das Wasser ohne Feuer sieden?« »Tut nichts,« sprach der Bauer. »In diesem Kessel siedet auch das Wasser ohne Feuer. Greift nur hinein, und Ihr werdet es glauben.«
Der Herr griff in das heiße Wasser und rief: »Wahrlich, das ist ein kostbarer Kessel! Möchtest du ihn nicht mir geben? ich erlasse dir dafür den Zins.« Der Bauer weigerte sich anfangs, erfüllte aber endlich den Wunsch des Herrn und dieser ließ den Kessel in sein Haus tragen.
Seelenvergnügt rief er seiner Frau bei der Heimkunft zu: »Liebes Weib, da hast du nun einen Kessel, in welchem das Wasser ohne Feuer siedet.« Entzückt über dies Geschenk und voll Neugierde ließ sie den Kessel mit Wasser füllen, allein das Wasser wollte nicht warm werden.
Endlich brach ihr die Geduld, sie lief zu ihrem Herrn und rief: »Du dummer Esel, wie hast du dich betrügen lassen! - Der Kessel braucht Holz wie jeder andere. Jage doch das betrügerische Lumpenpack, das dich so bei der Nase herumgeführt hat, aus dem Hause!« Der Herr sprach: »Wart nur, ich werde das Gesindel schon wegtreiben wie die Hunde.«
Nach einem Jahr ging der reiche Mann hinaus zu den armen Leuten, um den Zins zu fordern und ihnen die Wohnung aufzukünden. Er traf aber nur das Weib zu Hause an und fragte sie: »Wo ist dein Mann?« Sie antwortete: »Er ist auf dem Felde, ich werde aber gleich das Häschen hinaus schicken, um ihn zu holen.«
»Ei was,« sprach der Herr, »ein Häschen soll ihn rufen?« »Ja«, erwiderte das Weib und verließ auf einige Minuten den Herrn. Bald darauf kam der arme Mann mit einem Häschen im Arme, das er streichelte.
Der Herr glaubte nun, der Hase habe wirklich den Bauern, der zwei Hasen besaß und einen auf das Feld mitgenommen hatte, herbeigerufen, und sprach: »Potztausend, das ist doch ein kluges Tier. Überlaß es mir für meine Frau und ich will dir den Zins schenken.«
Der Bauer wollte anfangs nicht darauf eingehen, gab aber doch endlich nach und der Herr eilte hocherfreut mit dem Wundertiere nach Hause. »Ei sieh!« sprach er zu seiner Frau, »was ich dir heute bringe. Wenn ich fort bin, brauchst du nur dies kluge Tier nach mir zu schicken, und es läuft und holt mich.« Die Frau bewunderte den Hasen und dachte: »einen solchen Boten kann ich wohl brauchen.«
Am folgenden Morgen wollte der Herr mit den Arbeitern auf das Feld gehen und sprach zur Frau: »Ich gehe nun auf den Acker, um dort nachzusehen. Wenn das Mittagsmahl bereitet ist, schicke das Häschen hinaus.« Er begab sich nun fort, und als das Essen bereitet war, schickte die Frau das Häschen ins Freie.
Dies aber sprang lustig ins Weite, ohne sich um den Auftrag zu kümmern, und ließ sich nie wieder sehen. Der Herr wartete und wartete auf den Boten, der ihn zum Essen rufen sollte; allein vergebens. Endlich war seine Geduld alle und er eilte nach Hause.
Als er zu seiner Frau kam, rief er: »Warum hast du den Hasen nicht hinaus geschickt, um mich zu rufen?« Darauf entgegnete die Frau: »Ich habe ihn wohl mit der Botschaft weg gesandt. Ist er nicht gekommen?« »Nein,« antwortete der Mann. Da ward die Frau zornig und schrie: »Du bist ein gepelzter Narr, weil du dich wieder hast betrügen lassen.«
Der Herr sagte aber: »Nur Geduld, ich werde die Leute aus dem Hause werfen.« Es verging aber wieder ein Jahr, bis er zu dem armen Paar hinausging. Als er die Treppe hinaufstieg, schlug der Mann das Weib mit einer Stange zu Boden, daß es wie leblos da lag.
Der Reiche fragte erschrocken: »Ei, was hast du hier getan?« Der Arme antwortete: »Ich werde sie schon aufstehen machen,« holte eine alte Geige aus der Truhe, begann damit aufzuspielen - und das Weib sprang lustig wie ein Widder auf und ging das Mittag kochen.
Da staunte der Reiche und sprach: »Ei, was hast du für eine Geige!« »Ja,« antwortete der arme Mann: »sie ist Goldes wert, denn wie ich mit ihr aufspiele, so muß das Weib tanzen.« Darauf sagte der Herr: »Wenn diese Geige eine solche Eigenschaft hat, könnte ich damit meine Frau gehorchen machen. Gib mir die Geige und ich schenke dir den Mietzins und gebe dir darüber noch das Geld, das ich bei mir trage.«
Der Mann war des zufrieden, gab ihm die Geige gegen das versprochene Entgelt und der Reiche ging seelenfroh nach Hause. Bald darauf erzürnte ihn seine Frau und er nahm eine Stange und schlug sie damit tot. Das ganze Gesinde lief zusammen und fragte: »Warum habt Ihr dies getan? Die Frau ist tot, Ihr seid ein Mörder.«
Er antwortete ruhig darauf: »Ich werde sie schon aufstehen machen,« holte die Geige und fiedelte lange Zeit der Leiche vor. Diese rührte sich aber nicht und lag steif und fest da wie ein Stock. Endlich ward er des Geigens müde und sprach zornig: »Warte nur, du faules Weib, ich werde dich doch zum Aufstehen bringen. Am jüngsten Tage will ich geigen, daß du gewiß aufstehen und nach meiner Geige tanzen mußt.«
Den armen Leuten ging es aber fürbaß gut, denn sie hatten für die Geige soviel Geld bekommen, daß ihr Hauswesen sich bessern konnte.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Proveis
DER KNABE UND DIE RIESEN ...

Vor langer Zeit trieb ein Riese sein Unwesen. Er war so stark, daß er die größten Bäume zu Wieden drehte und mächtige Felsstücke fernhin schleuderte. Diese Stärke machte ihn übermütig und er tat den Menschen Leides, wo er nur konnte. Deshalb suchte man ihn unschädlich zu machen, doch niemand wagte es, mit ihm zu kämpfen.
Endlich kamen die Leute auf den Gedanken, ihn durch List zu fangen. Man grub nun in einem Garten, in dem er oft spazieren ging, eine große, große Grube und bedeckte sie mit Rasen und Gesträuch. Wirklich kam er bald darauf in den Garten, wandelte auf und ab und geriet endlich in die Falle.
Da brüllte er vor Wut, daß Berge und Bäume zitterten. Als die Leute dies hörten, liefen sie herbei und banden ihn mit Zauberstricken, denn andere hätte er zerrissen wie einen dünnen Faden. So gefesselt wurde er nun in einen Keller gesperrt, wo er Hunger und Durst litt.
Da erbarmte sich ein kleiner Knabe des wilden Mannes und brachte ihm täglich etwas zu essen, denn die Leute ließen den Kleinen gerne in den Keller hinunter, um den »Enzkerl« anzusehen. Da bat der Riese den Knaben, ihm die Stricke von den Händen loszumachen.
Der Knabe wagte es aber nicht, weil er den Zorn der Leute fürchtete. Als aber der Riese immer von neuem bat und ihm allerlei Gutes versprach, dachte der Junge: »Was wird es schaden, wenn ich ihm die Hände frei mache? Er hat ja seine Füße auch gebunden und kann doch nicht davonlaufen.«
Mitleidig löste er die Handstricke auf, erschrak aber nicht wenig, als der Riese jetzt sich selbst die Fußbanden weg riß. Der Knabe weinte bitterlich, denn er fürchtete scharfe Strafe. Da sprach der Riese ihm Trost ein und sagte: »Weine nicht, dir soll es gut gehen. Ich will deinen Dienst belohnen. Geh gleich mit mir und du sollst die Königstochter gewinnen und Zepter und Krone.«
Da besann sich der Junge nicht lange, denn er fürchtete die Schläge seines Vaters, und lief mit dem Riesen in den wilden Wald hinaus. Hier weideten auf einem freien Platze, der rings von Tannen und Lärchen dicht umgeben war, zwölf Bären und zwölf Pferde. An der Spitze der letzteren graste eines, das ein goldenes Hinterteil hatte.
Da sagte der Riese zum Knaben: »Hüte diese zwölf Bären und diese zwölf Pferde und fürchte dich nicht davor. Ich werde dir eine Harfe geben, und wenn du auf der selben spielst, werden dir die Tiere willig folgen und dir nachgehen wie Lämmer. Wenn aber dann ein Riese kommt und dich erschlagen will, so wehre dich. Und sobald er dich fassen will, rufe dreimal: 'Fall nieder!' und schlag ihn dann mit dem Stocke, den ich dir hier gebe, auf den Kopf, und er wird sogleich tot sein.
Bald darauf wird ein anderer Riese kommen und sagen: 'Knabe, warum hast du meinen Bruder erschlagen? Wart du sollst es büßen', und er wird dich töten wollen. Da mache es aber ebenso wie bei dem ersten, und er wird dir kein Leid tun. Wenn der zweite tot ist, wird der dritte und der größte Riese daher laufen und zu dir sagen: 'Lump, warum hast du meine zwei Brüder erschlagen? Wart, du sollst es mit dem Leben büßen.'
Mit seiner Eisenstange wird er dich totschlagen wollen, sage aber nur sogleich dreimal: 'Falle nieder' - und er wird zu deinen Füßen liegen und du tötest ihn. Sind alle drei erschlagen, dann nimm das Pferdchen mit dem goldenen Hinterteil und reite in die Königsstadt. Dort wirst du dein Glück machen und die schöne Prinzessin heiraten können.« Nachdem der Riese dies gesagt hatte, ging er fort und verschwand im Walde.
Der Knabe begann nun die Saiten zu rühren und diese klangen so wunderschön, daß man auf Erden nichts Süßeres hören konnte. Selbst die Bären kamen herbei, legten sich dem Knaben zu Füßen und horchten zu. Die Pferde hielten im Grasen inne und standen wie angewurzelt und die Vöglein auf den Bäumen hörten auf zu singen, um den schmeichelnden Tönen zu lauschen.
Da rauschte und prasselte es auf einmal in den Bäumen und ein fürchterlicher Riese sprang auf das Feld: »Knabe, warum hütest du meine Bären und meine Pferde? Wart, du sollst es büßen,« brüllte er und drehte zornig seine funkelnden Augen. Wie er aber auf ihn losspringen wollte, rief der Junge dreimal: »Fall nieder!«, und der lange Lümmel lag vor ihm hingestreckt wie ein gefällter Baum. Sogleich schlug der Knabe mit dem Stocke auf den Kopf des Waldmannes und im Augenblicke war er mausetot.
Es dauerte nicht lange, da kam der zweite Riese und wollte den Knaben erschlagen, wie es vorausgesagt war. Allein der Junge fällte auch diesen, der noch größer und schrecklicher war als der erste. Endlich kam der dritte Waldmann herangebraust. Seine Augen funkelten vor Zorn wie zwei brennende Räder und schon von weitem brüllte er, daß die Bäume zitterten: »Lump, warum hast du meine zwei Brüder erschlagen? Wart, du sollst es mit dem Leben büßen!« schrie er und stürzte auf den Knaben los.
Dieser war nicht faul, rief dreimal: »Fall nieder!«, und der fürchterliche Enzmann lag wie ein Stock vor ihm. Im Nu schlug der Junge ihn auf den Kopf und der Waldmann tat keinen Schnaufer mehr. Da dachte sich der Knabe: »Jetzt habe ich alle drei Mordskerle erschlagen, jetzt muß ich doch nachsehen, was jeder bei sich trägt, denn das gehört mir.«
Gedacht, getan. Er untersuchte den Sack des ersten, darin fand er ein eisernes Schlüsselchen. Im Sacke des zweiten traf er ein silbernes, in der Tasche des dritten lag aber ein goldenes. Da steckte er alle drei Schlüsselchen zu sich, nahm die wunderbare Harfe, schwang sich auf das Pferd mit dem goldenen Hinterteil und sprengte in den Wald der Gegend zu, von der die Riesen gekommen waren.
Da ritt er lange, lange und sah nichts als die alten Bäume und hörte nichts als hier und dort das Pfeifen eines Vogels. Als er schon lange Zeit geritten war, lichtete sich endlich der Wald und er kam zu einem freien grünen Platze. Darauf stand ein prächtiges Schloß und hinter dem selben breitete sich ein weiter Garten aus voll bunter, duftender Blumen und schöner Bäume, an denen die herrlichsten Früchte hingen.
Darüber freute sich der Knabe, denn er war müde und hungrig und sehnte sich nach Ruhe, Speise und Trank. Er wollte in das Schloß, allein das einzige Tor war gesperrt und der Garten war mit einer Mauer, die man nicht übersteigen konnte, umgeben. Da dachte er sich, vielleicht öffnet ein Schlüssel die Burg.
Er ging zum Tore und versuchte es mit dem goldenen Schlüsselchen zu öffnen, konnte aber damit nichts ausrichten. Da nahm er das silberne, allein auch dieses paßte nicht in das Schloß. Aber das dritte öffnete die Türe und er trat in eine hohe Halle, die von Gold und Silber strahlte. Eine solche Herrlichkeit hatte er sein Lebtag nicht gesehen.
Eine weiße Marmorstiege führte ins erste Stockwerk. Er stieg hinan und kam zu einer geschlossenen Türe. Diese öffnete er mit dem silbernen Schlüsselchen. Er trat nun in die Küche und von dort in den dahinter gelegenen Speisesaal. Darin war eine große Tafel gedeckt und mit den besten Speisen beladen. Was nur jemand wünschen konnte, stand darauf: Fleisch und Fische, Braten und Torten, Früchte und Wein.
Der hungrige Bursche setzte sich rasch hinzu und ließ sich all die Speisen herrlich schmecken, bis er satt war. Dann streckte er sich auf ein Faulbett hin und suchte Ruhe und neue Kraft im Schlafe. Als er wieder die Augen öffnete, glänzte schon der Morgen durch die hohen Fenster. Er sprang vom Lager, nahm einen Imbiß und besichtigte als dann das Schloß.
Da kam er zu einer Türe, die ganz von Golde, jedoch gesperrt war. Da nahm er das goldene Schlüsselein und öffnete sie. Welch eine Pracht blendete da seine Augen! Alle Wände schimmerten von rotem Golde und blitzenden Edelsteinen und alles Geräte war aus denselben kostbaren Stoffen gefertigt. Anfangs konnte sich der Junge vor all dieser Herrlichkeit nicht fassen. Er stand regungslos da, als ob er versteinert sei.
Als er sich satt gesehen hatte, musterte er die einzelnen Gegenstände, Stück für Stück. Da fand er ein goldenes Gewand, das wie die Sonne glänzte. Dies wäre ein Kleid für dich, dachte er und probierte das selbe an. Da saß es ihm so gut, als ob es ihm angegossen wäre, und jubelnd besah er sich in dem Gold umrahmten großen Spiegel, der an einer Wand hing.
Wie er dann im Zimmer herumstolzierte, sah er zu seiner größten Freude einen goldenen Sattel. »Ha, der paßt für mein Pferd,« rief er und nahm ihn zu sich. Flugs eilte der Junge in den Hof hinunter, wo das Pferd stand, sattelte es, schwang sich hinauf und flog schnell wie der Wind von dannen. Er ritt geraden Weges der Königsstadt zu.
Als er dort ankam, lief ihm groß und klein nach, denn einen so schönen Reiter hatte noch niemand gesehen. Bei einem Gasthaus machte der Junge Halt und blieb dort über Nacht. Er tat, als ob er ein fahrender Harfner wäre, und spielte den Leuten allerlei Stücke vor. Da war das Staunen über seine Kunst noch größer als das über seine Schönheit, und jung und alt wurde von seiner Musik bezaubert.
Der Ruf vom schönen Spielmanne flog durch die Stadt und drang bis zu Hofe. Nun bat die Prinzessin ihren Vater, er möchte doch den fremden Spielmann in die Burg kommen lassen, damit sie seine Weisen höre. Der Vater widerstand den Bitten seiner einzigen Tochter nicht und hieß den Harfner herbeiholen.
Er kam und sein ganzes Wesen gewann die Herzen aller. Als er aber in die Saiten griff, da glaubte man, die Musik der Engel zu hören, und jeder vergaß sein Weh und Ach und das Herz der schönen Königstochter schmolz wie der Schnee im Frühling. Sie glaubte ohne den wundersamen Spielmann des Lebens nicht mehr froh werden zu können, so sehr liebte sie ihn.
Der König hieß ihn aber am Hofe bleiben und hielt ihn in hohen Ehren. Es dauerte nicht lange und er hatte durch seine Kunst und Tapferkeit so sehr die Herzen aller gewonnen, daß ihm der König seine Tochter zur Frau gab. Da ward eine Hochzeit gefeiert, so reich und prächtig, daß man nie eine schönere sah.
Auch seine armen Eltern hatte er dazu eingeladen, die das Glück ihres Kindes nicht begreifen konnten, bis er ihnen die Geschichte mit den Riesen haarklein erzählt hatte. Nachdem das Fest zu Ende war, zog er mit seiner Braut auf die herrliche Riesenburg im Walde, wo er die glücklichsten Tage verlebte, bis ihm der alte König Krone und Reich abtrat.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Sarnthal
DER GESCHEITE HANS´L ...
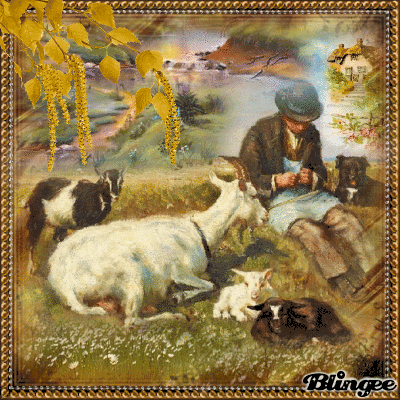
Es war einmal ein Bauer, der hatte drei Söhne. Der Jüngste darunter war der dümmste und hieß Hans; die Leute nannten ihn aber zum Spotte immer nur den gescheiten Hans.
Hans mußte im Herbst mit seinen Brüdern auf den Wiesen die Schafe und Böcke seines Vaters hüten und da neckten und tratzten ihn die anderen Hirtenbuben oft und Hans gab den Narren ab für alle.
Einmal vergaßen die drei Knaben, als sie von Hause fortgingen, das Mittagsmahl mitzunehmen. Erst als es sie hungerte, gedachten sie des selben und schickten den Hans nach Hause zurück, damit er ihnen etwas zu essen hole. Die Mutter kochte, als Hans angetrollt gekommen war und seinen Auftrag entrichtet hatte, dem Knaben einen Stupfplenten, gab diesen dem Hans und schickte ihn dann auf die Wiese hinaus zu den hütenden Brüdern.
Hans trollte mit offenem Munde über Stock und Stein dahin und dachte wie ein rechter Lappe weder an den Himmel noch an die Welt noch an die Hölle. Es stieß ihm auf seiner Wanderung lange nichts Erhebliches zu, bis er neben sich auf dem Boden einen langen, langen dunkeln Mann einhergehen sah.
Der Mann hatte aber so lange Arme, daß sie länger waren als der ganze Hans'l, und die Beine des Mannes waren so hoch als die fünfzigjährigen Pappeln am Wiesenbache. Der vermeintliche Mann war aber Hansens Schatten. Anfangs wären dem Hans, als er den riesigen, geheimnisvollen Mann sah, bald die Gänsrupfen aufgestanden, als aber der lange Hans'l sich ganz ruhig verhielt, faßte sich Hans'l wieder, und als er Hunger verspürte, nahm er ein Stück Plenten und aß es mit großem Behagen.
Kaum hatte aber Hans'l die Lippen bewegt, so schien der große Mann auch zu kauen, als ob sein Mund in Wieden gewesen wäre. »Das ist ein Stummer,« dachte sich Hans'l, »und weil er auch etwas zu beißen haben will, macht er so das Maul auf und zu.« Mitleidig warf er dem stummen Begleiter ein Stück Plenten zu und ging seines Weges weiter. Wie aber Hans seinen Mund auftat, tat der Stumme dasselbe.
»Der arme Teufel will halt auch noch ein Stück haben,« dachte Hans und warf ihm wieder ein gutes Stück zu. So ging es fort, Hans aß immer und der lange Kerl hatte einen solchen Regimentshunger, daß er nie genug zu haben schien. Hans war endlich des Spieles überdrüssig und wollte den Langen jagen.
Allein es war umsonst, der Mann begleitete ihn, bis die Sonne hinter den bewaldeten Bergen untergegangen war; da war aber auch der Stupfplenten zu Ende und Hans hatte seinen Brüdern nichts mehr zu bringen, denn er hatte alles selbst verzehrt oder seinem Begleiter gegeben.
Als ihn seine Brüder von ferne kommen sahen, stürzten sie ihm entgegen, denn es hungerte sie. Auf ihr Begehren sprach er, er hätte keinen Bissen mehr, denn sein langer, stummer Begleiter habe ihm alles abgefressen. Die Brüder ahnten, daß hinter dieser Geschichte nur eine Dummheit stecke, und darüber erbost jagten sie ihn gleich wieder nach Hause, etwas anderes zu holen.
Hans'l eilte nun heim und hinterbrachte der Mutter das Anliegen seiner Brüder. Sie riß die Augen nicht wenig auf, als sie dieses hörte, und mit einem nicht eben freundlichen Gesichte ging sie in die Küche und buk dort Kuchen. Als ein Teller damit vollgetürmt war, legte sie die selben in ein Körbchen und gab es dem Hans.
»Da nimm die Kost für deine Brüder,« sprach die Mutter mahnend, »und mache nicht eine neue Dummheit; denn die Gottesgabe ist teuer und deine Brüder plagt der Hunger und das ist ein böser Gast.« Dabei gab sie ihm zwei Kuchen, damit er die anderen desto sicherer den Brüdern brächte.
Hans nahm sich die Worte der Mutter zu Herzen und aß die Kuchen und machte dann rechtsum durch die Türe hinaus. Er ging seine Wege fort und alles ging in Ordnung. Da kam er aber zu einer Brücke und auf dieser sah er gar viele Löcher und Spalten.
»Ah,« dachte Hans, »das geht nicht. Morgen müssen wir mit den Schafen da überfahren und da könnten sich die armen Tiere leicht ihre Füße brechen. Ich will sie zur Vorsicht vermachen.« - Hans setzte seinen Gedanken ins Werk. Er nahm einen Kuchen nach dem anderen aus dem Körbchen und verstopfte damit die Löcher der Brücke. - Als er mit der Arbeit fertig war, war auch das Körbchen leer und so kam Hans wieder mit leeren Händen zu seinen Brüdern.
Die Brüder wurden sehr böse, als sie Hans mit leeren Händen sahen; denn es hungerte sie, daß sie Holz und Steine hätten essen mögen. Allein es war schon dunkle Nacht und so war guter Rat teuer. Sie legten sich nun mit dem hungernden Magen auf die Streu und schliefen gar süß, denn sie hatten keine bösen Träume.
Als der Morgen hinter den Bergen emporstieg und den Himmel goldenrot malte, erwachten die Brüder und der Hunger mit ihnen. »Was ist nun zu tun?« dachten sie, »den Hans'l können wir nicht heimschicken; denn die dritte Dummheit bliebe gewiß nicht aus.«
Nach einigem Hin- und Herdenken gerieten sie endlich auf den Einfall selbst nach Hause zu gehen und dem Hans'l einstweilen das weidende Vieh anzuvertrauen. »He, Hans'l!« rief der Älteste, »heute gehen wir nach Hause, das Essen zu holen, habe indessen auf das Vieh recht acht, auf daß kein Stück verlaufe.«
Die Brüder waren nun fort und Hans war allein bei der Herde. Er legte sich an den Rain hinaus in die Sonne und ließ die selbe sich in das Gesicht scheinen, denn dies gefiel ihm gar zu gut. Die Geise und Böcke sprangen und grasten und meckerten und klingelten, daß es eine Lust war. So ging die Wirtschaft ganz gut und Hans'l war auch mit sich zufrieden.
Als aber die Mittagszeit kam und die Magenuhr sich immer mehr bemerklich machte, da wollte Hans nicht mehr so ruhig sich sonnen, sondern stund auf und spähte in die Ferne, ob seine Brüder nicht kämen. Er schaute und harrte, allein alles war umsonst.
Da legte sich Hans wieder unmutig in das Gras und die Herde legte sich um ihn und wiederkäute das abgerupfte Futter. Der Hirt nahm nun seine braune Lodenjoppe her und durchstöberte jeden Sack der selben, um ein Krümchen Brot zu finden. Lange war sein Suchen vergebens, da fand er endlich ein Stückchen hartes, verschimmeltes Maisbrot und das verzehrte er mit dem größten Heißhunger und es schmeckte ihm besser als der herrlichste Butterweck.
Nach diesem kurzen Mittagsmahle legte er sich wieder ins Gras und sah den sich lagernden Ziegen und Böcken zu. Wie er aber diese so da liegen sah, glaubte er, dies Vieh äffe ihn nach und spotte seiner, und wurde über die Maßen zornig. Er nahm in seiner Tollwut einen Erlenstock, fiel über das arme, unschuldige Vieh her und mißhandelte es schrecklich.
Es dauerte nicht mehr lange und die Brüder kamen von der Heimat zurück aufs Feld. Wie groß war aber ihr Staunen und ihr Schrecken, als sie den Hans mit dem blutigen Erlenstocke da stehen und die ganze Herde blutig und tot da liegen sahen.
»Was hast um des Himmels willen du da getan?« riefen beide wie aus einem Munde ihn an. »Ja, das Teufelsvieh hat mich da geantert und das hab' ich ihm mit dem Stecken schon ausgetrieben,« gab Hans zur Antwort. Die Brüder jammerten und weinten aus Furcht vor den Eltern und getrauten sich nicht mehr nach Hause. Was war nun zu tun? -
Beim toten Vieh bleiben wollten sie auch nicht und so beschlossen sie, durch den Wald zu gehen und in der nächsten Stadt ihr Unterkommen zu suchen. Hans wollte auch mit ihnen, allein sie ließen ihn lange nicht mit. Als er aber nicht zu bitten aufhörte und immer inständiger flehte, gaben sie endlich nach und nahmen ihn mit.
Die drei wanderten nun in den Wald hinein. Als sie schon tief hinein gekommen waren und der Weg sich schon sehr verschlimmert hatte, hörten sie von ferne Stimmen. Sie erschraken darüber gar sehr; denn es war schon dunkel und im Walde hausten Räuber und wilde Männer. Um sich nun zu retten, flüchteten sich die beiden älteren Brüder auf einen hohen, hohen Tannenbaum hinauf und zitterten dort wie das Birkenlaub beim Frühlingswehen.
Hans'l stund aber drunten und verrichtete sich nicht hinauf, so oft ihm auch die Brüder halblaut zuriefen: »Komm, sonst fressen dich die Räuber.« Er blieb an einem Gehege stehen und riß heftig ein Gatter, das sich daran befand, hin und wieder, bis er es endlich aus den Angeln hatte. -
Dieses nahm er und schleppte es mit sich auf den hohen Baum hinauf; denn er meinte die Brüder hätten ihm zugerufen: »Komm, nimm das Gatter mit herauf!«
So saßen alle drei nun droben wie die Zeisige auf den Leimstangen und Hans hielt das schwere Gatter fest.
Da kamen dann die Räuber und führten einen Wagen mit sich, der voll Gold war. Sie machten halt und setzten sich gerade unter den Baum, auf den die Brüder sich geflüchtet hatten, und zählten ihr Geld und tranken Gebranntes aus einem Kürbis, den sie die Runde machen ließen.
Wie die drei auf dem Baum die Räuber drunten sahen, und diese nie eine Miene machten weiter zu ziehen, wurde ihnen so unheimlich und bange, daß ihnen helle Schweißtropfen kamen und vom Baum herunterfielen.
Wie so einzelne Tropfen herunterschauerten, meinten die Räuber, es drohe ein Regen und sie müßten sich bald auf den Weg machen. Als sie nun so hin und wieder redeten, was zu tun sei, wurde dem Hans droben das Gatter zu schwer und er ließ es fallen. Pump, pump! rauschte es durch die Zweige herunter und brauste näher und näher.
Die Räuber hörten das Gepolter und in der Furcht, es nahe augenscheinlich die Strafe Gottes, liefen sie alle von dannen. In der Ferne hörten sie noch das Gepolter, das vom Auffallen des Gatters verursacht wurde, und stürzten noch atemloser weiter. Die Räuber waren nun fort und hatten den Wagen und das Gold zurück gelassen.
Als dies die drei Unglücksbrüder sahen, stiegen sie alsbald vom Baum herab, machten sich das viele Geld eigen und trabten lustig und singend miteinander nach Hause. Dort zahlten sie dem traurigen Vater, der sie nicht mehr erwartet hatte, die ganze Herde und noch mehr.
Alle drei Brüder kauften sich Haus und Hof und lebten recht zufrieden und glücklich miteinander und leben noch, denn es hat für sie noch nie Zügen geläutet.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Meran
DER MÜLLERBURSCH UND DIE KATZE ...

Kam einmal ein Mühlknecht zu einem Müller und bat ihn, er möchte ihm doch Arbeit geben, er sei schon lange Zeit gewandert und wolle sich nun wieder ein paar Kreuzer verdienen. Der Mühlknecht gefiel dem Müller, denn er war ein flinker, rüstiger Bursche, und er hätte ihm sogleich Arbeit gegeben, wenn ihm nicht ein sonderbares Bedenken in den Kopf geschossen wäre.
Er kratzte sich eine Zeit lang hinter den Ohren und rückte dann langsam mit seiner Meinung heraus: »Ja, ich brauche jetzt freilich einen Mühlknecht und es stand mir nicht leicht einer so gut zu Gesicht wie eben du. Aber noch hat es einen anderen Haken.«
»Was denn für einen?« fragte hastig der Müllerbursch.
»Ja, du wirst mir es vielleicht nicht glauben wollen, aber es ist doch so, wie ich sage. So oft ich noch einen Mühlknecht in der Mühle schlafen ließ, ward er am anderen Tage tot gefunden. Was
eigentlich dahinter steckt, konnte ich noch nie erfahren; aber es ist einmal so.«
»So weit hat es noch nicht herabgeschneit, daß sich unsereiner fürchtet,« erwiderte lachend der Mühlknecht. »Da laßt nur mich machen, ich bin nicht von Schreckbühl zu Hause.« »Nein, wäre doch jammerschade um dein junges Leben,« meinte der Müller, »und wo noch keiner davon gekommen ist, da wird mit dir nichts besonderes gemacht werden.«
»Kurz und gut, ich fürchte mich nicht und ich bleibe bei Euch, wenn Ihr mir Arbeit gebt.« »Wenn du durchaus dein Leben aufs Spiel setzen willst, so bleibe halt. Angehen tut es dich,« erwiderte halb froh und halb zornig der Müller.
Der neue Mühlknecht ging nun in die Mühle und arbeitete trotz einem. Als es nachtete, legte er sich ein wenig nieder, ließ aber keinen Schlaf über seine Augen kommen und schaute und schaute, was denn etwa in der Mühle spuken möchte.
Auf einmal kam eine große schöne Katze auf ihn zu geschlichen und miaute und stellte den Buckel auf und wedelte langsam mit dem Schweif und schlich immer um den Mühlknecht herum, so daß dieser genug zu tun hatte, das unheimliche Vieh von sich abzuwehren.
Wie aber das »Gsch!« und »Mache dich!« und solche Sprüche nicht helfen wollten, wurde er über und über zornig, faßte die Katze am Schweif und warf sie weit von sich weg. Nun schlich die Katze wieder zur Türe hinaus, der Mühlknecht aber dachte sich: »Warte du, komm mir noch einmal,« legte sich auf ein Ohr und konnte ungestört schlafen.
Morgens in aller Frühe kam der Müller und wollte nach dem Leichnam des Mühlknechtes sehen. Wie machte er aber große Augen, als ihm der Bursche singend und pfeifend entgegenkam und die Geschichte von der Katze erzählte.
Als es wieder Abend wurde, holte sich der Mühlknecht eine kleine Hacke und die versteckte er in seinem Bette. Bald war es Nacht, der Bursche legte sich nieder und die Katze schlich wieder miauend heran. Der Mühlknecht scheuchte sie diesmal nicht von sich, sondern tat ihr schön und suchte sie immer näher und näher zu sich heranzulocken.
Wie sie eng an seinem Bette stand, zog er flink die Hacke heraus und schlug ihr lachend eine Vorderpfote ab. »So, nun werde ich Ruhe haben,« meinte er und legte sich wieder in seinem Bette zurecht. Die Katze aber hinkte mit erbärmlichem Miauen auf drei Beinen zur Türe hinaus.
Morgens in aller Frühe kam wieder der Müller, um nach seinem Burschen zu sehen. Dieser war seinen Meister kaum ansichtig geworden, da schrie er schon voll Freude: »Da seht einmal, was die Bestie zurückgelassen hat. Die kommt zu mir gewiß nimmer.«
Mit diesen Worten zeigte er dem Müller die Pfote, die er der Katze abgehackt hatte. Der Müller lachte sich den Buckel voll an und konnte sich über seinen neuen Mühlknecht nicht genug freuen. Als er sich genug gelacht hatte, ging er wieder seiner Wege und der Vormittag verging wie andere Male, nur wunderte es den Meister, warum sich heute sein Weib gar nicht sehen lasse.
Es wurde endlich Mittagszeit und in der Küche brannte noch kein Feuer. Da ging dem Meister die Geduld aus und er schrie an allen Ecken und Enden nach seiner Alten. Die Meisterin aber kam nicht und gab auch keine Antwort. Endlich ging der Müller in die Schlafkammer hinauf und fand die Seinige noch im Bette.
»Was tust du denn?« rief er. »Es ist schon Mittagszeit und in der Küche drunten brennt noch kein Spänlein.« »Ich kann heute nicht kochen, antwortete sie, mir fehlt etwas.« Der Müller war neugierig, was denn das sei. Da bemerkte er, daß sein Weib mit den Armen so verzagt tat, und auf einmal sah er, daß ihr eine Hand abgehackt sei.
»Aha,« dachte er sich, »das fehlt dir«, und lief zornig über die Stiege hinab und erzählte dem Mühlknecht, was er gesehen habe. Der Bursche merkte wohl auch sogleich, daß die Katze niemand anders gewesen war als die Meisterin, und daß diese eine böse Hexe sei.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Meran
DIE DREI KÖNIGSKRONEN ...
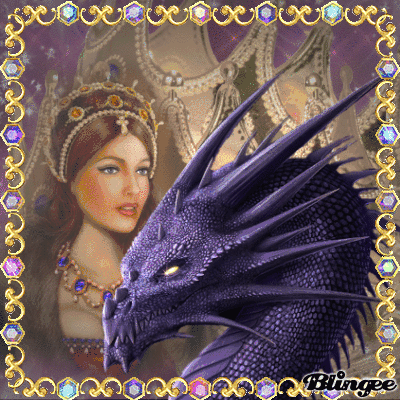
Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, die ihm alle gleich lieb waren, und von denen er eine so ungern von sich gelassen hätte wie die andere. Da kam eines Morgens die Botschaft zu ihm, daß in der Nacht alle drei Prinzessinnen verschwunden seien und kein Mensch von ihrem Weggehen etwas gesehen habe.
Der König horchte groß auf bei dieser Nachricht und wollte ihr anfangs gar keinen Glauben schenken. Er ging selbst in das Schlafgemach seiner drei Töchter und suchte alle Winkel des Schlosses aus, konnte aber nirgends die Vermißten entdecken.
Je länger er umsonst herumsuchte, desto größer war seine Angst, und als er endlich im ganzen Schlosse und in der weiten Umgebung umsonst gesucht hatte, da wußte er sich völlig nimmer zu helfen und glaubte jeden Preis daran setzen zu müssen, um seine geliebten Kinder wieder zu erlangen.
Er ließ daher im ganzen Reiche ausschreiben, die jungen Mannsbilder sollen sich aufmachen um die Prinzessinnen zu suchen, denn derjenige, welcher dem Könige Nachricht brächte, würde ein halbes Königreich und eine von den Töchtern zur Gemahlin erhalten.
Da waren in dem Lande drei Brüder, welche auch von dem glänzenden Versprechen des Königs hörten und also gleich beschlossen, miteinander auf Kundschaft auszuziehen und nicht eher zurückzukehren, als bis sie den Aufenthalt der Königstöchter erforscht hätten.
Ohne Verzug machten sie sich auf den Weg und ließen ihre Beine den ersten Tag rüstig ausgreifen. Als die Nacht heraufzurücken begann, fingen auch die Knie an ein bißchen zu schnappen und der Magen wollte ihnen immer tiefer hinabfallen. Sie dachten nun an ein Wirtshaus und meinten, jetzt aber müsse eines an der Straße stehen.
Allein wie sie auch um einen Bug der Straße herum waren, so zeigte sich immer nur eine neue Wegstrecke und nirgends wollte ein Schild einladend heraus hängen. Endlich sahen sie zwischen dem Waldesgrün ein dunkles Gemäuer hervorgucken und darauf beschlossen sie los zu gehen, möchte der Bau gehören, wem er auch wolle.
Sie stiegen einen kleinen Hügel hinauf und stunden als bald vor einem alten Schlosse, an dem alle Türen und Tore offen waren, ohne daß irgendwo ein lebendes Wesen sich sehen ließ. Sie gingen ungehindert hinein und über die Stiege hinauf und traten dann in einen stattlichen Saal.
Da war alles wunderschön eingerichtet und auf dem Tische stand ein Essen, daß noch nie auf eine Königstafel ein so gutes gestellt wurde. Sie taten aber ihrem Gelüste einen Zwang an und wollten warten, bis der Eigentümer des Schlosses herein käme und sich an den gedeckten Tisch setzte.
Allein ihr Warten war umsonst und ihr Hunger wurde allmählich so groß, daß sie, ohne lange zu fragen, sich hinsetzten und in die köstlichen Speisen drein schlugen, als ob sie drei Tage nichts gehabt hätten. Als sie satt waren, dachten sie an nichts weiter als an das Schlafen, und weil im Saale zwei Betten standen, machten sie kurzen Prozeß und es legten sich die zwei Jüngern in das eine Bett und der Älteste allein in das andere.
Die zwei, welche beisammen schliefen, hatten ihre gute Ruhe und schliefen ohne aufzuwachen bis an den späten Morgen. Der Älteste aber hatte den Handel nicht zu loben, denn um elf Uhr kam ein spannenlanges Männlein zu ihm in das Bett, schüttelte ihn beim Kopf und trieb sein Unwesen eine ganze Stunde lang. Als es zwölf Uhr schlug, machte sich das Männlein davon und der Bursche konnte ungestört schlafen, bis ihn der Tag aufweckte.
Als die drei Brüder aufgestanden waren, fragte einer den anderen, wie er geschlafen habe, und jeder wußte, das gute Bett zu loben und die große Ruhe, die in dem Schlosse nur herrsche. Auch der Älteste sagte nichts von dem mutwilligen Männlein und dachte, er wolle die zwei anderen auch ihre Erfahrungen machen lassen.
Den Dreien gefiel es im Schlosse gar wohl und sie beschlossen, einige Tage hier zu bleiben und sich für die Reise zu stärken. Als nun der nächste Abend ankam und es Schlafenszeit war, da sagte der Älteste zu dem Zweiten: »Es ist doch billig, daß wir mit dem Alleinschlafen ein wenig abwechseln. Lege du dich heute in dieses Bett, ich habe schon die letzte Nacht gut ausgerastet und will mich heute zu dem Jüngsten legen.«
Der Bruder war mit diesem Antrag sehr zufrieden und legte sich allein in das andere Bett, während der Älteste zu dem Jüngsten hineinstieg. Als es elf Uhr schlug, kam richtig wieder das Männlein zu demjenigen, der allein schlief, nahm ihn beim Kopf, schüttelte und zerrte ihn und gab keine Ruhe eine ganze Stunde lang. Um zwölf Uhr lief es davon und der Bursche konnte wieder ruhig schlafen, bis der lichte Morgen ihn aufweckte.
Beim Ankleiden redeten die Brüder ab, wie sie geschlafen hätten, und keiner wußte etwas auszustellen, weder über die Betten noch über Unruhe oder sonstige Ursachen eines üblen Schlafes. Als aber der Jüngste zufällig hinausging, da wunderte es den zweiten, ob in der vorigen Nacht das Männlein wirklich nicht gekommen sei wie in der letzten.
Er fragte daher den Ältesten und sie erzählten nun einander von dem unruhigen kleinen Schlafkameraden, machten aber aus, dem Jüngsten nichts zu sagen und ihn auch einmal probieren zu lassen.
Als es abends wieder zum Schlafengehen kam, sagten die zwei anderen zum Jüngsten: »Es ist doch billig, daß du auch einmal allein schlafen und ordentlich ausruhen kannst. Geh du heut in dieses Bett, wir wollen zusammen in das andere gehen.« Der Jüngste war zufrieden und legte sich allein zu Bette. Als es aber elf Uhr war, da spürte er schon, warum ihn die anderen zwei hierher geschickt hatten.
Das spannenlange Männlein hockte bei seinem Haupte, zog und zerrte ihn daran und gebärdete sich, als ob es ihn geradezu aus dem Bette hinaus haben wollte. Der Jüngste verstand aber weniger Spaß als seine Brüder und hub an zu räsonieren und zu fluchen als wie ein Fuhrmann. Da ließ das Männlein endlich ab und wollte davon laufen, allein der Bursche sprang auch aus dem Bette und rannte ihm nach zur Türe hinaus.
Das Männlein lief nun aus dem Schlosse und in den Wald hinein und der Bursche immer ihm nach. In kurzer Zeit kamen sie zu einem Loch, durch welches eine Stiege hinabführte. Das Männlein rannte voraus über die Stiege hinab und der andere wieder schleunig hinterdrein. Aber kaum waren sie drunten, so waren Männlein und Stiege verschwunden und der Bursche stak allein in einem finstern Loche, von dem er keinen Ausweg wußte.
Er blieb eine Zeit lang wie angenagelt stehen und kam vor lauter Angst zu keinem rechten Gedanken. Als er sich vom ersten Schrecken erholt hatte, kehrte er sich nach allen Seiten um und fing an im Finsteren herumzutappen. Auf einmal kam ein matter Schein in seine Augen. Er stand stille und schaute unverwendet nach dem beleuchteten Orte hin. Da bemerkte er nicht weit von sich ein kleines Fensterlein, aus welchem ein Licht herausstrahlte.
Nun ward ihm etwas leichter ums Herz, er trat näher hinzu und schaute durchs Fenster hinein. Wie erstaunte er da, als er in ein Gemach sah, in welchem drei wunderschöne Jungfrauen saßen. Auf ihren Häuptern glänzten goldene Königskronen und auf dem Schoße einer jeden lag ein schlafender Drache.
Sogleich fiel dem Burschen ein, er werde jetzt die verschwundenen Königstöchter gefunden haben, und er wollte auf einen Plan sinnen, die schönen Jungfrauen zu erretten. In dem selben Augenblicke schauten die drei an das Fenster, erblickten ihn, lächelten ihn freundlich an und winkten ihm hereinzugehen. Er folgte ihnen mit froher Bereitwilligkeit, suchte nach der Türe und trat leise in das Gemach.
Nachdem er die Jungfrauen geprüft hatte, huben diese an zu reden und sprachen: »Du könntest uns alle drei erlösen, aber nur dann, wenn du allen drei Drachen die Köpfe abschlägst. Das wirst du aber nicht allein zustande bringen, darum ist es gescheiter, du gehst wieder von hinnen, denn wenn du noch hier bist, sobald diese Tiere erwachen, so ist es um dich geschehen. Darum geh nur geschwind, - geh!«
Als die Jungfrauen diese letzteren Worte sagten, war ihre fröhliche Miene verschwunden und sie ließen wieder traurig die Köpfe hängen. Der Bursche hatte auch wirklich keine Lust, sich an die drei Ungeheuer zu wagen, und folgte eilig dem Rate der Jungfrauen; traurig ging er hinaus und dachte an die zwei Brüder und meinte, wie leicht das Werk zu vollbringen wäre, wenn ihrer drei zugleich über die drei Untiere herfallen könnten.
Neben diesen Gedanken beschäftigte ihn aufs neue die Angst wegen des Hinaufkommens, weil die Leiter verschwunden und sonst keine Hoffnung ins Freie zu gelangen vorhanden war.
Als die zwei anderen Brüder des Morgens erwacht waren, schauten sie nach dem Jüngsten und waren schon neugierig zu erfahren, wie es ihm beim Alleinschlafen ergangen wäre. Aber der Bruder war fort und alles Suchen und Rufen im ganzen Schlosse herum wollte nichts helfen. Sie ahnten nun wohl, daß es nicht mit rechten Dingen werde zugegangen sein, und waren allen Ernstes um sein Leben besorgt.
Als sie rings um das Schloß alles durchforscht hatten, gingen sie in den Wald und fingen dort an zu suchen und zu rufen. Es dauerte nicht gar lange, so erhielten sie wirklich aus der Ferne eine Antwort. Sie gingen eifrig dem Orte zu, woher die Stimme kam, und gelangten endlich zu dem Loche, in welchem der Bruder gefangen war.
Er redete zu ihnen herauf, sie redeten zu ihm hinab, - er erzählte ihnen von den drei Jungfrauen und den schlafenden Drachen, sie mußten auf Mittel denken, zu ihrem Bruder hinab zu kommen oder ihn herauf zu bringen. Da sagte der Älteste zum Zweiten: »Warte, ich will dich an einem Seil hinab lassen und ich als der Stärkste von allen will hier bleiben, um dann die Jungfrauen und euch wieder heraufzuziehen.«
Dem anderen ging dieser Vorschlag ein, er band sich einen Strick um die Mitte und der Älteste ließ ihn ordentlich hinab. Als er drunten ankam, hatte der Jüngste eine Freude, daß es gar nicht zu sagen ist, und sie fingen sogleich an abzureden, wie sie den Drachen auf die geschickteste Weise den Garaus machen könnten.
Während sie verlegen waren um passende Waffen, kam auf einmal das spannenlange Männlein daher, brachte zwei schneidige Säbel und sprach ihnen Mut ein wie ein General. Sie nahmen die Säbel, gingen keck hinein und nach drei lustigen Hieben lagen die Köpfe aller Drachen auf dem Boden; freudig standen die Jungfrauen von ihren Sitzen auf, reichten den Brüdern die Hand und hörten fast nicht auf, für ihre Rettung zu danken.
Dann trat zu jedem Jünglinge eine von den Jungfrauen, gab ihm das Versprechen ihn zu heiraten und reichte ihm als Unterpfand ihre goldene Krone dar. Die Burschen waren hoch erfreut über diesen Antrag und führten nun ihre Bräute nebst der dritten Prinzessin aus dem Gemach hinaus, um mit den selben wieder in das Freie zurückzukehren.
Sie riefen ihren Bruder und gaben ihm Nachricht von dem glücklichen Gelingen ihrer Heldentat. Er zeigte sich hocherfreut, ließ den Strick herunter und zog nun von den Prinzessinnen eine nach der anderen hinauf. Als er aber diese hinaufgebracht hatte, eilte er damit von dannen und nahm ihnen einen Eid ab, daß sie zu Hause sagen sollten, er allein sei ihr Retter und kein anderer habe einen Teil daran.
Die zwei Brüder mußten nun im finsteren Loche sitzen, während er mit den drei Prinzessinnen der Königsburg zueilte. Als er am Hofe ankam, wurde alles völlig närrisch vor lauter Freude und der König wollte nicht aufhören, seine wiedergefundenen Kinder zu herzen und zu umarmen. Zwei-, dreimal ließ er sich die Geschichte ihrer Rettung erzählen, bald von ihnen, bald von dem Burschen, der sie gebracht hatte, und allemal mußte er wieder die gleichen Lügen anhören.
Denn von den zwei Brüdern, die noch im finsteren Loche saßen, und welche doch die Hauptsache ausgeführt hatten, war gar nicht die Rede und die zwei Prinzessinnen, die sich mit den selben verlobt hatten, mußten sich alle Gewalt antun, um ihren Schmerz zu unterdrücken und nicht mit der Wahrheit herauszuplatzen.
Weil nun der König wirklich meinte, daß derjenige, der vor ihm stand, allein seine Töchter gerettet habe, so versprach er diesem das ganze Königreich und hieß ihn darauf bedacht sein, welche von seinen Töchtern er zur Gemahlin nehmen wolle, man wünsche, daß sogleich am folgenden Tage die Hochzeit gefeiert werde. Der Bursche war mit diesem Angebote zufrieden und versprach, durch einen Aufschub seiner Wahl das Fest gewiß nicht zu verzögern.
Was für eine Angst die anderen zwei im Loche aushielten, das kann man sich wohl denken. Die ganze Zeit ließ sich niemand sehen oder hören und erst nach vielen Stunden, als es droben schon anfing Abend zu werden, ließen sich zum erstenmal wieder Schritte hören. Da kam das spannenlange Männlein, sprach ihnen Trost zu und hieß sie umschauen und die gute Gelegenheit nicht übersehen.
Sie schauten sich um und sahen die Stiege wieder aufgestellt, dankten dem Männlein und sprangen hastig die Stufen hinauf. Sie beeilten sich, aus dem Walde herauszukommen, und schlugen dann jenen Weg ein, auf welchem sie am schleunigsten zur Residenz zu kommen hofften. Weil sie aber doch unterwegs über Nacht bleiben mußten, so wählten sie nicht lange und kehrten, als es finster war, ins nächste beste Haus ein.
Sie gerieten zufällig zu einem Goldschmiede und baten ihn inständig um eine Nachtherberge. Er aber machte ein herrisches Gesicht, wollte sie abweisen und sagte: »Ich kann heute niemand brauchen in meinem Hause, denn ich muß die ganze Nacht arbeiten. Morgen hat eine von den drei Königstöchtern Hochzeit, und da muß ich drei Kronen machen, weil von ihren früheren gleichen Kronen zwei verloren gegangen sind. Laßt mich also in Ruhe und sucht euch anderswo eine Herberge.«
Die zwei Burschen ließen sich aber nicht so geschwind abweisen, sondern sagten, sie seien auch Goldschmiede und wollten sich gerne herbeilassen, zwei Kronen über Nacht zu verfertigen, wenn er ihnen nur ein Zimmer und das nötige Handwerkszeug geben würde; der Goldschmied machte jetzt ein ganz anderes Gesicht, führte sie ins Haus, wies ihnen ein Zimmer an und brachte Handwerkszeug soviel sie nur verlangten.
Sie brauchten aber gar nicht viel, denn sie stellten sich nur, als ob sie etwas machen wollten, und um ein bißchen zu klopfen und zu hämmern war leicht etwas gut genug. Nachdem sie die ganze Nacht ein wenig gelärmt und doch nichts getan hatten, brachten sie am anderen Tag die zwei Kronen, welche sie von den Prinzessinnen erhalten hatten, und stellten sich, als ob diese erst in der letzten Nacht von ihnen gearbeitet worden wären.
Der Goldschmied, welcher seine Krone noch gar nicht fertig hatte, erstaunte sehr über ihre Geschicklichkeit und freute sich schon über das Lob, das er bei Hofe zu erwerben hoffte. Als es Zeit war, machte er sich auf und ging mit den Kronen in die Residenz. Er wurde vor die Prinzessinnen geführt und zeigte ihnen mit viel Ruhmredigkeit die schönen Arbeiten vor. Aber haben da die zwei Prinzessinnen, welche ihre Kronen wieder erkannten, große Augen gemacht!
Sogleich stellten sie den Goldschmied zur Rede und fragten ihn, ob er die zwei kunstreichen Kronen gearbeitet habe? Er war verwundert über diese Frage und sagte: »Ja.« Da fragten sie ihn noch einmal und sagten: »Lüge nur nicht und sage uns die Wahrheit. Denn wenn auch nicht du sie gemacht hast, so wirst du deswegen doch reichlich dafür bezahlt werden.«
Da sah der Goldschmied, daß es gescheiter sei, die Wahrheit zu sagen, und er erzählte offen und treu von den Goldschmiedegesellen, welche heute Nacht bei ihm eingekehrt seien und die schönen Arbeiten in so kurzer Zeit zustande gebracht haben. Da ging den Prinzessinnen ein Licht auf und sie gaben dem Goldschmied Befehl, die wandernden Gesellen also gleich zu holen und in ihrem Namen zur Hochzeit einzuladen.
Der Goldschmied gehorchte, obwohl er noch nicht recht wußte, was die ganze Sache zu bedeuten habe, und in kurzer Zeit kam er mit seinen zwei kunstreichen Gästen zurück. Diese wurden von den Prinzessinnen so gleich als ihre Retter erkannt und vor den König geführt. Da erzählten sie nun, welche Spitzbubereien ihr Bruder getrieben hatte, und wie er sie um alle Aussicht auf ihren wohl verdienten Lohn gebracht habe.
Während sie so erzählten und sich ereiferten, kam auf einmal das spannenlange Männlein, bekräftigte die Wahrheit ihrer Worte und verriet noch obendrein, daß der älteste Bruder den Prinzessinnen mit dem Tode gedroht habe, wenn sie nicht ihn allein als ihren Retter angeben würden.
Wie der König das alles hörte, ward er über und über ergrimmt, gab sogleich Befehl, den ältesten Bruder hinzurichten, und schenkte jedem der anderen beiden die Hälfte seines Reiches. Am selben Tage noch hielten die zwei Brüder Hochzeit mit ihren Bräuten und sie werden dann noch lange Zeit froh und brav gelebt haben.
Das Männlein aber ist am selben Tage wieder verschwunden, an dem es gekommen war, und kein Mensch weiß, wo es sich jetzt aufhält.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Sarnthal
DER GESCHEITE HANS ...
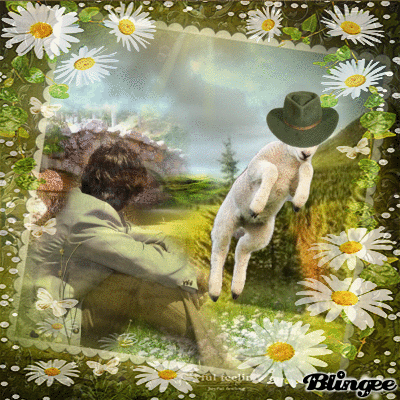
In alten Zeiten lebten einmal zwei Brüder, von denen der eine gescheit, der andere dumm war. Eines Tages erkrankte die arme Mutter. Da sprach der Kluge zum Lappen: »Ich will bei der Mutter bleiben und ihrer warten; deshalb mußt du heute betteln gehen, damit wir der Mutter ein Stück Fleisch kaufen und eine nahrhafte Suppe bereiten können. Mach aber deine Sache recht und heb deinen Hut den Leuten vor, auf daß sie dir ihr Almosen hineinwerfen können.«
Hansel versprach zu folgen und ging wohlgemut betteln. Da kam er bald zu einer Näherin, hob ihr den Hut vor und bat um Gottes willen um ein Almosen. Diese war aber selbst arm und hatte nichts als Zwirn und Nadeln. Sie warf daher dem Hansel eine Nähnadel in den Hut.
Der Lapp ging nun mit der Nähnadel im Hute und kam zu einem Anstieg, den soeben ein Heuwagen hinan fahren sollte. Allein das Fuhrwerk ging nicht vorwärts, so sehr auch die Pferde zogen und keuchten. Als Hansel dies sah, trat er zum Wagen und half schieben und schieben, bis das Fuhrwerk vorwärts kam.
Doch da hatte er seine Nadel verloren und kam nun gar traurig nach Hause, wo er sein Unglück dem gescheiten Bruder mitteilte. Sprach dieser: »Aber wem fiele ein, eine Nadel im Hut zu tragen und dabei noch schieben zu helfen! Hättest sie auf den Hut stecken und diesen aufsetzen sollen.«
Mit dieser Lehre ging der Lapp wieder weiter und bettelte und bettelte, doch umsonst. Endlich begegnete er einer Schafherde und bat den Hirten. Dieser war ein mildherziger Mann und gab dem Hansel ein Lämmchen. Dieser dankte und dachte sich: »Wie soll ich's jetzt machen? Das Schäflein kann ich nicht an den Hut stecken. Es bleibt nichts übrig, als daß ich ihm den Hut aufsetze.«
Gedacht, getan. Er setzte dem Tiere den Hut auf - und dieses wurde scheu und lief mit dem Hut auf und davon. Da blieb dem Hansel nichts über, als Hut und Lämmlein nachzuschauen. Traurig kehrte er heim und klagte dem Bruder seine Not. Als dieser es hörte, sagte er: »Aber mit dir ist nichts anzufangen. Du hättest das Schäflein anbinden und führen sollen.«
Hansel ging von neuem zu betteln und dachte, diesmal will ich's gscheiter machen. Nach kurzer Zeit bekam er einen Butterweck geschenkt. Da nahm er eine Schnur und band ihn daran und zog ihn durch dick und dünn. Als er aber nach Hause kam, war der Butterweck verloren. Darob war der Hansel gar traurig und klagte weinend seinem Bruder das Unglück.
Sprach dieser: »Wie dumm bist du doch! Hättest das Brot in ein Tüchlein binden und heimtragen sollen.« Mit dem besten Vorsatz, klüger zu handeln, ging Hansel weiter und bekam von einer Bäuerin Milch geschenkt. Dachte sich der Lappe: »Der Bruder hat gesagt: ich soll's ins Tüchel binden.« Deshalb leerte er die Milch in sein Sacktuch, band es zu und trug es nach Hause.
Doch wie riß er die Augen auf, als er das Tüchlein leer fand, denn die Milch war ausgeronnen. Als der Kluge das hörte, sprach er: »Wenn's so fortginge, müßte die Mutter Hungers sterben. Darum will ich betteln gehen, und du bleibst bei ihr. Richt ihr ein Bad an, doch nicht zu kalt, und koche ihr indes Nudel.«
Kaum war der Bruder fort, stellte Hansel einen Kessel voll Wasser ans Feuer und machte ihn siedend heiß. Dann füllte er damit eine alte Truhe und setzte die kranke Mutter in das brühheiße Bad, darin sie bald, jämmerlich verbrannt, den Geist aufgab.
Hansel kochte, während die Tote im Bade lag, Nudel und brachte sie der Mutter. Doch diese wollte sich weder rühren, noch essen. Das konnte der Dumme nicht verstehen. Er nahm nun einen Löffel und stopfte der Mutter Nudel um Nudel in den Mund. Wie er dies geendet hatte, kam der Gescheite zurück.
Da sagte Hansel: »Pst, Pst, stille, die Mutter schläft. Weck sie nicht auf!« Der Kluge schlich näher und sah bald, daß sie tot war. Da war er anfangs wie von Sinnen. Endlich faßte er sich und sprach; »Was hast du jetzt angestellt! Wenn wir nicht beide aufs Rad kommen wollen, müssen wir die Leiche wegräumen. Du nimmst auf einem Brette die Mutter und ich nehme Pickel und Schaufel. So wollen wir in den Wald gehen und die Mutter dort heimlich begraben.«
Gesagt, getan. Hansel trug die Mutter fort und beide gingen in den Wald, wo der Gescheite ein Grab aufwarf. Doch wie er die Mutter hineinlegen wollte, war die Leiche nicht vorhanden, denn sie war auf dem Wege vom Brette gefallen, ohne daß Hansel es bemerkt hatte. - Darob ward der Kluge zornig und sprach: »Jetzt geh gleich zurück und such die Mutter.«
Sagte Hansel: »Ich weiß den Weg nicht mehr!« Da gingen beide die Leichen suchen. Der eine hielt sich mehr zur Linken, während der andere mehr rechtshin ging. Als Hansel eine Strecke gegangen war, kam er zu einem Brunnen, an dem ein altes Weib Garn wusch.
Kaum war dessen ansichtig, rief er freudig: »Wart du Hex! bist mir davon gelaufen. Sollst mir nicht abermals entkommen,« nahm eine in der Nähe liegende Mistgabel, gabelte das alte Weiblein auf und trug es in den Wald. Als sie beim Grabe zusammenkamen, brachte jedweder eine Leiche mit sich.
Da schrak der Kluge zusammen und machte dem Hansel bittere Vorwürfe. »Was hast du angestellt?« rief er. »Hast neuerdings einen Mord begangen. Jetzt sind wir vogelfrei, und wenn wir in's Dorf kämen, würde man uns vierteilen.«
Nachdem sie beide Leichen begraben hatten, gingen sie weiter in den Wald hinein. Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie Räuber daherkommen hörten. Da kletterte der Gescheite flugs an einem Baum hinauf. Der Dumme blieb aber zurück und wurde von den Räubern gefangen.
»Den können wir gut brauchen,« sagte der Räuberhauptmann. »Stellt ihn dort zum Weggatter und sagt ihm, er solle bei Lebensstrafe das Gitter aufhalten. Nur wenn Schergen nahen, soll er's zufallen lassen.« Der Lapp ward nun ans Gitter gestellt und mußte es aufhalten, während die Räuber sich unter einen Baum setzten und die großen Schätze zählten, die sie einem Kaufmanne abgenommen hatten.
Wie aber der Spaß des Gatterhaltens dem Lappen zu langweilig wurde, ließ er das Gitter pimpspumps zufallen. Dadurch erschreckt fuhren die Räuber auf, ließen Geld Geld sein und liefen auf und davon, als ob sie den Henker schon am Hälse hätten.
Als der Kluge dies sah, stieg er vom Baum. Beide Brüder sackten nun die Schätze ein und trugen sie davon. Sie waren nun steinreiche Leute und kauften sich in einer fernen Gegend an. Ob Hansel gescheiter geworden, weiß ich nicht. Möcht' es aber schon nicht gerne glauben, weil er Hansel geheißen.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Schwaz
OSTERMÄRL ...
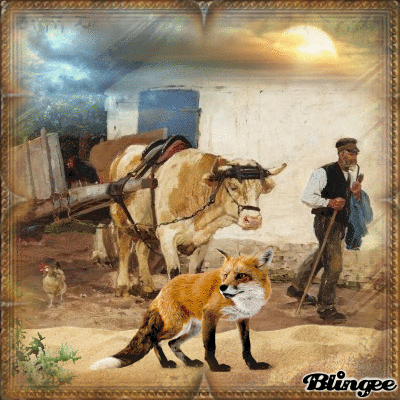
Ein armes Bäuerlein fuhr mit seinen paar Öchslein in den Wald um Holz. Während er das Holz auflädt, kommt ein Bär daher und will ihm einen Ochsen reißen. Das Bäuerlein bittet den Bären, er soll ihn nur diesmal mit dem Holz heimfahren lassen, er habe ein böses Weib zu Hause: wenn er ihr kein Holz heimbrächte, so würde er lange Zeit kein gutes Weib mehr an ihr haben, er wolle aber bald wiederkommen und ihm hernach ein Öchslein lassen.
Der Bär lässt sich schließlich überreden, bewilligt dem Bauern, mit dem Holz nach Hause zu fahren und geht davon. Sobald der Bär vom Bauern weg gegangen war, da springt ein Fuchs aus dem Gesträuch hervor und fragt den Bauern: „Was hast du mit dem Bären gehabt?“
Der Bauer antwortet höchst betrübt: „Ach! Was sollt ich gehabt haben, er hat mir kürzlich ein Öchslein fressen wollen, und ich hab gleich wohl soviel erbeten, daß er mich diesmal noch heimfahren ließ. Ich muß aber geschwind wiederkommen und ihm hernach ein Öchslein lassen.“
„Los! Bauer“, sagte der Fuchs, „wenn du mich unter deine Hennen lassen willst, so will ich dir wohl aus diesem Handel helfen und dein Öchslein am Leben erhalten.“
„Mein Fuchs“, antwortete der Bauer, „von Herzen gern.“ „Na, denn los, mein Bauer“, entgegnete wiederum der Fuchs, „Ich hab neulich deine Hennen heimgesucht, ich meine, die haben alle die Dörrsucht, sie sind zaundürr. Ich habe mir keine anzugreifen getraut, ich fürchtete, ich würde davon erkranken. Du musst sie wohl besser mästen, wenn ich dir diesen Dienst tue.
„Ei freilich, mein Fuchs“, spricht der Bauer, „hilf mir nur aus diesem Handel, ich will dich schon unter die guten, feisten Hennen lassen. Du hast nur die kranken gesehen, welche die Bäuerin in der Sonne herausgelassen hat. Die guten feisten hat sie im Hühnerstall und auf der Hühnerstiege, sie tut etliche zum Verkaufen mästen. „Nun, so fahr fort“, sagt der Fuchs zum Bauern, „und komm bald wieder.“
Der Bauer fährt mit dem Holz heim, legt es zu Hause ab und fährt wiederum hinaus in den Wald. Sobald der Bauer wieder zu dem vorigen Ort gekommen ist und das Holz aufladen wollte, da kam als bald der Bär hervor und wollte den einen Ochsen haben.
Der Bauer fängt abermals an zu bitten, er sollte sich nur noch ein wenig gedulden, sollte ihn nur noch einmal mit einem Füderlein Holz nach Hause fahren lassen. Unterdessen fängt der Fuchs am Weg an zu rauschen und zu knallen wie ein Hund: „Hu, hu, hu“, der Bär schaut sich um, erschrickt, fragt den Bauern, was es bedeute.
Der Bauer antwortete: „Was soll es bedeuten? Wie ich herauf gefahren bin, sind halt Jäger da unten gewesen, die haben mit den Hunden eine Jagd angestellt, sie werden jetzt bald hier sein.“ Der Bär erschrickt noch übler von diesen Worten.
„Sei still“, sagte er zum Bauern, daß man mich nicht bemerke.“ Unterdesssen schreit der Fuchs zum Bauern hinauf: „Was machst du dort droben?“ Der Bauer antwortet: „Herr, Holz leg ich auf.“„Mach’s fein bald“, spricht der Fuchs, „und fahre fort, damit du mir das Wild nicht verjagst. Ich will jetzt gleich mit den Hunden hinaufkommen, um zu jagen. Ich bin auf die Spur eines Bären gekommen, hast du keinen gesehen.?“
Da fing der Bär an zu zittern und sagte zum Bauern: „Lege mich geschwind auf den Wagen und leg Holz auf mich, daß man mich nicht sieht, und führe mich hinweg, als wenn du Holz führst, damit ich nicht unter die Hunde und unter die Jäger komme.“
Der Bauer nimmt den Bären, legt ihn auf den Wagen hinauf, bedeckt ihn mit Holz und bindet ihn mit Holzstricken so stark, daß er sich nicht rühren konnte.Wie dies der Fuchs merkt, springt er hervor, wischt über den Bären hin und bringt ihn um, wendet sich darauf zum Bauern und sagt: „Gelt, ich habe dir aus dem Handel geholfen? Jetzt mußt du mir wohl auch dein Wort halten und mußt mich unter die Hennen lassen.“
„Ja, freilich, mein lieber Fuchs“, spricht der Bauer – „geh nur mit mir, ich will dich unter alle meine Hennen lassen, und weil du meinst, es haben etliche darunter die Dörrsucht, so nimm heraus, was dir am besten gefällt.“ Der Fuchs sagte zum Bauern: „Fahr derweil heim, du fährst gar langsam, ich mag keinen Schmöller abgeben, ich will bald nachkommen.“
Der Bauer fährt mit Freuden heim, erzählt seinem Weib den ganzen Handel und bittet, sie solle den Fuchs doch unter die Hennen lassen. „Ja, ja“, sagt die Bäuerin, „laß ihn nur kommen.“
Unterdessen kommt der Fuchs, die Bäuerin führt ihn zum Hennenstall und sagt zu ihm: „Schau, da will ich dir die Tür ein wenig aufmachen. Guck mit dem Kopf hinein und schau, welche Henne dir am besten gefällt, aber laß dich nicht viel sehen, denn ich hab einen so bösen Hahn bei den Hennen, wenn er dich sehen sollte, so würde er dir keine Henne lassen.“
Wie nun der Fuchs mit dem Kopf durch die Tür in den Hühnerstall hineinschaut, schlägt die Bäuerin die Tür zu und zerschmettert dem Fuchs den Kopf. Da hat mein Fuchs seinen Lohn gehabt und sich nicht mehr sorgen müssen, daß ihn die dörrsüchtigen Hennen krank machen.
Quelle: Heribert v. Salurn Märlein der Barockzeit
DAS MÄDCHEN OHNE HÄNDE ...

Es war einmal eine Wirtin, die hatte eine einzige Tochter. So oft Gäste kamen, sagten sie unter sich: »Die Wirtin ist doch wahrhaft ein schönes Weib, wie keines im Lande!« Sobald sie aber die Tochter ansahen, da konnten sie ihre Augen gar nicht mehr abwenden und sagten: »Die Frau Wirtin ist schön, aber ihre Tochter ist doch viel schöner!«
Die Wirtin war stolz auf ihre Schönheit und wäre gern allein die schönste gewesen, sie kränkte sich daher, so oft die Leute sagten, ihre Tochter sei schöner als sie. Als aber das Mädchen täglich noch schöner wurde, konnte die Mutter ihren Ärger und Zorn nicht länger verhalten. Sie bestellte einen Mann und gab ihm den Auftrag, das Mädchen auf den Berg zu führen und dort zu töten; zum Zeichen sollte er ihr das Herz zurückbringen.
Der Mann führte das Mädchen auf den Berg und kündete ihm dort den Befehl der Mutter an. Da weinte das Mädchen bitterlich, warf sich auf die Knie und bat ihn flehentlich, er möge doch ihr junges Leben schonen. Der Mann war gerührt und schenkte ihr das Leben unter der Bedingung, daß sie weit fortgehe in fremde Länder und nie mehr nach Hause zurückkomme. Der Wirtin aber brachte er das Herz eines Hundes.
Traurig ging das Mädchen in die weite Welt und kam endlich in eine Stadt, wo sie längere Zeit als Dienstmagd blieb. Aber sie war immer traurig und dachte an die Heimat und an ihre böse Mutter. Sie konnte nicht glauben, daß eine Mutter so grausam sein könne, und sagte zu sich selbst: »Gewiß hat sie es schon oft bereut und weint und trauert jetzt im Stillen über meinen vermeintlichen Tod!«
Endlich konnte sie ihrer Sehnsucht nicht länger widerstehen und begab sich auf die Reise in die Heimat. Allein sie wurde von ihrer Mutter mit zorniger Verwunderung empfangen. Das stolze Weib ließ jenen Mann wieder kommen und verwies ihm den Betrug, den er sich gegen sie hatte zuschulden kommen lassen. Sie gab ihm von neuem den Auftrag, das Mädchen auf den Berg zu führen und es zu töten; zum Zeichen sollte er ihr die abgehauenen Hände mitbringen.
Der Mann tat es und als sie auf dem Berge waren, fiel das Mädchen vor ihm auf die Knie und beschwor ihn weinend und flehend, ihr doch das Leben zu schenken. Der Mann wurde selbst davon gerührt, aber er fürchtete den Zorn der Wirtin. »Wie soll ich es angehen,« sagte er; »deine Mutter hat mir befohlen, ihr deine Hände mitzubringen, und ich muß ihr gehorchen.«
Da warf das junge Mädchen einen schmerzlichen Blick zum Himmel und sagte: »Lieber will ich die Hände, als das Leben verlieren. Hau mir die Hände ab, doch schenke mir das Leben!« Sie legte die Hände auf einen Baumstrunk und das Schreckliche geschah; dann half ihr der Mann noch die blutenden Hände verbinden, befahl ihr weit fortzugehen und ließ sie schwören, nie mehr nach Hause zu kommen.
Mit unsäglichen Schmerzen ging das Mädchen weit in den dunkeln Wald hinein. Sie betete, daß Gott sie heilen lasse und schütze, und ihr Gebet war nicht umsonst. Die Arme fingen bald an, langsam zu heilen, sie fand Nahrung an Kräutern und Wurzeln und Früchten des Waldes und die wilden Tiere bedrohten ihr Leben nicht. Anfangs wohnte sie in einer Höhle; dann aber fand sie einen großen alten Weidenbaum, dessen Stamm innen schon morsch war, und sie höhlte ihn mit großer Mühe und Anstrengung aus.
Da war sie nun gegen Hitze und Kälte sowie gegen die wilden Tiere besser geschützt, und wenn ihre Wunden sie schmerzten und ihr die Frage, was aus ihr wohl noch werden solle, schwer auf das Herz fiel, so betete sie und weinte und das Gebet und die Tränen erleichterten ihren Kummer. »Gott wird dich nicht verlassen!« rief eine Stimme in ihr und glücklich ist ja selbst der Ärmste und Elendeste, welcher eine solche Stimme in sich hört und ihr gläubig lauscht.
Eines Tages geschah es, daß der Sohn des Königs einer etwas entfernten Stadt auf der Jagd in das Gebirge kam und seine Begleiter verlor. Wie er so allein durch den Wald streifte, erblickte er unweit das schöne Mädchen. Anfangs hielt er sie für ein schönes seltsames Tier und schoß seinen Pfeil nicht ab, da er es lebendig fangen wollte. Als sie ihn bemerkte, entfloh sie wie ein Reh; er aber eilte ihr nach und sah, wie sie sich in den hohlen Weidenbaum flüchtete.
Er ging hin und befahl ihr hervorzutreten. Wie erstaunt war er, ein wunderschönes Mädchen mit abgehauenen Händen vor sich zu sehen! »Wer bist du, mein Kind, wie kommst du hierher? Wer hat dich der Hände beraubt?« Sie aber schwieg und weinte. Da entflammte er in Liebe zu ihr und er sagte: »Ich sehe wohl, mein Kind, daß du in böser Menschen Hände gefallen sein mußt. Aber ich will dich retten und du sollst noch schönere Tage erleben, komm mit mir in die Stadt!«
Und er stieß in sein Jagdhorn, daß der Ruf gellend durch den Wald scholl und von den Felsen widerhallte. Es dauerte nicht lange, so kamen seine Begleiter und Diener, diese mußten augenblicklich eine Tragbahre herrichten, darauf setzte er das Mädchen und bedeckte es mit seinem Mantel. Als er in seinen Palast in der Stadt gekommen war, ließ er ihr eigene Gemächer einräumen, gab ihr kostbare Kleider und Diener und sorgte in allem für sie auf das beste.
Eines Tages ging er zu ihr und fragte sie, ob sie nicht seine Frau werden wolle. Da errötete sie und antwortete: »Das kann nicht sein.« Betrübt fragte er, warum sie so antworte. »Wie kann ich armes Mädchen ohne Hände deine Frau werden?« sagte sie. »Was wird deine Mutter sagen?« »Darum sei unbesorgt,« sagte er, »ich bin mein eigener Herr und folge der Stimme meines Herzens, welche mir sagt, du werdest mich glücklich machen. Ich liebe dich innig und wahr - doch, wenn du mich nicht lieben kannst« -.
Bei diesen Worten wurde ihr Gesicht feuerrot und ihr Herz schlug laut, zugleich sank sie vor ihm auf die Knie und bedeckte seine Hände mit Küssen und heißen Tränen. »Nun bist du meine Braut vor Gott und vor den Menschen!« rief er jubelnd, hob sie auf und drückte ihr einen Kuß auf die reine weiße Stirne. Dann ging er zu seiner Mutter und erklärte ihr, er wolle das Mädchen heiraten.
Diese Mutter war eine stolze Frau und hatte schon lange im stillen darauf gerechnet, ihr Sohn werde nur die schönste und reichste Prinzessin heiraten. Daher wurde sie wütend vor Zorn, nachdem sie die Erklärung des Prinzen gehört hatte. »Bist du wahnsinnig?« rief sie ihm zu. »Eine hergelaufene Dirne ohne Hände willst du mir als Schwiegertochter und dem Volke zur Königin geben?«
Aber der Prinz blieb fest, er zwang seine Mutter, ihren Zorn zu bezähmen oder doch zu verbergen und nahm das Mädchen zu seiner Frau. Das Volk grollte ihm deshalb nicht, sondern liebte die junge Königin immer mehr; denn ohne Hände spendete sie in kurzer Zeit viel mehr Wohltaten, als die alte Königin während ihres ganzen Lebens mit ihren gesunden Händen gegeben hatte.
Das Glück der beiden Gatten dauerte nur wenige Monate, denn es brach ein Krieg aus und der Prinz mußte mit dem Heere fort. Er befahl allen seinen Dienern, auf seine Gemahlin wohl acht zu haben und nicht zu dulden, daß ihr das mindeste Leid widerfahre. Sodann nahm er zärtlichen Abschied von ihr und zog mit dem Heere fort.
Wieder verflossen mehrere Monate, da gebar die junge Königin zwei wunderschöne Knaben. Die alte Königin war voll Zorn und gern hätte sie ihr die Kinder entrissen, aber die Diener, der Worte ihres Herrn eingedenk, bewachten die junge Königin und ihre Kinder getreulich und ließen sie keinen Augenblick hinein.
Nun sandte die alte Königin einen vertrauten Boten an den Prinzen und ließ ihm melden, seine Gemahlin habe zwei Kinder geboren, welche wie junge Hunde aussähen, das Volk murre laut und er solle daher befehlen, was zu tun sei. Sie glaubte, ihr Sohn würde nun den Befehl geben, Mutter und Kinder zu töten, aber sie täuschte sich. Der Prinz ließ den Befehl melden, niemand solle sich an seiner Frau und an den Kindern vergreifen, bevor er selbst zurückkomme.
Da ergrimmte die alte Königin noch mehr und schickte den selben Boten wieder zum Prinzen mit der Nachricht, das Volk drohe mit einem Aufstand und sie sehe sich daher genötigt, Mutter und Kinder auf öffentlichem Platze verbrennen zu lassen. Sie würde es wohl auch getan haben, wenn es nicht die junge Königin rechtzeitig erfahren hätte. Da stand sie in der Nacht auf, nahm ihre beiden Kinder in die Arme und flüchtete heimlich aus dem Schlosse und aus der Stadt. »Gott wird mich und die armen Würmlein nicht verlassen!« dachte sie und ging ihres Weges.
Sie ging weit und war endlich in ein Tal in der Wildnis des Waldes gekommen. Da begegneten ihr zwei ehrwürdige Männer und fragten sie: »Sind diese Kinder getauft?« »Nein,« erwiderte sie und erzählte ihnen von ihrer Flucht und ihrer Bedrängnis. Da sagte der eine: »Wohl, so will ich die Kinder taufen; welche Namen soll ich ihnen geben?« »Welche ihr wollt!« sagte sie.
»Wohlan,« erwiderte der Mann, »so soll der eine Johannes, der andere Joseph heißen!« Und er taufte die Knaben mit dem Wasser des Flusses, welcher durch das Tal strömte. Die beiden Männer aber waren niemand anderes als die Heiligen Johannes und Joseph selbst.
Sodann sagte ersterer: »Nun nimm deine Kinder und geh noch bis in den Hintergrund des Tales; dort wirst du ein schönes Haus finden nebst allem, was du für dich und deine Kinder nötig hast. Aber nie sollst du jenes Haus mehr verlassen und auch nie jemandem öffnen, es sei denn, er rufe dich bei den fünf Wunden unseres Heilandes an.«
Erfreut versprach sie es, dankte ihnen herzlich und ging weiter. Da begegnete sie einer schönen Frau, die sah sie mild an und sagte: »Armes Weib, du hast keine Hände!« Da seufzte sie; die schöne Frau aber war keine andere als die Mutter Gottes und sie sagte: »Stecke deine Arme in das Wasser dieses Flusses!« Sie tat es, und als sie die Arme herauszog, hatte sie ihre beiden gesunden Hände wieder.
Vor Freude weinend dankte sie der himmlischen Frau, welche ihr zum Abschied sagte: »Geh in jenes Haus und beobachte getreulich alles, was dir die beiden Heiligen gesagt haben. Dann wird es dir und deinen Kindern gut ergehen, weil du immer fromm gewesen bist und in deinen Nöten auf den Himmel vertraut hast.«
Frohen Herzens ging sie weiter und fand das ihr bezeichnete Haus. Da blieb sie einsam, denn weit und breit war keine menschliche Seele zu finden, aber sie hatte alles was sie wünschte. Die zwei Knaben wuchsen und bald sprangen sie lustig im Walde herum; der Mutter aber folgten sie auf das Wort, waren fromm und gut und beteten fleißig morgens und abends zum lieben Gott, daß er sie schützen und segnen möge.
So verflossen sechs Jahre. Der Prinz war indessen aus dem Kriege zurückgekehrt und König geworden. Er war immer traurig, denn er erinnerte sich oft an seine Gemahlin und seine Kinder, die er für tot hielt; seine Mutter aber hatte er vom Hofe verbannt. Da ging er wieder einmal auf die Jagd und verirrte sich im Walde.
Schon brach die Nacht herein und ein furchtbares Wetter war heraufgezogen. Vergebens suchte er unter alten Bäumen Schutz; der Wind peitschte ihm den Regen ins Gesicht, der Donner rollte in einem fort und die flammenden Blitze erleuchteten die Gegend. Da sah er jenes Haus, in welchem seine Frau und seine Kinder lebten, und er pochte an die Türe; allein niemand öffnete ihm.
Das Wetter wurde immer ärger, eben flammte wieder ein Blitz, da rief er in größtem Schrecken: »Bei den fünf Wunden unseres Heilands macht die Türe auf!« Als die Königin diese Worte hörte, schloß sie die Türe auf und ließ ihn eintreten.
»Gebt mir ein Obdach für die Nacht,« rief er, »ich bin ganz ermüdet und durchnäßt!« Sie hatte ihn gleich erkannt; er selbst glaubte anfangs auch seine Frau zu sehen und wollte in Freudenrufe ausbrechen. Aber ein Blick auf ihre Hände sagte ihm, daß er sich täusche; denn seine Frau hatte ja keine Hände. Sie aber hielt sich zurück und gab sich ihm nicht zu erkennen; dann führte sie ihn zum Herde, schürte ein großes Feuer an und brachte ihm Speise und Trank.
Die beiden Knaben aber wagten es anfangs nicht, den fremden Mann anzusehen und fürchteten sich, denn die armen Kleinen hatten ja außer ihrer Mutter noch nie einen Menschen gesehen. Erst auf das Zureden der Mutter kamen sie schüchtern näher und blickten, sich an die Arme der Mutter schmiegend, mit großen Augen auf den fremden Mann, welcher mit ihnen recht lieb und freundlich tat.
Mit Tränen in den Augen dachte er sich: »So groß müßten jetzt meine Kinder auch sein, wenn sie noch am Leben wären!« Der König saß am Feuer und trocknete seine Kleider; da überfiel ihn der Schlaf und er schlummerte ein. Als sie sah, daß er schlafe, sagte sie ihren Kindern, dieser Mann sei ihr Vater; sie sollten daher, wenn er wieder erwache, recht freundlich mit ihm sein.
Da geschah es, daß dem schlafenden König der Hut vom Kopfe auf die Erde fiel. »Johannes,« befahl die Mutter, »heb dem Vater den Hut auf!« Der Knabe gehorchte, der König aber war halb erwacht und hatte die Worte gehört. »Was soll das sein?« dachte er sich, »ich will mich nun stellen, als ob ich schlafe und den Hut wieder fallen lassen.«
Nach einer Weile fiel der Hut wieder auf den Boden. »Joseph,« rief die Mutter, »heb dem Vater den Hut auf!« Als der König dies hörte, richtete er sich auf und sagte: »Frau, warum nennt Ihr mich Vater?« Da lächelte sie und sagte: »Seht mich einmal recht an!« Da brach er in Tränen aus und sagte: »Ja, Ihr gleicht ganz meiner Frau, aber es ist nicht möglich, daß Ihr es seid; denn meine geliebte Gemahlin war ohne Hände.«
Da rief sie: »Und doch ist es möglich, mein herzgeliebter Gemahl, Gott hat mir meine Hände wieder gegeben, und diese Knaben sind deine Kinder!« Da umarmten sie sich, daß ihnen vor Seligkeit das Herz fast brechen wollte; dann nahm er die beiden Knaben auf die Arme und konnte sich an ihnen nicht satt sehen und küßte sie in einem fort, während die Tränen der Freude über seine Wangen rannen. Sie blieben die ganze Nacht beisammen und konnten sich nicht genug erzählen.
Am Morgen wollte er sie und die Knaben mit sich in die Stadt führen, aber sie sagte: »Mein herzliebster Gemahl, die Heiligen haben mir geboten, für immer hier zu bleiben, und ich muß ihnen gehorchen.« Da sprach er kein Wort dagegen, sondern küßte sie und die Knaben zum Abschied und sagte: »Ich werde bald wieder zu euch kommen.«
Er kehrte in die Stadt zurück. Dort legte er die Krone und die Regierung nieder, verkaufte alles, was er hatte, wählte unter seinen Dienern die treuesten aus und kehrte dann zu seiner Frau und seinen Kindern zurück. Da lebten sie im schönen, stillen, grünen Bergtal noch lange Jahre froh zusammen und genossen in reichlichstem Maße jenes Glück, welches nur die wahre treue Liebe der Herzen und der heilige Friede der Seele den Menschen zu bieten vermag.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Welschtirol
GOTTES LOHN ...
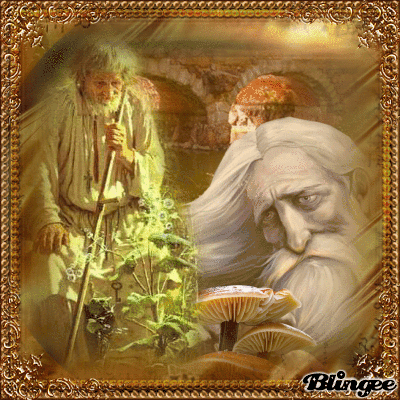
Vor vielen, vielen Jahren hörte ein armer Mann, daß derjenige, welcher dem lieben Herrgott etwas leiht, das selbe hundertfach zurück bekomme. Ohne sich lange zu besinnen, warf er nun seine ganze Barschaft, die in einem einzigen Geldstück bestand, in den Klingelbeutel, fest überzeugt, daß er dafür hundert solche Stücke erhalten werde.
Als ein Jahr längst verstrichen war und die hundert Geldstücke nie ankamen, machte sich der gute Mann auf den Weg, um den Herrgott selbst aufzusuchen und ihn an sein Versprechen zu mahnen. Nachdem er den ganzen langen Tag gewandert war, kam er schachmatt zu einem Hause, in das er ging und um ein Nachtlager bat.
Die Leute, die eben bei dem Nachtmahle waren, sagten ihm seine Bitte zu und hießen ihn mitessen. Bald fragte man, wohin seine Reise gehe. Er machte kein Hehl und sprach: »Ich gehe unseren lieben Herrgott aufsuchen, um ihn an seine Schuld zu erinnern.«
Da sagte die Frau: »Wenn du zu unserm Herrgott gehst, so richte ihm auch von uns etwas aus. Morgen sollte unsere Tochter Hochzeit haben und heute ist sie schwer erkrankt. Es ist als ob sie nicht heiraten sollte. Schon früher war zweimal alles in Ordnung und der Hochzeitstag war bestimmt und beide Male erkrankte sie. Wenn du zum lieben Gotte kommst, sage ihm unser Anliegen und bitte ihn, er möchte doch unsere Tochter heiraten lassen.«
Der Bettler versprach, ihren Wunsch zu erfüllen, ruhte die Nacht hindurch aus und wanderte am frühesten Morgen weiter. Den ganzen Tag ging er und erst abends wollte er sich Rast und Ruhe gönnen. Als die Sonne längst untergegangen war, kam er zu einem einsamen Hause, an dem ein großer Obstanger lag. Er bat um Nachtherberge und wurde freundlich aufgenommen. Auf die Frage: »Wohin des Weges?« teilte er das Ziel seiner Reise mit.
Da sprach der Bauer, dem der Hof gehörte: »Wenn du zu unserem lieben Herrgott kommst, dann frage ihn, warum in unserm Anger keine Trauben mehr wachsen?« Der Bettler versprach dies zu tun, legte sich dann zur Ruhe und schlief, bis der Hahn krähte.
Dann ging er wieder seines Weges und wanderte den ganzen, langen Tag, bis er abends zur Hütte zweier armen Brüder kam, die ihn willkommen hießen und ihm eine Wassersuppe kochten. Als diese vom Zwecke seiner Reise hörten, sagte der ältere: »Wenn du den lieben Herrgott findest, so frage ihn doch, warum zwischen uns Brüdern immer Unfriede herrsche, und wie diesem Übelstand abzuhelfen sei?«
Der Bettler versprach diesen Wunsch zu erfüllen, lag bei ihnen über Nacht und wanderte mit dem frühesten Morgen wieder weiter. Er war erst einige Stunden gegangen, da begegnete ihm ein ehrwürdiger alter Mann mit silberweißen Haaren und langem, grauen Barte. Der Greis fragte den Bettler: »Wohin des Weges?«
Dieser antwortete: »Ich gehe unseren lieben Herrgott suchen, um ihn an ein Versprechen zu mahnen.« »Wenn dem so ist,« erwiderte der Greis, »dann bist du am Ziele; denn ich bin, den du suchst.« Da fiel der Bettler auf die Knie und sprach: »Wenn Ihr der liebe Herrgott seid, dann bitte ich um die hundert Geldstücke, die Ihr mir versprochen habt.«
»Geh getrost nach Hause,« erwiderte unser Herrgott, »und ehe du heimkommst, wirst du mehr als das Hundertfache haben.« Da dankte der Bettler, sprang auf und wollte schon umkehren, doch fielen ihm noch zu rechter Zeit die Wünsche seiner Wirte ein. Er trug nun die Anliegen der selben Gott vor und dieser gab die gewünschten Bescheide. Dankend empfahl sich der Bettler und schlug eiligst den Rückweg ein.
Als er zur Hütte der zwei Brüder kam, fragten ihn diese sogleich: »Hast du ihn gefunden? Hast du ihn auch gefragt?« »Ja wohl!« erwiderte der Bettler, »ich habe ihn gefunden und euch läßt er folgendes sagen: 'Ihr lebt in Zwist und Hader, weil keiner dem anderen nachgeben will. Ihr sollt euch deshalb voneinander trennen und ein jeder soll eine eigene Wirtschaft anfangen.'« -
»Ah, das hätten wir längst getan, aber wir sind zu arm und haben nichts als diese baufällige Hütte,« sprachen die Brüder. »Ei habt nur Geduld und laßt mich zu Ende reden!« versetzte der Bettler. »Der Herrgott sagte, ihr solltet den Herd in der Küche abtragen und das Weitere werde sich von selbst ergeben.« Also gleich eilten sie in die Küche, schlugen den Herd zusammen und fanden im Grunde einen ungeheuren Topf, gefüllt mit Goldstücken.
Überglücklich fielen die Brüder dem Bettler um den Hals, gaben ihm so viel Geld, daß er es kaum tragen konnte, und ließen ihn nach einer kargen Bewirtung seines Weges ziehen. Der Bettler war nun ein wohlhabender Mann und wanderte Gott dankend und seelenvergnügt weiter.
Endlich kam er zum zweiten Hause, in dem er übernachtet hatte, und auch hier fragte man ihn sogleich, ob er bei unserm Herrgott gewesen sei, und was dieser gesagt habe? Da antwortete der Wanderer: »Der liebe Herrgott, bei dem ich gewesen bin, läßt euch sagen: Wundert euch nicht, daß in eurem Anger keine Trauben mehr wachsen! Ehedem hattet ihr um euren Garten einen so niedrigen Zaun, daß jeder Wanderer sich mit der Frucht eurer Reben erquicken konnte, und deshalb segnete ich eure Pflanzung.
Nun aber habt ihr den Anger mit so hohen Mauern umgeben, daß kaum mehr ein Vöglein sich an den Trauben laben kann. Wenn ihr nicht mehr so hartherzig gegen eure Nächsten sein werdet, werde auch ich freigebig gegen euch sein und eure Reben segnen.« Die Leute sahen reuig ihren begangenen Fehler ein, beschenkten und bewirteten den Wanderer reichlich und am folgenden Morgen zog er wieder weiter, bis er zum dritten Hause kam.
»Ich habe ihn gefunden,« rief er zur Türe hinein. Die Eltern begrüßten ihn aufs beste, luden ihn ins Haus und fragten nach dem Bescheide. »Ja,« antwortete er, »unser Herr läßt euch sagen: Habt ihr ganz vergessen, daß ihr euer Kind in zarter Jugend mir geschenkt habt? Wie könnt ihr nun das selbe einem irdischen Bräutigam antrauen wollen? Wenn ihr wollt, daß eure Tochter gesund bleibe, und daß ich euer Haus segne, so denkt nicht mehr an die Vermählung eurer Tochter.«
Die Eltern sahen ein, daß sie gefehlt hatten, bereuten es und beschenkten den Wanderer so reichlich, daß er nun nicht nur hundertfach, sondern tausendfach für sein Geldstück belohnt war. Er blieb einige Tage in diesem Hause und schickte von hier die Hälfte seines Geldes den Seinigen, denn ihn selbst wandelte die Lust an, sich ein wenig in der Welt umzusehen.
Er zog nun weiter und kam eines Tages zu einem wunderschönen Garten. Neugierig blieb er am Gitter stehen, um die prächtigen Blumen und schönen Bäume näher zu betrachten. Da sah er, wie der Gärtner die zarten Bäumchen auf eine erbärmliche Weise beschnitt, und er mußte über das läppische Treiben laut auflachen. Dies vernahm der Graf, dem der Garten gehörte, und fragte ihn, warum er denn lache.
»Und wer sollte nicht lachen,« sprach der Wandersmann, »wenn man so schöne Bäumchen auf so ungeschickte Weise behandelt?« »Wärst du imstande, es besser zu machen?« fragte der Graf. »Ja, ich hätte zu lange gelebt, wenn ich es nicht besser verstünde,« antwortete der Befragte. »Nun dann komm und laß deine Kunst sehen!« sprach der Graf und öffnete das Gitter.
Unser Wanderer ließ sich das nicht zweimal sagen, ging in den Garten, nahm das Messer und beschnitt die Bäumchen so kunstgerecht, daß der staunende Graf ihn fragte, ob er nicht bei ihm bleiben und den Garten besorgen möchte. »Warum nicht,« versetzte der Mann, »wenn guter Lohn und ordentliche Verpflegung herausschaut?« »Das soll dir nicht fehlen,« sprach der Graf, und sogleich wurde der Wanderer als Gärtner angestellt.
Der Garten gedieh nun unter der Hand des fleißigen, klugen Mannes dergestalt, daß der Graf Stolz und Freude darüber empfand und den Gärtner von Tag zu Tag lieber gewann. Dieser hatte aber selbst die größte Lust an seiner Beschäftigung und deren glänzenden Erfolgen, daß ihm Wochen wie Stunden vorkamen und ihm einige Jahre vergingen, ohne daß er daran dachte weiter zu gehen.
Endlich aber erhielt doch die Sehnsucht, die Seinigen und die liebe Heimat zu sehen, die Oberhand und er entschloß sich nach Hause zu wandern. Er teilte dem Grafen sein Vorhaben mit und bat ihn um den Lohn. Der Herr wollte ihn aber nicht wegziehen lassen, denn er glaubte, daß er keinen so geschickten Gärtner jemals mehr bekommen werde.
Da aber der Gärtner auf seinem Entschluss bestand, sprach der Graf: »Nun denn, wenn es sein muß, geh in Gottes Namen! Zum Lohne gebe ich dir nichts als diese drei Lehren: Erstens, wenn du auf deiner Reise zu zwei Wegen kommst, einem alten und einem neuen, so folge immer dem alten; zweitens, frage nie in fremden Häusern, warum dieses oder jenes da sei, oder was dies oder jenes zu bedeuten habe; drittens, tue nie etwas in der Aufwallung des Zornes.«
Da dachte sich der Gärtner, das ist ein schöner Lohn, ging und packte seine Sachen zusammen. Als er aber sein Bündel geschnürt hatte und Abschied nahm, gab ihm der Graf eine Torte und sprach: »Zum Angedenken gebe ich dir diese Torte, schneide aber die selbe nicht an außer im Augenblicke deiner höchsten Freude!« Der Gärtner dankte, nahm Abschied und machte sich auf den Heimweg.
Er war noch nicht weit gegangen, da holte ihn ein prächtiger Wagen ein und der Herr des selben lud den Fußgänger ein, mit ihm zu fahren. Unser Wanderer ließ sich dies nicht zweimal sagen und nahm die Einladung mit Dank an. Als sie eine Strecke gefahren waren, teilte sich der Weg.
Da bemerkte der Gärtner, daß der Kutscher den neuen einschlage, bat zu halten, stieg aus und folgte der alten Straße, bis er dorthin gelangte, wo der neue Weg wiederum mit dem alten zusammenlief. Hier erkundigte er sich im Wirtshause, ob nicht eine Kutsche vorüber gefahren sei. Man verneinte seine Frage.
Doch während er noch sprach, sprengte allein ein Pferd daher, und als man nun ging, um zu sehen, ob ein Unglück begegnet sei, fand man den Herrn schwer verwundet auf der neuen Straße liegen. Räuber hatten den Wagen überfallen, den Kutscher erschlagen und den Herrn beraubt und arg zugerichtet.
Unser Mann dankte Gott, daß er dem Rate des Grafen gefolgt war, und nahm sich ernstlich vor, immer dessen Lehren zu beobachten. Ernst und nachdenkend wanderte er weiter, bis er abends zu einer einsamen Schenke kam, in welcher er Nachtherberge nahm.
Wie erschrak er aber, als er aus dem Fenster blickte und im Hof Arme, Hände, Füße eines Menschen liegen sah. Schon wollte er fragen, was dies zu bedeuten habe, als er sich der Mahnung des Grafen erinnerte und das Wort auf der Zunge unterdrückte. Er legte sich zu Bette, konnte aber vor Angst und Furcht die ganze Nacht hindurch kein Auge schließen.
Frühmorgens stand er auf und wollte seine Zeche bezahlen. Da fragte ihn der Wirt, ob er sich nicht verwundert habe wegen der im Hofe liegenden Menschenglieder, und warum er nicht Aufschluß darüber verlangt habe. Unser Mann antwortete: »Weil ich nicht gewohnt bin, nach Dingen zu fragen, die mich nicht angehen.« »Du hast wohl getan,« versetzte der Wirt, »denn hättest du gefragt, hättest auch du ein Glied zurücklassen müssen.«
Gott und dem Grafen im stillen dankend nahm er Abschied und setzte seine Reise mit verdoppelten Schritten fort, denn er war seiner Heimat schon nahe. Im heimatlichen Dorfe angekommen, kehrte er im Wirtshaus, das seiner Hütte gerade gegenüber lag, ein und erquickte sich. Wie er nun am Fenster saß, sah er einen jungen Priester in seine Hütte treten, der von seinem Weibe auf das freundlichste empfangen wurde. Ja, sie fiel ihm an den Hals, küßte ihn und drückte ihn an ihr Herz.
Das däuchte dem Heimgekehrten zu arg, er sprang auf und wollte ins Haus hinüber eilen, um die Untreue zu züchtigen. Da fiel ihm der dritte Rat des Grafen ein, er hielt sich zurück und fragte, wer der junge Pfaffe sei. Darauf antwortete man ihm, es sei der Sohn jener Witwe, der ihr Mann längst davon gegangen sei. Der neugeweihte Priester sei eben nach Hause gekommen, um morgen die erste heilige Messe zu lesen. Es sei dies ein Fest für die ganze Gemeinde.
Da ertönten auf einmal die Glocken und es krachten die Böller zur Vorfeier des Tages. Der Mann konnte sich vor Rührung kaum der Tränen enthalten und pries im Herzen die wunderbaren Fügungen Gottes. Am folgenden Tage wurde die Primiz in feierlichster Weise begangen. Als der Gottesdienst vollendet war, zogen alle Gäste in das Wirtshaus zum festlichen Mahle.
Der Fremde saß auch unerkannt am Tische. Als aber Lebehochs auf den Neugeweihten und dessen Mutter ausgebracht wurden, stimmte der Gast mit lauter Stimme ein und sprach dann: »Soll aber der Vater des Priesters, dessen Ehrentag heute gefeiert wird, ganz vergessen bleiben? - Kennt mich denn niemand mehr? Auch du nicht, geliebtes treues Weib? Auch ihr nicht, liebe Kinder?« -
Da erscholl es wie aus einem Munde: »O lieber, lieber Mann!« »O lieber, lieber Vater!« und der Freude war kein Maß. Nachdem man sich umarmt und geküßt hatte, rief der Vater: »Dies ist gewiß der freudigste Augenblick meines ganzen Lebens und deshalb will ich dem Grafen folgen und die schwere Torte anschneiden.«
Er holte nun die Torte, stellte sie in die Mitte des Tisches und schnitt sie an. Sie war aber so hart, daß kein Messer durchdringen wollte. Endlich brach sie entzwei - und sieh, es rollten unzählige Goldstücke aus dem Kuchen, die ihm der Graf als Lohn für seine treuen Dienste in der Torte gespendet hatte.
Des Staunens war kein Ende. Der Vater blickte aber gegen Himmel und sprach mit feierlicher Stimme: »Seht, so bezahlt der Herrgott das ihm Geliehene.«
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Luserna
DAS TOTENKÖPFLEIN ...

Es war einmal ein braves Mädchen, das eine gar böse Stiefmutter hatte. Diese jagte das arme Kind aus dem Hause mit den Worten: »Wenn du mir noch einmal unter die Augen kommst, schlag ich dich krumm.«
Da lief das Mädchen weit, weit weg und kam in einen großen dunklen Wald. Als die Nacht kam und es finster wurde, war das gute Kind ganz ermattet und glaubte schon unter den wilden Tieren im Freien übernachten zu müssen. Allein plötzlich sah es ein Licht in der Ferne schimmern und ging dem selben zu.
Da kam es bald zu einem schönen Schlosse und läutete an. Also gleich sah ein Totenköpflein zum Fenster herab und fragte nach dem Begehren des Kindes. Dieses sprach: »Ich bitte um Einlaß und Nachtherberge, damit mich nicht die Wölfe hier draußen fressen.«
Da rief das Totenköpflein: »Wenn du mich herauf trägst, will ich schon hinab kommen und dir die Türe öffnen. Denn heraufgehen kann ich nicht, weil ich nur kugeln muß.« Das Kind versprach es herauf zu tragen und das Totenköpflein kugelte über die Stiege hinunter und machte auf.
Das Mädchen nahm das Köpflein nun in die Schürze und trug es in das Schloß hinauf. Da sprach das Köpflein: »Stell mich nun auf den Tisch und geh in die Küche, mir einen Schmarren zu kochen. Eier und Mehl gibt es genug.«
Das Kind folgte, ging in die Küche und begann zu kochen. Während dieser Arbeit fielen Totenbeine und andere Dinge aus dem Kamine herunter. Das Mädchen ließ sich aber nicht irre machen, kochte die Speise fertig und trug sie ins Zimmer des Totenköpfleins.
Als der Schmarren auf den Tisch gestellt war, wurde er auf der Seite des Totenköpfleins kohlschwarz, auf der Seite des Mädchens blieb er schön gelb. Nach dem Essen sagte das Köpflein: »Jetzt kannst du schlafen gehen. Um Mitternacht wird aber ein Totengerippe kommen und dich aus dem Bette reißen wollen. Wenn du dich aber nicht fürchtest, kann es dich nicht heraus bringen.«
Das Mädchen ging auf die Kammer und legte sich ins Bett. Schlag zwölf Uhr kam ein Gerippe und wollte das Kind mit allen Kräften aus dem Bette werfen, konnte es aber nicht zustande bringen. Da ging das Gerippe wieder fort, und das Mädchen konnte nun ungestört schlafen.
Als es am anderen Tage erwachte, stand das Totenköpflein als schneeweiße Jungfrau vor dem Bette und sprach: »Gott vergelt es dir, daß du mich erlöst hast! Zum Danke gehört dir mein Schloß mit allem, was darin ist.« Mit diesen Worten flog der Geist als weiße Taube davon. Das Mädchen war nun reich für sein Lebtag und lebte im Waldschloss wie eine Gräfin.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol
DIE DREI POMERANZEN ...
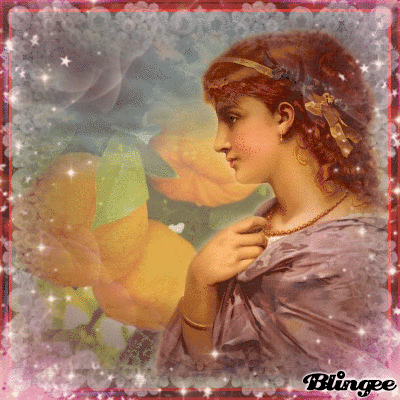
Es war einmal ein armes Weib, das hatte ein einziges Töchterlein, welches es wie ihren Augapfel liebte. Obgleich das Mädchen erst neun Jahre alt war, so war es doch so verständig wie eine Erwachsene und gar sanft und fromm.
Eines Tages waren Mutter und Tochter im Walde gewesen, um Holz zu klauben, und als sie heimkehrten, sahen sie bei einem Baume drei Feen, welche schon lange zu warten schienen und in gebieterischem Tone zur Mutter sagten: »Heute über ein Jahr führe dein Kind zu uns hierher auf diese Stelle!«
Voll Verzweiflung ging das Weib nach Hause. Wie viele Tränen weinte sie und wie traurig war sie stets! Aber das Mädchen suchte sie immer zu trösten. »Gott wird mir helfen, liebe Mutter,« sagte es oft; »du wirst sehen, daß ich vielleicht bald wieder wohlbehalten und glücklich zu dir zurückkehre.«
Als das Jahr abgelaufen war, führte die Mutter - denn sie wagte nicht ungehorsam zu sein - schweren Herzens ihre Tochter in den Wald. Dort warteten die drei Feen schon darauf, nahmen das Mädchen bei der Hand und entschwanden bald aus den Augen der Mutter, welche weinend nachschaute und tiefbetrübt nach Hause ging.
Die drei Feen aber führten das Mädchen in ihre Wohnung tief im Walde und legten ihm allerlei häusliche Dienste auf. Obwohl das Mädchen alles unverdrossen verrichtete, gelang es ihm doch nicht, sich die Gunst seiner strengen und unfreundlichen Gebieterinnen zu erwerben. Ja, es kam dahin, daß sie das Mädchen immer mehr haßten und sie beschlossen, dasselbe in das sichere Verderben zu schicken.
»Höre, Kleine,« sagte eines Abends eine der drei Feen, »geh morgen an diesen und diesen Ort und diesen und diesen Palast hin. Dort tritt ein und nimm der Alten, welche du dort findest, die drei Pomeranzen weg und bringe sie uns her. Wehe dir, wenn du unser Gebot nicht erfüllst!«
Das arme Mädchen versprach, es tun zu wollen; aber es ahnte wohl selbst, wie gefährlich dieses Unternehmen sein werde. Es weinte die ganze Nacht, dachte immer an seine liebe Mutter und betete inbrünstig, daß ihm das aufgetragene Werk gelingen möge.
Am frühesten Morgen machte es sich auf den Weg. Als es einige Stunden gegangen war, begegnete es einem alten Manne. »Wohin gehst du?« fragte er mitleidig, als er das Kind mit den verweinten Augen sah. »Ach, wenn du es wüßtest!« erwiderte es und erzählte ihm treuherzig alles.
Dann sprach der Alte: »Nimm diese Dinge, geh hin und mache davon Gebrauch, sobald du es nötig hast.« Und er gab ihm Nägel, ein Fläschchen Öl, einen Korb mit Brot, einen Besen und ein Seil. Das Mädchen nahm es, dankte recht herzlich dafür und machte sich, obwohl es an diesen Dingen ziemlich schwer zu tragen hatte, doch mit gutem Troste und besserem Mute wieder auf den Weg.
Bald kam es an den ihm von den Feen bezeichneten Ort und stand vor dem beschriebenen Palast. Vor dem selben war ein tiefer Graben und darüber führte eine Brücke, die war so alt und zerbrochen, daß man beim ersten Schritt darauf in die Tiefe stürzen mußte. Das Mädchen aber nahm die Nägel und befestigte damit ein Brett nach dem anderen, so daß es bald hinüber war.
Nun gelangte es zu einem großen Tor, das war mit Riegel und Ketten verschlossen und die waren so eingerostet, daß auch ein Riese mit all seiner Kraft sie nicht hätte zurückschieben können. Da nahm das Mädchen das Ölfläschchen und bestrich Riegel, Ketten und Angeln mit Öl, worauf sie sich leicht wegschieben ließen und das Tor wie von selbst sich öffnete.
Gleich hinter dem Tor lag ein Rudel Hunde, die stürzten wütend und bellend auf das Mädchen los, als wollten sie es zerreißen. Da griff dieses in den Korb und warf das Brot unter die Hunde, welche nun darauf los stürzten. Das Mädchen ließ sie fressen und ging weiter über einen Hof.
Da war ein Weib, welches den Hof mit seinem Kleide kehrte; das Mädchen aber gab ihm den Besen. Ganz nahe war ein Brunnen, daran stand ein Weib und zog den schweren Wassereimer mit ihren Haarflechten aus der Tiefe herauf. Hurtig gab ihr das Mädchen das Seil.
Nun war das Mädchen an der Stiege. Vorsichtig und leise ging es hinauf und kam in ein großes Gemach; da saß eine Alte halb wach und halb schlafend und spann. Auf einem Kasten aber lagen in goldenem Teller die drei Pomeranzen. Rasch ergriff sie das Mädchen und eilte hinweg; allein die Alte hatte es doch gemerkt und humpelte ihr nach.
Als das Mädchen am Brunnen war, rief die Alte dem Weibe, welches dort Wasser geschöpft, zu: »Halt sie auf, sie hat mir die drei Pomeranzen gestohlen!« Aber das Weib sagte: »Das tue ich nicht; seit so vielen Jahren zog ich den Wassereimer mit meinen Haarflechten herauf und nun hat mir das gute Kind ein Seil gegeben.«
Als das Mädchen zum Weibe kam, welches den Hof kehrte, rief die Alte wieder: »Schlag sie zu Boden, sie hat mir die drei Pomeranzen gestohlen!« Allein das Weib sagte: »Das tue ich nicht; seit so vielen Jahren kehrte ich den Hof mit meinem Kleide und nun hat mir das gute Kind einen Besen gegeben.«
Das Mädchen war schon bei den Hunden, da schrie die Alte zornig: »Packt sie, Hunde, zerreißt sie, sie hat mir die drei Pomeranzen gestohlen!« Allein die Hunde bellten nicht einmal, sondern sagten: »Das tun wir nicht; seit so vielen Jahren haben wir Hunger gelitten und nun hat uns das gute Kind Brot gegeben.«
Schon war das Mädchen am Tor, da schrie die Alte noch stärker: »Schließ dich, Tor, zerquetsche sie, sie hat mir die drei Pomeranzen gestohlen!« Aber das Tor rührte sich nicht, sondern sagte: »Das tue ich nicht; seit so vielen Jahren war ich rostig und nun hat mich das gute Kind mit Öl bestrichen.«
Eben trat das Mädchen auf die Brücke, da schrie die Alte immer noch einmal im höchsten Grimme: »Falle, Brücke, wirf sie hinab, sie hat mir die drei Pomeranzen gestohlen!« Die Brücke aber schwankte nicht einmal, sondern sagte: »Das tue ich nicht; seit so vielen Jahren war ich zerbrochen und nun hat mich das gute Kind wieder gemacht!«
Nun konnte die Alte nicht mehr weiter und das Mädchen war gerettet. Es dankte Gott und setzte freudig seinen Weg weiter fort, bis es wieder zu den Feen kam. Diese waren nicht wenig erstaunt, das Mädchen wieder zu sehen, noch erfreuter waren sie, als es ihnen die drei Pomeranzen überreichte.
Nachdem es ihnen alles erzählt hatte, lobten sie es und fragten, was für eine Belohnung es wolle. Das Mädchen verlangte nichts anderes, als zu seiner Mutter zurückkehren zu dürfen. Die Feen gestatteten es ihm und überhäuften es überdies mit den reichsten und kostbarsten Geschenken.
Welch große Freude die Mutter hatte, ihre Tochter wieder zu sehen, kann ich nicht beschreiben und will nur noch sagen, daß Mutter und Tochter fürderhin glücklich zusammen lebten und alle frühere Armut und Not für immer ein Ende hatte.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Borgo
DER BLINDE KÖNIG ...

Es war einmal ein König blind und keine Kunst der Ärzte konnte ihm das Licht der Augen wiederbringen. Zuletzt gab ihm ein Wahrsager den Bescheid, er würde nicht eher wieder sehend werden, als bis man ihm den Vogel Phönix brächte; nur dessen Gesang könnte das Wunder bewirken.
Da machten sich die drei Söhne des Königs, einer nach dem anderen auf den Weg, den Vogel Phönix zu suchen. Der Älteste kam in den ersten Tagen in eine große Stadt und sah da einen prächtig gebauten Palast, aus dessen Fenstern ihm ein schön gekleidetes Fräulein winkte. Auch hörte er allerlei lustige Weisen spielen. Da bedachte er sich nicht lange, sondern ging hinauf, kam aber nicht wieder herunter. Dasselbe Schicksal hatte auch der zweite Sohn.
Nun war die Reihe an dem dritten; den wollte aber der Vater, dem er allein noch übrig war, lange Zeit nicht von sich lassen, zumal er ihn am Liebsten hatte. Zuletzt erhielt er doch Urlaub, bestieg sein Roß und trabte davon. Bald kam er auch in die große Stadt und an dem prächtigen Palast vorbei, wo so lustig gesungen und gejubelt wurde, und das schöne Fräulein ihm aus dem Fenster winkte.
Der Lärm war ihm aber da zu laut; er gab seinem Pferde die Sporen und ritt in ein anderes Wirtshaus, wo er Nachtherberge nahm. Als er nun lag und schlief, weckte ihn ein Pochen an der Türe. »Herein!« rief er und rieb sich lachend die Augen, weil er wohl wußte, daß niemand hereintreten würde, denn er hatte die Türe verriegelt.
Da pochte es zum anderen Male, und lachend rief er wieder »Herein!« und freute sich, daß der Narr an der Türe so lange stehen müsse. Aber noch zum dritten Mal pochte es, und er rief wieder »Herein!« Aber nun war es ihm nicht mehr ums Lachen, denn die Türe ging auf und eine lange bleiche Gestalt trat auf ihn zu. »Fürchte dich nicht«, redete sie den Prinzen an, »sondern erweise mir eine Wohltat, es soll dein Schade nicht sein.
Ich mußte diesem Wirt einmal die Zeche schuldig bleiben: da fiel er über mich her und warf mich die Treppe herab, daß ich Arm und Bein zerbrach; zuletzt schlug er mich gar tot und zog meinen Leib dann in den Keller hinab und verscharrte ihn. Wenn du nun dem Wirte meine Schuld bezahlst und mich christlich begraben läßt, so werde ich erlöst sein und dir auch einmal helfen«. Darauf verschwand der Geist.
Der Prinz aber, dem es eiskalt über dem Rücken gelaufen war, konnte nicht wieder einschlafen. Sobald der Hahn krähte, stand er auf und fragte den Wirt, ob er nicht etwas im Hause habe, das nicht hineingehöre, sondern auf den Friedhof. Der Wirt ward erst weiß, wie eine Mauer, dann aber fing er ganz gottlos zu schimpfen an über den Gast, der seine Zeche nicht bezahlt habe.
Als er aber hörte, daß der Prinz diese Zeche bezahlen und den Toten ehrlich begraben lassen wolle, beruhigte er sich wieder und war dem Prinzen gerne behilflich die Leiche aus dem Keller zu schaffen. Als dem Toten sein Recht geschehen war, ritt der Prinz fort, den Vogel Phönix zu suchen.
Da kam er durch einen großen dunklen Wald, wo ihm plötzlich ein Wolf in den Weg lief. Da sprang der Prinz im ersten Schrecken vom Pferde und erstach es, damit der Wolf sich an dem Pferde ersättige und ihn ziehen ließe. Wie erschrak er aber, als der Wolf seinen Rachen auftat und ihn anredete: »Weh, warum hast du das Pferd getötet? Wir hätten beide darauf sitzen können; so aber mußt du nun auf meinem Rücken reiten, denn ich will dein Reisegefährte sein.«
Da der Wolf so schön reden konnte, setzte sich der Prinz auf seinen Rücken und das Tier lief über Stock und Pflock mit ihm davon. So kamen sie bald zu einem herrlichen Schloß in schöner Landschaft. »Siehst du« sagte der Wolf, »da ist das Zauberschloß: da mußt du nun hinaufgehen; da wirst du ein ganzes Zimmer voll schöner Vögel und Vogelkörbe sehen. Aber nimm ja keines davon, sondern ganz im Winkel nimm das schlechte Vogelhaus: darin ist der Vogel Phönix. Und neben ihm steht ein goldener Mann, den berühre ja nicht, sonst ist alles umsonst«.
Der Königssohn gehorchte und fand alles so, wie es der Wolf beschrieben hatte; als er aber im Winkel den Vogel Phönix sah, mußte er lachen, denn das arme Ding schaute aus, wie eine gerupfte Henne. »Der Vogel gefällt mir nicht,« dachte der Prinz, »aber der goldene Mann desto besser: am besten ist, ich nehme sie beide«.
Als er aber den goldenen Mann berührte, schrien alle Vögel durcheinander: »Dieb, Dieb, Dieb!«, und eine Schar Diener ergriff ihn und führte ihn vor den Schloßherrn. Da mußte er alles erzählen, wie es ihm ergangen sei, und warum er den Vogel habe nehmen wollen.
Da sagte der Herr: »Weil die Sache so steht, will ich dich freilassen. Ich will dir auch, damit dein Vater sehend werde, den Vogel geben, wenn du mir das Roß verschaffst, das so schnell läuft, wie der Wind weht. Wenn du das bringst, so ist der Vogel dein!« So kam der Königssohn zurück zu dem Wolf, der ihn tüchtig ausschalt wegen seines Ungehorsams.
»Wenn du mir gefolgt hättest, so wäre nun alles vorbei, und du könntest heimreiten. Nun mußt du dich wieder auf meinen Rücken setzen, bis wir das windschnelle Roß gefunden haben.« Der Prinz war froh, daß er mit Schelten davon kam, und setzte sich wieder dem Wolf auf den Rücken.
Nach kurzer Zeit kamen sie zu einem anderen Schlosse, wo der Wolf stille stand und den Prinz absteigen hieß. »Du mußt nun hinter das Schloß gehen, bis du eine große Türe findest: wenn du da hineingehst, wirst du viele schöne Pferde sehen. Nimm aber keines von den schönen, sondern das schlechteste und magerste von allen nimm, das ist das rechte.«
Da ging der Prinz und fand alles so, wie der Wolf gesagt hatte. Als er aber unter vielen schönen Schimmeln das schlechte Pferd sah, sagte er halblaut »Himmel, das ist ein Klepper! daran könnt ich meinen Hut aufhängen; das Tier kann ja kaum stehen.« Da band er es los und wollte schon damit fort; aber noch unter der Türe kehrte er wieder um:
»Auf dem Klepper kann ich ja nicht reiten: warum denn das Schlechteste nehmen, wo so viel Gutes ist?« Rasch hatte er schon ein anderes ergriffen und wollte damit fort; aber da entstand ein Höllenlärm: hundert Hunde packten ihn und fort ging es zum Schloßherrn.
»Wer hat dich geheißen meine Pferde stehlen, du Landstreicher!« fuhr der ihn an. Da stand der Prinz wieder als Dieb da und mußte seine Geschichte erzählen, damit er nur davon käme. Da lachte ihn der Herr aus, und die Diener halfen dabei; zuletzt sprach aber jener: »Mir liegt nicht so viel an dem Roß und wollte, es dir schon geben, wenn du mir die schönste Frau, die auf der Welt zu finden, herbei brächtest«. -
»So einen folgsamen und klugen Prinzen wie du bist, wird man nicht leicht finden«, sagte der Wolf, als er ohne das Roß zu ihm zurückkam. Der Prinz wußte nicht, was er sagen sollte, und mußte sich nun wieder auf des Wolfes Rücken setzen. Über Stock und Stein ging es nun fort, bis sie nach drei Tagen wieder vor dem Tor eines schönen Schlosses hielten, wo der Prinz absteigen mußte.
»Geh jetzt hinauf ins Schloß,« sprach der Wolf, »und durch alle Zimmer, bis du in eines kommst wo du zwei Frauen schlafend findest: eine ist schwarz wie die Nacht, die andere weiß und schön wie der Tag. Die Schwarze mußt du nehmen, sonst helfe dir wer kann, ich kann es nimmer!«
Da ging der Prinz auf das Schloß und kam durch viele Säle und Zimmer und fand auch endlich das, worin zwei Frauen schliefen. Die eine war schwarz wie die Nacht, die andere schön wie der Tag. Der Prinz wußte sich nicht zu helfen und stand lange unschlüssig. »Soll ich die Schwarze nehmen oder nicht? Pfui tausend! Aber wenn ich sie nicht nehme, ist es aus: was tut dann mein blinder Vater? Ja, ich nehme die Schwarze.«
Sein Entschluß stand fest, er nahm die Schwarze bei der Hand: sie stand auf und folgte ihm. Als sie aber vor dem Schloßtor waren, wurde sie so schön wie der helle Tag, noch schöner als die andere gewesen war; sie dankte auch dem Prinzen, daß er sie erlöst habe. Nun trippelte auch der Wolf daher und sprach ihr zu, sich nicht zu fürchten, und den Prinzen lobte er, daß er diesmal die Probe bestanden habe.
Dann nahm er sie beide auf den Rücken und trug sie zu dem Schlosse, wo das windschnelle Pferd war. Da ging der Prinz mit der Jungfrau zu dem Schloßherrn und sagte: »Hier ist die Schönste auf der Welt: jetzt halte dein Versprechen!« Da hieß der Herr das Pferd in den Schloßhof führen; der Prinz aber stellte sich als traue er ihm nicht recht und sagte: »Wer weiß, ob das der windschnelle Schimmel ist; ich will ihn erst probieren.«
Alsbald schwang er sich mit der Jungfrau auf und das Roß ward nun schön und groß und im nämlichen Augenblicke standen sie vor dem Schlosse, wo der Vogel Phönix war. Als er hier ein ritt, stand der Schloßherr gerade am Fenster. »Hier ist das Roß, das du verlangt hast,« rief ihm der Prinz hinauf, »jetzt gib mir den Vogel.«
Da kam der Herr hinab mit dem Vogel und hieß den Prinzen absteigen. »Nein,« sagte er, »das tue ich nicht, du könntest Roß und Vogel für dich behalten. Das ist ja wohl auch nicht der rechte Phönix, laß sehen.« Der Herr reichte ihm den Vogel. »Ja, das ist schon der rechte; schönen Dank!« und spornstreichs war der Königssohn mit Roß und Jungfrau und Vogel davon.
Sie ritten oder vielmehr flogen nun fort, bis sie in den Wald kamen, wo der Wolf dem Königssohn begegnet war. »Hier bleib ich zurück,« sagte der Wolf, »weißt du, wer ich bin?« »Wie könnt ich das wissen?« »Ich bin der Geist des Toten, den du los gekauft und jetzt erlöst hast. Siehst du nun, daß es dein Schade nicht war?
Wenn du nun bald in die Stadt kommst, so laß dir ja nicht einfallen, Galgenfleisch zu kaufen.« »Wo denkst du hin, Wolf? wie würde ich das wohl?« »Kauf kein Fleisch vom Galgen! das sag ich dir,« rief der Wolf noch einmal und verschwand. Da ritt der Prinz nach der Stadt und wie er an das Tor kam, sah er eine große Menge Menschen und hörte, da sollten zwei Lumpen, gar nasse Brüder, hingerichtet werden, die alles verjubelt hätten.
Als der Wagen herbei kam, worauf die Missetäter saßen, gruselte es dem Prinzen vom Kopf bis zu den Zehen, denn er erkannte seine beiden Brüder. Da war es sein erstes, sie loszukaufen und neu zu kleiden; dann setzte er sich mit ihnen auf das windschnelle Roß und ritt nach der Heimat.
Unterwegs stieß der eine Bruder den anderen an und flüsterte ihm zu: »Wir müssen uns schämen vor dem Vater, daß unser jüngster Bruder alles gewonnen hat und wir nichts, das wird uns Reich und Thron kosten. Du bist der Älteste, dir gebührt es. Geh, wir schneiden dem Jungen den Hals ab und verbergen ihn dort unter dem Laubhaufen; dann bringen wir dem Vater den Vogel und nehmen Roß und Jungfrau für uns.«
»Das ist wahr,« sagte der ältere, »der Milchbart darf nicht König werden!« Da schnitten sie dem Jüngern, der sich nichts Böses versah, in den Hals und warfen ihn unter den Laubhaufen. Als sie nun in die Hauptstadt kamen und dem blinden König den Wundervogel brachten, freute er sich sehr; aber seine Freude war bald in Trauer verkehrt, weil der jüngste Sohn nicht mitgekommen war und der Phönix nicht singen wollte und so zerrupft im Käfig saß.
Unterdes hatte der treue Wolf den jüngsten Bruder unter dem Laube hervorgescharrt; er war auch noch nicht tot und als der Wolf seine Halswunde beleckt hatte, stand er gesund wieder auf. »Gelt! wieder nicht gefolgt,« sagte der Wolf, »mußtest du doch Galgenfleisch kaufen! Jetzt geh nur schnell heim, daß dein Vater wieder sehend werde; deine Brüder aber laß nur gleich an den Galgen hängen, denn dahin gehören sie.«
Der Prinz dankte dem Wolf und ging ganz traurig auf die Hauptstadt zu und in das Schloß seines Vaters, und als er die Zimmertüre öffnete, fing der Phönix wunderschön zu singen an und war auch wieder so schön, als er gewesen war. Im nämlichen Augenblick erhielt auch der König sein Augenlicht wieder.
Als sie den Vogel singen hörten, sprangen auch die beiden Brüder herein; aber sie erblaßten, als sie den jüngsten wieder sahen und hatten auch Grund dazu, denn als durch die Erzählung des Prinzen ihre Schuld an den Tag kam, ließ der König sie hinrichten. Dann hielt der Prinz Hochzeit mit der erlösten Jungfrau; und dabei hätten wir auch wohl sein mögen, nicht wahr? Ja, bei der Hochzeit schon; aber bei der Hinrichtung nicht!
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Meran
HYACINTH UND ROSENBLÜTE ...
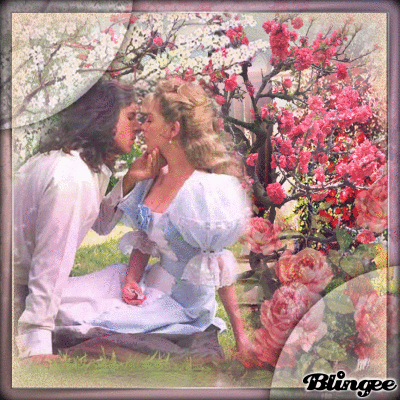
Unter den Mädchen war Eine, ein köstliches, bildschönes Kind, sah aus wie Wachs, Haare wie goldene Seide, kirschrote Lippen, wie ein Püppchen gewachsen, brandrabenschwarze Augen.
Wer sie sah, hätte mögen vergehen, so lieblich war sie. Damals war Rosenblüte, so hieß sie, dem bildschönen Hyacinth, so hieß er, von Herzen gut,und er hatte sie lieb zum Sterben. Die anderen Kinder wußten es nicht.
Ein Veilchen hatte es ihnen zuerst gesagt, die Hauskätzchen hatten es wohl gemerkt, die Häuser ihrer Eltern lagen nahe beisammen. Wenn nun Hyacinth die Nacht an seinem Fenster stand und Rosenblüte an ihrem, und die Kätzchen auf dem Mäusefang da vorbei liefen, da sahen sie die Beiden stehen. und lachten und kicherten oft so laut, daß sie es hörten und böse wurden.
Das Veilchen hatte es der Erdbeere im Vertrauen gesagt, die sagte es ihrer Freundin, der Stachelbeere, die ließ nun das Sticheln nicht, wenn Hyacinth gegangen kam; so erfuhr es denn bald der
ganze Garten und der Wald, und wenn Hyacinth ausging, so rief es von allen Seiten:
„Rosenblütchen ist mein Schätzchen!“
Nun ärgerte sich Hyacinth, und mußte doch wieder aus Herzensgrunde lachen, wenn das Eidechsen geschlüpft kam, sich auf einen warmen Stein setzte, mit dem Schwänzchen wedelte und sang:
„Rosenblütchen, das gute Kind,
Ist geworden auf einmal blind,
Denkt, die Mutter sei Hyacinth,
Fällt ihm um den Hals geschwind;
Merkt sie aber das fremde Gesicht,
Denkt nur an, da erschrickt sie nicht,
Fährt, als merkte sie kein Wort,
Immer nur mit Küssen fort.“
Ach! Wie bald war die Herrlichkeit vorbei. Es kam ein Mann aus fremden Landen gegangen, der war erstaunlich weit gereist, hatte einen langen Bart, tiefe Augen, entsetzliche Augenbrauen, ein wunderliches Kleid mit vielen Falten und seltsamen Figuren hineingewebt.
Er setzte sich vor das Haus, das Hyacinths Eltern gehörte. Nun war Hyacinth sehr neugierig, und setzte sich zu ihm und holte Brot und Wein. Da tat er seinen weißen Bart von einander und erzählte bis tief in die Nacht, und Hyacinth wich und wankte nicht, und wurde auch nicht müde zuzuhören.
So viel man nachher vernahm, so hat er viel von fremden Ländern, unbekannten Gegenden, von erstaunlich wunderbaren Sachen erzählt, und ist drei Tage da geblieben, und mit Hyacinth in tiefe Schachten hinunter gekrochen.
Rosenblütchen hat genug den alten Hexenmeister verwünscht, denn Hyacinth ist ganz versessen auf seine Gespräche gewesen und hat sich um nichts bekümmert; kaum daß er ein wenig Speise zu sich genommen. Endlich hat jener sich fort gemacht, doch dem Hyacinth ein Büchelchen da gelassen, das kein Mensch lesen konnte.
Dieser hatte ihm noch Früchte, Brot und Wasser mitgegeben, und ihn weit weg begleitet. Und dann ist er tiefsinnig zurück gekommen und hat einen ganz neuen Lebenswandel begonnen.
Rosenblütchen hat recht zum Erbarmen um ihn getan, denn von der Zeit an hat er sich wenig aus ihr gemacht und ist immer für sich geblieben.
Nun begab sich, daß er einmal nach Hause kam, und war wie neu geboren. Er fiel seinen Eltern um den Hals, und weinte. „Ich muß fort in fremde Lande, sagte er, „die alte wunderliche Frau im Walde hat mir erzählt, wie gesund ich werden müßte, das Buch hat sie ins Feuer geworfen, und hat mich getrieben, zu euch zu gehen und euch um euren Segen zu bitten.
Vielleicht komme ich bald, vielleicht nie wieder. Grüßt Rosenblütchen. Ich hätte sie gern gesprochen, ich weiß nicht, wie mir ist, es drängt mich fort; wenn ich an die alten Zeiten zurück denken will, so kommen gleich mächtige Gedanken dazwischen, die Ruhe ist fort, Herz und Liebe mit, ich muß sie suchen gehen.
Ich wollt euch gern sagen, wohin, ich weiß selbst nicht, dahin, wo die Mutter der Dinge wohnt, die verschleierte Jungfrau. Nach der ist mein Gemüt entzündet. Lebt wohl!“ Er riß sich los und ging fort. Seine Eltern wehklagten und vergossen Tränen, Rosenblütchen blieb in ihrer Kammer und weinte bitterlich.
Hyacinth lief nun was er konnte, durch Täler und Wildnisse, über Berge und Ströme, dem geheimnisvollen Lande zu. Er fragte überall nach der heiligen Göttin Isis, Menschen und Tiere, Felsen und Bäume. Manche lachten, manche schwiegen, nirgends erhielt er Bescheid.
Im Anfang kam er durch raues, wildes Land, Nebel und Wolken warfen sich ihm in den Weg, es stürmte immerfort; dann fand er unabsehliche Sandwüsten, glühenden Staub, und wie er wandelte, so veränderte sich auch sein Gemüt, die Zeit wurde ihm lang und die innere Unruhe legte sich, er wurde sanfter und das gewaltige Treiben in ihm allgemach zu einem leisen, aber starken Zuge, in den sein Gemüt sich auflöste.
Es lag wie viele Jahre hinter ihm. Nun wurde die Gegend auch wieder reicher und mannigfalter, die Luft lau und blau, der Weg ebener, grüne Büsche lockten ihn mit anmutigem Schatten, aber er verstand ihre Sprache nicht, sie schienen auch nicht zu sprechen, und doch erfüllten sie auch sein Herz mit grünen Farben und kühlem, stillem Wesen.
Immer höher wuchs jene süße Sehnsucht in ihm, und immer breiter und saftiger wurden die Blätter, immer lauter und lustiger die Vögel und Tiere, balsamischer die Früchte, dunkler der Himmel, wärmer die Luft, und heißer seine Liebe, die Zeit ging immer schneller, als sähe er sich nahe am Ziele.
Eines Tages begegnete er einem kristallenen Quell und einer Menge Blumen, die kamen in ein Tal herunter zwischen schwarzen himmelhohen Säulen. Sie grüßten ihn freundlich mit bekannten Worten: „Liebe Landsleute“, sagte er, „wo finde ich wohl den geheiligten Wohnsitz der Isis? Hier herum muß er sein, und ihr seid vielleicht hier bekannter als ich.“ –
„Wir auch nur hier durch“, antworteten die Blumen; eine Geisterfamilie ist auf der Reise und wir bereiten ihr Weg und Quartier, indes sind wir vor kurzem durch eine Gegend gekommen, da hörten wir ihren Namen nennen. Gehe nur aufwärts, wo wir herkommen, so wirst du schon mehr erfahren.“ Die Blumen und die Quelle lächelten, wie sie das sagten, boten ihm einen frischen Trunk und gingen weiter.
Hyacinth folgte ihrem Rat, frug und frug und kam endlich zu jener längst gesuchten Wohnung, die unter Palmen und anderen köstlichen Gewächsen versteckt lag. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht, und die süßeste Bangigkeit durchdrang ihn in dieser Behausung der ewigen Jahreszeiten.
Unter himmlischen Wohlgedüften entschlummerte er, weil ihn nur ein Traum in das Allerheiligste führen durfte. Wunderlich führte ihn der Traum durch unendliche Gemächer voll seltsamer Sachen auf lauter reizenden Klängen und in abwechselnden Akkorden. Es dünkte ihm alles so bekannt und doch nie gesehene Herrlichkeit, da schwand auch der letzte irdische Anflug, wie in Luft verzehrt, und er stand vor der himmlischen Jungfrau, da hob er den leichten, glänzenden Schleier, und Rosenblütchen sank in seine Armen.
Friedrich Freiherr von Hardenberg
DER MESSNERSOHN ...
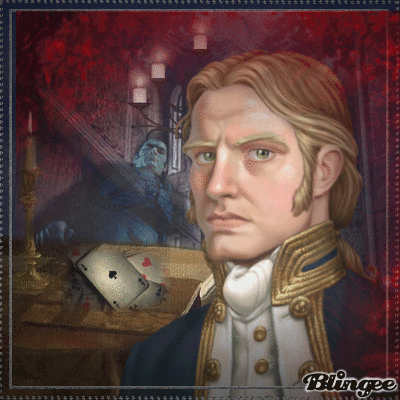
Es war einmal ein Meßnersohn, dem beide Eltern gestorben waren und der nur eine einzige Schwester hatte. Er hieß Hans und war ein gar kecker und furchtloser Bursche, so daß er sich weder von den Menschen noch vor den Geistern fürchtete. Nachts ging er nie nach Hause und ins Bett, sondern blieb auf dem Friedhofe und schlief auf den Gräbern, die überwachsen waren, und wenn der Mond ihm blaß ins Gesicht schien, oder die schwarzen Wolken wild dahinjagten und der Wind an den Totenkreuzen rüttelte und schüttelte, wurde dem Hans erst wohl und er meinte, es könnte gar keine schönere Nacht geben.
Die Schwester sah dieses Treiben ihres Bruders ungern und bat ihn oft, er möchte doch nach Hause und ins warme Bett gehen und nicht immer bei den Toten schlafen, denn sonst könnte es ihm einmal über gehen. Allein diese Reden schlugen an taube Ohren. Hans ließ sich nichts einreden und übernachtete auf seinen Gräbern.
„Warte nur“, dachte sich die Schwester, „wenn du den Worten nicht folgst, will ich dich fürchten lehren.“ Gedacht, getan. Als er wieder übernachtete, ging die Schwester in ihre Kammer, hüllte sich in ein weißes Leintuch und schlich sich auf den Gottesacker. Dort stellte sie sich zur Trauerweide, unter der Hans gewöhnlich schlief.
Sie wartete lange, bis endlich der Bruder kam, und glaubte, er würde sich nun fürchten. Hans hatte aber das Gruseln nie gelernt, besann sich nicht lange, nahm seinen Knittel auf und schlug den Geist mausetot. – Als dann schaute er, was das für ein Geist gewesen sei, und fand, o Schrecken, seine liebe einzige Schwester leblos und blutbefleckt zu seinen Füßen liegen.
Er wußte sich nun weder Trost noch Rat und sah sich schon auf dem Rade. Der Boden brannte ihm unter den Füßen und er beschloß, in die weite Welt zu wandern, um dem Gerichte und wo möglich dem Gewissen zu entrinnen. –
Er machte sich noch in der selben Stunde auf und ging ohne zu rasten und ohne nur einmal rückwärts zu schauen, bis am anderen Tage die Nacht herandunkelte und alles ins Schweigen und Träumen wiegte. –
Da war Hans hungrig und müde und ging in ein Wirtshaus, das am Wege stand und gar herrlich beleuchtet war. „Hier ist kein Platz mehr“, sprach der Wirt, „das Haus ist vollgestopft wie eine magere Wurst. Hier kannst du keine Herberge mehr finden.“ „Ist hier in der Nähe auch nirgends ein Nachtlager zu haben?“ forschte der Ermüdete.
„Nein“, antwortete der Befragte, „es steht mein Wirtshaus hier Mutterseelen allein. Da drüben das Schloß wäre wohl ganz leer und du hättest darin Platz genug – allein ich will es früher sagen – es geistert in den Sälen. Schon mancher ließ es sich nicht wehren und schlief drüben, allein morgens fand man noch jeden tot.“
„Pah, was geistern!“ fiel Hans dem Wirt in die Rede, „die Geister scheren mich nicht. Will mal sehen, was die da drüben treiben.“ Er ließ sich vom Wirt nun eine Flasche Wein, ein Brot, ein Spiel Karten geben und verlangte aufs Geisterschloß zu gehen. Der Wirt trug ihm zwei Lichter voran, führte ihn in ein schönes, hohes, aber etwas altertümliches Zimmer, stellte dort den Armleuchter auf den Tisch und ging wieder fort.
Hans war nun allein und ganz guter Dinge, er trank und aß und spielte für sich, gab aber immer die Karten für zwei Spieler aus und spielte auch für die Abwesenden.
Als es auf dem Turme der Schlosskapelle mit dumpfen Klängen zwölf Uhr schlug, klopfte es stark an die Türe des Zimmers. „Herein, was Hosen sein, Weiber sollen draußen bleiben“, rief Hans mit starker Stimme. Kaum hatte er dieses gesagt, so öffnete sich die Türe und ein weißer Geist trat ein und verneigte sich vor dem Spieler.
Als Hans dieses sah, stand er voll Freuden auf, bot dem Fremdling seinen Sitz an und lud ihn ein mitzuspielen. Der Geist nickte stillschweigend und spielte ohne ein Wort zu verlieren. – So hatten sie einige Zeit gespielt, da klopft es wider an der Türe. „Herein, was Hosen sein, Weiber sollen draußen bleiben“, antwortete Hans.
Auf diese Worte öffnete sich die Türe und es kam wieder ein Geist und trug einen schweren, schweren Sack auf der rechten Achsel. Schweigend winkte der Ankömmling dem Hans, er möchte ihm doch helfen. – Der Meßnersohn sprach aber: „I hab dir nit aufgeholfen, i hilf dir a nit ab.“
Trotzig warf nun der Geist den schweren Sack auf die Erde, daß die Dielen zitterten und die Wände bebten. Hans verzog zum bösen Spiele keine Miene und wartete neugierig auf die Dinge, die da kommen würden. Der zweite Geist setzte sich nun auch zum Tische und spielte mit den Zweien. Nachdem er einige Zeit lang gespielt hatte, stand er auf und winkte dem Hans wieder, er möchte ihm den Sack aufhelfen. –
Der gute Hans gab ihm aber wieder zur Antwort: „I hab dir nie abgeholfen, i helfe dir a nie auf.“ – Wie Hans das gesagt hatte, waren die Geister erlöst, übergaben ihm das Geld und das Schloß und verschwanden wie der Rauch bei heiterem Himmel. – Hans war nun ein reicher Mann und legt sich froh und glücklich aufs Bett und schnarchte bis zum späten Morgen.
Als die Morgensonne schon in das nahe Tal gekommen und die Vögel ihr Morgenlied sangen, dachte sich der Wirt, „ich muß doch sehen, wie’s dem Burschen geht“, und ging hinüber im festen Glauben, ihn tot zu finden.
Wie groß aber war das Staunen als er den Hans frisch und gesund im Bette fand und ihm dieser die ganze Geschichte der verflossenen Nacht erzählte. Hans war nun reich wie ein Fürst, und wohnte einige Jahre auf dem Schlosse, das er sich stattlich herbauen ließ.
Endlich wurde ihm das einsame Leben da droben zu langweilig und er beschloss weiter zu wandern und die Welt anzuschauen. Er besorgte sich ein stolzes Reitpferd und schöne Kleider und ritt nun in die Ferne. Eines Abends kam er auf seinen Wanderzügen in eine große, prächtige Stadt, in der ein König wohnte.
Es war aber in den weiten Gassen und in den schönen Palästen gar öde und traurig, denn nirgends wurde gelacht oder gesungen und die Leute gingen herum mit gar trüben und ernsten Gesichtern. Ritter Hans fragte nach der Ursache der allgemeinen Trauer und hörte, die Königstochter müsse heute dem Drachen vorgeworfen werden. –
Hans war, als er dieses erfahren, nicht faul, ging zum Könige und fragte ihn, was er ihm geben wollte, wenn er seine Tochter befreien würde. „Meine Tochter selbst!“ rief freudig der König, dem ein unerwarteter Hoffnungsstrahl, dass seine wunderschöne Tochter vielleicht noch gerettet werden könnte, durchs Herz zuckte.
Hans war mit dem Preise einverstanden, brachte ihm die Drachenzunge und wurde wie ein Sohn vom alten Herrscher aufgenommen und umarmt. Er hätte nun die Königstochter heiraten und mit sich nehmen gesollt, allein er sprach: „Ich will mich noch in der Welt umsehen und wenn ich nach einem Jahr wieder komme, werde ich die schöne Prinzessin zum Altare führen.“
Hans kehrte nun wieder auf sein Schloss zurück und baute und ordnete dort, oder jagte in den Wäldern Hirsche und Rehe. Es gingen Tage und Wochen vorbei, und dem Hans gefiel das Leben und Treiben so wohl, dass er die Königstochter fast vergaß.
Das Jahr war fast zu Ende, da dachte er sich: „Ich muß doch mein Wort halten“ und machte sich auf den Weg in die Königsstadt. Als er in die Stadt kam, sah er in allen Ecken und Enden nur fröhliche Gesichter und überall waren Vorbereitungen zu großen Festlichkeiten getroffen.
Hans konnte sich das alles nicht erklären und fragte einen, der ihm begegnete, was das alles zu bedeuten hätte. – „Ja“ wurde ihm erwidert, „die Königstochter hat Hochzeit und deshalb triumphiert
alles so.“
„Die Königstochter Hochzeit!“ sprach Hans stille bei sich, „wenn dem so wäre, müßte ich doch auch etwas davon wissen“, und wollte in die Burg zum Könige.
Wie der König den Retter seiner Tochter sah, von dem er dreihundertfünfundsechzig Tage kein Wörtchen mehr gehört hatte, stand er wie versteinert da. Hans konnte an den Mienen des Königs lesen, daß er hier zu spät gekommen sei, und sagte zum Könige, er wolle seine Ansprüche auf die Prinzessin fahren lassen, wenn er ihm viel Geld geben würde.
Der König war über diesen Antrag ganz getröstet und gab ihm soviel Gold, daß es Hans fast nicht fortbringen konnte. Der Meßnersohn kehrte nun in sein Schloß zurück und war der Reichste im ganzen Lande.
Märchen aus Österreich
DER KLEINE SCHNEIDER ...
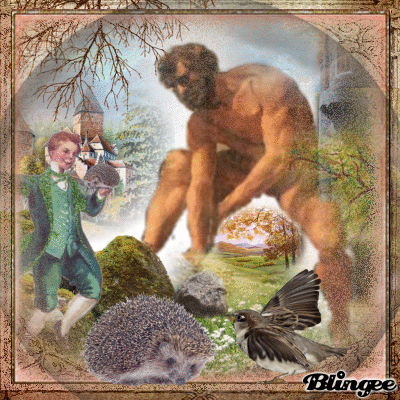
Es war einmal ein armer Taglöhner, der sich mit seiner Frau und seinen drei Kindern nur kümmerlich durchbrachte. Als der älteste Sohn vierzehn Jahre alt war, kam er zu einem Schlosser in die Lehre; ebenso der zweitälteste. Als aber an den jüngsten, Namens Hans, die Reihe kam, war er noch viel zu schwach, um in die Lehre zu gehen und mußte also einstweilen seines Vaters Gänse hüten.
Eines Tages kam ein altes Weib zu den Tagelöhnersleuten, mit welchen sie bekannt war. Dieses Weib stand im Rufe einer Zauberin, und die Mutter fragte sie deshalb, was sie mit dem kleinen Hansl anfangen sollten. Die Alte sagte: »Ei was, laßt ihn einen Schneider werden, das ist ein Handwerk, was einen goldenen Boden hat. Und wißt ihr was, da habt ihr einen kleinen Fingerhut, den gebt dem Hans. So und jetzt behüt euch Gott.«
Mit diesen Worten gab sie der Mutter einen kleinen Fingerhut, welchen diese dem gerade vom Gänsehüten heimkehrenden Hans übergab. Er bedankte sich bei der alten Frau, und diese gab ihm, über den großen Dank erfreut, auch eine Schere und befahl ihm, nie mit einer anderen Schere oder einem anderen Fingerhut zu arbeiten, als mit dem ihrigen.
Schon in der nächsten Woche kam Hans zu einem Schneider im Dorfe. Weil er den bezauberten Fingerhut hatte, so konnte er das Nähen bald besser als es je ein Schneider gekonnt hatte. Jetzt sollte er auch das Zuschneiden lernen; das ging nun mit seiner Schere auch recht gut, und darum ward er von seinem Lehrherrn freigesprochen.
Er kam in die nächste Stadt, wo ihn aber niemand aufnehmen wollte, denn er war so klein wie ein sechsjähriger Knabe. Endlich fand er bei einer Schneiderswitwe Arbeit. Die machte ihn bald wegen seiner Geschicklichkeit zum Werkführer über ihre zehn Gesellen.
Diese wollten schier vor lauter Neid zerplatzen, denn sie waren viel älter und schon lange bei der Witwe im Dienste. Sie sprachen also zu einander: »Wir müssen diesem Gelbschnabel einen Possen spielen, denn das leiden wir nicht, daß der kleine Sterzel unser Altgeselle ist.«
Sie hatten bemerkt, daß Hans nie mit einer anderen Schere als der seinigen schnitt, und sie nahmen sich deshalb vor, diese ihm zu entwenden und selbst zu benutzen. Gedacht, getan. Einer der Gesellen nahm ihm eines Tages die Schere und schnitt damit einen Rock zu. Er spürte bald, wie die Schere von selbst fort und fort zuschnitt und seine Hand nachzog.
Aber o Schrecken! Als er den Rock entfaltete, war es ein Rock für einen Buckligen, und der eine Ärmel war um eine halbe Elle länger als der andere. Fluchend und scheltend warf er die Schere weg und verabredete sich mit seinen Kameraden, den Hans wegen Hexerei zu verklagen. Hans aber witterte das und entfloh.
Als er schon ein paar Tagreisen zurückgelegt hatte, kam er in eine Stadt, in welcher alle Leute in Mehlsäcke gekleidet waren. Er trat unter das Stadttor und wurde von einem Paare solcher in rote Mehlsäcke gekleideter Männer gepackt und in ein Haus vor eine Versammlung von Männern geschleppt, die in schwarze Mehlsäcke gekleidet waren.
Einer der selben schlug mit der Faust auf den Tisch, daß alles krachte und schrie: »In welcher Kleidung kommst du in diese Stadt und wer bist du?« Hans sagte: »Ich bin ein Schneider; und was meine Kleidung betrifft, so ist sie nach der neuesten Mode.«
»Ha Unglücklicher«, schrie der Richter, denn ein solcher war es, »weißt du denn nicht, daß jeder, der diese Stadt betritt, einen Sack anhaben muß und daß du wegen Übertretung dieses Gesetzes 100 Stockstreiche bekommst? Und weißt du nicht, daß jeder Schneider, der diese Stadt betritt, um die Königstochter mit einem Riesen kämpfen muß?«
»Ja wie soll ich denn das wissen«, sagte Hans verblüfft. »Unwissenheit entschuldigt nicht«, entgegnete der Richter, »du mußt mit dem Riesen kämpfen, die Prügel aber werden dir erlassen, denn du wirst ohnehin im Kampfe mit dem Riesen dein Ende finden.«
»Auch gut«, dachte Hans, »wieder etwas erspart.« Jetzt wurde er von zwei Soldaten ins Gefängniß geführt, wo er bis zum nächsten Tag bleiben sollte. Der Gefangenenwärter fühlte Erbarmen mit dem kleinen Schneiderlein und blieb bei ihm die ganze Nacht auf, indem er mit ihm plauderte.
»He«, fragte Hans, »jetzt sagt mir einmal, warum geht ihr denn da in Säcken herum, und warum sind denn die Schneider bei euch so verhaßt? Ich begreife gar nicht, was es für ein Verbrechen ist, das ehrsame Schneiderhandwerk zu betreiben?«
»Nun«, sagte der Gefangenenwärter, »ich will es dir gleich erzählen. Unsere frühere Königin war sehr eitel, und diese Eitelkeit ging so weit, daß sie alle Tage sieben neue Kleider anzog. Obwohl das schrecklich viel Geld kostete, hätte es doch nichts gemacht, wenn nicht der Luxus auf der Königin Tochter übergegangen wäre.
Diese trieb es aber noch viel ärger, als ihre Mutter, denn sie tat den ganzen Tag nichts als Kleider an und ausziehen. Da riß dem Könige die Geduld: er jagte die Königin davon, sperrte die Tochter in einen Turm und ließ sie von einem Riesen bewachen. Dann gab er das Gesetz heraus, daß alle Bewohner Säcke tragen sollten und vertrieb die Schneider als die Urheber seines Unglückes aus seinem Reiche und verbot ihnen, je wieder zu kommen.«
Am anderen Morgen, schon in aller früh ging Hans von Häschern und Soldaten begleitet zum Walde. Als sie so nahe gekommen waren, daß sie den Riesen schnarchen hörten, verließen die Häscher den Hans und sagten ihm, er solle nur gerade fortgehen.
Auf einmal stund das alte Weib, das ihm Fingerhut und Schere gegeben hatte, vor ihm und sagte: »Da hast du einen Igel und einen Vogel, gib acht auf beide, du wirst sie alle zwei noch recht gut brauchen.« Sie sprach es und verschwand.
Hans ging indessen weiter, bis er plötzlich des Riesen Stimme hörte und dessen gräuliche Gestalt hinter einem Baume hervortreten sah. »Du kleiner, elender Knirps, du willst dich mit mir messen? Nun gut, sieh einmal, wer die Kugel weiter schieben kann, ich oder du, hier ist eine Kegelbahn.« Und er nahm eine Kugel aus dem Sacke und schob sie weit, weit fort.
Hans aber ließ seinen Igel laufen, und der ließ nicht eher nach, bis er vor des Riesen Kugel war. Ärgerlich rief er: »Nun ja, das hättest du gewonnen, jetzt komm hieher. Siehst du, dieser Turm da hat 15 Stockwerke, und an das letzte treffe ich.« Er warf aber seinen Stein nur in das 12. Stockwerk. »So nun wirf du auch!«
Hans ließ seinen Vogel auffliegen, und dieser flog weit über den Thurm hinweg. »Das hättest du auch gewonnen, jetzt gilt es nur, wer höher springt«, sagte der Riese und sprang über eine Eiche. »So«, sagte Hans, »jetzt sei so gut und biege mir diese Pappel um, damit ich sie messe.«
Der Riese bog sie um und Hans hielt sich am Gipfel der selben an. »Kannst schon auslassen«, rief er dem Riesen zu, »ich weiß schon wie lang sie ist.« Der Riese ließ los und Hans flog von der Pappel emporgeschnellt über einige Bäume, die höher waren als die Eiche, über die der Riese gesprungen war.
Da rief der Riese: »Du hast dir das Leben gerettet und noch dazu die Königstochter gewonnen!« Dann hob er Hansen in die Höhe, so daß er im dritten Stockwerke durch ein Fenster die Königstochter erblicken konnte. Er spazierte auch gleich durch das Fenster hinein.
Alsdann gingen beide, Hans und die Königstochter, zum Könige und erzählten ihm, daß der Riese überwältigt worden sei. Der König trat an Hans das Königreich ab und Hans lebte mit seiner Frau noch lange Jahre.
Aber was hat der neue König mit den Wunderdingen getan? Mit der Schere hat er aus bösen Menschen gute geschnitten und mit dem Fingerhut hat er seinen Soldaten die abgehauenen Köpfe, Arme und Füße wieder angenäht, und alle waren dann wieder so frisch und gesund wie vorher.
Und wer es nicht glauben will, kann es bleiben lassen.
Theodor Vernaleken
DER VERZAUBERTE GRAFENSOHN ...
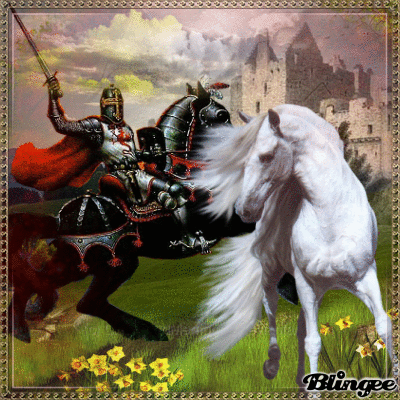
Es war einmal ein sehr reicher Graf. Er hatte viele Wälder und Felder, Burgen und Höfe und in seinem Schloßturme lagen unermeßliche Schätze aufgespeichert. Allein ein altes Sprichwort sagt: »Je mehr man hat, je mehr man will«, und dies ging auch am Grafen in Erfüllung.
In seiner Nähe wohnte ein anderer reicher Graf, der auch über große Besitzungen gebot und sich an Reichtum mit dem ersteren messen konnte. Dies wurmte den geizigen, hoffärtigen Grafen, daß er nicht allein über die ganze Gegend wie ein Fürst gebieten mochte, und Tag und Nacht sann er nach, seinen Nachbar zu verderben und dessen Besitz sich anzueignen.
Das schien ihm aber schwer, denn der edle Graf war beliebt und mächtig und hätte im offenen Kampfe vielleicht den Sieg davongetragen. Aufs Ungewisse wollte sich aber der Geizige nicht einlassen. Da war guter Rat teuer und er sperrte sich ein und brütete über schwarzen Plänen - und keiner gefiel ihm.
Als er sich nie seinem Ziele näher sah, kam ihm der Gedanke, in den Wald hinauszugehen und den Hexenmeister zu befragen, der in der Wildnis hauste. Er tat es, schwang sich auf seinen Rappen und sprengte mutterseelenallein hinaus in den dunkeln Forst und suchte dort den Zauberer auf.
Dieser gab ihm gegen eine große Belohnung eine Springwurzel, die Tür und Tor öffnete, und einen Zauberstab. Wen man damit berührte, der wurde in ein Pferd verwandelt. Nachdem der Graf diese Dinge und dazu Weise und Lehre erhalten hatte, ritt er vergnügt auf sein Schloß zurück. Hier ließ er seine vertrauten Leute sich rüsten, und als die dunkle Nacht eingebrochen war, zog er still und heimlich vor die Burg des anderen Grafen.
Mit der Springwurzel öffnete er das Tor - und den Wächter tötete man, ehe er ein Zeichen geben konnte. So machte man es auch mit den Dienern. Der geizige Graf selbst ging ins Schlafzimmer und erstach den guten Grafen; seinen einzigen Sohn aber, der süß im Bette schlummerte, berührte er mit der Zauberrute - und augenblicklich war er in einen Schimmel verwandelt.
Dann ließ der Mörder zwei treue Diener zurück, denen er Befehl gab, das Roß und die Burg zu hüten, und zog mit den übrigen Begleitern ab, als ob gar nichts geschehen wäre. Still ritten sie heim und niemand in der weiten Umgegend ahnte etwas von dieser nächtlichen Untat.
Der Graf sah nun seine Wünsche erfüllt und lachte über sein Verbrechen, denn sein Herz war kalt und hart wie Stein und sein Gewissen lange schon verschwunden. Als aber die folgende Nacht anbrach und die zwei Diener in der getäfelten Knappenstube saßen, erhob sich im geraubten Schlosse ein Höllenlärm.
Rosse wieherten im Hofe und in den Ställen, auf den Stiegen schienen sporenklirrende Ritter auf und abzuschreiten, die Türen flogen auf, die Fenster klirrten und selbst Stühle und Bänke bewegten sich. Die Diener, die in mancher Schlacht dem Tode mutig ins Auge geschaut hatten, zitterten wie Espenlaub und verbargen sich in einer Ecke.
Allein der Lärm wurde immer toller und endlich kamen die gemordeten Knechte und Knappen in die Stube, setzten sich an die Tische und brachten den zwei Hütern Angst und Not, bis der Morgen graute. Da verschwand der Spuk und alles war wieder stille und ruhig wie in einer Totengruft.
In der folgenden Nacht erhub sich wieder der alte Lärm und die zwei Diener beschlossen, eher sich töten zu lassen, als noch eine solche Schreckensnacht im Schlosse zu durchleben. Sie fütterten den Schimmel, schlossen Tür und Tor und gingen dann zu ihrer Burg und erzählten dem Grafen, was geschehen sei. Sie wollten um keinen Preis mehr im Geisterschlosse übernachten, setzten sie bei.
Da lachte er ob ihrer Feigheit und schickte zwei andere Wächter hin. Allein auch diesen erging es nicht besser und sie erklärten schon am folgenden Tage, vom unheimlichen Schlosse abziehen zu wollen. Als die anderen Diener dies hörten, fühlten sie keine Lust, das Abenteuer zu versuchen und blieben selbst gegen die reichen Versprechungen ihres Gebieters taub.
Da rief der Graf seinen alten Diener zu sich und sprach: »Martl, du hattest immer das Herz auf dem rechten Flecke und noch nie hast du Furcht gekannt. Übernimm du die Burghut und ich werde dich halten wie einen Sohn. Täglich sollst du haben an Speise und Trank, was dein Herz begehrt, und deine Dienste will ich überdies königlich belohnen.«
Martl kraulte sich unentschlossen hinter den Ohren. Als aber der Graf nicht nachgab, fügte er sich seinem Begehren und begab sich dann auf das unheimliche Schloß, nachdem er noch den Befehl erhalten hatte, dem Schimmel ja nicht mehr als eine Hand voll Heu für den Tag zu geben.
Der alte Diener lebte nun allein auf der Burg. Bei Tage schlief er und bei Nacht saß er auf seiner Stube, denn er hätte des Lärmens wegen doch kein Auge schließen können. Je am zweiten Tage kam aber der Graf, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Lange Zeit befolgte Martl den Befehl seines Herrn genau und gab dem Schimmel nur eine Hand voll Heu.
Als aber das schöne Tier von Tag zu Tag mehr abmagerte, so daß man seine Rippen zählen konnte, tat es dem Alten leid um das edle Roß und er dachte oft: dürfte ich dir mehr Futter geben! Allein dann kam ihm wieder das Gebot seines strengen Grafen in den Sinn und er ließ es bei dem Alten bewenden.
Da wurde das Pferd immer schwächer, daß es kaum stehen konnte. Dies ging dem Diener zu Herzen, dem die Sache lang schon seltsam vorgekommen war, und er meinte: »Was wird es machen, wenn ich dem Schimmel einmal genug zu fressen gebe?« Er tat es und gab dem Tiere Heu und Hafer.
Nachdem es sich gesättigt hatte, fing es an freudig zu wiehern und sprach: »Gott vergelt es dir! Wenn du aber glücklich für immer sein willst, so gib mir noch einmal ganz genug zu fressen. Dann schwing dich auf meinen Rücken und reite um den See herum, der drunten am Schloßhügel liegt, bis wir wieder zur Stelle kommen, von der wir ausgefahren sind.
Der Graf wird uns zwar auf einem schwarzen Gaule, der ausgreift wie der Teufel, verfolgen, das schadet aber nicht; denn wenn du merkst, daß er uns nahe ist, und wir nicht entrinnen können, dann schlag mit der Peitsche, die droben im Rittersaale hängt, auf den Boden und wir sind gerettet.«
Dem Martl kam der Fall, daß ein Roß reden könne, gar wunderbar vor und er sagte, wenn alles wahr wäre, wollte er folgen. Da versetzte der Schimmel: »An meiner Rede ist kein Wort erlogen. Das schwöre ich dir bei Gott und allen Heiligen« und dabei hob er den rechten Vorderfuß auf, als ob er schwören wolle.
»Ich will mich besinnen,« sprach der Diener. »Aber verrate kein Sterbenswörtchen davon, was ich dir gesagt habe, einer lebenden Seele, sonst sind wir beide verloren,« flehte das Roß. Martl ging aus dem Stalle und dachte hin und her, was er tun solle. »Ein redendes Roß, das ist mir nie begegnet,« sprach er halblaut vor sich hin; »das ist kurios und warum bekümmert sich der Graf so um diesen Schimmel? Doch will ich in den Rittersaal gehen und schauen, ob dort eine Peitsche ist. Ich war schon oft droben und habe nie eine bemerkt.«
Er stieg die Treppe hinauf, trat in den großen Saal und wirklich fand er eine schöne Peitsche mit goldenem Griffe unter einem alten Porträt hängen. »Bei Gott, das geht nicht mit rechten Dingen zu!« rief Martl. »Diese Peitsche ist erst heute hierhergekommen und niemand außer mir war im Schlosse.«
Je länger er nachsann, desto wunderbarer schien ihm die Sache. Ihn überkam eine gewaltige Neugierde und bald entschloß er sich, den Wunsch des Schimmels zu erfüllen. Am folgenden Morgen gab er dem Rosse vollauf zu fressen und dann schwang er sich auf dessen Rücken und sprengte zum Tore hinaus gegen den See hinunter.
Allein kaum war er dort angelangt, als der Graf auf einem pechschwarzen Rosse, aus dessen Nüstern Feuer stob, daher galoppiert kam. Der Schimmel griff so weit aus, daß er bald von Schweiß troff. Jedoch bald war der Rappe hart auf seinen Fersen und schon schien alles verloren, da schlug Martl mit der Peitsche auf den Boden, und sogleich sprang ein Hügel vor dem Grafen empor.
Der Rappe hatte bald denselben umlaufen und setzte mit neuem Feuer dem flüchtigen Schimmel nach und kam näher und näher. Nun benutzte Martl wieder die Peitsche, und ein Bühl erhob sich. Auf diese Weise kam endlich der Schimmel glücklich an den Ausgangspunkt an und in demselben Augenblicke fiel die Haut von ihm, und ein bildschöner junger Ritter stund vor Martl, ergriff dessen Hand, drückte sie und sprach: »Gott lohne es dir, daß du mich gerettet hast. Ich werde es dir zeitlebens vergelten.«
Kaum hatte er dies gesprochen, tat es einen furchtbaren Knall. Sie blickten sich um und sahen, wie Graf und Rappe in den Boden versanken. Denn das schwarze Roß war der leibhaftige Teufel gewesen und hatte den Geizhals nun geholt. Der junge Graf zog aber als Herr und Gebieter in seine Burg ein und verlebte dort fortan ruhige, glückliche Tage.
Den Martl behielt er lange als seinen vertrauten Diener an seiner Seite und schenkte ihm überdies einen großen, reichen Bauernhof, auf dem dieser später als eigener Herr schaltete und waltete.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Meran
DER TOTE SCHULDNER ...
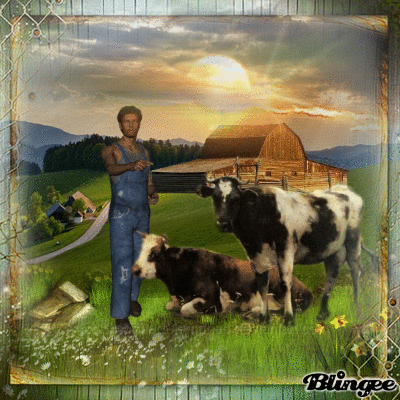
Es war einmal eine Mutter und ihr Sohn, die lebten friedlich und fromm, mußten aber ihrer Armut wegen mit klarem Tranke und schmaler Kost vorlieb nehmen. Sie hatten zwei Kühlein im Stalle und oft ging es ihnen so nahe, daß sie fast die Tiere verkaufen mußten.
Da hatten sie wieder einmal recht schlechte Zeiten, und die Mutter sagte zum Sohne: »Geh, verkauf doch eine Kuh! Wenn wir ein bischen Geld haben, können wir uns doch wieder einmal rühren und wenn wir gescheit damit umgehen, schaut vielleicht doch etwas heraus.«
Der Sohn tat, wie sie sagte, und fuhr am anderen Tage mit der Kuh auf den Markt. Er verkaufte sie leicht und bekam schönes Geld dafür, viel mehr als er gehofft hatte. Auf dem Heimwege kam er durch einen lutherischen Ort, da sah er auf einer Mauer einen Toten liegen und neben dem Toten einen Stecken.
Jedermann, der vorbeiging, nahm den Stecken und schlug damit auf den Toten. Das Ding kam dem Burschen sonderbar vor und er fragte einen der Vorbeigehenden, was denn der Tote und der Stecken und die Prügel zu bedeuten haben?
»Ja,« hieß es, »der Tote ist ein Katholischer, der hat Schulden zurückgelassen und muß nun so lange auf der Mauer liegen und sich prügeln lassen, bis er alles bezahlt hat.« »Wie groß sind denn seine Schulden?« fragte mitleidig der Jüngling. Sie sagten es ihm und er machte ihnen den Antrag, die Schuld zu bezahlen, wenn sie ihm den Leichnam abtreten wollten. Sie waren gern bereit dazu und er zahlte ihnen das Geld auf den Heller aus.
Dann ließ er den Toten auf geweihtem Erdreich begraben und ihm alles halten, wie es ein Katholischer nach seinem Tode zu haben wünscht. Aber das Ding alles miteinander kostete ihm so viel, daß er von dem gelösten Gelde keinen Kreuzer mehr übrig hatte und wie ein Schneider heimgehen mußte.
Als er nach Hause kam, fragte ihn die Mutter: »Wie stehts, hast du die Kuh gut verkauft?« »O ja, ich bin sie leicht ahnig geworden und habe mehr dafür gekriegt, als wir gemeint haben.« »Wo hast du dann das Geld?« »Das Geld habe ich schon verbraucht, um einen Toten loszukaufen, den die Lutherischen seiner Schulden wegen geprügelt haben.«
»Ja, mein Sohn, das ist freilich ein gutes Werk, aber was sollen wir jetzt anfangen, wenn wir kein Geld haben?« »Seid nur nicht verzagt, Mutter! Wir haben ja noch eine Kuh im Stalle, die auch was eintragen kann. Es ist ja nächstens Markt, dort will ich das Kühlein hinführen und gut anzubringen suchen.«
»Es ist wohl hart, gar keine Kuh mehr im Stalle zu haben, aber wenn es nicht anders sein kann, verkauf halt die zweite auch noch und schau, daß du einen ordentlichen Kreuzer dafür lösest!«
In etlichen Tagen fuhr der Sohn auf den Markt und brachte die Kuh ohne Anstand an Mann. Er bekam weit mehr dafür, als er gehofft hatte, und machte sich nun wohlgemut auf den Heimweg. Er war nicht lange gegangen, da sah er einen Haufen Meerräuber daher kommen, die schleppten ein nacktes Weibsbild mit sich, dem sie nichts übrig gelassen hatten, als ein Tüchel um den Kopf.
Den Burschen faßte ein großes Erbarmen und als die Räuber in der Nähe waren, rief er: »Was tut ihr mit dem Weibsbild?« »Verkaufen,« schrien die Seeräuber. Da brachte es der Bursche nicht mehr über sich, die Jungfrau den wilden Menschen zu überlassen. Er fragte, was sie denn koste, und die Summe, welche die Räuber verlangten, kam gerade dem Gelde gleich, das er für seine Kuh gelöst hatte.
Er zahlte das Verlangte, hieß die Seeräuber wohlleben und reichte der Jungfrau seinen Mantel. Diese dankte ihm über die Maßen, bekleidete sich und so gingen sie der Heimat des Burschen zu. Als sie in die Stube traten, kam die Mutter und fragte den Sohn, ob er das Kühlein gut verkauft habe.
»O ja« sagte der Sohn, »ich habe mehr gekriegt, als wir gemeint haben.« »Wo hast du dann das Geld?« Auf diese Frage konnte der Sohn freilich nicht viel antworten, denn er hatte keinen Vierer mehr in der Tasche und mußte nun die ganze Geschichte von den Seeräubern und von dem Kauf des Weibsbildes erzählen.
Als die Mutter das alles hörte, wußte sie sich nimmer zu helfen und fing an zu lamentieren: »Geh weiter, was fällt dir alles ein? Keine Kuh mehr im Stall, kein Geld mehr im Beutel und dafür noch das Weibsbild im Haus, das keinen Schlampen Gewand mitgebracht hat, geschweige sonst etwas.«
So ging es eine Zeitlang fort, aber als sie ein bißchen nachgab, fiel ihr die Jungfrau ins Wort und sagte, sie könne schön arbeiten und hoffe, so leicht einige Kreuzer ins Haus zu bringen. Auch bat sie recht inständig, man solle sie nur nicht verstoßen, weil sie nicht wüßte, wohin gehen, wenn sie wieder in die Welt hinausgejagt würde.
Die Mutter wurde etwas sanfter und ließ die Jungfrau in dem Hause bleiben. Sie ward ihr auch von Tag zu Tag mehr zugetan. Denn sie war sehr brav und konnte so schön sticken, daß die Leute nach und nach von allen Seiten herbei kamen und ihr Arbeit brachten. So kam wieder Geld in das Haus, und was der Sohn ausgegeben hatte, wurde reichlich hereingebracht.
Nach einiger Zeit nahm der Sohn die Jungfrau zur Ehe und es war nun Freude und Wohlstand im Hause. Da hub die Jungfrau einmal an in aller Heimlichkeit ein Tüchel zu sticken und stickte lange Zeit daran, ohne daß der Mann oder die Mutter etwas davon zu sehen bekam.
Als die Stickerei zu Ende war, sagte sie einmal zu ihrem Manne: »Lieber Mann, wir haben lang genug gelitten miteinander und strenge Tage gehabt, wir wollen einmal ausruhen und Kirchfahrten gehen.« Der Mann hatte nichts dagegen und in wenigen Tagen machte er sich mit ihr auf den Weg.
Während der Wanderschaft sagte sie einmal: »Lieber Mann, ich weiß einen Platz, wo der König tagtäglich vorbeifährt, dort wollen wir uns aufstellen und sehen, ob uns nicht ein Goldstück zuteil wird.« Der Mann war mit diesem Antrag einverstanden und sie stellten sich an den Ort hin, wo der König vorbeifahren sollte.
Sie warteten nicht lange, da kam eine königliche Kutsche daher, und die Frau sagte: »Der ist's, der ist's!« Zugleich zog sie das Tüchlein heraus, an dem sie so lange gearbeitet hatte, und darauf waren die Namen des Königs und der ganzen königlichen Verwandtschaft gestickt.
Als die Kutsche ganz nahe kam, hielt sie das Tüchlein ausgebreitet vor sich und rief: »Vater, Vater, wartet ein bißchen.« Der König wurde aufmerksam, ließ anhalten und las seinen eigenen und seiner Verwandten Namen auf dem dar gehaltenen Tüchlein. Er stieg aus, grüßte das Weibsbild und schaute es verwundert an.
Auf einmal erkannte er seine Tochter, fiel ihr um den Hals und konnte nicht zu Worte kommen vor lauter Freude. Der Mann machte dabei große Augen und fragte, was das zu bedeuten habe. Da erzählte die Frau, daß die Meerräuber sie dem König, ihrem Vater, gestohlen hätten und ihr Gewand in die See geworfen. Dann stellte sie dem König ihren Retter vor und sagte ihm, daß dieser seinen letzten Kreuzer für sie hingegeben und daß sie ihn zum Danke dafür geheiratet habe.
Dem König rannen gerade die Tränen von den Augen, während er das alles hörte, er hieß die zwei zu sich in den Wagen sitzen und sie fuhren nun miteinander in den Palast. Was da für eine Freude war und wie die Verwandten zusammenliefen, das kann man sich wohl vorstellen.
Als die ganze Familie bei einander war, hub die Königstochter wieder an zu sprechen und sagte: »Wir sind nun alle beisammen, Mutter und Kind, Vettern und Basen, aber eines fehlt noch von unserer Verwandtschaft und das soll auch da sein.« Der König fragte, wer das wäre, und die Tochter antwortete ihm: »Das ist die Mutter meines Gemahls, die war immer gut gegen mich und hat mich in ihr Haus aufgenommen in meinen schlimmsten Tagen. Laß sie hierher kommen und behalte sie am Hofe, damit ihr ersetzt werde, was sie an mir getan hat!«
Der König hatte eine große Freude hierüber und sagte zu seiner Tochter: »Laß also gleich einspannen, fahrt hin und bringt sie hierher!« Bevor sie abreisten versprach er auch noch dem Schwiegersohn, daß er einstweilen das halbe und nach seinem Tode das ganze Königreich bekommen solle. Sie fuhren nun mit zwei königlichen Dienern weg, um die Mutter abzuholen.
Die Diener wußten, daß die Straße an einem Meere vorbeiging, und weil sie dem Bauernburschen um sein Glück neidig waren, so redeten sie insgeheim ab, daß sie den Wagen umwerfen und den Gemahl der Prinzessin ins Wasser hinaus stoßen wollten. Gesagt, getan.
Als der Wagen am Meere vorbeifuhr, fiel er auf einmal um, und der junge König bekam einen Stoß, daß er mitten im Wasser lag. Die Königin fing nun freilich an zu jammern und bat ihre zwei Begleiter, daß sie ihm heraus helfen sollten, bevor es zu spät sei. Die zwei aber lachten sie aus, stellten den Wagen zurecht und nahmen ihr einen Eid ab, daß sie niemand sagen sollte, daß ihr Mann durch Bosheit zu Grunde gegangen sei.
Sie kamen nun zur alten Mutter und da machten die zwei Diener sogleich ein großes Wesen daraus, was sich für Unglück ereignet habe, daß der Wagen umgefallen und der junge König ins Wasser gestürzt sei. Die alte Bäurin machte große Augen und wußte sich weder zu raten noch zu helfen, sowohl bei der Nachricht vom Glücke ihres Sohnes, als bei der Erzählung von seinem Unglücke. Sie mußte nun mit an den Hof fahren und wurde dort mit aller Freude empfangen.
Dem alten König logen die zwei Diener wieder ein Lustiges vor und die junge Königin durfte ihnen nicht widersprechen des gegebenen Eides wegen. Da hätte nun Freude sein sollen am Hofe, aber da war lauter Jammer, denn wer hätte daran gedacht, daß der junge kerngesunde Mann der Prinzessin so bald zugrunde gehen sollte?
Aber daß er zugrunde gegangen sei, das war erlogen, denn er hatte sich durch Schwimmen auf eine Insel gerettet. Auf der Insel war ein Adlernest und der alte Adler brachte seinen Jungen tagtäglich Fleisch zur Nahrung. Von diesem Fleisch suchte er immer etwas zu bekommen und fristete sich auf diese Weise sein Leben.
Inzwischen hatte man am Hofe die ärgste Trauer vergessen und es hieß, die Königstochter sollte sich einen neuen Gemahl wählen. Sie gab mit der Zeit dem Wunsch der Ihrigen nach und wählte sich einen braven Mann. Der Hochzeitstag erschien und abends sollte die Vermählung gefeiert werden.
Während am Hofe alles mit Vorbereitung zur Festlichkeit beschäftigt war, saß der junge König auf seiner Insel und schaute hinaus in das weite Meer. Auf einmal sah er etwas daher schwimmen und als es immer näher und näher kam, erkannte er, daß es Menschengestalt habe.
Kaum war der Schwimmende ans Ufer gelangt, so winkte er ihm und sagte: »Komm mit!« Der König wollte davon nichts wissen und fragte: »Ja, wie soll ich mit dir kommen? Ich habe beim Hereinschwimmen gelitten genug und bin völlig nur durch ein Wunder gerettet worden. Soll ich mich noch einmal in diese Gefahr begeben?«
Da machte ihm der Schwimmer Mut und sagte: »Sei nur nicht verzagt und vertraue auf mich, ich will dich schon herausbringen. Weißt du aber auch, wer ich bin?« »Nein«, antwortete der König. »Ich bin jener Tote, den du losgekauft hast, ich habe bis zum heutigen Tag im Fegefeuer bleiben müssen, zum Danke für deine Wohltat will ich dir jetzt heraushelfen, damit du zur rechten Zeit die Deinigen wiederfindest.«
Jetzt gewann der König Vertrauen und glaubte auch den Schwimmer als jenen Toten zu erkennen. Er wagte es, sprang zu ihm in das Meer und wurde glücklich ans Ufer gebracht. Als sie auf trockenem Boden waren, sagte der Tote: »Jetzt schau, daß du heimkommst. Denn deine Gemahlin soll heute mit einem anderen Hochzeit haben und abends wird die Vermählung sein. Schau, daß du zu rechter Zeit hinkommst, die Königin wird dich schon erkennen.«
Da nahm der König vom Toten Abschied und eilte nach Hause. Als er am Hof ankam, hielten ihn die Schildwachen zurück. Sie sagten, es dürfe kein Mensch hinein oder heraus; und er, weil er so zerlumpt und abgemagert ausschaue, solle nur gar nicht daran denken. Er sagte aber in einem fort, er müsse bei der Königin sein und brachte sie endlich so weit, daß sie eine Botschaft hineinschickten.
Die Königin schickte ein Geld herab, und dieses boten ihm die Wachen mit dem Bedeuten, daß er jetzt zufrieden sein und fortgehen solle. Er war aber nicht zufrieden und wiederholte sein altes Lied, daß er bei der Königin selber sein müsse. Endlich schickten die Schildwachen noch einmal hinauf und sie kam herunter.
Er hatte eine übergroße Freude, als er seine Gemahlin wiedersah und gab sich ihr sogleich zu erkennen. Sie war freilich wie vom Himmel gefallen, als ihr tot geglaubter Gemahl auf einmal vor ihr stand, zweifelte aber keinen Augenblick, daß er der rechte sei. Nun gingen sie zum Könige und erzählten ihm, daß es mit der Hochzeit nichts mehr sei, denn der frühere Gemahl sei wiedergekommen.
Was für eine Freude jetzt im königlichen Schlosse war, das magst du dir selber einbilden, denn zu beschreiben ist es gar nicht. Was tat aber der Bräutigam, den die Königstochter am selbigen Abend hätte heiraten sollen? Er mußte halt länger ledig bleiben, bekam aber zur Entschädigung einen Teil des Königreiches und wird später wohl eine andere Frau genommen haben.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Meran
LAURINS ROSENGARTEN ...

Ferdinand Leeke, Zwergenkönig Laurin am Hof des Dietrich von Bern
In uralter Zeit, da Riesen und Zwerge die Alpentäler bevölkerten, herrschte im Innern des Berges, den wir heute Rosengarten nennen, Zwergkönig Laurin über ein unterirdisches Reich. Des kleinen Fürsten Rüstung blinkte von hellem Golde, seinen Helm zierte eine funkelnde, edelsteinbekränzte Krone, er ritt auf zierlichem, weißen Zelter, der nicht größer war als ein Reh, und trug, wenn er zum Kampfe ritt, einen Speer, an dem ein seidenes, Wappen geschmücktes Fähnlein flatterte.
Laurin besaß aber auch geheimnisvolle Kräfte; seine Tarnkappe machte ihn unsichtbar, und ein Juwelen geschmückter Gürtel gab dem Zwergenkönig die Stärke von zwölf Männern. Laurins Stolz war ein wunderschöner Garten vor dem Tore seiner Felsenburg, in welchem das ganze Jahr hindurch unzählige prachtvolle Rosen blühten und ihrem Duft ausströmten.
Dieser Rosengarten war mit goldenen Fäden eingezäumt und nur durch ein enges goldenes Pförtlein zu betreten. Streng wachte der kleine König über die Unversehrtheit seines Gartens; wer mutwillig in das Gehege einbrach und auch nur eine der Rosen pflückte, verlor zur Strafe die linke Hand und den rechten Fuß.
Auf einer seiner geheimen Fahrten, die er, in der Tarnkappe unsichtbar, durch die Lande unternahm, erblickte Laurin einst auf einem Blumenanger vor der Burg zu Steier, Kühnhilde, des Schlossherrn Tochter, in ihrer jugendlichen Schönheit. Das Herz des Zwergenprinzen entbrannte in Liebe zu dem holden Menschenkinde.
Laurin schlich sich an Kühnhilde heran, nahm sie flugs unter seine Tarnkappe und entführte die nun Unsichtbare durch die Luft in sein unterirdisches Schloß im Rosengarten. Auf der Steierburg herrschten Schrecken und Trauer, denn niemand wußte, wohin die schöne Kühnhilde plötzlich entschwunden war.
Endlich machte sich der junge Ditleib von Steier auf, um die Schwester zu suchen, und kam auf abenteuerliche Fahrt auch an den Sitz des Gotenkönigs Dietrich von Bern. Der hörte im Kreise seiner Freunde, des alten Hildebrant, seines Waffenmeisters, dessen Neffe Wolfhart und des Recken Wittich, die Erzählung Ditleibs und beriet mit seinen Mannen, was da zu tun sei.
Da meinte Hildebrant, Kühnhildes Räuber könne nur der Zwergkönig Laurin sein, der allein die Tarnkappe besitze und sich damit den menschlichen Blicken entziehe, den müßte man in seinem Felsenschloß aufsuchen. Dietrich, der trotz seines Waffenruhmes noch nie gegen Zwerge gekämpft hatte, war schnell zur Fahrt bereit und lud die Freunde ein, ihm ins Rosengartenland zu folgen.
Tag und Nacht ritten die Berner und seine Getreuen nordwärts, bis sie am Zusammenfluß von Etsch und Eisack zum ersten Mal aus dem Hintergrund der Täler den Rosengarten leuchten sahen. Begeisterung und Kampfeslust beflügelten die Recken, die nach langer Fahrt endlich an dem goldenen Pförtlein des Gartens hielten.
Während Dietrich in Staunen über die Pracht der Rosen versunken war, zerhieb der ungeduldige Wittich mit einem Schlag seines Schwertes die goldenen Fäden, trat in rohem Ungestüm das goldene Türlein in den Boden, köpfte die herrlichen Rosen und zerstampfte blindwütig den Gartengrund.
Da sprengte auch schon auf weißem Rößlein König Laurin heran, in Gold gewappnet und gerüstet bebend vor Zorn über den Frevel, der an seinen Rosen geschehen. Mit zürnenden Worten warf er den beiden Helden die Untat vor und forderte von ihnen als Vergeltung Hand und Fuß.
Dietrich wies solche grausamen Verlangen ab, bot aber Laurin reiche Gold – und Silberspende, um seinen Zorn zu besänftigen. Doch der Zwerg bestand auf seinem Pfand. Nun griff Wittich trotz der Warnung Dietrichs zu den Waffen; er führte einen gewaltigen Schwerthieb gegen Laurin, verfehlte aber sein Ziel und wurde selbst vom ersten Speerstoß des kleinen Königs aus dem Sattel geworfen.
Schon stürzte sich Laurin auf seinen Gegner, um ihm Hand und Fuß zu nehmen, da fiel ihm Dietrich in den Arm, der solche Schmach seines Freundes nicht duldete. Jetzt wandte sich der streitbare Laurin gegen den Gotenkönig, und nun hob ein heißer, ungleicher Kampf an.
Denn plötzlich wurde Laurin unsichtbar; der Zwerg hatte sich die Tarnkappe über den Helm gestülpt, daher trafen Dietrichs Schwertstreiche nurmehr die leere Luft. Erbittert warf der Berner seine Waffe zu Boden und begann mit dem unsichtbaren Gegner zu ringen. Schon ermattete der Held, da erfaßte seine Hand ganz ungefähr die Tarnkappe Laurins, riß sie ab, und nun stand der Kleine wieder sichtbar vor Dietrich.
Im gleichen Augenblick packte der Berner den Zwerg um die Mitte, schwang ihn am Zaubergürtel in die Luft und schmetterte Laurin zu Boden, so daß der Gürtel zerbrach und in Dietrichs Händen blieb. Nun, da seine übernatürlichen Kräfte von ihm gewichen, lag Laurin kraftlos am Boden und flehte seinen Bezwinger um Schonung an.
Doch der kampfesheiße Dietrich hätte den Zwergenkönig getötet, wenn nicht Ditleib, der die geliebte Schwester ohne den Zwerg nie zu befreien erhoffen durfte, den Berner um Gnade für Laurin gebeten hätte.
Noch aber war Dietrichs Kampfeslust nicht erloschen; unmutsvoll wandte er sich gegen Ditleib, und schon kreuzten die beiden Recken ihre Klingen, als Hildebrant, Wolfhart und Wittich die Kämpfenden trennten und zur Eintracht mahnten. Als nun auch Laurin seine kleinen Hände den siegreichen Gegnern zur Versöhnung reichte und sie zum Besuch seines Königschlosses einluden, herrschten nach heißem Streit wieder Frieden im Rosengarten.
Unter der Führung des Zwergenkönigs traten die Recken durch eine Felsenpforte ein in das wunderbare Reich Laurins. Herrlich prangte im Innern des Berges der Thronsaal, aus Marmor, Gold und edlen Steinen erbaut. Laurins Gefolge, zierlich gewappnete Zwergenritter und winzige Edelfrauen, begrüßten die Berner Helden nach höflicher Sitte. Und dann trat aus goldener Tür Kühnhilde hervor, prächtig geschmückt als Braut des Zwergenkönigs.
Als die Maid Ditleib unter den Gästen erblickte, flog ein Leuchten über ihre Züge, sie umarmte den geliebten Bruder und gestand ihm unter Tränen ihr Leid. Wohl werde sie im Zwergenreich als Königin geehrt, Laurin gewähre ihr jeden Wunsch, sie aber könne des kleinen Fürsten Liebe nie erwidern und sei daher trotz aller Pracht und Herrlichkeit im tiefsten Herzen glücklos.
Leise versprach Ditleib der teuren Schwester die Befreiung, doch gebot er ihr vorerst strengstes Stillschweigen. Laurin lud nun seine Gäste zu Tisch, hieß sie die schweren Rüstungen ablegen und als Ersatz kostbare Gewänder anziehen.
Arglos tafelten die Helden und ahnten nicht, daß der tückische Zwerg ihnen betäubende Säfte in den Trank gemischt hatte. Einer nach dem anderen, zuletzt auch Dietrich sanken von der Kraft des Weines überwältigt, zur Erde. Laurin ließ nun triumphierend die wehrlosen Helden fesseln und in einen Kerker werfen, ihre Waffen verwahrte er in einem abgelegenen Gemach.
Diese karge Tat berichtete ein treuer Zwergendiener heimlich Kühnhilde. Sogleich entschloß sie sich, den Bruder und die Freunde aus schmachvoller Haft zu retten. Kühnhilde eilte zum Kerker, öffnete sein verriegeltes Tor und löste zunächst die Fesseln Ditleibs. Inzwischen war auch Dietrich aus seiner Betäubung erwacht und fühlte sich, zum ersten Male in seinem Leben, in Banden.
Da schlug der Zorn des Berner in hellen Flammen aus seinem Munde, daß die ehernen Fesseln an Händen und Füßen schmolzen. Ditleib hatte inzwischen mit Kühnhildes Hilfe die Waffen der Recken herbei getragen, und nun umgürtete Dietrich sich und seine Freunde, um an dem verbrecherischen Zwergvolk blutige Rache zu nehmen.
Das Geklirr der Waffen weckte nun auch Laurin, der alsbald mit schmetterndem Hornstoß die Kriegsscharen seiner Zwerge herbei rief. Es begann ein furchtbarer Kampf der Berner Helden gegen den Zwergenkönig und die Seinen. Tausende von abgefallenen Zwergen deckten den Boden der Halle, aber auch Dietrich und seine Waffengefährten bluteten aus vielen Wunden.
Als sich die Scharen immer mehr lichteten, ließ Laurin fünf Riesen aus den Wäldern am Fuße des Rosengartens aufbieten. Aber auch dies half nichts mehr, denn die Berner Helden töteten in heißem Kampfe auch die Riesen. Die Entscheidung fiel jedoch erst, als es Dietrich endlich gelang, sich Laurins zu bemächtigen und ihn gefangen zu nehmen. Nun war die Herrlichkeit für immer zu Ende.
All seiner Macht und seiner Zauberkräfte beraubt, mußte Laurin seinen Verrat schwer büßen. In Ketten wurde er nebst vielen Wagen voll Gold und Silber von den Siegern nach Bern geführt und mußte dort am Hofe Dietrichs schmachtvoll dienen.
Kühnhilde aber trat befreit aus dem Berge in die Helle des Sonnenlandes und ritt beglückt an Ditleib Seite an Seite nach Steier. Seither ist Laurins Rosengarten verwandelt; die Glut der Rosen erlosch, ihr Duft verwehte, und nur riesige, nackte Felsentürme ragen zum Himmel.
Wo einst der herrliche Garten geblüht, leuchtet heute noch am Fuße der Laurinswand das „Gartl“, ein heller Schuttfleck, der in einen kleinen See mündet, und von dem der Schnee oft nicht ganz schmilzt. Zur Abendzeit glüht der ganze Berg auf im Widerschein der sinkenden Sonne und spiegelt in seinem Leuchten die Sage von König Laurin und seinem Rosengarten.
Südtirol
CISTL IM KÖRBL ...
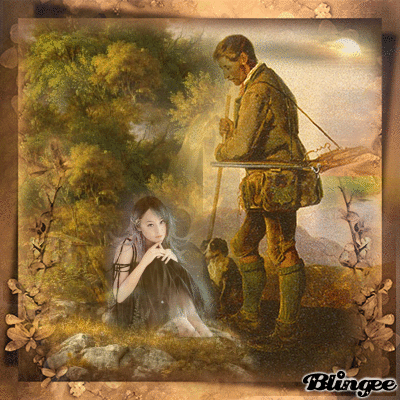
Es war einmal ein armes, armes Mädchen, dem waren seine Eltern gestorben und hatten ihm nichts hinterlassen, als die Lumpen, die es am Leibe trug. Das Mädchen mußte aus der väterlichen Hütte fort, - denn die wurde verkauft, um die alten Gläubiger zu befriedigen, - und wußte sich weder ein noch aus. Weinend ging es fort in den dunklen Wald hinein, indem es früher so oft Himbeeren und Schwämme gelesen hatte, und dachte, wenn die Menschen mich verlassen, so werden die Hasen und Rehe mir ein Winkelchen bei ihnen gönnen.
Wie das arme Kind so weiter und weiter ging, und immer tiefer und tiefer in den Wald hinein kam, fing es an Abend zu werden, und die alten Föhren und Tannen warfen gar unheimliche Schatten. Das Mädchen bekam eine unnennbare Furcht und fing an, so heftig zu weinen an, daß die Tropfen auf das Haidreich und das weiche Moos niedertröpfelten, als ob Tau fiele.
Wie das arme, schmutzige Mädchen nun so weinte, daß die kalten Felsen damit hätten Erbarmen haben mögen, stand plötzlich ein Jäger vor ihm und sprach: „Was weinst du mein Kind?“ Das Mädchen schlug die blauen Augen auf und ließ sie wieder sinken und sprach schluchzend: „Weil ich nichts habe, und es mich so hungert, und es hier so unheimlich ist!“ –
Bei diesen Worten zitterte das arme, verlassene Kind und weinte noch bitterlicher als zuvor. _ „Sei still!“ fiel der Jäger tröstend ein. „Gehe mit mir, und du sollst Wunderdinge sehen, und es soll dich nicht gereuen.“ Das Mädchen war es zufrieden und folgte seinem Führer.
Dieser ging ohne ein Wort zu sprechen, immer weiter und weiter in den kühlen dunklen Wald hinein, bis er vor einer riesigen, bemoosten Eiche stehen blieb. Es war so still im grünen Grunde; kein Lüftchen regte sich, nur ein kleines Bächlein rieselte vorbei, - es war so still wie an einem Feiertage.
„Liebes Kind“, unterbrach der geheimnisvolle Jäger die Stille, „wir sind am Platze; nun sei getrost und weine nicht mehr!“ Das Mädchen wischte sich mit der Schürze noch zwei große Tränen aus den Augen und stand dann stille und war neugierig, was da kommen sollte. –
„Graue Eiche, öffne dich!“ sprach der Jäger im gebieterischen Tone. Und siehe, wie auf einen Zauberschlag tat sich der breite Stamm auf, und innen glitzerte, glänzte und schimmerte es, daß einem hätte das Sehen vergehen mögen. Da waren silberne Kleider und goldene Münzen und prächtige Edelsteine, und alles funkelte und leuchtete um die Wette.
Das arme überraschte Mädchen wußte nicht, wie ihm geschah. Es hielt beide Hände unter der Schürze und hielt vor Staunen den Mund und beide Augen weit offen, und schaute und schaute und konnte sich nicht satt sehen. „dies alles ist dein, und du kannst von diesen Dingen nehmen, soviel du willst“, sprach der Jäger, „wenn du es vor den Menschen draußen geheim hältst und meinen Namen merkst.“ –
Das freudig erstaunte Kind stammelte ein frohes: „O ja“, und meinte, „den Namen werde es sich schon merken, wenn es ihn nur erst wüßte. Der Jäger fuhr weiter: „Ich heiße Cistl im Körbl.“ „Cistl im Körbl“, flüsterte das Mädchen vor sich hin, um den sonderbaren Namen seinem Gedächtnis recht sicher einzuprägen. –
„In sieben Jahren werde ich wieder kommen, bis dahin kannst du dir vom Baume holen, was du willst. Komme ich aber dann wieder und kannst nicht meinen Namen nennen, so wirst du höchst unglücklich werden. Gebrauche die Schätze klug, denn davon hängt dein Glück ab.“
Das Mädchen wollte dem grünen Jäger danken, aber er war schon verschwunden und die Eiche hatte sich geschlossen und stand ernst und ruhig vor ihm, nur in den Zweigen spielte hin und wieder ein Lüftchen. Das Mädchen wußte nicht recht, ob das Geschehene Wirklichkeit oder ein Traum sei, und sprach versuchsweise:
„Graue Eiche, öffne dich!“ Und siehe, der Baum öffnete sich, und zeigte wieder alle seine Herrlichkeiten. wie früher. Mit zitternden Händen griff die arme Waise hinein und nahm einen blanken Zwanziger, und der dicke Stamm schloß sich wieder, wie ehevor, und die Eiche stand so ernst und ruhig da, als ob nichts geschehen wäre.
Es fing schon an zu dunkeln, da dachte sich das Mädchen: „Hier im Walde kann ich doch nicht übernachten, denn es könnte der Bär oder der Wolf kommen und mich fressen.“ Es sah noch einmal den Baum an, schaute sich genau das Plätzchen ab, auf dem er stand, und ging der Seite zu, auf welcher der Wald sich zu lichten schien.
Kaum war es einige Schritte gegangen, so kam es auf eine schöne, breite Straße und auf dieser ging es weiter und weiter und wiederholte immer bei sich halblaut: „Cistl im Körbl“, bis es plötzlich vor einem großen, schönen Schlosse stand, in dem es gar lustig herzugehen schien.
Das Mädchen faßte sich ein Herz und ging in den Hof hinein und über die Stiege hinauf bis zur Küche. Dort war des Grafen Köchin gerade mit der Bereitung des Abendessens beschäftigt und der Braten brutzelte, daß es eine Lust war.
Das Mädchen näherte sich schüchtern dem Herde und bat die Köchin um eine Nachtherberge oder um einen Dienst. Die Köchin sah aber das Mädchen vom Kopfe bis zu den Zehen an und fing an zu schmähen: „Pack dich fort aus der Küche, du Lumpenkind! Wir können hier kein so schmutziges, garstiges Bettelkind brauchen.“
Das arme Kind schrak zusammen und fing an zu weinen, und hörte nicht auf zu bitten und zu weinen. Endlich wurde das harte Herz der Wirtschafterin erweicht, und sie sprach barsch zu dem Mädchen: „Nun, wenn du es anders nicht tust, so kannst halt die Hennen und Hühnlein hüten. Du mußt aber früh aufstehen und darfst erst spät dich niederlegen, und schlafen mußt du auch im Hühnerhäuschen. Hab aber Acht, geht ein Hühnlein verloren, so wirst du aus dem Hause gejagt.“
Das Mägdlein war es zufrieden und ging auf die Wiese hinunter in das Hühnerhaus und trieb die Hähne, die Hennen und Hühnchen ein und schlief dort auf dem Stroh. Früh morgens trieb es dann seine Hähne, die Hennen und die Hühnlein wieder ein und schlief in ihrer Mitte auf dem Stroh. So ging es eine Woche und das Mädchen fühlte sich wohl und dachte oft an die graue Eiche und das Cistl im Körbl.
Da kam der Sonntag, und die Glocken klangen von allen Seiten, und die Leute gingen in ihrem Sonntagsputz in die Kirche. Dem Mädchen wurde aber Weh ums Herz, als es die schönen Kleider der Kirchgänger sah und es allein so schmutzig im grauen Kittelchen da stand.
Da kam ihm die graue Eiche in den Sinn, und es ging in den Wald hinaus, bis es zu dem Wunderbaume kam, und sprach mit zitternder Stimme: „Graue Eiche öffne dich!“ Die graue Eiche öffnete sich, und ihr waren die schönsten Kleider, die man je auf dieser Erde gesehen hatte, und das Mädchen nahm eines, das wie die Sonne am Mittag glänzte, wusch sich am Bächlein, zog das Sonnenkleid an und zog in die Kirche zur Messe.
Sie kam gerade zum Gloria. Als die Leute das Sonntagskleid sahen, machten sie der Kommenden ehrerbietig Platz, so daß sie bis zum Betstuhle des Grafen kam. Das arme Mädchen im reichen Sonnenkleide kniete sich neben ihm nieder und betete. Der Graf aber war ganz überrascht und sah die schöne, schöne Nachbarin an und wurde immer zerstreuter, je mehr er sie ansah, denn sie dünkte ihm gar zu schön.
Wie die Messe vorbei war, eilte die Schöne im Sonnenkleide aus der Kirche, daß es rauschte, und entschwand in den Wald. Dort zog sie das schimmernde Sonnenkleid ab und tat wieder das arme, schmutzige, graue Kittelchen an und kehrte als Hennenmädel wieder zum Schlosse zurück.
Der Graf hatte aber seit der Sonntagsmesse keine frohe Stunde mehr, denn es fehlte ihm etwas, und er getraute sich nicht, es zu sagen. Er war verstimmt und sah oft Viertelstunden lang zum Fenster hinaus, ohne ein Auge zu verwenden. Die Wochentage schienen ihm so langsam vorbeizugehen, und er sehnte sich nach der Sonntagsmesse.
Endlich kam wieder der Sonntag und die Glocken läuteten zur Messe, da ging das arme Mädchen wieder in den Wald hinaus und kam tiefer und tiefer bis zur Eiche. "Graue Eiche, öffne dich!" sprach es und die graue Eiche öffnete sich, und in ihr waren die schönsten Kleider, die man je auf dieser Erde gesehen hatte, und darunter war ein Kleid, das glänzte so licht und blaß und schön wie der Mond, wenn er am klaren Abendhimmel steht, und das gefiel dem Mädchen vor allen übrigen und das zog es, nachdem es sich in dem klaren Bächlein gewaschen hatte, an und eilte in die Kirche.
Wie das Mädchen in die Kirche kam, machten alle der schönen Jungfrau Platz, so daß sie bis zum Betstuhle des Grafen kam. Sie kniete sich hinein, und der Graf sah die schöne Jungfrau an und sah des Mondkleid und konnte keinen Blick von ihr wenden. Als die Messe zu Ende ging, winkte der Graf den Bedienten, der unbekannten Schönen zu folgen und sie nicht wegzulassen.
Als das schöne Mädchen sich wieder entfernte, und das Mondkleid rauschte, machten sich die Bedienten auf und folgten ihr auf dem Fuße nach. Sie eilte; als sie aber sah, daß kein Entrinnen möglich sei, holte sie aus ihrem Beutel blanke Zwanziger hervor, die sie aus der Eiche mitgenommen hatte, und warf sie aus. Die Diener machten sich nun gierig über die Silberlinge her und dachten, wenn sie genug Geld hätten, könnten sie auch anderswo unterkommen.
Das arme Mädchen entkam aber im Mondkleide zur grauen Eiche, zog das blasse Mondkleid aus, und tat wieder das arme, schmutzige, graue Kittelchen an und kehrte als Hennenmädel zum stolzen Schlosse zurück, wo es die Hähne, Hennen und Hühnlein auf dem Wiesengrunde hinter dem Turm hütete.
Der junge Graf aber hatte nun keine Ruhe und Rast mehr, denn es fehlte ihm die schöne Jungfrau im blassen Mondkleide, und das machte ihn verstimmt und unzufrieden, so daß sein Antlitz, das früher wie eine Rose blühte, welkte, und seine Stirne nie mehr heiter war. Stundenlang stand er auf dem Söller und stierte gedankenlos in die blaue Ferne hinaus, und in Gesellschaften wußte er nicht einmal, wovon gesprochen wurde. Die lange, lange Woche schien ihm gar kein Ende nehmen zu wollen; so langsam verstrichen die Tage.
Als wieder der Sonntag kam, und die Glocken läuteten, ging der Graf wieder in die Kirche; das Hennenmädchen aber ging wieder in den Wald hinaus zur grauen Eiche, wusch sich an der klaren Quelle und sprach mit hastiger Stimme: "Graue Eiche, öffne dich!" Die graue Eiche öffnete sich und das Mädchen nahm diesmal das Sternenkleid. Das war blau und voll goldener Sterne, die glänzten aber wie wirkliche Sterne, die nachts am Himmel stehen, und es war, als ob sie sich sachte bewegten und bald mehr, bald weniger schimmerten. Zugleich steckte sie viele, viele Goldstücke in die Tasche, und eilte in die Messe.
Es war schon das Gloria, als die schöne Jungfrau im schimmernden Sternenkleide daher kam und sich an die Seite des Grafen kniete. Der Graf war wieder froh und sah und sah nur die schöne Jungfrau an und das schimmernde Sternenkleid, und konnte keinen Blick von ihr wenden, denn er meinte, noch nie etwas Schöneres gesehen zu haben. Und wie er sie so selig ansah, und sie ihn anlächelte, wurde ihm das Herz so weich, daß er den Grafenring von der Hand zog und ihn der schönen Nachbarin an den Finger steckte.
Als die Messe zu ende war, und die schöne Jungfrau aus der Kirche ging und das Sternenkleid rauschte, stürzten auf einen Wink des Grafen die Diener ihr nach und folgten ihr auf dem Fuße. Sie griff aber in den Beutel und warf Goldstücke aus, daß es auf dem Boden glitzerte und funkelte, als hätte es Gold geschneit, und die Diener warfen sich auf die goldnen Füchse und dachten: Wenn wir Geld genug haben, können wir auch anderswo unterkommen.
Das arme Mädchen im Sternenkleide enteilte aber, ging zur grauen Eiche, zog das schimmernde Sternenkleid aus, und tat wieder das arme, graue Kittelchen an und kehrt als Hennenmädel zum stolzen Schlosse zurück, wo es die Hähne, Hennen und Hühner und Hühnlein auf dem Wiesengrunde hinter dem Turme hütete.
Der Graf aber hatte keinen frohen Tag mehr, so ging es ihm zu Herzen, und er sah tagtäglich blasser aus und alterte zusehends. Man holte Ärzte aus der ganzen Umgegend, allein sie konnten dem kranken Grafen nicht helfen, denn es war für diese Krankheit kein Kräutlein gewachsen. Da rieten dem kranken Herrn die Freunde, die um die Sache wußten, er solle sich aufheitern, und ließen ein großes Mahl veranstalten, zu dem viele lustige Gesellen geladen wurden.
Da gab es in der Küche vollauf zu tun, und das Hennenmädel mußte auch helfen, und die Hühnlein und Hähnlein rupfen, die es früher auf dem Wiesengrunde draußen gehütet hatte. Und wie es damit fertig war, mußte es zum Herde und der Köchin, die gerade Kuchen buk, die Pfanne halten. Und wenn die Kuchen recht hin und her wogten und das Schmalz aufbrodelte und wallte, bekam das Hennenmädel auch Lust, einen Kuchen hineinzugeben.
Es bat die Köchin darum, aber diese schnauzte und barschte das Mädchen an und schlug seine Bitte geradezu ab. Aber als das Hennenmädel immer von neuem bat, sagte endlich die Köchin: Da von diesem Rest Teig kannst du einen Kuchen machen." - Denn sie dachte, dieser kommt doch nicht mehr zur Tafel. -
Das Mädchen war voller Freude darob und gab den Kuchen in die Pfanne, zuvor hatte sie aber schnell den Grafenring in den Teig gebracht. Wie der Kuchen nun im brodelnden Schmalze schwamm, wurde er immer größer und ging so auf, daß er der schönste unter allen war und auf einem Teller nicht einmal Platz hatte, und alle über den schönen Kuchen staunten.
Die Köchin ließ den schönen Kuchen auf einer besonderen Tasse zur Tafel tragen und dem Grafen vorstellen. Als alle den Kuchen genug bewundert hatten, zerschnitt der traurige Graf den Kuchen - und sank ohnmächtig in den Sessel zurück.
Bald erholte er sich aber wieder, ließ die Köchin rufen und fragte sie hastig, wer den Kuchen gebacken hätte. - Mit Zittern und Bangen gestand endlich die Köchin, das Hennenmädel hätte sie so lange gebeten, und da hätte sie es ihm endlich erlaubt, den letzten Kuchen zu backen, dieser sei aber so schön ausgefallen, daß sie ihn doch zur Tafel getragen.
Der erstaunte Graf tröstete sie freundlich und zeigte ihr den Grafenring und sagte, sie sollte gleich das Hennenmädel in den Saal kommen lassen. „Aber, mein Himmel! die ist ja so garstig und schmutzig!“ meinte die Köchin. „Nun so soll sie sich umkleiden!“ befahl der Graf, und die Köchin ging wieder in die Küche hinaus.
Das Hennenmädel hatte sich aber indessen gewaschen und als die Köchin ihr den Befehl des Grafen gesagt hatte, ging sie weg und zog ein prächtiges Kleid an, das Morgenkleid, denn es war so golden, wie der Morgenhimmel; das hatte sie gestern von der grauen Eiche zum Feste geholt und unter ihrem Strohlager verborgen.
Und als sie es anhatte, war sie so schön, wie der Morgen, und niemand kannte sie mehr, und als sie in den Saal trat, standen alle Gäste auf und staunten über ihre Schönheit, und der Graf erkannte sie und eilte auf sie zu und führte sie hinaus zu seinem Sitze, wo sie nun neben ihm sitzen musste, und er nannte sie seine Braut, und das Mahl wurde ein Hochzeitsmahl, denn abends gingen sie in die Schlosskapelle, und dort wartete schon auf sie der Schlosskaplan, um sie zu trauen.
Der Graf und die schöne Gräfin lebten nun glücklich mitsummen auf dem Schlosse und hatten einander recht lieb und dachten an nichts anderes mehr. Die Jahre gingen so schnell vorüber und die schöne Gräfin hatte schon ein schönes Mädchen, dass sie auf ihrem Schoße wiegen konnte.
Wie alles so schön war und der Graf sich glücklich fühlte, kam der Gräfin aber plötzlich der grüne Jäger in den Sinn, dem sie ihr Glück zu verdanken hatte, und sie erinnerte sich an ihr Versprechen, seinen Namen zu merken, und da wurde es ihr schwer, recht schwer ums Herz – denn sie wusste ihn nicht mehr.
Die sieben Jahre waren bald vorüber, und die Gräfin wurde immer ernster und trauriger und bleicher, so dass man sie bald nimmer gekannt hätte. Die lächelte nie mehr und wenn ihr Mädchen auf ihrem Schoße kniete und mit den blonden Locken spielte, oder ihr in die blauen Augen schaute und ihre Wange streichelte, gingen ihr die Augen über und sie fing an zu weinen und dachte an das drohende Unglück.
Und das Mädchen, wenn es die Mutter weinen sah, weinte auch mit, und es war sehr traurig auf dem Schlosse, und niemand wußte warum. Der Graf forschte nach und bot alles auf, um die liebe Gräfin zu erheitern, aber alles war umsonst.
Eines Abends saß die traurige Gräfin wieder auf dem Söller und sah in den Garten hinab, wo die Gärtnerknaben arbeiteten, und war so traurig, wie nie, denn morgen waren die sieben Jahre vorüber und sie wusste nimmer den Namen des Jägers.
Wie sie lange so gesessen war und sann und nachdachte, sah sie, wie die Gärtnerjungen ihre Gerätschaften zusammenpackten, und einer hatte ein Cistl und das war er in sein Körbl.
Als das die Gräfin sah, fing sie laut an zu lachen und rief: „Cistl im Körbl!“ so daß der Graf und die Kammermädchen herbei kamen, und alle staunten, denn keine lebende Seele wußte, was die Gräfin so froh gemacht hätte. Der Graf freute sich und küßte die frohe Gräfin, die so lange trüb und traurig gewesen.
Am Tage darauf kam der grüne Jäger, als die Gräfin eben spazieren ging, und die Gräfin grüßte ihn und nannte ihn beim Namen. Da lächelte er, legte den Finger auf den Mund zum Zeichen, daß sie keiner Menschenseele etwas von ihm sagen sollte, und er verschwand auf immer.
Die Gräfin und der Graf lebten aber noch lange, lange recht glücklich und bekamen noch zwei Kinderchen, ein Büblein und ein Mädchen. Und die Geschichte ist wahr, denn der sie erzählt, lebt noch.
Märchen aus Österreich
DER DRACHENTÖTER ...
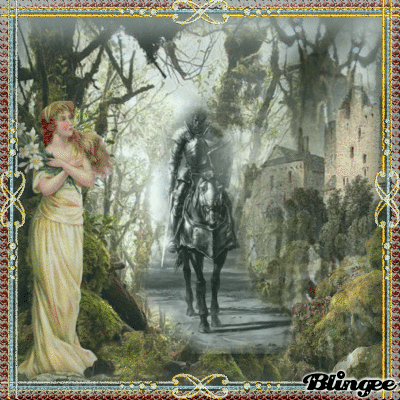
Es war ein schönes und fruchtbares Land mit Wäldern, Feldern, Flüssen, Straßen und Städten. Ein König war darüber gesetzt von Gott, ein Greis, älter und stolzer als alle Könige, von denen man je Glaubwürdiges gehört hat. Dieses Königs einziges Kind war ein Mädchen von großer Jugend, Sehnsucht und Schönheit.
Der König war verwandt mit allen Thronen der Nachbarschaft, seine Tochter aber war noch ein Kind und allein, wie ohne alle Verwandtschaft. Gewiß war ihre Sanftmut und Milde und die Macht ihres unerwachten stillen Angesichtes die unschuldige Ursache jenes Drachens, welcher, je mehr sie emporwuchs und aufblühte, desto näher heranschlich und sich endlich im Walde vor der schönsten Stadt des Landes, wie der Schrecken selber, niederließ; denn es bestehen geheime Beziehungen zwischen dem Schönen und dem Schrecklichen, an einer bestimmten Stelle ergänzen sich beide wie das lachende Leben und der nahe tägliche Tod.
Damit ist nicht gesagt, daß der Drache der jungen Dame feindlich war, wie ja auch niemand auf Ehre und Gewissen sagen kann, ob der Tod des Lebens Widersacher ist. Vielleicht hätte das große kochende Tier sich wie ein Hund neben dem schönen Mädchen niedergelegt und es wäre vielleicht nur durch die Abscheulichkeit der eigenen Zunge abgehalten worden, die lieblichsten Hände in tierischer Demut zu liebkosen.
Aber man ließ es natürlich auf eine Probe nicht ankommen, zumal der Drache gegen alle, die zufällig in den Kreis seiner Kraft traten, erbarmungslos war und, einem sichtbaren Tode vergleichbar, alles, Kinder und Herden nicht ausgenommen, ergriff und behielt.
Der König wird es zuerst mit hoher Befriedigung vermerkt haben, daß diese Not und Gefahr viele Jünglinge seines Landes zu Männern machte. Diese jungen Leute aus allen Ständen, Adelige, Priesterschüler und Knechte, zogen aus wie in ein fremdes, fernes Land, hatten das Heldentum einer einzigen, heißen, atemlosen Stunde, in der sie Leben und Tod hatten und Hoffnung und Angst und alles – wie im Traum.
Schon nach einigen Wochen fiel es keinem mehr ein, diese kühnen Söhne zu zählen und ihre Namen irgendwo aufzuzeichnen. Denn in solchen bangen Tagen gewöhnt sich das Volk auch an Helden; sie sind dann nichts Unerhörtes mehr. Das Gefühl, die Furcht, der Hunger von Tausenden schreit nach ihnen, und sie sind da, wie eine Notwendigkeit, wie Brot, von jenen letzten Gesetzen bedingt, die auch in den Zeiten des Unheils nicht aufhören zu wirken.
Als aber die Zahl derer, welche sich nach hoffnungsloser Gegenwehr opferten, immer noch wuchs, als fast in jeder Familie des Landes der beste Sohn (und oft noch in knabenhafter Jugend) gefallen war, da begann der König mit Recht zu fürchten, daß alle Erstlinge seines Landes zugrunde gehen könnten und daß zu viele junge Mädchen eine jungfräuliche Witwenschaft auf sich nehmen müßten für die langen Jahre eines kinderlosen Frauenlebens. Und er versagte seinen Untertanen den Kampf.
Fremden Kaufleuten aber, die in namenlosem Entsetzen aus dem heimgesuchten Lande flohen, gab er eine Kunde mit, welche Könige, in ähnlicher Lage, seit alten Zeiten verbreiten ließen: wem es gelänge, das arme Land von diesem großen Tode zu befreien, der sollte die Hand der Königstochter erhalten, mag er von Adel sein oder eines Henkers letzter Sohn.
Und es zeigte sich, daß auch die Fremde voller Helden war, und daß der hohe Preis seine Wirkung nicht verfehlte. Die Fremden waren aber nicht glücklicher als die Einheimischen: sie kamen nur, um zu sterben.
In der Tochter des Königs ging in diesen Tagen eine Veränderung vor; wenn ihr Herz bis jetzt, von der Trauer und dem Verhängnis des Landes bedrückt, den Untergang des Untiers erflehte, so verbündete sich nun, da sie einem starken Unbekannten zugesprochen war, ihr naives Gefühl dem Bedränger, dem Drachen, und es kam so weit, daß sie in der Aufrichtigkeit des Traumes Gebete zu seinen Gunsten erfand und von heiligen Frauen verlangte, daß sie das Ungeheuer in ihren Schutz nehmen sollten.
Eines Morgens, als sie aus solchen Träumen voll Scham erwachte, kam ein Gerücht zu ihr, das sie erschreckte und verwirrte. Man erzählte sich von einem jungen Menschen, der – Gott weiß woher – zum Kampfe gekommen war, und dem es allerdings nicht gelang, den Drachen zu töten, wohl aber wund und blutend aus den Klauen des gräßlichen Feindes sich loszureißen und in den dichtesten Wald sich zu verkriechen.
Dort fand man den Bewußtlosen, kalt in seiner kalten eisernen Schale, und brachte ihn in ein Haus, wo er nun in tiefem Fieber lag, mit heißem Blut hinter den brennenden Verbänden.
Als das junge Mädchen diese Nachricht vernahm, wäre sie gerne, wie sie war, in ihrem Hemde von weißer Seide, durch die Straßen gelaufen, um an dem Lager des Todkranken zu sein. Aber als die Kammermädchen sie angekleidet hatten, und sie ihr wunderschönes Kleid und ihr trauriges Gesicht in den vielen Spiegeln des Schlosses gehen und kommen sah, da verließ sie der Mut, so Ungewöhnliches zu wagen.
Sie brachte es nicht einmal über sich, irgendeine verschwiegene Dienerin in das Haus zu senden, darin der fremde Kranke lag, um ihm eine Linderung zu schaffen, feine Leinwand oder eine sanfte Salbe.
Aber es war eine Unruhe in ihr, die sie beinahe krank machte. Bei Einbruch der Nacht saß sie lange am Fenster und suchte das Haus zu erraten, in dem der fremde Mann starb. Denn, daß er starb, schien ihr selbstverständlich. Nur Eine hätte ihn vielleicht retten können, aber diese Eine war viel zu feige, ihn zu suchen.
Dieser Gedanke, daß das Leben des wunden Helden in ihre Hand gegeben sei, verließ sie nicht mehr. Dieser Gedanke stieß sie endlich nach dem dritten Tage, den sie so in Qualen und Selbstvorwürfen verbracht hatte, in die Nacht hinaus, in eine schwarze, bange, regnende Frühlingsnacht, in der sie herumirrte, wie in einem dunklen Zimmer.
Sie wußte nicht, woran sie das Haus erkennen würde, das sie suchte. Aber sie erkannte es ohne weiteres an einem Fenster, das weit offen stand, an einem Licht, das drinnen im Zimmer brannte, einem langen seltsamen Licht, bei dem niemand lesen oder schlafen konnte. Und langsam ging sie an dem Hause vorbei, hilflos, arm, versunken in die erste Traurigkeit ihres Lebens.
Sie ging weiter und weiter. Der Regen hatte aufgehört; über losen Wolkenstreifen standen einzelne große Sterne, und irgendwo in einem Garten sang eine Nachtigall den Anfang ihrer Strophe, die sie noch nicht vollenden konnte. Sie hob immer wieder fragend an, und ihre Stimme war groß und gewaltig aus der Stille gewachsen, wie die Stimme eines Riesenvogels, dessen Nest auf den Wipfeln von neun Eichen ruht.
Als die Prinzessin endlich die Blicke, in denen Tränen standen, von ihrem langen Wege erhob, sah sie einen Wald und einen Streifen Morgen dahinter. Und vor diesem Streifen hob sich etwas Schwarzes ab, das sich zu nähern schien. Es war ein Reiter. Unwillkürlich drückte sie sich in das dunkle, nasse Gebüsch.
Er ritt langsam an ihr vorbei, und sein Pferd war schwarz von Schweiß und bebte. Und er selbst schien zu zittern: alle Ringe seines Panzers klangen leise aneinander. Sein Haupt war ohne Helm, seine Hände waren bloß, sein Schwert hing schwer und müde herab. Sie sah sein Gesicht im Profil; es war heiß, mit verwehtem Haar.
Sie sah ihm nach, lange. Sie wußte: er hat den Drachen getötet. Und ihre Traurigkeit fiel ihr ab. Sie war kein verirrtes, verlorenes Ding mehr in dieser Nacht. Sie gehörte ihm, diesem fremden, zitternden Helden, sie war sein Besitz, als ob sie eine Schwester seines Schwertes wäre.
Und sie eilte nach Hause, um ihn zu erwarten. Sie kam unbemerkt in ihre Gemächer, und sobald es anging, weckte sie die Kammermädchen und ließ sich das schönste ihrer Kleider bringen. Während man es ihr anzog, erwachte die Stadt zu lauter Freude.
Die Menschen jubelten und die Glocken überschlugen sich fast in den Türmen. Und die Prinzessin, die diesen Lärm hörte, wußte plötzlich, daß er nicht kommen würde. Sie versuchte, sich ihn vorzustellen, umwogt von der lauten Dankbarkeit der Menge: sie vermochte es nicht.
Fast ängstlich suchte sie sich das Bild des einsamen Helden, des Zitternden, zu erhalten, wie sie ihn gesehen hatte. Als ob es wichtig wäre für ihr Leben, das nicht zu vergessen. Und dabei war ihr so festlich zu Mut, daß sie, obwohl sie wußte, daß niemand kommen würde, die Kammermädchen, die sie schmückten, nicht unterbrach.
Sie ließ sich Smaragden und Perlen ins Haar verflechten, das sich, zum größten Erstaunen der Dienerinnen, feucht anfühlte. Die Prinzessin war fertig. Sie lächelte den Kammermädchen zu und ging, etwas bleich, an den Spiegeln vorbei, im Geräusche ihrer weißen Schleppe, die weit hinter ihr herkam.
Der greise König aber saß, ernst und würdig, im hohen Thronsaal. Die alten Paladine des Reiches standen um ihn und glänzten. Er wartete auf den fremden Helden, den Befreier.
Der aber ritt schon weit von der Stadt, und es war ein Himmel voll Lerchen über ihm. Hätte ihn jemand an den Preis seiner Tat erinnert, vielleicht wäre er lachend umgekehrt; er hatte ihn ganz vergessen.
Rainer Maria Rilke, Kunstmärchen
DIE WEISSE ROSE ...

Wenn die frommen Brüder des Klosters Arnoldstein im Gaital des Morgens in die Kirche gingen, um gemeinsam Gott den Herrn zu loben und zu preisen, geschah es manchmal, daß einer der Mönche auf seinem Betstuhl eine duftende weiße Rose vorfand. Dann küßte er sie demütig und bereitete sich auf den Tod vor; denn diese Rose war das Zeichen, das der Herr demjenigen seiner Diener sandte, den er noch am selben Tag zu sich berufen wollte.
Eines Abends kam ein müdes abgehärmtes Weib mit einem Knäblein an die Klosterpforte und bat um Kost und Herberge. Die mildtätigen Brüder gewährten ihre Bitte. In der Nacht starb die Frau an Erschöpfung, und ihr Söhnlein Johannes wäre allein in der Welt dagestanden, wenn sich der Pförtner nicht seiner angenommen hätte.
Der Knabe wuchs heran, zeigte aufgeweckten Sinn und gute Begabung, so daß ihm der Abt Unterricht in der Klosterschule geben ließ. Als der stille, versonnene Jüngling sein Studium beendet hatte, wählte er den Priesterstand zu seinem Beruf und trat als Mönch in das Kloster ein.
Als er dem Herrn sein erstes Messopfer darbrachte, strömte, wie immer bei solchem Anlaß, viel Volk aus der ganzen Gegend zusammen, um des Segen des neugeweihten Priesters teilhaftig zu werden; darunter befand sich auch ein schönes junges Mädchen, die Tochter des Verwalters der Fuggerischen Güter.
So wie die übrigen Andächtigen drängte auch die Jungfrau nach vorn, um vor dem segnenden Priester niederzuknien. Da traf sie sein blick, sie sah sein Auge sich senken und tiefe Röte sein Antlitz überziehen. Errötend neigte die Maid ihr Haupt. Beschämt gestand sich der junge Mönch, daß eine weltliche Regung sein Innerstes berührt habe.
Trotz aller Feierlichkeiten war er den ganzen Tag niedergeschlagen; sehnsüchtige Liebe nahm seinen Sinn gefangen, und die Aussichtslosigkeit seiner plötzlich entflammten Neigung, machte sein Herz traurig und ließ seinen Mund verstummen. Das Bild des lieblichen Mädchens schwebte unablässig vor seinen Augen, begleitete ihn bis in den Traum und stand vor seiner Seele, als er am nächsten Morgen als erster die Kirche betrat.
Lächelnd näherte er sich seinem Platz. Da leuchtete ihm etwas Weißes entgegen. Zagend schritt er hinzu, es war – eine weiße Rose. Vor Schrecken erbleichend, tat er, wozu ihn der nackte Selbsterhaltungstrieb, die Furcht vor dem Tode, zwang, er legte die todkündende Blume auf den nächsten Platz; denn das Leben schien so lockend und schön; es hatte ja eben erst begonnen und verhieß für die Zukunft alle irdische Seligkeit.
Als kurz darauf die anderen Brüder zur Morgenandacht kamen, erblickte ein greiser Pater, auf seinem Platz die Botschaft des Todes und freute sich innig, daß ihn der Herr endlich zu sich berufen wolle; denn er hatte Gott schon längst um Erlösung von diesem mühseligen Erdenleben gebeten. Kaum hatte er sich nieder gekniet, sank er tot um.
Noch am selben Tag kamen Dienstleute des Verwalters ins Kloster; sie waren auf der Suche nach der Tochter ihres Herrn, die am frühen Morgen das Elternhaus verlassen hatte, und seitdem nicht wieder zurückgekehrt war. Man suchte das Mädchen überall, viele Leute schlossen sich den Nachforschungen an. Endlich fand man es tot am Fuße eines Felsens.
Bald stellte sich heraus, daß sie es gewesen, die jene weiße Rose zum Zeichen ihrer unschuldigen Neigung dem jungen Mönch auf das Betpult gelegt hatte. Davon aber erfuhr Johannes erst viel später. Von tiefem Gram und schweren Gewissensbissen gequält, wandelte er den ganzen Tag ruhelos im Kloster umher.
Der plötzliche Tod des geliebten Mädchens erschütterte sein Herz, nagende Reue folterte sein Gewissen. Lange Zeit fand er weder Rast noch Ruhe. Unermüdlich flehte er den Himmel an, ihn von dieser Erdenqual zu lösen, ihm die weiße Rose zu senden.
So verstrich Jahr um Jahr, aber er harrte vergebens; nie lag die weiße Rose an seinem Platz. Eines Tages fand man den Neunzigjährigen sanft entschlummert auf dem Grab des Mädchens, mit der Rechten die weiße Rose umklammernd, die dem Grab der Toten entsprossen war.
Sage aus Österreich
WIE EIN SCHAFHIRT REICH WURDE ...

Ein Hirt weidete auf der Wiese seine Schafe. Es war ein heißer Sommertag, und die Herde verlief sich in den benachbarten Wald, um vor der Hitze geschützt zu sein. Als sich der Hirt vergebens bemüht hatte, die Schafe zusammenzutreiben, wurde er zornig, und die Herde sich selbst überlassend, ging er fort in die weite Welt.
Der Schäfer war das Gehen gewohnt, daher dauerte es gar nicht lange, und er stand vor dem Tor der Hauptstadt, die er noch nie gesehen hatte. Ihm kam daher vieles wunderbar vor, und er blieb oft mit aufgesperrtem Mund stehen wie die Kuh vor der neuen Stalltür. Unter anderem gewahrte er einen Mann mit blauen Beinkleidern und weißem Rock.
Erstaunt über solche Kleidung, fragte er einen Nebenstehenden: "Freund, könnt Ihr mir nicht sagen, was das dort für ein Herr ist, der blaue Beinkleider und einen weißen Rock trägt?" "Das ist ein Soldat", erwiderte der Gefragte. "Soldat? Was ist denn das, ein Soldat?" fragte abermals der Hirt. "Der Soldat steht im Dienst des Königs, wofür er Geld bekommt; er muß Wache stehen und in den Krieg ziehen", sagte der Städter.
"So ein Stand möchte mir gefallen", erwiderte der Schäfer. "Könnte ich wohl Soldat werden?" "Das versteht sich, und Ihr kämt dem König gerade recht, denn jetzt braucht er viele Leute, da es mit dem benachbarten König wahrscheinlich zum Krieg kommt."
Nachdem der Hirt noch über verschiedenes gefragt hatte, ging er ins königliche Schloß und ließ sich anwerben. Schon am anderen Tag schritt der neu gebackene Soldat stolz durch die Straßen der Hauptstadt und bildete sich auf seine Kleidung etwas ein.
Kaum konnte unser Soldat ein wenig mit dem Gewehr umgehen und bald rechts, bald links sich drehen, so kam schon die Reihe an ihn, Wache zu stehen, und zwar in der Nacht. Dies hätte ihn nicht eingeschüchtert, denn er war kein Hasenherz, aber es stand diesmal, wie er von einem Kameraden hörte, das Leben auf dem Spiel.
Der Soldat sollte nämlich beim "Teufelsfelsen" von elf bis zwölf Uhr wachen, und um diese Zeit trieb dort der Teufel sein Unwesen, und der hatte schon manchen Wache haltenden Soldaten in Stücke zerrissen. Der Hirt wurde ganz außer sich und dachte nach, wie er dieser Gefahr entkommen könne. Während seine Kameraden zu Mittag in der Kaserne ihr Mahl verzehrten, machte sich der Schäfer unbemerkt reisefertig und verließ so schnell, als es eben ging, die Stadt.
Außerhalb derselben begegnete er einem Greis, welcher den Soldaten nach der Ursache seiner Eile befragte. Der Hirt, gewöhnt, offen und wahr zu reden, vertraute sein Vorhaben dem alten Mann.
Dieser sprach: "Mein Sohn, du begehst eine schlechte Tat, indem du weg läufst; kehr zurück, stell dich auf den gefürchteten Posten, vergiß nur nicht, mit dem geweihten Bajonett einen Kreis um dich zu ziehen. Folgst du meinem Rat, so wird dir kein Haar gekrümmt werden."
Die Worte des Alten gingen dem jungen Ausreißer zu Herzen. Er machte rechtsum und schritt in die Stadt zurück. Es hatte noch nicht elf geschlagen, als unser Soldat schon bei dem "Teufelsfelsen" stand, und da er nach dem Rat des Greises einen Kreis um sich gezogen hatte und auf diese Weise seine Haut den Krallen und Zähnen des Teufels entzog, harrte er mutvoll der Dinge, die da kommen sollten.
Um elf Uhr kam der böse Geist und rannte auf die Wache los. Vor dem Kreis angelangt, konnte er nicht weiter und schrie vor Zorn schnaubend: "Komm heraus, sonst zerreiße ich dich!" - Der Soldat gab weder eine Antwort, noch rührte er sich von der Stelle.
Der Teufel rief das selbe noch zweimal, aber umsonst; hierauf sprach er gelassen: "Du bist der erste, der meiner Macht Trotz geboten hat. Für diese Tat sollst du einen Lohn von mir haben. Komm mit mir!"
Der Soldat besann sich eine Weile und folgte dann dem Teufel. Dieser schritt rasch auf eine Stelle des Felsens zu, und dort schlug er mit einer goldenen Rute auf den Felsen, welcher so gleich aufsprang. Beide traten in das Innere ein. Hier zeigte der Teufel dem erstaunten jungen Soldaten eine Menge Gold, Silber und schöne Perlen.
Als beide sich verabschiedeten, übergab der Teufel dem Hirten drei wertvolle Sachen und sprach: "Brauchst du Geld, so komm zu diesem Felsen, schlage mit der goldenen Rute, die ich dir da schenke, auf den selben, und er öffnet sich dir, worauf du so viel von den Schätzen nehmen kannst, als du nötig hast.
Dieses Fläschchen enthält eine Flüssigkeit von der Beschaffenheit, daß ein mit der selben befeuchtetes Schloß sich sogleich öffnet. Das dritte ist diese schwarze Wurzel. Legst du sie auf ein Häuflein Geld, so wird augenblicklich das gerecht erworbene von dem ungerecht erworbenen geschieden." Nachdem der Teufel dies gesagt hatte, verschwand er.
Der Soldat wollte sich auf seinen Posten begeben, jedoch es stand schon ein anderer Wache. Er ging nun zu seinem Vorgesetzten und erzählte, wie es ihm ergangen war. Da er sich nun ohne große Mühe genug Geld verschaffen konnte, kündigte er dem König den Dienst und führte von nun an ein bequemes Leben, vergaß aber dabei die Armen nicht.
So schenkte er seinem Schuhmacher, der sehr bedürftig war, für jedes Putzen der Stiefel einen Dukaten. Der arme Schuhmacher pries auch, wohin er nur immer kam, die große Freigebigkeit seines Wohltäters.
Eines Morgens sprach der reiche Schäfer zum Schuhmacher, welcher eben die Stiefel gebracht hatte: "Ich habe dir schon viel Gutes getan, aber es ist noch zuwenig. Ich will dich zu einem reichen Mann machen; komm daher heute zu mir, wenn es dunkel geworden ist."
Vor Freude außer sich, verließ der Schuhmacher den Schäfer und hatte nun nichts Eiligeres zu tun, als allen Leuten, denen er begegnete, das ihm bevorstehende Glück auszuposaunen. Einer erzählte es dem anderen, und so ging die Nachricht durch die Stadt, bis es selbst der König erfuhr.
Dieser ließ den Schuhmacher vor sich rufen, und nachdem er ihn über die Sache genau befragt hatte, sprach er: "Ich werde dich auch reich machen, wenn du mich heute anstatt deiner mit dem Schäfer gehen läßt und mir deine Kleider borgst."
Der Schuster willigte ein und versprach, darüber zu schweigen. Als es dunkel wurde, begab sich der verkleidete König zum Schäfer, welcher ihn schon erwartete. In der Dunkelheit blieb der König unerkannt. Beide gingen nun in das Haus eines wegen Betrug und Wucher berüchtigten Kaufmanns.
Mit dem Zauberwasser befeuchtet, sprangen alle Schlösser auf, und so gelangten sie bis zur Kasse. Nachdem diese geöffnet war, legte der Schäfer die schwarze Wurzel auf das Geld, und siehe da - fast die Hälfte des Geldes, nämlich das ungerecht erworbene, flog heraus und wurde vom König aufgefangen, da ihm der Schäfer zurief: "Greif nur zu! Nimm, soviel du kannst!"
Als beide das Haus des Kaufmanns verließen, sprach der verkleidete König: "Jetzt gehen wir wohl in die königliche Schatzkammer, nicht wahr?" "Hast du denn nicht schon genug an diesem, daß du noch mehr verlangst? Ich war noch nicht drinnen und gehe auch heute nicht hinein", antwortete der redliche Schäfer. Der König ließ ihm aber keine Ruhe, bis er nachgab und seine Schritte zum Schatzhaus richtete.
Im Innern des selben angelangt, legte der Schäfer abermals die schwarze Wurzel auf das aufgespeicherte Geld, aber nichts rührte sich von der Stelle. Der König horchte gespannt, bis der Schäfer ihm befehlen werde, zuzugreifen, aber dieser schwieg, und als der König mit der Hand in das Geld fuhr, um einiges mitzunehmen, sprach der Schäfer voll Entrüstung über die kecke Tat: "Augenblicklich laß ab von dem, oder ich hau dir den Arm entzwei; denn merke dir es: Ich nehme nur das ungerecht erworbene Geld."
Gleich darauf verließen beide das Schatzhaus, und vor der Tür des selben nahmen sie Abschied voneinander. Da sprach der Schäfer zu dem vermeintlichen Schuhmacher: "Weil du arm warst, so wollte ich dich reich machen, aber kaum hast du den Glanz des Goldes gesehen, so wirst du auch schon habsüchtig. Geh von mir, erwarte nie mehr eine Unterstützung."
Am anderen Tag ließ der König den Schäfer holen und belobte ihn wegen seiner Ehrlichkeit, nachdem er dem selben das Geheimnis der vorigen Nacht offenbart hatte. Dann bat er ihn, er möge auf diese Weise fortfahren, den Armen zu nützen. Der Schäfer tat dies auch und lebte so, sich und andere Leute glücklich machend. Bevor er starb, vermachte er die drei Zauberdinge dem König.
Theodor Vernaleken
DER GRAF MIT DEM STEINERNEN HERZEN ...

Im oberen Inntal, der Ort ist heute vergessen, lebte vor langer Zeit ein Graf, der trug ein steinernes Herz in seiner Brust. Wär es anders gewesen, hätte er einmal aufgehört, seine Untertanen so hart und unerbittlich zu regieren, wie es kein anderer Herr in ganz Tirol übte.
Sieben Dörfer mussten ihm dienen. Wenn er von seinem Schloss herab übers Land ritt, dann lief schon ein heimlicher Melder voraus: "Der steinerne Graf ist auf dem Weg! Hütet euch,hütet euch!
Er war am schärfsten gegen Bettelleute, die sich durch seine Landschaft von Haus zu Haus bettelten um eine Schnitte Brot oder um paar Löffel Suppe. So schickte er einen Befehl an alle Häuser: "Wer einem Bettler etwas schenkt, der wird von Haus und Hof gejagt!"
Der steinerne Graf aber traute seinen Untertanen nicht. Er wollte selber sehen, ob die Bauern seinen Befehl befolgen und stieg als Bettler in das Bauernland hinab.
Er hinkte von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf und kopfte an jedes Fenster: "Ein armer, hungriger Mann täte um ein Bröcklein Brot bitten!", sprach er mit verstellter Stimme zu jedem
Fenster hinein.
Und was er selber nicht geglaubt hätte, das musste er jetzt erkennen: Kein einziger Bauersmann wagte es, gegen seinen Befehl zu handeln! Die Furcht vor dem harten Grafen lag wie eine bleierne Last auf seiner Landschaft.
Hungrig und doch zufrieden hinkte der falsche Bettler aus dem letzten Dorf hinaus. Sein ganzer Reichtum, den er aus den Bauern erpresste, blieb ihm ganz allein erhalten.
Da sah er am kleinen Waldrand noch eine kleine Hütte stehen. Der steinerne Graf ging hinein und flehte die Frau an: "Erbarm dich doch über einen Hungrigen,der bald keinen Schritt mehr weit gehen kann vor lauter müd und matt!"
Die Frau konnte das Elend, das sie vor ihr auf den Knien vermeinte, nicht ansehen. Sie steckte ihm eine Brotschnitte zu und flüsterte: "Schnell, geh fort und lass dir es gesegnet sein!" Der Bauer sah es und war voll Sorge.
Ein Tag war nur vergangen, dann brachte man ihn aufs Schloss vor den Grafen. Der fuhr ihn an: "Ist nicht gestern ein Bettler zu dir gekommen, der dich um eine Brotschnitte anging?"
Der Bauer wollte es nicht leugnen. "Das ist wohl geschehen, aber ich habe mich an deinen Befehl gehalten,Herr!" "Jetzt lügst du , Bauer!", schrie der Graf, " Warte, der Bettler selbst soll das beweisen!"
Er ging in eine andere Kammer und kehrte bald darauf als der verkleidete Bettler zurück. Dem Bauern fuhr der Schrecken in die Beine. Jetzt bin ich verloren, ging es ihm durch den Kopf. Der Graf warf ihm auch die Brotschnitte vor die Füße. "Willst du es leugnen, dass dieses Brot aus deinem Haus kommt?", fragte er höhnisch.
" Gnade, Herr Graf!" Er faltete die Hände vor ihm. Was soll denn jetzt mit meinen Kindern geschehen? Wirf uns nicht auf die Straße!" Der steinerne Graf dachte: Ich will ihm etwas auftragen, dass er doch nicht erfüllen kann! Dann kann ich ihn immer noch auf die Bettlerstaße hinaus treiben!
Geh in meinen Wald und suche die dickste Eiche. Die sollst du fällen und bis zum Mittag Schlag zwölf aufs Schloss bringen. Dann will ich dir die Vertreibung erlassen!"
Der Bauer ging von dem Schloss hinab mit dem Gedanken, dass er schon verloren war. Denn allein den dicksten Eichenbaum fällen und ihn auch noch schaffen, das brachte er doch niemals zuwege. Mutlos nahm er die große Axt und ging in den Wald des Grafen hinaus.
Da trat ein Jäger aus dem Gebüsch. "Du blickst traurig drein! Was ist dir denn geschehen?",fragte er freundlich. Der Bauer erzählte, was ihm Kummer machte. Der Jäger zeichnete drei Kreuze auf dem Boden - da lag eine breite Axt vor ihm, und der Jäger lachte:" Das wäre das richtige Äxtlein!" Wie der Bauer hin schlug auf den Stamm, hackte er ihn mit drei Hieben. Mit Krachen und Bersten sank der mächtige Baum um.
Wieder klopfte der Jäger mit dem langen Hackenstiel dreimal auf den Waldboden. Da war von der Straße her ein Rumpeln und Rasseln zu hören. Bald tauchten sechs prächtige Rappen vor einem schweren Wagen auf, die wendeten herein zu der gefällten Eiche.
"Drei Paar Rosse sind stark genug!", nickte der Bauer!". "Jetzt müssen wir nur bald genug aufs Schloss kommen!" Doch sie rumpelten so schnell den Schlossberg empor, dass der Wagen zum Tor hinein fuhr, als gerade die Mittagsglocke anfing zu schlagen.
" Und du hast doch verloren, Bauer!", schrie der Graf zornig. "Ich habe keinem Menschen aus meiner Landschaft erlaubt, dir zu helfen!" Der Jäger hob nur ein bissel die Hand. "Herr Graf, kennst du mich nicht mehr?",fragte er und schaute ihn mit funkelnden Augen an.
Davon erschrak der Burgherr und musste schweigen. Der Bauer schaute von einem zum anderen. Ihm ging es auf einmal auf, dass der Jäger noch mächtiger war als der Graf. "Aus welchem Land kommst du her?", fragte er ängstlich.
Das deutete der Jäger nur ungewiss am Himmel entlang. " Von drüben - von drüben - aber das ist gar nicht weit aus der Welt!", sagte er wie hinter einer Wand aus Nebel und Glas.
Der Graf wollte zurückweichen, aber er schwankte auf einmal hin und her. Zuletzt sank er auf dem Boden nieder, und die Augen gingen ihm vor Schrecken weit auf.
Da lief der Bauer hin und beugte sich über ihn: "Herr Graf......", sagte er noch - da war der Herr mit dem steinernen Herzen tot.
Langsam ließ ihn der Bauer niedersinken auf die Steine. Wie er sich umdrehte, gab es keine sechs Rappen und keinen Jäger mehr zu sehen. Nur die Eiche lag noch da, und füllte mit ihren Ästen den ganzen Burghof aus.
Tirol
DER ZAUBERTOPF UND DIE ZAUBERKUGEL ...

In einem Dorf lebte vorzeiten ein armer Kirchendiener, der nur mit Mühe sein und seiner Familie Leben fristete. Seine Frau handelte mit Eiern, die sie nach der nahe gelegenen Stadt trug, wo sie für den Erlös Nahrungsmittel kaufte. Aber plötzlich verlor sie fast alle Hühner, und sie sah sich genötigt, auch das letzte noch zu verkaufen.
Am nächsten Morgen ging sie nach der Stadt mit einem Korb auf dem Rücken, in welchem sich die Henne befand. Sie mußte über einen steilen Berg gehen und setzte sich unterwegs nieder, um ein wenig auszuruhen. Plötzlich sprang aus dem Gebüsch ein Männchen hervor, welches einen großmächtigen weißen Bart hatte. Es trat näher zu der erschrockenen Frau und fragte, wohin sie gehe.
Sie antwortete: "Nach der Stadt, um meine einzige Henne zu verkaufen."
Das Männchen erwiderte: "Wenn du willst, so gebe ich dir einen Topf für die Henne."
Die Frau lachte über diesen Antrag und sagte: "Du mußt nicht glauben, daß ich nicht weiß, was ein Topf und was eine Henne wert ist."
Das Männchen aber entgegnete: "Lach nicht zu früh, es wird sich erst zeigen, ob die Henne oder der Topf wertvoller ist; wenn du übrigens nicht willst, zwingen kann ich dich nicht." Die Frau besann sich noch einige Zeit und willigte endlich in den Tausch ein.
Das Männchen verschwand und kam nach einiger Zeit mit einem rußigen Topf zurück und sprach: "Mit diesem Topf kannst du alles herbeischaffen, was du nur wünschst. Wenn du ihn gebrauchen willst, so stell ihn in den Schatten, bedecke ihn und sprich: ‚Fülle dich, Topf', und du wirst sehen, daß der Topf gehorcht; nur hüte dich, ihn je zu reinigen oder von der Sonne bescheinen zu lassen."
Die Frau nahm den Topf in Empfang, versprach, alle Vorsichtsmaßregeln zu beachten, und entfernte sich.
Sobald sie zu Hause ankam, wollte sie sich überzeugen, ob der Topf auch wirklich diese Eigenschaften besitze. Sie ging damit in den Schatten, bedeckte ihn und sprach: "Fülle dich, Topf, mit Milch." Sie nahm den Deckel weg und der Topf war bis an den Rand mit Milch gefüllt. Sie suchte nun ihren Mann auf, um ihm ihr Glück zu erzählen.
Lange Zeit hatte der Topf der Familie gute Dienste geleistet, aber nach jedem Gebrauch wurde er schwärzer und glänzte wie Ebenholz. Die Frau rieb daher eines Tages den schwarzen Topf blank und stellte ihn an die Sonne. Als er trocken war, glänzte er wie pures Gold. Die Frau war darüber sehr erfreut und wollte den Topf in das Zimmer tragen, aber kaum hatte sie die Hand nach dem Topf ausgestreckt, als sie auch schon einen so derben Schlag erhielt, daß sie ohnmächtig niederstürzte.
Als sie wieder zu sich kam, sah sie, daß der Topf verschwunden war. Jetzt erst erinnerte sie sich, daß sie das Gebot übertreten habe, und an die Stelle des Überflusses trat wiederum die Not. Deshalb sagte die Frau zu ihrem Mann, er solle auch einmal in die Stadt gehen, Vielleicht begegne er jenem Männchen.
Der Kirchendiener ging zu seinem Nachbar, kaufte von ihm ein Lamm und trieb es nach der Stadt. Als er auf dem Berg ankam, setzte er sich auf derselben Stelle nieder, wo vor einiger Zeit seine Frau ausgeruht hatte. Er blieb einige Zeit sitzen, aber es wollte sich kein Männchen zeigen. Endlich stand er auf und ging weiter, da rauschte es plötzlich im Gebüsch, und das Männchen stand vor ihm.
"Wohin eilst du?" fragte es.
Der Kirchendiener, der schnell das Kreuz machte, antwortete mit zitternder Stimme: "Ich treibe dieses Lamm nach der Stadt, um es zu verkaufen."
Das Männchen sagte hierauf: "Deine Mühe ist vergebens, denn heute sind so viele Schafe auf dem Markt, daß das deinige ganz unbeachtet bleiben wird; aber wenn du willst, so gebe ich dir eine Kugel dafür."
"Aus diesem Tausch kann nichts werden", sagte der Kirchendiener, "denn wenn ich mein Lamm verkaufe, so kann ich mir genug Kugeln kaufen."
Darauf sagte das Männchen zum Kirchendiener, der sich indessen ein wenig gefaßt hatte: "Sprich nicht so voreilig, ich weiß nicht, ob du dir solche Kugeln kaufen kannst, wie ich sie besitze; wenn du aber nicht willst, so behalte dein Lamm, ich brauche es nicht."
Der Kirchendiener, der jetzt an den Topf dachte, ging endlich auf den Tausch ein.
Das Männchen verschwand und kam nach einiger Zeit mit einer Kugel wieder, die aus Holz zu sein schien. Sodann sprach es zum Kirchendiener: "Wenn du diese Kugel gebrauchen willst, so lege sie auf die Erde und sprich: ‚Kugel, sei höflich, und nimm die Mütze ab'; du wirst die Wirkung dann schon sehen. Jedoch hüte dich, wenn du die Kugel gebrauchst, etwas offen zu lassen."
Der Kirchendiener nahm die Kugel in die Hand, aber er konnte sie kaum halten, so schwer war sie. Er band sie nun in ein Tuch und eilte voller Freude nach Hause.
Zu Hause angekommen, beschloß er den Versuch zu machen, schloß alle Fenster und Türen, legte die Kugel auf die Erde und sprach: "Kugel, sei höflich, und nimm die Mütze ab!"
Die Kugel fing an zu rollen, und zwar immer stärker und stärker, und endlich teilte sie sich in zwei Teile, und eine Menge kleiner Männchen hüpften aus derselben heraus und bedeckten den Tisch mit goldenem Geschirr und köstlichen Speisen; sodann verschwanden sie wieder in die Kugel.
Die Familie setzte sich nun zum Mahl und ließ es sich wohl schmecken. Kaum hatten sie gegessen, so teilte sich die Kugel, und die selben Männchen, die früher den Tisch gedeckt hatten, räumten ab und verschwanden mit dem goldenen Geschirr in die Kugel, die sich, als alle drinnen waren, wieder schloß.
Lange besaß die Familie diese Kugel, und man ging mit ihr vorsichtiger um als mit dem Topf. Allein nach und nach wurde es im Ort bekannt, daß der Kirchendiener eine Zauberkugel besitze, und es kam auch zu den Ohren des Klostervorstehers. Dieser ließ den Kirchendiener vor sich kommen und befragte ihn, ob das, was man von ihm spreche, wahr sei.
Anfangs wollte der Kirchendiener mit der Farbe nicht heraus, als ihm aber der Vorsteher mit Entlassung drohte, gestand er alles der Wahrheit gemäß. Der Vorsteher befahl dem Kirchendiener, die Kugel zu bringen. Der gehorchte, und nachdem er erklärt hatte, wie man mit der Kugel zu Werke gehen müsse, entließ ihn der Vorsteher mit der Versicherung, ihm eine einträglichere Stelle zu verschaffen.
Allein diese ließ sehr lange auf sich warten, und der Kirchendiener entschloß sich, noch einmal auf den Berg zu gehen und das Männchen um eine andere Kugel zu bitten. Er kaufte deshalb zwei Ochsen und trieb sie nach der Stadt. Wie er auf dem Berg ankam, ruhte er aus. Aber kaum hatte er sich niedergesetzt, so war auch schon das Männchen da.
Es fragte ihn: "Kommst du wieder eine Kugel holen?"
"Ja", war die Antwort des Kirchendieners. "Ich möchte aber gern eine noch bessere Kugel haben, deshalb habe ich zwei Ochsen mitgenommen."
"Du sollst sie haben", antwortete das Männchen, verschwand und brachte eine etwas größere Kugel als das vorige Mal. Diese gab es dem Kirchendiener mit den Worten: "Was du zu tun hast, weißt du."
Der Kirchendiener bejahte es und entfernte sich. Als er zu Hause ankam, schloß er alle Türen und Fenster, legte die Kugel auf den Boden und sagte: "Kugel, sei höflich, und nimm die Mütze ab!"
Die Kugel fing an zu rollen, und zwar immer schneller und schneller, und teilte sich endlich; aber welcher Schrecken - statt der kleinen Männchen mit goldenen Schüsseln kamen zwei Riesen mit ungeheuren Knütteln aus der Kugel und schlugen alle so unbarmherzig, daß sie ohnmächtig auf dem Boden herumlagen. Dann kehrten sie wieder in die Kugel zurück.
Der erste, der sich von der Ohnmacht erholt hatte, war der Kirchendiener, und dieser beschloß, sich an seinem Vorgesetzten furchtbar zu rächen. Er nahm die Kugel und ging zu dem selben, allein er erhielt keinen Einlaß, weil Gäste da wären. Das war dem Kirchendiener noch erwünschter; er ließ nämlich dem Vorsteher des Klosters melden, daß er nun eine weit bessere Kugel besitze.
Dieser ließ ihn sogleich rufen und forderte ihn auf, das Kunststück vor der ganzen Gesellschaft zu zeigen. Der Kirchendiener legte die Kugel auf den Boden und sprach: "Kugel, sei höflich, und nimm die Mütze ab!"
Die Kugel teilte sich in zwei Teile, und die zwei Riesen fielen mit ihren Knütteln über die wehrlosen Gäste her und schlugen sie so derb, daß sie wie Mücken am Boden herumlagen. Nur der Vorsteher hatte die Besinnung nicht ganz verloren und schrie fortwährend zu dem Kirchendiener, er solle die zwei Teufel zur Ruhe bringen. Allein der Kirchendiener entgegnete ihm: "Nicht früher werden sie ruhen, bis ich meine alte Kugel habe."
"Da ist der Schlüssel zu jenem Kasten, und in diesem ist die Kugel", sprach der Vorsteher, und die beiden Riesen zogen sich in die Kugel zurück. Der Kirchendiener ging zu dem Kasten hin, sperrte ihn auf, nahm die Kugel und ging mit beiden nach Hause.
Er benützte die kleinere Kugel noch lange Zeit. Eines Tages hatte er seine Freunde zu sich geladen, und als alle beisammen waren, nahm er die Kugel, legte sie auf den Boden und sprach: "Kugel, sei höflich, und nimm die Mütze ab!"
Die Kugel fing an zu rollen. Aber während sie rollte, trat jemand in die Stube, und die Kugel flog durch die offene Tür ins Freie. Alle stürzten hinaus und liefen der Kugel nach, aber diese rollte immer schneller und teilte sich endlich, worauf eine Unzahl kleiner Männchen aus der Kugel herauskamen und mit allerlei Goldsachen davon eilten. Und zwar liefen die Männchen auf die Berge, wo sie jetzt noch das Gold hüten.
Auch die andere Kugel war durch die offene Tür hinaus geflogen und hatte sich ebenfalls geteilt. Allein aus dieser kamen keine Männchen, sondern nur eine Schar Riesen, welche ebenfalls ins Gebirge flüchteten. Und dort halten sie sich noch immer auf.
Theodor Vernaleken
DIE ZWEI SCHÄCHTELCHEN ...
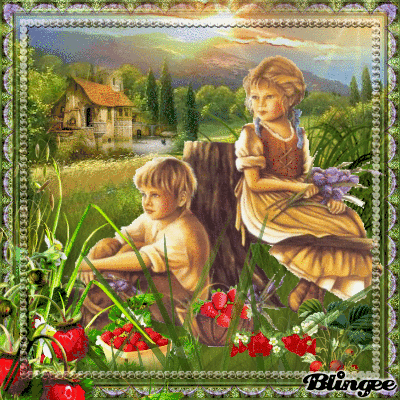
Es waren einmal ein Mädchen und ein Bübchen, die nahmen einander bei der Hand und gingen in den Wald hinaus, wo sie einen Platz wußten, der von Erdbeeren dicht überwachsen war. Als sie dort ankamen und die roten Dingerchen ihnen entgegenlachten, juchzten sie auf vor Freude, nahmen ihre Körbchen hervor und knieten auf den Boden hin. Sie pflückten, soviel nur die Hände ertaten 1), und schauten nicht rechts und nicht links.
Als sie beide die Körblein voll hatten, stellten sie sie beiseite und fingen nach Herzenslust zu essen an. Es war ihnen wie dem Vogel im Hanf, und sie aßen und aßen, ohne ans Heimgehen zu denken. Wenn sie aufhören wollten, so sahen sie wieder ein paar schöne und große Beeren unter den grünen Blättern hervorgucken, die sie unmöglich stehenlassen konnten. Hatten sie aber wieder angefangen, so konnten sie nicht sogleich wieder aufhören.
Als es aber anfing, dunkel zu werden und im Dorf Ave-Maria zu läuten, da sagten sie zueinander: "Jetzt müssen wir doch heimgehen, sonst übernachten wir hier." Sie nahmen ihre Körblein vom Boden, reichten sich die Hand und gingen heimwärts. Unterwegs kamen sie zu einem vermoderten Stock, darauf saß ein altes, zaggeltes 2) Bettelmandl, das ausschaute wie die liebe Not. Die Kinder erschraken, drückten die Händchen fester ineinander und wollten vorbeihuschen. Das Mandl aber redete sie an und sagte: "Liebe Kinderlen, wollt ihr mir nicht Läuse suchen?"
Der Knabe schaute das Mandl ganz verwirrt an und entschuldigte sich schleunig: "Das können wir dir heut' nimmer tun, es fängt schon an zu nachten, und wir müssen noch heimgehen." Sogleich wandte er sich wieder weg und wollte mit dem Mädchen fortlaufen.
Der Alte aber fiel schnell ein: "Mädele, du bist gewiß braver als der Bruder; geh, such du mir etliche Läus' ab." Das Mädchen machte sich vom Brüderl los, ging zum Alten hin und suchte ihm Läuse. Als das geschehen war, zog das Mandl zwei Schächtelchen hervor und gab eines dem Mädchen und eines dem Bübchen, verbot ihnen aber, die Schächtelchen zu öffnen, bevor sie nicht daheim wären.
Mädchen und Bübchen gaben sich wieder die Hand und liefen mit ihren Körbchen und Schächtelchen der Heimat zu. Sie hätten so gern gewußt, was etwa in den Schächtelchen sei, getrauten sich aber doch nicht, sie aufzumachen.
Wie sie heimgekommen waren und in die Stube traten, stellten sie sogleich ihre Körbchen beiseite, und das Mädchen fing an, sein Schächtelchen vorsichtig aufzumachen. Neugierig schauten beide mit großen Augen auf die Schachtel - und juchhe! wie freuten sie sich, als der Deckel aufging und eine ganze Schar Engelein heraushüpfte und in der Stube herumflog. Die Kinder wollten nicht aufhören zu juchzen und zu lachen und zu springen und in die Hände zu klatschen.
Aber jetzt dachte sich der Knabe: Ich muß doch mein Schächtelchen auch aufmachen. Er nahm es und tat vorsichtig den Deckel auf, aber schreiend warf er Schachtel und Deckel weg, lief der Mutter in die Arme und verbarg sein Angesicht in ihrer Schürze: Lauter kleine Teufelchen waren aus dem Schächtelchen geschlüpft und hüpften jetzt in der Stube umher und machten ihre Sprünge um den weinenden Knaben.
Siehst du, böser Bub, da hast du's! Warum hast du dem Alten nicht getan, worum er dich gebettelt hat!
1) ertun: tun können, zuwege bringen
2) zaggelt: zerlumpt
aus dem Ötztal
DIE WUNDERBARE RETTUNG ...

Vor vielen Jahren lebte ein König, der ein großes Reich beherrschte. Einst rüstete er sich zu einem Jagdzug; da er aber, um in das Jagdrevier zu gelangen, übers Meer fahren musste und die Jagd auch mit vielen Gefahren verbunden war, so sagte er bei der Abfahrt zu seiner Gemahlin:
»Da ich bei dieser Jagd umkommen könnte, dieselbe auch lange dauern dürfte, müssen wir uns ein Merkmal geben, um uns wiederzuerkennen; stecke diesen Ring an deinen Finger, er ist demjenigen, den ich trage, ganz gleich; an ihm werden wir uns erkennen. Komme ich aber binnen zehn Jahren nicht zurück, so kannst du sicher sein, dass ich nicht mehr am Leben bin, und nach Ablauf dieser Frist wähle dir einen anderen Gemahl.«
Nach mehreren Tagen glücklicher Fahrt landete er mit zwanzig Mann seiner Getreuen und zwanzig Pferden in seinem Revier. Sie streiften umher und hatten eine ergiebige Jagd, doch bei einem Zug, den sie unternahmen, verirrten sie sich. Sie kamen in einen Wald, wo die Bäume magnetisch waren, deshalb konnten sie aus demselben nicht herauskommen. Es war in dem Wald aber auch kein Wild, weshalb der König und seine Leute große Not litten und die Pferde töten und essen mussten, um nicht zu verhungern. Nur das des Königs ließen sie leben.
Trotzdem waren neunzehn Leute den Anstrengungen erlegen, nur der König und ein Mann waren noch übrig. Die beiden hielten Rat, wie sie aus diesem Wald wegkommen könnten. Der Mann, der dem König noch übrig geblieben war, wusste, dass in diesem Wald ein ungeheurer Vogel hauste, der zwölf Köpfe hatte. Darauf gestützt, fasste er einen sonderbaren Plan. Das Pferd, das sie noch besaßen, solle getötet und der König in die Haut desselben eingenäht werden; er solle keine anderen Waffen als das Schwert und das Messer behalten, während der Mann sich nach dem Einnähen töten solle.
Der König wollte anfangs in diesen Plan nicht eingehen, doch nach vielem Hin- und Herreden nahm er denselben an, und es geschah, wie der Mann es wollte. Der König wurde auf der Spitze eines Berges, der sich in dem Wald befand, eingenäht, und dann tötete sich der Soldat selbst.
So war der König mehrere Stunden in einer sehr unbequemen Lage, bis endlich der Vogel kam. Der hob ihn auf, als wäre er eine Feder, und flog mit ihm davon, nicht wissend, dass er eine so edle Last trage. Er flog mit ihm mehrere Stunden durch die Luft, bis er sich in einem anderen Wald auf der Spitze einer ungeheuren uralten Eiche niederließ und den eingenähten König in sein Nest legte, in dem er seine Jungen hatte, die ebenfalls zwölfköpfig waren. Hier überließ er ihn seinen Jungen, während er selbst davon flog.
Der König hatte kaum bemerkt, dass der alte Vogel weg war, als er schon sein Messer hervorzog, die Pferdehaut durchschnitt, aus derselben kroch und sämtliche Jungen tötete. Schnell stieg er nun von dem Baum herunter und verbarg sich in der Nähe. Er hatte auch allen Grund dazu, denn der Vogel kam gerade wieder zurück.
Das Geschrei, das er ausstieß, als er seine Jungen getötet sah, war unbeschreiblich; das Brüllen eines Ochsen ist nichts dagegen. Mit seinen Flügeln peitschte er die Luft, so dass man es wohl stundenweit hören konnte. Durch dieses Geschrei wurde ein Löwe herbeigelockt. Der Vogel hatte ihn aber kaum bemerkt, als er sich wütend auf ihn warf, denn er dachte, dieser sei der Mörder seiner Jungen.
Der Löwe wäre bald unterlegen, wäre der König ihm nicht zu Hilfe geeilt; doch auch beide vereint hatten große Not mit dem Vogel, denn kaum hatte er ihm einen Kopf abgeschlagen, als er ihm auch schon wieder wuchs. Erst nach großen Anstrengungen gelang es ihnen, des Vogels Meister zu werden.
Nun glaubte der König, er würde es mit dem Löwen zu tun haben, doch wie wunderte er sich, als derselbe sich wie ein Hund zu seinen Füßen legte und ihm die Hände leckte. Sie wanderten viele Tage miteinander, und der Löwe versorgte den König mit Wild, bis sie endlich an einen Fluss kamen, der siedend heißes Wasser hatte.
Hier wollte der König ein Floß machen, um mit Hilfe des selben den Fluss hinabfahren zu können. Er erbaute sich zuerst eine kleine Hütte, um vor dem Regen sicher zu sein, dann nahm er das Schwert zur Hand, fällte Bäume und machte ein Floß; die Fugen verschmierte er mit Harz. Während er diese Arbeiten verrichtete, jagte der Löwe im Wald und versorgte den König so reichlich mit Speise, dass noch etwas auf die Reise übrig blieb.
Das Floß war gemacht und der König vollkommen reisefertig, nur der Löwe war noch abwesend. Da fasste der König den Plan, sich von demselben zu befreien, da er ihm noch immer nicht recht traute. Er stieg rasch auf das Floß und stieß vom Ufer ab, doch der Löwe kam gerade, mit einem Tier im Rachen, von seiner Jagd zurück, und als er den König auf dem Floß sah, stutzte er ein wenig, doch besann er sich nicht lange und sprang mit einem ungeheuren Sprung aufs Floß.
Aber nur mit den Vorderfüßen erreichte er dasselbe, das Hinterteil fiel ins heiße Wasser, so dass er sich tüchtig brannte. Infolgedessen gingen ihm die Haare an jenem Teil aus, und daher sind die Löwen bis auf den heutigen Tag hinten ganz kurz behaart. Nach einiger Anstrengung gelang es ihm, aufs Floß zu gelangen, wo er dem König einen Blick sandte, der ihm durch Mark und Bein ging. Doch war der Löwe großmütig und tat dem König nichts. Nun fuhren sie zusammen auf dem Floß; hatten sie keine Nahrung, so hielten sie an, und der Löwe ging auf die Jagd.
Sie waren viele Tage hindurch gefahren, jedoch immer durch unbewohnte Gegenden, bis sie endlich nach einigen Monaten zu einem Wirtshaus kamen. Sie gingen hinein. Im Zimmer war niemand als der Wirt, dem die sonderbare Kleidung des Königs auffiel, denn er war nur in Tierfelle eingehüllt; auch wunderte er sich über seinen Begleiter. Der König fragte den Wirt um den Namen des Landes, in dem er sich befinde, und es zeigte sich, dass er nicht mehr weit von seinem Schloss war; doch die Frist war beinahe abgelaufen.
Im Gastzimmer hing an der Wand ein Schwert, das sich von selbst bewegte und das der König um jeden Preis haben wollte. Da er aber kein Geld hatte, es zu kaufen, so nahm er es, als der Wirt auf einen Augenblick hinausgegangen war, von der Wand, während er sein eigenes an dieselbe Stelle hängte. Er gab dem selben einen Schwung und ging samt dem Löwen hinaus.
Sie stiegen aufs Floß und wollten fortfahren, doch es ging nicht, denn der Fluss war ganz voll von Gestrüpp und Schlingpflanzen. Der König hing nun das Schwert an die Spitze des Fahrzeugs, wodurch sie sich Luft machten, denn das Schwert fuhr hin und her und zerschnitt die Schlingpflanzen. So fuhren sie noch mehrere Tage, bis sie endlich am letzten Tag der Frist vor dem Residenzschloss anlangten.
Während dieser Ereignisse hatte die Königin in einem Zustand der Aufregung gelebt. Das Schiff, das den König mit seinen Leuten ins Revier geführt hatte, war zurückgekommen und hatte das Verschwinden des Königs gemeldet, deshalb drangen die Fürsten und Großen des Reichs in sie, sich einen anderen Gemahl zu erwählen, doch sie sagte immer: »Kommt er binnen zehn Jahren nicht zurück, so werde ich mir einen wählen, früher nicht.«
Die Fürsten aber drohten ihr, denn sie wollten nicht von einer Frau beherrscht werden, bis sie endlich einwilligte, sich zu vermählen. Die Trauung sollte am letzten Tag der zehn Jahre stattfinden. Der Bräutigam war gerade mit den Fürsten angekommen, um sich in die Kirche zu begeben, als die Heirat durch das Erscheinen des Königs verhindert wurde.
Der Bräutigam und auch die Fürsten widersetzten sich und wollten den König töten, doch er zog sein Schwert, welches so fürchterliche Verheerungen anrichtete, dass von den anwesenden Fürsten kein einziger am Leben blieb.
Der König lebte noch lange mit seiner Gemahlin und war sehr glücklich; der Löwe blieb immer sein treuer Gefährte, und als der König gestorben war, nahm er keine Speise mehr und starb auf dem Grab seines Herrn.
Theodor Vernaleken
DER ERLÖSTE ZWERG ...

Ein Taglöhner ging eines Morgens in einen Wald, um Holz zu sammeln. Da begegnete ihm ein Bettler, der mühselig auf Krücken einher humpelte und ihn fragte: »Wie weit ist es noch bis zum nächsten Dorf?«
Der Taglöhner antwortete: »Es ist wohl nur eine halbe Stunde, aber du wirst es vor einer Stunde nicht erreichen.« Der Bettler dankte und fragte weiter: »Möchtest du mir nicht einen Dienst erweisen?« »Recht gern, wenn ich nur nicht zuviel Zeit verliere, denn ich muss auf meinen Verdienst bedacht sein.« »Das sei deine geringste Sorge«, erwiderte der Bettler. »Wenn du mir den Gefallen erweist, so sollst du Geld in Hülle und Fülle haben.« »Und was kann ich für dich tun?« fragte der Taglöhner.
»Geh um Mitternacht«, sagte der Bettler, »dort auf jenen Felsen, der am Ende des Waldes sich erhebt, und klopfe da dreimal an die Erde. Dann wird ein Männlein erscheinen, das sollst du mit einem Stein töten; nimm dich aber dabei in Acht, denn wenn du das Männlein nicht gleich mit dem ersten Schlag tötest, so wird deine Bemühung fruchtlos sein. Du kannst dich übrigens beruhigen; befindest du dich in einer Gefahr, so brauchst du nur die Worte zu sagen:
‚Helft und kommt,
wenn es mir frommt.’
Wiederholst du dies dreimal, so wird dir stets geholfen werden. Wenn du deinen Auftrag glücklich vollzogen hast, so kehre auf demselben Weg wieder zurück, und ein Pfiff wird dir kundtun, dass ich im Wald dir nahe bin. Das weitere wirst du erfahren.«
Der Taglöhner hatte zwar einige Bedenken, aber die Aussicht auf Gewinn machte ihm frohen Mut für den Weg. Er stieg auf eine Anhöhe und gewahrte ein Schloss. Das entzog sich aber seinen Blicken, und an dessen Stelle sah er eine blutrote Fahne, welche an einer hohen Stange wehte. Als er immer näher ging, verschwand die Fahne, und er befand sich vor demselben Schloss, das er früher erblickt hatte.
Der Taglöhner trat hinein und setzte sich auf eine steinerne Bank im Vorhof, um zu sehen, was da kommen werde. Er bemerkte aber nichts und wollte aufstehen. Da fühlte er sich auf seinem Sitz festgehalten. In der Angst gedachte er des Sprüchleins und rief dreimal:
»Helft und kommt,
wenn es mir frommt.«
Da erschien ein kleines Mädchen und sagte, er müsse ein Stück von der Bank abhauen, dann könne er loskommen. Darauf verschwand es.
Der Taglöhner hatte nichts als sein Taschenmesser bei sich. Als er mit diesem den ersten Stoß gegen den Stein versuchte, spaltete sich das Messer in zwei Teile, und aus jedem Teil wurde ein Ei. Das machte ihn unmutig, und er warf die Eier an die steinerne Bank. Sie blieben aber unversehrt, dagegen lag ein Stück von der Bank auf der Erde, und er konnte frei aufstehen.
Er steckte nun die wunderbaren Eier zu sich und ging in das Schloss hinauf, um zu sehen, wer denn darin wohne. Im ersten Stock sah er eine große Tür offen stehen, die zu einem geräumigen Saal führte. Mitten in demselben sah er einen Riesen an einer reich gedeckten Tafel sitzen.
Als der Riese den Eintretenden erblickte, hieß er ihn willkommen und lud ihn ein, mitzuhalten. Verlegen setzte er sich zum Tisch. Der Riese war sehr gesprächig und erzählte ihm alle seine Abenteuer, wobei er sich seiner ungeheuren Stärke rühmte. Dabei wurde dem Gast sonderbar zumute. Er dachte hin und her, und es fiel ihm ein, dem gewaltigen Tischgenossen eines seiner Eier als Speise anzubieten.
Indem er aber in die Tasche griff, prahlte der Riese wieder, dass er imstande sei, einen festen Schrank mit einem Schlag zu zertrümmern. Dabei hieb er um sich und traf den Kopf seines Gastes so stark, dass dieser bewusstlos zu Boden fiel.
Als er endlich wieder zu sich kam, befand er sich zu seinem Erstaunen nicht im Speisesaal des Riesen, sondern nahe bei jenem Felsen, wo er das Männlein töten sollte. Er wartete, bis die Sonne untergegangen war. Da vernahm er einen Gesang; der von Knaben- und Mädchenstimmen herzurühren schien. Der Gesang kam immer näher, und der Taglöhner trat in ein Gebüsch, um von dort aus die Vorüberziehenden zu belauschen.
Da erschien ein Zug von Zwergen, hüpfend und singend. Unter ihnen war ein größerer, um welchen sich die kleinen fröhlich herumtummelten. Das muss ihr König sein, dachte sich der Lauscher, und vielleicht ist's der, welchen ich um Mitternacht töten soll.
Beherzt trat er hervor, ging auf den Zwergenkönig zu und redete ihn an: »Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu unterhandeln.« Der Zwerg gab einen Wink, und plötzlich verstummte der Gesang. Der Taglöhner führte ihn abseits und sagte: »Ich habe schon lange auf dich gewartet, weil ich dir mitzuteilen habe, dass ein böser Zauberer euch aus eurer Behausung vertreiben und all eure Schätze nehmen will.«
Der Zwerg wollte Näheres wissen, allein der Taglöhner entgegnete: »Für jetzt kann ich nichts mehr sagen, komm aber um Mitternacht zu jenem Felsen; ich werde dreimal klopfen, und dann erscheine ohne alle Begleitung.« Der Zwergenkönig versprach, pünktlich zu kommen, und zog dann mit seiner munteren Gesellschaft weiter.
Der Taglöhner war nun in Verlegenheit, da er nicht wusste, wann gerade Mitternacht sein werde. Er sagte daher sein Sprüchlein dreimal her, und es erschien ein Knabe, der sprach: »Mitternacht ist, sobald du ein dumpfes Rauschen vernimmst.« Nicht lange war der Knabe verschwunden, als der Taglöhner ein eigentümliches Rauschen hörte. Da nahm er einen Stein, klopfte dreimal an den Boden und der Zwerg erschien.
Während dieser grüßte und um nähere Mitteilungen bat, versetzte ihm der Taglöhner einen solchen Hieb auf den Kopf, dass er tot nieder sank. In dem Augenblick ertönte ein gellender Pfiff, und anstatt des erschlagenen Zwerges stand ein blühender Jüngling vor ihm, der nicht genug danken konnte für seine Erlösung. Um ihn standen eine Menge Edle und Knappen, welche gleich ihrem Herrn sich freuten.
Alle gingen nun den Berg hinab, und unterwegs erzählte der Jüngling folgendes: »Ich bin der Sohn eines Königs und samt meinem Gefolge in früher Jugend von einem bösen Zauberer geraubt worden. Nicht lange danach kam zu meinem betrübten Vater ein anderer Zauberer, der uns zu befreien versprach. Das war jener Bettler, welcher wusste, dass ich in einen Zwerg verwandelt war.«
So gingen sie eine Strecke des Weges miteinander und trafen im Wald statt des alten Bettlers den mächtigen Zauberer. Dieser begrüßte sie und führte alle an den königlichen Hof. Hocherfreut schenkte der König dem Taglöhner ein ungeheures Goldstück, dem der Zauberer noch die Eigenschaft verlieh, dass das Gold von niemand gestohlen werden konnte.
So wurde der arme Taglöhner ein reicher Mann.
Theodor Vernaleken
DER KÖNIGSSOHN ...

Vor alten Zeiten lebte ein mächtiger, weiser König, der herrschte weit über Land und Leute, und seine Untertanen waren zufrieden und glücklich, denn er regierte weise und milde und war ein Vater seiner Untergebenen. Als er nun alt und schwach geworden war und sein müdes Haupt die schwere Krone nicht mehr zu tragen vermochte, wollte er sie seinem ältesten Sohn übergeben, dass er sein Nachfolger im Reich werde.
Als aber die jüngeren Söhne dies hörten, traten sie zum alten König und sprachen: "Unser Bruder ist nicht recht bei Verstand und folglich zum König nicht geschaffen; gib einem von uns deine Krone, damit wir sie deiner würdig tragen und durch Einsicht und Tugend deinem Namen Ehre machen."
Da antwortete ihnen der König: "Damit ferner kein Streit unter euch sei, will ich euch eine Probe auferlegen! Geht hin in die Nachbarländer und wer mit dem schönsten Becher wiederkehrt, der soll König sein und ihr anderen sollt nicht mehr streiten, sondern in Gehorsam und Treue ihm untertan bleiben."
Mit frohen Herzen gingen die beiden jüngeren Brüder miteinander, den Becher zu suchen, der Älteste aber schritt allein durch den Wald und war traurig, dass seine Brüder ihm sein gutes Recht nehmen wollten und sagten, dass er nicht recht bei Verstand sei.
Als er so einige Zeit in Gedanken dahin gewandert war, stand plötzlich vor seinen Augen ein großes, prächtiges Schloss, das er noch niemals gesehen hatte, sooft er auch durch den Wald gegangen war. Tor und Türen standen offen und er konnte ungehindert hineingehen und die Stiege hinaufsteigen.
Er schritt durch das erste Zimmer, aber kein menschliches Wesen ließ sich darin sehen; er ging nun weiter und weiter durch eine lange Reihe der prachtvollsten Zimmer, bis er endlich an das letzte gekommen war. Da trat ihm eine Katze entgegen, setzte sich vor ihm auf die hinteren Füße und fragte ihn mit wohlwollender Stimme, was sein Begehren sei.
"Liebe Frau Katze," entgegnete ihr beherzt der Jüngling, "ihr könntet mir einen recht großen Gefallen erweisen, wenn ihr mir einen Becher bringt, denn das Glück meines Lebens hängt davon ab, dass ich einen schöneren nach Hause bringe, als meine beiden Brüder, welche auch ausgegangen sind, ein solches Kleinod zu suchen."
Die Katze nickte freundlich mit dem grauen Kopf, ließ sich auf ihre vorderen Pfoten nieder und eilte davon. Wenige Augenblicke waren verstrichen, so kam sie wieder und legte einen großen, prächtigen Becher in die Hände des Jünglings.
Er konnte sich aber vor Erstaunen und Freude kaum fassen, als er den schönen, funkelnden Becher sah. Er war aus purem Gold und Edelstein. Wundersame Bilder waren darauf ausgeprägt, Schlachten, Ritterfahrten und Hochzeiten, und der Becher gab einen so hellen Schein, als ob die untergehende Sonne ihre vollen Gluten in das Zimmer geworfen hätte.
Als er endlich wieder zur Besinnung kam und der guten Katze für ihr schönes Geschenk danken wollte, war sie längst entschwunden und er stand allein und wusste nicht recht, wie ihm geschehen war. Schnellen Schrittes eilte er nun über die Treppe und durch den Wald nach Haus. Dort waren seine Brüder mit ihren Bechern schon angekommen und erwarteten ihn.
Als er nun mit seinem herrlichen, leuchtenden Pokal zu ihnen hin trat, mussten sie wohl selbst gestehen, dass er das schönste Kleinod gefunden habe und von Rechts wegen die Krone verdiene; aber sie bestürmten nur desto mehr ihren alten Vater ihnen noch eine Probe aufzuerlegen, und hörten nicht auf zu flehen, bis er endlich ihren Bitten nachgab.
"So geht denn in Gottes Namen", sprach er, "noch einmal aus und wer das schönste und beste Schwert heimbringt, der soll ohne allen Widerspruch König sein und die anderen sollen ihm gehorchen."
Zufrieden mit diesem Spruch eilten die beiden jüngeren Brüder wieder gemeinsam fort. Der Älteste aber ging in den Wald und dem Schloss zu, wo seine Wohltäterin, die Katze, wohnte. Dieses Mal war sie ihm schon auf der Treppe entgegengekommen und fragte ihn mit schmeichelnder Stimme, was er wolle.
"Liebe Katze", entgegnete er, "sei doch so gut und bring mir ein recht schönes und gutes Schwert; du wirst mich zu ewigem Dank verpflichten, denn wenn ich ein schöneres heimbringe als meine Brüder, so werde ich König sein und sie müssen mir dienen."
Die Katze nickte freundlich mit dem grauen Kopf, sprang lustig davon und kam bald mit einem großen, schönen Schwert wieder, das sie mit dem reichen Wehrgehänge dem erstaunten Jüngling um die Hüften gürtete. "Kehrst du noch einmal zurück", rief sie ihm zu, indem sie ihm ihre weichen Pfoten zum Abschied entgegenstreckte, "so fasse mich nur an den beiden Hinterfüßen, trage mich in die Küche und schlage mich so lange an den Herd, bis du nichts mehr von mir siehst."
Mit diesen Worten war die Katze entschwunden und der Jüngling kehrte nach Hause zurück und dachte hin und her, was diese Rede wohl bedeuten möchte. Als er bei Hofe anlangte waren seine Brüder mit ihren Schwertern schon angekommen und glaubten sicher, dass sie den Preis erringen würden.
Aber so schön ihre Waffen auch waren, sie konnten sich mit dem Schwert ihres Bruders nicht vergleichen und der Alte zögerte nicht, dem Sieger seine Krone als Preis zuzuerkennen. Da traten die beiden jüngeren Söhne noch einmal zu ihm und ließen nicht nach ihn mit Bitten und heißen Tränen zu bestürmen, ihnen nur noch eine letzte Probe zu gestatten, bis er endlich ihren Worten nicht länger widerstehen konnte und in ihr Begehren einwilligte.
„So geht denn zum dritten und letzten Mal hin und wer die schönste Braut nach Hause bringt, der soll sie zur Frau haben und König sein."
Darüber waren nun die beiden jüngeren Brüder sehr erfreut und der Älteste gab sich damit zufrieden, denn er zweifelte nicht, dass seine Freundin, die Katze, ihm in dieser letzten und härtesten Probe beistehen werde. Ohne sich lange zu besinnen eilte er durch den Wald dem Schloss zu und erinnerte sich gar wohl des Auftrages, den er das letzte Mal erhalten hatte.
Als er zum Schloss kam, stand die Katze schon unter dem Tor, winkte ihm entgegen und fragte ihn gar freundlich, was denn diesmal sein Begehren sei. Der Jüngling aber antwortete ihr nicht, sondern hob sie an ihren hinteren Füßen empor, trug sie in die Küche und schlug sie so lange an den Herd, bis er nichts mehr von ihr sah.
Da war es plötzlich, wie wenn eine Wolke vor seinen Augen zerronnen wäre, und eine herrliche Jungfrau stand vor ihm, schön, wie er noch keine gesehen, und er hielt den goldenen Saum ihres langen, wallenden Gewandes in seinen bebenden Händen.
"Willst du mit mir zu meinem Vater kommen?" sprach der entzückte Jüngling, indem er die errötende Jungfrau mit seinen Armen umschlang, "so sollst du meine Braut und Königin sein." Sie winkte ihm lächelnd entgegen und reichte ihm ihre weiße, zarte Hand, auf dass er sie zu seinem Vater führe.
Unterdessen waren die beiden jüngeren Söhne schon mit ihren Bräuten gekommen und harrten mit klopfendem Herzen des ältesten Bruders. Als nun dieser mit der herrlichen Jungfrau in den Saal trat, da neigten sich alle in Ehrfurcht vor ihr und der alte König stieg vom Thron nieder und setzte die goldene Krone auf das Haupt des ältesten Sohnes.
Er legte einen blühenden Kranz um die Locken der Jungfrau, die Brüder huldigten ihrer Königin und gestanden es zu, daß ihr Bruder den höchsten Preis errungen habe.
Da kommt die Maus,
Das Märlein ist aus.
Kinder- und Hausmärchen aus Tirol
DER ARME SPIELMANN UND DIE GOLDENEN SCHUHE ...
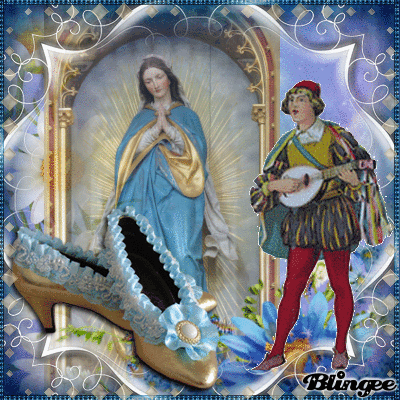
Es war einmal ein armer Spielmann. Er reiste jahraus, jahrein in der weiten Welt umher, geigte und sang überall, wohin er kam, und brachte sich mühsam mit den paar Kreuzern, die er dabei
verdiente, fort.
Auf seiner Wanderung kam er auch einmal zu einer Kapelle. Weil er gerade voll frommer Gedanken war, ging er hinein und spielte und sang ein Lied zu Gottes Ehr', so schön und so gut er es konnte.
Wie er so in Eifer und Andacht sang und die Saiten strich, erhellte sich plötzlich das Antlitz der Muttergottesstatue, und einer ihrer goldenen Schuhe fiel herab und dem Spielmann zu Füßen. Da
erschrak er nicht wenig, doch dann sagte er zu sich: "Wart, den nehme ich mit, weil er so wunderschön ist, der Schuh, und gar so hell funkelt. Denn: Ist die Gabe noch so klein, muss man doch
zufrieden sein!"
Der arme Spielmann wusste ja nicht, dass der Schuh aus purem Gold war.
Und er zog weiter und kam zu einem Bauernhaus, dort fragte er, ob man ihm den Schuh für wenig Geld abkaufen wolle.
‚Nein, nein, mein Lieber', dachte der Bauer, ‚den Schuh hast du gestohlen, und es wäre dir recht, wenn ich ihn kaufe. So etwas Feines!' überlegte er weiter, ‚aus Leder ist dieser Schuh bestimmt
nicht.' Und laut sagte er: "Geh damit in den Marktflecken zum Schuster, der nimmt ihn dir vielleicht ab, ich kann ihn nicht kaufen." Dann bezeichnete er dem Spielmann den Weg und beschrieb auch
genau das Haus, in dem der Schuster zu finden war.
Der Spielmann ging hin, sang und geigte und zog dann den goldenen Schuh heraus.
"Wollt Ihr ihn nicht kaufen?" fragte er den Schustermeister.
Doch auch diesem kam die Sache nicht geheuer vor, und er sagte zum Spielmann: "Mit dem Schuh kann ich nichts anfangen, denn er ist nicht aus Leder." Und er gab ihm den Rat, zu einem Goldschmied
zu gehen, nannte ihm einen und wies ihm den Weg dahin.
Der Spielmann wanderte nun in die Stadt, kam vor das Haus des Goldschmieds und ging hinein. Da sang er wieder ein Lied und bot dann dem Meister den Schuh an. Der machte große Augen, als er
merkte, dass der Schuh aus purem Gold war.
"Ich will ihn dir gern abkaufen, doch muss ich vorher noch eine kleine Arbeit verrichten. Drum setz dich eine Weile nieder!"
Sprach's und gab draußen seiner Frau einen Wink, sie möge die Landwächter holen. Die waren im Nu zur Stelle und fragten den Spielmann streng, wo er den Schuh gestohlen habe.
"Gott im Himmel weiß, dass meine Hände stets rein waren und sind!" versicherte der arme Spielmann.
Doch die Landwächter schenkten ihm keinen Glauben, obgleich er beteuerte, dass ihm die Gottesmutter in der Kapelle den Schuh herab geworfen habe. Sie schleppten den Spielmann vor den Richter, der
ihn zum Tod am Galgen verurteilte.
Am dritten Tag danach wurde der arme Spielmann mit einer Schlinge um den Hals hinaus zum Richtplatz geführt. Da klagte er recht jämmerlich und bat um eine letzte Gnade. Er sagte: "Führt mich doch
zu der Kapelle und lasst mich noch einmal dort spielen!"
Da wurden die Landwächter von Mitleid ergriffen und gewährten ihm die Bitte. Als sie vor dem Altar standen, setzte der Spielmann seine Geige an und spielte so wehmutsvoll und innig, dass er alle
Herzen rührte.
Auf einmal erhellte sich wieder das Antlitz der Marienstatue, und sie warf dem Spielmann den zweiten Schuh herab. Die Landwächter erschraken über das Wunder und erkannten nun, dass der Spielmann
nicht gelogen hatte. So ließen sie ihn mit den beiden goldenen Schuhen seines Weges ziehen.
Er aber ging wieder zurück zum Goldschmied, der ihm nun die kostbaren Schuhe abkaufte. Der Spielmann hatte jetzt so viel Geld, dass er nicht mehr in der Welt umherwandern musste, sondern
glücklich und zufrieden seine Tage beschließen konnte.
Ein Märchen aus Österreich
NOTWENDIGKEIT DES SALZES ...
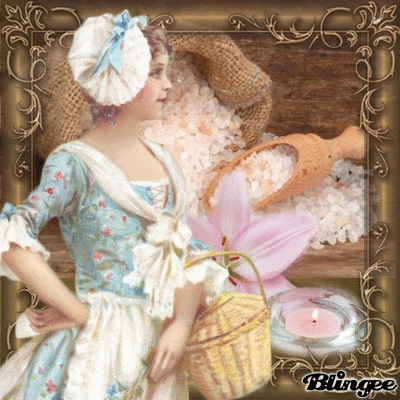
Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, die er alle drei recht herzlich liebte, weil sie brav und schön waren. Er wußte nun nicht, welche von den dreien er zur Königin bestimmen sollte.
Als sein Geburtstag vor der Türe stund, ließ er die Töchter vor sich kommen und sprach zu ihnen: "Meine lieben Kinder, ich hab' euch alle drei recht herzlich gern und wußte lange nicht, welche von euch ich zur Erbin meines Thrones einsetzen sollte. Nun aber bin ich mit mir eins geworden, daß diejenige von euch, welche mir etwas zu meinem Geburtsfeste bringt, was im menschlichen Leben höchst notwendig ist, Königin werden soll. Geht also und bedenkt euch die Sache mit allem Fleiße !"
Als der Geburtstag des alten Königs herankam, da brachten ihm die zwei ältesten Töchter sehr notwendige, aber zugleich höchst kostbare Dinge zum Geschenke. Die jüngste aber brachte in einem verzierten Gefäße nichts mehr als ein Häuflein Salz. Wie der König dies ihr Geschenk sah, ward er über und über zornig, jagte seine Tochter aus dem Schlosse und verbot ihr, sich jemals wieder unter seine Augen zu wagen.
Die verstoßene Königstochter zog nun mit tiefem Herzeleid in die ihr unbekannte Welt hinaus und nur das Vertrauen auf ihre Verständigkeit vermochte sie einigermaßen zu trösten. Nachdem sie eine gute Zeit so fortgegangen war, kam sie zu einem Wirtshause. Da fand sie eine wackere Wirtin, die das Kochen von Grund aus verstand.
Bei dieser ging sie in die Lehre und brachte es bald so weit, daß sie die Wirtin in der Kochkunst um ein gutes übertraf. Man redete nun weitum von der vortrefflichen Köchin, die in diesem Wirtshause sei, und jedermann, der des Weges kam und noch ein paar übrige Kreuzer in der Tasche klingen hörte, kehrte ein, um sich einen Braten oder was Vornehmeres geben zu lassen.
Der Ruf der berühmten Köchin drang auch zu den Ohren des Königs und bewog ihn, dieselbe als Hofköchin anzunehmen. Da trug es sich zu, daß die älteste Königstochter Hochzeit hatte und die berühmte Köchin das Hochzeitsmahl mit allem Aufwande bereiten mußte.
Am Hochzeitstage wurde also die eine vornehme Speise nach der anderen aufgetragen, so daß fast der Tisch krachte. Alles war vortrefflich gekocht und das Lob der Köchin ging von Mund zu Munde. Endlich kam auch die Lieblingsspeise des Königs. Dieser nahm schnell seinen Löffel und verkostete. "Die Speise da ist nicht gesalzen," rief er zornig, "laßt die Köchin vor mich kommen !"
Man lief also schnell um die Köchin und diese trat unerschrocken in den Saal. "Warum hast du meine Lieblingsspeise zu salzen vergessen, du nachlässiges Mädel!" barschte sie der König gleich an. Die Köchin aber antwortete: "Ihr habt ja eure jüngste Tochter verstoßen, weil sie das Salz für so notwendig hielt. Seht ihr jetzt vielleicht ein, daß euer Kind so unrecht nicht hatte ?"
Wie der König diese Worte hörte, erkannte er seine Tochter, bat sie um Verzeihung, hieß sie an seine Seite sitzen und nahm sie wieder als sein liebes Kind auf. Jetzt wurde die Hochzeit erst recht lustig und der König lebte noch viele Jahre nach dem Hochzeitstage freudig und liebevoll bei seinen Kindern.
Kinder- und Hausmärchen aus Tirol
DER SCHMIED IN RUMPELBACH ...
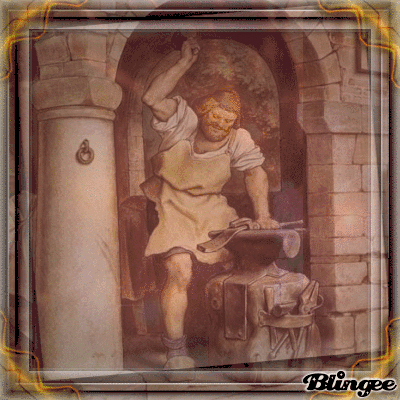
Der Schmied in Rumpelbach war stets ein kreuzbraver, arbeitsamer Mann gewesen. Er war aber so unglücklich, sein Geld bei solchen Leuten gut zu haben, deren Beutel zwar vom Gelde nicht leer, deren Herz aber davon noch voller war.
Da er nun trotz der sauren Arbeit nichts zu beißen hatte, so wurde er täglich mürrischer und kam in einer Nacht auf den Gedanken, ob denn für die Kargheit seiner Gläubiger nicht einige Klaster unter der Erde ein Kräutlein gewachsen sei. Nur wusste er nicht, wie er den Doktor, der dasselbe bringen sollte, herbeiholen könnte. Doch der Teufel ist bekanntermaßen ein Herr, der sich nicht lange laden lässt. Am anderen Morgen ging der Schmied, den Kopf voll Gedanken, in die Werkstätte und griff verdrießlich zum Hammer. Siehe da! ein schmuckes Herrlein im grünen Rock, den Hirschfänger an der Seite und die Flinte auf dem Rücken, tritt zur Türe herein.
"Wie geht's, Rumpelbacher?", lautete sein freundlicher Zuruf. "Ach, wie geht's; Arbeit genug und doch kein Geld!"
"Arbeiten und kein Geld haben, wie ginge das zu, das heißt ja säen ohne zu ernten." Der Schmied, zu einem langen Geschwätz nicht aufgelegt, fuhr den Junker barsch an: "Was hilft's reden, ihr könnt mir doch nicht helfen."
"Ich nicht helfen können", spöttelte der Teufel, und schob den Hut ein wenig bei Seite, so dass der Rumpelbacher ein krummes Hörnlein wohl wahrnehmen konnte. "Ah, wenn ihr der seid", entgegnete höflich der Schmied, in dem er die schmutzige Kappe abnahm, "dann ließe sich mit euch wohl ein Geschäft machen."
"Warum denn nicht? Aber wisse, dass ich für alle Dienste, die ich dir erweise, keine geringere Belohnung nehme als deine Seele und diese will ich nicht später holen als nach sieben Jahren."
Diese Worte fuhren dem Schmied durch Mark und Bein; er stand eine Weile stumm da, wollte dann eine Entschuldigung hervorstottern, hatte aber nicht den Mut, dem Teufel zu widersprechen.
Dieser schaute den Verzagten mit höhnischem Stolz an und machte Miene wegzugehen, als ihn der Rumpelbacher zurückhielt mit dem Ruf: "Nun, so sei's gewagt. Hör, was ich von dir für meine Seele verlange. Ich möchte eine Bank vor meinem Haus, wer sich auf der selben niedersetzt, der soll ohne meinen Willen nicht wieder wegkommen."
"Das kann ich dir wohl geben", fiel der Teufel hastig ein, "also unterschreibe."
"Oho", erwiderte der Schmied, "das geht nicht so leicht, für die Bank allein ist mir meine Seele zu teuer. Ich möchte auch noch einen Kirschbaum, wer auf den selben hinaufsteigt, soll ohne meinen Willen nicht wieder herunter kommen. Und weil aller guten Dinge drei sind, so gib mir auch noch einen Sack, wer in dem selben steckt, soll ohne meinen Willen nicht wieder herauskommen. Bringst du mir diese drei Stücke, so will ich dir meine Seele verschreiben."
Der Teufel willigte mit Freuden ein, zog ein gewaltiges Buch aus der Rocktasche hervor, in das selbe wurde der Vertrag geschrieben, und der Schmied musste seinen Namen mit seinem eigenen Blut unterzeichnen. Der Teufel entfernte sich und kam bald mit Sack, Bank und Baum zurück. Man mochte sich nur wundern, wie er alles tragen konnte; doch was könnte wohl der Teufel nicht ertragen!
Der Sack wurde in der Werkstätte hinterlegt, die Bank vor dem Haus aufgestellt und der Baum in den Garten gepflanzt. Dabei half der Teufel redlich mit und nachdem die Arbeit vorbei war, rief er: "Auf Wiedersehen in sieben Jahren!" Mit diesen Worten spazierte er von dannen.
Kaum war der Teufel weg, als eine dicke Bäuerin des Weges kam, deren Mann nicht selten ein Stück Eisen aus des Schmiedes Werkstätte geholt hatte, ohne seine Geldtasche dafür aufzutun.
"Gott willkommen, Bäuerin!" rief der Schmied, "nur nicht so geeilt! Gibt's nichts Neues im Außerdorf? Komm, setze dich zu mir auf die Bank und erzähl mir etwas."
Die Bäuerin mochte wohl das Verhältnis nicht ganz kennen, welches zwischen ihrem Hans und dem Schmied bestand, und setzte sich auf die Bank; denn das Plaudern war ihre Sache. Sie erzählte nun alles, von der Anna und Annamaria angefangen bis zum Zapfhannes und Ziegenpeter.
Als sie eben ihre Zeitung von vorn wieder anfangen wollte, guckte der Mond schon hinter dem nahen Berg herauf. Nun merkte sie erst, wie lange sie geplaudert hatte, und wollte aufstehen und nach Hause gehen. Doch wie erschrak sie, als sie umsonst sich zu erheben versuchte und der Schmied mit unbändigem Lachen ausrief: "Hab ich dich nun einmal! Nun kommst du mir nimmer Los, ehe mich dein Mann bezahlt hat."
Der Rumpelbacher eilte nun ins Haus zum Abendessen und zur Nachtruhe. Am anderen Morgen vernahm er in aller Früh ein ungestümes Gepolter an der Haustür. Er ging hinunter, um nach dem Lärmer zu sehen, und fand den Mann der Bäuerin, der ihm dreifache Bezahlung anbot, wenn er nur die "Urschi" vom Fleck ließe.
Der Rumpelbacher willigte freudig ein und der Bauer eilte mit seiner Ehehälfte beschämt nach Hause. Kaum waren sie weg, kam ein Bub daher gelaufen, dessen Vater beim Schmied nicht in bestem Andenken stand.
"He da, Junge!", rief der Rumpelbacher, "magst du Kirschen?" "Wie sollte ich keine Kirschen mögen? Her damit!"
"Steig nur auf den Baum hinauf da draußen im Garten und iss nach Herzenslust!"
Der Knabe ließ sich das nicht zweimal sagen. Im Nu war er hinter dem Haus und auf dem Baum. Da aß er nun Kirschen, es war eine Freude ihm zuzuschauen. Aber oh weh! als er vom Baume herabsteigen wollte, war alle Anstrengung umsonst. Es kam ihm vor, als sei er festgebunden, und er musste oben bleiben, mochte er wollen oder nicht.
Bald kam der Schmied, um nach dem neuen Fang zu sehen. Der Bursch bat mit weinerlicher Stimme um Befreiung vom luftigen Kerker, aber es half nichts. Der Schmied sprach: "Bevor mich dein Vater nicht bezahlt hat, sollst du mir vom Baum nicht herunterkommen."
Erst gegen Mittag ging der Vater des Knaben hinter dem Haus vorbei, um sein Kind zu suchen. Als er dieses auf dem Kirschbaum sah, schrie er zornig: "Gehst nicht herunter, Schleckermaul?" "Wenn ich nicht kann", jammerte der auf dem Baum, und zeigte dem Vater, dass alle Anstrengung herunter zu kommen vergeblich sei.
Unterdessen kam der Schmied aus dem Haus und lachte aus vollem Herzen. "Aha, hab ich deinen Vogel gefangen; nun mach schnell und bezahle, sonst bleibt mir der Junge ewig auf dem Baum sitzen."
Der Bauer merkte wohl, was damit gemeint sei, zog schnell den Beutel heraus und bezahlte dem Schmied das Dreifache von dem, was er schuldig war. Da war es dem Knaben, als ob er losgebunden würde, und er eilte mit seinem Vater beschämt nach Hause.
Der Schmied schob vergnügt das Geld ein und dachte eben daran, wie er auch von seinem Sack guten Gebrauch machen könnte, als ein Mädchen des Weges kam, das war pudelnärrisch, weil es bald heiraten sollte. Gretes Bräutigam war aber auch einer von denen, die dem Schmied das Bänklein, den Baum und den Sack notwendig gemacht hatten.
Grete lief freundlich auf den Schmied zu: "Guten Nachmittag, Meister Rumpelbacher! Wie geht's? Wie steht's?"
"Wie magst du um derlei Dinge fragen? Unsereinem geht's immer gut, wenn er nur Geld hat. Aber komm, Grete, und schau, was ich heute Neues in der Werkstatt habe. So einen Sack hast du dein Lebtag nicht gesehen."
Sie gingen nun mitsammen in die Werkstätte und der Schmied zog den ungeheuren Teufelssack aus der Ecke hervor. "Potz Blitz!" schrie das lachende Mädchen, "da drinnen könnte ich ja mit meinem Peter einen Walzer tanzen."
"So tanz halt", spottete der Schmied, indem er ihr den Sack über den Kopf warf, so dass sie von dem selben ganz bedeckt war. - Nun half kein Bitten und kein Flehen. Sie musste in dem finsteren Quartier bleiben, bis ihr Bräutigam kommen würde sie auszulösen.
Abends war im "Grauen Bären" ein Tanz angesagt. Peter wollte auch dabei erscheinen, ging den ganzen Nachmittag herum, seine Grete zu suchen, fand sie aber nirgends. Als er ungeduldig an der Werkstätte des Schmiedes vorbeikam, hörte er seine Grete bitten und weinen. "Wo bist du denn? Was fehlt dir?", fragte Peter erstaunt.
Da kam schon der Schmied des Weges daher und fuhr ihn barsch an: "Da heißt's einmal bezahlen, sonst kriegst du deine Grete bis zum jüngsten Tag nimmer."
Peter war erstaunt, wusste aber wohl, wo hinaus das Wort "zahlen" wollte, und als er seine Grete im Sack fand, bezahlte er schnell das Dreifache und eilte mit seiner Liebsten davon. Solche Streiche machte nun der Schmied gar viele und er war in kurzer Zeit ein reicher Mann.
Ein Jahr verstrich nach dem anderen, endlich ging auch das siebente Jahr zu Ende und es nahte der Tag, an welchem der Teufel den Schmied holen sollte. Dieser aber war immer guter Dinge. Am ersten Tag des achten Jahres kam das Herrlein im grünen Anzug in die Werkstätte und lud den Schmied höflich ein, ihm zu folgen.
"Ach, ich bin schnell fertig", entgegnete der Rumpelbacher, "ich möchte nur noch das Hufeisen fertig schmieden; setzt euch indessen ein wenig auf die Bank da draußen, denn ihr seid gewiss müde."
Der Teufel war ein dummer Teufel und setzte sich auf die Bank. Bald merkte er aber, dass vom Wegkommen nicht so leicht die Rede sei. Er fing nun an, den Schmied um seine Freilassung zu bitten. Dieser meinte aber: "Wenn du mir noch sieben Jahre hierzubleiben vergönnst, so lasse ich dich los." - Der Teufel ging endlich auf die Bedingung ein und machte sich verdrießlich aus dem Staub.
Auch in den folgenden sieben Jahren vergaß der Rumpelbacher nicht, seine drei Stücke gehörig zu gebrauchen. Aber die Zeit flog vorüber wie der Wind und der erste Tag des achten Jahres nahte. Das grüne Herrlein kam wieder früh morgens in die Werkstätte und tat noch freundlicher.
"Nun, Herr Schmiedemeister, wollen wir uns auf den Weg machen?" "Nur eine Viertelstunde noch", versetzte der Rumpelbacher, "und dann bin ich mit dieser Kette fertig. Ich habe einen schönen Kirschbaum im Garten, der steht voll der süßesten Kirschen. Tut euch indessen einwenig gütlich; denn ihr seid gewiss müde und durstig. Ich will euch die Leiter zurechtstellen." -
Wie gesagt, so getan. In einer Minute stand der Teufel auf dem Kirschbaum und spürte, dass er in die Falle geraten war. Er musste nun dem Schmied abermals versprechen, dass er erst in sieben Jahren kommen werde, ihn zu holen. So war er wieder der Betrogene und musste sich abermals allein auf den Rückweg machen.
Auch in den kommenden sieben Jahren mussten Bank, Baum und Sack gar oft ihre Dienste tun. Bald aber kam es so weit, dass niemand mehr beim Schmied etwas schuldig blieb aus Furcht vor den verrufenen Stücken. Der Rumpelbacher war nun der reichste Mann weitum und es quälte ihn nur die Sorge, ob es ihm glücken würde, den Teufel auch zum dritten Mal daran zu bekommen.
Der gefürchtete Tag kam heran und der Teufel erschien wieder in seiner vollen Tracht.
"Nun, Herr Schmied, sind's sieben Jahre. Heute wollen wir zusammen zu meiner Großmutter wandern." Der Rumpelbacher wusste sich in aller Eile zu fassen. "Aber mein lieber Herr! Geduldet doch einen Augenblick! Ich habe meinem Nachbar versprochen, heute noch sein Ross zu beschlagen, und wäre ein Lump, wenn ich mein Versprechen nicht halten würde. Ich werde geschwind hinüber laufen und den Schimmel holen. Damit es aber schneller geht, habt ihr wohl die Güte, indessen aus dem Sack da drüben 32 Nägel herauszufinden.
Der Schmied ging und der dumme Teufel kroch in den Sack, um die Nägel, die ganz in der Tiefe lagen, herauszubekommen. Als der Rumpelbacher mit dem Schimmel kam, schrie der Teufel im Sack aus voller Brust: "O weh, o weh, ich komme nimmer Ios! Lass' mich gehen. ich will gern alles tun, was du haben willst."
Dem Schmied lachte das Herz, als er sah, dass seine List geglückt war, und er begann: "Nun wenn du mir versprichst, all das Recht, was du auf mich hast, aufzugeben, so will ich dich loslassen. Willst du mir das nicht versprechen, so kannst du ewig in dem Sack sitzen und wirst noch dazu jeden Morgen tüchtig geklopft."
Der Teufel schrie voll Zorn: "Ja, ja! Mach nur, dass ich loskomme, ich verlange kein Haar von dir!"
Der Teufel wurde nun freigelassen und fuhr in seiner Höllengestalt mit furchtbarem Geräusch und Gestank durch die Lüfte hinweg. Der Schmied lebte noch viele, viele Jahre, er wurde tagtäglich reicher und dachte nicht viel an's Sterben. Aber auch ihm blieb sein Stündchen nicht aus.
Als er diese Erde verlassen hatte, wandelte er zuerst wohlgemut, pfeifend und singend der Hölle zu; denn drunten, meinte er, muss es lustiger sein als im Himmel droben. Als er zur großen Höllenpforte kam, pochte er mit seinem Hammer, den er als Andenken von der Welt mitgenommen hatte, so gewaltig an, dass er sie beinahe einschlug.
Des Teufels Großmutter, die eben allein zu Hause war und den Morgenkaffee trank, stellte ihre Schale beiseite und hinkte verdrießlich zum Tor: "Wer ist da draußen?"
"Der Schmied von Rumpelbach."
"Ah so! Kommst du jetzt, du Schurke! Glaubst du, du kannst die Teufel immer zum Besten haben. Pack dich nur, für dich ist hier kein Platz."
Während sie dies sagte, stellte sie schnell einige Kessel zur Tür, damit der Rumpelbacher diese nicht so leicht einrennen könne. Dieser aber dachte sich: "Was liegt daran, lässt man mich hier nicht ein, so gehe ich in den Himmel." Er kehrte schnell um und stieg einen langen und steilen Weg empor.
Als er vor dem Himmelstor stand, klopfte er ganz sittlich an das selbe - denn er hatte wohl gesehen, dass man mit Grobem nichts ausrichte. "Wer ist draußen?", rief St. Petrus, der himmlische Torwärter. "Der Rumpelbacher Schmied", ertönte laut die Antwort.
"Was glaubst du denn, Lumpen, die mit dem Teufel einen Pakt machen, könnten wir im Himmel brauchen? - Geh' du nur abwärts."
Das war nun dem Schmied ein wenig zu arg. - "Dass ich zu schlecht bin für die Hölle und zu schlecht für den Himmel - das hätte ich doch nie geglaubt", murmelte er ärgerlich vor sich hin - und ging wieder abwärts. Als er nun wieder an das Höllentor kam und sich als Schmied aus Rumpelbach anmeldete, war eben die ganze Teufelsfamilie zu Hause, und kleine wie große Teufel schrien zusammen: "Lasst ihn nicht herein, lasst ihn nicht herein! Bei dem könnte es uns übel ergehen!"
Der arme Schmied musste nun wieder umkehren, um auch an der Himmelstür das zweite Mal sein Glück zu versuchen. Er klopfte wieder ganz sittlich an und bat um Einlass. Petrus wies ihn aber mit noch herberen Worten zurück als das erste Mal.
"So lasst mich doch einen Augenblick in den Himmel hineinschauen!", flehte der Schmied. "Nun, das will ich dir gönnen, damit du uns einmal vom Halse bleibst", murrte Petrus und tat die goldene Himmelstür ein wenig auf. Kaum gewahrte der Schmied die kleine Öffnung, warf er seine alte Kappe in den Himmel hinein.
Petrus wollte ihm diese herausreichen, aber der Rumpelbacher sagte: "Ich kann mir meine Sache schon selber holen." Er wurde nun hineingelassen, um seine Kappe herauszutragen. Aber - kaum war er drinnen, so setzte er sich auf der selben nieder und rief frohlockend: "Nun sitze ich auf meinem Eigentum" und niemand konnte ihn wegschaffen.
Und wo ist denn jetzt der Schmied von Rumpelbach? Er sitzt noch im Himmel droben auf seiner Kappe und hört der englischen Musik zu.
Kinder- und Hausmärchen aus Tirol
DAS ALPENGLÜHEN ...
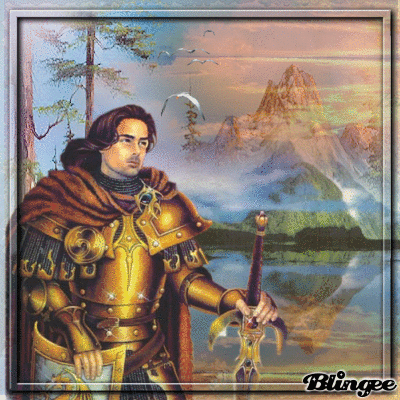
Der Rosengarten ist ein 3000 Meter hoher Dolomitberg bei Bozen; man preist ihn wegen seiner malerischen Formen, wegen seines Alpenglühens und wegen seiner Sagen.
Das Alpenglühen kommt freilich auch sonst im Hochgebirge vor. Wenn ein kahler Gipfel von den letzten Strahlen der sinkenden Sonne beleuchtet wird, dann "glüht" er, das heißt, er nimmt eine rötliche Farbe an und wird immer satter, immer dunkler, bis endlich der letzte Strahl erlischt. Dieses Alpenglühen nun zeigt sich gerade am Rosengarten in ganz besonderer Schönheit. Wenn die bergumgürtete Bozner Flur mit ihren Rebgeländen, ihren Zypressen und Pinien und ihren burgengekrönten Hügeln im Abendschatten liegt, dann beginnt der hohe Dolomitberg im Osten gar wundersam zu strahlen. Die lange Zackenkette seiner Felsgipfel färbt sich rot und scheint zu glühen, als ob ein Feuer im Innern des Berges wäre. Der Hauptgipfel hat eine tiefe Mulde, deren Rand auch im Hochsommer verschneit ist; der Schneefleck leuchtet während des Alpenglühens am seltsamsten. Man nennt diese Mulde "Das Gartl". An ihrem Grunde ist ein kleiner vereister See, der selten auftaut. Dort soll der Eingang in den Rosengarten sein - so berichtet die Sage.
Wißt ihr, was eine Sage ist? Etwas Uralt-Überliefertes, was nicht aus Büchern stammt, sondern von Leuten, die nicht lesen und nicht schreiben konnten. Wo sie die Sage her hatten, wußten sie nicht; sie war angeblich immer da und wurde erzählt und geglaubt. So ist auch der Rosengarten eine Sage; das heißt, der Berg nicht, denn der hat seine mächtige Wirklichkeit, aber die Geschichte vom Rosengarten und vom Alpenglühen das ist eine Sage. Und sie berichtet folgendes:
Es war einmal ein Alpenkönig, der auf einem Berge voll Rosen wohnte. Diese Rosen stammten noch aus der guten alten Zeit, in der es keinen Haß und keinen Totschlag gab. Da kamen einst fremde Krieger des Weges und ihre Rosse zerstampften die Rosen. Der König, der das nicht dulden wollte, wurde überwältigt, gefangen genommen und von den fremden Kriegern fortgeschleppt. In ihrer Halle banden sie ihn an einen Pfahl, ließen ihn singen und tanzen und lachten über ihn. Einmal schliefen sie dabei ein. Da näherte sich der Gefangene dem Feuer, das in der Mitte der Halle brannte, und versengte das Lederseil, mit dem er gefesselt war. Als das Lederseil zu brennen begann, riß es, und der Gefangene wurde frei. Auf abenteuerlichen Fahrten kehrte er zurück in seine Heimat. Als er aber den Berg erblickte, der über und über voll Rosen war und in der Sonne purpurn leuchtete, da sagte der heimkehrende König: "Diese Rosen mit ihrem Schein haben mich verraten; hätten die fremden Krieger nicht diese Rosen gesehen, so wären sie nie auf meinen Berg gekommen."
Also sprach er über die Rosen einen Zauber aus, damit sie weder bei Tage noch bei Nacht je wieder sichtbar sein sollten. Er hatte jedoch die Dämmerung vergessen, die nicht Tag und nicht Nacht ist. So kommt es nun, daß in der Dämmerung die Rosen wieder sichtbar werden, und dann steht der ganze Berg in rotem Glanze da. Das nennt man Alpenglühen.
Wenn aber das Alpenglühen aufstrahlt, dann treten die Menschen aus ihren Hütten heraus und schauen und staunen und haben eine Ahnung von der alten Zeit, wo alles schöner und besser war. -
Seht ihr, das ist eine Sage. Die Berghirten auf dem Rosengarten haben sie erzählt und gepflegt, vielleicht Jahrtausende lang, bis sie endlich aufgeschrieben wurde und in die Bücher kam. Es ist die Sage vom Alpenglühen. Aber an den Rosengarten, der so herrlich aufragt über der Bozner Flur, knüpfen sich noch weitere Sagen; von den Zwergen, von ihrem König Laurin, von der Prinzessin Similde und von dem Recken Dietrich von Berne.
Dolomiten Sagen
GESCHWIND WIE DER WIND ...
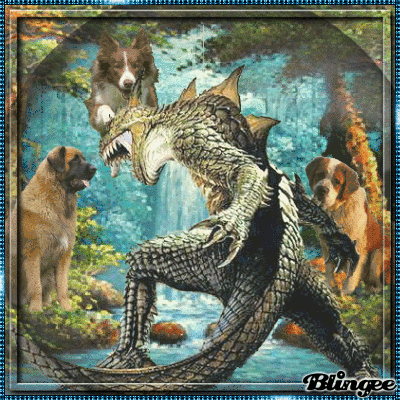
Es lag einmal ein alter Vater, der einen Sohn hatte, auf dem Totenbett. Als er dem Sterben nahe war, sprach er zu seinem Knaben, der am Bette stand und weinte, dass es ihm fast das Herz abstieß. "Jörgl, ich muss nun von dir fort in die Ewigkeit und kann dir nichts hinterlassen als die drei Hunde im Hundestall drunten. Sie werden dir treu und redlich dienen und wenn du brav und redlich bist, wirst du noch einmal dein Glück in der Welt machen." - Bei den letzten Worten verließ den Alten die Stimme, er sank ganz aufs Lager zurück und die Augen waren für immer geschlossen.
Jörg wusste wohl, was das zu bedeuten habe, und weinte vom Morgen bis zum Abend bei seinem toten Vater. So trieb er es zwei Tage lang. Am dritten Tag aber kamen zwei schwarze Totengräber, die trugen den toten Vater vom weinenden Knaben weg und begruben ihn. In das Stübchen, in dem der Vater gestorben, kamen aber andere Leute und der Jörg, der wohl recht arm war, musste sich fort trollen. Er nahm den Stecken seines Vaters, ein Stücklein verschimmeltes Brot, das von den Lebzeiten des Vaters her noch da war, und die drei Hunde mit sich und ging in die weite Welt.
Die Hunde hießen aber: Geschwind wie der Wind, Pack an, Eisenfest. Denn der Erste lief wie der Wind, der Zweite stürzte mit solcher Kraft auf die wildesten Tiere los, dass ihm keines widerstehen konnte, und der Dritte war so stark, dass er nichts, was er einmal gefasst hatte, los ließ und alles zermalmte.
Jörgl war mit seinen drei Begleitern schon weit, weit gegangen und bettelte sich Brot vor den Türen oder half, wo er konnte, auf dem Feld arbeiten, Heu mähen und Korn schneiden. Als er einmal wieder, es war gerade Sommer und die Sonne schien sehr heiß, mit seinen drei Begleitern weiter wanderte und ihm der Schweiß in großen Tropfen von der Stirn rann, sah er eine große Stadt mit hohen Türmen und großen, schönen Häusern.
Er ging auf sie zu und als er näher kam, sah er, dass alle Gebäude mit schwarzem Flor behangen waren, und die Türme waren auch mit schwarzem Zeug überzogen, sodass man nur die goldenen Knöpfe glänzen sah. Es kam ihm dieses so sonderbar vor und noch sonderbarer schien ihm die Stille, die er ringsum bemerkte, als er in die Stadt gekommen war. Da war alles öde und wie ausgestorben, kein Wagen rollte über das Straßenpflaster, kein Schmied hämmerte, kein Binder polterte, keine Seele regte sich.
Als er auf den Platz gekommen war, sah er ein Mädchen, das schwarz angezogen in einem irdenen Krug Wasser vom Brunnen holte. Auf das ging er zu und fragte es, was das alles zu bedeuten hätte. Das Mädchen erzählte ihm bestürzt, dass in der Nähe ein fürchterlicher Drache hause, der die ganze Gegend weitum verheere und täglich zwei Jungfrauen mit Haut und Haar auffresse. Jeden Morgen würde das Los geworfen und die Jungfrauen, die das Los treffe, würden dem unersättlichen Wurm geopfert.
Heute sei das Los auf die einzige, schöne Königstochter gefallen und deshalb sei alles in Trauer, selbst die Stadttürme. Der König sei ganz trostlos und habe dem, welcher die schöne Prinzessin befreien würde, seine Tochter und das ganze Königreich versprochen. Aber alles umsonst, denn jeder meide den gewissen Tod und niemand fände Lust, um die Königstochter zu werben.
Der alte König sei deshalb noch bestürzter und zerraufe sich den greisgrauen Bart. Es dauere nur noch eine Stunde, dann sei Mittag, und der scheußliche Drache müsste abgefüttert werden. Als das Mädchen ihm so erzählte, hörte er plötzlich Trompetenstöße und es kamen Herolde und ein Wagen, den sechs Schimmel zogen, und darin saß eine schöne Jungfrau mit goldenen Haaren und blauen verweinten Augen, die so schwarz wie die Nacht gekleidet war.
Der Wagen hielt mitten auf dem Platz still, ein Herold trat vor und rief: "Das ist des Königs Wille und Begehr. Wer seine schöne Tochter vom Drachen befreit, soll sein geliebter Schwiegersohn und Nachfolger werden." Und wieder war es still und öde. Als aber Jörg die schöne Königstochter so weinen sah, wurde ihm das Herz so weich, dass ihm selbst die Augen übergingen, und er dachte: Ich will es in Gottes Namen wagen, denn wird die Königstochter vom wüsten Drachen gefressen, kann ich des Lebens doch nimmer froh werden. Er trat deshalb vor den Herold und sagte: "Wenn es so ist, wie du sagst, will ich es mit dem Drachen probieren."
Die holde Königstochter wischte, als sie dieses hörte, ihre blauen Augen aus und sie lächelte dem Jörg so lieb und bittend zu, dass er vor Freude zitterte. Sie führte ihn nun zum alten, greisgrauen König und als dieser den Jörg sah und von seinem Vorhaben hörte, umarmte er ihn weinend und gab ihm seinen Segen.
Indessen war die Stunde verflossen und es schlug zwölf Uhr. Da musste Jörg hinaus zum Drachen, denn dieser fraß auch um die zwölfte Stunde zu Mittag. Jörg pfiff seinen drei Hunden, dem Geschwind wie der Wind, dem Pack an und dem Eisenfest, und ging eine Viertelstunde nach Norden, bis er in die Nähe der Drachenhöhle kam.
Kaum war er dort angekommen, kroch der Drache aus der Höhle, um das Essen in Empfang zu nehmen, und spie vor Hunger so viel Feuer aus, dass es dampfte wie in einer Esse. Kaum sah Jörgl das Ungestüm, rief er dem ersten Hund zu: "Geschwind wie der Wind!" und der Geschwind wie der Wind stürzte sich schnell wie der Wind auf den Drachen los, dass dieser ganz und gar erschrak.
Gleich rief Jörg dem zweiten Hund zu: "Pack an!" und dieser packte den wüsten Drachen mit solcher Kraft, dass der Wurm ihm nicht widerstehen konnte und nicht vom Fleck kam. "Eisenfest!" rief Jörg dem dritten zu und Eisenfest schlug seine Zähne in die harten Schuppen des Drachen ein dass sie zersprangen wie Glas und zerfleischte das Ungetüm, bis es tot war.
Jörg schnitt dem im Blut daliegenden Wurm die lange Zunge heraus und brachte sie dem traurigen König. Als dieser die Zunge sah, weinte er vor Freude, fiel dem Jörg um den Hals und ließ ihn wie seinen eigenen Sohn kleiden. Dann führte er ihn zur schönen Prinzessin, die nun das schwarze Kleid abgelegt hatte und die so schön war wie der Tag, und sagte: "Weil du mein Alles mir gegeben, so gebe ich dir alles."
Er legte dann die Hände beider ineinander und segnete sie. Und als er das getan hatte, fiel draußen die Musik ein und beide hielten sich lange an der Hand und sprachen kein Wörtchen, sondern sahen nur einander an, als ob sie sich in alle Ewigkeit nicht satt sehen könnten. Ihre Augen glänzten vor Freude, als ob sie beide im Himmel wären.
Und abends war Hochzeit, da hatten die drei Hunde auch einen recht guten Tag und fraßen, als ob sie gewusst hätten, was für ein Fest wäre. Jörg lebte aber viele, viele Jahre mit der Königstochter recht glücklich und als der alte König gestorben war, wurde er König und regierte, dass es eine Freude war. Die drei Hunde wachten an seinem Thron Tag und Nacht, bis auch er dem alten König gefolgt war.
Kinder- und Hausmärchen aus Tirol
DIE NEUN VÖGEL ...
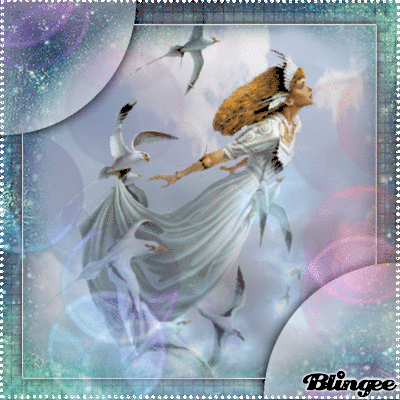
Einst lebte ein König, welcher eine Tochter hatte, die sehr grausam war. Schon in ihrer Jugend war sie sehr blutdürstig. So schnitt sie z. B. den Vögeln, die sie gefangen hatte, die Zunge oder die Füße ab und ließ sie dann fliegen; oder sie brannte ihnen die Augen aus. Wo sie einem Tier etwas zuleide tun konnte, tat sie es. Als sie älter wurde, vergrößerte sich auch ihre Grausamkeit, und sie wagte es, diese auch an Menschen auszuüben.
Sie ließ alle Bettler durch ihre Hunde aus dem Schloß hetzen, und je mehr sie von den Hunden zerbissen wurden, desto mehr Freude hatte sie.
Als nun ihr Vater gestorben war, kam ein Ritterssohn, um ihre Hand anzuhalten. Sie nahm diesen Antrag an, und der Trauungstag wurde festgesetzt.
Als dieser gekommen war, schickte sie den Ritter in einen andern Teil des Schlosses, daß er das Brautgeschmeide hole. Um in das bezeichnete Zimmer zu gelangen, mußte er über einen hölzernen Gang gehen, welcher so eingerichtet war, daß, wenn sie an einer Schnur anzog, derjenige, welcher darübergehen wollte, samt den Brettern in einen tiefen Brunnen fiel und darin noch das teuflische Lachen dieses grausamen Weibes hören mußte.
So waren schon neun Jünglinge zugrunde gegangen, als endlich einer kam, welcher all dies schon vorhergesehen hatte, da er ein Schwarzkünstler war. Sie hatte ihm schon ihre Hand zugesichert, und als sie ihn in jenes Zimmer schicken wollte, weigerte er sich und sagte, sie solle das Geschmeide selbst holen.
Sie redete ihm jedoch mit den freundlichsten Worten zu, er möge ihr doch diesen Gefallen tun.
Allein zornig erwiderte er: "Glaubst du, ich sollte der zehnte sein, der in dem Brunnen sein Grab findet? Diesmal wird es dir nicht gelingen, denn die Zeit der Vergeltung ist gekommen."
Über diese Rede erzürnt, befahl sie ihren Knechten, ihn zu binden und in den Brunnen zu werfen. Er ließ sich auch willig binden und in den Brunnen werfen, blieb aber auf dem Wasser und lächelte der Fürstin zu, welche in ihrer Wut Hand und Reich demjenigen zusagte, der ihren Feind töten würde. Da nahmen die Knechte ihre Armbrüste, und es zischten neun Pfeile nach dem Ritter. Die Pfeile aber verwandelten sich während des Fluges in Vögel, welche zwitschernd das Haupt des Ritters umkreisten.
"Wärst du nur hier, ich wollte dich schon töten", sagte sie. Er aber erhob sich samt den Vögeln aus dem Brunnen, und ehe sich alle recht besinnen konnten, war er im nächsten Wald verschwunden.
Dort schrieb er neun Briefe, worin er den Tod der neun Jünglinge schilderte, band jedem Vogel einen solchen Brief an den Hals und ließ sie durch Land und Städte fliegen.
Überall ließen sie ihre Briefe lesen und kehrten endlich zur Königstochter selbst zurück und übergaben ihr die Briefe.
Diese zerriß dieselben, rang aber unaufhörlich die Hände und jammerte fortwährend, da ihr Verbrechen nun an den Tag gekommen war. Sie legte auch ihren Schmuck ab, zog ein Trauergewand an und lebte in dem Wald, in dem sich der letzte Ritter samt den Vögeln niedergelassen hatte, als Einsiedlerin.
Die Vögel kamen täglich zu ihr und sangen die ganze Begebenheit, wie sie in den Briefen geschildert war, sie aber streute ihnen unter Tränen ihr Futter vor die Hütte und bereute tausendfach ihr Verbrechen. Als dieses nun gebüßt war, verwandelten sich die neun Vögel in Jünglinge, und diese verziehen der Königstochter ihr Verbrechen. Darauf verwandelten sich die neun Jünglinge in Engel und trugen die reuige Büßerin in den Himmel.
Theodor Vernaleken, Kinder- und Haus- Märchen aus Österreich
WINTERKÖLBL ...
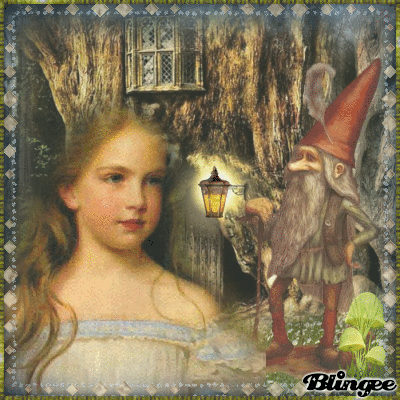
Es lebte einmal ein armer Holzhauer mit seiner Frau und seinem kleinen Töchterlein an einem großen Wald. Er wusste oft nicht, womit er den Hunger der Seinen stillen sollte, und nahm sich deshalb vor, seine Tochter in den Wald zu führen und dort zu verlassen.
Als er wieder einmal für sich und seine Familie nichts zu essen hatte und auch keine Arbeit bekommen konnte, nahm er das Kind mit in den Wald und verließ es auf einer schönen Waldwiese, mit dem Versprechen, bald wiederzukommen. Um das Kind zu täuschen, band er ein Stück Holz mittels eines Strickes an einen Baum, so dass der Wind es hin- und herschleuderte; das Anschlagen an den Baum machte ein Geräusch, als ob man mit einer Axt Holz fällte.
Das Kind wurde dadurch getäuscht, suchte Erdbeeren und spielte mit den Blumen; nach einiger Zeit schlief es müde vom Herumlaufen ein. Als es erwachte, stand der Mond schon hoch am Himmel, und der Vater kam noch immer nicht. Das Mädchen fing nun heftig zu weinen an und lief tiefer in den Wald hinein, um den Vater zu suchen.
Auf einmal erblickte es ein Feuer, neben welchem mehrere kleine topfförmige Gefäße standen. Neugierig lief es hin, legte geschäftig trockene Reiser auf das erlöschende Feuer und blies aus Leibeskräften hinein, um es zu verstärken. Als es sich umwandte, bemerkte es ein Männlein, welches ihm wohlgefällig zulächelte. Es war ganz grau, und der weiße Bart, welcher seltsam vom grauen Kittel abstach, ging ihm bis über die Brust herab.
Die Kleine fürchtete sich, und wollte davonlaufen; doch der Zwerg rief sie zu sich. Widerstrebend gehorchte das Kind; der Alte streichelte ihm die Backen und sprach so freundlich, dass es alle Furcht verlor und ihm beim Kochen behilflich war. Der Graue fragte um den Namen und wer sein Vater sei. Als das Mädchen es ihm mit Tränen in den Augen sagte, tröstete er es und meinte, es solle bei ihm bleiben und seine Tochter sein. Das Kind nahm es an und wurde von dem Alten in dessen Wohnung geführt. Es war dies ein großer hohler Baum, in welchem ein Haufen Laub die Stelle des Bettes vertrat. Das Männlein richtete noch ein zweites Lager her, damit sich das ermüdete Kind zur Ruhe legen konnte.
Am anderen Morgen weckte der Zwerg das Mädchen, und sagte, er müsse fortgehen, es solle unterdessen das Haus - so nannte er den Baum - in Ordnung halten, bis er wiederkomme. Er kam auch bald zurück und zeigte ihm alles, lehrte es kochen und die anderen häuslichen Verrichtungen; so verging der Tag schnell, und der Abend kam heran, ehe sie sich's versahen. —
So lebten sie mehrere Jahre ruhig und zufrieden; das Mädchen war herangewachsen, so dass es seinen Pflegevater bald kopfhoch überragte. Da sprach der Zwerg eines Abends zu ihm: »Ich muss jetzt auch für deine Zukunft sorgen; die Königin, welche hier in der Nähe wohnt, bedarf einer treuen Dienerin, und ich war dort und habe dich ihr empfohlen, sie ist gesonnen, dich aufzunehmen. Bleib nur fein sittsam, dein Leben lang wird es dir dann nicht schlecht gehen.«
Am anderen Morgen gingen sie zusammen ins Schloss, die Jungfrau wurde der Königin vorgestellt und von ihr aufgenommen. Von ihrem Pflegevater nahm sie herzlichen Abschied, und er musste versprechen, sie jeden Sonntag zu besuchen. Noch war sie nicht lange im Dienst, als der junge König, der mit einem anderen Krieg geführt hatte, als Sieger heimkehrte. Der junge König fand Gefallen an dem Mädchen und begehrte es zur Frau. Seine Mutter, welche die Jungfrau sehr gern hatte, willigte ein.
Als der Graue, wie man ihn im Schloss nannte, wieder einmal kam, um seine Tochter zu besuchen, sagte die Königin, dass ihr Sohn gesonnen sei, seine Tochter zu heiraten, dass auch diese eingewilligt habe und es jetzt nur noch auf ihn ankomme, seinen Wunsch auszusprechen.
Der Alte sagte mürrisch: »Der König wird nur dann mein Töchterlein bekommen, wenn er mir meinen Namen sagen kann.« Daraufhin entfernte er sich und ging wieder in den Wald zurück.
Im Wald angekommen, machte er wie gewöhnlich sein Feuer an und kochte. Während des Kochens hüpfte er oft um das Feuer und sang:
»Siede, Töpfchen, siede,
damit der König es nicht weiß,
dass ich Winterkölbl heiß'.«
Der König zerbrach sich den Kopf und schickte zuweilen einen Diener aus, damit er diesen erfahre. Ein solcher Diener hörte dem Alten einmal zu und eilte freudig ins Schloss zurück, sagte dem König den Namen und erhielt viele Goldstücke zur Belohnung.
Als der Zwerg wiederkam, begrüßte ihn der König mit den Worten: »Willkommen, Vater Winterkölbl!«
Dieser sah sich überlistet und gab seine Einwilligung. Die Hochzeit wurde festlich begangen, und auch Winterkölbl war zugegen. Er war aber nicht dazu zu bringen, in das Schloss zu ziehen, und wohnte nach wie vor in seinem Baum.
(Theodor Vernaleken)
DIE FAULE KATL ...
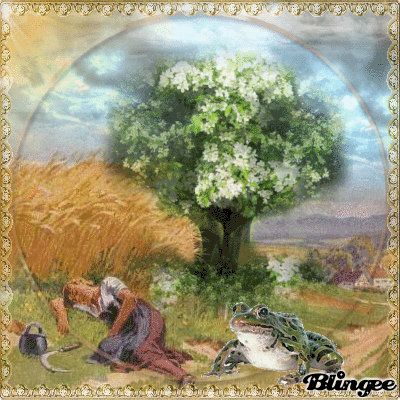
Es ist schon viel Wasser seitdem in dem Inn hinunter geronnen, da hatte einmal ein Wirt drei Töchter. Die zwei älteren waren brav und fleißig und arbeiteten zu Hause und auf dem Felde, die jüngste aber, die Katl hieß, war stinkfaul, schlief, bis ihr die Sonne in die Augen schien, und kümmerte sich weder um Keller noch um Küche.
Eines Tages mußte sie auf das Feld gehen, um dort zu arbeiten. Katl war aber wieder faul, wie immer, legte sich, als sie auf den Acker gekommen war, unter einen Kirschbaum und tat sich im Schatten gütlich. Bald war sie eingeschlafen, doch dauerte ihre Ruhe nicht lange, denn eine große Kröte kroch ihr über das Gesicht. Das Mädchen fuhr erschreckt auf und zitterte an allen Gliedern, als es das garstige Tier sah.
Die Kröte sah ruhig die faule Dirne an und sprach endlich: »Guigg, guagg. Katl geh mit mir! guigg, guagg!« Da dachte sich die Katl, bei diesem schmutzigen Tiere wird es nicht viel Arbeit geben und sagte: »Ja«. Nun patschte die Kröte durchs Feld hin, und die schläfrige Katl folgte ihr nach und gähnte. So ging es eine Zeit lang und dann kamen sie in den Wald, der an des Wirtes Güter grenzte. Die Kröte patschte eine Weile durch dick und dünn, und Katl folgte ihr.
Sie waren erst eine kleine Strecke gegangen, da stand ein großes herrliches Schloß vor ihnen, das Katl noch nie gesehen hatte, obwohl sie den Wald gut kannte. Die Kröte watschelte in die schöne Burg hinein und Katl ging nach und dachte bei sich: »Da ist's feiner, als in meines Vaters Wirtshause, wo einem die Gäste viel Arbeit machen«.
Als beide im Saale waren, fing die Kröte, die auf dem Wege kein Sterbenswörtchen verloren hatte, wieder zu reden an und sprach: »Guigg, guagg! Katl, jetzt mußt du sieben Jahre bei mir bleiben. Guigg, guagg, ja sieben Jahr darfst du dich nicht mehr waschen, nicht mehr kämmen und nichts Warmes mehr essen«. »Je,« dachte sich Katl, »das ist ein Schrecken! das will ich gerne tun,« denn die faule Dirne hatte die größte Freude an diesem Befehle der Kröte.
Katl wusch sich nie, kämmte sich nie und aß nie warme Speise. Sie lag Tag und Nacht und Nacht und Tag in ihrem Bette und stand höchstens auf, wenn sie der Hunger nötigte, aber auch dann trank sie nur kühles Wasser und aß hartes Brot. So verging ihr die Zeit schnell und ehe sie es wünschte waren die sieben Jahre zum Staube aus.
Der Jahrtag ihrer Ankunft im Waldschlosse war vor der Türe. Es wollte Abend werden und die Sonne sank schon hinter den Bergen, da begann es fürchterlich zu donnern, die Kröte patschte in den Saal, wo Katl faulenzte, und sprach: »Guigg, guagg, Katl, heute mußt wachen, heut darfst kein Auge zufallen lassen.« Ja, dachte sich Katl, jetzt hast sieben Jahre geschlafen, jetzt kannst wohl auch eine Nacht wachen, stieg aus ihrem Bette und setzte sich in einen seidenen Lehnsessel.
Indessen dunkelte es mehr und mehr und ein fürchterliches Gewitter zog am Himmel herauf. Kein Stern ließ sich sehen, nur Blitze zuckten durch die pechschwarzen Wolken und der Sturmwind heulte wie ein hungriger Wolf durch den zitternden Wald. Wie es schon spät war und der Sturm am ärgsten lärmte, läutete es am Schloßtore.
Als die Kröte das hörte, sagte sie zur Katl: »Guigg, guagg, laß es ein!« Katl ließ sich das gefallen, nahm die Lampe, stieg in den Schloßhof nieder und öffnete das Tor. Davor stand ein wunderschöner Rittersmann, der für die gastliche Aufnahme dankte und der Katl in den Saal folgte. Wie die Kröte den schönen Ritter, der vom Ungewitter hart mitgenommen war, sah, hüpfte sie auf und quakte: »Guigg, guagg! Katl etwas Warmes kochen und dann auch essen davon. Vor dem Auftragen mußt du dich aber waschen, kämmen und das Gewand anziehen.«
Bei den letzten Worten langte die Kröte aus einem Kasten ein so prachtvolles Kleid hervor, daß es Katl's Augen beinahe blendete. Die Dirne war zufrieden und dachte sich: »In sieben Jahren kannst du wohl einmal kochen und eine kleine Arbeit tun, besonders wenn du ein so schönes Kleid dafür bekommst.«
Katl ging in die Küche, feuerte an und gab einen Hasen, der auf der Anrichte lag, an's Feuer. Dann kämmte und wusch sie sich und tat sich das wunderschöne Kleid an. Sobald der Hase gebraten war, legte sie ihn auf den Teller und trug ihn in den Saal. Wie staunte aber Katl, als sie hineintrat! Da war anstatt der garstigen Kröte eine stattliche Frau im weißen Kleide an der Seite des Ritters und sprach zu Katl freundlich: »Du hast mich, liebes Kind, aus meinem Zauber gelöst. Ich bin durch dich befreit worden, deshalb nimm zum Lohne diesen Schlüssel, der dir alle Schätze meines Schlosses öffnet, und meinen Sohn zum Gemahle.«
Bei diesen Worten gab ihr die Gräfin einen goldenen Schlüssel und legte die Rechte des Ritters in die Hand der Katl. Dann war die Gräfin verschwunden und nie mehr gesehen. Katl lebte aber mit ihrem schönen Ritter viele Jahre glücklich auf dem stolzen Schlosse. Ob sie noch dort haust, ist mir nicht gesagt worden.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Schwaz
DER BLÖDE PETER ...
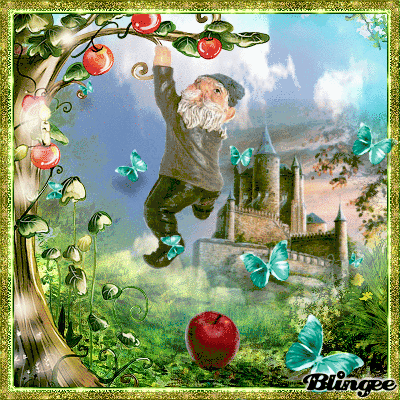
Es war einmal ein Knabe, den man allgemein den blöden Peter nannte. Seine Eltern waren frühzeitig gestorben, und so war er aufgewachsen, ohne etwas gelernt zu haben. Er verstand nur wie ein Singvogel zu schlagen und ahmte den Gesang der Lerchen täuschend nach.
Eines Tages hatte Peter einen gewaltigen Hunger, er ging deshalb in ein Bauernhaus und begehrte zu essen. Die Bäuerin gab ihm auch die Überreste der Mahlzeit, die er auf der Erde sitzend aß. Plötzlich kam ein Reiter daher, hielt bei dem Bauernhaus an und fragte, welcher Weg nach der Burg führe, die der stärkste Riese der Erde bewohne.
"Was wollt Ihr in der Burg machen?" fragte die Bäuerin, die von der Burg wusste.
Der Reiter erwiderte: "Die goldene Schale holen, welche die Kraft hat, dass Kranke genesen, wenn sie aus ihr trinken, und dass Tote wieder erwachen, wenn man die Schale an ihre Lippen hält; dann die diamantene Lanze, die alles zerbricht und tötet, was man damit berührt."
"Wem gehört denn die Burg?" fragte Peter, und die Bäuerin gab zur Antwort: "Dem Riesen, einem Zauberer; es wohnt bei ihm noch ein Bruder, der ebenfalls ein Zauberer ist."
Der Reiter aber sprach: "Mir hilft der Feind des Zauberers, jener hat mir alles gesagt, was ich tun soll."
"Was hat er Euch denn gesagt?" fragte Peter.
"Er hat mir gesagt", erwiderte der Reiter, "zuerst müsse ich durch einen verzauberten Wald reiten, dann treffe ich auf einen Zwerg, der ein feuriges Schwert hat und einen Apfelbaum voll goldener Früchte bewacht, von welchen ich eine haben muss; dann finde ich die lachende Blume, die ein Löwe bewacht. Diese Blume muss ich pflücken und durch den Drachensee schwimmen und mit dem Riesen kämpfen, der eine Kugel hat, die nie ihr Ziel verfehlt. Nachher komme ich in einen Lustgarten, darf mich dort aber nicht verleiten lassen. Dann muss ich durch einen Fluss, an dessen anderem Ufer ich ein Weib finde. Das setze ich hinter mich aufs Pferd, und sie sagt mir dann, was ich weiter zu tun habe."
Die Bäuerin zeigte dem Reiter den Weg, und er verschwand bald hinter den Bäumen.
Da kam der Bauer nach Hause und fragte den Peter, ob er bei ihm bleiben wolle, um das Vieh zu hüten. Peter sagte ja, und er wurde nun Viehhirte.
Eines Tages sah er einen Riesen daherreiten, der hatte eine diamantene Lanze. Peter hielt sie sogleich für die, von welcher der Reiter gesprochen hatte. Hinter dem Riesen lief ein Füllen. Peter sann weiter nicht darüber nach, und es vergingen mehrere Tage.
Da kam eines Abends ein alter Mann und blieb beim Wald stehen. Peter ging auf ihn zu und fragte: "Wer seid Ihr?"
Der Mann antwortete: "Ich bin ein mächtiger Zauberer, und mein Bruder ist ein Riese." Er machte dann in den Sand einige Kreise und murmelte mehrere Worte, und sogleich erschien das Füllen, das Peter früher gesehen hatte. Der Mann schwang sich auf dasselbe und jagte in den Wald.
Unserem Peter kam das sonderbar vor, aber er sagte keinem Menschen etwas von dem Gesehenen. Er versuchte ebenfalls das Füllen hervorzuzaubern; er machte deshalb ein paar Kreise in den Sand und murmelte einige Worte, aber das Füllen erschien nicht.
Als nun Peter den Riesen am nächsten Tag wieder in den Wald reiten sah, bekam er Lust, auch einmal nach jener Burg zu gehen. Er hielt deshalb immer einen Zaum samt einer Schlinge bereit, füllte einen Sack mit Federn und Vogelleim; auch streute er auf den Weg Brotkrumen, um das Füllen aufzuhalten, da er hoffte, dass der Riese am nächsten Tag wieder vorüberreiten werde. Der Riese erschien auch, das Füllen roch die Brotkrumen, blieb zurück und verzehrte sie. Als der Riese weit genug entfernt war, warf Peter dem Füllen geschwind den Zaum um und ließ sich von dem Füllen durch den verzauberten Wald tragen.
Bald erreichte Peter die Wiese, auf welcher der Apfelbaum stand. Diesen sah er von einem Zwerg bewacht, der ein feuriges Schwert hatte, welches alles vernichtete, was es berührte. Als der Zwerg den Peter sah, stieß er einen Schrei aus und schwang sein Schwert.
Peter aber zog die Mütze und sprach zu dem Zwerg: "Ich will zu der Burg, weil mich der Herr derselben bestellt hat.
"Wer bist du denn?" fragte der Zwerg.
"Ich bin der blöde Peter, ein Vogelfänger, und muss nach der Burg, um Sperlinge zu fangen, denn der Herr derselben hat mich bestellt, und er gab mir darum sein Füllen."
Der Zwerg erkannte das Füllen des Riesen und dachte, es müsse wohl wahr sein, und sprach zu ihm: "Nun, wenn du ein guter Vogelfänger bist, so fange mir einige, denn ich habe hier auch viele Sperlinge."
Peter stellte sich nun, als ob er das Füllen an den Baum binden wollte; statt des Füllens aber band er die Schlinge an einem Zweig fest und rief dem Zwerg, er solle das andere Ende der Schlinge halten. Der Zwerg tat dies, Peter stieg auf den Baum, zog die Schlinge zu, und der Zwerg war gefangen. Peter pflückte geschwind einen Apfel, sprengte davon und ließ den an den Baum gebundenen Zwerg zappeln.
Nach einigen Stunden kam er auf eine Wiese, auf der es viele schöne Blumen gab. Aus der Mitte der Blumen ragte eine besonders schöne hervor, diese war die "lachende". Der Löwe, der diese Blume bewachte, lief sogleich vom Feld herbei und zeigte Peter seinen Rachen. Peter zog seine Mütze, grüßte den Löwen und fragte, ob dieser Weg nach der Burg führe.
"Und was willst du denn dort?" fragte der Löwe.
"Ich muss dem Herrn der Burg einen Sack Lerchen bringen." Der Löwe fragte abermals: "Wie viele hast du denn?"
"Den ganzen Sack voll", erwiderte Peter und zeigte dem Löwen den Sack, welchen er mit Leim und Federn gefüllt hatte. Dann fing er an, den Gesang der Lerchen nachzuahmen, und dies täuschte den Löwen noch mehr.
"Zeig mir doch die Vögel", sagte der Löwe, "ich will sehen, ob sie für unseren Herrn auch fett genug sind."
"Sehr gern", versetzte Peter, "aber wenn ich den Sack öffne, so fliegen sie mir davon."
"So lass mich wenigstens ein wenig hineinschauen." Peter nahm den Sack, öffnete ihn ein wenig, und der Löwe fuhr gierig mit dem Kopf hinein, blieb aber zwischen dem Leim und den Federn stecken. Peter lief nun schnell zur lachenden Blume, pflückte sie und jagte davon.
Alsdann kam er zu dem Drachensee, den er durchschwimmen musste. Sogleich kamen die Drachen und öffneten ihre ungeheuren Rachen, um ihn zu verschlingen. Peter aber nahm schnell den aufbewahrten Speck aus der Tasche, warf jedem ein Stück in den Rachen und schwamm hurtig durch den See.
Als Peter an das andere Ufer des Sees kam, erblickte er sogleich den schwarzen Riesen mit der Kugel. Er saß an einem Felsen, seine Füße waren an demselben festgeschmiedet, und in der Hand hielt er die Kugel. In seinem großen Kopf hatte er sechs Augen. Zum Glück für Peter waren gerade die zwei Augen geschlossen, welche nach ihm die Richtung hatten.
Peter stieg vom Füllen, verbarg sich hinter einem Gebüsch und fing nun wie eine Lerche zu singen an, wobei dem Riesen ein Auge zufiel. Darauf ahmte er den Schlag der Nachtigall nach, und es fielen dem Riesen noch zwei Augen zu. Dann pfiff er ein Liedchen auf seiner Pfeife, und das letzte Auge des Riesen schloss sich ebenfalls. Schnell eilte Peter zu seinem Füllen, zog es vor dem Riesen vorbei und gelangte so zu dem Lustgarten. Dies war ein Garten voll von schönen Früchten, Blumen, und an jedem Ende des Gartens standen gedeckte Tafeln voll der köstlichsten Speisen. Peter zog aber gleich seine Mütze über die Augen und gelangte so fort.
Nun musste er auch noch durch einen Fluss schwimmen. Am anderen Ufer saß ein Weib, das war schwarz gekleidet, und ihr Gesicht war gelb.
"Komm näher", sagte sie, "dass ich mich zu dir auf das Pferd setzen kann."
Peter ließ es geschehen und fragte: "Wie heißt Ihr denn?" "Pest!" versetzte das Weib.
Peter erschrak und wollte sich in den Fluss stürzen.
Die Pest aber sagte: "Bleib nur sitzen, denn ich helfe dir ja, dass der Zauberer stirbt. Du musst ihm den Apfel geben, den du von dem Baum gepflückt hast, der vom Zwerge bewacht war. Er wird davon kosten, dann berühre ich ihn, und er muss sogleich sterben."
"Wie bekomme ich aber dann die Lanze und die Schale?" fragte Peter.
"Die lachende Blume, welche du besitzt, öffnet dir alle Türen und selbst die eiserne Tür, welche das Zimmer schließt, in der die Lanze und die Schale liegen", erwiderte das Weib.
Endlich erreichten sie die Burg. Der Zauberriese lag unter einem Thron und rauchte. Als er Peter sah, rief er: "Was, der blöde Peter reitet auf meinem Füllen?"
"Ja", antwortete der, "ich bin es; dein Bruder gab mir das Füllen, um dir zwei Geschenke zu bringen, nämlich einen Apfel und dieses Weib, welches auf dem Pferd sitzt." Peter ließ das Weib absteigen und gab dem Riesen den Apfel. Der Riese aß sogleich von dem Apfel, da eilte die Pest hinzu, berührte ihn, und der Riese sank tot zu Boden. Peter aber durchwanderte alle Säle der Burg und kam endlich zu einer eisernen Tür; diese sprang vor der lachenden Blume auf, die er in der Hand hielt, und er fand dort die Schale und die Lanze.
Während er beides aufhob, erbebte die Erde, und die Burg war verschwunden. Peter befand sich in einem dichten Wald; er ging weiter, und bald erreichte er eine Stadt. Der König derselben war vom Feind belagert und versprach dem, welcher die Stadt retten werde, seine Tochter.
Peter ging sogleich zum König und erhielt die Erlaubnis, am Kampf teilzunehmen. Er stellte sich an die Spitze des Heeres, und alles fiel, was er mit seiner Lanze berührte. Wenn aber einer von den Seinigen gefallen war, so eilte er hin und hielt ihm die goldene Schale an die Lippen, und augenblicklich stand der Tote wieder auf.
So trugen sie den Sieg über ihre Feinde davon. Peter erhielt die Königstochter zur Gemahlin und wurde König über das ganze Land.
(Theodor Vernaleken)
DIE DREI RABEN ...
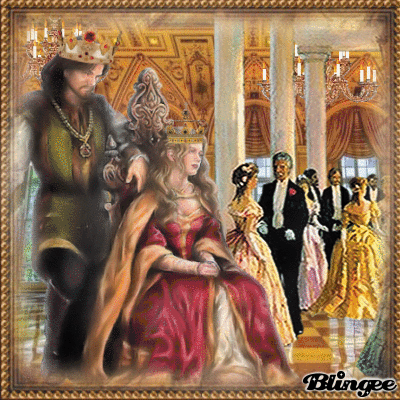
Einmal lag ein reicher König, dem viele Lande und Leute botmäßig waren, auf dem Todbette. Da ließ er seinen einzigen Sohn zu sich kommen und sprach zu ihm: »Lieber Prinz, ich werde bald sterben und du wirst dann keinen Vater mehr haben. Doch sei unbesorgt, denn ich hinterlasse dir einen klugen Berater, der dir in allen Nöten und Gefahren mit Rat und Tat beistehen wird. Solange du dem Bedienten Ratgeb folgen wirst, kann dir kein Unfall begegnen. Halte dich an ihn!« Als der König dies gesprochen hatte, verschied er.
Da erbte nun der Prinz die Burgen und Städte seines Vaters und sollte über Land und Leute gebieten. Dies sah aber seine Mutter, die eine stolze, herrschsüchtige Frau war, nicht gerne, denn sie wollte selbst das Zepter führen. Deshalb sagte sie einmal zu ihrem Sohne: »Du bist noch jung und zu wenig erfahren, darum sollst du in die weite Welt ziehen und Menschen und Städte kennen lernen. Ich will indes anstatt deiner regieren und sorgen, daß deinem Reich kein Leid und Schaden widerfahre.«
Der junge König teilte diesen Vorschlag dem klugen Ratgeb mit. Dieser meinte, eine Reise wäre nicht ungelegen, und alsbald wurde gepackt und geschnürt und alles zum Abschiede vorbereitet. Die Königin dachte aber gar Arges und wollte die Rückkehr ihres Sohnes auf immer verhindern. Deshalb kochte sie tödliches Gift, tat es in eine kristallene Flasche und gab sie ihrem Sohne mit den Worten: »Man weiß nie, was einem auf einer Reise zustoßen kann, darum nimm diese Flasche mit dem Lebenstranke. Wenn du matt und fahrtmüde bist, so trink daraus und du wirst alsogleich frisch und kräftig werden.«
Der Prinz ahnte nichts Böses, nahm die Flasche und dankte seiner Mutter. Dann nahm er Abschied von ihr und seinen Räten und fuhr mit Ratgeb auf und davon. Sie waren nicht lange gereist, als sie in einen kühlen Wald kamen, der weit und breit sich ausdehnte. Sie fuhren zwei Tage und zwei Nächte und kamen noch nicht ins Freie. Da waren sie müde und hungerig, denn im Walde fand sich keine Herberge und kein Wirtshaus lud zur Rast.
Jetzt dachte der Prinz an den Lebenstrank, nahm die Flasche und wollte trinken. Das sah der kluge Ratgeb und sprach: »Lieber Herr, die Rosse sind auch matt und hungerig und schleppen den Wagen kaum mehr weiter. Darum wollen wir zuerst ihnen vom Safte geben und erst dann wir trinken. Sie verdienen es, denn sie ziehen und wir sitzen bequem im Wagen.« Diese Rede gefiel dem Prinzen und er gab dem treuen Diener die Flasche.
Ratgeb stieg nun aus dem Wagen und gab einem Pferde einige Tropfen vom Tranke. Doch siehe, kaum war der höllische Saft auf die Zunge des armen Tieres gekommen, als es mausetot zu Boden fiel. Nun war die Arglist der stolzen Königin offenbar. Ratgeb spannte das tote Pferd aus und man fuhr mit den drei übrigen von dannen. Als sie ein Stücklein Weges gefahren waren, schaute Ratgeb zurück und sah, wie drei Raben zum toten Pferde flogen, um vom Aase zu fressen. Kaum hatten sie aber vom Pferdefleische gepickt, als sie tot niederstürzten.
Da dachte sich der kluge Ratgeb, vielleicht können die toten Raben uns nützen, hielt den Wagen an und holte die toten Vögel. Dann ging die Fahrt wieder langsam weiter. Jetzt wurde der Wald immer dichter und dichter, uralte Bäume streckten ihre bemoosten Äste aus, auf denen wildes Gevögel kreischte. Da zeigte sich in dieser schaurigen Einöde bald ein Haus, auf das der Prinz und Ratgeb zufuhren.
Als sie dabei ankamen, war nur eine alte Frau zu Hause. Sie schlug, als sie die zwei Fremden sah, die Hände über dem Kopfe zusammen und sprach: »Mein lieber Gott, ihr seid in eine Räuberhöhle geraten, woraus euch niemand retten kann, denn bald werden die zwölf Schelme kommen und dann ist's um euch geschehen.« Da wurde der Prinz blaß vor Schrecken, aber der Ratgeb verzog seine Miene nicht und flüsterte dem jungen Könige zu: »Seid unbesorgt und tut alles, was ich tue.«
Ratgeb nahm die drei toten Raben, gab sie der alten Frau und sprach: »Koch uns mit diesen Vögeln ein Eingemachtes, denn wir sind hungrig.« Indes die Alte in die Küche ging, um den Auftrag zu vollziehen, traten der Prinz und Ratgeb in die Stube, wo sie sich setzten. Sie waren noch nicht lange dort, als die zwölf Räuber kamen und sich bei Fraß und Trank gütlich zu tun anfingen. Ratgeb spielte den Lustigen und sang und lärmte mit den Räubern, als ob Kirchweih wäre. Der Prinz folgte seinem treuen Diener und lachte auch mit.
Als das eine Zeitlang so gegangen war, brachte die alte Frau das Eingemachte und setzte es auf den Tisch. Die Brühe duftete gar süß und stieg allen Räubern in die Nase. Wie Ratgeb dies bemerkte, war er froh und lud die Räuber zum edeln Essen ein. Die zwölf Kerle ließen sich das nicht zweimal sagen und fielen heißhungrig wie Drescher über Brühe und Vögel her. Da taumelte einer nach dem anderen unter den Tisch hinein und keiner stand wieder auf. So waren der Prinz und Ratgeb durch die vergifteten Raben aus den Händen der Räuber befreit worden und setzten, nachdem sie sich mit Wein und Brot gestärkt hatten, ihre Reise fort.
Der Wald wurde lichter, und eher als sie meinten, waren sie im Freien. Da lag eine große wunderschöne Stadt vor ihren Augen, auf die sie freudig los fuhren. Bald hatten sie den Ort erreicht und machten beim ersten besten Wirtshaus Halt. Sie gingen, nachdem ausgespannt und abgeladen war, in die Zechstube und setzten sich zu anderen Gästen.
Ratgeb machte also gleich mit einigen Trinkern Bekanntschaft und fragte: »Was gibt es hierzulande Neues?« »Ach mein Gott,« sprach ein Gast, »bei uns bleibt alles im alten und auch die Prinzessin, der dies Land gehört, treibt ihre alten Torheiten fort.« »Wieso?« forschte Ratgeb weiter. »Ja, das weiß ja die ganze Welt. Sie hat vor Jahr und Tag schon kundtun lassen, daß sie jenem, der imstande ist, ihre Rätsel zu lösen, ihre Hand und ihr Reich geben werde. Seitdem kommen nun Freier aus allen Weltgegenden und wollen die Rätsel der Königin lösen.
Doch bisher glückte es keinem. Darum weiß aber auch die stolze Frau nicht mehr vor Stolz, was sie mit den armen Teufeln anfangen soll. Errät ein Werber ihre Rätsel nicht, so läßt sie ihn als Narren ankleiden und durch die Stadt peitschen oder er muß auf einem Esel durch alle Gassen und Straßen reiten und den Buben zu argem Gespötte dienen. Das hat schon manch edler Herr verkostet und schlich sich dann geschändet für weltewige Zeiten von dannen. Das tut einem ehrlichen Kerl, wie unsereiner ist, weh, denn Stolz geht voran und Schande hintennach.«
Da dachte sich Ratgeb, die muß ich zu Paaren treiben, und ging mit dem Prinzen in die königliche Burg. Hier angekommen, wurden sie als Werber zur Königin geführt, die ihnen Rätsel aufgeben wollte. Dem kam aber der kluge Ratgeb zuvor und sprach: »Frau Königin! mit eurer Huld und Gnade will ich die Sache umkehren und eurer Gnaden ein Rätsel vorlegen, denn eure Weisheit, die so harte Nüsse anderen zu knacken gibt, versteht sonder Zweifel fremde Rätsel leicht zu lösen. Darum wollen euer Gnaden geruhen, ein Rätsel von mir anzunehmen und, falls dasselbe nicht gelöst werden sollte, meinen Begleiter als Ehegemahl zu erklären.«
Die Königin konnte gegen diesen Antrag nichts Stichhaltiges entgegnen und mußte sich das böse Spiel gefallen lassen - doch nahm sie sich drei Tage Bedenkzeit und hoffte, binnen dieser Frist mit Hilfe ihrer Bücher jedes Rätsel lösen zu können. Ratgeb gab nun folgendes Rätsel: »Eins tötet drei, drei töten zwölf. Was ist das?« Dann kehrte er mit dem Prinzen in das Gasthaus zurück, wo sie bis zum Ablaufe des dritten Tages blieben.
Die Königin aber sann und sann, schlug in ihren alten Büchern nach und ließ alle Minister, Räte und Weisen zusammenkommen. Doch alles war vergebens. Für dies Rätsel war kein Kräutlein gewachsen, und ehe man sich dessen versah, waren die drei Tage verflossen und die zwei Fremden begehrten Vorlaß. Da half der stolzen Königin all ihre Weisheit nichts und sie mußte ihrem Versprechen gemäß dem Prinzen, den sie für einen Landstreicher hielt, ihre Hand geben. Da ward nun getrommelt und gepfiffen, daß die ganze Stadt widerhallte, und die Hochzeit dauerte drei ganze Tage.
Der treue Ratgeb wurde Minister und blieb bei Tag und bei Nacht in der Nähe des Königs. Dieser hatte aber wenig Freude an seiner Gemahlin, denn sie war stolz und herrisch und verachtete ihren Mann. Das mißfiel dem treuen Ratgeb sehr und er beschloß diesem Treiben ein Ende zu machen. Er nahm deshalb seinen Herrn oft zu sich und ritt mit ihm auf ein einsames Waldschloß, wo sie sich tagelang aufhielten. Wenn der schöne junge König dann wieder zurückkam, freute sich die Königin und fragte, warum er so lange ferne geblieben sei, und was er getan habe. Dann erhielt sie zur Antwort: »Wir spielten auf dem Waldschlosse mit anderen Herren und heute habe ich wieder hunderttausend Gulden verloren.«
Das war der Königin zu toll, sie zürnte und war grämlich, bis der junge König wieder mit dem Minister Ratgeb von dannen ritt, um sich beim Spiele die üble Laune zu vertreiben. So ging es lange Zeit, bis eines Abends der König leichenblaß in das Zimmer der Königin stürzte und rief: »Mein liebes Gemahl, ich habe alles verspielt. Das Königreich samt Land und Leuten ist verloren. Wir müssen augenblicklich fort, wenn wir der Schande und dem Betteln entrinnen wollen.«
Ehe die Königin sich faßte, stand ein Wagen mit sechs Pferden bespannt in Bereitschaft, den die Königin, ihr Gemahl und der Minister Ratgeb bestiegen. Alsbald ging's so schnell von dannen, als ob der Wind sie fort trüge. So ward gefahren, bis sie zur Heimat des Prinzen kamen. Als sie sich der Residenz näherten, wurde angehalten und Ratgeb eilte nun zu Fuß voraus.
Langsam fuhren der König und die Königin weiter. Bald kamen sie zu einer kleinen armen Hütte, die in einer verrufenen und schmutzigen Gasse stand. Hier wurde Halt gemacht und ein altes gebeugtes Mütterlein humpelte heraus und zeigte die größte Freude über die Ankunft ihres lange vermißten Sohnes. Der Prinz stieg nun aus dem Wagen und beide begaben sich in die niedrige dumpfe Stube.
Darauf sprach der Königssohn zu seiner Frau: »Liebes Gemahl, wir sind nun in meiner Heimat. Laß es dir hier gefallen und arbeite, damit wir nicht Hunger leiden müssen. Ich werde wieder als Maurergeselle ins Tagwerk gehen und mit der Arbeit meiner Hände unser Brot verdienen.« Die Königin blieb nun im niedrigen Häuslein, während ihr Gemahl täglich in die Stadt ging, um, wie sie meinte, dort zu mauern. In der Tat begab er sich aber in das königliche Schloß, wo er mit seinen Räten und Ministern Regierungsgeschäften oblag, denn seine stolze Mutter war indes gestorben.
Wenn er abends ins kleine Häuschen zurückkam, bot er seiner Frau den Tagelohn, um das Nötige damit zu bestreiten. Die Frau wollte durch Sticken und Häkeln sich manchen Kreuzer verdienen; doch all Bemühen war vergebens, denn so oft sie ein Stück Arbeit in die Stadt geschickt hatte, wurde es ihr zurückgesandt mit den Worten: »Eine so grobe und schlechte Arbeit kauft man nirgends.« Darüber war die arme Frau gar beschämt und betrübt und klagte das Leid ihrem Manne.
Dieser sprach zu ihr: »Mein liebes Weib, da mußt du auf andere Weise dir einen Kreuzer zu gewinnen suchen. Ich will irgendwo Geld zu leihen suchen. Damit kannst du Geschirr kaufen und das auf dem Platze feilbieten. Einiges kannst du dir damit verdienen; denn regnet es nicht, so tröpfelt's doch.« Gesagt, getan. Der vermeinte Maurergeselle ging fort und kam mit Geld nach Hause. Nun wurden bayerische Häfen und Teller, Schüsseln und Krüge gekauft und am folgenden Tage saß die Frau in einem ärmlichen Kittel auf dem Platze und bot Geschirr feil. Das tat sie längere Zeit hindurch und mancher Kreuzer flog ihr so in die Schürze.
Wie sie eines Tages wieder auf dem Platze bei ihren Töpfen und Tiegeln saß, da kam ein stolzer schöner Herr, der ihrem Manne ähnlich sah, auf einem weißen Pferde heran geritten und sprengte, ohne daß er es zu bemerken schien, über das Geschirr der armen Händlerin hin, daß die Scherben links und rechts hinaus flogen. Da weinte das arme Weib bittere Tränen, denn all ihre Habe und ihre Hoffnung war zertrümmert. Traurig kehrte sie in die dumpfe Hütte zurück und klagte dem Maurer, als er heimkam, ihr Unglück. Da zankte er sie aus und machte ihr bittere Vorwürfe über ihre Unachtsamkeit. Sie ertrug seine beißenden Worte ohne Gegenrede.
Endlich schien ihr Mann besänftigt und sprach zu ihr: »Nun lassen wir das Verlorene fahren, denn dies Geschirr macht niemand mehr ganz. Aber höre, morgen muß ich den vollen Tag in der königlichen Burg arbeiten und darf keinen Schritt wegmachen. Drum bring mir morgen das Mittagessen aufs Schloß. Du darfst nur bei der Pforte nach mir fragen und dann wirst du mich schon finden.« Am folgenden Tage ging der Maurer in aller Frühe in die Stadt.
Als die Mittagstunde nahe war, trug das arme Weib einen Hafen mit Suppe und Knödeln in die Burg. Weil sie sich aber schämte, den schwarzen Hafen öffentlich über die Gasse zu tragen, hatte sie ihn unter die Schürze gebunden und ging so zur Pforte. Als sie dort nach dem Maurergesellen fragte, hieß es: »Geh nur über die Stiege hinauf in die Küche. Dort wird man dir den Weg weisen.« Geduldig stieg sie über die blanke Marmortreppe hinauf und trat in die Küche. Da sagte der Koch: »Ganz gut, daß jemand kommt. Nimm gleich diesen Auflauf und trag ihn zum Saale hinauf. Du brauchst nicht hineinzugehen. Ein Bedienter wird dir den Teller schon abnehmen, und dann komm und ich werde dich schon zum Maurer weisen.«
Sie willfuhr, nahm den Teller und trug ihn zum Saal hinauf, wo Pauken und Trompeten lärmten. Als sie bei der Türe stand und keinen Bedienten sah, spähte sie in den Saal. Kaum hatte sie aber einen Blick hineingeworfen, kam ein schöner, reicher Herr und führte sie in den Saal, wo sie trotz alles Sträubens mit ihm tanzen mußte. Wie sie so walzten, flogen Suppe und Knödel rechts und links, daß sie vor Scham feuerrot wurde. Kaum hatte dies der prächtige Herr, mit dem sie tanzte, bemerkt, als er mit seiner Rechten winkte.
Augenblicks schwiegen Trompeten und Hörner. Er führte nun die arme Frau zum Throne und sprach: »Meine Treuen, in dieser Frau stelle ich meine Gemahlin und eure Königin vor.« Auf dieses fielen schmetternd Trompeten und Pauken ein. Ein Tusch folgte dem anderen. Indessen führte der junge König seine Gemahlin in ein Nebengemach, wo für sie ein goldenes Kleid bereit lag und der König ihr erklärte, wie er sie geprüft habe.
Als sich die Königin umgekleidet hatte, kehrten sie in den festlich geschmückten Saal zurück und feierten eine glänzende Hochzeit. Seitdem herrschten König und Königin über zwei Reiche und lebten vergnügt und glücklich. Die Königin waltete gar milde und ward wegen ihrer Bescheidenheit ohne Maß geliebt. Ratgeb blieb Minister und der treue Ratgeber des edeln Königs bis zu seinem späten Tode.
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Schwaz
