MÄRCHEN AUS DEUTSCHLAND
Verzeichnis I
"Springmännchen und Goldfasan"
"Rübezahl - Er bewegt einen Eichbaum"
"Rübezahl - Er jagte zwei Jäger"
"Rübezahl - Er vertritt einen Tanzbären"
"Rübezahl - Er hackt Holz"
"Rübezahl - Er verleiht Geld"
"Rübezahl - Er wandelt sich zum Esel"
"Rübezahl - Vom Rübezahl - 1. Geschichte vom Esel
"Rübezahl - Er verschenkt Stöcke"
"Rübezahl - Er zählte die Rüben"
"Rübezahl - Woher ist er gekommen"
"Schneeflöckchen"
"Die Sage vom Hexentanzplatz"
"Die Sage von der Roßtrappe"
"Der hart geschmiedete Landgraf"
"Unverhofftes Wiedersehen"
"Der Erdspiegel"
"Das Teufelsbad"
"Das Schloß am Beyer"
"Betrüger und Bedrücker"
"Das Kristallsehen"
"Das erschrockene Wichtel von Gössitz"
"Das Mädchenkreuz"
"Das Wunderpferdchen"
"Die bestrafte Hexe"
"Heinrich von Kempten"
"Der Goldmacher auf Stolzenfels"
"Die zwei Mädchen und der Engel"
"Die zwei Riesen"
"Der Räuber Matthes"
"Die vier Brüder"
"Von drei Schwänen"
"Das Vöglein auf der Eiche"
"Von dem Breikessel"
"Der Prinz als Meisterdieb"
"Das Märchen vom dummen Peter"
"Der goldene Hammer und die harte Nuß"
"Barbara"
"Vom dicken fetten Pfannekuchen"
"Die Sonnenbrücke"
"Der Rattenfänger zu Hameln"
"Der Tanz in der Christnacht"
"Der dumme Krischan"
"Clarawunde"
"Die singende Besenbinderstochter"
"Der dumme Bauer"
"Die Jungfer auf dem Schloßberge bei Ohrdruf"
"Die Jungfernklippe"
"Hans und der Kalbskopf"
"Der Königssohn"
"Ein Siegfried-Märchen"
"Erlkönigs Tochter"
"Der Hexentanz auf dem Brocken"
"Die Amtmannsfrau zu Helbra"
"Die erlöste Jungfrau"
"Frau Harre und Frau Motte"
"Die grüne Jungfer auf dem Hausberge"
"Der Steinberg"
"Die Futterstelle des wilden Jägers"
"Altes Mütterchen erlöst"
"Der wilde Jäger"
"Hast du geholfen jagen, mußt du auch helfen nagen"
"Die Taube in den Zwölften"
"Der Räuber und die Haustiere"
"Kaiser Friedrich, die Königin Holle und Napoleon"
"Otto der Rote im Kiffhäuser und zu Quedlinburg"
"Der Schatz"
"Frau Holle"
"Die beiden Raben"
"Ein anderes Märchen von einem Grafensohn"
"Vom jungen Grafen, der sein Glück suchen ging"
"Die beiden Brüder"
"Die verwünschten Prinzessinnen"
"Die schwarze Prinzessin"
"Die Königstochter und der Soldat"
"Der dumme Wirrschopf"
"Die Nixe im Mansfelder See"
"Der eiserne Mann"
"Der Berggeister Geschenke"
"Prinzessin Schneeflöckchen"
"Sepp auf der Freite"
"Elend währt bis an den jüngsten Tag"
"Wie sich der Christoph und das Bärbel immer aneinander vorbeigewünscht haben"
"Die Alte-Weiber-Mühle"
"Die drei Schwestern mit den gläsernen Herzen"
"Der kleine Vogel"
"Der Wunschring"
"Das gläserne Krönlein"
"Die himmlische Musik"
"Der verrostete Ritter"
"Das Klapperstorch-Märchen"
"Das kleine bucklige Mädchen"
"Der Schelm von Bergen"
"Der vergrabene Schatz in Eberswalde"
"Vom Eschenheimer Turm"
"Die Wittekindsburgen"
"Das Trompeterschlösschen"
"Das verwünschte Schloss"
"Die tönende Linde"
"Die Prinzessin auf dem Baum"
"Bulemanns Haus"
"Die Berggeister von Altenstein"
"Die Gruben von St. Andreasberg"
"Der Drache als Diener"
"Das Wunderbuch"
"Das brennende Geld"
"Die verwünschte Prinzessin von den Müggelbergen"
"Reise nach Frankfurt"
"Rungele"
"Die Erdgeister in Greifswald"
"Warum die Buche so stachelige Früchte hat"
"Das Märchen vom Rosenblättchen"
"Hans Bär"
"Hans, der Grafensohn, und die schwarze Prinzessin"
"Das verwünschte Schloß"
DAS VERWÜNSCHTE SCHLOSS ...
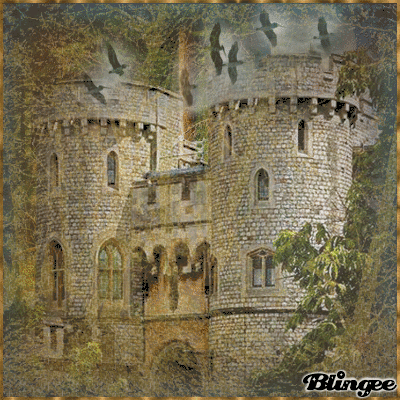
Zwischen Schwerte und Wandhofen, wo jetzt die Wandhofer Heide ist, hat vorzeiten ein großes, prächtiges Schloß gestanden, von dessen früherer Geschichte aber nichts mehr bekannt ist. Nur das weiß man noch, daß dessen letzter Besitzer in Pracht und Üppigkeit lebte und daß er, um seinen Begierden und Wünschen ganz dienen zu können, einen Bund mit dem Bösen schloß.
Nachdem dieser ihm eine lange Zeit gedient hatte, sind einmal beide uneins geworden, worauf der Teufel den Ritter holen wollte. Weil aber dessen Lebenszeit noch nicht abgelaufen war, hat der Teufel in dem Augenblick, als er das Schloß unsichtbar gemacht hatte, um es mitsamt seinen Bewohnern in die Hölle zu stoßen, seine Macht darüber verloren.
Darum hat er es nicht bis in die Hölle bringen können. Es ist an seiner alten Stelle geblieben und nur nicht wieder sichtbar geworden. Alle hundert Jahre aber kommt es in einer Vollmondnacht zum Vorschein.
Ein angesehener Mann von Wandhofen hat es zuletzt gesehen. Diesen führte vor mehreren Jahren, als er von Schwerte nach Wandhofen zurückkehren wollte, sein Weg über die Wandhofer Heide, auf der er gegen zwölf Uhr nachts ankam, als gerade Vollmond war. Auf einmal verschwand der Weg, auf dem er ging, und er sah, sich in eine fremde Gegend versetzt, die er noch nie gesehen hatte.
Vor sich erblickte er ein großes, schönes, hell erleuchtetes Schloß, aus dem ihm lauter Jubel und die schönste Musik entgegenschallte. Er blieb verwundert eine Zeit lang stehen. Als ihm aber die Geschichte des verwünschten Schlosses einfiel, eilte er erschrocken von dannen. Doch den Weg konnte er nicht wieder finden.
Wohl zwei Stunden lief er voll Angst in der Irre umher, bis er zuletzt in der Ferne dreschen hörte. Darauf ging er zu, und er erreichte glücklich das Dorf Wandhofen. Am anderen Morgen ging er mit vielen Leuten auf die Heide zurück, aber sie fanden nichts. Nur an einer Stelle, die etwas hügelig war, wehte ihnen ein starker Schwefelgeruch entgegen.
Deutsche Sage
HANS, DER GRAFENSOHN, UND DIE SCHWARZE PRINZESSIN ...
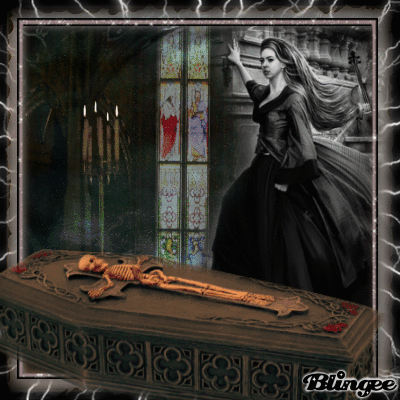
Es war einmal ein Graf, der hatte drei Söhne. Die beiden Ältesten dienten dem König, der eine als Hauptmann, der andere als Fähnrich, und der Vater hatte eine rechte Freude an ihnen; um so größer war sein Kummer über Hans, den jüngsten, der war zu nichts etwas nutze. Er wollte nicht Soldat und nicht Landwirt werden; endlich riss dem Alten die Geduld, er rief ihn zu sich und sprach zu ihm "Ich hab es jetzt lange genug getragen; etwas musst du lernen, und da du sonst nichts willst, so magst du die Schweine hüten."
Hans bekam keinen Schreck, als er seinen Vater so sprechen hörte, doch hofft er, es sei nur Spaß; doch es war kein Spaß. Am anderen Morgen um vier Uhr ward Hans aus dem Bette getrieben, bekam ein Tuthorn umgehängt und eine Peitsche in die Hand, und dann musste er die Schweine in den Buchenwald treiben. Das war ein saures Stück Arbeit und dazu wiesen die Leute mit Fingern auf ihn und lachten ihn aus.
Ehe noch die Sonne dreimal aufgegangen war, lief er darum zu dem alten Grafen und sagte zu ihm: "Vater, ich habe mich besonnen, ich will Dir fortan keine Schande mehr machen und will werden, was meine Brüder sind!" Da war der Graf aller Freuden voll, denn den Soldatenstand schätzte er am höchsten. "siehst du, Mutter, sagte er zu seiner Frau, der Gräfin, unser Hans ist gar nicht so schlimm als er aussieht. Ich habe es immer gesagt, wenn er nur scharf genommen wird, so soll noch etwas Ordentliches aus ihm werden."
Hans bekam darauf alle Taschen voll guter Speisen und Getränke und dreihundert Taler obendrein, dass er keine Not litte, dann machte er sich auf den weg in die Stadt; und als er dort war, wurde er eingekleidet.
Die Soldaten sind aber lose Vögel; die merkten bald, dass der neue Rekrut bei Gelde sei, und sie gingen ihm um den Bart und sorgten dafür, dass er keinen Dienst mitzumachen brauchte, und redeten ihm zu, dass er etwas darauf gehen ließe. Da waren sie gerade an den Rechten gekommen, Hans ließ sich nicht lange bitten und verlebte mit ihnen einen Tag wie den anderen in Saus und Braus; und als die zweite Woche zu Ende gegangen war, hatte er auch keinen roten Heller mehr in der Tasche.
"Was machen wir jetzt?" sagte Hans. "Du schickst einen Boten an den alten Grafen", rieten die Kameraden, "und lässt ihm melden: Vater, mir ist es sehr gut ergangen unter der Fahne, und mein Hauptmann hat mich zum Gefreiten gemacht!" Das tat denn Hans auch, und als der alte Graf die Botschaft vernommen hatte, wollten ihm schier die Freudentränen aus den Augen stürzen, so vergnügt war er.
Dann ging er zum Geldschrank und holte vierhundert Taler heraus, gab sie dem Boten und sprach: "Das bring meinem Sohne und grüß ihn mir schön von seinem alten Vater. Und das schicke ich ihm, denn ein Gefreiter muss Geld haben, dass er keine Not leidet." Als der Bote mit dem Gelde in der Stadt angekommen war, fing das gute Leben von neuem an, bis auch die vierhundert Taler zu Ende gegangen waren.
Da beförderte sich Hans auf den Rat seiner Gesellen zum Fähnrich und erhielt fünfhundert Taler; dann ward er ein Feldwebel und bekam sechshundert Taler; ein paar Wochen später wurde er ein Leutnant; und der Vater sandte siebenhundert Taler; endlich kündete er ihm sogar an, er wäre Hauptmann geworden.
Da hielt es den Alten nicht länger zu Haus. "Mutter, ich muss meinen Hans wieder sehen", sprach er zu der Gräfin, "der macht mir mehr Freude wie die beiden anderen zusammen genommen." Und weil ein Hauptmann reiten muss, so nahm er die beiden schönsten Hengste aus dem Stalle, und weil ein Hauptmann Geld braucht, so steckte er tausend Taler in die Tasche; dann ritt er in die Stadt und fragte den ersten besten auf der Straße, er möge ihm sagen wo sein Sohn Hans, der Hauptmann wohne.
"Einen solchen Hauptmann gibt es hier gar nicht", antwortete der Angeredete und ging weiter. "Der Mann wird wohl hier nicht bekannt sein", dachte der Graf und fragte die Schildwache, welche vor dem Schlosse auf und ab ging: "Wo wohnt mein Sohn Hans, der Hauptmann?" "Einen solchen Hauptmann gibt es hier gar nicht", antwortete auch der Soldat, legte sein Gewehr auf die andere Schulter und ging wieder auf und ab.
"Der Bauernlümmel", schalt der Graf, "kennt nicht einmal die Hauptleute in der Stadt!" Dann ging er zum General und fragte den, wo sein Sohn Hans, der Hauptmann, wohne. Der General ließ die Listen nachschlagen, dann sagte er. "Einen Hauptmann des Namens gibt es hier nicht, wohl aber einen liederlichen Rekruten, der die meiste Zeit im Loche sitzt und mit seinen Gesellen Geld verprasst."
Da ward der alte Graf fuchsteufelswild und rief: "Hat mich der Schlingel so an der Nase herumgeführt, so will ich es ihm gedenken!" Damit lief er zum Hause heraus und kehrte, ohne seinen Sohn gesehen zu haben, mit den tausend Talern und mit den beiden Hengsten wieder auf sein Schloss zurück.
Als die Sache ruchbar ward, wie Hans seinen Vater geprellt hatte schrieb der General an den König und fragte an, was sie mit dem liederlichen Rekruten machen sollten. Das Beste wäre, sie jagten ihn fort und trieben ihn über die Grenze. Da kam der Bescheid von dem König zurück: "Ihr sollt Hans nicht entlassen, denn ich kann ihn gut gebrauchen; er soll bei dem Sarge meiner Tochter Wache stehen."
Mit der verstorbenen Prinzessin hatte es aber folgende Bewandtnis:
Der König des Landes hatte sich vor vielen Jahren mit einer reichen Prinzessin verheiratet; aber so schön sie auch war und wie großen Reichtum sie ihm auch eingebracht hatte, so war er doch von
Herzen verzagt und bekümmert, denn sie gebar ihm kein Kind. All sein Bitten und Flehen zu Gott half ihm nichts, und endlich ward er ganz verzagt und verzweifelt und lief Tag aus Tag ein halb im
Wahne im Walde herum.
Da begegnete ihm eines Tages ein altes Mütterchen, das rief. "Ei, Herr König, was seht Ihr so betrübt aus ? Euch sollte es doch an nichts fehlen!" - "Lass mich zufrieden", entgegnete der König, "du kannst mir doch nicht helfen." - "Wer weiß", antwortete das Mütterchen, "von alten runzligen Weibern sind oft die schiersten Ratschläge gekommen! "Da dachte der König: "Hilft es nicht, so schadet es auch nicht", und offenbarte der Alten seinen Kummer.
Sagte das Mütterchen: "Wenn es weiter nichts ist, so soll Euch bald geholfen werden. Wartet ein Weilchen, ich komme bald zurück!" Damit humpelte es in den Wald hinein und pflückte Kräuter und Blumen, die ganze Schürze voll, und als es damit zu dem König kam, gab es ihm das Kräuterwesen und hieß ihn, das selbe seiner Frau, der Königin, bringen, dass sie davon einen Tee koche. "Davon müsst ihr in Gottes Namen beide trinken, ehe ihr zu Bette geht, und euer Wunsch wird erfüllt werden." -
Der König glaubte zwar nicht an die Reden der Alten; aber er nahm die Kräuter doch an sich und brachte sie der Königin auf das Schloss, und sie kochte auch wirklich Tee davon. Wie sie nun beide vor dem Schlafengehen davon tranken, überkam es den König wieder wie Wahn und Verzweiflung, und er rief: "Trink, Frau, in Gottes Namen mit dem Teufel immerzu!" Danach gingen sie zu Bette und legten sich nieder .
Und das alte Weib hatte den König nicht betrogen. Über neun Monde genas die Königin eines Mädchens, das war gesund an allen Gliedern, aber kohlschwarz von Farbe. Da dachte der alte König an seinen lästerlichen Fluch und weinte still vor sich hin. Er glaubte, der liebe Gott habe dem Kinde zur Strafe für die schwere Sünde seines Vaters die schwarze Haut gegeben, aber es sollte noch schlimmer kommen.
Das Mädchen aß nicht und trank nicht, es lachte nicht und weinte nicht, es schrie nicht und sprach nicht, und dabei wuchs es so schnell, dass es mit einem Jahre schon die Größe eines fünfjährigen Kindes besaß. Als nun sein erster Geburtstag kam, tat es um die zwölfte Stunde der Nacht, zu welcher Zeit es geboren war, plötzlich den Mund auf und rief: "Vater!" "Was willst du, mein Kind?" antwortete erschrocken der König. "Jetzt spreche ich zum ersten Mal", versetzte die schwarze Prinzessin, dann tat sie den Mund zu und war wieder so stumm wie zuvor.
Im zweiten Jahre wuchs das Mädchen so groß, dass es aussah wie eine zehnjährige. Um die Mitternachtsstunde des zweiten Geburtstages rief sie wieder. "Vater!" "Was willst du, mein Kind?" fragte der König noch ängstlicher wie das erste Mal. "Jetzt spreche ich zum zweiten Male", erwiderte seine Tochter, "aber wundern wirst du dich, wenn ich zum dritten Male den Mund auftue." Damit schloss sie die Lippen und verlebte das dritte Jahr, wie sie die beiden ersten verbracht hatte; nur dass sie am Ende des dritten Jahres so groß und stark geworden war wie eine mannbare Jungfrau.
Vor dem dritten Geburtstag überkam den König ein Grauen, und er hätte sich lieber hundert Klafter unter die Erde gewünscht als zu seinem Kinde. Doch es ließ ihn nicht fort, er musste aushalten. Als die Glocke zwölf schlug, öffnete das Mädchen, wie es vorher gesagt hatte, seinen Mund und sprach: "Vater!" "Was willst du, mein Kind?" entgegnete zitternd der König.
"Lasst mir einen eisernen Sarg machen, legt mich hinein und stellt dann den Sarg vor den Altar in die große Domkirche. Ein ganzes Jahr muss jede Nacht ein Soldat an meinem Sarge Leichenwacht halten; geschieht das nicht, so bringe ich Unglück über Unglück über Euer Reich." Dann verstummte sie wieder, und der König gehorchte voll Angst dem Befehle. Ein eiserner Sarg wurde geschmiedet; danach legte man die schwarze Prinzessin wie eine Leiche in ihn hinein und trug sie auf einer Bahre in die Kirche, wo der Sarg, wie die Königstochter befohlen hatte, vor dem Altar seine Aufstellung fand.
Darauf erhielt ein Soldat den Befehl, bei der Leiche die Nacht über Schildwache zu stehen. Als er aber am anderen Morgen von seinem Posten abgelöst werden sollte, fand man nichts mehr als seine Kleider und ein Häufchen Knochen: das übrige hatte die schwarze Prinzessin gefressen.
Die Kunde davon kam dem König sauer an. Aber was half es! Dem Wüten seiner Tochter musste er gehorchen, sollte nicht noch größeres Unglück sein Reich treffen. Es wurde also ein zweiter Soldat auf den Nachtposten gestellt, und als dieser ebenfalls von der schwarzen Jungfer gefressen wurde, ein dritter und vierter und so weiter ebenfalls, bis schließlich kein Soldat mehr zu finden war, der die böse Wache übernehmen wollte.
Da bot der König eine große Belohnung aus dem, der eine Nacht im Dome an dem Sarge seiner Tochter verbringen würde, und er lockte dadurch eine gute Zahl Menschen herbei, die sämtlich ihr Leben einbüßten. Endlich zog auch das nicht mehr, und der König glaubte sich verloren, obwohl nur noch drei Tage an dem Jahre fehlten; denn niemand war durch alle Schätze der Welt zu bewegen, bei der schwarzen Prinzessin zu wachen. Außerdem wurde das Volk unruhig und drohte, den König abzusetzen, wenn er den Posten in der Kirche nicht einzöge.
Da langte in letzter Stunde der Brief des Generals bei dem König an, und Hans wurde von ihm ausersehen, den Wachtdienst zu besorgen. Er mochte wollen oder nicht, er wurde in die Kirche geführt, und dann schloss der König eigenhändig hinter ihm die Türe zu. Drinnen in der Kirche brannten zwei Lichter auf dem Altar, und vor dem selben stand der offene Sarg mit der schwarzen Prinzessin. Kurz bevor die Glocke elf schlug, ward Hans graulich zumute, und er beschloss, aus der Kirche zu fliehen.
Vor der Türe hielt ihn jedoch ein kleines Männchen mit langem grauen Bart auf, das war aber unser lieber Herrgott, der den Jammer, welchen der Teufel tagtäglich anrichtete, nicht länger mit ansehen wollte. "Hans", sprach das Graumännchen, "flieh nicht aus der Kirche, sondern verstecke dich in der Orgel. Sprich aber ja kein Sterbenswörtchen, wenn die schwarze Prinzessin dich rufen wird."
Hans tat, wie ihm geheißen war, und kletterte in die Orgel hinein; und kaum saß er in seinem Versteck, so erhob sich die Königstochter und schaute nach dem Posten, und als sie ihn nicht erblickte, hub sie an, ihn zu suchen und mit kläglicher Stimme zu rufen: "Schildwache! Schildwache! Wo bist du ? Ach, Schildwache, erbarme dich doch!" Aber Hans rückte und rührte sich nicht. Endlich kletterte die schwarze Prinzessin in die Orgel, ward des Soldaten gewahr und wollte sich gerade auf ihn stürzen, um ihn zu zerreißen, als die Glocke zwölf schlug und die Prinzessin wieder in den Sarg zurück kehren musste.
Der alte König jauchzte vor Freude, als Hans am anderen Morgen gesund und munter aus der Domkirche heraustrat, und der Schatzmeister musste ihm auf der Stelle dreihundert Taler in die Hand zählen. Dann wurde abgemacht, dass er auch noch eine zweite Nacht an dem Sarge zubringen solle.
Wieder überkam Hans Furcht und Grausen bei dem Anblick der schwarzen Prinzessin, dass er zur Türe floh, und wieder erschien ihm das kleine Graumännlein und hielt ihn am Fliehen zurück. Diesmal musste sich Hans aber unter dem Altar verstecken. Um elf Uhr stand die Königstochter auf und verließ den Sarg; dann rief sie, wie den Tag zuvor, mit herzzerreißender Stimme:
"Schildwache! Schildwache! Wo bist du ? Ach, Schildwache, erbarme dich doch!" Und als niemand ihr antwortete, rief sie: "Pfui, ich bin wieder betrogen und habe doch solchen Hunger. Schildwache! Schildwache! Kriege ich dich, so fresse ich dich!" Dann suchte sie zuerst die Orgel und darauf die ganze übrige Kirche ab , bis sie an den Altar kam. Als sie aber des Burschen ansichtig wurde, schlug die Uhr in dem selben Augenblicke zwölf, und sie mochte wollen oder nicht, sie musste wieder in den Sarg zurück; denn mit dem Schlage zwölf war alle ihre Macht gebrochen.
Am anderen Morgen öffnete der König selbst die Türe, um zu sehen, ob Hans wieder mit dem Leben davon gekommen sei; und als er es so befand, drückte er dem Burschen die Hand und lobte ihn über die Maßen und setzte ihm so lange zu, bis er auch noch die dritte und letzte Nacht Wache zu stehen versprach, wieder um den Lohn von dreihundert Talern.
Das kleine Graumännchen hatte aber in der Nacht vorher Hans den Rat gegeben, wenn er auch noch die dritte Nacht wachen würde, so solle er sich Brot und Wein und Braten mit in die Kirche nehmen. Das tat Hans auch und stellte die Speisen und Getränke auf eine Bank bei dem Altare.
Es dauerte gar nicht lange, so trat das Graumännlein auf ihn zu und sprach: "Diesmal krieche unter den Sarg, und wenn die Prinzessin den Sarg verlässt und dich in der Kirche sucht, so spring aus deinem Versteck hervor und lege dich statt ihrer in den Sarg hinein. Sprich aber nicht, und sei im übrigen ohne Furcht, der Spuk kann dir nichts anhaben." Hans dankte dem Graumännlein für den guten Rat und tat, wie es ihm geheißen.
Kaum hatte die Königstocher den Sarg verlassen, so kroch er hervor und legte sich statt ihrer hinein, und es kümmerte ihn wenig, dass sie laut klagend durch die Kirche rief: "Schildwache! Schildwache! Wo bist du? Ach Schildwache, erbarme dich doch! Ich bin unglücklich! Krieg' ich dich, ich freß dich lebendig!" Weil die schwarze Jungfer den Soldaten aber nirgends finden konnte, trat sie an ihren Sarg, um sich mit dem Schlage zwölf wieder hineinzulegen.
Da sah sie, dass der Platz schon besetzt war. Jetzt tobte und schrie sie fürchterlich und drohte, Hans in Stücke zu reißen, wenn er nicht mache, dass er aus dem Sarg käme; aber Hans dachte an die Worte des Männleins und rührte kein Glied am ganzen Körper. Plötzlich verkündete die Uhr die zwölfte Stunde, und als der zwölfte Schlag verklungen war, verwandelte sich die Prinzessin vor seinen Augen und wurde weiß vom Kopf bis zur Sohle.
Dann reichte sie ihm freundlich die Hand und sprach zu ihm: "Du hast mich erlöst; ich bin jetzt aus des Teufels Klauen befreit und nicht anders wie die übrigen Menschenkinder. Steh auf, wir wollen essen; denn ich habe Hunger." Da stand Hans auf; und sie aßen von dem Brot und Braten und tranken von dem Wein, den er auf des Graumännleins Befehl mit in die Kirche genommen hatte.
Mit Sonnenaufgang ward die Kirchentür aufgeschlossen, und siehe, da traten die Prinzessin und Hans aus dem Dome heraus und gingen geradewegs auf den alten König zu. Der rieb sich die Augen und kniff sich in die Ohren, denn er dachte, er läge im Schlafe und träume. Als er aber sah, dass er sich nicht täuschte und dass seine einzige Tochter erlöst war, da wusste er sich vor Freude nicht zu lassen. Er herzte und küsste erst die Prinzessin und dann ihren Erlöser; darauf mussten die beiden in das Schloss kommen, und dort wurde Hochzeit gefeiert. Und da der König schon alt war, so übergab er Hans die Regierung, und er herrschte an seiner Statt einige Jahre lang.
Da sprach eines Morgens seine Frau, die junge Königin: "Hans, hättest du denn nicht Lust, einmal deinen alten Vater zu besuchen ?" "Das hätte ich wohl", antwortete Hans, "aber ich dachte, du würdest es mir übel nehmen und das Reich könnte so lange den König nicht entbehren!" "Das hat nichts auf sich, lieber Hans", erwiderte die Königin, "ich lasse dich gerne ziehen, und das Reich werde ich derweil für dich verwalten."
Da ließ Hans fünfhundert Soldaten kommen, bestieg ein prächtiges Ross und reiste seines Vaters Schlosse zu. Unterwegs musste er durch einen großen Wald, der wollte kein Ende nehmen. Schon dachte Hans, er müsse die Nacht im Freien zubringen, als er ein hell erleuchtetes Gasthaus vor sich sah.
Da hinein ging er mit seinen Soldaten, und nachdem sie gegessen und getrunken hatten, legten sie sich schlafen. Das Haus war aber kein Gasthaus, sondern eine Räuberherberge, in der fünfhundert Räuber ihr Wesen trieben. Als die selben um Mitternacht heimkehrten, ermordeten sie die Soldaten und ließen nur diejenigen am Leben, die ihnen schworen, dass sie mit in der Bande dienen wollten.
Dann stieg der Räuberhauptmann mit einigen seiner Gesellen die Treppe hinauf, um den König in seinem Schlafzimmer zu töten. Der hatte aber den Unrat gemerkt, denn er hatte gehört, wie es draußen klipperte und klapperte und knickerte und knackerte, und war im Hemde aus dem Bette und zum Fenster hinaus gesprungen und lief nun seines Vaters Schlosse zu.
Noch vor Tages Grauen langte er dort an und pochte an die Türe, aber niemand wollte ihm öffnen. Da rief er: "Vater, mach doch auf! Hans, dein jüngster Sohn, ist da!" "Bist du es, du
Galgenstrick", rief der alte Graf zornig, riss die Reitpeitsche von der Wand und trat hinaus.
"Vater, du wirst mich doch nicht schlagen!" sagte Hans. "Ich bin ja dein König!"
"So, nun bist du König geworden!" sprach der Alte grimmig, "erst Gefreiter, dann Fähnrich, dann Feldwebel, dann Leutnant, dann Hauptmann und jetzt gar König. Und noch dazu schlimmer, wie ein Bettler, im blanken Hemde. Warte, Schlingel, ich werde dir helfen." Und damit ergriff er die Reitpeitsche beim anderen Ende und schlug mit dem Rehfuß auf den armen Hans ein; und je mehr dieser schrie: "Vater, ich bin dein König!" um so mehr schlug der Alte zu, bis Hans Hören und Sehen verging und er ohnmächtig zu Boden sank.
Als er wieder aus der Ohnmacht erwachte, warf ihm der Vater ein paar Lumpen zu, die musste er anziehen; dann hingen ihm die Knechte ein Tuthorn um und gaben ihm eine Peitsche in die Hand, und er war ein Schweinehirt geworden und musste, wie damals, in den Buchenwald treiben, dass sich die Schweine dort mit den Eckern mästeten.
Vom reichen König ein Schweinehirt, das wollte Hans nicht in den Kopf, und betrübt starrte er vor sich hin, wenn er im Walde saß und das Schweinevolk um ihn herum quiekte und grunzte.
Wie er eines Tages so traurig da saß, trat das Graumännlein vor ihn hin und sprach zu ihm: "Hans, ich weiß, dass es dir schlecht geht, und ich will dir helfen. Hier hast du eine Pfeife, und wenn
du darauf spielst, so müssen alle Schweine tanzen; nimm sie nur, dann hast du mehr Freude am Hüten."
Hans bedankte sich bei dem Männlein für das Geschenk, und als er wieder verschwunden war, brachte er die pfeife an die Lippen, und richtig, alle Schweine, groß und klein, wie sie gewachsen waren, stellten sich auf die Hinterbeine und tanzten Polka und Schottisch links herum; und das sah so lustig und drollig aus, dass Hans vor Lachen die Tränen über die Backen liefen. Und er hörte nicht auf mit dem Pfeifen und trieb die Tiere pfeifend nach Hause, und sie tanzten unaufhörlich, bis sie an den Eingang des Dorfes gekommen waren.
Dort stand der reiche Großbauer vor der Türe, und wie er die tanzenden Schweine sah, freute er sich ebenfalls und rief: "Hans, lass mir von deinen Schweinen ein Ferkel ab, ich gebe dir hundert Taler dafür." Das war Hans zufrieden, und für die hundert Taler erhielt der Großbauer ein Ferkel.
Den folgenden Tag machte es Hans geradeso, und er hatte jetzt seine Lust an dem schlechten Dienst; als er aber am Abend mit der tanzenden Horde nach Hause zog, kam ihm der Großbauer schon vor dem Dorfe entgegen und rief: "Hans, mein Ferkel will nicht tanzen!" "Es bangt sich so allein", antwortete Hans, "und sehnt sich nach Gesellschaft." Da musste der Bauer zweihundert Taler darauf wenden, um ein zweites Ferkel zu dem ersten dazu zu kaufen, denn für hundert Taler wollte es Hans nimmer mehr tun.
Aber so sehr sich auch Hans über seine tanzenden Schweine freute, so wenig waren die Schweine mit dem Tanzen einverstanden; denn Hans ließ ihnen gar keine Zeit, sich Bucheckern und Eicheln zu suchen. Sie wurden darum zusehends magerer und dünner , und die Viehmagd lief zum Grafen auf das Schloss und sagte zu ihm: "Herr Graf, mit Euren Schweinen ist es nicht richtig; tut Ihr nichts dazu, so geht Euch die ganze Herde zugrunde!"
Das schrieb sich der Graf hinter die Ohren, denn er ahnte, dass ihm Hans einen Streich gespielt habe; und als dieser am nächsten Morgen mit dem Schlage vier die Schweine in den Wald trieb, schlich er ihm heimlich nach, und da merkte er denn gar bald, warum seine Herde so schlecht im Stande war. "Du Galgenstrick und Taugenichts", rief er zornig, "willst du gleich die Pfeife aus dem Munde nehmen!" und dann sprang er auf ihn zu und riss ihm die Pfeife aus der Hand und gab ihm seinen Knotenstock zu fühlen, dass er am Leben verzagte.
Diesmal waren am Abend beim Eintreiben die Schweine vergnügt und Hans traurig. Und als der Bauer ihm wieder mit der Rede kam: "Hans, meine Ferkel tanzen nicht mehr", sagte er mürrisch: "Meine haben es auch verlernt!" und trieb seine Herde in den Stall hinein.
So mochten etwa sechs Wochen und darüber vergangen sein, da sagte die Königin zu ihren Dienern: "Mein Mann ist nun schon so lange fort und kommt und kommt nicht wieder. Wenn ihm nur kein Unglück zugestoßen ist! Ich will mich selbst aufmachen und ihn suchen." So gleich mussten von der Reiterei dreihundert Mann aufsitzen, und dann ritt sie mit ihnen dem Grafenschlosse zu.
Unterwegs kam sie durch den selben großen Wald, und die Dunkelheit überraschte auch sie dicht vor der Räuber Herberge. Als sie aber in den Hof ein ritt mit ihren Reitern, wurde sie durch Männer gewarnt, welche von der Bedeckung ihres Mannes übrig geblieben waren und aus Zwang der Bande hatten beitreten müssen. Von denen erfuhr sie auch, wie alles gekommen sei, und dass die fünfhundert Räuber in zwei Abteilungen in der Nacht zurückzukehren pflegten.
Und das war recht gut, dass die Königin das wusste; denn so war sie mit ihren dreihundert Reitern der einzelnen Abteilung gegenüber in der Überzahl. Sie befahl daher, dass die Reiter ihre Waffen nicht ablegten, und als die Räuber heimkamen, rieben sie erst die eine Schar auf und dann die andere. Nur die Soldaten ihres Mannes ließ sie am Leben, denn die konnten ja nichts dafür, dass sie hatten Räuber werden müssen.
Unter den Schätzen, welche die schlechten Menschen in dem Hause zusammen getragen hatten, befanden sich auch die goldenen Kleider des Königs; und da sie nicht zerrissen und auch nicht blutig waren, so Schloss sie daraus, dass er noch am Leben sei und sich wohl bei seinem Vater aufhalten werde. Die Kleider wurden darauf eingepackt, und als die Sonne aufging, eilte sie mit ihren Reitern dem Grafenschlosse zu.
Das waren einmal Verbeugungen, die der alte Graf machte, als er den hohen Besuch bekam; er hielt der Königin selbst den Steigbügel und half ihr vom Rosse und bat sie, in sein Haus zu treten und damit fürlieb zu nehmen, was er ihr zu bieten vermöge. Der Königin lag aber nicht an Essen und Trinken, und sie fragte ihn sogleich, als sie in der Stube waren, ob er denn keine Kinder besitze.
"Gewiss, Frau Königin", antwortete der Graf, "und da sind zwei Jungen, an denen ich meine Herzensfreude habe; sie stehen beide in des Königs Heer, und der eine ist ein Hauptmann und der andere ein Fähnrich!" "Sind das Eure einzigen Kinder?" forschte die Königin. "Nein", sagte der alte Graf, "leider Gottes nicht, ich habe noch einen Erzschelm und Taugenichts, einen Tagedieb und Tunichtgut; ach wenn ich ihn doch erst los wäre, dann hätte ich Ruhe und Frieden."
"Schäm" er sich doch", versetzte die Königin, die wohl merkte, dass er ihren Hans meinte, "wer wird denn so schlecht von seinem eigenen Kinde sprechen! Wo ist denn Euer Sohn? Habt ihr ihn bei Euch oder ist er in der Fremde?" "Der hütet die Schweine", sagte der Alte giftig, "seht, da treibt er gerade in den Hof hinein!" Da schaute die Königin aus dem Fenster und erblickte ihren lieben Mann, in schlechten Lumpen, das Tuthorn auf dem Buckel, hinter den Schweinen einher schreiten. Das tat ihr in tiefster Seele weh, aber sie bezwang sich und sagte:
"Mag er auch noch so schlecht sein, zum Schweinehirten sollte ein Graf seinen Sohn denn doch nicht machen"; darauf setzten sie sich nieder und aßen zu Mittag. Nach dem Essen bat die Königin den Grafen, dass sie seine Felder besichtigen dürfe. Das war ihm eine große Ehre, und er wollte sie selbst hinausfahren; aber die Königin wehrte ihm und sagte: er habe wohl wichtigere Sachen zu tun; dann stieg sie in den Wagen, und der Kutscher musste sie hinaus in den Wald fahren, wo Hans die Schweine hütete. Dort sprang sie aus dem Schlage heraus und schritt geradewegs auf ihn zu.
"Hans, kennst du mich nicht mehr?" rief sie und klopfte ihm auf die Schultern. Da schaute Hans in die Höhe, und als er seine Frau, die Königin, erblickte, lachte ihm das Herz im Leibe, und er sprach: " Frau, wie hast du es angefangen, dass du mich hier gefunden hast ? " Sie erzählte ihm darauf alles, wie es gekommen sei, und neckte ihn, wie sie mit den dreihundert Reitern die fünfhundert Räuber vernichtet habe, während er mit den fünfhundert Soldaten ihrer nicht Herr werden konnte.
"Ja, du bist klüger als ich", entgegnete Hans, "und darum hilf mir jetzt aus meinem Elend." Seine Frau versprach ihm das auch und vertröstete ihn auf den Abend, wenn er sich bei seinen Schweinen im Stalle zum Schlafe nieder gelegt habe. Darauf sagte sie ihm Lebewohl, stieg in den Wagen und fuhr wieder auf das Grafenschloss zurück.
Während die Königin bei dem Grafen stand und ihm erzählte, wie ihr seine Äcker und Wiesen gefallen hätte, kehrte Hans mit den Schweinen vom Busche heim; denn es hatte ihm keine Ruhe mehr draußen gelassen, seit er wusste, dass seine liebe Frau auf dem Schlosse bei seinem Vater war. Es war aber erst die fünfte Stunde, und der alte Graf schalt ihn, dass er schon so früh zurückgekommen sei.
Vor Schlägen rettete ihn zwar die Königin, aber das konnte sie nicht verhindern, dass er ohne Abendbrot zu erhalten zu den Schweinen in den Stall gesperrt wurde. "Sind die Schweine nicht dick geworden, so braucht er auch nicht satt zu werden", sagte der Graf, und dabei blieb es. Und damit ja niemand sich unterstünde, ihn aus dem Stalle herauszulassen, zog er selbst den Schlüssel ab und steckte ihn zu sich.
Als am Abend alles zu Bette gegangen war, gab die Königin ihren Reitern Befehl, dass sie den Stall erbrächen und Hans herausholten; dann zog sie ihm seine königlichen Kleider an, und sie blieben die Nacht über beisammen. Ob sie geschlafen haben, ich glaub" es nicht, sie hatten einander gar viel zu erzählen; und die Reiter hatten auch wenig Ruhe, sie mussten ein Schwein abstechen und mit seinem Blute die Schwelle und den Fußboden des Stalles bestreichen, dass es aussah, als sei ein reißendes Tier eingebrochen und habe den Hirten gefressen.
Mit Tagesanbruch gingen Hans und seine junge Frau zu dem Grafen herab, und die Königin erzählte ihm, über Nacht sei ihr Mann, der König, gekommen und wollte auch sein Gast sein.
Da war der alte Graf erst recht höflich und konnte sich gar nicht genug bedanken für die große Ehre, welche seinem Hause widerfahren wäre. Verwunderlich war ihm nur, dass auch der König so gleich
nach seinem jüngsten Sohne fragte und ihn bat, dass er den selben vor ihn fahre.
"Der Schlingel ist im Schweinestall", antwortete der alte Graf, "hier ist der Schlüssel, er soll gleich austreiben." Darauf ging er auf den Hof, und der König und die Königin folgten ihm nach. Ja, da war die Türe offen und die Schwelle und die Diele mit Blut besudelt und von Hans nirgends eine Spur. "Ein wildes Tier hat ihn gefressen!" schrie die Königin. "Gott sei Dank", sagte der Graf, "dass ich ihn los bin, nun will ich in Frieden sterben!"
"Aber lieber Graf", sagte jetzt der König, der doch Hans selber war "ich glaube, Ihr kennt Euren Sohn gar nicht, sonst würdet Ihr ihn nicht so schlecht behandeln." "Den Schlingel sollte ich nicht kennen", rief der Alte, "den finde ich unter tausend Menschen auf der Stelle heraus." "Das sagt Ihr", lachte die Königin. "und Euer Sohn steht neben Euch." Da sah der alte Graf dem König näher ins Gesicht, und richtig, es war sein Hans, und er sank vor ihm auf die Knie und bat um Verzeihung.
"Nicht doch, Vater", sprach Hans und zog ihn in die Höhe, "du hast mich zwar schlecht genug behandelt, aber ich habe es auch arg getrieben. Und nun komm mit mir auf mein königliches Schloss, dass du all die Pracht und Herrlichkeit sehen kannst, die ich mir erworben habe." Das tat der alte Graf auch, und er lebte bei seinem Sohne, dem König, und bei der jungen Königin noch lange Jahre in Glück und Frieden, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch.
Volksmärchen aus Pommern und Rügen
HANS BÄR ...

In einem alten Fichtenwalde wohnte einmal vor vielen, vielen Jahren ein armer Köhler mit seiner Frau, die ihm erst vor kurzem ein gesundes Knäblein geschenkt hatte, das in der Taufe den Namen Hans empfing. Dieser entwickelte bald nach seiner Geburt eine solche Körperstärke, dass er drei kleine Hündchen, die die Eltern ihm als Spielkameraden beigegeben hatten, der Reihe nach mit seinen Händchen zu Tode drückte.
Darüber schalten sie wohl den Knaben; in ihrem Herzen aber freuten sie sich über die so wunderbaren Anlagen ihres Söhnleins, und gedachten noch einmal etwas Großes aus ihm zu ziehen. Doch nicht lange sollten sie solche Freude genießen. Es hauste nämlich in diesem selbigen Walde ein ungeheurer Bär; dem hatten die Jäger seine Jungen abgenommen, worüber er sehr betrübt war, und Tag und Nacht vor Schmerz im Walde umherheulte.
So kam er einst auch vor das Haus des Köhlers, wo der kleine Hans an der Ecke saß und spielte. Als der Bär ihn gewahrte, ward er noch lebhafter gemahnt an seine eigenen Kindlein zu denken, und, um Rache zu nehmen an den bösen Menschen, die sie ihm geraubt hatten, fuhr er auf den kleinen Hans zu, um ihn zu fressen. Hans aber riss ein Bäumchen aus der Erde, und schlug so tapfer auf den großen Bären los, dass dieser, erstaunt über die Kraft und den Mut des Kindes, bald ganz anderen Sinnes ward und bei sich selber dachte:
„Den Jungen sollst du mit in deine Höhle nehmen, und ihn säugen mit deiner Milch, und ihn so stark machen, wie es wohl sonst deine eigenen Bärlein geworden wären, damit er dich wieder pflegen und schützen kann, wenn du einmal alt und schwach geworden bist.“ Solches dachte die alte Bärenmutter in ihrem Sinn, nahm dann trotz seines Schreiens und Sträubens den kleinen Hans gar sanft zwischen ihre Vordertatzen und trabte mit ihm Wald einwärts ihrer Höhle zu.
Kaum war sie da selbst angekommen, so legte sie auch zugleich ihr neues Pflegesöhnlein auf das weiche Lager, das sie vorher ihren eigenen Kindern bereitet hatte, schüttelte ihm die Streu zurechte und brummte ihn gar freundlich an, dass Hänschen sich allmählich beruhigte und endlich vor Ermattung und Müdigkeit einschlief.
Als er am Morgen die Augen aufschlug, sah er den alten Bären vor seinem Lager sitzen, der ihm mit seinen Tatzen eine Menge schöner, roter Erdbeeren darreichte, die er in den Frühstunden im Walde gepflückt hatte; dann bot er ihm seine Brust und säugte ihn mit seiner Milch, so dass Hänschen gar vergnügt ward, und dem alten Bär, bald auf dem breiten Rücken klopfte, in bald in seinem zottigen Pelz zauste, dass es eine Lust war.
Der Bär ging wieder aus der Höhle, wälzte, bevor er weg ging, einen ungeheuren Stein vor die Öffnung, dass Tor und Tür versperrt war. So ging eine Zeit lang fort, morgens ging der Bär aus, und mittags kam er wieder nach Hause, wo er dann immer eine schöne Beere oder Blume, für sein Pflegesöhnlein mitbrachte, und nachdem er eine Weile mit ihm gespielt hatte, trabte er wieder gegen Abend im Wald umher; wälzte aber zu Hänschens großem Verdruss stets den bösen Stein vor die Öffnung der Höhle.
Nach und nach war Hänschen nun immer größer und stärker geworden, wozu der Genuss der kräftigen Bärenmilch wahrlich nicht wenig beigetragen hatte; und je stärker und größer er ward, desto verdrießlicher wurde ihm der große Stein, der ihm den Weg zu dem schönen, grünen Wald versperrte; und als eines Morgens der alte Bär, wie gewöhnlich Wald einwärts getrabt war, um sich eine süße Portion oder ein fettes Häschen zur Frühkost zu suchen, da setzte Hänschen mit aller Macht den Rücken gegen den Stein, brachte ihn aber trotz seines Stampfens und Keuchens nur ein Kleines von der Stelle.
Und als nun der alte Bär nach Hause kam, und es gewahrte, dass der Stein verschoben war, da sah er Hänschen gar grimmig an und legte noch mehr Steine vor die Tür, als er das nächste Mal die Höhle verließ. So musste Hänschen sich denn fürs erste in Geduld fassen; denn teils reichten seine Kräfte noch nicht hin, die Steine gänzlich von der Öffnung hinweg zu schieben, teils fürchtete er sich gar sehr vor dem Zorne des Bären, wenn dieser sähe, dass Hänschen trotz aller Pflege einen zweiten Versuch zum Entfliehen gemacht hatte.
Als er aber endlich merkte, dass er groß und stark genug sei, um die Steine alle hinweg stoßen zu können, da hielt er es nicht länger aus: mit aller Macht stemmte er sich, als der Bär seine gewöhnliche Nachmittagsreise angetreten hatte, wieder einmal gegen die Steine – und wer beschreibt die Freude! Knicks, knacks! ging es, und rechts und links fielen und brachen die großen Steine auseinander.
Da stand er nun in Gottes Natur, in die er sich so lange hinein gesehnt hatte, und um ihn rauschten die hohen, grünen Bäume und über ihm sangen die munteren Waldvögelein ihre hellen Lieder; dass ihm gar froh und leicht ums Herz gewesen wäre, wenn er sich nicht gefürchtet hätte, der Bär möchte ihn wieder in die Höhle zurückbringen. Deshalb lief er, so schnell ihn die Füße nur tragen wollten, immer der Nase nach vorwärts, bis er endlich an eine alte Köhlerhütte kam.
Indessen war es Abend geworden, und der Köhler ruhte mit seiner Frau schon aus nach der Arbeit des Tages; und deshalb klopfte Hans, da er immer noch eine große Furcht vor dem Bären hatte, gar gewaltig an die Haustür, und als die guten Leute ihm endlich aufgemacht hatten und nach seinem Begehr fragten, bat er sie inständig, ihn doch als Knecht in ihre Dienste zu nehmen; und erzählte ihnen die Geschichte, so weit er selber darum wusste.
Der Köhler und seine Frau betrachteten ihn mit scharfen Augen, und erkannten gar bald ein schwarzes Wärzchen, das Hans an der linken Schulter hatte, dass der Schutzflehende niemand anders sei, als ihr eigenes Söhnlein, das sie vor vielen Jahren auf so sonderbare Weise verloren hatten.
Wer war vergnügter, als Hans, dass er so unvermutet seine lieben Eltern wiedergefunden hatte! Wer war vergnügter, als der Köhler und seine Frau, als sie so unvermittelt ihren Sohn wiederfanden, der noch dazu aus einem kleinen Hänschen jetzt ein großer Hans geworden war. –
Als er nun eine geraume Zeit bei ihnen verweilt, und ihnen oft genug seine wunderbare Geschichte vorerzählt hatte, so sehnte er sich endlich in die Fremde, und kündigte eines Tages seinen Eltern an, dass er große Lust hege, sich einmal auf Wanderschaft zu begeben; da diese nichts dawider hatten, so schnürte er eines Morgens sein Bündlein und ging davon.
Da er sich nun genügsam im Lande umgesehen hatte, so ward er des längeren Wanderns müde; und als er einst einen großen, stattlichen Bauernhof sah, so bedachte er sich nicht lange, sondern kehrte also bald ein und bot dem Hausherrn gute Dienste an. Dieser aber, als er sah, dass er groß und stattlich war, fragte ihn nach seinem Namen und nahm ihn als Knecht in sein Haus.
Zu der selbigen Zeit waren die Früchte gereift in den Obstgärten; daher ward Hans am anderen Morgen in den Garten geschickt, um seines Herrn Obstbäume zu schütteln. Als er aber sein Schütteln anfing, da brach er von den Bäumen die Zweige samt den Früchten herunter, und als sein Herr bald nachher in den Garten trat, um die Arbeit seines neuen Knechts nachzusehen, da sprach der Hans gutherzig zu ihm:
„Herr, Eure Obstbäume müssen wohl gar alt uns spröde sein, und da ich die Früchte schütteln muss, brachen alle Zweige mit herunter!“ Der Herr aber gab ihm böse Worte, dass er ihm seine schönen Bäume verdorben habe; dann schickte er ihn in den Wald, um Holz zu fällen und gab ihm eine gute Axt mit auf den Weg. Hans aber warf die Axt bei Seite und suchte sich eine starke eiserne Kette.
Als er diese gefunden hatte, ging er, wie ihm befohlen war, in den Wald, befestigte bald an diesen, bald an jenen seine Kette, und riss so einen nach dem anderen mit der Wurzel aus, bis gegen Abend sein Herr mit den anderen zu Wagen angefahren kamen, um das gefällte Holz nach Hause zu holen. –
Als sie aber sahen, dass der halbe Wald mit der Wurzel aus der Erde gerissen sei, wollten sie schier nicht ihren Augen trauen und fragten einer um den anderen: „So sprich uns doch, Hans, wer hat dir solche Leibeskraft gegeben, dass du an einem Tage schaffst, was unserer nicht in hundert Tagen zu tun vermöchte!“ –
Hans, der bei all seiner Stärke doch sehr gutherzig und gefällig von Natur war, befriedigte allen ihre Neugier, und erzählte seine Geschichte wahrheitsgemäß; dann lud er zwei der dicksten Eichenbäume auf seine Schultern, und ging allmählich damit nach Hause. Die anderen aber standen noch lange im Walde und suchten vergeblich die ausgerissenen Bäume auf ihre Karren und Wagen zu laden.
Bald war die Geschichte weit und breit bekannt, und weil Hans von einem Bären gesäugt und gezogen und dadurch auch die Stärke eines Bären erhalten hatte, so ward er allenthalben nur Hans Bär genannt. Den Hofherrn und seine Knechte war über eine so unmäßige Leibesstärke ein gewaltiges Fürchten angekommen, weshalb sie den starken Hans auf alle mögliche Weise loszuwerden suchten, was ihnen aber durchaus nicht gelingen wollte. –
Da hielten sie heimlich einen bösen Rat und besprachen sich, wie sie den guten Hans Bär ums Leben bringen wollten, damit er ihnen durch seine Stärke nicht noch einmal großes Leid zu fügte. –
Nachdem sie sich also beraten, trat der Herr des Hauses zu und sprach: „Siehe, meine Muhme hat mir vertraut, dass ihr Vater in dem Brunnen auf meinem Hof einen Schatz vergraben habe, und dadurch die Hitze das Wasser ausgetrocknet ist, so steige du hinab und grabe danach, ob du ihn finden mögest!“
Hans tat wie befohlen. Kaum aber ward er hinab gestiegen, so kam der Herr mit seinen anderen Knechten, und warfen die Steine in den Brunnen hinab, in dem sie glaubten, ihn so leicht aus dem Wege zu räumen, Hans merkte nun freilich ihre böse Absicht gar wohl, da ihm ihre Steinwürfe aber keine Schmerzen verursachten, so ließ er sie ruhig gewähren.
Doch als sie nach und nach wohl hundert Steine hinab geworfen hatten, da riss ihn plötzlich die Geduld. „So jagd mir doch noch die Hühner vom Brunnen“, rief er ihnen von unten zu, „dass sie mir nicht also den Sand in die Augen streuen, oder ich werde euch nie und nimmer den Schatz aus dem Brunnen herausgraben!“ –
Als der Herr und seine Knechte solche Reden hörten, erschraken sie sehr; nachdem sie sich aber etwas von ihrem Schrecken erholt hatte, wälzten sie einen großen Mühlstein zum Brunnen und stürzten ihn hinab. – Nun glaubten sie doch sicher, sich den gefährlichen Hans vom Leibe geschafft zu haben; aber Hans Bär fing den Mühlstein auf und steckte seinen Kopf durch das Loch, dass ihm wie ein Kragen um den Hals hing, und als sie in den Brunnen hinab sahen, um sich seines Todes zu versichern, da rief er ihnen lachend zu:
„Was wollt ihr mich gar zum Pfaffen machen, dass ihr mir so einen gewaltigen Priesterkragen um den Hals hängt! Doch jetzt lasst es zu Ende sein mit der Narretei, und zieht mich heraus!“ Und somit schleuderte er den Mühlstein aus dem Brunnen hervor, dass einer der bösen Knechte darunter begraben wurde. Die anderen aber fürchteten sich heftig, und zogen ihn alsobald heraus; der Herr aber sah, dass sie viel zu schwach seien, um einem so starken Manne das Leben zu nehmen, und bot ihm schweres Gold, wenn er sich wegen ihres bösen Willens nicht an ihnen rächen, sondern sein Bündel schnüren, und das Haus verlassen wolle. –
Und Hans, der sich noch weiter in der Welt umsehen wollte, nahm das Geld, schnürte sein Bündel und ging davon. Als er nun einige Tage marschiert hatte, so hörte er weit und weit gar viel Gerede von der Schönheit der Königstochter; zugleich aber vernahm er, wie ein ungeschlachteter Riese sie zu seinem Ehegemahl begehre, und wie darüber der König, ihr Vater, gar sehr in Angst und Nöten sei, so dass er jedem, der den Riesen erlege, die Hälfte seines Reiches und seine Tochter zur Gemahlin versprochen habe.
Hans wurde immer neugieriger, die schöne Prinzessin zu sehen. Denn je näher er der Königsstadt kam, desto mehr, hörte er von ihrer unvergleichlichen Schönheit und Herzensgüte reden. Endlich war die Stadt erreicht. – Da saß die schöne Königstochter, und schaute aus dem Erkerfenster ihres Schlosses, und weinte gar bittere Tränen, dass ein so abscheulicher Riese sie als Ehegemahl hinwegführen sollte.
Hans war so von ihrem Anblick bezaubert, dass er sogleich bei sich entschloss, den Kampf mit dem Riesen zu bestehen, der schon drei schöne und tapfere Ritter erschlagen hatte, die um die Königsbraut mit ihm zu fechten wagten. Daher ging er also bald zu einem Wafenschmied, und kaufte sich für das Gold, dass er von seinem früheren Herrn empfangen hatte, einen schönen Helm, einen blanken Eisenrock, vor allen Dingen aber, ein scharfes Schwert.
So ausgerüstet trat er vor den König, und bat ihn um Erlaubnis, mit dem Riesen zu kämpfen. Dieser gab ihm seinen Segen und versprach ihm seine Tochter und sein halbes Reich, falls er den Riesen erlegen sollte. Als Hans aber hinweg gegangen war, da warf sich der gute König auf seine Knie und betete für seine Seele; denn er glaubte sicherlich, dass auch er, wie die anderen drei, seinen Todesstreich empfangen würde.
Hans suchte in dessen den Riesen auf, um ihn zum Zweikampf herauszufordern. Als der ihn kommen sah, glaubte er wieder gar leichtes Spiel zu haben. Deshalb lehnte er sich gemächlich an einen Baumstamm und höhnte ihm entgegen: „Männlein, versuche doch einmal, bevor du deinen schrecklichen Sarras gegen mich ziehst, wie hoch du dein Schwertlein da von der Erde heben mögest!“
Und somit schnallte er sich sein ungeheures Schlachtschwert von der Hüfte und warf es auf den Grund. Als der Riese solches tat, dass Hans, wie die drei anderen, es gar nicht vom Boden aufheben können. – Hans aber hub mit einer Hand das Schwert hoch über seinen Kopf und schleuderte es weit von sich weg, dass es bis an den Griff in die harte Erde hinab fuhr.
Da dachte der Riese bei sich selber: Der ist wohl noch stärker als du und redete ihm zu und sprach: „Ich sehe nun gar wohl, dass ich dir Unrecht getan habe, und dass du ein nicht gemeiner Kämpfer bist; deshalb lasst uns Frieden schließen miteinander; denn zwei so wackere Streiter sollten billig als Freunde auseinander scheiden. Siehe, ich gebe dir soviel Geld und Gold, als du nur immer auf drei Wagen hinwegzuführen vermagst. Du aber ziehe deine Wege, und lass mir die schöne Königstochter; denn ich liebe sie mehr, als alles Gold und Edelsteine der Erde!“
Hans aber liebte die schöne Königstochter selber mehr, als alles Gold und Edelsteine der Erde, ja mehr, denn sein eigenes Leben, und hörte nicht darauf, was der Riese sprach, sondern zog als bald sein Schwert, und der Riese musste nun das seinige aus der Erde herausziehen, wohin Hans es geschleudert hatte. Hu, wie da die Schwerter aneinander schmetterten, dass die hellen Funken heraus sprangen!
Doch nicht lange, da trennte Hans mit einem gewaltigen Hieb den Kopf des Riesen vom Rumpfe, dass von seinem schwarzen Blute, rings die grüne Erde bespritzt ward. Darauf nahm er das abgeschlagene Haupt des Riesen, als Zeichen seines Sieges mit sich und ging wieder auf das Schloss des Königs, um ihm die frohe Botschaft von dem Tod seines Feindes zu melden und ihn an sein gegebenes Versprechen zu erinnern. –
Als der König ihn so in sein Gemach treten sah, so ging er ihm entgegen und umarmte ihn und freute sich mit ihm seines Sieges; dann sprach er zu ihm: „Komm mit mir, mein Sohn, dass ich dich zu der Prinzessin, meiner Tochter, führe und dir die Hälfte meines Reichs abtrete.“ Und als sie nun zu der schönen Königstochter kamen, da freute auch sie sich über den Tod des Riesen und über den schönen Mann, den ihr der König als künftigen Gemahl zuführte. Denn obgleich Hans Bär von großer Leibesstärke war, so war seine Schönheit doch nicht geringer, denn seine Stärke. Daher freute sich die Prinzessin gar sehr eines so schönen Bräutigams, und reichte ihm bald vor dem Altare Herz und Hand. –
Kurz danach starb der alte König, und nachdem sie ihn feierlich begraben, und Hans nun auch die Hälfte seines Reichs von seinem Schwiegervater geerbt hatte, fuhr als bald mit seiner Gemahlin nach seiner Heimat, um seine Eltern und Geschwister mit sich nach seiner Residenz zu nehmen. Wie diese erstaunten, als die große, goldne Kutsche vor die niedrige Tür der Köhlerhütte rollte und stille hielt.
Und als sie nun vollends in dem König ihren lieben Sohn Hans erkannten, der ihnen die schöne Prinzessin als ihre Schwiegertochter zuführte, da war gar des Staunens und Freude kein Ende! Hans aber fuhr mit seinen Eltern und Geschwistern und seinem ganzen Gefolge nach der Bärenhöhle, zu seiner alten Pflegemutter.
Und als sie nun nicht mehr weit davon entfernt waren, da fingen sie alle an, sich zu fürchten und baten den König umzukehren. Doch er beruhigte sie, und ging, da sie als bald vor der Höhle angekommen waren, ohne alle Begleitung hinein. – Doch wie erschrak er! – Da lag der gute Bär gar kümmerlich auf seinem Lager hin gestreckt und wollte sterben. Denn da er so krank und schwach war, dass er sich selbst keine Speise mehr aus dem Walde holen konnte, so wäre er beinahe den Hungertod gestorben, wenn König Hans nicht noch zur rechten Zeit darüber zugekommen wäre. –
Als der Bär seinen Pflegesohn erkannte, wollte er sich aufrichten, um ihm entgegen zu kriechen; doch seine Kräfte versagten ihm und er fiel wieder auf sein Lager zurück. Hans aber rief seinen Dienern zu, ihm Speise und Trank zu bringen; dann setzte er sich zu seinem Bären auf die Streu und streichelte ihn mit seinen Händen und pflegte ihn auf alle Weise. –
Und der Bär leckte mit seiner rauen Zunge die Hände des Königs, und sah ihn gar freundlich an, als wollte er sagen: „So kommst du doch endlich noch, um mir den letzten Dienst zu erweisen, ich habe dich doch nicht umsonst gesäugt und gepflegt.“
Nach und nach waren alle in die Höhle getreten, und die Königin legte den Kopf des alten Bären auf ihren Schoß, in dem sie ihn mit ihren schönen Händen streichelte und sich, wie ihr Gemahl, auf alle mögliche Weise um ihn beschäftigte. – Doch alles umsonst! Der gute Bär war zu alt und zu schwach, um noch länger leben zu können. –
Nachdem er noch einen dankbaren Blick auf den König und seine schöne Gemahlin geworfen hatte, streckte er seine Glieder aus und verschied. Der König weinte um seine alte Pflegemutter, und alle waren gar sehr betrübt über den Tod des guten Tieres und standen noch lange an seinem Lager.
Dann begruben sie ihn unter dem Stamm einer alten Eiche, und fuhren alle nach der Königsstadt zurück, wo Hans der Bär, der König, noch viele Jahre mit seiner schönen Gemahlin glücklich und in Frieden regierte.
Ein Märchen von Theodor Storm
DAS MÄRCHEN VOM ROSENBLÄTTCHEN ...
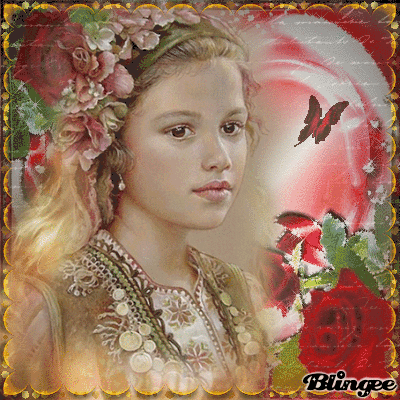
Der Herzog von Rosmital hatte eine sehr schöne Schwester, die er über alles liebte und der alles zu Gefallen tat. Sie hatte eine außerordentliche Liebe zu Blumen, besonders zu den Rosen, und ihr Bruder verwandelte deswegen beinahe sein ganzes Land in einen einzigen Rosengarten; außerdem hatte die noch eine andere Leidenschaft, und das war, ihre schönen Haare immer zu flechten und zu kämmen, und sie hatte zu diesem Zweck eine Menge Kammerfräulein, welche eigentlich Kammfräulein hießen und goldene Kämme anhängen hatten.
Ihre ganze Beschäftigung war, sich kämmen zu lassen und dann mit den Kammfräulein in Garten herumzuspringen, bis ihre Haare wieder in Ordnung waren und sie sich von neuem kämmen ließ.
Als sie einst morgens unter den Händen ihrer sechs Kammfräulein im Garten saß, welche ihr sechs Zöpfe flochten, trat ihr Bruder, der Herzog von Rosmital, vor sie und führte ihr an der Hand des Prinzen Immerundewig zu und redete sie also an: „Liebe Schwester! ich habe dir schon oft von meinem vertrautesten Freund, dem Prinzen Immerundewig erzählt, und du weißt, daß ich von jeher wünschte, du möchtest dich mit ihm vermählen, damit er immer und ewig bei mir bleibe; hier stelle ich ihn dir vor und bitte dich, ihm dein Herz zu schenken.“
In diesem Augenblick raufte eines der Kammfräulein die Prinzessin Rosalina, worüber sie sehr ungeduldig wurde und gegen sie ausrief: „Du raufst mich immer und ewig!“ Das Kammfräulein entschuldigte sich fein, indem es sagte: „Ja, Prinzessin, der Prinz Immerundewig raufte Euch, denn sein Auftreten hat mich zerstreut.“
Der Prinz begann sich schon zu entschuldigen, als wieder eine andere sie raufte, so daß Rosalina ganz aus der Fassung kam und den armen Immerundewig fragte: „Mein verehrter Prinz und mein geliebter Bruder! Ich erkläre, daß ich mich ebenso wenig als ein Rosenstock mit einem Kürbis mit dem Prinzen Immerundewig vermählen werde.“
Und nach diesen Worten lief sie weg und die Zopf flechtenden Kammfräulein ihr nach. Der Herzog konnte seinem Freunde keinen Trost geben, „denn“, sagte er, „ihre Worte sind unverbrüchlich.“
„Sind sie das“, sagte Immerundewig, „so will ich mein Heil versuchen“, umarmte dann denn Herzog und reiste ab zu einer Muhme, der Frau Nimmermehr, welche eine große Zauberkünstlerin war, und er holte sich Rat bei ihr. Mehrere Wochen nachher spazierte einst Rosalina im Garten umher, da sah sie eine alte Frau, die einen Rosenstock nach dem anderen betrachtete und bei jedem den Kopf schüttelte.
Rosalina ging zu ihr und fragte sie, warum sie immer den Kopf schüttelte. „Weil bei allen Rosen doch die schönste fehlt“, sagte die Alte, „nämlich die immer und ewig blühende.“ - "Wer hat sie?“ fragte Rosalina, „ich muß sie haben, um jeden Preis!“ „Nun, nun“, sagt die Alte, „um ein gutes Wort steht sie Euch zu Diensten!“ und zog den Deckel von ihrem Handkorb und zeigte der Prinzessin einen Kürbis, in welchen sie das blühende Rosenreischen gesteckt hatte, damit es frisch bleiben möge.
Rosalina war in der größten Freude über das Rosenstöckchen, und als sie die Alte fragte, was sie dafür verlangte, sagte diese: „Zwei Dinge: erstens, daß du mein Gast seiest bei meinem Mittagsbrot, und zweitens, daß du alle Monate, so oft dir das Rosenstöckchen eine Rose bringt, mit deinem Kammfräulein ein Fest begehst, wobei ihr alle über das Rosenstöckchen weg springt, ohne daß ihr ein Rosenblättchen mit Euren Kleidern abstreift, damit keines auf die Erde fällt; und bei welcher eines auf die Erde fällt, die muß ein paar tüchtige Hiebe mit Rosenzweigen auf die Hände bekommen, welche ihnen der Rosenstock geben wird, so sie zu ihm sprechen:
„Röslein! Röslein!
Triff mich fein!
Triff mich mit der Rut’,
Weil ich sprang nicht gut;
Triff mich mit der Rute recht,
Röslein! weil ich sprang so schlecht!“
Die Prinzessin lachte hierüber und willigte in alles ein. Da nahm die Alte einen hölzernen Löffel aus der Tasche, trennte den Kürbis in zwei Teile und nahm einen Löffel voll von seinen Kernen, den sie der Prinzessin zum Essen vorhielt. Diese machte anfangs einen schiefen Mund, als sie es aber einmal versucht hatte, schmeckte es ihr vortrefflich, und sie aß ziemlich viel von den Kernen.
Hierauf pflanzte die Alte den Rosenstock unter ihr Fenster, weil er bereits ein volles Röschen trug, sagte sie: „Fräulein Rosalina! ruft Eure Kammfräulein und beginnt das erste Fest vom Rosensprung.“ Da ging Rosalina und erzählte alles ihrem Bruder, dem Herzog; der bestellte Pauker und Trompeter und richtete das ganze Fest aus.
Als Rosalina und ihr Kammfräulein erschienen waren, losten sie, wer zuerst springen sollte, und es traf sich, daß Rosalina die Allerletzte war. Manches Fräulein sprang glücklich hinüber, aber alle jene, welche die Prinzessin gerauft hatten, als der Prinz Immerundewig um ihre Hand bat, streiften mit ihren langen Schleppen ein paar Blätter von der Rose ab und mußten ihre Hände mit den Worten:
"Röslein! Röslein!
Triff mich fein!
Triff mich mit der Rut’,
Weil ich sprang nicht gut;
Triff mich mit der Rute recht,
Weil ich sprang so schlecht."
dem Rosenstock dar bieten, welcher ihnen zur Bewunderung aller Anwesenden mit seinen Zweigen ein paar so tüchtige Hiebe über die Finger gab, daß ihnen das Wasser in die Augen kam. Als nun die Reihe zum Sprung an Rosalina kam, nahm sie einen tüchtigen Anlauf und wäre auch glücklich hinüber gekommen, wenn sich ihr im Sprung nicht die Haarflechten aufgelöst hätten, die ein Blättchen von der Rose abschlugen, welches sie aber im Sprung, ehe es zur Erde fiel, erhaschte und verschluckte, so daß ihr von der ganzen Gesellschaft Beifall zugeklatscht wurde.
Hierauf ward noch lustig geschmaust und getanzt, und als gegen Ende der Tafel allerlei Gesundheiten getrunken wurden, hob die alte Frau ihr Glas in die Höhe und sprach zu Rosalina:
"Weil Kürbiskern und Rosenblatt,
Dein roter Mund gesehen hat,
weil Ros’ und Kürbis sich verband,
Verlierst du deine stolze Hand:
An meinen Freund,
den Immerundewig.
Leb wohl,
im Abendschimmer entschweb’ ich.“
So sprach sie, und vor den Augen aller verschwand sie plötzlich. Rosalina aber, auf welche alle Augen gerichtet waren, tat einen lauten Schrei und fiel in Ohnmacht. Man brachte sie nach ihrer Stube, und sie bedachte mit großer Angst, daß sie dem Prinzen gesagt, sie wolle ihn nehmen, wenn Rose und Kürbis sich vermählten.
In der Nacht hatte sie sehr wunderbare Träume: Es war ihr immer, als wüchsen ihr Rosen aus dem Munde, und sie hatte Magenweh. Diese Träume hatte sie oft und immer ängstlicher. Als der kleine Monatsrosenstock wieder eine Rose brachte und sie wieder hinüber sprang, war sie ganz melancholisch und krank; Essen und Trinken schmeckten ihr nicht mehr.
Bei dem dritten Rosenfest hatte sie geträumt, sie würde ein Kürbis, und ihr Bruder mußte ihr das mit vieler Mühe ausreden. Aber gegen das vierte Rosenfest setzte sie sich den Gedanken noch viel fester in den Kopf, daß sie ein Kürbis sei, und wollte deswegen auf keine Weise mehr über den Rosenstock springen.
Bei dem fünften Rosenfest war sie nicht aus der Stube zu bringen und weinte den ganzen Tag darüber, daß sie ein Kürbis geworden sei. Der Herzog war sehr betrübt über ihre Einbildung und versammelte alle Ärzte um sie; aber es war ihr nicht mehr auszureden.
Das sechste Rosenfest kam, da war der Rosenstock schon so groß geworden, daß an kein Springen mehr zu denken war, und besonders, weil sie den ganzen Tag trauerte, daß sie ein Kürbis sei. Am siebenten Rosenfest guckte der Rosenstock ihr ins Fenster; am achten wuchsen seine Zweige schon um ihr Bett, und am neunten breitete er eine ganze Rosenlaube über sie.
Da träumte sie so lebendig, sie sei ein Kürbis und müsse sterben, daß sie ihren Bruder zu sich rufen ließ, der mit Licht hereintrat. Aber wie groß war ihr Erstaunen, als sie morgens neben ihrem Lager einen halben großen, goldnen Kürbis stehen sah, in welchem wie in einer Wiege ein schönes kleines Mägdelein schlummerte.
Da war die Prinzessin sehr gerührt und sagte: „Ach! wenn der gute Prinz Immerundewig da wäre, ich wollte gern seine Gemahlin werden!“ Da rauschten die Rosen um sie, und sie hörte eine Stimme: „Als Rose sterb’ ich, als Rose leb’ ich, Rose bin ich nun Immerundewig.“
Da war die Prinzessin sehr betrübt, denn sie hörte wohl, daß der gute Prinz ihr zuliebe ein Rosenstock geworden war, und sie gab dem Mägdlein den Namen Rosenblättchen und trug es mit seinem Bettchen in ihre geheimste Kammer, wo sie es erziehen wollte; denn sie hatte es so lieb, daß sie es keinem Menschen zu sehen gönnte.
Rosalina, welche bald wieder ganz lustig geworden war, saß am folgenden Tage im Bett und ließ sich von ihren Kammfräulein ihre Haare, die sie sonst in einem Kranz geflochten getragen hatte, auf eine andere Weise flechten: denn sie wollte nun die goldene Haube aufsetzen. Sie hatte kaum begonnen, als es an der Tür pochte und man ihr sagte, die Alte, welche den Kürbis und den Rosenstock gebracht, sei draußen und wolle Rosenblättchen sehen.
Sie ließ ihr aber sagen, sie solle warten, bis sie gekämmt sei. Nach einer Viertelstunde pochte die Alte wieder und erhielt die selbe Antwort, und das noch fünfmal. Da war die Alte beim siebenten Mal sehr zornig und rief ihr durch das Schlüsselloch hinein:
„Sieben Viertelstund’
hab’ ich geharrt,
Sieben Viertelstund’
ward ich genarrt:
So kämme denn noch sieben Jahr;
Dann bringt dein Kamm dich in Gefahr,
Du kämmst dich dann in großer Not,
Und kämmst das Rosenblättchen tot.“
So sagte die Alte im Zorn und verschwand. Rosalina achtete wenig hierauf und dachte an nichts als ihr Rosenblättchen, welches täglich größer und freundlicher wurde und wie seine Mutter schöne lange Haare hatte; und diese zu kämmen war Rosalinas höchste Lust, wenn sie sich allein mit dem Rosenblättchen eingesperrt hatte.
Nun war das Kind beinahe sieben Jahre alt geworden, und die Zeit nahte sich, wo der Unglückswunsch des alten Zauberweibes: „Du kämmst dich dann in großer Not. Und kämmst das Rosenblättchen tot“ wahr werden sollte; aber Rosalina dachte nicht mehr daran und kämmte das Rosenblättchen nach wie vor.
Als sie nun einst das Mägdlein zwischen ihren Beinen hatte und ihr den spitzigen goldnen Kamm durch die langen goldnen Locken zog, fühlte sie auf einmal einen großen Neid in sich erwachen, weil das Kind viel schönere Haare hatte als sie, und sagte ungeduldig; „Ach! hättest du einen kahlen Kopf. Und ich hätte all’ deine Haare im Zopf.“
Kaum aber hatte sie dieses gesagt, als sie vom Himmel gestraft wurde; denn eine unsichtbare Schere kam über sie her, und ritsch, ritsch schnitt sie ihr alle Haare vom Kopf herab, worüber sie so zusammenfuhr, daß sie mit der Hand zuckte und dem armen Rosenblättchen den spitzen Kamm so tief in das Häuptlein stieß, daß es mit einem Schrei tot zu ihren Füßen sank.
Da fiel der unglücklichen Rosalina der Zauberfluch der alten Frau ein; aber es war zu spät. Ihr geliebtes Rosenblättchen lag tot an der Erde, und ihre schönen, langen Haare, die sie so lange und mit viel Eitelkeit hatte kämmen lassen, lagen abgeschnitten umher, und sie rang ihre Hände verzweiflungsvoll über ihrem kahlen Kopf.
Nachdem sie so lange geweint hatte, stopfte sie ein Bettchen mit ihren langen Haaren und ein Kopfkissen mit Rosenblättern und legte das tote Rosenblättchen darauf, mit gefalteten Händen in einen Kasten von Kristallglas und ließ noch sechs andere Kasten von Kristall darüber machen und verschloß sie in der Kammer, wovon niemand etwas wußte als eine vertraute Dienerin.
So lebte sie noch einige Jahre in beständiger Trauer. Der Rosenstock verdorrte auch in der Stube, und als sie fühlte, daß die Stunde ihres Todes heran nahte, ließ sie ihren Bruder, den Herzog von Rosmital, zu sich kommen und sagte: „Geliebter Bruder! Das Ziel meines Lebens ist gekommen; ich wollte, ich wäre nie so eigensinnig und eitel gewesen, aber jetzt ist es zu spät; ich bitte Gott, er möge sich meiner erbarmen.
Alles was ich besessen habe, gehört nun dir; aber eins schwöre mir, damit ich ruhig sterben kann.“ Der Herzog schwor ihr unter Tränen, alles zu tun, was sie verlangte; denn er liebte sie über alles. Nun gab sie ihm einen Schlüssel und sagte: „Dieser ist der Schlüssel zu der letzten Kammer meiner Wohnung; bewahre ihn getreu und öffne diese Kammer niemals!“
Der Bruder beteuerte nochmals, sein Versprechern zu halten, und da sagte Rosalina: „Leb wohl und bete für mich“; dann wendete sie sich um und war tot, worauf sie der Herzog mit großem Gepränge beim Monatsrosenstock begraben ließ.
Einige Monate nachher vermählte sich der Herzog mit einer schönen, aber nicht gutmütigen Dame, und als er einst eine kleine Reise machen mußte, bat er seine Gemahlin, das Haus wohl in Ordnung zu halten und um alles in der Welt die letzte Kammer, deren Schlüssel er in seinem Schreibtisch verwahrt habe, nicht zu öffnen.
Sie versprach alles; aber kaum hatte er den Rücken gewendet, als sie, von Neugierde getrieben, den Schlüssel nahm und sich die verbotene Kammer öffnete.
Wie groß war ihr Zorn, da sie durch den gläsernen Kasten Rosenblättchen auf der Matratze liegen sah, die, seit sie hier von ihrer Mutter als tot eingeschlossen worden war, mitsamt dem gläsernen
Kasten gewachsen war und wie ein schönes schlummerndes Fräulein von vierzehn Jahren aussah; denn das alte Zauberweib hatte sie langen Jahre hindurch im Schlafe lebend erhalten.
Die böse Herzogin riß den Kasten zornig auf und sprach: „Ha, ha! darum soll ich nicht in die Kammer, damit die Jungfrau ruhig schlafen kann; aber warte! ich will das Murmeltierchen wecken“, und nun riß sie Rosenblättchen bei den Haaren hoch, so daß der Kamm, welcher noch von damals im Kopf stak, herab fiel und das arme Mägdlein aus ihrem Zauberschlaf erwachte mit dem Geschrei:
„Ach, Mutter! liebe Mutter! wie hast du mir weh getan!“ – „Ich will dich Muttern und Vatern“, sagte die Herzogin, „daß du den Lebtag dran denken sollst!“ und riß das zitternde und weinende Rosenblättchen aus dem Kristallkasten und schlug und misshandelte sie auf alle Weise mit der Drohung, wenn sie ein Wort zu irgendeinem Menschen rede, was ihr hier geschehen sei, solle sie ins Wasser geworfen werden.
Dann schnitt sie ihr die schönen langen Haare ab, machte ihr ein kurzes Kleid aus Sackleinwand, ließ sie Holz und Wasser tragen, Öfen heizen und Stuben scheuern und gab ihr täglich so viele Nasenstüber, Kopfnüsse, Ohrfeigen und Maulschellen, daß das arme Rosenblättchen so braun und blau im Gesicht aussah, als ob sie Heidelbeeren gegessen hätte.
Als der Herzog von Rosmital zurückkam und die Herzogin fragte, wer das arme Mädchen sei, das er täglich so gewaltig von ihr mißhandelt sehe, sagte sie: „Sie ist eine Sklavin, welche mir meine Muhme zugesendet hat: aber sie ist so boshaft und so dumm und faul, daß ich sie unaufhörlich strafen muß.“
Nach einiger Zeit reiste der Herzog auf einen großen Jahrmarkt und ließ nach seiner Gewohnheit alles, was im Schlosse lebte, bis auf die Katzen und Hunde vor sich rufen, um jeden zu fragen, was er ihm vom Jahrmarkt als Geschenk mitbringen sollte, da denn der eine dieses, der andre jenes begehrte; als endlich auch das arme Rosenblättchen in seinem groben Sklavenkittel hervortrat und der Herzog sie eben anreden wollte, unterbrach ihn seine böse Gemahlin mit den Worten:
„Muß der Schmutzkittel auch überall dabei sein? Sollen wir alle mit der faulen, groben Sklavin über einen Kamm geschoren werden? Fort mit dem widerwärtigen Tölpel! Ich weiß nicht, wie du ein so niedriges Wesen solcher Auszeichnungen würdigen magst!“ -
Da liefen dem armen Rosenblättchen vor Kummer die Tränen über die Wange herab, und der Herzog, der sehr gütig und mitleidig war, sagte gerührt zu ihr: „Weine nicht, du armes Kind, sondern sage mir von Herzen, was ich dir mitbringen soll, denn niemand soll mich hindern, auch dir eine Freude zu machen.“
Da sagte das Rosenblättchen: „Herzog, bringe mir eine Puppe mit und ein Messerchen und einen Schleifstein, und solltest du dieses vergessen, so wünsche ich, daß du nicht über den ersten Fluß, der dir in den Weg kommt, herüber gelangen könntest.“ Der Herzog reiste nun auf den Jahrmarkt und kaufte alles ein, nur die Puppe, das Messerchen und den Schleifstein für Rosenblättchen vergaß er.
Da er nun auf der Rückreise an einen Fluß kam, entstand ein solcher Sturm in den Wellen, daß kein Schiffer es wagte, ihn überzufahren; da fiel ihm die Verwünschung von Rosenblättchen ein. Er kehrte daher gleich zurück und kaufte alles, was sie bestellt hatte, und gelangte dann glücklich nach seinem Schloß, wo er alle seine Geschenke richtig austeilte.
Da Rosenblättchen ihre Geschenke erhalten hatte, trug sie alles in die Küche, stellte die Puppe auf den Herd, setzte sie vor sich hin und weinte bitterlich und begann, ihr, gerade als ob sie eine lebendige Person wäre, alle ihre Leiden und Qualen, die sie von der Herzogin erdulden mußte, nach der Reihe vorzuerzählen, und sagte immer dazwischen:
„Nicht wahr? Verstehst du? Hörst du? Gelt, das ist betrüblich? Nun, was sagst du dazu?“ Als aber die Puppe nicht antworten wollte, nahm Rosenblättchen ihr Messerchen und wetzte es auf ihrem Schleifstein und sagte: „Puppe, wenn du mir nicht antworten willst, so steche ich mir das Messerchen ins Herz, denn ich habe keinen Freund auf Erden als dich.“
Da schwoll die Puppe nach und nach wie ein Dudelsack, wenn man ihn aufbläst, und schnurrte endlich: „Versteh’ dich schon, versteh’ dich schon; versteh’, versteh’ dich schon viel besser als ein Tauber.“ Da nun diese Musik der Puppe und das Klagen des Rosenblättchens vor ihr mehrere Tage hintereinander von dem Herzog gehört wurden, der eine Stube dicht neben der Küche hatte, machte er sich ein Loch in die Tür, wo es sehen und hören konnte, wie Rosenblättchen weinend vor der Puppe saß und ihr erzählte:
Vom Prinzen Immerundewig, von den Kürbiskernen, vom Rosensprung; vom Rosenblatt, von dem Goldkürbis, worin sie gelegen, vom Kämmen der Mutter, von der Verwünschung des Zauberweibes, vom Einstoßen des Kamms in den Kopf, von ihrem Zauberschlaf, vom Liegen in den sieben Glaskästen, vom Schlüsselgeben an den Herzog und dem Verbot, die Kammer nicht zu öffnen, vom Tode der Prinzessin Rosalina, von der Reise des Herzogs, von der Neugierde der Herzogin, von der Öffnung der Kammer, dem Herausreißen des Kamms, dem Haarabschneiden und der argen Misshandlung, die sie stündlich ertragen müsse; dann sagte sie wieder:
„Antworte, oder ich bringe mich um! und setzte das Messer an ihr Herz.
Aber der Herzog sprang zur Türe herein und riß es ihr aus der Hand, umarmte sie zärtlich als seine Schwestertochter und brachte sie aus dem Schlosse zu der Gemahlin seines Ministers, wo sie herrlich gekleidet und gepflegt wurde.
Da sie sich nach einigen Monaten wieder recht erholt hatte von den Qualen und schweren Arbeiten, welche ihr die böse Herzogin auferlegt hatte, ließ er eine prächtige Mahlzeit in seinem Schlosse anstellen, bei welcher er Rosenblättchen, die niemand mehr in ihrem Glanze erkannte, als seine Nichte mit erscheinen ließ.
Nach Tisch wurde ein Zuckerhaus aufgetragen und jedermann hätte so gern gewusst, wer drin saß. Da sagte der Herzog zur Herzogin; „Wollt Ihr wohl das Zuckerhaus öffnen?“ – und sie tat es, da lag die kleine Puppe drin in sieben Glaskästen, wie Rosenblättchen gelegen hatte, und die Herzogin erschrak sehr und schlug vor Zorn die Glaskästen entzwei und riß die Puppe heraus.
Aber die lief ihr weg und setzte sich auf Rosenblättchens Schulter und blies sich dick, dick auf wie ein Dudelsack und erzählte der Herzogin alle ihre Grausamkeiten ins Gesicht, und wurde immer größer und größer und stand endlich wieder als das alte Zauberweib auf dem Tisch, welches oft in der Geschichte vorkommt, und flog zum Fenster hinaus.
Da ließ der Herzog seine böse Frau in eine Kutsche setzen und sie wieder zu ihren Eltern hinfahren, wo er sie einst abgeholt hatte. Das Rosenblättchen aber wurde die Gemahlin eines vornehmen Prinzen und erhielt das ganze Herzogtum Rosmital zum Brautschatz, und da blühte der Rosenstock des Prinzen Immerundewig wieder auf.
Und als Rosenblättchen eines Nachts den süßen Duft roch, trat sie mit ihrem Gemahl an das Fenster und sah ihre Mutter und die Kammfräulein über den Rosenstock springen, und der Prinz Immerundewig war auch dabei.
„Ach! rief sie aus, „liebste Eltern! Gott segne Euch!“ Da riefen sie von unten wieder herauf: „Ach! liebste Kinder! Gott segne Euch!“ und verschwanden in der Luft.
Da wurde das Rosenblättchen sehr still und ließ eine Wiege machen wie einen goldnen Kürbis, da bescherte ihr der Himmel einen kleinen Prinzen hinein, und der – der hat mir alles dieses für einen einzigen Pfefferkuchen erzählt.
Clemens Brentano
WARUM DIE BUCHE SO STACHELIGE FRÜCHTE HAT ...
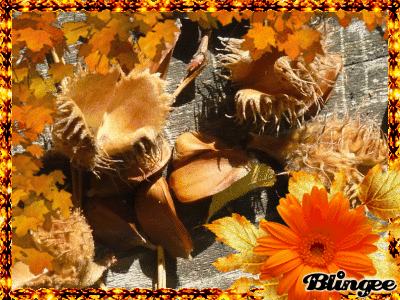
In Waldkönigs Reich ging es lustig und fröhlich zu. Frau Sonne lachte ganz vergnügt und machte ein ganz breites Gesicht, daß ihr Mund beinahe von einem Ohr bis zum anderen ging; Jungfer Ilse und Hold-Emmchen hüpften über die größten Steine weg und plauderten miteinander und erzählten sich alles, was sie von Vater Brocken gehört hatten, als sie noch bei ihm zu Hause gewesen waren und auf seinem Schoß gesessen hatten.
Herr Stieglitz hatte seine allerschönste Uniform angelegt, die ganz kunterbunt aussah, und Herr Buchfink hatte eine ganz neue rote Weste angezogen. Frau Bachstelze stolzierte auf und ab und hob ihre schwarze Schleppe immer ganz zierlich hoch, wenn sie von einem Stein auf den anderen hüpfte, um sie nicht ins Wasser zu tunken.
Frau Goldammer aber hatte ihr schönstes hellgelbes Mieder aus ihrem Schrank genommen und Frau Rotkehlchen ihren schönsten purpurnen Brustlatz. Herr Schwalbenschwanz hatte über seine gelben Hosen einen langen schwarzen Frack geworfen, Junker Ordensband war in höchster Gala erschienen mit dem breiten schwarzen Band über der roten Uniform.
Monsieur Siebenpunkt hatte sein gewöhnliches rotes Wams mit einem gelben vertauscht kurz und gut, es hatte sich alles aufs prächtigste geschmückt. Und wie fein sah es überall aus! Hier hingen auf hohen Stangen weiße und blaue und rote Glöcklein; dort leuchteten große goldene Sterne durch den Wald; da hingen Kränze von lieblichen blauen Blümelein oder grünen Zweigen; und alles lachte und alles duftete und alles glänzte, als ob ein großer Fasttag wäre.
Was war denn nur los? Denkt euch Herr und Frau Waldmaus feierten ihre silberne Hochzeit! Da mußte natürlich der ganze Wald mitfeiern. Herr Brummer und Frau Grille hatten schon mit dem Chor der Heimchen am frühen Morgen dem Jubelpaar ein Ständchen gebracht, und Herr Waldmaus hatte mit seinen kleinen schwarzen Äuglein aus dem Fensterchen an seinem Hause geguckt aber ganz raus kommen konnte er nicht gut, denn er war noch nicht ganz fertig mit Anziehen und hatte sich noch nicht seine langen Bartstoppeln abrasiert.
Dann hatte Frau Mücke mit ihren Balettdamen einen wunderbaren Tanz aufgeführt, bei dem sie immer umeinander herum hüpften. Dann waren alle Gratulanten gekommen, einer nach dem anderen und hatten ihre Glückwünsche ausgesprochen und Herrn und Frau Waldmaus ein langes Leben und viele gute Tage wünscht.
Da mußten nun doch Herr und Frau Waldmaus ein großes Fest für alle ihre Gäste geben. Aber das war nun eine schlimme Sache, soviel schöne Speisen und Getränke hatten sie ja gar nicht in ihrer Vorratskammer! Und sie wollten sich doch nicht blamieren vor ihren Gästen und merken lassen, daß sie gar nicht so reich waren, wie sie immer taten! Was sollten sie da nur machen!?
Aber Frau Waldmaus war um einen Ausweg nicht verlegen. Schnell warf sie ihr graubraunes Tuch um, daß sie aussah wie ein armes Bettelweiblein, und trippelte hinaus. Ein kleines Weilchen darauf blieb sie vor einem großen schönen Schloß stehen. Da wohnte Frau Brombeere, die war eine gutherzige und wohltätige Dame.
„Ach, liebe Frau Brombeere,“ klagte sie, „mir geht es so schlecht; mein Mann ist todkrank und kann gar nichts verdienen und meine vierundzwanzig Kinderlein haben nichts zu essen und zu trinken. Könnt Ihr mir nicht helfen?“
„Da, nehmt, nehmt!“ rief die gute Frau Brombeere, und schüttete ihr alle ihre schönen schwarzen Brote in die Schürze; „nehmt, soviel Ihr braucht, soviel Ihr wollt!“
„Danke schön,“ sagte Frau Waldmaus und packte sich alle Taschen voll und ganze Säcke voll, und dann kam Herr Waldmaus und fuhr einen Sack nach dem anderen nach Hause.
Frau Waldmaus aber trippelte weiter und kam zu Frau Himbeere. Die war auch so gut und glaubte ihrem Gewinsel und gab ihr alles, was sie hatte von ihren schönen roten und gelben Kuchen. Und ebenso machte es Frau Erdbeere und Frau Blaubeere und Frau Preiselbeere und alle die anderen guten Damen.
Aber schließlich war auch da nichts mehr zu holen und doch waren noch lange nicht alle Tische gedeckt und genug Essen für alle liebe Gäste. Da mußte zuletzt auch noch Herr Ginster und Frau Waldwicke ihre Schoten hergeben, bis im ganzen Reich nichts, rein gar nichts mehr zu haben war.
Und rauchen sollten die Herren doch auch! Da war guter Rat teuer. Aber Herr Waldmaus ging zu Herren Eichbaum, der hatte ein großes Lager von schönen Tabakpfeifchen. „Ach, Herr Eichbaum,“ sagte er, „ich bekomme heute Besuch aus Amerika, der möchte gern hunderttausend Tabakpfeifen kaufen; können Sie mir nicht Ihre Pfeifen schicken? Die werden sie Ihnen gewiß abkaufen!“
„Mit Vergnügen,“ sagte Herr Eichbaum, und schickte ihm alle Pfeifen, die er hatte.
Inzwischen hatte Frau Waldmaus weiter gebettelt: Frau Rose hatte ihre schönen roten Äpfel gegeben und Frau Haselnuß ihre braunen Brote, und noch immer hatte sie nicht genug. Da kam sie auch zu Frau Buche. „Ach, liebe Frau Buche,“ fing sie weinerlich an, „helft mir doch in meiner großen Not; mein Mann ist todkrank und meine vierundzwanzig Kinderchen verhungern beinahe.“
Aber Frau Buche schüttelte ihren Kopf und sagte: „Frau Waldmaus, ich habe gesehen, daß es Euch ganz gut geht; Ihr lügt mir etwas vor, Ihr wollt nur schlemmen und prassen geht nur, von mir kriegt Ihr nichts.“ Und Frau Buche schloß ihre Schränkchen, in denen sie ihr Brot hatte, ganz fest zu.
Da schimpfte Frau Waldmaus tüchtig; das wäre eine schöne Frömmigkeit! Geizig wäre sie und hartherzig, ließe arme Leute hungern, während sie alles in Hülle und Fülle hätte. Aber Frau Buche war eine kluge Frau und blieb ganz ruhig und sagte: „Geht nur, von mir kriegt Ihr nichts!“
Da lief Frau Waldmaus nach Hause und erzählte ihren Gästen, wie schlecht die Frau Buche wäre; die gönnte keinem armen Mäuschen auch nur ein trockenes Brotrindchen und hätte selber doch alle schränke voll. Da schimpften alle anderen auch tüchtig mit und ballten die Fäuste:
„Na warte, die wollen wir es merken lassen!“ Und weil sie nun alle schon von dem großen Fest und dem vielen Trinken und Schreien ganz dumm waren, beschlossen sie, Nachts die Frau Buche zu überfallen und alle ihre Brote ihr wegzunehmen.
Aber Herr Buchfink war ihr guter Freund, der flog schnell hin zu ihr, und sagte ihr, was geschehen sollte. Da schlug Frau Buche schnell in alle ihre braunen Schränkchen spitze Stacheln ein. Und wie nun die Räuber und Diebe kamen und wollten sie aufbrechen, da stachen sie sich ihre Finger ganz wund und mußten es sein lassen, und schimpfend zogen sie wieder ab.
Nun war das große Fest bei Herrn und Frau Waldmaus vorüber und alle gingen wieder nach Hause. Aber alles, was es in Waldkönigs Reich nur gab, hatten sie aufgezehrt. Da kam eine große, große Hungersnot, und die erst nicht genug hatten schlemmen können, die mußten nun mit knurrendem Magen herumlaufen.
Das war ganz schlimm; die Mäusekinderchen piepten vor Hunger; Herr Eichkatz lief verzweifelt hin und her und fand doch kein Nüßchen, um es seinen Kleinen zu bringen; Rehmutter scharrte mühsam unter dem welken Laube zusammen, was es seinen Kitzchen geben könnte, und Magister Lampe war ganz dünn und hager worden, seit Schmalhans bei ihm Küchenmeister war.
Da ging ein großes Wimmern und Wehklagen durchs ganze Land und alle meinten, sie müßten nun Hungers sterben. Da horch was war denn das? Da ging es auf einmal: „Knack Knack“ und alle spitzten die Ohren und reckten die Hälse, um zu sehen, was los war. Und was sahen sie?
Frau Buche erbrach ihre verschlossenen stachligen Schränkchen und heraus purzelten hunderttausend Millionen schöne knusprige Brötchen. „Kommt nur alle und eßt euch satt,“ rief Frau Buche, „als ihr es zum Schlemmen und Prassen haben wolltet, hab ich euch nichts gegeben; denn ich wußte wohl, daß die Not kommen würde ; dafür habe ich mein Brot aufgespart.“
Da kamen alle Tierchen und aßen sich satt und priesen die gute, kluge Frau Buche und sagten: „Es war doch gut, daß Frau Buche ihre Schränkchen so fest zugenagelt hatte!“
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
DIE ERDGEISTER IN GREIFSWALD ...
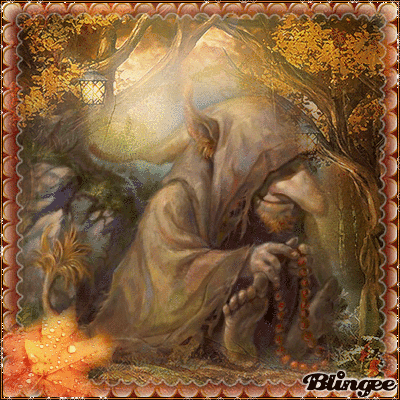
In der Stadt Greifswald hielten sich in früheren Zeiten viele unterirdische Erdgeister auf. Die Leute nannten sie nur „die Zwerge.“ Sie hüteten alles Gold und Silber und alle Edelsteine, die in der Erde verborgen liegen. Überwiegend waren sie gutartig und halfen den Menschen. Manchmal raubten sie hübsche Menschenkinder und legten stattdessen ihre hässlichen Wechselbälger in die Wiegen. Oft verliebten sie sich auch in schöne Mädchen und wollten sie heiraten.
Der Eingang zu ihren unterirdischen Wohnungen war meistens an einem schmutzigen Ort, zum Beispiel im Abfluss unter dem Spülbecken oder bei einem Gully. Tagsüber krochen sie in Gestalt von Fröschen oder anderem hässlichem Ungeziefer umher, Nachts aber zeigten sie sich in ihrer eigentlichen Gestalt. Besonders gerne tanzten sie im Mondschein und waren dann vergnügt und lustig. Man erzählte sich viele sonderbare Geschichten von diesen Erdgeistern.
So war einmal eine Frau, die verwünschte eines Abends zu später Stunde ihr Kind, weil es nicht aufhörte zu schreien und die Frau deshalb nicht einschlafen konnte. Da ging plötzlich leise und geschwind die Tür auf und ein Zwerg schlich herein, der riss ihr schnell das Kind vom Schoß und lief damit fort. Die Frau hat ihr Kind niemals wiedergesehen.
Ein andermal kam zu einer Köchin eine große Kröte in die Küche. Die Köchin nahm eine Kohlenschaufel um das Tier totzuschlagen, aber dieses kroch geschwind in einen Ausguss und rettete so mit knapper Not sein Leben. Nicht lange danach wurde die Köchin von den Zwergen als Taufpatin eingeladen und Nachts durch einen Gang unter dem Backtrog in die Erde geführt.
Sie musste viele Treppen hinabsteigen, bis sie in das Zimmer der Mutter mit dem Neugeborenen kam. Hier war alles aus Gold und Silber und die Zwergenfrau selbst war über und über mit Juwelen behängt. Nachdem das Kind getauft war, setzte man sich zu Tisch.
Der war gedeckt mit golddurchwirkten Tüchern und vielen köstlichen Speisen in silbernen und goldenen Schüsseln. Aber über dem Kopf der Köchin hing auf einmal ein großer, schwerer Mühlstein an einem seidenen Faden. Darüber erschrak sie sehr und wollte in ihrer Angst geschwind aufstehen. Die Zwergenmutter jedoch sagte zu ihr: „Fürchte dich nicht, es wird dir nichts geschehen.
Ich wollte dir nur zeigen, was für große Angst ich hatte, als du mich vor kurzem in der Küche mit der Schaufel erschlagen wolltest und mein Leben ebenfalls an einem seidenen Faden hing.“ Die Köchin aber war froh, als sie sich schließlich, mit Geschenken beladen, verabschieden durfte.
Einmal hatte sich ein wohlhabender Zwerg in ein schönes Mädchen verliebt und wollte es unbedingt heiraten. Das Mädchen mochte ihn zwar ganz und gar nicht, weil er so klein und hässlich war, doch der Zwerg versprach ihrem Vater viel Geld und Reichtümer, so dass sie ihm schließlich doch die Hochzeit zusagen musste. Sie hatte aber mit dem Zwerg vereinbart, dass sie frei wäre und er sie in Ruhe ließe, wenn es ihr gelänge, seinen Namen zu erfahren.
Lange Zeit kundschaftete sie vergebens. Doch zuletzt half ihr der Zufall. Es fuhr nämlich in einer Nacht ein Fischhändler auf der Straße nach Greifswald. Als er an einer Stelle viele Zwerge lustig im Mondschein tanzen und springen sah, hielt er verwundert an. Und da hörte er, wie einer der Zwerge in seinem Übermut laut rief: „Wenn meine Braut wüsste, dass ich Doppeltürk heiße, dann würde sie mich nicht heiraten!“
Da erzählte der Fischhändler am nächsten Tag in Greifswald im Wirtshaus und von der Wirtstochter erfuhr es die Braut. Die dachte sich gleich, dass dies ihr Verlobter gewesen sein muss. Als er wieder zu ihr kam, nannte sie ihn Doppeltürk. Da verschwand der Zwerg und ärgerte sich sehr. So hatte die Liebschaft ein Ende.
Greifswald soll nach der Sage nach auf einen Greif zurückgehen, der dort vor der Stadtgründung in einem Baum sein Nest hatte und gelegentlich Kinder als Nahrung für seine Jungen raubte, bis er schließlich von den Anwohnern vertrieben wurde.
Eine Sage aus Deutschland
RUNGELE ...
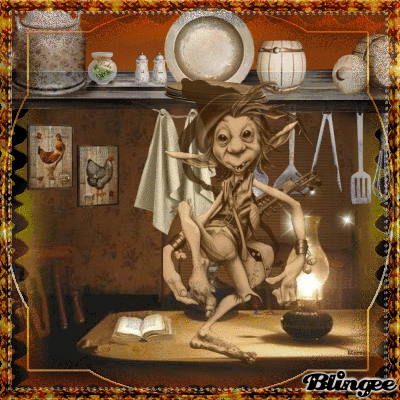
Im September des Jahres 1654 trug sich in Schleiz eine wunderliche Geschichte zu.
In einem Haus am Marktplatz, das einem Schuster namens Hans Frank gehörte, soll der Sage nach, ein Gespenst in der Stube gehext worden sein. Ein ganzes Vierteljahr trieb es jeden Abend von sechs bis neun Uhr sein Unwesen und bewarf die Kinder und die Bediensteten mit allerlei Sachen.
Wenn die Magd nach dem Abendessen die Stube aus wischte, zog es ihr den Putzlappen vom Schrubber und warf ihr dann den nassen Lappen ins Gesicht. Als diese Geschichte bekannt wurde, kamen jeden Abend Nachbarn und andere Leute in das Haus, um zuzusehen. Doch auch diese wurden beworfen, so dass mancher nicht wiederkam.
Bei Tage versteckte das Gespenst Messer und Löffel und wenn die Leute zu Mittag essen wollten, fanden sie kein Besteck. Des Schusters Tochter nannte das Gespenst Rungele und rief: „Rungele, bring mir doch mein Messer und meinen Löffel wieder!“ Da wurden die Messer auf den Tisch geworfen, dass sie in die Höhe sprangen.
Als der Schuster ein Schwein schlachten ließ und die Würste in die Stube gebracht wurden, nahm Rungele die Weißwürste und legte sie dem Schlächter wie einen Kragen um den Hals. Während des Essens warf das Gespenst eine Handvoll Zwiebeln in die Suppe, so dass diese rundum aus der Schüssel spritzte.
Dem Schuster zog es das Geld aus der Tasche und warf es den Kindern in die Milchsuppe. Da fischten die Kleinen das Geld mit Löffeln aus der Suppe wie manche Klugschwätzer die Weisheit. Einmal waren die Kinder allein zu Hause und als sie in der Abenddämmerung miteinander in der Stube spielten, erschien plötzlich das Rungele in Gestalt eines kleinen Kindes.
Es trug ein halboffenes weißes Hemd und seine Brust war blutig. Als das Mädchen die Erscheinung sah, fing es an zu schreien, und die Kinder liefen ängstlich hierhin und dorthin und suchten ihre Nachbarn und Eltern. Schließlich kamen diese mit ihnen und mit ihnen noch andere Leute.
Das Mädchen, das Rungele jederzeit hatte rufen können, schickten sie nun allein in die Stube. Es sollte nachsehen, ob das Kind noch drinnen sei. Das Mädchen fand es hinter dem Ofen stehend und fragte es: „Was willst du, Kind?“ Da antwortete die Erscheinung: „Du kannst mir ja doch nicht helfen!“
Auf Anweisung einer Frau, die draußen vor der Tür stand, musste das Mädchen dem Kind noch mancherlei Fragen stellen und bekam auf jede eine Antwort. Schließlich musste es sagen:
„Geh nun zur Ruhe, Kindlein, und komm nicht wieder!“ Da wich das Rungele aus der Stube, hielt sich aber noch längere Zeit im Haus auf. Wenn die Kinder zu Bett gegangen waren, wurden sie von ihm geknufft, an den Haaren und an der Nase gezogen, ja zuweilen versetzte Rungele ihnen sogar Ohrfeigen.
Das Gespenst ging auch ins Schlafzimmer der Eltern und schaukelte dort den Säugling so wild, dass er beinahe aus der Wiege fiel. Er zog die Schlüssel von den Schlössern ab.Er nahm die Bratwürste, legte sie auf einen Rost, briet sie im Ofen und aß sie auch auf, wobei es die Häute im Ofenloch liegen ließ.
Wollte der Schuhmacher zum Markt gehen, nahm es ihm die Schuhe von der Stange und schleppte oft auch ganze Lederhäute weg. Später wanderte das böse Gespenst in den Kuhstall. Dort nahm es immer wieder die Leiter weg, die zum Heuboden hinaufführte, und legte sie vor die Stalltür. Dann band es die Kühe los und jagte sie im Stall herum, bis ihnen der Schaum vorm Maul stand.
Nachdem es dabei aber ein paar Mal gestört worden war, ist es endlich ganz und gar gewichen.
Sage aus Schleiz Südost Thüringen
REISE NACH FRANKFURT ...
Zu ehemaligen Reichszeiten bestand auch ein großes Reichskammergericht zu Wetzlar, welchem noch manchem geneigten Leser in teurem und wertem Andenken sein kann, wenigstens in teuren. Viele berühmte Rechtsgelehrte, Advokaten und Schreiber saßen dort von Rechts wegen beisammen.
Wer daheim einen großen Prozeß verloren hatte, an dem nichts mehr zu sieden und zu braten war, konnte ihn in Wetzlar noch einmal anbrühen lassen – und noch einmal verlieren. Mancher hessische, württembergische und badische Batzen ist dort hin gewandelt und hat den Heimweg nimmer gefunden.
Als aber im Jahre 1806 der große Schlag auf das Deutsche Reich geschah, stürzte auch das Reichskammergericht zusammen, und alle Prozesse, die darin lagen, wurden tot geschlagen, mausetot, und keiner gab mehr ein Zeichen von sich, ausgenommen im Jahr 1817 in Gera in Sachsenland hat einer gezuckt.
Ein Leinwandweber da selbst liest in der Dresdner Zeitung, daß der Bundestag in Frankfurt sich mit dem Unterhalt und die Schadloshaltung der Räte, Advokaten und Schreiber sorgen wollte, welche seit 1806 keinen Sold mehr zogen und nichts mehr zu verdienen hatten, ob sie gleich täglich, wie die anderen, Mittag läuten hörten und schöne Schilde sahen an den Wirtshäusern.
Auf dem Speicher des Leinewebers aber fing es auf einmal an, in Akten zu rauschen, fast wie in den Totenbeinen von welchem der Prophet Ezechiel schreibt. Der Leineweber glaubte nämlich nichts anders, als das Reichskammergericht habe nur einen neuen Rock angezogen und heiße nun Bundestag, und der Bundestag habe nichts Wichtigeres zu tun, als die alten Prozesse, wenigstens seinen, wieder anzuzetteln.
Also ließ er sich einen guten Paß nach Frankfurt schreiben, und mit Akten schwer beladen, trat er die lange Reise an. Als er aber in Frankfurt angekommen war, war sein erstes, er fragte die Schildwache am Tor, wo der Bundestag sich angesetzt habe in Frankfurt. Die Schildwache erwiderte, sie stehen da so neben draus und erfahre nicht viel, was im Innern der Stadt geschehe. Ihres Wissens aber, seit sie da stehe, sei kein Bundestag einpassiert.
Da fing der Leineweber im Fortgehen an, sich zu betrüben und zu ergrimmen: „O Deutsche“, sagte er in seinem Innern, „Wie tief seid ihr gesunken! Ein Deutscher zu sein, noch dazu eine Frankfurter Schildwache und nichts vom Bundestag wissen.“ – „Guter Freund“, sagte er zu einem Vorbeigehenden, „könnt Ihr mir auch nicht sagen, wo der Bundestag sein Wesen hat?“
Der Vorbeigehende konnte es auch nicht sagen. „O Patriotismus“, fuhr er mit sich selber fort, „wohin bist du verschwunden? Fast müsse man sich schämen, ein Deutscher zu heißen, wenn man nicht unter seinesgleichen wäre.“
„Guter Freund“, redete er einen dritten an. „Wißt auch Ihr nicht, wo hier der Bundestag einquartiert ist?“ – „Lieber, guter Mann“, entgegnete der dritte,
„hier ist kein Bundestag einquartiert. Hier ist Frankfurt an der Oder. Der Bundestag ist in Frankfurt am Main.“
Der wohl erfahrrne Leser, weiß nämlich zum voraus schon, daß es zwei Frankfurt gibt, die nicht weniger als 66 Meilen voneinander entfernt sind, und der Leineweber war im unrechten. „Ihr habt übrigens nur noch 66 Meilen nach Frankfurt“, fuhr der dritte fort, „und wenn Ihr daher seid, wo Ihr sagt, so seid Ihr über hier nur 63 Meilen weit umgangen.“ –
„Das ist jetzt ein Tun“, sagte der Leineweber. „Hab’ ich A gesagt, so will ich auch B sagen. Zwanzigtausend Taler sind Geld, ohnehin bin ich es meinem seligen Großvater schuldig. Hat er den Prozeß angefangen und ist ein armer Mann geworden, so ist es meine Schuldigkeit, daß ich ihn fortsetze und wieder reich werde.“
Ha, ha“, sagte der dritte, „was gilt’s, das sind Akten, die Ihr da aufgepackt habt und fast drunter zusammenbrecht?“ – „Es sind auch noch ein wenig Lebensmittel dabei“, versetzte der Weber in kleinmütiger Stimme, „aber nimmer viel.“
Der geneigte Leser fängt an, einigen Spaß an der Sache zu finden. Von hieran aber bis Frankfurt am Main geht die Reise etwas langsam vonstatten. Der selbe darf herzhaft einstweilen noch ein gutes Pfeifchen stopfen, wie wohl er kann zum voraus sehen, wie alles gehen und enden wird.
Denn die Chronik will wissen, daß, einst die Phönizier erforschen wollten, ob der große Weltteil Afrika zu Wasser könne umfahren werden, rechneten sie die erforderliche Zeit der Reise auf ungefähr 2 Jahre, gleichwohl als sie hinter Ägypten in dem Roten Meer sich einschifften, der bibelfeste Leser kennt’s von Moses’ Zeiten her, nahmen sie nicht sonderlich viel Lebensvorrat mit, aber etwas Ackergeräte.
Sahen sie nun, daß die Lebensmittel zu Ende gehen wollten, stiegen sie an das Land, säten von Getreide und Gemüsegattungen, was die Jahreszeit mit sich brachte, wie wohl in Afrika ist fast immer Sommer und ein schneller, kräftiger Trieb in allem Wachstum.
Alsdann warteten sie die Reifung ab und brachten jedesmal nach wenigen Wochen einen neuen Vorrat in das Schiff und zogen wieder weiter, kamen auch richtig nach zwei Jahren wieder zum Vorschein durch die Meerenge von Gibraltar hinein, die der Zeitung kundige Leser ebenfalls noch kennt von General Elliots Zeichen her, dessen Andenken noch bis auf dieser Stunde auf Tabakspapieren gefeiert wird.
Also auch der Weber auf seiner langen Reise wußte sich zu helfen, wenn Geld und Vorrat zu Ende war. „Kunst geht nach Brot.“ Demnach, wenn er Mittags oder Abends in einem Städtlein oder Flekken eintraf, erkundigte er sich nach einem Zunftgenossen, und „habt Ihr nichts für mich zu weben“, redete er den Meister an, „um Atzung und um einiges Zehrgeld?“ Stellte ihn nun der Meister ein, so blieb er einige Tage bei ihm, bis er sich ausgefüttert und einige Batzen verdient hatte, und webte sich solchergestalt glücklich an dem Main hinauf und nach Frankfurt.
In Frankfurt pochte ihm das Herz hoch vor Freuden, daß er nun an dem Ziel seiner Reise sei und so nahe an seiner Geldquelle, die er jetzt nur anbohren dürfe, und als er in die Bundeskanzlei kam, gleich in der vordersten Stube, wo die Herrn sitzen, die am schönsten schreiben können, grüßte er sie freundlich und vertraut.
„Findet man Euch endlich einmal“, sagt er, „und seid Ihr jetzt hier?“ – Einer von den Herren, der Vornehmste von ihnen, nimmt die Feder aus dem Mund und legt sie auf den Tisch. „Wir sind noch niemand aus dem Weg gegangen“, sagte er, „und was habt Ihr hier zu schaffen? Was bringt Ihr Neues, Viereckiges, in Eurem Hängekorb? Eine Bundeslade? Es fehlt uns noch eine.“ –
„Spaß“ erwiderte der Weber, „meinen Prozeß von Anno 1767.“
Es ist nunmehr nichts weiter an der Sache zu erzählen. Natürlich nahm sich niemand seines Prozesses an, weil der Bundestag sich mit Prozessen nicht gemein macht, und die lange beschwerliche Reise war umsonst getan. Die Erzählung nimmt daher ein kahles Ende, der Hausfreund fühlt es. Fast sollte er noch etwas hinzufügen. Statt dessen aber will er hierneben eine Abbildung des Leinewebers stiften, wie er auf der Heimreise einmal ausruht und eine Standrede hält.
„Es ist mir in diesen sechs Wochen vieles klargeworden“, sagt er. Man muß einem deutschen Mann nicht sogleich Vorwürfe machen, wenn er in Vaterlandssachen ein wenig unwissend und kaltsinnig ist. Denn man ist selber einer. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Lerne zuerst selber und werde warm.
Den guten Leuten in Frankfurt an der Oder ist von mir Tort geschehen. In Frankfurt am Main aber mir. Wenn ihr in der Zeitung etwas lest oder im Plakat oder im Kräuterbuch und versteht es nicht, lasst euch raten, achtbare Zuhörer, und geht um verständige Belehrung aus, ehe ihr etwas unternehmt, besonders wenn es ein Prozeß ist.
Der beste Prozeß ist ein schlechter, und auf dem Lager bessert er sich nicht. Der Habicht ist besser als der Hättich. Friede ernährt. Unfrieden zerstört. Und nun, geliebte Akten, die ich jetzt hier ablege, gehabt euch wohl, und seid dem Mann empfohlen, der euch finden und vielleicht glücklich mit euch sein wird als ich.
Indem er aber die Akten absetzen wollte, klopfte ihm von hinten her ein Mann auf die Achsel, der auch des selben Wegs ging. (Man sieht ihn aber kaum auf der Abbildung, nichts desto weniger ist’s der Gewürzkrämer aus dem nächsten Städlein.)
„Guter Freund“, sagte er, „mit wem redet Ihr da so allein?“ – „Mit niemand“, erwiderte der Weber, "wenn Ihr mir aber meinen Prozeß abkaufen wollt, mit Euch. Lupft ihn einmal! Was gebt Ihr mir dafür?“ Der Mann sagte: „Anderthalb Kreuzer für das Pfund, wenn das Papier daran gut ist. Komm mit mir.“
Also verkaufte er dem Gewürzhändler die Akten für einen Gulden und vierundzwanzig Kreuzer, die vollends zum Rest der Reise hin reichten, und kam mit leerem Beutel und Korb wieder in der Heimat an. „An meine Frankfurter Reise“, sagte er, - „will ich denken. Diesmal in Frankfurt gewesen.“
Johann Peter Hebel
DIE VERWÜNSCHTE PRINZESSIN VON DEN MÜGGELBERGEN ...
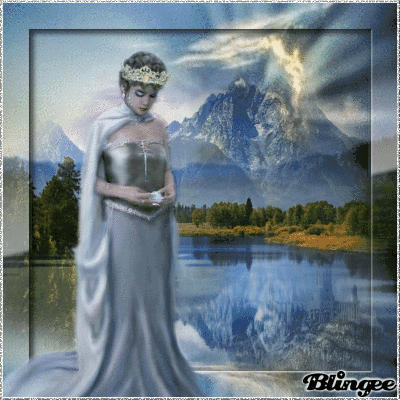
In der Mark Brandenburg erzählt man sich auf den Müggelbergen, unter dem der Sage nach ein Schatz verborgen liegt. Dort ließ sich zuweilen auch eine verwünschte Prinzessin sehen, die, um erlöst zu werden, darum bat, in der Kirche von Köpenick herum getragen zu werden, dies ist aber niemand gelungen.
In Köpenick nennt man den Stein deswegen den „Prinzessinnenstein“ und behauptet, selbiger liege noch immer auf einem Vorberge in der Nähe des Teufelssees. Dieser See befindet sich dicht am Fuß der Berge und ist ringsum von dunklen Fichten und Moorgrund umgeben. Sein Wasser ist von dunkler, fast schwarzer Farbe, und obwohl er nur klein ist, hat man sich doch bis jetzt vergeblich bemüht, wie tief er ist.
Ferner erzählt man von oben erwähntem Stein, er liege dort, wo einst ein prächtiges Schloß gestanden habe. Darin habe eine wunderschöne Prinzessin gewohnt, die nun aber verwünscht und mit dem ganzen Schloß in den Berg versunken sei. Sie kommt jedoch zuweilen zum Vorschein. Unter dem Stein führt nämlich ein Loch tief in den Berg hinein, daraus sieht man sie abends in Gestalt eines alten Mütterchens, gebückt und am Stock gehend, herauskommen.
Andere haben sie auch, meist um die Mittagszeit, als schöne Frau am Ufer des Teufelssees sitzen sehen, wo sie ihr Spiegelbild im Wasser betrachtete und ihre langen Haare kämmte. So sah sie einst ein kleines Mädchen aus Köpenick. Es hatte in der Nähe mit seiner Mutter Beeren gesucht, sich aber von jener zu weit entfernt. Es konnte sie nicht wiederfinden und irrte weinend im Wald umher.
Da hat die Prinzessin das Kind mit sich hinunter genommen in ihr Schloß, hat es reich beschenkt und nach kurzer Zeit wieder herauf gebracht. Sieht man sie am Abend aus dem Berg hervor kommen, so hält sie ein Kästchen voller Gold in der Hand, das soll derjenige bekommen, welcher sie dreimal um die Kirche von Köpenick trägt, ohne sich dabei umzusehen. Auf diese Weise könnte sie erlöst werden.
Einer wollte sich einmal das Geld verdienen und hat das Wagnis unternommen. Also nahm er sie auf den Rücken und ging mit ihr in Richtung Köpenick. Anfangs war sie federleicht, doch je näher er der Stadt kam, desto schwerer wurde sie. Er hielt tapfer aus, erreichte schließlich die Kirche und begann seinen Rundgang.
Aber da erschienen ihm plötzlich Schlangen und Kröten und allerhand scheußliche Tiere mit feurigen Augen. Zwerge stürzten wild hinter ihm her und bewarfen ihn mit Holzscheiten und Steinen. Er ließ sich jedoch durch all das nicht beirren und ging beherzt weiter.
So war er schon beim dritten Rundgang angelangt und hatte seine Aufgabe fast vollendet, als er auf einmal einen fürchterlichen roten Schein erblickte, so als ob ganz Köpenick in Flammen stünde. Da vergaß er das Verbot und schaute sich um. Im selben Augenblick war alles verschwunden und ein heftiger Schlag raubte ihm das Leben.
Im Fischerviertel von Köpenick wohnte vor vielen Jahren ein Fischer namens Buke. Er fischte in der Müggel und wenn er am hellen Mittag seine Netze auswarf, sah er oft eine weiße Gestalt auf einem Wagen herunter fahren. Davor waren vier Pferde gespannt, doch sie hatten alle keine Köpfe.
Nachdem er diese Erscheinung schon mehrmals gehabt hatte und sie eines Tages abermals sah, da war ihm, als hörte er eine Stimme. Die rief ihm zu, er solle nachts um zwölf Uhr in Köpenick auf den Kirchhof kommen und warten, bis die Prinzessin erscheine. Wenn er diese dreimal um die Kirche herum getragen hätte, ohne sich umzuschauen, wäre sie erlöst und er bekäme den großen Schatz, der unter dem Stein liege.
Also ist er tatsächlich nachts hingegangen und hat die Prinzessin auf den Rücken genommen. Doch kaum hatte er seinen Rundgang begonnen, sah er einen großen, schwer beladenen Heuwagen heranfahren, der von vier kleinen Mäusen gezogen wurde.
Das fand er so gruselig, dass er dem vorbeifahrenden Wagen ohne es zu wollen mit den Augen folgte und sich schließlich ganz umdrehte. Aber im selben Augenblick bekam er ein paar heftige Ohrfeigen und die Prinzessin war mitsamt dem Wagen verschwunden.
Volkssage aus Deutschland
DAS BRENNENDE GELD ...
Drei Bauern kamen eine Herbstnacht oder vielmehr früh, als es mehr gegen den Morgen ging, von einer Hochzeit aus dem Kirchdorf Lancken geritten. Sie waren Nachbarn, die in einem Dorfe wohnten, und ritten des Weges miteinander nach Hause.
Als sie nun aus einem Walde kamen, sahen sie an einem kleinen Busche auf dem Felde ein großes Feuer, das bald wie ein glühender Herd voll Kohlen glimmte, bald wieder in hellen Flammen aufloderte. Sie hielten still und verwunderten sich, was das sein möge, und meinten endlich, es seien wohl Hirten und Schäfer, die es gegen die Nachtkälte angezündet hätten.
Da fiel ihnen aber wieder ein, daß es am Schlusse Novembers war, und daß in dieser Jahreszeit keine Hirten und Schäfer im Felde zu sein pflegen. Da sprach der jüngste von den dreien, ein frecher Gesell: "Nachbarn, hört! Da brennt unser Glück! Und seid still und lasst uns hinreiten und jeden seine Taschen mit Kohlen füllen; dann haben wir für all unser Leben genug und können den Grafen fragen, was er für sein Schloß haben will."
Der älteste aber sprach: "Behüte Gott, daß ich in dieser späten Zeit aus dem Wege reiten sollte! Ich kenne den Reiter zu gut, der da ruft: Hoho! Hallo! Halt den Mittelweg!" Der zweite hatte auch keine Lust. Der jüngste aber ritt hin, und was sein Pferd auch schnob und sich wehrte und bäumte, er brachte es an das Feuer, sprang ab und füllte sich die Taschen mit Kohlen.
Die anderen beiden hatte die Angst ergriffen, und sie waren im sausenden Galopp davon gejagt, und er ließ sie auch ausreißen und holte sie dicht vor Vilmnitz wieder ein. Sie ritten nun noch ein Stündchen miteinander und kamen schweigend in ihrem Dorfe an, und keiner konnte ein Wort sprechen. Die Pferde waren aber schneeweiß von Schaum, so hatten sie sich abgelaufen und abgeängstigt.
Dem Bauer war auch ungefähr so zumute gewesen, als habe der Feind ihn schon beim Schopf erfaßt gehabt. Es brach der helle, lichte Morgen an, als sie zu Hause ankamen. Sie wollten nun sehen, was jener gefangen habe, denn seine Taschen hingen ihm schwer genug hinab, so schwer, als seien sie voll der gewichtigsten Dukaten.
Er langte hinein, aber au weh! er brachte nichts als tote Mäuse an den Tag. Die anderen beiden Bauern lachten und sprachen: "Da hast du deine ganze Teufelsbescherung! Die war der Angst wahrhaftig nicht wert!" Vor den Mäusen aber schauderten sie zusammen, versprachen ihrem Gesellen jedoch, keinem Menschen ein Sterbenswort von dem Abenteuer zu sagen.
Man hätte denken sollen, dieser Bauer mit den toten Mäusen habe nun für immer genug gehabt; aber er hat noch weiter gegrübelt über den Haufen brennender Kohlen und bei sich gesprochen: "Hättest du nur ein paar Körnlein Salz in der Tasche gehabt und geschwind auf die Kohlen streuen können, so hätte der Schatz wohl oben bleiben müssen und nicht weg gleiten können."
Und er hat die nächste Nacht wieder ausreiten müssen mit großem Schauder und Grauen, aber er hat es doch nicht lassen können; denn die Begier nach Geld war mächtiger als die Furcht. Und er hat es wieder brennen sehen genau an der gestrigen Stelle; bei Tage aber war da nichts zu sehen, sondern sie war grasgrün.
Und er ist hin geritten und hat das Salz hinein gestreut und seine Taschen voll Kohlen gerafft, und so ist er im sausenden Galopp nach Hause gejagt und hat sich gehütet, daß er einen Laut von sich gegeben noch jemand begegnet ist; denn dann ist es nicht richtig.
Aber er hat doch nichts als Kohlen in der Tasche gehabt und ein paar Schillinge, die von den Kohlen geschwärzt waren. Da hat er sich königlich gefreut, als sei dies der Anfang des Glückes und das Handgeld, das die Geister ihm gegeben haben. Er mochte aber die paar losen Schillinge von ungefähr in der Tasche gehabt haben, als er ausritt.
Und die Schillinge haben dem armen Mann, der sonst ein fleißiger, ordentlicher Bauer war, keine Rast noch Ruhe mehr gelassen; jede Nacht, die Gott werden ließ, hat er ausreiten müssen und seine besten Pferde dabei tot geritten. Man hat es aber nicht gemerkt, daß er Schätze gefunden hat, sondern seine Wirtschaft hat von Jahr zu Jahr abgenommen, und endlich ist er auf einer Nachtfahrt gar einmal verschwunden.
Und man hat von ihm und von seinem Pferde nie etwas wieder gesehen; seinen Hut aber haben die Leute in dem Schmachter See gefunden. Da muß der böse Feind ihn als Irrlicht hinein gelockt haben; denn er braucht solche Künste gegen die, welche sich mit ihm einlassen und ihn suchen.
Ernst Moritz Arndt
DAS WUNDERBUCH ...

In einem Dorfe lebte ein alter Schweinehirt mit seiner Frau, die hatten nur einen Sohn. Als der Alte gestorben war, konnte die Frau mit dem vierzehnjährigen Jungen das Geschäft nicht fort setzen und sah sich genötigt, ihren Sohn zu vermieten. Sie nahm den Jungen bei der Hand und ging mit ihm fort.
Bald kamen sie in einen großen Wald; dort begegnete ihnen ein feiner Herr, der in einer Chaise, mit vier Rappen bespannt, angefahren kam. "Wo wollt Ihr mit dem Knaben hin?" fragte er. "Ich will ihn vermieten", sagte die Frau, "denn ich bin arm und kann ihn nicht ernähren." Da erwiderte der Herr: "Ich gebrauche jetzt gerade einen solchen Burschen, und wenn Ihr wollt, miete ich ihn; gut Essen und Trinken und guten Lohn soll er bei mir haben, und die Arbeit ist auch nicht schwer."
Die Frau war damit einverstanden. Also nahm der Herr den jungen zu sich in den Wagen, und indem er versprach, daß er ihn über Jahr und Tag an der selben Stelle der Frau wieder übergeben wolle, jagte er davon. Nach langem Fahren kamen sie an einen Stock finstern Ort; der Wagen hielt, sie stiegen aus und gingen in ein Haus hinein, in dem es so dunkel war wie in der Nacht.
Im zweiten Zimmer stand auf einem Tisch eine brennende Lampe, und diese Stube wies der Herr dem Jungen zur Wohnung an. "Nun wirst du wohl Hunger haben", sagte er dann; "was möchtest du denn gern essen?" Der Junge antwortete: "Wenn ich jetzt Pellkartoffeln und Hering oder ein tüchtiges Stück Brot hätte, so wäre ich schon zufrieden."
"Das ist nicht viel", entgegnete der Herr. "weißt du nichts Besseres?" Nun wünschte der Junge sich Bratkartoffeln und ein Stück Speck, und der Herr sagte: "Das lasse ich mir schon eher gefallen. Sieh dich nur um, dort in der Ecke steht schon, was du dir gewünscht hast." Der Junge sah sich um und erblickte in der Ecke des Zimmers ein Tischchen, das vorher dort nicht gestanden und auf dem das gewünschte Mahl sich befand.
Als er sich gesättigt hatte, sprach der Herr: "Jetzt will ich dir auch sagen, was du zu tun hast. Dies Haus hat zwölf Stuben, von denen du täglich elf reinigen musst, die zwölfte aber darfst du nicht betreten. Willst du essen, so brauchst du nur zu wünschen, und alsbald wirst du das Gewünschte auf dem Tische finden, und Kleider hängen dort in jenem Schrank; wähle ganz nach Belieben! Ich verreise jetzt und kehre erst nach Jahresfrist zurück. Lass dir aber die Zeit nicht zu lang werden." Damit ging er.
Der Junge öffnete den Schrank, in dem sich die schönsten Kleider befanden, und im Nu verwandelte er sich in einen Prinzen und hing seine alten Kleider an den Nagel. Täglich kehrte er seine Stuben und lebte das ganze Jahr hindurch wie ein Fürst. Nach Ablauf des selben kam der Herr zurück und fand alles in der schönsten Ordnung.
"Jetzt willst du auch wohl deinen Lohn haben?" redete er den Jungen an. "Dort in jener Ecke steht ein Kasten; der wird sich von selbst öffnen, wenn du kommst; aus dem nimm, soviel du magst." Der Junge tat es, und der Herr sagte dann: "Wenn du dich entschließen kannst, noch ein Jahr hier zu bleiben, so behalte ich dich." Der Junge erklärte, er möchte gern für immer bleiben, aber der Herr erwiderte ihm: "Nein, mein Sohn, immer kann ich dich nicht gebrauchen, aber auf ein Jahr wollen wir es noch versuchen." Dann reiste er wieder ab.
Der Junge verrichtete seine Arbeit mit der größten Sorgfalt, und als der Herr nach Jahresfrist zurückkehrte, lobte er ihn sehr und mietete ihn noch auf ein Jahr.
Wieder reiste der Herr ab, und alles ging seinen gewohnten Gang; aber gegen das Ende des Jahres regte sich in dem Jungen die Neugier, und er beschloss, zu ergründen, was es mit dem zwölften
Zimmer für eine Bewandtnis habe.
Eines Morgens öffnete er das selbe, und wie erstaunte er, als ihm das helle Tageslicht entgegen strahlte! Er trat ans Fenster und erblickte einen so herrlichen Garten, wie er noch keinen gesehen hatte. Da plötzlich kam ein Specht heran geflogen und flatterte vor dem Fenster auf und nieder. Der Junge ergriff ein Gewehr, das an der Wand hing, um den Vogel zu schießen; dabei aber stieß er von dem nebenan stehenden Spinde ein Buch herunter, das sich im Fallen öffnete, und sogleich sprang zwischen den Blättern ein schwarzer Mann hervor und fragte, sich vor dem Jungen verbeugend:
"Königliche Majestät, was befehlen Sie?" Der Junge wusste nicht, wie ihm geschah. Rasch schloss er das Buch und legte es an seinen Ort; aber immer wieder fiel es herunter, bis er es endlich in die Tasche seines alten Rockes steckte, wo es auch blieb. Als nach Ablauf des Jahres der Herr wieder erschien, sagte er zu dem Jungen: "Jetzt nimm dir aus dem Kasten deinen Lohn und Kleider, soviel du willst, und dann mache, dass du fort kommst!"
Der Junge, der kein gutes Gewissen hatte, packte so schnell als möglich seine Sachen zusammen und machte sich auf den Weg. Unerkannt kam er zu seinem Heimatdorf und fragte nach der alten Schweinehirtin. Man bezeichnete ihm die Wohnung, und er fragte die Tagelöhnerfrau, bei der seine Mutter hausein wohnte, wo die selbe sei.
Die alte Frau wurde gerufen, aber sie erkannte ihren Sohn nicht wieder und sagte: "Wenn ich einen solchen Sohn hätte, was fehlte mir dann?" "Habt Ihr denn kein Zeichen", fragte da der Jüngling, "an dem Ihr Euren Sohn wiedererkennen würdet?" - "Ja", sagte sie, "auf der Brust hatte er einen Fleck." Da entblößte er seine Brust und, vor Freuden weinend, umarmte die Mutter ihren Sohn.
Bald hatte sich im Dorf die Nachricht verbreitet, dass der Sohn des Schweinehirten sehr reich wieder gekommen sei und er so feine Kleider trage, als selbst der Gutsherr nicht. Auch die einzige Tochter des Gutsherrn hörte von dem stattlichen Jüngling und ward neugierig, ihn kennen zu lernen. Auf ihren Wunsch wurde eine große Gesellschaft gegeben, zu der auch der Sohn des Schweinehirten eine Einladung erhielt.
Er erschien, und bald hatte sich das Fräulein so in ihn verliebt, dass sie ihrem Vater erklärte, nur den wolle sie zum Manne haben oder sonst keinen. Der Vater suchte es ihr auszureden, aber sie blieb dabei, sie wolle nur ihn haben, wenn er auch nur eines Schweinehirten Sohn sei. So fasste sich der Gutsherr seiner Tochter zuliebe endlich ein Herz und trug dem jungen Manne die Hand seiner Tochter an.
Doch der Jüngling erwiderte, er sei zum Heiraten noch zu jung. Darüber aber grämte sich die Jungfrau so sehr, dass sie in eine schwere Krankheit verfiel. Als sie genesen, bestürmte sie den Vater von neuem mit Bitten, und der wiederholte seinen Antrag. Der Jüngling aber erwiderte, er wolle seine Tochter überhaupt nicht heiraten.
Von nun ab machte er täglich Spaziergänge in die Umgegend. Eines Tages kam er an ein großes Moor, in dessen Mitte eine Stück trockenes Land lag. Das Stück Erde gefiel ihm so sehr, dass er beschloss, es dem Gutsherrn abzukaufen. Er ging zu ihm und trug sein Anliegen vor; der Gutsherr wollte es ihm schenken, das wollte der junge Mann aber nicht, sondern drang auf einen ordentlichen Verkauf, der denn auch zustande kam.
Unterwegs erinnerte er sich jenes Wunderbuches wieder; zu Hause angekommen, klappte er es auf, und sofort stand der schwarze Johann vor ihm und fragte: "Königliche Majestät, was befehlen Sie?" "Ja, Johann", sagte der Jüngling, "da ich dir nun doch einmal zu befehlen habe, so will ich, daß du mir auf dem gekauften Moor binnen achtundvierzig Stunden ein so prächtiges Schloss erbaust, wie es selbst der König von Holland nicht hat, und um das Schloss herum sollst du einen herrlichen Garten anlegen und Bäume mit goldenen und silbernen Blättern pflanzen."
Pünktlich war der Befehl ausgeführt, und der junge Mann nahm seine Mutter bei der Hand und sprach: "jetzt wollen wir unsere eigene Wohnung beziehen!" Dort lebte nun die alte Frau so glücklich wie im Paradiese. Nach einiger Zeit hörte der Hirtensohn, dass der König von Holland eine bildschöne Tochter habe, und diese wollte er um jeden Preis besitzen. Er stellte sich deshalb krank und sagte zur besorgten Mutter:
"Sterben werde ich nicht, aber wenn ich nur der Tochter des Königs von Holland in die Augen sehen könnte, so würde ich gesund." Die Mutter sprach: "Wenn es nicht allzu weit wäre, möchte ich schon hingehen." Nun schrieb der Sohn ein Brieflein an den König; das gab er seiner Mutter und sagte: "Wenn Euch die Wache nicht durchlassen will, braucht Ihr nur den Brief in die Höhe zu heben."
Es kam, wie der Sohn gesagt hatte, die Wache verbot ihr den Eintritt in das königliche Schloss. Als aber der König, der gerade im Fenster lag, den empor gehaltenen Brief erblickte, rief er dem Posten zu: "Lasst doch die alte Frau durch!" Die Frau trat ein und überreichte dem König den Brief ihres Sohnes. Der König las ihn und sagte: "Ich werde mit meiner Tochter sprechen."
Sogleich war die Prinzessin bereit, den Wunsch des Kranken zu erfüllen, und sagte: "Wenn meine Augen ihn gesund machen können, so will ich gern hinreisen." Ohne Unfall kam man bei dem Schlosse des Hirtensohnes an. Eine glänzende Dienerschar empfing die Prinzessin, die erstaunt war über all die Pracht, die sie hier erblickte.
Man führte sie zu dem Kranken, der schon sehnsüchtig nach ihr ausgeschaut hatte, und als er ihr so recht tief in die Augen gesehen, da äußerte er auch sogleich den Wunsch, aufzustehen, und wollte sich durch nichts mehr im Bett zurück halten lassen. Er war ganz gesund und bat die Prinzessin, mit ihm einen Spaziergang durch den Garten zu machen. Sie war entzückt über die schönen Blumen und die herrlichen Bäume mit den goldenen Blättern, aber der Schlossherr sagte traurig:
"Ja, schön ist der Garten, aber doch vermisse ich eine Blume, die in Ihrem Garten so wundervoll blüht." "Lässt sich jene Blume nicht hierher verpflanzen?" entgegnete die Prinzessin, und der Jüngling erwiderte: "Ja, wenn Sie selbst es wollen." Die Prinzessin kehrte nach Hause zurück und erzählte ihrem Vater alles. Aber noch hatte sie nicht geendet, da war schon ein Schnellläufer von jenem Schlosse eingetroffen und lud die holländischen Majestäten zu einem Feste dorthin ein.
Dankbar wurde die Einladung angenommen, denn der König wollte selbst den jungen Schlossherrn kennen lernen, den seine Tochter gesund gemacht hatte. Sie wurden mit solcher Pracht empfangen, wie sie an ihrem Hofe noch nicht gewesen war, und als der König die reiche Tafel und die prächtigen Gemächer und den herrlichen Garten aufs höchste rühmte; da sagte der Schlossherr:
"Schön ist ja alles, nur fehlt mir die Blume, die allein Ihren Garten ziert." Der König verstand den Wink; er ergriff die Hand seiner Tochter, legte sie in die Hand des Jünglings und sagte: "Da hast du die Blume, mein Sohn!" Nun ward eine prächtige Verlobung gefeiert, und als der Hochzeitstag heranrückte, da sagte der Schlossherr zu seinem Johann:
"Nun sorge dafür, dass auf den Wagen ein Sack voll Goldstücke kommt, und wenn wir in die holländische Residenz einziehen, öffnest du den Sack und lässt die Goldstücke auf die Straße fallen; doch achte darauf, dass kein Reicher etwas aufhebt, das Geschenk ist nur für die Armen bestimmt." Dann ward die Hochzeit gefeiert, und die Neuvermählten kehrten zurück zu dem Wunderschlosse.
Der König von Holland hatte aber einen schlauen Minister, der sich früher selbst um die Hand der Prinzessin beworben hatte und auch jetzt häufig zum Besuch nach dem Wunderschlosse kam. Als der Schlossherr nun einmal auf der Jagd war, fragte er die Prinzessin, woher denn all die Pracht stamme. Arglos antwortete sie: "Mein Gemahl hat ein Buch; dort über der Tür auf dem Brette liegt es; wenn er das in die Hand nimmt, so wird ihm jeder Wunsch erfüllt."
Begierig griff der Minister danach, und kaum hatte er es geöffnet, da stand Johann vor ihm und fragte nach seinen Befehlen. "Wenn ich dir zu befehlen habe", sagte der Minister, "so fordere ich, daß du deinen bisherigen Herrn vierundzwanzig Stunden in einem Sumpfe fest hältst, dies Schloss aber mit all seiner Herrlichkeit in eine Grube bringst, wohin weder Sonne noch Mond scheint." So geschah es.
Der Schlossherr geriet in einen Sumpf, aus dem er sich erst nach vierundzwanzig Stunden herauszuarbeiten vermochte, und da er wusste, dass sein Schloss nun nicht mehr auf der selben Stelle stehe, so machte er sich auf und wanderte zu seinem Schwiegervater nach Holland, dem er seine Not klagte. Der König aber rief zornig aus: "Das hat der nichtswürdige Minister getan !"
Nun streifte der Jüngling in den königlichen Wäldern umher, und zwölf Jäger mussten ihn begleiten, damit ihm kein Unglück zustieße. Aber schon am zweiten Tage verirrte er sich. Im Dickicht des Waldes traf er auf zwei Riesen, die einen heftigen Wortwechsel miteinander führten. Der Jüngling - durch seine Verheiratung mit der Prinzessin war er ein Prinz geworden - fragte sie:
"Warum zankt ihr euch?" Da erwiderten sie: "Wir haben hier zu gleicher Zeit einen Mantel gefunden, den nun jeder beansprucht; er wäre ja nicht des Streites wert, aber er besitzt die Eigenschaft, dass er den unsichtbar macht, der ihn anzieht." "Wisst ihr was?" sagte der Prinz. "Gebt mir den Wundermantel, ich kann ihn gut gebrauchen, ihr aber seid den Streit los."
Sie waren es zufrieden, er nahm den Mantel und ging weiter. Am nächsten Tage traf er abermals zwei Riesen in heftigem Streit um einen Stiefel, den sie gefunden hatten, und auch diese wusste er zu überreden, ihm den Stiefel zu lassen. Der Stiefel besaß aber die Eigenschaft, dass der, welcher ihn anhatte, jedes Mal hundert Meilen vorwärts machte, wenn er sagte: "Stiefel, schreit!"
Mit Hilfe des selben kam er bald zu Hause an, wo man seiner schon ängstlich geharrt hatte. Am folgenden Tage eröffnete er dem König, dass er sich auf die Reise nach dem verlorenen Schlosse begeben wolle und nicht eher wiederkehren werde, als bis er sein Eigentum gefunden. Obgleich ungern, ließ ihn der König ziehen.
Im Walde hängte er den Mantel um und fragte seine Begleiter, ob sie ihn noch sähen; sie verneinten es, und nun verabschiedete er sich von ihnen, zog dann den Stiefel an, und fort ging es, der Residenz des Riesenkönigs entgegen, wo er freundlich aufgenommen wurde. Nachdem der Prinz dem König sein Leid geklagt, sagte dieser: "Ich bin der Herr der Fische, Vögel und Mäuse; wenn sie nichts von dem Schlosse wissen, werde ich dir schwerlich helfen können."
Nun zog er eine Pfeife aus der Tasche und blies hinein. In kurzer Zeit waren alle Fische um den König versammelt, und er fragte sie, ob ihnen von dem Schlosse etwas bekannt sei. Alle verneinten. Ein kurzer Pfiff aus einer anderen Pfeife brachte dann alle Vögel vor den König, aber auch sie sagten, dass sie von dem Schlosse nichts wüssten. "Also hast du im Wasser und in der Luft dein Eigentum nicht zu suchen", sprach der König zu dem betrübt darein schauenden Jägersmann.
Endlich brachte ein Pfiff aus einer dritten Pfeife alle Mäuse vor den König. "Seid ihr alle hier?" fragte er. Alle waren erschienen bis auf ein dickes, fettes Mäuschen, das so schnell nicht hatte vorwärts kommen können. Endlich langte es schweißtriefend an. "Wo bist du so lange gewesen?" fragte der König freundlich. Die Maus berichtete, dass sie sehr weit weg in einem unterirdischen Schlosse wohne, das weder von Sonne noch von Mond beschienen werde, und nicht eher habe zur Stelle sein können. "Gut", sprach der König, "das Schloss gehört diesem Herrn hier, und willst du deine Untertanentreue beweisen, so führe ihn dort hin, er wird dir es zu Danken wissen."
Also machte sich der Prinz mit der Maus auf den Weg. Es ging aber gewaltig langsam, und der Prinz sagte deshalb zu seiner Begleiterin: "Das Gehen wird dir schwer; setze dich deshalb auf meinen Hut und gib mir die Richtung an, so werden wir schneller vorwärts kommen." So geschah es, und mit Hundertmeilenschritten eilten sie weiter. Bald kamen sie in die tiefste Finsternis, und die Maus erklärte, dass sie in der Nähe des unterirdischen Schlosses wären, und riet zugleich, ihr einen Faden an den Fuß zu binden, dann wolle sie vorangehen, und der Prinz solle ihr folgen. Sie gelangten bis dicht ans Schloss.
Der Prinz schickte nun die Maus in das Innere des selben, um zu erfahren, was die Bewohner trieben; nach kurzem kam sie zurück und brachte den Bescheid, dass der Minister mit seiner Gemahlin im Bette schlafe. "Sind nicht die Schlüssel zu finden", forschte der Prinz, "und kannst du sie nicht durch dein Loch mir bringen?" - "Ja", sagte die Maus und verschwand wieder; dann, nach wenig Minuten, brachte sie die Schlüssel angeschleppt, und der Prinz öffnete die Tür, blieb aber auf der Schwelle des Schlafgemaches stehen.
"Wo mag das Buch sein?" fragte er, und die Maus erwiderte: "Das hat der Minister unter dem Kopfkissen liegen." "So hole mir es!" bat der Prinz. Die Maus verkroch sich im Bett und fing an dem Buche zu zerren an. Endlich fiel es aus dem Bette heraus, und die Maus schleppte es nun bis zu den Füßen des Prinzen. Der ergriff es hocherfreut und öffnete es, und sogleich sprang Johann hervor.
"Ich Verlange", sagte nun der Prinz, "dass die beiden schlafen, bis ich es für gut finde, sie zu wecken, und dann hast du schleunigst das Schloss wieder an seine alte Stelle zu schaffen!" Und zu der Maus sagte er: "Und du, mein Mäuschen, setze dich dort auf den Tisch und komm mit mir, ich will dir wohl tun, solange du lebst."
Sobald das Schloss wieder an seiner früheren Stelle stand, ließ der Prinz durch einen Schnellläufer seinen Schwiegervater zu sich bitten, und als er ankam, führte er ihn in das Schlafgemach. Der
König ergriff den Degen und wollte die Schläfer durchbohren, aber der Prinz hielt ihn zurück und sagte: "Die Strafe wäre für den schändlichen Minister viel zu gelinde, er soll sich sein Urteil
selbst sprechen."
Also weckte er ihn, und als der Minister die Gefahr sah, in der er sich befand, sprach er:
"Ich habe verdient, von vier Bullen auseinander gerissen zu werden." Sofort wurde Johann beauftragt, vier schwarze Bullen, herbeizuschaffen; der Schurke wurde mit Armen und Beinen an den Tieren befestigt und so zerrissen. Seine Gemahlin aber begnadigte der Prinz und lebte glücklich mit ihr bis an sein Ende.
Deutsches Volksmärchen
DER DRACHE ALS DIENER ...
Ein Bauer in Prislich hatte ein Bündnis mit dem Teufel geschlossen und ihm seine Seele verschrieben. Dafür hatte er von ihm einen Drachen bekommen, der ihm alle möglichen Reichtümer herbei schaffte. Wann immer er wollte, kamen auf diese Weise Korn, Stroh, Mehl, Butter und allerlei schöne Dinge durch die Luft angesegelt und vermehrten den Reichtum des ohnehin wohlhabenden Bauern bis zum Überfluss.
Der Schäfer des Dorfes aber war ein pfiffiger Kopf und konnte sogar ein wenig zaubern. So gelang es ihm immer wieder, den Drachen seine Gaben schon vorher fallen zu lassen. Die Sachen, die sich der gierige Bauer gewünscht hatte, wurden in alle Winde verstreut und er ging leer aus.
Der Drache und sein Meister wollten sich für diesen Schabernack rächen. Der Drache besorgte eine ungeheure Menge von Läusen, die sollten alles Vieh im Dorf befallen und krank machen. Mit dem Einsammeln der Läuse hatten der Teufel und der Drache ganz schön lange zu tun.
Der Schäfer glaubte währenddessen schon, er hätte den Drachen wohl für immer vertrieben. Deswegen hielt er Nachts auch nicht mehr so oft Wache, sondern schlief tief und fest, als der Drache mit all dem Ungeziefer angebraust kam.
Zufällig war jedoch gerade ein anderer Bürger von Prislich draußen auf dem Feld. Er sah den Drachen und führte den gleichen Zauber aus, den er bei dem Schäfer so oft gesehen und gehört hatte. Er machte seine Sache recht gut, aber eben doch nicht ganz richtig. Der Drache verlor zwar sein Ungeziefer, doch alle Läuse fielen auf den Mann und verschafften ihm ein Jucken, wie er es sein Lebtag nicht gehabt hatte.
Bald darauf starb zur Freude des Dorfes der alte geizige Bauer und wurde vom Teufel eigenhändig abgeholt. Da verließ zum Glück auch der Drache das Dorf.
Deutsches Sagenbuch
DIE GRUBEN VON ST ANDREASBERG ...
Tief im Harz liegt die Bergstadt St. Andreasberg, in welcher vormals ein reicher Grubenbau betrieben wurde. Von den Gruben waren St. Andreas und Samson, Katharine Neufang, der Große Johann und der Goldene Altar die reichsten. Aber auch die weniger ergiebigen trugen schöne Namen, sie hießen Morgenröte, Abendröte, Teuerdank, Engelsburg, Drei Ringe, Weinstock und so fort.
Es gab auch Berggeister in jenen Gruben und so trug sich einmal Folgendes zu:
Ein redlich Gräflich – Hohensteinischer Obersteiger, der bereits recht alt war, einen eisgrauen Bart und graues Haar trug und Jakob Illing hieß, war einst in die Grube gefahren. Dort traf er auf einen Berggeist und dieser hauchte ihn an. Da wurde dem alten Mann sehr seltsam zumute und er fürchtete, dass er bald sterben müsse.
Nachdem er wieder an der Erdoberfläche gekommen war, machte er gleich sein Testament, denn nun fielen ihm auch alle Haare aus und er wurde völlig kahl. Der Mann blieb dennoch am Leben – und damit nicht genug. Es wuchs ihm neues, schönes schwarzes Haar und er verjüngte sich von Tag zu Tag. Schließlich war er wieder ein prächtiger junger Bursche geworden und heiratete noch einmal. Seine Nachkommen aber haben später viele Jahre lang das Grubenhagen’sche Bergwerk als Bergmeister mit großem Erfolg geleitet.
Ein anderer Steiger hatte zu einer Zeit, in der die Gruben reiche Ausbeute abwarfen, einige reiche Stufen Gesteinsstück aus dem großem Johann und dem Goldenen Altar bei Seite geschafft, um sie für weniger gute Zeiten als Rücklage aufzubewahren.
Seine Mitgesellen aber, die ihn beobachtet hatten, glaubten, dass er die Stufen für sich selbst abgezweigt habe, und klagten ihn wegen Veruntreuung an. Und da auf ein solches Vergehen damals die Todesstrafe stand, wurde nicht länger gefackelt. Der Bergmann sollte enthauptet werden. Als er nun im Angesicht des Todes auf der Richtstatt kniete, rief er:
„Gott wird ein Zeichen geben, an dem meine Unschuld erkannt werden wird! Fluch über die Gruben, bis ein Graf mit Glasaugen und Rehfüßen geboren wird und auch am Leben bleibt!“
Da tat der Scharfrichter seinen Schwerthieb, das Haupt des unschuldigen Mannes fiel, aber statt Blut kamen zwei Milchströme aus dem Rumpf geschossen. Dies war das göttliche Zeichen. Zugleich ertönte in der Ferne ein Donnerschlag, der die Erde erbeben ließ. Die genannten Gruben waren eingestürzt und fortan nicht mehr befahrbar.
Schließlich aber begab es sich, dass tatsächlich ein junger Graf geboren wurde, der Rehfüße und Glasaugen besaß, und man hoffte schon auf neuerlichen Segen für die verschütteten Gruben – doch die
Hoffnung wurde enttäuscht. Das seltsame Kind konnte nicht überleben.
So blieben die Gruben für immer verschüttet.
Volkssage
DIE BERGGEISTER VON ALTENSTEIN ...
In den Schächten und Stollen des Bergwerkes bei Altenstein gab es Berggeister und manchen verborgenen Schatz.
Einst ging ein junger Bergmann aus Steinbach zu seinem Schacht auf der Windleite. Dort sah er ein ganzes Heer kleiner Bergmännchen, die waren eifrig damit beschäftigt, die Kübel hochzuziehen und die Steine zu klopfen. Aber als er nun mit staunendem Mund näher kam, ganz verwundert über die kleinen Arbeiter, hui!, da purzelten sie alle miteinander kopfüber in den Schacht und es krachte, als ob der ganze Schacht in sich zusammen bräche.
Den jungen Bergmann packten Angst und Entsetzen, er ging zum Schacht hin, schnallte seinen Werkzeug Gürtel ab, warf ihn samt dem Grubenlicht in die Tiefe und rief: „Mit euch fahre ich nicht hinab!“ Er ging hinüber in die Ruhl und wurde ein Messerschmied.
Nachdem er dieses Handwerk gelernt hatte, kam er wieder nach Steinbach, ließ sich dort als Messermacher nieder und brachte so als erster Meister das Handwerk in diesen Ort. Im Laufe der Zeit haben die Steinbacher es ihm mehr und mehr nachgemacht und wurden nicht mehr Bergleute, sondern Messermacher.
Einst arbeitete ein Bergmann aus Glücksbrunn im Regina Schacht. Da hörte er ein Rauschen und meinte, es käme ein anderer Arbeiter angefahren. Er erblickte eine Menschengestalt, die trug einen schwarzen Hut, eine grüne Jacke, schwarze Hosen und Schuhe und weiße Strümpfe. Sie hielt ein hell brennendes Grubenlicht in der Hand, und hatte ein schönes Gesicht mit glänzenden Augen.
Die Erscheinung war jedoch so groß, dass sie oben an der Decke anstieß. Der verängstigte Bergmann schwieg und arbeitete angestrengt weiter, immer schneller und heftiger. Da wandte sich die Gestalt nach Osten und entfernte sich. Hätte der furchtsame Arbeiter doch nur den Bergmanngruß: „Glück auf!“ gesprochen, dann hätte der Geist ihm ganz gewiss den reichen Stollen des Glücks gezeigt und geöffnet.
So aber sah er diese Bergerscheinung nie wieder.
„Deutsche Volkssagen“ Friedrich Ranke
BULEMANNS HAUS ...
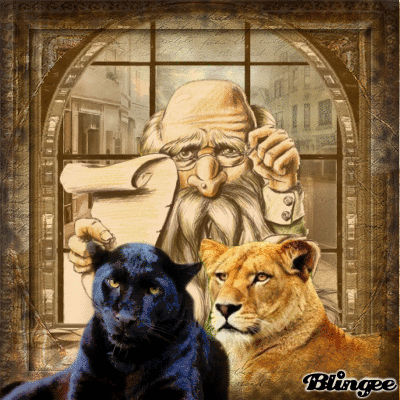
In einer norddeutschen Stadt in der sogenannten Düsternstraße steht ein verfallenes Haus. Es ist nur schmal, aber drei Stockwerke hoch; in der Mitte des selben vom Boden bis fast an die Spitze des Giebels, springt die Mauer in einem Erkerartigen Ausbau vor, welcher für jedes Stockwerk nach vorne und an den Seiten mit Fenstern versehen ist, so dass in hellen Nächten der Mond hinein scheinen kann. Seit Menschengedenken ist niemand in dieses Haus hinein – und niemand heraus gegangen, der schwere Messingklopfer an der Haustür ist fast schwarz von Grünspan, zwischen den Rotzen der Treppensteine wächst jahraus, jahrein das Gras.
Wenn ein Fremder fragt: „Was ist denn das für ein Haus?“, so erhält er gewiss zur Antwort: „Es ist Bulemanns Haus.“, wenn er aber weiter fragt: „Wer wohnt denn darin?“, so antwortet er eben
gewiss: „Es wohnt so niemand darin.“ Die Kinder auf den Straßen und die Ammen an der Wiege singen:
„In Bulemanns Haus,
In Bulemanns Haus,
Da gucken die Mäuse
zum Fenster hinaus.“
Und wirklich wollen lustige Brüder, die von nächtlichen Schmäusen dort vorbei gekommen, ein Gequicke wie von unzähligen Mäusen hinter den dunkeln Fenstern gehört haben. Einer, der im Übermut den
Türklopfer anschlug, um den Widerhall durch die öden Räume schollern zu hören, behauptet sogar, er habe drinnen auf den Treppen ganz deutlich das Springen großer Tiere gehört.
„Fast“, pflegt er, dies erzählend hinzuzusetzen, „hörte es sich an wie die Sprünge der großen Raubtiere, welche in der Menageriebude auf dem Rathausmarkt gezeigt wurden.“ Das gegenüberstehende Haus ist um ein Stockwerk niedriger, so dass nachts das Mondlicht ungehindert in die oberen Fenster des alten Hauses fallen kann.
Aus einer solchen Nacht hat auch der Wächter etwas zu erzählen; aber es ist nur ein kleines altes Menschenantlitz mit einer bunten Zipfelmütze, das er droben hinter den runden Erkerfenstern gesehen haben will. Die Nachbarn dagegen meinen, der Wächter sei wieder einmal betrunken gewesen; sie hätten drüben an den Fenstern niemals etwas gesehen, das einer Menschenseele gleich gewesen.
Am meisten Auskunft scheint noch ein alter, in einem entfernten Stadtviertel lebenden Mann geben zu können, der vor Jahren Organist in der St. Magdalenen Kirche gewesen ist. „Ich entsinne mich“, äußerte er, als er einmal darüber befragt wurde, „noch sehr wohl des hageren Mannes, der während meiner Knaben Zeit allein mit einer alten Weibsperson in jenem Haus wohnte.
Mit meinem Vater, der ein Trödler gewesen ist, stand er ein paar Jahre lang in lebhaftem Verkehr und ich bin derzeit manches Mal mit Bestellungen an ihn geschickt worden. Ich weiß auch noch, dass ich nicht gern diese Wege ging und oft allerlei Ausflucht suchte; denn selbst bei Tage fürchtete ich mich, dort die schmalen dunklen Treppen zu Herrn Bulemanns Stube im dritten Stock hinaufzusteigen.
Man nannte ihn unter den Leuten den „Seelenverkäufer“, und schon dieser Name erregte in mir Angst, zumal daneben allerlei unheimliches Gerede über ihn im Schwange ging. Er war, ehe er nach seines Vaters Tode das alte Haus bezogen hatte, viele Jahre als Supercargo auf Westindien gefahren.
Dort sollte er sich mit einer Schwarzen verheiratet haben; als er aber heimgekommen ist, hatte man vergebens darauf gewartet, eines Tages auch jene Frau mit einigen dunklen Kindern anlangen zu sehen. Und bald hieß es, er habe auf der Rückfahrt ein Sklavenschiff getroffen und an den Kapitän des selben sein eigen Fleisch und Blut nebst ihrer Mutter um schnödes Gold verkauft. –
„Was Wahres an solchen Reden gewesen, vermag ich nicht zu sagen“, pflegte der Greis hinzu zu setzen; „denn ich will auch einem Toten nicht zu nahe treten; aber so viel ist gewiß, ein geiziger und menschenscheuer Kauz war es; und seine Augen blickten auch, als hätten sie böse Taten zugesehen. Kein Unglücklicher und Hilfesuchender durfte seine Schwelle betreten; und wann immer ich damals dort gewesen, stets war von innen die eiserne Kette vor die Tür gelegt. –
„Wenn ich dann den schweren Klopfer wiederholt hatte anschlagen müssen, so hörte ich wohl von der obersten Treppe herab die scheltende Stimme des Hausherrn: „Frau Anken! Frau Anken! Ist sie taub! Hört sie nicht, es hat geklopft!“
Alsbald ließen sich aus dem Hinterhause über Pesel und Korridor die schlurfenden Schritte des alten Weibes vernehmen. Bevor sie aber öffnete, fragte sie hüstelnd: „Wer ist es denn?“, und erst, wenn ich geantwortet hatte: „Es ist der Leberecht!“ ,wurde die Kette drinnen abgehakt.
Wenn ich dann die siebenundsiebzig Treppenstufen – denn ich habe sie einmal gezählt – hinauf gestiegen war, pflegte Herr Bulemann auf dem kleinen dämmerigen Flur vor seinem Zimmer schon auf mich zu warten; in dieses selbst hatte er mich nicht hinein gelassen. Ich sehe ihn noch, wie er mit seinem gelb geblümten Schlafrocke mit der spitzen Zipfelmütze vor mir stand, mit der einen Hand rücklings die Klinke seiner Zimmertür haltend.
Während ich mein Gewerbe bestellte, pflegte er mich mit seinen grellen runden Augen ungeduldig anzusehen, und mich darauf hart und kurz abzufertigen. Am meisten erregte damals meine Aufmerksamkeit ein paar ungeheure Katzen, eine gelbe und eine schwarze, die sich mitunter hinter ihm aus seiner Stube drängten und ihre dicken Köpfe an seinen Knien rieben. Nach einigen Jahren hörte indessen der Verkehr mit meinem Vater auf, und ich bin nicht mehr dort gewesen. –
Dies alles ist nun über siebzig Jahre her, und Herr Bulemann muss längst dahin getragen sein, von wannen niemand wiederkehrt.“ – Der Mann irrte sich, als er so sprach. Herr Bulemann ist nicht aus seinem Hause getragen worden; er lebt darin noch jetzt. Das aber ist so zugegangen.
Vor ihm, dem letzten Besitzer, noch um die Zopf – und Haarbeutelzeit, wohnte in jenem Hause ein Pfandverleiher, ein altes verkümmertes Männchen. Da er sein Gewerbe mit Umsicht seit über fünf Jahrzehnte betrieben hatte und mit einem Weibe, das ihm seit dem Tode seiner Frau die Wirtschaft führte, aufs spärlichste lebte, so war er endlich ein reicher Mann geworden.
Dieser Reichtum bestand aber zumeist in einer fast unübersehbaren Menge von Pretiosen, Geräten und seltsamstem Trödelkram, was er alles von Verschwendern oder Notleidenden im Laufe der Jahre als Pfand erhalten hatte und das dann, da die Rückzahlung des darauf gegebenen Darlehns nicht erfolgte, in seinem Besitz zurück geblieben war.
Da er bei einem Verkauf dieser Pfänder, welcher gesetzlich durch die Gerichte geschehen musste, den Überschuss des Erlöses an die Eigentümer hätte herausgeben müssen, so häufte er sie lieber in den großen Nussbaumschränken auf, mit denen zu diesem Zwecke nach und nach die Stuben des ersten und endlich auch des zweiten Stockwerks besetzt wurden.
Nachts aber, wenn Frau Anken im Hinerhaus, in ihrem einsamen Kämmerchen schnarchte und die schwere Kette vor der Haustür lag, stieg er oft mit leisem Tritt die Treppen auf und ab. In seinem hechtgrauen Rockelor eingeknöpft, in der einen Hand die Lampe, in der anderen das Schlüsselbund, öffnete er bald im ersten, bald im zweiten Stockwerk die Stuben – und Schranktüren, nahm hier eine goldene Repetieruhr, dort eine emaillierte Schnupftabakdose aus dem Versteck hervor und berechnete bei sich die Jahre ihres Besitzes und ob die ursprünglichen Eigentümer dieser Dinge wohl verkommen und verschollen seien oder ob sie noch einmal mit dem Gelde in der Hand wiederkehrten und ihre Pfänder zurück fordern könnten.
Der Pfandverleiher war endlich im äußersten Greisenalter von seinen Schätzen weg gestorben und hatte das Haus nebst den vollen Schränken seinem einzigen Sohn hinterlassen müssen, den er während seines Lebens auf jede Weise daraus fernzuhalten gewusst hatte.
Dieser Sohn war der von dem kleinen Leberecht gefürchtete Supercargo, welcher eben von seiner überseeischen Fahrt in seine Vaterstadt zurück gekehrt war. Nach dem Begräbnis des Vaters gab er seine früheren Geschäfte auf und bezog dessen Zimmer im dritten Stock des alten Erkerhauses, wo nun statt des verkümmerten Männchens im hellgrauen Rockelor eine lange hagere Gestalt im gelb geblümten Schlafrock und bunter Zipfelmütze auf und ab wandelte oder rechnend an dem kleinen Pulte des Verstorbenen stand. –
Auf Herrn Bulemann hatte sich indessen das Behagen des alten Pfandverleihers an den aufgehäuften Kostbarkeiten nicht vererbt. Nachdem er bei geriegelten Türen den Inhalt der großen Nussbaumschränke untersucht hatte, ging er mit sich zu Rate, ob er den heimlichen Verkauf dieser Dinge wagen solle, die immer noch das Eigentum anderer waren und an deren Wert er nur auf Höhe der ererbten und, wie die Bücher ergaben, meist sehr geringen Darlehensforderung einen Anspruch hatte.
Aber Herr Bulemann war keiner von den Unentschlossenen. Schon in wenigen Tagen war die Verbindung mit einem in der äußersten Vorstadt wohnenden Trödler angeknüpft und nachdem ihm einige Pfänder aus den letzten Jahren zurück gesetzt hatte, wurde heimlich und vorsichtig der bunte Inhalt der großen Nussbaumschränke in gediegene Silbermünzen umgewandelt.
Das war die Zeit, wo der Knabe Leberecht ins Haus gekommen war. Das gelöste Geld tat Herr Bulemann in große, eisenbeschlagene Kasten, welche er nebeneinander in seine Schlafkammer setzen ließ; denn bei der Rechtlosigkeit seines Besitzes wagte er nicht, es auf Hypotheken auszutun oder sonst öffentlich anzulegen.
Als er alles verkauft hatte, machte er sich daran, sämtliche für die mögliche Zeit seines Lebens denkbare Ausgaben zu berechnen. Er nahm dabei ein Alter von neunzig Jahren in Ansatz, und teilte dann das Geld in einzelne Päckchen je für eine Woche, in dem er auf jedes Quartal auch noch ein Röllchen für unvorhergesehene Ausgaben dazulegte.
Dieses Geld wurde für sich in einen Kasten gelegt, welcher nebenan im Wohnzimmer stand; und alle Sonnabendmorgen erschien Frau Anken, die alte Wirtschafterin, die er aus der Verlassenheit seines Vaters mit übernommen hatte, um ein neues Päckchen in Empfang zu nehmen und über die Verausgabung des vorigen Tages Rechenschaft zu geben.
Wie schon erzählt, hatte Herr Bulemann Frau und Kinder nicht mitgebracht; dagegen waren zwei Katzen von besonderer Größe, eine gelbe und eine schwarze, am Tage nach der Beerdigung des alten Pfandverleihers durch einen Matrosen in einem fest zugebundenen Sacke von Bord des Schiffes ins Haus getragen worden.
Diese Tiere waren bald die einzige Gesellschaft ihres Herrn. Sie erhielten mittags ihre eigene Schüssel, die Frau Anken unter verbissenem Ingrimm tagaus – und – ein für sie bereiten musste; nach dem Essen, während Herr Bulemann sein kurzes Mittagsschläfchen ab tat, saßen sie gesättigt neben ihm auf dem Kanapee, ließen ein Läppchen Zunge hervorhängen und blinzelten ihn schläfrig aus ihren grünen Augen an.
Waren sie in den unteren Räumen des Hauses auf der Mausjagd gewesen, was ihnen indessen immer einen heimlichen Fußtritt von dem Weibe eintrug, so brachten sie gewiß die gefangenen Mäuse zu erst ihrem Herrn im Maule hergeschleppt und zeigten sie ihm, ehe sie unter das Kanapee krochen und sie verzehrten.
War dann die Nacht gekommen und hatte Herr Bulemann die bunte Zipfelmütze mit einer weißen vertauscht, so begab er sich mit seinen Katzen in das große Gardinenbett im Nebenkämmerchen, wo er sich durch die der gleichmäßigen Spinnen der zu seinen Füßen eingewühlten Tiere in den Schlaf bringen ließ.
Dieses friedliche Leben war indes nicht ohne Störung geblieben. Im Lauf der ersten Jahre waren dennoch einzelne Eigentümer der verkauften Pfänder gekommen und hatten gegen Rückzahlung des darauf erhaltenen Sümmchens die Auslieferung ihrer Pretiosen verlangt. Und Herr Bulemann, aus Furcht vor Prozessen wodurch sein Verfahren in die Öffentlichkeit hätte kommen können, griff in seinen großen Kasten und erkaufte sich durch größere oder kleinere Abfindungssummen das Schweigen der Beteiligten.
Das machte ihn noch menschenfeindlicher und verbissener. Der Verkehr mit dem alten Trödler hatte längst aufgehört; einsam saß er auf seinem Erkerstübchen mit der Lösung eines schon oft gesuchten Problems, der Berechnung eines sicheren Lotteriegewinnes beschäftigt, wodurch er dermaleinst seine Schätze ins Unermessliche zu vermehren dachte.
Auch Graps und Schnores, die beiden großen Kater hatten jetzt unter seiner Laune zu leiden. Hatte er sie in dem einen Augenblicke mit seinen langen Fingern getätschelt, so konnten sie sich im anderen, wenn etwa die Berechnung der Zahlentafel nicht stimmen wollte, eines Wurfs mit dem Sandfaß oder der Papierschere versehen, so dass sie heulend in die Ecke hinkten.
Herr Bulemann hatte eine Verwandte, eine Tochter seiner Mutter aus erster Ehe, welche indessen schon bei dem Tode dieser wegen ihrer Erbansprüche abgefunden war und daher an die von ihm ererbten Schätze keine Ansprüche hatte. Er kümmerte sich jedoch nicht um diese Halbschwester, obgleich sie in einem Vorstadtviertel in den dürftigsten Verhältnissen lebte; denn noch weniger als mit anderen Menschen liebte Herr Bulemann den Verkehr mit dürftigen Verwandten.
Nur einmal, als sie kurz nach dem Tode ihres Mannes in schon vorgerücktem Alter ein kränkliches Kind geboren hatte, war sie Hilfe suchend zu ihm gekommen. Frau Anken, die sie eingelassen hatte, war horchend unten an der Treppe sitzen geblieben, und bald hatte sie von oben die scharfe Stimme ihres Herrn gehört, bis endlich die Tür aufgerissen worden und die Frau weinend die Treppe herab gekommen war.
Noch an dem selben Abend hatte Frau Anken die strenge Weisung erhalten, die Kette für der hin nicht von der Haustür zu ziehen, falls etwa die Christine noch einmal wiederkommen sollte. Die Alte begann sich immer mehr vor der Hackennase und den grellen Eulenaugen ihres Herrn zu fürchten.
Wenn er oben am Treppengeländer ihren Namen rief oder auch, wie er es vom Schiffe her gewohnt war, nur einen schrillen Pfiff auf seinen Fingern tat, so kam sie gewiß, in welchem Winkel sie auch sitzen mochte, eiligst hervor gekrochen, und stieg stöhnend, Schimpf – und Klageworte vor sich herplappernd, die schmalen Treppen hinauf.
Wie aber in dem dritten Stockwerk Herr Bulemann, so hatte in den unteren Zimmern Frau Anken ihre ebenfalls nicht ganz rechtlich erworbenen Schätze aufgespeichert. – Schon im dem ersten Jahre ihres Zusammenlebens war sie von einer Art kindlicher Angst befallen worden, ihr Herr könne einmal die Verausgabung des Wirtschaftsgeldes selbst übernehmen, und sie werde dann bei dem Geize des selben noch auf ihre alten Tage Not zu leiden haben.
Um dieses abzuwenden, hatte sie ihm vorgelogen, der Weizen sei aufgeschlagen und demnächst die entsprechende Mehrsumme für den Brot Bedarf gefordert. Der Supercargo, der eben seine Lebens Rechnung begonnen, hatte scheltend seine Papiere zerrissen, und darauf seine Rechnung von vorn wieder aufgestellt und den Wochen Rationen die verlangte Summe zugesetzt.
Frau Anken aber, nach dem sie ihren Zweck erreicht, hatte zur Schonung ihres Gewissens und des Sprichworts gedenkend: „Geschleckt ist nicht gestohlen“, nun nicht die überschüssig empfangenen Schillinge, sondern regelmäßig nur die dafür gekauften Weizenbrötchen unterschlagen mit denen sie, da Herr Bulemann niemals die unteren Zimmer betrat, nach und nach die ihres kostbaren Inhalts beraubten großen Nussbaumschränke anfüllte.
So mochten etwa zehn Jahre verflossen sein. Herr Bulemann wurde immer hagerer und grauer, sein gelb geblümter Schlafrock immer fadenscheiniger. Dabei vergingen oft Tage, ohne dass er den Mund zum Sprechen geöffnet hätte; denn er sah keine lebenden Wesen, als die beiden Katzen und seine alte halb kindische Haushälterin.
Nur mitunter, wenn er hörte, dass unten die Nachbarskinder auf den Prellsteinen vor seinem Hause ritten, steckte er den Kopf ein wenig aus dem Fenster und schalt mit seiner scharfen Stimme in die Gasse hinab. „Der Seelenverkäufer, der Seelenverkäufer!“ schrien dann die Kinder und stoben auseinander. Herr Bulemann aber fluchte und schimpfte noch ingrimmiger, bis er endlich schmetternd das Fenster zuschlug und drinnen Graps und Schnores seinen Zorn entgelten ließ.
Um jede Verbindung mit der Nachbarschaft auszuschließen, musste Frau Anken schon seit geraumer Zeit ihre Wirtschaftseinkäufe in entlegene Straßen machen. Sie durfte jedoch erst mit dem Eintritt der Dunkelheit ausgehen und mußte dann die Haustür hinter sich verschließen.
Es mochte acht Tage vor Weihnachten sein, als die Alte wiederum eines Abends zu solchem Zwecke das Haus verlassen hatte. Trotz ihrer sonstigen Sorgfalt musste sie sich indessen diesmal einer Vergessenheit schuldig gemacht haben. Denn als Herr Bulemann eben mit dem Schwefelholz sein Talglicht angezündet hatte, hörte er zu seiner Verwunderung es draußen an den Stiegen poltern, und als er mit vorgehaltenem Lichte auf den Flur hinaustrat, sah er seine Halbschwester mit einem bleichen Knaben stehen.
„Wie seid ihr ins Haus gekommen?“ herrschte er sie an, nachdem er sie einen Augenblick erstaunt und ingrimmig angestarrt hatte. „Die Tür war offen unten“, sagte die Frau schüchtern. Er murmelte einen Fluch auf seine Wirtschafterin zwischen den Zähnen. „Was willst du?“ fragte er dann.
„Sei doch nicht so hart, Bruder“, bat die Frau, „ich habe sonst nicht den Mut zu dir zu sprechen.“ „Ich wüßte nicht, was du mit mir zu sprechen hättest; du hast dein Teil bekommen, wir sind fertig miteinander.“ Die Schwester stand schweigend vor ihm und suchte vergebens nach den rechten Worten. –
Drinnen wurde wiederholt ein Kratzen an der Stubentür vernehmbar. Als Herr Bulemann zurück gelangt und die Tür geöffnet hatte, sprangen die beiden großen Katzen auf den Flur hinaus und strichen spinnend an dem blassen Knaben herum, der sich furchtsam vor ihnen an die Wand zurückzog. Ihr Herr betrachtete ungeduldig, die noch immer schweigend vor ihm stehende Frau.
„Nun, wird’s bald?“ fragte er. „Ich wollte dich um etwas bitten, Daniel“, hub sie endlich an. „Dein Vater hat ein paar Jahre vor seinem Tode, da ich in bitterster Not war, ein silbern Becherlein von mir in Pfand genommen.“
„Mein Vater von dir?“ fragte Herr Bulemann. „Ja, Daniel, dein Vater; der Mann von unser beider Mutter. Hier ist der Pfandschein, er hat mir nicht zuviel darauf gegeben.“ „Weiter!“ sagte Herr Bulemann, der mit raschem Blicke die leeren Hände seiner Schwester gemustert hatte.
„Vor einiger Zait“, fuhr sie zaghaft fort, „träumte mir, ich gehe mit meinem kranken Kinde auf dem Kirchhof. Als wir an das Grab unserer Mutter kamen, saß sie auf ihrem Grabstein unter einem
Busch voll blühender weißer Rosen.
Sie hatte jenen kleinen Becher in der Hand, den ich einst als Kind von ihr erhalten; als wir aber näher gekommen waren, setzte sie ihn an die Lippen; und indem sie dem Knaben lächelnd zunickte,
hörte ich sie deutlich sagen:
„Zur Gesundheit!“ Es war ihre sanfte Stimme, Daniel, wie im Leben, und diesen Traum habe ich drei Nächte nacheinander geträumt.“ „Was soll das!“ fragte Herr Bulemann. „Gib mir den Becher zurück, Bruder! Das Christfest ist nahe; leg ihn dem kranken Kinde auf seinen leeren Weihnachtsteller!“
Der hagere Mann in seinem gelb geblümten Schlafrock, stand regungslos vor ihr und betrachtete sie mit seinen grellen runden Augen. „Hast du das Geld bei dir?“ fragte er. „Mit Träumen löst man keine Pfänder ein.“ „Oh, Daniel!“ rief sie „glaub unserer Mutter! Er wird gesund, wenn er aus dem kleinen Becher trinkt. Sei barmherzig! es ist doch von deinem Blute.“
Sie hatte die Hände nach ihm ausgestreckt; aber er trat einen Schritt zurück. „Bleib mir vom Leibe“, sagte er. Dann rief er nach seinen Katzen. „Graps, alte Bestie! Schnores, mein Söhnchen!“ Und der große gelbe Kater sprang mit einem Satz auf den Arm seines Herrn und klauete mit seinen Krallen in der bunten Zipfelmütze, während das schwarze Tier mauzend in seine Knien hinaufstrebte.
Der kranke Knabe war näher geschlichen. „Mutter“, sagte er, indem er sie heftig an dem Kleide zupfte, „ist das der böse Ohm, der seine schwarzen Kinder verkauft hat?“ Aber in dem selben Augenblicke hatte auch Herr Bulemann die Katze herab geworfen und den Arm des aufschreienden Knaben ergriffen. „Verfluchte Bettelbrut“, rief er, „Pfeifst du auch das tolle Lied?“
„Bruder, Bruder!“ jammerte die Frau. Doch schon lag der Knabe wimmernd drunten auf dem Treppenabsatz. Die Mutter sprang ihm nach und nahm ihn sanft auf ihren Arm; dann aber richtete sie sich hoch auf und den blutenden Kopf des Kindes an ihrer Brust, erhob sie die geballten Fäuste gegen ihren Bruder, der inzwischen seine spinnenden Katzen droben am Treppengeländer stand:
„Verruchter, böser Mann!“ rief sie. „Mögest du verkommen bei deinen Bestien!“
„Fluche, soviel du Lust hast!“ erwiderte der Bruder, „aber mach, dass du aus dem Hause kommst.“ Dann, während das Weib mit dem weinenden Knaben die dunklen Treppen hinab stieg, lockte er seine
Katzen und klappte die Stubentür hinter sich zu. –
Er bedachte nicht, dass die Flüche der Armen gefährlich sind, wenn die Hartherzigkeit der Reichen sie hervor gerufen hat.
Einige Tage später trat Frau Anken, wie gewöhnlich in die Stube ihres Herrn. Aber sie kniff heute noch mehr als sonst mit den dünnen Lippen, und ihre kleinen Augen leuchteten vor Vergnügen. Denn sie hatte die Worte nicht vergessen, die sie wegen ihrer Nachlässigkeit an jenem Abend hatte hin nehmen müssen, und sie dachte sie ihm jetzt mit Zinsen wieder heimzuzahlen.
„Habt Ihr es denn auf St. Magdalenen läuten hören?“ fragte sie. „Nein“, erwiderte Herr Bulemann kurz, der über seine Zahlentafeln saß. „Wißt Ihr denn wohl, wofür es geläutet hat?“ fragte die Alte weiter. „Dummes Geschwätz! Ich höre nicht nach dem Gebimmel!“ – „Es war aber doch für Euren Schwestersohn!“ Herr Bulemann legt die Feder hin: „was schwatzest du, Alte?“
„Ich sage“, erwiderte sie, „dass sie so eben den kleinen Christoph begraben haben.“ Herr Bulemann schrieb schon wieder weiter. „Warum erzählst du mir das? Was geht mich der Junge an?“ – „Nun, ich dachte nur; man erzählt ja wohl, was Neues in der Stadt passiert.“ Als sie gegangen war, legte aber doch Herr Bulemann die Feder wieder fort, und schritt, die Hände auf dem Rücken, eine lange Zeit in seinem Zimmer auf und ab.
Wenn unten auf der Gasse ein Geräusch entstand, trat er hastig ans Fenster, als erwarte den Stadtdiener eintreten zu sehen, der ihn wegen der Misshandlung des Knaben vor den Rat zitieren solle. Der schwarze Graps, der mauzend seinen Anteil an der aufgetragenen Speise verlangte, erhielt einen Fußtritt, dass er schreiend in die Ecke flog.
Aber, war es nun der Hunger, oder hatte sich unversehens die sonst so unterwürfige Natur des Tieres verändert, er wandte sich gegen seinen Herrn und fuhr fauchend und prustend auf ihn los, Herr Bulemann gab ihm einen zweiten Fußtritt. „Fresst“, sagte er. „Ihr braucht nicht auf mich zu warten.“ Mit einem Satz waren die beiden Katzen an der vollen Schüssel, die er ihnen auf den Fußboden gesetzt hatte.
Dann aber geschah etwas Seltsames. Als der gelbe Schnores, der zuerst seine Mahlzeit beendet hatte, nun in der Mitte des Zimmers stand, sich reckte und buckelte, blieb Herr Bulemann plötzlich vor ihm stehen; dann ging er um das Tier herum und betrachtete es von allen Seiten. „Schnores, alter Halunke, was ist denn das?“ sagte er, den Kopf des Katers kraulend.
„Du bist ja noch gewachsen, in deinen alten Tagen!“ – In diesem Augenblicke war auch die andere Katze hinzu gesprungen. Sie sträubte ihren glänzenden Pelz und stand dann hoch auf ihren schwarzen Beinen. Herr Bulemann schob die bunte Zipfelmütze aus der Stirn. „Auch der!“ murmelte er.
„Seltsam es muss an der Sorte liegen.“ Es war indes dämmrig geworden, und da niemand kam und ihn beunruhigte, so setzte er sich zu den Schüsseln, die auf dem Tische standen. Endlich begann er sogar seine großen Katzen, die neben ihm auf dem Kanapee saßen, mit einem gewissen Behagen zu beschauen. „Ein paar stattliche Burschen seid ihr!“ sagte er, ihnen zu nickend. „Nun soll euch das alte Weib unten auch die Ratten nicht mehr vergiften!“ –
Als er aber abends nebenan in seine Schlafkammer ging, ließ er sie nicht, wie sonst, zu sich herein; und als er sie nachts mit den Pfoten gegen die Kammertür fallen und mauzend daran herumrutschen hörte, zog er sich das Deckbett über beide Ohren und dachte: „Mauzt nur zu, ich habe eure Krallen gesehen.“
Dann kam der andere Tag, und als Mittag geworden, geschah das selbe, was tags zuvor geschehen war. Von der geleerten Schüssel sprangen die Katzen mit einem schweren Satz mitten ins Zimmer hinein, reckten und streckten sich; und als Herr Bulemann, der schon wieder über seine Zahlentafeln saß, einen Blick zu ihnen hinüber warf, stieß er entsetzt seinen Drehstuhl zurück und blieb mit ausgestrecktem Halse stehen.
Dort mit leisem Winseln, als wenn ihnen etwas Widriges angetan würde, standen Graps und Schnores zitternd mit geringelten Schwänzen, das Haar gesträubt; er sah sie deutlich, die dehnten sich, sie wurden groß und größer. Noch einen Augenblick stand er, die Hände an den Tisch geklammert; dann plötzlich schritt er an den Tieren vorbei und riss die Stubentür auf.
„Frau Anken, Frau Anken“ rief er, und da sie nicht gleich zu hören schien, tat er einen Pfiff auf seinen Fingern, und bald schlurrte auch die Alte unten aus dem Hinterhause hervor und keuchte eine Treppe nach der anderen herauf. „sehen Sie sich einmal die Katzen an!“ rief er, als sie ins Zimmer getreten war. „Die hab ich schon oft gesehen, Herr Bulemann.“ „Sieht Sie daran denn nichts!“
„Dass ich nicht wüsste, Herr Bulemann!“ erwiderte sie, mit ihren blöden Augen um sich blinzelnd. „Was sind denn das für Tiere? Das sind ja gar keine Katzen mehr!“ – Er packte die Alte an den Armen und rannte sie gegen die Wand. „Rotäugige Hexe“, schrie er, „bekenne, was hast du meinen Katzen eingebraut!“ Das Weib klammerte ihre knöchernen Hände ineinander und begann unverständliche Gebete herzuplappern.
Aber die furchtsamen Katzen sprangen von rechts und links auf die Schultern ihres Herrn und leckten ihn mit ihren scharfen Zungen ins Gesicht. Da musste er die Alte los lassen, fortwährend plappernd und hüstelnd schlich sie aus dem Zimmer und kroch die Treppen hinab. Sie war wie verwirrt; sie fürchtete sich, ob mehr von ihrem Herrn oder vor den großen Katzen, das wusste sie selber nicht.
So kam sie hinten in ihre Kammer. Mit zitternden Händen holte sie einen mit Geld gefüllten wollenen Strumpf aus ihrem Bette hervor; dann nahm sie aus einer Lade eine Anzahl alter Röcke und Lumpen und wickelte sie um ihren Schatz herum, so dass es endlich ein großes Bündel gab.
Denn sie wollte fort, um jeden Preis fort, sie dachte an die arme Halbschwester ihres Herrn draußen in der Vorstadt; die war immer freundlich gegen sie gewesen, zu der wollte sie. Freilich, es war ein weiter Weg, durch viele Gassen, über schmale und lange Brücken, welche über dunkele Gräben und Fleten hinwegführten, und draußen dämmerte schon der Winterabend.
Es trieb sie dennoch fort. Ohne an ihre Tausende von Weizenbrötchen zu denken, die sie in kindischer Fürsorge in den großen Nussbaumschränken aufgehäuft hatte, trat sie mit ihrem schweren Bündel auf dem Nacken aus dem Hause. Sorgfältig mit dem großen krausen Schlüssel verschloss sie die schwere eicherne Tür, steckte ihn in ihre Ledertasche und ging dann keuchend in die finstere Stadt hinaus.
Frau Anken ist niemals wiedergekommen, und die Tür von Bulemanns Haus ist niemals wieder aufgeschlossen worden. Noch an dem selben Tage aber, da sie fort gegangen, hat ein junger Taugenichts, der den Knecht Ruprecht spielend in den Häusern umher lief, mit Lachen seinem Kameraden erzählt, da er in seinem rauhen Pelze über die Kreszentiusbrücke gegangen sei, habe er ein altes Weib dermaßen erschreckt, dass sie mit ihrem Bündel wie toll in das schwarze Wasser hinab gesprungen sei. –
Auch ist in der Frühe des anderen Tages in der äußersten Vorstadt die Leiche eines alten Weibes, welche an einem großen Bündel festgebunden war, von den Wächtern aufgefischt und bald darauf, da niemand sie gekannt hat, auf dem Armenviertel des dortigen Kirchhofs in einem platten Sarge eingegraben worden.
Dieser andere Morgen war der Morgen des Weihnachtsabends. Herr Bulemann hatte eine schlechte Nacht gehabt; das Kratzen und Arbeiten der Tiere gegen seine Kammertür hatte ihm diesmal keine Ruhe gelassen; erst gegen Morgendämmerung war er in einen langen bleiernen Schlaf gefallen.
Als er endlich seinen Kopf mit der Zipfelmütze in das Wohnzimmer hinein steckte, sah er die beiden Katzen laut schnurrend mit unruhigen Schritten umeinander hergehen. Es war schon nach Mittag; die Wanduhr zeigte auf eins. „Sie werden Hunger haben, die Bestien“, murmelte er.
Dann öffnete er die Tür nach dem Flur und pfiff nach der Alten. Zugleich aber drängten die Katzen sich hinaus und rannten die Treppe hinab, und bald hörte er von unten aus der Küche herauf Springen und Teller geklapper. Sie mussten auf den Schrank gesprungen sein, auf den Frau Anken die Speisen für den anderen Tag zurückzusetzen pflegte.
Herr Bulemann stand oben an der Treppe und rief laut und scheltend nach der Alten: aber nur das Schweigen antworte ihm von unten herauf aus den Winkeln des alten Hauses ein schwacher Widerhall. Schon schlug er die Schöße seines geblümten Schlafrock übereinander und wollte selbst hinab steigen, da polterte es drunten von den Stiegen und die beiden Katzen kamen wieder herauf gerannt.
Aber das waren keine Katzen mehr; das waren zwei furchtbare namenlose Raubtiere. Die stellten sich gegen ihn, sahen ihn mit ihren glimmenden Augen an und stießen ein heiseres Geheul aus. Er wollte an ihnen vorbei, aber ein Schlag mit der Tatze, der ihm einen Fetzen aus dem Schlafrock riss, trieb ihn zurück.
Er lief ins Zimmer; er wollte ein Fenster aufreißen, um die Menschen auf der Gasse anzurufen; aber die Katzen sprangen hintendrein und kamen ihm zuvor. Grimmig schnurrend, mit erhobenem Schweif, wanderten sie vor den Fenstern auf und ab.
Herr Bulemann rannte auf den Flur hinaus und warf die Zimmertür hinter sich zu; aber die Katzen schlugen mit der Tatze auf die Klinke und standen schon vor ihm auf der Treppe. – Wieder floh er ins Zimmer zurück, und wieder waren die Katzen da.
Schon verschwand der Tag, und die Dunkelheit kroch in alle Ecken. Tief unten von der Gasse herauf hörte er Gesang; Knaben und Mädchen zogen von Haus zu Haus und sangen Weihnachtslieder. Sie gingen in alle Türen; er stand und horchte. Kam denn niemand an seine Tür? -
Aber er wusste es ja, er hatte sie selber alle fort getrieben, es klopfte niemand, es rüttelte niemand an der verschlossenen Haustür. Sie zogen vorüber, und allmählich ward es still, totenstill auf der Gasse.
Und wieder suchte er zu entrinnen; er wollte Gewalt anwenden; er rang mit den Tieren, er ließ sich Gesicht und Hände blutig reißen. Dann wieder wandte er sich zur List; er rief sie mit den alten Schmeichelnamen, er strich ihnen die Funken aus dem Pelz und wagte es sogar, ihren flachen Kopf mit großen weißen Zähnen zu kraulen.
Sie warfen sich auch vor ihm hin, und wälzten sich schnurrend zu seinen Füßen; aber wenn er den rechten Augenblick gekommen glaubte und aus der Tür schlüpfte, so sprangen sie auf und standen, ihr heiseres Geheul ausstoßend, vor ihm. –
So verging die Nacht, kam der Tag und noch immer rannte er zwischen der Treppe und den Fenstern seines Zimmers hin und wider, die Hände ringend, keuchend, das graue Haar zersaust. Und noch zweimal wechselten Tag und Nacht, da endlich warf er sich gänzlich erschöpft, an allen Gliedern zuckend, auf das Kanapee.
Die Katzen setzten sich ihm gegenüber und blinzelten ihn schläfrig aus halb geschlossenen Augen an. Allmählich wurde das Arbeiten seines Leibes und endlich hörte es ganz auf. Eine fahle Blässe überzog unter den Stoppeln des grauen Bartes sein Gesicht; noch einmal aufseufzend streckte er den Arm und spreizte die langen Finger über die Knie; dann regte er sich nicht mehr.
Unten in den öden Räumen war es indessen nicht ruhig gewesen. Draußen an der Tür des Hinterhauses, die auf den engen Hof hinausführt, geschah ein emsiges Nagen und Fressen. Endlich entstand über der Schwelle eine Öffnung, die größer und größer wurde; ein Mauskopf drängte sich hindurch, dann noch einer, und bald huschte eine ganze Schar von Mäusen über den Flur und die Treppe hinauf in den ersten Stock.
Hier begann das Arbeiten aufs neue an der Zimmertür, und als diese durchgenagt war, kamen die großen Schränke daran, in denen Frau Anke hinterlassene Schätze aufgespeichert lagen.
Da war ein Leben wie im Schlaraffenland; wer durch wollte, musste sich durchfressen. Und das Geziefer füllte sich den Wanst; und wenn es mit dem Fressen nicht mehr fort wollte, rollte es die Schwänze auf und hielt sein Schläfchen in den hohl gefressenen Weizenbrötchen.
Nachts kamen sie hervor, huschten über die Dielen oder saßen, ihre Pfötchen leckend, vor dem Fenster und schauten, mit ihren kleinen blanken Augen die Gasse hinab. Aber diese behagliche Wirtschaft sollte bald ihr Ende erreichen. In der dritten Nacht, als eben droben Herr Bulemann seine Augen zugetan hatte, polterte es draußen auf den Stiegen.
Die großen Katzen kamen herab gesprungen, öffneten mit einem Schlag ihrer Tatze die Tür des Zimmers und begannen ihre Jagd. Da hatte alle Herrlichkeit ein Ende. Quieksend und pfeifend rannten die fette Mäuse umher und strebten ratlos an den Wänden hinauf. Es war vergebens; sie verstummte eine nach der anderen zwischen den mahlenden Zähnen der beiden Raubtiere.
Dann wurde es still, und bald war in dem ganzen Haus nichts mehr vernehmbar, als das leise Spinnen der großen Katzen, die mit ausgestreckten Tatzen vor dem Zimmer ihres Herrn lagen. Unten in der Haustür verrostete das Schloß, den Messingklopfer überzog Grünspan, und zwischen den Treppensteinen begann das Gras zu wachsen.
Draußen aber ging die Welt unbekümmert ihren Gang. – Als der Sommer gekommen war, stand auf dem St. Magdalenen Kirchhof auf dem Grabe des kleinen Christoph ein blühender weißer Rosenbusch; und bald lag auch ein kleiner Denkstein unter dem selben.
Den Rosenbusch hatte seine Mutter ihm gepflanzt; den Stein freilich hatte sie nicht beschaffen können. Aber Christoph hatte einen Freund gehabt; es war ein junger Musikus; der Sohn eines Trödlers, der in dem Hause ihnen gegenüber wohnte. Zuerst hatte er sich unter sein Fenster geschlichen, wenn der Musiker drinnen am Klavier saß, später hatte dieser ihn zuweilen in die Magdalenen Kirche genommen, wo er sich nachmittags im Orgelspiel zu üben pflegte. –
Da saß nun der blasse Knabe auf einem Schemelchen zu seinen Füßen, lehnte lauschend den Kopf an die Orgelbank und sah wie die Sonnenlichter durch die Kirchenfenster spielten. Wenn der junge Musikus dann, von der Verarbeitung seines Themas fort gerissen, die tiefen mächtigen Register durch die Gewölbe brausen ließ, oder wenn er mitunter den Tremulanten zog und die Töne wie zitternd vor der Majestät Gottes dahin fluteten, so konnte es wohl geschehen, dass der Knabe in stilles Schluchzen ausbrach und sein Freund ihn nur schwer zu beruhigen vermochte.
Einmal auch sagte er bittend; „Es tut mir weh, Leberecht; spiele nicht so laut.“
Der Orgelspieler schob auch sogleich die großen Register wieder ein und nahm die Flöten – und andere sanfte Stimmen; und süß und ergreifend schwoll das Lieblingslied des Knaben durch die stille
Kirche: „Befiehl du deine Wege.“ – Leise mit seiner kränklichen Stimme hub er an mitzusingen.
„Ich will auch spielen lernen“, sagte er, als die Orgel schwieg, „willst du mich es lehren, Leberecht?“ Der junge Mann ließ seine Hand auf den Kopf des Knaben fallen, und ihm das gelbe Haar streichelnd, erwiderte er: „Werde nur erst recht gesund, Christoph; denn ich will dich es gern lehren.“ –
Aber Christoph war nicht gesund geworden. – Seinem kleinen Sarge folgte neben der Mutter auch der junge Orgelspieler. Sie sprachen hier zum ersten Mal zusammen; und die Mutter ihm jenen geträumten Traum von dem kleinen Erbbecher.
„Den Becher“, sagte Leberecht, „hätte ich Euch geben können; mein Vater, der ihn vor Jahren mit vielen anderen Dingen von Eurem Bruder erhandelte, hat mir das zierliche Stück einmal als Weihnachtsgeschenk gegeben.“ Die Frau brach in die bittersten Klagen aus.
„Ach“, rief sie immer wieder, „er wäre ja gewiss gesund geworden!“ Der junge Mann ging eine Weile schweigend neben ihr her. „Den Becher soll unser Christoph dennoch haben“, sagte er endlich.
Und so geschah es. Nach einigen Tagen hatte er den Becher an einen Sammler solcher Pretiosen um einen guten Preis verhandelt; von dem Gelde aber ließ er den Denkstein für das Grab des kleinen Christoph machen. Er ließ eine Marmortafel darin einlegen, auf welcher das Bild des Bechers ausgemeißelt wurde.
Darunter standen die Worte eingegraben:
„Zur Gesundheit!“ Noch viele Jahre hindurch, mochte der Schnee auf dem Grabe liegen oder mochte in der Junisonne der Busch mit Rosen überschüttet sein, kam oft eine blasse Frau und las andächtig
und sinnend die beiden Worte auf dem Grabstein. –
Dann eines Sommers ist sie nicht mehr gekommen, aber die Welt ging unbekümmert ihren Gang. Nur noch einmal, nach vielen Jahren, hat ein sehr alter Mann das Grab besucht, er hat sich den kleinen Denkstein angesehen und eine weiße Rose von dem alten Rosenstrauch gebrochen. Das ist der emeritierte Organist von St. Magdalenen gewesen.
Aber wir müssen das friedliche Kindergrab verlassen, und wenn zu Ende geführt werden soll, drüben in der Stadt noch einen Blick in das alte Erkerhaus in der Düsternstraße werfen. –
Noch immer stand es schweigend und verschlossen da. Während draußen das Leben unablässig daran vorbeiflutete, wucherte drinnen in den eingeschlossenen Räumen der Schwamm aus den Dielenritzen, löste sich der Gips an den Decken und stürzte herab, in einsamen Nächten ein unheimliches Echo über Flur und Stiege jagend.
Die Kinder, welche an jenem Christabend auf der Straße gesungen hatten, wohnten jetzt als alte Leute in den Häusern, oder sie hatten ihr Leben schon abgetan und waren gestorben; die Menschen, die jetzt auf der Gasse gingen, trugen andere Gewänder, und draußen auf dem Vorstadtkirchhof war der schwarze Nummernpfahl auf Frau Ankens namenloses Grab schon längst verfault.
Da schien eines Nachts wieder einmal, wie schon so oft, über das Nachbarhaus hinweg der Vollmond in das Erkerfenster des dritten Stockwerks und malte mit seinem bläulichen Lichte die kleinen runden Scheiben auf den Fußboden. Das Zimmer war leer; nur auf dem Kanapee zusammengekauert saß eine kleine Gestalt von der Größe eines jährigen Kindes; aber sein Gesicht war alt und bärtig und die magere Nase unverhältnismäßig groß; auch trug sie eine weit über die Ohren fallende Zipfelmütze und einen langen, augenscheinlich für einen ausgewachsenen Mann bestimmten Schlafrock, auf dessen Schoß sie die Füße heraufgezogen hatte. Diese Gestalt war Herr Bulemann. –
Der Hunger hatte ihn nicht getötet, aber durch den Mangel an Nahrung war sein Leib verdorrt und eingeschwunden, und so war er im Laufe der Jahre kleiner und kleiner geworden. Mitunter in Vollmondnächten, wie diese, war er erwacht und hatte, wenn auch mit immer schwächerer Kraft, seinen Wächtern zu entrinnen gesucht.
War er von den vergeblichen Anstrengungen erschöpft aufs Kanapee gesunken, oder zuletzt hinauf gekrochen, und hatte dann der bleierne Schlaf ihn wieder befallen, so streckten Graps und Schnores sich draußen vor der Treppe hin, peitschten mit dem Schweif den Boden und horchten, ob Frau Ankens Schätze neue Wanderzüge von Mäusen in das Haus gelockt hätten.
Heute war es anders, die Katzen waren weder im Zimmer noch draußen auf dem Flur. Als durch das Fenster fallende Mondlicht über den ganzen Fußboden weg und allmählich an der kleinen Gestalt hinaufrückte, begann sie sich zu regen; die großen runden Augen öffneten sich, und Herr Bulemann starrte in das leere Zimmer hinaus.
Nach einer Weile rutschte er, die langen Ärmel mühsam zurückschlagend, von dem Kanapee herab und schritt langsam der Tür zu, während die breite Schleppe des Schlafrocks hinter ihm herfegte. Auf den Fußspitzen nach der Klinke greifend, gelang es ihm, die Stubentür zu öffnen und draußen bis an das Geländer der Treppe vorzuschreiten.
Eine Weile blieb er keuchend stehen; dann streckte er den Kopf vor und mühte sich zu rufen: „Frau Anken, Frau Anken!“ Aber seine Stimme war nur wie das Wispern eines kranken Kindes. „Frau Anken,
mich hungert; so hören Sie doch.“
Alles blieb er still; nur die Mäuse quieksten jetzt heftig in den unteren Zimmern. Da wurde er zornig; „Hexe, verfluchte, was pfeift sie denn?“ Und der Schwall unverständlich geflüsterter
Schimpfworte sprudelte aus seinem Munde, bis ein Stickhusten ihn befiel und seine Zunge lähmte.
Draußen, unten an der Haustür, wurde der schwere Messingklopfer angeschlagen, dass der Hall bis in die Spitze des Hauses hinauf drang. Es mochte jener nächtlicher Geselle sein, von dem am Anfang dieser Geschichte die Rede gewesen ist. Herr Bulemann hatte sich wieder erholt. „So öffnen Sie doch!“ wisperte er, „es ist der Knabe, der Christoph, er will den Becher holen.“
Plötzlich wurden von unten herauf zwischen dem Pfeifen der Mäuse und die Sprünge und das Knurren der beiden großen Katzen vernehmbar. Er schien sich zu besinnen; zum ersten Mal bei seinem Erwachen hatten sie das oberste Stockwerk verlassen und ließen ihn gewähren. –
Hastig, den langen Schlafrock nach sich schleppend, stapfte er in das Zimmer zurück. Draußen vor der Tür der Gasse hörte er den Wächter rufen. „Ein Mensch, ein Mensch!“ murmelte er; „die Nacht ist so lang, so vielmal bin ich aufgewacht, und noch immer scheint der Mond.“ Er kletterte auf den Polsterstuhl, der in dem Erkerfenster stand.
Emsig arbeitete er mit den kleinen dürren Händen an dem Fensterhaken; denn drunten auf der mondhellen Gasse hatte er den Wächter stehen sehen. Aber die Haspen waren festgerostet; er mühte sich vergebens sie zu öffnen. Da sah er den Mann, der eine Weile hinauf gestarrt hatte, in den Schatten der Häuser zurücktreten.
Ein schwacher Schrei brach aus seinem Munde; zitternd mit geballten Fäusten schlug er gegen die Fensterscheiben; aber seine Kraft reichte nicht aus, sie zu zertrümmern. Nun begann er Bitten und Versprechungen durcheinander zu wispern; allmählich, während die Gestalt des unten gehenden Mannes sich immer mehr entfernte, wurde sein Flüstern zu einem erstickten Gekrächze; er wollte seine Schätze mit ihm teilen, wenn er nur hören wollte, er sollte alles haben, er selber wollte nichts, gar nichts für sich behalten; nur den Becher, der sei das Eigentum des kleinen Christoph.
Aber der Mann ging unbekümmert seinen Gang und bald war er in einer Nebengasse verschwunden. – Von allen Worten, die Herr Bulemann in jener Nacht gesprochen, ist keines von einer Menschenseele gehört worden.
Endlich nach aller vergeblichen Anstrengung kauerte sich die kleine Gestalt auf dem Polsterstuhl zusammen, rückte die Zipfelmütze zurecht und schaute, unverständliche Worte murmelnd, in den
leeren Nachthimmel hinauf,
So sitzt er noch jetzt und erwartet die Barmherzigkeit Gottes.
Theodor Storm
DIE PRINZESSIN AUF DEM BAUM ...
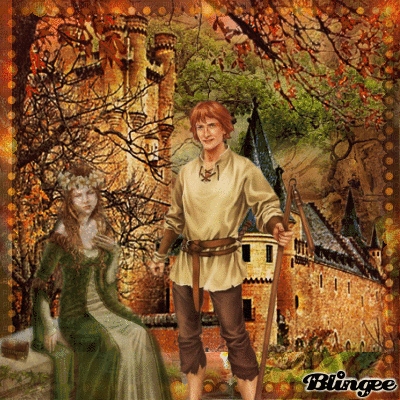
Es war einmal ein armer Junge, der musste Tag aus Tag ein, die Schweine in den Wald treiben, dass sie bei Bucheckern und Eichelmast fett würden. Dabei war er nach und nach, achtzehn Jahre alt geworden. Eines Tages trieb er seine Schweine tiefer in den Wald, als er gewöhnlich zu tun pflegte; da sah er plötzlich einen allmächtig hohen Baum vor sich, dessen Zweige sich in den Wolken verloren.
»Der tausend, das ist aber ein Baum!« sagte der Junge bei sich, »wie mag es wohl sein, wenn du dir von seinem Wipfel aus die Welt beschaust!« Gedacht, getan; er ließ seine Schweine im Boden wühlen und kletterte an dem Stamme empor. Er kletterte und kletterte, aber es wurde Mittag, die Sonne ging unter, und noch immer war er nicht in das Geäst gekommen.
Endlich, da es schon zu dunkeln begann, erreichte er einen Arm langen Stutz, der in die freie Luft hinaus ragte. Daran band er sich mit der neuen Peitschenschnur, die er in der Tasche trug, fest, dass er nicht hinabstürzte und Hals und Bein bräche, und dann schlief er ein.
Am anderen Morgen hatte er sich so weit verkobert, dass er sich mit frischen Kräften wieder an die Arbeit machen konnte. Um die Mittagszeit langte er denn auch in dem Geäste an, und von dort ging das Steigen leichter, doch den Zopf erreichte er auch diesmal nicht; wohl aber kam er gegen Abend in einem großen Dorfe an, das in die Zweige hinein gebaut war.
»Wo kommst du her?« fragten die Bauern verwundert, als sie ihn erblickten. »Ich bin von unten herauf gestiegen,« antwortete der Junge. »Da hast du eine weite Reise gehabt,« sprachen die Bauern, »bleib bei uns, dass wir dich in unseren Dienst nehmen!« – »Hat denn hier der Baum schon ein Ende?« fragte der Junge. »Nein,« gaben die Bauern zurück, »der Wipfel liegt noch ein gut Stück höher.« –
»Dann kann ich auch nicht bei euch wohnen bleiben,« versetzte der Junge, »ich muss in den Zopf hinauf. Aber zu essen könnt ihr mir geben; denn ich bin hungrig, und müde bin ich auch.« Da nahm ihn der Schulze des Dorfes in sein Haus, und er aß und trank, und nachdem er satt geworden war, legte er sich hin und schlief. Am anderen Morgen bedankte er sich bei den Bauern, sagte ihnen Lebewohl und stieg weiter den Baum hinauf.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als er ein großes Schloss erreichte. Da schaute eine Jungfrau zum Fenster hinaus, die freute sich sehr, dass ein Mensch gekommen sei, sie in ihrer Einsamkeit zu trösten. »Komm zu mir herein und bleibe bei mir,« sagte sie freundlich. »Hat hier denn der hohe Baum sein Ende?« fragte der Junge.
»Ja, höher hinauf kannst du nicht,« sprach die Jungfrau, »und nun komm herein, dass wir uns die Zeit vertreiben.« – »Was machst du denn hier oben so alleine?« fragte der Junge. Antwortete die Jungfrau: »Ich bin eines reichen Königs Tochter, und ein böser Zauberer hat mich hierher verwünscht, dass ich hier leben und sterben solle.« –
Sprach der Junge: »Da hätte er dich auch ein wenig tiefer verwünschen können.« Das half nun aber nichts, sie saß da oben und musste da oben bleiben; und weil die Prinzessin ein hübsches, artiges Mädchen war, so beschloss er, nicht wieder zurück zu kehren und mit ihr zusammen im Schlosse haus zu halten.
Das war ein lustiges Leben, das die beiden da oben im Schlosse auf dem hohen Baume führten. Um Speise und Trank durften sie nicht sorgen; denn was sie wünschten, stand auch sogleich vor ihnen; nur das wollte dem Jungen nicht behagen, dass die Prinzessin ihm verboten hatte, in ein bestimmtes Zimmer im Schlosse zu treten.
»Gehst du hinein,« hatte sie ihm gesagt, »so bringst du mich und dich ins Unglück.« Eine Zeit lang gehorchte er ihren Worten; endlich aber konnte er es nimmer mehr aushalten, und, als sie sich nach dem Essen hingelegt hatte, um ein Stündchen zu schlafen, nahm er das Schlüsselbund und suchte den Schlüssel hervor, ging hin und schloss die verbotene Türe auf.
Als er drinnen im Zimmer stand, gewahrte er einen kohlschwarzen großen Raben, der war mit drei Nägeln an die Wand geheftet; der eine ging ihm durch den Hals, und die beiden anderen durchbohrten seine Flügel. »Gut, dass du kommst,« schrie der Rabe, »ich bin vor Durst schier verschmachtet! gib mir von dem Kruge, der dort auf dem Tische steht, einen Tropfen zu trinken, sonst muss ich elendiglich des Todes sterben.«
Der Junge aber hatte über dem Anblick einen solchen Schrecken bekommen, dass er auf die Worte des Raben gar nicht achtete und zur Türe zurücktrat. Da schrie der Rabe mit kläglicher Stimme, dass es einen Stein erweichen konnte: »Ach, geh nicht von hinnen, ehe du mich geletzt hast; denke, wie dir zu Mute wäre, wenn dich jemand Durstes sterben ließe.« –
»Er hat recht,« sprach der Junge bei sich, »ich will ihm helfen!« Dann nahm er den Krug vom Tische und goss ihm einen Tropfen Wassers in den Schnabel hinein. Der Rabe fing ihn mit der Zunge auf, und sobald er ihn herunter geschluckt hatte, fiel der Nagel, der durch den Hals ging, zu Boden.
»Was war das?« fragte der Junge. »Nichts,« antwortete der Rabe, »lass mich nicht verschmachten und gib mir noch einen Tropfen Wassers!« – »Meinetwegen,« sagte der Junge und goss ihm einen zweiten Tropfen in den Schnabel hinein.
Da fiel auch der Nagel, welcher den rechten Flügel durchbohrt hatte, klirrend auf die Erde hinab. »Nun ist es aber genug,« sagte er. »Nicht doch,« bat der Rabe, »aller guten Dinge sind drei!«; doch als der Junge ihm auch den dritten Tropfen eingeflösst hatte, war der Rabe seiner Fesseln frei, schwang die Flügel und flog krächzend zum Fenster hinaus.
»Was hast du getan?« rief der Junge erschrocken, »wenn es nur die Prinzessin nicht merkt!« Die Prinzessin merkte es aber doch; denn er sah kreidebleich aus, als er zu ihr in die Stube trat. »Du bist wohl gar in dem verbotenen Zimmer gewesen?« sprach sie hastig.
»Ja, das bin ich gewesen,« antwortete der Junge kleinlaut, »aber ich habe weiter nichts Schlimmes dort verübt. Es hing nur ein verdursteter schwarzer Rabe an der Wand, dem gab ich zu trinken; und als er drei Tropfen getrunken hatte, fielen die Nägel, mit denen er angeheftet war, auf den Erdboden herab, und er bewegte die Flügel und flog durch das Fenster davon.« –
»Das ist der Teufel gewesen, der mich verzaubert hat,« jammerte die Prinzessin, »nun wird es nicht lange mehr währen, so holt er mich nach!« Und richtig, es dauerte gar nicht lange, so war eines Morgens die Prinzessin verschwunden, und sie kam nicht wieder, obgleich der Junge drei Tage lang auf ihre Rückkehr wartete.
»Kommt sie nicht zu mir, so gehe ich zu ihr!« sagte er bei sich, als sie auch am Abend des dritten Tages nicht wieder zurück gekehrt war, und machte sich mit dem folgenden Morgen auf den Weg, den Baum herab. Als er in dem Dorfe ankam, fragte er die Bauern: »Wisst ihr nicht, wo meine Prinzessin geblieben ist?« –
»Nein,« sagten die Bauern, »wie sollen wir es wissen, wenn du es nicht weißt, der du von dem Schlosse kommst!« Da stieg der Junge tiefer und tiefer, bis er endlich wieder auf den Erdboden gelangte. »Nach Hause gehst du nicht, da gibt es Schläge,« dachte er; darum wanderte er immer waldein, ob er nicht irgendwo die Spur der Prinzessin ausfindig machen könnte.
Nachdem er drei Tage im Walde umhergeirrt war, begegnete ihm ein Wolf. Er fürchtete sich und floh; doch der Wolf rief: »Fürchte dich nicht! Aber sage mir, wohin führt dich dein Weg?« – »Ich suche meine Prinzessin, die mir gestohlen ist,« antwortete der Junge.
»Da hast du noch weit zu laufen, ehe du sie bekommst,« sagte der Wolf. »Und hier hast du drei Spier Haare von mir. Wenn du in Lebensgefahr bist und die Haare zwischen den Fingern reibst, so bin ich bei dir und helfe dir aus der Not.« Der Junge bedankte sich bei dem Wolfe und ging weiter.
Über drei Tage kam ihm ein Bär in den Weg, und der Junge war vor Schreck wie versteinert; denn er hielt sich verloren. Auf einen Baum klettern nutzte nichts, denn der Bär wäre ihm nach gestiegen und hätte ihn in den Zweigen zerrissen. Der Bär war aber gar nicht blutdürstig gesinnt, sondern rief dem Jungen freundlich zu:
»Fürchte dich nicht, ich tue dir kein Leid an. Erzähle mir nur, was dir fehlt!« Als der Junge sah, wie gutmütig der Bär war, sagte er dreist: »Mir fehlt meine Prinzessin, die hat mir ein böser Zauberer gestohlen, und ich wandere jetzt in der Welt umher, bis ich sie finde.« –
»Da hast du noch einen guten Weg, bis du zu ihr gelangst,« erwiderte der Bär, »aber hier hast du drei Spier von meinen Haaren! Wenn du in Lebensgefahr kommst und meiner bedarfst, so reibe die Haare zwischen den Fingern, und ich bin bei dir und stehe dir bei.«
Der Junge steckte die Haare zu sich, bedankte sich und zog wieder drei Tage im Walde umher. Da begegnete ihm ein Löwe, und als der Junge vor Angst gerade auf einen Baum klettern wollte, rief das wilde Tier ihm zu: »Nicht doch! Bleib unten, ich tu dir nichts.« –
»Das ist etwas anderes,« sagte der Junge, und dann erzählte er auch dem Löwen, warum er ohne Weg und Steg in dem Wald herumlaufe. »Da hast du es gar nicht mehr weit,« antwortete der Löwe, »eine gute Stunde von hier sitzt die Prinzessin in dem Jägerhaus. Mach dich auf und geh zu ihr! Und wenn du in Lebensgefahr kommst und mich brauchen kannst, so nimm diese drei Spier Haare und reibe sie zwischen den Fingern; dann bin ich bei dir und helfe dir aus aller Not.«
Damit übergab er dem Jungen die drei Spier Haare und trottete weiter in den Busch hinein; der Junge aber schritt wacker zu, dass er das Jägerhaus bald erreiche.
Es dauerte auch gar nicht lange, so sah er es durch die Bäume schimmern, und noch ein klein Weilchen, so hatte er die Türe aufgeklinkt und stand in der Stube und sah die Prinzessin vor sich stehen. »Junge, wo kommst du her?« rief sie erstaunt.
»Wo ich her komme?« antwortete der Junge, »denkst du, ich werde allein oben bleiben und dich bei dem bösen Zauberer lassen? Aber jetzt gib mir geschwind etwas zu essen, und dann wollen wir uns auf und davon machen und zu deinem Vater gehen!« –
»Ach, mein Junge, das geht nicht so,« sagte die Prinzessin traurig, »der alte Jäger, der mich bewacht, ist zwar den ganzen Tag über im Walde; aber er hat einen dreibeinigen Schimmel im Stalle, der weiß alle Dinge und sagt ihm sogleich nach, wenn wir geflohen sind. Und wenn er das weiß, so holt er uns bald ein.«
Der Junge ließ sich das aber wenig kümmern, aß und trank, und nachdem er satt war, nahm er die Prinzessin bei der Hand und lief mit ihr aus dem Jägerhaus auf und davon. Als sie ein Weilchen gegangen waren, schrie der dreibeinige Schimmel im Stalle Mord und Zeter und hörte nicht auf, bis der alte Jäger herbei gelaufen kam und ihn fragte, was ihm fehle.
»Es ist jemand gekommen und hat die Prinzessin gestohlen!« schrie der Schimmel. »Sind sie schon weit?« fragte der Jäger. »Weit noch nicht,« antwortete der Schimmel, »setz dich nur auf meinen Rücken, wir werden sie bald einholen!« Als der Jäger den Jungen und die Prinzessin erblickte, rief er zornig:
»Warum hast du mir meine Prinzessin gestohlen?« – »Warum hast du sie mir gestohlen?« gab ihm der Junge trotzig zurück. »Ach, du bist es,« antwortete der alte Jäger, »da will ich dir die Sache für diesmal verzeihen, weil du damals mitleidig warst und mich mit dem Wasser tränktest. Aber unterstehst du dich noch einmal und raubst mir die Prinzessin, so muss dich mein dreibeiniger Schimmel in den Erdboden stampfen, dass du des Lebens vergisst.«
Dann nahm er dem Jungen die Prinzessin ab, hub sie vor sich auf den Sattel und ritt mit ihr in das Jägerhaus zurück. Der Junge schlich sich jedoch leise nach, und als der alte Zauberer wieder in den Wald gegangen war, trat er von neuem in das Haus hinein und sagte zur Prinzessin:
»Höre einmal, ich rette dich doch! Wenn ich nur erst einen solchen Schimmel habe, wie ihn der alte Jäger besitzt. Ich werde unter das Bett kriechen, und du fragst ihn dann, wenn ihr im Bett seid, wie er den dreibeinigen Schimmel erworben habe.« Damit war die Prinzessin einverstanden, und der Junge kroch unter das Bett und wartete, bis der Abend kam und der Jäger nach Hause kehrte.
»Väterchen,« sagte die Prinzessin zutraulich, als der Zauberer zu Bette gegangen war, und kraulte ihm die struppigen Haare, »Väterchen, wie seid Ihr nur zu dem dreibeinigen Schimmel gekommen! Das ist ein prächtiges Pferd, ist klüger, wie ein Mensch, und läuft schneller, wie der Wind.« –
»Das will ich dir sagen, mein Töchterchen,« sprach der alte Jäger und schmunzelte über sein garstiges Gesicht, denn das Kraulen tat ihm wohl, »den Schimmel habe ich mir in drei Tagen erworben.« – »Kann sich jeder Mensch ein solches Pferd verdienen?« fragte die Prinzessin.
»Gewiss,« antwortete der Jäger, »wenn er klug ist, kann es ihm nicht fehlen. Ein Stündchen von hier im Walde wohnt eine Bauersfrau, das ist eine arge Hexe. Sie besitzt die schönsten Pferde weit und breit; und wer ihre Fohlen drei Tage zu hüten vermag, der kann sich zur Belohnung das Pferd aussuchen, das ihm von allen Tieren im Stalle am besten gefällt.
Vor Zeiten gab sie auch noch zwölf Lämmer obendrein; mir hat sie die selben aber nicht gegeben; so kam es, dass die zwölf Wölfe, die in dem Walde wohnen, als ich mit meinem Schimmel davon ritt, auf mich los stürzten. Und da ich keine Lämmer hatte, die ich ihnen vorwerfen konnte, so eilten sie meinem Schimmel nach, und ehe ich über die Grenze kam, die sie nicht überschreiten dürfen, hatten sie dem Tiere den rechten Fuss ausgerissen, und seitdem hat er drei Beine bis auf den heutigen Tag.«
»Wer nun aber die Fohlen nicht hüten kann, wie geht es dem?« fragte die Prinzessin. »Dem geht es schlecht,« erwiderte der alte Jäger, »die Hexe schlägt ihm das Haupt ab und spießt es auf dem Zaun, der um das Gehöft geht, auf; und da stecken schon so viel Köpfe, dass sie bald einen neuen Zaun bauen muss, um sie alle unterzubringen.«
Jetzt wusste der Junge unter dem Bette genug; die Prinzessin hörte darum auf mit Fragen, und sie schliefen alle drei die ganze Nacht hindurch.
Am anderen Morgen, als der Jäger wieder in den Wald gegangen war, kroch der Junge unter dem Bette hervor, aß und trank mit der Prinzessin, und dann machte er sich auf den Weg nach dem Gehöft der Hexe, von dem der Jäger in der Nacht gesprochen hatte.
Es dauerte auch gar nicht lange, so sah er den Zaun mit den Menschenköpfen vor sich, und nun wusste er Bescheid, dass er nicht irre gegangen sei. Als er an dem Hoftore war, trat ihm auch schon die Hexe entgegen und sprach zu ihm: »Was willst du hier?« –
»Deine Fohlen hüten!« antwortete der Junge. – »Gut, ich will dich annehmen,« sagte die Hexe, »und wenn du mit den Pferden jeden Abend hübsch pünktlich um acht Uhr zu Hause ankommst, so darfst du dir nach drei Tagen das Pferd in meinem Stalle aussuchen, das dir am besten gefällt. Das soll dein Lohn sein!
Kommst du aber später heim, so schlage ich dir das Haupt ab und stecke es auf den Staketenzaun.« – »Das magst du tun,« erwiderte der Junge, »aber der Lohn ist mir nicht hoch genug. Ich verlange außer dem Pferde noch zwölf Lämmer obendrein.« –
»Das habe ich früher getan,« antwortete die Hexe, »aber die Zeiten sind schlechter geworden, und die Pferdezucht wirft die zwölf Lämmer nicht ab.« – »Dann hüte ich gar nicht,« antwortete der Junge. Als die Hexe sah, dass er auf seinem Kopfe bestand, brummte sie:
»Meinetwegen, bekommen wird er sie ja ebenso wenig, wie das Pferd,« dann sprach sie laut: »Die Sache ist abgemacht, du sollst auch die zwölf Lämmer erhalten, und morgen früh treibst du meine drei Fohlen auf die Wiese.«
Und so tat der Junge auch. Am frühen Morgen, ehe die Sonne aufging, schwang er sich dem stärksten Füllen auf den Rücken und ritt zur Wiese hinab, und es dauerte gerade eine halbe Stunde, bis er dort angelangt war. »Um halb acht musst du wieder aufbrechen,« dachte er bei sich, dann ließ er die Fohlen grasen und legte sich hinter einen Schlehenbusch, um die schönen Sachen zu verzehren, die ihm die alte Hexe in den Kaliet (Korb) gepackt gatte.
Da war Weißbrot und Braten und Wurst, aber das beste von allem war eine halbe Flasche Branntwein. Als er die an die Lippen gesetzt hatte und der erste Schluck die Kehle hinab gelaufen war, da tat ihm der Trank so wohl, und er trank und trank, bis er den ganzen Branntwein ausgetrunken hatte. In den Branntwein hatte die alte Hexe aber einen Schlaftrunk gemischt, und so kam es, dass er in einen tiefen Schlaf verfiel.
Nachdem er endlich wieder aufgewacht war, rieb er sich die Augen und sah sich um. Ja, da war von den drei Fohlen nichts mehr zu sehen, sie waren auf und davon gegangen, und er klagte und jammerte und schlug sich mit der Hand vor den Kopf.
Endlich fiel ihm der Wolf ein: »Wenn du in Not bist, sollst du die drei Spier Haare zwischen den Fingern reiben! hat er dir gesagt!« und damit zog er die Wolfshaare aus der Tasche hervor und rieb sie zwischen den Fingern. Sogleich stand der Wolf neben ihm und sprach: »Was ist dir, Junge, womit kann ich dir helfen?« –
»Ach, mir sind meine Fohlen weg gekommen,« jammerte der Junge, »und wenn du mir nicht hilfst, lieber Wolf, so schlägt mir die alte Hexe heute Abend den Kopf ab und steckt ihn auf den Staketenzaun.« –
»Zehn Meilen sind die Fohlen schon gelaufen,« antwortete der Wolf, »darum setz dich schnell auf meinen Rücken, und wenn ich sie eingeholt habe und ihnen vorgekommen bin, so schlage mit den drei Zäumen, die du in der Hand hast, drei Kreuze vor ihnen, und sie müssen stehen bleiben, als wären sie angewachsen.«
Da setzte er sich dem Wolf auf den Rücken, und der lief so schnell, dass dem Jungen die Haare nur so flogen. Es dauerte auch gar nicht lange, so hatte der Wolf den Fohlen einen Vorsprung abgewonnen; der Junge schlug mit den Zäumen dreimal ein Kreuz, und sie konnten weder vorwärts noch rückwärts.
»Nun reite mit ihnen nach Hause,« sprach der Wolf, »du wirst noch bei Zeiten heimkommen.« Das ließ sich der Junge nicht zweimal sagen, er schwang sich auf den Rücken des stärksten Füllens hinauf, und dann kehrte er mit ihnen im Trabe zur Wiese zurück und langte dort an, ehe die Glocke die siebente Stunde verkündet hatte.
Dann ließ er die Tiere noch ein Weilchen abtrocknen und grasen, bis er sich um halb acht auf den Heimweg machte und zur rechten Zeit in das Gehöft zurückkehrte.
Die alte Hexe riss die Augen weit auf, als sie den Jungen mit den Fohlen zur rechten Zeit heimkehren sah; aber sie bezwang sich und reichte ihm freundlich die Hand und sprach: »Du bist ein tüchtiger Hütejunge, du gefällst mir!« Dann führte sie ihn in die Stube und setzte ihm Speise und Trank vor, doch während er aß, lief sie in den Stall und bearbeitete die Fohlen mit dem Besenstiel.
»Konntet ihr ihm denn nicht entlaufen, ihr ungehorsamen Tiere,« rief sie zornig. »Wir sind zehn Meilen gelaufen,« schrien die Füllen, »er kam uns aber auf einem Wolf nachgeritten und hat uns wieder zurück gebracht.« – »Ein Wolf?« sagte die Hexe verwundert, »das ist etwas anderes; da müssen wir schon ein stärkeres Mittel gebrauchen.«
Und am anderen Morgen gab sie dem Jungen die Flasche, drei Viertel mit Branntwein gefüllt, mit auf den Weg. Der mundete ihm wieder so köstlich und tat ihm im Herzen so wohl, dass er ihn in einem Zuge leerte; dann sank er um und schlief unter dem Schlehdornbusch ein und rückte und rührte sich nicht.
Als er endlich aufwachte, merkte er wohl, dass die Mittagszeit schon vorüber sei, und von seinen Fohlen war wiederum nichts mehr zu sehen. Diesmal besann er sich aber nicht lange. »Gestern hat dir der Wolf geholfen, heute muss dich der Bär aus der Not retten,« dachte er und rieb die Bärenhaare zwischen den Fingern.
Und schon stand er vor ihm und sprach: »Was ist dir, mein Junge, und womit kann ich dir helfen?« »Hilf mir zu meinen Fohlen,« antwortete der Junge. – »Zwanzig Meilen sind sie schon gelaufen,« sprach der Bär, »aber setz dich geschwind auf meinen Rücken, dass wir sie einholen.«
Da stieg der Junge dem Bären auf den Rücken, und der Bär lief, dass die Haare seines Reiters in der Luft sausten, und er hörte nicht eher auf, als bis er den Fohlen einen Vorsprung abgewonnen hatte.
Darauf schlug der Junge mit den drei Zäumen die Kreuze, und als sie still standen, schwang er sich auf sein Handpferd hinauf und ritt so schnell wie möglich zur Wiese zurück; aber, so sehr er die Füllen auch laufen ließ, er konnte die Wiese nicht vor halb acht erreichen, so dass er stracks weiter reiten musste, um noch zur Zeit in den Hof der Hexe zu gelangen.
»Das nenne ich mir einen Hirten,« sagte die Alte freundlich, und doch war sie inwendig Gift und Galle, »jetzt komm nur hinein und verzehr dein Abendbrot.« Und als der Junge in der Stube saß und aß, lief sie wieder in den Stall hinab und hieb mit dem Besenstiel auf die Fohlen ein.
»Wir können nichts dafür,« riefen die Fohlen und schrien vor Schmerz, »wir sind zwanzig Meilen gelaufen, da kam er uns nachgeritten auf einem Bären und hat uns wieder zurück gebracht.« – »Auf einem Bären?« sagte die Hexe, »der Junge ist stärker, wie ich. Aber warte nur, morgen sollst du mir nicht entkommen.«
Den anderen Tag gab ihm die Hexe die ganze Flasche voll Branntwein mit auf den Weg, und der Junge bedankte sich noch bei der alten Hexe für das schöne Getränk. Und als er auf der Wiese angelangt war, trank er die ganze Flasche in einem Zuge aus und legte sich ins Gras und schlief fest ein und erwachte erst zur Nachmittagszeit wieder aus dem Schlafe.
»Donner Sachsen! Hilft mir heute der Löwe nicht, so bin ich gewisslich verloren!« rief er erschrocken, zog die drei Spier Löwenhaare eilends aus der Tasche hervor und rieb sie zwischen den Fingern. Alsbald stand der Löwe vor ihm und sprach:
»Nur rasch auf meinen Rücken hinauf, wir haben keine Zeit zu verlieren! Dreißig Meilen haben die Fohlen schon zurückgelegt;« und als der Junge sich auf ihn gesetzt hatte, lief er, wie der Sturmwind saust, und die Haare simmten und summten dem Jungen um den Kopf, und als die Sonne sich ihrem Untergange neigte, hatte der Löwe auch die Fohlen eingeholt und der Junge die selben zum Stehen gebracht.
»So, nun spare Sporn und Peitsche nicht und lass sie laufen, was sie nur können, dann kommst du noch hin auf den Hof,« rief der Löwe, und der Junge tat, wie ihm geheißen war, und spornte sein Pferd, dass ihm das Blut aus den Weichen floss, und hieb auf die anderen Fohlen mit der Peitsche ein, dass die Fetzen flogen, und langte ein Viertel vor acht auf der Wiese an.
Da war an Ruhe und Rast nicht zu denken, er trieb die Füllen nur um so schärfer an, und als die Glocke acht schlug, war er im Torweg, und die Flügel des Tores, welche die Alte zuwarf, hätten ihm beinahe die Fersen abgeschlagen.
»Das war die höchste Zeit!« rief der Junge atemlos und trat in das Haus hinein, die Alte aber lief zu den Fohlen und schlug sie mit dem Besenstiel, dass es einen Stein erbarmen konnte. »Wir können nichts dafür, verschon uns,« baten die Fohlen, »wir sind dreißig Meilen gelaufen, er aber kam uns auf einem Löwen nachgejagt und hat uns in Eile wieder zurück gebracht.«
Als die Hexe das hörte, ließ sie nach mit dem Schlagen und kehrte ärgerlich in die Stube zurück; dafür ging jetzt der Junge in den Stall hinein, um sich ein Pferd auszusuchen, und der Hexe kleine Tochter begleitete ihn.
In dem Stalle standen viele Pferde, und eins war immer schöner, wie das andere. Ganz hinten aber stand in einer besonderen Bucht ein hochbeiniger, magerer Schimmel. »Das ist meiner Mutter Reitpferd,« sagte das kleine Mädchen, »das läuft so schnell, wie der Wind.« Da wusste der Junge genug und ging wieder hinein zu der alten Hexe.
Am anderen Morgen sagte die Hexe: »Nun, Junge, welches Pferd willst du haben als Lohn für die Hütezeit?« – »Den Schimmel in der kleinen Bucht,« antwortete der Junge. »Ach, was willst du mit dem, der ist ja das Mitnehmen nicht wert! Sieh doch, wie mager und schmutzig er aussieht. Nein, mit dem Tier kann ich dich nicht ziehen lassen, die Leute würden über mich reden, wenn ich dir solch ein Pferd zum Lohne gäbe!«
Der Junge blieb aber bei seinem Willen, und da musste sich die Hexe wohl oder übel fügen. Als er jedoch aus dem Stalle getreten war, holte sie schnell einen Bohrer herbei und bohrte damit dem Schimmel Löcher durch alle vier Hufen; darauf nahm sie ein Rohr und sog ihm alles Mark aus seinem Gebein und tat es in einen irdenen Topf.
Dann nahm sie Mehl, mengte es mit dem Mark und buk einen Dinsback (Kuchen) daraus. Den schob sie dem Jungen ins Vorderhemd, dass er unterwegs zu essen habe und nicht Hunger leide. Nachdem sie das getan hatte, holte sie zwölf Lämmer aus dem Stalle hervor, band sie an den Hinterfüssen an einer Schnur auf und hing sie über den Schimmel.
»Da hast du deinen Lohn,« sprach sie, und der Junge sagte ihr Lebewohl und ging neben dem Schimmel her zum Torweg hinaus. Auf das Pferd setzen mochte er sich nicht, denn es trat so steif auf und ließ sich so schwach an, als ob es bald sterben müsse.
Auch wunderte ihn, dass es immer mit der Zunge nach seinem Vorderhemd leckte. »Was willst du denn dort, Schimmelchen?« fragte der Junge mitleidig. Da hub der Schimmel zu reden an und sprach: »Ich lecke nach dem Dinsback; denn die alte Hexe hat mir mit einem Rohr alles Mark aus meinem Gebein durch die Hufen gesogen, hat es mit Mehl gemengt und in deinen Dinsback gebacken.«
»Dann iss ihn nur,« sprach der Junge, »denn er steht dir von Rechts wegen zu.« Und als der Schimmel den Kuchen gegessen hatte, kam die alte Kraft wieder in sein Gebein, und der Junge schwang sich auf seinen Rücken, und er griff mächtig aus. Es dauerte gar nicht lange, so kamen sie in den Wald, und wie sie ein wenig darin gewesen waren, stürzten die zwölf Wölfe, von denen der alte Jäger gesprochen, auf sie los.
Rasch schnitt der Junge mit seinem scharfen Messer die Schnur entzwei, und die zwölf Lämmer fielen auf die Strasse herab, und die zwölf Wölfe stürzten über sie her und erwürgten sie und fraßen sie auf. Als sie die Lämmer gefressen hatten, war der Schimmel aber schon so weit gekommen, als die Macht der Hexe reichte, und der Junge hatte ihn also mit heilem Leibe vor den Wölfen in Sicherheit gebracht.
Nun machte er, dass er zu dem Jägerhäuschen kam. Dort ließ er den Schimmel am Türpfosten halten und lief hinein, holte die Prinzessin heraus und setzte sie vorne auf das Ross; dann schwang er sich selbst hinauf und ließ den Schimmel laufen, was er laufen wollte.
Als er fort war, erhub der dreibeinige Schimmel wieder wie damals einen grausamen Lärm und ruhte nicht eher, als bis der alte Zauberer herbei gelaufen kam und fragte: »Warum schreist du so? Was ist denn geschehen?« – »Der Junge ist wieder hier gewesen und hat die Prinzessin geraubt,« antwortete der dreibeinige Schimmel. –
»Sind sie schon weit?« – »Nein, weit sind sie noch nicht, wir werden sie schon einholen, setz dich nur auf meinen Rücken.« Da setzte sich der Zauberer auf des dreibeinigen Schimmels Rücken und ritt dem Jungen nach.
»Schimmelchen lauf! Schimmelchen lauf!« rief der Junge, als er den Zauberer erblickte; aber der Schimmel lief nicht, sondern ging gemächlich Schritt; da war es denn kein Wunder, dass der alte Jäger sie einholte. »Räuber,« rief er dem Jungen zu, »habe ich es dir nicht gesagt, du solltest es nicht noch einmal wagen, die Prinzessin zu stehlen; nun soll dich mein Schimmel in den Erdboden stampfen.«
Indem er das sagte, rief der vierbeinige Schimmel dem dreibeinigen zu: »Schwesterchen, wirf ihn ab!« Da warf der dreibeinige Schimmel den alten Hexenmeister auf die Erde, und der vierbeinige kam ihm zu Hilfe, und dann traten sie so lange mit ihren harten Hufen auf ihm herum, bis auch kein einziger Knochen unzermalmt war.
Als der Zauberer getötet war, setzte der Junge die Prinzessin auf den dreibeinigen Schimmel, er selbst blieb sitzen, wo er war, und sie ritten zusammen in das Königreich, wo der Vater der Prinzessin König war. Da war einmal die Freude groß, als er seine einzige Tochter wieder hatte, und als er hörte, dass der Junge sie erlöst habe, gab er sie ihm sogleich zur Frau, und es wurde Hochzeit gefeiert in großer Pracht und Herrlichkeit.
Der alte König starb bald darauf; da wurde der arme Schweinejunge König an seiner Statt, und er herrschte über seine Untertanen nach Recht und Gerechtigkeit.
Eines Tages fielen ihm seine beiden Schimmel ein, und er ging in den Stall hinab, in dem sie untergebracht waren. Da sprach der vierbeinige Schimmel zu ihm: »Mein Schwesterchen und ich haben dir geholfen, nun hilf du uns auch! Zieh dein Schwert und schlag uns das Haupt ab!«
Antwortete der junge König: »Das werde ich bleiben lassen. Ich habe euch viel zu lieb, und so lohnt man seinen Freunden nicht!« – »Wenn du mir nicht gehorchen willst,« sprach der Schimmel, »so schaffen wir dir Unglück über Unglück auf den Hals.«
Das wollte der junge König nun auch nicht haben, darum zog er das Schwert aus der Scheide und schlug damit den beiden Schimmeln die Köpfe ab. Kaum hatte er das getan, so standen ein stattlicher Prinz und eine wunderschöne Prinzessin vor ihm, die bedankten sich, dass er sie erlöst habe.
Der selbe alte Jäger, der die junge Königin auf den hohen Baum verwünscht, hatte auch sie in Pferde verwandelt. Nun aber waren sie und ihr ganzes Reich von dem Zauber erlöst, und die ganzen großen Wälder, in denen der alte Jäger sein Wesen getrieben hatte, waren mit erlöst und jetzt Städte und Dörfer, Mühlen und Seen geworden, und der Prinz und die Prinzessin waren Herrscher über das ganze Land.
Sie blieben noch eine Zeit lang bei ihrem Erlöser und seiner Frau, dann zogen sie in ihr eigenes Königreich. Der junge König lebte aber mit seiner Frau glücklich und zufrieden sein Leben lang, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch.
Ulrich Jahn, Volksmärchen aus Pommern und Rügen
DIE TÖNENDE LINDE ...
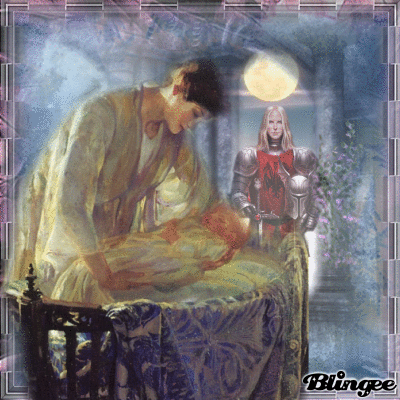
Es war einmal ein Mädchen, dem war schon früh die Mutter gestorben, und so lebte es mit seinem Vater allein. Einmal ging das Mädchen seine Patin besuchen. Die Patin aber hätte den Witwer gern geheiratet. "Wenn dein Vater mich zur Frau nimmt", versprach sie, "so werde ich deine Füße täglich in Milch waschen und dein Haar in Bier."
Der Vater nahm auch tatsächlich die Patin zur Frau, und am ersten Tag wusch die neue Stiefmutter dem Mädchen noch die Füße in Milch und die Haare in Bier, doch schon am zweiten Tag nahm sie Spülwasser.
Nach einiger Zeit wurden der Stiefmutter drei Töchter geboren, die erste hatte nur ein Auge, die zweite zwei und die dritte hatte drei Augen. Das arme Mädchen musste täglich die Kühe auf die Weide treiben und bekam abends nur ein Stück hartes Brot und gepfefferten Käse. Und doch wurde sie von Tag zu Tag schöner und hatte rötere Wangen als ihre Stiefschwestern zusammen.
Das ließ der Stiefmutter keine Ruhe. Sie wollte dahinterkommen, wieso das Mädchen so aufblühte, und so schickte sie ihre einäugige Tochter mit auf die Weide. Die sollte gut Acht geben, was die
Stieftochter den ganzen Tag über treibe.
Kaum waren sie auf der Weide, setzte sich die Einäugige ins Gras und befahl: "Kämm mir mein Haar!" Das Mädchen kämmte sie und flüsterte dabei: "Schlaf, Äuglein, schlaf!" Und die Einäugige schlief
ein.
Kaum hatte sie das Auge geschlossen, da lief eine gescheckte Kuh aus der Herde herbei und gab dem Mädchen aus einem Horn zu essen und aus dem anderen zu trinken. Am Abend erwachte die Einäugige und sie trieben gemeinsam die Kühe nach Hause. "Nun, hast du etwas gesehen?" fragte die Stiefmutter ihre Tochter, aber die hatte natürlich nichts gesehen.
Am nächsten Tag ging die zweite Tochter mit auf die Weide. Sie setzte sich ins Gras und befahl: "Kämm mir mein Haar!" Das Mädchen kämmte sie und flüsterte dabei: "Schlaft, Äuglein, schlaft Äugelein beide!" Und so schlief auch die zweite Stiefschwester ein und hat nichts gesehen.
Am dritten Tag schickte nun die Stiefmutter ihre dritte Tochter mit auf die Weide, und wie die ersten beiden, befahl auch sie: "Kämm mir mein Haar!". Das Mädchen kämmte das Haar und flüsterte dabei leise: "Schlaft, Äuglein, schlaft Äugelein beide!" Doch das dritte Auge hatte sie vergessen. Wieder kam die gescheckte Kuh gelaufen und gab ihr zu essen und zu trinken. Zwei Augen der Stiefschwester schliefen, doch das dritte sah alles mit. Als sie ihrer Mutter davon berichtete, beschloss diese, die Kuh zu schlachten.
Eines Tages sprach die Kuh zu dem Mädchen: "Heute wird man mich schlachten. Du aber lass dir von deiner Stiefmutter meine Eingeweide geben. Darin wirst du einen Stein finden, den pflanze unter deinem Fenster in die Erde."
Das Mädchen tat, wie ihr die Kuh geraten hatte, und aus dem Stein wuchs schon bald eine gläserne Linde. Wenn der Wind in ihren Blättern spielte, so erklang ein silberner Ton. Unter dem Baum bellte ein Hündchen, und aus der Wurzel entsprang ein klarer Quell. Die Stiefmutter ließ das arme Mädchen in dem Quell Wäsche waschen, bis ihre Hände blutig davon waren.
Einmal fuhr ein Edelmann an dem Haus vorbei, und als er das Mädchen sah, gefiel es ihm so gut, dass er es zur Frau nehmen wollte. Doch die Stiefmutter wollte das nicht zulassen. Der Edelmann kam nach einer Woche in einer Kutsche gefahren, um das Mädchen zu holen. Da befahl die Alte: "Nehmt starke Ketten und bindet damit die Linde!"
Inzwischen hatte das Mädchen seine schönsten Kleider angezogen, es setzte sich zu ihrem Bräutigam in die Kutsche und fuhr mit ihm davon. Da sprengte die Linde ihre Ketten und sprang hinten auf den Wagen. Hinter der Kutsche aber lief fröhlich bellend das Hündchen her.
Nach einem Jahr wurde der jungen Frau ein Sohn geboren. Als das die Stiefmutter erfuhr, machte sie sich mit ihrer zweiäugigen Tochter auf, die junge Mutter zu besuchen. "Wie geht es dir, mein Töchterlein?" fragte sie freundlich. "Danke, Mütterchen, gut." Die Alte trat ans Fenster und rief aus: "Oh, schau nur, mein Kind, wie da draußen im See die Fische spielen!"
Und als die junge Frau aus dem Fenster sah, gab die Alte ihr einen Stoß, so dass sie aus dem Fenster direkt in den See fiel. An der Stelle aber, wo sie verschwunden war, tauchte eine Ente auf und
schwamm traurig auf den Wellen.
Die Stiefmutter legte ihre eigene Tochter in das Bett und ging nach Hause.
Um Mitternacht aber kam eine Ente ins Zimmer geflogen, verwandelte sich in eine junge, schöne Frau, badete das Kind und weinte. Dann legte sie den Knaben zurück in die Wiege, küsste ihn auf die Stirn und sprach: "Meine Linde tönt nicht, mein Hündchen bellt nicht, nur mein Söhnchen, das weint gar sehr. Nun komme ich noch einmal, und dann nimmermehr." Dann verwandelte sie sich wieder in eine Ente und flog aus dem Fenster.
Eine Dienerin hatte alles mit angesehen und berichtete es dem Herrn. Der beschloss, in der nächsten Nacht in einem Versteck zu warten. Als die Nacht kam, flog wieder die Ente durchs Fenster, verwandelte sich in die schöne junge Frau, badete ihr Kindlein, küsste es auf die Stirn, als sie wieder in die Wiege legte und sprach: "Meine Linde tönt nicht, mein Hündchen bellt nicht, nur mein Söhnchen, das weint gar sehr. Nun komme ich nimmermehr."
Bei diesen Worten sprang ihr Gemahl aus dem Versteck hervor und umarmte sie noch ehe sie sich wieder in eine Ente verwandeln konnte. Die junge Frau aber bat traurig: "Lass mich los, mein Liebster, meine Zeit ist um!" "Nein, ich werde dich nie mehr von mir lassen!" rief der Edelmann und drückte sie noch fester an sich.
Da sagte die Frau: "Ich habe einen schmalen Gürtel um den Körper, wenn du ihn mit einem einzigen Schwertschlag durch schlägst, so darf ich bei dir bleiben. Doch wenn es dir nicht gelingt, so wird es mir schlecht ergehen."
Mit einem einzigen Schlag durchschlug der Edelmann den Gürtel, und da stand seine Frau wieder fröhlich und rotwangig vor ihm wie eh und je. Und sie erzählte ihm, was ihr die böse Stiefmutter angetan hatte. Am nächsten Tag banden die Knechte die Stiefmutter an den Schweif eines wilden Pferdes und jagten es davon.
Die Linde aber tönte wieder, das Hündchen bellte, und das Söhnchen lächelte in seiner Wiege.
Sorbisches Märchen
DAS VERWÜNSCHTE SCHLOSS ...

In alter Zeit ist mal ein Edelmann gewesen, der hatte einen großen, schönen Wald und vieles Wild darin, aber alle seine Jägerburschen, die er noch gehabt hatte, wenn sie ausgingen, in dem Wald zu jagen, so kamen sie nicht wieder zurück, so dass zuletzt keiner mehr bei dem Edelmann in Dienst gehen wollte.
Nach langer Zeit kam endlich mal wieder ein junger, hübscher Bursche zugereist, der stellte sich dem Edelmann als Jäger vor; da sagte ihm der Edelmann, wie es mit dem Walde bestellt wäre, und dass noch keiner wieder daraus zurückgekommen sei, aber der Bursche bat so viel, er möchte ihn doch annehmen, dass er ihn zuletzt doch in seinen Dienst nahm.
Gleich den anderen Tag sattelte der Jäger sein Pferd und zog zum Jagen in den Wald hinein. Nicht lange war er geritten, so sah er auf einmal dicht vor sich elf prächtige Hirschkühe und einen prächtigen Hirschbock, der trug ein Geweih von purem Golde. Da fasste den Jäger ein heftiges Verlangen, dem wunderbaren Hirsche zu folgen, dass er ihn womöglich erjagen möchte; darum trieb er sein Pferd zu raschem Laufe an.
Die zwölf Hirsche aber, als er ihnen nachsetzte, sprangen eilig davon; und zuletzt wurde der Wald so wüst und dicht, dass er die Hirsche ganz aus den Augen verlor und sich verirrte. Mit dem, so brach auch die Nacht herein. Da stieg der Jäger auf einen hohen Baum und sah von da aus der Ferne her ein Licht schimmern.
Als er nun in der Richtung, wo das Licht her schien, weiter ritt, so kam er an einen großen Pferdestall, darin brannte die Stalllaterne, und das war das Licht gewesen, welches er von dem Baume aus hatte schimmern sehen. Da band er sein Pferd wie die anderen Pferde in den Stall.
Der Pferdestall gehörte aber zu einem Schlosse, das stand nicht weit davon, und als der Jäger da hinein ging, so fand er alles aufs schönste eingerichtet, aber es war ganz still darin und kein lebendes Wesen zu hören und zu sehen. Nun stand da ein Schrank voll schöner Lesebücher, da nahm der Jäger eins von in die Hand, um sich die Zeit zu kürzen.
Mit einem Male so wurde eine Stimme wach, die rief: "Was beliebt?" "Ei!" sprach der Jäger, "wenn es nach meinem Belieben geht, so möchte ich wohl Waschwasser haben und ein gutes Abendbrot." Und was er verlangt hatte, das wurde ihm auch alles hergebracht. Da wusch er sich und setzte sich zum Abendessen, und als er gegessen hatte, nahm er wieder sein Buch zur Hand und las.
Um elf Uhr ließ sich wieder die Stimme vernehmen und sagte: wenn es zwölf wäre, so kämen vier Männer und schleppten ihn im ganzen Schlosse herum; dabei dürfte er aber ja keinen Laut von sich geben, sonst müsste er sterben.
Und richtig! Mit dem Schlage zwölf tat sich die Tür auf und herein traten vier schwarze Männer, die fassten ihn unsanft an, schleiften ihn Trepp' auf, Trepp' ab im ganzen Schlosse herum; er gab aber keinen Laut von sich, und als der Schlag eins aus der Glocke ging, da brachten sie ihn wieder in sein Zimmer zurück.
Da sagte die Stimme: auf dem Tische stände Salbe, da sollte er sich mit einreiben, und dann stände in dem Nebenzimmer ein schönes Bett, da sollte er sich hineinlegen. Das tat der Jäger auch und den anderen Morgen, da er erwachte, waren all seine Schmerzen vorüber. Es stand auch schon sein Morgenbrot bereit.
Er erhob sich, als er das sah, von seinem Lager, verzehrte was ihm gebracht war, und nachdem, so setzte er sich wieder hin und las schöne Geschichtsbücher, die er nach Belieben aus dem Schranke nehmen konnte. Den ganzen Tag über wurde er mit Essen und Trinken wohl versorgt, so dass es ihm sicher alles wohl gefallen hätte, wenn ihm nicht die unheimlichen schwarzen Männer von der Nacht vorher noch zu lebhaft in Gedanken gewesen wären.
Darum gedachte er, als der Abend anbrach, heimlich davon zu gehen. Aber o weh! Die Zugbrücke war aufgesogen und alle Anstrengungen, sie herunter zu lassen, waren vergeblich. Da musste er denn wohl wieder umkehren, er mochte wollen oder nicht.
Um elf Uhr wurde wieder die Stimme laut und sagte: statt dass gestern vier gekommen wären, würden heute Nacht acht kommen und ihn im ganzen Schlosse herumtragen; wenn er aber den geringsten Laut von sich gäbe, so müsste er sterben.
Und richtig! Mit dem Schlage zwölf tat sich die Türe auf und hereintraten acht große schwarze Männer, die packten ihn bei den Beinen und schleiften ihn mit dem Kopfe zu unterst Trepp' auf, Trepp' ab im ganzen Schlosse herum, dass ihm alle Rippen im Leibe knackten und sein Kopf voll Beulen wurde. Aber doch gab er keinen Laut von sich; und wie der Schlag eins aus der Glocke ging, da brachten sie ihn wieder hin, wo sie ihn hergeholt hatten.
Da sagte die Stimme wieder: auf dem Tische stände Salbe, da solle er sich mit einreiben, und in dem Nebenzimmer stände ein schönes Bett, da solle er sich hineinlegen. Das tat der Jäger auch; und den anderen Morgen, als er aufwachte, war sein Kopf wieder heil und tat ihm kein Finger weh.
Es stand auch schon ein gutes Morgenbrot bereit, das verzehrte er mit Behagen, und nachdem so setzte er sich wieder hin und las noch viel schönere Bücher als er den Tag vorher gelesen hatte, und zu bestimmter Zeit kriegte er auch wieder sein gutes Essen und war ganz vergnügt bis zum Abend, wo es anfing dunkel zu werden; da fielen ihm die schwarzen Männer wieder ein und herzlich gerne hätte er sich auf und davon gemacht, wenn er nur gekonnt hätte.
Um elf Uhr sagte die Stimme: anstatt dass gestern acht gekommen wären, kämen heute zwölf; er sollte aber nur standhaft bleiben und kein Wort sagen, sonst müsste er sterben.
Und richtig! Mit dem Schlage zwölf tat sich die Tür auf und herein traten zwölf kohlschwarze Männer, die banden ihm Hände und Füße mit eisernen Ketten und schleiften ihn im ganzen Schlosse herum und zuletzt hinaus auf den Hof zu einem tiefen Brunnen und taten, als ob sie ihn hineinwerfen wollten. Aber doch blieb er standhaft und gab keinen Laut von sich.
Sowie der Schlag eins aus der Glocke ging, brachten sie ihn wieder zurück in sein Gemach. Er war halb tot und alle Knochen taten ihm im Leibe weh, aber diesmal kam keine Salbe und wurde ihm auch kein Bett gegeben, so dass er auf allen vieren in eine Ecke kroch und da liegen blieb.
Die ganze Nacht tat er vor Schmerz kein Auge zu, und den anderen Morgen wurde auch kein Essen gebracht; aber es dauerte nicht lange, so klopfte jemand an die Tür, und als der Jäger "herein!" rief, da erschien ein wunderschönes Mädchen, das gab ihm von der Heilsalbe und sagte: in dem Nebenzimmer im Schranke, da hingen königliche Kleider, die sollte er anziehen, und wenn er das getan hätte, so sollte er nur oben heraufkommen. Damit ging sie wieder hinaus.
Der Jäger zog nun, nachdem er mit der Salbe seine Schmerzen gestillt hatte, die königlichen Kleider an und ging dann oben in das Schloss hinauf, und als er in den Saal trat, so saß da eine wunderschöne Prinzessin mit ihren elf Jungfrauen; das waren die zwölf Hirsche gewesen, die der Jäger verfolgt hatte; der mit den goldenen Hörnern war die Prinzessin.
Da bedankten sie sich bei dem Jäger, dass er sie durch seine Standhaftigkeit nun erlöst hatte. Nachdem so wurde der Jäger König und hielt Hochzeit mit der schönen Prinzessin, und wurde getanzt und geschmaust; und wenn die Hochzeit noch nicht zu Ende ist, so dauert sie heute noch.
Wilhelm Busch
DAS TROMPETERSCHLÖSSCHEN ...
Am Dippoldiswalder Platz in Dresden liegt der Gutshof „Zum Trompeterschlösschen.“ Dort in der abgeschnittenen Ecke im zweiten Stockwerk ein vergoldeter Trompeter zu sehen. Dessen Geschichte ist folgende:
Vor langer Zeit war dieses Haus einmal ein Jagdschlösschen der Grafen Drohna gewesen. Dann hatte es ein Dresdner Schankwirt zu seinem bereits bestehenden Gasthaus dazu gekauft, um mehr Gästezimmer zu haben. Er hat es auch recht billig bekommen, erfuhr den Grund für den niedrigen Preis aber erst nachher. In dem Haus sollte es spuken. Das beeindruckte den neuen Besitzer jedoch wenig, er hielt seinen Einzugs Schmaus und belegte das Haus mit Gästen.
Lange Zeit hörte und sah man nichts von einem Spuk. Dann bat eines Tages ein Ritter mit seinen Knappen um Herberge, doch beide Häuser waren schon überfüllt. Schließlich wies der Wirt dem Ritter einen alten Saal an, der voller Gerümpel stand und zugleich als Vorratsraum für Getreide benutzt wurde.
Der Ritter warf sich auf das Lager, das der Wirt ihm hergerichtet hatte, und schlief erschöpft ein. Mitten in der Nacht wurde er von dumpfen Poltern geweckt und sah plötzlich ein Gerippe mit einem Leichentuch vor sich, das fragte ihn, ob er nicht vielleicht zum Tanz aufspielen könne. Der Ritter griff zornig das Schwert, doch da berührte ihn die Erscheinung mit eiskalter, schwerer Totenhand und lähmte ihm seine Glieder.
Das Gespenst stellte die selbe Frage noch ein zweites und drittes Mal. Endlich ließ sich der Ritter zu einer verneinenden Antwort herab und der Geist ging traurig fort. Der Lärm und das Poltern hörten allmählich auf, aber der Ritter hielt es nicht länger im Saal aus. Er eilte die Treppe hinab, rief den Wirt und schlafenden Gäste wach und erzählte von seinem Abenteuer.
Da ging es dem Wirt aber schlecht, denn am nächsten Morgen, sobald es hell wurde, reisten alle Gäste ab. Niemand wollte mehr in dem verwünschten Haus schlafen, der Wirt musste froh sein, dass wenigstens sein altes Gasthaus noch ganz gut besucht wurde. Er versuchte das andere Haus zu verkaufen, aber die Geschichte hat sich überall herumgesprochen, und es fand sich weder Käufer noch ein Pächter. Endlich nahte Hilfe.
Eines Abends kam ein Trompeter angeritten und verlangte Herberge, es war jedoch alles besetzt. Der Wirt deutete spöttisch auf das Spukhaus und sagte, dort könne er noch unterkommen und hätte dann ein ganzes Haus für sich allein. Nur mit den Geistern müsse er sich abfinden. Kaltblütig antwortete der Trompeter, wenn es weiter nichts wäre, das würde er sich schon zutrauen. Der Wirt solle ihm nur ein Fässchen seines besten Bieres sowie ein Licht mitgeben, und ihm ein Schlaflager herrichten.
Der Wirt tat dies, führte den unerschrockenen Gast in das Spukhaus, und schloss die Tür hinter ihm zu, damit er nicht mitten in der Nacht angelaufen käme und die anderen Gäste aufschreckte. Der Trompeter ließ sich das Bier schmecken und versuchte dann zu schlafen, der Schlaf wollte allerdings nicht kommen. Er warf sich von einer Seite auf die andere, nichts half. Da stand er schließlich auf, nahm seine Trompete und blies sich selbst zur Beruhigung ein paar fröhliche Lieder.
So wurde es Mitternacht und mit dem Glockenschlag begann das Poltern, als liefen hundert Menschen durch das Haus. Die Tür sprang auf und im Saal erschien zwölf Paare von Totengerippen. Sie hatten Leintücher um die bloßen Knochen geschlungen und bewegten sich im Takt auf und ab. Der Trompeter wusste sich vor lauter Angst nicht anders zu helfen, er nahm seine Trompete und blies wiederum ein lustiges Stück.
Das schien den Geistern zu gefallen, sie nickten ihm zu und drehten sich zur Musik und je schneller er blies, umso rasender wurde der Wirbel der tanzenden Paare. Der Trompeter wollte aufhören, aber die sonderbare Versammlung machte ihm so drohende Zeichen, dass er aus Angst gleich wieder zur Trompete griff und blies, bis ihm beinahe die Luft ausging.
Schließlich hörten die Gespenster von selbst auf zu tanzen, einer der Knochenmänner trat auf ihn zu und sprach: „Hab Dank, Fremder, du hast uns zur ewigen Ruhe geblasen, fort an wird dieses Haus vor uns Gespenster sicher sein.“ Mit diesen Worten schlug es ein Uhr und alle Gerippe zerfielen zu Staub.
Der Trompeter wurde ohnmächtig und erst das Sonnenlicht des hellen Morgens, weckte ihn auf. Die Schrecken der vergangenen Nacht standen ihm noch lebhaft vor Augen, er riss das Fenster auf und sandte ein aus voller Brust geschmettertes Danklied zum Himmel hinauf.
Das trompetete Lied Gottes weckte den Wirt und die Gäste des alten Hauses. Sie kamen verwundert angerannt, ließen sich das Geschehene berichten und das Häuflein Asche zeigen, das von den tanzenden Paaren übrig geblieben war. Der Wirt war überglücklich und bot dem Trompeter vor Zeugen an, er dürfe zum Dank für diese Geister Vertreibung sein Leben lang bei ihm wohnen, und auf seine Kosten essen und trinken.
Der Trompeter nahm dieses Angebot jedoch nicht an und sagte, er sei mit dem Fässchen Bier als Lohn zufrieden, das habe er sich allerdings auch schwer genug verdient. Der Wirt aber gab keine Ruhe, bis er dem tapferen Mann einen Beutel voller Geld aufgedrängt hatte, damit er in seiner Heimat ein sorgenfreies Leben führen konnte.
Zum Andenken an diese Begebenheit ließ der Wirt ein Denkmal des Trompeters in Stein hauen und an seinem Haus anbringen.
Deutsches Sagenbuch
DIE WITTEKINDSBURGEN ...

Wittekindburg in Minden
Held Wittekind, oder Widukind, der Sachsenherzog, hatte eine Burg in der Gegend von Minden auf einem schönen Berg, da, wo das Wesergebirge beginnt und man einen reizenden Punkt der Gegend die Porta Westfalica nennt. Diese Burg hieß Wittekindsburg. Eine andere Burg stand stand auf der Werder, wo die Herforder Werre in die Weser fließt, und eine dritte hatte Wittekind nahe der heutigen Stadt Lübeck erbaut, die hieß Babylonie. Von allen dreien gehen noch Sagen um die Lande Westfalen.
Nahe der Burg am Werder soll ein greiser Christenpriester dem Helden Wittekind auf der Jagd im tiefen Wald begegnet sein und zu ihm gesprochen haben, er solle an das Christentum glauben und an
die Macht des ewigen Gottes.
Da habe der Heidenheld ein Zeichen gefordert und der Priester habe im Gebet Gott um solch eines angefleht, denn Wittekind hatte gesagt:„Mache, das Wasser aus diesem Felsen springt, dann will ich
die Taufe annehmen!“
Da habe sich das Pferd aufgebäumt, mit dem Huf an den Felsen geschlagen und ein Wasserstrahl sei aus dem Gestein gerauscht. Nachdem er dies gesehen hatte, stieg der Held vom Pferd und betete und ließ eine Kirche an diesem heiligen Ort bauen. Der Ort erhielt den Namen Bergkirchen und die Quelle darunter fließt noch heute und heißt der Wittekindborn.
Als aber der große Wittekind nach einem Leben voller Kämpfe gestorben war, da ist zwar sein Leib in Enger, wo er ebenfalls eine Burg hatte, beigesetzt worden, aber viele haben ihn nachher doch noch einmal wieder gesehen. Es geht nämlich die Sage, dass seine letzte Schlacht auf dem Wittenfelde gar vielen braven Streitern das Leben gekostet und dass der Held schließlich flüchtend nach Ellerbruch gezogen sei.
Da nun im Heerestross viele Frauen und Kinder gewesen seien, die nicht gut fortzubringen waren, da habe sich das Sprichwort erfüllt: „Krieche ein, krieche ein, die Welt ist dir Gram“, und es habe sich unter der Babylonie der Berg aufgetan und Wittekind sei mit seinem ganzen flüchtigen Heer und allem Gefolge hineingezogen. Für immer und ewig habe er sich da hinein verwünscht. Manches Mal sieht man ihn in gewissen Zeiten mit auserlesenem Gefolge im Wesergebirge auf weißen Pferden reiten, wenn er seine Burgen besucht.
Auch sein Heer kann man von Zeit zu Zeit sehen, wie es dahin zieht mit blinkenden Spießen, Pferdewiehern und Hörnerschall. Die Leute sagen, dass es Krieg bedeute, wenn der Wittekind aus der Babylonie ausreite.
Volkssage Deutschland
VOM ESCHENHEIMER TURM ...
Einst hatten die Frankfurter einen Wilddieb gefangen. Sein Name war Hänsel Winkelsee. Neun Tage lang saß er schon im finsteren Loch und wartete auf sein Urteil, und in jeder Nacht hörte er über seiner luftigen Behausung hoch oben im Eschenheimer Turm die Wetterfahne kreischen.
Schließlich sprach er: „Wenn ich frei wäre und schießen dürfte, wie es mir gefällt, dann schösse ich dir, du lausige Fahne, so viele Löcher durchs Blech, wie ich Nächte hier gesessen bin.“ Der Kerkermeister hatte dies gehört und so gleich dem Stadtschultheißen berichtet.
Der aber entschied, wenn der Winkelsee ein gar so guter Schütze sein wolle, dann soll er sein Glück versuchen. Man gab dem Winkelsee eine Büchse. Wenn es ihm gelänge, auszuführen, was er angekündigt habe, so sei er ein freier Mann. Gehe aber auch nur eine Kugel daneben, dann müsse er am Galgen baumeln.
Da hatte der Wildschütze seine Büchse und seine Kugeln genommen und sie mit guten Waidmannssprüchlein besprochen. Er legte an, zielte auf die Fahne, drückte ab: Tatsächlich war nun ein Löchlein im Blech. Nun machte er es achtmal genauso und jede Kugel saß an der richtigen Stelle. Mit dem neunten Schuss aber war der Neuner fertig, der noch heute in der Fahne auf dem Eschenheimer Turm zu sehen ist, und alle bejubelten den Schützen.
Der Stadtrat aber dachte im Stillen: „Wehe unserer armen Hirsche und allem sonstigen Wild, wenn dieser Wilderer wieder hinaus in die Wälder kommt!“ Er teilte seine Bedenken dem Schultheiß mit, welcher zum Winkelsee sprach: „Höre Hänsel, dass du gut schießen kannst, das haben wir nun mit eigenen Augen gesehen. Bleibe bei uns! Dann sollst du Schützenhauptmann in unserer Bürgerwehr werden!“
Der Hänsel aber erwiderte: „Eure Dachfahnen quietschen mir zu sehr und euer Hahn kräht mir zu wenig. Mich seht ihr nicht wieder und fangen werdet ihr mich auch nicht mehr. Danke für die Herberge!“ Er nahm seine Büchse und stapfte davon.
Was den Hahn betrifft, so hatte Hänsel nur gespottet. Er hatte nämlich das Frankfurter Wahrzeichen gemeint, den vergoldeten Hahn, der mitten auf der Sachsenhäuser Brücke steht, welche fertig zu bauen der Teufel geholfen hatte. Denn als der Baumeister sie nicht zu vollenden vermochte, da hat er den Teufel um Hilfe gerufen und ihm die erste Seele versprochen hat, die darüber laufe.
Dann aber, in der Frühe, jagte der Baumeister zu allererst einen Hahn über die Brücke. Da wurde der Teufel böse, zerriss den Hahn und warf ihn mitten durch die Brücke hindurch. Hierbei sind zwei Löcher entstanden, die bis heute nicht zugemauert werden konnten, weil über Nacht immer alles wieder in sich zusammen fiel, was am Tage zuvor gemauert worden war.
Auf der Brücke aber wurde der Hahn zum ewigen Wahrzeichen aufgestellt.
Diesen Hahn hatte der Hänsel Winkelsee gemeint, als er sagte, dass er zu wenig krähe. Dieser Hahn kräht nämlich überhaupt nicht.
Die Wetterfahne auf dem Eschenheimer Turm am Ende der Schillerstraße in Frankfurt am Main, einem der ehemals 60 Wehrtürmen der Stadt, weist heute noch die neun Löcher auf, die der Wilddieb hinein geschossen haben soll.
Friedrich Ranke
DER VERGRABENE SCHATZ IN EBERSWALDE ...
Ein Sattler aus Eberswalde hatte nicht genügend zu tun. Da erhielt er von einem Stadtherren den Auftrag, hinter dem Brunnen einen Graben auszuheben.
Während er auf solche Weise beschäftigt war, stieß er plötzlich auf einen großen Behälter, der mit Gold gefüllt und so schwer war, dass er ihn nicht mal anheben konnte. Er beschloss ihn nach und nach zu leeren und füllte seine Mütze mit Goldstücken voll, weil er nichts anderes zur Hand hatte.
Da kam sein kleiner Sohn des Weges und sprach zu ihm: „Vater, schenk mir auch einen Heller!“ Im selben Augenblick versank der Behälter mit dem Gold, das Erdreich brach von allen Seiten ein und der ehrbare Meister hatte kaum noch Zeit, die Mütze zu retten.
Dass er solches Pech gehabt hatte, ging ihm doch sehr zu Herzen und er begab sich sofort zu dem als Wundermann bekannten Stadtschäfer, um ihm von der Sache zu berichten. Der Schäfer erklärte, der Schatz sei versunken, weil man bei seinem Auffinden nicht hätte sprechen dürfen.
Aber er wusste auch, was zu tun war. Er wies den Sattler an in der nächsten Johannisnacht um elf Uhr abends mit mehreren Männern wieder an der selben Stelle zu sein. Auch er selbst werde da sein, sich unter eine große Linde stellen, um Wache zu halten, und Punkt zwölf das Zeichen zum Graben geben. Allerdings, so schärfte er dem Sattler ein, dürfe unter keinen Umständen auch nur ein einziges Wort während der Arbeit gesprochen werden.
Mit dem Glockenschlag zwölf Uhr in der fraglichen Nacht wurde mit dem Graben begonnen und schon kurz darauf war der Schatz frei gelegt. Da aber kamen einige Vorstädter vorbei, die in der Johannisnacht Heilkräuter sammelten, und sprachen die Grabenden an: „Was mach ihr denn da?“ Im selben Augenblick verschwand der Schatz wie durch Zauber, und wieder stürzte das Erdreich in sich zusammen.
Die Schatzgräber gingen sofort zu dem alten Schäfer und erzählten ihm von dem Vorfall, denn nun schien alles verloren. Doch der Alte tröstete sie und erteilte ihnen einen neuen Rat. Sie müssten sich nur von der Witwe Rücker ein ganz bestimmtes Buch geben lassen, dann könne der Schatz trotzdem gehoben werden, ganz gleich, was dabei geschehe.
Schon am nächsten Morgen begab sich der Sattler zu der Witwe und trug sein Anliegen vor. Er erhielt aber die traurige Auskunft, dass sie das Buch auf Geheiß ihres Mannes verbrannt habe. So blieb jener Schatz für alle Zeit ungehoben.
Deutsches Sagenbuch
DER SCHELM VON BERGEN ...
Als Friedrich Barbarossa zum deutschen Kaiser gewählt worden war, veranstaltete er in seinem Palast zu Frankfurt am Main ein großes Fest. Es war ein Maskenfest, zu dem jedermann, freien Zutritt hatte. Selbstverständlich tanzte die Kaiserin auch mit und traf dabei auf einen Vermummten, der sich als ein ausgezeichneter Tänzer erwies, so dass sie gar nicht genug von ihm bekam.
Da aber rückte die Stunde der Entlarvung heran, in der ein jeder Gast seine Masken ablegen musste, und auch der Tänzer der Kaiserin musste die seine sinken lassen. Wie entsetzt waren nun aber alle, als man sah, wer mit der Majestät getanzt hatte! Es war kein Edler, nicht einmal ein Bürger oder ein Bauer gewesen – es war der Schindler, der noch nicht einmal in Frankfurt, sondern nur außerhalb, in dem Ort Bergen wohnen durfte.
Da wurde der Kaiser sehr zornig und wollte dem frechen Eindringling den Kopf abschlagen lassen. Die Kaiserin aber hatte Mitleid mit ihm und setzte sich für ihn ein. Der Schindler aber sprach: „Gemach, Herr Kaiser, Ihr irrt! Nicht die Kaiserin ist durch meine Berührung entehrt worden, sondern ich bin dadurch, dass ich mit ihr getanzt habe, zu Ehren gekommen!“
Nun lachte der Kaiser. „Du Schelm von Bergen, für einen Schindler hast du wahrlich Verstand. Knie nieder, ich will dich noch mehr zu Ehren bringen!“ Und damit schlug ihn der Kaiser zum Ritter als
Schelm von Bergen, ein Name, der auch seinen Nachkommen geblieben ist, bis das Geschlecht im Jahr 1844
verstarb.
Friedrich Ranke
DAS KLEINE BUCKLIGE MÄDCHEN ...
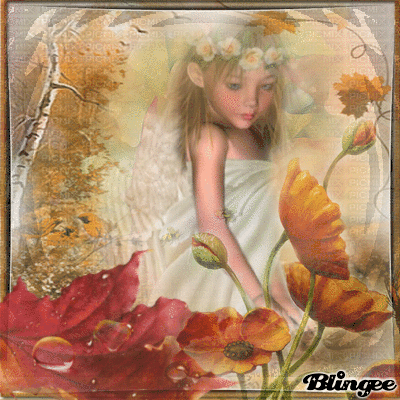
Es war einmal eine Frau, die hatte ein einziges Töchterchen, das war sehr klein und blass und wohl etwas anders wie andere Kinder. Denn wenn die Frau mit ihm ausging, blieben oft die Leute stehen, sahen dem Kinde nach und raunten sich etwas zu. Wenn dann das kleine Mädchen seine Mutter fragte, weshalb die Leute es so sonderbar ansehen, entgegnete die Mutter jedes Mal: "Weil du ein so wunderschönes, neues Kleidchen anhast." Darauf gab sich die Kleine zufrieden.
Kamen sie jedoch nach Hause zurück, so nahm die Mutter ihr Töchterchen auf die Arme, küsste es wieder und immer wieder und sagte: "Du lieber, süßer Herzensengel, was soll aus dir werden, wenn ich einmal tot bin? Kein Mensch weiß es, was du für ein lieber Engel bist; nicht einmal dein Vater!"
Nach einiger Zeit wurde die Mutter plötzlich krank, und am neunten Tage starb sie. Da warf sich der Vater des kleinen Mädchens verzweifelt auf das Totenbett und wollte sich mit seiner Frau begraben lassen. Seine Freunde jedoch redeten ihm zu und trösteten ihn; da ließ er es, und nach einem Jahre nahm er sich eine andere Frau, schöner, jünger und reicher als die erste, aber so gut war sie lange nicht.
Und das kleine Mädchen hatte die ganze Zeit, seit seine Mutter gestorben war, jeden Tag von früh bis Abend in der Stube auf dem Fensterbrett gesessen; denn es fand sich niemand, der mit ihm ausgehen wollte. Es war noch blässer geworden, und gewachsen war es in dem letzten Jahre gar nicht.
Als nun die neue Mutter ins Haus kam, dachte es: "Jetzt wirst du wieder spazieren gehen, vor die Stadt, im lustigen Sonnenschein auf den hübschen Wegen, an denen die schönen Sträucher und Blumen stehen und wo die vielen geputzten Menschen sind." Denn es wohnte in einem kleinen, engen Gässchen, in welches die Sonne nur selten hinein schien; und wenn man auf dem Fensterbrette saß, sah man nur ein Stückchen blauen Himmel, so groß wie ein Taschentuch.
Die neue Mutter ging auch jeden Tag aus, vormittags und nachmittags. Dazu zog sie jedes Mal ein wunderschönes buntes Kleid an, viel schöner, als die alte Mutter je eins besessen hatte. Doch das kleine Mädchen nahm sie nie mit sich.
Da fasste sich das letztere endlich ein Herz, und eines Tages bat es sie recht inständig, sie möchte es doch mitnehmen. Allein die neue Mutter schlug es ihr rund ab, in dem sie sagte: "Du bist wohl nicht recht gescheit! Was sollen wohl die Leute denken, wenn ich mich mit dir sehen lasse? Du bist ja ganz bucklig. Bucklige Kinder gehen nie spazieren, die bleiben immer zu Hause."
Darauf wurde das kleine Mädchen ganz still, und sobald die neue Mutter das Haus verlassen hatte, stellte es sich auf einen Stuhl und besah sich im Spiegel; und wirklich, es war bucklig, sehr bucklig! Da setzte es sich wieder auf sein Fensterbrett und sah hinab auf die Straße und dachte an seine gute alte Mutter, die es doch jeden Tag mitgenommen hatte.
Dann dachte es wieder an seinen Buckel: "Was nur da drin ist?" sagte es zu sich selbst, "es muss doch etwas in so einem Buckel drin sein."
Und der Sommer verging, und als der Winter kam, war das kleine Mädchen noch blasser und so schwach geworden, dass es sich gar nicht mehr auf das Fensterbrett setzen konnte, sondern stets im Bett liegen musste. Und als die Schneeglöckchen ihre ersten grünen Spitzchen aus der Erde hervor streckten, kam eines Nachts die alte, gute Mutter zu ihm und erzählte ihm, wie golden und herrlich es im Himmel aussähe.
Am andern Morgen war das kleine Mädchen tot.
"Weine nicht, Mann!" sagte die neue Mutter; "es ist für das arme Kind so am besten!" Und der Mann erwiderte kein Wort, sondern nickte stumm mit dem Kopfe. Als nun das kleine Mädchen begraben war, kam ein Engel mit großen, weißen Schwanenflügeln vom Himmel herab geflogen, setzte sich neben das Grab und klopfte daran, als wenn es eine Türe wäre.
Als bald kam das kleine Mädchen aus dem Grabe hervor, und der Engel erzählte ihm, er sei gekommen, um es zu seiner Mutter in den Himmel zu holen. Da fragte das kleine Mädchen schüchtern, ob denn bucklige Kinder auch in den Himmel kämen. Es könne sich das gar nicht vorstellen, weil es doch im Himmel so schön und vornehm wäre.
Jedoch der Engel erwiderte: "Du gutes, liebes Kind, du bist ja gar nicht mehr bucklig!" und berührte ihm den Rücken mit seiner weißen Hand. Da fiel der alte garstige Buckel ab wie eine große hohle Schale. Und was war darin?
Zwei herrliche, weiße Engelflügel! Die spannte es aus, als wenn es schon immer fliegen gekonnt hätte, und flog mit dem Engel durch den blitzenden Sonnenschein in den blauen Himmel hinauf. Auf dem höchsten Platze im Himmel aber saß seine gute, alte Mutter und breitete ihm die Arme entgegen. Der flog es gerade auf den Schoß.
Richard von Volkmann-Leander
DAS KLAPPERSTORCH-MÄRCHEN ...

Wovon die Beine der Teckel so kurz sind, und dass sie sich die selben abgelaufen haben, weiß jeder. Wie aber der Storch zu seinen langen Beinen gekommen ist, das ist eine ganz andere Geschichte.
Drei Tage nämlich, ehe der Storch ein kleines Kind bringt, klopft er mit seinem roten Schnabel an das Fenster der Leute, welche es bekommen sollen, und ruft:
"Schafft eine Wiege,
Ein' Schleier für Fliegen,
Ein buntes Röcklein,
Ein weißes Jäcklein,
Mützchen und Windel:
Bring' ein klein Kindel!"
Dann wissen die Leute, woran sie sind. Doch zuweilen, wenn er sehr viel zu tun hat, vergisst er es, und dann gibt es große Not, weil nichts fertig ist.
Bei zwei armen Leuten, welche im Dorf in einer kleinen Hütte wohnten, hatte es der Storch auch vergessen. Als er mit dem Kinde kam, war niemand zu Hause. Mann und Frau waren auf Feldarbeit gegangen und Türe und Fenster verschlossen; auch war nicht einmal eine Treppe vor dem Hause, auf die er es hätte legen können. Da flog er aufs Dach und klapperte so lange, bis das ganze Dorf zusammenlief und eine alte Frau eilends aufs Feld hinaus sprang, um die Leute zu holen.
"Herr Nachbar, Frau Nachbarin! Herr Nachbar, Frau Nachbarin!" rief sie schon von weitem, ganz außer Atem, "um Gottes Willen! Der Storch sitzt auf eurem Hause und will euch ein kleines Kind bringen. Niemand ist da, der ihm das Fenster aufmachen kann. Wenn ihr nicht bald kommt, lässt er es fallen, und es gibt ein Unglück. Oben beim Müller hat er es vor drei Jahren auch fallen lassen, und das arme Wurm ist heute noch bucklig."
Da liefen die beiden Hals über Kopf nach Haus und nahmen dem Storche das Kind ab. Wie sie es besahen, war es ein wunderhübscher kleiner Junge, und Mann und Frau waren vor Freude außer sich. Doch der Storch hatte sich über das lange Warten so geärgert, dass er sich vornahm, ganz bestimmt den beiden Leuten nie wieder ein Kind zu bringen.
Als sie endlich kamen, sah er sie schon ganz schief und ärgerlich an, und während er fort flog, sagte er noch: "Heute wird es auch wieder spät werden, ehe ich zu meiner Frau Storchin in den Sumpf komme. Ich habe noch zwölf Kinder auszutragen, und es ist schon spät. Das Leben wird einem doch recht sauer!"
Doch die beiden Leute hatten in ihrer Herzensfreude es gar nicht bemerkt, dass sich der Storch so schwer geärgert hatte. Eigentlich war er ja auch ganz allein daran schuld, dass er so lange hatte warten müssen, weil er es ihnen doch vergessen hatte, vorher zu sagen.
Wie nun das Kind wuchs und täglich hübscher wurde, sagte eines Tages die Frau:
"Wenn wir dem guten Storch, der uns das wunderhübsche Kind gebracht hat, nur irgend etwas schenken könnten, was ihm Spaß macht! Weißt du nichts? Mir will gar nichts einfallen!" "Das wird
schwer halten," erwiderte der Mann; "er hat schon alles!"
Am nächsten Morgen jedoch kam er zu seiner Frau und sagte zu ihr: "Was meinst du, wenn ich dem Storch beim Tischler ein paar recht schöne Stelzen machen ließe? Er muss doch immer in den Sumpf, um Frösche zu fangen, und dann wieder in den großen Teich hinterm Dorf, aus dem er die kleinen Knaben herausholt. Da muss er doch sehr oft nasse Füße bekommen! Ich dächte auch, er hätte damals, als er zu uns kam, ganz heiser geklappert."
"Das ist ein herrlicher Einfall!" entgegnete die Frau. "Aber der Tischler muss die Stelzen recht schön rot lackieren, damit sie zu seinem Schnabel passen!" "So?" sagte der Mann; "meinst du wirklich rot? Ich hatte an Grün gedacht." "Aber, bester Schatz!" fiel die Frau ein, "wo denkst du hin? Ihr Männer wisst doch niemals, was zusammenpasst und gut steht. Sie müssen unbedingt rot sein!"
Da nun der Mann sehr verständig war und stets auf seine Frau hörte, so bestellte er denn wirklich rote Stelzen, und als sie fertig waren, ging er an den Sumpf und brachte sie dem Storch. Und der Storch war sehr erfreut, probierte sie gleich und sagte:
"Eigentlich war ich auf euch recht böse, weil ihr mich damals so lange habt warten lassen. Weil ihr aber so gute Leute seid und mir die schönen roten Stelzen schenkt, so will ich euch auch noch ein kleines Mädchen bringen. Heute über vier Wochen werde ich kommen. Dass ihr mir dann aber auch hübsch zu Hause seid, und express es erst noch einmal ansagen werde ich nun nicht. Den Weg kann ich mir sparen! - Hörst du?"
"Nein, nein!" erwiderte der Mann. "Wir werden sicher zu Hause sein. Du sollst diesmal keinen Ärger davon haben."
Als die vier Wochen um waren, kam richtig der Storch geflogen und brachte ein kleines Mädchen; das war noch hübscher als der kleine Junge, und war nun gerade das Pärchen voll. Auch blieben beide Kinder hübsch und gesund, und die Eltern auch, so dass es eine rechte Freude war.
Nun wohnte aber im Dorf noch ein reicher Bauer, der besaß ebenfalls nur einen Knaben, und der war noch dazu ziemlich garstig, und der Bauer wünschte sich auch noch ein Mädchen dazu. Als er vernahm, wie es die armen Leute angefangen hatten, dachte er bei sich, es könne ihm gar nicht fehlen.
Er ging sofort zum Tischler und bestellte ebenfalls ein paar Stelzen, viel schöner wie die, welche die armen Leute hatten anfertigen lassen. Oben und unten mit goldenen Knöpfen und in der Mitte grün, gelb und blau geringelt. Als sie fertig waren, sahen sie in der Tat ungewöhnlich schön aus.
Darauf zog er sich seinen besten Rock an, nahm die Stelzen unter den Arm und ging hinaus an den Sumpf, wo er auch gleich den Storch fand. "Ganz gehorsamer Diener, Euer Gnaden!" sagte er zu
ihm und machte ein tiefes Kompliment.
"Meinst du mich?" fragte der Storch, der auf seinen schönen roten Stelzen behaglich im Wasser stand.
"Ich bin so frei!" erwiderte der Bauer. "Nun, was willst du?" "Ich möchte gern ein kleines Mädchen haben, und da hat sich meine Frau erlaubt, Euer Gnaden ein kleines Geschenk zu schicken. Ein Paar ganz bescheidene Stelzen."
"Da mach nur, dass du wieder nach Hause kommst!" entgegnete der Storch, in dem er sich auf einem Bein umdrehte und den Bauer gar nicht wieder ansah. "Ein kleines Mädchen kannst du nicht bekommen; und deine Stelzen brauche ich auch nicht! Ich habe schon zwei sehr schöne rote, und da ich meist nur eine auf einmal benutze, so werden sie wohl sehr lange vorhalten. -
Außerdem sind ja deine Stelzen ganz abscheulich hässlich. Pfui! blau, grün und gelb geringelt wie ein Hanswurst! Mit denen dürfte ich ja der Frau Storchin gar nicht unter die Augen kommen."
Da musste der Bauer mit seinen schönen Stelzen abziehen, und ein kleines Mädchen hat er sein Lebtag nicht bekommen.
Richard von Volkmann-Leander
DER VERROSTETE RITTER ...
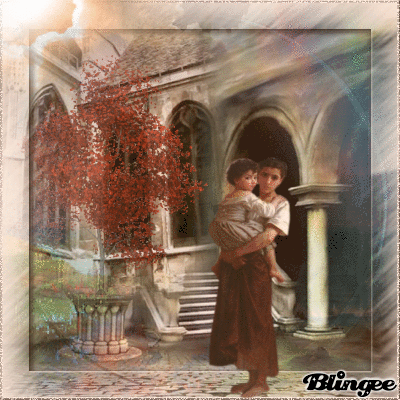
Ein sehr reicher und vornehmer Ritter lebte in Saus und Braus und war stolz und hart gegen die Armen. Deshalb ließ ihn Gott zur Strafe auf der einen Seite verrosten. Der linke Arm verrostete und das linke Bein; ebenso der Leib bis zur Mitte. Nur das Gesicht blieb frei.
Da zog der Ritter an die linke Hand einen Handschuh, ließ ihn sich am Handgelenk fest zunähen und legte ihn Tag und Nacht nicht ab, damit niemand sähe, wie sehr er verrostet sei. Darauf ging er in sich und versuchte einen neuen Lebenswandel anzufangen. Er entließ seine alten Freunde und Zechgenossen und nahm sich eine schöne und fromme Frau.
Dieselbe hatte wohl manches Schlimme von dem Ritter gehört, aber weil sein Gesicht gut geblieben war, glaubte sie es, wenn sie allein war und darüber nachdachte, nur halb, und wenn er bei ihr war und freundlich mit ihr sprach, gar nicht. Darum nahm sie ihn doch.
Nach der Hochzeit aber, in der ersten Nacht, merkte sie es, warum er niemals den Handschuh von der linken Hand abzog, und erschrak heftig. Sie ließ sich jedoch nichts merken, sondern sagte am anderen Morgen zu ihrem Manne, sie wolle in den Wald gehen, um in einer kleinen Kapelle, die dort stand, zu beten.
Neben der Kapelle aber befand sich eine Klause, in der lebte ein alter Eremit, der hatte früher lange in Jerusalem gelebt und war so heilig, dass die Leute von weit und breit zu ihm wallfahrteten. Den gedachte sie um Rat zu fragen.
Als sie nun dem Eremiten alles erzählt hatte, ging er in die Kapelle, betete dort lange zur Jungfrau Maria und sagte dann, als er wieder herauskam: "Du kannst deinen Mann noch erlösen, aber es ist schwer. Fängst du es an und bringst es nicht zu Ende, so musst du selbst auch verrosten.
Viel Unrecht hat dein Mann sein Lebtag getan, und stolz und hart gegen die Armen ist er gewesen: willst du für ihn betteln gehen, barfuss und in Lumpen wie das aller ärmste Bettlerweib, so lange, bis du hundert Goldgulden erbettelt hast, so ist dein Mann erlöst.
Dann nimm ihn an der Hand, gehe mit ihm in die Kirche und lege die hundert Goldgulden in das Kirchbecken für die Armen. Wenn du das tust, so wird Gott deinem Manne seine Sünden vergeben, der Rost wird abgehen, und er wird wieder so weiß werden wie zuvor."
"Das will ich tun", sagte die Ritterfrau, "und wenn es mir noch so schwer werden wird und es noch so lange dauert. Ich will meinen Mann erlösen, denn er ist nur auswendig verrostet, das glaube ich ganz sicher!"
Darauf ging sie fort, tief in den Wald hinein, und nicht lange, so begegnete ihr ein altes Mütterchen, welches Reisig suchte. Es hatte einen zerlumpten, schmutzigen Rock an und darüber einen Mantel, der war aus ebenso vielen Flecken zusammen gesetzt wie weiland das Heilige Römische Reich; was aber die Flicken früher für eine Farbe gehabt, das konnte man kaum mehr sehen, denn Regen und Sonnenschein hatten schon viel Arbeit mit dem Mantel gehabt.
"Willst du mir deinen Rock und deinen Mantel geben, alte Mutter", sagte die Ritterfrau, "so schenk ich dir alles Geld, was ich in der Tasche habe, und meine seidenen Kleider noch dazu; denn ich möchte gern arm sein."
Da sah die alte Frau sie verwundert an und sprach: "Will es schon tun, will es schon tun, mein blankes Töchterchen, wenn es dein Ernst ist. Hab schon viel gesehen auf der Welt, auch viele Leute gefunden, die gern reich werden wollten, dass aber jemand gern arm werden will, das ist mir noch nicht vorgekommen. Wird dir schlecht schmecken mit deinen seidenen Händchen und deinem süßen Frätzchen!"
Aber die Ritterfrau hatte schon begonnen sich auszuziehen und sah dabei so ernst und so traurig aus, dass die Alte wohl merkte, dass sie keinen Scherz treibe. Sie reichte ihr also Rock und Mantel hin, half ihr sie anlegen und fragte dann: "Was willst du nun tun, mein blankes Töchterchen?"
"Betteln, Mutter!" antwortete die Ritterfrau. "Betteln? Nun, gräme dich nicht darum, das ist keine Schande. An der Himmelstür wird es auch mancher tun müssen, der es hier unten nicht gelernt
hat. - Aber das Bettellied will ich dich erst noch lehren:
Betteln und lungern,
Dursten und hungern
Immerdar, allezeit
Müssen wir Bettelleut'!
Habt ihr was, schenkt mir was,
Ach, nur ein Häppchen!
Brot in den Bettelsack,
Suppe ins Näpfchen!
Lederne Ranzen,
Röcke mit Fransen
Tragen wir Bettelleut'!
Was man erbettelt hat,
Wird verjuchheit!
Nicht wahr, ein hübsches Lied?" sagte die Alte. Damit warf sie sich die seidenen Kleider um, sprang in den Busch und war bald verschwunden.
Die Ritterfrau aber wanderte durch den Wald, und nach einiger Zeit begegnete ihr ein Bauer, der war ausgegangen, eine Magd zu suchen, denn es war um die Ernte und Leute Not. Da blieb die Ritterfrau stehen, hielt die Hand hin und sagte: "Habt ihr was, schenkt mir was, ach, nur ein Häppchen!"
Aber die anderen Verse sagte sie nicht, weil sie ihr nicht gefielen. Der Bauer sah sich die Frau an, und da er fand, dass sie trotz ihrer Lumpen schmuck und gesund war, fragte er sie, ob sie nicht bei ihm Magd werden wolle.
"Ich schenke dir zu Ostern einen Kuchen, zu Martini eine Gans und zu Weihnachten einen Taler und ein neues Kleid. Bist du damit zufrieden?" "Nein", erwiderte die Ritterfrau, "ich muss betteln gehen, der liebe Gott will es so haben."
Darüber wurde der Bauer zornig, schimpfte und schmähte und sagte höhnisch: "Der liebe Gott will es so haben? He? Du hast wohl mit ihm zu Mittag gegessen? Was? Linsen mit Bratwürsten, nicht wahr? Oder bist du vielleicht seine Muhme, dass du so genau weißt, was er will? Eine faule Haut bist du. Gut für den Knüttel, zu schlecht für den Büttel!"
Darauf ging er seiner Wege, ließ sie stehen und gab ihr nichts. Da merkte die Ritterfrau wohl, dass das Betteln schwer sei. Sie ging jedoch weiter, und nach abermals einiger Zeit kam sie an eine Stelle, wo die Straße sich teilte und zwei Steine standen.
Auf dem einen saß ein Bettler mit einer Krücke. Da sie nun müde geworden war, gedachte sie sich eine kurze Zeit auf den leeren Stein zu setzen, um auszuruhen. Kaum hatte sie jedoch dies getan, als der Bettler mit der Krücke nach ihr schlug und ihr zurief:
"Mach, dass du fortkommst, du liederliche Liese! Willst du mir mit deinen Lumpen und deinem zuckersüßen Gesicht die Kundschaft abzwicken? Die Ecke hier habe ich gepachtet. Mach flink, sonst sollst du sehen, was mein Krückholz für ein schöner Fiedelbogen ist und dein Rücken für eine närrische Geige!"
Da seufzte die Ritterfrau, stand auf und ging so weit, als sie die Füße tragen wollten. Endlich kam sie in eine große fremde Stadt. Hier blieb sie, setzte sich an den Kirchweg und bettelte; und nachts schlief sie auf den Kirchenstufen. So lebte sie tagaus, tagein, und es schenkte ihr der eine einen Pfennig und der andere einen Heller; manche aber auch gaben ihr nichts oder schimpften gar, wie es der Bauer getan hatte.
Es ging aber sehr langsam mit den hundert Goldgulden. Denn als sie drei Vierteljahre gebettelt hatte, hatte sie erst einen Gulden erspart. Und genau wie der erste Gulden voll war, gebar sie einen wunderschönen Knaben, den nannte sie "Docherlöst", weil sie hoffte, dass sie ihren Mann doch noch erlösen würde.
Sie riss sich von ihrem Mantel unten einen Streifen ab, eine gute Elle breit, so dass der Mantel nur noch bis an die Knie reichte, wickelte das Kind hinein, nahm es auf den Schoß und bettelte
weiter. Und wenn das Kind nicht schlafen wollte, wiegte sie es und sang:
"Schlaf ein auf meinem Schoße,
Du armes Bettelkind,
Dein Vater wohnt im Schlosse -
Und draußen weht der Wind.
Er geht in Samt und Seide,
Trinkt Wein, isst weißes Brot,
Und sähe er so uns beide,
So härmt er sich zu Tod.
Er braucht sich nicht zu härmen,
Du liegst ja weich und warm;
Er ist ja noch viel ärmer,
Dass Gott sich sein erbarm!"
Da blieben oft die Leute stehen und besahen sich die arme junge Bettelfrau mit dem wunderschönen Kinde und schenkten ihr mehr als früher. Sie aber war getrost und weinte nicht mehr, denn sie wusste, dass sie ihren Mann gewiss erlösen würde, wenn sie nur ausharrte.
Als aber die Frau nicht wieder zurückkehrte, ward der Ritter auf seinem Schlosse tief betrübt, denn er sagte sich: Sie hat alles gemerkt und dich deshalb verlassen. Er ging zuerst in den Wald zu dem Eremiten, um zu hören, ob sie in der Kapelle gewesen sei und dort gebetet habe.
Aber der Eremit war sehr kurz angebunden und streng gegen ihn und sagte: "Hast du nicht in Saus und Braus gelebt? Bist du nicht stolz und hart gegen die Armen gewesen? Hat dich nicht der liebe Gott zur Strafe verrosten lassen? Deine Frau hat ganz recht getan, wenn sie dich verließ. Man muss nicht einen guten und einen faulen Apfel in einen Kasten legen, sonst wird der gute auch faul!"
Da setzte sich der Ritter auf die Erde, nahm den Helm ab und weinte bitterlich.
Als der Eremit dies gewahr wurde, ward er freundlicher und sprach: "Da ich sehe, dass dein Herz noch nicht mit verrostet ist, so will ich dir raten: tue Gutes und gehe in alle Kirchen, so wirst
du deine Frau wiederfinden."
Da verließ der Ritter sein Schloss und ritt in alle Welt. Wo er Arme fand, schenkte er ihnen etwas, und wenn er eine Kirche sah, ging er hinein und betete. Aber seine Frau fand er nicht. So war fast ein Jahr vergangen, da kam er auch in die Stadt, wo seine Frau am Kirchweg saß und bettelte, und sein erster Weg war in die Kirche.
Schon von weitem erkannte ihn die Frau, denn er war groß und stattlich und trug einen goldnen Helm mit einer Geierklaue auf dem Knauf, der weithin leuchtete. Da erschrak sie, denn sie hatte erst zwei Goldgulden zusammen, so dass sie ihn noch nicht erlösen konnte.
Sie zog sich den Mantel tief über den Kopf, damit er sie nicht erkennen sollte, und kauerte sich so eng zusammen, als sie irgend konnte, damit er nicht ihre schneeweißen Füße sähe; denn der Mantel ging ihr nur bis an die Knie, seit sie den Streifen für das Kind abgerissen hatte.
Als aber der Ritter an ihr vorbei schritt, hörte er sie leise schluchzen, und als er ihren zerlumpten und geflickten Mantel sah und das wunderschöne Kind auf ihrem Schoß, welches ebenfalls nur in Lumpen gewickelt war, tat es ihm in der Seele weh. Er trat an sie heran und fragte sie, was ihr fehle.
Doch die Frau antwortete nicht und schluchzte nur noch mehr, so sehr sie sich auch Mühe gab, es zu verbeißen. Da zog der Ritter seine Geldtasche hervor, in der viel mehr waren als hundert Goldgulden, legte sie ihr auf den Schoß und sagte: "Ich gebe dir alles, was ich noch habe, und sollte ich mich nach Hause betteln."
Da fiel der Frau, ohne dass sie es wollte, der Mantel vom Kopf herunter, und der Ritter sah, dass es sein eigenes, angetrautes Eheweib war, der er das Geld geschenkt hatte. Trotz der Lumpen fiel er ihr um den Hals und küsste sie, und als er vernahm, dass das Kind sein Sohn war, herzte und küsste er es auch.
Doch die Frau nahm ihren Mann, den Ritter, an der Hand, führte ihn in die Kirche und legte das Geld auf das Kirchbecken. Dann sagte sie: "Ich wollte dich erlösen, aber du hast dich selbst erlöst."
Und so war es auch; denn als der Ritter aus der Kirche trat, war der Fluch gehoben und der Rost, der seine ganze linke Seite bedeckte, verschwunden. Er hob seine Frau mit dem Kinde auf sein Pferd, ging selbst zu Fuß daneben und zog mit ihr zurück in sein Schloss, wo er lange Jahre glücklich mit ihr lebte und so viel Gutes tat, dass ihn alle Leute lobten.
Die Bettlerlumpen aber, die seine Frau getragen hatte, hing er in einen kostbaren Schrein, und jeden Morgen, wenn er aufgestanden war, ging er an den Schrein, besah sich die Lumpen und sagte: "Das ist meine Morgenandacht, die nimmt mir der liebe Gott nicht übel, denn er weiß, wie ich es meine, und ich gehe nachher doch noch in die Kirche."
Richard von Volkmann-Leander
DIE HIMMLISCHE MUSIK ...
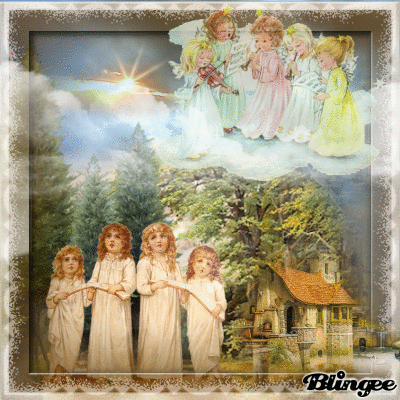
Als noch das goldene Zeitalter war, wo die Engel mit den Bauernkindern auf den Sandhaufen spielten, standen die Tore des Himmels weit offen, und der goldene Himmelsglanz fiel aus ihnen wie ein Regen auf die Erde herab.
Die Menschen sahen von der Erde in den offenen Himmel hinein; sie sahen oben die Seligen zwischen den Sternen spazieren gehen, und die Menschen grüßten hinauf, und die Seligen grüßten herunter. Das Schönste aber war die wundervolle Musik, die damals aus dem Himmel sich hören ließ.
Der liebe Gott hatte dazu die Noten selber aufgeschrieben, und tausend Engel führten sie mit Geigen, Pauken und Trompeten auf. Wenn sie zu ertönen begann, wurde es ganz still auf der Erde. Der Wind hörte auf zu rauschen, und die Wasser im Meer und in den Flüssen standen still. Die Menschen aber nickten sich zu und drückten sich heimlich die Hände. Es wurde ihnen beim Lauschen so wunderbar zumut, wie man das jetzt einem armen Menschenherzen gar nicht beschreiben kann.
So war es damals; aber es dauerte nicht lange. Denn eines Tages ließ der liebe Gott zur Strafe die Himmelstore zumachen und sagte zu den Engeln: "Hört auf mit eurer Musik; denn ich bin traurig!" Da wurden die Engel auch betrübt und setzten sich jeder mit seinem Notenblatt auf eine Wolke und zerschnitzelten die Notenblätter mit ihren kleinen goldenen Scheren in lauter einzelne Stückchen; die ließen sie auf die Erde hinunterfliegen.
Hier nahm sie der Wind, wehte sie wie Schneeflocken über Berg und Tal und zerstreute sie in alle Welt. Und die Menschenkinder haschten sich jeder ein Schnitzel, der eine ein großes und der andere ein kleines, und hoben sie sich sorgfältig auf und hielten die Schnitzel sehr wert; denn es war ja etwas von der himmlischen Musik, die so wundervoll geklungen hatte.
Aber mit der Zeit begannen sie sich zu streiten und zu entzweien, weil jeder glaubte, er hätte das Beste erwischt; und zuletzt behauptete jeder, das, was er hätte, wäre die eigentliche himmlische Musik, und das, was die anderen besäßen, wäre eitel Trug und Schein. Wer recht klug sein wollte und deren waren viele, machte noch hinten und vorn einen großen Schnörkel daran und bildete sich etwas ganz Besonderes darauf ein.
Der eine pfiff "a" und der andere sang "b"; der eine spielte in Moll und der andere in Dur; keiner konnte den anderen verstehen. Kurz, es war ein Lärm wie in einer Judenschule. So steht es noch heute.
Wenn aber der Jüngste Tag kommen wird, wo die Sterne auf die Erde fallen und die Sonne ins Meer und die Menschen sich an der Himmelspforte drängen wie die Kinder zu Weihnachten, wenn aufgemacht wird da wird der liebe Gott durch die Engel alle die Papierschnitzel von seinem himmlischen Notenbuche wieder einsammeln lassen, die großen ebenso wohl wie die kleinen, und selbst die ganz kleinen, auf denen nur eine einzige Note steht.
Die Engel werden die Stückchen wieder zusammensetzen, und dann werden die Tore aufspringen, und die himmlische Musik wird aufs neue erschallen, ebenso schön wie früher. Da werden die Menschenkinder verwundert und beschämt dastehen und lauschen und einer zum anderen sagen:
"Das hattest du! Das hatte ich! Nun aber klingt es erst wunderbar herrlich und ganz anders, nun alles wieder beisammen und am richtigen Orte ist!"
Ja, ja! So wird's. Ihr könnt euch darauf verlassen.
Richard von Volkmann-Leander
DAS GLÄSERNE KRÖNLEIN ...
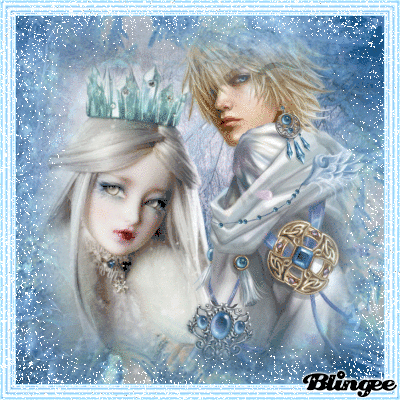
Es war einmal ein wunderschönes Königskind, das hatte ein gläsernes Krönlein. Und das war so gekommen: Als dem alten König und der alten Königin ein Prinzeßchen geboren wurde, da herrschte eitel Freude im ganzen Reich und alle Leute aus allem Land kamen herbei, um das kleine Königskind zu sehen und ihm irgend etwas in die seidene Wiege zu legen, Gold und Silber und Edelgestein und allerlei Schmuck und Geschmeide.
Und es war kein Ende all der schönen Schüsseln und Schalen und Becherlein und der Ketten, Ringe und Spangen. Und der alte König und die alte Königin gaben jedem ein Glas Wein und sagten: "Ich danke dir schön!" , und waren sehr zufrieden und glücklich und froh über die wunderschönen Sachen - und am allermeisten über ihr wunderschönes Königstöchterlein.
Als die Leute aber alle fort waren und jeder in sein Land gezogen, da kam eine seltsame fremde Fee an Prinzeßchens Kinderbett, und niemand wusste woher. Und die fremde Fee lächelte gar wunderbar und legte ein kleines gläsernes Krönlein auf den Königspurpur der Wiege und sagte dazu:
Du kleines Königstöchterlein,
das Krönlein musst du hüten fein,
und mag es mancher noch so sehr,
du gibst es nie und nimmer her,
bis dass ein feiner Knabe kommt,
der dir wohl als Herzliebster frommt.
Dann schenkst du ihm das Krönlein gleich
Und führst ihn in dein Königreich.
Und als die fremde Fee das gesagt hatte, hat sie das Königskind geküsst und ist leise, leise wieder von dannen gegangen und niemand wusste wohin. Aber im Schlosse hing noch drei Tage und drei Nächte lang ein Duft von Flieder und Rosen und durch die großen marmelsteinernen Hallen und Prunkgemächer ist's gehuscht, wie lauter verirrte Sonnenstrahlen.
Das war sehr schön und der alte König und die alte Königin und alle Leute im Schlosse merkten daran, dass ein Wunder geschehen war und dass es eine gar seltsame Bewandtnis hatte mit dem gläsernen Krönlein. Nur was das eigentlich alles war, wussten sie alle nicht, und war auch niemand, der es ihnen sagen konnte.
Das gläserne Krönlein aber wurde gar gut gehütet und bewacht und in eine güldene Kammer getan und die war mit sieben güldenen Schlössern verschlossen und mit sieben güldenen Riegeln verriegelt. Und erst als das kleine Prinzeßchen ein großes Prinzeßchen geworden war und noch viel schöner und holdseliger war, wie damals, als es in der seidenen Wiege lag, da wurden an der güldenen Kammer die sieben Schlösser aufgeschlossen und die sieben Riegel gelöst und das gläserne Krönlein hervorgeholt und dem Königskind auf das lange Lockenhaar gesetzt.
Und der alte König und die alte Königin weinten dabei, weil es doch ein so sehr feierlicher Augenblick war, und sagten dazu: "Sei nur ja recht vorsichtig, dass das gläserne Krönlein nicht zerbricht."
Die schöne Königstochter freute sich sehr und versprach auch ganz, ganz vorsichtig zu sein. Sie schaute nicht links und schaute nicht rechts, sondern immer geradeaus, damit ihr das gläserne Krönlein nur ja nicht vom langen Lockenhaar fiele.
Das Krönlein aber glänzte und funkelte noch tausendmal heller und schöner, als der hellste und schönste Demantstein. Und da das junge Königskind immer nur geradeaus ging und nicht rechts und nicht links sah, so ist das Krönlein auch gar nicht einmal irgendwo angestoßen oder gar heruntergefallen.
Nachts aber, wenn das Prinzesschen schlafen ging, dann standen zwölf weiß gekleidete Jungfrauen um das Königslager herum und hüteten das gläserne Krönlein. Das leuchtete und lohte weit aus dem Königsschloss heraus ins nächtliche Land, und das war sehr gut, denn es gab keine Laternen im Königreich und wenn nicht gerade der Mond schien, war es doch gar zu dunkel.
So waren alle sehr glücklich und zufrieden und priesen die fremde Fee und das gläserne Krönlein und nicht zum Wenigsten das wunderschöne junge Königskind.
Aber eines Tages, als das Prinzeßchen allein im Garten spazieren ging, unter all den vielen tausend Bäumen und Blumen, da hat es mit einem Male eine seltsame Wunderblume gesehen, die ganz
heimlich und unbemerkt über Nacht erblüht war.
Trotzdem sie in der Erde stand und im entferntesten Winkel des Gartens, so überstrahlte sie doch alle die anderen Blumen durch ihre zauberhafte Schönheit. Sie war gar herrlich anzusehen und hatte wunderlich geformte Blätter und eine große blaue Blüte, in deren tiefem Kelch es rot schimmerte, wie von roten Blutstropfen. Und ein Duft ging von dem Kelch aus, so seltsam süß und wunderbar weich, dass das Königskind gar nicht wusste, wie ihm geschah.
Es beugte sich tief und immer tiefer auf den Kelch der Wunderblume herab, um ihren Blütenduft zu atmen, und da wurde ihm so zu Mute, wie ihm noch nie gewesen war. Das gläserne Krönlein aber löste sich von dem Lockenhaar der Königstochter - fiel auf die Erde und zerbrach.
Da erbebte alles und das Königsschloss mit Hofstaat und Gesinde und allem, was dazu gehörte, versank, und das ganze Land mit all seinen Bewohnern war verschwunden. Der Tag ward finstere Nacht und das Prinzeßchen saß allein auf grauer Heide und vor ihm lag das zerbrochene gläserne Krönlein.
Als nun die Königstochter sah, dass das gläserne Krönlein zerbrochen war und dass alles versunken war, mit allem, was sie liebte, und sie allein und verlassen auf grauer Heide saß und noch dazu in stockfinsterer Nacht, da fing sie gottsjämmerlich an zu weinen und machte sich bittere Vorwürfe, dass sie über der seltsamen Wunderblume so ganz vergessen hatte, dass sie ein gläsernes Krönlein trug.
Da hörte sie es plötzlich neben sich ganz gedankenvoll: "Ja, ja, das hast du nun davon!" ,und wie sie hinsah, saß ein großer alter Rabe da, der war sehr schwarz und sehr weise, und schaute, die Füße einwärts und den Kopf ganz eingezogen, mit aufmerksamen Blicken auf das gläserne Krönlein.
"Ach, es ist so schrecklich, so schrecklich!" ,schluchzte das Königskind und war doch beinahe froh, dass nun etwas Lebendiges in seiner Nähe saß und es nicht mehr so mutterseelenallein war mit seinem Jammer. "Ja, es ist sehr schrecklich!" ,sagte der Rabe ruhig und klappte dabei gemütlos mit den Flügeln.
Weil nun aber das arme Prinzeßchen so gar erschrecklich weinte, so wurde der weise Rabe schließlich doch auch etwas gerührt. Er wischte sich sogar vorsichtig mit der Kralle eine Träne vom Auge, wackelte zur Königstochter hin und klopfte ihr beruhigend mit dem Flügel auf die Schulter und sagte dazu:
"Ja, es ist schrecklich, aber es ist doch nicht ganz so schrecklich, als es hätte sein können. Du hast ja die Wunderblume nicht abgebrochen, was noch viel schlimmer gewesen wäre. Und dann führen Feengeschenke nie zu einem schlechten Ende, selbst denjenigen nicht, der damit nicht umzugehen verstand!"
Die letzten Worte sagte er etwas strenger und schob dabei bedeutsam mit dem Schnabel die beiden Stücke des gläsernen Krönleins auseinander, das eine nach rechts und das andere nach links, so dass man recht deutlich sehen konnte, dass das Krönlein zerbrochen war.
"Ach, gibt es denn nichts, was das Krönlein wieder heil machen könnte?" ,fragte das Königstöchterlein. "Du weißt doch gewiss sehr viel. Kannst du mir es nicht sagen?" Der Rabe schloss geschmeichelt die Augen und schob dann die Stücke des Krönleins wieder höflich zusammen. "Ich glaube wohl" ,sagte er, "aber was da hilft, kann ich dir auch nicht sagen, du musst eben suchen."
Da stand die Königstochter auf, nahm die beiden Stücke ihres gläsernen Krönleins und steckte sie in die Tasche, seufzte sehr tief und bedankte sich beim Raben für seinen Rat und die tröstenden Worte. "Bitte, bitte, sehr gern geschehen" ,sagte der Rabe und reichte ihr die Kralle zum Abschied.
Die arme Königstochter aber ging ihrer Wege im Bettelgewand und mit ihrem zerbrochenen gläsernen Krönlein, auf dass sie jemand fände, der es ihr wieder heil mache. So kam sie in einen großen dunklen Wald, wo die Bäume so alt waren, dass sie es selbst nicht mehr wussten, und ihr Geäst war so dicht, dass sich nur selten ein Sonnenstrahl aufs grüne Moos verirrte.
Die Königstochter ging immer weiter und weiter, und als sie schon ganz weit gegangen war, da sah sie plötzlich ein kleines Männchen vor sich, es saß auf einem Baumstumpf, war gar gräulich anzusehen und hatte eine Nase so rot wie ein Karfunkelstein und spinnendürre Beinchen.
Sein Gewand aber war herrlich, von lauter flüssigem Gold und auf dem Kopf saß eine goldene Krone mit Zacken und auf jeder der Zacken war ein Edelstein und jedesmal ein anderer, so dass sie alle darin waren. Die ganze Krone war so schwer, dass man sich wundern musste, wie das Männchen sie tragen konnte mit den spinnendürren, gebrechlichen Beinchen.
Aber es trug sie doch und rauchte auch noch Pfeife dazu, eine kleine ganz zierliche goldene Pfeife, in der ein Tannenzapfen glimmte. "Guten Tag", sagte das Männchen, "was fällt dir ein, in diesen Wald zu kommen?" Dabei spuckte es ganz giftig nach rechts und nach links.
"Ich wusste nicht, dass es verboten ist" ,entschuldigte sich die Königstochter schüchtern und ängstlich. "So, so" ,sagte das Männchen, "ich bin der König der Zwerge und ich will dir meine Werkstätte zeigen - und das ist eine große Gnade!" Damit hüpfte das Männchen so schnell vom Baumstumpf herunter, dass die große Krone bedenklich wackelte, nahm die Pfeife aus dem zahnlosen Mund und stampfte dreimal mit den dünnen Füßchen auf den Boden.
Da tat sich die Erde auf und rote Glut lohte heraus und die Königstochter sah eine Treppe, die tief in die tiefste Tiefe führte. Die Stufen schienen kein Ende zu nehmen, es graute ihr, da hinab zu steigen, und sie blieb zögernd am Eingang stehen. Aber das Männchen fuhr auf sie los: "Es ist eine große Gnade" ,fauchte es ermunternd.
Da wagte die Königstochter nichts zu entgegnen und folgte dem komischen kleinen König die vielen, vielen Stufen hinab. Es war aber doch nicht so schlimm, als sie es sich gedacht hatte. Ehe sie sich versehen hatte, war sie unten und mitten drin in den Werkstätten der Zwerge.
Das waren lauter große, kunstvoll in den Felsen gehauene Säle und da stand überall Amboss an Amboss und Esse an Esse. Das war eine Glut von all dem lohenden Feuer und ein Lärm von den vielen Hämmern, die die vielen Zwerglein schwangen, dass einem Hören und Sehen verging.
In dem einen Saal wurden allerlei Waffen und Wehr geschmiedet, blanke Schwerter und glänzende Rüstungen und Schilde, und allerlei seltsame Zauberzeichen wurden darauf eingegraben zum Schutz gegen Hieb und Stich.
In einem anderen Saal wurden kostbare goldene und silberne Geräte angefertigt, Schüsseln und Schalen und Prunkpokale für die Königstafel des kleinen Männchens. Und auch für Feen war manches davon bestimmt, denn die Feen lassen sehr viel in den Werkstätten der Zwerglein arbeiten.
Die Königstochter staunte all die Pracht an und wurde doch nicht froh, denn sie dachte immer an ihr zerbrochenes gläsernes Krönlein. Das Männchen aber hüpfte ganz aufgeregt hin und her und guckte jedem Zwerglein auf die Arbeit, ob sie auch gut und wunderbar genug wäre, so wie es sich für eine Zwergenwerkstatt geziemt.
Und wenn ihm etwas nicht recht war, dann fauchte es und ärgerte sich und spuckte nach rechts und nach links und das sah sehr komisch aus. Wenn ihm aber etwas ganz besonders gefiel, dann beugte es sich ganz tief herab, rieb sich die dürren Händchen vor Vergnügen und seine Nase glühte dazu so rot, dass das lodernde Feuer der Essen gar nichts dagegen war.
Dann führte der kleine König die Prinzessin in einen dritten Saal und da war es viel stiller und auch nicht so rauchig und rußig, und man hörte nur ein ganz feines leises Hämmern, das klang wie lauter klingende Silberglöcklein. Da wurden Edelsteine gefasst zu allerlei schönen Geschmeiden und kleine Kronen wurden drin geschmiedet, die die Elfen bekommen, wenn sie artig sind und nachts im Mondschein den Ringelreihen schlingen.
Wie nun die Königstochter die zierlichen kleinen Krönlein sah, da freute sie sich sehr und dachte, die Zwerglein könnten dann doch auch ihr gläsernes Krönlein wieder zurecht hämmern. Und so holte sie das gläserne Krönlein hervor, zeigte dem Männchen die beiden stücke und sagte:
"Ach bitte, kannst du mir nicht das Krönlein wieder schmieden lassen? Es ist entzwei gegangen und das ist sehr traurig, und so lange es nicht wieder heil ist, muss ich auch immer traurig bleiben."
Das Männchen sah empört auf: "Was fällt dir ein?" ,schrie es ganz giftig, "es ist sowieso schon eine große Gnade, dass ich dich hier herunter geführt habe und gläserne Krönlein kann man überhaupt nicht wieder schmieden. Wenn sie entzwei sind, sind sie entzwei - ja!"
Da fing die arme Königstochter so bitterlich an zu weinen, dass alle die Zwerglein ihre Hämmer niederlegten und mit der Arbeit aufhörten und der kleine König ganz still wurde und ihm sogar eine große Träne langsam und schwer über die Karfunkelnase rollte.
"Ich habe eben auch Gemüt" ,sagte er, "wenn auch nicht viel, denn viel kann ich nicht brauchen, aber du tust mir wirklich leid, und ich will dir etwas sagen: " Ich will dir ein kleines güldenes Elfenkrönlein schenken, ja, das will ich. Aber es ist wirklich eine sehr große Gnade!"
Doch die Königstochter blieb so traurig wie sie war und sagte: "Ich danke dir, aber ich mag kein Elfenkrönlein und wenn es noch so schön sei. Ich will nur mein gläsernes Krönlein wieder geschmiedet haben und wenn du das nicht kannst, dann muss ich schon weiter suchen."
Da wurde das kleine Männchen böse. Es stampfte mit den spinnendürren Beinchen, dass die Krone hin und her wackelte und fuchtelte mit den Ärmchen dazu und spuckte nach rechts und nach links. "Du magst kein Elfenkrönlein?" ,schrie es wütend, "dann mach, dass du fortkommst! Es ist alles eine so große Gnade - und was fällt dir überhaupt ein?"
Da fingen die Hämmer wieder an zu schlagen, dass die Hallen dröhnten, und die Essen lohten auf, dass man vor lauter Ruß und Rauch den Feuerschein nicht mehr erkennen konnte. Die Königstochter aber befand sich auf einmal wieder draußen im tiefen Walde, auf dem grünen Moosboden, grade an dem Baumstumpf, wo sie das Männchen zuerst gesehen hatte.
Und sie raffte ihr Bettelgewand zusammen und setzte traurig ihren Weg weiter fort. Und als sie drei Tage und drei Nächte gegangen war und sich nur von wilden Beeren genährt und auf der bloßen Erde geschlafen hatte, ganz allein und einsam und ohne ein lebend Wesen zu sehen, da erblickte sie im Morgensonnenschein hoch auf höchster Höhe eine marmelsteinernen Tempel, der war ganz und gar mit den herrlichsten Lorbeerbäumen umstanden.
Und wie die Königstochter hinauf in den Lorbeerhain kam, da sah sie lauter Gestalten drin umhergehen mit bleichen, ernsten Gesichtern und mit einem Lorbeerzweig im Haar. Aber niemand sagte ein Wort und die Königstochter traute sich auch niemand anzureden und zu fragen.
An den Stufen des Tempels aber kam ihr ein Engel entgegen, der war wunderschön, aber sehr ernst und traurig, ganz so wie die vielen Gestalten im Lorbeerhain, und der Engel kam auf sie zu und sagte: "Ich bin der Engel des Ruhmes, was willst du in meinem Tempel und in meinen heiligen Hainen?" -
"Ich hab ein gläsernes Krönlein" ,sagte die Königstochter, "das ist mir zerbrochen und nun muss ich immer wandern und suchen, bis ich jemand finde, der es mir wieder heil macht."
Da nahm der Engel sie freundlich bei der Hand und führte sie in seinen Tempel hinein und da drinnen war alles von Marmelstein und an den Wänden und Säulen standen goldene Namen geschrieben und die Morgensonne schien darauf, dass sie glänzten und leuchteten - und draußen um die Mauer ging leise der Höhenwind und rauschte in den Wipfeln der Lorbeerbäume.
"Das sind alles die Namen derer, die draußen so still und ernst umhergehen" ,sagte der Engel, "es sind die Namen derer, die ihr innerstes Fühlen und Denken der Welt geschenkt haben und die von den Menschen unten mit Ehrfurcht und Dankbarkeit genannt werden.
So lange sie auf der Erde sind, geht es ihnen freilich nicht gut und sie müssen sehr viel kämpfen und leiden, und darum sind sie auch so still und ernst. Aber wenn sie die Erde verlassen haben, dann kommen sie zu mir und leben hier oben - und hier ist Ruhe und Klarheit und ewige Morgensonne.
Und wenn du magst, will ich dich auch zu einer der Meinigen machen und du wirst einen Lorbeerzweig tragen und dein Name wird in goldenen Lettern in meinem Tempel stehen."
"Das wäre sehr schön und ich danke dir sehr" ,sagte die Königstochter, "aber wird dann mein gläsernes Krönlein wieder heil werden? Wenn du das machen könntest, dann würde ich gerne bei dir bleiben." - "Nein, das kann ich nicht" ,sagte der Engel und sah sehr traurig aus. Und als er das sagte, schien es der Königstochter, als wären die goldenen Namen nicht mehr so glänzend und die Morgensonne nicht mehr so strahlend und die Lorbeerbäume matt und welk.
Die Königstochter ging aus dem Tempel hinaus und durch die heiligen Haine und ging wieder weiter und immer weiter. So ging sie sieben Tage und sieben Nächte, immer gen Norden zu, und rings um sie herum war Schnee und Eis und es war bitter kalt, so dass sie vor Frost zitterte in ihrem ärmlichen dünnen Bettelkleid.
Der Wald hörte auf, Strauchwerk und Blumen wurden immer spärlicher und schließlich war das arme Königskind zwischen lauter tief verschneiten Felsen, und inmitten der Felsen erhob sich ein wunderbares Schloss, das war das Schloss der Eiskönigin - und alle Tore und Türme und Mauern waren aus kristallklarem Eis und schimmerten im blauen Mondlicht.
Am Eingang standen zwei Männer, die trugen eine Rüstung aus Eis und hielten große Eiszapfen als Lanzen in der Hand, und wenn sie sich bewegten, dann knackten und klirrten sie vor lauter Frost. Hoch in der Königshalle aber saß die Eiskönigin auf kristallenem Throne und flocht sich silberne Mondstrahlen ins Haar und lachte dazu so seltsam, dass es klang, als ob kleine Eisstückchen zerbrechen. Draußen aber um die Schlossmauer fielen unaufhörlich weiche, weiße Schneeflocken.
Die arme Prinzessin im Bettelgewand wurde von den zwei Männern zum Throne der Eiskönigin geführt, und während die beiden Männer die langen Eiszapfen ehrerbietig vor ihrer Herrin neigten, machte die Königstochter einen tiefen Knicks und sagte:
"Kannst du mir nicht mein gläsernes Krönlein wieder heil machen? Es ist zerbrochen und das ist sehr traurig und ich muss immer wandern und suchen, bis ich jemand finde, der es mir wieder zusammenschmiedet." -
"Nein, das kann ich nicht" ,sagte die Eiskönigin und lächelte dabei ganz seltsam, "aber du kannst hier bei mir in meinem Schlosse bleiben und ich will dir ein Herz aus Eis geben, das tust du in deine Brust und dann vergisst du alles und fühlst nichts mehr und denkst auch nicht mehr an dein zerbrochenes Krönlein. Das ist sehr hübsch, du sitzt dann neben mir, wir flechten aus Mondenstrahlen ins Haar - und draußen fallen lauter weiße, weiche Schneeflocken."
Die Königstochter schüttelte traurig den Kopf und sagte: "Ich danke dir schön, aber ich mag kein Herz aus Eis, und wenn du mein gläsernes Krönlein nicht heil machen kannst, dann kann ich nicht bleiben und muss schon wieder weitersuchen." - "Ja, dann musst du schon wieder zurück auf die Erde. Viel Glück auf den Weg!" ,sagte die Eiskönigin und lachte kalt und höhnisch dazu, dass es klang, als ob kleine klare Eisstücke zerbrechen.
Das arme Königskind ging wieder zurück auf die Erde und wanderte immer weiter und weiter und diente hier und dort als Magd, um sich sein tägliches Brot zu verdienen. Überall war das schöne Mädchen gern gesehen, und man ließ es nur schweren Herzens wieder ziehen, doch es blieb nirgends und hatte keine Ruhe bei Tag und bei Nacht.
Von ihrem zerbrochenen Krönlein aber sagte sie niemand mehr etwas, denn es konnte ihr ja doch keiner helfen, dachte sie. Und wie sie so im Lande umherzog, da kam sie einmal vor ein wunderschönes Schloss, und da fragte sie, wem das Schloss gehöre. "Das Schloss gehört dem alten König, der so gerne süße Suppe isst" ,bekam sie zur Antwort.
"Könnt ihr mich nicht als Magd gebrauchen?" ,fragte sie weiter. Da wurde der Koch geholt und der Koch holte den Oberkoch und der Oberkoch holte den Küchenminister und der sagte: "Ja!" So wurde die arme Prinzessin mit dem zerbrochenen gläsernen Krönlein eine Küchenmagd im Schlosse des alten Königs, der so gerne süße Suppe aß. Sie war fleißig und bescheiden und alle hatten sie gerne.
Da geschah es, dass der junge Prinz, der der Sohn des alten Königs war, von einer langen, langen Reise zurückkehrte. Er war wohl durch hundert Länder gefahren, um sich eine Frau zu suchen; das hatte der alte König so gewollt, denn er hatte genug vom Regieren und wollte sich zurückziehen und nur noch süße Suppe essen.
Der junge Prinz aber hatte keine Prinzessin gefunden, die ihm gefiel und die er hätte von Herzen lieb haben können - und so kam er sehr traurig wieder zurück in seines Vaters Schloss. Der alte König und die alte Königin waren auch sehr traurig und das ganze Land natürlich auch.
Als der Prinz aber einzog, erblickte er plötzlich die neue Küchenmagd und es war ihm, als habe er nie etwas so Schönes und Liebreizendes gesehen und als habe er noch niemand so lieb gehabt. Da stieg er vom Pferde, ging auf sie zu, fasste sie bei der Hand und fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle.
Die Königstochter nickte und lächelte und war so glücklich, dass sie alles um sich herum vergaß und nur immer den Prinzen ansah, denn es war ihr, als habe sie noch nie etwas so Schönes und Ritterliches gesehen und als habe sie noch niemand so lieb gehabt. Und der Königssohn reichte seiner Braut den Arm und führte sie zum alten König und sagte:
"Lasst mich die freien, ich will keine andere." Der alte König aber sagte: "Eine Magd kann nicht Königin sein, das geht nicht." Da wurde der Prinz sehr traurig, die Prinzessin aber tröstete ihn und sagte, dass sie eine ganz richtige Königstochter wäre und keine Küchenmagd.
"So, so" ,sagte der alte König, "dann geht es." Und er umarmte erst die Prinzessin und dann den Prinzen und nachdem alle beide zusammen.
Und es wurde ein großes Fest angesagt und morgen sollte die Hochzeit sein. Als aber dann am anderen Tage die Prinzessin, mit dem kostbarsten Hochzeitskleid und dem schönsten Geschmeide angetan, im Königssaal stand unter all den vielen, vielen Ministern und Hofdamen und Trabanten, da sagte der Prinz zu ihr: "Nun setze dein Krönlein auf, damit wir einander angetraut werden."
Da fiel der armen Prinzessin mit einem Male ihr zerbrochenes gläsernes Krönlein ein, das sie über all ihrer Liebe zum Königssohn ganz und gar vergessen hatte - und sie fing bitterlich an zu weinen und unter heißen Tränen holte sie die beiden Stücke des Krönleins und zeigte sie dem Prinzen und dachte, dass nun alles, alles aus und vorbei wäre.
Der ganze Hof geriet in die größte Bestürzung, die Minister schüttelten missbilligend die weisen Häupter, die Hofdamen rümpften die Nase und die Trabanten standen nicht mehr stramm und kerzengerade wie früher. Der junge Königssohn aber sagte gar nichts, sondern neigte sich zur armen weinenden Prinzessin nieder und küsste sie auf den Mund.
Und in demselben Augenblick tat sich das zerbrochene gläserne Krönlein wieder zusammen, so fest, als ob es nie zerbrochen gewesen wäre. Und während alle über das Wunder staunten, setzte der Prinz der Prinzessin das Krönlein ins Haar und das funkelte und glänzte schöner und heller, als der schönste und hellste Demantstein, so dass sogar die Krone des alten Königs gar nichts dagegen war, trotzdem er sie noch kurz vorher sehr sorgfältig geputzt hatte.
Da war ein großer Jubel im Schloss und im ganzen Lande und es wurde eine herrliche Hochzeit gefeiert und gegessen und getrunken und der alte König aß dreimal so viel süße Suppe wie sonst und freute sich furchtbar. Wie sie aber beim Hochzeitsmahl saßen, da kam eine goldene Karosse vorgefahren und heraus stiegen die Eltern der Prinzessin, die nun erlöst waren mitsamt dem ganzen versunkenen Königreich.
Da kannte die Freude keine Grenzen mehr und alle umarmten sich so lange, bis sie müde wurden: die Könige und die Königinnen, der Prinz und die Prinzessin, und die Minister, die Hofdamen und die Trabanten. Und als sie sich genug umarmt hatten, da sagte der alte König, der so gerne süße Suppe aß, zu dem anderen alten König:
"Jetzt wollen wir unsere beiden Reiche zusammentun und das Regieren den jungen Leuten überlassen. Wir aber wollen uns zurückziehen und nur noch süße Suppe essen."
So geschah es und alle waren damit zufrieden. Der junge König aber und die junge Königin regierten zusammen und es war ein gar glückliches Königreich unter dem gläsernen Krönlein.
Manfred Kyber
DER WUNSCHRING ...
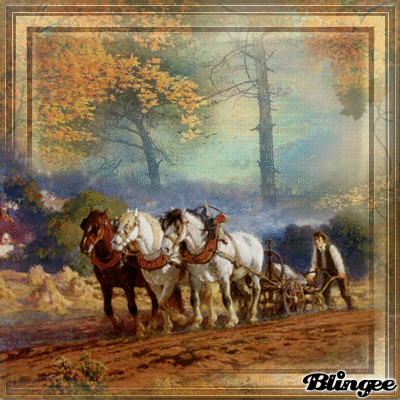
Ein junger Bauer, mit dem es in der Wirtschaft nicht recht vorwärts gehen wollte, saß auf seinem Pfluge und ruhte einen Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesichte zu wischen. Da kam eine alte Hexe vorbei geschlichen und rief ihm zu: "Was plagst du dich und bringst es doch zu nichts? Geh zwei Tage lang geradeaus, bis du an eine große Tanne kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume überragt. Wenn du sie umschlägst, ist dein Glück gemacht."
Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm sein Beil und machte sich auf den Weg. Nach zwei Tagen fand er die Tanne. Er ging sofort daran, sie zu fällen, und in dem Augenblicke, wo sie umstürzte und mit Gewalt auf den Boden schlug, fiel aus ihrem höchsten Wipfel ein Nest mit zwei Eiern heraus. Die Eier rollten auf den Boden und zerbrachen, und wie sie zerbrachen, kam aus dem einen Ei ein junger Adler heraus, und aus dem anderen fiel ein kleiner goldener Ring.
Der Adler wuchs zusehends, bis er wohl halbe Mannes Höhe hatte, schüttelte seine Flügel, als wollte er sie probieren, erhob sich etwas über die Erde und rief dann:
"Du hast mich erlöst! Nimm zum Dank den Ring, der in dem anderen Ei gewesen ist! Es ist ein Wunschring. Wenn du ihn am Finger umdrehst und dabei einen Wunsch aussprichst, wird er alsbald in Erfüllung gehen. Aber es ist nur ein einziger Wunsch im Ring. Ist der getan, so hat der Ring alle weitere Kraft verloren und ist nur wie ein gewöhnlicher Ring. Darum überlege dir wohl, was du dir wünschst, auf daß es dich nicht nachher gereue."
Darauf hob sich der Adler hoch in die Luft, schwebte lange noch in großen Kreisen über dem Haupte des Bauern und schoß dan wie ein Pfeil nach Morgen.
Der Bauer nahm den Ring, steckte ihn an den Finger und begab sich auf den Heimweg. Als es Abend war, langte er in einer Stadt an; da stand der Goldschmied im Laden und hatte viele köstliche Ringe feil. Da zeigte ihm der Bauer seinen Ring und fragte ihn, was er wohl wert wäre. "Einen Pappenstiel!" versetzte der Goldschmied.
Da lachte der Bauer laut auf und erzählte ihm, daß es ein Wunschring sei und mehr wert als alle Ringe zusammen, die jener feil hielte. Doch der Goldschmied war ein falscher, ränkevoller Mann. Er lud den Bauer ein, über Nacht bei ihm zu bleiben, und sagte:
"Einen Mann, wie dich, mit solchem Kleinode zu beherbergen, bringt Glück; bleibe bei mir!" Er bewirtete ihn aufs schönste mit Wein und glatten Worten, und als er nachts schlief, zog er ihm unbemerkt den Ring vom Finger und steckte ihm statt dessen einen ganz gleichen, gewöhnlichen Ring an.
Am nächsten Morgen konnte es der Goldschmied kaum erwarten, daß der Bauer aufbräche. Er weckte ihn schon in der frühesten Morgenstunde und sprach: "Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Es ist besser, wenn du dich früh aufmachst."
Sobald der Bauer fort war, ging er eiligst in seine Stube, schloß die Läden, damit niemand etwas sähe, riegelte dann auch noch die Tür hinter sich zu, stellte sich mitten in die Stube, drehte den Ring um und rief: "Ich will gleich hunderttausend Taler haben."
Kaum hatte er dies gesprochen, so fing es an, Taler zu regnen, harte, blanke Taler, als wenn es mit Mulden gösse, und die Taler schlugen ihm auf den Kopf, Schultern und Arme. Er fing an, kläglich zu schreien, und wollte zur Türe springen, doch ehe er sie erreichen und aufriegeln konnte, stürzte er, am ganzen Leibe blutend, zu Boden.
Aber das Taler regnen nahm kein Ende, und bald brach von der Lat die Diele zusammen, und der Goldschmied mitsamt dem Gelde stürzte in den tiefen Keller. Darauf regnete es immer weiter, bis die hunderttausend voll waren, und zuletzt lag der Goldschmied tot im Keller und auf ihm das viele Geld.
Von dem Lärm kamen die Nachbarn herbei geeilt, und als sie den Goldschmied tot unter dem Gelde liegen fanden, sprachen sie: "Es ist doch ein großes Unglück, wenn der Segen so knüppeldick kommt." Darauf kamen auch die Erben und teilten.
Unterdessen ging der Bauer vergnügt nach Hause und zeigte seiner Frau den Ring. "Nun kann es uns an gar nichts fehlen, liebe Frau", sagte er. "Unser Glück ist gemacht. Wir wollen uns nur recht überlegen, was wir uns wünschen wollen."
Doch die Frau wußte gleich guten Rat. "Was meinst du", sagte sie, "wenn wir uns noch etwas Acker wünschten? Wir haben gar so wenig. Da reicht so ein Zwickel gerade zwischen unsere Äcker hinein; den wollen wir uns wünschen."
"Das wäre der Mühe wert", erwiderte der Mann. "Wenn wir ein Jahr lang tüchtig arbeiten und etwas Glück haben, könnten wir ihn uns vielleicht kaufen." Darauf arbeiteten Mann und Frau ein Jahr lang mit aller Anstrengung, und bei der Ernte hatte es noch nie so geschüttet wie dieses Mal, so daß sie den Zwickel kaufen konnten und noch ein Stück Geld übrigblieb.
"Siehst du!" sagte der Mann, "wir haben den Zwickel, und der Wunsch ist immer noch frei." Da meinte die Frau, es wäre wohl gut, wenn sie sich noch eine Kuh wünschten und ein Pferd dazu. "Frau", entgegnete abermals der Mann, indem er mit dem übrig gebliebenen Gelde in der Hosentasche klapperte, "was wollen wir wegen solch einer Lumperei unsern Wunsch vergeben. Die Kuh und das Pferd kriegen wir auch so."
Und richtig, nach abermals einem Jahr waren die Kuh und das Pferd reichlich verdient. Da rieb sich der Mann vergnügt die Hände und sagte: "Wieder ein Jahr den Wunsch gespart und doch alles bekommen, was man sich wünschte. Was wir für ein Glück haben!" Doch die Frau redete ihrem Manne ernsthaft zu, endlich einmal an den Wunsch zu gehen.
"Ich kenne dich gar nicht wieder", versetzte sie ärgerlich. "Früher hast du immer geklagt und gebarmt und dir alles mögliche gewünscht, und jetzt, wo du es haben kannst, wie du es willst, plagst und schindest du dich, bist mit allem zufrieden und läßt die schönsten Jahre vergehen. König, Kaiser, Graf, ein großer, dicker Bauer könntest du sein, alle Truhen voll Geld haben - und kannst dich nicht entschließen, was du wählen willst."
"Laß doch dein ewiges Drängen und Treiben", erwiderte der Bauer. "Wir sind beide noch jung, und das Leben ist lang. Ein Wunsch ist nur in dem Ringe, und der ist bald vertan. Wer weiß, was uns noch einmal zustößt, wo wir den Ring brauchen. Fehlt es uns denn an etwas? Sind wir nicht, seit wir den Ring haben, schon so herauf gekommen, daß sich alle Welt wundert? Also sei verständig. Du kannst dir ja mittlerweile immer überlegen, was wir uns wünschen könnten."
Damit hatte die Sache vorläufig ein Ende. Und es war wirklich so, als wenn mit dem Ringe der volle Segen ins Haus gekommen wäre, denn Scheuern und Kammern wurden von Jahr zu Jahr voller und voller, und nach einer längeren Reihe von Jahren war aus dem kleinen, armen Bauer ein großer, dicker Bauer geworden, der den Tag über mit den Knechten schaffte und arbeitete, als wollte er die ganze Welt verdienen, nach dem Vesper aber behäbig und zufrieden vor der Haustüre saß und sich von den Leuten guten Abend wünschen ließ.
So verging Jahr um Jahr. Dann und wann, wenn sie ganz allein waren und niemand es hörte, erinnerte zwar die Frau ihren Mann immer noch an den Ring und machte ihm allerhand Vorschläge. Da er aber jedesmal erwiderte, es habe noch vollauf Zeit, und das Beste falle einem stets zuletzt ein, so tat sie es immer seltener, und zuletzt kam es kaum noch vor, daß auch nur von dem Ring gesprochen wurde. Zwar der Bauer selbst drehte den Ring täglich wohl zwanzigmal am Finger um und besah ihn sich, aber er hütete sich, einen Wunsch dabei auszusprechen.
Und dreißig und vierzig Jahre vergingen, und der Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden, der Wunsch aber war immer noch nicht getan. Da erwies ihnen Gott eine Gnade und ließ sie beide in einer Nacht selig sterben.
Kinder und Kindeskinder standen um ihre beiden Särge und weinten, und als eines von ihnen den Ring abziehen und aufheben wollte, sagte der älteste Sohn:
"Laß den Vater seinen Ring mit ins Grab nehmen. Er hat sein Lebtag seine Heimlichkeit mit ihm gehabt. Es ist wohl ein liebes Andenken. Und die Mutter besah sich den Ring auch so oft; am Ende hat sie ihn dem Vater in ihren jungen Tagen geschenkt."
So wurde denn der alte Bauer mit dem Ringe begraben, der ein Wunschring sein sollte und keiner war, und doch so viel Glück ins Haus gebracht hatte, als ein Mensch sich nur wünschen kann. Denn es ist eine eigene Sache mit dem, was richtig und was falsch ist; und schlecht Ding in guter Hand ist immer noch viel mehr wert als gut Ding in schlechter.
Richard von Volkmann-Leander
DER KLEINE VOGEL ...
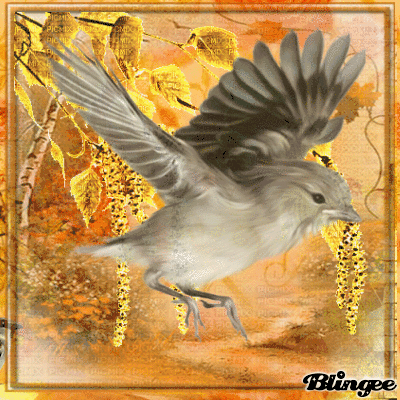
Ein Mann und eine Frau wohnten in einem hübschen kleinen Hause, und es fehlte ihnen nichts zu ihrer vollen Glückseligkeit. Hinter dem Hause war ein Garten mit schönen alten Bäumen, in dem die Frau die seltensten Pflanzen und Blumen zog.
Eines Tages ging der Mann im Garten spazieren, freute sich über die herrlichen Gerüche, welche die Blumen ausströmten, und dachte bei sich selbst: "Was du doch für ein glücklicher Mensch bist und für eine gute, hübsche, geschickte Frau hast!" Wie er das so bei sich dachte, da bewegte sich etwas zu seinen Füßen.
Der Mann, der sehr kurzsichtig war, bückte sich und entdeckte einen kleinen Vogel, der wahrscheinlich aus dem Neste gefallen war und noch nicht fliegen konnte.
Er hob ihn auf, besah ihn sich und trug ihn zu seiner Frau. "Herzensfrau", rief er ihr zu, "ich habe einen kleinen Vogel gefangen; ich glaube, es wird eine Nachtigall!" "Lieber gar!" antwortete die Frau, ohne den Vogel auch nur anzusehen; "wie soll eine junge Nachtigall in unseren Garten kommen? Es nisten ja keine alten drin."
"Du kannst dich darauf verlassen, es ist eine Nachtigall! Übrigens habe ich schon einmal eine in unserem Garten schlagen hören. Das wird herrlich, wenn sie groß wird und zu singen beginnt! Ich höre die Nachtigallen so gern!" "Es ist doch keine!" wiederholte die Frau, indem sie immer noch nicht aufsah; denn sie war gerade mit ihrem Strickstrumpfe beschäftigt, und es war ihr eine Masche heruntergefallen.
"Doch, doch!" sagte der Mann, "ich sehe es jetzt ganz genau!" und hielt sich den Vogel dicht an die Nase. Da trat die Frau heran, lachte laut und rief: "Männchen, es ist ja bloß ein Spatz!"
"Frau", entgegnete hierauf der Mann und wurde schon etwas heftig, "wie kannst du denken, dass ich eine Nachtigall gerade mit dem Allergemeinsten verwechseln werde, was es gibt! Du verstehst gar nichts von Naturgeschichte, und ich habe als Knabe eine Schmetterlings- und eine Käfersammlung gehabt."
"Aber, Mann, ich bitte dich, hat denn wohl eine Nachtigall einen so breiten Schnabel und einen so dicken Kopf?" "Jawohl, das hat sie; und es ist eine Nachtigall!" "Ich sage dir aber, es ist keine; höre doch, wie er piepst!" "Kleine Nachtigallen piepsen auch." Und so ging es fort, bis sie sich ganz ernstlich zankten. Zuletzt ging der Mann ärgerlich aus der Stube und holte einen kleinen Käfig.
"Dass du mir das eklige Tier nicht in die Stube setzt!" rief ihm die Frau entgegen, als er noch in der Türe stand. "Ich will es nicht haben!" "Ich werde doch sehen, ob ich noch Herr im Hause bin!" antwortete der Mann, tat den Vogel in den Käfig, ließ Ameiseneier holen und fütterte ihn - und der kleine Vogel ließ sich's gut schmecken. Beim Abendessen aber saßen der Mann und die Frau jeder an einer Tischecke und sprachen kein Wort miteinander.
Am nächsten Morgen trat die Frau schon ganz früh an das Bett ihres Mannes und sagte ernsthaft: "Lieber Mann, du bist gestern recht unvernünftig und gegen mich sehr unfreundlich gewesen. Ich habe mir eben den kleinen Vogel noch einmal besehen. Es ist ganz sicher ein junger Spatz; erlaube, dass ich ihn fortlasse." "Dass du mir die Nachtigall nicht anrührst!" rief der Mann wütend und würdigte seine Frau keines Blickes.
So vergingen vierzehn Tage. Aus dem kleinen Häuschen schienen Glück und Friede auf immer gewichen zu sein. Der Mann brummte, und wenn die Frau nicht brummte, weinte sie. Nur der kleine Vogel wurde bei seinen Ameiseneiern immer größer, und seine Federn wuchsen zusehends, als wenn er bald flügge werden wollte.
Er hüpfte im Käfig umher, setzte sich in den Sand auf dem Boden des Käfigs, zog den Kopf ein und plusterte die Federn auf, indem er sich schüttelte, und piepste und piepste - wie ein richtiger junger Spatz. Und jedes Mal, wenn er piepste, fuhr es der Frau wie ein Dolchstich durchs Herz. -
Eines Tages war der Mann ausgegangen, und die Frau saß weinend allein im Zimmer und dachte darüber nach, wie glücklich sie doch mit ihrem Manne gelebt habe; wie vergnügt sie von früh bis zum Abend gewesen seien und wie ihr Mann sie geliebt - und wie nun alles, alles aus sei, seit der verwünschte Vogel ins Haus gekommen.
Plötzlich sprang sie auf, wie jemand, der einen raschen Entschluss fasst, nahm den Vogel aus dem Käfig und ließ ihn zum Fenster in den Garten hinaushüpfen. Gleich darauf kam der Mann. "Lieber Mann", sagte die Frau, indem sie nicht wagte, ihn anzusehen, "es ist ein Unglück passiert; den kleinen Vogel hat die Katze gefressen."
"Die Katze gefressen?" wiederholte der Mann, indem er starr vor Entsetzen wurde; "die Katze gefressen? Du lügst! Du hast die Nachtigall absichtlich fort gelassen! Das hätte ich dir nie zugetraut. Du bist eine schlechte Frau. Nun ist es für ewig mit unserer Freundschaft aus!" Dabei wurde er ganz blass, und es traten ihm die Tränen in die Augen.
Wie dies die Frau sah, wurde sie auf einmal inne, dass sie doch ein recht großes Unrecht getan habe, den Vogel fortzulassen, und laut weinend eilte sie in den Garten, um zu sehen, ob sie ihn vielleicht dort noch fände und haschen könnte. Und richtig, mitten auf dem Wege hüpfte und flatterte das Vögelchen; denn es konnte immer noch nicht ordentlich fliegen.
Da stürzte die Frau auf das selbe zu, um es zu fangen, aber das Vögelchen huschte ins Beet und vom Beet in einen Busch und von diesem wieder unter einen anderen, und die Frau stürzte in ihrer Herzensangst hinter ihm her. Sie zertrat die Beete und Blumen, ohne im geringsten darauf zu achten, und jagte sich wohl eine halbe Stunde lang mit dem Vogel im Garten herum.
Endlich erhaschte sie ihn, und purpurrot im Gesicht und mit ganz verwildertem Haar kam sie in die Stube zurück. Ihre Augen funkelten vor Freude, und ihr
Herz klopfte heftig. "Goldner Mann", sagte sie, "ich habe die Nachtigall wieder gefangen. Sei nicht mehr böse; es war recht hässlich von mir!"
Da sah der Mann seine Frau zum ersten Male wieder freundlich an, und wie er sie ansah, meinte er, dass sie noch nie so hübsch gewesen wäre wie in diesem Augenblicke. Er nahm ihr den kleinen Vogel aus der Hand, hielt ihn sich wieder dicht vor die Nase, besah ihn sich von allen Seiten, schüttelte den Kopf und sagte dann: "Kindchen, du hattest doch recht! Jetzt sehe ich's erst; es ist wirklich nur ein Spatz. Es ist doch merkwürdig, wie sehr man sich täuschen kann."
"Männchen", erwiderte die Frau, "du sagst mir das bloß zuliebe. Heute sieht mir der Vogel wirklich selbst ganz wie eine Nachtigall aus." "Nein, nein!" fiel ihr der Mann ins Wort, indem er den Vogel noch einmal besah und laut lachte, "es ist ein ganz gewöhnlicher - Gelbschnabel." Dann gab er seiner Frau einen herzhaften Kuss und fuhr fort: "Trage ihn wieder in den Garten und lass den dummen Spatz, der uns vierzehn Tage lang so unglücklich gemacht hat, fliegen."
"Nein", entgegnete die Frau, "das wäre grausam! Er ist noch nicht recht flügge, und die Katze könnte ihn wirklich kriegen. Wir wollen ihn noch einige Tage füttern, bis ihm die Federn noch mehr gewachsen sind, und dann - dann wollen wir ihn fliegen lassen!" -
Die Moral von der Geschichte aber ist: wenn jemand einen Spatz gefangen hat und denkt, es sei eine Nachtigall - sag es ihm beileibe nicht; denn er nimmt es sonst übel, und später wird er es gewiss von selbst merken.
Richard von Volkmann-Leander
DIE DREI SCHWESTERN MIT DEN GLÄSERNEN HERZEN ...
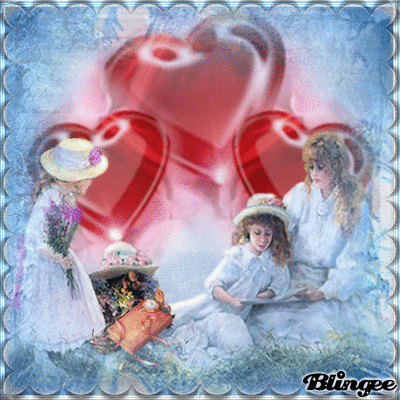
Es gibt Menschen mit gläsernen Herzen. Wenn man leise daran rührt, klingen sie so fein wie silberne Glocken. Stößt man jedoch derb daran, so gehen sie entzwei.
Da war nun auch ein Königspaar, das besaß drei Töchter, und alle drei hatten gläserne Herzen. "Kinder", sagte die Königin, "nehmt euch mit euren Herzen in acht, sie sind eine zerbrechliche Ware!"
Und sie taten es auch.
Eins Tages jedoch lehnte sich die älteste Schwester zum Fenster hinaus über die Brüstung und sah hinab in den Garten, wie die Bienen und Schmetterlinge um die Levkojen flogen. Dabei drückte sie sich ihr Herz: kling! ging es, wie wenn etwas zerspringt, und sie fiel hin und war tot.
Wieder nach einiger Zeit trank die zweite Tochter eine Tasse zu heißen Kaffee. Da gab es abermals einen Klang, wie wenn ein Glas springt, nur etwas feiner wie das erste Mal, und auch sie fiel um. Da hob sie ihre Mutter auf und besah sie, merkte aber bald zu ihrer Freude, dass sie nicht tot war, sondern dass ihr Herz nur einen Sprung bekommen hatte, jedoch noch hielt.
"Was sollen wir nun mit unserer Tochter anfangen?" ratschlagten der König und die Königin. "Sie hat einen Sprung im Herzen, und wenn er auch nur fein ist, so wird es doch leicht ganz
entzweigehen. Wir müssen sie sehr in acht nehmen."
Aber die Prinzessin sagte: "Lasst mich nur! Manchmal hält das, was einen Sprung bekommen hat, nachher gerade noch recht lange!"
Indessen war die jüngste Königstochter auch groß geworden und so schön, gut und verständig, dass von allen Seiten Königssöhne herbei strömten und um sie freiten. Doch der alte König war durch Schaden klug geworden und sagte: "Ich habe nur noch eine ganze Tochter, und auch die hat ein gläsernes Herz. Soll ich sie jemandem geben, so muss es ein König sein, der zugleich Glaser ist und mit so zerbrechlicher Ware umzugehen versteht."
Allein es war unter den vielen Freiern nicht einer, der sich gleichzeitig auf die Glaserei gelegt hätte, und so mussten sie alle wieder abziehen. Da war nun unter den Edelknaben im Schloss des Königs einer, der war beinahe fertig. Wenn er noch dreimal der jüngsten Königstochter die Schleppe getragen hatte, so war er Edelmann. Dann gratulierte ihm der König und sagte ihm: "Du bist nun fertig und Edelmann. Ich danke dir. Du kannst gehen."
Als er nun das erste Mal der Prinzessin die Schleppe trug, sah er, dass sie einen ganz königlichen Gang hatte. Als er sie ihr das zweite Mal trug, sagte die Prinzessin: "Las einmal einen Augenblick die Schleppe los, gib mir deine Hand und führe mich die Treppe hinauf, aber fein zierlich, wie es sich für einen Edelknaben, der eine Königstochter führt, schickt."
Als er dies tat, sah er, dass sie auch eine ganz königliche Hand hatte. Sie aber merkte auch etwas; was es aber war, will ich erst nachher sagen. Endlich, als er ihr das dritte Mal die Schleppe trug, drehte sich die Königstochter um und sagte zu ihm: "Wie reizend du mir meine Schleppe trägst! So reizend hat sie mir noch keiner getragen."
Da merkte der Edelknabe, dass sie auch eine ganz königliche Sprache führte. Damit war er nun aber fertig und Edelmann. Der König dankte und gratulierte ihm und sagte, er könne nun gehen. Als er ging, stand die Königstochter an der Gartentüre und sprach zu ihm: "Du hast mir so reizend die Schleppe getragen wie kein anderer. Wenn du doch Glaser und König wärst!"
Darauf antwortete er, er wolle sich alle Mühe geben, es zu werden; sie möge nur auf ihn warten, er käme gewiss wieder.
Er ging also zu einem Glaser und fragte ihn, ob er nicht einen Glaserjungen gebrauchen könne. "Jawohl", erwiderte dieser, "aber du musst vier Jahre bei mir lernen. Im ersten Jahr lernst du die Semmeln vom Bäcker holen und die Kinder waschen, kämmen und anziehen. Im zweiten lernst du die Ritzen mit Kitt verschmieren, im dritten Glas schneiden und einsetzen, und im vierten wirst du Meister."
Darauf fragte er den Glaser, ob er nicht von hinten anfangen könne, weil es dann doch schneller ging. Indes der Glaser bedeutete ihm, dass ein ordentlicher Glaser immer von vorn anfangen müsse,
sonst würde nichts Gescheites daraus.
Damit gab er sich zufrieden.
Im ersten Jahre holte er also die Semmeln vom Bäcker, wusch und kämmte die Kinder und zog sie an. Im zweiten verschmierte er die Ritzen mit Kitt, im dritten lernte er Glas schneiden und einsetzen, und im vierten Jahre wurde er Meister. Darauf zog er sich wieder seine Edelmannskleider an, nahm Abschied von seinem Lehrherrn und überlegte sich, wie er es anfinge, um nun auch noch König zu werden.
Während er so auf der Straße, ganz in Gedanken versunken, einherging und aufs Pflaster sah, trat ein Mann an ihn heran und fragte, ob er etwas verloren habe, dass er immer so auf die Erde sähe. Da erwiderte er: verloren habe er zwar nichts, aber suchen täte er doch etwas, nämlich ein Königreich; und fragte ihn, ob er nicht wisse, was er zu beginnen habe, um König zu werden.
"Wenn du ein Glaser wärst", sagte der Mann, "wüsste ich schon Rat." "Ich bin ja gerade ein Glaser!" antwortete er, "und eben fertig geworden!" Als er dies gesagt, erzählte ihm der Mann die Geschichte von den drei Schwestern mit den gläsernen Herzen, und wie der alte König durchaus seine Tochter nur einem Glaser vermählen wolle.
"Anfangs", so sprach er, "war noch die Bedingung, dass der Glaser, der sie bekäme, auch noch ein König oder ein Königssohn sein müsse; weil sich aber keiner finden will, der alles beides ist, Glaser und König zugleich, so hat er etwas nachgegeben, wie es der Klügste immer tun muss, und zwei andere Bedingungen gestellt. Glaser muss er freilich immer noch sein, dabei bleibt es!"
"Welches sind denn die beiden Bedingungen?" fragte der junge Edelmann.
"Er muss der Prinzessin gefallen und Samtpatschen haben. Kommt nun ein Glaser, welcher der Prinzessin gefällt und auch Samtpatschen hat, so will ihm der König seine Tochter geben und ihn später,
wenn er tot ist, zum König machen.
Es sind nun auch schon eine Menge Glaser auf dem Schloss gewesen, aber der Prinzessin wollte keiner gefallen. Außerdem hatten sie auch alle keine Samtpatschen, sondern grobe Hände, wie das von gewöhnlichen Glasern nicht anders zu erwarten ist."
Als dies der junge Edelmann vernommen, ging er in das Schloss, entdeckte sich dem König, erinnerte ihn daran, wie er bei ihm Edelknabe gewesen sei, und erzählte ihm, dass er seiner Tochter zuliebe Glaser geworden und sie nun gar gern heiraten und nach seinem Tode König werden wolle.
Da ließ der König die Prinzessin rufen und fragte sie, ob der junge Edelmann ihr gefiele, und als sie dies bejahte, weil sie ihn gleich erkannte, sagte er dann weiter, er solle nun auch seine Handschuhe ausziehen und zeigen, ob er auch Samtpatschen habe.
Aber die Prinzessin meinte, dies sei unnötig, sie wisse es ganz genau, dass er wirklich Samtpatschen habe. Sie hätte es schon damals gemerkt, als er sie die Treppe hinaufgeführt hätte. So waren denn beide Bedingungen erfüllt, und da die Prinzessin einen Glaser zum Mann bekam und noch dazu einen mit Samtpatschen, so nahm er ihr Herz sehr in acht, und es hielt bis an ihr seliges Ende.
Die zweite Schwester aber, welche schon den Sprung hatte, wurde die Tante, und zwar die allerbeste Tante der Welt. Dies versicherten nicht bloß die Kinder, welche der junge Edelmann und die Prinzessin zusammen bekamen, sondern auch alle anderen Leute.
Die kleinen Prinzessinnen lehrte sie lesen, beten und Puppenkleider machen; den Prinzen aber besah sie die Zensuren. Wer eine gute Zensur hatte, wurde sehr gelobt und bekam etwas geschenkt; hatte aber einmal einer eine schlechte Zensur, dann gab sie ihm einen Katzenkopf und sprach: "Sage einmal, sauberer Prinz, was du dir eigentlich vorstellst? Was willst du später einmal werden? Heraus mit der Sprache! Nun, wird's bald?"
Und wenn er dann stotterte und sagte: "Kö-Kö-Kö-König!" lachte sie und fragte: "König! Wohl König Midas? König Midas Hochgeboren mit zwei langen Eselsohren!" Dann schämte sich der, welcher die schlechte Zensur bekommen hatte, gewaltig.
Und auch diese zweite Prinzessin wurde steinalt, obwohl ihr Herz einen Sprung hatte. Wenn sich jemand darüber wunderte, sagte sie regelmäßig: "Was in der Jugend einen Sprung kriegt und geht nicht gleich entzwei, das hält nachher oft gerade noch recht lange."
Und das ist auch wahr. Denn meine Mutter hat auch so ein altes Sahnetöpfchen, weiß, mit kleinen bunten Blumensträußchen besät, das hat einen Sprung, solange ich denken kann, und hält immer noch; und seit es meine Mutter hat, sind schon so viele neue Sahnetöpfchen gekauft und immer wieder zerbrochen worden, dass man sie gar nicht zählen kann.
Richard von Volkmann-Leander
DIE ALTE-WEIBER-MÜHLE ...
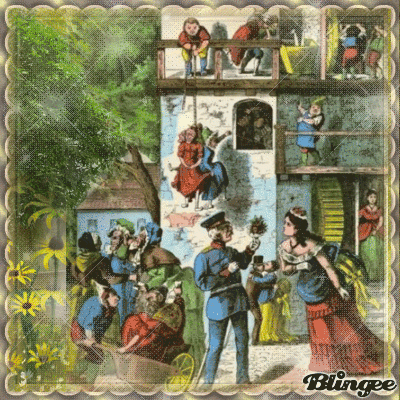
Bei Apolda in Thüringen liegt die Alte-Weiber-Mühle. Sie sieht ungefähr aus wie eine große Kaffeemühle, nur dass nicht oben gedreht wird, sondern unten. Unten stehen nämlich zwei große Balken heraus, die von zwei Knechten angefasst werden, um mit ihnen die Mühle zu drehen.
Oben werden die alten Weiber hineingetan; faltig und bucklig, ohne Haare und Zähne, und unten kommen sie jung wieder heraus: schmuck und rotbackig wie die Borstäpfel. Mit einem Male Umdrehen ist es gemacht; knack und krach geht es, dass es einem durch Mark und Bein fährt.
Wenn man aber die, welche herauskommen und wieder jung geworden sind, fragt, ob es nicht erschrecklich weh tue, antworten sie: "Lieber gar! Wunderschön ist es! Ungefähr so, wie wenn man früh aufwacht, gut ausgeschlafen ist und die Sonne ins Zimmer scheint, und draußen singen die Vögel, und die Bäume rauschen, und man sich dann noch einmal im Bett ordentlich dehnt und reckt. Da knackt es auch zuweilen."
Sehr weit von Apolda wohnte einmal eine alte Frau; die hatte auch davon gehört. Da sie nun sehr gern jung gewesen war, entschloss sie sich eines Tages kurz und machte sich auf den Weg. Es ging zwar langsam; sie musste oft stehen bleiben und husten, aber mit der Zeit kam sie doch vorwärts, und endlich langte sie richtig vor der Mühle an.
"Ich möchte wieder jung werden und mich ummahlen lassen", sagte sie zu einem der Knechte, der, die Hände in den Hosentaschen, vor der Mühle auf der Bank saß und aus seiner Pfeife Ringel in die blaue Luft blies. "Du lieber Gott, was das Apolda weit ist!"
"Wie heißt Ihr denn?" fragte der Knecht gähnend. "Die alte Mutter Klapprothen!"
"Setzt Euch solange auf die Bank, Mutter Klapprothen", sagte der Knecht, ging in die Mühle, schlug ein großes Buch auf und kam mit einem langen Zettel wieder heraus.
"Ist wohl die Rechnung, mein Jüngelchen?" fragte die Alte. "I bewahre!" erwiderte der Knecht. "Das Ummahlen kostet nichts. Aber Ihr müsst zuvor das hier unterschreiben!"
"Unterschreiben?" wiederholte die alte Frau. "Wohl meine arme Seele dem Teufel verschreiben? Nein! das tue ich nicht! Ich bin eine fromme Frau und hoffe, einmal in den Himmel zu kommen."
"Ist nicht so schlimm!" lachte der Knecht. "Auf dem Zettel stehen bloß alle Torheiten verzeichnet, die Ihr in Eurem ganzen Leben begangen habt, und zwar ganz genau der Reihe nach, mit Zeit und Stunde. Ehe Ihr Euch ummahlen lasst, müsst Ihr Euch verpflichten, wenn Ihr nun wieder jung geworden seid, alle die Torheiten noch einmal zu machen, und zwar ganz genau in derselben Reihenfolge, justement wie es auf dem Zettel steht!"
Darauf besah er den Zettel und sagte schmunzelnd: "Freilich ein bisschen viel, Mutter Klapprothen, ein bisschen viel! Vom sechzehnten bis zum sechsundzwanzigsten Lebensjahre täglich eine, sonntags zwei. Nachher wird es besser. Aber im Anfang der Vierziger, der Tausend, da kommt's noch einmal dicke! Zuletzt ist's wie gewöhnlich!"
Da seufzte die Alte und sagte: "Aber Kinder, dann lohnt es sich ja gar nicht, sich ummahlen zu lassen!" "Freilich, freilich", entgegnete der Knecht, "für die meisten lohnt sich es nicht! Darum haben die eben gute Zeit; sieben Feiertage die Woche, und die Mühle steht immer still, zumal seit den letzten Jahren. Früher war schon das Geschäft etwas lebhafter."
"Ist es denn nicht möglich, wenigstens etwas auf dem Zettel auszustreichen?" fragte die Alte noch einmal und streichelte dem Knechte die Backen. "Bloß drei Sachen, mein Jüngelchen, alles andere will ich, wenn es denn einmal sein muss, noch einmal machen."
"Nein", antwortete der Knecht, "das ist platterdings unmöglich. Entweder - oder!"
"Nehmt nur Euren Zettel wieder", sagte darauf die alte Frau nach einigem Besinnen, "ich habe die Lust an Euerer dummen alten Mühle verloren!" und machte sich auf den Heimweg.
Als sie aber zu Hause ankam und die Leute sie verwundert ansahen und sagten: "Aber Mutter Klapprothen, Ihr kommt ja gerade so alt wieder, als Ihr fort gegangen seid! Es ist wohl nichts mit der Mühle?" hustete sie und antwortete: "O ja, es ist wohl etwas daran; aber ich hatte zu große Angst, und dann - was hat man denn an dem bisschen Leben? Du lieber Gott!"
Richard von Volkmann-Leander
WIE SICH DER CHRISTOPH UND DAS BÄRBEL ANEINANDER VORBEIGEWÜNSCHT HABEN ...
Das mag nun schon geraume Zeit her sein, dass einmal der liebe Gott - wie er es oft zu tun pflegte - sagte: "Du, Gabriel, mach einmal die Luke auf und guck runter! Ich glaube, es weint was!"
Der Gabriel tat, wie ihm der liebe Gott befohlen, hielt sich die Hand vor die Augen, weil es blendete, sah überall umher und sagte endlich: "Da unten ist eine lange grüne Wiese; an dem einen Ende sitzt das Bärbel und hütet die Gänse und am anderen der Christoph und hütet die Schweine, und weinen tun sie alle beide, dass einem das Herz im Leibe weh tut." -
"So?" sagte der liebe Gott; "geh weg, Langer, damit ich selbst zusehen kann." (Dass der Engel Gabriel sehr lang ist, weiß jeder.) Wie er nun selbst zugesehen hat, fand er es geradeso, wie es der Engel Gabriel gesagt.
Dass aber der Christoph und das Bärbel beide so kläglich weinten, hat sich so zugetragen: Der Christoph und das Bärbel hatten sich beide sehr lieb; denn eins hütete die Gänse, das andere die Schweine, und sie passten also gut zusammen, weil nämlich der Stand kein Hindernis machte.
Sie nahmen sich denn vor, sie wollten sich heiraten, und meinten, dazu wär es gerade genug, dass sie sich so lieb hätten. Aber die Herrschaft war anderer Meinung. So mussten sie sich denn mit dem Brautstande zufrieden geben. Weil aber Ordnung zu allen Dingen nützt und das Küssen bei Brautleuten eine gar wichtige Sache ist, waren sie übereingekommen, dass sieben Küsse morgens und sieben Küsse abends eine gute Zahl wären.
Eine Zeitlang ist es denn auch ganz gut gegangen, und immer waren zur rechten Zeit die sieben richtig voll. Am Morgen aber des Tages, wo diese Geschichte sich zugetragen hat, eben da es zum siebenten Kusse kommen sollte, waren dem Bärbel seine Lieblingsgans und dem Christoph sein Lieblingsferkel wegen des Frühstücks uneinig geworden, also, dass sie sich gar hart anließen und beinahe schon zu Tätlichkeiten übergingen.
Da mussten sie es, um den Streit zu schlichten, bei der falschen Zahl lassen. Wie nun beide nachher so einsam und weit voneinander am Wiesenrande saßen, fiel ihnen ein, dass es doch sehr schlimm sei, und fingen an zu weinen, und weinten immer noch, als der liebe Gott selbst zusah.
Der liebe Gott meinte anfangs, ihr Leid würde sich mit der Zeit wohl von selbst geben; als aber das Weinen immer ärger wurde und dem Christoph sein Lieblingsferkel und dem Bärbel seine Lieblingsgans auch schon begannen schier traurig zu werden und ganz sauertöpfische Gesichter zu machen, sprach er: "Ich will ihnen helfen! Was sie sich am heutigen Tage nur immer wünschen mögen, soll in Erfüllung gehen."
Die zwei hatten aber nur einen Gedanken; denn wie so eins nach dem anderen schaute und konnten sich doch nicht sehen, denn die Wies war lang und in der Mitte ein Busch, dachte der Christoph: Wenn ich doch drüben bei den Gänsen wäre! und das Bärbel seufzte: Ach, wäre ich doch bei den Schweinen!
Auf einmal nun saß der Christoph wirklich bei den Gänsen und das Bärbel bei den Schweinen; und doch waren sie wieder nicht beieinander, und die falsche Zahl konnte immer noch nicht richtig gemacht werden.
Da dachte der Christoph: Das Bärbel wird mich wohl haben besuchen wollen. Und das Bärbel dachte: Was gilt es, der Christoph ist andersrum zu mir rüber gegangen! - Ach, wär ich doch bei meinen Gänsen! - Ach, wär ich doch bei meinen Schweinen! Da saß nun wieder das Bärbel bei den Gänsen und der Christoph bei den Schweinen, und so ist es den ganzen Tag über immer umschichtig fortgegangen, weil sich die beiden stets aneinander vorbeigewünscht haben.
So fehlt denn der siebente Morgenkuss des Tages heute noch. Der Christoph wollte ihn zwar selbigen Abends, als sie beide, todmüde gewünscht, nach Hause kamen, nachholen, aber das Bärbel meinte, es helfe nun doch nichts mehr, und die Unordnung sei nimmer wieder gut zu machen. -
Als aber der liebe Gott sah, dass sich die beiden immer so aneinander vorbeiwünschten, sprach er: "Da habe ich etwas Gutes angerichtet. Aber, was ich gesagt habe, habe ich gesagt! Dagegen kann nun weiter nichts helfen!" So hat er sich dann vorgenommen, nie wieder Liebesleuten ihre Wünsche so ohne weiteres in Erfüllung gehen zu lassen, sondern sich immer erst zu erkundigen, was sie denn eigentlich haben wollten.
Später aber soll er einmal im Vertrauen zum Gabriel gesagt haben: es wäre doch recht schade, dass ihre Wünsche so gar selten von der Art wären, dass er sie gewähren dürfe; und als ich mich vor langer, langer Zeit einmal in ähnlichen Angelegenheiten an ihn wandte, tat er gar nicht, als wenn er es hörte. Nachher erzählte mir der Gabriel diese Geschichte; da konnte ich mich freilich nicht mehr wundern.
Richard von Volkmann-Leander
ELEND WÄHRT BIS AN DEN JÜNGSTEN TAG ...
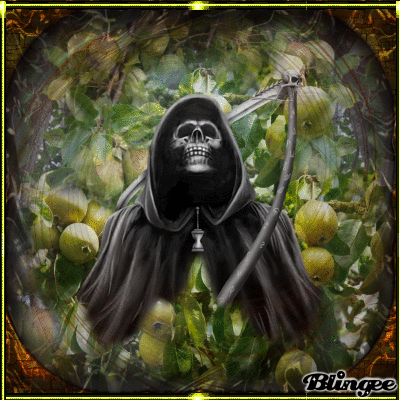
Apostel Petrus und Paulus machten einmal zusammen eine Reise, und als es Abend wurde, kamen sie miteinander an ein prächtiges steinernes Haus, darin wohnte ein reicher Geizhals. Die Apostel fragten eine Magd, welche im Bache vor diesem Hause Zeug spülte, ob sie dort übernachten könnten. Die Magd sagte, das werde ihr Herr aus Geiz nimmermehr zugeben, erbot sich aber, die Fremden zu ihrem Bruder zu bringen, der ein armes Bäuerlein war. Er hieß Elend, hatte nicht Weib und Kind, und wohnte gleich nebenan in einer dürftigen Hütte.
Das Bäuerlein hüpfte vor Freuden fast bis an die Decke seiner niedern Stube, weil es einmal zu einem Besuch kam. Es bot den beiden Aposteln sogleich an, dass sie sich Beide in sein Bett legen sollten, und wollte selbst auf dem harten Boden der Stube übernachten. Allein der Apostel Paulus sagte: "Leg du dich nur mit Petrus ins Bett, denn ich muss ohnehin die Nacht aufbleiben, weil ich zwei Briefe zu schreiben habe, den einen an die Korinther und den andern an den Timotheus; der hat einen so schwachen Magen, da will ich ihm schreiben, dass er sich den Durst mit Wein stillen soll."
Da legte sich der Bauer mit Petrus ins Bett, und der Apostel Paulus schrieb an die Korinther und an den Timotheus. Am anderen Morgen aber sagten die Apostel zu dem Bäuerlein, dass es sich eine Gnade ausbitten sollte. Da sagte es: es hätte nichts in seinem ganzen Vermögen als einen Birnbaum und von dem würden ihm so oft Birnen gestohlen. Da hätte es nun den sehnlichen Wunsch, dass Niemand, der auf den Baum herauf stiege, ohne seine besondere Erlaubnis wieder herunter könnte.
Du wünschest sehr mäßig, sprachen die Apostel, und deine Bitte soll erfüllt werden. Darauf gingen sie ihres Weges.
Es dauerte aber nicht lange, da saß einmal des Morgens der reiche Geizhals, der dem Bauer gegenüber wohnte, auf dem Birnbaume. Der hatte wollen in der Nacht dem Armen Birnen stehlen und schrie gewaltig, als er sah, dass er von dem Baume nicht wieder herunter konnte.
Elend aber klatschte vor Freuden in die Hände, als er seinen reichen Nachbar auf dem Birnbaume erblickte, und rief alle Nachbarn herbei, dass sie ihn dort sitzen sahen. Endlich versprach der reiche Geizhals, dass er ihm jeden Sonntag Mittag durch seine Schwester ein Huhn im Topfe schicken wolle. Da klatschte der Bauer Elend von neuem in die Hände, und ließ den Geizhals sogleich vom Birnbaume herunter.
Von dieser Zeit an hat der Bauer auch richtig jeden Sonntag sein Huhn im Topfe gehabt, solange seine Schwester und der reiche Geizhals lebten.
Die waren aber Beide schon gestorben, als eines Tages auch zu Elend der Tod kam. Das Bäuerlein war jetzt schon ganz zusammengekrümmt, wie nun so ein Bäuerlein auf seine alten Tage eben ist. So saß der Elend auf der Bank vor seinem Hause, und als der Tod erschien, war er ganz freundlich, dass einmal wieder Jemand zu ihm kam.
Als nun der aber sagte, dass er der Tod sei, da sprach Elend: "Lieber Tod! ich habe nur den einen Wunsch, dass ich noch vor meinem Ende einmal Birnen von meinem Birnbaume essen kann. Hättest du nicht auch ein Lüstchen darauf?" Hier schmunzelte der Tod ein wenig, denn er hatte wirklich ein Lüstchen zu Birnen.
"Nun denn", fuhr der Bauer Elend fort, "so steige hinauf auf den Birnbaum und hole uns ein Gericht Birnen herunter, ich selber bin schon steif und kann nicht mehr hinaufkommen."
Der Tod kletterte nun auf den Birnbaum und wollte die Birnen herunter holen. Als er aber oben war und sich die Taschen voll gesteckt hatte, merkte er, dass er nicht wieder herunter konnte. Da kam der Bauer aus seinem Hause und klatschte wieder vor Freuden in seine Hände, dass er den Tod auf seinem Birnbaume gefangen halte. Endlich aber ließ er ihn laufen unter der Bedingung, dass er zu ihm nicht wieder kommen dürfe.
Darum lebt Elend noch bis auf den heutigen Tag, und stöhnt und seufzt, lässt sich's dann aber auch einmal wohl sein an seinen Birnen. Und ich fürchte sehr, der Vetter Juchheidom stirbt und Elend lebt bis an den jüngsten Tag, obschon ihm doch am Ende im Grabe wohler wäre als hier auf der Erde.
Heinrich Pröhle, Kinder- und Volksmärchen
SEPP AUF DER FREITE ...
"Es ist heute Kirchweih", sagte die alte Bauersfrau, die seit fünf Jahren gichtbrüchig im Bette lag, indem sie sich mühsam aufrichtete und mit ihren zitternden Händen ein großes Tuch um den Kopf band, welches sie so oft wieder abnahm und umband, bis vorn mitten auf der Stirn eine große Schleife stand, wie vier Windmühlenflügel.
"Es ist heute Kirchweih, Sepp, und du wirst heute Abend wieder allein zu Tanze gehen, wie voriges Jahr und wie vorvoriges und wie immer. Hast du mir nicht bestimmt versprochen, dir in diesem Jahre eine Frau zu nehmen? Aber es wird wohl nichts werden, solange ich lebe, und nachher auch nichts. Wenn das dein Vater hätte erleben müssen! Willst du ein alter Hagestolz werden? Weißt du nicht, was die Mädchen singen?:
"Klipper, klapper Hagestolz,
Geh in den Wald und such dir Holz,
Dürres Holz im grünen Wald,
Denn es wird im Winter kalt
Jetzt ist's noch gelinder.
Ob's auch brennt und ob's nicht rußt,
dass du nicht so frieren musst
Frag die Bettelkinder!"
Da antwortete der Sohn kleinlaut, dass die Mädchen im Dorf ihm alle gleich gut gefielen und dass er nicht wisse, welches er erwählen solle. "So geh ins Dorf", sagte die Mutter, "und achte genau darauf, was die Mädchen, von denen du glaubst, dass sie für dich passen, machen, und dann komm zurück und sag mir es."
Und der Sepp ging. "Nun", rief die Mutter, als er wieder zurückkehrte, "wie war es? Wo bist du gewesen?" "Zuerst bei der Ursel; kam eben aus der Kirche; hatte ein schönes Kleid an und neue Ohrringe."
Da seufzte die Mutter und sagte: "Geht sie oft in die Kirche, wird sie den lieben Gott bald vergessen lernen. Der Müller hört die Mühle auch nicht klappern. Nichts für dich, mein Junge. Wohin bist du nachher gegangen?"
"Zur Käthe, Mutter." "Was tat sie?" "Stand in der Küche und rückte an allen Töpfen und Tellern." "Wie sahen die Töpfe aus?" "Schwarz." "Und die Finger?" "Weiß." "Schlicker, Schlecker", sagte darauf die Mutter:
"Schlicker, Schlecker!
Naschig und lecker!
Backt sich Kuchen und süßen Brei,
Vergisst die Kinder und das Vieh dabei.
Lass sie laufen, Sepp!"
"Darauf bin ich zur Bärbel gegangen. Saß im Garten und machte drei Kränze. Einen von Veilchen, einen von Rosen, einen von Nelken. Fragte mich, welchen sie heute zur Kirchweih aufsetzen sollte."
Da schwieg die Mutter eine Weile und sagte dann:
"Ein silbernes Herrchen
Und ein goldenes Närrchen,
Gibt eine kupferne Ehr'
Und viel eisernes Weh!
Weiter, mein Junge!"
"Zu viert bin ich zur Grete gekommen. Stand vor der Haustüre an der Straße und gab den armen Leuten Butterbrote." Da schüttelte die Mutter den Kopf und sagte: "Tut sie heut etwas, was alle Leute sehen sollen, tut sie ein anderes Mal wohl etwas, was keiner sehen soll. Steht sie am Tage vor der Haustür, hat sie wohl am Abend auch schon dahinter gestanden.
Wenn der Herr mittags aufs Feld kommt, während die Leute essen, springen nur die faulen Knechte auf, um zu mähen; die fleißigen bleiben sitzen. Bleib lieber ledig, Sepp, ehe du die nimmst! Bist du nicht weiter gekommen?"
"Zuletzt bin ich noch zur Anne gegangen." "Was tat sie?" "Gar nichts, Mutter!" "Sie wird doch irgend etwas getan haben?" fragte die alte Bauersfrau noch einmal. "Nichts, ist sehr wenig, Sepp!"
"Behüt Gott", antwortete der Sohn, "sie machte gar nichts; könnt Euch drauf verlassen!" "Dann nimm die Anne, mein Junge! Das gibt die besten Weiber, die gar nichts tun, was die Burschen erzählen können!"
Und der Sepp nahm die Anne und wurde überglücklich und sagte später noch oft zu seiner Mutter: "Mutter, Ihr hattet recht mit Euerem Rat:
"Die Ursel und Käthe,
Die Bärbel und Grete,
Die wiegen zusamm'
Nicht halb meine Ann'!
Jetzt könnte ich Euch schon viel von ihr erzählen - aber ich tu es nicht."
Richard von Volkmann-Leander
PRINZESSIN SCHNEEFLÖCKCHEN ...
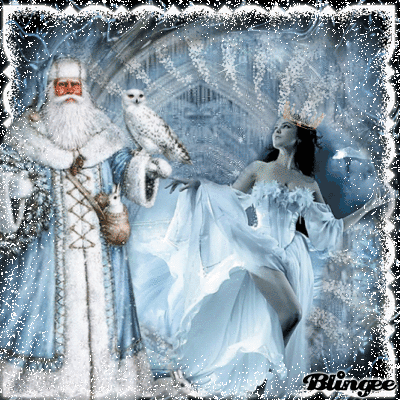
Weit, weit weg von hier, in der Schweiz, wo die Berge bis in die Wolken hinaufragen, steht auch ein großer Berg, auf dessen Spitze viel Schnee liegt, und selbst im heißesten Sommer kann der Schnee nicht schmelzen. Da hat der König Winter sein Schloß. Das hat Mauern von lauter Schnee und Türme von lauter Eis. Da sitzt der alte König mit seinem weißen, langen Haar und seinem weißen, langen Bart und führt ein strenges, hartes Regiment. Wer nur sich in seine Nähe wagt, den nimmt er gefangen.
Kommt ein Flüßchen den Berg hinunter gesprungen, gleich hält er es fest und legt ihm Ketten und Fesseln von Eis an, daß es nimmer weiterhüpfen kann, sondern ganz still liegen muß. Kommt gar ein Vöglein geflogen, so hält ers auch fest und ach, gar manches arme Vöglein kommt nicht wieder aus seinem Schlosse, sondern muß drin erfrieren und sterben. Darum fliegen auch die Schwälbchen und die Stare und die Störche und viele andere Vögel weit weg, wenn sie merken, daß der König Winter nahe ist, und die Käferchen und Würmlein kriechen schnell unter die Erde, damit er sie ja nicht fange!
Da war auch einmal eine wunderschöne kleine Prinzessin, die hieß Prinzeß Schneeflöckchen, denn sie hatte immer ein ganz weißes Kleidchen an und Strümpfchen von weißer Seide und weiße Atlasschuhe an den Füßchen und auf dem Kopfe eine Krone von lauter aus silbernen Fäden gewobenen Sternen. Die war ein gar lustiges Kind und tanzte und hüpfte und sprang und tollte den ganzen Tag herum. Und wie sie einmal so mitten im Tanzen war, kam sie zu nahe an das Schloß des Königs Winter, da hatte der böse König sie auch festgehalten und hielt sie in seinem Schloß gefangen.
Da war Prinzeß Schneeflöckchen freilich sehr traurig geworden, aber um sich die Traurigkeit zu vertreiben, hüpfte und tanzte sie noch viel mehr als sonst. Das ärgerte den alten, finsteren König sehr, denn der konnte es gar nicht leiden, wenn jemand fröhlich und ausgelassen war.
Darum, so oft Prinzeß Schneeflöckchen ihn bat, er möchte sie doch aus dem finsteren Schlosse wieder hinauslassen, antwortete er ihr immer, sie würde nie wieder hinauskommen, wenn sie nicht das Tanzen sein ließe. Wenn aber einmal ein Prinz käme, der ihr so gut gefiele, daß sie das Tanzen ganz vergäße, mit dem dürfte sie aus seinem Schlosse hinaus in die weite Welt ziehen.
Darüber war Prinzeß Schneeflöckchen groß geworden und war eine wunderliebliche Jungfrau, die jedem, der sie sah, gar wohl gefiel. Und es kamen viele, viele Prinzen und jeder hätte gern mit ihr Hochzeit gemacht.
Aber wenn dann ein Prinz zum König kam und sprach: „König Winter, gebt mir Prinzeß Schneeflöckchen doch zur Frau und laßt sie mit mir hinausreiten in die weite Welt,“ dann sprach er: „Versuchs nur! Wenn du ihr so gut gefällst, daß sie das Tanzen darüber vergißt, sollst du sie haben; wenn nicht, dann nehme ich dich auch gefangen!“
Das war freilich eine schlimme Geschichte, aber doch wagte mancher Prinz sein leben, um Prinzeß Schneeflöckchen zu befreien und sie zu seiner Prinzessin zu machen.
Da kam zuerst der Prinz Eiszacken, der sah gar prächtig aus, hatte einen Panzer von lauter glänzendem Eis und eine Eiskrone mit lauter spitzen Zacken, und einen Säbel an der Seite, der war so blank und spitz wie die Eiszäpflein, die im Winter an den Dächern hängen, und wenn die Sonne schien, dann glitzerte alles an ihm in den schönsten Regenbogenfarben, grün und blau und rot und gelb.
Der dachte: „Gewiß werde ich dem Prinzeßchen gefallen und sie wird darüber ganz das Tanzen vergessen.“ So ging er dann zum Prinzeßchen, und weil die Sonne gerade schien, sah er ganz herrlich bunt aus und alle Fräuleins riefen: „Ei!“ und „Ah!“ wenn sie ihn sahen, und bewunderten ihn sehr, weil er so ein schöner Mann war.
Aber als Prinzeß Schneeflöckchen ihn sah, mußte sie laut auflachen, denn es war ihr so komisch, daß er so kunterbunt war, und vor lauter Vergnügen klatschte sie in ihre Händchen und fing an zu tanzen und zu hüpfen. Da mußte der grimme König Winter doch auch in seinen weißen Bart hineinlachen über den armen Tölpel, den Prinzen Eiszacken.
Aber das war ein böses Lachen aus lauter Schadenfreude, denn weil der Prinz der Prinzessin Schneeflöckchen nicht so sehr gefallen hatte, daß sie darüber das Tanzen vergaß, nahm ihn der böse König Winter gefangen und steckte ihn in eine ganz dunkle Stube auf seinem Schloß.
Nicht lange danach kam ein zweiter Prinz, das war der Prinz Sausewind. Seine braunen Locken flogen ihm ganz wild um die Stirne und sein weiter Mantel flatterte hinter ihm her, wo er nur ging und stand, wie eine Fahne im Wind.
Der pfiff immer lustig vor sich her und machte lauter dumme Streiche; bald warf er eine Tür oder einen Fensterladen zu, daß es nur so krachte und die Leute erschreckt zusammenfuhren; bald riß er einem Herrn den Zylinderhut vom Kopfe, daß er weithin über die Straße kullerte; bald fuhr er einer Dame in den Regenschirm und stülpte ihn um und um, oder er nahm einem kleinen Jungen seinen Papierdrachen und flog damit hoch in die Luft, bis der arme Drachen mit seinem langen Schwanz an einem hohen Baume hängen blieb und kläglich zappeln mußte.
Der ging nun auch zu Prinzeß Schneeflöckchen, und alle Leute dachten: „Der wird gewiß dem Prinzeßchen gefallen, denn er ist gerade so lustig wie sie!“ Und richtig! Als die kleine Prinzessin ihn sah, wie er so vergnügt und pfeifend heran gesprungen kam, rief sie laut: „Ei, du gefällst mir!“ Aber meint ihr, sie hätte drüber das Tanzen vergessen?
Ach, nein im Gegenteil; wie sie sah, daß Prinz Sausewind so lustig war, nahm sie ihn gleich bei der Hand und fing an zu tanzen, und tanzte mit ihm und drehte sich hin und her und hüpfte und sprang so sehr, daß der Prinz Sausewind beinahe gar nicht mit konnte.
Kaum aber hatte das der König Winter gesehen, da kam er auch schon und nahm den armen Prinzen gefangen und steckte ihn zu dem Prinzen Eiszacken in die dunkle Stube; denn er hatte der Prinzessin auch nicht so gut gefallen, daß sie darüber das Tanzen vergessen hätte.
Da kam wieder ein Prinz aufs Schloß, das war der Prinz Blitz. Der sah gar fürchterlich aus. Seine Rüstung war ganz golden, daß man sie gar nicht ansehen konnte, so blendete sie einen. An der Seite hatte er einen spitzen Säbel, der ganz im Zickzack ging und auf dem Kopfe eine Krone, aus der immer lauter grelle Blitze schossen.
Und ein Paar Augen hatte er, ganz feurig, daß man ordentlich erschrak, wenn er einen ansah; und eine Stimme hatte er, ganz fürchterlich, daß es immer klang, als donnerte es, wenn er sprach. Der gefiel dem König Winter gar wohl, denn er dachte: „Wenn der Prinz Blitz zur Prinzessin kommt, dann wird sie das Tanzen schon sein lassen!“
Aber als Prinzeß Schneeflöckchen ihn sah und hörte, wie er polterte und wetterte und schimpfte, da fürchtete sie sich so sehr, daß sie schnell aufsprang und davon lief, bis sie der Prinz Blitz nicht mehr fangen konnte. Und nun freute sie sich darüber, daß sie ihm ausgerissen war, so sehr, daß sie vor lauter Vergnügen wieder tanzte und sprang.
Da wurde auch der Prinz Blitz vom König Winter eingesperrt, denn er hatte der Prinzessin nicht so gut gefallen, daß sie darüber das Tanzen vergessen hätte. Da saßen nun die drei Prinzen in ihrer dunklen Stube; Prinz Eiszacken hing ganz traurig seinen Kopf, Prinz Sausewind rüttelte an Türen und Fenstern und versuchte, sie aufzumachen, Prinz Blitz fuhr hin und her, bald in die eine, bald in die andere Decke und polterte und schimpfte, daß er so gefangen saß.
Und alle drei waren sehr böse auf Prinzeß Schneeflöckchen, denn um ihretwillen waren sie ja eingesperrt. Und schließlich machten sie miteinander einen Bund und verschworen sich hoch und teuer, daß, wenn einmal ein Prinz käme, der dem Prinzeßchen so gut gefiele, daß sie das Tanzen darüber vergäße, dann wollten sie es nicht erlauben, daß sie mit dem Prinzen in die weite Welt zöge, sondern wollten schon dafür sorgen, daß sie ihr ganzes Leben lang auf dem Schlosse des Königs Winter gefangen sitzen sollte.
Wie sie noch so miteinander redeten, kam auf des Königs Schloß wieder ein Prinz an. Der hatte ein Paar treue, sanfte, blaue Augen und blonde Haare und eine freundliche Stimme, hatte freilich gar keine prächtigen Kleider an, aber auf dem Kopfe ein Krönchen von Primeln und Schneeglöckchen, Leberblümchen und Veilchen und in der Hand einen Zweig mit weißen Kirschblüten und um den Leib eine Schärpe von grünen Blättern.
Der kam zum König Winter und sprach: „König Winter, ich bin der Prinz Sonnenschein und will mir Prinzeß Schneeflöckchen holen.“ Der König sah ihn aber ganz verächtlich an, denn er schien ihm gar nicht prächtig genug für einen Prinzen und sagte: „Versuchs nur! Wenn du ihr so gut gefällst, daß sie das Tanzen drüber vergißt, sollst du sie meinetwegen haben.
Wenn nicht dann komm her und sieh wie dirs dann gehen wird.“ Und damit zeigte er ihm durch ein Loch in der Wand die dunkle Stube, in der die drei gefangenen Prinzen saßen. Aber Prinz Sonnenschein fürchtete sich gar nicht, sondern lachte nur und ging zu Prinzeß Schneeflöckchen.
Wie ihn aber die Prinzessin sah, da konnte sie gar kein Wort sprechen, so gut gefiel er ihr, denn er sah sie so lieb und gut an und sprach so freundlich mit ihr. Da vergaß sie ganz das Tanzen und legte ihr Köpfchen auf des Prinzen Arm und sagte: „Ach, lieber Prinz Sonnenschein! Nimm mich doch mit aus diesem alten, kalten Schlosse hinaus in die weite, schöne, sonnige Welt!“
Da ging der Prinz mit ihr zum König Winter und sprach: „Seht, König Winter, ich habe der Prinzessin so gut gefallen, daß sie darüber das Tanzen ganz vergessen hat! Nun tut, wie Ihr mir versprochen habt und laßt sie mit mir ziehen.“ Der König brummte freilich noch etwas in seinem langen, weißen Bart aber weil er es einmal versprochen hatte, mußte er es auch erlauben.
Da spannte Prinz Sonnenschein zwanzig bunte, schöne Schmetterlinge vor seinen goldenen Wagen und hob Prinzeß Schneeflöckchen hinein. Alle Leute im Schloß riefen: „Glücke Reise!“ und die meisten waren traurig, daß das lustige Prinzeßchen von ihnen ging.
So fuhren sie nun den Berg hinunter, weit, weit fort, bis sie in ein schönes, freundliches, grünes Tal kamen. Da stand Prinz Sonnenschein sein Schloß. Das war von lauter sonnenhellem Gold gebaut und lag mitten in einem schönen Garten voller bunter, duftender Blumen. Goldene Käferchen trippelten drin hin und her, das waren des Prinzen Diener, -- und hoch vom Turm läuteten die Schneeglöckchen, als der Prinz und seine Prinzessin ihren Einzug hielten.
Da lebten sie nun herrlich und in Freuden. Prinzeßchen tanzte gar nicht mehr, aber sie war eine gute Prinzessin, die mit ihrem Prinzen zusammen allen ihren Untertanen, den Tierchen und den Blümchen im Tal viel Gutes tat. Und alle freuten sich, daß sie ins Tal gekommen war.
Nur einen verdroß es sehr, das war König Winter. Freilich hatte er sich immer geärgert, wenn Prinzeß Schneeflöckchen tanzte, aber eigentlich hatte er doch das kleine, lustige Ding sehr lieb gewonnen, weil es immer so fröhlich war und ihm manchmal mit ihren lustigen Späßen die Langeweile und die schlechte Laune vertrieben hatte.
Nun war Prinzeßchen fort und auf seinem Schlosse war es seitdem ganz still und langweilig geworden und gar zu gern hätte er Schneeflöckchen wieder gehabt.
Das hörten die drei gefangenen Prinzen und sprachen zum König: „Was willst du uns geben, wenn wir dir Prinzeßchen wiederbringen?“ Und der König sagte: „Dann will ich euch wieder loslassen und ihr
könnt wieder hin, wo ihr wollt.
Da freuten sich die drei Prinzen und machten sich auf. Zuerst ging der Prinz Eiszacken zum Prinzen Sonnenschein und tat gar wichtig und groß und ließ ihm sagen, er sollte ja Prinzeß Schneeflöckchen wieder herausgeben, sonst würde es ihm sehr schlecht gehen.
Aber der Prinz Sonnenschein lud ihn höflich ein, er möchte doch hereinkommen. Da ging der Prinz Eiszacken hinein ins Schloß; -- wie er aber all die Pracht und Herrlichkeit da sah, gefiel es ihm so gut, daß er gar nicht mehr daran dachte, Prinzeß Schneeflöckchen wegzuholen, sondern vielmehr darum bat, auch dort bleiben zu dürfen.
„Gut,“ sagte Prinz Sonnenschein, „das will ich dir erlauben, wenn du dein altes Eiszackenkleid ausziehst und hilfst meiner Prinzessin, den Blümchen und Tierchen alle Tage schönes frisches Wasser geben.“ Das versprach Prinz Eiszacken und blieb auf dem Schlosse des Prinzen Sonnenschein.
Als er aber nicht zurückkam, schickte König Winter den Prinzen Sausewind, er sollte Prinzessin Schneeflöckchen holen. Der kam dann auch ganz geschwind, lief um das ganze Schloß herum und suchte, ob nicht irgend ein Türchen offen stünde oder ein Spalt in der Mauer wäre, wo er hinein könnte.
Aber Prinz Sonnenschein hatte alles fest zugeschlossen. Da fing Prinz Sausewind an, mit aller Gewalt an dem schönen Schloß zu rütteln und wollte es einreißen. Aber Prinz Sonnenschein lachte und
rief ihm zu:
„Sausewind, laß dein Blasen sein,
sonst sperr ich dich in den Keller ein,“
und als er doch nicht aufhörte, nahm ihn der Prinz Sonnenschein gefangen und sperrte ihn ein.
Aber Prinz Sausewind tat ganz kläglich und bat:
„Sonnenschein, binde mich nur nicht an,
ich will dir dienen, so gut ich kann.“
Da antwortete Prinz Sonnenschein:
„Willst du schütteln vom Baum das welke Laub?
Willst du weitertragen den Blütenstaub?
Willst du trocknen, wo es geregnet hat?
So sollst du mir dienen früh und spat.“
Das versprach Prinz Sausewind. Da durfte er aus seiner dunklen Stube wieder heraus und auf dem Schlosse des Prinzen Sonnenschein wohnen.
Indessen wartete König Winter vergeblich auf ihn. Und da auch er nicht wiederkam, schickte er den Prinzen Blitz, er sollte Schneeflöckchen wiederholen. Der polterte denn auch mit aller Macht und schoß seine Pfeile gegen des Prinzen Schloß. Aber Prinz Sonnenschein wehrte sich tapfer, bis Prinz Blitz ganz müde geworden war. Da nahm er ihn auch gefangen.
Aber er hatte gemerkt, daß Prinz Blitz gar tapfer war und ihm gut helfen könnte, und so nahm er ihn auch in seine Dienste und befahl ihm, er sollte, wenn es gar zu heiß auf Erden würde, mit seinem Blitzbesen die Luft fegen, daß sie schön rein und kühl würde. So kam keiner von den drei Prinzen zurück.
Da stieg König Winter selbst ins Tal hinab, um sich Prinzeß Schneeflöckchen wieder zu holen. Als er aber hörte, daß Prinz Sonnenschein alle drei Prinzen gefangen hätte, und als er sah, wie Prinz Eiszacken die Blumen gießen und Sausewind die Bäume schütteln und Blitz die Luft fegen mußte, da dachte er: „O weh, nun wird Prinz Sonnenschein mich auch fangen.
Aber der gute Prinz Sonnenschein ging ihm entgegen und sagte zu ihm: „Lieber König Winter, wir wollen nicht miteinander streiten. Ich weiß, daß du Prinzeß Schneeflöckchen auch lieb hast, und darum schlage ich dir vor, wir werden gute Freunde, und jedesmal, wenn die Schwälbchen fortziehen, kommst du zu uns ins Tal herab und wohnst bei mir und bei Prinzeß Schneeflöckchen, und jedesmal, wenn die Schwälbchen wiederkommen, steigen wir zu dir hinauf und Prinzeß Schneeflöckchen wohnt mit in deinem Schlosse. Eiszacken aber und Sausewind und Blitz dienen von jetzt ab uns beiden.“ Da sagte König Winter „ja“, und Prinzeß Schneeflöckchen sagte auch „ja“, und Eiszacken und Blitz und Sausewind waren auch zufrieden.
Seitdem wohnt Prinzeß Schneeflöckchen manchmal auf dem Berge und manchmal im Tal, und weil sie nun alle miteinander Frieden haben, tanzt sie auch wieder, wenn sie bei dem König Winter wohnt; aber wenn ihr lieber Prinz Sonnenschein kommt, hört sie gleich auf, denn der hat ihr so gut gefallen, daß sie darüber das Tanzen immer wieder vergißt.
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
DER BERGGEISTER GESCHENKE ...

Ein Schneider und ein Goldschmied wanderten mit einander, und als es Abend wurde, hörten sie eine wunderliebliche Musik. Die Musik war so schön, daß sie alle Müdigkeit vergaßen und immer größere Schritte machten, um zu sehen wer die Musikanten seien. Bald war es, wenn sie aufhorchten, als rauschte nur der Wind so sanft in den Linden am Wege, bald als klängen die Glockenblumen auf der Wiese, wenn sie im Winde sich neigten. Und der Schneider dachte an seine liebe Braut, die er daheim gelassen hatte, und seufzte, daß er so arm sei und die Spielleute wohl noch lange nicht zu ihrem Hochzeitstanz aufspielen würden.
Wie sie nun fort gingen, tönte die Musik immer näher und näher, und zuletzt sahen sie auf einem Hügel viele kleine Gestalten, Männchen und Weibchen, die sich bei den Händen gefaßt hielten und im Kreise um einen alten Mann tanzten, gar lieblich sangen (das war die Musik) und sich immer wechselsweise vor dem Alten verneigten.
Der Alte war etwas größer als die übrigen, hatte einen langen, eisgrauen Bart, der tief über die Brust hinab ging, war von majestätischem Aussehen und prachtvoll gekleidet. Der Schneider und der Goldschmied blieben verwundert stehen und konnten sich nicht satt sehen. Da winkte ihnen der Alte; die Tänzer und Tänzerinnen öffneten ihren Kreis, und der Goldschmied, der ein verwegener, kleiner buckliger Kerl war, trat in den selben.
Der Schneider blieb furchtsam zurück; doch als er sah wie die kleinen Männchen und Weibchen seinen Gefährten so lieblich begrüßten, faßte er sich ein Herz und folgte ihm in den Kreis. Nun schloß sich der Reigen wieder, und die Kleinen tanzten und sangen fort.
Der Alte aber nahm ein langes, breites Messer, wetzte es, daß es hell funkelte, und nun barbierte er den beiden alle Kopfhaare und den ganzen Bart weg. Sie zitterten vor Angst, daß es nun an den Kopf gehen würde; doch klopfte ihnen der Alte freundlich auf die Schulter, als wollte er sagen, es sei hübsch von ihnen daß sie sich nicht gesträubt hätten.
Darauf wies er nach einem Haufen Kohlen, der zur Seite lag, und deutete ihnen durch Gebärden an, daß sie sich davon die Taschen füllen sollten. Der Goldschmied, der habgieriger Natur war, griff nach seiner Gewohnheit auch hier besser zu als der Schneider, obwohl die Kohlen keinen Wert hatten.
Nun gingen die beiden den Hügel hinab ein Nachtlager zu suchen, und sie sahen sich noch oft nach den kleinen, niedlichen Tänzern um. Die Musik tönte immer ferner und leiser; da schlug die Klosterglocke im Tal zwölf, und plötzlich war der Hügel leer, und Alles war verschwunden.
Unten in der Herberge deckten sich die beiden Wandersleute mit den Röcken zu, und da sie sehr müde waren, vergaßen sie die Kohlen aus den Taschen zu nehmen. Doch wachten sie früher als gewöhnlich auf, weil sie die Röcke wie Blei drückten. Sie griffen in die Taschen und wollten ihren Augen nicht trauen, als sie sahen daß sie nicht Kohlen, sondern eitles Gold darin hatten.
Der Goldschmied schätzte das seine auf dreißig tausend Thaler und das des Schneiders auf fünfzehn tausend. Auch Haare und Bart hatten sie vollständig wieder. Da priesen sie den Alten auf dem Berge, und der Goldschmied sprach: »Weißt du was? heute Abend gehen wir wieder hin, und da wollen wir uns die Taschen erst recht füllen.«
Der Schneider aber wollte nicht so. »Ich habe genug« sagte er »und bin zufrieden. Ich werde nun Meister, heirate meine Margaret, und da wollen wir fröhlich Wirtschaft führen.« Da der Goldschmied aber nicht weiter wollte und sie schon lange mit einander gewandert waren, blieb der Schneider ihm zu Liebe den Tag in der Herberge liegen.
Und als es Abend wurde, hängte sich der Goldschmied noch mehrere Taschen um und ging wieder zu dem Hügel. Er hörte die Musik wie am vorigen Tage und sah die kleinen Tänzer und Tänzerinnen und den Alten in ihrer Mitte. Und der Alte winkte ihm wieder, barbierte ihn und hieß ihn von den Kohlen nehmen.
Da raffte er so viel zusammen, als er fort bringen konnte, eilte in die Dorfschenke zurück, deckte sich mit dem Rocke und konnte nicht einschlafen vor Erwartung, wenn nun die Taschen, die von den Kohlen angefüllt so leicht waren, immer schwerer und schwerer werden würden. Aber es geht nicht Alles auf Erden wie die törichten Menschen meinen: die Taschen blieben leicht.
Kaum begann es zu dämmern, so ging er ans Fenster und besah alle Stücke Kohlen einzeln; doch es waren gewöhnliche Kohlen und machten ihm die Finger schwarz. Erschrocken holte er sein Gold vom vorigen Tage herbei; doch auch das glänzte nicht mehr rötlich. Es war Alles wieder zu Kohle geworden.
Da weckte er den Schneider um ihm sein Leid zu klagen; doch wie der ihn ansah, erschrak er, und nun erfuhr der Goldschmied erst sein ganzes Unglück. Haare und Bart waren ihm glatt abgeschoren, und sie wuchsen auch nie wieder. Was aber das Schlimmste war, er hatte einen Höker auf dem Rücken gehabt, und nun hatte er einen zweiten, eben so großen vorn auf der Brust und war von nun an zu seiner Arbeit untüchtig.
Da erkannte er wohl daß dies die Strafe für seine Ungenügsamkeit war und fing bitterlich zu weinen an. Der Schneider aber tröstete ihn und sprach »Da wir so lange auf der Wanderschaft gute Gesellen gewesen sind und den Schatz zusammen gefunden haben, so sollst du hinfort auch bei mir leben und mit von meinem Schatze zehren.«
Und der Schneider wurde bald Meister und nahm seine Margaret zur ehelichen Hausfrau. Er hat fromme Kinder und immer viel Arbeit, und den Goldschmied mit den beiden Hökern und ohne Haare pflegt er noch.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DER EISERNE MANN ...
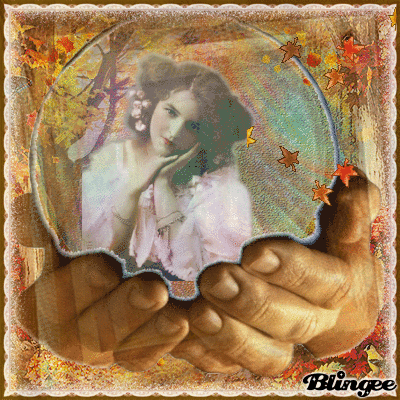
Es war ein König, der hielt eine große Jagd; und auf der Jagd fingen seine Schützen einen Mann, der war gestaltet wie andere Leute, doch war er ganz von Eisen. Über das Wunder freute sich der König, und er ließ einen Platz vor seinem Schlosse mit einem hohen, eisernen Gitter umhegen und den Mann hinein setzen und gebot seinen Leuten bei Lebensstrafe ihn nicht heraus zu lassen.
Nicht lange, so geschah es, daß eines Morgens der junge Königssohn auf dem Hofe Ball spielte. Da trat der eiserne Mann ans Gitter und spielte mit einem Balle, der sprang, wenn man ihn auf die Erde warf, weit höher als der des Königssohnes und war auch weit schöner anzusehen; denn er war ganz golden.
Da bat der Kleine gar freundlich um den Ball, und der eiserne Mann winkte ihm ans Gitter und sprach heimlich: »Schließ die Tür auf, so schenk ich dir den Ball.« Und der Knabe schlich leise zur Tür und machte sie auf. Da sprang der eiserne Mann heraus, gab ihm den goldnen Ball und lief quer über das Feld in den Wald.
Wie der König erfuhr daß der eiserne Mann entsprungen war, tat er einen großen Schwur, wer das Gitter aufgemacht habe, der solle sterben. Da kam sein liebes Söhnlein und bekannte demütigl, daß es den eisernen Mann heraus gelassen habe, und der König erschrak daß er seinem Sohne den Tod geschworen hatte, doch sein Wort mußte er halten.
Er sandte zwei Jäger mit dem Sohne in den Wald, und die sollten ihm das Leben nehmen. Die Jäger aber erbarmte der schöne Knabe, sie ließen ihn frei im Walde und hießen ihn in Gottes Namen laufen so weit der Himmel blau sei; und sie schossen ein wildes Schwein, schnitten ihm beide Augen und das Herz aus und brachten sie dem Könige und sagten, dies seien die Augen und das Herz seines Sohnes.
Der Knabe irrte den ganzen Tag in dem weiten Walde umher; und als der Abend kam, setzte er sich weinend auf einen Baumstumpf und klagte daß ihn nun, wenn er in der Nacht schliefe, die wilden Tiere auffressen würden. Da stand plötzlich der eiserne Mann vor ihm, strich ihm das Haar freundlich mit seiner eisernen Hand und sprach:
»Sei getrost, mein Bub; du hast mir geholfen, so will ich dir auch helfen. Den Tieren in meinem Walde will ich befehlen daß sie dir kein Leid tun; morgen früh aber will ich dich aus dem Walde vor das Schloß eines mächtigen Königs führen, und vor dem Fenster der Königstochter sollst du mit dem goldnen Balle spielen und sollst noch einst ein größerer König werden als dein Vater ist.«
Da legte sich der Knabe getrost aufs grüne Moos und schlief sanft ein; und die goldnen Sternlein gingen leise über den Himmel um ihn nicht aufzuwecken, als aber die liebe Sonne kam und ihn anlachte, sprang er auf, und der eiserne Mann war auch schon da, und sie gingen durch den Wald; und als sie ins Freie kamen, stand ein prachtvolles Schloß vor ihnen, und der eiserne Mann zeigte dem Knaben das Fenster der Königstochter und sprach zu ihm:
»Wenn die Königstochter den goldnen Ball sieht, wird sie ihn haben wollen; du darfst ihn aber nicht ihr schenken, wenn sie dir nicht erlaubt daß du eine Nacht in ihrem Zimmer schläfst, und wenn du das getan hast, komm morgen früh wieder zu mir.« Und wie es der eiserne Mann vorhergesagt hatte, so geschah es.
Kaum hatte der Knabe einige Zeit mit seinem Ball vor dem Fenster gespielt, so kam die Königstochter heraus; und sie war ein gar niedliches kleines Mädchen und sagte: »Ach was hast du für einen schönen Ball! schenk ihn mir, so kannst du dir eine Gnade von mir ausbitten«. –
»So bitt ich mir aus« sprach der Knabe »daß ich heut Nacht in deiner Kammer schlafe.« – »Ich will den Vater fragen ob ich es erlauben darf« sagte das Königstöchterlein und sprang ins Schloß; und bald kam sie wieder und sprach: »Der Vater meint, wenn du hübsch artig bist, kann ich es wohl erlauben.«
Nun spielten sie den ganzen Tag mit dem Balle, und am Abend gingen sie ins Schlafkämmerlein des Fräuleins, und sie legte sich in ihr seidenes Bett; der Knabe aber legte sich auf die Erde, und weil die Diele so hart war, sprach das Mädchen: »Wart, ich will dir ein Bettlein geben, daß du dich nicht so drückst.« Und sie gab ihm ein Bett und behielt eins für sich, und sie sagten sich gut Nacht und schliefen still bis an den Morgen.
Am Morgen nahm der Knabe Abschied und ging wieder in den Wald und erzählte dem eisernen Mann alles, wie es gekommen war. Und er blieb ein ganzes Jahr bei ihm und wurde täglich größer und schöner. Als aber das Jahr um war, gab ihm der eiserne Mann einen Ball von ganz durchsichtigem Kristall; der sah aus, wenn man ihn in die Höhe warf, wie klares Wasser, wenn die Sonne hindurch scheint: und er hieß ihn wieder zum Schlosse gehen und vor dem Fenster der Königstochter damit spielen.
Und wie er so spielte, kam die Königstochter ans Fenster, und sie hätte ihn kaum wieder erkannt, so groß war er geworden. Sie schämte sich zu ihm zu gehen und um den Ball zu bitten; darum bat sie ihren Vater, er möchte doch zu dem schönen Jüngling schicken und fragen lassen ob er ihr den Ball nicht schenken wolle.
Der Vater aber dachte »Was will der verlaufene Bube immer vor meinem Schlosse?« und er ließ ihn fangen, gab den Ball seiner Tochter, und den Prinzen schickte er in die Küche, wo er als Küchenjunge viele Wochen schwere Dienste tun mußte, bis er eine Stunde abpaßte und heimlich entsprang.
Er lief nun wieder in den Wald und klagte dem eisernen Mann wie traurig es ihm ergangen war. Doch der tröstete ihn und sprach »Gräme dich nicht; es wird noch alles gut werden. Ein großes Heer zieht gegen den König heran: ich will dir ein Pferd und eine Rüstung geben, damit ziehe hin und stelle dich in des Königs Heer.«
Und er führte ihn zu einem hohlen Berge, in dem standen viele tausend Pferde, und es lagen viele tausend Rüstungen dort: er waffnete ihn selbst mit seiner eisernen Hand, gab ihm noch manchen guten Rat, und der Königssohn zog in den Krieg. Er kam in eine große Schlacht und zeigte sich als den tapfersten Ritter darin, und durch ihn wurde die Schlacht gewonnen, und er rettete auch dem Könige das Leben.
Auch er aber wurde verwundet; und der König verband ihm die Wunde mit seiner eignen Schärpe und gebot seinen Dienern ihn wohl zu pflegen. Doch ehe sie sich versahen, war er verschwunden. Er war aber zum eisernen Mann in den Wald geritten; und der freute sich, daß alles so wohl gelungen war, und gab ihm einen Ball, der war noch weit schöner als die beiden ersten und war von rotem Karfunkelstein.
Damit ging der Königssohn wieder in seiner gewöhnlichen Tracht vor das Fenster der Königstochter und spielte. Und als sie den Ball sah, war sie ganz untröstlich, daß sie ihn nicht haben sollte. Unterdessen war auch der König mit seinem Heere heimgekehrt; und die Prinzessin sprang ihm entgegen, küßte ihn vielmal und sprach:
»Da du die große Schlacht gewonnen hast und ich dich so herzlich lieb habe, will ich dich um etwas bitten, und das darfst du mir nicht abschlagen.« Und der König versprach zu tun was sie wollte. »Der schöne fremde Jüngling ist wieder hier« sagte sie: »er hat einen Ball von rotem Karfunkelstein, und den soll er mir geben, was er auch dafür fordert. Du darfst ihm aber Nichts zu Leide tun.«
Doch der Jüngling wollte nicht Gold noch Kostbarkeiten für seinen Ball nehmen, sondern er verlangte die folgende Nacht noch einmal mit der Prinzessin in einer Kammer zu schlafen. Das mußte der König denn gewähren; doch als sie schliefen, schlich er zu ihnen und wollte den Prinzen ermorden.
Aber wie verwundert war er, als er sah, daß seine eigne Schärpe um den einen Arm des Prinzen gewunden war. Da erkannte er seinen Erretter, weckte die beiden auf und fragte ob sie Mann und Frau werden wollten. Das waren sie gern zufrieden und hielten schon am folgenden Morgen Hochzeit; und am Abend gingen sie in den Wald zum eisernen Manne, erzählten ihm ihr Glück und baten ihn mit auf ihr Schloß zu ziehen.
Doch der eiserne Mann sagte, er müsse in seinem Walde bleiben und seine Tiere bewachen, und er bat sie nur ihn manchmal zu besuchen, was sie auch treulich taten.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE NIXE IM MANSFELDER SEE ...
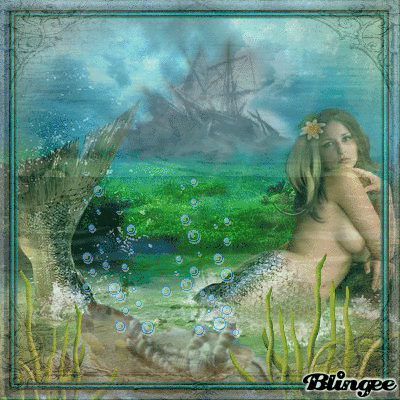
Nicht weit vom Mansfelder süßen See, liegt ein Dorf, doch wie es heißt weiß ich nicht. Da war alle Sonntage Musik und Tanz, und alle Burschen und Mädchen der Umgegend fanden sich dazu ein. Die Mädchen waren alle schön; aber eine war so schön, daß man sie sein Leben lang nicht mehr vergessen konnte, wenn man sie einmal gesehen hatte, doch wer sie war und woher sie kam, wußte niemand.
Einem jungen Schäfer gefiel sie so wohl, daß er mit keiner anderen mehr tanzen wollte, und als sie einst weg ging, schlich er ihr nach und bat sie ihm zu erlauben, daß er sie nach Hause begleite. »Ja« sagte sie, »das kannst du tun. Du mußt mir aber versprechen nicht auf dem halben Wege umzukehren, sondern ganz mitzukommen.«
Das versprach er gern, und sie faßte ihn bei der Hand und führte ihn nach einer Gegend hin, wo gar kein Dorf lag, so daß er bald ängstlich fragte ob sie auch den Weg kenne, sie müßten sich wohl verirrt haben. »Nein, nein« sagte sie: »komm nur mit und fürchte dich nicht; ich werde dir schon den rechten Weg zeigen.«
Sie gingen immer weiter und kamen endlich an den See, wo das Mädchen von den Weiden, die am Ufer stehen, eine Gerte abbrach und damit dreimal auf das Wasser schlug. Und siehe da, das Wasser tat sich auf, und eine hübsche, breite Treppe wurde sichtbar, die zum Grunde des Sees führte.
Der Schäfer blieb wohl einen Augenblick verwundert stehen, doch da ihn das Mädchen immer noch bei der Hand hielt und freundlich zu ihm sprach »Nun komm nur, komm!« so stieg er, von ihr geführt, die Stufen hinunter; und sie kamen in einem allerliebsten Dorfe an, wo die Mutter des Mädchens in einem kleinen, niedlichen Häuschen wohnte.
»Ei« rief die Alte, als sie eintraten, ihrer Tochter entgegen, »du bringst dir wohl gar einen Schatz mit? Nun, wir wollen sehen wie es ihm bei uns gefällt. Die von dort oben können immer nicht viel arbeiten und wollen gleich wieder hinauf. Doch es kommt auf einen Versuch an.«
Den anderen Tag ging die Alte in die Kirche. denn natürlich war auch eine Kirche im Dorfe, und ehe sie ging, schüttete sie einen Scheffel Rübsen in einen großen Haufen Asche und sagte zu dem Schäfer »Da suche die Körner heraus, wenn ich wieder komme, mußt du fertig sein.«
Der Schäfer blieb traurig vor dem Aschenhaufen stehen und wagte gar nicht ihn anzurühren. Doch das schöne Mädchen sprang herbei und rief »Wart, ich will dir helfen«; und sie öffnete einen Taubenschlag, aus dem ein ganzer Schwarm Tauben flog, die über die Körner her fielen und sie in kurzer Zeit alle wieder in den Scheffel gelesen hatten.
Die Alte kam zurück und erstaunte und freute sich über die wohl gelungene Arbeit. Als sie nun wieder ausging, gab sie dem Schäfer ein Sieb und hieß ihn einen Teich damit ausschöpfen; doch mit Hilfe seiner Geliebten gelang ihm auch dies und auch die dritte Arbeit, welche ihm die Alte auferlegte, und welche darin bestand, daß er an einem Vormittage einen großen Wald fällen, das Holz klein hacken und in Wellen binden mußte.
Da er diese Proben alle drei so glücklich bestanden hatte, erlaubte die Alte ihrer Tochter ihn zu heiraten; und sie hielten eine fröhliche Hochzeit, zu der viele Nixe und Nixen eingeladen wurden.
Zwei Jahre lebten sie glücklich und zufrieden mit einander, und sie hatten auch einen wunderniedlichen kleinen Sohn bekommen. Da wurde der Schäfer plötzlich von Sehnsucht nach seiner Heimat ergriffen, und er bat seine Frau, sie möchte ihm doch erlauben einmal seine Eltern und Geschwister zu besuchen.
»Das darfst du wohl« sagte sie: »wenn du mir versprichst wieder mit herab zu kommen, will ich selbst mit gehen und dich in dein Dorf führen.« Sie nahm ihr Kind auf den Arm und ging mit dem Schäfer die Stufen hinauf; und sie besuchten seine Eltern und alle Bekannte und blieben drei Tage im Dorfe.
Dann sprach die Frau: »Nun müssen wir umkehren; sonst kannst du dich von diesem Leben nicht mehr trennen.« Er nahm wehmütig Abschied und folgte ihr bis zum See; doch als sich das Wasser auftat, graute es ihm, und er konnte sich nicht entschließen wieder hinunter zu gehen und bat seine Frau oben bei ihm zu bleiben.
»Wir helfen meinen Eltern den Acker bauen« sagte er; »und wenn wir auch nicht so gut leben wie dort unten, so sehen wir doch den blauen Himmel und die liebe Sonne über uns.« Doch sie schüttelte traurig mit dem Kopfe und erinnerte ihn an die Liebe und Treue, die er ihr gelobt hatte.
»Und wenn du nicht mit kommst« sprach sie, »so müssen wir das Kind teilen; denn es gehört uns beiden. Sieh wie es lacht.« Damit hielt sie ihm das Kind hin, und es streckte die kleinen Arme freundlich nach ihm aus. Da weinte der Schäfer von Herzen und bat die Nixe den Knaben allein zu behalten.
Er versprach sie täglich am See zu besuchen; doch mit hinab kommen könne er nicht, lieber wolle er selbst sterben. »Wenn du oben bleibst« sagte die Nixe, »so müssen wir uns auf ewig trennen, und ich darf von dem Kinde nicht mehr behalten als mir gehört.«
Da küßte sie ihn noch zum Abschied, und sie teilte das Kind und hieß ihn wählen, welches Stück er wolle. Er nahm die untere Hälfte, und sie warf die obere in den See, wo alsbald ein munterer Fisch daraus wurde, der fröhlich fort ruderte. Und als der Schäfer ihm noch nachsah, war die Nixe schon die Stufen hinab gestiegen, und das Wasser schlug über ihr zusammen.
Da grub er die andere Hälfte des Kindes am Ufer ein, und an der Stelle wuchs eine Lilie, die neigte sich über das Wasser; und man sah oft wie der Fisch in der Dämmerung bei der Lilie auf und nieder schwamm.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DER DUMME WIRRSCHOPF ...

Ein Bauer hatte drei Söhne und eine Wiese. Von den Söhnen waren zwei klug und der dritte ein Dummling, und auf der Wiese wurde alljährlich das Heu gestohlen, wenn es gehauen und in Schober zusammen gestellt war. Als nun die Schober auch wieder einmal aufgerichtet waren, sprach der Bauer zu den Söhnen: »Wer mir das Heu bewacht, daß es nicht gestohlen wird, dem schenk ich einen Leinwandrock und ein Paar hölzerne Schuhe.«
Sprach der älteste »Die will ich wohl verdienen« und ging am Abend auf die Wiese. Er wachte auch bis gegen Mitternacht; doch dann fielen ihm die Augen zu, und als er sie wieder aufmachte, war von den drei Schobern, die auf der Wiese gestanden hatten, einer weg. Da kam er traurig nach Hause, und am nächsten Abend wanderte der zweite Bruder auf die Wiese; aber es erging ihm nicht besser als dem ersten, und es wurde auch der zweite Heuschober gestohlen.
Da sprach der Dummling: »Es ist doch hübsch von meinen Brüdern daß sie mir auch einmal Etwas übrig lassen«, nahm eine Hechel und eine Leine und ging auf die Wiese. Und die Brüder lachten ihm nach und sprachen: »Der dumme Wirrschopf will das tun, was wir nicht einmal gekonnt haben!«
Der Wirrschopf aber hieß er, weil er sehr lange, verworrene Haare hatte, die wie eine goldne Mähne um seinen Kopf flogen. Er schlang auf der Wiese die Leine um den noch übrigen Heuschober, band das Ende der selben an die Hechel und legte die Hechel, indem er sich auf den Boden streckte, dicht hinter seinen Kopf.
Nun schlief er getrost ein; doch es währte nicht lange, so kratzte ihn die Hechel, daß er aufwachte, und er sah ein graues Männchen, welches das Heu zusammen band und auf ein braunes Pferd lud. Da sprang er auf; doch ehe man drei zählen konnte, saß das Männchen schon auf dem Pferd und flog wie ein Pfeil über das Feld, er aber lief ihm nach und kam zu einem prächtigen Schloß im Walde, vor dem das graue Männchen grade vom Pferde stieg.
Da faßte es der dumme Wirrschopf; doch das Männchen fiel auf die Knie und bat um Gnade und sprach: »Wenn du mir das Leben läßt, schenk ich dir das schöne, braune Roß, auf dem ich geritten bin.« Das ließ sich der Bursch gefallen und sagte: »Morgen früh will ich mir es abholen. Jetzt muß ich wieder auf die Wiese, daß uns niemand das Heu stiehlt.«
Und als er zu dem Schober kam, brachte er die Leine und Hechel wieder in Ordnung und schlief ein. Doch die Hechel kratzte ihn bald wieder munter, und als er aufsah, war es das selbe graue Männchen, welches das Heu zusammen raffte und auf ein weißes Pferd band.
Da sprang er denn wieder auf und lief dem Männchen nach, traf es wieder bei dem Schloß im Walde, und es schenkte ihm auch noch das weiße Pferd und versprach nicht wieder zu kommen. Kaum aber war er zum dritten Mal auf der Wiese eingeschlafen, so fing die Hechel von Neuem zu kratzen an, und mit einem Satz sprang er auf das graue Männchen zu, packte es und drohte es auf der Stelle zu ermorden.
Da war das arme graue Männchen denn in großer Angst, und es schenkte ihm nicht bloß das schwarze Pferd, auf dem es diesmal das Heu hatte wegführen wollen, sondern bot ihm noch dazu das ganze Schloß an, mit allen Herrlichkeiten, die darin waren; und alles Heu, das es in den vielen Jahren gestohlen hatte, gelobte es wieder zu bringen.
Der dumme Wirrschopf sagte, er wolle das Schloß erst ansehen, und das graue Männchen führte ihn hinein, zeigte ihm alle die prachtvollen Säle und Gewölbe; und weil sie dem Wirrschopf gefielen und er dem Männchen Gnade verhieß, gab es ihm die Schlüssel des Schlosses und sprach: »Wenn du jetzt auf deine Wiese kommst, wirst du alles Heu, das ich deinem Vater genommen habe, wieder finden. Ich aber will dein Kämmerer sein und dein Schloß getreu bewachen; und wenn du Etwas willst, so komm und fordere es nur.«
Da nahm der dumme Wirrschopf die Schlüssel und band sie über dem Nacken in seinen langen, goldgelben Haaren fest, so daß sie niemand sehen konnte; denn er dachte: »Wenn ich meinem Vater und meinen Brüdern sage, daß ich ein herrliches Schloß besitze, ziehen sie hinein, und mich sperren sie in den Taubenschlag, wo ich schon oft habe sitzen müssen.« Auf der Wiese fand er über hundert Heuschober und ging nun fröhlich nach Haus.
Als seine Brüder ihn kommen sahen, lachten sie und sprachen: »Da kommt der dumme Wirrschopf: seht wie er verschlafen aussieht; hat die ganze Nacht geschlafen und noch nicht genug. Da haben sich die Diebe Zeit nehmen können,« und was dergleichen mehr war.
Darüber wurde er nicht böse, sondern sagte freundlich zum Vater: »Kommt mit hinaus; ich habe das Heu wieder gewonnen, das man euch in den vielen Jahren gestohlen hat.« Und nun war der Vater mit den Brüdern nicht wenig erstaunt, als sie auf die Wiese kamen und so viel Heu fanden, daß das ganze Dorf auf viele Jahre genug hatte.
Nun geschah es zu einer Zeit, daß der König des Landes überall ausrufen ließ, seine Tochter sei auf den Glasberg verwünscht, und wer den Berg hinauf reite und sie erlöse, der solle ihr Gemahl werden und das ganze Königreich bekommen. Es waren aber drei Tage in verschiedenen Monaten, an denen sie befreit werden konnte.
Da sprach der Bauer zu den beiden klugen Söhnen »Es wär doch schön, wenn Einer von euch König würde und ich ein Königsvater. Wir wollen unsere Pferde nehmen und uns aufmachen, ihr seid so klug, vielleicht erlöst ihr die Prinzessin. Der dumme Wirrschopf mag indessen den Misthaufen aus dem Hofe aufs Feld schaffen.«
Sie taten ihre Sonntagskleider an und zogen zum Glasberg. Der dumme Wirrschopf aber ging zu seinem Schlosse, nahm die Schlüssel aus den Haaren und schloß auf; und das graue Männchen sprang ihm freudig entgegen und rief »Es ist gut daß du kommst, du sollst die verwünschte Prinzessin erlösen. Hier nimm dein braunes Roß, tu diese königlichen Gewänder an und reit auf den Glasberg.«
Und es gab ihm prachtvolle Kleider, die von Gold und Silber strahlten. Die legte der Bursch an und sagte »Du mußt aber unterdessen den Mist in meines Vaters Hofe aufs Feld bringen.« Das versprach das graue Männchen zu tun, und er ritt davon.
Als er zum Glasberg kam, sah er den König und die Königin und viele hundert stattliche Ritter, die alle gar herrlich gekleidet waren; doch so schön wie er war keiner, und sie hielten ihn für einen vornehmen Prinzen und fragten viel wer er wohl sein möchte; doch kannte ihn Niemand.
Dicht am Berge traf er auch seine Brüder. Die hatten Stufen in das Glas gehauen und wollten grade hinauf reiten; doch ihre Pferde überschlugen sich und warfen die Reiter ab. Und als diese wieder aufstanden, jammerten sie daß sie ihre schönen Sonntagskleider so beschmutzt hatten, und der König und die Ritter lachten sie aus.
Der dumme Wirrschopf aber sprengte auf seinem braunen Rosse ohne abzusetzen gleich bis zur Mitte des Berges hinan, und Alle jubelten hinter ihm her; denn so hoch war noch keiner gekommen. Doch da glitt auch sein Roß ab, und wie ein Vogel flog es mit ihm über die Heide zu dem Schloß im Walde zurück. Als er nach Hause kam, fand er den Mist schön gespreitet auf dem Acker, und er dachte: »Vielleicht geht es das nächste Mal besser,« setzte sich in seinen alten, schlechten Kleidern auf die Ofenbank und pfiff sich Eins.
Da kehrten auch seine Brüder und sein Vater heim, und sie sprachen viel von dem fremden Prinzen; und der Vater sagte: »Aber ihr wart doch die klügsten von Allen, als ihr die Stufen ins Glas hiebet, dachte der König gewiß: ›Wenn die meine Tochter nicht erlösen, muß sie immer verwünscht bleiben‹; doch das nächste Mal erlöst ihr sie bestimmt, und dann teilen wir das Königreich unter einander.«
»Hütet euch nur« sprach der Wirrschopf dazwischen, »daß ihr die schönen Sonntagskleider nicht wieder beschmutzt und euch der König und die Ritter nicht auslachen.« Da wunderten sie sich woher er wisse, daß sie der König ausgelacht hatte; doch er pfiff weiter in seinem Liede und dachte: »Wundert euch nur! Was ich weiß, wißt ihr doch nicht.«
Der zweite Tag kam heran, und der Vater ritt mit den beiden klugen Söhnen wieder zum Glasberg. Der dumme Wirrschopf aber sollte unterdessen den Taubenschlag rein machen. Doch kaum waren sie aus dem Hofe, so lief er in sein Schloß; und das graue Männchen brachte ihm noch schönere Kleider als das erste Mal.
Er schwang sich auf sein weißes Roß und sprengte durch den Wald. Und am Fuße des Berges traf er wieder viele hundert Ritter; die setzten immer an, doch die Pferde glitten aus. Er aber sauste wie ein Wind durch sie hindurch, und sein Roß trug ihn bis dicht unter den Gipfel des Berges, da glitt es auch ab, und wie das erste Mal jagte er ohne ein Wort zu sprechen in den Wald zurück, und seine eignen Brüder erkannten ihn nicht. Daheim aber fand er den Taubenschlag so rein, wie er noch nie gewesen war. –
Am dritten Tage gab das graue Männchen dem Burschen die schönsten Kleider, die man je in dem Lande gesehen hatte. Es zäumte ihm sein schwarzes Roß, und als er auf dem über die Heide zum Glasberg geritten kam, staunten der König und alle Ritter; denn das Roß berührte den Boden kaum, und mit wenigen Sprüngen war es oben auf der Spitze des Berges.
Da jauchzte das ganze Volk rings um den Berg, und sie riefen ihn zum Könige aus, und die Prinzessin umarmte ihn und sprach »Nun bist du mein Bräutigam!« Doch er küßte sie nur einmal und ritt dann schnell wieder den Berg hinab. Die Ritter des Königs sperrten ihm den Weg, weil der König erfahren wollte wer der fremde Prinz sei, der seine Tochter erlöst hatte; doch gab er seinem Rosse die Sporen, und mit einem Satze flog es über die Ritter hinweg und verschwand im Walde.
Auf dem Hofe seines Vaters aber hatte das graue Männchen indessen den Hühnerstall ausräumen müssen. Und als der Vater und die Brüder heim kamen, trösteten sie einander und sprachen: »Wenn wir auch keine Könige sind, so sind wir doch klüger als andere Leute.«
Nun war die Prinzessin erlöst, doch sie war den ganzen Tag traurig, weil sie den fremden Prinzen gern zum Gemahl genommen hätte und nicht wußte wo er war. Da ließ der König in seinem Lande und in der ganzen Umgegend verkündigen, in drei Wochen solle sich der fremde Prinz melden, der seine Tochter befreit habe; da solle die Hochzeit gehalten werden.
Doch es kam Niemand, und die Prinzessin wurde immer betrübter. Des Königs Räte aber sprachen: »Vielleicht war es gar kein Prinz: darum raten wir, daß ihr in allen Dörfern und Städten ein Aufgebot ergehen laßt, alle jungen Burschen sollen sich am nächsten Pfingstsonntag versammeln; dann kann die Prinzessin suchen ob sie ihren Bräutigam unter ihnen findet.«
Der Rat gefiel dem Könige, und er ließ das Aufgebot ergehen. Und zu Pfingsten fuhr er mit der Prinzessin in allen Dörfern und Städten umher, und sie sah viele hundert Burschen, doch ihr Bräutigam war nicht darunter. Da kamen sie auch in das Dorf, in welchem der Bauer mit den drei Söhnen wohnte: und als der König die Burschen erblickte, fragte er ob nicht noch mehr im Dorfe seien.
»Einer ist noch zu Haus« sagte der Bauer: »doch das ist ein Dummling und nicht Wert, daß euer königlich Gnaden und die schöne Prinzessin ihn ansehen.« Die Prinzessin aber befahl ihn auch zu holen. Und als sie nun den dummen Wirrschopf in der Ferne kommen sah, da hatte sie ihn bald an seinen langen, goldenen Haaren erkannt, und sie flog auf ihn zu, fiel ihm um den Hals und führte ihn zur königlichen Kutsche.
Der König selbst machte den Kutschenschlag auf und hob ihn hinein. Da saß der dumme Wirrschopf nun auf den seidenen Polstern, und die schöne Prinzessin saß neben ihm und war seine Braut; und er grüßte seinen Vater und seine Brüder noch freundlich zum Abschied und fuhr mit dem Fräulein und dem Könige davon.
Als sie in den Wald kamen, zeigte er ihnen sein Schloß, und weil es weit schöner war als das des Königs, blieben sie dort. Am anderen Tage war Hochzeit, und das Märchen ist aus.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE KÖNIGSTOCHTER UND DER SOLDAT ...
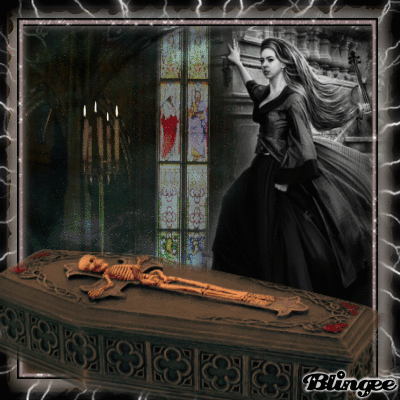
Es ist niemand so glücklich, daß er das Wünschen verlernte. Das erfuhr ein König und eine Königin wohl. Die lebten in aller Freude und Herrlichkeit der Welt und saßen doch oft traurig bei einander, denn sie hatten keine Kinder. Und als sie einst auch wieder über ihr Unglück klagten, vergaß sich der König und tat einen Fluch, er wolle ein Kind, und wenn es auch vom Teufel käme.
Und siehe da, kein Jahr verging, so bekam die Königin eine Tochter. Doch sie erschrak, als sie das Mädchen ansah; denn es war über und über schwarz und war auch nicht so klein wie die anderen Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, sondern konnte schon laufen und auch sprechen. Und es sagte zum König »Vater, ich werde nicht älter als sechzehn Jahr. Dann mußt du mich in der Schloßkirche hinter dem Altar beisetzen lassen, und jede Nacht muß ein Soldat bei mir Wache stehen.«
Die Prinzessin wuchs heran, und als sie sechzehn Jahr alt war, starb sie plötzlich. Da wurde sie denn, wie es einer Königstochter geziemt, mit großer Pracht in der Kirche beigesetzt, und ein Soldat wurde als Wache bei ihr gelassen. Doch als er am anderen Morgen abgelöst werden sollte, war er verschwunden. Man stellte einen anderen hin, doch auch von diesem war am folgenden Tage keine Spur zu finden. Und so ging es Tag für Tag viele Monate hindurch, und des Königs Heer wurde immer dünner.
Da kam die Reihe an einen Soldaten, der ein schlauer Gesell war und dachte »Du kannst wohl etwas Klügeres tun als dich von dem Teufelskind verschlingen lassen. Wie wär es, wenn du dich aufmachtest und davon liefst?« Wie gedacht, so getan. Als es Abend wurde, machte er sich auf den Weg, lief über Berge und Felder und kam auf eine schöne Wiese.
Da stand plötzlich ein graues Männchen vor ihm und fragte: »Wohin des Weges? Darf man nicht mit?« Und weil das Männchen so treuherzig aussah, erzählte ihm der Soldat daß er fort gelaufen sei, und warum er das getan habe. Das graue Männchen aber sprach: »Wenns weiter nichts ist, so kehre getrost wieder um und gehe auf deinen Posten. Wenn es gegen zwölf kommt, stelle dich auf die Kanzel und rühre dich nicht, du magst sehen und hören was du willst; so kann dir kein Leid geschehen.« Dem Rat folgte der Soldat und ging zurück in die Kirche.
Als die Glocke zwölf schlug, sprang der Deckel des Sarges auf, und die schwarze Prinzessin stieg heraus, rannte in der Kirche umher und suchte den Soldaten, und da sie ihn nicht fand, schalt sie auf ihren Vater und fluchte und lärmte, daß die Kirche wiederhallte. Da schlug es eins, und sie eilte zum Sarg zurück, legte sich hinein und war mäuschenstill. Der Soldat stieg von der Kanzel und setzte sich auf die Stufen des Altars; und als man am Morgen die Tür öffnete um eine neue Wache an den Sarg zu stellen, war man nicht wenig erstaunt ihn lebendig wieder zu finden.
Er sollte nun erzählen was er gesehen hatte; doch das wollte er nicht: und zur Strafe löste man ihn nicht ab, sondern ließ ihn zum zweiten Mal in der Kirche wachen. Da lief er denn wieder davon, doch das graue Männchen begegnete ihm auch diesmal, redete ihm Mut ein und sagte, er solle sich nur auf den Altar stellen, so werde ihn die Prinzessin nicht finden. Das tat er auch.
Die schwarze Prinzessin sprang um zwölf wieder aus dem Sarg, tobte und lärmte noch mehr als in der ersten Nacht, doch den Soldaten sah sie nicht; und als es eins schlug, legte sie sich in den Sarg. Am folgenden Morgen sollte der Soldat wieder erzählen was ihm begegnet war, und weil er es nicht tat, wurde er verurteilt auch noch die dritte Nachtwache zu halten. Was sollte er nun tun? in der Kirche bleiben ohne das Männchen zu fragen? das könnte ihm übel bekommen. Doch wer weiß ob das graue Männchen wieder auf der Wiese sein wird?
Er beschloß, wie es auch kommen möge, hinweg zu laufen und das Übrige abzuwarten. Doch zu seinem Glücke fand er das graue Männchen, und es sprach zu ihm: »Du willst wieder fort; doch kehre nur um und wache noch diese Nacht. Du wirst es nicht bereuen. Stelle dich an die linke Seite des Sarges, und sobald die Prinzessin heraus gestiegen ist, lege dich hinein: und wenn sie dann auch noch so sehr flucht und dich zu erwürgen droht, so rühre dich nicht und sprich kein Wort, bis sie dich um der drei Wunden Christi Willen bittet aufzustehen; dann steh auf, dann ist sie erlöst.«
Damit verschwand das graue Männchen, und der Soldat ging wieder in die Stadt, stellte sich in der Kirche auf die linke Seite des Sarges und erwartete ruhig die Mitternacht.
Kaum hatte die Uhr ausgeschlagen, so sprang der Deckel vom Sarge, und die Prinzessin tobte in der Kirche umher. Der Soldat aber legte sich schnell in den Sarg. Und wie es das graue Männchen vorausgesagt hatte, kam sie heran und drohte ihn zu erwürgen, wenn er nicht gleich aufstünde; doch je mehr sie schalt, desto weißer wurde ihr Gesicht: und da sich der Soldat nicht regte, faßte sie ihn zuletzt freundlich bei der Hand und sagte »Steh auf, steh auf! ich bitte dich um der drei Wunden Christi Willen.«
Und wie sie das gesprochen hatte, wurde sie blendend weiß und wunderschön; und kaum war der Soldat aufgestanden, so fiel sie ihm um den Hals und rief »Wie soll ich dir danken, du mein Erlöser? Du sollst mein Bräutigam sein, und wenn mein Vater stirbt, schenk ich dir das ganze Königreich.«
Sie setzten sich vor den Altar und herzten und küßten sich bis zum Morgen. Und als am Morgen die Wache kam den Soldaten abzulösen, erstaunte sie, als sie die beiden sitzen sah, lief zum Könige und erzählte ihm daß der Soldat seine Geliebte in der Kirche habe, und daß sie am Altar einander küßten.
Doch der König merkte was geschehen war. Er ließ seinen besten Staatswagen vorfahren und holte die beiden in der Kirche ab. Drei Tage darauf wurde Hochzeit gehalten; und als der König gestorben war, herrschte der Soldat mit seiner jungen Frau über das Land und beglückte alle Untertanen.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE SCHWARZE PRINZESSIN ...
Es war einmal ein König und eine Königin, die kriegten gar keine Kinder. Da sagte die Königin: "Ich wollte, ich kriegte ein Kind und wenn es auch vom Teufel wäre." Nicht lange darnach ward die Königin schwanger und gebar ein kleines Kind, das war eine Dirne. Sie ward, wie sie wuchs, von Tage zu Tage schöner, so dass sie ein jeder, der sie sah, von Herzen gerne leiden mochte.
Den Tag aber vor ihrem fünfzehnten Geburtstage sagt sie auf einmal zu ihrem Vater: "Morgen, Vater, muss ich sterben." "Mein liebes Kind," sagte der König, "sprich mir doch nicht von sterben."
"Doch Vater! Ich weiß gewiss, dass ich morgen sterben muss. Eins musst du mir aber versprechen: dass mein Sarg in der Schlosskirche vor den Altar gestellt und ein ganzes Jahr lang jede Nacht Wache dabei gehalten wird. Wenn sich dann unter der Wache Einer findet, der nichts Schlechtes getan hat, so kann der mich wieder erlösen." Das musste der König versprechen und ihr die Hand drauf geben.
Wie die Königstochter gesagt hatte, so kam es auch. Den anderen Tag nahm sie noch von Vater und Mutter Abschied, legte sich und starb und ward darnach kohlschwarz. Der König ließ sie nun in ihrem Sarge in die Schlosskirche vor den Altar stellen mit einer Wache dabei, wie die Prinzessin es verlangt hatte.
Des Nachts, da die Glocke gerade Zwölf schlug, fuhr die Prinzessin aus ihrem Sarge, packte die Wache, drehte ihr den Hals um und warf sie in ein finsteres Gewölbe, das da unter der Kirche war. Sobald aber die Glocke Eins schlug, musste sie wieder in ihren Sarg hinein.
In der zweiten Nacht ging es ebenso. Als die Glocke Zwölf schlug, fuhr die Königstochter aus ihrem Sarge, drehte der Wache den Hals um und warf sie in das Gewölbe, das unter der Kirche war. In jeder folgenden Nacht ging es ebenso; jeden Morgen war die Wache verschwunden und kein Mensch wusste, wo sie geblieben war.
Nun wollte zuletzt keiner mehr bei der Königstochter wachen. Da ließ der König im ganzen Lande bekannt machen: wer seine Tochter erlösen könnte, der sollte sie zur Frau haben und König werden.
Nun war da ein junger Schäfer mit gelben Haaren, der hieß Jakob, der reiste nach der Königsstadt und ließ sich anstellen als Wache bei dem Sarge der Prinzessin. In der ersten Nacht, da es kurz vor Zwölfe war und der Schäfer daran dachte, dass die anderen Wachen alle so sonderbar verschwunden waren, da ward er bange und wollte weglaufen.
Da rief eine Stimme hinter ihm her: "Jakob, geh nicht fort, du kannst mich erlösen, wenn du drei Nächte hintereinander an meinem Sarge wachst." Da kehrte der Schäfer wieder um und versteckte sich unter den Sarg der Prinzessin. Als nun die Glocke Zwölf schlug, fuhr die Königstochter aus ihrem Sarge und suchte die ganze Kirche durch; in dem Augenblick aber, wo sie an den Sarg kam und den Schäfer eben fassen wollte, schlug die Glocke gerade Eins; da musste sie wieder in ihren Sarg hinein.
In der zweiten Nacht, da es wieder bald Zwölfe war und der Schäfer daran dachte, dass es ihm auch ergehen könnte wie den anderrn Wachen, da ward er bange und wollte weglaufen. Da rief eine Stimme hinter ihm her: "Jakob, geh nicht fort; du kannst mich erlösen." Als der Schäfer das hörte, kehrte er wieder um und versteckte sich in das Gewölbe, wo die Leichen der früheren Wachen lagen.
Er beschmierte sich Gesicht und Hände ganz mit Blut, deckte einige der Toten über sich und verhielt sich so ruhig, als ob er auch eine Leiche wäre. Als nun die Glocke Zwölf schlug, fuhr die Königstochter wieder aus ihrem Sarge, durchsuchte die ganze Kirche und kam auch zuletzt in das Gewölbe, wo der Schäfer unter den Leichen lag.
"Dem die Füße warm sind, der ist es!" rief sie und tastete zwischen den Leichen herum. Schon war sie dem Schäfer ganz nahe, das Blut gerann ihm in den Adern, da schlug die Glocke Eins. Nun musste die Prinzessin wieder zurück in ihren Sarg.
- Am anderen Morgen kam der König mit seinem ganzen Hofstaate in die Kirche, um nach dem Schäfer zu sehen, und als sie das viele Blut in seinem Gesicht und an seinen Händen sahen, erschraken sie und meinten nicht anderes, denn es sei ihm ein Leid widerfahren. Jakob aber sprach:
"Wisset, dass ich gesonnen bin, auch noch die dritte Nacht Wache zu halten; Morgen früh Glocke Sechs, da kommt mit Pauken und Trompeten und der ganzen Musik, denn entweder bin ich tot oder die Prinzessin ist erlöst." Das musste ihm der König versprechen.
Kurz vor Zwölfe in der Nacht kroch der Schäfer unter den Sarg der Prinzessin, und als sie nun mit dem Schlage Zwölf herausfuhr, legte sich der Schäfer schnell selber in den Sarg hinein. Nun suchte die Prinzessin die ganze Kirche durch; als sie aber zuletzt auch an den Sarg kam, da schlug die Glocke Eins.
In dem selben Augenblick fing die Prinzessin an zu sprechen und sagte: "Jakob, ich danke dir viel tausend Mal; du hast mich nun erlöst." Von Stund an begann sie auch allmählich weiß zu werden, und morgens sechs Uhr stand sie da in voller Schönheit und weiß wie zuvor.
Da kamen auch der König und die Königin mit ihrem ganzen Hofstaate und vielem Volk, mit Pauken und Trompeten und voller Musik; und als nun Jakob mit der Prinzessin an der Hand aus der Kirche trat, da rief alles Volk: "Vivat, unser König Jakob!" und wollte des Jubilierens kein Ende werden.
Wilhelm Busch
DIE VERWÜNSCHTEN PRINZESSINNEN ...
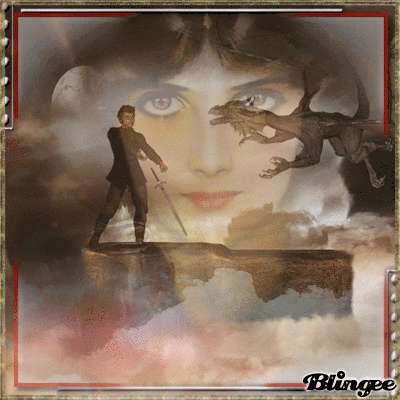
Ein Unteroffizier, ein Tambour und ein gemeiner Soldat wurden darüber einig, daß es besser sei gut essen und trinken und sein eigener Herr sein als sich im Kriege zum Krüppel schießen lassen. Darum zogen sie bei Nacht und Nebel aus, um zu suchen wo sie gut Essen und Trinken fänden und ihre eignen Herren wären.
Sie kamen in einen großen Wald, und weil es dunkel war, verirrten sie sich. Da überlegten sie denn was zu tun sei und beschlossen, Einer von ihnen solle auf einen Baum steigen, und wenn er ein Licht sehe, nach der Seite hin seine Mütze herunter werfen. Das Los traf den Tambour, und er stieg auf eine hohe Fichte, sah auch wirklich ein Licht und warf die Mütze nach der Gegend hin.
Nun gingen sie frohes Mutes in der Richtung weiter und kamen zu einem niedlichen, wohl eingerichteten Häuschen; in dem stand ein Tisch mit drei Stühlen, und auf dem Tische dufteten die schönsten Speisen und Getränke, doch es war kein Mensch im ganzen Hause zu finden.
Die drei Wanderer setzten sich an den Tisch, aßen und tranken, und am anderen Morgen beschlossen sie, daß immer einer von ihnen zu Hause bleiben und die Wirtschaft besorgen solle, während die anderen auf die Jagd gehen und sich sonst in der Gegend umsehen könnten.
Den ersten Tag blieb der Unteroffizier zu Haus. Er fegte die Stube, putzte die Fenster und kochte ein gutes Abendbrot für sich und seine Kameraden. Und als das Essen fertig war, und er sich hinsetzte seinen Teil zu verzehren, kam ein graues Männchen und sagte »Mir auch Etwas!« Der Unteroffizier wollte anfangs dem Männchen nichts geben; doch da es immer fort bettelte, gab er ihm ein Stückchen Brot.
Damit war es aber nicht zufrieden, sondern forderte auch noch Fleisch; und als es wieder lange gebettelt hatte, reichte ihm der Unteroffizier ein Stückchen Fleisch. Doch das graue Männchen war so ungeschickt und ließ es auf den Boden fallen. »Ach, ich bin so steif und kann mich nicht bücken« sagte es: »sei doch so gut und heb mir das Fleisch auf.«
Das tat der Unteroffizier auch. Kaum aber hatte er sich gebückt, so holte das Männchen eine Peitsche hervor, gab ihm in einer Minute wohl zwanzig Hiebe und verschwand. Als nun seine Gefährten zurück kamen, war er sehr ärgerlich; doch sagte er ihnen nichts, sondern dachte, sie können es ja auch versuchen.
Am zweiten Tage mußte der Gemeine die Wirtschaft führen, und es ging ihm nicht besser als dem Unteroffizier, doch er hütete sich wohl am Abend etwas davon zu erzählen. Als nun am dritten Tage der Tambour zu Hause blieb, kam das graue Männchen wieder und bettelte um Brot und Fleisch, ließ das Fleisch wieder auf die Erde fallen und bat den Tambour es aufzuheben.
Doch der Tambour war des Teufels Putzebeutel, oder mit anderen Worten, er war aus dem Kessel gesprungen, das heißt, er war ein pfiffiger, ausgelassener Strick wie alle Tamboure. Der merkte daß etwas dahinter steckte und behielt, als er sich bückte, das Männchen immer im Auge, und wie er sah, daß es die Peitsche hervor zog, sprang er auf, nahm die Peitsche und prügelte das arme graue Männchen braun und blau. Da lief es eilig aus der Stube, hob im Hause eine Falltür auf und verschwand darunter.
Wie nun die beiden anderen nach Hause kamen, erzählte der Tambour wie es ihm ergangen war; und sie gestanden ein, daß sie nicht so gut davon gekommen waren wie er und wollten gern wissen, wo das graue Männchen geblieben sei. Sie drehten von Binsen und Weiden ein Seil, und weil der Tambour am Besten mit dem Männchen fertig geworden war, banden sie ihn daran und ließen ihn durch die Falltür hinab.
Dort unten aber war es stock finster, und er tappte lange umher, bis er in einer kleinen Höhlung ein Pfeifchen fand. Darauf blies er keck, und siehe da, das graue Männchen stand vor ihm und bat, er möge es nur nicht schlagen, es wolle ja gern alles gestehen, was es wisse. Und nun erzählte es ihm, daß hier unten zwei wunderschöne verwünschte Prinzessinnen seien, die er erlösen könne, wenn er Mut genug habe, und es versprach ihm treulich dabei zu helfen.
»Dort in der Ecke steht eine Flasche« sagte es: »daraus tu drei Züge und dann nimm das Schwert, das über der Tür hängt, und geh hier in das erste Zimmer. Da wird die jüngste Prinzessin von einem Drachen bewacht, der hat zwei Köpfe und bläst das helle Feuer aus dem Rachen, doch mit diesem Schwerte kannst du ihn erlegen. So sieh denn zu, daß du ihn gut triffst.«
Der Tambour trank aus der Flasche, nahm das Schwert und machte die Tür auf. Da drang ihm ein breiter, wallender Feuerstrom entgegen; doch er sprang hindurch, hieb mit zwei Streichen dem Drachen beide Köpfe ab und befreite so die jüngste Königstochter. Die bot ihm bald große Schätze und ihr halbes Königreich zum Lohn an; und sie sagte, sie wolle seine Gemahlin werden, und zum Zeichen. daß es ihr Ernst sei zog sie einen Ring vom Finger und schenkte ihn dem Tambour.
Doch er wollte auch noch die andere Schwester befreien, pfiff wieder, und das graue Männchen brachte ihm die Flasche noch einmal und führte ihn vor das Zimmer, in dem die älteste Prinzessin saß. Die wurde von einem Drachen mit vier Köpfen bewacht; doch auch den erschlug er und erlöste sie auch.
Nun gingen sie alle drei zu dem Seile, und der ehrliche Tambour ließ die beiden Mädchen zuerst hinauf ziehen. Als aber die Reihe an ihn kam, dachte er daß seine Freunde wohl falsch sein könnten und band zum Versuch einen Stein an das Seil, und richtig, als der Stein halb hinauf gezogen war, ließen sie ihn plötzlich wieder herunter fallen. So hatte der Tambour sein Leben gerettet; doch wie sollte er nun hinauf kommen? Er ging überall herum und gelangte auch in einen schönen Garten. Dort spazierte er auf und nieder, und weil ihm die Zeit lang wurde, blies er sich ein Stück auf dem Pfeifchen.
Da stand plötzlich wieder das graue Männchen vor ihm und sprach »Eile, eile! Was streichst du hier herum und pfeifst? Es ist schon ein ganzer Monat verflossen, seit du die Prinzessinnen erlöst hast, und heut sollen deine Kameraden mit ihnen getraut werden, die Hochzeitsgäste sind schon versammelt. Komm, halte dich an meinen Rockzipfel, so will ich dich hinauf tragen.«
Der Tambour faßte den Zipfel an, und das graue Männchen flog mit ihm durch die Luft und brachte ihn so wieder hinauf auf die Erde. Es zeigte ihm noch den Weg zum Königsschloss, und dahin lief nun der Tambour so rasch er konnte, kam auch noch zu rechter Zeit an und mischte sich unter die Dienerschaft. Als die Suppe aufgetragen wurde, warf er den Ring in den Teller der jüngsten Prinzessin; und kaum erblickte sie das Gold, so sprang sie freudig auf und rief ihrer Schwester zu »Unser Erlöser ist da, nun sind wir gerettet.«
Da trat der Tambour hervor, und sie küßten sich, und er erzählte wie er von seinen Kameraden betrogen worden war und durch welche List er sich gerettet hatte. Die falschen Kameraden wurden zur Strafe für ihre Untreue ins Gefängnis geworfen und bekamen nie wieder einen Sonnenstrahl zu sehen. Der Tambour aber wurde mit der jüngsten Prinzessin vermählt und lebte lange Zeit glücklich mit ihr.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE BEIDEN BRÜDER ...

Ein König hatte zwei Söhne, und die waren so wunderschön, wie man noch nie Kinder gesehen hatte. Sie waren Zwillingsbrüder und glichen einander aufs Haar, so daß die Eltern selbst sie nicht hätten unterscheiden können, wenn sie nicht gleich bei der Geburt dem, welcher eine halbe Stunde früher zur Welt gekommen war, ein Band um den linken Arm gebunden hätten. Auch gingen sie immer gleich gekleidet; und als sie herangewachsen waren, gab der Vater jedem ein Roß und einen Jagdhund, und die Rosse und Hunde glichen sich so vollkommen wie ihre Herren und waren auch in einer Stunde von einer Mutter geboren.
Nun sprach der ältere Sohn eines Tages: »Vater, das Schloß ist mir zu eng; ich muß hinaus ziehen und mir die Welt besehen. Hier im Garten will ich eine Lilie pflanzen, an der kannst du stets sehen wie es mir geht. Wenn sie aufrecht steht, bin ich gesund; wenn sie sich neigt, bin ich in Not, und wenn sie verwelkt, bin ich tot.«
Er pflanzte die Lilie und ritt dann, von seinem Jagdhunde begleitet, manche hundert Meilen, bis er in eine Stadt kam, in der alles festlich geschmückt war und auf allen Straßen viele stattliche Ritter hin und her zogen. Da kehrte er in einem Gasthaus ein und hörte dort daß in einer Stunde ein großes Turnier vor dem König und seiner Gemahlin gehalten werden sollte, und wer im Turniere Sieger bleibe, der bekomme des Königs einzige Tochter und das ganze, große Königreich.
Und er dachte, hier gelte es seine ritterlichen Künste, die er daheim gelernt hatte, zu versuchen, ritt zum königlichen Schloß und sah auf dem Balkon ein schönes Mädchen stehen. Er schlug sein Visier zurück und grüßte freundlich. Da tat das Mädchen einen hellen Schrei und sprang ins Zimmer. Es war aber die Königstochter gewesen und sie war über seine Schönheit so erschrocken.
Sie eilte zu ihrem Vater und bat ihn: »Wenn der junge Ritter, der eben in den Hof reitet, mit turnieren will, so tu mir es zu Liebe und weis ihn ab. Der Ritter Wolf tötet ihn sonst, und er ist so schön! und wenn er tot ist, geh ich ins Kloster und will keine Königin werden.«
Der alte König lachte und ging dem Ritter, der unterdessen die Treppe herauf gestiegen war, freundlich entgegen, führte ihn in einen großen Saal, wo sich die Ritter, die an dem Turniere Teil nehmen wollten, alle versammelten; und sie zechten, bis der Herold das Zeichen zum Aufbruch gab.
Den jungen, fremden Ritter aber, der noch so zart aussah, und von dem niemand wußte daß er ein Königssohn war, blickte mancher Alte höhnisch über die Achseln an; und der übermütige Ritter Wolf, welcher die Perle des Rittertums hieß und sich im Voraus als des Königs Nachfolger betrachtete, klopfte ihm, als sie die Treppe hinuntergingen, auf die Schulter und sprach lachend:
»Was ihr für zarte Wänglein habt! Hat eure Frau Mutter euch gestern oder vorgestern das Rößlein geschenkt?« Das hörte der junge Königssohn schweigend an, schwang sich aufs Roß und sprengte auf den Kampfplatz.
Der Ritter Wolf stach alle Gegner im Turniere nieder, wenn er sie nur mit der Lanze berührte, flogen sie, wie vom Winde geweht, weit über das Roß hinaus auf den Sand. Doch als er mit dem Königssohne zusammen ritt, zersplitterte die Lanze des einen an des anderen Panzer; beide Reiter aber rückten sich nicht im Sattel.
Sie stiegen hierauf von den Rossen und gingen mit den Schwertern aufeinander los; und sie fochten wohl drei Stunden lang, bis der Königssohn dem Ritter Wolf das Schwert durch den Panzer mitten ins Herz stieß. Da war des Ritters Freude in den Brunnen gefallen, und er konnte sehen ob man ihn im ewigen Leben zum Könige machen wollte.
Die Königstochter trat nun aus der Mitte der Frauen, welche dem Turniere zugeschaut hatten, und der junge Ritter kniete vor ihr nieder. Sie aber hob ihn auf und küßte ihn als ihren lieben Bräutigam. Und noch an dem selben Tage wurde die Hochzeit gefeiert, und eine ganze Woche lang folgte ein Fest auf das andere. Daheim aber gingen die Eltern des jungen Königs und sein Bruder täglich zur Lilie, und sie freuten sich daß sie immer frischer zu blühen anfing.
Als die Feste zu Ende waren, sprach der junge König »Ich habe nun ein schönes Weib und ein großes Reich gewonnen. So will ich ausziehen das Land zu beschauen, und ich will heut mit den Wäldern anfangen und eine Jagd halten.« Und er zog mit seinen Jägern hinaus in den Wald. Sie trafen viele Hirsche, Rehe, Eber und anderes Wild, doch lange keinen Hasen, bis ihnen endlich einer entgegensprang, der nur drei Beine hatte, aber doch so schnell wie andere Hasen lief.
Weil dem jungen Könige dies wunderbar schien, rief er seinen Jagdgesellen zu, er wolle den Hasen allein jagen, und setzte ihm nach durch das Dickicht, bis sich sein Pferd vor einer Felsgrotte zurück bäumte. In die Grotte war der Hase gesprungen, und in dem selben Augenblicke hinkte ein altes, gebücktes Mütterchen daraus hervor, das war sehr häßlich, hielt die rechte Hand unter der Schürze und sah keifend an dem Könige empor.
»Was? willst du mir meinen Sohn totstechen?« rief sie, zog schnell die Hand unter der Schürze hervor und gab ihm einen Schlag mit einer Rute, die sie in der Hand hielt. Da war er augenblicklich in Stein verwandelt. Dann berührte sie auch das Roß und den Hund mit der Rute, und auch diese verwandelten sich in Stein; denn die Rute war eine Zauberrute, die Alte aber war Ritter Wolfs Mutter und war eine Hexe, die so den Tod ihres Sohnes gerächt hatte. Einige sagen, der dreibeinige Hase sei ihr Sohn Wolf gewesen; doch weiß man das nicht genau.
So stand der junge König mit seinem Ross und Hund als weißer Alabaster im Walde. Und als seine Eltern daheim am anderen Morgen zur Lilie kamen, war sie umgefallen: sie grünte noch, doch ließ sie sich nicht vom Boden aufrichten. Daran sahen sie, daß ihrem Sohne in der Fremde ein groß Unglück widerfahren war; und der jüngere Prinz sprach:
»Ich will ausziehen und meinen Bruder suchen, und will auch eine Lilie pflanzen, an der ihr sehen könnt wie es mir geht.« Er pflanzte die Lilie neben die seines Bruders und zog ins weite Land. Lange suchte er vergeblich eine Spur des Bruders, bis er einst bei einem Wirt einkehrte, der ihn als einen alten Bekannten empfing und fragte wie es ihm ergangen sei, seit er das erste Mal des Weges gekommen.
Da erkannte er, daß ihn der Wirt für seinen Bruder hielt, weil er diesem in allem glich; und er erkundigte sich wohin sein Bruder damals gezogen sei und schlug den selben Weg ein. So verfolgte er die Spur immer weiter, bis er in die Stadt kam, in welcher der Bruder zum Könige gekrönt war.
Da ging ihm das Volk mit großem Jubel entgegen und führte ihn zum königlichen Schlosse; und er dachte: »Ich will mich nur für meinen Bruder ausgeben, so kann ich ihn vielleicht besser retten« und ließ sich im Schlosse von der jungen Königin mit vielen Küssen empfangen. Und sie machte ihm Vorwürfe, wo er so lange gewesen sei; doch er erzählte ihr, er habe sich im Walde verirrt und nicht eher den Weg wieder gefunden.
Am Abend aber legte er sich in voller Rüstung ins Bett, und zwischen sich und sie streckte er ein blankes, zweischneidiges Schwert. Und als sie ihn erschrocken fragte was das bedeuten solle, tröstete er sie, daß er ein Gelübde getan habe und ihr später alles erzählen wolle.
Am folgenden Morgen stand er heimlich auf, als die junge Königin noch schlief, nahm ein stattliches Jagdgefolge mit und zog hinaus in den Zauberwald, aus dem sein Bruder, wie er gehört hatte, nicht heimgekehrt war. Und im Wald war alles wieder eben so, wie damals, als sein Bruder darin gejagt hatte. Lange stöberten die Hunde vergeblich nach einem Hasen, bis endlich der dreibeinige daher hupfte.
Und der junge Prinz bekam wie sein Bruder Lust ihn allein zu jagen und hetzte ihn durch Gehege und Bruch, bis sein Rößlein vor der Grotte im Felsen zurück schnob, und das gebückte Mütterchen, die rechte Hand unter der Schürze, heran hinkte. »Was?« keifte sie wieder, »willst du meinen lieben Sohn ermorden?« und zog eilig die Rute hervor und schwang sie auf den Prinzen.
Er aber hatte schon das steinerne Bild seines Bruders gesehen und hieb ihr mit einem Streich den Arm bis zum Ellenbogen ab, trat mit dem einen Fuß auf die Rute und mit dem anderen stieß er die Alte nieder und drohte sie mit dem Schwerte zu erstechen, wenn sie seinem Bruder nicht gleich das Leben wieder gebe.
Da zog sie eine Büchse aus ihrem Busen und sagte, dies sei die Salbe des Lebens; er solle sie nur aufstehen lassen, so wolle sie seinen Bruder wieder lebendig machen. Er ließ sie frei, und sie trippelte zu dem steinernen Hunde, sah sich aber immer nach der Rute um, ob sie die nicht noch bekommen könnte; doch der junge Prinz ließ kein Auge von ihr.
Da nahm sie etwas Salbe aus dem Büchschen und bestrich dem Hunde beide Schläfen damit, und sogleich sprang er fröhlich herum und bellte und spielte mit seinem Bruder, dem Jagdhund des Prinzen. Dann bestrich sie die Schläfe des Pferdes und zuletzt die des Reiters; und auch das Pferd und der Reiter begannen sich lustig zu regen und waren frisch und gesund wie zuvor.
Da umarmten und küßten sich die beiden Brüder; die Hexe aber stachen sie tot, damit sie niemand mehr ein Leid antun könne. Der ältere Bruder fragte nun den jüngeren wie er es angefangen habe ihn zu erlösen. Und der junge Prinz erzählte alles, wie es geschehen war; wie die alte Hexe mit der Salbe des Lebens die Steine bestrichen habe, und auch wie er in der Stadt von allen für den König gehalten worden sei, und wie er mit der jungen Königin in einem Bette geschlafen.
Wie das sein Bruder hörte, geriet er in Zorn und stach ihm das Schwert mitten durchs Herz. Und damit das Pferd und der Jagdhund nicht verrieten wo ihr Herr geblieben sei, stach er sie auch tot. Er ritt nun heim und wurde von der Königin aufs Lieblichste empfangen, und als er sich Abends auskleidete, lachte sie und sprach:
»Gott sei Dank, das dein Gelübde zu Ende ist. Gestern gingst du in der Rüstung zu Bett und legtest ein Schwert zwischen uns, daß ich glaubte, du würdest mich in der Nacht erstechen; doch heut bist du wieder so lieb und gut wie zuvor.« Da war es dem Könige als ob auch ihm Jemand ein Schwert durchs Herz stieße; denn er erkannte wohl wie ehrlich sein Bruder an ihm gehandelt hatte, und er bereute seinen Mord herzlich und weinte die ganze Nacht.
Als die Eltern aber am Morgen darauf zu den Lilien gingen, stand die des älteren Bruders wieder aufrecht und blühte frisch, doch die des jüngeren war verwelkt.
Am Morgen, als sich der junge König recht ausgeweint hatte, fiel ihm die Erzählung seines Bruders ein, daß die Hexe mit der Salbe des Lebens ihm und den Tieren die Schläfe bestrichen habe. »Vielleicht« dachte er »hilft es bei deinem Bruder auch« und ritt in den Wald hinaus, suchte das Salbenbüchschen und bestrich zuerst dem Hunde des Bruders die Schläfe, und der Hund sprang auf und war gesund.
Nun bestrich er sie eilig auch dem Pferde und dem Prinzen, und beide regten sich und schauten ihn fröhlich und gesund an. Da bat er seinen Bruder um Vergebung daß er ihn ermordet hatte, und sie versöhnten sich und ritten zusammen in die Stadt. Alles Volk aber und die Königin selbst staunte, als sie kamen, und niemand wußte wer der König sei und wer der fremde Prinz, bis sich der König zu erkennen gab.
Es wurde nun für seine Errettung ein großes Fest gefeiert, und der Prinz blieb ein ganzes Jahr bei dem König. Dann zog er heim und erzählte seinen Eltern alles; und sie freuten sich sehr und schenkten ihm ihr Königreich.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
VOM JUNGEN GRAFEN, DER SEIN GLÜCK SUCHEN GING ...
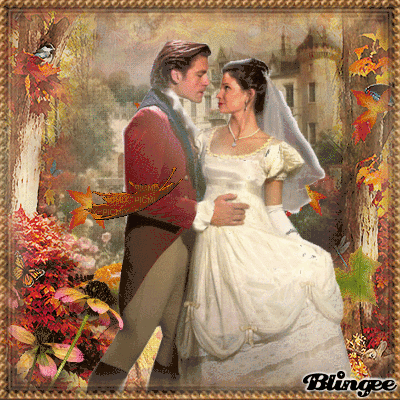
Ein Graf war krank, und alle Ärzte der Welt konnten ihm nicht helfen. Und weil er ohnehin nicht reich war, kam er durch die Krankheit immer mehr in Armut, und sein junger Sohn kannte die vollen Humpen nur aus den alten Büchern; denn seines Vaters Keller waren längst leer.
Da sprach einst die Gräfin »Lieber Sohn, ich freue mich, wenn ich dich sehe; doch du verlebst deine Jugend hier nicht wie du solltest. Ich und dein Vater, als wir jung waren, lachten, spielten und tanzten den ganzen Tag; doch du siehst in unserer Einsamkeit nur Jammer und Not. Willst du meinem Rat folgen, so ziehe hinaus in die Welt und suche dein Glück. Wer weiß was dir bestimmt ist. Die Welt ist groß, und es hat schon Mancher in ihr Etwas gefunden, wovon ihm an der Wiege nichts gesungen war.«
Und weil dem jungen Grafen der Rat gut schien, verkauften seine Eltern ein Stück Land und gaben ihm hundert Thaler, damit machte er sich auf den Weg und zog in die Welt sein Glück zu suchen. Er wanderte aber immer weiter und weiter, wohl über tausend Meilen, und sein Geld ging zu Ende, doch sein Glück hatte er noch nicht gefunden.
Da kam er in eine große Stadt und hatte nur noch einen Heller: dafür kaufte er sich ein Stück trockenes Brot, und da es grade Sonntag war und die Glocken läuteten, ging er in die Kirche und betete recht inbrünstig zu Gott, daß er ihm helfen möge.
Hinter ihm stand ein alter Arzt, der hörte sein Gebet und sah wie abgezehrt sein Gesicht war; und als sie aus der Kirche gingen, trat er zu ihm und fragte wer er sei und wohin er ziehe. Der Graf antwortete, er sei armer Leute Kind und ausgezogen sein Glück zu suchen; doch er finde es nicht.
Da nahm ihn der Alte, der ein liebreicher Mann war und keine Kinder hatte, mit in sein Haus und hielt ihn wie seinen Sohn. Mit guten Speisen und Arzneien brachte er ihn bald so weit, daß ihm niemand die Not, die er auf der Reise erlitten hatte, mehr ansah; und nun unterrichtete er ihn in den ärztlichen Künsten, und der junge Graf zeigte so großes Geschick dazu, daß er bald berühmter als sein Lehrmeister war, und der Tod in dem Lande alle Kundschaft verlor.
Jedermann schickte nach dem jungen Doktor; und so kam er einst auch in ein benachbartes Königreich zu einem Grafen, aus dessen Fenstern er eine Burg sah, die ganz in Nebel gehüllt war.
Als er fragte wem die Burg gehöre, erzählte man ihm, es sei dies ein verzaubertes Schloß, und vor vielen hundert Jahren habe eine Prinzessin darin gewohnt, der das ganze Land untertänig war; sie sei jung und über Alles schön gewesen, doch sei sie mit ihren Rittern und Knappen und mit allem Hofgesinde verwünscht worden und gehe nur noch in der Nacht von elf bis zwölf in der Burg umher.
»Wer die Prinzessin erlöst« sagten die Leute, »den nimmt sie zum Gemahl und macht ihn zum Könige des Landes; doch er muß zuvor drei Proben bestehen, und die sind so schwer, daß Jeder, der sich noch daran gewagt hat, schon bei der ersten gestorben ist.«
Wie der junge Graf das hörte, dachte er »Zeitlebens Salben streichen und Latwergen eingeben ist ein hartes Brot. Wer weiß ob mir nicht ein größer Glück beschert ist als ich schon gefunden habe, und wenn ich sterbe, was ist es? sterben muß ich doch einmal; darum kann ich mein Leben wohl für ein Königreich aufs Spiel setzen.«
Und als es Abend wurde, ging er den Berg hinan auf das Schloß und klopfte an das Tor. Ein alter Kastellan, der auch mit verwünscht war, machte ihm auf und fragte was er wolle. Der Graf sprach »Die verwünschte Prinzessin will ich erlösen.«
Da fing ihn der Kastellan freundlich zu warnen an und sagte »Ihr seid ein so schmuckes junges Blut; o kehrt um und erspart eueren Eltern den Gram, daß ihr früher stürbet als sie. Ihr könnt die Proben nicht bestehen. Da ist schon Mancher hergekommen, der wohl dreimal so alt und so stark war wie ihr; doch keiner ist wieder weggegangen.«
Und er führte ihn in eine Kammer; in der standen viele offene Särge, in denen junge und alte Männer lagen, und ein Sarg war leer. »Seht« sprach der Alte, »dieser Sarg ist für den bestimmt, welcher das nächste Mal die Proben bestehen will und nicht kann. Hier herein kommt ihr, wenn ihr nicht umkehrt.« Der Graf aber blieb fest, er wollte es wagen.
Da führte ihn der Kastellan eine breite marmorne Treppe hinauf in ein Zimmer das war prachtvoll erleuchtet und glänzte über und über von Gold und Edelstein. Und vier Diener brachten herrliche Speisen und den schönsten Wein, und der Graf setzte sich an den Tisch, aß und trank und meinte nie ein so gutes Mahl gehalten zu haben.
Kaum war er fertig, so schlug es elf, und herein trat eine ganz verschleierte Jungfrau. Sie grüßte ihn freundlich, doch mit wehmütigem Tone, und sagte »Du bist gekommen mich zu erlösen, so sei denn stark: du kannst es, doch darfst du kein Wort sprechen und dich mit keinem Schlage wehren, was dir auch geschieht. Nur drei Wochen noch kann ich erlöst werden; wenn unterdessen mein Erretter nicht kommt, so muß ich wieder hundert Jahre durch das Schloß wandern, ohne daß mir Jemand helfen könnte, wenn er die Proben auch bestünde.«
Damit ging sie hinaus, und aus den vier Ecken des Zimmers traten vier ungeschlachte, breitschultrige Männer; die packten ihn, drückten ihn zu einem Knäuel zusammen und warfen ihn einander zu, spielten Fangball mit ihm. Und oft, wenn sie es beim Fangen versahen, stürzte er zu Boden; doch sie hoben ihn lachend wieder auf und spielten weiter. Das trieben sie bis es zwölf schlug, da waren sie plötzlich verschwunden.
Der junge Graf aber lag halb tot am Boden und konnte kein Glied regen. Da hörte er Etwas auf der Treppe poltern und als die Tür aufging, war es der Kastellan mit den vier Dienern, welche den leeren Sarg getragen brachten. Als sie nun sahen daß der Graf die Augen aufschlug, ließen sie vor Verwunderung den Sarg fallen, und der Kastellan stürzte auf ihn zu und rief:
»O lieber Herr, mit euch ist Gott, daß ihr noch lebt. Wenn Einer uns erlösen kann, so seid ihr es; denn ihr habt ausgehalten was noch keiner ausgehalten hat. Alle, die noch bis um zwölf im Schlosse waren, haben wir um eins in den Sarg gelegt; doch ihr habt schon die erste Probe bestanden: jetzt nur noch zwei, so sind wir alle gerettet.«
Und die Diener sangen und sprangen im Zimmer herum, und sie flogen die Treppe hinab, holten einen köstlichen Balsam und gaben dem Grafen einen Schluck davon. Da fiel er in einen tiefen Schlaf und lag bis zum folgenden Mittag wie tot, dann wachte er auf und war ganz gesund, und es schien ihm als sei er stärker als zuvor.
Als es in der zweiten Nacht elf schlug, kam wieder die verwünschte Prinzessin, und diesmal ging ihr der Schleier nur noch bis unter die Augen. Dem Grafen zitterte das Herz, als er ihr lockiges, goldgelbes Haar und die klaren, lieblichen Augen sah; und wie sie sprach, war ihre Stimme schon nicht mehr so traurig wie den Tag vorher.
Sie dankte ihm, daß er die erste Probe so mutig bestanden hatte und sagte: »Du wirst heut noch mehr erleiden müssen als gestern, doch fürchte dich nicht, sie haben nur in der einen Stunde Gewalt über dich; und wenn du die dritte Probe bestanden hast, mache ich dich zu einem reichen, reichen Könige.« Und kaum war sie hinaus gegangen, so stürzte ein Löwe herein und auf den Grafen zu, als wollte er ihn zerreißen. Doch da der Graf still sitzen blieb und sich nicht wehrte, ging er langsam und knurrend wieder zur Tür hinaus.
Nun kamen acht Männer und hieben mit Knütteln auf den Grafen ein, daß ihm, knick knack! ein Glied nach dem anderen zerbrach, Arme und Beine, Brust und Kopf, dann ballten sie ihn zusammen und warfen ihn in die Höhe, und wenn er herunter kam, schnellten sie ihn immer wieder hinauf und trieben dies bis zum Schlage zwölf, mit dem sie verschwanden. Nun eilte der alte Kastellan wiederum mit seinen Dienern herbei, und sie gaben dem Grafen zwei Schluck von dem Balsam; und wieder versank er in den heilenden Zauberschlaf und war, als er aufwachte, gesund und stark.
Als in der dritten Nacht die Prinzessin kam, war sie schon bis zum Kinn entschleiert, und ihr Gesicht war so wunderschön, daß der Graf auf sie zuging und sie küssen wollte. Doch sie winkte ihm, daß er sie nicht anrühren solle, und sprach (und ihre Stimme klang weit fröhlicher als früher):
»Noch mußt du die dritte und schwerste Probe bestehen, doch sei unbesorgt; und wenn sie dich auch in Stücke hauen, sobald es zwölf schlägt, bin ich frei und habe Macht dich aus dem Tode zu erwecken, und dann wollen wir, bis wir sterben, fröhlich bei einander bleiben.«
Sie ging hinaus, und es kamen zwölf Männer mit Messern und Beilen und hieben ihm ein Glied nach dem anderen ab; doch er sprach kein Wort und wimmerte nicht einmal. Und als sie ihn ganz in kleine Stücke gehauen hatten, warfen sie die selben in ein Faß und verschlossen es fest. Da schlug es zwölf. Die Prinzessin eilte in das Zimmer, machte das Faß auf, und der Graf sprang gesund und unversehrt heraus und war weit schöner als je zuvor.
Vor ihm aber stand die Prinzessin in königlichen Gewändern, und sie war so wunderhold wie keine Frau vor ihr und nach ihr; und sie fiel ihm um den Hals und sagte, nun sei sie erlöst und sei seine liebe Braut, lachte und weinte und gab ihm einen herzlichen Kuß.
Als nun auch er sie zu küssen anfing, da hörte man Sporen und Schwerter die Treppe herauf klirren, und herein traten wohl hundert stattliche Ritter, die silberne Panzer und goldene Helme trugen; und sie ließen sich vor dem jungen Grafen nieder auf die Knie, begrüßten ihn als ihren Herrn und als König des Landes und erzählten, sie alle seien verwünscht gewesen und nun durch ihn erlöst.
Und wie sie noch sprachen, traten eben so viele schöne Frauen herein; die gingen alle in Samt und Seide und knieten vor dem Grafen nieder wie die Ritter: und dann kamen die Kammerjunker und Kammerjungfern, die Köche und Kellner, Jäger und Kutscher, und alle dankten dem Grafen für ihre Erlösung.
Unterdessen war es Morgen geworden, und die Prinzessin führte ihren jungen Gemahl ans Fenster, wies mit der Hand hinaus und sprach »Sieh, dies Alles ist dein.« Als er hinausblickte, war der Nebel, der früher das Schloß umgab, verschwunden, und vor ihm lagen reife Ährenfelder, grüne Wälder und dazwischen Hügel, Dörfer und Städte.
Und wie er so mit der Prinzessin am Fenster stand, da neigten sich die weiten Ährenfelder vor ihnen, und dann begannen die Wälder sich wie grüßend zu bücken, und zuletzt verneigten sich auch die Hügel und Berge. Nun lebten sie ein ganzes Jahr in großem Glück. Da fiel dem jungen König sein kranker Vater ein und seine liebe Mutter, und er bat seine Gemahlin um Urlaub, er wolle seine alten Eltern besuchen.
Sie steckte ihm einen Ring an den Finger und hieß ihn den auf der Reise immer ansehen, damit er sie nicht vergäße, und sagte ihm auch, er solle immer gradaus reiten und in keinen Weg, der rechts oder links abginge, einlenken, so werde er sicher zu seinen Eltern kommen; der Ring aber werde bei Nacht leuchten, daß er den Weg immer sehen könne. Und sie gab ihm und seinen beiden Knappen Rosse, die nie müde wurden, und mit denen sie Tag und Nacht ritten.
Als sie nun hundert Meilen geritten waren, führte ein Weg rechts in ein schattiges Gehölz; auf dem graden Wege aber schien die Sonne sehr heiß. Der Knappe zur Rechten sprach darum »Laßt uns den Schatten mitnehmen: wir kommen doch wieder auf den rechten Weg und erfrischen uns ein wenig.« Der König aber wollte den graden Weg nicht verlassen.
Da sprach der Knappe »So will ich allein durch das Holz reiten und am Ende auf euch warten, ich komme doch rascher hin als ihr.« Kaum aber war der Knappe eine Weile fort, so hörte ihn der König um Hilfe rufen, und als er nach der Gegend hin ritt, sah er daß der Knappe unter Räuber gefallen war, die ihn tot schlugen und mit seinen Kleidern und seinem Rosse davon ritten. Da erkannte der König wie gut sein Weib ihm geraten hatte.
Und als er mit dem anderen Knappen wieder hundert Meilen geritten war, ging der gerade Weg über einen Berg; links aber zog sich ein liebliches Tal um die Höhe. Und der Knappe zur Linken sprach »Wir wollen durch den Grund reiten, so werden wir nicht so müde und kommen doch noch früher wieder auf den rechten Weg.« Der König aber wollte nicht.
Da sagte der Knappe »So will ich allein reiten und auf der anderen Seite des Berges auf euch warten.« Doch kaum war er eine Strecke geritten, so hörte ihn der König schreien und wimmern, und als er nach ritt, fand er daß der Knappe in eine Löwengrube gefallen war und von den Löwen zerrissen wurde. Nun ritt der junge König Tag und Nacht allein weiter auf dem graden Wege und kam glücklich zu seinen Eltern.
Die wunderten sich als sie den stattlichen Ritter in ihr Schloß reiten sahen. Er aber sagte ihnen daß er ihr Sohn und nun ein mächtiger König sei, und dem Vater, der immer noch krank war, gab er eins von seinen guten Pulvern und machte ihn gesund damit. Und er führte seine Eltern heim zu seinem jungen Weibe, und dort lebten sie alle vier herrlich und in Freuden.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
EIN ANDERES MÄRCHEN VON EINEM GRAFENSOHN ...
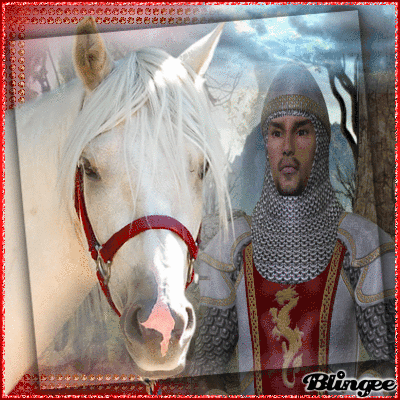
Vor vielen Jahren lebte ein Graf, der sehr reich und doch nicht glücklich war; denn es fehlte ihm ein Sohn, der einst all seine Reichtümer hätte erben können. Da ging er denn oft traurig in seinem Park umher, und als er einst auch wieder über sein Unglück nachdachte, stand plötzlich ein altes graues Männchen vor ihm und fragte ihn weshalb er so betrübt sei.
»Ach« sprach der Graf, »du kannst mir nicht helfen. Ich bin der reichste Mann im Lande, und doch fehlt mir eins; und weil ich das mit allen Schätzen nicht erkaufen kann, muß ich wohl betrübt sein.« Da lachte das graue Männchen und sprach »Ich weiß wohl, ihr wünscht euch einen Sohn. Den will ich euch schenken, wenn ihr gelobt mir dafür nach vierzehn Jahren das zu geben, was euch dann das Liebste sein wird.«
Das gelobte der Graf, und es verging kein Jahr, so bekam die Gräfin einen allerliebsten kleinen Knaben; der wuchs so schnell heran und war so klug, daß sich seine Eltern nicht genug über ihn freuen konnten. Doch als er ins vierzehnte Jahr kam, da fiel es dem Grafen schwer aufs Herz daß sein Sohn das Liebste sei, was er habe, und daß ihn das graue Männchen fordern werde. Und wie er dachte, so geschah es.
Am Geburtstag des Knaben kam das graue Männchen, erinnerte den Grafen an sein Versprechen und verlangte den Sohn. Da war der Vater ganz untröstlich; doch der junge Graf sprach ihm Mut ein und sagte, er fürchte sich nicht und hoffe wohl durch die Welt zu kommen und den Weg zu seinen lieben Eltern zurück zu finden.
Und auch das graue Männchen sprach »Grämt euch nicht so sehr. Wenn euer Sohn hübsch folgsam ist, wird es ihm bei mir an nichts fehlen, und er wird noch einst zu großen Ehren kommen.« Damit nahmen sie Abschied, und das Männchen führte den Knaben in einen Wald.
Sie waren noch nicht lange gegangen, so kamen sie in ein verfallenes Schloß. Da führte der Alte den Knaben in allen Gängen und Kammern umher und gab ihm auch eine Stube, in der er wohnen sollte. Als sie nun acht Tage hier friedlich mit einander gelebt hatten, sprach das graue Männchen eines Abends »Nun wirst du wohl einmal allein bleiben und haushalten können; denn ich muß auf einige Tage über Land.
Ich erlaube dir im Schloß und Garten überall hinzugehen außer in den Pferdestall und an den Brunnen im Garten. Hüte dich wohl da nicht hinein zu sehen; denn es würde dein Leben kosten.« Das graue Männchen ging weg, und um sich die Zeit zu vertreiben besah der Knabe am ersten Tage noch einmal alles im Schlosse, im Hofe und Garten genau; doch am zweiten Tage fing ihm die Zeit schon lang zu werden an, und am dritten dachte er »Es müßte doch hübsch sein, wenn du auch in den Pferdestall und den Brunnen sehen dürftest.«
Am vierten Tage ging er lange in tiefen Gedanken vor dem Pferdestall auf und ab und schielte immer von der Seite nach der Tür hin; doch plötzlich sprang er hastig darauf zu, riß die Tür auf, und vor ihm stand ein Pferd und ein Löwe.
Aber vor dem Löwen lag Heu auf der Raufe und vor dem Pferd Fleisch. »Ach wie gut« dachte der Knabe, »daß ich aufgemacht habe; sonst hätten die armen Tiere beide verhungern müssen. Was für ein Thor mag ihnen das Futter gebracht haben! Nicht einmal zu wissen daß die Löwen kein Heu und die Pferde kein Fleisch fressen!«
Und er sprang zur Raufe, gab dem Löwen das Fleisch und dem Pferd das Heu und ging dann aus dem Stall und machte die Tür vorsichtig wieder zu. Nun schlich er zum Brunnen, und als er nur noch drei Schritt davon war, stellte er sich auf die Zehen und wollte so hinein sehen; doch da er nichts sah, ging er einen Schritt näher und dann noch einen, und zuletzt bückte er sich über den Brunnen. Es war aber ganz finster darin.
Da hielt er den Finger hinein, und als er ihn wieder heraus zog, glänzte der Finger ganz golden. Darüber erschrak der Knabe sehr, und er wollte das Gold abwischen, aber es blieb daran, er holte ein Messer hervor und wollte es abschaben; doch wie auch das Blut aus dem Finger quoll, das Gold ging nicht weg. Unterdessen hörte der Knabe schon das graue Männchen in der Ferne kommen.
Er wickelte schnell ein Stückchen Leinwand um den Finger und war kaum damit fertig, als das Männchen vor ihm stand; und es fragte auch gleich was er mit dem Finger gemacht habe. Der Knabe hatte sich vorgenommen es nicht zu gestehen; doch als er das graue Männchen sah, war es ihm als ob schon alles verraten wäre, und er bat vielmal um Verzeihung daß er in den Pferdestall und den Brunnen gesehen habe und sagte, er wolle es nicht wieder tun.
»Noch einmal will ich dir glauben« sprach der Alte; »doch bist du zum zweiten Male ungehorsam, so mußt du sterben.« Acht Tage darauf ging das graue Männchen wieder weg und gebot dem Knaben noch strenger als das erste Mal nicht an den Brunnen und in den Pferdestall zu gehen.
Die ersten beiden Tage spazierte der Knabe wieder still in dem schönen, großen Garten und im Schloß umher; am dritten aber sah ihn der Pferdestall gar zu freundlich an, und er schlich ganz sacht zur Tür, öffnete sie nur ein Ritzchen und lugte hinein. Doch wie das erste Mal stand der Löwe vor einer Raufe voll Heu und das Pferd vor einem Stück Fleisch.
Da sprang er denn schnell hinein und wechselte das Futter; doch kaum war dies geschehen, so sprach das Pferd »Ach was hast du getan! Nun mußt du sterben, wenn du meinem Rate nicht folgst. Geh schnell zum Brunnen und wasche dir das Haar mit dem Wasser: dann komm und nimm einen Striegel, einen Stiebelappen und eine Kartätsche und setze dich auf meinen Rücken; so will ich dich retten.«
Der Knabe tat wie ihm das Pferd riet, und als er das Haar im Brunnen gewaschen hatte, glänzte es über und über wie Gold. Er kehrte zum Stall zurück, schwang sich auf das Pferd, und es trabte mit ihm zum Schloßtor hinaus. Als es eine Weile gelaufen war, sprach es zu dem Knaben »Schau dich um, ob du das graue Männchen noch nicht siehst: es muß nicht weit von uns sein.«
Und der Knabe erschrak, als er sich umwandte; denn das graue Männchen war nur noch einige Schritte von ihnen entfernt. »Wirf schnell den Striegel hinter dich!« rief das Pferd. Und als der Knabe dies getan hatte, verwandelte sich der Striegel in eine dichte Dornenhecke und versperrte dem Alten den Weg. Doch es währte nicht lange, so rief das Pferd wieder »Schau dich um, ob uns das graue Männchen nicht einholt.«
Und wirklich hatte es sich durch die Dornenhecke hindurch gearbeitet und war dicht hinter ihnen. »Nun wirf die Kartätsche hin!« sprach das Pferd, und gleich wurde daraus ein großer, finsterer Wald. Der Knabe sah sich jetzt immer von Zeit zu Zeit um, und es war kaum eine Stunde vergangen, so rief er »Das graue Männchen kommt! das graue Männchen kommt!« »So wirf den Stiebelappen weg!« sagte das Pferd.
Das tat der Knabe, und nun wallte plötzlich ein langer, breiter See hinter ihnen, und das graue Männchen stand am anderen Ufer und konnte nicht herüber. »Nun bist du gerettet« sprach das Pferd: »darum wollen wir ausruhen. Komm, hier in der Nähe ist ein alter Kalkofen; der soll unsere Herberge sein.«
Als sie einige Tage hier gewohnt hatten, sagte das Pferd »Du hast dich wohl schon von der Reise erholt; darum geh und versuche dein Glück. Nicht weit von hier wohnt ein mächtiger König, der eine einzige Tochter hat und keinen Bräutigam für sie finden kann, weil sie nur einen Mann mit goldnen Haaren heiraten will.
Bei dem Könige vermiete dich als Gärtnerbursche; doch binde ein Tuch um den Kopf, daß man deine goldnen Haare nicht bald sieht: und wenn du in Not bist, komm zu mir, so will ich dir raten.« Der Knabe ging auf das Schloß, und der König nahm den hübschen Burschen gern zum Gärtner an.
Und als nun die Blumen am Schönsten blühten, kam die Prinzessin in den Garten, besah alle Rosen und Nelken und die kleinen Aurikel, und sie fragte ihn auch warum er denn ein Tuch um den Kopf trage. Er aber wollte es nicht sagen. Doch am anderen Morgen pflückte er einen Blumenstrauß, umwand ihn mit einigen von seinen goldnen Haaren und warf ihn der Prinzessin durchs Fenster.
Und kaum hatte sie den Strauß gesehen, so kam sie aus dem Schlosse gesprungen, riß dem Knaben das Tuch vom Kopf und rief »Du bist mein Bräutigam! du bist mein Bräutigam!« und sie küßte ihn tausendmal. Da hörte auch der König bald daß der Gärtnerbursche goldne Haare hatte und daß die Prinzessin ihn heiraten wollte; und er wurde sehr zornig darüber und warf ihn in einen finstern Turm.
Nun dauerte es nicht lange, so brach Krieg aus. Und als des Königs Leute sich rüsteten, vergaßen sie ganz den jungen Grafen im Turm, und er entsprang heimlich. Er ging zu dem Pferde in den Kalkofen, und es freute sich sehr ihn wieder zu sehen und führte ihn durch einen langen Gang in einen Saal, in dem viele Harnische und Schwerter hingen, und sprach
»Hier suche dir eine Rüstung aus.« Und als er die Rüstung angelegt hatte, führte es ihn in einen anderen Saal; in dem standen wohl hundert Pferde, und es gab ihm das schönste davon und sagte »Nun bist du ein Reitersmann; darum zieh in die Schlacht und habe guten Mut, du kannst noch ein großer König werden.«
Als der Graf in die Schlacht kam, war der Vater der Prinzessin schon von den Feinden gefangen; doch er befreite ihn und gewann die ganze große Schlacht. Da freute sich der König, doch er erkannte den Grafen, der weit größer und stärker geworden war, nicht; und weil er sah daß der Graf eine Wunde am Arm hatte, verband er sie mit einem Tuche.
Nun ritt der Graf eilig auf das Schloß des Königs und erzählte der Prinzessin, seiner lieben Braut, daß er die große Schlacht gewonnen und ihren Vater befreit habe. »So wollen wir dem Vater schnell entgegen gehen« sagte sie: und sie faßten sich bei den Händen und gingen auf den Weg, auf welchem der König mit seinen Kriegsleuten heimkehrte.
Als der König den fremden, tapferen Ritter an dem Tuche erkannte und sah daß seine Tochter so freundlich mit ihm tat, fragte er lachend ob er zum Lohn für seine Tapferkeit die Prinzessin zur Frau haben wolle. Da lachte der Graf auch und sprach »Wenn ich nicht der arme Gärtnerbursche wäre, den ihr in den Turm werfen ließet, möchte ich sie wohl.«
Er band den Helm ab, und die langen, goldnen Haare fielen ihm bis auf die Schultern herab und glänzten wie die lichte Sonne. Da standen Alle verwundert, und der König willigte mit Freuden ein daß die Prinzessin mit dem Grafen Hochzeit hielt und gab ihnen das halbe Königreich.
Als nun der Graf drei Jahre mit seiner Gemahlin gar fröhlich gelebt hatte, dachte er an das treue Pferd, dem er all sein Glück verdankte. Er ging in den Kalkofen, und das Pferd kam ihm traurig entgegen und sprach »Ach wie lange bist du geblieben, ich glaubte, du hättest mich in deiner Freude ganz vergessen, und der einzige Wunsch, den ich noch habe, würde mir nicht erfüllt werden.
Ich kann dir jetzt nichts mehr helfen; darum komm und schlage mir mit deinem Schwerte den Kopf ab.« Das wollte der Graf lange nicht tun; da aber das Pferd so wehmütig bat, tat er es endlich. Doch das war ein Erstaunen. Wie der Kopf abflog, stand das schönste Mädchen vor ihm, das er je gesehen hatte; und sie sah ihn so recht freundlich und doch traurig an und sagte:
»Es war bös von dir daß du dem grauen Männchen im verfallenen Schlosse nicht folgsamer warst. Du hättest uns alle erretten können. Ein böser Zauberer hat meinen Vater in das graue Männchen, meinen Bruder in den Löwen und mich in das Pferd verwandelt; und alle hundert Jahre kann ein Knabe zwischen vierzehn und fünfzehn Jahren, der gehorsam ist, uns erlösen. Ich wäre nun deine Frau, und wir lebten alle glücklich in unserm Königreiche. Doch da es anders gekommen ist, muß ich ausziehen und versuchen ob ich vielleicht meinen Vater und Bruder noch von dem Zauber befreien kann, und ich nehme nun für immer Abschied von dir.«
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE BEIDEN RABEN ...
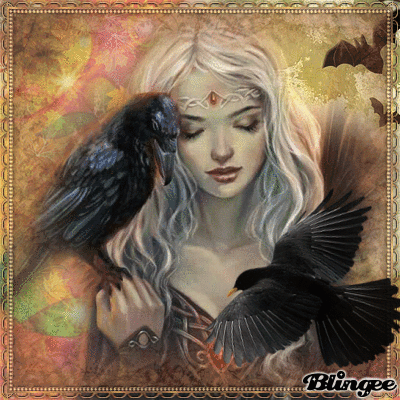
»Ach Mutter, wie hungert uns!« riefen die beiden Söhne einer armen Wittwe, die einen Aschkuchen buk und sie immer vertröstete daß er bald fertig sei. Sie aber riefen immer wieder »Ach Mutter, wie hungert uns!« Da konnte sich die Frau nicht länger halten und sprach im Zorn »So wollt ich doch, daß ihr gleich zu Raben würdet!« Und kaum hatte sie das gesagt so flogen die Söhne schon als Raben zum Fenster hinaus.
Nun saß sie oft traurig und weinte, daß sie ihre Söhne verwünscht hatte. Sie hatte nur noch ein einziges Töchterlein; doch das war ein gutes, frommes Kind, und als es heranwuchs und die Mutter immer betrübt sah, fragte es was ihr fehle. Da erzählte ihr die Mutter »Du hast zwei Brüder gehabt, und die hab ich in Raben verwünscht, als du noch in der Wiege lagst, und darum werde ich bis an meinen Tod nicht wieder froh.«
Doch das Mädchen sprach »Ich will ausziehen und meine Brüder suchen, und wenn ich sie wiederbringe, sollst du eine rechte Freude haben.« Da zog das Mädchen aus und wanderte einen ganzen Tag, und am Abend kam sie in eines Riesen Haus. Der Riese war ausgegangen, und seine Mutter empfing das Mädchen gar freundlich, gab ihm gut zu essen und zu trinken und versteckte es dann unter das Bett des Riesen.
Als der Riese nun heim kam, sah er sich überall um und sprach »Ich rieche, rieche Menschenfleisch.« Doch die Mutter lachte und sagte »Was du doch dumm bist! Ich habe eine Glucke unter dein Bett gesetzt, und du denkst, das ist Menschenfleisch.« Am anderen Morgen ging der Riese wieder aus, und die Mutter holte das Mädchen unter dem Bett hervor, gab ihm ein köstliches Frühstück, und dann wanderte das Mädchen weiter und kam am Abend wieder in ein Riesenhaus.
Da war es grade so wie im ersten. Der Riese sprach wieder »Ich rieche, rieche Menschenfleisch«; doch als er unter das Bett sehen wollte, sprach seine Mutter »Ich habe eine Gans darunter gesetzt: störe sie nicht; sie brütet sonst nicht aus.« Der Riese glaubte es auch, und am Morgen bekam das Mädchen wieder ihr Frühstück und ging weiter über die Berge und Felder; aber am Abend war es nicht anders, sie mußte wieder bei einem Riesen über Nacht bleiben.
Den betrog seine Mutter auch und sprach »Ich habe eine Ente unter dein Bett gesetzt.« Doch es war wieder nicht wahr, sondern das Schwesterlein der beiden Raben lag darunter; aber es war klug, rührte sich nicht und kicherte nicht einmal.
Am vierten Tag nun kam das Mädchen auf einen hohen, hohen Berg, und auf der Spitze des Berges sah sie eine Tür; die hob sie auf und gelangte in ein niedliches Kämmerchen: da standen zwei weiße Bettlein und ein Tisch, und auf dem Tische standen zwei kleine Teller mit Speisen und zwei Becherlein mit Wein.
Und weil das Mädchen seit dem Morgen nichts gegessen hatte, nippte es von Allem, was da war; in den einen Becher aber warf sie den Ring, den sie am Finger trug, und versteckte sich dann unter ein Bett. Nicht lange, so kamen zwei Raben durch das Fenster herein geflogen.
Sie schüttelten sich die Federn ab, und da waren es zwei schöne Jünglinge, die setzten sich an den Tisch. Und als sie aßen, sprachen sie »Wer hat gegessen von meinem Tellerlein?« und als sie tranken, sprachen sie »Wer hat getrunken aus meinem Becherlein?«
Als aber der jüngste Bruder seinen Wein austrank und den Ring im Grunde des Bechers fand, da rief er »Unser Schwesterlein ist da! unser Schwesterlein ist da!« und sie suchten durch die ganze Kammer und fanden sie unter dem Bett. Da gab es denn eine große Freude: und das Schwesterlein erzählte, es sei gekommen um sie zu erlösen.
»Ach« sprachen sie, »das kannst du nicht: das ist viel zu schwer für dich. Wer uns erlösen will, der muß ein ganzes Jahr an einem Hemd nähen und darf kein Wort dabei sprechen; und wenn er nur ein einziges Wort spricht, so ist alle Mühe verloren.« Doch das Mädchen sagte fröhlich »Wenn es nicht mehr ist, so sollt ihr übers Jahr erlöst sein.«
Unterdessen war schon eine Stunde vergangen und die Jünglinge verwandelten sich wieder in Raben und flogen davon. Das Mädchen aber setzte sich in eine hohle Weide und fing an dem Hemd zu nähen an. Nun kam einst ein Jäger des Weges, und als er an der Weide vorbei ging, blieben seine Hunde stehen, schnupperten an ihr herum und waren nicht wegzubringen.
Da holte der Jäger einige Leute aus dem Dorfe und ließ die Weide umhauen, und heraus sprang das schönste Mädchen, das seine Augen gesehen hatten. Doch es sprach kein Wort, wie viel man es auch fragte. Der Edelmann des Dorfes hörte bald von der schönen Jungfrau, und weil er ein Junggeselle war, nahm er sie zur Frau; und eh das Jahr um war, bekamen sie eine hübsche kleine Tochter.
Die Mutter des Edelmanns aber war zornig, daß ihr Sohn das fremde Mädchen geheiratet hatte, das man in einem Weidenbaum gefunden, und das nicht einmal reden konnte. Und als der Edelmann eines Tages ausgegangen war, ließ sie der jungen Frau das Kind wegnehmen, setzte es in einem Kästchen aufs Meer und klagte sie dann bei ihrem Sohne an daß sie eine Menschenfresserin sei.
Das wollte der Edelmann lange nicht glauben; doch da die Mutter auch alle seine Räte bestochen hatte, und sie alle sagten, die Frau müsse sterben, weil sie ihr Kind umgebracht habe, so mußte er zuletzt nachgeben, und die Mutter befahl ihre Schwiegertochter in Öl zu sieden.
Da wurde bald ein mächtiger Kessel mit Öl gefüllt, dürres Holz darunter gelegt und die Frau hineingesetzt und festgebunden. Sie nähte aber immerfort noch an dem Hemd, an dem sie alle Tage des Jahres gearbeitet hatte. Man holte schon das Feuer um das Holz unter dem Kessel anzuzünden: da standen plötzlich zwei Männer auf der Schwelle, und die Frau schrie hell auf vor Freude; denn es waren ihre Brüder, das Jahr war um, und sie waren erlöst.
Nun erzählte sie alles, wie es gekommen war, weshalb sie das Jahr über geschwiegen habe, und wie die böse Schwiegermutter ihr das Kind hatte nehmen lassen. Das Kind aber hatten die Brüder, als sie noch Raben waren, mit dem Kästchen auf ihren Flügeln aus dem Meere getragen, und sie brachten es ihr wieder.
Da weinte der Edelmann und bat sie vielmal um Vergebung, daß er seiner Mutter geglaubt und sie für eine Mörderin gehalten hatte. Und sie vergab es ihm wohl, doch seine Frau wollte sie nicht länger sein, sondern zog mit ihren Brüdern und dem Töchterlein heim zu ihrer Mutter.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
FRAU HOLLE ...
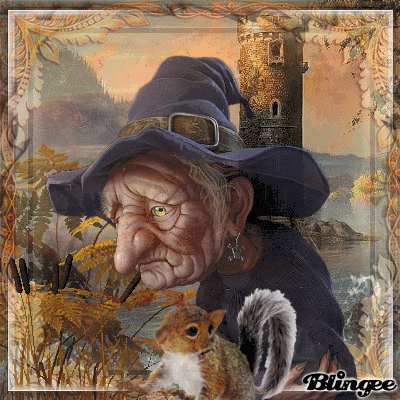
Frau Holle, die man in ganz Thüringen kennt, ist ein kleines, buckliges altes Mütterchen. Sie ist sehr häßlich und spielt den Leuten manchen bösen Streich, besonders wenn sie in den zwölf Nächten spinnen. Sie macht dann, daß die Kühe Blut statt Milch geben, daß das Garn ungleich wird und die Leinwand bald zerreißt.
Man fürchtet sie und spricht nur Gutes von ihr, das Böse flüstert man sich leise zu. Und wenn ein verwegener junger Bursch in der Spinnstube über sie spotten will und eine alte Frau dabei sitzt, springt sie wohl auf, hält ihm den Mund zu und murmelt, indem sie ängstlich nach dem Fenster sieht, »Gott segne uns, wenn sie das gehört hat.«
Frau Holle heißt sie auch im Magdeburgischen und um Naumburg, Weißenfels und Zeiz. Um Wollmirstedt dagegen, so wie um Eisleben (in Amsdorf, Ober- und Unterröblingen, Erdeborn, Helfta, Volkstädt, Helbra) und von da aufwärts nach der Saale zu, in Hedersleben, Dederstedt, Schochwitz, Gorsleben, wird sie allgemein Frau Wolle, in dem eine halbe Meile von Gorsleben dicht an der Saale gelegenen Zaschwitz aber, in Wettin und Beidersee Frau Rolle genannt.
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DER SCHATZ ...
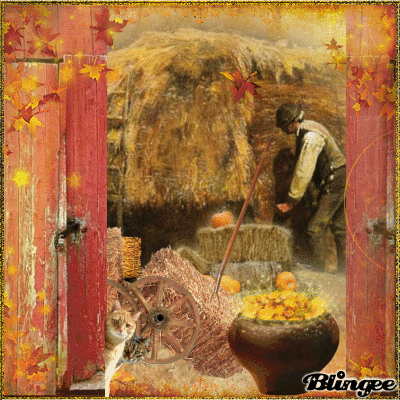
In den alten Zeiten war Vieles besser als heut, doch wer kein Geld hatte, der war auch damals schon übel dran. Davon konnte ein Bursch erzählen; der wäre der glücklichste im ganzen Dorfe gewesen, wenn er seines Nachbars Tochter hätte freien dürfen, doch der Nachbar war sehr reich und so übermütig, daß er seine Tochter Niemand geben wollte, der nicht viertausend Thaler mit in die Wirtschaft brächte.
Und weil der Bursch die nicht hatte, saß er oft einsam und weinte, und seine Liebste half ihm weinen; und sie überlegten oft mit einander wie sie es anfangen sollten die viertausend Thaler zu bekommen, doch es wollte ihnen nichts einfallen. Da legte sich der Bursch einst traurig auf seines Herren Bortenne, und er ahnte nicht daß sein Glück so nahe war.
Denn kaum hatte er eine Weile gelegen, so kam ein Bauer mit einer großen Mulde voll Goldgulden, grub ein Loch in die Tenne und schüttete das Gold hinein. Dann ging er wieder weg, und der Bursch sprang hinab, raffte einige Hände voll Gold zusammen, legte sich wieder in sein Versteck und dachte »Gott wird es vergeben. Er weiß daß ich es gut anwenden will. Ist es doch wahrhaftig besser daß ich damit Hochzeit halte als daß es hier in der Erde umkommt.«
Da kam der Bauer schon wieder und brachte eine zweite Mulde mit Gold; und weil das Loch noch lange nicht voll war, ging er noch mehrere Male und kam mit immer schöneren Goldstücken zurück. Und jedesmal, wenn er weg war, brachte der Bursch etwas von dem Schatze auf die Seite.
Als nun das Loch fast bis zum Rande gefüllt war, deckte es der Bauer mit Erde zu und sprach einen mächtigen Zauber darüber, diesen Schatz solle nur ein Knabe von neun Jahren heben können, der am neunten Tage eines Monats früh um neun Uhr geboren sei, und der müsse auf einem schwarzen Bocke mit weißen Füßen und weißer Blässe auf die Tenne geritten kommen, den Bock über dem Schatze schlachten und sich mit dem Blute besprengen.
Der Bauer ging weg, und der Bursch dachte dem Zauberspruche nicht weiter nach, sondern zählte sein Geld und verwunderte sich selbst, als es grade viertausend Thaler waren, keiner mehr und keiner weniger. Da sprang er denn zu seiner Geliebten und erzählte ihr wie glücklich er gewesen war, und daß sie nun bald seine Frau sein werde.
Er ging zu ihrem Vater, zählte die viertausend Thaler auf und bestellte die Fiedler zur Hochzeit, die schon drei Tage darauf gefeiert wurde. Das junge Paar lebte gar fröhlich; und als ein Jahr vorüber war, bekamen sie einen Sohn, der wurde grade an einem Neunten früh um neun geboren.
Da fiel dem Vater der Zauberspruch des Bauern wieder ein, und er erzählte seiner Frau davon und sagte »Wenn unser Sohn neun Jahr alt ist, suchen wir einen schwarzen Bock mit weißen Füßen und weißer Blässe, heben den Schatz und sind die reichsten Leute im Dorfe.«
Die Frau aber meinte, solch einen Bock würden sie wohl nicht finden. Doch was geschieht nicht alles auf Erden. Als der Knabe neun Jahr alt war, schickten sie im Lande umher und fanden richtig einen solchen Bock, gewannen den großen Schatz, und nun saßen sie nie mehr und weinten über ihre Armut.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
OTTO DER ROTE IM KIFFHÄUSER UND ZU QUEDLENBURG ...
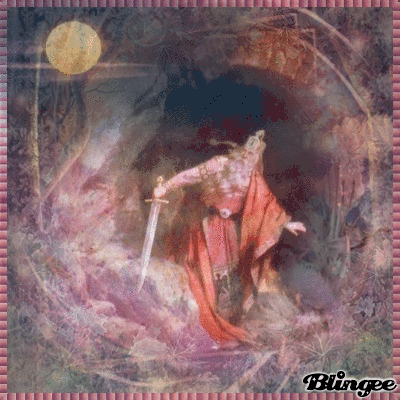
Kaiser Otto mit dem roten Bart geriet mit den Geistlichen in Streit, und da machten ihm die Reichsgeschäfte bald keine Sorgen mehr. Man sagte dem Volk, er sei plötzlich gestorben, und veranstaltete ein feierliches Begräbnis. Doch der Kaiser lag nicht im Sarg, sondern schmachtete in einem Gefängnis. Und als er nach vielen Jahren starb, fand sein Geist keine Ruhe im Grab, sondern irrte lange umher, bis er sich den Kiffhäuser zur Wohnstatt erkor.
Nun zogen einst Musikanten durch das Tal am Kiffhäuser und spielten vor allen Häusern, doch nirgends empfingen sie eine Gabe, so daß sie sich den ganzen Tag vergebens gemüht hatten. Da sprachen sie am Abend »Wir wollen dem Kaiser Otto ein Ständchen bringen, vielleicht schenkt er uns etwas.«
Und sie spielten vor dem Berge das schönste ihrer Stücke auf, und als sie fertig waren, kam des Kaisers Kastellan und überreichte jedem einen grünen Zweig. Die Musikanten aber warfen die Zweige weg und lachten. »Wenn wir nicht mehr hätten verdienen wollen« sprachen sie, »solch kaiserliche Gnade hätten wir auch sonst schon finden können.«
Nur einer steckte sich den Zweig an den Hut und sagte »So habe ich doch ein Andenken an den Kaiser Otto.« Und als sie Abends spät in die Herberge kamen, war der Zweig auf dem Hut des Musikanten zu eitlem Golde geworden, und der arme Musikant war nun für sein Leben ein reicher Mann.
Wie die anderen das sahen, eilten sie zum Berg zurück und suchten im Mondscheine nach ihren Zweigen, doch die Zweige waren verschwunden. Am folgenden Morgen spielten sie wieder vor dem Kiffhäuser und spielten drei ganze Tage hindurch, doch der Kastellan des Kaisers brachte ihnen Nichts zum Dank.
Ein armer Schäfer hatte gehört wie der Musikant durch das Geschenk des Kaisers so reich geworden war, und er trieb nun immer auf den Kiffhäuser und dachte »Wenn ich nur den Weg wüßte, der in den Berg zum Kaiser Otto führt, da er ein so liebreicher, wohltätiger Herr ist, so würde ich ihm meine Armut klagen, und er würde sich gewiß meiner annehmen.«
Und wie er einst auch wieder so bei sich dachte, bemerkte er vor seinen Füßen eine Falltür, die er nie zuvor gesehen hatte. Er öffnete sie und stieg eine lange Treppe in den Berg hinab, bis in einen weiten, hochgewölbten Saal. Dort saß der Kaiser Otto mit seinem langen roten Bart an einem großen steinernen Tisch, und um ihn her saßen viele hundert Ritter und Schildknappen in voller Rüstung.
Schüchtern blieb der Hirt am Fuße der Treppe stehen, doch der Kaiser winkte ihm freundlich und sprach »Ich weiß schon weshalb du kommst. Hier nimm dir so viel du brauchst, und wenn du Heim kommst, grüß dein Weib und deine Kinder von mir.« Und damit wies er auf einen Haufen glühender Kohlen, der in einem Winkel lag.
Der Hirt beugte sich ängstlich über die Kohlen, doch er wagte nicht sie anzurühren. Da lachte der Kaiser und rief »Greif nur zu; es brennt nicht. Doch nimm nicht zu wenig.« »Ja zu wenig!« dachte der Hirt, »wenn nur was zu nehmen wäre. Um Kohlen zu verschenken und arme Leute auszulachen braucht man kein Kaiser zu sein.«
Doch weil er sich fürchtete zu widersprechen, füllte er seine Hirtentasche mit Kohlen, verneigte sich tief vor dem Kaiser und seinen Rittern und Knappen und stieg die Treppe wieder hinauf. Und wie er oben die Kohlen aus der Tasche schütten wollte, war die Tasche voll gediegenen Goldes, und der Schäfer war so reich wie der Musikant; doch die Falltür konnte er nie wieder finden.
Ein andrer Schäfer verlor am Johannisabend seine Herde, die er auf dem Kiffhäuser gehütet hatte. Er lief durch das Gebüsch und hohe Gras sie zu suchen, und dabei streifte er, ohne es zu wissen, mit den Füßen die Wunderblume ab, und sie blieb in seiner Schuhschnalle hängen.
Wer diese Blume, die nur in der Johannisnacht blüht, an sich trägt, der kann die Geister sehen: und wie es nun im Tal elf schlug, war der Schäfer grade dicht unter dem Gipfel des Berges, und er sah wie sich der Berg auftat und der Kaiser Otto mit vielen Rittern heraus stieg. Sie waren gar stattlich anzuschauen und begannen auf dem Berg Kegel zu schieben, und als sie eine Weile geschoben hatten, schmaräkelten sie.
Der Schäfer blieb verwundert stehen und schaute zu. Da schlug es zwölf, und sie stiegen in den Berg zurück, und der Berg schloß sich wieder. Der Schäfer nahm zum Wahrzeichen den König der Kegel und steckte ihn in seine Hirtentasche. Er ging weiter nach seinen Schafen, fand sie auch bald und erzählte nun am Morgen den anderen Hirten was er in der Nacht gesehen hatte. Die aber lachten ihn aus. Da holte er den Kegel aus der Tasche, und wie er ihn ansah, war er ganz von Gold.
Nachdem der Kaiser Otto wohl manche hundert Jahre in dem Berge gehaust hatte, ging er zur Ruh ins Grab, und an seine Stelle zog der Kaiser Friedrich in den Kiffhäuser, der noch dort wohnt. –
Nach Anderen aber soll der Kaiser Otto aus dem Kiffhäuser in das quedlinburger Schloß gezogen sein und noch jetzt in den tiefen Kellern des selben sitzen. Die Magd des Küsters in Quedlinburg wurde einst von einem Geist hinab geführt und sah den Kaiser, der ganz von Golde war und sich nicht regte.
Nach einer alten Wahrsagung soll das quedlinburger Schloß einst abbrennen, dann wird man den Kaiser unter den Trümmern finden und das Schloß mit dem Golde, in das sein Leib sich verwandelt hat, neu und schöner aufbauen; sein Geist aber wird dann Ruhe finden.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
KAISER FRIEDRICH, DIE KÖNIGIN HOLLE UND NAPOLEON ...
Im letzten Kriege kam ein französischer Marschall nach Nordhausen, und wie er die Trümmer der Kiffhäuserburg sah und hörte, daß dies ein verwünschtes Schloß sei, auf dem es bei Nacht niemand Ruhe lasse, rief er im Übermut »So will ich die nächste Nacht dort oben schlafen«; und er hörte auf keine Warnung, sondern ließ sein Feldbett auf dem Kiffhäuser aufschlagen.
Und als es Mitternacht war, sandte der Kaiser Friedrich, der seit undenklichen Jahren im Kiffhäuser wohnt, die Königin Holle hinauf zu dem Marschall und ließ ihm sagen, er möge seinen Herrn, den Kaiser Napoleon, warnen nicht nach Rußland zu ziehen; denn von da werde er nur in Schmach und Not wiederkehren.
Und er möge dem Kaiser verkündigen, wenn er seinen Ruhm lieb habe, solle er Deutschland räumen; denn er, der Kaiser Friedrich, dulde nicht daß sein deutsches Volk den Franzosen untertänig sei: und wenn der Kaiser Napoleon diese Mahnung nicht höre, werde er in Jammer und Armut untergehn. –
Der Marschall eilte am folgenden Morgen nach Halle, wo Napoleon sich grade aufhielt, und sagte ihm was die Königin Holle ihm melden ließ, und alle Generale und alle Soldaten baten den Kaiser nicht nach Rußland zu gehen; doch er, wie er war, lachte sie aus, und das hat er denn büßen müssen.
Die Königin Holle ist Kaiser Friedrichs Haushälterin im Kiffhäuser. Sie war eine reiche Königswittwe und wurde freventlich ermordet. Da fand ihr Geist keine Ruh im Grabe und schwärmte lange umher, bis sie hörte daß der Kaiser Friedrich im Kiffhäuser eine Freistatt gefunden.
Und da sie sich aus ihrer Zeit erinnerte daß man ihn immer als einen so gerechten und gütigen Herrn gepriesen hatte, ging sie zu ihm in den Berg, und dort führt sie ihm nun die Wirtschaft und sorgt für alles, was er und die vielen hundert Ritter und Knappen bedürfen, die mit ihm um den großen steinernen Tisch sitzen.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DER RÄUBER UND DIE HAUSTIERE ...
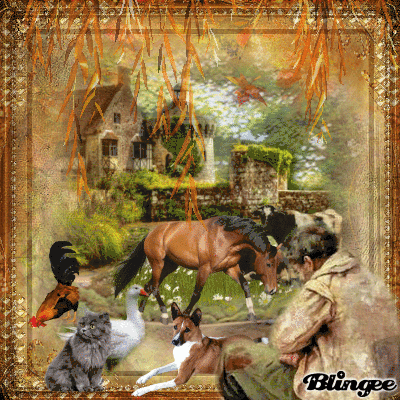
Es war einmal ein Müllerknecht, der hatte seinem Herrn schon viele Jahre lang treu und fleißig gedient und war alt geworden in der Mühle, also, daß die schwere Arbeit, die er hier zu verrichten hatte, endlich über seine Kräfte ging. Da sprach er eines Morgens zu seinem Herrn:
»Ich kann dir nicht länger dienen, ich bin zu schwach; entlaß' mich deshalb und gib mir meinen Lohn !« Der Müller sagte: » Jetzt ist nicht die Wanderzeit der Knechte; übrigens kannst du gehen,
wenn du willst, aber Lohn bekommst du nicht.«
Da wollte der alte Knecht lieber seinen Lohn fahren lassen, als sich noch länger in der Mühle so abzuquälen und verabschiedete sich von seinem Herrn.
Ehe er aber das Haus verließ, ging er noch zu den Tieren, die er bis dahin gefüttert und gepflegt hatte, um ihnen Lebewohl zu sagen. Als er nun zuerst von dem Pferd Abschied nahm, sprach es zu ihm: »Wo willst du denn hin?«
»Ich muß fort«, sagte er, »ich kann's hier nicht länger aushalten.« Und wie er dann weiter ging, so folgte das Pferd ihm nach. Darauf begab er sich zu dem Ochsen, streichelte ihn noch einmal und sprach: » Jetzt behüt' dich Gott, Alter!« -» Wo willst du denn hin ?« sprach der Ochs.
»Ach, ich muß fort. Ich kann's hier nicht länger aushalten«, sagte der Müllerknecht und ging traurig fort, um auch noch von dem Hund Abschied zu nehmen. Der Ochs aber zog hinter ihm her, wie das Pferd, und ebenso machten es die übrigen Haustiere, denen er adieu sagte, nämlich der Hund, der Hahn, die Katze und die Gans.
Als er nun draußen im Freien war und sah, daß die treuen Tiere ihm nachzogen, redete er ihnen freundlich zu, daß sie doch wieder umkehren und daheim bleiben möchten. »Ich habe jetzt selber nichts«, sprach er, »und kann für euch nicht mehr sorgen.« Allein die Tiere erklärten ihm, daß sie ihn nicht verlassen würden und zogen vergnügt hinter ihm drein.
Da kamen sie nach etlichen Tagen in einen großen, großen Wald. Das Pferd und der Ochs fanden hier gutes Gras; auch die Gans und der Hahn ließen sich's schmecken; die anderen Tiere aber, die Katze und der Hund, die mußten Hunger leiden wie der alte Müllerknecht, und knurrten und murrten nicht darüber.
Endlich, als sie ganz tief in den Wald hinein gekommen waren, sahen sie auf einmal ein schönes großes Haus vor sich stehen; das war aber fest zugeschlossen; nur ein Stall stand offen und war leer, und von hier aus konnte man durch eine Scheuer in das Haus kommen.
Weil nun niemand in dem Hause zu sehen war, so beschloß der Knecht, mit seinen Tieren da selbst zu bleiben und wies einem jeden seinen Platz an. Das Pferd stellte er vorn in den Stall, den Ochsen führte er an die andere Seite; der Hahn bekam seinen Platz auf dem Dach, der Hund auf dem Mist, die Katze auf dem Feuerherd, die Gans hinterm Ofen.
Dann reichte er jedem sein Futter, das er in dem Haus reichlich vorfand, und er selbst aß und trank, was er mochte und legte sich dann schlafen in ein gutes Bett, das in der Kammer fertig da stand.
Als es nun schon Nacht war und er fest schlief, kam der Räuber, dem dies Waldhaus gehörte, zurück. Wie der aber in den Hof trat, sprang sogleich der Hund wie wütend auf ihn los und bellte ihn an; dann schrie der Hahn vom Dache herunter: »Kikeriki! Kikeriki!« daß es dem Räuber angst und bange wurde; denn er hatte in seinem Leben noch keine Haustiere gesehen, die mit dem Menschen zusammenleben, sondern kannte bloß die wilden Tiere des Waldes.
Deshalb nahm er Reißaus und sprang eilig in den Stall, aber da schlug das Pferd hinten aus und traf ihn an die Seite, daß er taumelte und sich nur mit Mühe noch in die hintere Seite des Stalles flüchten konnte. Kaum aber war er hier angekommen, so drehte sich auch schon der Ochse um und wollte ihn auf seine Hörner nehmen.
Da bekam er einen neuen Schrecken und lief, was er konnte, durch die Scheuer hindurch und dann in die Küche, um ein Licht anzuzünden und zu sehen, was da los sei. Wie er nun auf dem Herd herumtastete und die Katze anrührte, fuhr die auf ihn los und kratzte ihn dermaßen, daß er Hals über Kopf davon sprang und sich eben in der Stube hinter den Ofen verkriechen wollte.
Da wachte aber die Gans auf und schrie und schlug mit den Flügeln, daß es dem Räuber Höllenangst wurde und er sich in die Kammer flüchtete. Da schnarchte nun der alte Müllerknecht in dem Bette so kräftig, wie ein schnurrendes Spinnrad, daß der Räuber meinte, die ganze Kammer sei mit fremden Leuten angefüllt.
Da überfiel ihn ein arges Grauen und Grausen, und er lief schnell zum Hause hinaus und rannte in den Wald hinein, und stand nicht eher still, als bis er seine Raubgesellen gefunden hatte.
Da fing er nun an zu erzählen: »Ich weiß nicht, was mit unserm Hause vorgegangen ist; es wohnt ein ganz fremdes Volk darin. Als ich in den Hof trat, sprang ein großer wilder Mann auf mich zu und schalt und brüllte so grimmig, daß ich dachte, er würde mich umbringen. Ein anderer reizte ihn noch auf und rief vom Dache herunter: >Gib'm au für mi! gib'm au für mi !<
Da mir's der erste schon arg genug machte, so wollte ich nicht warten, bis ihrer etwa mehrere über mich her fielen und flüchtete mich in den Stall. Aber da hat ein Schuster mir einen Leisten an die Seite geworfen, daß ich's noch spüre; und als ich dann hinten in den Stall kam, stand da ein Gabelmacher und wollte mich mit seiner Gabel aufspießen.
Und als ich in die Küche kam, saß da ein Hechelmacher und schlug mir seine Hechel in die Hand; und als ich in die Stube sprang und mich hinterm Ofen versteckten wollte, da schlug mich ein Schaufelmacher mit seiner Schaufel; als ich aber endlich in die Kammer lief, da schnarchten darin noch so viele andere, daß ich nur froh sein mußte, als ich lebendig wieder draußen war. «
Als die Räuber dies hörten, entsetzten sich alle so sehr, daß keiner Lust hatte, in das Haus zu gehen. Nein, sie meinten, die ganze Umgegend sei durch dies fremde Volk unsicher geworden und zogen noch in selbiger Nacht fort, weit weg in ein anderes Land und sind nie wieder gekommen.
Da lebte nun der Müllerknecht mit seinen treuen Tieren in Ruh' und Frieden in dem Haus der Räuber, und brauchte sich nicht mehr zu plagen in seinen alten Tagen, denn der schöne Garten neben dem Hause trug ihm jährlich mehr Obst, Gemüse und allerlei Nahrung, als er und seine Tiere verzehren konnten.
Volksmärchen aus Schwaben
DIE TAUBE IN DEN ZWÖLFTEN ...
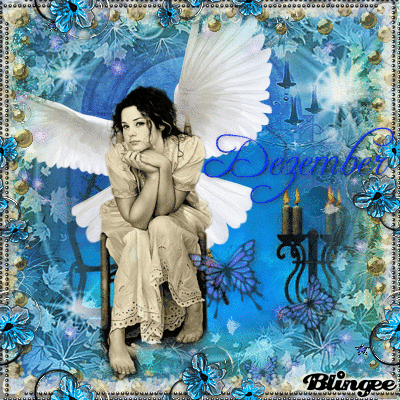
In den Zwölften hört man bei Nacht oft ein wunderbares Rauschen in der Luft. Dann freuen sich die Landleute; denn sie wissen daß ein fruchtbares Jahr folgt, und daß noch außerdem Manchem von ihnen ein unverhofftes Glück begegnen wird. Dann nämlich fliegt eine Frau, die nur in den Zwölften auf Erden erscheint, in Gestalt einer Taube durch die Luft.
Die Taube ist nicht größer als gewöhnliche Tauben; doch wenn sie die kleinen Flügel schlägt, saust die Luft weit hinter ihr her, daß man es wohl eine Viertelmeile weit hört. An ihren Füßchen schleppt die Taube ein kleines, niedliches Stühlchen, aus feinem Rohrschilf geflochten, und wenn sie müde wird, stellt sie das Stühlchen auf den Boden, setzt sich darauf und ruht aus: die Erde oder was zur Erde gehört berührt sie nie.
Wo sie sich nun so niedergelassen hat, da grünt und blüht es im folgenden Sommer am Schönsten; überall aber, wo sie vorüberzieht, werden die Felder fruchtbar und die Menschen mit vielfachem Glücke gesegnet. Am Morgen des Dreikönigstages wird die Taube wieder zur Frau; doch verschwindet diese alsbald und wird das ganze Jahr nicht gesehen. Wo sie sich das Jahr über aufhält und wer sie ist weiß Niemand.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
HAST DU GEHOLFEN ZU JAGEN, MUSST DU AUCH HELFEN NAGEN ...
Der wilde Jäger zieht bei Wettin oft durch den Grund, welcher die Pfaffenmat heißt. Da geht es »Kleff, kleff! hede, hede, hede!« Einst lag ein Hirt in seiner Hürde und hörte das Bellen und Hetzen. Da fragte er ob er nicht mitjagen dürfe. »Nur zu!« rief der wilde Jäger, und der Hirt jagte mit.
Als die Jagd zu Ende war, bekam er als Anteil an der Beute eine Pferdekeule, die er essen sollte. Und weil er dies nicht wollte, tanzte die Keule drei Nächte hinter einander auf der Weide rings um die Schafe und mitten durch sie hindurch, daß die Tiere sehr scheu wurden.
Da wandte sich der Hirt an den Prediger und klagte ihm seine Not, und der Prediger zitierte den wilden Jäger und gebot ihm die Keule zurück zu nehmen. Doch der wilde Jäger sagte, das sei alter Brauch bei ihm und seinen Jägersleuten, wer mit jage, der müsse auch mit essen; daher komme noch das alte Sprichwort
»Hast du geholfen jagen,
Mußt du auch helfen nagen.«
Da mußte sich der Hirt bequemen ein kleines Stück von der Keule zu essen, welche hierauf verschwand.
Die selbe Sage erzählt man zu Greifenhagen und Dederstedt. Zu Wettin aber rief einst ein Schiffer, als er den wilden Jäger über sich hin fahren hörte, »Mir auch eine Keule!« und augenblicklich lag eine mächtige Pferdekeule in seinem Kahn, die er lange umsonst hinaus zu werfen suchte; denn sie war so schwer, daß er sie gar nicht erheben konnte. Da stieß er im Ärger einen Fluch aus, und plötzlich war die Keule verschwunden.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DER WILDE JÄGER ...
In der Abbatissine, einem Gehölz bei Gutenberg, eine Meile von Halle, sieht man zu Mittag zwischen elf und zwölf den wilden Jäger ohne Kopf umher gehen. Bei Nacht hetzt er da selbst, von vielen kläffenden Hunden begleitet, die Lohjungfern.
In der dölauer Heide bei Halle reitet er bisweilen ohne Kopf auf einem Schimmel durch die Luft. Dann folgt jedesmal binnen drei Tagen Sturm und Ungewitter. – Ohne Kopf zeigt er sich auch in einem Walde zwischen Schraplau und Eisleben, im Zellgrunde zwischen dem Galgen- und Zellberge bei Erdeborn, im Mittelholz bei Näglitz und in vielen anderen Wäldern Sachsens.
Wenn er naht, legen sich die Wanderer auf den Boden, und er braust mit seinen Hunden über sie hinweg.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
ALTES MÜTTERCHEN ERLÖST ...
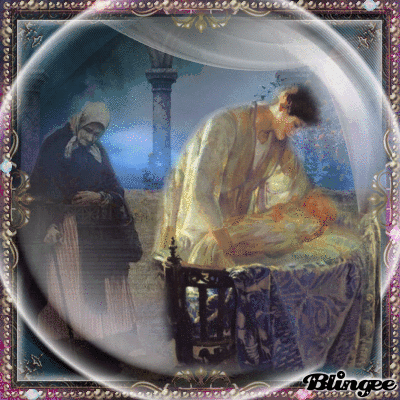
In Gutenberg war eine Wöchnerin eines Abend ganz allein zu Hause, weil ihr Mann über Land gegangen war und sich auf dem Heimwege verspätet hatte. Und als sie nun so still in ihrem Bette lag und sich im ganzen Dorfe nichts mehr regte, da begann es plötzlich unter ihr im Keller des Hauses zu rascheln; die Kellertreppe herauf kamen langsame Schritte, und herein trat ein altes, gebücktes Mütterchen mit einem Spinnrocken in der Hand.
Es setzte sich ohne zu grüßen oder ein Wort zu sprechen neben die Wiege und spann und sah das Kind von Zeit zu Zeit mit so recht freundlichen, doch wehmütigen Augen an. Die Frau zitterte vor Angst, doch schwieg sie und zog nur heimlich die Wiege immer etwas näher an das Bett.
Als das Mütterchen eine Weile gesponnen hatte, stand sie auf, nahm den Rocken in die Hand und winkte der Wöchnerin mit ihr zu gehen. Die aber hüllte sich tiefer ins Bett, machte die Augen fest zu und sah nicht eher wieder auf als bis sie ihren Mann zur Tür hereinkommen hörte.
Wie sie dem erzählte was sie gesehen hatte, wurde auch ihm ganz bang, und er versprach sie nicht wieder Abends allein zu lassen. Sie saßen nun die nächsten Abende traulich beisammen und sahen und hörten nichts.
Nach einigen Tagen aber geschah es doch wieder daß der Mann, als die Nacht anbrach, noch ausblieb, und nun kam um die selbe Zeit wie das erste Mal das alte Mütterchen mit dem Spinnrocken, setzte sich an die Wiege und spann ohne ein Wort zu sprechen. Und als sie wegging, winkte sie der Frau wieder und sah sie gar freundlich bittend mit so lieblicher und doch so bekümmerter Miene an, daß die Frau fast mitgegangen wäre, wenn sie nicht gefürchtet hätte, es sei nur ein böser Geist, der sie verlocken wolle.
Am folgenden Morgen ging der Mann der Wöchnerin zum Pfarrer und erzählte dem die Geschichte von dem alten Mütterchen, welches schon zweimal bei seiner Frau gewesen sei. Und der Pfarrer kam zu der Frau, segnete sie ein und las eine Messe über sie (denn es ist dies alles schon vor langer, langer Zeit geschehen, als die Sachsen noch katholisch waren), und nun hieß er sie, wenn das Mütterchen wieder komme, getrost aufstehen und mitgehen, nun würden alle bösen Geister der Welt ihr kein Haar zu krümmen wagen.
Als die Frau bald darauf wieder einmal des Abends allein war, kam richtig wieder das gebückte Mütterchen und spann wie früher still vor sich hin, grüßte nicht und sprach nicht; doch als sie diesmal den Rocken nahm und der Frau winkte, stand diese auf, ergriff ihre Lampe und folgte ihr.
Sie gingen die Kellertreppe hinab, und als die Frau auf die unterste Stufe trat, fuhr sie erschrocken zurück, denn vor ihr stand eine Mulde voll runder, blanker Dukaten. Und das alte Mütterchen fiel ihr um den Hals und rief »Gott sei gedankt! Nun bin ich erlöst, und du bist meine Retterin.
Ich war verwünscht diesen Schatz zu bewachen, bis am Neunten eines Monats in deinem Hause ein Knäblein geboren würde, dessen Mutter ich ohne zu sprechen zu dem Schatz herab locken könnte. Dein Sohn ist am Neunten geboren; doch wärst du heut nicht mit gekommen, so wäre ich verloren gewesen, denn nur dreimal durfte ich den Schatz verlassen.
Nun nimm das Gold und lebe fröhlich damit; so lange Einer von deinem Geschlechte übrig ist, wird es nicht zu Ende gehen.« Und wie die Wöchnerin noch erstaunt bald das Mütterchen, bald die Dukaten ansah, war die Alte plötzlich verschwunden.
Da griff die Frau eilig nach den Dukaten, um zu sehen ob sie auch verschwinden würden; doch es waren wirkliche Dukaten und wurden ihr sehr schwer, als sie die Mulde die Treppe hinauf trug.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE FUTTERSTELLE DES WILDEN JÄGERS ...
In Dederstedt bei Eisleben war eine Stelle, an welcher der wilde Jäger stets anzuhalten und seine Pferde und Hunde zu füttern pflegte. Als man dort vor einigen Jahren ein Haus baute, wurde die erste Mauer fünfzehn Mal hinter einander über Nacht wieder eingerissen: erst das sechzehnte Mal blieb sie stehen; doch ist es noch jetzt bei Nacht in den Zimmern unruhig, und rings um das Haus, welches grade an einer Ecke steht, weht zu allen Tageszeiten der Wind.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DER STEINBERG ...
Zwischen dem Dorfe Aseleben und dem salzigen See liegt ein Berg, der mit einigen hundert Steinen bedeckt ist. Auf diesem Berge hütete einst ein Schäfer, und als er frühstücken wollte, kam Frau Wolle den Berg herauf, um auf der anderen Seite zum See hinab zu gehen, und sich darin zu baden.
Wie sie den Schäfer sah, bat sie ihn um ein Stückchen von seinem Brote, doch er lachte und sprach, wenn sie essen wolle, solle sie arbeiten; sein Brot habe er ehrlich verdient und brauche es allein. Da berührte ihn Frau Wolle mit einer Rute, die sie in der Hand trug, und als bald war er in Stein verwandelt. Darauf berührte sie auch seine beiden Hunde, die rechts und links neben ihm lagen, und dann die ganze Herde, und auch die Hunde und alle Schafe wurden zu Stein.
Dies sind die Steine, welche auf dem Berge liegen, und noch heut sieht man an dem, in welchen der Schäfer verwandelt ist, den Stab aufragen, den der Schäfer beim Sitzen grade über seine Schulter gelehnt hatte. Der Berg wird seitdem der Steinberg, bisweilen auch der Schafberg genannt.
Auf einem Anger bei Ahlsdorf liegt eine Menge ähnlicher Steine; und auch dies ist ein Schäfer mit zwei Hunden und fünfhundert Schafen, die einst verwünscht worden sind. Wer sie verwünscht hat weiß man nicht; doch erzählt man daß sie einst noch erlöst werden sollen.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE GRÜNE JUNGFER AUF DEM HAUSBERGE ...

Auf dem Hausberge bei Eisleben stand vor alter Zeit ein mächtiges Schloß, welches in den Berg versunken ist, doch sich einst wieder aus ihm erheben wird. Das Burgfräulein ist mit in den Berg verwünscht und wird nur alle sieben Jahr in der Johannisnacht frei. Dann wandelt sie auf dem Berge umher, trägt ein Schlüsselbund am Gürtel und ist ganz grün gekleidet, weshalb sie das Volk nur »die grüne Jungfer« nennt.
Wer ihr begegnet, dem widerfährt ein großes Glück; denn er wird von ihr reich beschenkt. Das größte Glück aber ist dem bestimmt, dem es einst gelingen wird sie zu erlösen. Jedem nämlich, den sie trifft, gibt sie einen Schlüssel und führt ihn zu einer Falltür auf dem Gipfel des Berges, die auch nur alle sieben Jahr in der Johannisnacht zu sehen ist.
Die Tür heißt sie ihn aufschließen, und dann begleitet sie ihn durch die weiten Gemächer des Schlosses, zeigt ihm alle Herrlichkeiten und führt ihn zuletzt vor ein Buch, welches ihre und des Schlosses Geschichte enthält. Dieses Buch heißt sie ihn lesen; doch ist es in so alter Schrift geschrieben, daß noch Niemand es zu lesen vermocht hat.
Wenn aber einst Jemand das Buch wird lesen können, so wird sich das Schloß aus dem Berge auf den Gipfel des selben heben, und die Jungfer wird erlöst sein und ihren Erlöser zum Herrn des Schlosses und zu ihrem Gemahl machen.
Ein Amtmann las einst schon einige Seiten, da begann sich das Schloß alsbald im Berge zu rütteln, und ein Schäfer, der grade über den Berg ging, sah die Turmspitze schon daraus hervorragen. Doch weil der Amtmann nicht weiter lesen konnte, sank das Schloß in den Berg zurück.
Noch jetzt gehen Leute aus den benachbarten Dörfern in der Johannisnacht auf den Hausberg um der grünen Jungfer zu begegnen.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
FRAU HARRE UND FRAU MOTTE ...
In Gutenberg bei Halle hütet man sich in den zwölf Nächten zu spinnen, weil sonst Frau Harre kommt und den Rocken besudelt. In Pfützenthal wird sie Frau Harren, in Rothenburg (anderthalb Meilen von Pfützenthal) Frau Harfe und in Näglitz (eine halbe Meile von Gutenberg) Frau Archen genannt.
In Löbejün sagt man, Frau Motte kommt und verdirbt das Garn, das man in der Zwölften oder auch während der Fastnacht gesponnen hat.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE ERLÖSTE JUNGFRAU ...
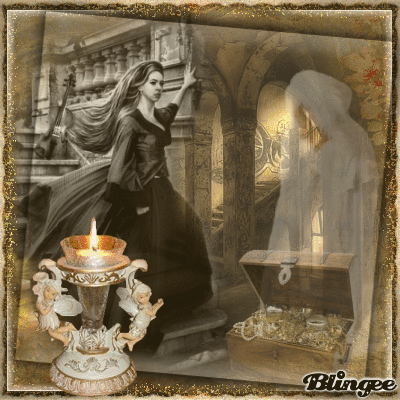
In einem Dorfe nicht weit von Halle wurde das Dienstmädchen des Pfarrers bei Nacht aus dem Schlafe geweckt, und als sie aufblickte, sah sie eine lange, weiße Gestalt, welche ihr winkte.
Das Mädchen aber hüllte sich tief ins Bett ein und erzählte am Morgen dem Pfarrer was sie gesehen hatte. Der schalt sie um ihres Aberglaubens willen und meinte, sie sollte, ehe sie einschliefe, hübsch beten, dann würde sie nicht so unruhige Träume haben.
In der folgenden Nacht aber sah das Mädchen die selbe weiße Gestalt, und diesmal sprach sie und bat das Mädchen aufzustehen und mitzugehen. Doch auch diesmal fürchtete sich die Magd. Wie sie aber dem Pfarrer am Morgen wieder von ihrem Gesicht erzählte, da sprach er »Wenn die Erscheinung zum dritten Male kommt, so steh auf und tu in Gottes Namen was sie verlangt.«
Und wirklich kam die weiße Gestalt auch in der dritten Nacht, und die Magd stand auf und folgte ihr. Sie wurde in des Pfarrers Keller hinabgeführt und durch eine Tür, welche sie nie zuvor gesehen hatte, in andre Keller und durch lange Gewölbe hindurch.
Die Gestalt schritt mit einer Kerze voran und blieb in einem kleinen Gemach stehen, an dessen Boden viele goldene und silberne Ketten, Ringe, Armspangen und andere Kleinode aufgehäuft lagen. Und die Gestalt sprach zu dem Mädchen »Sieh, dies alles ist dein: nimm es auf und lebe glücklich damit.«
Das Mädchen aber glaubte zu träumen und konnte sich an den Kostbarkeiten nicht satt sehen; doch wagte sie nichts anzurühren. Da gab ihr die Gestalt die Zipfel der Schürze in die Hand und schüttete ihr das Geschmeide in die Schürze.
Das Mädchen hielt die Schürze in Gedanken fest, und als nichts von all den Herrlichkeiten mehr am Boden lag, da trat eine schöne, prachtvoll gekleidete Jungfrau ins Gemach; die weinte vor Freude und rief »Nun sei Gott gelobt, nun bin ich erlöst.«
Damit eilte sie auf das Mädchen zu und wollte es umarmen; doch erschrocken ließ das Mädchen die Schürzenzipfel los, die Kleinode rollten über den Boden, und plötzlich war alles verschwunden, die Jungfrau samt der Gestalt, das Gold und die Edelsteine; und das Mädchen tappte im Finstern umher, bis sie in der Ferne Etwas schimmern sah.
Sie ging darauf zu und fand eine Treppe, die sie hinaufstieg. Und als sie sich nun umsah, stand sie an dem einen Ende des großen Kirchhofes, an dessen anderer Seite, wohl mehrere hundert Schritte davon, das Pfarrhaus stand. Sie ging schnell ins Haus und erzählte dem Pfarrer alles, wie es gekommen war.
Der Pfarrer schüttelte ungläubig den Kopf: da bemerkte er daß eine Perlenschnur an dem Schürzenband der Magd hing, an das sie sich mit dem Schlosse fest geschleift hatte; und nun zweifelte er nicht länger, sondern sprach »An diesem Wahrzeichen erkenne ich daß du die Wahrheit sagst: führe mich an den Ort, von dem du die Schnur mitgebracht hast.«
Und sie gingen in den Keller, doch die Tür zu den anderen Kellern suchten sie umsonst, und sie gruben auch auf dem Kirchhofe nach, doch sie fanden die unterirdischen Gänge nicht.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE AMTSMANNSFRAU ZU HELBRA ...
Einem Amtmann zu Helbra starb seine Frau, und er nahm eine zweite, die mit den Kindern der ersten lieblos umging. Da kam die erste Frau alle Morgen und alle Abende zu den Mägden in den Stall, half ihnen melken und das Vieh striegeln und bat sie gar wehmüthig, alles Liebe, was sie ihnen hier im Stalle antue, möchten sie doch ihren Kindern auf dem Schlosse wieder zu Gute kommen lassen; denn auf das Schloß dürfe sie nicht gehen.
Und weil die Mägde freundlich gegen sie waren, wurde sie immer vertraulicher, bis sie eines Morgens, als sie fort schlich, vom Amtmann bemerkt wurde. Da ließ er einen Jesuiten kommen, welcher die Frau bannen sollte. Und der Jesuit hieß sie aus dem Grabgewölbe nehmen und in ein Gehölz vor dem Dorfe legen, welches das Pfarrholz heißt.
An das Pfarrholz stößt ein Teich, und der Jesuit gab der Toten ein Sieb in die Hand und bannte sie, wenn sie im Grabe nicht rasten wolle, müsse sie mit dem Siebe erst den Teich ausschöpfen, ehe sie wieder auf den Schloßhof kommen dürfe.
Und nun war der Teich alle Morgen kleiner, und es währte nicht lange, so war er ausgetrocknet, und die Frau erschien wieder im Stalle. Da nahm man sie zum zweiten Mal aus dem Grabe und brachte sie über die Grenze in das Ahlsdorfer Gebiet.
Nun konnte sie nicht mehr auf das Schloß nach Helbra kommen; denn über die Grenzen dürfen Geister nicht: doch ging sie noch lange allnächtlich an den Grenzsteinen auf und nieder und schaute sehnsüchtig nach dem Schlosse hinüber. Und das ist erst vor fünfundzwanzig Jahren geschehen.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DER HEXENTANZ AUF DEN BROCKEN ...

Kupferstich von W. Jury nach Johann Heinrich Ramberg (1829) zu Goethes Faust
Auf dem Harzgebirge gibt es einen hohen, hohen Berg, der über alle Berge, wohl fünfzig Meilen in der Runde, weit hinweg sieht. Er heißt: der Brocken. Wenn man aber von den Zaubereien und Hexentaten, die auf und an ihm vorgehen und vorgegangen sind, spricht, so heißt er auch wohl der Blocksberg.
Auf dem Scheitel dieses kahlen, unfruchtbaren Berges – der mit hunderttausend Millionen Felsstücken übersät ist – hat der Teufel jährlich, in der Nacht vom letzten April auf den ersten Mai, der so genannten Walpurgisnacht, mit seinen Bundesgenossen, den Hexen und Zauberern der ganzen Erde, eine glänzende Zusammenkunft.
So wie die Mitternachtsstunde vorüber ist, kommen von allen Seiten diese Wesen auf Ofengabeln, Besen, Mistforken, gehörnten Ziegenböcken und sonstigen Untieren, durch die Luft herbei geritten, und der Teufel holt mehrere selbst dazu ab. Ist alles beisammen, so wird um ein hoch loderndes Feuer getanzt, gejauchzt, mit Feuerbränden die Luft durchschwenkt und bis zur Ermattung herum gerast.
Von Begeisterung ergriffen, tritt als dann der Teufel auf die »Teufelskanzel«, lästert auf Gott, seine Lehre und die lieben Englein, und zum Beschluß gibt er, als Wirt, ein Mahl, wo nichts als Würste gegessen werden, die man auf dem »Hexenaltar« zubereitet.
Die Hexe, die zuletzt ankommt, muß, wegen Vernachlässigung der herkömmlichen Etikette, eines grausamen Todes sterben. Sie wird nämlich, nach der letzten glühenden Umarmung des Regenten der Unterwelt, in Stücke zerrissen, und ihr auf dem Hexenaltar zerhacktes Fleisch, den anderen zum warnenden Beispiel, als eine der Hauptschüsseln des Schmauses vorgesetzt.
Mit anbrechender Morgenröte zerstäubt die ganze saubere Sippschaft nach allen Windgegenden hin.
Damit diese Unholde auf ihrer Hin- und Zurückreise weder Menschen noch Vieh Schaden zufügen können, so machen die Bewohner der Orte, um den Brocken vor der einbrechenden Walpurgisnacht, an die Türen der Häuser und Ställe drei Kreuze, und sind dann des festen Glaubens, daß sie und das Ihrige nun von den durchziehenden Geistern und bösen Wesen nicht behext werden können.
Die Sagen und Volksmährchen der Deutschen,
Caspar Friedrich Gottschalck (1772 – 1836)
ERLKÖNIGS TOCHTER ...
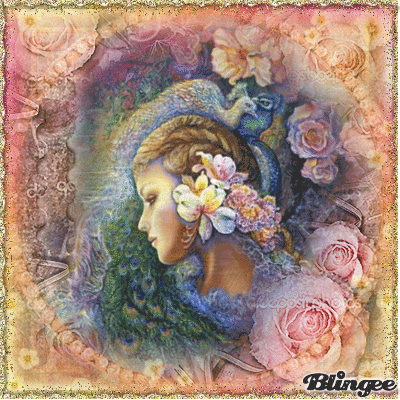
An der östlichen Küste von Seeland lag vor Alters eine große Stadt, welche in der Folge das Schicksal von Carthago und Persepolis erfuhr, die uns nur noch in ihren Ruinen an ihre ehemalige Herrlichkeit erinnern; ja die Zeit hat jener noch übler mitgespielt als diesen, denn ihre Stätte ist nicht mehr kenntlich, und selbst ihren Namen hat die Sage vergessen; wir wollen sie, weil doch jedes Ding seinen Namen haben muß, nach dem alten Namen des Ganzen, dessen Zierde sie war, Siölund nennen, und es dem Leser freistellen, nach dem, was sich aus Nebenumständen ergeben möchte, ihre Lage etwas genauer zu bestimmen.
Unser Siölund war eine gewaltige Handelsstadt, deren Kaufleute so reich und mächtig wie Fürsten waren; das Meer zollte ihnen seine Reichtümer, und die Geschäfte, die sie machten, erstreckten sich bis in die entferntesten Gegenden der Welt. Doch konnte sich keiner dieser wichtigen Männer mit Hinrich von Röschild messen, der sich seit ungefähr zwanzig Jahren hier niedergelassen hatte, und dessen Reichtum und Macht alles übertraf, was sich nur von kaufmännischer Herrlichkeit denken läßt.
Hinrich von Röschild hatte auf einer benachbarten Insel, die noch bis auf den heutigen Tag unter dem Namen der Erleninsel bekannt ist, ein großes Waarenlager, über dessen sonderbar gewählte Stätte sich viele verwunderten. Welch ein Einfall, Schätze von nicht geringem Wert einer unbewohnten Insel anzuvertrauen, wo die Seeräuber, die diese Küste nicht selten beunruhigten, bequem landen und freie Beute machen konnten! Aber die Stelle, worauf das Warenhaus stand, war Hinrichs erkauftes Eigentum, und Niemand hatte darein zu reden, auch landeten die Seeräuber nicht und machten freie Beute; die Kaufmannsgüter waren hingestellt unter Gottes Geleit, der Grund war heiliges Land, Niemand durfte sie antasten.
Diese Insel mußte Hiolm, der einzige Sohn Röschilds, der schon von frühester Jugend an zur Arbeit angehalten worden war, oft in Geschäften seines Vaters besuchen. Bald war es Vermehrung, bald Verminderung der dasigen Vorräte, bald Unterhaltung der eigensinnigsten Ordnung unter den selben weshalb er dahin geschickt wurde, und daher kam es auch, daß Hiolm auf der Insel, die kaum eine Meile im Umfang hat, fast so bekannt war, wie im väterlichen Hause.
Eines Tages fuhr Hiolm wie gewöhnlich in Begleitung eines alten Dieners nach der Insel, um dort seine Geschäfte zu betreiben. Man stieg an das Land, der erste Anblick, der sich den Augen der Ankommenden darbot, war ein entseelter menschlicher Körper.
Dies erregte Verwunderung, besonders bei Hiolm. Spuren, daß menschliche Wesen hier zu Zeiten weilten, hatte er bei seinen Wanderungen wohl oft entdeckt, aber nie einen der unbekannten Bewohner oder Besucher der Erleninsel gesehen, – und nun einen Toten! – Bedauernd hing er über ihn, den er für einen Ermordeten hielt, und vergoß bittere Tränen, die seinem Herzen Ehre machten.
Doch man mußte die Totenklage beseitigen und an die Arbeit gehen. Sie nahm den ganzen Tag in Anspruch, und als man am Abend wieder zur Rückkehr in den Kahn steigen wollte, war es wieder der entseelte Körper, der die Aufmerksamkeit des Jünglings auf sich zog.
»Es ist eine schändliche Grausamkeit,« sagte er zu seinem Begleiter, »die Überreste eines menschlichen Geschöpfs hier an der Sonne verwesen zu lassen; wir wollen eine Grube machen und den Leichnam einscharren.«
»Herr,« antwortete der Diener, »ich dächte, wir befaßten uns nicht mit Dingen, die uns nichts angehen; die Nacht bricht ein, und wir müssen eilen, unseren Nachen zu erreichen.« – Hiolm gehorchte dem alten Mann, aber er konnte nicht unterlassen, als sie im Glanz der untergehenden Sonne nach Hause schifften, ihn zu fragen, warum er dem Leichnam die Wohltat der Beerdigung nicht gönnen wollte?
»Eure Jugend und Unerfahrenheit,« erwiderte dieser, »macht euch bereitwilliger, Wohltaten zu erzeigen als es ratsam ist. Ich missgönne die Hand voll Erde, die unsre letze Mitgabe ist, keinem meiner Mitgeschöpfe, aber jener Leichnam sah mir zu verdächtig aus, als daß ich mich viel mit ihm hätte abgeben mögen. Ihr sollt wissen, mitten unter uns wohnt ein Geistergeschlecht, mit eben der Hülle bekleidet, die wir tragen und nur durch wenig Abzeichen von den wirklichen Menschen zu unterscheiden; aber sie sind nur unsere Halbbrüder, mächtiger als wir, und meistens bösartig.
Unter den tausend Sonderbarkeiten, die sie an sich haben, ist besonders zu bemerken, daß jene Wesen zwar dem Tode unterworfen sind wie wir, daß sie sich aber, wenn ihre entseelten Überreste zeitig genug, ehe sie in Verwesung übergehen, mit Erde bedeckt oder ins Wasser versenkt werden, wieder beseelen und von Neuem einen Lebenslauf beginnen, der gewöhnlich mehrere Jahrhunderte in sich begreift. Ob jener Leichnam zu dieser Klasse gehörte, weiß ich nicht, doch hätte ich euch nicht raten wollen, Hand an ihn zu legen, es hätte euch sonst ergehen können, wie jenem Fischer.«
Hiolm fragte, wie es jenem Fischer erging, und bekam ein Märchen zu hören, fast des Inhalts, wie die arabische Erzählung von dem Geiste, der seinem Retter aus dem Abgrund des Meeres übel lohnte. – Hiolm hatte das selbe entweder schon so oft gehört als unsere Leser, oder er war überhaupt kein Freund von dergleichen Sagen, genug er beachtete sie nicht, und noch weniger die daraus gezogene Moral: daß man niemand Gutes erzeigen dürfe, den man nicht genau kenne, da man sonst oft mit Undank gelohnt würde.
War es Trieb, eine Pflicht der Menschlichkeit zu üben, war es Vorwitz, oder jugendlicher Starrsinn, der sich gerade zu dem Verbotenen hin neigt, genug, Hiolm faßte noch auf dem Heimweg den Entschluss, sobald als möglich allein nach der Insel zu schiffen, und dem Leichnam, der seine Teilnahme so stark erregt hatte, wenigstens ein Grab zu gewähren, weil er ihm keine andere Wohltat mehr erzeigen konnte.
Es glückte ihm gleich am anderen Tage. Es gab neue Geschäfte auf der Erleninsel, der gewöhnliche Begleiter war durch plötzliche Krankheit abgehalten, und Hiolm reiste allein. Um ungestört das Werk, das ihm im Sinne lag, vollbringen zu können, unternahm er es, den Nachen mit eigener Hand zu regieren. Spaten und Schaufel wurden nicht vergessen, und zu dem Totengräbergerät legte er noch einen Schößling von einem Rosenstrauch – damals noch eine Seltenheit für den dasigen Himmelsstrich – welcher auf das Grab gepflanzt werden sollte, weil er eine andere Art von Monument über der Asche des Entseelten zu errichten, nicht im Stande war.
Hiolm's Vorhaben beschäftigte seine junge phantasiereiche Seele ganz, obgleich er selbst nicht wußte, was ihn dafür so sehr einnahm; vielleicht war es blos das Neue und Sonderbare, verbunden mit dem Reiz, den die Abmahnungen und Erzählungen des alten Dieners bei einem neugierigen Knaben nothwendig erregen mußten.
Unter tausenderlei Gedanken stieß er sein Fahrzeug ab und schiffte an das jenseitige Ufer. Die tote Einsamkeit der Erleninsel nahm ihn auf, das was jedem Anderen mit Grauen erfüllt haben würde, erregte in ihm bloß eine gewisse ernste, feierliche Empfindung, die für ihn mit unnennbarem Wohlbehagen verknüpft war, – kurz Hiolm befand sich noch in jenem glücklichen Alter, wo wir alles, was uns begegnet, in Freude verkehren und selbst unter Gräbern Blumen zu finden wissen.
Es war keine kleine Arbeit, deren sich der feurige Knabe unterzogen hatte. Er hatte vor Kurzem erst das zwölfte Jahr zurückgelegt, seine Arme waren noch schwach und besonders in dergleichen Arbeiten ungeübt; doch endlich kam das schwere Werk zu Stande. Im Schatten einer Gruppe der Bäume, von welchen die Insel den Namen hat, ruhte der Leichnam; der Rosenstrauch war zu seinem Haupte eingesenkt, und der junge Totengräber ging mit seinem: Sit tibi terra levis! das jedes Volk seinen Begrabenen in seiner Mundart nachzurufen pflegt, davon. Dieser fromme Wunsch konnte hier dem Wortverstande nach zutreffen, denn kaum eine Elle hoch deckte die Erde den Leichnam; Hiolms Arme waren zu schwach gewesen, dem Grabe seine gehörige Tiefe zu geben.
Die anderweitigen Geschäfte auf der Insel wurden darauf eiligst besorgt, bei der Rückkehr nach dem Fahrzeuge noch einige wohlgefällige Blicke auf das Monument geworfen, Schaufel und Spaten, als nunmehr unnütze Reisegefährten ins Meer versenkt, und die Heimreise so glücklich geendet als die Überkunft.
Hiolm hatte jetzt getan, was ihm entweder Gutmütigkeit oder ein kindischer Einfall eingegeben hatte, und nun dachte er nicht mehr an die Sache. Aber in der dritten Nacht zeigte es sich, daß die selbe von den anderweitigen Interessenten nicht so vergessen war als von ihm. Er lag und schlummerte – da dünkte ihm, eine Hand rühre ihn an und wecke ihn aus dem Schlafe.
Er richtete sich auf, eine Gestalt stand vor ihm, seinen Augen nicht ganz unbekannt, doch konnte er sich nicht besinnen, wann und wo er sie gesehen. Ein augenblicklicher Schrecken überfiel ihn, der aber bald in ruhigere Empfindungen überging.
»Holder Knabe,« flüsterte die Gestalt, in dem sie sich über sein Lager herab beugte, »der mir mit einer Hand voll Erde eine Wohltat erzeigte, die ich dir mit Königreichen nicht zu vergelten wüßte, wie soll ich dich belohnen? – Genieße, was dich jetzt ergötzen kann, und rechne in der Folge auf größere Wohltaten. Versäume nicht in den Nächten, wo der Mond voll wird, die Erleninsel allein zu besuchen, und du wirst dann ein schöneres Schauspiel sehen, als deine Augen je erblickten.«
Hiolm war zu leichtsinnig, diesen Traum zu beachten; wahrscheinlich vergaß er ihn, und würde vielleicht nie wieder an den selben gedacht oder seiner Weissagung gehorcht haben, wenn nicht der Zufall das seinige dabei getan hätte.
Der Fischfang an den Küsten von Siölund war ein beträchtlicher Erwerbszweig für die Bewohner dieser Gegenden. Arme und Reiche ernteten Gold von den Gaben des Meeres, die es ihnen zu gewissen Jahreszeiten aus dem entfernten Norden herüber schickte, doch wenn die Armen nur diese Gelegenheit benutzten, um ihr Brot zu verdienen, so nahmen die Reichen außerdem Veranlassung zu glänzenden Festen.
Viele von ihnen hatten Landhäuser, an deren Mauern die See spülte; zahlreiche Gesellschaften versammelten sich dann in zierlichen Villen, und nachdem man sich den Tag über mit Zeitvertreiben belustigt hatte, die damals Mode sein mochten, und von welchen wir freilich nach so manchem verflossenen Jahrhunderte nicht einmal etwas ahnen können, so ergötzte man sich am Abend auf kleinen zierlichen Gondeln, den Segen des Meeres einsammeln zu sehen, der sich, besonders in den hellen Vollmondnächten, hier unglaublich anhäufte.
Hinrich von Röschild, Hiolms Vater, der sich bei jeder Gelegenheit, wo es galt durch Reichtum zu imponieren, hervorzeichnete sich auch hier aus; er feierte das sogenannte Fischerfest mit einem Glanz, den man nur in seinem Hause erblickte, und dachte nicht, daß dieser Tag bestimmt war, ihn um das Liebste zu bringen, das er auf Erden hatte.
Im Buch der Sterne stand aber geschrieben: Wenn Hiolm, Hinrichs Sohn, das Meer zum dreizehntenmal mit den silbernen Heeren des Nordens bedeckt sieht, so findet er in den Wellen sein Grab, dafern nicht eine übermenschliche Macht in die Räder des Schicksals greift, und das zum irdischen Leben erhält, was die Unsterblichen gern frühzeitig in ihrem Kreise glänzen sehen möchten.
Hiolm, ein feuriger Jüngling, der bei jeder Lust mit ganzer voller Seele war, und keine Gefahr scheute, wo ihm doppelter Genuß zu winken schien, wagte sich in jener Nacht des rauschenden Vergnügens zu weit in die See, und während auf den Gondeln und in dem erleuchteten Saale seines Vaters die goldenen Becher fleißig auf das Wohlergehen des Hauses geleert wurden, das dieses königliche Fest gab, faßte plötzlich ein Wirbelwind die Gondel, welche die ganze Hoffnung dieses Hauses, den jungen Hiolm enthielt, und schleuderte sie weiter hinaus, als das Auge reichte, und weiter, als ihm die leichte Gruppe von Nachen, die ihn umgab, zu seiner Rettung folgen konnte.
Auch vermißte man ihn nicht gleich, und sein Fahrzeug, von seinen kindischen Armen nur schwach gegen die Gewalt des Windes verteidigt, war schon vom Abgrund des Meeres verschlungen, als erst Nachfrage geschah, wo der kühne Schiffer geblieben sein möchte.
Hiolm hätte das Schicksal seines Nachens geteilt und wäre in dem unersättlichen Schlund der See begraben worden, wenn nicht in diesem Augenblick ein übermenschliches Wesen, das sich für ihn interessierte, alter Verbindlichkeiten eingedenk, sein Retter geworden wäre. Hiolm empfand kaum die Kälte des Wassers, als er sich auch schon wie auf sanften Fittichen des Windes empor getragen und an ein Ufer geführt fühlte, das ihm nur in der ersten Bestürzung unbekannt sein konnte, das er aber, sobald er sich ein wenig erholte, augenblicklich für die Erleninsel erkannte.
Er sah sich, als Schrecken und Betäubung völlig verschwunden waren, nahe am Ufer des Meeres, zwischen dem Erlengebüsch in der Nähe des Grabmales, das er vor einigen Monaten dem Unbekannten errichtet hatte. Der Rosenstrauch, der durch Geisterhand gepflegt, wohl gediehen war, blühte schon und umhüllte seinen ersten Pflanzer mit Wohlgeruch.
Süß und stärkend war der Duft, der ihn umwehte, aber was glich seinem Entzücken, als er die Augen öffnete, und Dinge um sich her wahrnahm, wie sie noch kein Sterblicher jemals erblickte. Die ganze Insel schwamm in einem wundervollen Lichte. Nicht das Licht des Mondes war es, das hier leuchtete, oder wenn es dieser Planet war, aus welchem dieser unaussprechlich sanfte Schimmer aus floß, so mußte er auf diesen kleinen Bezirk seine ausgesuchtesten Strahlen gestreut haben, um allem was der selbe enthielt, einen namenlosen Zauberreiz zu geben.
Hiolm stand ganz in Anschauen verloren. War die Beleuchtung dieses Orts so entzückend, was sollte man erst von den Gegenständen sagen, die sie sichtbar machte! Die Landschaft rund umher war belebt; überirdische Gestalten bewegten sich nah und fern in abgemessenem Schweben. Die Jugend des Himmels schien sich hier zum Tanze versammelt zu haben; sanfte Töne, vielleicht mehr das melodische Schwirren der leuchtenden Insekten, die die Szene verschönerten, als Musik, beseelte den labyrinthischen Ringelreihen, der sich in tausend verwickelten Touren durch einander wand, und dann, auf einmal in irgend eine schöne einfache Form aufgelöst, den Schauplatz umzog.
Es war ein Anblick, an dem das Auge des glücklichen Schauers sich nicht satt sehen konnte, den das Gedächtnis gern treulich aufbewahren, von dem der Mund treulich berichten wollte, aber vergebens; wie vermag der Mund des Sterblichen überirdische Dinge zu schildern!
Zuletzt verwandelten sich die zauberischen Bilder, die Hiolm sah, in ein großes glänzendes Ganzes, die Gedanken vergingen ihm und er entschlief. Als er erwachte, war es Tag; er ging an das Ufer des Meeres, dachte an den Zufall, der ihn hierher gebracht hatte, an die Angst seines Vaters um ihn, an die Unmöglichkeit, auf dieser Insel längere Zeit sein Leben zu erhalten, und wünschte sich, ungeachtet der unnennbaren Freuden, die er diese Nacht genossen hatte, hinüber in den Kreis seiner Lieben.
Doch vergebens! drei Tage mußte er hier verharren, ehe sich Hoffnung zur Erlösung zeigte. Er nährte sich während dieser Zeit von den Früchten eines Baumes, den er auf seinen frühern Wanderungen durch die Insel nie gesehen hatte, und des Nachts ergötzte ihn noch zweimal das himmlische Schauspiel, das er schon einmal gesehen hatte; doch war es schon in der zweiten Nacht minder glänzend, und in der letzten schwand es fast ganz, denn der Mond war nicht mehr voll, und so wie sich seine eine Hälfte in Schatten verlor, so schienen auch die wundervollen Gegenstände, die er hier beleuchtete, sich in unwesentliche Schatten aufzulösen.
Jetzt fühlte sich Hiolm wahrhaft einsam auf der Erleninsel, und seine Sehnsucht nach dem väterlichen Hause steigerte sich mit jeder Stunde. Hinrich von Röschild trauerte indessen um den verlorenen Sohn, dessen Verlust ihm erst am Tage nach dem Fischerfeste kund geworden war. Im Gewühl der Freude war Hiolm nicht vermißt worden, jetzt aber wurde er mit Schrecken überall vergebens gesucht.
Das Meer warf die Trümmer des Nachens aus, auf welchem er sich dem untreuen Elemente anvertraut hatte, und nun konnte man nicht anderes glauben, als daß Hiolm in den Meeresfluten begraben läge. – Doch man beruhigt sich beim Verlust eines kostbaren Gutes erst spät mit der Unmöglichkeit der Wiedererlangung, man sucht und forscht, wenn uns auch die Vernunft sagt, daß dieses Suchen und Forschen Torheit ist, man will wenigstens noch einige Augenblicke Hoffnung nähren, ehe man sich der vollen Verzweiflung ergibt, – und so ging es auch hier.
Hiolms Vater sah die Unwahrscheinlichkeit von der Rettung seines Sohnes ein, gleichwohl überredete er sich vom Gegenteil. »Er kann auf irgend eine Insel geworfen, an irgend einer Küste geborgen worden sein,« rief er, »man muß ihn suchen!« Sogleich bedeckte sich die See mit Nachen, man durchspähte jede Nachbarinsel, und es war freilich zu bewundern, daß man erst zuletzt auf die Erleninsel kam, wo sich der Verlorene nun schon vier Tage lang aufgehalten hatte.
Man brachte ihn zurück in die Arme des Vaters, dessen Freude gränzenlos war. Hiolm wurde jedoch von dem Tage an, wo er in das väterliche Haus zurückgekehrt war, still und nachdenkend. Was er auf der Insel gesehen hatte, sagte er Niemand, aber er vergaß es auch nicht. Gegen den Glanz, gegen das Farbenspiel, das er dort erblickt hatte, kam ihm alles was ihn hier umgab, alltäglich und elend vor.
Sein Auge schmachtete nach neuer Weide, sehnend blickte er Tag und Nacht nach der Erleninsel, er fand sogar Gelegenheit einst da selbst zu übernachten, aber – er sah nichts, und erst jetzt gedachte er seines Traumes, der Vollmondnächte, und brachte es endlich dahin, sich die Zeit ganz richtig auszurechnen, wo er wieder erblicken könnte, was er ehemals sah.
Nachdem er erst hierüber mit sich einig war, so hatte das Übrige keine Schwierigkeiten. Sobald der Mond sich völlig rundete, lag ein Nachen in einer verborgenen Bucht bereit, Hiolm fuhr des Nachts heimlich nach seiner zauberischen Insel, sah wieder was er für das einzige Sehenswürdige auf diesem Erdenrund hielt, und schiffte befriedigt, ehe der Morgen graute, nach Siölund zurück.
Gern hätte er die Fahrt in den nächsten Nächten wiederholt, aber er wußte, daß die Schönheit des Schauspiels sich mit jeder Veränderung der Mondscheibe minderte, er fürchtete durch öftere Abwesenheit Verdacht zu erregen, und faßte den Entschluß, nur alle Monate einmal sich das Vergnügen zu gewähren, dem seines Erachtens keins auf Erden gleich kam.
So trieb er es ein ganzes Jahr lang, und ach, wie trauerte er, wenn umwölkter Himmel, raue Witterung, strenge Aufsicht, oder andere Hindernisse ihn einmal um seine kindische Freude brachten! –
Er dachte an nichts anders, als an das Entzücken, das uns in diesen Jahren der Anblick bunter Farben und schöner Formen gewährt, und wenn es ihm ja einmal beim Anschauen der Tänze dieser Äthergestalten in den Sinn kam, es müsse Seligkeit sein, sich in ihre Kreise zu mischen, so hielt ihn stets ein eigentümliches Gefühl zurück, und er blieb ruhig auf dem Grabe unter dem Rosenstrauche, welches immer sein gewählter Standort war.
Hinrich von Röschild fand nach der Zeit, daß sein Sohn Hiolm ein Träumer war, der bei herannahenden Jünglingsjahren wenig Hoffnung gab, das zu werden, was er als munterer Knabe versprochen hatte. Unter dreißig Tagen war kaum einer, wo man an ihm den alten Frohsinn bemerkte; sein Fleiß und seine Betriebsamkeit, von welcher sich schon in frühester Kindheit so schöne Spuren gezeigt hatten, machten einem düstern, trägen Wesen Platz, das dem Vater äußerst mißfiel.
Nur in den Geschäften, die auf der Erleninsel zu verrichten waren, zeigte Hiolm den alten Eifer; er war gern da selbst, um, wenn er auch das nicht sah, was er immer zu sehen wünschte, doch wenigstens auf dem Schauplatz der herrlichen Szenen das Vergnügen der Vollmondnächte zu feiern. So würde er sein ganzes Leben fort geträumt haben, hätte man ihn nicht mit Gewalt aus seinem Taumel gerissen.
Der Vater entschloß sich auf Anraten seiner Freunde, Hiolm nicht länger in Siölund zu lassen, wo alles seine Trägheit und seine Träumereien zu begünstigen schien. Er schickte ihn nach Röschild oder Röskild, seiner Vaterstadt, die in den damaligen Zeiten die blühendste aller nordischen Handelsstädte war, und noch den Vorrang vor Siölund behauptete.
König Harald Blantaand, der damals regierte, hielt sie für den schönsten Schmuck seiner Krone, und hatte viel zu ihrer Verschönerung getan; er residierte den größten Teil des Jahres da selbst, und hatte sich auf den Trümmern eines alten Schlosses, das noch König Roe bewohnt haben sollte, einen Palast gebaut, der in den damaligen Zeiten seines Gleichen suchte. –
Was Hinrich von der Veränderung des Ortes gehofft hatte, das geschah. Hiolm trauerte eine Zeit lang über den Abschied von der geliebten Erleninsel, suchte dann sich zu betäuben, sich an anderen minder glänzenden Gegenständen zu erfreuen, als die, welche er auf der zauberischen Insel gesehen hatte, fand einen Ersatz an den Schauspielen von Haralds prächtigem Hofe, und zuletzt Beruhigung in den Geschäften.
Er trieb sie mit Ernst, aber rechten Geschmack konnte er ihnen doch nicht abgewinnen; es schien, als wäre ihm das unaufhörliche Jagen nach Erwerb und Vorteil zu kleinlich, als fühle er in seinem Busen einen Trieb nach höheren Taten. Krieger, Held, Retter oder Beglücker ganzer Völker zu sein, – das war das Ziel seiner Wünsche, und die erste Gelegenheit einen Schritt aufwärts nach dieser Sphäre zu tun, wurde nicht versäumt.
Die Küste von Seeland wurde damals sehr von Seeräubern beunruhigt. Hiolms Vater hatte beträchtliche Verluste durch sie erlitten, und es war daher dem Sohne nicht zu verdenken, daß er sich entschloß, die seinem Vater angetanen Unbilden nach Kräften zu rächen. Hiolm äußerte seine Wünsche mit so viel Feuer, daß Hinrich entzückt war, in seinem Sohne die ehemalige Tätigkeit, die Quelle des vergötterten Reichtums, wieder erwachen zu sehen.
Er vergönnte ihm nicht allein einige Streifereien wider die nordischen Korsaren, sondern rüstete ihm, als der junge Held sich gar bald auf rühmliche Weise auszeichnete, ein eigenes Schiff aus, um ihm Gelegenheit zu geben, mit dem selben seinem Triebe zu Heldentaten desto besser nachhängen zu können. »Es gilt mir gleich,« sagte er, »ob mein Sohn Reichtümer zu erwerben, oder Reichtümer mit dem Schwerte zu schützen weiß; er sei nur tätig und ich bin zufrieden.«
Hiolm hatte damals das achtzehnte Jahr zurückgelegt; seine Heldenfigur und der kühne Mut, der ihn beseelte, bestimmten ihn zum Krieger, und die Kenntnisse, die er sich zu Röschild in der Schiffskunst erworben hatte, befähigten ihn zu der Stellung eines Seemannes. Er tat mit dem Schiff, das man seinem Kommando anvertraut hatte, den ersten Streifzug wider die Korsaren, und er kam mit Beute beladen zurück, den zweiten, und er hatte einen Sieg erfochten, der von großem Einflusse auf das Wohl seines Vaterlandes war.
Bald darauf hatte er das Glück, mit noch einigen Schiffen, die sich zu ihm gesellten, und ihn einmütig zum Anführer wählten, einen Streich auszuführen, der alle vorige an Kühnheit und glücklichem Erfolge übertraf, und seinen Ruhm weit über die Grenzen der nördlichen Inseln verbreitete. Dies entflammte seinen Mut noch mehr, und den Feinden der Sicherheit auf der Ostsee wurde ewiger Krieg geschworen.
Als es Hiolm nun endlich so weit gebracht hatte, daß das verderbliche Seeräubergesindel gänzlich von ihm vertilgt zu sein schien, und man ihn für den Retter des Vaterlandes halten mußte, da traten die Vornehmsten seiner Vaterstadt zusammen und beratschlagten, welche Belohnung des jungen Helden würdig sei.
»Mit Reichtümern« sagten sie »ist ihm nicht gedient; sein Vater ist reicher als wir alle. Für andere Dinge hat er kein Gefühl, denn er ist nicht wie die übrigen Jünglinge seines Alters; die Waffen sind sein Abgott, die gewöhnlichen Götzen der Jugend kennt er gar nicht.« – Endlich wurden sie einig, ihm zum Andenken der dem Vaterlande erzeigten Wohltaten, den Namen Hiolm von Seeland anzutragen, und ihn dadurch auf immer vor seinen Zeitgenossen auszuzeichnen.
»Du bist,« sagten sie zu ihm »der tapferste Sohn der vaterländischen Insel, du hast die Rechte deiner Mutter mit deinem Blute verteidigt, und es ist billig, daß du dich auch nach ihrem Namen nennst, und durch den selben jedem, der ihn hört, stillschweigend sagst, welch ein Mann du bist.« –
Viele Geschichtsforscher wollen in dieser Handlung die erste Spur von der Entstehung des Adels finden. Zwar wußte man damals noch nichts von Adel oder Adelstolz, aber der Keim zu dieser Erbsünde lag schon in manchem Herzen; auch in Hiolms Herzen fand er sich, und seine Mitbürger hatten gerade die rechte Ehrenbezeigung gefunden, ihn zu erfreuen und zu belohnen.
Der erlangte Ehrentitel entzückte ihn, und das Bewußtsein, ihn verdient zu haben, entschuldigte die kleine Eitelkeit, die in dieser Freude lag. Es war nun einmal Hiolms Schicksal, sich an einem glänzenden Nichts zu ergötzen; als Knabe fesselten ihn die bunten Erscheinungen der Erleninsel, als Jüngling ein hochtönender Name, und was für ein Spielzeug ihm als Mann aufbehalten war, das wird der Leser bald erfahren.
Hiolm von Seeland häufte Siege auf Siege, sein Durst nach Ehre wurde nimmer gestillt, seine Ruhe war das Geräusch der Waffen, und so würde es sein ganzes Leben hindurch gedauert haben, hätte ihn das Schicksal nicht dem beständigen Kreislauf, der keinen wahren Lebensgenuß aufkommen läßt, mit einem einzigen Zuge entrissen.
Einst geriet er an einen der grönländischen Seeräuber, die sich damals auf den nördlichen Gewässern so furchtbar machten, als die Algierer heut zu Tage auf den südlichen. Der Kampf war blutig, der Sieg wurde teuer erkauft, aber die Beute, die gemacht wurde, war auch des Kampfes wert! Als Hiolm die Beute musterte, die er gewöhnlich größtenteils unter seine Krieger austeilte, da wurden ihm auch zwei junge Sklavinnen von ungewöhnlicher Schönheit vorgestellt.
Diesen hätte er nun, wie er in einem solchen Falle sonst zu tun pflegte, gleich die Freiheit schenken und sie nach dem Orte bringen lassen sollen, den sie selbst bezeichnen würden, aber ungeachtet sie unsern Helden kniend hierum flehten, so wurden sie doch vorläufig mit ihrer Bitte abgewiesen und als Gefangene betrachtet.
Auch schien es, als wenn beide reizende Geschöpfe, besonders die Schönere von ihnen, die sich Edda nannte, nur Anfangs recht von Herzen um ihre Freiheit gebeten, später aber die Bitte nur des Anstandes wegen wiederholt hätten.
»Edda,« sagte Hiolm am vierten Tage zu seiner schönen Gefangenen, »du irrst, wenn du glaubst, daß ich dich noch länger gegen deinen Willen hier behalten wollte; du bist frei wie die Luft, die dich umgibt. Nenne mir das glückliche Land, wo du geboren bist, und meine Segel richten sich augenblicklich nach dieser Gegend, und sollten es die zimmerischen Inseln oder das mittägliche Feuerland sein.
Aber wenn du nun wieder bei den Deinigen bist, wenn nun diese Augen dich nicht mehr sehen, was soll dann aus mir werden? O Edda! Edda! welche Gewalt übst du über mein Herz! Sage, wer bist du, daß dein erster Blick mich so mächtig bezauberte? Du bist meiner Seele verwandt, ich sah dich heute nicht zum ersten Mal! Sage, wo haben dich diese Augen zuerst erblickt? –
Mir ist es, als wenn ich dich mein ganzes Leben hindurch rastlos gesucht hätte, und da ich dich nun endlich gefunden habe, soll ich dich denn so gleichgültig wieder hingeben, um dich für immer zu verlieren?«
Edda beantwortete diese Rede mit einer Träne, die aus ihren schönen Augen rollte. Eine zweideutige Antwort, die Hiolm vielleicht nicht zu seinem Gunsten deutete, zu deren Erklärung sich jedoch Edda selbst bald verstand und dadurch unsern Helden in einen Himmel von Freuden versetzte.
»Hiolm,« sagte das reizende Mädchen, »ob ich dich zuvor gesehen, ob ich dich gesucht und nun gefunden habe, das weis ich nicht, aber daß es mir in deiner Nähe wohl ist, daß mir wehe wird, wenn ich ans Scheiden denke, das fühle ich; auch möchte ich wohl gern bei dir bleiben, wenn ich wüßte, wie ich das mit gewissen Dingen vereinigen soll, über die ich mich noch nicht aussprechen kann. Hilf mir aus meinen Zweifeln und ich will dir danken!«
»Deine Zweifel sind leicht zu lösen,« sagte er, »du fürchtest dich wahrscheinlich, gegen den Willen deiner Eltern mein zu werden! Laß uns deshalb zu den Deinigen ziehen! Ich bin Hiolm von Seeland, ich hoffe, kein Fürst wird mir seine Tochter versagen!« »O nein! o nein!« rief sie mit ängstlicher Stimme, »willst du mich an einen Ort zurückbringen, den ich nie wieder verlassen dürfte?«
Diese Worte legte Hiolm als unbedingte Einwilligung aus, und da man also in der Hauptsache einig war, so wurde bald eine Verbindung geschlossen, die in den damaligen Zeiten eben so gut für die Ewigkeit geknüpft wurde, als in den unsrigen, die man aber in jenen einfachen Zeiten nie mit großen Zeremonien begleitete.
Als Hiolm des Jaworts seiner Geliebten gewiß war, führte er sie auf das Verdeck des Schiffs, und schwur ihr im Angesichte des Himmels, der sie grenzenlos umwölbte, und der Sonne, die eben in die westlichen Fluten wie in ein Feuermeer hinab sank, ewige Treue.
Thulis, die Gespielin der Braut, und Hiolms Schiffsvolk waren Zeugen; erstere beobachtete während der ganzen Szene ein nachdenkliches Schweigen, aber letztere ließen ein lautes: Es lebe Hiolm von Seeland und Edda sein Weib! in die Lüfte ertönen, daß von dem lauten Jubelgeschrei die Walfische aus dem ersten Schlummer auffuhren, die Meergötter die grünen Häupter hervor steckten, zu sehen, was es gäbe.
»Was hast du getan?« sprach Thulis zu ihrer Gefährtin, als sie wieder mit ihr allein war. »Ist dies eine Verbindung, die deiner Abkunft entspricht? Und wie denkst du solche vor einem strengen Richter zu verantworten, den du wohl kennst, und dem sie doch endlich kund werden muß?«
»O schweige, schweige!« rief Edda, »daß nicht irgend ein wandernder Geist dich höre und ihm bekannt mache, was er nie spät genug erfahren kann. Was Liebe tat, kann vielleicht Liebe entschuldigen.«
»O Edda! Edda!« erwiederte die Gespielin, »was ist aus dir, die sich früher zu gut dünkte, Skandinaviens Königin, oder Fürstin der Insel Mona zu werden, jetzt geworden?«
Nicht Neid oder menschenfeindliche Tadelsucht war es, was aus dem Munde der schönen Fremden sprach, sondern Liebe für ihre Freundin Edda; diese wußte sie in deß bald mit ihrer Wahl auszusöhnen, und da Thulis gestehen mußte, daß Hiolm von Seeland ein Mann ohne Gleichen sei, dessen Vorzüge wohl allenfalls eine Missheirat entschuldigen konnten, so war das vertrauliche Einverständniß zwischen den beiden Gespielinnen bald wieder hergestellt, und eine gelobte der anderen, in Lieb und Leid, in Not und Tod bei einander auszuhalten.
Hiolm wußte nichts von dem, was im Rate der Damen vorgegangen war, und wäre ihm auch ein Wörtchen davon zu Ohren gekommen, so würde er doch so wenig von diesen Rätseln verstanden haben, als unsere Leser zur Zeit noch davon verstehen.
Er fühlte sich an der Seite seiner Edda, die ihm die zärtlichste, liebevollste Gattin war, ganz glücklich, und obgleich heftige Stürme sein Schiff weit hinaus in die nördlichen Gewässer verschlagen hatten, wo in jetziger Zeit, weil es dort gar nicht lieblich zu schiffen ist, kein Segel weht, so achtete er doch die Mühseligkeiten, die Edda mit ihm teilte, wie nichts, und die lange Rückreise in das Vaterland dünkte ihm so kurz, wie die ehemaligen Fahrten nach der Erleninsel.
Ach, wie oft dachte er jetzt der dort verträumten himmlischen Stunden! Was damals seiner kindlichen Seele wie im Schatten vorschwebte, schien ihm jetzt im Arme seiner Edda ein weissagender Traum, der seine Deutung nicht verfehlte. Wie Edda und die Erleninsel zusammen paßten, wußte er eigentlich nicht, aber seine Phantasie verband gern Beide miteinander, vielleicht, weil Edda das, was er ihr von der Erleninsel sagte, so gut zu verstehen und zu beantworten wußte.
Nicht Jedermann kann sich in solche Schwärmereien finden, und wenn Hiolm zuweilen einem Freunde Winke von diesen Dingen gegeben hatte, so war er nicht selten verlacht worden. Seine Freundin verlachte ihn nicht, und sie war ihm deshalb um so teurer.
Bei der Eheverabredung zwischen Hiolm und der schönen Edda waren gegenseitig nur sehr wenig Bedingungen gemacht worden, doch war eine darunter, die Edda ihrem Verlobten mit großem Ernste vorgetragen hatte und von der sie durchaus nicht abgegangen war.
»Der Tag,« sagte sie, »der mich zuerst in die Sklaverei brachte, aus welcher du mich rettetest, wird mir ewig unvergeßlich sein! Ich habe gelobt, zu seinem Andenken immer den Achtundzwanzigsten jedes Monats mit Beten und Fasten zu feiern. Vierundzwanzig Stunden vor, und vierundzwanzig Stunden nach dieser Zeit werde ich dir stets unsichtbar sein, mich auf mein Zimmer verschließen, und ich verlange es als einen Beweis deiner Liebe, daß du nie einen Versuch machst, mich zu stören. Wärst du im Stande, hier gegen Einwendungen zu machen, so müßte ich auf eine Verbindung mit dir verzichten.«
Wo ist der Bräutigam, der bei solcher Bedrohung nicht zugesteht, was seine Verlobte fordert? Auch Hiolm tat es, obgleich es ihm als eine harte Forderung erschien, auf diese Weise jährlich fast einen Monat des Anblicks seiner Geliebten beraubt zu sein.
Eifersüchtig war Hiolm zum Glück nicht, auch hatte er, wenigstens während der Schifffahrt, keine Ursache sich etwas Arges unter dem Beten und Fasten seiner Gattin vorzustellen; der Schlüssel zu ihrer Kajüte war in seinen Händen, das Meer war Vormauer gegen alle verbotenen Wanderungen, und die treue Thulis, vor deren tugendhafter Strenge Hiolm große Achtung hegte, schlummerte als Hüterin in dem Vorzimmer der andächtigen Edda.
Endlich ging die lange Seereise zu Ende, und Hiolm sah wieder die weißen Küsten seines Vaterlandes. Er erzählte seiner jungen Gemahlin viel von der Liebe seines Volkes, viel von der Zärtlichkeit, die sein Vater für ihn hege, und von dem frohen Empfange, der daher für ihn und sein anderes Ich zu erwarten sei. –
Was das Erstere betrifft, so wurden seine Erwartungen auch einigermaßen erfüllt. Als in Siölund der Ruf erschallte, daß der angebetete Wohltäter des Vaterlandes, daß der lang erwartete Hiolm vor Anker liege, da strömte alles Volk hinaus, ihn willkommen zu heißen, und wo möglich etwas von der reichen Beute zu erhaschen, die er immer von seinen Streifzügen mit zu bringen pflegte.
Als sie aber sein Schiff sahen, das zuletzt noch einen großen Sturm ausgestanden hatte, und jetzt fast Mast- und Segellos im Hafen einlief, als sie in ihm und seiner Schiffsmannschaft mehr die Gestalten ermatteter Seefahrer als reicher Sieger erblickten, als sie erfuhren, daß Hiolm diesmal ganz arm zurückkehre, weil man dem Meere, um das Schiff zu erleichtern, alle Schätze hatte aufopfern müssen, da ließen sie bald eine gewaltige Verminderung der ersten Freude spüren, und der, der sonst fast keinen Schritt ohne jauchzendes Volksgedränge tun konnte, wurde nicht gehindert, mit seiner Edda und deren Gespielin Thulis, der einzigen Beute, die er mitbrachte, ruhig nach dem Hause Hinrichs von Röschild zu gehen.
Ihr Aufzug war freilich nichts weniger als glänzend, denn ihre Kleider waren durch die lange Seereise unscheinbar geworden, und Edda's Schönheit war ihr einziger Schmuck, die aber, wie bekannt, im geringen Gewande immer nur wenig Aufsehen macht.
War Hiolm schon von dem Volke schlecht empfangen worden, so war dies bei seinem Vater noch mehr der Fall; ersteres war unzufrieden, daß der sonst so beutereiche Held nichts, und Hinrich zürnte, daß er zuviel mitgebracht hatte. Die Schwiegertochter, welche der junge Mann seinem Vater vorstellte, stand dem selben gar nicht an; abgetragene Kleider und ein leeres Schiff waren ja keine Zeichen von reicher Mitgift.
Der gewinnsüchtige Kaufmann hatte auf eine glänzendere Verbindung für seinen Sohn gerechnet. Die stolze Bemerkung, die Hiolm bei seiner Bewerbung um Edda gemacht hatte, daß Hiolm von Seeland wohl auf eine Fürstentochter rechnen könne, war dem alten Hinrich einleuchtender als irgend Jemand; wie mußte es ihm nun schmerzen, daß sein Sohn alle seine großen Erwartungen um einer Sklavin, einer Bettlerin willen zu nichte gemacht hatte!
Dies waren die Namen, die er der schönen Edda beilegte, sobald er mit seinem Sohne allein war; sie in das Angesicht zu beschimpfen, dazu war der alte Herr doch nicht unhöflich genug, auch hatte sie Etwas an sich, das Ehrfurcht und Schonung gebot.
Hiolm war über das Mißvergnügen seines Vaters tief bekümmert, aber er vermochte nicht, deshalb seine Gattin zu verlassen, wie es sein Vater von ihm verlangte. Er tat alles Mögliche, um Hinrich von Röschild mit seiner Wahl auszusöhnen, aber dieser blieb der Mann, der Gold und Größe für das höchste Gut der Erde hielt, und Schönheit und Tugend nur dann eines Blicks würdigte, wenn sie mit dem ersten verbunden waren.
Edda war über den kalten Empfang tief betrübt, aber sie wußte ihre Gefühle gegen ihren Gemahl zu verbergen. Dieser brachte sie und ihre Freundin nach einem kleinen Hause am Ufer der See, welches ihm gehörte, und wo er seine Wirtschaft so sehr einschränkte, als es seine jetzigen Umstände erforderten. Edda ließ sich alles gefallen, und fügte sich mit bewundernswerter Geduld in ein Leben, zu welchem sie wahrscheinlich nicht geboren war.
Thulis weinte im Stillen und hütete sich, ihrer Freundin Vorwürfe zu machen, aber Hiolm war immer frohen Mutes und guter Hoffnung. »Meine Umstände,« sagte er zu sich selbst, »müssen sich ändern, es sei auf die eine oder die andere Art. Mein Vater kann nicht ewig hart gegen einen Sohn sein, den er ehemals vergötterte, und säumt er, mir seine helfende Hand zu bieten, so kann ein einziger Zug in die See mir soviel Beute bringen, daß Edda keinen Mangel mehr kennen, das die Liebe meines Volkes, vielleicht auch die Liebe meines Vaters zurückkehren wird.«
Die Hoffnungen, die sich Hiolm machte, täuschten ihn in deß abermals. Zwar nahm er die Trümmer seines kleinen Vermögens zusammen, sein Schiff wieder auszurüsten, zwar wagte er mit dem selben verschiedene Streifzüge wider die Seeräuber, die sich in seiner Abwesenheit ziemlich gemehrt hatten, aber er kam immer als der Besiegte zurück, und an Beute war gar nicht zu denken.
Liebe und Achtung sind immer der Schatten des Glücks, und da dieses von ihm gewichen, so war es natürlich, daß auch die beiden anderen nicht wiederkehrten. Das Volk sah seinen ehemaligen Retter ruhig an seiner Seite darben, und Hinrich verhärtete sein Herz immer mehr. Weder Hiolms Leiden, noch Eddas Schönheit, noch das Lächeln eines Enkels, den sie ihm um diese Zeit in die Arme legte, konnten zärtliche Gefühle in einem Herzen erregen, das für nichts Sinn hatte, als für Reichtum und Größe.
Zu jener Zeit hatte Edda wieder ihre Bet- und Fasttage abzuhalten; Hiolm gönnte ihr gern die Einsamkeit ihres Zimmers, um auf dem Seinigen gleichfalls einem Grame ungestört nachzuhängen, den er aus Schonung in ihrer Gegenwart nie freien Lauf ließ.
Der hartherzige Vater benutzte die traurige Lage seines Sohnes, um ihn zur Einwilligung in gewisse Pläne zu vermögen, die er ausgebrütet hatte. So wie das Haus des Reichen von Schmeichlern und Augendienern umlagert wird, so schlich um die Hütte des Armen unablässig ein Heer von Spähern und Austrägern, die alles auskundschafteten. So geschah es, daß Hinrich bald alles wußte, was in Hiolms vier Mauern vorging, und er verstand es, die erhaltenen Nachrichten bestens für seine Pläne zu benutzen.
»Was säumt Hiolm,« ließ er ihm sagen, »das Joch der Armut und des väterlichen Zornes abzuschütteln, das er um eines Weibes willen trägt, welches keine Aufopferung verdient? Wer ist Edda, daß ihr Gemahl ihr zu Liebe sich dem Elende hin gibt? Hat sie ihm genügende Auskunft über ihre Geburt und ihr Vaterland gegeben?
Kann er sich nur der kleinsten freundschaftlichsten Vertraulichkeit von der Falschen rühmen? Was beginnt sie in den Tagen und Nächten, da sie ihn von ihrer Gegenwart verscheut? Sie betet und fastet? – Ha des Wahns! Hiolm belausche sie nur einmal in ihrer Einsamkeit, so wird er die Sachen ganz anders finden!«
Wer weiß, was diese Vorstellungen, mit welchen man dem unglücklichen Manne täglich in den Ohren lag, endlich würden gefruchtet haben, wenn nicht eine weise, freundschaftliche Hand das Unheil abgelenkt hätte.
Die treue Thulis sah das Ungewitter aufsteigen, und hielt es für Pflicht, ihre Freundin zu warnen. »Edda,« sagte sie, »ein böser Geist ist geschäftig, dich und deinen geliebten Hiolm zu entzweien. Ich weiß, daß du es deinem Gatten nicht verzeihen könntest und dürftest, wenn er es wagen sollte, dir deine Geheimnisse zu entreißen, und doch hat er schon freventliche Versuche dazu gemacht. Ich scheue seine Gegenwart, weil er immer jene Geheimnisse zur Sprache bringt, die ich ihm wahrscheinlich enthüllen soll. Den kühnen Fragen werden bald kühne Handlungen folgen, wenn du nicht etwas tust, diesen vorzubeugen.«
Edda verfiel in ein tiefes Nachsinnen. »Wohlan,« rief sie nach einer langen Pause, »der Streich sei gewagt, den ich noch eine Zeitlang aufzuschieben gedachte; es ist besser, das Rätsel zu einer Zeit zu lösen, wo Hiolm noch des für ihn daraus entspringenden Glückes würdig ist, – es ist besser, die verdrießliche Lage, in der wir sind, jetzt zu ändern, ehe uns die Geduld ausgeht, als die Sache auch nur um einen Augenblick zu verzögern.
Was mich betrifft, so fühle ich zwar die Kraft in mir, noch Jahre lang um Hiolms willen zu dulden und ihm alles zu opfern, aber besitzt er Kraft und Mut, gleich mir auszudauern? – Und was hast du, gute Thulis, verschuldet, um ohne Nutzen und Zweck noch länger mit mir zu leiden?«
Die Freundinen überlegten hierauf miteinander, wie das, was sie im Sinne hatten, am füglichsten einzuleiten wäre, doch konnten sie nicht ganz einig werden; aber am folgenden Morgen mußte Hiolm selbst zu einem Anschlag die Hand bieten, der ohne Zweifel der beste war.
Dieser treue, zärtliche Gatte, der noch keinesweges so nahe daran war, wortbrüchig zu werden, als die ängstliche Thulis meinte, redete seine Gemahlin folgendermaßen an. »Edda,« sagte er, »ich vermag es nicht länger, dich im Elend und Unglück zu sehen, diese Arme müssen dein Schicksal ändern; geht es auf dem bisherigen Wege nicht, so laß uns einen andern wählen; ich gehe nächster Tage wieder in die See, um unser Glück auf andere Weise zu versuchen.«
»Wie?« fragte Edda ein wenig spitz, »kann Hiolm sich entschließen, seine Gattin auf Wochen und Monate sich selbst zu überlassen, die er kaum im einsamen Zimmer sich und der Tugend sicher glaubt?«
»Höre, was ich vorhabe,« erwiderte Hiolm, der ihre Rede nicht verstand oder nicht verstehen wollte. »Du weißt, daß ich nichts besitze, als jenes Schiff, das zu schlecht bemannt, zu schlecht mit Allem versehen ist, als daß ich nochmals einen von meinen gewöhnlichen Streifzügen wider die Seeräuber wagen könnte, die mir über dies nicht mehr glücken wollen. Ich habe mich daher entschlossen, mich in die Dienste irgend eines großen Königs zu begeben.
Noch ist der Name Hiolm von Seeland berühmt genug, mir günstige Aufnahme und großen Sold zu verschaffen, und dies genügt mir vorläufig. Für die Zukunft haftet mein Schwert; der Himmel wird ihm ja endlich wieder günstig werden, und es mit der alten Stärke wirken lassen! Bete für mich, du fromme Dulderin, daß dein Hiolm wieder der Schrecken der Feinde werde, was er vormals war.«
Edda wurde von Hiolms Erklärungen bis zu Tränen gerührt. Wie konnte sie wider diesen Mann Zorn oder Verdacht im Herzen hegen? Widerlegten nicht seine Worte alle ihre Besorgnisse? – Sie fühlte, daß diese wenigstens vor der Hand ganz unnötig gewesen, doch was sie für den wankenden Hiolm zu tun entschlossen war, das konnte sie dem standhaften noch weniger versagen.
»Mein Gemahl,« sagte sie, indem sich die gewöhnliche Holdseligkeit über ihr schönes Gesicht verbreitete, »darf deine Edda fragen, welcher König so glücklich sein wird, Hiolms Schwert für sich fechten zu sehen? – Doch nicht der König von Skandinavien? – O scheue den Dienst des blutgierigen Kriegers! Ehre, Ruhm und Beute gönnt er nur sich selbst, seinen Dienern Wunden und Tod.«
»Und wem sollte ich sonst meine Waffen widmen?« fragte Hiolm. »Der König der nordischen Reiche hat das nächste Recht auf die selben!« »Es gibt noch mehr nordische Fürsten, mein Teurer! Kennst du den König von Thule? Fürwahr ein tapferer und weiser Fürst, würdig, den ersten Thron der Welt zu besitzen, und doch zufrieden mit seinen rauhen Gebirgen, die die Natur so stiefmütterlich bedachte.«
Hiolm wunderte sich, seine Gemahlin mit so vielem Feuer von einem Fürsten sprechen zu hören, dessen Name in diesen Gegenden nicht allzubekannt war, denn der stille Ruhm guter friedfertiger Fürsten fliegt nicht weit über die Grenzen ihrer Reiche. Edda gab vor, unter den grönländischen Seeräubern, aus deren Gewalt sie Hiolm gerettet hatte, viel von dem König von Thule gehört zu haben, und erzählte noch so viel Rühmliches von ihm daß Hiolm, begeistert wie sie, bei seinem Schwerte gelobte, es für keinen anderen, als ihn zu ziehen.
Als sie ihn so entschlossen sah, fuhr sie fort: »Darf ich dir raten, mein Gemahl, so diene dem Fürsten, dem du dich widmest, ehe du ihm noch deine Dienste anbietest. Die Grönländer beunruhigen die Küste von Thule jetzt sehr, du wirst in diesen Gewässern unbestellte Arbeit finden. Laß den Ruf deiner Taten vor dir hergehen, und du wirst dem tapferen Könige der nördlichen Insel desto willkommner sein; und noch eins: –
In dem Lande, wo ich geboren bin, ein Seeland wie das Deinige, hält man viel auf ein glückliches Schiffszeichen; ich glaube, es hat dir bisher an einem solchen gemangelt, und du hast darum weder Sieg, noch Beute erlangen können. Nimm deshalb den alten Walfischkopf von dem Hinterteil deines Schiffes und scheue die Kosten nicht, mich, deinen Sohn und meine Freundin Thulis nach dem Leben auf das selbe malen zu lassen; du wirst sehen, welchen großen Nutzen dir dies bringt, und mir ewig dafür danken.«
Der Vorschlag der schönen Edda ließ sich hören, aber es bedurfte großer Vorbereitungen, um ihn auszuführen. Hiolm tat in deß sein Mögliches, sein Schiff zu einem solchen Zuge herzustellen, und hatte die Freude, Unterstützung von einer Seite zu erhalten, woher er längst nichts mehr erwartet hatte.
Hiolms Vater sah es nämlich aus verschiedenen Ursachen gern, daß sich sein Sohn von Siölund entfernte, und mit seiner Hilfe war er in sehr kurzer Zeit so weit, in See zu gehen. Auch das Gemälde war von einem guten lombardischen Meister, den ein Zufall nach Norden geführt hatte, gefertigt; zwar fand man es ein wenig seltsam, aber Edda hatte es ja so gewünscht, und ihr zur Liebe wurde es ihrem Gemahl sehr leicht, sich über das Gerede der Leute hinweg zu setzen.
Als Hiolm von seiner Gattin Abschied nahm, zeigte sich diese standhafter, als er selbst; ihr schien irgend etwas Großes vorzuschweben, das sie tröstete. Ach, dämmernde Hoffnung winkte ihr vielleicht von fern, und sie übersah darüber den Abgrund, der sich zu ihren Füßen öffnete!
Hinrich von Röschild hatte nur auf die Abreise seines Sohnes gewartet, um seine feindseligen Anschläge wider die unschuldige Edda auszuführen. Kaum hatten sich seine Segel am Horizont aus dem Gesicht verloren, so nahm der hartherzige Vater die schöne junge Frau, ihren Sohn und ihre Freundin, setzte sie in einen Nachen, und ließ sie mit den notdürftigsten Lebensmitteln versehen, auf die Erleninsel bringen, um dann Weiteres über die drei unglücklichen Personen zu beschließen.
Seine Neider sagten ihm nach, er habe im Sinne gehabt, sie an einen chinesischen Sklavenhändler zu verkaufen, dergleichen in den damaligen Zeiten, da alles anders war als jetzt, viele in Siölund einzusprechen pflegten.
Nicht alle Einwohner der Stadt, welche wir hier eben genannt haben, waren hartherzig oder undankbar; es gab viele, die Hiolms Gemahlin aufrichtig beweinten, als sie sie hinüber nach der übel berüchtigten Erleninsel führen sahen, und Hinrichs böse Absichten mutmaßen konnten. Sie aber lachte und suchte die schöne Thulis, die etwas weniger heiter war, als sie, zu gleicher Fröhlichkeit zu bewegen.
»Merke,« sagte sie leise zu ihr, »wie gut es das Schicksal mit uns meint; ist es doch, als hätte es unserem Feinde den Ort unserer Verweisung selbst in den Sinn gegeben!«
Während man auf diese Weise mit Hiolms Angehörigen verfuhr, durchschnitt sein Schiff den Ozean, und peitschte die Wellen, bis es in die Gegend kam, wo es laut der Weissagung seiner klugen Gemahlin bestellte Arbeit finden sollte, und sie wirklich fand. Der Seeräuber Naddock beunruhigte zur damaligen Zeit das atlantische Meer; seine Absicht war vornehmlich auf Thule gerichtet, und es wäre vielleicht um die Schneeinsel und ihren guten König geschehen gewesen – denn Naddock war sehr mächtig – wenn das Schicksal nicht einen Retter herbeigerufen hätte.
Wie es dem Helden von Seeland möglich war, mit einem einzigen Schiffe einen so mächtigen Gegner zu besiegen, darum befrage uns niemand, denn wir wissen nichts anderes zu antworten, als daß die alte Fabelgeschichte, besonders die nordische, reich an wohl noch ungläubigen Ereignissen ist.
Genug, Hiolm siegte, wenigstens in so weit, daß er den Feind von Thule auf eine lange Zeit entkräftete, und ihn nötigte, sich mit den Überbleibseln seiner Macht auf die große Insel zu flüchten, die man in den damaligen Zeiten Atlantis nannte, und wo es ihm wenigstens nicht an Raum fehlen konnte, wieder zu Kräften zu kommen, um einst doppelt fürchterlich zurückzukehren.
Hiolms Absicht war es nicht, ihn auf seiner Flucht zu verfolgen, wozu es ihm überdies an Macht fehlte; er ließ ihn im Besitze der goldenen Brücke, die laut dem Sprichwort jeder fliehende Feind verdient. Er lief, wie ihm Edda vorgeschrieben hatte, in den großen Hafen bei der Hauptstadt der Schneeinsel ein, wo ihm schon der Ruf von seinen Taten vorausgeeilt war, und wo sich bei seiner Ankunft das ganze Land regte.
»Ist das Hiolm von Seeland,« rief Jedermann, »dessen Namen uns unsere durch ihn geretteten Schiffe mit so viel Achtung nannten? Ist das der Überwinder des mächtigen Naddock, der Beschützer von Thule? – Mensch oder Halbgott, wer er auch sei, wir müssen ihn empfangen und ihn ehren, wie es Pflicht und Dankbarkeit erheischt. Wenn wir auch nicht vermögen, ihn für seine Taten würdig zu belohnen, so wird er doch gewiß nicht unempfänglich für die geringen Beweise unserws Dankes sein und unsre gute Absicht nicht verkennen.«
Hiolm war weder Halbgott, noch irgend ein anderes über menschliche Vergeltung erhabenes Wesen, und es erfreute ihn daher der glänzende Empfang, den man ihm bereitet hatte, ungemein. Man brachte ihm außerdem noch wertvolle Geschenke als ein Zeichen der Erkenntlichkeit dar, die Hiolm jedoch ausschlug, und durch diesen Beweis seiner Großmut sein Ansehen sehr vergrößerte. Auch bedurfte er solcher Geschenke nicht, denn in den Kämpfen mit Naddock hatte er reiche Beute gemacht.
Der alte König von Thule war von seinen Taten, von seinem edlen Betragen, von seiner Heldenfigur, von allem, was ihn umgab, ganz bezaubert. Hiolm begehrte in seine Dienste zu treten, und der gute Fürst erklärte mit vieler Rührung, er wolle ihn lieber zum Sohn als zum Diener annehmen. Der alte Herr, der den Wein und die Freuden einer nach nordischer Art gut besetzten Tafel sehr liebte, veranstaltete zu Ehren unseres tapferen Helden zahlreiche Gastmähler, in dem er glaubte, ihm hierdurch einen besondern Beweis seiner Achtung zu geben.
Nachdem Hiolm oft und köstlich genug auf des Königs stattlichem Meerschloß bewirtet worden war, hielt er es dem Wohlstand gemäß, ihn und seine Großen auch einmal in sein Schiff auf Seemannskost einzuladen. Die Einladung wurde angenommen, und es ging bei Hiolms Feste schier noch stattlicher zu, als beim Mahle des Königs.
Als die Gäste sich an seiner gut besetzten Tafel sehr ergötzt und den von Naddock erbeuteten Wein köstlich befunden hatten, kam ihnen die Lust an, Hiolms Schiff, an welchen ihnen, wie natürlich, alles fremd und neu erschien, zu besichtigen. Der Held von Seeland zeigte ihnen bereitwillig den ganzen inneren Bau des schwimmenden Hauses, und schlug zuletzt eine Fahrt um das ganze Schiff vor, damit man seine Schönheit und Stärke auch von außen beurteilen könnte.
Es wurde eine Schaluppe ausgesetzt, man stieg ein, und bewunderte, weil man einmal im Bewundern war, fast jeden Nagel, fast jede künstliche Fügung der Bretter und Bohlen; aber Erstaunen bemächtigte sich Aller, als Hiolm das Fahrzeug ein wenig weiter in die See führen, und dann auf das Hinterteil des Schiffs in gerader Richtung zusegeln ließ, als das herrliche Gemälde, dessen wir schon erwähnt haben, sich dem Auge in voller Schönheit dar stellte.
Man kann sich in der Tat nichts Reizenderes denken, als die wohlgetroffenen Portraits der zwei schönsten Personen, die damals leben mochten, und das Bild eines Kindes, schön wie der Liebesgott. Die lächelnde Edda wiegte den kleinen Hiolm auf ihren Knien, und ihre Freundin, die sich über ihre Schulter lehnte, schien sich an dem Anschauen der Mutter und des Sohnes zu weiden, ohne zu ahnden, wie viel sie selbst zur Vollkommnung der bewundernswürdigen Gruppe beitrug.
Alle drei waren so treffend abgebildet, daß der, der sie einmal im Original gesehen hatte, sie in dieser Kopie nicht verkennen konnte; auch hatte der Künstler die Farben so gut aufgetragen, daß Wind und Wetter ihnen nicht geschadet, ja sie vielmehr gehoben hatten. Als dem König das Wunderbild in die Augen fiel, da bemeisterte sich seiner ein solches Erstaunen, daß er mit Hintenansetzung des königlichen Anstandes die Arme weit auseinander breitete, und einen lauten Ruf der Überraschung ausstieß.
Seine Minister schienen ebenso ergriffen zu sein als er, sie wußten sich aber besser zu fassen. Sie wechselten bedeutungsvolle Blicke mit ihm, da sie aber sahen, daß ihr Gebieter die Worte, die ihm auf den Lippen schwebten, zurückhielt, so schwiegen auch sie, und ließen es bei stummen Zeichen des Erstaunens bewenden.
Hiolm war nicht viel weniger bestürzt, als seine Gäste; er besorgte aus der schnellen Veränderung aller Gesichter, daß hier etwas sein müßte, was einen nachtheiligen Eindruck machte. Er äußerte seine Furcht in einigen angstvollen Worten, denn er hatte den alten König von Thule lieb gewonnen, und hätte ihm ungern zu Mißvergnügen Anlass gegeben.
»Beruhigt euch, mein Sohn,« antwortete der gute Fürst, »ich bin mit euch zufrieden, und habe keine Ursache, auf euch zu zürnen; aber ich wiederhole nochmals meine Bitte, meinen Befehl, wenn ihr es so nennen wollt, diese Küste nicht eher zu verlassen, bis ich über gewisse Dinge ausführlich mit euch gesprochen habe.«
Nach diesen Worten gab der König Befehl, mit der Schaluppe nicht erst an das Schiff zu fahren, sondern sogleich zu landen, weil Dinge vorgefallen wären, die seine sofortige Rückkehr nötig machten.
In der Tat war der gute Fürst so ergriffen, daß er kaum seiner Sinne mächtig und deshalb genötigt war, die Einsamkeit zu suchen. – »Was ist das?« sagte er zu sich selbst, als er allein war, »welche Deutung soll ich jenem so seltsamen Gemälde geben, und was soll ich beginnen? Meine Leute, – sie haben alle gesehen, was ich sah; werden sie schweigen?
Und gleichwohl ist Schweigen Not, denn wer weiß, was unter dieser äußerst seltsamen Erscheinung verborgen liegt. – Nein, die Sache leidet keinen Aufschub, ich muß mir Aufklärung darüber zu verschaffen suchen!« – Nachdem der König durch dies Selbstgespräch sein Herz etwas erleichtert hatte, befahl er, Hiolm von Seeland herbeizurufen, den er sogleich sprechen müsse.
»Sage mir, Hiolm,« rief der König, als der junge Seefahrer, durch den schnellen Vorbescheid doppelt bestürzt gemacht, eilig hereintrat, »sage mir, was bewog dich an dieser Küste zu landen?« »Begierde nach Ehre und Ruhm, Begierde in eure Dienste zu treten, weil ihr mir als ein guter König gerühmt wurdet!«
»Warum zeigtest du mir heute das Gemälde am Hinterteile deines Schiffs, womit du mich so sehr überrascht hast?« »Es war meine Absicht nicht, es euch zu zeigen; wie konnte ich glauben, das es euch interessieren würde? Ihr bekamt es zu sehen, wie ihr jeden anderen Teil des Schiffs gesehen habt.«
»Unmöglich! unmöglich! dir ist gewiß alles bekannt! Ich beschwöre dich, eile, mich von dem Schicksale der Personen zu unterrichten, die jenes Wunderbild vorstellt!« »Ich weiß euch nicht viel von ihnen zu sagen; das Bild stellt meine Gattin mit ihrem Sohne und ihrer Freundin vor!«
»Himmel! deine Gattin? deinen Sohn? – Soll ich trauern oder mich freuen? Freuen, freuen will ich mich! denn bist du gleich kein Fürst, so kannst du es werden; auch hat dir der Himmel bereits ein Fürstenherz, Fürstentaten und Fürstenruhm gegeben.«
Hiolm wußte nicht recht, wie er mit dem alten Herrn daran war, und hielt es für gut, auf Dinge, die er nicht verstand, zu schweigen. »Rede, rede nur!« fuhr der König fort, »welche von den beiden Damen ist deine Gattin?« »Die Schönere!«
»Die Schönere! also die, welche sich über die Schulter ihrer Freundin lehnt?« »Mit nichten, die, welche das Kind auf den Knien hält!«
Bei diesen Worten nahmen die Gesichtszüge des Königs einen anderen Ausdruck an, von dem man nicht sagen konnte, ob Freude oder Mißvergnügen ihn veranlaßt. »Schlag ein, Hiolm,« sagte er nach einer Weile, in dem er dem bestürzten Seefahrer die königliche Hand hin hielt, »du bist mir nicht so nahe verwandt, als ich meinte, aber doch nahe genug, daß ich dir den Namen ›Sohn‹ bestätigen kann, den ich dir gleich Anfangs beilegte. Dich hat ein günstiger Zufall an diese Küste geführt, der dein Glück begründet, und mir zu dem Teuersten wieder verhilft, was ich auf Erden besaß.
Seeräuber raubten mir vor mehr als Jahresfrist meine Tochter und meine Nichte, – du schenkst sie mir wieder. Thulis ist mein Kind; deine Gemahlin Edda zwar nur die Tochter des Erlkönigs, aber doch eine Prinzessin, auf deren Besitz du stolz sein kannst, wenn du den selben zu behaupten weißt.«
»Ihn behaupten?« rief Hiolm, »den Besitz meiner Edda behaupten? dafür bürgt mir mein Schwert. Auch unser Sohn bürgt mir dafür; wie kann man seine Mutter von ihrem Gatten reissen, ohne sie auf ewig zu beschimpfen!«
»Dein Sohn möchte vielleicht das Band sein,« fuhr der König von Thule fort, »das dir deine Gemahlin auf ewig sichert; aber auf dein Schwert traue nicht, du kennst den Erlkönig nicht, sonst würdest du nicht so reden. Aller anderen Bedenklichkeiten zu geschweigen, so sind die kleinen Fürsten in gewissen Punkten kitzlicher, als die großen.
Ich würde dir vielleicht meine Thulis nicht missgönnt haben, ich hätte mich vielleicht meines Enkels gefreut; aber der Vater der schönen Edda? – Doch fasse guten Mut, und gib mir jetzt etwas nähere Nachricht von meinen Verlorenen, damit ich sehe, wie Thulis wieder in meine Arme zu bringen, und wie dir und deiner Gemahlin zu helfen ist.«
Hiolm und der König brachten den ganzen Morgen in Gesprächen über diese wichtigen Dinge zu. Der Vater der schönen Thulis machte ihn etwas näher mit der Familie des Erlkönigs bekannt, die ihm allerdings nicht gefallen wollte, und er hingegen erzählte seinem neuen Oheim so viel von der mißlichen Lage, in welcher sich Edda und ihre Freundin zu Seeland befänden, daß der König sofort beschloß, gleich den anderen Tag eine Gesandschaft abzuschicken, um die Prinzessinnen herüber zu holen.
Daß sich Hiolm an der Spitze der selben befinden sollte, versteht sich; wie hätte er die Abholung seiner Gemahlin einem anderen anvertrauen sollen? Er eilte auf sein Schiff, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, und sagte unaufhörlich zu sich selbst: »Deshalb also, weise Edda, sandtest du mich nach Thule! Dies war das Glück, das mir dein Bild bei dem besten aller Fürsten bringen sollte!«
Als der König seiner Seits auch mit allen Vorbereitungen zur Heimholung der Damen, die er so glänzend als möglich machte, fertig war, und ein günstiger Wind die Segel schwellte, da stießen die Schiffe endlich vom Lande, und der Vater der schönen Thulis rief seinem Neffen ein herzliches Lebewohl nach. »Sei getrost Hiolm,« sagte er, »und beschleunige deine Reise; ehe du mit meinen Töchtern zurückkommst, habe ich euch das Herz des Erlkönigs gewonnen, und gewiß kommt er euch selbst entgegen, dich als Sohn, seine Edda als Tochter zu umarmen.«
Ein günstiger Wind trug Hiolms Schiff, nebst denen der Gesandten von Thule, auf schnellen Flügeln nach Seeland, wo die glänzende Erscheinung kein kleines Aufsehen erregte. Hiolm's Flagge kannte man wohl; wer waren aber die anderen? – Und als jetzt die Gesandten an das Land stiegen, als der Name des Königs, der sie abschickte, und der Zweck ihrer Ankunft bekannt wurde, welche Verwunderung, welches Erstaunen! auf einer Seite, welche Beschämung! auf der anderen. –
Der alte Hinrich von Röschild vermochte kaum die Augen vor seinem Sohne aufzuschlagen, als er ihm gestehen mußte, in welcher Absicht er die unschuldige Edda nach der Erleninsel hatte bringen lassen. Der gutmütige Sohn konnte in deß dem grausamen Vater doch nicht zürnen, und verzieh ihm gern das seiner Edda zugefügte Unrecht. Zufrieden, nun aller Verfolgungen enthoben zu sein, warf er einen Schleier über das Vergangene, und suchte die Gesandten von Thule glauben zu machen, man habe die Prinzessinnen nur aus guter Vorsorge auf die Erleninsel geschickt, und diese schlichten, geradsinnigen Leute fanden hierin auch nichts Unglaubliches.
Die Überfahrt nach der wüsten Insel wurde mit großer Pracht vollzogen. Zu den königlichen Gesandten gesellten sich alle Patrizier von Siölund, an deren Spitze sich Hinrich von Röschild befand, der nicht wußte, wie er seine begangenen Fehler wieder gut machen, und sein Entzücken über die hohe Verwandtschaft, zu welcher ihm Edda verhalf, ausdrücken sollte.
Es ist schwer, denen die uns beleidigt, uns ins Elend gestürzt haben, dann nicht unsere Verachtung zu zeigen, wenn sich uns die Gelegenheit dazu darbietet. In einem solchen Falle befand sich Edda, doch war sie zu edel, Rache zu üben und sie zeigte sich daher nicht minder großmüthig als Hiolm. Die Gesandten blieben in ihrem Wahne, die Leute von Siölund fanden volle Erwiderung ihrer Höflichkeiten, und Hinrich von Röschild konnte über seine Schwiegertochter nicht klagen.
Nur in einem Punkte war sie unerbittlich, sie ließ sich nämlich nicht bewegen, eine Nacht in Siölund zuzubringen. Die Sehnsucht nach ihren Verwandten war viel zu groß, wie sie sagte, als daß sie nicht gleich von der Erleninsel dahin abschiffen sollte. Hinrich bat um Zurücklassung des kleinen Hiolm, welche wunderliche Bitte ihm jedoch ohne Weiteres abgeschlagen wurde.
Hiolm und Edda waren entzückt, sich unter solchen Aussichten wieder zu haben, aber nicht minder freute sich die schöne Thulis, endlich dem Elende entrissen zu sein, das sie blos aus Freundschaft für Edda erduldet hatte, und wieder in die Arme eines Vaters zu eilen, den sie ebenso sehr liebte, als sie sich von ihm geliebt wußte.
Eines Abends, als Hiolm und Edda miteinander auf dem Verdecke ihres Schiffs saßen, und der Landung zu Thule zitternd und hoffend entgegen sahen, begann die Tochter des Erlkönigs, ihrem Gemahle gewisse Aufschlüsse zu geben, welche zu fordern er zu bescheiden gewesen, nach denen er jedoch großes Verlangen trug.
Die Luft war still und heiter, die Wellen trugen das Schiff leicht auf dem grünen Rücken dahin, und der Mond kam am äußersten Horizont in Gestalt einer schmalen Sichel herauf; ein Zeichen, daß Hiolm sich eines ungestörten Umganges mit seiner Gemahlin erfreuen durfte.
»Mein Teurer,« begann die sanfte Edda, »ich schätze mich glücklich, daß ich nicht länger Geheimnisse vor dir zu haben brauche, die mich schon lange ängstigten, obschon du sie so gut zu ehren wußtest. Empfange meinen herzlichen Dank für diesen Beweis deines unbeschränkten Vertrauens zu mir, und höre nun meine Geschichte, die dich über alles aufklären wird, was dich etwa noch beunruhigen könnte.
Daß ich des Erlkönigs Tochter bin, weißt du bereits durch den König von Thule, aber der gute Oheim mag sagen, was er will, mein Vater ist kein so kleiner Fürst, als er ihn schildert. Wohl ihm in seinem freundlichen Wahne, daß er seine Schneeinsel für wichtiger hält, als das große Reich des Erlkönigs, das sich über die ganze Erde ausbreitet, und in den Gegenden, die euch Menschen die unbekanntesten sind, am größten ist.
Es wäre über diese geheimnißvollen Dinge mehr zu sagen, doch sollst du jetzt nur so viel davon hören, als du zu verfassen vermagst: Wir sind ein Geistergeschlecht, den Menschen nur zur Hälfte verwandt; unserer Herrschaft sind besonders unterworfen die wüsten Inseln des Meeres, und die Stellen der Erde, wo der Baum wächst, den man nach unsern Namen benannte.
Wir lieben die Menschen, und befreunden uns gern mit ihnen. Die nordischen Reiche sehen meistens Prinzessinnen aus unserm Hause auf ihren Thronen; auch ich war zu diesem Schicksal bestimmt, meiner wartete Skandinaviens Krone, was mein Unglück war, und es vielleicht noch in später Zukunft sein wird.
Kein weibliches Geschöpf kann auf Vorzüge der Schönheit und hoher Geburt eingebildeter sein, als ich es war; es gab kein irdisches Wesen, das ich einer Verbindung mit mir würdig schätzte, und gern hätte ich mich mit den Geistern des Äthers befreundet. Ich wußte, daß unser Geschlecht dem Tode ebenso gut unterworfen ist, als ihr es seid, und daß es des Vorrechts der Unsterblichkeit nur unter gewissen Bedingungen genießt, die ich nicht kannte, sowie sie auch den meisten von uns ein Geheimniß sind.
Dennoch war ich überzeugt, daß eine Verbindung mit dem schwachen, sterblichen Menschengeschlechte nicht der Weg sei, zur Unsterblichkeit zu gelangen und daher entstand vorzüglich mein Abscheu vor der Skandinavischen Krone, die ich mir durch die Verbindung mit einem Sterblichen erkaufen sollte. Ich widerstand dem Willen meines Vaters, so gut ich konnte, und suchte Aufschub und Ruhe in der Einsamkeit.
Mein Vater hatte mir die kleine Insel an der Küste von Seeland geschenkt; hier lebte ich in stiller Abgeschiedenheit mit meinen Jungfrauen, unbemerkt von dem groben Auge des Menschen, ihm nur in den hellen Mondnächten sichtbar, wo wir unsere Tänze zu halten pflegten, denn der dichtere Körper, in welchem wir uns zeigen, und in welchem auch du mich jetzt vor dir siehst, ist zwar der volle Abdruck der ätherischen Gestalt, die uns die Natur verlieh, aber für uns gleichsam nur ein grober Regenmantel, in welchen wir uns hüllen, um vor euch erscheinen zu können.
Ich lebte ruhig in meiner philosophischen Einsamkeit, wo ich mich mit lauter überirdischen Dingen, besonders mit den Mitteln zur Unsterblichkeit zu gelangen, beschäftigte. Daß rund umher mehrere Erlprinzen wohnten, wußte ich, aber ich achtete es nicht, und besorgte von ihnen nichts Arges; gleichwohl sollte einer von diesen auf eine widrige Art in mein Schicksal verwebt werden.
Der Fürst der Insel Mona hatte von mir gehört, und kam heimlich, mich zu sehen. Meine Schönheit fesselte seine Augen, meine hohe Geburt schmeichelte seinem Stolze, und mein bekannter Abscheu vor einer Verbindung mit einem Sterblichen machte ihm große Hoffnungen. –
Es dauerte nicht lange, so begann er, mit seinen Zudringlichkeiten mir lästig zu werden. Ich gab meinem Vater Nachricht davon, und er, dem eine Verbindung mit einem seiner Vasallen so wenig anstand als mir, säumte nicht, mir zu Hilfe zu kommen. Er traf den Verwegenen, als er in menschlicher Verkörperung, Gott weiß, in welcher Absicht, meine Wohnung umschlich. Die Strafe folgte dem Verbrechen auf dem Fuße.
Als der Fürst der Insel Mona unter den Händen meines Vaters fiel, fluchte er mir: ›Möchtest du Stolze,‹ rief er, ›durch eine Verbindung mit einem gemeinen Sterblichen gedemütigt werden! O könnte, könnte ich doch noch länger leben, um zu deinem Sturze beizutragen, um mich an deinem Falle zu weiden!‹
Mein Vater hielt es für gut, daß ich mich auf einige Zeit von meiner Insel entfernte. Er brachte mich zu dem Könige von Thule, meinem mütterlichen Verwandten. Dort lernte ich zuerst Menschen kennen und lieben, Geschöpfe, die ich früher nie gesehen hatte. Binnen kurzer Zeit wurde ich mit der schönen Thulis, der Tochter meines Oheims aufs innigste vertraut; wir schwuren einander feste Freundschaft in Glück und Widerwärtigkeit, und haben den Schwur gehalten, denn der gegenseitigen Aufopferungen zwischen uns sind nicht wenige gewesen.
Ich liebte meine Base so sehr, daß ich meinen bisherigen einsamen Aufenthaltsort ganz zu verlassen und bei ihr zu bleiben beschloß. Ich besuchte die Erleninsel nur zur Zeit des Vollmonds, weil uns dann ein unwiderstehlicher Zug in die Gegenden, wo wir herrschen, zur Feier mystischer Feste hinreißt. Der gröbere Körper, den ich meiner Freundin zu Liebe jetzt für beständig trug, blieb als Unterpfand meiner Wiederkunft bei ihr zurück, wenn ich des Monats einmal als leichte Schattengestalt nach meiner Insel schwebte.
Als treue Hüterin wachte sie bei der Hülle, deren Verletzung uns, so lange wir uns dieser irdischen Verkleidung bedienen, den Tod bringt. Ich fand auf meiner lieben Insel alles ziemlich so, wie ich es verlassen hatte. Meine Jungfrauen, die dort zurück geblieben waren, hatten schon früher Spuren auf der selben entdeckt, daß sie zuweilen von Menschen besucht würde; jetzt sagten sie mir, daß der gleichen Besuche sich noch öfter einfänden, und daß einer dieser Menschen es sogar zuweilen wage, auf unserem Grund und Boden zu übernachten.
Ich überzeugte mich bei der ersten Mondfeier selbst von dieser Kühnheit, ich sah den Verwegenen hinter einem Rosenstrauch lauschen, und unsere Tänze beobachten; sein Urteil war gesprochen. Als es tagte, verfügte ich mich selbst auf die Stelle des Frevels, ihn zu bestrafen. Aber – o Hiolm, wie kann ich in meiner Erzählung fortfahren, ohne einen Verdacht bei dir zu erregen, der meiner Würde nachteilig sein möchte!
Und doch bin ich dir ein offenes Geständniß schuldig und will selbst auf die Gefahr hin, von dir verkannt zu werden, in meiner Erzählung fortfahren. Ich sah einen schönen Jüngling, der kaum die Grenzen der Kindheit überschritten, schlafend auf einem Rasenhügel hingestreckt. Er blühte wie die Jugend des Himmels, Unschuld und Edelmut sprachen aus seinen sanften Zügen.
Der Rosenstrauch, unter dem er schlummerte, überstreute ihn mit den Blättern seiner Blumen, als wolle er ihn meinen Augen entziehen; ach, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn ich ihn nie gesehen hätte! Mein gerechter Zorn war entwaffnet, ich fühlte vielleicht in diesen Augenblicken den ersten Anfang einer Leidenschaft, mit der mir der Fürst der Insel Mona geflucht hatte.
Ich sah den holden Lauscher sich regen, als wolle er erwachen, und ich entfloh mit meinem luftigen Gefolge; ich fürchtete, von ihm gesehen zu werden. Man lasse ihn, sagte ich zu meinen Leuten, es ist fast noch ein Kind, von ihm wird uns weder Unfall noch Entweihung widerfahren.
Nach der Zeit gab es wenig Vollmondnächte, wo ich den jungen Menschen nicht hinter seinem Rosenstrauche sah. Ich trauerte, wenn ich ihn einmal vermißte, ich beschleunigte meine Herüberkunft von Thule, und verzögerte meine Abreise Ich lobte die Bescheidenheit des jungen Fremdlings, der sich immer nur mit dem Schauen begnügte, und es nie wagte, sich in unsere Reihen zu mischen, und doch wünschte ich heimlich auch wieder, er möchte einst kühner sein, und mir Gelegenheit geben, ihn näher kennen zu lernen.
Noch hatte ich nicht zwölf Mal die monatliche Reise von Thule nach meiner Insel gemacht, als ich den bisherigen Zuschauer unserer nächtlichen Feste nicht mehr auf seinem Rasenhügel lauschen sah, und vergebens seine Wiederkehr erwartete. Von der Zeit an fühlte ich mich auf der Insel einsamer, die Feier der Feste verlor für mich viel von ihren frühern Reizen und ich suchte meine Rückkehr nach Thule immer möglichst zu beschleunigen. – Was war das, Hiolm, das ich damals für dich fühlte? Liebe doch nicht? – O nein, diese Leidenschaft sollte ich erst später kennen lernen!
Jahre vergingen. Der schöne Knabe, den ich nicht mehr sah, konnte, wie Thulis meinte, nun wohl zum Jüngling herangereift sein, und meinem Herzen ernstlichere Gefahr drohen, wenn ihn das Schicksal mir wieder entgegen führte. Sie scherzte fleißig mit mir über diesen Gegenstand, und ich nahm diesen Scherz auf, wie Freundinnen so etwas von einander aufnehmen pflegen. Wir sprachen viel über das Abentheuer, belachten es von ganzem Herzen, und – vergaßen es.
Ach, es nahte jetzt eine Zeit, wo wir die jugendlichen Scherze unter dem Drucke des Unglücks ganz vergessen sollten. Wir hatten die heißen Quellen, dergleichen es in dem Königreiche meines Oheims viele giebt, besucht, und uns an den seltsamen Naturerscheinungen belustigt, an denen jene Gegenden so reich sind. Auf der Rückkehr reizte mich eine schöne Fläche voll grünen Berggrases zum Spaziergang. Es war nahe am Ufer des Meeres.
Ein Seeräuber, der mit seinem Schiffe hinter einem Felsen lag, wurde uns gewahr, und hielt uns für gute Beute. Wir wurden geraubt, und ehe man am Hofe des Königs von Thule unseren Verlust wissen konnte, waren wir bereits viele Meilen weit in die See einem Schicksal entgegen geführt, das für Jemand, der das Süße der Freiheit kennt, das schrecklichste unter der Sonne ist.
Wir wurden Sklavinnen, Sklavinnen Naddocks, des übermütigsten unter allen Seeräubern. Schon längst hatte er Absichten auf die Schneeinsel gehegt, der Besitz der Erbin dieses Landes feuerte ihn zu noch kühneren Gedanken an. Thulis wurde von seiner beleidigenden Liebe gequält, sie war seine Sklavin und sollte sich die Freiheit durch das Opfer ihrer Hand erkaufen.
Ich verschweige, in wie weit Naddocks Bande mich fesseln konnte, aber da ich zu schwach war, meine Freundin mit mir frei zu machen, so war ja wohl das geringste, was ich für sie tun konnte, daß ich bei ihr gefangen blieb, bis sich unser Schicksal änderte.
Wir litten viel von unserem grausamen Gebieter, und Thulis würde wahrscheinlich ohne mich noch mehr gelitten haben. Naddock schien in mir ein höheres Wesen zu ahnen. Er hatte eine Art von Furcht vor mir, deren Ursache ich besser kannte, als er. Ein Wort von mir konnte ihn in die Grenzen der Ehrfurcht zurückschrecken, wenn die Leidenschaft für meine Freundin ihn zuweilen die selbe vergessen ließ.
Wie lange ich im Stande gewesen sein würde, diesen wilden Menschen im Zaume zu halten, das weis ich nicht. Das Schicksal sorgte indeß für baldige Änderung unserer unglücklichen Lage, es führte uns in deine Hände. – O Hiolm! du weißt das Übrige! Ich sah dich, meine Augen kannten dich nicht mehr, aber mein Herz hatte dich nicht vergessen! Das ehemalige kindische Wohlgefallen an dem Knaben auf der Erleninsel, wurde, auf den Helden von Seeland übertragen, zur mächtigen Leidenschaft.
Ich wurde die Deinige, obgleich ich selbst nicht wußte, was mich, die stolze Tochter des Erlkönigs, so schnell zu einer Verbindung mit einem Sterblichen geneigt machte! Du erzähltest mir deine frühste Jugendgeschichte, ich reimte sie mit der meinigen zusammen, und nun wurde mir Manches klar. Wir waren alte Bekannte, schon längst vom Schicksal zu gegenseitiger Liebe bestimmt, Gott gebe von einem günstigen Schicksal! Ich fürchte nicht, daß der Fluch des Fürsten Mona nachteilig auf unsere Verbindung wirken wird. Ich liebe ja in Hiolm keinen gemeinen Sterblichen, liebe in ihm den Edelsten seines Geschlechts!
So lange ich dich noch nicht genau kannte, hielt ich es nicht für ratsam, dich mit meiner Geschichte bekannt zu machen, oder dir zu sagen, daß du in mir ein Wesen aus einer höheren Sphäre liebtest. Du mußtest erst geprüft werden, und wärst du in dieser Prüfung nicht bestanden, so hätten wir uns für immer trennen müssen.
Ich liebte dich indeß innig genug, um diese Trennung wie den Tod zu scheuen, und hielt es daher, als ich später Ursache hatte, die Fortdauer deiner Standhaftigkeit zu bezweifeln, für das Beste, das Rätsel noch zur rechten Zeit zu lösen, bevor du, von meinen Feinden aufgewiegelt, Schritte tätest, die ich dir nicht hätte verzeihen dürfen. Ich veranlaßte deine Reise zum König von Thule, ich wußte, daß dieser gute Fürst seine Tochter und mich im Bilde augenblicklich erkennen, und daß sich dann alles andere von selbst ergeben würde.
Auch wußte ich, daß mein Oheim alles aufbieten würde, um die Zustimmung meines Vaters zu unserer Verbindung zu erlangen, und ich zweifelte nicht an einem glücklichen Erfolg seiner Bemühungen. Voll von diesen süßen Hoffnungen sah ich dich gern abreisen, ohne zu ahnen, daß mir in deinem Vaterlande, von deinen nächsten Freunden zu eben der Zeit, Unheil drohte, da ich mich ganz für dich aufopferte, die Liebe meines Vaters, Krone und Thron, die Hoheit meiner Abkunft aufs Spiel setzte.
Noch weis ich nicht genau, was dein Vater wider mich im Sinne hatte, ob er mich töten, ob er mich in entfernte Weltteile als Sklavin verkaufen, oder, was noch schlimmer gewesen wäre, ob er mich in die Hände des Fürsten der Insel Mona liefern wollte. Leider habe ich seit einiger Zeit Ursache, zu glauben, daß dieser mein alter Verfolger, Gott weis durch welchen Zufall, beim Leben erhalten wurde, und mit dem tückischen Kaufmann von Seeland in heimlicher Verbindung steht.
Er hat seine Absichten auf mich noch nicht aufgegeben, er wünscht mich oder meinen Sohn zu besitzen – so viel sehe ich ziemlich klar, während ich alles Übrige jetzt noch nicht zu enthüllen weiß. Hiolm, hüte, hüte dich! Du bist ein kurzsichtiger Sterblicher; mein Verfolger könnte seine Pläne vielleicht durch deine eigene Hand auszuführen suchen!!«
Bei diesen Worten, die Edda mit sichtlicher Bewegung und großem Nachdruck sprach, sprühten einige Funken aus ihren Augen, eine Erscheinung, die Hiolm noch nicht an ihr gesehen hatte, und die ihm nicht ganz zu gefallen schien. – Er verbarg sein Entsetzen, gab ihr die besten Versicherungen, und sie fuhr fort:
»Dein treuloser Vater wählte glücklicher Weise ganz falsche Mittel zur Erreichung seiner Absichten, sein Verbündeter mußte ihn schlecht unterrichtet haben. Er brachte mich auf meine geliebte Erleninsel in Sicherheit, einem Orte, von wo mich weder Menschen- noch Geistergewalt entführen kann. Thulis kennt das Entzücken, mit welchem ich meine Insel begrüßte, die vergnügten Tage, die wir dort im Kreise der mir verwandten Geister verlebten. Es ist Schade, daß Thulis nur ein Erdenmädchen ist, sie schickte sich so gut in unsere Sitten, als wäre sie eine der Unseren, und als solche wurde sie auch von uns geliebt.
Deines Vaters Forderung, ihm meinen Sohn zurück zu lassen, kennst du; fast verließ mich bei der selben meine mühsam behauptete Mäßigung, denn ich merkte wohl, daß der Fürst von Mona ihn zu dieser Bitte veranlaßt hatte. Noch einmal, Hiolm, hüte, hüte dich! daß du nicht etwa einst selbst, durch diesen Verräter berückt, das Werkzeug zu unserm Unglück wirst! Eine dunkle Ahnung sagt mir, daß du schon einst in seinen Schlingen gewesen bist.«
Hiolm war froh, daß diese wiederholte Warnung diesmal sanfter ausgesprochen wurde, als das erste Mal; er umarmte seine Edda, und versprach ihr alles, was sie wollte. Obgleich es ihm lieber gewesen wäre, in der schöne Edda eine Erdbürgerin, als ein Wesen höherer Art zu sehen, so war ihm doch ihre Abkunft kein so großer Stein des Anstoßes, daß sich seine Liebe vermindert hätte, seine Treue wankend geworden wäre. Die Erlprinzessin mochte übrigens etwas Ähnliches befürchtet, und sich ihm deshalb so spät als möglich entdeckt haben.
Hiolm suchte den hohen Stand seiner Gemahlin zu vergessen, und sie unterließ ihrerseits auch alles, was ihn hätte daran erinnern können. Ohne Ansprüche irgend einer Art zu machen, zeigte sie sich ihm in allem gehorsam, teilte jede Freude, jeden Kummer mit ihm und war überhaupt ein so vollkommenes irdisches Weib, wie es nur ein solches auf dieser Erde geben kann. Sie wußte, daß man nicht blenden muß, wenn man gefallen will, und das scheue Ehrfurcht sich nicht mit inniger Liebe verträgt.
Die Liebenden würden sich ganz glücklich gefühlt haben, wenn sie nicht den Zorn des Erlkönigs zu befürchten gehabt hätten und deshalb wegen ihrer Aufnahme zu Thule in peinigender Ungewißheit gewesen wären. »Wird unser Fürsprecher gesiegt haben?« »Wird der Erlkönig unsre Liebe billigen und uns nicht trennen?« »Wird er den alten Plan, seine Edda zur Königin von Skandinavien zu machen um Hiolms willen gern und gänzlich aufgeben?« –
Dies waren die Fragen, welche die zärtlichen Gatten täglich so lange miteinander abhandelten, bis die lange Reise zu Ende ging, und der Erfolg ausweisen mußte, was man zu hoffen habe. Sie stiegen zu Thule an das Land, und, o Freude! Edda sah ihren Vater an der Seite des Oheims ihr entgegen kommen!
Durch dies gute Anzeichen ermutigt, stürzte sie sich vertrauensvoll in seine Arme und wurde väterlich von ihm empfangen. Gegen Hiolm benahm sich der Erlkönig dagegen etwas kalt, aber sein und Eddas kleiner Sohn wurde desto zärtlicher von dem Geisterfürsten geliebtkost. Man sah wohl, daß dieses Kind die einzige Ursache war, weshalb an keine Trennung einer Verbindung gedacht wurde, die übrigens nicht sonderlich nach dem Geschmack des stolzen Fürsten sein mochte.
So sehr sich auch Hiolm über die Einwilligung des Erlkönigs zu seiner Verbindung mit Edda freute, so behagte ihm doch sein hoher Schwiegervater nicht allzusehr. Besonders misfiel es ihm, daß dieser die garstige Angewohnheit hatte, bei der geringsten Veranlassung, die seinen Zorn erweckte, mit Funken um sich zu sprühen.
Hiolm hatte diese Erscheinung ein einziges Mal an seiner Edda wahr genommen, und sich nicht besonders darüber gefreut; wie mußte sie ihm nun an einem Wesen mißfallen, das ohnehin mehr Furcht als Liebe einflößte! Die Klugheit gebot in dessen Hiolm, seine Gefühle zu verbergen, und er beschloß nur, sich vor dem vornehmen Schwiegervater, dem er nicht recht traute, möglichst zu hüten.
Als man einen Monat zu Thule verweilt hatte, meinte der Erlkönig, es sei nun Zeit, seine Tochter und seinen Enkel heimzuführen, und seinen Eidam die Hauptstadt seines Königsreichs zu zeigen. Hiolm trug kein großes Verlangen nach dieser Reise, aber er hätte kein Held sein müssen, wenn er die mindeste Furcht hätte äußern wollen.
Der alte König von Thule, der einen tieferen Blick in das Herz des jungen Mannes tat, als die anderen alle, sprach ihm insgeheim Mut ein, und so ging man mit ziemlicher Fassung zu Schiff, einen Weg anzutreten, dessen Ende wenigstens Hiolm nicht wußte; er war entweder schlecht in der Geographie seiner Zeiten bewandert, oder die Hauptstadt des Erlkönigs stand auf keiner der damaligen Landkarten.
Er nahm sich oft die Freiheit, seinem Schwiegervater darüber einige Fragen vorzulegen, aber er erhielt immer nur unbefriedigende Antwort. Eines Tages, als er in ziemlich gutem Vernehmen mit ihm auf dem Verdeck stand, und seine gewöhnlichen Nachforschungen erneuerte, überkam den ungestümen Erlkönig der lang verbissene Grimm so heftig, daß er nicht säumte, einen Anschlag auszuführen, den er lange im Sinn gehabt hatte, und dem jetzt, da sie ohne Zeugen waren, nichts im Wege stand.
»Meine Hauptstadt,« sagte er zu dem fragenden Hiolm, »sollst du wohl nimmermehr sehen; gehe hin, und suche sie im Abgrund des Meeres!« Mit diesen Worten gab der boshafte Geisterfürst dem unglücklichen Gemahl der schönen Edda einen so heftigen Stoß, daß er über Bord viele Ellen weit hinaus in die See flog, die ihn mit gierigem Rachen aufnahm.
Ein Anderer hätte unserem Hiolm, der ungewöhnliche Kräfte besaß und dabei gewandt und vorsichtig war, diesen Streich so leicht nicht spielen sollen, ohne ihm im Fallen Gesellschaft zu leisten; aber hier waren die Kräfte zu ungleich. Welcher Sterbliche kann sich mit einem übermenschlichen Wesen messen?
Während Hiolm sank und sank bis auf des Meeres Boden, erhob der Erlkönig auf dem Schiffe ein gewaltiges Geschrei über den Unfall, der seinen lieben Eidam betroffen hatte. Es lag ihm viel daran, bei seiner Tochter keinen Verdacht wegen dieser Schandtat gegen sich aufkommen zu lassen, und deshalb stellte er sich über den unglücklichen Vorfall, wie er es nannte, so sehr betrübt.
Jedermann im Schiffe, der schwimmen konnte, wurde aufgeboten, den Mann zu retten, den sein treuloser Schwiegervater jetzt zum ersten Male mit den zärtlichsten Beinamen beehrte. Ja, er ging so weit, sich selbst hinab zu lassen in die tobenden Fluten, gleich als wolle er Hiolms Rettung mit eigener hoher Hand bewirken. Ein König wie dieser, der mit allen Elementen gleich vertraut war, konnte so etwas wohl wagen, ein anderer würde mehr Sorgfalt für seine geheiligte Person bewiesen haben.
Edda war über den Verlust ihres so innig geliebten Hiolm ganz untröstlich. Wäre sie eine gewöhnliche Sterbliche gewesen, so würde sie wahrscheinlich ihrem Gatten sogleich in das Meer nachgesprungen sein, aber ihr konnte ein solcher Sprung nichts frommen. Ein Geisterleben ist nicht so leicht im Ozean ausgelöscht, und doch wie gern hätte sie das ihrige hingegeben, um Hiolm zu retten. Die Unsterblichkeit galt nichts mehr in ihren Augen, seit die Liebe zu einem Erdbürger sie von ihrer phantastischen Höhe herabsteigen ließ.
Hiolm war indessen nicht so verlassen und verloren, als Edda besorgte und ihr Vater glaubte. Die nämliche Macht, die ihn in seinen Knabenjahren schon einmal das Leben erhalten hatte, war auch hier geschäftig, ihn, so tief er auch gesunken war, wieder empor zu heben. Kaum auf dem Meeresgrund angelangt, befand er sich gleich darauf wieder mit dem obern Teil des Körpers über dem Wasser, und nun schwamm er, er wußte selbst nicht wie, mit nie geahnter Leichtigkeit auf den stürmenden Wellen dahin.
Als er seine seltsame Fahrt ohne Fahrzeug, Ruder und Segel bis gegen Abend fort gesetzt hatte, sah er auf einmal Land, und ehe eine Viertelstunde verging, warf ihn eine große Welle mit ziemlichem Ungestüm auf das Ufer einer schönen grünen Insel, deren erster Anblick schon bezauberte, und die auch bei näherer Besichtigung keinen anderen Fehler hatte, als daß sie unbewohnt war.
Als Hiolm sich erholt und die Nacht in süßer Betäubung verschlafen hatte, gesellten sich zu dem frohen Gedanken: ich bin gerettet! eine Menge andere, die nicht so angenehm waren. »O Edda, Edda!« rief er »wie vermag ich getrennt von dir zu leben, und wie soll ich dich wieder finden? –« Von diesen traurigen Gedanken gequält, durchstrich er die ganze Insel, und als sich endlich Hunger und Durst bei ihm einstellten, da zeigte es sich, daß er für die Erhaltung seines Lebens nicht besorgt zu sein brauchte.
Überall fanden sich frische Quellen und fruchttragende Bäume, überall schattige Plätze und Höhlen, die zur Ruhe einluden, nirgend ein schädliches Tier! aber – dies war auch alles. Keine Spur von einem menschlichen Wesen, überall tote Einsamkeit, rund umher nichts als eine unermeßliche Fläche von Himmel und Wasser!
Welches Schiff sollte sich in diesen verlassenen Winkel der Erde verirren, ihn wieder zu der Geliebten zu bringen? Welcher Mund sollte ihm nun sagen, in welcher Himmelsgegend er sich befände, oder ihm zu irgend einem Plane der Rettung behilflich sein? – Armer Hiolm, wäre es wohl zu verwundern gewesen, wenn du dich der Verzweiflung überlassen, und dein Leben in den Wellen geendigt hättest, aus denen du kaum entkommen warst?
Es muß indeß nicht gewöhnlich sein, daß man sich um einer verlorenen Frau willen in das Meer stürzt, sonst wüßte ich nicht, wie Hiolm, der zärtlichste Gatte, den es jemals gab, einer solchen Versuchung hätte widerstehen können. Zwei lange Jahre brachte er trauernd und hoffend auf der Insel zu, bis endlich der Himmel sich seiner erbarmte. Der Himmel, sage ich? war ihm das auch ganz zuzuschreiben, was hier geschah?
Hiolm trat einst gegen Abend seine gewöhnliche Wanderung an den Strand des Meers an, die er, weil seine Hütte nicht weit von dem selben entlegen war, des Tages mehrmals zu wiederholen pflegte. An der äußersten Spitze seiner Insel glaubte er immer der entfernten Geliebten näher zu sein, dort, meinte er, müßten seine Seufzer ihr Ohr eher erreichen, als zwischen den Bäumen und Hügeln seiner Hütte.
Als er nun diesmal der untergehenden Sonne zuschritt, siehe, da kam ihm aus dem Dunkel eines Berges eine menschliche Gestalt entgegen. Langsam nahte sie, und gab der ganzen Abendszene einen seltsamen, schauerlichen Anstrich.
Welch eine Erscheinung! Der arme verlassene Hiolm wußte nicht, ob er seinen Augen trauen sollte; er glaubte sie vom Sonnenstrahl geblendet, und schützte sie mit der vorgehaltenen Rechten. Die Erscheinung blieb. Jetzt kam sie näher, und auf einmal stand ein großer majestätischer Mann vor ihm, dessen ernster Blick forschend auf ihm ruhte, und dessen ganzes Wesen von etwas Außerordentlichem zeigte.
Der entzückte Hiolm sah jedoch in ihm nur den Menschen, und flog ihm mit dem Jubel entgegen, den ein solcher Anblick in seiner Lage erregen mußte. »Ist es möglich!« rief er, »ist es möglich, daß ich endlich auf dieser unbewohnten Insel einen Menschen finde? Wer bist du und wo warst du in diesen langen einsamen Jahren, daß du dich mir nicht einmal zeigtest?«
»Du bist bisher der einzige Bewohner dieser Insel gewesen,« versetzte der Fremde; »wie hätte ich mich dir zeigen können? Ich bin erst in diesem Augenblicke hier angekommen, mit dir über wichtige Dinge zu sprechen.«
»Wie ist das möglich? Weder Schiff noch Sturm können dich an dieses Ufer gebracht haben.« »Ich kam auf nur mir bekannten Wegen hierher, die ich dir jetzt nicht näher bezeichnen kann. Ich kenne dich wohl, Hiolm von Seeland, ich kenne den ganzen Umfang deines Unglücks; auch die böse Tat des Erlkönigs, die er an dir verübte, ist mir nicht unbekannt.
Seine Ungerechtigkeit aufs höchste zu treiben, steht er jetzt im Begriff, dein Weib mit dem Könige von Skandinavien zu vermählen. Der morgende Tag ist zu dem Feste bestimmt, das du, wenn du deine Edda wahrhaft liebst, durch deine Gegenwart stören mußt. Es ist nötig daß du in dieser Stunde abreist, deine Rechte zu behaupten!«
»Abreisen? wie kann ich das?« »Ungläubiger! Ich, der ich dich zweimal aus den Fluten des Meeres rettete, werde im Stande sein, dich an den Ort zu bringen, wo ich dich haben will. Doch der Dienst, den ich dir zu erweisen im Begriff bin, ist nicht klein; was gibst du mir, deine Dankbarkeit zu bezeigen?«
»O alles, alles! Nimm mein Leben, nimm das Liebste, was ich habe!« »Das wäre zu viel! Wisse, ich bin dir mit alter Schuld verhaftet; du magst dafür die zweimalige Rettung deines Lebens rechnen. Für das Übrige will ich Bezahlung nehmen, aber nicht so viel, als du bietest; von dem Liebsten nur die Hälfte.«
»O laß das jetzt!« rief der ängstliche Hiolm, »und führe mich sogleich dahin, wo ich in diesem Augenblicke sein möchte!« »Noch ist es nicht Zeit,« sagte der Fremde mit seinem gewohnten Ernst, »die Sonne muß erst ganz untergehen, ehe wir reisen können. Setze dich jetzt und höre, was du notwendig wissen mußt, um bei dem wichtigen Geschäft so zu handeln, wie ich will.«
Hiolm setzte sich auf einen Stein dem Unbekannten gegenüber, der jetzt eine Erzählung begann, von welcher Hiolm nur wenige Worte vernahm, denn – o Wunder! bei dem ersten Eingang seiner Rede, die dem Anschein nach ziemlich lang werden mußte, fielen ihm die Augen zu und er entschlief.
Niemand hat wohl je weniger Neigung zum Schlafe gehabt, als Hiolm, da er von dem selben befallen wurde. Sein ganzes Wesen war mit Ungeduld erfüllt, dort zu sein, wo Edda auf dem Punkte stand, ihm entrissen zu werden; tausend Gedanken, ob sie gezwungen, oder freiwillig der Treue gegen ihn entsage, ob er sie bedauern, oder mit ihr zürnen müsse, wogten in seiner Seele auf und nieder, und kein Zustand ist, wie bekannt, dem Schlafe ungünstiger, als dieser.
Gleichwohl befiel ihm bei den ersten Worten, die er von der wichtigen Rede vernahm, eine solche Müdigkeit, daß er sich kaum aufrecht zu erhalten vermochte. Seine Augen schlossen und öffneten sich wechselweise, er sah den Unbekannten sich gegenüber, hörte das Summen seiner Stimme, wußte bald nichts mehr von dem, was er sah und hörte, und fiel in gänzliche Betäubung zurück.
Wahrscheinlich hatte der Fremde keine Lust, Hiolm die unbekannten Wege, auf welchen er selbst gekommen war, mit wachenden Augen machen zu lassen, und deshalb mochte er ihn in diesen Zustand der Besinnungslosigkeit versetzt haben.
Seinem Gefühl nach hatte Hiolm lange geschlafen und seltsam geträumt, als jetzt die Betäubung schwand, und er die Augen öffnete. »Edda treu?« sagte er zu sich selbst, »und doch im Begriff, die Gattin eines anderen zu werden? Ich, der einzige, der das verbrecherische Bündnis stören könnte, und doch hier an diese verwünschte Insel gefesselt? Durch das unermeßliche Meer von dem Ort getrennt, wo meine Gegenwart so nötig ist? O hätte ich doch Adlersflügel, oder könnte ich mich doch in die luftige Schattengestalt verwandeln, deren sich Edda bediente, wenn sie die Erleninsel besuchte! Ich erliege unter den Banden, die mich hier zurückhalten.«
So dachte Hiolm beim Aufwachen; als er aber sich jetzt völlig ermunterte, als er sich aufrichtete und um sich her sah, welches Erstaunen, sich an einem ganz anderen Orte zu befinden, als wo er entschlafen war!! Er glaubte noch immer zu träumen, er rieb sich die Augen und sah noch immer, was er gleich anfangs erblickt hatte. »Wo bin ich?« rief er. »Was sehe ich?
Ein stattliches Gebäude umgibt mich statt der Bäume und öden Felsen meiner Insel? Statt des grünen Rasens, auf welchem ich entschlummerte, fühle ich Marmorpflaster unter mir? Das ferne Getöse von Menschenstimmen und geschäftigen Händen, statt der ewigen Todesstille, die dort herrschte? Das ist der Vorhof eines königlichen Palastes! aber wo? Hat mich ein Wunder hierher gebracht? – Doch dort kommen Leute, ich muß sie fragen und das Rätsel wird sich nun gleich aufklären!«
Hiolm, der in seiner zweijährigen Einsamkeit nicht vergessen hatte, wer er war, und sich jetzt noch für dieselbe wichtige Person hielt, die er sein mochte, als ihn des Erlkönigs Majestät über Bord zu werfen geruhte, rief mit herrischem Tone einen der Diener herbei, die er in den benachbarten Hallen auf und ab gehen sah. Man kam, aber nicht um seine Befehle zu hören, oder auf seine Fragen Antwort zu geben, sondern nur um ihm ins Gesicht zu lachen.
»Wo ihr seid?« sagte endlich einer; »nun wahrhaftig, einfältiger hat nie ein schmutziger Bettler gefragt! Wie ihr hierherkommt? Diese Frage geben wir euch zurück! Ihr wißt doch hoffentlich wohl, daß euresgleichen nicht in diesen Palast gehören? Seid so gut und entfernt euch, denn wenn der Schloßwart vorübergeht, und euch sieht, so möchte es übel um euch stehen!«
Hiolm warf bei diesen Worten einen Blick auf seine Kleidung, und fand sie für eine Welt, in welcher man alles nach der äußern Schale beurteilt, in der Tat nicht sehr glänzend. Die Kleider, welche er bei seiner Ankunft auf der Insel getragen hatte, waren längst zerrissen, gegenwärtig bestand seine Hülle aus einem alten Segeltuch, zu welchem er, wir wissen nicht wie, gekommen war.
Das einzige, was noch hätte Ehrfurcht erwecken und seinen Stand mutmaßen lassen können, war sein gutes Schwert, an dessen Griff einige große Edelsteine saßen. Es war ein Geschenk des Königs von Thule, ihm schon um des Gebers willen unschätzbar, und daher von ihm so unzertrennlich, daß er es weder bei Tage noch bei Nacht abgürtete, und es also auch mit hierher gebracht hatte.
Sein Auge fiel im Überschauen seiner Hülle auch auf dieses Denkmal ehemaliger Größe, und es war, als wenn ihm dieser Anblick einige Beruhigung gewährte. Die Diener achteten nicht weiter auf ihn, und verließen ihn lachend. Er sah wohl ein, daß er es anders anfangen müßte, wenn er hier fortkommen wollte. Von einem heftigen Durste gequält, eilte er den Dienern nach und bat, indem er seinen früheren Ton sehr herabstimmte, höflichst um einen Trunk Wasser.
»Gut,« antwortete einer, »Höflichkeit möchte dir hier eher helfen, als Trotz. Folge uns, und du sollst deinen Durst stillen, aber nicht mit Wasser, denn hier wird heute nichts als Wein getrunken.« Man reichte ihm einen vollen Becher, er labte sich und dankte; allein man gab ihm zu verstehen, daß es hier nicht mit bloßem Dank getan wäre.
»Du bist stark genug, zu arbeiten,« sagten sie, »und an Arbeit für deinesgleichen fehlt es hier nicht. Nimm den Wassereimer! schöpfe aus dem Springbrunnen und besprenge das Marmorpflaster, daß es nicht staube, wenn der König und die Prinzessin über den Hof in den Garten gehen.«
»Aber, mein Gott,« rief Hiolm, »kann ich denn nicht erfahren, wo ich bin, und von was für Königen und Prinzessinnen die Rede ist?« – »Von wem anderes,« lautete die Antwort, »als von dem Könige von Skandinavien, und der Tochter des Königs der unbewohnten Inseln, seiner Braut, mit der er sich heute vermählen wird!«
Unserem Helden ging nun auf einmal ein helles Licht auf. Er wußte, daß unter letzerem König der Erlkönig gemeint war, der sich jenes Titels zuweilen bediente, und der Name des Königs von Skandinavien war ihm auch nicht unbekannt. – »Also ist alles, was mir gestern und heute begegnete, doch kein Traum?« sagte er zu sich selbst. »Edda die Braut eines Anderen?
Ich im Vorhofe ihres Palastes, die Hochzeitsfreude zu stören? Aber in dieser Gestalt, in der mich nicht einmal die geringsten Diener respektieren? – Himmel, was soll ich anfangen? O, daß ich doch die Ratschläge des Unbekannten nicht verschlafen hätte! Er wollte mir sagen, wie ich mich bei der Sache nach seinem Willen benehmen sollte, aber ich will sterben, wenn ich ein Wort davon weiß; der betrügerische Schlummer hat mich um Alles gebracht.«
Unter diesem Selbstgespräche hatte Hiolm seine Wassereimer gefüllt, und fing an, das Marmorpflaster zu besprengen. Er war eben wieder zum Brunnen gegangen, um noch einmal Wasser zu schöpfen, als dicht an ihm, aus dem Haupteingang des Schlosses kommend, eine weibliche Gestalt vorüber strich, die er augenblicklich erkannte, und ihr einen sehnenden Blick nachschickte.
Es war die schöne Thulis, die Tochter des Königs der Schneeinsel, die hinab in den Garten eilte, für ihre Freundin eigenhändig noch einige Blumen zum Brautschmuck zu pflücken. »Ja, wenn ich diese sprechen könnte!« dachte er, »doch wird sie mich auch für den erkennen!, der ich bin? Ach, meine Kleider sind es nicht allein, die mich unkenntlich machen, Not und Kummer mögen wohl meine Gesichtszüge sehr verändert haben!«
Hiolms Befürchtungen waren indeß ganz überflüssig. Der Gram der Liebe, sagt man, vermindert die Schönheit nicht. Hiolm hatte auf seiner Insel ganz gut leben können, auch hatte er da selbst die Sorge für seine Person keineswegs so ganz vernachlässigt, wie es wohl sonst die Bewohner von wüsten Inseln zu tun pflegen. Es war hier weder von lang gewachsenem Barte, noch ausgezehrtem, sonnenverbrannten Gesicht, noch von trüben, verloschenen Augen die Rede.
Er strich sich die dunklen Locken, die seine Heldenstirn und die rosigen Wangen ein wenig beschatteten, aus dem Gesichte, wusch sich an dem Brunnen, gürtete das kostbare Schwert über den groben Kittel, und machte so eine zwar etwas seltsame, aber nicht ganz uninteressante Figur. –
Wie kenntlich er war, das bewies das Erstaunen der schönen Thulis, welcher er bei ihrer Rückkunft aus dem Garten gerade entgegen trat, und die bei seinem Anblick laut aufschrie.
»Wie?« rief sie, »Hiolm von Seeland? In dieser Verkleidung? zu dieser Stunde? Wo seid ihr bisher gewesen? Daß ihr noch am Leben wärt, mutmaßten wir erst vor Kurzem; aber euer Außenbleiben, euer ewiges Außenbleiben!«
»Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich noch länger weg geblieben wäre,« sagte Hiolm mit einiger Empfindlichkeit. »Einer Gattin, die sich für eine Witwe hält, und zur zweiten Ehe schreiten will, kann der Anblick des ersten Gemahls am Hochzeittage nie erwünscht sein!«
»Das werdet ihr gleich sehen,« erwiederte sie. »Ich eile, euren Namen der betrübten Braut zu nennen.«
Da Hiolm von dem ungestümen Wesen der Prinzessin der Schneeinsel, das er sehr wohl kannte, Nachteiliges fürchtete, so riet er ihr Vorsicht und Behutsamkeit an; aber diese löblichen Tugenden waren bei solcher Veranlassung weder von ihr, noch von ihrer Freundin zu verlangen.
Edda saß am Putztisch, als ihr die atemlose Thulis den Namen ihres verlorenen Gemahls nannte, und das Entzücken übermannte die treue Gattin so sehr, daß sie, den kaum halb vollendeten Anzug, den königlichen Anstand und alle anderen Bedenklichkeiten ganz aus den Augen setzend, mit aufgelöstem Haar, mit unbedecktem Busen, mit fliegendem Gewand ihrer Freundin nach, in den Marmorhof hinabeilte, wo sie den einzig Geliebten, den so schmerzlich Vermißten wiederfinden sollte.
Wie schön war sie in der Unordnung, mit welcher sie sich ihrem Hiolm in die Arme stürzte! wie schön in den Tränen der Liebe, die sie an seinem Busen vergoß! – Das ganze Hofgesinde versammelte sich, um das seltsame Schauspiel, wie sich die königliche Braut mit einem Wasserträger küßte, mit anzuschauen; auch kamen die drei Könige, der von Skandinavien, der Erlkönig und der alte König von Thule auf dem Balkon zum Vorschein, um zu sehen, was es gäbe.
Sie hatten gehört, wie die beiden Damen die Treppen hinab stürzten, sie vernahmen nun das Getümmel unten im Hofe, und verließen voll Neugier die vollen Pokale, bei welchen sie immer saßen, um sich einen Anblick zu verschaffen, der wenigstens zweien von ihnen nicht erwünscht sein konnte.
Der König von Skandinavien rieb sich die Stirn, der Erlkönig sprühte Funken, und nur der gute alte König der Schneeinsel hielt es für gut, sich nicht eher zu erzürnen, als bis er von der Sache näher unterrichtet wäre. Der Name Hiolm, welcher tausendmal aus dem Munde der entzückten Gattin tönte, löste sehr bald das ganze Rätsel, aber die Sache gut zu machen, war er nicht hinlänglich; bei dem Erlkönig diente er nur dazu, sie noch mehr zu verschlimmern.
Seltsame Dinge würden erfolgt sein, wenn der weise Greis, der viel über den heftigen Geisterfürsten vermochte, nicht ein Wort im Ernst mit ihm geredet, und dann hinab gegangen wäre, die vierte Person bei dem seltsamen Schauspiel abzugeben.
Da sich die Identität des wiedergekommenen Gemahls nicht bezweifeln ließ, so kam gegen Abend unter Vermittlung des Königs von Thule ein Vergleich zu Stande, mit welchem alle Teile zufrieden waren, oder zufrieden sein mußten. Daß Hiolm und Edda ungetrennt blieben, forderten alle göttlichen und menschlichen Rechte.
Der König von Skandinavien entsagte seiner Braut, weil ein Anderer frühere Rechte auf sie hatte, und er tat es mit der besten Art von der Welt; denn er war keineswegs der böse Fürst, wie ihn Edda, deren kleiner Eigensinn ihr manchmal einen Streich spielte, ehemals ihrem Hiolm geschildert hatte.
Der Erlkönig schwieg, weil er besorgte, Hiolm möchte ihn sonst der meuchlerischen Tat laut anklagen, in Folge deren alle diese Verwirrungen entstanden waren; aber sein Widerwille gegen diese Verbindung mit einem gemeinen Sterblichen, der weder Krone noch Thron hatte, war auch in seinem Schweigen nicht zu verkennen.
Der König von Thule durchschaute ihn ganz, und da er ihn gern zufriedenstellen und das Entzücken des jungen Ehepaares noch vermehren wollte, so begann er folgendermaßen: »Ist der Held, Hiolm von Seeland,« sagte er, »zu gering, der Eidam des Königs der unbewohnten Inseln zu werden, so wird Hiolm, der Erbe des Thrones von Thule, vielleicht glücklicher sein. Die Gesetze meines Reiches schließen meine Tochter von der Thronfolge aus.
Sie wird die Krone tragen, die ihr künftiger Gemahl ihr zubringt; die meinige muß ich einem Fremden überlassen. Wohlan, so sei Hiolm dieser Fremde! Er ist es zwar weder meinem Herzen noch meinem Volke, er hat sich um das eine schon so verdient gemacht als um das andere, und ich hatte ihm auch diese Belohnung schon früher zugedacht, als alle diese Dinge sich ereigneten. Heil! Heil dem künftigem König von Thule! dem Retter meiner Tochter und meines Landes! dem glücklichen tapferen Hiolm von Seeland!«
In den Ruf des guten Königs stimmten alle Großen der Schneeinsel ein, welche gegenwärtig waren, die Liebenden sanken ihm zu Füßen und nannten ihn Vater, der Erlkönig gab sich zufrieden, und der König von Skandinavien, um auch etwas Ruhmwürdiges zu tun, befahl, daß das Fest der Wiedervereinigung Hiolms und seiner Edda diesen Abend mit eben der Pracht gefeiert werden sollte, als wäre es sein eigenes Hochzeitfest.
Alles war nun Wonne, alles Entzücken! Der Palast tönte wieder vom Freudengeschrei, und als die Nacht einbrach, erschufen tausend angezündete Kerzen einen künstlichen Tag. Man setzte sich zur Tafel, und der König von Skandinavien überließ Hiolm von Seeland gern den Platz neben seiner Edda, denn er hatte den Seinigen neben der schönen Thulis genommen.
Man lachte, man scherzte, man ließ die goldnen Pokale fleißig herumgehen, und dachte sich tausend Meilen weit vom Unglück entfernt, als es auf einmal die eiskalte Hand nach den Kindern der Freude ausstreckte.
Die Gäste starrten pötzlich zu gleicher Zeit auf eine Stelle, und das, was sie erblickten, schien einen allgemeinen Schrecken, dessen Grund man sich selbst nicht ganz erklären konnte, zu verbreiten. Mitten im Saal, der frohen Tischgesellschaft gegenüber, stand ein Mann, man wußte nicht, wer er war, man wußte nicht, woher er kam. –
Er nahte sich mit feierlicher Langsamkeit dem oberen Teil der Tafel, wo Edda mit ihrem Gemahl saß. »Kennst du mich, Hiolm von Seeland?« sprach er, »ich bin der, durch dessen Hilfe du das gegenwärtige Entzücken genießest. Ich komme, meinen Lohn zu fordern; erinnere dich, daß du mir gestern die Hälfte des Liebsten, was du besitzest, versprochen hast!«
»Fordere,« sagte Hiolm, der sich nichts Arges versah, »fordere, ich bin bereit mein Versprechen zu halten. Ich bin jetzt so reich, daß ich dir leicht die Hälfte meiner liebsten Schätze abtreten kann, ohne darum zu verarmen!«
»Wohlan,« entgegnete der Unbekannte, »ich weis, daß dir auf dieser Welt nichts teurer ist, als dieses Weib und dieses Kind; ich will nicht grausam sein, wähle du selbst, welches von beiden du behalten, und welches du mir überlassen willst. – Du zögerst? Kannst du das mir getane Versprechen leugnen?«
Edda hatte die ganze Zeit über in stummen Entsetzen da gesessen, und fand erst jetzt Worte, ihre Verzweiflung auszudrücken.
»Ein solches Versprechen konntest du tun?« fragte sie, indem sie sich zu Hiolm wandte. »Und kanntest du den, dem du es gabst? – O Hiolm! Hiolm! unvorsichtiger, blödsinniger Sterblicher! wie recht hatte ich, dir ehemals das, ›hüte, hüte dich!‹ zuzurufen.
Es ist der Fürst der Insel Mona, unser alter Feind, in dessen Fallstricke du geraten bist, vor welchem ich dich warnte, und nun, welche Macht soll dich retten? Du ziehst mich und meinen Sohn mit dir in den Abgrund hinab! Wir sind alle verloren!«
Hiolm war bei dieser Rede seiner Gemahlin mehr tot als lebendig. Allgemeines Entsetzen bemächtigte sich der ganzen Versammlung. Einige klagten laut über das kurze Glück der beiden wieder vereinigten Gatten, andere, die die Macht des Fürsten der Insel Mona nicht kannten, drohten, und noch andere boten ihm Schätze, Länder und Kronen an, um ihn zu befriedigen.
Er wies alles zurück, und beharrte auf seiner Forderung. »Ich wußte wohl,« rief Edda weinend, »daß du nicht eher ruhen würdest, bis du mich zur Vergeltung für einst verschmähte Liebe grenzenlos unglücklich gemacht hättest! O Gott! wen wird nun das Los des Elendes treffen, mich? oder dies unschuldige Kind?«
»Es ist mir lieb,« sagte der Furchtbare, »daß du die Ursache meiner Rache und die Rechtmäßigkeit der selben erkennst; doch würde die schöne Edda sehr irren, wenn sie glaubte, ich geizte noch nach ihrem Besitz. Um sie von dem Gegenteil zu überzeugen, erkläre ich sofort, daß ich sie gern ihrem Gemahle überlasse, und mit diesem Kinde, das mir gefällt, zufrieden sein will. Lebt wohl, und denkt nie an das Wiedersehen!«
Mit diesen Worten bemächtigte er sich des kleinen Hiolm, den seine weinende Mutter vergebens in ihren Armen fest zu halten strebte, und den ihr Gemahl, dem schon vor dem Verluste seiner Geliebten bange gewesen war, zwar mit Schmerzen, aber doch einigermaßen getröstet, in der Gewalt des Unerbittlichen sah.
»Tröste dich, Edda,« sagte er, »dieser Mann wird unserem Kind kein Leid zufügen. Ob er der von dir so sehr gefürchtete Fürst der Insel Mona ist, weiß ich nicht, aber wohl weiß ich, daß er es ist, der mich zweimal dem Tode entriss und dem ich deine Wiedererlangung danke; ich kann nicht glauben, daß wir von ihm großes Unheil zu befürchten haben!«
»Ist dies deine ernstliche Meinung von mir?« fragte der Fremde. Als Hiolm dies bejahte, fuhr er fort: »Nun so höre, was ich dir noch zu sagen habe: War ich dein Lebensretter, so warst du auch der meinige. Als diese grausame Prinzessin, und dieser blutgierige Tyrann, dieser Erlkönig, mir wegen meiner Liebe zu einer Undankbaren das Leben raubten, da warst du es, der es mir wieder gab, in dem du meinem Leichnam eine Hand voll Erde gönntest.
Ich hatte dir Dankbarkeit, ihr Rache gelobt, und ich dachte dieses Gelübde zu gleicher Zeit zu erfüllen. Ich veranstaltete, daß ihr einander saht. Liebe entglomm in euren beiden Herzen, – Liebe eines ätherischen Mädchens, Liebe eines gemeinen Sterblichen! Was konnte wohl Wirksameres erdacht werden, den einen zu erheben, die andere zu erniedrigen? Meine Hand war in der Folge überall bei Lenkung eures Schicksals mit im Spiele.
Es ist mir so ziemlich geglückt, diese stolze Schönheit zu demütigen, und ich leugne nicht, daß ich oft noch Schlimmeres mit ihr im Sinne hatte, als mir die Dankbarkeit gegen Hiolm auszuführen erlaubte. Mein Herz erweichte sich indessen nach und nach gegen die Undankbare, und völlig war es ausgesöhnt, als neue Liebe mich die alte, und die damit verbundene Rache vergessen ließ.
Ja, Edda, ich fühle es, ich liebe, aber nicht mehr dich, nein, deine sanfte, gutmütige, unschuldige Freundin, die schöne Thulis. Mein heimliches Einverständniß mit Hinrich von Röschild ist euch bekannt. Sein Verstand war zu plump, als daß ich von ihm hätte völlige Befriedigung meiner Wünsche hoffen können; vielleicht war auch eine höhere Hand zu Eddas Rettung geschäftig!
Anstatt, daß Hinrich mir die grausame Geliebte in die Hände hätte spielen sollen, brachte er sie an einen Ort, wo ich mich nur an ihrem Anschauen ergötzen durfte. Als ich nun einst auf die Erleninsel kam, mich an Eddas Schönheit zu weiden, sah ich die holde Thulis, und fand durch sie jeden anderen Reiz verdunkelt.
Sie ist gegenwärtig der Gegenstand aller meine Wünsche, und kann sie sich entschließen, den König von Skandinavien mir aufzuopfern, so gebe ich euch sofort euer Kind zurück; ich hatte nichts Böses mit ihm im Sinn, ich wollte es zum Erben der Insel Mona, zum Eigentümer der Inseln des stillen Meeres machen, die jetzt mir gehören. Aber was bedarf ich fremder Kinder, da Thulis, die schöne Thulis, mir Söhne geben kann?«
Aller Augen richteten sich bei diesen Worten auf die Tochter des Königs von Thule, die in sittsamer Verlegenheit an der Seite des Königs von Skandinavien saß, und kein Wort vorbringen konnte. Hiolm und Edda hingen an ihr mit bittendem Blick, sie wollten von ihrem Entschluss den Besitz des kleinen Hiolm und die Freundschaft des mächtigen Fürsten der Insel Mona erflehen.
Der König von Skandinavien zitterte; denn im Geheimen hatte er die schöne Thulis zu Eddas Stellvertreterin erkoren. Sein Glück stand hier abermals auf dem Spiele, und wenn es schon für den gemeinsten Sterblichen keine Kleinigkeit ist, in einem Tage zwei Bräute zu verlieren, um wie viel mehr mußte ein solcher Verlust einem Fürsten schmerzen, der gewohnt war, alles sich seinen Wünschen oder Befehlen fügen zu sehen.
Thulis zögerte, zu antworten; ach, ihr Herz hatte bereits nur allzulaut für ihren königlichen Bewerber gesprochen. Er war jung, schön und liebenswürdig, der Fürst der Insel Mona ernst, still und feierlich, und überdies ein Wesen höherer Art, mit dem nicht leicht ein Erdenmädchen gern eine Verbindung eingehen wird.
Ihre Blicke wanderten ängstlich von dem kleinen Hiolm, der noch in den Armen des Furchtbaren zitterte, auf ihre Freundin Edda, aus deren Augen die Tränen häufig hervorstürzten. Ihr Herz wurde bewegt, sie gedachte des Freundschaftsbundes, den sie mit Edda geschlossen, gedachte der vielen Aufopferungen, durch die sie ihrer Freundin bisher ihre Liebe bewiesen hatte, und wollte es nicht an der letzten und größten fehlen lassen, die anderen alle zu bekrönen.
Noch ein Seufzer für den König von Skandinavien, ein fragender Blick auf den König von Thule, und dann der heldenmutigste Entschluß, dessen sich je ein Mädchen rühmen konnte, Aufopferung der liebsten Wünsche, um eine Freundin glücklich zu machen.
Sie stand auf; Niemand war, der ihre edle Absicht verkannte, am wenigsten der Fürst der Insel Mona, über dessen Gesicht sich eine seltene Heiterkeit verbreitete, und der die Bewegung, welche die großmüthige Thulis machte, für eine Aufforderung ansah, den kleinen Hiolm seiner Mutter wieder zu geben.
Der König von Thule legte die Hand seiner Tochter in die Hand des künftigen Schwiegersohnes, der ihm weniger missfiel, als der zitternden Thulis. Glückwünsche, Ausrufungen des Beifalls, Danksagungen und Liebesversicherungen folgten jetzt so rasch hintereinander, daß man sich am Ende gar nicht mehr verstehen konnte.
Niemand spielte bei dem ganzen Handel eine traurigere Rolle, als der gute König von Skandinavien. Er ergriff indessen die klügste Partie, und tat, da es zwischen ihm und seiner zweiten Geliebten noch nicht zu wörtlicher Erklärung gekommen war, als ginge ihm die ganze Sache nichts an. Einige behaupten sogar, er sei der erste gewesen, der die Gesundheit des neuen Brautpaares ausgebracht habe.
Das Fest wurde mehrere Tage mit allem möglichen Glanz auf Kosten des großmütigen Königs von Skandinavien fortgesetzt. Während die meisten Gäste sich auf dem Gipfel des Entzückens befanden, gab es auch einige, die die allgemeine Freude nicht teilten.
Thulis, die so große Opfer gebracht, gehörte Anfangs zu diesen, doch söhnten Vernunft und Überlegung, so wie die heißen Danksagungen ihrer Freunde sie bald mit ihrem großmütigen Entschluss aus. Liebe und Dankbarkeit verschönerten ihren Gemahl mit der Zeit in ihren Augen. Was ihn an jugendlicher Anmut abging, das ersetzte sein weiser Ernst, und der hohe Rang, den er in der Reihe der Wesen behauptete.
In seinen Armen konnte sie sich Hoffnung auf Unsterblichkeit machen, während die gute Edda durch ihre Verbindung mit einem Sterblichen freilich der Vergänglichkeit entgegen reifte.
Zwar genoß die Tochter des Erlkönigs lange Zeit das Glück der Liebe an der Seite ihres Hiolm, aber endlich, endlich kam doch die Zeit der Trennung. Sie entfloh der Erde früher als er, und gab ihm im Sterben jenes berühmte Geschenk, den goldnen Becher, den noch jetzt die Gesänge unserer Barden feiern.
»Gränzenlos wird dein Kummer sein, wenn du mich nicht mehr dich mit liebevoller Zärtlichkeit umschweben siehst,« sagte sie zu ihrem Hiolm, der damals schon längst die Krone von Thule trug.
»Du würdest vergehen, wenn ich dir nicht ein Linderungsmittel lehrte! Nimm dieses goldne Trinkgeschirr; mit welchem Getränke es auch gefüllt sein mag, du wirst daraus Vergessenheit trinken, bis wir uns in seligern Gegenden wiederfinden, wo wir eines solchen betäubenden Mittels nicht mehr bedürfen.«
Der weinende Hiolm nahm das Geschenk seiner sterbenden Geliebten, brauchte es nach Vorschrift, und fand es probat; doch soll er es öfterer mit Wein als mit Wasser gefüllt, und sich dann allemal besser daraus gestärkt haben. Von ihm her schreibt sich die Gewohnheit der Erdensöhne bis auf unsere Tage, aus gefüllten Bechern Vergessenheit zu trinken.
Doch Hiolm trank nicht so viel, wie seine Nachfolger; Eddas Andenken war ihm zu teuer, als daß er hätte wünschen sollen, es ganz aus seiner Seele zu tilgen.
Er war der selbe König von Thule, der am späten Abend des Lebens, bei Annäherung des Todes, und nach geschehener Erbteilung, nichts für sich behielt, als den goldnen Becher. Bei dem letzten Feste der Schalen, das er auf seinem Schloß am Meer feierte, tat er noch den Scheidetrunk aus dem heiligen Gefäß, warf es dann mit einer Träne des Andenkens an die Geliebte hinab in die Fluten, und – starb.
Mit ihm starb auch die Herrlichkeit von Thule; der junge Hiolm, den sein Großvater, der Erlkönig, als künftigen Thronfolger wenig von seiner Seite ließ, war nicht im Lande. Der Seeräuber Naddock kam von dem fernen Atlantis herüber, nahm Besitz von der verlassenen Schneeinsel, und verwandelte ihren Namen in Eisland, oder Island, unter welchem sie noch bekannt ist bis auf den heutigen Tag.
Volksmährchen der Deutschen,
Christiane Benedicte Eugenia Naubert (1756–1819)
EIN SIEGFRIED-MÄRCHEN ...
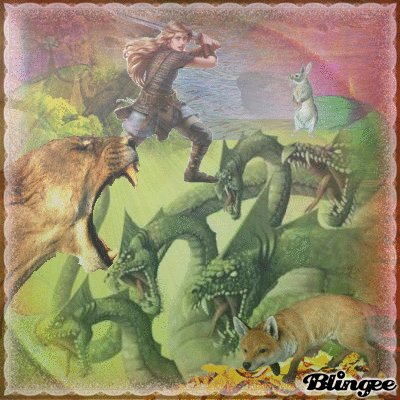
Ein armer Mann hatte zwei Söhne, mit denen er sich vom Besenbinden kümmerlich nährte. Eines Tages brachten sie ihm aus dem Walde statt der Reiser einen Vogel mit, dessen Flügel hatten goldene, die Brust silberne Farbe. Auch sang er so schön, daß es eine Freude war, ihn zu hören, und daß der Alte bald nichts lieber auf der Welt hatte, als seinen Gesang.
Da ritt einst ein Graf am Hause des Besenbinders vorüber. Er hörte den Vogel singen und hielt sein Roß an; da sah er, daß unter den Flügeln des Vogels zu lesen stand ›Wer mein Herz ißt, der wird einst König werden.‹ Da bot der Graf dem Alten viel Geld für den Vogel, und als der Alte nicht einwilligen wollte, versprach ihm der Graf, ihn und seine Söhne auf sein Schloß zu nehmen, wo sie gute Tage haben sollten.
Aber der Graf hielt nicht Wort; der alte Mann mußte täglich Holz hacken und seine Söhne es in die Küche tragen, wobei sie mehr Schläge als Brot bekamen. Den Vogel aber ließ der Graf rupfen und sein Herz braten, damit er einst König werde. Wie nun der Koch grade damit beschäftigt war, kam der jüngere Sohn des Besenbinders in die Küche, und da ihn sehr hungerte, nahm er in einem Augenblick, wo der Koch bei Seite gegangen, das gebratene Herz vom Teller und verzehrte es.
Der Koch war gewaltig erschrocken, denn der Graf hatte ihm höchste Sorgfalt anbefohlen; er jagte den Jungen unter der Drohung, dem Grafen alles zu sagen, vom Hofe, nahm das Herz einer Taube und setzte es dem Grafen gebraten vor.
Der Junge hatte seinem ältern Bruder sein Leid geklagt und beide beschlossen, zu entfliehen. Sie wanderten immer weiter und weiter, bis sie in einen dunklen Wald kamen. Sie legten sich ermüdet unter eine Eiche und schliefen ein. Als sie erwachten, stand vor ihnen ein Jäger; der sah sie scharf an und fragte, wer sie seien und woher sie gekommen.
Die Knaben zitterten, und der Jüngste, dem sein Gewissen schlug, erzählte sein Schicksal. Da wurde der Jäger freundlicher und sagte, sie sollten mit ihm kommen, er wolle tüchtige Jäger aus ihnen machen. Sie gingen mit ihm. Wie nun ihre Lehrzeit vorüber war, sagte er ›Ihr müßt nun in die Welt hinaus; vorher aber bittet euch drei Dinge von mir aus.‹
Da baten sie ihn Jeder um ein Pferd, einen Hirschfänger und um einerlei Kleidung für Beide. So trabten sie von dannen, bis sie an einen Scheideweg kamen. Da sprach der Ältere ›Hier wollen wir uns trennen und unsere Hirschfänger aufhängen; wer von uns zuerst wieder herkommt und sieht des anderen Hirschfänger gerostet, der mag wissen, daß es ihm schlecht geht oder er gar tot ist.‹ Drauf trennten sie sich; der eine ritt rechts, der andre links.
Dem Jüngsten kam nicht lange drauf ein Löwe in den Weg gelaufen. Er wollte seine Büchse anlegen; da erhob der Löwe seine Stimme, er solle ihn leben lassen, er wolle ihm auch in jeder Not und Gefahr beistehen. ›Nun dann,‹ sprach der Jäger, ›so wende dich hinter mich.‹ Bald darauf kam ein Fuchs gelaufen, mit dem ging es ebenso wie mit dem Löwen, und zuletzt ein Hase.
Als nun der Jäger mit den drei Tieren weiter zog, kam er in eine Stadt, die mit schwarzem Flor umzogen war. Er vernahm, daß ein Drache in der Gegend hause, der alljährlich eine Jungfrau verlange. In diesem Jahre sei die Reihe an des Königs Tochter und darum trauere alles. Der König habe sie demjenigen zur Frau versprochen, der den Drachen töte.
Am anderen Morgen machte sich der Jäger nach dem Orte auf, wo der Drache hauste. Schon hielt der Wagen des Königs dort, in dem die Königstochter saß. Nicht lange, so kam auch der Drache her gefahren, er hatte einen langen Schweif und sieben Köpfe. Da sprach der Jäger zu seinen Tieren ›Nun alle samt, und reißt, was ihr könnt.‹
Die Tiere packten den Drachen an, und der Jäger schlug wacker drauf los, daß der Drache bald tot da lag. Totmüde ruhte der Jäger am Boden, da nahm der Kutscher der Prinzessin das Schwert und schlug dem Jäger den Kopf ab und sagte zur Prinzessin ›Wenn du mir nicht schwörst, mich als den zu bezeichnen, der den Drachen getötet hat, so töte ich dich.‹ Da schwur ihm die Prinzessin, was er verlangte.
Die Tiere standen traurig bei ihrem toten Herrn. Da sprach der Fuchs zum Hasen ›Dort im Walde wohnt eine alte Frau, die hat eine Salbe; lauf so schnell wie möglich hin und bringe sie her.‹ Das tat der Hase und brachte die Salbe; der Fuchs nahm des Jägers Kopf, setzte ihn auf den Rumpf, bestrich die Wunde mit der Salbe und der Jäger war wieder lebendig.
Nach einem Jahre kam er wieder in die Stadt; jetzt war sie mit rotem Flor umgeben. Er erfuhr, daß heute die Prinzessin mit ihrem Befreier, dem Kutscher, Hochzeit halte. Da nahm der Jäger einen Korb, legte einen Brief hinein, in dem er alles erzählte, hing ihn dem Fuchse um den Hals und hieß ihn laufen. Der Fuchs lief in des Königs Palast, wo die Prinzessin mit ihrem Bräutigam oben an der Tafel saß und legte seinen Kopf samt dem Korb in ihren Schoß.
Die Prinzessin erschrak zuerst, dann nahm sie den Brief und las ihn. Drauf sprach sie zu dem König und seinen Räten ›Was hat der verdient, der so und so getan hat?‹ und erzählte die Geschichte. Da sprachen alle ›er ist Wert, in eine Tonne, mit Nägeln ausgeschlagen, gesteckt und vom Berge herunter ins Wasser gerollt zu werden.‹ Da sprach die Prinzessin ›So muß das meinem Bräutigam geschehen.‹ Und so geschah es auch; der Jäger aber machte mit der Prinzessin Hochzeit.
Er konnte aber vom Jagen nicht lassen. Einst verfolgte er auf der Jagd eine Hirschkuh, die ganz weiß war. Immer tiefer kam er in den Wald, daß es dunkelte. Da gelangte er zu einer Hütte, vor der eine alte Frau mit einer Rute in der Hand stand. Die bat er um Herberge. ›Ja,‹ sagte sie, ›die wolle sie ihm wohl gewähren; aber mir graut vor deinen Tieren, laß sie mich mit meiner Ruthe berühren.‹ Das erlaubte ihr der König, sie strich einmal mit der Rute über ihn und die Tiere: da wurden sie alle zu Stein.
Indeß war der ältere Bruder nach mehrjähriger Wanderung zu der Eiche gekommen, wo sie sich getrennt hatten. Da sah er seines Bruders Hirschfänger verrostet und machte sich auf, ihn zu suchen. Er kam in den Wald, in dem sein Bruder zu Stein verwandelt war, und kam auch zu der Hütte der alten Frau. Diese wollte ihn mit ihrer Rute berühren, da spannte er seine Büchse und drohte sie nieder zu schießen, wenn sie ihm nicht sage, wo sein Bruder sei.
Da bat die Frau um ihr Leben, führte ihn zu den Steinen, berührte sie mit der Rute und der Bruder und seine Tiere wurden wieder lebendig. Sie zogen in des Königs Schloß und lebten fröhlich bis an ihr Ende.
Märchen und Legenden aus Meklenburg
Karl Friedrich Adolf Konrad Bartsch 1832–1888
DER KÖNIGSSOHN ...
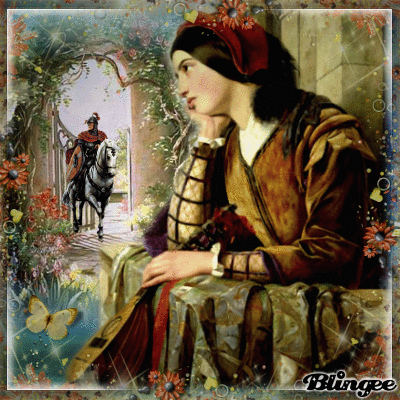
Es war einmal ein Königssohn, der ritt mit seinen Dienern auf die Jagd. Er hatte schon den ganzen Tag gejagt, ohne etwas zu treffen; er war im Begriff, heimzukehren, als eine Ricke ihm aufstieß. Um doch wenigstens etwas nach Hause zu bringen, setzte er ihr nach. Aber immer, wenn er sie nahe genug glaubte, um seinen Speer werfen zu können, war sie ihm wieder entschwunden. Dabei verlor er seine Gefährten ganz, die denn ohne ihn heimkehrten.
Die Ricke lief endlich über eine Brücke, der Königssohn hinter ihr her. Kaum war er hinüber, als die Brücke hinter ihm abbrach, und vor ihm stand statt der Ricke ein altes häßliches Weib, das ihn aufforderte ihr zu folgen. Er mußte ihr gehorchen, er mochte wollen oder nicht.
Sie führte ihn in ein Schloß mitten im Walde, das sie mit ihren drei Töchtern bewohnte. Die beiden ältesten waren so häßlich wie ihre Mutter und ebenso unfreundlich gegen ihn, die jüngste aber hübsch und freundlich. Nach einiger Zeit forderte die Alte ihn auf, ihre älteste Tochter zu heiraten. Dagegen weigerte er sich aber und erbot sich, die Jüngste zu nehmen.
Das wollte jedoch die Alte nicht, und er wurde von ihr und den beiden älteren Schwestern scharf bewacht, damit er nicht entrinne. Er fand aber doch Gelegenheit, der Jüngsten seine Liebe zu gestehen, die sie ihrerseits herzlich erwiderte. Beide beschlossen zu entfliehen.
Im Herbste liefen sie eines Nachts davon. Aber am Morgen setzte ihnen die mittlere Schwester nach. Wie die Jüngste bemerkte, daß sie verfolgt wurden, verwandelte sie sich in einen Rosenstock und ihren Geliebten in eine Rose. Da kehrte die Schwester um und erzählte, sie habe die Flüchtlinge nicht finden können, und zugleich, daß sie mitten im Walde einen Rosenstock gesehen hätte.
Da wurde sie von ihrer Mutter und Schwester gescholten, daß sie den Rosenstock nicht mitgebracht hatte. Nun wurde die älteste Tochter nachgeschickt. Als sie den Verfolgten auf die Spur kam, verwandelte ihre Schwester sich in ein Caroussel und ihren Geliebten in den Besitzer des selben, der in der Mitte sitzend in einem Buche las. Da kehrte die Aelteste um und berichtete, daß sie nichts gefunden und was sie im Walde gesehen.
Nun eilte die Alte ihnen selbst nach. Diesmal verwandelte sich die jüngste Tochter in einen See und den Königssohn in eine Ente, die auf dem See schwamm; vorher aber hatte sie ihn gewarnt, dem Ufer nicht zu nahe zu kommen. Die Alte lockte die Ente mit Brot, und einmal glaubte sie sie so nahe, daß sie mit der Hand darnach griff; da verlor sie aber das Gleichgewicht und fiel ins Wasser und ertrank.
Die beiden Liebenden setzten nun ihren Weg fort und kamen auch glücklich in die Heimat des Königssohns. Vor dem Tor verabredeten sie, die Braut solle noch draußen bleiben, während er hineingehe. Er traf nur seine Mutter noch am Leben, sein Vater war gestorben.
Großer Jubel empfing ihn bei seiner Rückkehr und große Feste wurden veranstaltet, so daß er seine Braut ganz vergaß und ihm zuletzt sein ganzes Erlebnis im Walde wie ein Traum erschien. Die Braut wartete draußen bis an den verabredeten Tag. Als er da nicht kam, verkleidete sie sich und ging ins Schloß, wo sie sich als Kammerzofe verdingte und durch ihre Geschicklichkeit und Bescheidenheit sich bald die Gunst der Königin erwarb.
Es gelang ihr aber nicht, ihren Geliebten zu Gesicht zu bekommen. Da wünschte sie sich eines Tages ein prachtvolles Kleid, auf dem der ganze Sternenhimmel zu sehen war, und weil sie eine Zauberin war, bekam sie es auch. Das zeigte sie der Königin, und diese, ganz entzückt darüber, wollte es ihr abkaufen.
Das Mädchen aber wollte es für Geld nicht hergeben, sondern es ihr schenken unter der Bedingung, daß sie eine Nacht im Schlafgemach des Königs zubringen dürfe. Das gewährte die Königin, sie gab aber ihrem Sohne vorher einen Schlaftrunk, damit er von der Gegenwart der Zofe nichts bemerke.
Das Mädchen suchte ihn durch Weinen und Wimmern, zuletzt durch Schütteln und Rütteln zu erwecken, es gelang ihr aber nicht, sondern er schlief bis zum vollen Tage, wo sie das Zimmer wieder verlassen mußte. Da wünschte sie sich ein prachtvolles Tuch mit Gold und Perlen besetzt, daß es wie die Sonne leuchtete; das zeigte sie wieder der Königin und schenkte es ihr unter der gleichen Bedingung.
Diesmal aber nahm der König den Schlaftrunk nicht, weil ihm einer seiner Diener verraten, was die Königin das vorige Mal getan hatte. Wie nun das Mädchen wieder in seinem Zimmer weinte und wimmerte, erwachte er und erkannte sie wieder. Und nun erkannte er auch, daß, was er im Walde erlebt, kein Traum gewesen war, erinnerte sich seines Versprechens und nahm am anderen Tage das Mädchen zu seiner Frau und beide lebten glücklich miteinander.
Märchen und Legenden aus Meklenburg
Karl Friedrich Adolf Konrad Bartsch 1832–1888
HANS UND DER KALBSKOPF ...

Ein Bauer hatte drei Söhne, der jüngste hieß Hans und galt für sehr einfältig. Eines Tages traten die beiden ältesten vor ihren Vater hin und sprachen ›Wir sind lange genug zu Hause gewesen, gib jedem von uns zehn Thaler und eine Kiepe voll Brot und Fleisch, so wollen wir in die Fremde wandern.‹
Der Vater gewährte ihre Bitte. Da wollte Hans auch zehn Thaler und eine Kiepe voll Brot und Speck, und da er nicht nach ließ, so mußte der Vater ihm willfahren. So zogen die Drei eines Morgens vom Hause weg. Die beiden ältesten waren ärgerlich, daß der dumme Hans mit ihnen ging, und eilten so, daß er nicht nachkommen konnte.
Da rief er ›Was hab ich hier gefunden!‹ und die Brüder kehrten um. Das tat er mehrere Male, bis sie ihm nicht mehr glaubten und ihres Weges weiter gingen. Nun war er bald ganz allein und wußte nicht, wo aus, wo ein. Es wurde dunkel, und aus Furcht vor Wölfen stieg er auf eine Eiche. Da sah er durch die Nacht ein Licht leuchten, stieg rasch herab und lief dem Lichte nach.
Er kam in ein großes Schloß mit vielen erleuchteten Zimmern, aber kein Mensch war darin. In einem der vorderen Zimmer war ein Tisch gedeckt und mit köstlichen Speisen besetzt. In einer Hinterstube fand er in einer Wiege einen Kalbskopf liegen, und als Hans ›guten Abend!‹ rief, schwenkte der Kalbskopf die Ohren und antwortete ›Schönen Dank!‹
Hans fuhr erschrocken zurück. Da sagte der Kalbskopf ›Gott sei Dank, daß du kommst! Bleib hier und iß und trink! Du sollst mir Neues erzählen, wie es in der Welt aussieht.‹ Hans ließ sich das gesagt sein, er gab Bescheid auf alle Fragen, aß und trank tüchtig und legte sich dann in einer der Stuben zu Bette. Am Morgen waren seine Kleider und Schuhe schön gebürstet und Essen und Trinken hatte er vollauf wie am ersten Abend.
Den Tag über mußte er an der Wiege sitzen und dem Kalbskopf erzählen. So blieb er ein Jahr dort, da dachte er an seine Eltern daheim und sagte dem Kalbskopf, daß er sie wohl sehen möchte. Damit war der Kalbskopf einverstanden, aber er sagte ›Dir fehlt es an Kleidern, Geld und einem Pferde, auch kennst du den Weg nicht.
Nimm diesen Stab und schlag auf jene Lade, da findest du Kleider und Waffen in Menge drin; er wird dir den Stall öffnen, in dem du Pferde zur Auswahl findest, und ebenso jene Kiste, in der findest du Geld und eine Pfeife. Weißt du den Weg nicht, dann blase auf der Pfeife und du wirst gleich wieder auf dem rechten Wege sein.‹
Hans tat wie ihm geheißen war. Er nahm sich einen schönen Jägerrock mit goldenen Tressen, einen dreieckigen Hut, einen Degen und ein Gewehr, aus dem Stalle einen schönen Schimmel, füllte seine Taschen mit Geld und nahm die Pfeife. Dann ritt er von dannen, nachdem er dem Kalbskopf versprochen hatte, bald wiederzukommen.
Seine Brüder waren nur wenige Tage von Hause weg gewesen; die Kiepe war bald leer, das Geld bald ausgegeben, und sie mußten, wenn sie nicht verhungern wollten, den Weg nach Hause suchen, wo sie denn tüchtig ausgelacht wurden. Da kommt eines Tages ein stolzer Reiter geritten. ›Kennt ihr mich nicht?‹ rief er, ›ich bin ja der Hans.‹
Da war großer Jubel und große Verwunderung; nur die beiden Brüder sahen scheel drein. Des Nachts verabredeten sie, sie wollten in die Dachluke steigen, den Hans erschlagen und ihm sein Geld abnehmen. Aber er erwachte, schoß nach ihnen und traf den einen in den Schenkel. An der Wunde wurde am anderen Morgen der Täter erkannt.
Nach einiger Zeit machte sich Hans wieder nach dem Schlosse auf und wurde vom Kalbskopf freudig empfangen. Eines Morgens sagte dieser zu ihm ›In der Küche steht ein Haublock und in der Speisekammer liegt ein Beil. Sieh her, ich hab hier am Hinterkopf ein böses Gewächs, das mich krank macht. Trag mich auf den Block und hau mir mit dem Beil das Gewächs ab.‹
Hans nahm den Kalbskopf bei den Ohren aus der Wiege und bemerkte mit Schrecken an dessen Hinterkopfe ein schlangenartiges, blaues Gewächs. Aber er faßte sich ein Herz, trug ihn nach dem Block, und kaum hatte er den Hieb getan, da stand eine wunderschöne Prinzessin vor ihm, das ganze Schloß war voll von Menschen, der Haublock eine alte Kammerfrau, das Beil ein alter Kutscher.
›Ich war verwünscht,‹ sprach die Prinzessin, ›du hast mich erlöst und sollst nun mein Mann sein.‹ Wer war glücklicher als Hans? Er ließ seine Eltern zu sich kommen, auch seinen Brüdern verzieh er, und lebte in Glück und Freude bis an sein Ende.
Märchen und Legenden aus Meklenburg
Karl Friedrich Adolf Konrad Bartsch 1832–1888
DIE JUNGFERNKLIPPE ...
Als noch die alte Staufenburg in Thüringen stand, schaute die Tochter eines Burgherrn einst viele Jahre lang von einem Felsen am Wallgraben hinaus in die Weite, um zu sehen ob ihr Geliebter nicht aus der Fremde wiederkehre.
Und weil sie so lange dort stand, drückte sich ihr Fuß in den Stein, und die Vertiefung ist noch zu sehen. Noch jetzt erscheint das Fräulein bisweilen mit goldenen Pantoffeln und mit langem, gelben Haar auf dem Felsen, welcher darum die Jungfernklippe genannt wird.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DIE JUNGFER AUF DEM SCHLOSSBERGE BEI OHRDRUF ...
Auf dem Schloßberge bei Ohrdruf, am Fuße des Thüringer Waldes, läßt sich manchmal eine Jungfer mit einem großen Schlüsselbunde sehen. Sie kommt um die zwölfte Stunde zu Mittag vom Berge herab, geht in das Tal zum Herlingsbrunnen, badet sich darin und steigt dann wieder den Berg hinauf.
Sagen Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen,
Emil Friedrich Julius Sommer (1819–1846)
DER DUMME BAUER ...
Es war einmal ein armer dummer Bauer, der hatte einen klugen Nachbarn; zu dem ging er jeden Abend und fragte ihn, was er am anderen Morgen tun wollte und wenn er es ihm gesagt hatte, so tat er das selbe und kam auf diese Art mit vorwärts. Endlich aber verdroß den klugen Bauern das ewige Fragen und er beschloß, seinem Nachbarn einen üblen Streich zu spielen.
Als er am Abend zu ihm kam, sagte ihm der Kluge, er wolle morgen sein Scheunfach umhaken. Der Dumme nahm das für Ernst und zog am Morgen mit Ochsen und Haken auf die Scheundiele. Der Nachbar sah es und lachte drüber, aber der Dumme hakte drauf los, ohne drüber nachzudenken, was er da säen wolle.
Nach einiger Zeit stieß die Hakenspitze auf einen harten Gegenstand und er mußte inne halten. Als er näher zusah, fand er einen Grapen mit Gold, lief ins Haus und zeigte seiner Frau seinen Fund. Der Nachbar aber, als er es hörte, ärgerte sich, daß sein übler Rat dem Dummen zum Glücke ausgeschlagen sei.
Märchen und Legenden aus Meklenburg
Karl Friedrich Adolf Konrad Bartsch 1832–1888
DIE SINGENDE BESENBINDER ...
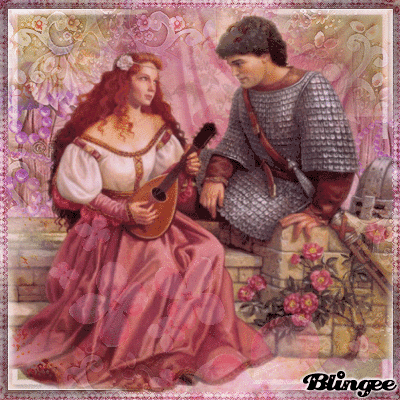
Es war einmal ein armer Besenbinder im Lande Portugal, der hatte eine einzige Tochter, die wunderschön singen und die Harfe spielen konnte. Seine Hütte lag dicht bei dem Palaste des Prinzen, und dieser hörte oftmals den schönen Gesang, wenn er vor der Tür seines Schlosses saß.
Zuletzt setzte er sich jeden Abend vor die Tür; nach einiger Zeit bat er den Besenbinder, alle Abend in sein Haus kommen und dem Gesange lauschen zu dürfen, und endlich nahm er, trotzdem daß seine Verwandten es ungern sahen, den Vater und die Tochter in seinen Palast.
Als nun des Prinzen Jahrestag gefeiert wurde und viele Sänger und Spieler ihre Kunst aufs beste wiesen, sang und spielte doch die Besenbinderstochter am schönsten von allen. Da erklärte der Prinz, der sie schon lange liebte, vor allen, er werde sie zu seiner Frau nehmen. Und so tat er auch.
Bald darauf brach ein Krieg mit den Türken aus und der Prinz wurde schon nach der ersten Schlacht gefangen genommen. Als das seine Gemahlin hörte, legte sie Pilgerkleider an, nahm ihre Harfe und fuhr auf einem Schiffe nach Constantinopel. Sie sang in den Höfen ihre Lieder für ein Almosen.
Da feierte der Sultan ein großes Fest, bei dem alle Sänger und Sängerinnen des Landes erscheinen mußten. Da sang der arme Pilger am schönsten unter allen, so daß der Sultan ihm gestattete, einen Wunsch auszusprechen. Der Pilger verlangte die Freiheit des Prinzen und der Sultan mußte es gewähren. So kehrte der Prinz nach Portugal zurück, den Pilger aber behielt der Sultan bei sich.
Als der Prinz heimkehrte, wurde seine Gemahlin von seinen Verwandten schändlich verleumdet. Sie aber lebte bei dem Sultan traurige Jahre; alle Tage ging sie ans Ufer, um zu sehen, ob nicht ein Schiff aus der Heimat komme. Endlich kam eines, und es gelang ihr, heimlich zu entfliehen.
In Portugal aber wurde sie ins Gefängnis geworfen und durfte nur ihre Harfe mit hinein nehmen. Oftmals hörte der Prinz ihre Lieder, aber er glaubte den Verleumdern und blieb ungerührt. Da hörte er sie einst ein Lied singen von dem Pilger, dem er seine Befreiung verdankte.
Er ließ sie fragen, was sie davon wisse, und nun erzählte sie ihm, daß sie der Pilger gewesen war. Sie wurde nun aus dem Gefängnis befreit und wieder des Prinzen liebes Gemahl, ihre Verleumder aber erfuhren die gerechte Strafe.
Märchen und Legenden aus Meklenburg
Karl (Friedrich Adolf Konrad) Bartsch 1832–1888
CLARAWUNDE ...
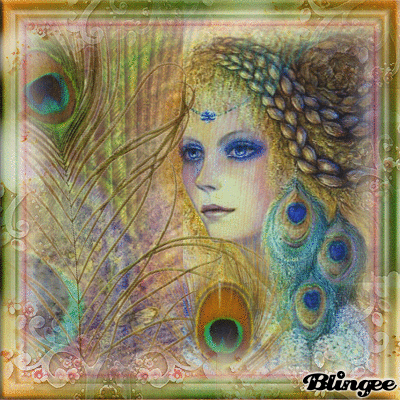
Vor vielen, vielen Jahren ritt einmal ein Königssohn in Begleitung eines treuen Dieners in die Welt hinaus, um Land und Leute kennen zu lernen. Bald kam er in einen ungeheuren Wald und sah hier viele hundert junge Raben, welche gierig nach Futter schrien.
Als der Prinz die Ursache ihres Geschreis erkannte, sprach er zu seinem Diener ›Schlachte dein Pferd und gib sein Fleisch den Raben, daß sie ihren Hunger stillen und kehre in Frieden zurück in die Heimat.‹ Der Diener tat, wie ihm befohlen war und sein Herr zog allein seine Straße weiter.
Aber noch ehe er das Ende des Waldes erreichte, gewahrte er auf einem Baume einen Vogel, dessen Gefieder mit wunderbarer Farbenpracht bedeckt war. ›Den Vogel muß ich haben,‹ sprach der Prinz laut vor sich hin; doch sein edles Roß warnte ihn und sprach ›Herr, laß Vogel Vogel sein, Vogel ist betrüglich, es kostet dir dein Leben.‹
Allein der Prinz bestand auf seinen Kopf; schnell sprang er vom Pferde und kletterte den Baum hinan. Noch saß der Vogel auf seinem Platze, schon streckte der junge König die Hand danach aus, und – o weh! der Vogel flog von dannen, und anstatt seiner hielt der Prinz eine Feder seines Schwanzes in der Hand.
Aber wie erstaunte er, als er plötzlich auf der Feder das Bild Clarawundens, der schönsten Dame der Welt, erblickte. Voll Vergnügen stieg er vom Baume herab, schwang sich auf sein Roß und ritt weiter. Lange ritt er dahin, ohne daß er es wußte, wohin er kam; denn er konnte sich nicht satt sehen an dem wunderbaren Bilde.
Da hörte er auf einmal ein leises Geräusch und als er um sich blickte, sah er einen Fisch, den die hochgehenden Wellen eines nahen Sees weit aufs trockne Land geschleudert hatten. Eilends stieg der Prinz vom Pferde, setzte den Fisch ins Wasser und zog von dannen.
Nicht lange darauf hörte er eine Stimme, die fast wie der Angstruf eines Menschen klang. Schnell eilte er dem Orte zu, wo die Stimme herkam und er fand einen Riesen, der bis an den Hals im Sumpfe steckte, so daß er sich nicht helfen konnte. Der Prinz besann sich nicht lange, warf dem Riesen ein Seil zu, zog ihn mit großer Anstrengung aus dem Schlamm und ritt seines Weges weiter.
So kam er eines Tages in die Stadt eines mächtigen Königs. Er ließ sich sogleich anmelden. Der König nahm ihn sehr freundlich auf und bat ihn schon nach einigen Tagen, in seinem Dienst zu bleiben. Der Prinz nahm das Anerbieten an und verlebte frohe Tage. Er hatte noch immer jene kostbare Feder als ein wertes Kleinod bei sich, und es verging wohl kein Tag, daß er nicht das schöne Bild Clarawundens betrachtete.
So hielt er auch eines Tages, als er auf seinem Zimmer allein war, die Feder in der Hand, als unerwartet der Prinz des Hauses bei ihm eintrat. Voll Erstaunen betrachtete dieser die schönen Farben der Feder; als er aber das wunderbare Bild erblickte, zitterte er vor Verwunderung. Unwillkürlich griff seine Hand nach der Feder und mit den Worten ›Sie muß mein eigen werden!‹ stürzte er damit zur Tür hinaus.
Traurig saß der Prinz da und weinte Tränen über das schöne Bildnis, das ihm für immer verloren schien. Aber nicht lange sollte er in seiner Traurigkeit bleiben; denn der alte König trat eilends in sein Zimmer und sprach ›Du bist ein tapferer Held, schaffe meinem Sohn Clarawunden herbei und ich werde dir einen hohen Lohn geben.‹
Der Prinz ging auf die Bitte des Königs ein und machte sich am anderen Morgen auf den Weg. Aber wo sollte er die schöne Prinzessin suchen? Welchen Weg mußte er einschlagen? Diese Fragen beschäftigten eben seine Seele, und schon war er nahe daran, wieder umzukehren, als er plötzlich eine Menge Raben über sich erblickte, welche ihn durch ihr Gekrächz einluden, ihnen zu folgen.
Es waren die Raben, denen er einst das Leben gefristet. Tag für Tag waren sie seine treuen Begleiter und Wegweiser, bis er an den Ort gelangte, wo das Schloß Clarawundens stand. Es lag mitten in einem See auf einer Insel, zu der eine lange Brücke hinüber führte.
Als der Prinz in das Schloß eintrat, fand er Clarawunde allein in einem prächtigen Saal. In aller Bescheidenheit brachte er sein Anliegen vor und bat, daß sie ihm folgen möchte. Mit tiefer Betrübniß vernahm die Prinzessin das Verlangen jenes mächtigen Herrschers. Schweigend folgte sie dem Prinzen, verschloß den Eingang des Schlosses und warf die Schlüssel in den See.
Als sie nun ihren Einzug in die Hauptstadt hielt, wurde sie mit großem Jubel empfangen, und man tat alles, was man ihr an den Augen absehen konnte. Doch Clarawunde sprach ›Ich finde an dem Allen kein Vergnügen, wenn man mir nicht mein Schloß nebst den Schlüsseln, welche ich in den See geworfen, herbei schafft.‹
Da forderte der alte König den Prinzen abermals auf, den Wunsch Clarawundens zu erfüllen. Man gab ihm ein großes Heer mit; aber dieses würde ihm nichts genützt haben, wenn nicht andere Hilfe gekommen wäre. Er traf nämlich jenen Riesen, dem er einst das Leben gerettet, und als er diesem sein Vorhaben erzählte, sprach er ›Schicke das Heer dem König zurück, ich werde dir kräftigere Hände herbeischaffen.‹
Darauf nahm der Riese ein mächtiges Horn von seiner Schulter und blies hinein, daß die Erde zitterte. Da kamen von allen Seiten unzählige Riesen herbei geeilt, und als sie alle beisammen waren, viel Tausend an der Zahl, zogen sie nach dem Schlosse. Mit Leichtigkeit hoben sie das selbe aus seinen Grundfesten und trugen es davon, als ob sie einen Federsack auf der Schulter hätten.
Der Prinz folgte dem Zuge, und als er an die Stelle kam, wo einst die Prinzessin die Schlüssel in den See geworfen, blickte er in die Tiefe hinab, ob er die selben vielleicht erspähen möchte. So hatte er einen Augenblick da gestanden, als das bekannte Fischlein herbei geschwommen kam, die Schlüssel im Munde tragend. Schnell eilte der Prinz an das Ufer des Sees und nahm die Schlüssel aus dem Munde des Fischleins.
Als nun das Schloß der Prinzessin in der Hauptstadt seinen Platz erhalten, verlangte der alte König von ihr, daß sie die Gemahlin seines Sohnes werde. Allein Clarawunde war dem jungen König abgeneigt, und viel lieber hätte sie dem Prinzen, der sie aus der Ferne herbei geholt, ihre Hand gereicht. Und als der alte König nicht nachließ mit Bitten, sprach sie endlich ›Ich werde nur den zu meinem Gemahl nehmen, der es wagt, von der Zinne meines Schlosses auf die Erde herabzuspringen.‹
Dies war eine harte Bedingung, und es meldeten sich zu dem gefährlichen Spiel nur die beiden königlichen Prinzen. Beide sprangen zu gleicher Zeit von dem Schloß auf die Erde herab und lagen betäubt am Boden. Eilends kam Clarawunde herbei. In ihrem Busen hatte sie drei Fläschlein verborgen. Das eine enthielt Wasser des Lebens, das zweite Wasser der Schönheit und das dritte Wasser des Todes.
Als sie sich nun über den Prinzen des Landes bückte, scheinbar um zu sehen, ob noch Leben in ihm sei, benetzte sie unvermerkt sein Gesicht mit Wasser des Todes, also daß er nimmer erwachte. Darauf ging sie zu dem anderen Prinzen und wusch sein Gesicht mit Wasser des Lebens und Wasser der Schönheit.
Da sprang der Prinz auf und seine Gestalt war viel schöner, denn zuvor, und jubelnd rief ihn das Volk zum König aus. Darauf zog er mit seiner schönen Braut in sein Land, und fröhlicher Jubel schallte ihnen aller Orten entgegen. Die Hochzeit ward gehalten und Friede und Freude herrschte in ihrem Reiche bis an ihr Ende.
Märchen und Legenden aus Meklenburg,
von einem Seminaristen in Neukloster.
Karl (Friedrich Adolf Konrad) Bartsch 1832–1888
DER DUMME KRISCHAN ...

Ein Bauer hatte drei Söhne, Fritz der Älteste, Johann der Zweite und Krischan der Jüngste; der galt bei seinem Vater und seinen Brüdern für ein bißchen dämlich und hieß deshalb nur ›der Dumme‹.
Als nun der Bauer zum Sterben kam, rief er seine drei Söhne an sein Bett und sagte ›Liebe Kinder, wenn ich tot bin, dann soll mein Sarg offen in der Kirche hingestellt werden, und jede Nacht soll einer von euch bei mir wachen, zu erst Fritz, dann Johann und zuletzt Krischan.‹
Wie er nun gestorben war und der erste Abend herankam, sagte Fritz zu Krischan ›Krischan, mir graut davor, bei Vatern zu wachen; geh du hin und wach für mich.‹ Das tat denn Krischan auch. Als die Glocke Zwölf schlug, da richtete sich der Tote auf und fragte ›Fritz, mein Sohn, bist du hier?‹ ›Nein, Vater,‹ antwortete Krischan, ›Fritzen graute vor dir, ich bin Krischan.‹
›Hier Krischan,‹ sagte der Tote, ›hast du 'ne weiße Flöte (Pfeife). Wenn du Morgens hier weg gehst, dann flöt auf beiden Enden und wart ab, was kommt.‹ Das tat denn Krischan und blies am Morgen erst auf dem rechten Ende, da stand ein schöner Schimmel, mit schönem Sattelzeug und schönen Kleidern auf dem Rücken, vor ihm.
Die Kleider zog er an und setzte sich auf das Pferd und ritt eine Weile herum. Dann stieg er ab und blies auf dem anderen Ende, da war der Schimmel weg. Er steckte die Flöte in die Kirchhofsmauer und ging nach Hause.
Am zweiten Abend kam die Reihe an Johann; der sagte zu Krischan ›Mir graut davor, in der Nacht bei Vatern zu wachen; geh du hin und wach für mich.‹ Und Krischan tat so, und es ging die Nacht wie die erste, nur bekam er dieses Mal eine braune Flöte.
Und wie er am Morgen drauf blies, stand da ein schöner Brauner, auf dem ritt er ein wenig herum, dann blies er am anderen Ende und der Braune war verschwunden. Er steckte auch diese Flöte in die Mauer und ging nach Hause.
Am dritten Abend kam an ihn die Reihe, und dies Mal gab ihm der Vater eine schwarze Flöte und sagte, nun brauche keiner mehr bei ihm zu wachen. Am Morgen pfiff er sich ein schönes schwarzes Pferd her, das er, nach dem er drauf geritten, wieder verschwinden ließ, worauf er die schwarze Flöte zu den anderen legte und heimging.
Nicht lange danach wurde von einer schönen Prinzessin erzählt, die auf einem hohen steilen Glasberg wohne. Der König, ihr Vater, ließ bekannt machen, wer den Berg zu Pferde hinauf reiten könne, solle seine Tochter zur Frau haben. Daran versuchten viele ihr Glück, aber keinem gelang es. Da beschlossen auch Fritz und Johann es zu wagen.
Als Krischan das hörte, sagte er, sie möchten ihn doch auch mitnehmen. ›Ach,‹ sagten die Brüder, ›dazu bist du viel zu dumm; du bleibst zu Hause,‹ und backten ihm die Pantoffeln an die Strümpfe fest, damit er ihnen nicht nachkommen könnte. Wie sie weg waren, zog Krischan die Strümpfe samt den Pantoffeln aus, ging barfuß nach dem Kirchhof, nahm die weiße Flöte und flötete, und als der Schimmel vor ihm stand, zog er die schönen Kleider an und ritt stracks nach dem Glasberg.
Der Schimmel kam bis an die Mitte des Berges. So weit war noch keiner gekommen; aber da konnte er auch nicht weiter. Abends, wie seine Brüder nach Hause kamen, war Krischan all da und hatte seine hölzernen Pantoffeln an. Die Brüder erzählten ihm von dem schönen Herrn, der bis zur Hälfte herauf geritten war, wußten aber nicht, daß das ihr Bruder Krischan mit den hölzernen Pantoffeln gewesen war.
Am anderen Tage ritten die Brüder wieder hin und Krischan hinter ihnen, diesmal auf seinem Braunen und diesmal kam er beinahe bis an die Spitze. Abends kamen die Brüder nach Hause und fanden Krischan schon vor; sie erzählten auch diesmal von dem Herrn auf dem Braunen.
Am dritten Tage ritt Krischan auf dem schwarzen Pferde in den schönsten Kleidern nach dem Glasberg und kam bis ganz hinauf, wo er von der Prinzessin gar lieblich empfangen wurde. Er wurde nun König über das ganze Land und hielt Hochzeit mit der schönen Königstochter.
Seinen Brüdern aber trug er es nicht nach, daß sie ihn ›den Dummen‹ genannt hatten, sondern holte sie an seinen Hof und hielt sie hoch in Ehren.
Märchen und Legenden aus Meklenburg
DER TANZ IN DER CHRISTNACHT ...
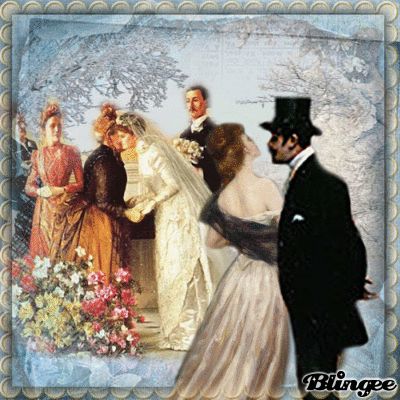
Im Unterinntal, wo die reichen Bauern ihre Höfe haben, lebte am Reinthaler See eine Bäurin, die war die reichste weit und breit, und dennoch war sie nicht glücklich. Vater und Mutter waren verstorben, Geschwister hatte sie keine, und so lebte sie einsam, denn bei all ihrem Geld wollte sie niemand zur Frau, sie war nämlich häßlich, so häßlich, daß kein Mensch ihren Anblick ertrug, ohne von Ekel befallen zu werden.
Oft saß sie einsam in ihrem Zimmer, betrachtete sich im Spiegel, spie aus, so widerwärtig fand sie sich selbst, knirschte mit den Zähnen vor Wut, an anderen Tagen weinte sie, flehte zum Himmel, daß er auch jemanden sende, den sie lieben könne und von dem sie wieder geliebt würde. Ihr ganzes Geld hätte sie darum gegeben, alles, wenn sie durch irgend etwas ansehnlicher geworden wäre.
So vergingen die Jahre, die Bäurin wurde zwar älter, aber nicht schöner, ihre Sehnsucht nach Liebe allerdings von Tag zu Tag größer. Ich nehme einen jeden, sagte sie sich, es muß nur ein Mann sein, und wie sie es sagte, wandte sich ihr Geschick, sie wagte es nicht, daran zu glauben.
Eines Tages kam den langen, sanft geschwungenen Weg zum Hof herauf eine Kutsche, heraus stieg ein Herr im Jägersgewand, am Kopf einen grünen Hut mit Auerhahnfedern, die der Wind hin und her blies, er ließ die Bäurin vors Haus rufen, stellte sich hin und sprach freiweg: „Die längste Zeit hab ich dich rühmen hören, deinen Fleiß, deinen Reichtum, nur haben die Leute gesagt: eine Schönheit ist sie nicht.
Und was sehe ich, du bist ja hübsch, zwar schon reifer als ein frisch gebrütetes Küchlein, aber eine Vergnügung für einen Mann, der schon so viel gesehen hat, daß er hinter dem Zauber der Jugend nur mehr die Mühsal des Alters erkennt.“
Die also Angesprochene glaubte, man erlaube sich einen Scherz mit ihr, drehte sich um und wollte ins Haus laufen. Schon stand der fremde Mann neben ihr, nahm sie am Arm, schaute sie liebevoll an, daß sie stehen blieb, und als er erst sagte, er sei eigens aus München gekommen, da war sie verwirrt und den Tränen nahe, und rief: „Bist du denn blind, siehst du nicht, welch Auswurf der Natur ich bin, wie häßlich, wie schrecklich häßlich!“
Der Jäger lachte galant und erwiderte: „Was weißt du, liebe Frau? Wenn in dem einen Land die Frau eine Schönheit ist, weil sie beleibt ist und die Männer ihre quellenden Formen lieben, so gilt sie in einem anderen als eine Vettel, oder wenn man sie hier verehrt und ihre schlanke Gestalt lobpreist, so sagt man anderswo: diese Bohnenstange, dieses Knochen geklapper, Schönheit und Hässlichkeit, was ist das? Ich habe lange genug gelebt, daß ich dahinter zu sehen vermag, und was ich bei dir sehe, das ist ein Herz, daß sich nach Liebe sehnt und sich, wenn es geliebt wird, in Liebe verzehrt, ist es nicht so?“
Die häßliche Bäurin wurde verlegen, neigte den Kopf, was konnte sie einer solchen Gewandtheit des Ausdruckes entgegenhalten, nur das eine; wie unendlich schön es wäre, wie beglückend, wenn der Herr aus München die Wahrheit spräche. Sie bat ihn ins Haus, zu mindenst das letztere wollte sie herausfinden. Und wer auf ihrem Hof arbeitete, konnte es bestätigen: es scheint ihr nicht schwer gefallen zu sein.
Gegen Abend ging sie mit ihrem Gast zur Kutsche, Arm in Arm, dann erhielt sie einen Kuß auf die Wange, sie winkte dem Wagen noch nach, als er schon längst verschwunden war, ihr Gesicht strahlte, ja wurde sogar um ein klein wenig schöner, dennoch blieb es häßlich genug.
Sie verging vor Glück, endlich hatte sich ihr sehnlichster Wunsch erfüllt, und es war einer gekommen und hatte ihr seine Liebe gestanden und sie um die Hand gebeten. Und was war das für ein Herr! Reich und gebildet, belesen, weit gereist, gewandt. Und sie hatte er auserwählt, sie! Wie war das nur möglich? Ihr Herz war randvoll von Glück und Freude.
Wegen des weiten Weges von München her und weil der Zukünftige noch Geschäftliches erledigen mußte, bevor er zu ihr ziehen konnte, hatten sie den Hochzeitstermin bereits festgesetzt, es störte sie nicht, das dies etwa schnell ging für hiesige Sitten, auch nicht, daß der schöne Herr Bräutigam darauf bestand, die Ehe am Christabend zu feiern. Jetzt oder nie, dachte sie sich.
Der goldene Herbst, der vor der Tür stand, wurde also in jeder Beziehung zu einer goldenen Zeit. Wie versessen schmückte sie den Hof, ließ das Dach ausbessern, den Dachstuhl neu streichen, die Böden schrubben, die Stuben putzen bis in die entlegensten Winkel, in denen der Schmutz von Jahrzehnten saß. Alles sollte blitzblank und einladend sein für den Zukünftigen, schließlich war er ein Städter und hatte einen anderen Begriff von Reinlichkeit.
Die Woche einmal bekam sie ein Briefchen, in dem der ferne Geliebte ihr neuerlich seine Liebe gestand, die nunmehr, da er sie endlich kennengelernt habe, beträchtlich gewachsen sei, so daß er den Tag der Vermählung kaum noch erwarten könne.
Die Blätter an den Bäumen verfärbten sich, der See der unterhalb des Hofes lag einsam, immer öfter schwebten weißliche Nebelwolken über dem Wasser, es wurde kälter, der erste Rauhreif überzog die Felder, dann kamen die Herbststürme und fegten das restliche Laub von den Ästen.
Die häßliche Bäurin saß schon längst zu Hause und wußte nicht, was sie noch alles tun sollte, um sich die Zeit zu vertreiben. Immer schwerer wurde ihr das Warten, schon waren die Einladungen verschickt und die Köche bestellt. Zwar gab es einige Frömmler, die am Hochzeitstermin etwas auszusetzen hatten, ja der Pfarrer weigerte sich rundheraus, die Trauung am Christabend vorzunehmen, aber was beschwerte sie das? –
Es kamen Leute genug, denen die Speisekarte, die sie der Einladung beigelegt hatte, mehr zu Gesicht stand als der Kirchenkalender. Zudem schrieb der Herr Bräutigam aus München, er werde sich selbst einen Geistlichen mitnehmen, bei ihm in der Großstadt verstehe man sich besser darauf, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich den Wünschen der Menschen anzupassen.
Wie er sich nur ausdrücken kann! – dachte sie und sprach fortan von den „Zeichen der Zeit“ und den „Wünschen der Menschen“, wenn jemand meinte, es bedeute vielleicht einen Frevel, die Hochzeit an einem Tag zu begehen, da Gott im Himmel Menschengestalt angenommen habe, um die Welt aus ihrem Leiden zu erlösen.
Wohl schrieb sie es in ihrem Brief, wie sie die Gewohnheit angenommen hatte, jede Woche ein Packen eingeschriebener Seiten nach München zu schicken. Der Mann ließ sich nicht irremachen, er antwortete postwendend: Wenn Gott das Leiden in die Welt nicht hinein getan hätte, müßte er es auch nicht heraus holen. Das kam ihr doch zu lästerlich vor, und sie sagte es niemanden.
So wurde es Dezember, Weihnachten rückte näher, gegen Ende November hatte es ausgiebig geschneit, wenn kein Südwind aufkam, wie es im letzten Jahr geschehen war, bestand die Hoffnung, daß der Schnee liegen blieb. Die Nächte waren kalt, der Himmel sternenklar, in den Hof der hässlichen Bäurin war Ruhe eingekehrt: alles war getan, den Bräutigam würdig zu empfangen.
Da geschah es, drei Tage vor der Hochzeit und damit drei Tage vor der Heiligen Nacht, daß im Tennen des Hofes, an welcher Stelle genau, das wurde niemals bekannt, weit nach Mitternacht ein Feuer ausbrach: in kürzester Zeit wurde das eingelagerte Heu erfasst, noch ehe einer im Haus ein Knistern vernahm, hatten die Flammen den vorderen, nach Westen gerichteten Wohnteil erfasst.
Die Hitze riß ein Loch ins Dach, begleitet von einem dumpfen Knall, im hohen Bogen flogen Ziegel auf den vereisten Weg vom Stall zur Tränke hinab. Das Feuer schlug hoch, jetzt hatte es Luft, fauchend schossen die Flammen aus den Heustöcken herauf, in der Luft begann es zu sausen, Wind kam auf und wirbelte über den Schnee.
Jetzt erst ging ein Licht an in einer der Kammern, das Fenster wurde aufgemacht, jemand streckte den Kopf heraus, viel zu langsam ging alles, sekundenlang war es still, dann ertönte der Schrei: „Feuer, Jesses, Feuer!“ aber es war schon zu spät, viel zu spät. Bis die Leute vom Dorf heraufkamen, war der Hof bis auf den Grund abgebrannt.
Mägde und Knechte standen in Decken gehüllt vor den glimmenden Resten des Hauses, bisher hatten sie, gleichsam gedankenverloren, in die Flammen gestarrt. Nein, nein, sie wollte nicht weinen, wie es alle erwarteten, sie wollte nicht alles sein lassen und verzweifeln, gar noch bereuen, wofür? Daß sie nicht leben durfte, daß ein blindes Schicksal oder ein missgünstiger Gott sie daran hinderten, das Mindeste zu haben, was allen anderen zugestanden wurde?
Eine ohnmächtige Wut packte sie, sie reckte die Fäuste zum Himmel und schrie: „Nur daß ihr es wisst, die Hochzeit findet statt, und weil der Hof jetzt abgebrannt ist, übersiedeln wir alle auf den See hinunter, dort lassen wir das Eis glänzen, daß das Fest gleich ein zweifaches wird, so werden die Lichter erstrahlen, das schwör ich, so wahr ich hier stehe!“
„Du bist meiner würdig“, sagte der Bräutigam, als er angereist kam und erfuhr, wie seine Braut sich entschieden hatte. In aller Eile wurde der Schnee aus der Mitte des Sees gekehrt, das bläuliche Eis tauchte auf, darin waren Luftblasen gefroren, man breitete Teppiche darüber, um die Kälte von unten und die Wärme von oben, wo die Tafel aufgestellt war, abzuhalten.
Der Schnee, am Rande des weitläufigen Kreises aufgeschüttet, wurde gestampft und darauf riesige Holzhaufen gestapelt. Sie sollten am Abend aufgeschüttet werden und die Luft innerhalb des Kreises erwärmen. Die Speisen wurden am Ufer zubereitet und in Schlitten zu den Tischen geführt.
Bevor das Gelage begann, trat der Franziskaner Pater unter die Leute, den der Bräutigam aus München mitgenommen hatte. Er forderte die Gäste auf, Platz zu nehmen. Als sich alle gesetzt hatten, stellte er sich vor das Brautpaar hin, welches in der Mitte des U – förmigen saß, und sprach:
„Da alle Kirchen heute zu einem anderen Gebrauch bestimmt sind, soweit mir bekannt ist, aber nichts in der Heiligen Schrift steht, was eine Vermählung an diesem Abend verbietet, haben wir und auf die größte aller Kirchen für unsere Feier erwählt: die Natur! Seht hin auf das strahlende Eis, auf das Weiß des Schnees, auf den schwarzen Wald – sie sind die heiligsten und beständigsten Zeugen, die ihr euch wünschen könnt.“
Und noch viele Worte machte der Pater, bis er das Sakrament stiftete. Die Bäuerin war zu Tränen gerührt, der Bräutigam schaute vornehm drein, und ließ alles in Würde über sich ergehen. Dann aber begann das Festmahl, Schnaps wurde gereicht, um alle aufzuwärmen, es folgte die Suppe, die Vorspeise, die Hauptspeise, die Nachspeise, und zuletzt, beim Kaffee war es schon soweit, daß man von überall her, zwar leise, aber deutlich vernehmbar, die Glocken läuten hörte, welche zur Mitternachtsmette luden.
Da verstummte die ausgelassene Gesellschaft, alle lauschten dem Läuten, sonst war nichts zu vernehmen, niemand bewegte sich, die Flammen der Kerzen und Fackeln brannten gerade nach oben, ihr Licht spiegelte sich am Eis, das man inmitten der Tische frei gelassen hatte, um nach dem Gastmahl zu tanzen.
So erstrahlte die Fläche vom hundertfachen Lichts, das ringsum aufgesteckt war. Auf dieses Licht schauten die Leute und wurden durch den Klang der Glocken in eine andere Stimmung versetzt, plötzlich wußten sie alle, daß an diesem Abend doch Weihnachten war, da mochten sie noch so ausgiebg Hochzeit feiern.
Dem Bräutigam aber gefiel diese Besinnlichkeit gar nicht, er sprang auf, warf die Serviette auf seinen Teller und rief: „So, Musik her, jetzt wird getanzt“, und er nahm die Hand seiner Braut riß sie hoch, trat zurück, daß die beiden Stühle umfielen, ging um die Tafel herum, stellte sich mitten aufs Eis, noch immer sprach niemand, noch immer starrten sie vor sich hin, da rief er noch einmal:
„Musik“, und da erklang ein lustiger Tanz und übertönte die Glocken, und der Bräutigam drehte die Braut, und die Braut drehte sich mit ihm, gewann wieder ein kleines Stück Schönheit dazu. Jetzt beugten sich die Leute einander zu, und sie sagten: „Wie weltgewandt er ist!“ oder: „Wieviel Geld er wohl hat!“
Immer schneller spielte die Musik, auch die drei Musiker hatte der Bräutigam aus München mitgebracht, immer schneller wirbelte das Paar herum. „Hör auf, ich kann schon nicht mehr!“ rief die Braut, der Bräutigam lachte, dann rief sie noch: „Ich fall gleich hin!“ und er rief: „Ich halt dich schon!“ und noch schneller spielten die Musiker.
Da sahen die Leute, daß er sie trug, daß ihre Füße schon nicht mehr den Boden berührten. „Ein starker Mann“ sagten sie und nickten voll Anerkennung. Und noch schneller wurde der Tanz, als habe ein Sturmwind die Töne erfasst, als hetzte er sie fort, immer wilder und schneller, da war es tatsächlich ein Wind, der blies die Kerzen aus, und auf einmal war es stockdunkel. Da verstummte die Musik, ein Sausen war zu vernehmen, ein grelles Lachen, und der Bräutigam fuhr mit der Braut in den Armen zwischen den Leuten hindurch, warf sie zur Seite.
Da begann es an allen Ecken und Enden zu krachen, der Boden schwankte, das Krachen und Brechen wurde lauter, lief unter den Teppichen hindurch, die Tische sanken, das Wasser brach ein, die Leute schrien, liefen auseinander, aber es ging zu schnell, viel zu schnell, niemand konnte sich retten: der See tat sich auf und verschlang sie mit Stühlen, Tischen und allen Köstlichkeiten, das Eiswasser schlug über ihnen zusammen, noch hörte man, da alles vorbei war, das Läuten der Mitternachtsglocken, die zur Mette luden, auf einer Eisscholle, die vereinzelt dahin trieb, lagen Brautschleier und Brautstrauß; das war es, was vom Fest übrigblieb.
Das Unglück sprach sich noch in derselben Nacht herum, in den Kirche wurde für die Toten gebetet, dabei verbreitete sich das Gerücht unter den Leuten, der Herr Bräutigam sei der Teufel gewesen, der Pater und die drei Musiker, die ganze Münchner Gesellschaft eben, seine verwandlungsreichen Gesellen. Wer weiß es?
Auferstanden ist keiner, um die Frage zu klären.
Deutschland Ignaz Zingerle
DER RATTENFÄNGER ZU HAMELN ...
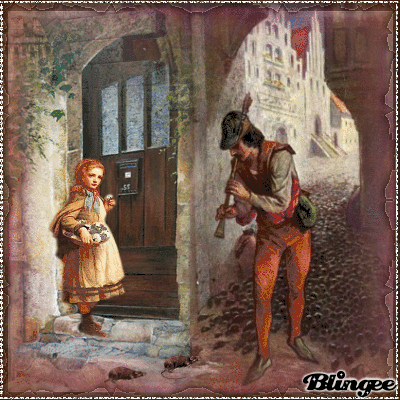
Im Jahre 1284 ließ sich zu Hameln ein sonderbarer Mann sehen. Er trug einen Rock von vielfarbigem, buntem Tuch, weswegen er Bundting geheißen haben soll, und gab sich für einen Rattenfänger aus. Er versprach für einen bestimmten Lohn die Stadt von allen Ratten und Mäusen zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und sicherten ihm den verlangten Betrag zu.
Der Rattenfänger zog demnach ein Pfeifchen aus der Tasche und begann eine eigenartige Weise zu pfeifen. Da kamen sogleich die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervor gekrochen und sammelten sich um ihn herum. Sobald der Fänger glaubte, es sei keine mehr zurückgeblieben, schritt er langsam zum Stadttor hinaus, und der ganze Haufen folgte ihm bis an die Weser. Dort schürzte der Mann seine Kleider, stieg in den Fluss, und alle Tiere sprangen hinter ihm drein und ertranken.
Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn, und sie verweigerten dem Mann die Auszahlung unter allerlei Ausflüchten, so dass er sich schließlich zornig und erbittert entfernte. Am 24. Juni, am Tage Johannis des Täufers, morgens früh um sieben Uhr erschien er wieder, diesmal in Gestalt eines Jägers, mit finsterem Blick, einen roten, wunderlichen Hut auf dem Kopf.
Wortlos zog er seine Pfeife hervor und ließ sie in den Gassen hören. Und in aller Eile kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mädchen, vom vierten Lebensjahr angefangen, in großer Zahl daher gelaufen. Darunter war auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters.
Der ganze Schwarm zog hinter dem Mann her, und er führte sie vor die Stadt zu einem Berg hinaus, wo er mit der ganzen Schar verschwand. Dies hatte ein Kindermädchen gesehen, das mit einem Kind auf dem Arm weit rückwärts nachgezogen war, dann aber umkehrte und die Kunde in die Stadt brachte.
Die Eltern liefen sogleich haufenweise vor alle Tore und suchten jammernd ihre Kinder. Besonders die Mütter klagten und weinten herzzerreißend. Ungesäumt wurden Boten zu Wasser und zu Land an alle Orte umhergeschickt, die nachforschen sollten, ob man die Kinder oder auch nur einige von ihnen irgendwo gesehen habe; aber alles Suchen war leider vergeblich.
Hundertunddreißig Kinder gingen damals verloren. Zwei sollen sich, wie man erzählt, verspätet haben und zurück gekommen sein, wovon aber das eine blind, das andere taubstumm war. Das blinde konnte den Ort nicht zeigen, wo es sich aufgehalten hatte, wohl aber erzählen, wie sie dem Spielmann gefolgt waren, das taubstumme nur den Ort weisen, da es nichts gehört hatte und auch nicht sprechen konnte.
Ein kleiner Knabe war im Hemd mitgelaufen und nach einiger Zeit umgekehrt, um seinen Rock zu holen, wodurch er dem Unglück entgangen war; denn als er zurückkam, waren die andern schon in der
Senkung eines Hügels verschwunden.
Die Straße, auf der die Kinder zum Tor hinaus gezogen waren, hieß später die bungelose (trommeltonlose, stille), weil kein Tanz darin abgehalten und kein Saitenspiel gerührt werden durfte.
Ja, wenn eine Braut mit Musik zur Kirche geführt wurde, mussten die Spielleute in dieser Gasse ihr Spiel unterbrechen. Der Berg bei Hameln, wo die Kinder verschwanden, heißt der Poppenberg. Dort sind links und rechts zwei Steine in Kreuzform zur Erinnerung an dies traurige und seltsame Ereignis errichtet.
Die Bürger von Hameln haben diese Begebenheit in ihrem Stadtbuch verzeichnen lassen. Im Jahre 1572 ließ der Bürgermeister die Geschichte auf den Kirchenfenstern abbilden.
Sage aus Deutschland
DIE SONNENBRÜCKE ...
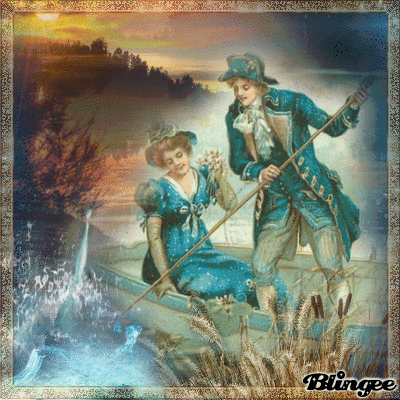
Vor vielen, vielen Jahren lebte auf der Insel Rügen in einem kleinen Fischerdorf ein junges Ehepaar. Der Mann, Namens Nordfan war Fischer. Er fuhr täglich hinaus auf die See, um Fische zu fangen, während die junge Frau daheim die Wirtschaft versorgte und Netze strickte. Die Eheleute hatten sich sehr lieb und kannten keine Sorgen, denn der Mann verdiente reichlich soviel, als sie bei ihren bescheidenen Ansprüchen gebrauchten.
Dennoch fehlte ihnen eins zu ihrem vollständigen Glück. Der Himmel hatte ihnen Kinder versagt, und sie hätten doch gar zu gern ein liebes Geschöpfchen gehabt. Eines Tages – es war im
Frühjahr, das Eis war längst von den warmen Strahlen der Sonne gewichen, die Wiesenfläche vor dem Dörfchen wurde wieder von der See bespült und leuchtete im saftigsten Grün, die blauen
Gottesaugen
und die Himmelschlüsselchen blühten lieblich in dem kleinen Vorgarten der jungen Fischersleute, kehrten die Störche und Schwalben aus den warmen Ländern zurück, um ihre alten, trauten Nester
aufzusuchen.
Ein alter Storch, der auf seiner Reise flügellahm geworden war, trug ein reizendes Mägdlein im Schnabel, das sicher für eine Königin oder Prinzessin bestimmt war, so fein und lieblich sah es aus. Aber seine Kräfte reichten nicht aus, es bis ins Schloß zu tragen; mit großer Mühe hielt er sich so lange, um nicht ins Meer zu stürzen, dann aber ließ er sich erschöpft nieder und legte das Mägdlein unter die schattige Linde vor Nordfans Tür.
Der Fischer war schon vor Tagesgrauen hinaus gefahren auf das Meer, aber seine Frau erschien bald vor der Tür, um die Wege des Gärtchens zu harken. Sie hörte ein leises Weinen und erblickte das reizende Kindlein. Mit einem Freudenschrei nahm sie es in die Arme und preßte es an ihre Brust.
Dann trug sie es ins Haus auf ihr Bett, holte das Kinderzeug, welches sie selbst einst getragen, und zog es dem Kinde an, tränkte und sättigte es mit frischer Milch, und als die Kleine dann eingeschlafen war, weidete sie sich eine Weile an dem Anblick des schlummernden Kindes, bewunderte seine schönen, feinen Züge, das rabenschwarze, seidenweiche Haar und die langen, dunklen Wimpern, welche wie Fransen über die zarten Wangen fielen.
Dann eilte sie auf den Dachboden und holte die alte Familienwiege herab, in welcher schon Mutter und Großmutter den süßen Schlaf der Unschuld geschlafen, säuberte sie von Staub und Spinngeweben, bezog die dazu gehörigen Bettchen mit schneeweißen Linnen und bette das Mägdlein hinein, das nun wirklich wie eine Prinzessin da lag.
Als die geschäftige Frau mit allem fertig war, eilte sie vor die Haustür an die Wiege, um sich über ihres Herzens Liebling zu erfreuen. So trieb sie es stundenlang, aber der Mann wollte noch immer nicht heimkehren. Er hatte versprochen, dem Förster drüben auf der gegenüberliegenden kleinen Insel Lebensmittel zu bringen, und hielt sich dort länger auf, als er anfänglich beabsichtigte.
Die Förstersleute hatten mit ihm gleiches Leid. Auch sie hatten keine Kinder und murrten oft deshalb, ja sie lebten lange nicht so glücklich und einig wie die jungen Fischersleute. Als Nordfan heute auf die auf die Insel kam, fand er den Förster in heller Aufregung. Der Förster war in aller Frühe in den Wald gegangen, um wilde Kaninchen zu schießen. Da war sein Hund plötzlich vor einem Gebüsch stehen geblieben und hatte sich winselnd und hülfeflehend umgesehen.
Der Förster war hinzugeeilt und fand ein reizendes Knäblein friedlich schlummernd im Moose. Sanft hob er es auf und trug es glückstrahlend nach Hause zu seiner Frau. Mit dem ersehnten Kinde war Glück und Friede ins Försterhaus gezogen. Sie gelobten sich, es fromm und Gott wohlgefällig zu erziehen und ihm durch gegenseitige Liebe und Einigkeit ein gutes Beispiel zu geben, und damit sie stets an ihr Versprechen erinnert werden, nannten sie den kleinen „Friedow.“
Der Knabe mochte wohl etwas über ein Jahr alt sein; er war reich und vornehm gekleidet und trug an seinem Halse ein goldenes Kettchen mit einer Kapsel, darin war das Bild einer schönen jungen Frau. Jedenfalls war es Friedows Mutter, denn er glich ihr auffallend. Er hatte das selbe Blonde Lockenhaar und ebenso große vergissmeinnichtblaue Augen.
Entzückt betrachtete Norfan den reizenden Knaben und horchte verwundert auf den Bericht des Försters. Er fühlte einen leisen Schmerz beim Glück der Förstersleute, als er seiner eigenen kinderlosen Häuslichkeit gedachte, und bitter traurig, wie es sonst nicht seine Art war, begab er sich auf den Heimweg.
Seine Frau kam ihm mit strahlendem Lächeln entgegen und schien sein bekümmertes Gesicht gar nicht zu sehen. Er erzählte ihr in größter Hast von dem Glück drüben auf der kleinen Insel und von dem kleinen Friedow; sie aber hörte ihn kaum. „Sieh nur, sieh, was Gott uns beschert hat!“ – rief sie und zog ihn mit sich zu der Wiege des Kindes.
Da war der Fischer wortlos vor Glück und Freude. Er sank an dem Bettchen in die Knie und küßte die weiße Stirn und die zierlichen Hände der Kleinen. Leise rauschte das Meer, sanft bewegten sich und flüsterten die Blätter der alten Linde, unter deren Dach das Kind zuerst geruht hatte, und die Eltern nannten es „Meerlinde.“
Die beiden Findelkinder erblühten lieblich zu der Eltern Freude, welche seit dieser Zeit ein inniges Freundschaftsband verknüpfte. So oft das Wetter es zuließ, besuchten sie sich, und die Kinder gewannen sich so lieb, daß sie kaum noch ohne einander lebten mochten. Sehr früh schon lernte Friedow den kleinen Nachen führen und durfte Meerlinde spazieren fahren; doch nur bei günstigem Wetter und dem Ufer nahe, wo ihnen kein Unfall zustoßen konnte.
Es war Sommer; die Linde vor Nordfans Tür stand in voller Blüte und sandte ihre süßen Düfte durch die offenen Fenster ins Fischerhäuschen. Meerlinde aber war an den Strand gelaufen und schaute sehnsüchtig hinaus über das Meer. Seit acht Tagen hatte es unaufhörlich gestürmt und geregnet, und sie hatte ihren lieben Friedow nicht gesehen.
Jetzt war es seit einer Stunde besser, das Gewitter und die mit ihm rabenschwarzen Wolken waren vorüber, und die untergehende Sonne überzog das Meer mit einem goldigen Schimmer. Würde Friedow wohl heute noch kommen? Wohl schwerlich. So spät hatten die Eltern in der Wirtschaft zu tun, und allein ließen sie ihn nicht so weit rudern.
Und drüben auf der Insel, hoch auf dem Berge, stand Friedow und schaute sehnsüchtig über das Meer zu dem Fischerdörfchen. Seine blonden Locken flatterten im Winde, seine Wangen glühten und seine blauen Augen leuchteten wie Himmelssterne. „O, dürfte ich zu Dir hinüber, Meerlinde“, rief er, als müßte sie ihn hören, „aber der Vater hat es verboten, ich darf allein nicht so weit fort.“
Da brach die scheidende Sonne noch einmal durch das dunkle, dichte Gewölk im Abend, und ihre glänzenden Strahlen legten sich gleich zu einer festen, goldenen Brücke von dem Fischerhäuschen nach der kleinen Insel. Entzückt schaute Friedow auf das herrliche Schauspiel und rief in kindlicher Einfalt: „Die lieben Engelein droben hörten meinen Wunsch und bauten mir eine goldene Brücke, Meerlinde, ich komme! Denn zu dir gehen haben mir die Eltern nicht verboten.“
Hastig lief er den Berg hinab an den Strand. Da entdeckte er zu seinem Kummer, daß ein ganzes Stück der Brücke bis zum Ufer fehlte. „Ach“, tröstete sich Friedow, „ein Stückchen zu fahren ist mir doch erlaubt.“ Er band seinen kleinen Nachen los und ruderte nach der Sonnenbrücke, aber wenn er sie erreicht zu haben glaubte, dann wich sie wieder ein Stück von ihm zurück.
Auf diese Weise war er weiter hinaus gekommen, als es ihm erlaubt war. Da erschien ihm die Brücke wieder ganz nahe, vor ihm tauchte eine schöne Frauengestalt in Gold schimmernden Gewande empor. Sie winkte ihm lächelnd zu und reif mit süßer Stimme: „Springe getrost in meinen Arm, ich trage Dich auf die goldene Brücke.“
„Ich komme“, rief Friedow und sprang zu ihr hinüber. Fest umschlang sie ihn mit ihren kalten, nassen Armen und tauchte mit ihm hinab auf den Meeresgrund, in ihr kristallenes Schloß. In dem selben Augenblick erschienen die Förstersleute droben auf dem Berge, sie suchten Friedow und sahen, wie die Wogen über ihm zusammen schlugen.
Sie versuchten ihn zu retten, aber sie fanden keine Spur von ihm und kehrten, Verzweiflung im Herzen in ihr vereinsamtes Haus zurück. Und die Wellen rollten dem Ufer zu und erzählten einander von dem schönen, versunkenen Friedow und der falschen Nixe, die ihn auf die trügerische Brücke in den Grund gelockt hatte.
Und am Uferrand stand ein dunkeläugiges Mädchen und schaute sehnsuchtsvoll nach dem teuren Gespielen. Sie schaute sich die Augen müde, bis die Wellen zu ihr kamen und ihr die traurige Kunde brachten, daß er auf dem Wege zu ihr versunken sei. „O, Friedow“, rief sie in Herz zerbrechendem Ton, „ich komme, ich werde dich finden und dich retten!“
Sie band einen Kahn los und ruderte, so lange ihre Kräfte ausreichten, dann ließ sie die Ruder sinken und beugte sich über den Rand des Kahns, Friedow zu suchen. Da tauchte vor ihr eine liebliche Frauengestalt in goldglänzendem Gewande aus den Wogen.
Die hielt den schlafenden Friedow im Arm, und rief mit süßer, verlockender Stimme: „Lieb Mägdlein, komm, sieh, Friedow ist schon hier!“ „Ich komme!“ rief Meerlinde und sprang hinab. Und mit zwei Opfern tauchte die falsche Nixe hinab und brachte triumphierend ihre Beute dem Nixenkönig.
Die armen, verlassenen Eltern waren nun einsamer denn zuvor. Sie blieben aber in inniger Freundschaft verbunden und trugen gemeinsam ihr herbes Leid. Wenn zuweilen abends die Strahlen der untergehenden Sonne sich gleich einer goldenen Brücke von dem Fischerdörfchen bis zur kleinen Insel über die See legten, und Fremde, welche die selbe besuchten, andächtig die Hände falteten bei dem erhabenen Schauspiel, dann wandten die Förster- und Fischersleute sich schaudernd von der trügerischen Brücke und gedachten voll bitteren Schmerzes ihrer versunkenen Lieblinge, „Friedow und Meerlinde.“
Jahre schwanden dahin, und nur selten wurde von den verschwundenen Kindern gesprochen, aber in den Herzen der Eltern lebte ihr Andenken ungeschwächt fort. Da eines Tages, zeigte sich plötzlich auf dem Meere ein prächtiges Schiff mit buntem Wimpeln. Es steuerte direkt nach der kleinen Insel zu und warf dort Anker.
Ein kleines zierliches Boot wurde herab gelassen; vier Herren in blitzenden Uniformen sprangen hinab und halfen einer schönen blonden Frau hinein. Als dann ließen sich alle von zwei Bootsleuten nach der kleinen Insel rudern. Die Fischersleute waren gerade bei dem Förster zu Gaste, als sich plötzlich die Tür öffnete und eine fremde Dame mit ihrem Gefolge auf der Schwelle erschien.
Ehrerbietig erhoben sie sich, um die Gäste zu begrüßen. „Vor achtzehn Jahren“, sagte die Dame, nachdem sie die freundliche Begrüßung erwidert, „trennte ich mich mit blutendem Herzen von meinem Sohn, um ihn vor sicherem Verderben zu retten. Ich legte ihn auf dieser Insel nieder, hoffend, ihr würdet Mitleid mit ihm haben, ihn an Kindesstatt annehmen und zu einem braven Menschen erziehen.
Heute sind alle Gefahren für ihn beseitigt, seine Feinde tot, und ich komme, ihn von Euch zurückzufordern, damit er endlich die ihm zukommende Würden eines Königs empfange.“ Die Förtsers- und Fischersleute sahen sich sprachlos an. Träne um Träne rann über ihre erbleichten Wangen, und nur mit Mühe vermochten sie der armen Mutter von dem Verschwinden des Sohnes und von ihrer eigenen Verzweiflung zu erzählen.
Die Königin war untröstlich, aufgelöst vor Schmerz. Wie lange hatte sie die Stunde ersehnt, den geliebten Sohn an ihr Herz zu drücken und ihn öffentlich anerkennen zu dürfen, und nun sollte sie ihn als tot beweinen. In stummer, namenloser Trauer verließ sie das Zimmer und eilte auf den Gipfel des Berges.
Sie spähte hinaus auf das Meer, nach der Stelle wo Friedow einst versunken. So stand sie lange, lange mit gerungenen Händen und todestraurigen Augen. Da brach plötzlich wie durch ein Zauberwort die scheidende Sonne noch einmal durch das dunkle Gewölk, und ihre Strahlen legten sich wie damals gleich einer goldenen Brücke über das Wasser.
„Da ist sie ja wieder, die schöne, aber trügerische Brücke“, riefen die Förstersleute, welche der Königin mit den übrigen auf der Insel Anwesenden gefolgt waren. Aller Augen waren entzückt von dem herrlichen Anblick und vermochten sich nicht davon abzuwenden.
Und siehe da. Plötzlich stieg inmitten der See auf der goldenen Brücke zwei Gestalten empor und schienen dem Ufer zuzuschweben. Ein hoher, schöner Jüngling mit blondem Lockenhaar und leuchtenden, blauen Augen und eine wunderschöne Jungfrau mit dunklen Samtaugen und rabenschwarzem Haar.
Die atemlosen Zuschauer auf dem Berge sahen nicht, daß sie beide in einer prachtvollen Perlmuttermuschel standen, welche von unsichtbaren Händen gelenkt wurde. Endlich landeten sie, kamen in fliegender Hast den Berg hinan und stürzten zu den Füßen der Königin.
Es waren Friedow und Meerlinde, welche nun den staunenden Zuhörern ihre wunderbaren Erlebnisse erzählten. Der Nixenkönig, gerührt von ihrer innigen kindlichen Liebe für einander, hatte sie bald zu seinen Lieblingen auserkoren und es ihnen an nichts fehlen lassen.
Sie wären in der sie umgebenden Pracht ganz glücklich gewesen, wenn sie nicht die verzehrendste Sehnsucht nach den lieben Eltern empfunden hätten. Eines Tages, als sie wieder vom schrecklichsten Heimweh geplagt wurden, teilte ihnen der Nixenkönig mit, daß Friedow gar nicht der Sohn des Försters sei.
Einst werde seine rechte Mutter, die eine Königin sei, kommen, um ihn aufzufordern, bis dahin solle er bei ihnen bleiben, denn er vermöge sich nicht eine Stunde eher von ihm zu trennen. Heute nun war er wieder bei ihnen erschienen und hatte gesagt:
„Friedow, die Stunde des Abschieds ist gekommen. So eben ist Deine Mutter bei der Insel gelandet, und Du darfst zu ihr zurückkehren.“ „Und Meerlinde?“ hatte Friedow ängstlich gefragt. „Sie wird bei mir bleiben, denn ich liebe sie“, erwiderte der Nixenkönig. „Dann gehe ich auch nicht“, erklärte Friedow und zog das weinende Mädchen an seine Brust.
Das rührte den Nixenkönig dermaßen, daß er auch Meerlinde freigab und sie beide sicher ans Land setzen ließ. Das junge Mädchen stand mit bang klopfendem Herzen als Friedow alles erzählte und dann hinzufügte: „Ich denke, was der Nixenkönig nicht vermochte, das wird auch meine liebe, gute Mutter nicht übers Herz bringen. Sie wird uns nicht trennen, sondern unsern Bund segnen, denn wir lieben uns und werde niemals einander verlassen.“
Dabei ergriff er Meerlindes Hand und führte sie zu der Königin. Diese schloß sie beide zärtlich in ihre Arme und freute sich, daß sie statt des einen lieben Kindes – zwei wiederfand. Nun gab es eine allgemeine, große Freude, und als das Schiff der Königin anderen Tages die Anker lichtete da hatte es lauter glückliche Menschen an Bord, denn auch die Försters- und Fischersleute fuhren mit, um der glänzenden Hochzeit ihrer lieben Kinder beizuwohnen, welche gleich nach ihrer Ankunft auf dem Königsschloß gefeiert wurde.
Märchen aus Preußen
VOM DICKEN FETTEN PFANNEKUCHEN ...

Es waren einmal drei alte Weiber, welche gern einen Pfannekuchen eßen wollten; da gab die erste ein Ei dazu her, die zweite Milch und die dritte Fett und Mehl. Als der dicke fette Pfannekuchen fertig war, richtete er sich in der Pfanne in die Höhe und lief den drei alten Weibern weg und lief immerzu und lief kanntapper, kanntapper in den Wald hinein.
Da begegnete ihm ein Häschen und rief: »Dicke fette Pannekauken, blief stahn, eck will di fräten!« Der Pfannekuchen antwortete: »Eck bin drei olen Wiebern entlopen un schölle di Häschen Wippsteert nich entlopen?« und lief kanntapper, kanntapper in den Wald hinein.
Da kam ein Wolf heran gelaufen und rief: »Dicke fette Pannekauken, blief stahn, eck will di fräten!« Der Pfannekuchen antwortete: »Eck bin drei olen Wiebern entlopen, Häschen Wippsteert und schölle di Wulf Dicksteert nich entlopen?« und lief kanntapper, kanntapper in den Wald hinein.
Da kam eine Ziege herzu gehüpft und rief: »Dicke fette Pannekauken, blief stahn, eck will di fräten!« Der Pfannekuchen antwortete: »Eck bin drei olen Wiebern entlopen, Häschen Wippsteert, Wulf Dicksteert und schölle di Zicke Langbart nich entlopen?« und lief kanntapper, kanntapper in den Wald hinein.
Da kam ein Pferd herbei gesprungen und rief: »Dicke fette Pannekauken, blief stahn, eck will di fräten!« Der Pfannekuchen antwortete: »Eck bin drei olen Wiebern entlopen, Häschen Wippsteert, Wulf Dicksteert, Zicke Langbart un schölle di Perd Plattfaut nich entlopen?« und lief kanntapper, kanntapper in den Wald hinein.
Da kam eine Sau daher gerannt und rief: »Dicke fette Pannekauken, blief stahn, eck will di fräten!« Der Pfannekuchen antwortete: »Eck bin drei olen Wiebern entlopen, Häschen Wippsteert, Wulf Dicksteert, Zicke Langbart, Perd Plattfaut un schölle di Su Haff nich entlopen?« und lief kanntapper, kanntapper in den Wald hinein.
Da kamen drei Kinder daher, die hatten keinen Vater und keine Mutter mehr und sprachen: »Lieber Pfannekuchen, bleib stehen! Wir haben noch nichts gegeßen den ganzen Tag!« Da sprang der dicke fette Pfannekuchen den Kindern in den Korb und ließ sich von ihnen eßen.
Carl und Theodor Colshorn: Märchen und Sagen, Hannover
BARBARA ...
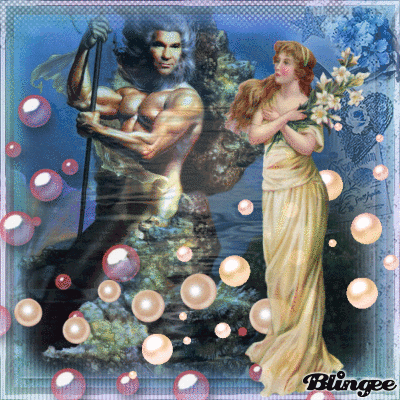
Zu Xanthen am Rhein, wo der schöne Dom steht, lebte ein Mädchen, das hieß Barbara. Sie war eine arme Waise und diente bösen Menschen als Magd, die sie hart behandelten und eines Tages aus dem Hause verstießen. Da stand sie nun unter freiem Himmel und wußte nicht, was tun sollte.
Aber Barbara war fromm und ihr Herz unschuldig und rein, sie betete zu Gott und ihr war, als höre sie eine tröstende Stimme in ihrem Innern sagen: Verzage nicht! Der, welcher die Lilien kleidet und die Sperlinge ernährt, der wird auch dich arme Waise nicht verlassen.
Das machte sie wieder froh und vergnügt, und sie lenkte mutig ihre Schritte zum Dome hin, um ihre Schutzpatronin, die heilige Barbara um ihren Beistand anzuflehen, denn schon neigte sich der Tag, und sie wußte nicht, wo sie die Nacht zubringen sollte. Sie ging hinein.
Die Kirche war fast leer, und nur hier und da verriet ein leises Gemurmel, daß noch Menschen darin waren. Barbara ging an all den schönen Altären und dem prachtvollen Hochaltar vorbei, zum einsamen Altare ihrer Schutzpatronin. Hier warf sie sich auf die Kniee nieder und betet so inbrünstig, daß sie alles vergaß und nicht einmal bemerkte, daß es dunkel, ganz dunkel zu werden begann.
Sie wollte sich entfernen und eilte zum Haupteingang hin, aber da war alles verschlossen, alle Menschen und sogar der Küster, der immer bis zuletzt blieb, hinaus. Letzterer mußte Barbara nicht gesehen haben, da sie sich ganz heimlich zu ihrem Lieblingsort geschlichen hatte. Was sollte sie nun anfangen!
Manche andere würde sich entsetzt haben, eine Nacht in der dunklen Kirche zuzubringen, wo nur die ewige Lampe brannte und rings umher wunderbare Gestalten und Bilder standen. Aber Barbara war nicht furchtsam und verzärtelt wie die Kinder glücklicher Eltern, es oft sind.
Ich will die Nacht hier schlafen, sagte sie ruhig vor sich hin, ich wußte ja doch nicht, wo ich bleiben sollte, es ist besser hier als unter freiem Himmel. Und als sie das gesagt hatte, tappte sie nach der heiligen Barbara zurück, legte sich auf die Stufen ihres Altares nieder und ihren Bündel unter den Kopf. Sie wollte ja einschlafen; der Decken bedurfte sie nicht, denn es war eine laue Sommernacht.
„Heilige Mutter Gottes! Heilige Barbara, bitt’ für mich!“ betete sie noch einmal fromm und innig und schlief ein, als wenn sie auf Rosen gebettet und ein Daunenkissen unter ihrem Kopf gelegen hätte.
Ihr träumte, sie wäre weit weg von Xanthen, vom Dome, von Rüters Viktor, ihrem Jugendgespielen, der heiligen Barbara und allem was ihr lieb, in einer großen, großen Wüste, wo nichts als Sand und Hitze und kein Wasser und keine Menschen waren.
Sie verschmachtete fast vor Durst und hatte Sehnsucht und Heimweh nach dem Orte, wo sie geboren war, da ward sie so traurig, daß sie laut weinte und erwachte. Aber o Himmel! was war das? und wie erschrak sie, als sie die Augen aufschlug und sich von einem wunderbaren Lichte umflossen sah.
Mitten in dem Lichte stand eine Frau von so wunderbarer Schönheit, daß Barbara fast geblendet ward, denn ihre Augen leuchteten wie die Sonne, und von ihren Schultern fiel ein langer Wolkenmantel nieder. Sie trug ein Diadem mit von Sternen und eine Krone, die war rot und golden wie das Abendrot.
Mit der Linken hielt sie den Mantel, und in der rechten einen Rosenkranz von Steinen, die wie Diamanten und Rubinen glänzten, und Lilie, welche weiß war wie der Schnee. „Aber, wer bist Du?“ fragte Barbara, „habe Erbarmen mit mir, ich kann Deinen Glanz nicht ertragen, denn ich bin nur eine arme Waise, die heute von bösen Leuten aus dem Dienst geschickt ist, und noch nie habe ich so Vornehmes gesehen, als wie Du bist.“
„Ich bin Barbara, Deine Schutzpatronin, welche über Dich und alle wacht, die sich in meinen Schutz begeben.“ „Barbara! heilige Barbara!“ rief das erschreckte Mädchen, außer sich vor Freude, „bist Du von Deinem Himmel zu mir herab gekommen? Ach wie danke ich Dir! Nun will ich gern noch einmal so viel leiden als bisher, da meine Augen Dich in Deinem Glanze gesehen haben!“
„Ich bin gekommen Dir zu helfen“, entgegnete die heilige Barbara, „nimm diese Lilie und diesen Rosenkranz, die eine trage auf Deinem Herzen und bewahre Sie als die heiligste Reliquie bis ans Ende Deines Lebens. Wenn dann Deine Augen matt werden und Du von der Erde scheiden mußt, dann erscheine ich wieder, um die Lilie zurückzufordern und als Lohn, wenn Du sie treu bewahrst, Dich zu mir in den Himmel aufzunehmen.“
Als sie das gesagt hatte, verschwand sie. Barbara fühlte sich umweht von einem leisen frischen Winde; der Rosenkranz hing schon an ihrem Halse, die Lilie ruhte schon auf ihrem Herzen, die aussah wie eine wirkliche Lilie, aber viel schöner duftete und nicht welk werden konnte, wenn sie sie auf ihrem Herzen verlor. Sie war glücklich über diese Schätze und darüber, daß ihr die heilige Barbara erschienen war, daß sie ihr großes Unglück vergaß und innerlich froh und vergnügt ward.
Sie setzte sich wieder auf die Marmorstufen nieder und überdachte alles das, was ihre Schutzpatronin gesagt hatte, denn schlafen konnte sie nicht mehr, auch war es schon weit in der Nacht, und durch die hohen bunt gemalten Fenster graute der Tag. Als sie noch eine Weile gesessen hatte und es heller ward, da rasselte es mit Schlüsseln vorn am Haupteingang; der Küster trat ein, um die Frühmesse anzuläuten.
Barbara schlich sich leise hinaus, küßte draußen die Schwelle, des heiligen Gotteshauses und eilte die Straße hinab. Sie kam beim Hause der bösen Leute vorbei, welche sie verstoßen hatte – Grüß’ Euch Gott, sagte sie, sich gegen das verschlossene Haus wendend, ich vergebe Euch alles, was Ihr mir getan habt.
Aber als sie um die Ecke bog, wo Rüters wohnten, die ihr immer gut und freundlich gewesen, dort alles verschlossen war, und auch Viktor noch im sanften Schlummer ruhte, ohne zu ahnen, was ihr begegnet war, flossen heiße Tränen aus ihren Augen. Wie gern hätte sie ihn noch einmal gesehen, um ihm zu danken für alle Freundschaft und alles Gute, was er ihr erzeigt hatte.
Sie ging zum Rhein hin, denn sie wollte sehen, ob nicht da ein mitleidiger Schiffer sie nach dem jenseitigen Ufer hinüber setzen könne. Die Sonne brannte, und als sie ankam, waren alle Schiffer und Nachen fort, und nur der große Fahrkahn lag noch da, dessen Fährmann aber rau und hart war und sie nicht ohne Geld hinüber setzen wollte.
Sie mußte warten bis zum Abend, wo die kleinen Nachen und die anderen Schiffer wieder herunter ruderten. Es war heiß und Barbara müde und hungrig. Sie suchte eine schattige Stelle am Ufer, wo es kühl und einsam war und Brombeeren in Fülle wuchsen. Diese aß sie; dann setzte sie sich dicht ans Ufer und sah in den klaren Rhein hinab.
Sie stützte ihre Hand unter ihrem Kopf und überdachte alles, was sie in der vorigen Nacht gehört und gesehen hatte. Aber es währte nicht lange, so schlief sie vor Müdigkeit ein. Sie hatte aber nicht daran gedacht, daß sie einschlafen würde, und sich zu nahe ans Wasser gesetzt.
Das machte sich der Rheinkönig zu Nutzen, der immer in der Mittagstunde, wenn alles still ist, aus dem Wasser hervorguckt, um nach Beute zu spähen. Als er nun Barbara da liegen sah, die im Schlafe leicht mit der Linken ihr Herz, mit der rechten die Perlenschnur gefaßt hielt und so selig lächelte wie in der letzten Nacht, wo ihr die heilige Barbara erschienen war, da zog er sie leise tiefer hinab, umfing sie sanft mit seinen langen Armen du trug sie zu den Tiefen des Rheines.
Sie erwachte in einem Bette von Kristall, auf Kissen von Weinlaub und unter einer Decke von Moos. Weinlaub rankte sich um ihr Bett herum, mit Trauben behangen, die groß waren wie Nüsse und durchsichtig wie Glas. Der Fußboden war von Marmor, die Wände von Muscheln, die Fenster und Türen, die Stühle und Tische von Kristall.
Und vor ihrem Bett saß der Rheinkönig, eine riesige Gestalt, umhüllt von einem Sand gelben Mantel von Muscheln, auf dem Haupte eine Krone von Bernstein, und in der Hand ein Szepter von Diamant. Mit der Linken hielt er das Szepter und mit der rechten die Hand von Barbara. „Fürchte Dich nicht, mein Kind“, sagte er zu ihr, als sie sich erschrocken und verwirrt umsah, „Du bist hier im Palaste des Rheinkönigs, wo Dir kein Leids geschehen soll, denn ich liebe Dich und alle meine Diener gehorchen Deinem Winke.
Sieh Dich nur ordentlich um, siehst Du nicht die köstlichen Trauben? Die darfst Du in Fülle genießen. Mich dauert alles Leid, das Du ertragen mußtest; aber bei mir sollst Du ein anderes los haben, zu arbeiten brauchst gar nicht; und kostbare Kleider sollst Du tragen von den feinsten Muscheln und eine Krone von Bernstein und ein diamantenes Diadem.“
„Ach, du mein Gott“, erwiderte Barbara und sah sich verwundert nach all den Herrlichkeiten um, indem sie mit den Händen nach den dicken, saftigen Trauben griff. Was das hier glänzt und blüht! Solche Trauben habe ich noch niemals gesehen und solche kostbaren Muscheln und Steine!“
„Der Rosenkranz um Deinen Hals ist schöner und glänzender, als alle Steine meiner Krone“, sagte der Rheinkönig. „Gott verhüte auch, daß er mir jemals geraubt werde“, entgegnete Barbara ängstlich, „er ist mein einziger Schmuck, und ich liebe ihn so sehr, wie die schneeweiße Lilie, die mir auch meine Schutzpatronin gegeben hat.“
„Also eine seltsame Blume besitzest Du auch?“ fragte der Rheinkönig, „nun, die wirst Du mir doch schenken, denn ich liebe seltene Blumen, und die Lilien gedeihen auch in dem Garten meines Palastes. „Nicht wahr, mein Kind, die schenkst du mir zum Dank, daß ich Dich bei mir aufnahm und Dir ein Leben ohne Sorge und Mühe verspreche.“
„O, du mein Gott“, antwortete Barbara erschrocken, die schenke ich nicht um alle Schätze der Welt! Wie müßte ich mich schämen, wenn die heilige Barbara mir wieder erscheine und ich ihre Gaben leichtsinnig vergeudet um eines bequemeren Leben willens verschenkt hätte. Nein, dann will ich lieber in der ärmsten Hütte mein Brot mit Stricken und Nähen und Kinderverwahren zu verdienen suchen.“
„Du bist eine kleine Närrin“, sagte der Rheinkönig lachend, „von einer heiligen Barbara habe ich noch nie etwas gehört. Nun, ich hoffe Du wirst Dich besinnen, und nun trinke einmal mit mir, dieser perlende Wein wird Deinen ermattenden Gliedern wohl tun.“ Und er nahm einen kristallenen Pokal mit funkenden Steinen, zerdrückte eine Traube darin und reichte ihn Barbara.
Diese setzte sich aber betrübt in eine Ecke auf einen gläsernen Stuhl und wollte nicht trinken,, denn sie achtete nicht mehr auf die Herrlichkeiten ringsum, seit sie gehört hatte, daß ihr ihre Lilie und ihr Rosenkranz geraubt werden sollten. Da läutete der Rheinkönig mit einer kostbaren Glocke, und eine Schar schöner Mädchen stürzte singend und tanzend zur Tür herein.
Sie trugen Kleider von Muscheln, einen Gürtel von Diamanten und auf dem Kopfe einen Kranz von Weinlaub und Rosen von Perlen. „Wie sitzt Du da in der Ecke und siehst traurig“, sagten sie zu Barbara, „schäme Dich, so zu weinen, um einer Lilie willen; wir alle hatten solche Kränze und Lilien, wie Du hast, als wir zum Palaste des Rheinkönigs hinab kamen, aber wir haben sie mit Freuden gegeben, da wir hier ein fröhliches Leben führen und nie mehr zur Welt da oben hinauf mögen.“
„Das mag sein“, antwortete Barbara ernst und fest, ihre Tränen trocknend, „aber ich bleibe der heiligen Barbara treu bis ans Ende meines Lebens, wo ich ihr zurückgeben will, was sie mir anvertraute. Immer kann ich ohnehin nicht hier bleiben, und wäre es so schön wie im Himmel selbst, ich sehne mich zurück nach Xanthen und nach der Dame, denn da ist jemand, den ich liebe wie meinen Bruder, und der heißt Viktor.“
Als sie das gesagt hatte, stießen alle in ein lautes Lachen aus, schalten sie als eine, die nicht wisse, was sich schicke, und verhöhnten sie. Die arme Barbara wußte nicht, was sie vor Angst und Schrecken machen sollte, sie sah ängstlich nach ihrer Lilie und war getröstet, sie noch immer zu besitzen.
Da stürzten drei der Nymphen herbei und fragten mit drohender Gebärde: „Willst Du dem Rheinkönig Deine Lilie geben?“ Nimmer mehr!“ antwortete Barbara, „ich bewahre sie der heiligen Barbara getreu bis ans Ende meines Lebens, und wenn Ihr mich auch in die Flut hinunter stürzen solltet.“
„Das wäre eine gelinde Strafe für Dich“, sagten sie. „Du sollst sieben Jahre in einer finstern Höhle sitzen, ganz unten im Palast, wohin weder Sonne noch Mond dringt, da magst Du Sitzen und an die heilige Barbara denken und Deine Torheit beweinen.“ Nun schlug jede dreimal mit der Hand auf den kristallenen Tisch, da war alles finster wie die schwarze Nacht, und Barbara stand allein in einer Höhle, in welcher nichts als Wasserratten und anderes Ungeziefer zu sehen und zu hören war.
Da saß sie nun lange, lange bewacht von einer uralten Hexe, die ihr täglich rohe Fische brachte, und dachte an den Dom und an die heilige Barbara und an Viktor, der ihr Nüsse und Äpfel gebracht, der ihr schöne Geschichten erzählt hatte. Und wie sie eines Tages wieder so saß, die Hand unter dem Kopfe, und nach der Blume ihres Herzens sah, da hörte sie ein leises Flüstern an einer Spalte der Höhle; es wurde immer lauter und lauter, bis sie zuletzt ganz deutlich „Barbara“ sagen hörte.
Sie stand auf, legte das Ohr an die Spalte und fragte dann mit leiser Stimme, wer da sei. „Es ist Viktor, der Dich erretten will“, sagte es von außen herein, und darauf begann ein kräftiges Stoßen und Bohren, daß die erstaunte Barbara nicht wußte, was sie vor Verwunderung anfangen sollte.
Endlich war ein großes Loch gebrochen, so daß sie hindurch konnte. „Komm getrost hervor“, sagte Viktor, „ich trage Dich durch die schäumenden Fluten, die heilige Barbara, Deine Schutzpatronin, befiehlt Dir es.“Aber sie zitterte so sehr vor Freude, daß sie erst ein wenig warten und sich erholen mußte, denn sie sah das helle Tageslicht wieder und Viktor, der so groß und schön geworden war, daß sie ihn fast nicht mehr nicht wieder erkannte.
Er kam jetzt zu ihr in die Eishöhle und erzählte, wie es in Xanthen seit ihrer Abreise ergangen und wie er zu ihrer Rettung gekommen ist. „Ich war so traurig, als Du fort warst“, sagte er, niemand wußte, wohin Du seiest, nur daß du am Abend vorher bei der heiligen Barbara gebetet hättest, das wußte man.
Ich dachte immer an Dich, und als ich die Lehrzeit bei meinem Meister zu Ende hatte und als Geselle in die Welt reiste, um mir Arbeit zu suchen, da fragte ich überall, aber keiner wußte von Dir. Nun geschah es, daß ich zu Johannis nach Hause kam und nach der Vesper in den Dom ging. Ich kniete vor dem Altare Deiner Schutzpatronin nieder und betete, daß Gott mir die Gnade gebe, Dich endlich zu entdecken.
Da sah ich mich plötzlich von einem wunderbaren Lichte umstrahlt, und als ich mich umsah, stand eine Frau, die schön war, wie die heilige Barbara selbst hinter mir. Erschrick nicht, Jüngling, sagte sie zu mir, ich komme Dir zu sagen, wo Deine Barbara geblieben ist.
Der listige Rheinkönig hat sie hinab getragen zu den Tiefen des Rheines, wo man ihr die Lilie und den Rosenkranz, welche ich ihr anvertraute, rauben wollte. Aber keine Lockungen des Bösen vermochten die Lilie von ihrem Herzen und den Rosenkranz von ihrem Hals zu reißen. Barbara blieb standhaft und dafür schmachtet sie in einer finstern Höhle, wo sie von einer Hexe bewacht wird und wo Wasserratten ihre einzige Gesellschaft sind.
Doch die Stunde ihrer Errettung hat geschlagen. Eile um die Mittagstunde zum Rhein, stürze Dich mutig hinein, wo er am tiefsten ist, Dein Leben wird Dich erhalten, denn ich begleite Dich hinab in die Tiefe, und die heilige Mutter Gottes sendet ihre Engel, daß sie Dir zur Seite stehen und Du mit Barbara zurückkehrst zu unserer und aller Guter Freude. Wenn Du Glauben hast, so eile hinab, und es soll Dir kein Haar gekrümmt werden.“
„Die Wunderbare war verschwunden“, sagte Viktor weiter, „aber ich zögerte nicht länger und stürzte mich hinunter. Da fand ich Dich, meine Barbara, meine liebe verlorene Barbara wieder, und er umarmte sie und küßte sie. Dann traten sie die Reise an durch die schäumenden Fluten. Es währte nicht lange, so waren sie am Ufer, denn die heilige Barbara beschützte und behütete sie, so daß sie unbeschadet hindurchgingen.
O, wie glücklich waren sie, als sie das helle Tageslicht wieder sahen und den Fuß auf den heimatlichen Boden setzten. Dann gingen sie in die Stadt und zuerst zum Dome hin, wo sie vor dem Altare der heiligen Barbara fromm die Hände falteten und ein Dankgebet für die erlangte Rettung hinaufschickten.
Und nun ging Viktor nicht mehr in die Welt hinaus; er hatte ein nettes Sümmchen von seinem Vater geerbt und damit wollte er sich als Meister niederlassen. Barbara ward seine Hausfrau; sie liebten sich treu und lebten ans Ende ihres Lebens froh und vergnügt.
Der Rosenkranz aber war verschwunden, und Barbara wußte nicht, wie es geschehen war, gleich wie die Jugend und Schönheit dahin gehen, ohne daß man es gewahrt; es geschah alles, wie es ihre Schutzpatronin gesagt hatte. Aber als sie nun alt waren und starben, da wuchs auf Viktors Grab ein grüner Palmbaum und auf Barbaras eine schneeweiße Lilie und niemand wußte, wer sie gepflanzt hatte.
Märchen aus Deutschland
DER GOLDENE HAMMER UND DIE HARTE NUSS ...
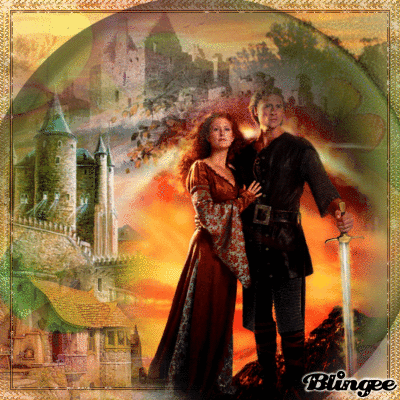
In alten Zeiten lebte ein reicher und mächtiger König, der hatte nur eine Tochter, die so schön und lieblich anzuschauen war, daß sie jeder voll Staunen und Bewunderung betrachtete. Da konnte es nicht fehlen, daß sich ein ganzes Heer von Freiern einfand, um so mehr, da es weltbekannt war, daß der künftige Gemahl der Prinzessin Aline einst auch der Beherrscher des Landes sein würde.
Allein die Prinzessin war nicht nur schön und gut, sie war auch klug und bescheiden und wollte nicht glauben, daß einer der vornehmen Freier sie liebe und an ihrer Person willen heiraten wolle, sondern sie meinte, es geschehe ihrer Reichtümer wegen. Mit diesem Misstrauen konnte sie sich zu keiner Heirat entschließen und fand immer wieder einen Vorwand, die Bewerber abzuweisen.
Dem König, ihrem Vater, riß die Geduld. Er berief eine weise Frau, die, mit den Künsten der Zauberei vertraut, ihm raten und helfen sollte, den Sinn seiner Tochter zu wenden und sie zu einer passenden Heirat geneigt zu machen. „Laßt mich nur machen,“ sagte diese, „ich kenne Aline genau und weiß, daß es nur Misstrauen ist, welche sie alle Freier zurückweisen heißt. Sie muß Beweise der Liebe und Treue sehen, wenn sie ihr Herz verschenken soll.“
Dann ging die alte, kluge Zauberin zur Prinzessin und sprach also: „Ich kann es nicht mit ansehen, daß Du mein liebes Patchen, so einsam und liebeleer durch das Leben gehst, - ich möchte Dir gerne zu einem Gemahl verhelfen, der Dich aufrichtig liebt und Deiner würdig ist. Um das zu erreichen, muß der, welcher Dich erringen will, eine Prüfung – eine Geduldsprobe bestehen.“
„Wie soll das geschehen?“, fragte Aline neugierig. „Das laß meine Sorge sein“, versetzte die Alte, „und wundere Dich nicht über das, was ich tun werde, sondern denke stets daran, daß alles zu Deinem Besten geschieht.“ Sie schritt zu einem kleinen Glasschrank, der viele Kleinodien barg, und entnahm ihm die reich mit Diamanten besetzte Königskrone.
Aline schaute verwundert auf das Tun und Treiben der Alten, welche mit einem glänzenden Stäbchen wiederholt auf die Krone strich. Diese war zusehends kleiner, zuletzt verschwand sie ganz und gar und statt ihrer hielt die Zauberin eine große Nuß in ihren Händen. „Was hast Du getan?“ fragte Aline erschrocken.
„So, wie Du die Krone hier in eine Nuß verwandelt siehst, so bist Du jetzt ein armes, einfaches Mädchen und Dein Vater in einen Bürgersmann verwandelt“, erklärte die Alte, "und nur derjenige, welcher diese Nuß zu spalten vermag, gibt Euch Eure Macht, Eure Krone und Euren Reichtum zurück -, nur er ist auch Deiner Liebe und Deines Besitzes würdig."
Damit verschwand die Zauberin und ließ Aline in der größten Bestürzung zurück. Nun war sie plötzlich ein armes Mädchen. Der ganze Troß von Kammerherren und Lakaien, von Hofdamen und Kammerkätzchen war verschwunden, und ihre kleinen Hände mußten für sich und ihren Vater allein sorgen und arbeiten. Und so, wie der Reichtum verschwunden war, so waren auch mit einem Mal alle vornehmen Freier wie fort geblasen, die ihr so versichert hatten, nicht ohne sie leben zu können.
„Siehst Du nun, daß ich recht hatte“, sagte Aline triumphierend zum Vater, „keiner von allen liebte mich aufrichtig, sie wollten alle Dein Geld und Deine Königskrone.“ Der König schwieg. Was sollte er auch erwidern? Aline hatte nur zu recht. Für die zerstobenen, vornehmen Freier fanden sich nun allerhand Glücksritter ein.
Die Kunde von der Verzauberung hatte sich schnell verbreitet, und da glaubten die Herrchen, sie könnten auf leichte Weise König und Gemahl der schönsten Prinzessin werde. Man kam mit Riesenhämmern, mit Äxten und Sägen. Gar mancher Schlag ward auf die Nuß getan, allein vergeblich. Sie widerstand allen Aufregungen, niemand vermochte sie zu öffnen.
In der Nähe des einstigen Königsschlosses, das jetzt in ein einfaches Häuschen verwandelt war, lag eine alte Burg, darauf wohnte ein Ritter, namens Justin von Felsingborg. Dieser liebte schon längst im stillen die liebreizende Prinzessin, wagte aber, solange sie vornehm und reich war, nicht, den Blick zu ihr zu erheben; da konnte er natürlich auch nicht sehen wie freundlich und wohlwollend sie ihm nachblickte, und nicht ahnen, daß sie ihn, den einfachen Ritter, allen Fürsten und Herzögen vorziehen würde.
Jetzt, da sie nun ärmer war als er, nahte er sich ehrerbietig, gestand ihr seine Liebe und bat sie, sein Weib zu werden und mit ihrem Vater seine Reichtümer zu teilen. Die Prinzessin war gerührt und erfreut über sein Anerbieten, aber so sehr sie ihn auch liebte, so gern sie auch die Seine geworden wäre und auf die Königskrone verzichtet hätte, so mochte sie doch ihrem Vater das nicht zuleide tun, der in den glänzenden Verhältnissen alt geworden war und mit ganzer Seele daran hing.
Und so gab sie auch Justin von Felsingborg den Bescheid, daß sie nur dann die Seine werden könne, wenn er die Nuß zu spalten vermöge und dadurch ihre und des Vaters Verzauberung löse. Traurig vernahm Justin ihre Antwort und grübelte Tag und Nacht, wie Alines Zauber zu haben sei.
Da vernahm er, daß in einer fernen, großen Stadt ein mächtiger Zauberer wohne, der für alles Rat wisse. Sofort war sein Entschluß gefaßt. Eines schönen Tages machte er sich auf die Wanderschaft und langte nach einer langen, beschwerlichen Reise in der befragten Stadt an.
Er fand in dem Zauberer einen schönen Greis mit wohlwollenden Zügen, der freundlich nach seinem Begehr fragte, und als ihm Justin seine Verlegenheit mitgeteilt hatte und um seinen Rat bat, da sagte er nach einigem Nachdenken:
„Mein lieber Sohn, um diese Nuß zu öffnen, bedarfst Du nur eines kleinen Hammers; aber Du mußt ihn eigenhändig aus selbstverdientem Golde gearbeitet haben. Dazu gehören Jahre, - wirst Du soviel Geduld haben?“ „An Geduld soll es mir nicht fehlen“, versicherte Justin, „denn ich liebe die Prinzessin und scheue für sie keine Opfer; aber wie und wo kann ich das Gold mit meiner Hände Arbeit verdienen?“
„Verlasse morgen vor Tagesanbruch diese Stadt“, riet ihm der Greis, „gehe immer dem Winde entgegen, bis du an ein großes Wasser kommst. Das übrige wird sich dann von selbst finden.“ Kopfschüttelnd über den dunklen Sinn dieser Worte, nahm Justin herzlich Abschied von dem Zauberer und tat, wie ihm geheißen.
Es war ein heißer, ermattender Tag und der Ritter dankte Gott, wenn ihm ein kühles Lüftchen entgegen wehte und ihm gleichzeitig den Weg bezeichnete, den er zu wandern hatte und welcher ihn gegen Mittag nach einem anstrengenden Marsch an den Strand des Meeres führte.
Erschöpft stieg er in einen der vielen Fischerkähne, die sich leise auf den Wellen schaukelten, spannte seine große Decke, die er bei der Wanderung bei sich führte, über sich aus zum Schutz gegen die brennende Sonne und streckte sich dann behaglich auf dem Boden des Kahn aus. Bald war er fest eingeschlafen.
Ein furchtbares Getöse erweckte ihn. Es war finstere Nacht um ihn; der Sturm heulte, feurige Blitze zuckten vom Himmel nieder, ihnen folgten knatternde Donnerschläge, die schaurig auf dem weiten, unendlichen Meere wiederhallten. Sein Boot befand sich bald auf haushohen Wellen, bald schoß es je in die Tiefe hinab.
Entsetzt blickte Justin um sich und konnte sich anfangs nicht besinnen, wie er in die schreckliche Lage gekommen war. Dann fiel ihm schaudernd ein, daß er in dem Kahn eingeschlafen und wahrscheinlich vom Unwetter hinaus getrieben worden und rettungslos verloren sei. Angstvoll griff er nach den Rudern, aber menschliche Kraft vermochte nichts gegen die Wut der Elemente auszurichten.
Außerdem machte es die Finsternis unmöglich, irgend ein Ziel ins Auge zu fassen. Entmutigt ließ er die Ruder sinken, eine neue gewaltige Welle brachte ihn zum Schwanken, er stürzte nieder und klammerte sich an die Planken des Bootes. So blieb er liegen, die tiefste Verzweiflung im Herzen.
„O, mein Gott!“ rief er schmerzlich, “so soll ich denn hier den jämmerlichen Tod finden und Aline niemals erfahren, wo und wie ich geendet!“ In dem selben Augenblick erleuchtete ein greller, lang anhaltender Blitz alles ringsumher. Justin richtete sich auf und erblickte in einiger Entfernung dunkle Massen, die ihn Land deuchten; aber gleich darauf warf ihn eine haushohe Welle zurück, stürzte das Boot um und schleuderte ihn mit aller Kraft an das Land, wo er besinnungslos liegen blieb.
Als er wieder zu sich kam, lag er ein Stück vom Strand auf festem Boden. Ein riesengroßer Mann mit langem, dunklen Bart stand über ihn gebeugt und leuchtete ihm mit einer Laterne ins Gesicht. „Holla, mein Bürschchen“, rief er mit tiefer Stimme, „sind die Fensterläden wieder offen? Ich glaubte schon, sie würden für immer geschlossen bleiben!“
„Wo bin ich?“ fragte Justin. „Auf dem Trockenen“, erwiderte der Riese. „Aber bald wäre es Euch schlecht ergangen“, fuhr er fort. „Der Sturm hat Euer Boot zerschellt und die Wellen Euch ans Land geworfen. Sie würden Euch auch sicherlich wieder fort gespült haben, wenn ich nicht zufällig hier gewesen wäre und Euch in Sicherheit gebracht hätte.“
Jetzt besann sich Justin auf alles und dankte seinem Retter mit warmen Worten: „Nichts da von Dank“, erwiderte der Riese barsch, „ich lasse mich nicht mit leeren Worten abspeisen, ich verlange die Tat. Wen ich dem Tod entreiße, der muß für mich arbeiten und zwar volle drei Jahre. Wenn er in dieser Zeit treu seine Pflicht erfüllt, dann sind wir quitt.
„Ich denke doch“, fügte er hinzu, „damit kann jeder, der dem jämmerlichen Tode entronnen ist, wohl zufrieden sein. Drei Jahre der Arbeit sind schnell herum.“ „Doch nun erhebt Euch“, rief er ungeduldig, als Justin noch immer still lag, " hier auf der Erde könnt Ihr doch nicht liegen bleiben, das würde Euch dem Tode, dem Ihr knapp entronnen seid, wieder in die Arme führen."
Mühsam erhob sich Justin. Die Zähne schlugen ihm vor Frost hörbar aufeinander. Der Riese zog die nassen Kleider ab und half ihm trockene anzulegen, die er bei sich führte, dann hüllte er ihn noch in eine wollene Decke und reichte ihm einen Schluck starken Weins aus seiner Flasche und zog ihn dann heftig mit sich fort.
Die schnelle Bewegung tat Justin wohl, ihm war wieder warm und in seine erstarrten Glieder kam neues Leben. Allein sein Herz war zum Zerspringen traurig. Wohl war er dem Tode entronnen; aber er war auf drei Jahre an den Riesen gebunden, was konnte in dieser langen Zeit alles geschehen? Vielleicht fand sich ja inzwischen ein anderer, der die Nuß spaltete, Alines Zauber löste und sie als sein Weib heimführte.
Während dieser traurigen Betrachtungen gelangte er neben seinem schweigsamen Begleiter in einen dichten, dunklen Wald. Die kleine Laterne warf nur einen kleinen Schein durch die Finsternis und ließ die mächtigen, dunklen Bäume unheimliche Riesen erscheinen, die ihre langen Arme nach den Wanderern ausstreckten, welche häufig über die knorrigen Wurzeln stolperten.
Nach einer Stunde Wanderns lichtete sich der Wald und sie gelangten auf einen freien Platz, von dessen Mitte sich ein helles Gebäude am dunklen Abendhimmel abzeichnete. Aus seinem hohen Schornstein sprühten leuchtende Funken empor zu dem düsteren Himmel. Dieses Zeichen von Leben und der Nähe anderer Menschen berührte Justin sehr wohltuend.
Sie umgingen das Gebäude und standen bald vor der Tür einer ungeheuren Schmiede. Dunkle, bärtige Gestalten hantierten darin umher. Der eine setzte den Blasebalg in Bewegung, um die Glut auf der Esse zu schüren, der andere schlug auf das glühende Eisen, daß die Funken stoben. Noch andere taten Metall in einen großen Kessel, und das Sieden und Zischen aus seiner Tiefe übertönte zuweilen jedes andere Geräusch.
Voll Interesse betrachtete Justin das nächtliche Treiben der Männer, während diese ihn keines Blickes würdigten. „Für heute ist das nichts“, störte ihn sein Begleiter, „kommt jetzt ins Haus und ruht Euch, - Ihr sollt diese Arbeit noch zu Genüge kennen lernen.“ Damit zog er ihn mit sich fort zu der eigentlichen Haustür durch einen dunklen Flur in ein matt erleuchtetes Zimmer.
Bei ihrem Antritt schreckte ein altes Mütterchen aus einem alten Lehnstuhl empor. „Bist du endlich da, Carlo“ murmelte sie schlaftrunken. "Dein Nachtessen wird kalt geworden sein.“ „Nun, dann wärme es, Mutter“, sagte Carlo, „und bringe noch einen zweiten Teller mit, denn ich habe einen neuen Gesellen für die Schmiede geworben.“
Jetzt musterte die Alte den neuen Ankömmling. „Ha, ha, ha, Bürschchen“, lachte sie „siehst mir nicht aus wie ein Schmiedegeselle, - eher wie ein feines Herrchen, das nichts anderes kennt als Reiten und Jagen.“ „So war es auch bisher, Mütterchen“, gestand Justin freimütig, „aber das soll mich nicht hindern, jetzt ein tüchtiger Schmied zu werden, um meinem Lebensretter dadurch meine Dankbarkeit zu beweisen.“
„Brav gesprochen; wenn Eure Taten Euren Worten gleichen, bin ich mit Euch zufrieden. Die meisten, denen ich bisher das Leben rettete, haben mir mit Undank gelohnt und sind heimlich davon gelaufen. Auch Ihr werdet kein Gefangener sein; wir werden ja sehen, ob Ihr Euer Wort haltet.“
„Ich habe noch niemals mein Wort gebrochen“, erwiderte Justin einfach, „und wenn mich auch heute drei Jahre eine Ewigkeit deuchten, weil sie mir ein entferntes Ziel in die weite Ferne, ja vielleicht auf ewig entrücken, so soll mich doch das alles nicht hindern, Euch mein gegebenes Wort zu halten. Hier meine Hand darauf, daß ich Euch nicht eher als über drei Jahre verlasse.“
Carlo schlug mit aller Kraft in die dargereichte feine Hand Justins, daß sie knackte und der Handel war geschlossen. Indessen hatte die Alte das Essen gebracht und sah schmunzelnd zu, wie es den beiden Hungrigen schmeckte. Nach dem Mahl nahm der Riese ein Endchen Licht, steckte es auf eine Flasche und geleitete Justin in sein Schlafkämmerchen.
Es war ein kleiner Raum unter dem Dache, darin stand ein sauberes Bett, ein wackliger Stuhl, ein kleiner, grob gezimmerter Tisch mit einer braunen, irdenen Waschschüssel und einem gleichen Wasserkrug. Aber dem bisher durch Glanz und Üppigkeit so sehr verwöhnten Ritter erschien dieses einfache Kämmerchen nach den überstandenen Gefahren wie ein Paradies.
Bald lag er im Schlaf der Jugend und träumte von Aline, mit der er sich seine Gedanken ja auch im Wachen am meisten beschäftigten. Als er erwachte, stand die Sonne schon ziemlich hoch und sein Retter steckte den Kopf in die Tür. „Na, Ihr Siebenschläfer“, „rief er, „habt Ihr endlich ausgeschlafen?“ „Ich habe köstlich geschlafen“, versicherte Justin, „und fühle mich so gestärkt, daß ich die Arbeit gleich beginnen kann.“
„Das freut mich“, meinte Carlo, „ich habe auch alle Hände voll zu tun. Da ist mir, während ich schlief, ein undankbarer Bursche entwischt, und Ihr könnt gleich seine Stelle einnehmen.“ Sie gingen in das kleine Wohnzimmer hinab, und Justin genoß mit Behagen das bescheidene Frühstück, welches ihm das alte Mütterchen reichte.
Dann ging er mit Carlo in die Schmiede und ließ sich seine Arbeit anweisen. Vorläufig mußte er den Blasebalg treten und Feuerung zutragen. Das war nun zwar alles für den verwöhnten Ritter und seine feinen Hände ungewohnte Arbeit und ward ihm blutsauer.
Der Schweiß rann in Strömen von seiner Stirn, aber er tat alles mit einer gewissen, dankbaren Freudigkeit, und das alte Sprichwort: „Lust und Liebe zu einem Dinge macht alle Müh’ und Arbeit geringe!“ bewährte sich auch unserem Justin. Es erleichterte ihm das Schwere der Arbeit um ein gut Teil und machte, daß er sich bald in die neuen Verhältnisse einlebte.
Und wie schmeckte ihm das einfache, kräftige Mittagsmahl so prächtig, und wie lachte das alte Mütterchen so gutmütig, als es das feine Herrchen so verwandelt sah. Justin war sich oftmals mit den rußigen Händen über das schweißtriefende Antlitz gefahren, und als er sich in dem kleinen Spiegel, dem einzigen Luxux des Stübchens erblickte, da lachte er hell auf und dachte, was wohl Aline sagen würde, wenn sie ihn so zum Mohren verwandelt sähe.
Als die Woche rum war, überreichte Carlos dem Ritter eine kleine Goldkugel, kaum wie eine Erbse groß, und sagte: „Hier nehmt euren wohlverdienten Lohn.“ Justin sah ihn erstaunt an: „Aber ich beanspruche ja gar keinen Lohn“, erwiderte er, „ich möchte ja nur durch meine Arbeit die Schuld der Dankbarkeit abtragen.“
„Larifari,“ wehrte der Riese, „das Gold gehört Euch, - wenn Ihr nichts erspart, wovon wollt Ihr dann über drei Jahre Eure Heimreise bewerkstelligen, da Eure ganze Barschaft ins Wasser gefallen ist?“ Das war sehr richtig, und Justin weigerte sich nicht länger, am Schlusse jeder Woche ein solches Kügelchen anzunehmen.
Bei der rastlosen Tätigkeit verging im die Zeit im Fluge, denn nur faule Leute langweilen sich. Inzwischen waren wieder verschiedene Gehilfen so geschrieben aus der Schmiede entwischt und andere Schiffsbrüchige von dem menschenfreundlichen Schmied eingeführt worden.
Zu Justin hatte er ein großes Vertrauen gefaßt und übertrug ihm die schwierigsten Arbeiten. So sehr ihn auch oft die Sehnsucht nach der Heimat und Aline übermannte, so behagte ihn doch das tüchtige Leben. Er fühlte, daß er unter den Entbehrungen und der rastlosen Arbeit erst zu einem tatkräftigen Manne gereift war und daß er erst jetzt der Liebe und des Besitzes der Prinzessin würdig sei.
Um keinen Preis wäre er auch nur eine Stunde früher von seinem Wohltäter geschieden, als es die Pflicht ihm gestattete. Als die drei Jahre ihm wie im Traum dahin geschwunden waren, da wurde ihm ganz traurig zu Mute und er fühlte, wie lieb ihm das alte, fürsorgliche Mütterchen und der rauhe Schmied mit dem treuen Herzen geworden waren. –
Eines Tages rief ihn Carlo zu sich und sagte: „Bald schlägt nun eure Erlösungsstunde, ich aber scheide ungern von Euch, denn ich habe Euch lieb gewonnen. Ihr seid ein Mann, wie sichs gehört: fest und treu. Ich gestattete Euch volle Freiheit, zu leben wie es Euch gefiel.
Ihr durftet an Sonn- und Feiertagen den Wald durchstreifen, und es wäre Euch ein leichtes gewesen, zu entfliehen; aber Ihr gehorchtet der Pflicht und der Ehre.“ „Und der Liebe“, unterbrach ihn Jusin warm, - „riefen mich daheim nicht andere, heilige Pflichten, ich würde Euch und das alte Mütterchen noch lange nicht verlassen.“
„Ich glaub es, ich glaub es“, sagte der Riese gerührt und drückte seine Hand, daß sie schmerzte. „Aber was ich noch sagen wollte“, fuhr er fort, „ehe Ihr scheidet, müßt Ihr nach altem Brauch Euer Meisterstück machen. Bisher hat es keiner vollbracht, alle sind sie zuvor entwischt. Ihr seid der erste, den die Dankbarkeit so lange fesselte.
Holt alle Eure verdienten Goldkörnchen und kommt in die Schmiede.“ Der Ritter tat, was Carlo verlangte, und als er mit dem Gold in der Schmiede erschien, zeigte ihm der Riese einen kleinen Hammer und sagte: „Diesen Hammer lasse ich Euch als Modell, nun fertigt aus Eurem Golde einen eben solchen.“
Damit ließ er Justin allein. Dieser stand einige Zeit ratlos; wohl hatte er gelernt, geschickt mit dem Eisen umzugehen, aber Gold hatte er noch niemals verarbeitet. Da kam ihm ein Gedanke, der sich bald als ein guter erwies. Er formte aus Thon einen Teig, dahinein preßte er den Hammer und nahm ihn dann vorsichtig wieder hinaus.
Nun hatte er die ganze Form des selben. Dann schmolz er in einem kleinen Tiegel das Gold und goß es in die Form, welche bis in die kleinsten Ecken davon ausgefüllt wurde. Als die Masse erkaltet war, löste Justin den Thon von dem Golde und hielt zu seiner Freude einen wohl gelungenen Hammer in der Hand.
Nachdem er ihn sauber polierte, eilte er freudig zu seinem Meister. „Das hast Du brav gemacht“, rief dieser, nachdem er das Werk genau betrachtet, „nun steht Deinem Glücke nichts mehr im Wege, denn mit dem Hammer der Geduld knackt man die härtesten Nüsse.“
Als Justin diese Worte hörte, da ging es wie Erleuchtung durch seine Seele. Er war im wahren Sinne des Wortes an die rechte Schmiede gekommen und fühlte, daß er die drei Jahre nicht verloren, nicht vergebens gearbeitet habe. Voll froher Zuversicht schaute er in die Zukunft.
Mit innigem Dank schied er von seinem Lebensretter und dem alten Mütterchen und wanderte fröhlich in den Wald hinein. Er trug die selben Kleider, mit denen er Schiffbruch erlitten hatte, und als er in die Rocktasche faßte, fand er auch seinen Geldbeutel darin, - es fehlte kein Groschen an der Summe, welche er damals bei sich führte.
Nach mehrstündigem Wandern trat er aus dem Walde ins Freie. Hell und sonnig breitete sich eine schöne Landschaft vor ihm aus, welche ihm merkwürdig bekannt vorkam, und als er nach wenigen Stunden weiter ging, befand er sich zu seinem größten Erstaunen auf eigenem Grund und Boden.
Dort oben glänze im Sonnengold die Burg seiner Väter; aber er nahm sich nicht die Zeit, dort Einkehr zu halten. Es zog ihn vor allen Dingen ins Tal nach dem Hause der Geliebten, zu seiner Aline. Er fand alles unverändert und bald ruhte sie weinend vor Freude an seiner Brust.
Als sich der erste Freudenrausch gelegt hatte, dann ging es an ein Erzählen ohne Ende, und Justin erfuhr, daß alle Versuche, die Nuß zu sprengen, gescheitert seien. Dann erzählte er Aline alle Erlebnisse, und als sie hörte, was Justin ihretwegen erduldet und gelitten, da war sie tief gerührt und sagte:
„Jetzt erkenne ich, daß du mich treu und aufrichtig liebst, und gebe mich Dir für immer zu eigen.“ „Auch ohne Krone?“ fragte Justin. „Auch ohne Krone“, versicherte sie. „Und Dein Vater, wird er den Glanz entbehren und mit uns auf unserer Burg leben wollen?“
„Er wird es“, ließ sich jetzt der alte König vernehmen, „Eure Liebe, Euer Edelmut hat die harte Schale gesprengt, welche stolz und Vorurteil um mein Herz gelegt, und der Kern, Genügsamkeit und Zufriedenheit, tritt wieder zu Tage. Laßt uns von nun an in Liebe und Eintracht miteinander leben.“
„Und mich lasst die Nuß, um die sich so viele vergeblich bemühten, ins tiefe Wasser werfen“, rief Aline freudig. Sie holte sie, um sofort ihren Vorsatz auszuführen, aber Justin trat ihr in den Weg und sagte: „Laß mich die Nuß zuvor einmal sehen.“
Er zog seinen kleinen Geduldshammer, wie er ihn nannte, aus der Tasche und schlug wiederholt leise damit gegen die Nuß. Sie wuchs zusehends und bei dem siebenten Schlage spaltete sie sich und vor den erstaunten Blicken der Umstehenden erglänze die Königskrone in ihrer diamantenen Pracht.
Alsbald gab es ein Rauschen und Klingen ringsumher. Hofdamen und besternte Kammerherren, auch die alte Patin erschien und rief: „Ist nun endlich für mein Schätzchen der rechte gekommen? Glaubst Du nun, daß der Justin von Felsingborg Dich liebt und um Deiner selbst willen heiratet?“
„Gewiß glaube ich das und nur zu gern“, versicherte Aline, die wieder in königlicher Pracht strahlte, „denn auch ich habe ihn von ganzem Herzen lieb.“ – Nun war ein großer Jubel im Lande, denn alles war wieder entzaubert und ging seinen gewohnten Gang, der nur durch die glänzende Hochzeit des jungen Paares unterbrochen wurde.
Märchen aus Deutschland
DAS MÄRCHEN VOM DUMMEN PETER ...
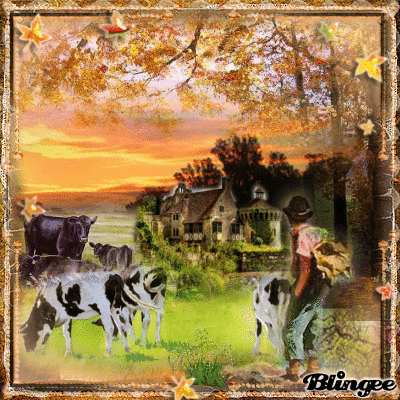
Es lebte einmal eine Mutter, die hatte zwei Kinder, einen Knaben und ein Mädchen. Dem kleinen Mädchen, dem ging es gut, denn es bekam den ganzen Tag Kuchen und Schokolade zu essen, niemals durfte es eine Arbeit tun, und obendrein wurde es gelobt, geherzt und geküßt.
Aber dem kleinen Jungen, dem ging es nicht gut. Die Mutter schalt ihn, wo sie nur konnte. Er mußte alle harte Arbeit tun, bekam Schläge, sobald etwas nicht ganz richtig war, am Abend gab man ihm trocken Brot zu essen, und des Nachts mußte er im Stall bei den Schweinen schlafen. Der Junge hieß Peter, und die Mutter, die nannte ihn nicht anders, "als du dummer Peter".
Eines Tages aber, als sie ihn wieder schalt, da hatte es der dumme Peter satt und sagte zu seiner Mutter: „Weißt du was, Mutter, du sagst den ganzen Tag, ich sei zu nichts zu gebrauchen, schiltst und schlägst mich da gehe ich lieber in die weite Welt und versuche dort mein Glück.“
Das war der Mutter ganz recht, darum sagte sie: „Ja, geh nur du dummer Peter, doch zum Abschied will ich dir noch ein Stück trocken Brot geben und hier den kleinen Hammer kannst du auch mitnehmen.“ Als sie das gesagt hatte, steckte sie dem dummen Peter das Brot in die eine und den Hammer in die andere Tasche, und dann ging der Peter fort.
Am Abend kam er an ein stattliches Haus, da schauten drei Mädchen zum Fenster heraus. „Guten Abend“, rief der Peter, „ich suche eine Arbeit, könnt ihr einen Kuhhirten gebrauchen?“ „Oh, wir suchen einen Kuhhirten, komm nur herauf und iß gleich mit uns Abendbrot.“ Das war dem Peter recht.
Er stieg die Stufen hinan, trat in die Stube und bekam zu essen, bis er ganz satt war. Dann führten ihn die Mädchen in ein schönes Schlafgemach, und er hatte ein weiches Bett wie nie zuvor im Leben.
Am nächsten Morgen gab man ihm einen Krug Wein und ein fettes Butterbrot mit auf den Weg, und der Peter zog mit seinen Kühen auf die Weide. Es war ein schöner Tag, und alles ging gut. Der Peter lag in der Sonne und freute sich recht seines Lebens.
Aber plötzlich – da kam aus dem Wald ein Ritter angesprengt, in einer Rüstung, ganz aus Silber, er schwang sein Schwert und rief: „Was machst du hier, du dummer Peter?“ „Das geht dich nichts an“, rief der Peter. Aber da wurde der Ritter böse, schwang sein Schwert und rief: „Na, warte nur, mir freche Antworten zu geben. Jetzt werde ich dir gleich den Kopf abschlagen.“
Der Peter zog seinen kleinen Hammer heraus, dem ihm die Mutter mitgegeben hatte, sprang auf das Pferd des Ritters und schlug dem Ritter eins gegen den Kopf da fiel er vomPferde und war tot. Peter nahm das Pferd, band es im Wald an einem Baum fest, zog dem Ritter die silberne Rüstung aus, versteckte sie und ging still mit seinen Kühen nach Hause, als sei nichts geschehen. Er nahm sich auch vor, den beiden Mädchen nichts zu sagen von dem, was er auf der Weide getan hatte.
Als die Mädchen den Peter kommen sahen, freuten sie sich, denn sie schauten schon zum Fenster heraus und warteten auf ihn. Sie hatten noch nie einen Kuhhirten gehabt, der am Abend wiedergekommen, weil ihn stets der Ritter erschlagen hatte. „Ach“, riefen sie „schaut, der Peter ist wieder da, der Peter ist wieder da“, und sie liefen ihm entgegen, holten ihn herauf und gaben ihm zu essen, bis er rund und satt und nudeldick war.
Dann geleiteten sie ihn in sein Schlafgemach, und der Peter schlief wohl und geborgen die ganze Nacht. Am neuen Morgen ging er wieder mit seinen Kühen auf die Weide, aber als er wiederkam, diesmal nur von der anderen Seite kam ein Ritter angesprengt, er war noch größer und mächtiger als der Ritter vom Tag zuvor, hatte eine Rüstung, sie war aus purem Gold, schwang sein Schwert und rief:
„Was machst du da, du dummer Peter?“ „Das geht dich gar nichts an!“ rief der Peter. „Na warte, mir so frech zu kommen, jetzt werde ich dir gleich den Kopf abschlagen.“ Unser Peter aber stand auf, zog den kleinen Hammer heraus, den ihm die Mutter mitgegeben hatte, sprang auf das Pferd und schlug dem Ritter damit gegen den Kopf, so daß er vom Pferde fiel und tot war.
Da zog der Peter ihm auch seine Rüstung aus und band das Pferd neben das andere. Dann ging er mit seinen Kühen nach Hause und sagte wieder nichts von dem, was auf der Weide geschehen war. Die Mädchen freuten sich, als sie den Peter sahen, gaben ihm wieder zu essen und zu trinken, und am nächsten Tag ging er abermals auf die Weide. Alles ging gut, er schaute nach links und nach links, kein Ritter kam herangesprengt.
Als er aber mit seinen Kühen nach Hause gehen wollte, da öffnete sich mitten auf der Weide eine Falltür, und heraus stieg ein großer, mächtiger Ritter in einer Rüstung ganz mit Diamanten besetzt. Er schwang sein Schwert und rief: „Was machst du hier, du dummer Peter?“ „Ach, das geht dich gar nichts an“, antwortete der dumme Peter.
„Na warte nur, mir so frech zu kommen! Nun werde ich dir gleich den Kopf abschlagen.“ Peter aber besann sich nicht lange, sprang auf den Ritter zu und gab ihm mit seinem Hammer eins gegen den Kopf, da fiel er hin und war tot. Nun, dachte der Peter, jetzt will ich sehen, was da eigentlich unter der Erde ist.
Er ließ seine Kühe allein nach Hause gehen und stieg in die Öffnung unter der Falltür. Er mußte siebenhundertsiebenundsiebzig Treppen heruntersteigen und kam schließlich in ein Zimmer, das hing ganz voll Kleider. Die brauche ich nicht, dachte der Peter. Ich habe da oben drei Rüstungen erbeutet, die halten mein ganzes Leben vor.
Doch sah der Peter, daß hier noch eine Tür war. Er öffnete sie und kam in ein Zimmer, das war angefüllt mit lauter Essen. Das ist eher was für mich, dachte er, und weil er ohnehin hungrig war, setzte er sich nieder und aß sich nudeldick satt an Kuchen, Braten, Würsten, Wein und Schokolade und Äpfel und Pflaumen und Nüssen, oder was er sonst noch haben wollte.
Doch während er aß, sah er, es gab sonst noch eine Tür dort, aber sie hatte keine Klinke. Der Peter wußte nicht, wie er die Tür öffnen sollte, nahm schließlich seinen Hammer und schlug damit
gegen die Tür, und da sprang sie auf. Und was glaubt ihr was da drin war? Gold, lauter Gold, blanke runde Goldstücke.
Sie fielen nur so hervor, und der Peter machte vor lauter Vergnügen ein Purzelbaum, stand auf dem Kopf und lief auf den Händen und wußte sich nicht zu fassen vor Freude.
Endlich kam ihm ein guter Gedanke. Er schloß wieder alle Türen zu, ging hinauf und zog die schönste Ritterrüstung an, stieg auf eines der Pferde und ritt zum Haus der Mädchen. Er ging herauf, klopfte an und fragte: „Kann ich bei euch ein Nachtmahl bekommen?“
Die drei Mädchen saßen an ihrem gedeckten Tisch und mochten nichts essen, sondern sie weinten und klagten, weil die Kühe ohne den dummen Peter nach Hause gekommen waren, als sie den schönen fremden Ritter sahen, fragten sie: „Wer seid Ihr denn?“ „Na, kennt ihr mich nicht?“ „Nein, woher sollen wir dich kennen, wir sehen dich heute zum ersten Mal.“ „Nun, ich bin doch der dumme Peter.“
Na, das wollten die Mädchen gar nicht glauben, daß das der dumme Peter war. „Ach, Sie sind nicht der dumme Peter“, riefen sie. „Doch, doch, ich bin der dumme Peter.“ Und nun erzählte der Peter, was ihm auf der Weide begegnet war, und wie er die drei Ritter erschlagen hatte. Da freuten sich die Mädchen. Denn ihr müßt wissen, die drei Ritter hatten die Mädchen geraubt und all das Gold, das hatten sie gestohlen.
Am nächsten Morgen spannte der Peter einen Wagen mit sieben Pferden an, und sieben Tage lang mußte jeden Tag siebenmal mit sieben Pferden fahren, um all das Gold aus der Erde zu holen. Von diesem Gold baute er sich ein schönes, stattliches Haus und heiratete das älteste der drei Mädchen.
Doch als er geheiratet hatte, sagte er zu seiner Frau: „Weißt du was, liebe Frau, jetzt gehe ich einmal wieder zu meiner Mutter und gebe ihr einen Teil von meinen Schätzen ab, denn wenn mich die Mutter auch oft geschlagen und gescholten hat, wenn sie mir nicht den Hammer mitgegeben hätte, da hätte ich die Ritter nicht erschlagen, und du wärst nicht meine Frau, und all die Schätze, die lägen noch unter der Erde.“ Der Frau war das schon recht so.
„Aber weißt du“, sagte der Peter, „vorher da mache ich mir einen Spaß mit meiner Mutter. Ich ziehe wieder meinen alten, schmutzigen Peterkittel an und sage, ich hätte es in der Welt zu nichts gebracht, die Mutter möchte mich wieder zu Hause behalten. Du aber kommst in unserer goldenen Karosse nachgefahren und sagst, es sei dir am Wagen ein Rad gebrochen, ob du nicht die Nacht da schlafen könntest. Na, paß einmal auf, was ich da weiter tue.“
Als der Peter das gesagt hatte, zog er sich den alten Kittel an und ging zu seiner Mutter. „Ach, liebe Mutter, nimm mich doch wieder bei dir auf, ich habe in der Welt kein Glück.“ „Natürlich, du dummer Peter, du bist zu allem zu dumm, das habe ich mir gleich gedacht. Hier komm und hilf mir Kartoffeln zu schälen, und draußen im Stall ist auch dein Lager noch, auf dem du schlafen kannst.“
Der Peter war mit allem zufrieden, aber als er in der Ofenecke saß und gerade Kartoffeln schälte, klopfte es, und die Frau vom Peter stand davor und sprach: „Ach, liebe, gute, alte Frau, wollt Ihr mich nicht bei Euch aufnehmen? An meinem Wagen ist ein Rad gebrochen, und ich kann die Nacht nicht weiterfahren.“
„Aber von Herzen gern“, sprach die Mutter, „kommt nur herein und eßt erst mit zur Nacht, ehe Ihr schlafen geht.“ Als aber die schöne Dame an dem Tisch saß und sich den Teller mit Kartoffeln gefüllt hatte, da stand der Peter auf, ging an den Tisch und aß mit der Hand eine Kartoffel nach der anderen vom Teller weg.
„Ach“, rief die Mutter, „da seh einer meinen dummen Peter an! Du bist aber auch zu nichts zu gebrauchen. Marsch in den Stall mit dir!“ Sie gab dem Peter eine Ohrfeige und jagte ihn zum Zimmer hinaus. Als sie jedoch die schöne fremde Dame in ihr Schlafgemach bringen wollte, wer lag schon in dem Bett und schnarchte? Der dumme Peter!
„Aber, Peter, dummer Peter“, rief die Mutter voll Entsetzen, „was machst du in dem Bett der fremden Dame?“ „Ach was, fremde Dame“, rief der Peter, sprang aus dem Bett und gab seiner Frau einen Kuß mitten auf den Mund, „das ist doch meine Frau.“ Ja, das wollte die Mutter gar nicht glauben, und sie war sehr erschrocken.
Aber der Peter, der war seiner Mutter nicht böse, sondern er sagte: „Weißt du was, Mutter, wenn du mich auch oft geschlagen und gescholten hast, aber wenn du das nicht gemacht hättest, da wäre ich nie in die weite Welt gezogen, und wenn du mir nicht den kleinen Hammer mit auf den Weg gegeben hättest, da hätte ich die Riesen nicht erschlagen können, und ich hätte die Mädchen nicht befreien können, die, die Ritter geraubt hatten, hätte den Schatz nicht entdeckt, und diese schöne junge Dame wäre gar nicht meine Frau. “
Und nun war alles gut. Und am nächsten Morgen brachte der Peter seiner Mutter einen Wagen mit Gold, und sie und seine Schwester hatten zu leben bis zu ihrem Tod, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie alle zusammen noch heute.
Märchen aus Deutschland
DER PRINZ ALS MEISTERDIEB ...
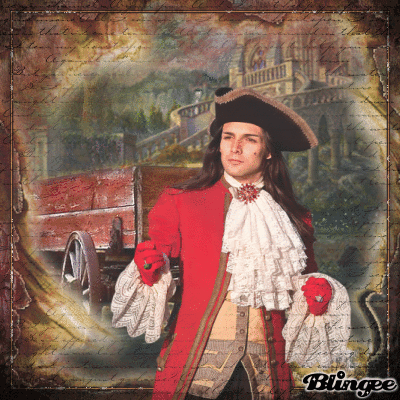
Es war einmal ein Herzog in Pommern, der war gut Freund mit dem russischen Kaiser, und sie kamen oft zusammen und tranken sich zu, bis sie schwer betrunken waren. Eines Tages machten sie miteinander ab, dass des Herzogs beide Söhne des Russen zwei Töchter heiraten sollten und zwar sollte Prinz Friedrich die Finetee, Prinz Karl aber die Galethee zur Frau bekommen.
Der Herzog von Pommern schrieb das als bald im Testament nieder; weil er aber betrunken war, verschrieb er sich und setzte statt der Worte: "Prinz Karl soll die russische Galethee kriegen", "Er
soll sich den russischen Galgen verdienen".
Als er nun starb, ward das Testament eröffnet und den Prinzen verlesen.
"Was unser Vater bestimmt hat, das müssen wir tun", sagten sie, und Prinz Friedrich zog mit großem Gepränge nach Russland, wo er mit der russischen Finetee verheiratet wurde; Prinz Karl dagegen zäumte sein Pferd und vernähte ein gut Teil Goldstücke in den Sattel, dann schwang er sich auf das Tier und ritt ebenfalls über die Grenze, um sich den russischen Galgen zu verdienen.
Er zog von einen Stadt zur anderen und von einem Dorf zum anderen, er ritt über Berg und Tal, über Stock und Stein, bis er endlich in einen großen dunklen Wald gelangte, der kein Ende nehmen sollte. Auf den Abend kam er obendrein von der Straße ab, und es dauerte gar nicht lange, so hielt er vor einen großen tiefen Bruch, und Weg und Steeg hatten ein Ende.
Wie er so da stand und wusste nicht aus noch ein, trat aus der Dickung ein schwarzer Mann auf ihn zu und sprach: "Was tust du hier?" - Antwortete Prinz Karl: "Ich habe mich verirrt." - Sagte der Mann: "Wenn du mir die Hälfte von dem Geld gibst, das du in den Sattel genäht hast, so will ich dich wieder auf den richtigen Weg leiten."
Die Rede gefiel dem Prinzen Karl so übel nicht, denn was nützte ihm das Geld, wenn er in dem Sumpfe ertrank; er trennte darum den Sattel auf und gab dem Mann die Hälfte von den Goldstücken. Der ergriff darauf das Pferd beim Zügel und führte es durch Gestrüpp und Buschwerk, bis sie wieder auf dem Weg waren. Dann verabschiedete er sich von dem Prinzen; doch ehe er ging, schenkte er ihm noch eine Kugel und sagte dabei: "Wenn du die in den Mund nimmst, so bist du unsichtbar." Prinz Karl steckte die Kugel zu sich und zog seiner Straße.
Den anderen Tag kam er wieder vom Wege ab, und nachdem er eine Zeit lang herumgeirrt war, stand er vor dem selben Bruch wie gestern. "Du hälst ja noch immer hier", rief eine Stimme, und der schwarze Mann trat aus der Dickung heraus. "Ja, es ist schlimm mit diesem Walde", sagte Prinz Karl, "wer darin nicht Bescheid weiß, verirrt sich und ertrinkt am Ende im Sumpfe. Kannst du mich nicht noch einmal auf den rechten Weg bringen?" -
"Mit dem größten Vergnügen", antwortete der schwarze Mann, "wenn du mir wiederum die Hälfte von dem Gelde gibst, das du noch hast." Dann behielt Prinz Karl zwar nur noch ein Viertel von dem ganzen Schatz; aber wozu brauchte er auch das rote Gold, um den russischen Galgen zu verdienen? Er gab darum dem schwarzen Mann den geforderten Preis, und dieser führte ihn durch das Dickicht auf die rechte Straße zurück, und schenkte ihm zum Abschied eine kleine Rute.
"Was du damit schlägst, sei es Mauer oder Fels, das öffnet sich", sagte er und verschwand. Prinz Karl aber setzte seine Reise fort, bis er vor einer Ellerei halt machen musste. Da er mit dem Pferd nicht heil durch den Busch kommen konnte, trennte er mit dem Schwerte den Sattel auf, nahm das letzte Gold heraus und steckte es zu sich in die Rocktasche; dann ließ er das Ross laufen und ging zu Fuß weiter und sprang von einem Bülten zum anderen, bis die Sonne unterging und es finster wurde am Himmel.
Da stieg er auf einen hohen Ellernbusch und hielt Ausschau, und siehe, nicht weit von ihm schimmerte ein Licht durch die Bäume. Eilends stieg er wieder herab und setzte seine Wanderung fort, bis er vor dem Hause stand. Er öffnete die Tür und ging hinein; da saß ein alter grauer Mann auf der Ofenbank, der fragte ihn, was er wolle.
Prinz Karl merkte wohl, dass er in eine Räuberhöhle geraten war; darum sprach er geschwind: "Guten Abend! Kennst du mich nicht? Ich gehöre zum schwarzen Karl und habe mich allein gerettet und will jetzt bei euch wohnen und euch helfen." Über diese Rede verfärbte sich der Alte, denn der schwarze Karl hatte eine Brust wie Eisen und die Kugeln prallten ab von seinem Leibe und konnten ihn nicht durchbohren; seine Bande aber war als die schlimmste verschrien weit und breit.
Deswegen hieß er den Gast freundlich willkommen, trug ihm Speise und Trank auf und bat ihn zu warten, bis die anderen nach Hause kämen. Um Mitternacht traten elf starke Kerle herein; aber Prinz Karl fürchtete sich nicht, ging auf sie zu und drückte einem jeden die Hand, dass es krachte. "Wer ist das?" fragten die Elf verwundert den Alten, der aber sagte:
“Es ist einer von den Leuten des schwarzen Karl. Er ist bei der großen Schlacht davon gekommen und hat das Leben geborgen. Jetzt will er bei euch bleiben und euch helfen." Sprachen die Elf: "Sei uns willkommen! Aber das sagen wir dir von vorn herein: gemordet wird nicht, wir vollbringen alles mit List! Nur wenn es sich nicht anders tun lässt, gehen wir den Leuten ans Leben." -
"So habe ich es beim schwarzen Karl auch gehalten", gab er kurz zur Antwort. Dann setzten sie sich allesamt zu Tische nieder, und nachdem sie satt gegessen und getrunken hatten, legten sie sich
zu Bette und schliefen, bis der Tag anbrach.
Am anderen Morgen sprach der alte graue Mann, welcher der Hauptmann der Bande war, zu Prinz Karl: "wir haben die Sitte: Wer bei uns eintreten will, muss ein Probestück machen." -
"Die Sitte lobe ich mir", sagte Prinz Karl und ging zum Hause hinaus. Über ein Weilchen erblickte er einen Schlächter, der zwei Ochsen vor sich her trieb. Die will ich stehlen, ohne Blut zu vergießen, dachte er bei sich. Dann lief er durch das Gebüsch dem Schlächter voraus und warf seine Säbelscheide auf die Straße.
Als der Schlächter vorbei kam, sagte er: "Sieh da, eine schöne Scheide! Was nützt sie dir aber ohne Säbel?" Damit ließ er die Scheide liegen und zog seiner Straße weiter. Das hatte Prinz Karl nur gewollt, und schnell hob er die Scheide auf und lief, was er konnte, quer durch den Wald und über den Berg herüber, um den sich die Straße zog. Dort warf er den Säbel in den Sand und wartete hinter dem Busche, bis der Schlächter kam.
Als dieser den blanken Säbel erblickte, sprach er bei sich: "Hättest du doch vorhin die schöne Scheide mitgenommen, hier liegt der Säbel dazu!" Geschwind band er die Ochsen an einen Baumstamm und lief die Straße zurück, um die Scheide zu suchen. Aber er fand sie nicht, und als er zurückkam, war auch der Säbel verschwunden und die Ochsen mit ihm, die hatte Prinz Karl über den Rasen in die Räuberhöhle geführt, so dass man die Spuren nicht sehen konnte.
"Das hast du gut gemacht"; sprach der Hauptmann, "und wenn du uns morgen noch einen Ballen Tuch aus der Stadt ohne Geld kaufen kannst, so wollen wir dich halten wie einen der unseren, und du sollst unser Spießgeselle werden." Das ließ sich Prinz Karl nicht zweimal sagen.
Den anderen Tag nahm er Pferd und Wagen, einer von den Elfen musste als Kutscher auf den Bock, während er wie ein vornehmer Herr, auf jedem Finger einen Ring, in dem Rücksitz saß. Außerdem hatte er bei sich eine Truhe, die klipperte und klapperte, sobald man daran stieß, wie wenn eitel Gold und Silber darinnen wären.
Als er nun mit seinem Gefährt in der Stadt angelangt war, hieß er die Kutsche vor dem besten Laden halten. Dort stieg er aus und ließ sich das feinste Tuch und das teuerste Seidenzeug vorlegen. Der Kaufmann sah nur auf die großen Ringen mit den glänzenden Steinen und freute sich, einen so reichen Kunden bekommen zu haben, und konnte nicht genug Ballen herbei schleppen.
"Ich nehme es, wie es da ist, ungesehen", sagte Prinz Karl, "und über die Bezahlung werden wir nachher einig werden. Schafft nur das Zeug auf den Wagen herauf und nehmt derweil die Truhe an Euch." - Das ist sein Geldkasten, dachte der Kaufmann bei sich und stieß den Ladendiener heimlich in die Rippen, und dann rechneten sie beide im voraus zusammen, wie viel sie bei dem Handel verdienen würden.
Prinz Karl aber ging aus dem Laden, als ob er sich in der Stadt erlustigen wollte. Das tat er jedoch nur so, in Wahrheit lief er vors Tor, und als der Räuber mit dem Wagen an ihm vorbeifuhr, sprang er geschwind zu ihm auf den Bock, und nun brachten sie die Ladung in den Wald hinaus in die Räuberhöhle. Da war es Zeug genug, dass sich die ganze Bande neu einkleiden konnte, und Prinz Karl wurde in allen Ehren eines Räubers von dem Hauptmanne eingesetzt.
Der Kaufmann wartete inzwischen zwei kurz und drei lang, dass der vornehme Herr zurück kommen sollte. Als er immer noch nicht bei ihm vorsprach, wollte er sich an der Geldkiste schadlos halten; doch wie er den Deckel der Lade erbrach, war nichts darin als Kieselsteine und Glasscherben, das hatte geklungen wie Geld, wenn man mit dem Fuße daran stieß.
Der Kaufmann fluchte über den argen Dieb, die Räuber aber lobten ihn. Doch Prinz Karl wollte von alledem nichts wissen und noch eine dritte Probe bestehen, obwohl er sie gar nicht mehr nötig hatte. "Kinder", sagte er, "aller guten Dinge sind drei; heute Nacht will ich mit euch des Kaisers Schatzkammer bestehlen." -
"Au!" riefen die Räuber, "das tun wir nicht, das bringt uns an Rad und Galgen." - "Ich gehe voran", sagte Prinz Karl, "und wer ein Herz hat, der folge mit." Da mochten sich die Räuber nicht lumpen lassen und taten, wie er ihnen befahl.
Er hieß sie aber den Wagen voll Stroh laden, und als sie mit Einbruch der Nacht vor der Stadt angelangt waren, mussten sie die Räder und die Hufe der Pferde mit Stroh umwickeln, dass niemand das Klappen der Eisen und das Knarren der Räder gewahr würde.
Als sie nun vor dem Kaiserlichen Schloss hielten, zog Prinz Karl die kleine Rute aus dem Busen hervor und schlug damit an die Mauern. So gleich taten sie sich auseinander. Die Wächter auf dem Hof schliefen, wie es Wächter gemeiniglich zu tun pflegen, und so gelangten sie ungestört bis an die Schatzkammer.
Ein Schlag mit der Rute, und die schwere Eisentür sprang auf, und jeder Räuber steckte so viel Gold und Silber zu sich, als er in seinem Sacke nur davon schleppen konnte. Endlich waren sie fertig, und nachdem sie alles auf den Wagen geladen hatten, fuhren sie ebenso lautlos wieder zur Stadt hinaus und in den Wald zurück, aus dem sie gekommen waren.
Am anderen Tage war großes Jammern und Wehklagen auf dem Schloss, denn der Kaiser ließ alle Wächter durchprügeln und jagte sie mit Schimpf und Schande aus dem Schloss, weil sie die Schatzkammer nicht besser gehütet hatten. In der Räuberhöhle jedoch wurde gesungen und gesprungen getanzt und gelacht, denn so viel Gold und Silber hatten sie noch niemals zusammengebracht, als sie auf dem letzten Zuge geraubt hatten.
Nun sollte Prinz Karl auch der Hauptmann werden und der alte Räubervater bot es ihm selbst an, aber er wollte nicht. "Ich bin noch zu jung", sagte er, "und dem Ältesten gebührt diese Ehre." Da gaben sich die anderen endlich zufrieden, und sie lebten einigte Zeit lustig in Saus und Braus. Aber die vielen Schätze, welche sie gewonnen hatten, machten sie lüstern auf noch größeren Reichtum, und sie baten den neuen Bruder, dass er sie noch einmal zum Schloss führen möge.
"Ich will es tun, aber es ist euer Unglück", sagte Prinz Karl, denn er ahnte wohl, dass der Kaiser so kurz nach der Tat doppelte Wachen ausstellen würde. Doch die Räuber ließen sich nicht davon abbringen. Da befahl er, den Wagen zum zweiten Male mit Stroh zu beladen, und dann fuhren sie zur Stadt, und der Räubervater blieb allein in der Höhle zurück.
Am Tor wurden wiederum die Räder und die Eisen der Pferde mit Strohbändern umwickelt und als sie auf diese Weise lautlos bis an die Schlossmauern gelangt waren, schlug Prinz Karl mit der Rute gegen das Gemäuer, und siede da, es klaffte auseinander.
Gierig schlich einer nach dem anderen durch die Öffnung hinein; aber sobald sie drinnen waren, wurden sie von den Schildwachen warm beim Wickel genommen, in Fesseln gelegt und in den Kerker geworfen.
Nur Prinz Karl ging frei aus, denn er hatte seine Kugel in den Mund genommen, und er hörte, wie die anderen sagten:" Wer fehlt denn? Wir waren doch zwölf und hier sind nur elf? Richtig, der Jüngste ist nicht da, der ist doch klüger wie wir anderen zusammen genommen!"
Am anderen Morgen wurden die Räuber vor den Kaiser gebracht, und nachdem jeder fünfzig aufgezählt erhalten hatte, fragte er sie, wo sie ihre Höhle hätten und wie groß ihre Bande wäre. Erst wollte sie nicht mit der Sprache heraus; als sie aber noch fünfzig erhalten hatten, sagten sie einmütig, sie seien ein Hauptmann und zwölf Mann, und ihre Höhle hätten sie draußen im Walde bei dem großen Ellernbruch.
Da schickte der Kaiser seine Soldaten hin, die nahmen den Räubervater gefangen und luden das Gold und Silber, das sie in der Höhle fanden, in große Karren und führten es in die Stadt zurück, wo es der Kaiser wieder in die Schatzkammer schütten ließ. Nun war alles da, nur der Dreizehnte fehlte.
"Ihr sollt nicht leben und nicht sterben", rief der Kaiser, "ehe ihr ihn nicht verraten habt." - Wir wissen ja selbst nicht, wie er heißt"; jammerte der Hauptmann, "er sagte, er sei vom Schwarzen Karl, und vierzehn Tage war er nur bei uns, da hat er all das Unglück, angerichtet." Der Kaiser glaubte aber den Reden nicht, und jeden Tag bekamen die Räuber Prügel, dass sie gestehen sollten, wo der Dreizehnte sei.
Indessen schlenderte Prinz Karl in den Straßen umher. Und wie er einmal stille stand und besah seine Stiefel, merkte er, dass es mit den Sohlen nicht zum besten bestellt war. Nun hatte unweit davon ein Flickschuster seinen Laden. Der soll den Schaden wieder gut machen, dachte er bei sich und trat zu ihm in die Werkstatt herein.
"Meister Schuster", sagte er, "hier ist ein Goldstück; geh hin und kauf gutes Leder ein und besohle mir die Stiefel." Der Altflicker nahm das Goldstück und lief, was er laufen mochte, denn solch vornehmen Herrn hatte er noch niemals zum Kunden gehabt. Während er fort war, zog Prinz Karl ein zweites Goldstück aus der Tasche und gab es der Frau, dass sie ein gutes Mittagessen besorge für drei Mann mit Braten und Wein.
Da ging nun ein schönes Leben bei den Altflickersleuten an, der Meister besohlte mit neuem Leder, und die Frau briet und schmorte, bis sie nicht mehr wussten, wo sie waren, und trunken zu Bette gingen. Die Stiefel wurden auf diese Weise den ersten Tag nicht fertig, das nimmt kein Wunder, und am zweiten auch nicht, denn da trieben sie es nicht anders.
Als sie aber endlich doch fertig waren, zog sie Prinz Karl auf seine Füße, lobte den Meister wegen der guten Arbeit und sprach: " Warum geht es ihm bei der guten Arbeit so schlecht?" Antwortete der Altflicker: "Ach lieber Herr, ich bin ein armer Mann und kann kein gutes Leder kaufen. Wer bei mir einmal besohlen ließ, der kam das zweite Mal nicht wieder. Und mit Goldstücken bezahlt sonst niemand, da seid ihr der erste." -
"Wenn es ihm an Geld fehlt, so geh er doch in des Kaisers Schatzkammer", sagte Prinz Karl, "da ist Gold und Silber wie Heu." - "Ja, wer das dürfte!" sagte der Meister. " Das ist nicht so schlimm", sprach Prinz Karl; und als es dunkel wurde, hieß er den Altflicker einen Sack auf den Buckel nehmen und ging mit ihm zum Schloss.
Sobald Prinz Karl das Gemäuer mit der Rute berührte, wich es auseinander, und sie hatten freien Gang, denn die Wachen waren schon wieder sorglos geworden und schnarchten um die Wette. Noch ein Schlag an die Eisentür, und sie standen in der Schatzkammer, und der Schuster füllte seinen Sack mit Gold, so schwer er nur irgend tragen konnte, und dann kehrten beide durch die Mauerritze in die Werkstätte zurück.
Dem Schuster erging es aber nicht anders wie den Räubern. Als er viel Geld hatte, war es ihm nicht Geld genug, und er sprach zu seinem Gast: "Wie ihr es macht, kann einer leicht zu Geld kommen. Aber die Zeiten sind schlecht, und die Preise sind hoch, was meint ihr, wir gehen heute Abend noch einmal in die Schatzkammer." -
"Zum zweiten Mal ist es gefährlich", warnte Prinz Karl. Aber da sich der Flickschuster nicht raten ließ, ging er mit ihm, und als sie an das alte Loch gekommen waren, kletterte der Schuster geschwind hinein. Doch er kam nicht weit, denn kaum hatte er die Beine auf der anderen Seite der Mauer, so griffen die Schildwachen, welche diesmal besser aufpassten, zu und zogen und zogen, damit sie ihn ganz hinein bekämen.
Prinz Karl hatte das wohl bemerkt, und da er den Meister nicht zu den Soldaten lassen wollte, zog er am Kopfende. Doch drinnen waren vier und draußen nur einer. "Verloren ist er doch", sprach Prinz Karl bei sich, und ratz! schnitt er ihm mit seinem langen Messer den Kopf ab, damit er wenigstens nicht noch sagen konnte, wo der dreizehnte Räuber geblieben sei.
Den anderen Morgen war die Freude groß im Schloss, denn sie glaubten allesamt, jetzt habe man den Dreizehnten erwischt. Als die Leiche aber dem Räubervater gezeigt wurde, schüttelte der selbe den Kopf und sagte: "Das ist der Dreizehnte nicht, dies ist ein kleiner schmächtiger Kerl, aber unser Bruder war groß und stark; er ist es gewesen, der diesem Mann den Kopf abschnitt."
Um sein Leben zu retten, gab er dem Kaiser den Rat, er solle die Leiche, die Füße nach vorn, auf einen Karren legen und zum Schindanger fahren lassen, aber im Umwege durch alle Straßen der Stadt. Wer dann schreie bei dem Anblick der Leiche, der sei ein Verwandter des Geköpften und könne wohl angeben, wo der Dreizehnte sei.
Und so tat der Kaiser auch. Während nun Prinz Karl bei der Altflickerin in der Werkstatt saß und erzählte, wie ihrem Manne die Geldgier das Leben gekostet habe, und dabei fleißig zu seinem Zeitvertreib mit Pechdraht und Nadel hantierte, führte der Scharfrichter den Schinderkarren mit der Leiche des Meisters an dem Fenster vorbei.
"Du meines Lebens!" schrie die Frau auf und fiel von einer Ohnmacht in die andere. Prinz Karl aber nicht faul und hieb sich das Schustereisen in das Knie, dass das Blut zur Erde floss. Als nun die Henkersknechte herbei kamen und Nachfrage hielten, weshalb die Frau so geschrien habe, wies er auf das strömende Blut.
Da waren die Männer zufrieden gestellt und zogen mit ihrem Karren weiter, aber den Dreizehnten fanden sie nicht. Prinz Karl ärgerte sich jedoch, dass der Kaiser so scharf hinter ihm her war, und er beschloss, ihm einen Streich zu spielen. Das stellte er so an: Er nahm seine Kugel in den Mund und ging unsichtbar in das Schloss hinein, die Treppen hinauf, bis er in der Kaisers Zimmer gelangte.
Dort lagen auf dem Tisch die Tagesbefehle, welche der Kaiser an den Feldmarschall und an den Bürgermeister zu schicken pflegte. Eins fix drei hatte Prinz Karl den ersten Brief erbrochen, und statt des Befehls, der darin stand, schrieb er hinein: "Weil die Soldaten gestern so gut exerziert und geschossen haben, sollen sie heute Mittag ein jeder zwei Pfund Fleisch zu essen bekommen", denn bei den Russen lagen dazumal alle Soldaten in Bürgerquartieren.
In den anderen Brief aber schrieb er: "Weil die Soldaten so schlechtes Gesindel sind und allesamt nichts taugen, sollen ihnen die Bürger heute Mittag nur trockene Kartoffeln vorsetzen." Dann versah er die falschen Briefe mit des Kaisers eigenem Siegel und ging wieder seine Wege zu der Schustersfrau.
Am Vormittag verlas der Feldmarschall den Soldaten, dem Bürgermeister und den Bürgern, den Tagesbefehl; und die Soldaten freuten sich, dass sie so viel Fleisch bekommen sollten, und die Bürger freuten sich, dass sie heute kein Fleisch zu geben brauchten.
Als nun aber die Soldaten müde vom Dienst heimkamen und es nicht fanden, wie ihnen durch Tagesbefehl verheißen war, wurden sie sehr zornig und schalten die Bürger Diebesgesindel und schlugen auf
sie ein, und es war ein Heulen und Wehklagen in der Stadt, wie es noch niemals gehört worden war. Endlich ließ der Feldmarschall Generalmarsch schlagen und als die Trommeln gingen:
Kam - er - ad -kum!
Kam - er - ad -kum!
Da mussten die Soldaten freilich vom Schlagen abstehen und zur Fahne eilen. Der Kaiser war sehr böse, als er von der Sache hörte, und konnte nicht begreifen, wie die falschen Befehle aus seinem
Zimmer gekommen waren.
Der Räubervater aber sagte zu ihm: "Das ist niemand anderes gewesen als der Dreizehnte; und wenn Ihr seiner nicht habhaft werdet, so bringe er noch Euch und das ganze Land ins Unglück!" Das sagte er aber nur, damit er alle Schuld auf den Prinzen Karl schieben mochte und mit dem Leben davon käme.
"Wie soll ich ihn aber fangen?" fragte der Kaiser. Da gab ihm der Räubervater folgenden Rat: "Der Dreizehnte ist ein großen starker Mann und dabei noch jung an Jahren. Lasst alle jungen Leute zu Euch auf das Schloss kommen, dass sie mit der Prinzessin Galethee und mit den Hofdamen tanzen; und die Nacht über müssen sie in dem Saale bleiben und auf einer Streu schlafen.
Wie ich den Dreizehnten kenne, wird er bei dem Feste nicht fehlen und in der Nacht Eure Tochter küssen. Dann muss ihm die Prinzessin mit schwarzer Farbe einen Strich auf die Wange malen, und am anderen Morgen könnt ihr sehen, wer Euch all das Unheil angerichtet hat."
Das ist ein guter Rat, dachte der Kaiser und tat, wie der Räubervater gesagt hatte. Alle jungen Leute wurden zu einem großen Feste aufs Schloss geladen und durften mit der Kaiserstochter und mit den Hofdamen tanzen, und Prinz Karl war wirklich mitten unter ihnen und tanzte fleißig mit.
Um Mitternacht war der Tanz zu Ende, und die Tänzer wurden auf einer Streu gebettet; die Prinzessin aber bekam vom Kaiser ein Töpfchen mit Farbe in die Hand gedrückt, damit sollte sie demjenigen, der sie bei Nacht stören würde, einen Strich auf die Backe malen. -
Und der Räubervater hatte sich nicht verrechnet. Als alles schlief, konnte Prinz Karl allein keinen Schlaf in die Augen bekommen. Die Kaiserstochter hatte es ihm angetan, und er stand auf und schlich in ihre Kammer und küsste sie. Die Prinzessin gedachte des Gebotes, das ihr der Kaiser gegeben, und sie malte dem Manne einen schwarzen Strich auf die Backe. Dann drehte sie sich um und schlief ein.
Prinz Karl aber war auf seiner Hut und hatte die List wohl gemerkt. Sobald die Prinzessin schlief, stahl er ihr das Töpfchen und malte mit der Farbe jedem Schläfer einen schwarzen Strich auf die Backe, vom Kaiser herab bis zum jüngsten Küchenjungen.
Am anderen Morgen stand der Kaiser früh auf und ging in seiner Tochter Kammer. "Aber Papa", sagte die Prinzessin, als sie die Augen aufschlug; und als der Kaiser nicht wusste, warum sie das sage, wies sie ihm den schwarzen Strich auf der Backe. Da lief der Kaiser in den Saal, und siehe, alle jungen Männer waren in der selben Weise gezeichnet.
Jetzt wurde der Kaiser gar zornig und drohte, den Räubervater lebendig braten zu lassen, wenn er ihm nicht den Dreizehnten schaffe. "Ich kann es nicht und wenn ich sterben muss"; rief der Hauptmann, "nur ein Mittel gibt es noch. Geh in den Saal und versprich dem, der Eure Tochter im Schlafe geküsst und die falschen Tagesbefehle geschrieben hat, die Prinzessin Galethee zur Frau. Dann wird er sich wohl melden."
Anfangs wollte dieser Rat dem Kaiser gar nicht in den Kopf, endlich aber bedachte er sich, dass er dem Reich keinen Besseren hinterlassen könne als einen solch klugen Schwiegersohn. So ging er in der Saal zurück und sprach mit lauter Stimme: "Wer gestern Nacht meine Tochter geküsst und den Spaß mit den Tagesbefehlen geschrieben hat, der melde sich, er soll mein Schwiegersohn werden."
Aber siehe da, niemand meldete sich. Der Kaiser sprach rs zum zweiten Male, es half wiederum nicht. Da setzte er die goldene Kaiserkrone auf und warf den Purpurmantel um und schwur bei Krone und Zepter, er wolle halten, was er gesagt habe.
Jetzt trat Prinz Karl vor und sagte: "Ich bin der Dreizehnte, ich bin es gewesen." - "Wie heißt du denn?" fragte der Kaiser verwundert. "Prinz Karl von Pommern", gab er zur Antwort. "Du bist Prinz Karl?" rief der alte Kaiser voll Freuden, "da solltest du ja schon längst meine Galethee zur Frau bekommen." -
"Davon stand nichts im Testament"; antwortete Prinz Karl, "den russischen Galgen sollte ich mir verdienen." - "Ach, Schnack"; sagte der Kaiser, "das kam damals so, da hat sich dein Vater verschrieben! Das sollte heißen: Prinz Karl soll die russische Galethee kriegen."
Nun war die Freude groß, und es wurde gleich Hochzeit gefeiert, und all die jungen Männer im Saale nahmen daran teil. Und wenn die Prinzessin dem Prinzen bei jedem Kuss, den er ihr an diesem Abend gab, einen schwarzen Strich ins Gesicht gemacht hätte, so wäre er zuletzt so schwarz im Gesicht gewesen wie ein Schornsteinfeger.
Die elf Räuber aber und der alte Hauptmann wurden in Freiheit gesetzt, denn eigentlich war es ja nur Prinz Karl gewesen, der sie zu den schlimmen Dingen angestiftet hatte. Und was das beste an der ganzen Geschichte ist, es ging hübsch alles ohne Blutvergießen ab.
Nur der Altflicker! Du mein Gott, ein Flickschuster, das spricht doch nicht mit, und dabei war er selbst ins Unglück gerannt. Wäre er hübsch zufrieden gewesen, so säße er noch in seinem Laden und machte den Leuten die Stiefel. So aber führte seine Frau ohne ihn das Geschäft fort und heiratete sich einen hübschen jungen Mann, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch.
Märchen aus Pommern
VON DEM BREIKESSEL ...

Sieben Meilen hinter Eulenpfingsten lebten vor alter Zeit ein Mann und eine Frau, aßen und tranken und waren allezeit guter Dinge. Der Mann aber war ein Müller; nun rate, was die Frau war. Und sie hatten eine einzige Tochter, wenn die im Sommer am Bache saß und ihre Füßchen spülte, kamen alle Fische herbei und sprangen vor Freuden aus dem Wasser, so schön war sie.
Einst wurde eine teure Zeit, und es kam nur wenig Korn zur Mühle. Deshalb hatten sie nichts mehr zu essen. Da ging die Frau eines Tages hin, schüttelte alle Kisten und Kasten und klopfte alle Säcke aus, tat das letzte Salz daran, kochte einen Roggenbrei und sagte: "Dies wird die letzte Mahlzeit sein, wir können uns dann hinlegen und sterben."
Als der Brei bald fertig war, kam der Mann in die Küche, nahm den hölzernen Löffel und wollte einmal schmecken. Die Frau verwehrte es ihm, und als er Gewalt brauchen wollte, nahm sie den Kessel auf den Kopf und lief davon, dass ihr die Haare um den Nacken flogen.
Der Mann mit dem Löffel in der Hand setzte hinter ihr her, und als die Tochter das sah, nahm sie ihre Schuhe in die Hand und lief hinter dem Vater her. Und sie kamen in einen Wald, da verlor das Mädchen den einen Schuh, und während sie den suchte, ohne ihn finden zu können, verschwanden Vater und Mutter hinter den Bäumen.
Da setzte sie sich hinter einen Busch und konnte nicht mehr, so müde war sie. Sie weinte und wimmerte, und als sie daran dachte, dass sie ihren einen Schuh verloren hatte, weinte sie noch viel mehr. Den Schuh aber hatte der Zaunkönig gefunden, und die Frau Zaunkönigin wiegte ihre Jungen darin.
Als sie nun da so saß und klagte, dass es einen Stein hätte erbarmen sollen, stand auf einmal eine steinalte Frau vor ihr, die sagte: "Was fehlt dir, mein Kind?" Das Mädchen antwortete: "Ja, die Mutter nahm das letzte Mehl und kochte einen Brei davon, da wollte der Vater schmecken, die Mutter wollte es nicht haben. Nun ist sie davon gelaufen mit dem Kessel auf dem Kopf, und der Vater läuft hinter ihr her mit dem Löffel in der Hand.
Als ich ihnen nachlief, verlor ich den einen Schuh, und während ich den suchte, verschwanden Vater und Mutter hinter den Bäumen. Was soll ich nun anfangen? Hätte ich nur den Schuh wieder!" "Hier hast du einen anderen", sagte die Frau, griff in die Tasche, holte einen funkelnagelneuen heraus und setzte hinzu: "Sei ruhig und tue, was ich dir sage, so wird alles gut!
Geh noch ein wenig tiefer in den Wald, da kommst du an ein großes Haus, das ist ein Königsschloss, da geh hinein. Wenn sie dir dann viele Kleider vorlegen, seidene, baumwollene und leinene, und dir sagen, du sollst dir davon eins wählen, so such dir das schönste seidene aus, und wenn sie dich fragen, warum du dir das wählst, so antworte: ›Ich bin in Seide erzogen.‹"
Das Mädchen bedankte sich und ging und kam bald an das schöne Schloss, und als sie hinein kam, und ihr die vielen Kleider vorgelegt wurden, seidene, baumwollene und leinene, suchte sie sich das schönste seidene aus. Da fragte sie der König: "Warum wählst du dir denn gleich ein seidenes?" Sie antwortete: "Ich bin in Seide erzogen!" Eigentlich war sie aber in Linnen erzogen.
Nun hatte der König einen Prinzen, der war zwölf Jahr alt und sollte heiraten, und als die Müllerstochter in dem seidenen Kleide herein kam, lief es ihm heiß durchs Herz, und er sagte: "Lieber Vater, wenn ich doch nun einmal mit Gewalt heiraten soll, so gebt mir die; eine andere nehme ich nun und nimmermehr!"
Des waren alle froh, und die Hochzeit wurde angesetzt. Eines Tages stand die Braut oben im Saale am Fenster und besah sich die Gegend. Als sie eben noch hinuntersah, siehe, da lief da ihre Mutter vorbei mit dem Kessel auf dem Kopf, dass ihr die Haare um den Nacken flogen, und hinter ihr her lief der Vater mit dem großen hölzernen Löffel in der Hand. Da konnte sie es nicht lassen, sie musste laut auflachen.
Das hörte der Prinz im Nebenzimmer und kam herein und sagte: "Schätzchen, was lachst du?" Sie wollte die Geschichte von ihren Eltern nicht gern erzählen und antwortete: "Ich lache darüber, dass wir in diesem kleinen Schlosse Hochzeit halten sollen, denn wo wollen hier die vielen Gäste unterkommen?"
Da versetzte der Prinz: "Hast du denn ein größeres?" Sie antwortete: "Ja, viel größer!" Sie hatte aber eigentlich gar kein Schloss. "Ei," sagte der Prinz, "so lass uns die Hochzeit noch acht Tage aufschieben! Wir bestellen dann alle auf dein Schloss, fahren gleichfalls dahin und feiern dort die Hochzeit." Damit ging er weg, um es dem Vater zu sagen.
Sie aber stieg in den Hof hinab und war traurig, denn wo sollte das große Schloss herkommen? Und als sie da saß und weinte, war auf einmal die alte Frau vor ihr und sagte: "Was fehlt dir?" Sie antwortete: "Ich stand gerade oben im Saale am Fenster und besah mir die Gegend, und siehe, da liefen meine Eltern unten vorbei, und da musste ich laut auflachen.
Das hörte mein Bräutigam im Nebenzimmer, und als er kam und sich erkundigte, warum ich gelacht habe, wandte ich vor, es sei wegen dieses kleinen Schlosses geschehen, ich hätte ein viel größeres. Nun soll dort die Hochzeit gefeiert werden, und ich habe doch gar kein Schloss."
"Das hast du doch!" erwiderte die Alte; "sei nur ruhig und fahre getrost mit hin, und wenn ihr ein bisschen gefahren seid, springt ein weißer Pudel aus dem Gebüsch, den du allein sehen kannst, wo der hinläuft, lass hinfahren." Damit verschwand die alte Frau, und das Mädchen ging wieder in den Saal.
Als die acht Tage um waren, und die Gäste zur Hochzeit kamen, fuhren sie über die Brücke in den Wald, und bald sprang ein weißer Pudel aus dem Gebüsch, den das Mädchen allein sehen konnte, und wohin der lief, ließ sie ihren Wagen fahren, und die anderen Wagen kamen alle hinterdrein.
Als sie eine Zeit lang unterwegs waren, und den Gästen die Zeit lange zu dauern anfing, fragten sie: "Sind wir noch nicht bald da?" Sie antwortete: "So gleich", und in dem selben Augenblick stand der Pudel still und verschwand im Gebüsch, und wo er verschwunden war, stand plötzlich ein großes Schloss mit hohen Türmen und hellen Fenstern, und lustig drängte sich der Rauch aus allen Schornsteinen.
"Das ist mein Schloss", sagte die Braut, und alle stiegen aus und gingen hinein. Und siehe, die Tische waren gedeckt, die Betten gemacht, und die Bedienten liefen ein und aus. Da hielten sie ein halbes Jahr Hochzeit. Und am letzten Tage, als sie schon eingepackt hatten, um wieder nach dem alten Schlosse zu fahren, und eben zum letzten Mal bei Tische saßen, da plötzlich rannte etwas gegen die Tür, dass sie krachend aufsprang.
"Frau Königin! Frau Königin!" rief eine Frau, die mit einem Kessel auf dem Kopfe herein stürzte, "Frau Königin schützt mich; mein Mann will mich schlagen!" Und der Mann kam hereingestürmt mit einem hölzernen Löffel und war ganz wütend und wollte die Frau schlagen; als er aber die hohen Gäste sah, ließ er es bleiben.
"Das sind meine lieben Eltern!" sagte die junge Königin, und der junge König freute sich, und der alte auch, denn sie hatten die schöne Frau über die Maße lieb, und als diese ihre ganze Geschichte erzählt hatte, mussten die Bedienten den großen hölzernen Löffel nehmen und jedem der Gäste einen Löffel voll von dem Brei, dem alle ihr Glück verdankten, auf den Teller geben, und alle aßen davon und lobten ihn; der Müller und die Müllerin aber bekamen so viel Wein und Braten, wie sie nur essen konnten, und das war sehr viel, denn sie hatten sich ungemein hungrig gelaufen.
Carl und Theodor Colshorn: Märchen und Sagen, Hannover 1854
DAS VÖGLEIN AUF DER EICHE ...
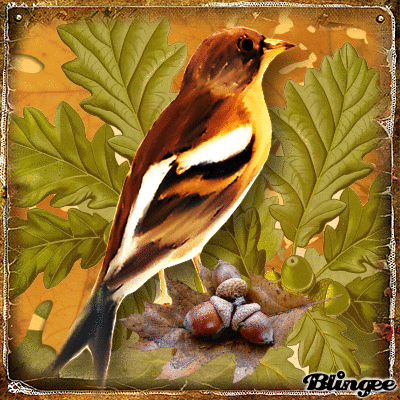
Ein Holzhauer arbeitete oftmals im Walde, und um keine Zeit zu verlieren, ließ er sich von seiner Frau das Eßen in den Wald bringen. Da schlachtete die Frau eines Tags ihr eigen Kind und kochte es und brachte es dem Manne hinaus; der aß nun das Fleisch ohne Arg. Als er aber heimging, hörte er im Walde auf einer Eiche ein Vöglein singen und verstand ganz deutlich die Worte:
Zwick, zwick,
Ein schönes Vöglein bin ich!
Meine Mutter hat mich kocht,
Mein Vater hat mich geßt.
Als der Mann nach Hause kam, erzählte er seiner Frau, was er von dem Vöglein gehört hatte und fragte nach seinem Kinde. Die Frau sagte: »Das Kind liegt schon im Bett und schläft; was Du mir aber da von dem Vöglein erzählst, das kann ich nimmermehr glauben.« Und obgleich der Mann es ihr ganz fest versicherte, daß er die Worte genau so gehört habe, so wollte sie es doch nicht zugeben und sagte, daß er sich getäuscht haben müße.
Am anderen Morgen früh ging der Mann wieder in den Wald, und wie er an die Eiche kam, sang dort das Vöglein das selbe Lied, welches es gestern gesungen hatte. Da verwunderte er sich noch mehr und ging auf der Stelle wieder heim, um seine Frau zu holen, damit sie selbst es hören möchte. Und so wie sie nun mit einander an den Eichbaum kamen, da sang das Vöglein:
Zwick, zwick,
Ein schönes Vöglein bin ich!
Meine Mutter hat mich kocht,
Mein Vater hat mich geßt.
Kaum aber war das Lied aus, so fiel der Eichbaum krachend um und schlug die böse Frau tot. Dem Holzhauer aber geschah kein Leid.
Deutsche Volksmärchen aus Schwaben
VON DREI SCHWÄNEN ...
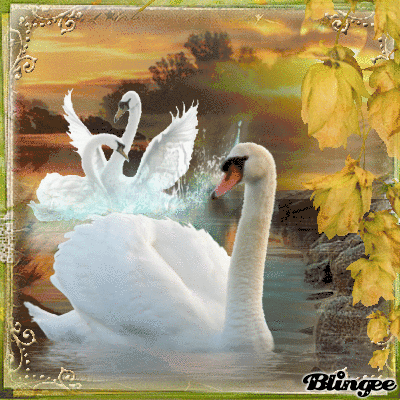
Es war einmal ein Jäger, der war sehr betrübt, weil ihm seine Frau gestorben war, und ging oft ganz allein im Walde herum und dachte, ob er wohl noch eine zweite Frau finden möchte, die er eben so lieb haben könnte, als seine erste. Da ging er einsmals mit seinem Gewehr an der Seite einen ganzen Tag lang immer weiter in den Wald hinein und wußte selbst nicht, wo er hin wollte, und kam endlich an eine Strohhütte.
In die trat er hinein und fand darin einen alten Mann, der hatte ein Kreuzbild vor sich liegen. Er grüßte den Mann, worauf der selbe ihn freundlich aufnahm und ihn fragte, was ihn in diese Waldhütte führe? Da klagte ihm der Jäger sein Leid, daß er seine Frau verloren habe und nun so einsam lebe und nicht wiße, ob er wohl noch einmal glücklich sein werde.
Sprach zu ihm der Alte: »dieser Not wird wohl zu helfen sein. Es werden als bald drei ›Schwäne‹ hierher kommen, die betrachte Dir recht genau! Und wenn sie dann in den Weiher fliegen, so mußt Du heimlich hingehen und ohne daß er es merkt, dem einen Schwan sein Kleid nehmen und gleich damit zurückkommen!« Und wie der Alte dieß gesagt hatte, da flogen drei schneeweiße Schwäne daher zu der Strohhütte, und nachdem der Jäger sie sich angesehen hatte, flogen sie weiter in einen benachbarten Weiher.
Da schlich der Jäger hin und nahm ganz heimlich den Rock, den der eine Schwan ausgezogen und ans Ufer gelegt hatte und brachte ihn zu der Hütte des Alten. Als darauf die Schwäne sich wieder anziehen wollten, hatte der eine nur noch sein Hemd, und kam sogleich als eine schöne Jungfrau zu dem Jäger, der ihren Rock hatte, und zog mit ihm in sein Haus und ward seine liebe Frau.
Ehe der Jäger jedoch den alten Mann verließ, sagte ihm der selbe noch: »Du mußt aber das Schwanenkleid sorgfältig vor Deiner Frau verbergen, daß sie es ja nicht wieder findet!« Das tat der Jäger denn auch und so lebte er fünfzehn Jahre lang mit seiner zweiten Frau und sie gebar ihm mehre Kinder, und beide Eheleute waren recht glücklich miteinander.
Da geschah es, daß der Mann eines Morgens ausging und zu seiner Frau sagte: »ich komme zum Mittageßen wieder!« Und als er fortging, sah die Frau ihm nach, und wie er nun im Walde war, ging sie auf die Bühne, welche der Mann dießmal nicht verschloßen hatte, machte den Koffer auf, worin das Schwanenkleid lag, und zog es an und flog als Schwan wieder davon, weit weit weg. –
Als der Mann nun zum Eßen kam, war die Frau verschwunden, und auch seine Kinder konnten nicht sagen, wo sie geblieben war, denn sie hatten nichts von ihr gesehen.
Da begab sich der Jäger wieder in den Wald zu dem alten Mann und klagte ihm sein Unglück, daß er abermals seine Frau verloren habe und nicht wiße, wo sie hingekommen sei. Da sagte der Mann: Du hast das Kleid nicht gehörig verwahrt; das hat sie gefunden und ist damit fort geflogen.
»Ach, sagte der Jäger ganz traurig, ist es denn gar nicht mehr möglich, daß ich sie noch einmal wieder bekomme?« »Möglich ist es wohl, sprach der Alte; aber jetzt ist es gefährlich; es kann Dir leicht das Leben kosten.« Der Jäger aber wollte ja gern alles für seine Frau tun und so sagte ihm der Alte:
»Du mußt zuerst suchen, in das Schloß zu kommen, wo Deine Frau jetzt lebt, und das wird am besten so gehen: sie hält Esel, die jeden Tag von einem Müller Mehl holen; da geh also zu dem Müller und bitte ihn, daß er Dich in einen Mehlsack steckt. Das Weitere wirst Du dann schon von Deiner Frau erfahren.« –
Darauf begab sich der Jäger zu dem Müller und beredete ihn und ließ sich in einen Sack stecken und von einem Esel weit weg in ein prächtiges Schloß tragen, und wie er dort ankam, fand er auch sogleich seine Frau da selbst, und da konnte niemand eine größere Freude haben als sie, und sie dankte ihrem Manne herzlich, daß er gekommen sei, um sie zu erlösen.
Sie sagte ihm aber: »ehe wir glücklich miteinander leben können, mußt Du mit drei Drachen, die hier sind, kämpfen; sie werden an drei Tagen in verschiedenen Gestalten zu Dir kommen und Dich eine Stunde lang peinigen und quälen; aber wenn Du es aushältst und keinen Laut von Dir gibst, so können sie Dir nichts anhaben und ich werde frei; redest Du aber nur ein einziges Wort, so werden sie Dich umbringen.« Da versprach ihr der Jäger, daß er sie gewißlich erlösen wolle.
Darauf kamen am ersten Tage drei mächtige Schlangen und wanden sich dem Jäger um die Füße, daß er nicht aus und nicht ein konnte, und quälten ihn eine ganze Stunde lang. Weil er es aber still ertrug, gingen sie fort, ohne ihn zu beschädigen. Am folgenden Tage kamen die Drachen als »Krotten« (Kröten) und schoßen in Einem fort feurige Kugeln auf den Jäger ab, daß es schier nicht mehr zum Aushalten war; aber er hielt es doch aus und gab keinen Laut von sich, so daß sie nach einer Stunde ihn wieder verließen. –
Am dritten Tage endlich kamen sie wieder als ungeheure Schlangen und nahmen den ganzen Jäger frei in ihren Rachen, daß es ihm Höllenangst wurde und er meinte, er müße schreien und könne es nicht länger ertragen; aber aus Liebe zu seiner Frau ertrug er es doch. Und als die dritte Stunde nun um war, da standen plötzlich statt der drei Schlangen drei vornehme Frauen da.
Das waren die drei verwünschten Schwäne, die er jetzt miteinander erlöst hatte; und die blieben nun auch bei ihm und bei seiner Frau in dem Schloße, und alle lebten in Frieden und Freude beisammen und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch.
Deutsche Volksmärchen aus Schwaben.
DIE VIER BRÜDER ...
Es waren einmal vier Brüder, die hießen Hans, Jörg, Jockel und Michel, davon war der erste ein Scharfschütz, der zweite ein Windbläser, der dritte ein Läufer und der vierte, der Michel, der war so stark, daß er die dicksten Eichen nur so spielend wie Grashalme aus der Erde rupfen konnte.
Alle vier Brüder aber waren mit einander in die Welt gegangen. Da traf einmal ein Forstmann den Hans, der eben sein Gewehr angelegt hatte, als wenn er in die Luft schießen wollte, weshalb ihn der Förster fragte, wornach er denn ziele?
Sprach jener: »hundert Stund von hier, auf einer Kirchturmspitze in Berlin sitzt ein Spatz, den will ich schießen,« und in dem selben Augenblicke drückte er los und sprach nach einer kleinen Weile: »da liegt er!« Der Förster aber wollte nicht glauben, daß er etwas getroffen habe, worauf der Scharfschütz den Schnellläufer herbei rief und ihn nach Berlin schickte, um den geschoßenen Spatz zu holen.
Der lief auch sogleich hin und war nach zwei Stunden wieder da und brachte richtig den Spatz mit; der war aber so gut getroffen, daß der Kopf rechts, der Leib links von dem Kirchturm herab gefallen war.
Darauf begleitete sie der Förster noch eine Strecke und traf den Jörg, der stand da bei sieben Windmühlen und schien ganz müßig in die Luft zu schauen und hielt beständig ein Rohr vor seinen Mund. Sprach der Förster: »Ei Kamerad, was machst du da?« – »Nun, sprach der Jörg, ich blase die Windmühlen an, daß sie nicht still stehen, weil heute der Wind nicht weht.« –
Nicht weit davon traf der Förster auch den Michel, der hatte ein großes Seil um siebzig Morgen Wald gespannt, daß der Förster gar nicht wußte, was das bedeuten sollte und ihn fragte, was er damit anfangen wolle? »Ach, sagte der Michel, ich wollte mir nur ein Büschel Holz holen, damit ich mir auch ein Feuerle machen kann, wenn es etwa im Winter kalt werden möchte,« und riß den ganzen Wald um, daß es krachte und trug ihn fort.
Da mußte der Förster sich schier verwundern und eilte, daß er nach Haus kam. Die vier Brüder aber wanderten bald darauf nach Berlin.
Da geschah es, daß der König von Preußen schwer erkrankte und der Leibarzt des selben erklärte: der König müße sterben, wenn nicht das Kraut des Lebens, das auf dem Sankt Gotthardt in der Schweiz wachse, binnen acht Stunden herbei geschafft werde. –
Da ließ der König sogleich bekannt machen: »wer das Kraut des Lebens innerhalb acht Stunden vom Sankt Gotthardt aus der Schweiz holen könne, der solle so viel Geld haben, als er nur begehre.« – Darauf meldete sich der Schnellläufer und erklärte sich bereit, das Kraut des Lebens holen zu wollen, wenn man ihm schriftlich den verheißenen Lohn zusichere. Das geschah denn auch.
Darauf sprang der Jockel schnell davon und kam schon in zwei Stunden auf dem Gotthardt an und fand dort auch so gleich das Kraut des Lebens und eilte damit wieder zurück. Als er aber noch etwa hundert Stunden von Berlin entfernt war, setzte er sich, um ein wenig auszuruhen, unter eine Eiche und schlief ein.
Da ward den übrigen Brüdern die Zeit etwas lang, weshalb der Scharfschütz nach ihm ausschaute und als bald sah, wie er unter der Eiche saß und fest eingeschlafen war. Da nahm der Scharfschütz flink sein Gewehr und schoß mit einer Kugel nach dem Rockzipfel des Bruders.
Dem kam es grad so vor, als ob ihn jemand am Rock zupfte, also, daß er aufwachte und schnell nach seiner Uhr sah. Da war es höchste Zeit und er lief gleich fort und kam nach fünf viertel Stunden noch zeitig genug in Berlin an und übergab das Kraut; daraus wurde für den König eine Arznei bereitet, durch welche er in wenigen Stunden vollkommen wieder gesund ward.
Nun war der König sehr froh und ließ dem Schnellläufer sagen, er möge nur kommen und seinen Lohn holen. Der aber ließ vorher einen Sack machen, zu dem gebrauchte er zweihundert Ellen Zwilch, und nahm zugleich seinen Bruder Michel, den Eichenumreißer mit, daß er in dem Sack das Geld tragen sollte, was der König zu geben versprochen hatte, nämlich so viel als Einer tragen könnte, und so begaben sie sich zum König.
Da führte sie der König in eine Schatzkammer und sagte: »hier nehmt Euch so viel als Einer tragen kann!« Da machte der Michel seinen großen Sack auf und nahm eine Tonne Goldes nach der anderen wie einen Spielball in die Hand und warf sie hinein; aber der Sack war noch lange nicht voll und der Michel konnte noch viel mehr tragen.
Deshalb begaben sie sich in eine zweite Schatzkammer und steckten ebenfalls alles Geld in den Sack, was sie dort vorfanden. Als sie darauf aber in die dritte gingen und noch immer nicht genug bekommen konnten, da ward der König bös und gab Befehl, daß zwei Regimenter Fußsoldaten und zwei Regimenter zu Pferd vor das Schloß rücken sollten.
Das dauerte aber zwei Stunden, bis sie ankamen. Unterdessen hatte der Michel seinen Sack über die Schulter geworfen und war fort gegangen. Weil der Sack aber so dick und breit war, so konnte er nicht ganz ungehindert damit aus dem Schloße kommen, sondern mußte ein wenig ziehen; da ging zwar der Sack hindurch, aber auch die ganze Schloßtür nebst acht Säulen blieben daran hängen.
Darauf ging der Michel seines Weges weiter, bis er zum Königstor kam; da war wieder der Durchgang zu klein; allein er drückte herzhaft und hob das ganze Königstor aus und trug es auf seinen Schultern von dannen nebst den acht Säulen der Schloßtür und den vielen Tonnen Goldes.
So kam er mit dieser Last an einen See und sprach: »Ich will doch ein Weilchen hier ausruhen, bis der Jockel und Jörg kommen; auch drückt mich das dumme Säckle ein wenig auf der Schulter.« Und wie er es nun ablegte, da sah er erst, was alles noch auf dem Sacke lag, und als die beiden Brüder jetzt ankamen, so mußten sie über den starken Michel recht herzlich lachen. –
Es dauerte aber nicht lange, da rückten die vier Regimenter Soldaten an den See und wollten das Geld wieder holen. Da nahm aber der Jörg bloß sein Windrohr und blies alle Soldaten in den See, daß sie jämmerlich ums Leben kamen, und darauf zogen die vier Brüder in Frieden weiter, teilten unter sich das Geld und lebten als reiche Leute vergnügt bis an ihr Ende.
Deutsche Volksmärchen aus Schwaben
DER RÄUBER MATTHES ...
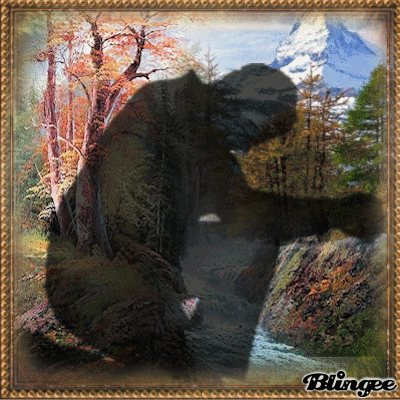
Vor vielen Jahren wollte einmal ein Fuhrmann die große Steige bei Haigerloch im Hechinger Ländchen mit einem schwer beladenen Fuhrwagen hinauf fahren; da stand plötzlich das ganze Fuhrwerk still als ob es verhext wäre und kein Pferd wollte mehr anziehen.
Der Fuhrmann versuchte es nun erst mit der Peitsche und schlug auf die Pferde los, um sie anzutreiben; aber es war umsonst. Dann betete er still; aber auch das half nichts. Endlich ward er zornig und fing an zu wettern und zu fluchen, so arg er es nur konnte.
Darauf trat ein buckeliger Jäger zu ihm hin und sagte: »was gibst Du mir, wenn ich Dir helfe?« – »Laß mal hören, was Du verlangst!« sprach der Bauer. Da sagte der Jäger: »Du mußt mir etwas versprechen, was Du daheim besitzest, ohne es zu wißen.«
Nun besann sich der Fuhrmann eine Weile und dachte: »Alles, was Wert hat in meinem Hause, das kenne ich ja; kenne ich etwas aber nicht, so hat es auch keinen Wert für mich,« und dann sprach er zu dem Jäger: »Du magst es meinetwegen nehmen; hilf mir jetzt nur, daß ich weiter fahren kann.« Da ließ sich der Jäger mit einem Blutstropfen diese Zusage verschreiben und dann konnten die Pferde ganz bequem den Wagen hinaufziehen.
Als der Bauer nun wißen wollte, was der Jäger gemeint hatte, so sprach er: »Deine Frau trägt ein Kindlein unter ihrem Herzen, davon Du noch nichts weißt, und wenn das geboren ist, so gehört es mir.« Da wurde der Bauer sehr traurig und verlangte die Unterschrift zurück; aber der Jäger lachte und machte daß er fort kam.
Seit der Zeit hatte der Bauer keine ruhige Stunde mehr in seinem Hause; er seufzte und weinte, mochte weder eßen noch trinken und konnte bei Nacht kein Auge zu tun. Da drang seine Frau so lange in ihn, bis er ihr endlich alles gestand und sagte, daß er das Kind, das sie bekommen werde, dem Teufel versprochen und verschrieben habe.
Da betete die Frau bei Tag und Nacht und weinte und jammerte; und als die Zeit nahe kam, wo sie ihr Kind gebären sollte, ging sie zu einem geistlichen Herrn ins Kloster und klagte dem ihre Not. Da behielt der Geistliche die Frau im Kloster und tröstete sie; und als sie hier einen Sohn geboren hatte, weihte sie ihn dem Dienste Gottes und seiner Kirche und ließ ihn zurück in dem Kloster.
Hier wurde der Knabe nun früh zu allem Guten angehalten, und war so fromm und brav, daß der Böse keine Gewalt über ihn hatte. Als er fünf Jahre alt war, lehrte man ihn ein Gebet, das mußte er alle Tage in der Kapelle der heiligen Jungfrau her sagen; und als er eben sein zehntes Jahr erreicht hatte, erschien ihm Maria und sprach zu ihm: »in zwei Jahren will ich Dir einen Stab geben, mit dem mußt Du in die Hölle wandern und Deinen Namen, der einem bösen Geiste verschrieben ist, zurück fordern.«
Nach dieser Zeit erschien ihm Maria noch öfters in der Kapelle und gab ihm gute Lehren und offenbarte ihm Mancherlei. Und als die zwei Jahr herum waren, brachte sie ihm den Stab, mit dem er seinen Namen aus der Hölle holen sollte und beschrieb ihm genau alle Wege und Stege, die er zu gehen hatte, und sagte ihm, wie er mit dem Stabe an die drei Höllentore klopfen müße und wie sie dann vor ihm aufspringen würden und wie er die Unterschrift seines Vaters von dem obersten der Teufel sich heraus geben laßen sollte. Das alles merkte sich der Knabe wohl und trat gutes Mutes seine Reise an.
Wie er nun Mutterseelen allein durch einen großen Wald ging, kam er zu einem Baum, der hing ganz voll von Blutroten Äpfeln und daneben kniete ein alter Mann auf dem Stumpfe eines abgehauenen Baumes und rief den Knaben an und sprach zu ihm: »Wohin, mein Sohn?« Sprach der Knabe: »Zur Hölle, um meinen Namen zurückzufordern.«
Sprach der Kniende: »Ach, ich warte schon lange darauf, daß Jemand zu mir kommt; vergiß doch nicht, Dich in der Hölle nach dem Bett des Räubers Matthes zu erkundigen, und gib mir auf dem Rückwege Nachricht, was Du davon erfahren hast!« Das versprach ihm der Knabe und zog weiter und kam an das erste eiserne Höllentor und klopfte mit seinem Stab an das selbe, daß es von selbst aufsprang.
Da trat Lucifer, der Oberste der bösen Geister, hervor und fragte den Knaben, was er wolle? Und als der Knabe ihm sein Begehren gesagt hatte, pfiff Lucifer, und als bald erschien ein großer Haufen schwarzer Männlein, die fragte er, ob einer unter ihnen sei, der den Namen des Knaben habe? Nein, da war keiner, der ihn hatte.
Da zog der Knabe weiter bis an ein zweites Höllentor, klopfte mit seinem Stab an, daß es aufsprang, und als bald erschien auch Lucifer hier und fragte ihn, was er wolle? Und nachdem er es ihm gesagt, pfiff Lucifer abermals einen Haufen schwarzer Männlein zusammen und erkundigte sich nach dem Namen des Knaben; aber auch hier hatte ihn keiner.
So mußte er zum dritten Höllentor eingehen, und nachdem Lucifer hier einen dritten Haufen armer Teufel herbei gepfiffen und befragt hatte, fand sich einer darunter, ein buckliger Jäger, der hatte die Handschrift mit dem Namen des Knaben. Da befahl ihm Lucifer, die Handschrift herauszugeben; er aber sprach: »es soll mich eher eine Krott (Kröte) freßen, ehe ich das tue.«
Da drohte ihm Lucifer und sagte: »gibst Du nicht auf der Stelle den Namen heraus, so wirst Du in das Bett gelegt, das für den Räuber Matthes da steht!« Und dabei zeigte er auf ein leeres Bett, das bestand aus nichts als aus Feuer und Flammen. Da gab der bucklige Jäger schnell die Unterschrift her, und als er die hatte, trat der Knabe unversehrt seine Rückreise an.
Unterwegs kam er auch wieder in den Wald und zu dem Baume, wo er den knienden Mann auf der Hinreise gesehen hatte und traf ihn noch ebenso dort an. So wie der Greis den Jüngling erblickte, rief er ihm entgegen: »Hast Du das Bett des Räubers Matthes gesehen?« –
»Ja, sprach der Knabe, ich habe es gesehen und mich entsetzt; das Bett war lauter Feuer und eine Flamme schlug über der anderen empor.« – »Das wird mein Bett einmal werden!« seufzte der Greis. –
Der Jüngling aber sagte hierauf, Maria habe ihm in der Kapelle geoffenbart, daß sogar der Räuber Matthes nicht verloren sein werde, wenn er ein aufrichtiges Bekenntnis ablege. Dann versprach ihm der Jüngling, daß er wieder zu ihm kommen wolle, sobald er Priester geworden sei. Das dauerte aber noch zwölf Jahre.
Nach dieser Zeit, als der junge Mann zum Priester geweiht war, machte er sich auf den Weg zu dem Greise, und traf ihn noch ebenso wie vor zwölf Jahren neben dem Apfelbaum auf einem abgehauenen Stumpf kniend, und forderte ihn auf, seine Sünden zu beichten.
Da sprach der greise Räuber mit zitternder Stimme: »so viel Blutrote Äpfel auf dem Baume da sitzen, so viel Himmel schreiende Mordtaten hab ich begangen. Gott sei mir armen Sünder gnädig!« –
Dann verhieß ihm der Priester, weil er so tiefe Reue zeigte, im Namen Gottes Vergebung, und nachdem er das heilige Abendmahl genoßen, sank er plötzlich zu einem rauchenden Asche Haufen zusammen; aus der Asche aber stieg eine weiße Taube empor und flog gen Himmel, und das war die erlöste Seele des Räubers Matthes.
Deutsche Volksmärchen aus Schwaben
DIE ZWEI RIESEN ...

Es waren einmal zwei Riesen, der wilde Witzel und der prahlende Rotzel, die wohnten jeder auf einer Seite eines Berges: hier der wilde Witzel, und da der prahlende Rotzel.
Eines Tages sagt Witzel zu seiner Frau: „Der Rotzel gefällt mir nicht. Ich gehe über den Berg, ich will ihn verprügeln.“ Also steigt er auf der einen Seite hoch und auf der anderen wieder hinunter. Er kommt zum Haus des Rotzels, aber da ist nur seine Frau daheim. „Wo ist der Rotzel? Der rotzelt mir zu viel, ich will ihn verprügeln.“
„Ach“, sagt die Frau, „der Rotzel ist gerade nicht zu Hause. Aber komm doch herein, du kannst warten.“ „Ja, wo ist er denn hingegangen?“, fragt Witzel.
„Ja, schau dort zum Berg. Der Rotzel ist hinauf gestiegen, um zu pinkeln.“
„Um zu pi…?“ „Ja“, sagt sie, „schau nur, wie der Strahl herunter fällt.“ Dabei zeigt sie auf einen Wasserfall, der da unentwegt vom Berg fällt.
„Er wird vor drei Stunden nicht damit fertig sein. Komm nur herein, ich koche dir eine Tasse Tee.“ „Oi“, denkt der Witzel, „drei Stunden macht der das, was muss das für ein Kerl sein!“ Und er sagt zur Frau Rotzel: „Nein, danke, ich geh doch lieber über den Berg nach Hause.“
Er steigt auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite wieder runter und erzählt seiner Frau, was er erlebt hat. „Und wenn er nun kommt und sich rächen will? Der macht Mus aus mir!“ „Lass mich nur machen, und bleib du ganz still“, beruhigt ihn seine Frau.
Unterdessen kommt der Rotzel heim – er war gar nicht auf dem Berg gewesen, er war im Wald, Holz sammeln. Und seine Frau erzählt ihm, dass der Witzel da gewesen ist, und wie das so gegangen ist.
„Was!“, schreit der prahlende Rotzel. „Dieser Angeber, ich zerdrück ihn zu Mus!“
Er steigt auf der einen Seite des Berges hinauf und auf der anderen wieder hinunter. Witzel sieht ihn kommen und jammert. „Sei still“, sagt seine Frau, „leg dich ins Bett, zieh die Decke bis
über die Nase, und rühr dich nicht.“
Dann läuft sie dem Rotzel entgegen und sagt: „Leise, leise, das Kind ist gerade eingeschlafen!“ Sie zieht ihn am Ärmel mit ans Bett und singt: „Schlaf, Kindchen, schlaf…“
Der Rotzel schaut auf den Berg unter der Bettdecke und denkt: „Oi, wenn das das Kind des wilden Witzels ist, wie wild muss dann der Witzel selber sein.“ Und er sagt zur Frau Witzel: „Ich geh doch wieder über den Berg nach Hause.“
Er steigt auf der einen Seite des Berges hinauf und auf der anderen wieder hinunter, und seit der Zeit leben Witzels und Rotzels ganz friedlich nebeneinander.
Märchen aus Ostfriesland
DIE ZWEI MÄDCHEN UND DER ENGEL ...
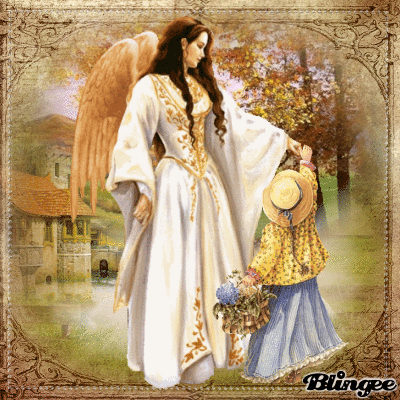
Ein junges Mädchen wollte gern in den Wald, um Erdbeeren zu suchen. Da erlaubte es ihm die Mutter und gab ihm Kraut und Speck mit auf den Weg.
Als das Mädchen an's Tor kam, saß da ein Engel und bat um etwas zu eßen. Da gab ihm das Mädchen so gleich alles hin, was es von der Mutter bekommen hatte, und ging vergnügt weiter in den Wald und suchte sich ein Körbchen voll Erdbeeren.
Und wie es nun heimging und aus dem Walde trat, stand der Engel wieder da und bat um einige Erdbeeren. Die gab ihm das Mädchen gern. Dann sprach der Engel: »wenn Du an's Tor kommst, so wirst Du eine Schachtel finden; die mußt Du mitnehmen, mußt sie aber ja nicht eher aufmachen, als bis Du daheim bist.« –
Nein, das wollte es auch nicht tun, sagte es, und ging hin und fand die Schachtel und trug sie flink in das Haus ihrer Mutter und machte sie dann auf: da war sie ganz voll von kostbaren Edelsteinen und von Goldstücken, also, daß das Mädchen auf einmal sehr reich geworden war.
Das hörte ein anderes Mädchen und wollte nun auch in den Wald um Erdbeeren zu suchen, und bekam auch von der Mutter Kraut und Speck mit auf den Weg. Als es nun an das Tor kam, saß da der Engel und bat: »Gib mir auch ein wenig Kraut und Speck!« das Mädchen aber antwortete: »Iß Du en Dreck!« und ging weiter und suchte sich im Walde einen ganzen Korb voll Erdbeeren.
Und als es aus dem Walde kam, war auch derselbe Engel wieder da und bat: »Gib mir auch ein paar Erdbeern!« »Die Erdbeern eß' ich selber gern,« sagte das Mädchen und gab ihm auch dießmal nichts und ging weiter, worauf der Engel ihr nach rief: »Nun so geh nur hin! am Tore wirst Du eine Schachtel finden; die darfst Du mitnehmen, mußt sie aber zu Haus erst aufmachen.«
Ei, wie konnte das Mädchen da laufen bis sie an das Tor kam und die Schachtel fand! Da war sie ganz außer sich vor Freude. Als sie aber nach Haus kam und die Schachtel aufmachte – was war darin? – lauter kleine schwarze Teufelchen.
Quelle: Deutsche Volksmärchen aus Schwaben
DER GOLDMACHER AUF STOLZENFELS ...
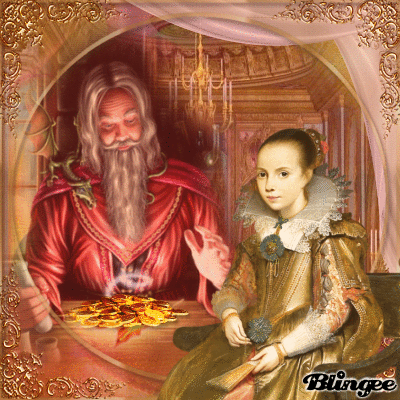
In einer stürmischen Nacht, in der ein heulender Orkan über die Zinnen brauste und die Wetterfahne krächzend bald nach rechts, bald nach links drehte, in der Regengüsse nieder rauschten und die Erde wegzuspülen schienen, pochte ein Pilger an den Toren der Burg Stolzenfels und wurde von dem Schatzhüter des Erzbischofs, Werner von Falkenstein, gastfreundlich aufgenommen.
Der Pilger nannte sich Maso und war ein finsterer hagerer Mann, dessen dunkler Bart ihm bis zum Gürtel fiel und seinem Gesicht einen Ausdruck von nachdenkendem Ernst gab, der oftmals sonderbar mit dem tückischen und schadenfrohen Blitzen in seinen Augen kontrastierte. Seine Sprache war rätselhaft, gemessen – und wenn er in Eifer kam, voll pathetischen Schwunges.
Seine Gestalt erhob sich ansichtlich, seine Augen glühten, und eine gewisse Majestät umgab sein ganzes Wesen. Um jene Zeit der entstehenden Wissenschaft waren selbst tüchtige Geister auf die Abwege der Alchimie, Astrologie und Magie geraten. Man glaubte durch die errungenen Anfangskenntnisse schon Herr der Natur zu sein und zog den Hang zum Wunderbaren in den Kreis der Forschung, um hierdurch in die Tiefen ihrer Gesetze einzudringen.
Besonders war es die Goldmacherkunst, welche die hellsten Köpfe eingenommen hatte; denn Gold war damals wie heute, der erste Hebel zur Macht, und viele Truhen waren durch die fortwährenden Fehden und die notwendige Haltung von Söldnern arg geleert.
Auch der Schatzmeister ergriff die Leidenschaft des Schmelzens, und als der gastfreundlich aufgenommene Pilger sich als einen Gelehrten in der Kunst des Schmelzens zu erkennen gab und die Tiefen seiner Kenntnisse vor dem lauschenden Ohre des Ritters mit geheimnisvoll durchwebten Worten entrollte, war es beschlossene Sache des Ritters, auch sein Glück zu versuchen, um den Stein der Weisen zu finden.
Er richtete dem Pilger ein abgelegenes Burggemach ein und brachte tagelang hier zu, um sich immer noch tiefer in das lockende Netz des zu gewinnenden Reichtums verstricken zu lassen. Der Schatzmeister hatte eine Tochter, die in holder Anmut herangewachsen war und mit Liebe ihrem Vater das Leben versüßte.
Mit geheimer Angst sah sie ihn mit dem ihr unheimlichen Menschen verkehren, und tiefes Weh bereitete ihr sein in der letzten Zeit so auffallendes und unstetes Benehmen. Er achtete nicht mehr auf ihre Liebkosungen wie früher, ja sie schienen ihm manchmal lästig, und länger als gewöhnlich schloß er sich in das entlegene Gemach, von dem er stets niedergeschlagener und trübsinniger hervorkam.
Eines Tages kehrte ein Ritter auf der Burg mit der Nachricht ein, daß der Erzbischof mit einigen Edlen und Rittern ihm folgen und einige Tage am Rhein verbringen werde. Mit Schrecken gewahrte Elsbeth – so hieß das Mädchen – den Eindruck, den diese Nachricht auf ihren Vater übte, denn bleich und verstört taumelte er zurück und wußte sich fast nicht zu fassen.
Später, als er sich allein glaubte, sah sie ihn auf und ab eilen, sich an die Stirn schlagen – und sie hörte ihn darauf laut weinen. Aus innerem Herzen mitweinend, wollte sie in seine Arme eilen, aber mit einem wilden, an Wahnsinn grenzenden Ausdruck, lief er in das geheimnisvolle Gemach und schloß sich darin ein.
Das Mädchen, von der Sorge um ihren Vater getrieben, eilte ihm nach und blieb wie gebannt an der Tür stehen, wo sie seine Stimme hörte, die sich in heftigen Vorwürfen und Klagen erging. Wie vom Blitz gerührt, taumelte sie bleich und voll Entsetzen bei dem Gehörten zurück, mußte gewaltsam den Busen zusammenpressen, um den Schrei der Verzweiflung zu unterdrücken, der sich loszulösen drängte.
Ihrer Sinne fast nicht mächtig und nicht mehr Herr über die wankenden Glieder, lehnte sie sich an die Wand, und nur ein tiefes, lautloses Schluchzen erschütterte das Herz, das ihr zu brechen schien vor Weh und Qual. Gemessen antwortete eine Stimme den heftigen Worten ihres Vaters.
In hinreißender Rhetorik entwickelte diese Stimme die Gründe der stets verfehlten Schmelzung und schloß mit den Worten: „Bringt mir eine reine, makellose Jungfrau, deren Herz noch niemals einen Mann gefühlt hat, und Ihr sollt das Gold gewinnen. Nur Euer Eigensinn hat bis jetzt die Operation mißlingen lassen.“
„Ungetüm! Mit einem Mord soll ich mich beflecken!“ schrie der gepeinigte Mann. „Meine Habe und meine Ehre habe ich eingeschmolzen, das Vertrauen meines Gebieters mißbraucht, soll ich mich auch mit Blutschuld bedecken und ein Mörder werden! Fluch deiner betrügerischen Kunst! Mein Gold schaff mir, oder mit eigenen Händen erwürg ich dich!“
„Nur das Herzblut einer Jungfrau läßt die Schmelzung gelingen; doch wenn Ihr es wünscht, versuche ich es noch einmal!“ „Versucht! Versucht! Ich muß das Gold haben. Ich will das Gold haben, und wenn ich der Hölle mich verkaufen sollte!“ Heftig flog die Tür auf, und er stürzte mit wilden Sätzen hinweg, um in der freien Natur seine Qual zu betäuben.
Mit einem spöttischen Lächeln schaute der Alchimist ihm nach; doch sein Lächeln verschwand plötzlich und machte einem staunenden und bewundernden Ausdruck Platz, denn vor ihm stand hoch und bleich Elsbeth und schaute ihn mit tränenlosen, aber brennenden Augen an. „Ich habe alles gehört, und ich bin die Jungfrau, welche für ihren Vater das Herzblut opfern will und kann.“
Ein wilder Blitz zuckte in dem glühenden Auge des Adepten auf und haftete auf dem Mädchen. Aber der Meister in der Kunst der Verstellung wußte diesen Blitz augenblicklich zu verwischen, und liebvoll und wohlwollend sprach er zu ihr und suchte dabei ihre Hände zu fassen. Schaudernd und voller Absicht trat Elsbeth zurück.
„Berührt mich nicht!“ rief sie, „Eure Berührung ist Entweihung. Sprecht, was ich tun soll, und mit eigenen Händen bohr ich mir den Stahl durch die Brust.“ Nachdenkend wandte der Adept sich ab, und ein grimmiger Ausdruck der Rache umspielte seine Züge, als er ihr mit abgewandtem Antlitz antwortete: „Kommt heute um Mitternacht hierher. Ich will die Schmelzung bis dahin vorbereiten, und wenn die Sonne sich erhebt, wird Eurer Vater Reichtum und Ansehen im Überfluß besitzen.“
„Könnt Ihr das schwören? Es auf das Kreuz schwören?!“ Schweigend zog der Adept ein Kruzifix aus der Brust, wandte sich um und hielt es dem Mädchen entgegen: „Ich schwöre es dir“, sprach er ernst und feierlich. „Wenn du allen meinen Anforderungen folgst, wie ich es dir befehle, mache ich deinen Vater reich und angesehen.“
„Ich komme!“ hauchte die Jungfrau mit einem erleichterten Seufzer und schritt ebenso aus dem Gemach, wie sie herein gekommen war. Ein kurzes unterdrücktes Hohnlachen folgte ihr. „Glaubst du mich zu betören, kleine Taube“, murmelte der Zurückgebliebene, „ich will dich kirren, trotz des Kreuzes, das mir schon treffliche Dienste geleistet hat.“ Und mit einem tückischen Kichern drückte er auf eine geheime Feder und ließ die vergiftete Dolchklinge, welche aus dem selben hervor sprang, schadenfroh in der Sonne funkeln.
„Ein trefflicher Gedanke, die beiden zusammenzustellen“, höhnte er vor sich hin. „Die Hölle im Bund mit dem Himmel, ha, ha; ein trefflicher Gedanke! Puh, die Deutschen, trotz ihres Mutes und trotz der Länge ihrer Schwerter, was sind sie gegen diese kleine Waffe? - Nichts! Durchbohrt sind sie schon, wenn sie schon ganz in der Verehrung des Kreuzes stehen. Hier ist die Macht des Kreuzes“, sprach er, die schändliche Waffe schwingend.
Sinnend schloß er die tödliche Klinge wieder in die entweihte Scheide und verbarg das Kreuz auf seiner Brust; dann schloß er sich vorsichtig ein, eilte in ein Nebengemach und hob mittels eines Brecheisens eine Steinplatte aus dem Boden. Mit triumphierendem Frohlocken entnahm er darauf der geöffneten Vertiefung einen ledernen Sack, knüpfte ihn auf und ließ mit innigem Behagen die darin enthaltenen Goldstücke durch seine Finger gleiten.
„Das ist das Geheimnis der Goldmacherkunst“, sprach er. In dem Tiegel suchen es die Narren; der Kluge dagegen benutzt die Zeit seiner Ernte. Komm Freund, heute wird sich schon die Gelegenheit zur Flucht bieten; das Mädchen öffnet meine Zelle, und wenn der Morgen tagt, werde ich über alle Berge und in Sicherheit sein, ehe sie bei der Verwirrung, die ich anrichte, daran denken, mich zu verfolgen.“
Schmunzelnd befestigte er während seines Selbstgespräches den Beutel an seinem Körper, legte die Platte wieder auf und harrte der Nacht entgegen, welche Zeugin seiner Schandtat und Flucht sein soll. Auf dem Burghof war es während der Zeit, als sie bei dem Adepten verweilte, tumultartig zugegangen.
Knechte und Reisige mit dem Gepäck des Erzbischofs waren in die Burg gesprengt, zäumten unter lautem Gerede und gegenseitigem Zurufen die dampfenden Pferde ab und plauderten mit den Burgsassen, die herbei gekommen waren.
In den Gemächern dagegen eilten die Frauen geschäftig auf und nieder, öffneten die gemalten Fenster, staubten die Möbel ab und überdeckten den Boden mit orientalischen Teppichen, die die Knechte gebracht und herauf getragen hatten. Bleich und ernst schritt Elsbeth unter den Mägden umher und leitete ihre Tätigkeit oder legte die letzte ordnende Hand an, während ihr Vater, er nochmals zu dem Goldschmelzer geschlichen war, um zu sehen, wie weit die letzte entscheidende Schmelzung vorgeschritten, mit neuer Hoffnung zurückkehrte und sichtlich erhoben die Anstalten zum Empfang zum des Gebieters traf.
Der Erzbischof ließ nicht lange mehr auf sich warten. Unter dem lauten Signal des Türmers kam er mit seiner glänzenden Umgebung den Berg herauf geritten und wurde von seinen Getreuen mit lautem Zuruf begrüßt. Freundlich dankend stieg er unter der Hilfe zweier Knappen ab, schüttelte dem Schloßvogt und Schatzmeister die Hand und ließ sich in seine Gemächer geleiten.
Unterwegs jedoch verlangte er Elsbeth zu sehen, und als das Mädchen mit Erröten, aber edlem Anstande ihm entgegentrat, sagte er: „Elsbeth, und ich stehe bei Eurer Holdseligkeit nicht dafür ein, daß Ihr mir keinen der anwesenden Ritter abtrünnig macht.“ Mit scherzendem Drohen stellte er sie den anwesenden Rittern vor, und manches Auge blickte mit zärtlichem Verlangen auf sie, die nur mit Gewalt die Tränen zurückpressen konnte und nicht aufzusehen wagte.
Unter den Rittern des Gefolges war auch ein Edler von Westerburg, auf den der Anblick dieses schönen und bescheidenen Mädchens einen tiefen Eindruck gemacht hatte. Er konnte ihr liebliches Bild den ganzen Abend nicht aus den Augen bringen, und auch in der Nacht stand es vor ihm und wehrte dem Schlaf.
Die Nacht war lau; der Mond schien hinter dem leichten Gewölke bleich und grau auf den Fluren, und die Nachtigall hauchte ihre Moll Akkorde aus dem nahen Gebüsch. Der Ritter legte sich angekleidet ans Fenster und schaute hinab in den von tiefer Ruhe übergossenen Hof, an dessen eine Seite das Haus des Schatzmeisters stand, in dem die Jungfrau wohnte, die schon tiefer in seinem Herzen thronte, als er es ahnte.
Der Vater hatte Elsbeth den Nachtkuß zärtlicher gegeben als seither und entschuldigt, daß sein unstetes Wesen ihr manche Tränen entlockt habe. „Du bist ein gutes Mädchen“, hatte er liebevoll, ihre Wange streichelnd, zu ihr gesprochen, „und morgen sollst du mich wieder so heiter und wohlgemut sehen wie sonst, ehe der Geist des wilden Forschers bei uns eingezogen war. Morgen bin ich von dem Alp befreit, der mich seither preßte, und ich kann wieder glücklich sein, ganz glücklich in deiner kindlichen Liebe.
Mit einem unterdrückten Seufzer war er darauf in sein Schlafgemach gegangen und Elsbeth hörte ihn auf- und abwandeln und leise vor sich hin murmeln. Die Zeit, um die sie bei dem Adepten erscheinen sollte, kam mit geflügelten Schritten heran. Mit Entschlossenheit nahm sie die Leuchte, schlich zum Gemach ihres Vaters und küßte den Türgriff den seine Hand berühren müßte.
„Leb wohl, Vater“, seufzte sie dabei leise, „um mich glücklich zu machen, hast du dich in das Unglück gestürzt, um dich ihm zu entreißen, gehe ich in den Tod. Beweine mich nicht, dort oben sehen wir uns wieder!“ Sie eilte zu dem Adepten, der sich bei ihrem Eintritt von den Büchern erhob, in die er sich vertieft zu haben schien.
Der junge Ritter, dessen Blicke sehnsüchtig nach den düster erleuchtenden Fenster des Mädchens geheftet waren, fühlte sein Interesse angespornt, als er an den hintersten Fenstern einen Schatten stets auf – und abwandeln sah, während an den vorderen Fenstern der Lichtschein verschwand und das Mädchen bald darauf scheu und eilig über den Gang zu dem entlegenen Teil der Gebäude eilte.
Fast willenlos trieb es ihn an ihr zu folgen, und leise und geräuschlos trat er deshalb aus seinem Gemach und eilte ihr nach. Plötzlich war sie verschwunden und er stand im Dunkel. Er ahnte ein Geheimnis. Von einer beklommenen Neugierde getrieben, über die er sich nicht Rechenschaft zu geben vermochte, tappte er sich vorwärts.
Da hörte er plötzlich Stimmen und bemerkte einen Türspalt, durch den er schaute. Er blickte in das Gemach des Adepten. Das Mädchen kniete in dem selben, während sich der Alchimist dicht über einen Tiegel beugte und mit einem Stäbchen dessen Inhalt zu prüfen schien. „Du bist fest entschlossen, alles zu tun, was ich begehre“, sprach er dabei mit einem triumphierenden Seitenblick.
Das Mädchen antwortete so leise, daß es der Lauscher nicht vernehmen konnte. „Du bist entschlossen, Kind, und ich will es deinem Vater lohnen dadurch, daß ich ihm Gold bereite, das er der eigenen Habe und derjenigen des Erzbischofs entzogen. Ehre um Ehre, Blut und Gold, so steht es in dem heiligen Buch der Wissenschaft. Opferst du deine Ehre, empfängt dein Vater alle Ehre, und glänzend wird sein Name unter der Ritterschaft sich erheben. Opferst du dein Blut, so kann ich das Gold bereiten, das ihn der Schmach entzieht.
Bereite dich auf beides, denn der Geist sagt mir, daß deine Schönheit nicht vergehen darf.“ Zähneklappernd und schaudernd vor glühender Eifersucht sah der Ritter, wie der Unverschämte sich dem Mädchen nahte. Er hob den Fuß, um die Tür zu sprengen, aber ein lauter Ausruf des Mädchens lockte ihn nochmals an den Spalt.
„Zurück, Niederträchtiger!“ rief das Mädchen mit edlem Stolz, der sich mit tiefer Abscheu paarte. Mein Blut zu opfern bin ich gekommen, denn das Glück meines Vaters geht mir über alles; aber eine Beleidigung lasse ich mir nicht, als Opfer für den Vater, bieten.“
Der Adept wandte sich achselzuckend ab und sprach wie vor sich hin: „Ich habe keine Zeit zu verlieren. Öffnet Euer Kleid, denn die Mischung klärt sich.“ Mit einem Stäbchen beschrieb er Zauberkreise und murmelte Zaubersprüche, während das Mädchen wieder auf die Knie sank und betete.
Dann griff sie einen Stahl, aber in dem selben Augenblick sprang die Tür krachend auf, und der Ritter fiel ihr in den gegen sich selbst bewaffneten Arm. Das Messer entsank ihrer Hand, und mit einem Seufzer sank sie ohnmächtig zur Erde. Der Adept stand bei dem Einbruch des Ritters fast wie gelähmt vor Schrecken und Angst.
Da der Ritter jedoch dem Mädchen beisprang, nahm er die Gelegenheit wahr und machte sich davon. Langsam erholte sich die Ohnmächtige. Wie aus einem wüsten Traum erwachend, kam sie zu sich, und als ihre Erinnerung zurückkehrte und sie ihre Lage überschauen konnte, brach sie in krampfhaftes Schluchzen und Weinen aus.
Wie heilender Balsam träuften die Ermutigungsworte des Jünglings in ihre Seele und erschlossen ihr Vertrauen. Alles teilte sie ihm mit, denn ihr Herz war voll und sie der Überlegung nicht mehr mächtig. Als sie schwieg und ihr Gesicht in die Hände vergrub, sprach er ihr Mut zu und versicherte, dem bedrängten Vater helfen und das Gold beschaffen zu wollen.
„Beruhigt Euch, edle Jungfrau“, fügte er hinzu, „Eurem Vater soll geholfen werden. Ich aber bin erfreut, von dem Zufall zu Eurer Rettung auserlesen worden zu sein. Ich habe einen herrlicheren Schatz gefunden, als alle Goldmacher je gewinnen können.“
Mit stillem Weinen der Dankbarkeit schaute die Jungfrau ihm in das Auge, und wie von unsichtbarer Gewalt gedrängt, näherten sich beider Lippen und wurzelten im Kusse fest und innig aufeinander. Ein warmer Hauch der neu erwachenden Hoffnung fuhr über das von Weh geknickte Herz des Mädchens, und indem sie sich fest an die Brust des Erretters anschmiegte, hörte sie still und mit glückseliger Wonne die Worte der Liebe an, die er zu ihr sprach.
Des anderen Morgens trat er vor den Vater. Dieser hatte die Nacht schlaflos zugebracht und harrte mit erwartungsvoller Ungeduld dem Aufgang der Sonne entgegen. Mit verzweiflungsvoller Bestürzung vernahm er das Vorgefallene und die Flucht des Adepten.
Als aber der Ritter ihm seine Liebe zu Elsbeth gestand und um ihre Hand warb, und als er ihm endlich seine Börse zur Verfügung stellte, schwoll das Herz des alten Mannes, und weinend preßte er den Edlen an seine Brust. Im Laufe des Tages fanden die Fischer eine Leiche im Rhein, die alsbald als diejenige des Adepten erkannt wurde.
Das Gold, das er bei sich trug, wurde dem Erzbischof ausgeliefert, und da der selbe ein offenes Geständnis von seinem Schatzmeister empfangen hatte, wie er sich habe hinreißen lassen, sein Vermögen an die falschen Vorspiegelungen dieses Betrügers zu hängen, so konnte es ihm wiedererstattet werden, bis auf ein Geringes, das der Tiegel verbraucht hatte.
Elsbeth empfing dagegen für ihrer kindliche Liebe und den Beweis ihres hohen Opfermutes ein reiches, und glänzendes Hochzeitsgeschenk und lebte bis ins hohe Alter in der glücklichen Ehe.
Sage aus Deutschland
HEINRICH VON KEMPTEN ...
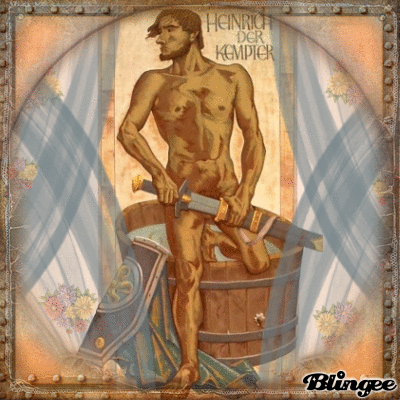
Wandmalerei an der Südfassade des Kemptener Rathauses
Zu allen Zeiten sind die Schwaben helle Köpfe gewesen und tapfer, was schon der Satz beweist: „Der wack're Schwabe forcht sich nicht!“ Eine hübsche Sage erzählt uns, daß es schon zur Zeit Otto des Großen, 936-973, schwäbische Helden gab, allen voran den Ritter Heinrich von Kempten.
Dieser Ritter war Lehr- und Zuchtmeister eines Sohnes des Schwabenherzogs und mit dem Edelknaben anwesend bei Hof zu Babenberg, wo der gefürchtete Otto der Große residierte. Der König nämlich war sehr streng, er trug einen schönen, roten Bart, bei dem er zu schwören und das Beschworene sicher auszuführen pflegte.
Ostern war es. Der König mit allen Fürsten und Edlen wohnte der Messe bei. Unterdessen stellte das Gesinde die Hoftafel bereit, ein großes Linnen, kostbare Geräte, Trinkgefäße und für jeden Gast ein Brötchen. Wie nun Edelknaben überall sind, wohin sie just nicht gehörten, der Sausewind fand den Weg in den großen Speisesaal, hinterdrein, aber verspätet, fahndete Ritter Heinrich nach seinem adligen Tunichtgut.
Eben griff dieser gerade nach einem Brötchen und biß herzhaft in das Gebäck, als der kaiserliche Truchseß in den Saal kam, um die Tafel zu besichtigen. Auf den ersten Blick erkannte der jähzornige Höfling die Freveltat des Edelknaben, und der Truchseßstab sauste strafend auf des Knaben Haupt so hart, daß Haar und Kleidung blutig wurden.
Das war so schnell geschehen, daß Ritter Heinrich es nicht verhindern konnte. Aber auf gut Kemptnerisch sagte er dem Truchseß wenigstens seine Meinung. Der Truchseß wurde patzig und warf sich erstaunlich in die Brust. Ritter Heinrich, nicht faul, klopfte dem Manne auf den Kopf, daß der wie ein Ei zerbrach und der Truchseß tot zu Boden sank.
Kaum hatte die erschrockene Dienerschaft den Leichnam weg geschafft, da kam der König mit den Fürsten in den Saal, und augenblicklich nahmen Ottos scharfe Augen die Blutspuren auf dem Estrich wahr. Zornig fragte er, was geschehen sei während der heiligen Handlung in der Kirche.
Ritter Heinrich trat vor und erzählte dem vor Zorn bereits glühenden König den ganzen Hergang des Streites, er leugnete auch nicht, dem Truchseß auf den Kopf geklopft zu haben. Da tobt der König grimmig und schwor: „Daß Ihr mir den Truchseß erschlagen, werd' ich an Euch rächen, bei meinem Barte sei's geschworen!“
Für den Augenblick erblaßte der Ritter Heinrich; sein Leben ist verwirkt bei solch königlichem Schwur. Doch faßte sich der Kemptener rasch, und in plötzlicher Ausführung eines Gedankens sprang Heinrich hin zum König und faßte ihn blitzschnell am roten Bart, so fest und überraschend, daß Ottos Krone vom Haupt fiel und am Eßtisch davon kollerte.
Mit gewaltigem Ruck warf der schwäbische Ritter den König auf die Tafel und schickte sich an, Otto mit dem Messer den Hals zu durchschneiden. Das Schrecklichste wollten die Fürsten und Edlen nun doch verhindern, sie drangen daher auf dem rabiaten Schwaben ein.
Doch Heinrich rief dröhnend durch den weiten Saal: „Keiner rühre mich an, oder der König ist ein toter Mann!“ Die Drohung schreckte die Edlen zurück. Zum Gebieter aber sagte der unverzagte Ritter: „Wollt Ihr das Leben haben, so tut mir Sicherheit, auf daß ich genese.“
Wenn einem das Messer den Hals kitzelt, wird meist jede Forderung bewilligt. Otto hob die rechte Hand zum Schwur und gelobte, dem Ritter das Leben zu schenken. Jetzt erst ließ Heinrich den Rotbart los und gab den König frei, daß dieser wieder auf die eigenen Füßen zu stehen kam.
Otto strich den Bart zurecht und sprach: „Ritter! Leib und Leben habe ich Euch zugesagt, damit fahret Eure Wege. Hütet Euch aber vor meinen Augen, daß die Euch nimmer wiedersehen. Nun räumt mir Hof und Land. Ihr seid mir zu schwer zum Hofgesind', und mein Bart müßte immerdar Euer Schermesser fürchten!“ Das ließ sich Ritter Heinrich natürlich nicht zweimal sagen und ritt, schleunigst südwärts in die Allgäuer Heimat, fest entschlossen, dem König nicht mehr vor die Augen zu kommen.
So vergingen wohl an zehn Jahre. Otto der Große war in Rom zum Kaiser gewählt worden, kam aber aus den Kriegshändeln nicht heraus. Diesmal galt es, jenseits der Alpen Ordnung zu schaffen und Ruhe zu stiften. Hierzu sind Truppen nötig, je mehr desto besser, und Otto hatte so wenig Soldaten, daß die Gefahr bestand, von den Italienern aus dem Land gejagt zu werden.
Da bat denn der Kaiser um Hilfe: wer ein Lehen des Reichs trage, sollte Krieger schicken und selbst erscheinen bei Verlust des Lehens und des Dienstes. Ein solches Aufgebot erhielt auch der Abt von Kempten, der sofort an den tapferen Ritter Heinrich dachte als den passenden Haudegen für den bedrängten Kaiser. Er ließ den Ritter aus seinem gewöhnlichen, beim Salzstadel zu Kempten gelegenen Haus, dem sogenannten Ritznerhaus, holen und meldete ihm das kaiserliche Aufgebot.
Ritter Heinrich fand die Lage peinlich genug. Gerne möchte er dem Kaiser Hilfe bringen und ihm den Arm leihen, aber nach des Kaisers Schwur darf der Ritter sich nicht mehr vor seinen Augen blicken lassen, ohne das Leben zu verlieren. Kommt Heinrich also nicht, so ist's genauso, als wenn er sich stellt und hingerichtet wird. Dem Kaiser ist auf keinen Fall geholfen, und im ersteren Fall, wenn der Ritter hübsch zu Hause bleibt, behält er sicher sein Leben.
Dies setzte Ritter Heinrich dem Prälaten auseinander, und er fügte hinzu: „Lieber gebe ich meine zwei Söhne und lasse sie mit zum Kaiser reiten.“ Der Abt ließ nicht locker: „Ihr seid mir nötiger als beide Söhne zusammen! Ich darf Euch nicht der Pflicht der Heeresfolge entbinden. Geht Ihr nicht, so leihe ich Euer Land anderen, die es besser verdienen wissen.“
Diesen Wink verstand der Schwabe und erklärte sich zum Zug bereit. Wenige Tage darauf war er auf seinem Schlachtroß unterwegs und bald darauf vor der Stadt in Welschland, wo der Kaiser mit den wenigen deutschen Kriegern lag. Ritter Heinrich kalkulierte mit Pfiffigkeit die Lage, sofort sich dem Kaiser zu stellen, wäre eine das Leben kostende Dummheit. Vernünftiger ist ein stilles, ruhiges Abwarten und Ausweichen.
So ließ der wackerer Ritter seine Zelte abseits vom großen Zeltlager der Deutschen aufschlagen, und er verlegte sich aufs Beobachten, was bekanntlich manchmal klüger ist als blindes Draufgehen und Dreinschlagen. Wenn man schier zwei Wochen Tag und Nacht mit wenig Ruhepausen für Roß und Reiter über die Alpen geritten ist und einem die Sonne des Welschlandes auf den Rücken brennt, ist ein Bad hochwillkommen.
Zudem hatte Ritter Heinrich mehr als genügend Zeit und einen großen Zuber dazu, den er gefunden hatte und sogleich als Kriegsbeute in sein Zelt bringen ließ. Der Knappe mußte Wasser holen und den Zuber füllen. Dann stieg Heinrich behaglich in das Bad und blickte durch die Zeltritze in die Gegend der belagerten Stadt. Seltsame Dinge sah da der Ritter.
Bürger kamen aus der Stadt, mehrere verloren ihre Waffen, die sie gleich wieder unterm Warm verbargen, und ein großer Haufen Lanzenträger war hinter dem Stadttor versteckt aufgestellt, jeden Augenblick zum Hervorbrechen bereit. Da ist etwas im Werk, sagte sich der im Wasser sitzende Ritter. Und richtig, bald darauf kam der Kaiser angeritten, leichtsinnig genug ohne jedes Gefolge und unbewaffnet.
Arglos ritt Otto den verschlagenen Bürgern zu einer Aussprache entgegen und stieg vom Gaul, um die Besprechung zu eröffnen. Da umringten die falschen Welschen den wehrlosen Kaiser und schlugen auf ihn ein. Messer blitzten auf. Das sehen, Schild und Schwert ergreifen und splitternackt hinausstürmen, den Kaiser zu retten, das war das Werk eines Augenblicks.
Wütend hieb der schwäbische Held auf die falsche Bande ein, mit jedem Schwerthieb einen Welschen tötend, so daß die Bürger alsbald Fersengeld gaben und in die Stadt flüchteten. Der Kaiser war befreit, und wie er sich, wieder im Sattel sitzend, nach dem wie es schien nackten Ritter umblickte, war der verschwunden, heimgesprungen. Heinrich saß wieder im Bad und tat, als sei nicht das geringste vorgefallen.
Im Kaiserzelt angekommen, ließ Otto nachforschen, wer nackt dem Kaiser zu Hilfe gekommen sei. Es solle der Lebensretter vor dem Gebieter erscheinen und den kaiserlichen Dank entgegen nehmen. Nun wußten einige Edle vom Hof, daß gehorsam dem Aufgebot, Ritter Heinrich erschienen sei, häufig bade abseits vom großen Lager, also wahrscheinlich der Helfer gewesen sei.
Man trug Bedenken, seinen Namen dem Kaiser zu nennen, da Otto dem Ritter im Wiedersehensfalle doch den Tod geschworen hatte, und man sagte daher dem Kaiser, daß es mit dem Ritter eine eigene Sache sei, weil auf ihm eine schwere Ungnade laste. Da gelobte Otto bei seinem Bart: Verziehen solle ihm sein und wenn der Ritter gleich seinen Vater erschlagen hätte.
Jetzt nannten die Höflinge des Ritters Namen: Heinrich von Kempten. Wie der Ritter gerade stand, mußte er vor den Kaiser kommen; es war ein Glück, daß der Schwabe nicht wieder im Wasser gewesen war. Und Otto beschloß ein Spiel mit dem Ritter. Scheinbar zornig schrie der Kaiser den treuherzig blickenden Kemptner an, wie er sich getraute, dem Kaiser unter die Augen zu treten! Das Leben sei verwirkt und dergleichen mehr.
Ritter Heinrich stand demütig vor dem Gebieter und sagte: „Gnade, Herr und Kaiser. Ich kam nur gezwungen durch Euer Aufgebot und des Abtes Drohung. Den Zug hab' ich geleitet, gehorsam und gewiß nicht gern; aber der Diensteid mußte eingelöst werden. Wer mir das verübelt, dem schlag' ich die Knochen entzwei!“
In Erinnerung an die Szene zu Babenberg wollte Otto es nicht zu einer Bestätigung dieses gefährlichen Gelöbnisses kommen lassen, denn der Kaiser zog es vor, das Spiel zu beenden. Lachend reichte er dem Ritter die Hände und hieß ihn willkommen als Lebensretter. Jetzt war nun auch der Schwabe froh. Der Kaiser überschüttete den Retter mit Reichtum und ehrte ihn bis ans Ende.
Deutsche Sage
DIE BESTRAFTE HEXE ...
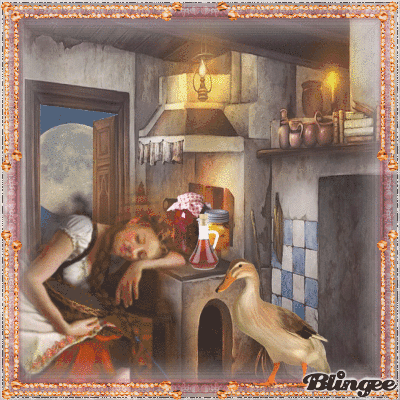
Es ist einmal eine rechte alte Hexe gewesen, die hatte zwei Töchter, eine rechte Tochter und eine Stieftochter, und die Stieftochter war schön und gut, die rechte Tochter aber boshaft und hässlich.
Da kam ein junger Jäger, nahm die Stieftochter zur Frau, weil sie ihm gut gefiel und zog mit ihr in sein Haus, das im Walde lag. Die alte Hexe stellte sich dazu ganz freundlich; in ihrem Herzen wusste sie sich aber vor Ärger und Bosheit nicht zu lassen, darum, dass der Jäger ihre eigene Tochter nicht genommen hatte, sondern die Stieftochter, die sie gar nicht leiden konnte.
Über eine Zeit kriegte die Jägersfrau einen kleinen Jungen und musste zu Bett liegen. Da wurde die Stiefmutter geholt, dass sie das Kind wüsche und anzöge, auch die Suppe kochte und sonst zur Hand wäre, wenn die kranke Frau ihrer bedürfen sollte. Der Jäger aber hatte zur Erheiterung und Kurzweil seiner Frau allerlei Vögel in die Stube gebracht, die sangen, und ein Spiel hatte er gemacht von allerlei Glocken, die klangen.
Dicht an dem Hause lag ein großer Teich, auf dem viele Enten schwammen. Nun stand eines Tages die Stiefmutter am offenen Fenster und sah auf den Teich hinaus, und weil des Jägers Frau schon wieder auf Besserung war und zuweilen aufstehen konnte, rief ihr die Hexe zu: »Steh doch auf, mein Kind, und sieh einmal die vielen Enten, die da auf dem Teiche schwimmen.«
Ohne an Arges zu denken, stand die Frau auf und lehnte sich aus dem Fenster, und indem, so gab ihr das boshafte Weib einen heftigen Stoß, dass sie hinab in den Teich stürzte, und verwünschte sie in eine Ente; da schwamm sie nun mit den anderen Enten auf dem Teiche herum.
Ihr Kind aber fing an zu weinen, und ihren Mann befiel zu der selben Stunde eine große Traurigkeit und wusste doch nicht warum; die Vögel sangen nicht, die Glocken klangen nicht. Da nahm die Hexe ihre eigene Tochter, legte sie in der Frauen Bett und band ihr ein Tuch um den Kopf, als ob sie krank wäre, so dass sie der Mann nicht erkennen konnte, als er kam, seine Frau zu besuchen.
Als es nun Abend ward und die Magd allein in der Küche war, kam auf dem Teich her eine Ente angeschwommen, die schnatterte vor dem Gossensteine wie Enten tun: »Niep, Niep! Natt, Natt!« und dann fing sie ordentlich an zu sprechen:
»Weint mein liebes Kind auch noch?
Weint mein lieber Mann auch noch?
Singen meine Vögel auch noch?
Klingen meine Glocken auch noch?«
Da antwortete die Magd:
»Eure Glocken klingen nicht,
Eure Vöglein singen nicht,
Euer Mann und Kind die weinen.«
Darauf ist die Ente wieder weg geschwommen. - Den zweiten Abend kam sie wieder, steckte den Kopf durch das Gossenloch und schnatterte ganz betrübt: »Niep, Niep! Natt, Natt!« und dann fing sie an zu sprechen:
»Weint mein liebes Kind auch noch?
Weint mein lieber Mann auch noch?
Singen meine Vögel auch noch?
Klingen meine Glocken auch noch?«
Und die Magd antwortete:
»Eure Glocken klingen nicht,
Eure Vöglein singen nicht,
Euer Mann und Kind die weinen.«
Darauf sprach die Ente: »Nun komme ich noch ein einziges Mal; dann fasse mich und haue mir den Kopf ab, so bin ich erlöst,« und schwamm fort. Das alles erzählte die Magd ihrem Herrn, der sagte: »Wenn die arme Ente so erlöst werden kann, so musst du es tun.«
Als nun die Ente den dritten Abend wieder den Kopf durch das Gossenloch steckte, fasste die Magd ein Beil und hieb ihn ab; in dem selben Augenblicke, da das Blut floss, wich der Zauber; die Frau war erlöst und ging zu ihrem Manne; der freute sich, dass er seine liebe Frau wieder hatte, denn sie erzählte ihm, wie das alles so gekommen und welcher großen Gefahr sie entgangen war.
Der Jäger, der nun wusste, was die Stiefmutter für ein böses Weib war, ließ sich nichts merken, sondern sann, wie er sich am besten an ihr rächen könnte. Auf den anderen Abend lud er eine große Gesellschaft; doch musste seine Frau noch zurück bleiben.
Wie sie nun alle zu Tische saßen, stand der Jäger auf und fragte, was sie wohl meinten, dass der Mutter geschehen müsste, die ihr Tochter in ein unvernünftiges Tier verwünscht hätte. Da sprang die Stiefmutter auf von ihrem Stuhle und war ganz verblendet und schrie:
»Die verdient, dass sie in ein durchnageltes Fass gesteckt und darin so lange gewälzt wird, bis sie tot ist.« »Du hast dir selbst dein Urteil gesprochen, du Hexe!« rief der Jäger und ließ seine Frau herein in die Stube treten. Wie das die Hexe sah, dass sie verraten war, ward sie kreideweiß vor Schreck und stürzte der Länge nach auf den Boden hin.
Da wurde sie in ein Fass gesteckt, welches mit eisernen Nägeln durchschlagen war; das wurde auf den höchsten Berg gebracht und da hinab gerollt. So hat die Hexe ihren verdienten Lohn erhalten.
Quelle: Wilhelm Busch
DAS WUNDERPFERDCHEN ...

Vor Zeiten lebte einmal ein junger Bursche, der war so arm, daß er viele Jahre bei einem reichen Gutsherrn als Knecht dienen mußte. Der Herr besaß einen Stall voll schöner Pferde, und der Bursche mußte von früh bis spät die Tiere pflegen, füttern, putzen und auf die Weide treiben.
Als der Bursche nach sieben Jahren des Dienstes überdrüssig geworden war, kündigte er den Dienst auf, denn er wollte in die weite Welt hinaus, um da sein Glück zu versuchen. Sein Herr aber sprach: „Da du mir so viele Jahre treu gedient hast, will ich dir zum Lohn ein Pferd aus meinem Stall geben. Such dir das aus, das dir am besten gefällt!“
Der Bursche, der sehr bescheiden war, nahm keines der stolzen Rosse, sondern das kleinste, ein mausgraues Pferdchen, das er besonders liebte. Er sattelte das Pferdchen, nahm Abschied vom Dienstherrn und ritt davon. Er ritt und ritt und trabte über Berg und Tal und Heide, bis er am Abend in einen dichten wilden Wald geriet.
Und in diesem Wald erblickte er am Boden eine wunderschöne, über alle Maßen prächtige Vogelfeder, die glänzte und funkelte wie ein Edelstein und strahlte heller als die Sonne, so daß der ganze Wald erleuchtet wurde. Der Bursche stieg verwundert vom Pferde, um die wunderbare Feder aus der Nähe zu betrachten.
Als er sie aber aufheben wollte, schüttelte das Pferdchen den Kopf und warnte mit menschlicher Stimme: „Laß um Gottes Willen die Feder da liegen! Sie würde dir nur Leid und Unheil bringen!“ Der Bursche jedoch schlug die Warnung in den Wind, weil ihm die prächtige Feder gar so gut gefiel.
Er hob sie auf und steckte sie an seine Pudelmütze. Dann ritt und ritt und trabte er weiter über Berg und Tal und Heide, bis er am dritten Tage eine große Stadt erreichte, in deren Mitte sich das aller prächtigste Königsschloß erhob. Am Königshof wimmelte es von Soldaten, Wächtern und anderem Hofgesinde.
Der Bursche fand Gefallen an diesem Getümmel, und er wäre für sein Leben gern hier geblieben. Doch als er den königlichen Haushofmeister fragte, ob man noch einen Wächter oder Diener benötige, winkte dieser nur ab: „Wächter und Dienstmannen haben wir mehr als genug. Aber wenn du Pferde zu warten verstehst, könntest du hier bleiben!“
Der Bursche war einverstanden, und so wurde er wieder Pferdeknecht, aber nun immerhin ein königlicher Pferdewärter. Was war das doch für ein vornehmes Stallgebäude! Was waren das doch für wunderbare Rosse, eins schöner als das andere! Pferde aller Gattungen und Farben!
Da gab es Schimmel und Rappen, Goldfüchse und Schecken, Braune und Falben, dazu noch Rot-und Blauschimmel und einen wunderschönen Apfelschimmel! Und diese Rosse standen in einem prächtigen Stall, der eigentlich ein Palast war mit marmornen Krippen und Bogenpfeilern und einem glitzernden Leuchter mit zwölf Kerzen, die den Raum von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang taghell erleuchteten.
Der Bursche hatte seine Wunderfeder an einen Pfeiler gesteckt, und die funkelte und leuchtete heller als die liebe Sonne zur Mittagszeit, so daß neben ihr die Kerzen nur noch wie Irrlichter flimmerten und zu erlöschen begannen. So ein Wunder konnte natürlich nicht verborgen bleiben. Man hinterbrachte also die Kunde von der leuchtenden Wunderfeder dem König.
Der König aber war ein habgieriger Bösewicht, der alles Schöne und Gute allein besitzen wollte. Es war also nicht verwunderlich, daß er sofort seine Wächter in den Stall schickte mit einem strengen Befehl, ihm die leuchtende Feder zu bringen.
Der Bursche hätte diese aber gern behalten und bat deswegen sein mausgraues Pferdchen um Rat. Das Pferdchen konnte ihm aber auch nicht helfen und sprach: „Diese Unglücksfeder wirst du wohl oder übel dem König geben müssen. Er wird dich sonst nicht in Ruhe lassen! Hatte ich Dir nicht gleich gesagt, du solltest die Feder im Wald liegen lassen, weil sie dir nur Leid und Unheil bringen würde?“
Also mußte sich der Bursche schweren Herzens von der Feder trennen und sie den königlichen Boten übergeben. Der König fand großen Gefallen an der Wunderfeder, die nun seinen Thronsaal erleuchtete. Bald darauf begann sich auch seine Habsucht wieder zu regen, und es gelüstete ihm, den Vogel zu besitzen, aus dessen Gefieder die prächtige Feder stammte.
Er ließ deswegen den Pferdepfleger zu sich kommen und befahl ihm: „Höre, was ich dir befehle! Beschaffe mir den Feuervogel, der die leuchtende Feder verloren hat! Bringst du ihn mir, ich will dich reich belohnen und zu meinem Oberstallmeister ernennen! Bringst du ihn mir aber nicht, so lasse ich dich auspeitschen und in den Kerker werfen.“
Der arme Pferdeknecht erschrak zu Tode. Wo sollte er den seltenen Vogel suchen und wie ihn fangen? Als er aber dem mausgrauen Pferdchen sein Leid klagte, begann es ihn zu trösten: „Hatte ich dir nicht abgeraten, die Feder aufzuheben? Nun ist Leid über dich gekommen. Aber sei getrost! Ich weiß, wo der Feuervogel zu finden ist und wie wir ihn fangen können. Dazu brauchen wir aber goldene und silberne Schlingen. Die muß der König dir geben!“
Also ging der Bursche zum König, um sich von ihm die Schlingen zu erbitten. Darauf ritt er in den Wald, wo der Wundervogel sein sollte. Als der Bursche das Versteck des Vogels entdeckt hatte, begann er dort auf Geheiß des Pferdchens Hirsekörner auszustreuen und darüber die goldenen und silbernen Schlingen auszulegen.
Er brauchte nicht lange zu warten, da kam auch schon der Feuervogel heran geflogen, begann die Hirsekörner aufzulesen, eines nach dem anderen, und war -schnapp!-auch schon in der Schlinge gefangen. Das war also der Wundervogel! Rotgolden war sein Gefieder. Es glänzte und funkelte, schimmerte, loderte und leuchtete heller als die liebe Sonne, so daß man gar nicht darauf schauen konnte.
Der prächtige Vogel war nun also gefangen und wurde zum König gebracht. Der setzte ihn in einen goldenen Käfig, den er im Thronsaal aufhängen ließ. Der Pferdeknecht erwartete den versprochenen Lohn, aber der habgierige König dachte nicht daran, sein Versprechen zu halten.
„Du scheinst ein tüchtiger und fähiger Bursche zu sein“, sagte er zum Pferdeknecht. „Deshalb sollst du mir auch ein Rätsel lösen! Sage mir, warum die Sonne bald hoch und bald tief am Himmel steht! Falls du das Rätsel lösen kannst, erwartet dich reiche Belohnung. Kannst du es aber nicht, lasse ich dich auspeitschen und ins Gefängnis werfen.“
Der Bursche erbat Bedenkzeit und ging wieder zu seinem Pferdchen, um es um Rat zu fragen. Und das Pferdchen sprach zu ihm: „Hättest du die Feder im Wald liegen gelassen, so hättest du dir viel Leid erspart. Aber ich will dir helfen!
Des Königs Rätsel ist bald gelöst! Mitten im blauen Meere wohnt auf einer Insel die Meerjungfrau Wunderschön, welche die Sonne bald hoch bald tief am Himmel stehen läßt, um nicht zu erfrieren oder vor Hitze zu verbrennen.! Der Bursche verkündete dem König des Rätsels Lösung.
Der König war über diese Kunde höchst verwundert, und da er ein so habgieriger Herrscher war, befahl er dem Pferdeknecht, die kluge und wunderschöne Meerjungfrau an seinen Hof zu bringen. „Kannst du diese Aufgabe erfüllen“, sagte er, „so will ich dich reich mit Gold und Silber belohnen und dich danach zu meinem Statthalter ernennen! Gelingt es dir aber nicht, lasse ich dir den Kopf abschlagen.“
Der Bursche entsetzte sich über eine solche Drohung und erzählte weinend dem guten Pferdchen, was der böse Herrscher von ihm verlangt hatte. Das Pferdchen aber antwortete: „Hatte ich dir nicht geraten, die Feder liegen zu lassen? Nun müssen wir uns bemühen, der Jungfrau habhaft zu werden! Wir müssen aber List walten lassen!
Laß dir vom König ein rotgoldenes Zelt geben, dazu eine goldene Liegestatt mit Seidenkissen, ein goldenes Tischlein und Silberbecher mit allerbestem Wein! Die Meerjungfrau Wunderschön wird neugierig ans Ufer kommen und vom süßen Weine trinken. Wenn sie dann im Schlaf versinkt, kannst du sie leicht ergreifen und zum König bringen.“
Der Bursche befolgte den Rat des Pferdchens, erhielt vom König die gewünschten Sachen, die er ans Meeresufer schaffen ließ. Dort schlug er das Zelt auf, statte es mit der goldenen Liegestatt und dem Tischlein aus und goß süßen Wein in die Silberbecher. Dann verbarg er sich mit seinem Pferdchen hinter dem Zelt.
Die Meerjungfrau Wunderschön erblickte von ihrer Insel das prächtige Zelt, und weil sie neugierig war, stieg sie in ihr Schifflein und fuhr zum Strande, um das rotgoldene Zelt aus der Nähe zu betrachten. Sie betrat das Zelt, setzte sich auf die Seidenkissen, nippte vom süßen Weine, und da er ihr so gut mundete, konnte sie nicht aufhören, von ihm zu trinken.
Der Wein war gut und süß und feurig! Kein Wunder, daß die Jungfrau bald schlaftrunken auf die Kissen sank und einschlief. Die Meerjungfrau war anmutig, liebreizend und wunderschön, so daß der König und alle, die sie sahen, kein Auge von ihr abwenden konnten.
Ob ihrer Entführung aber war sie über alle Maßen zornig geworden und rief: „Da ihr mich nun hierher gebracht habt, so schafft mir auch meine Stuten herbei, die auf der Insel geblieben sind!“ „Das soll mein Pferdeknecht tun!“ befahl der König und drohte dem Burschen wieder mit dem Henkerbeil, falls er den Befehl nicht ausführe!
„Hättest du nur auf meinen Rat gehört und hättest die Feder nicht aufgehoben“, sagte das Pferdchen. „Aber ich will dir auch diesmal helfen, obwohl es nicht leicht sein wird, die wilden und unbändigen Meeresstuten herbeizuschaffen. Irgendwie werden wir sie schon bekommen. Reiten wir zum Meeresufer! Du wirst pfeifen, und ich werde wiehern. So werden wir die Stuten an das Land locken und dann zum Königshof führen.“
Gesagt, getan! Der Bursche ritt zum Meeresufer und begann zu pfeifen, und sein Pferdchen wieherte aus vollem Halse. Da kamen die wilden Stuten herbei geschwommen, so daß das Meer hohe Wellen warf. Die Stuten sprangen ans Ufer, bäumten sich auf und schlugen wild mit den Hufen. Aber schließlich gelangte es dem Burschen, sie zu beruhigen, und zum Königshofe zu bringen.
Die Meerjungfrau Wunderschön freute sich, ihre Stuten wiederzusehen, befahl aber sofort: „Nun müssen die Tiere gemolken werden, denn ich bin es gewohnt, täglich in der Stutenmich ein Bad zu nehmen, um jung und schön zu bleiben!“ Der König, wie konnte es anders sein, befahl sofort seinem Pferdeknecht: „Du weißt, wie man mit Pferden umgeht. Mach dich also daran, die Stuten zu melken!“
Traurig und niedergeschlagen ging der Bursche wieder zu seinem Pferdchen, um es um Hilfe zu bitten, denn ihm war angst und bange vor den unbändigen Stuten. Das Pferdchen tröstete ihn und versprach zu helfen: „Hättest du aber meine Warnung befolgt und die Feder nicht genommen, wäre dir auch dieses Leid erspart geblieben! Aber hab keine Bange! Die wilden Stuten kann man bändigen!
Ich werde nach Kräften wiehern und sie so einschüchtern, daß sie zahm und folgsam still halten werden und du sie melken kannst.“ Der Bursche ritt auf die Weide, wo die Stuten sich tummelten. Das mausgraue Pferdchen aber begann zornig zu wiehern und mit den Hufen zu stampfen, so daß die Erde unter seinen Hufen zu beben begann. Da wurden die Stuten zahm und friedlich und ließen sich melken.
Die Meerjungfrau Wunderschön badete nun täglich in der Wunder wirkenden Stutenmilch und wurde von Tag zu Tag schöner und anmutiger. Was Wunder, wenn der König an ihr Gefallen fand und sie schließlich zur Gemahlin begehrte! Der König aber war ein häßlicher Greis, und deshalb verspürte die wunderschöne Meerjungfrau gar kein Verlangen nach einer solchen ungleichen Heirat.
„Ich kann deine Gemahlin nicht werden“, sagte sie zum König, „solange du alt und häßlich bleibst! Du sollst ein Bad in der Wunder wirkenden Stutenmilch nehmen, die dich in einen schönen Jüngling verwandeln kann. Der König wäre gern ein schöner Jüngling geworden, doch scheute er ein Bad in kochender Milch, weil er fürchtete, sich darin zu verbrühen.
Und er beschloß: „ Mag erst der Pferdeknecht probieren.“ Er ließ also den Burschen zu sich kommen und sprach zu ihm: „Morgen sollst du den Lohn für deine guten Dienste bekommen und wirst zu meinem Statthalter ernannt. Vorher mußt du aber ein Bad in siedendheißer Stutenmilch nehmen, die dich in einen Edelmann verwandeln wird!“
Der Bursche war starr vor Schrecken und bat das mausgraue Pferdchen flehentlich, ihm nochmals zu helfen. „Hatte ich dir nicht geraten, die Feder liegen zu lassen?“ sagte das Pferdchen. „Diesmal ist es aber das letzte Leid, das dir droht. Ich werde in die kochende Milch meine Tränen fließen lassen, bis sie kalt wird. Dann darfst du getrost hineinspringen!“
Am anderen Morgen ließ der König in einem Kessel Stutenmilch kochen. Viel Volk war herbei geeilt, um zu sehen, ob das Bad in der kochenden Milch auch wirklich in einen stattlichen Edelmann verwandeln würde. Das gute Pferdchen aber trat zum Kessel und ließ seine Tränen in Strömen in die Milch fließen. Dann sprang der Bursche in den Kessel und stieg wieder heraus als stattlicher Edelmann.
Als dies der König sah, ließ er schnell in einem zweiten Kessel Stutenmilch kochen, und als diese sprudelte, sprang er flugs hinein – und verbrühte sich so jämmerlich, daß er auf der Stelle tot war. Seine Untertanen aber waren gar nicht traurig, denn der König war ein grausamer und ungerechter Herrscher gewesen. Sie wählten den Pferdeknecht zum neuen König, der sich dann mit der wunderschönen Meerjungfrau vermählte.
Beide aber regierten gerecht und weise, und wenn sie dann und wann nicht aus noch ein wußten, baten sie das mausgraue Pferdchen um Rat und Beistand, und dieses half ihnen immer aus aller Not und Bedrängnis.
Ein sorbisches Märchen
DAS MÄDCHENKREUZ ...
Am Tage vor Fronleichnam hütete einst, auf dem Freiburger Schlossberge ein dreizehnjähriges Mädchen weidende Rinder. Plötzlich fing eines der selben an, mit seinem Horn den Boden aufzureißen und grub endlich eine silberne Scheibe heraus. Auf ihr befand sich, in erhabener Arbeit, ein Kruzifix zwischen Maria und Johannes.
Das Mädchen rief gleich Leute herbei und ließ durch sie das Geschehene in der Stadt anzeigen, worauf die Scheibe mit Kreuz und Fahne ins Münster abgeholt ward. An dem Orte, wo sie gefunden worden, errichtete man ein hölzernes Kreuz und sorgte zugleich für die lebenslängliche Pflege des Rindes, das nicht geschlachtet werden durfte.
Sobald das Mädchen erwachsen war, ging sie ins Kloster. Weil man ihr die Scheibe verdankt, wird die selbe bei Bittgängen stets den Mädchen vorgetragen, und deshalb das Mädchenkreuz genannt. Statt des hölzernen Kreuzes, welches dreimal vom Blitz zerstört ward, steht jetzt weiter unten ein steinernes Kruzifix.
Badisches Sage
DAS ERSCHROCKENE WICHTEL VON GÖSSITZ ...
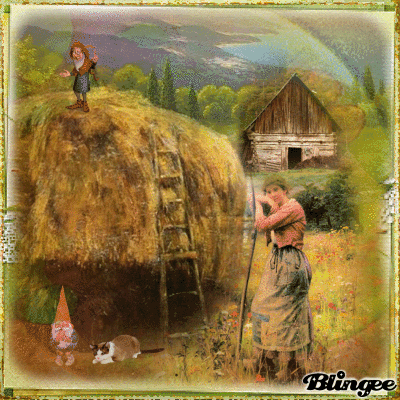
Eine Bauersfrau aus Gössitz an der Saale war eben dabei, auf ihrer Holzwiese im Schlingengrund den letzten Heuschober auszubreiten, als sie zu ihrem Schrecken oben auf dem Schober ein ganz kleines Männchen sitzen sah; das war nicht größer als eine aufrecht sitzende Katze.
Das kleine Wesen wandte der Frau den Rücken zu; diese wagte nicht, das Männchen anzureden, sondern zupfte vorsichtig von hinten mit dem Rechen etwas Heu unten vom Schober weg, dann streifte sie immer mehr Halme heraus und tat das so lange, bis der ganze Schober endlich zusammenbrach und das Männchen mit einem Schrei herunter purzelte.
Da kam aus dem Gehölz ein ganzer Haufe von eben solchen Männchen heraus gelaufen, die mit drohender Miene fragten:
»Sag an, sag an,
Eckele, hat sie dir was angetan?«
Das Wichtel aber krabbelte mühsam aus dem Heuhaufen hervor und schaute verwundert den eingestürzten Schober an. Dann schüttelte es den Kopf und sagte:
»Ei, ei!
Das Ding fiel nur so ein.
Ich purzelte hinterdrein,
Da möchte eins nicht schrei'n.
Ei, ei!
Es ist mir lieb,
Daß ich nicht drunter steckenblieb.«
Und dann lief das Männlein, was es nur laufen konnte, mit seinen Kameraden in den Wald hinein, ohne auf die Bauersfrau weiter zu achten, die lächelnd der hüpfenden Schar nachblickte und dann ruhig mit ihrer Arbeit fortfuhr.
Sage aus Thüringen
DAS KRISTALLSEHEN ...

Ein Erfurter Ratsprotokoll vom 10. Januar 1588 erzählt folgenden Fall:
Dem Pfeifer Jost Voigt, der zugleich Hausmann auf dem Allerheiligen Turme war, wurde aus dem Backofen im Gewölbe des Turmes eine schon gebratene Gans gestohlen. Sein Läutjunge Lorenz rät ihm, zur klugen Frau nach Daberstedt zu gehen und die zu befragen, wer der Dieb sei.
Von anderer Seite wird er an die Schucken in der Schmidtstedter Straße verwiesen, die mit Kristallsehen umzugehen wisse. Und die will wirklich im Spiegel des Kristallglases den Dieb erkannt haben, bezeichnet auch dem Pfeifer dessen Persönlichkeit. Aber sie hat einen ganz Unschuldigen getroffen, wie die gerichtliche Verhandlung ausweist.
Dieser, aufs höchste beleidigt, schwört, sich an dem Pfeifer zu rächen. Anderen Tages geht er zu einer berüchtigten Hexe und bittet sie, ihm dazu behilflich zu sein. Für ein gutes Stück Geld ist die weise Frau bald gewonnen, jenem ein Auge auszuschlagen.
Nun beginnt unter allerlei Zurüstungen und geheimen Mitteln die Zauberei. Er muß in seine Haustüre Nägel einschlagen, daran Fäden befestigen und sie straff anziehen. Dann legt er sich auf die Lauer und wartet, bis der Pfeifer Voigt durch die Turniergasse geht. Wie er seiner ansichtig wird, schlägt er den ersten Faden durch.
Sofort faßt der Turmwart nach seinem Auge; ihm ist es, als ob es von einem Schusse getroffen worden wäre. Doch ist von einem eingedrungenen Körper eben so wenig wie von einer Wunde zu sehen. Das Auge schmerzt täglich mehr, und nach Verlauf von vierzehn Tagen ist es vertrocknet und ganz blind.
Danach kommt es zu einem Prozeß mit Folterung und erpreßtem Bekenntnis, der in einem Hexenbrand endigt.
Sage aus Thüringen
BETRÜGER UND BEDRÜCKER ...
Der Zug der betrügerischen Fleischer, Müller, Wirte, Holzdiebe und Bedrücker der Bürger und Bauern ist besonders ansehnlich. Im Floßloch, einer schauerlichen Kluft über Steinbach, nach Liebenstein zu, sitzen drei gebannte Geister und spielen zusammen Karten.
Der eine ist ein Gastwirt aus Steinbach, der bei seinen Lebzeiten die Leute mit falschem Gewicht und Gemäß betrog, der andere ein Müller aus Grumbach, der zu viel metzte, der dritte ein Ackersmann aus Schweina, der die Grenzsteine verrückte.
Der erstere spukte nach seinem Tode in der Fleischkammer und dem Keller seines Hauses und stöhnte: »Drei Kartel (Nößel) für eine Kanne, drei Viertel für ein Pfund! « Der andere polterte als Geist bei Nacht in der Mühle umher und erschreckte die Kunden.
Der dritte wanderte als feuriger Mann an der Grenze seiner Äcker und tückte die Vorübergehenden, so daß sich niemand, sobald es dämmrig wurde, zwischen den Orten Steinbach und Schweina hin und her zu gehen getraute. Alle drei wurden von Jesuiten ins Floßloch gebannt, und weil sie in ihrem Leben gern Karten gespielt hatten, so gab ihnen einer der Geisterbanner eine Karte mit.
Da sitzen sie nun und spielen Solo und betrügen sich, werden uneins und zanken sich, daß der Lärm weithin durch den Wald schallt und verspätete Wanderer davor entsetzt fliehen. Manche haben die unheimlichen Spieler beisammen gesehen und wohl auch »Trumpfaus!« heischen hören. Der betrügerische Gastwirt hat aber immer dazwischen gerufen: »Drei Kartel für eine Kanne, drei Viertel für ein Pfund! «
Im Walde zwischen Herpf und Melkers, dem Eutel, spukt ein kleines graues Männchen mit Spinnwebegesicht, das Hackmännchen. Es hackt und hackt immerzu und muß bis zum jüngsten Tage hacken, ohne daß auch nur ein einziger Stamm fällt, zur Strafe dafür, daß es einmal an einem Sonntage in den Eutel gegangen ist, um Holz zu stehlen. –
Der böse Landrichter Stergenbeck aus Gera hatte Bürger und Bauern um Hab und Gut betrogen und mußte deshalb geistern. Man sah, wie er um Mitternacht durchs Kirchhofsgatter grinste, und hörte, wie er dabei einem Hunde gleich winselte und bellte, weshalb er dann schließlich durch den Henker an einen entlegenen Ort gebannt wurde.
Der ist lange Zeit unbekannt geblieben, bis einmal ein paar Weiber zum Holztage in den Wald gingen und zur Teufelskiefer auf den Kuhtanz kamen. Da haben sie um den Baum unzählige traurig pfeifende Vögel flattern sehen; in den Ästen aber saß niemand anderes als Stergenbeck, der böse Landrichter.
Er hatte einen graulichen Mantel an, sein Gesicht war löcherig anzusehen wie vom Krebs zerfressen, und blutig war das Schwert, das er im Gurte trug. Die Weiber sind nach langem entsetzten Irrlaufen von ihren Männern erst spät abends im Türkengraben wieder aufgefunden worden.
Sage aus Thüringen
DAS SCHLOSS AM BEYER ...

Das verwünschte und versunkene Schloß am Beyer hat einer von Oberalba gesehen, der um Mitternacht da vorüber mußte. Eine Schar wild aussehender Jäger mit langen Bärten und Spinnwebgesichtern saß davor und zechte an einer beleuchteten Tafel.
Die bildschöne Tochter des Kuhhirten von Oberalba war einer Kuh gefolgt, die sich schon wiederholt heimlich von der Herde entfernt hatte. Da kommt sie durch das offene Tor des Schlosses und ist kaum in den Hof getreten, als ihr ein stattlicher Junker entgegen tritt, sie bei ihrem Namen nennt und mit gar einschmeichelnden Worten fragt, ob sie ihn nicht zu ihrem Eheherrn nehmen und in dem prächtigen Schlosse da wohnen wolle.
Das Mädchen betrachtete den schönen Junker und schlug ein. Hocherfreut führte er sie in das Schloß und zeigte ihr all die prachtvollen Gemächer und die kostbaren Gold- und Silber durchwirkten Kleider, so daß ihr Herz vor Lust und Freude pochte.
Als der Junker dies gewahrte, wiederholte er seine Frage, knüpfte aber diesmal die Bedingung daran, sie müsse fest geloben, ihm eine Reihe von Jahren, es komme was da wolle, durchaus nicht zu zürnen. Das Hirtenmädchen ging auch darauf mit Freuden ein. Sie wurde nun in die kostbaren Gewänder gekleidet und lebte als Edelfrau herrlich und in Freuden.
Auch gebar sie dem Junker nacheinander zwei bildschöne Knaben. Sie liebte ihren Eheherrn so sehr, daß sie ihm nicht zürnte, als er ihr die Kinder bald nach der Geburt weg nehmen ließ. Doch als sie den dritten Knaben zur Welt gebracht hatte und ihr auch dieser genommen wurde, da empörte sich aus Liebe zu ihren Kindern ihr Herz, so daß die ihr Gelöbnis vergaß und ihrem Gemahl auf seine Frage, ob sie ihm zürne, ein heftiges Ja zur Antwort gab.
Kaum war es über ihre Lippen, als den Junker eine große Traurigkeit befiel. Ihr beiderseitiges Glück, sagte er, sei nun auf immer dahin. Vor vielen, vielen Jahren wäre das Schloß mit allen Bewohnern verwünscht und verflucht worden. Sie allein, wenn sie ihrem Gelübde treu geblieben wäre, hätte den Bann brechen und ihre drei Kinder zurück erhalten können. Nun aber sei alles verloren.
Die Hirtentochter verfiel hierauf in einen tiefen Schlaf, und als sie erwachte, befand sie sich in ihren alten Kleidern einsam im Walde.
Sage aus Thüringen
DAS TEUFELSBAD ...
Auf dem Schneekopf gibt es verrufene Moorlöcher, die Teufelskreise; unter ihnen gilt das Teufelsbad als besonders gefährlich. Kam doch Holz, das man hineingeworfen, in Arnstadt und hineingeschüttetes Blut im Mäbendorfer Felsbrunnen (Haseltal) wieder zum Vorschein.
Einst verlief sich in jener Gegend ein Pferd, das einem reichen Filz gehörte. Es wurde überall gesucht und nicht gefunden, und der Eigentümer ging selbst mit, während des Suchens vor sich hinbrummend: »Wo es nur der Teufel hat?« Bis sich´s denn fand, nämlich im Teufelsbad. Nur noch der Schwanz guckte heraus.
Gern hätte es der Besitzer, wenn auch tot, herausgezogen; das war aber lebensgefährlich, und so schnitt er ihm wenigstens den schönen langen Schweif ab, um die Haare etwa dem Förster zu Schneisschlingen zu verkaufen. Sowie es geschehen war, versank das Pferd vollends.
Voll schweren Ärgers ging der Geizhals heim. Als er aber in den Stall kam, siehe, da stand sein verlorenes Pferd frisch und gesund darinnen, nur der Schwanz fehlte, den hatte er in der Hand.
Sage aus Thüringen
DER ERDSPIEGEL ...

Die Leute im Wippertale sagen, es liege ein Königreich in dem Berge, darauf die Arnsburg stand, oder so viel des Goldes und der Kleinodien, daß damit eines Königsreiches Wert erlangt würde. In zwei steinernen Kisten wäre das alles wohl verwahrt.
Nach diesem großen Schatze trugen viele schon Verlangen, unter anderen auch eine Gräfin von Schwarzburg. Sie hatte einen Burghauptmann, der ein überaus kluger und weiser Mann war. Er besaß den Erdspiegel, in dem sich alles zeigte, was sich im Innern des Erdreiches und der Berge an edlen Metallen und vergrabenen Schätzen befand.
Mit diesem Erdspiegel kam er auf die Arnsburg und sah die Kisten deutlich stehen, merkte aber auch, daß der Schatz so versetzt war, daß es allzu viele Seelen kostete, wenn man ihn heben wollte. Deshalb stand die fromme Gräfin von ihrem Vorhaben ab; die Seelen blieben unverloren und das Königreich im Berge ungefunden. –
Den Erdspiegel zu gewinnen, war nicht leicht. Das zeigt die Geschichte eines Mannes aus Salzungen, namens Adam. Er kaufte sich einen kleinen Spiegel mit einem Schieber, ohne beim Krämer zu handeln oder zu mäkeln, und bewahrte ihn bis zum günstigen Zeitpunkte auf.
Endlich starb eine Wöchnerin, die am Karfreitag beerdigt wurde, und nun konnte er ans Werk gehen. Nachts mit dem Glockenschlag elf stand er am Kirchhof, zog die bloßen Füße aus den Pantoffeln, ließ den Mantel zur Erde fallen und schwang sich nackt, den Spiegel in der Hand, über die Mauer.
Er erreichte das frische Grab der Wöchnerin und arbeitete den Spiegel im Namen des dreieinigen Gottes hinein und zwar das Glas dem Sarge zugekehrt. Mühseliger war sein Rückweg, da er beim Gehen das Grab immer im Gesicht behalten mußte. Doch erreichte er glücklich die Mauer und bald darauf auch seine Wohnung.
Als er am dritten Abend wieder beim hellsten Mondschein den Kirchhof in der selben Stunde betrat, war um ihn plötzlich schwarze Nacht, dann und wann von grellen Blitzen durchzuckt. Auch vernahm er ein unheimliches Geräusch, als ob jemand vor ihm mit einem Besen den Erdboden fege, um ihn von dem Grabe der Wöchnerin abzuleiten.
Doch ließ er sich durch das alles nicht irre machen, fand nach einer Weile das Grab und zog, diesmal aber in Dreiteufels Namen, den Spiegel wieder heraus, drückte ihn sorgfältig mit dem Glas auf seinen Leib und trat in gewohnter Weise den Rückweg an.
Der Böse suchte ihn zu hindern und den Spiegel zu vernichten. Braun und blau geschlagen, dankte der Mann dem Himmel, als er wieder jenseits der Kirchhofsmauer stand. Doch hatte er nun einen Erdspiegel und wurde durch den selben bald einer der gesuchtesten weisen Männer der Gegend.
Keine Hexe, kein Dieb war sicher vor seiner Kunst. Er konnte sie und noch viel mehr in seinem Erdspiegel erblicken.
Sage aus Thüringen
UNVERHOFFTES WIEDERSEHEN ...
In Falun in Schweden küßte vor gut fünfzig Jahren und mehr ein junger Bergmann seine hübsche junge Braut und sagte zu ihr: „Auf Sankt Luciä wird unsere Liebe von des Priesters Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Frau und bauen uns ein eigenes Nestlein.“ -
„Und Friede und Liebe soll darin wohnen“, sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln, „denn du bist mein einziges und alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein als an einem anderen Ort.“ Als sie aber vor Sankt Luciä der Pfarrer zum zweiten Male ausgerufen hatte: „So nun jemand ein Hindernis wüßte anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammen zu kommen“, da meldete sich der Tod.
Denn als der Jüngling des anderen Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbei ging, der Bergmann hat sein Totenkleid immer an, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr.
Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück, und sie säumte vergeblich selbigen Morgens ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeitstag, sondern als er nimmer wieder kam. Legte sie es weg und weinte um ihn und vergaß ihn nie.
Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal von einem Erdbeben zerstört, und der Siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz der Erste starb, und der Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia starb, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar erobern.
Die Türken schlossen den General Stein in die Veteraner Höhle in Ungarn ein, und Kaiser Joseph starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte Russland – Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg fing an, und der Kaiser Leopold der Zweite ging auch ins Grab.
Napoleon eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen, und die Ackerleute säten und schnitten. Der Müller mahlte, und die Schmiede hämmerten und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt.
Als aber die Bergleute in Falun im Jahr 1809 etwas vor oder nach Johannis zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgraben wollten, gute dreihundert Ellen tief unter dem Boden, gruben sie einen Jüngling heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war, also daß man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor einer Stunde gestorben oder ein wenig eingeschlafen wäre an der Arbeit.
Als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte, Vater und Mutter, Befreundete und Bekannte waren schon lange tot, kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte.
Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und erkannte ihren Bräutigam; und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich von einer langen heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte, „es ist mein Verlobter“, sagte sie endlich, um den ich fünfzig Jahre lang getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen läßt vor meinem Ende. Acht Tage vor der Hochzeit ist er auf die Grube gegangen und nimmer gekommen.“
Umstehende von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne, und wie sie in ihrer Brust noch einmal erwachte: aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen; und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stübchen tragen ließ, als die einzige, die ihm angehöre und ein Recht auf ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof.
Den anderen Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die Bergleute holten, schloß sie ein Kästlein auf, legte ihm das schwarzrote Halstuch mit roten Streifen um und begleitete ihn in ihrem Sonntagsgewand, als wenn es ihr Hochzeitstag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre.
Denn als man ihn auf den Kirchhof ins Grab legte, sagte sie: „Schlafe nun wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitsbett, und laß dir die Zeit nicht lang werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wird’s wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Male auch nicht behalten“, sagte sie, als sie fortging und sich noch einmal umschaute.
Eine Geschichte v. Johann Peter Hebel 1760 - 1826
DER HART GESCHMIEDETE LANDGRAF ...

Zu Ruhla im Thüringerwald liegt eine uralte Schmiede, und sprichwörtlich pflegte man von langen Zeiten her einen strengen, unbiegsamen Mann zu bezeichnen: er ist in der Ruhla hart geschmiedet worden.
Landgraf Ludwig zu Thüringen und Hessen war anfänglich ein gar milder und weicher Herr, demütig gegen jedermann; da huben seine Junkern und Edelinge an stolz zu werden, verschmähten ihn und seine Gebote; aber die Untertanen drückten und schatzten sie aller Enden.
Es trug sich nun ein Mal zu, daß der Landgraf jagen ritt auf dem Walde, und traf ein Wild an; dem folgte er nach so lange, daß er sich verirrte, und ward benächtiget. Da gewahrte er eines Feuers durch die Bäume, richtete sich danach und kam in die Ruhla, zu einem Hammer oder Waldschmiede.
Der Fürst war mit schlechten Kleidern angetan, hatte sein Jagdhorn umhängen. Der Schmied frug: wer er wäre? »Des Landgrafen Jäger.« Da sprach der Schmied: »Pfui des Landgrafen! wer ihn nennt, sollte alle Mal das Maul wischen, des barmherzigen Herrn!«
Ludwig schwieg, und der Schmied sagte zuletzt: »Herbergen will ich dich heut; in der Schuppen da findest du Heu, magst dich mit deinem Pferde behelfen; aber um deines Herrn willen will ich dich nicht beherbergen.« Der Landgraf ging bei Seite, konnte nicht schlafen.
Die ganze Nacht aber arbeitete der Schmied, und wenn er so mit dem großen Hammer das Eisen zusammen schlug, sprach er bei jedem Schlag: »Landgraf werde hart, Landgraf werde hart, wie dies Eisen!« und schalt ihn, und sprach weiter: »Du böser, unseliger Herr! was taugst du den armen Leuten zu leben? siehst du nicht, wie deine Räte das Volk plagen und mären dir im Munde?«
Und erzählte also die liebe lange Nacht, was die Beamten für Untugend mit den armen Untertanen übten. Klagten dann die Untertanen, so wäre niemand, der ihnen Hülf täte; denn der Herr nähme es nicht an, die Ritterschaft spottete seiner hinterrücks, nennen ihn Landgraf Metz, und hielten ihn gar unwert.
Unser Fürst und seine Jäger treiben die Wölfe ins Garn, und die Amtleute die roten Füchse (die Goldmünzen) in ihre Beutel. Mit solchen und anderen Worten redete der Schmied die ganze lange Nacht zu dem Schmiedegesellen; und wenn die Hammerschläge kamen, schalt er den Herrn, und hieß ihn hart werden wie das Eisen.
Das trieb er an bis zum Morgen; aber der Landgraf fasste alles zu Ohren und Herzen, und ward seit der Zeit scharf und ernsthaft in seinem Gemüt, begann die Widerspenstigen zwingen und zum Gehorsam bringen. Das wollten etliche nicht leiden, sondern bunden sich zusammen, und unterstunden sich gegen ihren Herrn zu wehren.
Sage aus Thüringen
DIE SAGE VON DER ROSSTRAPPE ...

Einst begehrte der Riese Bodo die schöne Königstochter Brunhilde zur Frau. Sie aber wies den Freier und sein ungestümes Werben ab. Als Brunhilde nun eines Tages auf ihrem Roß durch die Wälder ritt und sich an der Natur erfreute, hörte sie plötzlich ein Stampfen, Unterholz brach, und Bodo näherte sich auf seinem Pferd.
Er hatte Brunhildes Spur gefunden und verfolgte und bedrängte nun das Mädchen. Kreuz und quer jagte Brunhilde durch den dichten Wald, doch ihr Versuch, den Verfolger abzuschütteln, mißlang. Plötzlich stockte ihr Roß mit jähem Ruck. Vor Brunhildes Augen lag ein gähnender Abgrund.
Inzwischen war Bodo in bedrohliche Nähe gekommen. Da gab die schöne Königstochter ihrem Pferd beherzt die Sporen und setzte damit zum Sprung über die tiefe Schlucht an. Der Sprung glückte. Tief grub sich der Huf des Rosses beim Aufschlag in den Felsen ein.
Brunhilde war gerettet, einzig ihre goldene Krone fiel während des Sprungs in die Tiefe hinab und versank sogleich in dem reißenden Fluß. Bodos Versuch, ebenfalls die andere Seite zu erreichen, schlug fehl. Er stürzte mit seinem Pferd in den Abgrund und wurde zur Strafe in einen Hund verwandelt.
Man sagt, er bewache die Krone Brunhildes für ewige Zeiten auf dem Grunde jenes nach ihm benannten Flusses.
Sage aus dem Harz
DIE SAGE VOM HEXENTANZPLATZ ...
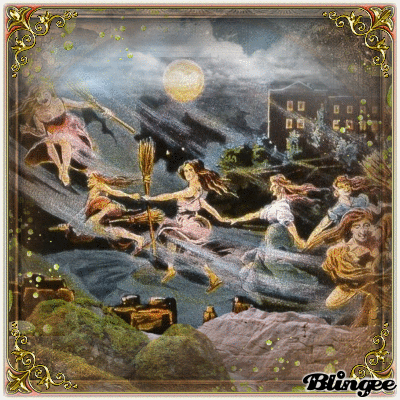
Auf dem hohen Felsen, welcher links am Eingange in das untere Bodetal hoch in die Lüfte ragt und unter dem Namen Hexentanzplatz bekannt ist, lebte der Sage nach ein altes Zauberweib namens Watelinde, welches durch ihre höllischen Künste viel Unheil anrichtete und von allen Harzbewohnern sehr gefürchtet wurde.
Sie lockte mit Vorliebe fromme Jungfrauen, durch allerlei schöne Versprechungen an sich, um ihren Zauber über sie werfen und ebenfalls Hexen aus ihnen machen zu können. An einem schönen Sommerabend ging die Jungfrau Hilda aus Thale in den nahen Wald, um heilsame Kräuter zu suchen.
Als es dunkel wurde und ihr Körbchen fast gefüllt war, schickte sie sich an heimzugehen. Nach knapp hundert Schritten brach der Mondschein durch die Baumwipfel, da fiel ihr ein, daß im Mondschein gebrochene Kräuter eine ganz besondere Heilkraft besitzen.
So begann das Suchen und Pflücken noch eifriger, dabei murmelten ihre Lippen seltsame Zauberworte. Plötzlich leuchteten ihr zwei große, gelb funkelnde Augen entgegen. Entsetzt versuchte sie zu fliehen, als sie eine Strecke weit gelaufen war, sah sie sich scheu um und erblickte ein großes, schwarzes Katzen ähnliches Tier, das ihr in wilden Sprüngen über die Büsche entgegen flog.
Es gab kein Entrinnen. Sie vernahm eine heisere Stimme, die zu ihr rief:"Fürchte dich doch nicht, Jungfrau, ich will dir ja kein Leid zufügen, sondern dir nur die Kräutlein nennen, mit deren Hilfe du deinen Liebsten für alle Zeit an dich fesseln kannst." Ihr war klar, das dies die Hexe Watelinde, in Gestalt eines Tieres war und wollte ihr entfliehen.
Doch plötzlich richtete sich das Tier in drohender Stellung auf und rief, Funken sprühend, mit gellender Stimme:"Ja, Jungfrau, jetzt bist du eingetreten in meinen Zauberkreis, und hier kann ich mit dir machen, was ich will!" Die Katze verwandelte sich in ein altes Weib.
Und kaum war die Verwandlung vollzogen, faßte Watelinde der Jungfrau Lockenhaar, um sie mit sich auf die Kuppe des Felsens fortzuziehen. In diesen bangen Augenblicken erinnerte sich jedoch Hilda der Lehren ihrer Mutter und bekreuzigte sich.
Da begann es in der Luft zu brausen; ein Sturmwind umsauste den Gipfel des Hexentanzplatzes, fuhr hernieder und während Blitze zuckten und ein gewaltiger Donnerschlag die Felsen ringsum erbeben ließ, wurde die böse Watelinde in die Lüfte gehoben, über das Bodetal hinweg gefegt und von einer unsichtbaren Hand gegen einen Felsen geschleudert, wo sie selbst zu Stein erstarrte.
Dieser Felsen trägt heute noch die Bezeichnung Hexengroßmutter. Die vom Verderben errettete Hilda gelangte wohlbehalten in die Hütte ihrer Mutter, heiratete ihren Liebsten und wurde glücklich.
Sage aus dem Harz
SCHNEEFLÖCKCHEN ...
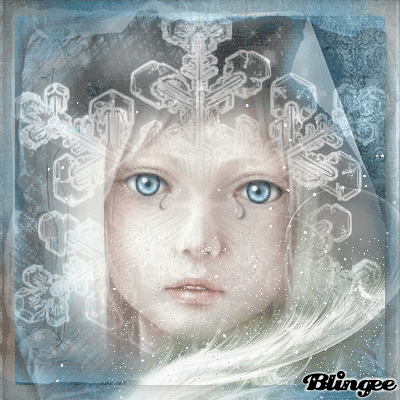
Schneeflöckchen war eine arme verwandelte Prinzessin, die in der Welt umher flog und Liebe suchte. Sie war ein wunderschönes Kind, schneeweiß und lieblich von Farbe mit himmelblauen Äuglein und blonden Löckchen, und ihr Vater war ein sehr mächtiger König in Indien.
Als sie sechs Jahre alt war, da starb ihre Mutter und sie bekam ein böse Stiefmutter. Diese gebar dem Könige auch zwei Töchter, aber die waren häßlich wie Krähen und Schneeflöckchen blühte nur noch anmutiger, wenn sie neben diesen beiden stand. Dies ärgerte die Königin, die eine böse Hexe war, und sie sann auf allerlei Tücken, wie sie das schöne Kind verderben könnte, das nun schon zwölf Jahre alt war.
Sie mußte sich aber vor dem Könige in Acht nehmen, denn er liebte Schneeflöckchen mehr als sein Leben. Gern hätte sie das Kind durch Gift oder Eisen weg geschafft, aber das däuchte ihr zu gefährlich und konnte verraten werden, sie meinte es also sicherer durch Hexerei zu verderben.
Und eines Tages, als sie es wusch und ihm ein reines Hemdchen anzog, da schmierte sie es mit einer Salbe ein, sprang dann sehr lebendig um das Kindchen herum und streichelte und herzte es, ward darauf plötzlich zu einer schwarzen Füchsin und beleckte das Kind, das erschrocken da stand, mit ihrer geschwinden Zunge, und murmelte die Worte:
Schneeflöckchen flieg hin!
Fliege durch die Welt hin!
Heute kalt und morgen warm!
Schlaf in keines Mannes Arm,
Der nicht in das fünfte Jahr
Treu dir ohne Wandel war.
Und in demselben Augenblicke, als sie von der Füchsin geleckt worden und die Worte über sie hin gemurmelt waren, ward die hübsche kleine Prinzessin zum Schneeflöckchen. Und die alte Hexe öffnete das Fenster und ließ sie hinausfliegen.
Es war aber ein kalter Wintertag, als dies geschah, und die böse Stiefmutter rief ihr höhnend nach: Fliege nun und friere bis in Ewigkeit! eher mag ich wieder jung werden wie du, als du einen Mann findest, der einem Schneeflöckchen fünf Jahre bis in die innersten Gedanken treu bleibt.
Und die süße kleine Prinzessin Schneeflöckchen flog mit den anderen Schneeflocken im kalten Winde umher und fror und zitterte und wimmerte wie die anderen. Es fühlte aber, warum es trauerte, denn es hatte die aller süßeste und aller wärmste Seeele behalten, obgleich es so jämmerlich verwandelt war, und mußte auch als Schneeflöckchen durch die weite wüste Welt nach Liebe umherfliegen.
Da war ihr denn das Traurigste, wenn sie je einmal auf ein hübsches Gesichtchen flog oder an eine schöne Brust sich schmiegte oder auf ein warmes Händchen sich hinab senkte, daß sie unfreundlich weg geblasen und abgeschüttelt ward, als habe sie nur unangenehmen Frost gebracht, wie alle anderen Schneeflocken.
So mußte sie immer wieder in die Welt hinein, wann sie gehofft hatte, sich einmal in Liebe auszuruhen, und flog den langen traurigen Winter umher und lag den gefrorenen Bergen und den Steinen und den eisigen Seen an der kalten Brust und weinte und ächzte um Liebe, die sie nirgends fand.
Und als es warm ward und die ersten Blümchen ihre Köpfchen aufrichteten und die ersten Vögelein wieder sangen, da durfte sie nicht bleiben an der schönen Sonne sondern mußte in die Dunkelheit; denn der Winter fing sie ein mit den anderen Schneeflocken und sperrte sie alle in den Tiefen und Höhlen der alten Berge ein, daß sie da lägen, bis er wieder auf die Erde empor käme.
Da lag nun Schneeflöckchen den schönen Frühling und den warmen Sommer und Herbst und verlebte ihre Stunden in Sehnsucht und Traurigkeit: in Sehnsucht, denn alle Erinnerungen waren in ihrem dünnen Schneeleibchen geblieben: in Traurigkeit, denn sie zweifelte, ob sie jemals Liebe finden würde.
Da hat sie manche wehmütige Töne geflüstert und manches traurige Liedlein geächzt, die allein die stummen Felswände gehört haben. Also klang eines der Liedlein, das sie oft schmerzvoll sang und das ein tiefer Durchklang ihres Schicksals zu sein schien:
Geister in den dunklen Höhlen,
Geister in der tiefen Nacht,
Habt ihr Liebe, habt ihr Seelen,
Gebt auf meine Klagen Acht,
Die ich seufze, die ich weine
In der stummen Einsamkeit,
Ferne von dem Sonnenscheine,
Von des Lebens Lieblichkeit.
Aus der süßen Welt verstoßen,
Welche warme Herzen hat,
mit den Stürmen mit den Schloßen
Flieg' ich schaurig meinen Pfad;
Zitternd vor den leichten Winden,
Vor der Lüfte Wankelmut,
Kann ich nirgends Ruhe finden.
Ach! ich armes junges Blut!
Und mein Seelchen voll von Liebe
Saus' ich durch die öde Welt,
Welche meine schönsten Triebe
Nur für Winterlügen hält,
Muß dem Stein am Busen frieren
Und dem starren harten Eis,
Das sich wohl mit Glanz zu zieren,
Aber nicht zu lieben weiß.
Und so kann ich einsam fliegen
Durch die lange Ewigkeit,
Und dies Herz wird nie sich schmiegen
An ein Herz voll Zärtlichkeit;
Wie ich brenne, wie ich glühe,
Keine Seele glaubt es je,
Wenn ich gleich von Flammen sprühe,
Heiß' ich doch der kalte Schnee.
O wo lebt das holde Wesen,
Wenn ihr's wißt, so sagt mir's an,
Welches diesen Zauber lösen,
Diese Liebe kühlen kann?
O wo lebt die seltne Treue,
Welche Stahl und Eisen schmelzt
Und für mich ein kühner Leue
Sich durch Feu'r und Strudel wälzt?
Ach! ihr Elfen! ach! ihr Zwerge!
Was verkünd' ich euch die Pein?
Ihr seid hart wie eure Berge,
Ihr seid kalt wie euer Stein.
Denn was nie an Menschenherzen
In der süßen Liebe lag,
Ahndet nichts von diesen Schmerzen,
Dieser Sehnsucht, dieser Schmach.
So hatte Schneeflöckchen eine lange, lange traurige Zeit in den düstern Berghallen gelegen und den stummen Steinen und gefühllosen Wassern und Lüften, die vorbei rauschten, ihr Leid geklagt, da kam der Winter wieder und öffnete die Tore und trieb seine leicht geflügelten Schaaren in die Welt hinaus.
Und Schneeflöckchen flog mit den anderen aus und mußte wieder nach Liebe durch die Welt umher fliegen; und die leichten Winde kamen und nahmen sie mit und trugen sie über Länder und Meere hin. Einmal lag sie bei diesen Reisen auf dem Gipfel des kalten Kaukasus und seufzte und ächzte jämmerlich in dem bitteren Gefühle ihrer Verlassenheit unter den kalten lieblosen Gesellen, mit welchen sie leben mußte.
Und als Schneeflöckchen hier zum Sterben krank war vor Liebe, da hörte sie unter sich in einer Bergschlucht jemand so jammervoll stöhnen und klagen, daß einem Stein davon das Herz hätte springen können. Und Schneeflöckchen flog auf und flog flugs hin, woher die Stimme tönte.
Und sie sah unter einem kahlen Baum, durch dessen wenige falbe Blätter der wintrige Wind heulend pfiff, einen Jüngling stehen stattlich und riesig von Wuchs und schön von Gestalt.
Er stand aber fast nackend da, sein Waffenkleid sein Panzer und Helm und Schild lagen im Schnee umhergestreut, sein edles Roß stand seitwärts und kratzte Gras unter der Schneekruste hervor und fraß, seinen Sporen lagen zerbrochen, sein Wams lag zerrissen neben ihm, in der Rechten hielt er ein blankes Schwert und seine Haare flogen wild im Winde und seine Blicke sahen verstört, wie wenn einer in eine Wüste hinein starrt, und von seinen Lippen ächzten jammervolle Klagen.
Schneeflöckchen legte sich angstvoll und schweigend zu seinen Füßen und dachte bei sich: Ach wenn der Mann weh voll ist wie ich und unglücklich durch Liebes Sehnsucht, so mag er mich hier zertreten in seiner Verzweiflung, daß ich den letzten Atem von Leben und Bewußtsein verliere! Das sollte mir der süßeste Tod sein. Er klagte aber also:
Seid mir willkommen, Orte der Trauer! ihr wüsten Felsen, kahlen Bäume, du raue und finstere Kluft und ihr Winde, die ihr mit dem Schneegestöber dahinpfeift – ihr seid mein Leichengefolge, meine Leichenmusik, wie ich sie liebe. Du bist hin, edle Stärke, worauf ich getrotzt habe, du bist verwelkt, Schönheit, welche Frauen und Jungfrauen gepriesen haben, du hast dich verschmachtet und verblutet, arme kranke Seele, und sollst hier die Ruhe und den Frieden finden, den die kalte Erde dir nicht geben konnte.
O kalte Erde! bald nicht mehr zu kalt, bald ein stilles kühles Bett dem Starren und Gefühllosen. – Komm treues Schwert, zu treuer Freund und Schirmer in so manchen Schlachten und Abenteuern! tu mir den letzten Dienst! schneide dies Herz in Zwei, das schon genug zerschnitten ist, dies arme Herz, dem alle Güter und Schätze gegeben waren, nur der einzige höchste Schatz der Liebe nicht.
O wenn dieser kalte häßliche Dornstrauch lieben könnte, ich wollte ihn umarmen, ich wollte ihn an meine Brust, ja in meine Brust hinein drücken, daß sie von seinen hundert Spitzen bluten sollte, und ich wollte jauchzen vor Seligkeit; ja dich dünnen Schnee wollt' ich nehmen, wenn deine Kälte zu Liebe erwärmen könnte, wollte mir die Hände von dir vollballen und dich tragen als meine köstlichste Habe, und Himmel und Erde sollten meinen Schrei hören: ich bin geliebt! ich bin glückselig!
Ja eine Otter, eine Kröte wollt' ich umarmen und sie Braut nennen und Zärtling und Liebling. – Nein! nein! nimmer! mimmer mehr! Komm denn Schwert! und komm denn Tod! du Retter aus allen Nöten! und mache der elenden Posse ein Ende! Und er rüstete sich zuzustoßen.
Und es war dem kleinen Schneeflöckchen wie ein Blitz durch das zärtliche Seelchen gefahren, und sie hob die Flügelchen auf und senkte sich sanft auf seine Hand, als sie eben den letzten Stoß tun wollte. Und er fühlte es wie warm, und als brennte ihn etwas. Und er schaute in die Hand und sah Schneeflöckchen da liegen in seiner zarten gefiederten Gestalt.
Und Schneeflöckchen, die eben eine Seele suchte, ward immer wärmer und brannte ihn wirklich. Und erstaunt ließ der Mann das Schwert fallen und sah Schneeflöckchen an, als verstände er das holde Kind, das nicht viel gewichtiger als ein wehendes Lüftchen auf seiner Hand lag, und voll Entzücken rief er:
Was? was? ist sie's? ist sie's? o gnädiger Gott! so will ich leben! und würd' es eine Ewigkeit, sie soll mir nicht zu lang sein! Und Schneeflöckchen, das diese Worte hörte, zerann vor Entzücken und ward ein glänzender Tropfen, der hell in seiner Hand lag und um Liebe zu flehen schien und wie das blaue Himmelsauge eines Engels aussah.
Und der Mann sah das funkelnde Tröpfchen, das immer noch warm in seiner Hand glühte, und lief eilends zu einem Baum, der noch einige frische Blätter hatte, und nahm das grünste Blatt und goß das Tröpfchen da hinein und barg es sorgsam an seinem Leibe. Dann kleidete und waffnete er sich, schwang sich auf sein Roß und ritt im Fluge der nächsten Stadt zu.
Nun muß ich erzählen, wer dieser Mann war und woher er kam und was ihm begegnet war.
Er war ein edler Prinz, eines Königs Sohn im Lande Arabien, wo das Gold wächst und die Myrrhen und andere köstliche Kräuter. Er war unter den wunderbarsten Umständen zur Welt geboren und mit so unvergleichlicher Schönheit geschmückt, daß sein Vater der König und die Weisen des Landes von seiner frühesten Kindheit an sehr aufmerksam auf ihn waren; denn sie meinten, sein Leben werde gewiß auch von ungewöhnlichen Schicksalen geführt werden.
Sie fragten das Loos, sie fragten die Sterne viel über ihn, sie spielten mit Rätseln und Wahrsagern um ihn; aber das Loos wollte nicht fallen und die Sterne wollten nicht sprechen und die Rätsel und Wahrsager wollten kein rechtes Geisterspiel spielen – sie blieben um Dunkeln über seine Zukunft.
Aber über sein Herz blieben sie nicht lange dunkel. Der Prinz zeigte von Kindauf eine ungewöhnliche Zartheit und Weichheit des Gemütes und in seinen großen und schwarzen Augen lag eine Wehmut und Schwärmerei, welche dem alten Könige bange machten; so daß er zu seinen Weisen und Räten wohl zuweilen zu sagen pflegte:
Der Knabe muß strenger erzogen werden und immer unter Menschen und im vollen Getümmel sein; er könnte sonst ein Träumer oder Sternseher werden, welche die schlechtesten Könige sind, oder die Liebe, die verderblichste und gefährlichste aller Leidenschaften, könnte ihn ganz aus der Bahn der Tugend treiben.
Alle Gebärden, alle Bewegungen des Prinzen waren eben so sanft und zart, als seine Seele, und sein Stimmchen klang leise und lieblich wie ein Sommerlüftchen, wenn es durch Maiblumen hinspielt. Deswegen ward er Prinz Bisbiglio genannt, welches zu deutsch so viel heißt als Gelispel.
Als Prinz Bisbiglio vier Jahre alt geworden war, tat der König sein Vater ihn nicht in die Einsamkeit zu einem Weisen, wie die Könige im Morgenlande zu tun pflegen, die da glauben, im Getümmel der Hauptstadt und im Glanze und der Üppigkeit des Hoflagers könne schwerlich jemand zur strengen Tugend gezogen und geübt werden, sondern er schickte ihn zu einem alten grauen Kriegsmann, der mit einer reisigen Kriegsschaar immer auf der Warte lag und der Grenzen hütete.
Da sollte er wie ein Krieger erzogen werden, nichts sehen als Rosse und Waffen, nichts hören als Waffenklang und Trompeten und Pfeifen, kein anderes Lager kennen als ein hartes Soldatenbett und keine andre Flur und Au als die Tummelplätze und Übungsplätze, worauf Menschen und Pferde auch kein Gräschen grünen ließen.
Künste sollte er nicht lernen, denn der König fürchtete, die Künste würden ihn zu weich machen, und ihm die strenge Arbeit verleiden, welche die beste Kunst für den ist, der als ein Mann Männern befehlen soll. Der Prinz lebte in diesem Lager zehn Jahre und ward ein vollkommener Kriegsmann, in allen Waffen geübt, ein Meister die Rosse zu tummeln und die Lanze zu werfen; außerdem war er schlank und riesig von Leibe und für sein Alter sehr stark.
In seinem fünfzehnten Jahre ließ der Vater ihn zurück kommen an seinen Hof und freute sich des schönen Jünglings und seiner weisen Erziehung. Aber was half sie ihm? Was die Natur in den Menschen gesät hat, das muß früher oder später einmal Wurzeln treiben, es ist unvertilgbar wie das Leben und läßt sich mit dem Leben selbst nur ausrotten.
Prinz Bisbiglio hatte nun seit zehn Jahren nichts gesehen als raue und eiserne Männer des Kriegs und Lanzen Bogen und Säbel, er hatte in keine Sterne geguckt, auf keine Nachtigallen gelauscht, in keinem Tanze sich mit umgeschwungen; doch waren so viele Sterne und Nachtigallen und Tänze in seiner Seele, daß sie von allem eisernen Lärm und eisernen Übungen nicht unterdrückt werden konnten. Ja sie wurden in ihm nur lebendiger, jemehr sie in das tiefste Innere seines Gemütes zurück gedrängt wurden.
Bisbiglio war ein Kind der Sehnsucht und Liebe und mitten in dem Feldlager unter den harten und rauen Kriegern hatte sein unbewußtes Herz immer nach Liebe gelechzt, sie hatte er aus allen Winken und Blicken aus allen Liedern und Märchen gesogen, die auch von ganz etwas anderem klangen, ja aus jedem leisesten Worte, das nur so lose vor ihm gesprochen war; sein eigenes Herz hatte ihm früh genug diesen bunten Himmel mit allen seinen Sternen und Nachtigallen geöffnet. So allmächtig ist der angeborene Trieb.
Bisbiglio stand jetzt in der Blüte der Jahre, wo die Fantasie am lebendigsten ist; er sehnte sich hinaus in die weite schöne Welt, damit er ihre Schönheit und Herrlichkeit erkundete, und ging zu seinem Vater dem Könige und bat ihn, daß er ihn ziehen lasse, wie andere Prinzen ausziehen, und sich durch fürstliche und ritterliche Abenteuer einen Namen machen.
Der Vater erlaubte es ihm gerne, denn er dachte: dieser ist ein fester Jüngling, unter Eisen und Waffen erzogen, den werden die girrenden Tauben der Liebe und die schmeichelnden Sirenen der Zärtlichkeit nicht von der Heldenbahn ablocken.
Aber Bisbiglio meinte es anders, als seine Worte vor dem Vater klangen: er wollte keine andere Abenteuer als Abenteuer der Liebe, er wollte auf die Liebe ausreiten, er wollte solange suchen in der weiten Welt, bis er die Liebe fände, die er sich von jeher als das höchste und seltenste Gut gedacht hatte.
Er hatte nämlich in dem Feldlager am Euphrat oft das Märchen erzählen gehört von dem persischen Prinzen Sospirio, der zwanzig Jahre nach der Liebe durch die ganze Welt umhertrabte und sie endlich in einem schneeweißen Dornröschen fand, das mitten in der Wüste Afrikas verborgen und einsam blühte.
Dies waren die hohen und geheimnißvollen Sterne, nach welchen Bisbiglio früher guckte, dies waren die süßen Nachtigallen, die ihm selbst da sangen, wo Streitrosse um ihn wieherten und Speere auch Schilden zersprangen; von wundervollen Abenteuern von Kämpfen mit Riesen und Drachen von Verwandlungen und Bezauberungen hatte er Tag und Nacht geträumt, aber nicht bloß um ritterliche und königliche Scherze und Spiele, nein alles um Liebe und immer um Liebe.
So war er in die Welt ausgezogen und zog nun schon in das vierte Jahr so um und hatte mit sehnlichen Schmerzen die Liebe gesucht aber immer noch nicht gefunden. Abenteuer hatte er genug gefunden Kämpfe genug bestanden schöne Frauen und Jungfrauen Prinzessinnen und Königinnen Amazonen und Sirenen wunderbare Blumen und Vögel genug gesehen, einige auch geliebt, aber ach! die Liebe hatte er nicht gefunden, die himmlische immer in Einem blühende, glühende, fühlende, spielende, lebende, schwebende, singende, klingende, jauchzende Liebe.
Er war schön jung und tapfer, er hatte alles Schönste und Lieblichste angezogen wie der Magnet das Eisen anzieht, er war auch zärtlich geliebt worden, aber ach! nach weinigen Tagen, oft nach wenigen Sekunden, hatte er immer den Mangel gefühlt und wieder ausreiten müssen, damit er die rechte Liebe fände, welche er suchte.
So war es ihm vor einem Monat eben wieder ergangen. In Damaskus hatte er des Königs Tochter gesehen schön wie eine Rose schlank wie eine Lilie und lieblich wie ein Veilchen im stillen Tale, und sie hatte ihn über ihr Leben lieb gewonnen, und er sie wieder.
Aber bald hatte der unglückliche Prinz wieder reiten müssen, fühlend, sie sei nicht die Liebe, die er suchte, und nun hatte er verzweifelt sie je zu finden und war hinauf geritten bis in das wilde verschneite Gebirge bis in den höchsten Kaukasus hinein, und da hatte ihn das süße Schneeflöckchen am Leben erhalten.
Als der Prinz zu der Stadt gekommen war, ritt er vor das Haus eines Juweliers und kaufte sich ein Fläschchen aus lauterem Diamant und goß sein funkelndes Tröpfchen sein Schneeflöckchen da hinein und versiegelte das Fläschchen und steckte es zu sich und sprach: du wirst noch wohl einmal Prinzessin werden, wie Dornröschen in der Wüste geworden ist, und wenn du es nimmer wirst, ich bin der glücklichste aller Menschen, solange ich nur diese Flammen fühle.
Er hatte sich nämlich ein Säckchen über dem Herzen gemacht, da rein steckte er das Fläschchen, und er fühlte es bis in sein Herz, und es war ihm wie ein sanftes Prickeln, das er um die ganze Welt nicht hätte missen wollen. Er ritt aber immer lustig fort durch die weite Welt.
Denn daß das Tröpfchen verwandelt werden mußte und daß es so nicht bleiben konnte, das ahndete ihn; das wußte er auch, daß er vor der Erfüllung seines Schicksals nicht nach Hause reiten durfte. Und Schneeflöckchen saß als ein kleines Tröpfchen in dem diamantenen Fläschchen und war die aller glückseligste, denn sie fühlte, daß sie geliebt war; aber doch zitterte sie oft bei sich und dachte:
Fünf Jahre wie lange! wie lange! und wird er die Proben bestehen? Es ist wohl süß, so auf seinem Herzen zu ruhen, aber wie viel süßer wäre es, ihn mit menschlichen Armen umfangen und an dies Herz drücken! Und sie bebte vor Wonne bei dem Gedanken und zugleich vor Furcht, daß sie ihn verlieren könnte.
Und drei Jahre war der Prinz Bisbiglio mit ihr durch die Welt geritten und sie waren ihm verschwunden wie drei Tage. Da kam die Zeit harter Proben, die er noch bestehen mußte, ehe ihr Schicksal erfüllt werden konnte.
Die erste Probe war diese:
Er ritt an einem Hause vorbei, das in Flammen stand. Da zweifelte er in sich: wenn sie, die meine Liebste ist, für dies Tröpfchen nun ein Mensch wäre und du lägest in den Flammen, sollte sie wohl hineinspringen und dich herausholen?
Und wie er den bösen Gedanken kaum gedacht hatte, da fühlte er sein Gläschen mit unwiderstehlicher Gewalt herauf springen, daß es ihm Hemd und Wams zerriß und den eisernen Panzer spaltete. Und wie ein Blitz flog es in die Flammen, und er sah das Fläschchen drinnen springen und da helle Tröpfchen weinte und ächzte in der feurigen Not, und bald erblickte er es nur noch als eine trübere Flamme.
Da erfaßte ihn unnennbare Seelenangst und er warf sich von dem Pferde in das Feuer und griff sich das Flämmchen heraus und barg es in seiner Hand. Und das Flämmchen brannte ihm ein tiefes Loch in die Hand, dann ward es wieder zum Tröpfchen.
Er ritt aber eilends in die nächste Stadt und kaufte sich wieder ein diamantenes Fläschchen, worin er es einfing und wieder an seine alte Stelle legte. In den Flammen hatte er sich das Haar versengt und die Wangen verbrannt und das Loch in seiner Hand war sehr tief.
Und er mußte große Schmerzen leiden und wohl drei Wochen krank liegen, ehe er genaß. Da trauerte er viel über seinen Unglauben, aber Schneeflöckchen war voller Freuden, daß er ihr so treu nach gesprungen war in das Feuer, aber über seine Schmerzen weinte sie innerlich. Und er merkte es wohl, denn es däuchte ihm oft, wie es in der Flasche ächzte, wiewohl er eigentlich nichts hörte.
Dies war die zweite Probe:
Er ritt über eine hohe Brücke, welche über ein reissendes Wasser führte, das der Tigris heißt. Da sah er das Nest eines Eisvogels auf dem Strome schwimmen und die Mutter saß auf dem Neste und fütterte die Jungen. Und er sprach bei dem Anblicke innig bewegt: o welche Liebe! haben Menschen wohl solche Treue? Wahrlich wenn der Strudel diese kleine Brut untertauchte, die Mutter tauchte ihnen nach und stürbe oder holte sie herauf.
Und Schneeflockchen auf seinem Herzen fühlte, was er drinnen bewegte, und mußte ihm in der inneren Seelenangst wieder Rock und Panzer sprengen, und klingend flog das Fläschchen gegen einen Stein und das Tröpfchen goß sich in den Strom und zischte leise, wie wenn man heißes Wasser in kaltes gießt, und floß mit den reißenden Wellen dahin.
Und der Prinz stürzte sich wie ein Blitz ihm nach in den Strom und kämpfte mit dem Strudel und tauchte sich auf und ab und rang mit Tod und Leben, und füllte seine Hände mit allen Wassern, bis er das zischende Tröpflein wiedergefunden hatte, das er wie eine brennende Kohle in der Hand fühlte.
Dann schwamm er an Land und sank erschöpft hin; das Tröpfchen aber hatte ihm wieder ein Loch gebrannt. Und als er wieder zu sich kam, war er zerschellt an allen Gliedern von den Felsen, woran er sich zerstoßen hatte, und die Wunde in der Hand schmerzte, aber seine Seele jauchzte in Wonne.
Und Schneeflöckchen war auch in Entzücken über seine tapfere Treue. In der nächsten Stadt aber fing er sein Tröpfchen wieder ein, legte sein Fläschchen aufs Herz und ritt weiter.
Dies war die dritte und letzte Probe:
Der Prinz trabte mit seinem Schneeflöckchen eines Morgens durch einen hohen Bergwald, da ward er eines gewaltigen Reiters gewahr, der auf einem weissen Hengst ritt und so hoch war, daß sein Haupt über die Spitzen der Eichen und Buchen ragte. Er hielt eine Lanze, die einem Mastbaum gleich in den Lüften schwankte, und fällte diese fürchterliche Wehr, als er des Prinzen ansichtig ward.
Dieser Riese – denn das war er – hatte ein häßliches und verrunzeltes altes Weib hinter sich auf, das ihn mit ihren dürren Armen umklammert hielt. Er führte sie wider Willen mit sich kraft eines Gelübdes, das er getan hatte, und dachte sie auf den Ersten Besten, den er treffen würde, abzuladen.
Als er also den Prinzen Bisbiglio erblickte, rief er mit lauter Stimme, daß alle Berge und Klüfte wieder halten, als hätten hundert Donnerwetter zugleich die himmlischen Karthaunen gelöst:
Halt, mein Knäblein! ich habe hier etwas für dich. Du bist jung und kannst einen Schatz gebrauchen, der meinen Jahren schon beschwerlich wird. Nimm diese Dame hinten auf und schwöre mir, daß du sie ritterlich halten und einen jeden, der dir begegnet zum Kampf auf Leben und Tod fordern willst, wenn er nicht bekennen will, daß sie die aller schönste Prinzessin sei, die je die Sonne beschienen hat.
Auf diese Bedingung laß ich dich hier frei vorüberreiten, sonst wird deine Mutter bald einen Toten begraben. Das geschieht nimmer, du Trotziger, solange noch ein Tropfen Blut in mir warm ist, rief Bisbiglio, von Zorn entbrannt; wehre dich, du Prahler! ich schlage auf dich.
Und mit diesen Worten sprang er aus dem Sattel und ließ sein Roß laufen. Denn er begriff wohl, daß er gegen den Riesen und dessen Koloß von Pferd nicht rennen konnte und daß die Gewandtheit und Geschmeidigkeit gegen die Übermacht helfen mußte. Und der Riese, der sich schämte schlechter zu sein als der Jüngling, sprang auch vom Pferde, und sie warfen beide die Lanzen weg und griffen zu den Schwertern.
Und es entstand nun einer der schönsten und seltensten Kämpfe, die je in einer Rennbahn gesehen worden. Die Erde erzitterte, wann der Riese seinen Fuß bewegte, und Felsen schienen unter jedem seiner Hiebe bersten zu müssen. Leicht wie der geflügelte Wind sprang der Prinz einher wich und bog sich jedem Streiche und Stoße aus und schlüpfte geschickt unter der Langsamkeit und Schwere des Riesen hin.
So hatten sie lange gekämpft und schon rieselte des Riesen Blut aus mancher Öffnung, aber es waren seichte Wunden. Der Prinz war aber noch ganz und spielte in leichter Beweglichkeit mit seinen leichten Waffen um das Ungeheuer herum. Als der Riese sich nun von seinem eigenen Blute erröten sah, da ergrimmte er in seiner Seele und rief: Genug! o schon zu viel! nicht länger soll diese Mücke mit dem Löwen spielen.
Und er holte einen gewaltigen Hieb aus, wodurch er den Prinzen wie eine Rübe in zwei Stücken zu spalten meinte. Doch der Hieb glitt vom Helm ab, nahm aber den ganzen Schild mit und die Hälfte des Panzers, und der Prinz fühlte die Spitze des Eisens bis an sein Herz dringen.
In dieser äußersten Not nahm auch er seine letzten Kräfte zusammen und stieß sein Schwert, so lang es war, in des Riesen Brust, daß das lange Scheusal fluchend und röchelnd hinstürzte.
Man kann sich Schneeflöckchens Angst denken bei diesem fürchterlichen Streit und wie sie in ihrem Fläschchen zitterte und bebte, wenn der Riese in seinen Waffen daher rasselte und sie die Stöße klingen und die Hiebe durch die Luft sausen hörte. Als sie aber die rote Flut den Panzer des Prinzen hinab rieseln sah, da konnte sie es nicht länger aushalten in ihrem Kerker, sprengte das Fläschchen und mischte sich mit dem Blute, das wie ein purpurner Strom am Boden floß.
Und o Wunder über alle Wunder! in dem selben Augenblicke, wie sie von dem Blute ganz umflossen war, stand die aller schönste Jungfrau da: Schneeflöckchen war wieder ein Mensch geworden.
Der Prinz hatte sich so erschöpft und verblutet, daß er in Ohnmacht hingesunken war. Schneeflöckchen warf sich mit tausend Tränen auf ihn, riß ihm den Panzer auf und trocknete das Blut seiner Wunde mit ihren schönen langen blonden Locken ab; sie beweinte ihn fast schon wie einen Toten.
Als sie so über ihm lag und klagte und schluchzte, siehe da schlug der Prinz die Augen auf und atmete wieder und sah sein allerliebstes süßestes Kind, um welche er nun so manches Jahr in der Welt herumgeritten war. Und es war ihm bei dem Anblicke, als ob neue Kräfte sich durch alle seine Adern gößen und er neu geboren wäre, und er fühlte seine Wunde nicht mehr noch wie das Blut herabrieselte, sondern sah nur das liebliche Schneeflöckchen und küßte und herzte sie.
Sie aber schnitt ihr Hemdchen inzwei, wo es ihr um das Herz lag, und legte das auf die Wunde, und das Blut ward gleich gestillt. Die Wunde war wohl tief, aber nicht tötlich, was sie leicht hätte werden können, wenn sie einen Zoll tiefer gedrungen wäre; denn der Riese hatte grade auf sein Herz getroffen. Dieser aber lag wirklich tot da und sollte nimmer wieder aufstehen.
Sie betrachteten nun seine ungeheure Lanze und seine gewaltigen Waffen, die ein gewöhnlicher Mann gar nicht von der Erde aufheben konnte, und ließen ihn da liegen; das alte garstige Weib aber, um welches der blutige Span entstanden war, ließen sie in Frieden gehen, wohin sie wollte.
Der Prinz aber nahm zum Andenken dieses Streits mit dem Riesen nichts weiter mit als den großen weißen Hengst, worauf der Unhold geritten war, und sein Schwert. Als sie das Schwert von der Erde aufnahmen und näher betrachteten, sahen sie ein neues Wunder: die Spitze war zusammengeflossen, wie Eisen geschieht, das in die Kohlenglut gelegt wird, damit es dem Schmiede wieder weich werde.
Und als Schneeflöckchen dies sah, funkelten ihr die Äuglein vor Entzücken und die hellen Tränen liefen ihr über die Wangen, und sie drückte den Prinzen mit einer Gewalt an ihre Brust, als wolle sie in Eins mit ihm zusammenrinnen, und rief: o du aller treueste und an Liebe unüberwindlichste Seele! so ist dein Herzblut so heiß von Liebe, daß das Eisen des Riesen daran geschmolzen ist und nicht hat eindringen können?
So habe ich nun dieses warme Herz, wovon mir so oft geträumt hat in bitterer Trauer während meiner traurigen Verwandlung? Nun sehe ich, daß alles erfüllt ist, was meine Stiefmutter die böse Hexe einst gemurmelt hat, als sie mich aus dem Fenster fliegen ließ. –
Und sie erzählte dem Prinzen nun die Geschichte ihrer Verwandlung und wie jämmerlich sie zwei Winter als Schneeflöckchen habe umher fliegen müssen, bis sie in seiner Hand zum Tropfen geworden sei.
Der Tag, an welchem dieser Kampf mit dem Riesen stand, war genau der letzte Tag des fünften Jahres seit dem Tage, wo Schneeflöckchen den verzweifelten Prinzen Bisbiglio in der öden Waldschlucht des Kaukasus gefunden hatte.
Und da beide sahen, daß das Schicksal alles mit ihnen erfüllt hatte, und da sie sich herzlich sehnten, die treueste und unvergleichlichste Liebe durch eine Hochzeit zu krönen, so ritten sie nun nicht weiter durch die Welt auf Abenteuer – denn sie hatten ja das aller schönste Abenteuer erlebt – sondern sie nahmen den gradesten Weg nach dem Schlosse, in welchem der alte König von Arabien, des Prinzen Bisbiglio Vater, wohnte.
Und sie sind dort glücklich angekommen und der Prinz hat dem Könige alles getreulich erzählt, wie es sich mit ihm begeben hatte. Und der alte Herr hat nun wohl gesehen, wie viel es mit der Weisheit der Erziehung seines Sohns auf sich gehabt hat, aber er hat sich alle seine wunderlichen Abenteuer gern gefallen lassen, da er ihm eine solche Schnur ins Haus gebracht hat; denn Schneeflöckchen war so freundlich und schön, daß sie nicht allein ihm und allen Menschen sondern allen Engeln im Himmel gefiel.
Und als der alte König sich genug gefreut hatte und die Hochzeit gewesen war, da machten Bisbiglio und Schneeflöckchen sich auf und zogen zu dem alten Könige in Indien. Und Schneeflöckchen erzählte ihm ihre ganze Geschichte, wie die Stiefmutter zur Füchsin geworden war und gesungen hatte: Schneeflöckchen flieg hin! fliege durch die Welt hin! und wie sie dann ein Schneeflöckchen geworden und aus dem Fenster gelassen wäre und so mehr als sechs traurige Jahre in der Verwandlung habe leben müssen.
Und der König ihr Vater ist so zornig geworden, daß er die alte Hexe hat an einen Pferdeschweif binden und zu Tode schleifen lassen. Auch hat er nun von ihren häßlichen Töchtern, die sie ihm geboren, nichts mehr wissen wollen, sondern hat sie hoch gen Norden hinauf in die Berglande Indiens geschickt und geringen Männern zu Frauen gegeben.
Schneeflöckchen aber ist Königin von Indien geworden nach seinem Tode und Indien und Arabien sind so ein Königreich geworden. Ein zärtlicheres und treueres Ehepaar ist aber auf der Welt nie gesehen worden als der treue Prinz Bisbiglio und seine süße Prinzessin Schneeflöckchen, so daß sie wegen ihrer Zärtlichkeit und Treue noch bis diesen Tag im ganzen Morgenlande in Fabeln und Liedern erzählt und gesungen werden.
Sie haben auch die aller schönsten und lieblichsten Kinder gehabt, die auch Herzen gehabt haben, sich aller Anmut und Schönheit des Himmels und der Erde zu freuen, und die ihren Eltern an Freundlichkeit und Milde gleich gewesen sind.
Märchen v. Ernst Moritz Arndt
RÜBEZAHL - Woher ist er gekommen ...
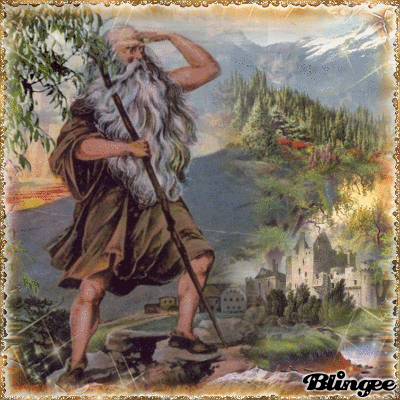
In grauer Vorzeit lebten im hohen Norden drei Brüder, die Schles, Wil und Wan hießen. Schles, der älteste von ihnen, hatte seinen Namen von seinen Vorfahren geerbt und war wie sein Vater ein Bauer und Fischer. Er wußte Runen zu schneiden und verstand es in den Sternen zu lesen. Auch war er geschickt in Heilkunst und in der Kräuterkunde und half jedem, dem noch zu helfen war, ohne etwas dafür zu fordern. So blieb er arm, aber er wurde weit und breit gelobt.
Wil und Wan dagegen waren zwei rauhe, wilde, gierige Gesellen, die vom Pflügen und Säen nichts wissen wollten, sondern mit ihren großen Schiffen die weiten Meere durchpflügten und Seeraub trieben. Und da sie mit viel Schlauheit und List zu Werke gingen, hatten sie niemals Ärger und wurden reicher und mächtiger.
Mit jedem neuen Raubzug wuchs ihre Beliebtheit unter dem Volk. „Bleibt im Lande eurer Väter, und nährt euch redlich“, sprach Schles zu ihnen, als sie sich zu einem neuen Beutezug rüsteten. Aber sie lachten ihn aus, schimpften ihn einen dummen Bauern und faßten an ihre Schwerter, die sie stets an der Hüfte trugen.
„Was ihr nicht wollt, das man euch tu', das fügt auch keinem anderen zu!“ rief Schles warnend. „Du bist ein Narr und ein Feigling!“ knirschten sie und bedrohten ihn mit Fäusten. „Je siegreicher der Räuber, um so jämmerlich sein Ende!“ murmelte Schles, drehte sich um und spannte die beiden Rappen vor den Pflug.
Nun bliesen Wil und Wan in ihre großen silbernen Kampfhörner, lockten damit ihre Anhänger zum Strand und gingen mit ihnen an Bord. Das Getreide sproß schon, als sie vom Ufer stießen. Als es wieder reifte, kehrten sie heim. Sie waren im fernen Land gewesen, hatten drei reiche Städte überfallen und Beute über Beute gemacht.
Sogleich riefen sie das Volk zum Rate zusammen und sprachen: „Auf, laßt uns hinüberfahren und sie alle mit unseren Schwertern zum Gehorsam zwingen, auf daß sie uns fortan dienen und wir ihre Herren sind in Ewigkeit!“ Und da sie alle die erbeuteten Schätze vorwiesen, fanden sie Beifall auf allen Seiten.
Nun aber hob Schles seine Stimme und rief: „Wehe allen, die solche Taten gut heißen! Hochmut kommt vor dem Fall. Die Sterne drohen.“ „Die Sterne lügen!!!“ brüllten Wil und Wan wie aus einem Munde und pochten mit den Schwertern an die Schilde, um des Bruders Stimme zu übertönen.
Darüber begann sich das Volk zu spalten. Die Alten standen zu Schles, aber die Jungen wollten ihn nicht hören. Doch die Alten gewannen noch einmal die Oberhand, und Schles sprach zu allen: „Gewalttat und unrechtes Gut gedeihen nimmermehr. Wem es hier in der Heimat nicht gefällt, der möge ausziehen in ein neues Land, darin noch keine Menschen wohnen.
Aber in ein Land einzudringen, um die darin Wohnenden zu unterjochen und auf ihnen zu schmarotzen, das ist die größte aller Torheiten. Niemals hätten unsere Väter solche Schändlichkeiten gebilligt. Wer abweicht vom Brauch seiner Vorfahren, der wird untergehen! Und je höher er sich erhoben hat, umso schneller und tiefer wird er fallen.“
Solche Worte vermochten Wil und Wan nicht zu widerlegen, und deshalb entschied sich die Mehrheit des Volkes gegen sie. Aber sie ließen nicht locker und zogen mit dem geraubten Gold immer mehr Wankelmütige zu sich herüber. Nun hatte Schles, dreizehn Kinder und auch sie vermochten der Versuchung nicht zu widerstehen, nahmen Gold und verließen ihren Vater.
Das ging Schles sehr zu Herzen, aber er blieb fest und unbeirrt. „Bist du nicht mit uns, so werden wir gegen dich sein!“ sprachen seine Brüder zu ihm und boten ihm zehn Lasten Silber und fünf Lasten Gold. „Nicht um alles in der Welt!“ rief er und wies sie von sich. Darauf drohten sie ihm mit Schimpf und Schlimmerem und verließen ihn.
Schles aber trat hinaus auf den Acker, schaute empor zu den ewigen Sternen und las darin, daß ihm daheim ein großes Unglück drohe. Deshalb kehrte er nicht in sein Haus zurück, sondern schlug sein Lager in einem Heuhaufen auf, den er am Rande der Wiese aufgeschichtet hatte.
Kurz vor Mitternacht begann sein Haus zu brennen. Er erwachte erst, als es schon in hellen Flammen stand. Nur das Vieh und eine uralte Truhe, die in der Tenne stand, konnte er retten, dann brach das Gebälk zusammen. Dem Vieh gab er die Freiheit, die Truhe brachte er an Bord seines kleinen Schiffes, noch vor Sonnenaufgang spannte er das Segel auf und ließ sich im Morgenwind das Wasser hinunter treiben.
Sieben Hartbrote lagen unter der Ruderbank, davon nährte er sich. Dann öffnete er die Truhe und fand darin zwei Angeln, mit denen er sich jeden Morgen einige Fische aus der Flut holte. Weiterhin barg die Truhe fünfzehn Runenstäbe, deren Zeichen er aber trotz aller Mühe nicht zu entziffern vermochte, und eine escherne Wünschelrute, die von seinem Großvater stammte.
Als er sie aufhob, brach der mürbe Bast, mit dem die Griffe umwickelt waren, schälte sich los und gab die Buchstaben frei, die darauf standen. Und Schles las: „Nimm mich zur Hand, und folge mir, dann wirst du kommen zur Höhle, darin die Quelle des ewigen Lebens fließt.“
Er gehorchte diesen Worten, nahm die Wünschelrute, wie er es bei seinem Großvater gesehen hatte, in beide Hände, stellte sich mitten in das Schifflein und drehte sich langsam auf seine Ferse. Das tat er siebenmal, und immer schlug die Rute nach Süden aus. Also fuhr er fortan entlang der Küste, bis er die Mündung eines Stromes erreichte, der von Süden kam.
In dieses breite, ruhig fließende Gewässer lenkte er ein und fuhr darauf so lange, bis sein Kiel in einer Sandbank steckenblieb. Hier ging er an Land, lud sich den geringen Mundvorrat und die dunklen Runenstäbe auf den Rücken, nahm die Wünschelrute zur Hand und drang am Ufer des Flusses immer weiter nach Süden vor.
Und da die Fische immer spärlicher wurden und das Brot längst zur Neige gegangen war, nährte er sich von Beeren und Pilzen, suchte Wurzeln und wilde Rüben, las Früchte von den Bäumen und erlegte Wild. So kam Schles in das Land, das nach ihm den Namen Schlesien trägt. Er fand es völlig menschenleer, weil es damals gerade von seinen bisherigen Bewohnern verlassen worden war, sie waren nach Süden davon gezogen.
Er durchschritt das verlassene Land, bis er am Fuß einer steilen Bergkette stand. „Welch ein riesiges Gebirge!“ sprach er zu sich selbst, denn er kam aus einem Lande, das ganz flach war. Nun erstieg er die rüstige Bergkette, die seitdem „das Riesengebirge“ heißt, und zog dabei fleißig die Wünschelrute zu Rate.
Und als auf dem Gipfel des höchsten Berges stand, der seitdem „die Schneekoppe“ genannt wird, schlug die Rute plötzlich nach Norden aus. Daran erkannte er, dass er den richtigen Ort erreicht hatte, und suchte solange, bis er den geheimnisvollen unterirdischen Raum gefunden hatte.
Weit oberhalb des Tales, in dem heute das Städtchen Schmiedeberg steht, lag der Eingang zur Höhle inmitten eines dichten Knieholzgebüsches. Es war ein schmaler Spalt, der von einer krausen, weit überhängenden Felsspalte geschützt wurde. Dann kam ein langer, gerader Gang, durch den ein Bächlein rauschte.
Immer weiter drang Schles mit seiner Kienfackel vor und fand riesige, dunkle Räume, die sich in vielfachen Windungen und Verzweigungen von einem Ende des Gebirges bis zum anderen erstreckten. Die Höhle wurde von unzähligen Quellen durchrieselt, kleinen und großen, und hatte insgesamt neun Ausgänge.
Mitten in diesem Reich schlug Schles sein Lager auf und lebte seit dem als Waldbauer, Jäger und Bergmann. Da die Wünschelrute ihm in der Höhle den Dienst versagte, trank er jeden Morgen aus einer anderen Quelle. Unermeßliche Reichtümer bargen die unterirdischen Räume an Gold, Silber und edlen Steinen.
„Ich muß reich werden“, sprach er zu sich selbst, „viel reicher als Wil und Wan, auf daß meine Kinder wieder zu mir zurück kehren.“ Und er brach die Schätze und Kostbarkeiten aus dem Gestein und häufte sie emsig neben seinem Lager. Dabei wurde er älter und älter, denn aus der Quelle des ewigen Lebens hatte er noch nicht getrunken.
So wurde Schles der erste aller Schlesier. Seine Kinder aber hatten inzwischen unter Anführung von Wil und Wan ein großes fremdes Land erobert, saßen dort als stille Gebieter auf ihren festen Burgen, unterdrückten das arme Volk mit aller Gewalt, lebten davon gar herrlich und in Freuden und hatten ihren Vater längst vergessen.
RÜBEZAHL - Er zählte die Rüben ...
Eines Abends fand Schles die Quelle des ewigen Lebens. Sie entsprang einer doppelten Kristalldruse und war so schwach, daß sie jeden Tag nur einen einzigen Tropfen von sich gab. Als er den dritten Tropfen getrunken hatte, verfiel er in einen tiefen Schlummer, schlief fünfhundert Jahre und erwachte als Jüngling.
Nun vermochte er auch die Runen zu entziffern, die von den Händen aller seiner Ahnen in die fünfzehn Stäbe geritzt worden waren und ihm Kunde gaben von der zauberhaften, unüberwindlichen Macht des richtigen Wortes. Dadurch wurde er ein Zauberer und Berggeist, der durch seinen Willen und den Hauch seines Mundes imstande war, unsichtbare Dinge hervorzurufen, sichtbar zu machen und vor Augen zu stellen.
Und da er ein guter Geist war, wollte er sogleich seine Kunst zum Besten der Menschen erproben. Schleunigst entfuhr er seiner Höhle, betrat die Oberwelt und hielt Umschau. Das Land hatte sich inzwischen wieder mit Menschen gefüllt. Wohin er sah, überall regten sich fleißige Hände.
Gelichtet waren die düsteren Wälder. Zwischen freundlichen Hainen, fruchtbaren Feldern und blühenden Obstbäumen ragten die Dächer der schlesischen Siedlungen hervor. Aus den Schloten wirbelte der Herdrauch lustig in die Frühlingsluft.
Es duftete ganz deutlich nach Streuselkuchen und schlesischem Himmelreich, der aus Backobst, Klößen und Speck bestehenden Festspeise der Schlesier. Auf den blumenreichen Bergwiesen weideten die Herden, die Bienen summten, die Hunde kläfften, und der Hirt blies fröhlich seine Schalmei.
Das gefiel Schles und er murmelte zufrieden: „Das sind sanfte Leute und lustige Kinder, sie werden mir nicht davon laufen, um sich in Beutejäger zu verwandeln.“ Wie er nun so durch die Täler dahin strich, hörte er einen Wasserfall rauschen und gewahrte in der Felsgrotte, durch die das Bächlein strömte, eine liebreizende Jungfrau beim Baden.
Ihre zwölf Gespielinnen lagerten am Ufer und sagen ein Lied zur Preisung ihrer großen Schönheit. Es war die Prinzessin Emma, die einzige Tochter des mächtigsten der schlesischen Fürsten, der auch das dem Riesengebirge vorgelagerte Hirschberger Tal von seinem hohen Schloß aus beherrschte.
Auf den ersten Blick verliebte sich Schles, der Jüngling und Berggeist, in diese Fürstentochter, und seine Liebe zu ihr wuchs so über alle Maßen und Begriffe, daß er nur noch darauf sann, sie zu entführen. Und als sie wiederum in der Grotte badete, gab der kiesige Grund des Baches nach, und sie versank blitzschnell in der Tiefe.
Als sie die Augen öffnete, fand sie sich auf einem wunderweichen Ruhebett in einem prächtigen Palast, mit dessen Herrlichkeit das Schloß ihres Vaters keinem Vergleich standhalten konnte. Und vor ihr kniete ein schöner Jüngling, der ihr mit heißen Worten seine unstillbare Liebe gestand.
„Wer bist du?“ fragte sie bestürzt und verwundert. „Ich bin der Berggeist“, gestand er und küßte ihre Hand. Der Prinzessin gefiel es, auch einmal von einem richtigen Berggeist geliebt zu werden, und sie ließ sich nun von ihm durch die hundert Säle und Gemächer führen.
Er schenkte ihr tausend Kleider und eine ganze Wagenladung Schmucksachen. Und je mehr er ihr schenkte, umso lieber hatte sie ihn. Dann wandelten sie durch den wundervollen Lustgarten mit duftenden Blumenbeeten und grünen Rasenplätzen, die das Schloß von allen Seiten umgaben.
Alle Bäume trugen reife, süße Früchte. Und die Gebüsche wimmelten von Singvögeln, die mit ihrem hunderstimmigen Gesang die Luft erfüllten. Das hatte alles Schles aus dem Unsichtbaren hervor gezaubert, und die Prinzessin erfreute sich daran drei Tage lang. Dann begann sie zu schmollen, denn sie sehnte sich nach ihren Gespielinnen.
Flugs ging der Berggeist hinaus aufs Feld, zog aus seinem Acker ein Dutzend Rüben, legte sie in ein Körbchen und brachte es der Prinzessin. „Holdeste aller Jungfrauen“, sprach er zu ihr, „nimm diesen kleinen bunten Stab, und berühre damit diese unscheinbaren Gewächse. Und sogleich werden sie die leuchtenden Gestalten deiner Sehnsucht annehmen.“
Sie gehorchte, nahm den Stab, und schon hatte sie ihre zwölf Dienerinnen um sich. Nun war die Freude groß, es gab fröhliche Tänze, rauschende Feste, große Gastmähler und ritterliche Spiele. Immer zahlreicher wurde der Hofstaat der Prinzessin, und sie ruhte und rastete nicht, ihn stetig zu erweitern.
Sie sann nur auf bunten Tand, Flitter und Prunk und dergleichen höhere und allerhöchste Kulturerrungenschaften. Und je mehr sich der Körper des Hofstaates aufblähte, umso leerer wurden die Felder, und umso bedrohlicher Schmolz der Rübenhaufen im Schloßkeller zusammen. Nur aus dem Unsichtbaren verstand Schles etwas hervorzuzaubern.
Die Kunst, aus dem Nichts zu schaffen, war ihm versagt. In seiner grenzenlosen Liebe, erkannte er nicht einmal, daß eine richtige Prinzessin tausendmal mehr Wünsche haben kann, als zehn tüchtige Zauberer zu befriedigen vermögen. Als nun der Rübenvorrat immer rascher zerrann, eilte der Berggeist in der Gestalt eines Pächters nach Hirschberg, kaufte eine Eselslast Rübsamen, bestellte damit alle seine Felder und schürte unter der Erde ein mächtiges Kohlenfeuer an, um die Keimlinge rascher empor zu treiben.
Aber der Prinzessin wuchsen sie lange nicht rasch genug, und sie begann darüber, dem Berggeist zu grollen. Schließlich wandte sich ihr Herz ganz von ihm ab, weil er nicht einmal imstande war, die kleinen und unschuldigen Wünsche einer hochwohlgeborenen Prinzessin zu erfüllen, und sann auf Flucht.
Zu diesem Zwecke verwandelte sie die vorletzten drei Rüben mittels des Zauberstabes in eine Biene, in eine Grille und in eine Elster und sandte sie alle drei zu ihrem früheren Liebhaber, dem Prinzen von Ratibor, an den sie sich plötzlich erinnerte.
Die Biene wurde von einer Schwalbe, die Grille von einem Storch gefressen, aber die Elster, dieses klügste, listigste und geschwätzigste aller Tiere, kam glücklich ans Ziel und richtete die Botschaft getreu aus. Eilig rüstete der Prinz ein Geschwader seiner Reisigen, und fort ging's, was die Rosse zu traben vermochten, dem Riesengebirge zu, um die holde Gefangene zu befreien.
Weit dem Zuge voran flog die Elster und brachte der Prinzessin die frohe Nachricht. „Morgen soll die Hochzeit sein!“ sprach sie darauf zum Berggeist und begann sich bräutlich zu schmücken. „Und damit ich sehe, daß du mich auch wahrhaft liebst, so gehe hinaus, und zähle mir alle Rüben auf dem Acker. Aber zähle genau, und verzähle dich nicht, sonst kann ich nimmermehr die Deine werden!“
Und Schles sprang hinaus, zählte und zählte, eilte die Furchen wohl auf und ab und brachte schließlich eine sehr hohe Summe heraus. Um aber seiner Sache ganz sicher zu sein, wiederholte er die Zählung. Und es stellte sich heraus, daß er sich das erste Mal bös verzählt hatte.
Zum dritten Mal begann er die schwierige Arbeit. Und wiederum war das Ergebnis ein anders, er raufte sich das Haar und zählte zum vierten Male. Und so ging es weiter und weiter, bis ihm der Schweiß von der Stirne troff. Indessen hatte die Prinzessin die letzte Rübe in ein mutiges Roß verwandelt.
Und während der Berggeist so in seine Zählerei vertieft war, daß er nichts anders sah und hörte, schwang sie sich in den Sattel und sprengte mit dem Sturmwind um die Wette über die Kuppen und Halden des Gebirges zu Tal. „Rübezahl! Rübezahl!!!“ rief sie noch zurück, als sie die Grenze seines Gebiets erreicht hatte, und flog in die offenen Arme des Prinzen von Ratibor.
Da hob der Berggeist den Blick und erkannte, wie schmählich er vernarrt worden war. Im ersten Zorn packte er einige Wolken, knüllte sie zusammen und schleuderte sie der Entflohenen nach. Aber er erreichte sie nicht mehr. Nur ein Hagelwetter schlug neben ihr in die Tannen, und Blitz zerschmetterte weit hinter ihr eine tausendjährige Eiche.
Nun riß der Berggeist das Bild der Undankbaren aus seinem Herzen und vollbrachte einen Schwur, sich niemals wieder zu verlieben, sondern fortan einsam zu bleiben und nur sich selber getreu zu sein. Seitdem lebt er ausschließlich mit seinen rasch wechselnden Launen.
Ist er heute ungestüm, wild und rauh, kann er morgen schon gutmütig, bieder und freundlich sein. Er ist genau so rätselhaft, unsicher und wendig wie das Wetter und die Klüfte seines Gebirges. Lieber narren, als genarrt werden! Das ist sein Wahlspruch.
Seinen Schwur, den er sich selbst gegeben hatte, hat er gehalten. Aber seitdem heißt es bei den Bewohnern der umliegenden Gegenden, die ihn bis heute noch niemals mit seinem richtigen Namen zu nennen gewußt haben, der Rübezahl. Doch wer ihn mit diesem Spottnamen ruft, dem zahlt er’s heim, und das gründlich.
RÜBEZAHL - Er verschenkt Stöcke ...
Zwei arme Handwerksburschen, ein Seiler und ein Schlosser wanderten einst zusammen über das Gebirge, um im Böhmischen Inland ihr Glück zu versuchen. Der Schlosser, ein finsterer, mürrischer Geselle, war immerdar schlechter Laune und hatte an allem und jedem etwas auszusetzen.
Der Seiler dagegen war alleweil vergnügt, ließ fünf gerade sein und nahm das Leben auf die leichte Schulter. Um den Weg abzukürzen, erzählte er dem Schlosser allerhand lustige Schwänke und Schnurren und kam zuletzt auf den Berggeist zu sprechen, wobei er sich wohl hütete, ihn mit dem Spottnamen zu bezeichnen.
Allein der Schlosser wollte dergleichen Märchen nicht hören und knirschte verdrießlich: „Der Teufel soll den Rübezahl holen!“ Im nächsten Augenblicke sahen sie eine prächtige Kutsche daher rollen. „Sieh da!“ rief der Seiler. „Was muß das für ein reicher, vornehmer Herr sein! Wir wollen ihn ansprechen. Vielleicht hat er etwas in seinem Beutel für uns übrig?“
„O du dreimal durchgesiebter Narr!“ sprach der Schlosser giftig. „Je reicher die Herren, umso geiziger sind sie, und umso schärfer drücken sie den Daumen auf den Beutel!“ Indessen war die Kutsche heran gekommen, und sie sahen, daß ein wohlhabender Reisender darin saß.
Nun schwangen sie ihre Mützen, die Kutsche hielt an, und der Seiler brachte nach altem, guten Handwerksbrauch in artigen Worten ihr Begehren vor. Daraufhin stieg der Herr aus der Kutsche, hieb mit seinem Hirschfänger aus dem Haselbusch am Wege zwei mehr als fingerdicke Wanderstecken ab und überreichte sie ihnen.
„Ich habe kein Kleingeld bei mir“, sprach er freundlich. „Nehmt darum diese beiden Stöcke von mir an, verliert sie nicht. Laßt sie auch nicht in der Herberge stehen, sondern haltet sie lieb und wert, wenn ihr euch daran erholen und auf die Beine kommen wollt.“
„Schönen Dank, Euer Gnaden!“ sprach der Seiler und verneigte sich. Nun stieg der Reisende wieder ein, und die Kutsche rollte von dannen. Der Schlosser aber erboste sich ganz gewaltig über das sonderbare Geschenk, ballte wütend die Faust hinter der Kutsche drein und lachte gellend: „Ja, so sind sie, die hohen Herren! Hab ich es dir nicht gleich gesagt? Wir bitten um zehn Pfennig, und sie geben uns ein Stück Holz!“
„Ei, Bruder!“ suchte ihn der Seiler zu besänftigen. „Warum so arg? Ich möchte meinen Stock behalten. Er ist mir gar handgerecht, schicklich und gerade, und er soll mir bis Prag noch viele gute Dinge leisten.“ Dabei hieb er ihn gegen die Felswand, um seine Festigkeit zu erproben, und siehe da, er brach mitten entzwei und lauter Goldstücke purzelten heraus.
Jetzt erkannten sie, wer der vornehme Herr gewesen war, und so gleich rannte der Schlosser Hals über Kopf davon, um seinen Stock zu suchen. Und er suchte und suchte, bis ihm der Kopf rauchte und die Zunge am Gaumen klebte. Aber es war alles umsonst. Der Stock war und blieb verschwunden.
Inzwischen sammelte der Seiler die Goldstücke auf und verstaute sie in seinem Ranzen. Fluchend und mit leeren Händen kehrte der Schlosser zu ihm zurück. „O weh!“ sprach der Seiler voller Mitleid. „Jetzt bin ich ein reicher Mann geworden, und du bist ein armer Schlucker.“ „Bruder, halb und halb!“ schlug der Schlosser vor. „Wohlan!“ erwiderte der Seiler. „Nimm die Hälfte, die Last ist mir zu schwer.“
Und sie teilten den Schatz miteinander, bis zuletzt ein Goldstück übrig blieb. „Laß uns darum in der Herberge würfeln“, sprach der Schlosser, dessen Herz beim Anblick des Goldes plötzlich vor Arglist und Gier überfloß.
Am Abend erreichten sie die Elbfallbaude. Hier zog der Schlosser seinen falschen Würfel aus dem Sack und gewann, gewann, gewann, bis der Seiler mit leeren Taschen dasaß. Aber davon wollte der Schlosser nichts wissen, sondern machte sich noch vor Sonnenaufgang schleunigst aus dem Staube. Das Gold brachte ihm jedoch kein Glück.
Elf Jahre später baumelte er als ein ertappter Beutelschneider an dem Galgen von Trautenau. Und der Strick, an dem er hing, stammte aus der Werkstatt des ehrsamen Pragers Seilermeister, der damals, als Geselle mit ihm über das Riesengebirge gewandert war und weiterhin durch Fleiß, Frohsinn und Redlichkeit sein Glück gemacht hatte.
RÜBEZAHL - Vom Rübezahl ... 1. geschichte vom Esel
Rübezahl, der Geist des Riesengebirges, hatte oft seine Freude daran, den Menschen allerlei Streiche zu spielen; dabei erwies er den Armen aber mancherlei Wohltaten und strafte die Hartherzigen und Geizigen.
Einmal wanderte ein armer Glashändler mit einer schweren Kiepe voll Glaswaren auf dem Rücken über das Gebirge. Da er recht müde geworden war, hätte er sich gerne etwas ausgeruht, aber nirgends war ein Felsvorsprung oder dergleichen zu sehen, worauf er seine Last hätte absetzen können.
Rübezahl, der ihn eine Weile beobachtet und bald seine Gedanken erraten hatte, verwandelte sich schnell in einen Baumstamm, der nun am Wege lag. Erfreut ging der müde Wanderer darauf zu, setzte seine Last ab und sich auf den Stamm, um sich zu erholen. Kaum aber saß er da, so rollte der Stamm unter ihm weg, den Berg hinunter, und der Händler und die Scherben des Glases lagen am Boden.
Traurig erhob sich der arme Mann, und als er seine zerbrochenen Schätze betrachtete, fing er bitterlich an zu weinen. Da kam Rübezahl, der wieder menschliche Gestalt angenommen hatte, auf ihn zu und fragte nach der Ursache seines Kummers. Treuherzig erzählte der Händler sein Unglück, und daß er bei seiner Armut nicht die Mittel zum Ankauf neuer Vorräte besitze.
Rübezahl teilte dem Traurigen nun mit, wer er sei, und daß er ihm helfen wolle, wieder neue Glaswaren kaufen zu können. Nun verwandelte sich Rübezahl vor den Augen des erstaunten Mannes in einen Esel und gebot ihm, ihn zur nächsten Mühle zu führen. Der Müller brauche gerade einen Esel und würde ihm gerne ein so schönes Tier, wie er sei, abkaufen. Dann solle er sich aber um nichts Weiteres kümmern, sondern sich mit dem Gelde schnell fortmachen.
Der Mann führte nun den Esel zur nächsten Mühle, und nachdem der knauserige Müller noch einen Taler vom geforderten Kaufpreis abgehandelt hatte, wurde das Grautier sein Eigentum. Der Händler nahm das Geld — er hatte noch zwei Taler mehr bekommen, als seine Glaswaren gekostet hatten — und machte sich damit schnell aus dem Staube.
Der Müller freute sich recht über den guten, billigen Kauf, führte das muntere Eselein in den Stall und gab dem Knechte den Auftrag, demselben Futter zu geben. Darauf ging er in seine Stube. Sogleich aber kam der Knecht, vor Furcht und Entsetzen zitternd, ihm schon nachgelaufen und sagte: »Herr, der neue Esel ist behext! Ich habe ihm Heu gegeben, aber da rief er: Ich fresse kein Heu! Ich will Braten und Kuchen haben!«
Der Müller wollte die Geschichte nicht glauben und ging mit in den Stall. Dort stand das Eselein ganz ruhig und still. Der Müller nahm nun eine Hand voll Heu, hielt es dem Tier hin und streichelte dasselbe. Der Graue aber nahm das übel, schlug mit dem Vorderfuß nach dem Müller und rief wieder: »Ich will Braten und Kuchen! Ich will Braten und Kuchen!«
Entsetzt wich der Müller zurück. Der Esel aber drehte sich um, gab ihm noch einen Tritt mit den Hinterbeinen, so daß er ins Heu kugelte, und sprang dann durch die offene Tür hinaus ins Freie, wo er bald verschwunden war. Nachdem der Knecht seinem Herrn wieder auf die Beine geholfen hatte, rieb dieser sich die schmerzenden Glieder und jammerte: »Hätte ich doch meine zwölf Taler wieder! Mein schönes Geld!«
Dem Müller aber war recht geschehen; denn er war geizig und hartherzig und hatte noch am Tage vorher einen armen Bauern um zwölf Taler betrogen, und Rübezahl hatte den Geizigen bestraft.
H. Weinert, Sagen und Märchen
RÜBEZAHL - Er wandelt sich zum Esel ...
Im Aupatale wohnte einst ein sehr habgieriger Müller. Der benutzte falsches Maß und falsche Gewichte, wucherte, log und betrog bei jedem Handel, beutete listig die armen Leute aus, ließ sie, wenn sie nicht bezahlen konnten, unbarmherzig von ihren ererbten Feldern und aus ihren Häusern vertreiben und wurde dadurch immer reicher.
Auf diese Weise brachte er auch einen jungen Bauern dazu, daß er alles zurück lassen und den Wanderstab zur Hand nehmen mußte. Traurig stieg der Vertriebene den steilen Aupagrund hinauf, um nach Schlesien auszuwandern, wo er sich als Knecht zu verdingen gedachte.
Als er endlich, des Steigens müde, die Mitte der Koppenwiesen erreicht hatte, setzte er sich auf einen Stein und stieß einen tiefen Seufzer aus. Sogleich rauschte und klingelte es hinter ihm im Busch, und ein Esel trabte heran, der einen Sattel auf dem Rücken und ein Glöcklein am Halsband trug.
„Bäuerlein warum seufzest du?“ fragte der Esel und blieb vor ihm stehen. Der angesprochene Bauer fiel ob dieser Frage fast aus den Wolken; denn er hatte doch noch niemals ein Tier gesehen, welches sprechen konnte und am allerwenigsten traute er das einem Esel zu.
Dann aber gedachte er im Stillen des Berggeistes, in dessen Revier er eingedrungen war, faßte sich ein Herz und erzählte getreulich, was ihn so arg bedrückte und bekümmerte. Und der Esel nickte zu jedem Wort, das der Bauer sprach. Nachdem er ihm so sein ganzes Herz ausgeschüttet hatte, schüttelte der Esel den Kopf, daß die langen Ohren krachend zusammenschlugen, rollte die Augen rechts und links herum, als sei ein großes Gewitter im Anzuge und sprach:
„Sitz auf!“ Der Bauer gehorchte. Kaum aber saß er im Sattel, so begann der Esel zu laufen und zu springen, daß dem Reiter die Ohren übergingen. Wie ein Wirbelwind ging's über die Koppenwiese, blitzschnell hinab durch den Aupagrund, und nach wenigen Augenblicken hielten sie vor der Mühle.
Der Müller, der immer nach einem guten Fang auf Lauer lag, trat sofort heraus und fing an, um den Esel zu feilschen. „Gehört er auch dir?“ fragte er als pfiffiger Schacherer. Und der Esel gab Antwort und sprach ganz laut und deutlich: „Ja-!“ Nun wurden die beiden handelseinig um zehn Taler, und der Müller zahlte das Geld.
Da er aber ein Betrüger von Grunde auf war, zählte er die Taler nicht in Silber, sondern in alten, schäbigen Kupfermünzen, dem Bauern in den Hut. Und der Esel stand dabei, zählte leise mit und nickte jedes Mal, wenn ein Taler voll war. Als der zehnte Taler bezahlt war, nieste der Esel auf den kupfernen Schatz. Und, o Wunder, jede Münze hatte sich auf der Stelle in einen blanken Dukaten verwandelt.
Mit freudigem Jauchzen eilte der Bauer von dannen. Nicht minder vergnügt aber war der Müller, denn er glaubte nichts anderes, als daß er mit dem wunderbaren Esel einen vortrefflichen Kauf gemacht hätte. Rasch eilte er ins Haus, raffte, da er kein Geld mehr hatte, alle Silbergroschen und Taler zusammen, füllte damit einen großen Zuber, stellte ihn vor den Esel und kitzelte ihn, weil er es mit dem Reichwerden eiliger denn jemals hatte, mit einer Gänsefeder in die Nase.
Darauf nieste der Esel zweimal. Und, o Schreck!, das ganze Silber das in dem Zuber lag, hatte sich auf der Stelle in lauter Eselsmist verwandelt. Als der Müller sah, roch und fühlte, was der wunderbare Esel angerichtet hatte, wollte er schier vor blasser Wut ersticken.
Dann aber ermannte er sich, griff einen derben Stock und begann den Esel ganz fürchterlich zu verprügeln. Der Esel aber schien die höllische Dresche gar nicht zu spüren, sondern er feixte und bockte dazu vor hellem Vergnügen und eitel Schadenfreude. „Warum hast du zweimal geniest, du Untier?“ jammerte der Müller, als ihm der Arm lahm geworden war. „Warum hast du mich in der Nase gekitzelt, du Unmensch?“ gab der Esel zur Antwort.
Nun fiel der Müller auf den Hosenboden und starrte den Esel an wie ein Weltwunder. Aber er erholte sich bald, legte den Finger an die Nase und dachte äußerst pfiffig: „Ein Tier, das spricht? Und dazu noch ein Esel! Das ist ein gutes Geschäft! Ich werde mit ihm auf die Jahrmärkte ziehen und ihn für teures Geld sehen lassen.“
Sodann befahl er seinem Knecht, den Esel in den Stall zu tun und ihm das beste Heu aufzuschütten. „Ich fresse kein Heu, nur lauter Gebratenes und Gebackenes!“ brüllte der Esel den Mühlknappen an, daß dieser davon sprang, als ob ihm die ganze Rückseite brenne. „Gib ihm, was er verlangt!“ befahl der Müller.
Nun fraß der Esel fünf Schinken, zwölf Hammelschlegel, siebzehn Bratwürste, vierundzwanzig Sauergurken, und einundreißig Rosinenwecken, das Stück zu zweieinhalb Pfund, und war noch lange nicht satt. Als der Müller solches erfuhr, raufte er sich das Haar und wimmerte: „Um Gottes und aller Heiligen Willen!“ In diesem Vieh steckt der Leibhaftige Teufel.“ Und schleunigst schickte er seinen Knecht nach Hohenelbe.
Dort lebte im Benediktinerkloster ein wohlbeleibter Prior, der zum lebhaften Kummer seines aufgeklärten Bischofs im ganzen böhmischen Lande einen großen Ruf als Teufelsaustreiber und Satansbanner genoß. Schon am nächsten Tage brach er auf, um die Künste seines geheimnisvollen Handwerks dem verhexten Esel angedeihen zu lassen. Und sehr viel Volk zog mit ihm und begleitete ihn zur Mühle.
Als sie dann in den Stahl traten, hub der Esel an zu singen: „Gloria! Viktoria! Der Müller beschummelt alle Leute, er soll nun werden, des Satans Beute.“ Dabei schüttelte er sich, daß das Glöcklein erklang, hüpfte auf und nieder wie ein junges Füllen und schlug mit dem Schwanz den Takt dazu. Und alle entsetzten sich.
Der Müller aber bekam einen knallroten Kopf, lief davon, als sei die ganze Hölle hinter ihm her, stürzte über den steilen Felsen ab und brach sich in seinem eigenen Bache den Hals. „Das ist Satans Finger!“ rief der Prior und setzte sich, um im Triumph heimzureiten auf den Esel, der nun so fromm wie ein Lämmchen tat.
Aber zwischen Marschendorf und Freiheit blieb er plötzlich stehen, nieste dreimal und sprach: „Auf die Dauer, Herr Prior, seid ihr für mich kleinen Esel doch etwas zu schwer!“ Damit bockte er, daß der Reiter in den Graben kollerte, und er sprang lachend auf und davon. Drei Tage später wurde der Prior abberufen und in die aller dunkelste Gegend versetzt, woher er gekommen war.
RÜBEZAHL - Er verleiht Geld ...

In Steinseiffen starb einst ein alter Bauer und hinterließ einen Sohn namens Veit und zwei Töchter. Da nun Veit die väterliche Wirtschaft übernahm, begehrten seine beiden Schwestern, die nach Arnsdorf und Dittersbach verheiratet waren, von ihm die Auszahlung ihres Erbteils. Und er gab ihnen Wort und Handschlag, ihnen das Geld auf den nächsten Johannistag zu zahlen, und machte sich auch bald daran, es herbeizuschaffen und zusammenzubringen.
Doch das war leichter als getan; denn das liebe Geld war wieder einmal äußerst rar geworden, dieweil die hohen Herren es auf jede nur erdenkliche Art und Weise aus dem Lande zog, um es in Wien, Venedig, Rom und Paris auszugeben, wo es sich viel vergnüglicher leben ließ als zwischen den schlesischen Wäldern und Stoppelfeldern.
So brachte dann Veit mit Mühe und Not fünfzig Taler zusammen. Und wenn er dazu auch noch das Heiratsgut seiner jungen Frau legte, fehlten ihm gleichwohl immer noch an die hundert Taler. Nun stand er mit seinen beiden Schwägern nicht sehr gut, weil sie äußerst raffgierig waren und keinem anderen etwas gönnten, und umso heftiger kränkte er sich darüber, das gegebene Wort nicht einlösen zu können.
Denn er war ein redlicher und gerechter Mann von Grund auf und wollte es auch bleiben und diesen Ruf nicht verlieren. „Ich habe zwei reiche Vettern auf der anderen Seite des Gebirges“, sprach seine Frau zu ihm, „vielleicht erbarmt sich einer und leiht uns von Herzen gern etwas von seinem Überfluß gegen gute Zinsen!“
Und Veit nickte, schrieb einen Schuldschein über einhundert Taler, worin er den Platz für den Namen des Gläubigers offen ließ, versah das Papier mit Datum und Unterschrift, steckte es in die Tasche, nahm den Bergstock zur Hand und machte sich in der Frühe auf.
Rüstig stieg er über den Kamm und erreichte am dritten Abend das Dorf, in dem die beiden Vettern wohnten. Allein er klopfte vergeblich an ihren Türen; denn der eine lag im Streit mit seinem Nachbarn und brauchte Taler zum Prozessieren, und der schlug ihm die Tür dicht vor der Nase zu.
Bekümmert machte sich Veit auf den Rückweg und zermarterte unterwegs sein Hirn, wen er wohl um die hundert Taler angehen könnte. Aber es fiel ihm nichts ein, so sehr er sich auch quälte. Plötzlich als er die Schneekoppe vor sich liegen sah, gedachte er des Berggeistes, blieb unwillkürlich stehen und seufzte aus Herzensgrund: „Ach, Rübezahl, Rübezahl, leih mir hundert Taler!“
Doch es kam keine Antwort, und so mußte er den Stecken einsetzen, denn er durfte sich nicht versäumen, wollte er vor Dunkelheit nach Hause kommen. Also wanderte er noch ein gutes Stündchen bergauf und bergab und gelangte an die beiden Teiche. Hier gesellte sich ein Mann zu ihm, der einen langen, grauen Bart und einen immergrünen Rock trug und der ganz beiläufig fragte, wer er sei, woher er käme und wohin er ginge.
Und da dem braven Veit das Herz zum Überlaufen voll war und ein Wort das andere gab, hielt er nicht länger hinterm Berge mit seinen schweren Sorgen. „Hundert Taler?“ ließ sich jetzt der grüne Mann vernehmen, nachdem er sich geräuspert hatte, und wiegte den Kopf, daß sein langer Bart im Winde wehte.
„Hundert Taler hätt' ich wohl übrig.“ „Leiht sie mir! Leiht sie mir!“ rief Veit hurtig. „In drei Jahren zahle ich sie Euch zurück auf Heller und Pfennig nebst Zins und Zinseszins.“ „Zins?“ fragte der Grüne und schüttelte den Kopf. „Zins bringt Krieg.“ „So leiht mir das Geld ohne Zinsen!“ drängte Veit. „Ich will Euch einen Schuldschein darüber geben und ihn einlösen pünktlich auf den Tag und Stunde.“
Der Grüne war damit einverstanden und führte ihn nun abseits durch einen dicken Busch. Das dauerte gut eine halbe Stunde. Endlich machte sie vor zwei hohen, kantigen Bergpfeilern halt, zwischen denen sich ein schmales Felsentor öffnete. „Hier wohne ich!“ sprach der Grüne und ging hinein. „Folge mir!“
Und Veit gehorchte und tappte im Stockfinsteren hinter ihm drein. So durchschritten sie einen langen, schmalen Gang, in dem ein kleines Bächlein rauschte. Als sie diese Röhre hinter sich hatten, wurde es allmählich heller und heller. Schließlich erreichten sie eine große, weite Höhle. Sie war ohne Säulen und gewölbt wie eine runde Halle, und in der Mitte stand eine kupferne Braupfanne.
Sie maß eine Klafter in der Höhe und gut hundert Klaftern in der Runde und war gefüllt mit neuen, funkelnden Dukaten und Talern bis zum Rand. Wie Veit diesen unermeßlichen Schatz erblickte, wußte er sofort, von wem er hierher geführt worden war, aber er hütete sich wohl, es zu verraten. „Nimm, was du brauchst!“ sprach der Grüne und deutete auf die Braupfanne.
Veit zählte sich laut und gewissenhaft einhundert Taler zu, und jede Zahl hallte klar und deutlich von der Decke wieder, als säße da oben einer und zählte ganz genau mit. Darauf steckte Veit das Geld ein und zog den Schuldschein heraus. „Wie ist Euer Name?“ fragte er dann und deutete auf die Lücke im Schuldschein.
„Was wollt Ihr mit diesem Schatz anfangen?“ forschte Veit ganz vorsichtig. „Ich werde ihn ausgeben, wenn die Zeit erfüllt ist, aber nicht einen Tag eher“, lautete die Antwort. Jetzt bedankte sich Veit für die hundert Taler, verließ die Höhle, merkte sich genau den Ort und die Lage des Felsentores und kam am späten Abend glücklich nach Hause.
Als er die hundert Taler auf den Tisch zählte, da glaubte seine Frau, daß er sie von ihren Vettern erhalten hatte, und er widersprach nicht und ließ sie ruhig dabei, um ihr das Herz nicht schwerer zu machen. Neunundneunzig Taler gab er weg, aber den Hundertsten behielt er.
Und das war ein richtiger Hecktaler, denn er brachte ihm Glück über Glück und vermehrte sich zusehends. Wo Veit säte, brachte der Acker doppelte und dreifache Ernte, denn Veit wühlte mit seinem Pfluge immer tiefer, als die anderen.
So konnte er dann im dritten Jahre frohgemut die hundert Taler in die Tasche stecken, um sie zurückzuzahlen. Als er aber an den Ort des Felsentores kam, hatten sich die beiden Bergpfeiler so eng zusammengeschoben, dass er keinen Grashalm hätte dazwischenstecken können, geschweige denn einen Finger.
Deshalb schlug er mit der Zwinge seines Stockes an die Felsenwand und rief mit lauter Stimme: „Veit aus Steinseiffen ist da und bringt die hundert Taler zurück!“ Aber die Pfeiler taten sich nicht auseinander. Noch zweimal pochte er, aber es wurde ihm nicht aufgetan. Da lüftete er zum Abschied den Hut, wandte sich zum Gehen und sprach: „Komme, was da wolle! Ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich kann warten, bis die Zeit erfüllt ist.“
In diesem Augenblick tanzte ein lustiger Wirbelwind über die Tannenkronen einher und warf ihm ein Blatt Papier vor die Füße. Und als er es aufhob, erkannte er seinen Schuldschein. Aber er war mitten durchgestrichen, und auf der Rückseite standen die mit Holzkohle geschriebenen Worte zu lesen: Zu Dank bezahlt. Schles.
Aha! dachte Veit. Das ist sein richtiger Name. Er heißt Schles. Das will ich mir merken. Und wenn ich wieder mal was brauche, dann will ich ihn mit diesem Namen anrufen. Aber er kam nie wieder in die Verlegenheit, um Hilfe bitten zu müssen, denn seine Wirtschaft gedieh weiter, und er lebte mit den Seinen gesund und heiter bis an sein seliges Ende.
RÜBEZAHL - Er hackt Holz ...
Gen Schmiedeberg kam einst ein Magister gezogen, der sich hier mit Handwerk des Rechtsverdrehens, darauf er sich vortrefflich verstand, einen hübschen Batzen Geld und ein schönes Ausgedinge zu verschaffen gedachte. Es ging ihm auch eine Weile ganz nach Wunsch; denn es gelang ihm in wenigen Wochen alle dortigen Streithammel so heftig aneinander zu bringen, daß sie schwarz und weiß und rechts und links nicht mehr ohne seine Hilfe zu unterscheiden vermochten.
So beschwatzte er sie denn von vorne und hinten, begleitete sie je nach Bedarf zum niederen, mittleren oder hohen Gericht und schröpfte sie wacker nach allen Regeln. Auf diese Weise wurde er geschwind reich, aber mit dem Reichtum wuchs seine Gier, immer noch reicher zu werden.
Nun begann er in seiner listigen und hinterhältigen Art, auch die ehrsamen Handwerker und redliche Tagelöhner zu begaunern, die für ihn schafften. Wie denn das Sprichwort sagt, daß ein Betrüger am schnellsten unter ehrlichen Leuten auf einen grünen Zweig kommen kann und daß ein tüchtiger Advokat niemals um eine faule Ausrede verlegen sein darf. Besonders hatte er es dabei auf die Holzhacker abgesehen, die er allesamt für niederträchtige Faulpelze, Lasterbäuche und Tagediebe hielt.
Dem ersten Holzhauer kürzte er den Lohn um ein Drittel, weil er die Scheite viel zu groß gemacht hatte. Den zweiten speiste er mit der Hälfte der ausbedungenen Summe ab, weil er die Scheite viel zu klein gemacht hatte. Dem dritten zahlte er nur ein Drittel des Geldes aus, weil er die Scheite viel zu spitzig gemacht hatte, daß sie das Ofenloch zerstießen.
Und dem vierten hielt er den ganzen Verdienst zurück, indem er ihn fälschlicherweise beschuldigte, einen Teil des Holzes heimlich verschleppt zu haben. „Das nächste Mal laß dir von Rübezahl das Holz hacken!“ rief der vierte Holzhacker, schulterte die Axt und ging nach Hause.
Als nun der Herbst herannahte, suchte der Magister vergeblich nach einem Holzhacker. Es begann zu schneien, und er hatte immer noch keinen Mann gefunden, der ihm die vier Fuder Buchenkloben und Eichenklötze klein schlagen wollte, an denen er sich im Winter über zu erwärmen gedachte.
Da pochte es plötzlich an der Tür, und als er öffnete, stand draußen ein Mann im Schnee und fragte: „Könnt ihr wohl einen Holzhacker gebrauchen?“ „Ihr kommt wie gerufen“, erwiderte der Rechtsverdreher. „Wie viel Groschen wollt Ihr für die vier Fuder haben?“ „Geld brauche ich nicht“, meinte der Holzhacker. Gebt mir nur für meine Arbeit soviel Holz, wie ich auf einmal auf meinem Rücken forttragen kann.“
„Welch ein Narr!“ dachte der Magister, ließ sich aber nichts davon anmerken und rief: „Das sollt Ihr haben, guter Mann. Nun geht, und holt Eure Axt, und macht Euch geschwinde an die Arbeit, damit ich Holz in den Ofen kriege.“ „Die Axt ist schon da, und ich will sie bald haben!“ sprach der Holzhauer, ging in den Hof, wo die vier Fuder lagen, stellte sich hier auf den rechten Fuß, packte das linke Bein mit beiden Händen, riß es sich mit einem Ruck aus und hieb damit wie toll und rasend auf die Kloben und Klötze los, wobei sich das sonderbare Werkzeug tausendmal schärfer als die allerbeste Axt bewies.
Der Magister, der solches alles von seiner kalten Stube aus genau beobachtet hatte, roch sogleich den Unrat, riß das Fenster auf und schrie: „Haltet ein, haltet ein, und packt Euch schleunigst vom Hofe! Aus dem Handel kann nichts werden!“ Aber der Holzhacker hörte nicht auf, die groben Holzklötze zu zerspalten und in kleine Scheite zu zertrümmern, und schrie dazwischen: „Wort ist Wort, und Handel ist Handel! So wahr ich hier auf einem Bein stehe, ich will nicht eher von der Stelle weichen, bis ich die vier Fuder klein gemacht habe und meinen ehrlichen Lohn davontrage.“
Jetzt erkannte der Magister, daß er doch seinen Meister gefunden hatte, wankte vom Fenster zurück, lehnte sich kraftlos an den eisigen Ofen und begann am ganzen Leibe zu beben und zu zittern. Indessen prügelte der Holzhacker unverdrossen auf die Buchenkloben und Eichenklötze ein, bis die Arbeit getan war.
Darauf steckte er das Bein wieder in die Lende hinein, zog ein großes Fischernetz aus der Hosentasche, sackte die vier Fuder Kleinholz hinein, huckte sich die ganze Last auf den Rücken und trug sie zum Hofe hinaus, als sei sie nicht schwerer als ein Federbett. So schritt er über die Straße zu den geprellten Holzhackern, warf einem jeden ein Viertel dieses Holzvorrates vor die Tür und ging dann über den nächsten Berg.
Am folgenden Tage packte der Magister seinen Sachen zusammen und machte sich auf und davon. Denn in einer kalten Stube friert selbst dem aller tüchtigsten Rechtsverdreher die Paragraphenmühle ein. Und Schmiedeberg war um eine Landplage ärmer geworden.
RÜBEZAHL - Er vertritt einen Tanzbären ...
Es waren einmal zwei junge Männer, die einen jungen russischen Bären aus dem Nest stahlen, ihm eine Zwinge durch die Nase zogen, ihn zum Tanzen abrichteten und mit ihm durch die Welt streiften, um fortan von seinen Künsten zu leben. Der eine blies auf dem Dudelsack und ging mit dem Teller herum, der andere hielt den Bären an einer Kette und schlug mit der Peitsche den Takt dazu. Und je mehr sie durch ihn verdienten, umso wüster, gröber und gieriger wurden sie.
Während sie wie zwei große Herren lebten und ihnen der Branntwein gar glatt zum Halse hinunterfloß, bekam der Bär immer mehr Prügel und immer weniger zu fressen, so daß er fast von den Knochen fiel und sein Fell immer dünner wurde. Endlich gerieten sie mit ihm auf die tschechische Seite des Riesengebirges und ließen ihn auch in Johannisbad tanzen, was dem Bären aber schon recht sauer wurde.
Und er taumelte zu den Dudelsackpfiffen auf und ab, hin und her und brummte dazu in einer Bärensprache: „Die verfluchten Gauner werden mich noch zu Tode prügeln, wenn ich nicht vorher verhungere.“ Allein die vornehmen Badegäste, vor denen er tanzte, verstanden nicht seine Bärensprache, ergötzten sich weidlich an seinen plumpen Sprüngen und an seinem tiefen Gebrumme und spendeten danach einen Groschen oder auch zwei und drei.
Ein ungarischer Edelmann gab sogar einen halben Taler und rief: „Ich wünschte, alle meine Bauern wären solche Bären, und ich könnte sie also vor den Leuten tanzen und für Geld sehen lassen!“ Solches geschah an einem Donnerstag.
Wie nun auf solche Art und Weise den beiden bösen Menschen wieder ein besonders fetter Fischzug gelungen war, gingen sie ins nächste Wirtshaus und tranken sich dort einen besonders scharfen Rausch an, um am nächsten Morgen mit dem nötigen Mut über das steile Riesengebirge zu kommen. Denn da sie das Land Böhmen bereits abgegrast hatten, wollten sie sich nun nach Schlesien wenden, wobei sie zuerst das Warme Bad bei Warmbrunn heimzusuchen gedachten.
Als sie am Freitag Mittag bei der letzten böhmischen Herberge anlangten, waren sie vom Steigen und Klettern so durstig geworden, daß sie wiederum einkehren mußten. Sie banden den Bären hinter dem Hause an, gaben ihm einige Fußtritte und brüllten dazu: „Laß dich von Rübezahl füttern, du Nimmersatt!“ Dann ließen sie ihn allein, setzten sich in die Gaststube und hießen den Wirt auffahren, was er in Küche und Keller hatte, bis sich der Tisch bog.
Indessen fing es draußen an zu regnen und zu hageln, und der Bär schnupperte um sich und brummte vor Hunger und Kälte: „Hier riecht es nach Bären, hier riecht es nach Bären!“ Plötzlich kam ein Waldhüter um die Hausecke und fragte ihn in der Bärensprache: „Was wirst du tun, wenn ich dir die Freiheit schenke?“
„Oh!“ antwortete der Bär. „Alles was du willst.“ „Dann lauf in den Wald, und verstecke dich, daß sie dich nicht finden“, sprach der Wildhüter und löste ihm die Zwinge von der Nase. „Ich danke dir!“ rief der Bär. „Ich will lieber auf eigene Faust verhungern, als mich von den beiden Gaunern langsam zu Tode schinden lassen.“ Darauf trabte er schleunigst von dannen.
Kaum aber war der Bär im Walde verschwunden, so nahm der Wildhüter die Gestalt des befreiten Bären an, legte sich selber an die Kette, schlief die ganze Nacht und trabte am nächsten Morgen mit den beiden Gaunern über das Gebirge nach Schlesien hinein. Und sie staunten sehr, daß ihn nicht wie sonst zu treiben brauchten, und freuten sich diebisch, daß er unterwegs Wurzeln und Tannenzapfen fraß und gar kein anderes Futter verlangte.
So kamen sie in guter Laune am Sonntagnachmittag nach Giersdorf. Und da um diese Zeit die Bauern alle zusammen andächtig im Kretscham hinter den Bierkrügen saßen, fragten die Gauner den Wirt, ob sie zur Belustigung seiner Gäste ein Bärenstücklein zum besten geben sollten.
Und der Wirt fragte die Bauern. „Sie sollen nur hereinkommen“, riefen die Bauern, „so es ein richtiger Bär ist!“ Denn die wenigsten von ihnen hatten einen lebendigen Bären von Angesicht zu Angesicht gesehen, und alle waren erpicht darauf, seine Künste zu bewundern.
Als nun der Bär von den beiden Gaunern hereingeführt wurde und sich wie ein Mensch auf die Hinterfüße stellte, da war der Beifall groß. Und als er sich nach der Musik zu drehen begann, sperrten die guten Giersdorfer Augen und Mäuler auf, so weit sie konnten, und zogen gerne den Beutel als der Sammelteller herumwanderte.
Nun gaben die Gauner noch ein Stücklein zu, und plötzlich begann der Bär nicht nur zu tanzen, sondern auch mit menschlicher Stimme zu singen: „Immer Hunger, immer Prügel! Bin ich denn ein Lauseigel? Länger laß ich mich nicht treiben von diesen bösen Beiden!“
Damit riß er an der Kette, daß die Zwinge zersprang, fuhr mit einem Satz durchs offene Fenster und verschwand spurlos hinter dem Düngerhaufen. Die Giersdorfer Bauern aber dachten nicht anders, als dieser richtige Bär nur ein verkleideter Mensch gewesen sei, machten einen starken Tumult und erhoben sich wie ein Mann gegen die beiden verdutzten Gauner, um sie für diesen schändlichen Betrug windelweich zu prügeln.
Allein sie fanden mit Hilfe des Wirtes noch ein Schlupfloch hinter dem Ausschank. Und sie liefen und liefen und standen nicht eher still, bis sie hinter Warschau waren.
RÜBEZAHL - Er jagte zwei Jäger ...
Ins Warme Bad kam einstmals eine schöne Witwe, um sich nach dem abgelaufenen Trauerjahr da selbst zu erholen und nach einem Ehegefährten umzusehen. Ihr Mann, ein reicher Kaufmann, war auf der Reise nach Mähren am Fieber gestorben und hatte sie wohlversorgt und in guten Umständen zurückgelassen.
Nun traf es sich, daß zur selben Zeit zwei schlesische Junker, ein junger und ein älterer, in Warmbrunn ihr Wesen trieben und auf einen glücklichen Zufall hofften, denn sie besaßen nur viele Schulden, einen Würfelbecher und ein Kartenspiel. Damit fristeten sie ihr Dasein, so gut es gehen wollte, und spielten recht und schlecht die großen Herren.
Kaum war die junge Witwe angekommen, so drängten sie sich herzu, ihre Bekanntschaft zu machen und ihr aufzuwarten. Als ihnen das gelungen war, berieten sie sich heimlich als getreue Freunde und Blutsbrüder, wie dieser hübsche Goldfisch am sichersten ins Netz zu treiben und zu fangen sei, und kamen überein, gemeinsam auf diesen Fischfang zu gehen und die Entscheidung, wer die Braut heimführen solle, dem Knobelbecher zu überlassen.
Und da ihnen zunächst als das Wichtigste erschien, keinen anderen Bewerber heranzulassen, gab einer dem anderen die Klinke in die Hand, so dass die Umworbene keinen Augenblick allein war.
Allein sie war klug genug, das listige Spiel zu durchschauen und sprach eines Tages zu ihnen: „Ich nehme nur einen kühnen Jägersmann, der sich nicht nur auf die niedere, sondern auf die hohe Jagd versteht. Nur wer mir einen sechszehnendigen Hirsch erlegt und bringt, der darf hoffen.“
Worauf er hoffen durfte, das verriet sie nicht; denn sie hatte solches nur geredet, um sie auf eine gute Art für etliche Tage los zu werden. Nun bestürmten die beiden Junker noch einmal ihre Gläubiger, von denen sie lebten, mieteten eine Kutsche mit drei Pferden, fuhren wie zwei echte Nimrode ins Gebirge und nahmen auch zwei Windhunde und einen Knecht mit.
In Schreiberhau übernachteten sie. Am folgenden Morgen ließen sie den Wagen zurück, saßen mit dem Knecht auf und ritten bis zur halben Höhe des Gebirges, wo der Hochwald begann. Hier stiegen sie ab, banden die Pferde an einen Baum, hießen den Knecht warten und sprachen zu ihm: „Hier bleibst du, bis das Halali ertönt.“
Und da er das Halali noch nicht kannte, griffen sie zu ihren Waldhörnern und bliesen es ihm vor. Dann nahm jeder seinen Spieß zur Hand, und mit Hussa und hallendem Spiel drangen sie in das immergrüne Gehege ein. Bald witterten die Windhunde eine Spur, fanden sie auch, stürzten sich mit Gekläff darauf, und die beiden Junker hetzten hinter ihnen drein, um den Hirsch zu erjagen.
So kamen sie immer höher und höher und mußten gar wacker klettern und schnaufen, um die beiden Hunde nicht aus dem Gehör zu verlieren. Plötzlich gerieten die beiden mutigen Jäger in einen dicken Nebel und sogleich verstummte auch das Gebell der Hunde. „Ha!“ riefen sie aus einem Munde. „Sie haben ihn! Sie haben ihn!“
Nun rafften sie alle Kräfte zusammen, stürmten mit langen Sprüngen durch den Nebel, der allmählich wieder etwas lichter wurde; verfolgten die Spur immer weiter und stießen schließlich auf die beiden Hunde, die hinter einer dicken Fichte standen, den Schweif einklemmten und so schauerlich winselten, daß sich den beiden Junkern sogleich die Haare sträubten, weil sie die Ursache solchen Benehmens nicht zu entdecken vermochten.
Auf einmal hörten sie von der Koppe her das Geschmetter eines großen Jagdhorns, das immer näher und näher kam, und vernahmen dazwischen auch bald das scharfe Gekläff der gereizten Meute. Dazu heulte der Sturm in den Tannen, daß die Äste knarrten und aneinandertrommelten.
Ob dieses wachsenden Gedröhns begann der Mut der beiden Junker zu wanken, und sie fanden es für geraten, zunächst etwas Fersengeld zu geben. So wurden die Hetzer zu Gehetzten und konnten zum ersten Male deutlich am eigenen Leibe spüren, wie das gejagt werden angenehm ist; endlich ging ihnen doch der Atem aus, und sie sahen nun durch den wirbelnden Nebel die anspringende Meute und den Jäger, der ihnen auf den Fersen war.
Er saß auf einem riesigen Wildschwein, das auf türkische Art gesattelt war und das er mit goldenen Sporen antrieb. Dazu machte er eine gar zornige Miene. In der Rechten hielt er einen Wurfspieß, der war so dick wie ein Weberbaum. Damit bedrohte er die beiden Junker von vorne.
„Was tut ihr da in meinem Revier?“ hörten sie ihn rufen. Aber sie gaben keinen Laut von sich, um ihn nicht noch mehr zu reizen und duckten sich wie zwei scheue Hasen ins Unterholz. Dann galoppierte der Jäger mit dem Wildschwein dreizehn mal um sie herum und verschwand wie ein Wirbelwind nach Osten, woher er gekommen war.
„Das war der Rübezahl!“ flüsterte der jüngere dem älteren ganz leise ins Ohr. Sie verblieben noch eine kleine Weile in ihrem Versteck, dann pfiffen sie den Hunden und machten sich kleinlaut auf den Heimweg. Kaum aber waren sie tausend Schritte weiter, roch es ihnen sehr stark nach Bock, und gleich darauf brach ein riesiger Hirsch aus dem Gebüsch.
„Den schickt uns der Rübezahl!“ rief der ältere Junker. Und sogleich hetzten sie die Hunde hinter ihm drein, jagten ihn in ein dichtes Gebüsch, darin er mit allen sechzehn Enden hängen blieb, erlegten ihn gemeinsam und bliesen dann gar fröhlich das Halali, bis der Knecht mit den drei Pferden daherkam.
Noch an dem selben Tage brachten sie die Jagdbeute nach Schreiberhau, legten sie auf das Dach der Kutsche und deckten sie mit einer großen Plane sorgsam zu. Und da es inzwischen wiederum Abend geworden war, setzten sie sich in die Herberge an den Tisch und begannen, da sie den Hirsch nun hatten, um den Goldfisch zu würfeln.
Bei diesem Spiel gewann der ältere Junker, worauf der jüngere sehr traurig den Kopf hängen ließ. „Nur gemach!“ tröstete ihn der ältere. „Du bist mein Herzbruder und sollst es auch bleiben!“ Und er versprach ihm in die Hand, daß er noch vor der Hochzeit in der Verwandtschaft seiner Zukünftigen nach einem zweiten Goldfisch Umschau hallten wollte, worauf sie immer noch einen tranken, bis der letzte Heller dahin war.
Am nächsten Mittag fuhren sie als stolze und glückliche Weidmänner vor das Haus ihrer Erwählten. Doch als sie ihr den Hirsch zu Füßen legen wollten, siehe, da hatte er plötzlich siebzehn Enden und sah einem alten, stinkenden Ziegenbock, an dessen Gehörn, ein Geweih ähnliches zackiges Wurzelgeflecht stak, zum Verwechseln ähnlich. So hatten sie zum Schaden auch noch den Spott.
RÜBEZAHL - Er bewegt einen Eichbaum ...

Kurz vor der Hochstadt im Böhmischen wohnte ein Edelmann, der ein Schloß und ein Dorf besaß, den Rotwein über alles liebte, an der Leber und an den Steinen litt und ein ganz übler Tyrann und Wüterich war. Er unterdrückte seine Bauern mit strengen Verboten und schweren Roboten und machte ihnen das Leben so sauer wie nur möglich.
Auch seinem einzigen Sohn tat er nichts Gutes, sondern hielt ihn streng, so daß er gar bald sein Herz von seinem Erzeuger abwandte und zu den Unterdrückten hielt. Zuerst tat er es nur heimlich, aber je älter er wurde, umso stärker und offener wurde sein Trotz.
Nun hatte der Schulze eine Tochter, die sehr schön war, sodass der Junker sich in sie verliebte und ihr die Ehe versprach. Solches Übertreten der Standesgesetze blieb dem Edelmann nicht lange verborgen, und als er erst dahinter gekommen war, erboste er sich und darob über die Maßen und fluchte lauthals los, wie ein türkischer Pascha mit sieben Rossschweifen.
Sodann fuhr er zwischen das Pärchen, schickte den Junker schleunigst auf die hohe Schule nach Prag und gebot dem Dorfschulzen, die so überaus feuergefährliche Tochter in ein Nonnenkloster zu sperren und den himmlischen Freuden zu überantworten.
Jedoch der Schulze weigerte sich standhaft, solches zu tun, dieweil seiner Tochter der Sinn nach den irdischen Freuden stand und sie von ihrem geliebten Junker um keinen Preis der Welt lassen wollte. Nachdem der Edelmann das vernommen hatte, ergrimmte er sich wie noch nie, leerte drei Flaschen in einem Aufsitzen, knirschte mit seinen zwölfeinhalb Zähnen, die er noch hatte, ballte die Fäuste und sann darüber nach, wie er den ungehorsamen Schulzen gehörig ducken und kurz und klein kriegen könnte.
Indessen zog ein Gewitter vom Gebirge heran, und ein schrecklicher Blitz fuhr in die beiden Eichen, die ganz dicht vor dem alten Schloss standen, spaltete die eine bis auf die Wurzel und legte sie, weil sie von oben bis unten hin kernfaul war, fein säuberlich nach beiden Seiten um, ohne weiterhin Schaden anzurichten.
Am nächsten Morgen schritt der Edelmann mit dem Schulzen in den Wald, suchte die dickste und höchste Eiche heraus und befahl, sie mit allen Wurzeln auszuheben, vor das Schloss zu fahren und sie da selbst an Stelle des zerschmetterten Baumes einzupflanzen.
„Euer Gnaden“, vermaß der Schulze mit schuldigem Respekt zu vermelden, „solch ein Werk geht über Menschenkräfte.“ „Halt er das Maul!“ schnauzte ihn der Edelmann an und wurde vor Gift und Galle buttergelb im Gesicht. „Und tu er, was befohlen ist. Also steht es im Gesetz geschrieben!! Und wer sich wider seinen Lehnsherrn empört, der kommt an den Galgen!!!“
Jetzt holte der Schulze die Bauern vom Felde, grub mit ihnen die Eiche aus und ließ alle Zugtiere des Dorfes vorspannen. Allein der Riesenbaum rührte sich keinen Zoll von der Stelle. „Unser Herr ist ein Narr!“ sprachen die Bauern leise untereinander.
„Die barmherzigen Brüder sollten ihn holen, denn er hat einen solchen Sparren, dass er ihn nimmermehr loswerden wird.“ Der Schulze aber begab sich ins Schloss und sprach: „Gnädiger Herr, wir sind viel zu schwach, die Eiche zu bewegen.“ „Faul seid ihr wie Mist!“ brüllte der Edelmann hinter der Rotweinflasche und schüttelte drohend die Fäuste.
„Ohne Hilfe bringen wir sie nicht aus dem Loch“, fuhr der Schulze unbeirrt fort. „Ihr Hunde, lasst euch vom Rübezahl helfen!“ tobte der Edelmann und wies ihn vor die Tür. Der Schulze aber begab sich zurück zu den Bauern und sprach: „Der gnädige Herr hat befohlen, daß uns der Rübezahl helfen soll. So wollen wir denn auf diesen Befehl hin unsere Mützen heben und laut rufen: Rübezahl helft uns!“
Aber er kam nicht. „Wohlan, liebe Leute und Nachbarn!“ sprach der Schulze nach einer Weile und setzte sich die Mütze wieder auf. „Er hat es nicht eilig. Warum sollen wir uns daher das Leder zerreißen? Laßt uns die Pferde ausspannen und heim zu Mittagessen gehen.“ Und es geschah also.
Des Nachts aber kam ein Sturm vom Gebirge her und warf die zweite Eiche um, die nicht minder kernfaul war als die erste. Und sie fiel auf das Dach des Schlosses, zertrümmerte den ganzen Mittelbau bis ins Erdgeschoß hinab und traf dabei den Edelmann an der linken Schläfe, daß er die Besinnung verlor und drei Tage lang kein Auge öffnen und kein Glied rühren konnte.
Als er wieder zu sich kam, stellte sich heraus, daß er alles vergessen hatte, auch das Einmaleins und das ABC und sogar seinen Namen. Er wußte nicht einmal mehr, was ein Edelmann war und wie er sich zu benehmen hat, um sich von dem gewöhnlichen Volke zu unterscheiden, und mußte gefüttert werden wie ein kleines, hilfloses Kind.
Einen Monat später brachte ihn sein Sohn, der inzwischen von Prag zurückgekehrt war, zu den Barmherzigen Brüdern nach Reichenberg. Weiterhin fand sich auch ein armer, alter Adliger, der gegen ein gutes Trinkgeld die schöne Schützentochter adoptierte.
Und so konnte aus den beiden Liebesleuten doch noch ein glückliches Ehepaar werden. Von Rübezahl aber hat man seitdem nichts mehr gehört. Es raunt im Gebirge, er sei nach Norden gefahren und werde bald wiederkehren.
Sage aus Deutschland
SPRINGMÄNNCHEN UND GOLDFASAN ...

Es war einmal ein sehr weiser König, der zwei Söhne hatte. Der Älteste, Prinz Balduin, war sehr mutig, hatte Freude an Ritterspielen, glänzenden Festen und Veranstaltungen; doch wurde er immer hochmütiger und prachtliebender.
Der jüngere Sohn, Prinz Immo, war sanft und still. Obwohl nicht minder tapfer als sein Bruder, sah er neidlos dessen Triumphe beim Turnier und festlichen Aufzügen. Er selbst liebte das Waidwerk im grünen Walde mehr als das festliche Gedränge der Ritterspiele. Wenn seines Vaters Untertanen ihm begegneten, nickte er ihnen freundlich zu. Die Leute verneigten sich tief vor ihm und sprachen zueinander: „Das ist unser guter Prinz Immo. Gott segne ihn.“ Sehr gern aber saß Immo im Kreise weiser Männer und ließ sich aus alten Pergamenten belehren, wodurch er seinem Vater eine besondere Freude bereitete.
Beide Königssöhne wollten auf Abenteuer ausziehen. Der König hörte das mit Sorge, denn er fürchtete, daß beide dabei zu Schaden kommen könnten. Doch dachte er endlich: „Vielleicht werden meine Söhne in der Fremde ihren Charakter und ihre Befähigung noch mehr als daheim zeigen, und ich werde je nachdem, wie sie sich in der Welt draußen bewähren, vielleicht genau ermessen können, wen ich später zu meinem Nachfolger machen kann.“ Er sprach lange und eindringlich mit Balduin und Immo, ermahnte sie nochmals zu allem Guten, besonders auch zu brüderlicher Treue und Einigkeit, und winkte ihnen darauf, ihm zu folgen.
Durch weite Säle und Gänge des Schlosses führte er sie zu einem ganz versteckten Gemach, das sie noch nicht kannten, dort also sprechend: „Liebe Söhne, ich will euch nun einen besonderen Beweis meines Vertrauens geben, indem ich euch zwei Dinge anvertraue, die bisher kostbare, unersetzliche Schätze für mich waren, und die ihr hoffentlich unversehrt wieder heimbringen werdet, denn sie können euch lebenslang von Nutzen sein.“
Der König öffnete eine Truhe und ließ die Prinzen hineinsehen. Sie erblickten zwei kleine Gegenstände: einen winzigen, aus Gold gefertigten Fasan und eine unscheinbare, ganz eingetrocknete Springwurzel. „Seht,“ sprach der König, „das sind die beiden Schätze, die ich euch anvertrauen will. Der kleine Goldfasan ist ein Zaubervogel, der, wenn das Zaubersprüchlein erklingt, zu der Größe eines Fasanen wächst und dem Besitzer goldene Federn und goldene Eier spendet, so oft dieser es heischt. Die Wurzel hat andere Zauberkräfte. Sie wandelt sich auf ihr Zaubersprüchlein hin in ein Männlein, das ,Springmännlein’ heißt und seinem Besitzer mit Rat und Tat beisteht, wenn er dessen bedarf. Balduin, du als ältester meiner Söhne, tritt zuerst zur Truhe und wähle dir einen von beiden Schätzen.“
Da lachte Balduin, ergriff den goldenen Vogel und sprach: „Mit Verlaub, mein Vater, ich halte es mit dem Goldfasan, denn ein Königssohn muß mit Glanz und Pracht in die Welt ziehen, und was den ,guten Rat’ anbelangt, so habe ich ja mein gutes Schwert, das ist mein bester Ratgeber.“ Ernst sprach der König: „Ich ahnte es, mein Sohn, daß du so wählen würdest, doch bedenke wohl, daß du mein Geschenk nicht zur Üppigkeit und Eitelkeit mißbrauchen sollst. Auch verachte niemals einen guten und weisen Rat und verlaß dich nicht allein auf dein Schwert. Oft im Leben wird die Gewalt durch kluge Erwägung besiegt.“
Dann wandte sich der König zu Immo: „Und nun, mein Jüngster, nimm die Gabe, die dein Bruder verschmähte; möge sie dir Segen bringen.“ Immo ergriff die Wurzel. Dann ein Knie vor seinem Vater beugend, sprach er: „Ich danke dir, mein Vater. Mein Bruder erriet wohl, daß diese Gabe mir die willkommenste sein würde! Ich will sie zu deiner Freude gebrauchen. Ich begehre nur, als einfacher Knappe gekleidet hinauszuziehen. Eitler Prunk lockt leicht Räuber an. Ein gutes Schwert und mein treues Rößlein seien meine Begleiter.“ Den König freute diese Gesinnung seines jüngsten Sohnes. Er prägte beiden sorgfältig ein, wie sie die Zaubergaben zu gebrauchen hätten, die ein jeder von ihnen dann gut verbarg.
Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, nahmen sie Abschied von ihrem Vater sowie von den Getreuen und verließen das Schloß. Gegen Abend erreichten sie ein Gehölz, durch das sie hindurch ritten, hoffend, alsdann ein Wirtshaus zu erreichen, in dem sie übernachten konnten. Doch nichts war rings zu erblicken, nur immer wieder neuer Wald. Da hörten sie ein ängstliches Flattern in einem Baum. Immo bemerkte ein Vögelchen, das sich an einer Leimrute gefangen hatte. Mit großer Vorsicht befreite er das Tierchen, das sich nun auf seine Schulter setzte und in sein Ohr zwitscherte:
„Tiri, tiri, o Königssohn,
Will di, will di nun gleich zum Lohn
Ein Obdach zeigen;
Mußt aufwärts steigen.“
Immo winkte seinem Bruder, und als beide noch ein kleines Stück bergauf ritten, lag eine Köhlerhütte vor ihnen. Der Köhler fand sich bereit, ihnen Obdach zu geben, wenn sie mit einem Strohlager vorlieb nehmen wollten. Er ahnte natürlich nicht, daß er zwei Königssöhne beherbergen sollte, wenn er auch Balduins kostbare Kleidung mit einigem Erstaunen musterte. Sein Weib brachte Brot, Milch und Käse und sorgte, daß es auch den Rossen an nichts mangelte. Balduin schlief, trotz des ungewohnten Lagers, bald ein, doch Immo setzte sich zu dem Köhler an das Herdfeuer und ließ sich von ihm etwas erzählen.
Der Köhler, welcher Immo für den Knappen Balduins hielt, berichtete ihm denn auch ohne Scheu, was der Königssohn wissen wollte, der nach der Gegend fragte, nach der Ausdehnung der Wälder und was sonst jemanden interessieren konnte, der auf Abenteuer ausziehen wollte. Als der Köhler letzteres merkte, ward er plötzlich ganz vertraulich und sagte: „Drei Tagereisen von hier liegt das Falkenschloß. Ganze Scharen von Falken umkreisen es tagaus, tagein; das sind verzauberte Menschen, die in die Gewalt des Zauberers gelangten, der im Falkenschloß haust. Sie wollten alle die beiden Prinzessinen erlösen, die dort oben irgendwo gefangen gehalten werden. Ein Hirte verirrte sich einmal in der Nähe des Falkenschlosses und hörte daselbst den Gesang der Prinzessinnen. Da hat er nirgends mehr Ruhe gefunden. Er ist oft wieder zum Falkenschloß gewandert, bis niemand ihn wiedersah. Gewiß ist auch er dem Zauberer verfallen und von ihm in einen Falken verwandelt worden.“
Immo hörte diese Erzählung mit Staunen. Gern hätte er noch mehr erfahren, doch der Köhler mußte noch allerlei Arbeiten verrichten; darum mochte er ihn nicht zurückhalten. Er nahm sich aber vor, ihn noch über das Falkenschloß zu befragen, ehe er von dannen ritt. Zunächst teilte er seinem Bruder alles mit, der sogleich erklärte, unbedingt zum Falkenschloß ziehen zu wollen.
Am nächsten Morgen ließen sich die Brüder von dem reichbelohnten Köhler noch ein Stück Weges geleiten, wobei sie sich alles erzählen ließen, was ihr Begleiter noch wußte, obwohl das nicht mehr viel war. Er berichtete, daß ein riesiger Greif die Jungfrauen bewachen solle und daß Gewalt ihn nicht besiegen könne. Vielmehr sei nur der des Sieges sicher, der neben Tapferkeit über das Zauberschwert verfüge. Wo das zu finden sei, vermochte er aber nicht zu sagen. Die Prinzen dankten dem schlichten Manne, der beim Abschied sie noch ernstlich warnte, sich nicht unvorsichtig in Gefahr zu begeben.
Die Brüder dachten über seine Warnung nach. Ihr Vater fiel ihnen ein und ihre Pflicht, ihn vor Kummer zu bewahren. Immo sprach: „Wohl zogen wir aus, um Abenteuer zu suchen, doch bat auch der Vater uns, unnütze Gefahren zu meiden. Um seinetwillen wäre es vielleicht besser, wir suchten uns andere Abenteuer, denn wer tröstet den alten Mann, wenn auch wir als Falken verwandelt dem Verhängnis anheimfallen?“
„Hast du Furcht, so kehre heim,“ antwortete Balduin. „Ich aber reite zum Falkenschloß.“ Da entgegnete Immo: „Dann komme ich mit dir, mein Bruder, denn ich verlasse dich nicht. Daß ich die Gefahr jedoch nicht meinetwegen meiden will, habe ich dir wohl schon öfters bewiesen.“ So ritten die Brüder denn dem Falkenschloß entgegen. Immo riet, zuerst das Zauberschwert zu suchen, das seiner Meinung nach sich in der Nähe des Schlosses befinden mußte. Doch Balduin wollte davon nichts hören, so daß Immo fürchtete, seines Bruders ungeduldiger Tatendrang würde alles verderben und sie beide ins Unheil stürzen.
Nach drei Tagen kamen sie an einen hohen Berg. Der Köhler hatte ihnen den Weg, so gut er es wußte, beschrieben; sie vermuteten nun, nicht mehr weit von ihrem Ziel entfernt zu sein. Müde und hungrig, wie sie waren, spähten sie nach einem Obdach, wo sie sich zu ihrem Vorhaben stärken konnten. Endlich entdeckten sie einen Lichtschein, der aus einer menschlichen Behausung kommen mußte. Vielleicht war es die Herberge, von der der Köhler zu ihnen gesprochen hatte.
Mit Mühe bahnten sie sich einen Weg durch das Gestrüpp, bis sie endlich vor der Tür des alten Gebäudes standen. Auf ihr Pochen trat ihnen eine Frau entgegen, die auf ihre Frage antwortete, daß sie die Frau des Wirtes sei, und daß das Haus die Herberge sei, in der sie übernachten könnten. Zwar war es nur ein elendes Kämmerlein, in dem die Königssöhne Unterkunft fanden, aber sie schliefen doch fest bis zum nächsten Morgen.
Die Sonne war schon aufgegangen, als sie erwachten und sich besannen, wo sie waren. Bald saßen sie in der ärmlichen Wirtsstube, wo ein kräftiger Imbiß von der Wirtin aufgetragen wurde. Als die Brüder nun ihre Wirtin nach dem Falkenschloß befragten, ließ die Frau vor Schrecken fast die Schüssel mit Mehlbrei fallen. Sie schlug die Hände zusammen und zeterte: „Ich plag’ meinen Mann alle Tag’, daß ich’s nimmer ansehen kann, wie die schmucken Ritter ins Elend ziehen, und daß ich fort von hier will, und ihr kommt nun so weit her, um euer junges Leben zu verlieren? Noch keiner ist zurückgekehrt, der dorthin zog, wo der höchste Berg liegt. Ach, es werden der Falken immer mehr! – Alle fanden ihr Elend und fielen in die Gewalt des Zauberers. Ich warne euch, kehrt heim; denn die Jungfrauen könnt ihr nimmer erlösen!“
Balduin aber antwortete: „Frau Wirtin, Ihr meint es gut, das merk’ ich, aber die armen Gefangenen werden es Euch wenig danken, wenn Ihr all die Retter fernhalten wollt. Sagt, wer sind die Jungfrauen?“ „O, Herr Ritter, mein Mann hat mir verboten, es zu erzählen, weil er denkt, die Retter würden dann eher von dem Wagnis ablassen.“ „Wenn Euer Mann das glaubt, so kennt er wenigstens mich schlecht,“ lautete Balduins Antwort. „Erzählt flugs, Frau, wer die Jungfrauen sind, denn wenn Ihr’s nicht tut, dann reite ich noch schneller zum Falkenschloß, um es vielleicht dort zu erfahren.“
„Das würde Euch schwerlich gut bekommen! Aber, Herr, wenn Ihr darauf besteht, so hört: die Jungfrauen sind Schwestern, und die Töchter eines mächtigen Königs, der das Falkenschloß sogar einst belagert hat, um die Mägdlein zu befreien. Alles war umsonst; sämtliche Mannen wurden in Falken verwandelt, und der König selbst entging mit knapper Not dem gleichen Schicksal. Seitdem hat der König keinen Angriff wieder gewagt.“ „Aber das Schwert, sagt, Frau Wirtin, wo findet man das Zauberschwert?“ mischte Immo, der schweigend zugehört hatte, sich jetzt in das Gespräch.
Die Wirtin, ebenfalls glaubend, den Knappen des unbekannten Ritters vor sich zu haben, antwortete geschäftig: „Wollt Ihr’s dem edlen Ritter suchen, dann müßt Ihr die Bäume nahe dem Falkenschloß danach durchforschen. Dort soll es zu finden sein; mehr weiß ich nicht. Muß es doch noch kein Ritter gefunden haben, sonst wär’ längst der Zauberer besiegt worden. Laßt ab von Eurem Vorhaben und kehrt heim, wenn Euch Euer Leben lieb ist; den Jungfrauen und den Falken ist nimmer zu helfen.“
Doch die Brüder beschworen die Wirtin, ihnen nun alles zu sagen, was sie noch wisse, so daß die Frau ihnen endlich noch weiter erzählte: „Es geht die Mär, der mächtige Greif, der die Jungfrauen bewache, schlafe nie, weil Zauberglöcklein, die in einem Baum hingen, ihn mit ihrem Klingen stetig wach erhielten. Auch erzählt man, der Zauberer selbst sei ein Greis mit einem ellenlangen Bart und einem greulichen, riesenhaften Höcker. Nur wer mit einem Hieb des Zauberschwertes diesen Höcker vom Rumpf zu trennen vermöchte, könne den Bösewicht besiegen. Das würde schwer sein. Aber den Vogel Greif zu töten, sei noch weit schwieriger, denn es heiße, seine löwenartige Mähne müsse mit einem kühnen Streich des Zauberschwertes abrasiert werden und seine Flügel ebenso. Dann könne er vielleicht besiegt werden. Wehe aber dem, den seine Klauen packten, oder den ein Schlag seines Schweifes träfe! Er müsse sein Leben lassen. Daß ist alles, was ich weiß,“ schloß die Wirtin ihren Bericht.
Die Brüder dankten der Frau und belohnten den Wirt reichlich, der bald darauf in die Stube trat, um zu melden, daß die Rosse aufgezäumt seien. Auch er riet den Brüdern erschrocken zur Heimkehr, da er vernahm, daß sie zum Falkenschloß wollten. Da er aber das Vergebliche seiner Warnung einsah, beschrieb er ihnen den Weg dorthin, der sie bis zum Abend in die Nähe des Unglücksschlosses, wie er ihr Ziel nannte, führen würde. Stunden um Stunden waren beide nun bergauf geritten, und sie mußten dem Ziel schon nahe sein, als Immo erklärte, daß es nun die Zeit sei, das Geschenk des Vaters, die Zauberwurzel anzuwenden, um den Rat des Springmännchens zu hören.
Balduin antwortete, ungläubig lachend: „Was soll das Männlein, wenn es wirklich erscheint, wohl vom Falkenschloß wissen? Laß mich zuvor mein Sprüchlein sagen; will erst sehen, ob der Goldfasan seine Schuldigkeit zu tun vermag. – Wer weiß, ob ich nicht seine Gaben brauchen kann.“ Balduin zog den Goldvogel aus seinem Versteck hervor, setzte ihn, wie sein Vater es ihm eingeprägt hatte, in einen niedrigen Baumast und sprach, mit den Armen dreimal die Bewegung des Fliegens nachahmend:
„Lieber Vogel schüttle dich,
Sträube dein Gefieder;
Reichlich fallen laß auf mich
Goldne Federn nieder!“
Erwartungsvoll blickten beide auf den kleinen Vogel. Und siehe da: Plötzlich reckte und dehnte er sich, als ob er lebe; er wuchs zusehends, und sein Gefieder gleißte, daß die Brüder kaum hinzusehen vermochten. Jetzt war er so groß wie ein wirklicher Goldfasan. Da wiederholte Balduin nochmals das Zaubersprüchlein, und nun flogen die glänzenden Federn wie ein Goldregen hernieder.
Balduin konnte sie kaum so schnell zusammenraffen. Sein Erstaunen machte ihn ganz sprachlos. Es ward noch größer, als nun auch ein schweres, goldenes Ei hinab fiel. Dann schrumpfte der Vogel wieder zusammen, bis er war wie zuvor. Balduin sprach mit lauter Stimme das Danksprüchlein:
„Dank dir, Dank, mein Goldfasan –
Sollst nun wieder Ruhe ha’n;“
worauf er die kostbare Gabe seines Vaters verbarg, ebenso seine goldenen Schätze. Nun zog auch Immo seine Zauberwurzel hervor, um ihre geheimen Kräfte kennen zu lernen. Da drang plötzlich ganz deutlich Gesang von Frauenstimmen zu ihnen herüber.
Balduin stutzte, ergriff seines Bruders Arm und rief hastig: „Bruder, hörst du’s? Die Jungfrauen im Falkenschloß singen. Wir müssen ganz nah’ sein. Komm’ ohne Säumen!“ Und ohne sich noch einmal nach Immo umzublicken, bestieg er sein Roß, eilig davonreitend. Immo mußte ihm wohl oder übel folgen, da der Übereifrige für seine Warnrufe taub war. Eilends verbarg der Jüngling seine kostbare Wurzel, dem Bruder über Stock und Stein auf den Berggipfel folgend.
Es dauerte auch nicht lange, so entdeckte er Gemäuer, zugleich auch Balduin, der nahe demselben entlang ritt. Ein finsterer Bau war es, der kaum Fenster zu haben schien. Aber nicht von dort erklang der Gesang, vielmehr kam er aus einem Turm, welcher nahe dem Falkenschloß auf erhöhter Stelle lag. Sonderbarerweise war er rings von sumpfigem Wasser umgeben und nur durch eine lange, vom Schloß aus dorthin führende Zugbrücke zugänglich. Jetzt hörten beide den Gesang und auch die Worte deutlich:
„Es rüttelt der Wind und der Sturm
Allstündlich wohl hier an dem Turm,
Doch Mauern und Tor sind gar fest. –
Wir Armen, wir sind hier gefangen
Und schau’n nach dem Retter mit Bangen
Nach Norden, nach Süd, Ost und West!“
Ach, der Gesang klang gar traurig, aber so süß und flehend, daß die Brüder wohl jetzt verstehen konnten, wie so viele Ritter und auch der Hirtenknabe von ihm bezwungen, ihr Rettungswerk versuchten. Immo verlor die Überlegung trotzdem aber nicht. Er zog nun an einem verborgenen Plätzchen, im tiefen Schatten der Bäume, die Zauberwurzel hervor, um den Rat des Springmännchens zuvor zu befragen, trotzdem er in Unruhe war, weil Balduin, seiner abermaligen Warnung ungeachtet, in stürmischer Ungeduld dem Schloß nahte.
Immo legte die Wurzel ins Gras, machte, wie des Vaters Anweisung es heischte, drei Sprünge und rief dann mit gedämpfter Stimme:
„O Springmännchen, erscheine,
Und künde mir sofort:
Ob klug ist, was ich meine?
Erschein’ an diesem Ort!“
Da bewegte sich plötzlich etwas im Grase, und aus dem selben hüpfte ein kaum Schuh hohes Männlein, das eigentümlich anzusehen war: Ein Bart aus feinen Wurzelfasern wallte fast bis zu den Füßen, die in winzigen Schnabelschuhen steckten, während aus dem braunen Antlitz zwei kohlschwarze Augen den Jüngling nicht unfreundlich, aber ernst anblickten. Mit den wurzelartigen Händen fuchtelte der Kleine in der Luft herum, machte drei Sprünge, bis er dicht vor Immo stand, und sprach dann vernehmlich:
„Laß den Bruder dein
Kämpfen jetzt allein,
Denn für dich ist’s noch nicht Zeit!“
Als der erstaunte Immo sich einigermaßen gefaßt hatte, antwortete er: „Aber wie dürfte ich denn meinen Bruder in der Gefahr allein lassen? O, Springmännlein, dein Rat scheint mit herzlos.“
Da antwortete der Kleine:
„Später, später richt’,
Was der Springmann spricht!
Will bewahren dich vor Leid!“
„Darf ich denn meinen Bruder nicht warnen? Darf ich ihm nicht suchen helfen, daß er das Zauberschwert finde?“ Das Männlein schüttelte sein Haupt, sprang wieder ein paarmal herum und hub abermals an:
„Immo, höre mich:
Schwert ist nur für dich,
Weil du’s brauchest mit Bedacht.
Tollkühn ist nicht gut –
Hilft dann auch kein Mut;
Tu’ dein Rettungswerk zur Nacht.“
„Soll ich nun tatenlos hier wie ein altes Weib hocken und von meinem Bruder für feige gehalten werden? O, liebes, gutes Springmännchen, rate mir doch, wie ich das Werk beginnen und durchführen soll.“ Springmännchen hüpfte wiederum und ließ sich nochmals also vernehmen:
„Halte bis zur Nacht
Mit Geduld hier Wacht;
Dann zur rechten Stunde
Bringt dir Springmann Kunde.
Glaub’, was Springmann spricht;
Immo, zweifle nicht!“ –
Noch drei Sprünge, und Springmännlein war verschwunden. Immo sprach mit bewegter Stimme den vorgeschriebenen Dank:
„Springmann, Dank, für deinen Rat;
Will ihm folgen früh und spat!“
Nachdenklich steckte Immo wieder die Wurzel zu sich, indessen sein Herz traurig war. Und doch mußte er tun, wie das Männchen ihm geraten hatte. Voll Angst um seinen Bruder spähte er durch die Bäume, doch von Balduin war keine Spur mehr zu entdecken. Er war augenscheinlich ohne Überlegung, und trotz aller Warnung, sich auf seinen Mut und sein gutes Schwert verlassend, in das Zauberschloß gedrungen.
Der Gesang im Turm ließ sich nur noch gedämpft vernehmen. Immos Herz war von großem Mitleid für die armen Opfer des Zauberers erfüllt, denn er ward nun auch auf die zahlreichen Falken, die in den Mauernischen saßen oder das Schloß umschwirrten, aufmerksam. Er wagte es jedoch nicht, des Springmännleins Gebot zu übertreten, hoffte auch, sein Bruder werde wieder zu ihm zurückkehren, da dieser doch genau von der Gefährlichkeit und Nutzlosigkeit seines blinden Eifers unterrichtet war. Immo sagte sich, daß Balduin, wenn die Kampfeslust ihn übermannte, sich auch von ihm nicht würde zurückhalten lassen. Er selbst würde dann höchstens sein Schicksal teilen müssen, ohne ihm helfen zu können, während er, wenn das Wagnis im Besitz des Zauberschwertes gelang, mit den übrigen Opfern auch seinen Bruder retten zu können hoffte. Er vertraute nun auf Springmännchens Hilfe.
Balduin war unterdessen, trotz aller Warnung, auf eigene Kraft vertrauend, und ehrgeizig hoffend, seinem Bruder mit dem Rettungswerk zuvorzukommen, durch das große, in das Schloß führende Tor geschritten. Das Klirren seiner Waffen und seiner Sporen war das einzige hörbare Geräusch ringsum; alles schien wie ausgestorben. Nur die Falken machten sich bemerkbar. Es schien Balduin, als wollten sie ihm den Eingang in das Gebäude wehren, denn sie umflatterten ihn ängstlich kreischend.
Aber auch das beachtete Balduin in seiner Verblendung nicht; er schritt furchtlos weiter, obwohl es zu dämmern begann. „Wenn ich nur den alten Zauberer erblicke,“ so dachte er, „dann ist sein Höcker geliefert. Mein gutes Schwert spaltet am Ende ebenso gut wie das Zauberschwert einen Menschen.“ Vom Hof betrat er einen weiten Saal, dessen prunkvolle Einrichtung er kaum beachtete. Seine Aufmerksamkeit galt einer etwas geöffneten Tür. Lichtschein drang durch die Spalte. Vorsichtig sich nähernd, lugte er in das Gemach, kein Auge von dem eigenartigen Anblick wendend: ihm den Rücken zukehrend, saß an einem Herd ein Mann, dessen riesengroßer Höcker ihn sofort als den Zauberer erkennen ließ. Er rührte unablässig in einem über dem Feuer hängenden Kesselchen, in dem irgendeine Masse kochte.
Jetzt sah Balduin deutlich, wie der Zauberer von Zeit zu Zeit aus einer Truhe eine Handvoll Gold nahm, das er in den Kessel tat. Dabei hörte der Lauscher ihn murmeln:
„Brodle, Goldbrei, zische, zische,
Daß sich alles gut vermische:
Löwenzahn und Fingerhut,
Schierling, Gold und Drachenblut.
Silber, Kupfer, nochmals Gold,
Daß das Werk gelingen sollt’.
Schmiede für zwei Jungfräulein
Aus dem Brei zwei Schlößlein fein,
Leg’ eins vor jed’ Mündlein schwer –
Daß das Singen es verwehr’. –
Brodle, Goldbrei, zische, zische –
Daß sich alles gut vermische.“
Gierig suchte der Alte wieder in der Truhe, doch er fand augenscheinlich kein Gold mehr, denn er murmelte abermals:
„Truhe ist von Golde leer –
Braucht’ ein Klümplein Gold noch sehr, –
Rotes, goldnes Glitzergold –
Lohnt’s gern dem, der’s bringen wollt’.“
Da kam Balduin eine kühne Idee: Wie, wenn er den Zauberer durch anscheinende Gefälligkeit zu überlisten suchte? Vielleicht kam er dadurch leichter zum Ziel? Gold besaß er ja genug. Zwar widerstrebte diese Handlungsweise seinem ritterlichen und kampfeslustigen Sinn, da er sie hinterlistig nennen mußte und er am liebsten dem Feinde gleich in offenem, ehrlichem Kampf entgegengetreten wäre, wie das sonst seine Art war. Aber es galt ja, den bösen Zauberer zu überwinden und damit viele Menschen zu retten; vor allem mußten auch die armen Jungfrauen vor noch größerer Schmach bewahrt werden.
Also verursachte Balduin ein Geräusch, daß der Zauberer sich umwandte, wobei er natürlich den Königssohn erblickte. Dieser wich vor dem über alle Begriffe häßlichen und boshaften Gesicht des Zauberers unwillkürlich einen Augenblick zurück, doch schnell gefaßt, sprach er: „In der Wildnis verirrt, erblickte ich das Schloß hier, wo ich hoffte, ein Obdach zu finden. Ihr seid gewiß ein Alchymist; das Gold dort im Kessel verrät es mir. Ich hab’ auch meinen Spaß daran. Darf ich Euch als Dank für ein Nachtquartier vielleicht dabei behilflich sein? Man braucht dazu viel Gold. Ich habe solches.“
Gierig hafteten des Alten böse Blicke auf dem Sprechenden. Seine kralligen Hände streckten sich aus: „Gebt her, schnell, das kann ich brauchen.“ Die Augen glühten, und unersättlich schien seine Goldgier geworden. Balduin gab bereitwillig, was der Goldfasan ihm gespendet. Als der Zauberer sich über den Kessel beugte und eifrig rührend an nichts zu denken schien als an seine Beschäftigung, da zuckte einen Augenblick Balduins Hand nach dem Schwert. Doch schon richtete sich der Zauberer wieder auf; der günstige Augenblick war vorbei.
Aber jetzt fiel Balduin das Goldei ein. Er holte es hervor, ließ es aber zur Erde gleiten. Gierig bückte sich der Zauberer tief, um das rollende Ding zu erhaschen. Im gleichen Augenblick sauste Balduins Schwert mit gewaltigem Hieb gegen den Höcker des Zauberers. Aber so wuchtig das Schwert auch herniedergesaust war, daß es wohl gleich zwei Höcker hätte abrasieren können, dem Zauberer verursachte es nur eine unbedeutende Wunde und – prallte ab.
Zu spät ward Balduin inne, daß ein Zauberer nicht mit einem gewöhnlichen Schwert überwältigt werden konnte. Er schlug zwar noch einmal los, doch wie eine Katze sprang der Zauberer empor, umkrallte den Hals des wie wahnsinnig mit dem Schwert um sich schlagenden Angreifers und rief wutschnaubend:
„Du böser, hinterlist’ger Schalk,
Nimm deinen Lohn und – sei ein Falk’!“
Mit Grausen fühlte Balduin sich gedankenschnell in den genannten Vogel verwandelt, der gleich darauf mit einem Klageschrei durch das einzige kleine Fenster davonflog. Was half es dem armen Verzauberten nun, daß er nicht nur bereute, so eigenmächtig und tollkühn vorgegangen zu sein, sondern auch den Bruder verlassen zu haben. Nun flog der Falke umher, um den Bruder zu warnen und ihm den Goldfasan zu bringen. Endlich entdeckte er den Gesuchten unter den Bäumen. Er flog dicht zu ihm hin und rief:
„Bruder, lieber Bruder mein,
Gehe nicht ins Schloß hinein,
Eh’ das Zauberschwert ist dein!“
Immo fuhr erschrocken aus seinem Sinnen auf. Ach, er begriff alles. Voll Mitleid sprach er dem armen Bruder Mut zu und sagte ihm, was Springmännchen ihm versprochen. Der Falke hörte aufmerksam zu. Dann öffnete er eine seiner Krallen, ließ den kleinen Zaubervogel dicht vor Immo hinabgleiten und sprach:
„Nimm ihn ohne Sorgen,
Halte ihn verborgen.“
Immo nahm den Schatz mit Seufzen. Darauf flog der Falke still in den nächsten Baum. Da war es Immo, als ob ein Ton wie das Klingen eines Glasglöckleins an sein Ohr schlüge. Vielleicht war es irgendein Zeichen. Springmännchen wartete vielleicht schon auf seinen Ruf. Er verfuhr mit der Wurzel genau wie vor einigen Stunden. Kaum hatte er sein Zauberverslein beendet, als auch der Kleine schon vor ihm stand, also sprechend:
„Menschenleer sind Schloß und Hallen,
Alles rings in Zauber fallen.
Doch der Greif und Zaub’rer wacht
Alle Tag’ und alle Nacht,
Daß kein Feind sich nah’ der Pforte
Zu dem bösen Zauberorte;
Denn der Zauberglocken Klingen
Künden gleich von allen Dingen.
Ich will dir das Mittel zeigen,
Daß die Glöcklein stille schweigen.
Auch den Ort will ich dir künden,
Wo das Zauberschwert zu finden!“
Springmännchen winkte darauf Immo, ihm zu folgen, ihn durch Zeichen zur Vorsicht ermahnend. Es war nun ziemlich dunkel; die Sichel des Mondes verbreitete unsicheres Licht. Immo mußte aufpassen, seinen kleinen Führer nicht aus den Augen zu verlieren. Je näher sie dem Schlosse und dem Turme kamen, desto lauter vernahm Immo das wunderbare Klingen, das von abgestimmten Kristallglocken herzurühren schien.
Springmännchen sprang, wie er immer tat, ehe er etwas sagte, mehrmals vor Immo auf und nieder; dann bedeutete er dem Prinzen abermals vorsichtig zu sein, und sprach leise:
„Dem Rettungswerk es jetzo gilt,
Bist du, mein Prinz, dazu gewillt?“
Als Immo bejahte, fuhr der Kleine fort:
„Nun wappne dich mit festem Mut,
Dann winket dir Gelingen gut.“
Nach diesen Worten hüpfte es behende weiter, sich immer nach Immo umblickend, ob dieser auch folge, indessen das Klingen der Glöcklein immer lauter wurde. Jetzt stand Springmännchen vor einem hohen Baume still, und nun sah Immo, emporblickend, wie in seinen Zweigen unendlich viele große und kleine Glasglöcklein hingen, die sanft leuchtend die wundervollen Klänge hervorbrachten.
Hier machte der Kleine halt, während Immo keinen Blick von ihm verwandte. Sonderbar erschien ihm Springmännchens Gebahren. Der tanzte erst dreimal um den Baum herum und sprang dann mit kühnem Satz in den untersten Zweig, ein Reislein von diesem pflückend. Danach klomm er behende von Ast zu Ast und berührte jedes Glöcklein mit dem Reis. Als dies geschehen war, rief er, noch droben sitzend, in gedämpftem, doch Immo noch verständlichem Tone, während er allerlei geheimnisvolle Zeichen und Bewegungen gegen die Glöcklein machte:
„Glöcklein, dürft nicht klingen,
Soll das Werk gelingen! –
Wind, ach lieber Wind,
Geh’ zur Ruh’ geschwind;
Schlüpf’ dort in die Hecke,
Daß den Greif nichts wecke,
Daß kein Glöcklein klinge,
Und das Werk gelinge.“
Sofort verstummte ein Glöcklein nach dem andern, und ein kühler Windhauch streifte an Immo vorbei, der Hecke zu. Dann sprang das Männlein zur Erde, dem Prinzen durch Zeichen bedeutend, am Baume auf ihn zu warten. Immo sah ihn davon hüpfen; er schien sich dem Turm zu nähern, der in nächtliche Schatten gehüllt unheimlich emporragte. Doch gleich war Springmännlein zurück. Mit der üblichen Vorbereitung flüsterte der Kleine:
„Liegt der Greif in Schlaf und Traum;
Nah’ getrost dem Zauberbaum.
Klimm’ hinauf, mein Immo du;
Wind und Glöcklein sind zur Ruh’ – –
Siehst das Schwert du hangen? –
Hol’s jetzt ohne Bangen.“
Immo blickte angestrengt in die Höhe. Und siehe da: wirklich hing dort im Baum mitten unter den Zauberglöcklein das Zauberschwert, dessen scharfe Klinge der Jüngling nun deutlich aufblitzen sah. Ohne Besinnen erklomm er gewandt den Baum, bis er das Schwert erreicht und aus den Zweigen gelöst hatte. Wieder unten angelangt, folgte er schnell dem voranspringenden Männlein, das ihn nun den selben Weg führte, den Balduin wenige Stunden zuvor in kühnem Wagemut gegangen war.
Der Falke saß indessen auf seinem Baum, hatte alles gehört und flog nun mit ängstlichem Flattern den beiden nach. Doch das Tor war schon wieder hinter dem ungleichen Paar geschlossen. So vermochte der Verzauberte hier nichts zu helfen, wie er gehofft hatte. Vor der Tür des selben Gemachs, wo Balduins Kampf stattgefunden hatte, blieb Springmännlein stehen, indem es flüsterte:
„Jetzt sei auf der Hut; –
Führ’ die Klinge gut.
Triff den Höcker gleich
Mit gewalt’gem Streich.“
Geräuschlos sprang die Tür auf. Dort am Herd stand der schreckliche Zauberer und schmiedete mit dröhnenden Hammerschlägen an zwei Goldschlößlein. Das dadurch verursachte Geräusch sowie der Eifer, mit welchem der Zauberer seiner Beschäftigung oblag, ließ ihn den Eintritt Immos überhören.
Mit gezücktem Schwert stand Immo hinter ihm, gewandt den richtigen Augenblick benutzend, als der Zauber sich über sein Werk beugte. Die scharfe Klinge des Zauberschwertes sauste, mit gewaltiger Kraft geführt, auf den Höcker hinab, daß dieser zu Boden rollte. So wuchtig war der Hieb geführt worden, daß das Schwert noch tief in den Kopf des Zauberers drang, diesen mitten durchspaltend, was dem Zauberer das Leben kostete. Dieses erste Werk war vollbracht; doch nun folgte das schwerere: der Weg in den Turm.
Springmännchen hüpfte voran, durch weite Säle und Gänge, die alle hell erleuchtet waren. Endlich standen sie vor einer schweren eichernen Tür, deren mächtige Bohlen zeigten, daß sie den Ausgang bilden mußten. Immo öffnete die rostigen Riegel mit Mühe. Nun lag die lange Zugbrücke vor ihm. Springmännchen hüpfte wieder und raunte dann:
„Prinz, dem Greifen wild
Jetzt dein Kämpfen gilt;
Zück’ mit Mut dein Schwert,
Denn der Preis ist’s wert.
Trenn’ die Flügel schnell,
Seiner Kräfte Quell.
Dann die Mähne glatt,
Das macht Greif wohl matt.
Dann flugs, ohne Grau’n,
In den Rachen; traun,
Eh’ noch weicht die Nacht,
Ist das Werk vollbracht.“
Mutig schritt der Königssohn voran, bis er das Tor des Turms erreicht hatte. War der Zauberer schon schrecklich anzuschau’n gewesen, so übertraf der Anblick des Greifen diesen noch an Furchtbarkeit. Ein schmaler Lichtstreif fiel aus dem Turm auf den schrecklichen Wächter der unglücklichen Königstöchter herab.
Immo sah, wie das Ungetüm regungslos, jedenfalls schlafend, dicht vor der schmalen in den Turm führenden Pforte lag. Der Kopf, die Mähne, der Schweif glichen dem des Löwen, während die mächtigen Flügel und die furchtbaren Krallen eher dem Adler anzugehören schienen.
Immo faßte das Zauberschwert recht fest, während er sich vorsichtig dem schrecklichen Tiere näherte. Kein Zweifel, es schlief; die verstummten Glasglöcklein hatten ihre Wirkung getan. Als Immo ganz nah war, holte er zu einem mächtigen Hieb aus, der auch den einen Flügel gänzlich vom Körper trennte. Aber nun erwachte der Greif auch mit schrecklichem Geheul. Doch schon sank der zweite Flügel, von wohl gelungenem Streich getroffen, hernieder.
Ehe der Unhold zum Sprunge auf seinen Angreifer fähig war, hatte Immo schon die Mähne mit sicherem Griff erfaßt, so daß sie im nächsten Augenblick neben den Flügeln am Boden lag. Fauchend, mit weitgeöffnetem Rachen vorwärts springend, versuchte der Greif nun, dem kühnen Jüngling die furchtbaren Krallen in den kampfesmächtigen Arm zu schlagen und seinen Schweif um des Prinzen Körper zu ringeln.
Doch tief in den gewaltigen Rachen tauchte die Klinge des Furchtlosen, daß ein mächtiger Blutstrom aufspritzte. Wohl hatte Immo nach allen Mut und alle Kraft zusammen zu nehmen, um das immer noch gefährliche Ungeheuer vollends zu töten, ehe es ihm mit seinen Krallen oder dem Schweif verderblich werden konnte. Ihm war, als ob seine eigene Kraft sich verdoppelte, ja, verdreifachte, ein Umstand, den er nebst seiner eigenen Anspannung aller Kräfte hauptsächlich dem Zauberschwert zuschrieb, und jedenfalls auch mit Recht. Er bedurfte solcher Kräfte aber auch, das erkannte er, denn die Anstrengung war nicht gering, bis das Tier endlich getötet zu seinen Füßen lag.
Erst jetzt wagte Immo, sich nach seinem getreuen Springmännchen umzublicken, und er konnte einen Jubelruf nicht unterdrücken, als er sah, wie der kleine Mann eben mit aller Kraft einen mächtigen Schlüssel aus einem Mauerloch hervorzog, den er durch ein Zeichen zu nehmen aufforderte. Dann, nach den üblichen Sprüngen, hub er an:
„Hast besiegt den Greif zur Nacht;
Hält nun niemand hier mehr Wacht.
Nun verliere keine Zeit,
Bis die Mägdlein sind befreit,
Bis die Falken auch gerettet,
Die nur so lang’ Zauber kettet,
Als die beiden noch gefangen;
Drum an’s letzte Werk ohn’ Bangen.
Hier der Schlüssel sprengt das Tor –
Steig getrost im Turm empor.“
Immo nahm mit freundlichem Dank den Schlüssel und sprach:
„Du, mein liebes Springmännlein, was du mir bisher geraten, war gut, so will ich auch nun mit Freuden an das letzte Werk gehen. Ohne deine Hilfe hätte ich dieses Ziel nie erreichen können. Werde ich dich noch hier finden, wenn ich die Jungfrauen befreit habe?“
Da antwortete Springmännlein mit fröhlichem Hüpfen:
„Springmann harret dein,
Bis es Zeit wird sein.
Hörst du die Jungfrau’n singen?
Sollst die Schönste dir erringen.“
Wenige Minuten später hatte Immo den Schlüssel im Torschloß umgedreht und schritt die enge Steintreppe zum Turmgemach empor. Springmann hatte recht gehabt: die Jungfrauen sangen; aber es war nicht mehr jenes Klagelied, das er schon gehört, sondern es war, als ob sie einem Dritten antworteten, denn der Prinz vernahm ihre Worte:
„Deine Botschaft wir vernahmen,
Daß heut’ zwei zur Rettung kamen.
Du bist einer von den beiden,
Mußtest bitter für uns leiden;
Doch dein Bruder Immo wert
Schwang mit Mut das Zauberschwert.
Unser Dank werd’ ihm zuteil;
Unserm Retter Immo Heil!“
Jetzt sprang die Tür zum Turmgemach auf, und Immo trat über die Schwelle. Er sah zuerst die beiden schönen Jungfrauen, die Hand in Hand an dem engen Fenster standen und Zwiesprache mit einem draußen am Eisengitter kauernden Falken hielten. Immo begriff gleich, daß sein Bruder die Freudenbotschaft gebracht hatte.
Als Immo nun das Zauberschwert klirren ließ, wandten sich die Jungfrauen erschrocken um. Doch ein Blick auf den Jüngling ließ sie erkennen, daß sie ihren Retter vor sich hatten. Jetzt erst gewahrte Immo, daß jede der beiden Gefangenen um einen Arm ein starkes Seil geschlungen trug, dessen Ende fest in das Gemäuer gefügt war. Ehe der Jüngling aber diese letzte Fessel der armen Jungfrauen löste, rief er dem Falken, der noch immer draußen am Fenster saß, zu:
„Mein Bruder, warn’ die Falken alle,
Daß keiner aus der Höhe falle.
Such’ jeder schnell sich festen Grund,
Denn jetzo naht die Rettungsstund’.“
Mit lautem Freudenschrei flog der Falke eilends davon, um den Auftrag auszuführen, indessen Immo sich ritterlich vor den Königstöchtern verneigte, die mit züchtig niedergeschlagenen Augen vor ihm standen.
Sie waren beide sehr schön. Die Älteste, Edelgarde, die dem Falken erst voll Mitleid nachgeblickt hatte, war vielleicht die Schönste; dennoch hafteten Immos Blicke an der jüngeren Schwester, Irmtraute, weil der Ausdruck ihres Antlitzes besonders große Herzensgüte zeigte. Jetzt sprach er: „Edle Jungfrauen! Als euer Retter nahe ich euch. Vergebt mir, daß ich hier eingedrungen bin und euch vielleicht erschreckt habe, anstatt, wie es euerm Range entsprach, mich zuvor bei euch anmelden zu lassen. Doch“, fuhr der Prinz lächelnd in seiner Rede fort, „woher sollte ich eine Dienerin oder einen Pagen nehmen? Alles ist verzaubert, wie ihr wißt, und so mußtet ihr mit der Botschaft eines Falken vorlieb nehmen, der, wie ich glaube, seines selbstgewählten Amtes zu eurer Zufriedenheit gewaltet hat. Und nun will ich eure Fesseln zertrennen, damit euch und den Falken Freiheit und Erlösung zuteil werde.“
Doch ehe Immo noch zum Zauberschwert griff, um die Stricke zu zerschneiden, gewahrte er Springmännchen an seiner Seite, der ihm zuwinkte und nach der üblichen Vorbereitung also sprach:
„Nimm fest das Schwert,
Doch nimmer schneide –
Der Springmann wehrt,
Weil’s sonst zum Leide.
Berühr’ den Strick
Mit flacher Klinge;
Im Augenblick
Dies Freiheit bringe.“ –
Immo tat, wie ihm geheißen. Kaum hatte das Zauberschwert den Strick berührt, als die Knoten auch schon von selbst aufsprangen und beide Jungfrauen befreit waren. Sie folgten mit ihrem Befreier nun schnell dem voraneilenden Springmännlein, das munter die Treppe hinabhüpfend, unten vor dem Tor vergnüglich zu tanzen begann, als die drei auf der Zugbrücke angelangt waren.
Nun eilten sie schnell, immer ihrem kleinen Führer folgend, in das Schloß, wo im größten Saal eine stattliche Anzahl Ritter ihrer harrte, die nun in lauten Jubel ausbrachen. Es waren natürlich die in Falken verzaubert gewesenen Prinzen sowie deren Knappen und Pagen, die nun ihre natürliche Gestalt wiedererhalten hatten.
Voran schritt Balduin den dreien entgegen und fiel seinem Bruder um den Hals, heiße Dankesworte stammelnd. Dann kamen alle die anderen, so daß Immo bald von den dankbaren Jünglingen wie von einer Mauer umgeben war, die alle ihm die Hände entgegenstreckten und ihren Dank auf die verschiedenste Weise zu bezeugen suchten. Bescheiden wehrte Immo alle Ehren von sich ab, indem er erklärte, daß er allen Erfolg nur dem guten Springmännlein, seinem treuen Ratgeber, und dem Zauberschwert verdanke. Nur mit Hilfe dieser beiden Bundesgenossen habe er den Zauberer und den Greif besiegen können. „Glück ist mir aus ihrem Wirken entsprossen,“ schloß Immo seine Rede.
Dann winkte Springmännlein dem Prinzen, der seinem kleinen Freunde folgte, bis dieser draußen im Schatten der Bäume halt machte. Immo dankte dem guten Springmännlein nochmals von Herzen für seine treue Hilfe. Doch der kleine Mann winkte abwehrend und ließ sich also vernehmen:
„Was Springmann half, das tat er gern,
Er wollte nützen seinem Herrn,
Weil er erkannt sein treu’ Gemüt,
Aus dem ihm noch viel Glück erblüht.
Jetzt ist’s für Springmann Zeit zu geh’n
Doch muß ihn Immo recht versteh’n:
Sobald er ruft, wird Springmann wach
Und dienet ferner seiner Sach’. –
Eh’ Springmann schlüpft ins Wurzelkleid,
Empfange Immo noch Bescheid:
Bevor man scheidet aus dem Schloß
Mit Mann und Roß und Dienertroß,
Mach’ jeder vor dem Abschied halt
Am Zauberbaume alsobald,
Und Immo mög’ zum Angedenken
Ein Zauberglöcklein jedem schenken.
Und jedes mahne beim Erklingen
Zur Wachsamkeit in allen Dingen.
Doch meinem lieben Immo wert
Gehöre auch das Zauberschwert.“
Nach diesen Worten dankte Immo nochmals seinem kleinen Freunde, doch er erhielt keine Antwort, und als er sich niederbeugte, lag vor ihm die unscheinbare Springwurzel. Er hob sie sorgsam empor, indem er sie fast zärtlich betrachtete, dann barg er den wertvollen Schatz mit größter Vorsicht in seinem Gewande.
Inzwischen hatten die Knappen und Pagen aus den reichen Vorräten in Küche und Keller ein Mahl bereitet, das sie eben, als Immo den Saal betrat, auf goldenen Schüsseln und in silbernen Kannen auftrugen. Ein jeder durfte ungestraft davon genießen, denn mit der Vernichtung des Zauberers und des Greifen hatte jeder verderbliche Zauber seine Macht verloren; das wußten die Beteiligten sehr wohl. Dennoch wollten alle, sobald es völlig Tag geworden war, den Ort ihrer Leiden verlassen, um zu den Ihrigen heimzukehren.
Es wurde beschlossen, daß die beiden Brüder mit einer kleinen Anzahl der Geretteten den Königstöchtern das Ehrengeleit in deren Heimat geben sollten. Alle waren froh und glücklich; sie hofften nun auf ein Wiedersehen mit den Ihrigen. Jubel herrschte im Lande der Königstöchter, als die Prinzessinnen mit ihrem Retter und ihrem Ehrengefolge in das elterliche Schloß einzogen, wo diesem Freudentag bald die glänzende Hochzeit folgte; denn der König gab freudig seine Zustimmung, als Balduin die schöne Edelgarde, Immo aber die liebliche Irmtraut zur Gemahlin begehrte.
Als aber die Brüder mit ihren Gemahlinnen wieder zu ihrem Vater heimkehrten, da jubelte das ganze Land, und der alte König hieß hochbeglückt seine Kinder willkommen. Als er alles erfahren und eingesehen hatte, daß auch Balduin durch die Erlebnisse geläutert worden, veranstaltete er ein großes Fest, bei dem er dem Volk verkünden ließ, daß er sein Land einst zwischen seinen beiden Söhnen teilen werde.
Es folgten nun viele glückliche Jahre, und als später Balduin und Immo das Land erhielten, lebten sie alle in Glück und Frieden, geliebt und geehrt von ihren Untertanen. Balduin brauchte den Goldfasan nur zur guten Zwecken. Immo hielt das Zauberschwert in Ehren, besonders aber die Springwurzel, denn Springmännlein hielt Wort und erschien, so oft Immo seines Rates bedurfte.
Elsbeth Montzheimer
