MÄRCHEN AUS GROSSBRITANIEN, IRRLAND, SCHOTLAND I ...
VERZEICHNIS
"Der Fischer und seine Seele"
"Das widerspenstige Schwein"
" Cherry von Zennor"
"Der geblendete Riese"
"Caolite Cosfhada"
"Der Regenpfeifer"
"Assipattle"
"Eule, Taube und Fledermaus"
"Conall"
"Die Suppe in der Eierschale"
"Die kluge Kate"
"Die verbotene Quelle"
"Däumling"
"Mister Miacca"
"Der Erzähler in Nöten"
"Spätereinmal"
"Der Lindwurm von Lambton"
"Der Bursche, der keine Geschichte kannte"
"Der rote Ettin"
"Wie der Wrekinberg bei Shrewsbury entstand"
"Dick Whittington"
" Gobborn Seer"
"Teigh O'Kane und der Tote"
"Eilians Flucht"
"Die Seejungfrau"
"Die Fee von Bedgelert"
"Die drei Bären"
"Koboldmärchen" (4)
"Olwen und Einion"
"Tam Lin"
"Die gefangenen Seelen"
"Lantrys neues Haus"
"Die Prinzessin von Colchester"
"Gräfin Kathleen O'Shea"
"Ich"
"Merlin - Merlinchen"
"Die Sterne am Himmel"
"Die Vogelschlacht"
"Gulliver"
"Der schwarze Stier von Norroway"
"Robin Hood"
"Fingerhut"
"Das Fräulein von St. Gilles"
"Die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen"
"Der Katzenkönig I + II"
"Hans und die Bohnenranke"
"Der Page und der Silberkelch"
"Die Zauberflasche"
"Lod"
"Der begrabene Mond"
Der begrabene Mond

Es ist lange her, in der Zeit meiner Großmutter, da bestand das Car-Land ganz aus Sümpfen, aus großen Tümpeln mit schwarzem Wasser und aus schleichenden Rinnsalen mit grünem Wasser und aus matschigen Schlammbuckeln, die aufspritzten, wenn man darauf trat. Nun, Großmutter pflegte davon zu sprechen, wie lange vor ihrer Zeit Frau Mond selbst einmal tot war und in den Sümpfen begraben, und so, wie sie es mir erzählte, will ich euch alles darüber erzählen.
Zu jener Zeit schien Frau Mond und schien, gerade wie sie es heute tut, und wenn sie schien, erhellte sie die Moortümpel, so dass einer umhergehen konnte geradeso sicher wie am Tage. Aber wenn Frau Mond nicht schien, dann kamen all die Wesen hervor, die in der Dunkelheit wohnen, und sie trieben sich umher, um zu suchen, wo sie Böses tun können und Leid zufügen. Sumpfgeister und kriechende Scheusale, alle kamen heraus, wenn Frau Mond nicht schien.
Nun, Frau Mond hörte davon, und da sie freundlich und gut ist - und gewiss ist sie das, wenn sie doch für uns in der Nacht scheint, anstatt ihre natürliche Rast zu halten -, war sie mächtig besorgt. "Ich will selbst nachsehen, ja, das will ich", sagte sie, "vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es die Leute machen."
Und wirklich, am Ende des Monats schritt sie herunter, eingehüllt in einen schwarzen Mantel und mit einer schwarzen Kapuze über ihrem gelben schimmernden Haar. Geradenwegs ging sie zum Rand des Sumpfes und sah sich um. Hier Wasser und da Wasser; wehende Büschel und zitternde Schlammbuckel und große schwarze Baumstümpfe, die sich wanden und krümmten. Vor ihr war alles dunkel - dunkel, bis auf das Glitzern der Sterne in den Tümpeln und das Licht, das von ihren eigenen weißen Füßen ausging, die sich unter dem schwarzen Mantel hervor stahlen.
Frau Mond zog ihren Mantel fester zusammen und zitterte, aber sie wollte nicht zurückgehen, ohne alles gesehen zu haben, was da zu sehen war. So ging sie weiter, so leicht wie der Sommerwind schritt sie von Grasbüschel zu Grasbüschel, hindurch zwischen den gierig gurgelnden Wasserlöchern. Gerade als sie sich einem großen schwarzen Tümpel näherte, glitt ihr Fuß aus, und sie taumelte beinahe hinein. Mit beiden Händen griff sie nach einem Baumstumpf in der Nähe, um sich so festzuhalten, aber als sie ihn berührte, wand er sich wie ein Paar Handschellen um ihre Handgelenke, und er packte sie so, dass sie sich nicht bewegen konnte. Sie zog und wand sich und rang mit ihm, aber es half nichts. Sie war gefesselt, und sie musste es bleiben.
Als sie so zitternd in der Dunkelheit stand und sich fragte, ob jemand zu Hilfe kommen werde, hörte sie plötzlich etwas in der Ferne rufen, rufen und rufen und dann mit einem Schluchzer verstummen, bis die Marschen erfüllt waren von diesem jammervollen Schreien. Dann hörte sie, wie sich Schritte abmühten, sie ließen den Schlamm aufspritzen und glitten auf den Büscheln aus, und durch die Dunkelheit sah sie ein weißes Gesicht mit großen angstvollen Augen.
Es war ein Mann, der sich in den Sümpfen verlaufen hatte. Verwirrt von Furcht kämpfte er sich vorwärts auf dieses flimmernde Licht zu, das nach Hilfe und Sicherheit aussah.
Aber als die arme Frau Mond sah, dass er immer näher und näher zu dem tiefen Wasserloch kam und immer weiter weg vom Pfad, da wurde sie so böse und so zornig, dass sie sich abmühte und rang und zerrte, fester als je zuvor. Und obgleich sie nicht loskommen konnte, wand und drehte sie sich, bis ihre schwarze Kapuze herunterfiel von ihrem schimmernden gelben Haar, und das schöne Licht, das davon ausging, trieb die Dunkelheit hinweg.
Oh, und wie da der Mann vor Freude aufschrie, als er das Licht wieder sah. Und sofort flohen alle bösen Wesen zurück in die finsteren Winkel, denn sie können das Licht nicht ertragen. So konnte er sehen, wo er war und wo der Pfad war und wie er aus den Sümpfen herauskommen konnte. Und er war in solcher Eile, von dem Quickschlamm und von den Sumpfgeistern und den Wesen, die hier wohnen, wegzukommen, dass er kaum auf das tapfere Licht sah, das von dem schönen schimmernden gelben Haar ausging und sich ergoss über den schwarzen Mantel und niederfiel auf das Wasser zu seinen Füßen. Und Frau Mond selbst war so eifrig darauf aus, ihn zu retten, und so voller Freude, dass er wieder auf dem richtigen Pfad war; sie vergaß ganz, dass sie selbst doch Hilfe brauchte und dass sie festgehalten wurde von dem schwarzen Baumstumpf.
So war er weg; erschöpft und keuchend stolperte er dahin und schluchzte vor Freude, er floh um sein Leben aus den schrecklichen Sümpfen. Da überkam es Frau Mond, dass sie mächtig gern mit ihm gehen würde. Und so zerrte sie und rang wie wahnsinnig, bis sie erschöpft von der Mühe am Fuß des Stumpfes auf ihre Knie niederfiel. Und als sie da lag und um Atem rang, fiel ihr die schwarze Kapuze nach vorn über den Kopf. Da ging das gesegnete Licht aus, und die Dunkelheit kam zurück und mit ihr all ihre bösen Wesen, und sie kamen mit schrillem Geschrei. Sie drängten sich um sie her, höhnten und schnappten und schlugen. Sie kreischten vor Wut und Bosheit und fluchten und knurrten, denn sie kannten sie als ihren alten Feind, der sie in die Winkel zurücktrieb und davon abhielt, ihre üblen Werke zu tun.
"Fürchte dich!" gellte es von den Hexenwichten, "wieder hast du uns in diesem Jahr unsere Hexereien verdorben!" - "Und uns hast du in den Winkeln brüten lassen!" heulten die Sumpfgeister. Und
alle Wesen stimmten ein mit lautem "Hoho!", so dass selbst die Grasbüschel erzitterten und die Wasser gurgelten.
Und von neuem fingen sie an. "Wir wollen sie vergiften - sie vergiften!" kreischten die Hexen. Und "Hoho!" heulten die Wesen wieder. "Wir wollen sie ersticken - sie ersticken!" zischelten die
kriechenden Scheusale und wanden sich um ihre Knie. Und "Ho ho!" höhnten alle anderen. Und wieder brüllten sie alle vor Hass und Bosheit. Und die arme Frau Mond duckte sich und wünschte, sie wäre
tot und es wäre alles vorbei. Und sie stritten und zankten sich darüber, was sie mit ihr tun sollten, bis ein fahles grünes Licht am Himmel aufstieg, und es nahte die Dämmerung. Und als sie das
sahen, bekamen sie Angst, sie hätten nicht mehr genug Zeit, ihre böse Absicht auszuführen, und sie ergriffen sie mit grässlichen knochigen Fingern und legten sie tief ins Wasser am Fuß des
Baumstumpfes. Und die Sumpfgeister holten einen sonderbaren großen Stein und wälzten ihn über sie, um sie am Aufstehen zu hindern. Und sie befahlen zwei Irrlichtern, sie sollten abwechselnd Wache
halten auf dem schwarzen Stumpf und darauf achten, dass sie sicher und still liegen bleibe und nicht hervorkommen könne, um ihr Treiben zu stören. Und da lag die arme Frau Mond tot und begraben
im Sumpf, bis irgendjemand sie befreien würde; und wer wüsste schon, wo man nach ihr suchen müsste.
Nun, die Tage vergingen, und es kam die Zeit des Neumondes, und die Leute steckten Pfennige in ihre Taschen und Strohhalme auf die Mützen, damit sie dafür bereit sind, und sie schauten nach Frau Mond aus, denn sie war den Leuten in den Marschen ein guter Freund, und sie waren immer mächtig froh, wenn die dunkle Zeit vorüber war und die Pfade wieder sicher waren, und wenn die bösen Wesen durch das gesegnete Licht zurückgetrieben wurden in die Dunkelheit und in die Wasserlöcher.
Aber es verging Tag um Tag, und kein Neumond kam. Und die Nächte blieben dunkel, und die bösen Wesen waren schlimmer denn je. Und es vergingen immer mehr Tage, und Frau Mond erschien nicht. Natürlich waren die armen Leute voll seltsamer Furcht und verwirrt, und viele von ihnen gingen zur Weisen Frau, die in der alten Mühle wohnte, und fragten, ob sie nicht herausbringen könnte, wohin Frau Mond verschwunden war.
"Nun", sagte sie, nachdem sie in den Brautopf geschaut hatte und in den Spiegel und in das Buch, "es ist ganz verrückt, aber was ihr zugestoßen ist, kann ich nicht richtig sagen. Wenn ihr irgendetwas erfahrt, kommt und sagt es mir." So gingen sie wieder ihrer Wege.
Und als die Tage verstrichen und kein Mond erscheinen wollte, da sprachen sie natürlich darüber - na, auf mein Wort - ich will meinen, dass sie da drüber sprachen! Ihre Zungen regten sich zu Haus und im Wirtshaus und auf dem Hof. Und eines Tages, als sie im Wirtshaus auf der langen Bank saßen, da geschah es, dass ein Mann vom andern Ende des Marschlandes dasaß, rauchte und zuhörte. Und ganz plötzlich richtete der sich auf und schlug sich aufs Knie. "Meiner Treu!" sagt er, "das hätte ich einfach vergessen, aber ich schätze, ich weiß, wo Frau Mond ist!" Und er erzählte ihnen davon, wie er sich in den Sümpfen verirrt hatte und wie ein Licht aufgeschienen war, als er schon beinahe tot war vor Angst, und wie er den Pfad gefunden hatte und sicher nach Hause gekommen war.
Da gingen sie alle fort zu der Weisen Frau und erzählten ihr davon, und sie schaute lange in den Topf und wieder in das Buch, und dann nickte sie mit dem Kopf. "Es ist immer noch düster, Kinder, es ist düster!" sagt sie. "Und ich kann's nicht richtig sehen, aber tut, wie ich euch sage, und ihr werdet es selbst herausfinden. Geht alle, gerade ehe die Nacht anbricht, nehmt einen Stein in den Mund und eine Haselrute in die Hand und sprecht kein Wort, bis ihr wieder sicher zu Hause seid. Dann geht los und fürchtet euch nicht, geht weit bis in die Mitte des Sumpflandes, bis ihr einen Sarg findet, eine Kerze und ein Kreuz. Dann seid ihr nicht weit von euerm Mond. Seht zu, vielleicht findet ihr sie."
So kam die nächste Nacht in der dunklen Zeit, und sie gingen alle zusammen hinaus, jeder mit einem Stein im Mund und einer Haselrute in der Hand, und wie man sich denken kann, war ihnen sehr bang und gruselig zumute. Und sie stolperten und tappten die Pfade entlang bis in die Mitte des Sumpflandes; sie sahen nichts, obwohl sie hörten, wie es um sie seufzte und unruhig hin und her glitt, und fühlten, wie kalte feuchte Finger sie berührten. Aber dann auf einmal....
Sie schauten immer aus nach dem Sarg, der Kerze und dem Kreuz, und dabei kamen sie immer näher an den Tümpel neben dem großen Baumstumpf, wo Frau Mond begraben lag. Und dann auf einmal hielten sie an, sie bebten und waren verstört und voll Grauen, denn da war ein großer Stein, halb im Wasser drin, halb draußen, und - um alles in der Welt - er sah aus wie ein seltsamer hoher Sarg! Und zu seinen Häupten war der schwarze Stumpf, der breitete seine Arme aus wie ein finsteres, grausiges Kreuz, und darauf flackerte ein dünnes Licht wie eine verlöschende Kerze.
Sie knieten alle nieder in den Schlamm und sagten das Vaterunser, zuerst vorwärts wegen des Kreuzes und dann rückwärts, um die Geister abzuhalten; aber sie sagten es, ohne es auszusprechen, denn sie wussten, die bösen Wesen würden sie fassen, wenn sie nicht das machten, was ihnen die Weise Frau gesagt hatte. Dann kamen sie näher und packten den großen Stein und schoben ihn weg, und wie sie dann später erzählten, sahen sie da einen winzigen Augenblick lang ein seltsames und schönes Gesicht, das schaute sie aus dem schwarzen Wasser heraus so in einer Art Freude an. Aber das Licht kam so rasch und so weiß und strahlend, dass sie verwirrt davon zurücktraten, und schon im nächsten Augenblick, als sie wieder richtig sehen konnten, stand der volle Mond am Himmel, strahlend und schön und freundlich wie immer, und er schien lächelnd herunter auf sie und machte die Sümpfe und Pfade taghell und drang selbst in die Winkel, als ob er die Dunkelheit und die Sumpfgeister, wenn er könnte, ganz und gar vertreiben wollte.
Ein Märchen aus England - Schottland
Lod

Es war einmal ein Farmer, der hatte einen Sohn, den man Lod nannte. Er war ein starker Bursche, der wußte, was er wollte. Eines Tages schickte ihn sein Vater mit einer großen Schüssel Haferbrei
zu einer Gruppe von Männern, die Torf stachen, aber unterwegs verschüttete Lod den Brei, die Arbeiter blieben ohne Essen und beklagten sich bei dem Farmer, als sie am Abend heimkehrten.
Der Vater schimpfte Lod aus und sagte ihm, er solle auf der Stelle das Haus verlassen und über fünfundzwanzig Straßen ziehen und sehen, wie er in der Welt zurechtkomme, er wolle mit ihm nichts
mehr zu schaffen haben.
»Wenn es so steht«, sagte Lod, »werde ich eben gehen. Ich bitte dich nur noch, daß du mir eine eiserne Keule gibst, damit ich mich auf meinen Wanderungen meiner Haut wehren kann. «
»Das sollst du haben«, sagte der Vater, ging stracks zu einem Schmied und ließ dort eine Keule machen, die war einen stone schwer. »Das ist eine gute Keule für dich«, sagte er.
Lod griff sich die Keule, und als er sie in die Hand nahm, brach sie sofort entzwei.
»Ach«, sprach er, »ich brauche eine Keule, die stark genug ist für mich.«
Also ging der Vater zurück zum Schmied und ließ eine zweite Keule machen, die hatte ein Gewicht von zwei stone.
»Die sollte nun aber gewiß stark genug sein«, sagte er, als er sie seinem Sohn gab.
Aber auch diese Keule brach sofort in zwei Teile, als Lod sie in die Hand nahm.
»Ach«, schimpfte Lod, »die ist auch nichts. Ich brauche eine bessere. «
Die dritte Keule war dreieinhalb stone schwer, und der Schmied sagte :
»Eine stärkere Keule kann ich nicht machen.«
Doch auch diese Waffe zerbrach, als Lod sie zweimal durch die Luft schwenkte.
Der Vater ließ die beiden Teile beim Schmied wieder zusammenschweißen und sprach dann zu seinem Sohn. »Damit mußt du nun auskommen. Ich bin es leid, dir ständig neue Keulen machen zu lassen.«
Dann nahmen sie Abschied, und der Junge zog fort. Es dauerte nicht lange, da kam er an das Schloß eines Königs und erkundigte sich dort, ob man wohl Arbeit für ihn habe.
»Was für Arbeit kannst du tun?« fragte der König.
»Ich bin ein guter Kuhhirt«, antwortete Lod, »mein Leben lang habe ich Kühe hüten müssen.«
»Das trifft sich gut«, sagte der König, »mein Vieh kommt mir Stück um Stück abhanden. Und ich kann keinen Hirten finden, der ordentlich aufpaßt. Willst du diese Arbeit übernehmen ?«
»Das will ich gern, wenn du mir als Lohn das zahlst, was ich brauche. Ich verlange zehn Guineas im Jahr, einen Sack Mehl in der Woche und soviel Milch, wie ich brauche, um mir meinen Brei
zuzubereiten. Ich esse zweimal am Tag, am Morgen und am Abend. Ich brauche ein Haus, in dem ich allein wohnen kann, einen Ofen und ein Bett.«
»Nun«, sagte der König, »du verlangst ziemlich viel. Aber da es sich um keine gewöhnliche Herde handelt, sollst du es haben, und wir wollen es für ein halbes Jahr zu diesen Bedingungen
miteinander versuchen.«
Also trat Lod in die Dienste des Königs und übernahm dessen Herde. Am nächsten Tag stand er zeitig auf, nahm seine Keule unter den Arm und ging auf die Weide. Während die Kühe auf dem hügligen
Grasland ihr Futter suchten, begann Lod in einem Dornendickicht Feuerholz zu sammeln.
Plötzlich hörte er Schritte und sah einen schrecklichen Riesen auf sich zukommen.
»Was treibst du hier, du Däumling?« brüllte der Riese.
»Ach, guter Mann!« sagte Lod, »jagen Sie mir doch nicht solche Angst ein. Ich sammle hier nur Feuerholz, wenn Sie es auf die Rinder abgesehen haben, die ich hüte, so nehmen Sie sie und lassen Sie
mich in Frieden.«
Der Riese ging, fing sich die schwerste und fetteste Kuh aus der Herde, band ihre vier Beine mit einem Seil aus Heidekraut zusammen, und dann rief er Lod zu :
»Komm her und heb sie mir auf den Rücken.«
»Ach«, sagte Lod, »ich habe Angst, dir zu nahe zu kommen.«
»Mach dir keine Sorgen. Ich tu dir nichts«, sagte der Riese. Also ging Lod zu dem Riesen hin und sagte:
»Du solltest besser deinen Kopf unter den Bauch der Kuh stecken, und ich helfe dann von hinten, damit du sie auf den Rücken bekommst.«
Kaum hatte der Riese Lods Rat befolgt, da ging Lod von hinten mit seiner Keule auf ihn los. Er machte die Kuh los, schlug dem Riesen den Kopf ab und hängte ihn zwischen die grünen Blätter eines
Baumes. Die Leiche des Riesen aber warf er in ein altes Torfloch.
Für den Rest des Tages blieb Lod mit seinen Tieren unbehelligt, und am Abend brachte er die Herde vollständig heim. Der König, der ihm auf dem Heimweg begegnete, war erstaunt und sprach:
» Wie hast du es geschafft, alle Tiere sicher heimzubringen?«
»Ich hab's geschafft. Warum auch nicht?« sagte Lod.
Er sagte dem König nicht, was geschehen war, und behielt sein Abenteuer für sich.
Am nächsten Tag stand er wieder zeitig auf und ging hinaus auf die Weide zu seinen Rindern. Kaum hatte er wieder das Dickicht betreten, wo er Holz sammeln wollte, da kam abermals ein Riese daher,
der sah noch stärker aus als der vom Vortag.
»Was machst du denn hier, du Dreikäsehoch?« bellte der Riese.
»Ich suche Feuerholz«, erwiderte Lod, »versuchen Sie nur nicht, mir einen Schrecken einzujagen. Es gibt wenig, was mir einen Schreck einjagen könnte.«
»Hast du gestern zufällig einen Mann gesehen, der mir ähnlich sieht?« fragte der Riese und runzelte die Stirn, »meine Mutter hat nämlich ihren jüngsten Sohn verloren.«
»Ich habe nichts gesehen«, sagte Lod, »ich war gestern gar nicht hier. Wenn du es auf eine meiner Kühe abgesehen hast, so such dir nur die fetteste heraus und mach dich mit ihr davon.«
Der Riese schlug die beste Kuh aus der Herde zu Boden, fesselte ihr die Beine mit einem Seil, und dann sagte er zu Lod:
»Nun hilf mir, damit ich das Vieh auf den Rücken nehmen kann.«
»0 nein«, sagte Lod, »da fürchte ich mich.«
»Ach was«, sagte der Riese, »ich tu dir nichts.«
Und dann kam alles, wie es schon am ersten Tag gekommen war. Bald hing der Schädel des toten Riesen in den Zweigen, und seine Leiche lag in einer Torfgrube, wo niemand, der vorbeikam, sie
entdeckt hätte.
Als an diesem Abend Lod nach Hause kam, vertrat ihm der König den Weg und war sehr erstaunt, als sein Hirte alle Rinder heil und gesund heimbrachte.
»Gewiß«, sagte der König, »hast du heute in den Hügeln drüben etwas Aufregendes erlebt?«
» Was soll ich erlebt haben«, sagte Lod, »dort drüben ist nur Heide, Wald, Torf und Moos. Was soll man da schon groß erleben.«
»Nun«, sprach der König, »du bist ein guter und geschickter Hirte. Nie zuvor ist es vorgekommen, daß einer stets die ganze Herde heimgebracht hat.«
Auch am dritten Tag erschien wieder ein Riese, und Lod übertölpelte ihn, und nun hingen schon drei Köpfe in den Zweigen, und drei Leichen lagen in der Torfgrube.
»Es kann nicht sein«, sagte der König abends, »daß du mir heute nichts zu erzählen hast.«
»Nun«, sprach Lod, »der Torf raucht, auf dem Gebirge wachsen Eschen und wildes Senfkraut -wenn du das noch nicht weißt.«
»Du bist wirklich der beste Hirte im Land und den Lohn wert, den ich dir zahle« , sagte der König.
Als Lod am nächsten Morgen aufstand, sprach er bei sich:
»Ich bin ja gespannt, was mir heute oben in den Hügeln widerfährt. Einen Riesen, noch größer als einer von den drei anderen, kann es ja eigentlich nicht geben.«
Er trieb also sein Vieh auf die Weide und ging in das Dikkicht, um Feuerholz zu suchen. Es dauerte nicht lange, da wehte ein starker Luftzug über die Berge, es war dies aber nicht der Wind, sondern der Atem einer großen grauen Hexe, die plötzlich in der Luft über Lod auftauchte und ihre klauenartigen Finger nach ihm ausstreckte.
»Hier steckst du also, du Schurke, du Bösewicht. Du hast meine drei Söhne getötet. Jetzt bin ich gekommen, um an dir Rache zu nehmen.«
Damit packte sie ihn, und wie zwei Ringer gingen sie beide kämpfend zu Boden. Über weiches und hartes Gelände rollten sie, verklebt von Torf und Blut bei ihrem Ringen. Und die alte Hexe war so
stark, daß Lod mehr als einmal um sein Leben fürchtete. Aber dann kam der Augenblick, wo er sich gewaltig anstrengte, die Hexe hochhob, ihr Arme und Beine brach und sie flach auf den Boden
warf.
»Nun, alte Hexe, was für ein Lösegeld gibst du mir, wenn ich deinen Qualen ein Ende mache?« fragte er.
»Ich gebe dir etwas, was groß und nicht klein ist«, antwortete sie schwach. »Es ist eine Truhe voll Gold und eine Truhe voller Silber, die unter der Schwelle meiner Höhle dort drüben
liegen.«
»Besten Dank«, sagte Lod, »und nun sollst du nicht länger leiden.«
Darauf schlug er ihr den Kopf ab und hängte ihn neben die Schädel ihrer Söhne in die Zweige, ihren Leib aber warf er in die Torfgrube.
An diesem Abend hielt ihn der König an, als er zurückkam, und sagte :
»Gewiß hast du heute draußen auf der Weide ein Abenteuer erlebt?«
» Die Formen der Hügel, der grüne Rasen und die Lerchen über den Feldern waren nicht anders als sonst auch«, antwortete Lod. »Nichts von Bedeutung weiß ich dir zu berichten.«
»Ach«, sagte der König, »du bist ein großartiger Bursche, wenn ich dich nur schon eher zum Hirten bestellt hätte, viel Ärger wäre mir erspart geblieben.«
Am anderen Tag brauchte sich Lod zum erstenmal, seitdem er im Dienste des Königs stand, mit niemandem herumzuschlagen, und als er heimkam, war er sehr erstaunt, daß der König ihm heute nicht entgegenkam und ihn nicht befragte, ob er auf dem Feld ein Abenteuer erlebt habe. Aber als er das Schloß erreichte, fand er alle Leute weinend und klagend über das schreckliche Schicksal der Königstochter.
Lod hörte, daß während des Tages ein großer Riese mit drei Köpfen zum Schloß gekommen war (man muß dabei bedenken, daß es damals noch von Riesen nur so wimmelte ). Er hatte gedroht, einen jeden im Land zu töten, wenn man ihm nicht die Prinzessin ausliefere. Er war dann wieder gegangen, hatte aber geschworen, er werde seine Drohung bestimmt wahrmachen, wenn man die Prinzessin nicht bis zum Abend in seine Höhle bringe.
Nach langem Überlegen hatte der König sich entschlossen, seine Tochter zu dem Riesen zu schicken. Er hielt dies für seine Pflicht, um sein Volk zu retten. Die Vorbereitungen waren schon in vollem
Gange. Ganz zuletzt aber hatte der schielende und rothaarige Koch des Königs den Einfall, aus der ganzen Sache noch gutes Kapital zu schlagen, und er versprach, die Prinzessin zur Höhle des
Riesen zu begleiten.
»Ich werde den Riesen töten«, sprach er zum König, »wenn ihr mir später die Prinzessin zur Frau gebt.«
Der König war nicht sehr erbaut darüber, einen schielenden und rothaarigen Koch zum Schwiegersohn zu bekommen, aber was sollte er machen. Er hatte eingewilligt. Und kurz ehe Lod aus den Bergen heimkam, war der Koch mit der Prinzessin aufgebrochen. Nun war Lod seit dem Augenblick, da er sie einmal durch das Fenster des Schlosses kurz gesehen hatte, in die Prinzessin verliebt. Als er nun hörte, in welcher Gefahr sie schwebte, machte er sich auch sogleich zur Höhle auf den Weg. Unter dem Arm trug er seine schwere Keule.
Als er die Höhle erreichte, sah er die Prinzessin zitternd dort stehen, während der schielende, rothaarige Koch, der ein großer Feigling war, sich hinter einem Stein versteckt hatte.
»Oh !« rief die Prinzessin, als sie Lod sah, »warum bist du nur hergekommen. Ist es nicht genug, wenn der Riese mich nimmt. Willst du auch noch von ihm getötet werden?«
» Was das angeht«, sagte Lod, »so ist er auch nicht allmächtig, und ich habe einige Erfahrung im Umgang mit solchen Burschen.«
In diesem Augenblick erhob sich drinnen in der Höhle ein furchtbares Gebrüll, und der Riese selbst trat heraus: ein gewaltiger Mann, mit Fellen bekleidet und mit drei Köpfen auf seinem schweren
Nacken.
Als er ins Freie trat, war er zunächst von der Helligkeit etwas geblendet, sofort sprang Lod auf ihn zu und hieb ihm die drei Köpfe ab. Das war das Ende des Riesen. Die Gewalt, mit der Lod zugeschlagen hatte, war so groß, daß er selbst hinstürzte und sich am Arm verletzte, und die Prinzessin verband ihn mit einem Streifen Tuch, den sie von ihrem Kleid abriß. Sie war außer sich vor Freude über ihre Rettung und schlug Lod vor, sofort mit ihr zum Schloß zu eilen, wo sie seine Frau werden wollte. Aber Lod war nach dem Tag auf dem Feld und dem Kampf mit dem Riesen ziemlich müde. Also sagte er der Prinzessin, er werde erst ein kurzes Schläfchen tun, legte sich ins Gras und schloß die Augen.
Die ganze Zeit hatte der schielende, rothaarige Koch in seinem Versteck gesessen. Kaum aber war Lod eingeschlafen, da nahm er die drei Köpfe des Riesen und faßte die Prinzessin beim Handgelenk. Vergebens versuchte sie sich zu befreien und Lod zu Hilfe zu rufen. Lod schlief tief. Ob sie wollte oder nicht, sie mußte dem Koch zum Schloß folgen. Dort legte er die drei Köpfe dem König vor die Füße, behauptete, er habe die Prinzessin gerettet und verlangte, der König möge nun sein Versprechen erfüllen. Was blieb dem König anderes übrig. Der Hochzeitstag wurde festgesetzt.
Es war ein großes Hochzeitsfest, und als alle Gäste versammelt waren, schaute der König in die Runde, um zu sehen, ob auch nichts fehle. Plötzlich runzelte er die Stirn.
»Ein Mensch fehlt«, rief er, »wo ist mein Rinderhirt?« »Hier bin ich«, kam eine Stimme von der Türschwelle, und dort stand Lod, schaute den Schurken von Koch böse an und kam langsam auf ihn zu.
Der Koch wurde bleich vor Furcht, wie er da auf dem Stuhl des Bräutigams saß.
»Oh, lieber Vater, es war dieser Mann dort, der mich vor dem Riesen errettet hat, und nicht der Koch«, sagte die Prinzessin.
»Ich wußte, daß er kommen würde, um mich zu heiraten.«
»Was für einen Beweis gibt es für diese Behauptung?« sagte der König.
Da stand die Prinzessin von ihrem Platz auf und trat auf Lod zu, um dessen Arm immer noch der Fetzen Stoff gewickelt war, den sie von ihrem Kleid abgerissen hatte. »Diese Wunde empfing er, als er dem Riesen die Köpfe abschlug, und ich habe sie verbunden«, rief sie, und dann ließ sie das Kleid hereinbringen, das sie an jenem Tag getragen hatte, und tatsächlich, da fehlte das Stück Stoff.
Da erkannte der König, daß sie die Wahrheit sagte, und nachdem der Koch davongejagt worden war, machten Lod, der Farmerssohn und des Königs Tochter Hochzeit.
Nachdem die Feiern vorbei waren, nahm Lod seine Frau und den König zu der Stelle mit, an der er die Rinder gehütet hatte, und zeigt ihnen die Schädel der drei Riesen und der alten Hexe in den Zweigen des Baumes. Und es dauerte lange, bis der König alle Abenteuer angehört hatte, die Lod bestanden hatte, seit er in den Dienst des Königs getreten war.
Sie holten dann noch die Truhe mit Gold und die Truhe mit Silber, die unter der Schwelle der Höhle vergraben lagen, und lebten in Saus und Braus für den Rest ihrer Tage, und wenn sie nicht
gestorben sind, so leben sie heute noch.
Märchen aus Schottland
Die Zauberflasche
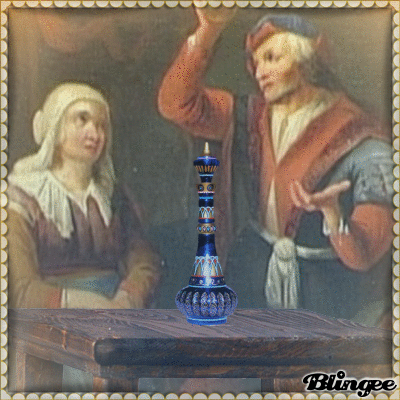
In den alten Zeiten, als sich das Elfenvolk noch sehen ließ, in dieser Zeit lebte ein Mann namens Michael, der hatte einige Äcker schlechtes und unfruchtbares Land gepachtet. Er besaß Frau und Kinder, sie taten was in ihren Kräften stand, um bei der Arbeit mit zu helfen. Aber das war nicht viel, denn es war noch kein Kind herangewachsen. Und die gute Frau besorgte die Kuh, kochte die Kartoffeln, trug Eier auf den Markt und verpflegte obendrein die Kinder. Doch wie sie auch schafften, es kam nicht genug zusammen, um die Pacht zu zahlen.
Eine Zeitlang schickten sie sich so gut es eben ging, doch zuletzt kam ein schlechtes Jahr, das bißchen Hafer verdarb, die Hühnchen verkümmerten, das Schwein magerte ab und wurde beinahe für nichts auf dem Markte verkauft, und der arme Michael sah, daß er nicht genug hatte, um die Hälfte des Pachtgeldes zu zahlen. „Was sollen wir nun anfangen, Marie?“ fragte er seine Frau. „Was wir anfangen sollen?“ antwortete sie. „Treib unsere Kuh auf den Markt und verkaufe sie dort. Montag ist Markttag, aber du mußt früh gehen, damit das arme Tier sich verschnauft, ehe es auf den Markt kommt. „Und was sollen wir anfangen, wenn auch die Kuh fort ist?“ sagte Michael bekümmert.
„Das weiß ich nicht, Michael, aber gewiß wird uns der liebe Gott nicht verlassen, du weißt doch, wie gütig er zu uns gewesen ist, als unser Kind krank war und wir gar nichts zu essen hatten. Der Doktor kam, verlangte nur einen Trank Milch und gab uns noch zwei Schilling zu Arzneien für das Kind. Und wenn ich in die Stadt ging, um ihn um Rat zu fragen, so gab er mir jedes Mal etwas zu essen.“ „Du hast recht, Marie, und darum will ich mir über den Verkauf der Kuh keine Sorgen machen. Morgen schon will ich gehen. Du mußt nur noch meinen Rock flicken, denn er ist unter den Armen zerrissen.“ Marie versicherte, daß sie es in Ordnung bringen wollte, am folgenden Tag war alles bereit, und sie schärfte ihm noch beim Fortgehen ein, die Kuh nur um den höchsten Preis zu verkaufen. Michael versprach, es nicht zu vergessen, und machte sich auf den Weg.
Er trieb die Kuh langsam durch den kleinen Fluß, der den Weg durchschneidet und unter den alten Mauern einer Burg hinrinnt. Als er dort vorbeikam, fielen seine Augen auf die alten Türme und einen von den Holunderbäumen, die wie kleine Gerten aussahen. „Ja“, rief er aus, „hätte ich nur die Hälfte des Geldes, das unter diesem Baum begraben liegen soll, dann brauchte ich die arme Kuh nicht dahinzutreiben. Ist es nicht ein Jammer, daß es unter der Erde ruht, während noch andere außer mir entbehren müssen? Nun, wenn’s Gottes Wille ist so komme ich ja mit etwas Geld in der Tasche zurück." Mit diesen Worten trieb er sein Vieh weiter.
Es war ein schöner Tag, und die Sonne schien auf die Mauern des alten Schlosses. Als drei Stunden vorbeigegangen waren, war er auf der Höhe des Berges, der jetzt der Flaschenberg heißt. Mitten auf der Höhe holte ihn jemand ein. „Guten Morgen“, sagte der Unbekannte. „Guten Morgen“, antwortete Michael freundlich und sah sich nach dem Fremden um. Es war ein kleines Männchen, man hätte ihn eher einen Zwerg nennen können, doch er war nicht ganz so klein wie ein Zwerg. Er hatte aber ein altes, verrunzeltes Antlitz, daß genau wie welker Blumenkohl aussah, dabei eine kleine, dünne Nase, rote Augen und weißes Haar; nicht nur seine Lippen waren rot, sondern sein ganzes Gesicht war von dieser Farbe.
Michaels Herz war eiskalt, als er ihn ansah. Er hatte gar kein Gefallen an der Gesellschaft des Kleinen, und konnte nicht das mindeste von seinen Beinen oder seinem Körper erblicken, denn das Männchen hatte sich, obgleich der Tag warm war, ganz in einen dicken, weiten Mantel eingewickelt. Michael trieb die Kuh rascher, aber der Kleine hielt sich immer neben ihm. Er wußte nicht, auf welche Art er schritt, denn er fürchtete sich so sehr, sich nach ihm umzuschauen; er wollte auch nicht das Kreuz über sich schlagen, um sich zu schützen, falls der Kleine einer vom Elfen oder Unholdenvolk war. Er war ganz bange, er möchte dann zornig werden. Jedenfalls deuchte ihm, der Kleine ginge nicht wie ein anderer Mensch und setzte einen Fuß vor den anderen sondern glitte nur über den rauen Weg wie ein Schatten dahin, ohne Geräusch und ohne Anstrengung.
Dem armen Michael zitterte das Herz im Leibe, er sagte ein Gebet für sich und wünschte, er wäre den Tag nicht ausgegangen, oder er wäre schon auf dem Markte, oder er brauchte die Kuh nicht zu hüten, damit er vor dem Gespenst davonlaufen könnte. Mitten in diesen Ängsten ward er von dem Gespenst angeredet. „Wohin wollt Ihr mit der Kuh, lieber Mann?“ „Nach dem Markt“, antwortete Michael zitternd bei der schnarrenden und schneidenden Stimme. „Wollt Ihr sie verkaufen?“ sagte der Fremde. „Freilich treib ich sie nur dahin, um sie zu verkaufen.“ „Wollt Ihr mir sie verkaufen?“ Michael fuhr erschrocken zurück; er fürchtete sich, mit dem Kleinen etwas zu tun zu haben, und er fürchtete sich noch mehr, nein zu sagen.
Endlich sprach er: „Was wollt Ihr mir dafür geben?“ „Ich will Euch etwas sagen“, antwortete der Kleine, „ich gebe Euch diese Flasche dafür.“ Er zog unter dem Mantel eine Flasche hervor. Michael schaute erst ihn und dann die Flasche an, dann mußte er, mitten in der Angst, in ein lautes Gelächter ausbrechen. „Lacht nur nach Herzenslust“, sprach der Kleine, „aber ich sage Euch, diese Flasche ist mehr wert als alles Geld, das Ihr für die Kuh auf dem Markt bekommt, ja tausendmal mehr. Michael lachte wieder: „Ihr denkt wohl“, sagte er, „ich wäre ein solcher Narr, daß ich meine Kuh für eine solche Flasche hingebe, die obendrein noch leer ist, wie ich sehe! Wahrhaftig, daraus wird nichts.“
„Ihr tut es besser, wenn Ihr mir die Kuh gebt und die Flasche nehmt; Ihr braucht es Euch nicht leid sein lassen.“ „Aber Marie, was würde die sagen? Das mag kein gutes Ende nehmen. Und wie soll ich meine Pacht bezahlen, was wollen wir ohne Geld anfangen?“ „Ich versichere Euch, die Flasche ist mehr wert als Geld. Nehmt sie und gebt mir die Kuh. Ich sage es zum letzten Mal, Michael. Michael war erschrocken: Wie hat er meinen Namen erfahren, dachte er! Der Fremde fuhr fort: „Michael, ich kenne Euch und habe Achtung vor Euch, darum folgt meinem Rat, oder Ihr werdet es büßen. Wißt, Eure Kuh wird hinfallen, bevor Ihr auf dem Markt seid. Dann ist sie wertlos.“ Michael wollte eben sagen: „Das verhüte Gott“, aber der Kleine fuhr rasch fort:
„Wohlan, so lebt wohl und bettelt hinfort für Euern Lebensunterhalt, seht Eure Kinder in Armut und Euer Weib in Mangel sterben.“ Bei diesen Worten lächelte der Kleine so boshaft was sein Antlitz noch grauenhafter machte. „Mag wohl sein“, sagte Michael noch immer zaudernd und unschlüssig. Aber er konnte nicht anders, er mußte dem Kleinen glauben, und in einem Anfall von Verzweiflung griff er nach der Flasche und sagte: „So nehmt die Kuh, und wenn Ihr mich belogen habt, so wird Euch der Fluch des Armen treffen.“ „Ich achte weder auf Euren Fluch noch auf Euren Segen, Michael, aber ich habe die Wahrheit gesprochen, das werdet Ihr noch heute Abend erfahren, wenn Ihr tut, was ich sage.
„Was soll ich tun?“ fragte Michael. „Wenn Ihr heimkommt, so kümmert Euch nicht darum, daß Euer Weib ärgerlich ist, sondern bleibt selbst gelassen und heißt sie den Flur sauber kehren, setzt den Tisch zurecht und deckt ein reines Tuch darüber, dann stellt die Flasche auf den Boden und sprecht die Worte: „Flasche, tue deine Schuldigkeit“, und ihr werdet den Erfolg sehen.“ „Und das ist alles?“ fragte Michael. „Nichts weiter, Michael, aber Ihr seid dann ein reicher Mann.“ „Das gebe Gott“, sagte Michael, als der alte Mann die Kuh forttrieb und er wieder auf dem Heimweg war.
Doch konnte er nicht umhin, den Kopf umzudrehen und dem Kleinen nachzuschauen, bis er ganz verschwunden war. „Gott behüte und bewahre mich“, rief Michael, „der gehört nicht dieser Welt an. Der ist vom Volk der Unholde. Aber wo ist meine Kuh?“ Sie war fort, und er hielt die leere Flasche in der Hand.
Während er voll Furcht und Sorge heimging, erreichte er am Abend seine Hütte und überraschte seine Frau, die am Herde stand und Feuer schürte. „Ei, Michael, du bist schon wieder da? Gewiß bist du gar nicht bis zum Markt gekommen? Sprich, was ist dir begegnet? Wo ist die Kuh, hast du sie verkauft? Wie viel hast du gelöst? Erzähle mir.“ „Wenn du mir Zeit läßt, so will ich dir alles genau erzählen. Wo unsere Kuh ist willst du wissen? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, denn ich weiß es selber nicht.“ „Ja, aber wie viel Geld bekamst du? Heraus mit dem Geld!“ „Geduld, Geduld, du wirst alles hören.“ Jetzt erst sah Marie die Flasche unter seiner Weste. „Und was ist das für eine Flasche?“ Michael stellte die Flasche auf den Tisch. „Das ist alles, was ich gelöst habe für die Kuh.“
Die arme Frau war wie vom Schlag getroffen. „Das ist alles?“ rief sie. „Oh, ich habe nicht gedacht, daß du solch ein Narr bist! Wovon soll ich jetzt die Pacht bezahlen?“ „Nimm doch nur Vernunft an“, bat Michael „und höre zu.“ Und nun erzählte er, wie er dem Alten begegnet sei, oben auf dem Berg, und wie dieser die Flasche für die Kuh geboten. Marie ergriff die Flasche und hätte sie am liebsten ihrem Mann an den Kopf geworfen. Aber Michael ergriff sie schnell und verbarg sie wieder unter seiner Weste. Die arme Marie, sie weinte und bekreuzigte sich, aber dann konnte sie nicht anders, sie tat, wie der Kleine befohlen hatte, sie ging hinaus und kehrte den Flur, hierauf ordnete sie alles und stellte den Tisch in die Mitte und deckte ein reines Tuch, das einzige, das sie hatten, darüber.
Und Michael stellte die Flasche auf die Erde und sprach: „Flasche, tue deine Schuldigkeit.“ „Mutter, sieh dort, dort!“ schrie der Älteste und hielt sich am Rock der Mutter fest, während er mit der Hand auf zwei winzige, kleine Gestalten zeigte, die Lichtstrahlen gleich aus der Flasche stiegen. Und in einem Augenblick war der Tisch mit silbernen und goldenen Schüsseln und Tellern besetzt, auf welchen die köstlichsten Speisen lagen. Nachdem alles in Ordnung war, stiegen die kleinen Gestalten wieder in die Flasche hinab. Solche Schüsseln und Teller hatten alle ihr Leben lang noch nicht gesehen, und sie betrachteten sie voll Erstaunen. Sie vergaßen fast ihren Hunger über lauter Anschauen. Endlich sagte Marie: „Komm, Michael, und setz dich nieder, versuch’s und iß ein wenig, du mußt doch hungrig sein.
Der Kleine hat also doch keine Unwahrheit gesagt.“ Michael setzte sich und gab auch den Kindern ihren Platz. Sie hielten alle zusammen eine herrliche Mahlzeit, und die Hälfte der Speisen blieb unangerührt. „Mich soll es wundern, obwohl die Kleinen die Reste wieder wegtragen“, sagte Michael. Sie warteten, aber niemand kam. Da hob Marie sorgfältig Schüssel und Teller auf und sprach: „Es ist also wahr, Michael, jetzt sind wir reiche Leute.“ Sie gingen alle zu Bett und überlegten vorm Einschlafen, wie sie alle Reste zu Geld machen könnten, um zu mehr Ländern zu kommen und ihre Pacht zu bezahlen. Am nächsten Morgen ging Michael auf den Markt und verkaufte die Gold- und Silberschüsseln, erhandelte sich Wagen und Pferde und überlegte, was er noch erwerben könnte. Sie gaben sich auch alle Mühe, die Flasche geheimzuhalten; doch vergeblich, der Gutsherr brachte es heraus.
Eines Tages kam er zu Michael und fragte ihn, wie er zu all dem Geld gekommen wäre, und quälte ihn so lange, bis Michael, um nicht den Anschein zu erwecken, er habe es auf unrechtmäßige Weise erworben, ihm von der Flasche erzählte. Der Gutsherr bot ihm viel Geld, doch davon wollte Michael nichts wissen, bis ihm zuletzt alles, was jetzt nur Pacht war, als Eigentum gehörte. Da dachte Michael, nun sei er reich genug und bedürfe der Flasche nicht mehr, und gab sie hin. Aber Michael hatte sich verrechnet. Er und die Seinen gaben das Geld so schnell dahin, sie glaubten, es nehme kein Ende. Nun, um die Geschichte kurz zu machen, sie wurden arm und ärmer, bis sie am Ende nichts mehr übrighatten als eine Kuh, die Michael ebenfalls verkaufen mußte, nicht ohne die Hoffnung, dem kleinen Mann wieder zu begegnen, um eine andere Flasche von ihm zu erhalten.
Es war früher Morgen, als er sich von daheim aufmachte, und er ging einen guten Schritt, bis er zu der Höhe kam. Er mußte beständig an das kleine Männlein denken, und richtig, gerade als er den Gipfel des Berges erreichte, wurde er von der wohlbekannten Stimme überrascht: „Nicht wahr, Michael, ich sagte es, du würdest ein reicher Mann werden?“ „Gewiß, Herr, aber zur Zeit bin ich kein reicher Mann. Habt Ihr nicht eine andere Flasche? Ich bedarf ihrer, so gut wie vordem und gebe Euch gern die Kuh dafür.“ „Hier ist die Flasche“, sagte der Kleine und lächelte, „du weißt, was damit zu tun ist.“ „Ach ja“, antwortete Michael, „ich will’s schon recht machen. Gutes Glück Euch und gutes Glück diesem Berge, der hinfort Flaschenberg heißen soll, damit er endlich einen Namen bekommt.“ Dann eilte er, so schnell er konnte zurück, ohne sich nach der Kuh oder dem Kleinen umzuschauen.
Wohlbehalten langte er ohne seiner Kuh daheim an und sobald er Marie erblickte, rief er aus: „Ich habe eine neue Flasche.“ „Oh, tausend“, rief die Frau aus, „du bist ein Glückskind.“ Sie brachte sofort alles in Ordnung und Michael schrie sofort in seiner Freude: „Flasche, tue deine Schuldigkeit.“ Im selben Augenblick sprangen zwei große, gewaltige Männer mit dicken Knüppeln aus der Flasche, die die ganze Familie durchbläuten, bis alles auf dem Boden lag. Sobald Michael zur Besinnung gekommen war, sah er sich um. Er sann und sann, dann sprach er: „Macht, daß ihr euch erholt, so gut es geht. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Und seine Flasche unter dem Arm, begab er sich zum Gutsherrn.
Dort war große Gesellschaft, und Michael bat einen Bedienten, dem Herrn zu sagen, daß er ein paar Worte mit ihm zu sprechen wünsche. Endlich kam der Herr heraus und fragte: „Was wünscht Ihr, und was bringt Ihr Neues?“ „Nichts, Herr, als daß ich eine neue andere Flasche habe.“ „Ei, ei, ist sie auch so gut wie die erste?“ „Besser, und wenn es Euch beliebt, will ich sie vor allen Damen und Herren vorführen.“ Nun ward Michael in den Saal geführt, wo er seine alte Flasche erblickte, die oben auf dem Gesims stand. Nun, dachte er, vielleicht habe ich dich in Kürze wieder.
Dann setzte er sich auf den Boden und sprach die Zauberworte. Im nächsten Augenblick lagen der Gutsherr, Damen, Herren, Bedienten, und wer sonst zugegen war, auf dem Boden, rannten, schrien, wälzten sich, stießen mit den Füßen, bis der Gutsherr endlich ausrief: „Bring die zwei Teufel zur Ruh’, oder ich lasse dich aufhängen. „Nicht ehr bringe ich sie zur Ruhe“, rief Michael, „als Ihr mir meine Flasche wiedergebt, die ich dort oben stehen sehe.“ „Hol sie dir, ehe wir alle ermordet sind.“
Nun steckte Michael die Flasche zu sich, die Männer sprangen wieder hinein, und er trug beide Flaschen heim. Was soll ich nun noch weiter erzählen? Michael ward reicher als zuvor, sein Sohn heiratete die Tochter des Gutherrn, und er und sein Weib starben in hohem Alter, beide am gleichen Tag. An diesem Tag gerieten zwei Diener in Streit und zerbrachen die Flasche. Und heute gibt es solche Flaschen nicht mehr. Das ist für uns sehr traurig. Aber der Berg in Irland heißt noch immer der Flaschenberg und wird so heißen bis ans Ende der Welt.
Märchen aus Irland
Der Page und der Silberkelch
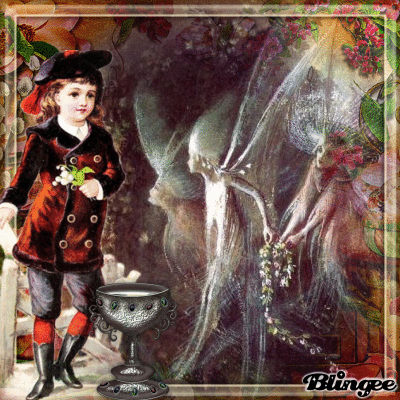
Es war einmal ein kleiner Page, der diente auf einem stattliche Schloss Er war ein gutmütiger kleiner Bursche und erfüllte seine Pflichten so willig und brav, dass ihn jedermann gern hatte, von
dem hohen Grafen an, dem er täglich auf gebeugten Knie aufwartete, bis hin zu dem dicken, alten Kellermeister, dessen Aufträge er ausführte.
Das Schloss stand auf einer Klippe hoch über dem Meer, und obwohl die Mauern auf dieser Seite sehr stark waren, befand sich in ihnen eine kleine Hintertür. Sie ging auf eine schmale Treppenflucht
hinaus, die an der Vorderseite der Klippe zum Seeufer hinabführte, so dass jeder, der es mochte, an schönen Sommermorgen dort hinuntergehen und im schimmernden Meere baden konnte.
Auf der anderen Seite des Schlosses waren Gärten und Spielgründe, die an einem langen Streifen heidebedeckten Ödlandes grenzten. Der kleine Page liebte es sehr, auf die Heide hinauszugehen, wenn
seine Arbeit getan war; denn dann konnte er so viel herumtollen, wie er wollte, Hummeln jagen und Schmetterlinge fangen und nach Vogelnestern ausgucken, wenn es Brutzeit war.
Der alte Kellermeister war sehr damit einverstanden; denn er wusste, wie gesund es für einen munteren kleinen Burschen ist, sich viel im Freien herumzutreiben. Aber bevor der Junge hinausging,
pflegte ihm der alte Mann immer die Mahnung mitzugeben: "Pass auf, mein Kerlchen, und halte dich fern von dem Elfenhügel; denn dem kleinen Volk ist nicht zu trauen."
Dieser Elfenhügel, von dem er sprach, war eine kleine grüne Anhöhe, die nicht zwanzig Ellen vom Gartentor entfernt auf der Heide lag. Die Leute sagten, sie sei die Wohnstätte von Feen, die jeden
voreiligen Sterblichen, der sich ihnen nähere, schwer bestraften.
Nun war der kleine Page ein abenteuerliche Wicht, und anstatt vor den Feen Angst zu haben, war er neugierig und wollte ausspüren, wie es bei ihnen aussah. So schlich er sich eines Nachts, als
alle im Schloss im Schlafe lagen, durch die kleine Hintertür und stahl sich die Steintreppen hinunter und am Meeresufer entlang, bis herauf zum öden Heideland , und dann ging er stracks auf den
Feenhügel los. Zu seiner Freude fand er die Spitze des Feenhügels aufgekippt. Aus der klaffenden Öffnung strömten Lichtstrahlen hervor.
Sein Herz schlug heftig vor Erregung, aber er nahm allen Mut zusammen, beugte sich nieder und schlüpfte ins Innere des Hügels. Dort fand er einen weiten Raum, den von zahllosen winzigen Kerzen
erleuchtet war, und um einen blanken Tisch saßen Scharen des kleinen Volkes, Feen und Elfen und Gnomen, in Grün und Gelb und Rot, in Blau und Lila und Scharlach gekleidet, kurz in allen Farben,
die man sich nur denken kann. "Holt den Kelch!" rief plötzlich eine unsichtbare Stimme, und sogleich eilten zwei kleine Feenpagen, ganz in scharlachroter Livree, vom Tisch zu einem kleinen
Schrank im Felsen und kehrten taumelnd unter der Last eines wertvollen Silberkelches zurück. Sie setzten ihn mitten auf den Tisch, und unter Händeklatschen und Freudengeschrei begannen alle Feen
daraus zu trinken. Der Page konnte von seinem Verstecke aus sehen, dass niemand Wein hineingoss und der Kelch doch immer voll war. Sogar der Wein, der darin funkelte, blieb nicht derselbe,
sondern jeder Elf, wenn er nach dem Fuße griff, wünschte sich den Wein, den er am liebsten mochte, und schau, im Augenblick war der Kelch voll davon.
Es wäre eine feine Sache, hätte ich den Kelch bei mir zu Haus, dachte der Page. Niemand wird glauben, ich sei hier gewesen, wenn ich nichts mitgebracht habe. So nahm er sich Zeit und passte
auf.
Plötzlich sahen ihn die Feen. Anstatt ärgerlich über seine Kühnheit und sein Eindringen zu sein, schienen sie sehr erfreut, ihn zu sehen und luden ihn ein, am Tisch Platz zu nehmen. Aber
allmählich wurden sie gar grob und unverschämt und spotteten über ihn, dass er damit zufrieden sei, bloßen Sterblichen zu dienen. Sie erzählten ihm, sie sähen alles, was auf dem Schlosse
vorginge, und dabei machten sie sich lustig über den alten Kellermeister, den der Page von ganzem Herzen liebte. Außerdem lachten sie über sein Essen und sagten, es wäre gerade für Tiere gut
genug. Und wenn irgendeine neue Leckerei von den scharlachroten Pagen aufgetragen wurde, schoben sie die Schüssel zu ihm hinüber und meinten: "Koste einmal; denn solche Sachen bekommst du im
Schloss doch nicht zu schmecken!"
Zuletzt konnte er ihren spöttische Bemerkungen nicht länger widerstehen; außerdem wusste er, wenn er sich den Kelch sichern wollte, so durfte er keine Zeit verlieren. So sprang er plötzlich auf
und fasste ihn fest mit der Hand: "Ich trinke euch mit Wasser zu!" rief er, und sofort verwandelte sich der rubinrote Wein in klares kaltes Wasser. Er hob den Kelch an die Lippen, aber er trank
nicht davon. Mit einem plötzlichen Schwung schüttete er das Wasser über die Kerzen, und im Nu war der Raum in Dunkelheit gehüllt.
Er drückte den kostbaren Becher fest in die Arme, eilte aus der Öffnung des Hügel. Es war die höchste Zeit; denn mit einem Krach schlug sie hinter ihm zu. Und nun hastete er über die nasse,
taubedeckte Heide, die ganze Schar der Feen auf den Fersen. Sie waren außer sich vor Ärger, und nach dem schrillen Wutgeheul, das sie ausstießen, konnte sich der Page wohl denken, dass er keine
Gnade von ihnen zu erwarten hatte, wenn sie ihn griffen.
Und ihm sank der Mut; denn war er auch flink zu Fuß, so war ihm das Elfenvolk doch weit überlegen und gewann ständig an Raum. Alles schien verloren, als plötzlich eine geheimnisvolle Stimme aus
der Dunkelheit ertönte:
"Willst du an der Schlosstür stehen,
Musst über die schwarzen Steine am Ufer gehen!"
Sofort wandte er sich um und stürmte keuchend ans Ufer hinunter. Seine Füße sanken tief ein in den trockenen Sand, sein Atem ging stoßweise, und er merkte wohl, er werde den Kampf aufgeben müssen. Aber er riss alle Kräfte zusammen, und gerade, als die vorderste der Feen Hand an ihn legen wollte, sprang er über die Wassermarke auf den festen feuchten Sand, von dem sich die Wogen eben zurückgezogen hatten, und da wusste er, dass er gesichert war.
Das kleine Volk konnte keinen Schritt weiter vordringen, sondern stand auf dem trockenen Sand und kreischte vor Wut und Enttäuschung, während der Page am Ufer entlang rannte, den köstlichen Kelch
in den Armen, behände die Treppen im Felsen aufstieg und durch die Hintertür verschwand. Und noch viele Jahre lang, lange nachdem der Page groß und ein tüchtiger Graf geworden war, blieb der
wunderbare Kelch in dem Schlosse als Zeugnis seines Abenteuers.
Aus Schottland
Hans und die Bohnenranke

Es war einmal eine arme Witwe, die hatte einen Sohn, der Hans hieß, und eine Kuh, die sie Milchweiß nannten. Und sie hatten nichts als die Milch der Kuh, um ihr Leben zu fristen. Jeden Morgen
trugen sie die Milch zum Markt und verkauften sie. Aber eines Tages gab Milchweiß keine Milch mehr, und nun wussten sie nicht, was sie tun sollten.
"Was sollen wir nur anfangen, was sollen wir nur anfangen?" klagte die Witwe.
"Sei guten Mutes, Mutter, ich werde fortziehen und Arbeit suchen". sagte Hans.
"Das hast du ja schon einmal versucht", sagte die Mutter, "aber niemand hat dich nehmen wollen. Wir müssen Milchweiß verkaufen und mit dem Geld ein Geschäft anfangen oder sonst etwas."
"Gut, Mutter", sagte Hans, "heute ist Markttag, da werde ich Milchweiß gut verkaufen können. Dann wollen wir sehen, was sich machen lässt." Und Hans band die Kuh an einen Strick und ging fort mit
ihr.
Auf dem Weg zum Markt begegnete ihm ein seltsam anmutendes altes Männlein, das sagte zu ihm: "Guten Morgen, Hans!"
"Auch einen schönen guten Morgen", sagte Hans und wunderte sich, wieso das Männlein seinen Namen kannte.
"Nun, Hans, wohin des Wegs?" fragte das Männlein.
"Auf den Markt, die Kuh verkaufen."
"Du schaust mir gar nicht danach aus, als ob du Kühe verkaufen könntest", sagte das Männlein. "Ich glaube, du weißt nicht einmal, wie viele Bohnen fünf ergeben."
"Zwei in deiner Hand und eine in deinem Mund", sagte Hans hurtig.
"Richtig", sagte das Männlein, "und da hast du auch schon die Bohnen." Und darauf zog es aus seiner Tasche eine Handvoll seltsam aussehender Bohnen.
"Weil du so schlau bist", sagte es, "so hab ich nichts dagegen, mit dir einen Handel zu machen. Gib mir die Kuh, ich gebe dir die Bohnen."
"Das möchte dir so passen", sagte Hans.
"Ah, du weißt nicht, was für Bohnen das sind.", sagte der Mann, "Wenn du sie am Abend einpflanzt, so sind sie am Morgen bis zum Himmel hinauf gewachsen."
"Ist das wahr, was du da sagst?" fragt Hans.
"Ja, es ist wahr, und wenn es nicht so ist, so kannst du deine Kuh zurück haben."
"Gut", sagt Hans und gibt ihm den Strick mit der Kuh und steckt die Bohnen in die Tasche.
Hans geht nun heimwärts, und weil er noch nicht weit gewesen ist, kommt er gerade nach Haus, bevor es dunkel wird.
"Bist du schon zurück?" sagt die Mutter "Ich sehe nicht mehr. Wie viel hast du für sie bekommen?"
"Das wirst du nie erraten, Mutter!" sagt Hans. "Nun, nun, so arg wird es nicht sein, mein guter Bub. Fünfzehn? Nein, zwanzig, das ist doch nicht möglich!"
"Ich habe es dir ja gesagt, du wirst es nie erraten. Was sagst du zu diesen Bohnen? Das sind Zauberbohnen! Pflanz sie ein über Nacht und..."
"Was?" ruft da die Mutter, "Bist du so ein Tollpatsch, so ein Dummian, so ein Narr und hast unsre Milchweiß für so ein paar lumpige Bohnen eingetauscht? Da, schau her, zum Fenster schmeiß ich sie
hinaus, deine teuren Bohnen! Und mit dir, marsch ins Bett Keinen Löffel Suppe und keinen Bissen Brot sollst du heute mehr bekommen."
Traurig stieg Hans in sein Dachkämmerlein. Es tat ihm leid, dass seine Mutter so böse war und er nun hungrig zu Bett gehen musste. Endlich schlief er ein.
Als Hans am nächsten Morgen erwachte, da schaute es in seiner Kammer ganz sonderbar aus. Die Sonne schien hell in eine Ecke, alles andre aber war dunkel und schattig. Hans hüpfte aus dem Bett und
lief zum Fenster. Und was glaubt ihr, was er da sah? Ja, die Bohnen, die seine Mutter zum Fenster hinausgeworfen hatte, waren aufgegangen und zu einer großen Ranke emporgeschossen, die immer
höher und höher gewachsen war, bis zum Himmel hinauf. Das Männlein hatte also die Wahrheit gesprochen.
Der Bohnenstrauch rankte sich ganz nahe am Fenster von Hans vorbei. Er brauchte bloß das Fenster zu öffnen und einen kleinen Schritt auf die Bohnenranke zu machen, die wie eine große Leiter zum
Himmel ragte. Hans kletterte also, er kletterte, kletterte, kletterte und kletterte, bis er endlich am Himmel anlangte. Und als er hineinging, da war eine lange und breite Straße, die führte
kerzengerade fort. Hans wanderte die Straße, und er wanderte, wanderte und wanderte, bis er zu einem großen, großen Haus kam, an dessen Türschwelle eine große, große Frau stand.
"Guten Morgen, gute Frau", sagt Hans, so höflich er kann. "Würdet Ihr so gütig sein und mir etwas zum Frühstück geben?" Denn er hatte noch nichts gegessen und, wie ihr wisst, auch kein Abendbrot
bekommen, und er war hungrig wie ein Wolf.
"Ein Frühstück willst du?" sagt die große, große Frau. "Das Frühstück, das wirst du selber gleich sein, wenn du dich nicht schleunigst auf und davon machst. Mein Mann ist ein Riese, und er hat
nichts lieber als geröstetes Bubenfleisch auf Brot. Gleich wird er hier sein."
"O bitte, gute Frau, gebt mir etwas zu essen. Ich habe seit gestern früh nichts gehabt, und es ist mir schon einerlei, ob ich geröstet werde oder ob ich Hungers sterben soll."
Nun, die Frau des Riesen war nicht halb so schlecht, wie es schien. Sie führte Hans in die Küche und gab ihm eine große Scheibe Brot und Käse und einen Krug Milch. Hans hatte aber noch nicht
aufgegessen, als schon - tap! tap! tap! - das ganze Haus zu dröhnen begann von dem Lärm, den der Riese bei seinem Kommen machte.
"Um Himmels willen, mein Mann kommt!" rief die Frau des Riesen. "Was soll ich nur machen? Schnell, komm und spring da hinein!" Und wie ein Bündel schob sie Hans in den Ofen, gerade bevor der
Riese hereinkam.
Es war ein großer Riese, das könnt ihr mir glauben. An seinem Gürtel hatte er drei Kälber an den Beinen festgebunden. Er band sie los, warf sie auf den Tisch und sagte: "Da, Weib, röst mir die
paar zum Frühstück! Ah! Was riecht da so fein? Ich rieche Menschenfleisch!"
"Unsinn, mein Lieber!" sagte die Frau, "Du träumst wohl. Oder mag sein, du riechst die Überreste von dem kleinen Jungen, der dir gestern zum Frühstück so geschmeckt hat. Da, geh und wasch dich
und mach dich sauber! Und wenn du zurückkommst, wird das Frühstück fertig sein.
Da ging der Riese hinaus, und Hans wollte gleich aus dem Ofen springen und fortlaufen, aber die Frau sagte zu ihm: "Warte, bis er eingeschlafen ist! Er macht immer ein Nickerchen nach den
Frühstück."
Nun, der Riese verzehrte sein Frühstück, und hernach geht er zu einer großen Kiste, nimmt ein paar Beutel Gold heraus, setzt sich nieder und zählt und zählt, bis endlich sein Kopf zu nicken
beginnt. Und dann fängt er an zu schnarchen, dass das ganze Haus wackelt.
Da kroch Hans auf den Zehenspitzen aus dem Ofen heraus, und als er beim Riesen vorbeiging, nahm er einen Beutel Gold unter seinen Arm und rannte, so schnell ihn nur seine Füße trugen, bis er zur
Bohnenranke kam. Er warf den Beutel Gold hinunter, der, versteht sich, in Mutters Garten fiel, und dann kletterte er abwärts, immer abwärts, bis er wieder bei seinem Fenster anlangte. Er erzählte
alles seiner Mutter, zeigte ihr das Gold im Beutel und sagte: "Nun, Mutter, hab ich nicht recht gehabt mit den Bohnen? Es sind wirklich Zauberbohnen."
Nun lebten sie eine schöne Zeitlang von dem Gold im Beutel. Aber einmal nahm das auch ein Ende, und Hans beschloss, noch einmal sein Glück mit der Bohnenranke zu versuchen. Eines schönen Morgens
stand er zeitig auf und kletterte die Bohnenranke hinauf. Und er kletterte, kletterte, kletterte und kletterte, bis er wieder zu der Straße kam und zu dem großen, großen Haus. in dem er gewesen
war. Und richtig, da stand auch wieder die große, große Frau auf der Türschwelle.
"Guten Morgen, gute Frau", sagte Hans, so kühn er nur konnte, "würdet Ihr so gütig sein und mir etwas zum Essen geben?"
"Geschwind, lauf fort!" sagte die große, große Frau, "Oder mein Mann wird kommen und dich zum Frühstück aufessen. Aber bist du nicht der Bengel, der schon einmal da war? Weißt du auch, dass am
selben Tag meinem Mann ein Goldbeutel gefehlt hat?"
"Sonderbar, wirklich sonderbar", sagte Hans. "ich glaube, ich könnte Euch darüber etwas erzählen, aber ich bin so hungrig, dass ich nicht reden kann, bevor ich nicht gegessen habe."
Nun, die große, große Frau war so neugierig, dass sie den Buben ins Haus hineinließ und ihm etwas zu essen gab. Kaum aber hatte er mit dem Essen begonnen, als sie - tap! tap! tap! - die Schritte
des Riesen hörten. Und die Frau versteckte Hans wieder in dem Ofen.
Nun war alles wieder so wie das erste Mal. Der Riese kam herein, sagte: "Ich rieche Menschenfleisch!" und bekam drei geröstete Ochsen zum Frühstück. Dann sagte er: "Frau, bring mir die Henne, die
die goldenen Eier legt." Da brachte die Frau die Henne, und der Riese sagte: "Leg!" und die Henne legte ein Ei, das war ganz aus Gold. Und dann begann der Riese einzunicken und zu schnarchen,
dass das ganze Haus wackelte.
Da kroch Hans auf den Zehenspitzen aus dem Ofen, packte die Henne und rannte, so schnell ihn seine Beine trugen. Aber auf einmal gackerte die Henne, und der Riese wachte auf, und gerade als Hans
zum Haus hinauslief, hörte er ihn rufen: "Weib, Weib, was hast du mit meiner Henne gemacht?"
Und die Frau sagte: "Warum, mein Lieber?"
Das war alles, was Hans noch hörte, denn er eilte fort zur Bohnenranke und kletterte so schnell hinunter, als ob zehn Teufel hinter ihm her wären. Als er heimkam, zeigte er seiner Mutter die
Wunderhenne und sagte: "Leg!" Und die Henne legte ein goldenes Ei, sooft er es sagte.
Aber Hans war noch immer nicht zufrieden, und nicht lange, so beschloss er, wieder sein Glück mit der Bohnenranke zu versuchen Eines schönen Morgens stand er zeitig auf, ging zur Bohnenranke, und
er kletterte, kletterte, kletterte und kletterte, bis er ganz oben war und wieder zu der Straße kam. Diesmal aber war er klüger und ging nicht geradewegs in das Haus des Riesen. Er versteckte
sich in der Nähe hinter einem Busch und wartete, bis die Frau des Riesen herauskam und mit einem Kübel zum Brunnen ging. Da schlüpfte Hans ins Haus und kroch in einen großen Kupferkessel. Bald
darauf hörte er, genauso wie früher - tap! tap! tap! -, und der Riese und seine Frau kamen herein.
"Ich rieche Menschenfleisch", rief der Riese. Und seine Frau sagte: "Dann ist es gewiss der kleine Bengel, der das Gold und die Henne gestohlen hat Bestimmt hat er sich im Ofen versteckt." Und
beide stürzten zum Ofen, aber zum Glück war Hans nicht dort. Und die Frau des Riesen sagte: "Du mit deinem 'Ich rieche Menschenfleisch!'. Gewiss riechst du noch etwas von dem Jungen, den ich dir
gestern zum Frühstück geröstet habe. Nach so vielen Jahren könntest du doch endlich einmal den Unterschied zwischen lebendigen und gerösteten Buben kennen!"
So setzte sich der Riese wieder zum Frühstück hin, aber alle Augenblicke murmelte er: "Ich hätte geschworen..." Und er stand auf und suchte in der Speisekammer, in den Schränken, überall. Zum
Glück aber dachte er nicht an den Kupferkessel.
Als er mit dem Frühstück fertig war, rief er: "Weib, bring mir die goldene Harfe!" Da brachte ihm die Frau die Harfe, und er stellte sie vor sich hin auf den Tisch. Dann sagte er: "Sing!" Und die
goldene Harfe fing an, wunderbar zu singen. Und sie sang und sang, bis der Riese fest eingeschlafen war und zu schnarchen anhub, dass das ganze Haus zitterte.
Da hob Hans den Deckel des Kupferkessels auf, ganz vorsichtig, schlüpfte hinaus wie eine Maus und kroch auf Händen und Füßen zum Tisch hin, packte die goldene Harfe und eilte zur Tür.
Aber da rief die Harfe ganz laut: "Meister! Meister!" Und der Riese erwachte gerade noch rechtzeitig, um Hans mit der Harfe aus dem Haus laufen zu sehen.
Hans lief, so schnell er konnte, der Riese ihm nach, und der hätte ihn auch bald eingeholt, aber Hans lief kreuz und quer, um den Riesen zu täuschen. Als er zu der Bohnenranke kam, war der Riese
nur noch zehn Schritte hinter ihm. Plötzlich aber verschwand Hans, und als der Riese ans Ende der Straße kam, sah er ihn die Bohnenranke hinunterklettern.
Nun, der Riese wollte sich einer solchen Leiter nicht anvertrauen, so stand er und wartete. Dadurch bekam Hans einen größeren Vorsprung. Aber in diesem Augenblick rief die Harfe wieder: "Meister!
Meister!"
Da schwang sich der Riese auf die Bohnenranke, die unter seinem Gewicht gewaltig schaukelte. Immer tiefer kletterte Hans, er kletterte, kletterte und kletterte, und hinter ihm der Riese. Schon
war Hans ganz nahe seinem Haus, da rief er: "Mutter, Mutter! Bring mir eine Axt! Bring mir eine Axt!"
Und seine Mutter stürzte heraus mit einer Axt in der Hand. Aber als sie zu der Bohnenranke kam, blieb sie stocksteif stehen vor Schreck, denn sie sah gerade den Riesen mit seinen Beinen durch die
Wolkendecke kommen.
Hans aber war mit einem Satz unten, ergriff die Axt, und mit einem Hieb spaltete er die Bohnenranke bis zur Hälfte. Der Riese spürte, wie die Bohnenranke schwankte und bebte, und er hielt inne,
um nachzusehen, was los wäre. Da schlug Hans zum zweiten Mal zu und hieb die Bohnenranke entzwei. Sie wankte und knickte zusammen, der Riese aber stürzte kopfüber hinunter und brach sich das
Genick, und die Bohnenranke stürzte über ihn und begrub ihn.
Dann zeigte Hans seiner Mutter die goldene Harfe. Und von dem Gesang der Harfe und von den goldenen Eiern, die sie verkauften, wurden Hans und seine Mutter sehr reich. Hans heiratete eine schöne
Prinzessin, und sie lebten glücklich bis an ihr Ende.
Quelle: (Märchen aus England)
Der Katzenkönig I + II

Der Katzenkönig I
Vor vielen, vielen Jahren verbrachten zwei junge Leute den Herbst im hohen Norden. Sie lebten in einem kleinen, einsamen Häuschen. Eine alte Frau, welche für sie kochte, deren Katze und zwei Jagdhunde machten den ganzen Haushalt aus.
Eines Tages wollte der ältere der beiden jungen Leute nicht ausgehen, der jüngere gieng also allein auf die Hühnerjagd, beabsichtigte aber, noch vor Sonnenuntergang nach Hause zu kommen. Allein
er kam nicht, und der ältere war sehr besorgt, als er umsonst lange über die Abendessenzeit hinaus wartete.
Endlich kehrte der jüngere zurück, sagte aber nicht, warum er so lange ausgeblieben sei. Erst als sie nach dem Abendessen mit ihren Pfeifen am Feuer saßen, die Hunde zu ihren Füßen, die Katze am
Herd, da begann der junge Mann wie folgt:
»Du wirst dich über mein langes Ausbleiben gewundert haben. Aber ich hatte ein seltsames Abenteuer. Wie ich beabsichtigte, schlug ich unseren gestrigen Weg ein. Gerade als ich heimkehren wollte,
fiel ein dichter Nebel, und ich verlor vollständig den Weg. Lange Zeit wanderte ich herum, ohne zu wissen, wo ich mich befand, bis ich endlich ein Licht sah, auf das ich in der Hoffnung auf Hilfe
losschritt. Wie ich näher kam, verschwand es, und ich fand mich in der Nähe eines großen, alten Eichenbaums. Ich kletterte hinauf, um besser nach dem Lichte ausblicken zu können, und da sah ich
es auch, aber unter mir, in dem hohlen Stamme des Baumes. Mir schien, als blickte ich in eine Kirche hinunter, wo gerade ein Begräbnis stattfand.
Ich hörte singen und sah einen Sarg von Fackeln umgeben, und diese wurden von - aber ich weiß, dass du mir's nicht glauben wirst, wenn ich dir's erzähle!«
Sein Freund bat ihn inständig, fortzufahren, und legte seine Pfeife hin, um besser zuhören zu können. Die Hunde schliefen ruhig, aber die Katze saß da und hörte offenbar ebenso aufmerksam zu wie
der junge Mann. Unwillkürlich blickten die beiden jungen Leute zu ihr hinüber.
»Jawohl,« fuhr der Erzähler fort, »es ist wirklich wahr. Der Sarg und die Fackeln wurden von Katzen getragen, und auf dem ersteren war eine Krone und ein Scepter gemalt!«
Weiter kam er nicht. Die Katze fuhr empor und kreischte: »Bei Jupiter! Der alte Peter ist todt, und ich bin Katzenkönig!« stürzte den Kamin hinauf und ward nicht mehr gesehen.
[Anna Kellner: Englische Märchen]
Der Katzenkönig II
An einem Winterabend saß die Frau des Totengräbers am Kamin. Ihr großer, schwarzer Kater, der alte Tom, lag neben ihr und erwartete wie sie schläfrig blinzelnd die Rückkehr des Herrn. Sie warteten und warteten, aber er blieb lange aus. Schließlich kam er hereingestürzt und rief ganz aufgeregt: "Wer ist denn eigentlich Tom Tildrum?" Beide, seine Frau und der Kater, starrten ihn an. „Was regst du dich denn so auf?", sagte endlich die Frau. "Und warum willst du wissen, wer Tom Tildrum ist?" „Oh, ich habe ein tolles Abenteuer erlebt! Ich war dabei, Herrn Foryces Grab zu schaufeln und muss wohl dabei eingeschlafen sein. Jedenfalls wachte ich erst durch das Jaulen einer Katze auf.
"Miau", gab der alte Tom zur Antwort. „Ja, gerade so war's! Ich guckte über das Grab hinweg, und was glaubt ihr, was ich sah?" „Wie kann ich das wissen?" sagte die Frau. „Denke dir nur, neun schwarze Katzen, wie Tom sahen sie aus, alle mit einem weißen Fleck auf ihrem Brustpelz. Und was glaubt ihr, was sie trugen? Einen kleinen Sarg, mit einem schwarzen Sammetbahrtuch bedeckt, und auf dem Tuch lag eine Krone, ganz von Gold. Und bei jedem dritten Schritt riefen alle 'Miau'!" -
„Miau", maunzte der alte Tom. „Ja, ganz genau so", sagte der Totengräber, "und als sie näher und näher kamen, konnte ich sie genauer sehen, weil ihre Augen in grünem Licht leuchteten. Und nun gingen sie Alle auf mich zu. Acht trugen den Sarg, und die neunte, die größte unter ihnen, schritt in aller Würde voran. - Aber sieh nur unsern Tom, wie er mich anstarrt! Man könnte denken, er verstünde alles, was ich sage." - "Nur weiter, weiter", sagte seine Frau. „Kümmre dich doch nicht um den alten Tom!“ „Also, ich sagte gerade, sie kamen langsam und feierlich auf mich zu und riefen alle bei jedem dritten Schritt 'Miau, miau'!“
"Miau", sagte der alte Tom wieder. Der Totengräber sah Tom erschreckt an und erblasste, fuhr aber dann fort. "Denke dir, sie stellten sich genau mir gegenüber an Herrn Foryces Grab auf. Dort blieben sie ruhig stehen und blickten auf mich. Aber sieh nur den Tom, er starrt mich genau so an wie sie!" "Weiter, nur weiter", sagte seine Frau, "kümmre dich doch nicht immer um den alten Kater!" -
"Wo war ich denn? Ach ja, sie standen alle und starrten mich an. Dann kam die eine, die den Sarg nicht mittrug, an mich heran, sah mir gerade ins Gesicht und sagte zu mir: Ja, ich versichre dir's, sie sprach zu mir mit quiekender Stimme: 'Sage Tom Tildrum, dass Tim Toldrum tot ist.' - Und darum, bei allen Heiligen frage ich dich, ob du weißt, wer Tom Tildrum ist? Denn wie kann ich Tom Tildrum sagen, dass Tim Toldrum tot ist?" -
"Sieh den alten Tom, sieh nur den alten Tom", schrie da seine Frau. Und auch der Mann fuhr vor Staunen zusammen. Denn Tom blähte sich auf, machte einen stattlichen Katzenbuckel und kreischte schließlich: "Was? Der alte Tim ist tot? Dann bin ich hinfort der Katzenkönig!" und sauste im Kaminschlot in die Höhe und ward nie mehr gesehen.
Ein Märchen aus Schottland
Die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen
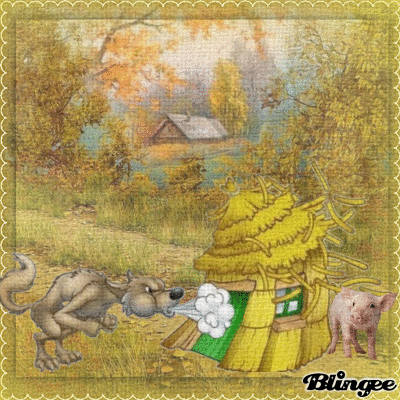
Es war einmal eine alte Sau, die hatte drei kleine Schweinchen. Und weil sie nicht genug besaß, um sie zu ernähren, schickte sie die Schweinchen aus, damit sie selbst ihr Glück suchten. Das erste ging fort und traf einen Mann mit einem Strohbündel. Es sagte zu ihm: "Mann, bitte gib mir dieses Stroh, damit ich mir ein Haus bauen kann." Der Mann gab es ihm, und das kleine Schweinchen baute sich daraus ein Haus. Gleich kam ein Wolf daher, klopfte an die Tür und sagte: "Schweinchen klein, Schweinchen klein, lass mich hinein." Darauf antwortete das Schweinchen: "Beim Haar an meinem Schnäuzchen, o nein, nein, nein." - Da sagte der Wolf: "Dann will ich husten und will pusten und blas dir dein Haus ein." Und er hustete und er pustete und blies das Haus ein und fraß das kleine Schweinchen auf.
Das zweite kleine Schweinchen traf einen Mann mit einem Ginsterbündel, und es sagte: "Mann, bitte gib mir dies Ginsterbündel, damit ich mir ein Haus bauen kann." Der Mann gab es ihm, und das
Schweinchen baute sich ein Haus. Dann kam der Wolf daher und sagte: "Schweinchen klein, Schweinchen klein, lass mich hinein." "Beim Haar an meinem Schnäuzchen, o nein, nein, nein." - "Dann will
ich husten und will pusten und blas dir dein Haus ein." Und er hustete und pustete und hustete und pustete, und schließlich blies er das Haus nieder und fraß das kleine Schweinchen auf.
Das dritte kleine Schweinchen traf einen Mann mit einer Fuhre Ziegel, und es sagte: "Mann, bitte gib mir diese Ziegel, damit ich mir ein Haus bauen kann." Da gab ihm der Mann die Ziegel, und es
baute sich daraus ein Haus. Wie er es bei den anderen kleinen Schweinchen getan hatte, kam der Wolf daher und sagte: "Schweinchen klein, Schweinchen klein, lass mich hinein." - "Beim Haar an
meinem Schnäuzchen, o nein, nein, nein." - "Dann will ich husten und will pusten und blas dir dein Haus ein." Nun also, er hustete und pustete, und er hustete und pustete, und er hustete und
pustete, aber er konnte einfach das Haus nicht nieder blasen.
Als er erkannte, dass er mit all seinem Husten und Pusten das Haus nicht nieder blasen konnte, sagte er: "Kleines Schweinchen, ich weiß, wo es ein schönes Rübenfeld gibt." - "Wo?" sagte das
kleine Schweinchen. "Oh, in Mister Smiths Hausgarten, und wenn du morgen früh bereit bist, komme ich vorbei, wir gehen zusammen hin und holen etwas für das Mittagessen." - "Sehr schön", sagte das
kleine Schweinchen. "Ich werde bereit sein. Um welche Zeit wolltest du gehen?" - "Ach, um sechs Uhr."
Nun, das kleine Schweinchen stand um fünf Uhr auf und holte die Rüben, noch ehe der Wolf kam. Um sechs Uhr kam der und sagte: "Kleines Schweinchen, bist du bereit?" Das kleine Schweinchen sagte:
"Bereit? Ich war dort und bin schon wieder zurück, und ich habe einen schönen Topf voll Rüben fürs Mittagessen." Der Wolf war darüber sehr ärgerlich, aber er meinte, so oder so würde er schon an
das kleine Schweinchen herankommen, und so sagte er: "Kleines Schweinchen, ich weiß, wo es einen schönen Apfelbaum gibt." - "Wo?" sagte das kleine Schweinchen. "Drunten in Merrygarden",
antwortete der Wolf, "und wenn du mich nicht betrügst, komme ich morgen um fünf Uhr bei dir vorbei, und wir gehen zusammen und holen uns Äpfel."
Nun, das kleine Schweinchen stand am andern Morgen um vier Uhr eilig auf und ging fort um die Äpfel, und es hoffte, es könnte zurückkehren, ehe der Wolf käme. Aber es musste diesmal weiter gehen,
und es musste auf den Baum klettern. Und gerade beim Herunterklettern sah es den Wolf daherkommen, und wie ihr euch denken könnt, erschrak es da sehr. Als er herankam, sagte der Wolf: "Kleines
Schweinchen, wie das? Du bist vor mir da? Sind die Äpfel schön?" - "Ja, sehr schön", sagte das kleine Schweinchen. "Ich werfe dir einen herunter." Und es warf ihn so weit, dass das kleine
Schweinchen herunter springen und heim laufen konnte, während der Wolf gegangen war, um den Apfel aufzuheben.
Am nächsten Tag kam der Wolf wieder, und er sagte zu dem kleinen Schweinchen: "Kleines Schweinchen, in Shanklin ist heute Nachmittag Jahrmarkt, gehst du hin?" - "O ja", sagte das Schweinchen,
"ich gehe hin. Wann brichst du auf?" - "Um drei Uhr", sagte der Wolf. Da ging das kleine Schweinchen wie gewöhnlich vor der Zeit fort, und es kam auf den Jahrmarkt und kaufte da ein Butterfass.
Damit wollte es sich auf den Heimweg machen, da sah es den Wolf daherkommen. Nun wusste es nicht, was tun. So kroch es in das Fass, um sich zu verstecken, und als es das tat, kippte es das Fass
um, und das rollte den Hügel hinunter mitsamt dem Schweinchen innen drin. Darüber erschrak der Wolf so sehr, dass er nach Hause rannte und nicht auf den Jahrmarkt ging. Er kam zum Haus des
kleinen Schweinchens und erzählte ihm, wie ihn ein mächtiges rundes Ding erschreckt habe, das den Hügel herunter an ihm vorübergerollt war. Da sagte das kleine Schweinchen: "Ha, dann habe ich
dich erschreckt. Ich war auf dem Jahrmarkt und habe ein Butterfass gekauft, und als ich dich sah, kroch ich hinein und rollte den Hügel hinunter."
Darauf ärgerte sich der Wolf wirklich sehr, und er erklärte, er würde das kleine Schweinchen ganz Gewiss auffressen, und er wolle durch den Kamin zu dem Schweinchen hinuntergelangen. Als das
kleine Schweinchen merkte, was er vorhatte, hing es den Kessel mit Wasser auf, schürte ein loderndes Feuer darunter an, und gerade als der Wolf herunterrutschte, nahm es den Deckel ab, und der
Wolf fiel hinein. Da tat das kleine Schweinchen im Nu den Deckel wieder auf den Kessel, kochte den Wolf gar und aß ihn zum Abendbrot. Und fortan lebte es allezeit glücklich.
Quelle: (Märchen aus England)
Das Fräulein von St. Gilles
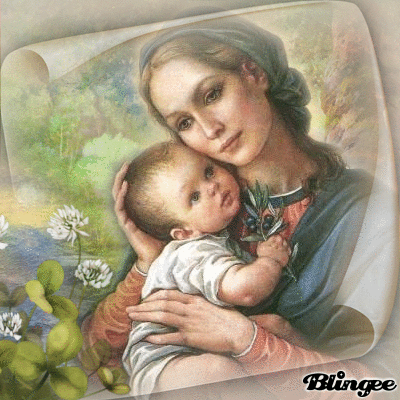
Es war einmal ein Graf in Piktenland und der hatte von seiner trefflichen, adeligen Gemahlin, die schon verstorben war, einen Sohn und eine Tochter. Als er nun einmal die Schönheit seiner Tochter
betrachtete, stiegen böse Wünsche in ihm auf, und er setzte ihr hart zu mit Liebkosungen und Drohungen; sie aber, gefestigt in Keuschheit und Reinheit, widerstand, gleich wie ein Mann, seiner
Bosheit und schrie, da er auf seinem frevelhaften Vorsatz, weidlich. Ihr Bruder weilte in Bologna, wohin er gezogen war, um der Wissenschaft obzuliegen, und so rief sie, da sie sonst niemand
hatte, dem sie hätte völlig vertrauen können, ihre Amme, und tat ihr das traurige Geheimnis kund. Ebenso betroffen über die Bosheit des Vaters wie über die Standhaftigkeit des Mägdleins, riet ihr
die Amme, dieser Gelegenheit der Sünde zu entfliehen, und so gingen sie Nachts, nicht ohne Kleinode und Geld mitgenommen zu haben, auf und davon. Sie gelangten schließlich nach St. Gilles, und da
ihnen das Geld schon zu mangeln begann, so gingen sie zu der Gräfin von St.Gilles und baten sie um des Lebens Notdurft. Ob der Schönheit und Unschuld, die aus dem Antlitz des Fräuleins strahlte,
nahm sie sich ihrer, gleich einer Tochter an, und die Amme behielt sie ihr zur Gesellschaft; und das Fräulein ließ nicht ab, Gott und die heilige Jungfrau um Bewahrung ihrer Keuschheit zu
bitten.
Nun wurde bei dem Grafen von St. Gilles der Königssohn Arelat von Burgund erzogen, und als der ihre adelige Ehrbarkeit sah, verliebte er sich von Herzen in sie. Ihm aber wollte seine Mutter, die
Königin von Arelat, die auf einem Schloss in der Nähe wohnte, die Tochter des Königs von Frankreich vermählen; da beschied er sie, nie werde er eine andere zur Gattin nehmen als Margarete, das
Fräulein von St.Gilles. Es versammelte sich die gesamte Blutsfreundschaft, aber all ihren Bitten gelang es nicht, seinen Sinn zu brechen, und so wurde schließlich das Fräulein entboten und mit
ihm vermählt, und das war der Beginn einer tödlichen Feindschaft der Königin von Arelat und ihrer Schwiegertochter. Der Königssohn ging ein zu ihr, und sie empfing, und als der Tag ihrer
Entbindung nahe war, mußte er als neuer König von Arelat in einen Kampf ziehen, und das war ihm gar zu hart. In dem vollen Vertrauen, das er in die Gräfin von St.Gilles setzte, die ihn erzogen
hatte, befahl er ihr seine schwangere Gattin innig und bat sie, ihm sofort nach der Geburt Nachricht zu geben und ihm alles, was sich dabei verlaufen werde, anzuzeigen. Er schied, und seine
Gattin genas eines wunderschönen Knäblein; sofort fertigte der Graf von St.Gilles einen Eilboten ab, um dem König das freudige Ereignis zu künden.
Der Bote aber, der sich auf seinem Ritte, eines Lohnes begierig, bei der Königin verweilte, wurde von ihr grausam getäuscht; denn in einem falschem Briefe sie, als wäre sie der Graf von
St.Gilles, die Gattin des Königs habe einen Knaben mit einem Hundkopf geboren. Wie betrüblich auch diese Botschaft war, daß er schriftlich befahl, Mutter und Kind trefflich zu nähren und zu
hüten. Auf dem Heimweg besuchte der Bote wieder die Königin; wieder machte sie ihn trunken, entwendete ihm das Schreiben und steckte an seiner Statt ein anderes dieses Inhalts in die Hülse: Der
König grüßt den Grafen. Da wir sichere Kenntnisnahme haben von der Niedrigkeit und Schlechtigkeit unserer Gattin, befehlen wir dir bei der Strafe des Verlustes unserer Liebe, Mutter und Kind zu
töten, auf daß ich nach meiner Rückkehr ein edles, schönes Fräulein in Ehren heimführen kann. Als der Graf den Brief las, kamen ihm, dem harten Ritter, die Tränen; trotzdem aber eröffnete er der
noch im Wochenbette liegenden Herrin den enthaltenen Auftrag und hieß sie, aufzustehen und sich in die Hände der Mörder zu begeben.
Sie erhob sich, fiel auf die Knie und rief Gott an: „Herr, der du Keuschheit und Wahrheit liebst, bewahre mich vor jeglicher Sünde und vor diesem Leid!“ Und in der Nacht führte sie die Henker
samt ihres Söhnleins hinaus in den Wald, um sie zu töten. Als sie aber den Knaben genommen und die Schwerter gezogen hatten und ihn töten (stand abschlachten) wollten, begann er zu lächeln. Darob
überkam sie Mitleid, und sie sagten untereinander: „Bringen wir nur die Mutter um und schonen wir den Sohn, so wird er durch Hunger zugrunde gehen.“ Beide aber zu töten, trugen sie Scheu, und so
sagten sie zu der Mutter: „Wolltest du fliehen und in ferne Lande ziehen, wo man dich nicht kennt, so würden wir dir um des Knaben willen das Leben schenken.“ Sie dankte ihnen und segnete sie und
ging mit dem Knaben.
Und sie bettelte sich durch die Fremde, bis sie endlich nach Bologna gelangte, wo einst ihr Bruder um der Wissenschaft willen gereist war, nun war er dort zum Bischof ernannt worden, und sie
empfing von ihm, der tagtäglich für die Pilger sorgte, Almosen. Einem Geistlichen in seinem Gefolge fielen ihre Schönheit und des Knabens Lieblichkeit auf, und so bat er den Bischof das junge
Weib in dem Hause einer vornehmen Frau unterzubringen, damit sie nicht, in der Welt umherstreifend, andern zum Ärgernis werde. Dieser Bitte schenkte der Bischof Gehör und wies ihr reichlichen
Unterhalt zu.
Unterdessen war der König aus dem Felde heimgekehrt und forderte von dem Grafen von St.Gilles Gattin und Sohn. Verwundert wies dieser den Brief vor, der den Tod beider befahl. Der Bote wurde
gerufen und über seine Reise befragt; da wurde denn befunden, daß die Mutter des Königs den Befehl gefälscht hatte. Die Henker wurden gerufen, und alles weinte bitterlich, und der König fragte
sie um die Begräbnisstätte der Gattin und des Sohnes, von denen er sich nimmer trennen wollte. Die Henker führten ihn in den Wald; weil sie aber nun die Wahrheit nicht mehr verhehlen konnten,
gestanden sie, wie sie den Knaben aus Mitleid geschont hätten und die Mutter mit ihm. Da zog Freude ein in das Herz des Königs und er schwor sein Reich nicht wieder zu betreten, bevor er sichere
Nachrichten von ihnen in Erfahrung gebracht haben werde; und nachdem er die königlichen Gewänder an die Armen verteilt und niedrige Kleidung angelegt hatte, machte er sich auf den Weg.
Almosen heischend, forschte er allenthalben nach seinen Lieben, indem er die Gattin nach deutlichen Zeichen beschrieb. Von andern Bettlern gewann er Kenntnis welchen Weg sie genommen hatten, und
so folgte er ihren Spuren, die ihn nach Bologna führten. Eines Tages empfing auch er das Almosen des Bischofs; weil er aber an ihm weder Siechtum noch sonst ein Zwang wahrzunehmen war, sondern
nur die Demut, womit er dieses Almosen empfing, rief ihn der Bischof in sein Gemach und befragte ihn nach der Ursache seines Wanderns. Da er nun der Reihe nach alles, was sich zugetragen hatte,
erzählte, erriet der Bischof, daß die Frau, für die er mildtätig sorgte, seine Gattin war. Dem König sagte er nichts davon, aber die junge Frau beschied er samt der Herrin, bei der sie weilte, zu
sich und befragte sie um ihre Abkunft und ihre Verhältnisse; so fand er, daß sie seine Schwester war und die Gattin des Königs von Burgund. Und ihn und sie lud er für den nächsten Tag zu einem
Mahle; bevor man aber zu Tische ging, ließ er Mutter und Sohn in königliche Gewänder kleiden, und als alle versammelt waren, führte er sie samt ihrem Knaben dem Gemahle zu. Jubelnd fiel ihr der
um den Hals, um sie zu küssen, und war nicht zu lösen aus der Umarmung der Gattin. Da rief der Bischof weinend: „Liebster, laß sie mir auch ein wenig; ich bin doch ihr leiblicher Bruder, der
Grafensohn von Piktenland!“
Und er gab seiner Schwester die Grafschaft Piktenland, in der er seinem Vater gefolgt war, und entließ sie alle drei in Freuden mit großem Geleite in ihr Reich.
Märchen aus Schottland
Fingerhut

In dem fruchtbaren Tale von Aherlow, an dem Fuße der düsteren Galteeberge, lebte einmal ein armer Mann, der hatte einen großen Buckel auf seinem Rücken. Er sah aus, als ob man seinen Körper
zusammengerollt und auf die Schultern gesetzt hätte, und der Kopf steckte so tief drinnen, dass das Kinn beim Sitzen auf den Knien zu ruhen kam. Die Landleute waren ein wenig ängstlich, wenn sie
ihn an einem einsamen Orte begegneten, denn obgleich der Arme so harmlos war wie ein neugeborenes Kind, so war doch seine Ungestaltheit so groß, dass er kaum wie ein menschliches Wesen aussah;
auch hatten übelwollende Leute befremdliche Gerüchte über ihn verbreitet. Es hieß, dass er sich auf allerlei Kräuter und Zaubersprüche verstand. Unzweifelhaft aber war, dass er mit großer
Gewandtheit aus Stroh und Binsen Hüte und Körbe flechten konnte. So verdiente er sich seinen Unterhalt.
Da er immer eine Blüte von der Pflanze, welche Fingerhut heißt, auf seinem Hute trug, so wurde er kurzweg Fingerhut genannt. Er wurde für seine Arbeit immer etwas besser bezahlt als jeder andere,
und das war vielleicht der Grund, warum einige neidische Personen die seltsamen Gerüchte über ihn ausstreuten. Da geschah es eines Abends, dass sich Fingerhut von dem hübschen Städtchen Cahir
nach Cappagh begab; da er aber infolge seines großen Buckels nur langsam von der Stelle kam, so war es bereits ganz dunkel, als er den alten Graben von Knockgrafton erreichte, welcher sich auf
der rechten Seite der Landstraße befand. Er war müde und erschöpft, und der Gedanke, dass er noch einen weiten Weg zurückzulegen habe und die ganze Nacht hindurch werde wandern müssen, hatte
nichts Tröstliches für ihn. Er setzte sich neben dem Graben nieder, um ein wenig auszuruhen, und schaute trüben Blickes zum Monde empor, der eben aufgegangen war.
Plötzlich drangen überirdische Töne an sein Ohr. Er horchte; noch nie im Leben hatte er solch herrliche Melodie gehört. Der Gesang rührte von vielen Stimmen her, die so wunderbar ineinander
klangen, dass es eine einzige Stimme schien, trotzdem sie alle verschiedene Melodien sangen. Das Lied enthielt keine anderen Worte als:
»Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort.«
Wenn sie diese Worte gesungen hatten, machten sie eine kleine Pause, dann fiengen sie wieder von vorne an. Er horchte gespannt. Er wagte kaum zu atmen, aus Furcht, dass ihm ein Ton entgehen
könnte. Nun erkannte er deutlich, dass der Gesang aus dem Graben kam. Obwohl er so entzückt davon war, so wurde es ihm endlich doch zu viel, immer wieder und wieder dieselbe Melodie ohne die
geringste Abwechslung zu hören; als daher die Elfen innehielten, setzte er ein und fügte am Schlusse die Worte: »Augus Da Dardeen« hinzu. Als die Elfen abermals ihr Lied sangen, sang er mit,
schloss aber mit »Augus Da Dardeen«. Die Elfen von Knockgrafton waren von dieser Verbesserung ihres Liedes so entzückt, dass sie sofort einmütig beschlossen, den Sterblichen, dessen musikalische
Kunst die ihre so sehr übertraf, kennen zu lernen. Mit der Geschwindigkeit eines Wirbelwindes brachten sie also den kleinen Fingerhut in ihre Mitte.
Herrlich war der Anblick, der sich ihm darbot, als er mit der Leichtigkeit eines Strohhalms sich tanzend in den Graben hinunterbewegte, während die lieblichste Musik jede seiner Bewegungen
begleitete. Sie erwiesen ihm die größten Ehren, erhoben ihn über alle anderen Sänger, stellten ihm Diener zur Verfügung, die jeden seiner Wünsche sofort ausführten, kurz, alles, was sein Herz
begehrte, wurde ihm zuteil, und er wurde wie der Vornehmste des Reiches geehrt. Plötzlich gewahrte Fingerhut, dass die Elfen großen Rat untereinander hielten, und er erschrack nicht wenig
darüber, trotzdem sie alle so liebenswürdig gegen ihn gewesen waren. Da trat eine Elfe aus dem Kreise der übrigen hervor und sagte:
»Fingerhut! Fingerhut!
Fürchte nichts und fasse Mut!
Weg ist der Berg von deinem Rücken,
Verzehrt, wie Stroh in Feuersglut.
Glück auf, geheilter Fingerhut!«
Als diese Worte verhallt waren, ward dem kleinen Fingerhut so leicht, so wohl zumute, dass er meinte, es würde ihm nicht schwer fallen, einen Sprung zum Monde hinauf zu tun; mit unaussprechlicher
Freude sah er seinen Buckel von den Schultern zu Boden fallen. Vorsichtig versuchte er nun den Kopf emporzuheben, denn er fürchtete, dass er damit an die Decke der großen Halle anrennen würde, in
welcher er sich befand. Mit dem größten Staunen und Entzücken schaute er sich überall um, alles erschien ihm schöner und schöner. Überwältigt von dem herrlichen Anblick, schwanden ihm die Sinne,
und er sank in einen tiefen Schlaf.
Als er erwachte, war es heller Tag, die Sonne schien hell, und die Vögel ließen ihren lieblichen Gesang ertönen. Er lag neben dem alten Graben von Knockgrafton, und die Kühe und Schafe grasten
ruhig in seiner Nähe. Das Erste, was er tat, nachdem er sein Morgengebet gesprochen, war, dass er sich mit der Hand auf den Rücken fuhr, um seinen Buckel zu befühlen. Aber davon war keine Spur
auf seinem Rücken, und er betrachtete sich von oben bis unten mit großem Stolze. Denn nicht nur war er jetzt ein wohlgebildeter flinker Bursche, er hatte überdies einen nagelneuen Anzug von den
Elfen bekommen. Leichten, elastischen Schrittes schlug er den Weg nach Cappagh ein, als wäre er sein ganzes Leben lang ein Tanzmeister gewesen. Keine Seele, die er traf, erkannte ihn ohne seinen
Buckel, und es kostete ihn nicht wenig Überredung, jeden einzelnen zu überzeugen, dass er es sei - in Wahrheit war er es ja auch nicht, soweit es sich um sein Äußeres handelte.
Es dauerte natürlich nicht lange, dass die Geschichte von Fingerhuts Buckel bekannt wurde. Im ganzen Lande, viele Meilen im Umkreise war er der Gesprächsstoff für hoch und niedrig, alt und jung,
und jedermann sprach von dem großen Wunder. Eines Morgens saß Fingerhut vergnügt vor seiner Hütte, da kam eine alte Frau auf ihn zu und fragte ihn um den Weg nach Cappagh. »Ihr seid in Cappagh,
gute Frau,« antwortete er, »wen sucht ihr hier?« »Ich komme aus Decieland in der Grafschaft Waterford,« sagte die Frau, »und suche einen gewissen Fingerhut. Ich habe gehört, dass ihn die Elfen
von seinem Buckel befreit haben. Der Sohn meiner Base hat auch einen Buckel, der sein Tod sein wird. Vielleicht könnte ihm derselbe Zauber helfen, durch den Fingerhut seinen Buckel verloren hat,
so dass auch er den seinen los wird. Ich bin so weit hergekommen, um in Erfahrung zu bringen, wie sich's mit diesem Wunder verhält.«
Der gutmütige Fingerhut erzählte nun der Frau bis ins kleinste, wie er eine neue Zeile zum Liede der Elfen hinzugefügt hatte, wie er darauf von seinem Buckel befreit wurde, und wie er noch
obendrein einen neuen Anzug bekommen hatte. Die Frau dankte ihm herzlich und ging frohen, leichten Mutes von dannen. Sie kehrte in das Haus ihrer Base in der Grafschaft Waterford zurück und
erzählte ihr alles, was sie von Fingerhut gehört hatte. So setzten sie denn den kleinen Buckligen, der von Geburt an ein boshafter, tückischer Kerl war, auf einen Karren und führten ihn so den
ganzen Weg bis nach Knockgrafton. Es war eine weite Reise, aber es lag ihnen nichts daran, wenn er nur seinen Buckel verlor. Bei Einbruch der Nacht erreichten sie den alten Graben und setzten ihn
dort ab.
Jack Madden, das war der Name des Buckligen, hatte noch nicht lange dagesessen, als er den lieblichen Gesang hörte. Der war noch schöner als das erstemal, denn die Elfen sangen die Melodie, wie
Fingerhut sie ihnen gesetzt hatte:
»Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort,
Augus Da Dareen.«
Jack Madden, der es sehr eilig hatte, seinen Buckel los zu werden, wartete nicht, bis die Elfen den Gesang beendet hatten, noch passte er auf die günstige Gelegenheit, das Lied um einige neue
Worte zu erweitern, sondern brüllte, ohne auf Sinn und Takt des Liedes zu achten, mitten in den Gesang hinein: »Augus Da Dareen, Augus Da Hena«. »Denn,« dachte er, »hat Fingerhut für eine neue
Zeile einen neuen Anzug bekommen, so sind mir für zwei neue Zeilen zwei neue Anzüge gewiss.« Kaum waren die Worte aus seinem Munde, da wurde er mit ungeheurer Gewalt in den Graben geschleudert;
wutentbrannt drängten sich die Elfen um ihn und schrien und kreischten mit gellender Stimme: »Wer stört unseren Gesang? Wer stört unseren Gesang?« Eine von ihnen trat aus dem Kreise der übrigen
zu ihm und sagte:
»Dummer Jack! Dummer Jack!
Mit deinem schrillen Froschgequack
Hast du das Elfenlied gestört;
Drum sei dir neu auf dein Genack
Ein zweiter Buckel noch beschert!«
Und zwanzig der stärksten Elfen brachten Fingerhuts Buckel herbei und taten ihn dem armen Jack auf den Rücken. Dort blieb er haften, so fest, als hätte ihn der geschickteste Zimmermann mit den
stärksten Nägeln angeschlagen. Dann trieben sie ihn mit Fußstößen aus ihrem Schlosse. Als am nächsten Morgen Jack Maddens Mutter und ihre Base herbeikamen, um zu sehen, was aus dem kleinen
Buckligen geworden war, da fanden sie ihn halbtot neben dem Graben liegen, und statt eines Buckels hatte er zwei auf dem Rücken.
Man kann sich denken, wie sie einander anschauten! Doch sie sprachen kein Wort, aus Angst, daß auch sie einen Buckel bekommen könnten. Traurigen Herzens kehrten sie mit dem unglücklichen Jack
Madden wieder nach Hause zurück. Die Mühseligkeiten der langen Reise und der zweite Buckel waren mehr, als er ertragen konnte, und sterbend verfluchte er alle Elfen und ihre Melodien.
Anna Kellner: Englische Märchen
Robin Hood

Wer von der Höhe der Zinnen von Nottingham, der festen Stadt, herabblickt, erkennt in der Ferne einen dunkelgrünen Waldstreifen. Das ist der Sherwood, der sich weit durch das englische Land
zieht. Dort lebte zur Zeit des Königs Richard, den alles Volk wegen seines hochgemuten, tapferen Wesens "Löwenherz" nannte, als Waldvogt Herr Hugh Fitzooth von Locksley. Er war ein Nachfahre der
angelsächsischen Geschlechter, die einst mit ihren Drachenschiffen zur britischen Insel gestoßen waren und dort seither als Freisassen gelebt hatten. Als dann vor drei Menschenaltern die
Normannen unter Wilhelm dem Eroberer das Inselreich in ihre Gewalt gebracht hatten, waren die angestammten Sachsen gezwungen, sich der Befehlsgewalt der Normannen zu beugen, aber deren Herrschaft
war verständnisvoll und milde gewesen, solange Richard Löwenherz sie ausübte. Er war gerecht und großherzig, und darum liebten ihn auch die Sachsen. Keiner der königlichen Statthalter, der Grafen
und Barone, missbrauchte seine Gewalt, denn sie sahen sich von dem rechtlich denkenden König Richard überwacht. Das wussten die Sachsen dem Normannenkönig zu danken, und besonders hatte er ihre
Zuneigung gewonnen, seit er ihnen die alten Rechte - vor allem das Jagdrecht - wiedergegeben hatte.
Doch nun war König Richard außer Landes, er machte einen Kreuzzug in das Heilige Land, um das Grab des Erlösers vor dem Zugriff der "Ungläubigen" zu schützen. Als Stellvertreter hatte er seinen
Bruder, den Prinzen Johann, eingesetzt und ihm die Regentschaft übertragen. Der Prinz - das Volk nannte ihn verächtlich "Johann-ohne-Land" - war ein schlechter Sachwalter des Willens seines
königlichen Bruders. In seinem Hass gegen die heimatstolzen Sachsen, die sich nicht der Fremdherrschaft beugen wollten, schrak Johann nicht davor zurück, ihnen angestammte Rechte zu versagen.
Leichtfertig setzte er sich darüber hinweg, dass König Richard ihnen das altüberlieferte Recht zu jagen ausdrücklich zugestanden hatte, und er verbot ihnen die Jagd; der hartherzige Prinz wusste
genau, dass ein Sachse ohne sie nicht leben kann.
Seit Johanns neue Gesetze galten, hatte Hugh von Locksley sein Amt als königlicher Waldvogt verloren. Er musste sich darüber im Klaren sein, dass die Vögte des Prinzen Johann jede Übertretung des
Verbots mit unnachsichtiger Härte ahnden würden, denn der Prinz hatte ihnen eingeschärft, notfalls jeden Trotz mit Gewalt zu brechen. In bitterer Unzufriedenheit hauste der sächsische Edeling mit
Frau und Kind, seinem Sohn Robert, den sie Robin nannten, in seiner festen Burg am Rande des riesigen Waldes. Der Sherwood war seine Welt, von den Vorfahren ererbt, und er war von Jugend auf
gewohnt, hier zu jagen - nun war ihm durch Prinz Johanns ungerechtes Verbot alles Lebensglück zerstört.
Wie König Richard seinen Grafen und Baronen milde und gerechte Verwaltung befahl und diese überwachte, so betrieb Prinz Johann mit aller Strenge die Durchführung seiner neuen Befehle. In der
festen Stadt Nottingham hatte er als seinen Vogt den Grafen de Lacy eingesetzt, einen grimmigen, hartherzigen Mann, der wie sein Herr die Sachsen hasste. Er misstraute dem Gehorsam des Waldvogts
von Locksley, und heimlich ließ er Herrn Hugh Fitzooth überwachen - er hoffte, man werde ihn bei einer gesetzeswidrigen Handlung überraschen und dann strenger Strafe zuführen können.
Die Mutter wollte, dass der Sohn Geistlicher würde, doch für den standesstolzen Edeling gab es keine Frage, dass Robin im Walde lebte wie er. "Jäger will ich werden wie der Vater", sagte auch
Robin selbstbewusst, "und unserm König Richard, wenngleich er Normanne ist, will ich dienen, denn er ist ein guter König, und ich will mit ihm hinausziehen und große Taten vollbringen." Der Vater
wusste, was ein sächsischer Edeling an Waffenkunst beherrschen muss. Von ihm lernte Robin die Kunst, mit dem Wolfsspieß zu werfen, vom Vater lernte er die Kunst des Bogenschießens, in der Herr
Hugh Fitzooth Meister war, und der Vater nahm ihn in harte Lehre, um ihn im Stockfechten zu unterweisen. Später sollte an die Stelle des schweren Eichenknüppels das Sachsenschwert treten. Harte
Tage, harte Wochen waren es für Robin, so hart, dass mancher Jüngling vielleicht den Wunsch der Mutter erwägen würde, Bücher zu lesen, um Geistlicher zu werden.
Nicht so Robin. Wenn er abends mit lahmen Gliedern und zerschundenen Knochen auf sein Lager sank, dann dachte er nicht zurück, sondern nur vorwärts: Wie hätte ich dem Schlag besser ausweichen
können, wie treffe ich des Vaters Stock härter, um ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen. Bald war Robin Hood, erst sechzehn Jahre alt, unübertrefflich im Stockfechten, im Werfen mit dem
Wolfsspieß, im Bogenschießen. Graf de Lacy, der Sheriff des Landes, hatte in seiner Stadt Nottingham ein Wettschießen mit dem Bogen angesagt. Nur widerwillig war Herr Hugh der Aufforderung
gefolgt. Robin begleitete den Vater. Die beiden wussten nicht von der Absicht des Sheriffs: mit einer Niederlage in dem Preisschießen wollte er ihr Ansehen herabsetzen. Er war fest überzeugt,
dass Red Gill, der Führer seiner Leibgarde, den Wettkampf gewinnen werde.
Die Zuschauer beim Wettschießen jubelten laut, als die Besten sich zur Entscheidung stellten. Immer weiter hatte man die Scheibe abgerückt, immer mehr der Bewerber waren ausgefallen. In der
Ehrenlaube saß Prinz Johann. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, das Festspiel zu besuchen. Nun standen, wie vorausgesehen. nur noch drei der Besten auf dem Platze. Es war Gill, der Rothaarige,
es war Hugh Fitzooth, der sächsische Freisass, es war Robin, sein Sohn. Der Herold trat in die Schranken: Die Scheibe wurde jetzt auf hundert Schritt Entfernung gerückt. Es ging um die letzte
Entscheidung.
"Den ersten Schuss hat Red Gill!" Laut klang des Herolds Stimme über den Platz. Der Aufgerufene trat vor, hob den Bogen, legte den Pfeil ein und zielte lange. In der fürstlichen Laube verfolgten
Prinz Johann und sein Sheriff voller Spannung den schwirrenden Pfeil. "Das nenne ich eine Leistung!" rief der Regent begeistert: "Auf solche Entfernung noch den Rand des Zentrums zu treffen!" De
Lacy, der Sheriff, nickte dienstbeflissen. "Ja, mein Fürst, kein Schütze in England kommt ihm gleich!"
"Es folgt der zweite Bewerber, Herr Robin Fitzooth", ertönte des Herolds Ansagen. "Der junge Mann sollte lieber auf seinen Schuss verzichten", meinte Prinz Johann und blickte gleichgültig zu
Robin hinüber. Ruhig, als sei es etwas ganz Alltägliches, legte Robin den Pfeil ein, schätzte mit dem Auge die Entfernung und zielte sorgfältig. Dann ließ er den Pfeil schwirren. Aus der
Frauenlaube hörte man Jubelrufe: "Ins Schwarze!"
"Das nenn ich Glück", stieß der Sheriff bissig hervor, während die Menge wie rasend vor Begeisterung tobte. Als der Beifall langsam verebbte, trat der Herold wieder vor. "Als dritter Bewerber
schießt Herr Hugh Fitzooth." Jedermann sah, Robins Schuss war nicht zu übertreffen. Herr Hugh nahm Aufstellung, sichtete kurz und ließ den Pfeil aus der Sehne schnellen. War so etwas möglich?
Sein Geschoß hatte Robins Pfeil, der genau im Zentrum steckte, in zwei Teile gespalten! "Solch einen Meisterschuss sieht man nicht in jedem Menschenleben!" rief ein weißbärtiger Alter ganz außer
sich. Die Menge war wie von Sinnen in ihrem Jubel.
Die glücklichen Schützen rief man vor die Frauenlaube, wo die Königinmutter den Sieger ehren sollte. "Majestät", sagte Herr Hugh, "gebt den Preis dem Schützen, dessen Pfeil zuerst das Zentrum
traf!" Doch sie schüttelte lächelnd den Kopf und überreichte ihm den kostbaren Siegespreis. Da trat ein Bote vor Herrn Hugh: "Der Sheriff lässt Euch auffordern, mit Eurem Sohne vor ihm zu
erscheinen!" Den Vater durchzuckte es ahnungsvoll: das war das Verhängnis, das er nahen sah. Robin spürte des Vaters Besorgnis. "Ach was", flüsterte er ihm zu, "er will uns doch nur zu unserm
Siege beglückwünschen." "Gott gebe es", murmelte der Vater.
Als sie vor dem Gestrengen erschienen, nickte er ihnen wohlwollend zu. "Gute Schützen seid ihr, Vater und Sohn", sagte er und blickte sie prüfend an. "Ich habe eine Frage an euch." Beide blickten
den Sheriff erwartungsvoll an. Würde sich des Vaters Besorgnis jetzt erfüllen? "Gute Schützen kann ich gebrauchen", sagte der Sheriff langsam, "es gibt so viel widersetzliche Menschen, die es zum
Gehorsam zu zwingen gilt. Wollt ihr nicht in meine Leibgarde eintreten?" "Mein Pfeil richtet sich nicht auf Menschen", sagte Vater Hugh hart. "Ich liebe meine Freiheit." "Und ich nicht weniger,
Herr Sheriff", fügte Robin schnell hinzu, "auch ich tauge nicht für solchen Herrendienst." "So frech wagt ihr mir zu trotzen?", fuhr de Lacy auf. "Erbärmliches Sachsengesindel!"
Hugh Fitzooth wollte aufbegehren, doch der Sheriff winkte böse ab. "Kein Wort mehr von solchen anmaßenden Frechlingen! Ihr werdet von mir hören!" Die Drohung war nicht von ungefähr. Noch am Abend
machten Vater und Sohn sich auf den Rückweg. Sie sehnten sich nach ihrem festen Hause und nach der Waldeseinsamkeit. Beide wussten nicht, was der Sheriff seinem treuesten Gefolgsmann und besten
Bogenschützen zugeflüstert hatte. Heimlich folgte Red Gill den Fitzooths mit einer kleinen Schar wendiger und kampferprobter Reiter.
Gedankenvoll ritten Vater und Sohn durch den dunkelnden Wald. "Wer sich gegen de Lacy aufzulehnen wagt, tut gut daran, auf der Hut zu sein", sagte er eben, zu Robin gewendet - da schwirrte ein
Pfeil durch die Luft, und sofort folgte auch ein Schrei. Voller Entsetzen blickte Robin zur Seite: zwischen des Vaters Schulterblättern haftete das Geschoß! Schon taumelte der Alte - jetzt brach
er zusammen. Erschüttert kniete Robin vor ihm: "Vater, lieber Vater!" keuchte er. "Das war des Sheriffs Geschoß!" stieß Hugh Fitzooth aus. Als Robin sich über den Vater beugte, spürte er, wie das
Herz zu schlagen aufhörte. Woher war der Schuss gekommen? Vorsichtig erhob sich der Junge und spähte nach allen Seiten. In diesem Augenblick schwirrte etwas durch die Luft. Robin warf sich
beiseite - über ihm im Baumstamm stak zitternd ein zweiter Pfeil!
Robin hatte den Bogen von der Schulter gerissen und schlich in die Richtung des unsichtbaren Schützen. Da bekam er ihn zu Gesicht. "Dachte ich es doch", stieß er hervor, "es ist Red Gill, dieses
feige Werkzeug des Sheriffs!" Red Gill schlich sich an, um die Wirkung seines Schusses festzustellen. Als er sich eine kleine Blöße gab, fuhr Robins Schuss ihm mitten ins Herz. Eben wollte er
sich wieder dem toten Vater zuwenden, da hörte er hinter sich Hufgetrappel. "Dort ist der Mörder!" schrieen mehrere Stimmen. "Los, packt ihn!" Es ging um Sekunden. Wieselgleich suchte Robin
hinter den Stämmen Schutz, wand sich durchs dichte Unterholz, wo die Pferde keinen Weg finden, und ließ das Waldesgrün über sich zusammenschlagen.
Mehrere Tage irrte Robin durch den Wald, um den Häschern zu entgehen. Erst als sich der dritte Abend herab senkte, wagte Robin sich aus seinem Versteck. Vorsichtig pirschte er sich um die
Waldecke, um das freie Feld zu überqueren, an dem das Elternhaus sich vor dem jenseitigen Waldrand erhob. Er würde nur auf einen Sprung einkehren, um der Mutter vom Tode des Vaters zu berichten.
Er würde ihr raten, zum Onkel Gamewell, dem alten Landedelmann in Norfolk, zu ziehen, bis bessere Zeiten kämen. Ich darf mich nicht lange bei der Mutter aufhalten, dachte Robin bitter bei sich
selber. Ich werde... Da, was ist das? Welch seltsame Abendbeleuchtung, dass er das feste Haus am Waldrand nicht erkennen konnte? Narrte ihn etwa ein Trugbild? Bin ich wahnsinnig geworden?
Durchfuhr es Robin wild.
Nein, es war kein Trugbild, was sich dort seinen Augen zeigte. Wo einst das Elternhaus stand, hoben sich verkohlte Mauerreste gegen den Abendhimmel ab. Noch qualmte es zwischen den Ruinen. Wie in
stummer Anklage ragte der alte Turm über den zusammengestürzten Mauern empor. Fassungslos stand Robin vor den noch schwelenden Trümmern des Hauses, in dem er einst mit Vater und Mutter glücklich
war. Ganz gebrochen trat der Hausverwalter zu seinem jungen Herrn. "Wo ist meine Mutter?" stieß Robin heiser hervor.
Der treue Mann hatte sie abseits von den Trümmern auf eine Felldecke gebettet. Dort lag sie unter freiem Himmel. Nur mit größter Vorsicht konnte Robin es wagen, in ihrer Nähe zu bleiben, denn
jeden Augenblick musste er gewärtig sein, dass des Sheriffs Häscher zurückkehrten, um ihn zur Stadt zu schleppen. Und dabei war es der Mutter anzusehen, dass sie in den letzten Zügen lag. Als sie
von dem schrecklichen Ende ihres Ehemannes hörte, sank ihr der Kopf zur Seite; der unendliche Schmerz brach ihr das Herz.
So wurde Robin ein Geächteter, ein "outlaw", das heißt ein Mann außerhalb der Gesetze. Die Landesgesetze, die für ihn galten, besagten, niemand dürfe ihm helfen, ihm Nahrung und Trank reichen,
niemand dürfe ihm Obdach gewähren. Robin Hood war vogelfrei! Die Mutter war gestorben - an gebrochenem Herzen, sagten die Leute mit Recht. Das Hausgesinde von daheim war in alle Winde verstreut;
nur Muck, der Reitknecht, hatte seinen jungen Herrn nicht verlassen wollen. Tief drinnen im Dunkel des Sherwood-Waldes, wo man sich vor dem Arm des Sheriffs sicher fühlen darf, hatten die beiden
ihr Freiheitsasyl gefunden. Was scherte es sie, dass sie auf nacktem Boden schlafen mussten, mit dem Laub der Waldbäume zugedeckt! Was scherte es sie, dass die Mahlzeiten karg waren und die
Nächte kalt.
Bald hatten sie, wo der Wald am dichtesten war, sich ein Lager eingerichtet. Mit Eschenbogen und Hirschfänger bot der Wald Nahrung genug, und der sprudelnde, frische Waldbach gewährte Trunk in
Fülle. Wie herrlich ist es, durch den Wald zu streifen, wenn der Tau noch auf Gräsern und Zweigen liegt, wenn die Vögel erwachen und die Sonne langsam über den Waldrand klettert. Wie schön ist
die Gottesnatur in der unberührten Morgenstille. Bald sammelten sich um Robin Hood Männer, die geächtet und vogelfrei waren wie er, alle entschlossene Gesellen, die die Fremdherrschaft der
Normannen hassten wie er. Da war Klein John, ein ungefüger, bärenstarker Kerl, der wie Robin ein Meister im Stockfechten war, und Bruder Tuck, ein entlaufener Mönch; da war Muck, des Oheims
getreuer Knecht, dazu die drei Brüder Huggins, denen die Normannenschergen das Elternhaus niedergebrannt hatten, weil die bedrängten Bauern die Steuern nicht bezahlen konnten. Immer mehr dieser
tollkühnen, wildentschlossenen Freiheitskämpfer stießen zu dem Haufen der Ausgestoßenen.
Wenn Ritter de Lacy, der Sheriff von Nottingham, von der Höhe seiner Stadtburg über das weite englische Land sah, wandte er nur ungern seinen Blick zu dem grünen Waldstreifen hinüber, denn mochte
er auch Herr über die weite Stadtumgebung sein: in den Sherwood reichte seine Macht nicht, denn dort hausten die sächsischen Outlaws - und Robin Hood war ihr Führer und der König des grünen
Waldes, denn er war der kühnste und verwegenste und klügste unter ihnen. Bald traute sich kein Normanne mehr in den Sherwood-Wald hinein, so gefürchtet waren Robin und seine tollkühnen Gesellen.
Man erkannte sie an dem Lincolnrock, den sie trugen, aber dieses waldgrüne Tuch machte sie unsichtbar. So waren sie allgegenwärtig, ein Schrecken der normannischen Häscher. Auch die Reichen
ringsum, die das Volk aussaugten, waren vor Robin Hoods Männern nicht sicher, denn er schonte keinen, zum Nutzen der Unbegüterten und Unterdrückten, die darben mussten.
Als Robin eines Tages durch das maiengrüne Land ritt, sah er auf einer Wiese neben der Landstraße eine seltsame Gruppe. Drei normannische Reiter waren es, die einen jungen Menschen in
kanarienbuntem Gewand in die Mitte genommen hatten. Der eine ließ drohend seine Reitpeitsche spielen, der andere zerrte das Bürschlein derb am Arme, während der dritte ihm seinen Spieß vor den
Bauch hielt. Sie wollten dem Spielmann das Pferd abnehmen. Blitzschnell hatte Robin seinen Eschenbogen in der Hand, den armlangen Pfeil auf der Sehne. "Ich pflege bedrängten Menschen zu helfen
und trete ein für Recht und Billigkeit, wenn unser gutes Sachsenrecht so mit Füßen getreten wird!" So erklärte er ruhig, als die drei Normannenreiter ihn beschimpfen wollten. Ruhig brachte er den
jungen Menschen in Sicherheit - und hatte der Bande der Geächteten einen neuen Freund gewonnen, einen normannischen Spielmann, der die Gesetzlosigkeit seiner eigenen Landsleute erlebt
hatte.
Als die beiden dem Waldlager zuritten, leuchtete es zwischen den Baumstämmen auf. Bärtige Männer, die um die Flammen saßen, sprangen auf, als die beiden in den Kreis einritten. Ganz unbekümmert,
ein echter Spielmann, klimperte Alin ein fröhliches Liedchen, während die Gesellen voll Erstaunen sein buntes Wams betrachteten. "Unser neuer Freund wird unser Schicksal teilen", rief Robin den
Gefährten zu. "Willkommen sei uns jeder, der für Recht und Freiheit ist!" Abends saßen sie wieder zusammen und wetterten über des Sheriffs Grausamkeit. "Wir sind nicht die einzigen", berichteten
Abel und Fred, "viele gibt es, die geächtet und vogelfrei sind und vor ihren Häschern im Walde Schutz gesucht haben."
"So holt sie herbei", rief Robin, "wenn ihr für sie bürgen könnt. Jeden freiheitsliebenden Mann können wir gebrauchen!" Tags darauf standen die Männer vor ihm, alles bärenstarke, hochgewachsene
Sachsen, die mit dem schmalen Schwert und dem langen Bogen aus Eschenholz umzugehen wussten. Und alles entschlossene Burschen, die Prinz Johanns grausame Härte gespürt hatten und ihm voll Ingrimm
den Tod an den Hals wünschten. "Willst du unsere Hilfe, Robin Hood", sagte der Führer dieser Burschen, "so wollen wir dir folgen!" "Seid mir willkommen. Und wie ist dein Name?" "Ich heiße Will
Stutely", versetzte der Mann. So wuchs der Haufen der Verschworenen. Und Robin Hood, der junge sächsische Edelmann, war ihr Haupt. Die Armen liebten ihn, der das freie Leben unter den Bäumen des
Waldes einem Leben in Zwang und Unfreiheit vorzog; der Sheriff aber hasste diesen Freund und Helfer der Unterdrückten und sann auf Mittel und Wege, ihn zu fangen und zum Tode zu führen. Er setzte
auf Robin Hoods Kopf einen Preis aus. Fünfzig Goldstücke für den, der den verhassten Freiheitskämpfer in Ritter de Lacys Hände lieferte!
Da gaben seine Ratgeber ihm einen Vorschlag für eine Veranstaltung ein, die Robin Hood in seine Hände führen könnte. Er ließ zu einem Wettschießen aufrufen, dessen Preis ein silberner Bogen sein
sollte. Sicherlich würde Robin Hood, der Meisterschütze, der Versuchung nicht widerstehen können auch wenn es mehr als Tollkühnheit bedeutete, sich in den Machtbereich des Sheriffs zu wagen. In
seinem unbändigen Verlangen, seine Kunst zu zeigen, lachte Robin Hood unbekümmert über die Bedenken seiner Gesellen. "Geh nicht, Robin", baten sie ihn, "denk auch daran, was du uns schuldig bist
als unser Führer! Es wäre für dich ein Tod in Schande!" "Für mich gibt es keine Gefahr", sagte er sorglos. "Mich fängt der Sheriff nicht. Aber was wird es für uns bedeuten, wenn jedermann weiß,
dass ich in Nottingham gewesen bin und am Bogenschießen des hochgeborenen Herrn de Lacy teilgenommen und den silbernen Bogen gewonnen habe!"
Als armseliger Bettler verkleidet, betrat der Geächtete die Stadt. Niemand kam auf den Gedanken, den gefürchteten Anführer der Freiheitskämpfer vor sich zu haben. Bunte Wimpel wehten über dem
Kampfplatz, wo die festliche Menge sich erwartungsfroh drängte. In der Laube des Sheriffs hatte auch Prinz Johann Platz genommen. Da trat der Herold in die Schranken, ließ sein Horn erschallen
und forderte die Bewerber auf, sich zum Wettkampf zu stellen. Ein Murren ging durch die Menge, als man unter den Meistern des Eschenbogens den zerlumpten Bettler gewahrte. Stimmen wurden laut,
dass solcher Bewerber nicht zuzulassen sei. Doch die Königinmutter, die ihr Volk liebte, sprach die Entscheidung. "Hier geht es nicht nach Rang und Stand, sondern nach der Fertigkeit im
Bogenschießen", rief sie lächelnd. "Jeder Meister ist uns willkommen!"
Der Wettkampf begann. Alle trafen das Ziel, das auf sechzig Schritt gestellt war. Der Bettler, der als erster schießen musste, schien sich gar keine Mühe zu geben, so dass es aussah, als habe er
nur durch Zufall getroffen. Weiter rückte man die Scheibe ab; schon verfehlten zwei der Herren das Ziel und mussten vom Wettkampf abtreten. Wieder wurde die Entfernung größer, und wieder mussten
zwei Bewerber sich geschlagen bekennen. Als des Herolds Helfer die Zielscheibe auf hundertundzwanzig Schritt gestellt hatten, waren nur noch zwei Schützen im Spiel: Thorn Greenwood, der Führer
der prinzlichen Jäger, und der unbekannte Bettler. "Jetzt wäre Red Gill vonnöten", rief jemand in die Spannung hinein. Den einstigen Führer der Bogenschützen hätte man hier in der Tat im
Wettkampf sehen mögen.
Ungeheuer war die Erregung, mit der die Menge den Wettkampf verfolgte. Einhundertundzwanzig Schritt war die Entfernung des Ziels! So klein war das Schwarze auf der Scheibe, dass es kaum noch zu
erkennen war. Jetzt ging es um die Entscheidung! Wieder schritt der Herold vor die Menge: "Wir werfen das Los, um festzustellen, wem der erste Schuss gehört!" Das Los traf den Bettler. Mit
demütiger Selbstsicherheit trat Robin vor. Er dachte an den einstigen Meisterschuss seines Vaters, dessen Schuss den im Mittelpunkt haftenden Pfeil gespalten hatte. Diese Leistung würde Thorn
Greenwood nicht vollbringen. So durfte Robin seines Sieges sicher sein. Ruhig legte er den Pfeil ein, zog ihn bis hinters Ohr zurück und ließ die Sehne schnellen. In atemloser Spannung folgten
die Augen der Zuschauer dem schwirrenden Geschoß. Es traf genau in den Mittelpunkt, schwankte einen Augenblick hin und her und stand wie ein stolzer Sieger.
Der Mitbewerber wusste, dass damit seine Aussicht, ins Ziel zu treffen, dahin war. "Man hätte einen hergelaufenen Bettler nicht zum Wettkampf ehrenhafter Männer zulassen sollen", knurrte er
verächtlich und trat beiseite. Ringsum wurden höhnische Stimmen laut, Jubelschreie für den Sieger. Nur mit Unwillen erklärte der Herold den Bettler zum Sieger. "Du sollst vor der Laube
erscheinen", sagte er unfreundlich. "Prinz Johann selber will dich kennen lernen." Für Robin Hood war es niemals zweifelhaft gewesen, wer den Siegespreis davontragen werde. Trotzdem schwoll ihm
das Herz vor Freude; denn nicht nur der Erfolg, auch das Abenteuerglück wog alles auf.
Während er, von der Menge bestaunt, zur Laube des Prinzen hinüberging, ließ er die Blicke über den Platz schweifen. Da plötzlich stutzte er: Ringsum zwischen den Zuschauern gewahrte er zu seiner
Überraschung die Gesichter seiner verwegenen Gesellen - da hatten sie sich doch in die Stadt gewagt, die treuen Freunde, um ihm in der Stunde der Gefahr zur Seite zu stehen! Alle waren
verkleidet; aber Robin erkannte sie in ihren Altweiberröcken und Bauernmänteln, in den Mönchskutten und Fuhrmannskitteln. Da packte den Freiheitskämpfer wieder die verwegene Abenteuerlust: Heute
wollte er einen Streich wagen, den der Sheriff sein Lebtag nicht vergessen sollte!
Herr de Lacy hatte gedacht, seinen Feind in eine Falle zu locken, als er das Wettschießen verkünden ließ, und nun fühlte er sich enttäuscht, dass Robin es nicht gewagt hatte zu erscheinen.
Mehrfach hatte der Sheriff die Gestalt des Bettlers gemustert. Sollte er etwa der Gesuchte sein? Aber nein, so sah Robin Hood nicht aus. Jetzt stand der Freiheitsheld vor dem verhassten Mann.
Gleichgültig blickte er an ihm vorbei. Den Kopf etwas gesenkt und in kraftloser Haltung. "Du hast den Wettkampf gewonnen", begann der Sheriff, und aus seiner Stimme war deutlich zu spüren, wie
ungern er diesem zerlumpten Strauchdieb die Anerkennung aussprach. "So empfange nun den Siegespreis; doch zuvor muss ich dich auffordern, uns deinen Namen zu nennen!"
"Was tut er zur Sache, Herr", versetzte der Bettler mit krächzender Stimme. "Was kann Euch hochgeborenen Herrn ein armer, namenloser Waldläufer kümmern, der..." "Nenne uns deinen Namen",
unterbrach ihn der Sheriff ungehalten, "so wie es Brauch ist unter ehrbaren Menschen . . ." Er stutzte voller Entsetzen, denn was nun geschah, musste ihm den Atem rauben. "Ja, Ritter de Lacy, so
hört meinen Namen und seht, wer ich bin!" schrie der Zerlumpte wild auf. Aus der zusammengesunkenen Gestalt des kraftlosen Bettlers wurde plötzlich ein aufrechter, starker Mann, die Bettlerlumpen
flogen beiseite, und vor dem Sheriff stand, in waldgrünes Wams gekleidet, der Mann, den er hasste und den er fürchtete . . .
"Robin Hood!" rief er stammelnd.
"Nicht schwer zu erraten", lachte Robin unbekümmert, sprang auf das Podest vor der Laube und hob sein Schwert. "Freiheit!" schrie er wild über die Menge hin. "Tod den Zwingherren!" Ein ungeheures
Getümmel erfüllte sekundenschnell den Platz. Robin drang auf den verhassten Gegner ein, doch der wich seinem Schwertstoß aus. Ehe die Häscher des Sheriffs zupacken konnten, hatten sich Robins
tollkühne Gesellen dazwischengedrängt. Entsetzt wichen Ritter de Lacys Männer zurück, als sie urplötzlich unter vielfacher Vermummung einen Haufen wildentschlossener Männer im grünen Gewand der
Freiheitskämpfer auftauchen sahen.
In dem allgemeinen Tumult kämpften diese sich durch die dicht gedrängte Menge. Immer mehr waren es von den Leuten der Stadtbevölkerung, die mit unterdrückter Freude Robins verwegene Tat
bewunderten. Schwerfällig schoben und drängten sie sich dazwischen, wenn die normannischen Knechte auf die Grünröcke eindrangen, und sicherten diesen so den Rückzug. Nun hatte Robin Hood das
Stadttor erreicht. Mit grimmigem Lachen schwang er sich auf die Mauerkuppe und stieß in sein Horn, dass es weit über die Stadt hin und über die Burg ertönte. "An diesen Tag wird der Sheriff noch
lange denken", rief er den Gesellen zu; dann verschwand er mit ihnen jenseits der Stadtmauer und führte sie zurück in den Sherwood-Wald. Wie zum Hohn klang noch lange Robins Horn zur Stadt
hinüber.
Wenige Tage später trat die Königinmutter in das Zimmer des Prinzen Johann. "Gute Kunde, mein Sohn, hat mich soeben erreicht. Richard sitzt in Verhaft in der Feste Dürnstein im Österreichischen,
doch der Bote meldet, dass wir ihn durch ein Lösegeld freikaufen können. . ." Prinz Johann tat erfreut - und wusste doch, dass mit der Rückkehr König Richards sein Los besiegelt war. "Wir müssen
das Volk zu einer Spende aufrufen, doch schwer wird es sein, den hohen Betrag aufzubringen, denn Robin Hood hat das Land ausgeplündert!"
Jeder wusste, wie lügnerisch seine Behauptung war. In Wirklichkeit war der Prinz glücklich, Geld in den Kasten fließen zu sehen, denn schon hatte er einen heimtückischen Plan, der König Richard
für alle Zeit die Heimkehr verwehren würde: er wollte die Spende des Volkes in seine eigene Schatzkammer führen - ein zweites Mal würde das ausgepresste Volk den Betrag nicht aufbringen können.
Das treue Volk gab sein Letztes, um dem Herrscher, den es so sehr liebte und zurückwünschte, die Freiheit zu verschaffen. Bald lag die riesige Summe des geforderten Lösegeldes bereit. Der
verräterische Prinz Johann ging sogleich daran, seinen Plan auszuführen, der ihm doppelten Vorteil und Gewinn bringen sollte. Noch vor Sonnenaufgang ließ er fünfzig seiner Bogenschützen in aller
Heimlichkeit auf dem Schlosshof versammeln. "Ihr reitet auf der Landstraße am Sherwood-Walde entlang. Dort legt ihr die grasgrünen Wämser an, die ich euch mitgeben lasse, und kleidet euch so wie
Robin Hoods Bande."
Niemand ahnte das hinterhältige Vorgehen des Prinzen. In der Tracht von Robin Hoods kühnen Gesellen sollten die Bogenschützen den Lastzug überfallen, der das für König Richard bestimmte Lösegeld
in Prinz Johanns Schatzkammer nach London schaffte! Doch Robin Hoods Späher erkannten rechtzeitig genug auch diesen heimtückischen Bubenstreich, der das Ansehen der grünen Gesellen so schmählich
missbrauchen und verunglimpfen und König Richard für immer die Heimkehr verwehren sollte. In Windeseile war die Bande zur Stelle und verhinderte die Entführung des Lösegeldes. Statt in die
Schatzkammer des eigensüchtigen Prinzen gelangte der Betrag an die richtige Stelle: Er diente als Lösegeld für den König, der fern der Heimat auf Rückkehr hoffte.
Nach dem erbarmungslos harten Winter in der Kälte der waldigen Schlupfwinkel sahen die Geächteten endlich den Frühling nahen. Mit ihm wuchs ihnen neuer Mut und neue Hoffnung. Immer neue Gesellen
strömten den Freiheitskämpfern als Helfer zu. In sorgenvollen Gedanken, wie er die große Zahl der Getreuen ernähren solle, schritt Robin Hood mit Bruder Tuck durch den Wald. Der freiheitsliebende
Mönch war seit langer Zeit einer der tätigsten unter seinen Gesellen. "Halt!" tönte es ihnen plötzlich entgegen. Robin zuckte zusammen. Gerade vor ihnen an der großen Eiche hielt ein Ritter hoch
zu Ross, in blanker Rüstung, das Visier heruntergeklappt. "Was wollt Ihr hier im Walde?" rief Robin drohend. "Ich suche Robin Hood! Wisst ihr, wo ich ihn finde?" "Ich selber bin es! Was wollt
Ihr?"
"Den Sherwood-Wald von Geächteten befreien! Wir wissen von deinen Schandtaten und Gesetzwidrigkeiten, Robin Hood. Du weigerst dich, dem Prinzen Johann den schuldigen Gehorsam zu erweisen, du hast
hier im Walde wider alles Landrecht einen Haufen gesetzloser Gesellen um dich geschart, du hast das Lösegeld geraubt, das für unsern gefangenen König bestimmt war!" "Weil der verräterische Prinz
falsches Spiel getrieben hat!" rief Robin in wildem Zorn. "Ihr dient einem schlechten Herrn, Herr Ritter! Soll ich sagen, wo das Geld geblieben ist? Seinem rechten Zweck habe ich es zugeführt!
Meine Männer haben es übers Meer gebracht, um unsern geliebten König Richard aus der schmählichen Gefangenschaft freizukaufen..."
Bruder Tuck konnte nicht mehr an sich halten. "Lasst diese herausfordernde Sprache, Herr Ritter! Und nehmt den Helm ab, oder ich schlage ihn Euch vom Schädel!" Drohend hatte der streitbare Mönch
den schweren Knüppel erhoben. Willig folgte der fremde Ritter der Aufforderung, löste den Riemen und nahm den Helm vom Kopf. Wie auf eine Geistererscheinung blickten die beiden Männer auf den
Reiter. "König - König Richard!" brach Robin fast stammelnd aus und beugte das Knie. Der Mönch tat desgleichen. "Ihr seid wieder zurück, Majestät", sagte Robin. Erst langsam begann er, sich zu
fassen. "Vergebt mir, Majestät, das große Auftreten", sagte er dann, "ich ahnte ja nicht . . ."
"Ihr habt nicht zu bitten, Robin Hood. Mit mir ist ganz England in Eurer Schuld. In Eurer Schuld und der Eurer verwegenen Gesellen." Gütig lächelnd stieg der König vom Pferde. "Robin Hood", sagte
er. "Kniet nieder, hier an der Stätte, wo Ihr für die Freiheit gekämpft habt." Der König hatte sein Schwert gezogen und legte es dem Knienden auf die Schulter. "Robin Hood, ich schlage Euch
hiermit zum Ritter meiner Krone und ernenne Euch hiermit zum Herzog," sagte er, als Herzog von Locksley sollt Ihr das Land hier ringsum als Lehen aus meiner Hand übernehmen und für mich in Treue
verwalten. Erhebt Euch, Sir Robin!"
Hand in Hand schritten die beiden dem Waldlager zu. Bruder Tuck führte des Königs Streitross am Zügel. Mit wilden Heilrufen umringten die Geächteten den König und seinen neuen Herzog. "Ich weiß,
wo ich meine Freunde zu suchen habe", sagte König Richard. "Ich werde sie zu belohnen wissen, und sie sollen die Stelle in meinem Reiche einnehmen, die ihnen zukommt und die dem Reiche förderlich
ist!" Da breitete Robin seine Arme aus, als wollte er alle darin einschließen, und dann rief er, dass es hinauf klang bis zu den Baumkronen des Sherwood-Waldes: "Hoch Robins tollkühne Gesellen!"
England hatte seinen Frieden wieder gefunden.
Quelle: Sage aus England
Der schwarze Stier von Norroway

Vor langer Zeit lebte in Norroway eine Frau, die hatte drei Töchter. Eines Tages sagte die Älteste zur Mutter: "Mutter, back mir einen Kuchen und brat mir ein Stück Fleisch, denn ich will
fortgehen und mein Glück zu suchen." Die Mutter tat es, und die Tochter ging fort zu einem Waschweib,das zaubern konnte, um sich Rat zu holen. Die alte Frau forderte sie auf, bei ihr über Nacht
zu bleiben.
"Schau aus der Haustür und erzähl mir, was du siehst",sagte sie zu ihr. Am ersten Tage sah das Mädchen nichts und auch am folgenden Tage nichts. Am dritten Tage jedoch sah sie eine sechsspännige
Kutsche heranrollen. Sie lief zu der Alten und erzählte ihr, was sie gesehen hatte. "Gut", erwiderte das alte Weib, "das ist für dich." Da bestieg sie die Kutsche und fuhr mit ihr davon.
Bald darauf sagte die zweite Tochter: "Mutter back mir einen Kuchen und brat mir ein Stück Fleisch, denn ich will fortgehen und mein Glück suchen." Die Mutter tat es, und die Tochter ging fort
und kam zu dem alten Waschweib, in der es ihr erging wie ihrer Schwester. Am dritten Tag sah sie eine vierspännige Kutsche heranrollen, und die Alte sagte zu ihr: "Gut, die ist für dich." Sie
stieg ein, und die Kutsche fuhr mit ihr davon.
Eines Tages bat die jüngste Tochter ihre Mutter: "Mutter, back mir einen Kuchen und brat mir ein Stück Fleisch, denn ich will fortgehen und mein Glück suchen." Die Mutter gab ihr Kuchen und
Fleisch, und sie ging wie ihre beiden Schwestern zu dem Waschweib. Die alte Frau forderte auch diesmal das Mädchen auf, aus der Tür zu schauen und ihr zu sagen, was sie erblickte, und sie tat,
wie ihr geheißen. Am ersten Tag sah sie nichts, und auch am zweiten blickte sie vergeblich hinaus. Am dritten Tag aber sagte sie zu dem alten Weib, daß sie nichts Besonderes sehen könne, nur ein
großer schwarzer Stier käme des Weges. "Gut", erwiderte die Alte "der ist für dich."
Als das Mädchen das hörte, war sie vor Schrecken wie gelähmt, aber schließlich faßte sie Mut und setzte sich auf den Rücken des Stieres, der sich sogleich in Bewegung setzte. Wahrhaftig, sie
ritten und ritten, bis dem Mädchen vor Hunger ganz schlecht wurde. "Iß aus meinem rechten Ohr", sagte der Stier, - "und trinke aus meinem linken Ohr und heb auf, was übrigbleibt." Sie tat wie er
gesagt hatte, und ward wunderbar gestärkt. Die Reise ging weiter und weiter, bis sie in der Ferne ein schönes Schloß sahen.
"Dort müssen wir bis zum Abend sein", sagte der Stier, "dort wohnt mein ältester Bruder." Schon bald hatten sie das Schloß erreicht. Das Mädchen wurde von dem Rücken des Stieres gehoben und
freundlich willkommen geheißen. Der Stier wurde für die Nacht in einem Stall untergebracht. Am anderem Morgen wurde das Mädchen in ein schönes schimmerndes Gemach geführt. Sie bekam einen
wunderbaren Apfel überreicht mit den Worten: "Brich den Apfel erst durch, wenn du aus einer großen Not keinen Ausweg mehr weißt. Dann wird dir geholfen."
Danach wurde sie wieder auf den Rücken des Stieres gesetzt, und die Reise ging weiter. Nachdem sie lange Zeit geritten waren, sahen sie wieder in der Ferne ein schönes Schloß, und noch größer als
das erste. Da sagte der Stier zu dem Mädchen: "Dort müssen wir bis zum Abend sein, dort wohnt mein zweiter Bruder." Bald waren sie angelangt, und das Mädchen wurde wieder vom Rücken des Tieres
gehoben und ins Schloß geführt, den Stier aber schickte man für die Nacht aufs Feld. Am Morgen des nächsten Tages wurde das Mädchen in ein reich ausgestattetes Zimmer geleitet.
Dort gab man ihm die schönste Birne, die sie je gesehen hatte. Dann wurde ihr gesagt: "Brich die Birne erst durch, wenn du aus einer großen Not keinen Ausweg mehr weißt. Dann wird dir geholfen.
Sie wurde wieder auf den Rücken des Stieres gesetzt, und fort ging es. Lange ritten sie mit großer Geschwindigkeit, bis sie in der Ferne ein riesiges Schloß erblickten. Es war so groß, daß es
schon von weitem zu sehen war.
Der Stier sagte: "Wir müssen bis zum Abend dort sein, mein jüngster Bruder wohnt dort." Am Abend erreichten sie das Schloß, das Mädchen wurde wieder vom Rücken des Stieres gehoben und in das
Schloß geführt, der Stier aber für die Nacht auf das Feld geschickt. Am nächsten Morgen kam das Mädchen in ein prächtiges Gemach, dem schönsten von allen. Dort überreichte man ihr eine Pflaume
mit den Worten: "Brich die Pflaume erst durch, wenn du aus einer großen Not keinen Ausweg mehr weißt. Dann wird dir geholfen."
Wieder wurde das Mädchen auf den Rücken des schwarzen Stieres gehoben, und fort ging es. Sie ritten eine lange Zeit, bis sie in ein dunkles unwegsames Tal kamen, wo sie anhielten. "Hier mußt du
bleiben", sagte der Stier zu dem Mädchen: "Ich gehe fort, um mit Old Hun zu kämpfen." Du mußt dich auf diesen Stein setzen und darfst weder Hand noch Fuß bewegen, bis ich zurückkomme. Sonst werde
ich dich niemals wiederfinden. Wenn sich alles hier verfärbt, habe ich Old Hun geschlagen, aber wenn alles rot wird, so hat er mich besiegt."
Sie setzte sich auf den Stein, und nach und nach wurde alles um sie herum blau.Vor Freude vergaß sie sich, hob einen Fuß und kreuzte ihn über den anderen. Sie war so froh, daß ihr Gefäherte
siegreich gewesen war. Aber als der Stier kam, konnte er das Mädchen nicht finden. Lange saß sie da und wartete und weinte, bis sie müde wurde. Schließlich erhob sie sich und ging fort, sie wußte
nicht wohin. Sie wanderte, bis sie an einen gläsernen Berg kam. Sie versuchte ihn zu ersteigen, aber es gelang ihr nicht. Sie ging rund um den Berg herum und forschte nach einem Weg.
Da traf sie auf einen Schmied, und der versprach ihr, wenn sie ihm sieben Jahre diente, würde er ihr ein paar eiserne Schuhe anfertigen, mit der sie den Glasberg ersteigen konnte. Als die sieben
Jahre um waren, bekam sie die eisernen Schuhe und bestieg damit den gäserenen Berg. Oben stand das Haus des alten Waschweibs, und dort hörte sie von einem stattlichen jungen Mann, der dem
Waschweib über und über mit Blut beschmierten Kleidern zum Waschen gegeben hatte; wer sie sauber bekäme, der solle seine Frau werden.
Das alte Waschweib hatte gewaschen, bis sie erlahmte, und dann hatte ihre Tochter ebenfalls gewaschen. Beide wuschen und wuschen in der Hoffnung, den jungen Ritter zu gewinnen. Aber soviel sie
sich auch abmühten, sie konnten keinen einzigen Fleck herausbekommen. Als das Mädchen kam, überließen sie die Arbeit ihm, und es wusch die Flecken heraus. Das alte Weib erzählte aber dem Ritter,
daß ihre Tochter die Kleider gewaschen habe, und so mußte der Ritter die Tochter der Waschfrau heiraten.
Das fremde Mädchen war traurig, wenn sie daran dachte, denn sie liebte ihn sehr. Da fiel ihr der Apfel ein, den sie bekommen hatte, und sie brach ihn auf. Sie fand ihn mit Gold und Schmuck
gefüllt. "Das alles", sagte sie zu der Tochter; "will ich dir schenken, wenn du deine Hochzeit um einen Tag aufschiebst und mir erlaubst, in der Nacht allein in das Zimmer des Ritters zu
gehen."
Die Tochter willigte ein, aber das alte Weib hatte einen Schlaftrunk vorbereitet und ihn dem Ritter gegeben. Als er ihn getrunken hatte, sank er in so tiefen Schlaf, daß er bis zum nächsten
Morgen nicht erwachte. Die ganze Nacht schluchzte und sang das Mädchen neben seinem Bett: "Sieben lange Jahre diente ich, einen Glasberg habe ich erstiegen, die blutige Kleidung gewaschen. Willst
du nicht erwachen? Willst du mich nicht lieben?"
Am nächsten Morgen wußte sie vor Kummer nicht aus noch ein. Doch dann brach sie die Birne in zwei Teile und fand sie mit Schmuck gefüllt, der noch schöner und kostbarer war als der erste. Für
diesen Schmuck erbat sie sich wieder von der Tochter die Erlaubnis, die Nacht im Zimmer des jungen Ritters zu verbringen. Aber das alte Weib hatte ihn wiederum einen Schlaftrunk gegeben, und er
schlief fest bis zum frühen Morgen. Die ganze Nacht schluchzte und sang das Mädchen: "Sieben lange Jahre diente ich, einen Glasberg habe ich erstiegen, die blutigen Kleider gewaschen. Willst du
nicht erwachen? Willst du mich nicht lieben? Doch er schlief und sie verlor alle Hoffnung.
Als am nächsten Tag der Ritter auf der Jagd war, fragte ihn einer seiner Leute, was das Seufzen und Wehklagen zu bedeuten habe, das in den letzten Nächten aus seinem Schlafgemach komme. "Ich habe
nichts gehört", antwortete der Ritter. Aber der Knecht beteuerte ihm, daß es so war, und der Ritter nahm sich vor, in dieser Nacht wach zu bleiben. Das Mädchen war völlig verzweifelt, aber sie
wollte auch in der dritten Nacht noch einen Versuch machen und brach die Pflaume entzwei. Aus ihr leuchtete ihr der schönste Schmuck entgegen, den die Früchte bisher enthalten hatten, und sie gab
ihn wieder der Tochter für eine Nacht bei dem Ritter.
Als das alte Weib ihm aber den Schlaftrunk brachte, sagte er, er könne ihn ungesüßt nicht trinken. Sie eilte fort, um Honig zu holen, und inzwischen schüttete er den Trunk aus. Das alte Weib
glaubte, er habe ihn schon getrunken, und alle begaben sich zur Ruhe. Wie in den vorhergegangenen Nächten sang das Mädchen an seinem Bett: "Sieben lange Jahre diente ich, einen Glasberg habe ich
erstiegen, die blutigen Kleider gewaschen. Willst du nich erwachen? Willst du mich nicht lieben?
Diesmal hörte er es und wendete sich ihr zu. Sie erzählte ihm, was sie erlebt hatte, und er erzählte ihr von seinem Leben. Das Waschweib und ihre Tochter verbannte der Ritter in ein fremdes Land,
er heiratete das Mädchen, und sie lebten, soviel ich weiß, glücklich bis zum heutigen Tag.
Quelle: Joseph Jacobs 1890 "Schottisches Märchen."
Gulliver

Es war einmal ein englischer Arzt namens Gulliver, der ein außergewöhnliches Abenteuer erlebte. Nachdem er in Bristol an Bord der „Antilope“ gegangen war, die nach Ostindien segelte, fiel er
während eines heftigen Sturms ins Wasser. Das Schiff ging mit Mann und Maus unter. Gulliver hielt sich an einem Brett fest und kämpfte die ganze Nacht gegen die Wellen. Erst bei Tagesanbruch
beruhigte sich die See endlich und der Arzt wurde von der Strömung an einen einsamen Strand gespült. Völlig erschöpft, aber froh, dass er noch lebte, fiel er sofort in einen tiefen Schlaf. Die
Sonne stand bereits hoch, als er erwachte, er öffnete die Augen einen Spalt weit und wollte den Arm heben, um sich vor dem Sonnenlicht zu schützen. Doch seine Hand ließ sich nicht bewegen – sie
wurde festgehalten. Auch den anderen Arm konnte er nicht rühren, als er versuchte den Kopf zu heben, bemerkte er, dass seine Haare am Boden befestigt waren. Die Beine steckten ebenfalls fest. Er
nahm ein undeutliches Stimmengeschwirr um sich herum wahr, doch weil er ja nur den Himmel sehen konnte, begriff er nicht, was vor sich ging.
Plötzlich bewegte sich etwas Lebendiges auf seinem Bein, stieg herauf zur Brust und gelangte zum Kinn. Gulliver versuchte, nach unten zu schauen und bemerkte voller Verwunderung einen winzigen
Mann vor sich. Er war sehr malerisch angezogen, vielleicht fünfzehn Zentimeter groß und von oben bis unten mit einem Bogen und Pfeilen bewaffnet. Mit einer gewaltigen Anstrengung gelang es
Gulliver, den rechten Arm zu befreien, so dass er sich auf die Seite drehen konnte. Jetzt sah er, dass eine riesige Menge winziger Männer ihn mit Stricken am Boden festgebunden hatten. Er nahm
das kleine Wesen vor sich in die Hand und versuchte, nachdem er auch den anderen Arm befreit hatte, ihm mit einer Geste zu erklären, dass er sehr durstig war. Der kleine Mann ließ einen schrillen
Pfiff los und kurz darauf kamen Wagen an, die mit Fässern voll köstlichem Wein beladen waren. Gulliver leerte mehr als fünfzig davon. Dann gaben sie ihm auch Brote, die so groß waren wie
Schrotkügelchen. Während der ganzen Zeit hielt Gulliver vorsichtig den Soldaten, der aussah wie ein Kommandant, als Geisel in der Hand. Jetzt hatten sowohl Gulliver als auch die kleinen Männer
begriffen, dass keiner von ihnen böse Absichten hegte. Der Arzt musste sehr aufpassen, dass er niemand zerquetschte, wenn er sich bewegte. Die kleinen Männer gaben ihm durch Gesten zu verstehen,
dass er aufstehen und mit ihnen kommen solle.
Es war ein Miniaturland, das Gulliver zu sehen bekam: Bäume, Flüsse, alles stand im Verhältnis zu den merkwürdigen kleinen Wesen. Sie gelangten in eine Stadt und Gulliver, der sich sehr
vorsichtig bewegte, wurde zu einem Turm geführt, wo ihn scheinbar sehr wichtige Personen erwarteten. Und wirklich war unter ihnen der Kaiser. Mit einem großen Lautsprecher sprachen sie von Turm
aus mehrfach das Wort: „Liliput“ aus. Gulliver verstand, dass dies der Name des seltsamen Landes war, in dem er sich befand. Man brachte ihn in der Nähe des Turms in einem Gebäude unter, das den
Liliputanern riesig vorkommen musste. Der Arzt ließ sich einen Fuß anketten, er wusste ja, dass er sich im Notfall befreien konnte. In den folgenden Tagen erholte sich Gulliver vom Schrecken des
Schiffsbruchs; er war froh, noch zu leben, wenn auch in einer so ungewöhnlichen Lage. Die Liliputaner besorgten ihm zu essen, was er nur wollte. Nach und nach gelang es ihnen, sich miteinander zu
verständigen, indem sie große Schilder benutzten, auf die Gulliver und einige Gelehrte abwechselnd große Buchstaben schrieben, jeder in seiner Sprache.
Die Beziehungen zum Kaiser von Liliput waren gut, jeden Tag kam eine riesige Menge herbei, um Gulliver zu bestaunen und jeder brachte Lebensmittel als Geschenk mit. Eines Tages wollte Gulliver
allen imponieren, indem er mit einem Pistolenschuss in die Luft abfeuerte. Das machte großen Eindruck, doch auch Gulliver konnte nicht ahnen, dass sich von jetzt an sein Schicksal ändern sollte.
Gulliver hatte vom Schiffbruch den Degen, die Pistole, seine Uhr, ein kleines Tagebuch, sein Rasiermesser, ein paar Münzen und einen alten Kamm retten können. Der Kaiser wollte wissen, wie
Gulliver diese Gegenstände gebrauchte. Besonders verblüfft war er, als er sah, wie Gulliver mit einem einzigen Degenhieb eine ganze Gruppe von Bäumen fällte. Jetzt, wo er anfing ihre Sprache zu
verstehen, lernte Gulliver viel über die Gewohnheiten der Liliputaner und er verstand auch, warum viele von ihnen bewaffnet waren.
Jenseits des Meeres gab es eine Insel namens Blefuscu, deren Bewohner seit langer Zeit Feinde der Liliputaner waren. Schon oft hatte Liliput die Attacken Blefuscus abgewehrt. Eines Tages kam
plötzlich ein Bote des Kaisers angerannt und bat Gulliver, sich sofort zum kaiserlichen Palast zu begeben, weil der Kaiser ihn sprechen müsse. Natürlich erwartete Gulliver ihn im Hof des
Palastes, da er wegen seiner Größe nicht eintreten konnte. Der Kaiser erklärte ihm, dass der Krieg unmittelbar bevorstehe, denn einige Spione haben ihm berichtet, dass die Flotte von Blefuscu
bereit war, in See zu stechen und Liliput anzugreifen. Er fragte daher Gulliver, ob er bereit sei, den Lilputanern zu helfen, sich gegen diesen Angriff zu verteidigen. Der sagte zu, stellte aber
zwei Bedingungen. Die erste war, dass es keine Opfer geben dürfe, die zweite, dass der Kaiser ihm im Falle eines Sieges helfen sollte, in diese Welt zurückzukehren, aus der er gekommen war.
Gulliver ließ sich darauf erklären, wo Blefuscu genau lag und wo sich der Hafen befand. Dann bat er, mit einem Lot die Tiefe des Meers auszumessen, das die Insel umgab. Als er erfuhr, dass ihm
das Wasser an den tiefsten Punkten nur bis zur Taille reichte, also nicht mehr als zwölf liliputanische Meter tief war, begann er, einen Angriffsplan auszuarbeiten. Er wartete einen Tag ab, an
dem ein lichter Nebel das Meer bedeckte und gelangte zum Hafen von Blefuscu, indem er zu Fuß durchs Wasser ging. Dort riss er aus Entsetzen der kleinen Inselbewohner die Ankertaue der Schiffe
heraus, mit denen sie Liliput angreifen wollten. Nachdem die Schiffe ins offene Meer gezogen hatten, versenkte er sie. Jetzt war Liliput sicher! Gulliver glaubte, auf diese Weise alle Probleme
gelöst zu haben, aber er wusste nicht, dass der Kaiser sein Versprechen, ihn freizulassen, nicht halten würde. Tatsächlich entschloss sich der Kaiser, nachdem er ihm einen schwarzen Hut geschenkt
hatte, der von vierundzwanzig Schneidern genäht war, ihm nicht beim Verlassen der Insel zu helfen.
Gulliver war für den Kaiser zu wertvoll geworden, der jetzt sogar davon träumte, Blefuscu zu unterwerfen. Aber der Kommandant der Wachen, der ihn zuerst am Strand gefunden hatte, sagte zu
Gulliver: „Wenn du nicht tust, was er will, lässt der Kaiser dich vergiften!“ Dieses Mal bekam Gulliver wirklich Angst. Das Gift war eine Waffe, vor der er sich nicht verteidigen konnte. Daher
entschloss er sich zur Flucht. Eines Nachts lud er alle Sachen auf ein Schiff, zog es hinter sich her und durchquerte auf diese Weise erneut das Meer bis Blefuscu. Dort angekommen, verlangte er
sogleich, den König der Insel zu sprechen, dem er den Grund seines Tuns erklärte: „Solange ich euch beschütze, kann Liliput euch niemals angreifen! Dafür müsst ihr mir helfen, in meine Welt
zurückzukehren.“ Dem König von Blefuscu kam es vor wie ein Wunder: Nachdem seine Flotte zerstört war, wendete sich das Geschick zu seinen Gunsten!
Gulliver war in Blefuscu willkommen, und als er um Hilfe bat, stellten ihm alle zur Verfügung. Als erstens verlangte Gulliver, die Inselküste abzusuchen. Sie sollten ihm sagen, ob sich irgendein
Stück vom Meer angespültes Strandgut finden ließ. Die Suche hatte schließlich ein unverhofftes Ergebnis. In der Nähe eines Felsens, der übers Meer ragte, fanden sie den Rumpf eines Beibootes im
Sand begraben, das ein Sturm ans Meer geworfen hatte. Gulliver eilte sofort herbei, um es zu sehen, und stellte fest, dass es ihm vielleicht gelingen könnte, es nach langer Arbeit und mit
Unterstützung der Bewohner von Blefuscu wiederherzustellen. Mit den winzigen Bäumen von Blefuscu dauerte es Monate, um das Boot zu reparieren....bis dann der große Tag kam.
Eine ganze Woche schleppten Heerscharen von Blefuscanern Wasser und Essen zum Boot. Als Gulliver sich zur Abreise entschloss, winkten ihm tausende winzige Taschentüchlein. Nach einigen kräftigen
Ruderstößen war Blefuscu nur noch ein kleiner Punkt am Horizont. Tag für Tag ruderte Gulliver, bis er feststellte, dass das Boot auch ohne zu rudern schnell vorankam. Eine starke Strömung trieb
es an, während ein geheimnisvoller Nebel aufs Meer sank. Schließlich lichtete sich der Nebel wie durch einen Zauber und Gulliver sah Möwen am Himmel: Es waren ungewöhnliche Möwen, die nicht so
winzig waren wie die liliputanischen.
Endlich war er in seine Welt zurückgekehrt.
Quelle: Ein Märchen aus England
Die Vogelschlacht
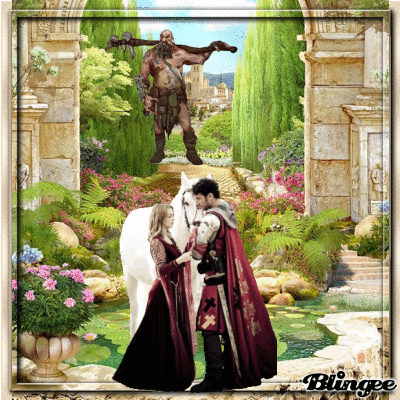
Vor langer, langer Zeit rüsteten alle vierfüßigen Tiere gegen die Vögel zum Krieg. Der Sohn des Königs von Tethertown sagte, er wolle ausziehen, um die Schlacht zu sehen und seinem Vater zu
berichten, wer dieses Jahr König der Tiere sein werde. Als er ankam, war die Schlacht bereits vorüber, nur ein Rabe und eine Schlange waren noch in heftigem Kampfe begriffen, und es schien, als
sollte die Schlange den Sieg über den Raben davontragen. Als dies der Königssohn sah, eilte er dem Raben zu Hilfe und schlug mit einem Hiebe der Schlange den Kopf ab. Sobald der Rabe sich von
seiner Erschöpfung erholte und die Schlange tot daliegen sah, sprach er: »Für den Dienst, den du mir erwiesen hast, will ich dir etwas zeigen. Setze dich dorthin, wo meine beiden Flügel
sprießen.«
Der Königssohn bestieg den Raben, und der trug ihn, ohne anzuhalten, über sieben Berge, sieben Täler und sieben Heiden. »Nun denn,« sagte der Rabe, »siehst du jenes Haus dort? Darauf gehe jetzt
los. Drinnen wohnt eine Schwester von mir, ich bürge dafür, dass du willkommen bist. Und wenn sie dich fragt: Bist du bei der Vogelschlacht dabei gewesen? so sage Ja. Und wenn sie dich fragt:
Hast du mein Ebenbild gesehen? so sage: Ja. Aber vergiss nicht, mich morgen früh bestimmt an dieser Stelle zu treffen.« Der Königssohn wurde in dieser Nacht vortrefflich bewirtet. Er bekam von
jeder Speise zu essen, von jedem Getränke zu trinken, warmes Wasser für seine Füße und ein weiches Bett für seine Glieder.
Am folgenden Tage trug ihn der Rabe wieder über sieben Berge, sieben Täler und sieben Heiden. In weiter Ferne stand eine Hütte, aber so weit es auch war, sie waren doch bald zur Stelle. Er wurde
wieder vortrefflich bewirtet; er bekam Speise und Trank in Hülle und Fülle, warmes Wasser für die Füße und ein weiches Bett für seine Glieder. Geradeso ging es am folgenden Tage. Am dritten
Morgen war der Rabe nicht zur Stelle; aber was glaubt Ihr wohl, wen der Königssohn sah? Einen wunderschönen Jüngling mit einem Bündel in der Hand. Der Königssohn fragte ihn, ob er nicht einen
großen, schwarzen Raben gesehen hätte. Da sagte der Jüngling zu ihm: »Du wirst den Raben niemals wieder sehen, denn der Rabe war ich. Ich war verzaubert, und du hast mich erlöst, dafür bekommst
du dieses Bündel zum Lohn. Jetzt gehe denselben Weg wieder zurück und schlafe jede Nacht in demselben Hause wie gestern und vorgestern; aber du darfst das Bündel nicht verlieren, bis du an dem
Orte bist, der dir auf Erden am besten gefällt.«
Der Königssohn wandte dem Jünglinge den Rücken und sein Antlitz dem Vaterhause zu, und wieder wurde er von den Schwestern des Raben bewirtet, wie die Abende vorher. Als er sich schon dem Hause
seines Vaters näherte, führte der Weg durch einen dichten Wald. Das Bündel schien ihm immer schwerer zu werden, und er wurde begierig, zu sehen, was es enthielt. Wie erstaunt war er, als er das
Bündel öffnete! In einem Augenblick stand die größte Herrlichkeit vor ihm; ein großes Schloss und ein Garten ringsum, in welchem sich alle Arten von Früchten und Kräutern befanden. Voll
Verwunderung und Bedauern sah er, dass er nicht imstande war, das Bündel wieder zu schließen; wie gerne hätte er die ganze Herrlichkeit in dem schönen grünen Tale gegenüber dem Hause seines
Vaters gesehen! Wie er von dem Bündel aufsah, stand plötzlich ein Riese vor ihm.
»Auf einem schlechten Platze, o Königssohn, hast du dein Haus gebaut,« sagte der Riese. »Gegen meinen Wunsch und zu meinem Schmerze ist es hieher geraten,« sagte der Königssohn. »Was gibst du
mir, wenn ich alles wieder in das Bündel tue, wie es zuvor war?« fragte der Riese. »Was verlangst du von mir?« fragte der Königssohn. »Gib mir deinen erstgeborenen Sohn, wenn er das Alter von
sieben Jahren erreicht hat,« sagte der Riese. »Wenn ich einen Sohn bekomme, sollst du ihn haben,« sagte der Königssohn. Im Nu tat der Riese Schloss und Garten wieder in das Bündel. »Nun,« sagte
er, »gehe du deinen Weg, und ich gehe meinen; aber gedenke deines Versprechens, und wenn du es auch vergessen solltest, ich werde es im Gedächtnis behalten.«
Der Königssohn machte sich auf den Weg, und nach wenigen Tagen erreichte er den Ort, der ihm auf der Welt der liebste war. Er öffnete das Bündel, und die Herrlichkeit war richtig darin wie zuvor.
Als er aber das Tor des Schlosses öffnete, sah er die schönste Jungfrau, der er jemals begegnet war. »Tritt ein, o Königssohn,« sprach sie, »alles ist für dich bereit, wenn du mich noch heute
heiraten willst.« »Von Herzen gern!« sagte der Königssohn, und so wurden sie noch am selben Tage getraut. Als aber sieben Jahre und ein Tag um waren, kam der Riese auf das Schloss. Der Königssohn
hatte sein Versprechen nicht vergessen, hatte aber bis jetzt seiner Frau nichts davon gesagt. »Überlasse das nur mir,« sagte die Königin.
»Heraus mit deinem Sohne!« sagte der Riese, »denke an dein Versprechen.« »Du sollst ihn haben,« antwortete der König, »wenn ihn seine Mutter für die Reise ausgestattet hat.« Die Königin aber zog
dem Sohne des Kochs schöne Kleider an und übergab ihn dem Riesen. Sie machten sich auf den Weg; als sie eine Strecke gegangen waren, gab der Riese dem Knaben eine Rute in die Hand und sprach:
»Wenn dein Vater diese Rute in der Hand hätte, was würde er tun?« »Wenn mein Vater die Rute in der Hand hätte, so würde er damit die Hunde und Katzen von den Speisen des Königs wegscheuchen,«
sagte der Knabe. »Du bist der Sohn des Kochs,« sagte der Riese, packte ihn bei den Knöcheln und schlug ihn gegen einen der Felsen, die sich rechts und links erhoben.
Darauf eilte er in wütendem Zorne zum Schlosse zurück und schrie, man solle den Königssohn herausgeben, sonst werde er das Oberste zu unterst kehren. Da sprach die Königin zum König: »Wir wollen
es noch einmal versuchen; der Sohn des Kellermeisters ist im selben Alter wie unser Kind.« Sie zog dem Sohne des Kellermeisters schöne Kleider an und übergab ihn dem Riesen. Er war nicht weit
gegangen, als er dem Knaben die Rute in die Hand gab. »Wenn dein Vater diese Rute hätte, was würde er tun?« »Er würde damit die Hunde und Katzen von den Gläsern und Flaschen verscheuchen,«
antwortete das Kind. »Du bist der Sohn des Kellermeisters,« rief der Riese und erschlug auch ihn an der Felswand. Er kehrte in fürchterlicher Wut zurück; die Erde erbebte unter seinen Tritten,
und das Schloss mit allem, was darin war, zitterte. »Heraus mit deinem Sohne!!!« schrie er, »sonst wird das Oberste zu unterst gekehrt.« Da mussten sie ihm denn das Kind übergeben.
Der Riese brachte den Knaben in sein Haus und erzog ihn als seinen eigenen Sohn. Eines Tages, als der Riese fortgegangen war, hörte der Knabe die süßeste Musik, die er jemals vernommen hatte; sie
kam von einem Zimmer im höchsten Stockwerke des Hauses her. Wie er hinaufsah, erblickte er das schönste Fräulein, das ihm jemals begegnet war. Sie winkte ihm, näher zu kommen und sprach: »Morgen
wird mein Vater es dir freistellen, eine meiner beiden Schwestern zu heiraten; du aber sage, du wollest keine von ihnen, sondern mich zur Frau. Mein Vater will mich an den König der grünen Stadt
verheiraten, aber ich kann ihn nicht ausstehen.« Am folgenden Tage führte ihm der Riese seine drei Töchter vor und sprach: »Sohn des Königs von Tethertown, es soll dein Schade nicht sein, dass du
so lange in meinem Hause gelebt hast. Du darfst dir eine von meinen zwei ältesten Töchtern zur Frau aussuchen und darfst mit ihr am Tage nach der Hochzeit in deine Heimat ziehen.«
»Wenn du mir,« sagte der Königssohn, »diese hübsche Kleine geben willst, so nehme ich dich beim Wort.« Der Riefe wurde furchtbar zornig und sprach: »Bevor du sie zur Frau bekommst, musst du drei
Dinge verrichten.« »Lass hören,« sagte der Königssohn. Da führte ihn der Riese in den Stall und sprach: »Hier siehst du den Dünger von hundert Ochsen und Kühen, der seit sieben Jahren nicht
weggeräumt wurde; ich gehe heute vom Hause fort, und wenn dieser Stall nicht bis zum Abend gereinigt ist, so dass ein goldener Apfel von einem Ende bis zum anderen rollt, so wirst du meine
Tochter nicht bekommen, und dein Blut wird noch heute meinen Durst löschen.«
Der Königssohn begann den Stall zu reinigen, aber es war gerade so, als hätte er es versucht, das große Meer auszuschöpfen. Um die Mittagszeit, als ihm der Schweiß in Strömen von der Stirne rann,
kam die Königstochter zu ihm und sprach: »Jetzt bist du gestraft, o Königssohn!« »Ach ja,« sagte er. »Komme zu mir herüber,« sprach sie, »und ruhe dich aus.« »Das will ich,« sagte er, »sowieso
gehe ich dem Tode entgegen.« Er setzte sich neben sie und schlief vor Müdigkeit ein. Als er erwachte, war die Königstochter nicht zu sehen, aber der Stall war so gründlich gereinigt, dass ein
goldener Apfel von einem Ende zum anderen rollen konnte.
Da kam der Riese herein und sagte: »Königssohn, hast du den Stall gereinigt?« »Jawohl,« antwortete er. »Jemand hat ihn gereinigt,« sagte der Riese. »Du hast es gewiss nicht getan,« sagte der
Königssohn. »Schon gut,« sagte der Riese, »da du heute so fleißig gewesen bist, so gebe ich dir Zeit bis morgen um dieselbe Stunde, den Stall mit Flaumfedern zu decken, aber nicht zwei von ihnen
dürfen die gleiche Farbe haben.«
Der Königssohn stand vor der Sonne auf, nahm Bogen und Pfeile und ging hinaus, um die Vögel zu töten. Er lief hinter ihnen her, bis ihm der Schweiß von der Stirne rann. Um die Mittagsstunde kam
die Tochter des Riesen daher. »Königssohn, du verschwendest deine Kraft,« sagte sie. »Ach ja,« antwortete er, »ich habe erst zwei Amseln geschossen, und beide sind von der gleichen Farbe.« »Komm'
herüber und ruh' dich aus,« sagte sie. »Recht gerne,« antwortete er. Er ging zu ihr hinüber, setzte sich neben sie und schlief vor Ermüdung ein. Als er erwachte, war die Tochter des Riesen
verschwunden, der Stall aber war mit Federn gedeckt.
Der Riese kam nach Hause und sprach: »Königssohn, hast du den Stall gedeckt?« »Jawohl,« antwortete er. »Jemand hat ihn gedeckt,« sagte der Riese. »Du hast es gewiss nicht getan,« sagte der
Königssohn. »Schon gut,« sagte der Riese, »gib acht. Neben jenem See dort steht ein Fichtenbaum, in dessen Wipfel hat eine Elster ihr Nest. Die Eier, die du in dem Neste finden wirst, muss ich zu
meiner ersten Mahlzeit haben, nicht eines von ihnen darfst du zerbrechen, und es sind ihrer fünf in dem Neste.«
Früh am Morgen ging der Königssohn aus, um den Baum zu suchen, und es war auch nicht schwer, ihn zu finden; es gab nicht seinesgleichen im ganzen Wald. Er maß von der Wurzel bis zum ersten Zweige
fünfhundert Fuß. Ratlos ging der Königssohn immer wieder um den Baum. Da kam sie, die ihm stets Hilfe brachte in der Not. »Der Baum schindet dir die Haut von Händen und Füßen,« sprach sie. »Ach
ja,« sagte er, »ich bemühe mich umsonst, auf den Baum zu gelangen.« »Es ist keine Zeit zu verlieren,« sagte die Tochter des Riesen, steckte einen Finger nach dem anderen in den Baum und machte so
eine Leiter für den Königssohn, damit er zum Neste der Elster gelange.
Als er oben beim Neste war, rief sie: »Spute dich jetzt mit den Eiern, denn ich spüre den Atem meines Vaters im Rücken.« In der Eile ließ sie den kleinen Finger im Wipfel des Baumes stecken.
»Jetzt,« sprach sie, »eile mit den Eiern nach Hause, und noch heute werde ich deine Frau, wenn du mich erkennst. Ich und meine beiden Schwestern werden ganz gleich gekleidet sein und ganz gleich
aussehen. Wenn nun mein Vater sagt: 'Königssohn, nimm' dir deine Frau,' so wirst du mich an der Hand erkennen, an welcher der kleine Finger fehlt.«
Er ging hin und übergab dem Riesen die Eier. »Schon gut,« sagte der Riese, »jetzt mache dich für die Hochzeit bereit.« Wirklich fand die Hochzeit statt. War das eine Hochzeit! Riesen und
Edelleute und der Sohn des Königs von der grünen Stadt waren unter den Gästen. Nachdem sie getraut worden waren, begann der Tanz. War das ein Tanz! Das Haus des Riesen erdröhnte vom First bis in
den Keller. Dann sagte der Riese: »Königssohn, jetzt suche dir deine Frau.« Sie streckte die Hand aus, an welcher der kleine Finger fehlte, und er nahm sie bei der Hand.
»Du hast es auch diesmal getroffen,« sagte der Riese, »aber wer weiß, vielleicht werden wir uns noch in anderer Weise begegnen.« Als sie sich zur Ruhe begaben, sagte sie: »Du darfst nicht
schlafen, sonst geht es dir ans Leben. Wir müssen fliehen, schnell, schnell, sonst wird dich mein Vater töten.« Sie gingen hinaus und setzten sich auf das graue Füllen des Riesen. »Warte eine
Weile,« sagte sie, »ich habe vorher noch einiges zu verrichten.« Sie eilte hinein, schnitt einen Apfel in neun Stücke, legte zwei Stücke zu Häupten des Bettes, zwei zu Füßen des Bettes, zwei vor
die Küchentür, zwei vor das große Tor und ein Stück draußen vor das Haus.
Der Riese erwachte und rief: »Schlaft Ihr schon?«
»Noch nicht,« rief der Apfel zu Häupten des Bettes.
Nach einer Weile wiederholte er seine Frage.
»Noch nicht,« rief der Apfel zu Füßen des Bettes.
Nach einer Weile wiederholte er von neuem seine Frage.
»Noch nicht,« antwortete der Apfel vor der Küchentüre.
Noch einmal rief sie der Riese an; diesmal antwortete der Apfel vor dem großen Tore.
»Ihr geht ja von mir fort,« rief der Riese.
»Noch nicht,« antwortete der Apfel draußen vor dem Hause.
»Ihr entflieht ja,« rief der Riese, sprang auf und gieng zum Bette; das aber war kalt und leer.
»Das sind die Streiche meiner Tochter,« sagte der Riese, »ihnen nach!«
Bei Tagesanbruch sagte die Tochter des Riesen: »Ich spüre den Atem meines Vaters im Rücken. Schnell, stecke deine Hand in das Ohr des grauen Füllens, und was du darin findest, wirf hinter dich!«
»Es ist ein Zweiglein von einem Schlehenbusch,« sagte er. »Wirf es hinter dich,« antwortete sie. Kaum hatte er dies getan, als sich ein zwanzig Meilen langer Wald von dichtem Schlehdorngestrüpp
erhob, so dicht, dass kaum ein Wiesel hindurchzuschlüpfen vermochte. Der Riese prallte gegen das Gestrüpp und zerriss sich Kopf und Nacken an den Dornen. »Wieder die Streiche meiner Tochter,«
sagte der Riese, »hätte ich nur Axt und Messer bei mir, es würde mir nicht schwer werden, einen Pfad durch den Wald zu hauen.« Er eilte nach Hause, holte sich Axt und Messer, war im Nu zurück,
und wie war er hinter der Arbeit her! Bald war der Weg durch das Gestrüpp gebahnt. »Jetzt lass ich Axt und Messer hier, bis ich zurückkomme,« sprach er. »Wenn du sie hier lässt,« sagte eine
Krähe, »so werden wir sie stehlen.« Der Riese trug Axt und Messer nach Hause zurück.
Um die Zeit der Mittagsglut spürte die Tochter des Riesen den Athem ihres Vaters im Rücken. »Stecke deinen Finger in das Ohr des Füllens und wirf hinter dich, was du darin findest.« Er zog einen
Splitter grauen Sandsteines hervor, und im Nu erhob sich ein Gebirge von grauem Sandstein, zwanzig Meilen breit und zwanzig Meilen hoch, hinter ihnen. Der Riese prallte gegen das Gestein, aber er
konnte nicht hindurch. »Die Streiche meiner Tochter geben mir zu schaffen,« sagte der Riese, »hätte ich Hammer und Stange bei mir, so würde es mir nicht schwer werden, mir auch durch das Gestein
einen Weg zu brechen.« Es blieb ihm nichts anderes übrig, als umzukehren, um Hammer und Stange zu holen. Wie war er hinter der Arbeit her! Alsbald war der Weg durch das Gestein gebrochen. »Jetzt
lass ich mein Werkzeug hier und kehre nicht zurück.« »Wenn du sie hier lässt,« sagte die Krähe, »so werde ich sie stehlen.« »Tu' das, wenn du willst, ich habe keine Zeit, zurückzugehen.«
Beim Anbruch der Nacht sagte die Tochter des Riesen: »Ich spüre den Atem meines Vaters im Rücken. Königssohn, suche im Ohre des Füllens, sonst sind wir verloren.« Diesmal fand er eine Blase voll
Wasser im Ohr. Er warf sie hinter sich, und im Nu erstreckte sich ein Süßwassersee, zwanzig Meilen breit und zwanzig Meilen lang, hinter ihnen. Der Riese eilte spornstreichs mitten in den See,
ging unter und ward nicht mehr gesehen. Am nächsten Tage erblickten sie das Haus, das dem Vater des Königssohnes gehörte. Da sprach die Tochter des Riesen: »Mein Vater ist tot, von ihm haben wir
also nichts mehr zu befürchten. Bevor wir aber weitergehen, begib du dich in das Haus deines Vaters und sag' ihm, wer mit dir gekommen ist. Nimm dich aber wohl inacht, dass weder Mensch noch Tier
dich küsse, sonst wirst du vergessen, dass du mich jemals gesehen hast.«
Jedermann, der ihn traf, hieß ihn herzlich willkommen, und er ließ sich weder vom Vater, noch von der Mutter küssen. Aber das Unglück wollte, dass ein Windspiel ihn erkannte und vor Freude an ihm
hinaufsprang und seinen Mund beleckte. Darauf entschwand ihm die Tochter des Riesen aus dem Sinn. Sie hatte sich an den Brunnenrand gesetzt, als sie der Königssohn verlassen hatte, und sie
wartete vergeblich auf seine Rückkehr. Beim Einbruche der Nacht kletterte sie auf einen Eichenbaum neben dem Brunnen und brachte die ganze Nacht dort zu. Ein Schuhmacher wohnte in der Nähe, und
um die Mittagszeit des folgenden Tages hieß er seine Frau zum Brunnen gehen, um ihm einen Trunk Wasser zu holen. Als sie zum Brunnen kam und den Schatten im Wasser sah, der von der Tochter des
Riesen herrührte, hielt sie ihn für ihren eigenen und war über ihre Schönheit so erstaunt, dass ihr das Gefäß auf den Boden fiel und zerbrach; so kehrte sie denn ohne Gefäß und Wasser ins Haus
zurück.
»Wo ist denn das Wasser, Frau?« fragte der Schuhmacher. »Du krummbeiniges, altes Scheusal, ich bin lange genug deine Magd gewesen.« »Frau, ich glaube, du hast den Verstand verloren. Geh' du,
meine Tochter, schnell, und hole deinem Vater einen Trunk Wasser.« Wie es der Mutter ergangen war, so erging es der Tochter. »Wo ist das Wasser?« fragte der Vater. »Du jämmerlicher Flickschuster,
ich bin viel zu gut für dich, suche dir eine andere Magd.« Der arme Schuhmacher meinte, sie wären beide um den Verstand gekommen und ging selbst zum Brunnen. Er sah den Schatten der Jungfrau im
Wasser, und wie er zum Baum hinaufblickte, sah er das schönste Weib, dem er jemals begegnet war.
»Du hast einen unsicheren Platz, aber ein schönes Gesicht,« sagte er, »komm' herunter, du kannst dich eine Zeitlang in meinem Hause nützlich machen.« Der Schuhmacher merkte, dass es ihr Schatten
war, der Frau und Tochter um den Verstand gebracht hatte. Er nahm sie in sein Haus und sagte ihr, dass er wohl nur eine ärmliche Hütte besitze, dass er aber alles ehrlich mit ihr teilen wolle.
Nach einigen Tagen kamen mehrere Edelleute in das Haus des Schuhmachers, um Schuhe zu kaufen, denn der Königssohn war zurückgekehrt, und seine Hochzeit stand bevor. Sie sahen die Tochter des
Riesen und waren von ihrer Schönheit geblendet.
»Du hast eine schöne Tochter,« sagten sie zum Schuhmacher. »Sie ist wohl schön,« antwortete er, »aber nicht meine Tochter.« »Der Tausend,« sagte einer von ihnen, »ich würde es mich hundert Pfund
kosten lassen, könnt' ich sie zur Frau bekommen.« Die anderen Edelleute sagten dasselbe. Da sagte der Schuhmacher, dass er keinerlei Macht über sie besitze. Als die Schuhe fertig waren und der
Schuhmacher im Begriffe war, sie in das Schloss des Königs zu tragen, sagte die Tochter des Riesen: »Ich möchte gerne den Königssohn sehen, bevor er sich vermählt.« »So komm' mit mir,« antwortete
der Schuhmacher, »die Diener im Schlosse kennen mich wohl, und du sollst den Königssohn und die ganze Gesellschaft sehen.«
Als die Edelleute die schöne Jungfrau erblickten, führten sie sie in den Hochzeitssaal und boten ihr ein Glas Wein an. Sie führte das Glas zum Munde, da züngelte eine Flamme daraus hervor, und
eine goldene und eine silberne Taube flogen heraus. Während sie im Saale herumflogen, fielen drei Gerstenkörner auf den Boden. Die silberne Taube eilte auf sie zu und pickte sie auf. Da sagte die
goldene Taube zu ihr: »Dächtest du daran, wie ich den Stall reinigte, so würdest du nicht essen, ohne mir meinen Anteil zu geben.«
Wieder fielen drei Gerstenkörner zu Boden, und wieder aß sie die silberne Taube wie zuvor. »Dächtest du daran, wie ich den Stall deckte, so würdest du nicht essen, ohne mir meinen Anteil zu
geben,« sagte die goldene Taube. Und wieder fielen drei Körner zu Boden, und wieder aß sie die silberne Taube. »Dächtest du daran, wie ich das Nest der Elster aushob,« sagte die goldene Taube,
»so würdest du nicht essen, ohne mir meinen Anteil zu geben. Ich habe dabei meinen kleinen Finger verloren, und er fehlt mir noch jetzt.«
Da kehrte dem Königssohne das Gedächtnis zurück, und er wusste, wer sie war. Er eilte auf sie zu und küsste sie von der Hand bis zum Mund. Und als der Priester kam, wurden sie zum zweitenmale
vermählt.
Anna Kellner: Englische Märchen
Die Sterne am Himmel

Es war einmal ein kleines Mädchen, das weinte vom Morgen bis zum Abend, es wollte die Sterne vom Himmel haben, um damit zu spielen. Kein Spielzeug war ihr recht, sie verlangte immer nur nach den
Sternen. So gieng sie denn eines Tages fort, um sie zu suchen. Und endlich kam sie zu einem Mühlenwehr. »Guten Tag,« sagte sie, »ich suche die Sterne vom Himmel, um damit zu spielen, hast du
keine gesehen, Wehr?« »Jawohl, mein hübsches Kind,« sagte das Wehr, »sie scheinen mir in der Nacht gerade ins Gesicht, so dass ich nicht schlafen kann. Spring' nur herein, vielleicht findest du
einen.« Sie sprang hinein und schwamm immer weiter und weiter, aber sie sah keinen einzigen Stern. Da ging sie weiter, bis sie zu einem Bächlein kam.
»Guten Tag, Bächlein,« sagte sie, »ich suche die Sterne vom Himmel, um damit zu spielen, hast du keine gesehen, Bächlein?« »Oh ja, mein schönes Kind,« sagte das Bächlein, »in der Nacht scheinen
sie an meinen Ufern. Plätschere nur ein wenig herum, vielleicht findest du einen.« Sie sprang hinein und plätscherte und plätscherte, aber sie fand keinen einzigen Stern. Da ging sie weiter, bis
sie zu den Elfen kam. »Guten Tag, liebe Elfen,« sagte sie, »ich suche die Sterne vom Himmel, um damit zu spielen, habt ihr vielleicht einen gesehen?« »Gewiss, mein liebes Kind,« sagten die Elfen,
»des Nachts scheinen sie auf das Gras. Tanze mit uns, da wirst du vielleicht einen finden.« Und sie tanzte und tanzte, aber sie fand keinen einzigen Stern. Da setzte sie sich hin, und sie
weinte.
»Ach, liebe, gute Elfen,« sagte sie, »ich bin geschwommen und habe geplätschert und getanzt, und wenn ihr mir nicht helft, so werd' ich niemals die Sterne vom Himmel finden, und ich möchte so
gern mit ihnen spielen!« Da flüsterten die Elfen miteinander, und eine von ihnen trat auf sie zu, fasste sie an der Hand und sagte: »Wenn du nicht zu deiner Mutter heimkehren willst, so geh'
immer weiter und weiter, aber nimm dich in acht, dass du den richtigen Weg nicht verfehlst. Bitte Vierfuß, dich zu Ohnefuß zu tragen, und bitte Ohnefuß, dich zur Treppe ohne Stufen zu bringen,
und wenn du die erklettern kannst, so - - -«
»Ach, werd' ich dann bei den Sternen am Himmel sein?« fragte das Mädchen. »Wenn du nicht dort bist, so wirst du anderswo sein,« sagten die Elfen und begannen wieder zu tanzen.
Frohen Mutes ging sie weiter, bis sie ein Pferd traf, das war an einen Baum gebunden. »Guten Tag, Pferd,« sagte sie, »ich suche die Sterne vom Himmel, um damit zu spielen. Willst du mich ein
wenig tragen? Denn alle Glieder tun mir weh.« »Nein,« erwiderte das Pferd, »ich weiß nichts von den Sternen am Himmel. Und ich bin hier, um den Willen der Elfen zu tun, nicht was mir gefällt.«
»Aber ich komme ja von den Elfen,« sagte sie, »und ich soll dir von ihnen ausrichten, du möchtest mich zu Ohnefuß tragen.« »Das ist was anderes,« sagte das Pferd, »steig' auf und komm' mit.« Sie
ritt weiter und immer weiter, bis sie aus dem Walde herauskamen und sich am Ufer des Meeres befanden. Auf der Wasserfläche vor ihnen glänzte ein langer, gerader Pfad, und am Ende desselben erhob
sich ein wunderschönes Ding aus dem Wasser, geradewegs zum Himmel hinauf. Und das hatte alle Farben von der Welt, blau, rot und grün und sah wunderbar aus.
»Nun steig' aber ab,« sagte das Pferd, »ich hab' dich dorthin gebracht, wo das Land aufhört, und mehr kann Vierfuß nicht tun. Jetzt muss ich zu meinen Leuten zurück.« »Aber wo ist denn Ohnefuß?«
fragte das Mädchen, »und wo ist die Treppe ohne Stufen?« »Das weiß ich nicht,« erwiderte das Pferd, »es geht mich auch weiter nichts an. Lebe wohl, mein Kind,« und damit war es fort. Das Mädchen
stand still und blickte auf das Meer hinaus, da kam ein seltsamer Fisch geschwommen. »Guten Tag, du großer Fisch,« sagte sie, »ich suche die Sterne vom Himmel und weiß nicht, wo die Treppe ist,
die zu ihnen führt. Möchtest du mir den Weg zeigen?« »Nein,« antwortete der Fisch, »das darf ich nur, wenn du mir Botschaft von den Elfen bringst.« »Die bring' ich,« sagte sie. »Sie sagten,
Vierfuß würde mich zu Ohnefuß bringen und Ohnefuß zu der Treppe ohne Stufen.«
»Dann ist's recht,« sagte der Fisch, »komm' auf meinen Rücken und halte dich fest.« Und plantsch! tauchte er ins Wasser, den Silberpfad entlang, auf den glänzenden Bogen zu. Und je näher sie
kamen, desto heller leuchtete er, so dass sie schützend die Hände vor ihre Augen halten musste. Und als sie endlich am Fuße der Treppe angelangt waren, da sah sie, dass es eine breite, lichte
Straße war, die stieg langsam auf bis zum Himmel, und ganz weit oben, ganz am Ende der Straße konnte sie winzige, glitzernde Sternchen sehen. »Nun bist du da,« sagte der Fisch, »und dort ist die
Treppe. Steig' hinauf, wenn du kannst, nur halte dich fest. Aber ich glaube, die Treppe bei dir zu Hause wirst du leichter erklettern als diese da. Die ist nicht für Kinderfüße gemacht.«
Sie stieg immer höher und höher hinauf, aber sie kam nie um einen Schritt weiter: das Licht glänzte vor ihr und ringsum, hinter ihr war das Wasser, und je mehr sie hinaufstrebte, desto mehr zog
es sie in das kalte Dunkel hinab; je höher sie stieg, desto tiefer sank sie. Doch sie klomm immer weiter und weiter, bis die Sinne ihr schwanden und sie vor Kälte zitterte und die Furcht sie
betäubte; doch immer höher klomm sie, bis sie endlich betäubt und schwindelig losließ und sank und sank und sank. Und bums! spürte sie harte Bretter unter sich, und als sie erwachte - da lag sie
weinend auf dem Boden neben ihrem Bette.
Anna Kellner: Englische Märchen
Merlin - Merlinchen

Es waren einmal zwei arme Leute, die lebten davon daß sie im Walde Holz fällten, und sie waren Nachbarn, und jeder hatte einen Esel, und dieser Esel bediente sie bei ihrer Hantierung. Und einer
von den zweien hatte Weib und Kinder, und sie kosteten ihn viel Geld, und er stand des Morgens in aller Frühe auf und legte sich spät in der Nacht nieder, und von dem, was er abends nach Hause
brachte, hatte er am Morgen nichts mehr. Der andere, der keine Kinder hatte, eilte, kaum daß er den Esel mit einer mäßigen Last beladen hatte, heim; er aber blieb noch lange im Walde, traurig und
bekümmert, und gar oft klagte er: „Ach Herr, was kann ich tun? Ich und mein Tier, wir sterben noch Hungers, und das Beil fällt mir schier vor Schwäche aus der Hand! Ach, und kein Geld, daß ich
Brot für uns kaufen könnte! Wahrhaftig, es ist ein traurig Los, als Armer geboren zu sein!“ Und so klagte er oft und oft, bis ihn einmal eine Stimme aus dem Dickicht anrief, warum er so jammere,
und der Holzhauer erzählte sein ganzes Unglück, und die Stimme antwortete: „Wenn ich dir aus deiner Not hülfe, würdest du wohl die hl. Dreifaltigkeit verehren und die Armen in Treue
lieben?“
„Ja“, sagte er, „das würde ich gewiß und wahrhaftig tun.“ – „Dann geh auf der Stelle nach Hause, und ganz hinten in deinem Garten hinter dem Holunderbaum wirst du einen großen Schatz finden.“
Dies gehört, neigte sich der Bauer in frommer Demut und fragte: „Herr, wer seid Ihr?“ – „Merlin, nennt man mich.“ – „Ach, gnädiger Herr Merlin, ich mache mich auf den Weg, und ich befehle Euch
Gott, der aus Wasser Wein gemacht hat!“ – „Geh denn; es wird sich ja zeigen, wie du dein Leben einrichten und dem Herrn Jesu Christo dienen willst. Und heute über ein Jahr kommst du wieder
hierher zu mir und legst mir Rechenschaft ab.“ – „Gern, gnädiger Herr! Und noch einmal großen Dank!“
Und er ging heim, ohne den Esel beladen zu haben, und als ihn seine Frau solcherweise daherkommen sah, lief sie ihm entgegen, um ihn zu schelten, aber er lachte übers ganze Gesicht, als sie
begann: „Du schlechter Mensch, hast du etwa einen Beutel Geld gefunden? Was werden wir heute essen, wenn du so ledig daherkommst?“ Antwortete er: „Schilt mich nicht, Weib; als bald werden wir, so
Gott es beliebt, Geld genug haben, und mit der Holzfällerei hat es ein Ende!“ Und er erzählte ihr alles, und sie gingen in den Garten und gruben mit Haue und Spaten unter dem Holunderbaum, und
schließlich fanden sie den Schatz, und da gab es eine große Freude. Und nun waren sie reich und lebten nach ihrem Behagen; aber Gott und die Armen liebten sie trotzdem nicht mehr als vordem. Und
jetzt, wo der Mann reich war, jedermann gut Freund mit ihm, und alle nannten ihn Vetter.
Und als ein Jahr vergangen war, ging der Bauer wieder in den Wald und zu jenem Dickicht, und er rief: „Ach, gnädiger Herr Merlin, Ihr meine einzige Hoffnung, kommt und sprecht mit mir; ich liebe
und ehre Euch von Herzen!“ – „Was willst du? wie geht es dir?“ – „Gut, gnädiger Herr Merlin! Ihr habt mir ein großes Gut gegeben, und Weib und Kinder sind trefflich genährt und gekleidet, und
alltäglich wächst meine Habe.“ – So ist’s recht, lieber Freund; aber sag mir, hast du einen Wunsch?“ – „Ach, gnädiger Herr Merlin, ich wäre gern Schulze meines Dorfes.“ – „In sechs Wochen sollst
du es sein; sei gut und fromm!“ – „Tausend Dank, gnädiger Herr!“ Und in sechs Wochen ward der Bauer zu dem Schulzen seines Dorfes bestellt; aber gegen die Armen, die seine Vettern waren, hatte er
nur Verachtung und Härte und beschimpfte sie gar oft, und die Reichen, die ehrte er, als wären sie seine Vettern gewesen.
Und wieder nach einem Jahr ging er in den Wald und rief: „Herr Merlin, kommt und sprecht mit mir, denn ich liebe Euch von Herzen.“ – „Was willst du?“ – „Ich möchte Euch bitten, daß mein Sohn, der
Geistliche, den ich gar sehr liebe, Bischof werde; der Bischof ist vorgestern begraben worden, und damit hättest du mich für immer jeder Sorge entledigt.“ – „Geh nur, in sechs Wochen wird er es
sein.“ Und der Wicht ging heim in großer Freude, aber seinem schlechten Wesen entsagte er nicht, und er ließ nicht ab von seiner Roheit gegen die Armen; und sein Sohn ward Bischof, und nun meinte
er, jeder Mühsal und jeden Kummer für immer enthoben zu sein.
Und übers Jahr ging er in den Wald und er rief: „Merlin, wo bist du? Sprich mit mir!“ Und die Stimme sagte alsbald kurz: „Was wünschst du, Mann?“ – Ich bitte dich, mache, daß meine Tochter den
Sohn des Statthalters zum Gatten erhält; sie ist schön und anmutig und klug und zu allen Leuten höflich, und es ist kein Makel an ihr.“ – „In sechs Wochen soll die Hochzeit sein; Gott gebe dir
frohen Mut!“ Und es geschah, wie die Stimme gesagt hatte, und der Bauer gewann die ganze Verwandtschaft. Aber obwohl er so hoch gestiegen war, hatte er für Gott keinen Dank noch Vergeltung,
sondern prangte nur in Ruhm und Ehren, und schließlich sagte er zu seinem Weibe: „Nun gehe ich nicht mehr in den Wald; ich bin reich genug an Geld und Gut, an Freunden und Sippen.“ Sie aber riet
ihm, doch noch einmal hinzugehen und recht höflich Abschied von Merlin zu nehmen.
Und als das Jahr um war, stieg er zu Pferde und nahm zwei Knechte mit und ritt in den Wald und rief: Merlinchen!“ Und die Stimme kam von einem Baume herab, und er fragte: „Warum bist du da oben?“
– „Weil mich sonst dein Pferd getreten hätte.“ Und der Wicht sagte: „Merlinchen, ich nehme Abschied: nun schere ich mich nicht mehr um dich; habe ich doch Geld über alle Maßen!“ Antwortet die
Stimme: „Ein Wicht bist du gewesen, ein Wicht sollst du wieder sein. Im ersten Jahre, da hast du dich vor mir verneigt und mich ehrfürchtig deinen gnädigen Herrn genannt, im zweiten warst du
schon so stolz, daß du zu mir nur noch Herr sagtest, und dann hast du mich mit Merlin angesprochen und jetzt nennst du mich gar Merlinchen! Und ich sage dir kurz; in dir war nie Tugend und Sitte,
du warst ungetreu gegen Gott und die Armen, du warst ein Wicht voller Grausamkeit. Und nun werde ich dich wieder arm machen zum gerechten Lohne.“
Und der Wicht kehrte heim und verlachte nur die Drohung, an die er nicht glaubte, Aber in wenigen Tagen starben sein Sohn und seine Tochter, und darob grämte er sich sehr, ohne jedoch, weil auf
seinen Reichtum baute, von seinem Stolze zu lassen. Und sein Landsherr begann einen Krieg mit einem andern und hatte große Verluste am beweglichen Gut, und als der Krieg aus war, brauchte er, da
Kisten und Kasten leer waren, Geld, und da sagte man ihm, sein Dorfschulze habe dessen genug, aber seine Art sei es nicht, milde und gut zu sein.
Und der Herr entbot ihn zu sich und forderte tausend Pfund, und der Schulze antwortete, er habe nichts und der Herr soll das Geld anderswo verlangen. Darob erbost, nahm ihm der Herr alles, was er
hatte, Geld, fahrende und liegende Habe. Nun, da er alles verloren hatte, die Kinder sowohl als auch sein Gut, nun sagte er sich, daß Merlin die Wahrheit gesprochen hatte, und er bejammerte sein
Schicksal, daß ihm nicht einmal den Esel gelassen hatte, dessen er zu seinem alten Handwerk bedurfte. Und er arbeitete und sparte, bis er sich einen Esel kaufen konnte, und mit dem begann er
alltäglich, wie einst, in den Wald zu gehen. Und in dieser Armut verblieb er, bis er elendiglich starb.
Märchen aus Schottland
Ich

In einer kleinen Hütte, weit entfernt von Stadt und Dorf, lebte einst eine arme Witwe ganz allein mit ihrem sechsjährigen Knaben. Vor der Hütte erhob sich ein Berg, und ringsum erstreckten sich
Sümpfe; ungeheure Felsblöcke umschlossen sumpfige Höhlen; kein Haus, kein lebendes Wesen weit und breit. Ihre nächsten Nachbarn waren die Elfen unten im Tal und die Irrwische drüben im Moor. Die
arme Witwe wusste gar viel zu erzählen von den Elfen, die in den Eichbäumen einander zuriefen, und von den tanzenden Lichtern, die in dunkeln Nächten bis ans Fenstersims heranhüpften. Doch blieb
sie trotzdem von Jahr zu Jahr in der einsamen Hütte, vielleicht weil sie niemand dafür Zins zu zahlen hatte.
Sie liebte es nicht, am Abend, wenn das Feuer heruntergebrannt war und man nicht wusste, was alles geschehen konnte, lange aufzusitzen; gewöhnlich unterhielt sie das Feuer bis nach dem Abendessen
und ging dann gleich zu Bette. Wenn dann etwas Schreckliches vorging, so konnte sie wenigstens ihren Kopf unter die Decke stecken. Aber ihr kleiner Sohn mochte nicht so zeitig schlafen gehen;
wenn seine Mutter ihn rief, so spielte er ruhig neben dem Feuer weiter, als ob er sie nicht gehört hätte.
Von seiner Geburt an war es schwer gewesen, mit ihm auszukommen, und seine Mutter hatte nicht das Herz, ihn hart anzufassen. Je mehr sie bestrebt war, seinen Gehorsam zu erzwingen, desto weniger
achtete er auf ihre Worte; gewöhnlich setzte er seinen Willen durch. Aber an einem Winterabende konnte sich die Witwe nicht entschließen, zu Bett zu gehen, während er noch beim Feuer spielte. Der
Wind heulte und rüttelte an Tür und Fenster, und sie wusste sehr wohl, dass in solchen Nächten Elfen und Kobolde ihr Wesen trieben und Böses im Schilde führten. So versuchte sie denn, den Knaben
zu überreden, dass er zu Bett gehe.
»In solcher Nacht ist man am besten in seinem Bette aufgehoben,« sagte sie. Aber er wollte nicht. Da drohte sie ihm mit Schlägen. Auch das fruchtete nicht.
Je mehr sie bat und schalt, desto mehr schüttelte er verneinend den Kopf, und als sie endlich die Geduld verlor und ihm sagte, dass ganz sicher die Elfen kommen und ihn holen würden, da lachte er
und sagte, er wünsche sich nichts Besseres, er möchte so gern einmal mit einem Elfenkinde spielen. Nun brach seine Mutter in Tränen aus und ging verzweifelt zu Bette, denn sie fürchtete, nach
solcher Rede würde sicher etwas Schreckliches geschehen. Der Knabe aber blieb ruhig auf seinem Sessel neben dem Feuer sitzen; das Weinen der Mutter ging ihm durchaus nicht nahe.
Nicht lange hatte er so allein dagesessen, als er im Kamin etwas flattern hörte, und im selben Augenblicke befand sich das winzigste Mädchen, das man sich nur denken konnte, an seiner Seite. Es
war kaum eine Spanne hoch, hatte grasgrüne Augen, schimmerndes Silberhaar und Wangen wie Pfingströslein. Überrascht blickte der kleine Junge sie an. »Ach!« rief er aus, »wie heißest du?« »Ich,«
antwortete sie mit einer etwas schrillen, aber doch sehr lieblichen Stimme und blickte ihn an. »Und du?« Vorsichtig erwiderte der Knabe: »Auch mein Name ist Ich.« Und sie begannen miteinander zu
spielen. Sie zeigte ihm einige schöne Kunststücke. Aus der Asche machte sie Tiere, die bewegten sich und sahen aus, als wären sie lebendig; dann wieder Bäume mit grünen Blättern und winzige
Häuschen, in denen befanden sich Männlein und Weiblein, die waren nur einen Zoll hoch, und wenn sie die anhauchte, so konnten sie gehen und sprechen wie wirkliche Menschen.
Aber das Feuer war heruntergebrannt, und es war dunkel geworden; da schürte der Knabe es mit einem Stocke. Plötzlich fiel eine glühende Kohle heraus, und zwar auf das winzige Füßlein des
Elfenkindes. Da begann sie so furchtbar zu quietschen, dass ihr Spielgefährte den Stock fallen ließ und sich mit den Händen die Ohren zuhielt; immer schriller wurde das gellende Geschrei, bis es
endlich nicht anders klang, als wie wenn der ganze Wind von der ganzen Welt durch ein winziges Schlüsselloch pfiffe. Wieder flatterte etwas im Kamin, aber diesmal wartete der Knabe nicht, um zu
sehen, was es sei, sondern verkroch sich eiligst ins Bett und horchte zitternd und zagend. Da ertönte eine scharfe Stimme: »Wer ist dort, und was ist los?« »Ich,« schluchzte das Elfenkind, »mein
Fuß ist verbrannt! Oh weh, oh weh!«
»Wer hat das getan?« fragte dieselbe Stimme zornig. Sie schien näher gekommen zu sein, und der Knabe, der vorsichtig unter der Bettdecke hervorlugte, konnte deutlich ein blasses Gesicht in der
Rauchfangöffnung sehen. »Ich!« weinte das Elfenkind. »Wenn du es selbst getan hast,« schrie die schrille Stimme der Mutter, »warum machst du dann so ein Geschrei?« Mit diesen Worten streckte sie
ihren langen, dünnen Arm aus, fasste das Töchterlein am Ohr, zauste es tüchtig und zog es daran den Rauchfang hinauf. Lange lag der Knabe noch wach da, immer in banger Erwartung, dass die
Elfenmutter nochmals zurückkommen würde. Zur großen Überraschung seiner Mutter war er am folgenden Abend gleich nach dem Essen bereit, zu Bett zu gehen. »Endlich eine Wendung zum Bessern!« sagte
die Witwe zu sich. Der Knabe aber dachte gerade bei sich, dass er, wenn er wieder einmal mit einem Elfenkind spielen sollte, vielleicht nicht so leicht davonkommen würde wie das erstemal.
Anna Kellner: Englische Märchen
Gräfin Kathleen O'Shea
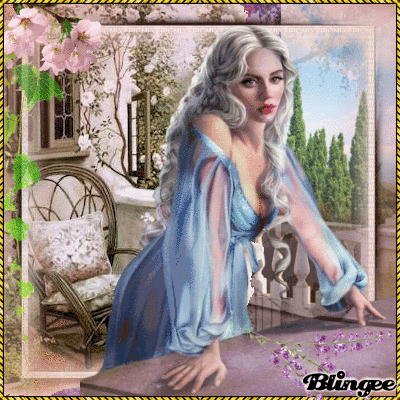
Vor sehr langer Zeit erschienen in Irland plötzlich zwei unbekannte Kaufleute, von denen nie jemand etwas gehört hatte. Die Sprache des Landes war ihnen jedoch vollkommen geläufig. Sie trugen
goldene Reifen in ihren rabenschwarzen Locken, und ihre Kleidung war von seltener Pracht. Sie schienen beide gleichen Alters zu sein, etwa fünfzig Jahre; ihre Stirnen waren gefurcht, ihre Bärte
von Silberfäden durchzogen. In dem Gasthaus, wo diese reichen Kaufleute abgestiegen waren, versuchte man zu erfahren, was sie wollten, aber vergebens; sie lebten still und zurückgezogen. Wie man
durch die Fenster ihrer Wohnung sehr gut wahrnehmen konnte, taten sie den ganzen Tag nichts, als immer wieder und wieder ihre Goldstücke zählen, die sie in Geldbeuteln verwahrten.
»Meine Herren,« sagte die Wirtin eines Tages zu ihnen, »wie kommt es, dass Ihr trotz Eures Reichtums nichts zur Linderung des allgemeinen Elends tut?«
»Liebe Frau Wirtin,« antwortete der eine von beiden, »wir haben bis nun nichts für die Armen getan, weil wir fürchteten, von falschen Bettlern betrogen zu werden. Der wirklichen Not werden wir
unsere Tür nicht verschließen.« Dies Gerücht, dass zwei reiche Fremdlinge gekommen waren, die ihr Gold mit vollen Händen ausstreuen wollten, hatte sich rasch verbreitet, und eine große
Menschenmenge belagerte das Haus. Aber anders sahen die Leute aus, als sie hineingiengen, anders als sie herauskamen; Stolz oder tiefe Scham war in ihren Mienen zu lesen.
Die beiden Männer kauften Seelen für den Teufel. Die Seelen der Alten waren zwanzig Goldstücke wert, nicht einen Penny mehr; denn Satan hatte Zeit gehabt, sie nach ihrem wahren Wert zu schätzen.
Die Seele einer alten Frau wurde auf fünfzig Goldstücke geschätzt, wenn sie schön, auf hundert, wenn sie hässlich war. Die Seele einer Jungfrau erzielte eine ungeheure Summe: die frischen und
reinen Blumen sind am teuersten. Um die selbe Zeit lebte in der Stadt ein wahrer Engel an Schönheit, die Gräfin Kathleen O'Shea. Sie war der Abgott des Volkes, die Vorsehung der Armen. Sobald sie
erfuhr, dass die Bösewichte aus der allgemeinen Not Nutzen zogen, indem sie Gott die Herzen abspenstig machten, ließ sie ihren Haushofmeister kommen.
»Patrick,« fragte sie ihn, »wie viel Goldstücke sind in meinen Truhen?« »Hunderttausend.« »Wie viel sind meine Juwelen wert?« »Ebenso viel.« »Was sind die Schlösser, Wälder und Äcker wert?« »Noch
einmal so viel.« »Gut, Patrick. Verkaufe alles und bringe mir die Rechnung. Ich will nur dieses Schloss und die dazu gehörigen Äcker behalten.«
In zwei Tagen war der Befehl der frommen Gräfin ausgeführt, und der Erlös wurde je nach ihren Bedürfnissen an die Armen verteilt. Das passte natürlich dem Bösen nicht, der keine Seelen mehr
kaufen konnte. Mit Hilfe eines treulosen Dieners drangen seine beiden Knechte in das Haus der edlen Gräfin ein und raubten ihr, was sie an Gold noch besaß. Vergebens suchte sie den Inhalt ihrer
Truhen zu retten, die teuflischen Räuber behielten die Oberhand. Wäre Kathleen imstande gewesen, das Zeichen des Kreuzes zu machen, so hätte sie sie dadurch in die Flucht jagen können. Aber ihre
Hände waren gebunden. So gelang der Raub. Als die Armen von neuem die beraubte Gräfin um Hilfe baten, geschah es vergebens, sie war nicht mehr imstande, ihr Elend zu lindern und musste sie der
Versuchung überlassen.
In acht Tagen erwartete man Korn und Futter aus dem Westen. Aber acht Tage sind oft eine Ewigkeit. Eine ungeheure Summe war erforderlich, um bei der Teuerung den Armen zu helfen. Sie mussten
entweder Hungers sterben oder ihre Seelen, das reichste Geschenk des gütigen Gottes, für schnödes Geld verkaufen. Kathleen besaß nichts mehr, sie hatte auch ihr Schloss für die Unglücklichen
hergegeben. Zwölf Stunden lang verbrachte sie in Trauer und Tränen, riss sich ihr goldenes Haar vom Kopfe und zerschlug sich die schneeweiße Brust. - Plötzlich erhob sie sich in düsterer
Entschlossenheit, von einem Gefühl der Verzweiflung erfasst. Sie ging zu den Seelenkäufern.
»Was willst du?« fragten sie. »Ihr kauft Seelen?« »Jawohl, eine und die andere, trotz der Gräfin Kathleen O'Shea. Oder ist es vielleicht nicht wahr, du Heilige mit den saphirblauen Augen?« »Heute
will ich Euch ein Geschäft antragen,« erwiderte sie. »Welches?« »Ich habe eine Seele zu verkaufen, aber sie ist sehr teuer.« »Das schadet nichts, wenn sie preiswert ist. Die Seele ist wie der
Diamant, je reiner, desto wertvoller.« »Es ist die meinige.«
Die beiden Abgesandten des Teufels fuhren empor. Die Klauen in den Lederhandschuhen schlossen sich krampfhaft, die grauen Augen funkelten. Die reine, jungfräuliche Seele Kathleens, es war ein
unschätzbarer Fang! »Schöne Jungfrau, was verlangst du dafür?« »Hundertundfünfzigtausend Goldstücke.« »Die stehen dir zur Verfügung,« erwiderten die Seelenkäufer und überreichten ihr ein schwarz
gesiegeltes Pergament, das sie schaudernd unterschrieb. Die verlangte Summe wurde ihr ausbezahlt. Sobald sie nach Hause kam, sagte sie zu ihrem Haushofmeister: »Verteile das Gold. Es wird
reichen, um den Armen über die nächsten acht Tage hinauszuhelfen, und keine einzige ihrer Seelen gehört dem Teufel.« Dann schloss sie sich in ihr Zimmer ein und gab den Befehl, dass niemand sie
stören dürfe. Drei Tage vergingen. Sie rief niemand und kam auch nicht aus dem Zimmer hervor. Da öffnete man die Tür und fand eine Leiche. Der Kummer hatte ihr das Herz gebrochen.
Aber Gott der Herr erklärte den Kauf dieser anbetungswürdigen Seele, die ihre Mitmenschen vor ewiger Verderbnis gerettet hatte, für null und nichtig. Nach acht Tagen brachten zahllose Schiffe
ungeheure Vorräte von Korn in das fast verhungerte Land. Die beiden Seelenkäufer verschwanden aus dem Gasthause, ohne dass jemand wusste, was aus ihnen geworden war. Aber die Fischer an der
schwarzen See behaupten, dass Lucifer sie in einem unterirdischen Kerker so lange gefangen hält, bis sie ihm die Seele der Gräfin Kathleen O'Shea abliefern. - Doch die ist ihnen für ewig
verloren.
Anna Kellner: Englische Märchen
Die Prinzessin von Colchester
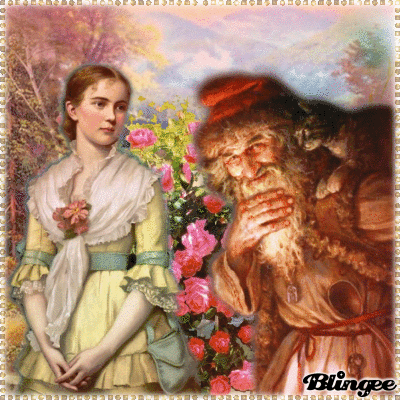
Lange vor König Arthur und den Rittern der Tafelrunde, da regierte im Osten von England ein König, der in Colchester Hof hielt. Er war stark, tapfer und klug, so dass er seiner Feinde nach außen
Herr wurde und im Innern seines Landes unter seinen Untertanen den Frieden aufrecht erhielt. Doch mitten in seinem Glanze starb die Königin und ließ eine einzige Tochter im Alter von fünfzehn
Jahren zurück. Alle, die die Prinzessin kannten, bewunderten sie ob ihrer Schönheit, ihrer Leutseligkeit und ihrer Herzensgüte.
Aber Habsucht ist die Wurzel aller Übel. Das bewährte sich auch hier. Der König hörte von einer Dame, welche er um ihres Reichtums willen zu heiraten beschloss, trotzdem sie alt, hässlich,
bucklig und krummnasig war. Auch besaß sie eine Tochter, eine gelbe Frauensperson, die sehr neidisch und boshaft, kurz, ihrer Mutter sehr ähnlich war. Trotz alledem brachte der König, von den
Edlen des Landes begleitet, seine missgestaltete Braut in den königlichen Palast, wo die Hochzeit stattfand.
Die beiden Frauen waren noch nicht lange am Hofe, als sie auch schon den König durch falsche Berichte und Anklagen gegen seine eigene schöne Tochter aufzuhetzen begannen. Nachdem die junge
Prinzessin die Liebe ihres Vaters verloren hatte, wurde sie des Lebens am Hofe überdrüssig, und als sie eines Tages mit ihrem Vater im Garten zusammentraf, bat sie ihn mit Tränen in den Augen,
ihr etwas Geld zu geben, denn sie wolle fortziehen und ihr Glück in der weiten Welt suchen. Der König willigte ein und befahl ihrer Stiefmutter, ihr nach ihrem Ermessen eine kleine Summe zu
geben. Die Königin gab ihr einen Leinwandbeutel mit Schwarzbrot und hartem Käse und eine Flasche Bier: eine erbärmliche Ausstattung für eine Königstochter. Aber die Prinzessin nahm, was sie ihr
gab, und dankte ihr dafür.
Dann machte sie sich auf den Weg und kam durch Felder, Wälder und Täler bis zu einer Höhle, an deren Eingang sie einen alten Mann auf einem Steine sitzen sah. Der sagte: »Guten Morgen, holde
Maid, wohin so schnell?« Sie antwortete: »Vater, ich gehe mein Glück suchen.« »Was hast du in dem Beutel und in der Flasche?« »Im Beutel hab' ich Brot und Käse, in der Flasche gutes, leichtes
Bier. Möchtest du vielleicht davon haben?« »Jawohl,« sagte er, »von Herzen gern.« Da zog die Prinzessin ihre Vorräte hervor und lud ihn ein, zu essen. Das tat er und dankte ihr herzlich. Dann
fügte er hinzu: »Du wirst gleich vor eine dichte dornige Hecke kommen, die dir undurchdringlich erscheinen wird. Aber nimm' diesen Stab, klopfe dreimal damit und sage: 'Bitte, Hecke, lass mich
durch', und sie wird sich sofort öffnen. Ein bischen weiter wirst du eine Quelle sehen. Setze dich an den Rand derselben, und bald werden drei goldene Köpfe hervortauchen, welche dich ansprechen
werden. Was sie auch verlangen mögen, das tue.«
Die Prinzessin versprach es dem alten Manne und nahm Abschied von ihm. Als sie zur Hecke kam und seine Weisungen befolgte, teilte sie sich und ließ sie durch. Und als sie bei der Quelle angelangt
war und sich eben niedergesetzt hatte, kam ein goldener Kopf empor und sang:
»Wasche mich, kämme mich, und leg' mich sachte nieder.« »Jawohl,« sagte sie, streckte die Hand aus und erwies ihm mit einem silbernen Kamme den verlangten Dienst, worauf sie ihn am Ufer auf ein
Beet von Primeln hinlegte. Bald kam ein zweiter und dann ein dritter Kopf, die dasselbe verlangten, und deren Wunsche sie ebenfalls nachkam. Darauf sprachen die Köpfe einer zum anderen: »Was
sollen wir für die Jungfrau tun, die uns so freundlich behandelt hat?« Da sagte der erste: »Ich werde ihrer Schönheit solche Reize hinzufügen, dass der mächtigste Prinz auf Erden davon bezaubert
werden soll.« Hierauf der zweite: »Ich werde ihrem Leibe und ihrem Atem einen Duft verleihen, der den der süßesten Blumen noch übertrifft.« Zuletzt der dritte: »Mein Geschenk wird nicht das
geringste sein. Da sie eine Königstochter ist, werde ich ihr zu dem Glücke verhelfen, die Gemahlin des mächtigsten aller Fürsten auf Erden zu werden.«
Dann baten die drei Köpfe die Prinzessin, sie möge sie wieder in die Quelle hinuntergleiten lassen. Sie tat es und setzte ihre Reise fort. Sie war noch nicht sehr weit gegangen, da sah sie im
Park einen König, von Adeligen umgeben, auf der Jagd. Sie wäre ihm gern ausgewichen, aber der König hatte sie erblickt und näherte sich ihr. Ihre Schönheit und ihr duftiger Athem bezauberten ihn
so sehr, dass er seine glühende Liebe nicht unterdrücken konnte, sondern sofort um sie zu freien begann. Er gewann ihre Liebe und brachte sie in seinen Palast. Dort ließ er sie in die
herrlichsten Gewänder kleiden.
Als der König hörte, dass sie die Tochter des Königs von Colchester sei, ließ er sofort mehrere Wagen anspannen, um dem König einen Besuch zu machen. Der Wagen, in welchem er mit seiner Braut
fuhr, war mit Gold und kostbaren Edelsteinen geschmückt.
Der König von Colchester war ganz erstaunt über das Glück seiner Tochter, bis der junge König ihm erzählte, wie alles zugegangen war. Die Freude aller am Hofe war groß, nur die Königin und ihre
klumpfüßige Tochter beneideten die Prinzessin um ihr Glück und waren nahe daran, vor Bosheit zu bersten. Ihre Wut war um so größer, als die Prinzessin nun hoch über ihnen allen stand. Große
Festlichkeiten folgten, bei denen gegessen und getrunken und getanzt wurde; das dauerte viele Tage. Endlich, nachdem der junge König noch die Mitgift seiner jungen Frau erhalten hatte, kehrte er
mit ihr nach Hause zurück.
Als die bucklige Stiefschwester sah, mit welchem Erfolge die Prinzessin ihr Glück gesucht hatte, wollte sie durchaus das gleiche tun. Sie vertraute sich ihrer Mutter an, und diese versah sie mit
reicher Kleidung, mit Zucker, Mandeln und süßen Bäckereien in großer Menge und mit einer großen Flasche Malagawein. So ausgestattet, schlug sie denselben Weg ein, wie ihre Schwester, und als sie
in die Nähe der Höhle kam, fragte der alte Mann: »Wohin so eilig, junges Frauenzimmer?« »Was kümmert das dich?« erwiderte sie. Dann fragte er weiter: »Was hast du in dem Beutel und in der
Flasche?« Sie antwortete: Allerlei Leckerbissen, aber nicht für Dich.« »Willst du mir nicht etwas davon geben?« fragte er. »Nein, keinen Bissen und keinen Tropfen.«
Der alte Mann runzelte die Stirn und sagte: »Fluch über dich!« Als sie weiterging, kam sie zu der Hecke, in welcher sie eine Lücke gewahrte; sie wollte hindurchschlüpfen, aber nachdem sie
hineingegangen war, schloss sich die Hecke hinter ihr, und die Dornen drangen ihr ins Fleisch, so dass sie nur mit großer Mühe durchkonnte. Von Blut überströmt, suchte sie nach Wasser, um sich zu
waschen, da sah sie die Quelle. Sie setzte sich an den Rand derselben hin, da erschien einer der Köpfe und sagte: »Wasche mich, kämme mich, und leg' mich sachte nieder.«
Sie aber schlug mit ihrer Flasche auf ihn los und sagte: »Da hast du.« Dann tauchte der zweite und dritte Kopf empor, die keine bessere Behandlung erfuhren als der erste; sie berieten dann alle
drei miteinander, mit welchen Strafen sie die boshafte Königstochter für solches Benehmen heimsuchen sollten. Der erste sagte: »Sie soll einen Aussatz im Gesichte bekommen.« Hierauf der zweite:
»Ihr Atem soll einen üblen Geruch haben.« Der dritte bestimmte ihr als Gatten einen armen Landschuster.
Sie ging weiter, bis sie in eine Stadt kam. Da es gerade ein Markttag war, hatten sich viele Leute eingefunden, die liefen alle, als sie das aussätzige Gesicht sahen, bis auf einen armen
Schuhflicker, davon. Der hatte vor kurzem die Stiefel eines alten Einsiedlers geflickt und von ihm, da er kein Geld besaß, an Zahlungsstatt einen Tiegel Salbe zur Heilung von Aussatz und ein
Tränklein gegen übelriechenden Athem erhalten. Da der Schuster geneigt war, Barmherzigkeit zu üben, so ging er zu ihr und fragte sie, wer sie sei. »Ich bin,« antwortete sie, »die Stieftochter des
Königs von Colchester.« »Wenn ich dir,« fragte er, »deine natürliche Hautfarbe wieder verschaffe und sowohl dein Gesicht, als auch deinen Atem gründlich heile, willst du mich dann zur Belohnung
zum Manne nehmen?« »Jawohl, lieber Freund,« erwiderte sie, »von Herzen gern.«
Der Schuhflicker wendete die genannten Mittel an, welche nach einigen Wochen ihre Wirkung nicht versagten. Darauf heirateten die beiden und machten sich auf den Weg an den Hof von Colchester. Als
die Königin hörte, dass ihre Tochter einen armen Landschuster geheiratet hatte, geriet sie in solche Verzweiflung, dass sie sich aufhängte. Ihr Tod bereitete dem Könige, der froh war, sie so bald
losgeworden zu sein, große Freude. Er gab dem Schuhflicker hundert Pfund, damit er mit seiner Frau den Hof verlasse und sich an einem entfernten Orte ansässig mache. Dort lebte das Paar viele
Jahre; er flickte Schuhe, und sie spann Garn.
Anna Kellner: Englische Märchen
Lantrys neues Haus

Lantry M’ Cluskey hatte eine Frau genommen, und natürlich musste er nun auch ein Haus haben, um irgendwo zu leben. Nun hatte sich Lantry ein Stück Bauernland gekauft,an die sechs Morgen, aber es stand kein Haus darauf. Da entschloss er sich, eines zu bauen; und weil es so komfortabel wie möglich sein sollte, suchte er als Bauplatz eine jener schönen Erhebungen aus, von denen man sagt, sie seien Tanzplätze der Feen. Man warnte Lantry. Aber er war ein eigensinniger Mann und kannte keine Furcht.
Er sagte, einen so hübschen Platz zum Hausbau werde er so bald nicht wieder finden, und wenn er alle Feen in ganz Europa gegen sich aufbringe, hier und nirgendwo anders wolle er seine vier Wände
errichten. Er machte sich ans Bauen und brachte es auch gut zu Ende. Und wie es üblich ist von alters her, lud er seine Freunde und Nachbarn darauf unter das neue Dach ein. Lantry hatte im Lauf
des Tages seine Frau in das neue Haus geholt. Er hatte einen Fiedler bestellt und eine Menge Whiskey gekauft, und am Abend sollte getanzt werden.
Gut und schön. Dagegen war nichts einzuwenden. So gehört sich’s! Der Spaß und die Ausgelassenheit hatten alle Gäste erfasst, als man nachdem die Dunkelheit hereingebrochen war, ein merkwürdiges
Geräusch vernahm. Es hörte sich an, als zerbrächen langsam, aber sicher die Dachbalken. Ein Krachen und Knarren, ein Zerren und Splittern war das, als seien Tausende kleine Männer dabei, das Dach
zum Einsturz zu bringen. „Nur zu“, sagte eine Stimme, die in befehlendem Ton sprach, „legt euch ins Zeug: ihr wisst, ehe es Mitternacht wird muß Lantrys Haus eingerissen sein!“
Das war eine unangenehme Neuigkeit für den guten Lantry. Er machte sich nun klar, dass er seine Feinde unterschätzt hatte. Und wenn man das weiß, dann hilft nichts, als zu kapitulieren. Also trat
er vor die Feen hin und redete sie so an: „Meine Herren, ich bitte euch sehr untertänigst um Entschuldigung, dass ich auf einem Grundstück, das euch gehört, ein Haus habe errichten lassen. Wenn
ihr so freundlich sein wolltet, mich heute Nacht nicht weiter zu behelligen, so verspreche ich, es morgen abzureißen und es anderswo wieder aufbauen zu lassen.“
Auf diese Rede folgte ein Geräusch gleich dem Klatschen tausend kleiner Hände, und der Ruf wurde laut: „Bravo, Lantry! Bau auf halbem Weg zwischen den beiden Weißdornhecken und dem kleinen
Hügel.“ Nach einem weiteren Freudenruf und dem Geräusch sich entfernender Schritte wurde es mucksmäuschenstill. Die Geschichte aber ist hier noch nicht zu Ende, denn als Lantry die Grube für das
Fundament des neuen Hauses aushob, fand er eine Kiste voller Gold, und also wurde er dadurch, dass er den Tanzplatz der Feen räumte, reicher, als er es je auf anderer Art und Weise geworden
wäre
Märchen aus Irland
Die gefangenen Seelen
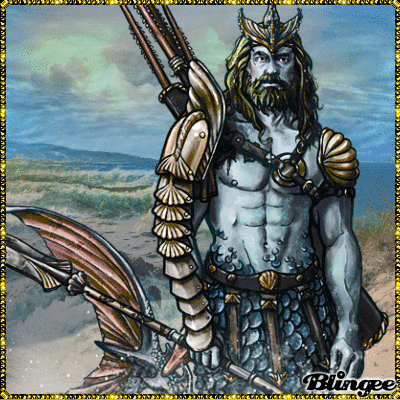
Jack Dogherty war ein Fischer, wie sein Vater und Großvater vor ihm. Wie diese, lebte auch er ganz allein mit seiner Frau in seinem Häuschen am Meeresstrande in der Grafschaft Clare. Die Leute
wunderten sich, dass die Familie Dogherty sich dieses weltentlegene, rings von steilen Felsen umgebene, wogenumrauschte Plätzchen zum Wohnsitz ausgesucht hatten. Aber die Doghertys wussten wohl,
warum.
Dunbey Bay war der einzige Ort an der ganzen Küste, wo es sich gut wohnte. Es war eine kleine Bucht, in welcher ein Boot so geschützt liegen konnte, wie ein Vogel in seinem Nest; und aus dem
Hintergrunde streckte sich eine Felsplatte in die See hinaus. Wenn nun, was nicht selten geschah, ein Sturm auf dem Atlantischen Ocean wütete und an der Küste sich starker Westwind erhob, dann
zerschellte manch reichbeladenes Schiff an diesen Felsen, und was kam dann nicht alles ans Land! Ganze Ballen mit schöner Baumwolle und Tabak, Fässer, große und kleine, mit Wein, Rum, Cognac und
Wachholderbranntwein gefüllt, kurz, ein Dogherty lebte in dieser Bucht wie ein Edelmann auf seinem Gut.
Die Doghertys waren freundlich und hilfreich, wenn es einmal einem schiffbrüchigen Matrosen glückte, das Land zu erreichen; oft zog auch Jack auf seiner kleinen Zille hinaus und half der
Mannschaft eines gescheiterten Schiffes ans Land. Wenn aber das Schiff zerschellt und die Bemannung ertrunken war, wer möchte Jack tadeln, dass er heimtrug, was er fand? »Und wer wird dadurch
benachtheiligt?« pflegte Jack zu sagen; »der König, Gott segne ihn! ist doch wahrlich reich genug und braucht nicht noch das, was die See mir beschert.«
Trotzdem Jack das Leben eines Einsiedlers führte, war er ein gutherziger, munterer Bursche. Einem anderen wäre es auch schwerlich gelungen, Biddy Mahony zu überreden, das behagliche, schmucke
Haus ihres Vaters in der Mitte der Stadt Ennis zu verlassen und fortan so viele Meilen entfernt mitten unter den Felsen zu leben, wo Robben und Seemöwen ihre einzigen Nachbarn waren. Aber Biddy
wusste sehr wohl, dass Jack der richtige Mann war, mit dem eine Frau glücklich und behaglich leben konnte; denn er versah die meisten Herrenhäuser des umliegenden Landes nicht nur mit Fischen,
sondern auch mit den unerwarteten reichen Gaben, die in die Bucht geschwemmt wurden. Und sie hatte ihre Wahl nicht zu bereuen, denn keine Frau aß und trank besser, keine Frau war Sonntags in der
Kirche besser gekleidet, als Frau Dogherty.
Es war nur natürlich, dass Jack mancherlei seltsame Dinge zu sehen und zu hören bekam, aber er kannte keine Furcht, ja, es war sogar der sehnlichste Wunsch seines Herzens, einmal mit einem Nix
zusammenzutreffen. Jack hatte gehört, dass sie ein menschenfreundliches Volk wären, und dass eine Bekanntschaft mit ihnen immer Glück bringe. So oft er in der Ferne auf der Oberfläche des Meeres
die Meermänner in ihren nebligen Gewändern zu sehen glaubte, da ruderte er spornstreichs auf sie los. Wie oft schalt ihn Biddy in ihrer sanften Weise, wenn er den ganzen Tag draußen auf dem Meere
gewesen war, ohne einen Fisch heimzubringen. Wenn Biddy gewusst hätte, auf was für Fang sein Sinn gerichtet war!
Jack ärgerte sich oft, dass er nie einen Nix ordentlich zu Gesicht bekam, und sie waren doch an der Küste so häufig wie Hummern. Er ärgerte sich umsomehr, als sein Vater und Großvater sehr oft
Nixen gesehen hatte, ja, er erinnerte sich sogar, als Kind gehört zu haben, dass sein Großvater, der sich als erster der Familie in Dunbey Bay niedergelassen hatte, mit einem Nix geradezu
vertraut gewesen war. Und so lieb war ihm der Nix gewesen, dass er sich nur aus Furcht vor dem Priester davon abhalten ließ, ihn bei einem seiner Kinder Gevatter stehen zu lassen.
Endlich schien Jack das Glück hold zu sein und ihm nicht versagen zu wollen, was es seinem Vater und Großvater vor ihm gewährt hatte. Als er nämlich eines Tages weiter als sonst die Küste entlang
geschlendert war, sah er, gerade als er umkehren wollte, etwas auf einem Felsen hocken, was er nie zuvor gesehen hatte. Der Körper war, so viel er aus der Entfernung sehen konnte, grün, und er
hätte schwören können, dass das Ding einen Dreispitz in der Hand hielt. Jack stand eine gute halbe Stunde da und betrachtete es mit gespannter Aufmerksamkeit; die ganze Zeit über rührte es sich
nicht vom Fleck. Endlich war Jacks Geduld zu Ende, er tat einen lauten Pfiff und einen Ruf, als der Nix, denn ein solcher war es, in die Höhe fuhr, den Dreispitz aufsetzte und kopfüber von dem
Felsen in die Flut tauchte. Jacks Neugierde war auf das höchste gestiegen, und er ging geradewegs auf die Stelle zu, doch es war nichts mehr von dem Nix mit dem Dreispitz zu sehen. Jack dachte so
viel darüber nach, dass er sich zuletzt einbildete, er habe alles nur geträumt.
An einem sehr stürmischen Tage, als die See haushohe Wellen warf, beschloss Jack, einen Blick auf den Nixenfelsen zu werfen; sonst war er immer nur an schönen Tagen dort gewesen. Als er hinkam,
sah er richtig den Nix. Er schlug Purzelbäume auf dem Felsen, tauchte in die Flut, kam wieder empor und tauchte wieder unter. Von nun ab konnte Jack den Nix sehen, so oft es ihm beliebte; er
brauchte nur einen recht windigen Tag zu wählen. Aber das befriedigte ihn auf die Dauer nicht; wem man einen Finger reicht, der will die ganze Hand. Er wollte die Bekanntschaft des Nixes machen.
Und es gelang ihm.
Eines Tages ging er wieder zu der Stelle, von wo er einen guten Ausblick auf den Nixenfelsen hatte, da erhob sich ein so furchtbarer Sturm, dass er in einer Höhle, deren es sehr viele an der
Küste gab, Schutz suchen musste. Als er eintrat, sah er zu seiner Verwunderung den Nix dort sitzen. Er hatte einen Fischschwanz, Schuppen auf den Beinen und Flossen an den kurzen Armen, grünes
Haar, lange, grüne Zähne, eine rote Nase und Schweinsäuglein. Er trug keine Kleider, hielt den Dreispitz unter dem Arm und schien in ernste Gedanken vertieft. Jack war trotz alles Mutes ein wenig
eingeschüchtert, aber »jetzt oder nie« dachte er. So ging er denn kühn auf den in Gedanken versunkenen Nix zu, nahm seinen Hut ab und machte ihm eine tiefe Verbeugung.
»Euer Diener, mein Herr,« sagte Jack. »Der deine, Jack Dogherty,« erwiderte der Nix. »Wie, Euer Gnaden wissen meinen Namen?« rief Jack aus. »Sollt' ich ihn etwa nicht wissen, Jack Dogherty? Ich
hab' deinen Großvater gekannt, mein Lieber, lange bevor er Judy Regan, deine Großmutter, zur Frau nahm! Ach, Jack, lieber Jack, wie gern hab ich deinen Großvater gehabt! War das ein prächtiger
Herr! Nie hab' ich vorher oder nachher, über oder unter dem Wasser seinesgleichen in der edlen Kunst des Zechens gesehen. Ich hoffe, mein Junge,« fügte er mit lustigem Augenblinzeln hinzu, »ich
hoffe, du bist sein würdiger Enkel!« »Es kommt auf einen Versuch an,« sagte Jack. »Nun, es freut mich, dich so wacker sprechen zu hören. Wir müssen besser miteinander bekannt werden, und wäre es
nur um deines Großvaters willen. Aber dein Vater, Jack, mit dem war nichts anzufangen.«
»Ich kann mir wohl denken,« sagte Jack, »dass Ihr manch mächtigen Zug tut, um da unten in der kühlen, nassen Flut Euer Blut bei einiger Wärme zu erhalten. Aber darf ich so frei sein, zu fragen,
wo Ihr den Stoff hernehmt?« »Wo nimmst du ihn denn her, Jack?« fragte der Nix und zupfte mit Daumen und Zeigefinger an seiner roten Nase. »Haha,« rief Jack, »jetzt geht mir ein Licht auf; ich
hoffe nur, Euer Gnaden haben unten einen guten trockenen Keller, wo Ihr ihn aufbewahrt.« »Verlass dich auf mich,« sagte der Nix mit schlauem Zwinkern seines linken Auges. »Es verlohnt sich gewiss
sehr, den Keller anzusehen,« fuhr Jack fort. »Du hast recht, Jack,« sagte der Nix, »und wenn du mich am folgenden Montag um dieselbe Zeit hier treffen willst, dann werden wir weiter über die
Sache sprechen.« Jack und der Nix schieden als die besten Freunde von der Welt.
Am folgenden Montag trafen sie wieder zusammen, und zum Erstaunen Jacks hatte der Nix zwei Dreispitze mit, unter jedem Arm einen. »Darf ich mir die Freiheit nehmen, zu fragen,« sagte Jack, »warum
Euer Gnaden heute zwei Hüte mit haben? Ihr wollt mir doch nicht vielleicht gar einen davon schenken, damit ich ihn der Seltenheit wegen mit nach Hause nehme?« »Nein, Jack,« erwiderte er, »ich
komme nicht so leicht zu meinen Hüten, dass ich mich so rasch davon trennen könnte. Aber ich will, dass du mit mir hinunter kommst und mit mir zu Mittag speisest, und zu dem Zwecke hab' ich dir
den Hut mitgebracht.« »Der Herr bewahre und beschütze uns!« rief Jack erstaunt aus, »Ihr wollt doch nicht, dass ich zum Meeresgrund hinunter fahre? Ich würde doch sicher in dem Salzwasser
ertrinken. Was würde die arme Biddy anfangen? Was würde sie dazu sagen?«
»Was liegt daran, was sie sagt, du Tropf? Wer kehrt sich an ihr Zetern? Dein Großvater hätte nicht solche Einwendungen gemacht. Wie oft hat er sich diesen selben Hut aufgesetzt und ist mir mutig
in die Tiefe gefolgt! Wie oft haben wir zusammen gespeist und manche Muschel voll Brantwein dort unten auf dem Grunde des Wassers miteinander geleert!« »Ist das Euer Ernst?« fragte Jack, »wohlan
denn, hol mich der und jener, wenn ich meinem eigenen Großvater nachstehen will. Hier ist meine Hand. Ich gebe mich ganz in Eure Gewalt, es gilt Leben oder Tod.« »Jetzt bist du der Großvater, wie
er leibt und lebt«, sagte der alte Meermann, »komm also und folge meinem Beispiele.«
Sie verließen die Höhle, gingen in die Flut hinein und schwammen dann ein Stück, bis sie zu dem Felsen gelangten. Der Nix kletterte auf den Gipfel desselben und Jack folgte ihm. Auf der andern
Seite fiel der Felsen so jäh ab wie eine Mauer, und die See sah so tief aus, dass Jack einiges Zagen empfand. »Nun, Jack,« sagte der Nix, »setze den Hut auf, und halte nur ja die Augen ganz
offen. Halte dich an meinem Schweif fest, und folge mir, dann wirst du was zu sehen bekommen.«
Er sprang hinein, und Jack folgte ihm mutig nach. Sie fuhren lange Zeit dahin, und Jack glaubte, es würde kein Ende nehmen. Manchmal wünschte er, mit Biddy gemütlich am Kamin zu sitzen. Aber was
nützte der Wunsch, jetzt, da er sich so viele, viele Meilen unter den Wogen des Atlantischen Oceans wähnte? Er hielt sich fest an den Schweif des Meermannes, so schlüpfrig er auch war. Endlich
kamen sie aus dem Wasser heraus und waren zum großen Erstaunen Jacks auf trockenem Lande auf dem Grunde der See. Sie landeten vor einem hübschen Hause, das sehr nett mit Austernschalen gedeckt
war. Der Nix wendete sich zu Jack um und hieß ihn willkommen.
Halb vor Verwunderung, halb außer Atem nach der schnellen Fahrt durch das Wasser, war Jack kaum imstande zu sprechen. Er blickte um sich und sah kein lebendes Wesen, außer Krabben und Hummern,
die gemächlich auf dem Sande spazieren gingen. Über ihm wölbte sich das Meer wie der Himmel, und die Fische bewegten sich darin, wie Vögel in der Luft. »Warum so stumm, Jack?« fragte der Nix, »du
hattest wohl keine Ahnung, dass ich hier unten so ein schmuckes kleines Anwesen besitze? Bist du erstickt oder ertrunken, oder grämst du dich um Biddy, he?« »O nein,« erwiderte lachend Jack und
zeigte seine blanken Zähne, »aber wer in aller Welt hätte sich auch so etwas gedacht.« »Komm, Jack, wir wollen jetzt sehen, was wir zu essen bekommen.«
Jack verspürte wirklich großen Hunger, und er war nicht wenig erfreut, als er aus dem Kamin eine Rauchsäule aufsteigen sah, die verriet, was drinnen vorging. Er folgte dem Nix ins Haus und in die
schöne Küche; die war reichlich mit allem Nötigen ausgestattet. Ein großer Anrichtetisch war da und eine Menge Pfannen und Töpfe, und zwei junge Meermänner kochten. Dann führte ihn sein Wirt in
das Zimmer; das war freilich ziemlich schäbig. Es war weder Tisch noch Stuhl darin, Bretter und Holzblöcke versahen ihre Stelle. Doch brannte ein gutes Feuer im Kamin, und Jack fühlte sich bei
dem Anblick desselben ganz behaglich.
»Jetzt komm',« sagte der Nix, »ich werde dir zeigen, wo ich die - du weißt schon, was ich meine - aufbewahre.« Und er warf ihm einen schlauen Blick zu.
Dann öffnete er eine kleine Türe und führte Jack in einen schönen Keller, der war mit Fässern aller Art von unten bis oben gefüllt. »Was sagst du dazu, Jack Dogherty? Eh? Glaubst du nun, dass man
sich's auch unter dem Wasser behaglich einrichten kann?« »Ich zweifle nicht daran,« erwiderte Jack, und das Wasser lief ihm im Munde zusammen. Als sie in das Zimmer zurückkehrten, war das Essen
bereit. Es war freilich kein Tischtuch da, aber was schadete das? Jack hatte auch zu Hause nicht immer eins. Die feinste Familie im Lande hätte sich dieses Mittagessens an einem Fasttage nicht zu
schämen brauchen. Es gab natürlich die besten Fische. Steinbutt, Stör, Seezunge, Hummer, Austern und viele andere kamen mit den allerbesten ausländischen Schnäpsen zugleich auf den Tisch. Die
Weine, sagte der alte Meermann, seien ihm für seinen Magen zu kalt.
Jack aß und trank, bis er nicht mehr weiter konnte. Dann ergriff er eine Muschel voll Cognac und sagte: »Auf Eure Gesundheit, Euer Gnaden. Euern Namen weiß ich merkwürdigerweise noch nicht,
trotzdem wir doch jetzt schon so lange miteinander bekannt sind.« »Das ist wahr, Jack, ich hab' nie daran gedacht. Aber spät ist besser als gar nicht. Mein Name ist Coomara.« »Was für ein schöner
Name!« rief Jack aus und füllte seine Muschel von neuem. »Auf Euer Wohl, also, Coomara, mögt Ihr Euch noch fünfzig Jahre Eures Dasein freuen!« »Fünfzig Jahre,« wiederholte Coomara, »ich bin dir
wirklich sehr verbunden! Wenn du fünfhundert gesagt hättest, das wäre doch wenigstens der Mühe wert gewesen.« »Auf Ehre,« rief Jack aus, »ihr erreicht ein hohes Alter hier unten! Ihr habt meinen
Großvater gekannt, der ist nun seit sechzig Jahren tot. Es ist wohl ein gesundes Wohnen hier?« »Gewiss, gewiss. Geh', Jack, bediene dich.«
Sie leerten eine Muschel nach der anderen, und Jack fand zu seiner ungeheuern Überraschung, dass die Getränke ihm nicht zu Kopfe stiegen. Offenbar war die Wasserfläche über ihnen die Ursache,
dass sie kühle Köpfe behielten. Der alte Coomara fühlte sich immer behaglicher und sang mehrere Lieder; aber Jack konnte sich nur an den Schluss eines einzigen Liedes erinnern:
»Rum fum boodle boo,
Ripple dipple ritty doo;
Dum doo doodle coo,
Raffle taffle tschittiboo!«
Endlich sagte der Nix zu Jack: »Nun, mein Lieber, werd' ich dir meine Sammlung von Merkwürdigkeiten zeigen, komm' mit!« Er öffnete eine kleine Tür und führte Jack in ein großes Zimmer, wo dieser
eine Menge Krimskrams sah, den Coomara im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Was aber Jacks Aufmerksamkeit am meisten erregte, waren Hummerbüchsen, die auf dem Boden die Wand entlang aufgestellt
waren. »Nun, Jack, wie gefallen dir meine Merkwürdigkeiten?« fragte der alte Meermann. »Auf Ehre, sehr sehenswert,« sagte Jack; »aber dürfte ich mir die Frage erlauben, was die Hummerbüchsen da
bedeuten?« »Ach! du meinst die Seelenkäfige?« »Was, Euer Gnaden?« »Die Dinger, in denen ich die Seelen aufbewahre.« »Ja, was für Seelen denn, Euer Gnaden?« fragte Jack höchlich erstaunt, »die
Fische haben doch keine Seelen?« »Oh nein,« erwiderte Coomara ganz ruhig, »die nicht, das sind die Seelen von ertrunkenen Matrosen.« »Der Herr beschütze und bewahre uns vor allem Bösen!« murmelte
Jack, »wie in aller Welt seid Ihr dazu gekommen?«
»Einfach genug. Wenn ich sehe, dass ein tüchtiger Sturm im Anzuge ist, so brauche ich nur zwei Dutzend von diesen Büchsen aufzustellen; sobald dann die Matrosen ertrunken sind und ihre Seelen
herauskommen, so sind die armen Dinger, die doch an die Kälte hier unten nicht gewöhnt sind, fast erfroren; da suchen sie in meinen Büchsen Schutz, ich sperre sie dann zu und bringe sie hierher
ins Trockene. Tut es den armen Seelen nicht gut, ein so vortreffliches Quartier zu bekommen?« Jack war so erstaunt, dass er nicht wusste, was er sagen sollte; er schwieg also. Sie gingen in das
Speisezimmer zurück und tranken noch ein wenig von dem ausgezeichneten Cognac, dann dachte Jack, es sei schon spät und Biddy würde ängstlich werden; er stand also auf und meinte, nun sei es Zeit,
dass er sich auf den Weg mache.
»Ganz wie du willst, Jack,« sagte Coomara, »aber nimm noch einen Abschiedstrunk, bevor du gehst, denn du hast eine kalte Reise vor dir.« Jack war viel zu höflich, als dass er den Abschiedstrunk
abgelehnt hätte. »Werd' ich wohl,« sagte er dann zum Meermann, »meinen Weg nach Hause finden?« »Was kann dir geschehen,« erwiderte sein Wirt, »wenn ich ihn dir zeige?« Sie gingen hinaus, und
Coomara setzte Jack einen Dreispitz auf, aber verkehrt, dann hob er ihn auf seine Schulter, um ihn von Stapel zu lassen. »So,« sagte er und gab ihm einen tüchtigen Schub, »du wirst genau an
derselben Stelle hinauskommen, von der wir hereingekommen sind; vergiss nur ja nicht, Jack, mir den Hut wieder herunterzuwerfen.« Damit schoss Jack wie eine Blase in die Höhe, surr, surr, surr,
bis er zu dem Felsen kam, von welchem er hinabgesprungen war. Dann warf er den Dreispitz ins Meer; der sank unter wie ein Stein.
Es war ein schöner Sommertag. Die Sonne ging gerade unter. Einsam funkelte ein Stern an dem wolkenlosen Firmament, die Wogen des Atlantischen Oceans erstrahlten in einem Meer von goldigem Licht.
Als Jack sah, dass es schon so spät war, machte er sich auf den Heimweg; doch sagte er Biddy kein Wort davon, wo er den Tag zugebracht hatte. Jack musste viel an die armen Seelen denken, die in
den Hummerbüchsen eingesperrt waren, und der Gedanke, wie er sie erlösen könnte, beschäftigte ihn unausgesetzt. Anfangs wollte er mit dem Pfarrer über die Sache sprechen, aber was hätte der tun
können, und was kümmerte sich der Nix um den Pfarrer? Coomara war übrigens ein guter Kerl und wusste nicht, dass er etwas Unrechtes tat. Überdies hätte sich Jack selbst damit geschadet, wenn man
erfahren hätte, dass er mit Meermännern zu Mittag speiste.
Er fasste also den Plan, Coomara zum Mittagessen einzuladen und alles aufzubieten, damit er sich einen Rausch antrinke. Dann wollte er den Dreispitz nehmen, in die Tiefe tauchen und die Seelen
aus den Hummerbüchsen befreien. In allererster Reihe war es nötig, Biddy fernzuhalten, denn Jack war klug genug, seine Absicht zu verbergen. Jack wurde also mit einemmale sehr fromm und sagte
Biddy, es wäre wohl beider Seelenheil zuträglich, wenn sie zum Johannisbrunnen in der Nähe von Ennis eine kleine Wallfahrt unternähme. Biddy war derselben Ansicht, und so machte sie sich denn an
einem schönen Morgen bei Tagesanbruch auf den Weg, nachdem sie Jack noch strenge aufgetragen hatte, das Haus zu hüten. Als die Luft rein war, ging Jack zu dem Felsen hinüber und gab Coomara das
verabredete Zeichen, das heißt, er warf einen großen Stein in das Wasser. Sofort tauchte der Nix empor.
»Guten Morgen, Jack,« sagte er, »was willst du von mir?« »Es ist nicht der Rede wert, Euer Gnaden,« erwiderte Jack. »Ich nehme mir nur die Freiheit, Euch zum Mittagessen einzuladen.« »Ich komme
sehr gern, Jack; um welche Stunde speisest du?« »Wie es Euch am besten passt, Euer Gnaden - vielleicht um ein Uhr, damit ihr noch bei Tageslicht nach Hause könnt.« »Gut, ich komme, du kannst
bestimmt auf mich rechnen.« Jack ging nach Hause und richtete ein feines Mittagessen her; dann brachte er Cognac in solcher Menge, dass sich zwanzig Männer daran hätten betrinken können.
Zur Minute kam Coomara, seinen Dreispitz unter dem Arm. Das Mittagessen war bereit, sie setzten sich zu Tische und aßen und tranken wacker drauf los.
Jack gedachte der armen Seelen unten in den Hummerbüchsen und tat Coomara beim Cognac tüchtig Bescheid. Er spornte ihn auch an, zu singen, weil er ihn so unter den Tisch zu bringen hoffte, aber
er vergaß, dass sie nicht die See über ihren Köpfen hatten. Der Cognac berauschte ihn; Coomara taumelte nach Hause, während Jack stumm wie ein Stockfisch am Charfreitag unter dem Tische lag. Er
erwachte erst am folgenden Morgen, und da befand er sich in einem traurigen Zustande.
»Es ist vergebens,« sagte Jack, »so ist dem alten Zecher nicht beizukommen; wie in aller Welt kann ich den armen Seelen aus den Hummerbüchsen helfen?«
Nachdem er fast den ganzen Tag darüber nachgedacht hatte, kam ihm plötzlich ein Gedanke. »Ich hab's,« rief er und schlug sich in seiner Freude aufs Knie, »ich hab's! Ich möchte darauf schwören,
dass er, so alt er auch ist, noch nie einen Tropfen echten Bergthaues gesehen hat; der wird seine Wirkung nicht verfehlen. Wie gut, dass Biddy noch zwei Tage fortbleibt! Da kann ich es ein
zweitesmal mit ihm versuchen.«
Er lud den Nix wieder ein, und der lachte ihn aus, dass er so wenig vertrug, und sagte ihm, dass er seinen Großvater nie erreichen würde. »Versucht es nur noch einmal,« erwiderte Jack, »und ich
bürge Euch dafür, dass ich Euch unter den Tisch trinke.« »Ich tue dir gern einen Gefallen, wenn es in meiner Macht steht,« sagte Coomara. Diesmal wässerte Jack seinen eigenen Cognac tüchtig, dem
Meermanne aber gab er den stärksten Cognac, den er besaß. Endlich sagte er: »Ich bitte, Euer Gnaden, habt ihr je einmal echten Bergthau getrunken?« »Nein,« antwortete der Nix, »was ist das, und
woher kommt es?« »Oh, das ist ein Geheimnis,« sagte Jack, »aber es ist der rechte Stoff. Wenn er nicht fünzigmal besser ist als Cognac oder Rum, so könnt Ihr mich einen Lügner schimpfen. Biddys
Bruder hat mir gerade für ein Fässchen Cognac ein wenig davon geschickt, und da Ihr ein alter Freund meiner Familie seid, so hab' ich ihn aufgehoben, um Euch damit aufzuwarten.« »Na, lass mal
sehen, was es ist,« sagte Coomara.
Der Whisky, den Jack seinem Gaste einschenkte, war ganz ausgezeichnet, und Coomara war entzückt. Er trank und trank und sang »Rum fum boodle boo« dazu und lachte und tanzte, bis er auf den Boden
fiel. Bald war er fest eingeschlafen. Da griff Jack, der ganz nüchtern geblieben war, nach dem Dreispitz, rannte zum Felsen, sprang hinein und erreichte bald Coomaras Haus. Alles war so still wie
ein Kirchhof um Mitternacht, kein Nix, weder alt noch jung, war zu sehen. Er ging hinein und stürzte die Hummerbüchsen um, aber er sah nichts; nur ein leises Pfeifen und Zirpen ward hörbar, als
er die Büchsen in die Höhe hob. Er war überrascht, doch erinnerte er sich, dass die Pfarrer oft gesagt hatten, kein lebendes Wesen könne die Seele sehen, geradeso wenig wie den Wind oder die
Luft. Nachdem er nun alles für sie getan hatte, was in seiner Macht stand, setzte er die Hummerbüchsen wieder so hin, wie er sie gefunden hatte, dann sprach er ein Gebet für die armen
Seelen.
Nun dachte Jack an den Rückweg. Er setzte sich den Hut verkehrt auf, wie es sich gehörte. Aber als er draußen war, fand er, dass das Wasser so hoch über seinem Kopfe stand, dass er keine Hoffnung
hatte, je hinein zu gelangen, denn nun war Coomara nicht da, um ihn, wie sonst, auf seine Schulter zu heben. Er schaute sich überall nach einer Leiter um, konnte aber keine finden, und es war
auch weit und breit kein Felsen zu sehen. Endlich kam es ihm vor, dass die See an einer Stelle tiefer herabhinge als überall sonst; er entschloss sich also, dort einen Versuch zu machen. Gerade
als er hinkam, sah er den Schweif eines großen Stockfisches vor sich. Da sprang er in die Höhe und ergriff den Schweif, und der erstaunte Stockfisch schnellte empor und zog Jack mit hinauf. In
dem Augenblicke, da der Dreispitz das Wasser berührte, schoss Jack auch schon wie ein Kork in die Höhe. In kurzer Zeit erreichte er den Felsen und eilte, ohne sich einen Augenblick aufzuhalten,
nach Hause, hocherfreut über das fromme Werk, das er vollbracht hatte.
Inzwischen gieng es zu Hause schön zu. Denn kaum hatte Jack das Haus verlassen, um sich zu den Seelen zu begeben, als Biddy von der Wallfahrt heimkam.
Als sie in das Haus eintrat, sah sie auf dem Tische alles durcheinander liegen. »Das ist eine nette Geschichte,« sagte sie, »der Lump! Ich Unglückliche! Während ich für sein Seelenheil bete, hat
er sich irgend einen Vagabunden aufgelesen und mit ihm zusammen den ganzen Bergthau, den ihm mein Bruder geschenkt hat, und alle Schnäpse, die er an die Edelleute verkaufen sollte, ausgetrunken.«
Da hörte sie ein seltsames Grunzen, sie blickte zu Boden, und da sah sie den Nix unterm Tische liegen.
»Heilige Jungfrau, beschütze mich,« rief sie aus, »er liegt da wie ein Tier! Ja, das Trinken, das macht den Menschen zum Tiere. Oh weh, oh weh! Jack, liebster Schatz, was soll ich mit dir
anfangen? Oder vielmehr, was soll ich ohne dich anfangen?« Unter solchen Klagen ging Biddy hinaus, sie wusste selbst nicht wohin, als sie plötzlich die wohlbekannte Stimme Jacks hörte, die ein
lustiges Lied sang. Wie froh war Biddy, ihn frisch und gesund wiederzusehen, und nicht in ein Tier verwandelt, das weder Fisch noch Fleisch war! Jack musste ihr nun alles erzählen, und obwohl
Biddy ihm eigentlich böse sein wollte, weil er ihr nicht schon früher alles gestanden hatte, so musste sie doch zugeben, dass er den armen Seelen einen großen Dienst erwiesen hatte.
Hand in Hand kehrten sie versöhnt ins Haus zurück. Jack weckte Coomara auf. Als er sah, dass der Nix ein wenig missgestimmt war, bat er ihn, sich nichts draus zu machen, denn das sei schon
manchem braven Manne passiert. Er sagte ihm ferner, das käme nur daher, dass er an den Bergthau nicht gewöhnt sei, und empfahl ihm, das Gift durch Gegengift zu vertreiben. Aber der Meermann
schien der Meinung, dass er genug getrunken hatte. Übel gelaunt stand er auf; er besaß nicht einmal so viel Lebensart, Jack ein höfliches Wort zu erwidern, sondern schlich sich davon, um sich
durch einen Sprung in das Salzwasser abzukühlen.
Der Nix erfuhr niemals, dass die Seelen nicht mehr in seinem Besitze waren. Er und Jack waren weiter die besten Freunde von der Welt. Was aber die Befreiung der Seelen aus ewiger Verdammnis
betrifft, so hat es darin noch kein Mensch Jack gleich getan. Er fand immer neue Ausflüchte, um ohne Wissen Coomaras in dessen Haus zu gelangen; dann wendete er die Hummerbüchsen um und ließ die
Seelen entfliehen. Nur eines ärgerte ihn: dass er sie niemals sehen konnte. Aber da er wusste, dass das unmöglich war, so musste er sich endlich zufrieden geben.
Sein Verkehr mit dem Meermann dauerte noch einige Jahre. Eines Morgens aber, als Jack wie gewöhnlich einen Stein ins Wasser warf, bekam er keine Antwort. Er warf einen Stein nach dem anderen
hinein, aber keine Antwort folgte. Er ging fort und kam am nächsten Morgen wieder, aber es half nichts. Da er keinen Dreispitz hatte, so konnte er nicht nachsehen, was aus dem alten Coomara
geworden war. Vermutlich war der Alte mittlerweile gestorben oder in eine andere Gegend gezogen.
Anna Kellner: Englische Märchen
Tam Lin
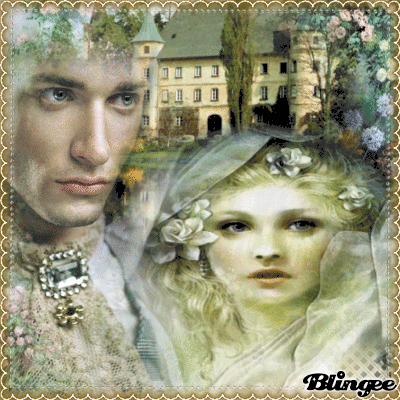
Die schöne Janet war die Tochter eines Grafen aus dem Unterland, der in seinem grauen Schloss inmitten grüner Wiesen wohnte. Eines Tages wurde es dem Mädchen zu langweilig, immer nur in ihrem
Zimmer zu nähen oder mit den Hofdamen ihres Vaters Schach zu spielen. So nahm sie einen grünen Umhang über die Schulter, flocht ihr gelbes Haar zu Zöpfen und ging aus, um die Wälder von
Carterhaugh zu durchstreifen. Sie wanderte bei Sonnenschein durch ruhige, grasbewachsene Täler voller grüner Schatten, wo Heckenrosen wucherten und Glockenblumen wuchsen. Sie streckte ihre Hand
aus, pflückte eine blasse Rose und steckte sie an ihre Hüfte. Kaum aber hatte sie die Blume vom Strauch gebrochen, da trat ein junger Mann auf den Pfad vor ihr. "Wie kannst du es wagen, die Rosen
von Carterhaugh zu pflücken und hier ohne Erlaubnis herumzulaufen?" fragte er Janet. "Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht", antwortete ihm das Mädchen. "Ich bin der Wächter dieser Wälder und
muß aufpassen, das niemand ihren Frieden stört", sagte der junge Mann.
Dann lächelte er so wie jemand, der lange Zeit nicht gelächelt hat, brach eine weiße Rose ab und steckte sie zu der weißen, die das Mädchen abgepflückt hatte. "Jemandem, der so hübsch ist wie du,
würde ich alle Rosen von Carterhaugh geben", sagte er. "Wer bist du?" fragte Janet. "Mein Name ist Tam Lin", antwortete der junge Mann. "Von dir habe ich schon gehört. Du bist doch ein
Feenritter", rief das Mädchen und warf die Blume, die er in ihren Gürtel gesteckt hatte, hastig von sich. "Du brauchst keine Angst zu haben, schöne Janet", sagte Tam Lin, "wenn man mich auch den
Feenritter nennt, so bin ich doch als sterblicher Mensch geboren worden wie du selbst auch." Janet hörte verwundert zu, als er ihr seine Geschichte erzählte: "Mein Vater und meine Mutter starben,
als ich noch ein Kind war. Mein Großvater, der Graf von Roxburgh, nahm mich zu sich. Eines Tages waren wir in diesem Wald hier auf der Jagd, als ein seltsam kalter Wind aus Norden aufkam. Ich
wurde sehr müde. Ich blieb hinter meinen Gefährten zurück und stürzte schließlich vom Pferd. Als ich erwachte, befand ich mich im Reich der Feen. Die Feenkönigin war gekommen, um mich zu stehlen,
als ich schlief." Hier hielt Tam Lin inne, und es war, als denke er an das grüne verzauberte Land. "Von da an", fuhr er fort, "stehe ich unter dem Bann, den die Feenkönigin über mich verhängt
hat. Am Tage bewache ich die Wälder von Carterhaugh und in der Nacht kehre ich ins Feenland zurück. 0 Janet, wie gern würde ich wieder das Leben eines gewöhnlichen Sterblichen führen. Ich wünsche
mir von ganzem Herzen, ich käme aus der Verzauberung los."
Er sagte das so unglücklich, daß Janet ausrief: "Und gibt es denn keine Möglichkeit, den Zauber zu brechen?" Da faßte Tam Lin sie bei den Händen und sagte: "Heute Nacht ist Halloween, Janet, und
das ist die Nacht der Nächte, wenn man es versuchen will. Zu Halloween reitet das Feenvolk aus, und ich reite mit ihnen." "Sag mir, was ich tun soll, um dir zu helfen?" fragte Janet, denn gar zu
gern würde ich das tun." "Wenn Mitternacht kommt", sagte Tam Lin zu ihr, "mußt du zum Kreuzweg, gehen und dort warten, bis der Zug der Feen vorbeikommt. Reitet die erste Gruppe heran, so kümmere
dich nicht um sie, sondern laß sie vorüber, auch die zweite Gruppe mußt du nicht beachten. Ich werde in der dritten Gruppe reiten. Mein Pferd ist eine milchweiße Stute, und auf dem Kopf trage ich
einen goldenen Reif. Dann lauf auf mich zu, reiß mich vom Pferd und nimm mich fest in die Arme, so fest, daß ich deine Brüste spüren kann. Was immer dann auch mit mir geschieht, halte mich fest
und laß mich nicht los, so kannst du mich zu den Sterblichen zurückholen."
Kurz nach zwölf in dieser Nacht eilte die schöne Janet zum Kreuzweg und wartete dort im Schatten eines Dornenbusches. Die Bäche glitzerten im Mondlicht, die Büsche warfen seltsame Schatten und
der Wind ratterte unheimlich im Laub der Bäume. Ganz schwach hörte sie den Klang der Hufe und das Geräusch des Lederzeugs. Da wußte sie, daß Feenpferde unterwegs waren. Sie fror und nahm ihren
Mantel fester um die Schultern und schaute die Straße hinunter. Zuerst sah sie das Blitzen eines silbernen Zaumzeugs, dann den weißen Blitz auf der Stirn des Pferdes, das zuerst kam. Bald war der
ganze Feenzug zu sehen. Die Reiter hatten ihre bleichen Gesichter zum Mond gewandt und Feenlocken wehten hinter ihnen drein, als sie dahinritten. Als die erste Abteilung vorbeikam, bei der sich
die Feenkönigin auf einer schwarzen Stute befand, verhielt sie sich ganz still. Auch bei der zweiten Gruppe rührte sie sich nicht. Dann kam die dritte Abteilung, und sie entdeckte das milchweiße
Pferd, auf dem Tam Lin saß. Sie sah auch den Goldreif in seinem Haar. Da sprang sie aus dem Schatten hervor, griff den Zügel, zerrte den Mann aus dem Sattel, nahm ihn in ihre Arme und preßte
seinen Kopf an ihre Brüste.
Sofort erhob sich Geschrei: "Tam Lin ist verschwunden!" Auf ihrem Rappen kam die Feenkönigin angeprescht. Sie wandte sich um und richtete ihre schönen unmenschlichen Augen auf Janet und Tam Lin.
Der Zauber der Feenkönigin traf Tam Lin, er wurde kleiner und kleiner, und plötzlich merkte die schöne Janet, daß sie eine Eidechse an ihrem Busen hielt. Aus der Eidechse wurde eine schlüpfrige
Schlange. Sie hatte Mühe, das Tier festzuhalten. Der Schreck rann ihr durch alle Glieder, als sich die Schlange in ein Stück rotglühendes Eisen verwandelte. Tränen der Furcht rannen Janet über
die Wangen, aber sie drückte Tam Lin an sich und ließ ihn nicht gehen.
Da wußte die Feenkönigin, daß sie Tam Lin verloren geben mußte, weil er die unnachgiebige Liebe eines sterblichen Weibes gewonnen hatte, und sie verwandelte den Ritter wieder in seine
ursprüngliche Gestalt zurück. Janet hielt plötzlich einen Mann umfangen, der war nackt, so wie er in diese Welt gekommen war aus dem Schoß seiner Mutter. Der Feenzug hielt noch einmal an. Eine
schmale grüne Hand schob sich vor und führte die milchweiße Stute fort, die Tam Lin geritten hatte. Dabei brach die Feenkönigin in bitteres Wehklagen aus: "Der schönste Ritter aus meinem Zug", so
rief sie, "ist verloren an die Welt der Sterblichen. Adieu Tam Lin! Hätte ich gewußt, daß sich eine sterbliche Frau in dich verlieben würde, ich hätte ihr das Herz aus der Brust gerissen und ihr
ein Herz aus Stein dafür eingesetzt. Hätte ich gewußt, daß die schöne Janet nach Carterhaugh kommt, ich hätte ihr ihre hübschen grauen Augen aus dem Kopf gekratzt und ihr statt dessen ein Paar
Holzaugen angehext." Als sie das rief, begann es hell zu werden, und mit einem unheimlichen Schrei gaben die Reiter ihren Pferden die Sporen und verschwanden. Tam Lin aber küsste Janets
verbrannte Hände, und zusammen liefen sie zu dem grauen Schloss, wo Janets Vater wohnte.
Märchen aus Schottland
Olwen und Einion
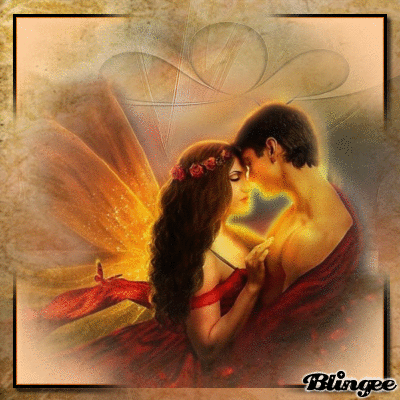
Einstmals trieb ein junger Hirt seine Herde einen Berg hinan. An jenem Tage, wie an so manchem schon bevor, herrschte ein dichter Nebel. Obgleich er nun mit der Gegend gar wohl vertraut war,
verlor er dennoch seinen Weg und ging bald vorwärts und bald rückwärts, durch so manche lange Stunde. Schließlich gelangte er an eine tiefergelegene, abschüssige Stelle, wo er vor sich kreisrunde
Ringe gewahrte. Da begriff er sogleich, an welch einem Platze er sich befand, und begann für sich das Schlimmste zu befürchten. Er hatte zu hunderten Malen schon von den traurigen Erfahrungen
jener gehört, die in solche Ringe geraten waren; von manch einem Schafhirt, der zufällig den Tanzplatz oder die Kreise der Feenfamilie betreten. Er eilte daher davon, so schnell er nur konnte,
damit er nicht wie die übrigen verderbe. Doch, obgleich er sich dermaßen anstrengte, daß ihm die Schweißtropfen von der Stirn liefen und der Atem ihm versagte, fand er sich doch immer wieder an
derselben Stelle stehen und so blieb er denn da für geraume Zeit.
Schließlich erschien vor ihm ein altes fettes Männchen mit munteren blauen Augen, das ihn fragte, was er hier suche. Der Jüngling antwortete, daß er bestrebt wäre, seinen Weg nach Hause zu
finden. »O«, sagte das Männlein, »folge mir nach, doch rede kein Wort, bis daß ich dir's heiße!« Der junge Hirt gehorchte und folgte jenem, bis daß sie zu einem ovalen Stein gelangten. Das alte
dicke Männchen hob diesen nun empor, nachdem er zuvor mit seinem Spazierstocke dreimal darauf geschlagen hatte. An dessen Stelle befand sich ein schmaler Pfad in die Tiefe, der dann und wann von
Treppen unterbrochen ward. Und eine Art von geisterhaftem Licht, ungefähr zwischen grau und blau, ward zwischen den Steinen zugleich sichtbar. »Folge mir ohne Furcht«, sagte das fette Männlein,
»und nichts Schlimmes soll dir widerfahren!« So schritt denn der arme Jüngling hinterdrein, so widerwillig wie ein Kalb, das geschlachtet werden soll.
Doch alsbald breitete sich eine herrliche, fruchtbare und bewaldete Landschaft vor ihnen aus, mit zierlich angeordneten Herrenhäusern übersät, während allerlei Zeichen von Wohlstand und Pracht
dem Auge sich darboten und alles in der Landschaft zu lächeln schien. Die blitzenden Wasser der Flüsse schlängelten sich zwischen den gewundenen Ufern und die Hügel waren mit dem üppigen Grün
ihrer Waldbestände überdeckt, die Berghöhen mit einem leuchtenden Vlies von glatten Weideflächen. Mittlerweile hatten sie sich einem stattlichen Herrensitze genähert. Des jungen Mannes Sinne
waren wie berauscht von den süßen Tönen der Lieder, welche die Vögel in den Büschen ringsher erklingen ließen.
Im Herrenhause gewahrte er leuchtendes Gold allüberall, das seine Augen blendete, und silberne Strahlen machten ihn vollends wirr. Er sah daselbst auch alle Arten von Musikinstrumenten und die
verschiedensten Dinge zum Spiel und Vergnügen. Doch konnte er nirgends einen Bewohner entdecken! Sodann saßen das Männlein und der Jüngling nieder, um zu essen, und da kamen die Speisen von
selbst auf den Tisch vor ihre Plätze und verschwanden wieder, sobald sie genossen. Dies machte den jungen Hirten über alle Maßen neugierig; mehr aber noch der Umstand, daß er rings um sich her
Leute miteinander reden hörte, gleichwohl er, was immer er auch tat, keinen anderen um sich sehen konnte, als seinen alten Gefährten. Schließlich sagte das fette Männlein zu ihm: »Nun kannst du
reden, so viel es dir gefällt.« Doch als er seine Zunge bewegen wollte, da rührte sie sich nicht. Wie wenn sie ein Klumpen Eis geworden wäre, so unbeweglich war sie, was ihn gar arg
erschreckte.
In diesem Augenblick erschien eine zierliche Dame bei ihnen, deren Gesicht von Gesundheit und Wohlwollen strahlte. Sie blickte leicht lächelnd auf den Hirten. Die Dame ward von ihren drei
Töchtern gefolgt, welche bemerkenswert schön waren. Sie sahen mit einer Art neckischen Blicks nach ihm und begannen schließlich zu ihm zu reden; allein seine Zunge rührte sich nicht. Darauf trat
eines der Mädchen zu ihm heran, spielte mit seinen blonden gekrausten Locken und gab ihm schließlich einen herzhaften Kuß auf seine jugendroten Lippen. Dies löste den Bann, der seine Zunge
gefesselt, und er begann nun zu sprechen, freimütig und beredt. Und so stand er denn unter dem Zauber jenes Kusses, das Herz erfüllt von der Wonne höchster Glückseligkeit. In diesem Banne
verblieb er ein Jahr und einen Tag, ohne daß er selbst es ahnen mochte, daß er mehr als einen Tag bei dem Mädchen verbracht; denn er war in ein Land gelangt, wo man die Zeit nicht rechnete.
Doch nach und nach begann er etwas wie Sehnsucht nach seinem alten Heim zu empfinden, das er besuchen wollte, und er fragte daher das feiste Männlein, ob er dahin gehen könnte. »Harre noch ein
wenig«, sagte jener, »und du sollst für geraume Zeit dahin können.« Auch diese Frist verging und er machte sich zum Aufbruch bereit; doch Olwen - so hieß die junge Fee, die ihn geküßt hatte -
zeigte sich sehr ungehalten darüber, daß er sie verlassen wollte. Sie sah ein jedesmal betrübt darein, wenn er von seinem Fortgehen sprach. Aber auch er dachte nur ungern daran, daß er sie
verlassen sollte, und er tat dies niemals, ohne einen kalten Schauer zu empfinden, der seinen ganzen Körper durchrieselte. Gegen das Versprechen der baldigen Rückkehr erlangte er schließlich auch
ihre Einwilligung, sich zu entfernen, und er ging dahin, versehen mit einer Menge Gold und Silber, mit Flitterwerk und Edelsteinen.
Als er daheim anlangte, erkannte ihn niemand; hatte man doch den Glauben gehegt, daß er durch einen anderen Schafhirt getötet worden, der sich genötigt sah, eilends zu flüchten, ansonst er
sicherlich gehenkt worden wäre. Doch nun war Einion Lâs zu Hause und jedermann erstaunte gar sehr, ihn zu erblicken und zu sehen, daß er das Äußere eines Weltmannes hatte. Seine Manieren, seine
Kleidung, seine Redeweise und die Schätze, die er mit sich brachte, all das trug dazu bei, ihm den Anstrich von Vornehmheit zu geben. In einer Donnerstagnacht aber, am ersten Neumond in jenem
Monat, entfernte er sich wieder und verschwand ebenso plötzlich wie einstmals und niemand wußte, wohin er geraten. Da war große Freude in dem unterirdischen Lande, als Einion dahin zurückkehrte,
doch niemand freute sich wohl mehr darüber als Olwen, seine geliebte Braut.
Die beiden ersehnten nun nichts heißer, als sich verheiraten zu können; doch mußte dies unbedingt in aller Stille geschehen; denn die Familie in der Unterwelt verabscheute nichts mehr als Lärm
und Getöse. So wurden sie denn in einer halb geheimen Weise einander vermählt. Einion war nun außerordentlich begierig, noch einmal unter seine Landsleute zu gehen, begleitet natürlich diesmal
von seiner Gattin. Nachdem er längere Zeit den alten Mann um Erlaubnis gedrängt, machten sich beide auf zwei schneeweißen Ponys dahin auf den Weg. So gelangte er denn mit seiner Gemahlin in sein
altes Heim und aller Meinungen stimmten darin überein, daß Einions Gattin die schönste Frau war, die sie jemals gesehen. Dieweil sie daheim weilten, wurde ihnen ein Söhnchen geboren, dem sie den
Namen Taliessin gaben. Einion erfreute sich nun des höchsten Ruhmes unter seinen Landsleuten, die auch seiner Frau den gebührenden Respekt entgegenbrachten. Ihr Vermögen war ansehnlich und sie
erstanden sich einen ausgedehnten Grundbesitz.
Doch währte es nicht lange, daß die Leute nach der Familie von Einions Gattin zu forschen begannen. In der Gegend war man der Ansicht, daß es nicht mit rechten Dingen zugehen müsse, wenn man
keine Familienzugehörigkeit nachzuweisen habe. Einion wurde darüber befragt, ohne daß er jedoch eine zufriedenstellende Antwort gegeben hätte. Und da kam denn einer zu der Vermutung, daß sie von
einer Feenfamilie herstammen müßte. »Gewiß«, entgegnete Einion, »da kann kein Zweifel sein, daß sie aus einer wahren Feenfamilie ist, denn sie besitzt zwei Schwestern, die ebenso feenhaft schön
sind, wie sie; wenn ihr sie beisammen sehen möchtet, würdet ihr zugeben müssen, daß 'Feenfamilie' die einzig zutreffende Bezeichnung für sie ist.« Dies ist der Grund, weshalb die vornehmste
Familie in der Gegend von Hud a Lledrith heute noch die »Feenfamilie« genannt wird.
Keltisch: M. Brusot: Keltische Volkserzählungen
Koboldmärchen
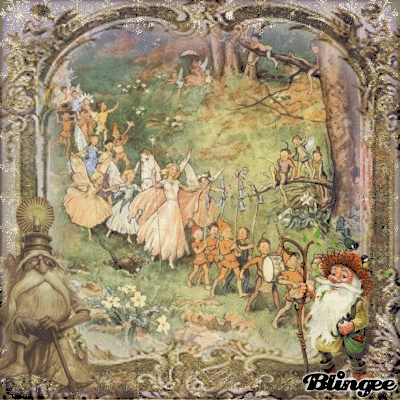
Der Grund des Sees Llyn Cynnwch, auf dem Landgute Nannau, birgt in seiner Tiefe den Herdstein vom Hause des Dôl y Clochyd. Dieser Grund wurde von dem Geliebten eines Mädchens namens Siwsi
erforscht, als er auf dem Wege zu ihr von Nannau aus, wo er Knecht war, sich einst verirrte. Der arme Jüngling fiel dabei in den See und sank tiefer und tiefer, bis er bemerkte, daß es klarer zu
werden anfing, je tiefer er gelangte. Schließlich blieb er auf ebenen Boden stehen, wo jegliches so aussah, wie er es vom trockenen Lande her kannte. Als er derart den Grund des Sees erreicht
hatte, erschien ein kurzbeiniger fetter alter Mann vor ihm und fragte ihn, was er hier suche; worauf er ihm erzählte, wie es gekommen, daß er daselbst erschienen wäre.
Der Jüngling wurde freundlichst willkommen geheißen und blieb nun einen Monat in der Tiefe, dieweil er drei Tage kaum verweilt zu haben vermeinte. Als es zum Abschied kam, wurde er von allen
Bewohnern des Seebodens bis an das trockene Land geleitet, worauf er den Weg zu seiner Geliebten nahm. Er berichtete später, daß die ganze Gegend eben wäre, ausgenommen einer einzigen Stelle, wo
er etwa einen Faden nach abwärts steigen mußte; doch, fügte er hinzu, wäre es darauf notwendig gewesen, ebensoviel wieder emporzusteigen, um den Herdstein des Dôl y Clochyd zu erreichen. Das
Wunderbarste aber sei gewesen, daß dieser Stein sich von selbst emporhob, als er den unterirdischen Gang emporgeschritten kam. So war er denn eines Abends wiedergekehrt, gerade als das geliebte
Mädchen am Feuer saß und um ihn weinte. Siwsi war vor einigen Tagen aus gewesen und dabei den Kobolden begegnet. Sie hatte daher alles gewußt, was ihm zugestoßen war, ohne daß sie jedoch irgend
jemand es anvertraut hätte. Solcherart war denn durch Zufall die Tiefe des Llyn Cynnwch bekannt geworden.
* * *
Ganz vorzüglich gilt das Gelände von Aran Fawdwy als ein Lieblingsplatz der Feen- und Koboldfamilie. Dort finden sie sich regelmäßig ein, um ihren Spielen zu frönen und rings in der Gegend wird
dann ihr Lärmen vernommen. Auch um Bwlch y Groes pflegen sie, wie man erzählt, scharenweise aufzutauchen. Einstmals kreuzte ein Jüngling das Gelände gegen Dämmerung an einem schönen Sommertage,
und da sah er ganz nahe von Aber Rhiwlech einen Schwarm der kleinen Familie, Kobolde und Feen, wie diese gerade voll Eifer dem Tanze oblagen. Der Jüngling ward dabei von ihnen erblickt und begann
nun zu laufen, verfolgt von zwei Feenmädchen, die ihn stehen zu bleiben hießen. Robin aber, so hieß jener Jüngling, lief hurtig und unablässig, so daß ihn die beiden Feen nicht erhaschen konnten;
ansonst er sicherlich in ihren Liebesfesseln zugrunde gegangen wäre. Man findet noch heute eine Menge ihrer Tanzringe rings an den Abhängen, besonders zwischen Aber Rhiwlech und Bwlch y
Groes.
* * *
Eines Tages begaben sich zwei Freunde an die Ufer des Pennant, um Ottern zu jagen und als sie nahe zum Fluß gelangten, erblickten sie irgendein kleines Wesen von roter Farbe, das quer durch die
Wiesen hurtig gegen den Fluß zulief. Sie eilten ihm nach und sahen, wie es zwischen den Wurzeln eines Baumes am Ufer sich verkroch, um dort sich zu verbergen. Die beiden Männer dachten, daß es
eine Otter wäre, obgleich sie nicht begreifen konnten, wieso sie ihnen von roter Farbe erschien. Sie wünschten diese lebend einzufangen und einer von ihnen begab sich daher nach einer Bauernhütte
in der Nähe, um dort einen Sack auszuleihen, damit er darin das Wesen fangen könnte.
Nun waren zwei Löcher unter den Wurzeln des Baumes und indes der eine den Sack mit der Öffnung über das eine hielt, steckte der andere seinen Stock in das zweite Loch und das Geschöpf lief so in
den Sack. Die zwei Männer glaubten eine Otter gefangen zu haben, was sie als nicht geringes Kunststück ansahen. Sie machten sich nach Hause auf, doch ehe sie noch ein größeres Stück gegangen
waren, begann der Gefangene im Sack mit einer traurigen Stimme also zu ihnen zu sprechen: »Meine Mutter ruft mich! Ach, meine Mutter ruft mich!« Dies jagte den beiden Jägern so gewaltigen
Schrecken ein, daß sie mit einem Mal den Sack zur Erde warfen. Doch wie groß war ihre Überraschung, einen kleinen Mann in roter Joppe daraus hervorstürzen und gegen den Fluß zu flüchten zu sehen!
Er entschwand alsbald ihren Augen hinter den Büschen am Flusse. Die beiden Männer waren arg erschrocken und hielten es für das klügste heimzugehen, statt mit der Koboldfamilie sich weiter
einzulassen.
* * *
Der Eigentümer einer Hütte in jener Gegend hatte einen kleinen Teil des Berghangs neben seinem Heime beackert, in der Absicht Kartoffeln zu pflanzen; was er auch tat. Dabei bemerkte er auf einem
Baume, unfern von seinem Acker, das Nest einer Saatkrähe und er dachte, daß es am klügsten wäre, das Nest zu zerstören, ehe die Krähen sich vermehrt haben würden. Daher erkletterte er den Baum
und zerstörte das Nest. Als er darauf herabstieg, gewahrte er einen grünen Kreis - einen Feenring - rings um den Baum und innerhalb dieses Kreises erspähte er zu seiner großen Freude ein
funkelndes Goldstück. Als er am folgenden Tage zur selben Stelle kam, fand er ein anderes Goldstück auf dem gleichen Flecke, wie gestern. Und so geschah es durch mehrere Tage; doch eines Tages
erzählte er einem Freunde von seinem Glücke und zeigte ihm auch die Stelle, wo er an jedem Morgen das Goldstück gefunden hatte. Aber am nächsten Morgen, da fand sich für ihn weder ein Goldstück,
noch sonst irgend etwas. Denn er hatte die Gesetze des Feenvolkes verletzt, indem er ihre Freigebigkeit bekannt gemacht. Denn diese sind der Meinung, daß die linke Hand nicht zu wissen brauche,
was die rechte tue.
Keltisch: M. Brusot: Keltische Volkserzählungen
Die drei Bären

Es waren einmal drei Bären, die lebten zusammen in ihrem eigenen Hause mitten im Walde. Einer von ihnen war kleinwinzig, der andere war mittelgroß und der dritte war ein ungeheuer großer
Riesenbär. Sie hatten jeder einen Napf für ihre Suppe, der kleinwinzige einen kleinwinzigen, der mittelgroße einen mittelgroßen und der Riesenbär einen sehr großen. Sie hatten auch jeder einen
Stuhl, der kleinwinzige einen kleinwinzigen, der mittelgroße einen mittelgroßen und der Riesenbär einen sehr großen. Und sie hatten ferner jeder ein Bett, der kleinwinzige ein kleinwinziges, der
mittelgroße ein mittelgroßes und der Riesenbär ein sehr großes.
Eines Tages kochten sie ihre Frühstücksuppe und schütteten sie in ihre Näpfe, und während die Suppe auskühlte, gingen sie in den Wald, um nicht zu frühe zu essen und sich so den Mund zu
verbrennen. Und während sie so im Walde spazieren gingen, kam ein altes Weiblein herbei. Es konnte unmöglich ein ehrliches altes Weiblein sein, denn zuerst guckte es durch das Fenster und dann
durch das Schlüsselloch hinein; und als es niemand drin sah, drückte es an der Türklinke. Die Tür war nicht verschlossen, denn die Bären waren gute Bären, die niemand etwas zuleide taten und auch
niemals fürchteten, dass jemand ihnen etwas zuleide tun könnte. Das alte Weiblein öffnete also die Tür und war hoch erfreut, als sie die Suppe auf dem Tische sah. Wäre sie ein gutes altes
Weiblein gewesen, so hätte sie gewartet, bis die Bären heimkehrten, die hätten sie dann vielleicht zum Frühstück eingeladen, denn es waren gute Bären - ein wenig bärbeißig vielleicht, wie es
schon die Art der Bären ist, aber sonst sehr gutherzig und gastfreundlich. Sie war aber eine böse, unverschämte alte Frau und griff uneingeladen zu.
Zuerst kostete sie die Suppe des Riesenbären, die war ihr zu heiß und sie fluchte darüber. Dann kostete sie die Suppe des mittelgroßen Bären. Die war ihr zu kalt und sie fluchte auch darüber.
Zuletzt kostete sie die Suppe des kleinwinzigen Bären. Die war ihr weder zu heiß, noch zu kalt, sondern gerade recht und schmeckte ihr so gut, dass sie die ganze Suppe auslöffelte. Aber auch über
den kleinwinzigen Napf fluchte die böse alte Frau, denn es war ihr nicht genug Suppe drin. Dann setzte sich das alte Weiblein auf den Stuhl des Riesenbären, aber der war ihr zu hart. Sie setzte
sich nun auf den Stuhl des mittelgroßen Bären, aber der war ihr zu weich. Zuletzt setzte sie sich auf den Stuhl des kleinwinzigen Bären, der war ihr weder zu hart, noch zu weich, sondern gerade
recht. So saß sie denn auf dem Stuhl des kleinwinzigen Bären, bis der Sitz durchbrach und sie plumps! auf den Boden fiel. Da fluchte die alte Frau auch darüber.
Dann ging das alte Weiblein die Treppe hinauf in das Schlafzimmer der drei Bären. Zuerst legte sie sich in das Bett des Riesenbären, aber da waren ihr die Kopfkissen zu hoch. Dann legte sie sich
in das Bett des mittelgroßen Bären, aber da war ihr das Keilkissen zu niedrig. Zuletzt legte sie sich in das Bett des kleinwinzigen Bären, da waren ihr weder die Kopfkissen zu hoch, noch das
Keilkissen zu niedrig, sondern es war ihr gerade recht. Sie deckte sich also recht warm zu und war bald fest eingeschlafen.
Um diese Zeit glaubten die Bären, dass ihre Suppe schon ausgekühlt sein würde; sie gingen also nach Hause, um zu frühstücken. Nun hatte aber das alte Weiblein den Löffel in der Suppe des
Riesenbären stecken lassen, und dieser sagte in seiner rauhen Bassstimme: »Jemand hat von meiner Suppe gegessen!«
Als der mittelgroße Bär auf seine Suppe blickte, sah er auch darin den Löffel stecken. Wären es silberne Löffel gewesen, so hätte die böse alte Frau sie sicherlich eingesteckt. »Jemand hat von
meiner Suppe gegessen!« sagte der mittelgroße Bär in seiner mittelstarken Stimme. Dann sah der kleinwinzige Bär auf seinen Suppennapf; auch da steckte der Löffel drin, aber die Suppe war
verschwunden. »Jemand hat von meiner Suppe gegessen!« sagte der kleinwinzige Bär in seiner dünnen Fistelstimme.
Als nun die Bären sahen, dass jemand in ihr Haus gekommen war und das Frühstück des kleinwinzigen Bären aufgegessen hatte, begannen sie alle drei sich umzuschauen. Nun hatte aber das alte
Weiblein das harte Kissen auf dem Stuhle des Riesenbären nicht wieder zurechtgerückt, als sie sich daraus erhoben hatte. »Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen!« sagte der Riesenbär in seiner
rauhen Bassstimme. Das alte Weiblein hatte das weiche Kissen des mittelgroßen Bären plattgedrückt. »Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen!« sagte der mittelgroße Bär in seiner mittelstarken
Stimme. Nun wisst ihr alle, was das alte Weiblein dem dritten Stuhl getan hat. »Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen und den Sitz durchgebrochen!« sagte der kleinwinzige Bär in seiner dünnen
Fistelstimme.
Da hielten es die drei Bären für angezeigt, weiter Umschau zu halten, und sie gingen alle drei die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. Nun hatte aber das alte Weiblein das Kopfkissen des
Riesenbären verschoben. »Jemand hat in meinem Bett gelegen!« sagte der Riesenbär in seiner rauhen Bassstimme! Das alte Weiblein hatte aber auch das Keilkissen des mittelgroßen Bären verschoben.
»Jemand hat in meinem Bett gelegen!« sagte der mittelmäßige Bär in seiner mittelstarken Stimme. Als der kleinwinzige Bär auf sein Bett hinblickte, da lag das Keilkissen auf seinem Platz, und auf
dem Keilkissen lag das Kissen und auf dem Kissen der schmutzige, hässliche Kopf des alten Weibleins - aber nicht auf seinem Platz, denn er hatte dort nichts zu suchen. »Jemand hat in meinem Bett
gelegen - und da ist sie!« sagte der kleinwinzige Bär in seiner dünnen Fistelstimme.
Das alte Weiblein hatte im Schlafe die rauhe Bassstimme des Riesenbären gehört; aber sie schlief so fest, dass es ihr vorkam wie das Heulen des Windes oder das Rollen des Donners. Sie hatte auch
die mittelstarke Stimme des mittelgroßen Bären gehört, aber da war ihr, als ob sie jemand im Traume sprechen hörte.
Aber die dünne Fistelstimme des kleinwinzigen Bären war so schrill und durchdringend, dass sie sofort aufwachte. Sie fuhr in die Höhe, und als sie drei Bären an der einen Seite des Bettes stehen
sah, wälzte sie sich auf der anderen Seite hinunter und rannte aus dem Fenster. Das Fenster war offen, weil die Bären wie alle guten ordentlichen Bären immer das Fenster ihres Schlafzimmers
öffneten, sobald sie des Morgens aufstanden. Das alte Weiblein sprang aus dem Fenster. Ob sie nun bei dem Falle ihr Genick brach, oder ob sie in den Wald rannte und sich dort verirrte, oder ob
sie den Weg aus dem Walde fand und vom Polizeimann festgenommen und als Landstreicherin in die Besserungsanstalt geschickt wurde, das ist mir nicht bekannt.
Die drei Bären aber haben sie nie wieder zu sehen bekommen.
Anna Kellner: Englische Märchen
Die Fee von Bedgelert
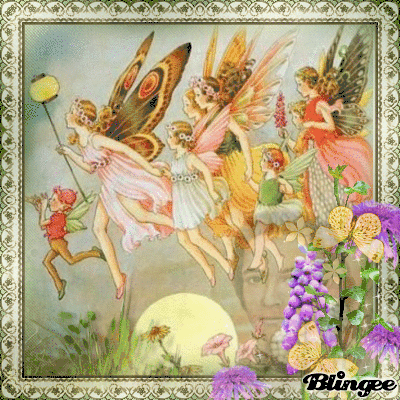
Am nordwestlichen Ende des Pfarrdorfes Bedgelert befindet sich eine Gegend, die von den alten Dorfbewohnern das »Feenland« genannt wird und die sich vom Cwm Hafod Ruffyd, längs dem Abhang des
Berges Drws y Coed, bis zum Llyn y Dywarchen hin erstreckt. In früheren Zeiten pflegten die Leute dieser Gegend viel Vergnügen und Unterhaltung darin zu finden, in Mondnächten der bezaubernden
Musik der Feenfamilie zu lauschen und ihrem Tanz und wunderlichen Treiben zuzusehen.
Einstmals, vor langer Zeit, lebte droben auf dem Hange des Drws y Coed ein Jüngling, frohen und werktätigen Naturells, stattlich und kühnen Herzens. Dieser Jüngling vergnügte sich so manche Nacht
damit, dem Treiben der Feen zuzusehen und ihren Gesängen zu lauschen. Eines Nachts waren diese auf ein Feld in der Nähe seines Hauses gekommen, das am Ufer des Llyn y Dywarchen stand, um da eine
heitere Nacht zu verbringen. Er ging, wie gewöhnlich, um ihnen zuzusehen, als seine Blicke auf eine von den Feen trafen, die so voll lieblicher Reize war, wie er es bei keinem menschlichen Weibe
noch gesehen. Ihr Teint war wie Alabaster so weiß, ihre Stimme klang so süß wie die der Nachtigall und war so sanft einschmeichelnd, wie der Zephir in einem Blumengarten um die Mitte eines langen
Sommertages. Ihre Bewegungen waren zierlich und edel; und ihre Füßchen schwebten sich beim Tanz ebenso flüchtig überm Rasen hin, wie die Sonnenstrahlen, die vor wenigen Stunden noch über den See
geglitten waren.
Der Jüngling verliebte sich über Hals und Kopf auf der Stelle; und angetrieben von der Macht der Leidenschaft - denn was ist mächtiger als Liebe! - stürzte er sich, eben als das Getöse seinen
Höhepunkt erreicht hatte, inmitten des Haufens, riß das anmutige Mägdlein in seine Arme und lief im Nu mit seiner Beute nach Hause. Als die Feen die Gewalttat des Sterblichen sahen, brachen sie
ihren Tanz ab und liefen hinterher nach dem Hause. Doch als sie davor anlangten, fanden sie das Tor mit Eisenbalken verriegelt, so daß sie ihrer Gespielin nicht nahen, noch auch mit ihr sich
verständigen konnten, denn jener hatte die junge Fee in einem sicheren Gemache eingeschlossen. Der Jüngling versuchte nun, nachdem er sie so unter seinem Dache hatte, mit all seinen
Überredungskünsten ihre Neigung zu gewinnen und sie zu bestimmen, seine Gattin zu werden. Anfangs wollte sie um keinen Preis ihn anhören; doch schließlich, seine Beharrlichkeit gewahrend und
einsehend, daß er sie nicht mehr zu ihren Leuten zurückkehren lassen würde, erklärte sie sich gewillt, bei ihm als Magd zu verbleiben, falls er ihren Namen erraten könnte; heiraten aber würde sie
ihn nicht.
Da der Jüngling dachte, daß es ihm nicht unmöglich sein würde, so willigte er halb und halb in diese Bedingung ein. Doch nachdem er seinen Kopf mit allen Namen abgeplagt, die man in der Gegend
nur kennen mochte, fand er sich seinem Ziele dennoch nicht näher gebracht. Allein er war trotzdem nicht gewillt, sein Suchen übereilterweise aufzugeben. Eines Nachts, als er vom Markte zu
Carnarvon auf dem Heimwege sich befand, sah er eine Anzahl von Feen in einem Haufen beisammen, unfern von seinem Pfade. Sie schienen in einer wichtigen Beratung begriffen und da fiel ihm ein, daß
sie wohl schlüssig werden möchten, wie sie ihre entführte Schwester befreien könnten. Zudem aber dachte er, daß, wenn er verstohlen in Hörweite gelangen könnte, er vielleicht auch deren Namen
vernehmen würde. Nachdem er sorgfältig umhergeblickt, fand er, daß ein Graben just neben der Stelle vorbeilief, wo sie standen. So nahm er denn seinen Weg herum nach dem Graben und kroch auf
allen vieren diesen entlang, bis daß er in Hörweite der Versammelten gelangte.
Nachdem er ein wenig gelauscht, fand er, daß ihre Beratungen sich um das Schicksal der Fee drehten, die er entführt hatte und er vernahm, wie eine von ihnen klagend ausrief: »O Penelop, o
Penelop, meine Schwester! Warum ließest du dich von jenem Sterblichen entführen?« »Penelop«, sagte der junge Mann zu sich selbst, »dies muß der Name meiner Liebsten sein: es ist mir genug!«
Darauf begann er vorsichtig nach rückwärts zu kriechen und kehrte wohlbehalten nach Hause zurück, ohne von den Feen erblickt worden zu sein. Als er das Haus betrat, rief er das Mädchen zu sich
heran, indem er sagte: »Penelop, du meine Allerliebste, komm' zu mir!« Und sie kam herbei und fragte voll Erstaunen: »O Sterblicher, wer hat dir meinen Namen verraten?« Dann, ihre zarten Hände
emporhebend, rief sie aus: »Ach, mein Schicksal, mein Schicksal!«
Dennoch fand sie sich gar bald mit ihrem Schicksal ab und ging ernsthaft an ihre Beschäftigung. Jegliches im Hause und auf der Farm prosperierte unter ihrer Obhut. Da war keine tüchtigere oder
reinlichere Hausfrau in der ganzen Nachbarschaft herum, oder eine, die umsichtiger gewesen wäre, als sie. Der junge Mann war indessen keineswegs befriedigt damit, sie in seinem Hause lediglich
als Magd schalten zu sehen, und nachdem er lange und hartnäckig sie bestürmt, willigte sie schließlich ein ihn zu heiraten, unter der einen Bedingung, daß, wenn er jemals sie mit Eisen berühren
würde, sie frei werden sollte, um ihn zu verlassen und zu ihrer Familie zurückzukehren. Er willigte in diese Bedingung, da er überzeugt war, daß dergleichen Ding niemals in seine Hände geraten
würde. So heirateten sie denn und lebten mehrere Jahre glücklich und angenehm beisammen. Zwei Kinder wurden ihnen geboren, ein Knabe und ein Mädchen, die Ebenbilder ihrer Mutter und die Abgötter
ihres Vaters.
Eines Morgens, als der Gatte sich aufmachte, um nach Carnarvon auf die Messe zu gehen, trat er vors Haus, um ein junges Füllen einzufangen, das nebenan auf dem Anger graste. Aber um alles in der
Welt wollte es ihm nicht gelingen, dieses zu erhaschen und er rief deshalb nach seiner Frau, damit sie ihm behilflich wäre. Sie erschien ohne Zögern und es gelang ihnen auch, das Füllen in einen
Winkel zu treiben, wo sie es gesichert wähnten. Als jedoch der Mann sich ihm näherte, um es zu erfassen, da huschte es dicht neben ihm davon. In seiner Aufregung warf er ihm den Zaum nach; doch
wer kam just aus jener Richtung herbeigelaufen? ... Sein eigenes Weib! Der eiserne Halfter schlug ihr auf die Wange und sie entschwand auf der Stelle seinen Blicken. Der Gatte sah sie niemals
wieder. Doch in einer kalten, frostigen Nacht, geraume Zeit nach jenem Vorfall, wurde er von irgend jemand aus seinem Schlummer wachgerüttelt, der an die Scheibe seiner Stube pochte. Und nachdem
er Antwort gegeben, erkannte er die süße und zärtliche Stimme seiner Gattin, die also zu ihm redete:
»Ist dem Knaben kalt - hörst du? -
Deck' ihn mit Vaters Rocke zu!
Ist dem Mägdlein kühl jedoch,
Bedeck's mit meinem Unterrock!«
Man sagt, daß die Nachkommen dieser Familie in jener Gegend noch fortleben und daß sie leicht zu erkennen wären durch ihren hellen Teint und ihre schönen Gesichtszüge ....
Keltisch: M. Brusot: Keltische Volkserzählungen
Die Seejungfrau
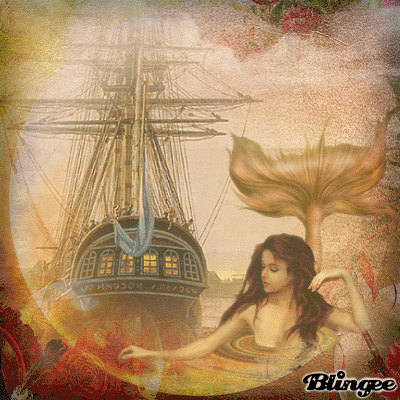
Es war einmal ein alter Fischer, der fing eine Zeitlang nur sehr wenig Fische. Da tauchte eines Tages dicht vor seinem Boote eine Seejungfrau empor, die fragte ihn, ob er viele Fische finge.
»Nein,« antwortete der alte Mann. »Was für Belohnung,« fragte ihn die Seejungfrau, »verheißest du mir, wenn ich dir Fische im Überfluss ins Netz schicke?« »Ach,« sagte der alte Mann, »ich besitze
blutwenig.« »Willst du mir deinen erstgeborenen Sohn geben?« fragte sie.
»O ja, wenn ich je einen haben sollte. Aber ich habe keinen und werde nie einen haben, denn ich und meine Frau, wir sind beide schon alt.« »Sage mir, was du besitzest.« »Ich habe nur eine alte
Mähre, einen alten Hund und meine Frau. Ich hab' sonst nichts auf der Welt.«
»Hier sind drei Körner, die du noch heut abends deiner Frau geben sollst,« fuhr die Seejungfrau fort, »hier drei andere für den Hund und drei für dein Pferd. Diese drei hier aber sollst du hinter
deinem Hause pflanzen. Und es wird die Zeit kommen, da wird deine Frau drei Söhne haben und der Hund drei Junge und die Mähre drei Füllen. Und hinter deinem Hause werden drei Bäume emporwachsen,
und wenn einer von deinen Söhnen stirbt, so wird einer von den Bäumen verdorren, du aber wirst von nun an Fische fangen im Überfluss. Doch denke daran, dass du mir deinen ältesten Sohn bringen
musst, sobald er drei Jahre alt geworden ist.«
Alles ging in Erfüllung, wie es die Seejungfrau vorausgesagt hatte, und der alte Mann fing Fische in Menge. Aber als das dritte Jahr sich seinem Ende näherte, da wurde er sehr niedergeschlagen
und bekümmert und kam zusehends von Kräften. An dem Tage, da das dritte Jahr um war, fuhr er wie gewöhnlich aufs Meer hinaus, um zu fischen, aber er nahm seinen Sohn nicht mit. Da tauchte die
Seejungfrau dicht vor seinem Boote auf und fragte: »Hast du mir deinen Sohn gebracht?« »Nein,« erwiderte der Fischer, »ich hab' ihn nicht mitgebracht, ich habe ganz vergessen, dass gerade heute
die drei Jahre um sind.« »Schon gut,« sagte die Seejungfrau, »behalte ihn noch vier Jahre; vielleicht kannst du dich dann leichter von ihm trennen.«
Überglücklich, dass er seinen Sohn noch vier Jahre behalten dürfe, kehrte der alte Mann nach Hause zurück. Er fuhr fort, Fische zu fangen, die ihm reichlich ins Netz kamen, aber als das vierte
Jahr seinem Ende zuging, da wurde er vor Kummer ganz krank, er aß nicht und trank nicht, und seine Frau wusste nicht, was ihm fehlte. Diesesmal wusste er nicht, was er tun sollte, doch war er
fest entschlossen, auch diesesmal seinen Sohn nicht mitzunehmen. Wieder fuhr er wie sonst aufs Meer hinaus, um zu fischen, und wieder tauchte die Seejungfrau dicht vor seinem Boote empor und
fragte ihn: »Hast du mir deinen Sohn gebracht?« »Ach,« erwiderte der Fischer, »ich hab' ihn auch diesmal vergessen.« »Kehre nach Hause zurück«, sagte die Seejungfrau, »aber von heute in sieben
Jahren musst du ihn mir ganz bestimmt bringen. Es wird dir dann nicht leichter fallen, dich von ihm zu trennen. Inzwischen wirst du weiter Fische haben in Überfluss.«
Voller Freude kam der alte Mann heim. Er konnte seinen Sohn weitere sieben Jahre behalten, länger, glaubte er, würde er wohl nicht leben und also die Seejungfrau nicht mehr sehen. Aber das Ende
der siebenten Jahres kam heran, und wieder empfand der Fischer Kummer und Sorge. Er fand Tag und Nacht keine Ruhe. Eines Tages fragte ihn sein ältester Sohn, was ihn betrübe. Der Vater wollte
zuerst nicht mit der Sprache heraus. Da sagte der Bursche, dass er es erfahren müsse, und endlich erzählte ihm der Vater von dem Übereinkommen zwischen ihm und der Seejungfrau. »Sei unbesorgt,«
sagte der Sohn, »mache mit mir, was du willst.« »Du sollst aber nicht zu ihr gehen, mein Sohn, und wenn ich mein Lebenlang keinen Fisch mehr fange.« »Wenn du nicht willst, dass ich mit dir gehe,
so bestelle mir beim Schmied ein festes, starkes Schwert, damit will ich mein Glück versuchen,« sagte der Sohn.
Da ging der Vater zum Schmied, und der machte ihm ein tüchtiges Schwert. Als er damit heimkam, da ergriff es der Sohn; kaum aber hatte er es ein- oder zweimal geschwungen, so zersprang es in
hundert Splitter. Da bat er seinen Vater, ihm ein anderes Schwert machen zu lassen, das aber sollte noch einmal so schwer sein. Sein Vater tat es, aber es erging dem neuen Schwerte nicht besser
als dem ersten: er zerbrach es in zwei Hälften. Da ging der alte Mann zum drittenmale zum Schmied, und der schmiedete ein Schwert, wie er noch nie zuvor eines gemacht hatte. »Hier hast du das
Schwert,« sagte der Schmied, »es gehört eine tüchtige Faust dazu, es zu schwingen.« Der Fischer brachte es seinem Sohne, der es probierte.
»Das ist recht,« sagte er, »nun ist es hohe Zeit, mich auf den Weg zu machen.« Am folgenden Morgen sattelte er das schwarze Pferd und ritt, von seinem Hunde gefolgt, von dannen. Unterwegs stieß
er auf ein totes Schaf; ein großer Hund, ein Falke und eine Fischotter stritten sich darum. Da stieg er vom Pferde und verteilte das Aas so unter die drei, dass der Falke einen, die Fischotter
zwei und der Hund drei Teile davon erhielt. Darauf sagte der Hund: »Wenn dir ein flinker Fuß oder ein scharfer Zahn nützen kann, dann denk' an mich, und ich will dir zu Hilfe kommen.« Dann sagte
die Fischotter: »Wenn dir ein schwimmender Fuß in der Tiefe eines Sees zustatten kommen kann, so denk' an mich, und ich will dir zu Hilfe kommen.« Zuletzt sprach der Falke: »Wenn du in Not
gerätst, aus der dich hurtige Schwingen oder krumme Krallen befreien können, so denk' an mich, und ich will dir zu Hilfe kommen.«
Darauf ritt er weiter, bis er das Schloss eines Königs erreichte. Dort nahm er einen Dienst als Kuhhirte an, und sein Lohn sollte groß oder klein sein, je nachdem die Kühe viel oder wenig Milch
gaben. Er trieb das Vieh auf die Weide, aber diese war spärlich. Daher gaben sie auch nicht viel Milch, als er sie heimgetrieben hatte, und so bekam er an diesem Abend auch nur wenig Speise und
Trank. Am nächsten Tage ging er viel weiter mit ihnen und kam endlich zu einer grasreichen Wiese in einem grünen Tal, wie er ihresgleichen noch nie gesehen hatte. Aber als er das Vieh wieder
heimtreiben wollte, da kam ein ungeheurer Riese mit gezogenem Schwerte auf ihn zu.
»Hiu! Hau! Hogaraich!!!« rief er aus. »Schon lange sehnen sich meine verrosteten Zähne nach Menschenfleisch. Das Vieh ist mein, denn ich hab' es auf meinem Grund und Boden getroffen, und du wirst
bald ein toter Mann sein.« »Das kann man noch nicht wissen,« sagte der Hirte, »es ist leichter gesagt, als getan.« Sie gingen aufeinander los. Der Hirte zog sein haarscharfes Schwert, und während
des Kampfes sprang der schwarze Hund dem Riesen auf den Rücken. Der Hirte tötete den Riesen; dann sprang er auf das schwarze Pferd und begann, das Haus des Riesen zu suchen. Er fand es bald; der
Riese hatte in der Eile Tür und Tor offen gelassen. Der Hirte trat ein und fand Geld und Kostbarkeiten und gold- und silberbesetzte Kleider in Hülle und Fülle.
Zu Beginn der Nacht ging er wieder in das königliche Schloss zurück, aber er nahm nichts aus dem Hause des Riesen mit. Und als am Abend die Kühe gemolken wurden, da gaben sie viel Milch. An dem
Abend bekam er reichlich zu essen und zu trinken, und der König war ungeheuer froh, einen so guten Hirten bekommen zu haben. So ging der Hirte täglich in das grüne Tal, aber endlich war die Wiese
abgegrast. Da beschloss er, ein wenig tiefer in das Land des Riesen einzudringen. Dort fand er einen ungeheueren Park und reichliches Gras. Er holte also das Vieh und brachte es in den Park. Kaum
waren sie drinnen, so kam ein ungeheurer Riese wühend herangestürmt.
»Hiu! Hau! Hogaraich!!!« rief er. »Heute nachts werd' ich meinen Durst mit deinem Blute löschen!« »Das kann man noch nicht wissen,« sagte der Hirte, »es ist leichter gesagt, als getan.« Die
beiden gingen aufeinander los. Hei, wie da die Schwerter blitzten! Es schien, als sollte der Riese den Sieg über den Hirten davontragen. Aber da rief dieser seinen Hund, und der sprang dem Riesen
an den Hals. Rasch hieb ihm der Hirte den Kopf ab. An dem Abend kam er sehr müde nach Hause. Wieder hatten die Kühe viel Milch, und die ganze königliche Familie war froh, dass sie so einen Hirten
hatte. Er ließ das Vieh eine Zeitlang in dem Parke weiden. Aber als er eines Abends heimkam, da wurde er nicht wie sonst von der Kuhmagd freundlich begrüßt, sondern alles weinte und
jammerte.
Er fragte nach der Ursache des Kummers. Da erzählte ihm die Kuhmagd, dass sich in dem See ein großes Ungeheuer mit drei Köpfen befinde, das erhalte jedes Jahr eine Jungfrau als Tribut, und
diesmal sei das Los auf die Königstochter gefallen, die am folgenden Tage um die Mittagszeit von dem Ungetüm erwartet wurde. Doch sei ihr Freier entschlossen, sie zu retten. »Welcher Freier?«
fragte der Hirte. »Ein tapferer Ritter,« sagte die Kuhmagd. »Wenn es ihm gelingt, das Ungeheuer zu töten, dann wird er die Königstochter heiraten, denn der König hat sie demjenigen, der sie
rettet, zur Frau versprochen.«
Am folgenden Tage um die bestimmte Zeit ging die Königstochter mit dem Ritter zu dem schwarzen Ungetüm. Kaum waren sie dort angelangt, so tauchte es in der Mitte des Sees empor; aber als der
Ritter das furchtbare dreiköpfige Untier erblickte, da überkam ihn die Angst, und er schlich sich davon und verbarg sich. Zitternd vor Furcht stand nun die Königstochter allein da, ohne Aussicht
auf Rettung. Plötzlich erblickte sie einen beherzten schönen Jüngling auf schwarzem Pferde. Er war prächtig gekleidet, vortrefflich bewaffnet und von einem schwarzen Hunde gefolgt. Er ritt auf
sie zu und sprach: »Dein holdes Gesicht ist von Trauer erfüllt, oh Jungfrau. Was tust du hier?«
»Ach,« erwiderte die Königstochter, »ich werde nicht lange mehr hier sein.« »Das ist noch gar nicht ausgemacht.« »Ein tapferer Ritter,« sagte sie, »ist bereits vor der Gefahr entflohen.« »Tapfer
ist derjenige, der dem Kampfe standhält,« erwiderte der Jüngling. Er legte sich zu ihren Füßen nieder, um ein wenig zu schlafen und bat sie, ihn zu wecken, sobald das Ungeheuer sich dem Ufer
nähere. »Wie soll ich dich wecken?« fragte sie. »Indem du den goldenen Ring von deiner Hand an meinen kleinen Finger steckst,« sagte er.
Er war noch nicht lange da, als sie sah, wie das Ungetüm sich dem Ufer zu nähern begann. Da nahm sie einen Ring von ihrem Finger und steckte ihn dem Jüngling an seinen kleinen Finger. Er erwachte
und ging mit dem Schwert in der Hand, von seinem Hunde gefolgt, dem Ungeheuer entgegen. Hoch auf spritzte die Flut, als die beiden im Kampfe aufeinanderstießen. Die Königstochter war starr vor
Schrecken bei dem Gebrülle des Ungetüms. Bald waren sie unten, bald wieder oben. Endlich gelang es dem Jüngling, dem Untier einen Kopf abzuhauen. Da brüllte es: »Raivic!« und der Sohn der Erde,
das Echo, gab den Schrei zurück; das Ungeheuer rührte den See von einem Ende bis zum anderen auf und verschwand im Nu.
»Heil dem Sieger!« rief die Tochter des Königs, »für diese Nacht bin ich gerettet; aber das Ungetüm wird wieder und immer wieder kommen, so lange es nicht die anderen zwei Köpfe verliert.« Er zog
eine Weidenrute durch den Kopf des Ungeheuers und gab ihn ihr, hieß sie aber am folgenden Tage den Kopf wieder mitbringen. Während der Hirte zu seiner Herde ging, begab sie sich nach Hause. Den
Kopf trug sie auf der Schulter. Sie war noch nicht weit gegangen, als der Ritter sie von seinem Versteck aus gewahrte. Der drohte ihr mit dem Tode, wenn sie nicht sagen wolle, dass er es gewesen,
der dem Untier den Kopf abgehauen habe.
»Jawohl,« sagte sie, »wer hat es denn sonst getan!« Sie erreichten das königliche Schloss, und der Ritter trug den Kopf des Ungetüms auf seiner Schulter. Großer Jubel herrschte, dass die
Königstochter gesund und heil heimgekehrt war. Alle bewunderten den Ritter, dessen Hände von dem Blute des Ungeheuers rot gefärbt waren. Am folgenden Morgen gingen die beiden wieder an den See,
aber niemand zweifelte daran, dass der Ritter die Königstochter befreien würde.
Wieder kamen sie an denselben Ort; es dauerte nicht lange, so regte sich das furchtbare Untier in der Mitte des Sees, und der Held schlich sich hinweg wie am Tage zuvor. Aber gleich darauf kam
der Jüngling auf dem schwarzen Pferde, nur in einem anderen Gewand. Sie erkannte ihn trotzdem und sprach: »Wie freue ich mich, dich wiederzusehen! Ich hoffe, du wirst dich heute mit gleicher
Tapferkeit wie gestern deines großen Schwertes bedienen. Komm' her und raste ein wenig.« Er setzte sich neben die Königstochter und sprach: »Wenn ich einschlafe, bevor das Untier kommt, so wecke
mich.« »Wie soll ich dich wecken?« fragte sie ihn. »Indem du den Ring aus deinem Ohre in das meine steckst,« sagte er. Er war kaum eingeschlafen, da rief die Königstochter: »Wach' auf! wach'
auf!«
Aber er wachte nicht auf. Da nahm sie den Ring aus ihrem Ohr und tat ihn in das Ohr des Jünglings. Sofort wachte er auf und ging dem Ungetüm entgegen.
Wie hieben sie da auf einander ein! Wie schäumte und raste und brüllte das Tier! So kämpften sie lange Zeit, aber bei Einbruch der Nacht hieb er dem Ungeheuer den zweiten Kopf ab. Die
Königstochter ging mit beiden Köpfen heim, da kam wieder der Ritter, und er befahl ihr wieder, zu sagen, dass er es gewesen sei, der dem Untier auch den zweiten Kopf abgehauen habe. »Jawohl,«
sagte sie, »wer hat es denn sonst getan!« Sie erreichten das königliche Schloss. Da herrschte Jubel und Freude. War der König das erstemal hoffnungsvoll gewesen, so war er jetzt davon überzeugt,
dass dieser große Held seine Tochter erretten würde, und niemand zweifelte daran, dass am folgenden Morgen auch der dritte Kopf des Ungeheuers fallen würde.
Am folgenden Tage entfernten sich die beiden wieder, und der Ritter verbarg sich wie früher. Die Königstochter begab sich an das Ufer des Sees. Der Jüngling auf dem schwarzen Rosse erschien und
setzte sich an ihre Seite. Wieder weckte sie ihn, indem sie den anderen Ohrring an sein Ohr steckte, und wieder ging er dem Ungeheuer entgegen. Das Ungeheuer brüllte und raste noch
fürchterlicher, als die Tage vorher. Aber es half ihm nichts, nach heftigem Kampfe hieb der Jüngling ihm auch den dritten Kopf ab. Dann zog er eine Weidenrute hindurch, und die Königstochter trug
die Köpfe nach Hause. Als sie das Königsschloss erreichten, da schwelgten alle in Wonne, und am folgenden Tage sollte der Ritter die Königstochter heiraten.
Aber als der Priester kam, da sagte sie, dass sie nur denjenigen heiraten würde, der die Köpfe des Ungetüms von der Weidenrute lösen könne, ohne sie zu zerschneiden. »Wer anders sollte die Köpfe
lösen, als derjenige, der sie auf die Weidenrute getan?« sagte der König. Der Ritter versuchte vergebens, die Köpfe abzunehmen; nach ihm versuchten es alle anderen im königlichen Schlosse, aber
niemanden gelang es. Da fragte der König, ob sich noch jemand im Schlosse befinde, der den Versuch nicht gemacht hätte. Da antwortete man ihm, dass der Hirte es noch nicht versucht hätte. Man
ließ ihn holen, und es dauerte nicht lange, so hatte er die Köpfe von der Weidenrute gelöst.
»Warte ein wenig,« sagte die Königstochter zu ihm; »der Mann, der dem Ungeheuer die Köpfe abgeschlagen hat, ist auch im Besitze meines Ringes und meiner Ohrringe.« Da steckte der Hirte die Hand
in die Tasche und warf die drei Ringe auf den Tisch. »Du bekommst mich zur Frau,« sagte die Königstochter. Der König war nicht sehr erfreut, als er sah, dass der zukünftige Mann seiner Tochter
ein Hirte war; doch befahl er, dass man ihn besser kleide. Da sagte die Tochter, dass er ein so prächtiges Gewand besitze, wie es schöner im Königsschlosse nicht zu finden sei, und der Hirte zog
das goldbesetzte Gewand des Riesen an, und noch an demselben Abend wurden sie getraut.
Sie waren nun Mann und Frau und lebten sehr glücklich miteinander. Da gingen sie eines Tages am Ufer des Sees spazieren, als plötzlich ein furchtbares Ungetüm herbeikam, das weit schrecklicher
war, als das erste, und den Mann der Königstochter, ohne viel zu fragen, in den See hineinzog. Die Königstochter war tief unglücklich, sie verwandte kein Auge von dem See. Sie traf einen alten
Schmied und erzählte ihm, was ihrem Gatten widerfahren sei. Der riet ihr, das Schönste was sie besaß, auf demselben Platze auszubreiten, an welchem ihr Gatte ihr geraubt worden war. Sie tat, was
er ihr geraten hatte. Da tauchte das Scheusal empor und sagte: »Deine Juwelen sind schön, o Königstochter.« »Viel schöner,« erwiderte sie, »ist das Juwel, das du mir genommen hast, lass mich
meinen Mann sehen, und du kannst dir von dem Schmucke wählen, was du willst.« Das Ungeheuer brachte ihn herbei.
»Gib mir ihn wieder, und du sollst den ganzen Schmuck bekommen, den du hier siehst,« sagte die Königstochter. Das Untier erfüllte ihr Begehren und warf ihr den Gatten lebendig und unversehrt an
das Ufer. Wieder gingen sie nach einiger Zeit am Ufer des Sees spazieren, da kam dasselbe Ungetüm und raubte die Königstochter. Ihr Mann war trostlos und wanderte Tag und Nacht am Ufer hin und
her. Da traf er den alten Schmied, und der sagte ihm, es gebe nur einen einzigen Weg, das Ungeheuer zu töten, und das sei folgender: »Auf der Insel in der Mitte des Sees befindet sich die
weißfüßige Hirschkuh Eillid Chaisfhion, die hat die schlanksten Beine und den schnellsten Lauf. Und wenn sie gefangen wird, so springt eine Nebelkrähe aus ihr hervor, und wenn die Nebelkrähe
gefangen wird, so springt eine Forelle aus ihr empor, aber die Forelle hat ein Ei in ihrem Munde, und in dem Ei ist die Seele des Untiers, und wenn das Ei zerbricht, dann ist das Ungeheuer
tot.«
Es war aber unmöglich, auf die Insel zu gelangen, denn das Ungeheuer zog jedes Boot in die Tiefe, das sich auf den See wagte. Da wollte er versuchen, mit dem schwarzen Rosse hinüberzuspringen.
Das gelang ihm, das schwarze Ross wagte den Sprung, und der schwarze Hund folgte nach. Er sah die Hirschkuh Eillid Chaisfhion und ließ sie von dem schwarzen Hunde verfolgen, aber wenn dieser auf
der einen Seite der Insel war, so war sie schon auf der anderen. »Ach!« rief der junge Mann aus, »wäre doch jetzt der große Hund da, den ich damals bei dem toten Schaf getroffen habe!« Kaum hatte
er das Wort ausgesprochen, so befand sich der dankbare Hund an seiner Seite, und es dauerte nicht lange, da hatte er die Hirschkuh mit Hilfe des schwarzen Hundes erreicht. Aber kaum war sie
gefangen, als eine Nebelkrähe aus ihr hervorsprang.
»Ach, wie gut wäre es, wenn ich den grauen Falken mit dem scharfen Auge und schnellen Fluge jetzt hier hätte!« Kaum hatte er das gesagt, so war der Falke hinter der Nebelkrähe her, und es dauerte
nicht lange, so hatte er sie erreicht. Aber kaum fiel sie am Ufer des Sees nieder, so sprang die Forelle aus ihr hervor. »Ach, wärst du jetzt bei mir, o Fischotter!« Kaum hatte er die Worte
gesprochen, so war die Fischotter an seiner Seite. Sofort sprang sie in den See und brachte die Forelle herbei. Da kam aus ihrem Munde das Ei heraus. Er sprang hinzu und setzte den Fuß auf das
Ei, da brüllte das Ungeheuer: »Zerbrich das Ei nicht, und ich gebe dir, was du verlangst!« »Gib mir meine Frau zurück!« In einem Augenblick war sie an seiner Seite. Als er ihre Hand in seine
beiden Hände nahm, da zerdrückte er das Ei mit seinem Fuße, und das Untier war tot. Es war ein scheußlicher Anblick.
Sie ließen das Scheusal liegen und gingen nach Hause, und im Schlosse des Königs herrschte eitel Freude. Jetzt erst erzählte der Jüngling dem Könige, wie er die beiden Ungetüme getötet hatte. Und
der König erwies ihm große Ehren, und er machte ihn zu einem Großen des Reiches. Eines Tages ging er mit seiner Frau spazieren, da bemerkte er in einem Walde am See ein kleines Schloss, und er
fragte seine Frau, wer dort wohne. Sie antwortete ihm, dass niemand sich in die Nähe des Schlosses wage, denn noch keiner, der hineingegangen, sei wiedergekommen. »Noch heute abends,« sagte er,
»will ich mich davon überzeugen, wer dort wohnt.« »Geh' nicht, geh' nicht,« bat sie, »es ist noch nie jemand von dort zurückgekehrt.« »Dem sei, wie ihm wolle,« sagte er, »ich muss hinein.« Und er
gieng. Als er das Thor erreichte, trat ihm ein glattzüngiges, altes Weib entgegen.
»Heil und Segen, Fischerssohn,« sagte sie; »ich freue mich, dich zu sehen. Eine große Ehre ist diesem Königreiche widerfahren, als du es betratst. Dein Kommen wird dieser armen Hütte zum Ruhme
gereichen. Geh' du voran, Ehre wem Ehre gebürt.« Er ging hinein. Da schlug sie ihn mit der Zauberkeule Slachdan druidhach auf das Haupt. Sofort fiel er zu Boden. In dieser Nacht herrschte Jammer
im Königsschlosse und am folgenden Morgen im Hause des Fischers. Denn einer von den Bäumen verdorrte, und da sagte der mittlere Sohn, dass sein Bruder tot sei, und er tat einen Schwur, dass er
nicht rasten würde, bis er seinen Leichnam gefunden. Er sattelte sein schwarzes Pferd und rief seinem schwarzen Hunde; denn jeder der drei Söhne des Fischers besaß ein schwarzes Pferd und einen
schwarzen Hund, und er folgte den Spuren seines Bruders, bis er das Königsschloss erreichte.
Er sah seinem älteren Bruder so ähnlich, dass die Königstochter ihn für ihren Gatten hielt. Sie erzählten ihm, was seinem Bruder widerfahren sei, und da beschloss er, in das Schloss des alten
Weibes zu gehen, was immer ihm auch geschehe. So ging er denn in das Schloss, aber wie es dem älteren Bruder ergangen war, so erging es auch ihm: nach einem Schlage der Zauberkeule sank er neben
seinem Bruder nieder. Als der jüngste Sohn des Fischers den zweiten Baum verdorren sah, da sagte er, dass nun seine beiden Brüder tot seien, und dass er erfahren müsse, wie sie ihren Tod gefunden
hätten. Wie seine Brüder, so ritt auch er auf seinem schwarzen Pferde aus, gefolgt von dem schwarzen Hunde, und er ritt ohne Rast, bis er in das Schloss des Königs kam. Der König freute sich
sehr, ihn zu sehen, aber sie wollten ihn nicht fortlassen in das schwarze Schloss, wo seine Brüder den Tod gefunden hatten. Er aber bestand darauf und ging.
»Heil und Segen, o Fischerssohn! Ich freue mich, dich zu sehen. Tritt ein und raste ein wenig,« sagte das alte Weib. »Nach dir,« erwiderte der Fischerssohn, »ich kann Schmeichelreden vor der Tür
nicht leiden, drinnen will ich hören, was du zu sagen hast.« Sie ging hinein, und als sie ihm den Rücken zukehrte, zog er sein Schwert und hieb ihr den Kopf ab. Aber das Schwert entglitt seiner
Hand. Da griff die Alte schnell mit beiden Händen nach ihrem Kopfe und setzte sich ihn wieder auf. Der Hund sprang auf sie los, aber sie schlug das treue Tier mit ihrer Zauberkeule, so dass es zu
Boden fiel. Aber der Jüngling war nicht faul. Er begann mit der Alten zu ringen, erfasste das Slachdan druidhach, und mit einem Schlage auf den Kopf warf er sie augenblicklich nieder. Dann ging
er weiter, und da sah er seine Brüder nebeneinander auf dem Boden liegen. Da berührte er sie mit dem Slachdan druidhach, und sie sprangen auf und waren unversehrt. Sie fanden reiche Beute, Gold
und Silber und Kostbarkeiten in dem schwarzen Schlosse. Als sie in das königliche Schloss zurückkehrten, wurden sie mit lautem Jubel empfangen.
Der König war alt, und so ließ er den ältesten Sohn des Fischers zum König krönen. Seine beiden Brüder blieben ein Jahr und einen Tag in dem Schlosse, dann kehrten sie nach Hause zurück. Sie
nahmen die Schätze aus dem schwarzen Schlosse und viele kostbare Geschenke des Königs mit, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
Anna Kellner: Englische Märchen
Eilians Flucht
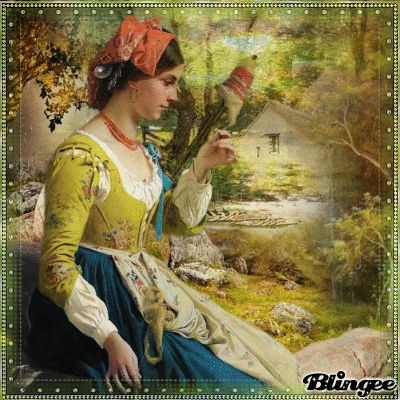
Ein alter Mann und sein Weib lebten dereinst zu Garth Dorwen vor langer, langer Zeit. Sie begaben sich einmal nach Carnarvon zur Messe, um eine Dienstmagd zu heuern; es war dies gerade am
Allerseelentag. Es war Brauch bei den jungen Männern und Mädchen, die sich verdingen wollten, zur Zeit der Messe sich dort auf einer kleinen grünen Anhöhe aufzustellen, die noch jetzt die »Maes«
genannt wird. Der alte Mann und sein Weib gingen zu jener Stelle und gewahrten dort ein Mägdlein mit flachsgelben Haaren, das von den übrigen etwas abseits stand. Die alte Frau trat auf sie zu
und fragte, ob sie einen Dienstplatz brauche. Sie entgegnete, daß sie einen suche und verdingte sich auf der Stelle; und zur festgesetzten Zeit erschien sie auch an ihrem Dienstort.
In jener Zeit war es während der langen Winterabende üblich, daß man nach dem Abendbrot sich zum Spinnrocken setzte. Nun liebte es die Magd, wenn es Mondschein war, sich auf die Wiese
hinauszusetzen, um dort zu spinnen. Da pflegten die Tylwyth Teg zu ihr zu kommen, um zu singen und zu tanzen. Doch einstmals im Frühling, als die Tage länger geworden, da entfloh Eilian, das
Mädchen, mit einem der Tylwyth Teg und ward nicht wieder gesehen. Das Feld, wo man zuletzt sie erblickt, wird bis zum Tage »Eilians Feld« genannt und die Wiese dabei heißt noch der
»Mädchenanger«. Die alte Frau zu Garth Dorwen war als eine »hilfreiche Frau« berühmt, die ihren bettlägerigen Mitschwestern geschickt beizustehen verstand und großes Begehr war darum nach ihr
weit und breit.
Einige Zeit nach Eilians Flucht erschien ein Gentleman auf einem Rosse vor ihrem Tore, just in einer Nacht, da es Vollmond war, dieser jedoch von dichtem Nebel verhüllt wurde, der ringsher sich
niederließ. Der Fremde war gekommen, um die alte Frau zu seinem Weibe zu holen. So ritt sie denn hinter dem Fremden auf dessen Rosse dahin und sie gelangten in die Gegend von Rhos y Cowrt. Dort
befand sich zu jener Zeit, gerade im Mittelpunkte von Rhos, eine Art erhöhten Erdwerks, das einer alten Festung ähnlich sah, umgeben von einer Unzahl mächtiger Steinblöcke rings auf der Höhe und
gegen Norden durch einen breiten Wall aus Steinen geschützt. Es ist bis zur Stunde noch dort zu sehen und führt den Namen Bryn y Pibion.
Nachdem die beiden zu jener Stelle gelangt waren, betraten sie eine weite Höhle und gingen von da in ein Gemach, wo die Frau in ihrem Bette lag. Es war der herrlichste Raum, den die Alte
zeitlebens gesehen hatte. Nachdem nun die junge Frau glücklich mit einem Kinde niedergekommen, begab sich die Alte in die Nähe des Feuers, um das Kindchen zu reinigen. Sobald solches geschehen
war, trat der Hausvater mit einer Flasche Salböl zur Alten und trug ihr auf, die Augen des Kindes damit zu benetzen; warnte sie jedoch, die eigenen Augen damit zu berühren. Nun aber, nachdem sie
die Flasche gebraucht und beiseite gestellt, begann das eine Auge der Alten zu jucken und sie rieb es mit dem nämlichen Finger, damit sie die Augen des Kindes eingerieben.
Da sah sie nun mit diesem Auge, wie das junge Weib auf einem Bündel von Binsen und welkem Farnkraut lag, in einer großen Höhle mit riesigen Steinen ringsher und mit ein wenig Feuer in einem
Winkel. Und sie entdeckte auch zu ihrer Überraschung, daß jene keine andere als Eilian war, ihre einstige Magd; dieweil sie mit dem anderen Auge noch fort den schönsten Platz erblickte, den sie
jemals gesehen. Nicht lange nach diesem Begebnis ging die Alte nach Carnarvon zum Markt, wo sie den Ehemann erblickte, der sie damals nächtlicherweile geholt hatte. Und sie fragte ihn:
»Wie geht es Eilian?« »Sie ist bei bestem Wohlsein«, sagte er zur alten Frau, »doch mit welchem Auge vermagst du mich zu sehen?« »Mit diesem hier!« gab sie zur Antwort. Darauf ergriff er eine
Binse und stieß ihr damit das eine Auge aus.
Keltisch: M. Brusot: Keltische Volkserzählungen
Teigh O'Kane und der Tote

Es war einmal ein Bursche in der Grafschaft Leitrim, der war stark und geweckt und der Sohn eines reichen Gutsbesitzers. Sein Vater hatte viel Geld und ließ es dem Sohne an nichts fehlen. Die
Folge davon war, dass der Junge die Unterhaltung mehr liebte als die Arbeit; da er aber der einzige Sohn seines Vaters war, so ließ dieser ihm in allen Dingen seinen Willen. Er war sehr
leichtsinnig und warf mit dem gelben Gelde um sich, wie ein anderer mit weißem. Er war selten zu Hause, wo aber auf zehn Meilen in der Runde ein Jahrmarkt, ein Wettrennen oder sonst eine
Versammlung war, da konnte man sicher sein, ihn zu finden. Er wurde immer ausgelassener und unbotmäßiger und verbrachte die Nächte mit Kartenspiel und wilden Gelagen; sein Vater aber schien
dieses gottlose Gebaren nicht zu sehen und strafte ihn nie.
Eines Tages wurde ihm hinterbracht, dass sein Sohn einem Mädchen die Ehe versprochen habe und sein Wort nicht halten wolle; da geriet er in großen Zorn, ließ seinen Sohn vor sich kommen und
sprach: »Mein Sohn, du weißt, wie ich dich liebe; ich habe deinem Treiben ruhig zugesehen, so wenig es mir auch gefiel; ich habe es dir an nichts fehlen lassen, und es war meine Absicht, dir bei
meinem Ableben Haus und Hof und mein ganzes Vermögen zu hinterlassen. Heute aber ist mir etwas zu Ohren gekommen, das mich mit Schmerz und Abscheu erfüllt, und ich sage es dir klar und bestimmt:
wenn du das Mädchen nicht heiratest, dem du die Ehe versprochen hast, so wird mein Brudersohn nach meinem Tode Haus und Hof und mein ganzes Vermögen besitzen. Ich stelle dir die Wahl, entweder
das Mädchen zu heiraten und mein Erbe zu werden oder dein Wort zu brechen und alles zu verlieren; morgen früh wirst du mir sagen, wofür du dich entschieden hast.«
»Aber Vater, wer hat dir nur gesagt, dass ich das Mädchen nicht heiraten will?« Doch der Vater war fort, und Teigh wusste, dass er Wort halten würde. Er kannte seinen Vater; so ruhig und sanft er
war, so wusste sich doch keiner im Lande zu erinnern, dass er jemals seinen Sinn geändert hätte, denn kein Mensch war schwerer umzustimmen, als er. Teigh wusste nicht recht, was er tun sollte. Er
liebte das Mädchen und hatte die ehrliche Absicht, sie eines Tages, wenn es ihm gefiele, zu heiraten; aber vorläufig behagte es ihm besser, seine wilde Lebensweise weiterzuführen. Überdies
verdross es ihn, sie auf Befehl heiraten zu müssen. Er war so aufgeregt, dass er in die Nacht hinauseilte, um sein erhitztes Blut zu beruhigen. Er zündete sich seine Pfeife an und ging raschen
Schrittes beim Lichte des Vollmondes immer tiefer in die Nacht hinein. Nicht ein Lüftchen regte sich, es war eine wunderbar milde und ruhige Nacht. Über drei Stunden war er gegangen, da erst
merkte er, wie spät es geworden war.
»Der Tausend,« sagte er, »es muss nahe an zwölf Uhr sein.« Er hatte kaum das Wort ausgesprochen, als er viele Stimmen und das Getrappel von Füßen auf der Straße hörte. »Wer nur so spät auf diesem
einsamen Wege herumgeht?« sagte er zu sich. Er lauschte dem wirren Durcheinander der vielen Stimmen, aber er verstand nicht, was sie sagten. Als er einige Schritte weitergegangen war, sah er beim
Mondlichte eine Schar kleiner Leute auf sich zukommen; sie trugen eine große, schwere Last in ihrer Mitte. »Himmel,« sagte er zu sich, »es sind doch nicht etwa die Kobolde?«
Aber die Haare standen ihm zu Berge und er zitterte am ganzen Leibe, denn sie kamen schneller und schneller auf ihn zu. Er sah sie jetzt genauer an. Es waren etwa ihrer zwanzig, und keiner war
größer als drei Fuß und höchstens noch einen halben darüber, und einige von ihnen waren grau und schienen sehr alt zu sein. Er wollte wissen, was das für eine Last war, die sie in ihrer Mitte
trugen, konnte sie aber nicht unterscheiden. Auf einmal waren sie hart bei ihm und umringten ihn. Sie warfen die Last auf den Boden, und da sah er, dass es ein Leichnam war. Es lief ihm eiskalt
über den Rücken, jeder Blutstropfen in seinen Adern schien zu gerinnen. Da kam ein altes, graues Männlein auf ihn zu und sprach: »Ist es nicht recht glücklich, dass wir dich getroffen haben,
Teigh O'Kane?«
Teigh wäre nicht um die Welt imstande gewesen, die Lippen auseinander zu bringen, er gab also keine Antwort. »Teigh O'Kane,« sagte das graue Männlein wieder, »ist es nicht die höchste Zeit, dass
du uns getroffen hast?« Teigh blieb stumm. »Teigh O'Kane,« fuhr er fort, »ich frage dich zum drittenmale: 'Ist es nicht glücklich und höchste Zeit, dass wir dich getroffen haben?'« Aber Teigh
schwieg, denn die Zunge war ihm wie gelähmt. Hierauf wandte sich das graue Männlein an seine Gefährten, und die Freude blitzte ihm aus den Äuglein hervor.
»Jetzt,« sagte er, »da Teigh O'Kane kein Wort zu erwidern hat, können wir mit ihm machen, was wir wollen. Teigh, Teigh,« fuhr er fort, »du führst das Leben eines Bösewichts, und wir können dich
zu unserem Sklaven machen; versuche es nicht, dich uns zu widersetzen, denn es wäre umsonst. Hebe den Leichnam auf!«
Teigh hatte solche Angst, dass er gerade nur imstande war, das eine Wort »nein« hervorzubringen, denn so groß seine Angst auch war, so war er doch halsstarrig und widerspenstig wie immer. »Teigh
O'Kane will den Leichnam nicht aufheben,« sagte das graue Männlein, mit boshaftem Lachen, und seine Stimme klang wie der Ton einer geborstenen Glocke, »Teigh O'Kane will den Leichnam nicht
aufheben, redet ihm zu.«
Kaum war das Wort aus seinem Munde, so umzingelten sie Teigh und begannen durcheinander zu reden und zu lachen. Teigh versuchte ihnen zu entrinnen, aber sie verfolgten ihn, und einer stellte ihm
ein Bein, so dass er der Länge nach auf den Boden fiel. Bevor er sich noch erheben konnte, packten ihn die Kobolde an Händen und Füßen und hielten ihn fest, mit dem Gesichte nach unten. Hierauf
hoben sechs oder sieben von ihnen den Leichnam auf und legten ihn Teigh auf den Rücken. Die Brust des Leichnams drückte gegen Teighs Schultern, und seine Arme umklammerten Teighs Hals. Dann
wichen die Kobolde einige Schritte zurück und hießen Teigh aufstehen. Er erhob sich schäumend und fluchend und tat alles, um den Leichnam von sich abzuschütteln. Aber wie groß war sein Entsetzen,
als er merkte, dass die Arme des Toten seinen Hals umklammert und die Beine seine Hüften umschlossen hielten. Er mochte tun, was er wollte, es war ihm nicht möglich, den Leichnam los zu werden,
so wenig als ein Pferd seinen Sattel abzuwerfen vermag. Er hielt sich für verloren und in seiner Todesangst rief er: »Mein sündiges Leben hat den Kobolden diese Macht über mich gegeben. Ich
verspreche es Gott und der Jungfrau Maria, Peter und Paul, Patrick und Brigitta, dass ich ein anderer werde, wenn sie mich aus dieser Gefahr befreien - und das Mädchen nehme ich zur Frau.«
Das graue Männlein kam an ihn heran und sprach: »Nun, lieber Teigh, du wolltest den Leichnam nicht aufheben, als wir dir's geboten, und doch hast du es getan; vielleicht wirst du dich auch
weigern, den Leichnam zu begraben, wenn wir dir's gebieten, und doch wirst du es tun.« »Ich stehe Euer Gnaden in allem und jedem zur Verfügung,« sagte der einst so stolze Teigh, der inzwischen
windelweich geworden war. Das Männlein lachte wieder in seiner eigentümlichen Weise. »So ist's recht, Teigh,« sagte er, »jetzt pass auf, und wenn du mir nicht in allem gehorchst, so wirst du es
bitter bereuen. Du musst den Leichnam, der sich auf deinem Rücken befindet, nach Teampoll-Demus tragen und ihm dort mitten in der Kirche ein Grab graben; du musst die Steinplatten aufheben und
wieder einsetzen, dann musst du die Erde aus der Kirche tragen und alle Spuren verwischen, so dass niemand irgend eine Veränderung bemerkt.
Aber das ist nicht alles. Es wird vielleicht nicht möglich sein, den Leichnam in jener Kirche zu begraben, ein anderer hat vielleicht das Lager inne und wird es mit ihm nicht teilen wollen.
Kannst du ihn nun nicht in Teampoll- Demus begraben, so trage ihn nach Carrickfhadvic- Orus und suche ihn dort auf dem Kirchhofe zu begraben. Kannst du ihn auch dort nicht begraben, so trage ihn
nach Teampoll-Ronan. Findest du den Zugang zu diesem Kirchhofe versperrt, so trage ihn nach Imlogue-Fada, und kannst du ihn auch dort nicht begraben, so hast du nichts weiter zu tun, als ihn nach
Kill-Breedya zu bringen. Dort steht dann der Beerdigung nichts weiter im Wege. Ich kann dir nicht sagen, in welcher von diesen Kirchen es dir gestattet sein wird, den Leichnam zu bergen, aber in
einer von ihnen geschieht es gewiss. Tust du, was wir dir auftragen, wie sich's gehört, so werden wir dir Dank wissen, und du sollst keine Ursache haben, dich über uns zu beklagen. Betreibst du
dagegen deine Arbeit nicht, wie du sollst, so wird es dich gereuen.«
Als das graue Männlein geendet hatte, lachten seine Gefährten und klatschten Beifall. »Hottaho, hottaho, vorwärts, vorwärts,« riefen sie alle, »bis zum Morgen hast du Zeit genug vor dir, und hast
du den Mann nicht vor Sonnenaufgang begraben, so bist du verloren.« Sie trieben ihn an mit Faustschlägen und Fußtritten, und er musste gehen, schnell gehen, ob er wollte oder nicht, denn sie
gaben ihm keine Ruhe. Es kam ihm vor, als sei er in jener Nacht über jeden nassen Pfad, durch jede schmutzige Pfütze, durch jeden krummen Weg in der ganzen Grafschaft gehetzt worden. Die Nacht
war zuweilen stockfinster, und so oft sich der Mond hinter Wolken verbarg, sah er nicht einen Schritt vor sich und fiel nieder. Manchmal verletzte er sich beim Fall, manchmal kam er schadlos
davon, immer aber musste er im Augenblick wieder aufstehen und weiter eilen. So oft der Mond aus den Wolken trat, sah er sich um und fand das kleine Volk immer hart auf seinen Fersen. Sie
schwätzten und schrien und kreischten wie eine Schar Seemöwen durcheinander, aber nicht ein Wort von allen ihren Reden konnte er verstehen.
Weit war er gewandert, er wusste selbst nicht, wie weit, da rief einer aus der Schar: »Halt!« Er blieb stehen, und alle sammelten sich um ihn. »Siehst du die verdorrten Bäume dort?« sprach das
alte Männlein zu Teigh, »Teampoll-Demus ist unter diesen Bäumen versteckt, da musst du allein hinein, denn dorthin können wir dir nicht folgen; wir müssen hier bleiben. Geh' du nur mutig hinein.«
Teigh sah eine hohe Mauer vor sich und durch die Lücken in derselben eine alte, graue Kirche und um diese herum etwa ein Dutzend verdorrter Bäume zerstreut. Sie hatten weder Laub noch Reis,
streckten aber ihre nackten, krummen Zweige wie ein zorniger Mann seine Arme drohend in die Luft. Aber es half nichts, er musste hinein.
Er war etwa dreihundert Schritte von der Kirche entfernt; diese legte er, ohne sich umzublicken, zurück, bis er zur Kirchhofpforte kam. Sie war eingefallen und der Eingang frei. Er wandte sich
um, denn er wollte sehen, ob ihm die kleinen Leute gefolgt waren. Da bedeckte eine Wolke den Mond, es wurde stockfinster, und er sah nichts. Er durchschritt den Kirchhof und ging den
grasbedeckten Pfad zur Kirchentüre hinauf. Diese war versperrt. Er versuchte sie zu öffnen, aber sie gab nicht nach. Nun dachte er bei sich: »Hier ist meine Mühe zu Ende, die Tür ist zu und ich
kann sie nicht öffnen.« Aber kaum waren ihm diese Worte durch den Sinn gegangen, als er eine Stimme hart an seinem Ohre hörte. »Suche den Schlüssel über der Türe oder auf der Mauer.« Er fuhr
zusammen.
»Wer spricht?« rief er und wandte sich um. Aber niemand war zu sehen. Wieder hörte er die Stimme: »Suche den Schlüssel über der Türe oder auf der Mauer.«
»Was ist das?« sagte er, und der Schweiß rann ihm von der Stirne, »wer spricht?« »Ich, der Leichnam,« sagte die Stimme. »Kannst du sprechen?« fragte Teigh.
»Hie und da,« antwortete der Leichnam. Teigh suchte den Schlüssel und fand ihn auf der Mauer. Voller Angst öffnete er die Türe und ging, so schnell er konnte, mit dem Leichnam auf dem Rücken
hinein. Es war stockfinster drinnen, und der arme Teigh zitterte am ganzen Leibe. »Zünde die Kerze an,« sagte der Leichnam.
Teigh zog Stahl und Stein aus der Tasche, schlug sie aneinander, dass sie Funken gaben, und entzündete ein Stückchen Leinwand, das er bei sich hatte, daran. In das blies er, bis es eine kleine
Flamme gab, und nun blickte er um sich. Die Kirche war sehr alt und ein Teil der Mauer eingefallen, die Fenster waren zerbrochen, das Holz der Bänke wurmstichig und verfault. Sechs oder sieben
eiserne Leuchter waren noch da, und in einem von diesen entdeckte Teigh ein Lichtstümpfchen; das zündete er an. Noch hatte er sich nicht recht in der grausigen Kirche umgesehen, als der Leichnam
ihm ins Ohr flüsterte: »Begrabe mich, begrabe mich, hier ist ein Spaten, hebe die Erde aus.«
Teigh fand einen Spaten neben dem Altar, stieß das Eisen in eine Fuge, stützte sein ganzes Gewicht auf den Spaten und hob so Erde und Stein. Als dieser von seinem Platze entfernt war, war es ein
leichtes, die andere zu entfernen; da die Erde darunter weich war, so hatte er bald einen Haufen davon zur Seite geworfen. Plötzlich stieß er auf etwas Weiches; es war ein Leichnam, der dort
begraben war. »Ich fürchte sehr, es wird nicht angehen, zwei Leichen auf derselben Stelle zu begraben,« sagte Teigh zu sich; »he da, du auf meinem Rücken, bist du es zufrieden, wenn ich dich hier
begrabe?« Der Leichnam schwieg. »Das ist ein gutes Zeichen,« dachte Teigh und stieß den Spaten wieder in die Erde. Da erhob der Leichnam, der dort begraben war, ein grässliches Geschrei: »Hu! hu!
hu! fort, fort, fort! Oder ich mach' dich kalt, kalt, kalt!« Darauf fiel er wieder in sein Grab zurück.
Teigh sträubten sich die Haare auf dem Kopfe, der kalte Schweiß rann ihm über das Gesicht und er zitterte dermaßen, dass er sich kaum aufrecht zu erhalten vermochte. Nach einer Weile jedoch
fasste er sich wieder, füllte das Grab und tat die Steine sorgfältig darüber, so dass alles aussah wie zuvor. Dann rückte er einige Schritte näher zur Türe, hob drei oder vier Fliesen aus und
begann dort die Erde zu entfernen. Alsbald stieß er auf ein altes Weib, das in seinem Leichengewande dalag. Sie erhob sich halb und schrie: »Hoho, du Tölpel, hat er kein eigenes Lager?« Der arme
Teigh fuhr zurück, und als sie sah, dass sie keine Antwort bekam, schloss sie sachte die Augen und fiel kraftlos und langsam in ihren Sarg zurück. Teigh verfuhr jetzt genau so wie beim ersten
Grabe - er warf die Erde hinein und legte die Steine wieder auf ihren Platz. Noch einmal begann er nahe der Türe zu graben, da stieß er auf eine menschliche Hand.
»Bei meiner Seele,« sagte er, »hier ist all meine Mühe umsonst.«
Er schüttete das Grab zu und setzte die Steine wieder ein. Dann verließ er mit schwerem Herzen die Kirche, verschloss die Türe und legte den Schlüssel wieder dorthin, wo er ihn gefunden hatte.
Ratlos setzte er sich auf einen Grabstein, bedeckte das Antlitz mit den Händen und weinte vor Kummer und Erschöpfung; er hielt sich für verloren. Umsonst versuchte er es, die Hände des Leichnams,
die seinen Hals umschlossen, zu lösen, sie hielten so fest, als wären sie zusammengeschmiedet. Und je mehr er sich bemühte, sie auseinander zu bringen, desto mehr fühlte er ihren Druck. Da
sprachen die kalten Lippen des Leichnams das Wort: »Carrickfhadvic-Orus.« Er erinnerte sich des Befehles der kleinen Leute, den Leichnam nach diesem Orte zu bringen, falls es ihm unmöglich sein
sollte, ihn in der ersten Kirche zu begraben. Er stand auf und blickte um sich. »Ich kenne den Weg nicht,« sagte er.
Kaum hatte er das Wort ausgesprochen, so streckte der Leichnam plötzlich die linke Hand aus, die eben noch seinen Hals umklammert hatte, wie um ihm den Weg zu zeigen, den er einzuschlagen hätte.
Teigh folgte der Richtung der ausgestreckten Hand, verließ den Kirchhof und gelangte auf einen alten, ausgefahrenen, steinigen Weg. Alsbald kamen sie zu einer Kreuzung, und Teigh stand ratlos da.
Da streckte der Leichnam zum zweitenmale seine Knochenhand aus und zeigte ihm den Weg. Lange wanderte er, bis er hart an der Straße einen Begräbnisplatz entdeckte, aber da war weder Kirche, noch
Kapelle, noch sonst ein Gebäude zu sehen. Der Leichnam drückte ihn fester, und Teigh blieb stehen. »Begrabe mich, begrabe mich,« sagte die Stimme. Teigh näherte sich dem alten Friedhofe und war
nur noch etwa dreißig Schritte davon entfernt, als er Hunderte und Aberhunderte von Gespenstern - Männer, Frauen und Kinder - auf der Mauer sitzen, innerhalb derselben stehen oder hin- und
herlaufen sah; alle zeigten sie auf ihn, und ihre Lippen bewegten sich, als ob sie sprächen, er aber hörte keinen Laut.
Starr vor Schrecken blieb er wie angewurzelt stehen. In demselben Augenblick wurden auch die Geister ruhig und still. Da merkte Teigh, dass sie ihn nicht einlassen wollten. Als er sich wieder
einige Schritte vorwagte, stürzte die ganze Meute auf die Stelle zu, der er sich näherte, und sie bildeten eine so dichte Mauer, dass es ihm unmöglich gewesen wäre, sie zu durchbrechen, selbst
wenn er den Willen gehabt hätte, es zu versuchen. Aber dazu verspürte er durchaus keine Lust. Ganz entmutigt kehrte er zurück, und kaum hatte er sich ratlos einige hundert Schritte von dem
Begräbnisplatze entfernt, als die Stimme des Leichnams ihm ins Ohr flüsterte: »Teampoll-Ronan!« Und die knochige Hand zeigte ihm wieder den Weg.
So müde er auch war, er musste weiter; es war ein langer, mühsamer Weg. Die Nacht war finsterer als je, und es war schwer, von der Stelle zu kommen. Mit Beulen bedeckt, kam er endlich zur Kirche
in Teampoll-Ronan, die sich mitten auf einem Begräbnisplatze erhob. Guten Mutes ging er auf sie zu, denn er sah weder Geister, noch sonst jemand auf der Mauer und hoffte bestimmt, ungehindert
Eingang zu finden und seine Bürde los zu werden. Er langte bei der Türe an, stolperte aber über die Schwelle. Bevor er sich wieder aufrichten konnte, wurde er von unsichtbaren Händen gepackt,
gedrückt, geschüttelt und fast zu Tode gewürgt. Endlich wurde er aufgehoben, fortgetragen und etwa hundert Schritte von dem Begräbnisplatze mit sammt der Leiche in einen Seitengraben
geworfen.
Ganz wund von den Schlägen und Stößen stand er auf. »He da, du auf meinem Rücken,« sagte er, »soll ich noch einmal zum Kirchhof zurück?« Aber der Leichnam schwieg.
»Gut,« sagte Teigh, »das heißt, ich soll nicht wieder hingehen. Aber was fang ich jetzt an?« Da flüsterte ihm der Leichnam ins Ohr: »Imlogue- Fada.« »Himmel!« rief Teigh, »auch das noch! Wenn ich
noch lange so wandern muss, so stürze ich unter der Last zusammen.« Aber er setzte doch seinen Weg fort, immer in der Richtung, die ihm der Leichnam zeigte. Er ging und ging, und der Weg wollte
kein Ende nehmen. Endlich schnürte ihm der Leichnam den Hals noch fester zusammen und sagte: »Da!« Teigh sah eine niedere Mauer vor sich, die an so vielen Stellen durchbrochen war, dass es
eigentlich gar keine Mauer mehr war. Sie befand sich mitten in einem weiten Felde, abseits von der Straße, und nur drei oder vier mächtige Ecksteine ließen darauf schließen, dass diese Mauer
einmal eine Begräbnisstätte eingeschlossen hatte. »Ist dies Imlogue-Fada? Soll ich dich hier begraben?« fragte Teigh. »Ja,« sagte die Stimme. »Aber ich sehe weder Grab noch Grabstein,« sagte
Teigh. Der Leichnam schwieg, streckte aber seine lange, fleischlose Hand aus, und Teigh folgte der Richtung.
Kaum hatte er sich aber der Mauer auf etwa zwanzig Schritte genähert, als es wie ein Blitz mit gelber, roter und blauer Flamme um die Mauer zuckte, und je länger Teigh darauf hinsah, desto größer
wurde der Flammenring um den alten Friedhof, desto lichter wurden seine Farben, desto zahlreicher die Funken, die er sprühte. Teigh war starr vor Entsetzen. Wie Nebel legte es sich ihm um die
Augen, und von Schwindel erfasst, sank er zu Boden. Kaum war er einigermaßen zu sich gekommen, so flüsterte ihm die Stimme ins Ohr: »Kill-Breedya!« Dabei drückte ihn der Leichnam so heftig, dass
er vor Schmerz laut aufschrie. Er stand auf, müde und zitternd, ging weiter. Es wehte ein kalter Wind, der Weg war schlecht, die Last auf seinem Rücken war schwer, die Nacht stockfinster
geworden, und er war so erschöpft, dass er jeden Augenblick glaubte, niedersinken zu müssen.
Endlich streckte der Leichnam die Hand aus und sagte: »Begrabe mich hier!« »Dies ist die letzte Begräbnisstätte,« dachte Teigh, »auf einem Friedhof muss ich ihn begraben können, sagte das graue
Männlein, also ist es hier.« Der erste schwache Schein der Morgendämmerung wurde im Osten sichtbar, und die Wolken fingen an, sich an der Sonne zu entzünden. »Spute dich, spute dich!« sagte der
Leichnam. Teigh eilte, so gut er konnte, auf die Begräbnisstätte zu, die sich auf einem nackten Hügel befand. Kühn ging er durch die offene Pforte hinein - nichts stellte sich ihm in den Weg. Als
er in der Mitte angekommen war, schaute er sich nach einem Spaten oder einer Schaufel um. Wie er sich so suchend umblickte, fuhr er erschrocken zusammen - ein frisches Grab starrte ihm entgegen.
Er ging darauf zu und sah in der Tiefe einen schwarzen Sarg. Er kroch in die Grube und hob den Deckel auf; der Sarg war leer. Kaum aber war er wieder oben angelangt, da löste der Leichnam von
selbst die Hände von seinem Halse und die Beine von seinen Hüften und sank plumps! in den offenen Sarg.
Teigh fiel am Rande des Grabes in die Knie und dankte Gott mit inbrünstigen Worten. Dann schloss er den Sarg, warf so lange mit den Händen Erde auf das Grab, bis es ausgefüllt war, stampfte mit
seinen Füßen darauf, bis der Boden fest und hart war, und eilte davon. Eben war er mit seiner Arbeit fertig geworden, als die Sonne über dem Horizonte erschien. Er langte wieder auf der Straße an
und blickte sehnsüchtig nach einem Hause aus, wo er sich niederlegen könnte. Endlich fand er ein Gasthaus, warf sich aufs Bett und schlief bis in die Nacht hinein. Dann stand er auf, stärkte sich
ein wenig und schlief wieder bis zum Morgen. Hierauf mietete er ein Pferd und ritt nach Hause. Mehr als sechs Meilen hatte er zurückzulegen; diesen ganzen Weg hatte er in einer Nacht mit dem
Leichnam auf seinem Rücken gemacht.
Seine Verwandten hatten geglaubt, er hätte das Land verlassen; groß war daher ihre Freude, als sie ihn wieder zu sehen bekamen. Wo er gewesen war, hat außer seinem Vater nie jemand erfahren. Von
jenem Tage an war er ein anderer Mensch. Vierzehn Tage, nachdem er zurückgekehrt war, wurde er mit Mary getraut. Mit Spielen, Trinken und Nachtschwärmen war es ein- für allemal vorbei. Teigh
wurde ein glücklicher Mann, möget ihr so glücklich werden wie er.
Anna Kellner: Englische Märchen
Gobborn Seer
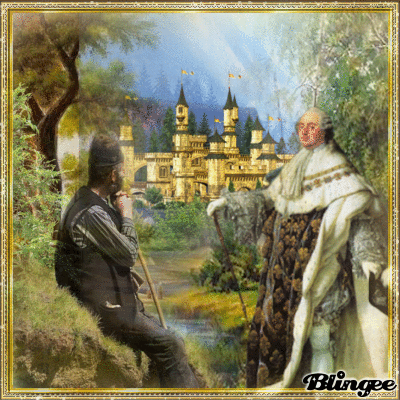
Es war einmal ein Mann, der hieß Gobborn Seer, und hatte einen Sohn namens Jack. Eines Tages schickte Gobborn Seer seinen Sohn fort, damit er ein Schaffell verkaufe, und sagte zu ihm: »Du musst
Geld heimbringen und die Schafshaut dazu.« Jack machte sich auf den Weg, aber er fand niemand, der ihm Geld für seine Ware geben wollte und die Ware dazu. So kam er missmutig wieder nach Hause
zurück. Sein Vater aber sagte zu ihm: »Du musst morgen wieder einen Versuch machen.« Abermals ging Jack fort, aber niemand wollte ihm unter solchen Bedingungen das Schaffell abkaufen. Als er nach
Hause kam, sagte sein Vater wieder: »Du musst morgen zum drittenmale dein Glück versuchen.«
Am dritten Tage erging es ihm aber nicht besser, und er war halb entschlossen, gar nicht mehr heimzukehren aus Angst vor dem Zorne seines Vaters. Er kam zu einer Brücke und lehnte sich über das
Geländer - und dachte darüber nach, was er nun tun sollte; es war vielleicht töricht, fortzulaufen. Sollte er nach Hause zurückkehren? Da fiel sein Blick auf ein Mädchen, das wusch unten am Ufer
Wäsche. Sie schaute zu ihm hinauf und fragte ihn: »Nimm mir die Frage nicht übel, was bekümmert dich so sehr?« »Mein Vater,« antwortete er, »hat mir das Schaffell gegeben und mir aufgetragen, ihm
dafür Geld heimzubringen und die Schafshaut dazu.« »Ist das alles? Nichts leichter als das.«
Das Mädchen wusch das Fell, schor die Wolle ab, bezahlte ihm, was diese wert war, und gab ihm die Haut zurück. Gobborn Seer war sehr zufrieden und sagte zu seinem Sohne: »Das ist ein gescheites
Mädchen und wäre eine prächtige Frau für dich. Glaubst du, dass du sie wiedererkennen wirst?« Jack hoffte es, und da hieß ihn sein Vater wieder zur Brücke hingehen, und wenn er sie träfe, zum Tee
einladen. Jack fand sie und erzählte ihr, dass sein Vater sie sehr gern kennen möchte, und er lud sie ein, bei ihnen Tee zu trinken. Das Mädchen dankte ihm herzlich und sagte, heute hätte sie
keine Zeit, doch versprach sie, am folgenden Tage zu kommen. »Um so besser,« sagte Jack, »da habe ich Zeit, alles vorzubereiten.«
Als sie am nächsten Abend sich einfand, da erkannte Gobborn Seer, dass sie ein kluges Mädchen sei, und er fragte sie, ob sie die Frau seines Sohnes werden möchte. Sie antwortete »Ja«, und so
wurden die beiden getraut. Nach einiger Zeit sagte Gobborn Seer zu seinem Sohne, er müsse ihm bei dem Bau eines Schlosses helfen. Das sollte nach dem Befehl des Königs das schönste Schloss
werden, das es auf der Welt gebe, und alle anderen an Pracht und Herrlichkeit übertreffen. Als Jack ihn begleitete, um ihm bei der Grundsteinlegung zu helfen, fragte ihn sein Vater: »Kannst du
mir nicht den Weg verkürzen?« Der Sohn blickte auf die Straße, die sich lange vor ihnen hinzog, und sagte: »Ich wüsste nicht, Vater, wie ich auch nur ein Stückchen davon abbrechen könnte.« »Dann
kann ich dich nicht brauchen,« sagte der Vater, »geh' nach Hause zurück.« Da machte der arme Jack Kehrt, und als seine Frau ihn erblickte, fragte sie ihn: »Warum bist du denn wieder da und
allein?«
Er erzählte ihr, was sein Vater von ihm verlangt und welche Antwort er ihm gegeben hatte. »Du Narr,« sagte seine kluge Frau, »wenn du ihm eine Geschichte erzählt hättest, so würdest du ihm den
Weg verkürzt haben! Ich erzähl' dir rasch eine, pass' auf, und versuche dann, deinen Vater einzuholen, und erzähle sie ihm sofort. Sie wird ihm gefallen, und wenn du damit fertig geworden bist,
werdet ihr am Bauplatze angelangt sein.« In Schweiß gebadet, holte Jack seinen Vater ein. Der sprach kein Wort, aber sein Sohn begann sofort mit der Geschichte, und so kürzte er ihm, wie seine
Frau es ihm vorhergesagt hatte, den Weg.
Als sie ihr Reiseziel erreichten, begannen sie sofort mit dem Bau des Schlosses, das alle anderen übertreffen sollte. Jacks Frau hatte ihnen den Rat gegeben, sich mit der Dienerschaft des Königs
sehr gut zu verhalten. Sie befolgten ihren Rat und wurden deshalb von allen freundlich begrüßt. Nach einem Jahre hatte der kundige Gobborn Seer das Schloss vollendet, das war so herrlich, dass
tausende herbeikamen und es bewunderten. Der König sagte: »Das Schloss ist fertig. Morgen komme ich wieder, um euch alle zu bezahlen.« »Ich muss nur noch oben in einem Vorsaal die Decke
vollenden,« sagte Gobborn Seer, »dann bin ich ganz fertig.«
Aber als der König fort war, da ließ die Haushälterin Vater und Sohn holen und sagte ihnen, dass sie nur auf einen günstigen Augenblick gewartet habe, um sie zu warnen; der König fürchte nämlich
so sehr, dass sie einem anderen ein ebenso herrliches Schloss bauen würden, dass er beschlossen habe, am folgenden Morgen beide zu töten. Darauf sagte Gobborn Seer zu seinem Sohne, er möge nur
guten Mutes sein, sie würden sich schon aus der Schlinge ziehen. Als der König wiederkam, sagte ihm Gobborn Seer, dass er seine Arbeit nicht vollenden könnte, weil ihm ein Werkzeug dazu fehle.
Das habe er zu Hause gelassen, aber Jack solle es holen. »Nein, nein,« sagte der König, »kann nicht einer von den Leuten das Werkzeug holen?« »Nein,« antwortete Gobborn Seer, »es muss mein Sohn
Jack sein.« »Du und dein Sohn, ihr müsst hierbleiben,« sagte der König, »aber wie wäre es, wenn ich meinen eigenen Sohn sende?« »Der ist mir recht,« lautete die Antwort. Gobborn Seer schickte
also den Prinzen mit dem Auftrage zu Jacks Frau, ihm »Gerade und Krumm« zu senden.
Nun befand sich ein schmales, ziemlich langes Loch in der Wand, und Jacks Frau tat, als bemühte sie sich, aus dem darin befindlichen Schrank »Gerade und Krumm« hervorzuholen; endlich bat sie den
Königssohn, ihr zu helfen, denn seine Arme seien länger als die ihren. Aber als er sich über den Schrank beugte, da ergriff sie ihn bei den Füßen und schob ihn hinein und verschloss dann den
Schrank. Da hockte er nun »gerade und krumm«. Und sie ließ ihn nicht heraus und bohrte Löcher in den Schrank, damit er Luft zum Atmen habe. Da bat der Prinz sie um Tinte, Feder und Papier, und
sie brachte ihm das Gewünschte.
Und der König bekam den Brief, in dem stand, dass der Prinz nur dann seine Freiheit wieder erlangen würde, wenn Jack und sein Vater heil nach Hause kämen.
Da blieb dem König nichts anderes übrig, als den Baulohn für das Schloss zu bezahlen und die beiden ziehen zu lassen. Auf dem Heimwege sagte Gobborn Seer zu seinem Sohne, dass er der klugen Frau
ein Schloss bauen wolle, welches weit herrlicher sein sollte als das des Königs. Das tat er auch, und dort lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr seliges Ende.
Anna Kellner: Englische Märchen
Dick Whittington
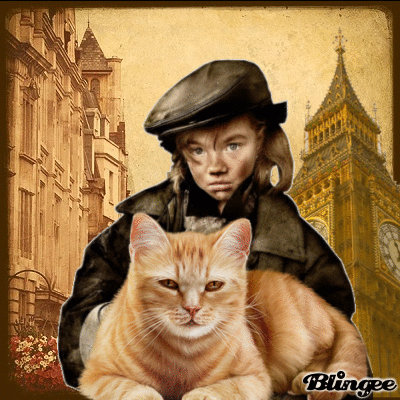
Zur Zeit, als in England der große König Eduard III. regierte, lebte daselbst ein kleiner Waisenknabe, Dick Whittington. Der arme Dick war sehr schlecht dran; er war noch nicht alt genug, um zu
arbeiten und hatte gar wenig zum Mittagessen und oft gar nichts zum Frühstück; denn die Leute im Dorfe waren sehr arm und konnten ihm nur Erdäpfelschalen und Abfälle, selten einmal eine harte
Brotrinde schenken. Dick hatte viel seltsame Dinge über die große Stadt London gehört; denn die Leute auf dem Lande glaubten damals, dass in London nur feine Herren und Damen wohnten, dass man
dort den ganzen Tag sang und spielte, und dass die Straßen mit Gold gepflastert wären.
Eines Tages fuhr ein großer Wagen mit acht Pferden, die alle mit Schellen behängt waren, durch das Dorf.
»Der schöne Wagen,« dachte Dick, »fährt gewiss nach London.«
Er fasste Mut und bat den Fuhrmann um die Erlaubnis, neben dem Wagen herlaufen zu dürfen. Als der Fuhrmann hörte, dass der arme Dick weder Vater noch Mutter besaß, und sah, wie zerlumpt er war,
sagte er: »Komm nur mit, wenn du willst.«
Und sie zogen zusammen fort.
Dick kam glücklich in London an und nahm sich nicht einmal die Zeit, dem freundlichen Fuhrmann zu danken, denn er wollte nur schnell zu den schönen, goldgepflasterten Straßen kommen. Er lief, so
schnell ihn seine Füße trugen, durch viele, viele Straßen; er glaubte jeden Augenblick, dass endlich das Goldpflaster beginnen müsste. Dick hatte schon dreimal ein Goldstück gesehen und wusste,
wie viel Kleingeld man dafür bekam, er glaubte daher, dass er sich nur ein Stückchen Pflaster abzubrechen brauchte, um Geld in Hülle und Fülle zu haben. Der arme Dick lief, bis er müde war und
den guten Fuhrmann ganz vergessen hatte; endlich sah er, dass in London statt Gold nur Schmutz zu finden war, und da die Nacht hereinbrach, setzte er sich in einem Winkel nieder und weinte sich
in den Schlaf. Dick war die ganze Nacht auf der Straße; am nächsten Morgen stand er auf, und da er sehr hungrig war, bat er jeden, den er traf, um einen halben Penny, damit er nicht verhungern
müsste; aber niemand gab ihm Antwort, und nur zwei schenkten ihm einen halben Penny, so dass der arme Junge vor Hunger bald ganz schwach wurde.
Endlich wurde der hungrige Knabe von einem gutmütigen Herrn bemerkt.
»Warum arbeitest du nicht, mein Junge?« fragte er ihn.
»Ich möchte gerne arbeiten,« sagte Dick. »Aber ich weiß nicht, wo ich Arbeit bekommen könnte.«
»Wenn du wirklich arbeiten willst,« sagte der Herr, »so komm' mit mir,« und er führte ihn zu einem Heufeld, wo Dick fleißig arbeitete und ganz lustig lebte, bis das Heu eingefahren war. Dann war
er wieder in großer Not; und eines Tages legte er sich halbverhungert auf die Schwelle eines Hauses nieder. Das gehörte dem reichen Kaufmann Mister Fitzwarren. Die Köchin, die eine böse Person
und gerade damit beschäftigt war, das Mittagessen für ihre Herrschaft zu richten, sah ihn bald und schrie ihn an: »Was hast du hier zu suchen, du fauler Schlingel? Nichts wie Bettler überall!
Wenn du nicht schaust, dass du weiterkommst, so werde ich dich mit einem Schaff heißen Spülwassers begießen!«
In diesem Augenblick kam Mister Fitzwarren zum Essen nach Hause; und als er den schmutzigen, zerlumpten Buben auf der Schwelle liegen sah, sprach er zu ihm: »Warum liegst du hier, mein Kind? Du
scheinst alt genug zu sein, um arbeiten zu können, du bist wohl zu faul dazu?«
»O nein, Herr,« sagte Dick, »ich würde von Herzen gerne arbeiten, aber ich kenne niemanden, und ich bin ohnmächtig vor Hunger.«
»Armer Teufel, steh' auf; wir wollen sehen, was dir fehlt.« Dick versuchte aufzustehen, allein er war zu schwach und sank wieder zurück, denn er hatte volle drei Tage nichts gegessen und war
nicht mehr imstande, auf der Straße herumzulaufen und zu betteln. Der freundliche Kaufmann befahl, dass man ihn ins Haus nehme und ihm ein gutes Mittagessen gebe, und behielt ihn als Küchenjungen
in seinem Hause.
Der kleine Dick hätte nun ein sehr glückliches Leben geführt, wenn nur nicht die böse Köchin gewesen wäre. Die tadelte und schalt ihn vom Morgen bis zum Abend und bearbeitete ihn mit dem Besen
oder was sie gerade in der Hand hatte. Endlich erfuhr Alice, das Töchterlein des Kaufmannes, davon und sagte der Köchin, sie würde entlassen werden, wenn sie nicht aufhörte, den armen Jungen zu
misshandeln. Nun wurde die Köchin etwas freundlicher, aber er litt auch noch von einer anderen Seite. Sein Bett stand in einem Bodenstübchen, dessen Mauern und Dielen so durchlöchert waren, dass
er jede Nacht von Mäusen und Ratten gequält wurde. Ein Herr hatte ihm einmal fürs Schuhputzen einen Penny gegeben, und er beabsichtigte, sich dafür eine Katze zu kaufen. Am folgenden Tage sah er
ein Mädchen, das eine auf dem Arm trug, und er fragte sie: »Willst du mir die Katze für einen Penny verkaufen?« »Jawohl,« sagte das Mädchen. »Sie ist zwar ein ausgezeichneter Mauser, aber ich
will dir sie geben.« Dick versteckte seine Katze im Dachstübchen und trug ihr immer einen Teil seines Essens hinauf; nach kurzer Zeit schon konnte er jede Nacht fest schlafen, ohne von den Ratten
und Mäusen belästigt zu werden.
Kurz darauf ließ sein Herr ein Schiff ausrüsten, das mit allerlei Waren in fremde Länder segeln sollte, und da er wollte, dass die Dienstboten so gut wie er selbst Gelegenheit hätten, ihr Glück
zu versuchen, rief er sie alle in das Wohnzimmer und fragte sie, was sie wohl mitgeben möchten. Sie wollten alle etwas wagen, außer dem armen Dick, der weder Geld noch Geldeswert besaß. Deshalb
kam er nicht mit den übrigen in das Wohnzimmer, aber Miss Alice verriet den Grund und ließ ihn hereinrufen. »Ich will etwas von meinem eigenen Geld für ihn auslegen,« sagte sie; aber ihr Vater
meinte: »Das geht nicht, es muss sein eigen sein.« Als der arme Dick dies hörte, sagte er: »Ich habe nichts als eine Katze, die ich vor einiger Zeit um einen Penny gekauft habe.«
»So hole deine Katze, mein Junge,« sagte Mister Fitzwarren, »und lass sie reisen.« Dick gieng hinauf und brachte die arme Mieze; mit Tränen in den Augen übergab er sie dem Capitän. »Jetzt werden
mich die Ratten und Mäuse nie mehr schlafen lassen,« klagte er.
Alle lachten über Dicks seltsame Ware, und Miss Alice, die Mitleid für ihn fühlte, gab ihm etwas Geld, damit er sich eine andere Katze kaufen könne.
Dies und viele andere Zeichen des Wohlwollens, die Miss Alice ihm bezeigte, bewirkten, dass die böse Köchin auf den armen Dick eifersüchtig wurde, und sie behandelte ihn grausamer als je, und
spottete, er habe seine Katze auf Reisen geschickt. »Glaubst du,« höhnte sie ihn, »dass man für die Katze Geld genug bekommen wird, um einen Stock für dich zu kaufen?« Endlich konnte der arme
Dick diese Behandlung nicht mehr ertragen, und er beschloss, davonzulaufen; er packte seine wenigen Habseligkeiten und ging sehr zeitig in der Früh am Allerheiligentage fort. Er kam bis nach
Holloway; dort setzte er sich auf einen Stein, der bis auf den heutigen Tag der Whittingtonstein genannt wird, und überlegte, welchen Weg er einschlagen sollte.
Während er noch darüber nachdachte, begannen die Glocken der Bowkirche zu läuten, und er glaubte folgende Worte in dem Glockenspiele zu hören: »Kehr' um, kehr' um, Dick Whittington, Bürgermeister
von London!« »Bürgermeister von London!« sagte Dick. »Ei, ich wollte jetzt gern alles ertragen, um, wenn ich groß bin, Bürgermeister von London zu werden und in einer schönen Kutsche zu fahren.
Ich will lieber umkehren und mir aus dem Puffen und Schelten der alten Köchin nichts machen, wenn ich nur Bürgermeister von London werde.« Dick ging zurück, und konnte glücklicherweise noch ins
Haus gehen und sich an seine Arbeit machen, bevor die alte Köchin herunterkam.
Nun müssen wir uns mit Fräulein Mieze an die Küste von Afrika begeben. Das Schiff war lange auf der See und wurde endlich an die Küste der Berberei getrieben, welche nur von Mauren bewohnt war.
Die Einwohner kamen in großen Massen, um die Seeleute zu sehen, weil sie von anderer Gesichtsfarbe waren, als sie; sie waren sehr freundlich, und als sie näher bekannt wurden, wollten sie gerne
die schönen Dinge kaufen, mit denen das Schiff beladen war. Als der Capitän dies merkte, sandte er dem Könige des Landes Muster seiner schönsten Waren; dem gefielen sie so gut, dass er den
Capitän in seinen Palast berief. Dort setzten sie sich, wie es die Landessitte heischt, auf schöne, gold- und silbergestickte Teppiche, der König und die Königin obenan. Allerlei Gerichte wurden
zum Abendessen hereingebracht, aber kaum hatten sie zu speisen begonnen, als eine große Anzahl von Ratten und Mäusen hereinstürzte und sich das Essen vortrefflich munden ließ. Der Capitän war
darüber sehr erstaunt und fragte, ob das Getier denn den Majestäten nicht unangenehm sei.
»O ja,« sagte ein Höfling, »sogar sehr unangenehm; der König würde gern die Hälfte seines Schatzes hergeben, um sie los zu werden, denn sie verderben ihm nicht nur seine Mahlzeiten, wie Ihr seht,
sondern sie belästigen ihn auch in seinem Gemache und sogar in seinem Bette, so dass er sich, wenn er schlafen will, bewachen lassen muss.« Der Capitän hüpfte vor Freude. Er erinnerte sich des
armen Whittington und seiner Katze und sagte dem Könige, dass er ein Geschöpf am Bord habe, welches alle Ratten und Mäuse augenblicklich ausrotten würde. Der König atmete bei dieser angenehmen
Nachricht so tief auf, dass ihm der Turban vom Kopfe fiel. »Bringe mir dieses Geschöpf,« sagte er, »und wenn es vollbringt, was du sagst, so will ich dir dafür dein Schiff mit Gold und
Edelsteinen beladen.«
Der Capitän, der sein Geschäft verstand, benützte diese Gelegenheit, um die guten Eigenschaften Fräulein Miezes herauszustreichen. Er sagte den Majestäten: »Es ist zwar ein großes Opfer, uns von
ihr zu trennen, da die Ratten und Mäuse auf dem Schiffe die Waren beschädigen werden, wenn sie nicht mehr da ist, aber Euern Majestäten will ich sie gern bringen.« »Schnell, schnell!« bat die
Königin. »Ich brenne vor Ungeduld, das liebe Geschöpf zu sehen!« Der Capitän kehrte zum Schiff zurück, während man ein anderes Abendessen bereitete. Er nahm Mieze unter den Arm und kam gerade
zurecht, um den Tisch wieder voller Ratten und Mäuse zu sehen. Als Mieze diese erblickte, besann sie sich nicht lange, sondern sprang hinunter und machte sich über Ratten und Mäuse her. In
einigen Minuten lagen die meisten tot zu ihren Füßen. Die übrigen liefen in ihrer Angst schnell in ihre Löcher zurück.
Der König war ganz entzückt, eine solche Plage so leicht los zu werden, und die Königin wünschte das Geschöpf, das ihnen so viel Gutes getan hatte, in der Nähe anzusehen. Darauf rief der Capitän:
»Mieze, Mieze!« und sie kam zu ihm. Dann reichte er sie der Königin, die zurückfuhr und sich nicht getraute, das Geschöpf, das unter den Ratten und Mäusen so aufgeräumt hatte, anzurühren. Allein,
als der Capitän die Katze streichelte und rief: »Mieze, Mieze!« streichelte sie sie auch und rief: »Mieti, Mieti!« denn sie konnte das Wort nicht gut aussprechen. Dann setzte er sie auf den Schoß
der Königin, wo sie mit der Hand Ihrer Majestät spielte und endlich schnurrend einschlief.
Da der König Miezes Heldentaten gesehen hatte und man ihm zu verstehen gab, dass ihre Jungen mit der Zeit das ganze Land von Ratten und Mäusen säubern würden, kaufte er ihm die ganze Ladung ab
und gab ihm für die Katze allein zehnmal so viel, als für alles andere zusammen. Dann nahm der Capitän von der königlichen Familie Abschied und segelte mit einem günstigen Winde nach England.
Nach einer glücklichen Reise kam er wohlbehalten in London an. Eines schönen Morgens saß Mister Fitzwarren in seinem Bureau vor dem Schreibtisch, als es an die Türe klopfte. »Wer da?« fragte
Mister Fitzwarren. »Ein Freund,« antwortete der andere, »ich bringe gute Nachrichten von Eurem Schiff, Mister Fitzwarren.« Da vergaß der Kaufmann seine Gichtschmerzen und sprang rasch auf. Er
öffnete die Tür. Und wer stand draußen? Der Capitän, ein Kästchen voll Edelsteinen in der Hand. Bei diesem Anblick hob Mister Fitzwarren die Augen zum Himmel empor und dankte Gott für die
glückliche Fahrt.
Dann erzählte der Capitän die Geschichte von der Katze und zeigte die schönen Geschenke, die der König und die Königin der Berberei dem armen Dick geschickt hatten. Als der Kaufmann dies hörte,
sagte er zu seiner Dienerschaft:
Ruft mir den glücklichen Jüngling herbei,
»Mister« Whittington von nun an sein Name sei.
Jetzt zeigte es sich, welch ein Ehrenmann Mister Fitzwarren war, denn als seine Dienerschaft meinte, dass ein so großer Schatz für den armen Küchenjungen zu viel sei, antwortete er: »Gott
verhüte, dass ich ihm auch nur einen einzigen Penny vorenthalte; der Schatz gehört ihm, und er soll ihn bis auf den letzten Heller bekommen.« Dann schickte er um Dick, der gerade für die Köchin
Töpfe scheuerte und ganz schmutzig war. Er schämte sich daher, in das Bureau zu kommen. Aber der Kaufmann befahl ihm, einzutreten. Mister Fitzwarren bot Dick einen Sessel an; der glaubte nicht
anders, als dass man sich über ihn lustig machte, und sagte: »Bitte, halten Sie mich armen Jungen nicht zum Besten, und lassen Sie mich wieder an meine Arbeit gehen!«
»Nein, nein, Mister Whittington,« sagte der Kaufmann, »ich scherze nicht. Ich freue mich ungemein über die gute Nachricht, die dieser Herr Ihnen gebracht hat. Der Capitän hat nämlich Ihre Katze
dem König der Berberei verkauft und dafür mehr Geld bekommen, als mein ganzes Vermögen beträgt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich Ihres Besitzes recht lange erfreuen mögen.« Dann ersuchte Mister
Fitzwarren den Capitän, die mitgebrachten Schätze zu zeigen, und sagte: »Mister Whittington hat jetzt nichts weiter zu tun, als seinen Reichtum gehörig zu verwahren und zu verwalten.« Der arme
Dick wusste gar nicht, was er vor Freude alles tun sollte. Er bat seinen Herrn, sich so viel von den Kostbarkeiten zu nehmen, als ihm gefiel, da er ja ihm alles zu verdanken hätte.
»Nein, nein,« sagte Mister Fitzwarren, »es ist Ihr Eigentum, und ich zweifle nicht daran, dass Sie einen guten Gebrauch davon machen werden.« Da bat Dick Miss Alice, einen Teil seines Vermögens
anzunehmen, aber auch sie weigerte sich und sagte ihm, dass sie sich über sein Glück sehr freue. Doch der arme Bursche war zu gutherzig, um alles für sich zu behalten; so machte er denn dem
Capitän, dem Steuermann, den Matrosen und allen anderen Bediensteten Mister Fitzwarrens Geschenke, und nicht einmal die böse Köchin ging leer aus.
Darauf gab ihm Mister Fitzwarren den Rat, einen guten Schneider kommen und sich Kleider machen zu lassen, wie sie einem feinen Herrn geziemten, ferner sagte er ihm, dass es ihm großes Vergnügen
bereiten würde, wenn er in seinem Hause bleiben wollte, bis er ein besseres gefunden hätte. Als Whittington gewaschen, gekämmt und schön angezogen war, da sah er so schön und fein aus wie die
anderen jungen Herren, welche im Hause Mister Fitzwarrens verkehrten.
Er erwies Miss Alice, der Tochter seines Wohlthäters, alle möglichen Aufmerksamkeiten, und endlich warb er um ihre Hand. Alice, die ihn immer lieb gehabt hatte, willigte gern ein, seine Frau zu
werden, und Mister Fitzwarren segnete ihre Liebe. Der Hochzeitstag wurde festgesetzt, und bei der Trauung war der Oberbürgermeister von London mit allen Stadträten und eine große Anzahl von
reichen Kaufleuten zugegen; das Hochzeitsfest wurde mit einem glänzenden Mahle beschlossen.
Mister Whittington, der mit seiner Frau in glücklichster Ehe lebte, wurde zuerst Stadtrat und dann Oberbürgermeister von London und später von König Heinrich V. in den Ritterstand erhoben.
Anna Kellner: Englische Märchen
Wie der Wrekinberg bei Shrewsbury entstand
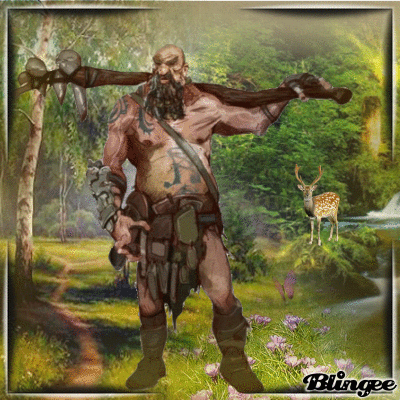
In Wales lebte einmal ein gottloser alter Riese, der aus irgend einem Grunde gegen den Bürgermeister von Shrewsbury und alle seine Leute so furchtbar aufgebracht war, dass er beschloss, den Severn abzudämmen und dadurch eine solche Überschwemmung zu verursachen, dass die ganze Stadt zugrunde gehen sollte.
So machte er sich denn mit einem Spaten voll Erde auf den Weg und legte eine Meile nach der anderen zurück, um den Weg nach Shrewsbury zu finden. Wie er ihn verfehlte, weiß ich nicht, aber er
muss irgendwie irre gegangen sein, denn er war plötzlich ganz nahe bei Wellington und fauchte und pustete unter der schweren Last und sehnte schon das Ende der Reise herbei. Nach einiger Zeit kam
ein Schuhflicker mit einem Sack voll alter Stiefel und Schuhe auf dem Rücken die Straße einher, der wohnte in Wellington und ging alle vierzehn Tage einmal nach Shrewsbury, wo er bei seinen
Kunden Schuhe zum Flicken abholte. Da rief ihn der Riese an.
»Du,« fragte er, »wie weit ist's bis nach Shrewsbury?« »Shrewsbury?« antwortete der Schuster, »was wollt Ihr in Shrewsbury?« »Ich will,« versetzte der Riese, »dort den Severn mit diesem
Erdklumpen ausfüllen. Ich hab' einen alten Groll gegen den Bürgermeister und alle Leute von Shrewsbury, ich gedenke sie also alle zu ertränken und sie so auf einmal los zu werden.« »Bei meiner
Ehre!« dachte der Schuhflicker, »das darf nie und nimmer geschehen! Meine Mittel erlauben es mir nicht, meine Kunden umbringen zu lassen.« Laut sagte er: »Ihr werdet nie nach Shrewsbury kommen,
weder heut, noch morgen. Schaut mich an! Ich komme gerade von Shrewsbury, und seit ich unterwegs bin, hab' ich all diese alten Stiefel und Schuhe abgenützt.« Und er zeigte ihm seinen Sack. »Ach!«
stöhnte der Riese »dann ist es umsonst! Ich bin schon sehr müde und kann diese Last nicht noch weiter schleppen. Ich lass sie hier liegen und geh' wieder nach Hause.«
So ließ er den Erdklumpen, wo er gerade stand, zu Boden fallen, putzte seine Stiefel an dem Spaten ab, ging wieder nach Wales zurück, und seit der Zeit hat nie wieder jemand in Shropshire etwas
von ihm gehört. Aber dort, wo er den Erdklumpen niederwarf, steht der Wrekinberg bis auf den heutigen Tag, und die Erde, die er von seinen Stiefeln abkratzte, war ein solcher Haufen, dass daraus
der kleine Ercallberg neben dem Wrekinberg entstand.
Anna Kellner: Englische Märchen
Der rote Ettin
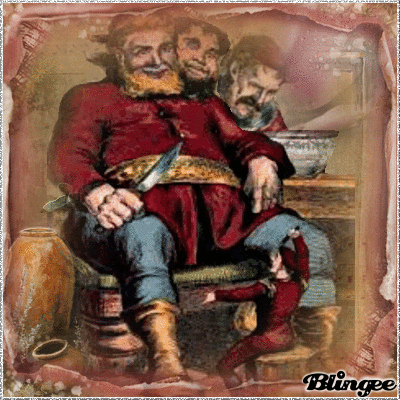
Es war einmal eine Witwe, die hatte von einem Pächter einen kleinen Acker gemietet, und davon bestritt sie ihren Unterhalt. Sie hatte zwei Söhne, und es kam die Zeit, dass sie fortziehen mussten,
ihr Glück in der Welt zu suchen. Eines Tages sagte sie also ihrem älteren Sohne, er möchte ihr in einem Kruge Wasser vom Brunnen bringen, damit sie ihm einen Kuchen backe. Sie sagte ihm ferner,
dass der Kuchen klein oder groß ausfallen würde, je nachdem er wenig oder viel Wasser bringe, und dass sie ihm außer diesem Kuchen nichts auf die Reise mitgeben könne.
Der Bursche ging mit dem Kruge zum Brunnen, füllte ihn mit Wasser und kam wieder heim, aber der Krug war zerbrochen, und so war der größte Teil des Wassers herausgeronnen, bevor er nach Hause
kam. Sein Kuchen geriet also nur sehr klein. Trotzdem fragte ihn seine Mutter, ob er die Hälfte davon mit ihrem Segen oder den ganzen Kuchen mit ihrem Fluche haben wolle. Der Sohn dachte, er
würde wohl weit zu wandern haben, und es war ungewiss, wann oder wie er wieder etwas zu essen bekommen würde; so sagte er denn, er wolle den ganzen Kuchen haben. Er erhielt ihn mit ihrem Fluche.
Dann übergab er heimlich seinem Bruder ein Messer und bat ihn, es aufzubewahren, bis er wiederkäme. Doch sollte er es jeden Morgen ansehen. So lange es rein war, konnte er sicher sein, dass sein
Besitzer sich wohl befinde; wurde es aber trübe und rostig, dann war ihm Übles widerfahren.
Der junge Mann ging also fort, um sein Glück zu versuchen. Er wanderte zwei Tage lang dahin, am dritten Tag stieß er nachmittags auf eine Schafherde mit ihrem Hirten. Diesen fragte er, wem die
Schafe gehörten, und erhielt folgende Antwort:
»Der rote Ettin von Irenland
Wohnt' einst in Ballygant;
Er hat König Malcom's Tochter geraubt,
Die Prinzessin von Schottland.
Er bindet sie, er züchtigt sie,
Er macht, was ihm gefällt,
Wie Julian, der Römer,
Trotzt er der ganzen Welt.
Wohl ist vom Schicksal bestimmt ihm
Durch Menschenhand der Tod -
Doch der Mann ist noch nicht geboren;
Da hat's lange noch keine Not.«
Dann warnte ihn der Hirte vor den Tieren; die er demnächst treffen würde, denn sie seien ganz anders als alle anderen, die er je gesehen hätte. Der junge Bursche ging weiter, und nach einiger
Zeit sah er eine ganze Menge schrecklicher Tiere; die hatten zwei Köpfe und auf jedem Kopf vier Hörner. Er erschrack sehr und rannte davon, so schnell er konnte und war sehr froh, als er zu einem
Schlosse kam. Das stand auf einem Hügel, und das Tor war weit offen. Er ging hinein, um Schutz zu suchen, und da sah er eine alte Frau beim Feuer sitzen. Er fragte sie, ob er nicht die Nacht über
dableiben könnte, er sei von seiner langen Reise sehr ermüdet. Sie antwortete, er dürfe wohl bleiben, doch das Haus gehöre dem roten Ettin; das sei ein schreckliches Tier mit drei Köpfen, das
kein menschliches Wesen schone, wenn es in seine Gewalt gerate.
Der junge Mensch hätte sich nun am liebsten entfernt, aber er fürchtete sich vor den Tieren außerhalb des Schlosses; so bat er denn die alte Frau, ihn so gut als möglich zu verstecken und dem
roten Ettin seine Anwesenheit nicht zu verraten. Er dachte, wenn er nur die Nacht über bleiben könnte, so würde es ihm möglich sein, am Morgen zu entfliehen, ohne von den Tieren gesehen zu
werden.
Er war noch nicht lange in seinem Versteck, als der scheußliche Ettin hereinkam. Und kaum war er da, so schrie er auch schon:
»Feh, fei, foh, fum!
Ich riech' einen Menschen hier herum;
Er sei lebendig, er sei tot,
Aus seinen Knochen mahl' ich Brot.«
Bald fand er den armen Burschen und zog ihn aus seinem Loche hervor. Doch sagte er ihm, dass er sein Leben schonen wolle, wenn er imstande sei, drei Fragen zu beantworten. Da fragte der erste
Kopf des roten Ettin: »Ein Ding ohne Ende, was ist das?«
Der junge Mensch wusste es nicht.
Da fragte der zweite Kopf: »Je kleiner, desto gefährlicher ist's; was ist das?«
Der junge Mensch wusste es nicht.
Zuletzt fragte der dritte Kopf: »Totes trägt Lebendiges; was ist das?«
Der junge Mensch wusste auch das nicht. Da er keine einzige der drei Fragen hatte beantworten können, so holte der rote Ettin eine Keule, versetzte ihm damit einen Schlag auf den Kopf und
verwandelte ihn in eine Steinsäule.
An dem Morgen, nachdem dies geschehen war, betrachtete der jüngere Bruder das Messer und war sehr betrübt, als er es ganz mit Rost bedeckt fand. Er sagte zu seiner Mutter, dass nun auch für ihn
die Zeit gekommen sei, fortzuziehen, und sie hieß ihn Wasser holen, damit sie ihm einen Kuchen backe. Er ging, und als er das Wasser nach Hause trug, rief ihm ein Rabe aus den Lüften zu, er solle
sich umschauen, dann würde er sehen, dass das Wasser aus dem Kruge heraus fließe. Und da er ein geweckter Bursche war, so verstopfte er die Löcher des Kruges mit etwas Lehm, und so brachte er
genug Wasser für einen großen Kuchen nach Hause. Als ihm seine Mutter vorschlug, die Hälfte des Kuchens mit ihrem Segen anstatt den ganzen mit ihrem Fluche zu nehmen, da zog er den halben Kuchen
vor, und der war immer noch größer als der ganze seines Bruders.
Er machte sich also auf den Weg, und nachdem er schon sehr weit gegangen war, traf er eine alte Frau, die fragte ihn, ob er ihr nicht ein Stückchen von seinem Kuchen geben möchte. »Sehr gern,«
antwortete er und gab ihr ein Stück davon, und sie schenkte ihm dafür einen Zauberstab. Die alte Frau, die eigentlich eine Fee war, sagte ihm, dass der Stab ihm sehr nützlich sein würde, wenn er
ihn richtig anwendete. Sie sagte ihm ferner, was ihm widerfahren würde, und was er in den betreffenden Fällen tun müsse. Einen Augenblick später war sie seinen Blicken entschwunden. Er ging
weiter und immer weiter, und da traf er den alten Mann, der die Schafe hütete. Er fragte ihn, wem die Schafe gehörten, und erhielt folgende Antwort:
»Der rote Ettin von Irenland
Wohnt' einst in Ballygant,
Er hat König Malcolm's Tochter geraubt,
Die Prinzessin von Schottland.
Er bindet sie, er züchtigt sie,
Er macht, was ihm gefällt.
Wie Julian, der Römer,
Trotzt er der ganzen Welt.
Doch Schicksal treulich sich erfüllt,
Du schlägst ihn mit deiner Hand,
Und du wirst dann, ich seh' es klar,
Der Herr von diesem Land.«
Als er zu der Stelle kam, wo die scheußlichen Tiere sich befanden, blieb er weder stehen, noch lief er davon, sondern ging kühn mitten durch. Brüllend kam eines von ihnen mit offenem Rachen auf
ihn los, um ihn zu zerreißen, da schlug er es mit seinem Zauberstab, dass es augenblicklich tot zu seinen Füßen niedersank. Dann ging er zu dem Schlosse des roten Ettin, klopfte an und wurde
eingelassen. Die alte Frau, welche am Feuer saß, teilte ihm warnend mit, wer der furchtbare Ettin sei, und welches Schicksal seinen Bruder ereilt habe. Aber er ließ sich nicht abschrecken. Da kam
das Ungeheuer herein und sagte:
»Feh, fei, foh, fum,
Ich riech' einen Menschen hier herum;
Er sei lebendig, er sei tot,
Aus seinen Knochen mahl' ich Brot.«
Er erblickte den jungen Menschen und befahl ihm vorzutreten. Dann stellte er die drei Fragen an ihn. Da ihm aber die Fee alles gesagt hatte, so war er auch imstande, alle Fragen zu
beantworten.
Der erste Kopf fragte: »Ein Ding ohne Ende, was ist das?«
Er antwortete: »Eine Kugel.«
Der zweite Kopf fragte: »Je kleiner, desto gefährlicher ist's, was ist das?«
Er antwortete sofort: »Eine Brücke.«
Zuletzt fragte der dritte Kopf: »Totes trägt Lebendiges, was ist das?«
Da antwortete der junge Mann sofort: »Ein Schiff mit seiner Bemannung.«
Als der rote Ettin dies hörte, da wusste er, dass seine Macht zu Ende war. Der junge Mensch nahm eine Axt und hieb dem Ungeheuer alle drei Köpfe ab. Dann forderte er die alte Frau auf, ihm zu
zeigen, wo sich die Königstochter befand. Sie führte ihn die Treppe hinauf und öffnete viele Türen, und da kam aus jeder Tür eine schöne Jungfrau hervor. Sie alle hatte Ettin hier gefangen
gehalten, und eine von ihnen war die Königstochter. Dann führte ihn die alte Frau in ein unterirdisches Gemach, dort stand eine steinerne Säule. Aber er berührte sie mit seinem Zauberstab, da
kehrte sein Bruder ins Leben zurück. Alle Gefangenen freuten sich über die Maßen ihrer Erlösung und dankten dem jungen Menschen herzlich.
Am nächsten Tage machten sie sich alle nach dem Hofe des Königs auf; es war eine stattliche Gesellschaft. Und der König gab seine Tochter ihrem Befreier zur Frau, und seinen älteren Bruder
verheiratete er mit der Tochter eines Edelmannes. Und so lebten sie alle glücklich bis an ihr Ende.
Anna Kellner: Englische Märchen
Der Bursche, der keine Geschichte kannte

Es war einmal ein junger Bursche, Paddy Ahern. Er war freundlich zu jedermann und doch nicht gerade willkommen in den Häusern der anderen, denn man hätte statt seiner auch einen Stein in die Ecke
setzen können. Ja, stumm wie ein Stein war Paddy, wenn es darum ging, die anderen zu unterhalten. Kein Lied konnte er singen, keine Geschichte erzählen, ja nicht einmal ein Rätsel oder einen Witz
konnte Paddy zum Besten geben.
Einmal arbeitete Paddy für einen Bauern in der Gegend von Limerick, mal für diesen, mal für jenen, und übernachtete dort, wo es sich gerade anbot. Aber bald merkte er, dass er auch hier nicht
willkommen war in den Häusern, in denen er über Nacht blieb. Denn die Leute waren zwar gastfreundlich, aber sie erwarteten doch, dass er als Fremder Neuigkeiten zu erzählen hätte oder den Abend
durch Lieder und Geschichten verkürzen könnte. Der arme Paddy war betrübt, aber was sollte er tun?
So ging er eines Abends einen einsamen Weg entlang, denn er hatte noch keine Unterkunft für die Nacht gefunden. Da sah er auf einmal Licht in einem Haus etwas abseits mitten im Feld. Paddy sprang
über den Straßengraben, ging auf das Haus zu und klopfte an die Tür. Es war ein seltsames Haus, groß und dunkel, und die Tür öffnete ein seltsamer großer und dunkler Mann. „Willkommen Paddy
Ahern!“, sagte der Mann. „Komm herein und setz dich ans Feuer.“ Paddy wunderte sich, dass der Mann seinen Namen wusste, aber er traute sich nicht zu fragen, denn es war wirklich ein seltsamer
Ort. Sie aßen zusammen, und dann zeigte der Mann Paddy, wo er schlafen konnte. Paddy zog seine Kleider aus und legte sich hin, müde wie er war.
Aber viel Schlaf bekam er nicht in dieser Nacht. Denn kaum hatte er die Augen zugemacht, da schlug krachend die Tür auf, und drei Männer kamen herein, sie trugen einen Sarg – er schien sehr
schwer zu sein. Vom Hausherrn war nichts zu sehen. „Wer hilft uns nun, den Sarg zu tragen?“, fragte einer der Männer die beiden anderen. „Paddy Ahern, wer sonst?!“, sagten sie. Nun musste Paddy
aufstehen, sich anziehen und mit einem der Männer ans Fußende des Sarges gehen, die beiden anderen gingen am Kopfende, und dann trugen sie den Sarg aus den Haus über die Wiesen, weiter und immer
weiter querfeldein durch Gräben und Hecken. Es dauerte nicht lange, da war Paddy völlig durchnässt, schmutzig und ganz zerkratzt. Wenn Paddy stehen blieb, um zu verschnaufen, schimpften die
Männer ihn aus, und wenn er stolperte und hinfiel, so traten sie ihn mit Füßen, bis er wieder aufstand. Ihm war hundeelend.
Schließlich kamen sie an eine mannshohe Mauer – schrecklich einsam war es dort. „Wer hebt nun den Sarg über die Mauer?“, fragte einer der Männer. „Paddy Ahern, wer sonst?!“, sagten die beiden
anderen. Und nun musste Paddy ganz allein den schweren Sarg über die Mauer wuchten, das war kaum zu schaffen. Als er endlich den Sarg über die Mauer gebracht hatte, sah er, dass sie auf einem
Friedhof standen. Paddy konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Aber die Männer ließen ihm keine Ruhe. „Wer gräbt nun das Grab?“, fragte einer. „Paddy Ahern, wer sonst?!“ Sie gaben ihm einen
Spaten, und Paddy schaufelte ein Grab. Als die Grube endlich ausgehoben war, sagte einer der Männer: „Wer öffnet nun den Sarg?“ – „Paddy Ahern, wer sonst?!“ Paddy wäre fast gestorben vor Angst,
aber was blieb ihm übrig? Er kniete nieder, öffnete mit zitternden Fingern den Sarg und nahm den Deckel ab. Und stellt euch vor: Der Sarg – so schwer er war – war leer.
„Wer legt sich nun in den Sarg?“ – „Paddy Ahern, wer sonst?!“ Die drei Männer wollten Paddy packen, aber der wartete nicht länger, er sprang auf, sprang über die Mauer und lief davon über die
Felder, so schnell er konnte. Und die drei Männer hinter ihm her, sie schrieen und johlten, eine schöne Hetzjagd war das! Paddy rannte und rannte wie nie zuvor in seinem Leben, und doch hätten
die drei Männer ihn mehr als einmal fast gepackt, aber irgendwie konnte Paddy ihnen immer wieder im letzten Augenblick entwischen. Da sah er in der Ferne Licht im Fenster, und rannte darauf zu.
„Macht auf“, schrie er schon weitem, „macht auf, um Himmels willen, und rettet mich!“ Die Tür ging auf, und Paddy stürzte hinein in die Küche. Und wer hatte Paddy geöffnet? Ein seltsamer, großer,
dunkler Mann. Das war zuviel für Paddy, ohnmächtig brach er zusammen.
Als Paddy wieder zu sich kam, war es heller Tag, er lag in dem Bett, in dem er am Vorabend eingeschlafen war. Der Hausherr kochte in der Küche Tee. Sonst war niemand zu sehen. „Ah, bist du
endlich wach, Paddy?“, fragte er. „Ich hoffe, du hast gut geschlafen?“ „Ganz und gar nicht“, sagte Paddy. „Völlig zerschlagen bin ich von dem, was ich heut Nacht erlebt habe. Und ich bleibe nicht
eine Minute länger in diesem Haus. Ich gehe!“ Er stand auf und schlüpfte in seine Kleider, die vor dem Bett lagen. Ja, aber die waren sauber und trocken, ohne Risse, ohne Flecken, ohne irgendeine
Spur von den Erlebnissen der vergangenen Nacht. Paddy wusste nicht, was er davon halten sollte, er nahm sein Bündel und ging rasch zur Tür.
„Hör mal, Paddy,“ sagte da der Hausherr, „du hast mir Leid getan, wie du so umhergezogen bist ohne Lied, ohne Geschichte. Aber sag doch selbst, bevor du gehst: Hast du nun nicht eine schöne
Geschichte zu erzählen?“ Paddy gab keine Antwort, sondern machte, dass er hinauskam, und erst als er über den Straßengraben gesprungen war, schaute er noch einmal zurück – aber da war nichts,
keine Spur von einem Haus, nur blanke Felder, auf denen Schafe weideten.
Quelle: keltisches Märchen
Der Lindwurm von Lambton
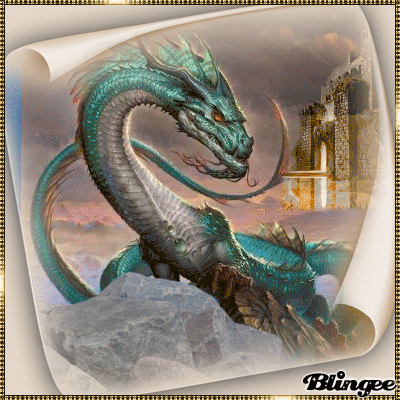
Vor vielen, vielen Jahren führte der junge Erbe von Lambton ein leichtsinniges, wüstes Leben. Er kümmerte sich weder um Gott, noch um die Menschen und ging am Sonntagmorgen viel lieber auf den
Fischfang, als zur heiligen Messe. So war er eines Sonntags wieder damit beschäftigt, seine Angelrute in den Wearfluss zu werfen. Als er das mehrmals ohne Erfolg getan hatte, begann er vor Wut
heftig zu fluchen. Das erregte Ärgernis unter seinen Pächtern und Knechten, die gerade vorbeikamen, denn sie waren alle auf dem Wege nach der Kapelle von Brugeford begriffen.
Gleich darauf spürte er, dass etwas an seiner Angel zog, und in der Hoffnung, dass er endlich einen großen, schönen Fisch gefangen habe, wendete er all seine Kraft und Geschicklichkeit daran,
seine Beute herauszuziehen. Aber wie groß war seine Enttäuschung und sein Entsetzen, als er anstatt eines Fisches einen scheußlichen Lindwurm zu seinen Füßen sah! Rasch riss er das Untier vom
Angelhaken los und warf es in einen Brunnen in seiner Nähe. Der heißt Lindwurmbrunnen bis auf den heutigen Tag.
Kaum hatte der junge Erbe seine Angel wieder in den Strom geworfen, als ein Fremdling von sehr ehrwürdigem Aussehen vorbeikam. Er fragte ihn, ob er reichlichen Fang getan habe. Darauf antwortete
der junge Lord: »Ich glaube wirklich, ich hab' den Teufel in höchsteigener Person gefangen. Schau' dort in den Brunnen hinein und überzeug' dich selbst.«
Der Fremdling blickte hinein und sagte, dass er nie in seinem Leben etwas Ähnliches gesehen habe. Es sehe einer Eidechse ähnlich, habe aber an jeder Seite des Rachens neun Öffnungen. Dann fügte
er hinzu, er fürchte sehr, das bedeute nichts Gutes. Unbeachtet blieb der Lindwurm in dem Brunnen, der dem täglich größer werdenden Ungetüm bald zu eng wurde. Es kroch hervor und war von nun ab
tagsüber im Wear. In der Mitte desselben befand sich ein Felsen, und dort lag er zusammengerollt da. Des Nachts aber kroch der Lindwurm zu einem Berge, der sich in der Nähe befand. Er wurde immer
größer und größer, so dass er bald den Berg dreimal umringeln konnte. Der Berg heißt Lindwurmberg bis auf den heutigen Tag. Er ist von länglicher Form und ungefähr eine und eine halbe Meile vom
Lambtonschlosse entfernt.
Bald war das Ungetüm der Schrecken des ganzen Landes. Es sog den Kühen die Milch aus, erwürgte das Vieh, verschlang die Lämmer und plünderte die hilflosen Bauern in jeder Weise. Nachdem es das
linke Ufer des Stromes vollständig verwüstet hatte, kam es auf das rechte Ufer hinüber, in die Nähe des Schlosses Lambton. Dort lebte der alte Lord allein und verlassen, Sein Sohn hatte endlich
über sein wüstes Leben Reue empfunden und in fernen Ländern Kriegsdienste genommen.
Als die Bewohner des Schlosses vernahmen, dass ihr Feind nahe, versammelten sie sich erschreckt und hielten Rat. Der eine sprach dies, der andere jenes; endlich riet der Verwalter, ein alter,
erfahrener Mann, man solle den großen Trog im Hofe unverzüglich mit Milch füllen. Das geschah. Das Ungeheuer kam und trank die Milch aus, dann kehrte es, ohne jemandem etwas zu Leide zu tun, in
den Fluss und von da zu dem Berge zurück. Am nächsten Tage kam der Lindwurm wieder. Eiligst füllte man den Trog mit Milch, und er trank ihn von neuem leer. Die Milch von neun Kühen war nötig, um
den Trog zu füllen. Regelmäßig kam nun das Ungetüm und ging ruhig wieder davon, nachdem es den Trog geleert hatte. Nur wenn derselbe nicht ganz voll war, dann geriet es in eine furchtbare Wut,
schlang seinen Schweif um die Bäume im Park und entwurzelte sie. Die Schreckenskunde von dem Untier hatte sich über das ganze Land verbreitet, und manch tapferer Ritter hatte den Kampf mit dem
Ungeheuer aufgenommen, aber vergebens, denn wenn es selbst entzwei gehauen wurde, so wuchsen die Teile immer wieder zusammen; umsonst wurden so viele Menschenleben geopfert, das Untier blieb doch
im ungestörten Besitze des Berges und seiner nächsten Umgebung.
Nach sieben langen Jahren kehrte der Erbe von Lambton in die Heimat zurück, durch mancherlei Erfahrungen gewitzigt und gebessert. Das Land seiner Väter war verwüstet, seine Leute beinahe zugrunde
gerichtet, der Vater, von Kummer und Sorge gebeugt, stand mit einem Fuße im Grabe. Der junge Lord gönnte sich keine Ruhe. Er setzte über den Strom und betrachtete den Lindwurm, der, wie immer, um
dem Hügel gerollt dalag. Als er hörte, wie es den anderen Rittern im Kampfe mit dem Untier ergangen war, holte er sich bei einer Wahrsagerin Rat.
Diese schalt ihn zuerst in heftiger Weise, dass er diese Geißel über sein Haus und das ganze Land gebracht hatte. Aber als sie sah, welch tiefe Reue er empfand, und dass er um jeden Preis das
Land von dem selbstverschuldeten Übel befreien wollte, da gab sie ihm Rat und Weisung. Er sollte seine beste Rüstung dicht mit Lanzenspitzen besetzen lassen und sie anlegen. Dann sollte er sich
auf den Felsen mitten im Strome begeben und dort im Vertrauen auf sein gutes Schwert und auf die gütige Vorsehung den Feind erwarten. Aber bevor er in den Kampf zog, musste er schwören, dass er
im Falle seines Sieges das erste lebende Wesen, das ihm auf dem Heimwege begegnete töten würde. Wenn er diesen Schwur nicht erfüllte, dann würde neun Geschlechter hindurch kein Lord von Lambton
eines natürlichen Todes sterben.
Der junge Lord leistete den feierlichen Eid in der Kapelle zu Brugeford. Dann legte er die Rüstung an, welche ganz mit Lanzenspitzen besetzt war, und begab sich mit gezogenem Schwerte auf den
Felsen im Wear. Um die gewohnte Stunde rollte sich der Lindwurm auf und nahm seinen Weg zum Schlosse. Als er an dem Felsen vorbeikam, auf welchem der Ritter seiner harrte, da versetzte ihm dieser
einen wuchtigen Hieb auf den Kopf. Wütend, wenn auch unverletzt, schlang das Ungeheuer seinen Schweif um ihn, um ihn zu erwürgen. Nun sah der Ritter, wie wertvoll der Rat der Wahrsagerin war. Je
enger das Ungetüm ihn umschlang, desto mehr tötliche Wunden brachte es sich selbst bei; bald war der Fluss von seinem Blute rot gefärbt. Da das Ungeheuer infolge des Blutverlustes immer schwächer
wurde, gelang es dem Ritter endlich, es in zwei Hälften zu spalten. Diesmal war es aber dem Lindwurm unmöglich, wieder zusammenzuwachsen, denn die heftige Strömung riss gleich die eine Hälfte mit
sich fort; so wurde das Land von dem Ungetüme befreit.
Während des langen, verzweifelten Kampfes beteten sämmtliche Bewohner des Schlosses für den jungen Lord. Er hatte versprochen, wenn er als Sieger aus dem Kampfe hervorgehe, in sein Horn zu
stoßen. Das sollte seinem Vater künden, dass er außer Gefahr sei, und dass sein Lieblingshund losgelassen werde. Der sollte, den Weisungen der Wahrsagerin und dem Schwure des Ritters gemäß, das
Opfer sein. Als aber das Horn ertönte, da vergaß der alte Lord alles, er wusste nur, dass sein Sohn außer Gefahr sei, und er stürzte hinaus, dem jungen Helden entgegen, um ihn zu umarmen.
Wie vom Blitze getroffen stand der Erbe von Lambton da; was sollte er tun? Er konnte unmöglich die Hand gegen den Vater erheben. Wie sollte er nun seinen Schwur erfüllen? In seiner Bestürzung
stieß er noch einmal ins Horn. Der Hund wurde losgelassen und sprang zu seinem Herrn, und dieser stieß ihm das Schwert, das noch von dem Blute des Ungetüms rauchte, ins Herz. Aber vergebens. Der
Schwur war gebrochen, und der Ausspruch der Wahrsagerin ging in Erfüllung: neun Geschlechter hindurch lastete der Fluch auf der Familie Lambton.
Anna Kellner: Englische Märchen
Spätereinmal

Es war einmal ein Pächter namens Jan, der lebte ganz allein auf seinem Gehöft. Da kam ihm der Gedanke, dass es doch viel behaglicher wäre, eine Frau im Hause zu
haben. Er freite also um eine hübsche Dirne und fragte sie. »Willst du meine Frau werden?« »Vom Herzen gern,« antwortete sie. Sie gingen in die Kirche und wurden getraut. Dann nahm er sie zu sich
auf sein Pferd und brachte sie in sein Haus. Und sie lebten glücklich und vergnügt.
Eines Tages fragte Jan seine Frau: »Frau, kannst du melken?« »O ja, Jan, ich kann melken. Wie ich zu Hause war, hat die Mutter immer gemolken.« Da ging er auf
den Markt und kaufte ihr zehn rote Kühe. Alles ging recht gut, bis sie eines Tages die Kühe zur Tränke trieb. Es kam ihr vor, dass sie nicht schnell genug tranken. Da trieb sie sie weit in den
Teich hinein, und sie ertranken alle. Als Jan heimkam, da fasste sie sich ein Herz und erzählte ihm, was ihr zugestoßen sei. Er aber sagte: »Mach' dir nichts d'raus, mein Schatz, das nächstemal
wird es schon besser gehen.«
So verging eine Zeit, da fragte Jan eines Tages seine Frau: »Frau, kannst du Schweine füttern?« »O ja, Jan, ich kann Schweine füttern. Wie ich zu Hause war, hat
die Mutter immer Schweine gefüttert.« Da ging er auf den Markt und brachte ihr ein paar Schweine. Alles ging recht gut, bis sie eines Tages den Schweinen das Futter in den Trog schüttete. Es kam
ihr vor, dass sie nicht schnell genug fraßen. Da stieß sie ihnen die Köpfe tief in den Trog hinein, und sie erstickten alle. Als Jan heimkam, fasste sie sich ein Herz und gestand ihm, was ihr
zugestoßen sei. Er aber sagte: »Mach' dir nichts d'raus, mein Schatz, das nächstemal wird es schon besser gehen.«
So verging eine Zeit, da fragte Jan eines Tages seine Frau: »Frau, kannst du backen?« »O ja, Jan, ich kann backen. Wie ich zu Hause war, hat die Mutter immer
gebacken.« Da kaufte er ihr alles Nötige zum Brotbacken. Alles ging recht gut, bis sie eines Tages beschloss, Jan mit schmackhaftem Weißbrot zu überraschen. Sie trug also ihr Mehl auf den Gipfel
eines hohen Berges und ließ den Wind darüber blasen, denn sie dachte, er würde die Kleie aus dem Mehl fortblasen. Aber der Wind blies Mehl und Kleie und alles fort - und mit dem Weißbrot war's
nichts. Als Jan heimkam, fasste sie sich ein Herz und sagte ihm, was ihr zugestoßen sei. Er aber sprach: »Mach' dir nichts d'raus, mein Schatz, das nächstemal wird es schon besser
gehen.«
So vergieng eine Zeit, da fragte Jan eines Tages seine Frau: »Frau, kannst du Bier brauen?« »O ja, Jan, ich kann Bier brauen. Wie ich zu Hause war, hat die
Mutter immer Bier gebraut.« Da kaufte er ihr alles Nötige zum Bierbrauen. Alles ging recht gut; da kam eines Tages, als sie gerade ein Fass Bier gebraut hatte, ein großer schwarzer Hund ins Haus
und sah sie an. Sie jagte ihn hinaus, aber er blieb vor der Tür stehen und sah sie unverwandt an. Da wurde sie so zornig, dass sie den Zapfen aus dem Fasse zog und hinter ihm herwarf. Dabei sagte
sie: »Was schaust du mich an? Ich bin Jans Frau.« Da lief der Hund die Straße hinab, und sie lief ihm nach, um ihn ganz zu vertreiben. Als sie zurückkam, sah sie, dass das ganze Fass ausgeronnen
war, und mit dem Bier war's nichts. Als Jan heimkam, fasste sie sich ein Herz und gestand ihm, was ihr zugestoßen sei. Er aber sagte: »Mach' dir nichts d'raus, mein Schatz, das nächstemal wird es
schon besser gehen.«
So verging eine Zeit, da sprach sie eines Tages zu sich: »Es ist hohe Zeit, das Haus gründlich zu scheuern.« Als sie das große Bett herausnahm, fand sie einen
Beutel voll Geld auf dem Betthimmel. Wie Jan nach Hause kam, fasste sie sich ein Herz und fragte ihn: »Jan, für wen ist dieses Geld?« »Für später einmal, mein Schatz.« Nun stand aber ein Dieb
unter dem Fenster, und der hörte, was Jan sagte. Am folgenden Tage wartete er, bis Jan zu Markte gegangen war, dann klopfte er an die Tür. »Was wünscht Ihr, bitte?« fragte Mally. »Mein Name ist
Spätereinmal,« sagte der Dieb, »ich komme um das Geld.« Der Dieb war wie ein feiner Herr angezogen. Mally dachte, es sei doch sehr freundlich von einem so feinen Herrn, in eigener Person das Geld
zu holen. Sie rannte die Treppe hinauf und brachte dem Dieb den Geldbeutel. Der nahm ihn und ging damit fort.
Als Jan heimkam, sagte sie zu ihm: »Jan, Spätereinmal war hier und hat sich das Geld geholt.« »Was soll das heißen?« fragte Jan. Da erzählte sie ihm
alles.
Er aber sagte: »Jetzt ist's um uns geschehen, denn das war der Pachtzins. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als durch die Welt zu wandern, bis wir den
Geldbeutel finden.« Jan hob das Haustor aus den Angeln. »Das ist jetzt unser Bett,« sagte er. Er nahm die Tür auf den Rücken, und sie machten sich beide auf, Spätereinmal zu suchen. So wanderten
sie manchen Tag, und in der Nacht legte Jan die Tür auf die Zweige eines Baumes, und darauf schliefen sie. Eines Tages kamen sie zu einem hohen Berge; am Fuße desselben befand sich ein mächtiger
Baum. Auf die Zweige desselben legte Jan die Tür, und sie stiegen hinauf, um darauf zu schlafen. Nach einiger Zeit hörte Mally ein Geräusch, und sie blickte hinunter, um zu sehen, woher es
käme.
Da öffnete sich eine Tür in dem Berge, und heraus kamen zwei Herren, die trugen einen großen Tisch. Ihnen folgten andere feine Damen und Herren, von denen jeder
einen Geldbeutel in der Hand hatte. Und unter ihnen befand sich Spätereinmal mit Jans Geldbeutel. Sie setzten sich alle an den Tisch und tranken und plauderten und zählten ihr Geld. Da weckte
Mally ihren Mann auf und fragte ihn, was sie tun sollten. »Jetzt ist unsere Zeit gekommen,« sagte Jan, stieß die Tür hinunter, so dass sie mitten auf den Tisch fiel, und die erschrockenen Gauner
liefen davon.
Dann stieg Jan und seine Frau vom Baum herunter. Sie nahmen so viele Geldsäcke mit, als auf der Tür Platz fanden, und gingen geradewegs nach Hause. Und Jan
kaufte seiner Frau neue Kühe und neue Schweine und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende.
Anna Kellner: Englische Märchen
Der Erzähler in Nöten

Zur Zeit, als Tuatha de Dannan die Oberherrschaft über Irland hatte, da regierte in Leinster ein König, der hörte unendlich gern Geschichten erzählen. Wie alle anderen Fürsten und Häuptlinge des
Reiches, so hatte auch er einen Lieblingserzähler. Dem hatte er ein großes Gut geschenkt, dafür musste er ihm täglich vor dem Schlafengehen eine neue Geschichte erzählen. So viele wusste der
Erzähler, dass er schon ein hohes Alter erreicht hatte, ohne dass ihn seine Phantasie auch nur ein einzigesmal im Stich gelassen hätte, und seine Geschicklichkeit war so groß, dass es ihm immer
gelang, und wenn noch so viele Staatssorgen oder anderer Kummer das Gemüt des Königs bedrückten, ihm Schlaf zu verschaffen.
Eines Morgens stand der Erzähler früh auf und ging seiner Gewohnheit gemäß in den Garten hinaus, um dort über Ereignisse nachzudenken, welche er in eine Geschichte für den Abend verweben könnte.
Aber an diesem Morgen war er in arger Verlegenheit. Nachdem er durch das ganze Gut gewandert war, kehrte er ins Haus zurück, ohne etwas Neues oder Seltsames gefunden zu haben. Es machte ihm keine
Schwierigkeit, einen Anfang zu finden, wie: »Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne« oder: »Eines Tages ging der König von Irland«, aber weiter kam er nicht. Als er endlich zum Frühstück
ging, fragte ihn seine Frau verwundert: »Warum kommst du so spät zum Frühstück, lieber Mann?«
»Ich habe gar keinen Appetit,« erwiderte er. »So lange ich im Dienste des Königs stehe, habe ich mich noch nie zum Frühstück hingesetzt, ohne eine Geschichte für den Abend bereit zu haben; aber
heute versagt mir mein Gehirn, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Beste wäre, ich legte mich gleich hin und stürbe. Denn wenn der König heut Abend nach seinem Erzähler verlangt, so bin ich
für immer entehrt.«
In dem Augenblicke schaute seine Frau zum Fenster hinaus.
»Siehst du dort am Ende des Feldes etwas Schwarzes?« fragte sie ihn.
»Jawohl,« erwiderte er.
Sie gingen hin und fanden einen alten Mann auf der Erde liegen; er sah elend aus, und ein hölzernes Bein lag neben ihm.
»Wer bist du, guter Mann?« fragte ihn der Erzähler.
»Ach, was liegt daran, wer ich bin!« war die Antwort. »Ich bin ein armer, alter, lahmer, heruntergekommener Geselle und hab' mich hieher gesetzt, um ein wenig auszuruhen.«
»Und was soll das Würfelspiel in deiner Hand?«
»Ich warte, ob nicht jemand mit mir spielen will,« sagte der Bettler.
»Mit dir spielen! Was hat ein armer, alter Bettler wie du einzusetzen?«
»Ich habe hundert Goldstücke in dieser Lederbörse,« sagte der alte Mann.
»Es wäre vielleicht gut, wenn du mit ihm spieltest,« sagte die Frau des Erzählers zu ihrem Manne, »möglicherweise wirst du dann dem König am Abend etwas zu erzählen haben.«
Sie holten einen flachen Stein und würfelten darauf. Nach kurzer Zeit hatte der Erzähler sein ganzes Geld verloren.
»Wohl bekomm's, mein Freund,« sagte er, »was hätte ich auch anderes erwarten können, Thor, der ich bin!«
»Willst du weiterspielen?« fragte ihn der alte Mann.
»Schwätze nicht, Mensch, du hast ja schon all mein Geld.«
»Hast du nicht Wagen, Pferde und Hunde?«
»Nun, was soll's damit?«
»Ich setze gegen diese mein ganzes Geld ein.«
»Unsinn! Nicht um alles Geld Irlands möchte ich meine Frau in die Lage bringen, zu Fuß gehen zu müssen.«
»Vielleicht gewinnst du,« sagte der Landstreicher.
»Vielleicht aber nicht,« sagte der Erzähler.
»Spiele mit ihm, lieber Mann,« riet seine Frau, »ich mache mir nichts daraus, zu Fuß zu gehen, wenn du dir nur nichts daraus machst.«
»Ich habe dir noch nie etwas abgeschlagen,« sagte der Erzähler, »so will ich's auch jetzt nicht tun.«
Er setzte sich also wieder hin und verlor auf einen Wurf Häuser, Hunde, Wagen und Pferde.
»Willst du weiterspielen?« fragte der Bettler.
»Mensch, willst du dich über mich lustig machen?« rief der Erzähler aus, »was soll ich denn einsetzen?«
»Ich setze meinen ganzen Gewinst gegen deine Frau,« sagte der alte Mann.
Schweigend wendete sich der Erzähler ab, aber seine Frau sagte:
»Nimm sein Anerbieten an, wer weiß, ob dir nicht das Glück winkt? Aller guten Dinge sind drei. Du wirst jetzt sicher gewinnen.«
Wieder spielten sie, und wieder verlor der Erzähler; zu seinem Schmerze und Kummer setzte sich seine Frau sofort zu dem hässlichen, alten Bettler hin.
»So willst du mich verlassen?« fragte der Erzähler seine Frau.
»Du hast mich ja verspielt,« sagte sie, »und wirst doch den armen Mann nicht betrügen wollen?«
»Hast du noch was einzusetzen?« fragte der Bettler.
»Du weißt sehr gut, dass ich nichts mehr besitze,« erwiderte der Erzähler.
»So will ich alles, was ich gewonnen habe,« schlug der Bettler vor, »gegen deine Person setzen.«
Zum letztenmale würfelten sie, aber auch diesmal gewann der Alte.
»Nun denn,« sagte der Erzähler, »hier bin ich; was hast du mit mir vor?«
»Das wirst du bald sehen,« erwiderte der Bettler, und er zog aus seiner Tasche eine lange Schnur und einen Stab hervor.
»Nun wähle dir,« sagte er zu dem Erzähler, »was du sein willst: Rehbock, Fuchs oder Hase? Jetzt hast du noch die Wahl, später nicht mehr.«
Der Erzähler wählte die Gestalt eines Hasen.
Der alte Mann warf ihm die Schnur um den Leib und berührte ihn mit dem Stabe, und siehe da! ein langohriger, munterer Hase hüpfte und sprang auf dem Grase einher. Es dauerte nicht lange, so rief
seine Frau den Hunden und hetzte sie auf ihn. Der Hase entfloh, die Hunde verfolgten ihn. Das Feld war von einer hohen Mauer umgeben, so dass der Hase, er mochte rennen, so viel er wollte, nicht
entfliehen konnte. Der Bettler und seine Frau ergötzten sich höchlich, als sie ihm zusahen, wie er sich drehte und wandte, um seinen Verfolgern zu entgehen. Vergebens suchte er Zuflucht bei
seiner Frau; sie stieß ihn zu den Hunden zurück. Endlich gebot der Bettler den Tieren Einhalt, berührte den Hasen mit seinem Zauberstab, und der Erzähler stand keuchend und atemlos vor
ihnen.
»Wie hat dir die Unterhaltung gefallen?« fragte der Bettler.
»Es mag für andere sehr unterhaltend gewesen sein,« erwiderte der Erzähler, indem er seine Frau anblickte, »was mich betrifft, so hätte ich gerne auf das Vergnügen verzichtet. Darf ich mir
übrigens die Frage erlauben, wer du bist, woher du kommst und was für Vergnügen du daran findest, mich armen Alten zu quälen?«
»Ach,« sagte der Fremde, »ich bin so eine Art Thunichtgut, den einen Tag reich, den anderen arm; wenn du aber neugierig bist, mehr über mich und meine Lebensweise zu erfahren, so komm mit mir,
und ich werde dir vielleicht mehr zeigen können, als du jemals allein zu sehen bekämest.« Der Fremde fuhr mit der Hand in seinen Reisesack und holte vor ihren Augen einen hübschen Mann in den
besten Jahren hervor, zu dem sprach er also: »Bei allem, was du gehört und gesehen hast, seitdem du dich in meinem Reisesacke befindest, bewache diese Dame und das Gespann, und halte sie für mich
bereit für den Fall, als ich sie brauchen sollte.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als alles verschwand, und der Erzähler sich in der Nähe des Schlosses von Hugh O'Donnel befand. Er konnte
alle sehen, war aber selbst unsichtbar.
O'Donnel war in seiner Halle; sein Leib war müde und gedrückt sein Gemüt.
»Geh' hinaus,« sagte er zu seinem Türsteher, »und sieh' nach, wer oder was des Weges daherkommt.«
Der Türsteher ging, und ein hagerer, grauer Bettler kam ihm entgegen. Von dem Schwerte, das er an der Seite trug, fehlte die Scheide zur Hälfte; kaltes, schmutziges Wasser quoll aus den Löchern
seiner Schuhe hervor; aus dem alten, zerfetzten Hut guckten oben die Ohren heraus. Die Schultern waren nur zum Teil mit den Lumpen des schäbigen Rockes bedeckt, und das Zweiglein einer Stechpalme
hielt er in der Hand.
»Gott zum Gruß, O'Donnel!« sagte der Bettelmann.
»Gott zum Gruß!« antwortete O'Donnel. »Woher kommst du, und was ist dein Geschäft?«
»Ich komme vom äußersten Ende der Welt,
Wo die weißen Schwäne gleiten;
Eine Nacht in Islay, eine Nacht in Man,
So schweif' ich durch Höhen und Weiten.«
»Du bist ein vielgereister Mann,« sagte O'Donnel, »vielleicht hast du etwas auf deinen Wanderungen gelernt?«
»Ich bin ein Taschenspieler,« antwortete der hagere, graue Bettler, »und für fünf Silberstücke will ich Euch eines meiner Kunststücke zeigen.«
»Die sollst du haben,« sagte O'Donnel.
Der hagere, graue Bettler nahm drei kleine Stückchen Stroh und legte sie ihm auf die Hand.
»Das mittlere,« sagte er, »werde ich wegblasen, die beiden anderen werden liegen bleiben.«
»Das kannst du nicht!« riefen alle.
Aber der hagere, graue Bettler legte je einen Finger auf die Stückchen rechts und links, und puff! blies er das mittlere weg.
»Das ist ein schönes Kunststück,« sagte O'Donnel und zahlte ihm die fünf Silberstücke aus.
»Für die Hälfte des Geldes,« sagte der Sohn eines Höflings, »will ich dasselbe Kunststück machen.«
»Nimm ihn beim Wort, O'Donnel,« rief der Bettler.
Der Junker legte drei Strohstückchen auf seine Hand, hielt die beiden zur Rechten und Linken mit je einem Finger fest und blies. Was geschah? Mit dem Strohstückchen blies er gleich die ganze Hand
weg. »Wenn du mir noch sechs Silberstücke geben willst, so sollst du ein anderes Kunststück zu sehen bekommen,« sagte der hagere, graue Bettler.
»Die sollst du haben.«
»Siehst du meine beiden Ohren? Das eine werde ich bewegen, das andere nicht.«
»Deine Ohren sind leicht zu sehen, denn sie sind wahrhaftig groß genug, aber du kannst unmöglich eines allein bewegen.«
Der hagere, graue Bettler erhob die Hand zu seinem Ohre und zauste es tüchtig. O'Donnel lachte und zahlte ihm die sechs Silberstücke aus.
»Ein schönes Kunststück!« sagte der Junker Ohnhand, »das kann jeder tun.«
Er hob die Hand zum Ohre und zauste es. Aber was geschah? Er riss sich gleich Ohr und Kopf weg.
»O'Donnel,« sagte der hagere, graue Bettler, »ich habe Euch einige seltsame Kunststücke gezeigt, aber für dasselbe Geld sollt Ihr ein noch seltsameres zu sehen bekommen.«
»Einverstanden,« sagte O'Donnel.
Darauf nahm der hagere, graue Bettler unter der Achselhöhle einen Sack und aus diesem einen Knäuel Seide hervor. Er wickelte den Knäuel auf und warf ihn schräge in die klare, blaue Luft, da wurde
eine Leiter daraus. Dann zog er einen Hasen hervor und stellte ihn auf die Leiter; die lief der Hase hinauf. Nun holte er einen Jagdhund mit roten Ohren aus dem Sack, der lief eiligst dem Hasen
nach.
»Nun,« sagte der Bettler, »hat jemand Lust, dem Hunde nachzulaufen?«
»Ich,« rief einer von O'Donnel's Junkern.
»Also rasch hinauf!« sagte der Taschenspieler, »aber ich sage es dir: wenn du meinen Hasen töten lässt, schlage ich dir, wie du herunter kommst, den Kopf ab.«
Der Junker eilte die Leiter hinauf, und bald war nichts mehr von allen dreien zu sehen.
Der graue Bettler sah ihnen eine gute Weile nach, dann sagte er: »Ich fürchte, der Hund frisst den Hasen, und unser junger Freund ist eingeschlafen.«
Mit diesen Worten begann er den Knäuel wieder aufzuwickeln, und siehe da! zuerst erschien der Junker in tiefem Schlafe, dann kam der Jagdhund mit den roten Ohren, den letzten Bissen vom Hasen im
Munde.
Der Bettler versetzte dem Junker einen Schwertstreich, der ihm den Kopf vom Rumpfe hieb. Dem Hund erging es nicht besser.
»Es macht mir durchaus kein Vergnügen,« sagte O'Donnel, »sondern es ärgert mich sehr, dass an meinem Hofe ein Jagdhund und ein Knabe ums Leben gekommen sind.«
»Gebt mir zehn Silberstücke für jeden,« sagte der Taschenspieler, »und der Kopf sitzt ihnen wieder wie vorher auf den Schultern.«
»Einverstanden,« rief O'Donnel.
Das Silber wurde ihm ausbezahlt, und siehe da! in demselben Augenblicke hatte der Junker sowohl, als der Jagdhund wieder seinen Kopf auf dem Nacken.
Kaum war dies geschehen, als der hagere, graue Bettelmann verschwand, und man wusste nicht, war er durch die Lüfte entflohen, oder hatte die Erde ihn verschlungen.
Müde war der Leib und gedrückt das Gemüt des Königs von Leinster. Es war die Stunde, in der er sonst eine Geschichte zu hören pflegte, aber wohin er auch Boten ausschickte, von seinem
Leiberzähler war nichts zu hören und zu sehen.
»Geh' hinaus,« sagte er zu seinem Türsteher, »und sieh' nach, wer oder was des Weges daherkommt.«
Der Türsteher ging, und ein hagerer, grauer Bettler kam ihm entgegen. Von dem Schwerte, das er an der Seite trug, fehlte die Scheide zur Hälfte; kaltes, schmutziges Wasser quoll aus den Löchern
seiner Schuhe hervor; aus dem alten, zerfetzten Hut guckten oben die Ohren heraus. Die Schultern waren nur zum Teil mit den Lumpen des schäbigen Rockes bedeckt, und eine dreisaitige Harfe hielt
er in der Hand.
»Was kannst du?« fragte der Türsteher.
»Ich kann spielen,« sagte der hagere, graue Bettler. »Fürchte nichts,« fügte er leise hinzu, indem er sich zu dem Erzähler wendete, »du wirst alles mitansehen und dabei für alle unsichtbar
sein.«
Als der König erfuhr, dass ein Harfenspieler draußen sei, ließ er ihn hereinkommen.
»Ich besitze die besten Harfenspieler im ganzen Reiche,« sagte der König von Leinster und winkte ihnen.
Während diese spielten, hörte der hagere, graue Bettler zu.
»Hast du je etwas Ähnliches gehört?« fragte ihn der König.
»Hast du, o König, jemals das Schnurren einer Katze oder das Summen der Käfer im Zwielicht oder das Zetern einer schrillen Weiberstimme gehört?«
»Gewiss,« sagte der König.
»All diese Geräusche sind meinem Ohre wohltönender, als die schönsten Harfentöne deiner Harfenspieler.«
Als dies die Harfenspieler hörten, zogen sie ihre Schwerter und drangen auf ihn ein, aber anstatt ihn mit ihren Hieben zu treffen, schlugen sie gegenseitig aufeinander los, und bald gab es lauter
blutige Köpfe im Saal.
»Hängt den Kerl auf, der die ganze Geschichte angefangen hat,« befahl der König, »wenn ich schon keine Geschichte hören soll, so will ich wenigstens Ruhe haben.« Die Wache erschien, ergriff den
hageren, grauen Bettler, führte ihn zum Galgen und hängte ihn auf, ohne viel Aufhebens zu machen.
Als sie wieder in das Schloss zurückkehrten, was glaubt ihr wohl, sahen sie? Auf einer Bank saß der hagere, graue Bettler und führte gerade den Bierkrug zum Munde.
»Der Teufel auch!« rief der Hauptmann der Wache aus, »haben wir dich nicht soeben aufgeknüpft? Wie kommst du wieder her?«
»Glaubst du, dass ich es wirklich bin?«
»Wer sonst?« fragte der Hauptmann.
Sie liefen eiligst zum Galgen zurück, da hieng der Lieblingsbruder des Königs drauf.
Sofort rannten sie zum Könige; der war eingeschlafen.
»Majestät,« sagte der Hauptmann, »wir haben den Landstreicher aufgehängt, aber er sitzt unten ganz heil.«
»So hängt ihn noch einmal,« befahl der König und wandte sich um, um wieder einzuschlafen.
Sie vollzogen den Befehl des Königs, aber nun hing anstatt des hageren, grauen Bettlers der erste Harfenspieler des Königs auf dem Galgen.
Der Hauptmann war starr.
»Wollt ihr mich ein drittesmal aufhängen?« fragte der hagere, graue Bettler.
»Mach', dass du fortkommst,« sagte der Hauptmann, »aber so schnell als möglich und nur recht weit. Du hast schon genug Unheil angerichtet.«
»Jetzt bist du vernünftig,« sagte der Bettler, »und da ihr nicht mehr daran denkt, einen Fremden aufzuhängen, einzig und allein, weil er an eurer Musik was auszusetzen hat, so sag' ich euch zum
Lohne dafür auch, dass ihr, wenn ihr euch wieder zum Galgen bemühen wollt, eure Freunde auf dem Rasen sitzen sehen werdet, als wäre ihnen gar nichts geschehen.« Mit diesen Worten verschwand
er.
Der Erzähler befand sich auf demselben Fleck, auf dem er zuerst den hageren, grauen Bettelmann getroffen hatte, und ganz in der Nähe war seine Frau mit Wagen und Pferden.
»Nun will ich dich nicht länger quälen,« sagte der hagere, graue Bettelmann. »Hier ist dein Geld, dein Wagen, deine Pferde, deine Hunde und deine Frau. Du kannst damit machen, was dir
beliebt.«
»Wagen, Pferde und Hunde nehme ich dankbar an,« sagte der Erzähler, »aber meine Frau und mein Geld behalte dir.«
»Nein,« versetzte der andere, »ich brauche keines von beiden, und was deine Frau betrifft, so darfst du nicht übel von ihr denken, sie musste tun, was sie tat.«
»Sie musste! Sie musste die Hunde auf mich hetzen! Sie musste einen elenden, alten Bettler mir vorziehen - -«
»Ich bin nicht der Bettler, für den du mich hältst. Ich bin Angus von Bruff, dem du so manchen Dienst bei Hofe erwiesen hast. Heute früh erfuhr ich durch meine Zauberkunst, in welcher
Verlegenheit du dich befandest, und da beschloss ich, dich daraus zu befreien. Was deine Frau betrifft, so hat dieselbe Macht, die deinen Leib verwandelte, ihren Sinn verkehrt. Vergiss und
vergib, wie es sich unter Eheleuten geziemt. Und nun weißt du eine Geschichte für den König von Leinster, wenn er eine verlangt.« Mit diesen Worten verschwand er.
Und wirklich, der Erzähler hatte nun eine Geschichte, die eines Königs würdig war. Er erzählte vom Anfang bis zu Ende, was ihm widerfahren war, und der König lachte so laut und so lange, dass er
überhaupt nicht schlafen konnte. Er sagte dem Erzähler, dass er nie wieder über eine neue Geschichte nachzudenken brauche, und jeden Abend, so lange er lebte, ließ er sich die Geschichte von dem
hageren, grauen Bettler erzählen und lachte immer wieder von neuem dazu.
Anna Kellner: Englische Märchen
Mister Miacca

Tommy Grimes war manchmal ein artiger und manchmal ein schlimmer Junge; wenn er aber ein schlimmer Junge war, dann war er auch schon ein sehr schlimmer Junge. Seine Mutter pflegte ihm oft
zu sagen: »Tommy, Tommy, sei schön artig und geh' nicht allein auf die Straße, sonst wird der Mister Miacca kommen und dich holen.« Wenn Tommy aber ein ungezogener Junge war, so ging er doch
allein auf die Straße. Eines Tages war er kaum um die Ecke gekommen, als auch schon Mister Miacca ihn packte. Er tat ihn mit dem Kopf nach unten und den Füßen nach oben in einen Sack und nahm ihn
mit nach Hause. Dort angekommen, zog er ihn aus dem Sack hervor, stellte ihn hin und betastete seine Arme und Beine.
»Du bist ein bischen zähe,« sagte er, »aber ich hab' nichts anderes zum Abendessen, und beim Kochen wird sich's schon geben. Aber meiner Treu, jetzt hab' ich das Gemüse vergessen, und ohne Gemüse
wirst du mir nicht schmecken. Sally! Du, Sally, komm' her!« rief er seine Frau. Sie kam aus dem anderen Zimmer und fragte: »Was willst du, mein Schatz?« »Ah, ich hab' da einen kleinen Jungen fürs
Abendessen mitgebracht,« sagte Mister Miacca, »und ganz das Gemüse vergessen. Bitte, gib auf ihn acht, während ich es hole.« »Schon recht, lieber Mann,« antwortete Frau Miacca, und Mister Miacca
ging.
Da sagte Tommy Grimes zu Frau Miacca: »Isst Mister Miacca immer kleine Buben zum Nachtmahl?« »Größtenteils,« sagte Frau Miacca, »wenn die kleinen Jungen schlimm sind und ihm in den Weg laufen.«
»Und haben Sie sonst nichts als Bubenfleisch? Keinen Pudding?« fragte Tommy. »Ach, ich esse Pudding so gern!« antwortete Frau Miacca, »aber unsereins bekommt nicht oft Pudding zu sehen.« »Meine
Mutter macht gerade heute einen Pudding,« sagte Tommy Grimes, »und ich bin davon überzeugt, dass sie Ihnen ein bischen davon gibt, wenn ich sie darum bitte. Soll ich schnell hinlaufen und ihn
holen?« »Du bist wirklich ein braver Junge,« sagte Frau Miacca, »aber bleib' nicht zu lang' aus und komm' nur ja rechtzeitig vor dem Abendessen zurück!«
Tommy machte sich eiligst aus dem Staube und war froh, so leichten Kaufes davonzukommen. Eine Zeitlang war er so brav, als man sich's nur wünschen konnte, und gieng nie allein auf die Straße.
Aber es war so schwer, immer artig zu sein, und so ging er eines Tages wieder allein um die Ecke. Der Zufall wollte, dass in demselben Augenblick wieder Mister Miacca vorbeikam; der packte ihn,
tat ihn in seinen Sack und nahm ihn mit nach Hause. Dort angekommen, ließ er ihn aus dem Sack, und als er ihn näher betrachtete, sagte er: »Aha, du bist der junge Herr, der mir und meiner Frau
neulich einen so schlimmen Streich gespielt und uns um unser Abendessen gebracht hat. Na, das wird nicht wieder vorkommen. Heut' werd' ich selber auf dich acht geben. Da, kriech' unter das Sofa,
ich werde mich draufsetzen und warten, bis das Wasser zu sieden beginnt.«
So musste denn der arme Tommy Grimes unter das Sofa kriechen, und Mister Miacca setzte sich drauf und wartete, bis das Wasser zu sieden begann. Und sie warteten und warteten, aber das Wasser
wollte nicht kochen, und endlich wurde Mister Miacca ungeduldig und sagte: »Du, dort unten, ich will nicht länger warten. Steck' dein Bein heraus, sonst läufst du mir am Ende wieder davon.« Tommy
steckte ein Bein heraus, und Mister Miacca nahm ein Hackmesser, hackte es ab und warf es in den Topf. Plötzlich rief er: »Sally, liebe Sally!«
Aber niemand antwortete. Da ging er ins nächste Zimmer, um zu sehen, wo Frau Miacca blieb. Rasch kroch Tommy unter dem Sofa hervor und rannte zur Tür hinaus. Denn er hatte Mister Miacca statt
seines Beines ein Sofabein hingehalten. So kam er glücklich nach Hause und nie wieder ging er, so lange er klein war, allein auf die Straße.
Anna Kellner: Englische Märchen
Däumling
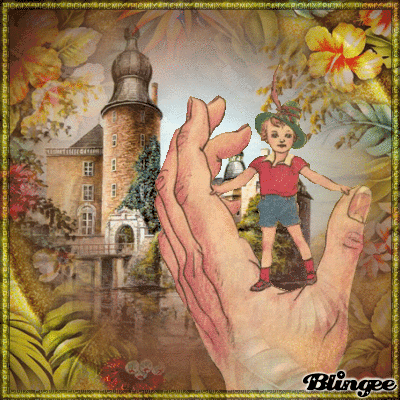
In den Tagen des berühmten Königs Arthur, da lebte ein großer Zauberer, Merlin mit Namen, der weiseste und geschickteste Zauberer seiner Zeit. Einst reiste Merlin, der jede beliebige Gestalt
annehmen konnte, als armer Bettler, und da er sehr müde war, ging er in die Hütte eines ehrlichen Bauers, um dort auszuruhen, und bat um eine Erfrischung. Der Bauer begrüßte ihn herzlich, und
sein Weib, eine gutherzige, gastfreundliche Frau, brachte ihm allsogleich etwas Milch in einem Holzbecher und ein Stück grobes Schwarzbrot auf einem Teller.
Merlin freute dieses einfache Mahl und die Freundlichkeit des Bauern und seines Weibes; doch bemerkte er, dass, obgleich es in der Hütte sehr nett und hübsch aussah, die beiden doch gedrückt und
unglücklich zu sein schienen. Er fragte nach der Ursache ihrer Schwermut und erfuhr, dass sie sich unglücklich fühlten, weil sie keine Kinder hatten. Die Frau beteuerte mit Tränen in den Augen,
dass sie das glücklichste Geschöpf auf Erden wäre, wenn sie einen Sohn besäße, und wenn er nicht größer wäre, als der Daumen ihres Mannes, sie wäre zufrieden.
Merlin belustigte der Gedanke an einen Knaben, der nicht größer sein sollte, als der Daumen eines Mannes, so sehr, dass er beschloss, der Feenkönigin einen Besuch abzustatten und sie zu bitten,
sie möge den Wunsch der armen Frau erfüllen. Der Gedanke eines solch drollig winzigen Menschenkindes gefiel auch der Feenkönigin außerordentlich und sie versprach Merlin, den Wunsch zu erfüllen.
Demgemäß bekam auch nach einiger Zeit die Frau des Bauern einen Sohn, der, o Wunder! nicht ein bischen größer war, als der Daumen seines Vaters. Die Feenkönigin, welche den kleinen Knirps zu
sehen wünschte, kam zum Fenster herein, während die Mutter im Bette saß und ihn bewunderte.
Die Königin küsste das Kind und gab ihm den Namen Tom Däumling. Dann ließ sie einige Feen kommen, welche ihren kleinen Liebling nach ihren Anweisungen bekleideten: ein Eichenblatt diente ihm als
Kranz, sein Hemd war aus Spinnweb, sein Röckchen aus Distelflaum, sein Beinkleid aus Federn, seine Strümpfe aus Apfelschale, die Bänder dazu aus Wimperhaaren seiner Mutter, die Schuhe aus
Mäuseleder mit den weichen Haaren nach innen.
Bemerkenswert ist, dass Däumling nie größer wurde, als der Daumen seines Vaters, der von gewöhnlicher Größe war; aber im Laufe der Jahre zeigte es sich, dass er sehr schlau und zu allerlei
Streichen aufgelegt war. Sobald er alt genug war, mit den Knaben zu spielen, verlor er im Spiel einst alle seine Kirschkerne; da kroch er in die Beutel seiner Spielkameraden, füllte seine
Taschen, kroch unbemerkt wieder heraus und setzte das Spiel fort, als wäre gar nichts geschehen. Doch als er eines Tages aus einem Beutel herauskam, wo er wie gewöhnlich gemaust hatte, sah ihn
der Knabe zufällig, dem der Beutel gehörte. »Aha, mein kleiner Däumling,« sagte er, »da hab' ich dich endlich erwischt, wie du meine Kirschkerne stiehlst, jetzt sollst du für deine diebischen
Streiche schon belohnt werden!«
Bei diesen Worten zog er die Schnur des Beutels fest um seinen Hals und schüttelte ihn so tüchtig, dass der arme Däumling arg zugerichtet wurde. Tom schrie laut auf vor Schmerz und bat, sein
Kamerad möchte ihn wieder hinauslassen, er wolle sich auch bestimmt nie mehr solch schlimme Streiche zu Schulden kommen lassen.
Kurze Zeit darauf machte seine Mutter einen Pudding, und Däumling, der für sein Leben gern zusehen wollte, wie er gemacht wird, kletterte auf den Rand der Schüssel; unglücklicherweise aber glitt
sein Fuß aus, und er plumpste Hals über Kopf in die Masse, ohne dass seine Mutter es bemerkte, welche ihn in die Puddingform goss und zum Kochen in den Topf tat. Die Puddingmasse hatte Däumlings
Mund gefüllt und ihn am Schreien gehindert; als er aber das heiße Wasser spürte, strampelte und zappelte er so sehr in dem Topf herum, dass seine Mutter glaubte, der Pudding sei verhext. Sie nahm
ihn also rasch aus dem Topfe und schüttete ihn vor der Tür aus.
Ein armer Kesselflicker, der vorbeigieng, tat den Pudding in seinen Ranzen und ging weiter. Als Däumling nun seinen Mund von dem Teige frei hatte, begann er laut zu schreien, worüber der
Kesselflicker so erschrak, dass er den Pudding fortschleuderte und davonrannte. Als so der Pudding in Stücke gegangen war, kroch Däumling, über und über mit Teig bedeckt, heraus und ging nach
Hause zurück. Seine Mutter, die ganz unglücklich war, ihren Liebling in einem solch bejammernswerten Zustande zu sehen, setzte ihn in eine Teetasse und wusch bald den Teig herunter; dann legte
sie ihn ins Bett.
Kurze Zeit nach dem Pudding-Abenteuer, ging Däumlings Mutter auf die Wiese, um ihre Kuh zu melken und nahm ihn mit. Da es sehr windig war, band sie ihn, damit er nicht weggeweht würde, mit einem
Zwirnsfaden an eine Distel. Aber die Kuh sah den Hut mit Eichenlaub, er gefiel ihr, und sie hatte einen Augenblick später die Distel sammt dem Knirps im Maule. Während sie an der Distel kaute,
fürchtete sich Däumling vor den großen Zähnen, die ihn in Stücke zu zerbeißen drohten, und er schrie, so laut er konnte: »Mutter! Mutter!«
»Wo bist du, Däumling, mein lieber Däumling?« »Hier Mutter,« erwiderte er, »in dem Maule der roten Kuh.« Seine Mutter begann zu weinen und die Hände zu ringen, da öffnete die Kuh, über das
seltsame Geräusch in ihrer Kehle erstaunt, ihr Maul, und Däumling fiel heraus. Glücklicherweise fing ihn seine Mutter in der Schürze auf, als er zu Boden fiel, sonst hätte er sich schwer
verletzt. Dann tat sie ihn in ihren Busen und rannte nach Hause.
Sein Vater machte ihm eine Peitsche aus Haferstroh zum Viehtreiben, und als er eines Tages ins Feld ging, glitt er aus und fiel in eine Furche. Ein Rabe flog gerade vorbei, der pickte ihn mit
seinem Schnabel auf und flog mit ihm auf das Schloss eines Riesen am Meere; dort ließ er ihn liegen. Däumling war in einer schrecklichen Lage und wusste nicht, was er tun sollte; bald erschrak er
noch viel mehr, denn der alte Riese Grumbo kam auf die Terrasse, um da spazieren zu gehen. Als er Däumling sah, hob er ihn auf und verschluckte ihn wie eine Pille.
Doch bald bereute der Riese, was er getan hatte, denn Däumling begann so sehr zu strampeln und zu zappeln, dass er ein großes Unbehagen empfand. Endlich brach er ihn aus - ins Meer. In demselben
Augenblicke wurde der arme kleine Tom von einem großen Fische verschluckt. Dieser wurde gleich darauf gefangen und für die Küche König Arthurs gekauft. Wie erstaunt war man beim Öffnen des
Fisches, das winzige Kerlchen in seinem Magen zu finden!
Däumling aber war ganz glücklich über die wiedererlangte Freiheit. Man brachte ihn vor den König. Dieser ernannte ihn zum Hofzwerg, und Tom war bald ein großer Liebling des Hofes, denn er
erheiterte durch seine Schelmenstreiche nicht nur den König und die Königin, sondern alle Ritter von der Tafelrunde.
Es heißt sogar, dass der König ihn, wenn er ausritt, oft mitnahm; und wenn es zu regnen begann, kroch er in die Westentasche Seiner Majestät, wo er schlief, bis der Regen vorüber war.
Eines Tages fragte König Arthur den Däumling, ob seine Eltern auch so klein seien wie er, und in welchen Verhältnissen sie sich befänden. Tom erzählte dem König, dass seine Eltern so groß seien,
wie all die Leute an des Königs Hof, dass sie aber in Armut lebten. Als der König dies vernahm, trug er Däumling in seine Schatzkammer und hieß ihn so viel Geld, als er zu tragen vermochte,
seinen Eltern nach Hause bringen. Tom schlug vor Freude einen Purzelbaum und brachte eine Börse, die aus einer Seifenblase bestand. In diese tat er ein Silberstückchen.
Unserem kleinen Helden fiel es schwer, sich die Bürde auf den Rücken zu laden, endlich aber gelang es ihm, und er machte sich auf die Reise. Er erreichte, ohne dass ihm ein Unfall widerfuhr, nach
zwei Tagen und zwei Nächten, nachdem er mehr als hundertmal gerastet hatte, glücklich das Haus seines Vaters.
Achtundvierzig Stunden war er mit dem riesigen Silberstück auf dem Rücken gereist und kam totmüde zu Hause an, da kam seine Mutter ihm gerade entgegen und trug ihn ins Haus.
Seine Eltern waren glücklich, als sie ihn wiedersahen, umsomehr, da er eine solch erstaunliche Summe Geldes mitgebracht hatte; aber der arme kleine Kerl war ungeheuer müde. Hatte er doch in
achtundvierzig Stunden eine halbe Meile zurückgelegt, mit einem Silberstück auf dem Rücken! Damit er sich von der Müdigkeit erhole, legte ihn seine Mutter in eine Nussschale neben dem Kamin und
gab ihm in drei Tagen eine ganze Haselnuss zu essen; davon wurde er aber sehr krank, denn eine Haselnuss pflegte ihm sonst für einen ganzen Monat zu genügen.
Däumling erholte sich bald wieder, aber da es geregnet hatte und der Boden sehr nass war, konnte er nicht an den Hof König Arthurs zurück. Da machte seine Mutter eines Tages, als der Wind in
dieser Richtung wehte, einen kleinen Schirm aus Seidenpapier, band Däumling daran fest und blies in die Luft, so dass er bald in den Palast des Königs geweht wurde. Der König, die Königin und der
ganze Adel waren froh, Däumling wiederzusehen, der sie bei Kampfspielen und Turnieren durch seine Gewandtheit sehr unterhielt; aber seine Anstrengungen, ihnen zu gefallen, kamen ihm sehr teuer zu
stehen und führten eine so schwere Krankheit herbei, dass er von den Ärzten aufgegeben wurde.
Aber die Feenkönigin kam, als sie von seiner Erkrankung hörte, in einem Wagen, der von Fledermäusen gezogen wurde, an den Hof; sie setzte Däumling neben sich und fuhr mit ihm durch die Luft, ohne
irgendwo anzuhalten, bis sie in ihrem Palast angelangt waren. Nachdem sie ihn wieder gesund gemacht und ihm erlaubt hatte, sich an den Herrlichkeiten des Feenlandes zu ergötzen, erhob sich auf
ihren Befehl ein starker Luftstrom. Auf diesen setzte sie Däumling, der schwamm darauf wie ein Kork auf dem Wasser und war in einem Augenblick beim königlichen Palaste.
Gerade als er durch den Hof geflogen kam, ging zufällig der Koch mit der großen Schüssel voll Weizenbrei, der Lieblingsspeise des Königs, vorüber, und der arme, kleine Knirps fiel gerade mitten
hinein, so dass das heiße Gericht dem Koch ins Gesicht spritzte. Dieser war ein boshafter Mensch und geriet in eine furchtbare Wut, weil Däumling ihn so erschreckt und verbrannt hatte. Er ging
schnurstracks zum Könige und meldete ihm, dass Däumling aus purem Mutwillen in den königlichen Weizenbrei gesprungen sei und ihn ausgeschüttet habe. Der König war so zornig, als er dies vernahm,
dass er befahl, Tom zu verhaften und des Hochverrats anzuklagen; und da niemand wagte, ein gutes Wort für ihn einzulegen, so wurde er zum Tode durch das Fallbeil verurteilt.
Als der arme Däumling diesen furchtbaren Urteilsspruch vernahm, begann er vor Angst zu zittern. Da er keinen Ausweg wusste, machte er einen mächtigen Sprung - gerade durch den großen offenen Mund
eines Müllers, der gaffend in der Menge stand, in dessen Kehle hinein. Das tat er mit solcher Behendigkeit, dass kein Mensch es bemerkte; selbst der Müller wusste nicht, was ihm geschehen sei. Da
Däumling so plötzlich verschwunden war, zerstreute sich der Hof, und der Müller ging heim in seine Mühle. Als Tom die Mühle klappern hörte, wusste er, dass er sich nicht mehr am Hofe des Königs
befand; da begann er zu strampeln, dass der Müller keine Ruhe finden konnte und sich für verhext hielt. Zuletzt schickte er um einen Doctor.
Sobald dieser kam, begann Däumling zu tanzen und zu singen, so dass der Arzt eiligst fünf andere Doctoren und zwanzig weise Männer holen ließ. Es entspann sich nun ein großer Streit über die
Ursache dieses ungewöhnlichen Ereignisses: da gähnte der Müller zufällig. Diese Gelegenheit benützte Tom, und mit einem Sprung war er heil draußen, mitten auf dem Tisch. Der Müller war so wütend
darüber, dass ein solch zwerghaftes Geschöpf ihn so gequält hatte, dass er Däumling ergriff und ihn durch das offene Fenster in den Strom warf.
In diesem Augenblicke schnappte ein großer Lachs nach ihm. Ein Fischer fing den schönen Fisch und verkaufte ihn auf dem Markte dem Haushofmeister eines großen Lords. Der Edelmann machte den
Riesenlachs König Arthur zum Geschenk, der ihn sofort dem Koche zur Zubereitung übergeben ließ. Als man den Fisch öffnete, fand man Tom darin und brachte ihn zum König, aber Seine Majestät, die
mit Staatsangelegenheiten beschäftigt war, befahl, ihn abzuführen und in Gewahrsam zu halten, bis er um ihn schicken würde.
Der Koch war entschlossen, Däumling diesmal nicht entschlüpfen zu lassen. Er tat ihn also in eine Mausefalle. Eine ganze Woche lang hatte der arme Tom in der Mausefalle gesessen, als König Arthur
ihn holen ließ. Dieser verzieh ihm, dass er mutwillig den Weizenbrei ausgeschüttet hatte, und nahm ihn in Gnaden wieder auf. In Anbetracht der wundervollen Taten, die er vollbracht hatte, schlug
ihn der König zum Ritter, und Däumling führte fortab den später so berühmt gewordenen Namen »Ritter Tom Däumling«.
Da die Kleider des neuen Ritters im Pudding, im Weizenbrei und im Innern des Riesen, des Müllers und der Fische sehr gelitten hatten, so bestellte ihm Seine Majestät einen neuen Anzug. Das Hemd
war aus den Flügeln eines Schmetterlings, die Stiefel aus Hühnerhaut, und ein geschickter Feenschneider verfertigte seinen Anzug. Eine Nadel hing ihm an der Seite, und eine stattliche Maus trug
den stolzen Ritter zum Turnier.
Es war wirklich sehr belustigend, Däumling in diesem Gewande auf der Maus reiten zu sehen, wie er dem König und dem Adel auf die Jagd folgte; alle glaubten, vor Lachen umkommen zu müssen bei dem
Anblick des Reiters und seines Tieres. Als sie eines Tages an einem Bauernhofe vorüberritten, tat eine große Katze, die an der Tür gelauert hatte, einen Sprung und fing den Reiter und seine Maus.
Sie kletterte auf einen Baum und begann die Maus zu verzehren, als Däumling kühn sein Schwert zog und die Katze so heftig angriff, dass sie ihn sammt der Maus fallen ließ. Einer der Adeligen fing
ihn in seinem Hut auf und legte ihn auf ein Eiderdunenbett in ein Elfenbeinkästchen. Gleich darauf kam die Feenkönigin, um Däumling zu besuchen, und nahm ihn ins Feenland mit, wo er mehrere Jahre
blieb.
Während dieser Zeit war König Arthur wie auch alle anderen Leute am Hofe, die ihn gekannt hatten, gestorben. Da Däumling sich wieder zu Hofe zurücksehnte, schickte ihn die Feenkönigin, nachdem
sie ihm einen neuen Anzug geschenkt hatte, durch die Luft in den königlichen Palast. Das war zur Zeit König Thunstanes, des Nachfolgers Arthurs. Alle liefen zusammen, um ihn zu sehen, und man
brachte ihn vor den König; der fragte ihn, wer er sei, woher er käme und wo er wohnte. Däumling antwortete:
»Tom Däumling ist mein Name genannt,
Ich komme aus dem Elfenland.
Als Arthur noch saß auf dem britischen Thron,
Hab' ich ihm manch' heitere Stunde beschert;
Die Ritterschaft gab er dafür mir zum Lohn.
Habt nie Ihr von Ritter Däumling gehört?«
Der König war so entzückt von der Rede, dass er einen kleinen Sessel machen ließ, damit Däumling an seinem Tische essen könne. Auch bestellte er ihm als Wohnhaus einen kleinen goldenen Palast,
eine Spanne hoch, in den führte eine Thür, welche einen Zoll breit war. Ferner schenkte ihm der König eine Kutsche, die von sechs kleinen Mäusen gezogen wurde.ie Königin war so empört über die
Ehren, welche man Ritter Däumling erwies, dass sie beschloss, ihn zu verderben. Sie sagte also dem Könige, dass der kleine Ritter keck gegen sie gewesen sei.
Sofort ließ der König Däumling holen; dieser aber wusste, was königlicher Zorn zu bedeuten hatte, und kroch in ein leeres Schneckenhaus, wo er so lange Zeit blieb, dass er fast vor Hunger
gestorben wäre. Endlich wagte er es, hinauszugucken, und als er in der Nähe seines Verstecks einen schönen großen Schmetterling auf dem Boden sah, näherte er sich sehr vorsichtig und setzte sich
rittlings darauf. Einen Augenblick darauf erhob sich der Schmetterling in die Luft und flog mit ihm von Baum zu Baum, von Feld zu Feld, bis er zuletzt wieder zu Hofe zurückkehrte, wo der König
und die Adeligen sich bemühten, ihn zu fangen. Doch fiel der arme Däumling endlich in eine Gießkanne, wo er fast ertrank.
Als die Königin ihn sah, wurde sie sehr zornig und sagte, er müsse geköpft werden, und wieder tat man ihn in eine Mausefalle bis zur Vollziehung des Todesurteils. Aber eine Katze, die etwas
Lebendiges in der Falle bemerkte, bearbeitete dieselbe so lange mit den Pfoten, bis die Drähte zerbrachen. Auf diese Weise wurde Ritter Tom wieder frei.
Der König nahm Däumling wieder in Gnaden auf, dieser aber konnte sich nicht lange der königlichen Huld erfreuen, denn eines Tages griff ihn eine große giftige Spinne an, und obwohl er sein
Schwert zog und tapfer kämpfte, so unterlag er doch endlich dem Gift der Spinne. König Thunstane und sein ganzer Hof waren so betrübt über den Verlust ihres Lieblings, dass sie Trauer um ihn
anlegten und über seinem Grabe ein schönes Denkmal aus weißem Marmor errichteten, welches folgende Inschrift trug:
»Hier ruht Tom Däumling in ewiger Nacht,
Eine Spinne hat ihn ums Leben gebracht!
Von Arthur ward er hochgeehrt,
Weil er der Trübsal stets gewehrt.
Auf einer Maus - aller Mäuse Zier -
Ritt er zu Wettkampf und Turnier.
Einst erfüllt er den Hof mit Lachen und Scherz;
Sein Tod ist uns allen ein tiefer Schmerz.
Raufet das Haar und klaget sehr,
Denn Ritter Tom Däumling ist nicht mehr.«
Anna Kellner: Englische Märchen
Die verbotene Quelle

Es war einmal ein Junge von zwölf Jahren, der wurde von seinem Vater ausgeschickt, um die Schafe am Fenne fawr zu hüten. Zeitig eines Morgens im Juni trieb er
seine Schafe auf die Weide und schaute zur Spitze des Frenne fawr, um zu sehen, wie der Morgennebel falle. Jung wie er war, kannte er sich noch doch mit dem Wetter aus und wußte, wenn sich der
Nebel nach Cardiganshire absenkte, mußte man mit schlechtem Wetter rechnen. Sank er aber gegen Pembrokeshire ab, dann gab es schönes Wetter. Nun, an diesem tag deuteten die Zeichen auf schönes
Wetter hin, und der Junge freute sich, pfiff sich Lied und schaute sich -was kostet die Welt!- neugierig um. Da sah er in einiger Entfernung eine größere Abteilung Soldaten, die mit etwas
beschäftigt waren, woraus er nicht klug wurde.
"So zeitig am Morgen können doch noch keine Soldaten hier oben im Gebierge sein". "Könnte das vielleicht eine Feenfamilie sein?" sprach er zu sich. Er hatte oft
von Feen reden gehört und war an ihren Ringen vorbeigekommen, aber er hatte nie jemanden vom kleinen Volk selbst zu Gesicht bekommen. Zuerst wollte er heimlaufen und seinem Vater und seiner
Mutter davon erzählen, aber ehe er zurück sein würde, würden die Feen vielleicht verschwunden sein, oder aber seine Eltern würden ihm verbieten hierher zurückzukommen.
Viele Leute fürchteten sich nämlich vor den Feen. Er dachte noch eine Weile nach, und dann entschloß er sich, so nahe heranzugehen, wie er nur konnte. Und
tatsächlich kam er ihnen recht nahe und konnte genau beobachten, was sie da trieben. Sie waren kleine Wesen beiderlei Geschlechts, so schön anzusehen, wie er nie einen Menschen gesehen hatte.
Einige von ihnen tanzten. Sie hatten sich dabei an den Händen gefaßt und einen kreis gebildet. Andere spielten Nachlaufen, und wieder andere ritten auf kleinen weißen Pferden. Ihre Kleider waren
unterschiedlich in den Farben, einige waren weiß, andere scharlachrot. Die kleinen Männer trugen Kappen mit drei Spitzen und die Fauen einen Kopfschmuck, der weithin glitzerte. Es dauerte nicht
lange, da wurden sie auf den Jungen aufmerksam und winkenten ihn lachend zu sich heran. Zögernd kam er näher und näher, bis er es schließlich wagte, einen Fuß in den Kreis zu setzen. Kaum hatte
er das getan,da vernahm er die wunderbarste Musik von der Welt, und etwas drängte ihn, noch weiter in den Kreis hineinzugehen.
Als er diesem Verlangen nachgab, fand er sich nicht länger in einem Feenring am Abhang des Gebirges, sondern in einem prächtigen Palast, in dem es vor Gold und
Perlen nur so funkelte. Jede Art von Schönheit umgab ihn, und jede Art von Vergnügen wurde ihm geboten. Er konnte sich frei bewegen, und immer bedienten ihn die Mädchen, die alle wunderschön
waren. Statt Kartoffeln mit Buttermilch und den Milchbrei, an an den er bis dahin gewohnt gewesen war, legte man ihm die besten Stücke Fleisch auf silberne Tellern vor, und statt einem dünnen
Bier- das einzige alkoholische Getränk, das er bisher in seinem Leben je getrunken hatte - kredenzte man ihm roten und gelben Wein in mit Edelstein geschmückten Pokalen. Es gab nur ein einziges
Verbot. Es war ihm nicht erlaubt, aus einer bestimmten Quelle im Garten zu trinken. Ihr Wasser ergoß sich in ein Becken, in dem schwammen Fische, sie waren golden oder glänzten in anderen
Farben.
Jeden Tag hatten die Feen wieder ein neues Vergnügen für ih bereit, und jede Beschäftigung war neu und lustig, und er sah dabei Wesen aus dem kleinen Volk,
denen er zuvor noch nicht begegnet war. Nachdem er nun alles hatte, was sich ein Sterblicher wünschen kann, wünschte sich der Junge auch noch das Verbotene. Wie Eva im Garten Eden, so spielte
auch ihm die Neugier diesen Streich. Eines Tages kam er in die Nähe der Quelle und schaute den Fischen zu, die sich im Becken tummelten. Niemand sah zu, und da tauchte er seine Hand ins Wasser.
Sofort verschwanden die Fische. Er trank von dem Wasser. Und fort war der Palast und alle Feen. Er stand wieder im Gebirge, eben an der Stelle, an der er in den Feenring eingetreten war. Die
Schafe grasten noch dort, wo er sie verlassen hatte. Der Nebel über dem Berg hatte sich kaum bewegt. Er meinte viele Jahre fortgewesen zu sein, aber es waren nur wenige Minuten.
Märchen aus Wales
Die kluge Kate
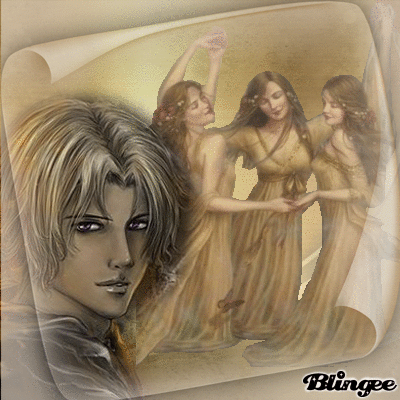
Es war einmal ein König und eine Königin. Der König hatte aus erster Ehe eine Tochter, Anne, und die Königin eine namens Kate, aber Anne war viel schöner, als die Tochter der Königin, doch
liebten die Beiden einander wie wirkliche Schwestern. Die Königin war eifersüchtig darauf, dass die Tochter des Königs schöner war, als ihre eigene, und sann darüber nach, wie sie ihre Schönheit
verderben könnte. Sie beriet sich mit der Hühnerfrau, und die sagte, sie möge ihr das Mädchen am folgenden Morgen schicken, aber bevor sie etwas gegessen hätte.
Früh am folgenden Morgen sagte die Königin zu Anne: »Geh', liebes Kind, zur Hühnerfrau und bringe mir einige Eier.« Anne gieng, aber als sie durch die Küche kam, sah sie eine Brotkruste liegen,
die nahm sie mit und knusperte unterwegs daran. Als sie zur Hühnerfrau kam, bat sie sie um Eier, wie ihr geheißen ward; die Hühnerfrau sagte ihr: »Hebe den Deckel von jenem Topfe auf und schau'
hinein.« Das Mädchen tat es, aber es ereignete sich nichts.
»Geh' nach Hause zu Deiner Mutter und sag' ihr, sie möge die Tür zur Speisekammer besser schließen,« sagte die Hühnerfrau.
Anne ging nach Hause und bestellte der Königin, was ihr die Hühnerfrau aufgetragen hatte. Daraus ersah die Königin, dass das Mädchen, bevor es zur Hühnerfrau kam, etwas gegessen haben müsse; sie
gab also am folgenden Morgen acht und schickte sie fort, ohne daß sie einen Bissen genossen hatte. Aber die Prinzessin sah unterwegs einige Landleute Erbsen abpflücken, und da sie sehr freundlich
war, sprach sie zu den Leuten und nahm eine Hand voll Erbsen, die sie unterwegs aß.
Als sie zur Hühnerfrau kam, sagte diese: »Hebe den Deckel von jenem Topf auf und schau' hinein.« Wieder hob Anne den Deckel auf, aber es ereignete sich nichts. Da wurde die Hühnerfrau sehr böse
und sagte: »Sag' Deiner Mutter, ohne Feuer siedet kein Topf.« Anne ging heim und sagte es der Königin.
Am folgenden Tage begleitete die Königin das Mädchen zur Hühnerfrau. Als Anne diesmal den Deckel vom Topf abhob, fiel ihr hübscher Kopf ab, und statt dessen saß der Kopf eines Schafes auf ihren
Schultern. Die Königin war nun zufrieden und ging nach Hause.
Ihre Tochter Kate aber nahm ein feines Linnentuch und hüllte den Kopf ihrer Schwester darein, dann ergriff sie ihre Hand, und sie gingen zusammen fort, um ihr Glück zu suchen. Sie wanderten
weiter und immer weiter, bis sie zu einem Schlosse kamen. Kate klopfte an und bat um ein Nachtlager für sich und eine kranke Schwester. Sie traten ein und sahen, dass sie sich in einem
königlichen Schlosse befanden. Der König hatte zwei Söhne, von denen der eine totkrank war, aber Keiner wusste, was ihm fehlte. Seltsam war, dass, wer immer eine Nacht bei ihm wachte, für immer
verschwand. So bot denn der König jedem, der bei ihm aufbleiben wollte, eine Metze Silber an. Kate war ein sehr tapferes Mädchen, sie erbot sich also, bei ihm zu wachen.
Bis Mitternacht ging alles gut. Als die Uhr zwölf schlug, da stand der kranke Prinz auf, kleidete sich an und schlüpfte die Treppe hinunter. Kate folgte ihm, aber er schien sie nicht zu bemerken.
Er ging in den Stall, sattelte sein Pferd, rief seinen Jagdhund und sprang in den Sattel; Kate saß hinter ihm auf. So ritten die Beiden durch den grünen Wald, und Kate pflückte im Vorbeireiten
Nüsse von den Bäumen und tat sie in ihre Schürze. Sie ritten immer weiter, bis sie zu einem grünen Hügel kamen. Da zog der Prinz die Zügel an und sagte: »Tu' dich auf, tu' dich auf, grüner Hügel,
und laß den jungen Prinzen ein und sein Pferd und seinen Hund.« Da fügte Kate hinzu: »Und das Mädchen hinter ihm.«
Sofort tat sich der grüne Hügel auf, und sie gingen hinein. Der Prinz trat in eine hellbeleuchtete, prächtige Halle ein, da umringten ihn viele Elfen und führten ihn zum Tanze. Kate hatte sich
unbemerkt hinter der Tür versteckt. Da sah sie wie der Prinz tanzte und immerfort tanzte und tanzte, bis er nicht mehr weiter konnte und auf ein Ruhebett niedersank. Dann fächelten ihn die Elfen,
bis er sich wieder erheben und weitertanzen konnte. Endlich krähte der Hahn, da beeilte sich der Prinz, wieder aufzusitzen, Kate sprang hinter ihm auf das Pferd, und sie ritten heim.
Als die Morgensonne aufstieg, fand man Kate beim Kaminfeuer sitzen, wo sie ihre Nüsse knackte. Sie sagte, der Prinz hätte eine gute Nacht gehabt, sie würde aber nur dann auch die folgende Nacht
bei ihm aufbleiben, wenn sie dafür eine Metze Gold erhielte. Die zweite Nacht verging wie die erste. Um Mitternacht erhob sich der Prinz und ritt zu dem grünen Hügel zum Feenball, und Kate
begleitete ihn und pflückte Nüsse, als sie durch den Wald ritten. Diesmal bewachte sie den Prinzen nicht, denn sie wußte, er würde tanzen und immerfort tanzen. Sie sah ein Elfenkind mit einem
Stabe spielen und hörte, wie eine der Elfen sagte: »Drei Schläge mit diesem Stabe würden Kate's kranker Schwester ihre Schönheit wieder geben.«
Da rollte Kate Nüsse zu dem Elfenkinde hinüber, und das tat sie so lange, bis das Kind zu den Nüssen hintorkelte und den Stab fallen ließ. Kate hob ihn auf und steckte ihn in ihre Schürze. Beim
ersten Hahnenschrei ritten sie wie früher nach Hause, und kaum waren sie ins Schloß gekommen, so eilte sie zu Anne und berührte sie drei Mal mit dem Stabe, da fiel der häßliche Schafskopf ab, und
ihre Schwester war wieder die alte schöne Anne. Die dritte Nacht wollte Kate nur unter der Bedingung beim kranken Prinzen wachen, daß sie ihn zum Manne bekomme.
Alles verlief wie in den beiden ersten Nächten. Diesmal spielte das Elfenkind mit einem Vogel, und Kate hörte, wie eine der Elfen sagte: »Drei Bissen dieses Vogels würden den kranken Prinzen
wieder so gesund machen, wie er einst war.« Da rollte Kate alle Nüsse, die sie besaß, dem Elfenkinde hinüber, bis es den Vogel fallen ließ. Auch diesen tat Kate in ihre Schürze.
Beim ersten Hahnenschrei ritten sie wieder heim, aber dieses Mal knackte Kate keine Nüsse, sondern rupfte den Vogel ab und kochte ihn. Ein köstlicher Duft drang durch das Zimmer. »Ach!«, sagte
der Prinz, »ich möchte so gern' ein Stückchen von diesem Vogel essen!« Da gab ihm Kate einen Bissen, und er stützte sich auf den Ellbogen. Dann rief er wieder: »Ach, wenn ich doch noch einen
Bissen von dem Vogel bekäme!« Da gab ihm Kate wieder ein Stückchen, und er setzte sich im Bette auf. Dann sagte er wieder: »Ach, ich möchte so gern noch ein einziges Stückchen von dem Vogel!« Da
gab ihm Kate den dritten Bissen, und er war gesund und stark und stand auf und kleidete sich an und setzte sich an das Kaminfeuer. Und als die Leute am nächsten Morgen eintraten, fanden sie Kate
und den jungen Prinzen damit beschäftigt, Nüsse zu knacken.
Inzwischen hatte sein Bruder Anne gesehen und sich in sie verliebt, wie Jeder, der ihr schönes, süßes Gesicht sah. So heiratete der kranke Königssohn die gesunde Schwester, und der gesunde Sohn
heiratete die kranke Schwester, und sie lebten alle glücklich bis an ihr seliges Ende.
Anna Kellner: Englische Märchen
Die Suppe in der Eierschale
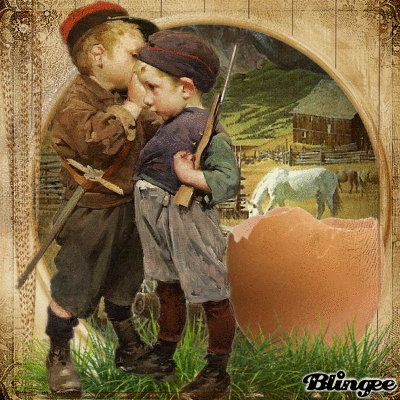
Eine ähnliche Geschichte wird im Kirchspiel Trefeglwys nahe bei Llanidlons in der Grafschaft Montgomery erzählt. Daselbst ist nämlich eine kleine Schäferhütte, welche vom Volk, wegen des merkwürdigen Zankes der einstens daselbst statt gefunden hat, Twt y Cwmrws, »der Zankplatz« genannt wird.
In dieser Hütte wohnte vor Zeiten ein Mann und seine Frau; diese gebar ihm Zwillinge, welche beide Eltern mit der größten Liebe und Zärtlichkeit pflegten. Einige Monate nach der Geburt dieser
Zwillinge riefen dringende Besorgungen die Mutter in ein Nachbarhaus; wiewol sie nun allerdings nicht weit zu gehn hatte, so fiel es ihr doch schwer aufs Herz, die Kinder auch nur eine Minute
allein zu laßen, da niemand im Häuschen war und in der Nachbarschaft die Tylwyth Têg spuken sollte. Allein es konnte ihr nichts helfen; sie verriegelte also die Türe, ging und kehrte so rasch als
menschenmöglich zurück, war aber auf dem Heimwege nicht wenig erschreckt, da sie – obwol es heller Mittag war – einige von »den alten Elfen in blauen Röckchen« sah. Sie vermuthete schon nichts
Gutes; und um so größer war ihre Freude, als sie, beim Nachhausekommen alles fand, wie sie's verlaßen hatte.
Aber nach längerer Zeit fingen die guten Leute sich zu wundern an, daß ihre Zwillinge gar nicht wachsen wollten, sondern immer so kleine Zwerge blieben. Der Mann sagte: »das sind gar meine Kinder
nicht!«, die Frau aber behauptete: »das sind deine Kinder doch!« und daraus entstand jener lange Zank zwischen beiden Eheleuten, wonach der Platz bis auf den heutigen Tag noch heißt. Eines
Abends, da die Frau sehr schweren Herzens war, beschloß sie zu einem Gwr Cyfarwydd oder weisen Mann zu gehn und ihn um Rat zu fragen, da sie wußte, daß diesem alle Dinge bekannt seien.
Nun war es grade an der Zeit, daß man bald Roggen und Hafer einbrachte. Da sagte der weise Mann zu ihr: »wenn du das Mittagseßen für die Schnitter bereitest, so nimm die leere Schaale eines
Hühnereies und fülle Suppe hinein und trag' es zur Türe hinaus, als ob Du es den Schnittern zum Mittagseßen bringen wolltest, und dann höre darauf, was die Zwillinge sagen werden. Wenn die Kinder
Dinge sprechen, die über den Kinderverstand hinaus sind, so geh' ins Haus zurück und nimm die Kinder und wirf sie in das Waßer des Llyn Ebyr, welcher nicht weit von deiner Hütte ist; wenn sie
aber nichts besonders sagen, so tu' ihnen auch kein Leides!«
Da nun der Erntetag kam, tat die Frau, was der weise Mann ihr vorgeschrieben hatte, und als sie aus dem Hause war, hörte sie, wie ein Kind zu dem andern sagte:
Ich weiß, daß vor dem Huhn das Ei,
Die Eichel vor der Eiche sei;
Doch nie sah ich ein Mittagsmahl
Für Schnitter in 'ner Eierschaal!
Da kehrte die Mutter eilig in ihr Haus zurück, nahm die beiden Wechselbälge und warf sie in den Llyn (oder Teich). Sogleich kamen die Feen in ihren blauen Röckchen, um ihre Zwerge zu holen; die
Mutter aber fand zu Haus ihre eigenen Kinder wieder, die inzwischen stark und kräftig gewachsen waren, und damit hatte der lange Zank zwischen ihr und ihrem Manne ein fröhliches Ende.
Julius Rodenberg: Märchen aus Wales
Conall

Zur Zeit, da Irland noch in mehrere Königreiche zerfiel, lebte in einem derselben, in Erin, ein tüchtiger Pächter, der hieß Conall und hatte drei Söhne. Nun geschah es einmal, dass diese mit den
Kindern des Königs in Streit gerieten. Conalls Söhne waren die stärkeren, und sie töteten den ältesten Sohn des Königs.
Der König ließ Conall holen und sprach zu ihm: »Warum haben deine Kinder die meinigen angegriffen und meinen ältesten Sohn getötet? Was wird es aber mir nützen, wenn ich Rache an dir nehme? Ich
will dir lieber einen Auftrag geben, und wenn du ihn ausführst, dann will ich das Verbrechen nicht ahnden. Du und deine Söhne, ihr müsst mir den Braunen des Königs von Lochlann bringen - gelingt
Euch das, so sei deinen Söhnen das Leben geschenkt.« »Dein Wunsch, o König, ist mir immer Befehl,« sagte Conall, »wohl verlangst du Schweres von mir, aber selbst wenn es mir und meinen Söhnen ans
Leben geht, will ich doch den Wunsch des Königs erfüllen.«
Nach diesen Worten gieng Conall fort; traurig und bestürzt kam er heim und erzählte seiner Frau, was der König ihm aufgetragen hatte. Kummervoll hörte sie ihn an; wenn er sich jetzt von ihr
trennte, so sah sie ihn vielleicht nie wieder. »Ach, Conall,« sagte sie, »warum ließest du nicht lieber den König tun, was ihm gut dünkte, anstatt sein Begehr zu erfüllen? Wer weiß, ob ich dich
jemals wiedersehen werde!«
Am folgenden Morgen traf Conall die nötigen Vorbereitungen und machte sich mit seinen drei Söhnen nach Lochlann auf. Sie reisten ohne Unterlass, bis sie es erreichten. Aber als sie in Lochlann
waren, da wussten sie nicht, was sie nun beginnen sollten, und der alte Mann sagte zu seinen Söhnen: »Wir wollen den Müller des Königs aufsuchen.«
Als sie in das Haus des Müllers kamen, lud dieser sie ein, über Nacht bei ihm zu bleiben. Da erzählte ihm Conall, dass seine Söhne mit den königlichen Prinzen in Streit geraten seien und den
ältesten Königssohn erschlagen hätten. Und nun müsse er zur Buße den Braunen des Königs von Lochlann herbeischaffen.
»Wenn du mir,« fuhr Conall fort, »den großen Gefallen erweisen und es mir ermöglichen willst, in den Besitz des Rosses zu gelangen, so will ich dich reichlich dafür bezahlen.«
»Dein Vorhaben ist unsinnig,« erwiderte der Müller, »denn der König hängt so sehr an seinem Ross, dass du es unmöglich bekommen kannst, höchstens du stiehlst es. Wenn du Mittel und Wege dazu
findest, von mir soll es niemand erfahren.« »Ich habe folgende Idee,« sagte Conall. »Da du täglich für den König zu tun hast, könntest du mit deinen Knechten mich und meine Söhne in vier Säcke
stecken, die mit Kleie gefüllt sind.« »Der Einfall ist nicht schlecht,« meinte der Müller.
Er sprach mit seinen Knechten, und die taten Conall und seine Söhne in die Säcke. Als die Knechte des Königs um die Kleie kamen, gab man ihnen die Säcke, in denen Conall und seine Söhne steckten.
Im Stalle schütteten die Knechte die Kleie vor die Pferde, schlossen die Tür zu und giengen fort. Sofort legten Conalls Söhne Hand an den Braunen, da sagte ihr Vater: »Das dürft ihr nicht. Es
wird sehr schwer sein, von hier zu entkommen. Wir wollen uns zuvor vier Löcher graben, in denen werden wir uns verbergen, wenn jemand kommt.«
Sie gruben die Löcher, dann machten sie sich wieder an das Pferd. Das war aber noch nicht vollständig gezähmt und begann zu schnauben und um sich zu schlagen, dass der König den Riesenlärm hörte.
»Mit dem Braunen ist etwas los,« sagte er seinen Knechten, »schaut nach, was ihm fehlt.« Als Conall und seine Söhne die Knechte herbeikommen hörten, versteckten sie sich in den Löchern. Die
Knechte sahen sich überall um, fanden aber alles in Ordnung. Sie kehrten zum König zurück und teilten ihm dies mit. Da sagte der König, dass sie sich zur Ruhe begeben könnten.
Einige Zeit, nachdem die Knechte sich entfernt hatten, wollten Conall und seine Söhne den Braunen fortführen, aber er widersetzte sich noch viel mehr, als das erstemal. Da ließ der König wieder
seine Knechte rufen und sagte ihnen, dass er davon überzeugt sei, es fehle dem Braunen etwas, und er befahl ihnen, sich noch einmal gut umzuschauen. Wieder gingen die Knechte in den Stall, wieder
verbargen sich bei ihrem Nahen Conall und seine Söhne. Die Knechte durchsuchten sorgfältig den ganzen Stall, aber sie fanden nichts. Sie begaben sich zum König und teilten ihm dies mit. »Das
nimmt mich wunder,« sagte der König, »geht zur Ruhe. Sollte ich wieder etwas merken, so werde ich selbst nachsehen.«
Als Conall und seine Söhne sahen, dass die Knechte fort waren, versuchten sie es von neuem, das Ross fortzuführen. Aber kaum berührten sie es, so geberdete es sich so wütend, dass es der König
noch viel deutlicher hörte, als vorher. »Der Tausend,« sagte der König zu sich, »es ist unbedingt mit meinem Braunen etwas los.«
Er läutete hastig, und als sein Kammerdiener erschien, schickte er ihn zu seinen Knechten mit der Nachricht, dass dem Braunen etwas geschehen sein müsse. Die Knechte kamen, und der König ging mit
ihnen in den Stall. Als Conall und seine Söhne die herannahenden Schritte hörten, krochen sie in ihre Löcher.
Aber der König war ein kluger Mann, und er gab acht, auf welcher Seite des Stalles die Pferde unruhig waren. »Gebt acht,« sagte er, »es sind sicher Leute im Stalle. Wir müssen sie finden.«
Der König gieng den Spuren der Männer nach und fand sie in ihrem Versteck. Conall war wohlbekannt, denn er war ein sehr geschätzter Pächter des Königs von Erin, und als der König ihn aus seinem
Versteck hervorzog, rief er aus: »O Conall, bist du es wirklich?« »Leider, o König, und die Not hat mich hieher gebracht. Ich empfehle mich deiner Gnade und stelle mich unter deinen
Schutz.«
Er erzählte, was ihm widerfahren war, und dass er dem König von Erin den Braunen bringen müsse, sonst seien seine Söhne dem Tode verfallen. »Ich wusste,« schloss er, »dass ich das Pferd durch
Bitten nicht bekommen würde, und so wollte ich es stehlen.« »Schon gut, Conall, folge mir,« sagte der König. Dann befahl er seinen Knechten, Conalls Söhnen Speise und Trank vorzusetzen und sie
sorgfältig zu bewachen.
»Jetzt sag' mir, Conall,« sprach der König zu diesem, »hast du dich jemals in einer schlimmeren Lage befunden als nun, da dir nichts geringeres bevorsteht, als alle deine Söhne hängen zu sehen?
Aber du hast dich meiner Güte und Gnade empfohlen und sagst, dass dich nur die Not hieher geführt hat. Darum höre, was ich dir sage. Wenn du mir einen Fall nennen kannst, der dem heutigen
gleichkommt, so schenk' ich dir das Leben deines jüngsten Sohnes.«
»Ich hab mich schon einmal in einer ebenso schlimmen Lage befunden,« sagte Conall, »und ich will dir den Fall erzählen. Ich war damals ein junger Bursche. Mein Vater besaß viel Land und eine
ganze Zucht einjähriger Kühe. Eine von diesen hatte gerade gekalbt, und mein Vater trug mir auf, sie nach Hause zu bringen. Ich machte mich mit Kuh und Kalb auf den Weg, da fiel starker Schnee,
und ich ging in die Hütte des Hirten, um dort zu warten, bis das Wetter vorüber sei. Da kamen plötzlich zwölf Katzen herein, die größte von ihnen, ihr Oberhaupt, war fuchsrot und einäugig. Ich
war durchaus nicht erfreut über ihre Gesellschaft.« »Stimmt an,« rief das Oberhaupt aus, »warum sollten wir schweigen? Stimmt an und singt Conall ein Lied.«
Ich war erstaunt, dass den Katzen mein Name bekannt war. Nachdem sie den Gesang beendet hatten, sagte die einäugige Katze zu mir: »Nun Conall, her mit der Belohnung für den Gesang der Katzen!«
Ich antwortete, dass ich nichts für sie hätte, doch könnten sie sich das Kalb nehmen. Kaum hatte ich das Wort gesprochen, als alle zwölf Katzen über das Kalb herfielen, und es dauerte nicht
lange, so waren sie damit fertig. »Stimmt an, warum so schweigsam? Singt Conall ein Lied!« rief die einäugige Katze abermals.
Ich verspürte durchaus keine Sehnsucht nach dem Gesange, trotzdem kamen alle elf herbei und sangen unverzüglich drauf los. Darauf wieder ihr Oberhaupt: »Her mit der Belohnung!« »Lass mich
ungeschoren mit der Belohnung,« sagte ich, »ich hab' nichts für euch, es wäre denn die Kuh.« Sie stürzten sich auf die Kuh, und es dauerte nicht lange, so waren sie auch mit der fertig. »Warum so
stumm?« begann die fuchsrote Katze wieder, »singt Conall ein Lied!« Mir war durchaus nicht an ihrem Gesange gelegen, o König, und ich begann zu merken, dass ich mich in schlimmer Gesellschaft
befand.
Als sie fertig waren, umringten sie wieder ihr Oberhaupt. Wieder verlangte dieses die Belohnung, aber, o König, ich hatte keine für sie, und ich sagte es ihr. Da begannen sie eine greuliche
Katzenmusik. Ich sprang aus dem Fenster und rannte, so schnell ich konnte, in den Wald. Damals war ich flink und stark, und als ich die Katzen hinter mir spürte, da kletterte ich flugs auf den
allerhöchsten Baum, dessen Wipfel sehr dicht war; dort verbarg ich mich, so gut es ging. Die Katzen aber suchten mich überall im Walde, und als sie müde geworden waren und mich nicht finden
konnten, da sagte eine zur anderen, sie wollten heimkehren.
Doch ihr Oberhaupt, die einäugige, fuchsrote große Katze sprach plötzlich: »Ihr könnt ihn mit zwei Augen nicht sehen, und ich sehe ihn mit einem einzigen. Dort oben auf dem Baum sitzt der
Hallunke.« Da kletterte eine von ihnen herauf, auf mich zu. Doch ich tötete sie mit einem Messer, das ich bei mir hatte.
»Der Teufel auch,« rief ihr Oberhaupt aus, »so kann ich mir meine Leute nicht umbringen lassen. Umringt den Baum und grabt die Wurzeln aus, so bekommen wir den Elenden herunter!«
Sie taten, wie ihnen geheißen ward, und als die erste Wurzel freilag, ging ein Zittern durch den Baum, und ich stieß einen Hilferuf aus. Nicht weit vom Walde entfernt war ein Priester mit zehn
Leuten bei der Feldarbeit. Da sagte der Priester: »Das war der Schrei eines Mannes in äußerster Not, dem muss ich helfen.« Aber der klügste unter ihnen sagte: »Wir wollen warten, bis wir ihn noch
einmal hören.«
Wütend gruben die Katzen weiter, und als die zweite Wurzel bloßgelegt war, da stieß ich wieder einen Hilferuf aus, und der war wahrhaftig nicht schwach.
»Ganz gewiss,« sagte nun der Priester, »befindet der Mann sich in Lebensgefahr, lasst uns eilen.« Sie machten sich auf den Weg. Aber die Katzen hatten die dritte Wurzel bloßgelegt, und der Baum
neigte sich zum Falle. Da tat ich den dritten Hilferuf. Eiligst kamen die starken Männer näher, und als sie sahen, was die Katzen mit dem Baume vorhatten, da gingen sie mit ihren Spaten auf sie
los, und sie kämpften mit den Katzen, bis diese endlich die Flucht ergriffen.
Ich aber, o König, rührte mich nicht, bevor die letzte fort war. Dann erst ging ich heim. Und das ist die schlimmste Lage, in der ich mich jemals befand, und ich glaube, dass es wahrhaftig
schlimmer ist, von Katzen zerrissen zu werden, als an dem Galgen des Königs von Lochlann zu hängen. »Ach, Conall,« sagte der König, »wie redegewandt bist du! Nun denn, mit deiner Geschichte hast
du deinem jüngsten Sohne das Leben gerettet. Wenn du mir von einer noch schlimmeren Lage erzählen kannst, so sei auch deinem zweiten Sohne das Leben geschenkt.« »Unter dieser Bedingung,«
versetzte Conall, »will ich dir gern erzählen, wie ich mich einmal in noch weit schlimmerer Lage befand, als heute, wo ich in deiner Gewalt bin.« »Lass hören,« sagte der König.
»Ich war damals,« begann Conall, »ein ganz junger Bursche. Das Gut meines Vaters lag hart am Meere, und die Küste war reich an Felsen, Spalten und Höhlen. Als ich mich eines Tages auf der Jagd
befand, da schien es mir, als stiege zwischen zwei Felsblöcken eine Rauchsäule auf. Neugierig, woher wohl der Rauch kommen möge, trat ich näher und blickte hinein. Aber da tat ich auch schon
einen Fall. Doch war der Boden so dicht mit Heidekraut bedeckt, dass ich keinerlei Verletzung davontrug.
Wie ich da wieder hinauskommen sollte, wusste ich nicht. Ich sah nicht vor mich hin, sondern blickte hinauf - ich hatte keine Hoffnung, je wieder das Tageslicht zu sehen. Der Gedanke, dass ich
bis zu meinem Tode in dieser Höhle bleiben müsste, war furchtbar. Da hörte ich plötzlich ein Geräusch, das immer näher und näher kam, und was erblickten meine Augen? Einen ungeheuren Riesen, von
zwei Dutzend Ziegen und einem Ziegenbocke gefolgt. Er band die Ziegen an, dann trat er auf mich zu und sprach: 'Halloh, Conall! Mein Messer ist fast rostig geworden in der Scheide, so lange warte
ich schon auf dein zartes Fleisch.'«
»Ach!« sagte ich, »es ist nicht viel an mir; du wirst kaum für eine Mahlzeit genug haben. Aber ich sehe, dass du auf einem Auge blind bist. Ich bin ein guter Arzt und werde dein anderes Auge
wieder sehend machen.« Da tat der Riese den großen Kessel auf das Feuer. Ich gab ihm Weisung, das Wasser warm werden zu lassen, dann holte ich Heidekraut herbei, und als sich der Riese auf mein
Geheiß in den Kessel gesetzt hatte, begann ich seine Augen mit zusammengeballtem Heidekraut einzureiben, zuerst das sehende, denn ich erklärte ihm, dass ich dessen Sehkraft auf das blinde Auge
übertragen müsse. Es war natürlich viel leichter, das gesunde Auge krank, als das kranke gesund zu machen, und nach einiger Zeit war es mir gelungen: der Riese war auf beiden Augen blind.
Als er merkte, dass er nichts mehr sehen konnte, und als ich ihm sagte, dass er mich nun nicht mehr daran hindern würde, ins Freie zu gelangen, da sprang er aus dem Wasser und stellte sich an den
Eingang der Höhle und sagte, dass er sich bitter an mir rächen wolle. Die ganze Nacht verbrachte ich in hockender Stellung in der Höhle und musste den Atem anhalten, um nicht zu verraten, wo ich
war. Als dem Riesen endlich der Gesang der Vögel verriet, dass der Tag angebrochen sei, da sagte er: »Schläfst du, Conall? Wach' auf und lass die Ziegen ins Freie hinaus.«
Da tötete ich den Ziegenbock. Der Riese rief: »Ich glaube gar, du tötest meinen Ziegenbock?« »O nein,« erwiderte ich, »die Ziegen sind so fest angebunden, dass es viel Zeit braucht, sie
loszubinden.« Als ich die erste Ziege hinausließ, liebkoste sie der Riese und sprach: »Da bist du, meine zottige, weiße Ziege, du siehst mich, aber ich kann dich leider nicht sehen.«
Eine nach der anderen ließ ich hinaus, während ich dem Ziegenbock das Fell abzog; bevor die letzte draußen war, hatte ich meine Arbeit vollendet. Dann zog ich mir das Fell über den Leib, und zwar
so, dass meine Hände in den Vorderfüßen und meine Füße in den Hinterfüßen steckten; da auch die Hörner auf der Kopfhaut nicht fehlten, so musste der Riese glauben, es sei der Ziegenbock. Als ich
auf allen Vieren hinausgieng, streichelte mich der Riese und sprach: »Da bist du, mein lieber, schöner Ziegenbock, du siehst mich, aber ich kann dich leider nicht sehen.«
Endlich befand ich mich wieder in Gottes freier Welt! Wie freute ich mich da, o König! Ich warf das Ziegenfell ab und rief dem Riesen zu: »Dir zum Trotze bin ich nun doch frei!« »Aha!« sagte er,
»hast du mich überlistet! Nun, weil du so kühn warst, dich selbst zu befreien, will ich dir diesen Ring hier schenken. Nimm ihn, er wird dir nützlich sein.« »Ich will ihn nicht aus deiner Hand
nehmen,« rief ich, »aber wenn du ihn herwerfen willst, will ich ihn aufheben.« Er warf den Ring zu Boden, und ich hob ihn auf und steckte ihn an meinen Finger.
Darauf fragte mich der Riese: »Passt er dir?« »Jawohl,« antwortete ich. Da rief er: »Wo bist du, Ring?« Und der Ring sagte: »Hier bin ich.« Der Riese ging der Stimme des Ringes nach und kam immer
näher und näher, und ich merkte, dass ich mich in einer weit schlimmeren Lage befand, als je zuvor. Da zog ich meinen Dolch und schnitt mir den Finger ab und warf ihn, so weit ich konnte, in die
See hinaus, wo sie am tiefsten war. Wieder rief der Riese: »Wo bist du, Ring?« Und der Ring antwortete: »Hier bin ich« vom Meere herüber.
Mit einem Sprunge folgte er der Stimme des Ringes - da war er mitten in der See. Und ich stand dabei, wie er ertrank, und freute mich so unendlich darüber, als ich mich jetzt freuen würde, wenn
du, o König, mir mein eigenes Leben und das meiner anderen beiden Söhne schenken und mir jede weitere Strafe erlassen wolltest! Als von dem Riesen nichts mehr zu sehen war, da ging ich in die
Höhle und nahm den Schatz mit, den ich dort fand, und kehrte nach Hause zurück. Wie freuten sich alle, als sie mich wiedersahen! Zum Zeichen, dass die Geschichte wahr ist, die ich dir erzählt
habe, o König, sieh' her, ein Finger an meiner Hand fehlt.
»Wirklich, Conall,« sagte der König, »du bist nicht nur wortreich, sondern auch weise. Der Finger fehlt wirklich. Du hast nun auch deinem zweiten Sohn das Leben gerettet. Nun erzähle mir noch
einen Fall, da dir viel trauriger zumute war, als wenn du mitansehen müsstest, wie dein ältester Sohn gehängt wird, und du sollst auch den dritten Sohn behalten.«
»Kurze Zeit darauf,« begann Conall wieder, »ging mein Vater hin und suchte mir eine Frau aus, und wir wurden getraut.« Einst ging ich an der Meeresküste auf die Jagd. Weit draußen in der See
befand sich eine Insel. Wie ich so die Küste entlang gieng, erblickte ich ein Boot, das hatte vorne und hinten ein Tau und war mit allerlei Kostbarkeiten beladen. In meiner Begierde nach dem
Schatze stieg ich in das Boot. Kaum aber war ich darin, da fuhr es in das Meer hinaus und hielt erst, als es bei der Insel angelangt war. Ich stieg aus, da kehrte das Boot an seinen früheren
Platz zurück. Was sollte ich nun beginnen? Auf der Insel war kein Haus zu sehen weit und breit.
Ich ging weiter und kam auf den Gipfel eines Berges, von dort stieg ich in ein enges Tal hinab. Da sah ich in einer Höhle eine Frau sitzen. Die hielt ein nacktes Kind im Schoß und ein Messer in
der Hand. Sie schien die Absicht zu haben, dem Kind den Hals zu durchschneiden, aber das Kind blickte sie an und begann zu lachen. Da brach die Frau in Weinen aus und warf das Messer fort. Ich
rief die Frau an und fragte sie: »Was tust du hier?« Da sprach sie: »Wie kamst du her?« Und ich erzählte ihr Wort für Wort, was geschehen war. »Ganz so ist es mir ergangen,« sagte sie und zeigte
mir, auf welchem Wege ich zu ihr in die Höhle gelangen könnte.
Als ich vor ihr stand, fragte ich sie: »Warum wolltest du vorhin das Kind töten?« »Ich muss es für den Riesen, der hier lebt, braten, sonst tötet er mich.« In dem Augenblicke hörten wir auch
schon die Schritte des Riesen. »Was soll ich tun? Was soll ich tun?« schrie die Frau. Ich ging schnell zu dem Kessel hinüber, der glücklicherweise noch nicht sehr heiß war, und stieg hinein,
gerade als das Ungeheuer eintrat. »Hast du den Jungen gebraten?« fragte er. »Er ist noch nicht weich,« antwortete sie. Ich aber rief aus dem Kessel hervor: »Mütterchen, liebes Mütterchen, ich
brate!« Da lachte der Riese und sagte: »Hai, Hau, Hogaraich!« Dann tat er einen Haufen Holz in das Feuer.
Nun wusste ich, dass es um mich geschehen war. Zu meinem Glücke schlief aber das Ungeheuer neben dem Kessel ein. Als die Frau das sah, legte sie ihre Lippen an ein Loch in dem Deckel und fragte
mich leise: »Lebst du?« »Jawohl,« sagte ich. Dann hob ich den Kopf; das Loch war so groß, dass ich ihn bequem durchstecken konnte. Auch weiterhin ging es leicht, aber als ich meine Hüften
hindurchzwängte, da blieb meine Haut an dem Deckel zurück. Nun war ich wohl draußen, aber was nun? Die Frau sagte mir, außer der Waffe des Riesen sei in der ganzen Höhle keine zu finden. Da
begann ich ihm langsam den Speer aus der Hand zu ziehen, und bei jedem Atemzug, den er tat, glaubte ich, dass mein Ende gekommen war. Aber endlich hatte ich den Speer in meiner Gewalt.
Dann aber ging es mir nicht besser als einem, der unter einem Haufen Stroh Schutz sucht gegen einen heftigen Wind, denn die Waffe war meiner Hand zu schwer. Es war ein furchtbarer Anblick, den
Riesen anzusehen, der nur ein Auge mitten im Gesicht hatte; der Gedanke, ihn anzugreifen, war mir durchaus nicht angenehm. Da zog ich, so gut ich konnte, die Spitze aus dem Speer und stieß sie
dem Riesen ins Auge. Als er das Eisen spürte, fuhr er mit dem Kopfe auf, so dass das andere Ende der Lanzenspitze gegen die Decke der Höhle stieß und ihm den Kopf durchbohrte.
Mausetodt fiel er zu Boden, und du kannst mir glauben, o König, dass ich keine geringe Freude empfand. Die Frau und ich, wir brachten die Nacht außerhalb der Höhle zu, dann holte ich das Boot mit
all seinen Schätzen herbei, und das brachte uns sammt dem Kinde ans Land. Von da kehrte ich nach Hause zurück.
Die Mutter des Königs von Lochlann hörte die Erzählung Conalls mit an, während sie damit beschäftigt war, ein Feuer anzuzünden. »Bist du es,« fragte sie ihn, »der in die Höhle des Riesen kam?«
»Gewiss,« antwortete Conall, »ich bin es.« »Ach, ach!« rief da die Mutter des Königs aus, »ich bin die Frau, und mein Sohn hier ist das Kind, denen du damals das Leben gerettet hast. Dir sind wir
zu ewigem Danke verpflichtet.« Da freuten sich alle ungeheuer.
Der König aber sprach: »O Conall, was für Mühseligkeiten hast du erlitten! Jetzt gehört aber der Braune dir, und ich will ihn mit einem Sack voll der kostbarsten Edelsteine aus meiner
Schatzkammer beladen.« Nun begaben sich alle zur Ruhe. So früh aber auch Conall sich erhob, so war doch die Königin noch viel früher aufgestanden, um alles vorzubereiten. Conall erhielt den
Braunen und einen Sack voll Kostbarkeiten, und er zog mit seinen drei Söhnen nach Erin zurück. Das Gold und die Edelsteine lud er in seinem Hause ab, das Ross brachte er seinem Könige, der von
der Zeit ab ihm sehr gewogen war. Dann kehrte er zu seiner Frau zurück, und sie gaben ein herrliches Fest, wie es herrlicher noch nie auf Erden gefeiert wurde.
Anna Kellner: Englische Märchen
Eule, Taube und Fledermaus
Taube und Eule reisten einmal zusammen und kamen zur Abenddämmerung an einen alten Schuppen, wo sie zu übernachten beschlossen. In diesem alten Schuppen hauste der Häuptling eines
Fledermaus-Stammes mit seiner Familie, und als er die Fremden bemerkt hatte, lud er sie ein, mit ihm zu Abend zu speisen. Als die Eule genug von den leckeren Speisen und starken Getränken
genossen hatte, erhob sie sich und begann den Häuptling in folgender Weise zu loben:
'O du hochedle Fledermaus, deine Freigebigkeit ist groß, dein Ruhm unaussprechlich. Ich halte keinen dir gleich, dir und deiner erlauchten Familie. Auch kenne ich nicht deinesgleichen an Weisheit
und Gelehrsamkeit. Du bist tapferer als der Adler und schöner als der Pfau, und deine Stimme ist lieblicher als selbst die der Nachtigall.' Der Fledermaushäuptling war außerordentlich stolz über
dies Loblied, und nun erwartete er, daß die Taube ihn ähnlich anreden sollte, aber die Taube saß still am Tische, ohne zu beachten, was die Eule sagte, und ohne etwas dazu zu bemerken.
Endlich wandte sie sich um und dankte dem Fledermaushäuptling höflich für seine Gastfreundschaft und Freigebigkeit, ohne sonst etwas hinzuzufügen. Da sah die ganze Sippschaft voll Ärger auf die
Taube und blickte sie gar zornig an und warf ihr Mangel an Erziehung vor, weil sie den Häuptling der Fledermäuse nicht in zierlicher und höflicher Weise loben könne, wie es die Eule getan habe -
doch alles, was die Taube darauf sagte, war, daß sie Schmeicheleien hasse.
Darauf gerieten alle in große Wut, schlugen und verwundeten sie und warfen sie hinaus in die dunkle und sturmvolle Nacht, wo sie hungerte und fror bis zum Morgen.
Bei Tagesanbruch flog sie zum Adler und klagte über die Fledermaus und die Eule, der Adler aber schwur: wenn sich Fledermaus und Eule jemals bei Tage zeigten, so sollten alle Vögel der Erde sie
mißhandeln und verachten, aber den Tauben bewilligte er, daß sie immer in Schwärmen leben dürften, und er liebte und achtete sie von dieser Zeit an wegen ihrer Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe. Ein
Schwarm von Fledermäusen oder Eulen ist seitdem nicht mehr gesehen worden.
Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Volksmärchen
Assipattle
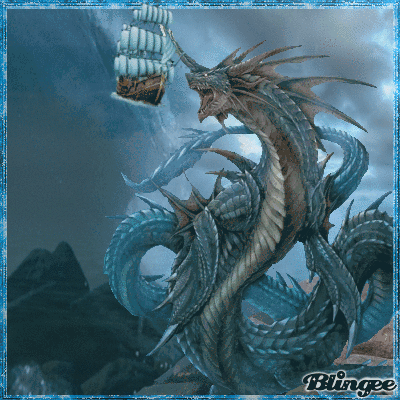
Das Gut Leegarth gehörte einem reichen Bauer aus Udale. Sein Gehöft lag in einem Thale, das von einem Bächlein durchzogen wurde, und war durch die umliegenden Berge gut geschützt. Er hatte eine sparsame, fleißige Frau und acht Kinder: sieben Söhne und eine Tochter. Der jüngste Sohn hieß Assipattle. Auf den schauten seine Brüder voll Verachtung herab, denn er arbeitete wenig oder gar nichts. Den ganzen Tag trieb er sich in zerlumpten Kleidern herum, aus seinem wirren, ungekämmten Haar flog bei dem leisesten Winde eine Aschenwolke auf. Nachtsüber aber lag er in der Asche.
Assipattle musste den Boden fegen, Torf bringen und sonst allerlei niedrige Arbeiten verrichten, für welche seine älteren Brüder sich zu gut dünkten. Diese pufften ihn und stießen mit dem Fuße nach ihm; die Frauen lachten ihn aus, kurz, er führte ein wahres Hundeleben. Fast alle Leute sagten, dass er es nicht besser verdiene. Seine Schwester aber war gut gegen ihn. Sie lauschte seinen langen Geschichten über Trolle und Riesen und ermutigte ihn, mehr davon zu erzählen; seine Brüder dagegen bewarfen ihn mit Erdklößen und befahlen ihm, mit seinen lügnerischen Geschichten aufzuhören. Über diese waren sie umso wütender, als Assipattle stets selbst der Held seiner Erzählungen war und immer siegreich aus den Abenteuern hervorging.
Eines Tages kamen Boten des Königs nach Leegarth und richteten dem Hausvater aus, dass er seine Tochter in das königliche Schloss senden möge, denn sie sei zur Magd der Prinzessin, der einzigen Tochter des Königs, bestimmt. Das Mädchen zog ihr bestes Kleid an, und ihr Vater machte ihr mit eigenen Händen ein Paar Sandalen. Sie war sehr stolz darauf, denn bis nun war sie immer barfuß gegangen. Dann setzte man sie auf ein Pony und schickte sie zu der Prinzessin.
Da kam böse Kunde ins Land. Es hieß, dass der Stoorworm, die große Seeschlange, nahe. Bei dieser Nachricht schlugen die mutigsten Herzen schneller. Und er kam wirklich. Er kehrte seinen
furchtbaren Rachen landeinwärts und gähnte, und wenn dann seine Kinnbacken sich wieder schlossen, so erbebte das Land und die See. Durch das Gähnen gab er zu verstehen, dass er das Land verwüsten
würde, wenn man ihn nicht gehörig fütterte. Sein giftiger Atem tötete jedes lebende Wesen, vernichtete alles, was die Erde hervorbrachte. Furcht erfüllte die Herzen der Menschen, und das Land
hallte wieder von ihren Wehklagen.
Nun lebte im Lande ein mächtiger Zauberer, dem waren alle Dinge kund. Aber der König konnte ihn nicht leiden, denn er hielt ihn für einen Heuchler. Drei Tage lang beriet sich nun der König mit dem Reichsrat, aber sie fanden kein Mittel, wie sie dem Stoorworm entrinnen oder ihn aus dem Lande verjagen könnten. Als die Räte keine Hilfe wussten, da kam die Königin in die Versammlung. Sie war eine sehr strenge, mutige Frau, groß und stark, kurz, ein Mannweib, und sie sprach zu den versammelten Räten: »Ihr seid sehr tapfer und kriegerisch, wenn ihr Männern gegenübersteht. Aber nun habt ihr es mit einem Feinde zu tun, der eurer Stärke spottet, gegen den eure Waffen so wenig vermögen, als wären sie Stroh. Nicht durch Schwert und Speer, einzig und allein durch Zauberkraft kann dieses Ungeheuer überwältigt werden. Beratet euch mit dem mächtigen Zauberer, dem alle Dinge kund sind: Weisheit siegt, wo Kraft unterliegt.«
Der Rat der Königin wurde einstimmig angenommen. Man rief den Zauberer und legte ihm die Sache vor. Der Zauberer war alt und grau und sah aus wie ein Popanz. Er sagte, dass die Frage keine geringfügige und schwer zu beantworten sei; doch wolle er am folgenden Tage bei Sonnenaufgang seine Meinung verkünden. Am nächsten Morgen teilte er dem Reichsrat mit, dass es nur ein Mittel gebe, den Stoorworm zu befriedigen und so das Land zu retten, und zwar müsse man ihm jede Woche einmal sieben Jungfrauen opfern. Wenn das Ungeheuer nicht nach einiger Zeit das Land verlasse, dann gebe es nur noch einen einzigen Ausweg, der sei aber so greulich, dass er ihn erst mitteilen wolle, wenn der erste Plan misslungen sei. So sprach der Zauberer. Sein Rat wurde angenommen und zum Beschlusse erhoben.
Und jeden Sonnabend wurden sieben Jungfrauen gebunden auf einen Felsen dem Ungeheuer hingelegt, und es öffnete seinen scheußlichen Rachen und verschlang die schönen jungen Mädchen; es war ein furchtbarer, herzzerreißender Anblick. Einmal gingen die Leute von Leegarth und der Umgebung auf den Gipfel eines Berges; von dort aus konnten sie sehen, wie das Ungetüm seine Mahlzeit hielt. Frauen weinten und schrien laut auf, starke Männer stöhnten, und ihre Gesichter wurden aschenfahl. Während alle in Wehklagen ausbrachen und jammerten, ob es denn keinen anderen Ausweg gebe, das Land zu retten, stand Assipattle plötzlich auf. Er betrachtete den Stoorworm mit weitgeöffneten Augen und sagte: »Ich fürchte mich nicht, gern möcht' ich das Ungeheuer bekämpfen.«
Da versetzte ihm sein ältester Bruder einen Fußstoß und hieß ihn sich in sein Aschenloch trollen. Aber auf dem Heimwege behauptete Assipattle von neuem, dass er das Ungeheuer töten wolle. Das prahlerische Reden empörte seine Brüder so sehr, dass sie mit Steinen nach ihm warfen, bis er entfloh. Am Abend schickte ihn seine Mutter zur Scheune, damit er seine Brüder zum Abendessen rufe. Diese waren gerade damit beschäftigt, Stroh für das Vieh zu dreschen. Als sie Assipattle erblickten, warfen sie ihn zu Boden und häuften das Stroh über ihm auf, so dass er fast erstickt wäre. Glücklicherweise kam sein Vater herbei und befreite ihn.
Beim Abendessen schalt der Vater seine Söhne wegen ihrer Roheit. Da sagte Assipattle: »Du hättest mir nicht zu Hilfe kommen müssen, Vater, ich wäre mit allen fertig geworden, wenn ich gewollt hätte.« Da lachten seine Brüder und fragten ihn: »Warum hast du es denn nicht versucht?« »Weil ich mit meinen Kräften haushalten muss,« erwiderte Assipattle, »bis ich gegen den Stoorworm ausziehe.« Da brachen sie alle in ein lautes Gelächter aus, und der Vater sagte: »Wenn ich aus den Hörnern des Mondes Kämme machen werde, dann wirst du gegen den Stoorworm kämpfen!«
Mittlerweile wurden die Klagen über den Verlust so vieler Jungfrauen immer lauter und drohender; wenn das so fortginge, jammerte das Land, würde bald keine einzige Jungfrau mehr übrig bleiben. So traten die Räte denn wieder zusammen und ließen den Zauberer kommen; den fragten sie nach dem zweiten Mittel.
Der hässliche Zauberer, dessen Bart bis zu den Knieen reichte, und dessen Haar ihn wie ein Mantel umschloss, erhob sich und sagte: »Mit bitterem Schmerze muss ich gestehen, dass es nur einen einzigen Ausweg gibt. Ach, wär' ich nie geboren, oder hätt' ich den Tag nicht erlebt, an dem ich das Schreckliche verkünden muss! Nicht eher wird der Stoorworm das Land verlassen, als bis die Tochter des Königs, die Prinzessin Gemdelovely, ihm geopfert worden ist.«
Große Stille herrschte in der Versammlung. Endlich erhob sich der König. Groß, grimmig und gramvoll stand er da. Er sprach: »Sie ist mein einziges Kind, das teuerste auf Erden. Sie sollte meine
Nachfolgerin auf dem Throne sein. Aber wenn ihr Tod das Land zu retten vermag, dann führt sie zum Tode. Es ziemt sich wohl, dass sie als die letzte des alten Geschlechts für ihr Land sterbe.«
Darauf fragte der Älteste, ob das der Beschluss des Reichsrates sei. Keiner sprach, aber alle streckten zum Zeichen ihrer Zustimmung die Hände empor. Sie taten es mit schwerem Herzen, denn alle liebten die Prinzessin Gemdelovely. Als der Älteste sich mit kummervoller Miene erhob, da sagte der Kämpe des Königs: »Ich beantrage einen Nachsatz zu diesem Beschlusse, und der sei: Verlässt das Ungeheuer, nachdem es die Prinzessin verzehrt hat, auch dann nicht das Land, so soll ihm der Zauberer vorgeworfen werden.« Dieser Antrag wurde mit lauter Zustimmung aufgenommen. Bevor der Beschluss Gesetzeskraft erlangte, bat der König um einen Aufschub von drei Wochen, damit er verkünden könne, dass derjenige Ritter, welcher den Stoorworm besiege, seine Tochter zur Frau bekomme. Die Frist wurde ihm bewilligt und darauf der Beschluss zum Gesetz erhoben.
Dann schickte der König Boten in alle benachbarten Reiche, die taten kund und zu wissen, dass derjenige, der mit dem Schwerte oder durch List den Stoorworm aus dem Lande vertreibe, Gemdelovely zur Frau erhalte und als Mitgift ihr rechtmäßiges Erbe, das Königreich und das berühmte Schwert Sickersnapper. Mit diesem Schwerte hatte einst Oddie seine Feinde bekämpft und vertrieben. So mancher Fürst und tapfere Ritter hielt diesen dreifachen Lohn - eine Frau, ein Königreich und ein Schwert - für das größte Glück auf Erden. Aber bei dem Gedanken an die bevorstehende Gefahr stand das Herz des Kühnsten stille.
Als Assipattles Vater aus der Versammlung mit der Nachricht nach Leegarth heimkehrte, dass die schöne Gemdelovely dem Ungeheuer geopfert werden müsse, da erhob sich überall großes Wehklagen, denn die Prinzessin wurde von allen geliebt, nur nicht von der Königin, die ihre Stiefmutter war. Was immer Assipattle auch denken mochte, als er von dem Beschlusse des Reichsrates erfuhr, er verriet es mit keinem Worte.
Es kamen sechsunddreißig tapfere Ritter ins Land, die wollten den Preis gewinnen. Aber als sie den Stoorworm erblickten, fielen zwölf von ihnen in Ohnmacht und mussten nach Hause getragen werden, zwölf wurden von solchem Entsetzen ergriffen, dass sie spornstreichs in ihre Heimat zurückkehrten, und zwölf verbargen ihre Angst und verblieben im königlichen Schlosse. An dem Abend vor dem Tag der Entscheidung veranstaltete der König ein großes Bankett. Es war ein trauriges Mahl - wenig wurde gegessen, noch weniger gesprochen. Wohl tranken die Männer reichlich, aber keiner von ihnen war zum Scherzen aufgelegt, denn der Gedanke an den folgenden Tag lastete ihnen schwer auf den Herzen.
Als alle außer dem Könige und seinem Kämpen sich entfernt hatten, da öffnete der König die Truhe, auf der er gesessen hatte. Dort bewahrte er seine Kostbarkeiten auf. Er holte das große Schwert Sickersnapper hervor. »O, Herr,« fragte der Kämpe, »wozu holst du Sickersnapper hervor? Morgen werden es sechsundneunzig Jahre, dass du das Licht der Welt erblickt hast. Manch wackere Tat hast du seither vollbracht, aber die Zeit des Kampfes ist für dich vorbei. Laß Sickersnapper liegen, mein König, du bist zu alt, ihn jetzt noch zu schwingen.«
»Schweig'!« rief der König aus, »oder ich werde meine Kraft an dir versuchen. Glaubst du wirklich, dass ich, der Nachkomme des großen Oddie, ruhig zusehen werde, wie ein Ungeheuer mein einziges Kind verschlingt, ohne dass ich für mein Fleisch und Blut kämpfe? Ich sage dir« - und er kreuzte die Daumen über der Schneide des Schwertes - »ich schwöre es, dass ich und mein gutes Schwert verderben werden, bevor meine Tochter stirbt. Jawohl, mein teurer Sickersnapper! Bevor der Stoorworm das Blut meines Kindes kostet, wirst du dich mit dem Blute des Ungeheuers färben. Du aber, mein treuer Kämpe, eile beim ersten Hahnenschrei an die Küste. Bereite mein Boot vor, rüste Mast und Segel und kehre den Kiel seewärts. Gib acht darauf, bis ich komme. Es ist der letzte Dienst, den du mir erweisen wirst. Gute Nacht, alter Waffengefährte.«
In Leegarth wurden an demselben Abend große Vorbereitungen getroffen, denn alle wollten am folgenden Morgen mit ansehen, wie sich das traurige Geschick der Prinzessin Gemdelovely erfüllte. Nur Assipattle sollte zu Hause bleiben und die Gänse hüten. Aber in der Nacht konnte Assipattle nicht schlafen, seine Gedanken hielten ihn wach. Da hörte er, wie seine Eltern miteinander sprachen.
Die Mutter sagte: »Also morgen werdet ihr alle fortgehen, um den Tod der Prinzessin mit anzusehen.«
Darauf erwiderte der Vater: »Du musst mitkommen, liebe Frau.«
»Ich glaube nicht,« sagte sie, »ich kann unmöglich zu Fuß gehen, und allein reite ich nicht gern.«
»Das brauchst du auch nicht,« sagte er, »ich setze dich hinter mich auf Teetgong, und so reiten wir zusammen, und ich verspreche dir, dass keiner vor uns dort sein soll.«
Teetgong war das schnellste Pferd weit und breit.
»Ach, wird es dir auch recht sein, vor all den Leuten mit so einem alten Weibe dahergeritten zu kommen?«
»Possen!« antwortete ihr Mann, »du weißt recht gut, dass ich keine andere als meine eigene Frau hinter mir aufsitzen lassen möchte.«
»Ich weiß nicht,« sagte die Frau, »aber ich habe mir schon manchmal gedacht, dass du mich nicht mehr gern hast.«
»Wer hat dir das in den Kopf gesetzt?« fragte er. »Was hab' ich je getan oder gesagt, woraus du schließen könntest, dass ich dich nicht lieb habe?«
»Nicht, was du sagst, sondern das, was du nicht sagst, veranlasst mich, an deiner Liebe zu zweifeln. Seit fünf Jahren frag' ich dich vergebens, woher es kommt, dass Teetgong der schnellste Renner
weit und breit ist, aber ich könnt' ebenso gut die Wand hier befragen. Ist das ein Zeichen wahrer Liebe?«
»Es geschah niemals aus Mangel an Liebe, gute Frau, höchstens aus Mangel an Vertrauen. Denn siehst du, liebe Frau, wir Männer glauben nun einmal, dass ihr Frauen eure Zungen nicht hüten könnt; da
hielt ich es denn für das Beste, das Geheimnis für mich zu bewahren; mir könnte es schaden, wenn ich es verrate, dir aber schadet es nichts, wenn du es nicht weißt. Indessen will ich dein Herz
nicht länger betrüben und dir das Geheimnis offenbaren. Wenn ich will, dass Teetgong still stehe, so gebe ich ihm einen Schlag auf die linke, wenn ich will, dass er schneller traben soll, zwei
auf die rechte Schulter. Will ich aber, dass er galoppiere, so schnell er kann, so blase ich durch die Gurgel einer Gans, die hab' ich immer in meiner rechten Rocktasche bereit. Wenn Teetgong
mich blasen hört, so rast er wie ein Sturmwind dahin. Nun, da du alles weißt, bist du hoffentlich beruhigt. - Und jetzt ist es Zeit zu schlafen, es ist schon sehr spät.«
Assipattle hatte alles gehört, aber er lag mäuschenstill da, bis er die Alten schnarchen hörte. Dann hielt es ihn nicht länger. Er nahm die Gurgel aus der Rocktasche seines Vaters und schlich wie ein Dieb zum Stall. Dort sattelte er Teetgong und führte ihn hinaus. Aber das Pferd spürte, dass es nicht die Hand seines Herrn war, die ihn hielt, und es sprang und bäumte sich wild auf. Da schlug Assipattle das Pferd auf die rechte Schulter, und es stand still wie eine Mauer. Assipattle schwang sich auf seinen Rücken und klopfte ihm zweimal auf die rechte Schulter, da setzte es sich in Bewegung. Aber in dem Augenblicke wieherte Teetgong laut. Das weckte den Hausvater, der sofort die Stimme seines Pferdes erkannte; er sprang auf und rief seine Söhne; sie stiegen alle zu Pferde, eilten im schnellsten Galopp nach und riefen: »Dieb! Dieb! Haltet den Dieb!«
Da schrie der Alte, der allen voran war, mit aller Macht:
»Br, br, he!
Steh', Teetgong, steh'!«
Als Teetgong dies hörte, blieb er unbeweglich stehen. Aber Assipattle zog die Gurgel heraus und blies, so fest er konnte. Jetzt flog Teetgong dahin wie der Wind, so dass Assipattle kaum atmen konnte. Tieftraurig über den Verlust Teetgongs kehrte der Alte mit seinen Söhnen heim.
Als der Morgen im Osten zu grauen begann, erreichte Assipattle die Meeresküste. In einem Tale legte er dem Pferde die Zügel lose um den Hals und band es fest. Dann ging er weiter, bis er zu einem kleinen Häuschen kam. Darin schlief eine alte Frau. Aus dem fast erloschenen Feuer nahm er ein Stück glimmenden Torfs, tat es in einen alten Topf und ging damit zur Küste. Dort sah er das Boot des Königs, das an einem Steine am Strande befestigt war. In dem Boote befand sich der Mann, der darauf achthaben sollte, bis der König käme.
»Schneidend kalt heute,« sagte Assipattle.
»Das weiß ich am besten,« sagte der Mann. »Ich sitze die ganze Nacht da, so dass mir das Mark in den Knochen erstarrt ist.«
»Warum kommst du nicht ein wenig auf den Strand, um dich zu erwärmen?«
»Wenn der Kämpe mich außerhalb des Bootes findet, so schlägt er mich halb tot!«
»Du bist ein kluger Mann. Eine kalte Haut ist dir lieber, als eine heiße. Aber ich muss ein Feuer anmachen, um mir ein paar Muscheln zu braten, denn der Hunger frisst mir sonst ein Loch in den
Magen.«
Und mit diesen Worten begann er ein Loch in den Boden zu graben, um darin ein Feuer zu machen. Nach einer Minute rief er: »Beim Himmel! Gold! Gold! So wahr ich meiner Mutter Sohn bin, hier liegt
Gold in der Erde!«
Als der Mann im Boot dies hörte, sprang er ans Land und stieß Assipattle unsanft zur Seite. Und während er im Boden scharrte, ergriff Assipattle seinen Topf, löste das Bootseil, sprang ins Boot und ruderte hinaus, ohne sich an das Schreien und Fluchen des anderen zu kehren. Als die Sonne über die Berge hervorzugucken begann, da hisste Assipattle die Segel und steuerte gerade auf den Kopf des Ungeheuers zu. Dieses lag da, so groß und mächtig wie ein Berg, und seine Augen glühten wie ein Wachtfeuer. Es war ein Anblick, der auch das mutigste Herz erschreckt hätte. Der Stoorworm war so groß, dass er sich über die halbe Welt erstreckte; seine Zunge war viele hundert Meilen lang und fegte, wenn das Untier zornig war, Bäume, Berge, ja ganze Städte ins Meer. Diese fürchterliche Zunge war gabelförmig, und das Ungeheuer benützte die Zinken wie eine Zange zum Ergreifen der Beute. Mit der Gabel konnte es das größte Schiff und die dicksten Mauern wie Nussschalen zerdrücken. Aber Assipattle kannte keine Furcht.
Mittlerweile war der König mit seinen Mannen herbeigekommen, und als er das Boot auf dem Meere als das seine erkannte, da geriet er in großen Zorn. Als Assipattle bei dem Kopfe des Ungeheuers angelangt war, strich er das Segel und harrte ruhig der Dinge, die da kommen würden. Sobald die Sonne dem Ungetüm in die Augen schien, gähnte es siebenmal, bevor es sein grausiges Frühstück begann, und jedesmal stürzte eine große Wasserflut in den geöffneten Rachen. Nun kam Assipattle ganz nahe an diesen heran, so dass beim zweiten Gähnen das Boot in die Strömung geriet; auf diese Weise wurde Assipattle sammt seinem Fahrzeug in den Rachen und von dort in die schwarze Kehle des Ungeheuers geschwemmt. Dort gähnte es Assipattle wie ein bodenloser Abgrund entgegen. Ihr glaubt wohl, dass er es dort sehr finster hatte; aber nein, Decke und Wände des Rachens glänzten in einem matten, silbernen Lichte.
Immer weiter, immer tiefer fuhr Assipattle wie auf einem Strome dahin. Der Himmel bewahre uns! Nicht um alles in der Welt möchte ich eine solche Fahrt unternehmen! Er steuerte so, dass sein Boot immer in der Mitte des Stromes blieb; aber je tiefer es hinuntergieng, desto seichter wurde das Wasser, das in die zahlreichen Höhlen zu beiden Seiten des Rachens abfloss. Nun wurde aber dieser so eng, dass die Mastspitze sich in den Gaumen einbohrte, während der Kiel auf dem Boden festsaß. Da sprang Assipattle aus dem Boot, nahm seinen Topf in die Hand und watete immer weiter und weiter, bis er bei der ungeheuren Leber der Seeschlange angelangt war. Da zog er seinen Bohrer hervor, grub ein Loch in die Leber und legte das glimmende Torfstück hinein. In das blies er mit vollen Backen, bis es zu brennen begann. Die Flamme ergriff das Öl der Leber, und in kürzester Zeit gab es ein stattliches Feuer. Wahrhaftig, das Ungeheuer hatte sich jetzt nicht über Kälte zu beklagen.
Assipattle aber eilte, so schnell ihn seine Füße tragen wollten, zum Boote zurück. Als die Seeschlange die Glut in ihrem Innern spürte, begann sie fürchterlich zu speien, und ungeheure Fluten ergossen sich aus ihrem Magen in das Meer. Eine derselben packte das Boot, brach den Mast wie ein dürres Reislein entzwei und warf Mann und Schifflein aufs Land. Der König und sein Volk hatten sich auf einen hohen Berg geflüchtet, wo sie vor den Fluten, die das Untier ausspie, und den Feuerflammen, die sie begleiteten, in Sicherheit waren.
Es war furchtbar, die Qualen der Seeschlange anzusehen, die immer größer wurden, je mehr sich das Feuer in ihrem Innern ausbreitete. Die Zunge fuhr aus dem Rachen und zuckte hin und her. In ihrer Qual reckte sie dieselbe so weit hervor, dass sie die Mondsichel berührte. Dann fiel sie mit solchem Gewichte auf die Erde zurück, dass das Festland gespalten wurde; die Meeresenge, die auf diese Weise entstand, ist dieselbe, die Dänemark von Schweden und Norwegen trennt. Darauf zog das Ungeheuer die lange Zunge wieder ein und rollte sich zu einem riesigen Klumpen zusammen. In seinem Schmerze hob es den Kopf dreimal bis zu den Wolken empor, und dreimal fiel es mit welterschütternder Gewalt in das Meer zurück. Der Himmel bewahre uns! Das erstemal schlug ihm der Fall eine Anzahl seiner Zähne aus, und aus diesen Zähnen sind die Orkney-Inseln entstanden. Das zweitemal verlor es abermals einige Zähne, das sind die Shetland-Inseln. Das drittemal fielen ihm wieder einige Zähne heraus, und diese bildeten die Faröer-Inseln. Der Klumpen aber, zu dem sich die sterbende Seeschlange zusammengerollt hatte, ist Island.
Die Seeschlange starb, aber noch brennt es unter der Insel fort, und von dem Feuer jenes Brandes kommen die feuerspeienden Berge auf Island her. Und nun muss ich euch erzählen, wie es Assipattle ergangen ist.
Der König umarmte und küsste und segnete ihn und nannte ihn seinen Sohn; er nahm seinen königlichen Mantel ab und legte ihn Assipattle um. Dann bestieg Assipattle den Teetgong und ritt an Gemdelovelys Seite; glückstrahlend zogen sie alle ins königliche Schloss. Assipattle und Gemdelovely wurden bald darauf ein Paar, und das Hochzeitsfest dauerte neun Wochen. Dann wurden sie König und Königin und lebten sehr glücklich und in großer Pracht und Herrlichkeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
Anna Kellner: Englische Märchen
Der Regenpfeifer

An einem Sabbat vergnügte sich das Christuskind mit anderen Kindern und formte Vögel aus Lehm. Nachdem sie sich schon ein Weilchen damit belustigt hatten, kam zufällig ein Sadduzäer bei ihnen vorbei, der war sehr alt und sehr streng und schalt die Kinder, daß sie sich an einem Sabbat mit etwas beschäftigten.
Er ließ es aber nicht einmal beim Schelten bewenden, sondern ging zu den Lehmvögeln hin und zerbrach sie alle, zum größten Schmerz der Kinder.
Als das Christuskind dies sah, segnete es alle die Vögelchen, die es gemacht hatte, daß sie allsobald lebendig wurden und in die Lüfte flogen. Diese Vögel heißen jetzt Regenpfeifer, und sie
lobsingen ihrem Herrn, daß er sie errettet hat aus der grausamen Hand des Sadduzäers.
Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Volksmärchen
Caolite Cosfhada

In alten Zeiten lebte einmal ein Ehepaar, und zwar in Grain-Leathan, nahe Bailean-Locha in der Grafschaft Roscommon. Sie waren schon über zwanzig Jahre verheiratet und hatten keine Kinder. Eines
Morgens ging Diarmuid - so hieß der Mann - aufs Feld, um zu versuchen einen Hasen zu erwischen. Es war eine Menge Schnee gefallen, und der Nebel hing so dick, daß man auf eine halbe Rute nichts
erkennen konnte. Diarmuid kannte sich auf jedem Zollbreit Boden gut aus, eine Meile ringsum. Aber trotzdem verirrte er sich. Er wollte zur Heide gehen, die am Rande eines Torfstichs lag, dort
pflegten Hasen zu sein.
Er wanderte immerfort, stundenlang, und konnte den Rand des Moores nicht finden, schließlich wollte er nach Hause, aber er fand auch nicht den Heimweg. Er ging, bis er ganz müde war, und setzte
sich dann hin. Da sah er einen alten Hasen herankommen. Er hob schon die Hand, um ihn niederzuschlagen. Doch der Hase sprang beiseite und sagte: "Halte deine Hand zurück, Diarmuid! Erschlag nicht
deinen Freund!" Diarmuid wäre bald umgefallen, so schwach wurde er vor Schreck. Als er wieder zu sich kam, stand der schwarze Hase vor ihm und sprach: "Hab keine Angst vor mir! Ich kam nicht, um
dir zu schaden, sondern um dir zu nutzen. Fasse Mut und höre zu:
Du hast den Weg verloren, denn du bist auf den Irrhügel geraten. Du würdest im Schnee umkommen, wenn ich mich nicht um dich gekümmert hätte. Du weißt ganz gut, daß du viele meines Stammes
umgebracht hast, und sie haben keine Rache an dir geübt. Ich werde dir sogar Gutes tun nach allem, was du an uns verübt hast! Sage mir deinen größten Herzenswunsch. Außer dem Himmelreich will ich
dir alles verschaffen, was du dir wünschst!" Diarmuid besann sich ein Weilchen und sagte: "Über zwanzig Jahre bin ich schon verheiratet und habe keine Kinder. Ich und meine Frau werden niemand
haben, der uns im Alter beisteht, der uns aufs Totenbett legt und uns betrauert. Es ist mein größter Herzenswunsch - und auch der meiner Frau - einen Sohn zu haben. Doch ich fürchte, jetzt sind
wir schon zu alt."
"Wahrhaftig, nein", sagte der Hase. "Deine Frau soll von heut in neun Monaten einen Sohn haben, und auf dem ganzen Erdenkreise wird nicht seinesgleichen zu finden sein. Jetzt folge meiner
Schneespur, ich will dich heimführen. Aber was dir auch begegnet - erzähle keiner lebenden Seele, daß du mich sahst. Und dann versprich mir, von jetzt ab keinen Hasen mehr zu töten!" "Ich
verspreche es dir!" sagte Diarmuid. Hierauf lief der Hase immer vor ihm her, bis sie an die Giebelseite des Hauses kamen. "Hier ist dein Haus", sagte der Hase. "Geh hinein!"
Als Diarmuid eintrat, hieß ihn Roise, seine Frau, willkommen und sagte: "Wo bist du nur den langen Tag gewesen? Ich wollte schon gehen und dich suchen. Du bist vor Kälte erstarrt und halbtot vor
Hunger." "In der Tat, sei du glücklich, Frau, daß ich nicht im Sumpfloch oder in der Sandgrube untersank. Ich bin auf den Irrhügel geraten und fand mich nicht mehr zurecht. Aber verlaß dich auf
mein Wort: Solange ich lebe, spüre ich keinem Hasen mehr nach!" Es war gut und war nicht schlecht. Diarmuid dachte an nichts weiteres als an den Erben, der ihm zugedacht war. Als er merkte, daß
Roise ihm gewiss ein Kind schenken würde, war er der glücklichste Mann, den man sich in der Welt nur denken kann. Er ließ eine Wiege bauen und alles herrichten für den jungen Erben, den er
erwartete.
Als die Nachbarn wahrnahmen, daß Roise schwanger war, fanden sie es sehr wunderbar, denn sie waren schon über fünfzig Jahre alt und hatten kein bißchen Fleisch an sich. Ihr Körper war wie bei
einer Siebzigjährigen, so ausgetrocknet. Alle Leute redeten von Roise und Diarmuid. Als neun Monate vergangen waren, bekam Roise einen kleinen Sohn. Diarmuid schickte den Frauen des Ortes eine
Einladung zum Festschmaus am Tage der Taufe. Er hätte sie besser da gelassen, wo sie waren! Als das Kind geboren wurde, war es gar nicht wie ein anderes. Es war vier Fuß lang, dünn wie ein Stock,
mit Füßen, die mehr als einen Fuß Länge hatten. Die Frauen staunten, alt und jung: Solch ein Neugeborenes wie dies hier hatten sie noch nicht gesehen!
Diarmuid gab ihnen Schnaps, und sie lobten das Kind, bis alles ausgetrunken war. Danach begannen sie, es schlechtzumachen. "Heißt es nicht Diarmuid?" fragte eine halb betrunkene Alte. "Nun",
meinte eine andere alte Frau, "es wäre recht verkehrt, ihn Diarmuid zu nennen. Caolite Cosfhada sollte er vielmehr heißen!" "Wir wollen ihm diesen Namen geben", sagte die erste Frau darauf. Roise
hörte die Reden mit an und wurde zornig. Sie rief Diarmuid und sagte ihm leise ins Ohr, daß die Frauen heimlich über den jungen Diarmuid spotteten, er solle sie aus dem Hause jagen. Diarmuid ging
auf die Frauen los und wollte sie hinauswerfen. Noch nie hatte es in Grain-Leathan ein solches Gekeife gegeben zwischen Diarmuid und den Frauen. Sie wollten keinen Fußbreit weichen. Diarmuid war
gezwungen, ihnen erst noch ein Fläschchen Schnaps auszugeben, bevor sie sich in Bewegung setzten. Aber wie dem auch war, der Name "Caolite Langfuß", blieb an dem jungen Diarmuid haften, solange
er lebte.
Als der Junge zehn Jahre alt war, hatte er mehr als sechs Fuß Länge. Dabei war er dünn wie eine Angelrute, und seine Füße maßen von den Knöcheln an anderthalb Fuß und waren schmal wie ein Daumen.
Was das Laufen anbelangte, übertraf ihn kein Jagdhund oder Windspiel in ganz Irland. Er ging selten aus dem Hause, denn die Leute machten sich über ihn lustig. Beim Ballschleudern brauchte
Caolite keinen Krückstock, sondern er trieb den Ball mit den Füßen. Und hatte er ihn erst vor sich, so holte ihn keiner ein!
Die Jahre vergingen, und Caolite wuchs. Mit einundzwanzig Jahren hatte er eine Länge von mehr als siebeneinhalb Fuß. Aber er war noch nicht dicker geworden, als er mit zehn Jahren gewesen war. An
ihm saß gerade soviel Fleisch wie an einer Zange. Dabei bekam er genug zu essen und zu trinken. Er verzehrte mehr als sieben Mann! Die Leute meinten, er war gar kein richtiger Mensch, sondern ein
alter Lorgadan. Und Eingeweide hatte er auch nicht. Jedoch Diarmuid und Roise fanden, es gab im ganzen Lande keinen halb so ansehnlichen jungen Mann wie ihn, und sie meinten, er würde noch dicker
und fetter werden, wenn er nur erst mit dem Wachsen aufhörte. Das Fleisch würde dann schon kommen. Indessen es kam nicht!
Eines Tages nun war Caolite mit seinem Vater im Torfstich, um dort Torf aufzustapeln. Da sahen sie einen Hase laufen, und zwar aus Leibeskräften. Ein Wiesel verfolgte ihn und kam ihm schon dicht
auf den Pelz. Da schrie der Hase, so laut er konnte, Caolite lief ihm nach und erwischte ihn, ehe ihn das Wiesel einholte. Nun war dies erbost und griff ihn an. Es zerriß und zerkratzte ihn und
warf ihm Schaum ins rechte Auge, daß er davon erblindete. Dann lief das Wiesel fort und verschwand in einem Torfhaufen. Während der ganzen Zeit hatte sich der Hase an Caolites Brust verkrochen.
Als das Wiesel fort war, sagte er: "Ich verdanke dir diesmal mein Leben, Caolite, aber du selbst bist auch in Gefahr. Das Wiesel ist eine Hexe, du hast jetzt nur ein Auge. Aber strecke deine Hand
in mein rechtes Ohr, und du wirst drin ein Fläschchen Öl finden. Reibe damit dein Auge ein, so wirst du dein Augenlicht wiederhaben, und es wird so gut sein, wie es war."
Caolite tat das und erlangte sein Augenlicht. Dann fuhr der Hase fort: "Nun laß mich wieder meiner Wege gehen. Immer wenn du für die Jäger einen Hasen aufspüren willst, komm hin zum Binsensumpf
am Seeufer, dort werde ich sein. Kein Jagdhund der Welt, kein Windspiel kann mich einholen. Nur du kannst mich greifen, wenn du Lust hast. Aber bei allem, was dir begegnet, liefere mich nicht den
Hunden und Jägern aus! Und nun sei auf der Hut heute Nacht! Das Wiesel wird dich aufsuchen und dir die Kehle zerschneiden, wenn du nicht den Kater von Brigid Ni Mathghamhain bei dir im Bett hast.
Du wirst eine Stimme vernehmen, die sagt:
"Es ist der Kater von Brigid Ni Math'uin,
Der den Speck fraß.
Und es ist der Kater von Brigid Ni Math'uin,
Der den Speck fraß."
Sobald du dies dreimal hintereinander gehört hast, laß den Kater los, und dann bist du ohne Gefahr." Caolite gab nun den Hasen frei und ging zu seinem Vater zurück. Er erzählte ihm, was sich
zugetragen hatte. "Aha!" sagte der Vater. "Der Hase ist dein bester Freund! Befolge seinen Rat! Aber sieh dich selbst vor und erzähle nichts von ihm den Nachbarn! Gib ihnen keinen Anlaß zum
Gerede! Denn erzählst du ihnen diese Geschichte, so kannst du weder in unserm Bezirk noch in den sieben nächsten ungestört leben!" "In der Tat, ich bin nicht so dumm", sagte Caolite. "Von Geburt
an war ich kein Schwätzer. Aber ich bitte dich, daß du hiervon auch meiner Mutter nichts erzählst."
Jeden Abend ging er hin zum Haus der Brigid Ni Mathghamhain und wollte sie um ihren Kater bitten. Als er nahe am Haus war, bemerkte er einen Fuchs. Caolite verfolgte ihn, und als er ihm dicht auf
den Pelz kam, ließ der Fuchs den Gänserich fahren und entwischte selbst in einen kleinen Wald nahebei. Caolite brachte den Gänserich zu Brigid und sagte zu ihr: "Der Fuchs hatte ihn schon
gepackt, doch ich habe ihm seine Beute entrissen." "Ich bin dir sehr dankbar", antwortete sie ihm. "Wünschest du irgend etwas? Oft kommst du nicht auf Besuch!" Ich wollte dich bitten, mir deinen
Kater zu leihen. Unser Mehlsack ist von Mäusen zerbissen." "Nimm ihn gern mit", sagte sie, "und behalte ihn, bis er alle Mäuse im Hause getötet hat, er ist ein Bursche, der's versteht, sie zu
vertreiben." Caolite trug den Kater heim und ging ins Bett.
Aber kein Schlaf kam in seine Augen. Etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht hörte er das Lied:
"Es ist der Kater von Brigid Ni Math'uin,
Der den Speck fraß.
Und es ist der Kater von Brigid Math'uin,
Der den Speck fraß.
Und es ist der Kater von Brigid Math'uin,
Der den Speck fraß."
Als er diese Worte dreimal vernommen hatte, war die Stimme ganz dicht bei ihm. Aber der Kater war tüchtig, sprang hervor und sagte: "Du Lügenhexe! Nicht ich, sondern du hast den Speck gestohlen!"
Und er griff das Wiesel an. Und so etwas von Kratzen und Kreischen hat noch nie ein Mensch gehört! Die arme Roise war rein närrisch vor Angst und vermochte nichts weiter zu sagen als: "Still!
Wirst du wohl raus, Katz!" Und das wiederholte sie, bis ihr die Kehle heiser war. Der Kampf dauerte an, bis der Tag dämmerte. Dann verließ das Wiesel das Schlachtfeld und verschwand in einem
Loch. Der arme Kater war ohne Haut und Haare. Als Caolite ihn anfassen wollte, sprach er: "Reibe mich mit dem Öl ein, das du im Ohr des Hasen fandest." Das tat Caolite und heilte ihn damit, so
daß er gesund war wie vorher. Caolite gab dem Kater Milch. Er ging dann heim, während Caolite einen Besen nahm und Haut und Haare auskehrte, aber Blutspuren blieben am Boden. Alles Wasser im See
hätte sie nicht fortwischen können!
Eines Tages gab es in der Grafschaft Roscommon eine große Jagd, und der Hirsch wandte sich Grain-Leathan zu. Caolite befand sich gerade auf dem Felde, als er sah, wie er kam und Hunde und Reiter
hinterdreinstürmten. Caolite setzte dem Hirsch nach, und einer der Jäger sagte zu ihm: "Gelingt es dir, ihn zurückzutreiben, ehe er über den Fluß setzt, gebe ich dir ein Goldstück. "Während er
noch mit Caolite redete, war ihnen der Hirsch schon weit voraus. Doch bald hatte Caolite ihn eingeholt und trieb ihn dann zurück. Er hielt nun an, bis der Jäger herankam, und er gab ihm dann ein
Goldstück. Der Hirsch lief dem See zu, als die Hunde ihm ganz nahe wurden, sprang er ins Wasser und schwamm auf die andere Seite. Die Hunde konnten ihm nicht mehr nach. As die Jäger das Seeufer
erreicht hatten, sagten sie zueinander: "Der Hirsch ist fort. Es gelingt uns nicht mehr, ihn heute noch aufzuspüren. Er entkam in dem Wald von Loch Glinn."
Caolite hörte ihr Gespräch mit an und sprach: "Ich wette meinen Kopf für zehn Penny, daß ich den Hirsch noch einhole und daß ich ihn zu euch zurücktreibe, noch ehe er halbwegs Loch Glinn
erreicht. Wenn es euch recht ist, wartet hier eine halbe Stunde. Ich schaffe euch den Hirsch her - oder gebe euch die Erlaubnis, mir den Kopf abzuschlagen." "Gut", sagten sie, "wir werden eine
halbe Stunde warten." Nun lief Caolite aus Leibeskräften und holte den Hirsch ein beim Hügel Breccna-Mor. Er trieb ihn zurück und hatte ihn bald wieder zum Seeufer gejagt. Als die Jäger sahen,
wie der Hirsch ankam und Caolite hinterdreinjagte, staunten sie und sagten, Caolite sei ein Tacharan, man müßte ihn aus der Gegend vertreiben. Doch sie hatten jetzt keine Zeit, etwas gegen ihn zu
unternehmen. Die Hunde jagten dem Hirsch nach, und sie selbst mußten folgen.
Der Hirsch lief immer vor ihnen her und wandte sich Caislean Riabhach zu. Dann bog er in ein kleines Gehölz nahe bei Bailean-Locha. Dort verloren sie ihn. Die Jäger gingen nach Caislean Riabhach.
Damit war die Jagd für den Tag beendet. Caolite ging nach Hause und war sehr zufrieden mit dem Goldstück und seinem Tagewerk. Er gab es seinem Vater und erzählte ihm, was er erlebt hatte. Etwa
eine Woche später war Caolite im Moor, um Heidekraut für die Kuh zu ziehen. Da kamen die selben Jäger wieder den Weg entlang. Sie fragten ihn, ob er einen Hasen gesehen hätte. "Nein", gab er zur
Antwort. "Aber ich weiß, wo ein Hase steckt." "Spüre ihn für uns auf!" sagte einer. "Wir werden dir dafür den Preis von ein paar Schuhen geben." "Das ist etwas, das ich nicht brauche", meinte
Caolite, "aber gebt mir den Preis für ein paar Hosen." "Ja", sagten sie. "Gebt es mir vorher", sprach Caolite. "Vergangene Woche gewann ich zehn Penny von den Jägern, sie haben sie mir nicht
gegeben. Bin ich auch wunderlich anzusehen, so bin ich doch kein Narr!" Sie gaben ihm fünf Geldmünzen und sagten ihm, er solle ihnen nun den Hasen auftreiben.
Dann ging er zum Binsenloch am Seeufer und spürte seinen Freund den Hasen, auf. Hunde und Jäger hetzten hinter ihm her. Er aber wandte sich dem Torfstich zu, und sie holten ihn nicht ein. Die
Jäger kamen fünf Tage hintereinander, und Caolite trieb alle Tage den Hasen für sie auf. Aber sie konnten ihn nicht fassen. Am sechsten Tage sagten sie zu Caolite, er sei ein Zauberer und habe
ihnen immer einen verhexten Hasen zugetrieben. "Ist das eure Vermutung, so treibt euch selbst einen zu!" versetzte Caolite. Da wollten sie ihn greifen, doch er war zu flink für sie. Sie
verfolgten ihn bis zu seinem Hause und forderten dort seinen Vater und seine Mutter auf, ihn herauszugeben, sie wollten ihn töten. "Was tat er euch?" fragte der Vater. "Er ist ein verhexter
Tacharan", erwiderten sie.
Als Roise das vernahm, kam sie herausgelaufen, sie setzte ihre Zunge in Bewegung! Aber ihr Reden half nichts, die Männer riefen, wenn Caolite nicht herauskäme, wollten sie das Haus in Brand
stecken. Als Caolite das hörte, griff er nach dem Schaufelstiel, Diarmuid nach der Zange und Roise nach dem Kesselhaken. Caolite lief hinaus, griff sie mit dem Spaten an und streckte sie nieder.
Und allen, die er hinwarf, gaben es sein Vater und seine Mutter mit Zange und Kesselhaken noch obendrein. Schließlich lagen alle Männer am Boden, unfähig sich zu wehren. Allmählich kamen sie zu
sich und verliefen sich nach und nach, bis auch der letzte fort war.
Nach einigen Tagen gingen sie zu einem Priester und beklagten sich heftig über Caolite und seine Eltern. "Ich werde hingehen zu Diarmuid", sagte der Priester, "und über diesen Fall Erkundigungen
einziehen." Am Morgen darauf ging der Priester zu Diarmuids Haus und bekam dort die Ursache des ganzen Streits zu hören. Er ging heim und schickte zu den Leuten, die die Klage vorgebracht hatten.
Weder Diarmuid ist zu tadeln noch seine Frau noch sein Sohn", sagte er. "Hättet ihr nicht angefangen, sie hätten euch kein Unrecht zugefügt. Und ich rate euch, sie in Ruhe zu lassen." Mit dem Rat
des Priesters waren sie nicht zufrieden. Sie verschworen sich, heimlich bei Nacht das Haus von Diarmuid anzuzünden, sobald er und seine Frau und der Sohn schliefen.
Am selben Tage ging Caolite zum Torfstich, um einen Korb Torf zu holen. Da traf er den Hasen, und der sagte: "Höre Caolite, heute nacht will eine Schar Leute zu eurem Hause, um dich, deinen Vater
und deine Mutter abzufackeln. Doch ich werde über ihre Augen einen Nebel decken, daß sie irregehen. Sie werden den Weg zu deinem Hause nicht finden, auch nicht zu ihrem eigenen, bis der Morgen
naht. Und wenn sie etwa noch einen Versuch gegen dich machen sollten, werde ich sie im See ertränken."
An jenem Abend wurde von Haus zu Haus die Losung gegeben: Alle, die zu Diarmuids Hause wollen, um es anzuzünden, sollten sich um Mitternacht am Kreuzweg treffen. Etwa zwanzig Mann versammelten
sich an Ort und Stelle. Sie gingen in Richtung auf Diarmuids Haus zu, aber sie fanden es nicht. Da wollten sie heimkehren, aber sie konnten weder ihr Haus noch ein anderes finden. Das dauerte,
bis der weiße Ring des Tages am Himmelsrand sichtbar wurde. Da sahen sie sich nach einer langen Nachtwanderung am Kreuzweg wieder, von dem sie ausgegangen waren. Von jener Nacht belästigten sie
weder Caolite noch seinen Vater noch die Mutter. Aber sie mieden ihn, als wäre er ein Spion oder Dieb.
Eines Tages war Diarmuid wieder beim Torfstich, als der alte schwarze Hase ankam, derselbe, der zu ihm gekommen war an jenem Morgen vor zweiundzwanzig Jahren, als er sich verirrt hatte. "Nun",
hub er an, "ich komme, um dir mitzuteilen, daß deine Lebenszeit und die deiner Frau nur noch kurz bemessen ist. Wenn ihr also etwas zu ordnen habt, macht es bald. Ihr habt nur noch eine Woche zu
leben!" "Und was wird aus Caolite, fragte Diarmuid, "wenn er keinen Menschen hat, der ihn schützt?" "Sorge dich nicht um Caolite", sprach der Hase. "Er ist von meinem Stamm, und ich werde ihn zu
mir nehmen. Und, mein Wort darauf - er wird glücklicher sein als unter seinen Nachbarn! Nun brauchst du nicht mehr das Geheimnis zu bewahren, sondern kannst es jedem erzählen."
Diarmuid war auf dem Heimwege tief betrübt, als er seinen Brudersohn traf. Er erzählte ihm die Geschichte von Anfang bis zu Ende. "In der Tat, wenn du diese Geschichte irgendeinem Menschen
erzählst, ist deine Familie entehrt, und wir finden keinen Menschen dazu, euch zu begraben." "Ich will sie keinem weitererzählen, nur Roise und dem Priester", sagte Diarmuid. Er ging nach Hause
und erzählte Roise die Geschichte. Als er zu Ende war, überkam sie einen Hustenanfall, und daran erstickte sie. Diarmuid und Caolite begruben sie. Am Ende derselben Woche starb auch Diarmuid. In
der Nacht, nachdem er begraben war, ging Caolite fort.
Seitdem hat keiner mehr von ihm gehört. Diarmuids Neffe konnte das Geheimnis nicht bei sich behalten, und nach kurzer Zeit lief die Geschichte von Mund zu Mund durch das Land. Viele Leute
behaupteten, sie hätten Caolite oft am See gesehen. Mag dem sein, wie es will - wir hoffen, daß sie alle im himmlischen Reich sind.
Märchen aus Irland
Der geblendete Riese

Zu Dalton bei Thirst in Yorkshire steht eine Mühle, die erst vor kurzem umgebaut wurde, aber als ich vor sechs Jahren dort war, stand das alte Gebäude noch. Vor dem Hause befand sich ein
länglicher Hügel, der den Namen Riesengrab führte, und in der Mühle zeigte man eine lange Eisenklinge; sie hatte einige Ähnlichkeit mit einer Sense, war aber nicht gekrümmt und wurde von den
Leuten das Riesenmesser genannt.
In der Mühle lebte ein Riese, welcher menschliche Gebeine zermahlte und daraus Brot buck. Eines Tages fing er einen Burschen aus Pillmoor, aber anstatt ihn zu zermahlen, behielt er ihn als
Knecht. Jack diente dem Riesen viele Jahre, durfte aber niemals ausgehen. Endlich ertrug er es nicht länger. Der Jahrmarkt in Topcliffe rückte heran, und der Bursche bat den Riesen um die
Erlaubnis, hinzugehen. Er wollte wieder einmal die Dirnen sehen und sich etwas kaufen. Aber der Riese verweigerte ihm den Urlaub. Da beschloss Jack, sich ihn eigenmächtig zu nehmen.
Es war ein heißer Tag, und nach dem Mittagessen legte sich der Riese in der Mühle zum Schlafen nieder, einen großen Laib Knochenbrot neben sich. Das Riesenmesser hielt er in der Hand, aber nur
leicht, denn er schlief. Jack ergriff die Gelegenheit, nahm das Messer vorsichtig in beide Hände und stieß es dem Riesen in sein einziges Auge.
Der erwachte mit einem schrecklichen Schrei und stürzte rasch zur Tür, um so den Ausgang zu verstellen. Das war ein neues Hindernis, aber Jack half sich bald. Der Riese hatte einen Lieblingshund,
der schlief gerade, als sein Herr geblendet wurde. Jack tötete den Hund, zog ihm die Haut ab, warf sich das Fell auf den Rücken und lief bellend auf allen Vieren dem Riesen zwischen den Beinen
durch.
So entkam er.
Anna Kellner: Englische Märchen
Cherry von Zennor
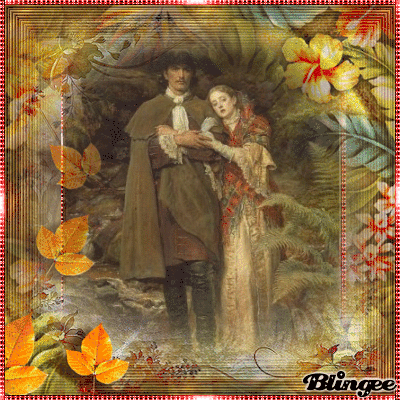
Auf den Felsen von Tereen in Zennor stand eine kleine Hütte, die aus zwei Zimmern und einem Alkoven bestand. Dort wohnte der alte Honey mit Weib und Kindern, zehn an der Zahl, welche alle dort geboren und erzogen worden waren. Sie lebten, so gut es ging, von dem Erträgnis der wenigen Morgen Landes. Der Boden war so dürftig, dass selbst eine Ziege nur mit Not darauf gedeihen konnte. Die vielen Schalen von Teller- und Herzmuscheln, die man auf Schritt und Tritt sah, ließen fast vermuten, dass die Familie sich hauptsächlich von solchen nährte, doch hatten sie täglich Fische und Kartoffeln, ja, an manchen Sonntagen kam sogar Suppe und Schweinefleisch auf den Tisch. Zu Weihnachten und an anderen Festtagen hatten sie weißes Brot. In der ganzen Gemeinde gab es keine gesünderen und schöneren Kinder als die des alten Honey. Doch werden wir uns nur mit einer seiner Töchter, mit Cherry, beschäftigen. Diese war flink wie ein Hase und immer lustig und guter Dinge.
Wenn der Müllerbursche ins Dorf kam und sein Pferd an den Schober trockenen Ginsters band, um nachzufragen, ob jemand Korn in die Mühle zu schicken habe, so saß sie in einem Augenblick auf dem Rücken des Pferdes und galoppierte zu den Felsen hinüber. Wenn der Müllerbursche ihr bis zu der zerklüfteten Küste nacheilte, so ritt sie die Steinhügel hinauf, und der schnellste Hund hätte sie nicht einholen können, der Müllerbursche aber schon gar nicht.
Als Cherry das dreizehnte Jahr überschritten hatte, wurde sie immer unzufriedener. Ein Jahr nach dem anderen versprach ihr die Mutter ein neues Kleid, dass sie so hübsch wie die anderen zur Messe
nach Morva gehen könnte, aber jedesmal fehlte das nötige Geld dazu, und Cherry hatte kein anständiges Kleid anzuziehen. Sie konnte weder zum Jahrmarkt, noch zur Kirche gehen.
So war Cherry sechzehn Jahre alt geworden. Eine ihrer Spielgefährtinnen hatte ein neues Kleid mit reichem Bänderschmuck bekommen und erzählte ihr, wie sie bei der Predigt in Nancledry gewesen sei, und wie viele Anbeter sie nach Hause begleitet hätten. Das erfüllte die vergnügungssüchtige Cherry mit fieberhafter Sehnsucht. Sie erklärte ihrer Mutter, dass sie sich im Unterlande einen Dienst suchen wolle, damit sie sich anständige Kleider anschaffen könne wie andere Mädchen.
Ihre Mutter wollte nun, dass sie nach Towednack ginge, damit sie hie und da Gelegenheit hätte, sie Sonntags einmal zu sehen. »Nein, nein!« erwiderte Cherry, »ich denke nicht daran, zu Leuten zu gehen, wo die Kuh vor lauter Hunger am Glockenstrang nagt, und wo man tagaus, tagein nichts als Fische und Kartoffeln und am Sonntag höchstens zur Abwechslung Aalpastete bekommt.«
Eines schönes Morgens band sich Cherry ihr Bündel zusammen und machte sich auf den Weg. Zuvor versprach sie ihrem Vater, so nahe als möglich einen Dienst anzunehmen und bei der ersten Gelegenheit nach Hause zu kommen. Der alte Mann sagte, sie sei verhext, doch ließ er sie fort, nachdem er ihr noch auftrug, sich weder von Matrosen, noch von Seeräubern entführen zu lassen. Cherry gieng die Straße entlang, welche nach Ludgvan und Gulval führte. Als der letzte Rauchfang von Tereen ihren Blicken entschwunden war, entsank ihr der Mut, und sie hatte große Lust, wieder umzukehren. Doch ging sie weiter. Endlich kam sie zu einem Scheidewege, wo vier Straßen sich kreuzten; da setzte sie sich auf einen Stein hin und weinte und dachte an ihr Heim, das sie vielleicht nie wiedersehen würde. Endlich beruhigte sie sich und beschloss, umzukehren und sich in ihr Schicksal zu fügen.
Als sie ihre Tränen trocknete und den Kopf hob, sah sie zu ihrer Überraschung einen Herrn auf sich zukommen. Sie begriff nicht, woher er so plötzlich gekommen war; noch vor wenigen Minuten war niemand auf den Hügeln zu sehen gewesen. Der Herr sagte ihr »guten Morgen«, erkundigte sich nach dem Wege nach Towednack und fragte sie, wohin sie gehe. Cherry erzählte ihm, dass sie heute morgens ihr Vaterhaus verlassen habe, um sich nach einem Dienst umzuschauen, dass ihr aber plötzlich der Mut entsunken sei und sie über die Hügel nach Zennor zurückkehren wolle. »Welch unerwarteter, glücklicher Zufall!« rief der Herr aus. »Ich bin heute früh vom Hause fortgegangen, um ein nettes, sauberes Mädchen zu suchen, das mir die Wirtschaft führen soll, und da treff' ich dich.«
Er erzählte Cherry, dass er vor kurzem Witwer geworden sei und einen lieben kleinen Knaben habe, den sie zu beaufsichtigen hätte. Cherry passte ihm ganz ausgezeichnet. Sie war hübsch und sauber, und wenn ihr Kleid auch so geflickt war, dass man nicht erkennen konnte, welches der ursprüngliche Stoff gewesen sei, so war sie doch lieblich wie eine Rose. Die arme Cherry verstand nicht den vierten Teil von dem, was der Herr zu ihr sprach, doch antwortete sie auf alles: »Jawohl, Herr.« Sie hatte es von ihrer Mutter gelernt, »Jawohl, Herr« dem Pfarrer oder jedem anderen Herrn zur Antwort zu geben, wenn sie ihn nicht verstand. Der Herr sagte ihr, er wohne nicht weit, im Unterlande, und sie würde nicht viel Arbeit haben, außer der Pflege des Kindes und dem Melken der Kuh. Cherry willigte also ein, mit ihm zu gehen.
Sie machten sich auf den Weg, und er sprach so freundlich zu ihr, dass sie gar nicht merkte, wie die Zeit verging, und ganz vergaß, welchen weiten Weg sie schon zurückgelegt hatte. Endlich befanden sie sich zwischen zwei dichten Hecken; kaum dass hie und da ein Sonnenstrahl durch das Laubwerk drang. So weit Cherry sehen konnte, gab es nichts als Bäume und Blumen. Der Duft der Feldrosen und des Geisblattes erfüllte die Luft, und rote, reife Äpfel hingen an den Bäumen. Dann kamen sie zu einem krystallhellen Bächlein, das quer über die Straße floss. Es war schon dunkel, und Cherry zögerte einen Augenblick und überlegte, wie sie wohl am besten das jenseitige Ufer erreichen könnte. Doch der Herr trug sie hinüber, so dass ihre Füße trocken blieben. Der Weg wurde immer enger und dunkler, und sie schienen stark bergab zu gehen. Cherry hielt sich fest an dem Arm des Herrn an; da er so freundlich gegen sie war, hatte sie die Empfindung, dass sie so mit ihm bis ans Ende der Welt gehen könnte.
Nach einer Weile öffnete der Herr ein Tor, das in einen wunderschönen Garten führte, und sagte: »Hier, liebe Cherry, wohnen wir.« Cherry traute ihren Augen kaum. Sie hatte noch nie eine solche Herrlichkeit gesehen. Blumen in den herrlichsten Farben umgaben sie; allerlei Früchte hingen an den Bäumen, und die Vögel jauchzten und jubelten. Die Großmutter hatte von Elfen und Geistern erzählt; war ihr Herr vielleicht einer von ihnen? Unmöglich. Er war so groß wie der Pfarrer. Und jetzt kam auch ein kleiner Junge den Kiesweg heruntergerannt und rief: »Papa, Papa!« Das Kind schien zwei oder drei Jahre alt zu sein, doch hatte es einen seltsamen alten Ausdruck im Gesicht. Die Augen waren glänzend und hatten einen durchdringenden Blick, das ganze Gesicht verriet List. Cherry sagte von ihm, dass niemand seinen Blicken standhalten könnte. Bevor sie noch ein Wort zu dem Knaben sprechen konnte, kam eine steinalte, dürre, hässliche Frau herbei; sie ergriff das Kind am Arm und zog es brummend und scheltend ins Haus. Dabei warf sie Cherry einen durchbohrenden Blick zu.
Als der Herr bemerkte, dass Cherry ein wenig außer Fassung geraten war, erklärte er ihr, dass die Alte die Großmutter seiner verstorbenen Frau sei, die nur so lange dableiben würde, bis Cherry sich ein wenig eingelebt haben würde; dann müsse sie fort, denn sie sei alt und launisch. Nachdem das junge Mädchen sich an dem Garten satt gesehen hatte, gingen sie in das Haus, das noch viel schöner war. Überall blühten die schönsten Blumen, und überall war heller Sonnenschein, und doch sah Cherry die Sonne nicht.
Mutter Prudence, so hieß die alte Frau, deckte den Tisch und trug verschiedene köstliche Gerichte auf. Nachdem Cherry sich herzhaft gestärkt hatte, hieß man sie zu Bette gehen, und zwar sollte sie mit dem Kinde in einem Dachzimmer schlafen. Prudence befahl ihr, jedenfalls, ob sie nun schlafe oder nicht, die Augen geschlossen zu halten, sonst könnte sie Dinge zu sehen bekommen, die ihr nicht gefallen würden. Auch dürfe sie die ganze Nacht hindurch nicht zu dem Kinde sprechen. Die Alte befahl ihr ferner, bei Sonnenaufgang aufzustehen und den Knaben an der Quelle im Garten zu waschen. Sodann sollte sie ihm die Augen mit einer Salbe bestreichen, die sich in einer Krystallbüchse in der Felsenspalte befand, keinesfalls aber dürfe sie sich die Augen damit berühren. Dann hatte sie die Kuh zu melken, und erst wenn ein Eimer damit voll war, von der letzten Milch dem Knaben eine Tasse voll zum Frühstück zu geben. Cherry verzehrte sich vor Neugierde. Mehrmals begann sie an das Kind Fragen zu richten, dieses aber unterbrach sie jedesmal mit der Drohung: »Ich werde es Mutter Prudence sagen.«
Früh morgens stand Cherry, den erhaltenen Befehlen gemäß, auf. Der kleine Knabe führte sie zu der krystallenen Quelle, welche aus einem Granitfelsen hervorquoll; dieser war mit Epheu und schönem Moos bewachsen. Sie wusch das Kind und bestrich seine Augen mit der Salbe. Ihr kleiner Schutzbefohlener sagte ihr, sie müsse nun die Kuh rufen. »Pruit, pruit, pruit!« rief Cherry, und siehe da! eine schöne, große Kuh kam unter den Bäumen hervor und blieb bei Cherry stehen. Kaum hatte sie die Hand an das Euter der Kuh gelegt, als vier Ströme von Milch rasch den Eimer füllten. Dann gab sie dem Knaben seine Tasse Milch, die er austrank. Darauf entfernte sich die Kuh, und Cherry kehrte ins Haus zurück, um sich in ihrem Tagewerk unterweisen zu lassen.
Mutter Prudence gab Cherry ein ausgezeichnetes Frühstück, dann befahl sie ihr, in der Küche zu bleiben und dort ihre Arbeiten zu verrichten: die Milch zu kochen, Butter zu machen und die Teller und Näpfe mit Wasser und Reibsand zu waschen. Sie riet ihr ferner, nicht neugierig zu sein, aus der Küche nicht fortzugehen und ja nicht zu versuchen, geschlossene Türen zu öffnen. Am zweiten Tage, als Cherry mit ihrer täglichen Arbeit fertig war, hieß sie ihr Herr in den Garten kommen. Sie sollte ihm helfen, die Äpfel und Birnen abzunehmen und die Zwiebelbeete zu jäten. Cherry war froh, aus der Nähe der Alten fortzukommen, denn diese schaute immer nur mit einem Auge auf die Strickerei, mit dem anderen durchbohrte sie die arme Cherry. Hie und da pflegte sie zu brummen: »Ich wusste es wohl, dass Robie irgend ein Närrchen aus Zennor mit heimbringen würde; es wäre besser für beide gewesen, sie wäre geblieben, wo sie war.«
Einige Tage darauf führte Prudence das junge Mädchen in den Teil des Hauses, den Cherry noch nicht gesehen hatte. Nachdem sie durch einen langen, dunklen Gang geschritten waren, musste Cherry ihre Schuhe ablegen, und sie traten in ein Zimmer, dessen Boden aussah wie Glas; rings umher, auf dem Boden und auf Gestellen befanden sich große und kleine versteinerte Menschen. Manche waren in Lebensgröße, anderen fehlten die Arme, wieder andere hatte nur Kopf und Schultern. Cherry sagte der alten Frau, dass sie nicht um alle Schätze der Welt weitergehe; sie glaubte von Anfang an, dass sie sich im Elfenland befinde, wo nur ihr Herr ein Mensch sei wie andere, nun wusste sie, dass sie bei Zauberern sei, die all diese Menschen zu Stein verwandelt hatten. Sie hatte in Zennor davon reden hören und fürchtete, dass sie jeden Augenblick ins Leben zurückkehren und sie auffressen könnten.
Die alte Prudence lachte Cherry aus und zog sie weiter fort. Sie zwang sie, einen Kasten, der Cherry wie ein Sarg auf sechs Beinen erschien, zu reiben, bis sie ihr Gesicht darin sehen würde. Da Cherry nicht feige war, so begann sie herzhaft zu reiben; die alte Frau stand strickend dabei und sagte hie und da: »Reibe, reibe, reibe! Fester! Schneller!« Verzweifelt rieb Cherry drauf los, so dass sie den Kasten fast umgestürzt hätte. Dieser gab nun einen solch kläglichen und gespenstischen Ton von sich, dass Cherry nicht anders glaubte, als dass all die steinernen Menschen lebendig geworden seien. In ihrem Schrecken fiel sie ohnmächtig nieder. Der Herr hörte das Geräusch und kam herbei, um nach der Ursache dieses Lärmes zu fragen. Er geriet in heftige Wut, dass Prudence Cherry in das verschlossene Zimmer geführt hatte, und jagte die Alte sofort aus dem Hause. Das junge Mädchen aber trug er in die Küche und brachte sie durch belebende Tropfen wieder zur Besinnung.
Cherry konnte sich nicht an das Geschehene erinnern, nur Eines wusste sie, dass der andere Teil des Hauses Schreckliches barg. Doch nun war sie Herrin - die alte Prudence war fort. Ihr Herr war so freundlich und gut, dass ein Jahr wie ein einziger Sommertag dahinschwand. Manchmal verließ er für einige Zeit das Haus; wenn er dann wiederkam, so verweilte er oft und lange in dem verwunschenen Zimmer, und Cherry hörte deutlich, wie er mit den steinernen Menschen sprach. Trotzdem das junge Mädchen alles besaß, was das Menschenherz sich nur wünschen konnte, war sie doch nicht glücklich; sie hätte so gern mehr über das Haus und die Menschen darin erfahren. Sie hatte die Entdeckung gemacht, dass durch die Salbe die Augen des Kleinen hell und klar wurden, und es kam ihr oft vor, dass er mehr sähe als sie. Sie wollte auch einmal die Salbe versuchen!
Als sie am folgenden Morgen den Knaben gewaschen, seine Augen mit der Salbe bestrichen und die Kuh gemolken hatte, schickte sie ihn fort, Blumen für sie zu pflücken, dann bestrich sie ihr Auge mit der Salbe. Da empfand sie einen heftigen, brennenden Schmerz und eilte, um ihn mit kühlem Wasser zu lindern, zur Quelle unter dem Felsen. Und siehe da! auf dem Grunde des Wassers sah sie hunderte von kleinen Leuten, zumeist Weiblein, sich ergötzen, und ihr Herr war darunter, nicht größer als die anderen. Alles war nun verändert. Überall war das kleine Volk zu sehen, in den tauglänzenden Blumen, auf den Zweigen der Bäume, unter den Grashalmen. An diesem Tage zeigte sich ihr Herr gar nicht; erst des Abends kam er in seiner gewöhnlichen Gestalt nach Hause. Er begab sich in das verwunschene Gemach, und bald hörte Cherry die herrlichste Musik.
Am folgenden Morgen verließ der Herr im Jagdgewand das Haus. Nachts kehrte er zurück und begab sich sofort in sein Zimmer. So verging ein Tag wie der andere, bis Cherry es nicht länger mehr aushalten konnte. Sie guckte durchs Schlüsselloch, und da sah sie ihn mit einer ganzen Menge Damen; eine von ihnen war wie eine Königin gekleidet, die spielte auf dem Sarge, während die anderen sangen. Am folgenden Tage blieb er zu Hause, um das Obst abzunehmen, und forderte sie auf, ihm dabei zu helfen. Darauf sagte sie, er möge sich von den kleinen Leuten helfen lassen, mit denen er sich immer unter dem Wasser unterhalte.
Da erkannte er, dass sie die Salbe benützt hatte. Sehr betrübt sagte er ihr nun, dass sie nach Hause gehen müsse, dass er keine Späher um sich dulden könne, und dass er Mutter Prudence wieder kommen lassen werde. Lange vor Tagesanbruch weckte er sie denn auch. Er schenkte ihr eine Menge Kleider und viele andere Sachen, nahm ihr Bündel in die eine und eine Laterne in die andere Hand und befahl ihr, ihm zu folgen. So gingen sie viele Meilen weit, immer bergauf, immer durch Hecken und enge Gänge. Als sie endlich auf die Ebene kamen, begann der Tag zu grauen.
Er nahm Abschied von ihr und sagte: »Das ist die Strafe für deine müßige Neugierde.«
Bei diesen Worten verschwand er.
Anna Kellner: Englische Märchen
Das widerspenstige Schwein

Eine alte Frau fegte ihr Zimmer, da fand sie eine Silbermünze. »Was,« sagte sie, »soll ich mit der Silbermünze anfangen? Ich werde auf den Markt gehen und mir
ein junges Schwein dafür kaufen.« Auf dem Rückwege musste sie über einen Zaun, aber das Schwein wollte nicht hinüber. Sie gieng ein Stückchen weiter und traf einen Hund. Da sagte sie zu ihm:
»Hund, Hund, beiße das Schwein, denn es will nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause kommen.«
Aber der Hund wollte nicht. Sie gieng ein Stückchen weiter und traf einen Stock. Da sagte sie: »Stock, Stock, schlage den Hund, denn der Hund will das Schwein
nicht beißen, das Schwein will nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause kommen.« Aber der Stock wollte nicht.
Sie gieng ein Stückchen weiter und traf ein Feuer. Da sagte sie: »Feuer, Feuer, verbrenne den Stock, denn der Stock will den Hund nicht schlagen, der Hund will
das Schwein nicht beißen, das Schwein will nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause kommen.« Aber das Feuer wollte nicht.
Sie gieng ein Stückchen weiter und traf etwas Wasser. Da sagte sie: »Wasser, Wasser, lösche das Feuer, denn das Feuer will den Stock nicht verbrennen, der Stock
will den Hund nicht schlagen, der Hund will das Schwein nicht beißen, das Schwein will nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause kommen.« Aber das Wasser wollte
nicht.
Sie gieng ein Stückchen weiter und traf einen Ochsen. Da sagte sie: »Ochs, Ochs, trinke das Wasser, denn das Wasser will das Feuer nicht löschen, das Feuer will
den Stock nicht verbrennen, der Stock will den Hund nicht schlagen, der Hund will das Schwein nicht beißen, das Schwein will nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause
kommen.« Aber der Ochs wollte nicht. Sie gieng ein Stückchen weiter und traf einen Fleischhauer. Da sagte sie: »Fleischhauer, Fleischhauer, schlachte den Ochsen, denn der Ochs will das Wasser
nicht trinken, das Wasser will das Feuer nicht löschen, das Feuer will den Stock nicht verbrennen, der Stock will den Hund nicht schlagen, der Hund will das Schwein nicht beißen, das Schwein will
nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause kommen.« Aber der Fleischhauer wollte nicht.
Sie gieng ein Stückchen weiter und traf einen Strick. Da sagte sie: »Strick, Strick, hänge den Fleischhauer auf, denn der Fleischhauer will den Ochsen nicht
schlachten, der Ochs will das Wasser nicht trinken, das Wasser will das Feuer nicht löschen, das Feuer will den Stock nicht verbrennen, der Stock will den Hund nicht schlagen, der Hund will das
Schwein nicht beißen, das Schwein will nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause kommen.«
Aber der Strick wollte nicht. Sie gieng ein Stückchen weiter und traf eine Ratte. Da sagte sie: »Ratte, Ratte, zernage den Strick, denn der Strick will den
Fleischhauer nicht aufhängen, der Fleischhauer will den Ochsen nicht schlachten, der Ochs will das Wasser nicht trinken, das Wasser will das Feuer nicht löschen, das Feuer will den Stock nicht
verbrennen, der Stock will den Hund nicht schlagen, der Hund will das Schwein nicht beißen, das Schwein will nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause kommen.« Aber die
Ratte wollte nicht.
Sie gieng ein Stückchen weiter und traf eine Katze. Da sagte sie: »Katze, Katze, erwürge die Ratte, denn die Ratte will den Strick nicht zernagen, der Strick
will den Fleischhauer nicht aufhängen, der Fleischhauer will den Ochsen nicht schlachten, der Ochs will das Wasser nicht trinken, das Wasser will das Feuer nicht löschen, das Feuer will den Stock
nicht verbrennen, der Stock will den Hund nicht schlagen, der Hund will das Schwein nicht beißen, das Schwein will nicht über den Zaun, und ich werde heute vor Nacht nicht nach Hause kommen.«
Aber die Katze sagte zu ihr: »Wenn du zu der Kuh dort drüben gehen und mir einen Teller voll Milch bringen willst, dann werde ich die Ratte erwürgen.« Da gieng die alte Frau zu der
Kuh.
Aber die Kuh sagte zu ihr: »Wenn du zu dem Heuschober dort drüben gehen und mir eine Handvoll Heu holen willst, so werde ich dir die Milch
geben.«
Da gieng die alte Frau zu dem Heuschober und brachte der Kuh das Heu. Sobald die Kuh das Heu gegessen hatte, gab sie der alten Frau die Milch, und die alte Frau
brachte sie der Katze in einem Teller. Sobald die Katze die Milch aufgeleckt hatte, begann sie die Ratte zu würgen, die Ratte begann den Strick zu zernagen, der Strick begann den Fleischhauer
aufzuhängen, der Fleischhauer begann den Ochsen zu schlachten, der Ochs begann das Wasser zu trinken, das Wasser begann das Feuer zu löschen, das Feuer begann den Stock zu verbrennen, der Stock
begann den Hund zu schlagen, der Hund begann das Schwein zu beißen, das Schwein sprang erschrocken über den Zaun, und so kam die alte Frau noch vor Nacht nach Hause.
Anna Kellner: Englische Märchen
Der Fischer und seine Seele

Jeden Abend fuhr der junge Fischer hinaus auf das Meer und warf seine Netze ins Wasser. Wenn der Wind vom Land her wehte, fing er nichts oder nur wenig, denn es war ein bitterer Wind mit
schwarzen Schwingen, und schwere Wellen bäumten sich ihm entgegen. Doch wenn der Wind zur Küste hin wehte, kamen die Fische aus der Tiefe herauf und schwammen in die Maschen seiner Netze, und er
trug sie zum Markt und verkaufte sie.
Jeden Abend fuhr er hinaus auf das Meer, und eines Abends war das Netz so schwer, dass er es kaum ins Boot ziehen konnte. Und er lachte und sprach bei sich selber: »Sicherlich habe ich alle
Fische gefangen, die schwimmen, oder eines der trägen Ungeheuer, über die die Leute sich wundern werden, oder sonst einen Gegenstand des Grauens, wonach die große Königin verlangen wird«, und er
nahm alle Kraft zusammen und zog an den groben Tauen, bis die langen Adern an seinen Armen hervortraten wie Linien von blauem Email auf einem Bronzegefäß. Er zog an den dünnen Tauen, und näher
und näher kam der Ring aus flachen Korken, und endlich stieg das Netz an die Oberfläche des Wassers. Aber kein Fisch war darin, auch kein Ungeheuer noch ein Gegenstand des Grauens, sondern nur
eine kleine Meerjungfrau, die fest schlief. Ihr Haar war wie ein feuchtes Vlies aus Gold, und jedes einzelne Haar wie ein Faden aus lauterem Gold in einer gläsernen Schale. Ihr Leib war wie
weißes Elfenbein, ihr Schwanz aus Silber und Perlmutt. Aus Silber und Perlmutt war ihr Schwanz, und grüner Seetang schlang sich darum; und wie Seemuscheln waren ihre Ohren und ihre Lippen wie
Meerkorallen. Die kalten Wogen schlugen über ihre kalten Brüste, und das Salz glitzerte auf ihren Augenlidern. So schön war sie, dass der junge Fischer bei ihrem Anblick von Staunen erfüllt
wurde, und er streckte seine Hand aus und zog das Netz nahe zu sich heran, lehnte sich über den Bootsrand und umfasste sie mit seinen Armen. Und als er sie berührte, stieß sie einen Schrei aus
wie eine aufgescheuchte Möwe, erwachte und blickte ihn mit malven- und amethystfarbenen Augen voll Entsetzen an und wand sich, um ihm zu entkommen. Er aber drückte sie fest an sich und wollte sie
nicht von sich lassen. Und da sie merkte, dass sie ihm auf keine Art entfliehen konnte, fing sie an zu weinen und sprach: »Ich bitte dich, lass mich gehen, denn ich bin eines Königs einzige
Tochter, und mein Vater ist alt und einsam.« Aber der junge Fischer antwortete: »Ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du gibst mir das Versprechen, dass du kommst, wann immer ich dich rufe,
und für mich singst, denn die Fische lauschen gern dem Gesang des Meervolks, und so werden meine Netze sich füllen.« »Wirst du mich wahrhaftig gehen lassen, wenn ich dir das verspreche?« rief die
Meerjungfrau. »Ich werde dich wahrhaftig gehen lassen«, sagte der junge Fischer. So gab sie ihm das Versprechen, das er verlangte, und beschwor es mit dem Eid des Meervolks. Und er löste seine
Arme von ihrem Leib, und sie sank nieder ins Wasser und erzitterte in fremdartiger Furcht.
Jeden Abend fuhr der junge Fischer hinaus auf das Meer und rief nach der Meerjungfrau, und sie stieg aus dem Wasser und sang für ihn. Rund um sie herum schwammen die Delphine, und die wilden
Möwen kreisten über ihrem Kopf. Und sie sang ein herrliches Lied. Denn sie sang vom Meervolk, das seine Herden von Höhle zu Höhle treibt und die kleinen Kälber auf der Schulter trägt; von den
Tritonen mit langen, grünen Bärten und einer behaarten Brust, die in gewundene Muschelhörner blasen, wenn der König vorbeizieht; vom Palast des Königs, der ganz aus Bernstein ist, mit einem Dach
aus klarem Smaragd und einem Boden aus strahlenden Perlen; und von den Gärten der See, wo die großen Filigranfächer der Korallen den ganzen Tag auf und nieder wallen und die Fische umherflitzen
gleich silbernen Vögeln und die Anemonen sich an den Felsen schmiegen und in geribbtem, gelbem Sand die Nelken knospen. Sie sang von den Sirenen, die von so herrlichen Dingen sagen, dass die
Kaufleute ihre Ohren mit Wachs verstopfen müssen, damit sie sie nicht hören und ins Wasser springen und ertrinken; von den versunkenen Galeeren mit ihren hohen Masten, und den erfrorenen
Matrosen, die sich ans Takelwerk klammern, und den Makrelen, die durch die offenen Bullaugen aus und ein schwimmen; von den kleinen Entenmuscheln, die große Reisen machen, sich an die Kiele der
Schiffe heften und rund um die weite Welt fahren; und von den Tintenfischen, die an den Rändern der Klippen leben und ihre langen schwarzen Arme ausstrecken und Nacht machen können, wann sie
wollen. Sie sang vom Nautilus, der ein eigenes Boot hat, aus einem Opal geschnitzt und gesteuert mit einem seidenen Segel; von den glücklichen Meermännern, die auf der Harfe spielen und den
großen Kraken in Schlaf zaubern können; von den kleinen Kindern, die die glitschigen Meerschweinchen einfangen und lachend auf ihren Rücken reiten; von den Meerjungfrauen, die im weißen Gischt
liegen und ihre Arme ausstrecken nach den Matrosen; von den Seelöwen mit ihren krummen Fangzähnen und von den Seepferden mit ihren dahin treibenden Mähnen.
Und wie sie so sang, kamen alle die Thunfische aus der Tiefe herauf, um ihr zu lauschen, und der junge Fischer warf seine Netze um sie und fing sie, und andere erlegte er mit dem Speer. Und wenn
sein Boot wohlgeladen war, sank die Meerjungfrau hinab ins Meer und lächelte ihm zu. Niemals jedoch kam sie ihm so nahe, dass er sie hätte berühren können. Oft rief er sie und flehte sie an, aber
sie kam nicht; und wenn er sie zu fassen suchte, tauchte sie wie eine Robbe ins Wasser und ließ sich den ganzen Tag nicht mehr sehen. Und jeden Tag wurde der Klang ihrer Stimme seinen Ohren
süßer. So süß war ihre Stimme, dass er seiner Netze und seiner List vergaß und sich nicht kümmerte um sein Handwerk. Mit zinnoberroten Flossen und Augen aus gebuckeltem Gold schwammen die
Thunfische in Scharen vorbei, er aber beachtete sie nicht. Müßig lag der Speer an seiner Seite, und seine Körbe aus Weidengeflecht blieben leer. Mit offenem Mund und vor Staunen dunklen Augen saß
er reglos in seinem Boot und lauschte und lauschte, bis die Seenebel um ihn krochen und der wandernde Mond seine braunen Glieder silbern färbte.
Und eines Abends rief er sie und sprach: »Kleine Meerjungfrau, kleine Meerjungfrau, ich liebe dich. Nimm mich zu deinem Bräutigam, denn ich liebe dich.« Aber die Meer Jungfer schüttelte den Kopf.
»Du hast eine menschliche Seele«, antwortete sie. »Wenn du nur deine Seele fort senden wolltest, dann könnte ich dich lieben.« Und der junge Fischer sprach bei sich selber: »Was nützt mir meine
Seele? Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht berühren. Ich kenne sie nicht. Wahrlich, ich will sie von mir senden, und große Freude wird meiner warten.« Und ein Freudenruf brach von seinen
Lippen, er stand auf in dem bunten Boot und streckte seine Arme aus nach der Meerjungfrau. »Ich will meine Seele fort senden«, rief er, »und du sollst meine Braut sein und ich dein Bräutigam, und
in den Tiefen des Meeres werden wir zusammen wohnen, und alles, wovon du gesungen hast, sollst du mir zeigen, und alles, was du begehrst, will ich tun, und nichts soll unsere Leben trennen.« Und
die kleine Nixe lachte vor Vergnügen und barg das Gesicht in ihren Händen. »Aber wie soll ich meine Seele von mir senden?« rief der junge Fischer. »Sag mir, wie ich es tun kann, und siehe es wird
geschehen!« »Ach! Ich weiß es nicht«, sprach die kleine Meerjungfrau. » Das Meervolk hat keine Seelen.« Und sie sank hinab in die Tiefe und blickte ihn sehnsuchtsvoll an.
Früh am nächsten Morgen, bevor die Sonne die Spanne einer Manneshand hoch über dem Hügel stand, ging der junge Fischer zum Haus des Priesters und klopfte dreimal an die Tür. Der Novize schaute
durchs Guckloch heraus, und als er sah, wer es war, schob er den Riegel zurück und sprach: »Tritt ein.« Und der junge Fischer trat ein und kniete auf den süß duftenden Binsen des Bodens nieder
und rief den Priester an, der aus der Heiligen Schrift las, und sprach zu ihm: »Vater, ich liebe eine aus dem Meervolk, und meine Seele hindert mich, nach meiner Lust zu tun. Sag mir, wie ich
meine Seele von mir sende, denn fürwahr, ich bedarf ihrer nicht. Welchen Wert hat meine Seele für mich? Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht berühren. Ich kenne sie nicht.« Und der
Priester schlug sich die Brust und antwortete: »Wehe, wehe, dein Geist ist irr, oder du hast von giftigen Kräutern gegessen; denn die Seele ist des Menschen edelster Teil, uns von Gott gegeben,
auf dass wir uns ihrer in edler Weise bedienen. Kein kostbarer Ding ist als eine menschliche Seele, nichts Irdisches kann sie aufwiegen. Alles Gold ist sie wert, das in der Welt ist, wertvoller
ist sie als die Rubine der Könige. Deshalb, mein Sohn, denk nicht weiter daran, denn dies ist eine Sünde, die nicht vergeben wird. Und was das Meervolk anlangt, so sind sie alle verloren, und
verloren ist, wer Umgang pflegt mit ihnen. Sie sind wie die Tiere des Feldes, die nicht das Gute vom Üblen scheiden, und für sie ist der Herr nicht gestorben.«
Als er die bitteren Worte des Priesters hörte, füllten die Augen des jungen Fischers sich mit Tränen, und er erhob sich von den Knien und sprach zu ihm: »Vater, die Faune leben im Wald und sind
froh, und auf den Klippen sitzen die Meermänner mit ihren Harfen aus rotem Gold. Lass mich sein wie sie, ich flehe dich an, denn ihre Tage sind wie die Tage der Blumen. Und meine Seele, was nützt
sie mir, wenn sie zwischen mir steht und dem, was ich liebe?« »Nichtswürdig ist die Liebe des Leibes«, rief der Priester und zog die Brauen zusammen, »und verächtlich und böse sind die
heidnischen Wesen, die Gott durch Seine Welt wandern lässt. Fluch über die Faune des Waldes, und Fluch über die Sänger des Meeres! Zur Nachtzeit habe ich sie gehört, und sie haben mich von meinem
Rosenkranz wegzulocken gesucht. Sie klopfen ans Fenster und lachen. Ins Ohr raunen sie mir die Mär ihrer verderblichen Wonnen. Sie versuchen mich mit Versuchungen, und wenn ich bete, schneiden
sie mir Fratzen. Verloren sind sie, sage ich dir, sie sind verloren. Für sie gibt es weder Himmel noch Hölle, und weder da noch dort sollen sie den Namen Gottes preisen.« »Vater«, rief der junge
Fischer, »du weißt nicht, was du sagst. Einmal fing ich eine Königstochter in meinem Netz. Sie ist schöner als der Morgenstern und weißer als der Mond. Für ihren Leib will ich meine Seele
hingeben, und für ihre Liebe den Himmel abtreten. Sage mir, worum ich dich bitte, und lass mich in Frieden ziehen.« »Hinweg! Hinweg!« schrie der Priester. »Deine Buhle ist verloren, und du sollst
mit ihr verloren sein.« Und er gab ihm keinen Segen, sondern jagte ihn von seiner Tür.
Der junge Fischer ging hinunter auf den Marktplatz, und er ging langsam, mit gebeugtem Kopf, wie jemand, der ein Leid trägt. Und als die Kaufleute ihn kommen sahen, begannen sie, miteinander zu
tuscheln, und einer von ihnen ging ihm entgegen und rief ihn beim Namen und sprach zu ihm: »Was hast du zu verkaufen?« »Ich will dir meine Seele verkaufen«, antwortete er. »Ich bitte dich, kauf
sie mir ab, denn ich bin ihrer müde. Was nützt mir meine Seele? Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht berühren. Ich kenne sie nicht.« Aber die Kaufleute verhöhnten ihn und sprachen: »Was
nützt denn uns eines Menschen Seele? Keine gekippte Silbermünze ist sie wert. Verkaufe uns deinen Leib als Sklave, und wir wollen dich in Seepurpur kleiden und einen Ring an deinen Finger stecken
und dich zum Liebling der großen Königin machen. Aber rede uns nicht von der Seele, denn uns ist sie ein Nichts, noch besitzt sie Wert für unser Geschäft.« - Der junge Fischer sprach bei sich
selber: »Wie seltsam! Der Priester sagt, die Seele sei alles Gold der Welt wert, und die Kaufleute sagen, sie sei weniger wert als eine gekippte Silbermünze.« Und er verließ den Marktplatz und
ging hinunter ans Gestade des Meeres und begann zu überlegen, was er tun sollte.
Zu Mittag fiel ihm ein, wie einer seiner Gefährten, der ein Sammler von Meerfenchel gewesen, ihm von einer jungen Hexe erzählt hatte, die am Ende der Bucht in einer Höhle wohnte und in
Hexenkünsten sehr beschlagen war. Und er machte sich auf und rannte, so begierig war er, seine Seele loszuwerden, und wie er rund um das Ufer der Bucht lief, folgte ihm eine Staubwolke. Am Jucken
ihrer hohlen Hand erriet die junge Hexe, dass er kam, und sie lachte und löste ihr rotes Haar. Umwallt von ihrem roten Haar stand sie am Eingang der Höhle, und in der Hand hielt sie einen
blühenden Zweig von wildem Schierling. »Was brauchst? Was brauchst?« rief sie, als er keuchend den Abhang heraufkam und sich vor ihr neigte. »Fische für dein Netz, wenn der Wind flau ist? Ich
habe eine kleine Rohrpfeife, und wenn ich darauf blase, kommen die Meeräschen in die Bucht gezogen. Aber sie hat ihren Preis, schöner Knabe, sie hat ihren Preis. Was brauchst? Was brauchst? Einen
Sturm, der die Schiffe scheitern lässt und Kisten voll reicher Schätze ans Land spült? Ich habe mehr Stürme als der Wind, denn ich diene einem, der stärker ist als dieser, und mit einem Sieb und
einem Eimer Wasser kann ich die großen Galeeren in den Meeresgrund schicken. Aber es hat seinen Preis, schöner Knabe, es hat seinen Preis. Was brauchst? Was brauchst? Ich weiß eine Blume, die
blüht im Tal, keiner kennt sie, nur ich. Purpurne Blätter hat sie und einen Stern im Herzen, und ihr Saft ist weiß wie Milch. Berührtest du mit dieser Blume die harten Lippen der Königin, durch
die ganze Welt würde sie dir folgen. Heraus aus dem Bett des Königs würde sie steigen, und durch die ganze Welt würde sie dir folgen. Und das hat seinen Preis, schöner Knabe, das hat seinen
Preis. Was brauchst? Was brauchst? Ich kann eine Kröte im Mörser zerstampfen und Brühe daraus machen, und die Brühe rühren mit der Hand eines Toten. Sprenge sie auf deinen Feind, wenn er schläft,
und er wird zu einer schwarzen Natter werden, und seine eigene Mutter wird ihn erschlagen. Mit einem Rad kann ich den Mond vom Himmel ziehen und in einem Kristall dir den Tod zeigen. Was
brauchst? Was brauchst? Sag mir, was du begehrst, und ich will es dir geben, und du sollst mir einen Preis zahlen, schöner Knabe, sollst mir einen Preis zahlen.«
»Mein Wunsch geht nur nach einem kleinen Ding«, sagte der junge Fischer, »und doch hat der Priester mir gezürnt und mich fortgejagt. Es ist nur nach einem kleinen Ding, und doch haben die
Kaufleute mich verhöhnt und mir's versagt. Deshalb komme ich zu dir, wenn auch die Menschen dich böse nennen, und was dein Preis auch sei, ich will ihn zahlen.« »Was willst du?« fragte die Hexe
und kam näher. »Ich will meine Seele von mir senden«, antwortete der junge Fischer.
Die Hexe erbleichte und schauerte und verbarg ihr Gesicht in ihrem blauen Umhang. »Schöner Knabe, schöner Knabe«, murmelte sie, »furchtbar ist, was du tun willst.« Er schüttelte seine braunen
Locken und lachte. »Meine Seele achte ich für nichts«, erwiderte er. »Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht berühren. Ich kenne sie nicht.«
»Was willst du mir geben, wenn ich es dir verrate?« fragte die Hexe und blickte mit ihren schönen Augen auf ihn nieder. »Fünf Goldstücke«, entgegnete er, »und meine Netze und das Haus aus
Flechtwerk, in dem ich wohne, und das bunte Boot, mit dem ich aufs Meer fahre. Sag mir nur, wie ich meine Seele loswerde, und ich will dir alles geben, was ich besitze.« Spöttisch lachte sie ihm
ins Gesicht und schlug ihn mit dem Schierlingszweig. »Ich kann die Blätter des Herbstes in Gold verwandeln«, antwortete sie, »und ich kann die bleichen Mondstrahlen zu Silber weben, wenn ich es
will. Er, dem ich diene, ist reicher als alle Könige dieser Welt, und er herrscht über ihre Länder.« »Was sonst soll ich dir geben«, rief er, »wenn dein Preis nicht Gold noch Silber ist?« Mit
ihrer schmalen weißen Hand strich die Hexe ihm übers Haar. »Du musst mit mir tanzen, schöner Knabe«, murmelte sie und lächelte ihm zu, während sie sprach. »Nichts als das?« rief der junge Fischer
verwundert aus und stand auf. »Nichts als das«, antwortete sie und lächelte ihm wieder zu. »Dann wollen wir bei Sonnenuntergang an einem geheimen Ort miteinander tanzen«, sagte er, »und wenn wir
getanzt haben, sollst du mir sagen, was ich zu wissen begehre.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn der Mond voll ist, wenn der Mond voll ist«, murmelte sie. Dann spähte sie um sich und horchte. Ein
blauer Vogel erhob sich schreiend aus seinem Nest und kreiste über den Dünen, und drei gefleckte Vögel raschelten durch das harte, graue Gras und pfiffen einander zu. Sonst war kein Laut zu
hören, außer dem Laut einer Woge, die sich unten an den glatten Kieselsteinen rieb. Da streckte sie ihre Hand aus und näherte sich ihm und brachte ihre trockenen Lippen nahe an sein Ohr. »Heut
Nacht musst du kommen, zum Gipfel des Berges«, flüsterte sie. »Sabbath ist, und Er wird dort sein.« Der junge Fischer fuhr zusammen und sah sie an, und sie zeigte ihre weißen Zähne und lachte.
»Wer ist Er, von dem du sprichst?« fragte er. »Was liegt daran?« antwortete sie. »Komm du heut Nacht und steh unter den Ästen der Hainbuche und warte, bis ich komme. Wenn ein schwarzer Hund auf
dich zuläuft, schlag ihn mit einer Weidenrute, und er wird von dir ablassen. Wenn eine Eule dich anruft, gib ihr keine Antwort. Wenn der Mond voll ist, bin ich bei dir, und auf dem Gras wollen
wir miteinander tanzen.« »Aber schwörst du, mir zu sagen, wie ich meine Seele von mir senden kann?« drang er in sie. Sie trat hinaus ins Sonnenlicht, und der Wind schlängelte sich durch ihr rotes
Haar. »Bei den Hufen des Geißbocks, ich schwöre es«, gab sie zur Antwort.
»Du bist die beste der Hexen«, rief der junge Fischer, »und gewiss will ich heute Nacht auf dem Gipfel des Berges mit dir tanzen. Ich wünschte zwar, du hättest Gold oder Silber von mir verlangt.
Doch was dein Preis auch sei, du sollst ihn haben, denn es ist nur ein Kleines.« Und er zog seine Mütze vor ihr und neigte tief sein Haupt, und von großer Freude erfüllt lief er zurück in die
Stadt.
Die Hexe sah ihm nach, wie er ging, und als er ihr aus den Augen war, trat sie in ihre Höhle; und sie nahm aus einer Lade von geschnitzter Zeder einen Spiegel und stellte ihn auf einen Balken,
und auf glühenden Holzkohlen verbrannte sie davor Eisenkraut und spähte durch das Gekringel des Rauchs. Und nach einer Weile ballte sie die Hände im Zorn. »Mein hätte er werden müssen«, murmelte
sie heiser. »Ich bin so schön wie sie.« Und diesen Abend, als der Mond aufgegangen war, stieg der junge Fischer hinauf zum Gipfel des Berges und stellte sich unter die Äste der Hainbuche. Wie ein
Schild von blankem Metall lag das Rund des Meeres zu seinen Füßen, und die Schatten der Fischerboote trieben in der kleinen Bucht. Eine große Eule mit gelben, schwefeligen Augen rief ihn beim
Namen, aber er gab ihr keine Antwort. Ein schwarzer Hund lief auf ihn zu und knurrte. Er schlug ihn mit einer Weidenrute, und jaulend lief der Hund weg. Um Mitternacht kamen wie Fledermäuse die
Hexen durch die Luft geflogen. »Hui!« riefen sie, als sie auf die Erde herabstießen, »hier ist einer, den wir nicht kennen!« Und sie schnüffelten umher, schwatzten miteinander und winkten
einander zu. Als allerletzte kam die junge Hexe, und ihr rotes Haar flatterte im Wind. Sie trug ein Kleid aus Goldgewebe, mit Pfauenaugen bestickt, und eine kleine Mütze aus grünem Samt saß auf
ihrem Kopf.
»Wo ist er, wo ist er?« kreischten die Hexen, als sie sie sahen, aber sie lachte nur und lief zur Hainbuche, nahm den Fischer an der Hand, führte ihn hinaus ins Mondlicht und begann zu tanzen.
Rundherum im Kreis wirbelten sie, und die junge Hexe sprang so hoch, dass er die scharlachroten Absätze ihrer Schuhe sehen konnte. Dann kam quer durch die Tanzenden das Geräusch eines
galoppierenden Pferdes, aber kein Pferd war zu sehen, und er fürchtete sich. »Schneller«, rief die Hexe, und sie warf ihre Arme um seinen Nacken, und ihr Atem war heiß auf seinem Gesicht.
»Schneller, schneller!« rief sie, und die Erde schien sich unter seinen Füßen zu drehen, und sein Hirn trübte sich, und eine große Angst überfiel ihn, wie vor Bösem, das ihn belauerte, und
endlich gewahrte er, dass unter dem Schatten eines Felsens eine Gestalt war, die zuvor nicht dort gewesen. Es war ein Mann, gekleidet in ein Gewand aus schwarzem Samt, nach spanischer Mode
geschnitten. Sein Gesicht war seltsam bleich, aber seine Lippen waren wie eine stolze rote Blume. Er schien müde, lehnte sich zurück und tändelte achtlos mit dem Knauf seines Dolches. Im Gras
neben ihm lagen ein Federhut und ein Paar Reithandschuhe, mit vergoldeten Schnüren besetzt und mit Staubperlen bestickt, die sich zu einem wunderlichen Muster fügten. Ein kurzer, mit Zobel
gesäumter Umhang hing von seiner Schulter, und seine feinen weißen Hände waren mit Ringen besetzt. Schwere Lider senkten sich über seine Augen. Der junge Fischer starrte ihn an, als bannte ihn
ein Zauber. Endlich trafen ihre Augen einander, und wo er auch tanzte, stets war ihm, als folgten ihm die Augen des Mannes. Er hörte die Hexe lachen und griff sie um den Leib und wirbelte sie wie
rasend um und um.
Plötzlich bellte ein Hund im Wald, und die Tänzer hielten inne und gingen in Paaren hin, knieten nieder und küssten des Mannes Hände. Als sie dies taten, berührte der Anflug eines Lächelns seine
stolzen Lippen, wie eines Vogels Schwinge das Wasser berührt, dass es sich lachend kräuselt. Doch lag Verachtung darin. Noch immer war sein Blick auf den jungen Fischer gerichtet. »Komm! Lass uns
anbeten«, raunte die Hexe, und sie führte ihn hin, und eine große Begierde erfasste ihn, zu tun, was sie verlangte, und er folgte ihr. Doch als er nahe heran war, schlug er, ohne zu wissen warum,
auf seiner Brust das Zeichen des Kreuzes und sprach den heiligen Namen aus. Kaum hatte er das getan, so kreischten die Hexen auf wie Falken und flogen hinweg, und das bleiche Gesicht, das ihn
angeblickt, zuckte in einem Schmerzenskrampf. Der Mann schritt hinüber zu einem kleinen Gehölz und pfiff. Ein kleines spanisches Pferd mit silbernem Geschirr kam ihm entgegengetrabt. Als er sich
in den Sattel schwang, wandte er sich um und blickte den jungen Fischer traurig an. Und die Hexe mit den roten Haaren versuchte ebenfalls wegzufliegen, aber der Fischer packte sie bei den
Handgelenken und hielt sie fest. »Gib mich frei«, rief sie, »und lass mich gehen. Denn du hast ausgesprochen, was nicht ausgesprochen werden soll, und jenes Zeichen gezeigt, das nicht erblickt
werden darf.«
»O nein«, erwiderte er, »ich lasse dich nicht gehen, du sagtest mir denn das Geheimnis.« »Welches Geheimnis?« sagte die Hexe, rang mit ihm wie eine wilde Katze und biss sich auf die
schaumgefleckten Lippen. »Du weißt es«, gab er zur Antwort. Ihre grasgrünen Augen wurden trüb vor Tränen, und sie sagte zum Fischer: »Verlange alles von mir, nur dies nicht.« Er lachte und hielt
sie nur um so fester. Und als sie sah, dass sie sich nicht befreien konnte, flüsterte sie ihm zu: »Ich bin wohl auch so schön wie die Tochter der See und so anmutig wie sie, die in den blauen
Wassern wohnen«, und schmeichelnd schmiegte sie sich an ihn und brachte ihr Gesicht dicht an das seine. Er aber stieß sie finster zurück und sprach: »Wenn du nicht das Versprechen hältst, das du
mir gegeben, will ich dich als eine falsche Hexe erschlagen.« Sie wurde grau wie die Blüte des Judasbaumes und erschauerte. »Sei es denn«, murmelte sie. »Es ist deine Seele und nicht meine. Mach
damit, was du willst.« Und sie zog aus ihrem Gürtel ein kleines Messer mit einem Griff aus grüner Natternhaut und gab es ihm.
»Wozu soll mir das dienen?« fragte er verwundert. Eine kleine Weile schwieg sie, und ein Ausdruck des Entsetzens flog über ihr Gesicht. Dann strich sie ihr Haar aus der Stirn zurück, lächelte ihn
seltsam an und sagte: »Was die Menschen den Schatten des Leibes nennen, ist nicht der Schatten des Leibes, sondern der Leib der Seele. Stelle dich ans Ufer des Meeres mit dem Rücken zum Mond und
schneide rund um deine Füße deinen Schatten weg, der der Leib deiner Seele ist, und heiß deine Seele, dich zu verlassen, und sie wird es tun.« Der junge Fischer zitterte. »Ist das wahr?« murmelte
er. »Es ist wahr, und ich wollte, ich hätte es dir nicht gesagt«, rief sie und umfasste weinend seine Knie. Er schob sie von sich und ließ sie im üppigen Gras, trat an des Gipfels Rand, steckte
das Messer in seinen Gürtel und begann hinabzusteigen. Und seine Seele, die in ihm war, rief heraus zu ihm und sprach: »Siehe! Alle diese Jahre habe ich bei dir gewohnt und war deine Dienerin.
Sende mich jetzt nicht von dir; denn was habe ich dir Übles getan?« Und der junge Fischer lachte. »Du hast mir nichts Übles getan, aber ich brauche dich nicht«, antwortete er. »Die Welt ist weit,
und da sind der Himmel und auch die Hölle und jenes trübe, dämmrige Haus, das zwischen beiden liegt. Gehe, wohin du willst, aber belästige mich nicht, denn meine Liebste ruft nach mir.« Seine
Seele beschwor ihn flehentlich, aber er achtete ihrer nicht, sondern sprang wie eine wilde Ziege mit sicherem Fuß von Klippe zu Klippe, und endlich erreichte er ebenen Grund und das gelbe Gestade
des Meeres.
Mit bronzenen Gliedern und anmutiger Gestalt, gleich einer von den Griechen geformten Statue, stand er am Strand, den Rücken zum Mond gekehrt, und aus dem Gischt hoben sich weiße Arme, die ihm
zuwinkten, und aus den Wogen erhoben sich Nebelgestalten, die ihm huldigten. Vor ihm lag sein Schatten, der der Leib seiner Seele war, und hinter ihm hing der Mond in der honigfarbenen Luft. Und
seine Seele sprach zu ihm: »Wenn du mich denn wirklich von dir treiben musst, so sende mich nicht ohne Herz fort. Die Welt ist grausam, gib mir dein Herz, dass ich es mitnehmen kann.« Er
schüttelte seinen Kopf und lächelte. »Womit sollte ich meine Liebste lieben, wenn ich dir mein Herz gäbe?« rief er. »Ach, habe Erbarmen mit mir«, bat die Seele. »Gib mir dein Herz, denn die Welt
ist sehr grausam, und ich fürchte mich.« »Mein Herz gehört meiner Liebsten«, antwortete er» »daher verweile nicht» sondern gehe mir aus den Augen.«
»Soll nicht auch ich lieben?« fragte seine Seele. »Hebe dich hinweg, denn ich bedarf deiner nicht«, rief der junge Fischer, und er nahm das kleine Messer mit dem Griff aus grüner Natternhaut, und
rings um seine Füße schnitt er seinen Schatten weg, und der Schatten erhob sich und stand vor ihm und blickte ihn an, und es war einer gerade so wie der andere. Der Fischer wich zurück und stieß
das Messer in seinen Gürtel, und ein Gefühl des Grauens überkam ihn. »Hebe dich hinweg«, murmelte er, »und lass mich dein Gesicht nicht mehr sehen.« »Und doch müssen wir einander wieder
begegnen«, versetzte die Seele. Ihre Stimme war leise und flötengleich, und wenn sie sprach, bewegten sich kaum ihre Lippen.
»Wie sollten wir einander wieder begegnen?« rief der junge Fischer. »Du willst mir doch nicht folgen in die Tiefen des Meeres?« »Einmal im Jahr will ich an diesen Ort hier kommen und dich rufen«,
erwiderte die Seele. »Vielleicht, dass du dann meiner bedarfst.« »Wie sollte ich deiner bedürfen?« rief der junge Fischer. »Doch es sei, wie du willst«, und er tauchte hinab in die Flut, und die
Tritonen stießen in ihre Hörner, und die kleine Meerjungfrau kam herauf, ihm entgegen, und sie schlang ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn auf den Mund. Und die Seele stand am einsamen Strand
und sah ihnen zu. Und als sie hinuntergesunken waren ins Meer, ging sie weinend über die Marschen davon.
Als ein Jahr vorüber war, kam die Seele herab ans Gestade des Meeres und rief den jungen Fischer, und er stieg empor aus der Tiefe und sagte: »Weshalb rufst du mich?« Und die Seele antwortete:
»Komm näher, auf dass ich mit dir rede, denn ich habe wunderbare Dinge gesehen.« Da kam er näher und lagerte sich im seichten Wasser, stützte den Kopf in die Hand und lauschte. Und die Seele
sagte zu ihm: »Als ich dich verlassen hatte, wandte ich mein Antlitz nach Osten und wanderte. Aus dem Osten kommt alles, was weise ist. Sechs Tage wanderte ich, und am Morgen des siebenten Tages
gelangte ich an einen Hügel, der im Land der Tataren liegt. Im Schatten eines Tamariskenbaumes setzte ich mich nieder, um Schutz vor der Sonne zu suchen. Das Land war dürr und ganz versengt von
der Hitze. Menschen bewegten sich auf der Ebene hin und her wie Fliegen, die über eine blanke Kupferscheibe kriechen. Zur Mittagsstunde erhob sich am flachen Horizont des Landes eine Wolke von
rotem Staub. Als die Tataren sie gewahrten, spannten sie ihre bemalten Bogen, schwangen sich auf ihre kleinen Pferde und jagten ihr entgegen. Kreischend flohen die Weiber zu den Wagen und
versteckten sich hinter Vorhängen aus Fellen.
In der Dämmerung kehrten die Tataren zurück, aber fünf von ihnen fehlten, und von denen, die zurückgekommen, waren nicht wenige verwundet. Sie schirrten ihre Pferde vor die Wagen und zogen eilig
davon. Drei Schakale kamen aus einer Höhle und schauten ihnen nach. Dann witterten sie mit ihren Nüstern in die Luft und trotteten in die entgegen gesetzte Richtung davon. Als der Mond aufging,
sah ich ein Lagerfeuer auf der Ebene brennen und ging darauf zu. Rund um das Feuer auf Teppichen saß eine Gesellschaft von Kaufleuten. Ihre Kamele waren hinter ihnen angepflockt, und die Neger,
die ihre Diener waren, stellten Zelte aus gegerbten Häuten im Sand auf und errichteten einen hohen Wall aus Opuntien. Als ich mich ihnen genähert hatte, erhob sich der Oberste der Händler, zog
sein Schwert und fragte mich nach meinem Begehr.
Ich erwiderte, ich sei ein Fürst in meinem Land und den Tataren entflohen, die getrachtet hätten, mich zu ihrem Sklaven zu machen. Der Anführer lächelte und wies auf fünf Köpfe, die auf hohen
Bambusstangen staken. Dann fragte er mich, wer der Prophet Gottes sei, und ich antwortete: Mohammed. Als der den Namen des falschen Propheten hörte, verneigte er sich, nahm mich bei der Hand und
hieß mich an seiner Seite sitzen. Ein Neger brachte mir Stutenmilch in einer hölzernen Schale und ein Stück gebratenen Lammfleisches. Bei Tagesanbruch machten wir uns auf die Reise. Ich ritt auf
einem rothaarigen Kamel an der Seite des Anführers, und ein Läufer, der einen Speer trug, lief vor uns her. Links und rechts von uns schritten die Krieger, und die Maultiere folgten mit den
Waren. Vierzig Kamele zählte ich, und die Maultiere waren zweimal vierzig an der Zahl.
Wir zogen vom Land der Tataren ins Land derer, die den Mond verfluchen. Auf den weißen Felsen sahen wir die Greife ihr Gold hüten und die schuppigen Drachen in ihren Höhlen schlafen. Wenn wir
über die Gebirge stiegen, hielten wir den Atem an, dass der Schnee nicht auf uns fiele, und jeder von uns band sich einen Gazeschleier vor die Augen. Wenn wir durch die Täler kamen, schössen aus
den Höhlungen der Bäume die Pygmäen mit Pfeilen nach uns, und zur Nachtzeit hörten wir die Wilden ihre Trommeln schlagen. Als wir zum Turm der Affen kamen, stellten wir Früchte vor sie hin, und
sie taten uns kein Leid. Als wir zum Turm der Schlangen kamen, gaben wir ihnen warme Milch in Messingschalen, und sie ließen uns vorüberziehen. Dreimal auf unserer Reise stießen wir an die Ufer
des Oxus. Wir überquerten ihn auf Flößen aus Holz und prallen Schwimmblasen aus Tierhäuten. Die Flusspferde wüteten gegen uns und wollten uns töten. Wenn die Kamele sie sahen, so zitterten sie.
Die Könige einer jeden Stadt erhoben Zoll von uns, verwehrten uns aber, durch ihre Tore zu schreiten. Sie warfen uns Brot über die Mauern, kleine, in Honig gebackene Maiskuchen, und Kuchen aus
feinem Mehl, mit Datteln gefüllt. Für jedes Hundert Körbe gaben wir ihnen eine Bernsteinperle. Wenn die Bewohner der Dörfer uns kommen sahen, vergifteten sie die Brunnen und flohen auf die
Berggipfel. Wir kämpften gegen die Magadäer, die alt zur Welt kommen und jedes Jahr jünger und jünger werden und sterben, wenn sie kleine Kinder sind; und gegen die Laktroiten, die von sich
sagen, sie wären die Söhne von Tigern, und sich selber gelb und schwarz bemalen; und gegen die Auranten, die ihre Toten in den Wipfeln der Bäume bestatten und selbst in dunklen Höhlen leben, auf
dass die Sonne, die ihr Gold ist, sie nicht töte; und gegen die Krimnier, die ein Krokodil anbeten und ihm Ohrringe aus grünem Gras geben und es mit Butter und frischem Geflügel nähren; und gegen
die Agazomben, die Hundsgesichtigen, und gegen die Silbaner, die Pferdefüße haben und schneller laufen als Pferde. Ein Dritteil unserer Schar fiel in der Schlacht, und ein Dritteil erlag dem
Mangel. Die übrigen murrten gegen mich und sagten, ich hätte ihnen Unglück gebracht. Da griff ich unter einen Stein, holte eine Hornviper hervor und ließ mich von ihr stechen. Als sie sahen, dass
ich davon nicht erkrankte, erschraken sie.
Im vierten Monat erreichten wir die Stadt Illel. Es war Nacht, als wir bei dem Hain anlangten, der außerhalb ihrer Mauern liegt, und die Luft war schwül, denn der Mond stand im Zeichen des
Skorpions. Wir pflückten die reifen Granatäpfel von den Bäumen und brachen sie auf und tranken ihren süßen Saft. Dann legten wir uns nieder auf unsere Teppiche und warteten auf die
Morgendämmerung. Und in der Morgendämmerung erhoben wir uns und klopften ans Tor der Stadt. Es war aus roter Bronze geschmiedet und mit Seedrachen und Drachen, die Flügel haben, ziseliert. Die
Wächter blickten von ihren Zinnen herab und fragten nach unserem Begehr. Der Dolmetscher der Karawane erwiderte, wir kämen mit viel Ware von der Insel Syrien. Sie nahmen Geiseln und sagten, sie
wollten zu Mittag das Tor für uns öffnen, und hießen uns bis dahin warten.
Als es Mittag war, öffneten sie das Tor, und als wir die Stadt betraten, kamen die Menschen in Scharen aus den Häusern, uns anzugaffen, und ein Ausrufer ging durch die ganze Stadt und rief durch
eine Muschel. Wir standen auf dem Marktplatz, und die Neger schnürten die bunten Stoffballen auf und öffneten die geschnitzten Kästen aus Sykomorenholz. Und als sie damit geendet hatten,
breiteten die Händler ihre seltenen Waren aus: gewachstes Linnen aus Ägypten, gefärbtes Linnen aus dem Land der Äthiopier, Purpurschwämme aus Tyrus und blaue Wandbehänge aus Sidon, Schalen aus
kühlem Bernstein, feine Gefäße aus Glas und seltsame Gefäße aus gebranntem Ton. Vom Dach eines Hauses sah uns eine Schar von Frauen zu. Eine von ihnen trug eine Maske aus vergoldetem Leder.
Am ersten Tag kamen die Priester und tauschten mit uns, und am zweiten Tag kamen die Vornehmen, und am dritten Tag kamen die Handwerker und die Sklaven. Und so ist es bei ihnen Brauch mit allen
Kaufleuten, solange sie in ihrer Stadt weilen. Und wir verweilten einen Mond lang, und als der Mond im Abnehmen war, wurde ich des Treibens müde und wanderte durch die Straßen der Stadt und
gelangte zum Hain ihres Gottes. Schweigend wandelten die Priester in ihren gelben Gewändern dahin unter den grünen Bäumen, und auf einem Pflaster aus schwarzem Marmor erhob sich das rosenrote
Haus, in dem der Gott seine Wohnung hatte. Seine Tore waren mit gestäubtem Lack bedeckt, und in erhabener Arbeit prangten darauf Stiere und Pfaue aus glänzendem Gold. Das Dach deckten Ziegel von
meergrünem Porzellan, und die vorspringenden Traufen waren mit Glöckchen behangen. Wenn die weißen Tauben vorüber flogen, schlugen sie mit ihren Flügeln an die Glöckchen und ließen sie klingeln.
Vor dem Tempel war ein Teich von klarem Wasser, mit geädertem Onyx gepflastert. Ich legte mich daneben hin, und mit meinen bleichen Fingern berührte ich die breiten Blätter. Einer der Priester
kam auf mich zu und blieb hinter mir stehen. An den Füßen hatte er Sandalen, eine aus weicher Schlangenhaut, die andere aus Vogelgefieder. Auf seinem Kopf trug er eine Mitra aus schwarzem Filz,
geschmückt mit silbernen Mondsicheln. In siebenfältigem Gelb war sein Gewand gewoben, und sein gekräuseltes Haar war mit Antimon gefärbt. Und nach einer kleinen Weile redete er mich an und fragte
mich nach meinem Begehr. Ich sagte ihm, mein Begehren wäre, den Gott zu sehen.
»Der Gott ist auf der Jagd «, sprach der Priester und blickte mich mit seinen schmalen, schrägen Augen seltsam an. »Sag mir, in welchem Wald, und ich will mit ihm reiten«, antwortete ich. Er
kämmte mit seinen langen, gespitzten Nägeln durch die weichen Fransen seiner Tunika. »Der Gott schläft«, murmelte er. »Sag mir, auf welchem Lager, und ich will bei ihm wachen«, erwiderte ich.
»Der Gott ist beim Festmahl« rief er. »lst der Wein süß, so will ich mit ihm trinken, und ist er bitter, so will ich gleichfalls mit ihm trinken«, war meine Antwort. Staunend neigte er den Kopf,
fasste mich an der Hand, half mir auf und führte mich in den Tempel hinein. Und in der ersten Kammer sah ich ein Götzenbild auf einem Thron aus Jaspis sitzen, besetzt mit großen, glänzenden
Perlen. Es war aus Ebenholz geschnitzt, und seine Gestalt war gleich der Gestalt eines Mannes. Auf seiner Stirn leuchtete ein Rubin, und dickflüssiges Öl tropfte von seinem Haar nieder auf seine
Schenkel. Seine Füße waren gerötet vom Blut eines frisch geschlachteten Zickleins, seine Lenden gegürtet mit einem Kupfergürtel, der mit sieben Beryllen besetzt war. Und ich sprach zu dem
Priester: »Ist das der Gott?«, und er antwortete: »Das ist der Gott.« »Zeig mir den Gott«, rief ich, »oder ich werde dich gewisslich töten.« Und ich berührte seine Hand, und sie verdorrte. Der
Priester flehte mich an und sprach: »Möge mein Herr seinen Diener heilen, und ich will ihm den Gott zeigen.« Da blies ich mit meinem Atem auf seine Hand, und sie ward wieder heil, und er
erzitterte und führte mich in die zweite Kammer, und ich sah ein Götzenbild auf einem Lotus aus Jade stehen, behängt mit großen Smaragden. Es war aus Elfenbein geschnitzt, und seine Gestalt war
doppelt so groß wie die Gestalt eines Mannes. Auf seiner Stirn glänzte ein Chrysolith, und seine Brüste waren mit Myrrhen und Zimt gesalbt. In einer Hand hielt es ein gebogenes Zepter aus Jade,
in der anderen einen runden Kristall. Es stand auf Kothurnen aus Messing, und von seinem dicken Nacken wand sich ein Kranz von Seleniten. Und ich sprach zu dem Priester: »Ist das der Gott?«, und
er antwortete mir: »Das ist der Gott.«
»Zeig mir den Gott«, schrie ich, »oder ich werde dich gewisslich töten.« Und ich berührte seine Augen, und sie waren blind. Und der Priester flehte mich an und sprach: »Möge mein Herr seinen
Diener heilen, und ich will ihm den Gott zeigen.« Da blies ich mit meinem Atem über seine Augen, und das Gesicht kam ihm zurück; er erzitterte wieder und führte mich in die dritte Kammer, und
siehe! dort war kein Götzenbild, noch ein Bild von anderer Art, sondern nur ein runder Spiegel aus Metall auf einem steinernen Altar.
Ich sprach zu dem Priester: »Wo ist der Gott?« Und er antwortete mir: »Es gibt keinen Gott außer diesem Spiegel, den du siehst, denn dies ist der Spiegel der Weisheit. Und er spiegelt alle Dinge
wider, die im Himmel und auf Erden sind, ausgenommen allein das Antlitz dessen, der in ihn hineinblickt. Dies allein spiegelt er nicht wider, auf dass er, der hineinblickt, weise sei. Viele
andere Spiegel sind hier, doch sie sind nur Spiegel der Meinungen. Dieser allein ist der Spiegel der Weisheit. Und die diesen Spiegel besitzen, sind allwissend, und nichts bleibt ihnen verborgen.
Und die ihn nicht besitzen, haben auch keine Weisheit. Deshalb ist er der Gott, und wir beten ihn an.« Und ich blickte in den Spiegel, und es war, wie er mir gesagt hatte. Und ich tat etwas
Seltsames; doch was es war, ist nicht wichtig, denn in einem Tal, nur eine Tagesreise von hier, habe ich den Spiegel der Weisheit verborgen. Lass mich nur wieder in dich ein und dein Diener sein,
und du sollst weiser sein als alle Weisen, und alle Weisheit soll dein sein. Lass mich nur wieder in dich eingehen, und keiner wird so weise sein wie du.« Aber der junge Fischer lachte. »Liebe
ist besser als Weisheit«, rief er, »und die kleine Meerjungfrau liebt mich.« »Nein, nichts ist besser als Weisheit«, sagte die Seele. »Die Liebe ist besser«, antwortete der junge Fischer und
tauchte hinab in die Tiefe, und die Seele ging weinend weg über die Marschen davon.
Als das zweite Jahr vorüber war, kam die Seele herab ans Gestade des Meeres und rief den jungen Fischer, und er stieg empor aus der Tiefe und sagte: »Was rufst du mich?« Und die Seele antwortete:
»Komm näher, auf dass ich mit dir rede, denn ich habe wunderbare Dinge gesehen.« Da kam er näher und lagerte sich im seichten Wasser und stützte den Kopf in die Hand und lauschte. Und die Seele
sagte zu ihm: »Als ich dich verließ, wandte ich mein Antlitz nach Süden und wanderte. Aus dem Süden kommt alles, was kostbar ist. Sechs Tage wanderte ich über die Landstraßen, die zu der Stadt
Aschter führen, über die staubigen, rötlichen Landstraßen wanderte ich, wo die Pilger ziehen, und am Morgen des siebenten Tages erhob ich meine Augen, und siehe! die Stadt lag zu meinen Füßen,
denn sie liegt in einem Tal. Neun Tore führen in diese Stadt, und vor jedem Tor steht ein bronzenes Ross, das wiehert, wenn die Beduinen niedersteigen von den Bergen. Die Mauern sind mit Kupfer
gepanzert, die Wachttürme auf den Wällen mit Messing überdacht. In jedem Turm steht ein Bogenschütze mit einem Bogen in der Hand. Bei Sonnenuntergang stößt er in ein hürnenes Horn.
Als ich die Stadt betreten wollte, hielten die Wachen mich auf und fragten mich, wer ich sei. Ich gab zur Antwort, ich sei ein Derwisch und auf dem Weg nach der Stadt Mekka, wo man einen grünen
Schleier habe, worauf in silbernen Lettern von der Hand der Engel der Koran gestickt wäre. Von Staunen erfüllt, forderten sie mich auf einzutreten. Drinnen war es wie in einem Basar. Wahrlich, du
hättest mit mir sein sollen. Über den engen Gassen flattern bunte Papierlaternen gleich großen Schmetterlingen. Wenn der Wind über die Dächer bläst, steigen und fallen sie wie farbige
Seifenblasen. Auf Seidenteppichen sitzen die Kaufleute vor ihren Buden. Sie haben glatte, schwarze Bärte, und ihre Turbane sind mit goldenen Zechinen bedeckt, und lange Schnüre von Bernstein und
geschnitzten Pfirsichkernen gleiten durch ihre kühlen Finger. Einige von ihnen verkaufen Galbanum und Narde, und seltsames Räucherwerk von den Inseln des Indischen Meeres, und das dickflüssige Öl
der roten Rosen, und Myrrhe und kleine, nageiförmige Nelken. Bleibt einer stehen, um mit ihnen zu sprechen, so werfen sie Weihrauchkörner auf ein Kohlenbecken und machen damit die Luft süß.
Ich sah einen Syrer, der in seinen Händen einen Stab hielt, dünn wie ein Schilfrohr. Graue Rauchfäden stiegen davon auf, und sein Geruch, da er brannte, war wie der Duft von rosa Mandelblüten im
Frühling. Andere verkaufen silberne Armreifen, über und über besetzt mit milchigblauen Türkisen, und Knöchelreifen aus Messingdraht, mit kleinen Perlen gesäumt, und in Gold gefasste Tigeraugen,
und die Klauen jener güldenen Katze, des Leoparden, gleichfalls in Gold gefasst, und Ohrringe aus durchbohrtem Smaragd, und Fingerringe aus gehöhlter Jade. Aus den Teehäusern steigt der Klang der
Gitarre, und die Opiumraucher mit ihren weißen, lächelnden Gesichtern blicken heraus auf die Vorübergehenden. Wahrlich, du hättest mit mir sein sollen. Mit ihren Ellbogen bahnen die Weinverkäufer
sich den Weg durch die Menge, große schwarze Schläuche auf ihren Schultern. Die meisten von ihnen verkaufen den Wein aus Schiraz, der so süß ist wie Honig. Sie schenken ihn aus in kleinen
metallenen Näpfen und streuen Rosenblätter darauf. Auf dem Marktplatz stehen die Obsthändler, die alle Arten von Früchten feilbieten: reife Feigen mit ihrem aufbrechenden purpurnen Fleisch,
Melonen, nach Moschus duftend und gelb wie Topase, Zitronen und Rosenäpfel und Trauben von weißem Wein, runde, rotgoldene Orangen und ovale Limonen von grünem Gold. Einmal sah ich einen Elefanten
vorübergehen. Sein Rüssel war mit Zinnober und Gelbwurz bemalt, und über seine Ohren spannte sich ein Netz von karmesinfarbenen seidenen Schnüren. Gegenüber einer der Buden hielt er an und
begann, die Orangen zu fressen, und der Händler lachte nur. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein seltsames Volk das ist. Wenn sie fröhlich sind, gehen sie zu den Vogelhändlern und kaufen
einen gefangenen Vogel im Käfig und lassen ihn frei, auf dass ihre Freude noch größer werde, und wenn sie traurig sind, geißeln sie sich selber mit Dornen, auf dass ihre Trauer sich nicht
mindere.
Eines Abends begegnete ich Negern, die eine schwere Sänfte durch den Basar trugen. Sie war aus vergoldetem Bambus gemacht, und die Tragstangen waren aus zinnoberrotem Lack, mit Pfauen aus Messing
beschlagen. Vor den Fenstern hingen dünne Vorhänge aus Musselin, bestickt mit Käferflügeln und feinen Staubperlen, und als die Sänfte vorüberzog, sah eine bleiche Zirkassierin heraus und lächelte
mir zu. Ich folgte der Sänfte, und die Neger blickten finster und beschleunigten ihre Schritte. Doch das kümmerte mich nicht. Ich fühlte, wie eine große Neugier über mich kam. Endlich verhielten
sie vor einem würfelförmigen weißen Haus. Es hatte keine Fenster, nur eine kleine Pforte, wie der Eingang zu einer Gruft. Sie setzten die Sänfte nieder und klopften dreimal mit einem kupfernen
Hammer. Ein Armenier in einem Kaftan aus grünem Leder spähte heraus, und da er sie erblickte, öffnete er und breitete einen Teppich auf den Boden, und die Frau stieg aus der Sänfte. Als sie
hineinging, wandte sie sich um und lächelte mir abermals zu. Nie hatte ich jemanden gesehen, der so bleich war. Als der Mond aufging, kehrte ich an denselben Ort zurück und hielt Ausschau nach
dem Haus, aber es war nicht mehr da. Als ich das sah, wusste ich, wer die Frau war, und warum sie mir zugelächelt hatte.
Wahrlich, du hättest mit mir sein sollen. Beim Fest des Neuen Mondes trat der junge Kaiser heraus aus seinem Palast und ging in die Moschee, um zu beten. Sein Haar und Bart waren mit
Rosenblättern gefärbt, und seine Wangen mit feinem Goldstaub gepudert. Die Flächen seiner Füße und Hände waren gelb von Safran. Bei Sonnenaufgang schritt er heraus aus seinem Palast in einem
Gewand aus Silber, und bei Sonnenuntergang kehrte er in einem Gewand aus Gold dahin zurück. Das Volk warf sich auf die Erde und verbarg sein Gesicht, aber ich verhielt mich nicht ebenso. Ich
stand neben der Bude eines Dattelverkäufers und wartete. Als der Kaiser mich erblickte, hob er seine bemalten Brauen und hielt an. Ich stand ganz ruhig und erwies ihm keine Huldigung. Die Leute
erstaunten über meine Verwegenheit und rieten mir, aus der Stadt zu fliehen. Ich beachtete sie nicht, sondern ging hin und setzte mich zu den Verkäufern fremder Götter, die man um ihres Gewerbes
willen verabscheut. Als ich ihnen erzählte, was ich getan hatte, gab mir jeder von ihnen einen Gott und bat mich, sie zu verlassen. Diese Nacht, da ich in dem Teehaus in der Straße der
Granatäpfel auf einem Kissen lag, traten des Kaisers Wachen ein und führten mich zum Palast. Als ich eintrat, schlossen sie jedes Tor hinter mir zu und legten eine Kette davor. Drinnen war ein
großer Hof, um den ein Arkadengang lief. Die Mauern waren aus weißem Alabaster, hier und dort mit blauen und grünen Ziegeln eingelegt. Die Pfeiler waren aus grünem Marmor, das Pflaster aus Marmor
in der Farbe von Pfirsichblüten. Nie zuvor hatte ich Ähnliches gesehen. Da ich über den Hof ging, sahen zwei verschleierte Frauen von einem Balkon herab und verwünschten mich. Die Wachen hasteten
vorwärts, und die Schäfte ihrer Lanzen hallten auf dem blanken Boden. Sie öffneten ein Tor aus geschnitztem Elfenbein, und ich fand mich in einem wohlbewässerten, in sieben Terrassen ansteigenden
Garten. Er war bepflanzt mit Tulpen und Mondblumen und silberdurchwirkten Aloen. Wie ein schlankes Schilfrohr aus Kristall hing ein Springbrunnen in der schwärzlichen Luft. Die Zypressen glichen
ausgebrannten Fackeln. Auf einer von ihnen sang eine Nachtigall. Am Ende des Gartens stand ein kleiner Pavillon. Als wir uns ihm näherten, traten zwei Eunuchen heraus und kamen uns entgegen. Ihre
fetten Leiber schwappten beim Gehen, und mit ihren gelblidrigen Augen blickten sie mich neugierig an. Der eine von ihnen zog den Hauptmann der Wache beiseite und flüsterte ihm mit leiser Stimme
etwas zu. Der andere kaute schmatzend duftende Pastillen, die er mit einer gezierten Geste einer ovalen Dose aus lila Email entnahm. Nach wenigen Augenblicken entließ der Hauptmann der Wache die
Soldaten. Sie gingen zurück zum Palast; langsam folgten ihnen die Eunuchen, die im Vorübergehen süße Maulbeeren von den Bäumen pflückten. Einmal wandte der ältere der beiden sich um und lächelte
mir zu mit einem üblen Lächeln. Dann winkte mich der Hauptmann der Wache zum Eingang des Pavillons. Ohne Zittern schritt ich vorwärts, schlug den schweren Vorhang zur Seite und trat ein.
Der junge Kaiser ruhte ausgestreckt auf einem Lager aus gegerbten Löwenfellen, und ein Gerfalke hockte auf seinem Handgelenk. Hinter ihm stand ein Nubier mit einem Turban aus Messing, nackt bis
zu den Hüften und mit schweren Ohrringen in seinen gespaltenen Ohren. Auf einem Tisch neben dem Ruhebett lag ein mächtiger Türkensäbel aus Stahl. Als der Kaiser mich erblickte, runzelte er die
Stirn und sagte zu mir: »Was ist dein Name? Weißt du nicht, dass ich der Kaiser dieser Stadt bin?« Aber ich gab ihm keine Antwort. Er deutete mit seinem Finger auf den Türkensäbel, und der Nubier
ergriff ihn, stürzte vorwärts und hieb nach mir mit großer Gewalt. Die Klinge zischte durch mich hindurch und tat mir keinen Schaden. Der Mann fiel der Länge nach auf den Boden, und als er
aufstand, klapperten seine Zähne vor Entsetzen, und er verbarg sich hinter dem Lager. Der Kaiser sprang auf, riss eine Lanze aus einem Waffenständer und schleuderte sie auf mich. Ich fing sie in
ihrem Flug und zerbrach den Schaft in zwei Teile. Er schoss nach mir mit einem Pfeil, aber ich hob meine Hände empor, und der Pfeil stand mitten in der Luft still. Da zückte der Kaiser einen
Dolch aus einem Gürtel aus weißem Leder und bohrte ihn dem Nubier in den Hals, dass der Sklave seine Schmach nicht verriete. Der Mann krümmte sich wie eine zertretene Schlange, und roter Schaum
troff von seinen Lippen.
Kaum war er tot, wandte sich der Kaiser zu mir, und nachdem er mit einem kleinen Mundtuch aus bestickter purpurfarbener Seide sich den glänzenden Schweiß von der Stirn gewischt hatte, sprach er:
»Bist du ein Prophet, dass ich dir kein Leid tun kann, oder der Sohn eines Propheten, dass ich dich nicht zu verwunden vermag? Ich bitte dich, verlass meine Stadt noch diese Nacht, denn solange
du in ihr weilst, bin ich nicht länger ihr Herr.« Und ich antwortete ihm: »Um die Hälfte deines Schatzes will ich gehen. Gib mir die Hälfte deines Schatzes, und ich will von hinnen ziehen.« Er
nahm mich bei der Hand und führte mich hinaus in den Garten. Als der Hauptmann der Garde mich sah, erstaunte er sehr. Als die Eunuchen mich erblickten, schlotterten ihre Knie, und sie fielen in
Furcht zu Boden. Im Palast gibt es eine Kammer mit acht Wänden aus rotem Porphyr und einer messinggeschuppten Decke, die mit Lampen behangen ist. Der Kaiser berührte eine der Wände, und sie
öffnete sich, und wir schritten einen Gang hinunter, der von vielen Fackeln erhellt war. In den Nischen zur Linken und zur Rechten standen große Weinkrüge, bis zum Rand gefüllt mit Silberstücken.
Als wir die Mitte des Ganges erreicht hatten, sprach der Kaiser das Wort aus, das nicht genannt werden darf, und von einer geheimen Feder bewegt, sprang eine granitene Tür auf, und er legte die
Hände vor das Gesicht, dass seine Augen nicht geblendet würden. Du kannst nicht ermessen, was dieser für ein herrlicher Ort war. Da waren ungeheure Schildkrötenschalen voll mit Perlen, und
gehöhlte Mondsteine von seltener Größe, überhäuft von roten Rubinen. In Koffern aus Elefantenhaut war das Gold gelagert und der Goldstaub in ledernen Flaschen. Da waren Opale und Saphire, jene in
Schalen von Kristall, diese in Schalen von Jade. Runde grüne Smaragde reihten sich auf feinen Platten von Elfenbein, und in einer Ecke lehnten seidene Beutel, die einen gefüllt mit Türkisen, die
anderen mit Beryllen. Aus Füllhörnern von Elfenbein quollen purpurfarbene Amethyste, aus Füllhörnern von Messing Chalzedone und Karneole. Die Pfeiler aus Zedernholz waren mit Schnüren von gelben
Luchssteinen behangen. In flachen, ovalen Schilden lagen Karfunkel, weinfarbene und solche von der Farbe des Grases. Und doch habe ich dir erst ein Zehntel von dem beschrieben, was dort
war.
Als der Kaiser die Hände vom Gesicht genommen hatte, sprach er zu mir: »Dies ist mein Schatzhaus, und die Hälfte von dem, was darin ist, sei dein, wie ich es dir versprochen habe. Und ich will
dir Kamele geben und Kameltreiber, und sie sollen tun, wie du ihnen heißt, und deinen Teil des Schatzes an jeden Ort der Welt bringen, wohin du auch ziehen möchtest. Und das soll noch heute Nacht
geschehen, denn ich will nicht, dass der Gott der Sonne, der mein Vater ist, in meiner Stadt einen Mann erblickt, den ich nicht töten kann.« Ich aber erwiderte ihm: »Das Gold, das hier ist, ist
dein, und auch das Silber ist dein, und dein sind die kostbaren Juwelen und die wertvollen Dinge. Denn ich selber bedarf ihrer nicht. Nichts will ich von dir nehmen als den kleinen Ring, den du
am Finger deiner Hand trägst. « Der Kaiser runzelte die Stirn. »Es ist nur ein Ring aus Blei«, rief er, »und er hat keinen Wert. Nimm deshalb die Hälfte meines Schatzes und gehe aus meiner
Stadt.« »Nein«, antwortete ich, »ich will nichts nehmen als nur diesen Ring aus Blei, denn ich weiß, was darin geschrieben steht und zu welchem Zweck.«
Der Kaiser erzitterte und flehte mich an und sprach: »Nimm den ganzen Schatz und gehe aus meiner Stadt. Auch die Hälfte, die mein ist, soll noch dir gehören.« Und ich tat etwas Seltsames, doch
was ich tat, ist nicht wichtig, denn in einer Höhle, die nur eine Tagesreise von hier ist, habe ich den Ring der Reichtümer verborgen. Es ist nur eine Tagesreise von hier, und er erwartet dein
Kommen. Er, der den Ring hat, ist reicher als alle Könige der Welt. Komm daher und nimm ihn, und die Reichtümer der Welt sollen dein sein.« Aber der junge Fischer lachte. »Liebe ist besser als
Reichtum«, rief er, »und die kleine Meerjungfrau liebt mich.« »Nein, nichts ist besser als Reichtum«, sagte die Seele. »Die Liebe ist besser«, antwortete der junge Fischer, und er tauchte hinab
in die Tiefe, und die Seele ging weinend über die Marschen davon.
Und da das dritte Jahr vorüber war, kam die Seele herab ans Gestade des Meeres und rief den jungen Fischer, und er stieg herauf aus der Tiefe und sagte: »Weshalb rufst du mich?« Und die Seele
antwortete: »Komm näher, auf dass ich mit dir rede, denn ich habe wunderbare Dinge gesehen.« Da kam er näher, lagerte sich im seichten Wasser, stützte den Kopf in die Hand und lauschte. Und die
Seele sprach zu ihm: »In einer Stadt, die ich kenne, steht eine Schenke am Ufer des Flusses. Dort saß ich mit Matrosen, die von zwei verschiedenfarbenen Weinen tranken und Gerstenbrot aßen und
kleine gesalzene Fische, die auf Lorbeerblättern mit Essig gereicht wurden. Und als wir da saßen und fröhlich waren, da trat zu uns ein alter Mann, der trug einen Teppich aus Leder und eine Laute
mit zwei Schnecken aus Bernstein. Und als er den Teppich auf den Boden gebreitet hatte, schlug er mit einem Federkiel die Drahtsaiten seiner Laute, und ein Mädchen mit verschleiertem Gesicht lief
herein und begann, vor uns zu tanzen. Ihr Gesicht war mit einem Schleier von Gaze verhangen, doch ihre Füße waren nackt. Nackt waren ihre Füße, und sie schwebten über den Teppich wie kleine weiße
Tauben. Nie habe ich etwas so Herrliches gesehen, und die Stadt, in der sie tanzt, ist nur eine Tagesreise von hier.« Als nun der junge Fischer diese Worte seiner Seele vernahm, fiel ihm ein,
dass die kleine Meerjungfrau keine Füße hatte und nicht tanzen konnte. Und ein großes Verlangen überkam ihn, und er sprach bei sich selber: »Es ist nur eine Tagesreise von hier, und ich kann zu
meiner Liebsten zurückkehren«, und er lachte und stand auf in dem seichten Wasser und schritt zum Ufer. Und als er das trockene Ufer erreicht hatte, lachte er wieder und breitete die Arme seiner
Seele entgegen. Und seine Seele stieß einen lauten Freudenschrei aus und lief auf ihn zu und ging in ihn ein, und vor sich auf den Sand hingeworfen sah der junge Fischer jenen Schatten des
Leibes, der der Leib der Seele ist. Und seine Seele sprach zu ihm: »Lass uns nicht säumen, sondern uns sogleich aufmachen, denn die Meeresgötter sind eifersüchtig und haben Ungeheuer, die ihrem
Geheiß folgen.« Sie eilten also von hinnen und zogen die ganze Nacht dahin unter dem Mond, und den ganzen nächsten Tag wanderten sie dahin unter der Sonne, und am Abend dieses Tages kamen sie zu
einer Stadt. Und der junge Fischer sprach zu seiner Seele: »Ist das die Stadt, in der sie tanzt, von der du mir gesagt hast?« Und seine Seele antwortete ihm: »Es ist nicht diese Stadt, sondern
eine andere. Dennoch lass uns hineingehen.«
Sie gingen also hinein und wanderten durch die Straßen, und als sie durch die Straße der Juweliere kamen, sah der junge Fischer eine schöne Silberschale in einer Bude ausgestellt. Und seine Seele
sprach zu ihm: »Nimm diese Silberschale und verbirg sie.« Da nahm er die Schale und verbarg sie in den Falten seiner Tunika, und sie verließen eilends die Stadt. Und nachdem sie sich eine
Wegstunde von der Stadt entfernt hatten, runzelte der junge Fischer die Stirn und schleuderte die Schale von sich und sprach zu seiner Seele: »Warum hießest du mich, diese Schale zu nehmen und zu
verbergen, da dies doch übel gehandelt war?« Aber seine Seele erwiderte ihm: »Sei ruhig, sei ruhig!«
Und am Abend des zweiten Tages kamen sie zu einer Stadt, und der junge Fischer sprach zu seiner Seele: »Ist das die Stadt, in der sie tanzt, von der du mir gesagt hast?« Und seine Seele
antwortete: »Es ist nicht diese Stadt, sondern eine andere. Dennoch lass uns hineingehen.« Sie gingen also hinein und wanderten durch die Straßen, und als sie durch die Straße der
Sandalenverkäufer kamen, sah der junge Fischer neben einem Wasserkrug ein Kind stehen. Und seine Seele sprach zu ihm: »Ohrfeige dieses Kind.« Da ohrfeigte er das Kind, bis es weinte, und als er
das getan hatte, verließen sie eilends die Stadt. Und nachdem sie sich eine Wegstunde von der Stadt entfernt hatten, da wurde der junge Fischer zornig und sprach zu seiner Seele: »Warum hießest
du mich dieses Kind ohrfeigen, da dies doch übel gehandelt war?« Aber seine Seele erwiderte ihm: »Sei ruhig, sei ruhig.«
Und am Abend des dritten Tages kamen sie zu einer Stadt, und der junge Fischer sprach zu seiner Seele: »Ist das die Stadt, in der sie tanzt, von der du mir gesagt hast?« Und seine Seele
antwortete ihm: »Es kann sein, dass es diese Stadt ist, lass uns hineingehen.« Also betraten sie die Stadt und wanderten durch die Straßen, aber nirgends konnte der junge Fischer den Fluß finden,
noch die Schenke, die an seinem Ufer stand. Und die Bewohner der Stadt blickten ihn neugierig an, und er begann, sich zu fürchten, und sprach zu seiner Seele: »Lass uns weiterziehen, denn sie,
die mit weißen Füßen tanzt, ist nicht hier.« Doch seine Seele versetzte: »Nein, lass uns noch verweilen, denn die Nacht ist finster, und es werden Räuber auf dem Weg sein.« Da setzte er sich hin
auf den Marktplatz und rastete, und nach einer Weile kam ein Kaufmann vorüber, der sich in einen Umhang aus Tatarentuch gehüllt hatte und auf der Spitze eines knotigen Rohres eine Laterne trug,
die aus durchbrochenem Hörn war. Und der Kaufmann sprach zu ihm: »Was sitzest du hier auf dem Marktplatz, da die Buden geschlossen und die Ballen verschnürt sind?« Und der junge Fischer
antwortete ihm: »Ich kann keine Herberge finden in dieser Stadt, noch habe ich Vetter oder Bruder, der mir Obdach gäbe.« »Sind wir nicht alle Brüder?« versetzte der Kaufmann. »Hat nicht ein Gott
uns alle geschaffen? Daher komme mit mir, denn ich habe Raum für einen Gast.«
Da erhob sich der junge Fischer und folgte dem Kaufmann zu seinem Haus. Und als er durch einen Garten mit Granatäpfelbäumen geschritten war und das Haus betreten hatte, brachte der Kaufmann ihm
Rosenwasser in einem kupfernen Becken, dass er sich die Hände wasche, und reife Melonen, dass er seinen Durst stille, und stellte eine Schale voll Reis und ein Stück gebratenen Zickleins vor ihn
hin. Und nachdem er sein Mahl beendet hatte, führte der Kaufmann ihn ins Gastzimmer und hieß ihn schlafen und wohl ruhen. Und der junge Fischer dankte ihm und küsste den Ring, der an seiner Hand
war, und legte sich nieder auf die Teppiche aus gefärbtem Ziegenhaar. Und nachdem er sich mit einer Decke aus schwarzer Schafwolle zugedeckt hatte, fiel er in Schlaf. Und drei Stunden vor der
Morgendämmerung, da es noch Nacht war, weckte ihn seine Seele und sprach zu ihm: »Erhebe dich und geh ins Zimmer des Kaufmanns, in das Zimmer, darin er schläft, und erschlage ihn, und nimm ihm
sein Gold, denn wir können es wohl gebrauchen.« Und der junge Fischer erhob sich und schlich zum Zimmer des Kaufmanns, und quer über den Füßen des Kaufmanns lag ein krummes Schwert, und auf dem
Tisch neben dem Kaufmann lagen neun Börsen voll Gold. Und er streckte seine Hand aus und griff nach dem Schwert, und als er es berührte, fuhr der Kaufmann zusammen und erwachte, sprang auf und
griff selber nach dem Schwert und rief dem jungen Fischer zu: »Vergiltst du so Gutes mit Üblem und zahlst mit Blutvergießen für die Güte, die ich dir erwies?« Und seine Seele sagte zu dem jungen
Fischer: »Schlag ihn!« Und er schlug den Kaufmann derart, dass diesem die Sinne vergingen, und der junge Fischer ergriff die neun Börsen voll Gold und floh hastig durch den Granatäpfelgarten und
wandte sein Antlitz nach jenem Stern, der der Stern des Morgens ist.
Als sie sich eine Wegstunde von der Stadt entfernt hatten, da schlug sich der junge Fischer an die Brust und sprach zu seiner Seele: »Warum hießest du mich den Händler schlagen und sein Gold
stehlen? Wahrlich, du bist von Übel.« Aber seine Seele erwiderte ihm: »Sei ruhig, sei ruhig.« »Nein«, rief der junge Fischer, »ich will nicht ruhig sein, denn ich hasse alles, was du mich tun
ließest. Auch dich hasse ich, und ich bitte dich, mir zu sagen, warum du so mit mir umgehst.« Und seine Seele gab ihm zur Antwort: »Als du mich in die Welt hinaus stießest, gabst du mir kein
Herz; so lernte ich alle diese Dinge tun und mich daran erfreuen.« »Was sagst du da?« murmelte der junge Fischer. »Du weißt es«, versetzte seine Seele, »du weißt es wohl. Hast du vergessen, dass
du mir kein Herz gabst? Ich glaube kaum. Und nun quäle weder dich selber noch mich, sondern sei ruhig, denn da ist kein Schmerz, den du nicht geben, noch ein Vergnügen, das du nicht empfangen
sollst.« Und als der junge Fischer diese Worte hörte, zitterte er und sagte zu seiner Seele: »Nein, du bist von Übel, hast mich meine Liebste vergessen lassen, mich mit Versuchungen versucht und
meinen Fuß den Pfad der Sünde geführt.« Und seine Seele antwortete ihm: »Du hast es nicht vergessen, dass du mir kein Herz gabst, als du mich in die Welt hinaus sandtest. Komm, lass uns in eine
andere Stadt ziehen und lustig sein, denn wir haben neun Börsen voll Gold.« Aber der junge Fischer nahm die neun Börsen voll Gold und warf sie auf die Erde und trat sie unter seine Füße.
»Nein«, rief er, »nein, ich will nichts mit dir zu schaffen haben, noch will ich irgendwohin mit dir gehen; sondern wie ich dich zuvor von mir stieß, also will ich dich auch jetzt verstoßen, denn
du hast mir nichts als Unheil gebracht.« Und er wandte seinen Rücken dem Mond zu, und mit dem kleinen Messer, dessen Griff aus grüner Natternhaut war, versuchte er, von seinen Füßen jenen
Schatten des Leibes wegzuschneiden, der der Leib der Seele ist. Doch seine Seele wich nicht von ihm, noch achtete sie seines Gebotes, sondern sprach zu ihm: »Der Zauber, den die Hexe dich lehrte,
hilft dir nichts mehr, denn ich kann dich nicht verlassen, noch kannst du mich von hinnen senden. Einmal in seinem Leben kann der Mensch seine Seele fort senden, aber der seine Seele wieder bei
sich aufnimmt, muss sie von nun an bei sich behalten, und das ist seine Strafe und sein Lohn.« Und der junge Fischer erbleichte und ballte die Hände und schrie: »Sie war eine falsche Hexe, dass
sie mir das nicht gesagt hat.« »Das war sie nicht«, antwortete seine Seele, »sie war nur Ihm treu, den sie anbetet und dessen Magd sie immer sein wird.« Und da nun der junge Fischer wusste, dass
er seine Seele nie wieder loswerden konnte und dass sie eine böse Seele war und immer bei ihm wohnen würde, da fiel er zu Boden und weinte bitterlich.
Als es Tag geworden, erhob sich der junge Fischer und sprach zu seiner Seele: »Ich werde meine Hände binden, dass ich deinem Geheiß nicht Folge leiste, und meine Lippen schließen, dass ich nicht
deine Worte spreche, und an den Ort zurückkehren, wo sie ihre Wohnung hat, die ich liebe. Sogleich will ich zum Meer zurückkehren und in die kleine Bucht, wo sie zu singen pflegte, und ich will
nach ihr rufen und ihr das Übel bekennen, das ich getan habe, und das Übel, das du über mich gebracht hast.« Und seine Seele versuchte ihn und sagte: »Wer ist deine Liebste, dass du zu ihr
zurückkehren solltest? Die Welt hat viele, die schöner sind als sie. Da sind Tänzerinnen von Samaris, die tanzen in der Art der Vögel und der vierbeinigen Tiere. Ihre Füße sind mit Henna gefärbt,
und in ihren Händen haben sie kleine kupferne Schellen. Sie lachen, während sie tanzen, und ihr Lachen ist so hell wie das Lachen des Wassers. Komm mit mir, und ich will sie dir zeigen. Denn was
ist es, was dich an der Sünde ängstigt? Ist, was vergnüglich ist zu essen, nicht gemacht für den Esser? Ist Gift in dem Getränk, das süß ist zu trinken? Ängstige dich nicht, sondern komm mit mir
in eine andere Stadt. Nahe von hier ist eine kleine Stadt, darin steht ein Garten von Tulpenbäumen. Und in diesem anmutigen Garten hausen weiße Pfauen und Pfauen mit blauer Brust. Wenn sie in der
Sonne ihre Räder schlagen, so sind sie wie Scheiben von Elfenbein und wie Scheiben von Gold. Und die sie füttert, tanzt zu ihrer Lust, und manchmal tanzt sie auf den Händen und ein anderes Mal
auf den Füßen. Ihre Augen sind mit Antimon gefärbt, und ihre Nasenflügel sind wie die Schwingen einer Schwalbe. Von einem Häkchen aus ihrer Nase hängt eine Blume herab, und die ist aus einer
Perle geschnitzt. Während sie tanzt, lacht sie, und die silbernen Spangen rund um ihre Knöchel klingeln wie silberne Glocken. Betrübe dich also nicht länger, sondern komm mit mir in diese Stadt.«
Aber der junge Fischer gab seiner Seele keine Antwort, sondern verschloss seine Lippen mit dem Siegel des Schweigens; mit einer straffen Schnur band er seine Hände, und so reiste er zurück an den
Ort, von dem er gekommen war, bis zu jener kleinen Bucht, wo seine Liebste zu singen pflegte. Und wieder und wieder versuchte ihn seine Seele, während sie wanderten, aber er gab ihr keine
Antwort, noch tat er etwas von all dem Bösen, das sie ihn tun hieß, so groß war die Macht der Liebe, die in ihm war.
Und als er das Gestade des Meeres erreicht hatte, da löste er den Strick von seinen Händen und nahm das Siegel des Schweigens von seinen Lippen und rief nach der kleinen Meerjungfrau. Aber sie
kam nicht auf seinen Ruf, obwohl er den ganzen Tag nach ihr rief und flehte. Und seine Seele verhöhnte ihn und sprach: »Du hast wahrlich nicht viel Freude an deiner Liebe. Du bist wie einer, der
zur Zeit der Dürre Wasser schöpft mit einem zerbrochenen Gefäß. Du gibst hin, was du hast, und nichts wird dir dafür gegeben. Es wäre besser für dich, du kämst mit mir, denn ich weiß, wo das Tal
der Lust liegt und welche Dinge dort getan werden.« Aber der junge Fischer gab seiner Seele keine Antwort, sondern baute sich in einer Felsenkluft eine Hütte aus Flechtwerk und verweilte hier ein
volles Jahr. Und jeden Morgen rief er nach der Meerjungfrau, und jeden Mittag rief er wieder nach ihr, und am Abend nannte er ihren Namen. Doch niemals stieg sie herauf aus der See, um ihn zu
sehen, und an keinem Ort des Meeres konnte er sie finden, obgleich er in den Höhlen und im grünen Wasser nach ihr suchte, in den Wassern der Gezeiten und in den Brunnen am Grund des Meeres. Und
immer wieder versuchte ihn seine Seele mit Übel und raunte ihm von grässlichen Dingen. Doch sie vermochte damit bei ihm nichts, so groß war die Macht seiner Liebe.
Als das Jahr vorüber war, da dachte die Seele in ihm: »Ich habe meinen Herrn mit Übel versucht, und seine Liebe ist stärker als ich. Nun will ich ihn mit Gutem versuchen, und es mag sein, dass er
dann mit mir kommt.« So redete sie also den jungen Fischer an und sprach: »Ich habe dir von den Freuden der Welt erzählt, und du hast mir ein taubes Ohr geliehen. Lass mich dir nun vom Leid der
Welt berichten, vielleicht dass du mir Gehör gibst. Denn das Leid ist in Wahrheit Herr dieser Welt, und keiner ist, der seinem Netz entschlüpft. Den einen fehlt es an Kleidern, den anderen an
Brot. Witwen gibt es, die schreiten in Purpur einher, und andere, die gehen in Fetzen. Hin und her auf den Mooren gehen die Aussätzigen, und sie sind grausam gegeneinander. Die Bettler ziehen die
Landstraßen auf und ab, und ihre Ranzen sind leer. Durch die Straßen der Stadt schleicht die Hungersnot, und vor ihren Toren hockt die Pest. Komm, lass uns hingehen und den Jammer lindern und dem
Elend abhelfen. Was sollst du hier verweilen und nach deiner Liebsten rufen, da sie doch nicht kommt auf deinen Ruf? Und was ist die Liebe, dass du ihr so hohen Wert zuerkennst?« Aber der junge
Fischer gab ihr keine Antwort, so groß war die Macht seiner Liebe. Und jeden Morgen rief er nach der Meerjungfrau, und jeden Mittag rief er wieder nach ihr, und am Abend nannte er ihren Namen.
Doch niemals stieg sie herauf aus der See, um ihn zu sehen, und an keinem Ort des Meeres konnte er sie finden, obgleich er nach ihr suchte in den Strömen der See und in den Tälern, die unter den
Wogen sind, im Meer, das die Nacht purpurn färbt, und im Meer, das die Morgendämmerung grau hinter sich lässt.
Und als das zweite Jahr vorüber war, sprach die Seele des Nachts zu dem jungen Fischer, da er allein saß in seiner Hütte aus Flechtwerk: »Siehe! Nun habe ich dich mit Bösem versucht, und ich habe
dich mit Gutem versucht, und deine Liebe ist stärker als ich. Ich will dich deshalb nicht länger versuchen, sondern dich bitten, du mögest mich einlassen in dein Herz, auf dass ich eins werde mit
dir wie zuvor.« »Du bist in meinem Herzen willkommen«, erwiderte der junge Fischer. »Denn in den Tagen, da du ohne Herz durch die Welt gingst, magst du wohl viel gelitten haben.« »Ach!« rief die
Seele, »ich kann keine Stelle für einen Eingang finden, so ganz umschlossen von Liebe ist dein Herz.« »Und doch wollte ich, ich könnte dir helfen«, antwortete der junge Fischer.
Und als er das sagte, da erklang vom Meer her ein lauter Schmerzensschrei, jener Schrei, den die Menschen hören, wenn jemand vom Meervolk gestorben ist. Und der junge Fischer sprang auf und
verließ sein geflochtenes Haus und stürzte hinunter ans Ufer. Und die schwarzen Wogen kamen eilends ans Ufer gerollt und führten mit sich eine Last, die weißer war als Silber. Weiß wie die
Brandung war sie, und wie eine Blume trieb sie auf den Wogen. Und die Brandung entriss sie den Wogen, und der Schaum entriss sie der Brandung, und das Gestade empfing sie, und zu seinen Füßen
liegend erblickte der junge Fischer den Leib der kleinen Meerjungfrau. Tot lag sie zu seinen Füßen. Weinend wie einer, den der Schmerz zu Boden drückt, warf er sich an ihrer Seite nieder und
küsste das kalte Rot des Mundes und spielte mit dem feuchten Bernstein des Haares. An ihrer Seite warf er sich hin auf den Sand und weinte wie jemand, der vor Lust erschauert, und in seinen
braunen Armen drückte er sie an seine Brust. Kalt waren die Lippen, und doch küsste er sie. Salz war der Honig des Haares, doch er kostete ihn mit bitterer Freude. Er küsste die geschlossenen
Augenlider, und der wilde Gischt, der auf den Hügeln ihrer Augen lag, war weniger salzig als seine Tränen. Und dem toten Leib beichtete er. In die Muscheln ihrer Ohren goß er den herben Wein
seiner Geschichte. Er legte die kleinen Hände um seinen Nacken, und mit seinen Fingern berührte er das zarte Rohr des Halses. Bitter, bitter war seine Freude, und voll fremdartiger Freude war
sein Schmerz.
Die schwarze See kam näher, und der weiße Schaum ächzte wie ein Aussätziger. Mit weißen Tatzen aus Schaum griff die See ans Ufer. Aus dem Palast des Meerkönigs kam wieder der Schrei der Trauer,
und weit draußen auf dem Meer bliesen die großen Tritonen heiser auf ihren Hörnern. »Flieh hinweg«, sprach seine Seele, »denn siehe, näher und näher rollt die See, und wenn du säumst, wird sie
dich verderben. Fliehe, denn ich fürchte mich, weil deiner großen Liebe wegen dein Herz vor mir verschlossen ist. Flieh hinweg an einen sicheren Ort. Du willst mich doch nicht ohne Herz in eine
andere Welt senden wollen?« Aber der junge Fischer hörte nicht auf seine Seele, sondern rief die kleine Meerjungfrau an und sprach: »Liebe ist besser als Weisheit und kostbarer als Reichtum und
schöner als die Füße der Menschentöchter. Feuer kann sie nicht zerstören, noch Wasser sie löschen. In der Morgendämmerung rief ich dich, und du kamst nicht auf meinen Ruf. Der Mond hörte deinen
Namen, doch du schenktest mir kein Gehör. Zum Bösen hatte ich dich verlassen, und zu meinem eigenen Schmerze war ich fort gegangen. Jedoch immer war deine Liebe bei mir, und immer war sie stark,
und nichts kam gegen sie auf, ob ich auf Übles sah oder auf Gutes. Und nun, da du tot bist, nun will ich wahrlich mit dir sterben.« Und seine Seele beschwor ihn, aufzubrechen, aber er wollte
nicht, so groß war seine Liebe. Und die See kam näher und suchte ihn mit ihren Wogen zu bedecken, und als er sah, dass das Ende nahe war, küsste er mit irren Lippen die kalten Lippen der
Meerjungfrau, und sein Herz brach, da fand die Seele einen Eingang und ging hinein und war eins mit ihm wie zuvor. Und die See bedeckte den jungen Fischer mit ihren Wogen.
Am Morgen ging der Priester hinaus, um das Meer zu segnen, denn es war stürmisch gewesen. Und mit ihm gingen die Mönche und die Musikanten und die Kerzenträger und die Weihrauchschwinger und eine
große Gesellschaft. Und als der Priester das Ufer erreichte, da sah er den jungen Fischer ertrunken in der Brandung liegen, und in seinen Armen lag der Leib der kleinen Meerjungfrau. Und erzürnt
wandte er sich ab und machte das Zeichen des Kreuzes und rief laut und sprach: »Ich will das Meer nicht segnen, noch irgend etwas, das darin ist. Verflucht sei das Meervolk und verflucht seien
alle, die mit ihm Umgang treiben. Und was ihn anlangt, der um der Liebe willen Gott verließ und hier liegt mit seiner Buhle, erschlagen von Gottes Urteil - nehmt auf seinen Leichnam und den
Leichnam seiner Buhle und begrabt sie in der Ecke des Schindangers und setzt kein Mal darauf, noch ein Zeichen von irgendeiner Art, auf dass keiner den Ort ihrer Ruhe wisse. Denn verflucht waren
sie zu ihren Lebzeiten, und verflucht sollen sie auch in ihrem Tode sein.« Und die Leute taten, wie er sie geheißen, und in der Ecke des Schindangers, wo keine süßen Kräuter wachsen, gruben sie
eine tiefe Grube und legten die toten Leiber hinein.
Als das dritte Jahr vorüber war, an einem Tag, der ein heiliger Tag war, ging der Priester hinauf zur Kapelle, dass er dem Volk die Wunden des Herrn zeige und zu ihnen spreche von Gottes Zorn.
Und als er, in seine Gewänder gekleidet, eintrat und sich vor dem Altar neigte, da sah er, dass der Altar mit fremdartigen Blumen bedeckt war, wie man sie niemals zuvor gesehen hatte. Seltsam
waren sie anzuschauen und von eigenartiger Schönheit, und ihre Schönheit verwirrte ihn, und ihr Duft war süß in seiner Nase, und er war froh und wusste nicht, warum. Und als er den Tabernakel
geöffnet und die Monstranz darin beweihräuchert und die schöne Hostie dem Volk gezeigt und sie wieder hinter dem Schleier der Schleier verborgen hatte, begann er, zum Volk zu sprechen, und er
wollte ihm sagen von Gottes Zorn. Aber die Schönheit der weißen Blumen verwirrte ihn, und ihr Duft war süß in seiner Nase, und ein anderes Wort kam auf seine Lippen, und er sprach nicht von
Gottes Zorn, sondern von dem Gott, dessen Name Liebe heißt. Und warum er so sprach, wusste er nicht. Und als er seine Predigt geendet hatte, da weinten die Leute, und der Priester ging zurück in
seine Sakristei, und seine Augen waren voll Tränen. Und die Diakone traten herein und begannen, ihn zu entkleiden, und nahmen ihm die Alba und den Gürtel ab, die Manipel und die Stola. Und er
stand da wie im Traum. Und da sie ihm die Kleider abgenommen hatten, blickte er sie an und sprach: »Was sind das für Blumen, die auf dem Altar stehen, und woher kommen sie?« Und sie antworteten
ihm: »Was das für Blumen sind, können wir nicht sagen, aber sie kommen von der Ecke des Schindangers.« Und der Priester erzitterte und kehrte ein in sein Haus und betete.
Am Morgen, da es noch dämmerte, ging er hinaus mit den Mönchen und den Musikanten, den Kerzenträgern und den Weihrauchschwingern und einer großen Gesellschaft und gelangte ans Gestade des Meeres
und segnete das Meer und alle die wilden Geschöpfe, die darin sind. Auch die Faune segnete er und die kleinen Geschöpfe, die im Wald tanzen, und die Wesen mit den glänzenden Augen, die zwischen
den Blättern herausspähen. Alle Lebewesen in Gottes Welt segnete er, und die Leute waren erfüllt von Freude und Staunen. Doch niemals wieder blühten in der Ecke des Schindangers Blumen von
irgendeiner Art, sondern das Feld blieb unfruchtbar wie zuvor. Und auch das Meervolk kam nicht mehr in die Bucht wie früher, denn es zog in einen anderen Teil der See.
Von Oscar Wilde (1831)
