MÄRCHEN NACH DEN GEBRÜDERN GRIMM II
VERZEICHNIS II
"Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben"
"Der Räuber und seine Söhne"
Das Lämmchen und Fischchen"
"Die Kristalkugel"
"Lohengrin zu Brabant“
„Die alte Bettelfrau“
„Der Ritter mit dem Schwan“
„Das Bergmännchen“
„Die Krähen“
„Die Scholle“
„Buttermilchturm“
„Die weisse Taube“
„Lieb und Leid teilen“
„Der Mond“
„Meister Pfriem“
„Die Schlickerlinge“
„Der Frauensand“
„Der Nagel“
„Der verzauberte See“
„Die Kuh mit den sieben Fersen“
„Die Erscheinungen des O´Donoghue“
„Der Sperling und seine vier Kinder“
„Der Hahnenbalken“
„Daniel O´Rourke´s Irrfahrten“
„Vom Schreiner und Drechsler“
„Der Soldat und der Schreiner“
„Oll Rinkrank“
„Die Springwurzel“
„Das gebückte Mütterchen“
„Die treuen Tiere“
„Der Löwe und der Frosch“
„Springwasser“
"Der faule Heinz"
„Die Haselrute“
„Der Stiefel von Büffelleder“
„Die Hochzeit der Frau Füchsin“
„Das Unglück“
„Die Salzprinzessin“
„König Blaubart“
„Hans Dumm“
„Doktor Allwissend“
„Der getreue Paul“
„DerEisenofen“
„Die drei Schlangenblätter“
„Die drei Faulen“
„Das alte Mütterchen“
„Die drei Brüder“
„Frau Trude“
"Der Frieder und das Katherlieschen“
„Der Fuchs und das Pferd“
„Die drei Handwerksburschen“
„Die Eule“
„Der Königssohn, der sich vor nichts fürchtet“
„Der junge Riese“
„Die drei Feldscherer“
„Die Rübe“
„Vom klugen Schneiderlein“
„Der Riese und der Schneider“
„Das Erdmännchen“
„Der Spielhansl“
„Das Wasser des Lebens“
„Die sechs Diener“
„Die kluge Else“
„Die kluge Bauerntochter“
„Frau Holle“
„Der Schneider im Himmel“
„Die himmlische Hochzeit“
„Der Tod und der Gänsehirt“
„Das Totenhemdchen“
„Die wunderliche Gasterei“
„Die zwölf Jäger“
„Die goldene Gans“
„Tischlein deck dich, Esel streck dich“
„Der Froschkönig“
„Rapunzel“
„Die sieben Raben“
„Die sieben Geisslein“
„Die weisse Schlange“
„Der Geist im Glas“
DER GEIST IM GLAS
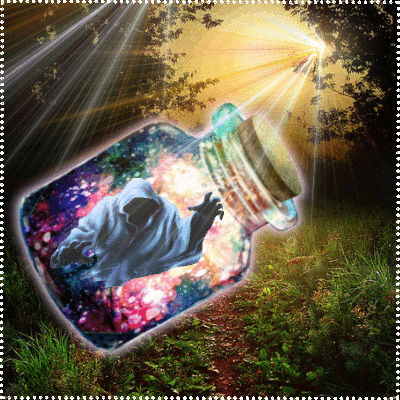
Es ließ ein Mann seinen Sohn studieren, wie der ein paar Schulen durchstudiert hatte, konnte der Vater nichts mehr an ihn verwenden; da ließ er ihn zu sich kommen und sprach: „du weißt, unser Vermögen ist aufgegangen, ich kann nichts mehr an dir thun.“ Da sagte der Sohn: „lieber Vater, macht euch darüber keinen Kummer, wenn es so ist, da bleib’ ich bei euch und will mit euch gehen und etwas am Malterholz (d.h. am Zuhauen und Aufrichten) verdienen;“ denn der Vater war ein Taglöhner, und erwarb sein Brot damit. Der Vater sagte: „ja, mein Sohn, das soll dir beschwerlich ankommen, ich hab’ auch nur eine Axt und kann dir keine kaufen.“ „Ei, sagte der Sohn, geht zum Nachbar, der leiht euch eine.“ Also borgte der Vater eine Axt für ihn und sie gingen miteinander ins Holz und arbeiteten. Wie sie bis Mittag gearbeitet hatten, sagte der Vater: „nun wollen wir ein bischen rasten und unser Mittagsbrot essen, da geht die Arbeit hernach noch einmal so frisch.“
Der Student nahm sein Mittagsbrot in die Hand und sagte zum Vater, er wollte damit herumgehen und Vogelnester suchen. „O du Geck! sprach der Vater, was willst du da herumgehen, bleib bei mir, sonst wirst du müd’ und kannst hernach nichts mehr thun.“ Der Sohn ging aber in dem Wald herum, aß sein Brot und sah sich nach Vögelsnestern um und kam zu einer großen, gefährlichen Eiche, da suchte er ein bischen herum. Auf einmal kam gegen ihn eine Stimme aus der Wurzel, die rief mit so einem recht dumpfen Ton: „laß mich heraus! laß mich heraus!“ Da horcht’ er darnach und rief: „wo bist du?“ es sprach von neuem: „laß mich heraus! laß mich heraus!“ „Ja ich seh’ aber nichts, sagte der Student, wo bist du?“ – „Hier bin ich bei der Eichwurzel.“ Da fing er an zu suchen und fand in einer kleinen Höhle eine Glasflasche, daraus war die Stimme gekommen, er hielt sie gegen das Licht, da war eine Gestalt darin wie ein Frosch, die Gestalt rief aber weiter: „nimm den Pfropfen herab.“ Das that der Student, und wie er den Pfropfen abgenommen hatte, kam ein Kerl von entsetzlicher Größe heraus und sprach: „weißt du wohl, was du für einen Lohn verdient, weil du mich herausgelassen hast?“ „Nein,“ sagte der Student. „So will ich dir’s sagen: ich muß dir den Hals dafür brechen.“ „Nein, sagte der Student, mir nicht so, das hättest du früher sagen sollen, so hätt’ ich dich nicht herausgelassen. Da müssen erst mehr Leute gefragt werden.“ – „Mehr Leute hin, mehr Leute her, du mußt deinen verdienten Lohn haben, du kannst leicht denken, daß ich nicht aus Gnade da eingeschlossen war, sondern aus Strafe: weißt du wohl, was ich für einen Namen habe?“ – „Nein, sagte der Student, das weiß ich nicht.“ Da sprach der Geist: „ich bin der großmächtige Merkurius, ich muß dir den Hals zerbrechen.“ „Nein das geht nicht, so wie du meinst, sagte der Student, du mußt einen andern Rath anfangen; ich muß auch sehen, ob du wieder in die Flasche hinein kommst, sonst glaub’ ich nimmermehr, daß du herauskommen bist, wenn ich das aber sehe, will ich mich in deine Gefangenschaft geben.“
Da willigte der Geist ein und begab sich durch dasselbe Loch und durch den Hals der Flasche wieder hinein; wie er drin war, steckte der Student den abgezogenen Pfropfen wieder auf und der Geist war angeführt. Da bat der Geist, er möcht’ ihn doch wieder erlösen und herauslassen. „Nein, sagte der Student, der mir nach dem Leben strebte, den kann ich nicht wieder herauslassen und den will ich in Ewigkeit nicht wieder herauslassen.“ Da sprach der Geist: „ich will dir auch so viel geben, daß du dein Lebtag genug hast.“ „Du würdest mich doch betrügen, wie das erstemal, sagte der Student.“ „Nein, sagte der Geist, ich will dir nichts thun.“ Da ließ er sich bewegen und that den Pfropfen wieder ab und der Geist stieg heraus. „Nun will ich dich belohnen, sprach er, da hast du ein Pflaster, wenn du mit dem einen Ende eine Wunde damit bestreichst, so wird sie heilen, und wenn du Stahl oder Eisen mit dem andern Ende bestreichst, soll es all in Silber verwandelt seyn.“ Da wollte der Student das Pflaster probiren und machte an einem Baum einen kleinen Ritz und hielt dann das Pflaster daran, da war er alsbald geheilt. Da dankte der Student dem Geiste und der Geist dankte ihm auch für seine Erlösung und sie nahmen Abschied von einander. Der Student ging zurück zu seinem Vater, der wieder an der Arbeit war und ihn schalt, daß er so lange ausgeblieben wäre: „ich hab’s ja gesagt, daß du nichts thun würdest.“ „Ich will’s schon nachholen,“ sprach der Student. „Ja, sagte der Vater zornig, nachholen hat keine Art.“ – „Vater, was soll ich zuerst thun?“ – „Hau den Baum da um.“ Da that der Student sein Pflaster heraus und strich seine Axt damit, wie er nun ein paar Hiebe gethan hatte, war sie ganz schief und hatte sich die Schärfe umgelegt, denn sie war von Silber geworden. „Nun seht ihr, Vater, sprach der Sohn, was habt ihr mir für eine Axt gegeben, die ist ja ganz schief geworden?“ – „Ach! was hast du gemacht, sagte der Vater und war noch böser, nun muß ich die Axt bezahlen, so bringst du mich mit deiner Hülfe nur in Schaden.“
Der Sohn sprach: „werdet nicht bös, Vater, ich will die Axt schon bezahlen.“ „Ja du Dummbart, wovon willst du sie denn bezahlen, du hast nichts, als was ich dir gebe, das sind Studentenkniffe, die stecken dir im Kopf; vom Holzhacken hast du keinen Verstand.“ Da wollte der Sohn den Vater bereden, Feierabend zu machen, der Vater sagte, er solle sich packen; der Student aber ließ ihm keine Ruhe und sagte, er könne nicht allein nach Haus gehen, bis der Vater mitging. Der Sohn nahm die Axt mit, der Vater aber war ein alter Mann und konnte nicht sehen, daß sie zu Silber geworden war. Wie sie nach Haus kamen, sagte der Vater: „nun bring’ die Axt hin und sieh, was sie dafür geben wollen.“ Der Student aber nahm die Axt, ging damit in die Stadt zum Goldschmidt und fragte, was er dafür geben wollte. Wie der Goldschmidt sie gesehen hatte, sagte er, er wär’ nicht so reich in seinem Vermögen, daß er sie bezahlen könnte. Da sprach der Student, er sollte ihm geben, was er hätte, er wollt ihm das andere borgen. Da gab ihm der Goldschmidt 300 Thaler und lieh noch 100 Thaler dazu. Damit ging der Student heim zu seinem Vater und sprach: „hier hab’ ich Geld, nun geht hin und fragt was der Mann haben will für die Axt.“ „Das weiß ich schon, sagte der Vater 1 Thaler. 6 Groschen.“ – „So gebt im 2 Thaler. 12 Groschen, das ist das Doppelte und ist genug.“ Dann gab der Student seinem Vater hundert Thaler und sagte, es sollte ihm niemals fehlen und erzählte ihm die ganze Geschichte, wie es gegangen wäre. Mit den andern 300 Thalern aber ging er hin und studierte aus; mit seinem Pflaster konnt’ er hernach alle Wunden heilen und war der berühmteste Doctor in der ganzen Welt.
DIE WEISSE SCHLANGE

Es ist nun schon lange her, da lebte ein König, dessen Weisheit im ganzen Lande berühmt war. Nichts blieb ihm unbekannt und es war, als ob ihm Nachricht von den verborgensten Dingen durch die Luft zugetragen würde. Er hatte aber eine seltsame Sitte. Jeden Mittag, wenn von der Tafel alles abgetragen und niemand mehr zugegen war, mußte ein vertrauter Diener noch eine Schüßel bringen. Sie war aber zugedeckt, und der Diener wußte selbst nicht, was darin lag, und kein Mensch wußte es, denn der König deckte sie nicht eher auf und ass nicht davon, bis er ganz allein war. Das hatte schon lange Zeit gedauert, da überkam eines Tages den Diener, der die Schüßel wieder wegtrug, die Neugierde, daß er nicht widerstehen konnte, sondern die Schüßel in seine Kammer brachte.
Als er die Tür sorgfältig verschloßen hatte, hob er den Deckel auf und da sah er, daß eine weiße Schlange darin lag. Bei ihrem Anblick konnte er die Lust nicht zurückhalten, sie zu kosten; er schnitt ein Stückchen davon ab und steckte es in den Mund. Kaum aber hatte es seine Zunge berührt, so hörte er vor seinem Fenster ein seltsames Gewisper von feinen Stimmen. Er ging und horchte, da merkte er, daß es die Sperlinge waren, die miteinander sprachen und sich allerlei erzählten, was sie im Felde und Walde gesehen hatten. Der Genuß der Schlange hatte ihm die Fähigkeit verliehen, die Sprache der Tiere zu verstehen.
Nun trug es sich zu, daß gerade an diesem Tage der Königin ihr schönster Ring fortkam und auf den vertrauten Diener, der überall Zugang hatte, der Verdacht fiel, er habe ihn gestohlen. Der König ließ ihn vor sich kommen und drohte ihm unter heftigen Scheltworten, wenn er bis morgen den Täter nicht zu nennen wüßte, so sollte er dafür angesehen und gerichtet werden. Es half nichts, daß er seine Unschuld beteuerte, er ward mit keinem besseren Bescheid entlaßen. In seiner Unruhe und Angst ging er hinab auf den Hof und bedachte, wie er sich aus seiner Not helfen könne. Da saßen die Enten an einem fließenden Wasser friedlich nebeneinander und ruhten, sie putzten sich mit ihren Schnäbeln glatt und hielten ein vertrauliches Gespräch.
Der Diener blieb stehen und hörte ihnen zu. Sie erzählten sich, wo sie heute morgen all herumgewackelt wären und was für gutes Futter sie gefunden hätten. Da sagte eine verdrießlich: "Mir liegt etwas schwer im Magen, ich habe einen Ring, der unter der Königin Fenster lag, in der Hast mit hinuntergeschluckt." Da packte sie der Diener gleich beim Kragen, trug sie in die Küche und sprach zum Koch: "Schlachte doch diese ab, sie ist wohlgenährt." - "Ja," sagte der Koch und wog sie in der Hand; "die hat keine Mühe gescheut sich zu mästen und schon lange darauf gewartet, gebraten zu werden." Er schnitt ihr den Hals ab, und als sie ausgenommen ward, fand sich der Ring der Königin in ihrem Magen.
Der Diener konnte nun leicht vor dem Könige seine Unschuld beweisen, und da dieser sein Unrecht wieder gutmachen wollte, erlaubte er ihm, sich eine Gnade auszubitten und versprach ihm die größte Ehrenstelle, die er sich an seinem Hofe wünschte. Der Diener schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und Reisegeld. Denn er hatte Lust, die Welt zu sehen und eine Weile darin herumzuziehen. Als seine Bitte erfüllt war, machte er sich auf den Weg und kam eines Tages an einem Teich vorbei, wo er drei Fische bemerkte, die sich im Rohr gefangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, die Fische wären stumm, so vernahm er doch ihre Klage, daß sie so elend umkommen müßten. Weil er ein mitleidiges Herz hatte, so stieg er vom Pferde ab und setzte die drei Gefangenen wieder ins Wasser. Sie zappelten vor Freude, steckten die Köpfe heraus und riefen ihm zu: "Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten, daß du uns errettet hast!"
Er ritt weiter, und nach einem Weilchen kam es ihm vor, als hörte er zu seinen Füßen in dem Sand eine Stimme. Er horchte und vernahm, wie ein Ameisenkönig klagte: "Wenn uns nur die Menschen mit den ungeschickten Tieren vom Leib blieben! Da tritt mir das dumme Pferd mit seinen schweren Hufen meine Leute ohne Barmherzigkeit nieder!" Er lenkte auf einen Seitenweg ein, und der Ameisenkönig rief ihm zu: "Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten!" Der Weg führte ihn in einen Wald, und da sah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter, die standen bei ihrem Nest und warfen ihre Jungen heraus. "Fort mit euch, ihr Galgenschwengel!" riefen sie, "wir können euch nicht mehr satt machen, ihr seid groß genug und könnt euch selbst ernähren."
Die armen Jungen lagen auf der Erde, flatterten und schlugen mit ihren Fittichen und schrien: "Wir hilflosen Kinder, wir sollen uns selbst ernähren und können noch nicht fliegen! Was bleibt uns übrig, als hier Hungers zu sterben!" Da stieg der gute Jüngling ab, tötete das Pferd mit seinem Degen und überließ es den jungen Raben zum Futter. Die kamen herbeigehüpft, sättigten sich und riefen: "Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten!" Er mußte jetzt seine Beine gebrauchen, und als er lange Wege gegangen war, kam er in eine große Stadt. Da war großer Lärm und Gedränge in den Straßen und kam einer zu Pferde und machte bekannt: Die Königstochter suche einen Gemahl, wer sich aber um sie bewerben wolle, der müße eine schwere Aufgabe vollbringen, und könne er es nicht glücklich ausführen, so habe er sein Leben verwirkt.
Viele hatten es schon versucht, aber vergeblich ihr Leben daran gesetzt. Der Jüngling, als er die Königstochter sah, ward von ihrer großen Schönheit so verblendet, daß er alle Gefahr vergaß, vor den König trat und sich als Freier meldete. Alsbald ward er hinaus ans Meer geführt und vor seinen Augen ein goldener Ring hineingeworfen. Dann hieß ihn der König diesen Ring aus dem Meeresgrund wieder hervorzuholen, und fügte hinzu: "Wenn du ohne ihn wieder in die Höhe kommst, so wirst du immer aufs neue hinabgestürzt, bis du in den Wellen umkommst." Alle bedauerten den schönen Jüngling und ließen ihn dann einsam am Meer zurück. Er stand am Ufer und überlegte, was er wohl tun sollte.
Da sah er auf einmal drei Fische daherschwimmen, und es waren keine andern als jene, welchen er das Leben gerettet hatte. Der mittelste hielt eine Muschel im Munde, die er an den Strand zu den Füßen des Jünglings hinlegte, und als dieser sie aufhob und öffnete, so lag der Goldring darin. Voll Freude brachte er ihn dem Könige und erwartete, daß er ihm den verheißenen Lohn gewähren würde. Die stolze Königstochter aber, als sie vernahm, daß er ihr nicht ebenbürtig war, verschmähte ihn und verlangte, er sollte zuvor eine zweite Aufgabe lösen. Sie ging hinab in den Garten und streute selbst zehn Säcke voll Hirse ins Gras. "Die muß er morgen, eh die Sonne hervorkommt, aufgelesen haben," sprach sie, "und es darf kein Körnchen fehlen."
Der Jüngling setzte sich in den Garten und dachte nach, wie es möglich wäre, die Aufgabe zu lösen; aber er konnte nichts ersinnen, saß da ganz traurig und erwartete bei Anbruch des Morgens, zum Tode geführt zu werden. Als aber die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, so sah er die zehn Säcke alle wohlgefüllt nebeneinander stehen, und kein Körnchen fehlte darin. Der Ameisenkönig war mit seinen tausend und tausend Ameisen in der Nacht angekommen, und die dankbaren Tiere hatten die Hirse mit großer Emsigkeit gelesen und in die Säcke gesammelt. Die Königstochter kam selbst in den Garten herab und sah mit Verwunderung, daß der Jüngling vollbracht hatte, was ihm aufgegeben war.
Aber sie konnte ihr stolzes Herz noch nicht bezwingen und sprach: "Hat er auch die beiden Aufgaben gelöst, so soll er doch nicht eher mein Gemahl werden, bis er mir einen Apfel vom Baume des Lebens gebracht hat." Der Jüngling wußte nicht, wo der Baum des Lebens stand. Er machte sich auf und wollte immer zugehen, solange ihn seine Beine trügen, aber er hatte keine Hoffnung, ihn zu finden. Als er schon durch drei Königreiche gewandert war und abends in einen Wald kam, setzte er sich unter einen Baum und wollte schlafen. Da hörte er in den Ästen ein Geräusch und ein goldener Apfel fiel in seine Hand.
Zugleich flogen drei Raben zu ihm herab, setzten sich auf seine Knie und sagten: "Wir sind die drei jungen Raben, die du vom Hungertod errettet hast. Als wir groß geworden waren und hörten, daß du den goldenen Apfel suchtest, so sind wir über das Meer geflogen bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht, und haben dir den Apfel geholt." Voll Freude machte sich der Jüngling auf den Heimweg und brachte der schönen Königstochter den goldenen Apfel, der nun keine Ausrede mehr übrig blieb. Sie teilten den Apfel des Lebens und assen ihn zusammen. Da ward ihr Herz mit Liebe zu ihm erfüllt, und sie erreichten in ungestörtem Glück ein hohes Alter.
DIE SIEBEN GEISSLEIN

Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein, und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach: "Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor dem Wolf, wenn er hereinkommt, so frißt er euch mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen." Die Geißlein sagten: "Liebe Mutter, wir wollen uns schon in acht nehmen, Ihr könnt ohne Sorge fortgehen." Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg. Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief: "Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht!" Aber die Geißlein hörten an der rauhen Stimme, daß es der Wolf war. "Wir machen nicht auf," riefen sie, "du bist unsere Mutter nicht, die hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme aber ist rau; du bist der Wolf." Da ging der Wolf fort zu einem Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide; er aß es auf und machte damit seine Stimme fein. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief: "Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht!" Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die Kinder und riefen: "Wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß, wie du; du bist der Wolf!" Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach: "Ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich mir Teig darüber." Als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach: "Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote." Der Müller dachte: Der Wolf will einen betrügen, und weigerte sich; aber der Wolf sprach: "Wenn du es nicht tust, fresse ich dich!" Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Ja, so sind die Menschen.
Nun ging der Bösewicht zum dritten Mal zu der Haustür, klopfte an und sprach: "Macht auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht!" Die Geißlein riefen: "Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wißen, daß du unser liebes Mütterchen bist." Da legte der Wolf die Pfote ins Fenster, und als sie sahen, daß sie weiß war, so glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam, war der Wolf. Die Geißlein erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüßel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen: eins nach dem andern schluckte er in seinen Rachen; nur das jüngste in dem Uhrkasten fand er nicht. Als der Wolf seine Lust gebüßt hatte, trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter einen Baum und fing an zu schlafen.
Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach, was mußte sie da erblicken! Die Haustür stand sperrweit auf, Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen, die Waschschüßel lag in Scherben, Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich, als sie das jüngste rief, da rief eine feine Stimme: "Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten. "Sie holte es heraus, und es erzählte ihr, daß der Wolf gekommen wäre und die anderen alle gefreßen hätte. Da könnt ihr denken, wie sie über ihre armen Kinder geweint hat! Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geißlein lief mit. Als sie auf die Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte, daß die Äste zitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten und sah, daß in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. Ach, Gott, dachte sie, sollten meine armen Kinder, die er zum Nachtmahl hinuntergewürgt hat, noch am Leben sein? Da mußte das Geißlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen Schnitt getan, so streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus, und als sie weiter schnitt, so sprangen nacheinander alle sechse heraus, und waren noch alle am Leben, und hatten nicht einmal Schaden erlitten, denn das Ungetüm hatte sie in der Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude! Da herzten sie ihre liebe Mutter, und hüpften wie Schneider, der Hochzeit hält.
Die Alte aber sagte: "Jetzt geht und sucht Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen Tier den Bauch füllen, solange es noch im Schlafe liegt." Da schleppten die sieben Geißerchen in aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch, so viel als sie hineinbringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, daß er nichts merkte und sich nicht einmal regte. Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine, und weil ihm die Steine im Magen so großen Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken.
Als er aber anfing zu gehen und sich hin und her zu bewegen, so stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er:
"Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum?
Ich meinte, es wären sechs Geißelein,
doch sind's lauter Wackerstein."
Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein, und er mußte jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, kamen sie eilig herbeigelaufen und riefen laut:
"Der Wolf ist tot!
Der Wolf ist tot!"
und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.
DIE SIEBEN RABEN

Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sichs auch wünschte; endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hoffnung zu einem Kinde, und wie es zur Welt kam, war es auch ein Mädchen. Die Freude war groß, aber das Kind war schmächtig und klein, und sollte wegen seiner Schwachheit die Nottaufe haben. Der Vater schickte einen der Knaben eilends zur Quelle, Taufwasser zu holen: die andern sechs liefen mit, und weil jeder der erste beim Schöpfen sein wollte, so fiel ihnen der Krug in den Brunnen. Da standen sie und wußten nicht, was sie tun sollten, und keiner getraute sich heim. Als sie immer nicht zurückkamen, ward der Vater ungeduldig und sprach: "Gewiß haben sie's wieder über ein Spiel vergeßen, die gottlosen Jungen." Es ward ihm angst, das Mädchen müßte ungetauft verscheiden, und im Ärger rief er: "Ich wollte, daß die Jungen alle zu Raben würden." Kaum war das Wort ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Luft, blickte in die Höhe und sah sieben kohlschwarze Raben auf- und davon fliegen. Die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen, und so traurig sie über den Verlust ihrer sieben Söhne waren, trösteten sie sich doch einigermaßen durch ihr liebes Töchterchen, das bald zu Kräften kam, und mit jedem Tage schöner ward. Es wußte lange Zeit nicht einmal, daß es Geschwister gehabt hatte, denn die Eltern hüteten sich, ihrer zu erwähnen, bis es eines Tags von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte, das Mädchen wäre wohl schön, aber doch eigentlich schuld an dem Unglück seiner sieben Brüder. Da ward es ganz betrübt, ging zu Vater und Mutter und fragte, ob es denn Brüder gehabt hätte, und wo sie hingeraten wären. Nun durften die Eltern das Geheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch, es sei so des Himmels Verhängnis und seine Geburt nur der unschuldige Anlaß gewesen. Allein das Mädchen machte sich täglich ein Gewißen daraus und glaubte, es müßte seine Geschwister wieder erlösen. Es hatte nicht Ruhe und Rast, bis es sich heimlich aufmachte und in die weite Welt ging, seine Brüder irgendwo aufzuspüren und zu befreien, es möchte kosten, was es wollte.
Es nahm nichts mit sich als ein Ringlein von seinen Eltern zum Andenken, einen Laib Brot für den Hunger, ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen für die Müdigkeit. Nun ging es immerzu, weit weit, bis an der Welt Ende. Da kam es zur Sonne, aber die war zu heiß und fürchterlich, und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und lief hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch grausig und bös, und als er das Kind merkte, sprach er: "Ich rieche Menschenfleisch." Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen, die waren ihm freundlich und gut, und jeder saß auf seinem besondern Stühlchen. Der Morgenstern aber stand auf, gab ihm ein Hinkelbeinchen und sprach: "Wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du den Glasberg nicht aufschließen, und in dem Glasberg, da sind deine Brüder." Das Mädchen nahm das Beinchen, wickelte es wohl in ein Tüchlein, und ging wieder fort, so lange, bis es an den Glasberg kam. Das Tor war verschloßen und es wollte das Beinchen hervorholen, aber wie es das Tüchlein aufmachte, so war es leer, und es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfangen? Seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen SchIüßel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Tor und schloß glücklich auf. Als es eingegangen war, kam ihm ein Zwerglein entgegen, das sprach: "Mein Kind, was suchst du?" - "Ich suche meine Brüder, die sieben Raben," antwortete es. Der Zwerg sprach: "Die Herren Raben sind nicht zu Haus, aber willst du hier so lang warten, bis sie kommen, so tritt ein." Darauf trug das Zwerglein die Speise der Raben herein auf sieben Tellerchen und in sieben Becherchen, und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Bröckchen, und aus jedem Becherchen trank es ein SchIückchen; in das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen hatte. Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, da sprach das Zwerglein: "Jetzt kommen die Herren Raben heim geflogen." Da kamen sie, wollten essen und trinken, und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem andern: "Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen." Und wie der siebente auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, daß es ein Ring von Vater und Mutter war, und sprach: "Gott gebe, unser Schwesterlein wäre da, so wären wir erlöst." Wie das Mädchen, das hinter der Türe stand und lauschte, den Wunsch hörte, so trat es hervor, und da bekamen alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küßten einander, und zogen fröhlich heim.
RAPUNZEL
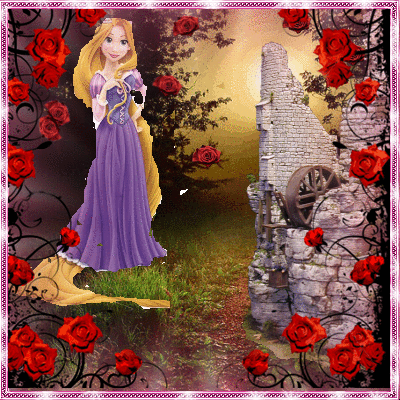
Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind, endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand; er war aber von einer hohen Mauer umgeben, und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab, da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war; und sie sahen so frisch und grün aus, daß sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wußte, daß sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blaß und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte: "Was fehlt dir, liebe Frau?" - "Ach," antwortete sie, "wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserm Hause zu essen kriege, so sterbe ich." Der Mann, der sie lieb hatte, dachte: "Eh du deine Frau sterben lässest, holst du ihr von den Rapunzeln, es mag kosten, was es will." In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und ass sie in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, daß sie den andern Tag noch dreimal soviel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so mußte der Mann noch einmal in den Garten steigen.
Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. "Wie kannst du es wagen," sprach sie mit zornigem Blick, "in meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? Das soll dir schlecht bekommen." - "Ach," antwortete er, "laßt Gnade für Recht ergehen, ich habe mich nur aus Not dazu entschloßen: meine Frau hat Eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt, und empfindet ein so großes Gelüsten, daß sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme." Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm: "Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, soviel du willst, allein ich mache eine Bedingung: Du mußt mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter." Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort.
Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloß es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag, und weder Treppe noch Türe hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich hin und rief:
"Rapunzel, Rapunzel,
Laß mir dein Haar herunter."
Rapunzel hatte lange prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter, und die Zauberin, stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, daß der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorüberkam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, daß er still hielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Türe des Turms, aber es war keine zu finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, daß er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte.
Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, daß eine Zauberin herankam, und hörte, wie sie hinaufrief:
"Rapunzel, Rapunzel,
Laß dein Haar herunter."
Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab, und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. "Ist das die Leiter, auf welcher man hinaufkommt, so will ich auch einmal mein Glück versuchen." Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu dem Turme und rief:
"Rapunzel, Rapunzel,
Laß dein Haar herunter."
Alsbald fielen die Haare herab, und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten, doch der Königssohn fing an ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, daß von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, daß es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müßen. Da verlor Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte, ob sie ihn zum Mann nehmen wollte, und sie sah, daß er jung und schön war, so dachte sie: "Der wird mich lieber haben als die alte Frau Gothel," und sagte ja, und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach: "Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bringe jedesmal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter flechten, und wenn die fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd."
Sie verabredeten, daß er bis dahin alle Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte: "Sag Sie mir doch, Frau Gothel, wie kommt es nur, sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir." - "Ach du gottloses Kind," rief die Zauberin, "was muß ich von dir hören, ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden, und du hast mich doch betrogen!" In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paarmal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten, und ritsch, ratsch waren sie abgeschnitten, und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, daß sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben mußte. Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest, und als der Königssohn kam und rief: "Rapunzel, Rapunzel, Laß dein Haar herunter." so ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah. "Aha," rief sie höhnisch, "du willst die Frau Liebste holen, aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr, die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren, du wirst sie nie wieder erblicken." Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen, und in der Verzweiflung sprang er den Turm herab: das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Walde umher, ass nichts als Wurzeln und Beeren, und tat nichts als jammern und weinen über den Verlust seiner liebsten Frau.
So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und Mädchen, kümmerlich lebte. Er vernahm eine Stimme, und sie deuchte ihn so bekannt; da ging er darauf zu, und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen, da wurden sie wieder klar, und er konnte damit sehen wie sonst. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen ward, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt.
DER FROSCHKÖNIG
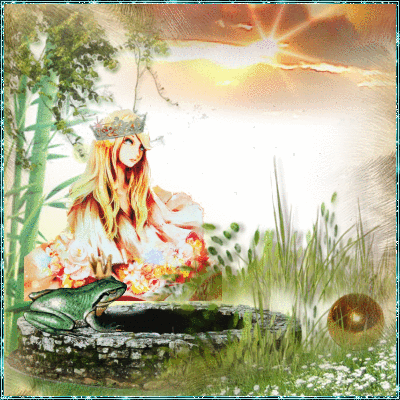
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schloße des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen; wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens - und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.Nun trug es sich einmal zu, daß die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief, daß man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten.
Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu: "Was hast du vor, Königstochter, du schreist ja, daß sich ein Stein erbarmen möchte." Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, häßlichen Kopf aus dem Wasser streckte. "Ach, du bist's, alter Wasserpatscher," sagte sie, "ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist." - "Sei still und weine nicht," antwortete der Frosch, "ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?" - "Was du haben willst, lieber Frosch," sagte sie; "meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage."Der Frosch antwortete: "Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich liebhaben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen." - "Ach ja," sagte sie, "ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst." Sie dachte aber: Was der einfältige Frosch schwätzt! Der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab, und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras.
Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. "Warte, warte," rief der Frosch, "nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du!" Aber was half es ihm, daß er ihr sein Quak, Quak so laut nachschrie, als er konnte! Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen mußte.Am andern Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen, und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief: "Königstochter, jüngste, mach mir auf!" Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre, als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und es war ihr ganz angst. Der König sah wohl, daß ihr das Herz gewaltig klopfte, und sprach: "Mein Kind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?" - "Ach nein," antwortete sie, "es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch." - "Was will der Frosch von dir?" - "Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Geselle werden; ich dachte aber nimmermehr, daß er aus seinem Wasser herauskönnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein."
Und schon klopfte es zum zweitenmal und rief:
"Königstochter, jüngste,
Mach mir auf,
Weißt du nicht, was gestern
Du zu mir gesagt
Bei dem kühlen Wasserbrunnen?
Königstochter, jüngste, Mach mir auf!"
Da sagte der König: "Was du versprochen hast, das mußt du auch halten; geh nur und mach ihm auf." Sie ging und öffnete die Türe, da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: "Heb mich herauf zu dir." Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er: "Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen." Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie's nicht gerne tat. Der Frosch liess sich's gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bißlein im Halse. Endlich sprach er: "Ich habe mich sattgegessen und bin müde; nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen." Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte.
Der König aber ward zornig und sprach: "Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten." Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach: "Ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater." Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand: "Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch." Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein, und am andern Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten, und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, daß er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen; der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief:
"Heinrich, der Wagen bricht!"
"Nein, Herr, der Wagen nicht,
Es ist ein Band von meinem Herzen,
Das da lag in grossen Schmerzen,
Als Ihr in dem Brunnen sasst, Als Ihr eine Fretsche wast."
Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war.
TISCHLEIN DECK DICH, ESEL STRECK DICH UND KNUEPPEL AUS DEM SACK
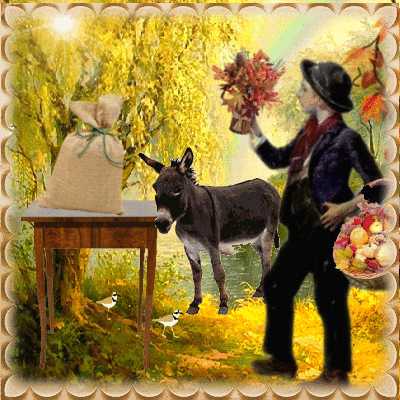
Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, mußte ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war heimzugehen, fragte er: "Ziege, bist du satt?" Die Ziege antwortete:
"Ich bin so satt,
Ich mag kein Blatt, mäh! mäh!"
"So komm nach Haus," sprach der Junge, faßte sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. "Nun," sagte der alte Schneider, "hat die Ziege ihr gehöriges Futter?" - "Oh," antwortete der Sohn, "die ist so satt, sie mag kein Blatt." Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall streichelte das liebe Tier und fragte: "Ziege, bist du auch satt?" Die Ziege antwortete:
"Wovon sollt ich satt sein?
Ich sprang nur über Gräbelein
Und fand kein einzig Blättelein, mäh! mäh!"
"Was muß ich hören!" rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen: "Ei, du Lügner, sagst die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen?" Und in seinem Zorn nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus.
Am anderen Tag war die Reihe am zweiten Sohn, der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie rein ab.
Abends, als er heim wollte, fragte er: "Ziege, bist du satt?" Die Ziege antwortete:
"Ich bin so satt,
Ich mag kein Blatt, mäh! mäh!"
"So komm nach Haus," sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. "Nun," sagte der alte Schneider, "hat die Ziege ihr gehöriges Futter?" - "Oh," antwortete der Sohn, ,die ist so satt, sie mag kein Blatt." Der Schneider wollte sich darauf nicht verlaßen, ging hinab in den Stall und fragte: "Ziege, bist du auch satt?" Die Ziege antwortete:
"Wovon sollt ich satt sein?
Ich sprang nur über Gräbelein
Und fand kein einzig Blättelein, mäh! mäh!"
"Der gottlose Bösewicht!" schrie der Schneider, "so ein frommes Tier hungern zu lassen " Lief hinauf und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustüre hinaus.
Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn, der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er: "Ziege, bist du auch satt?" Die Ziege antwortete:
"Ich bin so satt,
Ich mag kein Blatt, mäh! mäh!"
"So komm nach Haus," sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest. "Nun," sagte der alte Schneider, "hat die Ziege ihr gehöriges Futter?" - "Oh," antwortete der Sohn, "die ist so satt, sie mag kein Blatt." Der Schneider traute nicht, ging hinab und fragte: "Ziege, bist du auch satt?" Das boshafte Tier antwortete:
"Wovon sollt ich satt sein?
Ich sprang nur über Gräbelein
Und fand kein einzig Blättelein, mäh! mäh!"
"Oh, die Lügenbrut!" rief der Schneider, "einer so gottlos und pflichtvergessen wie der andere! Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben!" Und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf und gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, daß er zum Haus hinaus sprang.
Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am anderen Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach: "Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen." Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und unter Schafrippe und was sonst die Ziegen gerne fressen. "Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen," sprach er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er: "Ziege, bist du satt?" Sie antwortete:
"Ich bin so satt,
Ich mag kein Blatt, mäh! mäh!"
"So komm nach Haus," sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte: "Nun bist du doch einmal satt!" Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief:
"Wie sollt ich satt sein?
Ich sprang nur über Gräbelein
Und fand kein einzig Blättelein, mäh! mäh!"
Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, daß er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. "Wart," rief er, " Du undankbares Geschöpf, dich fortzujagen ist noch zu wenig, ich will dich zeichnen, daß du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen." In einer Hast sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, daß sie in gewaltigen Sprüngen davonlief.
Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, aber niemand wußte, wo sie hingeraten waren. Der älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen, da lernte er fleißig und unverdrossen, und als seine Zeit herum war, daß er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war; aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach: "Tischlein, deck dich!" so war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und stand da ein Teller, und Messer und Gabel daneben und Schüßeln mit Gesottenem und Gebratenem, so viel Platz hatten, und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, daß einem das Herz lachte. Der junge Gesell dachte: Damit hast du genug für dein Lebtag. Zog guter Dinge in der Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Wald, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, nahm er sein Tischchen vom Rücken, stellte es vor sich und sprach: "Deck dich!" so war alles da, was sein Herz begehrte. Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren, sein Zorn würde sich gelegt haben, und mit dem "Tischchen deck dich" würde er ihn gerne wieder aufnehmen. Es trug sich zu, daß er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen. "Nein," antwortete der Schreiner, "die paar Bissen will ich euch nicht von dem Munde nehmen, lieber sollt ihr meine Gäste sein." Sie lachten und meinten, er treibe seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach: "Tischlein, deck dich!" Augenblicklich war es mit Speisen besetzt, so gut, wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. "Zugegriffen, liebe Freunde!" sprach der Schreiner, und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah den Dingen zu; er wußte gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber: Einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht, endlich legten sie sich schlafen, und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wunschtischchen an die Wand. Dem Wirte aber ließen seine Gedanken keine Ruhe, es fiel ihm ein, daß in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stände, das geradeso aussah; das holte er ganz sachte herbei und vertauschte es mit dem Wunschtischchen. Am anderen Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran, daß er ein falsches hätte, und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. "Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?" sagte er zu ihm. "Vater, ich bin ein Schreiner geworden." - "Ein gutes Handwerk," erwiderte der Alte, "aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?" - "Vater, das beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen." Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte: "Daran hast du kein Meisterstück gemacht, das ist ein altes und schlechtes Tischchen." - "Aber es ist ein ›Tischchen deck dich‹," antwortete der Sohn, "wenn ich es hinstelle und sage ihm, es solle sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandte und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt." Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach: "Tischlein, deck dich!" Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischchen vertauscht war, und schämte sich, daß er wie ein Lügner da stand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mußten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Der Vater holte seine Lappen wieder herbei und schneiderte fort, der Sohn aber ging bei einem Meister in die Arbeit.
Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister: "Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art, er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke." - "Wozu ist er denn nütze?" fragte der junge Geselle. "Er speit Gold," antwortete der Müller, "wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst: Bricklebrit! so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn." - "Das ist eine schöne Sache," sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel "Bricklebrit!" zu sagen, so regnete es Goldstücke, und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Wo er hin kam, war ihm das Beste gut genug, und je teurer je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er: Du mußt deinen Vater aufsuchen, wenn du mit dem Goldesel kommst, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, daß er in das selbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischchen vertauscht war. Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden, der junge Geselle aber sprach: "Gebt Euch keine Mühe, meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muß wissen, wo er steht." Dem Wirt kam das wunderlich vor, und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen müßte, hätte nicht viel zu verzehren; aber als der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er solle nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre, der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müßte er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Geld war eben zu Ende. "Wartet einen Augenblick, Herr Wirt," sprach er, "ich will nur gehen und Gold holen!" nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wußte nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach, und da der Gast die Stalltüre zuriegelte, so guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief "Bricklebrit!" und augenblicklich fing das Tier an Gold zu speien von hinten und von vorne, daß es ordentlich auf die Erde herabregnete. "Ei, der Tausend!" sagte der Wirt, "da sind die Dukaten bald geprägt! So ein Geldbeutel ist nicht übel!" Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen, der Wirt aber schlich in der Nacht herab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen Esel an seine Stelle. Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wiedersah, und ihn gerne aufnahm. "Was ist aus dir geworden, mein Sohn?" fragte der Alte. "Ein Müller, lieber Vater," antwortete er. "Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?" - "Weiter nichts als einen Esel." - "Esel gibt's hier genug," sagte der Vater, "da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen." - "Ja," antwortete der Sohn, "aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel; wenn ich sage Bricklebrit!, so speit Euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Laßt nur alle Verwandten herbeirufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten." - "Das laß ich mir gefallen," sagte der Schneider, "dann brauch ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen," sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Müller Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. "Jetzt gebt acht!" sagte er und rief: "Bricklebrit!" aber es waren keine Goldstücke, was herab fiel, und es zeigte sich, daß das Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringt's nicht jeder Esel soweit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, daß er betrogen war, und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte mußte wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen.
Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen, und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, mußte er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe, wie schlimm es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wunschdinge gebracht hätte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack und sagte: "Es liegt ein Knüppel darin." - "Den Sack kann ich umhängen, und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihn nur schwer." - "Das will ich dir sagen," antwortete der Meister. "Hat dir jemand etwas zuleid getan, so sprich nur: ›Knüppel, aus dem Sack!‹, so springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, daß sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können; und eher läßt er nicht ab, als bis du sagst: ›Knüppel, in den Sack!‹" Der Gesell dankte ihm, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er: "Knüppel, aus dem Sack!" Alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem andern den Rock oder das Wams gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte; und das ging so geschwind, daß, eh sich's einer versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler langte zur Abendzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. "Ja," sagte er, "man findet wohl ein Tischchen deck dich, einen Goldesel und dergleichen, lauter gute Dinge, die ich nicht verachte, aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sack führe." Der Wirt spitzte die Ohren: Was in aller Welt mag das sein? dachte er, der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt; den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei. Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet; wie nun der Wirt eben einen herzhaften Ruck tun wollte, rief er: "Knüppel, aus dem Sack!" Alsbald fuhr der Knüppel heraus, dem Wirt auf den Leib und rieb ihm die Nähte, daß es eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler: "Wenn du das Tischchen deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, so soll der Tanz von neuem angehen!" - "Ach nein," rief der Wirt ganz kleinlaut, ich gebe alles gerne wieder heraus, laßt nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen." Da sprach der Geselle: "Ich will Gnade vor Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden!" Dann rief er "Knüppel, in den Sack!" und ließ ihn ruhen.
Der Drechsler zog am anderen Morgen mit dem Tichlein deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wiedersah, und fragte auch ihn, was es in der Fremde gelernt hätte. "Lieber Vater," antwortete er, "ich bin ein Drechsler geworden." - "Ein kunstreiches Handwerk," sagte der Vater, "was hast du von der Wanderschaft mitgebracht?" - "Ein kostbares Stück, lieber Vater," antwortete der Sohn, "einen Knüppel in dem Sack." - "Was?" rief der Vater, "einen Knüppel! Das ist der Mühe wert! Den kannst du dir von jedem Baume abhauen." - "Aber einen solchen nicht lieber Vater. Sage ich: ›Knüppel aus dem Sack!‹ so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und läßt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr mit diesem Knüppel habe ich das Tischlein deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt laßt sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein, ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen." Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder: "Nun, lieber Bruder, sprich mit ihm!" Der Müller sagte: "Bricklebrit!" und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen, und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, daß sie nicht mehr tragen konnten. Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte: "Lieber Bruder, nun sprich mit ihm!" Und kaum hatte der Schreiner "Tischlein, deck dich!" gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüßeln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Hause erlebt hatte, und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht, und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloß Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit.
Wo ist aber die Ziege hingekommen, die schuld war, daß der Schneider seine drei Söhne fort jagte? Das will ich dir sagen. Sie schämte sich, daß sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als der Fuchs nach Hause kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, daß er erschrak und wieder zurücklief. Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, so sprach er: "Was ist dir, Bruder Fuchs, was machst du für ein Gesicht?" - "Ach," antwortete der Rote, "ein grimmig Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt." - "Das wollen wir bald austreiben," sprach der Bär, ging mit zu der Höhle und schaute hinein; als er aber die feurigen Augen erblickte, wandelte ihn ebenfalls Furcht an, er wollte mit dem grimmigen Tiere nichts zu tun haben und nahm Reißaus. Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte, daß es ihm in seiner Haut nicht wohl zumute war, sprach sie: "Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießlich Gesicht, wo ist deine Lustigkeit geblieben?" - "Du hast gut reden," antwortete der Bär, "es sitzt ein grimmiges Tier mit Glotzaugen in dem Hause des Roten, und wir können es nicht herausjagen." Die Biene sprach: "Du dauerst mich, Bär, ich bin ein armes, schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht anguckt, aber ich glaube doch, daß ich euch helfen kann." Sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich der Ziege auf den glatten, geschorenen Kopf und stach sie so gewaltig, daß sie aufsprang, "mäh! mäh!" schrie und wie toll in die Welt hinein lief; und weiß niemand auf diese Stunde, wo sie hin gelaufen ist.
DIE GOLDENE GANS

Es war ein Mann, der hatte drei Söhne, davon hieß der jüngste der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, daß der älteste in den Wald gehen wollte, Holz hauen, und eh' er ging, gab ihm noch seine Mutter einen schönen feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes, graues Männlein, das bot ihm einen guten Tag und sprach: "Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und laß mich einen Schluck von deinem Wein trinken! Ich bin so hungrig und durstig." Der kluge Sohn aber antwortete: "Geb ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so hab ich selber nichts, pack dich deiner Wege!" ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl, und die Axt fuhr ihm in den Arm, daß er mußte heimgehen und sich verbinden lassen. Das war aber von dem grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald, und die Mutter gab ihm, wie dem ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete gleichfalls das alte, graue Männchen und hielt um ein Stückchen Kuchen und einen Trunk Wein an. Aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig: "Was ich dir gebe, das geht mir selber ab, pack dich deiner Wege!" ließ das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus, als er ein paar Hiebe am Baum getan, hieb er sich ins Bein, dass er mußte nach Haus getragen werden.
Da sagte der Dummling: "Vater, laß mich einmal hinausgehen und Holz hauen!" Antwortete der Vater: "Deine Brüder haben sich Schaden dabei getan, laß dich davon, du verstehst nichts davon." Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte: "Geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden." Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken, und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte, graue Männchen, grüßte ihn und sprach: "Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche, ich bin so hungrig und durstig." Antwortet der Dummling: " Ich habe nur Aschenkuchen und saures Bier, wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen." Da setzten sie sich, und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war's ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein: "Weil du ein gutes Herz hast und von dem deinigen gerne mitteilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden." Darauf nahm das Männlein Abschied.
Der Dummling ging hin und hieb den Baum um, und wie er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans, die hatte Federn von reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus, da wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter, die sahen die Gans, waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel wäre, und hätten gar gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die älteste dachte: Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann. Und als der Dummling einmal hinaus gegangen war, faßte sie die Gans beim Flügel aber Finger und Hand blieben ihr daran fest hängen. Bald hernach kam die zweite und hatte keinen andern Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen, kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie fest hängen. Endlich kam auch die dritte in der gleichen Absicht. Da schrien die andern: "Bleib weg, um Himmels Willen bleib weg!" Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, dachte: Sind die dabei so kann ich auch dabeisein und sprang hinzu, und wie sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb sie an ihr hängen. So mußten sie die Nacht bei der Gans zubringen.
Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm ging fort und kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mußten immer hinter im drein laufen, links und rechts, wie's ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Felde begegnete ihnen der Pfarrer, und als er den Aufzug sah, sprach er: "Schämt euch, ihr garstigen Mädchen, was lauft ihr dem jungen Bursch durchs Feld nach, schickt sich das?" Damit faßte er die jüngste an der Hand und wollte sie zurückziehen, wie er sie aber anrührte, blieb er gleichfalls hängen und mußte selber hinterdreinlaufen. Nicht lange, so kam der Küster daher und sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuß folgte. Da verwunderte er sich und rief: "Ei, Herr Pfarrer, wohinaus so geschwind? vergeßt nicht, daß wir heute noch eine Kindtaufe haben." Lief auf ihn zu und faßte ihn am Ärmel, blieb aber auch fest hängen. Wie die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Felde. Da rief der Pfarrer sie an und bat, sie möchten ihn und den Küster losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben sie hängen, und waren ihrer nun siebene, die dem Dummling mit der Gans nachliefen.
Er kam darauf in eine Stadt; da herrschte ein König, der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft, daß sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gesetz gegeben, wer sie könnte zum Lachen bringen, der sollte sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter, und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören.
Da verlangte sie der Dummling zur Braut, aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht, er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müßte ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könne. Der Dummling dachte an das graue Männchen, das könnte ihm wohl helfen, ging hinaus in den Wald, und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen, der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nähme. Da antwortete er: "Ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen, das kalte Wasser vertrage ich nicht, ein Faß Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einen heißen Stein?" - "Da kann ich dir helfen," sagte der Dummling, "komm nur mit mir, du sollst satt haben!" Er führte ihn darauf in des Königs Keller, und der Mann machte sich über die großen Fäßer, trank und trank, dassß ihm die Hüften weh taten, und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken.
Der Dummling verlangte abermals seine Braut, der König aber ärgerte sich, daß ein schlechter Bursch, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte, und machte neue Bedingungen: Er müßte erst einen Mann schaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte: "Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen, aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich. Mein Magen bleibt leer, und ich muß ihn zuschnüren, wenn ich nicht Hungers sterben soll." Der Dummling war froh darüber und sprach: "Mach dich auf und geh mit mir, du sollst dich satt essen!" Er führte ihn an den Hof des Königs, der hatte alles Mehl aus dem ganzen Reich zusammenfahren und einen ungeheuren Berg davon bauen laßen; der Mann aber aus dem Walde stellte sich davor, fing an zu essen, und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte zum drittenmal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnt. "Sowie du aber damit angesegelt kommst," sagte er, "sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben." Der Dummling ging geraden Weges in den Wald, da saß das alte, graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte: "Ich habe für dich getrunken und gegessen, ich will dir auch das Schiff geben; das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist" Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr, und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten.
Die Hochzeit ward gefeiert; nach des Königs Tod erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin.
DIE ZWÖLF JÄGER

Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Braut und hatte sie sehr lieb. Als er nun bei ihr saß und ganz vergnügt war, da kam die Nachricht, daß sein Vater todkrank läge und ihn noch vor seinem Ende zu sehen verlangte. Da sprach er zu seiner Liebsten 'ich muß nun fort und muß dich verlaßen, da geb ich dir einen Ring zu meinem Andenken. Wann ich König bin, komm ich wieder und hol dich heim.' Da ritt er fort, und als er bei seinem Vater anlangte, war dieser sterbens krank und dem Tode nah. Er sprach zu ihm 'liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen, versprich mir, nach meinem Willen dich zu verheiraten,' und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, dass er sich gar nicht bedachte, sondern sprach 'ja, lieber Vater, was Euer Wille ist, soll geschehen,' und darauf schloss der König die Augen und starb.
Als nun der Sohn zum König ausgerufen und die Trauerzeit verfloßen war, muße er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte, und ließ um die Königstochter werben, und sie ward ihm auch zugesagt. Das hörte seine erste Braut und grämte sich über die Untreue so sehr, daß sie fast verging. Da sprach ihr Vater zu ihr 'liebstes Kind, warum bist du so traurig? was du dir wünschest, das sollst du haben.' Sie bedachte sich einen Augenblick, dann sprach sie 'lieber Vater, ich wünsche mir elf Mädchen, von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich.' Sprach der König 'wenns möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden,' und ließ in seinem ganzen Reich so lange suchen, bis elf Jungfrauen gefunden waren, seiner Tochter von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich.
Als sie zu der Königstochter kamen, ließ diese zwölf Jägerkleider machen, eins wie das andere, und die elf Jungfrauen mussten die Jägerkleider anziehen, und sie selber zog das zwölfte an. Darauf nahm sie Abschied von ihrem Vater und ritt mit ihnen fort und ritt an den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie so sehr liebte. Da fragte sie an, ob er Jäger brauchte, und ob er sie nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der König sah sie an und erkannte sie nicht; weil es aber so schöne Leute waren, sprach er ja, er wollte sie gerne nehmen; und da waren sie die zwölf Jäger des Königs.
Der König aber hatte einen Löwen, das war ein wunderliches Tier, denn er wußte alles Verborgene und Heimliche. Es trug sich zu, daß er eines Abends zum König sprach 'du meinst, du hättest da zwölf Jäger?' 'Ja,' sagte der König, 'zwölf Jäger sinds.' Sprach der Löwe weiter 'du irrst dich, das sind zwölf Mädchen.' Antwortete der König 'das ist nimmermehr wahr, wie willst du mir das beweisen?' 'O, laß nur Erbsen in dein Vorzimmer streuen,' antwortete der Löwe, 'da wirst du es gleich sehen. Männer haben einen festen Tritt, wenn die über Erbsen hingehen, regt sich keine, aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurfeln, und die Erbsen rollen.' Dem König gefiel der Rat wohl, und er ließ die Erbsen streuen.
Es war aber ein Diener des Königs, der war den Jägern gut, und wie er hörte, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, ging er hin und erzählte ihnen alles wieder und sprach 'der Löwe will dem König weismachen, ihr wärt Mädchen.' Da dankte ihm die Königstochter und sprach hernach zu ihren Jungfrauen 'tut euch Gewalt an und tretet fest auf die Erbsen.' Als nun der König am andern Morgen die zwölf Jäger zu sich rufen ließ, und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, so traten sie so fest darauf und hatten einen so sichern starken Gang, daß auch nicht eine rollte oder sich bewegte. Da gingen sie wieder fort, und der König sprach zum Löwen 'du hast mich belogen, sie gehen ja wie Männer.' Antwortete der Löwe 'sie habens gewußt, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angetan. Laß nur einmal zwölf Spinnräder ins Vorzimmer bringen, so werden sie herzukommen und werden sich daran freuen, und das tut kein Mann.' Dem König gefiel der Rat, und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer stellen.
Der Diener aber, der es redlich mit den Jägern meinte, ging hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach die Königstochter, als sie allein waren, zu ihren elf Mädchen 'tut euch Gewalt an und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern.' Wie nun der König am andern Morgen seine zwölf Jäger rufen ließ, so kamen sie durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wiederum zum Löwen 'du hast mich belogen, es sind Männer, denn sie haben die Spinnräder nicht angesehen.' Der Löwe antwortete 'sie habens gewußt, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angetan.' Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben.
Die zwölf Jäger folgten dem König beständig zur Jagd, und er hatte sie je länger je lieber. Nun geschah es, daß, als sie einmal auf der Jagd waren, Nachricht kam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Wie die rechte Braut das hörte, tats ihr so weh, daß es ihr fast das Herz abstieß, und sie ohnmächtig auf die Erde fiel. Der König meinte, seinem lieben Jäger sei etwas begegnet, lief hinzu und wollte ihm helfen, und zog ihm den Handschuh aus. Da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut gegeben, und als er ihr in das Gesicht sah, erkannte er sie. Da ward sein Herz so gerührt, daß er sie küßte, und als sie die Augen aufschlug, sprach er 'du bist mein und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern.' Zu der andern Braut aber schickte er einen Boten und ließ sie bitten, in ihr Reich zurückzukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten SchIüßel wiedergefunden habe, brauche den neuen nicht. Darauf ward die Hochzeit gefeiert, und der Löwe kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte.
DIE WUNDERLICHE GASTEREI

Auf eine Zeit lebte eine Blutwurst und eine Leberwurst in Freundschaft, und die Blutwurst bat die Leberwurst zu Gast. Wie es Essenszeit war, ging die Leberwurst auch ganz vergnügt zu der Blutwurst, als sie aber in die Hausthüre trat, sah sie allerlei wunderliche Dinge, auf jeder Stiege der Treppe, deren viele waren, immer etwas anderes, da war etwa ein Besen und eine Schippe, die sich miteinander schlugen, dann ein Affe mit einer grossen Wunde am Kopf und dergleichen mehr.
Die Leberwurst war ganz erschrocken und bestürzt darüber, doch nahm sie sich ein Herz, trat in die Stube und wurde von der Blutwurst freundschaftlich empfangen. Die Leberwurst hub an, sich nach den seltsamen Dingen zu erkundigen, die draussen auf der Treppe wären, die Blutwurst that aber, als hörte sie es nicht, oder als sei es nicht der Mühe werth davon zu sprechen, oder sie sagte etwa von der Schippe und dem Besen: "Es wird meine Magd gewesen seyn, die auf der Treppe mit jemand geschwätzt hat," und brachte die Rede auf etwas anderes.
Die Blutwurst ging darauf hinaus und sagte, sie müsse in der Küche nach dem Essen sehen, ob alles ordentlich angerichtet werde, und nichts in die Asche geworfen. Wie die Leberwurst derweil in der Stube auf und abging und immer die wunderlichen Dinge im Kopf hatte, kam jemand, ich weiss nicht, wers gewesen ist, herein und sagte: "Ich warne dich, Leberwurst, du bist in einer Blut- und Mörderhöhle, mach dich eilig fort, wenn dir dein Leben lieb ist." Die Leberwurst besann sich nicht lang, schlich zur Thür hinaus und lief, was sie konnte; sie stand auch nicht eher still, bis sie aus dem Haus mitten auf der Strasse war. Da blickte sie sich um, und sah die Blutwurst oben im Bodenloch stehen mit einem langen, langen Messer, das blinkte, als wärs frisch gewetzt, und damit drohte sie, und rief herab: "Hätt ich dich, so wollt ich dich!"
DAS TOTENHEMDCHEN

Es hatte eine Mutter ein Büblein von sieben Jahren, das war so schön und lieblich, daß es niemand ansehen konnte, ohne mit ihm gut zu sein, und sie hatte es auch lieber als alles auf der Welt. Nun geschah es, daß es plötzlich krank ward, und der liebe Gott es zu sich nahm; darüber konnte sich die Mutter nicht trösten und weinte Tag und Nacht. Bald darauf aber, nachdem es begraben war, zeigte sich das Kind nachts an den Plätzen, wo es sonst im Leben gesessen und gespielt hatte; weinte die Mutter, so weinte es auch, und wenn der Morgen kam, war es verschwunden. Als aber die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, kam es in einer Nacht mit seinem weißen Totenhemdchen, in welchem es in den Sarg gelegt war, und mit dem Kränzchen auf dem Kopf, setzte sich zu ihren Füßen auf das Bett und sprach 'ach Mutter, höre doch auf zu weinen, sonst kann ich in meinem Sarge nicht einschlafen, denn mein Totenhemdchen wird nicht trocken von deinen Tränen, die alle darauf fallen.' Da erschrak die Mutter, als sie das hörte, und weinte nicht mehr. Und in der andern Nacht kam das Kindchen wieder, hielt in der Hand ein Lichtchen und sagte 'siehst du, nun ist mein Hemdchen bald trocken, und ich habe Ruhe in meinem Grab.' Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid und ertrug es still und geduldig, und das Kind kam nicht wieder, sondern schlief in seinem unterirdischen Bettchen.
DER TOD UND DER GÄNSEHIRT

Es ging ein armer Hirt an dem Ufer eines grossen und ungestümen Wassers, hütend einen Haufen weisser Gänse. Zu diesem kam der Tod über Wasser und wurde von dem Hirten gefragt, wo er herkomme und wo er hin wolle. Der Tod antwortete, dass er aus dem Wasser komme und aus der Welt wolle. Der arme Gänsehirt fragte ferners, wie man doch aus der Welt kommen könne. Der Tod sagte, dass man über das Wasser in die neue Welt müsse, welche jenseits gelegen. Der Hirt sagte, dass er dieses Lebens müde, und bat den Tod, er sollte ihn mit über nehmen. Der Tod sagte, dass es noch nicht Zeit, und hätte er jetzt sonst zu verrichten. Es war aber unferne davon ein Geizhals, der trachtete bei nachts auf seinem Lager, wie er doch mehr Geld und Gut zusammenbringen möchte, den führte der Tod zu dem grossen Wasser und stiess ihn hinein. Weil er aber nicht schwimmen konnte, ist er zu Grunde gesunken, bevor er an das Ufer konnte. Seine Hunde und Katzen, so ihm nachgelaufen, sind auch mit ihm ersoffen. Etliche Tage hernach kam der Tod auch zu dem Gänsehirten, fand ihn fröhlich singen und sprach zu ihm: "Willst du nun mit?" Er war willig und kam mit seinen weissen Gänsen wohl hinüber, welche alle in weisse Schafe verwandelt worden. Der Gänsehirt betrachtete das schöne Land und hörte, dass die Hirten derorten zu Königen würden, und indem er sich recht umsah, kamen ihm die Erzhirten Abraham, Isaak und Jakob entgegen, setzten ihm eine königliche Krone auf und führten ihn in der Hirten Schloss, allda er noch zu finden.
DIE HIMMLISCHE HOCHZEIT

Es hörte einmal ein armer Bauernjunge in der Kirche, wie der Pfarrer sprach 'wer da will ins Himmelreich kommen, muss immer geradeaus gehen.' Da machte er sich auf, und ging immerzu, immer gerade, ohne abzuweichen, über Berg und Tal. Endlich führte ihn sein Weg in eine große Stadt, und mitten in die Kirche, wo eben Gottesdienst gehalten wurde. Wie er nun all die Herrlichkeit sah, meinte er, nun wäre er im Himmel angelangt, setzte sich hin und war von Herzen froh. Als der Gottesdienst vorbei war und der Küster ihn hinausgehen hiess, antwortete er 'nein, ich gehe nicht wieder hinaus, ich bin froh, dass ich endlich im Himmel bin,' Da ging der Küster zum Pfarrer und sagte ihm, es wäre ein Kind in der Kirche, das wollte nicht wieder heraus, weil es glaubte, es wäre im Himmelreich. Der Pfarrer sprach 'wenn es das glaubt, so wollen wir es darin lassen.' Darauf ging er hin und fragte, ob es auch Lust hätte zu arbeiten. 'Ja,' antwortete der Kleine, ans Arbeiten wäre er gewöhnt, aber aus dem Himmel ginge er nicht wieder heraus. Nun blieb er in der Kirche, und als er sah, wie die Leute zu dem Muttergottesbild mit dem Jesuskind, das aus Holz geschnitten war, kamen, knieten und beteten, dachte er 'das ist der liebe Gott,' und sprach 'hör einmal, lieber Gott, was bist du mager! gewiss lassen dich die Leute hungern: ich will dir aber jeden Tag mein halbes Essen bringen,' Von nun an brachte er dem Bilde jeden Tag die Hälfte von seinem Essen, und das Bild fing auch an, die Speise zu geniessen. Wie ein paar Wochen herum waren, merkten die Leute, dass das Bild zunahm, dick und stark ward, und wunderten sich sehr. Der Pfarrer konnt es auch nicht begreifen, blieb in der Kirche und ging dem Kleinen nach, da sah er, wie der Knabe sein Brot mit der Mutter Gottes teilte und diese es auch annahm.
Nach einiger Zeit wurde der Knabe krank und kam acht Tage lang nicht aus dem Bett; wie er aber wieder aufstehen konnte, war sein erstes, dass er seine Speise der Mutter Gottes brachte. Der Pfarrer ging ihm nach und hörte, wie er sprach 'lieber Gott, nimm es nicht übel, dass ich dir so lange nichts gebracht habe: ich war aber krank und konnte nicht aufstehen,' Da antwortete ihm das Bild und sprach 'ich habe deinen guten Willen gesehen, das ist mir genug; nächsten Sonntag sollst du mit mir auf die Hochzeit kommen,' Der Knabe freute sich darüber und sagte es dem Pfarrer, der bat ihn hinzugehen und das Bild zu fragen, ob er auch dürfte mitkommen. 'Nein,' antwortete das Bild, 'du allein,' Der Pfarrer wollte ihn erst vorbereiten und ihm das Abendmahl geben, das war der Knabe zufrieden; und nächsten Sonntag, wie das Abendmahl an ihn kam, fiel er um und war tot und war zur ewigen Hochzeit.
DER SCHNEIDER IM HIMMEL

Es trug sich zu, dass der liebe Gott an einem schönen Tag in dem himmlischen Garten sich ergehen wollte und alle Apostel und Heiligen mitnahm, also dass niemand mehr im Himmel blieb als der heilige Petrus. Der Herr hatte ihm befohlen, während seiner Abwesenheit niemand einzulassen, Petrus stand also an der Pforte und hielt Wache. Nicht lange, so klopfte jemand an. Petrus fragte, wer da wäre und was er wollte. "Ich bin ein armer ehrlicher Schneider," antwortete eine feine Stimme, "der um Einlass bittet." - "Ja, ehrlich," sagte Petrus, "wie der Dieb am Galgen, du hast lange Finger gemacht und den Leuten das Tuch abgezwickt. Du kommst nicht in den Himmel, der Herr hat mir verboten, solange er draußen wäre, irgend jemand einzulassen. " - "Seid doch barmherzig," rief der Schneider, "kleine Flicklappen, die von selbst vom Tisch herabfallen, sind nicht gestohlen und nicht der Rede wert. Seht, ich hinke und habe von dem Weg daher Blasen an den Füssen, ich kann unmöglich wieder umkehren. Lasst mich nur hinein, ich will alle schlechte Arbeit tun. Ich will die Kinder tragen, die Windeln waschen, die Bänke, darauf sie gespielt haben, säubern und abwischen und ihre zerrissenen Kleider flicken. " Der heilige Petrus ließ sich aus Mitleiden bewegen und öffnete dem lahmen Schneider die Himmelspforte so weit, dass er mit seinem dürren Leib hineinschlüpfen konnte. Er musste sich in einen Winkel hinter die Türe setzen und sollte sich da still und ruhig verhalten, damit ihn der Herr, wenn er zurück käme, nicht bemerkte und zornig würde. Der Schneider gehorchte, als aber der heilige Petrus einmal zur Türe hinaustrat, stand er auf, ging voll Neugierde in allen Winkeln des Himmels herum und besah sich die Gelegenheit. Endlich kam er zu einem Platz, da standen viele schöne und köstliche Stühle und in der Mitte ein ganz goldener Sessel, der mit glänzenden Edelsteinen besetzt war; er war auch viel höher als die übrigen Stühle, und ein goldener Fussschemel stand davor. Es war aber der Sessel, auf welchem der Herr sass, wenn er daheim war, und von welchem er alles sehen konnte, was auf Erden geschah. Der Schneider stand still und sah den Sessel eine gute Weile an, denn er gefiel ihm besser als alles andere. Endlich konnte er den Vorwitz nicht bezähmen, stieg hinauf und setzte sich in den Sessel. Da sah er alles, was auf Erden geschah, und bemerkte eine alte hässliche Frau, die an einem Bach stand und wusch und zwei Schleier heimlich beiseite tat. Der Schneider erzürnte sich bei diesem Anblicke so sehr, dass er den goldenen Fussschemel ergriff und durch den Himmel auf die Erde hinab nach der alten Diebin warf. Da er aber den Schemel nicht wieder heraufholen konnte, so schlich er sich sachte aus dem Sessel weg, setzte sich an seinen Platz hinter die Türe und tat, als ob er kein Wasser getrübt hätte.
Als der Herr und Meister mit dem himmlischen Gefolge wieder zurückkam, ward er zwar den Schneider hinter der Türe nicht gewahr, als er sich aber auf seinen Sessel setzte, mangelte der Schemel. Er fragte den heiligen Petrus, wo der Schemel hingekommen wäre, der wusste es nicht. Da fragte er weiter, ob er jemand hereingelassen hätte. "Ich weiß niemand," antwortete Petrus, "der dagewesen wäre, als ein lahmer Schneider, der noch hinter der Türe sitzt." Da liess der Herr den Schneider vor sich treten und fragte ihn, ob er den Schemel weggenommen und wo er ihn hingetan hätte. "O Herr," antwortete der Schneider freudig, "ich habe ihn im Zorne hinab auf die Erde nach einem alten Weibe geworfen, das ich bei der Wäsche zwei Schleier stehlen sah." - "O du Schalk," sprach der Herr, "wollt ich richten, wie du richtest, wie meinst du, dass es dir schon längst ergangen wäre? Ich hätte schon lange keine Stühle, Bänke, Sessel, ja keine Ofengabel mehr hier gehabt, sondern alles nach den Sündern hinabgeworfen. Fortan kannst du nicht mehr im Himmel bleiben, sondern musst wieder hinaus vor das Tor: da sieh zu, wo du hinkommst. Hier soll niemand strafen denn ich allein, der Herr."
Petrus musste den Schneider wieder hinaus vor den Himmel bringen, und weil er zerrissene Schuhe hatte und die Füsse voll Blasen, nahm er einen Stock in die Hand und zog nach Warteinweil, wo die frommen Soldaten sitzen und sich lustig machen.
FRAU HOLLE
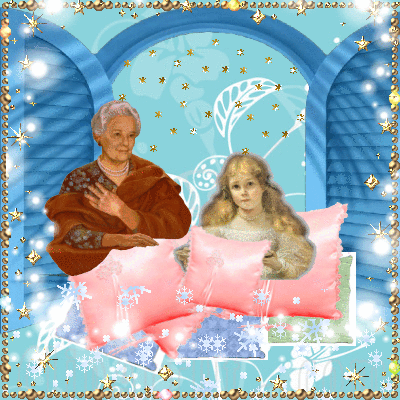
Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die grosse Strasse bei einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war, da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen; sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach: "Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf." Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte; und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und vieltausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief: "Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: ich bin schon längst ausgebacken." Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und rief ihm zu: "Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif." Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war; und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so grosse Zähne hatte, ward ihm angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: "Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll dir's gut gehn. Du musst nur achtgeben, dass du mein Bett gut machst und es fleissig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt; ich bin die Frau Holle." Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig, auf dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen; dafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte, endlich merkte es, dass es Heimweh war; ob es ihm hier gleich vieltausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr: "Ich habe den Jammer nach Haus gekriegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den Meinigen." Die Frau Holle sagte: "Es gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen." Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein grosses Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. "Das sollst du haben, weil du so fleissig gewesen bist," sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus; und als es in den Hof kam, sass der Hahn auf dem Brunnen und rief:
"Kikeriki,
Unsere goldene Jungfrau ist wieder hie."
Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen.
Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem grossen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder: "Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebacken." Die Faule aber antwortete: "Da hätt ich Lust, mich schmutzig zu machen," und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief: "Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif." Sie antwortete aber: "Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen," und ging damit weiter. Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren grossen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleissig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde; am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sich's gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen; die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein grosser Kessel voll Pech ausgeschüttet. "Das ist zur Belohnung deiner Dienste," sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief:
"Kikeriki,
Unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie."
Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen.
DIE KLUGE BAUERNTOCHTER
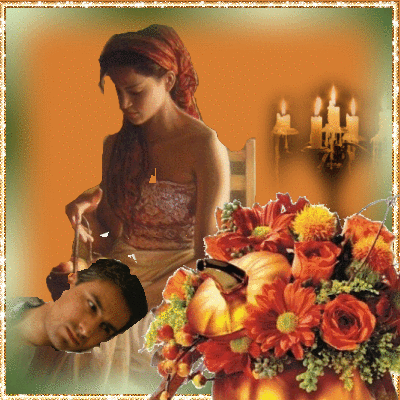
Es war einmal ein armer Bauer, der hatte kein Land, nur ein kleines Häuschen und eine alleinige Tochter, da sprach die Tochter 'wir sollten den Herrn König um ein Stückchen Rottland bitten.' Da der König ihre Armut hörte, schenkte er ihnen auch ein Eckchen Rasen, den hackte sie und ihr Vater um, und wollten ein wenig Korn und der Art Frucht darauf säen. Als sie den Acker beinah herum hatten, so fanden sie in der Erde einen Mörsel von purem Gold 'Hör,' sagte der Vater zu dem Mädchen, 'weil unser Herr König ist so gnädig gewesen und hat uns diesen Acker geschenkt, so müssen wir ihm den Mörsel dafür geben.' Die Tochter aber wollte es nicht bewilligen und sagte 'Vater, wenn wir den Mörsel haben und haben den Stösser nicht' dann müssen wir auch den Stösser herbeischaffen, darum schweigt lieber still.'
Er wollt ihr aber nicht gehorchen, nahm den Mörsel, trug ihn zum Herrn König und sagte, den hätte er gefunden in der Heide, ob er ihn als eine Verehrung annehmen wollte. Der König nahm den Mörsel und fragte, ob er nichts mehr gefunden hätte. 'Nein,' antwortete der Bauer. Da sagte der König, er solle nun auch den Stösser herbeischaffen. Der Bauer sprach, den hätten sie nicht gefunden; aber das half ihm so viel, als hätt ers in den Wind gesagt, er ward ins Gefängnis gesetzt, und sollte so lange da sitzen, bis er den Stösser herbeigeschafft hätte. Die Bedienten mussten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man so in dem Gefängnis kriegt, da hörten sie, wie der Mann als fort schrie 'ach, hätt ich meiner Tochter gehört! ach, ach, hätt ich meiner Tochter gehört!, Da gingen die Bedienten zum König und sprachen das, wie der Gefangene als fort schrie 'ach, hätt ich doch meiner Tochter gehört!' und wollte nicht essen und nicht trinken.
Da befahl er den Bedienten, sie sollten den Gefangenen vor ihn bringen, und da fragte ihn der Herr König, warum er also fort schrie 'ach, hätt ich meiner Tochter gehört!' 'Was hat Eure Tochter denn gesagt?' 'Ja, sie hat gesprochen, ich sollte den Mörsel nicht bringen, sonst müsst ich auch den Stösser schaffen.' 'Habt Ihr so eine kluge Tochter, so lasst sie einmal herkommen.' Also musste sie vor den König kommen, der fragte sie, ob sie denn so klug wäre, und sagte, er wollte ihr ein Rätsel aufgeben, wenn sie das treffen könnte, dann wollte er sie heiraten. Da sprach sie gleich ja, sie wollts erraten. Da sagte der König 'komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg, und wenn du das kannst, will ich dich heiraten.'
Da ging sie hin, und zog sich aus splinternackend, da war sie nicht gekleidet, und nahm ein grosses Fischgarn, und setzte sich hinein und wickelte es ganz um sich herum, da war sie nicht nackend: und borgte einen Esel fürs Geld und band dem Esel das Fischgarn an den Schwanz, darin er sie fortschleppen musste und war das nicht geritten und nicht gefahren: der Esel musste sie aber in der Fahrgleise schleppen, so dass sie nur mit der grossen Zehe auf die Erde kam, und war das nicht in dem Weg und nicht außer dem Wege. Und wie sie so daherkam, sagte der König, sie hätte das Rätsel getroffen, und es wäre alles erfüllt. Da liess er ihren Vater los aus dem Gefängnis, und nahm sie bei sich als seine Gemahlin und befahl ihr das ganze königliche Gut an.
Nun waren etliche Jahre herum, als der Herr König einmal auf die Parade zog, da trug es sich zu, dass Bauern mit ihren Wagen vor dem Schloss hielten, die hatten Holz verkauft; etliche hatten Ochsen vorgespannt, und etliche Pferde. Da war ein Bauer, der hatte drei Pferde, davon kriegte eins ein junges Füllchen, das lief weg und legte sich mitten zwischen zwei Ochsen, die vor dem Wagen waren. Als nun die Bauern zusammenkamen, fingen sie an sich zu zanken, zu schmeissen und zu lärmen, und der Ochsenbauer wollte das Füllchen behalten und sagte, die Ochsen hättens gehabt: und der andere sagte nein, seine Pferde hättens gehabt, und es wäre sein. Der Zank kam vor den König, und er tat den Ausspruch, wo das Füllen gelegen hätte, da sollt es bleiben; und also bekams der Ochsenbauer, dems doch nicht gehörte. Da ging der andere weg, weinte und lamentierte über sein Füllchen.
Nun hatte er gehört, wie dass die Frau Königin so gnädig wäre, weil sie auch von armen Bauersleuten gekommen wäre: ging er zu ihr und bat sie, ob sie ihm nicht helfen könnte, dass er sein Füllchen wieder bekäme. Sagte sie 'ja, wenn Ihr mir versprecht, dass Ihr mich nicht verraten wollt, so will ichs Euch sagen. Morgen früh, wenn der König auf der Wachtparade ist, so stellt Euch hin mitten in die Strasse, wo er vorbeikommen muss, nehmt ein großes Fischgarn und tut, als fischtet Ihr, und fischt also fort und schüttet das Garn aus, als wenn Ihrs voll hättet,' und sagte ihm auch, was er antworten sollte, wenn er vom König gefragt würde.
Also stand der Bauer am andern Tag da und fischte auf einem trockenen Platz. Wie der König vorbeikam und das sah, schickte er seinen Laufer hin, der sollte fragen, was der närrische Mann vorhätte. Da gab er zur Antwort 'ich fische.' Fragte der Laufer, wie er fischen könnte, es wäre ja kein Wasser da. Sagte der Bauer 'so gu t als zwei Ochsen können ein Füllen kriegen, so gut kann ich auch auf dem trockenen Platz fischen.' Der Laufer ging hin und brachte dem König die Antwort, da liess er den Bauer vor sich kommen und sagte ihm, das hätte er nicht von sich, von wem er das hätte: und sollts gleich bekennen. Der Bauer aber wollts nicht tun und sagte immer: Gott bewahr! er hätt es von sich. Sie legten ihn aber auf ein Gebund Stroh und schlugen und drangsalten ihn so lange, bis ers bekannte, dass ers von der Frau Königin hätte.
Als der König nach Haus kam, sagte er zu seiner Frau 'warum bist du so falsch mit mir, ich will dich nicht mehr zur Gemahlin: deine Zeit ist um, geh wieder hin, woher du gekommen bist, in dein Bauernhäuschen.' Doch erlaubte er ihr eins, sie sollte sich das Liebste und Beste mitnehmen, was sie wüsste, und das sollte ihr Abschied sein. Sie sagte 'ja, lieber Mann,' wenn dus so befiehlst, will ich es auch tun,' und fiel über ihn her und küsste ihn und sprach, sie wollte Abschied von ihm nehmen.
Dann liess sie einen starken Schlaftrunk kommen, Abschied mit ihm zu trinken: der König tat einen großen Zug, sie aber trank nur ein wenig. Da geriet er bald in einen tiefen Schlaf, und als sie das sah, rief sie einen Bedienten und nahm ein schönes weisses Linnentuch und schlug ihn da hinein, und die Bedienten mussten ihn in einen Wagen vor die Türe tragen, und fuhr sie ihn heim in ihr Häuschen. Da legte sie ihn in ihr Bettchen, und er schlief Tag und Nacht in einem fort, und als er aufwachte, sah er sich um und sagte 'ach Gott, wo bin ich denn?' rief seinen Bedienten, aber es war keiner da. Endlich kam seine Frau vors Bett und sagte 'lieber Herr König, Ihr habt mir befohlen, ich sollte das Liebste und Beste aus dem Schloss mitnehmen, nun hab ich nichts Besseres und Lieberes als dich, da hab ich dich mitgenommen.' Dem König stiegen die Tränen in die Augen, und er sagte 'liebe Frau, d u sollst mein sein und ich dein,' und nahm sie wieder mit ins königliche Schloss und liess sich aufs neue mit ihr vermählen; und werden sie ja wohl noch auf den heutigen Tag leben.
DIE KLUGE ELSE

Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die kluge Else. Als sie nun erwachsen war, sprach der Vater: "Wir wollen sie heiraten lassen." - "Ja," sagte die Mutter, "wenn nur einer käme, der sie haben wollte!" Endlich kam von weither einer, der hieß Hans und hielt um sie an; er machte aber die Bedingung, dass die kluge Else auch recht gescheit wäre. "O," sprach der Vater, "die hat Zwirn im Kopf," und die Mutter sagte: "Ach, die sieht den Wind auf der Gasse laufen und hört die Fliegen husten." - "Ja," sprach der Hans, "wenn sie nicht recht gescheit ist, so nehme ich sie nicht."
Als sie nun zu Tisch sassen und gegessen hatten, sprach die Mutter: "Else, geh in den Keller und hol Bier!" Da nahm die kluge Else den Krug von der Wand, ging in den Keller und klappte unterwegs brav mit dem Deckel, damit ihr die Zeit ja nicht lang würde. Als sie unten war, holte sie ein Stühlchen und stellte es vors Fass, damit sie sich nicht zu bücken brauchte und ihrem Rücken etwa nicht wehe täte und unverhofften Schaden nähme. Dann stellte sie die Kanne vor sich und drehte den Hahn auf, und während der Zeit, dass das Bier hineinlief, wollte sie doch ihre Augen nicht müssig lassen, sah oben an die Wand hinauf und erblickte nach vielem Hin- und Herschauen eine Kreuzhacke gerade über sich, welche die Maurer da aus Versehen hatten stecken lassen. Da fing die kluge Else an zu weinen und sprach: "Wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und wir schicken das Kind in den Keller, dass es hier soll Bier zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot." Da sass sie und weinte und schrie aus Leibeskräften über das bevorstehende Unglück.
Die oben warteten auf den Trank, aber die kluge Else kam immer nicht. Da sprach die Frau zur Magd: "Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt!" Die Magd ging und fand sie vor dem Fasse sitzend und laut schreiend. "Else, was weinst du?" fragte die Magd. "Ach," antwortete sie, "soll ich nicht weinen? Wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und soll hier Trinken zapfen, so fällt ihm vielleicht die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt es tot." Da sprach die Magd: "Was haben wir für eine kluge Else!" setzte sich zu ihr und fing auch an, über das Unglück zu weinen. Über eine Weile, als die Magd nicht wiederkam, und die droben durstig nach dem Trank waren, sprach der Mann zum Knecht: "Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else und die Magd bleibt!"
Der Knecht ging hinab, da sass die kluge Else und die Magd, und weinten beide zusammen. Da fragte er: "Was weint ihr denn?" -"Ach," sprach die Else, "soll ich nicht weinen? Wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und soll hier Trinken zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot." Da sprach der Knecht: "Was haben wir für eine kluge Else!" setzte sich zu ihr und fing auch an laut zu heulen. Oben warteten sie auf den Knecht, als er aber immer nicht kam, sprach der Mann zur Frau: "Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt!"
Die Frau ging hinab und fand alle drei in Wehklagen und fragte nach der Ursache; da erzählte ihr die Else auch, dass ihr zukünftiges Kind wohl würde von der Kreuzhacke totgeschlagen werden, wenn es erst groß wäre und Bier zapfen sollte und die Kreuzhacke fiele herab. Da sprach die Mutter gleichfalls: "Ach, was haben wir für eine kluge Else!" setzte sich hin und weinte mit. Der Mann oben wartete noch ein Weilchen, als aber seine Frau nicht wiederkam und sein Durst immer stärker ward, sprach er: "Ich muss nun selber in den Keller gehn und sehen, wo die Else bleibt."
Als er aber in den Keller kam und alle da beieinander sassen und weinten und er die Ursache hörte, dass das Kind der Else schuldig wäre, das sie vielleicht einmal zur Welt brächte und von der Kreuzhacke könnte totgeschlagen werden, wenn es gerade zur Zeit, wo sie herab fiele, darunter säße, Bier zu zapfen, da rief er: "Was für eine kluge Else!" setzte sich und weinte auch mit. Der Bräutigam blieb lange oben allein, da niemand wiederkommen wollte, dachte er: "Sie werden unten auf dich warten, du musst auch hingehen und sehen, was sie vorhaben." Als er hinabkam, saßen da fünfe und schrien und jammerten ganz erbärmlich, einer immer besser als der andere. "Was für ein Unglück ist denn geschehen?" fragte er. "Ach, lieber Hans," sprach die Else, "wenn wir einander heiraten und haben ein Kind, und es ist groß, und wir schicken's vielleicht hierher, Trinken zu zapfen, da kann ihm ja die Kreuzhacke, die da oben ist stecken geblieben, wenn sie herabfallen sollte, den Kopf zerschlagen, dass es liegen bleibt; sollen wir da nicht weinen?" - "Nun," sprach Hans, "mehr Verstand ist für meinen Haushalt nicht nötig; weil du so eine kluge Else bist, so will ich dich haben," packte sie bei der Hand und nahm sie mit hinauf und hielt Hochzeit mit ihr.
Als sie den Hans eine Weile hatte, sprach er: "Frau, ich will ausgehen, arbeiten und uns Geld verdienen, geh du ins Feld, und schneide das Korn, dass wir Brot haben." - "Ja, mein lieber Hans, das will ich tun." Nachdem der Hans fort war, kochte sie sich einen guten Brei und nahm ihn mit ins Feld. Als sie vor den Acker kam, sprach sie zu sich selbst: "Was tu ich? Schneid ich ehr, oder eß ich ehr? Hei, ich will erst essen." Nun ass sie ihren Topf mit Brei aus, und als sie dick satt war, sprach sie wieder: "Was tu ich? Schneid ich ehr, oder schlaf ich ehr? Hei, ich will erst schlafen." Da legte sie sich ins Korn und schlief ein.
Der Hans war längst zu Haus, aber die Else wollte nicht kommen, da sprach er: "Was hab ich für eine kluge Else, die ist so fleißig, dass sie nicht einmal nach Haus kommt und isst." Als sie aber noch immer ausblieb und es Abend ward, ging der Hans hinaus und wollte sehen, was sie geschnitten hätte. Aber es war nichts geschnitten, sondern sie lag im Korn und schlief. Da eilte Hans geschwind heim und holte ein Vogelgarn mit kleinen Schellen und hängte es um sie herum; und sie schlief noch immer fort. Dann lief er heim, schloss die Haustüre zu und setzte sich auf seinen Stuhl und arbeitete.
Endlich, als es schon ganz dunkel war, erwachte die kluge Else, und als sie aufstand, rappelte es um sie herum, und die Schellen klingelten bei jedem Schritte, den sie tat. Da erschrak sie, ward irre, ob sie auch wirklich die kluge Else wäre und sprach: "Bin ich's oder bin ich's nicht?" Sie wusste aber nicht, was sie darauf antworten sollte und stand eine Zeitlang zweifelhaft. Endlich dachte sie: Ich will nach Hause gehen und fragen, ob ich's bin, oder ob ich's nicht bin, die werden's ja wissen. Sie lief vor ihre Haustüre, aber die war verschlossen. Da klopfte sie an das Fenster und rief: "Hans, ist die Else drinnen?" - "Ja," antwortete der Hans, "sie ist drinnen." Da erschrak sie und sprach: "Ach Gott, dann bin ich's nicht," und ging vor eine andere Tür; als aber die Leute das Klingeln der Schellen hörten, wollten sie nicht aufmachen, und sie konnte nirgends unterkommen. Da lief sie fort zum Dorf hinaus, und niemand hat sie wieder gesehen.
DIE SECHS DIENER

Illustration Věnceslav Černý, 1902
Vor Zeiten lebte eine alte Königin, die war eine Zauberin, und ihre Tochter war das schönste Mädchen unter der Sonne. Die Alte dachte aber auf nichts, als wie sie die Menschen ins Verderben locken könnte, und wenn ein Freier kam, so sprach sie, wer ihre Tochter haben wollte, müsste zuvor eine Aufgabe lösen, oder er müsste sterben. Viele waren von der Schönheit der Jungfrau verblendet und wagten es wohl, aber sie konnten nicht vollbringen, was die Alte ihnen auflegte, und dann war keine Gnade, sie mussten niederknien, und das Haupt ward ihnen abgeschlagen. Ein Königssohn, der hatte auch von der großen Schönheit der Jungfrau gehört und sprach zu seinem Vater: "Lasst mich hinziehen, ich will um sie werben." "Nimmermehr," antwortete der König, "gehst du fort, so gehst du in deinen Tod." Da legte der Sohn sich nieder und ward sterbenskrank und lag sieben Jahre lang, und kein Arzt konnte ihm helfen. Als der Vater sah, dass keine Hoffnung mehr war, sprach er voll Herzenstraurigkeit zu ihm: "Zieh hin und versuche dein Glück, ich weiß dir sonst nicht zu helfen." Wie der Sohn das hörte, stand er auf von seinem Lager, ward gesund und machte sich fröhlich auf den Weg.
Es trug sich zu, als er über eine Heide zu reiten kam, dass er von weitem auf der Erde etwas liegen sah wie einen großen Heuhaufen, und wie er sich näherte, konnte er unterscheiden, dass es der Bauch eines Menschen war, der sich dahingestreckt hatte; der Bauch aber sah aus wie ein kleiner Berg. Der Dicke, wie er den Reisenden erblickte, richtete sich in die Höhe und sprach: "Wenn Ihr jemand braucht, so nehmt mich in Eure Dienste." Der Königssohn antwortete: "Was soll ich mit einem so ungefügen Mann anfangen?" "Oh," sprach der Dicke, "das will nichts sagen, wenn ich mich recht auseinander tue, bin ich noch dreitausendmal so dick." "Wenn das so ist," sagte der Königssohn, "so kann ich dich brauchen, komm mit mir." Da ging der Dicke hinter dem Königssohn her, und über eine Weile fanden sie einen anderen, der lag da auf der Erde und hatte das Ohr auf den Rasen gelegt. Fragte der Königssohn: "Was machst du da?" "Ich horche," antwortete der Mann. "Wonach horchst du so aufmerksam?" "Ich horche nach dem, was eben in der Welt sich zuträgt, denn meinen Ohren entgeht nichts, das Gras sogar hör ich wachsen. Fragte der Königssohn: "Sage mir, was hörst du am Hofe der alten Königin, welche die schöne Tochter hat?" Da antwortete er: "Ich höre das Schwert sausen, das einem Freier den Kopf abschlägt." Der Königssohn sprach: "Ich kann dich brauchen, komm mit mir." Da zogen sie weiter und sahen einmal ein Paar Füsse da liegen und auch etwas von den Beinen, aber das Ende konnten sie nicht sehen.
Als sie eine gute Strecke fortgegangen waren, kamen sie zu dem Leib und endlich auch zu dem Kopf. "Ei," sprach der Königssohn, "was bist du für ein langer Strick!" "Oh," antwortete der Lange, "das ist noch gar nichts, wenn ich meine Gliedmassen erst recht ausstrecke, bin ich noch dreitausendmal so lang und bin grösser als der höchste Berg auf Erden. Ich will Euch gerne dienen, wenn Ihr mich annehmen wollt." "Komm mit," sprach der Königssohn, "ich kann dich brauchen." Sie zogen weiter und fanden einen am Weg sitzen, der hatte die Augen zugebunden. Sprach der Königssohn zu ihm: "Hast du blöde Augen, dass du nicht in das Licht sehen kannst?" "Nein," antwortete der Mann, "ich darf die Binde nicht abnehmen, denn was ich mit meinen Augen ansehe, das springt auseinander, so gewaltig ist mein Blick. Kann Euch das nütze so will ich Euch gern dienen." "Komm mit," antwortete der Königssohn, "ich kann dich brauchen." Sie zogen weiter und fanden einen Mann, der lag mitten im heißen Sonnenschein und zitterte und fror am ganzen Leibe, so dass ihm kein Glied still stand. "Wie kannst du frieren?" sprach der Königssohn, "und die Sonne scheint so warm." "Ach," antwortete der Mann, "meine Natur ist ganz anderer Art, je heißer es ist, desto mehr frier ich, und der Frost dringt mir durch alle Knochen. Und je kälter es ist, desto heißer wird mir. Mitten im Eis kann ich's vor Hitze und mitten im Feuer vor Kälte nicht aushalten." "Du bist ein wunderlicher Kerl," sprach der Königssohn, "aber wenn du mir dienen willst, so komm mit." Nun zogen sie weiter und sahen einen Mann stehen, der machte einen langen Hals, schaute sich um und schaute über alle Berge hinaus. Sprach der Königssohn: "Wonach siehst du so eifrig?" Der Mann antwortete: "Ich habe so helle Augen, dass ich über alle Wälder und Felder, Täler und Berge hinaus und durch die ganze Welt sehen kann." Der Königssohn sprach: "Willst du, so komm mit mir, denn so einer fehlte mir noch." Nun zog der Königssohn mit seinen sechs Dienern in die Stadt ein, wo die alte Königin lebte. Er sagte nicht, wer er wäre, aber er sprach: "Wollt Ihr mir Eure schöne Tochter geben, so will ich vollbringen, was Ihr mir auferlegt." Die Zauberin freute sich, dass ein so schöner Jüngling wieder in ihre Netze fiel, und sprach: "Dreimal will ich dir eine Aufgabe aufgeben, lösest du sie jedesmal, so sollst du der Herr und Gemahl meiner Tochter werden." "Was soll das erste sein?" fragte er. "Dass du mir einen Ring herbei bringst, den ich ins Rote Meer habe fallen lassen." Da ging der Königssohn heim zu seinen Dienern und sprach:
"Die erste Aufgabe ist nicht leicht, ein Ring soll aus dem Roten Meer geholt werden, nun schafft Rat." Da sprach der mit den hellen Augen: "Ich will sehen, wo er liegt," schaute in das Meer hinab und sagte: "Dort hängt er an einem spitzen Stein." Der Lange trug sie hin und sprach: "Ich wollte ihn wohl herausholen, wenn ich ihn nur sehen könnte." "Wenn's weiter nichts ist," rief der Dicke, legte sich nieder und hielt seinen Mund ans Wasser. Da fielen die Wellen hinein wie in einen Abgrund, und er trank das ganze Meer aus, dass es trocken ward wie eine Wiese. Der Lange bückte sich ein wenig und holte den Ring mit der Hand heraus. Da ward der Königssohn froh, als er den Ring hatte, und brachte ihn der Alten. Sie erstaunte und sprach: "Ja, es ist der rechte Ring. Die erste Aufgabe hast du glücklich gelöst, aber nun kommt die zweite. Siehst du, dort auf der Wiese vor meinem Schlosse, da weiden dreihundert fette Ochsen, die musst du mit Haut und Haar, Knochen und Hörnern verzehren. Und unten im Keller liegen dreihundert Fässer Wein, die musst du dazu austrinken, und bleibt von den Ochsen ein Haar und von dem Wein ein Tröpfchen übrig, so ist mir dein Leben verfallen." Sprach der Königssohn: "Darf ich mir keine Gäste dazu laden? Ohne Gesellschaft schmeckt keine Mahlzeit." Die Alte lachte boshaft und antwortete: "Einen darfst du dir dazu laden, damit du Gesellschaft hast, aber weiter keinen."
Da ging der Königssohn zu seinen Dienern und sprach zu dem Dicken: "Du sollst heute mein Gast sein und dich einmal satt essen." Da tat sich der Dicke voneinander und aß die dreihundert Ochsen, dass kein Haar übrig blieb, und fragte, ob weiter nichts als das Frühstück da wäre. Den Wein aber trank er gleich aus den Fässern, ohne dass er ein Glas nötig hatte, und trank den letzten Tropfen vom Nagel herunter. Als die Mahlzeit zu Ende war, ging der Königssohn zur Alten und sagte ihr, die zweite Aufgabe wäre gelöst. Sie verwunderte sich und sprach: "So weit hat's noch keiner gebracht, aber es ist noch eine Aufgabe übrig," und dachte: Du sollst mir nicht entgehen und wirst deinen Kopf nicht oben behalten.
"Heute Abend," sprach sie, "bring ich meine Tochter zu dir in deine Kammer, und du sollst sie mit deinem Arm umschlingen. Und wenn ihr da beisammen sitzt, so hüte dich, dass du nicht einschläfst. Ich komme Schlag zwölf Uhr, und ist sie dann nicht mehr in deinen Armen, so hast du verloren." Der Königssohn dachte: Der Bund ist leicht, ich will wohl meine Augen offen behalten, doch rief er seine Diener, erzählte ihnen, was die Alte gesagt hatte, und sprach: "Wer weiß, was für eine List dahintersteckt, Vorsicht ist gut, haltet Wache und sorgt, dass die Jungfrau nicht wieder aus meiner Kammer kommt." Als die Nacht einbrach, kam die Alte mit ihrer Tochter und führte sie in die Arme des Königssohns, und dann schlang sich der Lange um sie beide in einen Kreis, und der Dicke stellte sich vor die Türe, also dass keine lebendige Seele herein konnte. Da sassen sie beide, und die Jungfrau sprach kein Wort, aber der Mond schien durchs Fenster auf ihr Angesicht, dass er ihre wunderbare Schönheit sehen konnte. Er tat nichts als sie anschauen, war voll Freude und Liebe, und es kam keine Müdigkeit in seine Augen. Das dauerte bis elf Uhr, da warf die Alte einen Zauber über alle, dass sie einschliefen, und in dem Augenblick war auch die Jungfrau entrückt. Nun schliefen sie hart bis ein Viertel vor zwölf, da war der Zauber kraftlos, und sie erwachten alle wieder. "O Jammer und Unglück," rief der Königssohn, "nun bin ich verloren!"
Die treuen Diener fingen auch an zu klagen, aber der Horcher sprach: "Seid still, ich will horchen," da horchte er einen Augenblick, und dann sprach er: "Sie sitzt in einem Felsen dreihundert Stunden von hier und bejammert ihr Schicksal. Du allein kannst helfen, Langer, wenn du dich aufrichtest, so bist du mit ein paar Schritten dort." "Ja," antwortete der Lange, "aber der mit den scharfen Augen muss mitgehen, damit wir den Felsen wegschaffen." Da huckte der Lange den mit den verbundenen Augen auf, und im Augenblick, wie man eine Hand umwendet, waren sie vor dem verwünschten Felsen. Alsbald nahm der Lange dem anderen die Binde von den Augen, der sich nur umschaute, so zersprang der Felsen in tausend Stücke. Da nahm der Lange die Jungfrau auf den Arm, trug sie in einem Nu zurück, holte ebenso schnell auch noch seinen Kameraden, und eh es Zwölfe schlug, sassen sie alle wieder wie vorher und waren munter und guter Dinge. Als es zwölf schlug, kam die alte Zauberin herbei geschlichen, machte ein höhnisches Gesicht, als wollte sie sagen: "Nun ist er mein," und glaubte, ihre Tochter säße dreihundert Stunden weit im Felsen. Als sie aber ihre Tochter in den Armen des Königssohns erblickte, erschrak sie und sprach: "Da ist einer, der kann mehr als ich." Aber sie durfte nichts einwenden und musste ihm die Jungfrau zusagen. Da sprach sie ihr ins Ohr: "Schande für dich, dass du gemeinem Volk gehorchen sollst und dir einen Gemahl nicht nach deinem Gefallen wählen darfst." Da ward das stolze Herz der Jungfrau mit Zorn erfüllt und sann auf Rache. Sie ließ am anderen Morgen dreihundert Malter Holz zusammenfahren und sprach zu dem Königssohn, die drei Aufgaben wären gelöst, sie würde aber nicht eher seine Gemahlin werden, bis einer bereit wäre, sich mitten in das Holz zu setzen und das Feuer auszuhalten.
Sie dachte, keiner seiner Diener würde sich für ihn verbrennen und aus Liebe zu ihr würde er selber sich hineinsetzen und dann wäre sie frei. Die Diener aber sprachen: "Wir haben alle etwas getan, nur der Frostige noch nicht, der muss auch daran," setzten ihn mitten auf den Holzstoß und steckten ihn an. Da begann das Feuer zu brennen und brannte drei Tage, bis alles Holz verzehrt war, und als die Flammen sich legten, stand der Frostige mitten in der Asche, zitterte wie ein Espenlaub und sprach: "Einen solchen Frost habe ich mein Lebtage nicht ausgehalten, und wenn er länger gedauert hätte, so wäre ich erstarrt." Nun war keine Ausflucht mehr zu finden, die schöne Jungfrau musste den unbekannten Jüngling zum Gemahl nehmen. Als sie aber nach der Kirche fuhren, sprach die Alte: "Ich kann die Schande nicht ertragen," und schickte ihr Kriegsvolk nach, das sollte alles niedermachen, was ihm vor käme, und ihr die Tochter zurückbringen. Der Horcher aber hatte die Ohren gespitzt und die heimlichen Reden der Alten vernommen. "Was fangen wir an?" sprach er zu dem Dicken, aber der wusste Rat, spie einmal oder zweimal hinter dem Wagen einen Teil von dem Meereswasser aus, das er getrunken hatte, da entstand ein großer See, worin die Kriegsvölker steckenblieben und ertranken. Als die Zauberin das vernahm, schickte sie ihre geharnischten Reiter, aber der Horcher hörte das Rasseln ihrer Rüstung und band dem einen die Augen auf, der guckte die Feinde ein bisschen scharf an, da sprangen sie auseinander wie Glas.
Nun fuhren sie ungestört weiter, und als die beiden in der Kirche eingesegnet waren, nahmen die sechs Diener ihren Abschied und sprachen zu ihrem Herrn: "Eure Wünsche sind erfüllt. Ihr habt uns nicht mehr nötig, wir wollen weiter ziehen und unser Glück versuchen. Eine halbe Stunde vor dem Schloss war ein Dorf, vor dem hütete ein Schweinehirt seine Herde. Wie sie dahin kamen, sprach er zu seiner Frau: "Weißt du auch recht, wer ich bin? Ich bin kein Königssohn, sondern ein Schweinehirt, und der mit der Herde dort, das ist mein Vater. Wir zwei müssen auch daran und ihm helfen hüten." Dann stieg er mit ihr in das Wirtshaus ab und sagte heimlich zu den Wirtsleuten, in der Nacht sollten sie ihr die königlichen Kleider wegnehmen. Wie sie nun am Morgen aufwachte, hatte sie nichts anzutun, und die Wirtin gab ihr einen alten Rock und ein Paar alte, wollene Strümpfe, dabei tat sie noch, als wär's ein großes Geschenk, und sprach: "Wenn nicht Eurer Mann wäre, hätt ich's Euch gar nicht gegeben." Da glaubte sie, er wäre wirklich ein Schweinehirt, und hütete mit ihm die Herde und dachte: Ich habe es verdient mit meinem Übermut und Stolz. Das dauerte acht Tage, da konnte sie es nicht mehr aushalten, denn die Füsse waren ihr wund geworden. Da kamen ein paar Leute und fragten, ob sie wüsste, wer ihr Mann wäre. "Ja," antwortete sie, "er ist ein Schweinehirt und ist eben ausgegangen, mit Bändern und Schnüren einen kleinen Handel zu treiben." Sie sprachen aber: "Kommt einmal mit, wir wollen Euch zu ihm hinführen," und brachten sie ins Schloss hinauf; und wie sie in den Saal kam, stand da ihr Mann in königlichen Kleidern. Sie erkannte ihn aber nicht, bis er ihr um den Hals fiel, sie küsste und sprach: "Ich habe so viel für dich gelitten, da hast du auch für mich leiden sollen." Nun ward erst die Hochzeit gefeiert, und der's erzählt hat, wollte, er wäre auch dabeigewesen.
DAS WASSER DES LEBENS
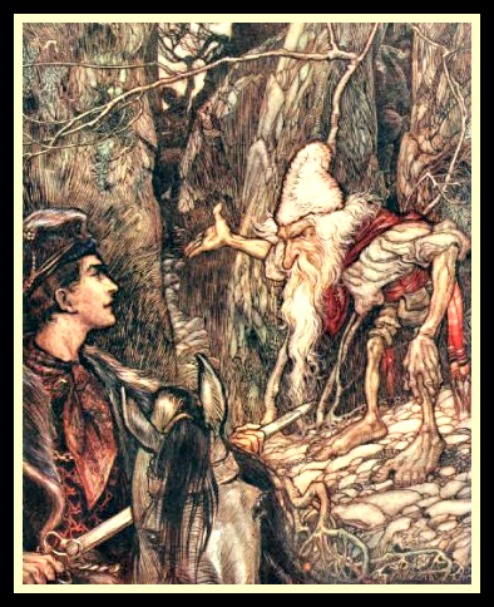
Es war einmal ein König, der war krank, und niemand glaubte, dass er mit dem Leben davon käme. Er hatte aber drei Söhne, die waren darüber betrübt, gingen hinunter in den Schlossgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, der fragte sie nach ihrem Kummer. Sie sagten ihm, ihr Vater wäre so krank, dass er wohl sterben würde, denn es wollte ihm nichts helfen. Da sprach der Alte 'ich weiß ein Mittel, das ist das Wasser des Lebens, wenn er davon trinkt, so wird er wieder gesund: es ist aber schwer zu finden.' Der älteste sagte 'ich will es schon finden,' ging zum kranken König und bat ihn, er möchte ihm erlauben auszuziehen, um das Wasser des Lebens zu suchen, denn das könnte ihn allein heilen. 'Nein,' sprach der König, 'die Gefahr dabei ist zu gross, lieber will ich sterben.' Er bat aber so lange, bis der König einwilligte.
Der Prinz dachte in seinem Herzen 'bringe ich das Wasser, so bin ich meinem Vater der liebste und erbe das Reich.' Also machte er sich auf, und als er eine Zeit lang fort geritten war, stand da ein Zwerg auf dem Wege, der rief ihn an und sprach 'wo hinaus so geschwind?, 'Dummer Knirps,' sagte der Prinz ganz stolz, 'das brauchst du nicht zu wissen,' und ritt weiter. Das kleine Männchen aber war zornig geworden und hatte einen bösen Wunsch getan. Der Prinz geriet bald hernach in eine Bergschlucht, und je weiter er ritt, je enger taten sich die Berge zusammen, und endlich ward der Weg so eng, dass er keinen Schritt weiter konnte; es war nicht möglich, das Pferd zu wenden oder aus dem Sattel zu steigen, und er sass da wie eingesperrt. Der kranke König wartete lange Zeit auf ihn, aber er kam nicht.
Da sagte der zweite Sohn 'Vater, lasst mich ausziehen und das Wasser suchen,' und dachte bei sich 'ist mein Bruder tot, so fällt das Reich mir zu.' Der König wollt ihn anfangs auch nicht ziehen lassen, endlich gab er nach. Der Prinz zog also auf demselben Weg fort, den sein Bruder eingeschlagen hatte, und begegnete auch dem Zwerg, der ihn anhielt und fragte, wohin er so eilig wollte. 'Kleiner Knirps,' sagte der Prinz, 'das brauchst du nicht zu wissen,' und ritt fort, ohne sich weiter um zu sehen. Aber der Zwerg verwünschte ihn, und er geriet wie der andere in eine Bergschlucht und konnte nicht vorwärts und rückwärts. So geht es aber den Hochmütigen. Als auch der zweite Sohn ausblieb, so erbot sich der jüngste, auszuziehen und das Wasser zu holen, und der König musste ihn endlich ziehen lassen.
Als er dem Zwerg begegnete und dieser fragte, wohin er so eilig wolle, so hielt er an, gab ihm Rede und Antwort und sagte 'ich suche das Wasser des Lebens, denn mein Vater ist sterbenskrank.' 'Weißt du auch, wo das zu finden ist?, 'Nein,' sagte der Prinz. 'Weil du dich betragen hast, wie sichs geziemt, nicht übermütig wie deine falschen Brüder, so will ich dir Auskunft geben und dir sagen, wie du zu dem Wasser des Lebens gelangst. Es quillt aus einem Brunnen in dem Hofe eines verwünschten Schlosses, aber du dringst nicht hinein, wenn ich dir nicht eine eiserne Rute gebe und zwei Laiberchen Brot. Mit der Rute schlag dreimal an das eiserne Tor des Schlosses, so wird es aufspringen: inwendig liegen zwei Löwen, die den Rachen aufsperren, wenn du aber jedem ein Brot hinein wirfst, so werden sie still, und dann eile dich und hol von dem Wasser des Lebens, bevor es zwölf schlägt, sonst schlägt das Tor wieder zu und du bist eingesperrt.'
Der Prinz dankte ihm, nahm die Rute und das Brot, und machte sich auf den Weg. Und als er anlangte, war alles so, wie der Zwerg gesagt hatte. Das Tor sprang beim dritten Rutenschlag auf, und als er die Löwen mit dem Brot gesänftigt hatte, trat er in das Schloss und kam in einen großen schönen Saal: darin sassen verwünschte Prinzen, denen zog er die Ringe vom Finger, dann lag da ein Schwert und ein Brot, das nahm er weg. Und weiter kam er in ein Zimmer, darin stand eine schöne Jungfrau, die freute sich, als sie ihn sah, küsste ihn und sagte, er hätte sie erlöst und sollte ihr ganzes Reich haben, und wenn er in einem Jahre wiederkäme, so sollte ihre Hochzeit gefeiert werden. Dann sagte sie ihm auch, wo der Brunnen wäre mit dem Lebenswasser, er müsste sich aber eilen und daraus schöpfen, eh es zwö lf schlüge. Da ging er weiter und kam endlich in ein Zimmer, wo ein schönes frischgedecktes Bett stand, und weil er müde war, wollt er erst ein wenig ausruhen. Also legte er sich und schlief ein: als er erwachte, schlug es dreiviertel auf zwölf. Da sprang er ganz erschrocken auf, lief zu dem Brunnen und schöpfte daraus mit einem Becher, der daneben stand, und eilte, dass er fortkam.
Wie er eben zum eisernen Tor hinausging, da schlug es zwölf, und das Tor schlug so heftig zu, dass es ihm noch ein Stück von der Ferse wegnahm. Er aber war froh, dass er das Wasser des Lebens erlangt hatte, ging heimwärts und kam wieder an dem Zwerg vorbei. Als dieser das Schwert und das Brot sah, sprach er 'damit hast du großes Gut gewonnen, mit dem Schwert kannst du ganze Heere schlagen, das Brot aber wird niemals all.' Der Prinz wollte ohne seine Brüder nicht zu dem Vater nach Haus kommen und sprach 'lieber Zwerg, kannst du mir nicht sagen, wo meine zwei Brüder sind? sie sind früher als ich nach dem Wasser des Lebens ausgezogen und sind nicht wiedergekommen.' 'Zwischen zwei Bergen stecken sie eingeschlossen,' sprach der Zwerg, 'dahin habe ich sie verwünscht, weil sie so übermütig waren.' Da bat der Prinz so lange, bis der Zwerg sie wieder los ließ, aber er warnte ihn und sprach 'hüte dich vor ihnen, sie haben ein böses Herz.' Als seine Brüder kamen, freute er sich und erzählte ihnen, wie es ihm ergangen wäre, dass er das Wasser des Lebens gefunden und einen Becher voll mitgenommen und eine schöne Prinzessin erlöst hätte, die wollte ein Jahr lang auf ihn warten, dann sollte Hochzeit gehalten werden, und er bekäme ein großes Reich.
Danach ritten sie zusammen fort und gerieten in ein Land, wo Hunger und Krieg war, und der König glaubte schon, er müsste verderben, so groß war die Not. Da ging der Prinz zu ihm und gab ihm das Brot, womit er sein ganzes Reich speiste und sättigte: und dann gab ihm der Prinz auch das Schwert, damit schlug er die Heere seiner Feinde und konnte nun in Ruhe und Frieden leben. Da nahm der Prinz sein Brot und Schwert wieder zurück, und die drei Brüder ritten weiter. Sie kamen aber noch in zwei Länder, wo Hunger und Krieg herrschten, und da gab der Prinz den Königen jedesmal sein Brot und Schwert, und hatte nun drei Reiche gerettet. Und danach setzten sie sich auf ein Schiff und fuhren übers Meer. Während der Fahrt, da sprachen die beiden ältesten unter sich 'der jüngste hat das Wasser des Lebens gefunden und wir nicht, dafür wird ihm unser Vater das Reich geben, das uns gebührt, und er wird unser Glück wegnehmen.' Da wurden sie rachsüchtig und verabredeten miteinander, dass sie ihn verderben wollten. Sie warteten, bis er einmal fest eingeschlafen war, da gossen sie das Wasser des Lebens aus dem Becher und nahmen es für sich, ihm aber gossen sie bitteres Meerwasser hinein.
Als sie nun daheim ankamen, brachte der jüngste dem kranken König seinen Becher, damit er daraus trinken und gesund werden sollte. Kaum aber hatte er ein wenig von dem bittern Meerwasser getrunken, so ward er noch kränker als zuvor. Und wie er darüber jammerte, kamen die beiden ältesten Söhne und klagten den jüngsten an, er hätte ihn vergiften wollen, sie brächten ihm das rechte Wasser des Lebens und reichten es ihm. Kaum hatte er davon getrunken, so fühlte er seine Krankheit verschwinden, und war stark und gesund wie in seinen jungen Tagen. Danach gingen die beiden zu dem jüngsten, verspotteten ihn und sagten 'du hast zwar das Wasser des Lebens gefunden, aber du hast die Mühe gehabt und wir den Lohn; du hättest klüger sein und die Augen aufbehalten sollen, wir haben dirs genommen, während du auf dem Meere eingeschlafen warst, und übers Jahr, da holt sich einer von uns die schöne Königstochter. Aber hüte dich, dass du nichts davon verrätst, der Vater glaubt dir doch nicht, und wenn du ein einziges Wort sagst, so sollst du noch obendrein dein Leben verlieren, schweigst du aber, so soll dir´ s geschenkt sein.'
Der alte König war zornig über seinen jüngsten Sohn und glaubte, er hätte ihm nach dem Leben getrachtet. Also ließ er den Hof versammeln und das Urteil über ihn sprechen, dass er heimlich sollte erschossen werden. Als der Prinz nun einmal auf die Jagd ritt und nichts Böses vermutete, musste des Königs Jäger mitgehen. Draußen, als sie ganz allein im Wald waren, und der Jäger so traurig aussah, sagte der Prinz zu ihm 'lieber Jäger, was fehlt dir?' Der Jäger sprach 'ich kanns nicht sagen und soll es doch.' Da sprach der Prinz 'sage heraus, was es ist, ich will dirs verzeihen.' 'Ach', sagte der Jäger, 'ich soll Euch totschiessen, der König hat mirs befohlen.' Da erschrak der Prinz und sprach 'lieber Jäger, lass mich leben, da geb ich dir mein königliches Kleid, gib mir dafür dein schlechtes.' Der Jäger sagte 'das will ich gerne tun, ich hätte doch nicht nach Euch schiessen können.' Da tauschten sie die Kleider, und der Jäger ging heim, der Prinz aber ging weiter in den Wald hinein. Über eine Zeit, da kamen zu dem alten König drei Wagen mit Gold und Edelsteinen für seinen jüngsten Sohn: sie waren aber von den drei Königen geschickt, die mit des Prinzen Schwert die Feinde geschlagen und mit seinem Brot ihr Land ernährt hatten, und die sich dankbar bezeigen wollten. Da dachte der alte König 'sollte mein Sohn unschuldig gewesen sein?, und sprach zu seinen Leuten 'wäre er noch am Leben, wie tut mirs so leid, dass ich ihn habe töten lassen.' 'Er lebt noch', sprach der Jäger, 'ich konnte es nicht übers Herz bringen, Euren Befehl auszuführen,' und sagte dem König, wie es zugegangen war.
Da fiel dem König ein Stein von dem Herzen, und er ließ in allen Reichen verkündigen, sein Sohn dürfte wiederkommen und sollte in Gnaden aufgenommen werden. Die Königstochter aber liess eine Strasse vor ihrem Schloss machen, die war ganz golden und glänzend, und sagte ihren Leuten, wer darauf geradeswegs zu ihr geritten käme, das wäre der rechte, und den sollten sie einlassen, wer aber daneben käme, der wäre der rechte nicht, und den sollten sie auch nicht einlassen. Als nun die Zeit bald herum war, dachte der älteste, er wollte sich eilen, zur Königstochter gehen und sich für ihren Erlöser ausgeben, da bekäme er sie zur Gemahlin und das Reich daneben. Also ritt er fort, und als er vor das Schloss kam und die schöne goldene Strasse sah, dachte er 'das wäre jammerschade, wenn du darauf rittest,' lenkte ab und ritt rechts nebenher. Wie er aber vor das Tor kam, sagten die Leute zu ihm, er wäre der rechte nicht, er sollte wieder fortgehen. Bald darauf machte sich der zweite Prinz auf, und wie der zur goldenen Strasse kam und das Pferd den einen Fuss daraufgesetzt hatte, dachte er 'es wäre jammerschade, das könnte etwas abtreten,' lenkte ab und ritt links nebenher. Wie er aber vor das Tor kam, sagten die Leute, er wäre der rechte nicht, er sollte wieder fortgehen.
Als nun das Jahr ganz herum war, wollte der dritte aus dem Wald fort zu seiner Liebsten reiten und bei ihr sein Leid vergessen. Also machte er sich auf, und dachte immer an sie und wäre gerne schon bei ihr gewesen, und sah die goldene Strasse gar nicht. Da ritt sein Pferd mitten darüber hin, und als er vor das Tor kam, ward es aufgetan, und die Königstochter empfing ihn mit Freuden und sagte, er wär ihr Erlöser und der Herr des Königreichs, und ward die Hochzeit gehalten mit großer Glückseligkeit. Und als sie vorbei war, erzählte sie ihm, dass sein Vater ihn zu sich entboten und ihm verziehen hätte. Da ritt er hin und sagte ihm alles, wie seine Brüder ihn betrogen und er doch dazu geschwiegen hätte. Der alte König wollte sie strafen, aber sie hatten sich aufs Meer gesetzt und waren fortgeschifft und kamen ihr Lebtag nicht wieder.
DER SPIELHANSL
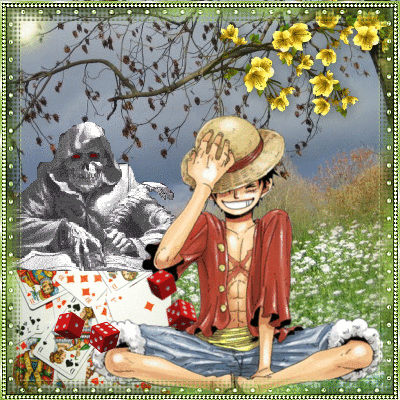
Da ist einmal ein Mann gewesen, der hat nichts anderes getan als gespielt; und da haben ihn die Leute nur den Spielhansl geheissen, und weil er gar nicht aufgehört hat zu spielen, so hat er sein Haus und alles verspielt. Jetzt, eben am letzten Tag, als ihm sein Haus weggenommen werden sollte, ist unser Herrgott und der heilige Petrus gekommen und haben gesagt, er solle sie über Nacht bei sich behalten. Da hat der Spielhansl gesagt: "Wegen meiner könnt ihr dableiben zur Nacht; aber ich kann euch kein Bett und nichts zu essen geben." Da hat unser Herrgott gesagt, er solle sie nur aufnehmen, und sie wollten sich selbst etwas zu essen kaufen; das ist dem Spielhansl recht gewesen. Da hat ihm der heilige Petrus drei Groschen gegeben, und damit sollte er zum Bäcker gehen und ein Brot holen. Jetzt ist halt der Spielhansl gegangen. Wie er aber zu dem Haus gekommen ist, wo die andern Spiellumpen drin gewesen sind, die ihm alles abgewonnen hatten, haben sie gerufen und geschrien: "Hansl, komm nur herein!" - "Ja," hat er gesagt, "wollt's mir die drei Groschen auch noch abgewinnen." Sie haben aber nicht ausgelassen. Jetzt ist er halt hinein und hat die drei Groschen auch noch verspielt. Der heilige Petrus und unser Herrgott aber haben immer gewartet, und wie er so lang nicht gekommen ist, sind sie ihm entgegengegangen. Der Spielhansl aber, wie er sie hat kommen sehen, hat so getan, als wären ihm die drei Groschen in eine Wasserlache gefallen, und hat eifrig darin herumgestochert: aber unser Herrgott hat schon gewusst, dass er sie verspielt hat. Da hat ihm der heilige Petrus noch einmal drei Groschen gegeben. Jetzt hat er sich aber nicht mehr verführen lassen und hat ihnen das Brot gebracht.
Da hat ihn unser Herrgott gefragt, ob er keinen Wein nicht hat; da hat er gesagt: "O Herr, die Fässer sind alle leer." Da hat unser Herrgott gesagt, er solle nur in den Keller hinabgehen, es sei noch der beste Wein drunten. Er hat's lange nicht glauben wollen, aber zuletzt hat er gesagt: "Ich will doch hinuntergehen, aber ich weiss, dass keiner drunten ist." Wie er aber das Fass angezapft hat, ist der beste Wein herausgekommen. Jetzt hat er ihnen den Wein gebracht und die zwei sind über Nacht geblieben. Am andern Tag, in der Frühe, hat unser Herrgott zum Spielhansl gesagt, er solle sich drei Gnaden ausbitten. Er hat gemeint, er würde sich den Himmel ausbitten, aber der Spielhansl hat um Karten gebeten, mit denen er alles gewinnt, und um Würfel, mit denen er alles gewinnt, und um einen Baum, auf dem alles Obst wächst, und wenn einer hinaufsteigt, dass er nicht mehr herab kann, bis er es ihm befiehlt. Jetzt hat ihm unser Herrgott alles gegeben, was er verlangt hat, und ist mit dem heiligen Petrus wieder fort. Jetzt hat der Spielhansl erst recht zu spielen angefangen und hätte bald die halbe Welt zusammengewonnen. Da hat der heilige Petrus zu unserem Herrgott gesagt: "Herr, das Ding tut nicht gut, er gewinnt schliesslich noch die ganze Welt; wir müssen ihm den Tod schicken." Und da haben sie ihm den Tod geschickt. Wie der Tod gekommen ist, hat der Spielhansl natürlich beim Spiel gesessen; da hat der Tod gesagt: "Hansl, komm mal ein bissei heraus!" Der Spielhansl aber sagte: "Wart nur ein bissei, bis das Spiel aus ist und steig derweil auf den Baum da draussen und brich uns ein bissei was ab, damit wir auf dem Wege was zu naschen haben." Ist also der Tod auf den Baum gestiegen, und wie er wieder hat herunterwollen, hat er es nicht gekonnt, und der Spielhansl hat ihn sieben Jahre drobengelassen und derweil ist kein Mensch mehr gestorben.
Da hat der heilige Petrus zu unserem Herrgott gesagt: "Herr, das Ding tut nicht gut; es stirbt ja kein Mensch mehr; wir müssen uns schon selber aufmachen." Jetzt sind sie also schon selber gekommen und da hat unser Herrgott dem Spielhansl befohlen, dass er den Tod herunterlassen sollte. Da ist er nun gleich gegangen und hat zum Tod gesagt: "Geh herunter," und der hat ihn gleich genommen und hat ihn erwürgt. Da sind sie nun miteinander fort und sind in die andere Welt gekommen. Da ist nun mein Spielhansl zum Himmelstor gegangen und hat da angeklopft. "Wer ist draussen?" - "Der Spielhansl." - "Ach, den brauchen wir nicht, geh nur wieder fort." Da ist er zum Fegefeuer gegangen und hat wieder angeklopft. "Wer ist draussen?" - "Der Spielhansl." - "Ach, es ist schon Jammer und Not genug bei uns, wir wollen nicht spielen. Geh nur wieder fort." Da ist er zum Höllentor gegangen, und da haben sie ihn hereingelassen; es ist aber niemand daheim gewesen als der alte Luzifer und ein paar krumme Teufel (die geraden haben auf der Welt zu tun gehabt), und da hat er sich gleich niedergesetzt und hat wieder zu spielen angefangen. Da hat aber der Luzifer nichts gehabt als seine krummen Teufel. Die hat ihm der Spielhansl abgewonnen, weil er mit seinen Karten alles hat gewinnen müssen. Jetzt ist der Spielhansl mit seinen krummen Teufeln fort, und da sind sie nach Hohenfürt und haben die Hopfenstangen ausgerissen und sind damit zum Himmel hinauf und haben zu stossen angefangen, und jetzt hat der Himmel schon gekracht.
Da hat der heilige Petrus wieder gesagt: "Herr, das Ding tut nicht gut, wir müssen ihn hereinlassen, sonst wirft er uns den Himmel herab." Jetzt haben sie ihn halt hereingelassen. Aber der Spielhansl hat gleich wieder zu spielen angefangen, und da ist dann ein solcher Lärm und so ein Getöse geworden, dass man sein eigenes Wort nicht verstanden hat. Da hat der heilige Petrus wieder gesagt: "Herr, das Ding tut nicht gut, wir müssen ihn hinauswerfen, er macht uns sonst den ganzen Himmel rebellisch." Jetzt sind sie über ihn her und haben ihn hinausgeworfen, und da hat sich seine Seele zerteilt und ist in all die Spiellumpen gefahren, die noch bis heute leben.
DAS ERDMÄNNCHEN

Es war einmal ein reicher König, der hatte drei Töchter, die gingen alle Tage im Schlossgarten spazieren; und der König, der ein grosser Liebhaber von allerhand schönen Bäumen war, liebte einen Baum ganz besonders, so dass er denjenigen, der ihm einen Apfel davon pflückte, hundert Klafter tief unter die Erde wünschte. Als es nun Herbst war, da wurden die Äpfel an dem Baum so rot wie Blut. Die drei Töchter gingen alle Tage unter den Baum und sahen zu, ob nicht der Wind einen Apfel heruntergeschlagen hätte, aber sie fanden ihr Lebtag keinen, und der Baum war so voll, als ob er brechen wollte, und die Zweige hingen bis auf die Erde herab. Da gelüstete es die jüngste Königstochter gewaltig, und sie sagte zu ihrer Schwester: "Unser Vater, der hat uns viel zu lieb, als dass er uns verwünschen würde; ich glaube, das sagt er nur wegen der fremden Leute." Und das Kind pflückte einen ganz dicken Apfel ab und sprang vor seine Schwestern her und sagte: "Ah, nun schmeckt mal, meine lieben Schwestern, ich hab mein Lebtag noch nicht so was Schönes gegessen." Da bissen die beiden andern Königstöchter auch in den Apfel, und da versanken sie alle drei tief unter die Erde, dass kein Hahn mehr nach ihnen krähte. Als es nun Mittag wurde, da wollte der König sie zu Tische rufen, aber sie waren nirgends zu finden. Er suchte sie überall, im Schloss und im Garten, aber er konnte sie nicht finden. Da wurde er sehr betrübt und liess das ganze Land aufbieten, und der, der ihm seine Töchter wiederbrächte, der sollte eine davon zur Frau haben.
Da gingen nun so viele junge Leute über Feld und suchten mit allen Kräften und über alle Massen, denn jeder hatte die drei Kinder gern gehabt, weil sie gegen jedermann so freundlich und auch schön von Angesicht gewesen waren. Und es zogen auch drei Jägerburschen aus, und als sie wohl an die acht Tage gewandert waren, da kamen sie zu einem grossen Schloss, da waren so hübsche Stuben drin, und in einem Zimmer war ein Tisch gedeckt, darauf standen so süsse Speisen, die waren noch warm und dampften; aber in dem ganzen Schloss war kein Mensch weder zu hören noch zu sehen. Da warteten sie noch einen halben Tag, und die Speisen blieben immer warm und dampften; doch dann wurden sie so hungrig, dass sie sich an den Tisch setzten und mit grossem Appetit assen. Sie machten miteinander aus, sie wollten auf dem Schlosse wohnen bleiben, und sie wollten darum losen, dass einer im Haus bleiben und die beiden andern die Töchter suchen sollten; das taten sie auch, und das Los traf den ältesten.
Am nächsten Tag gingen die zwei jüngsten auf die Suche, und der älteste musste zu Hause bleiben. Am Mittwoch kam so ein kleines Männchen, das um ein Stückchen Brot bat. Da nahm der älteste von dem Brote, das er dort gefunden hatte, schnitt ein Stück rund um das Brot weg und wollte ihm das geben. Er reichte es dem kleinen Männchen hin, doch dieses liess das Stück fallen und sagte zu dem Jägerburschen, er solle es aufheben und ihm wiedergeben. Das wollte er auch tun und bückte sich, aber da nahm das kleine Männchen einen Stock, packte ihn bei den Haaren und gab ihm tüchtige Schläge. Am andern Tag, da ist der zweite zu Hause geblieben, dem erging es nicht besser. Als die beiden andern am Abend nach Hause kamen, da sagte der älteste: "Na, wie ist es dir ergangen?" - "Oh, mir ist es schlecht ergangen." Da klagten sie einander ihre Not, aber dem jüngsten sagten sie nichts davon, denn den konnten sie gar nicht leiden und hatten ihn immer den dummen Hans genannt, weil er nicht sonderlich weltklug war.
Am dritten Tag blieb der jüngste zu Haus; da kam das kleine Männchen wieder und hielt um ein Stückchen Brot an. Und wie er es ihm nun gegeben hatte, liess er es wieder fallen und sagte, er möchte doch so gut sein und ihm das Stückchen wieder geben. Da sagte Hans zu dem kleinen Männchen: "Was! Kannst du das Stück nicht selber aufheben? Gibst du dir um deine tägliche Nahrung nicht einmal soviel Mühe, dann bist du auch nicht wert, dass du es isst!" Da wurde das Männchen böse und sagte, er müsste es tun; Hans aber, nicht faul, nahm das kleine Männchen und drosch es tüchtig durch. Da schrie das Männchen ganz laut und rief: "Hör auf, hör auf, und lass mich los, dann will ich dir auch sagen, wo die Königstöchter sind." Wie Hans das hörte, schlug er nicht mehr, und das Männchen erzählte, er sei ein Erdmännchen, und solcher wären mehr als tausend, er möge nur mit ihm gehen, dann wolle er ihm auch zeigen, wo die Königstöchter wären. Da zeigte er ihm einen tiefen Brunnen, in dem aber kein Wasser mehr war. Und da sagte das Männchen, er wisse wohl, dass seine Gesellen es nicht ehrlich mit ihm meinten, und wenn er die Königskinder erlösen wolle, dann müsse er es alleine tun.
Die beiden andern Brüder wollten wohl auch gern die Königstöchter wiederhaben, aber sie wollten sich deswegen keiner Mühe und Gefahr unterziehen. Um die Töchter zu erlösen, müsse er einen grossen Korb nehmen, sich mit einem Hirschfänger und einer Schelle hineinsetzen und sich herunterwinden lassen. Unten seien drei Zimmer; in jedem sitze ein Königskind und habe einen Drachen mit vielen Köpfen zu kraulen: denen müsste er die Köpfe abschlagen. Als das Erdmännchen das alles gesagt hatte, verschwand es. Als es Abend war, da kamen die beiden andern und fragten ihn, wie es ihm ergangen sei. Da sagte er: "Oh, soweit gut," und er habe keinen Menschen gesehen, ausser am Mittag, da sei so ein kleines Männchen gekommen, das habe um ein Stückchen Brot gebeten, und als er es ihm gegeben habe, liess das Männchen es fallen und sagte, er möge es ihm wieder aufheben. Und wie er das nicht habe tun wollen, da fing es an zu drohen; das aber verstand er als Unrecht und verprügelte das Männchen; da habe es ihm erzählt, wo die Königskinder seien. Da ärgerten sich die beiden andern Jägerburschen so sehr, dass sie gelb und grün wurden.
Am andern Morgen da gingen sie zusammen an den Brunnen und machten Lose, wer sich zuerst in den Korb setzen sollte. Das Los fiel auf den ältesten, er musste sich hineinsetzen und die Schelle mitnehmen. Da sagte er: "Wenn ich schelle, müsst ihr mich wieder geschwind heraufwinden." Er war nur kurz unten, da schellte es schon, und die zwei andern Brüder wanden ihn wieder herauf. Da setzte sich der zweite hinein: der machte es geradeso. Nun kam die Reihe an den jüngsten, der sich ganz hinunterwinden liess. Als er aus dem Korb gestiegen war, nahm er seinen Hirschfänger, ging zur ersten Tür und lauschte: da hörte er den Drachen ganz laut schnarchen. Er machte langsam die Tür auf; da sass eine Königstochter, die hatte auf ihrem Schoss neun Drachenköpfe liegen und kraulte sie.
Da nahm er seinen Hirschfänger und hieb zu, und neun Köpfe waren ab. Die Königstochter sprang auf und fiel ihm um den Hals und küsste ihn von Herzen; dann nahm sie einen Schmuck, den sie auf ihrer Brust trug und der von altem Golde war, und hängte ihn dem jungen Jäger um. Da ging er auch zu der zweiten Königstochter, die einen Drachen mit sieben Köpfen kraulen musste; und sie erlöste er auch. Dann erlöste er auch die jüngste, die einen Drachen mit vier Köpfen kraulen musste. Die drei Schwestern umarmten und küssten sich voller Freude, ohne aufzuhören.
Nun schellte der jüngste Bruder daraufhin so laut, bis sie es droben hörten. Da setzte er die Königstöchter eine nach der andern in den Korb und liess sie alle drei hinaufziehen. Wie aber nun die Reihe an ihn kommt, fallen ihm die Worte des Erdmännchens wieder ein, dass es seine Gesellen mit ihm nicht gut meinten. Da nahm er einen grossen Stein, der auf der Erde lag, und legte ihn in den Korb. Als der Korb bis etwa zur Mitte heraufgezogen war, schnitten die falschen Brüder oben den Strick durch, dass der Korb mit den Steinen auf den Grund fiel, und nun meinten sie, er wäre tot. Sie liefen mit den drei Königstöchtern fort und liessen sich von ihnen versprechen, dass sie ihrem Vater sagen sollten, die beiden ältesten Brüder hätten sie erlöst. So kamen sie zum König, und ein jeder begehrte eine Königstochter zur Frau. Unterdes ging der jüngste Jägerbursche ganz betrübt in den drei Kammern umher; er dachte, dass er nun wohl sterben müsse. Da sah er an der Wand eine Flöte hängen, und sagte: "Warum hängst du denn da? Hier kann ja keiner lustig sein!" Er besah sich auch die Drachenköpfe; dann sagte er: "Ihr könnt mir auch nicht helfen!" Und er ging auf und ab spazieren, dass der Erdboden davon ganz glatt wurde. Und auf einmal, da kriegte er andere Gedanken, nahm die Flöte von der Wand und blies ein Stückchen darauf; und plötzlich kam bei jedem Ton, den er blies, ein Erdmännchen hervor. Er blies so lange, bis das ganze Zimmer voller Erdmännchen war.
Die fragten alle, was sein Begehren wäre. Da sagte er, er wolle wieder nach oben ans Tageslicht. Da fasste jeder an einem seiner Kopfhaare, und so flogen sie mit ihm zur Erde hinauf. Wie er oben war, ging er gleich zum Königsschloss, wo gerade die Hochzeit mit der einen Königstochter sein sollte; und er ging auf das Zimmer, wo der König mit seinen drei Töchtern sass. Wie ihn da die Kinder sahen, da wurden sie ohnmächtig. Da wurde der König sehr böse, und liess ihn gleich ins Gefängnis werfen, weil er meinte, er hätte den Kindern ein Leid angetan. Als aber die Königstöchter wieder zu sich gekommen waren, da baten sie ihren Vater, er möchte ihn doch wieder freilassen. Der König fragte sie, warum, aber die Kinder sagten, sie dürften das nicht erzählen. Doch der Vater sagte, sie sollten es dem Ofen erzählen. Dann ging er hinaus, lauschte an der Tür und hörte alles. Da liess er die beiden Brüder an den Galgen hängen, und dem jüngsten gab er die jüngste Tochter. Und da zog ich ein Paar gläserne Schuhe an, und da stiess ich an einen Stein, da machte es 'klink', da waren sie entzwei.
DER RIESE UND DER SCHNEIDER

Einem Schneider, der ein großer Prahler war, aber ein schlechter Zahler, kam es in den Sinn, ein wenig auszugehen und sich in der Welt umzuschauen. Sobald er nur konnte, verließ er seine Werkstatt,
wanderte seinen Weg
über Brücke und Steg,
bald da, bald dort,
immer fort und fort.
Als er nun draußen war, erblickte er in der blauen Ferne einen steilen Berg und dahinter einen himmelhohen Turm, der aus einem wilden und finstern Wald hervorragte.
“Potz Blitz!” rief der Schneider, “was ist das?”
Und weil ihn die Neugierde gewaltig stach, so ging er frisch darauf los. Was sperrte er aber Maul und Augen auf, als er in die Nähe kam, denn der Turm hatte Beine, sprang in einem Satz über den steilen Berg und stand als ein großmächtiger Riese vor dem Schneider.
“Was willst du hier, du winziges Fliegenbein,” rief der mit einer Stimme, als wenn’s von allen Seiten donnerte.
Der Schneider wisperte: “Ich will mich umschauen, ob ich mein Stückchen Brot in dem Wald verdienen kann.”
“Wenn’s um die Zeit ist,” sagte der Riese, “so kannst du ja bei mir in den Dienst eintreten.”
“Wenn’s sein muß, warum das nicht? Was krieg ich aber für einen Lohn?”
“Was du für einen Lohn kriegst?” sagte der Riese. “Das sollst du hören. Jährlich dreihundertundfünfundsechzig Tage, und wenn’s ein Schaltjahr ist, noch einen obendrein. Ist dir das recht?”
“Meinetwegen,” antwortete der Schneider und dachte in seinem Sinn: Man muß sich strecken nach seiner Decke. Ich such mich bald wieder loszumachen.
Darauf sprach der Riese zu ihm: “Geh, kleiner Halunke, und hol mir einen Krug Wasser.”
“Warum nicht lieber gleich den Brunnen mitsamt der Quelle?” fragte der Prahlhans und ging mit dem Krug zu dem Wasser.
“Was? Den Brunnen mitsamt der Quelle?” brummte der Riese, der ein bißchen tölpisch und albern war, in den Bart hinein und fing an sich zu fürchten: “Der Kerl kann mehr als Äpfel braten. Der hat einen Alraun im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.”
Als der Schneider das Wasser gebracht hatte, befahl ihm der Riese, in dem Wald ein paar Scheite Holz zu hauen und heimzutragen.
“Warum nicht lieber den ganzen Wald mit einem Streich,
den ganzen Wald
mit jung und alt,
mit allem, was er hat,
knorzig und glatt?”
fragte das Schneiderlein und ging, das Holz zu hauen.
“Was?
Den ganzen Wald
mit jung und alt,
mit allem, was er hat,
knorzig und glatt?
und den Brunnen mitsamt der Quelle?”
brummte der leichtgläubige Riese in den Bart und fürchtete sich noch mehr. “Der Kerl kann mehr als Äpfel braten, der hat einen Alraun im Leib: Sei auf deiner Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.”
Wie der Schneider das Holz gebracht hatte, befahl ihm der Riese, zwei oder drei wilde Schweine zum Abendessen zu schießen.
“Warum nicht lieber gleich tausend auf einen Schuß und dich dazu?” fragte der hoffärtige Schneider.
“Was?” rief der Hasenfuß von einem Riesen und war heftig erschrocken. “Laß es nur für heute gut sein und lege dich schlafen.”
Der Riese fürchtete sich so gewaltig, daß er die ganze Nacht kein Auge zutun konnte und hin und her dachte, wie er’s anfangen sollte, um sich den verwünschten Hexenmeister von Diener je eher je lieber vom Hals zu schaffen.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Am anderen Morgen gingen der Riese und der Schneider zu einem Sumpf, um den ringsherum eine Menge Weidenbäume standen. Da sprach der Riese. “Hör einmal, Schneider, setz dich auf eine von den Weidenruten, ich möchte um mein Leben gern sehen, ob du imstande bist, sie herab zu biegen.” Husch, saß das Schneiderlein oben, hielt den Atem ein und machte sich schwer, so schwer, daß sich die Gerte nieder bog. Als er aber wieder Atem schöpfen mußte, da schnellte sie ihn, weil er zum Unglück kein Bügeleisen in die Tasche gesteckt hatte, zu großer Freude des Riesen so weit in die Höhe, daß man ihn gar nicht mehr sehen konnte.
Wenn er nicht wieder heruntergefallen ist, so wird er wohl noch oben in der Luft herumschweben.
VOM KLUGEN SCHNEIDERLEIN

Es war einmal eine Prinzessin gewaltig stolz; kam ein Freier, so gab sie ihm etwas zu raten auf, und wenn er's nicht erraten konnte, so ward er mit Spott fortgeschickt. Sie ließ auch bekanntmachen, wer ihr Rätsel löste, sollte sich mit ihr vermählen, und möchte kommen, wer da wollte. Endlich fanden sich auch drei Schneider zusammen; davon meinten die zwei ältesten, sie hätten so manchen feinen Stich getan und hätten's getroffen, da könnt's ihnen nicht fehlen, sie müßten's auch hier treffen. Der dritte war ein kleiner, unnützer Springinsfeld, der nicht einmal sein Handwerk verstand, aber meinte, er müßte dabei Glück haben; denn woher sollt's ihm sonst kommen. Da sprachen die zwei andern zu ihm: "Bleib nur zu Haus, du wirst mit deinem bißchen Verstande nicht weit kommen!" Das Schneiderlein ließ sich aber nicht irremachen und sagte, es hätten einmal seinen Kopf darauf gesetzt und wollte sich schon helfen, und ging dahin, als wäre die ganze Welt sein.
Da meldeten sich alle drei bei der Prinzessin und sagten, sie sollte ihnen ihre Rätsel vorlegen; es wären die rechten Leute angekommen, die hätten einen feinen Verstand, daß man ihn wohl in eine Nadel fädeln könnte. Da sprach die Prinzessin: "Ich habe zweierlei Haar auf dem Kopf, von was für Farben ist das?" - "Wenn's weiter nichts ist," sagte der erste, "es wird schwarz und weiß sein wie Tuch, das man Kümmel und Salz nennt." Die Prinzessin sprach: "Falsch geraten, antworte der zweite!" Da sagte der zweite: "Ist's nicht schwarz und weiß, so ist's braun und rot, wie meines Herrn Vaters Bratenrock." - "Falsch geraten," sagte die Prinzessin, "antworte der dritte, dem seh ich's an, der weiß es sicherlich."
Da trat das Schneiderlein keck hervor und sprach: "Die Prinzessin hat ein silbernes und ein goldenes Haar auf dem Kopf, und das sind die zweierlei Farben." Wie die Prinzessin das hörte, ward sie blaß und wäre vor Schrecken beinah hingefallen, denn das Schneiderlein hatte es getroffen, und sie hatte fest geglaubt, das würde kein Mensch auf der Welt herausbringen. Als ihr das Herz wieder kam, sprach sie: "Damit hast du mich noch nicht gewonnen; du mußt noch eins tun. Unten im Stall liegt ein Bär, bei dem sollst du die Nacht zubringen; wenn ich dann morgen aufstehe und du bist noch lebendig, so sollst du mich heiraten." Sie dachte aber, damit wollte sie das Schneiderlein loswerden, denn der Bär hatte noch keinen Menschen lebendig gelassen, der ihm unter die Tatzen gekommen war. Das Schneiderlein ließ sich nicht abschrecken, war ganz vergnügt und sprach: "Frisch gewagt ist halb gewonnen."
Als nun der Abend kam, ward mein Schneiderlein hinunter zum Bären gebracht. Der Bär wollte auch gleich auf den kleinen Kerl los und ihm mit seiner Tatze einen guten Willkommen geben. "Sachte, sachte," sprach das Schneiderlein, "ich will dich schon zur Ruhe bringen." Da holte es ganz gemächlich, als hätt es keine Sorgen, welsche Nüsse aus der Tasche, biß sie auf und aß die Kerne. Wie der Bär das sah, kriegte er Lust und wollte auch Nüsse haben. Das Schneiderlein griff in die Tasche und reichte ihm eine Handvoll; es waren aber keine Nüsse, sondern Wackersteine. Der Bär steckte sie ins Maul, konnte aber nichts aufbringen, er mochte beißen, wie er wollte. Ei, dachte er, was bist du für ein dummer Klotz! kannst nicht einmal die Nüsse aufbeißen, und sprach zum Schneiderlein: "Mein, beiß mir die Nüsse auf!" - "Da siehst du, was du für ein Kerl bist," sprach das Schneiderlein, "hast so ein großes Maul und kannst die kleine Nuß nicht aufbeißen." Da nahm es die Steine, war hurtig, steckte dafür eine Nuß in den Mund und knack! war sie entzwei. "Ich muß das Ding noch einmal probieren," sprach der Bär, "wenn ich's so ansehe, ich mein, ich müßt's auch können."
Da gab ihm das Schneiderlein abermals Wackersteine, und der Bär arbeitete und biß aus allen Leibeskräften hinein. Aber du glaubst auch nicht, daß er sie aufgebracht hat. Wie das vorbei war, holte das Schneiderlein eine Violine unter dem Rock hervor und spielte sich ein Stückchen darauf. Als der Bär die Musik vernahm, konnte er es nicht lassen und fing an zu tanzen, und als er ein Weilchen getanzt hatte, gefiel ihm das Ding so wohl, daß er zum Schneiderlein sprach: "Hör, ist das Geigen schwer?" - "Kinderleicht, siehst du, mit der Linken leg ich die Finger auf, und mit der Rechten streich ich mit dem Bogen drauf los, da geht's lustig, hopsasa, vivallalera!" - "So geigen," sprach der Bär, "das möcht ich auch verstehen, damit ich tanzen könnte, so oft ich Lust hätte. Was meinst du dazu? Willst du mir Unterricht darin geben?" - "Von Herzen gern," sagte das Schneiderlein, "wenn du Geschick dazu hast. Aber weis einmal deine Tatzen her, die sind gewaltig lang, ich muß dir die Nägel ein wenig abschneiden."
Da ward ein Schraubstock herbeigeholt, und der Bär legte seine Tatzen darauf; das Schneiderlein aber schraubte sie fest und sprach: "Nun warte, bis ich mit der Schere komme!" ließ den Bären brummen, soviel er wollte, legte sich in die Ecke auf ein Bund Stroh und schlief ein. Die Prinzessin, als sie am Abend den Bären so gewaltig brummen hörte, glaubte nicht anders, als er brummte vor Freuden und hätte dem Schneider den Garaus gemacht. Am Morgen stand sie ganz unbesorgt und vergnügt auf; wie sie aber nach dem Stall guckt, so steht das Schneiderlein ganz munter davor und ist gesund wie ein Fisch im Wasser. Da konnte sie nun kein Wort mehr dagegen sagen, weil sie's öffentlich versprochen hatte, und der König ließ einen Wagen kommen, darin mußte sie mit dem Schneiderlein zur Kirche fahren, und sollte sie da vermählt werden. Wie sie eingestiegen waren, gingen die beiden anderen Schneider, die ein falsches Herz hatten und ihm sein Glück nicht gönnten, in den Stall und schraubten den Bären los.
Der Bär in voller Wut rannte hinter dem Wagen her. Die Prinzessin hörte ihn schnauben und brummen. Es ward ihr angst, und sie rief: "Ach, der Bär ist hinter uns und will dich holen!" Das Schneiderlein war fix, stellte sich auf den Kopf, streckte die Beine zum Fenster hinaus und rief: "Siehst du den Schraubstock? Wann du nicht gehst, so sollst du wieder hinein." Wie der Bär das sah, drehte er um und lief fort. Mein Schneiderlein fuhr da ruhig in die Kirche, und die Prinzessin ward ihm an die Hand getraut, und er lebte mit ihr vergnügt wie eine Heidlerche. Wer's nicht glaubt, bezahlt einen Taler.
DIE RÜBE
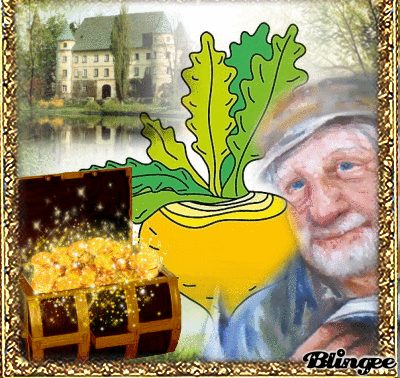
Es waren einmal zwei Brüder, die dienten beide als Soldaten, und war der eine reich, der andere arm. Da wollte der Arme sich aus seiner Not helfen, zog den Soldatenrock aus, und ward ein Bauer. Also grub und hackte er sein Stückchen Acker, und säte Rübsamen.
Der Same ging auf, und es wuchs da eine Rübe, die ward groß und stark, und zusehends dicker, und wollte gar nicht aufhören zu wachsen, so daß sie eine Fürstin aller Rüben heißen konnte, denn nimmer war so eine gesehen, und wird auch nimmer wieder gesehen werden. Zuletzt war sie so groß, daß sie allein einen ganzen Wagen anfüllte, und zwei Ochsen daran ziehen mußten, und der Bauer wußte nicht was er damit anfangen sollte, und obs sein Glück oder sein Unglück wäre. Endlich dachte er 'verkaufst du sie, was wirst du großes dafür bekommen, und willst du sie selber essen, so tun die kleinen Rüben denselben Dienst, am besten ist, du bringst sie dem König, und machst ihm eine Verehrung damit.'
Also lud er sie auf den Wagen, spannte zwei Ochsen vor, brachte sie an den Hof, und schenkte sie dem König. 'Was ist das für ein seltsam Ding?' sagte der König, 'mir ist viel Wunderliches vor die Augen gekommen, aber so ein Ungetüm noch nicht; aus was für Samen mag die gewachsen sein? oder dir geräts allein, und du bist ein Glückskind.'
'Ach nein,' sagte der Bauer, 'ein Glückskind bin ich nicht, ich bin ein armer Soldat, der, weil er sich nicht mehr nähren konnte, den Soldatenrock an den Nagel hing, und das Land baute; ich habe noch einen Bruder, der ist reich, und Euch, Herr König, auch wohl bekannt, ich aber, weil ich nichts habe, bin von aller Welt vergessen.'
Da empfand der König Mitleid mit ihm, und sprach 'deiner Armut sollst du überhoben und so von mir beschenkt werden, daß du wohl deinem reichen Bruder gleich kommst.' Da schenkte er ihm eine Menge Gold, Äcker, Wiesen und Herden, und machte ihn steinreich, so daß des anderen Bruders Reichtum gar nicht konnte damit verglichen werden.
Als dieser hörte was sein Bruder mit einer einzigen Rübe erworben hatte, beneidete er ihn, und sann hin und her wie er sich auch ein solches Glück zuwenden könnte. Er wollts aber noch viel gescheiter anfangen, nahm Gold und Pferde, und brachte sie dem König, und meinte nicht anders, der würde ihm ein viel größeres Gegengeschenk machen, denn hätte sein Bruder so viel für eine Rübe bekommen, was würde es ihm für so schöne Dinge nicht alles tragen.
Der König nahm das Geschenk, und sagte er wüßte ihm nichts wieder zu geben, das seltener und besser wäre, als die große Rübe. Also mußte der Reiche seines Bruders Rübe auf einen Wagen legen, und nach hause fahren lassen. Daheim wußte er nicht an wem er seinen Zorn und Ärger auslassen sollte, bis ihm böse Gedanken kamen, und er beschloß seinen Bruder zu töten. Er gewann Mörder, die mußten sich in einen Hinterhalt stellen, und darauf ging er zu seinem Bruder, und sprach 'lieber Bruder, ich weiß einen heimlichen Schatz, den wollen wir mit einander heben, und teilen.'
Der andere ließ sichs auch gefallen, und ging ohne Arg mit; als sie aber hinauskamen, stürzten die Mörder über ihn her, banden ihn, und wollten ihn an einen Baum hängen. Indem sie eben darüber waren, erscholl aus der Ferne lauter Gesang und Hufschlag, daß ihnen der Schrecken in den Leib fuhr, und sie über Hals und Kopf ihren Gefangenen in den Sack steckten, am Ast hinaufwanden, und die Flucht ergriffen. Er aber arbeitete oben bis er ein Loch im Sack hatte, wodurch er den Kopf stecken konnte.
Wer aber des Wegs kam, war nichts als ein fahrender Schüler, ein junger Geselle, der fröhlich sein Lied singend durch den Wald auf der Straße daher ritt. Wie der oben nun merkte daß einer unter ihm vorbei ging, rief er 'sei mir gegrüßt, zu guter Stunde.' Der Schüler guckte sich überall um, wußte nicht, wo die Stimme her schallte, endlich sprach er 'wer ruft mir?' Da antwortete es aus dem Wipfel 'erhebe deine Augen, ich sitze hier oben im Sack der Weisheit: in kurzer Zeit habe ich große Dinge gelernt, dagegen sind alle Schulen ein Wind, um ein Weniges, so werde ich ausgelernt haben, herabsteigen und weiser sein als alle Menschen. Ich verstehe die Gestirne und Himmelszeichen, das Wehen aller Winde, den Sand im Meer, Heilung der Krankheit, die Kräfte der Kräuter, Vögel und Steine. Wärst du einmal darin, du würdest fühlen was für Herrlichkeit aus dem Sack der Weisheit fließt.'
Der Schüler, wie er das alles hörte, erstaunte, und sprach 'gesegnet sei die Stunde, wo ich dich gefunden habe, könnt ich nicht auch ein wenig in den Sack kommen?' Oben der antwortete, als tät ers nicht gerne, 'eine kleine Weile will ich dich wohl hinein lassen für Lohn und gute Worte, aber du mußt doch noch eine Stunde warten, es ist ein Stück übrig, dass ich erst lernen muß.' Als der Schüler ein wenig gewartet hatte, war ihm die Zeit zu lang, und er bat daß er doch möchte hineingelassen werden, sein Durst nach Weisheit wäre gar zu groß. Da stellte sich der oben als gäbe er endlich nach und sprach 'damit ich aus dem Sack der Weisheit heraus kann, mußt du den Sack am Strick herunterlassen, so sollst du eingehen.'
Also ließ der Schüler ihn herunter, band den Sack auf, und befreite ihn, dann rief er selber 'nun zieh mich recht geschwind hinauf,' und wollt geradstehend in den Sack einschreiten. 'Halt!' sagte der andere, 'so gehts nicht an,' packte ihn beim Kopf, steckte ihn umgekehrt in den Sack, schnürte zu und zog den Jünger der Weisheit am Strick baumwärts; dann schwengelte er ihn in der Luft, und sprach 'wie stehts, mein lieber Geselle? siehe, schon fühlst du daß dir die Weisheit kommt, und machst gute Erfahrung, sitze also fein ruhig, bis du klüger wirst.' Damit stieg er auf des Schülers Pferd, und ritt fort.
DIE DREI FELDSCHERRER

Drei Feldscherer reisten in der Welt, die meinten, ihre Kunst ausgelernt zu haben, und kamen in ein Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Der Wirt fragte, wo sie her wären und hinaus wollten. 'Wir ziehen auf unsere Kunst in der Welt herum.' 'Zeigt mir doch einmal, was ihr könnt,' sagte der Wirt. Da sprach der erste, er wollte seine Hand abschneiden und morgen früh wieder anheilen: der zweite sprach, er wollte sein Herz ausreißen und morgen früh wieder anheilen: der dritte sprach, er wollte seine Augen ausstechen und morgen früh wieder einheilen. 'Könnt ihr das,' sprach der Wirt, 'so habt ihr ausgelernt.'
Sie hatten aber eine Salbe, was sie damit bestrichen, das heilte zusammen, und das Fläschchen, wo sie drin war, trugen sie beständig bei sich. Da schnitten sie Hand, Herz und Auge vom Leibe, wie sie gesagt hatten, legtens zusammen auf einen Teller und gaben es dem Wirt. Der Wirt gab es einem Mädchen, das sollts in den Schrank stellen und wohl aufheben. Das Mädchen aber hatte einen heimlichen Schatz, der war ein Soldat.
Wie nun der Wirt, die drei Feldscherer und alle Leute im Haus schliefen, kam der Soldat und wollte was zu essen haben. Da schloß das Mädchen den Schrank auf und holte ihm etwas, und über der großen Liebe vergaß es, die Schranktüre zuzumachen, setzte sich zum Liebsten an Tisch, und sie schwätzten miteinander. Wie es so vergnügt saß und an kein Unglück dachte, kam die Katze hereingeschlichen, fand den Schrank offen, nahm die Hand, das Herz und die Augen der drei Feldscherer und lief damit hinaus.
Als nun der Soldat gegessen hatte und das Mädchen das Gerät aufheben und den Schrank zuschließen wollte, da sah es wohl, daß der Teller, den ihm der Wirt aufzuheben gegeben hatte, ledig war. Da sagte es erschrocken zu seinem Schatz 'ach, was will ich armes Mädchen anfangen! Die Hand ist fort, das Herz und die Augen sind auch fort, wie wird mir es morgen früh ergehen!, 'Sei still,' sprach der Soldat, 'ich will dir aus der Not helfen: es hängt ein Dieb draußen am Galgen, dem will ich die Hand abschneiden; welche Hand wars denn?, 'Die rechte.'
Da gab ihm das Mädchen ein scharfes Messer, und er ging hin, schnitt dem armen Sünder die rechte Hand ab und brachte sie herbei. Darauf packte er die Katze und stach ihr die Augen aus; nun fehlte nur noch das Herz. 'Habt ihr nicht geschlachtet und liegt das Schweinefleisch nicht im Keller?' 'Ja,' sagte das Mädchen. 'Nun, das ist gut,' sagte der Soldat, ging hinunter und holte ein Schweineherz. Das Mädchen tat alles zusammen auf den Teller und stellte ihn in den Schrank, und als ihr Liebster darauf Abschied genommen hatte, legte es sich ruhig ins Bett.
Morgens, als die Feldscherer aufstanden, sagten sie dem Mädchen, es sollte ihnen den Teller holen, darauf Hand, Herz und Augen lägen. Da brachte es ihn aus dem Schrank, und der erste hielt sich die Diebeshand an und bestrich sie mit seiner Salbe, alsbald war sie ihm angewachsen. Der zweite nahm die Katzenaugen und heilte sie ein: der dritte machte das Schweineherz fest. Der Wirt aber stand dabei, bewunderte ihre Kunst und sagte, dergleichen hätt er noch nicht gesehen, er wollte sie bei jedermann rühmen und empfehlen. Darauf bezahlten sie ihre Zeche und reisten weiter.
Wie sie so dahingingen, so blieb der mit dem Schweineherzen gar nicht bei ihnen, sondern wo eine Ecke war, lief er hin und schnüffelte darin herum, wie Schweine es tun. Die andern wollten ihn an dem Rockschlippen zurückhalten, aber das half nichts, er riß sich los und lief hin, wo der dickste Unrat lag. Der zweite stellte sich auch wunderlich an, rieb die Augen und sagte zu dem andern 'Kamerad, was ist das? das sind meine Augen nicht, ich sehe ja nichts, leite mich doch einer, daß ich nicht falle.' Da gingen sie mit Mühe fort bis zum Abend, wo sie zu einer andern Herberge kamen.
Sie traten zusammen in die Wirtsstube, da saß in einer Ecke ein reicher Herr vorm Tisch und zählte Geld. Der mit der Diebeshand ging um ihn herum, zuckte ein paarmal mit dem Arm, endlich, wie der Herr sich umwendete, griff er in den Haufen hinein und nahm eine Handvoll Geld heraus. Der eine sahs und sprach 'Kamerad, was machst du? stehlen darfst du nicht, schäm dich!' 'Ei,' sagte er, 'was kann ich dafür! es zuckt mir in der Hand' ich muß zugreifen, ich mag wollen oder nicht.' Sie legten sich danach schlafen, und wie sie daliegen, ists so finster, daß man keine Hand vor Augen sehen kann. Auf einmal erwachte der mit den Katzenaugen, weckte die andern und sprach 'Brüder, schaut einmal auf, seht ihr die weißen Mäuschen, die da herumlaufen?, Die zwei richteten sich auf, konnten aber nichts sehen. Da sprach er 'es ist mit uns nicht richtig, wir haben das Unsrige nicht wiedergekriegt, wir müssen zurück nach dem Wirt, der hat uns betrogen.'
Also machten sie sich am andern Morgen dahin auf und sagten dem Wirt, sie hätten ihr richtig Werk nicht wiedergekriegt, der eine hätte eine Diebeshand, der zweite Katzenaugen und der dritte ein Schweineherz. Der Wirt sprach, daran müßte das Mädchen schuld sein, und wollte es rufen, aber wie das die drei hatte kommen sehen, war es zum Hinterpförtchen fortgelaufen, und kam nicht wieder. Da sprachen die drei, er sollte ihnen viel Geld geben, sonst ließen sie ihm den roten Hahn übers Haus fliegen: da gab er, was er hatte und nur aufbringen konnte, und die drei zogen damit fort. Es war für ihr Lebtag genug, sie hätten aber doch lieber ihr richtig Werk gehabt.
DER JUNGE RIESE

Ein Bauersmann hatte einen Sohn, der war so groß wie ein Daumen und ward gar nicht größer und wuchs in etlichen Jahren nicht ein Haarbreit. Einmal wollte der Bauer ins Feld gehen und pflügen, da sagte der Kleine 'Vater, ich will mit hinaus.' 'Du willst mit hinaus?' sprach der Vater, 'bleib du hier, dort bist du zu nichts nutz; du könntest mir auch verloren gehen.' Da fing der Däumling an zu weinen, und um Ruhe zu haben, steckte ihn der Vater in die Tasche und nahm ihn mit. Draußen auf dem Felde holte er ihn wieder heraus und setzte ihn in eine frische Furche. Wie er da so saß, kam über den Berg ein großer Riese daher. 'Siehst du dort den großen Butzemann?' sagte der Vater, und wollte den Kleinen schrecken, damit er artig wäre, 'der kommt und holt dich.' Der Riese aber hatte mit seinen langen Beinen kaum ein paar Schritte getan, so war er bei der Furche. Er hob den kleinen Däumling mit zwei Fingern behutsam in die Höhe, betrachtete ihn und ging, ohne ein Wort zu sprechen, mit ihm fort. Der Vater stand dabei, konnte vor Schrecken keinen Laut hervorbringen und dachte nicht anders als sein Kind für verloren, also daß ers sein Lebtag nicht wieder mit Augen sehen würde.
Der Riese aber trug es heim und ließ es an seiner Brust saugen, und der Däumling wuchs und ward groß und stark nach Art der Riesen. Nach Verlauf von zwei Jahren ging der Alte mit ihm in den Wald, wollte ihn versuchen und sprach 'zieh dir eine Gerte heraus.' Da war der Knabe schon so stark, daß er einen jungen Baum mit den Wurzeln aus der Erde riß. Der Riese aber meinte 'das muß besser kommen,' nahm ihn wieder mit und säugte ihn noch zwei Jahre. Als er ihn versuchte, hatte seine Kraft schon so zugenommen, daß er einen alten Baum aus der Erde brechen konnte. Das war dem Riesen noch immer nicht genug, er säugte ihn abermals zwei Jahre, und als er dann mit ihm in den Wald ging und sprach 'nun reiß einmal eine ordentliche Gerte aus,' so riß der Junge den dicksten Eichenbaum aus der Erde, daß er krachte, und war ihm nur ein Spaß. 'Nun ists genug,' sprach der Riese, 'du hast ausgelernt,' und führte ihn zurück auf den Acker, wo er ihn geholt hatte. Sein Vater stand da hinter dem Pflug, der junge Riese ging auf ihn zu und sprach 'sieht er wohl, Vater, was sein Sohn für ein Mann geworden ist.' Der Bauer erschrak und sagte 'nein, du bist mein Sohn nicht, ich will dich nicht, geh weg von mir.' 'Freilich bin ich sein Sohn, laß er mich an die Arbeit, ich kann pflügen so gut als er und noch besser.' 'Nein, nein, du bist mein Sohn nicht, du kannst auch nicht pflügen, geh weg von mir.' Weil er sich aber vor dem großen Mann fürchtete, ließ er den Pflug los, trat zurück und setzte sich zur Seite ans Land. Da nahm der Junge das Geschirr und drückte bloß mit einer Hand darauf, aber der Druck war so gewaltig, daß der Pflug tief in die Erde ging. Der Bauer konnte das nicht mit ansehen und rief ihm zu 'wenn du pflügen willst, mußt du nicht so gewaltig drücken, das gibt schlechte Arbeit.' Der Junge aber spannte die Pferde aus, zog selber den Pflug und sagte 'geh er nur nach Haus , Vater, und laß er die Mutter eine große Schüssel voll Essen kochen; ich will derweil den Acker schon umreißen.'
Da ging der Bauer heim und bestellte das Essen bei seiner Frau: der Junge aber pflügte das Feld, zwei Morgen groß, ganz allein, und dann spannte er sich auch selber vor die Egge und eggte alles mit zwei Eggen zugleich. Wie er fertig war, ging er in den Wald und riß zwei Eichenbäume aus, legte sie auf die Schultern, und hinten und vorn eine Egge darauf, und hinten und vorn auch ein Pferd, und trug das alles, als wär es ein Bund Stroh, nach seiner Eltern Haus. Wie er in den Hof kam, erkannte ihn seine Mutter nicht und fragte 'wer ist der entsetzliche große Mann?' Der Bauer sagte 'das ist unser Sohn.' Sie sprach 'nein, unser Sohn ist das nimmermehr, so groß haben wir keinen gehabt, unser war ein kleines Ding.' Sie rief ihm zu 'geh fort, wir wollen dich nicht.' Der Junge schwieg still, zog seine Pferde in den Stall, gab ihnen Hafer und Heu, alles wie sichs gehörte. Als er fertig war, ging er in die Stube, setzte sich auf die Bank und sagte 'Mutter, nun hätte ich Lust zu essen, ists bald fertig?' Da sagte sie 'ja, und brachte zwei große große Schüsseln voll herein, daran hätten sie und ihr Mann acht Tage lang satt gehabt. Der Junge aber aß sie allein auf und fragte, ob sie nicht mehr vorsetzen könnte. 'Nein,' sagte sie, 'das ist alles, was wir haben.' 'Das war ja nur zum Schmecken, ich muß mehr haben.' Sie getraute nicht, ihm zu widerstehen, ging hin und setzte einen großen Schweinekessel voll übers Feuer, und wie es gar war, trug sie es herein. 'Endlich kommen noch ein paar Brocken,' sagte er und aß alles hinein; es war aber doch nicht genug, seinen Hunger zu stillen. Da sprach er 'Vater, ich sehe wohl, bei ihm werd ich nicht satt, will er mir einen Stab von Eisen verschaffen, der stark ist und den ich vor meinen Knien nicht zerbrechen kann, so will ich fort in die Welt gehen.' Der Bauer war froh, spannte seine zwei Pferde vor den Wagen und holte bei dem Schmied einen Stab so groß und dick, als ihn die zwei Pferde nur fortschaffen konnten. Der Junge nahm ihn vor die Knie und ratsch! brach er ihn wie eine Bohnenstange in der Mitte entzwei und warf ihn weg. Der Vater spannte vier Pferde vor und holte einen Stab so groß und dick, als ihn die vier Pferde fortschaffen konnten. Der Sohn knickte auch diesen vor dem Knie entzwei, warf ihn hin und sprach 'Vater, der kann mir nicht helfen, er muß besser vorspannen und einen stärkern Stab holen.' Da spannte der Vater acht Pferde vor und holte einen so groß und dick, als ihn die acht Pferde herbeifahren konnten. Wie der Sohn den in die Hand nahm, brach er gleich oben ein Stück davon ab und sagte 'Vater, ich sehe, er kann mir keinen Stab anschaffen, wie ich ihn brauche, ich will nicht länger bei ihm bleiben.'
Da ging er fort und gab sich für einen Schmiedegesellen aus.
Er kam in ein Dorf, darin wohnte ein Schmied, der war ein Geizmann, gönnte keinem Menschen etwas und wollte alles allein haben; zu dem trat er in die Schmiede und fragte, ob er keinen Gesellen brauchte. 'Ja,' sagte der Schmied, sah ihn an und dachte 'das ist ein tüchtiger Kerl, der wird gut vorschlagen und sein Brot verdienen.' Er fragte 'wieviel willst du Lohn haben?' 'Gar keinen will ich haben,' antwortete er, 'nur alle vierzehn Tage, wenn die andern Gesellen ihren Lohn bezahlt kriegen, will ich dir zwei Streiche geben, die mußt du aushalten.' Das war der Geizmann von Herzen zufrieden und dachte damit viel Geld zu sparen. Am andern Morgen sollte der fremde Geselle zuerst vorschlagen, wie aber der Meister den glühenden Stab brachte und jener den ersten Schlag tat, so flog das Eisen voneinander und der Amboß sank in die Erde, so tief, daß sie ihn gar nicht wieder herausbringen konnten. Da ward der Geizmann bös und sagte 'ei was, dich kann ich nicht brauchen, du schlägst gar zu grob, was willst du für den einen Zuschlag haben?' Da sprach er 'ich will dir nur einen ganz kleinen Streich geben, weiter nichts.' Und hob seinen Fuß auf und gab ihm einen Tritt, daß er über vier Fuder Heu hinausflog. Darauf suchte er sich den dicksten Eisenstab aus, der in der Schmiede war, nahm ihn als einen Stock in die Hand und ging weiter.
Als er eine Weile gezogen war, kam er zu einem Vorwerk und fragte den Amtmann, ob er keinen Großknecht nötig hätte. 'Ja,' sagte der Amtmann, 'ich kann einen brauchen: du siehst aus wie ein tüchtiger Kerl, der schon was vermag, wieviel willst du Jahrslohn haben?' Er antwortete wiederum, er verlangte gar keinen Lohn, aber alle Jahre wollte er ihm drei Streiche geben, die müßte er aushalten. Das war der Amtmann zufrieden, denn er war auch ein Geizhals. Am andern Morgen, da sollten die Knechte ins Holz fahren, und die andern Knechte waren schon auf, er aber lag noch im Bett. Da rief ihn einer an 'steh auf, es ist Zeit, wir wollen ins Holz, und du mußt mit.' 'Ach,' sagte er ganz grob und trotzig, 'geht ihr nur hin, ich komme doch eher wieder als ihr alle miteinander.' Da gingen die andern zum Amtmann und erzählten ihm, der Großknecht läge noch im Bett und wollte nicht mit ins Holz fahren. Der Amtmann sagte, sie sollten ihn noch einmal wecken und ihn heißen die Pferde vorspannen. Der Großknecht sprach aber wie vorher 'geht ihr nur hin, ich komme doch eher wieder als ihr alle miteinander.' Darauf blieb er noch zwei Stunden liegen, da stieg er endlich aus den Federn, holte sich aber erst zwei Scheffel voll Erbsen vom Boden, kochte sich einen Brei und aß den mit guter Ruhe, und wie das alles geschehen war, ging er hin, spannte die Pferde vor und fuhr ins Holz.
Nicht weit vor dem Holz war ein Hohlweg, wo er durch mußte, da fuhr er den Wagen erst vorwärts, dann mußten die Pferde stille halten, und er ging hinter den Wagen, nahm Bäume und Reisig und machte da eine große Hucke (Verhack), so daß kein Pferd durchkommen konnte. Wie er nun vors Holz kam, fuhren die andern eben mit ihren beladenen Wagen heraus und wollten heim, da sprach er zu ihnen 'fahrt nur hin, ich komme doch eher als ihr nach Haus.' Er fuhr gar nicht weit ins Holz, riß gleich zwei der allergrößten Bäume aus der Erde, warf sie auf de n Wagen und drehte um. Als er vor der Hucke anlangte, standen die andern noch da und konnten nicht durch. 'Seht ihr wohl,' sprach er, 'wärt ihr bei mir geblieben, so wärt ihr ebenso schnell nach Haus gekommen und hättet noch eine Stunde schlafen können.' Er wollte nun zufahren, aber seine Pferde konnten sich nicht durcharbeiten, da spannte er sie aus, legte sie oben auf den Wagen, nahm selber die Deichsel in die Hand, und hüf! zog er alles durch, und das ging so leicht, als hätt er Federn geladen. Wie er drüben war, sprach er zu den andern 'seht ihr wohl, ich bin schneller hindurch als ihr,' fuhr weiter, und die andern mußten stehen bleiben. In dem Hof aber nahm er einen Baum in die Hand, zeigte ihn dem Amtmann und sagte 'ist das nicht ein schönes Klafterstück?' Da sprach der Amtmann zu seiner Frau 'der Knecht ist gut; wenn er auch lang schläft, er ist doch eher wieder da als die andern.'
Nun diente er dem Amtmann ein Jahr: wie das herum war und die andern Knechte ihren Lohn kriegten, sprach er, es wäre Zeit, er wollte sich auch seinen Lohn nehmen. Dem Amtmann ward aber angst vor den Streichen, die er kriegen sollte, und bat ihn inständig, er möchte sie ihm schenken, lieber wollte er selbst Großknecht werden, und er sollte Amtmann sein. 'Nein,' sprach er, 'ich will kein Amtmann werden, ich bin Großknecht und wills bleiben, ich will aber austeilen, was bedungen ist.' Der Amtmann wollte ihm geben, was er nur verlangte, aber es half nichts, der Großknecht sprach zu allem 'nein.' Da wußte sich der Amtmann nicht zu helfen und bat ihn um vierzehn Tage Frist, er wollte sich auf etwas besinnen. Der Großknecht sprach, die Frist sollte er haben. Der Amtmann berief alle seine Schreiber zusammen, sie sollten sich bedenken und ihm einen Rat geben. Die Schreiber besannen sich lange, endlich sagten sie, vor dem Großknecht wäre niemand seines Lebens sicher, der schlüge einen Menschen wie eine Mücke tot. Er sollte ihn heißen in den Brunnen steigen und ihn reinigen, wenn er unten wäre, wollten sie einen von den Mühlensteinen, die da lägen, herbeirollen und ihm auf den Kopf werfen, dann würde er nicht wieder an des Tages Licht kommen. Der Rat gefiel dem Amtmann, und der Großknecht war bereit, in den Brunnen hinabzusteigen. Als er unten auf dem Grund stand, rollten sie den größten Mühlenstein hinab, und meinten, der Kopf wäre ihm eingeschlagen, aber er rief 'jagt die Hühner vom Brunnen weg, die kratzen da oben im Sand und werfen mir die Körner in die Augen, daß ich nicht sehen kann.' Da rief der Amtmann 'husch! husch!' und tat, als scheuchte er die Hühner weg. Als der Großknecht mit seiner Arbeit fertig war, stieg er herauf und sagte 'seht einmal, ich habe doch ein schönes Halsband um,' da war es der Mühlenstein, den er um den Hals trug. Der Großknecht wollte jetzt seinen Lohn nehmen, aber der Amtmann bat wieder um vierzehn Tage Bedenkzeit.
Die Schreiber kamen zusammen und gaben den Rat, er sollte den Großknecht in die verwünschte Mühle schicken, um dort in der Nacht Korn zu mahlen: von da wäre noch kein Mensch morgens lebendig herausgekommen. Der Anschlag gefiel dem Amtmann, er rief den Großknecht noch denselben Abend und hieß ihn acht Malter Korn in die Mühle fahren und in der Nacht noch mahlen; sie hättens nötig. Da ging der Großknecht auf den Boden und tat zwei Malter in seine rechte Tasche, zwei in die linke, vier nahm er in einem Quersack halb auf den Rücken, halb auf die Brust, und ging also beladen nach der verwünschten Mühle. Der Müller sagte ihm, bei Tag könnte er recht gut da mahlen, aber nicht in der Nacht, da wäre die Mühle verwünscht, und wer da noch hineingegangen wäre, den hätte man am Morgen tot darin gefunden. Er sprach 'ich will schon durchkommen, macht Euch nur fort und legt Euch aufs Ohr.' Darauf ging er in die Mühle und schüttete das Korn auf. Gegen elf Uhr ging er in die Müllerstube und setzte sich auf die Bank. Als er ein Weilchen da gesessen hatte, tat sich auf einmal die Tür auf und kam eine große große Tafel herein, und auf die Tafel stellte sich Wein und Braten und viel gutes Essen, alles von selber, denn es war niemand da, ders auftrug. Und danach rückten sich die Stühle herbei, aber es kamen keine Leute, bis auf einmal sah er Finger, die hantierten mit den Messern und Gabeln und legten Speisen auf die Teller, aber sonst konnte er nichts sehen. Da er hungrig war und die Speisen sah, so setzte er sich auch an die Tafel, aß mit und ließ sichs gut schmecken. Als er satt war und die andern ihre Schüsseln auch ganz leer gemacht hatten, da wurden die Lichter auf einmal alle ausgeputzt, das hörte er deutlich, und wies nun stockfinster war, so kriegte er so etwas wie eine Ohrfei ge ins Gesicht. Da sprach er 'wenn noch einmal so etwas kommt, so teil ich auch wieder aus.' Und wie er zum zweitenmal eine Ohrfeige kriegte, da schlug er gleichfalls mit hinein. Und so ging das fort die ganze Nacht, er nahm nichts umsonst, sondern gab reichlich zurück und schlug nicht faul um sich herum: bei Tagesanbruch aber hörte alles auf. Wie der Müller aufgestanden war, wollte er nach ihm sehen und verwunderte sich, daß er noch lebte. Da sprach er 'ich habe mich satt gegessen, habe Ohrfeigen gekriegt, aber ich habe auch Ohrfeigen ausgeteilt.' Der Müller freute sich und sagte, nun wäre die Mühle erlöst, und wollt ihm gern zur Belohnung viel Geld geben. Er sprach aber 'Geld will ich nicht, ich habe doch genug.'
Dann nahm er sein Mehl auf den Rücken, ging nach Haus und sagte dem Amtmann, er hätte die Sache ausgerichtet und wollte nun seinen bedungenen Lohn haben. Wie der Amtmann das hörte, da ward ihm erst recht angst: er wußte sich nicht zu lassen, ging in der Stube auf und ab, und die Schweißtropfen liefen ihm von der Stirne herunter. Da machte er das Fenster auf nach frischer Luft, ehe er sichs aber versah, hatte ihm der Großknecht einen Tritt gegeben, daß er durchs Fenster in die Luft hineinflog, immer fort, bis ihn niemand mehr sehen konnte. Da sprach der Großknecht zur Frau des Amtmanns 'kommt er nicht wieder, so müßt Ihr den anderen Streich hinnehmen.' Sie rief 'nein, nein, ich kanns nicht aushalten,' und machte das andere Fenster auf, weil ihr die Schweißtropfen die Stirne herunterliefen. Da gab er ihr einen Tritt, daß sie gleichfalls hinausflog, und da sie leichter war, noch viel höher als ihr Mann. Der Mann rief 'komm doch zu mir,' sie aber rief 'komm du zu mir, ich kann nicht zu dir.' Und sie schwebten da in der Luft, und konnte keins zum andern kommen, und ob sie da noch schweben, das weiß ich nicht; der junge Riese aber nahm seine Eisenstange und ging weiter.
DER KÖNIGSSOHN, DER SICH VOR NICHTS FÜRCHTET
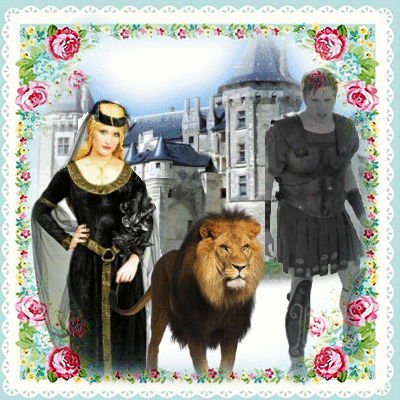
Es war einmal ein Königssohn, dem gefiel es nicht mehr daheim in seines Vaters Haus, und weil er vor nichts Furcht hatte, so dachte er 'ich will in die weite Welt gehen, da wird mir Zeit und Weile nicht lang, und ich werde wunderliche Dinge genug sehen.' Also nahm er von seinen Eltern Abschied und ging fort, immerzu, von Morgen bis Abend, und es war ihm einerlei, wo hinaus ihn der Weg führte.
Es trug sich zu, daß er vor eines Riesen Haus kam, und weil er müde war, setzte er sich vor die Türe und ruhte. Und als er seine Augen so hin- und hergehen ließ, sah er auf dem Hof des Riesenspielwerk liegen: das waren ein paar mächtige Kugeln und Kegel, so groß als ein Mensch. Über ein Weilchen bekam er Lust, stellte die Kegel auf und schob mit den Kugeln danach, schrie und rief, wenn die Kegel fielen, und war guter Dinge. Der Riese hörte den Lärm, streckte seinen Kopf zum Fenster heraus und erblickte einen Menschen, der nicht größer war als andere, und doch mit seinen Kegeln spielte. 'Würmchen,' rief er, 'was kegelst du mit meinen Kegeln? wer hat dir die Stärke dazu gegeben?' Der Königssohn schaute auf, sah den Riesen an und sprach 'o du Klotz, du meinst wohl, du hättest allein starke Arme? ich kann alles, wozu ich Lust habe.'
Der Riese kam herab, sah dem Kegeln ganz verwundert zu und sprach 'Menschenkind, wenn du der Art bist, so geh und hol mir einen Apfel vom Baum des Lebens.' 'Was willst du damit?' sprach der Königssohn. 'Ich will den Apfel nicht für mich,' antwortete der Riese, 'aber ich habe eine Braut, die verlangt danach; ich bin weit in der Welt umhergegangen und kann den Baum nicht finden.' 'Ich will ihn schon finden,' sagte der Königssohn, 'und ich weiß nicht, was mich abhalten soll, den Apfel herunterzuholen.' Der Riese sprach 'du meinst wohl, das wäre so leicht? der Garten, worin der Baum steht, ist von einem eisernen Gitter umgeben, und vor dem Gitter liegen wilde Tiere, eins neben dem andern, die halten Wache und lassen keinen Menschen hinein.' 'Mich werden sie schon einlassen,' sagte der Königssohn. 'Ja, gelangst du auch in den Garten und siehst den Apfel am Baum hängen, so ist er doch noch nicht dein: es hängt ein Ring davor, durch den muß einer die Hand stecken, wenn er den Apfel erreichen und abbrechen will, und das ist noch keinem geglückt.' 'Mir solls schon glücken,' sprach der Königssohn.
Da nahm er Abschied von dem Riesen, ging fort über Berg und Tal, durch Felder und Wälder, bis er endlich den Wundergarten fand. Die Tiere lagen ringsumher, aber sie hatten die Köpfe gesenkt und schliefen. Sie erwachten auch nicht, als er herankam, sondern er trat über sie weg, stieg über das Gitter und kam glücklich in den Garten. Da stand mitten inne der Baum des Lebens, und die roten Äpfel leuchteten an den listen. Er kletterte an dem Stamm in die Höhe, und wie er nach einem Apfel reichen wollte, sah er einen Ring davor hängen, aber er steckte seine Hand ohne Mühe hindurch und brach den Apfel. Der Ring schloß sich fest an seinen Arm, und er fühlte, wie auf einmal eine gewaltige Kraft durch seine Adern drang. Als er mit dem Apfel von dem Baum wieder herabgestiegen war, wollte er nicht über das Gitter klettern, sondern faßte das große Tor und brauchte nur einmal daran zu schütteln, so sprang es mit Krachen auf. Da ging er hinaus, und der Löwe, der davor gelegen hatte, war wach geworden und sprang ihm nach, aber nicht in Wut und Wildheit, sondern er folgte ihm demütig als seinem Herrn.
Der Königssohn brachte dem Riesen den versprochenen Apfel und sprach 'siehst du, ich habe ihn ohne Mühe geholt.' Der Riese war froh, daß sein Wunsch so bald erfüllt war, eilte zu seiner Braut und gab ihr den Apfel, den sie verlangt hatte. Es war eine schöne und kluge Jungfrau, und da sie den Ring nicht an seinem Arm sah, sprach sie 'ich glaube nicht eher, daß du den Apfel geholt hast, als bis ich den Ring an deinem Arm erblicke.' Der Riese sagte 'ich brauche nur heim zu gehen und ihn zu holen,' und meinte, es wäre ein leichtes, dem schwachen Menschen mit Gewalt wegzunehmen, was er nicht gutwillig geben wollte. Er forderte also den Ring von ihm, aber der Königssohn weigerte sich, 'Wo der Apfel ist, muß auch der Ring sein,' sprach der Riese, 'gibst du ihn nicht gutwillig, so mußt du mit mir darum kämpfen.'
Sie rangen lange Zeit miteinander, aber der Riese konnte dem Königssohn, den die Zauberkraft des Ringes stärkte, nichts anhaben. Da sann der Riese auf eine List und sprach 'mir ist warm geworden bei dem Kampf, und dir auch, wir wollen im Flusse baden und uns abkühlen, eh wir wieder anfangen.' Der Königssohn, der von Falschheit nichts wußte, ging mit ihm zu dem Wasser, streifte mit seinen Kleidern auch den Ring vom Arm und sprang in den Fluß. Alsbald griff der Riese nach dem Ring und lief damit fort, aber der Löwe, der den Diebstahl bemerkt hatte, setzte dem Riesen nach, riß den Ring ihm aus der Hand und brachte ihn seinem Herrn zurück. Da stellte sich der Riese hinter einen Eichbaum, und als der Königssohn beschäftigt war, seine Kleider wieder anzuziehen, überfiel er ihn und stach ihm beide Augen aus.
Nun stand da der arme Königssohn, war blind und wußte sich nicht zu helfen. Da kam der Riese wieder herbei, faßte ihn bei der Hand wie jemand, der ihn leiten wollte, und führte ihn auf die Spitze eines hohen Felsens. Dann ließ er ihn stehen und dachte 'noch ein paar Schritte weiter, so stürzt er sich tot, und ich kann ihm den Ring abziehen.' Aber der treue Löwe hatte seinen Herrn nicht verlassen, hielt ihn am Kleide fest und zog ihn allmählich wieder zurück. Als der Riese kam und den Toten berauben wollte, sah er, daß seine List vergeblich gewesen war. 'Ist denn ein so schwaches Menschenkind nicht zu verderben!' sprach er zornig zu sich selbst, faßte den Königssohn und führte ihn auf einem andern Weg nochmals zu dem Abgrund: aber der Löwe, der die böse Absicht merkte, half seinem Herrn auch hier aus der Gefahr. Als sie nahe zum Rand gekommen waren, ließ der Riese die Hand des Blinden fahren und wollte ihn allein zurücklassen, aber der Löwe stieß den Riesen, daß er hinabstürzte und zerschmettert auf den Boden fiel.
Das treue Tier zog seinen Herrn wieder von dem Abgrund zurück und leitete ihn zu einem Baum, an dem ein klarer Bach floß. Der Königssohn setzte sich da nieder, der Löwe aber legte sich und spritzte mit seiner Tatze ihm das Wasser ins Antlitz. Kaum hatten ein paar Tröpfchen die Augenhöhlen benetzt, so konnte er wieder etwas sehen und bemerkte ein Vöglein, das flog ganz nah vorbei, stieß sich aber an einem Baumstamm: hierauf ließ es sich in das Wasser herab und badete sich darin, dann flog es auf, strich ohne anzustoßen zwischen den Bäumen hin, als hätte es sein Gesicht wiederbekommen. Da erkannte der Königssohn den Wink Gottes, neigte sich herab zu dem Wasser und wusch und badete sich darin das Gesicht. Und als er sich aufrichtete, hatte er seine Augen wieder so hell und rein, wie sie nie gewesen waren.
Der Königssohn dankte Gott für die große Gnade und zog mit seinem Löwen weiter in der Welt herum. Nun trug es sich zu, daß er vor ein Schloß kam, welches verwünscht war. In dem Tor stand eine Jungfrau von schöner Gestalt und feinem Antlitz, aber sie war ganz schwarz. Sie redete ihn an und sprach 'ach könntest du mich erlösen aus dem bösen Zauber, der über mich geworfen ist.' 'Was soll ich tun?' sprach der Königssohn. Die Jungfrau antwortete 'drei Nächte mußt du in dem großen Saal des verwünschten Schlosses zubringen, aber es darf keine Furcht in dein Herz kommen. Wenn sie dich auf das ärgste quälen und du hältst es aus, ohne einen Laut von dir zu geben, so bin ich erlöst; das Leben dürfen sie dir nicht nehmen.' Da sprach der Königssohn 'ich fürchte mich nicht, ich wills mit Gottes Hilfe versuchen.' Also ging er fröhlich in das Schloß, und als es dunkel ward, setzte er sich in den großen Saal und wartete. Es war aber still bis Mitternacht, da fing plötzlich ein großer Lärm an, und aus allen Ecken und Winkeln kamen kleine Teufel herbei. Sie taten, als ob sie ihn nicht sähen, setzten sich mitten in die Stube, machten ein Feuer an und fingen an zu spielen. Wenn einer verlor, sprach er 'es ist nicht richtig, es ist einer da, der nicht zu uns gehört, der ist schuld, daß ich verliere.' 'Wart, ich komme, du hinter dem Ofen,' sagte ein anderer. Das Schreien ward immer größer, so daß es niemand ohne Schrecken hätte anhören können.
Der Königssohn blieb ganz ruhig sitzen und hatte keine Furcht: doch endlich sprangen die Teufel von der Erde auf und fielen über ihn her, und es waren so viele, daß er sich ihrer nicht erwehren konnte. Sie zerrten ihn auf dem Boden herum, zwickten, stachen, schlugen und quälten ihn, aber er gab keinen Laut von sich. Gegen Morgen verschwanden sie, und er war so abgemattet, daß er kaum seine Glieder regen konnte: als aber der Tag anbrach, da trat die schwarze Jungfrau zu ihm herein. Sie trug in ihrer Hand eine kleine Flasche, worin Wasser des Lebens war, damit wusch sie ihn, und alsbald fühlte er, wie alle Schmerzen verschwanden und frische Kraft in seine Adern drang. Sie sprach 'eine Nacht hast du glücklich ausgehalten, aber noch zwei stehen dir bevor.' Da ging sie wieder weg, und im Weggehen bemerkte er, daß ihre Füße weiß geworden waren. In der folgenden Nacht kamen die Teufel und fingen ihr Spiel aufs neue an: sie fielen über den Königssohn her und schlugen ihn viel härter als in der vorigen Nacht, daß sein Leib voll Wunden war. Doch da er alles still ertrug, mußten sie von ihm lassen, und als die Morgenröte anbrach, erschien die Jungfrau und heilte ihn mit dem Lebenswasser. Und als sie wegging, sah er mit Freuden, daß sie schon weiß geworden war bis zu den Fingerspitzen. Nun hatte er nur noch eine Nacht auszuhalten, aber die war die schlimmste. Der Teufelsspuk kam wieder: 'bist du noch da?' schrien sie, 'du sollst gepeinigt werden, daß dir der Atem stehen bleibt.' Sie stachen und schlugen ihn, warfen ihn hin und her und zogen ihn an Armen und Beinen, als wollten sie ihn zerreißen: aber er duldete alles und gab keinen Laut von sich. Endlich verschwanden die Teufel, aber er lag da ohnmächtig und regte sich nicht: er konnte auch nicht die Augen aufheben, um die Jungfrau zu sehen, die hereinkam und ihn mit dem Wasser des Lebens benetzte und begoß. Aber auf einmal war er von allen Schmerzen befreit und fühlte sich frisch und gesund, als wäre er aus einem Schlaf erwacht, und wie er die Augen aufschlug, so sah er die Jungfrau neben sich stehen, die war schneeweiß und schön wie der helle Tag. 'Steh auf,' sprach sie, 'und schwing dein Schwert dreimal über die Treppe, so ist alles erlöst.' Und als er das getan hatte, da war das ganze Schloß vom Zauber befreit, und die Jungfrau war eine reiche Königstochter. Die Diener kamen und sagten, im großen Saale wäre die Tafel schon zubereitet und die Speisen aufgetragen. Da setzten sie sich nieder, aßen und tranken zusammen, und abends ward in großen Freuden die Hochzeit gefeiert.
DIE EULE

Vor ein paar hundert Jahren, als die Leute noch lange nicht so klug und verschmitzt waren, als sie heutzutage sind, hat sich in einer kleinen Stadt eine seltsame Geschichte zugetragen.
Von ungefähr war eine von den großen Eulen, die man Schuhu nennt, aus dem benachbarten Walde bei nächtlicher Weile in die Scheuer eines Bürgers geraten und wagte sich, als der Tag anbrach, aus Furcht vor den anderen Vögeln, die, wenn sie sich blicken läßt, ein furchtbares Geschrei erheben, nicht wieder aus ihrem Schlupfwinkel heraus. Als nun der Hausknecht morgens in die Scheuer kam, um Stroh zu holen, erschrak er bei dem Anblick der Eule, die da in einer Ecke saß, so gewaltig, daß er fortlief und seinem Herrn ankündigte, ein Ungeheuer, wie er Zeit seines Lebens keins erblickt hätte, säße in der Scheuer, drehte die Augen im Kopf herum und könnte einen ohne Umstände verschlingen. ‘Ich kenne dich schon,’ sagte der Herr, ‘einer Amsel im Felde nachzujagen, dazu hast du Mut genug, aber wenn du ein totes Huhn liegen siehst, so holst du dir erst einen Stock, ehe du ihm nahe kommst. Ich muß nur selbst einmal nachsehen, was das für ein Ungeheuer ist,’ setzte der Herr hinzu, ging ganz tapfer zur Scheuer hinein und blickte umher.
Als er aber das seltsame und gräuliche Tier mit eigenen Augen sah, so geriet er in nicht geringere Angst als der Knecht. Mit ein paar Sätzen sprang er hinaus, lief zu seinen Nachbarn und bat sie flehentlich, ihm gegen ein unbekanntes und gefährliches Tier Beistand zu leisten; ohnehin könnte die ganze Stadt in Gefahr kommen, wenn es aus der Scheuer, wo es säße, heraus bräche. Es entstand großer Lärm und Geschrei in allen Straßen: die Bürger kamen mit Spießen, Heugabeln, Sensen und Äxten bewaffnet herbei, als wollten sie gegen den Feind ausziehen: zuletzt erschienen auch die Herren des Rats mit dem Bürgermeister an der Spitze. Als sie sich auf dem Markt geordnet hatten, zogen sie zu der Scheuer und umringten sie von allen Seiten. Hierauf trat einer der beherztesten hervor und ging mit gefälltem Spieß hinein, kam aber gleich darauf mit einem Schrei und totenbleich wieder heraus gelaufen, und konnte kein Wort hervorbringen. Noch zwei andere wagten sich hinein, es erging ihnen aber nicht besser.
Endlich trat einer hervor, ein großer starker Mann, der wegen seiner Kriegstaten berühmt war, und sprach ‘mit bloßem Ansehen werdet ihr das Ungetüm nicht vertreiben, hier muß Ernst gebraucht werden, aber ich sehe, daß ihr alle zu Weibern geworden seid und keiner den Fuchs beißen will.’ Er ließ sich Harnisch, Schwert und Spieß bringen und rüstete sich. Alle rühmten seinen Mut, obgleich viele um sein Leben besorgt waren. Die beiden Scheuertore wurden aufgetan, und man erblickte die Eule, die sich indessen in die Mitte auf einen großen Querbalken gesetzt hatte. Er ließ eine Leiter herbeibringen, und als er sie anlegte und sich bereitete hinaufzusteigen, so riefen ihm alle zu, er solle sich männlich halten, und empfahlen ihn dem heiligen Georg, der den Drachen getötet hatte.
Als er bald oben war, und die Eule sah, daß er an sie wollte, auch von der Menge und dem Geschrei des Volks verwirrt war und nicht wußte, wohinaus, so verdrehte sie die Augen, sträubte die Federn, sperrte die Flügel auf, gnappte mit dem Schnabel und ließ ihr schuhu, schuhu mit rauher Stimme hören. ‘Stoß zu, stoß zu!’ rief die Menge draußen dem tapferen Helden zu. ‘Wer hier stände, wo ich stehe,’ antwortete er, ‘der würde nicht stoß zu rufen.’ Er setzte zwar den Fuß noch eine Staffel höher, dann aber fing er an zu zittern und machte sich halb ohnmächtig auf den Rückweg.
Nun war keiner mehr übrig, der sich in die Gefahr hätte begeben wollen. ‘Das Ungeheuer,’ sagten sie, ‘hat den stärksten Mann, der unter uns zu finden war, durch sein Gnappen und Anhauchen allein vergiftet und tödlich verwundet, sollen wir andern auch unser Leben in die Schanze schlagen?’ Sie ratschlagten, was zu tun wäre, wenn die ganze Stadt nicht sollte zugrunde gehen. Lange Zeit schien alles vergeblich, bis endlich der Bürgermeister einen Ausweg fand. ‘Meine Meinung geht dahin,’ sprach er, ‘daß wir aus gemeinem Säckel diese Scheuer samt allem, was darin liegt, Getreide, Stroh und Heu, dem Eigentümer bezahlen und ihn schadlos halten, dann aber das ganze Gebäude und mit ihm das fürchterliche Tier abbrennen, so braucht doch niemand sein Leben daran zu setzen. Hier ist keine Gelegenheit zu sparen, und Knauserei wäre übel angewendet.’ Alle stimmten ihm bei. Also ward die Scheuer an vier Ecken angezündet, und mit ihr die Eule jämmerlich verbrannt. Wer es nicht glauben will, der gehe hin und frage selbst nach.
DIE DREI HANDWERKSBURSCHEN

Es waren drei Handwerksburschen, die hatten es verabredet, auf ihrer Wanderung beisammen zu bleiben und immer in einer Stadt zu arbeiten. Auf eine Zeit aber fanden sie bei ihren Meistern kein Verdienst mehr, so daß sie endlich ganz abgerissen waren und nichts zu leben hatten. Da sprach der eine 'was sollen wir anfangen? hier bleiben können wir nicht länger, wir wollen wieder wandern, und wenn wir in der Stadt, wo wir hinkommen, keine Arbeit finden, so wollen wir beim Herbergsvater ausmachen, daß wir ihm schreiben, wo wir uns aufhalten, und einer vom andern Nachricht haben kann, und dann wollen wir uns trennen;' das schien den andern auch das beste.
Sie zogen fort, da kam ihnen auf dem Weg ein reich gekleideter Mann entgegen, der fragte, wer sie wären. 'Wir sind Handwerksleute und suchen Arbeit: wir haben uns bisher zusammengehalten, wenn wir aber keine mehr finden, so wollen wir uns trennen.' 'Das hat keine Not,' sprach der Mann, 'wenn ihr tun wollt, was ich euch sage, solls euch an Geld und Arbeit nicht fehlen; ja ihr sollt große Herren werden und in Kutschen fahren.'
Der eine sprach ,wenns unserer Seele und Seligkeit nicht schadet, so wollen wirs wohl tun.' 'Nein,' antwortete der Mann, 'ich habe keinen Teil an euch.' Der andere aber hatte nach seinen Füßen gesehen, und als er da einen Pferdefuß und einen Menschenfuß erblickte, wollte er sich nicht mit ihm einlassen. Der Teufel aber sprach 'gebt euch zufrieden, es ist nicht auf euch abgesehen, sondern auf eines anderen Seele, der schon halb mein ist, und dessen Maß nur vollaufen soll.'
Weil sie nun sicher waren, willigten sie ein, und der Teufel sagte ihnen, was er verlangte, der erste sollte auf jede Frage antworten 'wir alle drei,' der zweite 'ums Geld,' der dritte 'und das war recht.' Das sollten sie immer hintereinander sagen, weiter aber dürften sie kein Wort sprechen, und überträten sie das Gebot, so wäre gleich alles Geld verschwunden: solange sie es aber befolgten, sollten ihre Taschen immer voll sein. Zum Anfang gab er ihnen auch gleich soviel, als sie tragen konnten, und hieß sie in die Stadt in das und das Wirtshaus gehen.
Sie gingen hinein, der Wirt kam ihnen entgegen und fragte 'wollt ihr etwas zu essen?' Der erste antwortete 'wir alle drei.' 'Ja,' sagte der Wirt, 'das mein ich auch.' Der zweite 'ums Geld.' 'Das versteht sich,' sagte der Wirt. Der dritte 'und das war recht.' 'Jawohl wars recht,' sagte der Wirt. Es ward ihnen nun gut Essen und Trinken gebracht und wohl aufgewartet. Nach dem Essen mußte die Bezahlung geschehen, da hielt der Wirt dem einen die Rechnung hin' der sprach 'wir alle drei,' der zweite 'ums Geld,' der dritte 'und das war recht.' 'Freilich ists recht,' sagte der Wirt, 'alle drei bezahlen, und ohne Geld kann ich nichts geben.' Sie bezahlten aber noch mehr, als er gefordert hatte. Die Gäste sahen das mit an und sprachen 'die Leute müssen toll sein.' 'Ja, das sind sie auch,' sagte der Wirt, 'sie sind nicht recht klug.' So blieben sie eine Zeitlang in dem Wirtshaus und sprachen kein ander Wort als 'wir alle drei, ums Geld, und das war recht.' Sie sahen aber und wußten alles, was darin vorging.
Es trug sich zu, daß ein großer Kaufmann kam mit vielem Geld, der sprach 'Herr Wirt, heb er mir mein Geld auf, da sind die drei närrischen Handwerksbursche, die möchten mirs stehlen.' Das tat der Wirt. Wie er den Mantelsack in seine Stube trug, fühlte er, daß er schwer von Gold war. Darauf gab er den drei Handwerkern unten ein Lager, der Kaufmann aber kam oben hin in eine besondere Stube.
Als Mitternacht war und der Wirt dachte, sie schliefen alle, kam er mit seiner Frau, und sie hatten eine Holzaxt und schlugen den reichen Kaufmann tot; nach vollbrachtem Mord legten sie sich wieder schlafen. Wies nun Tag war, gabs großen Lärm, der Kaufmann lag tot im Bett und schwamm in seinem Blut. Da liefen alle Gäste zusammen, der Wirt aber sprach 'das haben die drei tollen Handwerker getan.' Die Gä ste bestätigten es und sagten 'niemand anders kanns gewesen sein. Der Wirt aber ließ sie rufen und sagte zu ihnen 'habt ihr den Kaufmann getötet?' 'Wir alle drei,' sagte der erste, 'ums Geld,' der zweite, 'und das war recht,' der dritte. 'Da hört ihrs nun,' sprach der Wirt, 'sie gestehens selber.' Sie wurden also ins Gefängnis gebracht, und sollten gerichtet werden.
Wie sie nun sahen, daß es so ernsthaft ging, ward ihnen doch Angst, aber nachts kam der Teufel und sprach 'haltet nur noch einen Tag aus' und verscherzt euer Glück nicht, es soll euch kein Haar gekrümmt werden.'
Am andern Morgen wurden sie vor Gericht geführt: da sprach der Richter 'seid ihr die Mörder?' 'Wir alle drei.' 'Warum habt ihr den Kaufmann erschlagen?' 'Ums Geld.' 'Ihr Bösewichter,' sagte der Richter, 'habt ihr euch nicht der Sünde gescheut?' 'Und das war recht.' 'Sie haben bekannt und sind noch halsstarrig dazu,' sprach der Richter, 'führt sie gleich zum Tod.' Also wurden sie hinausgebracht, und der Wirt mußte mit in den Kreis treten.
Wie sie nun von den Henkersknechten gefaßt und oben aufs Gerüst geführt wurden, wo der Scharfrichter mit bloßem Schwerte stand, kam auf einmal eine Kutsche mit vier blutroten Füchsen bespannt, und fuhr, daß das Feuer aus den Steinen sprang, aus dem Fenster aber winkte einer mit einem weißen Tuche. Da sprach der Scharfrichter 'es kommt Gnade,' und ward aus dem Wagen 'Gnade! Gnade!' gerufen.
Da trat der Teufel heraus als ein sehr vornehmer Herr, prächtig gekleidet, und sprach 'ihr drei seid unschuldig; ihr dürft nun sprechen, sagt heraus, was ihr gesehen und gehört habt.' Da sprach der älteste 'wir haben den Kaufmann nicht getötet, der Mörder steht da im Kreis,' und deutete auf den Wirt, 'zum Wahrzeichen geht hin in seinen Keller, da hängen noch viele andere, die er ums Leben gebracht.'
Da schickte der Richter die Henkersknechte hin, die fanden es, wies gesagt war, und als sie dem Richter das berichtet hatten, ließ er den Wirt hinaufführen und ihm das Haupt abschlagen. Da sprach der Teufel zu den dreien 'nun hab ich die Seele, die ich haben wollte, ihr seid aber frei und habt Geld für euer Lebtag.'
DER FUCHS UND DAS PFERD
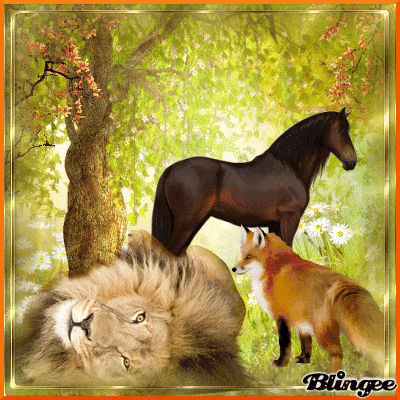
Es hatte ein Bauer ein treues Pferd, das war alt geworden und konnte keine Dienste mehr tun, da wollte ihm sein Herr nichts mehr zu fressen geben und sprach 'brauchen kann ich dich freilich nicht mehr, indes mein ich es gut mit dir, zeigst du dich noch so stark, daß du mir einen Löwen hierher bringst, so will ich dich behalten, jetzt aber mach dich fort aus meinem Stall,' und jagte es damit ins weite Feld.
Das Pferd war traurig und ging nach dem Wald zu, dort ein wenig Schutz vor dem Wetter zu suchen. Da begegnete ihm der Fuchs und sprach 'was hängst du so den Kopf und gehst so einsam herum?' 'Ach,' antwortete das Pferd, 'Geiz und Treue wohnen nicht beisammen in einem Haus, mein Herr hat vergessen, was ich ihm für Dienste in so vielen Jahren geleistet habe, und weil ich nicht recht mehr ackern kann, will er mir kein Futter mehr geben, und hat mich fortgejagt.' 'Ohne allen Trost?' fragte der Fuchs. 'Der Trost war schlecht, er hat gesagt, wenn ich noch so stark wäre, daß ich ihm einen Löwen brächte, wollt er mich behalten, aber er weiß wohl, daß ich das nicht vermag.' Der Fuchs sprach 'da will ich dir helfen, leg dich nur hin, strecke dich aus und rege dich nicht, als wärst du tot.'
Das Pferd tat, was der Fuchs verlangte, der Fuchs aber ging zum Löwen, der seine Höhle nicht weit davon hatte, und sprach 'da draußen liegt ein totes Pferd, komm doch mit hinaus, da kannst du eine fette Mahlzeit halten.' Der Löwe ging mit, und wie sie bei dem Pferd standen, sprach der Fuchs 'hier hast du´s doch nicht nach deiner Gemächlichkeit, weißt du was? ich wills mit dem Schweif an dich binden, so kannst du´s in deine Höhle ziehen und in aller Ruhe verzehren.' Dem Löwen gefiel der Rat, er stellte sich hin, und damit ihm der Fuchs das Pferd festknüpfen könnte, hielt er ganz still. Der Fuchs aber band mit des Pferdes Schweif dem Löwen die Beine zusammen und drehte und schnürte alles so wohl und stark, daß es m it keiner Kraft zu zerreißen war. Als er nun sein Werk vollendet hatte, klopfte er dem Pferd auf die Schulter und sprach 'zieh, Schimmel, zieh.'
Da sprang das Pferd mit einmal auf und zog den Löwen mit sich fort. Der Löwe fing an zu brüllen, daß die Vögel in dem ganzen Wald vor Schrecken aufflogen, aber das Pferd ließ ihn brüllen, zog und schleppte ihn über das Feld vor seines Herrn Tür.
Wie der Herr das sah, besann er sich eines Bessern und sprach zu dem Pferd 'du sollst bei mir bleiben und es gut haben,' und gab ihm satt zu fressen, bis es starb.
DER FRIEDER UND DAS KATHERLIESCHEN
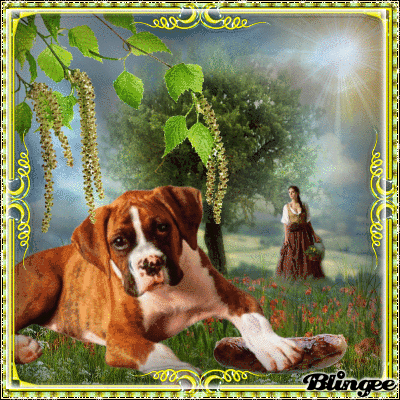
Es war ein Mann, der hieß Frieder, und eine Frau, die hieß Katherlieschen, die hatten einander geheiratet und lebten zusammen als junge Eheleute. Eines Tages sprach der Frieder: "Ich will jetzt zu Acker, Katherlieschen, wenn ich wiederkomme, muß etwas Gebratenes auf dem Tisch stehen für den Hunger, und ein frischer Trunk dabei für den Durst." - "Geh nur, Friederchen," antwortete Katherlieschen. "Geh nur, will dir's schon recht machen."
Als nun die Essenszeit herbeirückte, holte sie eine Wurst aus dem Schornstein, tat sie in eine Bratpfanne, legte Butter dazu und stellte sie übers Feuer. Die Wurst fing an zu braten und zu brutzeln, Katherlieschen stand dabei, hielt den Pfannenstiel und hatte so seine Gedanken. Da fiel ihm ein: Bis die Wurst fertig wird, derweil könntest du ja im Keller den Trunk zapfen. Also stellte es den Pfannenstiel fest, nahm eine Kanne, ging hinab in den Keller und zapfte Bier. Das Bier lief in die Kanne und Katherlieschen sah ihm zu. Da fiel ihm ein: Holla, der Hund oben ist nicht bei getan, der könnte die Wurst aus der Pfanne holen, du kämst mir recht.
Und im Hui war es die Kellertreppe hinauf. Aber der Spitz hatte die Wurst schon im Maul und schleifte sie auf der Erde mit sich fort. Doch Katherlieschen, nicht faul, setzte ihm nach und jagte ihn ein gut Stück ins Feld; aber der Hund war geschwinder als Katherlieschen, ließ auch die Wurst nicht fallen, sondern über die Acker hin hüpfen. "Hin ist hin!" sprach Katherlieschen, kehrte um, und weil es sich müde gelaufen hatte, ging es hübsch langsam und kühlte sich ab.
Während der Zeit lief das Bier aus dem Faß immerzu, denn Katherlieschen hatte den Hahn nicht umgedreht, und als die Kanne voll und sonst kein Platz da war, so lief es in den Keller und hörte nicht eher auf, als bis das ganze Faß leer war. Katherlieschen sah schon auf der Treppe das Unglück. "Spuk," rief es, "was fängst du jetzt an, daß es der Frieder nicht merkt!" Es besann sich ein Weilchen, endlich fiel ihm ein, von der letzten Kirmes stände noch ein Sack mit schönem Weizenmehl auf dem Boden, das wollte es herabholen und in das Bier streuen. "Ja," sprach es, "wer zu rechten Zeit was spart, der hat's hernach in der Not," stieg auf den Boden, trug den Sack herab und warf ihn gerade auf die Kanne voll Bier, daß sie umstürzte und der Trunk des Frieders auch im Keller schwamm. "Es ist ganz recht," sprach Katherlieschen, "wo eins ist, muß das andere auch sein," und zerstreute das Mehl im ganzen Keller. Als es fertig war, freute es sich gewaltig über seine Arbeit und sagte: "Wie's so reinlich und sauber hier aussieht!"
Um Mittagszeit kam der Frieder heim. "Nun, Frau, was hast du mir zurechtgemacht?" - "Ach, Friederchen," antwortete sie, "ich wollte dir ja eine Wurst braten, aber während ich das Bier dazu zapfte, hat sie der Hund aus der Pfanne weggeholt, und während ich dem Hund nachsprang, ist das Bier ausgelaufen, und als ich das Bier mit dem Weizenmehl auftrocknen wollte, hab ich die Kanne auch noch umgestoßen; aber sei nur zufrieden, der Keller ist wieder ganz trocken." Sprach der Frieder: "Katherlieschen, Katherlieschen, das hättest du nicht tun müssen! Läßt die Wurst weg holen und das Bier aus dem Faß laufen und verschüttest obendrein unser feines Mehl!" - "Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewußt, hättest mir's sagen müssen."
Der Mann dachte: Geht das so weiter mit deiner Frau, so mußt du dich besser vorsehen. Nun hatte er eine hübsche Summe Taler zusammengebracht, die wechselte er in Gold ein und sprach zum Katherlieschen: "Siehst du, das sind gelbe Gickelinge, die will ich in einen Topf tun und im Stall unter der Kuhkrippe vergraben, aber daß du mir ja davon bleibst, sonst geht dir's schlimm."
Sprach sie: "Nein, Friederchen, will's gewiß nicht tun!" Nun, als der Frieder fort war, da kamen Krämer, die irrdne Näpfe und Töpfe feil hatten, ins Dorf und fragten bei der jungen Frau an, ob sie nichts zu handeln hätte. "Oh, ihr lieben Leute," sprach Katherlieschen, "ich habe kein Geld und kann nichts kaufen; aber könnt ihr gelbe Gickelinge brauchen, so will ich wohl kaufen." -
"Gelbe Gickelinge, warum nicht? Laßt sie einmal sehen." - "So geht in den Stall und grabt unter der Kuhkrippe, so werdet ihr die gelben Gickelinge finden, ich darf nicht dabei gehen."
Die Spitzbuben gingen hin, gruben und fanden eitel Gold. Da packten sie auf damit, liefen fort und ließen die Töpfe und Näpfe im Hause stehen. Katherlieschen meinte, sie müßte das neue Geschirr auch brauchen; weil nun in der Küche ohne hin kein Mangel daran war, schlug sie jedem Topf den Boden aus und steckte sie insgesamt zum Zierat auf die Zaunpfähle rings ums Haus herum. Wie der Frieder kam und den neuen Zierat sah, sprach er: "Katherlieschen, was hast du gemacht?" - "Hab's gekauft, Friederchen, für die gelben Gickelinge, die unter der Kuhkrippe steckten, bin selber nicht dabei gegangen, die Krämer haben sich's heraus graben müssen." -
"Ach, Frau," sprach der Frieder, "was hast du gemacht! Das waren keine Gickelinge, es war eitel Gold und war all unser Vermögen; das hättest du nicht tun sollen!" - "Ja, Friederchen," antwortete sie, "das hab' ich nicht gewußt, hättest mir's vorher sagen sollen."
Katherlieschen stand ein Weilchen und besann sich, da sprach sie: "Hör, Friederchen, das Gold wollen wir schon wieder kriegen, wollen hinter den Dieben herlaufen." - "So komm," sprach der Frieder, "wir wollen's versuchen; nimm aber Brot und Käse mit, daß wir auf dem Weg was zu essen haben." - "Ja, Friederchen, will's mitnehmen."
Sie machten sich fort, und weil der Frieder besser zu Fuß war, ging Katherlieschen hinten nach. Ist mein Vorteil, dachte es, wenn wir umkehren, hab ich ja ein Stück voraus. Nun kam es an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Wegs tiefe Fahrgleise waren. "Da sehe einer," sprach Katherlieschen, "was sie das arme Erdreich zerrissen, geschunden und gedrückt haben! Das wird sein Lebtag nicht wieder heil." Und aus mitleidigem Herzen nahm es seine Butter und bestrich die Gleise, rechts und links, damit sie von den Rädern nicht so gedrückt würden. Und wie es sich bei seiner Barmherzigkeit so bückte, rollte ihm ein Käse aus der Tasche den Berg hinab.
Sprach das Katherlieschen: "Ich habe den Weg schon einmal heraufgemacht, ich gehe nicht wieder hinab, es mag ein anderer hin laufen und ihn wieder holen." Also nahm es einen andern Käs und rollte ihn hinab. Die Käse aber kamen nicht wieder, da ließ es noch einen dritten hinab laufen und dachte: Vielleicht warten sie auf Gesellschaft und gehen nicht gern allein. Als sie alle drei ausblieben, sprach es: "Ich weiß nicht, was das vorstellen soll! Doch kann's ja sein, der dritte hat den Weg nicht gefunden und sich verirrt, ich will nun den vierten schicken, daß er sie herbeiruft." Der vierte machte es aber nicht besser als der dritte. Da ward das Katherlieschen ärgerlich und warf noch den fünften und sechsten hinab, und das waren die letzten.
Eine Zeitlang blieb es stehen und lauerte, daß sie kämen, als sie aber immer nicht kamen, sprach es: "Oh, ihr seid gut nach dem Tod schicken, ihr bleibt fein lange aus! Meint ihr, ich wollt noch länger auf euch warten? Ich gehe meiner Wege, ihr könnt mir nachlaufen, ihr habt jüngere Beine als ich." Katherlieschen ging fort und fand den Frieder, der war stehen geblieben und hatte gewartet, weil er gerne was essen wollte. "Nun gib einmal her, was du mitgenommen hast." Sie reichte ihm das trockene Brot. "Wo ist Butter und Käse?" fragte der Mann. "Ach, Friederchen," sagte Katherlieschen, "mit der Butter hab ich die Fahrgleise geschmiert, und die Käse werden bald kommen; einer lief mir fort, da hab ich die anderen nachgeschickt, sie sollten ihn rufen."
Sprach der Frieder: "Das hättest du nicht tun sollen, Katherlieschen, die Butter an den Weg schmieren und die Käse den Berg hinabrollen." - "Ja, Friederchen, hättest mir's sagen müssen!"
Da aßen sie das trockene Brot zusammen, und der Frieder sagte: "Katherlieschen, hast du auch unser Haus verwahrt, wie du fortgegangen bist?" -"Nein, Friederchen, hättest mir's vorher sagen sollen." - "So geh wieder heim und bewahr erst das Haus, ehe wir weitergehen; bring auch etwas anderes zu essen mit, ich will hier auf dich warten."
Katherlieschen ging zurück und dachte: Friederchen will etwas anderes zu essen, Butter und Käse schmeckt ihm wohl nicht, so will ich ein Tuch voll Hutzeln und einen Krug Essig zum Trunk mitnehmen. Danach riegelte es die Obertüre zu, aber die Untertüre hob es aus, nahm sie auf die Schulter und glaubte, wenn es die Türe in Sicherheit gebracht hätte, müßte das Haus wohl bewahrt sein. Katherlieschen nahm sich Zeit zum Weg und dachte: Desto länger ruht sich Friederchen aus.
Als es ihn wieder erreicht hatte, sprach es: "Da, Friederchen, hast du die Haustüre, da kannst du das Haus selber verwahren." - "Ach, Gott!" sprach er, "was hab ich für eine kluge Frau! Hebt die Türe unten aus, daß alles hineinlaufen kann, und riegelt sie oben zu. Jetzt ist's zu spät, noch einmal nach Haus zu gehen, aber hast du die Türe hierher gebracht, so sollst du sie auch ferner tragen." - "Die Türe will ich tragen, Friederchen, aber die Hutzeln und der Essigkrug werden mir zu schwer, ich hänge sie an die Türe, die mag sie tragen."
Nun gingen sie in den Wald und suchten die Spitzbuben, aber sie fanden sie nicht. Weil's endlich dunkel ward, stiegen sie auf einen Baum und wollten da übernachten. Kaum aber saßen sie oben, so kamen die Kerle daher, die fort tragen, was nicht mitgehen will, und die Dinge finden, ehe sie verloren sind. Sie ließen sich gerade unter dem Baum nieder, auf dem Frieder und Katherlieschen saßen, machten sich ein Feuer an und wollten ihre Beute teilen.
Der Frieder stieg von der andern Seite herab und sammelte Steine, stieg damit wieder hinauf und wollte die Diebe tot werfen. Die Steine aber trafen nicht, und die Spitzbuben riefen: "Es ist bald Morgen, der Wind schüttelt die Tannäpfel herunter." Katherlieschen hatte die Tür noch immer auf der Schulter, und weil sie so schwer drückte, dachte es, die Hutzeln wären schuld, und sprach: "Friederchen, ich muß die Hutzeln hinabwerfen." - "Nein, Katherlieschen, jetzt nicht," antwortete er, "sie könnten uns verraten." -
"Ach, Friederchen, ich muß, sie drücken mich gar zu sehr." - "Nun so tu's, in Henkers Namen!" Da rollten die Hutzeln zwischen den Ästen herab, und die Kerle unten sprachen: "Die Vögel misten."
Eine Weile danach, weil die Türe noch immer drückte, sprach Katherlieschen: "Ach, Friederchen, ich muß den Essig ausschütten." - "Nein, Katherlieschen, das darfst du nicht, es könnte uns verraten." - "Ach, Friederchen, ich muß, es drückt mich gar zu sehr." - "Nun so tu's, in Henkers Namen!" Da schüttete es den Essig aus, daß es die Kerle bespritzte. Sie sprachen untereinander: "Der Tau tröpfelt schon herunter."
Endlich dachte Katherlieschen: Sollte es wohl die Türe sein, was mich so drückt? und sprach: "Friederchen, ich muß die Türe hinabwerfen." - "Nein, Katherlieschen, jetzt nicht, sie könnte uns verraten." - "Ach, Friederchen, ich muß, sie drückt mich gar zu sehr." - "Nein, Katherlieschen, halt sie ja fest!" - "Ach, Friederchen, ich laß sie fallen." - "Ei," antwortete Frieder ärgerlich, "so laß sie fallen ins Teufels Namen!" Da fiel sie herunter mit starkem Gepolter, und die Kerle unten riefen: "Der Teufel kommt vom Baum herab," rissen aus und ließen alles im Stich. Frühmorgens, wie die zwei herunter kamen, fanden sie all ihr Gold wieder und trugen's heim.
Als sie wieder zu Haus waren, sprach der Frieder: "Katherlieschen, nun mußt du aber auch fleißig sein und arbeiten." - "Ja, Friederchen, will's schon tun, will ins Feld gehen, Frucht schneiden." Als Katherlieschen im Feld war, sprach's mit sich selber: "Eß ich, ehe ich schneid, oder schlaf ich, ehe ich schneid? Hei, ich will eher essen!" Da aß Katherlieschen und ward überm Essen schläfrig und fing an zu schneiden und schnitt halb träumend alle seine Kleider entzwei: Schürze, Rock und Hemd.
Wie Katherlieschen nach langem Schlaf wieder erwachte, stand es halb nackig da und sprach zu sich selber: "Bin ich's oder bin ich's nicht? Ach, ich bin's nicht!" Unterdessen ward's Nacht, da lief Katherlieschen ins Dorf hinein, klopfte an ihres Mannes Fenster und rief: "Friederchen!" - "Was ist denn?" - "Möcht gern wissen, ob Katherlieschen drinnen ist." - "Ja, ja," antwortete der Frieder, "es wird wohl drinnen liegen und schlafen." Sprach sie: "Gut, dann bin ich gewiß schon zu Haus," und lief fort.
Draußen fand Katherlieschen Spitzbuben, die wollten stehlen. Da ging es zu ihnen und sprach: "Ich will euch helfen stehlen." Die Spitzbuben meinten, es wüßte die Gelegenheit des Orts und waren's zufrieden. Katherlieschen ging vor die Häuser und rief: "Leute, habt ihr was? Wir wollen stehlen." Dachten die Spitzbuben: Das wird gut und wünschten, sie wären Katherlieschen wieder los. Da sprachen sie zu ihm: "Vorm Dorfe hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld, geh hin und rupf uns Rüben!"
Katherlieschen ging hin aufs Land und fing an zu rupfen, war aber so faul und hob sich nicht in die Höhe. Da kam ein Mann vorbei, sah's und stand still und dachte, das wäre der Teufel, der so in den Rüben wühlte. Lief fort ins Dorf zum Pfarrer und sprach: "Herr Pfarrer, in Eurem Rübenland ist der Teufel und rupft!" - "Ach Gott," antwortete der Pfarrer, "ich habe einen lahmen Fuß, ich kann nicht hinaus und ihn weg bannen." Sprach der Mann: "So will ich Euch hockeln," und hockelte ihn hinaus.
Und als sie auf das Land kamen, machte sich das Katherlieschen auf und reckte sich in die Höhe. "Ach, der Teufel!" rief der Pfarrer, und beide eilten fort, und der Pfarrer konnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuß gerader laufen als der Mann, der ihn gehockt hatte, mit seinen gesunden Beinen.
FRAU TRUDE
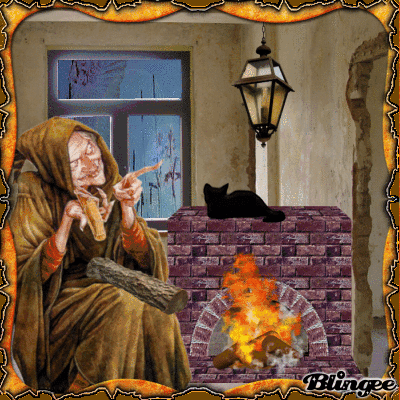
Es war einmal ein kleines Mädchen, das war eigensinnig und vorwitzig, und wenn ihm seine Eltern etwas sagten, so gehorchte es nicht: wie konnte es dem gut gehen?
Eines Tages sagte es zu seinen Eltern: "Ich habe so viel von der Frau Trude gehört, ich will einmal zu ihr hingehen, die Leute sagen, es sehe so wunderlich bei ihr aus, und erzählen, es seien so seltsame Dinge in ihrem Hause, da bin ich ganz neugierig geworden." Die Eltern verboten es ihr streng und sagten: "Die Frau Trude ist eine böse Frau, die gottlose Dinge treibt, und wenn du zu ihr hingehst, so bist du unser Kind nicht mehr."
Aber das Mädchen kehrte sich nicht an das Verbot seiner Eltern und ging doch zu der Frau Trude. Und als es zu ihr kam, fragte die Frau Trude: "Warum bist du so bleich?" - "Ach," antwortete es und zitterte am Leibe, "ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe." - "Was hast du gesehen?" - "Ich sah auf Eurer Stiege einen schwarzen Mann." - "Das war ein Köhler." - "Dann sah ich einen grünen Mann." - "Das war ein Jäger." - "Danach sah ich einen blutroten Mann." - "Das war ein Metzger." - "Ach, Frau Trude, mir grauste, ich sah durchs Fenster und sah Euch nicht, wohl aber den Teufel mit feurigem Kopf." - "Oho," sagte sie, "so hast du die Hexe in ihrem rechten Schmuck gesehen: ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt, du sollst mir leuchten."
Da verwandelte sie das Mädchen in einen Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in voller Glut war, setzte sie sich daneben, wärmte sich daran und sprach: "Das leuchtet einmal hell!"
DIE DREI BRÜDER
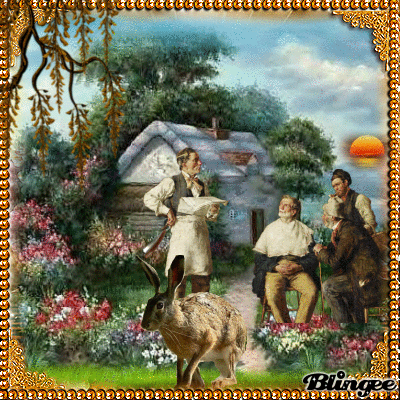
Es war ein Mann, der hatte drei Söhne und weiter nichts im Vermögen als das Haus, worin er wohnte. Nun hätte jeder gerne nach seinem Tode das Haus gehabt, dem Vater war aber einer so lieb als der andere, da wußte er nicht, wie ers anfangen sollte, daß er keinem zu nahe tät; verkaufen wollte er das Haus auch nicht, weils von seinen Voreltern war, sonst hätte er das Geld unter sie geteilt. Da fiel ihm endlich ein Rat ein, und er sprach zu seinen Söhnen 'geht in die Welt und versucht euch, und lerne jeder sein Handwerk, wenn ihr dann wiederkommt, wer das beste Meisterstück macht, der soll das Haus haben.'
Da waren die Söhne zufrieden, und der älteste wollte ein Hufschmied, der zweite ein Barbier, der dritte aber ein Fechtmeister werden. Darauf bestimmten sie eine Zeit, wo sie wieder nach Haus zusammenkommen wollten, und zogen fort. Es traf sich auch, daß jeder einen tüchtigen Meister fand, wo er was Rechtschaffenes lernte. Der Schmied mußte des Königs Pferde beschlagen und dachte 'nun kann dir´s nicht fehlen, du kriegst das Haus.' Der Barbier rasierte lauter vornehme Herren und meinte auch, das Haus wäre schon sein. Der Fechtmeister kriegte manchen Hieb, biß aber die Zähne zusammen und ließ sich´s nicht verdrießen, denn er dachte bei sich 'fürchtest du dich vor einem Hieb, so kriegst du das Haus nimmermehr.'
Als nun die gesetzte Zeit herum war, kamen sie bei ihrem Vater wieder zusammen: sie wußten aber nicht, wie sie die beste Gelegenheit finden sollten, ihre Kunst zu zeigen, saßen beisammen und ratschlagten. Wie sie so saßen, kam auf einmal ein Hase übers Feld daher gelaufen. 'Ei,' sagte der Barbier, 'der kommt wie gerufen,' nahm Becken und Seife, schäumte so lange, bis der Hase in die Nähe kam, dann seifte er ihn in vollem Laufe ein, und rasierte ihm auch in vollem Laufe ein Stutzbärtchen, und dabei schnitt er ihn nicht und tat ihm an keinem Haare weh. 'Das gefällt mir,' sagte der Vater, 'wenn sich die anderen nicht gewaltig angreifen, so ist das Haus dein.'
Es währte nicht lang, so kam ein Herr in einem Wagen daher gerennt in vollem Tagen 'Nun sollt Ihr sehen, Vater, was ich kann,' sprach der Hufschmied, sprang dem Wagen nach, riß dem Pferd, das in einem fort jagte, die vier Hufeisen ab und schlug ihm auch im Jagen vier neue wieder an. 'Du bist ein ganzer Kerl,' sprach der Vater, 'du machst deine Sachen so gut wie dein Bruder; ich weiß nicht, wem ich das Haus geben soll.'
Da sprach der dritte 'Vater, laßt mich auch einmal gewähren,' und weil es anfing zu regnen, zog er seinen Degen und schwenkte ihn in Kreuzhieben über seinen Kopf, daß kein Tropfen auf ihn fiel: und als der Regen stärker ward, und endlich so stark, als ob man mit Mulden vom Himmel gösse, schwang er den Degen immer schneller und blieb so trocken, als säß er unter Dach und Fach. Wie der Vater das sah, erstaunte er und sprach 'du hast das beste Meisterstück gemacht, das Haus ist dein.'
Die beiden anderen Brüder waren damit zufrieden, wie sie vorher gelobt hatten, und weil sie sich einander so lieb hatten, blieben sie alle drei zusammen im Haus und trieben ihr Handwerk; und da sie so gut ausgelernt hatten und so geschickt waren, verdienten sie viel Geld. So lebten sie vergnügt bis in ihr Alter zusammen, und als der eine krank ward und starb, grämten sich die zwei anderen so sehr darüber, daß sie auch krank wurden und bald starben. Da wurden sie, weil sie so geschickt gewesen waren und sich so lieb gehabt hatten, alle drei zusammen in ein Grab gelegt.
DAS ALTE MÜTTERCHEN

Es war in einer großen Stadt ein altes Mütterchen, das saß abends allein in seiner Kammer: es dachte so darüber nach, wie es erst den Mann, dann die beiden Kinder, nach und nach alle Verwandte, endlich auch heute noch den letzten Freund verloren hätte und nun ganz allein und verlassen wäre. Da ward es in tiefstem Herzen traurig, und vor allem schwer war ihm der Verlust der beiden Söhne, daß es in seinem Schmerz Gott darüber anklagte.
So saß es still und in sich versunken, als es auf einmal zur Frühkirche läuten hörte. Es wunderte sich, daß es die ganze Nacht also in Leid durchwacht hätte, zündete seine Leuchte an und ging zur Kirche. Bei seiner Ankunft war sie schon erhellt, aber nicht, wie gewöhnlich, von Kerzen, sondern von einem dämmernden Licht. Sie war auch schon angefüllt mit Menschen, und alle Plätze waren besetzt, und als das Mütterchen zu seinem gewöhnlichen Sitz kam, war er auch nicht mehr ledig, sondern die ganze Bank gedrängt voll.
Und wie es die Leute ansah, so waren es lauter verstorbene Verwandten, die saßen da in ihren altmodischen Kleidern, aber mit blassem Angesicht. Sie sprachen auch nicht und sangen nicht, es ging aber ein leises Summen und Wehen durch die Kirche. Da stand eine Muhme auf, trat vor und sprach zu dem Mütterlein: "Dort sieh nach dem Altar, da wirst du deine Söhne sehen."
Die Alte blickte hin und sah ihre beiden Kinder, der eine hing am Galgen, der andere war auf das Rad geflochten. Da sprach die Muhme: "Siehst du, so wäre es ihnen ergangen, wären sie im Leben geblieben und hätte sie Gott nicht als unschuldige Kinder zu sich genommen."
Die Alte ging zitternd nach Haus und dankte Gott auf den Knien, daß er es besser mit ihr gemacht hätte, als sie hätte begreifen können; und am dritten Tag legte sie sich und starb.
DIE DREI FAULEN

Ein König hatte drei Söhne, die waren ihm alle gleich lieb, und er wußte nicht, welchen er zum König nach seinem Tode bestimmen sollte. Als die Zeit kam, daß er sterben wollte, rief er sie vor sein Bett und sprach 'liebe Kinder, ich habe etwas bei mir bedacht, das will ich euch eröffnen: welcher von euch der faulste ist, der soll nach mir König werden.'
Da sprach der älteste 'Vater, so gehört das Reich mir, denn ich bin so faul, wenn ich liege und will schlafen, und es fällt mir ein Tropfen in die Augen, so mag ich sie nicht zutun, damit ich einschlafe.' Der zweite sprach 'Vater, das Reich gehört mir, denn ich bin so faul, wenn ich beim Feuer sitze, mich zu wärmen, so ließ ich mir eher die Fersen verbrennen, eh ich die Beine zurückzöge.'
Der dritte sprach 'Vater, das Reich ist mein, denn ich bin so faul, sollt ich aufgehängt werden, und hätte den Strick schon um den Hals, und einer gäbe mir ein scharfes Messer in die Hand, damit ich den Strick zerschneiden dürfte, so ließ ich mich eher aufhängen, ehe ich meine Hand erhübe zum Strick.' Wie der Vater das hörte, sprach er 'du hast es am weitesten gebracht und sollst der König sein.'
DIE DREI SCHLANGENBLÄTTER
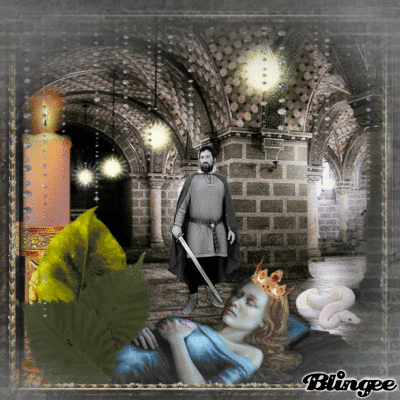
Es war einmal ein armer Mann, der konnte seinen einzigen Sohn nicht mehr ernähren. Da sprach der Sohn 'lieber Vater, es geht Euch so kümmerlich, ich falle Euch zur Last, lieber will ich selbst fortgehen und sehen, wie ich mein Brot verdiene.' Da gab ihm der Vater seinen Segen und nahm mit großer Trauer von ihm Abschied.
Zu dieser Zeit führte der König eines mächtigen Reichs Krieg, der Jüngling nahm Dienste bei ihm und zog mit ins Feld. Und als er vor den Feind kam, so ward eine Schlacht geliefert, und es war große Gefahr und regnete blaue Bohnen, daß seine Kameraden von allen Seiten nieder fielen. Und als auch der Anführer blieb, so wollten die übrigen die Flucht ergreifen, aber der Jüngling trat heraus, sprach ihnen Mut zu und rief 'wir wollen unser Vaterland nicht zugrunde gehen lassen.' Da folgten ihm die andern, und er drang ein und schlug den Feind. Der König, als er hörte, daß er ihm allein den Sieg zu danken habe, erhob ihn über alle andern, gab ihm große Schätze und machte ihn zum Ersten in seinem Reich.
Der König hatte eine Tochter, die war sehr schön, aber sie war auch sehr wunderlich. Sie hatte das Gelübde getan, keinen zum Herrn und Gemahl zu nehmen, der nicht verspräche, wenn sie zuerst stürbe, sich lebendig mit ihr begraben zu lassen. 'Hat er mich von Herzen lieb,' sagte sie, 'wozu dient ihm dann noch das Leben?' Dagegen wollte sie ein Gleiches tun, und wenn er zuerst stürbe, mit ihm in das Grab steigen. Dieses seltsame Gelübde hatte bis jetzt alle Freier abgeschreckt, aber der Jüngling wurde von ihrer Schönheit so eingenommen, daß er auf nichts achtete, sondern bei ihrem Vater um sie anhielt. 'Weißt du auch,' sprach der König, 'was du versprechen mußt?' 'Ich muß mit ihr in das Grab gehen,' antwortete er, 'wenn ich sie überlebe, aber meine Liebe ist so groß, daß ich der Gefahr nicht achte.' Da willigte der König ein, und die Hochzeit ward mit großer Pracht gefeiert.
Nun lebten sie eine Zeitlang glücklich und vergnügt miteinander, da geschah es, daß die junge Königin in eine schwere Krankheit fiel, und kein Arzt konnte ihr helfen. Und als sie tot dalag, da erinnerte sich der junge König, was er hatte versprechen müssen, und es grauste ihm davor, sich lebendig in das Grab zu legen, aber es war kein Ausweg: der König hatte alle Tore mit Wachen besetzen lassen, und es war nicht möglich, dem Schicksal zu entgehen. Als der Tag kam, wo die Leiche in das königliche Gewölbe beigesetzt wurde, da ward er mit hinabgeführt, und dann das Tor verriegelt und verschlossen.
Neben dem Sarg stand ein Tisch, darauf vier Lichter, vier Laibe Brot und vier Flaschen Wein. Sobald dieser Vorrat zu Ende ging, mußte er verschmachten. Nun saß er da voll Schmerz und Trauer, aß jeden Tag nur ein Bißlein Brot, trank nur einen Schluck Wein, und sah doch, wie der Tod immer näher rückte. Indem er so vor sich hin starrte, sah er aus der Ecke des Gewölbes eine Schlange hervor kriechen, die sich der Leiche näherte. Und weil er dachte, sie käme, um daran zu nagen, zog er sein Schwert und sprach 'solange ich lebe, sollst du sie nicht anrühren,' und hieb sie in drei Stücke.
Über ein Weilchen kroch eine zweite Schlange aus der Ecke hervor, als sie aber die andere tot und zerstückelt liegen sah, ging sie zurück, kam bald wieder und hatte drei grüne Blätter im Munde. Dann nahm sie die drei Stücke von der Schlange, legte sie, wie sie zusammengehörten, und tat auf jede Wunde eins von den Blättern. Alsbald fügte sich das Getrennte aneinander, die Schlange regte sich und ward wieder lebendig, und beide eilten miteinander fort. Die Blätter blieben auf der Erde liegen, und dem Unglücklichen, der alles mit angesehen hatte, kam es in die Gedanken, ob nicht die wunderbare Kraft der Blätter, welche die Schlange wieder lebendig gemacht hatte, auch einem Menschen helfen könnte.
Er hob also die Blätter auf und legte eins davon auf den Mund der Toten, die beiden andern auf ihre Augen. Und kaum war es geschehen, so bewegte sich das Blut in den Adern, stieg in das bleiche Angesicht und rötete es wieder. Da zog sie Atem, schlug die Augen auf und sprach 'ach, Gott, wo bin ich?' 'Du bist bei mir, liebe Frau,' antwortete er, und erzählte ihr, wie alles gekommen war und er sie wieder ins Leben erweckt hatte. Dann reichte er ihr etwas Wein und Brot, und als sie wieder zu Kräften gekommen war, erhob sie sich, und sie gingen zu der Türe, und klopften und riefen so laut, daß es die Wachen hörten und dem König meldeten.
Der König kam selbst herab und öffnete die Türe, da fand er beide frisch und gesund und freute sich mit ihnen, daß nun alle Not überstanden war. Die drei Schlangenblätter aber nahm der junge König mit, gab sie einem Diener und sprach 'verwahr sie mir sorgfältig, und trag sie zu jeder Zeit bei dir, wer weiß, in welcher Not sie uns noch helfen können.'
Es war aber in der Frau, nachdem sie wieder ins Leben war erweckt worden, eine Veränderung vorgegangen: es war, als ob alle Liebe zu ihrem Manne aus ihrem Herzen gewichen wäre. Als er nach einiger Zeit eine Fahrt zu seinem alten Vater über das Meer machen wollte, und sie auf ein Schiff gestiegen waren, so vergaß sie die große Liebe und Treue, die er ihr bewiesen, und womit er sie vom Tode gerettet hatte, und faßte eine böse Neigung zu dem Schiffer.
Und als der junge König einmal dalag und schlief, rief sie den Schiffer herbei, und faßte den Schlafenden am Kopfe, und der Schiffer mußte ihn an den Füßen fassen, und so warfen sie ihn hinab ins Meer. Als die Schandtat vollbracht war, sprach sie zu ihm 'nun laß uns heimkehren und sagen, er sei unterwegs gestorben. Ich will dich schon bei meinem Vater so herausstreichen und rühmen, daß er mich mit dir vermählt und dich zum Erben seiner Krone einsetzt.'
Aber der treue Diener, der alles mit angesehen hatte, machte unbemerkt ein kleines Schifflein von dem großen los, setzte sich hinein, schiffte seinem Herrn nach, und ließ die Verräter fortfahren. Er fischte den Toten wieder auf, und mit Hilfe der drei Schlangenblätter, die er bei sich trug und auf die Augen und den Mund legte, brachte er ihn glücklich wieder ins Leben.
Sie ruderten beide aus allen Kräften Tag und Nacht, und ihr kleines Schiff flog so schnell dahin, daß sie früher als das andere bei dem alten König anlangten. Er verwunderte sich, als er sie allein kommen sah, und fragte, was ihnen begegnet wäre. Als er die Bosheit seiner Tochter vernahm, sprach er 'ich kanns nicht glauben, daß sie so schlecht gehandelt hat, aber die Wahrheit wird bald an den Tag kommen,' und hieß beide in eine verborgene Kammer gehen und sich vor jedermann heimlich halten.
Bald hernach kam das große Schiff herangefahren, und die gottlose Frau erschien vor ihrem Vater mit einer betrübten Miene. Er sprach 'warum kehrst du allein zurück? wo ist dein Mann?' 'Ach, lieber Vater,' antwortete sie, 'ich komme in großer Trauer wieder heim, mein Mann ist während der Fahrt plötzlich erkrankt und gestorben, und wenn der gute Schiffer mir nicht Beistand geleistet hätte, so wäre es mir schlimm ergangen; er ist bei seinem Tode zugegen gewesen und kann Euch alles erzählen.'
Der König sprach 'ich will den Toten wieder lebendig machen,' und öffnete die Kammer, und hieß die beiden herausgehen. Die Frau, als sie ihren Mann erblickte, war wie vom Donner gerührt, sank auf die Knie und bat um Gnade. Der König sprach 'da ist keine Gnade, er war bereit, mit dir zu sterben, und hat dir dein Leben wiedergegeben, du aber hast ihn im Schlaf umgebracht, und sollst deinen verdienten Lohn empfangen.'
Da ward sie mit ihrem Helfershelfer in ein durchlöchertes Schiff gesetzt und hinaus ins Meer getrieben, wo sie bald in den Wellen versanken.
DER EISENOFEN
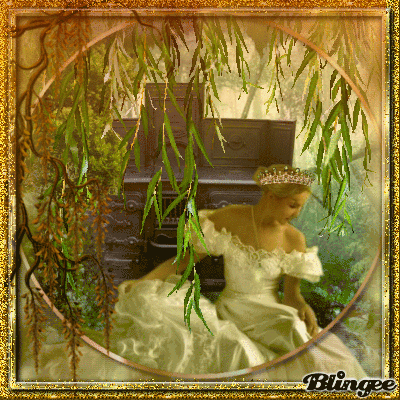
Zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, ward ein Königssohn von einer alten Hexe verwünscht, daß er im Walde in einem großen Eisenofen sitzen sollte. Da brachte er viele Jahre zu, und konnte ihn niemand erlösen. Einmal kam eine Königstochter in den Wald, die hatte sich irre gegangen und konnte ihres Vaters Reich nicht wiederfinden, neun Tage war sie so herumgegangen und stand zuletzt vor dem eisernen Kasten. Da kam eine Stimme heraus und fragte sie: "Wo kommst du her' und wo willst du hin?" Sie antwortete: "Ich habe meines Vaters Königreich verloren und kann nicht wieder nach Haus kommen."
Da sprachs aus dem Eisenofen: "Ich will dir wieder nach Hause verhelfen, und zwar in einer kurzen Zeit' wenn du willst unterschreiben zu tun' was ich verlange. Ich bin ein größerer Königssohn als du eine Königstochter, und will dich heiraten.' Da erschrak sie und dachte 'lieber Gott, was soll ich mit dem Eisenofen anfangen!' Weil sie aber gerne wieder zu ihrem Vater heim wollte, unterschrieb sie sich doch zu tun, was er verlangte. Er sprach aber 'du sollst wiederkommen, ein Messer mitbringen und ein Loch in das Eisen schrappen.' Dann gab er ihr jemand zum Gefährten, der ging nebenher und sprach nicht, er brachte sie aber; in zwei Stunden nach Haus.
Nun war große Freude im Schloß, als die Königstochter wiederkam, und der alte König fiel ihr um den Hals und küßte sie. Sie war aber sehr betrübt und sprach 'lieber Vater, wie mirs gegangen hat! ich wäre nicht wieder nach Haus gekommen aus dem großen wilden Walde, wenn ich nicht wäre bei einen eisernen Ofen gekommen, dem habe ich mich müssen dafür unterschreiben, daß ich wollte wieder zu ihm zurückkehren, ihn erlösen und heiraten.' Da erschrak der alte König so sehr, daß er beinahe in eine Ohnmacht gefallen wäre, denn er hatte nur die einzige Tochter. Beratschlagten sich also, sie wollten die Müllerstochter, die schön wäre, an ihre Stelle nehmen; führten die hinaus, gaben ihr ein Messer und sagten, sie sollte an dem Eisenofen schaben.
Sie schrappte auch vierundzwanzig Stunden lang, konnte aber nicht das geringste herabbringen. Wie nun der Tag anbrach, riefs in dem Eisenofen 'mich deucht, es ist Tag draußen.' Da antwortete sie 'das deucht mich auch, ich meine, ich höre meines Vaters Mühle rappeln.' 'So bist du eine Müllerstochter, dann geh gleich hinaus und laß die Königstochter herkommen.' Da ging sie hin und sagte dem alten König, der draußen wollte sie nicht, er wollte seine Tochter.
Da erschrak der alte König und die Tochter weinte. Sie hatten aber noch eine Schweinehirtentochter, die war noch schöner als die Müllerstochter, der wollten sie ein Stück Geld geben, damit sie für die Königstochter zum eisernen Ofen ginge. Also ward sie hinausgebracht und mußte auch vierundzwanzig Stunden lang schrappen; sie brachte aber nichts davon. Wie nun der Tag anbrach, riefs im Ofen 'mich deucht, es ist Tag draußen.' Da antwortete sie 'das deucht mich auch, ich meine, ich höre meines Vaters Hörnchen tüten.' 'So bist du eine Schweinehirtentochter, geh gleich fort und laß die Königstochter kommen, und sag ihr, es sollt ihr widerfahren, was ich ihr versprochen hätte, und wenn sie nicht käme, sollte im ganzen Reich alles zerfallen und einstürzen und kein Stein auf dem andern bleiben.'
Als die Königstochter das hörte, fing sie an zu weinen, es war aber nun nicht anders, sie mußte ihr Versprechen halten. Da nahm sie Abschied von ihrem Vater, steckte ein Messer ein und ging zu dem Eisenofen in den Wald hinaus. Wie sie nun angekommen war, hub sie an zu schrappen, und das Eisen gab nach, und wie zwei Stunden vorbei waren, hatte sie schon ein kleines Loch geschabt. Da guckte sie hinein und sah einen so schönen Jüngling, ach, der glimmerte in Gold und Edelsteinen, daß er ihr recht in der Seele gefiel. Nun, da schrappte sie noch weiter fort und machte das Loch so groß, daß er heraus konnte. Da sprach er 'du bist mein und ich bin dein, du bist meine Braut und hast mich erlöst.'
Er wollte sie mit sich in sein Reich führen, aber sie bat sich aus, daß sie noch einmal dürfte zu ihrem Vater gehen, und der Königssohn erlaubte es ihr, doch sollte sie nicht mehr mit ihrem Vater sprechen als drei Worte, und dann sollte sie wiederkommen. Also ging sie heim, sie sprach aber mehr als drei Worte, da verschwand alsbald der Eisenofen und ward weit weg gerückt über gläserne Berge und schneidende Schwerter; doch der Königssohn war erlöst, und nicht mehr darin eingeschlossen.
Danach nahm sie Abschied von ihrem Vater und nahm etwas Geld mit, aber nicht viel, ging wieder in den großen Wald und suchte den Eisenofen, allein der war nicht zu finden. Neun Tage suchte sie, da ward ihr Hunger so groß, daß sie sich nicht zu helfen wußte, denn sie hatte nichts mehr zu leben. Und als es Abend ward, setzte sie sich auf einen kleinen Baum und gedachte darauf die Nacht hinzubringen, weil sie sich vor den wilden Tieren fürchtete.
Als nun Mitternacht herankam, sah sie von fern ein kleines Lichtchen und dachte 'ach, da wär ich wohl erlöst,' stieg vom Baum und ging dem Lichtchen nach, auf dem Weg aber betete sie. Da kam sie zu einem kleinen alten Häuschen, und war viel Gras darum gewachsen, und stand ein kleines Häufchen Holz davor. Dachte sie 'ach, wo kommst du hier hin!, guckte durchs Fenster hinein, so sah sie nichts darin als dicke und kleine Itschen (Kröten), aber einen Tisch, schön gedeckt mit Wein und Braten, und Teller und Becher waren von Silber. Da nahm sie sich das Herz und klopfte an. Alsbald rief die Dicke
'Jungfer grün und klein,
Hutzelbein,
Hutzelbeins Hündchen,
hutzel hin und her,
laß geschwind sehen' wer draußen wär.'
Da kam eine kleine Itsche herbeigegangen und machte ihr auf. Wie sie eintrat, hießen alle sie willkommen, und sie mußte sich setzen. Sie fragten 'wo kommt Ihr her? wo wollt Ihr hin?' Da erzählte sie alles, wie es ihr gegangen wäre, und weil sie das Gebot übertreten hätte, nicht mehr als drei Worte zu sprechen, wäre der Ofen weg samt dem Königssohn, nun wollte sie so lange suchen und über Berg und Tal wandern, bis sie ihn fände. Da sprach die alte Dicke
'Jungfer grün und klein,
Hutzelbein,
Hutzelbeins Hündchen,
hutzel hin und her,
bring mir die große Schachtel her.'
Da ging die kleine hin und brachte die Schachtel herbei getragen. Hernach gaben sie ihr Essen und Trinken, und brachten sie zu einem schönen gemachten Bett, das war wie Seide und Sammet, da legte sie sich hinein und schlief in Gottes Namen. Als der Tag kam, stieg sie auf, und gab ihr die alte Itsche drei Nadeln aus der großen Schachtel, die sollte sie mitnehmen; sie würden ihr nötig tun, denn sie müßte über einen hohen gläsernen Berg und über drei schneidende Schwerter und über ein großes Wasser, wenn sie das durchsetzte, würde sie ihren Liebsten wiederkriegen. Nun gab sie hiermit drei Teile, die sollte sie recht in acht nehmen, nämlich drei große Nadeln, ein Pflugrad und drei Nüsse.
Hiermit reiste sie ab, und wie sie vor den gläsernen Berg kam, der so glatt war, steckte sie die drei Nadeln als hinter die Füße und dann wieder vorwärts, und gelangte so hinüber, und als sie hinüber war, steckte sie sie an einen Ort, den sie wohl in acht nahm. Danach kam sie vor die drei schneidenden Schwerter, da stellte sie sich auf ihr Pflugrad und rollte hinüber. Endlich kam sie vor ein großes Wasser, und wie sie übergefahren war, in ein großes schönes Schloß.
Sie ging hinein und hielt um einen Dienst an, sie wär eine arme Magd und wollte sich gerne vermieten; sie wußte aber, daß der Königssohn drinne war, den sie erlöst hatte aus dem eisernen Ofen im großen Wald. Also ward sie angenommen zum Küchenmädchen für geringen Lohn. Nun hatte der Königssohn schon wieder eine andere an der Seite, die wollte er heiraten, denn er dachte, sie wäre längst gestorben. Abends, wie sie aufgewaschen hatte und fertig war, fühlte sie in die Tasche und fand die drei Nüsse, welche ihr die alte Itsche gegeben hatte. Biß eine auf und wollte den Kern essen, siehe, da war ein stolzes königliches Kleid drin.
Wies nun die Braut hörte, kam sie und hielt um das Kleid an und wollte es kaufen und sagte, es wäre kein Kleid für eine Dienstmagd. Da sprach sie nein, sie wollts nicht verkaufen, doch wann sie ihr einerlei wollte erlauben, so sollte sies haben, nämlich eine Nacht in der Kammer ihres Bräutigams zu schlafen. Die Braue erlaubt es ihr, weil das Kleid so schön war und sie noch keins so hatte. Wies nun Abend war, sagte sie zu ihrem Bräutigam 'das närrische Mädchen will in deiner Kammer schlafen.' 'Wenn dus zufrieden bist, bin ichs auch,' sprach er.
Sie gab aber dem Mann ein Glas Wein, in das sie einen Schlaftrunk getan hatte. Also gingen beide in die Kammer schlafen' und er schlief so fest, daß sie ihn nicht erwecken konnte. Sie weinte die ganze Nacht und rief 'ich habe dich erlöst aus dem wilden Wald und aus einem eisernen Ofen, ich habe dich gesucht und bin gegangen über einen gläsernen Berg, über drei schneidende Schwerter und über ein großes Wasser, ehe ich dich gefunden habe, und willst mich doch nicht hören.' Die Bedienten saßen vor der Stubentüre und hörten, wie sie so die ganze Nacht weinte, und sagtens am Morgen ihrem Herrn.
Und wie sie im andern Abend aufgewaschen hatte, biß sie die zweite Nuß auf, da war noch ein weit schöneres Kleid drin; wie das die Braut sah, wollte sie es kaufen. Aber Geld wollte das Mädchen nicht und bat sich aus, daß es noch einmal in der Kammer des Bräutigams schlafen dürfte. Die Braut gab ihm aber einen Schlaftrunk, und er schlief so fest, daß er nichts hören konnte. Das Küchenmädchen weinte aber die ganze Nacht und rief 'ich habe dich erlöst aus einem Walde und aus einem eisernen Ofen, ich habe dich gesucht und bin gegangen über einen gläsernen Berg, über drei schneidende Schwerter und über ein großes Wasser, ehe ich dich gefunden habe, und du willst mich doch nicht hören.' Die Bedienten saßen vor der Stubentüre und hörten, wie sie so die ganze Nacht weinte, und sagtens am Morgen ihrem Herrn.
Und als sie am dritten Abend aufgewaschen hatte, biß sie die dritte Nuß auf, da war ein noch schöneres Kleid drin, das starrte von purem Gold. Wie die Braut das sah, wollte sie es haben, das Mädchen aber gab es nur hin, wenn es zum drittenmal dürfte in der Kammer des Bräutigams schlafen. Der Königssohn aber hütete sich und ließ den Schlaftrunk vorbeilaufen. Wie sie nun anfing zu weinen und zu rufen 'liebster Schatz, ich habe dich erlöst aus dem grausamen wilden Walde und aus einem eisernen Ofen,' so sprang der Königssohn auf und sprach 'du bist die rechte, du bist mein, und ich bin dein.'
Darauf setzte er sich noch in der Nacht mit ihr in einen Wagen, und der falschen Braut nahmen sie die Kleider weg, daß sie nicht aufstehen konnte. Als sie zu dem großen Wasser kamen, da schifften sie hinüber, und vor den drei schneidenden Schwertern, da setzten sie sich aufs Pflugrad, und vor dem gläsernen Berg, da steckten sie die drei Nadeln hinein. So gelangten sie endlich zu dem alten kleinen Häuschen, aber wie sie hineintraten, wars ein großes Schloß, die Itschen waren alle erlöst und lauter Königskinder und waren in voller Freude.
Da ward Vermählung gehalten, und sie blieben in dem Schloß, das war viel größer als ihres Vaters Schloß. Weil aber der Alte jammerte, daß er allein bleiben sollte, so fuhren sie weg und holten ihn zu sich, und hatten zwei Königreiche und lebten in gutem Ehestand.
Da kam eine Maus, Das Märchen war aus.
DER GETREUE PAUL
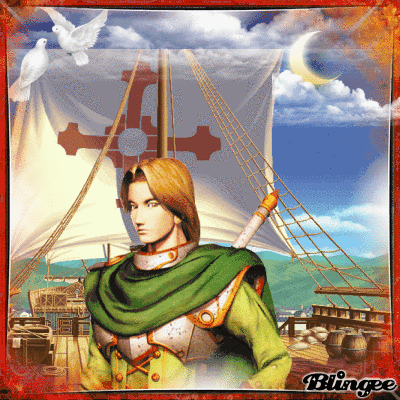
Der König von Spanien ging eines Tages auf die Jagd, aber es war kein Wild zu sehen weit und breit. Da hörte er im Walde etwas jammern und als er hinzu kam, war es ein armes Knäbchen das weinte. Er nahm das Kind in seinen Mantel, trug es mit sich in sein Schloss und ließ es mit seinem eigenen Sohne erziehen. Der hieß Ferdinand, das Knäbchen bekam den Namen Paul.
Als die Beiden achtzehn Jahre alt waren und recht stattliche Jünglinge, da wollten sie sich die Welt beschauen und gingen zu Schiffe. Sie waren aber noch nicht weit gekommen, da wurde ihr Schiff von Seeräubern umzingelt und Beide gefangen genommen. Das war wohl sehr hart, aber noch härter, als sie jetzt als Sklaven verkauft wurden und in des Sultans Gärten die niedrigsten Arbeiten verrichten mussten.
Der Sultan hatte eine Tochter, die war sehr schön. Diese ging jeden Tag in dem Garten spazieren, wo die beiden Jünglinge arbeiteten, denn der lag unter ihren Fenstern. Als sie das stolze Wesen der Beiden sah und besonders Ferdinands, da dachte sie, dieselben müssten nicht von geringer Herkunft sein und fragte sie eines Tages, aus welchem Lande sie stammten? Da erzählte Ferdinand ihr Alles und das rührte sie so sehr, dass sie den Jünglingen gut wurde und ihnen manches zukommen ließ. Jetzt mussten sie ihr jeden Tag erzählen und je mehr sie erzählten um so lieber wurden sie ihr und besonders Ferdinand, bis sie endlich erkannte, dass er ihr lieber als Vater und Mutter, ja als alles in der Welt sei.
Auch Ferdinand liebte sie von ganzem Herzen und beriet mit Paul, wie er mit ihr fliehen könne. Da gab ihm Paul einen trefflichen Rat, welcher sogleich ausgeführt wurde. Die Prinzessin legte sich zu Bette, sprach, sie sei sehr krank. Da kamen alle Ärzte der Hauptstadt, aber keiner konnte finden, was ihr fehlte, Endlich sprach sie: "Lasst mich auf unser Lustschloss ans Meer, vielleicht wird mir da besser", und ihr Vater ließ sie sogleich dahin bringen.
Als sie dort einige Tage war, sprach sie: "Die Gärten gefallen mir nicht, denn die Gärtner verstehen nichts von den edeln Blumen, welche hier wachsen, ich will andere Gärtner." Da sandte ihr Vater ihr andere, aber die gefielen ihr alle nicht, bis er endlich die beiden Jünglinge hinschickte; da sagte sie: "Die verstehen es."
Jetzt harrten sie sehnsüchtig auf ein Schiff, welches sie in ihr Vaterland brächte, aber es wollte keins kommen und wollte keins kommen. Endlich sah Paul eines Abends in der Nähe ein Schiff vorbeifahren, worauf die Fahne von Spanien wehte. Schnell rief er Ferdinand zu, dieser der Prinzessin, alle drei setzten sich in einen Nachen und ruderten auf das Schiff zu. Als sie nahe bei demselben waren, rief Paul dem Schiffsherrn zu: "He Landsmann, hier ist der Prinz Ferdinand, rette ihn aus der Gefangenschaft und du sollst großen Lohn haben."
Als der Schiffsherr hörte, dass der Prinz in dem Kahne sei, hielt er sogleich an, nahm alle drei in sein Schiff auf und erwies dem Prinzen große Ehren. Dann befahl er schnell alle Segel aufzuziehen und da der Wind günstig blies, so war das Schiff bald so weit, dass es nicht leicht eingeholt werden konnte. Die beiden Jünglinge verabredeten sich aber, dass jeder eine Nacht in dem Mastkorbe sitzen und Wache halten sollte, damit der Sultan sie nicht überrasche.
Als Paul eines Abends im Mastkorbe saß, da kamen gegen Mitternacht zwei weiße Tauben geflogen, die setzten sich auf den Mast und die eine sprach: "Rucke di guck, wenn die drunten noch zwei Tage fahren, sind sie zu Hause; jetzt schon kann der Sultan sie nicht mehr einholen." "Rucke di guck, aber zu Lande kann er ihnen schaden" sprach die andre Taube. "Rucke di guck, wie kann er das?" "Rucke di guck, durch einen Gaul, den hat er durch seine Künste in die Hauptstadt gebracht. Wenn der Prinz ihn sieht, will er ihn haben, reitet er aber drauf, so fliegt der Gaul mit ihm in die Türkei zurück." "Rucke di guck, was ist da zu machen?" "Rucke di guck, Einer muss den Gaul tot stechen, darf aber nicht sagen warum, sonst wird er bis an die Brust zu Sandstein." "Rucke di guck, ei was du sagst!" Als sie so gesprochen hatten, hoben sie ihre Flügel wieder und flogen weiter.
Paul hatte aber Alles verstanden, denn er war im Walde geboren und hatte da den Vöglein fleißig zugehorcht, bis er ihre Sprache verstand. Jetzt dankte er Gott von Herzen für diese Gabe. Am folgenden Abend wollte Ferdinand in den Mastkorb steigen, aber Paul sprach: "Lasset mich hinein, es ist besser so." Da gab Ferdinand nach und Paul wachte auch diese Nacht.
Gegen Mitternacht kamen abermals die zwei weißen Tauben geflogen, die setzten sich auf den Mast und plauderten zusammen. Die eine sprach: "Rucke di guck, noch einen Tag, dann sind die drunten zu Hause." "Rucke di guck, der Prinz mag sich zu Hause in Acht nehmen" sprach die andre. "Rucke di guck, wie meinst du das?" "Rucke di guck, der Sultan schickt eine große Kreuzspinne aus, die kriecht an der Decke über den Hochzeitstisch und lässt ihr Gift in Ferdinands Becher fallen, wenn er daraus trinkt, stirbt er auf der Stelle." "Rucke di guck, was ist da zu machen?" "Rucke di guck, wer's weiß wirft den Becher um, dann verplatzt die Kreuzspinne, sagt er aber warum er's getan, dann wird er zu einem Salzstein." "Rucke di guck, ei was du sagst!" Da hoben die Täubchen die Flügel wieder und flogen weg.
Am folgenden Tage landete das Schiff und da war eine große Freude in der Hauptstadt. Sobald es bekannt wurde, der Prinz sei wieder da, zog alles Volk hinaus und begrüßte ihn mit großer Freude. Als er nun seinen festlichen Einzug hielt, da musste die Sultanstochter zu seiner rechten Seite reiten und Paul zu seiner linken, denn er sprach: "Diesen Beiden verdanke ich meine Freiheit und mein Leben und ich will sie hoch ehren bis zu meinem Tode."
Die alte Königin, seine Mutter, fuhr in ihrem Wagen hintendrein. Als sie über den Markt kamen, hielt da ein Mann mit einem wunderschönen Pferde, welches dem Prinzen so sehr gefiel, dass er es sogleich kaufte und sich drauf schwingen wollte. Doch da sprang Paul hinzu, zog sein Schwert und durchstach den Gaul, dass er sogleich tot hinstürzte. Ferdinand schaute ihn erstaunt an und sprach: "Was machst du und warum verdirbst du mir meine Freude?" "Das ist der pure Neid, mein Sohn", sprach die alte Königin, welche den Paul nie hatte leiden können, und Paul konnte nichts sagen als: "Das musste so sein, fraget mich nicht weiter."
Da ging der Zug weiter zum Schlosse und am folgenden Tage war schon die Hochzeit. Als nun alle fröhlich an der Tafel saßen, da aß Paul nichts und trank nichts und schaute nur stets nach der Decke. "Siehst du wie er sich ärgert, mein Sohn? Das ist der pure Neid", sprach die alte Königin. Da sah Paul wie die Kreuzspinne aus einer Ecke des Zimmers heran kroch und sich mit ihrem schwarzen giftigen Leibe gerade über des Prinzen Becher hing, auch wie sie das Gift fallen ließ, einen Tropfen und noch einen und noch einen.
Da griff der Prinz zu dem Becher, aber Paul warf den Becher im selben Augenblicke um, so dass der Wein über die Tafel floss. "Da siehst du es deutlich, mein Sohn, dass er vor Neid nicht weiß was er tut", sprach die alte Königin. "Ich an deiner Stelle würde ihn sogleich ins Gefängnis werfen." Nach der Tafel rief der Prinz Paul zu sich, ging mit ihm in den Garten und sprach: "Nun sage mir doch Paul, warum hast du denn das schöne Pferd erstochen und meinen Becher umgeworfen?" "Das darf ich nicht sagen, darum zwingt mich nicht dazu, es wäre mein Unglück und euch brächte es doch kein Glück", sprach Paul, doch der Prinz drang in ihn, er müsse es sagen, damit die alte Königin nicht ferner so schlecht von ihm denke.
Da konnte Paul zuletzt nicht mehr widerstehen und sagte ihm, warum er das Pferd erstochen habe und sogleich wurde er bis an die Brust zu Salzstein. "Bin ich soweit zu Stein geworden, dann will ich es auch ganz werden" sprach er und erzählte auch, warum er den Becher umgeworfen habe und zugleich stand er regungslos da. Da war Ferdinand sehr betrübt und jammerte laut, dass er eine so große Treue so schlecht belohnt habe. Er ließ den Salzstein in das Schloss tragen, ging jeden Tag zu ihm und betrachtete ihn mit betrübten Blicken.
Nach Jahresfrist schenkte seine Frau ihm ein Kind. Da träumte ihm in einer Nacht, der Stein tue den Mund auf und sage: "Du kannst mich erlösen, wenn du dein Kind schlachtest und mich mit seinem Blut bestreichst." Das war doch gar zu hart für ein Vaterherz, welches eben erst seines Kindes froh zu werden denkt; darum überredete er sich leicht, der Traum sei eben nur ein Traum, wie alle andern.
In der zweiten Nacht träumte ihm aber dasselbe und da fing er an, sehr traurig darüber zu werden. In der dritten Nacht wiederholte sich der Traum noch einmal und der Salzstein sprach noch dazu: "Wenn du mich heut nicht erlösest, dann bin ich für ewig zum Stein verwünscht." Da dachte der Prinz, er dürfe nun nicht zögern und müsse Treue mit Treue lohnen.
Er stand mit Tagesanbruch auf, nahm das Kind aus der Wiege, seinen Hirschfänger von der Wand und ging in die Stube, wo der Salzstein stand. Da küsste er das arme Kind noch einmal und hob das Mordmesser, um es zu schlachten, doch da war der Stein plötzlich lebendig und Paul hielt ihm den Arm, ehe noch dem Kinde ein Leides geschah. Jetzt war die Freude erst groß!
Im ganzen Schloss kehrte ein anderes Leben ein, denn alle Leute hatten den getreuen Paul nun doppelt so lieb. Der Prinz aber schenkte ihm eine Grafschaft in der Nähe von der Hauptstadt und es verging kein Tag, wo die Beiden sich nicht gesehen hätten.
DOKTOR ALLWISSEND

Es war einmal ein armer Bauer namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt und verkaufte es für zwei Taler an einen Doktor. Als ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doktor gerade zu Tisch; da sah der Bauer, wie er schön aß und trank, und das Herz ging ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doktor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte endlich, ob er nicht auch ein Doktor werden könnte. "Oh ja", sagte der Doktor, "das ist bald geschehen." – "Was muss ich tun?" fragte der Bauer. "Zuerst kauf dir ein ABC-Buch, so eins, wo vorn ein Gockelhahn drin ist; zweitens mache deinen Wagen und deine zwei Ochsen zu Geld und schaff dir damit Kleider an und was sonst zur Doktorei gehört; drittens lass dir ein Schild malen mit den Worten: ,Ich bin der Doktor Allwissend' und lass das oben über deine Haustür nageln!" Der Bauer tat alles, wie es ihm geheißen war. Als er nun ein wenig rumgedoktert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen, großen Herrn Geld gestohlen. Da ward ihm vom Doktor Allwissend berichtet, der in einem Dorfe wohne und wissen müsste, wo das Geld hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf und fragte bei ihm an, ob er der Doktor Allwissend sei. Ja, der sei er. So solle er mitgehen und das gestohlene Geld wieder beschaffen. O ja, aber die Grete, seine Frau müsse auch mit. Der Herr war damit einverstanden und ließ sie beide in den Wagen sitzen, und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf den adligen Hof ankamen, war der Tisch gedeckt; und sie sollten erst mitessen.
Ja, aber seine Frau, die Grete, auch, sagte er und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Als nun der erste Diener mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte: "Grete, das war der Erste", und meinte, es sei derjenige, welcher das erste Essen bringe. Der Diener aber meinte, er habe damit sagen wollen: "Das ist der erste Dieb." Und weil er es nun wirklich war, ward ihm angst, und er sagte draußen zu seinen Kameraden: "Der Doktor weiß alles, es wird uns übel ergehen; er hat gesagt, ich sei der Erste." Der zweite wollte gar nicht herein, er musste aber doch. Als er nun mit seiner Schüssel herein kam, stieß der Bauer seine Frau an: "Grete, das ist der Zweite." Dem Bedienten ward ebenfalls angst, und er machte, dass er hinauskam. Dem dritten ging's nicht besser; der Bauer sagte wieder: "Grete, das ist der Dritte." Der vierte musste eine verdeckte Schüssel herein tragen, und der Herr sprach zum Doktor, er solle seine Kunst zeigen und raten, was darunter liege; es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wusste nicht, wie er sich helfen sollte, und sprach: "Ach, ich armer Krebs!" Als der Herr das hörte, rief er: "Da, er weiß es, nun weiß er auch, wer das Geld hat."
Dem Diener aber ward gewaltig angst, und er blinzelte den Doktor an, er möge einmal herauskommen. Als er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle Viere, sie hätten das Geld gestohlen; sie wollten es ja gerne herausgeben und ihm eine große Summe dazu geben, wenn er sie nicht verraten würde; es ginge ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doktor einverstanden, ging wieder hinein, setzte sich an den Tisch und sprach: "Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo das Geld steckt." Der fünfte Bediente aber kroch in den Ofen und wollte hören, ob der Doktor noch mehr wüsste. Der saß aber und schlug sein ABC-Buch auf, blätterte hin und her und suchte den Gockelhahn. Weil er ihn nicht gleich finden konnte, sprach er: "Du bist doch darin und musst auch heraus." Da glaubte der im Ofen, er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus und rief: "Der Mann weiß alles." Nun zeigte der Doktor Allwissend dem Herrn, wo das Geld lag, sagte aber nicht, wer es gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung und ward ein berühmter Mann.
HANS DUMM

Es war ein König, der lebte mit seiner Tochter, die sein einziges Kind war, vergnügt. Auf einmal aber brachte die Prinzessin ein Kind zur Welt, und niemand wusste, wer der Vater war; der König wusste lang nicht, was er anfangen sollte, am Ende befahl er, die Prinzessin solle mit dem Kind in die Kirche gehen, da sollte ihm eine Zitrone in die Hand gegeben werden, und wem es die reiche, solle der Vater des Kinds und Gemahl der Prinzessin sein. Das geschah nun, doch war der Befehl gegeben, dass niemand als schöne Leute in die Kirche sollten eingelassen werden. Es war aber in der Stadt ein kleiner, schiefer und buckelichter Bursch, der nicht recht klug war und darum der Hans Dumm hiess, der drängte sich ungesehen zwischen den ändern auch in die Kirche, und wie das Kind die Zitrone austeilen sollte, so reichte es sie dem Hans Dumm. Die Prinzessin war erschrocken, der König war so aufgebracht, dass er sie und das Kind mit dem Hans Dumm in eine Tonne stecken und aufs Meer setzen liess.
Die Tonne schwamm bald fort, und wie sie allein auf dem Meere waren, klagte die Prinzessin und sagte: "Du garstiger, buckelichter, naseweiser Bub bist an meinem Unglück schuld, was hast du dich in die Kirche gedrängt, das Kind ging dich nichts an." - "O ja," sagte Hans Dumm, "das ging mich wohl etwas an, denn ich habe es einmal gewünscht, dass du ein Kind bekämst, und was ich wünsche, das trifft ein." - "Wenn das wahr ist, so wünsch uns doch was zu essen hierher." - "Das kann ich auch," sagte Hans Dumm, wünschte sich aber eine Schüssel recht voll Kartoffel, die Prinzessin hätte gern etwas Besseres gehabt, aber weil sie so hungrig war, half sie ihm die Kartoffel essen. Nachdem sie satt waren, sagte Hans Dumm: "Nun will ich uns ein schönes Schiff wünschen!," und kaum hatte er das gesagt, so sassen sie in einem prächtigen Schiff, darin war alles zum Überfluss, was man nur verlangen konnte. Der Steuermann fuhr grad ans Land, und als sie ausstiegen, sagte Hans Dumm: "Nun soll ein Schloss dort stehen!" Da stand ein prächtiges Schloss, und Diener in Goldkleidern kamen und führten die Prinzessin und das Kind hinein, und als sie mitten in dem Saal waren, sagte Hans Dumm: "Nun wünsch ich, dass ich ein junger und kluger Prinz werde!" Da verlor sich sein Buckel, und er war schön und gerad und freundlich, und er gefiel der Prinzessin gut und ward ihr Gemahl.
So lebten sie lange Zeit vergnügt; da ritt einmal der alte König aus, verirrte sich und kam zu dem Schloss. Er verwunderte sich darüber, weil er es noch nie gesehen, und kehrte ein. Die Prinzessin erkannte gleich ihren Vater, er aber erkannte sie nicht, er dachte auch, sie sei schon längst im Meer ertrunken. Sie bewirtete ihn prächtig, und als er wieder nach Haus wollte, steckte sie ihm heimlich einen goldenen Becher in die Tasche. Nachdem er aber fortgeritten war, schickte sie ein paar Reiter nach, die mussten ihn anhalten und untersuchen, ob er den goldenen Becher nicht gestohlen, und wie sie ihn in seiner Tasche fanden, brachten sie ihn mit zurück. Er schwur der Prinzessin, er habe ihn nicht gestohlen und wisse nicht, wie er in seine Tasche gekommen sei, "darum," sagte sie, "muss man sich hüten, jemand gleich für schuldig zu halten," und gab sich als seine Tochter zu erkennen. Da freute sich der König, und sie lebten vergnügt zusammen, und nach seinem Tod ward Hans Dumm König.
KÖNIG BLAUBART

(Zeichnung Edmund Evans 1889)
In einem Walde lebte ein Mann, der hatte drei Söhne und eine schöne Tochter. Einmal kam ein goldener Wagen mit sechs Pferden und einer Menge Bedienten angefahren, hielt vor dem Haus still, und ein König stieg aus und bat den Mann, er möchte ihm seine Tochter zur Gemahlin geben. Der Mann war froh, dass seiner Tochter ein solches Glück widerfuhr, und sagte gleich ja; es war auch an dem Freier gar nichts auszusetzen, als dass er einen ganz blauen Bart hatte, so dass man einen kleinen Schrecken kriegte, sooft man ihn ansah. Das Mädchen erschrak auch anfangs davor und scheute sich, ihn zu heiraten, aber auf Zureden ihres Vaters willigte es endlich ein. Doch weil es so eine Angst fühlte, ging es erst zu seinen drei Brüdern, nahm sie allein und sagte: "Liebe Brüder, wenn ihr mich schreien hört, wo ihr auch seid, so lasst alles stehen und liegen und kommt mir zu Hülfe." Das versprachen ihm die Brüder und küssten es. "Leb wohl, liebe Schwester, wenn wir deine Stimme hören, springen wir auf unsere Pferde und sind bald bei dir."
Darauf setzte es sich in den Wagen zu dem Blaubart und fuhr mit ihm fort. Wie es in sein Schloss kam, war alles prächtig, und was die Königin nur wünschte, das geschah, und sie wären recht glücklich gewesen, wenn sie sich nur an den blauen Bart des Königs hätte gewöhnen können, aber immer, wenn sie den sah, erschrak sie innerlich davor. Nachdem das einige Zeit gewährt, sprach er: "Ich muss eine grosse Reise machen, da hast du die Schlüssel zu dem ganzen Schloss, du kannst überall aufschliessen und alles besehen, nur die Kammer, wozu dieser kleine goldene Schlüssel gehört, verbiet ich dir; schliesst du die auf, so ist dein Leben verfallen." Sie nahm die Schlüssel, versprach ihm zu gehorchen, und als er fort war, schloss sie nacheinander die Türen auf und sah so viel Reichtümer und Herrlichkeiten, dass sie meinte, aus der ganzen Welt wären sie hier zusammengebracht. Es war nun nichts mehr übrig als die verbotene Kammer, der Schlüssel war von Gold, da gedachte sie, in dieser ist vielleicht das Allerkostbarste verschlossen; die Neugierde fing an, sie zu plagen, und sie hätte lieber all das andere nicht gesehen, wenn sie nur gewusst, was in dieser wäre.
Eine Zeitlang widerstand sie der Begierde, zuletzt aber ward diese so mächtig, dass sie den Schlüssel nahm und zu der Kammer hinging: "Wer wird es sehen, dass ich sie öffne," sagte sie zu sich selbst, "ich will auch nur einen Blick hineintun." Da schloss sie auf, und wie die Türe aufging, schwomm ihr ein Strom Blut entgegen, und an den Wänden herum sah sie tote Weiber hängen, und von einigen waren nur die Gerippe noch übrig. Sie erschrak so heftig, dass sie die Türe gleich wieder zuschlug, aber der Schlüssel sprang dabei heraus und fiel in das Blut. Geschwind hob sie ihn auf und wollte das Blut abwischen, aber es war umsonst, wenn sie es auf der einen Seite abgewischt, kam es auf der ändern wieder zum Vorschein; sie setzte sich den ganzen Tag hin und rieb daran und versuchte alles mögliche, aber es half nichts, die Blutflecken waren nicht herabzubringen; endlich am Abend legte sie ihn ins Heu, das sollte in der Nacht das Blut ausziehen.
Am ändern Tag kam der Blaubart zurück, und das erste war, dass er die Schlüssel von ihr forderte; ihr Herz schlug, sie brachte die ändern und hoffte, er werde es nicht bemerken, dass der goldene fehlte. Er aber zählte sie alle, und wie er fertig war, sagte er: "Wo ist der zu der heimlichen Kammer?" Dabei sah er ihr in das Gesicht. Sie ward blutrot und antwortete: "Er liegt oben, ich habe ihn verlegt, morgen will ich ihn suchen." - "Geh lieber gleich, liebe Frau, ich werde ihn noch heute brauchen." - "Ach ich will dir's nur sagen, ich habe ihn im Heu verloren, da muss ich erst suchen." - "Du hast ihn nicht verloren," sagte der Blaubart zornig, "du hast ihn dahin gesteckt, damit die Blutflecken herausziehen sollen, denn du hast mein Gebot übertreten und bist in der Kammer gewesen, aber jetzt sollst du hinein, wenn du auch nicht willst." Da musste sie den Schlüssel holen, der war noch voller Blutflecken. "Nun bereite dich zum Tode, du sollst noch heute sterben," sagte der Blaubart, holte sein grosses Messer und führte sie auf den Hausehrn. "Lass mich nur noch vor meinem Tod mein Gebet tun," sagte sie. "So geh, aber eil dich, denn ich habe keine Zeit lang zu warten." Da lief sie die Treppe hinauf und rief, so laut sie konnte, zum Fenster hinaus: "Brüder, meine lieben Brüder, kommt, helft mir!" Die Brüder sassen im Wald beim kühlen Wein, da sprach der jüngste: "Mir ist, als hätt ich unserer Schwester Stimme gehört; auf! wir müssen ihr zu Hülfe eilen!" Da sprangen sie auf ihre Pferde und ritten, als wären sie der Sturmwind. Ihre Schwester aber lag in Angst auf den Knieen; da rief der Blaubart unten: "Nun, bist du bald fertig?"
Dabei hörte sie, wie er auf der untersten Stufe sein Messer wetzte; sie sah hinaus, aber sie sah nichts als von Ferne einen Staub, als kam eine Herde gezogen. Da schrie sie noch einmal: "Brüder, meine lieben Brüder! kommt, helft mir!" Und ihre Angst ward immer grösser. Der Blaubart aber rief: "Wenn du nicht bald kommst, so hol ich dich, mein Messer ist gewetzt!" Da sah sie wieder hinaus und sah ihre drei Brüder durch das Feld reiten, als flögen sie wie Vögel in der Luft, da schrie sie zum drittenmal in der höchsten Not und aus allen Kräften: "Brüder, meine lieben Brüder! kommt, helft mir!" Und der jüngste war schon so nah, dass sie seine Stimme hörte: "Tröste dich, liebe Schwester, noch einen Augenblick, so sind wir bei dir!" Der Blaubart aber rief: "Nun ist's genug gebetet, ich will nicht länger warten, kommst du nicht, so hol ich dich!" - "Ach! nur noch für meine drei lieben Brüder lass mich beten." Er hörte aber nicht, kam die Treppe heraufgegangen und zog sie hinunter, und eben hatte er sie an den Haaren gefasst und wollte ihr das Messer in das Herz stossen, da schlugen die drei Brüder an die Haustüre, drangen herein und rissen sie ihm aus der Hand, dann zogen sie ihre Säbel und hieben ihn nieder. Da ward er in die Blutkammer aufgehängt zu den andern Weibern, die er getötet, die Brüder aber nahmen ihre liebste Schwester mit nach Haus, und alle Reichtümer des Blaubarts gehörten ihr.
DIE SALZPRINZESSIN
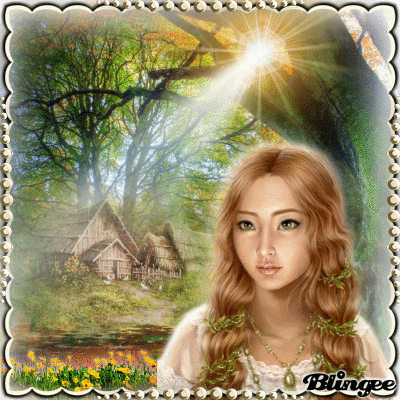
Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, Antonia, Martha und Mariechen, die er wie sein Augenlicht liebte. Er war schon alt und des Herrschens müde und so sann er oft darüber nach, welche seiner Töchter nach seinem Tode Königin werden sollte. Die Wahl wurde ihm schwer, denn er liebte alle drei gleichermaßen. Endlich, nach reiflichem und langem Erwägen entschloss er sich, diejenige zur Herrscherin zu bestimmen, die ihn am innigsten liebte. Er berief die Prinzessinnen vor seinen Thron und sprach zu ihnen:
“Meine lieben Töchter! Ich bin alt und schwach geworden und werde nicht mehr lange unter euch weilen. Doch bevor ich sterbe, will ich eine von euch zu meiner Nachfolgerin ernennen. Vorerst aber will ich prüfen, welche mich am liebsten hat. Sage du mir, Antonia, meine Älteste, wie liebst du deinen Vater?”
“Ach, lieber Vater, ich liebe dich mehr als Gold!” antwortete Antonia und küsste seine Hand.
“Und du, Martha, wie sehr liebst du mich denn?”
“Ach, mein gutes Väterchen”, rief das Mädchen und umarmte den König, “ich liebe dich wie mein Brautgeschmeide.”
“Und nun du, meine Jüngste, sage mir, wie du mich liebst?” fragte der König und wandte sich Mariechen zu.
“Ich, Vater, liebe dich … wie Salz!” antwortete sie nach kurzem Überlegen und sah den König allerliebst an.
“Oh, du böses Mädchen, du liebst deinen Vater nur wie Salz? Schäme dich!” riefen ihre beiden Schwestern empört.
“Ja, wie Salz liebe ich meinen Vater!” wiederholte Mariechen von neuem.
Da wurde auch der alte König zornig. Er konnte nicht verstehen, dass Mariechen ihre Liebe zu ihm mit einem so einfachen Dinge verglich, das jedermann, auch der Ärmste besaß und nur für wenige Groschen erwerben konnte.
“Geh, mir aus den Augen, du undankbares Mädchen!” rief er. “Ich will dich erst dann wiedersehen, wenn den Menschen Salz wertvoller als Gold und Edelsteine erscheinen wird. Dann kehre zurück, denn dann will ich dich zur Königin machen!”
Dass jemals eine solche Zeit kommen könnte, daran glaubten weder der alte König noch seine beiden älteren Töchter.
Ohne zu widersprechen, mit tränenüberströmtem Antlitz, verließ das stets gehorsame Mariechen das Schloss ihres Vaters. Einsam und verlassen stand sie auf der Straße und wusste nicht, wohin sie ihre Schritte wenden sollte. Schließlich beschloss sie, der Richtung des Windes zu folgen. Sie wanderte über Berge und Täler, bis sie zu einem dichten Wäldchen kam. Da trat ihr eine alte Frau in den Weg. Mariechen grüßte freundlich und wünschte der Alten einen guten Morgen. Die Alte sah die rotgeweinten Augen des Mädchens und sagte mitfühlend:
“Was bedrückt dich denn, mein Kind, dass du so bitterlich weinest?”
“Ach, Mütterchen!” antwortete Mariechen, “fragt nicht nach meinem Kummer! Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen!”
“Vielleicht doch!” sagte die Alte lächelnd. “Öffne mir dein Herz und sage mir, was dich quält. Wo graue Haare sind, da ist auch Vernunft.”
Ermutigt erzählte nun Mariechen, was sich zugetragen hatte, und weinend fügte sie hinzu:
“Ich will ja gar nicht Königin werden, sondern will nur allzu gerne meinen Vater von meiner aufrichtigen Liebe zu ihm überzeugen!”
Die Alte ließ Mariechen zu Ende erzählen, obzwar sie von allem Anfang an wusste, was der Grund ihres Kummers war, denn sie war keine gewöhnliche alte Frau, sondern eine gute Fee. Freundlich nahm sie das Mädchen bei der Hand und forderte es auf, in ihre Dienste einzutreten. Mariechen war überglücklich und ging mit der Alten.
Die gute Fee führte sie in ihr Häuschen und gab ihr zu essen und zu trinken. Als sich Mariechen gelabt hatte, fragte die alte Frau:
“Kannst du Schafe hüten? Kannst du melken? Kannst du spinnen und weben?”
“Nichts desgleichen habe ich gelernt!”, antwortete das Mädchen traurig. “Doch wenn Ihr es mir zeigen wollt, will ich es versuchen und sicherlich schnell lernen!”
“Dies werde ich gerne tun und dich in allem unterweisen. Sei nur stets gut und gehorsam und tue, was ich dir sagen werde. Wenn sich die Zeit zur Zeit gesellt, wird dir Glück und Freude erwachsen!”
Mariechen versprach folgsam zu sein, und da sie fleißig und willig war, lernte sie schnell, und die Arbeit machte ihr viel Freude.
Inzwischen lebten die beiden älteren Prinzessinnen auf dem Schloss in Saus und Braus. Mit falschen Worten und vorgetäuschten Liebkosungen umgarnten sie den alten König und verlangten täglich neue und neue Geschenke. Die älteste Prinzessin stand den lieben Tag lang vor dem Spiegel und kleidete sich in prächtige Gewänder, während ihre Schwester sich mit Gold und Edelsteine schmückte und unaufhörlich tanzte. Ein Festmahl folgte dem anderen, und die Mädchen hatten nichts anderes als nur ihr Vergnügen im Sinne.
Da gingen dem alten König die Augen auf und er musste erkennen, dass seinen Töchtern Gold und Tanz lieber waren als er. Er gedachte seiner jüngsten Tochter und erinnerte sich an die aufrichtige Liebe, mit der sie ihn immer umgeben, ihn geherzt und geliebkost hatte und er wusste nun, dass er sie allein zur Königin hätte ernennen sollen. Wie gerne hätte er sie zurückgeholt, wenn er nur ihren Aufenthaltsort gekannt hätte! Kamen ihm aber ihre Worte in den Sinn, dass sie ihn nur so wie Salz liebe, wurde er wiederum ärgerlich und zweifelte an ihr. Eines Tages sollte ein Festmahl im Schloss gegeben werden. Da stürzte der Koch vor des Königs Thron und rief:
“Herr, ein großes Missgeschick hat uns befallen! Das Salz in der Küche und auch im ganzen Lande ist zerflossen und hat sich aufgelöst. Womit soll ich denn die Speisen salzen?”
“Kannst du denn nichts anderes zum Würzen verwenden?” fragte der König ärgerlich.
“Oh, Herr, welches Gewürz könnte denn Salz ersetzen?” rief der Koch verzweifelt. Auf diese Frage aber wusste der König keine Antwort. Er wurde böse und befahl dem Koch, das Festmahl ohne Salz zu bereiten.
“Wenn es dem König recht ist, mir kann es sicherlich recht sein!”, dachte der Koch und sandte ungesalzene Speisen zur Königstafel. Den Gästen wollten die Gerichte nicht munden, obzwar sie sonst schmackhaft und wohlgefällig zubereitet waren.
Der König sandte seine Boten nach allen Windrichtungen aus, um Salz zu holen, doch sie alle kehrten unverrichteter Dinge und mit leeren Händen ins Schloss zurück. Das gleiche Missgeschick hatte auch die Nachbarländer betroffen und wer noch einen kleinen Salzvorrat hatte, wollte sich nicht für alles Gold der Welt von ihm trennen.
Auf Befehl des Königs bereitete nun der Koch nur süße Speisen und Gerichte zu, die keines Salzes bedurften. Doch auch diese Speisen wollten den Gästen auf die Dauer nicht schmecken, und als sie sahen, dass keine Besserung abzusehen war, verließen sie, einer nach dem anderen, das königliche Schloss. Die beiden Prinzessinnen waren untröstlich, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Gäste ziehen zu lassen.
Doch nicht nur die Menschen, sondern auch das Vieh in den Ställen litt unter diesem Salzmangel. Kühe, Ziegen und Schafe gaben wenig Milch. Es war ein Unglück für jedermann im Lande. Die Leute wankten müde zur Arbeit und wurden schwach und krank. Sogar den König und seine beiden Töchter verschonte die Krankheit nicht. Da erst erkannten sie, welch seltene Gabe des Himmels das Salz war und wie wenig sie diese geschätzt hatten. Die Schuld, Mariechen Unrecht getan zu haben, lastete schwer auf des Königs Gewissen.
In der Zwischenzeit lebte das Mädchen in der Hütte im Walde glücklich und zufrieden. Sie ahnte nicht, wie schlecht es ihrem Vater und ihren beiden Schwestern zu Hause erging. Die weise Frau jedoch wusste nur zu genau, was sich dort zutrug!
Eines Tages sprach sie zu Mariechen:
“Stets sagte ich dir, dass wenn die Zeit sich zur Zeit gesellt, deine Stunde kommen wird. Deine Stunde hat nun geschlagen. Kehre nach Hause zurück!”
“Ach, mein gutes Mütterchen, wie könnte ich denn jemals wieder zurückkehren, wenn mich mein eigener Vater aus dem Haus gewiesen hat”, antwortete das Mädchen und fing zu weinen an.
Da erzählte ihr die gute Fee, was sich während ihrer Abwesenheit im Lande zugetragen hatte, dass nun die Worte an ihren Vater wahr geworden und Salz wertvoller als Gold und Edelsteine sei.
Ungern verließ Mariechen die gute Fee, die sie so viele nützliche Dinge gelehrt hatte. Doch ihre Sehnsucht nach dem Vater war erwacht und sie konnte es kaum erwarten, ihn wiederzusehen.
“Du hast mir treu gedient, Mariechen”, sprach die Alte beim Abschied, “und ich will dich gut entlohnen. Sage mir, was du dir wünschest.”
“Ihr wart so gut zu mir und habt mich so vieles gelehrt”, antwortete Mariechen, “ich will nichts anders von Euch, Mütterchen, als ein wenig Salz, welches ich meinem Vater bringen will.”
“Und nichts weiter wünschest Du? Ich könnte jeden deiner Wünsche erfüllen”, fragte nochmals die gute Fee.
“Nein, nichts mehr begehre ich, Mütterchen, als das Salz”, beharrte Mariechen.
“Da du das Salz so hoch schätzest, möge es dir niemals daran fehlen!” sprach die Alte. “Nimm hier diese kleine Weidenrute, und wenn einmal der Mittagswind zu wehen beginnt, folge ihm. Gehe durch drei Täler und über drei Berge, dann halte ein und berühre den Boden mit der Weidenrute. Die Erde wird sich öffnen und du trete getrost ein. Was du dort finden wirst, behalte – es sei dein Eigen.”
Dankend nahm Mariechen die Weidenrute und verwahrte sie sorgfältig. Dann gab ihr die alte Frau ein Beutelchen, welches sie mit Salz füllte. Schweren Herzens nahm das Mädchen Abschied von dem kleinen Waldhäuschen, das ihr zur zweiten Heimat geworden war und machte sich, von dem Mütterchen begleitet, auf den Heimweg. Weinend versicherte Mariechen, dass sie wiederkommen wolle, um die alte Frau zu holen, um sie für immer mit sich auf Schloss zu nehmen.
“Bleibe nur stets gut und gehorsam”, sagte die Alte lächelnd, als sie den Rand des Wäldchens erreicht hatten, “und es wird dir wohl ergehen!”
Als ihr Mariechen nochmals für ihre Güte danken wollte, war sie verschwunden.
Verwundert stand das Mädchen da, doch die Sehnsucht nach ihrem Vater ließ sie nicht lange verweilen und sie eilte dem Schlosse zu.
Sie war ärmlich gekleidet und da sie den Kopf in ein Tuch gehüllt hatte, erkannte sie niemand. Die Diener im Schloss verweigerten ihr den Eintritt zum König, da er krank und schwach im Bette lag.
“Ach, lasst mich doch ein.”, bat sie. “Ich bringe ein Geschenk, welches dem König seine verlorene Kraft und Gesundheit wiedergeben wird!”
Als der König dies hörte, befahl er, das Mädchen zu ihm zu bringen.
“Gebt mir ein Stück Brot!” bat Mariechen, als sie vor dem König stand.
“Salz kann ich Dir mit dem Brote jedoch nicht reichen lassen,” seufzte der König, “denn wir haben im Schloss kein Stäubchen davon.”
“Das Salz habe ich!” rief Mariechen und sie öffnete ihren Beutel, streute ein wenig aufs Brot und reichte es dem König.
“Salz! Hört ihr Leute”, rief der König entzückt. “Wie soll ich dir nur für deine Gabe danken? Sage mir, was du dir wünschest!”
“Nichts wünsche ich mir sehnlicher, als dass du, mein geliebtes Väterchen, mich wiederum zu dir nimmst und mich ebenso liebst wie das Salz hier”, antwortete Mariechen und enthüllte ihr liebliches Antlitz.
Der König war überglücklich, als er seine jüngste Tochter wiedersah. Er bat sie um Verzeihung, doch Mariechen küsste und streichelte ihren Vater nur und hatte auch schon alles Unrecht, welches ihr geschehen war, vergessen.
Schnell verbreitete sich im Schloss und auch im ganzen Lande die Kunde, dass des Königs jüngste Tochter heimgekehrt war und Salz mitgebracht hätte. Jeder, der im Schloss erschien und um Salz bat, bekam ein wenig aus dem Beutelchen, welches nie leer wurde.
Der König wurde gesund und voller Freude darüber berief er eines Tages um die Mittagsstunde seine Edelleute, um ihnen zu verkünden, dass er Mariechen zu seiner Nachfolgerin bestimmen wolle.
Mariechen wurde gerufen und unter großem Jubel des Volkes wurde sie zur Königin ernannt. Da strich ein warmer Windhauch leise über ihre Wange und es war ihr, als höre sie die Stimme der alten Frau im Walde. Sie erkannte das Zeichen, welches ihr der Mittagswind gab und beschloss, ihm zu folgen.
Schnell vertraute sie sich ihrem Vater an, nahm die kleine Weidenrute zur Hand und schritt in der Richtung des Windes aus. Sie wanderte über drei Berge und durch drei Täler und blieb hierauf stehen, so wie es ihr die alte Frau geboten hatte. Mit ihrer Rute schlug sie auf den Boden und siehe da! Die Erde öffnete sich und Mariechen trat ein.
Sie stand inmitten eines großen Saales, dessen Wände und Boden wie aus Eis gebaut zu sein schienen. Von allen Seiten liefen winzige Männchen herbei, die alle hellleuchtende Fackeln trugen.
“Sei uns willkommen, oh Königin!” riefen sie. “Wir haben deine Ankunft lange erwartet! Unsere Gebieterin befahl uns, dir dieses unterirdische Reich zu zeigen, denn es gehört dir!”
So schnatterte und plapperte es von allen Seiten, die kleinen Wesen hüpften und tanzten ihre Fackeln schwingend um Mariechen herum. Sie kletterten auf die Wände hinauf und sprangen über die glitzernden Kristalle, die wie Edelsteine im Fackellichte blitzten.
Die kleinen Männchen führten Mariechen durch Gänge, von deren Decken silberschimmernde Eiszapfen hingen. Sie geleiteten sie in Gärten, in welchen rote Eisrosen und andere wunderbare Blumen blühten. Dann brachen sie eine der schimmernden Blüten ab und reichten sie Mariechen, doch kein lieblicher Duft entströmte ihrem Kelch.
“Was soll denn all dies bedeuten?” fragte das Mädchen verwundert. “Niemals noch habe ich solche Pracht gesehen!”
“All dies ist Salz!” riefen die Männchen im Chor. “Nimm davon, so viel dir beliebt. Der Vorrat ist unerschöpflich!”
Mariechen dankte den kleinen Wesen von ganzem Herzen und kehrte ans Tageslicht zurück. Der Eingang zum unterirdischen Reiche aber schloss sich nicht wieder.
Als sie nach Hause zurückkehrte und ihrem Vater von ihrem wunderbaren Erlebnis erzählt hatte, erkannte dieser, mit welch unschätzbarem Reichtum seine Tochter von der alten Frau im Zauberwald überschüttet worden war.
Mariechen sehnte sich nach der alten Frau, und sie eilte mit einem großen Gefolge zum vertrauten Wäldchen, um sie zu finden und für immer ins Schloss zu holen, so wie sie es ihr beim Abschied versprochen hatte. Doch so sehr sie sich auch bemühte und den Wald kreuz und quer durchsuchte – es gelang ihr nicht, die Hütte zu finden und das Mütterchen blieb verschwunden.
Da erst wurde es Mariechen klar, dass die alte Frau ihre gütige Fee gewesen war. Sie kehrte heim und wurde von ihren Untertanen stets geliebt und geehrt.
Und wenn sie nicht gestorben ist, so lebt sie vielleicht noch heute.
DER SEE CORRIB

Nicht weit von dem See Corrib in der Grafschaft Galway lebte ein junges Paar, Cormak und Marie, die sich zärtlich liebten und deren Glück nichts im Wege zu stehen schien.
Ihr Hochzeitstag war schon bestimmt, als Marie plötzlich verschwand, niemand wußte wohin. Sie war ausgegangen und abends zu der gewöhnlichen Stunde nicht wieder nach Haus gekommen, und als ihre Eltern, während Sorge und Angst jede Minute wuchs, vergeblich die ganze Nacht auf sie gewartet und auch der helle Morgen ihr geliebtes Kind nicht zurückgeführt hatte, so gaben sie alle Hoffnung auf, und der nagende Schmerz über ihren Verlust wurde noch geschärft durch den Gedanken, daß ein Sturz in Abgründe oder sonst ein jämmerlicher, qualvoller Tod ihrem jungen Leben ein Ende gemacht habe.
Wer vermag Cormaks Schmerz und Verzweiflung zu beschreiben! Er irrte weit und breit umher, die heimlichsten und unzugänglichsten Orte suchte er auf, doch es schien, wenn auch Wald und Feld, Bäume, Blumen und Steine die Sprache erhalten hätten, sie würden nichts von ihr haben sagen können; kein lebendes Wesen hatte sie erblickt und alle Spur von ihrem Dasein war verschwunden.
Von nun an ging er jeden Abend hinaus zu dem See Corrib, setzte sich auf die Felsen am Ufer, wo die wildesten und traurigsten Gedanken, wahnsinnige Wut und lebloses Erstarren, sich abwechselnd seiner Seele bemächtigten und sie in immer tiefere Verwirrung senkten.
»Nein, sie ist nicht tot!« rief er aus, »sie lebt, das dunkle Grab hat kein Verlangen nach dieser reinen Taube, die schneeweiß und unschuldig ist und ohne Sünde; der Tod zielt nur nach jenen, deren Seele gereinigt werden soll. Sie lebt hier unter dem Wasser des Corribs, bei jeder Welle, die daher rauscht, höre ich ihre Stimme und vernehme die Lieder, die ich sie selbst gelehrt habe. Kalt ist der Felsen, auf dem ich sitze, frostig wehen die Winde mich an, Nebel bedeckt das dunkle Gewässer, aber ihr Herz ist noch kälter! Warum kehrt sie nicht zu mir zurück? Ach! harte, entsetzliche Zauberworte halten sie gebannt!«
Einmal lag der See in der tiefsten Ruhe. Nur eine einzige weiße Welle rollte sanft darüber hin. Sie kam näher und näher bis zu Cormaks Sitze. Da schien es ihm, als entwickle sich daraus ein ganzer Zug wunderbarer Gestalten. Der Vollmond leuchtete so hell darüber hin, daß er imstand war, sie deutlich zu unterscheiden, und doch waren die Gestalten so zart und luftig, daß der Strahl des Mondes ungehindert durch sie drang.
Vor ihnen entfaltete sich flatternd eine Fahne, dann folgte ein langer Zug in prächtiger Rüstung, Helme und Speere leuchteten in höchstem Glanz und deutlich war zu sehen, wie der Widerschein davon auf dem leicht zitternden Wasserspiegel in beständiger Bewegung hin und her schwankte. Sie saßen auf geschmückten Rossen, welche auf dieser pfadlosen Bahn in die Höhe stiegen und wild sich bäumten, während über ihren Häuptern wallende Düfte hingen, deren Säume in den Farben des Regenbogens schimmerten.
Rührte ein leiser Wind daran, so lösten sich schillernde Flöckchen ab und zitterten in dem sanften Luftstrom. Kein Schweigen herrschte, es erhob sich ein langsamer, feierlicher Gesang, dessen Töne in unaussprechlicher Süßigkeit leis und doch mächtig heran schwollen. Bei diesem Gesang bewegte sich die ganz luftige Schar in anmutiger Leichtigkeit.
Cormak saß und starrte die Erscheinung an, seine betäubten Sinne wußten nicht, ob er sich selbst mit diesem Blendwerk täusche, oder ob es wirklich vor ihm nach dem Takt der Musik auf- und abwalle, bald in höchster Lust anschwellend, bald dahinsterbend, als spotte es seiner.
Endlich sich ermannend rief er mit lauter Stimme: »Christ, rette ihre Seele!« und kaum war der geheiligte Namen über seine Lippen gekommen, als ein furchtbares Geheul und teuflisches Geschrei antwortete und die ganze Erscheinung verschwand.
Neben ihm am Ufer stand Marie, schöner als je, frei durch das eine Wort von aller Macht des Zaubers und ihm zu neuem Leben und neuer Liebe zurückgegeben.
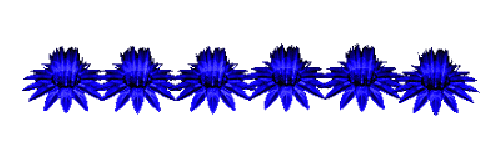
Anmerkung
Der See Corrib liegt in der Grafschaft Galway, ist etwa zehn Stunden lang und an der breitesten Stelle etwas über fünf Stunden breit. Er ist in der Mitte so zusammengezogen, daß er zwei Seen ähnlich sieht.
Gervasius von Tilbury bemerkt gewisse Wassergeister, Dracae genannt, lockten Mädchen und Kinder in ihre Wohnungen unter Seen und Flüssen.
Einer frommen Ausrufung wird die Kraft zugeschrieben, den Zauber zu brechen, womit die Geister den halten, den sie entführt haben.
Ein Messer mit schwarzem Stiel wird als besonders dienlich erachtet, wenn es sollte nötig sein, mit einem von den bösen Geistern zu kämpfen. Das Kleid oder den Mantel umzuwenden wird auch in dieser Hinsicht empfohlen.
Im Original ist es eine Ballade, welche aber nach der ausdrücklichen Versicherung des Verfassers nur ein Versuch war, eine den übrigen ursprünglich ähnliche Sage umzuarbeiten, welche wir in ihre erste Gestalt zurückzuführen versucht haben.
DAS UNGLÜCK
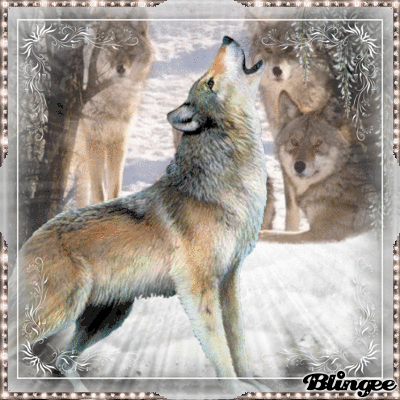
Wen das Unglück aufsucht, der mag sich aus einer Ecke in die andere verkriechen, oder ins weite Feld fliehen, es weiß ihn dennoch zu finden.
Es war einmal ein Mann so arm geworden, daß er kein Scheit Holz mehr hatte, um das Feuer auf seinem Herde zu erhalten. Da ging er hinaus in den Wald, und wollte einen Baum fällen, aber sie waren alle zu groß und stark. Er ging immer tiefer hinein, endlich fand er einen, den er wohl bezwingen konnte.
Als er eben die Axt aufgehoben hatte, sah er aus dem Dickicht eine Schar Wölfe hervorbrechen, und mit Geheul auf ihn eindringen. Er warf die Axt hin, floh und erreichte eine Brücke. Das tiefe Wasser aber hatte die Brücke unterwühlt, und in dem Augenblick, wo er darauf treten wollte, krachte sie, und fiel zusammen.
Was sollte er tun? Blieb er stehen, und erwartete die Wölfe, so zerrissen sie ihn. Er wagte in der Not einen Sprung in das Wasser, aber da er nicht schwimmen konnte, sank er hinab.
Ein paar Fischer, die an dem jenseitigen Ufer saßen, sahen den Mann ins Wasser stürzen, schwammen herbei, und brachten ihn ans Land. Sie lehnten ihn an eine alte Mauer, damit er sich in der Sonne erwärmen und wieder zu Kräften kommen sollte. Als er aber aus der Ohnmacht erwachte, den Fischern danken und ihnen sein Schicksal erzählen wollte, fiel das Gemäuer über ihn zusammen, und erschlug ihn.
DIE HOCHZEIT DER FRAU FÜCHSIN

ERSTES MÄRCHEN
Es war einmal ein alter Fuchs mit neun Schwänzen, der glaubte, seine Frau wäre ihm nicht treu, und wollte er sie in Versuchung führen. Er streckte sich unter die Bank, regte kein Glied und stellte sich, als wenn er mausetot wäre. Die Frau Füchsin ging auf ihre Kammer, schloß sich ein, und ihre Magd, die Jungfer Katze, saß auf dem Herd und kochte. Als es nun bekannt ward, daß der alte Fuchs gestorben war, so meldeten sich die Freier. Da hörte die Magd, daß jemand vor der Haustüre stand und anklopfte; sie ging und machte auf, und da wars ein junger Fuchs, der sprach
'was machet sie, Jungfer Katze?
schläft se oder wacht se?'
Sie antwortete
'ich schlafe nicht, ich wache.
Will er wissen, was ich mache?
Ich koche warm Bier, tue Butter hinein:
will der Herr mein Gast sein?'
'Ich bedanke mich, Jungfer,' sagte der Fuchs, 'was macht die Frau Füchsin?' Die Magd antwortete
'sie sitze auf ihrer Kammer,
sie beklagt ihren Jammer,
weint ihre Äuglein seidenrot,
weil der alte Herr Fuchs ist tot.'
'Sag sie ihr doch, Jungfer, es wäre ein junger Fuchs da, der wollte sie gerne freien.' 'Schon gut, junger Herr.'
Da ging die Katz die Tripp die Trapp,
Da schlug die Tür die Klipp die Klapp.
'Frau Füchsin, sind Sie da?'
'Ach ja, mein Kätzchen, ja.'
'Es ist ein Freier draus.'
'Mein Kind, wie siehe er aus?
Hat er denn auch neun so schöne Zeiselschwänze wie der selige Herr Fuchs?' 'Ach nein,' antwortete die Katze, 'er hat nur einen.' 'So will ich ihn nicht haben.'
Die Jungfer Katze ging hinab und schickte den Freier fort. Bald darauf klopfte es wieder an, und war ein anderer Fuchs vor der Türe, der wollte die Frau Füchsin freien; er hatte zwei Schwänze; aber es ging ihm nicht besser als dem ersten. Danach kamen noch andere, immer mit einem Schwanz mehr, die alle abgewiesen wurden, bis zuletzt einer kam, der neun Schwänze hatte wie der alte Herr Fuchs. Als die Witwe das hörte, sprach sie voll Freude zu der Katze
'nun macht mir Tor und Türe auf,
und kehrt den alten Herrn Fuchs hinaus.'
Als aber eben die Hochzeit sollte gefeiert werden, da regte sich der alte Herr Fuchs unter der Bank, prügelte das ganze Gesindel durch und jagte es mit der Frau Füchsin zum Haus hinaus.
ZWEITES MÄRCHEN
Als der alte Herr Fuchs gestorben war, kam der Wolf als Freier, klopfte an die Türe, und die Katze, die als Magd bei der Frau Füchsin diente, machte auf. Der Wolf grüßte sie und sprach
'guten Tag, Frau Katz von Kehrewitz,
wie kommts, daß sie alleine sitzt?
was macht sie Gutes da?'
Die Katze antwortete
'brock mir Wecke und Milch ein:
will der Herr mein Gast sein?'
'Dank schön, Frau Katze,' antwortete der Wolf, 'die Frau Füchsin nicht zu Haus?'
Die Katze sprach
'sie sitzt droben in der Kammer,
beweint ihren Jammer,
beweint ihre große Not,
daß der alte Herr Fuchs ist tot.'
Der Wolf antwortete
'will sie haben einen andern Mann,
so soll sie nur herunter gan.'
Die Katz, die lief die Trepp hinan'
und ließ ihr Zeilchen rummer gan,
bis sie kam vor den langen Saal:
klopft an mit ihren fünf goldenen Ringen.
'Frau Füchsin, ist sie drinnen?
Will sie haben einen andern Mann,
so soll sie nur herunter gan.'
Die Frau Füchsin fragte
'hat der Herr rote Höslein an, und hat er ein spitz Mäulchen?' 'Nein,' antwortete die Katze. 'So kann er mir nicht dienen.'
Als der Wolf abgewiesen war, kam ein Hund, ein Hirsch, ein Hase, ein Bär, ein Löwe, und nacheinander alle Waldtiere. Aber es fehlte immer eine von den guten Eigenschaften, die der alte Herr Fuchs gehabt hatte, und die Katze mußte den Freier jedesmal wegschicken. Endlich kam ein junger Fuchs. Da sprach die Frau Füchsin 'hat der Herr rote Höslein an, und hat er ein spitz Mäulchen?' 'Ja,' sagte die Katze, 'das hat er.' 'So soll er heraufkommen,' sprach die Frau Füchsin, und hieß die Magd das Hochzeitsfest bereiten.
'Katze, kehr die Stube aus,
und schmeiß den alten Fuchs zum Fenster hinaus.
Bracht so manche dicke fette Maus,
fraß sie immer alleine,
gab mir aber keine.'
Da ward die Hochzeit gehalten mit dem jungen Herrn Fuchs, und ward gejubelt und getanzt, und wenn sie nicht aufgehört haben, so tanzen sie noch.
DER STIEFEL VON BÜFFELLEDER
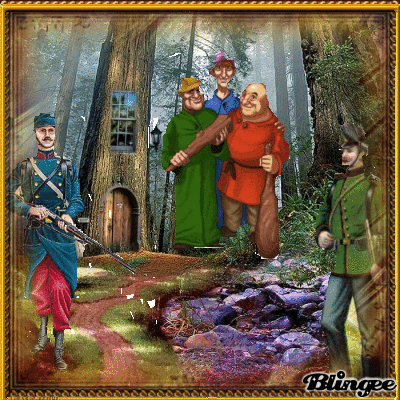
Ein Soldat, der sich vor nichts fürchtet, kümmert sich auch um nichts. So einer hatte seinen Abschied erhalten, und da er nichts gelernt hatte und nichts verdienen konnte, so zog er umher und bat gute Leute um ein Almosen. Auf seinen Schultern hing ein alter Wettermantel, und ein Paar Reiterstiefeln von Büffelleder waren ihm auch noch geblieben. Eines Tages ging er, ohne auf Weg und Steg zu achten, immer ins Feld hinein und gelangte endlich in einen Wald. Er wußte nicht, wo er war, sah aber auf einem abgehauenen Baumstamm einen Mann sitzen, der gut gekleidet war und einen grünen Jägerrock trug. Der Soldat reichte ihm die Hand, ließ sich neben ihm auf das Gras nieder und streckte seine Beine aus. 'Ich sehe, du hast feine Stiefel an, die glänzend gewichst sind,' sagte er zu dem Jäger, 'wenn du aber herumziehen müßtest wie ich, so würden sie nicht lange halten. Schau die meinigen an, die sind von Büffelleder und haben schon lange gedient, gehen aber durch dick und dünn.' Nach einer Weile stand der Soldat auf und sprach 'ich kann nicht länger bleiben, der Hunger treibt mich fort. Aber, Bruder Wichsstiefel, wo hinaus geht der Weg?' 'Ich weiß es selber nicht,' antwortete der Jäger, 'ich habe mich in dem Wald verirrt.' 'So geht dirs ja wie mir,' sprach der Soldat, 'gleich und gleich gesellt sich gern, wir wollen beieinander bleiben und den Weg suchen.' Der Jäger lächelte ein wenig, und sie gingen zusammen fort, immer weiter, bis die Nacht einbrach.
'Wir kommen aus dem Wald nicht heraus,' sprach der Soldat, 'aber ich sehe dort in der Ferne ein Licht schimmern, da wirds etwas zu essen geben.' Sie fanden ein Steinhaus, klopften an die Türe, und ein altes Weib öffnete. 'Wir suchen ein Nachtquartier,' sprach der Soldat, 'und etwas Unterfutter für den Magen, denn der meinige ist so leer wie ein alter Tornister.' 'Hier könnt ihr nicht bleiben,' antwortete die Alte, 'das ist ein Räuberhaus, und ihr tut am klügsten, daß ihr euch fortmacht, bevor sie heim kommen, denn finden sie euch, so seid ihr verloren.' 'Es wird so schlimm nicht sein,' antwortete der Soldat, 'ich habe seit zwei Tagen keinen Bissen genossen, und es ist mir einerlei, ob ich hier umkomme oder im Wald vor Hunger sterbe. Ich gehe herein.' Der Jäger wollte nicht folgen, aber der Soldat zog ihn am Ärmel mit sich 'komm, Bruderherz, es wird nicht gleich an den Kragen gehen.' Die Alte hatte Mitleiden und sagte 'kriecht hinter den Ofen, wenn sie etwas übrig lassen und eingeschlafen sind, so will ichs euch zustecken.' Kaum saßen sie in der Ecke, so kamen zwölf Räuber hereingestürmt, setzten sich an den Tisch, der schon gedeckt war, und forderten mit Ungestüm das Essen. Die Alte trug einen großen Braten herein, und die Räuber ließen sichs wohl schmecken. Als der Geruch von der Speise dem Soldaten in die Nase stieg, sagte er zum Jäger 'ich halts nicht länger aus, ich setze mich an den Tisch und esse mit.' 'Du bringst uns ums Leben,' sprach der Jäger und hielt ihn am Arm.
Aber der Soldat fing an laut zu husten. Als die Räuber das hörten, warfen sie Messer und Gabel hin, sprangen auf und entdeckten die beiden hinter dem Ofen. 'Aha, ihr Herren,' riefen sie, 'sitzt ihr in der Ecke? was wollt ihr hier? seid ihr als Kundschafter ausgeschickt? wartet, ihr sollt an einem dürren Ast das Fliegen lernen.' 'Nur manierlich,' sprach der Soldat, 'mich hungert, gebt mir zu essen, hernach könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt.' Die Räuber stutzten, und der Anführer sprach 'ich sehe, du fürchtest dich nicht, gut, Essen sollst du haben, aber hernach mußt du sterben.' 'Das wird sich finden,' sagte der Soldat, setzte sich an den Tisch und fing an tapfer in den Braten einzuhauen. 'Bruder Wichsstiefel, komm und iß,' rief er dem Jäger zu, 'du wirst hungrig sein so gut als ich, und einen bessern Braten kannst du zu Haus nicht haben;' aber der Jäger wollte nicht essen. Die Räuber sahen dem Soldaten mit Erstaunen zu und sagten 'der Kerl macht keine Umstände.' Hernach sprach er 'das Essen wäre schon gut, nun schafft auch einen guten Trunk herbei.' Der Anführer war in der Laune, sich das auch noch gefallen zu lassen, und rief der Alten zu 'hol eine Flasche aus dem Keller, und zwar von dem besten.' Der Soldat zog den Pfropfen heraus, daß es knallte, ging mit der Flasche zu dem Jäger und sprach 'gib acht, Bruder, du sollst dein blaues Wunder sehen: jetzt will ich eine Gesundheit auf die ganze Sippschaft ausbringen.' Dann schwenkte er die Flasche über den Köpfen der Räuber, rief 'ihr sollt alle leben, aber das Maul auf und die rechte Hand in der Höhe,' und tat einen herzhaften Zug. Kaum waren die Worte heraus, so saßen sie alle bewegungslos, als wären sie von Stein, hatten das Maul offen und streckten den rechten Arm in die Höhe.
Der Jäger sprach zu dem Soldaten 'ich sehe, du kannst noch andere Kunststücke, aber nun komm und laß uns heim gehen.' 'Oho, Bruderherz, das wäre zu früh abmarschiert, wir haben den Feind geschlagen und wollen erst Beute machen. Die sitzen da fest und sperren das Maul vor Verwunderung auf: sie dürfen sich aber nicht rühren, bis ich es erlaube. Komm, iß und trink.' Die Alte mußte noch eine Flasche von dem besten holen, und der Soldat stand nicht eher auf, als bis er wieder für drei Tage gegessen hatte. Endlich, als der Tag kam, sagte er 'nun ist es Zeit, daß wir das Zelt abbrechen, und damit wir einen kurzen Marsch haben, so soll die Alte uns den nächsten Weg nach der Stadt zeigen.' Als sie dort angelangt waren, ging er zu seinen alten Kameraden und sprach 'ich habe draußen im Wald ein Nest voll Galgenvögel aufgefunden, kommt mit, wir wollen es ausheben.' Der Soldat führte sie an und sprach zu dem Jäger 'du mußt wieder mit zurück: und zusehen, wie sie flattern, wenn wir s ie an den Füßen packen.' Er stellte die Mannschaft rings um die Räuber herum, dann nahm er die Flasche, trank einen Schluck, schwenkte sie über ihnen her und rief 'ihr sollt alle leben!, Augenblicklich hatten sie ihre Bewegung wieder, wurden aber niedergeworfen und an Händen und Füßen mit Stricken gebunden. Dann hieß sie der Soldat wie Säcke auf einen Wagen werfen und sagte 'fahrt sie nur gleich vor das Gefängnis.' Der Jäger aber nahm einen von der Mannschaft beiseite und gab ihm noch eine Bestellung mit.
'Bruder Wichsstiefel,' sprach der Soldat, 'wir haben den Feind glücklich überrumpelt und uns wohl genährt, jetzt wollen wir als Nachzügler in aller Ruhe hinterher marschieren.' Als sie sich der Stadt näherten, so sah der Soldat, wie sich eine Menge Menschen aus dem Stadttor drängten, lautes Freudengeschrei erhuben und grüne Zweige in der Luft schwangen. Dann sah er, daß die ganze Leibwache herangezogen kam.
'Was soll das heißen?' sprach er ganz verwundert zu dem Jäger. 'Weißt du nicht,' antwortete er, 'daß der König lange Zeit aus seinem Reich entfernt war, heute kehrt er zurück, und da gehen ihm alle entgegen.' 'Aber wo ist der König?' sprach der Soldat, 'ich sehe ihn nicht.' 'Hier ist er,' antwortete der Jäger, 'ich bin der König und habe meine Ankunft melden lassen.' Dann öffnete er seinen Jägerrock, daß man die königlichen Kleider sehen konnte. Der Soldat erschrak, fiel auf die Knie und bat ihn um Vergebung, daß er ihn in der Unwissenheit wie seinesgleichen behandelt und ihn mit solchem Namen angeredet habe. Der König aber reichte ihm die Hand und sprach 'du bist ein braver Soldat und hast mir das Leben gerettet. Du sollst keine Not mehr leiden, ich will schon für dich sorgen. Und wenn du einmal ein Stück guten Braten essen willst, so gut als in dem Räuberhaus, so komm nur in die königliche Küche. Willst du aber eine Gesundheit ausbringen, so sollst du erst bei mir Erlaubnis dazu holen.'
DIE HASELRUTE
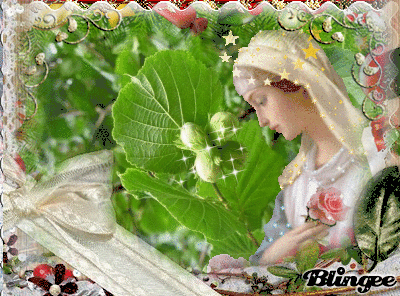
Eines Nachmittags hatte sich das Christkind in sein Wiegenbett gelegt und war eingeschlafen, da trat seine Mutter heran, sah es voll Freude an und sprach 'hast du dich schlafen gelegt, mein Kind? schlaf sanft, ich will derweil in den Wald gehen und eine Handvoll Erdbeeren für dich holen; ich weiss wohl, du freust dich darüber, wenn du aufgewacht bist.'
Draussen im Wald fand sie einen Platz mit den schönsten Erdbeeren, als sie sich aber herabbückt, um eine zu brechen, so springt aus dem Gras eine Natter in die Höhe. Sie erschrickt, lässt die Beere stehen und eilt hinweg. Die Natter schiesst ihr nach, aber die Mutter Gottes, das könnt ihr denken, weiss guten Rat, sie versteckt sich hinter eine Haselstaude und bleibt da stehen, bis die Natter sich wieder verkrochen hat.
Sie sammelt dann die Beeren, und als sie sich auf den Heimweg macht, spricht sie 'wie die Haselstaude diesmal mein Schutz gewesen ist, so soll sie es auch in Zukunft andern Menschen sein.' Darum ist seit den ältesten Zeiten ein grüner Haselzweig gegen Nattern, Schlangen, und was sonst auf der Erde kriecht, der sicherste Schutz.
DER FAULE HEINZ
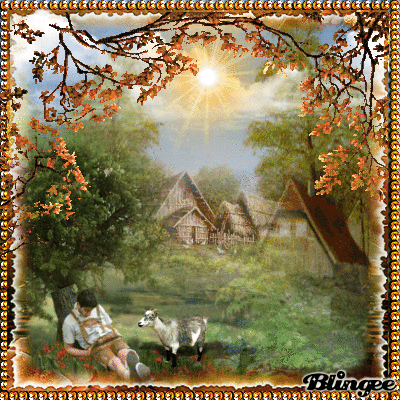
Heinz war faul, und obgleich er weiter nichts zu tun hatte, als seine Ziege täglich auf die Weide zu treiben, so seufzte er dennoch, wenn er nach vollbrachtem Tagewerk abends nach Hause kam. 'Es ist in Wahrheit eine schwere Last,' sagte er, 'und ein mühseliges Geschäft, so eine Ziege Jahr aus Jahr ein bis in den späten Herbst ins Feld zu treiben. Und wenn man sich noch dabei hinlegen und schlafen könnte! aber nein, da muß man die Augen aufhaben, damit sie die jungen Bäume nicht beschädigt, durch die Hecke in einen Garten dringt oder gar davonläuft. Wie soll da einer zur Ruhe kommen und seines Lebens froh werden!' Er setzte sich, sammelte seine Gedanken und überlegte, wie er seine Schultern von dieser Bürde frei machen könnte. Lange war alles Nachsinnen vergeblich, plötzlich fiels ihm wie Schuppen von den Augen. 'Ich weiß, was ich tue,' rief er aus, 'ich heirate die dicke Trine, die hat auch eine Ziege und kann meine mit austreiben, so brauche ich mich nicht länger zu quälen.'
Heinz erhob sich also, setzte seine müden Glieder in Bewegung, ging quer über die Straße, denn weiter war der Weg nicht, wo die Eltern der dicken Trine wohnten, und hielt um ihre arbeitsame und tugendreiche Tochter an. Die Eltern besannen sich nicht lange, 'gleich und gleich gesellt sich gern,' meinten sie und willigten ein. Nun ward die dicke Trine Heinzens Frau und trieb die beiden Ziegen aus. Heinz hatte gute Tage und brauchte sich von keiner andern Arbeit zu erholen als von seiner eigenen Faulheit. Nur dann und wann ging er mit hinaus und sagte 'es geschieht bloß, damit mir die Ruhe hernach desto besser schmeckt: man verliert sonst alles Gefühl dafür.'
Aber die dicke Trine war nicht minder faul. 'Lieber Heinz,' sprach sie eines Tages, 'warum sollen wir uns das Leben ohne Not sauer machen und unsere beste Jugendzeit verkümmern? Ist es nicht besser, wir geben die beiden Ziegen, die jeden Morgen einen mit ihrem Meckern im besten Schlafe stören, unserm Nachbar, und der gibt uns einen Bienenstock dafür? den Bienenstock stellen wir an einen sonnigen Platz hinter das Haus und bekümmern uns weiter nicht darum. Die Bienen brauchen nicht gehütet und nicht ins Feld getrieben zu werden: sie fliegen aus, finden den Weg nach Haus von selbst wieder und sammeln Honig, ohne daß es uns die geringste Mühe macht.' 'Du hast wie eine verständige Frau gesprochen,' antwortete Heinz, 'deinen Vorschlag wollen wir ohne Zaudern ausführen: außerdem schmeckt und nährt der Honig besser als die Ziegenmilch und läßt sich auch länger aufbewahren.'
Der Nachbar gab für die beiden Ziegen gerne einen Bienenstock. Die Bienen flogen unermüdlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend aus und ein, und füllten den Stock mit dem schönsten Honig, so daß Heinz im Herbst einen ganzen Krug voll herausnehmen konnte.
Sie stellten den Krug auf ein Brett, das oben an der Wand in ihrer Schlafkammer befestigt war, und weil sie fürchteten, er könnte ihnen gestohlen werden oder die Mäuse könnten darüber geraten, so holte Trine einen starken Haselstock herbei und legte ihn neben ihr Bett, damit sie ihn, ohne unnötigerweise aufzustehen, mit der Hand erreichen und die ungebetenen Gäste von dem Bette aus verjagen könnte.
Der faule Heinz verließ das Bett nicht gerne vor Mittag: 'wer früh aufsteht,' sprach er, 'sein Gut verzehrt.' Eines Morgens, als er so am hellen Tage noch in den Federn lag und von dem langen Schlaf ausruhte, sprach er zu seiner Frau 'die Weiber lieben die Süßigkeit,' und du naschest von dem Honig, es ist besser, ehe er von dir allein ausgegessen wird, daß wir dafür eine Gans mit einem jungen Gänslein erhandeln.' 'Aber nicht eher,' erwiderte Trine, 'als bis wir ein Kind haben, das sie hütet. Soll ich mich etwa mit den jungen Gänsen plagen und meine Kräfte dabei unnötigerweise zusetzen?' 'Meinst du,' sagte Heinz, 'der Junge werde Gänse hüten? heutzutage gehorchen die Kinder nicht mehr: sie tun nach ihrem eigenen Willen, weil sie sich klüger dünken als die Eltern, gerade wie jener Knecht, der die Kuh suchen sollte und drei Amseln nachjagte.' 'O,' antwortete Trine, 'dem soll es schlecht bekommen, wenn er nicht tut, was ich sage. Einen Stock will ich nehmen und mit ungezählten Schlägen ihm die Haut gerben. Siehst du, Heinz,' rief sie in ihrem Eifer und faßte den Stock, mit dem sie die Mäuse verjagen wollte, 'siehst du, so will ich auf ihn losschlagen.' Sie holte aus, traf aber unglücklicherweise den Honigkrug über dem Bette. Der Krug sprang wider die Wand und fiel in Scherben herab, und der schöne Honig floß auf den Boden. 'Da liegt nun die Gans mit dem jungen Gänslein,' sagte Heinz, 'und braucht nicht gehütet zu werden. Aber ein Glück ist es, daß mir der Krug nicht auf den Kopf gefallen ist, wir haben alle Ursache, mit unserm Schicksal zufrieden zu sein.' Und da er in einer Scherbe noch etwas Honig bemerkte, so langte er danach und sprach ganz vergnügt 'das Restchen, Frau, wollen wir uns noch schmecken lassen und dann nach dem gehabten Schrecken ein wenig ausruhen, was tuts, wenn wir etwas später als gewöhnlich aufstehen, der Tag ist doch noch lang genug.' 'Ja,' antwortete Trine, 'man kommt immer noch zu rechter Zeit. Weißt du, die Schnecke war einmal zur Hochzeit eingeladen, machte sich auf den Weg, kam aber zur Kindtaufe an. Vor dem Hause stürzte sie noch über den Zaun und sagte 'eilen tut nicht gut,.'
SPRINGWASSER
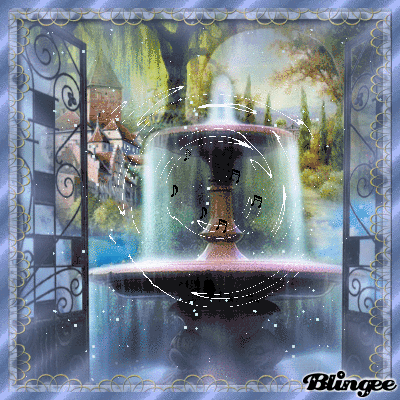
Wenn man aus der Stadt Cork geht, unweit der Galgenwiese, liegt ein großer See, auf dem sich Winters das Volk mit Schlittschuhlaufen ergötzt, aber die Lust über dem Wasser ist nichts in Vergleich mit der, die darunter ist, denn auf dem Boden dieses Sees stehen Gebäude und Gärten, die prächtigsten, die man je gesehen. Wie sie dahin kamen, hat sich folgendermaßen zugetragen.
Lange bevor ein sächsischer Fuß irischen Grund betrat, lebte ein großer König namens Corc; sein Schloß stand da, wo jetzt der See ist, in einer grünen, meilenbreiten Aue. Mitten im Burghof befand sich ein Springbrunnen so reinen, klaren Wassers, daß es ein Wunder war.
Der König freute sich auch nicht wenig, eine solche Merkwürdigkeit in seinem Schlosse zu besitzen; als aber die Leute in Haufen herbei kamen von fern und von nah, das köstliche Wasser dieses Brunnens zu schöpfen, fürchtete er, daß es mit der Zeit versiegen möchte. Er befahl eine hohe Mauer rundherum zu bauen und wollte niemand mehr zu dem Wasser lassen, was ein großer Schaden für die armen Leute war, die in der Gegend wohnten. So oft er aber selbst Wasser brauchte, sandte er seine Tochter hin, es zu holen und vertraute den Schlüssel zu der Quelltüre keinem seiner Diener, aus Besorgnis, sie könnten etwas davon weggeben.
Eines abends feierte der König ein großes Fest, viele Fürsten waren zugegen, Grafen und Edelleute ohne Zahl, das ganze Schloß war voll Herrlichkeit, Freudenfeuer stiegen in die Wolken auf, der Tanz drehte sich und so süße Musik ging dazu, daß sie die Toten aus ihren Gräbern hätte wecken mögen; Speisen standen für jeden bereit, der hereinkam und niemand wurde von dem Schloßtor zurückgewiesen, jedem rief der Pförtner »willkommen, herzlich willkommen!« entgegen.
Nun geschah es aber, daß bei diesem großen Feste auch ein junger Prinz erschienen war, lieblich von Ansehen, so schlank und gerade, wie sich ihn nur ein Auge wünschen möchte zu erblicken. Recht lustig tanzte er den Abend mit des alten Königs Tochter auf und nieder, federleicht und die Füße so zierlich setzend, daß es allgemeine Bewunderung auf sich zog.
Die Musikanten spielten aufs beste, um einem solchen Tanze Ehre zu machen und jene tanzten, als stände ihr Leben darauf. Nach dem Tanz folgte das Abendessen, der junge Prinz saß seiner schönen Tänzerin zur Seite und so oft er mit ihr sprach, lächelte sie ihm zu, er tat es aber lange nicht so oft, als sie wünschte, denn er mußte sich vielmals zu der Gesellschaft umdrehen und für die Komplimente danken, die seiner schönen Tischgefährtin und ihm gemacht wurden.
Mitten in der Mahlzeit sagte einer von den großen Herrn zu dem König Corc: »Mit eurer Majestät Erlaubnis, alles ist hier im Überfluß, was das Herz sich wünschen mag, beides zu essen und zu trinken, nur kein Wasser.«
»Wasser!« sagte der König mit Wohlgefallen darüber, daß jemand das forderte, woran absichtlich Mangel gelassen war: »Wasser sollt ihr gleich haben und von so köstlicher Art, daß ich die ganze Welt auffordere, ein gleiches vorzuweisen. Tochter«, rief er, »geh, hole welches, in dem Goldeimer, den ich dazu habe machen lassen.«
Die Königstochter, welche Fior Usga (Springwasser) hieß, schien eben nicht zufrieden damit, heute vor so vielen Leuten diese gemeine Hausarbeit zu übernehmen. Sie wagte nicht ihres Vaters Geheiß zu widerstreben, aber sie zögerte, auf den Boden schauend. Der König, welcher seine Tochter sehr liebte, merkte ihre Verlegenheit und es tat ihm leid, daß er es von ihr begehrt hatte, doch sein königliches Wort durfte er nicht zurücknehmen, er sann auf ein Mittel, sie gleich dahin zu bringen, daß sie das Wasser holte und fiel auf den Gedanken, der Prinz, ihr Tischgesell solle sie begleiten.
Mit lauter Stimme sagte er: »Meine Tochter, mich wundert nicht, daß du dich fürchtest allein auszugehen so spät in der Nacht, der junge Prinz dir zur Seite, hoffe ich, wird dich begleiten.« Der Prinz hörte das mit Vergnügen und den Goldeimer an die eine Hand nehmend, mit der andern die Königstochter aus dem Saal führend, zog er die Blicke aller Gäste auf sich.
Als sie zu dem Wasserbrunnen im Schloßhof kamen, schloß die schöne Usga das Tor sorgfältig auf, bückte sich mit dem Goldeimer und wollte Wasser schöpfen, aber das Gefäß wurde ihr so schwer, daß sie das Gleichgewicht verlor und in den Brunnen stürzte. Vergeblich strebte der junge Prinz sie zu retten, das Wasser stieg und stieg so mächtig, daß es schnell den ganzen Schloßhof einnahm, außer sich eilte er zurück zu dem König.
Das Brunnentor war offen geblieben und das lang verschloßne Wasser, froh über die erlangte Freiheit, rauschte unablässig herein, stieg jeden Augenblick höher und war in dem Gastsaal so schnell wie der junge Prinz selbst, dergestalt, daß, wie er versuchte mit dem König zu reden, er bis an den Hals im Wasser stand. In die Länge stieg das Wasser zu solcher Höhe, daß es die ganze grüne Aue, in welcher des Königs Schloß lag, erfüllte und so wurde der jetzige See von Cork gebildet.
Aber der König und seine Gäste ertranken nicht, noch seine Tochter, die schöne Usga, sondern die nächste Nacht nach dem schreckenvollen Ereignis kehrte sie zum Festgelag zurück und seitdem jede Nacht geht das Fest und der Tanz an in dem Boden des Sees und wird so lange dauern, bis es einem gelingt, den Goldeimer heraus zu bringen, der die Ursache des Unheils war.
Und niemand kann zweifeln, daß dies Gericht darum über den König erging, weil er den Brunnen im Schloßhof den armen Leuten verschlossen hatte. Wer aber der Sage nicht glaubt, gehe hin an den See, wenn das Wasser niedrig und hell steht, so wird er mit guten Augen die Turmspitzen und andere Häuser in der Tiefe erblicken.
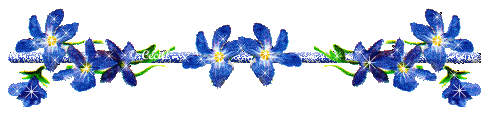
Anmerkung
Im westlichen Irland erzählte ein Bauer eine ähnliche Sage. Geht man an einem schönen Sommerabend, wenn die Sonne gerade hinter die Berge sinkt, zu dem See und kommt man zu einem kleinen Überhang auf der Westseite, so hat man, wenn man sich bückt und in das Wasser schaut, den schönsten Anblick von der Welt, denn man sieht unter dem Wasser ganz deutlich eine große Stadt mit Palästen, langen Straßen und Plätzen.
Giraldus Cambrensis (aus dem 12ten Jahrh.) gedenkt einer Sage, daß der See Neagh vormals eine Quelle gewesen, welche das ganze Land überschwemmt habe.
Waldron hat eine Sage von der Insel Man, wonach ein Taucher in eine Stadt unter dem Meer kam, deren Pracht er nicht genug beschreiben kann und wo der Boden der Zimmer aus Edelsteinen zusammengesetzt war.
Es gibt auch in Deutschland und sonst genug Sagen von Seen, die an der Stelle ehemaliger Städte und Burgen stehen.
DER LÖWE UND DER FROSCH
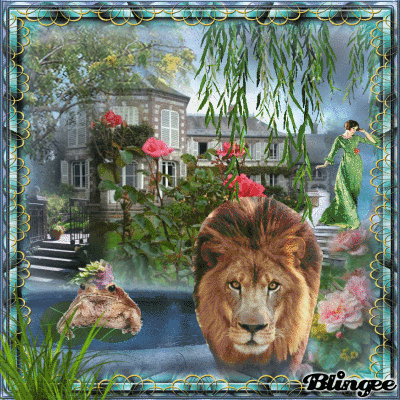
Es war ein König und eine Königin, die hatten einen Sohn und eine Tochter, die hatten sie herzlich lieb. Der Prinz ging oft auf die Jagd und blieb manchmal lange Zeit draußen im Wald, einmal aber kam er gar nicht wieder. Darüber weinte sich seine Schwester fast blind, endlich, wie sie's nicht länger aushalten konnte, ging sie fort in den Wald und wollte ihren Bruder suchen.
Als sie nun lange Wege gegangen war, konnte sie vor Müdigkeit nicht weiter, und wie sie sich umsah, da stand ein Löwe neben ihr, der tat ganz freundlich und sah so gut aus. Da setzte sie sich auf seinen Rücken, und der Löwe trug sie fort und streichelte sie immer mit seinem Schwanze und kühlte ihr die Backen. Als er nun ein gut Stück fortgelaufen war, kamen sie vor eine Höhle, da trug sie der Löwe hinein, und sie fürchtete sich nicht und wollte auch nicht herab springen, weil der Löwe so freundlich war.
Also ging's durch die Höhle, die immer dunkler war und endlich ganz stockfinster, und als das ein Weilchen gedauert hatte, kamen sie wieder an das Tageslicht in einen wunderschönen Garten. Da war alles so frisch und glänzte in der Sonne, und mittendrin stand ein prächtiger Palast. Wie sie ans Tor kamen, hielt der Löwe, und die Prinzessin stieg von seinem Rücken herunter. Da fing der Löwe an zu sprechen und sagte: "In dem schönen Haus sollst du wohnen und mir dienen, und wenn du alles erfüllst, was ich fordere, so wirst du deinen Bruder wieder sehen."
Da diente die Prinzessin dem Löwen und gehorchte ihm in allen Stücken. Einmal ging sie in dem Garten spazieren, darin war es so schön, und doch war sie traurig, weil sie so allein und von aller Welt verlassen war. Wie sie so auf und ab ging, ward sie einen Teich gewahr, und auf der Mitte des Teichs war eine kleine Insel mit einem Zelt.
Da sah sie, dass unter dem Zelt ein grasgrüner Laubfrosch saß, und hatte ein Rosenblatt auf dem Kopf statt einer Haube. Der Frosch guckte sie an und sprach: "Warum bist du so traurig?" "Ach", sagte sie, "warum sollte ich nicht traurig sein?" Und klagte ihm da recht ihre Not. Da sprach der Frosch ganz freundlich: "Wenn du was brauchst, so komm nur zu mir, so will ich dir mit Rat und Tat zur Hand gehen." "Wie soll ich dir das aber vergelten?" "Du brauchst mir nichts zu vergelten", sprach der Quakfrosch, "bring mir nur alle Tage ein frisches Rosenblatt zur Haube."
Da ging nun die Prinzessin wieder zurück und war ein bisschen getröstet, und sooft der Löwe etwas verlangte, lief sie zum Teich, da sprang der Frosch herüber und hinüber und hatte ihr bald herbeigeschafft, was sie brauchte. Auf eine Zeit sagte der Löwe: "Heut Abend esse ich gern eine Mückenpastete, sie muss aber gut zubereitet sein." Da dachte die Prinzessin, wie soll ich die herbeischaffen, das ist mir ganz unmöglich, lief hinaus und klagte es ihrem Frosch.
Der Frosch aber sprach: "Mach dir keine Sorgen, eine Mückenpastete will ich schon herbeischaffen." Darauf setzte er sich hin, sperrte rechts und links das Maul auf, schnappte zu und fing Mücken, soviel er brauchte. Darauf hüpfte er hin und her, trug Holzspäne zusammen und blies ein Feuer an. Wie's brannte, knetete er die Pastete und setzte sie über Kohlen, und es währte keine zwei Stunden, so war sie fertig und so gut, als einer nur wünschen konnte.
Da sprach er zu dem Mädchen: "Die Pastete kriegst du aber nicht eher, als bis du mir versprichst, dem Löwen, sobald er eingeschlafen ist, den Kopf abzuschlagen mit einem Schwert, das hinter seinem Lager verborgen ist." "Nein", sagte sie, "das tue ich nicht, der Löwe ist doch immer gut gegen mich gewesen." Da sprach der Frosch: "Wenn du das nicht tust, wirst du nimmer mehr deinen Bruder wieder sehen, und dem Löwen selber tust du auch kein Leid damit an."
Da fasste sie Mut, nahm die Pastete und brachte sie dem Löwen. "Die sieht ja recht gut aus", sagte der Löwe, schnupperte daran und fing gleich an rein zu beißen, aß sie auch ganz auf. Wie er nun fertig war, fühlte er eine Müdigkeit und wollte ein wenig schlafen; also sprach er zur Prinzessin: "Komm und setz dich neben mich und kraul mir ein bisschen hinter den Ohren, bis ich eingeschlafen bin."
Da setzt sie sich neben ihn, kraulte ihn mit der Linken und suchte mit der Rechten nach dem Schwert, welches hinter seinem Bette liegt. Wie er nun eingeschlafen ist, so zieht sie es hervor, drückt die Augen zu und haut mit einem Streich dem Löwen den Kopf ab. Wie sie aber wieder hinblickt, da war der Löwe verschwunden, und ihr lieber Bruder stand neben ihr, der küsste sie herzlich und sprach: "Du hast mich erlöst, denn ich war der Löwe und war verwünscht, es so lang zu bleiben, bis eine Mädchenhand aus Liebe zu mir dem Löwen den Kopf abhauen würde."
Darauf gingen sie miteinander in den Garten und wollten dem Frosch danken, wie sie aber ankamen, sahen sie, wie er nach allen Seiten herumhüpfte und kleine Späne suchte und ein Feuer anmachte. Als es nun recht hell brannte, hüpfte er selber hinein, und da brennt's noch ein bisschen, und dann geht das Feuer aus und steht ein schönes Mädchen da, das war auch verwünscht worden und die Liebste des Prinzen.
Da ziehen sie miteinander heim zu dem alten König und der Frau Königin, und wird eine große Hochzeit gehalten, und wer dabei gewesen, der ist nicht hungrig nach Haus gegangen.
DIE TREUEN TIERE
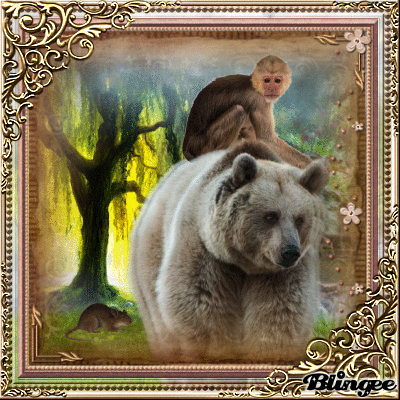
Es war einmal ein Mann, der hatte gar nicht viel Geld, und mit dem wenigen, das ihm übrig blieb, zog er in die weite Welt. Da kam er in ein Dorf, wo die Jungen zusammen liefen, schrien und lärmten. ’Was habt ihr vor, ihr Jungen?’ fragte der Mann. ’Ei,’ antworteten sie, ’da haben wir eine Maus, die muß uns tanzen, seht einmal was das für ein Spaß ist! wie die herum trippelt!’ Den Mann aber dauerte das arme Tierchen, und er sprach ’laßt die Maus laufen, ihr Jungen, ich will euch auch Geld geben.’ Da gab er ihnen Geld, und sie ließen die Maus gehen, die lief, was sie konnte, in ein Loch hinein.
Der Mann ging fort, und kam in ein anderes Dorf, da hatten die Jungen einen Affen, der mußte tanzen und Purzelbäume machen, und sie lachten darüber, und ließen dem Tier keine Ruh. Da gab ihnen der Mann auch Geld, damit sie den Affen losließen. Danach kam der Mann in ein drittes Dorf, da hatten die Jungen einen Bären, der musste sich aufrecht setzen und tanzen, und wenn er dazu brummte, war´s ihnen eben recht. Da kaufte ihn der Mann auch los, und der Bär war froh, dass er wieder auf seine vier Beine kam, und trabte fort.
Der Mann aber hatte nun sein bisschen übriges Geld ausgegeben, und hatte keinen roten Heller mehr in der Tasche. Da sprach er zu sich selber ’der König hat so viel in seiner Schatzkammer, was er nicht braucht, Hungers kannst du nicht sterben, du willst da etwas nehmen, und wenn du wieder zu Geld kommst, kannst du`s ja wieder hineinlegen.’
Also machte er sich über die Schatzkammer, und nahm sich ein wenig davon, allein beim Herausschleichen ward er von den Leuten des Königs erwischt. Sie sagten er wäre ein Dieb, und führten ihn vor Gericht, und weil er Unrecht getan hatte, ward er verurteilt dass er in einem Kasten sollte aufs Wasser gesetzt werden. Der Kastendeckel war voll Löcher : damit Luft hinein konnte, auch ward ihm ein Krug Wasser und ein Laib Brot mit hinein gegeben.
Wie er nun so auf dem Wasser schwamm und recht in Angst war, hörte er was krabbeln am Schloß, nagen und schnauben; auf einmal springt das Schloß auf, und der Deckel fährt in die Höhe, und stehen da Maus, Affe und Bär, die hattens getan; weil er ihnen geholfen hatte, wollten sie ihm wieder helfen. Nun wußten sie aber nicht was sie noch weiter tun sollten, und ratschlagten mit einander.
Indem kam ein weißer Stein auf dem Wasser daher geschwommen, der sah aus wie ein rundes Ei. Da sagte der Bär ’der kommt zu rechter Zeit, das ist ein Wunderstein, wem der eigen ist, der kann sich wünschen wozu er nur Lust hat.’ Da fing der Mann den Stein, und wie er ihn in der Hand hielt, wünschte er sich ein Schloß mit Garten und Marstall, und kaum hatte er den Wunsch gesagt, so saß er in dem Schloß mit dem Garten und dem Marstall, und war alles so schön und prächtig, dass er sich nicht genug verwundern konnte.
Nach einer Zeit zogen Kaufleute des Wegs vorbei. ’Sehe einer,’ riefen sie, ’was da für ein herrliches Schloß steht, und das letztemal, wie wir vorbei kamen, lag da noch schlechter Sand.’ Weil sie nun neugierig waren, gingen sie hinein, und erkundigten sich bei dem Mann wie er alles so geschwind hätte bauen können. Da sprach er ’das hab ich nicht getan, sondern mein Wunderstein.’ ’Was ist das für ein Stein ?’ fragten sie.
Da gieg er hin und holte ihn, und zeigte ihn den Kaufleuten. Sie hatten große Lust dazu, und fragten ob er nicht zu erhandeln wäre, auch boten sie ihm alle ihre schönen Waren dafür. Dem Manne stachen die Waren in die Augen, und weil das Herz unbeständig ist, ließ er sich betören, und meinte die schönen Waren wären mehr wert, als sein Wunderstein, und gab ihn hin.
Kaum aber hatte er ihn aus den Händen gegeben, da war auch alles Glück dahin, und er saß auf einmal wieder in dem verschlossenen Kasten auf dem Fluß, und hatte nichts als einen Krug Wasser und einen Laib Brot. Die treuen Tiere, Maus, Affe und Bär, wie sie sein Unglück sahen, kamen wieder herbei, und wollten ihm helfen, aber sie konnten nicht einmal das Schloß aufsprengen, weil’s viel fester war als das erstemal.
Da sprach der Bär ’wir müssen den Wunderstein wieder schaffen, oder es ist alles umsonst.’ Weil nun die Kaufleute in dem Schloß noch wohnten, gingen die Tiere mit einander da hin, und wie sie nahe dabei kamen, sagte der Bär ’Maus, guck einmal durchs Schlüsselloch, und sieh was anzufangen ist; du bist klein, dich merkt kein Mensch.’ Die Maus war willig, kam aber wieder und sagte ’es geht nicht, ich habe hineingeguckt, der Stein hängt unter dem Spiegel an einem roten Bändchen, und hüben und drüben sitzen ein paar große Katzen mit feurigen Augen, die sollen ihn bewachen.’
Da sagten die andern ’geh nur wieder hinein, und warte bis der Herr im Bett liegt und schläft, dann schleich dich durch ein Loch hinein, und kriech aufs Bett, und zwick ihn an der Nase, und beiß ihm seine Haare ab.’ Die Maus ging wieder hinein, und tat wie die anderen gesagt hatten, und der Herr wachte auf, rieb sich die Nase, war ärgerlich und sprach ’die Katzen taugen nichts, sie lassen die Mäuse herein, die mir die Haare vom Kopf abbeißen,’ und jagte sie alle beide fort. Da hatte die Maus gewonnen Spiel.
Wie nun der Herr die andere Nacht wieder eingeschlafen war, machte sich die Maus hinein, knupperte und nagte an dem roten Band, woran der Stein hing, so lange bis es entzwei war, und der Stein herunter fiel. Dann schleifte sie ihn bis zur Haustür. Das ward aber der armen kleinen Maus recht sauer, und sie sprach zum Affen, der schon auf der Lauer stand ’nimm du nun deine Pfote und hol´s ganz heraus.’ Das war dem Affen ein Leichtes, der nahm den Stein in die Hand, und sie gingen so mit einander bis zum Fluß.
Da sagte der Affe ’wie sollen wir nun zu dem Kasten kommen?’ Der Bär antwortete ’das ist bald geschehen, ich geh ins Wasser und schwimme. Affe, setz du dich auf meinen Rücken, halt dich aber mit deinen Händen fest, und nimm den Stein ins Maul. Mäuschen, du kannst dich in mein rechtes Ohr setzen.’ Also taten sie und schwammen den Fluß hinab. Nach einiger Zeit war´s dem Bären so still, fing an zu schwatzen, und sagte ’hör, Affe, wir sind doch brave Cameraden, was meinst du?’ Der Affe aber antwortete nicht und schwieg still. ’Ist das Manier?’ sagte der Bär, ’willst du deinem Cameraden keine Antwort geben? ein schlechter Kerl, der nicht antwortet!’
Da konnte sich der Affe nicht länger zurückhalten, er ließ den Stein ins Wasser fallen, und rief ’dummer Kerl, wie konnte ich mit dem Stein im Mund dir antworten? jetzt ist er verloren, und daran bist du schuld.’ ’Zank nur nicht,’ sagte der Bär, ’wir wollen schon etwas erdenken.’ Da beratschlagten sie sich und riefen die Laubfrösche, Unken und alles Getier, das im Wasser lebt, zusammen, und sagten ’es wird ein gewaltiger Feind über euch kommen, macht dass ihr Steine zusammen schafft, so viel ihr könnt, so wollen wir euch eine Mauer bauen, die euch schützt.’
Da erschraken die Tiere, und brachten Steine von allen Seiten herbeigeschleppt, endlich kam auch ein alter dicker Quakfrosch aus dem Grund heraufgerudert, und hatte das rote Band mit dem Wunderstein im Mund. Da war der Bär froh, nahm dem Frosch seine Last ab, sagte es wäre alles gut, sie könnten wieder nach Hause gehen, und machte einen kurzen Abschied.
Darauf fuhren die drei den Fluß zu dem Mann im Kasten, sprengten den Deckel mit Hülfe des Steins, und kamen zu rechter Zeit, denn er hatte das Brot schon aufgezehrt und das Wasser getrunken, und war schon halb verschmachtet. Wie er aber den Wunderstein wieder in die Hände bekam, wünschte er sich eine gute Gesundheit, und versetzte sich in sein schönes Schloß mit dem Garten und dem Marstall; da lebte er vergnügt, und die drei Tiere blieben bei ihm, und hatten´s gut ihr Lebenlang.
DAS GEBÜCKTE MÜTTERCHEN
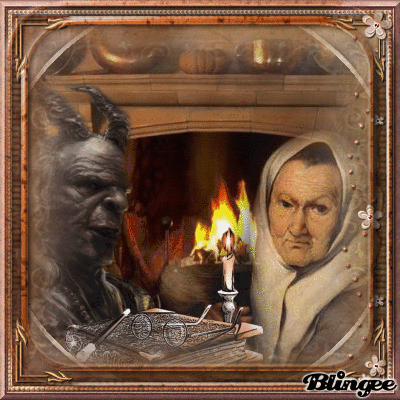
Margareth Barrett war in ihrer Jugend schlank, artig und wohlgesittet und zeichnete sich durch die Vereinigung zweier Eigenschaften aus, die man nicht oft beisammen findet. Sie war nämlich eine sehr sparsame Hausfrau und zugleich die beste Tänzerin in ihrem Geburtsort dem Dorfe Ballyhuley.
Gegenwärtig ist sie an den sechszigen und in den letzten zehn Jahren ihres Lebens durchaus nicht mehr im Stande gewesen, sich aufzurichten. Sie geht gebückt, beinahe bis zur Erde, doch ihre Glieder gebraucht sie, so weit es in dieser Stellung möglich ist, mit völliger Freiheit; ihre Gesundheit ist gut, ihr Geist kräftig und in der Familie ihres ältesten Sohns, bei welchem sie seit dem Tode ihres Mannes lebt, verrichtet sie alle häuslichen Arbeiten, welche ihr Alter und jenes Gebrechen zulassen.
Sie wäscht die Kartoffeln, macht Feuer an, kehrt das Haus (lauter Geschäfte, wobei ihr, wie sie mit guter Laune bemerkt, ihr krummer Rücken sehr zustatten kommt), spielt mit den Kindern und erzählt ihren Hausgenossen und den Freunden aus der Nachbarschaft, die sich oft rund um sie beim Feuer versammeln, ihr in den langen Winterabenden zuzuhören, allerlei Geschichten.
Die anziehende Kraft ihrer Unterhaltung wird sehr gepriesen sowohl wegen ihrer guten Laune als auch wegen ihrer Erzählungen; und drollige und scherzhafte Begebenheiten, die sich auf ihre gekrümmte Gestalt beziehen, dann aber das Ereignis selbst, welches Schuld an diesem Mißgeschick ist, sind das Lieblingskapitel ihrer Gespräche.
So hörte man sie unter andern erzählen, wie an einem gewissen Tage, bei dem Schluß einer schlechten Ernte, als verschiedene Pächter in der Gegend, wo sie lebte, auf dem Feld eine Bittschrift um Verminderung des Pachtgeldes beschlossen hätten, das Papier zum Schreiben sei auf ihren Rücken gelegt und dieser als ein leidlich guter Tisch befunden worden.
Margrethe, wie alle gescheite Erzähler, pflegte sich sowohl was die Ausführlichkeit als den Inhalt ihrer Geschichten betraf, nach den Zuhörern und den Umständen zu richten. Sie wußte, daß bei hellem Tageslicht, wenn die Sonne glänzend scheint, die Bäume knospen, die Vögel rings um uns singen, rührige und gesprächige Menschen ihren Geschäften oder Vergnügungen nachgehen; sie wußte, doch gewißlich ohne die Ursache zu kennen oder sich viel darum zu bekümmern, daß wenn wir mit dem wirklichen Leben und der wirklichen Welt beschäftigt sind, der glaubige Sinn fehlt, ohne welchen Erzählungen, die sonst aufs gewaltigste die Teilnahme anregen, einen Eindruck hinterlassen.
In solchen Stunden war Margareth kurz, hielt sich nur an Tatsachen und berührte das Wunderbare gar nicht. Doch an einem Weihnachtsabend bei dem flackernden Herde, wenn Ungläubigkeit aus allen Gesellschaften verbannt ist, wenigstens bei stiller und einfacher Lebensart, als eine Eigenschaft, welche, um das geringste zu sagen, in diese Zeit nicht paßt: wenn die Winde in düstern Dezembertagen kalt um die Mauern pfeifen und durch die Türen des kleinen Hauses dringen, eine Mahnung an seine Bewohner, daß wenn die Welt von Elementen, die stärker als menschliche Kräfte sind, geplagt wird, sie auch Wesen einer höheren Natur besuchen - in solchen Stunden pflegte Margareth Barrett ihren Erinnerungen und ihrer Phantasie, oder beiden, ohne Rückhalt nachzugeben, und bei einer solchen Gelegenheit war es, wo sie umständlich erzählte, wie sie zu dieser gekrümmten Gestalt gekommen sei.
»Es war gerade unter allen Tagen im Jahr, der Tag vor dem Mai, wo ich hinaus in den Garten ging, die Kartoffel zu jäten. Ich wäre den Tag nicht herausgegangen, wäre ich nicht traurig und kummervoll gewesen und gerne für mich allein. Die Burschen und Mädchen im Haus lachten alle, scherzten und machten Bälle zum Schleudern oder Bänder zurecht für die Vermummten am folgenden Tage.
Ich konnte das nicht ertragen. Eben erst die vergangenen Ostern, und die letzten Ostern waren es zehn Jahre, ich werde die Zeit niemals vergessen, hatte ich meinen armen Mann begraben und ich dachte daran, wie vergnügt und voller Freude ich war, so manches lange Jahr vorher eben an diesem Tage, als Robin neben mir saß und ich die Bänder für den Schleuderball schnitt und nähte, die ich den folgenden Tag den Burschen geben wollte mit dem stolzen Gefühl, allen Mädchen an den Ufern des Blackwaters vorgezogen zu werden von dem hübschesten und besten Schleuderer in dem Dorf.
Ich verließ das Haus und ging in den Garten. Ich blieb da den ganzen Tag und kam nicht heim zum Essen. Ich weiß nicht, wie es war, und nur soviel, daß ich in kummervollen Gedanken immer fortfuhr zu jäten, einige von den alten Liedern singend, die ich aber und abermals in den Tagen gesungen habe, die nun dahin sind, vor dem, der nimmer zurückkehrt, sie anzuhören. Die Wahrheit zu sagen, es war mir unerträglich, hinzugehen und schweigend und finster zu Haus zu sitzen, unter Menschen, die lustig und jung waren und ihre besten Tage vor sich hatten.
Es ward spät, ehe ich an die Heimkehr dachte und ich verließ den Garten erst einige Zeit nach Sonnenuntergang. Der Mond stand am Himmel, obgleich kein Wölkchen zu sehen war und hier und da ein Stern blinkte, so war der Tag noch nicht lang genug verschwunden, um helles Mondlicht zu haben; doch schien er hinlänglich, um auf einer Seite alle Dinge in des Himmels Licht bleich und silberfarbig zu machen und ein dünner Nebel begann soeben über die Felder hin zu ziehen.
Auf der andern Seite, nach Sonnenuntergang zu, war noch mehr Tageslicht und der Himmel blickte ängstlich, rot und feurig durch die Bäume gleich als ob unten eine große Stadt in Brand aufloderte. Überall Schweigen, wie auf einem Kirchhof, nur dann und wann hörte man in der Ferne einen Hund bellen, oder eine eben gemelkte Kuh brüllen. Kein lebendes Wesen war zu sehen, weder auf dem Wege, noch auf dem Feld.
Ich verwunderte mich erst, dann erinnerte ich mich, daß es der Abend vor dem Mai war und daß mancherlei, Gutes und Böses, in dieser Nacht umher schwärme und ich die Gefahren meiden müsse, wie jeder andre. Ich ging so rasch zu, als ich konnte und gelangte bald an das Ende der Mauer, die das Gut umgibt, wo die Bäume hoch und dicht auf jeder Seite des Wegs aufsteigen und sich meist mit den Wipfeln berühren.
Mein Herz hatte ein Vorgefühl, als ich unter ihre Schatten kam. Die Öffnung oben ließ so viel Licht herab, daß ich einen Steinwurf weit vor mir sehen konnte. Plötzlich hörte ich in den Ästen auf der rechten Seite des Wegs ein Rascheln und sah etwas, das einem kleinen schwarzen Ziegenbock ähnlich war, nur mit langen, breiten Hörnern auswärts gerichtet statt rückwärts gekrümmt; es stand auf den Hinterfüßen am Rand der Mauer und schaute auf mich herab.
Der Atem stockte mir, und ich konnte mich fast eine Minute lang nicht bewegen. Ich mußte, wie es auch zuging, meine Augen unverwandt dahin richten, aber es schaute immer starr auf mich herab. Endlich nahm ich mich zusammen und ging fort, aber ich hatte noch keine zehn Schritte getan, als ich dieselbe Erscheinung auf der Mauer zu meiner linken erblickte, genau in derselben Stellung, nur noch drei- oder viermal so hoch und beinahe so groß, als der größte Mann.
Die Hörner sahen schrecklich aus, es starrte mich an, wie dort. Meine Beine zitterten, die Zähne schnatterten und ich glaubte jeden Augenblick ich würde tot hinfallen. Endlich war es mir, als wäre ich gezwungen zu gehen und ich ging wirklich fort, aber ich fühlte nicht, wie ich mich bewegte oder wie meine Beine mich forttrugen.
Eben als ich an der Stelle vorbei kam, wo das entsetzliche Wesen stand, hörte ich ein Geräusch, als ob etwas die Mauer herabspränge und hatte ein Gefühl, als wenn ein schweres Tier auf mich stürzte, das mit den Vorderfüßen mich fest um die Schultern packend die Hinterfüße in meinen faltigen, zusammengesteckten Rock verwickelte.
Ich verwunderte mich noch und werde es tun, solange ich lebe, wie ich die heftige Erschütterung ertragen habe, aber ich fiel weder, noch schwankte ich bei der Wucht, sondern ging darauflos, als hätte ich die Stärke von zehn Männern; jedoch fühlte ich, daß ich gezwungen war, mich fortzubewegen und nicht die Macht hatte, still zu stehen, wie ich es wünschte.
Doch ich keuchte ängstlich, ich wußte was ich tat, so deutlich, als ich es in diesem Augenblick weiß; ich versuchte zu schreien, doch ich konnte es nicht, versuchte zu laufen, aber es war nicht möglich, versuchte rückwärts zu schauen, aber Kopf und Nacken waren wie in einen Schraubstock gespannt.
Ich konnte nur meine Augen nach beiden Seiten hindrehen und dann erblickte ich so klar und deutlich, als wäre es in vollem Licht der lieben Sonne, einen schwarzen und gespaltenen Fuß fest auf meine Schulter gelegt. Ich hörte ein leises Atmen in meinem Ohr, ich fühlte, daß bei jedem Schritt, den ich tat, meine Beine an die Füße jener Kreatur stießen, die auf meinem Rücken hing.
Endlich sah ich das Haus und es war mir ein willkommener Anblick, denn ich dachte, ich würde erlöst, wenn ich es erreichte. Ich kam bald nah an die Türe, doch sie war verschlossen, ich schaute nach dem kleinen Fenster, aber es war auch verschlossen, denn sie waren an diesem Abend vorsichtiger als ich; ich sah innen das Licht durch die Spalten in der Türe, ich hörte sie drinnen reden und lachen. Ich fühlte, nur drei Ellen weit war ich von denen entfernt, die alles würden aufgeboten haben, mich zu retten. Und möge Gott mich bewahren, noch einmal zu fühlen, was ich in jener Nacht gefühlt habe!
Ich fand mich gehalten von etwas, das nicht gut sein konnte, ohne Macht mir zu helfen, oder meine Freunde anzurufen, oder meine Hand auszustrecken, um zu klopfen, oder nur meinen Fuß zu heben, um an die Türe zu stoßen und sie wissen zu lassen, daß ich außen wäre. Es war, als ob meine Hände an die Seite wüchsen oder meine Füße an den Boden geheftet wären, oder als hätte das Gewicht eines Felsen sie daran befestigt.
Endlich dachte ich daran, mich zu bekreuzigen und meine rechte Hand, die sonst nichts tat, tat es für mich. Die Last blieb auf meinem Rücken und alles war wie zuvor. Ich bekreuzigte mich abermals, es war immer dasselbe. Ich gab mich für verloren, doch ich bekreuzigte mich zum drittenmal und meine Hand hatte nicht sobald das Zeichen vollendet, als ich fühlte, wie die Bürde von meinem Rücken sprang. Die Türe fuhr auf, als wenn der Donner in sie einschlüge und ich stürzte vorwärts gerade auf die Stirne mitten in den Flur. Als ich wieder aufstand, war mein Rücken krumm, und ich konnte mich nicht wieder gerade aufrichten von jener Nacht an, bis zu dieser Stunde.«
Es entstand eine kleine Stille, als Margareth Barrett geendigt hatte. Diejenigen, welche die Geschichte schon kannten, hatten mit dem Ausdruck halb befriedigter Teilnahme, gemischt indessen mit jenem ernsthaften und feierlichen Gefühl, welches eine Erzählung übernatürlicher Wunder erregt, sooft sie auch erzählt wird, zugehört.
Sich auf ihren Sitzen bewegend verließen sie die Stellung, in welcher sie während der Erzählung verharrt hatten und nahmen eine andre an, welche zu erkennen gab, daß ihre Neugierde in Beziehung auf die Ursache dieser seltsamen Begebenheit schon längst befriedigt war. Diejenigen aber, welche sie noch nicht gekannt hatten, behielten den Ausdruck und die Stellung gespannter Aufmerksamkeit und ängstlicher, aber feierlicher Erwartung.
Ein Enkel der Margareth von etwa neun Jahren (doch kein Kind des Sohnes, bei welchem sie lebte), hatte noch nie die Geschichte gehört. So wie seine Aufmerksamkeit wuchs, drängte es sich immer fester an die Seite der alten Frau und beim Schluß schaute es unverwandt nach ihr hin, mit seinem Leib über ihre Knie zurück gebogen, und sein Gesicht zu ihr hinauf gerichtet, mit einem Ausdruck, in welchem die Neigung zu weinen mit der Neugierde zu kämpfen schien.
Nach einem augenblicklichen Stillschweigen konnte es nicht länger seine Neugierde bezähmen, und ihre grauen Locken mit einem Händchen fassend, während Tränen der Furcht und des Erstaunens gerade von seinen Augenwimpern herab tröpfelten, rief es: »Großmutter, wer war das?«
Margareth lächelte erst nach dem ältern Teil der Zuhörer, dann nach ihrem Enkel hin und ihm sanft über die Stirne streichelnd sagte sie:
»Es war die Phuka!«
DIE SPRINGWURZEL
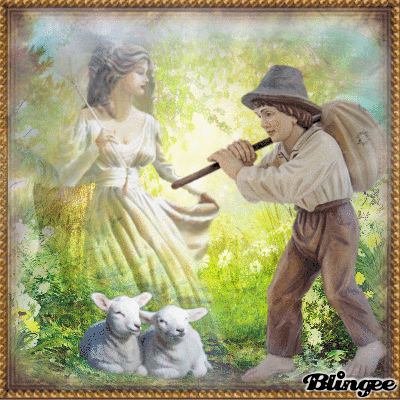
Vorzeiten hütete ein Schäfersmann friedlich auf dem Köterberg, da stand, als er sich einmal umwendete, ein prächtiges Königsfräulein vor ihm und sprach: »Nimm die Springwurzel und folge mir nach.« Die Springwurzel erhält man dadurch, daß man einem Grünspecht (Elster oder Wiedehopf) sein Nest mit einem Holz zukeilt; der Vogel, wie er das bemerkt, fliegt alsbald fort und weiß die wunderbare Wurzel zu finden, die ein Mensch noch immer vergeblich gesucht hat. Er bringt sie im Schnabel und will sein Nest damit wieder öffnen; denn hält er sie vor den Holzkeil, so springt er heraus, wie vom stärksten Schlag getrieben.
Hat man sich versteckt und macht nun, wie er herankommt, einen großen Lärm, so läßt er sie erschreckt fallen (man kann aber auch nur ein weißes oder rotes Tuch unter das Nest breiten, so wirft er sie darauf, sobald er sie gebraucht hat). Eine solche Springwurzel besaß der Hirt, ließ nun seine Tiere herumtreiben und folgte dem Fräulein.
Sie führte ihn bei einer Höhle in den Berg hinein. Kamen sie zu einer Türe oder einem verschlossenen Gang, so mußte er seine Wurzel vorhalten, und alsbald sprang sie krachend auf. Sie gingen immer fort, bis sie etwa in die Mitte des Bergs gelangten, da saßen noch zwei Jungfrauen und spannen emsig; der Böse war auch da, aber ohne Macht und unten an den Tisch, vor dem die beiden saßen, festgebunden.
Ringsum war in Körben Gold und leuchtende Edelsteine aufgehäuft, und die Königstochter sprach zu dem Schäfer, der da stand und die Schätze anlusterte: »Nimm dir, soviel du willst.« Ohne Zaudern griff er hinein und füllte seine Taschen, soviel sie halten konnten, und wie er, also reich beladen, wieder hinaus wollte, sprach sie: »Aber vergiß das Beste nicht!« Er meinte nicht anders, als das wären die Schätze, und glaubte sich gar wohl versorgt zu haben, aber es war das Springwort.
Wie er nun hinaustrat, ohne die Wurzel, die er auf den Tisch gelegt, schlug das Tor mit Schallen hinter ihm zu, hart an die Ferse, doch ohne weiteren Schaden, wie wohl er leicht sein Leben hätte einbüßen können. Die großen Reichtümer brachte er glücklich nach Haus, aber den Eingang konnte er nicht wiederfinden.
OLL RINKRANK
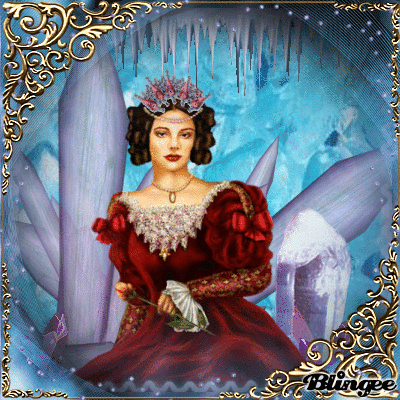
Es war einmal ein König, und der hatte eine Tochter; der hatte er einen gläsernem Berg machen lassen und hatte gesagt: Wer darüber laufen könne, ohne zu fallen, der sollte seine Tochter zur Frau haben.
Nun war da auch einer, der mochte die Königstochter von Herzen gern leiden. Der fragte den König, ob er seine Tochter nicht haben könnte? "Ja", sagte der König; "wenn er über den Berg laufen könnte, ohne zu fallen, dann könnte er sie haben. Da sagte die Königstochter, sie wollte mit ihm hinüberlaufen und ihn halten, wenn er fallen sollte.
Da lief sie nun mit ihm hinüber; wie sie aber mitten drauf waren, glitt die Königstochter aus und fiel, und der Glasberg öffnete sich, und sie stürzte da hinein, und der Bräutigam konnte nicht sehen, wo sie geblieben war; denn der Berg hatte sich gleich wieder geschlossen. Da jammerte und weinte er so sehr; und der König war auch so sehr traurig und ließ den Berg wieder wegbrechen und meinte, er könnte sie wieder heraus kriegen; aber sie konnten die Stelle nicht finden, wo sie hinuntergefallen war.
Unterdessen war die Königstochter ganz tief auf den Grund in eine große Höhle gekommen. Da kam ihr so ein alter Kerl mit einem ganz langen grauen Bart entgegen; und er sagte, wenn sie seine Magd werden wollte und alles täte, was er ihr befehle, dann sollte sie am Leben bleiben; sonst würde er sie umbringen. Da tat sie alles, was er ihr sagte.
Am Morgen nahm er seine Leiter aus der Tasche, legte sie an den Berg und stieg damit aus dem Berg heraus; und dann zog er die Leiter oben zu sich herauf. Und dann musste sie sein Essen kochen und sein Bett machen und alle Arbeit tun; und dann, wenn er wieder nach Hause kam, brachte er immer einen Haufen Gold und Silber mit.
Als sie viel Jahre bei ihm gewesen und ganz alt geworden war, da nannte er sie "Frau Mansrot", und sie musste ihn "Oll Rinkrank" nennen. Als er wieder einmal hinaus war, da machte sie ihm sein Bett und wusch seine Schüsseln. Und dann machte sie die Türen und Fenster alle dicht zu, und da war nur ein Schiebefenster, wo Licht hinein schien; das ließ sie offen. Als der alte Rinkrank nun wiederkam, da klopfte er an die Tür und rief: "Fro Mansrot, mach mir die Türe auf!" - "Nein", sagte sie, "ich tu' dir, oll Rinkrank, die Türe nicht auf." Da sagte er:
"Hier sta ik arme Rinkrank
Up min söventein Benen lank,
Up min en vergällen Vot (vergoldeten Fuß),
Fro Mansrot, wask mi d'Schöttels!"
"Ich habe deine Schüsseln schon gewaschen!" sagte sie. Da sagte er wieder:
"Hier sta ik arme Rinkrank
Up min söventein Benen lank,
Up min en vergällen Vot,
Fro Mansrot, mak mi't Bedd!"
"Ich habe dein Bett schon gemacht", sagte sie. Da sagte er wieder:
"Hier sta ik arme Rinkrank
Up min söventein Benen lank,
Up min en vergällen Vot,
Fro Mansrot, do mi d'Dör apen!"
Da lief er rund um sein Haus und sah, dass die kleine Luke offen war; da dachte er: "Du musst doch einmal nachgucken, was sie da wohl macht und warum sie die Tür nicht aufmachen will."
Da will er nun durch die Luke hindurchgucken und kann den Kopf nicht durchkriegen wegen seinem langen Bart. Da steckt er seinen Bart erst durch die Luke, und als er ihn da hindurch gesteckt hatte, da kam die Frau Mannsrot herbei und zog die Luke grade mit einem Band zu, das sie daran gebunden hatte, und so blieb der Bart fest darin sitzen.
Da fing er jämmerlich an zu schreien, das täte ihm so weh. Und da bat er sie, sie möchte ihn doch wieder loslassen. Da sagte sie : Eher nicht, als bis er ihr die Leiter gäbe, mit der er zum Berg heraussteige. Da mochte er nun wollen oder nicht, er musste ihr sagen, wo die Leiter wäre. Da band sie ein ganz langes Band an das Schiebefenster, und dann legte sie die Leiter an und stieg aus dem Berg heraus; und wie sie oben ist, da zieht sie das Schiebefenster auf.
Dann ging sie zu ihrem Vater und erzählte ihm, wie es ihr ergangen war. Da freute sich der König sehr, und ihr Bräutigam lebte auch noch. Und nun gingen sie hin und gruben den Berg auf und fanden den alten Rinkrank mit all seinem Gold und Silber darin. Da ließ der König den alten Rinkrank totmachen, und sein Gold und Silber nahm er mit sich, fort.
Die Königstochter aber kriegte noch den früheren Bräutigam zum Mann, und sie lebten vergnügt und herrlich und in Freuden.
DER SOLDAT UND DER SCHREINER

Es wohnten in einer Stadt zwei Tischler, deren Häuser stießen aneinander, und jeder hatte einen Sohn; die Kinder waren immer beisammen, spielten miteinander und hießen darum das Messerchen und Gäbelchen, die auch immer nebeneinander auf den Tisch gelegt werden. Als sie nun beide groß waren, wollten sie auch voneinander nicht weichen, der eine war aber mutig und der andere furchtsam, da ward der eine Soldat, der andere lernte das Handwerk. Wie die Zeit kam, dass dieser wandern musste, wollt ihn der Soldat nicht verlassen, und gingen sie zusammen aus.
Sie kamen nun in eine Stadt, wo der Tischler bei einem Meister in die Arbeit ging, der Soldat wollte da auch bleiben und verdingte sich bei demselben Meister als Hausknecht. Das wäre gut gewesen, aber der Soldat hatte keine Lust am Arbeiten, lag auf der Bärenhaut, und es dauerte nicht lang, so wurde er vom Meister weggeschickt; der Fleißige wollt ihn aus Treue nun nicht allein lassen, sagte dem Meister auf und zog mit ihm weiter. So ging's aber immerfort; hatten sie Arbeit, so dauerte es nicht lang, weil der Soldat faul war und fortgeschickt wurde, der andere aber ohne ihn nicht bleiben wollte.
Einmal kamen sie in eine große Stadt, weil aber der Soldat keine Hand regen wollte, ward er am Abend schon verabschiedet, und sie mussten dieselbe Nacht wieder hinaus. Da führte sie der Weg vor einen unbekannten großen Wald; der Furchtsame sprach: "Ich geh nicht hinein, darin springen Hexen und Gespenster herum." Der Soldat aber antwortete: "Ei was! Davor fürcht ich mich noch nicht!", ging voran, und der Furchtsame, weil er doch nicht von ihm lassen wollte, ging mit.
In kurzer Zeit hatten sie den Weg verloren und irrten in der Dunkelheit durch die Bäume, endlich sahen sie ein Licht. Das suchten sie auf und kamen zu einem schönen Schloss, das hell erleuchtet war, und draußen lag ein schwarzer Hund, und auf einem Teich neben saß ein roter Schwan; als sie aber hinein traten, sahen sie nirgends einen Menschen, bis sie in die Küche kamen, da saß noch eine graue Katze bei einem Topf am Feuer und kochte.
Sie gingen weiter und fanden viele prächtige Zimmer, die waren alle leer, in einem aber stand ein Tisch, mit Essen und Trinken reichlich besetzt. Weil sie nun großen Hunger hatten, machten sie sich daran und ließen sich's gut schmecken. Darnach sprach der Soldat: "Wenn du gegessen hast und satt worden bist, sollst du schlafen gehen!", machte eine Kammer auf, darin standen zwei schöne Betten. Sie legten sich, aber als sie eben einschlafen wollten, fiel dem Furchtsamen ein, dass sie noch nicht gebetet hätten, da stand er auf und sah in der Wand einen Schrank, den Schloss er auf, und war da ein Kruzifix mit zwei Gebetbüchern dabei. Gleich weckte er den Soldaten, dass er aufstehen musste, und sie knieten beide nieder und taten ihr Gebet; darnach schliefen sie ruhig ein.
Am andern Morgen kriegte der Soldat einen heftigen Stoß, dass er in die Höhe fuhr: "Du, was schlägst du mich", rief er dem andern zu, der aber hatte auch einen Stoß gekriegt und sprach: "Was stößt du mich, ich stoß dich nicht!" Da sagte der Soldat: "Es wird wohl ein Zeichen sein, dass wir hervor sollen." Wie sie nun herauskamen, stand schon ein Frühstück auf dem Tisch, der Furchtsame sprach aber: "Eh wir es anrühren, wollen wir erst nach einem Menschen suchen." "Ja", sagte der Soldat, "ich mein auch immer, die Katze hätt's gekocht und eingebrockt, da vergeht mir alle Lust."
Sie gingen also wieder von unten bis oben durchs Schloss, fanden aber keine Seele, endlich sagte der Soldat: "Wir wollen auch in den Keller steigen." Wie sie die Treppe herunter waren, sahen sie vor dem ersten Keller eine alte Frau sitzen; sie redeten sie an und sprachen: "Guten Tag! Hat Sie uns das gute Essen gekocht?" "Ja, Kinder, hat's euch geschmeckt?" Da gingen sie weiter und kamen zum zweiten Keller, davor saß ein Jüngling von vierzehn Jahren, den grüßten sie auch, er gab ihnen aber keine Antwort.
Endlich kamen sie in den dritten Keller, davor saß ein Mädchen von zwölf Jahren, das antwortete ihnen auch nicht auf ihren Gruß. Sie gingen noch weiter durch alle Keller, fanden aber weiter niemand. Wie sie nun wieder zurückkamen, war das Mädchen von seinem Sitz aufgestanden, da sagten sie zu ihm: "Willst du mit uns hinaufgehen?"
Es sprach aber: "Ist der rote Schwan noch oben auf dem Teich?" "Ja, wir haben ihn beim Eingang gesehen." "Das ist traurig, so kann ich nicht mitgehen." Der Jüngling war auch aufgestanden, und als sie zu ihm kamen, fragten sie ihn: "Willst du mit uns hinaufgehen?" Er aber sprach: "Ist der schwarze Hund noch auf dem Hof?" "Ja, wir haben ihn beim Eingang gesehen." "Das ist traurig, so kann ich nicht mit euch gehen."
Als sie zu der alten Frau kamen, hatte sie sich auch aufgerichtet: "Mütterchen", sprachen sie, "wollt Ihr mit uns hinaufgehen?" "Ist die graue Katze noch oben in der Küche?" "Ja, sie sitzt auf dem Herd bei einem Topf und kocht." "Das ist traurig, eh ihr nicht den roten Schwan, den schwarzen Hund und die graue Katze tötet, können wir nicht aus dem Keller heraus."
Als die zwei Gesellen wieder oben in die Küche kamen, wollten sie die Katze streicheln, sie machte aber feurige Augen und sah ganz wild aus. Nun war noch eine kleine Kammer übrig, in der sie nicht gewesen waren, wie sie die aufmachten, war sie ganz leer, nur an der Wand ein Bogen und Pfeil, ein Schwert und eine Eisenzange. Über Bogen und Pfeil standen die Worte: "Das tötet den roten Schwan", über dem Schwert: "Das haut dem schwarzen Hund den Kopf herunter", und über der Zange: "Das kneift der grauen Katze den Kopf ab". "Ach", sagte der Furchtsame, "wir wollen fort von hier", der Soldat aber: "Nein, wir wollen die Tiere aufsuchen."
Sie nahmen die Waffen von der Wand und gingen in die Küche, da standen die drei Tiere, der Schwan, der Hund und die Katze, beisammen, als hätten sie was Böses vor. Wie der Furchtsame das sah, lief er wieder fort; der Soldat sprach ihm ein Herz ein, er hingegen wollte erst etwas essen; wie er gegessen hatte, sagte er: "In einem Zimmer hab ich Harnische gesehen, da will ich einen zuvor anlegen." Als er in dem Zimmer war, wollt er sich fort helfen und sprach: "Es ist besser, wir steigen zum Fenster hinaus, was kümmern uns die Tiere!" Wie er aber zum Fenster trat, war ein starkes Eisengitter davor.
Nun konnte er's nicht länger verreden, ging zu den Harnischen und wollte einen anziehen, aber sie waren alle zu schwer. Da sagte der Soldat: "Ei was, lass uns so gehen, wie wir sind." "Ja", sprach der andere, "wenn unser noch drei wären." Wie er die Worte sprach, da flatterte eine weiße Taube außen ans Fenster und stieß daran, der Soldat machte ihr auf, und wie sie herein war, stand ein schöner Jüngling vor ihnen, der sprach: "Ich will bei euch sein und euch helfen", und nahm Bogen und Pfeil. Der Furchtsame sprach zu ihm, er hätt's am besten mit dem Bogen und Pfeil, nach dem Schuss wär's gut, und er könnte hingehen, wohin er Lust hätte, sie aber müssten mit ihren Waffen den Zaubertieren näher auf den Leib. Da gab der Jüngling ihm den Bogen und Pfeil und nahm das Schwert.
Da gingen alle drei zur Küche, wo die Tiere noch beisammen standen, und der Jüngling hieb dem schwarzen Hund den Kopf ab, und der Soldat packte die graue Katze mit der Zange, und der Furchtsame stand hinten und schoss den roten Schwan tot. Und wie die drei Tiere nieder fielen, in dem Augenblick kam die Alte und ihre zwei Kinder mit großem Geschrei aus dem Keller gelaufen: "Ihr habt meine liebsten Freunde getötet, ihr seid Verräter", drangen auf sie und wollten sie ermorden.
Aber die drei überwältigten sie und töteten sie mit ihren Waffen, und wie sie tot waren, fing auf einmal ein wunderliches Gemurmel ringsherum an und kam aus allen Ecken. Der Furchtsame sprach: "Wir wollen die drei Leichen begraben, es waren doch Christen, das haben wir am Kruzifix gesehen." Sie trugen sie also hinaus auf den Hof, machten drei Gräber und legten sie hinein.
Während der Arbeit nahm aber das Gemurmel im Schloss immer zu, ward immer lauter, und wie sie fertig waren, hörten sie ordentlich Stimmen darin, und einer rief: "Wo sind sie? Wo sind sie?" Und weil der schöne Jüngling nicht mehr da war, ward ihnen Angst, und sie liefen fort. Als sie ein wenig weg waren, sagte der Soldat: "Ei, das ist unrecht, dass wir so fortgelaufen sind, wir wollen umkehren und sehen, was dort ist." "Nein", sagte der andere, "ich will mit dem Zauberwesen nichts zu tun haben und mein ehrliches Auskommen in der Stadt suchen."
Aber der Soldat ließ ihm keine Ruhe, bis er mit ihm zurückging. Wie sie vors Schloss kamen, war alles voll Leben, Pferde sprangen durch den Hof, und Bediente liefen hin und her. Da gaben sie sich für zwei arme Handwerker aus und baten um ein wenig Essen. Einer aus dem Haufen sprach: "Ja, kommt nur herein, heut wird allen Gutes getan." Sie wurden in ein schönes Zimmer geführt, und ward ihnen Speise und Wein gegeben. Darnach wurden sie gefragt, ob sie nicht zwei junge Leute von der Burg hätten kommen sehen.
"Nein", sagten sie. Als aber einer sah, dass sie Blut an den Händen hatten, fragte er, woher das Blut käme. Da sprach der Soldat: "Ich habe mich in den Finger geschnitten." Der Diener aber sagte es dem Herrn, der kam selber und wollt es sehen, es war aber der schöne Jüngling, der ihnen beigestanden hatte, und wie er sie mit Augen sah, rief er: "Das sind sie, die das Schloss errettet haben!" Da empfing er sie mit Freuden und erzählte, wie es zugegangen wäre:
"Im Schloss war eine Haushälterin mit ihren zwei Kindern, die war eine heimliche Hexe, und als sie einmal von der Herrschaft gescholten wurde, geriet sie in Bosheit und verwandelte alles, was Leben hatte im Schloss, zu Steinen, nur über drei andere böse Hofbediente, die auch Zauberei verstanden, hatte sie keine rechte Gewalt und konnte sie nur in Tiere verwandeln, die nun oben im Schloss ihr Wesen trieben, dabei fürchtete sie sich vor ihnen und flüchtete mit ihren Kindern in den Keller.
Auch über mich hatte sie nur so viel Gewalt gehabt, dass sie mich in eine weiße Taube außerhalb des Schlosses verwandeln konnte. Wie ihr zwei ins Schloss kamt, da solltet ihr die Tiere töten, damit sie frei würde, und zum Lohn wollte sie euch wieder umbringen, aber Gott hat es besser gemacht, das Schloss ist erlöst, und die Steine sind wieder lebendig geworden in dem Augenblick, wo die gottlose Hexe mit ihren Kindern getötet wurde, und das Gemurmel, das ihr gehört, das waren die ersten Worte, welche die Freigewordenen sprachen."
Darauf führte er die zwei Gesellen zu dem Hausherrn, der hatte zwei schöne Töchter, die wurden ihnen gegeben, und sie lebten vergnügt ihr lebenlang als große Ritter.
VOM SCHREINER UND DRECHSLER
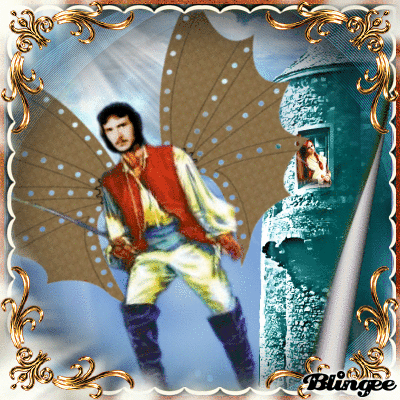
Ein Schreiner und ein Drechsler sollten ihr Meisterstück machen. Da machte der Schreiner einen Tisch, der konnte von sich selbst schwimmen, der Drechsler Flügel, mit denen man fliegen konnte. Und alle sagten, dass dem Schreiner sein Kunststück besser gelungen wäre, der Drechsler nahm also seine Flügel, tat sie an und flog fort aus dem Land, von Morgen bis zu Abend in einem fort.
In dem Land war ein junger Prinz, der sah ihn fliegen und bat ihn, er möchte ihm doch seine paar Flügel leihen, er wollt's ihm gut lohnen. Der Prinz bekam also die Flügel und flog, bis er in ein anderes Reich kam, da war ein Turm, mit vielen Lichtern erleuchtet, dabei senkte er sich nieder zur Erde, fragte nach der Ursache und hörte, dass hier die aller schönste Prinzessin der Welt wohnte. Nun wurde er höchst neugierig, und als es Abend wurde, flog er in ein offenes Fenster hinein; wie sie aber nicht lange Zeit beisammen waren, wurde die Sache verraten, und der Prinz samt der Prinzessin sollten auf dem Scheiterhaufen sterben.
Der Prinz nahm indessen seine Flügel mit hinauf, und als die Flamme schon zu ihnen herauf schlug, band er sich die Flügel um und entfloh mit der Prinzessin bis in sein Vaterland, da ließ er sich nieder, und weil jedermann über seine Abwesenheit betrübt war, so gab er sich zu erkennen und wurde zum König erwählt.
Nach einiger Zeit aber ließ der Vater der entführten Prinzessin bekanntmachen, dass derjenige das halbe Königreich bekommen sollte, der ihm seine Tochter wiederbringe. Dies erfährt der Prinz, rüstet ein Heer aus und bringt die Prinzessin selbst ihrem Vater zu, den er zwingt, ihm sein Versprechen zu erfüllen.
DANIEL O'ROURKE'S IRRFAHRTEN

Jedermann hat von den berüchtigten Abenteuern des Daniel O'Rourke gehört, doch wie wenige wissen die wahre Ursache aller diesseits und jenseits erlebten Gefahren, und doch war sie keine andere, als daß er unter den Mauern der Phuka-Burg eingeschlafen war.
Ich kenne den Mann recht gut, er wohnt in dem Tal von Hungry Hill, rechter Hand an der Landstraße, die nach Bantry führt. Er war zur Zeit, wo er mir das letztemal die Geschichte erzählte, ein alter Mann mit grauem Haar und roter Nase und es war den fünf und zwanzigsten Juni 1813, als ich sie von seinen eigenen Lippen hörte. Er saß eben und rauchte seine Pfeife unter einem alten Pappelbaum an einem so prächtigen Abend, als noch einer am Himmel gestanden hat. Ich hatte die Höhlen auf der Insel Dursey gesehen und den Morgen zu Glengariff zugebracht.
»Ich bin schon oft angegangen worden, Herr, es zu erzählen und es ist daher nicht das erstemal. Seht, der Sohn unseres Herrn war auf Reisen gewesen, jenseits in Frankreich und Spanien, wie es bei den jungen Herrn Sitte ist, ehe man noch etwas von Bonaparte oder seinesgleichen gehört hatte, und war nun zurückgekommen. Bei der Gelegenheit ward der ganzen Umgegend ein Fest gegeben und vornehm und gering, hoch und niedrig, arm und reich eingeladen. Es waren lauter Ehrenmänner von altem Korn und Schrot, mit eurer Erlaubnis sei es gesagt.
Es ist wohl einem ein böses Wort herausgefahren oder dann und wann ein Peitschenstreich ausgeteilt worden, freilich! doch wir hatten am Ende keinen Schaden davon und sie waren so leutselig und artig, alles lief auf und ab und jeder war tausendmal willkommen; da nagte keiner wegen des Mietzinses und der geringen Mittel, da war kaum ein Pächter, der nicht von der Milde seines Herrn mehr als einmal im Jahr Beweise erhielt. Jetzt ist´s freilich anders, doch ich will davon schweigen und Euch lieber meine Geschichte erzählen.
Also, wir hatten alles aufs Beste und vollauf, wir aßen und tranken, wir tanzten und der junge Herr tanzte bei der Gelegenheit mit Gretchen Barry: damals ein schönes Paar, doch jetzt ist´s auch vorbei. Um mich kurz zu fassen, ich bekam bei der Gelegenheit, wie man zu sagen pflegt, einen kleinen Hieb, denn ich erinnere mich nicht recht, wie es kam, daß ich den Ort verließ, und doch verließ ich ihn, das ist gewiß. Ich dachte bei mir: du willst dich aufmachen zu der Marie Cronahan, der weisen Frau, und ein Wort mit ihr über das junge Kühchen reden, das notwendig behext sein muß.
Und als ich so auf den Schrittsteinen quer durch die Furt von Ballyashenogh dahin ging, und zu den Sternen aufblickte, und mich segnete, warum? es war unserer Frauen Tag, so glitt mir der Fuß aus und platsch! fiel ich ins Wasser. Donner und Hagel, dachte ich, jetzt bist du verloren! Indessen hub ich an zu schwimmen und zu schwimmen immerzu, was ich nur konnte, bis ich endlich auf irgend eine Art, denn wie es zugegangen ist, weiß kein Mensch, an einer einsamen Insel landete.
Ich wanderte da auf und ab, ohne zu wissen, wohin ich wanderte, bis ich zuletzt in einen großen Sumpf geriet. Der Mond schien so hell, als der Tag oder die Augen Eurer schönen Frau, verzeiht, Herr, daß ich mir das zu sagen erlaube, und ich sah mich um nach Osten und Westen, nach Norden und Süden, nach allen Seiten, aber ich sah nichts als Sumpf und abermals Sumpf.
Ich konnte nicht ausfindig machen, wie ich hinein gekommen war und mein Herz ward kalt vor Angst, denn gewiß und wahrhaftig, das mußte mein Totenhof werden. Ich saß da auf einem Stein, welcher zu gutem Glück sich da neben mir fand, riß mich in den Haaren und blies Trübsal nach Noten, als auf einmal der Mond dunkel ward. Ich blickte auf und konnte deutlich etwas sehen, das sich zwischen mir und dem Mond bewegte, aber ich konnte nicht sagen, was es war. Doch es kam herab mit einer Kralle und schaute mir gerade ins Gesicht und was war es anders, als ein Adler? so gut, als je einer durch das Land Kerry geflogen ist. Er schaute mir gerade ins Gesicht und sprach:
'Daniel O'Rourke, wie gehts Euch?'
'Gut, Herr, ich danke Euch', antwortete ich, 'ich will hoffen, Ihr befindet Euch auch wohl', während ich mich nicht genug verwundern konnte, daß so ein Adler sprach, wie ein Christenmensch.
'Was bringt Euch hieher, Daniel?' sprach er weiter.
'Gar nichts, Herr, ich wünsche nichts, als daß ich wohlbehalten wieder zu Haus wäre.'
'Ihr möchtet also gerne wieder von der Insel fort, Daniel?'
'Freilich, Herr', sagte ich, und erzählte ihm, ich hätte wohl einen Tropfen zu viel getrunken, und wäre ins Wasser gefallen, auf die Insel geschwommen und endlich in diesen Sumpf geraten und jetzt wüßte ich nicht, wie ich wieder heraus sollte.
'Daniel', sprach er, nach einem Augenblick Nachdenken, 'es war von Euch sehr unschicklich, an unserer Frauen Tag Euch zu berauschen, doch da Ihr sonst ein ehrbarer, mäßiger Mann seid, der ordentlich in die Messe geht und nach mir und den meinigen nicht mit Steinen wirft oder uns im Felde nachschreit, so setzt Euch auf meinen Rücken und haltet Euch fest, damit Ihr nicht herabfallt, ich will Euch aus diesem Sumpf tragen.'
'Lieber Herr', sagte ich, 'ich fürchte nur, Ihr treibt Euren Scherz mit mir! Wer hat je gehört, daß sich einer rittlings auf eines Adlers Rücken gesetzt hätte?'
'Auf mein Ehrenwort', erwiderte er, 'es ist mein völliger Ernst, und nun nehmt mein Erbieten an, oder kommt um in diesem Sumpfe. Zudem sehe ich, daß Eure Schwere den Stein sinken macht.'
Es war leider wahr, was er sagte, denn ich fand, daß der Stein jeden Augenblick unter mir sank. Ich hatte keine Wahl und dachte bei mir: wer wagt, gewinnt! und das machte mir Mut.
'Ich danke, Euer Gnaden', sagte ich, 'für die erzeigte Höflichkeit und will Euer gütiges Erbieten annehmen.'
Ich bestieg also den Rücken des Adlers und hielt mich fest an seinen Hals. Er erhob sich in die Luft, als wär' er eine Lerche. Ich wußte nichts von dem Streich, den er mir spielen wollte. Er flog immer höher auf, Gott weiß, wie weit.
'Aber, Herr', sagte ich zu ihm, weil ich dachte, der gerade Weg nach Haus wäre ihm unbekannt, doch überaus artig sagte ich es zu ihm, denn ich war gänzlich in seiner Gewalt, 'möge es Euer Gnaden gefallen, und in dem ich es Eurem bessern Urteil untertänig anheim gebe, wenn Ihr ein weniges herunterfliegen wolltet, so kämen wir gerade über mein kleines Haus und ich könnte da absitzen und mich bei Euer Herrlichkeit tausendmal bedanken.'
'Zum Henker, Daniel', sagte er, 'meinst du, ich wäre ein Narr? Schau herab auf das nächste Feld, siehst du nicht zwei Männer mit Flinten? Wahrhaftig, das wäre ein schöner Spaß, wenn ich mich sollte totschießen lassen, einem betrunkenen Lump zu gefallen, den ich in einem Sumpf von einem Steine aufgepickt habe!'
'Willst du mich hudelen!' dachte ich bei mir, sagte es aber nicht heraus, denn was hätte mir das genützt? Gut, er stieg in die Höhe, immerzu, und ich bat ihn jeden Augenblick herab zu fliegen, aber alles war vergeblich.
'Wo in aller Welt, Herr, geht die Reise hin?' sprach ich zu ihm.
'Halt dein Maul, Daniel', antwortete er, 'besorge deine eigenen Geschäfte und mische dich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute.'
'Aber ich sollte meinen, das wäre meine eigene Angelegenheit' rief ich.
'Verhalte dich ruhig, Daniel', sprach er, und ich sagte nichts mehr.
Endlich langten wir an, aber auf dem Mond selbst. Nun, Ihr könnt´s von hieraus nicht sehen, aber dort ist, oder dort war zu meiner Zeit, an der Seite des Monds eine Sichel, seht, in folgender Gestalt!«
Dabei machte Daniel mit der Spitze seines Stocks in der Erde einen Kreis und rechter Hand einen sichelförmigen Hacken daran.
»'Daniel', sagte der Adler, 'von dem langen Flug bin ich müde, ich habe keinen Begriff davon gehabt, daß es so weit wäre.'
'Aber, was in aller Welt, hat Euer Herrlichkeit bewogen, einen so weiten Weg zu machen? Ich gewiß nicht. Habe ich nicht ersucht, gebeten und gefleht, nur ein halbes Stündchen zurück zu rufen?'
'Unnützes Geschwätz, Daniel', sagte er, 'ich bin schrecklich abgemattet, du mußt absteigen und so lange dich auf den Mond niederlassen, bis ich mich erholt habe.'
'Ich soll mich auf den Mond setzen, auf das kleine, runde Ding da? Nichts gewisser, als daß ich im ersten Augenblick herunterfalle und verloren bin, und tot und in Stücke zerschmettert: Ihr seid ein schändlicher Betrüger, ja das seid Ihr!'
'Nicht ganz und gar, Daniel', sagte er, 'du kannst die Sichel ergreifen, die an der Seite des Mondes herausragt und dich daran fest halten.'
'Ich will aber nicht', sagte ich.
'Es geht nicht anders' sagte er ganz gelassen, 'willst du aber nicht, lieber Mann, so gebe ich dir einen Schubs und einen Klaps mit meinen Flügeln dazu, und schicke dich hinab auf den Boden, wo jeder Knochen von dir in so kleine Stücke soll zerschmettert werden, als frühmorgens ein Tautropfen, der von einem Kohlblatt fällt.'
'Nun', sagte ich zu mir, 'so weit hat mich´s gebracht, daß ich mich mit euresgleichen eingelassen habe' und eine harte Verwünschung ihm zurufend, damit er wüßte, was ich gesagt hätte, sprang ich mit schwerem Herzen von seinem Rücken, faßte die Sichel und saß nun oben auf dem Mond und es war ein verwünscht kalter Sitz, das kann ich Euch sagen.
Als er mich so hübsch abgesetzt hatte, wendete er sich zu mir und sagte:
'Guten Morgen, Daniel O'Rourke, ich denke, ich habe dich artig erwischt! Du hast mir voriges Jahr mein Nest beraubt (daran hatte er wahrhaftig Recht, aber wie er das herausgebracht hat, ist schwer zu sagen) und zur Vergeltung mußt du es dir gefallen lassen, deine Fußsohlen abzukühlen, wenn du auf dem Mond herumschwankst, wie ein Hahn der aufgehängt ist, um danach zu schlagen.'
'Ist das alles und willst du mich auf diese Art verlassen, du Bestie du?' rief ich, 'du unnatürliches Scheusal, ist das das Ende von deiner Dienstfertigkeit? Daß du verschimmeln möchtest, krummnasiger Lump! Du und deine ganze Brut!'
Was half alles! Er spreitete seine großen mächtigen Schwingen voneinander, brach in lautes Gelächter aus und flog mit Blitzesschnelligkeit dahin. Ich schrie ihm nach, er möchte anhalten, doch ich hätte in alle Ewigkeit rufen und schreien können, er würde mich nicht gehört haben. Er flog fort und ich habe ihn nicht wieder gesehen, bis auf diesen Tag. Mögen ihn zehn Donnerkeile erschlagen! Ihr seht ein, ich war in einer verzweifelten Lage, ich blieb zurück laut schreiend in so großer Bedrängnis, als auf einmal mitten im Mond eine Türe sich öffnete, die in ihren Angeln krachte, als wenn sie seit Monaten nicht wäre aufgemacht worden. Ich glaube, sie haben noch niemals daran gedacht, sie ein wenig einzuschmieren. Wer kam heraus? Ihr wißt es schon, der Mann im Mond. Ich erkannte ihn an seinem Bündel.
'Guten Morgen, Daniel O'Rourke', sagte er 'wie gehts Euch.'
'Gut, ich danke Euch, ich hoffe, Ihr befindet Euch auch wohl.'
'Was bringt Euch hieher, Daniel?' sagte er.
Ich erzählte ihm, daß ich mich auf dem Fest des jungen Herrn ein wenig übernommen hätte und auf eine einsame Insel wäre geworfen worden und dort in einen Sumpf mich verloren hätte und daß ein Schurke von Adler versprochen, mich herauszutragen, statt dessen aber mich auf den Mond heraufgeschleppt hätte.
Als ich mit meiner Erzählung zu Ende war, nahm der Mann eine Prise Tabak und sagte: 'Daniel, hier dürft Ihr nicht stehen.'
'Freilich, Herr, es ist ganz gegen meinen Willen, daß ich hier bin, aber wie soll ich wieder zurückkommen?'
'Das ist eure Sache, Daniel', sagte er, 'meine ist es, Euch anzukündigen, daß Ihr hier nicht stehen dürft, also macht Euch fort und das in weniger als gar keiner Zeit.'
'Ich tue Euch keinen Schaden, und halte mich nur an der Sichel fest, damit ich nicht herabfalle.'
'Gerade das ist, was Ihr nicht tun sollt, Daniel', sagte er.
'Verzeiht, Herr', sagte ich, 'darf ich fragen, wie stark eure Familie ist, weil Ihr einen armen Reisenden nicht herbergen wollt? Ich weiß gewiß, Ihr werdet nicht all zu oft durch Fremde belästigt, die Euch gerne sehen wollen, da es ein weiter Weg ist.'
'Ich lebe für mich allein, Daniel', antwortete er, 'doch Ihr tätet besser, wenn Ihr von der Sichel los liesset.'
'Mit Eurer Erlaubnis, ich lasse den Griff nicht los, darauf könnt Ihr rechnen.'
'Ihr tätet besser, Daniel', wiederholte er.
'Ei, kleiner Kroate', sagte ich, indem ich die ganze Gestalt mit den Augen von Kopf bis zu Füßen maß, 'zu einem Handel gehören zwei, und ich will nicht von hier weg, aber Euch steht´s frei, wenn es Euch gefällig ist.'
'Wir wollen sehen, wie sich´s einrichten läßt', sagte er und ging ab, indem er die Türe so hinter sich zuschlug, denn er war offenbar ärgerlich, daß ich dachte, der Mond mit allem Zubehör würde herabfallen.
Ich bereitete mich vor, Gewalt bei ihm zu brauchen, als er wieder zurückkam mit einem Küchenmesser in der Hand; ohne ein Wort zu sagen, schlug er zweimal auf den Griff der Sichel und ratsch! entzwei war sie.
'Guten Morgen, Daniel!' rief der kleine boshafte Racker, als er mich mit einem Stückchen von dem Griff in der Hand ganz säuberlich hinabfallen sah, 'Ich danke für Euren Besuch und wünsche Euch gutes Wetter zur Reise.'
Ich hatte keine Zeit, ihm zu antworten, denn ich stürzte und wälzte mich um und um, wie es bei einer Fuchsjagd hergeht.
'Gott stehe mir bei!' rief ich, 'aber es muß ein erbaulicher Spaß sein, einen rechtschaffenen Mann zur Nachtzeit in solcher Hetze zu sehen! Ich bin schön abgefahren!'
Das Wort war mir kaum aus dem Munde, husch! da rauschte etwas ganz nah an meinem Ohr vorüber und was konnte das anders sein, als ein Flug wilder Gänse? Und der alte Gänserich, der Anführer war, drehte den Kopf nach mir und rief: 'Bist du es, Daniel?'
Ich erstaunte nicht im geringsten über das, was er sagte, denn ich war dazumal an alle Arten von Teufeleien gewohnt und außerdem, ich kannte ihn aus alter Zeit.
'Guten Morgen, Daniel O'Rourke', sagte er, 'wie stehts mit der Gesundheit?'
'Gut, Herr, ich danke Euch schönstens', sagte ich, nach Atem schnappend, denn ich konnte kaum dazu kommen, 'ich hoffe ein Gleiches von Euch.'
'Mich dünkt, du bist eben beschäftigt herabzufallen, Daniel?'
'Wie es Euch beliebt zu sagen, Herr', antwortete ich.
'Und wohin so eilig?' fragte der Alte.
Ich erzählte ihm, daß ich ein Tröpfchen zu viel getrunken hätte und auf eine Insel gekommen wäre, wo ich mich in einen Sumpf verloren hätte und wie ein Teufel von Adler mich auf den Mond getragen und der Mann im Mond mich wieder fortgejagt hätte.
'Daniel', sagte er, 'ich will dich retten, strecke die Hand aus und packe mein Bein, so will ich dich nach Haus bringen.'
'Mein Augentrost!' sagte ich, 'Eure Worte sind Honigseim', doch ich dachte dabei: 'Sonderlich darf ich dir nicht trauen', aber da war sonst keine Rettung. Ich packte den Gänserich beim Bein und wir flogen hinter ihm her, ich und die andern Gänse, so schnell als sprängen wir im Tanz.
Wir flogen und flogen, bis wir über das weite Meer kamen. Ich wußte es wohl, denn ich sah rechter Hand das Cap Clear, wie es aus dem Wasser hervorspringt.
'Ach, gnädiger Herr', sagte ich zu dem Anführer der Gänse, denn mir schien es das klügste, wenn ich es an artigen Worten nicht fehlen ließe, 'fliegt doch landeinwärts, wenn es Euch gefällig ist.'
'Das geht jetzt unmöglich, siehst du wohl, Daniel', antwortete er, 'wir sind auf dem Weg nach Arabien.'
'Nach Arabien!' rief ich, 'das ist gewiß ein Ort in der Fremde, weit von hier.'
'Stille, still, du Narr', antwortete er, 'laß dein Geschwätz, ich sage dir, Arabien ist ein prächtiger Ort und West-Carbery so ähnlich als ein Ei dem andern, nur ein bißchen mehr Sand ist dort.'
Indem wir so sprachen, ward ein Schiff sichtbar, das im Wind stolz daher schoß.
'Ach! Herr', sagte ich, 'wenn es Euch gefällig wäre, mich in das Schiff hinabfallen zu lassen.'
'Wir sind nicht gerade über dem Schiff', antwortete er.
'Wir sind es', sagte ich.
'Wir sind es nicht', antwortete er. 'Wenn ich dich jetzt fallen lasse, so platschest du ins Wasser.'
'Ach nein', sagte ich, 'ich verstehe das besser, es ist gerade unter uns; laßt mich nur herunterfallen.'
'Wenn du mußt', sagte er, 'so gehe deiner Wege.'
Er ließ mich los und wahrhaftig, er hatte recht, denn ich plumpste richtig in die Tiefe des salzigen Meeres. Ja, ich plumpste in die Tiefe und gab mich auf immer verloren, als ein Walfisch auf mich los kam, der sich nach seinem nächtlichen Schlaf die Augen aus rieb und mich gerade ins Gesicht anglotzte, ohne ein Sterbenswörtchen zu reden. Doch hob er seinen Schwanz in die Höhe und plätscherte damit, daß ich über und über mit salzigem, kaltem Wasser begossen ward, so lange bis kein trockner Faden mehr am ganzen Leibe war. Da hörte ich jemand sagen, und es war eine Stimme, die ich wohl kannte:
'Steig auf, du Trunkenbold, fort von hier!'
Indem wachte ich auf und da stand Judy mit einem Zuber voll Wasser, den sie über mich ausschüttete. Gott habe sie selig! Aber sie war eine gute Frau, die es nicht übers Herz bringen konnte, mich trunken zu sehen und die über ihr Eigentum mit kräftiger Hand waltete.
'Steig auf!' sagte sie, 'gabs keinen andern Platz im Kirchsprengel, wo du deiner Neigung folgen und dich niederlegen konntest, als dieser, unter den alten Mauern von Carrigaphuka? Ich wette, du hast einen erbärmlichen Schlaf gehabt.'
Und wahrhaftig, das hatte ich, denn meine Seele war nicht schlecht gequält worden, von Adlern, Männern im Monde, fliegenden Gänsen, und Walfischen, die mich durch Sümpfe, hinauf in den Mond und herab in den Grund des grünen Meers jagten. Und wenn ich zehnmal mehr getrunken hätte, es könnte doch einer lange darauf warten, bis ich mich wieder an jener Stelle niederlegte; ich kenne das!«
DER HAHNENBALKEN
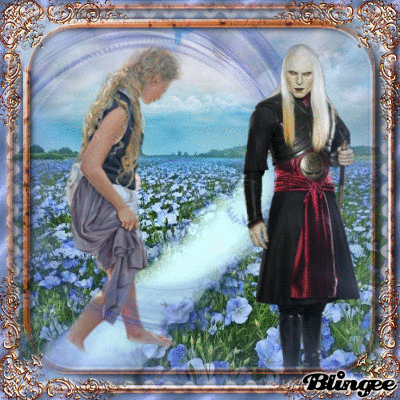
Es war einmal ein Zauberer, der stand mitten in einer großen Menge Volks und vollbrachte seine Wunderdinge. Da ließ er auch einen Hahn einherschreiten, der hob einen schweren Balken und trug ihn, als wäre er federleicht.
Nun war aber ein Mädchen, das hatte eben ein vierblättriges Kleeblatt gefunden und war dadurch klug geworden, so dass kein Blendwerk vor ihm bestehen konnte, und sah, dass der Balken nichts war als ein Strohhalm. Da rief es "ihr Leute, seht ihr nicht, das ist ein bloßer Strohhalm und kein Balken, was der Hahn da trägt." Alsbald verschwand der Zauber, und die Leute sahen, was es war, und jagten den Hexenmeister mit Schimpf und Schande fort. Er aber, voll innerlichen Zornes, sprach "ich will mich schon rächen."
Nach einiger Zeit hielt das Mädchen Hochzeit, war geputzt und ging in einem großen Zug über das Feld nach dem Ort, wo die Kirche stand. Auf einmal kamen sie an einen stark angeschwollenen Bach, und war keine Brücke und kein Steg, darüber zu gehen. Da war die Braut flink, hob ihre Kleider auf und wollte durchwaten. Wie sie nun eben im Wasser so steht, ruft ein Mann, und das war der Zauberer, neben ihr ganz spöttisch "ei! wo hast du deine Augen, dass du das für ein Wasser hältst?
Da gingen ihr die Augen auf, und sie sah, dass sie mit ihren aufgehobenen Kleidern mitten in einem blau blühenden Flachsfeld stand. Da sahen es die Leute auch allesamt und jagten sie mit Schimpf und Gelächter fort.
DER SPERLING UND SEINE VIER KINDER

Ein Sperling hatte vier Junge in einem Schwalbennest. Wie sie nun flügge sind, stoßen böse Buben das Nest ein, sie kommen aber alle glücklich in Windbraus davon. Nun ist dem Alten leid, weil seine Söhne in die Welt kommen, dass er sie nicht vor allerlei Gefahr erst verwarnet und ihnen gute Lehren fürgesagt habe.
Auf´n Herbst kommen in einem Weizenacker viele Sperlinge zusammen, allda trifft der Alte seine vier Jungen an, die führe er voll Freuden mit sich heim. "Ach, meine lieben Söhne, was habt ihr mir den Sommer über Sorge gemacht, dieweil ihr ohne meine Lehre in Winde kamt; höret meine Worte und folget eurem Vater und sehet euch wohl vor: kleine Vöglein haben große Gefährlichkeit auszustehen!"
Darauf fragte er den ältern, wo er sich den Sommer über aufgehalten und wie er sich ernähret hätte. "Ich habe mich in den Gärten gehalten, Räuplein und Würmlein gesucht, bis die Kirschen reif wurden." "Ach, mein Sohn," sagte der Vater, "die Schnabelweid ist nicht bös, aber es ist große Gefahr dabei, darum habe fortan deiner wohl acht, und sonderlich, wenn Leute in Gärten umhergehen, die lange grüne Stangen tragen, die inwendig hohl sind und oben ein Löchlein haben." "Ja, mein Vater, wenn dann ein grün Blättlein aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre?" spricht der Sohn. "Wo hast du das gesehen?" "In eines Kaufmanns Garten," sagt der Junge. "O mein Sohn," spricht der Vater, "Kaufleute, geschwinde Leute! bist du um die Weltkinder gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug gelernt, siehe und brauche es nur recht wohl und trau dir nicht zuviel."
Darauf befragt er den andern "wo hast du dein Wesen gehabt?" "Zu Hofe," spricht der Sohn. "Sperling und alberne Vöglein dienen nicht an diesem Ort, da viel Gold, Samt, Seiden, Wehr, Harnisch, Sperber, Kauzen und Blaufüß sind, halt dich zum Rossstall, da man den Hafer schwingt, oder wo man drischt, so kann es dir Glück mit gutem Fried auch dein täglich Körnlein bescheren." "Ja, Vater," sagte dieser Sohn, "wenn aber die Stalljungen Hebritzen machen und ihre Maschen und Schlingen ins Stroh binden, da bleibt auch mancher behenken." "Wo hast du das gesehen?" sagte der Alte. "Zu Hof, beim Rossbuben." "O, mein Sohn, Hofbuben, böse Buben! bist du zu Hof und um die Herren gewesen und hast keine Federn da gelassen, so hast du ziemlich gelernt und wirst dich in der Welt wohl wissen auszureißen, doch siehe dich um und auf: die Wölfe fressen auch oft die gescheiten Hündlein."
Der Vater nimmt den dritten auch vor sich "wo hast du dein Heil versuche?" "Auf den Fahrwegen und Landstraßen hab ich Kübel und Seil eingeworfen und da bisweilen ein Körnlein oder Gräuplein angetroffen." "Dies ist ja," sage der Vater, "eine feine Nahrung, aber merk gleichwohl auf die Schanz und siehe fleißig auf, sonderlich wenn sich einer bücket und einen Stein aufheben will, da ist dir nicht lang zu bleiben." "Wahr ist's," sage der Sohn, "wenn aber einer zuvor einen Wand- oder Handstein im Busen oder Tasche trüge?" "Wo hast du dies gesehen?" "Bei den Bergleuten, lieber Vater, wenn sie ausfahren, führen sie gemeinlich Handsteine bei sich." "Bergleute, Werkleute, anschlägige Leute! bist du um Bergburschen gewesen, so hast du etwas gesehen und erfahren. Fahr hin und nimm deiner Sachen gleichwohl gut acht, Bergbuben haben manchen Sperling mit Kobold umbracht."
Endlich komme der Vater an jüngsten Sohn "du mein liebes Gackennestle, du warst allzeit der alberst und schwächest, bleib du bei mir, die Welt hat viel grober und böser Vögel, die krumme Schnäbel und lange Krallen haben und nur auf arme Vöglein lauern und sie verschlucken: halt dich zu deinesgleichen und lies die Spinnlein und Räuplein von den Bäumen oder Häuslein, so bleibst du lang zufrieden." "Du, mein lieber Vater, wer sich nährt ohne andrer Leute Schaden, der kommt lang hin, und kein Sperber, Habicht, Aar oder Weih wird ihm nicht schaden, wenn er zumal sich und seine ehrliche Nahrung dem lieben Gott all Abend und Morgen treulich befiehlt, welcher aller Wald- und Dorfvöglein Schöpfer und Erhalter ist, der auch der jungen Räblein Geschrei und Gebet höret, denn ohne seinen Willen fällt auch kein Sperling oder Schneekünglein auf die Erde."
"Wo hast du dies gelernt?" Antwortet der Sohn "wie mich der große Windbraus von dir wegriss, kam ich in eine Kirche, da las ich den Sommer die Fliegen und Spinnen von den Fenstern ab und hörte diese Sprüche predigen, da hat mich der Vater aller Sperlinge den Sommer über ernährt und behütet vor allem Unglück und grimmigen Vögeln." "Traun! mein lieber Sohn, fleuchst du in die Kirchen und hilfst Spinnen und die sumsenden Fliegen aufräumen und zirpst zu Gott wie die jungen Räblein und befiehlst dich dem ewigen Schöpfer, so wirst du wohl bleiben, und wenn die ganze Welt voll wilder tückischer Vögel wäre.
Denn wer dem Herrn befiehlt seine Sach,
schweigt, leidet, wartet, betet, brauche Glimpf, tut gemach,
bewahrt Glaub und gut Gewissen rein,
dem will Gore Schutz und Helfer sein."
DIE ERSCHEINUNGEN DES O'DONOGHUE
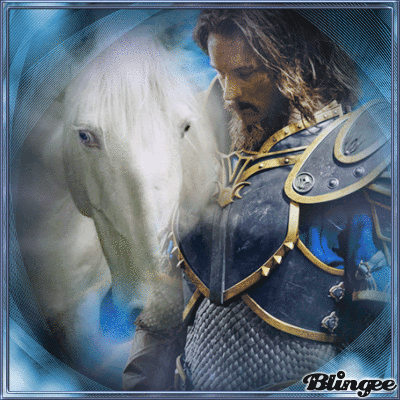
Ehemals zu einer Zeit, die schon so lange dahin geschwunden ist, daß sie nicht genau mehr kann bestimmt werden, herrschte in dem Land, welches den reizenden See Lean, der jetzt See von Killarney heißt, umgibt, ein Fürst namens O'Donoghue. Weisheit, Wohlwollen und Gerechtigkeit zeichneten seine Regierung aus, Glück und Wohlfahrt seiner Untertanen waren die natürlichen Folgen davon. Er soll eben so berühmt geworden sein durch Heldentaten im Krieg, als durch Tugenden des Friedens und zum Beweis, daß die Milde seiner Regierung der Strenge keinen Abbruch tat, wird Fremden eine Felseninsel gezeigt, die O'Donoghue's Gefängnis heißt, weil er einmal seinen eigenen Sohn wegen eines unordentlichen und ungehorsamen Betrages dahin verwies.
Sein Ende, denn man kann nicht eigentlich sagen sein Tod, war seltsam und geheimnisreich. Auf einem jener glänzenden Feste, die seinen Hof verherrlichten, umgeben von seinen ausgezeichnetsten Untertanen, kam ein prophetischer Geist über ihn und er sagte voraus, was in den zukünftigen Zeiten geschehen würde. Seine Zuhörer horchten, bald von Staunen ergriffen, bald in Unwillen entbrannt, bald glühend vor Scham oder von Kummer gebeugt, je nachdem er die Tapferkeit, die Ungerechtigkeiten, die Verbrechen und das Elend ihrer Nachkommen offen verkündigte.
Mitten in diesen Prophezeiungen erhob er sich langsam von seinem Sitz, bewegte sich in feierlichen, gemessenen und majestätischen Schritten nach dem Ufer des Sees und ging ruhig auf der Oberfläche des Wassers fort, das unter seinen Füßen nicht wich. Als er beinahe die Mitte erreicht hatte, blieb er einen Augenblick stehen, dann kehrte er sich langsam um, schaute zurück nach seinen Freunden und die Arme gegen sie bewegend, wie wenn jemand mit liebreicher Gebärde einen kurzen Abschied nimmt, entschwand er ihren Blicken.
Das Andenken an den guten O'Donoghue ist von den folgenden Geschlechtern sorgsam und mit Ehrfurcht bewahrt worden. Man glaubt, jedesmal am ersten Mai, dem Jahrestage seines Scheidens, morgens bei Sonnenaufgang, komme er wieder, sein altes Reich zu besuchen. Nur wenigen Begünstigten ist in der Regel vergönnt, ihn zu sehen und wem diese Auszeichnung zuteil wird, der betrachtet sie als eine glückliche Vorbedeutung. Ist es vielen gestattet, so gilt es als sicheres Zeichen reichlicher Ernte, ein Segen, dessen Mangel während der Regierung dieses Fürsten von seinem Volke niemals gefühlt wurde.
Einige Jahre waren verstrichen seit der letzten Erscheinung des O'Donoghue. Der April war diesmal auffallend wild und stürmisch gewesen, doch am Morgen des ersten Mais hatte sich die Wut der Elemente gelegt. Die Luft wehte sanft und still und der Himmel, der sich in dem reinen See spiegelte, glich einem schönen doch trügenden Antlitz, dessen Lächeln nach den heftigsten Bewegungen den Unkundigen zu glauben verleitet, daß es einer Seele angehöre, die noch von keiner Leidenschaft sei zerrissen worden.
Die ersten Strahlen der aufsteigenden Sonne vergoldeten eben den hohen Gipfel des Glenaa, als das Gewässer bei dem östlichen Ufer des Sees plötzlich und heftig bewegt wurde, obgleich der übrige Teil seines Spiegels ruhig und still lag, wie ein Grabmal von geglättetem Marmor. Im nächsten Augenblick schoß eine schäumende Welle vorwärts und glich einem stolzen Streitroß mit hoch gekämmten Mähnen; übermütig in ihrer Kraft, rauschte sie über den See nach dem Tumies Gebirge hin.
Hinter dieser Woge erschien ein herrlicher, völlig bewaffneter Krieger, auf einem milchweißen Pferde sitzend. Schneeige Federn wallten prächtig von einem Helm aus glänzendem Stahl und über seinen Rücken flatterte eine hellblaue Binde. Das Roß, sichtbar stolz auf seine edle Last, sprang hinter der Welle auf dem Wasser daher, welches ihn wie festes Land trug, während Bogen von Schaum, der glänzend in der Morgensonne schimmerte, bei jedem Sprunge aufspritzten.
Der Krieger war O'Donoghue. Hinter ihm her kam eine zahllose Menge Jünglinge und Mädchen, welche sich leicht und ohne Anstrengung auf der Oberfläche des Sees bewegten, wie Elfen im Mondschein über luftige Gefilde dahingleiten. Sie waren durch Gewinde köstlicher Frühlingsblumen verbunden und ihre Schritte folgten dem Takte einer bezaubernden Melodie.
Als O'Donoghue beinahe die westliche Seite des Sees erreicht hatte, wendete er plötzlich das Pferd und richtete seinen Lauf längs dem waldbekränzten Gestade von Glenaa hin, vor ihm her die mächtige Woge, die wallend bis zu dem Nacken des Pferdes aufschäumte, dessen feurige Nüstern darüber weg schnaubten. Der lange Zug der Diener folgte mit lustigen Seitensprüngen der Spur des Führers und bewegte sich in unermüdlicher Lebhaftigkeit nach den Akkorden der himmlischen Musik, bis sie nach und nach, bei ihrem Eintritt in die schmale Enge zwischen Glenaa und Dinis in die Nebel, welche allezeit über einem Teil der See schweben, eingehüllt wurden und vor den Augen der staunenden Zuschauer erblaßten.
Doch die Töne der Musik erreichten immer noch ihre Ohren, und das Echo, welches diese melodischen Weisen erfaßte, wiederholte sie eifrig und verlängerte sie in immer sanftem Klängen, bis endlich der letzte, schwache Laut dahin starb und die Zuhörer wie aus einem seligen Traum erwachten.
DIE KUH MIT DEN SIEBEN FÄRSEN
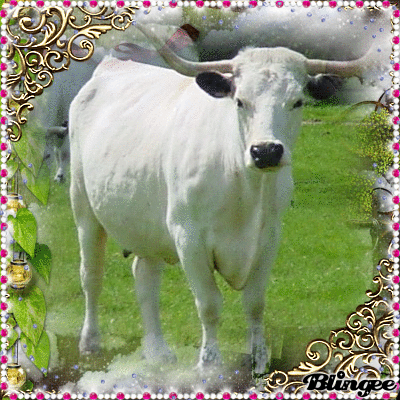
Lorenz Cotter besaß ein kleines Gut in der Gegend von dem See Gur und gedieh dabei, denn er war ein guter, fleißiger Mann, der bis an seinen Tod still und ruhig darauf gelebt haben würde, wenn ihn nicht ein Unglück betroffen hätte, von dem ihr sogleich hören sollt.
Nah am Wasser gehörte ihm ein feines Stück Wiesenland, wie man es sich nicht besser wünschen kann, um dessen Ertrag er aber schmählich gebracht wurde und niemand konnte sagen, durch wen. Ein Jahr um das andere fand es sich immer auf dieselbe Weise zu Grund gerichtet. Die Einfriedigung war im gehörigen Stand und kein Grenzstein verrückt; des Nachbars Vieh konnte keinen Schaden gestiftet haben, denn es war gekoppelt; aber wie es nun geschehen mochte, das Gras auf der Wiese wurde zu großem Verluste Lorenz völlig verdorben.
»Was in der weiten Welt soll ich nur anfangen?« sagte Lorenz Cotter zu Thomas Welch, seinem Nachbar, einem ehrsamen Mann: »Das bißchen Wiese, wofür ich schwere Abgaben entrichten muß, bringt mir so viel wie nichts ein und die Zeiten sind bitter schlecht genug, sie brauchten nicht noch schlimmer zu werden.«
»Ihr redet wahr, Lorenz« versetzte Welch, »die Zeiten sind bitter schlecht, aber ich glaube, wenn ihr bei Nacht wachen wolltet, ihr könntet bald dahinter kommen; Michel und Diether, meine beiden Jungen, sollen mit euch wachen, es ist zum Erbarmen, daß ein so ehrlicher Mann, wie ihr seid, auf so schimpfliche Weise zugrunde gehen sollte.«
Dieser Übereinkunft gemäß nahmen die folgende Nacht Lorenz Cotter und Welch's beide Söhne ihren Posten in einer Ecke der Wiese. Es war eben Vollmond, der sein Licht über den ruhigen See ergoß, kein Wölkchen war am Himmel zu sehen, kein Laut zu hören, als der Schrei der Wachteln, die sich einander über das Wasser hin zuriefen.
»Jungen, Jungen!« sagte Lorenz, »schaut auf, schaut auf, aber ums Leben macht kein Geräusch und rührt euch keinen Schritt, bis ich das Wort sage.«
Sie schauten und sahen eine dicke fette Kuh in Begleitung von sieben milchweißen Färsen über die glatte Fläche des Sees sich nach der Wiese zu bewegen.
»Das ist nicht Tim Dwyers, des Pfeifers Kuh, die sich alles Fleisch von den Knochen getanzt hat«, flüsterte Michel zu seinem Bruder.
»Ihr Jungen«, sprach jetzt Lorenz Cotter, der die saubere Kuh mit ihren sieben weißen Färsen schönstens auf der Wiese angelangt sah, »sucht mir zwischen sie und den See zu kommen, wir wollen sie geradezu in den Pfandstall treiben, gleichviel wem sie gehören.«
Die Kuh mußte aber diese Worte vernommen haben, denn augenblicklich wendete sie sich in größter Eile zu dem Ufer des Sees und sprang hinein vor ihrer aller Augen; hinter ihr liefen die sieben Färsen, doch die Jungen gewannen ihnen den Vorsprung ab und hatten große Mühe, sie von dem See weg zu Lorenz Cotter hinzutreiben.
Lorenz trieb die sieben Färsen in den Pfandstall, es waren prächtige Tiere, und nachdem er sie daselbst drei Tage lang gehalten hatte, ohne daß sich ein Eigentümer meldete, so nahm er sie heraus und brachte sie auf eines seiner Grundstücke. Sie wuchsen und gediehen mächtig, bis in einer Nacht das Gatter offen gelassen wurde und des morgens die sieben Färsen fort waren.
Lorenz konnte nichts wieder von ihnen in Erfahrung bringen und ohne Zweifel waren sie in den See zurück gegangen. Woher sie nun kamen und welcher Welt sie zugehörten, Lorenz bekam ihretwegen kein Hälmchen Gras mehr von der Wiese. Aus Verdruß gab er sich ans Trinken und der Trunk, sagt man, hat ihn getötet.
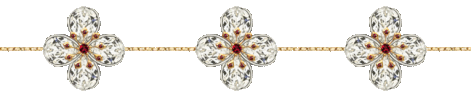
Anmerkung
In der Grafschaft Tipperary, nicht weit von Callir, ist ein See, genannt Longh na Bo oder See der Kuh, nach einer Sage, die Ähnlichkeit hat mit der vom See Gur. Die Hörner dieser Kuh sollen so lang sein, daß man bei niedrigem Wasserstand die Spitzen kann hervorragen sehen.
Aus dem See Blarney hat man zwei Kühe heraussteigen gesehen, die in den zunächst liegenden Wiesen und Kornfeldern bedeutenden Schaden sollen angerichtet haben.
Alle sieben Jahre kommt ein großer, vornehmer Mann aus dem See und wandelt eine Stunde oder weiter in der Hoffnung, daß jemand mit ihm rede, aber da es niemand wagt, so kehrt er in den See zurück.
Dieser große Mann ist ohne Zweifel niemand als der Graf von Clancarthy, eifrig bemüht, Mittel an die Hand zu geben, wie man seinen Silberkasten entdecken könne, welcher der Sage zufolge in den See geschleudert wurde, um zu verhindern, daß er nicht den Feinden, die seine Burg erobert hatten, in die Hände falle.
Dieses Märchen hängt mit den schottischen und nordischen Sagen vom Elfstier zusammen, worüber die Einleitung nachzusehen ist.
DER VERZAUBERTE SEE

Im westlichen Irland war ein See und ohne Zweifel ist er noch daselbst, in dem zu verschiedenen Zeiten mehrere junge Leute ertranken. Was dieses Ereignis besonders merkwürdig machte, war, daß man die Leichname der Ertrunkenen niemals wieder fand. Das Volk geriet darüber in Verwunderung und allmählich erlangte der See einen schlimmen Ruf.
Schreckvolle Geschichten wurden erzählt, einige behaupteten, in dunkler Nacht leuchteten die Fluten wie Feuer, andere wollten schauerliche Gestalten über den See haben gleiten sehen, jedermann gab zu, daß ein seltsamer Schwefelgeruch aus ihm hervorsteige.
Es lebte in geringer Entfernung von diesem See ein junger Pächter namens Roderich Keating, Bräutigam mit einem der schönsten Mädchen der ganzen Gegend. Eben war er von Limerick, wo er einen Trauring gekauft hatte, im Geleit zweier oder dreier von seiner Bekanntschaft zurückkehrend, an dem Gestade des Sees angelangt, als diese mit ihm über Gretchen Honan ihren Scherz zu treiben begannen.
Einer erwähnte sogar, daß der junge Delaney, ein Nebenbuhler, in des Bräutigams Abwesenheit um die Gunst der Geliebten würbe; aber Roderichs Vertrauen auf seine Verlobte war so fest, daß er, ohne im geringsten durch diese Rede beunruhigt zu werden, mit der Hand in die Tasche griff, den Trauring hervorzog und ihn bedeutungsvoll umherblickend in die Höhe hielt.
Indem er so den Ring, als ein wahres Siegeszeichen zwischen Zeigefinger und Daumen umdrehte, entfiel er seiner Hand und rollte in den See hinab. Roderich sah ihm mit der höchsten Bestürzung nach, weniger seines Wertes, obgleich er eine halbe Guinee dafür gegeben hatte, als der schlimmen Vorbedeutung wegen; das Wasser war so tief, daß man des Rings schwerlich wieder habhaft werden konnte.
Seine Gefährten lachten ihn aus; vergeblich suchte er durch das Anerbieten ansehnlicher Belohnung sie zu bewegen, nach dem Ring unterzutauchen, sie waren so wenig zu dem Wagstücke geneigt, als Roderich selbst; die Erzählungen, die sie als Kinder vernommen hatten, schwebten ihrem Gedächtnis vor und abergläubische Furcht erfüllte die Brust eines jeden.
»Muß ich also nach Limerick umkehren einen andern Ring zu kaufen?« rief der junge Pächter, »zehnmal soviel als der Ring kostet, will es keiner darum wagen?« Unter den Umstehenden befand sich ein Mensch, den man allgemein für blödsinnig und nicht recht bei Troste hielt, er war aber unschuldig wie ein Kind und pflegte in der Gegend hin und her von einem Ort zum andern zu gehen.
Als er so ansehnlichen Lohn ausrufen hörte, erklärte Paddin, denn das war sein Name, wolle ihm Roderich Keating geben, was er den andern verheißen hätte, so getraue er sich wohl nach dem Ring unterzutauchen. Und Paddin schaute, während er sprach, eben so begierig nach der Lustfahrt hin als nach dem Geld.
»Ich halte dich beim Wort« sprach Roderich und augenblicklich seinen Rock abziehend, ohne weiter eine einzige Silbe zu verlieren, stürzte sich Paddin häuptlings in den See. Wie tief er hinein kam, läßt sich nicht genau berichten, aber er ging und ging und ging durch das Wasser fort, bis das Wasser vor ihm wich und er auf ein trockenes Land gelangte.
Himmel, Luft, Tageslicht und alles andere waren da gerade so wie hier bei uns; er sah einen reizenden Grund, wodurch ein zierlicher Weg führte nach einem großen, mit stattlichen Treppen umgebenen Hause. Sobald er sich von seinem Staunen erholt hatte, unter dem Wasser so trocknes und anmutiges Land zu finden, schaute er genauer um und was sollte er anders erblicken, als die ertrunkenen Jünglinge, die sich in diesem Lustort beschäftigten, als wäre ihnen niemals ein Übel zugestoßen.
Einige mähten Gras, einige schafften Kiessand auf den Weg oder taten andere leichte Arbeiten, und vollbrachten alles auf so gute Art und so munter, als wären sie niemals ertrunken. Dann sangen sie mit großer Lust Lieder, worin sie die Frau vom Hause wegen ihrer Schönheit und ihres Reichtums priesen, wogegen nichts in der Welt bestehen könne.
Paddin konnte sich nicht enthalten, ihnen zuzusehen, einige darunter, bevor sie im See ertrunken waren, hatte er gut gekannt; aber er war stumm wie ein Fisch, dachte dafür sein Teil, und kein Sterbenswörtchen kam über seine Lippen. So ging er nach dem großen Haus zu, ganz unbefangen, als habe er nichts gesehen, was der Rede wert gewesen, dabei wünschte er gar sehr, zu wissen, wer die junge Frau wäre, von welcher die jungen Männer in ihrem Gesang so viel Wesens gemacht hatten.
Als er nah zu dem Tor des großen Hauses gelangt war, trat aus der Küche eine gewaltig dicke Frau heraus, wie eine Biertonne auf zwei Beinen. Daher bewegte sie sich und Zähne ragten aus ihrem Munde, nicht geringer als Pferdezähne.
Sie kam auf ihn zu und sagte: »Guten Morgen, Paddin.«
»Guten Morgen, Frau«, antwortete er.
»Was bringt Euch hierher?« fragte sie.
»Ich komme wegen Roderich Keatings Goldring.«
»Hier ist er«, sagte Paddins dicke Freundin, mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, das sich bewegte, wie kochender Haferbrei.
»Ich danke Euch«, antwortete Paddin und nahm den Ring aus ihrer Hand. »Es ist nicht nötig, daß ich hinzufüge, der Herr gebe Euch sein Gedeihen! Denn ihr seid bereits wohlbeleibt genug. Aber wollt Ihr so gut sein und mir sagen, führt der Weg, auf welchem ich gekommen bin, auch wieder zurück?«
»Kamt Ihr denn nicht, mich zu heiraten?« schrie die dicke Frau ganz außer sich.
»Diesmal nicht, mein Schatz, wann ich wiederkomme«, antwortete Paddin. »Ich werde für meinen Gang hierher gut bezahlt und muß machen, daß ich Antwort bringe, oder die werden Wunder denken, was aus mir geworden sei.
»Bekümmert Euch um kein Geld«, sagte die dicke Frau, »wenn Ihr mich heiratet, so sollt Ihr für euer Lebtag in dem Haus wohnen und an nichts Mangel leiden.«
Paddin sah deutlich, daß, da er einmal im Besitz des Ringes sei, die dicke Frau weiter keine Gewalt habe, ihn zurückzuhalten. Ohne also länger auf ihre Worte zu achten, wandelte er ganz gelassen den Gang wieder herab und schaute sich dabei um; denn er hatte, die Wahrheit zu sagen, keine sonderliche Lust, die dicke Hexe zu heiraten.
Als er zu dem Gatter kam, stürzte er, ohne nur guten Tag zu sagen, hinaus und fand das Wasser, welches ihm entgegen kam. Er sprang hinein und arbeitete sich in die Höhe und es war wunderbar genug, da man den Paddin nach der entgegengesetzten Seite des Sees hatte wegschwimmen sehen; doch er gelangte bald ans Ufer und erzählte dem Roderich Keating und den andern Burschen, die da standen und auf ihn gewartet hatten, alles was ihm begegnet war.
Roderich zahlte ihm auf der Stelle fünf Guineen für diesen Ring und mit diesem Geld in der Tasche deuchte sich Paddin so reich, daß er nicht Lust hatte zurückzukehren und die dicke Frau zu heiraten, die in dem Grund des Sees in dem schönen Hause saß. Er dachte, sie hat ja unter der Menge junger Leute die Wahl, wenn ihr die Lust ankommen sollte, einen Mann zu nehmen.
DER NAGEL

Ein Kaufmann hatte auf der Messe gute Geschäfte gemacht, alle Waren verkauft und seine Geldkatze mit Gold und Silber gespickt. Er wollte jetzt heimreisen und vor Einbruch der Nacht zu Haus sein. Er packte also den Mantelsack mit dem Geld auf sein Pferd und ritt fort. Zu Mittag rastete er in einer Stadt; als er weiter wollte, führte ihm der Hausknecht das Ross vor, sprach aber:
"Herr, am linken Hinterfuß fehlt im Hufeisen ein Nagel."
"Lass ihn fehlen," erwiderte der Kaufmann, "die sechs Stunden, die ich noch zu machen habe, wird das Eisen wohl festhalten. Ich habe Eile."
Nachmittags, als er wieder abgestiegen war und dem Ross Brot geben ließ, kam der Knecht in die Stube und sagte:
"Herr, Euerm Pferd fehlt am linken Hinterfuß ein Hufeisen. Soll ich's zum Schmied führen?"
"Lass es fehlen," erwiderte der Herr, "die paar Stunden, die noch übrig sind, wird das Pferd wohl aushalten. Ich habe Eile."
Er ritt fort, aber nicht lange, so fing das Pferd zu hinken an. Es hinkte nicht lange, so fing es an zu stolpern, und es stolperte nicht lange, so fiel es nieder und brach ein Bein. Der Kaufmann musste das Pferd liegen lassen, den Mantelsack abschnallen, auf die Schulter nehmen und zu Fuß nach Haus gehen, wo er erst spät in der Nacht erlangte.
"An allem Unglück," sprach er zu sich selbst, "ist der verwünschte Nagel schuld." Eile mit Weile.
DER FRAUENSAND
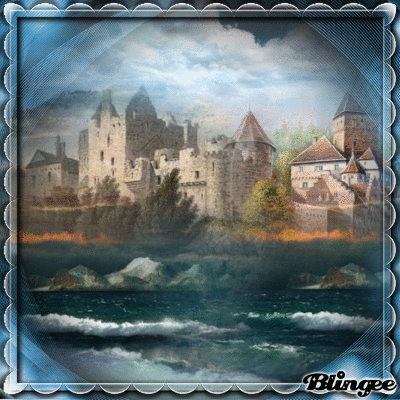
Westlich im Südersee wachsen mitten aus dem Meer Gräser und Halme hervor an der Stelle, wo die Kirchtürme und stolzen Häuser der vormaligen Stadt Stavoren in tiefer Flut begraben liegen. Der Reichtum hatte ihre Bewohner ruchlos gemacht, und als das Maß ihrer Übeltaten erfüllt war, gingen sie bald zugrunde. Fischer und Schiffer am Strand des Südersees haben die Sage von Mund zu Mund fortbewahrt.
Die vermögendste aller Insassen der Stadt Stavoren war eine sichere Jungfrau, deren Namen man nicht mehr nennt. Stolz auf ihr Geld und Gut, hart gegen die Menschen, strebte sie bloß, ihre Schätze immer noch zu vermehren. Flüche und gotteslästerliche Reden hörte man viel aus ihrem Munde. Auch die übrigen Bürger dieser unmäßig reichen Stadt, zu deren Zeit man Amsterdam noch nicht nannte und Rotterdam ein kleines Dorf war, hatten den Weg der Tugend verlassen.
Eines Tags rief die Jungfrau ihren Schiffsmeister und befahl ihm auszufahren und eine Ladung des Edelsten und Besten mitzubringen, was auf der Welt wäre. Vergebens forderte der Seemann, gewohnt an pünktliche und bestimmte Aufträge, nähere Weisung; die Jungfrau bestand zornig auf ihrem Wort und hieß ihn als bald in die See stechen.
Der Schiffsmeister fuhr unschlüssig und unsicher ab, er wußte nicht, wie er dem Geheiß seiner Frau, deren bösen, strengen Sinn er wohl kannte, nachkommen möchte und überlegte hin und her, was zu tun. Endlich dachte er: Ich will ihr eine Ladung des köstlichsten Weizen bringen, was ist Schöners und Edleres zu finden auf Erden als dies herrliche Korn, dessen kein Mensch entbehren kann?
Also steuerte er nach Danzig, befrachtete sein Schiff mit ausgesuchtem Weizen und kehrte als dann, immer noch unruhig und furchtsam vor dem Ausgang, wieder in seine Heimat zurück. »Wie, Schiffsmeister«, rief ihm die Jungfrau entgegen, »du bist schon hier? Ich glaubte dich an der Küste von Afrika, um Gold und Elfenbein zu handeln, laß sehen, was du geladen hast.«
Zögernd, denn an ihren Reden sah er schon, wie wenig sein Einkauf ihr behagen würde, antwortete er: »Meine Frau, ich führe Euch zu dem köstlichsten Weizen, der auf dem ganzen Erdreich mag gefunden werden.« - »Weizen«, sprach sie, »so elendes Zeug bringst du mir?« - »Ich dachte, das wäre so elend nicht, was uns unser tägliches und gesundes Brot gibt.« - »Ich will dir zeigen, wie verächtlich mir deine Ladung ist; von welcher Seite ist das Schiff geladen?« - »Von der rechten Seite (Stuurboordszyde)«, sprach der Schiffsmeister. - »Wohlan, so befehl ich dir, daß du zur Stunde die ganze Ladung auf der linken Seite (Backboord) in die See schüttest; ich komme selbst hin und sehe, ob mein Befehl erfüllt worden.«
Der Seemann zauderte, einen Befehl auszuführen, der sich so greulich an der Gabe Gottes versündigte, und berief in Eile alle armen und dürftigen Leute aus der Stadt an die Stelle, wo das Schiff lag, durch deren Anblick er seine Herrin zu bewegen hoffte. Sie kam und frug: »Wie ist mein Befehl ausgerichtet?« Da fiel eine Schar von Armen auf die Knie vor ihr und baten, daß sie ihnen das Korn austeilen möchte, lieber als es vom Meer verschlingen zu lassen.
Aber das Herz der Jungfrau war hart wie Stein, und sie erneuerte den Befehl, die ganze Ladung schleunig über Bord zu werfen. Da bezwang sich der Schiffsmeister länger nicht und rief laut: »Nein, diese Bosheit kann Gott nicht ungerächt lassen, wenn es wahr ist, daß der Himmel das Gute lohnt und das Böse straft; ein Tag wird kommen, wo Ihr gerne die edlen Körner, die Ihr so verspielt, eins nach dem andern auflesen möchtet, Euren Hunger damit zu stillen!« -
»Wie«, rief sie mit höllischem Gelächter, »ich soll dürftig werden können? Ich soll in Armut und Brotmangel fallen? So wahr dies geschieht, so wahr sollen auch meine Augen diesen Ring wieder erblicken, den ich hier in die Tiefe der See werfe.« Bei diesem Wort zog sie einen kostbaren Ring vom Finger und warf ihn in die Wellen. Die ganze Ladung des Schiffes und aller Weizen, der darauf war, wurde also in die See ausgeschüttet.
Was geschieht? Einige Tage darauf ging die Magd dieser Frauen zu Markt, kaufte einen Schellfisch und wollte ihn in der Küche zurichten; als sie ihn aufschnitt, fand sie darin einen kostbaren Ring und zeigte ihn ihrer Frau. Wie ihn die Meisterin sah, erkannte sie ihn sogleich für ihren Ring, den sie neulich ins Meer geworfen hatte, erbleichte und fühlte die Vorboten der Strafe in ihrem Gewissen.
Wie groß war aber ihr Schrecken, als in demselben Augenblick die Botschaft eintraf, ihre ganze, aus Morgenland kommende Flotte wäre gestrandet! Wenige Tage darauf kam die neue Zeitung von untergegangenen Schiffen, worauf sie noch reiche Ladungen hatte. Ein anderes Schiff raubten die Mohren und Türken; der Fall einiger Kaufhäuser, worin sie verwickelt war, vollendete bald ihr Unglück, und kaum war ein Jahr verflossen, so erfüllte sich die schreckliche Drohung des Schiffsmeisters in allen Stücken.
Arm und von keinem betrauert, von vielen verhöhnt, sank sie je länger, je mehr in Not und Elend, hungrig bettelte sie Brot vor den Türen und bekam oft keinen Bissen, endlich verkümmerte sie und starb verzweifelnd.
Der Weizen aber, der in das Meer geschüttet worden war, sproß und wuchs das folgende Jahr, doch trug er taube Ähren. Niemand achtete das Warnungszeichen, allein die Ruchlosigkeit von Stavoren nahm von Jahr zu Jahr überhand, da zog Gott der Herr seine schirmende Hand ab von der bösen Stadt.
Auf eine Zeit schöpfte man Hering und Butt aus dem Ziehbrunnen, und in der Nacht öffnete sich die See und verschwalg mehr als drei Viertel der Stadt in rauschender Flut. Noch beinah jedes Jahr versinken einige Hütten der Insassen, und es ist seit der Zeit kein Segen und kein wohlhabender Mann in Stavoren zu finden.
Noch immer wächst jährlich an derselben Stelle ein Gras aus dem Wasser, das kein Kräuterkenner kennt, das keine Blüte trägt und sonst nirgends mehr auf Erden gefunden wird. Der Halm treibt lang und hoch, die Ähre gleicht der Weizenähre, ist aber taub und ohne Körner. Die Sandbank, worauf es grünt, liegt entlangs der Stadt Stavoren und trägt keinen andern Namen als den des Frauensands.
DIE SCHLICKERLINGE
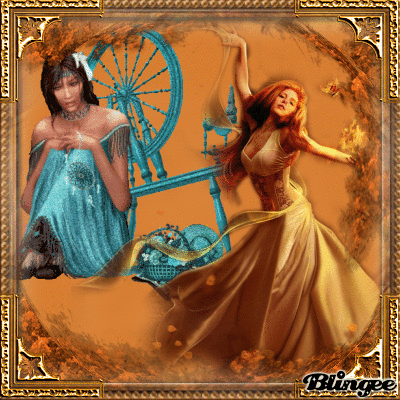
Es war einmal ein Mädchen, das war schön, aber faul und nachlässig. Wenn es spinnen sollte, so war es so verdrießlich, dass, wenn ein kleiner Knoten im Flachs war, es gleich einen ganzen Haufen mit heraus riss und neben sich zur Erde schlickerte.
Nun hatte es ein Dienstmädchen, das war arbeitsam, suchte den weg geworfenen Flachs zusammen, reinigte ihn, spann ihn fein und ließ sich ein hübsches Kleid daraus weben. Ein junger Mann hatte um das faule Mädchen geworben, und die Hochzeit sollte gehalten werden. Auf dem Polterabend tanzte das fleißige in seinem schönen Kleide lustig herum, da sprach die Braut
"ach, wat kann dat Mäken springen
in minen Slickerlingen!"
Das hörte der Bräutigam und fragte die Braut, was sie damit sagen wollte. Da erzählte sie ihm, dass das Mädchen ein Kleid von dem Flachs trüge, den sie weggeworfen hätte. Wie der Bräutigam das hörte und ihre Faulheit bemerkte und den Fleiß des armen Mädchens, so ließ er sie stehen, ging zu jener und wählte sie zu seiner Frau.
MEISTER PFRIEM

Meister Pfriem war ein kleiner hagerer, aber lebhafter Mann, der keinen Augenblick Ruhe hatte. Sein Gesicht, aus dem nur die aufgestülpte Nase vorragte, war pockennarbig und leichenblass, sein Haar grau und struppig, seine Augen klein, aber sie blitzten unaufhörlich rechts und links hin. Er bemerkte alles, tadelte alles, wusste alles besser und hatte in allem recht.
Ging er auf der Straße, so ruderte er heftig mit beiden Armen, und einmal schlug er einem Mädchen, das Wasser trug, den Eimer so hoch in die Luft, dass er selbst davon begossen ward. "Schafskopf," rief er ihr zu, indem er sich schüttelte, "konntest du nicht sehen, dass ich hinter dir herkam?"
Seines Handwerks war er ein Schuster, und wenn er arbeitete, so fuhr er mit dem Draht so gewaltig aus, dass er jedem, der sich nicht weit genug in der Ferne hielt, die Faust in den Leib stieß. Kein Geselle blieb länger als einen Monat bei ihm, denn er hatte an der besten Arbeit immer etwas auszusetzen. Bald waren die Stiche nicht gleich, bald war ein Schuh länger, bald ein Absatz höher als der andere, bald war das Leder nicht hinlänglich geschlagen.
"Warte," sagte er zu dem Lehrjungen, "ich will dir schon zeigen, wie man die Haut weich schlägt," holte den Riemen und gab ihm ein paar Hiebe über den Rücken. Faulenzer nannte er sie alle. Er selber brachte aber doch nicht viel vor sich, weil er keine Viertelstunde ruhig sitzen blieb. War seine Frau früh morgens aufgestanden und hatte Feuer angezündet, so sprang er aus dem Bett und lief mit bloßen Füßen in die Küche. "Wollt ihr mir das Haus anzünden?" schrie er, "das ist ja ein Feuer, dass man einen Ochsen dabei braten könnte! oder kostet das Holz etwa kein Geld?"
Standen die Mägde am Waschfass, lachten und erzählten sich, was sie wussten, so schalt er sie aus "da stehen die Gänse und schnattern und vergessen über dem Geschwätz ihre Arbeit. Und wo zu die frische Seife? heillose Verschwendung und obendrein eine schändliche Faulheit: sie wollen die Hände schonen und das Zeug nicht ordentlich reiben." Er sprang fort, stieß aber einen Eimer voll Lauge um, so dass die ganze Küche überschwemmt ward.
Richtete man ein neues Haus auf, so lief er ans Fenster und sah zu. "Da vermauern sie wieder den roten Sandstein," rief er, "der niemals austrocknet; in dem Haus bleibt kein Mensch gesund. Und seht einmal, wie schlecht die Gesellen die Steine aufsetzen. Der Mörtel taugt auch nichts: Kies muss hinein, nicht Sand. Ich erlebe noch, dass den Leuten das Haus über dem Kopf zusammenfällt."
Er setzte sich und tat ein paar Stiche, dann sprang er wieder auf, hakte sein Schurzfell los und rief "ich will nur hinaus und den Menschen ins Gewissen reden." Er geriet aber an die Zimmerleute. "Was ist das?" rief er, "ihr haut ja nicht nach der Schnur. Meint ihr, die Balken würden gerade stehen? es weicht einmal alles aus den Fugen."
Er riss einem Zimmermann die Axt aus der Hand und wollte ihm zeigen, wie er hauen müsste, als aber ein mit Lehm beladner Wagen herangefahren kam, warf er die Axt weg und sprang zu dem Bauer, der nebenher ging. "Ihr seid nicht recht bei Trost," rief er, "wer spannt junge Pferde vor einen schwer beladnen Wagen? die armen Tiere werden Euch auf dem Platz umfallen." Der Bauer gab ihm keine Antwort, und Pfriem lief vor Ärger in seine Werkstätte zurück.
Als er sich wieder zur Arbeit setzen wollte, reichte ihm der Lehrjunge einen Schuh. "Was ist das wieder?" schrie er ihn an, "habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet die Schuhe nicht so weit ausschneiden? wer wird einen solchen Schuh kaufen, an dem fast nichts ist als die Sohle? ich verlange, dass meine Befehle unmangelhaft befolgt werden." "Meister," antwortete der Lehrjunge, "Ihr mögt wohl recht haben, dass der Schuh nichts taugt, aber es ist derselbe, den Ihr zugeschnitten und selbst in Arbeit genommen habt. Als Ihr vorhin aufgesprungen seid, habt Ihr ihn vom Tisch herab geworfen, und ich habe ihn nur aufgehoben. Euch könnte es aber ein Engel vom Himmel nicht recht machen."
Meister Pfriem träumte in einer Nacht, er wäre gestorben und befände sich auf dem Weg nach dem Himmel. Als er anlangte, klopfte er heftig an die Pforte: "es wundert mich," sprach er, "dass sie nicht einen Ring am Tor haben, man klopft sich die Knöchel wund." Der Apostel Petrus öffnete und wollte sehen, wer so ungestüm Einlass begehrte. "Ach, Ihr seid es, Meister Pfriem," sagte er, "ich will Euch wohl einlassen, aber ich warne Euch, dass Ihr von Eurer Gewohnheit ablasst und nichts tadelt, was Ihr im Himmel seht: es könnte Euch übel bekommen."
"Ihr hättet Euch die Ermahnung sparen können," erwiderte Pfriem, "ich weiß schon, was sich ziemt, und hier ist, Gott sei Dank, alles vollkommen und nichts zu tadeln wie auf Erden." Er trat also ein und ging in den weiten Räumen des Himmels auf und ab. Er sah sich um, rechts und links, schüttelte aber zuweilen mit dem Kopf oder brummte etwas vor sich hin.
Indem erblickte er zwei Engel, die einen Balken weg trugen. Es war der Balken, den einer im Auge gehabt hatte, während er nach dem Splitter in den Augen anderer suchte. Sie trugen aber den Balken nicht der Länge nach, sondern quer. "Hat man je einen solchen Unverstand gesehen?" dachte Meister Pfriem; doch schwieg er und gab sich zufrieden: "es ist im Grunde einerlei, wie man den Balken trägt, geradeaus oder quer, wenn man nur damit durchkommt, und wahrhaftig, ich sehe, sie stoßen nirgends an."
Bald hernach erblickte er zwei Engel, welche Wasser aus einem Brunnen in ein Fass schöpften, zugleich bemerkte er, dass das Fass durchlöchert war und das Wasser von allen Seiten heraus lief. Sie tränkten die Erde mit Regen. "Alle Hagel!" platzte er heraus, besann sich aber glücklicherweise und dachte "vielleicht ist's bloßer Zeitvertreib; macht's einem Spaß, so kann man dergleichen unnütze Dinge tun, zumal hier im Himmel, wo man, wie ich schon bemerkt habe, doch nur faulenzt."
Er ging weiter und sah einen Wagen, der in einem tiefen Loch stecken geblieben war. "Kein Wunder," sprach er zu dem Mann, der dabei stand, "wer wird so unvernünftig aufladen? was habt Ihr da?" "Fromme Wünsche," antwortete der Mann, "ich konnte damit nicht auf den rechten Weg kommen, aber ich habe den Wagen noch glücklich herauf geschoben, und hier werden sie mich nicht stecken lassen."
Wirklich kam ein Engel und spannte zwei Pferde vor. "Ganz gut," meinte Pfriem, "aber zwei Pferde bringen den Wagen nicht heraus, viere müssen wenigstens davor." Ein anderer Engel kam und führte noch zwei Pferde herbei, spannte sie aber nicht vorn, sondern hinten an. Das war dem Meister Pfriem zu viel. "Tollpatsch," brach er los, "was machst du da? hat man je, solange die Welt steht, auf diese Weise einen Wagen herausgezogen? da meinen sie aber in ihrem dünkelhaften Übermut alles besser zu wissen."
Er wollte weiterreden, aber einer von den Himmelsbewohnern hatte ihn am Kragen gepackt und schob ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus. Unter der Pforte drehte der Meister noch einmal den Kopf nach dem Wagen und sah, wie er von vier Flügelpferden in die Höhe gehoben ward.
In diesem Augenblick erwachte Meister Pfriem. "Es geht freilich im Himmel etwas anders her als auf Erden," sprach er zu sich selbst, "und da lässt sich manches entschuldigen, aber wer kann geduldig mit ansehen, dass man die Pferde zugleich hinten und vorn anspannt? freilich, sie hatten Flügel, aber wer kann das wissen? Es ist übrigens eine gewaltige Dummheit, Pferden, die vier Beine zum Laufen haben, noch ein paar Flügel anzuheften. Aber ich muss aufstehen, sonst machen sie mir im Haus lauter verkehrtes Zeug. Es ist nur ein Glück, dass ich nicht wirklich gestorben bin."
DER MOND
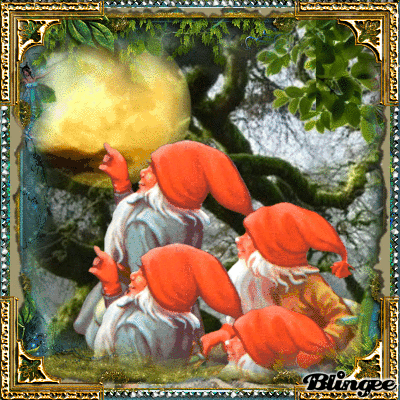
Vorzeiten gab es ein Land, wo die Nacht immer dunkel und der Himmel wie ein schwarzes Tuch darüber gebreitet war, denn es ging dort niemals der Mond auf, und kein Stern blinkte in der Finsternis. Bei Erschaffung der Welt hatte das nächtliche Licht ausgereicht.
Aus diesem Land gingen einmal vier Bursche auf die Wanderschaft und gelangten in ein anderes Reich, wo abends, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, auf einem Eichbaum eine leuchtende Kugel stand, die weit und breit ein sanftes Licht aus goss. Man konnte dabei alles wohl sehen und unterscheiden, wenn es auch nicht so glänzend wie die Sonne war.
Die Wanderer standen still und fragten einen Bauer, der da mit seinem Wagen vorbeifuhr, was das für ein Licht sei. "Das ist der Mond," antwortete dieser, "unser Schultheiß hat ihn für drei Taler gekauft und an den Eichbaum befestigt. Er muss täglich Öl aufgießen und ihn rein erhalten, damit er immer hell brennt. Dafür erhält er von uns wöchentlich einen Taler."
Als der Bauer weggefahren war, sagte der eine von ihnen "diese Lampe könnten wir brauchen, wir haben daheim einen Eichbaum, der ebenso groß ist, daran können wir sie hängen. Was für eine Freude, wenn wir nachts nicht in der Finsternis herumtappen!"
"Wisst ihr was?" sprach der zweite, "wir wollen Wagen und Pferde holen und den Mond weg führen. Sie können sich hier einen andern kaufen." "Ich kann gut klettern," sprach der dritte, "ich will ihn schon herunterholen!" Der vierte brachte einen Wagen mit Pferden herbei, und der dritte stieg den Baum hinauf, bohrte ein Loch in den Mond, zog ein Seil hindurch und ließ ihn herab.
Als die glänzende Kugel auf dem Wagen lag, deckten sie ein Tuch darüber, damit niemand den Raub bemerken sollte. Sie brachten ihn glücklich in ihr Land und stellten ihn auf eine hohe Eiche. Alte und Junge freuten sich, als die neue Lampe ihr Licht über alle Felder leuchten ließ und Stuben und Kammern damit erfüllte. Die Zwerge kamen aus den Felsenhöhlen hervor, und die kleinen Wichtelmänner tanzten in ihren roten Röckchen auf den Wiesen den Ringeltanz.
Die vier versorgten den Mond mit Öl, putzten den Docht und erhielten wöchentlich ihren Taler. Aber sie wurden alte Greise, und als der eine erkrankte und seinen Tod voraussah, verordnete er, dass der vierte Teil des Mondes als sein Eigentum ihm mit in das Grab sollte gegeben werden. Als er gestorben war, stieg der Schultheiß auf den Baum und schnitt mit der Heckenschere ein Viertel ab, das in den Sarg gelegt ward.
Das Licht des Mondes nahm ab, aber noch nicht merklich. Als der zweite starb, ward ihm das zweite Viertel mitgegeben, und das Licht minderte sich. Noch schwächer ward es nach dem Tod des dritten, der gleichfalls seinen Teil mitnahm, und als der vierte ins Grab kam, trat die alte Finsternis wieder ein. Wenn die Leute abends ohne Laterne ausgingen, stießen sie mit den Köpfen zusammen.
Als aber die Teile des Monds in der Unterwelt sich wieder vereinigten, so wurden dort, wo immer Dunkelheit geherrscht hatte, die Toten unruhig und erwachten aus ihrem Schlaf. Sie erstaunten, als sie wieder sehen konnten: das Mondlicht war ihnen genug, denn ihre Augen waren so schwach geworden, dass sie den Glanz der Sonne nicht ertragen hätten.
Sie erhoben sich, wurden lustig und nahmen ihre alte Lebensweise wieder an. Ein Teil ging zum Spiel und Tanz, andere liefen in die Wirtshäuser, wo sie Wein forderten, sich betranken, tobten und zankten, und endlich ihre Knüppel aufhoben und sich prügelten. Der Lärm ward immer ärger und drang endlich bis in den Himmel hinauf.
Der heilige Petrus, der das Himmelstor bewacht, glaubte, die Unterwelt wäre in Aufruhr geraten, und rief die himmlischen Heerscharen zusammen, die den bösen Feind, wenn er mit seinen Gesellen den Aufenthalt der Seligen stürmen wollte, zurück jagen sollten. Da sie aber nicht kamen, so setzte er sich auf sein Pferd und ritt durch das Himmelstor hinab in die Unterwelt. Da brachte er die Toten zur Ruhe, hieß sie sich wieder in ihre Gräber legen und nahm den Mond mit fort, den er oben am Himmel aufhing.
LIEB UND LEID TEILEN

Es war einmal ein Schneider, der war ein zänkischer Mensch, und seine Frau, die gut, fleißig und fromm war, konnte es ihm niemals recht machen. Was sie tat, er war unzufrieden, brummte, schalt, raufte und schlug sie. Als die Obrigkeit endlich davon hörte, ließ sie ihn vorfordern und ins Gefängnis setzen, damit er sich bessern sollte.
Er saß eine Zeitlang bei Wasser und Brot, dann wurde er wieder freigelassen, musste aber geloben, seine Frau nicht mehr zu schlagen, sondern friedlich mit ihr zu leben, Lieb und Leid zu teilen, wie es sich unter Eheleuten gebührt. Eine Zeitlang ging es gut, dann aber geriet er wieder in seine alte Weise, war mürrisch und zänkisch. Und weil er sie nicht schlagen durfte, wollte er sie beiden Haaren packen und raufen.
Die Frau entwischte ihm und sprang auf den Hof hinaus, er lief aber mit der Elle und Schere hinter ihr her, jagte sie herum und warf ihr die Elle und Schere, und was ihm sonst zur Hand war, nach. Wenn er sie traf, so lachte er, und wenn er sie fehlte, so tobte und wetterte er. Er trieb es so lange, bis die Nachbarn der Frau zu Hilfe kamen.
Der Schneider ward wieder vor die Obrigkeit gerufen und an sein Versprechen erinnert. "Liebe Herren," antwortete er, "ich habe gehalten, was ich gelobt habe, ich habe sie nicht geschlagen, sondern Lieb und Leid mit ihr geteilt." "Wie kann das sein," sprach der Richter, "da sie abermals so große Klage über Euch führt?"
"Ich habe sie nicht geschlagen, sondern ihr nur, weil sie so wunderlich aussah, die Haare mit der Hand kämmen wollen: sie ist mir aber entwichen und hat mich böslich verlassen. Da bin ich ihr nachgeeilt und habe, damit sie zu ihrer Pflicht zurückkehre, als eine gut gemeinte Erinnerung nachgeworfen, was mir eben zur Hand war. Ich habe auch Lieb und Leid mit ihr geteilt, denn sooft ich sie getroffen habe, ist es mir lieb gewesen und ihr leid: habe ich sie aber gefehlt, so ist es ihr lieb gewesen, mir aber leid."
Die Richter waren mit dieser Antwort nicht zufrieden, sondern ließen ihm seinen verdienten Lohn auszahlen.
DIE WEISSE TAUBE
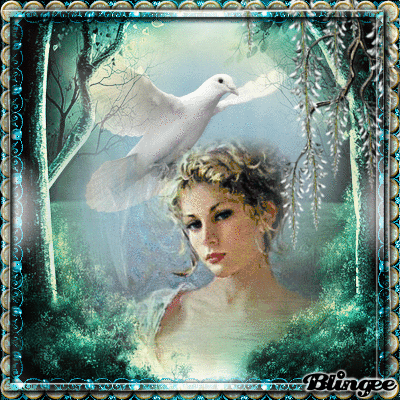
Vor eines Königs Palast stand ein prächtiger Birnbaum, der trug jedes Jahr die schönsten Früchte, aber wenn sie reif waren, wurden sie in einer Nacht alle geholt, und kein Mensch wusste, wer es getan hatte.
Der König hatte drei Söhne, davon ward der jüngste für einfältig gehalten, und hieß der Dummling. Da befahl er dem ältesten, er solle ein Jahr lang alle Nacht unter dem Birnbaum wachen, damit der Dieb einmal entdeckt werde. Der tat das auch und wachte alle Nacht, der Baum blühte und war ganz voll von Früchten, und wie sie anfingen reif zu werden, wachte er noch fleißiger, und endlich waren sie ganz reif und sollten am andern Tage abgebrochen werden; in der letzten Nacht aber überfiel ihn ein Schlaf und er schlief ein, und wie er aufwachte, waren alle Früchte fort, und nur die Blätter noch übrig.
Da befahl der König dem zweiten Sohn ein Jahr zu wachen, dem ging es nicht besser, als dem ersten; in der letzten Nacht konnte er sich des Schlafes gar nicht erwehren, und am Morgen waren die Birnen alle abgebrochen. Endlich befahl der König dem Dummling ein Jahr zu wachen, darüber lachten alle, die an des Königs Hof waren.
Der Dummling aber wachte, und in der letzten Nacht wehrte er sich den Schlaf ab, da sah er, wie eine weiße Taube geflogen kam, eine Birne nach der andern abpickte und fort trug. Und als sie mit der letzten fort flog, stand der Dummling auf und ging ihr nach.
Die Taube flog aber auf einen hohen Berg und verschwand auf einmal in einem Felsenritz. Der Dummling sah sich um, da stand ein kleines graues Männchen neben ihm, zu dem sprach er: "Gott segne dich!" "Gott hat mich gesegnet in diesem Augenblick durch diese deine Worte", antwortete das Männchen, "denn sie haben mich erlöst, steig du in den Felsen hinab, da wirst du dein Glück finden."
Der Dummling trat in den Felsen, viele Stufen führten ihn hinunter, und wie er unten hin kam, sah er die Weiße Taube ganz von Spinnweben umstrickt und zugewebt. Wie sie ihn aber erblickte, brach sie hindurch, und als sie den letzten Faden zerrissen, stand eine schöne Prinzessin vor ihm, die hatte er auch erlöst, und sie ward seine Gemahlin und er ein reicher König, und regierte sein Land mit Weisheit.
BUTTERMILCHTURM

Vom Buttermilchturm zu Marienburg in Preußen wird erzählt, einstmal habe der Deutschmeister auf einem nah gelegenen Dorf etwas Buttermilch für sich fordern lassen. Allein die Bauern spotteten seines Boten und sandten tags darauf zwei Männer in die Burg, die brachten ein ganzes Faß voll Buttermilch getragen. Erzürnt sperrte der Deutschmeister die beiden Bauern in einen Turm und zwang sie, so lang drin zu bleiben, bis sie die Milch sämtlich aus dem Faß gegessen hätten. Seitdem hat der Burgturm den Namen.
Andere aber berichten folgendes: Die Einwohner eines benachbarten Dorfs mußten bis zu dem Bauplatz einen Weg mit Mariengroschen legen und so viel Buttermilch herbeischaffen, als zur Bereitung des Kalks statt Wassers nötig war, und mit diesem Mörtel wurde hernach der Turm aufgemauert.
Nach Fürst: Die Bauern von Großlichtenau waren so gottlos, daß sie eine Sau ins Bett legten und den Pfaffen des Orts, dem Kranken die letzte Ölung zu geben, rufen ließen. Zur Strafe dieser Leichtfertigkeit wurde ihnen befohlen, auf ihre Kosten den Turm aufzuführen und den Kalk dazu mit Buttermilch anzumachen.
DIE SCHOLLE

Die Fische waren schon lange unzufrieden, dass keine Ordnung in ihrem Reich herrschte. Keiner kehrte sich an den andern, schwamm rechts und links, wie es ihm einfiel, fuhr zwischen denen durch, die zusammenbleiben wollten, oder sperrte ihnen den Weg, und der Stärkere gab dem Schwächeren einen Schlag mit dem Schwanz, dass er weit weg fuhr, oder er verschlang ihn ohne weiteres.
"Wie schön wäre es, wenn wir einen König hätten, der Recht und Gerechtigkeit bei uns übte," sagten sie und vereinigten sich, den zu ihrem Herrn zu wählen, der am schnellsten die Fluten durchstreichen und dem Schwachen Hilfe bringen könnte.
Sie stellten sich also am Ufer in Reihe und Glied auf, und der Hecht gab mit dem Schwanz ein Zeichen, worauf sie alle zusammen aufbrachen. Wie ein Pfeil schoss der Hecht dahin und mit ihm der Hering, der Gründling, der Barsch, die Karpfen, und wie sie alle heißen. Auch die Scholle schwamm mit und hoffte das Ziel zu erreichen.
Auf einmal ertönte der Ruf "der Hering ist vor! der Hering ist vor." "Wen is vör?" schrie verdrießlich die platte missgünstige Scholle, die weit zurückgeblieben war, "wen is vör?" "Der Hering, der Hering," war die Antwort. "De nackte Hering?" rief die Neidische, "de nackte Hering?" Seit der Zeit steht der Scholle zur Strafe das Maul schief.
DIE KRÄHEN
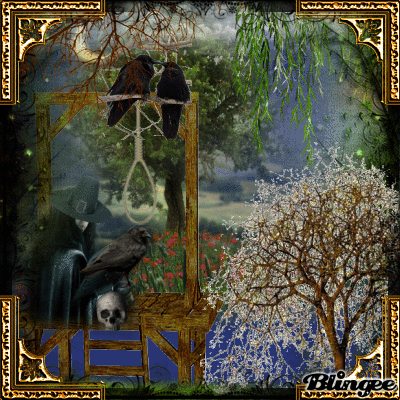
Es hatte ein rechtschaffener Soldat etwas Geld verdient und zusammengespart, weil er fleißig war und es nicht, wie die andern, in den Wirtshäusern durchbrachte. Nun waren zwei von seinen Kameraden, die hatten eigentlich ein falsches Herz und wollten ihn um sein Geld bringen, sie stellten sich aber äußerlich ganz freundschaftlich an. Auf eine Zeit sprachen sie zu ihm: "Hör, was sollen wir hier in der Stadt liegen, wir sind ja eingeschlossen darin, als wären wir Gefangene, und gar einer wie du, der könnte sich daheim was Ordentliches verdienen und vergnügt leben."
Mit solchen Reden setzten sie ihm auch so lange zu, bis er endlich einwilligte und mit ihnen ausreißen wollte; die zwei andern hatten aber nichts anders im Sinn, als ihm draußen sein Geld abzunehmen. Wie sie nun ein Stück Wegs fort gegangen waren, sagten die zwei: "Wir müssen uns da rechts einschlagen, wenn wir an die Grenze kommen wollen." "Nein", antwortete er, "da geht's gerade wieder in die Stadt zurück, links müssen wir uns halten." "Was, du willst dich mausig machen?" riefen die zwei, drangen auf ihn ein, schlugen ihn, bis er nieder fiel, und nahmen ihm sein Geld aus den Taschen; das war aber noch nicht genug, sie stachen ihm die Augen aus, schleppten ihn zum Galgen und banden ihn daran fest. Da ließen sie ihn und gingen mit dem gestohlenen Geld in die Stadt zurück.
Der arme Blinde wusste nicht, an welchem schlechten Ort er war, fühlte um sich und merkte, dass er unter einem Balken Holz saß. Da meinte er, es wäre ein Kreuz, sprach: "Es ist doch gut von ihnen, dass sie mich wenigstens unter ein Kreuz gebunden haben, Gott ist bei mir", und fing an, recht zu Gott zu beten. Wie es ungefähr Nacht werden mochte, hörte er etwas flattern; das waren aber drei Krähen, die ließen sich auf dem Balken nieder.
Danach hörte er, wie eine sprach: "Schwester, was bringt Ihr Gutes? Ja, wenn die Menschen wüssten, was wir wissen! Die Königstochter ist krank, und der alte König hat sie demjenigen versprochen, der sie heilt; das kann aber keiner, denn sie wird nur gesund, wenn die Kröte in dem Teich dort zu Asche verbrannt wird und sie die Asche mit Wasser trinkt."
Da sprach die zweite: "Ja, wenn die Menschen wüssten, was wir wissen! Heute Nacht fällt ein Tau vom Himmel, so wunderbar und heilsam, wer blind ist und bestreicht seine Augen damit, der erhält sein Gesicht wieder." Da sprach auch die dritte: "Ja, wenn die Menschen wüssten, was wir wissen! Die Kröte hilft nur einem, und der Tau hilft nur wenigen, aber in der Stadt ist große Not, da sind alle Brunnen vertrocknet, und niemand weiß, dass der große viereckige Stein auf dem Markt muss weg genommen und darunter gegraben werden, dort quillt das schönste Wasser."
Wie die drei Krähen das gesagt hatten, hörte er es wieder flattern, und sie flogen da fort. Er machte sich allmählich von seinen Banden los, und dann bückte er sich und brach ein paar Gräserchen ab und bestrich seine Augen mit dem Tau, der darauf gefallen war. Alsbald ward er wieder sehend und waren Mond und Sterne am Himmel, und sah er, dass er neben dem Galgen stand.
Danach suchte er Scherben und sammelte von dem köstlichen Tau, soviel er zusammenbringen konnte, und wie das geschehen war, ging er zum Teich, grub das Wasser davon ab, holte die Kröte heraus und verbrannte sie zu Asche. Mit der Asche ging er an des Königs Hof und ließ die Königstochter davon einnehmen, und als sie gesund war, verlangte er sie, wie es versprochen war, zur Gemahlin.
Dem König aber gefiel er nicht, weil er so schlechte Kleider anhatte, und er sprach, wer seine Tochter haben wollte, der müsste der Stadt erst Wasser verschaffen, und hoffte ihn damit loszuwerden. Er aber ging hin, hieß die Leute den viereckigen Stein auf dem Markt weg heben und darunter nach Wasser graben. Kaum hatten sie angefangen zu graben, so kamen sie schon zu einer Quelle, aus der ein mächtiger Wasserstrahl hervor sprang. Der König konnte ihm nun seine Tochter nicht länger verweigern, er wurde mit ihr vermählt, und lebten sie in einer vergnügten Ehe.
Auf eine Zeit, als er durchs Feld spazieren ging, begegneten ihm seine beiden ehemaligen Kameraden, die so treulos an ihm gehandelt hatten. Sie kannten ihn nicht, er aber erkannte sie gleich, ging auf sie zu und sprach: "Seht, das ist euer ehemaliger Kamerad, dem ihr so schändlich die Augen ausgestochen habt, aber der liebe Gott hat mir's zum Glück gedeihen lassen." Da fielen sie ihm zu Füßen und baten um Gnade, und weil er ein gutes Herz hatte, erbarmte er sich ihrer und nahm sie mit sich, gab ihnen auch Nahrung und Kleider. Er erzählte ihnen danach, wie es ihm ergangen und wie er zu diesen Ehren gekommen wäre.
Als die zwei das vernahmen, hatten sie keine Ruhe und wollten sich eine Nacht unter den Galgen setzen, ob sie vielleicht auch etwas Gutes hörten. Wie sie nun unter dem Galgen saßen, flatterte auch bald etwas über ihren Häuptern und kamen die drei Krähen. Die eine sprach zur andern: "Hört, Schwestern, es muss uns jemand behorcht haben, denn die Königstochter ist gesund, die Kröte ist fort aus dem Teich, ein Blinder ist sehend geworden, und in der Stadt haben sie einen frischen Brunnen gegraben, kommt, lasst uns den Horcher suchen und ihn bestrafen."
Da flatterten sie herab und fanden die beiden, und eh sich die helfen konnten, saßen ihnen die Raben auf den Köpfen und hackten ihnen die Augen aus und hackten weiter so lange ins Gesicht, bis sie ganz tot waren. Da blieben sie liegen unter dem Galgen. Als sie nun ein paar Tage nicht wiederkamen, dachte ihr ehemaliger Kamerad: "Wo mögen die zwei herum irren", und ging hinaus, sie zu suchen. Da fand er aber nichts mehr als ihre Gebeine, die trug er vom Galgen weg und legte sie in ein Grab.
DAS BERGMÄNNCHEN

In der Schweiz hat es im Volk viele Erzählungen von Berggeistern, nicht bloß auf dem Gebirg allein, sondern auch unten am Belp, zu Gelterfingen und Rümlingen im Bernerland. Diese Bergmänner sind auch Hirten, aber nicht Ziegen, Schafe und Kühe sind ihr Vieh, sondern Gemsen, und aus der Gemsenmilch machen sie Käse, die so lange wieder wachsen und ganz werden, wenn man sie angeschnitten oder angebissen, bis man sie unvorsichtigerweise völlig und auf einmal, ohne Reste zu lassen, verzehrt.
Still und friedlich wohnt das Zwergvolk in den innersten Felsklüften und arbeitet emsig fort, selten erscheinen sie den Menschen, oder ihre Erscheinung bedeutet ein Leid und ein Unglück; außer wenn man sie auf den Matten tanzen sieht, welches ein gesegnetes Jahr anzeigt. Verirrte Lämmer führen sie oft den Leuten nach Haus, und arme Kinder, die nach Holz gehen, finden zuweilen Näpfe mit Milch im Walde stehen, auch Körbchen mit Beeren, die ihnen die Zwerge hinstellen.
Vorzeiten pflügte einmal ein Hirt mit seinem Knechte den Acker, da sah man neben aus der Felswand dampfen und rauchen. »Da kochen und sieden die Zwerge«, sprach der Knecht, »und wir leiden schweren Hunger, hätten wir doch auch ein Schüsselchen voll davon.«
Und wie sie das Pflugsterz umkehrten, siehe, da lag in der Furche ein weißes Laken gebreitet, und darauf stand ein Teller mit frischgebackenem Kuchen, und sie aßen dankbar und wurden satt. Abends beim Heimgehen war Teller und Messer verschwunden, bloß das Tischtuch lag noch da, das der Bauer mit nach Haus nahm.
DER RITTER MIT DEM SCHWAN

Zu Flandern war vor alters ein Königreich Lillefort, da, wo jetzt die Städte Ryßel und Doway liegen; in demselben herrschte Pyrion mit Matabruna, seiner Gemahlin. Sie zeugten einen Sohn, namens Oriant. Dieser jagte eines Tages im Walde einen Hirsch, der Hirsch entsprang ihm aber in ein Wasser, und Oriant setzte sich müde an einen schönen Brunnen, um dabei auszuruhen.
Als er so allein saß, kam eine edle Jungfrau gegangen, die seine Hunde sah und ihn fragte, mit wessen Erlaub er in ihrem Wald jage. Diese Jungfrau hieß Beatrix, und Oriant wurde von ihrer wunderbaren Schönheit so getroffen, daß er ihr die Liebe erklärte und seine Hand auf der Stelle bot. Beatrix willigte ein, und der junge König nahm sie mit aus dem Wald nach Lillefort, um eine fröhliche Hochzeit zu feiern.
Matabrun, seine Mutter, ging ihm aber entgegen und war der jungen Braut gram darum, daß er sie nackt und bloß heim geführt hatte und niemand wußte, woher sie stammte. Nach einiger Zeit nun wurde die Königin schwanger; während dessen geschah's, daß sie von ungefähr am Fenster stand und zwei Kindlein, die eine Frau auf einmal geboren hatte, zur Taufe tragen sah. Da rief sie heimlich ihren Gemahl und sprach: wie das möglich wäre, daß eine Frau zwei Kinder gebäre, ohne zwei Männer zu haben? Oriant antwortete: »Mit Gottes Gnaden kann eine Frau sieben Kinder auf einmal von ihrem Manne empfangen.«
Bald darnach mußte der König in den Krieg ziehen; da sich nun seine Gemahlin schwanger befand, empfahl er sie seiner Mutter zu sorgfältiger Obhut und nahm Abschied. Matabruna hingegen dachte auf nichts als Böses und beredete sich mit der Wehmutter, daß sie der Königin, wenn sie gebären würde, statt der Kinder junge Hunde unterschieben, die Kinder selbst töten und Beatrix einer strafbaren Gemeinschaft mit Hunden anklagen wollten.
Als nun ihre Zeit heranrückte, ward Beatrix von sechs Söhnen und einer Tochter entbunden, und jedem Kindlein lag um seinen Hals eine silberne Kette. Matabruna schaffte sogleich die Kinder weg und legte sieben Welpen hin; die Wehfrau aber rief. »Ach, Königin, was ist Euch geschehen! Ihr habt sieben scheußliche Welpen geboren, tut sie weg und laßt sie unter die Erde graben, daß dem Könige seine Ehre bewahrt bleibe.«
Beatrix weinte und rang die Hände, daß es einen erbarmen mußte; die alte Königin aber hub an sie heftig zu schelten und des schändlichsten Ehebruchs zu zeihen. Darauf ging Matabruna weg, rief einen vertrauten Diener, dem sie die sieben Kindlein übergab, und sprach: »Die silbernen Ketten an dieser Brut bedeuten, daß sie dereinst Räuber und Mörder werden; darum muß man eilen, sie aus der Welt zu schaffen.«
Der Knecht nahm sie in seinen Mantel, ritt in den Wald und wollte sie töten; als sie ihn aber anlachten, wurde er mitleidig, legte sie hin und empfahl sie der Barmherzigkeit Gottes. Darauf kehrte er an den Hof zurück und sagte der Alten, daß er ihren Befehl ausgerichtet, wofür sie ihm großen Lohn versprach.
Die sieben Kinder schrien unterdessen vor Hunger im Walde; das hörte ein Einsiedler, Helias mit Namen, der fand sie und trug sie in seinem Gewande mit sich in die Klause. Der alte Mann wußte aber nicht, wie er sie ernähren sollte; siehe, da kam eine weiße Geiß gelaufen, bot den Kindern ihre Mammen, und sie sogen begierig daran. Diese Geiß stellte sich nun von Tag zu Tage ein, bis daß die Kinder wuchsen und größer wurden. Der Einsiedel machte ihnen dann kleine Röcklein von Blättern, sie gingen spielen im Gesträuch und suchten sich wilde Beeren, die sie aßen, und wurden auferzogen in Gottes Furcht und Gnade.
Der König, nachdem er den Feind besiegt hatte, kehrte heim und wurde mit Klagen empfangen, daß sein Gemahlin von einem schändlichen Hunde sieben Welpen geboren hätte, welche man weggeschafft. Da befiel ihn tiefer Schmerz; er versammelte seinen Rat und fragte, was zu tun wäre. Und einige rieten, die Königin zu verbrennen, andere aber, sie nur gefangen einzuschließen. Dieses letztere gefiel dem Könige besser, weil er sie noch immer liebte. Also blieb die unschuldige Beatrix eingeschlossen, bis zur Zeit, daß sie wieder erlöst werden sollte.
Der Einsiedel hatte unterdessen die sieben Kinder getauft und eines, das er besonders liebte, Helias nach seinem Namen geheißen. Die Kinder aber in ihren Blätterröcklein, barfuß und barhaupt, liefen stets miteinander im Wald herum.
Es geschah, daß ein Jäger der alten Königin daselbst jagte und die Kindlein alle sieben, mit ihren Silberketten um den Hals, unter einem Baum sitzen sah, von dem sie die wilden Äpfel abrupften und aßen. Der Jäger grüßte sie, da flohen die Kinder zu der Klause, und der Einsiedler bat, daß der Jäger ihnen kein Leid tun möchte. Als dieser Jäger wieder nach Lillefort kam, erzählte er Matabrunen alles, was er gesehen hatte; sie wunderte sich und riet wohl, daß es Oriants sieben Kinder wären, welche Gott beschirmt hatte.
Da sprach sie auf der Stelle: »O guter Gesell, nehmt von Euren Leuten und kehret mir eilends zum Wald, daß Ihr die sieben Kinder tötet, und bringt mir die sieben Ketten zum Wahrzeichen mit! Tut Ihr das nicht, so ist's um Euer eigen Leben geschehen, sonst aber sollt Ihr großen Lohn haben.« Der Jäger sagte: »Euer Wille soll befolgt werden«, nahm sieben Männer und machte sich auf den Weg nach dem Walde.
Unterwegs mußten sie durch ein Dorf, wo ein großer Haufen Menschen versammelt war. Der Jäger fragte nach der Ursache und erhielt zur Antwort: »Es soll eine Frau hingerichtet werden, weil sie ihr Kind ermordet hat.« Ach, dachte der Jäger, diese Frau wird verbrannt, weil sie ein Kind getötet hat, und ich gehe darauf aus, sieben Kinder zu morden; verflucht sei die Hand, die der gleichen vollbringt! Da sprachen alle Jäger. »Wir wollen den Kindern kein Leid tun, sondern ihnen die Ketten ablösen und sie der Königin bringen, zum Beweise, daß sie tot seien.«
Hierauf kamen sie in den Wald, und der Einsiedler war gerade ausgegangen, auf dem Dorfe Brot zu betteln, und hatte eins der Kinder mitgenommen, das ihm tragen helfen mußte. Die sechs andern schrien vor Furcht, wie sie die fremden Männer sahen. »Fürchtet euch nicht«, sprach der Jäger. Da nahmen sie die Kinder und taten ihnen die Ketten vom Hals; in demselben Augenblick, wo dies geschah, wurden sie zu weißen Schwänen und flogen in die Luft.
Die Jäger aber erschraken sehr, und zuletzt gingen sie nach Haus und brachten der alten Königin die sechs Ketten unter dem Vorgeben, die siebente hätten sie verloren. Darüber war Matabruna sehr bös und entbot einen Goldschmied, aus den sechsen einen Napf zu schmieden. Der Goldschmied nahm eine der Ketten und wollte sie im Feuer prüfen, ob das Silber gut wäre. Da wurde die Kette so schwer, daß sie allein mehr wog als vorher die sechse zusammen.
Der Schmied war verwundert, gab die fünfe seiner Frau, sie aufzuheben; und aus der sechsten, die geschmolzen war, wirkte er zwei Näpfe, jeden so groß, als ihn Matabrun begehrt hatte. Den einen Napf behielt er auch noch zu den Ketten und den andern trug er der Königin hin, die sehr zufrieden mit seiner Schwere und Größe war.
Als nun die Kinder in weiße Schwäne verwandelt worden waren, kam der Einsiedler mit dem jungen Helias auch wieder heim und war erschrocken, daß die andern fehlten. Und sie suchten nach ihnen den lieben langen Tag bis zum Abend und fanden nichts und waren sehr traurig. Morgens frühe begann der kleine Helias wieder nach seinen Geschwistern zu suchen, bis er zu einem Weiher kam, worauf sechs Schwäne schwammen, die zu ihm hinflossen und sich mit Brot füttern ließen. Von nun ging er alle Tage zu dem Wasser und brachte den Schwänen Brot; es verstrich eine geraume Zeit.
Während Beatrix gefangen saß, dachte Matabrun auf nichts anderes, als sie durch den Tod wegzuräumen. Sie stiftete daher einen falschen Zeugen an, welcher aussagte, den Hund gekannt zu haben, mit dem die Königin Umgang gepflogen hätte. Oriant wurde dadurch von neuem erbittert; und als der Zeuge sich erbot, seine Aussage gegen jedermann im Gotteskampf zu bewähren, schwur der König, daß Beatrix sterben solle, wenn kein Kämpfer für sie aufträte.
In dieser Not betete sie zu Gott, der ihr Flehen hörte und einen Engel zum Einsiedler sandte. Dieser erfuhr nunmehr den ganzen Verlauf: wer die Schwäne wären und in welcher Gefahr ihre arme Mutter schwebte. Helias, der Jüngling, war erfreut über diese Nachricht und machte sich barfuß, barhaupt und in seinem Blätterkleid auf, an den Hof des Königs, seines Vaters, zu gehen.
Das Gericht war gerade versammelt, und der Verräter stand zum Kampfe bereit. Helias erschien, seine einzige Waffe war eine hölzerne Keule. Hierauf überwand der Jüngling seinen Gegner und tat die Unschuld der geliebten Mutter dar, die sogleich befreit und in ihre vorigen Rechte eingesetzt wurde.
Als sich nun die ganze Verräterei enthüllt hatte, wurde sogleich der Goldschmied gesandt, der die Schwanketten verschmieden sollte. Er kam und brachte fünf Ketten und den Napf, der ihm von der sechsten übergeschossen war. Helias nahm nun diese Ketten und war begierig, seine Geschwister wieder zu erlösen; plötzlich sah man sechs Schwäne zu dem Schloßweiher geflogen kommen.
Da gingen Vater und Mutter mit ihm hinaus, und das Volk stand um das Ufer und wollte dem Wunder zusehen. Sobald die Schwäne Helias erblickten, schwammen sie hinzu, und er strich ihnen die Federn und wies ihnen die Ketten. Hierauf legte er einem nach dem andern die Kette um den Hals, augenblicklich standen sie in menschlicher Gestalt vor ihm, vier Söhne und eine Tochter, und die Eltern liefen hinzu, ihre Kinder zu halsen und zu küssen.
Als aber der sechste Schwan sah, daß er allein übrigblieb und kein Mensch wurde, war er tief betrübt und zog sich im Schmerz die Federn aus; Helias weinte und ermahnte ihn tröstend zur Geduld. Der Schwan neigte mit dem Hals, als ob er ihm dankte, und jedermann bemitleidete ihn. Die fünf andern Kinder wurden darauf zur Kirche geführt und getauft; die Tochter empfing den Namen Rose, die vier Brüder wurden hernachmals fromme und tapfere Helden.
König Oriant, nach diesen wunderbaren Begebenheiten, gab nun die Regierung des Reichs in seines Sohnes Helias Hände. Der junge König aber beschloß, vor allem das Recht walten zu lassen, eroberte die feste Burg, wohin Matabrun geflohen war, und überlieferte sie dem Gericht, welches die Übeltäterin zum Tode des Feuers verdammte. Dieses Urteil wurde sodann vollstreckt.
Helias regierte nun eine Weile zu Lillefort; eines Tages aber, da er den Schwan, seinen Bruder, auf dem Schloßweiher einen Nachen ziehen sah, hatte er keine längre Ruhe, sondern hielt dies für ein Zeichen des Himmels, daß er dem Schwan folgen und irgendwo Ruhm und Ehre erwerben solle. Er versammelte daher Eltern und Geschwister, entdeckte ihnen sein Vorhaben und küßte sie zum Abschied. Dann ließ er sich Harnisch und Schild bringen. Oriant, sein Vater, schenkte ihm ein Horn und sprach: »Dieses Horn bewahre wohl! Denn alle, die es blasen hören, denen mag kein Leid geschehen!«
Der Schwan schrie drei- oder viermal mit ganz seltsamer Stimme, da ging Helias zum Gestade hinab; sogleich schlug der Vogel die Flügel, als ob er ihn fröhlich bewillkommnete, und neigte seinen Hals. Helias betrat den Nachen, und der Schwan stellte sich vornen hin und schwamm voraus; schnell flossen sie davon, von Fluß in Fluß, von Strom in Strom, bis sie zu der Stelle gelangten, wohin sie nach Gottes Willen beschieden waren.
Zu diesen Zeiten herrschte Otto I., Kaiser von Deutschland, und unter ihm stand das Ardennerland, Lüttich und Namur. Dieser hielt gerade seinen Reichstag zu Nimwegen, und wer über ein Unrecht zu klagen hatte, der kam dahin und brachte seine Worte an. Es begab sich nun, daß auch der Graf von Frankenburg vor den Kaiser trat und die Herzogin von Billon (Bouillon), namens Clarissa, beschuldigte, ihren Gemahl vergiftet und während seiner dreijährigen Meerfahrt eine unrechte Tochter erzeugt zu haben; darum sei das Land nunmehr an ihn, den Bruder des Herzogs, verfallen.
Die Herzogin verantwortete sich, so gut sie konnte; aber das Gericht sprach einen Gotteskampf aus, und daß sie sich einen Streiter gegen den Grafen von Frankenburg stellen müsse, der ihre Unschuld dartun wolle. Die Herzogin sah sich aber vergebens nach einem Retter um; indem hörten alle ein Horn blasen. Da schaute der Kaiser zum Fenster, und man erblickte auf dem Wasser den Nachen fahren, von dem Schwan geleitet, in welchem Helias gewappnet stand.
Kaiser Otto verwunderte sich, und als das Fahrzeug anhielt und der Held landete, hieß er ihn sogleich vor sich führen. Die Herzogin sah ihn auch kommen und erzählte ihrer Tochter einen Traum, den sie die letzte Nacht gehabt hatte: »Es träumte mir, daß ich vor Gericht mit dem Grafen dingte, und ward verurteilt, verbrannt zu werden. Und wie ich schon an den Flammen stand, flog über meinem Haupt ein Schwan und brachte Wasser zum Löschen des Feuers; aus dem Wasser stieg ein Fisch, vor dem fürchteten sich alle, so daß sie bebten; darum hoffe ich, daß uns dieser Ritter vom Tode erlösen wird.«
Helias grüßte den Kaiser und sprach: »Ich bin ein armer Ritter, der durch Abenteuer hierherkommt, um Euch zu dienen.« Der Kaiser antwortete: »Abenteuer habt Ihr hier gefunden! Hier stehet eine auf den Tod verklagte Herzogin; wollt Ihr für sie kämpfen, so könnt Ihr sie retten, wenn ihre Sache gut ist.« Helias sah die Herzogin an, die ihm sehr ehrbar zu sein schien, und ihre Tochter war von wunderbarer Schönheit, daß sie ihm herzlich wohlgefiel. Sie aber schwur ihm mit Tränen, daß sie unschuldig wäre; und Helias gelobte, ihr Kämpfer zu werden.
Das Gefecht wurde hierauf anberaumt, und nach einem gefährlichen Streite schlug der Ritter mit dem Schwan dem Grafen Otto das Haupt vom Halse, und der Herzogin Unschuld wurde offenbar. Der Kaiser begrüßte den Sieger; die Herzogin aber begab sich des Landes zugunsten ihrer Tochter Clarissa und vermählte sie mit dem Helden, der sie befreit hatte. Die Hochzeit wurde prächtig zu Nimwegen gefeiert; hernach zogen sie in ihr Land Billon, wo sie mit Freuden empfangen wurden.
Nach neun Monaten gebar die Herzogin eine Tochter, welche den Namen Ida empfing und späterhin die Mutter berühmter Helden ward. Eines Tages nun fragte die Herzogin ihren Gemahl nach seinen Freunden und Magen, und aus welchem Lande er gekommen wäre. Helias aber antwortete nichts, sondern verbot ihr diese Frage; sonst müsse er von ihr scheiden. Sie fragte ihn also nicht mehr, und sechs Jahre lebten sie in Ruhe und Frieden zusammen.
Was man den Frauen verbietet, das tun sie zumeist, und die Herzogin, als sie einer Nacht bei ihrem Gemahl zu Bette lag, sprach dennoch: »O mein Herr! Ich möchte gerne wissen, von wannen Ihr seid.« Als dies Helias hörte, wurde er betrübt und antwortete: »Ihr wißt, daß Ihr das nicht wissen sollt; ich gelobe Euch nun, morgen von Lande zu scheiden.« Und wieviel sie und die Tochter klagten und weinten, stand der Herzog morgens auf, berief seine Mannen und gebot ihnen, Frau und Tochter nach Nimwegen zu geleiten, damit er sie dort dem Kaiser empfehlen könne; denn er kehre nimmermehr wieder.
Unter diesen Reden hörte man schon den Schwan schreien, der sich über seines Bruders Wiederkunft freuete, und Helias trat in den Nachen. Die Herzogin reiste mit ihrer Tochter zu Lande nach Nimwegen, dahin kam bald der Schwan geschwommen. Helias blies ins Horn und trat vor den Kaiser, dem er sagte, daß er notgedrungen sein Land verlassen müsse, und dringend seine Tochter Ida empfahl. Otto sagte es ihm zu, und Helias, nachdem er Abschied genommen, Weib und Kind zärtlich geküßt hatte, fuhr in dem Nachen davon.
Der Schwan aber geleitete ihn wieder nach Lillefort, wo ihn alle, und zumal Beatrix, seine Mutter, fröhlich bewillkommten. Helias dachte vor allen Dingen, wie er seinen Bruder Schwan wieder lösen möchte. Er ließ daher den Goldschmied rufen und händigte ihm die Näpfe ein, mit dem Befehl, daraus eine Kette zu schmieden, wie die gewesen war, die er einstens geschmolzen hatte. Der Schmied tat es, und brachte die Kette; Helias hängte sie dem Schwan um, der ward alsobald ein schöner Jüngling, wurde getauft und Eßmer (nach andern Emeri, Emerich) genannt.
Einige Zeit darauf erzählte Helias seinen Verwandten die Begebenheit, die er im Lande Billon erfahren hatte; begab sich darauf der Welt und ging in ein Kloster, um da geistlich zu leben bis an sein Ende. Aber zum Andenken ließ er ein Schloß bauen, ganz wie das in den Ardennen, und nannte es auch mit demselben Namen Billon.
Als nun Ida, Helias' Tochter, vierzehn Jahre alt geworden war, vermählte sie Kaiser Otto mit Eustachias, einem Grafen von Bonn. Ida lag auf eine Zeit im Traum, da deuchte ihr, als wenn drei Kinder an ihrer Brust lägen, jedes mit einer Krone auf dem Haupt; aber dem dritten zerbrach die Krone, und sie hörte eine Stimme, die sprach, sie würde drei Söhne gebären, von denen der Christenheit viel Frommen erwachsen solle; nur müsse sie verhüten, daß sie keine andere Milch sögen als ihre eigene.
Innerhalb drei Jahren brachte auch die Gräfin drei Söhne zur Welt; der älteste hieß Gottfried, der zweite Baldewin, der dritte Eustachias; alle aber zog sie sorgfältig mit ihrer Milch groß. Da begab sich, daß auf einen Pfingsttag die Gräfin in der Kirche war und etwas lange von ihrem Säugling Eustachias blieb; da weinte das Kind so, daß eine andere Frau ihm zu säugen gab.
Als die Gräfin zurückkehrte und ihren Sohn an der Frauen Brust fand, sprach sie: »Ach, Frau, was habt Ihr getan? Nun wird mein Kind seine Würdigkeit verlieren.« Die Frau sagte: »Ich meinte wohl zu tun, weil es so weinte, und dachte es zu stillen.« Die Gräfin aber war betrübt, aß und trank den ganzen Tag nicht und grüßte die Leute nicht, die ihr vorgestellt wurden.
Die Herzogin, ihre Mutter, hätte unterdessen gar zu gern Kundschaft von ihrem Gemahl gehabt, wohin er gekommen wäre; und sie sandte Pilger aus, die ihn suchen sollten in allen Landen. Nun kam endlich einer dieser Pilger vor ein Schloß, nach dessen Namen er fragte, und hörte mit Erstaunen, daß es Billon hieße; da er doch wohl wußte, Billon liege noch viel weiter. Die Landleute erzählten ihm aber, warum Helias diesen Bau gestiftet und so benannt habe, und berichteten den Pilgrim der ganzen Geschichte.
Der Pilgrim dankte Gott, daß er endlich gefunden hatte, was er so lange suchte; ließ sich bei dem König Oriant und seinen Söhnen melden und erzählte, wie es um die Herzogin in Billon und ihre Tochter stünde. Eßmer brachte dem Helias die frohe Botschaft in sein Kloster, Helias gab dem Pilgrim seinen Trauring zum Wahrzeichen mit; auch sandten die andern viele Kostbarkeiten ihren Freunden zu Billon.
Der Pilgrim fuhr damit in seine Heimat, und bald zogen die Herzogin und die Gräfin hin zu ihrem Gemahl und Vater in sein Kloster. Helias empfing sie fröhlich, starb aber nicht lange darnach; die Herzogin folgte ihm aus Betrübnis. Die Gräfin aber, als ihre Eltern begraben waren, zog wieder heim in ihr Land und unterwies ihre Söhne in aller Tugend und Gottesfurcht. Diese Söhne gewannen hernachmals den Ungläubigen das Heilige Land ab, und Gottfried und Baldewin wurden zu Jerusalem als Könige gekrönt.
DIE ALTE BETTELFRAU

Es war einmal eine alte Frau, du hast wohl ehe eine alte Frau sehn betteln gehen? diese Frau bettelte auch, und wann sie etwas bekam, dann sagte sie 'Gott lohn Euch.' Die Bettelfrau kam an die Tür, da stand ein freundlicher Schelm von Jungen am Feuer und wärmte sich. Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Frau, wie sie so an der Tür stand und zitterte 'kommt, Altmutter, und erwärmt Euch.'
Sie kam herzu, ging aber zu nahe ans Feuer stehen, dass ihre alten Lumpen anfingen zu brennen, und sie ward es nicht gewahr. Der Junge stand und sah das, er hätte es doch löschen sollen? Nicht wahr, er hätte löschen sollen? Und wenn er kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er alles Wasser in seinem Leibe zu den Augen herausweinen sollen, das hätte so zwei hübsche Bächlein gegeben zum löschen.
LOHENGRIN ZU BRABANT

Der Herzog von Brabant starb, ohne andere Erben als eine junge Tochter Elsa zu hinterlassen. Diese empfahl er auf dem Totenbette einem seiner Dienstmannen, Friedrich von Telramund. Friedrich, sonst ein tapferer Held, der zu Stockholm in Schweden einen Drachen getötet hatte, wurde übermütig und warb um der jungen Herzogin Hand und Land.
Da sie sich standhaft weigerte, klagte Friedrich bei dem Kaiser Heinrich dem Vogler unter dem falschen Vorgeben, daß sie ihm die Ehe gelobt hätte. Es wurde Recht gesprochen, daß sie sich im Gottesgericht durch einen Helden gegen ihn verteidigen müsse. Als sich keiner finden wollte, betete die Herzogin inbrünstig zu Gott um Rettung.
Da erscholl weit davon zu Monsalvat beim Gral der Laut der Glocke zum Zeichen, daß jemand dringender Hilfe bedürfe. Alsobald beschloß der Gral, den Sohn Parzivals, Lohengrin, danach auszusenden. Eben wollte dieser seinen Fuß in den Stegreif setzen, da kam ein Schwan auf dem Wasser geschwommen und zog hinter sich ein Schiff daher. Kaum erblickte ihn Lohengrin, als er rief: „Bringt das Roß wieder zur Krippe, ich will nun mit diesem Vogel ziehen, wohin er mich führt." Im Vertrauen auf Gott nahm er keine Speise mit ins Schiff. Nachdem sie fünf Tage über Meer gefahren waren, fuhr der Schwan mit dem Schnabel ins Wasser, fing ein Fischlein auf, aß es halb und gab dem Fürsten die andere Hälfte zu essen.
Unterdessen hatte Elsa ihre Fürsten und Mannen nach Antwerpen zu einer Landsprache berufen. Gerade am Tage der Versammlung sah man einen Schwan die Schelde herauf schwimmen, der ein Schifflein zog, in welchem Lohengrin auf seinem Schild ausgestreckt schlief. Der Schwan landete bald am Gestade, und der Fürst wurde fröhlich empfangen. Kaum hatte man ihm Helm, Schild und Schwert aus dem Schiffe getragen, als der Schwan sogleich zurückfuhr.
Lohengrin vernahm nun das Unrecht, welches die Herzogin litt und übernahm es gerne, ihr Kämpfer zu sein. Elsa ließ hierauf alle ihre Verwandten und Untertanen entbieten, die sich bereitwillig in großer Zahl einstellten. Der Zug machte sich auf den Weg, sammelte sich nachher vollständig zu Saarbrück und ging von da nach Mainz. Kaiser Heinrich, der sich zu Frankfurt aufhielt, kam nach Mainz entgegen, und in dieser Stadt wurde das Gestühl errichtet, wo Lohengrin und Friedrich kämpfen sollten.
Der Held vom Gral siegte; Friedrich gestand, die Herzogin verleumdet zu haben und wurde hingerichtet. Lohengrin gewann Elsas Hand, da sie einander längst liebten; doch bedang er sich aus, daß ihr Mund alle Fragen nach seiner Herkunft zu vermeiden habe; denn sonst müsse er sie augenblicklich verlassen.
Eine Zeitlang verlebten die Eheleute in ungestörtem Glück, und Lohengrin beherrschte das Land weise und mächtig; auch dem Kaiser leistete er auf den Zügen gegen die Hunnen und Heiden große Dienste. Es trug sich aber zu, daß er einmal im Speerwechsel den Herzog von Cleve herunter stach und dieser den Arm zerbrach. Neidisch redete da die Clever Herzogin laut unter den Frauen: „Ein kühner Held mag Lohengrin sein, und Christenglauben scheint er zu haben; schade, daß Adels halben sein Ruhm gering ist; denn niemand weiß, woher er ans Land geschwommen kam."
Dies Wort ging der Herzogin von Brabant durch das Herz, sie errötete und erblich. Nachts, als sie mit ihrem Gemahl allein war, weinte sie. Er sprach: „Lieb, was verwirret dich?" Sie antwortete: „Die Clever Herzogin hat mich zu tiefem Seufzen gebracht." Aber Lohengrin schwieg und fragte nicht weiter. Die zweite Nacht wollte sie wieder davon reden; er aber merkte es wohl und beruhigte sie nochmals. Allein in der dritten Nacht konnte sich Elsa nicht länger halten und sprach: „Herr, zürnt mir nicht! Ich wüßte gerne, von wannen Ihr geboren seid; denn mein Herz sagt mir, Ihr seiet reich an Adel."
Als nun der Tag anbrach, erklärte Lohengrin öffentlich, von woher er stamme, daß Parzival sein Vater sei und Gott ihn vom Grale her gesandt habe. Darauf ließ er seine beiden Kinder bringen, küßte sie und befahl ihnen, Horn und Schwert, die er zurücklasse, wohl aufzuheben. Der Herzogin ließ er das Ringlein, das ihm einst seine Mutter geschenkt hatte. Da kam mit Eile sein Freund, der Schwan, geschwommen, hinter ihm das Schifflein; der Fürst trat hinein und fuhr wider Wasser und Wogen in des Grales Amt.
DIE KRISTALLKUGEL
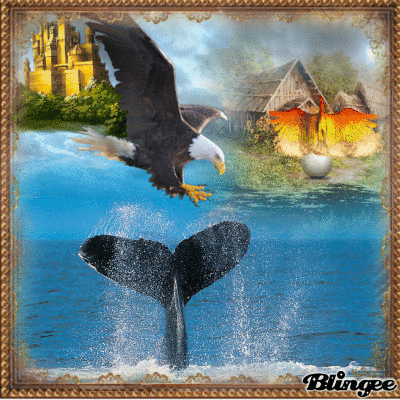
Es war einmal eine Zauberin, die hatte drei Söhne, die sich brüderlich liebten, aber die Alte traute ihnen nicht und dachte, sie wollten ihr ihre Macht rauben. Da verwandelte sie den ältesten in einen Adler, der mußte auf einem Felsengebirge hausen, und man sah ihn manchmal am Himmel in großen Kreisen auf- und niederschweben.
Den zweiten verwandelte sie in einen Walfisch, der lebte im tiefen Meer, und man sah nur, wie er zuweilen einen mächtigen Wasserstrahl in die Höhe warf. Beide hatten nur zwei Stunden jeden Tag ihre menschliche Gestalt. Der dritte Sohn, da er fürchtete, sie möchte ihn auch in ein reißendes Tier verwandeln, in einen Bären oder einen Wolf, so ging er heimlich fort.
Er hatte aber gehört, daß auf dem Schloß der goldenen Sonne eine verwünschte Königstochter säße, die auf Erlösung harrte, es müßte aber jeder sein Leben daran wagen, schon dreiundzwanzig Jünglinge wären eines jämmerlichen Todes gestorben und nur noch einer übrig, dann dürfte keiner mehr kommen. Und da sein Herz ohne Furcht war, so faßte er den Entschluß, das Schloß von der goldenen Sonne aufzusuchen.
Er war schon lange Zeit herumgezogen und hatte es nicht finden können, da geriet er in einen großen Wald und wußte nicht, wo der Ausgang war. Auf einmal erblickte er in der Ferne zwei Riesen, die winkten ihm mit der Hand, und als er zu ihnen kam, sprachen sie "wir streiten um einen Hut, wem er gehören soll, und da wir beide gleich stark sind, so kann keiner den andern überwältigen. Die kleinen Menschen sind klüger als wir, daher wollen wir dir die Entscheidung überlassen." "Wie könnt ihr euch um einen alten Hut streiten?, sagte der Jüngling. "Du weißt nicht, was er für Eigenschaften hat, es ist ein Wünschhut, wer den aufsetzt, der kann sich hinwünschen, wohin er will, und im Augenblick ist er dort." "Gebt mir d en Hut," sagte der Jüngling, "ich will ein Stück Wegs gehen, und wenn ich euch dann rufe, so lauft um die Wette, und wer am ersten bei mir ist, dem soll er gehören."
Er setzte den Hut auf und ging fort, dachte aber an die Königstochter, vergaß die Riesen und ging immer weiter. Einmal seufzte er aus Herzensgrund und rief "ach, wäre ich doch auf dem Schloß der goldenen Sonne!" Und kaum waren die Worte über seine Lippen, so stand er auf einem hohen Berg vor dem Tor des Schlosses.
Er trat hinein und ging durch alle Zimmer, bis er in dem letzten die Königstochter fand. Aber wie erschrak er, als er sie anblickte: sie hatte ein aschgraues Gesicht voll Runzeln, trübe Augen und rote Haare. "Seid Ihr die Königstochter, deren Schönheit alle Welt rühmt?" rief er aus. "Ach," erwiderte sie, "das ist meine Gestalt nicht, die Augen der Menschen können mich nur in dieser Häßlichkeit erblicken, aber damit du weißt, wie ich aussehe, so schau in den Spiegel, der läßt sich nicht irre machen, der zeigt dir mein Bild, wie es in Wahrheit ist."
Sie gab ihm den Spiegel in die Hand, und er sah darin das Abbild der schönsten Jungfrau, die auf der Welt war, und sah, wie ihr vor Traurigkeit die Tränen über die Wangen rollten. Da sprach er "wie kannst du erlöst werden? ich scheue keine Gefahr." Sie sprach "wer die kristallne Kugel erlangt und hält sie dem Zauberer vor, der bricht damit seine Macht, und ich kehre in meine wahre Gestalt zurück. Ach," setzte sie hinzu, "schon so mancher ist darum in seinen Tod gegangen, und du junges Blut, du jammerst mich, wenn du dich in die großen Gefährlichkeiten begibst." "Mich kann nichts abhalten," sprach er, "aber sage mir, was ich tun muß."
"Du sollst alles wissen," sprach die Königstochter, "wenn du den Berg, auf dem das Schloß steht, hinabgehst, so wird unten an einer Quelle ein wilder Auerochs stehen, mit dem mußt du kämpfen. Und wenn es dir glückt, ihn zu töten, so wird sich aus ihm ein feuriger Vogel erheben, der trägt in seinem Leib ein glühendes Ei, und in dem Ei steckt als Dotter die Kristallkugel. Er läßt aber das Ei nicht fallen, bis er dazu gedrängt wird, fällt es aber auf die Erde, so zündet es und verbrennt alles in seiner Nähe, und das Ei selbst zerschmilzt und mit ihm die kristallne Kugel, und all deine Mühe ist vergeblich gewesen."
Der Jüngling stieg hinab zu der Quelle, wo der Auerochse schnaubte und ihn anbrüllte. Nach langem Kampf stieß er ihm sein Schwert in den Leib, und er sank nieder. Augenblicklich erhob sich aus ihm der Feuervogel und wollte fortfliegen, aber der Adler, der Bruder des Jünglings, der zwischen den Wolken daher zog" stürzte auf ihn herab, jagte ihn nach dem Meer hin und stieß ihn mit seinem Schnabel an, so daß er in der Bedrängnis das Ei fallen ließ.
Es fiel aber nicht in das Meer, sondern auf eine Fischerhütte, die am Ufer stand, und die fing gleich an zu rauchen und wollte in Flammen aufgehen. Da erhoben sich im Meer haushohe Wellen, strömten über die Hütte und bezwangen das Feuer. Der andere Bruder, der Walfisch, war heran geschwommen und hatte das Wasser in die Höhe getrieben. Als der Brand gelöscht war, suchte der Jüngling nach dem Ei und fand es glücklicherweise. Es war noch nicht geschmolzen, aber die Schale war von der pIötzlichen Abkühlung durch das kalte Wasser zerbröckelt, und er konnte die Kristallkugel unversehrt herausnehmen.
Als der Jüngling zu dem Zauberer ging und sie ihm vorhielt, so sagte dieser "meine Macht ist zerstört, und du bist von nun an der König vom Schloß der goldenen Sonne. Auch deinen Brüdern kannst du die menschliche Gestalt damit zurückgeben."
Da eilte der Jüngling zu der Königstochter, und als er in ihr Zimmer trat, so stand sie da in vollem Glanz ihrer Schönheit, und beide wechselten voll Freude ihre Ringe miteinander.
DAS LÄMMCHEN UND FISCHCHEN

Es war einmal ein Brüderchen und Schwesterchen, die hatten sich herzlich lieb. Ihre rechte Mutter war aber tot, und sie hatten eine Stiefmutter, die war ihnen nicht gut und tat ihnen heimlich alles Leid an.
Es trug sich zu, daß die zwei mit andern Kindern auf einer Wiese vor dem Haus spielten, und an der Wiese war ein Teich, der ging bis an die eine Seite vom Haus. Die Kinder liefen da herum, kriegten sich und spielten Abzählens:
"Eneke, Beneke, lat mi liewen,
will di ock min Vügelken giewen.
Vügelken sall mi Strau söken,
Serau will ick den Köseken giewen,
Köseken sall mie Melk giewen,
Melk will ich den Bäcker giewen,
Bäcker sall mie 'n Kocken backen,
Kocken will ick den Kätken giewen,
Kätken sall mie Müse fangen,
Müse will ick in 'n Rauck hangen
un will se anschnien."
Dabei standen sie in einem Kreis, und auf welchen nun das Wort "anschnien" (fortlaufen) fiel, der mußte fortlaufen, und die anderen liefen ihm nach und fingen ihn. Wie sie so fröhlich dahinsprangen, sah's die Stiefmutter vom Fenster mit an und ärgerte sich. Weil sie aber Hexenkünste verstand, so verwünschte sie beide, das Brüderchen in einen Fisch und das Schwesterchen in ein Lamm.
Da schwamm das Fischchen im Teich hin und her, und war traurig, das Lämmchen ging auf der Wiese hin und her und war traurig und fraß nicht und rührte kein Hälmchen an. So ging eine lange Zeit hin, da kamen fremde Gäste auf das Schloß. Die falsche Stiefmutter dachte: "Jetzt ist die Gelegenheit gut", rief den Koch und sprach zu ihm: "Geh und hol das Lamm von der Wiese und schlacht's, wir haben sonst nichts für die Gäste."
Da ging der Koch hin und holte das Lämmchen und führte es in die Küche und band ihm die Füßchen; das litt es alles geduldig. Wie er nun sein Messer herausgezogen hatte und auf der Schwelle wetzte, um es abzustechen, sah es, wie ein Fischlein in dem Wasser vor dem Gossenstein hin und her schwamm und zu ihm hinaufblickte.
Das war aber das Brüderchen, denn als das Fischchen gesehen hatte, wie der Koch das Lämmchen fortführte, war es im Teich mit geschwommen bis zum Haus. Da rief das Lämmchen hinab:
"Ach Brüderchen im tiefen See,
wie tut mir doch mein Herz so weh!
Der Koch, der wetzt das Messer,
will mir mein Herz durchstechen."
Das Fischchen antwortete:
"Ach Schwesterchen in der Höh,
wie tut mir doch mein Herz so weh
in dieser tiefen See!"
Wie der Koch hörte, daß das Lämmchen sprechen konnte und so traurige Worte zu dem Fischchen hinab rief, erschrak er und dachte, es müßte kein natürliches Lämmchen sein, sondern wäre von der bösen Frau im Haus verwünscht.
Da sprach er: "Sei ruhig, ich will dich nicht schlachten", nahm ein anderes Tier und bereitete das für die Gäste, und brachte das Lämmchen zu einer guten Bäuerin, der erzählte er alles, was er gesehen und gehört hatte. Die Bäuerin war aber gerade die Amme von dem Schwesterchen gewesen, vermutete gleich, wer's sein würde, und ging mit ihm zu einer weisen Frau.
Da sprach die weise Frau einen Segen über das Lämmchen und Fischchen, wovon sie ihre menschliche Gestalt wiederbekamen, und danach führte sie beide in einen großen Wald in ein klein Häuschen wo sie einsam, aber zufrieden und glücklich lebten.
DER RÄUBER UND SEINE SÖHNE

Es war einmal ein Räuber, der hauste in einem großen Walde, und lebte mit seinen Gesellen in Schluchten und Felsenhöhlen, und wenn Fürsten, Herrn und reiche Kaufleute auf der Landstraße zogen, so lauerte er ihnen auf, und raubte ihnen Geld und Gut.
Als er zu Jahren kam, so gefiel ihm das Handwerk nicht mehr, und es gereute ihn dass er so viel Böses getan hatte. Er hub also an ein besseres Leben zu führen, lebte redlich, und tat Gutes, wo er konnte. Die Leute wunderten sich dass er sich so schnell bekehrt hatte, aber sie freuten sich darüber.
Er hatte drei Söhne, als die herangewachsen waren, rief er sie vor sich, und sprach: "Liebe Kinder, sagt mir was für ein Handwerk wollt ihr erwählen, womit ihr euch ehrlich ernähren könnt?"
Die Söhne besprachen sich miteinander, und gaben ihm dann zur Antwort "der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wir wollen uns ernähren, wie ihr euch ernährt habt: wir wollen Räuber werden. Ein Handwerk, wobei wir von Morgen bis Abend uns abarbeiten, und doch wenig Gewinn und ein mühseliges Leben haben, das gefällt uns nicht."
"Ach liebe Kinder", antwortete der Vater, "warum wollt ihr nicht ruhig leben und mit wenigem zufrieden sein. Ehrlich währt am längsten. Die Räuberei ist eine böse und gottlose Sache, die zu einem schlimmen Ende führet: an dem Reichtum, den ihr zusammenbringt, habt ihr keine Freude: ich weiß ja wie es mir dabei zu Mut gewesen ist. Ich sage euch, es nimmt einen schlechten Ausgang. Der Krug geht so lange zum Wasser bis er bricht: ihr werdet zuletzt ergriffen, und an den Galgen gehenkt." Die Söhne aber achteten nicht auf seine Ermahnungen, und blieben bei ihrem Vorsatz.
Nun wollten die drei Jünglinge gleich ihr Probestück machen. Sie wussten dass die Königin in ihrem Stall ein schönes Pferd hatte, das von großem Wert war, das wollten sie ihr stehlen. Sie wussten auch, dass das Pferd kein anderes Futter fraß als ein saftiges Gras, das allein in einem feuchten Wald wuchs.
Sie gingen also hinaus, schnitten das Gras ab, und machten einen großen Bündel daraus, in welchen die beiden ältesten den jüngsten und kleinsten steckten, so dass er nicht konnte gesehen werden. Sie trugen das Bündel auf den Markt, wo der Stallmeister der Königin ihn kaufte, zu dem Pferd in den Stall tragen und hinlegen ließ.
Als es Mitternacht war, und jedermann schlief, machte sich der Kleine aus dem Grasbündel heraus, band das Pferd ab, zäumte es mit dem goldenen Zaum, und legte ihm das goldgestickte Reitzeug an, und die Schellen, die daran hingen, verstopfte er mit Wachs, damit sie keinen Klang gäben. Dann öffnete er die verschlossene Pforte, und ritt auf dem Pferd in aller Eile fort nach dem Ort, wohin ihn seine Brüder beschieden hatten. Allein die Wächter in der Stadt bemerkten den Dieb, eilten ihm nach, und als sie ihn draußen mit seinen Brüdern fanden, nahmen sie alle drei gefangen und führten sie in das Gefängnis.
Am anderen Morgen wurden sie vor die Königin geführt, und als diese sah dass es drei schöne Jünglinge waren, so forschte sie nach ihrer Herkunft, und vernahm dass es die drei Söhne des alten Räubers wären, der seine Lebensweise geändert und als ein gehorsamer Untertan gelebt hatte. Sie ließ sie also wieder in das Gefängnis zurückführen und bei dem Vater anfragen ob er seine Söhne lösen wollte.
Der Alte kam, und sagte "meine Söhne sind nicht wert dass ich sie mit einem Pfennig löse." Da sprach die Königin zu ihm "du bist ein weit bekannter, verrufener Räuber gewesen, erzähle mir das merkwürdigste Abenteuer aus deinem Räuberleben, so will ich dir deine Kinder wiedergeben."
Als der Alte das vernahm, hub er an "Frau Königin, hört meine Rede, ich will euch ein Ereignis erzählen, was mich mehr erschreckt hat als Feuer und Wasser. Ich brachte in Erfahrung dass in einer wilden Waldschlucht zwischen zwei Bergen, zwanzig Meilen von den Menschen entfernt, ein Riese lebte, der einen großen Schatz, viel tausend Mark Silber und Gold besäße. Ich wählte also aus meinen Gesellen so viele aus, dass unser hundert waren, und wir zogen hin.
Es war ein langer mühsamer Weg zwischen Felsen und Abgründen. Wir fanden den Riesen nicht zu Haus, waren froh darüber und nahmen von dem Gold und Silber so viel wir tragen konnten. Als wir damit uns auf den Heimweg machen wollten, und ganz sicher zu sein glaubten, da kam der Riese mit zehn anderen Riesen unversehens daher, und nahm uns alle gefangen. Sie teilten uns unter sich aus: jeder erhielt zehn von uns, und ich fiel mit neun meiner Gesellen dem Riesen zu, dem wir seinen Schatz genommen hatten. Er band uns die Hände auf den Rücken, und trieb uns wie Schafe in seine Felsenhöhle.
Wir waren bereit uns mit Geld und Gut zu lösen, er aber antwortete 'eure Schätze brauche ich nicht, ich will euch behalten, und euer Fleisch verzehren, dass ist mir lieber.' Dann befühlte er uns alle, wählte einen aus, und sprach 'der ist der fetteste, mit dem will ich den Anfang machen.' Dann schlug er ihn nieder, warf das zerschnittene Fleisch in einen Kessel mit Wasser, den er über das Feuer setzte, und als es gesotten war, hielt er seine Mahlzeit.
So aß er jeden Tag einen von uns, und weil ich der magerste war, so sollte ich der letzte sein. Als nun meine neun Gesellen aufgezehrt waren, und die Reihe an mich kam, so besann ich mich auf eine List. 'Ich sehe wohl dass du böse Augen hast', sprach ich zu ihm, 'und am Gesicht leidest: ich bin ein Arzt und bin in meiner Kunst wohl erfahren, ich will dir deine Augen heilen, wenn du mir mein Leben lassen willst.'
Er sicherte mir mein Leben zu, wenn ich das vermöchte. Er gab mir alles was ich dazu verlangte. Ich tat Öl in einen Kessel, mengte Schwefel, Pech, Salz, Arsenik und andere verderbliche Dinge hinein, und stellte den Kessel über das Feuer, als wollte ich ein Pflaster für seine Augen bereiten. Sobald das Öl im Sieden war, musste der Riese sich niederlegen, und ich goss ihm alles, was in dem Kessel war, auf die Augen, über den Hals und den Leib, so dass er das Gesicht völlig verlor, und die Haut am ganzen Leib verbrannte und zusammenschrumpfte.
Er fuhr mit entsetzlichem Geheul in die Höhe, warf sich wieder zur Erde, wälzte sich hin und her, und schrie und brüllte dabei wie ein Löwe oder ein Ochse. Dann sprang er in Wut auf, packte eine große Keule, und in dem Haus umher laufend, schlug er auf die Erde und gegen die Wand, und dachte mich zu treffen. Entfliehen konnte ich nicht, denn das Haus war überall von hohen Mauern umgeben, und die Türen waren mit eisernen Riegeln verschlossen. Ich sprang aus einem Winkel in den anderen, endlich wusste ich mir nicht anders zu helfen, ich stieg auf einer Leiter bis zum Dach, und hing mich mit beiden Händen an den Hahnenbalken.
Da hing ich einen Tag und eine Nacht, als ich es aber nicht länger aushalten konnte, so stieg ich wieder herab, und mischte mich unter die Schafe. Da musste ich behend sein, und immer mit den Tieren zwischen seinen Beinen hindurch laufen ohne dass er mich gewahr ward. Endlich fand ich in einer Ecke unter den Schafen die Haut eines Widders liegen, ich schlüpfte hinein, und wusste es so zu machen, dass mir die Hörner des Tiers gerade auf dem Kopf standen.
Der Riese hatte die Gewohnheit, wenn die Schafe hinaus auf die Weide gehen sollten, so ließ er sie vorher durch seine Beine laufen. Da zählte er sie, und welches am feistesten war, das packte er, kochte es, hielt damit seine Mahlzeit. Ich wäre bei dieser Gelegenheit gerne davon gelaufen, und drängte mich durch seine Beine, wie die Schafe taten, als er mich aber packte, und merkte dass ich schwer war, so sprach er 'du bist feist, du sollst mir heute meinen Bauch füllen.'
Ich tat einen Satz, und entsprang ihm aus den Händen, aber er ergriff mich wieder. Ich entkam nochmals, aber er packte mich aufs Neue, und so ging es siebenmal. Da ward er zornig und sprach 'lauf hin, die Wölfe mögen dich fressen, du hast mich genug genarrt.' Als ich draußen war, warf ich die Haut ab, rief ihm spöttisch zu dass ich ihm doch entsprungen wäre, und höhnte ihn.
Er zog einen Ring vom Finger, und sprach 'nimm diesen goldenen Ring als eine Gabe von mir, du hast ihn wohl verdient. Es ziemt sich nicht dass ein so listiger und behender Mann unbeschenkt von mir gehe.' Ich nahm den Ring, und steckte ihn an meinen Finger, aber ich wusste nicht dass ein Zauber darin lag. Von dem Augenblick an, wo er mir am Finger saß, musste ich unaufhörlich rufen 'hier bin ich! hier bin ich!' ich mochte wollen oder nicht.
Da der Riese daran merken konnte wo ich mich befand, so lief er mir in den Wald nach. Dabei rannte er, weil er blind war, jeden Augenblick gegen einen Ast oder einen Stamm, und fiel nieder wie ein mächtiger Baum, aber er erhob sich schnell wieder und da er lange Beine hatte, und große Schritte machen konnte, so holte er mich immer wieder ein, und war mir schon ganz nahe, denn ich rief ohne Unterlass 'hier bin ich ! hier bin ich.'
Ich merkte wohl dass der Ring die Ursache meines Geschreis war, und wollte ihn abziehen, aber ich vermochte es nicht. Da blieb mir nichts anderes übrig, ich biss mir mit meinen Zähnen den Finger ab. In dem Augenblick hörte ich auf zu rufen, und ich entlief glücklich dem Riesen. Zwar hatte ich meinen Finger verloren, aber ich hatte doch mein Leben behalten."
"Frau Königin", sprach der Räuber, "ich habe euch diese Geschichte erzählt, um einen meiner Söhne zu erlösen, jetzt will ich, um den zweiten zu befreien, berichten was sich weiter zutrug. Als ich den Händen des Riesen entronnen war, irrte ich in der Wildnis umher, und wusste nicht wo ich mich hinwenden sollte. Ich stieg auf die höchsten Tannen und auf die Gipfel der Berge, aber wohin ich blickte, weit und breit war kein Haus, kein Acker, keine Spur von menschlichem Dasein, überall nichts als eine schreckliche Wildnis.
Ich stieg von himmelhohen Bergen herab in Täler, die waren aber wie die tiefsten Abgründe. Mir begegneten Löwen, Bären, Büffel, Waldesel, giftige Schlangen und scheußliches Gewürm; ich sah wilde, behaarte Waldmenschen, Leute mit Hörnern und Schnäbeln, so entsetzlich, dass mir noch jetzt schaudert, wenn ich daran zurückdenke. Ich zog immer weiter, Hunger und Durst quälten mich, und ich musste jeden Augenblick befürchten vor Müdigkeit umzusinken.
Endlich, eben als die Sonne untergehen wollte, kam ich auf einen hohen Berg, da sah ich in einem öden Tal einen Rauch aufsteigen, wie aus einem angezündeten Backofen. Ich lief so schnell ich konnte den Berg herab nach dem Rauch zu, als ich unten ankam, sah ich drei tote Männer, die waren an dem Ast eines Baumes aufgehängt. Ich erschrak, denn ich dachte ich würde in die Gewalt eines anderen Riesen kommen, und war um mein Leben besorgt. Doch fasste ich mir ein Herz, ging weiter, und fand ein kleines Haus, dessen Tür weit offen stand: und bei dem Feuer des Herdes saß da eine Frau mit ihrem Kinde.
Ich trat ein, grüßte sie, und fragte warum sie hier so allein säße, und wo ihr Mann sich befände; ich fragte auch ob es noch weit bis dahin wäre, wo Menschen wohnten. Sie antwortete mir das Land, wo Menschen wohnten, das läge in weiter Ferne, und erzählte mit weinenden Augen in voriger Nacht wären die wilden Waldungeheuer gekommen, und hätten sie und das Kind von der Seite ihres Mannes weggeraubt, und in diese Wildnis gebracht. Dann wären sie am Morgen wieder ausgezogen, und hätten ihr geboten das Kind zu töten und zu kochen, weil sie es, wenn sie zurückkämen, aufessen wollten.
Als ich das gehört hatte, empfand ich großes Mitleid mit der Frau und dem Kinde, und beschloss sie aus dieser Not zu erlösen. Ich lief fort zu dem Baum, an welchem die drei Diebe aufgehängt waren, nahm den Mittelsten, der wohlbeleibt war, herab, und trug ihn in das Haus. Ich zerteilte ihn in Stücke, und sagte der Frau sie sollte ihn den Riesen zu essen geben. Das Kind aber nahm ich, und versteckte es in einem hohlen Baum, dann verbarg ich mich selbst hinter das Haus, so dass ich bemerken konnte wo die wilden Menschen herkämen und ob es Not wäre, der Frau selbst zu Hilfe zu eilen.
Als die Sonne untergehen wollte, sah ich die Ungeheuer von dem Berge herablaufen, sie waren gräulich und furchtbar anzusehen, den Affen an Gestalt ähnlich. Sie schleppten einen toten Leib hinter sich her, aber ich konnte nicht sehen wer es war. Als sie in das Haus kamen, zündeten sie ein großes Feuer an, zerrissen den blutigen Leib mit ihren Zähnen, und verzehrten ihn. Danach nahmen sie den Kessel, in dem das Fleisch des Diebes gekocht war, vom Feuer und zerteilten die Stücke unter sich zum Abendessen. Als sie fertig waren, fragte einer, der ihr Oberhaupt zu sein schien, die Frau ob das, was sie gegessen hätten, das Fleisch ihres Kindes gewesen wäre. Die Frau sagte 'ja.' Da sprach das Ungeheuer 'ich glaube du hast dein Kind versteckt, und uns einen von den Dieben gekocht, die an dem Ast hängen.'
Er hieß drei von seinen Gesellen hinlaufen und ihm von einem jeden der drei Diebe ein Stück Fleisch bringen, damit er sähe dass sie noch alle dort wären. Als ich das hörte lief ich schnell voraus, und hing mich mit meinen Händen, mitten zwischen die zwei Diebe, an das Seil, von dem ich den dritten abgenommen hatte. Als nun die Ungeheuer kamen, schnitten sie einem jeden ein Stück Fleisch aus den Lenden. Auch mir schnitten sie ein Stück heraus, aber ich duldete es ohne einen Laut von mir zu geben. Ich habe zum Zeugnis noch die Narbe an meinem Leib."
Hier schwieg der Räuber einen Augenblick und sprach dann "Frau Königin, ich habe euch dies Abenteuer erzählt für meinen zweiten Sohn, jetzt will ich euch für den dritten den Schluss der Geschichte berichten. Als das wilde Volk mit den drei Stücken Fleisch fortgelaufen war, so ließ ich mich wieder herab, und verband meine Wunde mit Streifen von meinem Hemd so gut ich konnte, doch das Blut ließ sich nicht stillen, sondern strömte an mir herab. Aber ich achtete nicht darauf sondern dachte nur wie ich der Frau mein Versprechen halten, und sie und das Kind retten wollte.
Ich eilte also wieder zu dem Haus zurück, hielt mich verborgen und horchte auf das was geschah, aber ich konnte mich nur mit Mühe aufrechterhalten: mich schmerzte die Wunde, und ich war von Hunger und Durst ganz abgemattet. Indessen versuchte der Riese die drei Stücke Fleisch, die ihm gebracht waren, und als er das gekostet hatte, das mir ausgeschnitten und noch blutig war, so sprach er lauft hin, und bringt mir den mittelsten Dieb, sein Fleisch ist noch frisch und behagt mir.
Als ich das hörte, eilte ich zurück zu dem Galgen, und hing mich wieder an das Seil zwischen die zwei Toten. Bald darauf kamen die Ungeheuer, nahmen mich von dem Galgen herab, und schleiften mich über Dornen und Distel zu dem Haus, wo sie mich auf den Boden hinstreckten. Sie schärften ihre Zähne, wetzten ihre Messer über mir, und bereiteten sich mich zu schlachten und zu essen. Eben wollten sie Hand anlegen, als plötzlich ein solches Ungewitter mit Blitz, Donner und Wind sich erhob, dass die Ungeheuer selbst in Schrecken gerieten, und mit grässlichem Geschrei zu den Fenstern, Türen und zum Dach hinausfuhren, und mich auf dem Boden liegen ließen. Nach drei Stunden begann es Tag zu werden, und die klare Sonne stieg empor.
Ich machte mich mit der Frau und dem Kinde auf, wir wanderten vierzig Tage durch die Wildnis, und hatten keine andere Nahrung als Wurzeln Beeren und Kräuter, die im Walde wachsen. Endlich kam ich wieder unter Menschen, und brachte die Frau mit dem Kinde wieder zu ihrem Mann: wie groß die Freude war kann sich jeder leicht denken."
Damit war die Geschichte des Räubers zu Ende.
"Du hast durch die Befreiung der Frau und des Kindes viel Böses, was du getan hast, wieder gut gemacht", sprach die Königin zu ihm, "ich gebe dir deine drei Söhne frei."
WIE KINDER SCHLACHTENS MITEINANDER GESPIELT HABEN
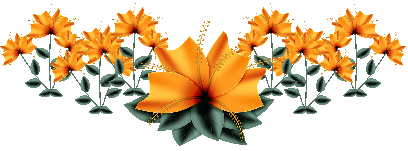
In einer Stadt, Franecker genannt, gelegen in Westfriesland, da ist es geschehen, dass junge Kinder, fünf- und sechsjährige, Mägdlein und Knaben, miteinander spielten. Und sie ordneten ein Büblein an, das solle der Metzger sein, ein anderes Büblein, das solle Koch sein, und ein drittes Büblein, das solle eine Sau sein. Ein Mägdlein, ordneten sie, solle Köchin sein, wieder ein anderes, das solle Unterköchin sein; und die Unterköchin solle in einem Geschirrlein das Blut von der Sau empfahen, dass man Würste könne machen. Der Metzger geriet nun verabredetermassen an das Büblein, das die Sau sollte sein, riss es nieder und schnitt ihm mit einem Messerlein die Gurgel auf, und die Unterköchin empfing das Blut in ihrem Geschirrlein.
Ein Ratsherr, der von ungefähr vorübergeht, sieht dies Elend: er nimmt von Stund an den Metzger mit sich und führt ihn in des Obersten Haus, welcher sogleich den ganzen Rat versammeln liess. Sie sassen all über diesen Handel und wussten nicht, wie sie ihm tun sollten, denn sie sahen wohl, dass es kindlicherweise geschehen war. Einer unter ihnen, ein alter weiser Mann, gab den Rat, der oberste Richter solle einen schönen roten Apfel in eine Hand nehmen, in die andere einen rheinischen Gulden, solle das Kind zu sich rufen und beide Hände gleich gegen dasselbe ausstrecken: nehme es den Apfel, so soll' es ledig erkannt werden, nehme es aber den Gulden, so solle man es töten. Dem wird gefolgt, das Kind aber ergreift den Apfel lachend, wird also aller Strafe ledig erkannt.

Einstmals hat ein Hausvater ein Schwein geschlachtet, das haben seine Kinder gesehen; als sie nun nachmittag miteinander spielen wollen, hat das eine Kind zum andern gesagt: "Du sollst das Schweinchen und ich der Metzger sein"; hat darauf ein bloss Messer genommen und es seinem Brüderchen in den Hals gestossen. Die Mutter, welche oben in der Stube sass und ihr jüngstes Kindlein in einem Zuber badete, hörte das Schreien ihres anderen Kindes, lief alsbald hinunter, und als sie sah, was vorgegangen, zog sie das Messer dem Kind aus dem Hals und stiess es im Zorn dem andern Kind, welches der Metzger gewesen, ins Herz.
Darauf lief sie alsbald nach der Stube und wollte sehen, was ihr Kind in dem Badezuber mache, aber es war unterdessen in dem Bad ertrunken; deswegen dann die Frau so voller Angst ward, dass sie in Verzweifelung geriet, sich von ihrem Gesinde nicht wollte trösten lassen, sondern sich selbst erhängte. Der Mann kam vom Felde, und als er dies alles gesehen, hat er sich so betrübt, dass er kurz darauf gestorben ist.
