MÄRCHEN VON HANS CHRISTIAN ANDERSEN
VERZEICHNIS III
„Das stumme Buch“
„Anne Lisbeth“
„Feder und Tintenfass“
„Der Schmetterling“
„Die Schnecke und der Rosenstock“
„Hofhahn und Wetterhahn“
„Die alte Kirchenglocke“
„Die Teekanne“
„Der silberne Schilling“
„Eine Geschichte aus den Sanddünen“
„Im Entenhof“
„Die Psyche“
„Der Kobold und die Madam“
„Wer war die Glücklichste“
„Sonnenschein Geschichten“
„Die Kröte“
„Fliedermütterchen“
„Der Komet“
„Was die Distel erlebte“
„Der Freundschaftsbund“
„Die kleinen Grünen“
„Tantchen“
„Die Schweine“
„Die Lumpen“
„Die große Seeschlange“
„Der Haustürschlüssel“
„Die Windmühle“
„Frag die Grünwarenfrau“
„Die alte Strassenlaterne“
„Die Galoschen des Glücks“
„Der fliegende Koffer“
„Der Sturm zieht mit den Schidern um“
„Die Jungfern“
„Der Wassertropfen“
„Des Kaisers neue Kleider“
„Grossmütterchen“
„Die roten Tanzschuhe“
„Die Glockentiefe“
„Die Glocke“
„Tante Zahnweh“
„Der Floh und der Professor“
„Die Geschichte des Jahres“
„Kinderschnack“
„Eine Rose von Homers Grab“
„Die schönste Rose der Welt“
„Was die alte Johanne erzählte“
„Das alte Haus“
„Ein Unterschied ist da“
„Der Gärtner und die Herrschaft“
„Die Nachtigall“
DIE NACHTIGALL
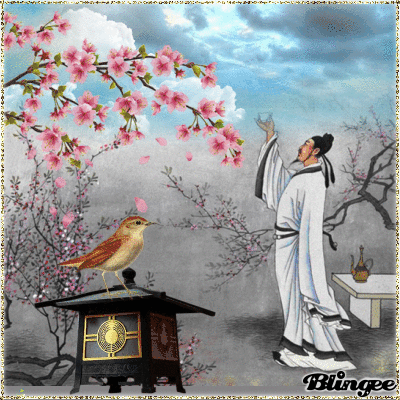
In China, weißt du ja wohl, ist der Kaiser ein Chinese, und alle, die er um sich hat, sind Chinesen. Es sind nun viele Jahre her, aber gerade deshalb ist es wert, die Geschichte zu hören, ehe sie vergessen wird. Des Kaisers Schloß war das prächtigste der Welt, ganz und gar von feinem Porzellan, so kostbar, aber so spröde, so mißlich daran zu rühren, daß man sich ordentlich in acht nehmen mußte. Im Garten sah man die wunderbarsten Blumen, und an die allerprächtigsten waren Silberglocken gebunden, die erklangen, damit man nicht vorbeigehen möchte, ohne die Blumen zu bemerken. Ja, alles war in des Kaisers Garten fein ausgedacht, und er erstreckte sich so weit, daß der Gärtner selbst das Ende nicht kannte; ging man immer weiter, so kam man in den herrlichsten Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen. Der Wald ging gerade hinunter bis zum Meere, das blau und tief war. Große Schiffe konnten unter den Zweigen hinsegeln, und in diesen wohnte eine Nachtigall, die so herrlich sang, daß selbst der arme Fischer, der soviel anderes zu tun hatte, stillhielt und horchte, wenn er nachts ausgefahren war, um das Fischnetz aufzuziehen. »Ach Gott, wie ist das schön!« sagte er, aber dann mußte er auf sein Netz achtgeben und vergaß den Vogel; doch wenn dieser in der nächsten Nacht wieder sang und der Fischer dorthin kam, sagte er wieder: »Ach Gott, wie ist das doch schön!«
Von allen Ländern kamen Reisende nach der Stadt des Kaisers und bewunderten sie, das Schloß und den Garten; doch wenn sie die Nachtigall zu hören bekamen, sagten sie alle: »Das ist doch das Beste!«
Die Reisenden erzählten davon, wenn sie nach Hause kamen, und die Gelehrten schrieben viele Bücher über die Stadt, das Schloß und den Garten, aber die Nachtigall vergaßen sie nicht, sie wurde am höchsten gestellt, und die, welche dichten konnten, schrieben die herrlichsten Gedichte über die Nachtigall im Walde bei dem tiefen See.
Die Bücher durchliefen die Welt, und einige kamen dann auch einmal zum Kaiser. Er saß in seinem goldenen Stuhl, las und las, jeden Augenblick nickte er mit dem Kopfe, denn er freute sich über die prächtigen Beschreibungen der Stadt, des Schlosses und des Gartens. »Aber die Nachtigall ist doch das Allerbeste!« stand da geschrieben.
»Was ist das?« fragte der Kaiser. »Die Nachtigall kenne ich ja gar nicht! Ist ein solcher Vogel hier in meinem Kaiserreiche und sogar in meinem Garten? Das habe ich nie gehört; so etwas soll man erst aus Büchern erfahren?«
Da rief er seinen Haushofmeister. Der war so vornehm, daß, wenn jemand, der geringer war als er, mit ihm zu sprechen oder ihn um etwas zu fragen wagte, er weiter nichts erwiderte als: »P!« Und das hat nichts zu bedeuten.
»Hier soll ja ein höchst merkwürdiger Vogel sein, der Nachtigall genannt wird!« sagte der Kaiser. »Man spricht, dies sei das Allerbeste in meinem großen Reiche; weshalb hat man mir nie etwas davon gesagt?«
»Ich habe ihn früher nie nennen hören«, sagte der Haushofmeister. »Er ist nie bei Hofe vorgestellt worden!«
»Ich will, daß er heute abend herkomme und vor mir singe!« sagte der Kaiser. »Die ganze Welt weiß, was ich habe, und ich weiß es nicht!«
»Ich habe ihn früher nie nennen hören!« sagte der Haushofmeister. »Ich werde ihn suchen, ich werde ihn finden!«
Aber wo war er zu finden? Der Haushofmeister lief alle Treppen auf und nieder, durch Säle und Gänge, keiner von allen denen, auf die er traf, hatte von der Nachtigall sprechen hören. Und der Haushofmeister lief wieder zum Kaiser und sagte, daß es sicher eine Fabel von denen sei, die da Bücher schreiben. »Dero Kaiserliche Majestät können gar nicht glauben, was da alles geschrieben wird; das sind Erdichtungen und etwas, was man die schwarze Kunst nennt!«
»Aber das Buch, in dem ich dieses gelesen habe», sagte der Kaiser, »ist mir von dem großmächtigen Kaiser von Japan gesandt, also kann es keine Unwahrheit sein. Ich will die Nachtigall hören; sie muß heute abend hier sein! Sie hat meine höchste Gnade! Und kommt sie nicht, so soll dem ganzen Hof auf den Leib getrampelt werden, wenn er Abendbrot gegessen hat!«
»Tsing-pe!« sagte der Haushofmeister und lief wieder alle Treppen auf und nieder, durch alle Säle und Gänge; und der halbe Hof lief mit, denn sie wollten nicht gern auf den Leib getrampelt werden. Da gab es ein Fragen nach der merkwürdigen Nachtigall, die von aller Welt gekannt war, nur von niemand bei Hofe.
Endlich trafen sie ein kleines, armes Mädchen in der Küche. Sie sagte: »O Gott, die Nachtigall, die kenne ich gut, ja, wie kann die singen! Jeden Abend habe ich die Erlaubnis, meiner armen, kranken Mutter einige Überbleibsel vom Tische mit nach Hause zu bringen. Sie wohnt unten am Strande, wenn ich dann zurückgehe, müde bin und im Walde ausruhe, höre ich Nachtigall singen. Es kommt mir dabei das Wasser in die Augen, und es ist gerade, als ob meine Mutter mich küßte!«
»Kleine Köchin«, sagte der Haushofmeister, »ich werde dir eine feste Anstellung in der Küche und die Erlaubnis, den Kaiser speisen zu sehen, verschaffen, wenn du uns zur Nachtigall führen kannst; denn sie ist zu heute abend angesagt.«
So zogen sie allesamt hinaus in den Wald, wo die Nachtigall zu singen pflegte; der halbe Hof war mit. Als sie im besten Zuge waren, fing eine Kuh zu brüllen an.
»Oh!« sagten die Hofjunker, »nun haben wir sie; das ist doch eine merkwürdige Kraft in einem so kleinen Tiere! Die habe ich sicher schon früher gehört!«
»Nein, das sind Kühe, die brüllen!« sagte die kleine Köchin. »Wir sind noch weit von dem Orte entfernt!«
Nun quakten die Frösche im Sumpfe.
»Herrlich!« sagte der chinesische Schloßpropst. »Nun höre ich sie, es klingt gerade wie kleine Tempelglocken.«
»Nein, das sind Frösche!« sagte die kleine Köchin. »Aber nun, denke ich werden wir sie bald hören!«
Da begann die Nachtigall zu singen.
»Das ist sie«, sagte das kleine Mädchen. »Hört, hört! Und da sitzt sie!« Sie zeigte nach einem kleinen, grauen Vogel oben in den Zweigen.
»Ist es möglich?« sagte der Haushofmeister. »So hätte ich sie mir nimmer gedacht; wie einfach sie aussieht! Sie hat sicher ihre Farbe darüber verloren, daß sie so viele vornehme Menschen um sich erblickt!«
»Kleine Nachtigall«, rief die kleine Köchin ganz laut, »unser gnädigste Kaiser will, daß Sie vor ihm singen möchten!«
»Mit dem größten Vergnügen«, sagte die Nachtigall und sang dann, daß es eine Lust war.
»Es ist gerade wie Glasglocken!« sagte der Haushofmeister. »Und seht die kleine Kehle, wie sie arbeitet! Es ist merkwürdig, daß wir sie früher nie gesehen haben; sie wird großes Aufsehen bei Hofe machen!«
»Soll ich noch einmal vor dem Kaiser singen?« fragte die Nachtigall, die glaubte, der Kaiser sei auch da.
»Meine vortreffliche, kleine Nachtigall«, sagte der Haushofmeister, »ich habe die große Freude, Sie zu einem Hoffeste heute abend einzuladen, wo Sie Dero hohe Kaiserliche Gnaden mit Ihrem prächtigen Gesange bezaubern werden!«
»Der nimmt sich am besten im Grünen aus!« sagte die Nachtigall, aber sie kam doch gern mit, als sie hörte, daß der Kaiser es wünschte.
Auf dem Schlosse war alles aufgeputzt. Wände und Fußboden, die von Porzellan waren, glänzten im Strahle vieler tausend goldener Lampen, und die prächtigsten Blumen, die recht klingeln konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Da war ein Laufen und ein Zugwind, aber alle Glocken klingelten so, daß man sein eigenes Wort nicht hören konnte.
Mitten in dem großen Saal, wo der Kaiser saß, war ein goldener Stab hingestellt, auf dem sollte die Nachtigall sitzen. Der ganze Hof war da, und die kleine Köchin hatte die Erlaubnis erhalten, hinter der Tür zu stehen, da sie nun den Titel einer wirklichen Hofköchin bekommen hatte. Alle waren in ihrem größten Staate, und alle sahen nach dem kleinen, grauen Vogel, dem der Kaiser zunickte.
Die Nachtigall sang so herrlich, daß dem Kaiser die Tränen in die Augen traten, die Tränen liefen ihm über die Wangen hernieder, und da sang die Nachtigall noch schöner; das ging recht zu Herzen. Der Kaiser war sehr erfreut und sagte, daß die Nachtigall einen goldenen Pantoffel um den Hals tragen solle. Aber die Nachtigall dankte, sie habe schon Belohnung genug erhalten.
»Ich habe Tränen in des Kaisers Augen gesehen, das ist mir der reichste Schatz! Gott weiß es, ich bin genug belohnt!« Und darauf sang sie wieder mit ihrer süßen, herrlichen Stimme.
»Das ist die liebenswürdigste Stimme, die wir kennen!« sagten die Damen ringsherum, und dann nahmen sie Wasser in den Mund, um zu klucken, wenn jemand mit ihnen spräche; sie glaubten, dann auch Nachtigallen zu sein. Ja, die Diener und Kammermädchen ließen melden, daß auch sie zufrieden seien, und das will viel sagen, denn sie sind am schwierigsten zu befriedigen. Ja, die Nachtigall machte wahrlich Glück.
Sie sollte nun bei Hofe bleiben, ihren eigenen Käfig haben, samt der Freiheit, zweimal des Tages und einmal des Nachts herauszuspazieren. Sie bekam zwölf Diener mit, die ihr ein Seidenband um das Bein geschlungen hatten, woran sie sie festhielten. Es war durchaus kein Vergnügen bei solchem Ausflug.
Die ganze Stadt sprach von dem merkwürdigen Vogel, und begegneten sich zwei, dann seufzten sie und verstanden einander: Ja, elf Hökerkinder wurden nach ihr benannt, aber nicht eins von ihnen hatte einen Ton in der Kehle.
Eines Tages erhielt der Kaiser eine Kiste, auf der geschrieben stand: »Die Nachtigall.«
»Da haben wir nun ein neues Buch über unseren berühmten Vogel!« sagte der Kaiser; aber es war kein Buch, es war ein Kunststück, das in einer Schachtel lag, eine künstliche Nachtigall, die der lebenden gleichen sollte, aber überall mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt war. Sobald man den künstlichen Vogel aufzog, konnte er eins der Stücke, die der wirkliche sang, singen, und dann bewegte sich der Schweif auf und nieder und glänzte von Silber und Gold. Um den Hals hing ein kleines Band, und darauf stand geschrieben: »Des Kaisers von Japan Nachtigall ist arm gegen die des Kaisers von China.«
»Das ist herrlich!« sagten alle, und der Mann, der den künstlichen Vogel gebracht hatte, erhielt sogleich den Titel: Kaiserlicher Oberhofnachtigallbringer.
»Nun müssen sie zusammen singen! Was wird das für ein Genuß werden!«
Sie mußten zusammen singen, aber es wollte nicht recht gehen, denn die wirkliche Nachtigall sang auf ihre Weise, und der Kunstvogel ging auf Walzen. »Der hat keine Schuld«, sagte der Spielmeister; »der ist besonders taktfest und ganz nach meiner Schule!« Nun sollte der Kunstvogel allein singen. Er machte ebenso viel Glück wie der wirkliche, und dann war er viel niedlicher anzusehen; er glänzte wie Armbänder und Brustnadeln.
Dreiunddreißigmal sang er ein und dasselbe Stück und war doch nicht müde; die Leute hätten ihn gern wieder von vorn gehört, aber der Kaiser meinte, daß nun auch die lebendige Nachtigall etwas singen solle. Aber wo war die? Niemand hatte bemerkt, daß sie aus dem offenen Fenster fort zu ihren grünen Wäldern geflogen war.
»Aber was ist denn das?« fragte der Kaiser; und alle Hofleute schalten und meinten, daß die Nachtigall ein höchst undankbares Tier sei. »Den besten Vogel haben wir doch!« sagten sie, und so mußte der Kunstvogel wieder singen, und das war das vierunddreißigste Mal, daß sie dasselbe Stück zu hören bekamen, aber sie konnten es noch nicht ganz auswendig, denn es war sehr schwer. Der Spielmeister lobte den Vogel außerordentlich, ja, er versicherte, daß er besser als die wirkliche Nachtigall sei, nicht nur was die Kleider und die vielen herrlichen Diamanten betreffe, sondern auch innerlich.
Denn sehen Sie, meine Herrschaften, der Kaiser vor allen! Bei der wirklichen Nachtigall kann man nie berechnen, was da kommen wird, aber bei dem Kunstvogel ist alles bestimmt; man kann es erklären, man kann ihn aufmachen und das menschliche Denken zeigen, wie die Walzen liegen, wie sie gehen und wie das eine aus dem andern folgt!«
»Das sind ganz unsere Gedanken!« sagten sie alle, und der Spielmeister erhielt die Erlaubnis, am nächsten Sonntag den Vogel dem Volke vorzuzeigen. Es sollte ihn auch singen hören, befahl der Kaiser, und es hörte ihn, und es wurde so vergnügt, als ob es sich im Tee berauscht hätte, denn das ist ganz chinesisch; und da sagten alle: »Oh!« und hielten den Zeigefinger in die Höhe und nickten dazu. Aber die armen Fischer, welche die wirkliche Nachtigall gehört hatten, sagten: »Es klingt hübsch, die Melodien gleichen sich auch, aber es fehlt etwas, wir wissen nicht was!«
Die wirkliche Nachtigall ward aus dem Lande und Reiche verwiesen.
Der Kunstvogel hatte seinen Platz auf einem seidenen Kissen dicht bei des Kaisers Bett; alle Geschenke, die er erhalten, Gold und Edelsteine, lagen rings um ihn her, und im Titel war er zu einem 'Hochkaiserlichen Nachttischsänger' gestiegen, im Range Numero eins zur linken Seite, denn der Kaiser rechnete die Seite für die vornehmste, auf der das Herz saß, und das Herz sitzt auch bei einem Kaiser links. Und der Spielmeister schrieb ein Werk von fünfundzwanzig Bänden über den Kunstvogel; das war so gelehrt und lang, voll von den allerschwersten chinesischen Wörtern, daß alle Leute sagten, sie haben es gelesen und verstanden, denn sonst wären sie ja dumm gewesen und auf den Leib getrampelt worden.
So ging es ein ganzes Jahr; der Kaiser, der Hof und alle die übrigen Chinesen konnten jeden kleinen Kluck in des Kunstvogels Gesang auswendig, aber gerade deshalb gefiel er ihnen jetzt am allerbesten; sie konnten selbst mitsingen, und das taten sie. Die Straßenbuben sangen »Ziziiz! Kluckkluckkluck!« und der Kaiser sang es. Ja, das war gewiß prächtig!
Aber eines Abends, als der Kunstvogel am besten sang und der Kaiser im Bette lag und darauf hörte, sagte es »Schwupp« inwendig im Vogel; da sprang etwas. »Schnurrrr!« Alle Räder liefen herum, und dann stand die Musik still.
Der Kaiser sprang gleich aus dem Bette und ließ seinen Leibarzt rufen. Aber was konnte der helfen? Dann ließen sie den Uhrmacher holen, und nach vielem Sprechen und Nachsehen brachte er den Vogel etwas in Ordnung, aber er sagte, daß er sehr geschont werden müsse, denn die Zapfen seien abgenutzt, und es sei unmöglich, neue so einzusetzen, daß die Musik sicher gehe. Das war nun eine große Trauer! Nur einmal des Jahres durfte man den Kunstvogel singen lassen, und das war fast schon zuviel, aber dann hielt der Spielmeister eine kleine Rede mit schweren Worten und sagte, daß es ebensogut wie früher sei, und dann war es ebensogut wie früher.
Nun waren fünf Jahre vergangen, und das ganze Land bekam eine wirkliche, große Trauer. Die Chinesen hielten im Grunde allesamt große Stücke auf ihren Kaiser, und jetzt war er krank und konnte nicht länger leben. Schon war ein neuer Kaiser gewählt, und das Volk stand draußen auf der Straße und fragte den Haushofmeister, wie es seinem alten Kaiser gehe.
»P!« sagte er und schüttelte mit dem Kopfe.
Kalt und bleich lag der Kaiser in seinem großen, prächtigen Bett. Der ganze Hof glaubte ihn tot, und ein jeder lief, den neuen Kaiser zu begrüßen, die Kammerdiener liefen hinaus, um darüber zu sprechen, und die Kammermädchen hatten große Kaffeegesellschaft. Ringsumher in allen Sälen und Gängen war Tuch gelegt, damit man niemand gehen höre, und deshalb war es sehr still. Aber der Kaiser war noch nicht tot; steif und bleich lag er in dem prächtigen Bette mit den langen Samtvorhängen und den schweren Goldquasten, hoch oben stand ein Fenster auf, und der Mond schien herein auf den Kaiser und den Kunstvogel.
Der arme Kaiser konnte kaum atmen, es war gerade, als ob etwas auf seiner Brust säße. Er schlug die Augen auf, und da sah er, daß es der Tod war. Er hatte sich eine goldene Krone aufgesetzt und hielt in der einen Hand des Kaisers goldenen Säbel, in der andern seine prächtige Fahne. Ringsumher aus den Falten der großen Samtbettvorhänge sahen allerlei wunderliche Köpfe hervor, einige ganz häßlich, andere lieblich und mild; das waren des Kaisers gute und böse Taten, die ihn anblickten, jetzt, da der Tod ihm auf dem Herzen saß.
»Entsinnst du dich dessen?« Und dann erzählten sie ihm so viel, daß ihm der Schweiß von der Stirne rann.
»Das habe ich nie gewußt!« sagte der Kaiser. »Musik, Musik, die große chinesische Trommel«, rief er, »damit ich nicht alles zu hören brauche, was sie sagen!«
Aber sie fuhren fort, und der Tod nickte wie ein Chinese zu allem, was gesagt wurde. »Musik, Musik!« schrie der Kaiser. »Du kleiner herrlicher Goldvogel, singe doch, singe! Ich habe dir Gold und Kostbarkeiten gegeben, ich habe dir selbst meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt, singe doch, singe!«
Aber der Vogel stand still, es war niemand da, um ihn aufzuziehen, sonst sang er nicht, und der Tod fuhr fort, den Kaiser mit seinen großen, leeren Augenhöhlen anzustarren, und es war still, erschrecklich still.
Da klang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang. Es war die kleine, lebendige Nachtigall, die auf einem Zweige draußen saß. Sie hatte von der Not ihres Kaisers gehört und war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu singen; und so wie sie sang, wurden die Gespenster bleicher und bleicher, das Blut kam immer rascher und rascher in des Kaisers schwachen Gliedern in Bewegung, und selbst der Tod horchte und sagte: »Fahre fort, kleine Nachtigall! Fahre fort!«
»Ja, willst du mir den prächtigen, goldenen Säbel geben? Willst du mir die reiche Fahne geben? Willst du mir des Kaisers Krone geben?«
Der Tod gab jedes Kleinod für einen Gesang, und die Nachtigall fuhr fort zu singen. Sie sang von dem stillen Gottesacker, wo die weißen Rosen wachsen, wo der Flieder duftet und wo das frische Gras von den Tränen der Überlebenden befeuchtet wird. Da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter, weißer Nebel aus dem Fenster.
»Dank, Dank!« sagte der Kaiser, »du himmlischer, kleiner Vogel, ich kenne dich wohl! Dich habe ich aus meinem Lande und Reich gejagt, und doch hast du die bösen Geister von meinem Bette weggesungen, den Tod von meinem Herzen weggeschafft! Wie kann ich dir lohnen?«
»Du hast mich belohnt!« sagte die Nachtigall. »Ich habe deinen Augen Tränen entlockt, als ich das erstemal sang, das vergesse ich nie; das sind die Juwelen, die ein Sängerherz erfreuen. Aber schlafe nun und werde stark, ich werde dir vorsingen!«
Sie sang, und der Kaiser fiel in süßen Schlummer; mild und wohltuend war der Schlaf!
Die Sonne schien durch das Fenster herein, als er gestärkt und gesund erwachte. Keiner von seinen Dienern war noch zurückgekehrt; denn sie glaubten, er sei tot; aber die Nachtigall saß noch und sang.
»Immer mußt du bei mir bleiben!« sagte der Kaiser. »Du sollst nur singen, wenn du selbst willst, und den Kunstvogel schlage ich in tausend Stücke.«
»Tue das nicht«, sagte die Nachtigall, »der hat ja das Gute getan, solange er konnte, behalte ihn wie bisher. Ich kann nicht nisten und wohnen im Schlosse, aber laß mich kommen, wenn ich selbst Lust habe, da will ich des Abends dort beim Fenster sitzen und dir vorsingen, damit du froh werden kannst und gedankenvoll zugleich. Ich werde von den Glücklichen singen und von denen, die da leiden; ich werde vom Bösen und Guten singen, was rings um dich her dir verborgen bleibt. Der kleine Singvogel fliegt weit herum zu dem armen Fischer, zu des Landmanns Dach, zu jedem, der weit von dir und deinem Hofe entfernt ist. Ich liebe dein Herz mehr als deine Krone, und doch hat die Krone einen Duft von etwas Heiligem um sich. Ich komme und singe dir vor! Aber eins mußt du mir versprechen!«
»Alles!« sagte der Kaiser und stand da in seiner kaiserlichen Tracht, die er angelegt hatte, und drückte den Säbel, der schwer von Gold war, an sein Herz. »Um eins bitte ich dich; erzähle niemand, daß du einen kleinen Vogel hast, der dir alles sagt, dann wird es noch besser gehen!«
So flog die Nachtigall fort.
Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen; ja, da standen sie, und der Kaiser sagte: »Guten Morgen!«
DER GÄRTNER UND DIE HERRSCHAFT
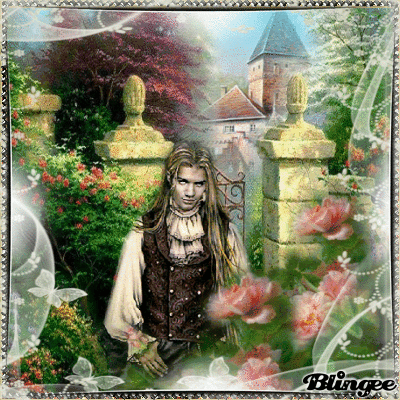
Eine Meile von der Hauptstadt entfernt stand ein altes Schloß mit dicken Mauern, Türmen und gezackten Giebeln.
Hier wohnte, jedoch nur in der Sommerzeit, eine reiche, hochadelige Herrschaft; das Schloß war das beste und schönste von allen Schlössern, die sie besaß. Es stand wie neugegossen von außen da, und drinnen herrschten Traulichkeit und Bequemlichkeit. Das Wappen der Familie war in Stein über dem Tor eingehauen, wunderschöne Rosen schlangen sich um Wappen und Erker, ein ganzer Grasteppich breitete sich vor dem Schlosse aus, und da waren Rotdorn und Weißdorn, da waren seltene Blumen selbst außerhalb des Treibhauses.
Die Herrschaft hatte auch einen tüchtigen Gärtner; es war eine Lust, den Blumengarten, den Obst- und Küchengarten zu sehen. An diesen grenzte noch ein Rest von dem ursprünglichen alten Garten des Schlosses mit Buchsbaumhecken, die so beschnitten waren, daß sie Kronen und Pyramiden bildeten. Hinter diesen standen zwei mächtige alte Bäume; sie waren fast immer blätterlos, und man hätte leicht glauben können, daß ein Sturmwind oder eine Windhose sie mit großen Klumpen Dünger bestreut hätte, aber jeder Klumpen war ein Vogelnest.
Hier baute seit undenkbaren Zeiten eine Schar schreiender Dohlen und Krähen ihre Nester: es war eine ganze Vogelstadt, und die Vögel waren die Herrschaft, die Besitzer, die älteste Familie des Gutes, die eigentliche Herrschaft des Schlosses. Keiner von den Menschen da untern ging sie etwas an, aber sie duldeten diese niedrig gehenden Geschöpfe, obwohl diese zuweilen mit der Flinte knallten, so daß es den Vögeln im Rückgrat kribbelte und jeder Vogel vor Schreck aufflog und schrie: "Rack! Rack!"
Der Gärtner sprach oft mit seiner Herrschaft davon, daß man die alten Bäume fällen sollte, sie sähen nicht gut aus, und wenn sie wegkämen, würde man wahrscheinlich von den schreienden Vögeln befreit werden, die anderswohin fliegen würden. Aber die Herrschaft wollte weder die Bäume noch die Vogelschar entbehren, das war etwas, was das Schloß nicht verlieren durfte, es war etwas aus der alten Zeit, und die sollte man nicht ganz auslöschen.
"Diese Bäume sind nun des Erbgut der Vögel, mögen sie es behalten, mein guter Larsen!"
Der Gärtner hieß Larsen, aber das hat nun weiter nichts zu bedeuten.
"Ist ihr Wirkungskreis nicht groß genug, lieber Larsen? Sie haben doch den ganzen Blumengarten, die Treibhäuser, den Obst- und Küchengarten?"
Das alles hatte er, und er pflegte und hegte es mit Eifer und Tüchtigkeit, und das wurde von der Herrschaft anerkannt, aber sie verhehlten ihm nicht, daß sie bei Fremden oft Früchte aßen und Blumen sahen, die das übertrafen, was sie in ihrem eigenen Garten hatten, und das betrübte den Gärtner, denn er wollte das Beste und tat das Beste. Er hatte ein gutes Herz und verrichtete seine Arbeit gut.
Eines Tages ließ ihn die Herrschaft rufen und sagte in aller Milde und Herrschaftlichkeit, daß sie am vorhergehenden Tage bei vornehmen Freunden eine Art Äpfel und Birnen bekommen hatten, die so saftig und wohlschmeckend waren, daß sie und alle Gäste sich voller Bewunderung geäußert hatten. Die Früchte waren gewiß nicht hier aus dem Lande, aber die sollten eingeführt und hier heimisch werden, wenn unser Klima es erlaubte. Man wußte, daß sie drinnen in der Stadt bei dem ersten Fruchthändler gekauft waren. Der Gärtner sollte in die Stadt reiten und sich danach erkundigen, woher diese Äpfel und Birnen gekommen waren, und dann Pfropfzweige anfordern.
Der Gärtner kannte den Fruchthändler sehr gut, denn gerade an ihn verkaufte er für seine Herrschaft den Überfluß an Obst, der im Schloßgarten wuchs.
Und der Gärtner ritt in die Stadt und fragte den Obsthändler, woher er diese hochgepriesenen Äpfel und Birnen habe.
"Die sind aus Ihrem eigenen Garten!" sagte der Fruchthändler und zeigte ihm sowohl Äpfel wie Birnen, die er wiedererkannte.
Wie sich der Gärtner freute; er eilte zu seiner Herrschaft und erzählte, daß sowohl die Äpfel als auch die Birnen aus ihrem eigenen Garten seien.
Das wollte die Herrschaft gar nicht glauben. "Das ist doch nicht möglich, Larsen! Können Sie ein schriftliches Zeugnis vom Fruchthändler beschaffen?"
Und das konnte er, er brachte ein schriftliches Attest.
"Das ist doch sonderbar!" sagte die Herrschaft.
Nun kamen auf den herrschaftlichen Tisch jeden Tag große Schalen mit diesen prächtigen Äpfeln und Birnen aus ihrem eigenen Garten; scheffel- und tonnenweise wurden diese Früchte an Freunde in der Stadt und außerhalb der Stadt gesandt, ja selbst nach dem Auslande. Das war ein wahres Vergnügen! Doch mußten sie hinzufügen, daß es ja auch zwei außergewöhnlich gute Sommer für Baumobst gewesen seien. Dies sei überall im Lande gut geraten.
Es verging eine Weile; die Herrschaft aß eines Mittags bei Hofe. Am Tage darauf wurde der Gärtner zu seiner Herrschaft gerufen. Sie hatten bei Tafel Melonen bekommen, überaus saftvoll, wohlschmeckend, sie waren aus dem Treibhause der Majestäten.
"Sie müssen zum Hofgärtner gehen, lieber Larsen, und uns einige von den Kernen dieser köstlichen Melonen verschaffen!"
"Aber der Hofgärtner hat die Kerne von uns bekommen!" sagte der Gärtner ganz vergnügt.
"Dann hat der Mann verstanden, die Früchte zu einer höheren Entwicklung zu bringen!" entgegnete die Herrschaft. "Jede Melone war ausgezeichnet."
"Ja, dann kann ich stolz sein!" sagte der Gärtner. "Ich will der gnädigen Herrschaft nur sagen, daß der Schloßgärtner in diesem Jahre mit seinen Melonen kein Glück gehabt hat, und als er sah, wie prächtig unsere standen, und sie kostete, da bestellte der drei davon fürs Schloß!"
"Larsen, bilden Sie sich doch nicht ein, daß diese Melonen aus unserem Garten waren!"
"Ich glaube es!" sagte der Gärtner, ging zum Schloßgärtner und erhielt von ihm einen schriftlichen Beweis, daß die Melonen auf der königlichen Tafel aus dem Herrschaftsgarten gekommen seien.
Das war wirklich eine Überraschung für die Herrschaft, und sie verschwieg die Geschichte nicht, sie zeigte das Attest vor, ja, es wurden Melonenkerne weit und breit versandt, so wie früher die Pfropfzweige.
Von diesen erhielt man Nachricht, sie hatten angeschlagen, hatten Früchte angesetzt, ganz vorzüglich, und die waren nach dem Schloß der Herrschaft genannt, so daß der Name dadurch jetzt auf englisch, französisch und deutsch zu lesen war.
Das hätte man sich doch niemals träumen lassen.
"Wenn nur der Gärtner nicht zu große Ideen von sich bekommt!" sagte die Herrschaft.
Er faßte die Sache ganz anders auf: er wollte jetzt bestrebt sein, seinen Namen als einen der besten Gärtner des Landes zu behaupten, jedes Jahr wollte er versuchen, etwas Vorzügliches von allen Gartenarten zu bringen, und das tat er, aber oft mußte er doch hören, daß die allerersten Früchte, die er gebracht hatte, die Äpfel und die Birnen, eigentlich die besten gewesen seien, alle späteren Arten standen weit zurück. Die Melonen waren ja freilich sehr gut gewesen, aber das war ja auch eine ganz andere Art; die Erdbeeren könnte man ja vortrefflich nennen, aber doch nicht besser als die, die andere Herrschaften hatten, und als die Rettiche in einem Jahre nicht gerieten, sprach man nur von den verunglückten Rettichen und nicht von all dem andern Guten, was das Jahr gebracht hatte.
Es war fast, als ob die Herrschaft eine Erleichterung empfand, wenn sie sagen konnte:
"Dieses Jahr glückte es Ihnen nicht, lieber Larsen!" Sie waren wirklich ganz froh, wenn sie sagen konnten: " Dieses Jahr glückte es nicht!"
Ein paarmal in der Woche brachte der Gärtner frische Blumen ins Zimmer, immer höchst geschmackvoll geordnet. Er setzte die Farben durch die Zusammenstellung gleichsam in ein stärkeres Licht.
"Sie haben Geschmack, Larsen!" sagte die Herrschaft. "Es ist eine Gabe, die der liebe Gott Ihnen gegeben hat, aus sich selber haben Sie es nicht!"
Eines Tages kam der Gärtner mit einer großen Kristallschale, darin lag ein Wasserrosenblatt; auf dieses war, mit dem langen, dicken Stengel im Wasser, eine strahlende blaue Blume gelegt, so groß wie eine Sonnenblume.
"Hindustans Lotus!" sagte die Herrschaft.
Eine solche Blume hatten sie noch nie gesehen, und sie wurde am Tage in die Sonne und am Abend ins Reflexlicht gestellt. Jeder, der sie sah, fand sie wunderbar schön und selten, ja, das sagte selbst die vornehmste von den jungen Damen des Landes, und das war eine Prinzessin; klug und herzensgut war sie.
Die Herrschaft setzte eine Ehre darein, ihr die Blume zu überreichen, und sie kam mit der Prinzessin auf das Schloß.
Nun ging die Herrschaft in den Garten hinab, um selber eine Blume von derselben Art zu pflücken, wenn noch eine solche da war, aber sie war nicht zu finden. Dann riefen sie den Gärtner und fragten, woher er die Lotus habe.
"Wir haben vergebens gesucht!" sagten sie. "Wir sind in den Treibhäusern und durch den ganzen Blumengarten gegangen!"
"Nein, da ist sie wirklich auch nicht zu finden!" sagte der Gärtner. "Es ist nur eine geringe Blume aus dem Küchengarten! Aber, nicht war, wie schön sie ist! Sie sieht aus, als sei es ein blauer Kaktus, und ist doch nur die Blüte einer Artischocke!"
"Das hätten Sie uns aber gleich sagen müssen!" sagte die Herrschaft. "Wir mußten glauben, daß es eine fremde seltene Blume sei. Sie haben uns vor der jungen Prinzessin blamiert! Sie sah die Blume bei uns, fand sie so schön, kannte sie nicht, und sie ist doch gut bewandert in der Botanik, aber die Wissenschaft hat gewiß nicht mit den Küchenkräutern zu tun. Wie konnte es Ihnen doch einfallen, lieber Larsen, eine solche Blume ins Zimmer zu setzen. Sie machen uns ja lächerlich!"
Und die schöne blaue Prachtblüte, die aus dem Küchengarten geholt war, wurde aus dem herrschaftlichen Zimmer entfernt, wohin sie nicht gehörte, ja, die Herrschaft brachte eine Entschuldigung bei der Prinzessin vor und erzählte, daß die Blume nur ein Küchengewächs sei, das der Gärtner hinzustellen sich erkühnt habe; aber er habe dafür auch einen ernsten Tadel erhalten.
"Das ist aber wirklich unrecht!" sagte die Prinzessin. "Er hat ja unsere Augen für eine Prachtblüte erschlossen, die wir bisher nicht beachtet hatten. Er hat uns die Schönheit gezeigt, wo es uns nicht eingefallen war, sie zu suchen! Der Schloßgärtner soll mir jeden Tag, solange die Artischocken blühen, eine Blume davon in mein Zimmer bringen!"
Und so geschah es.
Die Herrschaft ließ dem Gärtner sagen, daß er nun wieder eine frische Artischockenblüte bringen könne.
"Sie ist eigentlich sehr schön," sagten sie, "höchst eigentümlich!" und der Gärtner erhielt ein Lob.
"Das geht dem guten Larsen glatt herunter!" sagte die Herrschaft. "Er ist ein verhätscheltes Kind."
Im Herbst brauste ein schrecklicher Sturm. Des Nachts wehte es so gewaltsam, daß viele große Bäume am Rande des Waldes mit der Wurzel ausgerissen wurden, und zum großen Kummer für die Herrschaft, sie nannten es einen Kummer, aber zur Freude für den Gärtner, wehten die beiden großen Bäume mit allen den Vogelnestern um. Man hörte im Sturm das Geschrei der Dohlen und Krähen, sie schlugen mit den Flügeln gegen die Fensterscheiben, sagten die Leute im Schloß.
"Jetzt freuen Sie sich wohl, Larsen!" sagte die Herrschaft. "Der Sturm hat die Bäume gefällt, und die Vogel sind nach dem Walde geflogen. Jetzt ist ja nichts hier von der alten Zeit zu erblicken, jede Spur, jede Andeutung ist verschwunden! Uns hat es betrübt!"
Der Gärtner sagte nichts, aber er dachte an das, was er lange gedacht hatte, nämlich daran, den prächtigen, sonnigen Platz zu benutzen, über den er bisher nicht hatte verfügen können, der sollte eine Zierde des Gartens und eine Freude für die Herrschaft werden.
Die großen, umgewehten Bäume hatten die uralten Buchsbaumhecken mit all ihrer Verschneidung zerdrückt und zerschmettert. Er pflanzte hier ein Dickicht von Gewächsen, von heimischen Pflanzen aus Feld und Wald.
Was kein anderer Gärtner in so reicher Fülle in einen herrschaftlichen Garten zu pflanzen gewagt haben würde, das setzte er hier in die Erde, die jedes einzelne Gewächs verlangte, und in Sonnenschein oder Schatten, so wie jede Art es bedurfte. Er pflegte in Liebe, und es wuchs in Herrlichkeit.
Der Wachholderbusch aus der jütländischen Heide prangte hier in Form und Farbe wie die Zypresse Italiens, der blanke, stachlige Christusdorn, immergrün in Winterkälte und in Sommersonne, stand herrlich zu sehen da. Im Vordergrund wuchsen Farnkräuter, viele verschiedene Arten, einige sahen aus, als seien sie Kinder des Palmenbaums, und andere, als seien sie die Eltern der feinen, schönen Pflanzen, die wir Venushaar nennen. Hier stand die verachtete Klette, die in ihrer Frische so schön ist, daß sie in einem Bukett zum Schmuck gereichte. Die Klette stand auf dürrem Boden, aber niedriger; in den feuchten Grund wuchs der Ampfer, auch eine verachtete Pflanze, die doch durch ihre Größe und ihre mächtigen Blätter so malerisch schön aussah. Ellenhoch, mit unzähligen Blüten, wie ein mächtiger, vielarmiger Kandelaber, ragte die Königskerze auf, die aus dem Feld in den Garten verpflanzt war. Hier standen Waldmeister, Schlüsselblume und Maiglockchen, die wilde Calla und der dreiblättrige Sauerklee. Es war eine Pracht.
Davor aber, auf Stahldraht gestützt, wuchsen in Reihen ganz kleine Birnbäume aus französischem Erdboden; sie bekamen Sonne und gute Pflege und trugen bald große, saftige Früchte wie in dem Lande, woher sie kamen.
Statt der beiden alten, blätterlosen Bäume wurde eine hohe Flaggenstange aufgerichtet, um die der Danebrog wehte, und dicht daneben noch eine Stange, um die sich zur Sommer- und Herbstzeit die Hopfenranken mit ihren duftenden Blütenbüscheln schlangen, wo aber im Winter nach alter Sitte eine Hafergarbe aufgehängt wurde, damit die Vögel des Himmels in der frohen Weihnachtszeit auch eine Mahlzeit hatten.
"Der gute Larsen wird in seinen alten Jahren sentimental!" sagte die Herrschaft. "Aber er ist uns ja treu und ergeben!"
Zu Neujahr kam in einer der illustrierten Zeitungen der Hauptstadt ein Bild von dem alten Schloß, man sah die Flaggenstange und die Hafergarbe für die Vögel des Himmels in der frohen Weihnachtszeit, und es stand als ein schöner Gedanke gesprochen und hervorgehoben, daß eine alte Sitte hier wieder zu Ehren gebracht war, so bezeichnend gerade für das alte Schloß.
"Alles, was dieser Larsen tut," sagte die Herrschaft, "wird an die große Glocke gehängt. Es ist ein glücklicher Mann! Wir müssen ja fest stolz darauf sein, daß wir ihn haben!"
Aber sie waren gar nicht stolz darauf! Sie fühlten, daß sie die Herrschaft waren, sie konnten Larsen kündigen, aber das taten sie nicht, sie waren gute Menschen, und es gibt so viele gute Menschen dieser Art, und das ist ein Glück für jeden Larsen.
Ja, das ist die Geschichte "von dem Gärtner und der Herrschaft."
Nun kannst du darüber nachdenken!
EIN UNTERSCHIED IST DA
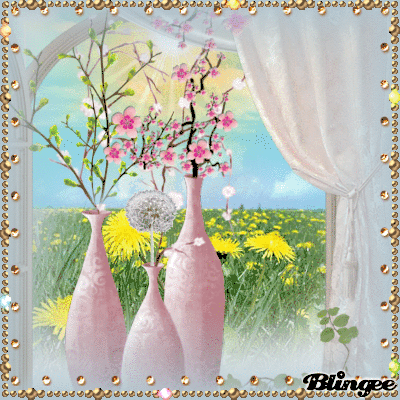
Es war im Maimonat, der Wind blies noch kalt; aber »der Frühling ist da«, sagten Büsche und Bäume, Feld und Flur; es wimmelte von Blumen bis in die lebendigen Hecken hinauf; und dort führte der Frühling selbst seine Sache, er predigte von einem kleinen Apfelbaume herab, dort hing ein einziger Zweig, frisch und blühend, mit feinen, rosenroten Knospen überstreut, welche im Begriff waren, sich zu öffnen; er wußte recht wohl, wie schön es sei, denn es liegt im Blatte sowohl wie im Blute; deshalb überraschte es ihn auch nicht, als ein herrschaftlicher Wagen vor ihm anhielt, und die junge Gräfin sagte, daß ein Apfelzweig das lieblichste sei, das man sehen könne: er sei der Frühling selbst in seiner herrlichsten Offenbarung. Der Zweig wurde abgebrochen, sie nahm ihn in ihre feine Hand, und beschattete ihn mit ihrem seidenen Sonnenschirme, – dann fuhren sie nach dem Schlosse, wo sich hohe Säle und prächtige Zimmer befanden; klare, weiße Gardinen flatterten vor den offenen Fenstern und herrliche Blumen standen in glänzenden, durchsichtigen Vasen, und in eine derselben, die wie aus frischgefallenem Schnee geschnitten war, wurde der Apfelzweig zwischen frische, lichte Buchenzweige gesteckt; es war eine Lust ihn zu sehen.
Da wurde der Zweig stolz und das ist ja menschlich!
Es kamen verschiedenartige Leute durch die Zimmer, und je nachdem sie etwas galten, durften sie ihre Bewunderung aussprechen. Einige sagten nichts, andere wiederum zu viel, und der Apfelzweig verstand es, daß ein Unterschied zwischen den Gewächsen sei. »Einige sind zum Staate und einige zum Ernähren da; es gibt auch solche, die man ganz entbehren könnte,« meinte der Apfelzweig, und da er gerade vor dem offenen Fenster stand, von wo aus er in den Garten und auf das Feld sehen konnte, so hatte er Blumen und Gewächse genug, um sie zu betrachten und darüber nachzudenken; dort standen reiche und arme, einige gar zu ärmliche.
»Arme verstoßene Kräuter!« sagte der Apfelzweig, »ein Unterschied ist freilich da! wie unglücklich müssen sie sich suhlen, wenn die Art so fühlen kann wie ich und meines Gleichen; freilich ist ein Unterschied da, aber der muß auch gemacht werden, sonst wären sie ja Alle gleich!«
Und der Apfelzweig sah mit gewissem Mitleid besonders auf eine Art von Blumen, welche sich in Menge auf Feldern und in Gräben vorfanden; Keiner Band sie zum Strauße; sie waren gar zu gewöhnlich, ja, man konnte sie selbst zwischen den Steinpflaster finden. Sie schossen wie das ärgste Unkraut hervor, und hatten den häßlichen Namen: Hundsblumen.
»Armes, verachtetes Gewächs!« sagte der Apfelzweig, »Du kannst nichts dafür, daß Du den häßlichen Namen erhieltest, welchen Du führst. Aber mit den Gewächsen ist es wie mit den Menschen, ein Unterschied muß sein!«
»Unterschied!« sagte der Sonnenstrahl und küßte den blühenden Apfelzweig, küßte aber auch die gelben Hundsblumen draußen auf dem Felde, alle Brüder des Sonnenstrahls küßten sie, die armen Blumen sowohl wie die reichen.
Der Apfelzweig hatte niemals über Gottes unendliche Liebe gegen Alles, was da lebt und sich in ihm bewegt, nachgedacht, wie viel Schönes und Gutes verborgen, aber nicht vergessen daliegen kann, – aber auch das war menschlich!
Der Sonnenstrahl, der Strahl des Lichts wußte es besser: »Du siehst nicht weit, Du siehst nicht klar! – Welches ist das verachtete Kraut, das Du namentlich beklagst?«
»Die Hundsblume!« sagte der Apfelzweig. »Niemals wird sie zum Strauß gebunden, sie wird mit Füßen getreten; es sind ihrer zu viele, und wenn sie in Samen schießen, so stiegen sie wie klein geschnittene Wolle über den Weg und hängen sich an die Kleider der Leute. Unkraut ist's, aber auch das soll ja sein! – Ich bin wirklich sehr dankbar, daß ich keine jener Blumen geworden bin!«
Und über das Feld kam eine Schar Kinder. Das jüngste derselben war noch so klein daß es von den andern getragen wurde. Als es zwischen den gelben Blumen in das Gras gesetzt wurde, lachte es laut vor Freude, zappelte mit den Beinchen, wälzte sich umher, pflückte nur die gelben Blumen, und küßte sie in süßer Unschuld. Die etwas größeren Kinder brachen die Blumen von den hohen Stielen, bogen diese rund in sich selbst zusammen, Glied an Glied, sodaß eine Kette daraus entstand; erst eine für den Hals, dann eine, um sie über die Schultern und um den Leib zu hängen, und dann noch eine um sie auf der Brust und auf dem Kopf zu befestigen; das war eine Pracht von grünen Gliedern und Ketten! Aber die größten Kinder faßten vorsichtig die abgeblühte Blume beim Stengel, der die gefiederte zusammengesetzte Samenkrone trug; diese lose, luftige Wollblume, welche ein rechtes Kunstwerk ist, wie aus den feinsten Federn, Flocken oder Daunen, hielten sie an den Mund, um sie mit einem Male rein abzublasen, und wer das konnte, bekam, wie die Großmutter sagte, neue Kinder, bevor das Jahr zu Ende ging.
Die verachtete Blume war bei dieser Gelegenheit ein Prophet.
»Siehst Du!« sagte der Sonnenstrahl. »Siehst Du ihre Schönheit siehst Du ihre Macht?«
»Ja für Kinder!« antwortete der Apfelzweig.
Und eine alte Frau kam auf das Feld und grub mit ihrem stumpfen, schaftlosen Messer um die Wurzel des Krautes, und zog diese heraus; von einigen der Wurzeln wollte sie sich Kaffee kochen, für andere wollte sie Geld lösen, indem sie dieselbe dem Apotheker verkaufte.
»Schönheit ist doch etwas Höheres!« sagte der Apfelzweig. »Nur die Auserwählten kommen in das Reich des Schönen! Es gibt einen Unterschied zwischen den Gewächsen, wie es einen Unterschied zwischen den Menschen gibt!«
Der Sonnenstrahl sprach von der unendlichen Liebe Gottes, die sich im Erschaffnen offenbart, und von Allem, was Leben hat und von der gleichen Verteilung aller Dinge in Zeit und Ewigkeit!
»Ja, das ist nun Ihre Meinung!« sagte der Apfelzweig
Es kamen Leute in das Zimmer, und die junge schöne Gräfin erschien, sie, welche den Apfelzweig in die durchsichtige Vase gestellt hatte, wo das Sonnenlicht strahlte; sie brachte eine Blume, oder was es sonst sein mochte, der Gegenstand wurde von drei bis vier großen Blattern verborgen gehalten, welche wie eine Tüte um ihn gehalten wurden, damit weder Zug noch Windstoß ihm Schaden tun solle, und er wurde so vorsichtig getragen, wie es mit einem Apfelzweige niemals geschehen war. Vorsichtig wurden nun die großen Blatter entfernt, und man sah die feine gefiederte Samenkrone der gelben verachteten Hundsblume. Die war es, welche sie so vorsichtig gepflückt hatte, so sorgfältig trug, damit nicht einer der seinen Federpfeile, welche ihre Nebelgestalten bilden, und lose sitzen, fortwehen solle. Unversehrt trug sie diese, und bewunderte ihre schöne Form, ihre luftige Klarheit, ihre ganz eigentümliche Zusammensetzung, ihre Schönheit, die so im Winde verwehen sollte.
»Sieh doch, wie wunderbar lieblich Gott sie gemacht hat!« sagte sie. »Ich will, sie mit dem Apfelzweige zusammen malen, den finden Alle so unendlich schön, aber auch diese arme Blume hat auf eine andere Weise ebenso viel vom lieben Gott erhalten; so verschieden sie auch sind, sind sie doch beide Kinder im Reiche der Schönheit!«
Der Sonnenstrahl küßte die ärmliche Blume und den blühenden Apfelzweig, dessen Blätter dabei zu erröten schienen.
DAS ALTE HAUS
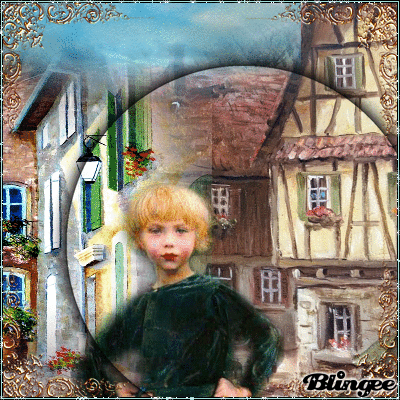
Drüben in der Straße stand ein altes, altes Haus, das war fast dreihundert Jahr alt, so konnte man an einem Balken lesen, an dem die Jahreszahl zugleich mit Tulpen und Hopfenranken eingekerbt war. Da standen ganze Verse in der Schreibweise alter Tage, und über jedem Fenster war ein fratzenhaftes Gesicht in den Balken eingeschnitten. Das obere Stockwerk hing weit über das untere, und unter dem Dache war eine Bleirinne mit Drachenköpfen. Das Regenwasser sollte aus dem Rachen herauslaufen, aber es lief aus dem Bauche, denn es war ein Loch in der Rinne.
Alle anderen Häuser in der Straße waren so neu und so nett, mit großen Scheiben und glatten Wänden, und man konnte wohl sehen, daß sie nichts mit dem alten Haus zu tun haben wollten. Sie dachten wohl: "Wie lange soll das Gerümpel hier noch der Straße zur Schande stehen bleiben. Der Erker steht so weit heraus, daß niemand aus unseren Fenstern sehen kann, was auf der anderen Seite geschieht! Die Treppe ist so breit, wie bei einem Schloß und so hoch wie bei einem Kirchturm. Das Eisengeländer sieht ja aus, wie die Tür zu einem alten Erbbegräbnis, dazu hat es noch Messingknöpfe. Das ist geschmacklos!"
Gerade gegenüber in der Straße standen auch neue und nette Häuser, und sie dachten wie die anderen. Aber am Fenster saß hier ein kleiner Knabe mit frischen, roten Wangen, mit klaren, strahlenden Augen, dem das alte Haus am besten gefiel sowohl im Sonnenschein wie im Mondschein. Wenn er nach der Mauer hinüber sah, wo der Kalk abgebröckelt war, konnte er sitzen und sich die wunderbarsten Bilder ausdenken: wie wohl die Straße früher ausgesehen haben mochte mit Treppen, Erkern und spitzen Giebeln. Er konnte Soldaten mit Hellebarden sehen, und Dachrinnen, die wie Drachen und Lindwürmer herumliefen. – Das war so recht ein Haus zum Betrachten. Und drüben wohnte ein alter Mann; der ging in Kniehosen, hatte einen Rock mit großen Messingknöpfen und eine Perrücke, bei der man sehen konnte, daß es eine wirkliche Perrücke war. Jeden Morgen kam ein alter Diener zu ihm, der aufräumte und Gänge besorgte. Sonst war der alte Mann in den Kniehosen ganz allein in dem alten Hause. Zwischendurch kam er wohl einmal ans Fenster und sah hinaus, und der kleine Knabe nickte zu ihm hinüber; der alte Mann nickte wieder, und so wurden sie Bekannte, und so wurden sie Freunde, obwohl sie niemals miteinander gesprochen hatten. Aber das war auch unnötig.
Der kleine Knabe hörte seine Eltern sagen: "Der alte Mann da drüben hat es gut, aber er ist so schrecklich allein!"
Am nächsten Sonntag nahm der kleine Knabe etwas, wickelte es in ein Stück Papier, ging vor die Tür, und als der Diener, der die Gänge besorgte, vorbeikam, sagte er zu ihm: "Hör, willst Du dem alten Mann da drüben das von mir bringen? Ich habe zwei Zinnsoldaten, dies ist der eine; er soll ihn haben, denn ich weiß, daß er so schrecklich allein ist."
Und der alte Diener sah ganz vergnügt aus, nickte und trug den Zinnsoldaten hinüber in das alte Haus. Darauf kam von drüben ein Bote mit der Anfrage, ob der kleine Knabe wohl Lust hätte, selbst einmal herüber zu kommen und Besuch zu machen. Dazu bekam er von seinen Eltern Erlaubnis, und so kam er in das alte Haus hinüber.
Die Messingknöpfe am Treppengeländer glänzten viel stärker als sonst. Man hätte glauben mögen, daß sie des Besuches wegen poliert worden wären. Und es war, als ob die geschnitzten Trompeter – denn es waren geschnitzte Trompeter an der Tür, die in den Tulpen standen – aus Leibeskräften bliesen; ihre Backen sahen viel dicker aus als zuvor. Ja, sie bliesen: "Tratteratra. Der kleine Knabe kommt. Tratteratra!" und dann ging die Türe auf. Den ganzen Gang entlang hingen alte Porträts, Ritter in Harnischen und Frauen in Seidenkleidern. Und die Harnische rasselten und die seiden Kleider raschelten! Dann kam eine Treppe, die ging ein großes Stück hinauf und ein kleines hinab und dann war man auf einem Altan, der freilich sehr altersschwach und voller großer Löcher und Risse war, aber daraus hervor wuchsen Gras und Blätter; denn der ganze Altan, der Hof und die Mauern waren mit soviel Grün bewachsen, daß es wie ein Garten aussah. Aber es war nur ein Altan. Hier standen alte Blumentöpfe, die Gesichter und Eselsohren hatten. Die Blumen darin wuchsen aber ganz wie sie selbst wollten. In dem einen Topf liefen die Nelken nach allen Seiten über den Rand, das heißt das Grüne, Schößling neben Schößling, und ganz deutlich sagten sie: "Die Luft hat mich gestreichelt, die Sonne hat mich geküßt und mir am Sonntag eine kleine Blume versprochen, eine kleine Blume am Sonntag."
Und dann kamen sie in eine Kammer hinein, wo die Wände mit Schweinsleder bezogen waren, darauf waren goldene Blumen gedruckt.
"Vergoldung vergeht, aber Schweinsleder besteht" sagten die Wände.
Und Lehnstühle standen da mit hohen Rücken, über und über geschnitzt, und mit Armen an beiden Seiten. "Sitz nieder! Sitz nieder!" sagten sie; "O, wie es in mir knackt! Nun bekomme ich die Gicht wie der alte Schrank. Gicht im Rücken. O!"
Und dann kam der kleine Knabe in die Stube hinein, wo der Erker war und wo der alte Mann saß.
"Schönen Dank für den Zinnsoldaten, mein kleiner Freund" sagte der alte Mann. "Und Dank, daß Du zu mir herüberkommst!"
"Dank, Dank," oder "Knack, Knack," sagte es in allen Möbeln. Da waren so viele, daß sie sich fast im Wege standen, um den kleinen Knaben anzusehen.
Mitten an der Wand hing eine Malerei mit einer wunderschönen Dame, so jung, so froh, aber ganz so gekleidet, wie vor alten Zeiten, mit Puder im Haar und Kleidern, die ganz steif um sie herum standen. Sie sagte weder "Dank" noch "Knack," aber sah mit ihren freundlichen Augen den kleinen Knaben an, der sogleich den alten Mann fragte: "Wo hast Du sie her bekommen?"
"Drüben vom Trödler" sagte der alte Mann. "Da hängen soviele Bilder. Keiner kennt sie mehr und macht sich etwas daraus, denn alle sind nun begraben. Aber in alten Tagen habe ich sie gekannt; nun ist sie tot schon seit fast einem halben Jahrhundert"
Und unter der Malerei hing unter Glas ein verwelkter Blumenstrauß. Der hatte gewiß auch ein halbes Jahrhundert gesehen, so alt war er. Und der Perpendikel an der großen Uhr ging hin und her und der Zeiger drehte sich und alle Dinge in der Stube wurden immer älter, aber das merkten sie nicht.
"Sie sagen zuhause," sagte der kleine Knabe, "daß Du so schrecklich einsam bist."
"O," sagte er, "die alten Gedanken mit allem, was sie so mit sich führen können, kommen und besuchen mich, und nun kommst Du ja auch. Mir geht es ganz gut."
Und dann nahm er vom Bücherbrett ein Buch mit Bildern. Darin waren ganze Aufzüge, die wunderlichsten Karossen, die man heute nicht mehr zu sehen bekommt, Soldaten wie auf den Spielkarten und Bürger mit wehenden Fahnen. Die Schneider hatten eine mit einer Schere, die von zwei Löwen gehalten wurde, und die Schuhmacher hatten eine ohne Stiefel, aber mit einem Adler, der zwei Köpfe besaß, denn die Schuhmacher müssen alles so haben, daß sie sagen können: das ist ein Paar. – Ja, das war ein Bilderbuch.
Und der alte Mann ging in die andere Stube, um Eingezuckertes und Äpfel und Nüsse zu holen; – es war wirklich prächtig hier drüben in dem alten Hause.
"Ich kann es nicht aushalten!" sagte der Zinnsoldat, der auf der Kommode stand; "hier ist es so einsam und traurig; nein, wenn man einmal Familienleben kennen gelernt hat, kann man sich hier nicht eingewöhnen. – Ich kann das nicht aushalten! Der ganze Tag ist so lang und der Abend noch länger. Hier ist es nicht wie drüben bei Dir, wo Deine Mutter und Dein Vater so fröhlich miteinander sprachen, und wo Du und alle Ihr süßen Kinder einen so prächtigen Spektakel machtet! Nein, wie allein der alte Mann ist. Glaubst Du, er bekommt einen Kuß? Glaubst Du, jemand macht ihm freundliche Augen oder einen Weihnachtsbaum? Er bekommt gar nichts, nur ein Begräbnis – Ich kann das nicht aushalten!"
"Du mußt es nicht so schwer nehmen!" sagte der kleine Knabe, "mir kommt es hier herrlich vor, und alle die alten Gedanken mit dem, was sie so mit sich führen können, kommen ja auch und machen Besuch."
"Ja, die sehe ich nicht, und die kenne ich nicht" sagte der Zinnsoldat. "Ich kann das nicht aushalten!"
"Das mußt Du" sagte der kleine Knabe.
Und der alte Mann kam mit dem vergnügtesten Gesicht und mit dem herrlichsten Eingemachten und Äpfeln und Nüssen, und da dachte der kleine Knabe nicht mehr an den Zinnsoldaten.
Glücklich und froh kam der kleine Knabe heim. Es vergingen Wochen und Tage, es wurde zu dem alten Hause und von dem alten Hause hinübergenickt, und dann kam der kleine Knabe wieder hinüber.
Und die geschnitzten Trompeter bliesen: "Tratteratra. Da ist der kleine Knabe. Tratteratra" Und Schwerter und Rüstungen auf den alten Ritterbildern rasselten und die Seidenkleider raschelten, das Schweinsleder sprach und die alten Stühle hatten Gicht im Rücken: "au!" Es war ganz genau wie beim ersten Mal, denn hier drüben war ein Tag und eine Stunde ganz wie die andere.
"Ich kann das nicht aushalten!" sagte der Zinnsoldat. "Ich habe Zinn geweint! Hier ist es allzu traurig laß mich lieber in den Krieg ziehen und Arme und Beine verlieren! Das ist doch eine Abwechslung. Ich kann das nicht aushalten! – nun weiß ich, was das heißt, Besuch von seinen alten Gedanken zu bekommen, mit dem was sie mit sich führen können. Ich habe von meinen Besuch gehabt, und Du kannst mir glauben, es ist kein Vergnügen auf die Dauer. Ich war zuletzt nahe daran, von der Kommode zu springen. Euch alle da drüben sah ich so deutlich, als ob Ihr wirklich hier wäret; es war wieder der Sonntagmorgen – Du weißt doch noch. Alle Ihr Kinder standet vor dem Tische und sangt Eure Lieder, wie Ihr sie jeden Morgen singt. Ihr standet andächtig mit gefalteten Händen, und Vater und Mutter waren ebenso feierlich, und dann ging die Tür auf, und die kleine Schwester Maria, die noch nicht zwei Jahre alt war, und die immer tanzte, wenn sie Musik oder Gesang hörte, was für eine Art es auch sein mochte, wurde hereingeschoben. Sie sollte es nun eigentlich nicht – aber sie fing an zu tanzen, konnte jedoch nicht recht in den Takt kommen, denn die Töne waren so lang, und so stand sie erst auf dem einen Bein und bog den Kopf ganz nach vorn über, und dann auf dem andern Bein und den Kopf noch weiter vornüber, aber es wollte nicht recht gehen. Ihr standet alle ganz ernst da, obgleich es recht schwer hielt damit; ich aber lachte innerlich, und deshalb fiel ich vom Tische herunter und bekam eine Beule, mit der ich jetzt noch gehe, denn es war nicht recht von mir, zu lachen. Aber das Ganze zieht jetzt wieder innerlich an mir vorüber und noch manches andere, was ich so erlebt habe. Das werden wohl die alten Gedanken sein, mit allem, was sie mit sich führen können. Sag mir, singt Ihr noch immer an den Sonntagen? Erzähle mir ein bischen von der kleinen Maria. Und wie geht es meinem Kameraden, dem andern Zinnsoldaten? Ja, er ist wirklich glücklich. Ich kann das nicht aushalten."
"Du bist weggeschenkt!" sagte der kleine Knabe. "Du mußt bleiben. Kannst Du das nicht einsehen?"
Und der alte Mann kam mit einem Kasten, worin es viele Dinge zu sehen gab, seltsame, kleine Häuschen, Balsambüchsen und alte Karten, so groß und dick vergoldet, wie man sie jetzt gar nicht mehr sieht. Und es wurden große Schubladen aufgezogen und das Klavier wurde geöffnet; das hatte eine Landschaft inwendig auf dem Deckel und war ganz heiser, als der alte Mann darauf spielte. Er summte dabei eine alte Weise.
"Ja, die konnte sie singen" sagte er, und dann nickte er zu dem Porträt hinüber, das er beim Trödler gekauft hatte, und des alten Mannes Augen leuchteten auf.
"Ich will in den Krieg! Ich will in den Kriegt" rief plötzlich der Zinnsoldat so laut er konnte und stürzte sich auf den Fußboden.
Ja, wo war er geblieben? Der alte Mann suchte, der kleine Knabe suchte, aber fort war er und fort blieb er. "Ich werde ihn schon finden!" sagte der Alte, aber er fand ihn nie mehr! Der Fußboden hatte allzu große Löcher und Ritzen. Der Zinnsoldat war durch eine Spalte gefallen, und dort lag er im offenen Grabe.
Und der Tag verging, und der kleine Knabe kam heim, und die Woche verging und noch viele Wochen. Die Fenster waren ganz zugefroren. Der kleine Knabe mußte sitzen und darauf blasen, um ein Guckloch zu dem alten Haus hinüber zu bekommen. Dort war der Schnee in alle Schnörkel und Inschriften hineingefegt. Er lag dicht über der Treppe, gerade, als sei niemand dort zuhause. Und es war auch niemand zuhause, der alte Mann war tot.
Am Abend hielt ein Wagen davor, und zu ihm herunter trug man ihn in seinem Sarge. Er sollte draußen auf dem Lande in seinem Erbbegräbnis beerdigt werden. Da fuhr er nun, aber niemand folgte, alle seine Freunde waren ja tot. Nur der kleine Knabe warf dem Sarge viele Kußhände nach, als er fortfuhr.
Einige Tage später war Auktion in dem alten Hause, und der kleine Knabe sah von seinem Fenster aus, wie man die alten Ritter und die alten Damen, die Blumentöpfe mit den langen Ohren, die alten Stühle und die alten Schränke weg trug. Einiges kam hierhin, einiges dorthin. Das Porträt von ihr, das er beim Trödler gefunden hatte, kam wieder zum Trödler und dort blieb es hängen; denn nun kannte sie niemand mehr, und niemand kümmerte sich um das alte Bild.
Im Frühjahr riß man auch das Haus nieder, denn es sei nur ein altes Gerümpel, sagten die Leute. Von der Straße aus konnte man gerade in die Stuben mit dem Schweinslederbezug hineinsehen, der zerfetzt und heruntergerissen wurde. Und all das Grüne hing vom Altan wild um die fallenden Balken herab. – Und dann wurde dort aufgeräumt.
"Das half!" sagten die Nachbarhäuser.
Und es wurde ein herrliches, neues Haus dort gebaut mit großen Fenstern und weißen, glatten Mauern. Aber vorne, wo eigentlich das alte Haus gestanden hatte, wurde ein kleiner Garten angelegt, und zu des Nachbarhauses Mauern hinauf wuchsen wilde Weinranken. Vor den Garten kam ein großes eisernes Gitter mit eiserner Tür; das sah gar stattlich aus. Die Leute standen still und schauten hinein. Und die Spatzen hingen sich dutzendweil an die Weinranken und nahmen einander das Wort vom Munde, so gut sie konnten, aber es war nicht das alte Haus, worüber sie sprachen, denn darauf konnten sie sich nicht besinnen. Es waren nun schon so viele Jahre darüber hingegangen, daß der kleine Knabe zu einem großen Manne herangewachsen war, ja, zu einem tüchtigen Mann, an dem seine Eltern Freude hatten. Er hatte sich eben verheiratet und war mit seiner kleinen Frau hier in das Haus gezogen, wo der Garten war. Und er stand dort bei ihr, während sie eine Feldblume pflanzte, die sie gar niedlich fand. Sie pflanzte sie mit ihrer kleinen Hand und klopfte die Erde mit den Fingern fest. – Au, was war das? Sie hatte sich gestochen. Da saß etwas Spitzes gerade oben auf der weichen Erde.
Es war – ja denk nur. Es war der Zinnsoldat, er, der bei dem alten Mann da oben fortgekommen war, der inzwischen bei Zimmerholz und Schutt herumgebummelt, sich tüchtig getummelt und zuletzt viele Jahre lang in der Erde gelegen hatte.
Und die junge Frau wischte den Soldaten zuerst mit einem grünen Blatte, dann mit ihrem feinen Taschentuch ab; das hatte einen so lieblichen Duft. Und es war dem Zinnsoldaten, als erwache er aus einer Ohnmacht.
"Laß mich sehen!" sagte der junge Mann, dann lachte er und schüttelte den Kopf. "Ja, er kann es wohl nicht gut sein, aber er erinnert mich an eine Geschichte mit einem Zinnsoldaten, die geschah, als ich noch ein kleiner Knabe war." Und dann erzählte er seiner Frau von dem alten Hause und dem alten Manne und dem Zinnsoldaten, den er ihm hinübergeschickt hatte, weil er so schrecklich allein war. Und er erzählte es ganz genau so, wie es wirklich gewesen war, so daß der jungen Frau Tränen in die Augen stiegen über das alte Haus und den alten Mann.
"Es kann doch sein, daß es derselbe Zinnsoldat ist!" sagte sie. "Ich will ihn aufbewahren und alles behalten, was Du mir erzählt hast. Aber des alten Mannes Grab mußt Du mir zeigen!"
"Ja, das weiß ich nicht," sagte er, "und niemand weiß es. Alle seine Freunde waren tot, niemand kümmerte sich darum, und ich war ja ein kleiner Knabe."
"Wie schrecklich allein muß er gewesen sein." sagte sie.
"Schrecklich allein!" sagte der Zinnsoldat, "aber es ist herrlich, nicht vergessen zu sein."
"Herrlich!" rief etwas dicht daneben; aber niemand außer dem Zinnsoldaten sah, daß es ein Fetzen von dem schweinsledernen Bezuge war. Er war ohne alle Vergoldung und sah aus wie nasse Erde, aber eine Meinung hatte er, und die sprach er aus:
"Vergoldung vergeht, Aber Schweinsleder besteht." Doch das glaubte der Zinnsoldat nicht.
WAS DIE ALTE JOHANNE ERZÄHLTE
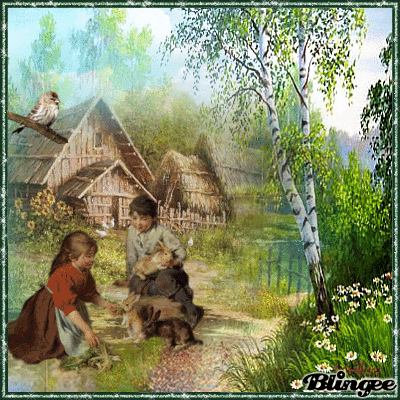
Der Wind saust in dem alten Weidenbaum!
Es ist, als hörte man ein Lied; der Wind singt es, der Baum erzählt es. Verstehst du es nicht, dann frage die alte Johanne im Armenhaus, sie weiß Bescheid, sie ist hier im Dorfe geboren.
Vor vielen Jahren, als die Landstraße noch hier vorüberführte, war der Baum schon groß und bemerkbar. Er stand, wo er noch jetzt steht, vor dem weißen Fachwerkhaus des Schneiders, dicht am Teich, der damals so groß war, daß das Vieh darin getränkt wurde, und wo im heißen Sommer die kleinen Bauernjungen nackt herumliefen und im Wasser plätscherten. Dicht unter dem Baum war ein Meilenzeiger aus gehauenen Steinen aufgestellt; jetzt ist er umgefallen, die Brombeerranken wachsen darüber hin.
Jenseits des reichen Bauernhofes wurde die neue Landstraße angelegt, die alte wurde Feldweg, der Teich eine Pfütze, mit Entenflott überwuchert; plumpste ein Frosch hinein, so trennte sich das Grüne, und man sah das schwarze Wasser; ringsumher wuchsen und wachsen noch heute Rohrkolben, Bitterklee und gelbe Iris.
Das Haus des Schneiders wurde alt und schief, das Dach ein Mistbeet für Moos und Hauslauch; der Taubenschlag war eingestürtzt, und der Star baute da; die Schwalben hängten Nest an Nest unter dem Giebel des Hauses und unter dem Dach auf, als sei hier eine Stätte des Glücks.
Das war es hier auch einmal; jetzt war es einsam und still geworden. Einsam und willensschwach lebte hier drinnen "der dumme Rasmus," wie sie ihn nannten; er war hier geboren, er hatte hier gespielt, war über Feld und Zaun gesprungen, hatte als kleiner Junge im offenen Teich geplätschert und war in den alten Baum hinaufgeklettert.
Der erhob seine großen Zweige mit Pracht und Schönheit, so wie er sie noch jetzt erhebt, aber der Sturm hatte den Stamm schon ein wenig schief gebogen, und die Zeit hatte ihm einen Riß beigebracht; jetzt haben Wind und Wetter Erde in den Riß hineingelegt, es wachsen Gras und Kräuter darin, ja, ein kleiner Vogelbeerbaum hat sich selber da hineingepflanzt.
Wenn im Frühling die Schwalben kamen, flogen sie um den Baum und um das Doch, sie klebten und besserten ihre alten Nester aus, der dumme Rasmus ließ sein Nest stehen oder verfallen, wie es wollte; er besserte es weder aus noch stützte er es. "Was kann das nützen!" war seine Redensart, und das war auch die seines Vaters gewesen.
Er blieb in seinem Heim, die Schwalben flogen fort, aber die kamen wieder, die treuen Tiere. Der Star flog fort, er kam wieder zurück und flötete sein Lied; einmal konnte Rasmus mit ihm um die Wette flöten; jetzt flötete und sang er nicht mehr.
Der Wind sauste in dem alten Weidenbaum, er saust noch, es ist, als hörte man ein Lied; der Wind singt es, der Baum erzählt es; verstehst du es nicht, dann frage die alte Johanne im Armenhaus, sie weiß Bescheid, sie ist klug in alten Geschichten, sie ist wie eine Chronik mit Aufzeichnungen und alten Erinnerungen.
Als das Haus neu und gut war, zog der Dorfschneider Ivar Ölse mit seiner Frau Maren hinein; strebsame, rechtschaffene Leute alle beide. Die alte Johanne war damals ein Kind, sie war die Tochter des Holzschuhmachers, eines der ärmsten Leute im Dorf. Manch ein gutes Butterbrot bekam sie von Maren, in deren Hause kein Mangel an Essen war; die stand sich gut mit der Schloßherrin, immer lachte sie und war froh, sie ließ sich nicht einschüchtern. Sie brauchte ihren Mund, aber auch ihre Hände; sie führte die Nähnadel ebenso schnell wie den Mund und besorgte dabei ihr Haus und ihre Kinder. Es war fast ein Dutzend, volle elf, das zwölfte blieb aus.
"Arme Leute haben immer das Nest voll von Gören!" brummte der Schloßherr. "Könnte man sie wie die kleinen Katzen ersäufen und nur ein oder zwei von den stärksten behalten, so gäbe es nicht so viel Unglück!"
"Gott erbarme sich!" sagte die Schneidersfrau. "Kinder sind doch ein Segen Gottes, sie sind die Freude im Hause. Jedes Kind ist ein Vaterunser mehr. Ist es knapp und hat man viele Münder zu versorgen, so strengt man sich stärker an, findet Rat und Tat in aller Ehrlichkeit, der liebe Gott verläßt uns nicht, wenn wir ihn nicht verlassen."
Die Schloßherrin stimmte ihr bei, nickte freundlich und streichelte Marens Wange, das hatte sie oft getan, ja, sie hatte sie auch geküßt, aber da war die gnädige Frau noch ein kleines Kind und Maren ihr Kindermädchen. Sie liebten einander, und diese Gesinnung veränderte sich nicht.
Jedes Jahr, zur Weihnachtszeit, kam vom Schloß Wintervorrat für das Haus des Schneiders: eine Tonne Mehl, ein Schwein, zwei Gänse, eine Vierteltonne Butter, Käse und Äpfel. Das half der Speisekammer auf. Ivar Ölse sah denn auch recht vergnügt aus, kam aber doch bald wieder mit seiner alten Redensart: "Was kann das nützen!"
Rein und nett war es dort im Hause, Gardinen vor den Fenstern und Blumen auf den Fensterbrettern, Nelken und Balsaminen. Ein Namentuch prangte im Bilderrahmen, und dicht daneben hing ein Gedicht, das Maren Ölse selber gedichtet hatte; sie wußte die Reime zu fügen. Sie war stolz auf den Familiennamen Ölse. Immer bewahrte sie ihre gute Laune, niemals sagte sie wie der Mann: "Was kann das nützen!" Ihre Redensart war: "Halte auf dich und halte dich am Herrn!" Das tat sie, und das hielt das Ganze zusammen. Die Kinder gediehen gut und wuchsen über das Nest hinaus, kamen weit umher und schickten sich gut. Rasmus war der kleinste; er war ein so hübsches Kind, daß einer der großen Bildermaler in der Stadt ihn sich lieh, um ihn zu malen, und zwar so nackt, wie ihn der liebe Gott erschaffen hatte. Das Bild hing jetzt im königlichen Schloß, da hatte die Schloßherrin es gesehen und den kleinen Rasmus erkannt, obwohl er keine Kleider anhatte.
Aber nun kamen schwere Zeiten. Der Schneider bekam Gicht in beiden Händen, es setzten sich große Knoten, kein Doktor konnte helfen, nicht einmal die kluge Stine, die "dokterte."
"Man muß nur nicht verzagen!" sagte Maren. "Es hilft nicht, den Kopf hängen zu lassen! Nun kann der Vater die Hände nicht mehr gebrauchen, da muß ich sehen, daß ich meine um so flinker gebrauche. Der kleine Rasmus kann auch die Nadel führen!"
Es saß schon auf dem Tisch, pfiff und sang, er war ein lustiger Junge.
Den ganzen Tag solle er nicht dasitzen, sagte die Mutter, das sei Unrecht gegen das Kind; spielen und springen sollte er auch.
Holzschuhmachers Johanne war sein bester Spielkamerad; sie hatte noch ärmere Eltern als Rasmus. Schön war sie nicht, barfüßig ging sie; die Kleider hingen ihr in Lumpen vom Leibe, sie hatte niemand, der sie ihr hätte ausbessern können, und es selber zu tun, fiel ihr nicht ein; sie war ein Kind und froh wie ein Vogel in des lieben Gottes Sonnenschein.
Am Meilenzeiger unter dem großen Weidenbaum spielten Rasmus und Johanne.
Er hatte hochfliegende Gedanken; er wollte einmal ein feiner Schneider werden und in der Stadt wohnen, wo Meister waren, die zehn Gesellen auf dem Tisch sitzen hatten, das hatte er von seinem Vater gehört; dort wollte er Geselle werden, und dort wollte er Meister werden, und dann sollte Johanne kommen und ihn besuchen, und wenn sie dann zu kochen verstand, sollte sie das Essen für sie alle machen und ihre eigene Stube haben.
Johanne wagte nicht recht daran zu glauben, aber Rasmus glaubte, daß es wohl geschehen würde.
Dann saßen sie unter dem alten Baum, und der Wind sauste in den Blättern und Zweigen, es war, als wenn der Wind sang und der Baum erzählte.
Im Herbst fielen alle Blätter vom Baum, der Regen tropfte von den kahlen Zweigen.
"Sie schlagen wieder aus!" sagte Mutter Ölse.
"Was kann das nützen!" sagte der Mann. "Ein neues Jahr, neue Sorgen fürs Auskommen!"
"Die Speisekammer ist gefüllt!" sagte die Frau. "Dafür können wir unserer guten gnädigen Frau danken. Ich bin gesund und habe gute Kräfte. Es wäre unrecht von uns, wenn wir klagen wollten!"
Während der Weihnachtszeit blieben der Schloßherr und seine Frau in ihrem Schloß auf dem Lande, aber in der Woche nach Neujahr zogen sie in die Stadt, wo sie ihren Winter in Freude und Lustbarkeit verbrachten. Sie gingen auf Bälle und zu Festlichkeiten beim König selber.
Die gnädige Frau hatte zwei herrliche Kleider aus Frankreich bekommen; sie waren aus einem solchen Stoff, von einem solchen Schnitt und einer solchen Machart, daß die Schneiderfrau Maren noch nie eine solche Herrlichkeit gesehen hatte. Sie bat sich denn auch bei der gnädigen Frau aus, daß sie mit ihrem Mann auf das Schloß kommen dürfe, so daß auch er die Kleider sehen könnte. So etwas hätte der Dorfschneider noch nie gesehen, sagte sie.
Er sah sie und hatte kein Wort dafür, bis er nach Hause kam, und was er dann sagte, war nur, was er immer sagte: "Was kann das nützen!" und diesmal wurden seine Worte Wahrheit.
Die Herrschaft kam in die Stadt, Bälle und Lustbarkeiten begannen da drinnen, aber während all dieser Herrlichkeit starb der alte Schloßherr und die Frau kam gar nicht in ihre kostbaren Kleider. Sie war so betrübt und von Kopf bis zu den Füßen in schwarze, dichte Trauerkleidung gehüllt; nicht einmal ein weißer Streifen war zu sehen; alle Dienstboten waren in Schwarz, selbst die Staatskutsche wurde mit schwarzem, feinem Tuch überzogen.
Es war eine eiskalte Frostnacht, der Schnee leuchtete, die Sterne blitzten; der schwere Leichenwagen kam mit der Leiche aus der Stadt nach der Schloßkirche, wo sie in dem Erbbegräbnis der Familie beigesetzt werden sollte. Der Verwalter und der Dorfschulze hielten zu Pferde und mit Fackeln vor der Kirchhofspforte. Die Kirche war erleuchtet, und der Pfarrer stand in der öffnen Kirchentür und nahm die Leiche in Empfang. Der Sarg wurde in den Chor hinaufgetragen, die ganze Gemeinde folgte. Der Pfarrer redete, ein Gesang wurde gesungen; die gnädige Frau war auch in der Kirche, sie war in der schwarzüberzogenen Staatskutsche dahin gefahren, die war inwendig schwarz und auswendig schwarz; so etwas war noch nie im Dorfe gesehen worden.
Von all diesen Trauerfeierlichkeiten wurde den ganzen Winter hindurch geredet, ja, das war ein "herrschaftliches Begräbnis."
"Da sah man, was der Mann bedeutete!" sagten die Leute im Dorf. "Er war hochadelig geboren, und er wurde hochadelig begraben!"
"Was kann das nützen!" sagte der Schneider. "Jetzt hat er weder Leben noch Güter. Wir haben doch wenigstens einen Teil davon!"
"Rede doch nicht solche Worte!" sagte Maren. "Er hat das ewige Leben im Himmelreich!"
"Wer hat dir das gesagt; Maren?" fragte der Schneider. "Ein toter Mann ist guter Dünger! Aber der Mann hier war gewiß selber zu vornehm, um in der Erde Nutzen zu schaffen. Er soll in der Grabkapelle liegen!"
"Rede doch nicht so gottlos!" sagte Maren. "Ich sage es dir nochmals: er hat das ewige Leben!"
"Wer hat dir das gesagt, Maren?" wiederholte der Schneider.
Und Maren warf ihre Schürze über den kleinen Rasmus; er sollte solche Reden nicht hören.
Sie trug ihn hinüber in den Torfschuppen und weinte.
"Das, was du vorhin gehört hast, lieber Rasmus, das waren nicht deines Vaters Worte, die sagte der Böse, der durch die Stube ging und die Stimme deines Vaters annahm. Bete ein Vaterunser! Wir wollen beide beten!" Sie faltete die Hände des Kindes.
"Jetzt bin ich wieder froh!" sagte sie. "Halte auf dich und halte fest an dem lieben Gott!"
Das Trauerjahr war zu Ende, die Witwe ging in Halbtrauer. Im Herzen trug sie volle Freude.
Es wurde davon geflüstert, daß sie einen Bewerber habe und schon an Hochzeit denke. Maren wußte etwas davon, und der Pfarrer wußte noch ein wenig mehr.
Am Palmsonntag, nach der Predigt, sollten die Witwe und ihr Verlobter aufgeboten werden. Er war Holzschnitzer oder Bildhauer, den Namen seiner Beschäftigung wußte man nicht so recht, damals waren Thorwaldsen und seine Kunst noch nicht recht im Volksmund. Der neue Schloßherr war nicht hochadelig, aber doch ein sehr stattlicher Herr; er war etwas, was niemand verstand, sagten sie, er haute Bilder aus, war tüchtig in seinem Beruf, jung und schön.
"Was kann das nützen!" sagte Schneider Ölse.
Am Palmsonntag wurde das Aufgebot von der Kanzel verlesen; dann folgten Gesang und Abendmahl. Der Schneider, seine Frau und der kleine Rasmus waren in der Kirche. Die Eltern gingen zum Abendmahl, Rasmus saß im Kirchenstuhl, er war noch nicht konfirmiert. Es hatte in der letzten Zeit in dem Haus des Schneiders an Kleidern gefehlt; die alten, die sie hatten, waren wieder und wieder gewendet, genäht und geflickt; nun waren sie alle drei in neuen Kleidern, aber es war schwarzes Zeug, wie zu einem Begräbnis, die waren in den Überzug der Trauerkutsche gekleidet. Der Mann hatte Rock und Hose davon bekommen, Maren ein hochhalsiges Kleid und Rasmus einen ganzen Anzug, in den er zur Konfirmation hineinwachsen konnte. Man hatte das auswendige wie auch das inwendige Zeug von der Trauerkutsche genommen. Niemand brauchte zu wissen, wozu es früher gebraucht worden war, aber die Leute bekamen es doch bald zu wissen, die kluge Frau Stine und ein paar andere ebenso kluge Frauen, die freilich nicht von ihrer Klugheit lebten, sagten, daß die Kleider Unglück und Krankheit ins Haus bringen würden. "Man darf sich nicht in eine Leichenkutsche kleiden, außer wenn man zu Grabe fährt.
Holzschuhmachers Johanne weinte, als sie das hörte, und da es sich nun so traf, daß der Schneider seit jenem Tage mehr und mehr kränkelte, so würde es sich wohl zeigen, wer daran glauben müsse.
Und es zeigte sich.
Am ersten Sonntag nach Trinitatis starb Schneider Ölse. Nun mußte Maren das Ganze allein zusammenhalten; sie hielt es zusammen, sie hielt auf sich selber, und sie hielt sich am Herrn.
Das Jahr darauf wurde Rasmus eingesegnet; nun sollte er zur Stadt, zu einem großen Schneider, freilich nicht mit zwölf Gesellen auf dem Tisch, sondern mit einem; der kleine Rasmus konnte für einen halben gerechnet werden; froh sah er aus, aber Johanne weinte, sie liebte ihn mehr, als sie es selber wußte. Die Frau des Schneiders blieb in dem alten Haus und setzte die Profession fort.
Um die Zeit war es, daß die neue Landstraße eröffnet wurde, und die alte, die an dem Weidenbaum und an dem Hause des Schneiders vorüberführte, wurde Feldweg, der Teich wuchs zu. Entenflott legte sich über die Wasserpfütze, die zurückgeblieben war, der Meilenzeiger fiel um, er hatte keinen Zweck mehr, aber der Baum hielt sich kräftig und schön, der Wind sauste in Zweigen und Blättern.
Die Schwalben flogen fort, der Star flog fort, aber sie kamen im Frühling wieder, und als sie nun zum viertenmal zurückkehrten, kam auch Rasmus nach Hause. Er hatte sein Gesellenstück gemacht, war ein schöner Bursche, freilich ein wenig schmächtig. Jetzt wollte er seinen Ranzen schnüren, fremde Länder sehen; danach stand sein Sinn. Aber die Mutter hielt ihn zurück; daheim war es doch am besten! Alle die anderen Kinder waren ringsumher verstreut, er war der jüngste, er sollte das Haus haben. Arbeit könne er genug bekommen in der Gegend als reisender Schneider, vierzehn Tage auf dem einen Hof, vierzehn Tage auf dem anderen. Das war auch Reisen. Und Rasmus fügte sich seiner Mutter.
So schlief er wieder unter dem Dach seines Elternhauses, saß wieder unter dem alten Weidenbaum und hörte ihn sausen.
Gut sah er aus, pfeifen konnte er und neue und alte Lieder singen. Gern gesehen war er auf den großen Höfen, namentlich bei Klaus Hansen, dem zweitreichsten Bauer in der Gemeinde.
Die Tochter Else war wie die schönste Blume anzusehen, und sie lachte immer; es gab ja Leute, die schlimm genug waren, zu sagen, sie lache nur, um ihre schönen Zähne zu zeigen. Zum Lachen aufgelegt war sie und immer bereit, Narrenpossen zu treiben; alles kleidete sie.
Sie verliebte sich in Rasmus, und er verliebte sich in sie, aber niemand von ihnen sagte es mit klaren Worten.
Und dann ging er hin und wurde schwermütig; er hatte mehr von dem Sinn seines Vaters als von dem seiner Mutter. Guter Laune war er nur, wenn Else kam, dann lachten sie alle beide, scherzten und trieben Narrenpossen; aber obwohl Gelegenheit genug da war, sagte er doch nicht ein einziges heimliches Wort über seine Liebe. "Was kann das nützen!" war sein Gedanke. "Die Eltern sehen auf Wohlstand für sie, und den habe ich nicht; am klügsten ist es, wegzureisen!" Aber er konnte sich nicht von dem Hofe trennen, es war, als halte ihn Else an Fäden fest, er war in ihren Händen wie ein abgerichteter Vogel, er sang und pfiff nach ihrem Belieben und nach ihrem Willen.
Johanne, die Tochter des Holzschuhmachers, war Dienstmagd auf dem Hof, bei der geringsten Arbeit angestellt. Sie fuhr den Milchwagen aufs Feld, wo sie mit den andern Mägden die Kühe molk, ja, Dünger mußte sie auch fahren, wenn es nötig war. Sie kam nicht in die beste Stube hinein, und sie sah nicht viel von Rasmus und Else, aber doch hörte sie, daß die beiden so gut wie verlobt seien.
"Dann kommt Rasmus in Wohlstand!" sagte sie. "Das kann ich ihm gönnen!" Und ihre Augen wurden ganz feucht, aber das war doch kein Grund zum Weinen.
Es war Markt in der Stadt; Klaus Hansen fuhr dahin, und Rasmus war mit dabei, er saß neben Else. Er war ganz berauscht vor Liebe, aber davon sagte er kein Wort zu ihr.
"Er muß mir doch etwas davon sagen!" meinte das Mädchen, und darin hatte sie recht. "Wenn er nicht reden will, dann will ich ihn aufschrecken!"
Und bald sprach man auf dem Hofe davon, daß der reichste Hofbesitzer im Kirchspiel um Else gefreit habe, und das hatte er auch getan, aber niemand wußte, welche Antwort sie ihm gegeben hatte.
Die Gedanken schwirrten Rasmus im Kopfe herum.
Eines Abend steckte Else einen goldenen Ring an den Finger und fragte Rasmus dann, was er glaube, daß das zu bedeuten habe.
"Verlobung!" sagte er.
"Und mit wem, glaubst du?" fragte sie.
"Mit dem reichen Hofbesitzer!" sagte er.
"Das hast du getroffen!" sagte sie, nickte und schlüpfte davon.
Aber er schlich auch davon, kam heim in das Haus seiner Mutter wie ein verwirrter Mensch und schnürte seinen Ranzen. In die weite Welt hinaus wollte er; es half nichts, daß die Mutter weinte.
Er schnitt sich einen Stecken von dem alten Weidenbaume, er pfiff, als sei er guter Laune, er wollte hinaus, um die Herrlichkeit der ganzen Welt zu sehen.
"Das ist ein großer Kummer für mich!" sagte die Mutter. "Aber für dich ist es wohl am besten und am richtigsten, daß du fortkommst, dann muß ich mich dareinschicken. Halte auf dich, und halte dich am Herrn, dann bekomme ich dich froh und vergnügt wieder."
Er ging die neue Landstraße entlang, da sah er Johanne, die mit einem Fuder Dünger gefahren kam, sie hatte ihn nicht bemerkt, und er wollte nicht von ihr gesehen werden; er setzte sich hinter den Grabenzaun, da saß er gut verborgen - und Johanne fuhr vorüber.
In die Welt hinaus ging er. Niemand wußte wohin, seine Mutter dachte, er kommt wohl wieder nach Hause, ehe das Jahr um ist; nun bekommt er Neues zu sehen, Neues zu denken und kommt dann wieder in die alten Falten hinein, die sich nicht mit einem Bügeleisen auspressen lassen. Er hat ein wenig zuviel von dem Sinn seines Vaters, ich sähe es lieber, wenn er meinen Sinn hätte, das arme Kind! Aber er kommt wohl heim, er kann ohne mich und das Haus nicht leben.
Die Muter wollte Jahr und Tag warten. Else wartete nur einen Monat, dann ging sie heimlich zu der klugen Frau Stine Madsdatter, die '"doktern" konnte und aus Karten und Kaffee wahrsagen und mehr wußte als ihr "Vaterunser." Sie wußte denn auch, wo Rasmus war. Das las sie aus dem Kaffeesatz. Er war in einer fremden Stadt, aber den Namen konnte sie nicht lesen. In der Stadt waren Soldaten und hübsche Mädchen. Seine Gedanken waren darauf gerichtet, die Flinte oder eins von den Mädchen zu nehmen.
Else konnte es nicht ertragen, das zu hören. Sie wollte gern ihr Spargeld geben, um ihn freizukaufen, aber niemand durfte es wissen.
Und die alte Stine versprach, daß er zurückkommen solle. Sie verstand sich auf eine Kunst, auf eine gefährliche Kunst für den, dem sie galt, aber das war das äußerste Mittel. Sie wollte den Kessel aufsetzen, um nach ihm zu kochen, und dann mußte er fort, wo in der Welt er auch war, er mußte heim, dahin, wo der Kessel und die Liebste ihn erwarteten; es konnten Monate darüber hingehen, ehe er kam, aber kommen mußte er, wenn er noch am Leben war.
Ohne Ruhe und Rast, Tag und Nacht mußte er wandern, über See und Berg, mochte das Wetter mild oder rauh sein, mochten die Füße noch so müde werden. Heim sollte er, heim mußte er.
Der Mond war im ersten Viertel, das sei nötig für die Kunst, sagte die alte Stine. Es war stürmisches Wetter, es krachte in dem alten Weidenbaume; Stine schnitt einen Zweig ab, band einen Knoten hinein, das sollte schon helfen, Rasmus nach dem Hause seiner Mutter zurückzuziehen. Moos und Hauslauch wurden vom Dach genommen und in den Kessel getan, der auf das Feuer gesetzt wurde. Else sollte ein Blatt aus dem Gesangbuch reißen, sie riß zufällig das letzte Blatt heraus, das mit den Druckfehlern. "Das ist ganz egal!" sagte Stine und warf es in den Kessel.
Alles mögliche mußte in die Grütze hinein, die kochen und immer kochen mußte, bis Rasmus nach Hause kam. Der schwarze Hahn in der Stube bei der alten Stine mußte seinen roten Kamm hergeben, der kam in den Kessel. Elses dicker, goldener Ring kam auch hinein, und den würde sie nie wieder zu sehen bekommen, das sagte ihr Stine im voraus. Sie war so klug, Stine. Mancherlei, was wir nicht nennen können, kam in den Kessel hinein; er stand beständig auf dem Feuer oder auf glühenden Kohlen oder heißer Asche. Nur sie und Else wußten es.
Der Mond nahm zu, der Mond nahm ab; jedesmal kam Else und fragte: "Siehst du ihn nicht kommen?"
"Vieles weiß ich," sagte Stine, "und vieles sehe ich, aber die Weglänge, die er zu gehen hat, kann ich nicht sehen. Nun ist er über die ersten Berge! Nun ist er auf der See bei bösem Wetter! Der Weg ist lang, durch große Wälder, er hat Blasen an den Füßen, er hat Fieber im Kopf, aber weiter muß er."
"Nein, nein!" sagte Else. "Es tut mir so leid!"
"Jetzt kann er nicht zurückgehalten werden, denn wenn wir das tun, so stürzt er tot auf der Landstraße um!"
Jahr und Tag sind vergangen. Der Mond schien rund und groß, der Wind sauste in dem alten Baum, am Himmel zeigte sich ein Regenbogen im Mondschein.
"Das ist das Zeichen der Bestätigung!" sagte Stine. "Nun kommt Rasmus."
Aber er kam doch nicht.
"Die Wartezeit ist lang!" sagte Stine.
"Jetzt habe ich es satt!" sagte Else. Sie kam seltener zu Stine, brachte ihr keine neuen Geschenke.
Ihr Sinn wurde leichter, und eines schönen Morgens wußten sie alle im Dorfe, daß Else dem reichsten Hofbesitzer ihr Wort gegeben hatte.
Sie fuhr hinüber, um Hof und Acker, Vieh und Hausgerät anzusehen. Alles war in gutem Stande, da war kein Grund, mit der Hochzeit zu warten.
Sie ward mit einem großen Gastmahl, das drei Tage währte, gefeiert. Da wurde zu Klarinetten und Violinen getanzt. Niemand im Dorfe war bei der Einladung vergessen. Mutter Ölse war auch da, und als das Fest zu Ende war und die Schaffner den Gästen gedankt hatten und die Trompeten abgeblasen hatten, ging sie nach Hause mit den Resten von der Festmahlzeit.
Sie hatte die Tür nur mit einem Pflocke geschlossen, der war herausgenommen, die Tür stand offen, und in der Stube saß Rasmus. Er war heimgekehrt; in dieser Stunde gekommen. Herrgott, wie sah er aus! Nichts als Haut und Knochen, bleich und gelb war er.
"Rasmus!" sagte die Mutter. "Bist du es, den ich da sehe! - Wie siehst du elend aus! Aber ich freue mich von ganzem Herzen, daß ich dich wiederhabe!"
Und sie gab ihm von den guten Speisen, die sie vom Gastmahl heimgebracht hatte, ein Stück vom Braten und von der Hochzeitstorte.
Er habe in der letzten Zeit, sagte er, soviel an seine Mutter, seine Heimat und den alten Weidenbaum gedacht. Es war sonderbar, wie oft er in seinen Träumen den Baum und die barfüßige Johanne gesehen habe.
Else erwähnte er nicht. Krank war er und zu Bett mußte er; aber wir glauben nicht, daß der Kessel schuld daran war oder daß er seine Macht über ihn ausgeübt hatte. Nur die alte Stine und Else glaubten es, aber sie sprachen nicht davon.
Rasmus lag in heftigem Fieber, ansteckend war es, niemand kam daher in das Haus des Schneiders außer Johanne, des Holzschuhmachers Tochter. Sie weinte, als sie sah, wie elend Rasmus war.
Der Doktor verschrieb ihm etwas von der Apotheke; er wollte keine Medizin nehmen. "Was kann das nützen!" sagte er.
"Ja, dann wirst du wieder besser!" sagte die Mutter. "Halte auf dich, und halte dich am Herrn! Könnte ich doch nur sehen, daß du wieder Fleisch auf den Knochen hast, könnte ich dich doch wieder flöten und singen hören, dann wollte ich gern mein Leben lassen!"
Und Rasmus genas von der Krankheit, aber seine Mutter bekam sie. Der liebe Gott rief sie zu sich und nicht ihn.
Einsam war es dort im Hause, und noch ärmer wurde es da drinnen. "Er ist verbraucht!" sagten sie im Dorfe. "Der dumme Rasmus!"
Ein wildes Leben hatte er auf seinen Reisen geführt, das und nicht der Kessel, der kochte, hatte sein Mark ausgesogen und ihm die Unruhe in den Körper gebracht. Das Haar wurde dünn und grau; etwas Ordentliches tun mochte er nicht. "Was kann das nützen!" sagte er. Er ging lieber in den Krug als in die Kirche.
An einem Herbstabend kam er, in Regen und Wind, beschwerlich den schmutzigen Weg vom Kruge nach seinem Hause gegangen. Seine Mutter war lange fort, in ihr Grab gelegt. Die Schwalben und der Star waren auch fort, die treuen Tiere. Johanne, die Tochter des Holzschuhmachers, war nicht fort; sie holte ihn auf dem Wege ein, sie begleitete ihn eine Strecke.
"Nimm dich zusammen, Rasmus!"
"Was kann das nützen!" sagte er.
"Das ist eine dumme Redensart, die du da hast!" sagte sie. "Denke an die Worte deiner Mutter: 'Halte auf dich, und halte dich am Herrn!' Das tust du nicht, Rasmus! Das muß man und soll man tun. Sage niemals: 'Was kann das nützen', dann reißt du all dein Tun mit der Wurzel aus!"
Sie begleitete ihn bis an seine Haustür, da ging sie von ihm. Er blieb nicht im Hause. Er ging nach dem alten Weidenbaum, setzte sich auf einen Stein des umgestürzten Meilenzeigers.
Der Wind sauste in den Zweigen des Baumes; es war wie eine Rede. Rasmus antwortete darauf, er sprach laut, aber niemand hörte es, nur der Baum und der sausende Wind.
"Mich überfällt eine solche Kälte! Es ist wohl Zeit, zu Bett zu gehen! Schlafen! Schlafen!"
Und er ging aber nicht nach Hause, an den Teich hinab ging er; dort schwankte er und fiel. Der Regen strömte herab, der Wind war so eisig kalt, er fühlte es nicht; aber als die Sonne aufging und die Krähen über das Röhricht des Teiches flogen, erwachte er, halbtot. Hätte er seinen Kopf dahin gelegt, wo seine Füße lagen, dann hätte er sich nie wieder erhoben, das grüne Entenflott wäre sein Leichentuch geworden.
Als der Tag vorüber war, kam Johanne nach dem Hause des Schneiders. Sie war seine Hilfe, sie brachte ihn ins Krankenhaus.
"Wir haben einander von klein auf gekannt," sagte sie. "Deine Mutter hat mir Bier und Essen gegeben, das kann ich ihr nie vergelten. Du wirst wieder gesund werden, du wirst ein Mensch werden und leben."
Und der liebe Gott wollte, daß er leben sollte. Aber auf und ab ging es mit Gesundheit und Stimmung.
Die Schwalben und der Star kamen und flogen wieder fort. Rasmus war alt vor den Jahren. Einsam saß er im Hause, das mehr und mehr verfiel. Arm war er, ärmer jetzt als Johanne.
"Du hast keinen Glauben!" sagte sie, "und wenn wir den lieben Gott nicht haben, was haben wir dann! - Du solltest zum Abendmahl gehen!" sagte sie. "Du bist seit deiner Einsegnung nicht dagewesen!"
"Ja, was kann das nützen!" sagte er.
"Wenn du das sagst und glaubst, dann laß es nur sein! Unwillige Gäste will der Herr nicht an seinem Tische haben. Denke doch an deine Mutter und an deine Kindheit! Du warst einmal ein guter, frommer Junge. Soll ich dir einen Gesang vorlesen?"
"Was kann das nützen!" sagte er.
"Mich tröstet es immer!" antwortete sie.
"Johanne, du bist wohl unter die Frommen gegangen?" Er sah sie mit matten, müden Augen an.
Und Johanne betete den Gesang, aber nicht aus einem Buch, sie hatte keins, sie wußte ihn auswendig.
"Das waren schöne Worte," sagte er; "aber ich konnte nicht ganz folgen. Mir ist der Kopf so schwer!"
Rasmus war ein alter Mann geworden; aber Else war auch nicht mehr jung, wenn wir von ihr reden sollen; Rasmus redete nie von ihr. Sie war Großmutter; ein kleines, geschwätziges Mädchen war ihre Enkelin; die Kleine spielte mit den anderen Kindern im Dorfe. Rasmus kam, auf seinen Stock gestützt; er stand still, sah dem Spiel der Kinder zu, lächelte ihnen zu, alte Zeiten schimmerten in seine Gedanken hinein. Elses Enkelin zeigte auf ihn. "Dummer Rasmus!" rief sie; die anderen kleinen Mädchen folgten ihrem Bespiel. "Dummer Rasmus!" riefen sie und verfolgten den alten Mann mit Geschrei.
Das war ein grauer, schwerer Tag und dem folgten mehrere solcher Tage; aber nach grauen und schweren Tagen kommt auch wieder ein sonniger Tag.
Es war ein schöner Pfingstmorgen; die Kirche war mit grünen Birkenzweigen geschmückt; es war ein Duft wie im Walde drinnen, und die Sonne schien über die Kirchenstühle hin. Die großen Altarkerzen waren angezündet; es war Abendmahl. Johanne war zwischen den Knienden, aber Rasmus war nicht unter ihnen. Gerade an dem Morgen hatte der liebe Gott ihn zu sich gerufen.
Bei Gott ist Gnade und Barmherzigkeit.
Viele Jahre sind seitdem vergangen; das Haus des Schneiders steht noch da, aber niemand wohnt dort; der erste Nachtsturm kann es umwerfen. Der Teich ist mit Schilf und Bitterklee überwuchert. Der Wind saust in dem alten Baum, es ist, als hörte man ein Lied; der Wind singt es, der Baum erzählt es; verstehst du es nicht, dann frage die alte Johanne im Armenhaus.
Sie lebt dort, sie singt ihren Gesang, denselben, den sie Rasmus vorgesungen hat; sie denkt an ihn, sie betet zu dem lieben Gott für ihn, die treue Seele. Sie kann erzählen von der Zeit, die verging, und von den Erinnerungen, die in dem alten Baum sausen.
DIE SCHÖNSTE ROSE DER WELT
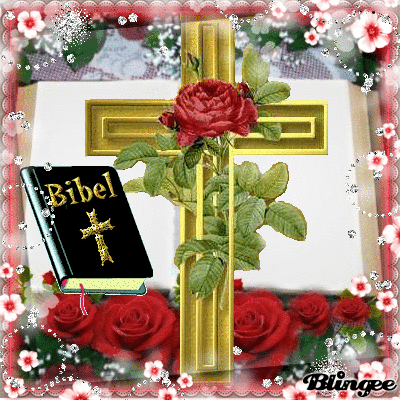
Es war eine mächtige Königin, in deren Garten befanden sich die schönsten Blumen jeder Jahreszeit und aus allen Ländern der Welt; aber die Rosen liebte sie besonders, und deshalb hatte sie von diesen die verschiedensten Arten, von der wilden Heckenrose mit den nach Äpfeln duftenden grünen Blättern bis zur schönsten Rose aus Frankreichs Provence. Und sie wuchsen an den Mauern des Schlosses hinauf, rankten sich um Säulen und Fensterrahmen, in die Gänge hinein und an den Decken der Säle entlang, und jede gab ihr Bestes in Duft, Form und Farbe.
Aber Trauer und Trübsal wohnten drinnen. Die Königin lag auf dem Sterbelager und die Ärzte verkündeten, daß sie sterben müsse.
"Eine Rettung gibt es noch für sie" sagte der Weiseste unter ihnen. "Bringt ihr die schönste Rose der Welt, die Rose, die das Sinnbild der höchsten und reinsten Liebe ist; kommt ihr diese vor die Augen, ehe sie brechen, so stirbt sie nicht."
Und Jung und Alt kamen von weit und breit mit Rosen, den herrlichsten, die in jedem Garten wuchsen; aber diese Rosen waren es nicht. Aus dem Garten der Liebe mußte die Blume geholt werden. Aber welche von den Rosen dort mochte der Ausdruck der höchsten, der reinsten Liebe sein?
Und die Skalden sangen von der schönsten Rose der Welt, jeder sang von der seinigen. Und es erging Botschaft weit im Lande umher an jedes Herz, das in Liebe schlug, Botschaft an jeden Stand und jedes Alter.
"Noch hat niemand die Blume genannt!" sagte der Weise. "Niemand hat den Ort gewiesen, wo ihre Schönheit entsprang. Nicht sind es die Rosen von Romeos und Julias Sarg oder von Walborgs Grabe, ob sie auch immer durch Sage und Lied duften werden: es sind nicht die Rosen, die aus Winkelrieds blutigen Lanzen hervorsprießen, aus dem Blute, das heilig der Brust des Helden entströmt beim Tode fürs Vaterland, obgleich kein Tod süßer, keine Rose röter ist als das Blut, was da geflossen ist. Auch jene Wunderblume ist es nicht, für deren Pflege der Mann im Jahr und Tag, in langen schlaflosen Nächten, in einsamer Stube, sein frisches Leben hingibt, der Wissenschaft magische Rose."
"Ich weiß, wo sie blüht" sagte eine glückselige Mutter, die mit ihrem kleinen Kinde an das Lager der Königin trat. "Ich weiß, wo man die schönste Rose der Welt finden kann, die Rose, die das Sinnbild der höchsten und reinsten Liebe ist. Sie blüht auf den rosigen Wangen meines süßen Kindes, wenn es, vom Schlafe gestärkt, die Augen aufschlägt und mich mit all seiner Liebe anlacht!"
"Lieblich ist diese Rose, aber es gibt eine schönere" sagte der Weise.
"Ja, eine weit schönere" sagte eine der Frauen. "Ich habe sie erblickt; eine erhabenere, eine heiligere Rose blüht nirgends, aber sie war bleich, wie die Blütenblätter der Teerose; auf den Wangen der Königin sah ich sie. Sie hatte ihre königliche Krone abgetan und trug selbst in langer, sorgenvoller Nacht ihr krankes Kind in den Armen, weinte darum, küßte es und flehte darum zu Gott, wie nur eine Mutter betet in der Stunde der Angst"
"Heilig und wunderbar in ihrer Macht ist der Sorge weiße Rose, aber auch sie ist es nicht."
"Nein, die schönste Rose der Welt sah ich am Altar des Herrn" sagte der gute, alte Bischof. "Ich sah sie leuchten; wie eines Engels Antlitz zeigte sie sich. Die jungen Mädchen gingen zum Tische des Herrn, um den Bund der Taufe zu erneuen, und es erblühten und erbleichten Rosen auf ihren frischen Wangen. Ein junges Mädchen stand dort; sie schaute mit der vollen Reinheit und Liebe ihrer ganzen Seele zu ihrem Gott auf; das war der Ausdruck der reinsten und höchsten Liebe."
"Gesegnet sei sie!" sagte der Weise, "doch noch immer hat keiner von Euch die schönste Rose der Welt genannt."
Da trat in die Stube ein Kind, der Königin kleiner Sohn. Die Tränen standen in seinen Augen und auf seinen Wangen; er trug ein großes, aufgeschlagenes Buch, in Samt gebunden und mit Silber beschlagen.
"Mutter" sagte der Kleine, "O, hör doch, was ich gelesen habe." Und das Kind setzte sich an das Bett und las aus dem Buche vor von dem, der sich selbst am Kreuze geopfert hatte, um die Menschheit, selbst die noch ungeborenen Geschlechter, zu erlösen. "Größere Liebe gibt es nicht."
Da ging ein Rosenschein über die Wangen der Königin, ihre Augen wurden groß, so klar, denn sie sah aus den Blättern des Buches die schönste Rose der Welt emporwachsen, sie, die aus Christi Blut am Kreuzesstamme hervorsproß.
"Ich sehe sie" sagte sie. "Niemals stirbt, wer diese Rose sah, die schönste auf Erden."
EINE ROSE VON HOMERS GRAB
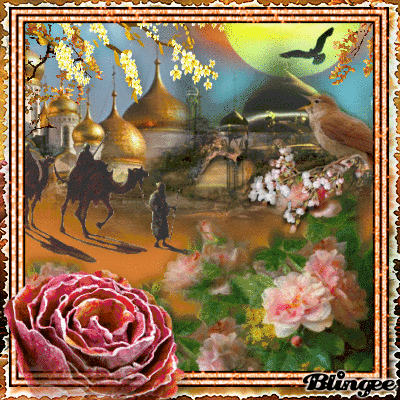
In allen Liedern des Orients erklingt die Liebe der Nachtigall zu der Rose. In den schweigenden, sternklaren Nächten bringt der geflügelte Sänger seiner duftenden Blume eine Serenade dar.
Nicht weit von Smyrna, unter den hohen Platanen, wo der Kaufmann seine belasteten Kamele treibt, die stolz ihre langen Hälse erheben und schwerfällig über eine Erde stampfen, die heilig ist, sah ich eine blühende Rosenhecke. Wilde Tauben flogen zwischen den Zweigen der hochstämmigen Bäume, und die Flügel der Tauben glänzten, wenn ein Sonnenstrahl darüber hinglitt, als seien sie aus Perlmutter gemacht.
In der Rosenhecke war eine Blüte von allen die schönste, und für sie sang die Nachtigall von ihrem Liebesschmerz, aber die Rose war stumm, nicht ein Tautropfen lag, wie eine Träne des Mitleidens, auf ihren Blättern, sie neigte sich auf ihrem Zweige über einige große Steine.
"Hier ruht der Erde größter Sänger!" sagte die Rose, "über seinem Grabe will ich duften, meine Blätter will ich darauf verstreuen, wenn der Sturm sie mir abstreift. Der Ilias' Sänger ward zu Erde in dieser Erde, aus der ich sprieße! – Ich, eine Rose von Homers Grab, bin zu heilig, um für eine armselige Nachtigall zu blühen!"
Und die Nachtigall sang sich zu Tode!
Der Kameltreiber kam mit seinen beladenen Kamelen und seinen schwarzen Sklaven. Sein kleiner Sohn fand den toten Vogel und beerdigte ihn in des großen Homers Grab; und die Rosen bebten im Winde. Der Abend kam. Die Rose faltete ihre Blätter dichter zusammen und träumte,– sie träumte, es wäre ein herrlicher Sonnentag. Eine Schar fremder fränkischer Männer kam her, sie hatten eine Pilgerreise zu Homers Grab gemacht. Unter den Fremden war ein Sänger aus dem Norden, aus der Heimat der Nebel und Nordlichter. Er brach die Rose, preßte sie in einem Buche und nahm sie so mit sich nach einem anderen Weltteil hinüber, mit nach seinem fernen Vaterland. Und die Rose welkte vor Kummer und lag in dem engen Buche, das er in seinem Heim öffnete, und er sagte: "Hier ist eine Rose von Homers Grab."
Sieh, das träumte die Blume und sie erwachte und zitterte im Windel Ein Tautropfen fiel von ihren Blättern auf des Sängers Grab; da ging die Sonne auf, und die Rose blühte schöner als zuvor. Der Tag wurde heiß, es war ja im heißen Asien. Da schallten Fußtritte, fremde Franken kamen, wie sie die Rose im Traume gesehen hatte, und unter diesen Fremden war ein Dichter aus dem Norden; er brach die Rose, drückte einen Kuß auf ihren frischen Mund, und führte sie mit sich in die Heimat der Nebel und der Nordlichter. Wie eine Mumie ruht nun die Blumenleiche in seiner llias, und wie im Traume hört sie ihn das Buch öffnen und sagen: "Hier ist eine Rose von Homers Grab!"
KINDERSCHNACK
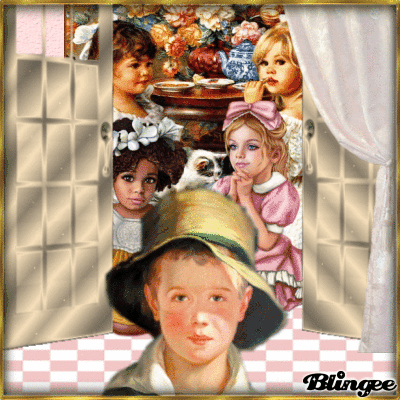
Drinnen bei dem reichen Kaufmanne war eine Kindergesellschaft, reicher und vornehmer Leute Kinder; der Kaufmann war ein gelehrter Mann, er hatte einst das Studentenexamen gemacht, dazu hielt ihn sein ehrlicher Vater an, der von Anfang an nur Viehhändler gewesen, aber ehrlich und betriebsam; der Handel hatte Geld gebracht, und die Gelder hatte der Kaufmann zu mehren gewußt. Klug war er und Herz hatte er auch, aber von seinem Herzen wurde weniger gesprochen, als von seinem vielen Gelde. Bei dem Kaufmanne gingen vornehme Leute ein und aus, sowohl Leute von Blut, wie es heißt, als von Geist, auch Leute von beiden Teilen und auch keines von beiden. Diesmal war eine Kindergesellschaft dort und Kinderschnack, und Kinder sprechen rein von der Leber weg. Unter andern war dort ein wunderschönes, kleines Mädchen, aber die Kleine war entsetzlich stolz, das hatten die Dienstleute in sie geküßt, nicht die Eltern, denn dazu waren die gar zu vernünftige Leute, ihr Vater war Kammerjunker, und das ist was Großes, das wußte sie.
»Ich bin ein Kammerkind!« sagte sie. Sie hätte nun ebenso gut ein Kellerkind sein können, selbst kann Jeder gleichviel dafür; dann erzählte sie den andern Kindern, daß sie »geboren« sei, und sagte, daß wenn man nicht geboren sei, könne man nichts werden; das helfe zu nichts, daß man lesen und fleißig sein wolle, sei man nicht geboren, könne man nichts werden.
»Und diejenigen, deren Namen mit »sen« endigen,« sagte sie, »aus denen kann nun ganz und gar nichts werden! Man muß die Arme in die Seite stemmen und sie weit von sich halten diese »sen! sen!« – und dabei stemmte sie ihre wunderschönen, kleinen Arme in die Seite und machte den Ellenbogen spitz, um zu zeigen, wie man es tun sollte; und die Ärmchen waren gar niedlich. Es war ein recht süßes Mädchen.
Doch die kleine Tochter des Kaufmanns wurde bei dieser Rede gar zornig; ihr Vater hieß Petersen, und von dem Namen wußte sie, daß er auf »sen« endigte, und deshalb sagte sie so stolz wie sie es vermochte:
»Aber mein Vater kann für hundert Taler Bonbons kaufen und sie unter die Kinder werfen! – kann Dein Vater das?«
»Ja, aber mein Vater,« fügte das Töchterlein eines Schriftstellers, »kann Deinen Vater, und Deinen Vater, und alle Väter in die Zeitung setzen! Alle Menschen fürchten ihn, sagt meine Mutter, denn mein Vater ist es, der in der Zeitung regiert!«
Und das Töchterlein sah stolz dabei aus, als wenn es eine wirkliche Prinzessin gewesen, die da stolz aussehen müsse.
Aber draußen vor der nur angelehnten Türe stand ein armer Knabe und blickte durch die Türspalte. Er war so gering, daß er nicht einmal mit in die Stube hinein durfte. Er hatte der Köchin den Bratspieß gedreht, und die hatte ihm nun erlaubt, hinter der Tür zu stehen und zu den geputzten Kindern, die sich einen vergnügten Tag machten, hinein zu blicken, und das war für ihn viel.
»Wer doch Einer von Jenen wäre!« dachte er, und dabei hörte er, was gesprochen wurde, und das war nun freilich um recht mißmutig zu werden. Nicht einen Pfennig besaßen die Eltern zu Hause, den sie zurücklegen, um dafür eine Zeitung halten zu können, geschweige denn eine solche schreiben, mit nichten! – und nun noch das Allerschlimmste: seines Vaters Name und also auch der seinige, endigte auf »sen«, aus ihm könne somit auch ganz und gar nichts werden. Das war zu traurig! – Doch, geboren sei er, schien es ihm, so recht geboren, das könne doch unmöglich anders sein.
Das war nun an diesem Abende.
Seitdem verstrichen viele Jahre, und während dessen werden Kinder erwachsene Menschen.
In der Stadt stand ein prächtiges Haus, es war angefüllt mit lauter schönen Sachen und Schätzen, alle Leute wollten es sehen, selbst Leute, die außerhalb der Stadt wohnten, kamen zur Stadt, um es zu sehen. Wer von den Kindern, von denen wir erzählt haben, mochte wohl jetzt das Haus das seinige nennen? Ja, das zu wissen, ist natürlich sehr leicht! Nein, nein, es ist doch nicht so sehr leicht. Das Haus gehörte dem kleinen, armen Knaben, der an jenem Abend hinter der Tür gestanden hatte; aus ihm wurde doch Etwas, obgleich sein Name auf »sen« endigte, – – Thorwaldsen.
Und die drei andern Kinder? – die Kinder des Blutes, des Geldes und des Geisteshochmuts, – ja Eins hat dem Andern nichts vorzuwerfen, sie sind gleiche Kinder – aus ihnen wurde alles Gutes, die Natur hatte sie gut ausgestattet; was sie damals gedacht und gesprochen, war eben nur Kinderschnack.
DIE GESCHICHTE DES JAHRES
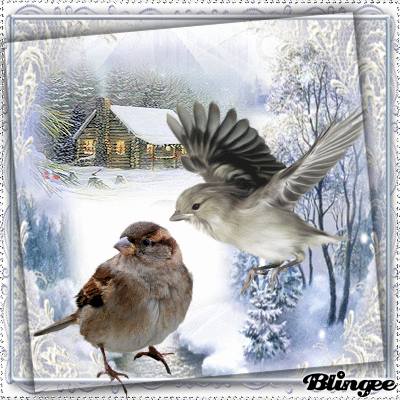
Es war in den letzten Tagen des Januar; ein fürchterlicher Schneesturm trieb daher. Der Schnee fegte wirbelnd durch die Straßen und Gassen. Die Fensterscheiben waren außen wie vom Schnee gepolstert, von den Dächern stürzte er in ganzen Haufen und die Leute hasteten vorwärts; sie liefen, sie flogen und stürzten einander in die Arme, hielten sich aneinander einen Augenblick fest und hatten wenigstens solange einen Halt. Wagen und Pferde waren gleichsam überpudert, die Diener standen mit dem Rücken gegen den Wagen gelehnt, um sich vor dem Winde zu schützen, und die Fußgänger suchten beständig Deckung hinter den Wagen, die nur langsam in dem tiefen Schnee von der Stelle kamen. Als sich endlich der Sturm legte, und ein schmaler Fußsteig längs den Häusern ausgeworfen wurde, standen die Leute doch noch stille, wenn sie sich begegneten. Keiner von ihnen hatte Lust, den ersten Schritt in den tiefen Schnee an den Seiten zu tun, damit der andere vorüber könne. Schweigend standen sie still, bis endlich, fast wie in einer stummen Übereinkunft, jeder von ihnen ein Bein preisgab und es in dem Schneehaufen versinken ließ.
Gegen Abend wurde es windstill. Der Himmel sah aus wie gefegt und höher und durchsichtiger als zuvor; die Sterne waren funkelfnagelneu und glänzten blau und klar. Dabei fror es, daß der Schnee krachte. Bei dem Wetter konnte wohl die oberste Schneeschicht so fest werden, daß sie am Morgen die Spatzen trug; die hüpften bald oben herum bald unten, wo geschaufelt war; viel Nahrung war jedoch nicht zu finden und sie froren bitterlich.
"Piep" sagte der eine zum anderen, "das nennt man nun das neue Jahr. Es ist ja schlimmer als das alte. Dann hätten wir es ebensogut behalten können. Ich bin schlechter Laune, und dazu habe ich guten Grund."
"Ja, da liefen nun die Menschen umher und schossen das neue Jahr ein," sagte ein kleiner verfrorener Spatz. "Sie warfen Töpfe gegen die Türen und waren rein außer sich vor Freude, daß nun das alte Jahr vergangen war. Und ich war auch froh darüber, denn ich erwartete, daß wir nun warme Tage bekommen würden, aber daraus ist nichts geworden! Es friert noch viel stärker als zuvor; die Menschen haben sich in der Zeitrechnung geirrt!"
"Das haben sie" sagte ein Dritter, der schon alt und weißköpfig war. "Sie haben da etwas, das sie den Kalender nennen. Das ist ihre eigene Erfindung, und deshalb soll sich alles danach richten, aber das tut es nicht. Wenn der Frühling kommt, beginnt das Jahr. Das ist der Lauf der Natur und danach rechne ich."
"Aber wann kommt der Frühling?" fragten die anderen.
"Der kommt, wenn der Storch kommt; aber damit ist es ziemlich unbestimmt. Hier in der Stadt ist keiner, der etwas davon versteht. Auf dem Lande draußen wissen sie es besser. Wollen wir hinaus fliegen und warten? Dort ist man doch dem Frühling näher."
"Ja, das ist ein guter Gedanke!" sagte einer von denen, die lange auf und ab gehüpft waren und gepiept hatten, ohne eigentlich etwas zu sagen. "Ich habe hier in der Stadt allerdings einige Bequemlichkeiten, die ich fürchte, draußen entbehren zu müssen. Hier in der Nähe in einem Hofe wohnt eine Menschenfamilie, die den vernünftigen Gedanken gehabt, hat, an der Wand drei bis vier Blumentöpfe mit der großen Öffnung nach innen und dem Boden nach außen anzunageln. Dort ist ein Loch hineingeschnitten, das gerade so groß ist, daß ich aus und ein fliegen kann. Dort habe ich mit meinem Manne genistet, und von dort sind alle unsere Jungen ausgeflogen. Die Menschenfamilie hat das Ganze natürlich nur eingerichtet, um das Vergnügen zu haben, uns zu beobachten, sonst hätten sie es wohl kaum getan. Sie streuen Brotkrumen hin, natürlich auch zu ihrem Vergnügen, und wir haben dadurch Nahrung. Es ist sozusagen für uns gesorgt, – und deshalb glaube ich, daß ich bleibe und daß auch mein Mann bleibt, obgleich wir sehr unzufrieden sind, – aber wir bleiben!"
"Und wir fliegen hinaus aufs Land, um zu sehen, ob nicht das Frühjahr kommt." Und dann flogen sie.
Aber es war eisiger Winter draußen auf dem Lande; es fror noch ein paar Grade mehr als in der Stadt drinnen. Der scharfe Wind blies über die schneebedeckten Felder. Der Bauer, mit großen Fausthandschuhen an den Händen, saß auf dem Schlitten und schlug die Arme übereinander, um die Kälte auszuhalten. Die Peitsche lag in seinem Schoße, die mageren Pferde liefen, daß sie dampften, der Schnee knirschte und die Spatzen hüpften in den Kufenspuren und froren. "Piep! wann kommt der Frühling? Es dauert so lange!"
"Solange!" erklang es über die Felder von dem schneebedeckten Hügel her. Es konnte das Echo sein, was man hörte, aber es konnte auch die Rede des wunderlichen alten Mannes sein, der oben auf der Schneewehe in Wind und Wetter saß. Er war ganz weiß, gerade wie ein Bauer im weißen Flauschmantel, mit langem weißen Haar, weißem Barte, ganz bleich und mit großen, klaren Augen.
"Wer ist der Alte dort?" fragten die Spatzen.
"Das weiß ich!" sagte ein alter Rabe, der auf einem Zaunpfahle saß und herablassend genug war, anzuerkennen, daß wir alle vor Gott nur kleine Vögel sind, und sich deshalb auch mit den Spatzen einließ und eine Erklärung abgab. "Ich weiß, wer der Alte ist. Das ist der Winter, der alte Mann vom vorigen Jahr; er ist nicht tot, wie der Kalender sagt, nein, er ist sozusagen der Vormund des kleinen Prinzen Frühling, der nun kommt. Ja, der Winter führt das Regiment. Hu! Ihr klappert ja ordentlich, Ihr Kleinen!"
"Na, was habe ich immer gesagt?" sagte der kleinste. "Der Kalender ist eine Menschenerfindung! die sich nicht in die Natur einfügen will. Das sollten sie lieber uns überlassen, uns, die wir mit viel feineren Sinnen begabt sind."
Und es verging eine Woche, es vergingen fast zwei; der Wald war schwarz, der gefrorene See lag schwer und sah aus wie erstarrtes Blei. Die Wolken, ja, das waren keine Wolken, das war nasser, eiskalter Nebel, der über der Erde hing. Die großen, schwarzen Krähen flogen in Scharen ohne jeden Schrei; es war, als schliefe alles. – Da glitt ein Sonnenstrahl über den See, und er glänzte wie geschmolzenes Zinn. Die Schneedecke über den Feldern und oben auf der Anhöhe schimmerte nicht mehr wie zuvor, aber die weiße Gestalt, der Winter selbst, saß dort noch immer, den Blick stets gen Süden gerichtet. Er bemerkte es gar nicht, daß der Schneeteppich gleichsam in die Erde versank und daß hier und da ein kleiner grasgrüner Fleck zum Vorschein kam; da wimmelte es dann von Spatzen.
"Quivit, Quivit, kommt nun der Frühling?"
"Der Frühling" klang es über Feld und Wiese und durch die schwarzbraunen Wälder, in denen das Moos frischgrün auf den Baumstämmen leuchtete. Und durch die Luft kamen von Süden her die ersten zwei Störche gezogen. Auf dem Rücken jedes von ihnen saß ein kleines schönes Kind, ein Knabe und ein Mädchen. Sie küßten die Erde zum Willkomm, und wohin sie ihren Fuß setzten, wuchsen weiße Blumen unter dem Schnee hervor. Hand in Hand gingen sie hinauf zu dem alten Eismanne, dem Winter, und legten sich zu neuem Gruße an seine Brust, und in demselben Augenblick waren sie alle drei verschwunden, und die ganze Landschaft war verschwunden. Ein dicker, nasser Nebel, dicht und schwer, umhüllte alles. – Ein wenig später blies ein Lüftlein, dann fuhr der Wind daher mit starken Stößen und jagte den Nebel fort, und die Sonne schien warm. Der Winter selbst war verschwunden und des Frühlings schöne Kinder saßen auf dem Throne des Jahres.
"Das nenne ich Neujahr" sagten die Spatzen "Nun werden wir wohl wieder in unsere Rechte eingesetzt und bekommen Ersatz für den strengen Winter."
Wohin die beiden Kinder sich wandten, sprießen grüne Knospen an Büschen und Bäumen hervor, wurde das Gras höher und die Saatfelder grüner und schöner. Und ringsum streute das kleine Mädchen Blumen. Sie hatte einen ganzen Überfluß davon in ihrem Schürzchen, sie schienen daraus hervorzuquellen, stets war es gefüllt, wie eifrig sie auch streute. In ihrer Eilfertigkeit schüttelte sie einen wahren Blütenschnee über die Äpfel- und Pfirsichbäume, so daß sie in voller Pracht dastanden, noch bevor sie grüne Blätter hatten.
Und sie klatschte in die Hände und der Knabe klatschte ebenfalls. Da kamen alle Vögel hervor, man wußte nicht woher, und alle zwitscherten und sangen: "Der Frühling ist gekommen!"
Es war herrlich anzuschauen. Und manches alte Mütterchen kam aus seiner Tür in den Sonnenschein hinaus, sah sich ringsum und erblickte die vielen gelben Blumen, die die ganze Wiese bedeckten gerade wie in ihren jungen Jahren. Die Welt wurde wieder einmal jung. "Es ist ein gesegneter Tag heute" sagte sie.
Der Wald war noch braungrün und Knospe stand an Knospe, aber der Waldmeister war schon da, frisch und duftend. Die Veilchen standen in Mengen, und es gab Anemonen und gelbe Kuhblumen, ja, in jedem Grashalm war Saft und Kraft; es war wirklich ein Prachtteppich, der förmlich zum Sitzen aufforderte, und dort saß das junge Frühlingspaar, hielt sich an des Händen und sang und lächelte und wuchs und wuchs.
Ein milder Regen fiel vom Himmel auf sie herab; sie merkten es nicht. Regentropfen und Freudentränen vereinigten sich zu einem einzigen Tropfen. Braut und Bräutigam küßten einander, und im Nu schlug der ganze Wald aus. – Als die Sonne aufging, waren alle Wälder grün.
Und Hand in Hand ging das Brautpaar unter dem frischen, hängenden Laubdach, wo nur des Sonnenlichts Strahlen und die Schlagschatten einen Farbenwechsel in all dem Grün hervorzauberten. Eine jungfräuliche Reinheit und ein erfrischender Duft lag über den feinen Blättern. Klar und lebhaft rieselten Bächlein und Quellen zwischen dem samtgrünen Schilfe und über die glitzernden Steine dahin. "Und so ist es und bleibt es ewiglich" sagte die ganze Natur. Und der Kuckuck rief und die Lerche trillerte, und der schöne Frühling war da. Nur die Weiden trugen noch Wollhandschuhe über ihren Blüten, sie waren eben so übervorsichtig, und das ist langweilig!
Und so vergingen Tage und Wochen, die Wärme strömte zur Erde nieder; heiße Luftwellen gingen durch das Korn, das sich mehr und mehr gelb färbte. Des Nordens weiße Lotosblume breitete auf den Waldseen ihre großen, grünen Blätter über dem Wasserspiegel aus, und die Fische suchten den Schatten darunter. Auf der windgeschützten Seite des Waldes, wo die Sonne auf die Wände des Bauernhauses hinab brannte und die aufgeblühten Rosen tüchtig durchwärmte und wo die Kirschenbäume voller saftiger, schwarzer, fast sonnenheißer Kirschen hingen, saß des Sommers herrliches Weib, sie, die wir schon als Kind und Braut sahen. Sie sah in die aufsteigenden dunklen Wolken, die wogenförmig, den Bergen gleich, sich schwarzblau und schwer höher und höher erhoben. Von drei Seiten kamen sie; mehr und mehr senkten sie sich wie ein versteinertes Meer gegen den Wald hinab, wo alles wie verzaubert stille schwieg. Jedes Lüftchen hatte sich gelegt, jeder Vogel schwieg, Ernst und Erwartung lagen über der ganzen Natur. Aber auf den Wegen und Steigen eilten Fahrende, Reitende und Gehende vorwärts, um unter Dach zu kommen. – Da leuchtete es mit einem Male auf, als breche die Sonne hervor, blinkend, blendend, verbrennend, und unter rollendem Krachen versank wieder alles im Dunkel. Das Wasser stürzte in Strömen vom Himmel; es wurde Nacht und wieder Licht, es ward totenstille, und dann donnerte es wieder. Die jungen braungefiederten Rohrstengel im Sumpfe bewegten sich wogend auf und nieder, die Zweige des Waldes verbargen sich unter einer Regenhülle; Dunkel und Licht, Stille und Donner wechselten unaufhörlich. Gras und Korn lagen wie niedergeschlagen, wie zur Erde gespült, als könnten sie sich nie wieder erheben. – Plötzlich wurden aus dem Regen einzelne Tropfen, die Sonne schien und von Gräsern und Blättern blinkten die Wassertropfen wie Perlen, die Vögel sangen wieder, die Fische sprangen im Wasser des Baches, die Mücken tanzten, und draußen auf den Steinen im salzigen, gepeitschten Meereswasser saß der Sommer selbst, der kräftige Mann mit den fülligen Gliedern, dem triefenden Haar – verjüngt vom frischen Bade saß er im warmen Sonnenschein. Die ganze Natur ringsum war verjüngt. Alles stand reich und kräftig und schön; es war Sommer, warmer, herrlicher Sommer.
Lieblich und süß war der Duft, der von dem üppigen Kleefelde herüberwehte, die Bienen summten um das uralte Thing, die Brombeerranken wanden sich um den Opferaltar, der vom Regen gewaschen im Sonnenlichte glänzte. Dorthin flog die Bienenkönigin mit ihrem Schwarm und setzte dort Wachs und Honig an. Niemand sah es außer dem Sommer und seinem kräftigen Weibe; für sie allein stand der Altartisch gedeckt mit den Opfergaben der Natur.
Der Abendhimmel erstrahlte wie Gold, keine Kirchenkuppel war so reich, und der Mond leuchtete zwischen Abend- und Morgenrot. Es war Sommerszeit.
Und es vergingen Wochen und Tage. – Der Schnitter blanke Sensen blinkten in den Kornfeldern. Die Zweige der Apfelbäume beugten sich unter der Last ihrer gelben und roten Früchte; der Hopfen duftete köstlich und hing in großen Knospen, und unter dem Haselbusch, an dem die Nüsse in schweren Büscheln hingen, ruhten Mann und Frau, der Sommer und sein tiefernstes Weib.
"Welcher Reichtum" sagte sie. "Rundum ruht Segen, heimlich und gut, über allem, und doch, ich weiß selbst nicht, ich sehne mich nach Ruhe – Stille. Ich finde nicht das rechte Wort dafür. Nun pflügen sie schon wieder auf den Feldern! Mehr und immer mehr wollen die Menschen gewinnen! – Sieh, die Störche kommen schon in Scharen und gehen hinter dem Pfluge her, Ägyptens Vögel, die uns durch die Lüfte trugen. Erinnerst Du Dich, wie wir beide als Kinder hierher nach den Ländern des Nordens kamen? – Blumen brachten wir her, herrlichen Sonnenschein und grüne Wälder, nun hat sie der Wind schon tüchtig zerzaust, sie werden braun und dunkel wie des Südens Bäume, aber sie tragen nicht, wie diese, goldene Früchte."
"Danach sehnst Du Dich?" fragte der Sommer. "Nun so freue Dich." Er hob den Arm und die Blätter färbten sich mit Rot und mit Gold und die Wälder erstrahlten in herrlichster Farbenpracht; an den Rosenhecken leuchteten feuerrote Hagebutten, die Fliederbüsche hingen schwer zur Erde unter der Last ihrer großen schwarzbraunen Beeren, die wilden Kastanien fielen reif aus ihren dunkelgrünen Schalen und im Walde drinnen blühten die Veilchen zum zweiten Male.
Aber des Jahres Königin wurde immer stiller und bleicher. "Es weht kalt" sagte sie, "die Nacht hat nasse Nebel. – Ich sehne mich nach dem Lande der Kindheit."
Sie sah die Störche fortfliegen, jeden einzigen! Und sie streckte die Hände nach ihnen aus. Sie sah zu den Nestern empor, die leer standen; in einem wuchs eine langstielige Kornblume und in einem anderen der gelbe Löwenzahn, als sei das Nest nur zu ihrem Schutz und Schirm da. Und die Spatzen setzten sich hinein.
"Piep. Wo sind denn die Herrschaften geblieben! Sie können wohl nicht vertragen, daß ihnen ein bißchen Luft um die Nase weht, da sind sie gleich ins Ausland gegangen. Glück auf die Reise."
Und gelber und gelber färbten sich die Wälder, Blatt nach Blatt fiel, die Herbststürme sausten; die Erntezeit ging zu Ende. Auf dem gelben Laubteppich lag die Königin des Jahres und sah mit sanften Augen zu den blinkenden Sternen empor, ihr Gemahl stand bei ihr. Ein Windstoß wirbelte das Laub auf – es fiel wieder zur Erde, aber sie war verschwunden; nur ein Schmetterling, des Jahres letzter, flog durch die kalte Luft.
Und die nassen Nebel kamen, die eisigen Winde und die dunklen, langen Nächte. Des Jahres Beherrscher stand mit schneeweißem Haar. Er selbst wußte nichts davon, er glaubte, es seien Schneeflocken, die aus den Wolken niederfielen; eine dünne .Schneedecke legte sich über die grünen Felder.
Die Kirchenglocken läuteten die Weihnachtszeit ein.
"Die Glocken der Geburt klingen!" sagte des Jahres Beherrscher. "Bald wird das neue Herrscherpaar geboren, und ich gehe zur Ruhe wie sie. Zur Ruhe bei den blinkenden Sternen."
Und in dem frischen, grünen Tannenwald, über dem der Schnee lag, stand der Weihnachtsengel und weihte die jungen Bäume, die zum Fest kommen sollten.
"Freude in den Stuben und unter den grünen Zweigen" sagte des Jahres greiser Beherrscher; diese Wochen hatten ihn schneeweiß und uralt gemacht. "Jetzt naht die Stunde der Ruhe; des Jahres, junges Paar empfängt nun Zepter und Krone."
"Die Macht ist noch Dein," sagte der Weihnachtsengel, "die Macht und nicht die Ruhe! Laß den Schnee wärmend über den jungen Saaten liegen. Lerne ertragen, daß einem anderen gehuldigt wird, während Du noch Herrscher bist, lerne, vergessen zu sein und doch zu leben. Die Stunde Deiner Freiheit naht, wenn der Frühling kommt."
"Wann kommt der Frühling?" fragte der Winter.
"Er kommt, wenn der Storch kommt."
Und mit weißen Locken und schneeweißem Barte saß der Winter eiskalt, alt und gebeugt, aber stark wie der Wintersturm und des Eises Macht hoch oben auf der Schneewehe des Hügels und blickte gen Süden, wie der vorige Winter gesessen und geschaut hatte. – Das Eis krachte, der Schnee knirschte, die Schlittschuhläufer schwangen sich auf den blanken Seen, und Raben und Krähen gefielen sich auf dem weißen Grunde, kein Wind rührte sich. Und in der stillen Luft faltete der Winter die Hände und das Eis legte sich stark als Brücke zwischen die Länder.
Da kamen wieder die Spatzen aus der Stadt und fragten: "Wer ist der alte Mann dort oben?" Und der Rabe saß wieder dort, oder war es ein Sohn von ihm? aber das ist ja gleich – und er sagte zu ihnen: "Das ist der Winter. Der alte Mann vom vorigen Jahr. Er ist nicht tot, wie der Kalender sagt, sondern der Vormund des kommenden Frühlings."
"Wann kommt der Frühling?" fragten die Spatzen, "dann bekommen wir bessere Zeiten und ein mildes Regiment. Das alte taugte nichts!"
Und in stillen Gedanken nickte der Winter zum blätterlosen, schwarzen Walde hinüber, wo jeder Baum seiner Zweige herrliche Form und Biegung zeigte, und über ihren Winterschlaf legten sich der Wolken eiskalte Nebel. Der Herrscher träumte von seinen Jugend- und Mannesjahren und als es tagte, stand der ganze Wald mit glitzerndem Rauhreif überschüttet; das war der Sommertraum des Winters. Der Sonnenschein aber nahm den Rauhreif wieder von den Zweigen.
"Wann kommt der Frühling?" fragten die Spatzen.
"Der Frühling?" erklang es wie Echo von den Hügeln, auf denen der Schnee noch lag. Und die Sonne schien wärmer und wärmer, der Schnee schmolz und die Vögel zwitscherten: "Der Frühling kommt."
Und hoch durch die Lüfte kam der erste Storch, der zweite folgte; ein schönes Kind saß auf dem Rücken jedes von ihnen und sie schwebten auf das offene Feld nieder und küßten die Erde und küßten den alten stillen Mann, der, wie Moses auf dem Berge, von einer Nebelwolke getragen, verschwand.
Die Geschichte des Jahres war zu Ende.
"Das ist sehr richtig!" sagten die Spatzen, "und es ist auch sehr schön, aber es stimmt nach dem Kalender nicht und deshalb ist es doch verkehrt!"
DER FLOH UND DER PROFESSOR

Es war einmal ein Luftschiffer, dem ging es verkehrt, der Ballon zersprang, der Mann plumpste herunter und ging in Stücke. Seinen Jungen hatte er zwei Minuten früher mit dem Fallschirm herabgeschickt, das war des Jungen Glück, er blieb unbeschädigt und ging umher mit großen Vorkenntnissen, um Luftschiffer zu werden, aber er hatte keinen Ballon und auch nicht die Mittel, sich einen zu verschaffen.
Leben mußte er, und so verlegte er sich auf die Künste der Behendigkeit und darauf, mit dem Leib reden zu können, das heißt, Bauchredner zu sein. Jung war er und sah gut aus, und als er einen Bart bekam und gute Kleider anzog, konnte er für ein Grafenkind gehalten werden. Die Damen fanden ihn schön, ja, eine Jungfrau wurde so eingenommen von seiner Schönheit und seinen Behendigkeitskünsten, daß sie ihn zu fremden Städten und Ländern begleitete; dort nannte er sich Professor, weniger konnte es nicht sein.
Sein ständiger Gedanke war, sich einen Luftballon zu verschaffen und in die Luft zu gehen mit seiner kleinen Frau, aber sie hatten noch nicht die Mittel dazu.
"Sie kommen!" sagte er.
"Wenn sie nur wollten!" sagte sie.
"Wir sind ja junge Leute! Und nun bin ich ein Professor, Krümeln sind auch Brot!"
Sie half ihm neulich, saß am Eingang und verkaufte Billette zu der Vorstellung, und das war ein kaltes Vergnügen im Winter. Sie half ihm auch in einem Kunststück. Er steckte seine Frau ins Schubfach, ein großes Schubfach; da kroch sie hinein ins Hinterfach, und dann war sie im Vorderfach nicht zu sehen; das war wie eine Augentäuschung.
Aber eines Abends, als er das Schubfach aufzog, war sie auch fort von ihn; sie war nicht im Vorderfach, nicht im Hinterfach, nicht im ganzen Haus, nicht zu sehen, nicht zu hören. Das war ihre Behendigkeitskunst. Sie kam niemals wieder; sie hatte es satt, und er bekam es satt, verlor seine gute Laune, konnte nicht mehr lachen und Witze machen, und so kamen auch keine Leute hin; der Verdienst wurde schlecht, die Kleider wurden schlecht; er besaß zuletzt nur einen großen Floh, ein Erbstück von seiner Frau, und deshalb hielt er so viel auf ihn. So dressierte er ihn, lehrte ihn Behendigungskünste, lehrte ihn, das Gewehr zu präsentieren und eine Kanone abzuschießen, aber nur eine kleine.
Der Professor war stolz auf den Floh, und der war stolz auf sich selber; er hatte etwas gelernt und hatte Menschenblut in sich und war in den größten Städten gewesen, von Prinzen und Prinzessinnen gesehen worden und hatte ihren hohen Beifall gewonnen. Das stand gedruckt in den Zeitungen und auf den Plakaten. Er wußte, daß er eine Berühmtheit war und einen Professor ernähren konnte, sogar eine ganze Familie.
Stolz war er, und berühmt war er, und doch, wenn er und der Professor reisten, fuhren sie auf der Eisenbahn vierter Klasse; die geht ebenso schnell wie die erste. Es war ein stillschweigendes Gelübde, daß sie niemals sich trennen wollten, niemals sich verheiraten, der Floh wollte Junggeselle bleiben und der Professor Witwer; das kommt auf eins heraus.
"Wo man das größte Glück macht," sagte der Professor, "dahin soll man nicht zweimal kommen!" Er war ein Menschenkenner, und das ist auch eine Kenntnis.
Zuletzt hatten sie alle Länder bereist, außer dem Lande der Wilden; und so wollte er hin zu dem Lande der Wilden; dort essen sie freilich Christenmenschen, das wußte der Professor, aber er war kein richtiger Christ, und der Floh war kein richtiger Mensch, so meinte er, daß er wohl dahin reisen könnte und einen guten Verdienst haben.
Sie reisten mit dem Dampfschiff und mit dem Segelschiff; der Floh machte seine Künste, und so hatten sie freie Reise unterwegs und kamen zu dem Lande der Wilden.
Hier regierte eine kleine Prinzessin, sie war erst acht Jahre, aber sie regierte; sie hatte Vater und Mutter die Macht genommen, denn sie hatte einen Willen und war so unvergleichlich reizend und unartig.
Gleich, so wie der Floh das Gewehr präsentierte und die Kanone abschoß, wurde sie so eingenommen von dem Floh, daß sie sagte: "Ihn oder keinen!" Sie wurde ganz wild vor Liebe und war ja schon vorher wild gewesen.
"Süßes, kleines, vernünftiges Kind," sagte ihr eigener Vater, "könnte man nur erst einen Menschen aus ihm machen!"
"Dafür laß mich sorgen, Alter!" sagte sie, und das ist nicht nett gesagt von einer kleinen Prinzessin, die zu ihrem Vater spricht, aber sie war wild.
Sie setzte den Floh auf ihre kleine Hand.
"Nun bist du ein Mensch und regierst mit mir; aber du sollst tun, was ich will, sonst schlage ich dich tot und fresse den Professor."
Der Professor bekam einen großen Saal, um darin zu wohnen. Die Wände waren aus Zuckerrohr, da konnte er hingehen und daran lecken, aber er war kein Leckermaul. Er bekam eine Hängematte, um darin zu schlafen, es war, als läge er in einem Luftballon, den Hatte er sich immer gewünscht und der war sein ständiger Gedanke.
Der Floh blieb bei der Prinzessin, saß auf ihrer kleinen Hand und auf ihrem feinen Hals. Sie hatte ein Haar von Ihrem Kopf genommen, und das mußte der Professor dem Floh ums Bein binden, und so hielt sie ihn an das große Korallenstück gebunden, das sie im Ohrläppchen hatte.
Das war eine herrliche Zeit für die Prinzessin, auch für den Floh, dachte sie; aber der Professor fühlte sich nicht zufrieden, er war ein Reisemensch, er liebte es, von Land zu Land zu ziehen, in den Zeitungen zu lesen von seiner Unterhaltendheit und Klugheit, daß er einen Floh lehren konnte, menschliche Taten zu tun. Tagaus, tagein lag er in der Hängematte, faulenzte und bekam sein gutes Essen, frische Vogeleier, Elefantenaugen und gebratenen Giraffenohren; die Menschenfresser leben nicht nur von Menschenfleisch, das ist eine Delikatesse. "Kinderschultern mit scharfer Sauce," sagte die Prinzessinmutter, "ist das Delikateste."
Der Professor langweilte sich und wollte gerne fort von dem Lande der Wilden, aber den Floh mußte er mithaben, das war sein Wunder und Lebensunterhalt. Wie sollte er ihn kriegen und fangen. Das war nicht so leicht. Er spannte alle seine Denkkräfte an, und da sagte er: "Nun habe ich es!"
"Prinzessinvater, gönne mir, etwas zu tun! Darf ich die Bewohner des Landes üben im Präsentieren, das ist das, was man in den größten Ländern der Welt Bildung nennt!"
"Und was kannst du mich lehren?" fragte der Prinzessinvater.
"Meine größte Kunst," sagte der Professor, "nämlich eine Kanone abzufeuern, so daß die ganze Erde bebt und all die leckersten Vögel des Himmels gebraten herabfallen! Das ist der Knall dabei!"
"Komm mit der Kanone!" sagte der Prinzessinvater.
Aber im ganzen Land gab es keine Kanone außer der, die der Floh gebracht hatte, und die war zu klein.
"Ich gieße eine größere zurecht!" sagte der Professor. "Gib mir nur die Mittel! Ich muß feines Seidenzeug haben, Nadel und Faden, Tau und Schnüre und Magentropfen für den Luftballon, die blasen auf, machen leicht und erheben, die geben den Knall in dem Kanonenbau." Alles, was er Verlangte, bekam er. Das ganze Land kam zusammen, um die große Kanone zu sehen. Der Professor rief sie nicht, bevor er nicht den Ballon ganz fertig hatte, um ihn aufzufüllen und aufzusteigen.
Der Floh saß auf der Hand der Prinzessin und sah zu. Der Ballon wurde gefüllt, er schwoll und konnte kaum gehalten werden, so wild war er.
"Ich muß ihn in der Luft haben, damit er abgekühlt werden kann!" sagte der Professor und setzt sich in den Korb, der unter dem Ballon hing. "Allen vermag ich nicht, ihn zu lenken. Ich muß einen kundigen Kameraden mithaben, um mir zu helfen. Hier ist keiner, der das kann, außer dem Floh!"
"Ich gestatte es ungern!" sagte die Prinzessin, aber sie reichte doch den Floh dem Professor, der ihn auf seine Hand setzte.
"Laßt Taue und Schnüre los!" sagte er. "Nun geht der Ballon!"
Sie glaubten, er sagte: "Die Kanone!"
Und dann ging der Ballon höher und höher, hinauf über die Wolken, fort von dem Lande der Wilden.
Die kleine Prinzessin, ihr Vater und ihre Mutter, das ganze Volk standen und warteten. Sie warten noch, und glaubst du das nicht, so reise nach dem Lande der Wilden, dort spricht jedes Kind vom Floh und dem Professor, glaubt, daß sie wiederkommen, wenn die Kanone abgekühlt ist, aber sie kommen nicht wieder, sie sind daheim bei uns, sie sind in ihrem Vaterland, fahren auf der Eisenbahn erster Klasse, nicht vierter, sie haben einen guten Verdienst, einen großen Ballon. Keiner fragt, wie sie den Ballon bekommen haben oder woher sie ihn haben, sie sind angesehene Leute, geehrte Leute, der Floh und der Professor.
TANTE ZAHNWEH
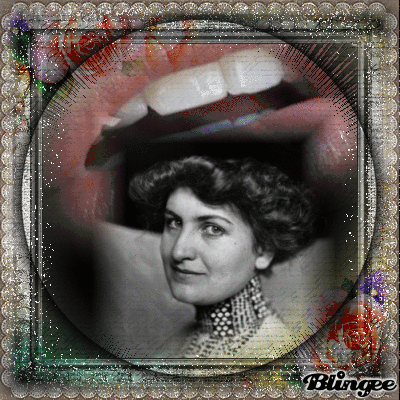
Woher haben wir die Geschichte?
Willst du es wissen?
Wir haben sie aus der Tonne, aus der mit dem alten Papier.
Manch ein gutes und seltenes Buch ist zum Fettwarenhändler und zum Gewürzkrämer gewandert, nicht als Lektüre, sondern als Gebrauchsartikel. Die müssen Papier gebrauchen zu Tüten für Stärke und Kaffeebohnen, Papier für gesalzene Heringe, Butter und Käse. Geschriebene Sachen sind auch brauchbar.
Oft wandert in die Bütte, was nicht in die Bütte wandern sollte.
Ich kenne einen Krämerlehrling, den Sohn eines Fettwarenhändlers; er ist vom Keller in das Erdgeschoß aufgestiegen, ein Mensch, der viel gelesen hat, Tütenlektüre, die gedruckte und die geschriebene. Er hat eine interessante Sammlung, und darin sind mehrere wichtige Aktenstücke aus dem Papierkörben dieses und jenes überarbeiteten, zerstreuten Beamten; manch ein vertraulicher Brief von einer Freundin an die Freundin: Skandalmitteilungen, die nicht weitergehen dürften, von niemand erwähnt werden sollten. Er ist eine lebende Rettungsanstalt für einen großen Teil der Literatur, er hat den Laden der Eltern und des Prinzipals und hat da manch ein Buch oder Blätter von einem Buch gerettet, die wohl verdienen könnten, zweimal gelesen zu werden.
Er hat mir seine Sammlung von gedruckten und geschriebenen Sachen aus der Bütte gezeigt, am reichsten war die Sammlung aus der Bütte des Fettwarenhändlers. Da lagen ein paar Blätter aus einem größeren Schreibheft; die außerordentlich schöne und deutliche Handschrift zog gleich meine Aufmerksamkeit auf sich.
"Das hat der Student geschrieben," sagte er, "der Student, der hier gerade gegenüber wohnte und vor einem Monat starb. Er hat an schrecklichen Zahnschmerzen gelitten, das sieht man aus seinen Aufzeichnungen. Das ist ganz amüsant zu lesen. Es ist nur noch wenig von dem Geschriebenen da, es war ein ganzes Buch und noch ein bißchen mehr; meine Eltern gaben der Wirtin des Studenten ein halbes Pfund grüne Seife dafür. Dies ist alles, was ich gerettet habe."
Ich lieh es, ich las es und jetzt erzähle ich es.
Die Überschrift lautete:
Tante Zahnweh
Tante gab mir süße Näschereien, als ich klein war. Meine Zähne hielten es aus, wurden nicht schlecht dadurch; jetzt bin ich älter geworden, bin Student; sie verhätschelt mich noch immer mit Süßigkeiten, sagt, daß ich ein Dichter bin.
Ich habe etwas vom Poeten in mir, aber nicht genug. Oft, wenn ich in den Straßen der Stadt gehe, ist es mir, als ginge ich in einer großen Bibliothek; die Häuser sind Bücherregale, jedes Stockwerk ist ein Brett mit Büchern. Dort steht eine gute, alte Komödie, dort stehen wissenschaftliche Werke aus allen Fächern, hier Schnitzliteratur und gute Lektüre. Ich kann über alle die Bücher phantasieren und philosophieren.
Es ist etwas vom Poeten in mir, aber nicht genug. Manche Menschen haben gewiß ebenso viel davon in sich und tragen doch kein Schild oder Halsband mit dem Namen Poet.
Ihnen wie mir ist eine Gabe Gottes gegeben, ein Segen, groß genug an sich, aber zu klein, um ausgestückt und an andre gegeben zu werden. Es kommt ganz plötzlich, wie ein Sonnenstrahl, füllt die Seele und den Gedanken, es kommt wie ein Blumenduft, wie eine Melodie, die man kennt, ohne doch zu wissen, woher sie kommt.
Neulich abends saß ich in meinem Zimmer, hatte Verlangen, etwas zu lesen, hatte kein Buch, kein Blatt, da fiel ein grünes Blatt vom Lindenbaum. Der Wind trug es zum Fenster, zu mir herein.
Ich betrachtete die vielen verzweigten Adern; ein kleiner Wurm bewegte sich darüber hin, als wollte er ein gründliches Studium des Blattes unternehmen.
Da mußte ich an Menschenweisheit denken, wir krabbeln auch auf dem Blatt umher, kennen nur das, aber halten sofort einen Vortrag über den ganzen großen Baum, die Wurzeln, den Stamm und die Krone; über den großen Baum: Gott, die Welt und die Unsterblichkeit, und kennen von dem ganzen Baum nur ein kleines Blatt.
Wie ich so dasaß, bekam ich Besuch von Tante Mille.
Ich zeigte ihr das Blatt mit dem Wurm, sagte ihr meine Gedanken dabei, und ihre Augen leuchteten.
"Du bist ein Dichter," sagte sie, "vielleicht der größte, den wir haben! Wenn ich das erleben sollte, dann gehe ich gern in mein Grab. Du hast mich seit Brauer Rasmussens Begräbnis immer durch deine mächtige Phantasie in Erstaunen versetzt."
Das sagte Tante Mille, und dann küßte sie mich.
Wer war Tante Mille, und wer war Brauer Rasmussen?
Muters Tante wurde von uns Kindern Tante genannt, wir hatten keinen anderen Namen für sie.
Sie gab uns Eingemachtes und Zucker, obwohl das sehr schlecht für unsere Zähne war, aber sie war den süßen Kindern gegenüber schwach, das sagte sie selber. Es sei ja grausam, ihnen das bißchen Süße vorzuenthalten, das sie doch so sehr liebten.
Und daher hatten wir Tante so lieb.
Sie war ein altes Fräulein, solange ich mich erinnern kann, immer alt! Sie stand im Alter still.
In früheren Jahren litt sie sehr an Zahnschmerzen und sprach immer davon, und dann war Ihr Freund, Brauer Rasmussen, witzig und nannte sie Tante Zahnweh.
Während der letzten Jahre braute er nicht mehr, er lebte von seinen Zinsen, kam oft zu Tante und war älter als sie. Er hatte gar keine Zähne, nur ein paar schwarze Stummel.
Als kleiner Junge habe er zuviel Zucker gegessen, sagte er zu uns Kindern, und dann würde man so aussehen.
Tante hatte als Kind gewiß niemals Zucker gegessen, sie hatte die schönsten weißen Zähne.
Sie gehe auch sparsam damit um, schlafe des Nachts nicht mit ihren Zähnen, sagte Brauer Rasmussen.
Das war eine Bosheit, das wußten wir Kinder, er dachte sich aber nichts dabei.
Eines Vormittags, beim Frühstück, erzählte sie einen schrecklichen Traum; sie hatte in der Nacht geträumt, daß einer ihrer Zähne ausgefallen war.
"Das bedeutet," sagte sie, "daß ich einen wahren Freund oder eine Freundin verlieren werde!"
"War es ein falscher Zahn," sagte der Brauer lächelnd, "dann kann es nur bedeuten, daß Sie einen falschen Freund verlieren!"
"Sie sind ein unhöflicher alter Herr!" sagte Tante so erzürnt, wie ich sie niemals, weder früher noch später, gesehen habe.
Später sagte sie, es sei nur eine Neckerei von ihrem alten Freund, er sei der edelste Mensch auf der Welt, und wenn er einmal stürbe, würde er ein kleiner Engel Gottes im Himmel werden.
Ich dachte viel über die Verwandlung nach und ob ich wohl imstande sein würde, ihn in der neuen Gestalt zu erkennen.
Als die Tante jung war und er auch jung war, hielt er um ihre Hand an. Sie besann sich zu lange, blieb sitzen, blieb zu lange sitzen, wurde ein altes Fräulein, blieb aber immer eine treue Freundin.
Und dann starb Brauer Rasmussen.
Er wurde im teuersten Leichenwagen zu Grabe geführt und hatte ein großes Gefolge, Leute mit Orden und in Uniformen.
Tante stand in Trauerkleidern am Fenster mit uns Kindern allen, den kleinen Bruder ausgenommen, den der Storch vor einer Woche gebracht hatte.
Nun waren der Leichenwagen und das Gefolge vorüber, die Straße war leer, die Tante wollte gehen, aber das wollte ich nicht, ich wartete auf den Engel, Brauer Rasmussen; er war ja jetzt ein kleines, beschwingtes Kind Gottes geworden und mußte nun erscheinen.
"Tante!" sagte ich. "Glaubst du nicht, daß er jetzt kommt? Oder daß, wenn der Storch uns wieder einen kleinen Bruder bringt, er uns dann den Engel Rasmussen bringt?"
Tante war ganz überwältigt von meiner Phantasie und sagte: "Das Kind wird ein großer Dichter!" Und das wiederholte sie während meiner ganzen Schulzeit, ja nach meiner Konfirmation und auch jetzt noch, wo ich Student bin.
Sie war und ist meine treueste Freundin, sowohl in Dichterschmerzen als auch in Zahnschmerzen. Ich habe ja Anfälle von beiden.
"Schreibe nur alle deine Gedanken nieder," sagte sie, "und lege sie in die Tischschublade; das tat Jean Paul: er wurde ein großer Dichter; ich mag ihn freilich nicht, er ist nicht spannend genug! Du mußt spannend sein! Und du wirst spannend!"
In der Nacht nach dieser Rede lag ich in großer Sehnsucht und Schmerzen, in Drang und Lust, der große Dichter zu werden, den Tante in mir sah und spürte; ich lag in Dichterschmerzen, aber es gibt noch einen schlimmeren Schmerz: das Zahnweh; das wühlte und bohrte in mir; ich ward ein sich windender Wurm mit Kräuterkissen und spanischer Fliege.
"Das kenne ich!" sagte die Tante.
Ein Lächeln des Kummers umspielte ihren Mund; ihre Zähne schimmerten so weiß.
Aber ich muß einen neuen Abschnitt in meiner Geschickte und der Geschichte meiner Tante anfangen.
Ich war in eine neue Wohnung gezogen und hatte da während eines Monats gewohnt. Hierüber sprach ich mit Tante.
"Ich wohne bei einer stillen Familie; sie denkt nicht an mich, selbst nicht, wenn ich dreimal klingele. Übrigens ist es ein wahres Spektakelhaus mit Geräuschen und Lärm von Wetter und Wind und Menschen. Ich wohne gerade über dem Torweg, jeder Wagen, der herein- oder hinausfährt, macht die Bilder an den Wänden erzittern. Die Haustür knallt und rüttelt, so daß das Haus schwankt wie bei einem Erdbeben. Wenn ich im Bett liege, fühle ich die Stöße in allen Gliedern; aber das soll nervenstärkend sein. Wenn es weht, und hierzulande weht es ja immer, dann baumeln die langen Fensterhaken draußen hin und her und schlagen gegen die Mauer. Die Torglocke des Nachbarn auf dem Hof klingelt bei jedem Windstoß.
Unsere Hausbewohner kommen tropfenweise nach Hause, spät am Abend, tief in der Nacht; der Mieter gerade über mir, der am Tage Stunden in Posaunenblasen gibt, kommt am spätesten nach Hause, und er legt sich nicht schlafen, ehe er einen kleinen Mitternachtssparziergang mit schweren Schritten und eisenbeschlagenen Stiefeln gemacht hat.
Doppelte Fenster sind nicht da, aber da ist eine gerissene Fensterscheibe, die hat die Wirtin mit Papier verkleistert, der Wind bläst trotzdem durch den Riß hinein und bringt einen Laut hervor wie von einer summenden Bremse. Das ist Schlafmusik. Schlafe ich dann endlich ein, dann werde ich bald vom Hahnengeschrei geweckt. Hahn und Huhn auf dem Hühnerhof bei dem Kellermann melden, daß es bald Morgen ist. Die kleinen Nordlandpferdchen, die keinen Stall haben, sondern im Sandloch unter der Treppe angebunden sind, schlagen gegen die Tür und das Paneel, um sich Bewegung zu machen.
Der Tag dämmert; der Pförtner, der mit seiner Familie in der Mansarde wohnt, lärmt die Treppe hinab; die hölzernen Pantoffeln klappern, die Haustür knallt, das Haus erbebt, und wenn das überstanden ist, fängt der Mieter über mir an, sich im Turnen zu üben: er hebt in jeder Hand eine schwere Eisenkugel empor, die er nicht halten kann; sie fällt wieder und wieder herab, während gleichzeitig die Jugend des Hauses, die zur Schule gehen soll, schreiend die Treppe hinabstürzt. Ich gehe an das Fenster und mache es auf, um frische Luft zu haben, und das ist auch erquickend, wenn ich sie nur bekommen kann und die Mamsell im Hinterhaus nicht gerade Handschuhe in Fleckwasser wäscht; das ist nämlich ihr Lebensunterhalt. Übrigens ist es ein gutes Haus, und ich wohne bei einer stillen Familie."
Das war das Referat, das ich Tante über meine Wohnung gab; ich erzählte lebhafter, der mündliche Vortrag hat frischere Farben als der geschriebene.
"Du bist ein Dichter!" rief Tante. "Schreibe nur deine Rede auf, dann kannst du es dreist mit Dickens aufnehmen! Ja, mich interessierst du viel mehr! Du malst, wenn du redest! Du beschreibst dein Haus, so daß man es sieht! Es schaudert einen! – Dichte nur weiter! Lege etwas Lebendes hinein, Menschen, nette Menschen, am liebsten unglückliche!"
Das Haus schrieb ich wirklich nieder, wie es mit allen seinen Geräuschen und Mängeln dasteht, aber nur mit mir selber, ohne Handlung. Die kam später!
Es war zur Winterzeit, spät am Abend, nach dem Theater, ein furchtbares Wetter, Schneesturm, so daß man kaum vorwärts kommen konnte.
Die Tante war im Theater, und ich war gekommen, um sie nach Hause zu begleiten, aber man hatte Mühe, selber zu gehen, geschweige denn andere zu führen. Die Mietkutschen waren alle besetzt; die Tante wohnte weit draußen in der Vorstadt, meine Wohnung dahingegen lag dicht beim Theater, wäre das nicht der Fall gewesen, so hätten wir bis auf weiteres in einem Schilderhaus stehen müssen.
Wir stolperten vorwärts im tiefen Schnee, umsaust von den wirbelnden Schneeflocken. Ich hielt sie, stieß sie vorwärts. Nur zweimal fielen wir, aber wir fielen weich.
Wir erreichten meinen Torweg, wo wir unsere Kleider schüttelten; auch an der Treppe schüttelten wir uns und hatten doch Schnee genug mitgebracht, um den Fußboden auf dem Vorplatz damit anzufüllen.
Wir zogen die Überkleider und Stiefel und Strümpfe aus, befreiten uns von allem, was wir nur abwerfen konnten. Die Wirtin gab der Tante trockene Strümpfe und eine Morgenmütze, das sei notwendig, sagte die Wirtin und fügte hinzu, was auch richtig war, die Tante könne unmöglich in dieser Nacht nach Hause kommen; so bat sie, mit ihrer Wohnstube fürlieb zu nehmen; da wollte sie ein Bett auf dem Sofa vor der immer zu meinem Zimmer abgeschlossenen Tür für sie aufmachen.
Und das geschah.
Das Feuer brannte in meinem Ofen, die Teemaschine kam auf den Tisch, es ward gemütlich in dem kleinen Zimmer, wenn auch nicht so gemütlich wie bei Tante, wo im Winter dicke Gardinen vor den Fenstern hängen und doppelte Teppiche, mir drei dicken Schichten Papier darunter, auf dem Fußboden liegen; man sitzt da wie in einer fest zugekorkten Flasche mit warmer Luft, doch, wie gesagt, es ward auch gemütlich bei mir; der Wind sauste draußen.
Die Tante erzählte und erzählte; die Jugendzeit kam wieder, der Brauer kam wieder, alte Erinnerungen.
Sie erinnerte sich noch, wie ich den ersten Zahn bekam, und an die Freude der Familie darüber.
Der erste Zahn! Der Zahn der Unschuld, schimmernd wie ein kleiner Milchtropfen, der Milchzahn.
Es kam einer, es kamen mehrere, eine ganze Reihe, nebeneinander, oben und unten, die schönsten Kinderzähne, und doch nur die Vortraber, nicht die richtigen, die für das ganze Leben dauern sollen.
Auch die kamen und auch die Weisheitszähne, die Flügelmänner in der Reihe, unter Schmerzen und großen Beschwerden geboren.
Die vergehen wieder, jeder einzelne, die vergehen, ehe die Dienstzeit um ist, selbst der letzte Zahn vergeht, und das ist kein Festtag, das ist ein Wehmutstag.
Dann ist man alt, selbst wenn das Gemüt noch jung ist.
Solche Gedanken und Reden sind nicht immer vergnüglich, und doch sprachen wir von all dem, wir kehrten zurück zu den Jahren der Kindheit, redeten und redeten, die Uhr wurde zwölf, ehe Tante sich in die Stube nebenan begab.
"Gute Nacht, mein süßes Kind!" rief sie. "Nun schlafe ich, als läge ich in meiner eigenen Kommode!"
Und sie war zur Ruhe gegangen, aber Ruhe war weder im Hause noch draußen. Der Sturm rüttelte an den Fenstern, schlug mit den langen, baumelnden eisernen Haken, klingelte mit der Türglocke im Hinterhof. Der Mieter oben war nach Hause gekommen. Er machte noch einen kleinen nächtlichen Spaziergang auf und nieder, warf dann die Stiefeln hinaus und legte sich endlich ins Bett zum Schlafen nieder; aber er schnarcht, so daß man es mit guten Ohren durch die Decke hindurch hören kann.
Ich fand nicht Ruhe, ich konnte nicht schlafen; das Wetter ward auch nicht ruhig, es war unmanierlich lebhaft. Der Wind sauste und sang auf seine Weise, meine Zähne fingen auch an, lebhaft zu werden, sie sausten und sangen auf ihre Weise. Sie schlugen an zu großen Zahnschmerzen.
Vom Fenster her zog es. Der Mond schien auf den Fußboden hinein. Das Licht kam und ging im Sturm. Es war eine Unruhe in Schatten und Licht, aber schließlich sah der Schatten am Fußboden aus wie etwas; ich starrte nach diesem beweglichen Etwas hin und spürte einen eiskalten Wind.
Auf dem Fußboden saß eine Gestalt, dünn und lang, wie wenn ein Kind mit einem Griffel etwas auf die Tafel zeichnet, was einem Menschen gleichen soll, ein einziger dünner Strich ist der Körper, ein Strich und noch einer sind die Arme; die Beine sind auch nur ein Strich, der Kopf ist ein Vieleck.
Bald wurde die Gestalt deutlicher, sie bekam eine Art Gewand, sehr dünn, sehr fein, aber es deutete an, daß sie dem weiblichen Geschlecht angehörte. Ich vernahm ein Summen. War sie es, oder war es der Wind, der wie eine Bremse im Fensterriß surrte.
Nein, sie war es selber, Frau Zahnweh! Ihre Entsetzlichkeit Satania infernalis, Gott bewahre uns vor ihrem Besuch.
"Hier ist gut sein!" summte sie. "Hier ist ein gutes Quartier, Sumpfgrund, Moorgrund. Hier haben die Mücken mit Gift in den Stacheln gesummt, jetzt habe ich den Stachel. Der muß an Menschenzähnen gewetzt werden. Sie schimmern so weiß bei dem, der hier im Bett liegt. Sie haben Süß und Sauer, Heiß und Kalt, Nußkern und Pflaumenstein getrotzt! Aber ich will sie schon rütteln und schütteln, die Wurzeln mit Zugwind düngen, sie fußkalt machen!"
Es war eine schreckliche Rede, ein fürchterlicher Gast.
"Du bist also Dichter!" sagte sie. "Ja, ich will dich in allen Versmaßen der Pein hinaufdichten! Ich will dir Eisen und Stahl in den Körper geben, die Fäden in alle deine Nervenfasern hineinlegen!"
Es war, als führe sie einen glühenden Pfriem in den Kinnbacken hinein; ich wand und krümmte mich.
"Ein famoses Zahnwerk!" sagte sie! "Eine Orgel, auf der man spielen kann. Maulharfen-Konzert, großartig, mit Pauken und Trompeten, Flöte piccolo, Posaune im Weisheitszahn. Großer Poet, große Musik!"
Ja, sie spielte auf, und entsetzlich sah sie aus, selbst wenn man nichts weiter von ihr sah als die Hand, diese schattengraue, eiskalte Hand mit den langen, pfriemdünnen Fingern; jeder von ihnen war ein Foltergerät: der Daumen und der Zeigefinger waren Kneifzange und Schrauben, der Langemann endete in einem spitzen Pfriem, der Ringfinger war ein Handbohrer und der kleine Finger eine Spritze mit Mückengift.
"Ich will dich Versemachen lehren!" sagte sie. "Ein großer Dichter soll große Zahnschmerzen haben, kleine Dichter kleine Zahnschmerzen!"
"Ach, laß mich klein sein!" bat ich. "Laß mich gar nicht sein! Und ich bin nicht Poet, ich habe nur Dichteranfälle sowie Anfälle von Zahnweh. Fahre hin! Fahre hin!"
"Erkennst du denn, daß ich mächtiger bin als die Poesie, die Philosophie, die Mathematik und die ganze Musik!" sagte sie. "Mächtiger als alle diese abgemalten und in Marmor gehauenen Empfindungen. Ich bin die älteste von ihnen allen. Ich bin dicht am Garten des Paradieses geboren, draußen, wo der Wind sauste und die nassen Pilze wuchsen. Ich veranlaßte Eva, sich in dem kalten Wetter zu bekleiden, und Adam auch. Du kannst mir glauben, da war Kraft in dem ersten Zahnweh!"
"Ich glaube alles!" sagte ich. "Fahre hin! Fahre hin!"
"Ja, willst du deine Dichterwirksamkeit aufgeben, nimmer mehr Verse auf Papier, Tafel oder irgendeine Art von Schreibmaterial niederschreiben, dann will ich dich verlassen, aber ich komme wieder, sobald du dichtest!"
"Ich schwöre!" sagte ich. "Laß mich dich nur niemals mehr sehen oder spüren!"
"Sehen sollst du mich, aber in einer volleren, lieberen Gestalt wie jetzt! Du sollst mich als Tante Mille sehen; und ich will sagen; dichte, mein süßer Junge! Du bist ein großer Dichter, der größte vielleicht, den wir haben, aber sobald du es glaubst und anfängst zu dichten, setze ich deine Verse in Musik, spiele sie auf deiner Mundharfe, du süßes Kind! – Denke an mich, wenn du Tante Mille siehst!"
Und dann verschwand sie.
Zum Abschied bekam ich noch einen glühenden Pfriemstich in den Kinnbacken hinten, aber das beruhigte sich bald, es war, als flösse ich auf dem weichen Wasser, als sähe ich die weißen Wasserrosen mit den grünen breiten Blättern sich neigen, sich unter mich senken, verwelken, sich auflösen, und ich sank mit ihnen wurde in Frieden und Ruhe aufgelöst. –
"Sterben, hinschmelzen wie der Schnee!" sang es und klang es im Wasser.
"In der Wolke verdunsten, hinfahren wie die Wolke! – "
Zu mir hinab durch das Wasser schimmerten große, strahlende Namen, Inschriften auf wehenden Siegesfahnen, das Patent der Unsterblichkeit – auf dem Flügel der Eintagsfliege geschrieben.
Der Schlaf war tief, der Schlaf ohne Traum. Ich hörte weder den sausenden Wind, die knallende Hautür, die klingelnde Torglocke des Nachbarn noch die schweren Turnübungen des Mieters über mir.
Glückseligkeit!
Dann kam ein Windstoß, so daß die verschlossene Tür zu Tante aufsprang. Auch Tante sprang auf, kam in ihre Schuhe, kam in die Kleider, kam zu mir herein.
"Ich habe wie ein Engel Gottes geschlafen," sagte sie, sie habe nicht gewagt, mich zu wecken.
Ich erwachte auch, schloß die Augen auf, hatte ganz vergessen, daß Tante hier im Hause war, aber bald fiel es mir ein, meine Zahnweh-Erscheinung fiel mir ein. Traum und Wirklichkeit vermischten sich miteinander.
"Du hast gestern abend, nachdem wir einander Gute Nacht gesagt hatten, wohl nicht mehr geschrieben?" frage sie. "Ach hättest du es doch getan! Du bist mein Dichter, und das bleibst du!"
Es war mir, als lächle sie hinterlistig. Ich wußte nicht, ob es die gute Tante Mille war, die mich liebte, oder die Entsetzliche, der ich des Nachts das Versprechen gegeben hatte.
"Hast du gedichtet, süßes Kind?"
"Nein, nein!" rief ich. "Du bist doch Tante Mille?"
"Wer sollte ich sonst wohl sein!" sagte sie. Und es war wirklich Tante Mille. Sie küßte mich, kam in eine Droschke und fuhr nach Hause. Ich schrieb nieder, was hier geschrieben steht. Es ist nicht in Versen und soll nie gedruckt werden.
Ja, hier hörte das Manuskript auf. Mein junger Freund, der Krämergehilfe, konnte das Fehlende nicht auftreiben, es war in die Welt hinausgegangen, als Papier um gesalzene Heringe, grüne Seife und Butter; es hatte seine Bestimmung erfüllt.
Der Brauer ist tot, die Tante ist tot, der Student ist tot, er, dessen Gedankenfunken in die Bütte wanderten: das ist das Ende der Geschichte – der Geschichte von Tante Zahnweh.
DIE GLOCKE

In den engen Straßen der großen Stadt hörte bald der eine, bald der andere am Abend, wenn die Sonne unterging und die Wolken zwischen den Schornsteinen golden aufleuchteten, einen wunderlichen Laut, fast wie der Ton einer Kirchenglocke, aber man hörte ihn nur für einen Augenblick, dann wurde er wieder von dem Geräusch der rasselnden Wagen und des Straßenlärms übertönt. "Nun läutet die Abendglocke." sagte man, "nun geht die Sonne unter."
Wenn man außerhalb der Stadt war, wo die Häuser von Gärten und kleinen Feldern umgeben waren und weiter voneinander entfernt standen, sah man den Abendhimmel noch prächtiger und hörte den Glockenklang weit stärker. Es war, als käme der Ton von einer Kirche tief in dem stillen, duftenden Walde; und die Leute blickten hinüber und wurden ganz andächtig.
Lange Zeit ging darüber hin. Der eine sagte zum andern: "Ob wohl eine Kirche draußen im Walde liegt? Die Glocke hat doch einen wunderbar schönen Klang; sollten wir nicht einmal hinaus und sie ein wenig näher betrachten?" Und die reichen Leute fuhren, und die armen gingen, aber der Weg wurde ihnen so seltsam lang, und als sie bei einer Gruppe von Weidenbäumen anlangten, die am Saume des Waldes standen, setzten sie sich nieder, blickten zu den Zweigen empor und glaubten, nun recht im Grünen zu sein. Der Konditor aus der Stadt kam heraus und schlug sein Zelt auf, und dann kam noch ein Konditor. Der hing eine Glocke über seinem Zelte auf, und zwar eine Glocke, die geteert war, damit sie auch Regen vertragen könne, nur der Klöppel fehlte darin. Wenn dann die Leute wieder nachhause gingen, sagten sie, es sei sehr romantisch gewesen. Drei Personen versicherten, daß sie bis zum Ende des Waldes vorgedrungen seien und immerwährend den seltsamen Glockenklang gehört hätten, aber es wäre ihnen so vorgekommen, als ob er aus der Stadt herüberklänge. Der eine schrieb ein richtiges Gedicht darüber und sagte darin, daß die Glocke wie einer Mutter sanfte Stimme zu ihrem Kinde klänge; keine Melodie sei herrlicher als der Klang der Glocke.
Der Kaiser des Landes wurde auch darauf aufmerksam und versprach dem, der genau ausfindig machen konnte, woher der Schall stammte, den Titel eines "Weltglöckners," selbst wenn sich herausstellen sollte, daß es keine Glocke sei.
Nun gingen gar viele in den Wald, denen das fette Amt in die Augen stach, aber nur einer von ihnen kam mit einer Art Erklärung nachhause. Keiner sei tief genug vorgedrungen, er selbst ebenfalls nicht, aber er meine doch, daß der Glockenklang von einer außergewöhnlich großen Eule in einem hohlen Baume herstamme. Das sei eine jener Weisheitseulen, die ihren Kopf unaufhörlich gegen den Baumstamm schlügen; aber ob der Laut von ihrem Kopfe oder dem Stamme verursacht würde, könne er noch nicht mit Bestimmtheit sagen. So wurde er denn als "Weltglöckner" angestellt und schrieb jedes Jahr eine kleine Abhandlung um die Eule, aber viel klüger wurde man daraus auch nicht.
Nun war gerade ein Einsegnungstag. Der Pfarrer hatte so schön und innig gesprochen; die Konfirmanden waren sehr bewegt, denn es war für sie ein wichtiger Tag, an dem sie aus Kindern plötzlich zu erwachsenen Menschen werden sollten. Die Kinderseele sollte nun gleichsam in eine verständigere Person hinüberfliegen. Es war der herrlichste Sonnenschein. Die Konfirmanden gingen aus der Stadt hinaus, und vom Walde her klang wundersam stark die große unbekannte Glocke. Da überkam sie auf einmal eine solche Lust, dorthin zu gehen, daß sich alle aufmachten, bis auf drei von ihnen. Die eine mußte nachhause, um ihr Ballkleid anzuprobieren, denn es war gerade das Kleid und der Ball, die der Grund waren, weshalb sie schon dieses Mal mit eingesegnet worden war, denn sonst hätte sie noch warten müssen. Der andere war ein armer Junge, der seinen Konfirmationsrock und die Stiefel bei dem Sohn seines Wirtes geliehen hatte und sie auf den Glockenschlag zurückliefern mußte; der dritte sagte, daß er niemals an einen fremden Ort ohne seine Eltern ginge, und daß er immer ein artiges Kind gewesen wäre und das auch bleiben wolle, selbst als Konfirmand, und darüber brauche man sich gar nicht lustig machen. – Aber das taten die anderen trotzdem.
Drei von, ihnen gingen also nicht mit; die anderen trabten davon. Die Sonne schien, und die Vögel sangen, und die Konfirmanden sangen mit und hielten sich bei den Händen; denn noch hatten sie ja keine schweren Pflichten und waren gerade heute so recht Gottes Kinder.
Aber bald wurden zwei von den kleinsten müde und kehrten nach der Stadt um. Zwei kleine Mädchen setzten sich nieder und banden Kränze; sie kamen auch nicht mit, und als die anderen die Weidenbäume erreichten, wo der Konditor wohnte, sagten sie: "Seht, nun sind wir hier draußen; die Glocke ist ja eigentlich nichts wirklich Bestehendes, sondern mehr etwas in der Phantasie Lebendes."
Da erklang auf einmal tief im Walde die Glocke so süß und feierlich, daß vier, fünf sich doch entschlossen, etwas tiefer in den Wald hineinzugehen. Der war so dicht belaubt, daß es ordentlich beschwerlich war, darin vorwärts zu kommen. Waldmeister und Anemonen wuchsen fast allzu üppig, blühende Winden und Brombeerranken hingen in langen Girlanden von Baum zu Baum, in denen Nachtigallen sangen und die Sonnenstrahlen spielten. O, es war so herrlich, aber es war kein Weg für Mädchen, denn sie wären mit zerrissenen Kleidern zurückgekommen. Da lagen Felsblöcke mit Moos von allen Farben bewachsen, das frische Quellwasser sickerte hervor, und leise und seltsam ertönte sein "kluck, kluck."
"Sollte das etwa die Glocke sein?" sagte einer der Konfirmanden und legte sich nieder, um zu lauschen. "Das muß man gründlich untersuchen!" Und so blieb er liegen und ließ die anderen weitergehen.
Sie kamen zu einem Haus aus Borke und Zweigen. Ein großer, wilder Apfelbaum lehnte sich darüber, als wolle er seinen ganzen Segen über das Dach ausschütten, auf dem Rosen blühten. Die langen Zweige beschatteten gerade den Giebel, und an diesem hing eine kleine Glocke. Sollte es diese sein, die man gehört hatte? Ja, darüber waren sich alle einig, außer einem, der sagte, daß die Glocke zu klein und fein sei, als daß man sie so weit entfernt hören könne, wie sie gehört worden war, und daß es ganz andere Töne wären, die ein Menschenherz so zu rühren vermochten. Der so sprach, war ein Königssohn, und deshalb sagten die anderen: "So einer will doch auch immer klüger sein."
Dann ließen sie ihn allein weitergehen, und als er ging, wurde seine Brust mehr und mehr von der Waldeseinsamkeit erfüllt. Aber noch immer hörte er die kleine Glocke, an der die anderen sich ergötzten, und zwischendurch, wenn der Wind die Töne von dem Konditor herüber trug, konnte er auch hören, wie dort gesungen wurde. Aber der tiefe Glockenklang tönte doch starker, und bald war es, als spiele eine Orgel dazu; der Laut kam von links, von der Seite auf der man das Herz trägt.
Nun raschelte es im Gebüsch, und auf einmal stand ein kleiner Knabe vor dem Königssohn, ein Knabe in Holzschuhen und einem Jäckchen, so kurz, daß die Handgelenke weit daraus hervorschauten. Sie kannten sich beide; der Knabe war eben der von den Konfirmanden, der nicht mitgehen konnte, weil er nachhause gehen und Jacke und Stiefel an des Wirtes Sohn zurückliefern mußte. Das hatte er getan und war nun in Holzschuhen und den ärmlichen Kleidern ganz allein fortgegangen, denn die Glocke klang so stark, so tief; er mußte hinaus.
"Da können wir ja zusammengehen!" sagte der Königssohn. Aber der arme Knabe mit den Holzschuhen war ganz verlegen; er zupfte an den kurzen Jackenärmeln und sagte, er fürchte, er könne nicht so rasch mitkommen; außerdem meine er, daß die Glocke nach rechts hinüber gesucht werden müsse, denn nach dieser Seite schiene alles so groß und herrlich zu sein.
"Ja, dann können wir freilich nicht zusammen gehen" sagte der Königssohn und nickte dem armen Knaben zu. Der ging nun in den düstersten und dichtesten Teil des Waldes hinein, wo die Dornen ihm die ärmlichen Kleider und Antlitz, Hände und Füße blutig rissen. Der Königssohn bekam auch einige tüchtige Risse ab, aber die Sonne schien doch auf seinem Wege, und ihm wollen wir nun folgen, denn er war ein flinker Bursch.
"Die Glocke will und muß ich finden," sagte er, "ob ich auch bis zum Ende der Welt gehen müßte!"
Die häßlichen Affen saßen oben in den Bäumen und fletschten grinsend die Zähne. "Wollen wir ihn verprügeln?" sagten sie; "wollen wir ihn verprügeln? Er ist ein Königssohn"
Aber er ging unverdrossen tiefer und tiefer in den Wald hinein, wo die seltsamsten Blumen wuchsen. Es waren dort weiße Sternlilien mit blutroten Staubfäden, himmelblaue Tulpen, die im Winde Funken zu sprühen schienen, und Apfelbäume, deren Äpfel ganz und gar wie große leuchtende Seifenblasen aussahen. Wie mußten diese Bäume im Sonnenschein strahlen! Ringsum waren die herrlichsten grünen Wiesen, wo Hirsch und Hindin im Grase spielten, wuchsen prächtige Eichen und Buchen; und hatte einer der Bäume in der Borke einen Riß, so wucherten darin Gräser und lange Ranken. Da waren auch große Waldstrecken mit stillen Seen, worin weiße Schwäne schwammen und mit den Flügeln schlugen. Der Königssohn stand oft stille und lauschte. Oft glaubte er, daß aus einem dieser tiefen Seen die Glocke zu ihm heraufklinge, aber dann merkte er doch, daß die Glocke nicht von daher, sondern tiefer im Walde erklang.
Nun ging die Sonne unter. Die Luft leuchtete rot wie Feuer; es wurde so stille, so still im Walde, und er sank auf seine Knie, sang sein Abendlied und sagte: "Nie finde ich, was ich suche. Nun geht die Sonne unter, nun kommt die Nacht, die finstere Nacht; doch einmal kann ich vielleicht die rote Sonnenscheibe noch sehen, bevor sie ganz hinter der Erde versunken ist. Ich will auf die Felsen steigen, die sich dort über die Bäume erheben!"
Und er griff in die Ranken und Wurzeln, klomm über die nassen Steine, an denen sich Wasserschlangen emporwanden, und wo die Kröten ihn gleichsam anbellten; aber er erreichte die Höhe noch bevor die Sonne ganz untergegangen war. O, welche Pracht. Das Meer, das große, herrliche Meer, das seine langen Wogen gegen die Küste wälzte, dehnte sich vor seinen Augen aus. Und die Sonne stand wie ein großer, leuchtender Altar weit draußen, wo Himmel und Erde zusammentreffen. Alles schmolz in glühenden Farben, der Wald sang, das Meer sang, und sein Herz sang mit. Die ganze Natur war wie eine große, heilige Kirche, deren Pfeiler die Bäume und schwebenden Wolken, deren Samtbehänge die Blumen und das Gras, und deren große Kuppel der Himmel selbst war. Dort oben erloschen nun die roten Farben, während die Sonne verschwand; aber Millionen Sterne leuchteten auf, Millionen Diamantlämpchen erstrahlten, und der Königssohn breitete seine Arme aus gegen den Himmel, das Meer und den Wald, – und im gleichen Augenblick kam von der rechten Seite mit kurzen Ärmeln und Holzschuhen der arme Knabe; er war ebenso zeitig angekommen auf seinem Wege, und sie liefen einander entgegen und hielten sich bei den Händen in der großen Kirche der Natur und der Poesie, und über ihnen erklang die unsichtbare heilige Glocke, umschwebt vom Tanze der seligen Geister zu einem jubelnden Hallelujah.
DIE GLOCKENTIEFE

"Ding-dang! Ding-dang!" klingt es aus der Glockentiefe herauf in den Odense-Bach. Jedes Kind in der alten Stadt Odense auf der Insel Fünen kennt den Bach, der die Gärten rings um die Stadt bespült und sich von der Schleuse bis zur Wassermühle unter den Holzbrücken hinzieht. Im Bach blühen gelbe Wasserlilien oder Seerosen, und braungefiedertes Röhricht wächst dort mit den schwarzen sammetartigen Rohrkolben, hoch und dick, alte geborstene Weiden, gereckt und gestreckt, hängen weit ins Wasser hinein an der Seite der Mönchswiese und der Bleiche, aber gegenüber liegt Garten an Garten, und keiner gleicht dem andern, bald mit schönen Blumen und Lauben, glatt und zierlich, wie ein kleiner Puppenstaat, bald nur mit Kohl und Gemüse bestanden; oder es ist auch gar kein Garten zu erblicken, da die großen Holunderbäume sich an den Ufern ausbreiten und weit über das strömende Gewässer hinaushängen, das hier und da tiefer ist, als daß die Ruderstange seinen Grund erreichen könnte. Dem alten Fräuleinkloster gegenüber ist die tiefste Stelle, Glockentiefe genannt, und dort unten wohnt der alte Wassermann. Der schläft den Tag über, wenn die Sonne durch das Wasser hinabstrahlt, aber bei sternenhellen Nächten und Mondschein zeigt er sich. Er ist sehr alt; die Großmutter sagt, sie habe von ihm erzählen hören von ihrer Großmutter; er lebe ein einsames Leben, habe gar niemanden, mit dem er reden könne, außer der großen, alten Kirchglocke. Einst hing die Glocke im Kirchturm, ja, jetzt ist keine Spur mehr davon zu sehen, weder vom Turm noch von der Kirche, welche St. Albani hieß.
"Ding-dang" - "Ding-dang!" klang die Glocke, als der Turm noch dastand, und eines Abends, als die Sonne sank und die Glocke im stärksten Schwunge sich befand, riß sie sich los und flog dahin durch die Luft; das blanke Metall blitze glühend in den roten Strahlen.
"Ding-dang! Ding-dang! Jetzt will ich mich zur Ruhe betten!" sang die Glocke und flog hinaus in den Odense-Bach, wo er am tiefsten ist, und deshalb heißt die Stelle die Glockentiefe. Allein ihr ward keine Ruh' und kein Schlaf. Unten bei dem Wassermann singt und klingt sie, daß es zuweilen herauftönt durch die Gewässer, und viele Leute sagen, solch Klingen bedeute, daß jemand stirbt, aber es ist nicht so, sie singt und unterhält sich mit dem Wassermann, der jetzt nicht mehr allein ist.
Und was erzählt wohl die Glocke? Sie ist alt, sehr alt, wie wir schon bemerkten, sie war schon lange da, bevor die Großmutter der Großmutter geboren ward, und doch ist sie dem Alter nach nur ein Kind gegen den Wassermann, der ein alter, stiller Mann, ein Sonderling ist mit seinen Hosen aus Aalhaut und seiner Fischjacke mit den gelben Knöpfen, mit dem Schilf- und Seerosenkranz im Haar und Wasserlinsen im Bart, aber hübsch sieht er doch aus so.
Was die Glocke erzählt - das wiederzugeben würde Jahre und Tage erfordern; sie erzählt jahrein, jahraus die alten Geschichten wieder aufs neue, bald kurz, bald lang, wie es ihr die Stimmung eingibt; sie erzählt von alten Zeiten, den harten, finstern Zeiten.
"In die St. Albani-Kirche, hinauf auf dem Turm stieg der Mönch, er war jung und schön, aber versonnen wie kein anderer. Er schaute von der Luke dort oben über den Odense-Bach hinaus, damals hatte er noch sein breites Bett, und die Mönchswiese war ein See; er schaute über ihn und über den grünen Wall hinweg zum "Nonnenhügel" drüben, wo das Kloster lag, wo das Licht aus der Zelle der Nonne strahlte; er hatte die Nonne sehr gut gekannt, und er erinnerte sich ihrer, und sein Herz klopfte stärker dabei - Ding-dang! Ding-dang!"
Ja, so erzählte die Glocke.
"Den Turm hinauf stieg auch der dämliche Diener des Bischofs, und wenn ich, die Glocke, die aus Metall gegossene, hart und gewichtig sang und mich schwang, hätte ich ihm das Gehirn zerschmettern können; er setzte sich dicht unter mich und spielte mit zwei Stöckchen, als wenn dieselben gar ein Saitenspiel wären, und er sang dazu: 'Jetzt darf ich laut heraussingen, was ich sonst nicht flüstern darf, von allem singen, was hinter Schloß und Riegel versteckt gehalten wird. Dort ist es kalt und naß! Die Ratten fressen sie bei lebendigem Leibe. Niemand weiß darum! Niemand hört davon! Auch jetzt nicht, denn die Glocke klingt und singt ihr lautes Ding-dang! Ding-dang!'
Ein König war damals, sie nannten ihn Kanut, er beugte sich vor Bischof und Mönch, als er aber den Wendelbauern zu nahe trat mit schweren Steuern und harten Worten, da nahmen diese Waffen und Stangen zur Hand und jagten ihn in die Flucht gleich einem wilden Tier; er suchte Schutz in der Kirche, schloß Tor und Tür hinter sich; die gewalttätige Schar lagerte draußen vor der Kirche, ich hörte davon erzählen; Krähen, Raben und Dohlen fuhren auf vor Schreck bei dem Geschrei und Gebrüll, welches ertönte; sie flogen in den Turm hinein und wieder hinaus, sie schauten auf die Menge dort unten hinab, sie blickten auch durch die Fenster der Kirche hinein, sie schrieen es laut heraus, was sie sahen. König Kanut lag betend vor dem Altar, seine Brüder Erich und Benedikt standen dort als Wache mit gezogenen Schwertern, allein der Diener des Königs, der falsche Blake, verriet seinen Herrn; die Menge vor der Kirche wußte, wo der König zu treffen sei, und einer schleuderte einen Stein durch die Fensterscheide, und der König lag tot da! Rufen und Schreien der wilden Schar und der Vögel zitterte durch die Luft, und auch ich stimmte mit ein, ich sang und Klang Ding-dang! Ding-dang!
Die Kirchglocke hängt hoch; schaut weit umher, sieht die Vögel um sich und versteht ihre Sprache, der Wind braust zu ihr hinein durch Luken und Schallblöcher, durch jede Ritze, und der Wind weiß alles, er hat es von der Luft, und diese umschließt alles, was Leben hat, sie dringt in die Lungen der Menschen hinein, weiß alles, was sich in Laut und Ton kundtut, jedes Wort, jeden Seufzer! Die Luft weiß es, der Wind erzählt es, die Kirchglocke versteht seine Sprache und läutet es hinaus in die Welt: Ding-dang! Ding-dang!
"Allein es wurde mir zu viel, all dies zu hören und zu erfahren, ich vermochte nicht mehr, es hinauszuläuten. Ich wurde so müde, so schwer, daß der Balken zerbrach und ich in die leuchtende Luft hinausflog, hinab, wo der Bach am tiefsten ist und der Wassermann wohnt, einsam und allein, und dort erzähle ich jahraus, jahrein, was gehört habe und was ich weiß: Ding-dang! Ding-dang!"
So läutet und klagt es aus der Glockentiefe in dem Odense-Bach; das hat die Großmutter erzählt.
Aber der Schulmeister sagt: "Es gibt keine Glocke, die dort unten läuten kann, denn sie kann es nicht! - Auch keinen Wassermann gibt es dort unten, denn es gibt gar keinen Wassermann!" Und wenn alle anderen Kirchenglocken gar herrlich klingen, so sagt er, daß es nicht die Glocken seien, sondern eigentlich die Luft, die da klingt, die sei es, die das Geläut gebe - und Großmutter erzählt auch, daß es die Glocke selber so gesagt habe - darüber sind sich beide demnach einig, so viel ist gewiß! "Sei behutsam, behutsam, und achte genau auf dich!" sagen sie beide.
Die Luft weiß alles. Sie ist um uns, sie ist in uns, sie spricht von unseren Gedanken und unseren Taten, und sie spricht länger davon als die Glocke unten in der Tiefe des Odense-Baches, wo der Wassermann wohnt; sie tönt es hinauf in die große Himmelstiefe, weit, weit hinauf, ewig und immer, bis die Himmelsglocken klingen: Ding-dang! Ding-dang!
DIE ROTEN SCHUHE

Es war einmal ein kleines Mädchen, gar fein und hübsch; aber es war arm und musste im Sommer immer barfuss gehen, und im Winter mit großen Holzschuhen, so dass der kleine Spann ganz rot wurde; es war zum Erbarmen.
Mitten im Dorfe wohnte die alte Schuhmacherin; sie setzte sich hin und nähte, so gut sie es konnte, von alten roten Tuchlappen ein paar kleine Schuhe. Recht plump wurden sie ja, aber es war doch gut gemeint, denn das kleine Mädchen sollte sie haben. Das kleine Mädchen hieß Karen.
Just an dem Tage, als ihre Mutter begraben wurde, bekam sie die roten Schuhe und zog sie zum ersten Male an; sie waren ja freilich zum Trauern nicht recht geeignet, aber sie hatte keine anderen, und so ging sie mit nackten Beinchen darin hinter dem ärmlichen Sarge her.
Da kam gerade ein großer, altmodischer Wagen dahergefahren; darin saß eine stattliche alte Dame. Sie sah das kleine Mädchen an und hatte Mitleid mit ihm, und deshalb sagte sie zu dem Pfarrer: "Hört, gebt mir das kleine Mädchen, ich werde für sie sorgen und gut zu ihr sein!"
Karen glaubte, dass sie alles dies den roten Schuhen zu danken habe. Aber die alte Frau sagte, dass sie schauderhaft seien, und dann wurden sie verbrannt. Karen selbst wurde reinlich und nett gekleidet; sie musste Lesen und Nähen lernen, und die Leute sagten, sie sei niedlich; aber der Spiegel sagte: "Du bist weit mehr als niedlich, Du bist schön."
Da reiste einmal die Königin durch das Land, und sie hatte ihre kleine Tochter bei sich, die eine Prinzessin war. Das Volk strömte zum Schlosse und Karen war auch dabei. Die kleine Prinzessin stand in feinen weißen Kleidern in einem Fenster und ließ sich bewundern. Sie hatte weder Schleppe noch Goldkrone, aber prächtige rote Saffianschuhe. Die waren freilich weit hübscher als die, welche die alte Schuhmacherin für die kleine Karen genäht hatte. Nichts in der Welt war doch mit solchen roten Schuhen vergleichbar!
Nun war Karen so alt, dass sie eingesegnet werden sollte. Sie bekam neue Kleider und sollte auch neue Schuhe haben. Der reiche Schuhmacher in der Stadt nahm Maß an ihrem kleinen Fuß. Das geschah in seinem Laden, wo große Glasschränke mit niedlichen Schuhen und blanken Stiefeln standen. Das sah gar hübsch aus, aber die alte Dame konnte nicht gut sehen und hatte daher auch keine Freude daran. Mitten zwischen den Schuhen standen ein paar rote, ganz wie die, welche die Prinzessin getragen hatte. Wie schön sie waren! Der Schuhmacher sagte auch, dass sie für ein Grafenkind genäht worden seien, aber sie hätten nicht gepasst.
"Das ist wohl Glanzleder" sagte die alte Dame, "sie glänzen so."
"Ja, sie glänzen!" sagte Karen, und sie passten gerade und wurden gekauft. Aber die alte Dame wusste nichts davon, dass sie rot waren, denn sie hätte Karen niemals erlaubt, in roten Schuhen zur Einsegnung zu gehen, aber das geschah nun also.
Alle Menschen sahen auf ihre Füße, und als sie durch die Kirche und zur Chortür hinein schritt, kam es ihr vor, als ob selbst die alten Bilder auf den Grabsteinen, die Steinbilder der Pfarrer und Pfarreresfrauen mit steifen Kragen und langen schwarzen Kleidern, die Augen auf ihre roten Schuhe hefteten, und nur an diese dachte sie, als der Pfarrer seine Hand auf ihr Haupt legte und von der heiligen Taufe sprach und von dem Bunde mit Gott, und dass sie nun eine erwachsene Christin sein sollte. Und die Orgel spielte so feierlich, die hellen Kinderstimmen sangen und der alte Kantor sang, aber Karen dachte nur an die roten Schuhe.
Am Nachmittag hörte die alte Dame von allen Leuten, dass die Schuhe rot gewesen wären, und sie sagte das wäre recht hässlich und unschicklich, und Karen müsse von jetzt ab stets mit schwarzen Schuhen zur Kirche gehen, selbst wenn sie alt wären.
Am nächsten Sonntag war Abendmahl, und Karen sah die schwarzen Schuhe an, dann die roten, - und dann sah sie die roten wieder an und zog sie an.
Es war herrlicher Sonnenschein; Karen und die alte Dame gingen einen Weg durch das Kornfeld; da stäubte es ein wenig.
An der Kirchentür stand ein alter Soldat mit einem Krückstock und einem gewaltig langen Barte, der war mehr rot als weiß, er war sogar fuchsrot. Er verbeugte sich tief bis zur Erde und fragte die alte Dame, ob er ihre Schuhe abstäuben dürfe. Und Karen streckte ihren kleinen Fuß auch aus. "Sieh, was für hübsche Tanzschuhe" sagte der Soldat, "sitzt fest, wenn Ihr tanzt." Und dann schlug er mit der Hand auf die Sohlen.
Die alte Dame gab dem Soldaten einen Schilling, und dann ging sie mit Karen in die Kirche.
Alle Menschen drinnen blickten auf Karens rote Schuhe, und alle Bilder blickten darauf, und als Karen vor dem Altar kniete und den goldenen Kelch an ihre Lippen setzte, dachte sie nur an die roten Schuhe. Es war ihr, als ob sie selbst in dem Kelche vor ihr schwämmen; und sie vergaß, den Choral mitzusingen und vergaß, ihr Vaterunser zu beten.
Nun gingen alle Leute aus der Kirche, und die alte Dame stieg in ihren Wagen. Karen hob den Fuß, um hinterher zu steigen; da sagte der alte Soldat, der dicht dabei stand: "Sieh, was für schöne Tanzschuhe." Und Karen konnte es nicht lassen, sie musste ein paar Tanzschritte machen!" Und als sie angefangen hatte, tanzten die Beine weiter; es war gerade, als hätten die Schuhe Macht über sie bekommen; sie tanzte um die Kirchenecke herum und konnte nicht wieder aufhören damit; der Kutscher musste hinterher laufen und sie festhalten. Er hob sie in den Wagen; aber die Füße tanzten weiter, so dass sie die gute alte Dame heftig trat.
Endlich zogen sie ihr die Schuhe ab, und die Beine kamen zur Ruhe.
Daheim wurden die Schuhe in den Schrank gesetzt, aber Karen konnte sich nicht enthalten, sie immer von neuem anzusehen.
Nun wurde die alte Frau krank, und es hieß, dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Sie sollte sorgsam gepflegt und gewartet werden, und niemand stand ihr ja näher als Karen. Aber in der Stadt war ein großer Ball und Karen war auch dazu eingeladen. Sie schaute die alte Frau an, die ja doch nicht wieder gesund wurde, sie schaute auf die roten Schuhe, und das schien ihr keine Sünde zu sein. - Da zog sie die roten Schuhe an - das konnte sie wohl auch ruhig tun! - aber dann ging sie auf den Ball und fing an zu tanzen.
Doch als sie nach rechts wollte, tanzten die Schuhe nach links, und als sie den Saal hinauf tanzen wollte, tanzten die Schuhe hinunter, die Treppe hinab, über den Hof durch das Tor aus der Stadt hinaus. Tanzen tat sie, und tanzen musste sie, mitten in den finsteren Wald hinein.
Da leuchtete es zwischen den Bäumen oben, und sie glaubte, dass es der Mond wäre; denn es sah aus wie ein Gesicht. Es war jedoch der alte Soldat mit dem roten Barte. Er saß und nickte und sprach: "Sieh, was für hübsche Tanzschuhe."
Da erschrak sie und wollte die roten Schuhe fortwerfen; aber sie hingen fest. Sie riss ihre Strümpfe ab; aber die Schuhe waren an ihren Füßen festgewachsen. Und tanzen tat sie und tanzen musste sie über Feld und Wiesen, in Regen und Sonnenschein, bei Tage und bei Nacht; aber in der Nacht war es zum Entsetzen.
Sie tanzte zum offenen Kirchhofe hinein, aber die Toten dort tanzten nicht; sie hatten weit Besseres zu tun als zu tanzen. Sie wollte auf dem Grabe eines Armen niedersitzen, wo bitteres Farnkraut grünte, aber für sie gab es weder Rast noch Ruhe. Und als sie auf die offene Kirchentür zutanzte, sah sie dort einen Engel in langen weißen Kleidern; seine Schwingen reichten von seinen Schultern bis zur Erde nieder. Sein Gesicht war strenge und ernst, und in der Hand hielt er ein Schwert, breit und leuchtend:
"Tanzen sollst Du" sagte er, "tanzen auf Deinen roten Schuhen, bist Du bleich und kalt bist, bis Deine Haut über dem Gerippe zusammengeschrumpft ist. Tanzen sollst Du von Tür zu Tür, und wo stolze, eitle Kinder wohnen, sollst Du anpochen, dass sie Dich hören und fürchten! Tanzen sollst Du, tanzen" "Gnade" rief Karen. Aber sie hörte nicht mehr, was der Engel antwortete, denn die Schuhe trugen sie durch die Pforte auf das Feld hinaus, über Weg und über Steg, und immer musste sie tanzen.
Eines Morgens tanzte sie an einer Tür vorbei, die ihr wohlbekannt war. Drinnen ertönten Totenpsalmen; ein Sarg wurde herausgetragen, der mit Blumen geschmückt war. Da wusste sie, dass die alte Frau tot war, und es kam ihr zum Bewusstsein, dass sie nun von allen verlassen war, und Gottes Engel hatte sie verflucht.
Tanzen tat sie und tanzen musste sie, tanzen in der dunkeln Nacht. Die Schuhe trugen sie dahin über Dorn und Steine, und sie riss sich blutig. Sie tanzte über die Heide hin bis zu einem kleinen, einsamen Hause. Hier, wusste sie, wohnte der Scharfrichter, und sie pochte mit dem Finger an die die Scheibe und sagte:
"Komm heraus - Komm heraus - Ich kann nicht hineinkommen, denn ich tanze."
Und der Scharfrichter sagte: "Du weißt wohl nicht, wer ich bin? Ich schlage bösen Menschen das Haupt ab, und ich fühle, dass mein Beil klirrt!"
"Schlag mir nicht das Haupt ab" sagte Karen, denn dann kann ich nicht meine Sünde bereuen! Aber haue meine Füße mit den roten Schuhen ab."
Nun bekannte sie ihre ganze Sünde, und der Scharfrichter hieb ihr die Füße mit den roten Schuhen ab: aber die Schuhe tanzten mit den kleinen Füßchen über das Feld in den tiefen Wald hinein.
Und er schnitzte ihr Holzbeine und Krücken, lehrte sie die Psalmen, die die armen Sünder singen, und sie küsste die Hand, die die Axt geführt hatte, und ging von dannen über die Heide.
"Nun habe ich genug um die roten Schuhe gelitten" sagte sie, "nun will ich in die Kirche gehen, damit es auch gesehen wird." Und sie ging, so schnell sie es mit den Holzfüßen konnte, auf die Kirchentür zu. Als sie aber dorthin kam, tanzten die roten Schuhe vor ihr her, und sie entsetzte sich und kehrte um.
Die ganze Woche hindurch war sie betrübt und weinte viele bittere Tränen. Als es aber Sonntag wurde, sagte sie: "So, nun habe ich genug gelitten und gestritten. Ich glaube wohl, dass ich ebenso gut bin wie viele von denen, die in der Kirche sitzen und prahlen!" Und dann machte sie sich mutig auf. Doch kam sie nicht weiter als bis zur Pforte; da sah sie die roten Schuhe vor sich hertanzen, und sie entsetzte sich sehr, kehrte wieder um und bereute ihre Sünde von ganzem Herzen.
Dann ging sie zum Pfarrhause und bat, ob sie dort Dienst nehmen dürfe; sie wolle fleißig sein und alles tun, was sie könne; auf Lohn sehe sie nicht, wenn sie nur ein Dach übers Haupt bekäme und bei guten Menschen wäre. Und die Pfarrersfrau hatte Mitleid mit ihr und nahm sie in Dienst. Und sie war fleißig und nachdenklich. Stille saß sie und hörte zu, wenn am Abend der Pfarrer laut aus der Bibel vorlas. All die Kleinen liebten sie sehr; aber wenn sie von Putz und Staat sprachen und dass es herrlich sein müsse, eine Königin zu sein, schüttelte sie mit dem Kopfe.
Am nächsten Sonntag gingen alle zur Kirche, und sie fragten sie, ob sie mitwolle, aber sie sah betrübt mit Tränen in den Augen auf ihre Krücken herab, und so gingen die anderen ohne sie fort, um Gottes Wort zu hören; sie aber ging allein in ihre kleine Kammer. Die war nicht größer, als dass ein Bett und ein Stuhl darin stehen konnte, und hier setzte sie sich mit ihrem Gesangbuche hin. Und als sie mit frommem Sinn darin las, trug der Wind die Orgeltöne aus der Kirche zu ihr herüber, und sie erhob unter Tränen ihr Antlitz und sagte: "O Gott, hilf mir."
Da schien die Sonne so hell, und gerade vor ihr stand Gottes Engel in den weißen Kleidern, er, den sie in der Nacht in der Kirchentür gesehen hatte. Aber er hielt nicht mehr das scharfe Schwert, sondern einen herrlichen grünen Zweig, der voller Rosen war. Mit diesem berührte er die Decke, und sie hob sich empor, und wo er sie berührt hatte, leuchtete ein goldener Stern. Und er berührte die Wände, und sie weiteten sich. Nun sah sie die Orgel und hörte ihren Klang, und sie sah die alten Steinbilder von den Pfarrern und Pfarrersfrauen.
Die Gemeinde saß in den geschmückten Stühlen und sang aus dem Gesangbuch. - Die Kirche war selbst zu dem armen Mädchen in die kleine, enge Kammer gekommen, oder war sie etwa in die Kirche gekommen? Sie saß im Stuhl bei den anderen aus dem Pfarrhause, und als der Psalm zu Ende gesungen war, blickten sie auf und nickten ihr zu und sagten: "Das war recht, dass Du kamst, Karen."
"Es war Gnade" sagte sie.
Und die Orgel klang, und die Kinderstimmen im Chor ertönten sanft und lieblich! Der klare Sonnenschein strömte warm durch die Fenster in den Kirchenstuhl, wo Karen saß; ihr Herz war so voll Sonnenschein, Frieden und Freude, dass es brach. Ihre Seele flog mit dem Sonnenschein auf zu Gott, und dort war niemand, der nach den roten Schuhen fragte.
GROSSMÜTTERCHEN
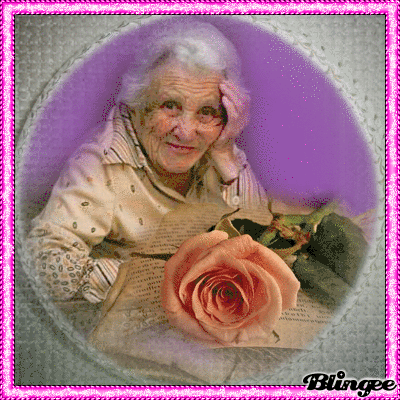
Großmutter ist so alt, sie hat gar viele Runzeln und ganz schneeweißes Haar, aber ihre Augen leuchten wie zwei Sterne; ja sie sind eigentlich viel schöner, sie sind so milde, daß es von Herzen wohltut, in sie hineinzuschauen. Sie weiß die herrlichsten Geschichten und hat ein Kleid mit großen, großen Blumen an; das ist aus so dickem Seidenzeug, daß es bei jeder Bewegung rauscht. Großmutter weiß so viel, denn sie hat viel länger als Vater und Mutter gelebt, das ist ganz gewiß.
Großmutter hat ein Gesangbuch mit dicken Silberbeschlägen, und darin liest sie oft. Mitten in dem Buche liegt eine Rose, die ganz flach und trocken ist; sie ist nicht so schön wie die Rosen, die sie im Glase stehen hat, und doch lächelt sie dieser am allerfreundlichsten zu, ja, es kommen ihr dabei Tränen in die Augen. Weshalb mag Großmutter so auf die welke Rose in dem alten Buche niederschauen? Weißt Du es? Jedesmal, wenn Großmutters Tränen auf die Blume fallen, wird ihre Farbe frischer, die Rose schwillt empor, und die ganze Stube erfüllt sich mit ihrem Duft, die Wände versinken, als seien sie Nebelschleier, und ringsum ist der grüne, herrliche Wald, wo die Sonne zwischen den Blättern spielt und Großmutter – ja sie ist ganz jung, ist ein liebreizendes Mädchen mit blonden Locken, mit rosigen, runden Wangen, schmuck und lieblich, keine Rose kann frischer sein. Doch die Augen, die milden sanften Augen, ja das sind immer noch Großmutters Augen.
An ihrer Seite sitzt ein Mann, so jung und kräftig und schön; er reicht ihr die Rose, und sie lächelt, – so lächelt Großmutter doch nicht.– Ja, das Lächeln ist da. Er ist fort; nun gehen viele Gedanken und Gestalten vorüber. Der schöne Mann ist fort, die Rose liegt im Gesangbuche, und Großmutter – ja, da sitzt sie wieder, eine alte Frau, und betrachtet die verwelkte Rose, die im Buche liegt.
Nun ist Großmutter tot. – Sie saß im Lehnstuhl und erzählte eine lange, lange herrliche Geschichte: "Und nun ist sie aus," sagte sie, "und ich bin so müde, laßt mich nun ein wenig schlafen!" Und dann lehnte sie sich zurück und atmete sanft; sie schlief. Aber es wurde stiller und stiller und ihr Antlitz war so voller Frieden und Glück, es war gleichsam, als ob der Sonnenschein darüber hinglitte, und da sagten sie, sie sei tot.
Sie wurde in den schwarzen Sarg gelegt. Dort lag sie, in weißes Linnen gehüllt; sie war so schön, aber die Augen waren geschlossen; alle Runzeln waren nun fort, und sie lag mit einem Lächeln um den Mund. Ihr Haar war so silberweiß, so ehrwürdig, ihr Anblick flößte gar keine Furcht ein, es war ja die liebe, herzenesgute Großmutter. Und das Gesangbuch wurde unter ihren Kopf gebettet, das hatte sie selbst verlangt, und die Rose lag in dem alten Buche; so wurde Großmutter begraben.
Auf dem Grabe, dicht unter der Kirchenmauer pflanzten sie einen Rosenbaum. Er stand voller Blüten, und die Nachtigall sang über ihm, und aus der Kirche hörte man die Orgel die schönsten Psalmen spielen, die in dem Buche unter dem Haupte der Toten standen. Der Mond schien gerade auf das Grab herab; aber die Tote ließ sich nicht blicken. Jedes Kind konnte des Nachts ruhig hingehen und sich dort an der Kirchhofmauer eine Rose pflücken. Ein Toter weiß mehr, als wir Lebenden wissen; der Tote kennt die Angst, die uns sein Wiedererscheinen einflößen würde. Die Toten sind besser als wir alle, und deshalb kommen sie nicht. Es liegt Erde über dem Sarge und Erde darin. Das Gesangbuch mit seinen Blättern ist zu Staub zerfallen. Aber darüber blühen neue Rosen, darüber singt die Nachtigall und die Orgel spielt. Man denkt an die alte Großmutter mit den milden, ewig jungen Augen. Augen können niemals sterben. Die unsrigen werden sie einmal erblicken, so jung und schön wie damals, als sie zum ersten Male die frische, rote Rose küßte, die Staub im Grabe ist.
DES KAISERS NEUE KLEIDER

Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser. Der hielt so ungeheuer viel auf neue Kleider, dass er für diese Pracht all sein Geld ausgab. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um die Staatsgeschäfte und liebte es nicht, in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte für jede Stunde des Tages einen eigenen Rock, und man sprach hinter vorgehaltener Hand: "Der Kaiser führt schon wieder seine Garderobe aus!"
In der großen Stadt, wo der Kaiser wohnte, ging es munter her. An jedem Tag kamen viele Fremde an, und eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Die gaben sich als Weber aus und sagten, sie könnten den schönsten Stoff der Welt weben. Die Kleider aus dem Stoff wären nicht nur ungewöhnlich schön, sie hätten auch eine wunderbare Eigenschaft. Sie wären für jeden Menschen unsichtbar, der in seinem Amte nichts tauge oder einfach dumm sei.
"Das müssen ja in der Tat prächtige Kleider sein", dachte sich der Kaiser. "Wenn ich die hätte, könnte ich auch erfahren, welche Männer in meinem Reiche nichts taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden! Ja, dieser Stoff muss sogleich für mich gewebt werden!"
Er gab den beiden Betrügern viel Geld, damit sie ihre Arbeit beginnen konnten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf und taten so, als ob sie arbeiteten. Doch auf den Webstühlen war nicht das Geringste zu sehen. Trotzdem verlangten die beiden Burschen die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis spät in die Nacht.
"Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Stoff gekommen sind", dachte sich der Kaiser. Aber er fürchtete sich ein wenig, sollten doch Taugenichtse und Dumme die Webarbeit nicht sehen können. Der Kaiser glaubte zwar, dass er für sich selbst nichts zu fürchten habe, aber er wollte zuerst einen anderen senden. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welche Kraft der Stoff haben sollte, und alle waren begierig darauf, zu sehen, wie schlecht oder dumm die Nachbarn waren.
"Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden", sagte der Kaiser. "Er kann am besten beurteilen, was vor sich geht, denn er hat Verstand. Und keiner versieht sein Amt besser als er!" Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger an den leeren Webstühlen arbeiteten. "Gott behüte uns!", dachte der alte Minister und riss die Augen auf. "Ich kann ja nichts erblicken!" Aber er ließ sich nichts anmerken.
Die Betrüger baten ihn näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, und der arme Minister traute seinen Augen nicht. Er konnte nichts sehen, denn es war nichts da. "Herr Gott", dachte er, gehöre ich denn zu den Dummen? Das hätte ich nie gedacht, und kein Mensch darf es wissen!"
"Nun, Sie sagen ja gar nichts?", fragte der eine von den Webern. "Oh, es ist wunderbar anzusehen!", antwortete der alte Minister und sah forschend durch seine Brille. "Dieses Muster und diese Farben! - Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt!" "Nun, das freut uns!", erwiderten die Weber, und erklärten noch lange die besonderen Farben und Muster. Der alte Minister hörte gut zu, damit er alles erzählen konnte, wenn er wieder vor den Kaiser trat.
Nun verlangten die Betrüger aber noch mehr Geld, und dazu auch noch Seide und Gold zum Weben. Sie steckten alles wieder in ihre eigenen Taschen und arbeiteten weiter an den leeren Webstühlen.
Der Kaiser sandte bald wieder einen tüchtigen Staatsmann, um nachzusehen, wie es mit dem Weben stehe. Es ging ihm aber gerade wie dem alten Minister. Er guckte und guckte, aber außer dem Webstuhl war da nichts zu sehen. "Ist das nicht ein prächtiges und hübsches Stück Stoff?", fragten die beiden Betrüger. Und sie zeigten dem Staatsmann das prächtige Muster, das gar nicht da war. "Dumm bin ich nicht", dachte der Mann. "Es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge! Das soll aber keiner wissen!" Der Staatsmann lobte also den Stoff, den er nicht sehen konnte und zeigte sich erfreut über die schönen Farben und das herrliche Muster. "Ja, es ist wahrhaft das Beste!", sagte er zum Kaiser.
Alle Menschen in der Stadt sprachen nur noch von dem prächtigen Stoff. Darum wollte der Kaiser ihn nun selber sehen. Der Kaiser wählte sogleich eine ganze Schar hervorragender Männer aus, darunter auch den alten Minister und den Staatsmann. Dann gingen sie zu den beiden Betrügern, die wieder webten, aber ohne Faser und Faden.
"Seht nur", sagte der alte Minister, "ist das nicht prächtig?" Und die Weber fragten: "Wollen Eure Majestät sehen, welches Muster, welche Farben?" Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, und erklärten den wundervollen Stoff in schönsten Worten.
"Oh weh", dachte der Kaiser, "ich sehe ja gar nichts! Das ist ja schrecklich! Bin ich dumm? Tauge ich nicht zum Amte eines Kaisers? Was soll ich nur tun?" Er überlegte kurz und sagte: "Nun, der Stoff ist sehr hübsch und verdient meinen Beifall!" Er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl von allen Seiten. Das ganze Gefolge sah zu und rieb sich die Augen, aber jeder sagte das Gleiche wie der Kaiser. Am Ende gaben sie dem Kaiser auch noch den Rat, die Wunderkleider das erste Mal bei dem großen Feste zu tragen, das bald bevorstand.
Die ganze Nacht vor dem Fest waren die Betrüger bei ihren Webstühlen zu sehen, damit man sie auch recht gut bei ihrer Arbeit beobachten konnte. Sie taten, als ob sie den Stoff aus dem Webstuhl nähmen, sie schnitten mit großen Scheren in der Luft, sie nähten mit Nadeln ohne Faden und sagten zuletzt: "Seht her, nun sind die Kleider fertig!"
Der Kaiser kam mit seinen vornehmsten Beamten, und beide Betrüger hoben einen Arm, gerade so, als ob sie etwas hielten. Sie sagten: "Eure Majestät, hier sind die Beinkleider. Hier ist das Kleid! Und hier ist der Mantel! Alles ist so leicht wie Spinnwebe. Man könnte glauben, man habe nichts auf dem Körper, aber das ist gerade die Schönheit dabei!"
"Ja", sagten alle Beamten, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da. "Belieben Eure Majestät nun die alten Kleider abzulegen", fragten die Betrüger, "dann wollen wir die neuen Kleider hier vor dem großen Spiegel anziehen!"
Der Kaiser legte seine Kleider ab, und die Betrüger stellten sich so auf, als würden sie ihm jedes Stück der neuen Kleider anziehen. Der Kaiser ließ es sich gefallen und wendete und drehte sich vor dem Spiegel. "Ei, wie herrlich die neuen Kleider sitzen!", riefen alle. "Welches Muster, welche Farben! Das ist ein wahrhaft kostbarer Anzug!" Der Kaiser wendete sich nochmals vor dem Spiegel, denn es sollte so aussehen, als wolle er seine Kleider noch einmal betrachten.
Die Kammerherren, die das Recht hatten, die Mantelschleppe zu tragen, griffen nun mit den Händen zum Fußboden. Sie taten so, als ob sie die Schleppe aufhöben, denn sie wagten es nicht, sich etwas anmerken zu lassen. So ging der Kaiser dann hinaus, und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen: "Des Kaisers neue Kleider sind wirklich unvergleichlich! Wie schön die Schleppe doch ist, und wie gut alles sitzt!"
Keiner wollte es sich anmerken lassen, dass er nichts sah. Denn jeder hatte Angst davor, als Taugenichts in seinem Amte oder als Dummkopf beschimpft zu werden. "Aber er hat ja gar nichts an!", sagte endlich ein kleines Kind. "Hört nicht darauf!", sagte der Vater. Aber man flüsterte sich jetzt gegenseitig zu, was das Kind gesagt hatte. Da rief plötzlich das ganze Volk: "Aber er hat ja gar nichts an!" Der Kaiser war zutiefst erschreckt, denn er spürte, dass es wohl die Wahrheit sein musste. "Nun", dachte sich der Kaiser, "es ist geschehen und ich muss jetzt Haltung und Würde bewahren." So trugen die Kammerherren auch weiterhin die unsichtbare Mantelschleppe, bis das Fest zu Ende war.
DER WASSERTROPFEN
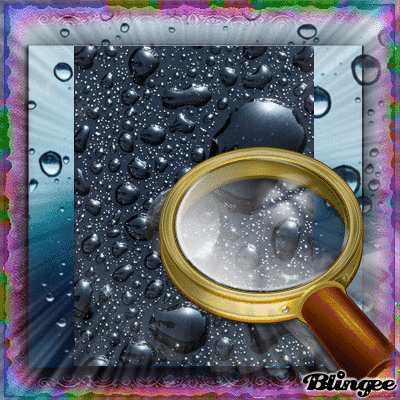
Du kennst doch wohl ein Vergrößerungsglas, so ein rundes Brillenglas, das alles hundertmal größer macht, als es ist. Wenn man es nimmt und vor das Auge hält und sich einen Wassertropfen aus dem Teiche draußen ansieht, so erblickt man über tausend wunderliche Tierchen, die man sonst nie im Wasser bemerkt; aber sie sind da, es ist so. Es sieht fast aus wie ein ganzer Teller voll Krabben, die zwischen einander herumspringen, und so freßgierig sind, daß sie einander Arme und Beine, Enden und Kanten wegreißen, und doch sind sie froh und vergnügt auf ihre Art.
Nun war einmal ein alter Mann, den alle Leute Kribbel-Krabbel nannten, denn so hieß er. Er wollte immer das Beste von einer Sache haben, und wenn es so nicht gehen wollte, dann nahm er es durch Zauberei.
Nun sitzt er eines Tages und hält sein Vergrößerungsglas ans Auge und betrachtet einen Wassertropfen, den er aus einer Pfütze beim Graben genommen hatte. Nein, wie es darin kribbelte und krabbelte! Alle die tausend winzigen Tierchen hüpften und sprangen, rissen an einander und fraßen von einander.
"Ja, aber das ist ja abscheulich!" sagte der alte Kribbel- Krabbel, "kann man sie nicht dazu bringen, daß sie in Frieden und Ruhe miteinander leben und jedes sich um sich selber bekümmert!" Und er dachte und dachte, aber es wollte nicht gehen, und da mußte er zaubern. "Ich muß ihnen Farbe geben, damit sie deutlicher zu sehen sind!" sagte er, und dann goß er etwas wie einen kleinen Tropfen Rotwein in den Wassertropfen, aber das war Hexenblut, und zwar von der allerfeinsten Sorte zu zwei Schilling, und so wurden all diese wunderlichen Tierchen rosenrot über den ganzen Körper; es sah aus wie eine ganze Stadt voller nackter, wilder Männer.
"Was hast Du da?" fragte ein anderer alter Zauberer, der keinen Namen hatte, und das war eben das Vornehme an ihm.
"Ja, kannst Du raten, was das ist," sagte Kribbel Krabbel, "dann will ich es Dir schenken; aber es ist nicht leicht herauszufinden, wenn man es nicht weiß!"
Und der Zauberer, der keinen Namen hatte, sah durch das Vergrößerungsglas. Es sah wirklich aus wie eine ganze Stadt, worin alle Menschen ohne Kleider herumliefen. Es war schauerlich; aber noch schauerlicher war es, zu sehen, wie der eine den anderen puffte und stieß, wie sie sich zwickten und zwackten einander bissen und rissen. Was unten war, sollte nach oben, und was oben war, sollte nach unten. "Sieh, sieh, sein Bein ist länger als meins! Baff. Weg damit. Da ist einer, der hat einen kleinen Knopf hinter dem Ohr, ein kleines unschuldiges Knöpfchen, aber es peinigt ihn, deshalb soll er noch mehr gepeinigt werden!" Und dann hackten sie darauf los und zerrten ihn hin und her, und sie fraßen ihn um des kleinen Knöpfchens willen. Da saß einer ganz stille wie eine kleine Jungfrau und wünschte sich nur Ruhe und Frieden. Aber nun mußte die Jungfrau heraus, und sie zerrten sie hervor, rissen sie entzwei und fraßen sie auf.
"Das ist außerordentlich unterhaltsam!" sagte der Zauberer.
"Was meinst Du wohl, was das ist?" fragte Kribbel-Krabbel. "Kannst Du es herausfinden?"
"Das ist ja leicht zu erkennen!" sagte der andere. "Das ist Kopenhagen oder irgendeine andere große Stadt, die sehen ja eins aus wie das andere. Eine große Stadt ist es."
"Es ist Grabenwasser" sagte Kribbel-Krabbel.
DIE JUNGFERN

Hast Du jemals eine Jungfer gesehen? Ich meine was die Steinsetzer eine Jungfer nennen, eine, mit der man die Pflastersteine feststampft. Sie ist ganz aus Holz, nach unten breit und mit eisernen Reifen beschlagen, und oben schmal und von einem Stab durchzogen, das sind ihre Arme.
In einem Hofe standen zwei solcher Jungfern, sie standen zwischen Schaufeln, Klaftermaßen und Schiebkarren, und dorthin drang das Gerücht, daß die Jungfern für die Zukunft nicht mehr "Jungfern," sondern "Stempel" genannt werden sollten, und das ist die neueste und einzig richtige Benennung in der Steinsetzersprache für das, was wir alle in alten Zeiten eine Jungfer nannten.
Nun gibt es unter uns Menschen etwas, was "emanzipierte Frauenzimmer," genannt wird, wozu Pensionats-Vorsteherinnen, Hebammen, Tänzerinnen, die in ihrem Berufe auf einem Bein stehen, Modistinnen und Pflegerinnen gezählt werden, und dieser Reihe von Emanzipierten schlossen sich auch die zwei Jungfern im Hofe an. Sie waren Jungfern bei der Wegebaubehörde und wollten unter keinen Umständen ihren guten alten Namen aufgeben und sich "Stempel" nennen lassen.
"Jungfer ist ein Menschenname," sagten sie, "aber Stempel ist ein Ding, und wir lassen uns nicht Ding nennen, das ist ein Schimpf für uns."
"Mein Verlobter ist imstande, die Verbindung mit mir zu lösen!" sagte die Jüngere, die mit einem Rammbock verlobt war; "das ist so eine große Maschine die Pfähle eintreibt, sie tut also im Groben, was die Jungfer im Feinen tut. Er will mich als Jungfer haben, aber als Stempel vielleicht nicht, also kann ich mich nicht umtaufen lassen!"
"Und ich lasse mir lieber beide Arme abbrechen!" sagte die Ältere.
Der Schiebkarren hatte jedoch eine andere Meinung darüber, und der Schiebkarren war etwas, er sah sich für eine Viertelkutsche an, da er ebenfalls auf einem Rade ging.
"Ich muß Ihnen sagen, daß Jungfer zu heißen ziemlich gewöhnlich ist und längst nicht so fein, als Stempel genannt zu werden; denn wenn man diesen Namen führt, wird man mit den Siegeln auf eine Stufe gestellt. Denken Sie nur an das Siegel des Reiches. Ich, an Ihrer Stelle, würde die Jungfer aufgeben!"
"Niemals. Dazu bin ich zu alt" sagte die Ältere.
"Sie wissen wohl nicht, was die europäische Notwendigkeit bedeutet!" sagte das ehrliche alte Klaftermaß. "Man muß sich einschränken, unterordnen, sich der Zeit und der Notwendigkeit fügen, und ist es ein Gesetz, wonach die Jungfer Stempel genannt werden soll, so muß sie Stempel genannt werden. Jedes Ding muß nach seinem eigenen Klaftermaß gemessen werden!"
"Da würde ich mich doch lieber Fräulein nennen lassen!" sagte die Jüngere, "wenn nun schon einmal geändert werden soll; Fräulein schmeckt doch immer noch etwas nach Jungfer."
"Aber ich lasse mich lieber kurz und klein hacken!" sagte die alte Jungfer.
Nun ging es an die Arbeit; die Jungfern fuhren, sie wurden auf den Schiebkarren gelegt, das war immerhin eine feine Behandlung, aber Stempel wurden sie doch genannt.
"Jung" sagten sie, indem sie das Steinpflaster stampften; "Jung" und sie waren nahe daran, das ganze Wort "Jungfer" auszusprechen; aber sie bissen kurz ab und schluckten herunter, was ihnen auf der Zunge schwebte, denn sie fanden, daß sie nicht einmal etwas entgegnen durften. Aber unter sich redeten sie sich mit dem Namen "Jungfer" an und priesen die guten alten Tage, als man noch jedes Ding bei seinem rechten Namen nannte und Jungfer genannt wurde wenn man Jungfer war. Und das blieben sie auch alle beide, denn der Rammbock, die große Maschine, hob wirklich die Verlobung mit der Jüngeren auf, mit einem Stempel wollte er sich nicht einlassen.
DER STURM ZIEHT MIT DEN SCHILDERN UM
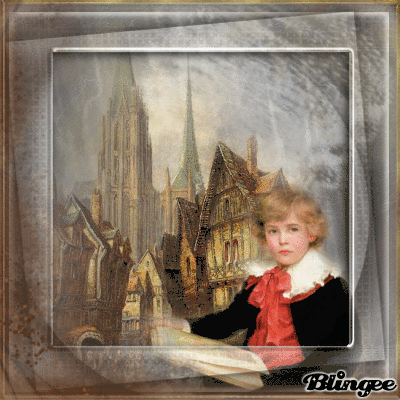
In alten Tagen, als Großvater ein ganz kleiner Knabe war und mit roten Höschen umherlief, auch mit einem roten Rocke, mit einen Gurt um den Leib und einer Feder aus der Casquette - denn so gingen die kleinen Knaben in seiner Kindheit gekleidet, wenn sie recht geputzt waren -, da war so vieles ganz anders wie jetzt; da war gar oft viel Staat auf der Straße, Staat, den wir nicht mehr sehen, weil er abgeschafft ist - er war zu altväterisch; aber unterhaltend ist es doch, Großvater davon erzählen zu hören.
Es muß damals wirklich ein Staat gewesen sein, als der Schuhmacher beim Wechsel des Gerichtshauses das Schild hinüberbrachte. Die seidene Fahne wehte; auf das Schild selber waren ein großer Stiefel und ein Adler mit zwei Köpfen gemalt; die jüngsten Buschen trugen das "Willkommen" und die Lade der Handwerker-Innung und hatten rote und weiße Bänder an ihren Hemdärmeln herabflattern; die älteren trugen gezogene Degen mit einer Zitrone auf der Spitze. Da war tolle Musik, und das prächtigste von allen Instrumenten war "der Vogel" wie Großvater die große Stange nannte mit dem Halbmonde daran und allen möglichen Tingeltangel; eine richtig türkische Musik. Die Stange wurde hoch in die Luft gehoben und geschwungen, daß es klingelte und klang und es einem die Augen blendete, wenn die Sonne auf das Gold, Silber und Messing schien.
Vor dem Zuge her lief der Harlekin in Kleidern von allen möglichen bunten Lappen zusammengenäht, mit schwarzem Gesicht und Glöckchen um den Kopf wie ein Schlittenpferd; der schlug mit seiner Pritsche auf die Leute ein, daß es klatschte, ohne ihnen Schaden zu tun, und die Leute drückten sich zusammen, um zurückzuweichen und gleich wieder hervorzukommen; kleine Knaben und Mädchen fielen über ihre eigenen Füße in den Rinnstein; alte Frauen pufften mit den Ellenbogen, machten saure Miene und schnupften. Der eine lachte, ein anderer schwatzte; das Volk war auf den Treppen und in den Fenstern, ja auf den Dächern. Die Sonne schien; ein wenig Regen bekamen sie auch, aber das war gut für den Landmann, und wenn sie so recht patschnaß wurden, so war das ein wahrer Segen für das Land.
Wie Großvater erzählen konnte! Er hatte als kleiner Knabe den Staat in der größten Pracht gesehen. Der älteste Gerichtsdiener hielt die Rede vom Gerüst, wo das Schild aufgehängt wurde; die Rede war in Versen, als ob sie gedichtet sei, und das war sie auch; es waren ihrer drei dazu gewesen; sie hatten erst eine tüchtige Terrine Punsch getrunken, um es recht gut zu machen.
Und das Volk brachte für die Rede ein Hurra aus, aber rief noch öfter: "Hurra für den Harlekin," als er auf dem Gerüst zum Vorschein kam und den Leuten einen schiefen Mund zog.
Der Narr machte einen ausgezeichneten Narren und trank Met aus Schnapsgläsern, die er dann unter das Volk schleuderte, wo sie von den Leuten aufgefangen wurden. Großvater war im Besitz eines solchen, das ihm ein Maurergeselle, der es erwischte, verehrt hatte. Das war wirklich belustigend. Das Schild an dem neuen Gerichtshause war mit Blumen behangen.
"Solch einen Staat vergißt man niemals, wie alt man auch werden mag," sagte Großvater, und er vergaß es auch nicht, obgleich er noch viel andere Pracht und Herrlichkeiten gesehen hatte und auch davon erzählte; das Ergötzlichste blieb aber doch immer, ihn von dem Schild erzählen zu hören, das in der großen Stadt von dem alten zu dem neuen Gerichtshause gebracht wurde.
Der Großvater reiste als kleiner Knabe mit seinen Eltern zu der Feierlichkeit; er hatte die größte Stadt des Landes vorher nie gesehen. Da waren so viele Menschen auf der Straße, daß er glaubte, man trüge schon das Schild fort; es gab da viele Schilder, man hätte hundert Stuben mit Bildern anfüllen können, hätte man sie inwendig und auswendig aufgehängt. Da waren bei dem Schneider alle Arten von Menschenkleidern abgemalt, und er konnte die Leute vom Groben bis zum Feinen benähen; da waren die Schilder von den Tabakswicklern, mit den anmutigsten kleinen Knaben welche Zigarren rauchten, ebenso wie in der Wirklichkeit; da waren Schilder mit Butter und Heringen, Priesterkragen und Särgen und außerdem Inschriften und Anschlagzettel; man konnte recht gut einen ganzen Tag in den Straßen auf und nieder gehen und sich an den Bildern müde sehen; dann wußte man aber auch das Ganze und welche Menschen in den Häusern wohnten, denn sie hatten ja ihr Schild selber herausgehängt, und das ist so gut, sagte der Großvater, und auch so lehrreich, gleich in einer großen Stadt zu wissen, wer darinnen wohnt.
So trug sich das mit den Schildern zu, als der Großvater in die Stadt kam; er hat es selbst erzählt, und er hatte keinen Schelm im Nacken, wie die Mutter glaubte, und hätte es mir gesagt, wenn er mir etwas weismachen wollte; er sah ganz zuverlässig aus.
Die erste Nacht, als er zur Stadt gekommen, war hier das fürchterlichste Wetter gewesen, wovon man noch jemals in der Zeitung gelesen: ein Wetter, wie sich niemals ein Mensch erinnerte erlebt zu haben. Die ganze Luft war mit Ziegelsteinen angefüllt; altes Holzwerk stürzte zusammen; ja ein Schubkarren lief ganz von selber die Straße hinauf, nur um sich zu retten. Es brüllte in der Luft, es heulte und kreischte, es war ein entsetzlicher Sturm. Das Wasser im Kanal lief über das Bollwerk hinaus, denn es wußte nicht, wo es bleiben sollte. Der Sturm fuhr über die Stadt hin und nahm die Schornsteine mit; mehr als eine alte, stolze Kirchturmspitze mußte sich beugen und hat das seitdem nie verwunden.
Da stand ein Schilderhaus, draußen, wo der alte, anständige Brand-Major wohnte, der immer mit der letzten Spritze kam; der Sturm wollte ihm das kleine Schilderhaus nicht gönnen, es wurde aus den Fugen gerissen und rollte die Straße hinab; und wunderbar genug erhob es sich wieder und blieb vor dem Hause des Zimmergesellen stehen, der bei dem letzten Brande drei Menschenleben gerettet hatte; aber das Schilderhaus dachte sich nichts dabei.
Das Schild vom Barbier, der große Messingteller, wurde heruntergerissen und gerade in die Fenstervertiefung des Justizrates geschleudert, und das sah fast wie Bosheit aus, so sagte die ganze Nachbarschaft, weil diese und die allerintimsten Freundinnen der Frau Justizrätin sie Rasiermesser nannten. Sie war so klug, daß sie von den Menschen mehr als die Menschen über sich selber wußte.
Da flog ein Schild mit einem abgerissenen, trocknen Klippfische gerade über die Tür eines Hauses, wo ein Mann wohnte, der eine Zeitung schrieb. Das war ein flauer Scherz von dem Sturmwinde, der nicht daran dachte, daß ein Zeitungsschreiber gar nicht geschaffen ist, um mit sich scherzen zu lassen, denn er ist ein König in seiner eigenen Zeitung und auch in seiner eigenen Meinung. Der Wetterhahn flog auf das gegenüberliegende Dach und stand da wie die schwärzeste Bosheit - sagten die Nachbarn.
Die Tonne des Faßbinders wurde unter "Damenputz" aufgehängt.
Des Gastwirts Speisezettel in einem schweren Rahmen, der an der Türe hing, wurde vom Sturme über den Eingang des Theaters gestellt, wo die Leute niemals hinkommen; es war ein lächerliches Plakat: "Meerrettichsuppe und gefülltem Kohlkopf," aber jetzt kamen die Leute.
Des Kürschners Fuchspelz, der sein ehrbares Schild ist, wurde an die Klingelschnur des jungen Mannes geschleudert, der immer in die Frühpredigt ging, wie ein herunter geschlagener Regenschirm aussah, nach Wahrheit strebte und, wie seine Tante sagte, ein "Exempel" war.
Die Inschrift "Höhere Bildungsanstalt" wurde über den Billardklub hingeschleudert, und die Anstalt selber bekam das Schild "Hier zieht man Kinder mit der Flasche auf"; das war gar nicht witzig, nur unartig, aber das hatte der Sturm getan, und den kann man nicht regieren.
Es war eine fürchterliche Nacht, und am Morgen - denkt nur - waren fast alle Schilder der Stadt verwechselt; an einigen Orten war es mit so großer Bosheit geschehen, daß Großvater gar nicht davon reden wollte, aber doch, wie ich ganz gut gesehen, inwendig lachte, und da ist es doch wohl möglich, daß er etwas hinter den Ohren hatte.
Die armen Leute in der Stadt, und ganz besonders die Fremden, irrten sich nun in den Menschen, und es konnte auch nicht gut anders sein, wenn sie sich nach dem Schilde richteten. So wollten einige zu einer ernsten Versammlung älterer Männer, wo die wichtigsten Dinge verhandelt werden sollten, und kamen nun in eine kreischende Knabenschule, wo alle über Tisch und Bänke sprangen.
Es waren auch Leute da, die die Kirche mit dem Theater verwechselten, und das ist doch entsetzlich!
Einen solchen Sturm hat es in heutiger Zeit nicht mehr gegeben, bloß Großvater hat ihn erlebt, und da war er noch sehr klein; ein solcher Sturm kommt vielleicht auch zu unseren Lebzeiten gar nicht vor, aber zu Lebzeiten unserer Enkel - dann wollen wir aber hoffen und beten, daß sie in ihren vier Wänden bleiben, wenn der Sturm mit den Schildern umzieht.
DER FLIEGENDE KOFFER

Es war einmal ein Kaufmann, der war so reich, daß er die ganze Straße und fast noch eine kleine Gasse dazu mit Silbergeld pflastern konnte; aber das that er nicht; er wußte sein Geld anders anzuwenden. Und gab er einen Schilling aus, so bekam er einen Thaler wieder: ein so kluger Kaufmann war er - bis er starb.
Der Sohn bekam nun all dieses Geld, und der lebte lustig, ging jede Nacht zur Maskerade, machte Papierdrachen aus Thalerscheinen und warf Fitschen auf der See mit Goldstücken, anstatt mit einem Steine. Auf diese Weise konnte das Geld schon alle werden, und das wurde es. Zuletzt besaß er nicht mehr als vier Schillinge, und hatte keine andern Kleider als ein Paar Pantoffeln und einen alten Schlafrock. Nun kümmerten sich seine Freunde nicht mehr um ihn, da sie ja nicht zusammen auf die Straße gehen konnten; aber einer von ihnen, der gutmüthig war, sandte ihm einen alten Koffer, mit der Bemerkung: "Packe ein!" Ja, das war nun recht schön, aber er hatte nichts einzupacken; darum setzte er sich selbst in den Koffer.
Das war ein merkwürdiger Koffer. Sobald man an das Schloß drückte, konnte der Koffer fliegen. Er drückte und wips! flog er mit ihm durch den Schornstein hoch über die Wolken hinauf, weiter und weiter fort. So oft aber der Boden ein wenig knackte, war er gar sehr in Angst, daß der Koffer in Stücke gehen möchte, denn alsdann hätte er einen ganz tüchtigen Purzelbaum gemacht - Gott bewahre uns! Auf solche Weise kam er nach dem Lande der Türken. Den Koffer verbarg er im Walde unter den verdorrten Blättern und ging dann in die Stadt hinein. Das konnte er auch ganz gut, denn bei den Türken gingen ja Alle so, wie er: in Schlafrock und Pantoffeln. Da begegnete er einer Amme mit einem kleinen Kinde. "Höre, Du Türkenamme," sagte er; "was ist das für ein großes Schloß hier dicht bei der Stadt, wo die Fenster so hoch sitzen?"
"Da wohnt die Tochter des Königs!" erwiederte sie. "Es ist prophezeit, daß sie über einen Geliebten sehr unglücklich werden würde, und deshalb darf Niemand zu ihr kommen, wenn nicht der König und die Königin mit dabei sind!"
"Ich danke!" sagte der Kaufmannssohn, und so ging er hinaus in den Wald, setzte sich in seinen Koffer, flog auf das Dach und kroch durch das Fenster zur Prinzessin hinein.
Sie lag auf dem Sopha und schlief; sie war so schön, daß der Kaufmannssohn sie küssen mußte. Da erwachte sie und erschrak gewaltig; aber er sagte, er sei der Türkengott, der durch die Luft zu ihr heruntergekommen wäre, und das gefiel ihr.
So saßen sie nebeneinander, und er erzählte ihr Geschichten von ihren Augen: das wären die herrlichsten, dunkeln Seen, und da schwämmen die Gedanken gleich Meerweibchen. Und er erzählte von ihrer Stirn; die wäre ein Schneeberg mit den prächtigsten Sälen und Bildern. Und er erzählte vom Storch, der die lieblichen kleinen Kinder bringt.
Ja, das waren schöne Geschichten! Dann freiete er um die Prinzessin, und sie sagte gleich ja!
"Aber Sie müssen am Sonnabend herkommen!" sagte sie. "Da sind der König und die Königin bei mir zum Thee! Sie werden sehr stolz darauf sein, daß ich den Türkengott bekomme. Aber sehen Sie zu, daß Sie ein recht hübsches Märchen wissen, denn das lieben meine Eltern ganz außerordentlich. Meine Mutter will es moralisch und vornehm, und mein Vater belustigend haben, sodaß man lachen kann!"
"Ja, ich bringe keine andere Morgengabe, als ein Märchen!" sagte er, und so schieden sie. Aber die Prinzessin gab ihm einen Säbel, der war mit Goldstücken besetzt, und die konnte er gerade gebrauchen.
Nun flog er fort, kaufte sich einen neuen Schlafrock und saß dann draußen im Walde und dichtete ein Märchen: das sollte bis zum Sonnabend fertig sein, und es ist doch nicht so leicht.
Er wurde fertig damit, und da war es Sonnabend.
Der König, die Königin und der ganze Hof warteten mit dem Tee bei der Prinzessin. Er wurde sehr nett empfangen!
"Wollen Sie uns nun ein Märchen erzählen?" fragte die Königin, "eins, das tiefsinnig und belehrend ist?"
"Aber worüber man doch lachen kann!" sagte der König.
"Ja wohl!" erwiederte er und erzählte; da muß man nun gut aufpassen.
""Es war einmal ein Bund Schwefelhölzer, die waren so außerordentlich stolz auf ihre hohe Herkunft! Ihr Stammbaum, das heißt: die große Fichte, wovon sie jedes ein kleines Hölzchen waren, war ein großer alter Baum im Walde gewesen. Die Schwefelhölzer lagen nun in der Mitte zwischen einem Feuerzeuge und einem alten eisernen Topfe, und diese erzählten von ihrer Jugend. "Ja, als wir auf dem grünen Zweige waren," sagten sie, "da waren wir wirklich auf dem grünen Zweige! Jeden Morgen und Abend gab es Diamantthee, das war der Thau; den ganzen Tag hatten wir Sonnenschein, wenn die Sonne schien, und alle die kleinen Vögel mußten Geschichten erzählen. Wir konnten wohl merken, daß wir auch reich waren, denn die Laubbäume waren nur im Sommer bekleidet, aber unsere Familie hatte Mittel zu grünen Kleidern sowohl im Sommer wie im Winter. Doch da kam der Holzhauer, das war die große Revolution, und unsere Familie wurde zersplittert. Der Stammherr erhielt eine Stelle als Hauptmast auf einem prächtigen Schiffe, welches die Welt umsegeln konnte, wenn es wollte; die andern Zweige kamen nach andern Orten, und wir haben nun das Amt, der niedrigen Menge das Licht anzuzünden. Deshalb sind wir vornehme Leute hierher in die Küche gekommen."
"Mein Schicksal gestaltete sich auf eine andere Weise," sagte der eiserne Topf, neben welchem die Schwefelhölzer lagen. "Von Anfang an, seit ich in die Welt kam, bin ich viele Mal gescheuert und gekocht worden! Ich sorge für das Solide und bin der Erste hier im Hause. Meine einzige Freude ist so nach Tisch rein und nett an meinem Platze zu liegen und ein vernünftiges Gespräch mit meinen Kameraden zu führen. Doch wenn ich den Wassereimer ausnehme, der hin und wieder einmal nach dem Hof hinunterkommt, so leben wir immer innerhalb unserer vier Wände. Unser einziger Neuigkeitsbote ist der Marktkorb, aber der spricht so unruhig über die Regierung und das Volk; ja, neulich war da ein alter Topf, der vor Schreck darüber niederfiel und sich in Stücke schlug. Der ist liberal, sage ich Euch!"
"Nun sprichst Du zu viel!" fiel das Feuerzeug ein, und der Stahl schlug gegen den Feuerstein, daß es sprühte. "Wollen wir uns nicht einen lustigen Abend machen?"
"Ja, laßt uns davon sprechen, wer der Vornehmste ist!" sagten die Schwefelhölzer.
"Nein, ich liebe es nicht, von mir selbst zu reden," wendete der Topf ein. "Laßt uns eine Abendunterhaltung veranstalten! Ich werde anfangen. Wir werden etwas erzählen, was ein Jeder erlebt hat; da kann man sich so leicht darein finden, und es ist so erfreulich. An der Ostsee bei den dänischen Buchen -"
"Das ist ein hübscher Anfang!" sagten alle Teller. "Das wird sicher eine Geschichte, die uns gefällt."
"Ja, da verlebte ich meine Jugend bei einer stillen Familie; die Möbel wurden gebohnert, der Fußboden gescheuert, und alle vierzehn Tage wurden reine Gardinen aufgehängt!"
"Wie Sie doch so interessant erzählen!" sagte der Kehrbesen. "Man kann gleich hören, daß ein Mann erzählt, der viel mit Frauen in Berührung gekommen ist; es geht so etwas Reines hindurch!"
"Ja, das fühlt man!" sagte der Wassereimer und machte vor Freuden einen kleinen Sprung, sodaß es auf dem Fußboden klatschte.
Und der Topf fuhr fort zu erzählen und das Ende war ebenso gut, als der Anfang.
Alle Teller klapperten vor Freude, und der Kehrbesen zog grüne Petersilie aus dem Sandloche und bekränzte den Topf, denn er wußte, daß es die Andern ärgern würde. "Bekränze ich ihn heute," dachte er, "so bekränzt er mich morgen."
"Nun will ich tanzen!" sagte die Feuerzange und tanzte. Gott bewahre uns, wie konnte sie das eine Bein in die Höhe strecken! Der alte Stuhlüberzug dort im Winkel platzte, als er es sah! "Werde ich nun auch bekränzt?" fragte die Feuerzange, und sie wurde es.
"Das ist doch nur Pöbel!" dachten die Schwefelhölzer.
Nun sollte die Teemaschine singen; aber die sagte, sie habe sich erkältet, sie könne nicht singen, wenn sie nicht koche. Allein das war bloße Vornehmthuerei: sie wollte nicht singen, wenn sie nicht drinnen bei der Herrschaft auf dem Tische stand.
Im Fenster stak eine alte Gänsefeder, mit der das Mädchen zu schreiben pflegte. Es war nichts Bemerkenswerthes an ihr, außer daß sie gar zu tief in die Tinte getaucht worden. Aber darauf war sie stolz. "Will die Teemaschine nicht singen," sagte sie, "so kann sie es bleiben lassen!
Draußen hängt eine Nachtigall im Käfig, die kann singen. Die hat zwar nichts gelernt, aber das wollen wir diesen Abend dahin gestellt sein lassen!"
"Ich finde es höchst unpassend," sagte der Teekessel - er war Küchensänger und Halbbruder der Theemaschine - "daß ein solcher fremder Vogel gehört werden soll! Ist das patriotisch? Der Marktkorb mag darüber richten!"
"Ich ärgere mich nur!" sagte der Marktkorb; "ich ärgere mich innerlich so, daß Niemand sich es denken kann! Ist das eine passende Art, den Abend hinzubringen? Würde es nicht vernünftiger sein, das Haus zurechtzusetzen? Ein Jeder müßte auf seinen Platz kommen, und ich würde das ganze Spiel leiten. Das würde etwas Anderes werden!"
"Ja, laßt uns Spektakel machen!" sagten Alle. Da ging die Türe auf. Es war das Dienstmädchen, und da standen sie stille. Keiner muckste! Aber da war nicht ein einziger Topf, der nicht gewußt hätte, was er zu tun vermöge und wie vornehm er sei. "Ja, wenn ich gewollt hätte," dachte Jeder, "so hätte es ein recht lustiger Abend werden sollen!"
Das Dienstmädchen nahm die Schwefelhölzer und machte Feuer damit an. - Gott bewahr' uns, wie die sprühten und in Flammen geriethen!
"Nun kann doch Jeder," dachten sie, "sehen, daß wir die Ersten sind! Welchen Glanz haben wir! Welches Licht!" - Und damit waren sie verbrannt."
"Das war ein herrliches Märchen!" sagte die Königin. "Ich fühlte mich so ganz in die Küche versetzt zu den Schwefelhölzern. Ja, nun sollst Du unsere Tochter haben."
"Ja wohl!" sagte der König; "Du sollst unsere Tochter am Montage haben!" Denn nun sagten sie "Du" zu ihm, da er zur Familie gehören sollte.
Die Hochzeit war nun bestimmt, und am Abend vorher wurde die ganze Stadt illuminirt. Zwieback und Brezeln wurden unter das Volk geworfen; die Straßenbuben standen auf den Zehen, riefen Hurrah und pfiffen auf den Fingern; es war außerordentlich prachtvoll.
"Ja, ich werde wohl auch Etwas zum Besten geben müssen!" dachte der Kaufmannssohn. Und so kaufte er Raketen, Knallerbsen und alles Feuerwerk, was man erdenken konnte, legte es in seinen Koffer und flog damit in die Luft.
Rutsch, wie das ging und wie das puffte!
Alle Türken hüpften dabei in die Höhe, daß ihnen die Pantoffeln um die Ohren flogen; eine solche Lufterscheinung hatten sie noch nie gesehen. Nun konnten sie begreifen, daß es der Türkengott selbst war, der die Prinzessin haben sollte.
Sobald der Kaufmannssohn wieder mit seinem Koffer herunter in den Wald kam, dachte er: "Ich will doch in die Stadt hineingehen, um zu erfahren, wie es sich ausgenommen hat!" Und es war ganz natürlich, daß er Lust dazu hatte.
Nein, was doch die Leute erzählten! Ein Jeder, den er danach fragte, hatte es auf seine Weise gesehen; aber schön hatten es Alle gefunden.
"Ich sah den Türkengott selbst," sagte der Eine. "Er hatte Augen, wie glänzende Sterne, und einen Bart, wie schäumende Wasser!" "Er flog in einem Feuermantel," sagte ein Anderer. "Die lieblichsten Engelskinder blickten aus den Falten hervor!"
Ja, das waren herrliche Sachen, die er hörte, und am folgenden Tage sollte er Hochzeit machen.
Nun ging er in den Wald zurück, um sich in seinen Koffer zu setzen - aber wo war der? Der Koffer war verbrannt. Ein Funken des Feuerwerks war zurückgeblieben, der hatte Feuer gefangen, und der Koffer lag in Asche. Er konnte nicht mehr fliegen, nicht mehr zu seiner Braut gelangen.
Sie stand den ganzen Tag auf dem Dache und wartete; sie wartet wahrscheinlich noch. Er aber durchwandert die Welt und erzählt Märchen, doch sind sie nicht mehr so lustig, wie das, welches er von den Schwefelhölzern erzählte.
DIE GALOSCHEN DES GLÜCKS
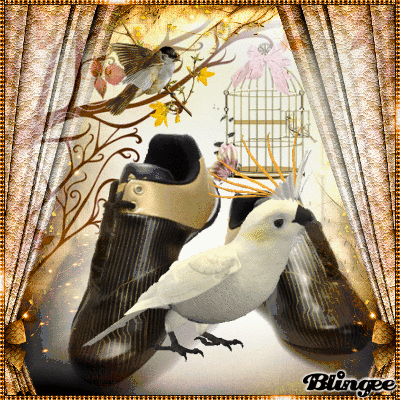
1. Ein Anfang.
Es war einmal in Kopenhagen in einem der Häuser in der Nähe vom Königsneumarkt eine große Gesellschaft eingeladen, denn das muß zwischendurch auch einmal sein, dann ist es abgemacht, und man kann auch wieder eingeladen werden. Die eine Hälfte der Gesellschaft saß schon an den Spieltischen, und die andere Hälfte wartete ab, was sich entwickeln würde, denn die Hausfrau hatte gesagt: "Nun, was tun wir jetzt!" Soweit war man nun, und die Unterhaltung ging ziemlich lebhaft.
Unter anderem kam auch die Rede auf das Mittelalter. Einzelne sahen es für weit schöner an als die Jetztzeit, ja, Justizrat Knap verteidigte diese Meinung so eifrig, daß die Frau des Hauses es sofort mit ihm hielt, und beide eiferten nun gegen Oerstedts Artikel im Almanach über alte und neue Zeit, worin unserem Zeitalter im wesentlichen der Vorrang eingeräumt wird. Justizrat Knap betrachtete die Zeit des dänischen Königs Hans als die hervorragendste und glücklichste.
Während dieses Wortkampfes für und wider, der kaum einen Augenblick aussetzte, als die Zeitung ankam, aber in der auch weiter nichts Lesenswertes stand, wollen wir in das Vorzimmer hinausgehen, wo Mäntel, Stöcke, Regenschirme und Galoschen ihren Platz hatten. Hier saßen zwei Mädchen, eine Junge und eine alt. Man glaubte, sie seien gekommen, um ihre Herrschaft heimzugeleiten, irgendein altes Fräulein oder eine Witwe; sah man sie aber genauer an, so bemerkte man bald, daß sie keine gewöhnlichen Dienstmädchen waren; dazu waren ihre Hände zu fein, ihre Haltung und die Art, sich zu bewegen, zu königlich, und auch die Kleider hatten einen ganz eigentümlich freien Schnitt. Es waren zwei Feen, die jüngere war wohl nicht das Glück selbst, aber eins der Kammermädchen ihrer Kammerjungfern, die die geringeren Gaben des Glückes verteilen, die ältere sah tiefernst aus. Es war die Trauer. Sie besorgt immer in höchsteigener Person ihre Angelegenheiten; dann weiß sie, daß sie wohl ausgeführt werden.
Sei erzählten einander, wo sie heute gewesen waren. Das Laufmädchen des Glückes hatte nur einige unbedeutende Sachen besorgt, sie hatte, wie sie sagte, einen neuen Hut vor dem Regen bewahrt, einem ehrlichen Manne einen Gruß von einer vornehmen Null verschafft und ähnliches, aber was nun noch übrig war, war etwas ganz Ungewöhnliches.
"Ich muß doch erzählen," sagte sie, "daß heute mein Geburtstag ist und dem zu Ehren sind mir ein Paar Galoschen anvertraut worden, die ich der Menschheit bringen soll. Diese Galoschen haben die Eigenschaft, daß jeder, der sie anzieht, sogleich an die Stelle oder in die Zeit versetzt wird, wo er am liebsten sein möchte. Jeder Wunsch in Hinsicht auf Zeit oder Ort wird augenblicklich erfüllt, und die Menschheit wird endlich einmal glücklich sein hinieden!"
"Ja," das glaubst du!" sagte die Trauer, "sie wird unglücklich werden und den Augenblick segnen, wo sie die Galoschen wieder los wird!"
"Wo denkst du hin!" sagte die andere. "Nun stelle ich sie hier an die Tür, einer irrt sich beim Zugreifen und wird der Glückliche!"
Sieh, das war ihr Gespräch!
2. Wie es dem Justizrat erging.
Es war spät. Justizrat Knap, noch ganz vertieft in König Hans Zeit, wollte nach Hause, und nun war es ihm beschieden, daß er an Stelle seiner Galoschen die des Glückes bekam, als er nun auf die Oststraße hinaustrat; jedoch durch der Galoschen Zauberkraft war er in die Zeit des Königs Hans zurückversetzt, und deshalb setzte er seinen Fuß mitten in Schlamm und Morast auf der Straße, da es in jenen Zeiten noch keine gepflasterten Wege gab.
"Es ist ja fürchterlich, wie schmutzig es hier ist!" sagte der Justizrat. Der ganze Bürgersteig ist weg, und alle Laternen sind aus!"
Der Mond war noch nicht aufgegangen und die Luft überdies ziemlich neblig, so daß alles ringsum im Dunkel verschwamm. An der nächsten Ecke hing jedoch eine Laterne vor einem Madonnenbilde, aber diese Beleuchtung war so gut wie keine, er bemerkte sie erst, als er gerade darunter stand und seine Augen auf das gemalte Bild mit Mutter und Kind fielen.
"Das ist wahrscheinlich," dachte er, "eine Kunsthandlung, wo vergessen worden ist, das Schild hereinzunehmen!"
Ein paar Menschen, in der damaligen Tracht, gingen an ihm vorbei.
"Wie sahen die denn aus! Sie kamen wahrscheinlich von einem Maskenfest!"
Da erklangen mit einem Male Trommeln und Pfeifen, und Fackeln leuchteten auf. Der Justizrat blieb stehen und sah nun einen wunderlichen Zug vorbeiziehen. Voran ging ein ganzer Trupp Trommelschläger die ihr Instrument recht artig bearbeiteten, ihnen folgten Trabanten mit Bogen und Armbrüsten. Der Vornehmste im Zuge war ein geistlicher Herr. Erstaunt fragte der Justizrat, was das zu bedeuten habe und wer jener Mann wäre.
"Das ist der Bischof von Seeland!" antwortete man ihm.
"Herrgott! was fällt denn dem Bischof ein?" seufzte der Justizrat und schüttelte mit dem Kopfe.
Der Bischof konnte es doch nicht gut sein. Darüber nachgrübelnd und nicht rechts, nicht links blickend ging der Justizrat durch die Oststraße über den Hohenbrückenplatz. Die Brücke zum Schloßplatz war nicht zu finden. Er sah undeutlich ein seichtes Flußufer und stieß hier endlich auf zwei Männer, die ein Boot bei sich hatten.
"Will der Herr nach dem Holm übergesetzt werden?" fragten sie.
"Nach dem Holm hinüber?" sagte der Justizrat, der ja nicht wußte, in welchem Zeitalter er herumwanderte. "Ich will nach Christianshafen hinaus in die kleine Torfgasse!"
Die Männer sahen ihn an.
"Sagt mir doch, wo die Brücke ist!" sagte er. "Es ist schändlich, daß hier keine Laternen angezündet sind, und dann ist es ein Schmutz hier, als ob man im Sumpf watete!"
Je länger er mit den Bootsmännern sprach, um so unverständlicher wurden sie ihm.
"Ich kann euer Bornholmisch nicht verstehen!" sagte er zuletzt wütend und wandte ihnen den Rücken.
Die Brücke konnte er nicht finden; ein Geländer war auch nicht da! "Es ist ein Skandal, wie es hier aussieht!" sagte er. Niemals hatte er sein Zeitalter elender gefunden, als an diesem Abend.
"Ich glaube, ich werde eine Droschke nehmen müssen!" dachte er, aber wo eine hernehmen? Zu sehen war jedenfalls keine. Ich werde zum Königsneumarkt zurückgehen müssen, dort halten wohl Wagen, sonst komme ich nie nach Christianshafen hinaus!"
Nun ging er die Oststraße zurück und war fast an ihrem Ende, als der Mond hervorkam.
"Herr Gott, was ist denn hier für ein Gerüst aufgestellt worden!" sagte er, als er das Osttor sah, das zu jener Zeit die Oststraße abschloß.
Endlich fand er doch eine kleine Pforte, und durch diese kam er bei unserem Neumarkt heraus, das war damals ein großer Wiesengrund; einzelnes Gesträuch wuchs wild durcheinander, und quer über die Wiese ging ein breiter Kanal oder Strom. Einige verwahrloste Holzbuden für die holländischen Schiffer, nach welchen der Ort den Namen "Hollandsau" trug, lagen auf dem gegenüberliegenden Ufer.
"Entweder sehe ich eine Fata Morgana, wie man es nennt, oder ich bin betrunken!" jammerte der Justizrat. "Was ist das nur! Was ist das nur!"
Er kehrte wieder zurück in dem festen Glauben daß er krank sei; als er in die Straße einbog, sah er sich die Häuser etwas genauer an. Die meisten waren aus Fachwerk, und viele hatten nur ein Strohdach.
"Nein, es geht mir doch gar nicht gut!" seufzte er, "und ich habe doch nur ein Glas Punsch getrunken aber ich kann ihn nicht vertragen! Und es war auch ganz und gar verkehrt, uns Punsch und warmen Lachs zu geben. Das werde ich der Dame auch einmal sagen. Ob ich zurückgehen und sie wissen lassen sollte, was das bei mir für Folgen hat. Aber das ist auch peinlich und wer weiß, ob sie überhaupt noch auf sind!" Er suchte nach dem Hause, konnte es aber nirgends finden.
"Es ist doch schrecklich! Ich kann die Oststraße nicht wiedererkennen! Nicht ein Laden ist da. Alte, elende Hütten sehe ich, als ob ich in Roskilde oder Ringstedt wäre! Ach, ich bin krank. Es nutzt nichts, sich zu genieren. Aber wo in aller Welt ist doch das Haus, aus dem ich eben fortging. Es ist nicht mehr dasselbe. Aber dort drinnen sind wenigstens noch Leute wach. Ach, ich bin ganz bestimmt krank!"
Nun stieß er auf eine halboffene Türe, durch deren Spalt Licht fiel. Es war eine der Herbergen der damaligen Zeit, eine Art Bierhaus. Die Stube hatte das Aussehen einer holsteinischen Diele. Eine ganze Menge guter Bürger, bestehend aus Schiffern, kopenhagener Patriziern und ein paar Gelehrten saßen hier in Gespräche vertieft bei ihren Krügen und gaben nur wenig acht auf den Eintretenden.
"Verzeihung!" sagte der Justizrat zu der Wirtin, die ihm entgegenkam, "mir ist plötzlich unwohl geworden! Wollen Sie mir nicht eine Droschke nach Christianshavn hinaus holen lassen?"
Die Frau sah ihn an und schüttelte den Kopf; darauf sprach sie ihn in deutscher Sprache an. Der Justizrat nahm an, daß sie der dänischen Zunge nicht mächtig sei und brachte daher seinen Wunsch auf deutsch vor; dies, wie auch seine Tracht bestärkten die Frau darin, daß sie einen Ausländer vor sich habe; daß er sich krank fühle, begriff sie schnell und gab ihm deshalb einen Krug Wasser, das freilich abgestanden schmeckte, obgleich es aus dem Brunnen war.
Der Justizrat stützte seinen Kopf in die Hand, holte tief Luft und grübelte über all das Seltsame rundum.
"Ist das "Der Tag" von heute abend?" fragte er, nur um etwas zu sagen, als er die Frau ein großes Stück Papier weglegen sah.
Sie verstand nicht, was er meinte, reichte ihm aber das Blatt. Es war ein Holzschnitt, der eine Lufterscheinung, die sich in der Stadt Köln gezeigt hatte, darstellte.
Das ist sehr alt!" sagte der Justizrat und wurde ganz aufgeräumt bei dem Gedanken, daß er ein so altes Stück entdeckt habe. "Wie sind Sie zu diesem seltenen Blatte gekommen? Das ist sehr interessant, obgleich es eine Fabel ist. Man erklärt sich dergleichen Lufterscheinungen als Nordlichter. Aber wahrscheinlich werden sie durch Elektrizität hervorgerufen!"
Diejenigen, die in der Nähe saßen und seine Rede gehört hatten, sahen verwundert zu ihm auf, und einer von ihnen erhob sich, lüftete ehrerbietig den Hut und sagte mit der ernsthaftesten Miene:
"Ihr seid gewiß ein hochgelehrter Herr, Monsieur!"
"O nein," erwiderte der Justizrat, "ich kann nur von diesem und jenen mitsprechen, wie es ja ein jeder können sollte!"
"Bescheidenheit ist eine schöne Tugend!" sagte der Mann. "Im übrigen muß ich zu Eurer Rede sagen, daß ich anderer Meinung bin, doch will ich hier gern mein Urteil zurückhalten!"
"Darf ich nicht fragen, mit wem ich das Vergnügen habe, zu sprechen?" fragte der Justizrat.
"Ich bin Baccalaureus der Heiligen Schrift!" antwortete der Mann.
Diese Antwort war dem Justizrat genug. Der Titel entsprach hier der Tracht; es ist sicher, so dachte er, ein alter Landschulmeister, so ein sonderlicher Kauz wie man sie noch ab und zu in Jütland da oben antrifft.
"Hier ist wohl nicht eigentlich der rechte Ort zu Gesprächen", begann der Mann, "doch bitte ich euch, euch zum Sprechen zu verstehen. Ihr seid gewiß sehr belesen in den Alten!"
"O ja, einigergmaßen!" antwortete der Justizrat, "ich lese gern alte, nützliche Schriften, aber ich habe auch viel für die neueren übrig, nur nicht für die , AIItagsgeschichten, die erleben wir genug in der Wirklichkeit! "Alltagsgeschichten?" fragte unser Baccalureus.
"Ja, ich meine diese neuen Romane, die man jetzt hat."
"O", lächelte der Mann, "sie enthalten doch viel Geist und werden auch bei Hofe gelesen; der König liebt besonders den Roman von Herrn Ivent und Herrn Gaudian, der von König Artus und den Rittern seiner Tafelrunde handelt. Er hat darüber mit seinen hohen Herren gescherzt!"
"Ja, den habe ich noch nicht gelesen!" sagte der Justizrat, "das muß etwas ganz neues sein, das Heiberg herausgegeben hat!"
"Nein", antwortete der Mann, "der ist nicht bei Heiberg herausgekommen. sondern bei Gottfried von Gehmen!"
"So ist das der Verfasser?" fragte der Justizrat. "Das ist ein sehr alter Name. Das ist ja der erste Buchdrucker, den es in Dänemark gab."
"Ja, das ist unser erster Buchdrucker!" sagte der Mann. Bis dahin ging alles gut; nun sprach einer der guten Bürgersleute von der schrecklichen Pestilenz, die vor ein paar Jahren geherrscht habe, und meinte damit die vom Jahre 1484. Der Justizrat nahm an, daß von der Cholera die Rede sei, und so ging der Diskurs recht gut vonstatten. Der Freibeuterkrieg von 1490 lag nahe, daß er berührt werden mußte. Die englischen Freibeuter hätten die Schiffe von der Reede genommen, meinten sie, und der Justizrat, der sich so recht in die Begebenheiten von 1801 hineingelebt hatte, stimmte vortrefflich gegen die Engländer mit ein. Die übrige Unterhaltung dagegen lief nicht so gut ab.
Jeden Augenblick schulmeisterten sie sich gegenseitig. Der gute Baccalaureus war doch allzu unwissend, und ihm erschienen des Justizrats einfachste Bemerkungen zu dreist und fantastisch. Sie sahen einander scharf an, und wurde es gar zu arg, so sprach der Baccalaureus Latein, weil er glaubte, so besser verstanden zu werden, aber es half nicht viel.
"Wie geht es euch!" fragte die Wirtin und zog den Justizrat am Ärmel; da kehrte seine Besinnung zurück, denn beim Gespräche hatte er alles vergessen, was vorausgegangen war.
"Herrgott, wo bin ich?" fragte er, und es schwindelte ihm, während er es bedachte.
"Klaret wollen wir trinken! Met und Bremer Bier!" rief einer der Gäste, "und Ihr sollt mithalten!"
Zwei Mädchen kamen herein. Die eine hatte eine zwiefarbene Haube. Sie schenkten ein und neigten sich zu ihm. Dem Justizrat lief es eiskalt über den Rücken.
"Was ist das nur! Was ist das nur!" sagte er, aber er mußte mit ihnen trinken. Sie ergriffen ganz artig Besitz von dem guten Mann, und er war aufs höchste verzweifelt. Als dann einer sagte, er sei betrunken, zweifelte er durchaus nicht an des Mannes Wort und bat ihn nur, ihm doch ein Droschke herbeizuschaffen. Da glaubten sie, er rede moskowitisch.
Niemals war er in so roher und beschränkter Gesellschaft gewesen. "Man könnte fast glauben, das Land sei zum Heidentum zurückgekehrt", meinte er, "dies ist der schrecklichste Augenblick meines Lebens!"
Aber gleichzeitig kam ihm der Gedanke, sich unter den Tisch zu bücken, zur Tür hinzukriechen und zu sehen, wie er hinausschlüpfen könne. Aber als er am Ausgange war, merkten die anderen, was er vorhatte; sie ergriffen ihn bei den Beinen, und da, zu seinem größten Glück, gingen die Galoschen ab – und mit diesen der ganze Zauber.
Der Justizrat sah ganz deutlich eine helle Laterne vor sich brennen, und hinter dieser lag ein großes Haus, er erkannte es ebenso wie die Nachbarhäuser. Es war die Oststraße, wie wir sie alle kennen. Er selbst lag mit den Beinen gegen eine Tür, und geradeüber saß der Wächter und schlief.
"Du mein Schöpfer, habe ich hier auf der Straße gelegen und geträumt!" sagte er. "Ja, das ist die Oststraße! Wie prächtig hell und bekannt! Es ist doch schrecklich, wie das Glas Punsch auf mich gewirkt haben muß!"
Zwei Minuten später saß er in einer Droschke, die mit ihm nach Christianshafen fuhr. Er dachte an all die Angst und Not, die er überstanden hatte, und pries aus ganzem Herzen die glückliche Wirklichkeit, unsere Zeit, die mit all ihren Mängeln doch weit angenehmer war, als die, in der er sich kürzlich befunden hatte. Und es war vernünftig von dem Justizrat gedacht!
3. Des Wächters Abenteuer.
"Da liegen wahrhaftig ein Paar Galoschen!" sagte der Wächter. "Die gehören sicher dem Leutnant, der hier oben wohnt. Sie liegen gerade bei der Tür!"
Gern hätte der ehrliche Mann geläutet und sie abgeliefert, denn es war noch Licht, aber er wollte die anderen Leute im Hause nicht werken und deshalb ließ er es sein.
"Das muß schön warm sein, so ein paar Dinger anzuhaben!" sagte er. "Sie sind so weich im Leder!"
Sie paßten gerade an seine Füße. "Wie merkwürdig ist doch die Welt eingerichtet. Nun könnte er sich da oben in sein gutes Bett legen, aber nein, er tut es nicht. Auf und ab trabt er auf dem Fußboden! Das ist ein glücklicher Mensch! Er hat weder Frau noch Kind. Jeden Abend ist er in Gesellschaft. Ach, wäre ich doch er, ja, dann wäre ich ein glücklicher Mann!"
Als er seinen Wunsch aussprach, wirkten die Galoschen, die er angezogen hatte, und der Wächter ging in des Leutnants ganze Person und Denkweise über.
Da stand er oben im Zimmer und hielt ein kleines rosenrotes Papier zwischen den Fingern, worauf ein Gedicht stand, ein Gedicht von dem Herrn Leutnant selbst; denn wer wäre nicht einmal in seinem Leben in der Stimmung zum Dichten gewesen, und schreibt man dann seine Gedanken nieder, dann hat man die Verse! Hier stand geschrieben:
Ach wär' ich reich! dacht ich manch liebes Mal,
Als ich kaum einen halben Meter groß.
Ach wär' ich reich! So würd' ich General
Bekäme Säbel, Uniform und Roß.
Bald kommt die Zeit, da werd' ich General
Doch eh ich reich, bin sicher längst ich tot –
O Herr, mein Gott!
Jung, lebensfroh, saß ich zur Abendstund,
und, da ich reich an Märchen und Geschichten,
küßt' mich die Siebenjährige auf den Mund.
An Geld gehört' ich zu den armen Wichten.
Die Kleine fragte doch nur nach Geschichten.
Da war ich reich! Doch nicht an Golde rot –
O Herr. mein Gott!
Ach, wär' ich reich! so fleht' mein ganz Gemüt.
Sie, die so schön, so klug, so herzensgut –
das Mägdlein ist zur Jungfrau aufgeblüht.
Verstünd' sie doch das Flehn in meinem Blut!
Sie tät es sicher, wär' sie mir noch gut.
Doch, da ich arm, verschweig ich meine Not –
O Herr, mein Gott!
Ja, solche Verse schreibt man, wenn man verliebt ist, aber ein besonnener Mann läßt sie nicht drucken. Leutnant, Liebe und Armut, das ist ein Dreieck, oder auch, das ist die Hälfte des zerbrochenen Glückswürfels. Das fühlte der Leutnant auch, und darum legte er sein Haupt gegen den Fensterrahmen und seufzte ganz tief:
"Der armselige Wächter auf der Straße draußen ist weit besser daran als ich! Er kennt nicht, was ich Mangel nenne. Er hat ein Heim, Frau und Kinder, die mit ihm im Kummer weinen und sich mit seiner Freude freuen! O, ich wäre glücklicher, als ich bin, könnte ich seine Person und Denkweise annehmen, denn er ist glücklicher als ich!"
In demselben Augenblick war der Wächter wieder Wächter, denn durch die Galoschen des Glückes war er der Leutnant geworden; aber, wie man sieht, fühlte er sich noch viel weniger zufrieden und wollte doch lieber das sein, was er eigentlich war. Also der Wächter war wieder Wächter.
"Das war ein häßlicher Traum!" sagte er, "aber merkwürdig genug. Mir war, als sei ich der Leutnant da oben, und das war durchaus kein Vergnügen. Ich entbehrte Mutter und die Kleinen, die immer bereit sind, mir die Augen herauszuküssen!"
Da saß er nun wieder und nickte. Der Traum wollte ihm nicht recht aus dem Sinn, und die Galoschen saßen immer noch an seinen Füßen. Eine Sternschnuppe fiel leuchtend vom Himmel.
"Weg ist sie nun!" sagte er, "aber es sind immer noch genug da! Mich gelüstete es wohl, mir die Dinger ein bißchen näher anzusehen, besonders den Mond, denn der verschwindet einem doch nicht unter den Händen. Wenn wir sterben, sagte der Student, für den meine Frau wäscht, fliegen wir von dem einen zum anderen. Das ist zwar eine Lüge, könnte aber ganz hübsch sein. Wenn ich den kleinen Sprung da hinauf machen könnte, so könnte meinetwegen der Körper gern hier auf der Treppe liegen bleiben!"
Seht, es gibt nun gewisse Dinge auf Erden, die mit Vorsicht zu genießen sind, ganz besonders aber soll man acht geben, wenn man die Galoschen des Glückes an den Füßen hat. . . Hört nur, wie es dem Wächter erging.
Was uns Menschen angeht, so kennen wir ja fast alle die Geschwindigkeit, die durch den Dampf erzeugt werden kann. Wir haben es entweder auf den Eisenbahnen oder mit den Schiffen über das Meer erprobt, doch ist dieser Flug wie die Wanderung des Faultieres oder der Gang der Schnecke, gemessen "an der Schnelligkeit des Lichts. Es fliegt neunzehnmillionenmal schneller als der beste Wettläufer. Und doch ist die Elektrizität noch schneller. Der Tod ist ein elektrischer Stoß in unser Herz; auf den Schwingen der Elektrizität fliegt die befreite Seele. Acht Minuten und wenige Sekunden braucht das Sonnenlicht zu einer Reise von über zwanzig Millionen Meilen. Mit der Eilpost der Elektrizität braucht die Seele noch weniger Minuten, um denselben Flug zu machen. Der Raum zwischen den Weltkörpern ist für sie nicht größer, als für uns der Raum zwischen den Häusern unserer Freunde in ein und derselben Stadt, selbst wenn diese ziemlich nahe beieinander liegen sollten. Indessen kostet uns dieser elektrische Herzstoß den Gebrauch unserer Glieder hier auf der Erde, falls wir nicht, wie der Wächter hier, die Galoschen des Glücks anhaben.
In wenigen Sekunden war der Wächter die 52 000 Meilen zum Mond hinauf gefahren, der, wie man weiß, aus einem viel leichteren Stoff geschaffen ist als unsere Erde und weich wie frischgefallener Schnee. Er befand sich auf einem der unzählbar vielen Ringberge, die wir aus Dr. Mädlers großer Mondkarte kennen. Denn die kennst du doch? Innerhalb fiel der Ringberg steil ab in einen Kessel, der sich eine ganze dänische Meile weit hinzog. Dort unten lag eine Stadt, die aussah, wie wenn man Eiweiß in ein Glas Wasser schlägt, ebenso weich und mit ähnlich gekuppelten Türmen und segelförmigen Altanen, durchsichtig und fließend in der dünnen Luft. Unsere Erde schwebte gleich einer großen feuerroten Kugel über seinem Haupt.
Da gab es viele Geschöpfe, die wir sicher mit "Menschen" bezeichnen würden, aber sie sahen ganz anders aus, als wir, sie hatten auch eine Sprache; aber niemand kann ja verlangen, daß des Wächters Seele sie verstehen konnte. Trotzdem konnte sie es.
Des Wächters Seele verstand die Sprache der Mondbewohner sehr gut. Sie disputierten über unsere Erde und bezweifelten, daß sie bewohnt wäre, die Luft müsse dort viel zu dick sein, als daß irgendein vernünftiges Mondgeschöpf darin leben könnte. Sie glauben daß der Mond allein lebende Wesen beherberge.
Aber wenden wir uns wieder herab in die Oststraße und sehen wir, wie es dem Körper des Wächters erging.
Leblos saß er auf der Treppe, der Spieß war ihm aus der Hand gefallen, und die Augen blickten zum Monde hinauf zu der ehrlichen Seele, die da oben spazierte.
"Was ist die Uhr, Wächter?" fragte ein Vorbeigehender. Aber wer nicht antwortete, war der Wächter. Da gab ihm der Mann einen sachten Nasenstüber. Aber nun war es aus mit dem Gleichgewicht. Da lag der Körper, so lang er war, der Mensch war tot. Der, der ihm den Nasenstüber verabreicht hatte, erschrak von Herzen. Der Wächter war tot, und tot blieb er auch. Es wurde gemeldet und besprochen, und in der Morgenstunde trug man den Körper aufs Hospital hinaus.
Das konnte ja ein netter Spaß für die Seele werden, wenn sie zurückkehrte und aller Wahrscheinlichkeit nach den Körper in der Oststraße suchen ging und ihn nicht fand. Zuerst würde sie sicherlich auf die Polizei laufen, damit von dort aus unter den verlorenen Sachen nachgesucht würde, und zuletzt nach dem Hospital hinaus; doch wir können uns damit trösten, daß die Seele am klügsten tut, wenn sie auf eigene Faust handelt. Der Körper macht sie nur dumm.
Wie gesagt, des Wächters Körper kam aufs Hospital und wurde dort in die Reinigungskammer gebracht. Das erste, was man dort tat, war natürlich, die Galoschen auszuziehen, und da mußte die Seele zurück. Sie schlug sogleich die Richtung nach dem Körper ein, und mit einemmal kam Leben in den Mann. Er versicherte, daß dies die schrecklichste Nacht in seinem gewesen sei, und dies nicht für einen Taler noch einmal durchmachen wolle, aber nun war es ja überstanden.
Am selben Tage wurde er wieder entlassen, aber die Galoschen blieben im Hospital.
4. Ein Hauptmoment. Eine Deklamationsnummer.
Eine höchst ungewöhnliche Reise.
Ein jeder Kopenhagener weiß, wie der Eingang zum Friedrichshospital aussieht, aber da wahrscheinlich auch einige Nicht-Kopenhagener diese Geschichte lesen werden, müssen wir eine kurze Beschreibung geben.
Das Hospital ist von der Straße durch ein ziemlich hohes Gitter getrennt, in welchem die dicken Eisenstangen so weit voneinander abstehen, daß, wie erzählt wird, sich sehr dünne Leute hindurch geklemmt haben und auf diesem Wege ihre kleinen Visiten abgemacht haben. Der Körperteil, der am schwierigsten hinauszupraktizieren war, war der Kopf. Hier, wie überall in der Welt, waren also die kleinen Köpfe die glücklichsten. Das wird als Einleitung genügen.
Einer der Jungen Hülfsärzte, von dem man nur in körperlicher Hinsicht behaupten konnte, daß er einen großen Kopf habe, hatte gerade an diesem Abend Wache. Es war strömender Regen, doch ungeachtet dieser beiden Hindernisse mußte er hinaus, nur auf eine Viertelstunde, aber es war nichts so Wichtiges, daß es dem Pförtner gemeldet werden mußte, wenn man durch die Eisenstangen hinausschlüpfen konnte. Da standen die Galoschen, die der Wächter vergessen hatte. Es kam ihm nicht in den Sinn, daß es die des Glückes sein könnten. Aber in diesem Wetter waren sie gut zu gebrauchen; er zog sie an. Nun kam es darauf an, ob er sich hindurchklemmen konnte, er hatte es früher nie versucht. Da stand er nun.
"Gotte gebe, daß ich erst den Kopf draußen habe!", sagte er und sogleich, obgleich er sehr dick und groß war, glitt er leicht und glücklich hindurch, das mußten die Galoschen verstehen; aber nun sollte der Körper auch hinaus, der stand noch drinnen.
"Ach Gott, ich bin zu dick!" sagte er, "ich habe geglaubt, der Kopf sei das schlimmste! Ich komme nicht hindurch."
Nun wollte er schnell den Kopf zurückziehen, aber das ging nicht. Den Hals konnte er zwar bequem bewegen, aber das war auch alles. Das erste Gefühl war, daß er sich ärgerte, das zweite, daß seine Laune unter Null fiel. Die Galoschen des Glückes hatten ihn in die unangenehmste Lage gebracht, und unglücklicherweise verfiel er nicht auf den Gedanken, sich frei zu wünschen, nein, er handelte und kam daher nicht von der Stelle. Der Regen strömte nieder, nicht ein Mensch war auf der Straße zu sehen. Die Torglocke konnte er nicht erreichen. Wie sollte er nur loskommen! Er sah voraus, daß er bis zum Morgen hier stehen könne. Dann mußte man erst nach einem Schmied senden, damit die Eisenstangen durchgefeilt werden könnten. Aber das ging auch nicht so geschwind. Die ganze Knabenschule gerade gegenüber würde auf die Beine kommen; alle Krankenhausinsassen würden zusammen laufen, um ihn am Pranger zu sehen. Er würde eine ganz andere Attraktion abgeben, als die Riesenagave im vorigen Jahr. "Ach je, das Blut steigt mir zu Kopfe rein zum irrsinnig werden! Ja, ich werde verrückt! Ach wäre ich doch erst wieder heraus, dann ginge es wohl vorüber!"
Seht, hätte er das ein wenig früher gesagt! Augenblicklich, der Gedanke war kaum ausgesprochen, so war sein Kopf auch schon frei, und er stürzte nun hinein, ganz verstört über den Schreck, den ihm die Galoschen des Glückes gebracht hatten.
Nun brauchen wir nicht etwa zu glauben, daß das Ganze hiermit vorüber sei, nein, es kommt noch schlimmer.
Die Nacht und der folgende Tag vergingen, und die Galoschen wurden nicht abgeholt.
Am Abend sollte eine Vorstellung in einem kleinen Theater stattfinden. Das Haus war gepfropft voll. Unter anderen Darbietungen wurde auch ein Gedicht vorgetragen; "Tante's Brille" hieß es und handelte von einer Brille, durch die gesehen die Menschheit offen wie ein Kartenspiel vor einem lag, so daß man aus dessen Blättern und Figuren die nächste Zukunft mit ihren Geschehnissen voraussehen konnte.
Das Gedicht wurde meisterlich vorgetragen und der Deklamator machte großes Glück damit. Unter den Zuschauern war auch der junge Hülfsarzt vom Hospital, der sein Abenteuer von der letzten Nacht bereits vergessen zu haben schien. Er hatte die Galoschen an, denn sie waren immer noch nicht abgeholt worden, und die Straßen waren schmutzig, sodaß sie ihm gute Dienste leisten konnten.
Das Gedicht gefiel ihm. Die Idee, solche Brille zu besitzen, beschäftigte ihn sehr. Vielleicht konnte man, wenn man sie richtig gebrauchte, den Leuten auch ins Herz hinein schauen. Er hätte das interessanter gefunden, als in die nächste Zukunft schauen zu können; denn das bekommt man ja nach und nach doch zu er fahren. Dagegen, wie es in den Herzen der Anderen aussieht, erfährt man niemals. "Ich denke mir nun die ganze Reihe von Herren und Damen auf der ersten Bank – könnte man ihnen gerade ins Herz hineinsehen, ja dann müßte doch eine Öffnung dazu da sein, so eine Art Laden. Ei, wie würden meine Augen im Laden umherschweifen! Bei dieser Dame dort würde ich sicher einen großen Modehandel finden! Bei dieser hier ist wohl der Laden leer, doch könnte eine Säuberung nichts schaden. Aber es würden wohl auch solide Läden zu finden sein! "Ach ja," seufzte er, "ich weiß wohl einen solchen Laden, in dem alles solide ist, aber es ist schon ein Gehülfe drinnen, das ist das einzige Üble an dem ganzen Laden! Aus dem einen oder anderen würde wohl auch gerufen: "Bitte sehr, treten Sie nur ein!" Ja, ich möchte wohl gern hinein, könnte man nur wie ein netter kleiner Gedanke durch die Herzen wandern!"
Seht, das genügte wieder für die Galoschen. Der ganze Hülfsarzt schrumpfte zusammen, und eine höchst ungewöhnliche Reise begann mitten durch die Herzen der ersten Reihe der Zuschauer. Das erste Herz, durch das er kam, gehörte einer Dame; aber augenblicklich glaubte er in ein orthopädisches Institut gekommen zu sein, wo der Arzt den Menschen Knoten wegmassiert, und Gipsabgüsse von verwachsenen Gliedern an den Wänden hängen, doch war der Unterschied der, daß in einem solchen Institut die Abgüsse genommen werden, wenn die Patienten hinkommen, aber hier im Herzen wurden sie genommen und aufbewahrt, wenn die guten Leute hinausgegangen waren. Es waren Abgüsse von körperlichen und geistigen Fehlern der Freundinnen, die hier aufbewahrt wurden.
Schnell war er bereits in einem anderen weiblichen Herzen, aber es erschien ihm wie eine große heilige Kirche. Der Unschuld weiße Taube flatterte um den Hochaltar, wie gerne wäre er in die Knie gesunken, aber fort mußte er, ins nächste Herz hinein; aber er hörte noch die Orgeltöne und fühlte, daß er selbst ein neuer und besserer Mensch geworden und nicht unwürdig war, ein neues Heiligtum zu betreten. Das zeigte ihm eine ärmliche Dachkammer mit einer kranken Mutter darin.
Aber durch die offenen Fenster strahlte Gottes warme Sonne, herrliche Rosen nickten aus dem kleinen Blumenkasten auf dem Dache, und zwei himmelblaue Vögel sangen von kindlichen Freuden, während die kranke Mutter Gottes Segen auf die Tochter herabflehte.
Nun kroch er auf Händen und Füßen durch einen überfüllten Schlächterladen. Da war Fleisch und immer nur Fleisch, worauf er auch stieß; es war das Herz eines reichen, geachteten Mannes, dessen Name allgemein bekannt war. Nun war er im Herzen seiner Gemahlin. Das war ein alter, verfallener Taubenschlag. Das Bild des Mannes wurde nur als Wetterhahn gebraucht, der mit den Türen in Verbindung stand, und so öffneten und schlossen sie sich, je nachdem der Mann sich drehte.
Darauf kam er in ein Spiegelkabinett, wie das, was wir im Rosenborg-Schloß haben. Aber die Spiegel Vergrößerten in unglaublichem Maße. Mitten auf dem Fußboden saß, wie ein Dalai-Lama, das unbedeutende Ich dieser Person in erstaunter Bewunderung seiner eigenen Größe.
Hierauf glaubte er sich in einer engen Nadelbüchse eingeschlossen, die voller spitziger Nadeln war. "Das ist bestimmt das Herz einer alten unverheirateten Jungfrau!" mußte er denken, aber das war nicht der Fall; es war ein ganz junger Militär mit mehreren Orden, ein Mann der, wie man zu sagen pflegt, Geist und Herz just auf dem rechten Fleck hat.
Ganz betäubt kam der arme Sünder von Hülfsarzt aus dem letzten Herzen in der Reihe. Er vermochte kaum, seine Gedanken zu ordnen und dachte, daß seine allzufeurige Phantasie mit ihm durchgegangen sei.
"Herr Gott," seufzte er, "ich habe bestimmt Anlage dazu,` den Verstand zu verlieren. Hier drinnen ist es auch unverzeihlich heiß! Das Blut steigt mir zu Kopf!" Und nun erinnerte er sich plötzlich der großen Begebenheit von gestern Nacht, wie er mit dem Kopfe zwischen den Eisenstangen vor dem Hospital fest gesessen hatte. "Dabei habe ich mir sicherlich etwas geholt!" meinte er. "Ich muß bei Zeiten etwas dagegen tun. Russisches Bad würde vielleicht gut tun. Wenn ich nur erst auf dem obersten Brett läge!"
Und da lag er auf dem obersten Brett im Dampfbad, aber er lag da mit allen Kleidern, mit Stiefeln und Galoschen. Die heißen Wassertropfen von der Decke tröpfelten ihm ins Gesicht.
"Hu!" schrie er und fuhr hinab, um ein Sturzbad zu nehmen. Der Aufwärter gab auch einen lauten Schrei von sich, als er den völlig bekleideten Menschen hier drinnen entdeckte.
Der Hülfsarzt hatte indessen gerade noch soviel Fassung, um ihm zuzuflüstern: "Es war wegen einer Wette!" Das erste jedoch, was er tat, als er auf sein eigenes Zimmer kam, war, sich ein großes spanisches Zugpflaster auf den Nacken und eins unten auf den Rücken zu legen, damit die Verrücktheit herausgezogen würde.
Am nächsten Morgen hatte er einen blutigen Rücken, das war alles, was er durch die Galoschen des Glückes gewonnen hatte.
5. Die Verwandlung des Schreibers.
Der Wächter, den wir sicher noch nicht vergessen haben, gedachte mittlerweile der Galoschen, die er gefunden und mit nach dem Hospital hinausgebracht hatte. Er holte sie ab, aber da weder der Leutnant, noch irgend ein anderer in der Straße sich zu ihnen bekennen wollte, wurden sie auf der Polizei abgeliefert.
"Sie sehen genau wie meine Galoschen aus!", sagte einer der Herren Schreiber, indem er den Fund betrachtete und sie an die Seite der seinigen stellte. "Da gehört mehr als ein Schuhmacherauge dazu, um sie auseinander zu halten!"
"Herr Schreiber!" rief ein Diener, der mit einigen Papieren hereintrat.
Der Schreiber wandte sich um und sprach mit dem Manne. Aber als das erledigt war, und er auf die Galoschen sah, befand er sich sehr im Ungewissen, ob die zur Linken oder zur Rechten es waren, die ihm gehörten. "Es müssen die sein, die naß sind," dachte er, aber das war gerade fehlgeraten, denn es waren die des Glückes; aber warum sollte die Polizei sich nicht auch einmal irrem Er zog sie an, steckte einige Papiere in die Tasche, andere nahm er unter den Arm, denn sie sollten zuhause durchgelesen und abgeschrieben werden; aber da es gerade Sonntagvormittag und das Wetter gut war, dachte er: "ein Spaziergang nach Friedrichsburg würde mir gut tun!" und so ging er dorthin.
Niemand konnte ruhiger und fleißiger sein, als dieser junge Mann. Wir gönnen ihm diesen kleinen Spaziergang von Herzen, denn er würde ihm gewiß wohltun nach dem vielen Sitzen. Anfangs ging er dahin, ohne an etwas zu denken; daher hatten die Galoschen keine Gelegenheit, ihre Zauberkraft zu beweisen.
In der Allee traf er einen Bekannten, einen jungen Dichter, der ihm erzählte, daß er am nächsten Tage seine Sommerreise beginnen werde.
"Nun, soll es schon wieder fortgehen" sagte der Schreiber. "Sie sind doch ein glücklicher, freier Mensch. Sie können fliegen, wohin Sie wollen, wir anderen haben eine Kette am Fuße!"
"Aber sie sitzt am Brotbaum fest!" antwortete der Dichter. "Sie brauchen nicht für den kommenden Tag zu sorgen, und wenn Sie alt sind, bekommen Sie Pension!"
"Sie haben es doch am besten!" sagte der Schreiber, "dazusitzen und zu dichten ist doch ein Vergnügen! Alle Welt sagt Ihnen Angenehmes, und Sie sind Ihr eigener Herr! ja, Sie sollten es nur einmal probieren, im Gericht zu sitzen bei den langweiligen Sachen!"
Der Dichter schüttelte mit dem Kopfe, und der Schreiber schüttelte auch mit dem Kopfe. Jeder blieb bei seiner Meinung und dann schieden sie voneinander.
"Es ist doch ein Völkchen für sich, diese Dichter!" sagte der Schreiber. Ich möchte wohl einmal versuchen, in solche Natur hineinzuschlüpfen, selbst ein Dichter zu werden. Ich glaube bestimmt, daß ich nicht solche Klagelieder wie die anderen schreiben würde! – Das ist so recht ein Frühlingstag für einen Dichter! Die Luft ist ungewöhnlich klar, die Wolken so schön, und es duftet nach all dem Grünen! Ja, viele Jahre lang habe ich das nicht so stark gefehlt, wie in diesem Augenblick."
Wir merken schon, daß er ein Dichter geworden war. Es fiel zwar nicht jedem sogleich in die Augen, denn es ist eine törichte Vorstellung, sich einen Dichter anders als andere Menschen zu denken, in denen weit mehr poetische Natur stecken kann, als in manchem anerkannten Dichter. Der Unterschied zeigt sich nur in dem besseren geistigen Gedächtnis des Dichters, mit dem er die Gedanken und Gefühle bewahren kann, bis sie klar und deutlich in Worte gefaßt dastehen. Das können die anderen nicht. Aber von einer Alltagsnatur in eine begabte sich zu wandeln, ist immer ein Übergang, und den hatte der Kopist nun überstanden.
"Der herrliche Duft!" sagte er, "wie erinnert er mich an die Veilchen bei Tante Lene! Ja, damals war ich noch ein kleiner Knabe! Herrgott, wie lange ist das her, daß ich daran gedacht habe! Das gute, alte Mädchen, sie wohnte da um die Börse herum. Immer hatte sie einen Zweig oder ein paar grüne Schößlinge im Wasser stehen, der Winter mochte noch so strenge sein. Die Veilchen dufteten, während ich die angewärmten Kupferschillinge gegen die gefrorenen Scheiben preßte und Gucklöcher machte. Das gab einen hübschen Blick. Draußen im Kanal lagen die Schiffe eingefroren und von der ganzen Mannschaft verlassen. Eine schreiende Krähe war die einzige Besatzung. Aber wenn das Frühjahr herangeweht kam, dann wurde es dort lebendig. Unter Gesang und Hurrarufen sägte man das Eis entzwei. Die Schiffe wurden geteert und aufgetakelt, und dann fuhren sie nach fremden Ländern.
Ich bin hier geblieben, und muß hier bleiben, immer in der Polizeistube sitzen und zusehen, wie die Anderen Pässe ins Ausland nehmen; das ist mein Los! Ach, ja!" seufzte er tief, aber plötzlich blieb er stehen. "Herrgott, was ist denn nur mit mir los? So etwas habe ich doch niemals früher gedacht oder gefühlt! Es muß die Frühjahrsluft sein. Das ist zugleich bedrückend und angenehm!" Er griff in die Tasche nach seinen Papieren. "Die werden mich schon auf andere Gedanken bringen!"
sagte er und ließ die Augen über das erste Blatt schweifen.. "Frau Sigbrith, Tragödie in fünf Akten," las er, "was ist denn das! das ist ja meine eigene Handschrift! Habe ich die Tragödie geschrieben?" Die Verschwörung auf dem Wall oder der Bußtag, Singspiel". – Aber wo kommt denn das her? Man muß es mir in die Tasche geschoben haben; hier ist ein Brief ?" Der war von der Theater-Direktion. Die Stücke waren abgelehnt, und der Brief selbst war nicht gerade höflich abgefaßt.
"Hm, hm" sagte der Schreiber und setzte sich auf eine Bank nieder. Seine Gedanken waren angeregt und sein Herz weich gestimmt. Unwillkürlich pflückte er eine Blume ab. Es war ein einfaches kleines Gänseblümchen. Was die Botaniker uns erst in vielen Vorlesungen erklären können, verkündete es in einer Minute. Es erzählte das Märchen seiner Geburt, von der Kraft des Sonnenlichtes, das die feinen Blättchen ausbreitete und sie zu duften zwang. Und er dachte an den Lebenskampf, der gleichfalls die Gefühle in uns erweckt. Luft und Licht buhlten um die Blume, aber das Licht war der Begünstigtere. Nach dem Lichte wendete sie sich und verschwand es, so rollte sie ihre Blätter zusammen und schlummerte in den Armen der Luft ein. "Es ist das Licht, das mich verschönt!" sagte die Blume. "Aber die Luft läßt dich atmen!" flüsterte des Dichters Stimme.
Dicht daneben stand ein Knabe und schlug mit seinem Stock in einen sumpfigen Graben. Die Wassertropfen spritzten bis in die grünen Zweige hinauf, und der Schreiber dachte an die Millionen unsichtbarer Tiere, die mit den Tropfen in eine Höhe geschleudert wurden, die ihnen im Verhältnis zu ihrer Größe ungefähr so erscheinen mochte, wie es für uns wäre, wenn wir hoch über die Wolken hinaus gewirbelt würden. Während der Schreiber hierüber und über die ganze Veränderung, die mit ihm vorgegangen war, nachdachte, lächelte er:
"Ich schlafe und träume! Merkwürdig ist es gleichwohl, wie lebenswahr man träumen kann und doch dabei selbst wissen, daß es nur ein Traum ist. Wenn ich ihn mir doch morgen beim Erwachen noch ins Gedächtnis zurückrufen könnte. Mir scheint nämlich, daß ich ganz ungewöhnlich gut aufgelegt bin. Ich habe einen klaren Überblick über alle Dinge, fühle mich so empfänglich für alles, aber ich bin sicher, wenn ich morgen wirklich etwas davon behalten haben sollte, so ist es verworrenes Zeug. So ist es mir bisher immer ergangen! Es geht mit allem dem Klugen und Prächtigen, das man im Traume hört oder sagt wie mit dem Golde der Unterirdischen: wenn man es bekommt, ist es Pracht und Herrlichkeit, aber bei Lichte besehen sind es nur Steine und trockene Blätter. "Ach," seufzte er ganz wehmütig und sah auf die singenden Vögel, die so fröhlich von Zweig zu Zweig hüpften, "sie haben es viel besser als ich! Fliegen, das ist eine herrliche Kunst, glücklich der, dem sie angeboren ist! Ja, wenn ich mich in etwas verwandeln könnte, so möchte ich so eine kleine Lerche sein!"
Sogleich entfalteten sich seine Rockschöße und Ärmel als Flügel, die Kleider wurden zu Federn und die Galoschen zu Krallen. Er merkte es recht gut und lachte innerlich: "So, nun weiß ich doch wenigstens, daß ich träume, aber so etwas närrisches ist mir bisher noch nicht vorgekommen!" Und dann flog er hinauf in die grünen Zweige und sang. Aber das war gar nicht mehr poetisch, denn die Dichternatur war fort. Die Galoschen konnten, wie jeder, der seine Sache gründlich macht, nur ein Ding auf einmal ausführen. Er wollte ein Dichter werden. Das war er geworden. Nun wollte er kleiner Vogel sein, aber indem er es wurde, verlor er die vorigen Eigenschaften.
"Das ist ja recht niedlich!" sagte er, "am Tage sitze ich auf der Polizei zwischen den trockensten Abhandlungen, und nachts im Traum kann ich als Lerche im Friedrichsberg-Garten herumfliegen.
Daraus ließe sich wirklich ein Theaterstück machen!"
Nun flog er in das Gras hinunter, drehte den Kopf nach allen Seiten und pickte mit dem Schnabel in die geschmeidigen Grashalme, die im Verhältnis zu seiner jetzigen Größe, ihm lang wie die Palmen Afrikas erschienen.
Das dauerte einen Augenblick, und dann wurde es kohlschwarze Nacht um ihn her. Ein, wie es ihm vorkam, ungeheurer Gegenstand wurde ihm über den Kopf geworfen. Es war eine große Mütze, die ein Knabe über den Vogel geworfen hatte. Eine Hand faßte hinein und griff den Schreiber um Rücken und Flügel, daß er vor Schmerz piepte. Im ersten Schrecken schrie er laut: "Du unverschämter Bengel! Ich bin Schreiber bei der Polizei!" Aber für den Knaben klang es nur wie ein "Piep Piep"! Er gab dem Vogel eins auf den Schnabel und wanderte davon.
In der Allee begegnete er zwei Schülern aus dem Gymnasium. Die kauften den Vogel für acht Schillinge, und so kam der Schreiber nach Kopenhagen zu einer Familie in der Gotenstraße.
"Es ist gut, daß ich nur träume!" sagte der Schreiber, "sonst würde mir die Galle überlaufen! Erst war ich ein Dichter und jetzt eine Lerche! Es ist sicher die Dichternatur, die mir zu diesem Lerchendasein verholfen hat. Aber das ist ein jämmerlich Ding, besonders, wenn man diesen Jungen in die Hände fällt! Ich möchte wissen, wie das noch ablaufen wird?"
Die Knaben brachten ihn in ein gut ausgestattetes Zimmer. Eine dicke, lächelnde Frau kam ihnen entgegen, aber erfreut war sie nicht gerade, daß der gewöhnliche Feldvogel, wie sie die Lerche nannte, mit hereinkam. Doch für heute wollte sie nichts sagen, und sie durften ihn in das leere Bauer setzen, das beim Fenster stand!
"Vielleicht macht es Papchen Spaß!" fügte sie hinzu und lachte zu einem großen grünen Papagei hinüber, der vornehm in seinem Ringe in einem prächtigen Messingbauer schaukelte. "Es ist Papchens Geburtstag, sagte sie ein wenig kindisch, "da kommt der kleine Feldvogel gratulieren!"
Papchen antwortete nicht ein einziges Wort, sondern schaukelte vornehm auf und ab. Dagegen begann ein hübscher Kanarienvogel, der im letzten Sommer aus seiner warmen, duftenden Heimat hierher gebracht worden war, laut zu singen.
"Schreihals!" sagte die Frau und warf ein weißes Taschentuch über das Bauer.
"Piep, piep!" seufzte er, "das schreckliche Schneewetter!" und mit diesem Seufzer verstummte er.
Der Schreiber, oder wie die Frau sagte, der Feldvogel, kam in ein kleines Bauer dicht neben den Kanarienvogel und nicht weit entfernt von dem Papagei. Die einzige Redensart, die Papchen hervorschnattern konnte, und die zuzeiten recht komisch klang, war: "nein, nun laßt uns Menschen sein!" Alles übrige, was er schnatterte, war ebenso unverständlich wie des Kanarienvogels Gezwitscher, aber nicht für den Schreiber, der ja selbst ein Vogel war. Er verstand die Kameraden ausgezeichnet.
"Ich flog unter der grünen Palme und dem blühenden Mandelbaum!" sang der Kanarienvogel, "ich flog mit meinen Brüdern und Schwestern hin, über die prächtigen Blumen und den glasklaren See, auf dessen Grunde sich Pflanzen wiegten. Ich sah auch viele herrliche Papageien, die die schönsten Geschichten erzählten, lang und viel!"
"Das waren wilde Vögel," erwiderte der Papagei, "sie waren ohne Bildung. Nein, laßt uns nun Menschen sein! – Warum lachst du nicht? Wenn die Frau und alle die Gäste darüber lachen können, so kannst du es auch. Es ist ein großer Mangel, wenn man keinen Sinn für Humor hat. Nein, laßt uns nun Menschen sein!"
"O denkst du noch der schönen Mädchen, die unter dem ausgespannten Zelt bei den blühenden Bäumen tanzten!? Gedenkst du der süßen Früchte und des kühlenden Saftes in den wild wachsenden Kräutern?"
"O ja," sagte der Papagei, "aber hier habe ich es viel besser! Ich habe gutes Essen und individuelle Behandlung. Ich weiß, ich bin ein guter Kopf, und mehr verlange ich nicht. Laßt uns nun Menschen sein! Du bist eine Dichterseele, wie sie es nennen; ich habe gründliche Kenntnisse und Witz. Du hast Genie aber keine Besonnenheit. Du versteigst dich zu den höchsten Tönen und darum decken Sie dich zu. Mir bieten sie das nicht! nein! denn ich habe sie mehr gekostet! Ich halte sie mit meinem Schnabel in Schach und kann einen Witz! Witz! Witz! machen, nein, nun laßt uns Menschen sein!"
"O, mein warmes, blühendes Vaterland!" sang der Kanarienvogel. "Ich will von deinen dunkel grünenden Bäumen singen, von deinen stillen Meeresbuchten, wo die Zweige den klaren Wasserspiegel küssen, singen von dem Jubel aller meiner schimmernden Brüder und Schwestern, wo der Wüste Pflanzenquellen wachsen!"
"Hör doch auf mit den Jammertönen!" sagte der Papagei. Sage doch etwas, worüber man lachen kann! Lachen ist das Kennzeichen des erhabensten geistigen Standpunktes. Sieh, ob ein Pferd oder ein Hund lachen kann! Nein, weinen können sie, aber das Lachen ist nur den Menschen gegeben. "Ho ho ho!" lachte Papchen und fügte seinen Witz hinzu: "Nun laßt uns Menschen sein!"
Du kleiner grauer Vogel," sagte der Kanarienvogel, "Du bist auch ein Gefangener! Es ist sicherlich kalt in deinen Wäldern, aber dort ist doch Freiheit. Fliege hinaus! – Sie haben vergessen, dich Einzuschließen; das oberste Fenster steht offen. Fliege! Fliege!"
Und das tat der Schreiber. Husch! war er aus dem Bauer. In diesem Augenblick knarrte die halboffene Tür, die ins Nebenzimmer führte und geschmeidig, mit grünen, funkelnden Augen schlich die Hauskatze herein und machte auf ihn Jagd. Der Kanarienvogel flatterte in dem Bauer und der Papagei schlug mit den Flügeln und rief: "Nun laßt uns Menschen sein!" Der Schreiber fühlte den tödlichsten Schreck und flog durch das Fenster davon über Häuser und Straßen. Zuletzt mußte er sich ein wenig ausruhen. Das gegenüberliegende Haus erschien ihm heimisch. Ein Fenster stand offen, er flog hinein, es war sein eigenes Zimmer; er setzte sich auf den Tisch.
"Nun laßt uns Menschen sein!" sagte er gedankenlos, wie er es von dem Papagei gehört hatte, und im selben Augenblick war er wieder Schreiber, aber er saß auf dem Tische.
"Gott bewahre!" sagte er, wie bin ich denn hier hinauf gekommen und in Schlaf gefallen! Das war ein recht unruhiger Traum. Nichts wie dummes Zeug war die ganze Geschichte!"
6. Das Das Beste, was die Galoschen brachten.
Zeitig morgens am folgenden Tage, als der Schreiber noch im Bette lag, klopfte es an seine Tür; es war sein Nachbar aus derselben Etage, ein Student, der Pastor werden wollte. Er trat ein.
Leihe mir deine Galoschen," sagte er, "es ist so naß im Garten, aber die Sonne scheint herrlich, ich möchte eine Pfeife Tabak da unten rauchen."
Er zog die Galoschen an und war bald unten im Garten, der einen Pflaumenbaum und einen Birnenbaum enthielt. Selbst ein so kleiner Garten, wie dieser, gilt in Kopenhagen für eine große Herrlichkeit.
Der Student wanderte im Gange auf und ab. Es war erst sechs Uhr. Draußen von der Straße erklang ein Posthorn.
"O, reisen! reisen!" rief er laut, "das ist doch das größte Glück in der Welt! Das ist meiner Wünsche höchstes Ziel! Das würde die Unruhe, die mich quält, stillen. Aber weit fort müßte es sein! Ich möchte die herrliche Schweiz sehen, nach. Italien fahren und – " Es war gut, daß die Galoschen sofort wirkten, sonst würde er allzu weit herumgekommen sein sowohl für seinen Geschmack als auch für den unseren. Er reiste; er war mitten in der Schweiz aber mit acht Anderen in einer Postkutsche zusammengepackt. Er hatte Kopfschmerzen, einen steifen Nacken, und das Blut machte seine Beine schwer und geschwollen, so daß ihn die Stiefel zwickten. Er schwebte in einem Zustande zwischen Wachen und Schlafen. In seiner rechten Tasche hatte er einen Kreditbrief, in der linken seinen Paß, und in einem kleinen Lederbeutel auf der Brust waren einige Goldstücke eingenäht.
Jeder Traum endete damit, das eines oder das andere dieser Kostbarkeiten verloren sei. Deshalb fuhr er jeden Augenblick empor, und die erste Bewegung, die seine Hand machte, war ein Dreieck von rechts nach links und zur Brust hinauf, um zu fühlen, ob sie noch da waren oder nicht.
Regenschirme, Stöcke und Hüte schaukelten im Netz über seinem Kopfe und verhinderten so ziemlich die Aussicht, die großartig war. Er schielte danach, während sein Herz sang, was ein Dichter, den wir kennen, auch schon gesungen hat, als er in der Schweiz war, er hat es aber bis jetzt nicht drucken lassen:
Ja, hier ist es schön und klar und still!
Sieh den Montblanc, mein Lieber, und schweige.
Wenn nur das Kleingeld ausreichen will,
Aber das geht gar bald auf die Neige!
Groß, ernst und düster war die Natur rings um ihn. Die Tannenwälder erschienen wie Heidekraut auf den hohen Felsen, deren Spitzen sich im Wolkenschleier verbergen. Nun begann es zu schneien und der kalte Wind blies.
"Hu!" seufzte er, "wären wir nur erst auf der anderen Seite der Alpen, dann wäre es Sommer und ich bekäme das Geld auf meinen Kreditbrief. Die Angst, die ich deswegen ausstehe, macht, daß ich die Schweiz nicht genießen kann, ach, wäre ich doch auf der anderen Seite!"
Und da war er auf der anderen Seite. Weit unten in Italien war er, zwischen Florenz und Rom. Der Trasimener See lag in der Abendbeleuchtung wie flammendes Gold zwischen den blauen Bergen; hier, wo Hannibal den Flaminius schlug, hielten nun Weinranken sich friedlich an den grünen Händen.
Anmutige halbnackte Kinder bewachten eine Herde kohlschwarzer Schweine; unter einer Gruppe duftender Lorbeerbäume am Wege. Verstünden wir, dies mit Worten zu malen, so würden alle Jubeln:
"Herrliches Italien!" Aber weder der Theolog noch auch nur ein einziger von seinen Reisegenossen im Wagen sagte etwas ähnliches.
Zu Hunderten flogen giftige Fliegen und Mücken zu ihnen hinein, vergebens schlugen sie mit Myrthenzweigen um sich; die Fliegen stachen doch. Kein Mensch im ganzen Wagen, dessen Gesicht nicht geschwollen und blutig von den Stichen war! Die armen Pferde sahen wie Kadaver aus. Die Fliegen saßen in großen Klumpen auf ihnen, und es half nur für Augenblicke, wenn der Kutscher herunterstieg und die Tiere abschabte. Nun ging die Sonne unter. Ein kurzer, aber eisiger Kälteschauer ging durch die ganze Natur. Das war nicht behaglich. Aber ringsum verdämmerten die Berge und Wolken in der seltsamsten grünen Farbe, so klar, so schmelzend ja, geht nur selbst hin und schaut; das ist besser, als Beschreibungen darüber zu lesen! Es war ein unvergleichliches Schauspiel. Die Reisenden fanden das auch – aber der Magen war leer, die Glieder matt, alle Sehnsucht des Herzens gipfelte in dem Nachtlager. Aber wie würde das ausfallen? Man hielt viel eifriger danach Ausschau als nach der schönen Natur.
Der Weg führte durch einen Olivenwald, es war, als führe man daheim zwischen knotigen Weiden. Hier lag das einsame Wirtshaus. Ein halb Dutzend bettelnder Krüppel hatte sich davor gelagert. Der gesündeste unter ihnen sah aus wie "des Hungers ältester Sohn, der seine Volljährigkeit erreicht hat", um mit Marryat zu sprechen. Die anderen waren entweder blind, hatten vertrocknete Beine und krochen auf den Händen, oder hatten abgezehrte Arme mit fingerlosen Händen. Das nackte Elend grinste überall aus den Lumpen hervor. "Erbarmen, gnädige Herren, habt Erbarmen!" seufzten sie und entblößten ihre kranken Glieder. Die Wirtin selbst mit bloßen Füßen, ungekämmtem Haar und in einer schmutzigen Bluse empfing die Gäste. Die Türen waren mit Bindfaden zusammengebunden. Der Fußboden in den Zimmern wies einen halbaufgerissenen Belag von Mauersteinen auf; Fledermäuse flatterten unter der Decke hin, und der Gestank hier drinnen – –
"Machen Sie lieber den Tisch im Stall zurecht!" sagte einer der Reisenden, "da unten weiß man wenigstens, was man einatmet!"
Die Fenster wurden geöffnet, daß ein wenig frische Luft hereinkommen konnte, aber geschwinder als diese drangen die vertrockneten Arme ein und das unaufhörliche Gejammer: "Habt Erbarmen, gnädige Herren!" An den Wänden standen viele Inschriften, und die Hälfte davon war gegen das "Schöne Italien" gerichtet.
Das Essen wurde aufgetragen; es gab eine Suppe aus Wasser, mit Pfeffer und ranzigem Öl gewürzt, das auch in der gleichen Güte beim Salat wieder erschien; verdorbene Eier und gebratene Hahnenkämme bildeten den Höhepunkt der Mahlzeit; selbst der Wein hatte einen Beigeschmack, es war eine wahre Medizin.Zur Nacht wurden die Koffer gegen die Tür gestellt und einer der Reisenden hielt Wacht, während die anderen schliefen. Der Theolog war der Wachthabende. O, wie schwül war es hier drinnen! Die Hitze drückte, die Mücken summten und stachen, und die Krüppel jammerten im Schlaf.
"Ja, Reisen ist schon recht gut!" seufzte der Student, "wenn man nur keinen Körper hätte. Könnte dieser ruhen, und der Geist indessen fliegen! Wohin ich komme, findet sich ein Mangel, der das Herz bedrückt. Nach etwas Besserem, als dem Augenblicklichen, sehne ich mich, ja, nach etwas Besserem, dem Besten, aber wo und was ist das? Im Grunde weiß ich wohl, was ich will: ich will zu einem glücklichen Ziel, dem glücklichsten von allen!"
Und, wie das Wort ausgesprochen war, war er in seinem Heim. Die langen, weißen Gardinen hingen vor den Fenstern herab, und mitten auf dem Fußboden stand der schwarze Sarg. In diesem lag er im stillen Todesschlafe. Sein Wunsch war erfüllt, der Körper ruhte, der Geist reiste. "Preise niemand glücklich vor seinem Tode", Solons Wort, hier bewies es wieder einmal seine Gültigkeit.
Jede Leiche ist der Unsterblichkeit Sphinx; auch die Sphinx hier in dem schwarzen Sarge gab keine Antwort auf das, was der Lebende zwei Tage vorher niedergeschrieben hatte.
Du starker Tod, Dein Schweigen wecket Grauen;
Des Kirchhofs Gräber zeigen Deine Spur.
Soll meinem Geiste keine Hoffnung blauen?
Blüh ich als Gras im Todesgarten nur?
"Dein größtes Leiden hat die Welt doch nie erblickt.
Der, der Du gleich Dir bliebst zum letzten ohne Arg.
Im Leben werd Dein Herz von manchem mehr bedrückt,
Als von der Erde, die man wirft auf Deinen Sarg!"
Zwei Gestalten bewegten sich im Zimmer. Wir kennen sie beide: Es waren die Trauer und die Abgesandte des Glückes. Sie beugten sich über den Toten.
"Siehst du," sagte die Trauer, "welches Glück brachten deine Galoschen wohl der Menschheit?"
"Sie brachten wenigstens dem, der hier schläft, ein dauerndes Gut!" antwortete die Freude.
"O nein!" sagte die Trauer, "selbst ging er fort, er wurde nicht abgerufen! Seine geistige Kraft hier war nicht stark genug, um die Schätze dort zu heben, die er nach seiner Bestimmung heben soll! Ich will ihm eine Wohltat erweisen!"
Und sie zog die Galoschen von seinen Füßen; da war der Todesschlaf zu Ende und der Wiederbelebte erhob sich. Die Trauer verschwand, mit ihr aber auch die Galoschen; sie hat sie gewiß als ihr Eigentum betrachtet.
DIE ALTE STRASSENLATERNE
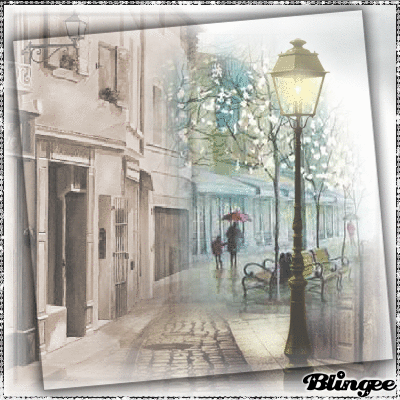
Hast du die Geschichte von der alten Straßenlaterne gehört? Sie ist gar nicht sehr belustigend, doch einmal kann man sie wohl hören. Es war eine gute, alte Straßenlaterne, die viele, viele Jahre gedient hatte, aber jetzt entfernt werden sollte. Es war der letzte Abend, an dem sie auf dem Pfahle saß und in der Straße leuchtete, und es war ihr zumute wie einer alten Tänzerin, die den letzten Abend tanzt und weiß, daß sie morgen vergessen in der Bodenkammer sitzt. Die Laterne hatte Furcht vor dem morgigen Tage, denn sie wußte, daß sie dann zum erstenmal auf das Rathaus kommen und von dem hochlöblichen Rat beurteilt werden sollte, ob sie noch tauglich oder unbrauchbar sei.
Da sollte bestimmt werden, ob sie nach einer der Brücken hinausgeschickt werden könne, um dort zu leuchten, oder auf das Land in eine Fabrik; vielleicht sollte sie geradezu in eine Eisengießerei kommen und umgeschmolzen werden. Dann konnte freilich alles aus ihr werden, aber es peinigte sie, daß sie nicht wußte, ob sie dann die Erinnerung daran behalten würde, daß sie eine Straßenlaterne gewesen war.
Wie es nun auch werden mochte, so werde sie doch vom Wächter und seiner Frau getrennt werden, die sie ganz wie ihre Familie betrachteten. Sie wurde zur Laterne, als er Wächter wurde. Damals war die Frau sehr vornehm, und wenn sie des Abends an der Laterne vorüberging, blickte sie diese an, am Tage aber nie. Dagegen in den letzten Jahren, als sie alle drei, der Wächter, seine Frau und die Laterne, alt geworden waren, hatte die Frau sie auch gepflegt, die Lampe abgeputzt und Öl eingegossen. Es war ein ehrliches Ehepaar, sie hatten die Lampe um keinen Tropfen betrogen. Es war der letzte Abend auf der Straße, und morgen sollte sie auf das Rathaus; das waren zwei finstere Gedanken für die Laterne, und so kann man wohl denken, wie sie brannte. Aber es kamen ihr noch andere Gedanken; sie hatte vieles gesehen, vieles beleuchtet, vielleicht ebensoviel wie der 'hochlöbliche Rat', aber das sagte sie nicht, denn sie war eine alte, ehrliche Laterne, sie wollte niemand erzürnen, am wenigsten ihre Obrigkeit. Es fiel ihr vieles ein, und mitunter flackerte die Flamme in ihr auf, es war, als ob ein Gefühl ihr sagte: 'Ja, man wird sich auch meiner erinnern!' So war da der hübsche, junge Mann – ja, das ist viele Jahre her; er kam mit einem Briefe, der war auf rosenrotem Papier, fein und mit goldenem Schnitt, er war niedlich geschrieben, es war eine Damenhand.
Er las ihn zweimal und küßte ihn und blickte mit seinen beiden Augen zu mir empor und sagte: "Ich bin der glücklichste Mensch!" – Nur er und ich wußten, was im ersten Brief von der Geliebten stand. – lch entsinne mich auch zweier anderer Augen; es ist merkwürdig, wie man mit den Gedanken springen kann! – Hier in der Straße fand ein prächtiges Begräbnis statt, die junge, hübsche Frau lag im Sarge auf dem mit Samt überzogenen Leichenwagen. Da prangten so viele Blumen und Kränze, da leuchteten so viele Fackeln, daß ich dabei ganz verschwand. Der ganze Bürgersteig war mit Menschen angefüllt, sie folgten alle dem Leichenzug, als aber die Fackeln verschwunden waren und ich mich umsah, stand hier noch einer am Pfahl und weinte, ich vergesse nie die beiden Augen voll Trauer, die gegen mich aufblickten!
Viele Gedanken durchkreuzten so die alte Straßenlaterne, die an diesem Abend zum letztenmal leuchtete. Die Schildwache, die abgelöst wird, kennt doch ihren Nachfolger und kann ihm ein paar Worte sagen, aber die Laterne kannte den ihrigen nicht, und doch hätte sie ihm einen oder den andern Wink über Regen und Schnee, wie weit der Mondschein auf dem Bürgersteig gehe und von welcher Seite der Wind blies, geben können.
Auf dem Rinnsteinbrette standen drei, die sich der Laterne vorgestellt hatten, indem sie glaubten, daß diese es sei, die das Amt zu vergeben habe. Der eine davon war ein Heringskopf, denn auch ein solcher leuchtet im Dunkeln, und daher meinte er, es würde eine große Ölersparnis sein, wenn er auf den Laternenpfahl käme. Der zweite war ein Stück faulen Holzes, das auch leuchtete, und überdies war es das letzte Stück von einem Baume, der einst die Zierde des Waldes gewesen war. Der dritte war ein Johanniswurm. Woher der gekommen, begriff die Laterne nicht, aber der Wurm war da und leuchtete auch. Aber das faule Holz und der Heringskopf beschworen, daß er nur zu gewissen Zeiten leuchte und daß er deshalb nie berücksichtigt werden könne.
Die alte Laterne sagte, daß keiner von ihnen genug leuchte, um Straßenlaterne zu sein, aber das glaubte nun keiner von ihnen, und als sie hörten, daß die Laterne selbst die Anstellung nicht zu vergeben habe, so sagten sie, daß das höchst erfreulich sei, denn sie sei schon gar zu hinfällig, um noch wählen zu können.
Gleichzeitig kam der Wind von der Straßenecke, er sauste durch den Schornstein der alten Laterne. "Was höre ich!" sagte er zu ihr, "du willst morgen fort? Ist dieses der letzte Abend, an dem ich dich hier treffe? Ja, dann mache ich dir ein Geschenk; nun erfrische ich deinen Verstandeskasten, so daß du klar und deutlich dich nicht allein dessen entsinnen kannst, was du gehört und gesehen hast, sondern wenn etwas in deiner Gegenwart erzählt oder gelesen wird, so sollst du so hellsehend sein, daß du alles auch siehst!"
"Das ist viel!" sagte die alte Straßenlaterne, "meinen besten Dank! Wenn ich nur nicht umgegossen werde!"
"Das geschieht noch nicht!" sagte der Wind, "und nun erfrische ich dir dein Gedächtnis. Kannst du mehr derartige Geschenke erhalten, so wirst du ein recht frohes Alter haben!"
"Wenn ich nur nicht umgeschmolzen werde!" sagte die Laterne, "Oder kannst du mir dann auch das Gedächtnis sichern?"
"Alte Laterne, sei vernünftig!" sagte der Wind, und dann wehte er. Gleichzeitig kam der Mond hervor.
"Was geben Sie?" fragte der Wind.
"Ich gebe gar nichts!" sagte dieser, "ich bin ja am Abnehmen, und die Laternen haben mir nie, sondern ich habe den Laternen geleuchtet." Darauf ging der Mond wieder hinter die Wolken, denn er mochte sich nicht quälen lassen. Da fiel ein Wassertropfen wie von einer Dachtraufe gerade auf den Schornstein, aber der Tropfen sagte, er komme aus den grauen Wolken und sei auch ein Geschenk, vielleicht das allerbeste. "Ich durchdringe dich so, daß du die Fähigkeit erhältst, in einer Nacht, wenn du es wünschest, dich in Rost zu verwandeln, so daß du ganz zusammenfällst und zu Staub wirst." Aber der Laterne schien das ein schlechtes Geschenk zu sein, und der Wind meinte es auch. "Gibt es nichts Besseres, gibt es nichts Besseres?" blies er, so laut er konnte; da fiel eine glänzende Sternschnuppe, sie leuchtete in einem langen Streifen.
"Was war das?" rief der Heringskopf. "Fiel da nicht ein Stein gerade herab? Ich glaube, er fuhr in die Laterne! – Nun, wird das Amt auch von so Hochstehenden gesucht, dann können wir uns zur Ruhe begeben!" Und das tat er und die andern mit. Aber die alte Laterne leuchtete auf einmal wunderbar stark. "Das war ein herrliches Geschenk!" sagte sie. "Die klaren Sterne, über die ich mich immer so sehr gefreut habe und die so herrlich scheinen, wie ich eigentlich nie habe leuchten können, obgleich es mein ganzes Streben und Trachten war, haben mich arme Laterne beachtet! Sie schickten mir einen davon mit einem Geschenk herab, das in der Fähigkeit besteht, daß alles, dessen ich mich entsinne und das ich recht deutlich erblicken auch von denjenigen gesehen werden kann, die ich liebe. Das ist erst das wahre Vergnügen, denn wenn man es nicht mit andern teilen kann, so ist es nur eine halbe Freude!"
"Das ist recht ehrenwert gedacht!" sagte der Wind, "aber du weißt noch nicht, daß dazu Wachslichter gehören. Wenn nicht ein Wachslicht in dir angezündet wird, kann keiner der andern etwas bei dir erblicken. Das haben die Sterne nicht gedacht, sie glauben, daß alles, was leuchtet, wenigstens ein Wachslicht in sich hat. Aber jetzt bin ich müde," sagte der Wind, "nun will ich mich legen!"
Und dann legte er sich.
Am folgenden Tage - ja, den folgenden Tag können wir überspringen – am folgenden Abend lag die Laterne im Lehnstuhl, und wo? – Bei dem alten Wächter. Vom hochlöblichen Rat hatte er sich für seine langen, treuen Dienste erbeten, die alte Laterne behalten zu dürfen. Sie lachten über ihn, und dann ließen sie ihm den Willen, und dann lag die Laterne im Lehnstuhl dicht bei dem warmen Ofen. Es war, als ob sie dadurch größer geworden wäre, sie füllte fast den ganzen Stuhl aus. Die alten Leute saßen schon beim Abendbrot und warfen der alten Laterne, der sie gern einen Platz am Tische eingeräumt hätten, freundliche Blicke zu.
Sie wohnten zwar in einem Keller, zwei Ellen tief unter der Erde, man mußte über einen gepflasterten Flur, um zur Stube zu gelangen, aber warm war es darin, denn sie hatten Tuchleisten um die Tür genagelt. Rein und niedlich sah es hier aus, Vorhänge um die Bettstellen und über den kleinen Fenstern, wo da oben auf dem Fensterbrette zwei sonderbare Blumentöpfe standen. Der Matrose Christian hatte sie von Ost- und Westindien mit nach Hause gebracht; es waren zwei Elefanten von Ton, denen der Rücken fehlte, aber an dessen Stelle wuchsen aus der Erde, die hineingelegt war, in dem einen der schönste Schnittlauch, das war der Küchengarten der alten Leute, und in dem anderen ein großes, blühendes Geranium, das war ihr Blumengarten.
An der Wand hing ein großes, buntes Bild, 'Die Fürstenversammlung zu Wien', da besaßen sie alle Kaiser und Könige auf einmal! Eine Schwarzwälder Uhr mit den schweren Bleigewichten 'tick-tack!' ging immer zu schnell; aber das sei besser, als wenn sie zu langsam ginge, meinten die alten Leute. Sie verzehrten ihr Abendbrot, und die alte Straßenlaterne lag, wie gesagt, im Lehnstuhl dicht bei dem warmen Ofen. Der Laterne kam es vor, als wäre die ganze Welt umgekehrt.
Als aber der Wächter sie anblickte und davon sprach, was sie beide miteinander erlebt hatten in Regen und Schneegestöber, in den hellen, kurzen Sommernächten und wenn der Schnee trieb, so daß es ihm wohltat, wieder in den Keller zu gelangen, da war für die alte Laterne wieder alles in Ordnung, denn wovon er sprach, das erblickte sie, als ob es noch immer da wäre. Ja, der Wind hatte sie inwendig wahrlich gut erleuchtet.
Sie waren fleißig und flink, die alten Leute, keine Stunde waren sie untätig. Am Sonntagnachmittag kam das eine oder andere Buch zum Vorschein, gewöhnlich eine Reisebeschreibung, und der alte Mann las laut von Afrika, von den großen Wäldern und Elefanten, die da wild umherliefen, und die alte Frau horchte auf und blickte dann verstohlen nach den Tonelefanten hin, die Blumentöpfe waren!
"Ich kann es mir beinahe denken!" sagte sie. Die Laterne wünschte dann sehnlichst, daß ein Wachslicht da wäre, damit es angezündet werde und in ihr brenne, dann sollte die Frau alles genau so sehen, wie die Laterne es erblickte, die hohen Bäume, die dicht ineinander verschlungenen Zweige, die schwarzen Menschen zu Pferde und ganze Scharen von Elefanten, die mit ihren breiten Füßen Rohr und Büsche zermalmten.
"Was helfen mir alle meine Fähigkeiten, wenn kein Wachslicht da ist!" seufzte die Laterne, "Sie haben nur Öl und Talglichter, und das ist nicht genug!"
Eines Tages kam ein ganzer Bund Wachslichtstückchen in den Keller, die größten Stücke wurden gebrannt, und die kleineren brauchte die alte Frau, um ihren Zwirn damit zu wachsen, wenn sie nähte. Wachslicht war nun da, aber es fiel den beiden Alten nicht ein, davon ein Stück in die Laterne zu setzen.
"Hier stehe ich mit meinen seltenen Fähigkeiten!" sagte die Laterne; "ich habe alles in mir, aber ich kann es nicht mit ihnen teilen. Sie wissen nicht, daß ich die weißen Wände in die schönsten Tapeten, in reiche Wälder, in alles, was sie sich wünschen wollen, verwandeln kann! – Sie wissen es nicht!"
Die Laterne stand übrigens gescheuert und sauber in einem Winkel, wo sie jederzeit in die Augen fiel; die Leute sagten zwar, daß es nur ein altes Gerümpel sei, aber daran kehrten sich die Alten nicht, sie liebten die Laterne.
Eines Tages, es war des alten Wächters Geburtstag, kam die alte Frau zur Laterne hin, lächelte und sagte: "lch will die Stube heute für ihn glänzend beleuchten!" Und die Laterne knarrte im Schornstein, denn sie dachte: 'Jetzt wird ihnen ein Licht aufgehen!' Aber da kam Öl und kein Wachslicht, sie brannte den ganzen Abend, wußte aber nun, daß die Gabe der Sterne, die beste Gabe von allen, für dieses Leben ein toter Schatz bleiben werde.
Da träumte sie – und wenn man solche Fähigkeiten hat, kann man wohl träumen –, daß sie selbst zum Eisengießer gekommen und umgeschmolzen werden sollte. Sie war ebenso in Furcht, als da sie auf das Rathaus kommen und von dem 'hochlöblichen Rat' beurteilt werden sollte; aber obgleich sie die Fähigkeit besaß, in Rost und Staub zu zerfallen, sobald sie es wünschte, so tat sie das doch nicht, und dann kam sie in den Schmelzofen und wurde zum schönsten eisernen Leuchter, in den man ein Wachslicht stellt; er hatte die Form eines Engels, der einen Blumenstrauß trug. Mitten in den Strauß wurde das Wachslicht gestellt, und der Leuchter erhielt seinen Platz auf einem grünen Schreibtisch. Das Zimmer war behaglich, da standen viele Bücher, da hingen herrliche Bilder, es war die Wohnung eines Dichters, und alles, was er sagte und schrieb, zeigte sich ringsherum. Das Zimmer wurde zu tiefen, dunklen Wäldern, zu sonnenbeleuchteten Wiesen, wo der Storch umherstolzierte, und zum Schiffsverdeck hoch auf dem wogenden Meere!
"Welche Fähigkeiten besitze ich!" sagte die alte Laterne, indem sie erwachte. "Fast möchte ich mich danach sehnen, umgeschmolzen zu werden! – Doch nein, das darf nicht geschehen, solange die alten Leute leben! Sie lieben mich meiner Person wegen! Ich bin ihnen ja an Kindes Statt, sie haben mich gescheuert und haben mir Öl gegeben; und ich habe es ebenso gut wie das Bild, das doch so etwas Vornehmes ist!" Von dieser Zeit an hatte sie mehr innere Ruhe, und das verdiente die ehrliche, alte Straßenlaterne.
FRAG DIE GRÜNWARENFRAU!
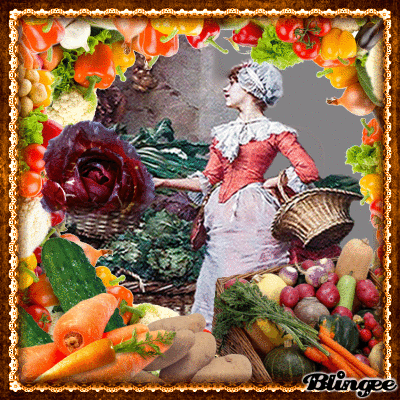
Da war eine alte Mohrrübe drin,
so knollig, so dick und so schwer,
die hatte gar einen gefährlichen Sinn,
sie wünschte, daß sie verheiratet wär
mit 'ner jungen Mohrrübe lieblich und gut
aus der Rüben alleradligstem Blut.
Und die Hochzeit kam.
Die Bewirtung war unbezahlbar gut;
sie kostete gar kein Geld,
sie leckten Mondschein und tranken Tau,
nahmen Blumenduft aus Wiese und Au
und Blütenstaub von Wald und Feld.
Die alte Mohrrübe grüßte mit einem Ruck
und sprach so viel und so lang;
die Worte, die glucksten kluck um kluck,
klein Mohrrübchen machte auch keinen Muck,
saß da so ernst und bang,
jung und schmuck.
Willst du's wissen genau,
frag die Grünwarenfrau.
Ein Rotkohl hat sie als Pfarrer getraut,
Brautjungfern sind weiße Rüben;
Spargel und Gurke kam nach Belieben,
Kartoffeln standen und sangen laut.
Und es wurde getanzt von groß und von klein –
frag die Grünwarenfrau, sie sagt's dir allein.
Die alte Mohrrübe sprang ohne Strümpfe und Schuh,
hohei, da zersprang sie im Rücken,
und dann war sie tot, wuchs niemals mehr zu.
Die junge Mohrrübe lachte in Ruh,
so wunderlich kann es sich schicken.
Nun war sie Witwe, nun war sie froh,
nun konnte sie leben, huchheia hei ho!
In den Suppentopf sprang sie als Jungfrau hinein,
jung, froh, frisch und fein.
Willst du's wissen genau,
frag die Grünwarenfrau.
DIE WINDMÜHLE ...
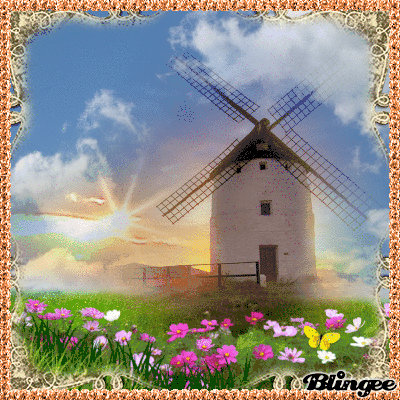
Da stand eine Windmühle auf dem Hügel, stolz anzusehen, und stolz fühlte sie ich:
"Ich bin durchaus nicht stolz," sagte sie, "aber ich bin sehr aufgeklärt, außen und innen. Sonne und Mond habe ich zu auswärtigem Gebrauch und zum inwendigen auch, und dann habe ich außerdem Stearinlicht, Öllampen und Talgkerzen, ich darf sagen, daß ich aufgeklärt bin; ich bin ein denkendes Wesen und so wohl gebaut, daß es ein Vergnügen ist. Ich habe ein gutes Mahlwerk in der Brust, ich habe vier Flügel, und die sitzen mir oben am Kopf, gerade unter dem Hut; die Vögel haben nur zwei Flügel, und müssen sie auf dem Rücken tragen. Ich bin ein Holländer von Geburt, das sieht man gleich an meiner Gestalt; ein fliegender Holländer! Die rechnet man zu dem Übernatürlichen, das weiß ich, und doch bin ich sehr natürlich. Ich habe eine Galerie um den Leib und Wohnungsgelegenheit im Unterteil, da hausen meine Gedanken. Mein stärkster Gedanke, der alles leitet und beherrscht, der heißt bei den anderen Gedanken: der Mann in der Mühle. Er weiß was er will, er steht hoch über Mehl und Kleie, hat aber doch seine Gefährtin, und sie heißt Mutter; sie ist das Gefühl, sie läuft nicht falsch herum, auch sie weiß, was sie will, sie weiß, was sie kann, sie ist mild wie ein Lufthauch, sie ist stark wie der Sturm, sie versteht herum zu bekommen und ihren Willen durchzusetzen. Sie ist mein sanfter Sinn, der Vater ist mein harter; sie sind zwei und doch eins, sie nennen auch einander 'meine Hälfte'. Sie haben einen Kinderschwarm, die beiden: kleine Gedanken, die wachsen können. Die Kleinen machen eine Wirtschaft! Neulich, als ich in meinem Tiefsinn den 'Vater' und seine Burschen das Mahlwerk und Rad in meiner Brust nachsehen ließ, ich wollte wissen, was da los war, denn etwas war in mir los, und man soll sich selber prüfen, da machten die Kleinen einen fürchterlichen Lärm, und das macht sich nicht gut, wenn man, wie ich, oben auf der Höhe steht; man muß daran denken, daß man in gutem Lichte steht: die Beurteilung ist auch ein Licht. Aber was ich sagen wollte, es war ein schrecklicher Lärm von den Kleinen! Der Kleinste fuhr mir bis unter den Hut und jauchzte, daß es mich kitzelte. Die kleinen Gedanken können wachsen, das habe ich erfahren,und von draußen kommen auch Gedanken, und nicht nur von meinem Geschlechte, denn ich sehe keinen von ihnen, so weit ich auch sehe, keinen außer mir selber; aber die flügellosen Häuser, wo man das Mahlwerk nicht hört, haben auch Gedanken, die kommen zu meinen Gedanken und verloben sich mit ihnen, wie man das nennt. Wunderlich genug! Ja, es gibt viel Wunderbares. Es ist über mich gekommen, oder in mich? Etwas hat sich im Mühlwerk verändert; es ist, als ob der Vater die Hälfte gewechselt, einen noch sanfteren Sinn erhalten hätte, eine noch liebevollere Gefährtin, so jung und fromm und jedoch dieselbe, aber sanfter, frommer durch die Zeit. Was bitter war, ist verdunstet; das ist sehr vergnüglich, das Ganze. Tage gehen, und Tage kommen, immer weiter zur Klarheit und Freude, und dann, ja, das ist gesagt und geschrieben, dann kommt ein Tag, wo es vorbei mit mir ist, doch nicht ganz vorbei: ich soll niedergerissen werden, um mich neu und besser zu erheben. Ich soll aufhören und doch fortfahren, zu sein! Eine ganz andere werden und doch dieselbe bleiben! Das ist für mich schwer zu begreifen, wie aufgeklärt ich auch bin bei Sonne, Mond, Stearin, Öl und Talg! Mein altes Zimmer im Mauerwerk soll sich wieder aus dem Schutt erheben. Ich will hoffen, daß ich die alten Gedanken behalte; den Vater in der Mühle, die Mutter, Große und Kleine, die Familie, die ich das Ganze nenne, eins und doch so viele, die ganze Gedankengesellschaft, denn die kann ich nicht entbehren! Und ich selber muß auch bleiben mit dem Mahlwerk in der Brust, den Flügeln auf dem Kopfe, der Galerie um den Leib, sonst könnte ich mich selber nicht kennen und die anderen könnten mich auch nicht kennen und sagen, da haben wir ja die Mühle auf dem Hügel, stolz anzusehen, und doch gar nicht stolz."
Das sagte die Mühle, sie sagte viel mehr, aber das war das Wichtigste.
Tage kamen, Tage gingen, und der jüngste Tag war der letzte.
Da ging die Mühle in Feuer auf; die Flammen erhoben sich, schlugen heraus, schlugen hinein, leckten an Balken und Brettern und fraßen sie auf. Die Mühle fiel, es war nur ein Aschehaufen übrig, der Rauch fuhr über die Brandstätte hin, der Wind trug ihn fort.
Was lebendig in der Mühle gewesen, blieb, und das, was dabei gewonnen, gehört nicht hierher zu diese Begebenheit. Die Müllerfamilie, eine Seele, viele Gedanken und doch nur einer, baute sich eine neue, eine prächtige Mühle, mit der konnte ihr gedient sein, sie glich ganz der alten, man sagte: da steht ja die Mühle auf dem Hügel, stolz anzusehen! Aber diese war besser eingerichtet, mehr zeitgemäß, damit es vorwärts geht. Das alte Zimmerwerk, das wurmstichig und schwammig war, lag in Staub und Asche; der Mühlenkörper erhob sich nicht, wie sie es geglaubt hatte; sie nahm es nur wörtlich, und man soll nicht alle Dinge wörtlich nehmen.
DER HAUSTÜRSCHLÜSSEL ...

Jeder Schlüssel hat seine Geschichte, und es gibt viele Schlüssel: Kammerherrnschlüssel, Uhrschlüssel, St.-Peters-Schlüssel; wir könnten von allen Schlüsseln erzählen, aber jetzt erzählen wir nur von dem Haustürschlüssel des Kammerrats.
Er war bei einem Schlosser zur Welt gekommen, aber er hätte gern glauben können, daß es ein Grobschmied sei, so faßte der Mann ihn an, hämmerte und feilte. Er war zu groß für die Hosentasche, darum mußte er in die Rocktasche. Hier lag er oft im Dunkeln, aber übrigens hatte er einen bestimmten Platz an der Wand neben der Silhouette des Kammerrats aus der Kindheit.
Man sagt, daß jeder Mensch in seinem Charakter und seiner Handlungsweise etwas von dem Himmelszeichen mitbekommt, unter dem er geboren wird, sei es nun der Stier, die Jungfrau, der Skorpion oder wie sie alle im Kalender heißen. Die Kammerrätin nannte keins von diesen, sie sagte, ihr Mann sei unter dem "Zeichen der Schubkarre" geboren. Immer mußte er vorwärtsgeschoben werden.
Sein Vater schob ihn aufs Kontor, seine Mutter schob ihn in den Ehestand hinein, und seine Frau schob ihn zum Kammerrat hinauf, aber das sagte sie nicht, sie war eine besonnene, brave Frau, die immer zur rechten Zeit schwieg und zur rechten Zeit sprach und schob.
Jetzt war er seit Jahren "wohlproportioniert," wie er selber sagte, ein Mann mit Bildung, Gutmütigkeit und dazu schlüsselklug, etwas, das wir näher erklären werden. Immer war er guter Laune, alle Menschen hatte er gern und mochte gern mit ihnen reden. Ging er in die Stadt, so war es schwer, ihn nach Hause zu bekommen, wenn seine Frau nicht mit war und schob. Er mußte mit jedem Bekannten reden, dem er begegnete. Er hatte viele Bekannte, und darunter mußte das Mittagessen leiden.
Vom Fenster aus gab die Kammerrätin auf ihn acht. "Jetzt kommt er!" sagte sie zu dem Mädchen. "Setz den Kochtopf auf! - Jetzt steht er still und spricht mit jemand, nimm den Kochtopf ab, sonst kocht das Essen zu lange! - Aber nun kommt er! Ja, dann setz den Kochtopf nur wieder auf!."
Aber deswegen kam er doch noch nicht.
Er konnte gerade unter dem Fenster des Hauses stehen und hinaufnicken, aber dann kam ein Bekannter vorüber, dann konnte er es nicht lassen, er mußte ihm ein paar Worte sagen. Kam dann, während er mit diesem sprach, ein anderer Bekannter, dann hielt er den ersten am Knopfloche fest und ergriff die Hand des andern, während er einen dritten, der vorüber wollte, anrief.
Das war eine Geduldsprobe für die Kammerrätin. "Kammerrat! Kammerrat!" rief sie dann. Ja, der Mensch ist unter dem Zeichen der Schubkarre geboren, vorwärts kann er nicht kommen, ohne daß er geschoben wird.
Er wollte gern in Buchläden gehen, in Büchern und Zeitungen blättern, er gab seinem Buchhändler ein kleines Honorar, um zu Hause bei sich die neuen Bücher lesen zu dürfen, das heißt, um Erlaubnis zu haben, die Bücher der Länge nach aufzuschneiden, aber nicht quer, denn dann konnten Sie nicht als neu verkauft werden. Er war eine lebende Zeitung in aller Gutmütigkeit, wußte Bescheid mit Verlobungen, Hochzeiten und Begräbnissen. Büchergeschwätz, ja, er ließ geheimnisvolle Andeutungen fallen, daß er Bescheid wußte, wo niemand Bescheid wußte, das hatte er vom Haustürschlüssel.
Schon als junges Ehepaar wohnten Kammerrats in ihrem eigenen Hause, und seit der Zeit hatten sie denselben Haustürschlüssel, aber da kannten sie seine wunderbaren Kraft noch nicht, die lernten sie erst später kennen.
Es war zu König Frederiks des Sechsten Zeit. Kopenhagen hatte damals kein Gas, es hatte Tranlampen, es hatte kein Tivoli oder Kasino, keine Straßenbahnen und keine Eisenbahnen. Es gab nur wenige Vergnügungen im Vergleich zu jetzt. Des Sonntags machte man einen Spaziergang zum Tor hinaus bis nach dem Assistenzkirchhof, las die Inschriften auf den Gräbern, setzte sich ins Gras, aß aus einem Vorratskorb und trank seinen Schnaps dazu, oder man ging nach Frederiksberg, wo vor dem Schlosse die Regimentsmusik, spielte und es von Menschen wimmelte, die die königliche Familie in den kleinen, engen Kanälen umherrudern sahen; der alte König steuerte das Boot, und er und die Königin grüßten alle Menschen ohne Standesunterschied. Da hinaus kamen wohlhabende Familien aus der Stadt und tranken ihren Abendtee. Warmes Wasser konnten sie in einem kleinen Bauernhaus auf dem Felde außerhalb des Gartens bekommen, aber sie mußten selber ihre Teemaschine mitbringen.
Da hinaus zogen Kammerrats an einem sonnigen Sonntagnachmittag. Das Dienstmädchen ging voran mit der Maschine, einen Vorratskorb und einer Schnapsflasche.
"Nimm auch den Haustürschlüssel mit," sagte die Kammerrätin, "damit wir in unser eigenes Haus hineinschlüpfen können, wenn wir zurückkommen; du weißt, die Tür wird bei Abenddämmerung geschlossen, und der Klingelzug ist seit heute morgen kaputt. - Wir kommen spät nach Hause! Wir wollen, wenn wir in Frederiksberg gewesen sind, noch in Casortis Theater auf Vesterbro gehen und die Pantomime "Harlekin, der Vorarbeiter der Drescher" sehen. Darin kommen sie in einer Wolke herunter. Das kostet zwei Mark die Person!"
Und sie gingen nach Frederiksberg, hörten die Musik, sahen die königlichen Boote mit wehenden Fahnen, sahen den alten König und die weißen Schwäne. Nachdem sie eine gute Tasse Tee getrunken hatten, eilten sie davon, kamen aber doch nicht rechtzeitig ins Theater.
Der Seiltanz war vorüber, der Stelzenmann war vorüber, und die Pantomime hatte begonnen; sie kamen wie immer zu spät, und daran war der Kammerrat schuld; jeden Augenblick blieb er auf dem Wege stehen, um mit Bekannten zu reden; im Theater traf er auch gute Freunde, und als die Vorstellung vorbei war, mußten er und seine Frau notwendigerweise mit zu einer Familie in der Vorstadt kommen, um ein Glas Punsch zu trinken, das würde nur zehn Minuten dauern, aber aus diesen zehn Minuten wurde freilich eine ganze Stunde. Es wurde geredet und geredet. Besonders unterhaltend war ein schwedischer Baron, oder war es ein deutscher, das hatte der Kammerrat nicht genau behalten, dahin gegen die Kunst mit dem Schlüssel, die er ihn lehrte, die behielt er für alle Zeiten. Es war außerordentlich interessant! Er konnte den Schlüssel dazu kriegen, auf alles zu antworten, wonach man ihn fragte, selbst auf das Allergeheimste.
Der Schlüssel des Kammerrats eignete sich besonders gut dazu. Er hatte einen schweren Bart, und der mußte herunterhängen. Den Griff des Schlüssels ließ der Baron auf dem Zeigefinger ruhen, frei und leicht hing er da, jeder Pulsschlag an der Fingerspitze setzte ihn in Bewegung, so daß er sich drehte, und wenn das nicht geschah, dann verstand es der Baron so ganz unmerklich, ihn sich so drehen zu lassen, wie er es wollte. Jede Drehung bedeutete einen Buchstaben von A an und das ganze Alphabet hinunter, soweit man wollte. Wenn der erste Buchstabe gefunden war, drehte sich der Schlüssel nach der entgegengesetzten Seite, darauf suchte man den nächsten Buchstaben, und so bekam man das ganze Wort, ganze Sätze, Antworten auf Fragen. Eine Lüge war das ganze, aber doch immer amüsant, das war auch eigentlich der erste Gedanke des Kammerrats, aber er ging ganz in dem Schlüsselgedanken auf.
"Mann! Mann!" rief die Kammerrätin. "Das Westtor wird um zwölf Uhr geschlossen! Wir kommen nicht hinein, wir haben nur eine Viertelstunde, müssen uns beeilen."
Ja, beeilen mußten sie sich; mehrere Personen, die auch in die Stadt wollten, überholten sie bald. Endlich näherten sie sich dem ersten Wachthaus, da schlug die Uhr zwölf, das Tor knallte zu; eine ganze Menge Menschen stand ausgeschlossen da, und zwischen ihnen Kammerrats mit Mädchen, Teemaschine und leerem Vorratskorb. Einige standen dort in großem Schrecken, andere voller Ärger; jeder faßte es auf seine Weise auf. Was war dabei zu machen?
Glücklicherweise war in der letzten Zeit der Beschluß gefaßt worden, daß eines der Tore der Stadt, das Nordertor, nicht geschlossen werden sollte, dort konnten die Fußgänger durch das Wachthaus in die Stadt hineinkommen.
Der Weg war gar nicht kurz, aber das Wetter war schön, der Himmel klar und voller Sterne und Sternschnuppen, die Frösche quakten im Graben und im Teiche. Die Gesellschaft selber fing an zu singen, ein Lied nach dem anderen, aber der Kammerrat sang nicht mit, sah auch nicht nach den Sternen, ja nicht einmal auf seine eigenen Beine, er fiel, so lang er war, dicht am Grabenrand hin, man hätte glauben können, er hätte zuviel getrunken, aber es war nicht der Punsch, sondern der Schlüssel, der ihm zu Kopf gestiegen war und sich dort umdrehte.
Endlich erreichten sie das Wachthaus des vorderen Tores, gelangten über die Brücke und in die Stadt hinein.
"Jetzt bin ich wieder froh!" sagte die Kammerrätin. "Hier ist unsere Haustür!"
"Aber wo ist denn der Haustürschlüssel?" sagte der Kammerrat. Er war nicht in der hinteren Rocktasche, auch nicht in der Seitentasche.
"Herr du meines Lebens!" rief die Kammerrätin. "Hast du den Schlüssel nicht? Den hast du bei den Schlüsselkünsten mit dem Baron verloren. Wie kommen wir nun hinein! Der Glockenstrang ist, wie du weißt, seit heute morgen kaputt, der Nachtwächter hat keinen Schlüssel zu unserem Hause. Wir sind ja in Verzweiflung!"
Das Dienstmädchen fing an zu heulen, der Kammerrat war der einzige, der die Fassung bewahrte.
"Wir müssen eine Fensterscheibe zum Laden des Fetthändlers einschlagen," sagte er, "ihn wecken und dann hineinschlüpfen."
Er schlug eine Fensterscheibe ein, er schlug zwei ein. "Petersen!" rief er und steckte den Schaft seines Regenschirms in das Fenster hinein; da schrie drinnen die Tochter des Fetthändlers laut auf. Der Krämersmann riß die Ladentür mit dem Rufe "Nachtwächter!" auf, und ehe er recht die Familie des Kammerrats gesehen, erkannt und hineingelassen hatte, pfiff der Wächter, und in der nächsten Straße antwortete ein anderer Wächter und pfiff. Leute kamen an den Fenstern zum Vorschein. "Wo ist das Feuer? Wo ist der Spektakel?" fragten sie und fragten noch, als der Kammerrat schon in seiner Stube war, den Rock auszog und - da lag der Haustürschlüssel, nicht in der Tasche, sondern in dem Futter; er war durch ein Loch hineingeschlüpft, das nicht in der Tasche hätte sein sollen.
Seit dem Abend bekam der Haustürschlüssel eine besonders große Bedeutung, nicht nur, wenn man des Abends ausging, sondern auch, wenn man zu Hause saß und der Kammerrat seine Geschicklichkeit zeigte und den Schlüssel Antwort auf die Fragen geben ließ.
Er dachte sich die wahrscheinlichste Antwort aus, und dann ließ er den Schlüssel sie geben, schließlich glaubte er selber daran; aber das tat der Apotheker nicht, er war ein junger Mann und ein naher Verwandter der Kammerrätin.
Der Apotheker war ein guter Kopf, ein kritischer Kopf, er hatte schon als Schuljunge Kritiken über Bücher und Theater geschrieben, aber ohne Nennung des Namens, das macht so viel. Er war, was man einen Schöngeist nennt, glaubte aber durchaus nicht an Geister, am allerwenigsten an Schlüsselgeister.
"Ja, ich glaube, ich glaube," sagte er, "verehrter Herr Kammerrat, ich glaube an den Haustürschlüssel und an alle Schlüsselgeister so fest, wie ich an eine neue Wissenschaft glaube, die anfängt, von sich reden zu machen; an den Tischtanz und die Geister in alten und neuen Möbeln. Haben Sie davon gehört? Ich habe davon gehört! Ich habe gezweifelt, Sie wissen, ich bin ein Zweifler, bin aber bekehrt worden, als ich in einem ganz glaubwürdigen ausländischen Blatt eine ganz schreckliche Geschichte las.
Kammerrat! Denken Sie nur, ja, ich gebe Ihnen die Geschichte wieder, wie ich sie gelesen habe. Zwei kluge Kinder hatten die Eltern den Geist in einem großen Eßtisch erwecken sehen. Die Kleinen waren allein und wollten nun versuchen, auf dieselbe Weise Leben in eine alte Kommode hineinzutreiben. Das Leben kam, und der Geist erwachte, aber er duldete das Kinderkommando nicht; er erhob sich, es krachte in der Kommode, er schob die Schubladen heraus und legte mit seinen Kommodebeinen die Kinder jedes in eine Schublade, und dann lief die Kommode mit ihnen zur offenen Tür hinaus, die Treppe hinab und auf die Straße hinaus nach dem Kanal, wo sie sich hineinstürzte und die beiden Kinder ersäufte. Die kleinen Leichen kamen in christliche Erde, aber die Kommode wurde aufs Rathaus gebracht, des Kindesmordes angeklagt und bei lebendigem Leibe auf dem Markte verbrannt. Ja, das habe ich gelesen," sagte der Apotheker, "habe es in einem ausländischen Blatt gelesen, es ist nichts, was ich selber erfunden habe. Es ist, hole mich der Schlüssel, wahr! Nun fluche ich einen schweren Fluch!"
Der Kammerrat fand, daß eine solche Rede ein zu grober Spaß sei, die beiden konnten ja doch nicht über den Schlüssel reden. Der Apotheker war schlüsseldumm.
Der Kammerrat machte Fortschritte in der Schlüsselwissenschaft, der Schlüssel war seine Unterhaltung und Weisheit.
Eines Abends, der Kammerrat war eben im Begriff, zu Bett zu gehen, er stand schon halb entkleidet, da klopfte es an die Tür nach der Diele hinaus. Es war der Fetthändler, der so spät kam; er war auch schon halb entkleidet, aber er sagte, er habe plötzlich einen Gedanken bekommen, und er sei bange, daß er ihn nicht die Nacht über behalten könne.
"Es handelt sich um meine Tochter, Lotte-Lene, ich muß von ihr reden. Sie ist ein schönes Mädchen, sie ist konfirmiert, nun wollte ich sie gern gut angebracht sehen!"
"Ich bin noch nicht Witwer," sagte der Kammerrat lächelnd, "und ich habe keinen Sohn, den ich ihr anbieten könnte!"
"Sie verstehen mich schon, Herr Kammerrat!" sagte der Krämersmann. "Klavierspielen kann sie, singen kann sie, das muß man ja hier oben im Hause hören können. Sie wissen nicht, worauf das Mädchen alles verfallen kann. Sie kann genauso reden und gehen wie alle Menschen. Sie ist für die Komödie geschaffen, und das ist eine gute Karriere für nette Mädchen aus guter Familie, sie können sich eine Grafschaft erheiraten, aber daran denkt Lotte-Lene nicht und ich auch nicht. Singen kann sie, Klavierspielen kann sie. Da ging ich denn neulich mit ihr nach der Singschule. Sie sang; sie hat aber nicht, was ich einen Bierbaß bei Frauenzimmern nenne, keinen Kanarienvogelgesang in den höchsten Tönen, so wie man es jetzt von den Sängerinnen verlangt, und dann riet man ihr ernstlich von der Karriere ab. Nun, dachte ich, kann sie nicht Sängerin werden, so kann sie immerhin Schauspielerin werden, dazu gehört ja nur die Sprache. Heute redete ich darüber mit dem Dramaturgen, wie sie ihn nennen. "Hat sie Kenntnisse?" fragte der. "Nein," sagte ich, "ganz und gar nicht!" - "Kenntnisse sind notwendig für eine Künstlerin!" sagte er. "Die kann sie noch bekommen," meinte ich, und dann ging ich nach Hause. "Sie kann ja in eine Leihbibliothek gehen und die Bücher lesen, die sie da haben," dachte ich, "dann bekommt sie Kenntnisse. "Aber wie ich nun heute Abend sitze und mich ausziehe, fällt mir plötzlich ein: "wozu soll man Bücher mieten, wenn man sie sich leihen kann? Der Herr Kammerrat hat Bücher in Hülle und Fülle, die kann sie ja lesen; dann hat sie Kenntnisse genug, und das kostet nichts!"
"Lotte-Lene ist ein gutes Mädchen," sagte der Kammerrat, "ein hübsches Mädchen! Bücher zum Lesen soll sie haben, Aber hat sie wohl das, was man Feuer des Feistes nennt, das Geniale, das Genie? Und hat sie, was hierbei ebenso wichtig ist, hat sie wohl Glück?"
"Sie hat zweimal in der Waren-Lotterie gewonnen," sagte der Fetthändler, "Einmal hat sie einen Schrank und einmal sechs Paar Laken gewonnen, das nenne ich Glück, und das hat sie!"
"Ich will den Schlüssel mal fragen!" sagte der Kammerrat.
Und er hängte den Schlüssel auf seinen rechten Zeigefinger und auf den rechten Zeigefinger des Kellermanns, ließ den Schlüssel sich schwingen und einen Buchstaben nach dem anderen von sich geben.
Der Schlüssel sagte: "Sieg und Glück!" und dann war Lotte-Lenes Zukunft bestimmt.
Der Kammerrat gab ihr gleich zwei Bücher: "Dyveke" und Knigges "Umgang mit Menschen."
Seit dem Abend begann eine Art näherer Bekanntschaft zwischen Lotte-Lene und Kammerrats. Sie kam zu der Familie hinaus, und der Kammerrat fand, daß sie ein verständiges Mädchen sei, sie glaubte an ihn und an den Schlüssel. Die Kammerrätin sah in der Freimütigkeit, womit sie jeden Augenblick ihre große Unwissenheit offenbarte, etwas Kindliches, Unschuldiges. Das Ehepaar hatte sie, jeder auf seine Weise, gern, und sie schwärmte für das Ehepaar.
"Es riecht so reizend da oben!" sage Lotte-Lene.
Da war Geruch, ein Duft, ein Apfelduft auf der Diele, wo die Kammerrätin eine ganze Tonne Gravensteiner Äpfel hingelegt hatte. Da war auch ein Räucherduft von Rosen und Lavendel in allen Zimmern.
"Das gibt so was Feines!" sagte Lotte-Lene. Und dann erfreuten sich ihre Augen an all den schönen Blumen, die die Kammerrätin immer hatte; ja, mitten im Winter blühten hier Syringen und Kirschenzweige. Die abgeschnittenen blätterlosen Zweige wurde ins Wasser gestellt, und in der warmen Stube trugen sie bald Blüten und Blätter.
"Man sollte glauben, daß das Leben in den nackten Zweigen erloschen sei, aber siehe nur, wie es von den Toten aufsteht."
"Das ist mir früher noch nie eingefallen!" sagte Lotte-Lene. "Die Natur ist doch reizend!"
Und der Kammerrat ließ sie sein Schlüsselbuch sehen, worin merkwürdige Dinge aufgeschrieben standen, die der Schlüssel gesagt hatte, selbst von einer halben Apfeltorte, die aus der Speisekammer verschwunden war, gerade an einem Abend, als das Mädchen Besuch von ihrem Bräutigam gehabt hatte.
Und der Kammerrat fragte seinen Schlüssel: "Wer hat die Apfeltorte gegessen, die Katze oder der Bräutigam?" Und der Haustürschlüssel antwortete: "Der Bräutigam!" Der Kammerrat glaubte es schon, ehe er fragte, und das Dienstmädchen gestand; der verdammte Schlüssel wußte ja doch alles.
"Ja, ist es nicht merkwürdig?" fragte der Kammerrat. "Dieser Schlüssel, dieser Schlüssel! Und von Lotte-Lene hat er gesagt: "Sieg und Glück!" - Das werden wir ja noch sehen! - Ich stehe dafür ein!"
"Es ist reizend!" sagte Lotte-Lene.
Die Frau des Kammerrats war nicht so vertrauensvoll, aber sie äußerte ihre Zweifel nicht, wenn der Mann es hörte; später aber vertraute sie Lotte-Lene, daß der Kammerrat, als er ein junger Mensch war, ganz versessen auf das Theater gewesen sei. Hätte ihn damals jemand geschoben, wäre er bestimmt Schauspieler geworden, aber die Familie schob davon weg. Auf die Bühne wollte er, und um dahin zu kommen, schrieb er eine Komödie.
"Es ist ein großes Geheimnis, das ich Ihnen anvertraue, liebe Lotte-Lene. Die Komödie war nicht schlecht, sie wurde auf dem königlichen Theater angenommen und ausgepfiffen, so daß man später nie mehr davon gehört hat, und darüber freue ich mich. Ich bin seine Frau, und ich kenne ihn. Nun wollen Sie denselben Weg gehen - ich wünsche Ihnen alles Gute, aber ich glaube nicht, daß es gehen wird, ich glaube nicht an den Haustürschlüssel!"
Lotte-Lene glaubte an ihn, und in diesem Glauben begegnete sie dem Kammerrat.
Ihre Herzen verstanden einander in Zucht und Ehren.
Das Mädchen hatte übrigens allerlei Fähigkeiten, auf die die Kammerrätin Wert legte. Lotte-Lene verstand es, Stärke aus Kartoffeln zu machen, seidene Handschuhe aus seidenen Strümpfen zu nähen, seidene Tanzschuhe zu überziehen, obwohl sie in der Lage war, sich alles neu anzuschaffen. Sie hatte, wie der Fetthändler sagte: Schillinge in der Tischschublade und Hypotheken im Geldschrank. "Das wäre eigentlich eine Frau für den Apotheker," dachte die Kammerrätin, aber sie sagte es nicht, ließ es auch den Schlüssel nicht sagen. Der Apotheker wollte sich bald niederlassen, seine eigene Apotheke einrichten, und zwar in einer der nächsten größeren Provinzstädte.
Lotte-Lene las noch immer "Dyveke" und Knigges "Umgang mit Menschen." Sie behielt die beiden Bücher zwei Jahre, aber dann konnte sie auch das eine auswendig, "Dyveke," die sämtlichen Rollen, aber sie wollte nur in der einen in der Dyvekes, auftreten, und zwar nicht in der Hauptstadt, wo so viel Neid ist und wo sie sie nicht haben wollten. Sie wollte ihre Künstlerlaufbahn, wie der Kammerrat es nannte, in einer der größeren Provinzstädte beginnen.
Nun traf es sich ganz merkwürdig, daß es gerade in derselben Stadt war, wo der Apotheker sich als der jüngste, wenn auch nicht der einzige Apotheker niedergelassen hatte.
Der große, erwartungsvolle Abend kam, Lotte-Lene sollte auftreten, Sieg und Glück erringen, wie es der Schlüssel geweißsagt hatte. Der Kammerrat war nicht da, er lag zu Bett, und die Kammerrätin pflegte ihn; warme Servietten und Kamillentee waren ihm verordnet: die Servietten um den Leib und der Tee in den Leib.
Das Ehepaar wohnte der "Dyveke"-Vorstellung nicht bei, aber der Apotheker war da, und der schrieb einen Brief darüber an seine Verwandte, die Kammerrätin.
"Der Dyveke-Kragen war das beste!" schrieb er. "Hätte ich den Haustürschlüssel des Kammerrats in meiner Tasche gehabt, so hätte ich ihn herausgeholt und darauf gepfiffen, das hätte der Schlüssel auch verdient, der so schändlich gelogen hat: "Sieg und Glück."
Der Kammerrat las den Brief. Das Ganze sei Bosheit, sagte er, Schlüsselhaß, und darunter mußte jetzt das unschuldige Mädchen leiden.
Und sobald er aus dem Bett aufstand und wieder ein Mensch war, sandte er dem Apotheker einen kleinen, aber giftspeienden Brief, und der Apotheker antwortete wieder, als ob er den Brief nur als Spaß aufgefaßt habe.
Er dankte ihm dafür, wie für jeden weiteren, freundlichen Beitrag zur Erkennung des unvergleichlichen Wertes und der Bedeutung des Schlüssels; ferner vertraute er dem Kammerrat an, daß er, außer seiner Apothenkerwirksamkeit, an einem großen Schlüsselroman schreibe, in dem alle handelnden Personen Schlüssel seien, einzig und allein Schlüssel. "Der Haustürschlüssel" war natürlich die Hauptperson, und der Haustürschlüssel des Kammerrats war ihm das Vorbild, mit Wahrsagungsfähigkeit begabt; um ihn mußten sich alle die andern Schlüssel drehen: der alte Kammerherrenschlüssel, der den Glanz und die Festlichkeit des Hofes kannte; der kleine Uhrschlüssel, fein und vornehm zu vier Schilling beim Eisenkrämer; der Schlüssel zum Kirchstuhl, der sich mit zur Geistlichkeit rechnete und der, als er eine Nacht im Schlüsselloch in der Kirche sitzengeblieben war, Geister gesehen hatte; der Speisekammer-, der Holzkammer- und der Weinkellerschlüssel, sie alle treten auf, verneigen sich und drehen sich um den Haustürschlüssel. Die Sonnenstrahlen lassen ihn wie Silber schimmern, der Wind, der Weltgeist, fährt in ihn hinein, so daß er pfeift. Er ist der Schlüssel für alle Schlüssel, er war der Haustürschlüssel des Kammerrats, jetzt ist er der Schlüssel zur Himmelspforte, er ist Papstschlüssel, er ist "unfehlbar"!
"Bosheit!" sagte der Kammerrat. "Pyramidale Bosheit!"
Er und der Apotheker sahen einander nicht mehr. Ja doch, bei dem Begräbnis der Kammerrätin.
Sie starb zuerst.
Es war Trauer und Kummer im Hause. Selbst die abgeschnittenen Kirschzweige, die schon frische Blätter und Blüten angesetzt hatten, trauerten und welkten hin, sie standen vergessen, sie pflegte sie nicht mehr.
Der Kammerrat und der Apotheker gingen hinter ihrem Sarge drein, Seite an Seite, als die zwei nächsten Verwandten, hier war keine Zeit und Stimmung, sich auf Wortgefechte einzulassen.
Lotte-Lene band einen Trauerflor um den Hut des Kammerrats. Sie war längst zurückgekehrt, ohne Sieg und Glück auf der Bahn der Kunst. Aber es konnte noch kommen, Lotte-Lene hatte eine Zukunft. Der Schlüssel hatte es gesagt, und der Kammerrat hatte es gesagt.
Sie kam zu ihm hinauf. Sie sprachen von der Verstorbenen, und sie weinten. Lotte-Lene war weich, sie sprachen von der Kunst, und Lotte-Lene war stark.
"Das Theaterleben ist reizend," sagte sie, "aber da ist so viel Neid, da sind so viele Schwierigkeiten! Ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Erst ich selber, dann die Kunst!"
Knigge hatte die Wahrheit gesprochen in dem Kapitel von den Schauspielern, das sah sie ein, der Schlüssel hatte nicht die Wahrheit geredet, aber davon sprach sie nicht mit dem Kammerrat; sie hatte ihn lieb.
Der Haustürschlüssel war ihm übrigens während des ganzen Trauerjahres ein Trost und eine Ermunterung. Er stellte ihm Fragen, und der Schlüssel gab ihm Antworten. Und als das Jahr vergangen war und er und Lotte-Lene eines stimmungsvollen Abends beisammen saßen, fragte er den Schlüssel:
"Verheirate ich mich, und mit wem verheirate ich mich?"
Da war niemand, der ihn schob, er schob den Schlüssel, und der Schlüssel sagte: "Lotte-Lene!"
Und dann war es gesagt, und Lotte-Lene wurde Kammerrätin.
"Sieg und Glück!"
Die Worte waren gesagt, schon früher vom Haustürschlüssel.
DIE GROSSE SEESCHLANGE ...

Es war einmal ein kleiner Seefisch aus guter Familie, des Namens entsinne ich mich nicht mehr, den müssen die Gelehrten dir sagten. Der kleine Fisch hatte achtzehnhundert Geschwister, alle gleich alt; sie kannten ihren Vater und Ihre Mutter nicht, sie mußten gleich selber für sich sorgen und umherschwimmen, aber das war ein großes Vergnügen für sie. Wasser zum Trinken hatten sie genug, das ganze Weltmeer, an Nahrung dachten sie nicht, die würde wohl kommen; jeder würde seiner Neigung folgen, jeder würde seine eigene Geschichte haben, ja, daran dachte auch keiner.
Die Sonne schien in das Wasser hinab, es schimmerte um sie herum, es war so klar, es war eine Welt mit den wunderlichsten Geschöpfen, und einige waren so schrecklich groß, mit mächtigen Rachen, die konnten die achtzehnhundert Geschwister verschlingen, aber auch daran dachten sie nicht, denn bisher war noch keines von ihnen verschlungen worden.
Die Kleinen schwammen zusammen, dicht nebeneinander, wie die Heringe und Makrelen schwimmen; aber während sie so im Wasser schwammen und an gar nichts dachten, sank mit einem schrecklichen Geräusch von oben herab mitten unter sie ein langes, schweres Ding, das gar kein Ende nehmen wollte; länger und länger streckte es sich, und jeder kleine Fisch, den es traf, wurde zerdrückt oder bekam einen Knacks, den er nie wieder verwinden konnte. Alle kleinen Fische und auch die großen, von der Meeresfläche hinab bis auf den Grund, stoben erschreckt beiseite; das schwere, gewaltsame Ding senkte sich tiefer und tiefer, es ward länger und länger, meilenlang, durch das ganze Meer.
Fische und Schnecken, alles was schwimmt, alles, was kriecht oder von den Strömungen getrieben wird, spürte dies entsetzliche Ding, diesen unendlichen, unbekannten Meeraal, der so ganz auf einmal von oben herabgekommen war.
Was für ein Ding war dies nur einmal? Ja, wir wissen es! Es war das große, meilenlange Telegraphenkabel, das die Menschen zwischen Europa und Amerika versenkten.
Es entstand eine Angst, es entstand eine Bewegung zwischen den rechtmäßigen Bewohnern des Meeres, überall, wo das Kabel versenkt wurde. Der fliegende Fisch schnellte in die Höhe, über die Meeresfläche, so hoch er nur konnte, ja, der Knurrhahn sprang einen ganzen Büchsenschuß über das Wasser empor, denn das kann er; andere Fische flohen auf den Meeresgrund, sie schossen mit einer solchen Heftigkeit hinab, daß sie lange, bevor das Kabeltau noch gesehen war, dort anlangten; sie erschreckten Kabeljau und Scholle, die friedlich in der Meerestiefe wanderten und ihre Mitgeschöpfe fraßen.
Ein paar Meerwalzen erschraken so sehr, daß sie ihren Magen ausspuckten, aber trotzdem weiterlebten, denn das konnten sie. Viele Hummern und Taschenkrebse verließen ihren guten Harnisch und mußten die Beine zurücklassen.
Während all dieser Angst und Verwirrung kamen die achtzehnhundert Geschwister auseinander und begegneten sich nicht wieder oder kannten einander wenigstens nicht mehr; nur ein Dutzend blieb auf demselben Fleck, und als sie sich ein paar Stunden ruhig verhalten hatten, verwanden sie den ersten Schrecken und fingen an, neugierig zu werden.
Sie sahen sich um; sie sahen aufwärts, und sie sahen abwärts, und da in der Tiefe glaubten sie das schreckliche Ding zu erblicken, das sie so in Angst versetzt hatte, groß wie klein. Das Ding lag lang über den Meeresboden ausgestreckt, so weit sie sehen konnten; sehr dünn war es, aber sie wußten ja nicht, wie dick es sich machen konnte oder wie stark es war. Es lag ganz still, aber, dachten sie, das konnte ja Hinterlist sein.
"Laßt es liegen, wo es liegt! Es geht uns gar nichts an!" sagte der vorsichtigste von den kleinen Fischen, aber der allerkleinste von ihnen konnte es sich doch nicht versagen, sich Gewißheit darüber zu verschaffen, was das Ding wohl sein könne; von oben war es herabgekommen, von obenher mußte man am besten Auskunft einholen können, und so schwammen sie denn zur Meeresoberfläche hinauf; es war windstilles Wetter.
Da begegneten sie einem Delphin; das ist so ein Springgesell, ein Meerstreicher, der Purzelbäume auf der Wasserfläche schlagen kann; Augen zum Sehen hat er, und er mußte gesehen haben, mußte Bescheid wissen; den fragten sie, aber er hatte nur an sich selber und an seine Purzelbäume gedacht, hatte nichts gesehen, wußte nichts zu antworten, und da schwieg er denn und sah stolz aus.
Dann wandten sie sich an den Seehund, der gerade niedertauchte; der war höflicher, obwohl er kleine Fische frißt, aber heute war er satt. Er wußte ein wenig mehr als der Springfisch.
"Ich habe manch liebe Nacht auf einem nassen Stein gelegen und landeinwärts gesehen, meilenweit von hier; da gibt es hinterlistige Geschöpfe, die werden in ihrer Sprache Menschen genannt, sie stellen uns nach, gewöhnlich entschlüpfen wir ihnen aber doch, das habe ich verstanden, und der Seeaal, von dem ihr redet, hat es auch verstanden. Er ist oben an Land in ihrer Macht gewesen, wohl seit undenkbaren Zeiten; von dort haben sie ihn auf ein Schiff gebracht, wohl um ihn übers Meer nach einem andern fernliegenden Land zu schaffen. Ich sah, welch eine Mühe sie damit hatten, aber sie konnten ihn bezwingen, er war ja an Land matt geworden. Sie legten ihn in Kränzen und Kreisen zusammen, ich hörte, wie er sich wand und sich wehrte, als sie ihn an Bord brachten, aber er entkam ihnen doch, floh hier hinaus. Sie hielten ihn mit aller Gewalt fest, viele Hände hielten ihn, er entschlüpfte ihnen doch und gelangte auf den Meeresboden, da liegt er, denke ich, bis auf weiteres!"
"Er ist ziemlich dünn!" sagten die kleinen Fische.
"Sie haben ihn ausgehungert!" sagte der Seehund. "Aber er wird sich bald erholen, wird seine alte Dicke und Länge wiedergewinnen. Ich nehme an, daß dies die große Seeschlange ist, vor der den Menschen so bange ist, und von der sie soviel reden; bisher habe ich sie noch niemals gesehen und habe auch nie daran geglaubt; jetzt glaube ich, daß sie es ist!" Und dann tauchte der Seehund unter.
"Wieviel er wußte! Wieviel er redete!" sagten die kleinen Fische. "Ich bin noch nie so klug gewesen! - Wenn es nur nicht Lügen sind!"
"Wir könnten ja hinabschwimmen und die Sache untersuchen!" sagte der Kleinste. "Unterwegs hören wir die Ansicht der anderen!"
"Ich mache keinen Schlag mit meinen Flossen, um etwas zu erfahren!" sagten die andern und wandten sich ab.
"Aber das tue ich!" sagte der Kleinste und lenkte seinen Kurs hinab in das tiefe Wasser; aber er war weit entfernt von der Stelle, wo das "lange, versenkte Ding" lag. Der kleine Fisch sah und suchte nach allen Seiten tief unten auf dem Meeresgrund.
Noch nie war ihm seine Welt so groß erschienen. Die Heringe schwammen in großen Schwärmen, schimmernd wie ein Riesenband aus Silber, die Makrelen schlugen dieselbe Richtung ein und sahen noch prächtiger aus. Da kamen Fische in allen Gestalten und mit Zeichnungen in allen Farben; Medusen, die halbdurchsichtigen Blumen glichen, die sich von den Strömungen tragen und führen ließen. Große Pflanzen wuchsen aus dem Meeresboden auf, klafterhohes Gras und palmenförmige Bäume, jedes Blatt mit schimmernden Schaltieren besetzt.
Endlich gewahrte der kleine Seefisch einen langen, dunkeln Streif dort unten und steuerte darauf zu, aber das war weder Fisch noch Tau, es war die Reling eines großen versunkenen Fahrzeugs, dessen oberstes und unterstes Deck durch den Druck des Meeres zerbrochen war. Der kleine Fisch schwamm in den Raum hinein, aus dem die vielen Menschen, die umgekommen waren, als das Schiff sank, jetzt alle bis auf zwei weggeschwemmt waren; eine junge Frau lag dort ausgestreckt mit einem kleine Kind in ihren Armen. Das Wasser hob sie und wiegte sie gleichsam, sie schienen zu schlafen. Der kleine Fisch erschrak sehr, er wußte ja nicht, daß sie nicht wieder erwachen konnten. Die Wasserpflanzen hingen wie Laubwerk über die Reling herab, rankten sich um die beiden schönen Leichen der Mutter und des Kindes. Es war so still dort und so einsam. Der kleine Fisch machte sich, so schnell er nur konnte, von dannen, schwamm dahin, wo das Wasser beleuchtet war, wo Fische zu sehen waren. Er war noch nicht weit gekommen, da begegnete er einem jungen Walfisch, der schrecklich groß war.
"Verschlinge mich nicht!" sagte der kleine Fisch. "Ich bin ja nicht einmal ein Bissen, so klein bin ich, und es ist mir eine große Freude zu leben!"
"Was willst du so tief hier unten, wohin deine Art nicht kommt?" fragte der Walfisch. Und dann erzählte der kleine Fisch von dem langen wunderlichen Aal oder was für ein Ding es sein möchte, das sich von oben herabgesenkt und selbst die allermutigsten Meergeschöpfe erschreckt hatte.
"Ho, ho!" sagte der Walfisch und sog so gewaltig Wasser ein, daß er einen mächtigen Wasserstrahl von sich geben mußte, wenn er an die Meeresfläche kam und Luft schöpfte. "Ha, ha!" sagte er. "Das also war das Ding, das mir den Rücken kitzelte, als ich mich umwandte! Ich glaubte, es sei ein Schiffsmast, den ich gebrauchen könnte, um mich zu jucken! Aber hier in dieser Gegend war es nicht. Nein, viel weiter hinaus liegt das Ding. Ich will es doch gleich mal untersuchen, ich habe gerade nichts weiter zu tun!"
Und dann schwamm er vorwärts, und der kleine Fisch schwamm hinterdrein, nicht zu nahe, denn wo der große Walfisch durch das Wasser schwamm, entstand gleichsam ein reißender Strom.
Sie begegneten einem Hai und einem alten Schwertfisch; die beiden hatten auch von dem wunderlichen Seeaale gehört, der so lang und so dünn war; gesehen hatten sie ihn nicht, aber sie wollten ihn sehen.
Jetzt kam eine Meerkatze.
"Ich komme mit!" sagte sie; sie wollte doch denselben Weg.
"Wenn die große Seeschlange nicht dicker ist als ein Ankertau, dann will ich sie schon in einem Biß durchbeißen!" Und dabei öffnete sie ihr Maul und zeigte ihre sechs Reihen Zähne. "Ich kann Merkzeichen in einen Schiffsanker beißen, da dann ich den Stengel wohl auch durchbeißen!"
"Da ist er!" sagte der große Walfisch. "Ich kann ihn sehen!" Er glaubte, daß er besser sehen könne als die andern. "Seht, wie er sich hebt, seht, wie er sich windet und beugt und krümmt!"
Aber das war er gar nicht, es war ein ungeheurer großer Seeaal, mehrere Ellen lang, der sich näherte.
"Den hab ich schon früher gesehen," sagte der Schwertfisch, "der hat nie großen Aufruhr im Meer verursacht oder irgendeinem großen Frisch Schrecken eingejagt!"
Und dann sprach sie mit ihm von dem neuen Aal und fragten, ob er mit auf die Entdeckungsreise wolle.
"Ist der Aal länger als ich," sagte der Seeaal, "dann soll ihm ein Unglück geschehen!"
"Ja, dem soll ein Unglück geschehen!" sagten die anderen. "Wir sind genug, um ihn nicht zu dulden!" Und dann eilten sie weiter.
Aber da kam ihnen etwas in den Weg, ein wunderliches Ungeheuer, das größer war als sie alle zusammen.
Es sah aus wie eine schwimmende Insel, die sich nicht an der Oberfläche zu halten vermochte.
Es war ein uralter Walfisch. Sein Kopf war mit Wasserpflanzen überwuchert, der Rücken mit so unendlich vielen Austern und Muscheln besetzt, daß seine schwarze Haut ganz weißgefleckt war.
"Komm mit, Alter," riefen sie ihm zu, "hier ist ein neuer Fisch angekommen, den wir nicht dulden wollen!"
"Ich will lieber liegenbleiben, wo ich liege!" sagte der alte Walfisch. "Laßt mich in Ruhe! Laßt mich liegen!
Ja, ja, ja, ja! Ich leide an einer schweren Krankheit. Die einzige Linderung gewährt es mir, wenn ich an die Meeresfläche hinaufsteige und den Rücken außer Wasser halte. Dann kommen die großen Seevögel und kraulen mich, das tut so gut! Wenn sie die Schnäbel nur nicht zu tief hineinhacken, oft picken sie bis in meinen Speck hinein. Seh nur einmal! Das ganze Gerippe eines Vogels sitzt mir noch auf dem Rücken; der Vogel schlug seine Klauen zu tief ein und konnte nicht wieder loskommen, als ich auf den Grund tauchte. Jetzt haben die kleinen Fische ihn abgefressen. Sehr nur, wie er aussieht und wie ich aussehe! Ich bin schwerkrank!"
"Das ist nichts als Einbildung," sagte der Walfisch. "Ich bin niemals krank. Kein Fisch ist krank."
"Entschuldigen Sie," sagte der alte Walfisch, "der Aal hat die Hautkrankheit, der Karpfen soll Pocken haben, und wir alle haben Eingeweidewürmer!"
"Unsinn!" sagte der Haifisch; er mochte nichts mehr hören, die andern auch nicht, sie hatten ja etwas anderes zu tun.
Endlich kamen sie an die Stelle, wo das Telegraphenkabel lag. Es hat ein langes Lager auf dem Meeresboden, von Europa nach Amerika hinüber, hinweg über Sandbänke und Meeresschlamm, über Klippengründe und Pflanzenwildnis, ja, über ganze Korallenwälder; und dann wechseln die Strömungen da unten, die Wasserwirbel drehen sich, Fische wimmeln hervor, mehr in einem Schwarm als die zahllosen Vogelscharen, die die Menschen in der Zugvogelzeit sehen. Da ist ein Rühren, ein Plätschern, ein Summen, ein Sausen. Von diesem Sausen spukte es noch ein wenig in den großen, leeren Meeresmuscheln, wenn wir sie an unser Ohr halten.
Jetzt kamen sie an die Stelle.
"Da liegt das Tier!" sagten die großen Fische, und die kleinen sagten es auch. Sie sahen das Tau, dessen Anfang und Ende ihrem Gesichtskreis entschwand.
Schwämme, Polypen und Gorgonen wiegten sich über dem Meeresgrund, senkten und beugten sich über das Tau, so daß es bald verdeckt war, bald wieder sichtbar wurde. Seestachelschweine, Schnecken und Würmer bewegten sich darum herum; riesige Spinnen, die eine ganze Besatzung von kriechenden Tieren mit sich schleppten, stolzierten auf dem Tau entlang. Dunkelblaue Meerwalzen oder wie das Gewürm heißt, das mit dem ganzen Körper frißt, lagen da und beschnüffelten das neue Tier, das sich auf dem Meeresboden gelagert hatte. Scholle und Kabeljau wendeten sich im Wasser, um nach allen Seiten zu lauschen. Der Sternfisch, der sich immer in den Schlamm hineinbohrt und nur die beiden langen Stengel mit den Augen blicken läßt, lag da und glotzte, um zu sehen, was aus der Bewegung herauskommen würde.
Das Telegraphenkabel lag ohne alle Bewegung da. Aber Leben und Gedanken waren darin; Menschengedanken gingen da hindurch.
"Das Ding ist heimtückisch!" sagte der Walfisch. "Es ist imstande, mich auf den Bauch zu schlagen, und das ist nun einmal meine schwache Seite!"
"Wir wollen uns vorfühlen!" sagte der Polyp. "Ich habe lange Arme, ich habe geschmeidige Finger; berührt habe ich ihn schon, jetzt will ich ihn einmal etwas fester anfassen."
Und er streckte seine geschmeidigen, längsten Arme nach dem Tau hinab, legte sie rund herum.
"Eine Schale hat er nicht," sagte der Polyp. "er hat keine Haut! Ich glaube, er wird nie lebende Junge zur Welt bringen!"
Der Seeaal legte sich längs des Telegraphenkabels und streckte sich so lang aus, wie er nur konnte.
"Das Ding ist länger als ich!" sagte er. "Aber die Länge macht es nicht, man muß Haut und Magen und Geschmeidigkeit haben!"
Der Walfisch, der junge, starke Walfisch, neigte sich tief hinab, tiefer, als er jemals gewesen war.
"Bist du Fisch oder Pflanze?" fragte er. "Oder bist du nur ein Machwerk von oben, das hier unten bei uns nicht gedeihen kann?"
Aber das Kabel antwortete nicht; das ist nicht seine Art. Es gingen Gedanken durch seinen Leib hindurch, Menschengedanken; es führte sie in einer Sekunde, die vielen hundert Meilen von Land zu Land.
"Willst du antworten, oder willst du durchgebissen werden?" fragte der gierige Hai, und alle die andern großen Fische fragten dasselbe: "Willst du antworten, oder willst du durchgebissen werden?"
Das Tau rührte sich nicht, es hatte seinen ganz aparten Gedanken, und einen solchen kann derjenige haben, der mit Gedanken angefüllt ist.
"Mögen sie mich durchbeißen! Dann werde ich hinaufgezogen und komme in bester Ordnung wieder zurück; das ist schon andern meiner Art in weit kleineren Gewässern begegnet!"
Deswegen antwortete das Tau nicht, es hatte anderes zu tun, es telegraphierte, lag von Amts wegen auf dem Grunde des Meeres.
Oben auf der Erde ging jetzt die Sonne unter, wie die Menschen es nannten, sie glich dem rötesten Feuer, und alle Wolken des Himmels schienen wie Feuer, eine immer noch prächtiger als die andere.
"Jetzt bekommen wir die rechte Beleuchtung," sagten die Polypen, "dann sieht man das Ding am Ende besser, falls es nötig ist!"
"Drauflos! Drauflos!" rief die Meerkatze und zeigte alle ihre Zähne.
"Drauflos! Drauflos!" sagten der Schwertfisch und der Walfisch und der Seeaal.
Sie stürzten vorwärts, die Meerkatze voran; aber im selben Augenblick, als sie in das Tau hineinbeißen wollte, jagte der Schwertfisch aus lauter Aufgeregtheit sein Schwert in das Hinterteil der Meerkatze hinein; das war ein großes Versehen, und die Katze hatte nun keine Kraft mehr zum Biß.
Es entstand ein wirres Durcheinander unten am Meeresgrund: große Fische und kleine Fische, Meerwalzen und Schnecken gingen aufeinander los, fraßen einander, wurden zerquetscht, zerdrückt. Das Tau lag still und verrichtete seine Arbeit, und das soll man tun.
Oben brütete die finstere Nacht, aber die Milliarden und Milliarden von lebenden kleinen Tieren des Meeres leuchteten. Krebse, kaum so groß wie ein Stecknadelkopf, leuchteten. Es ist ganz wunderbar, aber so ist es nun einmal.
Die Tiere des Meeres sahen das Telegraphenkabel an.
"Was ist doch das Ding, und was ist es nicht?"
Ja, das war die Frage.
Da kam eine alte Meerkuh. Die Menschen nennen die Art: Meermann, oder Meermaid. Eine Sie war es, sie hatte einen Schwanz und zwei kurze Arme zum Plätschern, einen hängenden Busen und Tang und Muscheln im Haar und darauf war sie stolz.
"Wollt ihr Kenntnis und Wissen erlangen," sagte sie, "so bin ich wohl die einzige, die euch dazu verhelfen kann. Aber dafür verlange ich gefahrlosen Weideplatz auf dem Meeresboden für mich und die Meinen. Ich bin ein Fisch wie ihr. Und ich bin auch ein kriechendes Tier durch Übung. Ich bin die Klügste im ganzen Meer, ich weiß von allem, was sich hier unten regt, und von allem, was da oben vor sich geht. Das Ding da, über das ihr euch die Köpfe zerbrecht, stammt von da oben, und was von da oben herunterplumpst, ist tot oder wird tot und machtlos; laßt es liegen, wie es liegt. Es ist nur eine Menschenerfindung."
"Ich glaube nun doch, daß etwas mehr daran ist!" sagte der kleine Walfisch.
"Halts Maul, Makrele!" sagte die große Meerkuh.
"Stichling!" sagten die andern, und das war eine noch größere Beleidigung.
Und die Meerkuh erklärte ihnen, daß das ganze Alarmtier, das ja übrigens keinen Muck sagte, nur eine Erfindung von dem trocknen Land sei. Und sie hielt einen Vortrag über die Verschlagenheit der Menschen.
"Sie wollen sich unser bemächtigen," sagte sie, "das ist das einzige, wofür sie leben, sie spannen ihre Netze aus, stecken den Köder auf den Angelhaken, um uns zu locken. Dies hier ist eine Art großer Angelleine, und sie glauben, daß wir daran anbeißen werden, so dumm sind sie! Aber das sind wir nicht! Berührt nur ja nicht das Machwerk, das löst sich in Fasern auf, wird zu Stückwerk und Schlamm, das Ganze. Was von oben kommt, hat alles einen Knacks, taugt nichts!"
"Taugt nichts!" sagten alle Geschöpfe des Meeres und hielten sich an die Meinung der Meerkuh, um auch eine Meinung zu haben.
Der keine Seefisch behielt seinen eigenen Gedanken. "Die unendlich dünne, lange Schlange ist am Ende der wunderbarste Fisch im ganzen Meer. Ich habe eine Empfindung davon."
"Ja, der wunderbarste!" sagen wir Menschen auch und sagen es mit Kenntnis und Gewißheit.
Es ist die große Seeschlange, von der schon längst in Liedern und Sagen erzählt ist.
Sie ist geboren und großgezogen, entsprungen aus der Klugheit der Menschen und auf dem Meeresboden niedergelegt, wo sie sich von den Ländern des Ostens bis zu den Ländern des Westens erstreckt und die Botschaft so schnell weiterträgt, wie der Strahl des Lichts von der Sonne zu unserer Erde hinabdringt. Sie wächst, wächst an Macht und Ausdehnung, wächst Jahr für Jahr, durch alle Meere, um die ganze Welt herum, unter den strömenden Wassern und des glasklaren Wassern, wo der Schiffer hinabsieht, als segele er durch die durchsichtige Luft, wo er wimmelnde Fische sieht, ein ganzes Farbenfeuerwerk.
Ganz tief unten erstreckt sich die Schlange, eine sagenhafte, segenspendende Riesenschlange, die sich in den Schwanz beißt, indem sie die Erde umschließt. Fische und kriechendes Gewürm rennt mit der Stirn dagegen, sie verstehen die Dinge von oben doch nicht: der Menschheit gedankenerfüllte, in allen Sprachen redende und doch lautlose Schlage der Erkenntnis des Guten und Bösen, das wunderbarste von allen Wundern des Meeres, die große Seeschlange unserer Zeit.
DIE LUMPEN ...

Draußen vor der Fabrik standen in Haufen hoch aufgestapelte große Lumpenbündel, die von weit und breit gesammelt waren; jeder Lump hatte seine Geschichte, jeder führte seine Rede, aber man kann sie nicht alle zugleich hören. Einige Lumpen waren inländisch, andere waren aus fremden Landen. Hier lag nun ein dänischer Lump gleich neben einem norwegischen Lumpen; urdänisch war der eine, und stocknorwegisch war der andere, und das war das Komische an den beiden, wird jeder vernünftige Norweger und jeder vernünftige Däne sagen.
Sie erkannten nun einander an der Sprache, obgleich jede von ihnen, sagte der Norweger, so verschieden war wie Französisch und Hebräisch. "Wir gehen zur Quelle, um es ungefälscht und ursprünglich zu haben, und der Däne macht sich seine suzelsüße Quatschsprache."
Die Lumpen redeten, und Lump ist Lump in jedem Lande, sie haben nur Geltung im Lumpenbündel.
"Ich bin norwegisch!" sagte der Norweger. "Und wenn ich sage, daß ich norwegisch bin, so glaube ich, genug gesagt zu haben! Ich bin fest von Gewebe wie die Urberge im alten Norwegen, dem Land, das eine Verfassung hat wie das freie Amerika! Es kitzelt mich in allen Fasern, zu denken, was ich bin, und den Gedanken mit Erzdröhnen in Granitworten erklingen zu lassen!"
"Aber wir haben eine Literatur!" sagte der dänische Lump. "Verstehen Sie, was das ist?"
"Verstehen!" wiederholte der Norweger. "Flachlandsbewohner, soll ich ihn zum Berg erheben und ihm mit Nordlichtern heimleuchten, Lapp, der er ist! Wenn das Eis vor der norwegischen Sonne taut, dann kommen dänische Lastbote zu uns hinauf mit Butter und Käse, recht eßbaren Waren! Und da kommt als Ballast dänische Literatur mit. Wir brauchen sie nicht! Man entbehrt gerne abgestandenes Bier da, wo die frische Quelle sprudelt, und hier ist es ein Brunnen, der nicht gebohrt ist, nicht zu europäischer Kenntnis geschwatzt durch Zeitungen, Cliquenwesen und Verfasserreisen in das Ausland. Frei rede ich von der Leber weg, und der Däne muß sich an die freien Tage gewöhnen, und das will er in seinem skandinavischen Anklammern an unser stolzes Felsenland, den Urstamm der Welt!"
"So konnte nun niemals ein dänischer Lump reden!" sagte der Däne. "Das ist nicht unsere Natur. Ich kenne mich selbst, und wie ich sind alle unsere Lumpen; wir sind so gutmütig, so bescheiden, wir glauben so wenig an uns selbst, und damit gewinnt man freilich nichts, aber ich kann das so gut leiden, ich finde es so reizend. Übrigens, das kann ich Ihnen versichern, kenne ich vollständig meine eigenen Qualitäten, aber ich spreche nicht davon, eines solchen Fehlers soll mich keiner beschuldigen können. Ich bin weich und biegsam, ertrage alles, beneide keinen, spreche gut von allen, ungeachtet nicht viel Gutes von den meisten anderen zu sagen ist, aber laß sie dabei! Ich habe nur immer ein Lächeln dafür, denn ich bin so begabt!"
"Sprechen Sie nicht diese weiche Flachlands-Kleister-Sprache zu mir, mich ekelt davor!" sagte der Norweger und löste sich im Winde aus dem Bündel und kam in ein anderes hinüber.
Papier wurden sie alle beide, und der Zufall wollte, daß der norwegische Lump ein Papier wurde, auf dem ein Nordländer einen treusinnigen Liebesbrief an ein dänisches Mädchen schrieb, und der dänische Lump wurde das Manuskript einer dänischen Ode zum Preis von Norwegens Herrlichkeit.
Es kann auch etwas Gutes aus den Lumpen werden, wenn sie erst aus dem Lumpenbündel heraus sind und die Verwandlung geschehen ist zu Wahrheit und Schönheit, die in gutem Verstehen leuchten, und in diesem liegt der Segen.
Das ist die Geschichte, sie ist ganz vergnüglich und verletzt niemand außer – den Lumpen.
DIE SCHWEINE

Charles Dickens hat uns vom Schweine erzählt, und seit der Zeit werden wir schon guter Laune, wenn wir es nur grunzen hören. Der heilige Antonius hat es unter seine Glorie genommen, und denkt man an den »verlorenen Sohn,« so ist man schon inmitten des Schweinestalles, und vor einem solchen hielt unser Wagen drüben in Schweden an. Nach der Landstraße heraus, dicht an seinem Hause hatte der Bauer seinen Schweinestall, und zwar einen Schweinestall sonder gleichen. Es war eine alte Staatskarosse; die Sitze waren herausgehoben, die Räder fortgeschafft, und so ohne Weiteres stand sie auf dem Bauche, und vier Schweine waren darin eingesperrt; ob diese die ersten waren? Nun, darüber konnte man allerdings nicht entscheiden; daß es aber eine geborene Staatskutsche war, davon zeugte Alles, selbst der Saffianfetzen, der von der Decke herab hing – Alles zeugte von besseren Tagen.
»Uff! – Uff!« sagte es da drinnen, und die Kutsche krachte und klagte; es war ja ein trauriges Ende, das sie genommen. »Das Schöne ist hin!« seufzte sie oder hätte sie wenigstens seufzen können.
Wir kamen im Herbste wieder, die Kutsche stand noch hier, aber die Schweine waren fort; sie spielten die Herren im Walde, die Blüten und Blätter waren von allen Bäumen herunter, Sturm und Regen regierten und gönnten ihnen weder Ruhe noch Rast; die Zugvögel waren fort. »Das Schöne ist hin! – Hier ist der herrliche, grüne Wald, der warme Sonnenschein und der Gesang der Vögel, hin! hin!« So sprach es, so krachte es in den Stämmen der hohen Bäume, und es klang ein Seufzer so tief, ein Seufzer aus dem Herzen des wilden Rosenstrauchs und Desjenigen, der da saß – es war der Rosenkönig. Kennst Du ihn? Er ist lauter Bart, der schönste, rotgrüne Bart, er ist leicht zu kennen. Geh' an die wilden Rosenhecken, und wenn im Herbste alle Blumen ihnen entfallen und nur noch die roten Hagebutten übrig sind, wirst Du oft unter diesen eine große, rotgrüne Moosblume erblicken, das ist der Rosenkönig; es wächst ihm ein kleines grünes Blatt aus dem Scheitel, das ist seine Feder; er ist an dem Rosenstrauche der einzige Mann seiner Art, und er war es, der da seufzte.
»Hin, hin! – Das Schöne ist hin! Die Rosen sind fort, die Blätter fallen ab! Hier ist's naß, hier ist's rauh! Die Vögel verstummen jetzt, die Schweine gehen auf die Eichelmast, sie sind Herren im Walde!«
Es waren kalte Nächte und graue Tage, aber der Rabe saß auf dem Zweige und sang trotzdem: »Brav, brav!« Rabe und Krähe saßen auf dem hohen Zweige; sie haben eine große Familie, und alle sagten sie: »Brav, brav!« die Menge hat ja immer Recht.
Unter den hohen Bäumen im Hohlwege war eine große Pfütze, und hier lag die Schweineheerde, groß und klein; sie fanden den Ort so beispiellos schön; oui! sagten sie; mehr Französisch konnten sie nicht, aber das war doch immer etwas. Sie waren so klug und so fett.
Die Alten lagen ruhig, und dachten; die Jungen dagegen waren sehr emsig und hatten keine Ruhe; ein kleines Ferkel hatte einen Ringel am Schwanze, dieser Ringel war der Stolz der Mutter; sie glaubte, Alle blickten den Ringel an und dächten nur an ihn, aber das taten sie nicht, sie dachten an sich selbst und an das Nützliche und daran, wozu der Wald wohl sei. Immer hatten sie gehört, daß die Eicheln, die sie fraßen, an der Wurzel der Bäume wuchsen, und hatten deshalb immer die Erde dort aufgewühlt; aber jetzt kam ein kleines Schwein – denn es sind immer die Jungen, die das Neue an den Tag fördern; – dasselbe behauptete, die Eicheln fielen von den Zweigen herab, ihm selbst sei eine auf den Kopf gefallen, und diese habe es auf die Idee gebracht; später habe es Beobachtungen angestellt, und jetzt sei es seiner Sache gewiß. Die Alten steckten die Köpfe zusammen; »uff!« sagten sie, »uff! Die Herrlichkeit ist hin! Mit dem Vogelgezwitscher ist es aus! Früchte wollen wir! Was gefressen werden kann, das ist gut, und wir fressen Alles!«
»Oui! Oui!« sagten sie alle.
Aber die Schweinemutter sah ihr kleines Ferkel an, das den Ringel am Schwanze hatte. »Man darf das Schöne nicht übersehen!« sagte sie.
»Brav! Brav!« schrie die Krähe und flog vom Baume herab, um als Nachtigall angestellt zu werden; eine mußte ja da sein, und die Krähe wurde gleich angestellt!
»Hin! hin!« seufzte der Rosenkönig. »Das Schöne ist hin!«
Es war rauh, es war grau, kalt und windig, und durch den Wald und über das Feld peitschte der Regen in langen Regenwolken dahin.
Wo ist der Vogel, der da sang, wo sind die Blumen auf der Wiese und die süßen Beeren des Waldes? – Hin! hin!
Da schimmerte ein Licht aus dem Forsthause, wie ein Stern wurde es angezündet und warf seinen langen Strahl zwischen den Bäumen hindurch; es tönte ein Gesang aus dem Hause heraus; schöne Kinder spielten dort um den Großvater; er saß, die Bibel auf dem Knie, und las von Gott und dem ewigen Leben und sprach vom Frühlinge, dem Wiederkehren, vom Walde, der sich auf's Neue grün belauben, von den Rosen, die blühen, den Nachtigallen, die singen, und dem Schönen, das wieder als Herrscher auftreten würde!
Aber der Rosenkönig hörte es nicht, er saß in dem nassen, kalten Wetter und seufzte: »Hin! hin!« – die Schweine waren Herren im Walde, und die Schweinemutter betrachtete ihr kleines Ferkel und seinen Ringel. »Es bleibt immer Jemand, der Sinn für das Schöne hat!« sagte die Schweinemutter.
TANTCHEN
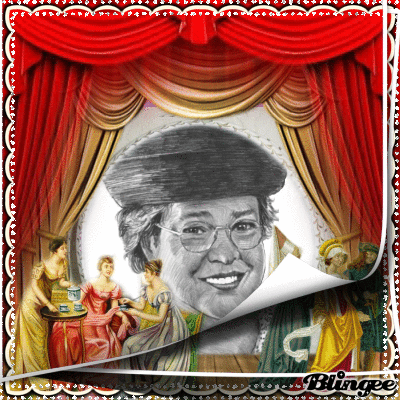
Du hättest Tantchen kennen sollen! Sie war reizend! Ja, das heißt, sie war gar nicht reizend, wie man es versteht, wenn man von ‚reizend sein‘ spricht, aber sie war süß und lieb, unterhaltend auf ihre Weise, richtig um über sie zu sprechen, wenn man über jemanden sprechen und sich lustig machen soll, sie war, um sie direkt in eine Komödie zu setzten – und das einzig und allein, weil sie nur für das Komödienhaus lebte und alles, was sich darinnen rührt. Sie war so ehrenwert, aber der Agent Fabs, den Tantchen immer Flabs nannte, nannte sie theatertoll.
„Das Theater ist meine Schule,“ sagte sie, „meine Wissensquelle, von dort her habe ich meine biblische Geschichte aufgefrischt: ‚Moses‘, ‚Joseph und seine Brüder‘, das sind nun Opern! Ich habe vom Theater meine Weltgeschichte, Geographie und Menschenkenntnis! Ich kenne das Pariser Leben aus den französischen Stücken – schlüpfrig, aber höchst interessant! Wie habe ich geweint über ‚Die Familie Riquebourg‘, daß der Mann sich tot trinken soll, damit sie den jungen Liebhaber bekommen kann! – Ja, wie viele Tränen habe ich doch geweint in den fünfzig Jahren, die ich abonniert bin!“
Tantchen kannte jedes Theaterstück, jede Kulisse, jede Person, die auftrat oder aufgetreten war. Sie lebte nur wirklich in den neun Theatermonaten. Der Sommer ohne Sommertheater war eine Zeit, die sie alt machte, während ein Theaterabend, der sich über Mitternacht hinauszog, eine Lebensverlängerung war. Sie sprach nicht wie andere Leute: „Nun haben wir Frühling, der Storch ist gekommen!“ – „Es steht in der Zeitung, von der ersten Erdbeere.“ Sie dagegen verkündete das Kommen des Herbstes. „Haben Sie gesehen, und kommen die Theaterlogen zur Auktion, nun beginnen die Vorstellungen?“
Sie berechnete den Wert und die gute Lage einer Wohnung danach, wie nahe sie dem Theater lag. Es war ihr ein Schmerz, die kleine Gasse hinter dem Theater zu verlassen und in die große Straße etwas weiter davon zu ziehen und dort in einem Haus zu wohnen, wo sie kein Gegenüber hatte.
„Zu Hause muß mein Fenster meine Theaterloge sein! Man kann doch nicht sitzen und in sich selber aufgehen; Menschen muß man doch sehen! Aber nun wohne ich, als wäre ich hinaus aufs Land gezogen. Will ich Menschen sehen, muß ich hinausgehen in meine Küche und mich auf den Gußstein setzen, nur da habe ich ein Gegenüber. Nein, als ich in meinem Gäßchen wohnte, da konnte ich gerade zum Leinenhändler hineinsehen, und dann hatte ich nur drei Schritte zum Theater, nun habe ich dreitausend Gardistenschritte.“
Tantchen konnte krank sein, aber wie schlecht sie sich auch fühlte, versäumte sie doch das Theater nicht. Ihr Arzt verordnete, daß sie eines Abends Sauerteig unter den Sohlen haben sollte, sie tat, wie er sagte, aber fuhr hin ins Theater und saß dort mit Sauerteig unter den Füßen. Wäre sie dort gestorben, so würde es sie gefreut haben. Thorwaldsen starb im Theater, das nannte sie einen „seligen Tod.“
Sie konnte sich gewiß das Himmelreich nicht anders vorstellen, als daß auch dort ein Theater sein müßte; das war uns ja nicht verheißen, aber es war doch anzunehmen, daß die vielen ausgezeichneten Schauspieler und Schauspielerinnen, die vorausgegangen waren, einen weiteren Wirkungskreis haben mußten.
Tantchen hatte ihren elektrischen Draht vom Theater zu ihrer Wohnung; das Telegramm kam jeden Sonntag zum Kaffee. Ihr elektrischer Draht war „Herr Sivertsen von der Theatermaschinerie,“ der die Signale gab für Auf und Ab, Ein und Aus mit Vorhängen und Kulissen.
Von ihm bekam sie voraus eine kurze und lebendige Ankündigung der Stücke, Shakespeares „Sturm“ nannte er „verfluchtes Zeug! Da ist so viel aufzustellen, und dann beginnt es mit Wasser bis zur ersten Kulisse!“ Das hieß, so weit heran gingen die rollenden Wogen. Stand dagegen durch all die fünf Akte ein und dieselbe Zimmerdekoration, dann sagte er, daß es vernünftig und gut geschrieben sei, es war ein Ruhestück, es spielte sich selber, ohne Aufstellung.
In früher Zeit, wie Tantchen die Zeit vor einigen dreißig Jahren nannte, waren sie und der eben erwähnte Herr Sivertsen jünger; er war schon bei der Maschinerie und, wie sie ihn nannte, ihr Wohltäter. Es war nämlich zu der Zeit Sitte, daß bei der Abendvorstellung in dem einzigen und großen Theater der Stadt Zuschauer auch auf den Boden kamen, jeder Maschinist hatte über einen oder zwei Plätze zu verfügen. Es war da oft gestopft voll und sehr feine Gesellschaft; man sagte, daß da sowohl Generalinnen als auch Kommerzienrätinnen gewesen seien; es war so interessant, hinter die Kulissen hinab zu sehen und zu wissen, wie die Menschen gingen und standen, wenn der Vorhang unten war.
Tantchen war mehrere Male dagewesen, sowohl zu Tragödien, als auch zu Ballet, denn die Stücke, wo das meiste Personal auftrat, waren die interessantesten vom Boden. Man saß so ziemlich im Dunkeln dort oben, die meisten hatten Abendbrot mit; einmal fielen drei Äpfel und eine Schnitte Butterbrot mit Rollwurst gerade hinab in Ugolinos Gefängnis, wo der Mensch Hungers sterben sollte, und da entstand ein Gelächter im Publikum. Die Rollwurst war einer der wichtigsten Gründe, weshalb die hohe Direktion die Zuschauerplätze auf dem Boden ganz aufheben ließ.
„Aber ich war siebenunddreißigmal da,“ sagte Tantchen, „und das vergesse ich Herrn Sivertsen niemals.“
Es war gerade der letzte Abend, daß der Boden dem Publikum geöffnet war, da wurde „Salomons Urteil“ gespielt, Tantchen erinnerte sich so genau; sie hatte durch ihren Wohltäter, Herrn Sievertsen, dem Agenten Fabs ein Eintrittsbillett verschafft, obgleich er es nicht verdiente, da er immer Narrenpossen mit dem Theater trieb und neckte; aber sie hatte ihn nun da hinaufgeschafft. Er wollte das Komödienzeug von der Kehrseite sehen, das waren seine eigenen Worte, und sie sahen ihm ähnlich, sagte Tantchen.
Und er sah „Salomons Urteil“ von oben und schlief ein; Man sollte wahrlich glauben, daß er von einem großen Diner mit vielen Toasten gekommen sei. Er schlief und wurde eingeschlossen, und schlief in der dunklen Nacht auf dem Theaterboden, und als er erwachte, erzählte er, aber Tantchen glaubte ihm nicht, da war „Salomons Urteil“ aus, alle Lampen und Lichter waren aus, alle Menschen aus, oben und unten; aber da begann erst das richtige Theater, das „Nachspiel,“ das war das Netteste, sagte der Agent. Da kam Leben in das Zeug! Es war nicht „Salomons Urteil,“ das gegeben wurde, nein, es war der Gerichtstag auf dem Theater. Und all das hatte der Agent Fabs die Frechheit, Tantchen einreden zu wollen; das war der Dank, weil sie ihn auf den Boden hinaufgeschafft hatte.
Was erzählte doch der Agent, ja, das war komisch genug zu hören, aber es lag Bosheit und Neckerei zugrunde.
„Es sah dunkel aus dort oben,“ sagte der Agent, „aber dann begann das Zauberzeug, große Vorstellung ‚Gerichtstag auf dem Theater‘. Die Kontrolleure standen an den Türen, jeder Zuschauer mußte sein geistiges Zensurbuch vorzeigen, ob er mit freien Händen hineinkommen durfte oder mit gebundenen, mit Maulkorb oder ohne Maulkorb. Herrschaften, die zu spät kamen, wenn die Vorstellung schon begonnen hatte, ebenso junge Menschen, die ja unmöglich immer die Zeit abpassen können, wurden draußen gefesselt, bekamen Filzsolen unter die Füße, um beim Anfang des nächsten Aktes hineinzugehen, dazu auch einen Maulkorb. Und dann begann der Gerichtstag.“
„Reine Bosheit, von der Gott nichts weiß,“ sagte Tantchen.
Der Maler sollte, wollte er in den Himmel, eine Treppe hinaufgehen, die er selber gemalt hatte, die aber kein Mensch hinaufklettern konnte. Das war ja nur eine Sünde gegen die Perspektive. Alle die Pflanzen und Gebäude, die der Maschinenmeister mit großer Ungelegenheit in Länder gestellt hatte, in die sie nicht hineingehörten, sollte der arme Mensch an den rechten Ort versetzen, und das vor dem ersten Hahnenschrei, wenn er in den Himmel hineinwollte. Herr Fabs sollte nur sehen, daß er selber hineinkommen könne; und was er von dem Personal erzählte, von der Komödie, von Gesang und Tanz, war nun das Schwärzeste von Herrn Fabs, Flabs! Er verdiente nicht, auf den Boden zu kommen, Tantchen wollte seine Worte nicht in den Mund nehmen. Es war niedergeschrieben, das Ganze, was er gesagt hatte, der Flabs! Es sollte in Druck kommen, wenn er tot und unter der Erde wäre, nicht früher; er wollte nicht geschunden werden.
Tantchen war nur einmal in Angst und Not gewesen in ihrem Glückseligkeitstempel, dem Theater. Es war ein Wintertag, einer von den Tagen, an denen es nur zwei Stunden Tag ist und auch da grau. Es war eine Kälte und ein Schnee, aber ins Theater mußte Tantchen; sie gaben „Herman von Unna,“ dazu eine kleine Oper und ein großes Ballett, einen Prolog und einen Epilog. Es würde erst in der Nacht aus sein. Tantchen mußte dahin; ihre Mieter hatten ihr ein Paar Pelzstiefel geliehen mit Fell außen und innen; sie reichten ihr hoch an den Beinen hinauf.
Sie kam ins Theater, sie kam in die Loge; die Stiefel waren warm, sie behielt sie an. Auf einmal wurde „Feuer“ gerufen; es kam Rauch von einer Kulisse, es kam Rauch vom Boden; es wurde ein fürchterlicher Schrecken. Die Leute stürmten hinaus; Tantchen war die letzte in der Loge – „zweiter Stock links, da nehmen sich die Dekorationen am besten aus,“ sagte sie, „sie werden immer so aufgestellt, daß sie sich von der königlichen Seite am besten ausnehmen“ – Tantchen wollte hinaus, die vor ihr warfen in Angst und Unbedachtheit die Türe zu; da saß Tantchen, hinaus konnte sie nicht kommen, hinein auch nicht, das heißt, hinein in die Nachbarloge, das Geländer war zu hoch. Sie rief, niemand hörte, sie sah hinab in den Stock unter ihr, der war leer, der war niedrig, der war ganz nahe; Tantchen fühlte sich in der Angst so jung und so leicht; sie wollte hinabspringen, brachte auch das eine Bein über die Brüstung, das andere auf die Bank; da saß sie rittlings, schön drapiert mit ihrem blumigen Rock, mit einem langen Bein, das über den Rand hinausschwebte, einem Bein mit einem ungeheuren Pelzstiefel; das war ein Bild zu sehen! Und da es gesehen wurde, wurde Tantchen auch gehört und davor gerettet, drinnen zu verbrennen, denn das Theater brannte nicht.
Das war der erinnernswerteste Abend ihres Lebens, sagte sie und war froh darüber, daß sie sich nicht selber hatte sehen können, denn sonst wäre sie vor Scham gestorben.
Ihr Wohltäter bei der Maschinerei, Herr Sivertsen, kam beständig jeden Sonntag zu ihr, aber von Sonntag zu Sonntag war eine lange Zeit; in der späteren Zeit hatte sie deshalb mitten in der Woche ein kleines Kind „zum Überrest,“ das heißt, um das zu genießen, was an dem Tag von Mittag übrigblieb. Es war ein kleines Kind vom Ballett, das das Essen auch brauchte. Die Kleine trat als Elfe und auch als Page auf; die schwierigste Partie war als Hinterfuß des Löwen in der „Zauberflöte,“ aber sie wuchs auf zum Vorderbein vom Löwen, dafür bekam sie freilich nur drei Mark, die Hinterbeine gaben einen Reichstaler, aber da mußte sie krumm gehen und die frische Luft entbehren. Das war sehr interessant zu wissen, meinte Tantchen.
Sie hätte verdient, zu leben, solange das Theater stand, aber das hielt sie doch nicht aus; sie starb auch nicht dort, sondern anständig und ehrbar in ihrem eignen Bett; ihre letzten Worte waren übrigens ganz charakteristisch, sie fragt: „Was spielen sie morgen?“
Nach ihrem Tode waren wohl ungefähr fünfhundert Reichstaler da; wir schließen aus der Rente, die zwanzig Reichstaler machte. Die hatte Tantchen als Legat für eine würdige alte Jungfer ohne Familie bestimmt; sie sollte verwendet werden, um jährlich einen Platz im zweiten Stock links für den Sonnabend zu abonnieren, denn an dem Tag gab man die besten Stücke. Es war nur eine einzige Verpflichtung an die Nutznießung des Legats geknüpft: jeden Sonnabend sollte die, die im Theater war, an Tantchen denken, die in ihrem Grabe lag.
Das war Tantchens Religion.
DIE KLEINEN GRÜNEN
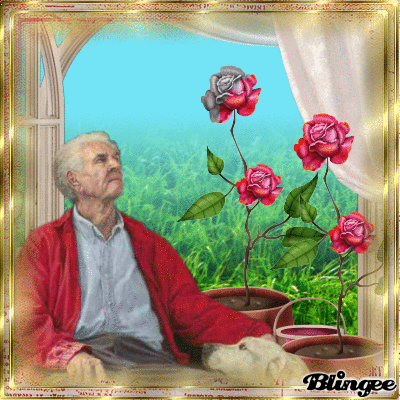
Im Fenster stand ein Rosenstock. Kürzlich war er noch frisch und blank, doch nun sah er matt aus, er litt unter irgend etwas. Er hatte Einquartierung bekommen die ihn auffraß; übrigens recht ehrenhafte Einquartierung in grüner Uniform.
Ich sprach mit einem der Einquartierten, er war erst drei Tage alt und schon Großvater. Weißt du, was er sagte? Wahr ist es, was er sagte; er sprach von sich und der ganzen Einquartierung.
"Wir sind das merkwürdigste Regiment unter den Geschöpfen der Erde. In der warmen Zeit gebären wir lebende Junge; das Wetter ist ja dann gut. Kaum sind wir da, so verloben wir uns schon und halten Hochzeit. In der kalten Zeit legen wir Eier; die Kleinen liegen warm. Das weiseste Tier, die Ameise, vor der wir viel Achtung haben, studiert uns und erkennt unseren Wert. Sie frißt uns nicht gleich, nein, sie nimmt unsere Eier und legt sie in ihren und ihrer Familie gemeinsamen Bau, und zwar in die unterste Etage. Dort legt sie uns mit Fachkenntnis, nach Nummern geordnet, Seite an Seite, Schicht auf Schicht, so daß jeden Tag ein neues aus den Eiern springen kann. Dann bringen sie uns in einen Stall, klemmen uns mit den Hinterbeinen fest und melken uns, bis wir tot sind; das ist ein angenehmer Tod! Bei ihnen tragen wir den wunderhübschen Namen: 'Süße Milchkuh!' Alle Tiere mit Ameisenverstand nennen uns so, nur die Menschen nicht, und das ist eine Kränkung für uns, über die wir fast unsere Süßigkeit verlieren möchten. Können Sie dieses Unrecht nicht steuern, können Sie sie nicht zurechtweisen, diese Menschen? Sie sehen uns an, so dumm, als wollten sie uns mit ihren Blicken besudeln, nur weil wir ein Rosenblatt essen, während sie selber alle lebenden Geschöpfe, alles, war grünt und blüht, auffressen. Sie geben uns den verächtlichsten, den abscheulichsten Namen; ich nenne ihn nicht, puh! Alles dreht sich in mir, ich kann ihn nicht aussprechen, wenigstens nicht in Uniform, und ich bin immer in Uniform.
Ich bin auf dem Blatt des Rosenstocks geboren, ich und das ganze Regiment leben von dem Rosenstock. Aber durch uns leben wieder höher geartete Geschöpfe. Die Menschen dulden uns nicht; sie kommen und töten uns mit Seifenwasser; das ist greulicher Trank! Mir scheint, ich rieche ihn schon. Es ist furchtbar, gewaschen zu werden, wenn man dazu geboren ist, nicht gewaschen zu werden!
Mensch! Du, der du mich mit den strengen Seifenwasseraugen betrachtest, denke über unseren Platz in der Natur nach, über unsere kunstreiche Einrichtung, Eier zu legen und Junge zu liefern! Uns wurde auch der Segen zuteil, die Welt zu erfüllen und uns zu mehren. In Rosen werden wir geboren, in Rosen sterben wir; unser ganzes Leben ist Poesie. Behafte uns nicht mit dem Namen, den du am abscheulichsten und garstigsten findest, dem Namen – nein, ich spreche ihn nicht aus, ich mag ihn nicht nennen! Nenne uns Milchkuh der Ameisen, das Regiment des Rosenstocks, die kleinen Grünen!"
Und ich, der Mensch, stand da und sah das Bäumchen an und die kleinen Grünen, deren Namen ich nicht nennen will, denn ich mag einen Rosenbürger, der eine große Familie mit Eiern und lebendigen Jungen hat, nicht kränken. Aus dem Seifenwasser, mit dem ich sie abwaschen wollte – denn ich war mit Seifenwasser und bösen Absichten gekommen –, will ich nun Schaum schlagen und Seifenblasen daraus machen. Und dann will ich mir die Pracht betrachten, vielleicht liegt ein Märchen in jeder Kugel.
Und die Kugel wurde so groß und schillerte in so wundersam strahlenden Farben, und in ihrem Grunde schien eine Silberperle zu schlummern. Die Kugel schwankte, schwebte, flog gegen die Tür und zerplatzte, aber die Tür sprang auf, und da stand das Märchenmütterchen selber.
"Ja, jetzt kann sie erzählen, und besser als ich, von den – nein, ich sage den Namen nicht! – den kleinen Grünen!"
"Blattläusen!" sagte Märchenmütterchen. "Man soll jedes Ding beim rechten Namen nennen, und darf man es sonst nicht, so muß man es doch im Märchen können!"
DER FREUNDSCHAFTSBUND...
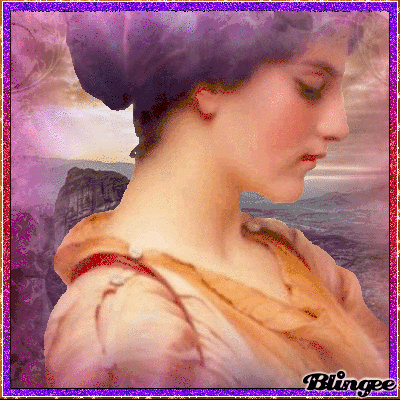
Wir fliegen fort vom dänischen Strand
Und wandeln auf fremden Pfaden,
Da kommen wir nach Griechenland,
Zu kornblauen, schönen Gestaden.
Gelbgelbe Zitronen wachsen wild,
Der Baum kann die Last kaum tragen;
Man sieht manch schönes Marmorbild
Aus Gras und Disteln ragen.
Wo der Hirte sitzt mit seinem Hund,
Lasst uns nun ein Lager bereiten
Und hören die Mär vom Freundschaftsbund,
Der Brauch war in alten Zeiten.
Unser Haus war aus Lehm zusammengeklebt, aber die Türpfosten waren geriffelte Marmorsäulen, dort gefunden, wo man das Haus erbaute. Das Dach reichte fast bis zur Erde herab, jetzt war es schwarzbraun und hässlich, aber als es gedeckt wurde, bestand es aus blühendem Oleander und frischen Lorbeerzweigen, hinter den Bergen geholt. Um unser Haus war es eng, die Felswände ragten steil empor und waren nackt und schwarz, ganz oben hingen oft Wolken wie weiße lebende Gestalten. Niemals hörte ich hier einen Singvogel, nie tanzten die Männer hier zu den Tönen der Sackpfeife, aber der Ort war geheiligt aus alten Zeiten, selbst der Name erinnert daran, er wird ja Delphi genannt! Die dunklen, ernsten Berge lagen alle mit Schnee bedeckt, der höchste, der am längsten in der roten Abendsonne schimmerte, war der Parnass; der Bach nahe an unserem Haus kam von ihm herab und war einst auch heilig, jetzt trübt ihn der Esel mit seinen Füßen, doch der Strom fließt fort und wird wieder klar. Wie entsinne ich mich jedes Flecks und seiner heiligen, tiefen Einsamkeit! Mitten in der Hütte wurde Feuer gemacht, und wenn die heiße Asche hoch und glühend da lag, das Brot darin gebacken; lag der Schnee um unsere Hütte, so dass sie fast versteckt war, dann schien meine Mutter am fröhlichsten zu sein, dann hielt sie meinen Kopf zwischen ihren Händen, küsste meine Stirn und sang die Lieder, die sie sonst niemals sang; denn die Türken, unsere Herren, litten es nicht, und sie sang:
„Auf dem Gipfel des Olymp, im niedrigen Fichtenwald, saß ein alter Hirsch, schwer waren seine Augen von Tränen; rote, ja grüne und blass-blaue Tränen weinte er, und ein Rehbock kam vorüber: Was ist dir, dass du so weinst, rote, grüne, ja blass-blaue Tränen? – Der Türke ist in unsere Stadt gekommen, hat wilde Hunde zu seiner Jagd, eine mächtige Meute! – Ich jage sie über die Inseln, sagte der junge Rehbock, ich jage sie über die Inseln ins tiefe Meer! – Aber ehe der Abend herabsank, war der Rehbock getötet, und ehe die Nacht kam, war der Hirsch gejagt und tot!“
Und wenn meine Mutter so sang, wurden ihre Augen feucht, und in ihren langen Wimpern hing eine Träne, aber sie verbarg sie und wendete dann unser schwarzes Brot in der Asche. Da ballte ich meine Hand und sagte: “Wir wollen die Türken totschlagen!“ Aber sie wiederholte aus dem Lied: “Ich jage sie über die Insel ins tiefe Meer! – Aber ehe der Abend herabsank, war der Rehbock getötet, und ehe die Nacht kam, war der Hirsch gejagt und tot! „
Mehrere Tage und Nächte waren wir einsam in unserer Hütte, da kam mein Vater; ich wusste, er würde mir aus dem Golf von Lepanto Muschelschalen mitbringen oder gar ein Messer, scharf und blitzend. Diesmal brachte er uns ein Kind, ein kleines nacktes Mädchen, das er unter seinem Schafpelz hatte; es war in ein Fell gewickelt, und alles, was es besaß, als es entkleidet auf dem Schoß meiner Mutter lag, waren drei Silbermünzen, in sein schwarzes Haar gebunden. Der Vater erzählte von den Türken, die die Eltern des Kindes getötet hatten, er erzählte uns so viel, dass ich die ganze Nacht davon träumte. – Mein Vater war selbst verwundet, die Mutter verband seinen Arm, die Wunde war tief, der dicke Schafpelz, voll Blut, steif gefroren. Das kleine Mädchen sollte meine Schwester sein, sie war so strahlend schön! Die Augen meiner Mutter waren nicht sanfter als ihre. Anastasia, wie sie genannt wurde, sollte meine Schwester sein, denn ihr Vater war dem meinen angetraut nach alter Sitte, wie wir sie noch halten. Sie hatten in der Jugend Brüderschaft geschlossen und das schönste und tugendhafteste Mädchen der ganzen Gegend erwählt, ihren Freundschaftsbund zu weihen; oft hörte ich von dem hübschen, seltsamen Brauch.
Nun war die Kleine meine Schwester; sie saß auf meinem Schoß, ich brachte ihr Blumen und die Federn der Bergvögel, wir tranken zusammen aus den Gewässern des Parnass und schliefen Kopf an Kopf unter dem Lorbeerdach der Hütte, während meine Mutter noch manchen Winter von den roten, grünen und blass-blauen Tränen sang. Aber noch begriff ich nicht, dass es mein eigenes Volk war, dessen tausendfältige Sorgen sich in diesen Tränen spiegelten.
Eines Tages kamen drei fränkische Männer, anders als wir gekleidet. Ihre Betten und Zelte hatten sie auf Pferden, und mehr als zwanzig Türken, alle mit Säbeln und Gewehren, begleiteten sie, denn sie waren Freunde des Paschas und hatten Geleitbriefe von ihm. Sie kamen nur, um unsere Berge zu sehen, um in Schnee und Wolken den Parnass zu besteigen und die seltsamen schwarzen, steilen Felsen um unsere Hütte zu betrachten. Sie hatten darin nicht Platz, vertrugen auch den Rauch nicht, der unter der Decke durch die niedrige Tür hinaus zog; sie schlugen daher ihre Zelte auf dem engen Platz neben unserer Hütte auf, brieten Lämmer und Vögel, schenkten süße, starke Weine ein, aber die Türken durften nicht davon trinken.
Als sie fortreisten, begleitete ich sie eine Strecke Wegs, und meine kleine Schwester Anastasia hing, in ein Ziegenfell genäht, auf meinem Rücken. Einer der fränkischen Herrn stellte mich vor einen Felsen, und zeichnete mich und sie ab, so lebendig, wie wir dort standen, wir sahen aus wie ein einziges Geschöpf – niemals hatte ich darüber nachgedacht, aber Anastasia und ich waren ja eins, immer lag sie in meinem Schoß oder hing auf meinem Rücken, und träumte ich, dann war sie in meinen Träumen.
Zwei Nächte später kamen andere Leute, mit Messern und Gewehren bewaffnet, in unsere Hütte. Es waren Albaner, kühne Leute, wie meine Mutter sagte. Sie blieben nur kurze Zeit dort; meine Schwester Anastasia saß auf dem Schoße des einen – als sie fort waren, hatte sie zwei und nicht drei Silbermünzen in ihrem Haar. Sie rollten Tabak in Papierstreifen und rauchten davon; der älteste sprach vom Weg, den sie einschlagen sollten, und war darüber in Ungewissheit. “Spucke ich nach oben“, sagte er, “so fällt es mir ins Gesicht, spucke ich nach unten, so fällt es in meinen Bart!“
Aber ein Weg musste gewählt werden; sie gingen, und mein Vater begleitete sie. Bald darauf hörten wir Schüsse – es knallte wieder –, Soldaten drangen in unsere Hütte und nahmen meine Mutter, mich und Anastasia mit; die Räuber hätten ihren Aufenthalt bei uns gehabt, mein Vater hätte sie begleitet, darum müssten wir fort. Ich sah die Leichen der Räuber, ich sah meines Vaters Leichnam; und ich weinte, bis ich einschlief. Als ich erwachte, waren wir im Gefängnis, aber der Raum war nicht elender als der in unserer Hütte, ich erhielt Zwiebeln und harzigen Wein, den sie aus einem geteerten Sack gossen, besser hatten wir es zu Hause auch nicht. Wie lange wir gefangen waren, weiß ich nicht; aber viele Tage und Nächte vergingen. Als wir herauskamen, war unser heiliges Osterfest, und ich trug Anastasia auf dem Rücken, denn meine Mutter war krank, nur langsam konnte sie gehen, und es war weit, ehe wir das Meer, den Golf von Lepanto, erreichten. Wir traten in eine Kirche, die von Bildern auf goldenem Grund wiederstrahlte; Engel waren da, oh, so hübsch, aber mir schien doch, dass unsere kleine Anastasia ebenso hübsch sei. Mitten auf dem Boden stand ein mit Rosen gefüllter Sarg; es sei der Herr Christus, der da als schöne Blume läge, sagte meine Mutter; und der Priester verkündete: “Christus ist auferstanden!“ Alle Leute küssten sich. Jeder hielt ein brennendes Licht in der Hand, ich selbst bekam eins, die kleine Anastasia auch eins, Sackpfeifen ertönten, Männer tanzten Hand in Hand aus der Kirche, und draußen brieten die Frauen das Osterlamm. Wir wurden eingeladen, ich saß am Feuer; ein Knabe, älter als ich, umschlang meinen Hals, küsste mich und sagte: “Christus ist auferstanden!“ So begegneten wir uns, Aphtanides und ich, zum ersten Mal.
Meine Mutter konnte Fischernetze knüpfen, das gab hier an der Bucht einen guten Verdienst, und wir blieben lange Zeit am Meer – dem schönen Meer, das wie Tränen schmeckte und durch seine Farben an die Tränen des Hirsches erinnerte, bald war es ja rot, bald grün und dann wieder blau.
Aphtanides verstand das Boot zu lenken, und ich saß mit meiner kleinen Anastasia darin, es glitt über das Wasser wie eine Wolke durch die Luft. Wenn dann die Sonne sank, färbten sich die Berge mit tieferem Blau, eine Bergreihe guckte über die andere, und am fernsten stand der Parnass mit seinem Schnee; in der Abendsonne schimmerte der Berggipfel wie glühendes Eisen, es sah aus, als komme das Licht von innen, denn lange, nachdem die Sonne untergegangen war, schimmerte er noch in der blauen, glänzenden Luft; die weißen Seevögel schlugen den Wasserspiegel mit ihren Flügeln, sonst war es hier so still wie bei Delphi zwischen den schwarzen Felsen. Ich lag im Boot auf dem Rücken, Anastasia saß auf meiner Brust, und die Sterne über uns schienen heller als die Lampen in unserer Kirche. Es waren dieselben Sterne, und sie standen an derselben Stelle über mir, wie in Delphi vor unserer Hütte. Zuletzt schien es mir, als sei ich noch dort! – Da klatschte es im Wasser, und das Boot schaukelte stark; ich schrie laut auf, denn Anastasia war ins Wasser gefallen, aber ebenso schnell sprang Aphtanides nach, und bald hob er sie zu mir empor. Wir streiften ihr die Kleider ab, drückten das Wasser aus und kleideten sie dann wieder an; das gleiche tat Aphtanides bei sich selbst, und wir blieben draußen, bis das Zeug wieder getrocknet war, und niemand erfuhr von unserem Schreck wegen der kleinen Pflegeschwester, an deren Leben ja Aphtanides nun teilhatte.
Es wurde Sommer. Die Sonne brannte so heiß, dass das Laub der Bäume verdorrte; ich dachte an unsere kühlen Berge, an ihr frisches Wasser; auch meine Mutter sehnte sich danach, und eines Abends wanderten wir wieder zurück. Wie war es dort still und ruhig! Wir gingen durch den hohen Thymian, der noch duftete, obgleich die Sonne seine Blätter versengt hatte. Nicht einem Hirten begegneten wir, nicht an einer Hütte kamen wir vorbei. Alles war still und einsam, nur eine Sternschnuppe sagte, dort im Himmel sei noch Leben. Ich weiß nicht, ob die klare, blaue Luft selbst leuchtete oder ob es die Strahlen der Sterne waren; wir sahen gut alle Umrisse der Berge. Meine Mutter machte Feuer, briet Zwiebeln, die sie mitgebracht hatte, und die kleine Schwester und ich schliefen im Thymian, ohne uns vor dem hässlichen Smidraki zu fürchten, dem die Flamme aus dem Hals leckt, noch weniger vor dem Wolf und dem Schakal; meine Mutter saß ja bei uns, und das, glaubte ich, sei genug.
Wir erreichten unsere alte Heimat, aber die Hütte war ein Schutthaufen, eine neue musste gebaut werden. Ein paar Frauen halfen meiner Mutter, und in wenigen Tagen waren Mauern errichtet und ein neues Dach von Oleander darübergedeckt. Meine Mutter flocht aus Fellen und Baumrinden viele Flaschenhüllen, ich hütete die kleine Herde der Priester; Anastasia und die kleinen Schildkröten waren meine Spielkameraden.
Eines Tages bekamen wir Besuch von dem geliebten Aphtanides; er sehne sich so sehr, uns zu sehen, sagte er und blieb zwei volle Tage bei uns.
Nach einem Monat kam er wieder und erzählte, er wolle mit einem Schiff nach Patras und Korfu fahren; vorher müsse er uns Lebewohl sagen; meiner Mutter brachte er einen großen Fisch mit. Er wusste soviel zu erzählen, nicht nur von den Fischern unten am Golf von Lepanto, sondern auch von Königen und Helden, die einst in Griechenland geherrscht hatten wie jetzt die Türken.
Ich habe den Rosenstrauch eine Knospe ansetzen und sie sich in Tagen und Wochen zu einer Blume entfalten sehen; sie wurde es, ehe ich daran dachte, wie groß, schön und rot sie sei; so erging es mir auch mit Anastasia. Sie war ein schönes, erwachsenes Mädchen, ich ein kräftiger Bursche. Die Wolfsfelle auf meiner Mutter und Anastasias Lager hatte ich selbst den Tieren abgezogen, die von meinem Schoß gefallen waren. Jahre waren dahingegangen.
Da kam eines Abends Aphtanides, schlank wie ein Rohr, stark und braun; er küsste uns alle und wusste von dem großen Meer, von Maltas Festungswerken und Ägyptens seltsamen Grabstätten zu erzählen; es klang wunderbar wie eine Legende der Priester ich sah mit einer Art Ehrfurcht zu ihm auf.
„Wie viel du weißt!“ sagte ich, “wie du erzählen kannst!“
„Du hast mir einmal das Schönste erzählt!“ sagte er. „Du hast mir erzählt, was mir niemals aus dem Sinn gekommen ist, von dem schönen, alten Brauch des Freundschaftsbundes, dem Brauch, dem zu folgen ich Lust hätte! Bruder, lass uns beide auch, wie dein und Anastasias Vater taten, zur Kirche gehen; das schönste und unschuldigste Mädchen ist Anastasia, deine Schwester, sie soll uns weihen! Kein Volk hat doch einen schöneren Brauch als wir Griechen!“
Anastasia errötete wie das frische Rosenblatt, meine Mutter küsste Aphtanides.
Eine Stunde Wegs von unserer Hütte entfernt, dort, wo die Felsen lockere Erde tragen und einzelne Bäume Schatten geben, lag die kleine Kirche; eine silberne Lampe hing vor dem Altar.
Ich hatte meine beste Kleidung angelegt, die weiße Fustanella fiel in reichen Falten über die Hüften herab, das rote Wams saß eng und stramm, die Quaste auf meinem Fes war mit Silber durchwirkt, in meinem Gürtel steckten Messer und Pistolen. Aphtanides hatte seine blaue Kleidung an, wie griechische Seeleute sie tragen, eine silberne Platte mit der Mutter Gottes hing an seiner Brust, seine Schärpe war kostbar, wie nur die reichen Herren sie tragen können. Jeder sah wohl, dass wir zu einer Feier wollten. Wir gingen in die kleine, einsame Kirche, wo die Abendsonne durch die Tür auf die brennende Lampe und die bunten Bilder auf goldenem Grund schien. Wir knieten auf den Stufen des Altars nieder, und Anastasia trat vor uns hin; ein langes weißes Gewand hing lose und leicht um ihre schönen Glieder; ihr weißer Hals und ihre Brust waren mit einer Kette alter und neuer Münzen bedeckt, die einen vollen, großen Kragen bildeten. Ihr schwarzes Haar war zu einem einzigen Knoten geschlungen, er wurde durch eine kleine Haube aus Silber- und Goldmünzen gehalten, die in den alten Tempeln gefunden worden waren. Einen schöneren Schmuck hatte kein griechisches Mädchen. Ihr Gesicht leuchtete, ihre Augen waren wie zwei Sterne.
Still beteten wir alle drei, und sie fragte uns: “Wollt ihr Freunde sein in Leben und Tod?“ –
„Ja!“ antworteten wir.
„Wollt ihr, was auch geschehen mag, daran denken: mein Bruder ist von mir ein Teil; mein Geheimnis, mein Glück ist das seine: Aufopferung, Ausdauer, alles in mir gehört ihm wie mir?“ Und wir wiederholten unser Ja.
Sie legte unsere Hände ineinander, küsste uns auf die Stirn, und wir beteten wieder leise. Da trat der Priester aus der Tür des Altarraumes, segnete uns alle drei, und ein Gesang der anderen allerheiligsten Herren ertönte hinter der Altarwand. Der Bund ewiger Freundschaft war geschlossen. Als wir uns erhoben, sah ich meine Mutter heftig weinend an der Tür der Kirche.
Wie war es heiter in unserer kleinen Hütte und an Delphis Quellen! Den Abend vor Aphtanides‘ Abreise saßen er und ich gedankenvoll am Abhang des Felsens, sein Arm war um meinen Leib geschlungen, der meine um seinen Hals; wir sprachen von Griechenlands Not, von den Männern, denen man vertrauen könnte. Jeder Gedanke unserer Seelen lag klar vor uns beiden, da ergriff ich seine Hand.
„Eins sollst du noch wissen, eins, was bis zu dieser Stunde nur ich und Gott gewusst! Meine ganze Seele ist Liebe! Eine Liebe, stärker als die zu meiner Mutter und zu dir!“
„Und wen liebst du?“ fragte Aphtanides, und sein Gesicht und Hals wurden rot.
„Ich liebe Anastasia!“ sagte ich – und seine Hand zitterte in meiner, er wurde leichenblass; ich sah es, ich begriff es, und ich glaube, dass auch meine Hand bebte, ich neigte mich zu ihm, küsste seine Stirn und flüsterte: „Ich habe es ihr nie gesagt, sie liebt mich vielleicht nicht! – Bruder, denk daran, ich habe sie täglich gesehen, sie ist an meiner Seite aufgewachsen, in meine Seele hinein gewachsen!“ –
„Und dein soll sie sein! „sagte er, “dein! – Ich kann dich nicht belügen und will es auch nicht. Auch ich liebe sie! – Aber morgen ziehe ich fort! In einem Jahr sehen wir uns wieder, dann seid ihr verheiratet, nicht wahr? – Ich habe etwas Geld, es sei dein, du musst es nehmen, du sollst es nehmen!“ Still wanderten wir über die Felsen; es war später Abend, als wir an der Hütte meiner Mutter standen.
Anastasia hielt uns die Lampe entgegen, als wir hereintraten, meine Mutter war nicht dort. Sie blickte wunderbar wehmütig auf Aphtanides.
„Morgen gehst du von uns!“ sagte sie, “wie mich das betrübt!“
„Dich betrübt!“ sagte er, und mir schien ein Schmerz darin zu liegen, groß wie mein eigener. Ich konnte nicht reden, er aber fasste ihre Hand und sagte: “Unser Bruder dort liebt dich, hast du ihn lieb? In seinem Schweigen liegt gerade seine Liebe.“
Anastasia zitterte und brach in Tränen aus; da sah ich nur sie, dachte nur an sie, schlang meinen Arm um ihren Leib und sagte: “Ja, ich liebe dich!“ Sie drückte ihren Mund auf meinen, legte ihre Hände um meinen Hals; aber die Lampe war auf den Fußboden gefallen, es war dunkel um uns her, wie in dem Herzen des lieben, armen Aphtanides.
Vor Tagesanbruch stand er auf, küsste uns alle zum Abschied und zog fort. Meiner Mutter hatte er all sein Geld für uns gegeben. Anastasia war meine Braut und nach wenigen Tagen meine Frau.
WAS DIE DISTEL ERLEBTE
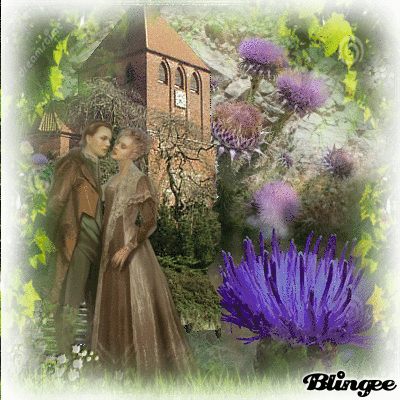
Zu dem reichen Herrensitz gehörte ein schöner, gutgehaltener Garten mit seltenen Bäumen und Blumen; die Gäste auf dem Schloß äußerten ihr Entzücken darüber, die Bewohner der Umgegend, vom Lande wie aus den Städten, kamen an Sonn- und Feiertagen und baten um Erlaubnis, den Garten zu sehen, ja, ganze Schulen fanden sich zu ähnlichen Besuchen ein.
Vor dem Garten, an dem Gitter nach dem Feldwege hinaus, stand eine mächtige Distel; sie war so groß, von der Wurzel aus in mehrere Zweige geteilt, daß man sie wohl einen Distelbusch nennen konnte. Niemand sah sie an außer dem alten Esel, der den Milchwagen des Milchmädchens zog. Er machte einen langen Hals nach der Distel und sagte: "Du bist schön! Ich könnte dich auffressen!" Aber die Leine, an der der Esel angepflockt stand, war nicht lang genug, als daß er sie hätte fressen können.
Es war große Gesellschaft im Schloß, hochadelige Verwandte aus der Hauptstadt, junge, niedliche Mädchen und unter ihnen ein Fräulein von weit her; sie kam aus Schottland, war von vornehmer Geburt, reich an Geld und Gut, eine Braut, deren Besitz sich schon verlohne, sagte mehr als ein junger Herr, und die Mütter sagten es auch.
Die Jugend tummelte sich auf dem Rasen und spielte Krocket; sie gingen zwischen den Blumen umher, und ein jedes der jungen Mädchen pflückte eine Blume und steckte sie einem der jungen Herren ins Knopfloch; aber die junge Schottin sah sich lange um, verwarf eine Blume nach der andern; keine schien nach ihrem Geschmack zu sein; da sah sie über das Gitter hinüber, da draußen stand der große Distelbusch mit seinen rotblauen, kräftigen Blüten, sie sah sie, sie lächelte und bat den Sohn des Hauses, ihr eine zu pflücken.
"Das ist Schottlands Blume!" sagte sie. "Sie prangt in dem Wappen des Landes, geben Sie mir die!"
Und er holte die schönste, und sie stach ihn in die Finger, als wachse der stärkste Rosendorf daran.
Die Distelblüte steckte sie dem jungen Mann ins Knopfloch, und er fühlte sich hochgeehrt. Alle die andern jungen Herren hätten gern ihre Prachtblume hergegeben, um diese tragen zu können, die von den feinen Händen der jungen Schottin gespendet war. Und wenn sich der Sohn des Hauses geehrt fühlte, wie mochte sich da die Distel vorkommen! Es war, als durchströmten sie Tau und Sonnenschein.
"Ich bin mehr, als ich glaube!" sagte sie im stillen. "Ich gehöre wohl eigentlich hinter das Gitter und nicht draußen auf das Feld. Man wird hier in der Welt wunderlich gestellt! Aber nun ist doch eine von den Meinen über das Gitter gekommen und sitzt obendrein im Knopfloch!"
Jeder Knospe, die kam und sich entfaltete, erzählte sie diese Begebenheit, und es waren noch nicht viele Tage vergangen, da hörte der Distelbusch, nicht von Menschen, nicht aus dem Vogelgezwitscher, sondern aus der Luft selber, die Laute auffängt und weiterträgt, aus den innersten Gängen des Gartens und aus den Zimmern des Schlosses, wo Türen und Fenster offenstehen, daß der junge Her, der die Distelblüte aus der Hand der feinen jungen Schottin erhielt, nun auch die Hand und das Herz bekommen habe. Es sei ein schönes Paar, eine gute Partie.
"Die habe ich zusammengebracht!" meinte der Distelbusch und dachte an die Blüte, die er für das Knopfloch hergegeben hatte. Jede Blüte, die aufbrach, bekam das Ereignis zu hören.
"Ich werden gewiß in den Garten gepflanzt," dachte die Distel, "Vielleicht in einen Topf gestellt, der klemmt, das soll ja das allerehrenvollste sein!"
Und der Distelbusch dachte so lebhaft daran, daß er mit voller Überzeugung sagte: "Ich komme in einen Topf!"
Er versprach jeder kleinen Distelblüte, die aufsproßte, daß sie auch in den Topf kommen solle, vielleicht gar ins Knopfloch. Das war das Höchste, was erreicht werden konnte; aber keine kam in den Topf, geschweige denn ins Knopfloch; sie tranken Luft und Licht, sie schleckten Sonnenschein am Tage und Tau in der Nacht, blühten, bekamen Besuch von Bienen und Bremsen, die nach Mitgift suchten, nach dem Honig in der Blüte, und den Honig nahmen sie, die Blume ließen sie stehen. "Das Räubergesindel!" sagte der Distelbusch. "Könnte ich sie doch auffressen! Aber das kann ich nicht!"
Die Blüten ließen den Kopf hängen, welkten hin, aber es kamen neue.
"Ihr kommt wie gerufen!" sagte der Distelbusch. "Jede Minute erwarte ich, daß man uns hinter das Gitter verpflanzt!"
Ein paar unschuldige Gänseblümchen und Wegerichpflanzen standen da und hörten mit Bewunderung zu und glaubten alles, was der Distelbusch sagte.
Der alte Esel vom Milchwagen schielte vom Wegesrande zu dem Distelbusch hinüber, aber die Leine war zu kurz, er konnte ihn nicht erreichen.
Und die Distel dachte so lange an die Distel Schottlands, zu deren Familie sie sich zählte, daß sie schließlich glaubte, sie sei aus Schottland gekommen und ihre Eltern wären selber im Wappen Schottlands erblüht. Das war ein großer Gedanke, aber eine große Distel kann wohl einen großen Gedanken haben.
"Man ist oft von so vornehmer Familie, daß man es gar nicht zu wissen wagt!" sagte die Nessel, die dicht daneben wuchs; sie hatte auch eine Ahnung davon, daß sie zu "Nesseltuch" werden könne, wenn sie nur richtig behandelt würde.
Und der Sommer verging, und der Herbst verging; die Blätter fielen von den Bäumen, die Blumen bekamen stärkere Farben und weniger Duft.
..
Die jungen Tannenbäume im Walde fingen an, Weihnachtssehnsucht zu bekommen, aber es war noch lange bis Weihnachten.
"Hier stehe ich noch!" sage die Diestel. "Es ist, als wenn niemand an mich dächte, und ich habe doch die Partie gemacht; verlobt haben sie sich, und Hochzeit haben sie gefeiert, es ist jetzt acht Tage her. Ja, ich, ich tue keinen Schritt, denn ich kann es nicht!"
Es vergingen noch einige Wochen; die Distel stand mit ihrer letzten, einzigen Blüte, groß und voll, ganz nahe an der Wurzel war sie empogesproßt. Der Wind wehte kalt darüber hin, die Farben vergingen, die Pracht verging, der Kelch stand wie eine versilberte Sonnenblume da.
Da kam das junge Paar, jetzt Mann und Frau, in den Garten; sie gingen am Gitter entlang, die junge Frau sah darüber hinaus.
"Da steht die große Diestel noch!" sagte sie. "Jetzt hat sie keine Blüte mehr!"
"Ja, da ist das Gespenst von der letzten!" sagte er und zeigte auf den silberschimmernden Rest der Blüte, der selbst eine Blüte war.
"Wie schön die ist!" sagte sie. "So eine Distel muß in den Rahmen um unser Bild geschnitzt werden!"
Und der junge Mann mußte abermals über das Gitter steigen und den Distelkelch abschneiden. Er stach ihn in die Finger, er hatte ihn ja "Gespenst" genannt. Und der Kelch kam in den Garten und in das Schloß und in den Saal; da stand ein Gemälde: das junge Ehepaar. In das Knopfloch des Bräutigams war eine Distelblüte gemalt. Man sprach davon, und man sprach von dem Diestelkelch, den sie brachten, die letzte, jetzt silbern schimmernde Distelblüte, die in den Rahmen hineingeschnitzt werden sollte.
"Was man doch alles erleben kann!" sagte der Distelbusch. "Meine Erstgeborene kam ins Knopfloch, meine Letztgeborene kommt in den Rahmen! Wohin komme ich?"
Und der Esel stand am Wegesrande und schielte zu dem Busch hinüber.
"Komm zu mir, mein Freß-Schatz! Ich kann nicht zu dir kommen, die Leine ist nicht lang genug!"
Der Distelbusch antwortete nicht. Immer mehr versank er in Gedanken; er dachte und dachte, ganz bis an die Weihnachtszeit hinan, und dann zeigte der Gedanke seine Blüte.
"Wenn die Kinder glücklich drinnen sitzen, findet eine Mutter sich darein, außerhalb des Gitters zu stehen!"
"Das ist ehrenwert gedacht!" sagte der Sonnenstrahl. "Sie sollen auch einen guten Platz bekommen!"
"Im Topf oder im Rahmen?" fragte die Distel.
"In einem Märchen!" sagte der Sonnenstrahl.
Und hier ist es!
DER KOMET
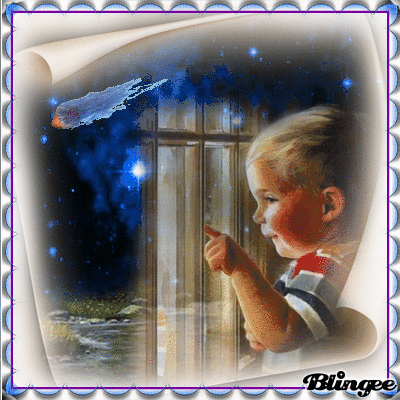
Und der Komet kam, schimmerte mit seinem Feuerkern und drohte mit seinem Schweif; er ward betrachtet aus dem reichen Schloß, aus der armen Hütte, aus dem Menschengedränge auf der Straße und von dem einsamen Wanderer, der über die weglose Heide schritt. Ein jeder hatte seinen Gedanken dabei.
"Kommt und seht das Zeichen des Himmels! Kommt und seht den prachtvollen Anblick!" sagte man, und alle beeilten sich, zu sehen.
Aber drinnen im Zimmer saßen noch ein kleiner Knabe und seine Mutter; das Talglicht brannte, und die Mutter glaubte, einen Hobelspan im Licht zu sehen; der Talg bildete eine Spitze und krümmte sich, das bedeutete, so glaubte sie, daß der kleine Knabe bald sterben müsse, der Hobelspan wandte sich ja ihm zu.
Das war ein alter Aberglaube, und den teilte sie.
Der kleine Knabe sollte aber noch viele Jahre auf der Erde leben, sollte leben und den Kometen sehen, wenn sich der nach mehr als sechzig Jahren wieder blicken ließ.
Der kleine Knabe sah nicht den Hobelspan im Licht, dachte auch nicht an den Kometen, der zum erstenmal in seinem Leben vom Himmel herabschien. Er saß, eine genietete Spülkumme vor sich, da; in der Kumme war Seifenwasser und dahinein tauchte er den Kopf einer kleinen tönernen Pfeife, setzte dann die Röhre an den Mund und machte Seifenblasen, kleine und große; sie bebten und schwebten in den herrlichsten Farben, sie gingen von Rot in Gelb, in Lila und Blau über, und dann wurden sie grün, wie das Blatt des Waldes, wenn die Sonne hindurchschimmert."Gott schenke dir so viele Jahre hier unten auf der Erde, wie du Seifenblasen machst!"
"So viele, so viele!" sagte der Kleine. "Das Seifenwasser kann nie alle werden!" Und der Kleine blies eine Blase nach der anderen in die Luft hinein.
"Da fliegt ein Jahr! Da fliegt noch ein Jahr! Sieh nur, wie sie fliegen!" sagte er bei jeder Seifenblase, die sich los löste und flog. Ein paar flogen ihm gerade in die Augen hinein; das biß und brannte, Tränen traten ihm in die Augen. In einer jeden Blase sah er ein Zukunftsbild, schimmernd, glitzernd.
"Jetzt kann man den Kometen sehen!" riefen die Nachbarn, "Kommt doch heraus und seht!"
Und die Mutter nahm den Kleinen bei der Hand, er mußte die tönerne Pfeife hinlegen, das Spiel mit den Seifenblasen unterbrechen; der Komet war da.
Und der Kleine sah die schimmernde Feuerkugel mit dem strahlenden Schweif, einige sagten, er sei drei Ellen lang, andere behaupteten, er messe Millionen Ellen; man sieht so verschieden.
Die Meisten von denen, die das sagten, waren auch tot und begraben, als er sich wieder zeigte; aber der kleine Knabe, für den sich der Hobelspan im Licht gebildet hatte und von dem die Mutter glaubte, daß er bald sterben würde, der lebte noch, war alt und weißhaarig. "Weiße Haare sind die Blüten des Alters!" sagt das Sprichwort, und er hatte viele von den Blüten; er war jetzt ein alter Schulmeister.
Die Schulkinder sagten, er sei so klug, er wisse so viel, er wußte Geschichte und Geographie und was man von den Himmelskörpern kennt.
"Alles kehrt wieder!" sagte er. "Gebt nur acht auf die Personen und Ereignisse, und ihr werdet erfahren, daß sie alle wiederkehren, in anderem Gewand, in anderem Land."
Und der Schulmeister hatte gerade von Wilhelm Tell erzählt, der einen Apfel von seines Sohnes Haupt schießen mußte, aber ehe er den Pfeil abschoß, barg er einen zweiten auf seiner Brust, um ihn dem bösen Geßler ins Herz zu schießen. Das geschah in der Schweiz, aber viele Jahre früher war genau dasselbe in Dänemark mit Palnatoke geschehen; der sollte auch einen Apfel von seines Sohnes Haupt schießen und steckte, wie Tell, einen Pfeil beiseite, mit dem er sich rächen wollte; und vor mehr als tuasend Jahren ward dieselbe Geschichte niedergeschrieben, die sich in Ägypten zugetragen hatte; es kehrt alles wieder so wie die Kometen, sie fahren hin verschwinden und kehren wieder.
Und der sprach von dem Kometen, der erwartet wurde, von dem Kometen, den er als kleiner Junge gesehen hatte. Der Schullehrer kannte die Himmelskörper, dachte über sie nach, vergaß aber darüber keineswegs die Weltgeschichte und die Geographie.
Seinen Garten hatte er in der Form der Landkarte von Dänemark angelegt. Hier standen Kräuter und Blumen, wie sie in den verschiedenen Gegenden des Landes Heimisch sind. "Holt mir Erbsen!" sagte er, und dann ging man nach dem Beet, das Laaland darstellte. "Holt mir Buchweizen!" und dann ging man nach Langeland. Der schöne blaue Enzian und der Porsch waren hoch oben bei Skagen zu finden, der schimmernde Christdorn drüben bei Silkeborg. Die Städte selber waren durch Postamente angedeutet. Hier stand St. Knud mit dem Lindwurm, das bedeutete Odense; Absalom mit dem Bischofsstab bedeutete Sorö; das kleine Fahrzeug mit den Rudern war das Kennzeichen, daß hier Aarhus lag. Aus dem Garten des Schulmeistern lernte man sehr gut die dänische Landkarte; aber erst mußte man ja von ihm belehrt werden, und das war gar ergötzlich.
Jetzt war der Komet in Aussicht, und von dem erzählte er, und er erzählte auch, was die Leute in alten Zeiten, als er zuletzt hier war, gesagt und geweissagt hatten. "Das Kometenjahr ist ein gutes Weinjahr!" sagte er. "Man kann den Wein mit Wasser verdünnen, ohne das es jemand merkt. Die Weinhändler sollen die Kometenjahre sehr lieben."
Vierzehn Tage und vierzehn Nächte war die ganze Luft mit Wolken angefüllt, man konnte den Kometen nicht sehen, aber er war da.
Der alte Schulmeister saß in seiner kleinen Kammer dicht neben der Schulstube. Die Bornholmer Uhr aus der Zeit seiner Eltern stand in der Ecke, die schweren Bleilote hoben sich nicht und sanken auch nicht. der Perpendikel rührte sich nicht; der kleine Kuckuck, der ehemals herauskam und die Stunden rief, hatte mehrere Jahre lang schweigend hinter dem geschlossenen Deckel gesessen; alles war stumm und still da drinnen, die Uhr ging nicht mehr. Aber das alte Klavier dicht dabei, das auch aus der Zeit der Eltern stammte, hatte noch Leben, die Saiten konnten noch klingen, freilich ein wenig heiser, konnten die Melodien eines ganzen Menschanalters singen. Der alte Mann ward dadurch an so vieles erinnert, an Frohes und Trauriges, während einer ganzen Reihe von Jahren, von der Zeit an, da er als kleiner Knabe den Kometen sah, bis auf heute, wo er wieder hier war. Er erinnerte sich dessen, was die Mutter von dem Hobelspan im Licht gesagt hatte, er erinnerte sich der herrlichen Seifenblasen, die er gemacht hatte; eine jede sei ein Lebensjahr, hatte sie gesagt, wie schimmernd, wie farbenreich! Alles Schöne und Erfreuliche hatte er darin gesehen: Kinderspiele und Jugendlust, die ganze weite Welt lag im Sonnenschein offen vor ihm, und dahinaus sollte es! Es waren Zukunftsblasen. Als alter Mann tönten ihm aus den Saiten des Klaviers Melodien aus entschwundenen Zeiten entgegen: Erinnerungsblasen mit dem Farbenschimmer der Erinnerungen; da erklang Großmutters Stricklied:
"Wohl keine Amazone hat
den ersten Strumpf gestrickt."
Da erklang das Lied, da die alte Magd des Hauses ihm als Kind gesungen:
"Gar mancherlei Gedanken
hienieden muß bestehn,
wer jung und unerfahren
und wenig hat gesehn!"
Ja, dann ertönten die Melodien, von dem ersten Ball, ein Menuett und ein Molinaski; jetzt klangen weiche, wehmutsvolle Töne, die Augen des alten Mannes füllten sich mit Tränen, jetzt brauste ein Kriegsmarsch, jetzt kam ein geistliches Lied, dann folgten untere Töne, eine Blase nach der anderen, wie zu der Zeit, da er als kleiner Knabe Blasen aus dem Seifenwasser in die Luft hinausgesandt hatte.
Sein Auge war auf das Fenster gerichtet, eine Wolke da draußen am Himmel glitt fort, er sah in der klaren Luft den Kometen, seinen schimmernden Kern, einen leuchtenden Nebelschleier.
Es war, als habe er ihn erst gestern abend gesehen, und doch lag ein ganzes reiches Menschenleben zwischen damals und jetzt; damals war er ein Kind und sah in den Blasen "vorwärts," jetzt zeigten die Blasen "zurück." In ihm regten sich Kindersinn und Kinderglaube, seine Augen strahlten, seine Hand sank auf die Tasten nieder – es klang, als zerspringe eine Saite.
"Kommt doch und seht, der Komet ist da!" wurde von den Nachbarn gerufen. "Der Himmel ist so herrlich klar! Kommt doch heraus, damit ihr ihn recht sehen könnt!"
Der alte Schulmeister antwortete nicht, er war auf dem Wege dahin, wo man so recht sehen kann; seine Seele schwebte auf größeren Bahnen, in einen weiteren Raume, als ihn der Komet durchfliegt. Und der Komet ward wieder von allen betrachtet, aus dem reichen Schloß, aus der armen Hütte, aus dem Gedränge auf der Straße und von dem Einsamen auf der weglosen Heide. Die Seele des alten Mannes aber schaute Gott an, schaute die lieben Heimgegangenen an, nach denen er sich geseht hatte.
FLIEDERMÜTTERCHEN
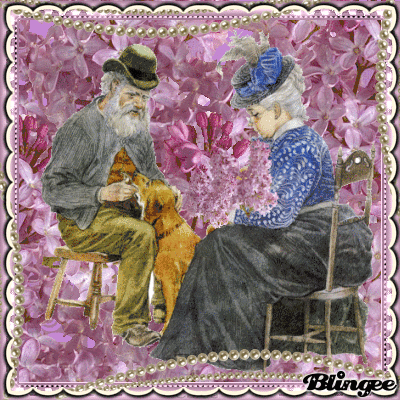
Es war einmal ein kleiner Knabe, der hatte sich erkältet; er war ausgegangen und hatte nasse Füße bekommen; Niemand konnte begreifen, wie er sie erhalten hatte, denn es war ganz trockenes Wetter. Nun entkleidete ihn seine Mutter, brachte ihn zu Bette und ließ die Teemaschine hereinbringen, um ihm eine gute Tasse Fliedertee zu bereiten, denn das erwärmt! Zu gleicher Zeit kam auch der alte freundliche Mann zur Tür herein, der ganz oben im Hause wohnte und so allein lebte, denn er hatte weder Frau noch Kinder, hielt aber viel auf alle Kinder und wußte viele Märchen und Geschichten zu erzählen, daß es eine Lust war.
“Nun trinkst Du Deinen Tee!” sagte die Mutter; “vielleicht bekommst Du dann auch ein Märchen zu hören.”
“Ja, wenn man nur ein neues wüßte!” sagte der alte Mann und nickte freundlich. “Wo hat aber der Kleine die nassen Füße bekommen?” fragte er.
“Ja, wie das geschehen ist,” sagte die Mutter, “das kann Niemand begreifen.”
“Erhalte ich ein Märchen?” fragte der Knabe.
“Ja, kannst Du mir einigermaßen genau sagen, denn das muß ich zuerst wissen, wie tief der Rinnstein in der kleinen Straße ist, wo Du in die Schule gehst?”
“Gerade bis mitten auf die Schäfte,” sagte der Knabe; “aber dann muß ich in das tiefe Loch gehen!”
“Sieh, davon haben wir die nassen Füße,” sagte der Alte. “Nun sollte ich freilich ein Märchen erzählen, aber ich weiß keins mehr!”
“Sie können gleich eins machen,” sagte der kleine Knabe. “Mutter sagt, daß Alles, was Sie betrachten, zu einem Märchen werden kann, und von Allem, was Sie berühren, können Sie eine Geschichte machen!”
“Ja, aber die Märchen und Geschichten taugen nichts! Nein, die ordentlichen, die kommen von selbst, die klopfen mir an die Stirn und sagen: Hier bin ich!”
“Klopft es nicht bald?” fragte der kleine Knabe; und die Mutter lachte, tat Fliedertee in die Kanne und goß kochendes Wasser darüber.
“Erzähle! erzähle!”
“Ja, wenn ein Märchen von selbst kommen möchte; aber so eins ist vornehm; es kommt nur, wenn es selbst Lust hat.” – “Warte!” sagte er auf einmal. “Da haben wir es! Gib Acht, nun ist eins in der Teekanne!”
Und der kleine Knabe sah nach der Teekanne hin: der Deckel hob sich mehr und mehr, und die Fliederblumen kamen frisch und weiß daraus hervor; sie schossen große, lange Zweige; selbst aus der Tülle verbreiteten sie sich nach allen Seiten und wurden größer und größer; es war der herrlichste Fliederbusch, ein ganzer Baum; er ragte in das Bett hinein und schob die Gardinen zur Seite; nein, wie das blühete und duftete! Und mitten im Baume saß eine alte freundliche Frau mit einem sonderbaren Kleide; es war ganz grün, gleich den Blättern des Fliederbaumes, und mit großen, weißen Fliederblumen besetzt; man konnte nicht gleich erkennen, ob es Zeug oder lebendiges Grün und Blumen waren.
“Wie heißt die Frau?” fragte der kleine Knabe.
“Ja, die Römer und Griechen,” sagte der alte Mann, “die nannten sie eine Dryade, aber das verstehen wir nicht; draußen in der Vorstadt der Matrosen haben wir einen bessern Namen für dieselbe; dort wird sie Fliedermütterchen genannt, und sie ist es, auf die Du Acht geben mußt; horch nur, und betrachte den herrlichen Fliederbaum.”
“Gerade ein solcher großer, blühender Baum steht da draußen; er wuchs dort in einem Winkel eines kleinen ärmlichen Hofes; unter diesem Baume saßen eines Nachmittags im schönsten Sonnenschein zwei alte Leute. Es war ein alter, alter Seemann und seine alte, alte Frau; sie waren Urgroßeltern und sollten bald ihre goldene Hochzeit feiern, aber sie konnten sich des Datums nicht recht entsinnen; und die Fliedermutter saß im Baume und sah so vergnügt aus, gerade wie hier. “Ich weiß wohl, wann die goldene Hochzeit ist!” sagte sie; aber sie hörten es nicht, sie sprachen von alten Zeiten.
“Ja, entsinnst Du Dich,” sagte der alte Seemann; “damals, als wir noch ganz klein waren und herumliefen und spielten; es war gerade in demselben Hofe, wo wir nun sitzen; und wir pflanzten kleine Zweige in den Hof und machten einen Garten.”
“Ja,” sagte die alte Frau; “dessen erinnere ich mich recht gut; und wir begossen die Zweige, und einer derselben war ein Fliederzweig, der schlug Wurzeln, schoß grüne Zweige und ist ein großer Baum geworden, unter dem wir alten Leute nun sitzen.”
“Ja sicher!” sagte er; “und dort in der Ecke stand ein Wasserkübel; dort schwamm mein Fahrzeug; ich hatte es selbst ausgeschnitten. Wie das segeln konnte! Aber ich kam freilich bald anderswohin zum Segeln.”
“Ja, aber zuerst gingen wir in die Schule und lernten etwas,” sagte sie; “und dann wurden wir eingesegnet; wir weinten beide; aber des Nachmittags gingen wir Hand in Hand auf den runden Turm und sahen in die Welt hinaus über Kopenhagen und das Wasser; dann gingen wir nach Friedrichsberg, wo der König und die Königin in ihrem prächtigen Boote auf den Kanälen herum fuhren.”
“Aber ich mußte wahrlich anders herum fahren, und das viele Jahre, weit weg, auf den langen Reisen!”
“Ja, ich weinte oft Deinetwegen,” sagte sie; “ich glaubte, Du seiest tot und fort, und lägest dort unten im tiefen Wasser, von den Wellen geschaukelt. Manche Nacht stand ich auf und sah, ob die Wetterfahne sich drehte; ja, sie drehte sich wohl, aber Du kamst nicht! Ich erinnere mich so deutlich, wie es eines Tages vom Himmel strömte; der Kärner, der den Kehricht holte, kam dort hin, wo ich diente; ich ging mit dem Kehrichtfasse hinunter und blieb in der Türe stehen; – was war das für ein abscheuliches Wetter! Und gerade als ich da stand, war der Briefträger mir zur Seite und gab mir einen Brief: der war von Dir! Ja, wie der herumgereist war! Ich riß ihn auf und las; ich lachte und weinte, ich war so froh! Da stand, daß Du in den warmen Ländern wärest, wo die Kaffeebohnen wachsen. Was muß das für ein herrliches Land sein! Du erzähltest so viel, und ich las das Alles, während der Regen hernieder strömte und ich mit dem Kehrichtfasse dastand. Da kam Einer und faßte mich um den Leib – -”
“- Ja, aber Du gabst ihm einen tüchtigen Schlag auf den Backen, daß es klatschte.”
“Ich wußte ja nicht, daß Du es warst; Du warst eben so geschwind, wie Dein Brief gekommen, und Du warst so schön; Das bist Du denn noch; Du hattest ein langes, gelbes, seidenes Tuch in der Tasche und einen glänzenden Hut auf. Du warst so fein! Gott, was das doch für ein Wetter war, und wie die Straße aussah!”
“Dann heirateten wir uns,” sagte er; “entsinnst Du Dich? Und dann, als wir den ersten kleinen Knaben und dann Marie und Niels und Peter und Hans Christian bekamen!”
“Ja, und wie Alle herangewachsen und ordentliche Menschen geworden sind, die ein Jeder leiden mag!”
“Und ihre Kinder haben wieder Kleine bekommen,” sagte der alte Matrose. “Ja, das sind Kindeskinder! Da ist Kern darin. – Es war, wenn ich nicht irre, in dieser Zeit des Jahres, als wir Hochzeitstag hielten.”
“Ja, eben heute ist der goldene Hochzeitstag,” sagte die Fliedermutter und streckte den Kopf gerade zwischen die beiden Alten hinunter; und die glaubten, es sei die Nachbarin, die da nickte; sie sahen einander an und faßten sich bei den Händen. Bald darauf kamen die Kinder und Kindeskinder; die wußten wohl, daß es der goldene Hochzeitstag sei; sie hatten schon am Morgen gratuliert, aber die Alten hatten es wieder vergessen, während sie so gut sich an alles Das erinnerten, was vor vielen Jahren schon geschehen war. Und der Fliederbaum duftete so stark, und die Sonne, die im Untergehen begriffen war, schien den beiden Alten gerade ins Gesicht; sie sahen beide so rotwangig aus; und das kleinste der Kindeskinder tanzte um sie herum und rief ganz glücklich, daß diesen Abend Pracht herrschen werde; sie sollten warme Kartoffeln haben; und die Fliedermutter nickte im Baume und rief mit allen Andern Hurrah!”
– “Aber das war ja kein Märchen!” sagte der kleine Knabe, der es erzählen hörte.
“Ja, das mußt Du verstehen!” sagte der Alte, der erzählte. “Aber laß uns Fliedermütterchen danach fragen!”
“Das war kein Märchen!” sagte die Fliedermutter; “aber nun kommt es! Aus der Wirklichkeit wächst gerade das sonderbarste Märchen heraus; sonst könnte ja mein schöner Fliederbusch nicht aus der Theekanne hervorgesproßt sein.” Und dann nahm sie den kleinen Knaben aus dem Bette und legte ihn an ihre Brust, und die Fliederzweige voller Blüten schlugen um sie zusammen; sie saßen wie in der dichtesten Laube, und diese flog mit ihnen durch die Luft; es war unaussprechlich schön. Fliedermütterchen war auf einmal ein junges niedliches Mädchen geworden, aber das Kleid war noch von demselben grünen weißgeblümten Zeuge, wie es Fliedermütterchen getragen hatte; am Busen hatte sie eine wirkliche Fliederblume, und um ihr gelbes, gelocktes Haar einen Kranz von Fliederblumen; ihre Augen waren so groß, so blau; o, sie war so herrlich anzuschauen! Sie und der Knabe küßten sich, und dann waren sie im gleichen Alter und fühlten gleiche Freuden.
Sie gingen Hand in Hand aus der Laube und standen nun in der Heimat schönem Blumengarten; bei dem frischen Grasplatze war des Vaters Stock an einen Pflock angebunden; für die Kleinen war Leben im Stocke; sobald sie sich quer über denselben setzten, verwandelte sich der blanke Knopf in einen prächtig wiehernden Kopf, die lange schwarze Mähne flatterte, vier schlanke, starke Beine schossen hervor; das Tier war stark und mutig; im Galopp fuhren sie um den Grasplatz herum: hussa! – “Nun reiten wir viele Meilen weit fort!” sagte der Knabe; “wir reiten nach dem Rittergute, wo wir im vorigen Jahre waren!” Und sie ritten um den Rasenplatz herum, und immer rief das kleine Mädchen, die, wie wir wissen, keine Andere als die Fliedermutter war: “Nun sind wir auf dem Lande! Siehst Du das Bauernhaus mit dem großen Backofen, der wie ein riesengroßes Ei aus der Mauer nach dem Wege heraussteht? Der Fliederbaum breitet seine Zweige über sie hin, und der Hahn geht und kratzt für die Hühner; sieh, wie er sich brüstet! – Nun sind wir bei der Kirche; die liegt hoch auf dem Hügel unter den großen Eichbäumen, wovon der eine halb abgestorben ist! – Nun sind wir bei der Schmiede, wo das Feuer brennt, und die halbnackten Männer mit den Hämmern schlagen, daß die Funken weit umhersprühen. Fort, fort nach dem prächtigen Rittergute!” Und Alles, was das kleine Mädchen sagte, die hinten auf dem Stock saß, das flog auch vorbei; der Knabe sah es, doch kamen sie nur um den Grasplatz herum. Dann spielten sie im Seitengange und ritzten in der Erde einen kleinen Garten; und sie nahm Fliederblumen aus ihrem Haar und pflanzte sie; und die wuchsen, gerade wie bei den Alten damals, als diese noch klein waren, wie früher erzählt worden ist. Sie gingen Hand in Hand, gerade wie die alten Leute es als Kinder gemacht hatten; aber nicht auf den runden Turm hinauf oder nach dem Friedrichsberger Garten – nein, das kleine Mädchen faßte den Knaben um den Leib und dann flogen sie weit herum im ganzen Lande. Und es war Frühjahr, und es wurde Sommer, und es war Herbst und es wurde Winter, und Tausende von Bildern spiegelten sich in des Knaben Augen und Herz ab, und immer sang das kleine Mädchen ihm vor: “Das wirst Du nie vergessen!” Und auf dem ganzen Fluge duftete der Fliederbaum so süß und so herrlich; er bemerkte wohl die Rosen und die frischen Buchen, aber der Fliederbaum duftete noch stärker, denn seine Blumen hingen an des kleinen Mädchens Herzen, und daran lehnte er oft im Fluge den Kopf.
“Hier ist es schön im Frühjahr!” sagte das junge Mädchen; und sie standen in dem frisch ausgeschlagenen Buchenwald, wo der Waldmeister zu ihren Füßen duftete; und in dem Grünen sahen die blaßroten Anemonen so lieblich aus. “O, wäre es immer Frühjahr in dem duftenden dänischen Buchenwalde!”
“Hier ist es herrlich im Sommer!” sagte sie; und sie fuhren an alten Schlössern aus der Ritterzeit vorbei, wo sich die hohen Mauern und gezackten Giebel in den Kanälen spiegelten, wo die Schwäne schwammen und in die alten kühlen Alleen hineinsahen. Auf dem Felde wogte das Korn, gleich einem See; in den Gräben standen rote und gelbe Blumen und auf den Gehegen wilder Hopfen und blühende Winden; und Abends stieg der Mond rund und groß empor; die Heuhaufen auf den Wiesen dufteten so süß. “Das vergißt sich nie!”
“Hier ist es herrlich im Herbst!” sagte das kleine Mädchen; und die Luft war doppelt so hoch und blau; der Wald bekam die schönsten Farben von Rot, Gelb und Grün. Die Jagdhunde jagten davon; ganze Schaaren Vogelwild flogen schreiend über die Hünengräber hin, auf denen sich Brombeerranken um die alten Steine schlangen. Das Meer war schwarzblau, mit Schiffen voll weißer Segel bedeckt; und in der Tenne saßen alte Frauen, Mädchen und Kinder und pflückten Hopfen in ein großes Gefäß; die Jungen sangen Lieder, aber die Alten erzählten Märchen von Kobolden und Zaubereien. Besser konnte es nirgends sein.
“Hier ist es schön im Winter!” sagte das kleine Mädchen; und alle Bäume waren mit Reif bedeckt, sodaß sie wie weiße Korallen aussahen; der Schnee knarrte unter den Füßen, als hätte man immer neue Stiefeln an; und vom Himmel fiel eine Sternschnuppe nach der andern. Im Zimmer wurde der Weihnachtsbaum angezündet, da gab es Geschenke und Fröhlichkeit; auf dem Lande ertönte in der Bauernstube die Violine; es wurde um Aepfelschnitte gespielt; selbst das ärmste Kind sagte: “Es ist doch schön im Winter!”
Ja, es war schön! Und das kleine Mädchen zeigte dem Knaben Alles; und immer duftete der Blütenbaum, und immer wehte die rote Flagge mit dem weißen Kreuze, die Flagge, unter welcher der alte Seemann gesegelt war. Der Knabe wurde zum Jüngling, und er sollte in die weite Welt hinaus, weit fort nach den warmen Ländern, wo der Kaffee wächst. Aber beim Abschiede nahm das kleine Mädchen eine Fliederblume von ihrer Brust und gab sie ihm zum Aufbewahren; und die wurde in das Gesangbuch gelegt; und im fremden Lande, wenn er das Buch öffnete, geschah es immer an der Stelle, wo die Erinnerungsblume lag; und jemehr er dieselbe betrachtete, desto frischer wurde sie, so daß er gleichsam einen Duft von den dänischen Wäldern einatmete; und deutlich erblickte er das kleine Mädchen, wie sie mit ihren klaren blauen Augen zwischen den Blumenblättern hervor sah; und die flüsterte dann: “Hier ist es schön im Frühling, im Herbst und im Winter!” Und Hunderte von Bildern glitten durch seine Gedanken.
So verstrichen viele Jahre, und er war nun ein alter Mann und saß mit seiner alten Frau unter einem blühenden Fliederbaum; sie hielten sich einander bei den Händen, gerade wie der Urgroßvater und die Urgroßmutter es draußen getan hatten; und sie sprachen eben so, wie diese, von den alten Zeiten und von der goldenen Hochzeit. Das kleine Mädchen mit den blauen Augen und mit den Fliederblumen im Haare saß oben im Baume, nickte Beiden zu und sagte: “Heute ist der goldene Hochzeitstag!” Und dann nahm sie zwei Blumen aus ihrem Kranze und küßte sie; und die glänzten zuerst wie Silber, dann wie Gold, und als sie die auf die Häupter der Alten legte, wurde jede Blume zu einer Goldkrone. Da saßen sie Beide, einem Könige und einer Königin gleich, unter dem duftenden Baume, der ganz und gar wie ein Fliederbaum aussah; und er erzählte seiner alten Frau die Geschichte von dem Fliedermütterchen, wie sie ihm erzählt worden war, als er noch ein kleiner Knabe gewesen; und sie meinten Beide, daß sie so Vieles enthielte, was ihrer eigenen gliche; und das, was ähnlich war, gefiel ihnen am besten.
“Ja, so ist es!” sagte das kleine Mädchen im Baume. “Einige nennen mich Fliedermütterchen, Andere Dryade, aber eigentlich heiße ich Erinnerung; ich bin es, die im Baume sitzt, welcher wächst und wächst; ich kann zurückdenken, ich kann erzählen! Laß sehen, ob Du Deine Blume noch hast!”
Und der alte Mann öffnete sein Gesangbuch; da lag die Fliederblume, so frisch, als wäre sie erst kürzlich hineingelegt; und die Erinnerung nickte, und die beiden Alten mit den Goldkronen auf dem Kopfe saßen in der roten Abendsonne; sie schlossen die Augen und – und -? Ja, da war das Märchen aus!
Der kleine Knabe lag in seinem Bette, er wußte nicht, ob er geträumt, oder ob er es erzählen gehört habe; die Theekanne stand auf dem Tische, aber es wuchs kein Fliederbaum daraus hervor; und der alte Mann, der erzählt hatte, war im Begriff, zur Türe hinauszugehen, und das tat er auch.
“Wie schön war das!” sagte der kleine Knabe. “Mutter, ich bin in den warmen Ländern gewesen!”
“Ja, das glaube ich wohl!” sagte die Mutter; “wenn man zwei volle Tassen Fliedertee zu sich nimmt, dann kommt man wohl nach den warmen Ländern!” – Und sie deckte ihn gut zu, damit er sich nicht erkälten sollte. “Du hast gut geschlafen, während ich mich mit ihm darüber stritt, ob es eine Geschichte oder ein Märchen sei.”
“Und wo ist die Fliedermutter?” fragte der Knabe.
“Die ist in der Teekanne,” sagte die Mutter, “und da mag sie bleiben!”
DIE KRÖTE
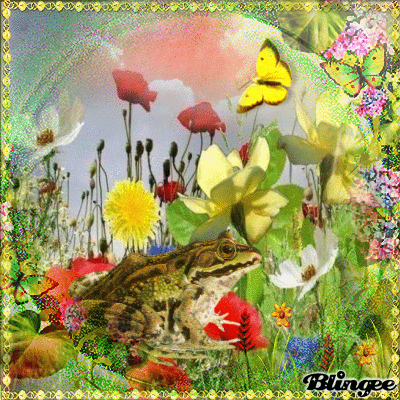
Der Brunnen war tief, darum war die Schnur lang. Die Winde ging sehr schwer, wenn man wenn man den Eimer mit Wasser über den Brunnenrand heben wollte. Die Sonne konnte niemals hinab gelangen und sich in dem Wasser spiegeln, wie klar es auch war, aber soweit sie in den Brunnen hinein scheinen konnte, wuchs Grün zwischen den Steinen.
Dort unten wohnte die Familie aus dem Geschlecht der Kröten, sie war eingewandert, sie war eigentlich kopfüber hinunter gekommen mittels der alten Krötenmutter, die noch lebte; die grünen Frösche, die hier seit viel längerer Zeit zu Hause waren und im Wasser herum schwammen, erkannten die Vetterschaft an und nannten sie "Brunnengäste." Sie hatten die Absicht, hier unten zu bleiben, sie lebten hier sehr angenehm auf dem Trocknen; so nannten sie die nassen Steine.
Die Froschmutter war einmal auf Reisen gegangen, war im Wassereimer gewesen, als der in die Höhe ging, aber es wurde ihr zu hell, sie bekam Augenschmerzen, glücklicherweise gelang es ihr, aus dem Eimer zu entweichen; sie fiel mit einem schrecklichen Plumps ins Wasser und litt drei ganze Tage danach an Rückenschmerzen. Viel konnte sie nicht von der Welt da oben erzählen, aber das wußte sie, und das wußten sie alle, daß der Brunnen nicht die ganze Welt war. Die Krötenmutter, die hätte erzählen können, aber sie antwortete niemals, wenn man fragte, und da fragte man lieber gar nicht.
"Dick und häßlich, fett und gräßlich ist sie!" sagten die jungen, grünen Frösche. "Ihre Jungen werden auch ebenso häßlich."
"Das mag wohl sein!" sagte die Krötenmutter. "Aber eins von ihnen hat einen Edelstein im Kopf, sonst habe ich ihn."
Und die grünen Frösche hörten es und sie glotzten, und da ihnen das gar nicht gefiel, so schnitten sie eine Fratze und gingen auf den Grund. Aber die jungen Kröten streckten die Hinterbeine vor lauter Stolz, eine jede glaubt, den Edelstein zu haben, und daher saßen sie ganz still mit dem Kopfe da, aber endlich fragten sie, worauf sie eigentlich stolz seien und was so ein Edelstein eigentlich sei.
"Das ist etwas so Herrliches und Köstliches," sagte die Krötenmutter, "daß ich es nicht beschreiben kann. Das ist etwas, was man zu seinem eigenen Vergnügen trägt und worüber die andern sich ärgern. Aber fragt mich nicht, ich antworte doch nicht!"
"Ja, ich habe den Edelstein nicht," sagte die kleinste Kröte; sie war so häßlich, wie sie nur sein konnte. "Warum sollte ich auch eine solche Herrlichkeit haben? Und wenn sich andre darüber ärgern, kann ich mich ja nicht darüber freuen! Nein, ich wünsche mir, daß ich einmal an die Brunnenkante hinaufkommen und hinaussehen könnte; das muß herrlich sein!"
"Bleib du nur, wo du bist," sagte die Alte, "da weißt du, was du hast und das kennst du! Nimm dich vor dem Eimer in acht, der zerquetscht dich! Und wenn du glücklich in ihn hineinkommst, so kannst du herausfallen; nicht alle fallen so glücklich wie ich und behalten ihre heilen Glieder und ihre Eier!"
"Quack!" sage die Kleine, und das war so, als wenn wir Menschen "Ach" sagen.
Sie hatte so eine Lust, auf den Brunnenrand hinaufzukommen und sich umzusehen; sie empfang eine solche Sehnsucht nach all dem Grünen da oben, und als am nächsten Morgen zufällig der Eimer mit Wasser gefüllt und in die Höhe gezogen wurde und gerade vor dem Stein anhielt, auf dem die Kröte saß, durchzuckte es das Tier, es sprang in den vollen Eimer hinein, fiel bis auf den Grund des Wassers, das dann aufgezogen und ausgegossen wurde.
"Pfui Teufel!" sagte der Knecht, der sie sah. "Das ist wahrhaftig das Greulichste, was ich je gesehen habe!" Und dann stieß er mit seinem Holzschuh nach der Kröte, die beinahe zerquetscht wäre, aber doch in die hohen Brennesseln entkam. Da sah sie einen Stengel neben dem anderen, sie sah auch aufwärts; die Sonne schien auf die Blätter nieder, sie waren ganz durchsichtig; das war für die Kröte so, als wenn wir Menschen auf einmal in einen großen Wald kommen, wo die Sonne zwischen den Zweigen und Blättern hindurch scheint.
"Hier ist es viel schöner als unten im Brunnen! Hier möchte man sein ganzes Leben bleiben!" sagte die kleine Kröte. Sie lag dort eine Stunde, sie lag dort zwei Stunden. "Was wohl da draußen ist? Wenn ich so weit gekommen bin, muß ich sehen, daß ich weiter komme!" Und sie kroch, so schnell sie kriechen konnte, und kam auf den Weg hinaus, wo die Sonne sie beschien und der Staub sie bepuderte, während sie über die Landstraße hinübermarschierte.
"Hier ist man so recht auf dem Trocknen," sagte die Kröte, "ich bekomme fast zuviel von dem Guten; es kribbelt in mir!"
Jetzt kam sie an den Graben. Da wuchsen Vergißmeinnicht und Spiera, da waren lebende Hecken aus Holunder und Weißdorn, dort wuchsen Winden, "Marias weiße Hemdärmel." Hier konnte man Farben sehen; auch ein Schmetterling flog da; die Kröte glaubte, es sei eine Blume, die sich losgerissen habe, um sich besser in der Welt umzusehen, das war ja so natürlich.
"Wenn man auch so schnell vorwärts kommen könnte wie die!" sagte die Kröte. "Quack, ach, wie viel Schönes ist hier zu sehen!"
Acht Tage und Nächte blieb sie hier am Graben, und es fehlte ihr nicht an Nahrung. Am neunten Tage dachte sie: "Weiter" – Aber ob sie etwas Schöneres finden würde? Vielleicht eine kleine Kröte oder ein paar grüne Frösche. Es hatte in der letzten Nacht so geklungen, als wenn Vettern in der Nähe wären.
"Es ist schön zu leben; aus dem Brunnen herauszukommen, in den Brennesseln zu liegen, auf dem staubigen Weg dahin zu kriechen und in dem nassen Graben zu liegen! Aber vorwärts! Man muß doch versuchen, Frösche oder eine kleine Kröte zu finden, die kann man nicht entbehren, die Natur allein genügt einem nicht!" Und dann machte sie sich wieder auf die Wanderung.
Sie kam aufs Feld an einen großen Teich, der ringsumher mit Schilf bewachsen war; da hinein schlüpfte sie.
"Hier ist es wohl reichlich feucht für Sie," sagten die Frösche, "aber Sie sind uns willkommen! – Sind Sie weiblichen oder männlichen Geschlechts? Aber das ist einerlei, Sie sind uns gleich willkommen!"
Und dann wurde sie zum Konzert am Abend eingeladen; Familienkonzert; große Begeisterung und dünne Stimmen, das kennen wir. Es gab keine Bewirtung, nur freie Getränke, der ganze Teich, wenn's nötig war.
"Jetzt reise ich weiter!" sagte die kleine Kröte; sie hatte immer das Bedürfnis nach etwas Besserem.
Sie sah die Sterne schimmern, so groß und so klar; sie sah den Vollmond leuchten, sie sah die Sonne aufgehen, höher und höher.
"Ich bin wohl noch immer im Brunnen, in einem großen Brunnen, ich muß höher hinauf! Ich habe eine Unruhe und eine Sehnsucht!" Und als der Mond ganz und rund wurde, dachte das arme Tier: "Ob das wohl der Eimer ist, der herabgelassen wird, und ob ich wohl hineinspringen muß, um höher hinaufzukommen? Oder ist die Sonne der große Eimer? Wie groß sie ist, wie strahlend, sie kann uns alle zusammen aufnehmen, ich muß die Gelegenheit benutzen! Ach, wie es in meinem Kopf leuchtet! Ich glaube nicht, daß der Edelstein besser leuchten kann! Aber den habe ich nicht, und ich weine deswegen nicht, nein, höher hinauf in Glanz und Freude! Ich habe eine ´Zuversicht, und doch empfinde ich eine Angst – es ist ein schwerer Schritt, den ich tun will! Aber man muß ihn tun! Vorwärts! Immer der Landstraße entlang!"
Und sie machte so große Schritte, wie sie so ein Krabbeltier nur machen kann, und dann war sie auf der großen Landstraße, wo die Menschen wohnten; da waren Blumengärten und Kohlgärten. Bei einem Kohlgarten machte sie Rast.
"Wie viele verschiedene Geschöpfe es doch gibt, die ich nie gekannt habe! Und wie groß und herrlich die Welt doch ist! Aber man soll sich auch darin umsehen und nicht immer auf einem Fleck sitzen bleiben." Und dann hüpfte sie in den Kohlgarten hinein. "Wie grün es hier ist und wie schön!"
"Ja, das weiß ich recht gut!" sagte der Kohlwurm auf seinem Blatt. "Mein Blatt ist das größte hier drinnen! Es verbirgt die halbe Welt, aber die kann ich gut entbehren!"
"Gluck, gluck!" sagte es, da kamen Hühner, sie trippelten im Kohlgarten. Das erste Huhn war weitsichtig; es sah den Wurm auf dem krausen Blatt und pickte danach, so daß er auf die Erde fiel, wo er sich wand und drehte. Das Huhn sah erst mit dem einen Auge und dann mit dem anderen, denn es wußte nicht, was aus dem Drehen und Winden werden würde.
"Gutwillig tut er es nicht!" dachte das Huhn und erhob den Kopf, um nach dem Wurm zu picken. Die Kröte erschrak so, daß sie ganz dicht an das Huhn herankroch.
"So, er hat Hilfstruppen!" sagte das Huhn. "So ein Wurmgezücht!" Und damit wandte es sich um. " Ich mache mir nichts aus dem kleinen grünen Mundvoll, der kitzelt ja nur im Hause!" Die andern Hühner waren derselben Ansicht, und dann gingen sie.
"Ich wand und krümmte mich, bis sie gingen!" sagte der Kohlwurm. "Es ist gut, Geistesgegenwart zu besitzen; aber das Schwerste steht mir noch bevor, auf mein Kohlblatt hinaufzukommen. Wo ist das nur?"
Und die kleine Kröte kam und äußerte ihre Teilnahme. Sie freute sich, daß sie die Hühner mit ihrer Häßlichkeit verscheucht hatte.
"Was meinen Sie damit?" fragte der Kohlwurm. "Ich habe mich ja selber durch mein Krümmen und Winden befreit. Sie sind unangenehm anzusehen! Ich möchte gern in meinem eigenen Hause allein sein! Jetzt reise ich im Kohl! Jetzt bin ich bei meinem Blatt angelangt! Es gibt doch nicht Schöneres als das eigene Heim! Aber höher hinaus muß ich noch!"
"Ja, höher hinauf," sagte die kleine Kröte, "höher hinauf! Er hat dieselben Empfindungen wie ich! Aber er ist heute schlechter Laune, das kommt von dem Schrecken! Wir wollen alle höher hinaus!" Und sie sah so hoch empor, wie sie nur konnte.
Der Storch saß im Nest auf des Bauern Dach; er klapperte, und die Storchenmutter klapperte auch.
In dem Bauernhause wohnten zwei junge Studenten, der eine war Poet, der andere Naturforscher; der eine sang und schrieb voller Freude von allem, was Gott geschaffen hatte und wie es sich in seinem Herzen spiegelte; er sang es in die Welt hinaus, kurz, klar und reich in klangvollen Versen; der andere griff die Dinge selber an, ja schnitt sie auf, wenn es not tat. Er faßte des lieben Gottes Schöpfung als großen Rechenexempel auf, subtrahierte, multiplizierte, wolle es in- und auswendig kennen und sprach mit Verstand davon, und es war wirklicher Verstand, und er sprach voller Freude und Klugheit davon. Es waren gute, fröhliche Menschen, alle beide.
"Da sitzt ja ein famoses Exemplar von einer Kröte!" sagte der Naturforscher. "Die muß ich in Spiritus setzen!"
"Du hast ja schon zwei solche!" meinte der Poet. "Laß die doch in Frieden sitzen und sich ihres Lebens freuen!"
"Aber sie ist so herrlich häßlich!" sagte der andere.
"Ja, wenn wir den Edelstein in ihrem Kopf finden könnten," sagte der Poet, "Dann wäre ich gleich mit dabei sie aufzuschneiden."
"Den Edelstein!" sagte der andere. "Du scheinst mir viel Naturgeschichte zu wissen!"
"Aber liegt nicht gerade viel Schönes in dem Volksglauben, daß die Kröte, das allerhäßlichste Tier, in ihrem Kopf den köstlichsten Edelstein birgt? Geht es nicht mit den Menschen ebenso? Welchen Edelstein hatte nicht Äsop, und nun gar Sokrates!"
Mehr hörte die Kröte nicht, und sie verstand auch nicht die Hälfte von dem, was sie hörte. Die beiden Freunde gingen, und sie wurde davor bewahrt, in Spiritus gesetzt zu werden.
"Sie sprachen auch von dem Edelstein!" sagte die Kröte. "Ein Glück, daß ich ihn nicht hatte, sonst wäre ich in Ungemach gekommen!"
Da klapperte es auf dem Dach des Bauern; der Storchenvater hielt seiner Familie einen Vortrag, und die sah schief hernieder auf die beiden jungen Leute im Kohlgarten.
"Der Mensch ist die eingebildeste Kreatur!" sagte der Storch. "Hört nur, wie ihm den Schnabel geht! Und dabei können sie doch nicht ordentlich klappern. Sie brüsten sich mit ihrer Redegabe, mit ihrer Sprache! Eine nette Sprache das! sobald sie nur eine Tagesreise machen, können sie sich nicht mehr verständlich machen; einer versteht den andern nicht mehr! Unsere Sprache können wir über die ganze Welt reden, in Dänemark so gut wie in Ägypten. Fliegen können die Menschen auch nicht; sie behelfen sich mit einer Erfindung, die sie 'Eisenbahn' nennen, aber auch dabei brechen sie sich noch oft genug den Hals. Es läuft mir kalt über den Schnabel, wenn ich nur daran denke. Die Welt kann sehr gut ohne Menschen bestehen. Wir könnten sie entbehren! Wenn wir nur die Frösche und Regenwürmer behalten!"
"Das war je eine gewaltige Rede!" dachte die kleine Kröte. "Was für ein großer Mann das ist! Und wie hoch er sitzt, und wie er schwimmen kann!" rief sie aus, als der Storch seine Flügel ausbreitete und durch die Lüfte dahinflog.
Und die Storchenmutter redete im Nest, sie erzählte von dem Land Ägypten, von dem Wasser des Nils und von all dem köstlichen Schlamm, der in dem fremden Lande war; das klang der kleinen Kröte ganz neu und lieblich.
"Ich muß nach Ägypten!" sagte sie. "Wenn mich nur der Storch mitnehmen wollte oder eins von seinen Jungen. Ich will ihm an seinem Hochzeitstage wieder dienen. Ja, ich komme nach Ägypten, denn das Glück ist mir hold! All die Sehnsucht und die Lust, die ich in mir trage, ist wahrhaftig besser, als einen Edelstein im Kopf zu haben!"
Und dabei hatte sie gerade den Edelstein: die ewige Sehnsucht und Lust, aufwärts, immer aufwärts! Die leuchtete da drinnen, die leuchtete in Freude, die strahlte in Lust.
Da kam im selben Augenblick der Storch; er hatte die Kröte im Gras erspäht, flog herab und packte das kleine Tier gerade nicht allzu sanft. Der Schnabel klemmte, der Wind sauste, es war nicht angenehm, aber es ging aufwärts, aufwärts, aufwärts nach Ägypten, das wußte die kleine Kröte, und darum strahlten ihre Augen, es war, als fliege ein Funke aus ihnen heraus:
"Quack! Ach!"
Der Körper war tot, die Kröte war verendet. Aber der Funke aus ihrem Auge, wo blieb der?
Der Sonnenstrahl nahm ihn auf, der Sonnenstrahl trug den Edelstein aus dem Kopf der Kröte. Wohin?
Danach mußt du den Naturforscher nicht fragen, frage lieber den Poeten; er erzählt es dir in Form eines Märchens. Und der Kohlwurm kommt auch darin vor und die Storchenfamilie. Denk nur! Der Kohlwurm verwandelt sich und wird ein herrlicher Schmetterling! Die Storchenfamilie fliegt über Berge und Meere fort nach dem fernen Afrika und findet doch wieder den kürzesten Weg in die Heimat zurück, nach demselben Ort, demselben Dach! Ja, das ist wirklich alles fast zu märchenhaft, und doch ist es wahr! Da kannst gern den Naturforscher fragen, er muß es zugeben; und du selber weißt es auch, denn du hast es gesehen.
Aber der Edelstein in dem Kopf der Kröte?
Suche ihn in der Sonne! Suche ihn, wenn du kannst!
Der Glanz dort ist zu stark. Wir haben noch keine Augen, die in all die Herrlichkeit hineinsehen können, die Gott geschaffen hat, aber wir werden sie einstmals bekommen, und das wird das schönste Märchen! Denn darin kommen wir selber auch vor.
SONNENSCHEIN-GESCHICHTEN
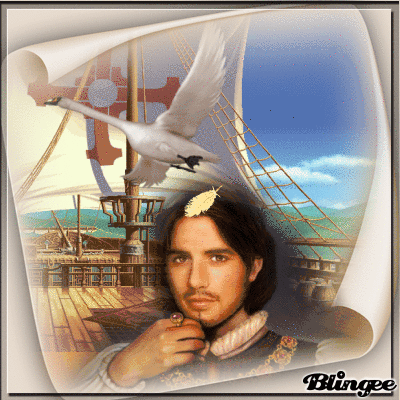
"Jetzt werde ich erzählen!" sagte der Wind.
"Nein, erlauben Sie," sagte das Regenwetter, "jetzt ist die Reihe an mir! Sie haben lange genug an der Straßenecke gestanden und haben geheult, was Sie heulen konnten!"
"Ist das der Dank," sagte der Wind, "weil ich Ihnen zur Ehre manchen Regenschirm umgekippt, ja zerknickt habe, wenn die Leute nichts von Ihnen wissen wollten!"
"Ich erzähle!" sagte der Sonnenschein. "Still!," und das wurde mit Glanz und Majestät gesagt, so daß der Wind sich legte, so lang er war, aber das Regenwetter rüttelte den Wind und sagte: "Daß wir das ertragen müssen! Sie bricht immer durch, diese Madame Sonnenschein. Wir wollen sie nicht anhören! Es ist der Mühe nicht wert!"
Und der Sonnenschein erzählte:
"Es flog ein Schwan über das rollende Meer dahin, jede Feder desselben leuchtete wie Gold; eine Feder fiel herab auf das große Kaufmannsschiff, welches mit vollen Segeln vorüberglitt; die Feder fiel auf den Lockenkopf eines jungen Mannes, des Beaufsichtigers der Waren, Superkargo nannten sie ihn. Die Feder des Glücksvogels berühre seine Stirn, wurde zur Schreibfeder in seiner Hand, und er wurde bald der reiche Kaufmann, der sich schon Sporen von Gold kaufen und eine goldne Schüssel in einen Adelsschild verwandeln konnte; ich habe den Schild beschienen!" sagte der Sonnenschein.
"Der Schwan flog über die grüne Wiese dahin, wo der kleine Schafhüter, ein Knabe von sieben Jahren, sich in den Schatten des alten einzigen Baumes hingestreckt hatte. Und der Schwan in seinem Fluge küßte ein Blatt des Baumes und das Blatt fiel herab, in die Hand des Knaben, und dieses eine Blatt wurde zu dreien, wurde zu zehn Blättern, wurde zu einem ganzen Buch, und der Knabe las in demselben von den Wunderwerken der Natur, von der Muttersprache, von Glauben und Wissen. Wenn er schlafen ging, legte er das Buch unter seinen Kopf, damit er nicht vergessen möchte, was er gelesen, und das Buch trug ihn auf die Schulbank und zu dem Tische des Gelehrten. Ich habe seinen Namen unter denen der Gelehrten gelesen!" sagte der Sonnenschein.
Der Schwan flog in die Waldeinsamkeit, ruhte sich dort aus auf den stillen dunklen Seen, wo die Wasserlilien blühen, wo die wilden Waldäpfel wachsen und des Kuckucks und der Waldtaube Heimat ist.
Eine arme Frau las dort Reisig auf; herabgefallene Baumzweige, die sie in einem Bündel auf ihrem Rücken trug, ihr Kind trug sie an der Brust, und so wanderte sie ihren Weg nach Hause. Sie sah den goldenen Schwan, den Glücksschwan, sich von dem schilfbewachsenen Ufer emporschwingen. Was glänzte dort? Ein goldiges Ei; es war noch warm. Sie legte es an ihre Brust, und es blieb warm, das Ei hatte gewiß Leben. Ja, es tickte hinter der Schale; sie fühlte das und glaubte, es sei ihr eigenes Herz, welches klopfte.
Zu Hause in ihrem ärmlichen Stübchen nahm sie das Goldei hervor. Ticktick! sagte es, als sei es eine köstliche goldene Uhr, aber es war ein Ei mit lebendigem Leben. Das Ei platzte, ein kleines Schwanenjunges, wie aus dem reisten Gold, strecke das Köpfchen hervor; das Junge hatte vier Ringe und den Hals, und da die arme Frau gerade vier Knaben, drei zu Hause und den vierten, den sie bei sich in der Waldeinsamkeit getragen, hatte, so begriff sie sogleich, daß hier ein Ring für jedes der Kinder sei, und indem sie das begriff, flog der kleine Goldvogel davon.
Sie küßte jeden Ring, ließ jedes der Kinder einen von den Ringen küssen, legte diesen an das Herz des Kindes und steckte ihn an seinen Finger.
"Ich sah dies alles" sagte der Sonnenschein, "ich sah auch, was darauf geschah.
Der eine Knabe setzt sich an den Lehmgraben, nahm einen Klumpen Lehm zur Hand, drehte und formte ihn mit den Fingern, und es wurde eine Jasongestalt daraus, die, welche das Goldene Vlies geholt hatte.
Der zweite der Knaben lief sogleich auf die Wiese hinaus, wo Blumen in allen denkbaren Farben standen; er pflückte eine Handvoll, drückte sie, daß der Saft ihm in die Augen spritzte und den Ring benetzt; es kribbelte und krabbelte in Gedanken und in der Hand, und nach Jahren und Tagen sprach die große Stadt von dem großen Meister.
Der dritte der Knaben hielt den Ring so fest in seinem Mund, daß er Klang und Widerhall vom Herzboden gab, Gefühle und Gedanken stiegen empor in Tönen, stiegen empor wie singende Schwäne, tauchten wie Schwäne hinab in den tiefen See, den tiefen See der Gedanken; er wurde ein Meister der Töne, jedes Land kann nun sagen: 'Mir gehört er an!'
Der vierte Kleine, ja, der war nun der Zurückgesetzte; er habe den Pips, sagten die Leute, er müsse Pfeffer und Butter haben, wie die kranken Hühner, geschmiert werden - und das meinten sie nun in ihrem Sinne, und Schmiere bekam er, aber von mir bekam er einen Sonnenschein-Kuß!" sagte der Sonnenschein. "Er bekam zehn Küsse für einen. Er war eine Dichter-Natur, er wurde gebliebkost und geküßt; aber den Glücksring hatte er vom goldenen Schwan des Glücks. Seine Gedanken flogen aus wie singende Schmetterlinge, der Unsterblichkeit Symbol."
"Das war eine lange Geschichte!" sagte der Wind.
"Und langweilig!" sagte das Regenwetter. "Blase mich an, daß ich mich wieder erhole!"
Und der Wind blies, und der Sonnenschein erzählte:
"Der Glücksschwan flog über den tiefen Meerbusen dahin, wo die Fischer ihr Garn ausgeworfen hatte. Der ärmste derselben dachte daran, sich zu verheiraten und er heiratete.
Ihm brachte der Schwan ein Stück Bernstein, und der Bernstein zieht an, er zog die Herzen ans Haus heran. Bernstein ist die schönste Räucherung. Es kam ein Duft ins Haus wie aus der Kirche, ein Duft wie aus der Natur Gottes. Er und die Seinen empfangen so recht das Glück des häuslichen Lebens, Zufriedenheit in kleinen Verhältnissen, und ihr Leben gestaltete sich deshalb auch zu einer ganzen Sonnenschein-Geschichte."
"Brechen wir aber jetzt ab!" sagte der Wind. "Nun hat der Sonnenschein lange genug erzählt. Ich habe mich gelangweilt!"
"Ich auch," sagte das Regenwetter.
Was sagen nun wir anderen, die wir die Geschichten gehört haben?
Wir sagen: "Nun sind sie aus!."
WER WAR DIE GLÜCKLICHSTE?
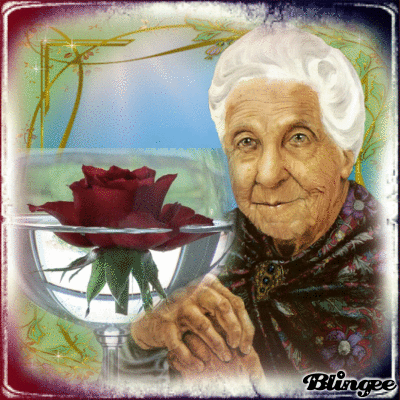
"Welch schöne Rosen!" sagte der Sonnenschein. "Und jede Knospe wird sich entfalten und ebenso schön werden. Das sind meine Kinder! Meine Küsse haben sie belebt."
"Meine Kinder sind es," sagte der Tau; "ich habe sie mit meinen Tränen gesäugt."
"Ich sollte doch meinen, daß ich ihre Mutter sei," sagte die Rosenhecke; "ihr andern seid nur Gevattern, die nach Vermögen und gutem Willen ein Patengeschenk gaben."
"Meine lieblichen Rosenkinder!" sagten sie alle drei und wünschten jeder Blume das schönste Glück; aber eine nur konnte die Glücklichste, eine mußte die am wenigsten Glückliche werden - aber welche von ihnen!
"Das will ich schon zu wissen bekommen," sagte der Wind; "ich jage weit umher, dränge mich in die engste Ritze und weiß außen und innen Bescheid."
Jede der aufgeblühten Rosen hörte, was gesagt wurde, jede schwellende Knospe vernahm es.
Da kam eine tiefbetrübte liebevolle, in Trauerkleider gehüllte Mutter in den Garten; sie pflückte eine von den Rosen, die halb erblüht, frisch und voll war und welche ihr die schönste von allen zu sein schien. Sie trug die Blume in die stille, schweigsame Kammer, wo vor wenigen Tagen noch die junge, lebensfrohe Tochter sich bewegte, welche jetzt, einem schlafenden Marmorbilde gleich, in dem schwarzen Sarge lag. Die Mutter küßte die Tote, küßte darauf die halberblühte Rose und legte diese auf die Brust des jungen Mädchens, als ob sie durch ihre Frische und den Kuß der Mutter ihr Herz wieder schlagen machen könnte.
Die Rose schien zu schwellen; jedes Blatt bebte in freudigen Gedanken. "Welch ein Weg der Liebe ist mir vergönnt! Ich werden wie ein Menschenkind, ich bekommen einen Mutterkuß, ich empfange ein Segenswort, und ich gehe mit in das unbekannte Reich, träumend an der Brust der Toten! Gewiß, ich wurde die Glücklichste von allen meinen Schwestern!"
In den Garten, in welchem der Rosenbusch stand, ging auch die alte Gärtnerin. Auch sie betrachtete die Herrlichkeit des Rosenstrauches, und ihr Auge haftete auf der größten voll erblühten Rose. Ein Tautropfen und ein warmer Tag - und die Blätter würden fallen. Das sah die Frau und fand, daß die Rose, welche den Gipfel ihrer Schönheit erreicht habe, auch Nutzen bringen müsse. Sie pflückte sie also und legte sie zwischen ein Zeitungsblatt, um sie mit nach Hause zu andern entblätterten Rosen zu nehmen, um Potpourri davon zu machen, in Gesellschaft mit den kleinen blauen Burschen, die man Lavendel nennt, und sie mit Salz einzubalsamieren. Balsamiert, das werden nur Rosen und Könige.
"Ich werde am höchsten geehrt!" sagte die Rose, als die Gärtnerin sie pflückte. "Ich werde die Glücklichste! Ich werde balsamiert werden."
Zwei junge Männer traten in den Garten, der eine war ein Maler, der andere ein Dichter. Jeder pflückte eine Rose, schön anzusehen.
Und der Maler gab der Leinwand ein Bild der blühenden Rose, so treu, daß diese sich im Spiegel zu sehen glaubte.
"So," sagte der Maler, "soll sie viele Menschalter leben, während Millionen und abermals Millionen Rosen welken und sterben."
"Ich bin die Begünstigste," sagte die Rose; "ich gewann des größte Glück!"
Der Dichter betrachtete seine Rose, schrieb ein Gedicht von ihr, eine ganze Mysterie, alles, was er von jedem einzelnen Blatt der Rose las: "Das Bilderbuch der Liebe"; es war eine unsterbliche Dichtung.
"Mit ihr bin ich unsterblich," sagte die Rose. "Ich bin die Glücklichste!"
Unter all der Pracht von Rosen war noch eine, welche fast vor den andern verborgen saß. Zufällig - zum Glück vielleicht - hatte sie ein Gebrechen; sie saß schief auf dem Stengel, und die Blätter der einen Seite entsprachen denen der andern nicht, ja, mitten aus der Blume heraus wuchs sogar ein kleines, verkrüppeltes grünes Blatt. Das kommt wohl zuweilen bei Rosen vor.
"Armes Kind," sagte der Wind und küßte ihre Wange. Die Rose glaubte, da sei ein Gruß, ein Liebesgruß; sie hatte ein Bewußtsein davon, daß sie etwas anders geschaffen sei als die andern Rosen und daß ein grünes Blatt mitten aus ihrem Innern herauswachse, und sie betrachtete das als eine Auszeichnung. Ein Schmetterling flatterte auf ihre Blätter herab und küßte sie: das war ein Freier; sie ließ ihn wieder fliegen. Dann kam ein gewaltig großer Grashüpfer; der setzte sich richtig genug auf eine andere Rose und rieb verliebt sein Schienbein (das ist bei den Grashüpfern ein Liebeszeichen); die Rose, auf welcher er saß, verstand es nicht, aber die Rose mit dem auszeichnenden grünen Blatte in ihrer Mitte verstand es, denn der Grashüpfer betrachtete sie mit Augen, welche sagten: "Ich könnte dich vor Liebe fressen!" Und weiter kann die Liebe doch nicht gehen: einer geht in dem andern auf! Aber die Rose wollte nicht in dem Springinsfeld aufgehen. Die Nachtigall sang in der sternenklaren Nacht.
"Die singt für mich allein!" sagte die Rose mit dem Gebrechen oder der Auszeichnung. "Weshalb soll ich vor allen meinen Schwestern so ausgezeichnet werden, weshalb ward mir diese Auszeichnung, welche mich zu der Glücklichsten macht?"
Da kamen zwei Herren, welche eine Zigarre rauchten, die sprachen von Rosen und von Tabak. Rosen sollen den Tabaksrauch nicht vertragen können, sie sollen die Farbe verändern und grün werden. Die Herren wollten das versuchen. Sie mochten keine von den prächtigsten Rosen nehmen, sie nahmen die Rose, welche das Gebrechen hatte.
"Welche neue Auszeichnung!" rief diese. "Ich bin über alle Maßen glücklich, die Allerglücklichste!"
Und sie ward grün in Bewußtsein und Tabaksrauch.
Eine Rose, halb noch Knospe, die Schönste vielleicht am ganzen Rosenbusche, erhielt den Ehrenplatz in des Gärtners kunstvoll gebundenem Bouquet, welches dem jungen gebietenden Herrn des Hauses gebracht wurde und mit ihm im Wagen fuhr. Sie saß als schönste Blume inmitten andrer Blumen und schönem Grün, sie kam zu einem glänzenden Feste, da saßen Männer und Frauen so prächtig beleuchtet von Tausenden von Lampen, die Musik erklang, es war im Lichtmeere des Theaters; und als unter stürmischem Jubel die gefeierte junge Tänzerin hervor auf die Bühne schwebe, flog Bouquet auf Bouquet wie ein Blumenregen zu ihren Füßen nieder. Da fiel das Bouquet, in welchem die schöne Rose, gleich einem Edelsteine, saß, sie fühlte ganz ihr namenloses Glück, die Ehre, den Glanz, in welchem sie hineinschwebte, und indem sie den Boden berührte, tanzte sie mit, sie sprang, fuhr über die Bretter hin und brach im Fallen von ihrem Stengel. Sie kam nicht in die Hände der Huldin, sie rollte hinter die Kulissen, ein Maschinist nahm sie auf, sah, wie schön sie war, sie lieblich sie duftete, aber sie hatte keinen Stengel. Er steckte sie in seine Tasche, und als er abends nach Hause kam, erhielt sie einen Platz in einem Schnapsglase und lag in demselben die ganze Nacht im Wasser. Frühmorgens wurde sie vor Großmutter hingestellt, welche alt und kraftlos im Lehnstuhle saß, sie betrachtete die geknickte schöne Rose und freute sich über sie und ihren Duft.
"Ja, du kommst nicht auf den Tisch des reichen feinen Fräuleins, sondern zu der armen alten Frau; aber hier bist du wie ein ganzer Rosenstrauch, wie schön bist du!"
Und mit kindlicher Freude blickte sie auf die Blume und gedachte wohl auch ihrer eigenen längst entschwundenen frischen Jugendzeit.
"Da war ein Loch in der Fensterscheibe," sagte der Wind, "ich konnte leicht hineinkommen und sah die jugendlich strahlenden Augen der alten Frau und die geknickte schöne Rose in dem Schnapsglase. Die Glücklichste von allen! Ich weiß das! Ich kann das erzählen!"
Jede Rose von dem Rosenstrauche des Gartens hatte ihre Geschichte. Jede Rose glaubte und dachte, die Glücklichste zu sein, und der Glaube macht selig. Aber die letzte Rose an dem Strauche war doch die Allerglücklichste, wie sie meinte.
"Ich überlebte sie alle! Ich bin die Letzte, die Einzige, Mutters liebstes Kind!"
"Und ich bin ihre Mutter," sage die Rosenhecke.
"Das bin ich," sagte der Sonnenschein.
"Und ich," sagten Wind und Wetter.
"Jeder hat teil an ihr!" sagte der Wind. "Und jeder soll einen Teil von ihr haben"; und damit streute der Wind ihre Blätter hin über die Hecke, auf welcher die Tautropfen lagen und auf welche die Sonne schien. - "Auch ich bekam mein Teil," sagte der Wind, "ich bekam die Geschichte aller Rosen, die ich nun der ganzen Welt erzählen will. Sage mir nun, welche war die Glücklichste von allen? Ja, das mußt du sagen, ich habe genug gesagt!"–
DER KOBOLD UND DIE MADAME
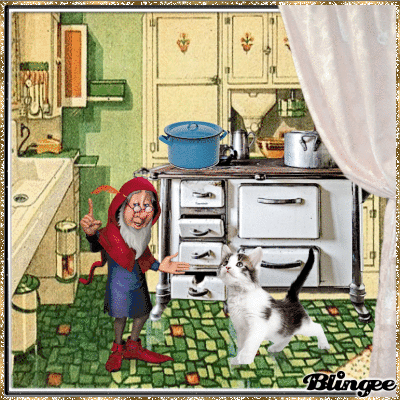
Den Kobold kennst du; kennst du aber die Madame, die Gärtnersfrau? Sie besaß Bildung, wußte Gedichte auswendig, sie konnte mit Leichtigkeit selber welche schreiben; nur die Reime, "das Klingelingeling," wie sie es nannte, machten ihr ein wenig Mühe. Sie besaß Schreibtalent und Rednertalent, sie hätte sehr gut Pastor sein können oder doch wenigstens Pastorin.
"Die Erde ist herrlich in ihrem Sonntagskleide!" sagte sie, und den Gedanken hatte sie in Verse und "Klingeling" gebracht, hatte ein schönes, langes Lied darüber gemacht.
Der Seminarist, Herr Kisserup, der Name tut nichts zur Sache, des Gärtners Schwestersohn, war zu Besuch im Gärtnerhaus. Er hörte das Gedicht der Madame, und es tue ihm wohl, sagte er, so recht innerlich wohl. "Sie haben Geist, Madame," sagte er.
"Unsinn!" sagte der Gärtner. "Setz ihr nicht so was in den Kopf! Eine Frau soll Körper sein, anständiger Körper, und auf ihren Kochtopf achtgeben, damit die Grütze nicht anbrennt!"
"Das Angebrannte nehme ich mit einer Holzkohle weg!" sagte die Madame. "Und die Verstimmung bei dir nehme ich mit einem kleinen Kuß weg. Man sollte glauben, du dächtest nur an Kohl und Kartoffeln, und doch liebst du die Blumen." Und dann küßte sie ihn. "Die Blumen sind der Geist!" sagte sie.
"Paß auf deinen Kochtopf auf!" sagte er und ging in den Garten. Der war sein Kochtopf, und auf den gab er acht.
Aber der Seminarist saß bei der Madame und redete mit der Madame. Über ihre schönen Worte "Die Erde ist herrlich" hielt er ihr gleichsam eine ganze Predigt auf seine Weise.
"Die Erde ist herrlich; machet sie euch untertan, ward gesagt, und wir wurden die Herrschaft. Einer ist es durch den Geist, der andere durch den Körper; der eine ward in die Welt gesetzt als Verwunderungs-Ausrufezeichen, ein anderer als Gedankenstrich, so daß man wohl fragen kann, was soll der hier? Einer wird Bischof, ein anderer nur ein armseliger Seminarist, aber alles ist weise eingerichtet. Die Erde ist herrlich, und sie ist immer im Sonntagskleide. Ihr Gedicht, Madame, war gedankenerweckend, voll Gefühl und Geographie."
"Sie haben Geist, Herr Kisserup," sagte die Madame, "viel Geist, das versichere ich Ihnen! Man bekommt Klarheit über sich selber, wenn man mit Ihnen redet!"
Und dann redeten sie weiter, ebenso schön und ebenso gut; aber draußen in der Küche, da redete auch jemand, nämlich der Kobold, der kleine, graugekleidete Kobold mit der roten Mütze.; du kennst ihn! Der Kobold saß in der Küche und war Topfgucker; er redete, aber niemand hörte ihn, außer der großen, schwarzen Mietzekatze, dem "Sahnedieb," wie die Madame sie nannte.
Der Kobold war so böse auf die Madame, denn sie glaubte nicht an sein Vorhandensein, daß wußte er; sie hatte ihn freilich niemals gesehen, aber bei all ihrer Belesenheit mußte sie doch wissen, daß er existierte, und ihm dann eine kleine Aufmerksamkeit erweisen. Es fiel ihr niemals ein, am Weihnachtsabend auch nur einen Löffel voll Grütze für ihn hinzusetzen, das hatten alle seine Vorfahren bekommen, und zwar von lauter Madams, die gar keine Gelehrsamkeit besaßen. Die Grütze hatte in Butter und Sahne geschwommen. Der Katze wurde ganz feucht um den Bart, wenn sie nur davon hörte.
"Sie nennt mich einen Begriff," sagte der Kobold, "Das geht wirklich über meine Begriffe. Sie verleugnet mich ja! Das hab ich ihr abgelauert, und nun habe ich wieder gelauert. Sie sitzt da und säuselt dem Seminaristen, diesem Büchsenspanner, was vor. Ich sage mit Vatern: 'Paß du auf deinen Kochtopf auf!' Das tut sie aber nicht, und nun will ich dafür sorgen, daß er überkocht!"
Und der Kobold blies ins Feuer, daß es aufflackerte und brannte. "Surre-rurre-rug!," da kochte der Kochtopf über.
"Jetzt will ich hineingehen und Löcher in Vaters Socken zupfen!" sagte der Kobold. "Ich will ein großes Loch in den Hacken und in die Zehe bohren, dann hat sie was zu stopfen, wenn sie nicht dichten muß. Dicht-Madame, stopf Vaters Strümpfe!"
Die Katze mußte niesen; sie war erkältet, obwohl sie immer mit einem Pelz ging.
"Ich habe die Speisekammertür aufgemacht," sagte der Kobold, "da steht aufgekochte Sahne, so dick wie Mehlpaps. Willst du nicht naschen, so werde ich es tun!"
"Wenn ich doch die Schuld und die Prügel bekommen, so will ich doch auch wenigstens von der Sahne schlecken!" sagte die Katze.
"Erst die Sahne, dann die Haue!" sagte der Kobold. "Aber nun will ich in des Seminaristen Stube gehen, seine Tragbänder über den Spiegel hängen und seine Socken in die Waschschüssel legen, dann glaubt er, daß der Punsch zu stark gewesen ist und daß ihm wirr im Kopfe ist. Über Nacht saß ich auf dem Holzstapel neben der Hundehütte; es ist mein größtes Vergnügen, den Kettenhund zu necken; ich ließ meine Beine herabhängen und baumelte damit. Der Hund konnte sie nicht erreichen, wie hoch er auch sprang; das ärgerte ihn. Er kläffte und kläffte, ich baumelte und baumelte; es war ein Spektakel. Der Seminarist erwachte davon; er stand dreimal auf und guckte, aber er sah mich nicht, obwohl er eine Brille aufhatte; er schläft immer mit der Brille!"
"Sag miau, wenn die Madame kommt!" sagte die Katze. "Ich höre nicht gut, ich bin heute krank."
"Du bist nur schleckkrank!" sagte der Kobold. "Schleck drauflos, schleck die Krankheit weg! aber trockne dir den Bart, damit keine Sahne daran hängenbleibt! Ich will jetzt hingehen und lauschen."
Und der Kobold stand an der Tür, und die Tür stand angelehnt, da war niemand im Zimmer als die Madame und der Seminarist. Sie sprachen über das, was man, wie sich der Seminarist schön ausdrückte, in jedem Hause über Kochtöpfe und Kessel setzen sollte: über die Gaben des Geistes.
"Herr Kisserup," sagte die Madame, "nun will ich Ihnen in bezug hierauf etwas zeigen, was ich bisher noch keiner menschlichen Seele, am allerwenigsten aber einem Manne, gezeigt habe, nämlich meine kleinen Dichtungen, einige sind ja freilich ein wenig lang. Jetzt sollen Sie sie hören."
.. ..
Und sie entnahm der Schublade ein Schreibheft mit hellgrünem Umschlag und zwei Tintenklecksen.
"Es steht viel Ernst in dem Buch!" sagte sie. "Ich habe am meisten Sinn für das Traurige. Da ist 'Der Seufzer in der Nacht', 'Mein Abendrot' und 'Als ich Klemmensen bekam', Das letztere können Sie überschlagen, obwohl viel Gefühl und tiefe Gedanken darin sind. 'Hausfrauenpflichten' ist das beste! Aber alle Gedichte sind traurig, darin liegt nun einmal meine Begabung. Nur eins ist in scherzendem Ton gehalten, das sind einige muntere Gedanken, wie man sie ja auch haben kann - Sie müssen nicht über mich lachen! - Gedanken darüber - wenn man Dichterin ist. Das kenne nur ich selber und meine Schublade, und nun kennen Sie es, Herr Kisserup! Ich liebe die Poesie, sie kommt so über mich, sie neckt mich, sie beherrscht, regiert mich. Ich habe das in dem Gedicht 'Der kleine Kobold' zum Ausdruck gebracht. Sie kennen ja den alten Volksglauben von dem Hauskobold, der stets sein Spiel im Hause treibt. Ich habe mir gedacht, daß ich selber das Haus bin und daß die Poesie, die Gefühle in mir, der Kobold sind, der Geist, der regiert; seine Macht, seine Gewalt habe ich in 'Der kleine Kobold' besungen. Aber Sie müssen mir geloben, daß sie das niemals an meinen Mann oder an sonst jemand verraten. Lesen Sie es laut, damit ich hören kann, ob sie meine Schrift lesen können."
Und der Seminarist las, und die Madame hörte zu, und der kleine Kobold hörte zu; er horchte, wie du ja weißt, und war gerade in dem Augenblick gekommen, als die Überschrift "Der kleine Kobold" gelesen wurde.
"Das betrifft mich ja!" sagte er. "Was kann sie nur über mich geschrieben haben? Ja, ich will sie schon zwicken; ich nehme ihr die Eier weg, nehme ihr die Küchlein weg, jage dem Fettkalb das Fett ab. Sie sollen mich schon kennenlernen, Madame!"
Und er lauschte mit spitzem Mund und langen Ohren; aber je mehr er von der Herrlichkeit und Macht des Kobolds, von seiner Gewalt über die Madame hörte - damit meinte sie ja, wie du wohl weißt, die Dichtkunst, aber der Kobold hielt sich wörtlich an die Überschrift - , um so heller wurde sein Lächeln, um so mehr strahlten seine Augen vor Freude, es kam etwas Vornehmes in seine Mundwinkel; er hob seine Fersen in die Höhe, stand auf den Zehenspitzen, wurde einen ganzen Zoll größer als sonst; er war entzückt über alles, was von dem kleinen Kobold gesagt wurde.
"Die Madame hat Geist und große Bildung! Wie hab ich der Frau doch unrecht getan! Sie hat mich in ihre Dichtung eingereiht, ich werde gedruckt und gelesen werden! Von nun an soll die Katze nicht mehr Erlaubnis haben, ihre Sahne zu trinken, das werde ich selber tun! Einer trinkt weniger als zweie, das ist immer eine Ersparnis, und die will ich einführen, und die Madame will ich achten und ehren."
"Er ist ja der reine Mensch, dieser Kobold!" sagte die Katze. "Nur ein süßes Miau von der Madame, ein Miau über ihn selber, und dann ist er gleich andern Sinnes. Sie ist schlau, die Madame!"
Aber die Madame war gar nicht schlau, aber der Kobold war so, wie sonst die Menschen sind.
Wenn du diese Geschichte nicht verstehen kannst, so darfst du fragen; aber den Kobold muß du nicht fragen und die Madame auch nicht.
DIE PSYCHE
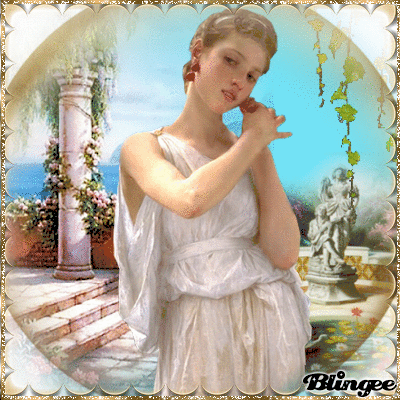
In der Morgendämmerung, in der roten Luft, glänzt ein großer Stern, der hellste Stern des Morgens; sein Strahl zittert auf der weißen Wand, als wollte er dort niederschreiben, was er zu erzählen weiß, was er Jahrtausende hindurch hier und dort auf unserer kreisenden Erde gesehen hat.
Hören wir eine seiner Erzählungen:
Erst kürzlich – das »kürzlich« des Stern heißt für uns Menschen »vor Jahrhunderten« – begleiteten meine Strahlen einen jungen Künstler; es war in der Stadt der Päpste, in der Weltstadt Rom. Vieles hat sich dort in der Zeiten Lauf verändert, doch nicht so schnell, wie die Menschengestalt vom Kind zum Greis übergeht. Die Kaiserburg war wie heute noch eine Ruine; Feigen- und Lorbeerbäume wuchsen zuwischen den umgestützten Marmorsäulen hin über die zerstörten Badezimmer, die noch mit Gold an den Wänden prangten; das Kolosseum war eine Ruine, die Kirchenglocken läuteten, das Räucherwerk duftete, durch die Straßen schritten Prozessionen mit Kerzen und strahlenden Baldachinen. Kirchenheilig war es hier, und hehr und heilig war die Kunst. In Rom lebte der größte Maler der Welt, Raffael; es lebte dort der erste Bildhauer des Zeitalters, Michelangelo; selbst der Papst huldigte diesen beiden, beehrte sie mit seinem Besuch; die Kunst war anerkannt, geehrt und wurde auch belohnt. Allein dessen ungeachtet wurde nicht alles Große und Tüchtige gesehen und bekannt.
In einem engen Gäßchen stand ein altes Haus, einst war es ein Tempel gewesen; ein junger Künstler wohnte darin, arm war er, unbekannt war er; er hatte freilich junge Freunde, Künstler wie er, jung von Gemüt, jung im Hoffen und Denken; sie sagten ihm, er sei reich an Talent und tüchtig, aber er sei ein Narr, daß er nicht selber daran glaube; zerbrach er doch stets, was er in Ton geformt hatte, wurde niemals zufrieden, bekam nie etwas fertig, und das muß man, damit es gesehen und anerkannt werden kann und Geld bringt:
»Du bist ein Träumer!« sagten sie ferner, »und das ist dein Unglück! Das kommt aber daher, daß du noch nicht gelebt, das Leben noch nicht gekostet hast, es nicht genossen hast in großen gesunden Zügen, wie es genossen werden muß. Gerade in der Jugend kann und muß man sein Ich mit dem Leben verschmelzen, auf daß sie eins werden! Schau den großen Meister Raffael an, den der Papst ehrt, den die Welt bewundert, er ist kein Verächter von Wein und Brot!«
»Er verspeist noch obendrein die Bäckerin, die niedliche Fornarina!« sagte Angelo, einer der lustigsten jungen Freunde.
Ja, was sagten sie nicht alles, je nach ihrer Jugend und nach ihrem Verstande. Sie wollten den jungen Künstler mit hinausziehen in das lustige, wilde Leben, das tolle Leben, wie man es auch nennen könnte; und er fühlte auch für Augenblicke Neigung dazu; er hatte heißes Blut, eine starke Phantasie, er verstand es wohl, in das lustige Gespräch mit einzustimmen, laut zu lachen mit den anderen; und doch, was sie »Raffaels fröhliches Leben« nannten, schwand ihm wie der Morgentau, wenn er den Gottesglanz sah, der aus den Bildern des großen Meisters leuchtete, und stand er im Vatikan vor den Schönheitsgestalten, welche die Meister vor Jahrhunderten aus Marmorblöcken geformt hatten, dann hob sich seine Brust, dann vernahm er in seinem Innern etwas so Hohes, Heiliges, Erhebendes, Großes und Gutes, und er wünschte aus dem Marmorblock ebensolche Gestalten zu schaffen, zu meißeln. Er wollte ein Bild schaffen von dem, was sich aus seinem Herzen hinauf zu dem Unendlichen emporschwang, aber wie und in welcher Gestalt? Der weiche Ton gestaltete sich unter seinen Fingern zu Schönheitsformen, doch tags darauf zerbrach er, wie immer, was er geschaffen hatte.
Eines Tages schritt er an einem der reichen Paläste vorüber, deren Rom so viele aufzuweisen hat; er blieb stehen vor der großen, offenen Einfahrt und sah hier mit Bildern geschmückte Bogengänge, die einen kleinen Garten umschlossen; der Garten prangte mit einer Fülle der schönsten Rosen. Große weiße Callas mit ihren grünen, saftigen Blättern schossen empor aus dem Marmorbassin, in welchem das klare Wasser plätscherte; und hier vorüber schwebte eine Gestalt, ein junges Mädchen, die Tochter dieses fürstlichen Hauses, fein, leicht, wunderbar schön! Eine solche Frauengestalt hatte er noch nie gesehen, und doch! gemalt von Raffael, gemalt als Psyche in einem der römischen Paläste. Ja, dort war sie gemalt, hier schritt sie lebendig einher.
In seinen Gedanken, in seinem Herzen lebte sie; und er ging zurück in sein ärmliches Zimmer und formte in Ton die Psyche, und es war die reiche, junge Römerin, die adlige Jungfrau; zum erstenmal betrachtete er sein Werk mit Befriedigung. Es hatte Bedeutung für ihn, es war sie. Und die Freunde, die es sahen, jubelten vor Freude; dieses Werk war eine Offenbarung seiner Künstlergröße, die sie im voraus erkannt hatten, jetzt sollte auch die Welt sie erkennen.
Der Ton ist zwar fleischig und lebendig, er besitzt aber nicht die Weiße und Dauer des Marmors; zum Leben in Marmor mußte diese Psyche gelangen, und den kostbaren Marmorblock besaß er schon, der lag schon seit Jahren als Eigentum der Eltern im Hof; Glasscherben, Fenchelkraut, Überbleibsel von Artischocken häuften sich über ihn und beschmutzten ihn, aber im Innern war der Block wie der Schein des Berges; aus diesem Marmor sollte die Psyche entstehen.
Eines Tages nun geschah es – ja, der helle Stern erzählt nichts davon, er sah es nicht, wir aber wissen es -, daß eine vornehme römische Gesellschaft in die enge, unansehnliche Gasse kam. Die Equipage hielt am Anfang der Gasse, die Gesellschaft begab sich zu Fuß zu dem Haus, um die Arbeit des jungen Künstlers zu sehen, sie hatten zufällig davon gehört. Und wer waren die vornehmen Gäste? Armer junger Mann! Gar zu glücklicher junger Mann könnte er auch genannt werden. Die junge Adelige selber stand hier im Zimmer, und mit welchem Lächeln, als ihr Vater sagte: »Du bist es, wie du leibst und lebst!« Das Lächeln kann nicht geformt, der Blick nicht wiedergegeben werden, der wunderbare Blick, mit dem sie den Künstler ansah; es war ein Blick, erhebend, adelnd und – zermalmend.
»Die Psyche muß in Marmor ausgeführt werden!« sagte der reiche Herr. Und das waren Lebensworte für den toten Ton und den schweren Marmorblock, wie es Lebensworte für den tief ergriffenen jungen Mann waren. »Wenn die Arbeit vollendet ist, kaufe ich sie!« sagte der fürstliche Herr.
Es war, als rollte eine neue Zeit herauf in der ärmlichen Werkstatt; Leben und Fröhlichkeit leuchteten, emsiger Fleiß schaffte darin. Der strahlende Morgenstern sah, wie die Arbeit fortschritt. Der Ton selber war wie beseelt, seitdem sie dagewesen war, er formte sich in erhöhter Schönheit zu den bekannten Zügen.
»Jetzt weiß ich, was Leben ist!« jubelte der Künstler, »es ist Liebe! Es ist erhabene Hingebung an das herrliche, entzückende Aufgehen im Schönen! Das, was die Freunde Leben und Genuß nennen, ist vergängliches Wesen, sind Blasen der gärenden Hefe, ist nicht der reine, himmlische Altarwein, der zum Leben weiht.
Der Marmorblock wurde aufgestellt; der Meißel schlug große Stücke von ihm ab; da wurde gemessen, Punkte und Zeichen wurden gemacht, das Handwerksmäßige ausgeführt, bis nach und nach der Stein sich in Körper, in Schönheitsgestalt, in die Psyche verwandelte, schön und herrlich, wie das Gottesbild in der Jungfrau. Der schwere Stein wurde schwebend, tanzend, luftgleich, eine anmutige Psyche mit dem himmlisch unschuldigen Lächeln, die dieses sich im Herzen des jungen Bildhauers gespiegelt hatte.
Der Stern des rosenfarbenen Morgens sah und begriff wohl, was sich in dem jungen Mann regte, begriff die wechselnde Färbung seiner Wangen, den Blitz, der aus seinem Auge schoß, während er schaffte, während er das wiedergab, was Gott gegeben hatte.
»Du bist ein Meister wie die der alten Griechen!« sagten die entzückten Freunde. »Bald wird die ganze Welt deine Psyche bewundern!«
»Meine Psyche!« wiederholte er. »Meine! Ja, sie muß es werden! Auch ich bin ein Künstler, wie jene großen Verblichenen! Gott hat mir das Gnadengeschenk gewährt, mich hoch gehoben wie die Edelgeborene!«
Und er kniete nieder, weinte im Dankgebet zu Gott – und vergaß Gott wieder ihretwegen, ihres Bildes in Marmor, der Psychegestalt werden, die wie aus Schnee geformt dastand, in der Morgensonne errötend.
In Wirklichkeit sollte er sie sehen, die Lebende, Schwebende, sie, deren Worte wie Musik klangen. In dem reichen Palast konnte er nun die Nachricht bringen, daß die Marmorpsyche vollendet sei. Er trat dort ein, schritt durch den offenen Hof, wo das Wasser aus den Delphinen in die Marmornen Bassins hinabplätscherte, wo die Callas blühten und die frischen Rosen in reicher Fülle sprossen. Er trat in die große, hohe Vorhalle, deren Wände und Decken in Farben prangen, mit Wappenzeichen und Bildern, Geputzte Diener, stolz und geziert, wie Schlittenpferde mit Schellen behangen, gingen hier auf und ab, einige streckten sich auch gemächlich und übermütig, auf den geschnitzten Holzbänken aus, als seien sie die Herren des Hauses. Er sagte Ihnen, was ihn in den Palast führte, und wurde die blanken, marmornen, mit weichen Teppichen belegten Treppen hinaufgeführt. Zu beiden Seiten standen Statuen, er schritt durch reich geschmückte Zimmer mit Bildern und glänzenden Mosaikfußböden. All dieser Glanz und diese Pracht machten ihm den Atem schwer, aber bald fühlte er sich wieder leicht; der alte fürstliche Herr empfing ihn gar freundlich, fast herzlich, und als er sich von ihm verabschiedete, wurde er gebeten, bei der Signora einzutreten, auch sie wünsche, ihn zu sehen. Der Diener führte ihn durch prachtvolle Zimmer, wo sie selber die Pracht und Herrlichkeit war.
Sie sprach zu ihn; kein Miserere, kein Kirchengesang hätte das Herz so schmelzen, die Seele höher erheben können als ihre Rede. Er ergriff ihre Hand, drückte sie an seine Lippen; keine Rose war so weich, aber es ging ein Feuer von dieser Rose aus, ein Feuer! Ein erhebendes Gefühl durchströmte ihn; es flossen Worte von seiner Zunge, er wußte selber nicht, welche. Weiß der Krater, daß er glühende Lava speit? Er gestand ihr seine Liebe. Sie stand überrascht, beleidigt, stolz da, mit einem Hohn in ihren Mienen, ja, mit einem Ausdruck, als hätte sie plötzlich einen nassen, kalten Frosch berührt, ihre Wangen röteten sich, ihre Lippen wurden blaß, ihre Augen waren Feuer und dennoch schwarz, wie die Finsternis der Nacht.
»Wahnsinniger!« sprach sie. »Fort! Hinab!« Und sie kehrte ihm den Rücken zu. Das Antlitz der Schönheit hatte einen Ausdruck, der jenem versteigerten Antlitz mit den Schlangenhaaren ähnlich war.
Einem sinkenden leblosen Gegenstand gleich wankte er die Treppen hinab, auf die Straße hinaus; wie ein Schlaftrunkener erreichte er seine Wohnung und erwachte in Raserei und Schmerz, ergriff seinen Hammer, hob ihn hoch in die Luft und wollte das schöne Marmorbild zermalmen, allein in seinem Zustand hatte er nicht bemerkt, daß der Freund Angelo neben ihm stand; dieser hielt mit einem kräftigen Griff seinen Arm zurück.
»Bist du rasend? Was beginnst du?«
Sie rangen miteinander; Angelo war der stärkere, und ermattet, mit tiefem Atemzug warf der junge Künstler sich auf einen Stuhl nieder.
»Was ist geschehen?« fragte Angelo. »So fasse dich doch! Sprich!«
Doch was konnte er sagen!« Und da Angelo den Redeknäuel nicht zu entwirren vermochte, ließ er davon ab.
»Dickes Blut bekommst du bei dieser ewigen Träumerei!« Sei doch ein Mensch, wie die andern es sind, lebe nicht immerfort in Idealen, man schnappt über dabei! Ein Weinräuschchen, und du schläfst glücklich ein! Laß ein schönes Mädchen dein Arzt sein! Die Mädchen der Campagna sind schön wie die Prinzessin im Marmorschloß; beide sind Evastöchter und im Paradies nicht zu unterscheiden! Folge du deinem Angelo! Dein Engel bin ich, ein Engel des Lebens! Die Zeit wird kommen, wo du alt wirst und der Körper zusammensinkt, und dann an einem schönen, sonnigen Tag, wenn alles lacht und jubelt, liegst du da, ein welker Halm, der nicht mehr wächst! Ich glaube nicht, was die Priester sagen von einem Leben jenseits des Grabes, das ist eine schöne Einbildung, ein Märchen für Kinder, ganz hübsch, wenn man es sich eben einbilden kann. ich lebe aber in der Wirklichkeit! Komm mit mir! Sei ein Mensch!«
Und es zog ihn mit sich, er konnte es in diesem Augenblick; Feuer sprühte im Blut des jungen Künstlers, in seiner Seele war eine Veränderung vorgegangen, er fühlte einen Drang, sich loszureißen von dem Alten, dem Gewohnten, sich aus seinem eigenen alten bisherigen Ich herauszureißen, und heute also folgte er Angelo.
In einer entlegenen Gegend vom Rom lag eine von Künstlern besuchte Osteria, in die Ruine einer alten Badekammer hineingebaut; die großen gelben Zitronen hingen zwischen dem dunkel glänzenden Laub und verdeckten einen Teil der alten rotgelben Mauern; die Osteria war ein tiefes Gewölbe, fast einer Höhle gleich in den Ruinen; drinnen brannte eine Lampe vor dem Madonnenbild, ein großes Feuer loderte auf dem Herd, hier wurde gekocht und gebraten; draußen, unter den Zitronen- und Lorbeerbäumen standen einige reich gedeckte Tische.
Beide wurden von den Freunden mit Jubel empfangen. Wenig aß man, viel trank man, das erhöhte die Fröhlichkeit; es wurde gesungen, Gitarre gespielt, der Saltarello erklang, und der lustige Tanz begann. Zwei junge Römerinnen, Modelle der jungen Künstler, nahmen teil an dem Tanz und an der Fröhlichkeit: zwei allerliebste Bacchantinnen! Freilich keine Psychegestalten, keine feinen, schönen Rosen, sondern frische, kräftige, glühende Nelken.
Wie war es an diesem Tag heiß. Feuer im Blut, Feuer in der Luft, Feuer in jedem Blick. Die Luft leuchtete in Gold und Rosen, das Leben war Gold und Rosen.
»Endlich bist du mal dabei! Laß dich nur tragen von den Fluten um dich und in dir!«
»Noch nie war ich so gesund, so fröhlich!« sagte der junge Künstler. »Du hast recht, ihr habt alle recht, ich war ein Narr, ein Träumer, der Mensch gehört in die Wirklichkeit und nicht in die Phantasie!«
Mit Gesang und klingenden Gitarren zogen die jungen Leute an dem sternhellen Abend von der Osteria durch die kleinen Gassen; die beiden glühenden Nelken, Töchter der Campagna zogen mit ihnen.
In Angelos Zimmer, zwischen umhergestreuten Farbskizzen, hingeworfenen Foglietten und glühenden, üppigen Bildern klangen die Stimmen gedämpfter, aber nicht weniger lebhaft; auf dem Fußboden lag manches Blatt, das den Töchtern der Campagna in ihrer wechselnden, kräftigen Schönheit gar ähnlich war, und doch waren sie selber weit schöner. Der sechsarmige Leuchter ließ alle seine Dochte flammen und leuchten; und vom Innern flammte und leuchtete die Menschengestalt als Gottheit heraus.
»Apollo! Jupiter! In euren Himmeln, in eure Herrlichkeit werde ich emporgehoben! Mir ist, als ginge die Blüte des Lebens in diesem Augenblick in meinem Herzen auf!«
Ja, sie ging auf – nickte , fiel, und ein häßlicher Dunst wirbelte heraus, blendete das Gesicht, betäubte die Gedanken; das Feuerwerk der Sinne erlosch, und es ward finster.
Er befand sich wieder in seinem eigenen Zimmer; hier setzte er sich auf sein Bett und sammelte sich. »Pfui!« klang es aus seinem eigenen Mund, aus seinem Herzensgrund. »Elender! Fort! Hinab!« und ein tiefer, schmerzlicher Seufzer entrang sich seiner Brust.
»Fort! Hinab!« Diese ihre Worte, die Worte der lebenden Psyche, klangen in seinem Innern, tönten von seinen Lippen. Er drückte seinen Kopf in die Kissen, die Gedanken wurden unklar, er schlief ein.
In der Morgendämmerung fuhr er auf, sammelte sich aufs neue. Was war geschehen? Hatte er das alles geträumt? Den Besuch bei ihr geträumt, den Besuch in der Osteria, den Abend mit den purpurnen Nelken der Campagna geträumt? – Nein, alles war Wirklichkeit, die ihm früher unbekannt gewesen war.
In der purpurnen Luft strahlte der klare Stern, sein Strahl fiel auf ihn und die Marmorpsyche; er selber zitterte, als er das Bild der Unvergänglichkeit betrachtete, unrein schien ihm sein Blick. Er warf das Tuch über die Statue, noch einmal berührte er es, um die Gestalt zu entschleiern, allein er vermochte es nicht, sein Werk zu betrachten.
Still, finster, in sich selber versunken, blieb er sitzen den lieben langen Tag; er vernahm nichts von dem, was sich draußen bewegte. Niemand wußte, was sich drinnen, in dieser Menschenbrust bewegte.
Tage, Wochen vergingen; die Nächte waren am längsten. Der blitzende Stern sah ihn eines Morgens blaß, fieberhaft sich vom Lager erheben, auf das Marmorbild hinschreiten, die Hülle zurückschlagen, einen langen, schmerzlichen Blick auf sein Werk werden und dann, fast unter der Last zusammenbrechend, die Statue in den Garten hinausschleppen. Dort befand sich ein ausgetrockneter Brunnen, jetzt eher ein Loch, in dieses senkte er die Psyche hinab, warf Erde über Sie, deckte Reisig und Nesseln über die Stätte.
»Fort! Hinab!« lautete die kurze Grabrede.
Der Stern gewahrte es aus der rosenroten Luft, und sein Strahl zitterte in zwei großen Tränen auf den todblassen Wangen des jungen Mannes, des Fiebernden – des Todkranken, sagten sie, als er auf dem Siechbette lag.
Der Klosterbruder Ignatius besuchte ihn als Freund und als Arzt, brachte ihm Trostesworte der Religion, sprach von dem Frieden und dem Glück der Kirche, von der Sünde der Menschen, von der Gnade und dem Frieden in Gott.
Und die Worte fielen gleich wärmenden Sonnenstrahlen auf den gärenden Boden; der dampfte und entsandte Nebelwolken, Gedankenbilder, Bilder die ihre Wirklichkeit hatten; und von diesen schwimmenden Inseln schaute der Kranke über das Menschenleben hin. Fehlgriffe, Täuschungen waren es, waren es auch für ihn gewesen. Die Kunst war eine Hexe, die in uns Eitelkeit, irdische Gelüste hinein trug. Falsch waren wir gegen uns selbst, gegen unsere Freunde, falsch gegen Gott. Die Schlange sprach immer in uns: »Iß, und du sollst werden wie Gott!«
Nun erst schien es ihm, als habe er sich selber verstanden, den Weg zur Wahrheit und zum Frieden gefunden. In der Kirche war das Licht und die Helle Gottes, in der Mönchszelle die Ruhe, durch die der Menschenbaum in die Ewigkeit hineinwachsen konnte.
Bruder Ignatius stärkte seinen Sinn, und der Entschluß wurde fest in ihm. Ein Weltkind wurde ein Diener der Kirche, der junge Künstler entsagte der Welt, ging ins Kloster.
Liebevoll kamen ihm die Brüder entgegen, und sonntagsfestlich war die Einweihung. Gott, so schien es ihm, war in dem Sonnenschein der Kirche, strahle von den heiligen Bildern und dem glänzenden Kreuze. Und als er nun am Abend beim Sonnenuntergang in seiner kleinen Zelle stand und das Fenster öffnete, über das alte Rom hinausblickte, über die zerstörten Tempel, das große, aber tote Kolosseum, und als er dies alles im Frühlingskleid sah, die Akazien blühten, das Immergrün war frisch, die Rosen sproßten überall hervor, Zitronen und Orangen prangten, die Palmen fächelten, da fühlte er sich ergriffen und erfüllt wie noch nie. Die offene, stille Campagna dehnte sich aus bis zu den blauen, schneebedeckten Bergen, diese schienen in die Luft gemalt zu sein: alles verschmolz ineinander, Frieden und Schönheit atmend, schwimmend, träumend – ein Traum das Ganze!
Ja, ein Traum war die Welt hier, und der Traum waltet stundenlang und kann für Stunden wiederkehren, aber das Klosterleben ist ein Leben von Jahren, langen und vielen Jahren.
Von innen kommt vieles, was den Menschen unrein macht, das fand er bestätigt! Welche Flammen durchloderten ihn manchmal! Welche Quelle des Bösen, das er nicht wollte, quoll immerfort! Er strafte seinen Leib, aber von innen kam das Böse. Ein Teilchen des Geistes in ihm wand sich geschmeidig wie die Schlange um sich selbst und kroch mit seinem Gewissen unter den Mantel der Alliebe und tröstete: die Heiligen beten für uns, die Mutter betet für uns, Jesus selber hat sein Blut für uns hingegeben. War es ein kindlich Gemüt oder der Jugend leichter Sinn, der sich der Gnade gab und sich durch sie erhoben fühlte, erhoben über viele; denn er hatte ja die Eitelkeit der Welt von sich gestoßen, er war ja ein Sohn der Kirche.
Eines Tages, nach Verlauf vieler Jahre, begegnete ihm Angelo, der ihn erkannte.
»Mensch!« rief Angelo, »ja, du bist es! Bist du jetzt glücklich? Du hast gesündigt gegen Gott und sein Gnadengeschenk von dir geworfen, deine Mission in dieser Welt verscherzt. Lies die Parabel von dem anvertrauten Pfunde! Der Meister, der sie erzählte, sprach die Wahrheit! Was hast du gewonnen, was gefunden? Legst du dir nicht ein Traumleben, legst du dir nicht eine Religion zurecht nach deinem Kopfe, wie sie es wohl alle tun? Wenn nun alles ein Traum, eine Phantasie, ein schöner Gedanke nur wäre!«
»Weiche von mir, Satan!« sprach der Mönch und verließ Angelo.
»Es gibt einen Teufel, einen Teufel in Menschengestalt! Heute sah ich ihn!« sprach der Mönch vor sich hin. »Ich reichte ihm einst einen Finger, er nahm meine ganze Hand« Nein!« seufzte er, »in mir selber ist das Böse, und in jenem Menschen ist das Böse, aber es beugt ihn nicht, er geht mit freier Stirn umher, genießt sein Wohlsein; und ich hasche nach meinem Wohlsein im Trost der Religion! Wenn sie nur Trost wäre? Wenn alles hier, wie die Welt, die ich verließ, nur schöne Gedanken wären, Täuschungen, wie die Schönheit der roten Abendwolken, wie das wallende Blau der fernen Berge! In der Nähe sind sie anders! Ewigkeit, du bist wie der große, unendliche, meeresstille Ozean, der winkt und ruft, uns mit Ahnungen erfüllt, und steigen wir hinaus auf ihn, dann sinken wir, verschwinden – sterben – hören auf zu sein! - Täuschung! Fort! Hinab!
Und ohne Tränen, in sich selber versunken, saß er auf seinem harten Lager, kniete nieder – vor wem? Vor dem steinernen Kreuz in der Mauer? Nein, die Gewohnheit ließ den Körper diese Lage einnehmen.
Je tiefer er sich bückte, desto finsterer schien es ihm dort. »Nichts innen, nichts außen! Vergeudet dieses Leben!« Und dieser Gedankenschneeball rollte, wuchs, zermalmte ihn – löschte ihn aus.
»Niemandem darf ich mich anvertrauen, zu niemandem von diesem nagenden Wurm hier innen sprechen! Mein Geheimnis ist mein Gefangener, lasse ich ihn entschlüpfen, bin ich der seine!«
Und die Gotteskraft, die ihm innewohnte, litt und stritt.
»O Herr, mein Herr!« rief er in seiner Verzweiflung, »sei barmherzig, schenke mir den Glauben! Dein Gnadengeschenk warf ich von mir, meine Mission ließ ich unerfüllt! Mir fehlte die Kraft, du gabst sie mir nicht. Die Unsterblichkeit, die Psyche in meiner Brust – fort, hinab! Begraben soll sie werden wie jene Psyche, mein bester Lebensstrahl! Nimmer ersteht sie aus dem Grabe!«
Der Stern in der rosenroten Luft leuchtete, der Stern, der gewiß verlöschen und vergehen wird, während die Seele lebt und leuchtet; sein zitternder Strahl fiel auf die weiße Wand, aber keine Schrift setzt er dorthin von der Herrlichkeit Gottes, von der Gnade, von der Alliebe, welche in der Brust des Gläubigen klingt.
»Die Psyche hier innen wird nimmer sterben! Leben im Bewußtsein? Kann das Unfaßliche geschehen? Ja! Ja! Unfaßlich ist mein Ich. Unfaßlich bist du, o Herr! Deine ganze Welt ist unfaßlich ein Wunderwerk an Macht, Herrlichkeit - Liebe!«
Seine Augen leuchteten, seine Augen brachen. Der Klang der Kirchenglocken war der letzte Laut über ihm, dem Toten; und man senkte ihn in Erde, die von Jerusalem geholt und mit dem Staub von frommen Toten gemischt war.
Nach Jahren hob man das Skelett heraus, wie es mit den vor ihm gestorbenen Mönchen geschehen war, man bekleidete es mit einer braunen Kutte, gab ihm eine Perlenschnur in die Hand und stellte es in die Reihen anderer Menschengebeine, die in den Grabgewölben des Klosters gefunden wurden. Und draußen schien die Sonne, drinnen dufteten die Räuchergefäße, wurden die Messen gelesen.
Jahre vergingen. Die Gebeine fielen auseinander; Totenköpfe wurden aufgestellt, sie bildeten eine ganze äußere Mauer der Kirche; dort stand auch sein Kopf in der sengenden Sonne, gar viele Tote waren dort, niemand kannte jetzt ihre Namen, auch den seinen nicht. Und siehe, im Sonnenschein bewegte sich etwas Lebendiges in den beiden Augenhöhlen, was mochte das sein? Eine bunte Eidechse sprang in dem holen Schädel umher, huschte aus und ein durch die leeren, großen Augenhöhlen. Die Eidechse war jetzt das Leben in dem Kopf, in welchem einst große Gedanken, helle Träume, die Liebe zur Kunst und zum Herrlichen sich erhoben hatte, von wo heiße Tränen herabgerollt waren und wo die Hoffnung auf Unsterblichkeit gelegt hatte. Die Eidechse sprang, verschwand; der Schädel zerbröckelte, ward Staub im Staube.
Es war Jahrhunderte später. Der helle Stern leuchtete unverändert, klar und groß, wie seit Jahrtausenden, die Luft leuchtete rot, frisch wie Rosen, purpurn wie Blut.
Dort, wo einst eine enge Gasse mit den Überresten eines Tempels gewesen war, lag jetzt ein Nonnenkloster; in dem Garten des Klosters wurde ein Grab gegraben, eine junge Nonne war gestorben und sollte an diesem Morgen in die Erde gebettet werden. Der Spaten stieß gegen einen Stein, der Stein leuchtete blenden weiß. Marmor kam zu Vorschein, er rundete sich zu einer Schulter, die allmählich ganz hervortrat; der Spaten wurde nun vorsichtiger geführt; ein weiblicher Kopf kam zu Tage – Schmetterlingsflügel! Aus dem Grab, in welches die junge Nonne gelegt werden sollte, hob man an dem rosenroten, flammenden Morgen eine wunderherrliche Psychegestalt, gemeißelt in weißen Marmor. »Wie schön, wie vollendet ist sie, ein Kunstwerk aus der besten Zeit!« sagte man. Wer mochte der Meister sein? Niemand wußte es, niemand kannte ihn als der helle, durch Jahrtausende leuchtende Stern; der kannte den Gang seines Erdenlebens, seine Prüfung, seine Schwäche, wußte, daß er eben nur ein Mensch gewesen war! Aber der war tot, verweht, wie der Staub es sein muß und soll, doch die Ausbeute seines besten Strebens, das Herzlichste, was das Göttliche in ihm bekundete, die Psyche, die niemals stirbt, die den Nachruhm überstrahlt, der Glanz dieser Psyche hier auf Erden, der blieb hier, wurde gesehen, erkannt, bewundert und idealisiert.
Der klare Morgenstern in der rosenfarbenen Luft sandte seinen blitzenden Strahl hernieder auf die Psyche und auf die in Glückseligkeit lächelnden Lippen und Augen der Bewunderer, welche die Seele sahen, gemeißelt aus dem Marmorblock.
Was irdisch ist, verweht, wird vergessen, nur der Stern im Unendlichen weiß davon. Was himmlisch ist, strahlt selbst im Nachruhm, und wenn der Nachruhm erlischt lebt noch die Psyche.
IM ENTENHOF ...
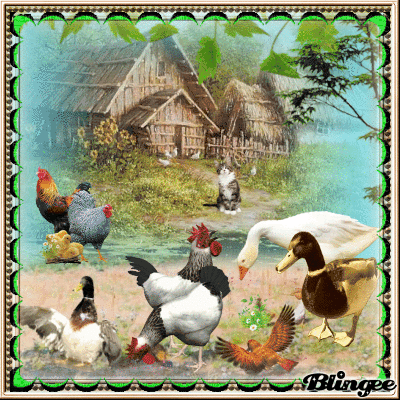
Es kam eine Ente aus Portugal, einige sagten, aus Spanien, doch das bleibt sich gleich; genug, sie wurde die Portugiesin genannt, legte Eier, wurde geschlachtet und angerichtet – das war ihr Lebenslauf. Alle Enten, die aus ihren Eiern auskrochen, wurden später auch Portugiesin genannt, und das wollte schon etwas heißen. Jetzt war von der ganzen Familie nur noch eine im Entenhof, einem Hof, zu dem auch die Hühner Zutritt haben und in dem der Hahn mit viel Hochmut auftrat.
"Er ärgert mich durch sein lautes Krähen," sagte die Portugiesin. "Aber bübisch ist er, das ist nicht zu leugnen, wenn er auch kein Enterich ist. Er sollte sich mäßigen, aber das ist eine Kunst, die von höherer Bildung zeugt, die haben bloß die kleinen Singvögel, drüben im Nachbargarten, in den Linden. Wie lieblich sie singen! Es liegt so etwas Rührendes in ihrem Gesang, ich nenne es Portugal! Hätte ich nur solch einen kleinen Singvogel, ich würde ihm eine Muter sein, lieb und gut, das liegt mir im Blut, in meinem portugiesischen Blut!"
Und während sie noch so sprach, kam ein kleiner Singvogel kopfüber vom Dach herab in den Hof. Der Kater war hinter ihm her, aber der Vogel kam dessen ungeachtet mit einem gebrochenen Flügel davon, deshalb fiel er in den Entenhof.
"Das sieht dem Kater ähnlich, er ist ein Bösewicht!" sagte die Portugiesin; "ich kenne ihn noch von der Zeit her, wo ich Kinder hatte. Daß so ein Wesen leben und auf den Dächern umhergehen darf! Ich glaube nicht, daß dies in Portugal der Fall ist!" Und sie bemitleidete den kleinen Singvogel, und die anderen Enten, die nicht portugiesischer Abkunft waren, bemitleideten ihn auch.
"Das kleine Tierchen!" sagten sie, während eine nach der andern herankam. "Wir können zwar nicht singen," sprachen sie, "aber wir haben den Resonanzboden, oder so etwas, innerlich, das fühlen wir, wenn wir auch nicht davon sprechen!"
"Ich aber werde davon sprechen!" sagte die Portugiesin, "und ich will etwas für die Kleine tun, das ist Pflicht!" und sie trat in den Wassertrog und schlug mit den Flügeln so in das Wasser, daß der kleine Singvogel in dem Bad, das er bekam, fast ertrank; aber es war gut gemeint. "Das ist eine gute Tat," sprach sie; "Die andern sollten sich ein Beispiel daran nehmen!"
"Piep!" sagte der kleine Vogel, dem einer seiner Flügel gebrochen war und dem es schwer wurde, sich zu schütteln; aber er begriff sehr gut das wohlgemeinte Bad. "Sie sind herzensgut, Madame!" sagte er, aber es verlange ihm nicht nach einem zweiten Bade.
"Ich habe nie über mein Herz nachgedacht"; fuhr die Portugiesin fort, "aber das eine weiß ich, daß ich alle meine Mitgeschöpfe liebe; nur nicht den Kater, das kann aber auch niemand von mir verlangen. Er hat zwei der meinigen gefressen; doch tun Sie so, als seien Sie zu Hause, das kann man schon. Ich selber bin auch aus einer fremden Gegend, wie Sie schon aus meiner Haltung und meinem Federkleid ersehen werden; mein Enterich dagegen ist ein Eingeborener, er ist nicht von meinem Geblüt, aber ich bin nicht hochmütig! Versteht Sie jemand hier im Hof, so darf ich wohl sagen, daß ich es bin!"
"Sie hat Portulak im Magen!" sagte ein kleines, gewöhnliches Entlein, das witzig war, und alle die andern gewöhnlichen Enten fanden das Wort Portulak ganz ausgezeichnet: es klang wie Portugal, und sie stießen sich an und sagen "Rapp" Es war zu witzig! Und alle anderen Enten gaben sich dann mit dem kleinen Singvogel ab.
"Die Portugiesin hat zwar die Sprache mehr in ihrer Gewalt," äußerten sie. "Was uns aber anbelangt, wir brüsten uns nicht so mit großen Worten im Schnabel; unsere Teilnahme jedoch ist ebenso groß. Tun wir nichts für Sie, so gehen wir still mit umher; und das finden wir am schönsten!"
"Sie haben eine liebliche Stimme!" sagte eine der ältesten. "Es muß ein schönes Bewußtsein sein, so vielen Freude zu bereiten, wie Sie dieses zu tun vermögen. Ich verstehe mich freilich auf Ihren Gesang nicht, deshalb halte ich auch den Schnabel, und dies ist immer besser, als ihnen etwas Dummes zu sagen, wie dies gar viele andere tun!"
"Quäle ihn nicht so," sagte die Portugiesin, "er bedarf der Ruhe und Pflege. Wünschen Sie, mein kleiner Singvogel, daß ich Ihnen wieder ein Bad bereite?"
"Ach nein, lassen sie mich trocken bleiben!" bat er.
"Die Wasserkur ist die einzige, die mir hilft, wenn mir etwas fehlt," antwortete die Portugiesin. "Zerstreuung ist auch etwas Gutes! Jetzt werden bald die Nachbarhühner ankommen und Visite machen, unter ihnen befinden sich auch zwei Chinesinnen; diese haben Höschen an, besitzen viel Bildung und sind importiert; deshalb stehen sie höher in meiner Achtung als die anderen." Und die Hühner kamen, und der Hahn kam; er war heute so höflich, daß er nicht grob war.
"Sie sind ein wirklicher Singvogel," sprach er, "und Sie machen aus Ihrer kleinen Stimme alles, was aus so einer kleinen Stimme zu machen ist. Aber etwas mehr Lokomotive muß man haben, damit jeder hört,daß man männlichen Geschlechts ist."
Die zwei Chinesinnen standen ganz entzückt da beim Anblick des Singvogels; er sah recht struppig aus von dem Bad, das er bekommen hatte, so daß es ihnen schien, er sehe fast wie ein chinesisches Küchlein aus. "Er ist reizend!" sagten sie, ließen sich mit ihm in ein Gespräch ein und sprachen nur flüsternd und mit Pa-Lauten, d. h. in vornehmem Chinesisch, mit ihn.
"Wir sind von Ihrer Art," führen sie fort. "Die Enten, selbst die Portugiesin, sind Schwimmvögel, wie Sie wohl bemerkt haben werden. Uns kennen Sie noch nicht; nur wenige kennen uns oder geben sich die Mühe, uns kennenzulernen; selbst von den Hühnern niemand, obwohl wir dazu geboren sind, auf einer höheren Sprosse zu sitzen als die meisten anderen; das kümmert uns aber nicht; wir gehen ruhig unseres Weges inmitten der anderen, deren Grundsätze nicht die unseren sind, denn wir beachten nur die guten Sitten und sprechen nur von dem Guten, obwohl es schwierig ist, da etwas zu finden, wo nichts ist. Außer uns beiden und dem Hahn gibt es im ganzen Hühnerhof niemanden, der talentvoll und zugleich honett ist! Das kann nicht einmal von den Bewohnern des Entenhofs gesagt werden. – Wir warnen Sie, kleiner Singvogel! Trauen Sie nicht der da mit den kurzen Schwanzfedern; sie ist hinterlistig. Die Bunte da, mit der schiefen Zeichnung auf den Flügeln, ist streitsüchtig und läßt keinem das letzte Wort, und obendrein hat sie noch immer unrecht. Die fette Ente dort spricht Böses über alle; dies ist unserer Natur zuwider; kann man nicht Gutes sprechen, so muß man den Schnabel halten. Die Portugiesin ist die einzige, die ein wenig Bildung hat und mit der man Umgang pflegen kann; aber sie ist leidenschaftlich und spricht zu viel von Portugal!"
"Was die beiden Chinesinnen nur immer zu flüstern haben!" flüsterte sich ein Entenpaar zu, "mich langweilen sie, wir haben nie mit ihnen gesprochen." Jetzt kam der Enterich herbei. Er glaubte, der Singvogel sei ein Spatz. "Ja ich kenne den Unterschied nicht," sagte er, "und das ist auch einerlei! Er gehört zu den Spielwerken, und hat man sie, so hat man sie!"
"Legen Sie nur kein Gewicht auf das, was er sagt," flüsterte die Portugiesin, "er ist in Geschäftssachen sehr respektabel, und Geschäfte gehen ihm über alles. Aber jetzt lege ich mich zur Ruhe! Das ist man sich selber schuldig, damit man hübsch fett wird, wenn man mit Äpfeln und Pflaumen balsamiert werden soll."
Und sie legte sich nun in die Sonne und blinzelte mit einem Auge; sie lag sehr gut, war auch sehr gut und schließ außerdem sehr gut.
Der kleine Singvogel machte sich an seinem gebrochenen Flügel zu schaffen, endlich legte er sich auch hin und drückte sich eng an seine Beschützerin; die Sonne schien warm und herrlich, er hatte einen recht guten Ort gefunden.
Die Nachbarhühner dagegen waren wach, sie liefen umher und kratzten den Boden auf; im Grunde genommen hatten sie den Besuch einzig und allein nur gemacht, um Nahrung zu sich zu nehmen. Die Chinesinnen waren die ersten, die den Entenhof verließen, die anderen Hühner folgten ihnen bald darauf. Das witzige Entlein sagte von der Portugiesin, die Alte werde nun bald "entenkindisch." Die anderen Enten lachten darüber, daß es nur so schnatterte. "Entenkindisch!" flüsterten sie, "das ist zu witzig!" Und sie wiederholten nun auch den ersten Witz: "Portulak!" Das war zu amüsant, meinten sie, dann legten sie sich nieder.
Als sie eine Weile gelegen hatte, wurde plötzlich etwas zum Schnabulieren in den Entenhof geworfen; es kam mit einem solchen Klatsch herab, daß die ganze Besatzung aus dem Schlaf auffuhr und mit den Flügeln schlug; auch die Portugiesin erwachte, wälzte sich auf die andere Seite und quetschte dabei den kleinen Singvogel sehr unsanft.
"Piep," sagte er. "Sie traten sehr hart auf, Madame!"
"Ja, warum liegen Sie mir auch im Weg!" rief sie. "Sie dürfen nicht so empfindlich sein! Ich habe auch Nerven, aber ich habe noch niemals Piep gesagt!" - "Seien Sie nicht böse!" sagte der kleine Vogel, " das Piep fuhr mir unwillkürlich aus dem Schnabel."
Die Portugiesin hörte nicht darauf, sondern führ schnell in das Fressen und hielt eine gute Mahlzeit. Als diese zu Ende war und sie sich wieder hinlegte, nahte sich ihr der kleine Singvogel und wollte liebenswürdig sein:
Tilleleleit! Von Herzen dein
will ich singen fein,
fliegen so weit, weit, weit!
"Jetzt will ich nach dem Essen ruhen!" sprach die Portugiesin. "Sie müssen hier auf die Sitten des Hauses achten. Jetzt will ich schlafen!"
Der kleine Singvogel war ganz verdutzt, denn er hatte es gut gemeint. Als die Madame später erwachte, stand er vor ihr mit einem Körnchen, das er gefunden hatte; er legte es ihr zu Fußen; da sie aber nicht gut geschlafen hatte, war sie natürlich sehr schlechter Laune.
"Geben Sie das einem Küken!" sagte sie; "Stehen Sie mir überhaupt hier nicht immer im Weg!"
"Warum zürnen Sie mir?" antwortete das Vöglein. "Was habe ich gemacht?"
"Gemacht?" fragte die Portugiesin, "dieser Ausdruck ist nicht gerade fein, darauf möchte ich Ihre Aufmerksamkeit lenken!"
"Gerstern war hier Sonnenschein," sagte der kleine Vogel, "heute ist hier trübe und dicke Luft."
"Sie wissen wohl wenig Bescheid mit der Zeitrechnung," entgegnete die Portugiesin, "der Tag ist noch nicht zu Ende; stehen Sie nicht so dumm da!"
"Aber Sie sehen mich gerade so an wie die bösen Augen, als ich hier in den Hof herabfiel."
"Unverschämter!" sagte die Portugiesin; "vergleichen Sie mich mit dem Kater, dem Raubtier? Kein falscher Blutstropfen ist in mir; ich habe mich Ihrer angenommen und werde Ihnen gute Manieren beibringen!"
Und sofort biß sie dem Singvogel den Kopf ab; tot lag er da.
"Was ist nun das wieder?" sagte sie, "das konnte er nicht vertragen! Ja, dann war er freilich auch nicht für diese Welt geschaffen. Ich bin ihm eine Mutter gewesen, das weiß ich, denn ein Herz habe ich."
Da steckte des Nachbars Hahn seinen Kopf in den Hof hinein und krähte mit Lokomotivkraft.
"Sie bringen mich um mit Ihrem Krähen!" rief sie. "Sie haben Schuld an allem; er hat den Kopf verloren, und ich bin nahe daran, ihn auch zu verlieren."
"Da wo er hinfiel, liegt nicht viel!," sagte der Hahn.
"Sprechen Sie mit Achtung von ihm!" erwiderte die Portugiesin, "er hatte Ton, Gesang und hohe Bildung: Liebevoll war er und weich, und das schickt sich sowohl für die Tiere wie für die sogenannten Menschen."
Und alle Enten drängten sich um den kleinen toten Singvogel. Die Enten haben starke Passionen, mögen sie nun Neid oder Mitleid fühlen, und da hier nun nichts zu beneiden war, so kam das Mitleid zum Vorschein, selbst bei den beiden Chinesinnen.
"Einen solchen Singvogel werden wir nimmer wieder bekommen; er war fast ein Chinese," flüsterte sie, und dabei weinten sie, daß es gluckste, und alle Hühner glucksten, aber die Enten gingen mit roten Augen umher.
"Herz haben wir!" sagten sie, "das kann uns niemand absprechen."
"Herz!" wiederholte die Portugiesin, "ja, das haben wir beinahe ebensoviel wie in Portugal!"
"Denken wir jetzt daran, etwas in den Magen zu bekommen!" sagte der Enterich, "das ist das Wichtigste! Wenn auch eins von den Spielwerken entzwei geht, wir haben genug dergleichen!"
EINE GESCHICHTE AUS DEN SANDDÜNEN ...
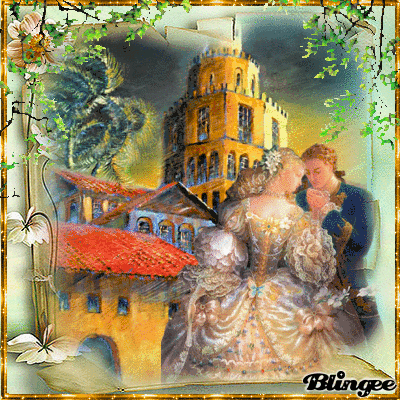
Es ist eine Geschichte aus den jütländischen Sanddünen, die aber nicht in Jütland anhebt, sondern weit weg von dieser nördlichen Halbinsel, im Süden, in Spanien beginnt; das Meer ist die Straße zwischen den Ländern; versetze dich in Gedanken dorthin, hin nach dem sonnigen Spanien! Dort ist es warm und wunderherrlich, dort wachsen die feuerroten Granatblüten zwischen dunklen Lorbeerbäumen; von den Bergen weht ein frischer, labender Wind herab über die Orangengärten, über die prächtigen maurischen Hallen mit ihren goldenen Kuppeln und farbigen Wänden; durch die Straßen ziehen Kinder in Prozessionen mit Lichtern und flatternden Fahnen, und über Ihnen, hoch und klar, erhebt sich der Himmel mit funkelnden Sternen; Gesang und Kastagnetten erklingen, Burschen und Mädchen schwingen sich im Tanz unter blühenden Akazien, während der Bettler auf dem behauenen Marmorstein sitzt, sich an der saftigen Wassermelone labt und das Leben halb träumend genießt; es ist wie ein herrlicher Traum das Ganze, und sich dem hinzugeben - ja, das taten so recht zwei junge Neuvermählte, und ihnen waren auch alle Güter der Erde gegeben: Gesundheit, froher Sinn, Reichtum und Ehre.
"Wir sind so glücklich, wie nur irgend jemand es sein kann!" sprachen sie aus vollster Herzensüberzeugung; doch noch eine Stufe des Glücks konnten sie erklimmen, wenn nämlich Gott ihnen ein Kind, einen Sohn, ihnen ähnlich an Körper und Seele, schenken wollte.
Das glückliche Kind würde mit Jubel begrüßt werden, die größte Sorgfalt und Liebe finden, all des Wohlseins und Reichtums teilhaftig werden, den eine einflußreiche Familie zu spenden vermag. Wie ein Fest verstrichen ihnen die Tage.
"Das Leben ist ein Gnadengeschenk der Liebe, eine fast unbegreiflich große Gabe!" sprach die junge Frau, "und die Fülle der Glückseligkeit soll im jenseitigen Leben noch wachsen, und zwar ewig und immer - ich fasse diesen Gedanken nicht!"
"Und der Gedanke ist in der Tat auch Übermut des Menschen!" versetzte der Mann. "Es ist im Grunde ein entsetzlicher Stolz, zu glauben, daß man ewig lebt - werden soll wie Gott! Waren es doch auch die Worte der Schlange, und sie war der Lüge Urheberin."
"Du zweifelst doch nicht an einem Leben im Jenseits?" fragte die junge Frau, und es war, als gleite zum ersten Mal ein Schatten durch ihr sonniges Gedankenreich.
"Der Glaube verheißt es, die Priester sagen es!" sprach der junge Mann, "aber gerade in all meinem Glück fühle und erkenne ich, daß es ein Stolz, ein übermütiger Gedanke wäre, ein anderes Leben nach diesem, eine fortgesetzte Glückseligkeit zu verlangen - ist uns nicht in dem Erdendasein so viel gegeben, daß wir wohl zufrieden sein können und sein müssen?"
"Ja, uns ward es gegeben!" sagte die junge Frau, "allein wie vielen Tausenden ward nicht dieses Leben zu einer schweren Prüfung; wie viele sind nicht in diese Welt hineingeworfen worden, gleichsam zur Armut nur, zur Schande, zur Krankheit und zum Unglück; nein, wenn es kein Leben nach diesem gäbe, dann wäre alles auf Erden zu ungleich verteilt, dann wäre Gott nicht die Gerechtigkeit!"
"Der Bettler dort unten hat Freuden, die er ebenso sehr schätzt, die ihn ebenso groß dünken, wie der König sie in seinem reichen Schloß hat!" versetzte der Mann, "und glaubst du nicht, daß das Arbeitstier, das geprügelt wird, hungert und sich zu Tode schleppt, seine schweren Lebenstage empfindet! Das Tier könnte auch ein jenseitiges ewiges Leben fordern, es ein Unrecht heißen, daß es nicht in ein höheres Reich der Schöpfung gestellt wurde!"
"In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, hat Christus gesagt"; antwortete die junge Frau, "das Himmelreich ist das Unendliche, wie Gottes Liebe unendlich ist - auch das Tier ist ein Geschöpf Gottes, und ich glaube fest daran, daß kein Leben verloren gehen wird, sondern all die Glückseligkeit genießen wird, die es empfangen kann und die ihm genügt."
"Mir aber genügt nun diese Welt!" rief der Mann und umschlang sein schönes, liebliches Weib, rauchte eine Zigarre auf dem offenen Altan, wo die kühle Luft erfüllt war mit dem Duft der Orangen und Nelken; Musik und Kastagnetten erklangen von der Straße herauf, die Sterne flimmerten von oben herab, und zwei Augen voller Liebe, die Augen seines Weibes, schauten ihn mit dem ewigen Leben der Liebe an.
"Eine solche Minute," sprach er, "ist es wohl wert, daß man geboren wird, empfindet und - verschwindet!" und er lächelte; die junge Frau hob die Hand mit mildem Vorwurf - und der Schatten auf ihrer Welt war wieder verschwunden, sie waren gar zu glücklich.
Und alles schien sich ihnen zu fügen, sie schritten voran in Ehre, in Wohlsein und Freude; ein Wechsel fand zwar statt, aber nur ein Ortswechsel, keiner im Genuß und in des Lebensfreude und Lust. Der junge Mann wurde von seinem König als Gesandter an den kaiserlichen Hof in Rußland geschickt, es war ein Ehrenamt, seine Geburt und seine Kenntnisse gaben ihm ein Recht zu diesem Posten; ein großes Vermögen besaß er, seine junge Frau hatte ihm ein nicht geringeres eingebracht, sie war die Tochter eines reichen, angesehenen Kaufmannes. Eines der größten, besten Schiffe dieses Kaufherrn sollte gerade in diesem Jahr nach Stockholm gehen, es wurde bestimmt, daß es die lieben Kinder, Tochter und Schwiegersohn, nach St. Petersburg führen solle, und an Bord ward alles prächtig eingerichtet, reiche Teppiche für die Füße, Seide und Luxus überall.
Ein altes Heldenlied heißt: "Des Königs von England Sohn"; der segelte auch an Bord eines prächtigen Schiffes, der Anker ward ausgelegt mit rotem Gold, jedes Tau mit Seide durchflochten - an dieses Schiff mußte man unwillkürlich denken, wenn man das aus Spanien sah, denn hier war dieselbe Pracht, und derselbe Abschiedsgedanke drängte sich einem auf, der Gedanke:
Gott lasse uns alle in Freuden
einst wieder zusammenfinden!
Und der Wind blies schön seewärts an der spanischen Küste, der Abschied war nur ein kurzer; in wenigen Wochen würden sie das Ziel ihrer Reise erreichen können; aber als sie auf die hohe See kamen, legte sich der Wind, das Meer ward blank und still, die Sterne des Himmels strahlten, es waren gleichsam Festabende, die in der reichen Kajüte verstrichen.
Endlich wünschte man doch, daß es ein wenig Luft und Fahrtwind geben möge, aber er blies nicht, und erhob sich ja einmal der Wind, da war es immer Gegenwind; so vergingen Wochen, ja volle zwei Monde, erst dann stellte sich der rechte Wind ein, er blies aus Südwest; das Schiff fuhr auf der hohen See zwischen Schottland und Jütland, und der Wind nahm zu, ganz wie in der alten Weise von "Des Königs von England Sohn."
Da gab es ein Wetter und Wolkenguß,
kein Land, keinen Schutz sie fanden,
und sie warfen ihr Ankergold -
doch der Wind blies westeinwärts auf Dänemark.
Das ist nun lange her. König Christian der Siebente saß damals auf dem dänischen Thron und war noch ein junger Mann. Vieles ist seit der Zeit geschehen, vieles hat gewechselt und sich verändert; See und Moorland haben sich in grünende Wiesen verwandelt, Heide ist Ackerland geworden, und im Schutz der Westjüten-Hütten wachsen Apfelbäume und Rosen, wenn man sie auch freilich suchen muß, denn sie ducken sich vor dem scharfen Westwind.
Man kann sich im westlichen Jütland so recht in die alte Zeit zurückversetzen, weiter zurück als in die Regierungszeit Christian des Siebten; wie damals, so erstreckt sich auch jetzt in Jütland die braune Heide meilenweit hin mit ihren Hünengräbern, ihren Luftspiegelungen, mit den sich kreuzenden holprigen und sandigen Wegen; westwärts, wo große Bäche in die Fjorde münden, breiten sich Wiesen und Moorland aus, umzäunt von hohen Sanddünen, die einer Alpenkette gleich sich mit ausgezackten Gipfeln gegen das Meer hin erheben, sie werden nur von hohen Lehmabhängen unterbrochen, von welchen die Fluten Jahr für Jahr Riesenbissen abbeißen, so daß die jähen Küstenufer, wie durch Erdbeben erschüttert, einstürzen. So sieht es dort noch am heutigen Tage aus, so war es auch vor vielen Jahren, damals, als die zwei Glücklichen draußen auf dem reichen Schiff segelten.
Es war in dem letzten Tagen des Septembers, es war Sonntag und sonniges Wetter, das Läuten der Kirchenglocken am Fjord von Nissum rollte dahin in der Luft wie eine tönende Kette; die Gotteshäuser dort sind fast nur aus behauenen Feldsteinen erbaut, jedes ist ein Stückchen Felsen; die Nordsee könnte über sie dahinbrausen, und sie würden stehenbleiben; an den meisten fehlte der Turm und die Glocken hingen dann im Freien zwischen zwei Balken. Der Gottesdienst war zu Ende; die Gemeinde trat aus der Kirche auf den Friedhof, wo damals wie heutzutage weder Baum noch Busch zu erblicken war, nicht eine Blume war dort gepflanzt, nicht ein Kreuz auf die Gräber hingelegt; knorrige Hügel zeigen an, wo die Toten eingesenkt sind, schneidendes Gras, vom Winde gepeitscht, überwuchert den ganzen Kirchhof; irgendein einzelnes Grab hat vielleicht ein Grabmal aufzuweisen, das heißt, einen, fast verwitterten Holzblock, zugehauen in der Form eines Sarges; der Holzblock ist dann aus dem Walde der jütländischen Westgegend geholt, und der Wald dieser Gegend ist das wilde Meer, dort wachsen für den Küstenbewohner die behauenen Balken, Bohlen und Hölzer, welche die Brandung ihm ans Land führt. Der Wind und die Seenebel verwittern bald das Holz; ein solcher Holzblock war hier auf ein Kindergrab von lieben Händen hingetragen, und eine der Frauen, die aus der Kirche kamen, schritt auf das Grab zu; sie blieb vor dem Grab stehen und ließ ihre Blicke auf dem verwitterten Grabmal ruhen; wenige Augenblicke später trat ihr Mann zu ihr heran; beide sprachen kein Wort, er ergriff aber ihre Hand, und sie wanderten vom Grab auf die braune Heide hinaus, über Moor und Wiese dahin auf die Sanddünen zu: lange Zeit gingen Sie schweigend nebeneinander her.
"Das war heute eine gute Predigt," sprach der Mann, "hätte man nicht den lieben Gott, man hätte gar nichts!"
"Ja," versetzte die Frau, "er schenkt Freude und Betrübnis, und er hat das Recht dazu! Morgen wäre unser kleiner Knabe fünf Jahre alt geworden, hätten wir ihn behalten dürfen."
Es Kommt nichts dabei heraus, daß du trauerst, Frauchen," sagte der Mann. "Ist der Knabe doch gut davongekommen! Er ist ja dort, wo wir durch unser Gebet hinkommen wollen!"
Und darauf sprachen sie nichts weiter und gingen auf ihr Haus zwischen den Sanddünen zu; plötzlich erhob sich von einer dieser Dünen, an der das Strandgras den Sand nicht mit seinen langen Wurzelgeflecht festhielt, gleichsam eine dicke Rauchwolke, ein Windstoß bohre sich in die Dünen und wirbelte die feinen Sandteilchen hoch auf, noch ein Windstoß, und all die mit Fischen zum Trocknen behangenen, ausgespannten Schnüre schlugen mit Macht gegen die Wand des Häuschens, und alles war wieder still; die Sonne strahle warm herab.
Mann und Frau traten ins Haus; bald hatten sie sich ihrer Sonntagskleider entledigt, und wieder hinaustretend, eilten sie nun über die Dünen, die wie ungeheure Wogen aus Sand, plötzlich in ihrer Bewegung aufgehalten, dastanden; der Sandhafer und das Dünengras mit ihren blaugrünen Halmen gaben dem weißen Sand etwas Farbe. Ein paar Nachbarn kamen noch hinzu, man war einander behilflich, die Boote höher auf den Sand hinaufzuziehen; der Wind blies jetzt gewaltiger als zuvor, er war scharf und kalt, und als die zurück über die Dünen eilten, wehten ihnen Sand und scharfe Steinchen ins Gesicht, die Wellen türmten sich mit weißen Schaumkronen hoch auf, und der Wind schnitt den Kamm ab, daß der Schaum weit umherspritzte.
Der Abend kam heran, in der Luft tönte ein heranschwellendes Sausen, heulend, klagend, wie eine Heerschar verzweifelter Geister, es übertönte das dröhnende Rollen des Meeres, obwohl das Fischerhaus ganz in seiner Nähe lag. Der Sand prasselte an die Fensterscheiben, und zuweilen kam ein Windstoß so gewaltig heran, daß das Häuschen gleichsam in seinem Grund erbebte. Es war finster, doch gegen Mitternacht würde der Mond aufgehen.
Die Luft klärte sich auf, aber der Sturm raste in seiner ganzen gewaltigen Macht über das tief aufgewühlte Meer dahin. Die Fischersleute hatten schon längst ihr Lager aufgesucht, allein bei dem Unwetter war nicht daran zu denken, ein Auge zu schließen; da klopfte es an das Fenster, die Tür tat sich auf, und jemand sagte:
"Ein großes Schiff liegt fest auf dem äußersten Riff!" Mit einem Sprung waren die Fischersleute vom Lager auf und in den Kleidern.
Der Mond war aufgegangen, es wäre hell genug gewesen, um zu sehen, hätte man die Augen wegen der Wirbel des Flugsandes auftun können; es war ein Wind, daß man sich gleichsam auf denselben legen konnte; nur mit großer Mühe, zwischen den Windstößen dahinkriechend, gelangte man über die Dünen hinweg, und hier nun flog wie Schwanendaunen in der Luft der Salzige Gischt und Schaum vom Meere hoch empor, das sich wie ein rollender, kochender Wasserfall gegen die Küste wälzte. Ein geübtes Auge gehörte dazu, um das Fahrzeug draußen zu erblicken; es war ein prächtiger Zweimaster; gerade jetzt hoben die Fluten es über das Riff; drei, vier Kabellängen außerhalb der gewöhnlichen Brandung, es trieb gegen das Land an, lief auf das zweite Riff auf und saß fest. Hilfe zu bringen war eine Unmöglichkeit, die See war zu gewaltig, sie schlug gegen das Schiff und rollte immerfort über dasselbe hinweg. Man glaubt die Notschreie, die Angstrufe der dem Tode Geweihten zu vernehmen, man gewahrte die emsige, hilflose Tätigkeit an Bord. Jetzt rollte eine Woge heran, die wie ein zermalmendes Felsstück auf den Bugspriet stürzte, der wurde dem Schiff entrissen. Das Heck hob sich hoch über die Flut. Zwei Menschen sprangen zu gleicher Zeit, einander umschlingend, in die Fluten - ein Augenblick - und eine der größten Wellen, die gegen die Dünen rollten, warf einen Körper auf die Küste - es war ein Weib, eine Leiche, wie die Schiffer dachten; ein paar von den Frauen erfaßten sie, glaubten noch Leben in ihr zu spüren, man brachte die Fremde über die Dünen hinweg in die Fischerhütte. Wie schön und fein war sie, gewiß eine vornehme Dame. Sie legten sie in das ärmliche Bett, aber es war schön warm.
Das Leben kehrte ihr wieder, aber im Fieber; sie wußte nichts von dem, was geschehen war oder wo sie sich befand, und so war es ja gerade gut, denn alles, was ihr lieb und wert war, lag auf dem Meeresgrund; es erging Schiff und Menschen draußen, wie es das Heldenlied von "Des Königs von England Sohn" singt.
Es war ein Grauen zu sehen -
in Stücke klein das Schiff verwehen.
Wrackstücke und Späne trieben an Land, sie war die einzig Überlebende von allen an Bord. Noch fegte der Wind heulend über die Küste. Einige kurze Augenblicke schien sie zu ruhen, aber bald traten Schmerzein ein, und ein Angstschrei tönte von ihren Lippen, sie schlug ihre wunderbar schönen Augen auf, sprach einige Worte, aber niemand hier verstand sie.
Und sieh, als Lohn für Kampf und Schmerzen hielt sie in ihren Armen ein neugeborenes Kind, ein Kind, das auf einem Prachtlager, umwallt von seidenen Vorhängen in dem reichen Hause hätte ruhen sollen! Es hätte mit Jubel begrüßt werden sollen zu einem Leben reich an allen Gütern der Erde, und jetzt hatte es Gott in diesem armen Winkel geboren werden lassen!
Die Fischersfrau legte das Kind an die Brust der Mutter, aber es lag an einem Herzen, daß nicht mehr schlug, sie war tot. Das Kind, dessen Amme Reichtum und Glück hätte sein sollen, war in die Welt hineingeworfen, in die Sanddünen von der See hineingespült worden, um das Los und die schweren Tage der Armen zu kosten. Und wieder kommt uns hier in den Sinn das alte Lied von dem englischen Königssohn, in welchem auch der damals durch Ritter und Knappen üblichen Ausplünderung der vom Schiffbruch Erretteten gedacht wird.
Eine Strecke südlich von dem Nissumfjord war das Schiff gestandet. Die harten, unmenschlichen Zeiten, in denen die Bewohner der Westküste Jütlands den Schiffbrüchigen Böses zufügten, wie man erzählt, waren damals schon längst vorüber; Liebe und Mitgefühl, Aufopferung für die Schiffbrüchigen waren dort zu finden, wie sie in unserer Zeit zu finden sind und in edlen Zügen hervorleuchten; die sterbende Mutter und das elende Kind hätten überall, wohin der Wind sie auch geweht hätte, Sorgfalt und Pflege gefunden, aber nirgends inniger als bei der armen Fischersfrau, die noch gestern schweren Herzens an dem Grab gestanden hatte, welches ihr Kind barg, das heute fünf Jahre alt geworden wäre, wenn Gott ihm zu leben vergönnt hätte. Niemand wußte, wer das fremde tote Weib war oder wohl sein könnte. Die Wrackstücke des Schiffes sprachen kein Wort hiervon.
Nach Spanien, in das reiche Haus, kam niemals ein Brief oder eine Botschaft über das Geschick der Tochter und des Schwiegersohnes, sie waren nicht an dem Ort ihrer Bestimmung angelangt, heftige Stürme hatten während der letztverflossenen Wochen gerast; man harrte Monate. "Total gescheitert; alle untergegangen!" das erfuhr man endlich. Aber in den Dünen bei Huusby, in dem Fischerhause, hatte die reiche spanische Familien nun einen kleinen Sprößling.
Wo Gott zweien Nahrung beschert, findet der dritte wohl auch eine Mahrzeit, und in der Tiefe des Meeres gibt es schon ein weiteres Gericht Fische für einen hungrigen Magen. Jürgen nannte man den Knaben.
"Er ist gewiß ein Judenkind," hieß es, "er sieht so schwarz aus!" Es könnte auch ein Italiener oder Spanier sein, sagte der Pfarrer. Der Fischersfrau schien es aber, als seien diese drei Nationen ganz gleich, und sie tröstete sich mit dem Gedanken, daß das Kind als Christ getauft war.
Der Knabe gedieh, das adelige Blut blieb warm und kräftigte sich bei der ärmlichen Kost, er wuchs heran in dem geringen Haus; der dänische Dialekt, wie ihn der Westjüte spricht, wurde seine Sprache. Der Granatkern aus dem Boden Spaniens wurde eine Strandhaferpflanze auf der Küste von Westjütland. So kann es einem Menschen ergehen! An diese Heimat klammerte er sich mit den erstjährigen Wurzeln seines Lebens. Hunger und Kälte, Drangsal und Not armer Leute sollte er kennenlernen, aber auch der Armen Freude genießen.
Das Kindesalter hat für jeden seine Lichthöhen, die später durchs ganze Leben hindurchsrahlen. Wie hatte er doch vollauf Freude am Spiel; die ganze Küste, meilenweit, lag voll Spielzeug, sie war ein Mosaik aus Steinen, rot wie Korallen, gelb wie Bernstein und weiß und gerundet, als seien es Vogeleier, in allen Farben und alle geschliffen und geglättet vom Meer. Selbst das gebleichte Fischskelett, die im Winde getrockneten Wasserpflanzen des Seetangs, schimmerndweiß, lang und schmal, wie leinene Bänder, flatternd zwischen den Steinen, waren wie alles zum Spielen und zur Freude für das Auge und den Gedanken da; und der Knabe war ein aufgeweckter Kopf, viele und große Fähigkeiten wohnten in ihm. Wie leicht behielt er im Gedächtnis die Geschickten und Lieder, die er hörte, und wie fingerfertig war er! Aus Steinen und Muschelschalen setzte er ganze Schiffe und Bilder zusammen, mit denen man die Stube ausputzen konnte; er könne seine Gedanken merkwürdig in einen Stecken schnitzen, sagte die Pflegemutter, und der Knabe sei doch noch sehr jung und klein! Herrlich klang seine Stimme, jede Melodie floß sogleich von seiner Zunge. Viele Saiten waren in der Brust gespannt, die hätten in die Welt hinausklingen können, wenn er anderswohin gestellt worden wäre als in das Fischerhaus an der Nordsee.
Eines Tages strandete wieder ein Schiff hier; unter anderem schwamm eine Kiste mit seltenen Blumenzwiebeln ans Land; einige wurden in den Kochtopf getan, man glaubte, sie seien genießbar, andere lagen und vermoderten im Sande, sie gelangten nicht zu ihrer Bestimmung, die Farbenpracht zu entfalten, die ihnen innewohnte - würde es wohl Jürgen besser ergehen? Die Blumenzwiebeln hatten bald ihre Rolle ausgespielt, er hatte noch die Jahre seiner Lehrzeit vor sich.
Weder ihm noch irgend einem andern fiel es auf, wie einsam und einförmig der Tag auf ihrer Scholle verstrich, gab es doch vollauf zu tun und zu sehen. Das Meer selber war ein großes Lehrbuch, jeden Tag bot es ein neues Blatt dar. Meeresstille, Brandung, Kühle und Sturm, Strandungen waren die Glanzpunkte; der Kirchenbesuch war ein Festbesuch, doch von den Festbesuchen zeichnete sich im Fischerhaus selber namentlich einer aus, der besonders willkommen war, er wiederholte sich zweimal jährlich, es war der Besuch des Bruders von Jürgens Pflegemutter, des Aalbauern aus Fjaltring, oben in der Nähe des Bowberges; er kam in einem rotangestrichenen Wagen, gefüllt mit Aalen, der Wagen war verschlossen und verdeckt wie eine Kiste und bemalt mit blauen und weißen Tulpen; er wurde von zwei fahlgelben Ochsen gezogen, und Jürgen durfte diese Ochsen lenken.
Der Aalbauer war ein guter Kopf, ein fröhlicher Gast, er führte ein Lägel voll Branntwein mit sich. Jedermann bekam aus demselben ein Schnapsglas oder eine Tasse voll, wenn es an Schnapsgläsern fehlte, selbst Jürgen bekam einen großen Fingerhut voll, damit er den fetten Aal verdauen könne, sagte der Aalbauer und erzählte dann immer wieder dieselbe Geschichte, und wenn man ihm darob zulächelte, erzählte er sie denselben Zuhörern sofort noch einmal. Da Jürgen während seiner ganzen Kindheit und selbst später aus dieser Geschichte des Aalbauern mehrere Redensarten gebrauchte und überhaupt die Geschichte vielfach zur Anwendung brachte, so müssen wir sie wohl einmal mitanhören.
"In die Bucht gingen die Aale, und die Aalmutter sagte zu ihren Töchtern, die sie um Erlaubnis baten, die Bucht eine kleine Strecke hinaufwandern zu dürfen: "Geht nicht zu weit, der häßliche Aalstecher könnte leicht kommen und euch alle wegschnappen!" Aber sie gingen zu weit hinaus, und von acht Töchtern kehrten nur drei zur Aalmutter wieder zurück, und diese jammerten: "Wir waren bloß ein wenig vor die Tür gegangen, als gleich der häßliche Aalstecher kam und fünf unserer Geschwister zu Tode stach." - "Die kommen schon wieder!" sprach die Aalmutter.- "Nein," sagten die Töchter, "Denn er verspeiste sie." - "Sie kommen schon wieder!" sagte die Aalmutter. - "Aber er trank Branntwein darauf!" versetzten die Töchter. - "Au, au" dann kehren sie nimmer wieder!" heulte die Aalmutter, "der Branntwein begräbt die Aale." - "Und deshalb muß man immer ein Glas Branntwein zu dem Gericht trinken!" sagte der Aalbauer.
Und diese Geschichte wurde der Flittergoldfaden, der humoristische Faden im Leben Jürgens. Auch er wollte gern ein wenig vor die Tür gehen und ein wenig die Bucht hinauf, das heißt, mit einem Schiff in die Welt hinaus, und die Mutter sprach wie der Aalbauer, "es gibt so viele schlechte Menschen, Aalstecher!" Doch ein wenig über die Sanddünen hinaus, nur ein wenig in die Heide hinein mußte er, und das gelang ihm denn auch. Vier fröhliche Tage, die lichtesten seiner Kindheit, rollten herauf, die ganze Herrlichkeit und Schönheit Jütlands, alle Freuden, aller Sonnenschein der Heimat lag in ihnen; er sollte zu einem Festgelage - ein Leichenschmaus war es allerdings.
Ein wohlhabender Verwandter der Fischerfamilie war gestorben; das Gehöft lag tief im Lande, ostwärts, einen Strich gegen Norden, wie es hieß. Vater und Mutter mußten dorthin, Jürgen sollte mit. Von den Dünen kamen sie über Heide und Moorland an die grüne Wiese, wo der Skjernfluß sich seine Bahn bricht, der Fluß mit den vielen Aalen, wo Aalmutter mit ihren Töchtern wohnte, die von schlechten Menschen gefangen und zerschnitten wurden: doch besser hatten die Menschen gar oft gegen ihre Mitmenschen nicht gehandelt; auch Herr Ritter Bugge wurde von bösen Menschen ermordet, und wie gut man ihn auch nannte, wollte er doch den Baumeister totschlagen, wie es in einer alten Legende heißt, der ihm sein Schloß mit den dicken Mauern und Türmen errichtet hatte, wo Jürgen mit seinen Pflegeeltern stand, wo der Fluß in die Bucht fällt. Die Auffahrt auf den Schloßwall war noch übriggeblieben, rote, zerbröckelte Mauerstücke lagen ringsumher. Hier hatte Ritter Bugge, als der Baumeister ihn verlassen hatte, zu seinem Knappen gesagt: "Geh ihm nach und sage: Meister, der Turm wackelt! Wendet er sich um, so schlägst du ihn tot und nimmst ihm das Geld ab, das ich ihm gab, wendet er sich aber nicht um, so läßt du ihn in Frieden ziehen!" Der Knappe gehorchte, und der Baumeister antwortete und sah sich nicht um: "Der Turm wackelt beileibe nicht, aber dereinst wird aus dem Westen ein Mann in einem blauen Mantel kommen, der wird ihn zum Wackeln bringen!" Und so geschah es hundert Jahre später, die Nordsee brach ein, und der Turm brach zusammen, doch der damalige Besitzer des Schlosses, Prebjörn Gyldenstjerne, baute höher hinauf, wo die Wiese aufhört, ein neues Schloß und das steht heute noch, es ist Nörre Vosborg.
An diesem vorüber ging die Reise Jürgens und seiner Pflegeeltern; während der langen Winterabende hatte man ihm davon erzählt, jetzt sah er den Herrenhof mit seinen doppelten Gräben, mit Bäumen und Gebüsch; der Wall, mit Farnkräutern überwuchert, erhob sich innerhalb des Grabens; aber das schönste waren die hohen Linden, die bis an die Dachfenster reichten und die Luft mit süßem Duft erfüllten. In einer Ecke des Garten nach Nordwesten zu stand ein großer Busch mit Blüten, gleich Winterschnee im Sommergrün; es war ein Holunderbusch, der erste, welchen Jürgen so hatte blühen sehen; den und die Linden vergaß er nie, die Kinderseele barg diese Erinnerungen voll Duft und Herrlichkeit für den alten Mann.
Von Nörre Vosborg an, wo der Holunder blühte, ging es bequemer weiter, denn sie trafen andere Gäste, die auch zu der Leichenfeier wollten und die zu Wagen waren; zwar mußten die drei hinten im Wagen auf einer kleinen Kiste sitzen, aber es war doch besser, als zu gehen, meinten sie. Die Reise ging nun zu Wagen über die holperige Heide dahin; die Ochsen, die den Wagen zogen, blieben dann und wann stehen, wo ein frischer Rasenfleck zwischen dem Heidekraut zum Vorschein kam, die Sonne schien warm, und wunderlich war es zu sehen, wie weit in der Ferne gleichsam ein Rauch wogte, und dieser Rauch war doch klarer als die Luft, er war durchsichtig, es war, als rollten und tanzten die Lichtstrahlen über die Heide dahin.
"Das ist der Lokemann, der seine Schafherde treibt," hieß es, und das war genug gesagt, um die Phantasie Jürgens zu wecken, ihm schien es, als führen sie nun in das Land der Märchen hinein und waren doch in der Wirklichkeit. Wie war es hier still! Weit und groß dehnte sich die Heide aus, aber gleich einem köstlichen Teppich; das Heidekraut blühte, die zypressengrünen Wacholderbüsche und die frischen Eichenschößlinge ragten gleich Buketts in der Heide hervor; wie einladend, um sich hier zu tummeln, wären nur nicht die vielen giftigen Nattern dagewesen, von denen sprach man und von den vielen Wölfen, die es hier gegeben hatte, weshalb auch der Kreis noch Wolfsborg-Kreis hieß. Der alte Mann, der die Ochsen lenkte, erzählte, wie zu Lebzeiten seines Vaters die Pferde hier oft einen harten Kampf gegen die jetzt ausgerotteten wilden Tiere hatten bestehen müssen und daß er eines Morgens, als er hierher kam, um die Pferde zu holen, eines von ihnen gefunden hatte, das mit beiden Vorderhufen auf einem Wolf stand, den es getötet hatte, wie aber auch das Fleisch von den Beinen des Pferdes ganz heruntergebissen gewesen war.
Zu schnell ging der Weg über die Heide und den tiefen Sand. Sie hielten vor dem Trauerhaus, woselbst es vollauf Gäste gab, drinnen und draußen; Wagen reihte sich an Wagen, Pferde und Ochsen grasten auf der mageren Weide; große Sanddünen, wie zu Hause an der Nordsee, erhoben sich hinter dem Gehöft und erstreckten sich weit und breit. Wie waren die hier heraufgekommen, drei Meilen ins Land hinein und ebenso hoch und groß wie die an der Meeresküste? Der Wind hatte sie gehoben und getragen, sie hatten auch ihre Geschichte.
Psalmen wurden gesungen, geweint wurde auch von einigen alten Leuten, sonst war alles fröhlich und vergnügt, wie es Jürgen schien, Essen und Trinken gab es in Hülle und Fülle, die herrlichsten fetten Aale, und auf diese muß man Branntwein gießen, "das fesselt den Aal," hatte der Aalbauer gesagt, und die Worte wurden freilich hier zur Tat.
Jürgen ging hier ein und aus; am dritten Tage fühlte er sich wie zu Hause, wie in dem Fischerhaus an den Sanddünen, wo er seine früheren Tage alle verlebt hatte. Hier auf der Heide war freilich ein ganz anderer Reichtum, hier wucherten Blumen und Preiselbeeren und Heidelbeeren, so groß und so süß und in solchen Mengen, daß sie beim Auftreten zerquetscht wurden, so daß das Heidekraut von dem roten Saft troff.
Hier ein Hünengrab, dort ein zweites; Rauchsäulen hoben sich in die stille Luft, es sei der Heidebrand, hieß es, der leuchtete schön am späten Abend. Jetzt kam der vierte Tag heran, und mit dem ging der Leichenschmaus zu Ende - nun ging es wieder von den Landdünen in die Stranddünen.
"Unsere sind doch die richtigen!" sagte der alte Fischer, Jürgens Pflegevater, "Diese hier haben keine Macht."
Und man sprach davon, wie die Sanddünen so ins Land hineingekommen waren, und das war alles sehr begreiflich. An der Küste war eine Leiche aufgefunden worden, die Bauern hatten sie auf dem Kirchhof begraben,da begann der Sandsturm, das Meer brach gewaltsam ein; ein kluger Mann im Kirchspiel riet, das Grab zu öffnen und nachzusehen, ob nicht der Begrabene da liege und an seinem Daumen lutsche, denn dann wäre es ein Meermann, den sie begraben hätten, und das Meer würde nicht ruhen, bis es ihn wieder geholt habe; das Grab wurde geöffnet - und richtig, er lag da und lutschte an dem Daumen, und nun legten sie ihn auf einen Karren, spannten zwei Ochsen vor denselben, und wie von einer Natter gebissen jagten sie nun dahin mit dem Meermann über Heide und Moorland in das Meer hinaus, da hielt der Flugsand inne, aber die Dünen liegen noch da. Dies alles hörte und behielt Jürgen im Gedächtnis aus den glücklichsten Tagen seiner Kindheit, den Tagen des Leichenschmauses.
Wie herrlich war das, hinauszukommen in fremde Gegenden und fremde Menschen zu sehen, und er sollte noch weiter kommen. Er war keine vierzehn Jahre als, noch ein Kind; er ging auf ein Schiff, kam hinaus, um zu erfahren, was die Welt gibt: böses Wetter, starken Seegag, bösen Sinn, harte Menschen lernte er kennen, er wurde Schiffsjunge! Schlechte Kost, kalte Nächte, Prügel und Faustschläge gab es; da spürte er etwas in seinem hochadeligen spanischen Blut, das gleichsam aufwallte und mit bitteren Worten ihm die Lippen schäumen machte - aber es war doch wohl das klügste, sie wieder zu verschlucken, und das war ein Gefühl, wie es dem Aal zumute sein muß, wenn er gehäutet, zerschnitten und in die Bratpfanne gelegt, wird.
"Ich komme wieder!" sprach es in seinem Innern. Er sah die spanische Küste, das Vaterland seiner Eltern, die Stadt selbst, wo sie in Wohlstand und Glück gelegt hatten, sah er, aber er wußte nicht von Heimat und Familie, seine Familie wußte noch viel weniger von ihm.
Der arme Schiffsjunge durfte auch nicht an Land gehen - doch am letzten Tag, an dem das Schiff hier im Hafen lag, kam er ans Land; es sollten verschiedene Einkäufe gemacht werden, und er sollte sie an Bord tragen.
Da stand Jürgen in schlechten Kleidern, die sahen aus, als seien sie im Graben gewaschen und im Schornstein getrocknet worden; zum ersten Mal sah er, der Dünenbewohner, eine große Stadt. Wie waren doch die Häuser hoch, die Straßen ganz mit Menschen überfüllt, einige drängten hier-, andere dorthin, es war wie ein ganzer Mahlstrom von Städtern und Bauern, von Mönchen und Soldaten, ein Schreien und Rufen, ein Klingeln von Esel- und Mauleselglöckchen, die Kirchenglocken läuteten sogar dazwischen! Sang und Klang, Hämmern und Klopfen durcheinander; jeder Berufsstand hatte seine Werkstatt im Hausflur oder auf dem Bürgersteig, und dazu brannte die Sonne so heiß, die Luft war so schwül, es war, als befände man sich in einem Backofen voll Mistkäfern, Maikäfern, Bienen und Fliegen, es summte und brummte; Jürgen wußte weder wo er ging, noch wo er stand. Da erblickte er aber gerade vor sich das mächtige Portal des Doms, die Lichter strahlten heraus aus den dunklen Wölbungen, und ein Duft von Weihrauch strömte ihm entgegen. Selbst der ärmste Bettler in Lumpen wagte sich die Treppe hinan in den Tempel. Der Matrose, dem Jürgen mitgegeben war, nahm den Weg durch die Kirche, und Jürgen stand im Heiligtum. Bunte Bilder strahlen auf goldenem Grund; die Gottesmutter mit dem Jesuskind stand auf dem Altar, umgeben von Lichtern und Blumen, Priester in festlichen Gewändern sangen; und schön geschmückte Chorknaben schwenkten die silbernen Räuchergefäße, welche Herrlichkeit, welche Pracht sah er hier, es durchströmte seine Seele, es überwältigte ihn; die Kirche und der Glaube seiner Eltern umfingen ihn und schlugen einen Akkord in seiner Seele an, so daß ihm Tränen in die Augen traten.
Von der Kirche ging es auf den Marktplatz, hier bekam er eine Menge Eßwaren zu tragen; der Weg bis zum Hafen war nicht kurz, müde und überwältigt von den wechselnden Eindrücken ruhte er einige Augenblicke aus vor einem prächtigen Haus mit marmornen Säulen, Statuen und breiten Treppenaufgängen; hier lehnte er seine Last an die Mauer, da trat ein betreßter Türsteher hervor, erhob seinen silberbeschlagenen Stock gegen ihn und jagte ihn fort, ihn - den Enkel des Hauses; aber das wußte niemand dort, er selber am allerwenigsten. Und nachher ging es wieder an Bord; Knuffe und harte Worte, wenig Schlaf und viel Arbeit - so hatte er denn auch das versucht! Und es soll gar gut sein, in der Jugend Böses zu leiden, sagt man - ja, wenn das Alter dann Gutes bringt.
Seine Verdingzeit auf dem Schiff war abgelaufen, das Fahrzeug lag wieder bei Ringkjöbing in Jütland, er kam an Land und nach Hause in die Sanddünen bei Huusby, allein die Pflegemutter war gestorben, während er auf der Reise gewesen war.
Ein strenger Winter folgte dem Sommer, Schneestürme jagten über Meer und Land dahin, man hatte Mühe, irgendwohin zu gelangen. Wie unterschiedlich war doch alles in dieser Welt verteilt! Hier heftige Kälte und Schneestürme, während im spanischen Land brennende Sonnenglut und starke Hitze herrschten; und doch, wenn es hier in der Heimat einen recht frostklaren Tag gab und Jürgen die Schwäne in Scharen über das Meer landeinwärts nach Vosborg hinausziehen sah, schien es ihm doch, als wenn man hier am leichtesten atme, und auch hier war herrlicher Sommer! In Gedanken sah er dann die Heide blühen und wuchern mit reifen, saftigen Beeren, sah den Holunder und die Linden bei Vosborg in Blüte stehen; dorthin mußte er doch noch einmal.
Der Frühling kam heran, die Fischerei begann, Jürgen war dabei ein tüchtiger Gehilfe; er war gewachsen im verflossenen Jahr und war flink bei der Arbeit, er war voll Leben, er konnte schwimmen, Wasser treten, sich wenden und tummeln draußen in den Fluten, oft warnte man ihn, sich vor den Schwärmen der Makrelen zu hüten; die packen den besten Schwimmer, ziehen ihn hinab, fressen ihn auf, und fort ist er; aber das wurde nicht Jürgens Los.
Beim Nachbarn in der Düne war ein Knabe namens Martin, mit dem Jürgen sich gut vertrug; beide nahmen auf ein und demselben Schiff nach Norwegen Dienst, gingen auch zusammen nach Holland, und sie hatten nie Zank miteinander, aber Zank kann es einmal leicht geben, und ist man von Natur aus heftig, so zeigt man leicht etwas zu starke Gebärden, und das tat Jürgen einmal bei einer Gelegenheit, als sie an Bord in Streit gerieten über gar nichts. Sie saßen gerade hinter der Kajüte und aßen aus einem tönernen Teller, welchen sie zwischen sich gestellt hatten; Jürgen hielt sein Taschenmesser in der Hand, zückte es gegen Martin und wurde dabei kreideweiß und blicke bös aus den Augen. Und Martin sagte nur: "Ach so, du bist einer von denen, die das Messer ziehen!"
Kaum war das gesagt, so fiel auch die Hand Jürgens herab, er erwiderte keine Silbe, aß weiter und ging darauf an seine Arbeit; als sie sich wieder ausruhten, trat er auf Martin zu und sagte:
"Schlage mich nur geradezu ins Gesicht! Ich habe es verdient! Ich habe so etwas wie einen Topf in mir, der überkocht!" - "Laß das man gut sein!" sprach Martin, und darauf waren sie fast doppelt so gute Freunde wie vorher, ja, als sie später nach Hause in die Dünen kamen und ihre Erlebnisse erzählten, wurde auch dieses erzählt, und Martin sagte, Jürgen sei zwar heftig, aber ein guter Kerl. Jung und gesund waren sie beide, wohlgewachsen und stark, aber Jürgen war der gewandtere.
In Norwegen ziehen die Bauersleute auf die Berge und führen das Vieh auf die Höhen, um es dort zu weiden; an der Westküste Jütlands hat man zwischen den Sanddünen Hütten errichtet, die aus Wrackteilen gezimmert und mit Heidetorf und Heidekraut gedeckt sind, Schlafstellen befinden sich rings an den Wänden, in ihnen schläft und wohnt das Fischervolk während der ersten Frühlingszeit. Jeder Fischer hat seine Gehilfin, seine Schaffnerin wie sie genannt wird, deren Tun besteht darin, den Köder an die Fischhaken zu stecken, die Fischer, wenn sie an Land kommen, mit Warmbier zu empfangen, ihnen Essen zu bereiten, wenn sie ermüdet und hungrig in die Hütte zurückkehren. Ferner schleppen die Schaffnerinnen die Fische vom Boote weg, schneiden sie auf, nehmen sie aus und haben viel zu tun.
Jürgen, sein Vater, ein paar andere Fischer und deren Schaffnerinnen hatten eine Hütte gemeinsam; Martin wohnte in der Nachbarhütte. Eins von den Mädchen, namens Else, hatte Jürgen von Kindheit an gekannt, sie sahen sich gern und hatten in vielen Dingen denselben Sinn, aber im Äußeren waren sie ganz und gar verschieden: er war braun, sie war weiß und hatte flachsgelbes Haar und Augen so blau wie das Meer bei Sonnenschein. Eines Tages, als sie zusammen gingen und Jürgen ihre Hand in der seinigen hielt, recht fest und innig hielt, sagte sie zu ihm:
"Jürgen, ich habe etwas auf dem Herzen! Laß mich Schaffnerin bei dir sein, denn du bist mir wie ein Bruder. Martin aber, der mich gemietet hat - er und ich sind Liebesleute, doch das brauchst du den andern nicht zu erzahlen."
Und es war Jürgen, als wenn der Flugsand sich unter ihm bewegte, er sagte kein Wort, nickte aber mit dem Kopf und das bedeutete so viel wie "ja"; mehr war nicht nötig, aber er fühlte mit einem Mal in seinem Herzen, daß er Martin nicht ausstehen konnte, und je länger er darüber nachsann, so hatte er früher nie an Else gedacht, desto klarer wurde es ihn, daß Martin ihm das einzige, das er lieb hatte, gestohlen hatte, und was war wirklich Else, jetzt war es ihm plötzlich klar.
Ist die See einigermaßen bewegt und kehren die Fischer in ihrem großen Boot zurück, dann sieh einmal, wie sie über die Riffe hinwegsetzen: einer der Leute steht aufrecht im Vorderteil des Bootes, die andern geben auf ihn acht, sitzen an den Rudern, die sie vor dem Riff so gebrauchen, als wollten sie nicht an Land, sondern in die See hinaus, so lange, bis endlich derjenige, der im Boot aufrecht steht, ihnen ein Zeichen gibt, daß jetzt die größere Woge herankommt, die das Boot über das Riff hebt; und das Boot wird nun auch hochgehoben, dermaßen gehoben, daß man vom Land aus seinen Kiel erblickt, im nächsten Augenblick ist das ganze Fahrzeug von den hohen Wellen gänzlich dem Auge entrückt, weder Boot noch Leute noch Mast sind zu sehen, man könnte glauben, das Meer habe sie alle verschlungen; wenige Augenblicke aber, und sie tauchen so empor, als krieche ein großes Seetier die Woge hinan, die Ruderstangen bewegen sich, als habe das Tier Beine; beim zweiten und dritten Riff geht es wie beim ersten, und nun springen die Fischer ins Wasser, ziehen das Boot ans Land, jeder Wellenschlag ist ihnen behilflich und bringt es einen guten Ruck vorwärts, bis sie es endlich aus dem Bereich der Brandung heraus haben.
Ein falscher Befehl vor dem Riff, nur ein Zaudern, und sie scheitern unfehlbar. "Dann wäre es mit mir vorbei und auch mit Martin!" Der Gedanken überkam Jürgen draußen auf See, wo gerade sein Pflegevater ernstlich erkrankt war. Das Fieber packte ihn; es war wenige Ruderschläge vor dem Riff, Jürgen sprang vom Sitz auf und stellte sich in das Vorderteil.
"Vater, laß mich vor!" sprach er, und sein Blick schweifte über Martin und über die Wogen dahin, aber als jede Ruderstange sich bei den kräftigen Zügen bewegte und er an die größte Woge herankam, da sah er das blasse Antlitz seines Vaters und - konnte nicht seiner bösen Eingebung gehorchen. Das Boot kam gut über das Riff und aufs Land; allein der böse Gedanke blieb ihm im Blut, und dieser ließ jede kleine Faser der Bitterkeit wieder hochkommen, die in seiner Erinnerung aus der Zeit der Kameradschaft zurückgeblieben war, doch zusammenzuspinnen vermöchte er die Faser nicht, und so unterließ er es, Martin hatte ihn beraubt, das fühlte er, und das genügte freilich, ihn zu hassen. Einige der Fischer bemerkten das wohl, Martin selber nicht, er war wie früher dienstwillig uni gesprächig, das letztere ein wenig zu sehr.
Jürgens Vater mußte das Bett hüten, und es wurde sein Totenbett. Die Woche darauf starb er - und nun bekam Jürgen als Erbe das Häuschen hinter den Dünen, zwar ein geringes Haus, aber immerhin etwas; so viel besaß Martin nicht.
"Jetzt wirst du doch keinen Seedienst mehr nehmen, Jürgen? Wirst wohl jetzt immer bei uns bleiben!" sprach einer der alten Fischer. Das war aber nicht nach Jürgens Sinn, er dachte gerade daran, sich wieder ein wenig in der Welt umzuschauen. Der Aalbauer aus Fjaltring hatte einen Ohm in Alt-Skagen, der war Fischer, aber zugleich ein wohlhabender Kaufmann, der Schiffe zur Seite hatte; der sollte ein recht lieber, alter Mann sein, in dessen Dienst zu treten, wäre wohl nicht übel. Alt-Skagen liegt im hohen Norden Jütlands, so weit von den Huusby-Dünen entfernt, wie man hierzulande nur kommen kann, und das war es gerade, was Jürgen am meisten gefiel, er wollte nicht einmal bis zur Hochzeit Elses und Martins hierbleiben, die sollte in einigen Wochen stattfinden.
Das sei unklug, die Gegend zu verlassen, meinte der alte Fischer, Jürgen habe ja jetzt ein Haus, Else würde noch geneigt sein, ihn lieber zu nehmen als Martin.
Jürgen antwortete hierauf so unzusammenhängend, daß es nicht leicht war, aus seiner Rede klug zu werden, aber der Alte führte Else zu ihm; sie sprach wenig, aber das sagte sie: "Du hast jetzt ein Haus, das muß bedacht werden." Und Jürgen bedachte vieles. Das Meer hat schwere Wogen, das Menschenherz hat noch schwerere, viele Gedanken, starke und schwache, gingen Jürgen wirr durch den Kopf und Sinn und er fragte Else:
"Wenn nun Martin ein Haus hätte, so wie ich, wen nähmst du dann am liebsten?" - "Aber Martin hat keins und wird auch keins kriegen!" - "Aber denken wir uns, daß er eins bekäme!" - "Ja, dann nähme ich wohl Martin, denn so ist mir jetzt ums Herz - aber davon kann man doch nicht leben!"
Und Jürgen dachte darüber nach, die ganze Nacht. Etwas gärte in seinem Innern, er selber vermochte nicht recht, es sich klar zu machen, aber er hatte einen Gedanken, der stärker war als seine Liebe zu Else; und so ging er zu Martin, und was er dort sagte und tat, war wohl überlegt, er überließ Martin unter den billigsten Bedingungen das Haus, er selber wollte wieder zur See gehen, weil es ihn so gelüstete. Und Else küßte ihn mitten auf den Mund, als sie das erfuhr, denn sie zog ja Martin allen vor.
In früher Morgenstunde wollte Jürgen fort. Am Abend vorher, es war schon spät, überkam ihn die Lust, Martin noch einmal zu besuchen, er ging, und zwischen den Dünen begegnete ihm der alte Fischer, dem seine Abreise nicht gefiel. Der Alte witzelte über Martin und meinte, das gehe nicht mit rechten Dingen zu, daß alle Mädchen den so gern hätten. Jürgen schlug diese Rede in den Wind, sagte dem Alten Lebewohl und ging auf das Haus zu, wo Martin wohnte, darinnen vernahm er lautes Gerede, Martin war nicht allein; Jürgen wurde deshalb schwankend in seinem Vorsatz, mit Else mochte er am wenigsten zusammentreffen, und wenn er es sich recht überlegte, mochte er auch nicht, daß Martin sich noch einmal bei ihm bedankte, und er kehrte wieder um.
Am folgenden Morgen, vor Tagesanbruch, schnürte er seinen Ranzen, nahm sein hölzernes Eßkästchen zur Hand und schritt zwischen den Sanddünen hindurch auf den Strandweg zu; der Weg war hier leichter zu gehen, als der schwere Sandweg und außerdem kürzer, denn er wollte erst nach Fjaltring bei Bowberg, wo der Aalbauer wohnte, dem er einen Besuch versprochen hatte.
Das Meer lag blank und blau vor ihm, Muschelschalen und Muscheln, das Spielzeug seiner Kindheit, knirschten ihm untern den Füßen. Während er so dahinschritt, begann plötzlich seine Nase zu bluten, ein geringfügiges Ereignis, das aber auch seine Bedeutung haben kann; ein Paar große Blutstropfen fielen auf seinen Ärmel, er wischte sie ab, stillte das Blut wieder, und es schien ihm, als habe der Blutverlust ihm ordentlich Kopf und Sinn erleichtert. Im Sande glühte hin und wieder der Meerkohl, er brach einen Stengel davon ab und steckte ihn auf seinen Hut; fröhlich und guter Dinge wollte er sein, ging es doch in die weite Welt, "ein wenig vor die Tür, die Bucht hinaus," wie die jungen Aale gesagt hatten. "Hütet euch vor den bösen Menschen, die euch fangen, das Fell abziehen, entzweischneiden und in die Bratpfanne legen!" wiederholte er in seinem stillen Sinn und lächelte dabei, er würde schon mit heiler Haut durch die 'Welt kommen, frischer Mut ist eine gute Wehr!
Die Sonne stand schon hoch, als er sich der schmalen Einfahrt des Nissumfjordes näherte, er blickte zurück und sah eine weite Strecke hinter sich zwei Reiter heransprengen, noch von anderen Leuten begleitet, allein das ging ihn nichts an.
Die Fähre lag auf der entgegengesetzten Seite des Fjordes; Jürgen rief den Fährmann heraus, und als dieser mit dem Boot herüberkam, stieg er ein; doch ehe er noch die halbe Strecke der Überfahrt zurückgelegt hatte, kamen die Männer, die so eilig hinter ihm geritten waren, heran, riefen dem Fährmann zu, drohten und nannten den Namen der Obrigkeit. Jürgen begriff nicht, wozu, aber er meinte, es sei das beste, umzukehren, nahm selber die eine Ruderstange zur Hand und ruderte zurück; in demselben Augenblick, als das Boot wieder am Land anlegte, sprangen die Leute auch hinein, und eh er es sich versah, schlangen sie einen Strick um seine Hände. "Deine böse Tat wird dich das Leben kosten!" sprachen sie, "Gut, daß wir dich haben!" Nichts Geringeres als einen Mord warfen sie ihm vor; man hatte Martin tot mit einem Messerstich durch den Hals, aufgefunden; einer der Fischer war gestern abend spät Jürgen begegnet, der zu Martin ging, es war nicht das erste Mal, daß Jürgen das Messer gegen Martin erhoben hatte, das wußte man, er mußte der Mörder sein; die Stadt und das Gericht waren weit entfernt, der Wind blies ihnen entgegen, aber um zur Fahrstelle und über die Bucht zu gelangen, brauchten sie keine halbe Stunde, von dort war es nur eine Viertelmeile nach Nörre Vosborg, dem großen Schloß mit Wällen und Gräben. Ein Fischer, ein Bruder des Großknechts dort, war einer der Reiter, und der meinte, man könnte wohl erwirken, daß Jürgen bis auf weiteres in das Loch auf Vosborg gesteckt würde, wo die Zigeunerin Langenmarthe bis zu ihrer Hinrichtung gesessen hatte.
Was Jürgen zu seiner Verteidigung sagte, wurde nicht beachtet; ein paar Blutstropfen auf seinem Hemdärmel sprachen schwer gegen ihn. Jürgen war sich aber seiner Unschuld bewußt, und da es hier und sogleich zu keiner Rechtfertigung kommen konnte, so ergab er sich in sein Schicksal.
Man ging nun an Land, gerade an der Stelle, wo Ritter Bugges Schloß gestanden hatte, wo Jürgen mit seinen Pflegeeltern nach dem Fest, der Begräbnisfeier, umhergegangen war, die viel seligsten, lichtvollsten Tage seiner Kindheit verlebt hatte. Er wurde denselben Weg über die Wiese nach Vosborg hinangeführt, und wieder blühte hier der Holunder, die hohen Linden dufteten, ihm war, als sei er gestern hier gewesen.
In den beiden Flügeln des Schlosses führt eine Treppe unter dem Aufgang hinüber, von da aus gelangt man in einen niedrigen, gewölbten Keller; hier hatte Langenmarthe gesessen, von hier aus war sie aufs Hochgericht gewandert; sie hatte fünf Kinderherzen gegessen und war in dem Wahne gewesen, daß sie, wenn sie noch zwei mehr bekommen hätte, denn fliegen und sich unsichtbar hätte machen können. In der Mitte des Kellers befand sich ein kleines enges Luftloch ohne Fenster; die duftenden Linden vermochten nicht, hier hinein eine Labung zu senden, drinnen war alles dunkel und moderig; eine Pritsche nur stand hier, aber ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen, ja, und deshalb konnte Jürgen auch gut ruhen.
Die aus dicken Bohlen gezimmerte Tür war geschlossen, eine eiserne Stange außen vorgeschoben; allein der Kobold des Aberglaubens schleicht sich durch ein Schlüsselloch, auf den Herrenhof so gut wie in die Fischerhütte, warum nicht hier herein, wo Jürgen saß und an Langenmarthe und ihre Untaten dachte; ihre letzten Gedanken, die Nacht vor der Hinrichtung hatten diesen Raum erfüllt; ihm kam all der Zauber in den Sinn, der hier in alten Zeiten gespukt hatte, als der Herr Schwanwedel hier hauste, und es war ja bekannt genug, daß heutzutage noch der Kettenhund, der auf der Brücke stand, jeden Morgen über dem Geländer an der Kette erhängt gefunden wurde. Dies alles erfüllte und durchschauerte Jürgen, doch ein Sonnenstrahl, ein labender Gedanke drang auch an diesen Ort von außen in sein Inneres, es war die Erinnerung an den blühenden Holunder und die duftenden Linden. Lange blieb er hier nicht sitzen; man führte ihn in die Stadt Ringkjöbing, wo sein Gefängnis ebenso streng war.
Jene Zeiten waren nicht unsere; gegen den gemeinen Mann verfuhr man hart, es war nur kurz nach den Zeiten, wo Bauerngehöfte und Bauerndörfer in neuen Rittergütern aufgingen, und bei diesem Regiment wurden Kutscher und Bediente oft Gerichtsamtmänner und hatten es in der Gewalt, den Geringen und Armen oft wegen eines kleinen Vergehens zum Verlust von Hab und Gut und zum Auspeitschen zu verurteilen; noch fanden sich hier und dort Richter dieser Art, und in Jütland, weit von der Hauptstadt und dem aufgeklärten, wohlgesinnten Lenker der Regierung entfernt, wurde das Gesetz zuweilen noch gehandhabt, wie es eben ging, und das war noch das kleinste Ungemach, das Jürgen betreffen konnte, daß man seine Untersuchung in die Länge zog.
Kalt und schaurig war sein Aufenthaltsort; wann würde diese Lage wohl ein Ende haben? Unverschuldet war er in Trübsal und Elend geraten, das war sein Los! Zeit hatte er jetzt, über sein Los in dieser Welt nachzudenken und weshalb wohl gerade ihm ein solches beschieden war; ja, das würde sich im jenseitigen Leben erst aufklären, in dem Leben nach diesem, das uns gewißlich erwartet; der Glaube war fest in ihm geworden in der armen Fischerhütte, das, was in der Fülle und dem Sonnenschein Spaniens in seines Vaters Gedanken nicht hineingeleuchtet hatte, wurde ihm in der Dürftigkeit und Finsternis ein Licht des Trostes, ein Gnadenmittel Gottes, und das trügt nie.
Die Frühlingsstürme stellten sich ein. Man hört das Rollen und Dröhnen der Nordsee meilenweit ins Land hinein, aber erst wenn der Sturmwind aufhört; es klingt, als wenn schwere Wagen zu Hunderten über einen harten unterhöhlten Weg dahinfahren; Jürgen vernahm diese Töne in seinem Gefängnis, und es war ihm eine Abwechslung, keine Melodie hätte ihm mehr zu Herzen gehen können als gerade diese Töne, das rollende Meer, das freie Meer, auf welchem man durch die Welt getragen wird, mit den Winden dahinfliegt und, wohin man auch gerät, sein eigen Haus bei sich führt, wie die Schnecke immer auf eigenem, auf heimatlichem Grund und Boden steht, selbst in fremdem Land.
Wie lauschte er auf das tiefe Dröhnen, wie tauchten ihm die Erinnerungen herauf: "Frei, frei!" Wie glücklich, frei zu sein, selbst ohne Schuhe und mit zerlumpten Hemd!" Dann und wann flammte es bei solchen Gedanken auf in seinem Innern, und er schlug mit geballter Faust gegen die dicke Wand.
Wochen, Monate, ein ganzes Jahr war verstrichen, da ergriff man einen Herumtreiber, Nils Dieb, der "Roßhändler" wurde er auch genannt, und nun kamen die besseren Zeiten, es wurde bekannt, welches Unrecht Jürgen hatte erdulden müssen.
In der Nähe von Ringkjöbing bei einem Häusler, der einen Ausschank hatte, waren an dem Nachmittag vor Jürgens Abreise von der Heimat, und vor dem Mord, Nils Dieb und Martin zusammengetroffen; es wurden ein paar Gläser getrunken, und die sollten wohl keinem Mann in den Kopf steigen, aber sie genügten doch, um bei Martin die Redseligkeit zu steigern, er schnitt auf, erzählte, daß er ein Haus bekommen habe und heiraten wolle, und als Nils fragte, wo das Geld dazu sei, schlug Martin hochmütig auf die Tasche und sagte: "Das Geld ist da, wo es sein soll!."
Diese Prahlerei kostete ihm das Leben; als er sich nach Hause begab, ging Nils ihm nach und jagte ihm ein Messer durch die Kehle, um dem Ermordeten das Geld zu nehmen, das nicht vorhanden war.
Dies wurde weitläufig auseinandergesetzt; uns genügt es nun, zu wissen, daß Jürgen wieder frei kam, aber was erhielt er als Ersatz dafür, daß er Jahr und Tag im Gefängnis gelitten hatte, vor allem Verkehr mit Menschen ausgestoßen gewesen war? Man sagte ihm, es sei noch sein Glück, daß er unschuldig war, er könne jetzt gehen. Der Bürgermeister gab ihm zwei Taler Reisegeld, und mehrere Bürger der Stadt setzten ihm Essen und Bier vor; es gab doch noch gute Menschen! Nicht alle "schinden und braten." Aber das beste war doch, daß Kaufmann Brönne aus Skagen, derselbe, bei dem Jürgen vor einem Jahr Dienst nehmen wollte, sich gerade in diesen Tagen in Geschäften in der Stadt Ringkjöbing aufhielt; Brönne erfuhr den ganzen Zusammenhang. Herz hatte der Mann, er begriff, was Jürgen empfunden und gelitten haben mußte, und er nahm sich nun vor, das wieder gutzumachen und Jürgen spüren zu lassen, daß es auch noch gute Menschen gebe.
Es ging jetzt aus dem Gefängnis in die Freiheit, ins Himmelreich zu Liebe und Herrlichkeit; auch diesen Gang sollte er wandern; kein Becher des Lebens ist reiner Wermut, kein guter Mensch könnte einem anderen Menschen den einschenken, sollte denn Gott, die Alliebe selber, es können?
"Lassen wir das alles nun begraben und vergessen sein!" sagte der Kaufmann Brönne; "ziehen wir einen recht dicken Strich unter das letzte Jahr, ja, wir wollen den Kalender sogar verbrennen! Und in zwei Tagen reisen wir in das friedliche, liebe und fröhliche Skagen! Ein abgelegener Winkel, sagen sie, ist Skagen; ein lieber guter Ofenwinkel ist es, mit offenen Fenstern in die weite Welt hinaus."
Das war eine Reise! Das hieß wieder Atemholen! Aus der kalten Gefängnisluft in den warmen Sonnenschein hinaus. Die Heide stand über und über mit blühendem Ginster in vollem Flor, und der Hirtenknabe saß auf dem Hünengrab und blies seine Flöte, die er sich aus einem Schafsknochen geschnitzt hatte. Fata morgana, die reizende Lufterscheinung der Wüste, zeigte sich mit hängenden Gärten und schwimmenden Wäldern und auch die wunderlich leichte Luftwallung, der Höhenrauch, von dem es hier heißt, es sei Lokemann, der seine Herde treibt.
Hinauf durch das Land der Wendeln, hinauf nach Skagen ging es, von wo die Männer mit den langen Bärten, die Langobarden, ausgewandert waren, damals, als unter König Snio alle Kinder und alten Leute getötet werden sollten, das edle Weib Gambaruck aber den Vorschlag machte, die jungen Leute sollten lieber auswandern; dies alles war Jürgen bekannt, so gelehrt war er, und kannte er auch nicht das Land der Langobarden hinter den hohen Alpen, so wußte er doch, wie es dort aussehen mußte, war er doch als Knabe selber im Süden, in Spanien gewesen, er gedachte der dort aufgetürmten Südfrüchte, der roten Granatblüten, des Summens, Brummens und Glockenklanges in dem großen Bienenkorb, der Stadt dort, aber am schönsten ist es doch in dem Lande der Heimat; Jürgens Heimat war Dänemark.
Endlich erreichten Sie "Wendilskaga," wie Skagen in alten norwegischen und isländischen Schriften heißt. Schon damals dehnten sich Alt-Skagen und die West- und Oststadt meilenweit hin mit Sanddünen und Ackerland bis zu dem Leuchtturm in der Nähe von "Skagens Horn"; die Häuser lagen dort wie jetzt, hingestreut zwischen aufgewehten, wechselnden Sandhügeln, eine Wüste, wo der Wind in dem losen Sand spielt und wo Möwen und wilde Schwäne sich hören lassen, daß es ins Ohr schneidet! Im Südwesten, eine Meile vom Meer, liegt Alt-Skagen, und hier wohnte Kaufmann Brönne, hier sollte Jürgen nun leben. Das große Wohnhaus war mit Teer angestrichen, die kleineren Wirtschaftshäuser hatten jedes ein umgestülptes Boot als Dach, der Schweinestall war aus Wrackstücken gezimmert, eine Umzäunung gab es hier nicht, war doch auch nichts da zu umzäunen, aber an Leinen in langen Reihen, eine über der anderen, hingen aufgeschnittene Fische, um im Winde zu trocknen. Das ganze Meerufer war mit verdorbenen Heringen überhäuft, das Netz war kaum ins Meer geworfen, als auch schon die Heringe fuderweise an Land gezogen wurden, es gab dort zuviel davon, man warf sie wieder ins Meer oder ließ sie am Strand liegen.
Frau und Tochter des Kaufmanns, ja, auch die Hausleute kamen dem zurückkehrenden Alten jubelnd entgegen, da war ein Händedrücken, ein Rufen, ein Reden, und die Tochter, welch liebes Gesicht und welche lieblichen Augen hatte sie! Im Hause war's gemütlich und geräumig. Goldbutten, die ein König als ein Prachtgericht angesehen hätte, kamen auf den Tisch, Wein aus den Weinbergen Skagens, dem großen Meer, wurde aufgetragen, die Trauben rollten gekeltert an Land in Fässern und auch in Flaschen.
Als Mutter und Tochter nachher erfuhren, wer Jürgen war und wie unschuldig er gelitten hatte, blickten sie ihn noch freundlicher an, und am freundlichsten strahlten die Augen der lieblichen Jungfrau Clara. Jürgen fand eine liebe Heimat in Alt-Skagen, es tat seinem Herzen wohl, und sein Herz hatte ja viel ertragen müssen, auch den bitteren Kelch der Liebe, der verhärtet oder erweicht, ja nach den Umständen; Jürgens Herz war noch weich, es war jung, es hatte noch Raum übrig, und deshalb war es gewiß sehr gut, daß es sich so traf, daß Jungfrau Clara in drei Wochen mit dem Schiff des Vaters nach Christiansand in Norwegen hinauffahren sollte, um eine Tante zu besuchen und den ganzen Winter dort zu verweilen.
Am Sonntag vor der Abreise waren alle in der Kirche zum heiligen Abendmahl; die Kirche war groß und schön, Schotten und Holländer hatten sie vor Jahrhunderten gebaut, sie lag eine kleine Strecke von der Stadt entfernt, etwas beschädigt war sie, und der Weg in dem tiefen Sande war beschwerlich, doch man schritt gern dahin, um in Gottes Haus zu gelangen, Psalmen zu singen und die Predigt zu hören. Der Sand lag bis über die Ringmauer des Kirchhofs hin, aber die Gräber hielt man noch immer frei vom Sand.
Es war die größte Kirche nördlich den Limfjords. Jungfrau Maria mit goldener Krone auf dem Haupt und dem Jesuskind im Arme stand wie lebendig auf dem Altar, die heiligen Apostel waren im Chor ausgemeißelt, an der Wand dort hingen Porträts von den alten Bürgermeistern und Ratsherren des Städtchens Skagen; die Kanzel war Schnitzwerk. Die Sonne schien belebend in die Kirche hinein, und ihr Glanz fiel über den blanken messingnen Kronleuchter und das kleine Schifflein, das von der Decke herabhing.
Jürgen war überwältigt von einem heiligen kindlichen Gefühl wie damals, da er als Knabe in den reichen Dom in Spanien gestanden hatte, hier aber war das Gefühl doch anders, weil er sich bewußt war, ein Glied der Gemeinde zu sein. Nach der Predigt folgte das heilige Abendmahl, er genoß das Brot und den Wein, und es fügte sich so, daß er neben Jungfrau Clara kniete; allein seine Gedanken waren so ausschließlich auf Gott und die heilige Handlung gerichtet, daß er erst, als sie sich erhob, seine Nachbarin bemerkte; er sah Tränen über ihre Wangen rollen.
Zwei Tage später verließ sie Skagen und ging nach Norwegen; er blieb zurück und machte sich im Hause und in der Wirtschaft nützlich; er ging auf Fischfang, und da waren Fische, damals in noch größerer Menge als jetzt; die Scharen der Makrelen leuchteten in finsteren Nächten und zeigten selber an, wo sie zogen, der Knurrhahn knurrte, und die Kohlkrabbe heulte, wenn sie gejagt wurde, die Fische sind nicht so stumm, wie man von ihnen sagt; Jürgen aber war stumm mit dem, was er im Herzen trug - aber einmal würde das wohl auch ans Tageslicht gelangen.
Jeden Sonntag, wenn er in der Kirche saß und sein Blick sich auf die Muttergottes am Altar richtete, haftete sein Auge auch eine Weile auf der Stelle, wo Jungfrau Clara an seiner Seite gekniet hatte, und er gedachte ihrer und wie herzlich und gut sie gegen ihn gewesen war.
Der Herbst kam mit Regen- und Schneewetter, das Wasser blieb auf den Wegen stehen, der Sand konnte all das Wasser nicht einsaugen, man mußte von Haus zu Haus waten, wenn nicht sogar im Kahn fahren; die Stürme warfen ein Schiff nach dem andern auf die todbringenden Riffe, Schnee- und Sandstürme rasten, der Sand flog um die Häuser herum und legte sich hoch an ihnen hinaus, so daß die Bewohner oben aus dem Schornstein hinauskriechen mußten, aber hier oben an der Nordsee Strand war das nichts Bemerkenswertes; im Zimmer war es gemütlich, gab es Schutz und Wärme, Heidetorf und Wrackstücke knisterten im Ofen, und Kaufmann Brönne las laut vor aus einer alten Chronik, las von dem Dänenprinzen Hamlet, der von England aus hier bei Bowberg an Land gegangen und eine Schlacht geliefert hatte; bei Ramme sei sein Grab, nur einige Meilen von dem Ort entfernt, wo der Aalbauer wohnte; Hünengräber zu Hunderten erhoben sich dort auf der Heide, ein großer Kirchhof. Kaufmann Brönne war dort gewesen am Grabe Hamlets; von alten Zeiten sprach man, von den Nachbarn, den Engländern und Schotten, und Jürgen sang das Lied von "Des Königs von England Sohn," von dem prächtigen Schiff:
Vergoldet war es von Bord zu Bord,
und geschrieben darauf stand Gottes Wort.
Und gemalt es stand, wie der Königssohn
seine Braut umarmte um Minnelohn.
Diesen letzten Vers namentlich sang Jürgen mit inniger Stimme, seine Augen leuchteten dabei, sie waren ja ohnedies schwarz und strahlend von Geburt an. Und so verstrich die Winterzeit bei Lesen und Singen; Wohlstand war da und ein wahres Familienleben bis zu den Haustieren herab, und alles war gut gehalten; die Küche blitzte von Kupfer und Zinn und weißen Tellern, und von der Decke herab hingen Würste, Schinken, Wintervorrat vollauf; ja, das alles ist noch heute zu sehen, drüben in vielen reichen Bauerngehöften der jütländischen Westküste, vollauf Essen und Trinken, geschmückte reine Zimmer, kluge Köpfe, fröhliche Gemüter, Gastfreundschaft ist dort zu Hause wie in dem Zelt des Arabers.
Nie wieder hatte Jürgen, seit er als Kind vier Tage bei der Begräbnisfeier gewesen war, eine so angenehme Zeit verlebt, und doch war Jungfrau Clara abwesend, nur nicht in den Gedanken und der Rede.
Im April sollte ein Schiff nach Norwegen abgehen, Jürgen sollte mit demselben fahren. Er war freilich jetzt voll Leben und Humor, und gut sah er aus, wohlgenährt, sagte Mutter Brönne, es sei eine Freude, ihn anzusehen.
"Es ist auch eine Freude, dich anzusehen!" sagte der alte Kaufmann, "Jürgen hat Leben in die Winterabende gebracht und in dich auch, Mutter! Du bist jünger geworden dieses Jahr, du siehst gut und nett aus! Du warst aber auch das schönste Mädchen in Wiborg, und das will viel heißen, denn dort habe ich immer die Mädchen am schönsten gefunden."
Jürgen sprach nichts dazu, das schickte sich nicht, aber er dachte an ein Mädchen aus Skagen; und zu ihr segelte er hinauf, das Schiff steuerte auf Christiansand zu und günstiger Wind führte ihn schnell zu dieser Stadt.
Eines Morgens ging Kaufmann Brönne zum Leuchtturm hinaus, der weit von Alt-Skagen steht, die Kohlen dort oben waren schon längst erloschen, die Sonne stand bereits hoch, als er den Turm erstieg; eine ganze Meile von der äußersten Spitze des Landes aus erstrecken sich die Sandbänke unter Wasser, von diesen zeigten sich heute viele Schiffe, und unter ihnen glaubte er mit Hilfe des Fernrohres "Karen Brönne," so hieß das Schiff, zu erkennen, und ganz richtig, es war dabei, herzusegeln, Clara und Jürgen waren an Bord. Die Kirche und der Leuchtturm Skagens zeigten sich ihnen als ein Reiher und ein Schwan auf dem blauen Gewässer. Clara saß auf Deck und sah die Sanddünen allmählich emportauchen; blieb der Wind stehen, so konnten sie in etwa einer Stunde die Heimat erreichen; so nahe waren sie ihr und der Freude - so nahe waren sie dem Tod und seiner Angst.
Eine Planke im Schiff zersprang, das Wasser drang herein; gestopft und gepumpt wurde sofort, alle Segel wurden gesetzt, die Notflagge gehißt; sie waren aber noch eine ganze Meile vom Land entfernt, Fischerboote waren zwar zu sehen, aber in der Ferne, der Wind stand landeinwärts, die Strömung war ihnen auch günstig, doch das genügte alles nicht, das Schiff sank. Jürgen schlang seinen rechten Arm um Clara und preßte sie fest an sich.
Mit welchem Blick schaute sie ihm ins Auge, als er sich im Namen des Herrn mit ihr ins Wasser stürzte; sie stieß einen Schrei aus, aber die fühlte sich doch sicher, er würde sie nicht sinken lassen.
Was das alte Lied sang:
Und gemalt es stand, wie der Königssohn
seine Braut umarmt um Minnelohn
Das tat Jürgen in der Stunde der Gefahr und Angst; wie nützte es ihm jetzt, ein guter Schwimmer zu sein, er arbeitete sich vorwärts mit den Füßen und einem Arm, den andern hielt er fest um das junge Mädchen geschlungen, er ruhte aus auf dem Wasser, er trat Wasser, er machte all die Bewegungen, die er kannte, damit er Kraft übrig behalte, das Land zu erreichen. Er hörte, wie Clara einen lauten Seufzer ausstieß, spürte, wie ein Zucken sie durchfuhr und er drückte sie fester an sich; dann und wann rollte eine Woge über sie dahin, eine andere Hob sie empor, das Wasser war so tief, so klar, einen Augenblick schien es ihm, als sähe er eine blitzende Makrelenschar dort unten, oder war es Leviathan selber, der sie zu verschlingen drohte? Die Wolken waren Schatten über die Wasserfläche, dann kamen blendende Sonnenstrahlen; schreiende Vögel in großen Scharen zogen über ihn hin, und die wilden Enten, die schwer und schläfrig sich von der Strömung treiben ließen, fuhren erschrocken beim Anblick des Schwimmers auf; aber seine Kräfte nahmen ab, das fühlte er, von Land war er noch ein paar Kabellängen entfernt, doch die Hilfe kam heran, es näherte sich ein Boot - aber unter dem Wasser stand, er sah es deutlich, eine weiße, ihn anstarrende Gestalt - eine Welle hob ihn empor, die Gestalt näherte sich - er fühlte einen Stoß, es ward Nacht, alles verschwamm vor seinen Augen.
Auf der Sandbank lag des Wrack eines Schiffes, die See ging darüber hin, die weiße Galionsfigur lehnte an einem Anker, das scharfe Eisen ragte gerade bis an den Wasserspiegel herauf; Jürgen war dagegen gestoßen, die Strömung hatte ihn mit doppelter Kraft herangetrieben; ohnmächtig versank er mit seiner Last, aber die nächste Woge hob ihn und das junge Mädchen wieder empor.
Die Fischer erhaschten sie und zogen sie ins Boot hinein, das Blut strömte über Jürgens Antlitz herab, er war wie tot, aber das Mädchen hielt er so fest umklammert, daß man es mit Gewalt aus Arm und Hand herauswinden mußte; totenblaß, leblos lag Clara in dem Boot ausgestreckt, das nun aufs Land zusteuerte.
Alle Mittel wurden angewendet, Clara ins Leben zurückzurufen, sie blieb tot; schon lange war er draußen auf den Fluten mit einer Leiche umhergeschwommen, hatte sich angestrengt und ermattet um einer Toten willen
Jürgen atmete noch, die Fischer trugen ihn in das nächste Haus auf den Sanddünen; eine Art Chirurg, der dort wohnte, der übrigens zugleich Schmid und Kleinhändler war, legte Jürgen einen Notverband an, bis man am folgenden Tag den Arzt aus der nächsten Stadt holte.
Das Gehirn des Kranken war angegriffen, er raste, er stieß wilde Schreie aus, aber am dritten Tag blieb er still und ermattet auf dem Lager liegen, sein Leben schien nur an einem Faden zu hängen; der Arzt sagte, es wäre am besten, wenn dieser Faden reißen würde. "Beten wir zu Gott, daß er ihn zu sich nimmt. Er wird nie wieder ein Mensch werden."
Doxh das Leben ließ nicht von ihm ab, der Faden wollte nicht reißen; aber der Faden der Erinnerung riß, der Faden aller Geisteskräfte war durchschnitten, das was das Entsetzliche, ein lebendiger Körper blieb; ein Körper, der gesunden, aber wie ein Gespenst umherwandeln sollte. Jürgen blieb im Haus des Kaufmanns Brönne. "Seine Krankheit hat er sich geholt, als er unser Kind retten wollte," sprach der alte Mann, "er ist jetzt unser Sohn."
Die Leute nannten Jürgen albern, allein das war nicht der rechte Ausdruck; er war wie ein Instrument, bei dem die Saiten zu locker gespannt sind, nicht mehr klingen können - nur einzelne Augenblicke, wenige Minuten bekamen sie eine Spannkraft, und alsdann ertönten sie wieder - alte Melodien klangen, einzelne Takte; Bilder rollten sich auf und schwinden wieder in Nebel hin, er saß aufs neue vor sich hinstarrend, gedankenlos da; wir dürfen glauben, daß er dabei nicht litt; die dunklen Augen verloren dann ihren Glanz, sie schienen nur ein schwarzes, angelaufenes Glas zu sein. "Der arme blöde Jürgen!" sagten die Leute.
Er war es, der unter dem Herzen seiner Mutter einem Erdenleben entgegengetragen wurde so reich, daß es Übermut, ja Stolz wein würde, ein jenseitiges Leben zu wünschen, geschweige denn an ein solches zu glauben. All die großen Geistesanlagen waren demnach verloren Nur harte Tage, Schmerz und Enttäuschung waren ihm geworden; eine Prachtzwiebel war er gewesen, aus ihrem reichen Erdboden herausgerissen und auf den Sand hingeworfen, um dort zu verdorren. Das in Gott geschaffene Bild sollte keinen besseren Wert haben? Das Ganze sollte nur ein Spiel des Zufalls sein? Nein! Der alliebende Gott mußte und würde ihm Ersatz in einem anderen Leben geben für das, was er hier erlitt und vermißte. "Der Herr ist barmherzig, und seine Güte währet ewiglich!" Diese Worte aus Davids Psalter sprach im Glauben und in Ergebung die alte, fromme Frau des Kaufmanns, und das Gebet ihres Herzens ging dahin, daß Gott Jürgen bald abrufen möge, damit er eingehen könne zum ewigen Leben.
Auf dem Kirchhof, wo der Sand über die Mauer hinweht, lag Clara begraben; es schien, als sei Jürgen sich dessen nicht bewußt, es gehörte nicht in seine Gedankensumme, die wußte nur Wrackstücke aus einer vergangenen Zeit. Jeden Sonntag ging er mit den Alten zur Kirche und saß dort still mit gedankenlosem Blick; eines Tages, während des Psalmengesanges, stieß er einen lauten Seufzer aus, seine Augen leuchteten, sie waren dem Altar, der Stelle zugewandt, wo er vor Jahr und Tag mit seiner toten Freundin zusammen gekniet hatte, er nannte ihre Namen und wurde blaß wie eine Leiche, Tränen rollten über seine Wangen.
Man geleitete ihn aus der Kirche, und er sagte den Umstehenden, er befinde sich wohl, er sei nicht krank gewesen, er, der von Gott Geprüfte, in die Welt Hinausgeworfene, erinnerte sich dessen nicht. Und Gott, unser Schöpfer, ist weise und voller Liebe, wer kann das bezweifeln? Unser Herz und unser Verstand bestätigen es: "Seine Güte währet ewiglich!"
In Spanien, wo zwischen Orangen- und Lorbeerbäumen die maurischen Kuppeln von warmen Luftwellen umwogt sind, wo Gesang und Kastagnetten ertönen, saß in dem prächtigen Haus ein kinderloser Greis, der reichte Kaufmann des Ortes; durch die Straßen zogen Kinder in Prozessionen mit flatternden Fahnen und flammenden Lichten. Wieviel hätte dieser Greis von seinem Reichtum gegeben, um seine Kinder an sein Herz drücken zu können, seine Tochter oder deren Kind, das vielleicht nie das Licht der Welt erblickt hatte, geschweige denn das der Ewigkeit des Paradieses? "Armes Kind!" Ja, armes Kind! Ein Kind zwar und doch an die dreißig Jahre alt - so alt war Jürgen hier oben in Alt-Skagen geworden.
Der Flugsand hatte sich über die Gräber des Kirchhofs gelegt, ganz um die Mauer der Kirche herum, aber hier bei den Vorangegangenen, bei ihren Verwandten und Lieben, wollten und mußten die Toten doch bestattet werden. Kaufmann Brönne und seine Gattin ruhten hier bei ihren Kindern unter dem weißen Sande.
Es war Frühjahr, die Zeit der Stürme; die Sanddünen rauchten und wirbelten empor, das Meer warf hohe Wogen, die Vögel jagten schreiend in Scharen, wie Wolken im Sturm, über die Dünen dahin; ein Schiffbruch folgte dem andern an den Riffen von Skagens Horn bis zu den Huusby-Dünen.
Eines Nachmittags saß Jürgen allein im Zimmer; da wurden seine Sinne plötzlich klarer, ein Gefühl der Unruhe, das ihn oft in jüngeren Jahren in die Dünen und auf die Heide hinausgetrieben hatte, bemächtigte sich seiner.
"In die Heimat! In die Heimat!" sprach er; niemand hörte ihn; er ging aus dem Haus, auf die Dünen zu; Sand und Steinchen wehten ihm ins Gesicht, wirbelten um ihn herum. Er schritt immer weiter, auf die Kirche zu; der Sand lag hoch an der Mauer, halb über die Fenster hinauf, aber vor dem Eingang war der Sand weggeschaufelt, die Kirchentür war nicht verschlossen und leicht zu öffnen; Jürgen trat in die Kirche.
Der Sturm fuhr heulend über das Städtchen Skagen dahin; es war ein Orkan wie seit Menschengedenken nicht, ein entsetzliches Unwetter, aber Jürgen befand sich im Gotteshaus, und während es draußen finstre Nacht war, leuchtete es in seinem Innern, es war das Licht der Seele, das nimmer erlöschen kann; den schweren Stein, der in seinem Kopf lag, fühlte er wie mit einem Knall zerspringen. Ihm schien die Orgel zu tönen, allein es war der Sturm und das dröhnende Meer; er ließ sich auf einem der Kirchenstühle nieder und siehe, die Lichter flammten auf, Licht an Licht; ein Reichtum entfaltete sich, wie er einen solchen nur im Lande Spanien erblickt hatte, und all die Bilder von den alten Ratsherren und Bürgermeistern wurden lebendig, sie traten aus der Wand heraus, so wie seit langen Jahren gehangen hatten, sie setzten sich unters Tor der Kirche; Tore und Türen der Kirche flogen auf, und eintraten die Toten alle, festlich gekleidet wie zu ihrer Zeit, sie schritten bei schöner Musik dahin und füllten die Plätze der Kirche; da brauste das Psalmlied wie ein dröhnendes Meer, und seine alten Pflegeeltern aus dem Huusby-Dünen waren hier und der alte Kaufmann Brönne und seine Gattin, und ihnen zur Seite, dicht neben Jürgen, saß ihre freundliche, liebliche Tochter Clara, sie reichte Jürgen die Hand, und beide schritten nun zum Altar hin, wo sie früher gekniet hatten, und der Pfarrer legte ihre Hände ineinander, weihte sie dem Leben in Liebe. - Da brauste der Klang der Posaunen, wundervoll wie eine Kinderstimme voll Sehnen und Lust, schwoll an zum Orgelklang, zu einem Orkan von vollen, erhebenden Tönen, lieblich und beseligend anzuhören und doch mächtig zum Zersprengen der Gräber Gestein.
Und das Schifflein, das im Chor von der Decke herabhing, ließ sich nieder vor beiden, wurde wunderbar groß, prachtvoll, mit seidenen Segeln und goldenen Rahen, die Anker waren aus rotem Gold, und jedes Tau war mit Seide durchflochten, wie es in dem alten Liede hieß. Und das Brautpaar ging an Bord und die ganze Gemeinde der Kirche mit ihn, und dort war Platz und Herzlichkeit für sie alle. Und die Wände und Bögen der Kirche blühten wie der Holunder und die duftenden Linden, und lieblich schaukelten und fächerten die duftenden Zweige und Blätter Kühlung, bogen sich auseinander, trennten sich, und das Schiff erhob sich und segelte mit ihnen durch das Meer, durch die Luft, jedes Kirchenlicht war ein Stern, und der Wind stimmte ein Psalmlied an, und alle sangen mit dem Winde: "In Liebe zur Herrlichkeit!" - "Kein Leben soll verlorengehen!" - "Voll seliger Freude! Halleluja!"
Und diese Worte waren auch die letzten, die Jürgen in dieser Welt sprach. Das Band zerriß, daß die unsterbliche Seele zurückhielt - nur ein toter Körper lang in der finsteren Kirche, über die der Sturm dahinbrauste, sie mit Flugsand umwirbelnd.
Am folgenden Morgen war Sonntag, die Gemeinde und der Pfarrer begaben sich zum Gottesdienst. Der Weg zur Kirche war mühsam gewesen, der Sand hatte den Weg fast ungangbar gemacht, und jetzt, wo sie endlich am Ziel waren, lag ein großer Sandhügel hoch aufgetürmt vor dem Eingang zur Kirche, die Kirchentür war verschüttet. Der Pfarrer sprach ein kurzes Gebet und sagte, Gott habe die Tür dieses seines Hauses verschlossen, die Gemeinde müsse zurückkehren und dem Herrn anderswo ein neues Haus errichten. So sangen sie ein Psalmlied unter freiem Himmel und wanderten zurück in die Häuser.
Jürgen war nirgends aufzufinden, weder in der Stadt Skagen noch in den Dünen, wie sehr man ihn auch suchte; die Wellen, die den Sand hinaufgerollt waren, hatten ihn wohl mit sich in die Fluten hinabgezogen, so meinte man. Sein Körper lag bestattet in dem größten Sarkophag, in der Kirche selbst; Gott hatte im Sturm eine Handvoll Erde auf seinen Sarg geworfen, die schwere Sandschicht lag darauf und liegt noch heute dort.
Der Flugsand hat die mächtigen Gewölbe überdeckt, Dünenweißdorn und wilde Rosen wachsen über die Kirche hin, über die der Wanderer jetzt zum Turm hinschreitet, der, ein riesiger Leichenstein auf dem Grabe, aus dem Sande emporragend, meilenweit zu sehen ist; keinem Könige setzte man einen prächtigeren Stein. Niemand stört die Ruhe der Toten; niemand wußte es, und auch niemand weiß es, erst jetzt kennen wir sein Grab - der Sturm hat mir in den Sanddünen davon gesungen.
DER SILBERNE SCHILLING ...

Es war einmal ein Schilling, blank ging er aus der Münze hervor, sprang und klang. "Hurra! Jetzt geht's in die weite Welt hinaus!" Und er kam freilich in die weite Welt hinaus.
Das Kind hielt ihn mit warmen Händen, der Geizige mit kalten, krampfhaften Händen; der Ältere wendete und drehte ihn Gott weiß wie viele Male, während die Jugend ihn gleich wieder rollen ließ. Der Schilling war aus Silber, hatte sehr wenig Kupfer an sich und befand sich bereits ein ganzes Jahr in der Welt, das heißt in dem Land, in dem er geprägt worden war. Eines Tages aber ging er auf Reisen ins Ausland; er war die letzte Landesmünze im Geldbeutel, den ein reisender Herr bei sich hatte, der Herr wußte selber nicht, daß er den Schilling noch hatte, bis er ihm unter die Finger kam. "Hier habe ich ja noch einen Schilling aus der Heimat!" sagte er, "nun, der kann die Reise mitmachen!" und der Schilling klang und sprang vor Freude, als er ihn wieder in den Beutel steckte. Hier lag er nun bei fremden Kameraden, die kamen und gingen, einer machte dem anderen Platz, aber der Schilling aus der Heimat blieb immer im Beutel, das war eine Auszeichnung.
Mehrere Wochen waren schon verstrichen, und der Schilling war weit in die Welt hinausgelangt, ohne daß er doch eigentlich wußte, wo er sich befand; zwar erfuhr er von den anderen Münzen, daß sie französische und italienische seien. Eine sagte, sie seien jetzt in dieser Stadt, eine andere sagte, in jener, allein der Schilling konnte sich keine Vorstellung von alledem machen; man sieht nichts von der Welt, wenn man immer im Sack steckt, und das war ja sein Los. Doch eines Tages, wie er so dalag, bemerkte er, daß der Geldbeutel nicht zugemacht war, und so schlich er sich bis an die Öffnung vor, um ein wenig hinauszuschauen; das hätte er nun freilich nicht tun sollen, er war aber neugierig und das rächt sich; er glitt hinaus in die Hosentasche, und als abends der Geldbeutel herausgenommen wurde, lag der Schilling noch da, wo er hingerutscht war, und kam mit den Kleidern auf den Vorplatz hinaus; dort fiel er sogleich auf den Fußboden, niemand hörte das, niemand sah das.
Am anderen Morgen wurden die Kleider wieder in das Zimmer getragen, der Herr zog sie an, reiste weiter, und der Schilling blieb zurück, er wurde gefunden, sollte wieder Dienste tun, und ging mit drei anderen Münzen aus. "Es ist doch angenehm, sich in der Welt umzuschauen," dachte der Schilling, "Andere Menschen, andere Sitten kennenzulernen."
"Was ist das für ein Schilling!" hieß es in demselben Augenblick. "Das ist keine Landesmünze! Der ist falsch! Der taugt nichts!"
Ja, nun beginnt die Geschichte des Schillings, wie er sie später selber erzählte. "Falsch! Taugt nichts! – Dies ging mir durch und durch," erzählte der Schilling. "Ich wußte, ich war von gutem Klang und hatte ein echtes Gepräge. Die Leute mußten sich jedenfalls irren, mich konnten sie nicht meinen, aber sie meinten mich doch! Ich war es, den sie falsch nannten; ich taugte nichts.
'Den muß ich im Dunkeln ausgeben!' sagte der Mann, der mich erhalten hatte, und ich wurde im Dunkeln ausgegeben und am hellen Tag wieder ausgeschimpft. 'Falsch, taugt nichts! Wir müssen machen, daß wir ihn los werden!' "
Und der Schilling zitterte zwischen den Fingern der Leute jedesmal, wenn er heimlich fortgeschafft wurde und als Landesmünze gelten sollte. "Ich elender Schilling! Was hilft mir mein Silber, mein Wert, mein Gepräge, wenn das alles keine Geltung hat! In den Augen der Welt ist man eben das, was die Welt von einem hält! Es muß entsetzlich sein, ein böses Gewissen zu haben, sich auf bösen Wegen umherzuschleichen, wenn mir, der ich doch ganz unschuldig bin, schon so zumute sein kann, weil ich bloß das Aussehen habe! Jedesmal, wenn man mich hervorsuchte, schauderte ich vor den Augen, die mich ansehen würden, wußte ich doch, daß ich zurückgestoßen, auf den Tisch hingeworden werden würde, als sei ich Lug und Trug. Einmal kam ich zu einer alten, armen Frau, sie erhielt mich als Tagelohn für harte Arbeit, allein sie konnte mich nun gar nicht wieder los werden. Niemand wollte mich annehmen, ich war der Frau ein wahres Unglück. 'Ich bin wahrhaftig gezwungen, jemanden mit dem Schilling anzuführen', sagte sie, 'ich kann mit dem besten Willen einen falschen Schilling nicht aufheben; der reiche Bäcker soll ihn haben, er kann es am besten verschmerzen – aber unrecht ist es trotzdem, daß ich's tue'."
"Auch das Gewissen der Frau muß ich noch obendrein belasten!" seufzte es in dem Schilling. "Habe ich mich denn auf meine alten Tage wirklich so verändert?"
"Und die Frau begab sich zu dem reichen Bäcker, aber der kannte gar zu gut die gängigen Schillinge, als daß er mich hätte behalten wollen, er warf mich der Frau gerade ins Gesicht, Brot bekam sie für mich nicht, und ich fühlte mich so recht von Herzen betrübt, daß ich solchergestalt zu anderer Ungemach geprägt worden war, ich, der ich in meinen jungen Tagen so freudig und sicher mir meines Wertes und echten Gepräges bewußt gewesen war! So recht traurig wurde ich, wie es ein armer Schilling werden kann, wenn niemand ihn haben will. Die Frau nahm mich aber wieder mit nach Hause, sie betrachtete mich mit einem herrlichen, freundlichen Blick und sagte: 'Nein, ich will niemanden mit dir anführen! Ich will ein Loch durch dich schlagen, damit jedermann sehen kann, daß du ein falsches Ding bist, und doch – das fällt mir jetzt so ein – du bist vielleicht gar ein Glücksschilling, kommt mir doch der Gedanke so ganz von selber, so daß ich daran glauben muß! Ich werde ein Loch durch den Schilling schlagen und eine Schnur durch das Loch ziehen und dem Kleinen der Nachbarsfrau den Schilling um den Hals als Glücksschilling hängen.' Und sie schlug ein Loch durch mich; angenehm ist es freilich nicht, wenn ein Loch durch einen geschlagen wird, allein wenn es in guter Absicht geschieht, läßt sich vieles ertragen! Eine Schnur wurde auch durchgezogen, ich wurde eine Art Medaillon zum Tragen, man hing mich um den Hals des kleinen Kindes, und das Kind lächelte mich an, küßte mich, und ich ruhte eine ganze Nacht an der warmen, unschuldigen Brust des Kindes.
Als es Morgen ward, nahm die Mutter mich zwischen ihre Finger, sah mich an und hatte so ihre eigenen Gedanken dabei, das fühlte ich bald heraus. Sie suchte eine Schere hervor und schnitt die Schnur durch.
'Glücksschilling!' sagte sie. 'Ja, das werden wir jetzt erfahren!' Und sie legte mich in Essig, bis ich ganz grün wurde, darauf kittete sie das Loch zu, rieb mich ein wenig und ging nun in der Dämmerstunde zum Lotterieeinnehmer, um sich ein Los zu kaufen, das Glück bringen sollte.
Wie war mir übel zumute! Es zwickte in mir, als müßte ich zerknicken, ich wußte, daß ich falsch genannt und hingeworfen werden würde, und zwar gerade vor die Menge von Schillingen und Münzen, die mit Inschrift und Gesicht dalagen, auf welche sie stolz sein konnten; aber ich entging der Schande; beim Einnehmer waren viele Menschen, er hatte gar viel zu tun, und ich fuhr klingend in den Kasten unter die anderen Münzen ob später das Los gewann, weiß ich nicht, das aber weiß ich, daß ich schon am andern Morgen als ein falscher Schilling erkannt, auf die Seite gelegt und ausgesandt wurde, um zu betrügen und immer zu betrügen. Es ist nicht auszuhalten, wenn man einen redlichen Charakter hat, und den kann ich mir selber nicht absprechen.
Jahr und Tag ging ich in solcher Weise von Hand zu Hand, von Haus zu Haus, immer ausgeschimpft, immer ungern gesehen; niemand traute mir, und ich traute mir selber, traute der Welt nicht, das war eine schwere Zeit! Da kam eines Tages ein Reisender, ein Fremder an, bei dem wurde ich angebracht, und er war treuherzig genug, mich für gängige Münze anzunehmen; aber nun wollte er mich abermals ausgeben, und ich vernahm wieder die Ausrufe: 'Taugt nichts! Falsch!'
'Ich habe ihn für echt erhalten', sagte der Mann und betrachtete mich dabei recht genau; plötzlich lächelte er über sein ganzes Gesicht, das geschah sonst bei keinem Gesicht, wenn man mich betrachtete. 'Nein, was ist doch das!' sagte er. 'Das ist ja eine unserer Landesmünzen, ein guter, ehrlicher Schilling aus der Heimat, durch den man ein Loch geschlagen hat, den man falsch nennt. Das ist in der Tat kurios! Dich werde ich mit nach Hause nehmen!'
Die Freude durchrieselte mich, man hieß mich einen guten, ehrlichen Schilling, und in die Heimat sollte ich zurückkehren, wo jedermann mich erkennen und wissen würde, daß ich aus gutem Silber war und echtes Gepräge hatte. Ich hätte vor Freude Funken schlagen können, aber es liegt nun einmal nicht in meiner Natur, zu sprühen, das kann wohl der Stahl, nicht aber das Silber.
Ich wurde in feines, weißes Papier eingewickelt, damit ich nicht mit den anderen Münzen verwechselt werden und abhanden kommen konnte, und bei festlichen Gelegenheiten, wenn Landsleute sich begegneten, wurde ich vorgezeigt, und es wurde sehr gut von mir gesprochen; sie sagten, ich sei interessant; es ist freilich merkwürdig, daß man interessant sein kann, ohne ein einziges Wort zu sagen.
Und endlich kam ich in die Heimat an! All meine Not hatte ein Ende, die Freude kehrte wieder bei mir ein, war ich doch aus gutem Silber, hatte das echte Gepräge! Und gar keine Widerwärtigkeiten hatte ich mehr auszustehen, obgleich man das Loch durch mich geschlagen hatte, weil ich als falsch galt, doch das tut nichts, wenn man es nur nicht ist! Man muß ausharren, alles kommt schließlich mit der Zeit zu seinem Recht! Das ist mein Glaube," sagte der Schilling.
DIE TEEKANNE
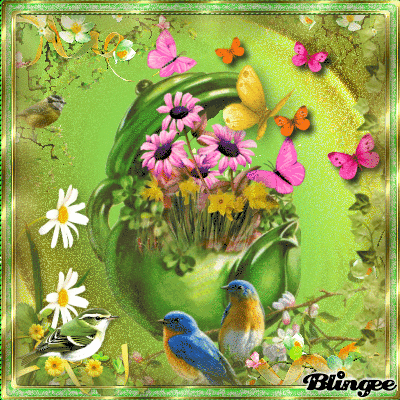
Es war einmal eine stolze Teekanne, stolz auf ihr Porzellan, stolz auf ihre lange Tülle, stolz auf ihren breiten Henkel; sie hatte etwas vorne an und hinten an, den Henkel hinten, die Tülle vorn, und davon sprach sie; aber sie sprach nicht von ihrem Deckel, der war zerbrochen, der war gekittet, der hatte einen Fehler, und von seinen Fehlern spricht man nicht gerne, das tun die anderen genug. Tassen, Sahnekännchen und Zuckerdose, das ganze Teegeschirr würden wohl mehr an die Gebrechlichkeit des Deckels denken und von der sprechen als von dem guten Henkel und der ausgezeichneten Tülle, das wußte die Teekanne.
"Ich kenne sie!" sagte sie zu sich selber. "Ich kenne auch wohl meine Mängel, und ich erkenne sie, darin liegt meine Demut, meine Bescheidenheit, Mängel haben wir alle, aber man hat doch auch Begabung. Die Tassen erhielten einen Henkel, die Zuckerdose einen Deckel, und ich erhielt noch ein Ding voraus, das sie niemals erhalten, ich erhielt eine Tülle, die Macht mich zur Königin auf dem Teetisch. Der Zuckerschale und dem Sahnekännchen ward es vergönnt, die Dienerinnen des Wohlgeschmacks zu sein, aber ich bin die Gebende, die Herrschende, ich verbreite den Segen unter der durstenden Menschheit; in meinem Innern werden die chinesischen Blätter mit dem kochenden geschmacklosen Wasser verbunden."
All dies sagte die Teekanne in ihrer unternehmenden Jugendzeit. Sie stand auf dem gedeckten Tisch, sie wurde von der feinsten Hand erhoben: aber die feinste Hand war ungeschickt, die Teekanne fiel, die Tülle brach ab, der Henkel brach ab, der Deckel ist nicht wert, darüber zu reden; es ist genug von ihm geredet. Die Teekanne lag ohnmächtig auf dem Fußboden; das kochende Wasser lief heraus. Es war ein schwerer Schlag, den sie erhielt, und das Schwerste war, daß sie lachten; sie lachten über sie und nicht über die ungeschickte Hand.
"Die Erinnerung kann ich nicht loswerden!" sagte die Teekanne, wenn sie sich später ihren Lebenslauf erzählte. "Ich wurde Invalide genannt, in eine Ecke gestellt und tags darauf an eine Frau fortgeschenkt, die um Küchenabfall bettelte; ich sank in Armut hinab, stand zwecklos, innerlich wie äußerlich; aber da, wie ich so stand, begann mein besseres Leben; man ist das eine und wird ein ganz anderes. Es wurde Erde in mich gelegt; das heißt für eine Teekanne, begraben zu werden; aber in die Erde wurde eine Blumenzwiebel gelegt; wer sie hineinlegte, wer sie gab, das weiß ich nicht; gegeben wurde sie, ein Ersatz für die chinesischen Blätter und das kochende Wasser, ein Ersatz für den abgebrochenen Henkel und die Tülle. Und die Zwiebel lag in der Erde, die Zwiebel lag in mir; sie wurde mein Herz, mein lebendes Herz; ein solches hatte ich früher nie gehabt.
Es war Leben in mir, es war Kraft, viel Kraft; der Puls schlug, die Zwiebel trieb Keime; es war, wie um zersprengt zu werden von Gedanken und Gefühlen; sie brachen auf in einer Blüte; ich sah sie, ich trug sie, ich vergaß mich selber in ihrer Herrlichkeit; gesegnet ist es, sich selber in anderen zu vergessen! Sie sagte mir nicht Dank; sie dachte nicht an mich – sie wurde bewundert und gepriesen. Ich war froh darüber, wie mußte sie es da sein! Eines Tages hörte ich, daß gesagt wurde, sie verdiene einen besseren Topf. Man schlug mich mitten entzwei; das tat gewaltig weh, aber die Blume kam in einen besseren Topf – und ich wurde in den Hof hinausgeworfen – liege da als ein alter Scherben – aber ich habe die Erinnerung, die kann ich nicht verlieren."
DIE ALTE KIRCHENGLOCKE
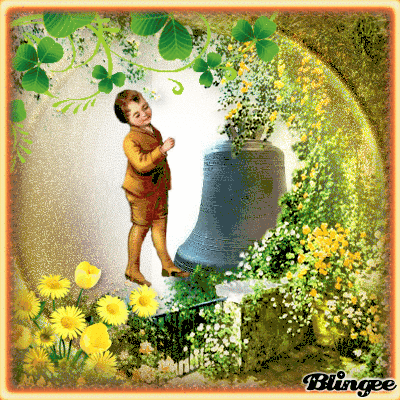
In dem deutschen Lande Württemberg, wo die Akazienbäume an den Landstraßen so herrlich blühen und sich die Apfel- und Birnbäume im Herbste unter ihrem reifen Segen beugen, liegt ein Städtchen: Marbach. Es gehört zu den ganz kleinen Städten, aber schön liegt es am Neckar, der an Städten, alten Ritterburgen und grünen Weinbergen vorübereilt, um seine Gewässer mit dem stolzen Rheinstrome zu vermischen.
Es war spät im Jahre, das rotgefärbte Weinlaub hing welk hinab, Regenschauer fielen und der kalte Wind wurde immer heftiger; für die Armen war es nicht die angenehmste Zeit. Es wurden finstere Tage, und finsterer noch war es in den alten kleinen Häusern. Eines davon lag mit dem Giebel nach der Straße zu, mit niedrigen Fenstern, ärmlich und gering anzusehen; und so war auch die Familie, die darin wohnte, aber brav und fleißig, mit Gottesfurcht in der Schatzkammer ihres Herzens. Noch ein Kind wollte der liebe Gott ihnen in kurzem schenken. Die Stunde war gekommen, die Mutter lag in Angst und Wehen; da tönte vom nahen Kirchturm Glockenklang zu ihr herein, so tief, so festlich. Es war eine Feierstunde, und der Glockenschall erfüllte die Betende mit Andacht und Zuversicht. Ihre Gedanken erhoben sich mit inniger Liebe zu Gott, und in demselben Augenblicke gebar sie ihren kleinen Sohn und fühlte sich so unendlich froh und glücklich. Die Glocke auf dem Turme schien ihre Freude über Stadt und Land hinaus zu läuten. Zwei klare Kinderaugen blickten sie an und des Kleinen Haar leuchtete, als ob es vergoldet wäre. Das Kind wurde an dem dunklen Novembertage in der Welt empfangen. Mutter und Vater küssten es, und in ihre Bibel schrieben sie: »Den zehnten November 1759 schenkte Gott uns einen Sohn«; und später wurde hinzugefügt, dass er in der Taufe die Namen »Johann Christoph Friedrich« erhielt.
Was wurde aus dem kleinen Burschen, dem armen Burschen aus dem geringen Marbach? Ja, das wußte niemand damals, nicht einmal die alte Kirchenglocke, obschon sie so hoch hing und zuerst für den geläutet und gesungen hatte, der später das herrliche Lied von der »Glocke« singen sollte.
Und der Kleine wuchs, und auch die Welt wuchs um ihn. Wohl zogen seine Eltern fort nach einer anderen Stadt; aber liebe Freunde blieben ihnen in dem kleinen Marbach, und deshalb kamen auch Mutter und Sohn eines Tages dorthin auf Besuch. Der Knabe war erst sechs Jahre alt, kannte aber gleichwohl schon einiges aus der Bibel und den frommen Psalmen. Er hatte bereits manchen Abend von seinem kleinen Rohrstuhl aus seinen Vater Gellerts Fabeln und Klopstocks Messias vorlesen hören. Heiße Tränen hatte er und seine zwei Jahre ältere Schwester vergossen, als sie von seinem Schicksale hörten, der den Kreuzestod zur Erlösung für uns alle erlitt.
Bei dem ersten Besuche in Marbach hatte sich die Stadt nicht sehr verändert; es war ja auch noch nicht so lange her, seitdem sie fortgezogen waren. Die Häuser standen nach wie vor mit spitzen Giebeln, schrägen Mauern und niedrigen Fenstern da. Auf dem Kirchhofe waren neue Gräber hinzugekommen, und dort, unmittelbar an der Mauer, stand jetzt unten im Grase die alte Glocke, die von ihrer Höhe hinabgefallen war, einen Sprung bekommen hatte und nicht mehr läuten konnte; eine neue war bereits an ihre Stelle gekommen.
Mutter und Sohn waren in den Kirchhof eingetreten; sie standen vor der alten Glocke, und die Mutter erzählte ihrem kleinen Knaben, wie die Glocke mehrere hundert Jahre gedient, zu Kindtaufen, zur Hochzeitsfreude und zu Begräbnissen geläutet hätte. Sie hätte Festfreude und Feuersnot verkündigt; ja, eines ganzen Menschenlebens Lauf besungen. Und nie vergaß das Kind, was die Mutter erzählte, es klang in seiner Brust wieder, bis es sich ihm als Mann zum Liede gestaltete. Und die Mutter erzählte ihm, wie ihr diese alte Kirchenglocke in der Stunde der Angst, als ihr von Gott ihr kleiner Knabe geschenkt worden, Trost und Freude ins Herz geläutet und gesungen hätte. Und das Kind betrachtete fast mit Andacht die große alte Glocke, es beugte sich hinab und küßte sie, obschon sie alt, zersprungen und wertlos hier zwischen Gras und Brennnesseln stand.
In der Erinnerung des kleinen Knaben, der in Armut aufwuchs und in die Höhe schoß, lebte sie fort. Lang und mager, rothaarig und voller Sommersprossen, ja, so war er, aber dazu besaß er zwei Augen, klar und hell wie das tiefe Wasser. Wie ging es ihm? Es ging ihm gut, beneidenswert gut! Durch allerhöchste Gnade war er in diejenige Abteilung der Militärschule aufgenommen worden, in der sich die Kinder der vornehmeren Leute befanden, und das war eine Ehre, ein Glück. Er ging in Stiefeletten, mit steifer Halsbinde und gepuderter Perücke. Kenntnisse wurden ihm beigebracht, und die kamen unter »Marsch!« »Halt!« »Front!« Daraus konnte schon etwas werden.
Die alte Kirchenglocke sollte wohl einmal in den Schmelzofen kommen, aber was kam dabei heraus? Ja, das war unmöglich zu sagen, und es war ebenso unmöglich zu sagen, was einmal aus der Glocke in der jungen Brust herauskommen und hervortönen würde. Es war ein Erz darin, das laut erschallte, das in die weite Welt hinausklingen mußte. Je enger es hinter den Schulmauern wurde und je betäubender der Kommandoton donnerte: »Marsch!« »Halt!« »Front!«, desto stärkere Klänge entquollen des Jünglings Brust, und er sang, was in ihm lebte, im Kreise seiner Kameraden, und die Klänge hallten über die Landesgrenzen hinüber. Aber zu dem Zwecke hatte er keine freie Schule, Kleider und Nahrung erhalten. Er war ja schon nummeriert als Schräubchen in dem großen Uhrwerk, zu dem wir alle zu handgreiflichem Nutzen gehören sollen. – Wie wenig verstehen wir uns doch selbst! Wie sollten dann die anderen, selbst die Besten, uns immer verstehen! Aber es ist gerade der Druck, durch den der Edelstein geschaffen wird. Der Druck war da; ob wohl im Laufe der Zeit die Welt den Edelstein erkennen würde?
Es war eine große Festlichkeit in der Hauptstadt des Landesherrn. Tausende von Lampen strahlten, die Raketen stiegen in die Höhe. Dieser Glanz entschwindet nicht aus der Erinnerung um des einen willen, der damals unter Tränen und Schmerz unbemerkt fremden Boden zu erreichen suchte. Er mußte fort vom Vaterlande, fort von der Mutter, von all seinen Lieben, oder im Strome der Alltagsmenschen untergehen.
Die alte Glocke hatte es gut, sie stand geschützt an der Marbacher Kirchenmauer! Der Wind fuhr über sie hin und hätte ihr von dem erzählen können, bei dessen Geburt sie läutete, erzählen, wie kalt er auch über ihn fortgeweht hätte, als er vor kurzem ganz erschöpft im Walde des Nachbarlandes niedersank, wo sein ganzer Reichtum und seine ganze Hoffnung für die Zukunft nur in dem Manuskripte des »Fiesko« bestand. Der Wind hätte von seinen ersten Beschützern, lauter Künstlern, erzählen können, die sich, einer nach dem anderen, von der Vorlesung fortschlichen und sich lieber mit Kegelschieben ergötzten. Der Wind hätte von dem bleichen Flüchtling melden können, welcher wochen-, ja monatelang in einer ärmlichen Schenke lebte, wo der Wirt schimpfte, tobte und trank, wo rohe Lustbarkeit herrschte, während er von seinem Ideale sang. Schwere Tage, dunkle Tage! Das Herz muß selber leiden und erfahren, was es im Gesange der Welt einst verkünden wird.
Finstere Tage, kalte Nächte gingen über die alte Glocke hin; sie empfand es nicht; aber die Glocke in der Menschenbrust empfindet ihre böse Zeit. Wie ging es dem jungen Manne? Wie ging es der alten Glocke? Nun, die Glocke kam weit fort, weiter als ihr Klang von der Höhe ihres Turmes herab je getragen hatte. Und der junge Mann? Nun, die Glocke in seiner Brust schallte weiter hinaus, als sein Fuß wandern und sein Auge sehen sollte, sie klang und klingt noch heute über das Weltmeer, ja rings über die ganze Erde fort. Höre aber erst von der Kirchenglocke! Aus Marbach wurde sie fortgeschafft, wurde als altes Kupfer verkauft und sollte in Bayern in den Schmelzofen wandern. Wie und wann kam sie dort hin? Ja, das mag die Glocke selbst erzählen, wenn sie kann, es ist nicht von großer Wichtigkeit; aber soviel steht bestimmt fest, daß sie nach der Hauptstadt Bayerns kam. Viele Jahre waren dahingeflossen, seitdem sie vom Turm gestürzt war; nun sollte sie eingeschmolzen werden; sollte mit dem Guße eines Ehrendenkmals, zur Bildsäule eines deutschen Geisteshelden verwandt werden. Höre nun, wie es sich traf; wunderbar und herrlich geht es doch in dieser Welt zu. In Dänemark, auf einer der grünen Inseln, wo die Buche wächst und wo die vielen Hünengräber sich erheben, lebte ein ganz armer Knabe. In Holzschuhen war er einhergegangen und hatte seinem Vater, einem Holzschnitzer, Essen in einem alten Tuche hingetragen. Das arme Kind war der Stolz seines Landes geworden, herrliche Marmorwerke schuf er, welche die Bewunderung der Welt erregten, und er war es gerade, der den Ehrenauftrag erhielt, in Ton die Gestalt einer unvergleichlichen Größe, einer strahlenden Schönheit zu bilden, die in Erz gegossen werden könnte, das Bild jenes Knaben, dessen Namen der Vater in seine Bibel geschrieben hatte: Johann Christoph Friedrich.
Und in die Form floß das glühende Erz, die alte Kirchenglocke – niemand dachte an ihre Heimat, niemand an ihr verhalltes Klingen; die Glocke floß mit in die Form und bildete das Haupt und die Brust der Statue, die jetzt enthüllt in Stuttgart vor dem alten Schloße steht, auf jenem Platze, wo er, den sie vorstellt, zu Lebzeiten einherging unter Kampf und Streben, unter dem Drucke der Welt, er, der Knabe von Marbach, der Zögling der Karlsschule, der Flüchtling, Deutschlands großer unsterblicher Dichter, der von dem Befreier der Schweiz und Frankreichs gottbegeisterter Jungfrau sang.
Es war ein sonniger Tag, Fahnen wehten von den Türmen und Dächern der königlichen Hauptstadt Stuttgart, die Kirchenglocken läuteten zu Fest und Freude, nur eine Glocke schwieg, sie leuchtete in dem klaren Sonnenschein, leuchtete von Antlitz und Brust der errichteten Statue. Hundert Jahre waren gerade seit jenem Tage verflossen, wo die Glocke auf Marbachs Turm Freude und Trost der leidenden Mutter zuläutete, die ihr Kind gebar, arm im armen Hause, aber dereinst der reiche Mann, dessen Schätze die Welt segnet; hundert Jahre verflossen seit der Geburt des Dichters edler Frauenherzen, des Sängers des Großen und Herrlichen, seit der Geburt Johann Christian Friedrich Schillers.
HOFHAHN UND WETTERHAHN...
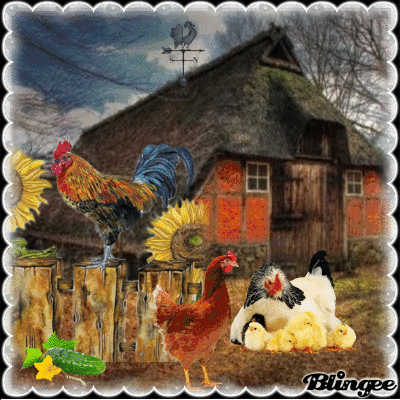
Zwei Hähne waren da, einer auf dem Misthaufen, einer auf dem Dach, hoffärtig waren sie beide, wer von den beiden richtete aber am meisten aus? Sage uns deine Meinung, wir behalten dessen ungeachtet doch unsere eigene bei.
Der Hühnerhof war durch einen Holzzaun von einem anderen Hof getrennt, in welchem ein Misthaufen lag, und auf dem Misthaufen lag und wuchs eine große Gurke, die das Bewußtsein hatte, ein Mistbeetgewächs zu sein.
"Dazu wird man geboren," sprach es im Innern der Gurke, "nicht alle können als Gurken geboren werden, es muß auch andere Arten geben! Die Hühner, die Enten und der ganze Viehbestand des Nachbarhofes sind auch Geschöpfe. Zu dem Hofhahn auf dem Holzzaun sehe ich nun empor, er ist freilich von ganz anderer Bedeutung als der Wetterhahn, der so hochgestellt ist und nicht einmal kämpfen, geschweige dann krähen kann; er hat weder Hühner noch Küchlein; er denkt nur an sich und schwitzt Grünspan! Nein, der Hofhahn, das ist ein Hahn! Sein Auftreten ist Tanz! Sein Krähen ist Musik; wo er hinkommt, wird es einem gleich klar, was ein Trompeter ist! Wenn er nur hier herein käme! Und wenn er mich auch mit Stumpf und Stiel auffräße, wenn ich auch in seinem Körper aufgehen müßte, es wäre ein seliger Tod!" sprach die Gurke.
Nachts kam ein entsetzliches Wetter; Hühner, Küchlein und selbst der Hahn suchten Schutz; den Holzzaun zwischen den beiden Höfen riß der Wind nieder, daß es krachte; die Dachziegel fielen herunter, aber der Wetterhahn saß fest; er drehte sich nicht einmal, er konnte sich nicht drehen, und doch war er jung, frisch gegossen, aber besonnen und gesetzt; er war alt geboren, ähnelte durchaus nicht den fliegenden Vögeln im Himmelsraum, den Sperlingen, den Schwalben, nein, die verachtete er, sie seien Piepvögel von geringer Größe, ordinäre Piepvögel! Die Tauben, meinte er, die seien groß und blank und schimmernd wie Perlmutt, sähen aus wie eine Art Wetterhahn, allein sie seien dick und dumm, ihr ganzes Sinnen und Trachten gehe darauf aus, den Wams zu füllen, auch seien sie langweilige Dinger im Umgang, sagte der Wetterhahn. Auch die Zugvögel hatten dem Wetterhahn ihre Visite gemacht, ihm von fremden Ländern, von Luftkarawanen und haarsträubenden Räubergeschichten mit den Raubvögeln erzählt, das war neu und interessant, das heißt, das erste Mal, aber später, das wußte der Wetterhahn, wiederholten sie sich, erzählten stets dieselben Geschichten, und das ist langweilig. Sie waren langweilig, und alles war langweilig, mit niemandem konnte man Umgang pflegen, jeder und alle waren fade und borniert.
"Die Welt taugt nichts!" sprach er. "Das Ganze ist dummes Zeug!"
Der Wetterhahn war, was man blasiert nennt, und diese Eigenschaft hätte ihn gewiß für die Gurke interessant gemacht, wenn sie es gewußt hätte, allein sie hatte nur Augen für den Hofhahn, und der war jetzt auf dem Hof bei ihr.
Den Holzzaun hatte der Wind umgeblasen, aber das Ungewitter war vorüber.
"Was sagt ihr zu dem Hahnenschrei?" sprach der Hofhahn zu den Hühnern und Küchlein. "Das war ein wenig roh, die Eleganz fehlte."
Und Hühner und Küchlein traten auf den Misthaufen, und der Hahn betrat ihn mit Reiterschritten.
"Gartengewächs!" sprach er zu der Gurke, und durch dieses eine Wort wurde ihr seine ganze tiefe Bildung klar, und sie vergaß, daß er in sie hackte und sie auffraß.
"Ein seliger Tod!"
Und die Hühner kamen, und die Küchlein kamen, und wenn das eine läuft, so läuft das andere auch, und sie glucksten und piepten, und sie schauten den Hahn an und waren stolz darauf, daß er von ihrer Art war.
"Kikeriki," krähte er, "die Küchlein werden sofort zu großen Hühnern, wenn ich es ausschreie in den Hühnerhof der Welt!"
Und Hühner und Küchlein glucksten und piepten!
Und der Hahn verkündete eine große Neuigkeit:
"Ein Hahn kann ein Ei legen! Und wißt ihr, was in dem Ei liegt? In dem Ei liegt ein Basilisk. Den Anblick seines solchen vermag niemand auszuhalten; das wissen die Menschen, und jetzt wißt ihr es auch, wißt, was in mir wohnt, was ich für ein Allerhühnerhofskerl bin!"
Und darauf schlug der Hofhahn mit den Flügeln, ließ den Hahnenkamm schwellen und krähte wieder; und es schauderte ihnen allen, den Hühnern und den kleinen Küchlein, aber sie waren gar stolz, daß einer von ihren Leuten so ein Allerhühnerhofskerl war; sie glucksten und piepten, daß der Wetterhahn es hören mußte, und er hörte es, aber er rührte sich nicht dabei.
"Das Ganze ist dummes Zeug!" sprach es im Innern des Wetterhahns. "Der Hofhahn legt keine Eier, und ich bin zu faul dazu; wenn ich wollte, ich könnte schon ein Windei legen, aber die Welt ist kein Windei wert. Das Ganze ist dummes Zeug! Jetzt mag ich nicht einmal länger hier sitzen."
Und damit bracht der Wetterhahn ab, aber er schlug nicht den Hofhahn tot, obgleich er es darauf abgesehen hatte, wie die Hühner sagten; und was sagt die Moral?
"Immerhin noch besser zu krähen als blasiert zu sein und abzubrechen!"
DIE SCHNECKE UND DER ROSENSTOCK…,

Rings um den Garten zog sich eine Hecke von Haselbüschen, außerhalb derselben war Feld und Wiese mit Kühen und Schafen, aber mitten in dem Garten stand ein blühender Rosenstock; unter diesem saß eine Schnecke, die hatte vieles in sich, sie hatte sich selbst.
"Wartet nur bis meine Zeit kommt!" sagte sie, "ich werde mehr ausrichten, als Rosen ansetzen, Nüsse tragen oder Milch geben wie Kühe und Schafe!"
"Ich erwarte sehr viel von Ihr!" sagte der Rosenstock. "Darf ich fragen: wann wird es zum Vorschein kommen?"
"Ich lasse mir Zeit!" sagte die Schnecke. "Sie haben nun solche Eile! Das spannt die Erwartungen nicht!"
Im darauffolgenden Jahr lag die Schnecke ungefähr auf derselben Stelle im Sonnenschein unter dem Rosenstock, der wieder Knospen trieb und Rosen entfaltete, immer frische, immer neue. Und die Schnecke kroch halb aus ihrem Haus heraus, steckte die Fühlhörner aus und zog sie wieder ein.
"Alles sieht aus wie im vorigen Jahr! Gar keinen Fortschritt; der Rosenstock bleibt bei den Rosen, weiter kommt er nicht!"
Der Sommer, der Herbst verstrich, der Rosenstock trug Rosen und Knospen, bis der Schnee fiel, bis das Wetter rauh und naß wurde; der Rosenstock beugte sich zur Erde, die Schnecke kroch in die Erde.
Es begann ein neues Jahr; die Rosen kamen zum Vorschein, die Schnecke kam zum Vorschein.
"Sie sind jetzt ein alter Rosenstock!" sagte die Schnecke. "Sie müssen machen, daß Sie bald eingehen. Sie haben der Welt alles gegeben, was Sie in sich gehabt haben, ob es von Belang war, das ist eine Frage, über die nachzudenken ich keine Zeit gehabt habe; so viel ist aber klar und deutlich, daß Sie nicht das Geringste für Ihre innere Entwicklung getan haben, sonst wäre wohl etwas anderes aus Ihnen hervorgegangen. Können Sie das verantworten? Sie werden jetzt bald ganz und gar nur Stock sein! Begreifen Sie, was ich sage?"
"Sie erschrecken mich!" sagte der Rosenstock. "Darüber habe ich noch nicht nachgedacht."
"Nein, Sie haben sich wohl überhaupt nie mit Denken abgegeben! Haben Sie sich jemals Rechenschaft gegeben, weshalb Sie blühen, und wie der Hergang beim Blühen ist; wie und warum nicht anders!"
"Nein!" sagte der Rosenstock. "Ich blühte in Freude, weil ich nicht anders konnte. Die Sonne schien und wärmte, die Luft erfrischte, ich trank den klaren Tau und den kräftigen Regen; ich atmete, ich lebte! Aus der Erde stieg eine Kraft in mich hinauf, von oben kam eine Kraft, und deshalb mußte ich immer blühen; das war mein Leben, ich konnte nicht anders!"
"Sie haben ein sehr gemächliches und angenehmes Leben geführt!" sagte die Schnecke.
"Gewiß! Alles wurde mir gegeben!" sagte der Rosenstock. "Doch Ihnen wurde noch mehr gegeben! Sie sind eine dieser denkenden, tiefsinnigen Naturen, eine dieser Hochbegabten, welche die Welt in Erstaunen setzen werden!"
"Das fällt mir nicht im entferntesten ein!" sagte die Schnecke. "Die Welt geht mich nichts an! Was habe ich mit der Welt zu schaffen? Ich habe genug mit mir selbst und genug in mir selbst!"
"Aber müssen wir alle hier auf Erden nicht unser bestes Teil den anderen geben, das darbringen, was wir eben vermögen? Freilich, ich habe nur Rosen gegeben! Doch Sie? Sie, die so reich begabt sind, was schenken Sie der Welt? Was werden Sie geben?"
"Was ich gab? Was ich gebe? – Ich spucke sie an! Sie taugt nichts! Sie geht mich nichts an. Setzen Sie Rosen an, meinetwegen, Sie können es nicht weiterbringen! Mag die Haselstaude Nüsse tragen, die Kühe und Schafe Milch geben, die haben jedes ihr Publikum, ich habe das meine in mir selbst! Ich gehe in mich selbst hinein, und dort bleibe ich. Die Welt geht mich nichts an!"
Und damit begab die Schnecke sich in ihr Haus hinein und verkittete dasselbe.
"Das ist recht traurig!" sagte der Rosenstock. "Ich kann mit dem besten Willen nicht hineinkriechen, ich muß immer heraus, immer Rosen ausschlagen. Die entblättern nun gar, verwehen im Winde! Doch ich sah, wie eine Rose in das Gesangbuch der Hausfrau gelegt wurde, eine meiner Rosen bekam ein Plätzchen an dem Busen eines jungen schönen Mädchens, und eine ward geküßt von den Lippen eines Kindes in lebensfroher Freude. Das tat mir so wohl, das war ein wahrer Segen. Das ist meine Erinnerung, mein Leben!"
Und der Rosenstock blühte in Unschuld, und die Schnecke lag und faulenzte in ihrem Haus. Die Welt ging sie nichts an.
Und Jahre verstrichen.
Die Schnecke war Erde in der Erde, der Rosenstock war Erde in der Erde; auch die Erinnerungsrose in dem Gesangbuch war verwelkt – aber im Garten blühten neue Rosenstöcke, im Garten wuchsen neue Schnecken; sie krochen in ihre Häuser hinein, spuckten aus – die Welt ging sie nichts an.
Ob wir die Geschichte wieder von vorne zu lesen anfangen? – Sie wird doch nicht anders.
DER SCHMETTERLING...
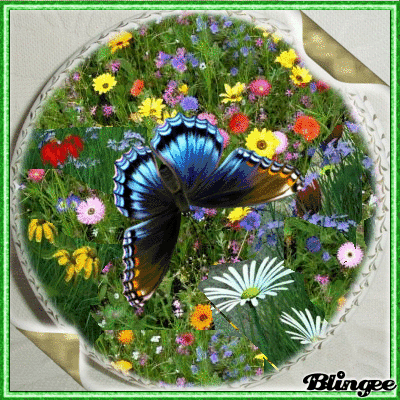
Der Schmetterling wollte eine Braut haben und sich unter den Blumen eine recht niedliche aussuchen. Zu dem Ende warf er einen musternden Blick über den ganzen Blumenflor und fand, daß jede Blume recht still und eher ehrsam auf ihrem Stengel saß, gerade wie es einer Jungfrau geziemt, wenn sie nicht verlobt ist; allein es waren gar viele da, und die Wahl drohte mühsam zu werden. Diese Mühe gefiel dem Schmetterling nicht, deshalb flog er auf Besuch zu dem Gänseblümchen. Dieses Blümlein nennen die Franzosen 'Margarete'; sie wissen auch, daß Margarete wahrsagen kann, und das tut sie, wenn die Liebesleute, wie es oft geschieht, ein Blättchen nach dem andern von ihr abpflücken, während sie an jedes eine Frage über den Geliebten stellen: 'Von Herzen? – Mit Schmerzen? – Liebt mich sehr? – ein klein wenig? – Ganz und gar nicht?' und dergleichen mehr. Jeder fragt in seiner Sprache. Der Schmetterling kam auch zu Margarete um zu fragen; er zupfte ihr aber nicht die Blätter aus, sondern er drückte jedem Blatte einen Kuß auf, denn er meinte, man käme mit Güte besser fort.
"Beste Margarete Gänseblümlein!" sprach er zu ihr, "Sie sind die klügste Frau unter den Blumen, Sie können wahrsagen – bitte, bitte, mir zu sagen, bekomme ich die oder die? Welche wird meine Braut sein? – Wenn ich das weiß, werde ich geradeswegs zu ihr hinfliegen und um sie anhalten."
Allein Margarete antwortete ihm nicht, sie ärgerte sich, daß er sie 'Frau' genannt hatte, da sie doch noch eine Jungfrau sei – das ist ein Unterschied! Er fragte zum zweiten und zum dritten Male; als sie aber stumm blieb und ihm kein einziges Wort entgegnete, so mochte er zuletzt auch nicht länger fragen, sondern flog davon, und zwar unmittelbar auf die Brautwerbung.
Es war in den ersten Tagen des Frühlings, ringsum blühten Schneeglöckchen und Krokus. 'Die sind sehr niedlich', dachte der Schmetterling, 'allerliebste kleine Konfirmanden, aber ein wenig zu sehr Backfisch!' – Er, wie alle jungen Burschen, spähte nach älteren Mädchen aus.
Darauf flog er auf die Anemonen zu; diese waren ihm ein wenig zu bitter, die Veilchen ein wenig zu schwärmerisch, die Lindenblüten zu klein und hatten eine zu große Verwandtschaft; die Apfelblüten – ja, die sahen zwar aus wie Rosen, aber sie blühten heute, um morgen schon abzufallen, meinte er. Die Erbsenblüte gefiel ihm am besten, rot und weiß war sie, auch zart und fein, und gehörte zu den häuslichen Mädchen, die gut aussehen und doch für die Küche taugen; er stand eben im Begriffe, seinen Liebesantrag zu stellen – da erblickte er dicht neben ihr eine Schote, an deren Spitze eine welke Blüte hing. "Wer ist die da?" fragte er. "Es ist meine Schwester," antwortete die Erbsenblüte.
"Ah, so! Sie werden später auch so aussehen?" fragte er und flog davon, denn er hatte sich darob entsetzt.
Das Geißblatt hing blühend über den Zaun hinaus, da war die Hülle und Fülle derartiger Fräulein, lange Gesichter, gelber Teint, nein, die Art gefiel ihm nicht. Aber welche liebte er denn?
Der Frühling verstrich, der Sommer ging zu Ende; es war Herbst; er aber war noch immer unschlüssig.
Die Blumen erschienen nun in den prachtvollsten Gewändern – doch vergeblich.
Es fehtle ihnen der frische, duftende Jugendsinn. Duft begehrt das Herz, wenn es selbst nicht mehr jung ist, und gerade hiervon ist bitter wenig bei den Georginen und Klatschrosen zu finden. So wandte sich denn der Schmetterling der Krauseminze zu ebener Erde zu.
Diese hat nun wenig Blüte, sie ist ganz und gar Blüte, duftet von unten bis oben, hat Blumenduft in jedem Blatte. "Die werde ich nehmen!" sagte der Schmetterling.
Und nun hielt er um sie an.
Aber die Krauseminze stand steif und still da und hörte ihn an; endlich sagte sie: "Freundschaft, ja! Aber weiter nichts! Ich bin alt, und Sie sind alt; wir können zwar sehr wohl füreinander leben, aber uns heiraten – nein! Machen wir uns nicht zum Narren in unserem Alter!"
So kam es denn, daß der Schmetterling keine Frau bekam. Er hatte zu lange gewählt, und das soll man nicht! Der Schmetterling blieb ein Hagestolz, wie man es nennt.
Es war im Spätherbste, Regen und trübes Wetter. Der Wind blies kalt über den Rücken der alten Weidenbäume dahin, so, daß es in ihnen knackte. Es war kein Wetter, um im Sommeranzuge herumzufliegen; aber der Schmetterling flog auch nicht draußen umher; er war zufälligerweise unter Dach und Fach geraten, wo Feuer im Ofen und es so recht sommerwarm war; er konnte schon leben; doch "Leben ist nicht genug!" sprach er. "Sonnenschein, Freiheit und ein kleines Blümchen muß man haben!"
Und er flog gegen die Fensterscheibe, wurde gesehen, bewundert, auf eine Nadel gesteckt und in dem Raritätenkasten ausgestellt; mehr konnte man nicht für ihn tun.
"Jetzt setze ich mich selbst auf einen Stengel wie die Blumen!" sagte der Schmetterling, "so recht angenehm ist das freilich nicht! So ungefähr wird es wohl sein, wenn man verheiratet ist, man sitzt fest!" – Damit tröstete er sich dann einigermaßen.
"Das ist ein schlechter Trost!" sagten die Topfgewächse im Zimmer.
"Aber," meinte der Schmetterling, "diesen Topfgewächsen ist nicht recht zu trauen, sie gehen zuviel mit Menschen um!"
FEDER UND TINTENFASS...
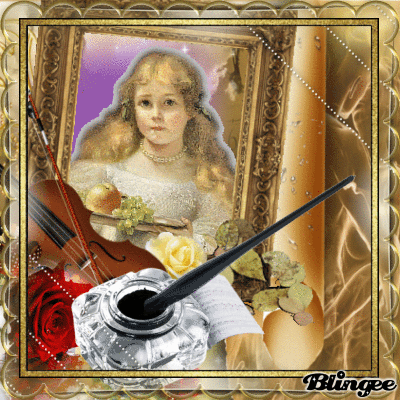
In der Stube eines Dichters, wo sein Tintenfaß auf dem Tisch stand, wurde gesagt: "Es ist merkwürdig, was doch alles aus dem Tintenfaß herauskommen kann! Was wohl nun das Nächste sein wird? Ja, es ist merkwürdig!"
"Ja, freilich!" sagte das Tintenfaß. "Es ist merkwürdig, was alles aus mir herauskommen kann! Ja, es ist schier unglaublich! Und ich weiß wirklich selber nicht, was das Nächste sein wird, wenn der Mensch erst beginnt, aus mir zu schöpfen. Ein Tropfen aus mir genügt für eine halbe Seite Papier, und was kann nicht alles auf der stehen! Ich bin etwas ganz Merkwürdiges! Von mir gehen alle Werke des Dichters aus, all diese lebendigen Menschen, die die Leute zu kennen wähnen, diese innigen Gefühle, dieser Humor, diese anmutigen Naturschilderungen; ich selber begreife es nicht, denn ich kenne die Natur nicht, aber es steckt nun einmal in mir! Von mir sind sie ausgegangen und gehen sie aus, die Heerscharen schwebender, anmutiger Mädchen, tapferer Ritter auf schnaubenden Rossen, Blinder und Lahmer; ja ich weiß selber nicht, was alles; ich versichere Ihnen, ich denke nichts dabei!"
"Da haben Sie recht," sagte die Feder, "denken tun Sie gar nichts, denn wenn Sie es täten, würden Sie auch begreifen, daß Sie nur die Flüssigkeit hergeben. Sie geben das Flüssige, damit ich auf dem Papier das, was mir innewohnt, das, was ich schreibe, zur Anschauung bringen kann. Die Feder ist es, die schreibt! Daran zweifelt kein Mensch, und die meisten Menschen haben nur ebensoviel Ahnung von der Poesie wie ein altes Tintenfaß."
"Sie haben nur wenig Erfahrung," antwortete das Tintenfaß; Sie sind ja kaum eine Woche im Dienst - und schon halb abgenutzt. Bilden Sie sich ein, Sie wären der Dichter? Sie sind nur ein Dienstbote, und ehe Sie kamen, habe ich viele von der Art gehabt, sowohl aus der Gänsefamilie wie aus englischem Fabrikat, ich kenne so gut den Federkiel wie die Stahlfeder. Viele habe ich im Dienst gehabt, und ich werde noch viele bekommen, wenn erst der Mensch kommt, der für mich die Bewegung macht und niederschreibt, was er aus meinem Innern herausbekommt. Ich möchte wohl wissen, was er jetzt zuerst aus mir herausheben wird!" - "Tintentopf!" sagte die Feder.
Spät am Abend kam der Dichter nach Hause, er war in einem Konzert gewesen, hatte einen ausgezeichneten Violinspieler gehört und war ganz erfüllt und entzückt von dessen herrlichem Spiel. Einen erstaunlichen Schwall von Tönen hatte der Spieler dem Instrument entlockt: bald hatte es wie klingende Wassertropfen, wie rollende Perlen getönt, bald wie zwitschernde Vögel im Chor, dann wieder war es dahingebraust wie der Wind durch Tannenwälder; er meinte sein eigenes Herz weinen zu hören, aber in Melodien, wie sie in der Stimme einer Frau ertönen können, als hätten nicht allein die Saiten der Violine, sondern auch der Steg, ja selbst die Schrauben und der Resonanzboden geklungen! Es war außerordentlich gewesen! Und schwer war es auch gewesen, hatte aber ausgesehen wie eine Spielerei, als fahre der Bogen nur so über die Saiten hin und her, man hätte glauben können, jeder könne das nachmachen. Die Violine klang von selbst, der Bogen spielte von selbst, die beiden waren es, die das Ganze taten, man vergaß den Meister, der sie führte, ihnen Leben und Seele einhauchte; den Meister vergaß man; aber seiner erinnerte sich der Dichter, er nannte ihn und schrieb seine Gedanken dabei nieder:
"Wie töricht, wollten die Violine und der Bogen sich eitel über ihr Tun gebärden! Und wir Menschen tun es doch so oft, der Dichter, der Künstler, der Erfinder auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Feldherr, wir tun es alle, wir alle sind doch nur die Instrumente, auf denen Gott, der Herr, spielt. Ihm allein die Ehre! Wir haben nichts, worauf wir stolz sein könnten!" Ja, das schrieb der Dichter nieder, schrieb es wie eine Parabel und nannte dieselbe: "Der Meister und die Instrumente."
"Da kriegen Sie was ab, Madame," sprach die Feder zum Tintenfaß, als die beiden wieder allein waren. "Sie hörten ihn doch laut vorlesen, was ich niedergeschrieben hatte?"
"Ja, das, was ich Ihnen zu schreiben gab!" sagte das Tintenfaß. "Das war ja ein Hieb für Sie, Ihres Übermuts wegen. Daß Sie nicht einmal begreifen können, daß man Sie zum besten hat! Ich versetzte Ihnen einen Hieb direkt aus meinem Innersten heraus, ich muß doch meine eigene Bosheit kennen."
"Tintenscherbe!" sagte die Feder. "Schreibstecken!" sagte das Tintenfaß.
Und beide hatten das Bewußtsein, gut geantwortet zu haben, und das ist ein angenehmes Bewußtsein, zu wissen, daß man gut geantwortet hat, darauf kann man schlafen, und sie schliefen darauf. Allein der Dichter schlief nicht. Gedanken sprudelten aus ihm hervor gleich den Tönen aus der Violine, rollend wie Perlen, brausend wie der Sturmwind durch die Wälder, er empfand sein eigenes Herz in diesen Gedanken, verspürte einen Blitzstrahl vom ewigen Meister. Ihm allein die Ehre!
ANNE LISBETH

Anne Lisbeth war wie Milch und Blut, jung, frisch und fröhlich, wunderschön sah sie aus, blendend weiße Zähne, klare Augen hatte sie, leicht war ihr Fuß im Tanze und ihr Sinn noch leichter! Was kam aber dabei heraus? "Ein häßlicher Bube!" Nein, schön war er nicht!" Er wurde bei der Frau des Feldarbeiters "abgegeben." Anne Lisbeth kam ins gräfliche Schloß, saß dort im Prunkzimmer, angetan mit Sammet und Seide, kein Wind durfte sie anwehen, niemand ihr ein hartes Wort sagen, hätte ihr das doch Schaden bringen können, und das dufte ja nicht sein. Sie stillte das gräfliche Kind, und das war fein und zart wie ein Prinz, schön wie ein Engel; wie liebte sie dieses Kind! Ihr eigenes, ja, das war untergebracht, war bei dem Feldarbeiter, wo nicht der Topf, wohl aber der Mund überkochte und wo in der Regel niemand zu Hause war bei dem Knaben. Dieser weinte dann - aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß -, er weinte sich in den Schlaf und im Schlaf empfindet man weder Hunger noch Durst; der Schlaf ist eine gar gute Erfindung. Mit den Jahren - auch Unkraut schießt empor - schoß Anne Lisbeths Knabe in die Höhe, und doch war er im Wachstum zurück, sagte man; aber in die Familie war er ganz und gar hinein gewachsen, sie hatten Geld dafür erhalten. Anne Lisbeth war ihn ganz los, sie war eine Stadtdame geworden, hatte es gut und gemütlich zu Hause und trug Hut und Schleier, wenn sie spazieren ging; aber sie spazierte nie zu dem Feldarbeiter hinaus, das war zu weit von der Stadt entfernt, und sie hatte ja dort auch nichts zu tun, der Knabe gehörte den Arbeiterleuten, und sein Essen hatte er, sagte Sie, und was tun fürs Essen müsse er auch, und deshalb hütete er Matz Matzens rote Kuh, er konnte schon Vieh hüten und sich nützlich machen.
Der Kettenhund auf der Bleiche des Herrenhofes sitzt stolz im Sonnenschein oben auf seiner Hütte und bellt jeden an, der vorübergeht; gibt es Regen, verkriecht er sich in die Hütte und liegt dort warm und trocken. Anne Lisbeths Knabe saß auf dem Feldzaun im Sonnenschein und schnitzte einen Spannpflock, denn im Frühling hatte er drei Erdbeerpflanzen entdeckt, die in Blüte standen, die würden sicher Beeren tragen. Er saß draußen in Regen und Wetter und ward naß bis auf die Haut, der scharfe Wind trocknete ihm nachher die Kleider am Leib. Kam er einmal auf den Herrenhof, wurde er geknufft und gestoßen, er sei gar zu häßlich, sagten die Mägde und Knechte, daran war er gewöhnt, niemand liebte ihn!
So erging es Anne Lisbeths Knaben, und wie sollte es ihm anders ergehen! Sein Los war nun einmal, niemals geliebt zu werden.
Bisher eine "Landkrabbe," wurde er nun vom Land "über Bord" geworfen, er fuhr zur See mit einem elenden Fahrzeug, saß am Ruder, während der Schiffer beim Schnapsglas saß; schmutzig und häßlich war er, durchgefroren und heißhungrig, man sollte meinen, er sei nie satt gewesen, und das war auch der Fall. Es war Spätherbst, rauhes, nasses, windiges Wetter; der Wind schnitt kalt durch die dicken Kleider, namentlich auf See; und da fuhr ein elendes Fahrzeug mit einem einzigen Segel und nur zwei Mann an Bord, ja, nur anderthalb, hätte man sagen können, dem Schiffer und seinem Schiffsjungen. Dämmerlicht war den ganzen Tag über gewesen, jetzt wurde es finster; es herrschte eine schneidende Kälte Der Schiffer trank einen Schnaps, der ihn von innen erwärmen konnte! Die Flasche war alt, das Glas auch, oben war es ganz, aber der Fuß war abgebrochen, und nun stand es auf einem geschnitzten, blau angestrichenen Holzklötzchen. Ein Schnaps tut wohl, zwei tun noch wohler, meinte der Schiffer. Der Junge saß am Ruder, das er mit seinen harten, schwieligen Händen festkeilte; häßlich war er, das Haar struppig, er selber verkrüppelt und verkümmert, er war des Feldarbeiters Kind - im Kirchenbuch hieß er Anne Lisbeths Kind.
Der Wind flog auf seine Weise, das Fahrzeug auf seine dahin. Das Segel blähte sich, der Wind war hinein gesprungen, es ging in sausender Fahrt, rauh, naß ringsumher, und noch ärger konnte es kommen! Halt! Was war nur das? Was stieß da, was zersprang dort, was ergriff das Schiff? Es drehte sich, legte sich um! War das ein Wolkenbruch? erhob sich eine Sturzsee? Der Junge am Ruder schrie laut auf: "In Jesu Namen!" Das Fahrzeug war auf einen großen Fels am Meeresoden gestoßen und sank wie ein alter Schuh in der Gosse, versank mit Mann und Maus, wie man sagt; und Mäuse waren an Bord, aber nur anderthalb Mann: Der Fischer und des Feldarbeiters Junge. Niemand sah es, außer den schwimmenden Möwen und den Fischen dort unten, und die sahen es auch nicht einmal recht, denn sie fuhren erschrocken auseinander, als das Wasser ins Schiff hineinbrauste und es versank. Kaum einen Faden unter dem Wasserspiegel lag es; diese beiden waren untergebracht, begraben und vergessen! Nur das Glas mit dem blauen hölzernen Fuß sank nicht, der Fuß hielt es oben; das Glas trieb dahin um zerbrochen und an die Küste gespült zu werden - wo und wann? Ja, wem läge wohl daran? Hatte es doch jetzt ausgedient und war es doch geliebt worden, nicht so Anne Lisbeths Knabe" Doch im Himmel wird keine Seele mehr sagen können: "Niemals geliebt!"
Anne Lisbeth wohnte in der Stadt, und zwar seit vielen Jahren hieß Madame und fühlte sich erst recht, wenn sie auf die alten Erinnerungen zu sprechen kam, auf die "gräfliche" Zeit, als sie in der Kutsche fuhr und mit Gräfinnen und Baroninnen verkehren konnte. Ihr süßes Grafenkind war der schönste Engel, die liebste Seele, es hatte sie so sehr geliebt und sie es wieder geliebt; sie hatten sich geküßt und geherzt, der Knabe war ihre Freude, ihr halbes Leben. Jetzt war er groß, vierzehn Jahre alt, schön und gelehrt; sie hatte ihn nicht wiedergesehen, seit sie ihn auf ihren Armen getragen; sie war seit vielen Jahren nicht mehr im gräflichen Schloß gewesen, war es doch eine ganze Reise bis dorthin!
"Ich muß mich mal aufraffen!" sagte Anne Lisbeth, "ich muß hin zu meiner Herrlichkeit, zu meinem süßen Grafenkind! Ja, er sehnt sich gewiß auch nach mir. Der junge Graf denkt an mich, liebt mich wie damals, als er mit seinen Engelsarmen an meinem Halse hing und rief "An-Lis!" es klang wie eine Violine! Ja, ich muß mich aufraffen und ihn wiedersehen!"
Sie fuhr in einem Schlächterwagen ins Land hinein, ging weiter zu Fuß und gelangte auf das gräfliche Schloß. Es war groß und prächtig, wie es immer gewesen, der Garten wie früher, von außen gesehen, aber die Leute drinnen im Hause waren ihr alle fremd, nicht einer unter ihnen kannte Anne Lisbeth, sie wußten nicht, was sie einst hier bedeutet hatte, aber die Gräfin würde es ihnen schon sagen, auch ihr eigener süßer Knabe; wie sehnte sie sich nach ihm!
Nun war Anne Lisbeth da; lange mußte sie oben warten, und dem Wartenden wird die Zeit lang! Ehe die Herrschaft zur Tafel ging, wurde sie zur Gräfin beschieden und sehr freundlich angesprochen. Ihren süßen Knaben sollte sie nach der Tafel sehen, sie sollte wieder hereingerufen werden.
Wie war er groß und lang und dünn geworden! Aber die wunderschönen Augen hatte er noch und den engelsüßen Mund! Er sah sie an, aber er sprach kein Wort. Er erkannte sie gewiß nicht wieder. Er wandte sich um, wollte weitergehen, da ergriff sie seine Hand und drückte sie an ihren Mund. "Gut, gut!" sagte er, und daraufhin ging er aus der Stube, er, der Gedanke ihrer Liebe, er, den sie am meisten geliebt hatte und am meisten liebte, er, ihr ganzer Erdenstolz!
Anne Lisbeth ging vor das Schloß und auf die offene Landstraße, ihr war traurig zumute; hatte er doch so fremd mit ihr getan, hatte er doch keinen Gedanken, kein Wort für sie gehabt, er, den sie einst bei Tag und Nacht getragen und immer noch in ihren Gedanken trug!
Ein großer, schwarzer Rabe schoß vor ihr auf der Landstraße nieder und schrie wieder und wieder auf. "Eia" sagte sie, "was bist du doch für ein Unglücksvogel!" Sie kam an dem Haus des Feldarbeiters vorüber; die Frau stand in der Tür, und beide sprachen miteinander.
"Du siehst gut aus!" sagte die Frau, "du bist dick und fett, dir geht es gut!" - "Oh ja! antwortete Anne Lisbeth. "Das Schiff ist mit ihnen untergegangen!" sagte die Frau. "Lars Schiffer und der Junge sind ertrunken, alle beide. Mit ihnen hat es ein Ende. Hatte ich doch immer geglaubt, der Junge würde mir einmal mit ein paar Talern aushelfen können, dich kostet er nun nichts mehr, Anne Lisbeth!"
"Sie sind ertrunken?" sagte Anne Lisbeth, und sie sprachen nicht mehr über die Angelegenheit. Anne Lisbeth war recht betrübt, weil ihr Grafenkind keine Lust gehabt hatte, mit ihr zu sprechen, mit ihr, die sie ihn so sehr liebte und den langen Weg zurückgelegt hatte, um zu ihm zu gelangen; und Geld hatte die Reise auch gekostet, aber das Vergnügen, welches ihr auf dem Schloß zuteil geworden, war nicht groß, doch hier sprach sie davon kein Wort, sie wollte ihr Herz nicht dadurch erleichtern, daß sie der Arbeitersfrau davon erzählte, könnte die doch leicht glauben, sie genieße nicht mehr das frühere Ansehen bei der Grafenfamilie.
Da schrie der Rabe wieder und flog über sie hin. "Das schwarze Untier!" sagte Anne Lisbeth. "Wird mir heute noch einen Schrecken einjagen!"
Sie hatte Kaffeebohnen und Zichorie mitgebracht, weil sie dachte, es wäre für die arme Frau eine Wohltat, wenn sie ihr dies gab, damit sie eine Tasse Kaffee kochen könne; sie selbst könnte dann auch eine Tasse trinken. Die Frau machte sich daran, den Kaffe zu kochen, während Anne Lisbeth sich auf einem Stuhl niederließ und dort ermüdet einschlief. Es träumte ihr von dem, von dem ihr noch nie geträumt hatte; sonderbar, ihr träumte von ihrem eigenen Kind, das hier in der armen Hüte des Feldarbeiters gehungert und geweint hatte, sich in Wind und Wetter umher getrieben hatte und jetzt in der Meerestiefe lag, der liebe Gott wußte, wo! Ihr träumte, daß sie säße, wo sie gerade saß, und daß die Frau mit Kaffee kochen beschäftigt weinte, sie roch sogar die Bohnen, und in der Tür der Hütte, auf der Schwelle, stand eine wunderschöne Gestalt, die war ebenso schön wie das Grafenkind, und dieses Kind sprach zu ihr:
"Jetzt geht die Welt unter! Halte dich an mir fest, denn du bist doch meine Mutter. Du hast einen Engel im Himmel! Halte dich an mir fest!" Und das Kind, der Engel, griff nach ihr, und ein grausiges Gekrach ertönte, die Welt ging aus den Fugen, und der Engel erhob sich über die Erde und hielt sie fest an ihrem Hemdärmel, so fest, schien ihr, daß sie von der Erde emporgehoben wurde; aber es hängte sich wiederum etwas sehr schwer an ihre Füße, lag schwer über ihrem Körper, es war, als klammerten sich Hunderte von Weibern fest an sie und als riefen sie: "Sollst du gerettet werden, müssen wir auch gerettet werden! Angeklammert! Angeklammert!" Und dann klammerten sie sich alle an; es waren zu viele, ritsch ratsch! und der Ärmel riß, und Anne Lisbeth fiel entsetzt herunter, so daß sie dabei erwachte! - und sie war in der Tat eben nahe daran, mitsamt dem Stuhl, auf dem sie saß, umzustürzen; sie war dermaßen erschrocken und verwirrt, daß sie sich dessen nicht entsinnen konnte, was sie geträumt hatte, aber etwas Böses war es gewesen.
Nun wurde der Kaffee getrunken, dann wurde geplaudert, und endlich ging Anne Lisbeth weiter auf das Städtchen zu, wo sie den Fuhrmann antreffen wollte, um noch in derselben Nacht mit diesem in ihre Heimat zu fahren. Als sie aber mit dem Fuhrmann sprach, sagte derselbe, er könne erst am Abend des nächsten Tages zum Fahren fertig sein. Sie sann jetzt über die Kosten und die Länge des Weges nach, und indem sie bedachte, daß der Weg, wenn sie längs der Meeresküste ging, schon zwei Meilen kürzer sei als der Fahrweg und daß es klares Wetter und wohl auch Mondschein geben würde, da entschloß sie sich, ihn zu Fuß zurückzulegen und sogleich weiterzuwandern, so würde sie schon am nächsten Tage zu Hause sein.
Die Sonne war untergegangen, das Abendläuten von den Glocken der Dorfkirchen hallte noch durch die Luft - doch nein, es waren die Glocken nicht, sondern die Unken, die im Schilfe klagten. Jetzt schwiegen sie, alles ringsum war still, nicht einen Vogel vernahm man, alle waren zur Ruhe gegangen, selbst die Eule mochte nicht zu Hause sein; lautlose Stille herrschte am Waldesrand und Meeresstrand; wie sie dahin schritt am Ufer, hörte sie ihre eigenen Fußtritte im Sand; das Meer hatte keinen Wellenschlag, alles draußen über dem tiefen Gewässer war verstummt. Alle waren verstummt, die Lebendigen und die Toten des Meeres.
Anne Lisbeth schritt dahin, sie dachte, wie man sagt, an gar nichts, sie war abwesend von ihren Gedanken, aber die Gedanken waren von ihr nicht abwesend, die sind niemals von uns abwesend, sie schlummern nur so, sowohl die gedachten Gedanken, die untergetaucht sind, als auch diejenigen, die sich noch nicht gerührt haben. Aber diese Gedanken brechen zu ihrer Zeit hervor, sie rühren sich bald im Herzen, bald im Kopfe; sie stürzen sich gleichsam auf uns herab!
Es steht geschrieben: "Eine gute Tat trägt ihre segensreiche Frucht!" Und so steht auch geschrieben: "In der Sünde ist der Tod!" Vieles steht geschrieben, vieles ist gesagt worden, man weiß es nicht, man entsinnt sich dessen nicht, so erging es Anne Lisbeth; allein es kann einem ein Licht aufgehen, das Vergessene kann sich einem nahen!
Alle Laster, alle Tugenden liegen in unserm Herzen: in deinem, in meinem; sie liegen dort als kleine unscheinbare Samenkörner; von außen her kommt dann ein Sonnenstrahl, die Berührung einer bösen Hand. Du biegst um die Ecke, nach rechts oder links, ja, das kann entscheidend sein, und das kleine Samenkorn wird erschüttert, es schwillt auf dabei, es zerspringt und ergießt seine Säfte in all dein Blut, und nun bist du schon getrieben von dir selbst! Es gibt qualvolle Gedanken, die hat man nicht, wenn man so gleichsam schlummernd umherwandelt, aber sie sind da, sie gären im Herzen; Anne Lisbeth schritt so mit schlummernden Sinnen dahin, die Gedanken gärten! Von Lichtmeß zu Lichtmeß ist dem Herzen viel aufgerechnet worden, es hat eine ganze Jahresrechnung. Vieles ist vergessen, Sünden in Worten und Gedanken gegen Gott, unseren Nächsten und gegen unser eigenes Gewissen, wir denken nicht darüber nach, und Anne Lisbeth tat das auch nicht; sie hatte nichts verbrochen gegen das öffentliche Recht und Gesetz, sie war sehr gut angesehen, eine ehrenwerte, geachtete Person, das wußte sie. Und wie sie so einherschritt am Meeresufer - was lag denn dort? Sie blieb stehen; was war dort angeschwemmt? Ein alter Männerhut lag da. Wo möchte der wohl über Bord gegangen sein? Sie trat näher heran, blieb stehen und blickte den Hut an. Ja, was lag den dort? Sie fuhr erschrocken zusammen; allein es war nichts, worüber sie erschrocken war, es war Seegras und Schilf, das sich über einen großen länglichen Stein gelegt hatte, sah es doch ganz aus wie ein Mensch, es war nur Schilf und Seegras, aber sie erschrak doch, und indem sie weiterschritt, kam ihr so vieles in den Sinn, was sie als Kind gehört hatte, alter Aberglaube von Gespenstern am Meeresufer, dem Geist des Ertrunkenen und nicht Begrabenen, der an der öden Meeresküste angeschwemmt liegt. Der tote Leib, der tue niemandem etwas zu Leide, aber sein Geist, ja, der verfolge den einsamen Wanderer, hänge sich an denselben und fordere, zum Kirchhof getragen zu werden, um in geweihter Erde zu liegen. Angeklammert! Angeklammert! rufe das Gespenst.
Und als Anne Lisbeth still für sich diese Worte wiederholte, stand ihr plötzlich ihr ganzer Traum vor Augen, leibhaftig wie er gewesen war, wie die Mutter sich an sie angeklammert und dieses Wort immerfort gerufen hatten, als die Welt versank, ihr Hemdärmel zerriß und sie aus den Händen ihres Kindes fiel, das sie in der Stunde des Jüngsten Gerichts hatte retten wollen. Ihr Kind, ihr eigenes, leibliches Kind, das sie nie geliebt hatte, ja, für das sie nicht einmal einen Gedanken gehabt hatte, dieses Kind lag jetzt auf dem Meeresgrunde, es konnte als Gespenst aus den Wellen auftauchen und rufen: "Angeklammert! Trage mich in geweihte Erde!" Und als sie daran dachte, prickelte ihr die Angst in den Fersen, so daß sie schneller dahinschritt; die Furcht kam heran als eine kalte, nasse Hand und legte sich in ihre Herzgrube, so daß sie fast ohnmächtig ward, und wie sie nun über das Meer hinausblickte, wurde dort alles dicker und dichter; ein schwerer Nebel wälzte sich heran, legte sich um Gebüsch und Baum, diese sonderbar gestaltend. Sie wandte sich um und schaute nach dem Mond, der hinter ihr stand; der war wie eine blasse Scheibe, ohne Strahlen, es war, als habe sich ein Etwas schwer auf alle ihre Gliedmaßen gelegt. Angeklammert! Angeklammert! dachte sie, und als sie sich wieder umdrehte und den Mond anblickte, schien es ihr, als sei dessen weißes Gesicht ihr ganz nahe, und der Nebel hing ihr wie ein Gewand von den Schultern herab.
"Angeklammert! Trage mich in geweihte Erde!" klang es in ihren Ohren, so hohl, so gar sonderbar, der Laut kam nicht von den Unken, nicht von den Raben oder Krähen, es war nichts von ihnen zu sehen. "Ein Grab! Grab mir ein Grab!" klang es ganz laut; ja, es war der Strandgeist von ihrem Kinde, das auf dem Meeresgrunde lag, das keinen Frieden fand, bevor es nicht auf den Kirchhof getragen und ihm ein Grab in geweihter Erde geschaufelt worden war. Dorthin wollte sie gehen, dort wollte sie graben, und sie schritt dahin in der Richtung, in der die Kirche lag, und es schien ihr dabei, als werde die Last ihr leichter, ja, sie verschwand, und da wollte sie wieder umkehren und auf dem kürzesten Wege nach Hause gehen, aber da faßte es sie wieder an: "Angeklammert! Angeklammert!" Es hörte sich an wie das Quaken der Frösche, wie das Klagen eines Vogels, nein, es klang ganz deutlich: "Ein Grab! Grab mir ein Grab!"
Der Nebel war kalt und feucht, Hand und Gesicht waren ihr kalt und naß vor Entsetzen, an ihren Körper faßte es und legte sich schwer darauf, in ihrem Innern öffnete sich ein unendlicher Raum für Gedanken, die niemals früher gekommen waren.
Hier im Norden schlägt der Buchenwald oft während einer einzigen Frühlingsnacht aus und steht im Tagessonnenschein da in seiner jungen, hellgrünen Pracht - in einer einzigen Sekunde kann in unserm Innern die Saat der Sünde in Gedanken, Worten und Taten aufgehen, die in unser bisheriges Leben gesät worden ist; sie sprießt empor und entfaltet sich während einer einzigen Sekunde, wenn das Gewissen erwacht, und Gott weckt es, wenn wir es am wenigsten vermuten. Alsdann ist nichts zu entschuldigen, die Tat ist da und zeugt wider uns; die Gedanken werden zu Worten, und die Worte klingen laut in die Welt hinaus. Wir entsetzen uns über das, was wir in uns getragen und nicht erstickt haben, über das, war wir in Übermut und Gedankenlosigkeit ausgesät haben. Das Herz birgt in sich alle Tugenden, aber auch alle Laster, und die gedeihen selbst auf kargstem Boden.
Anne Lisbeth hatte Raum für all die Gedanken, die wir hier in Worte gekleidet haben; sie war von ihnen überwältigt, sie brach zusammen und kroch eine Strecke auf der Erde hin. "Ein Grab, grab mir ein Grab!" ertönte es wieder, und am liebsten hätte sie sich selber begraben, wenn das Grab ein ewiges Vergessen jeglicher Tat wäre. Es war die ernste Stunde der Erweckung in Ängsten und Grauen. Der Aberglaube machte sie bald fröstelnd zittern, bald trieb er Fieberglut in ihr Blut. Gar vielen, von dem sie nie hatte reden mögen, kam ihr in den Sinn. Lautlos, wie die Wolkenschatten im hellen Mondenschein, fuhr eine gespenstische Erscheinung an ihr vorüber, sie hatte davon früher schon gehört. Dicht an ihr jagten vorüber vier schnaubende Rosse, das Feuer sprühte ihnen aus Augen und Nüstern, sie zogen eine glühende Kutsche, in der Kutsche saß der böse Gutsherr, der vor mehr als hundert Jahren in dieser Gegend sein Wesen getrieben hatte. Um jede Mitternacht, hieß es, fahre er in seinen Herrenhof hinein und kehre sogleich wieder um. Da! Da! Er war nicht bleich, wie man es von Toten sagt, nein, er war schwarz wie Kohle. Er nickte Anne Lisbeth zu und winkte ihr: "Angeklammert! Angeklammert! Dann kannst du wieder in gräflicher Kutsche fahren und kannst dein Kind vergessen. "
Sie raffte sich zusammen und eilte zum Kirchhof; aber die schwarzen Kreuze und die schwarzen Raben tanzten vor ihren Augen, und sie vermochte es nicht, die einen von den anderen zu unterscheiden. Die Raben schrien, wie der Rabe am Tage geschrien hatte, doch jetzt verstand sie, was sie schrien: "Ich bin die Rabenmutter! Die Rabenmutter" schrie jeder Rabe, und Anne Lisbeth wußte jetzt, daß dieser Name auch ihr galt; sie würde vielleicht in einen solchen schwarzen Vogel verwandelt werden und müßte vielleicht immerfort schreien, was die schrien, wenn sie das Grab nicht grübe.
Und sie warf sich auf die Erde, und sie grub mit ihren Händen ein Grab in den harten Boden, daß das Blut ihr aus den Nägeln sprang.
"Ein Grab, grab mir ein Grab!" tönte es immerfort, sie fürchtete, daß der Hahnenschrei und der erste rote Streifen im Osten kommen konnten, bevor sie ihre Arbeit beendigt hatte, dann war sie verloren.
Und der Hahn schrie, und es leuchtete im Osten auf - das Grab war nur halb gegraben; eine eisige Hand glitt über ihr Haupt und Antlitz hin bis in die Herzgrube. "Nur halbes Grab," seufzte es und entschwebte hinab auf den Meeresgrund, ja, es war der Strandgeist; Anne Lisbeth sank überwältigt und erstarrt zu Boden, alle Sinne schwanden ihr.
Es war heller Tag, als sie wieder zu sich kam, zwei Männer hoben sie auf; sie lag nicht auf dem Kirchhof, sondern unten am Meeresufer, und dort hatte sie ein tiefes Loch vor sich in den Sand gegraben und ihre Finger blutig geschnitten an einem zerbrochenen Glas, dessen scharfer Stiel in einem kleinen Holzklotz steckte. Anne Lisbeth war krank; das Gewissen hatte die Karten des Aberglaubens gemischt, hatte diese Karten gelegt und aus denselben herausbekommen, daß sie nunmehr nur eine halbe Seele hatte, die andere Hälfte hatte ihr Kind mit auf den Meeresgrund genommen; nimmer würde sie sich emporschwingen können zu der Gnade des Himmels, ehe sie nicht die andere Hälfte besäße, die festgehalten wurde in dem tiefen Wasser. Anne Lisbeth kam wieder in ihre Heimat, sie war nicht mehr dieselbe, die sie früher gewesen war, ihre Gedanken waren verwirrt wie verwirrtes Garn; nur einen Faden, nur einen Gedanken hatte sie frei gemacht, das war der, daß sie den Strandgeist zum Kirchhofe tragen und ihm ein Grab graben müsse, um dadurch ihre ganze Seele wieder zugewinnen.
Manche Nacht wurde sie in ihrer Wohnung vermißt, und immer fand man sie wieder an der Meeresküste, wo sie des Strandgeistes harrte; auf solche Weise verstrich ein ganzes Jahr, da verschwand sie wieder einmal eine Nacht, war aber nicht aufzufinden; der ganze folgende Tag verging mit vergeblichem Suchen.
Gegen Abend, als der Küster in die Kirche trat, um die Vesperglocke zu läuten, erblickte er dort vor dem Altar Anna Lisbeth, hier hatte sie seit dem frühesten Morgen verweilt; ihr Körper was fast unterlegen, aber ihre Augen strahlten, ihr Antlitz hatte einen rosigen Glanz, die letzten Sonnenstrahlen beschienen sie, strahlten über den Altar hin auf die blanken Beschläge der Bibel, die dort aufgeschlagen lag mit den Worten des Propheten Joel: "Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider, kehret um zum Herrn!" - "Das war nur so zufällig!" sagten die Leute, "Wie so vieles zufällig ist!"
Im Antlitz Anne Lisbeths, bestrahlt von der Sonne, war zu lesen von Frieden und Gnade. Ihr sei so wohl, sagte sie. Nun habe sie überwunden! Diese Nacht sei der Strandgeist, ihr eigenes Kind, bei ihr gewesen, er habe zu ihr gesagt: du grubst mir nur ein halbes Grab - aber du hast jetzt Jahr und Tag mich ganz in deinem Herzen begraben, und dort birgt eine Mutter ihr Kind am besten! Und darauf habe er ihr ihre verlorene Seele wiedergegeben und habe sie hier in die Kirche hineingeleitet.
"Jetzt bin ich in Gottes Haus!" sprach sie, "und in dem Hause ist man selig!" Als die Sonne ganz unten war, war Anne Lisbeths Seele ganz oben, wo keine Furcht ist, wenn man hier ausgelitten hat und Anne Lisbeth hatte ausgelitten.
DAS STUMME BUCH

An der Landstraße im Walde lag ein einsamer Bauernhof. Man mußte mitten durch den Hofraum hindurch. Da schien die Sonne, alle Fenster standen offen. Leben und Emsigkeit herrschte innen. Aber im Hofe, in einer Laube aus blühendem Flieder, stand ein offener Sarg. Der Tote war hier hinausgesetzt worden, denn am Vormittag sollte er begraben werden. Niemand stand und blickte voll Trauer auf den Toten, niemand weinte um ihn. Sein Gesicht war von einem weißen Tuche bedeckt und unter seinem Kopfe lag ein großes dickes Buch, dessen Blätter jedes ein ganzer Bogen aus grauem Papier waren. Und zwischen jedem lagen, verborgen und vergessen, verwelkte Blumen, ein ganzes Herbarium, das an verschiedenen Orten zusammengesucht war. Das sollte mit ins Grab, das hatte er selbst verlangt. An jede Blume knüpfte sich ein Kapitel seines Lebens.
"Wer ist der Tote?" fragten wir, und die Antwort war: "der alte Student von Upsala! Er soll einst ein tüchtiger Mann gewesen sein, gelehrte Sprachen verstanden, Lieder singen und schreiben gekonnt haben, sagt man. Aber dann ist ihm etwas in die Quere gekommen, und er ersäufte alle seine Gedanken und sich selbst mit im Branntwein. Und als seine Gesundheit zerstört war, kam er hier auf das Land hinaus, wo für ihn ein Kostgeld entrichtet wurde. Er war fromm wie ein Kind, wenn nicht der schwarze Sinn über ihn kam, denn dann gewann er seine Kräfte wieder und lief im Walde umher wie ein gejagtes Tier. Aber wenn wir ihn wieder zu fassen bekamen und ihn dazu brachten, in dies Buch mit den trocknen Pflanzen hineinzuschauen, konnte er den ganzen Tag sitzen und eine Pflanze nach der anderen anschauen. Und oftmals liefen ihm die Tränen über die Wangen dabei nieder. Gott mag wissen, an was er dabei dachte! Aber das Buch bat er mit in seinen Sarg zu legen, und nun liegt es dort, und um eine kurze Stunde soll der Deckel zugeschlagen werden und er wird sanft im Grabe ruhen."
Das Leichentuch wurde gelüftet; es lag Frieden über dem Antlitz des Toten. Ein Sonnenstrahl fiel darauf, eine Schwalbe schoß in ihrem pfeilschnellen Fluge in die Laube und wendete sich im Fluge zwitschernd über des Toten Haupt.
Wie wunderlich ist es doch – wir kennen gewiß alle das Gefühl – alte Briefe aus unserer Jugendzeit hervorzunehmen und sie wieder zu lesen. Da taucht gleichsam ein ganzes Leben vor uns auf, mit all seinen Hoffnungen, all seinen Sorgen. Wie viele von den Menschen, mit denen wir in jener Zeit so herzlich vertraut zusammen lebten, sind für uns gestorben, obwohl sie noch leben. Aber wir haben lange Zeit nicht mehr an sie gedacht, von denen wir einstmals glaubten, daß wir stets mit ihnen verbunden bleiben und Freude und Leid mit ihnen teilen würden.
Das welke Eichenblatt im Buche hier erinnert an den Freund, an den Freund aus der Schulzeit, den Freund für das ganze Leben. Er heftete dieses Blatt an die Studentenmütze im grünen Walde, als der Freundschaftspakt fürs ganze Leben geschlossen wurde. – Wo lebt er nun? – Das Blatt wurde bewahrt, die Freundschaft vergessen! – Hier ist eine fremdartige Treibhauspflanze, zu fein für die Gärten des Nordens – es ist, als sei noch ein Duft über diesen Blättern. Sie gab sie ihm, das Fräulein aus dem adligen Garten. Hier ist die Wasserrose, die er selbst gepflückt und mit salzigen Tränen begossen hat, die Wasserrose aus den süßen Gewässern. Und hier ist eine Nessel. Was sagen ihre Blätter? Woran dachte er, als er sie pflückte, als er sie aufbewahrte? Hier ist das Maiglöckchen aus der Waldeinsamkeit; hier ist Jelänger-Jelieber aus dem Blumentopf in der Wirtsstube, und hier sind nackte scharfe Grashalme. Der blühende Flieder breitet seine frischen, duftenden Dolden über des Toten Haupt, die Schwalbe fliegt wieder vorüber: "Quivit! Quivit!" – Nun kommen die Männer mit Nägeln und mit dem Hammer, der Deckel wird über den Toten gelegt, der sein Haupt auf dem stummen Buche ausruht. Verwahrt – vergessen.
