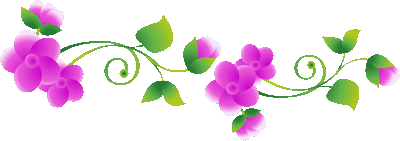MÄRCHEN AUS ITALIEN...
"Die große Lüge"
Das Rätsel"
"Der standhafte Büsser"
"Die beiden Gevattern"
"Mit Verstand durch die Welt"
"Die Männer von Cogolo"
"Die bestohlenen Diebe"
"Die Eselsleiche"
"Der Königssohn und die Bauerntochter"
"Beppo Pipetta"
"Cannetella"
"Corvetto"
"Das Mädchen im Schrein"
"Der Federkönig"
"Das Zauberpferd"
"Der Floh"
"Der Rabe"
"Der Waldmann"
"Der Zauberlehrling (1)
"Die Bärin"
"Der Höllenpförtner"
"Die drei Königskinder"
"Die guten Tage"
"Die Monate"
"Die drei Zitronen"
"Gagliuso"
"Herr Scarpacifico"
"Die sieben Tauben"
"Die sieben Speckschwarten"
"Die Schlange" (1)
"Die Schlange" (2)
"Der Pilger"
"Vardiello"
"Das Milchmädchen"
"Der Kaufmannssohn aus Livorno"
"Der Kaufmannssohn aus Genua"
"Die zwei ungleichen Brüder"
"Der Erdegang des Erlösers"
"Bauer Wahrhaft"
"Beutel, Mäntelchen und Wunderhorn"
"Die schöne Rosenblüte"
"Die Prinzessin im Apfel"
"Wie der Teufel den heiligen Franziskus plagte"
"Das goldene Schachspiel"
"Das Lavendelstöckchen"
"Bifara"
"Der Zauberlehrling" (2)
"Die drei Bäumchen oder die drei befreiten Jungfrauen"
"Das schwarze Ei", von Luigi Capuana
"Das Kind der Geschwister"
"Der listige Knecht"
"Der Gevatter Tod"
"Soldatino"
"Nennillo und Nennella"
"Die gedemütigte Königstochter"
"Der Königssohn als Bäcker"
"Der Bauernsohn"
"Der Zauberer Virgil"
"Die weiße Zwiebel"
"Vom Cacciaturino"
"Der böse Schulmeister und die wandernde Königstochter"
"Vom Hahn und der Maus"
"Die Affen"
"Die goldene Wurzel"
"Der goldene Adler"
"Romulus und Remus"
"Die Elster"
"Die drei Märchen des Papageien"
"Die beiden Fürstenkinder von Monteleone"
"Die drei Orangen"
"Die böse Gräfin"
"Die drei Schwestern"
"Die vier Königskinder"
"Die Gabe des Nönnleins"
"Vom Lignu di Scupa"
"Von Bensurdatu"
"Von Ciccu"
"Von Caterina und ihrem Schicksal"
"Von Caruseddu"
"Von Feledico und Epomata"
"Die Kaiserin Trebisonda"
"Die Schöne mit den sieben Schleiern"
"Lichtmess"
"Die Zauberkugeln"
"Schneeweiß-Feuerrot"
"Vom Joseph, der auszog sein Glück zu suchen"
"Der Drache"
"Vom Sant´ Oniriá oder Neriá"
"Die goldene Säule"
"Die Bärtige"
"Das Rothhütchen"
"Das Aschenbrödel"
"Die silberne Nase"
"Das Pfeifchen"
"Der goldhaarige Prinz"
"Die drei seltenen Stücke"
"Der Prinz mit den goldenen Haaren"
"Vom Löwen, Pferd und Fuchs"
"Die Heirat mit der Hexe"
"Die vier kunstreichen Brüder"
"Von Autumunti und Paccaredda"
"Die Sprache der Tiere"
"Vom tapferen Königssohn"
VOM TAPFEREN KÖNIGSSOHN ...

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder und hätten doch so gerne einen Sohn oder eine Tochter gehabt. Da ließ der König einen Sterndeuter kommen, der sollte ihm wahrsagen, ob die Königin wohl ein Kind gebären würde.
Der Sterndeuter antwortete: »Die Königin wird einen Sohn gebären; wenn er aber erwachsen ist, wird er euch den Kopf abschneiden.« Da erschrak der König und ließ in einer einsamen Gegend einen hohen Turm bauen ohne Fenster. Als nun die Königin einen Sohn gebar, ließ er ihn mit seiner Amme in den Turm einsperren. Nun lebte das Kind in dem Turm und wuchs einen Tag für zwei, und wurde immer stärker und schöner. Er kannte aber nur die Amme und hielt sie für seine Mutter.
Nun begab es sich eines Tages, daß er ein Stück Zicklein aß und darin einen spitzen Knochen fand. Den verwahrte er und fing an damit zum Spaß die Mauer aufzukratzen. Das Spiel gefiel ihm und er setzte es fort, bis er ein kleines Loch gebohrt hatte, durch das ein Sonnenstrahl in sein Zimmer fiel. Ganz verwundert grub er weiter und bald war das Loch so groß, daß er den Kopf hinaus stecken konnte.
Als er nun das schöne Feld mit den tausend Blumen sah und den blauen Himmel und das weite Meer, rief er seine Amme und frug sie, was denn das alles sei. Da erzählte sie ihm von den großen Ländern, die es gebe und von den schönen Städten, also daß er eine unwiderstehliche Sehnsucht bekam, in das Weite zu ziehen und alle diese Wunder selbst zu sehen.
»Liebe Mutter,« sprach er, »ich halte es in dem finstern Turm nicht mehr aus, wir wollen fort und die Welt besehen.« »Ach mein Sohn,« sprach die Amme, »was willst du in die weite Welt ziehen? Hier haben wir es ja gut, wir wollen lieber hier bleiben.« Er bat sie aber inständigst, sie möchte doch mit ihm gehen, und weil sie ihn so lieb hatte und ihm nichts abschlagen konnte, so gab sie denn endlich nach, schnürte ihr Bündelchen und zog mit ihm in die weite Welt.
Als sie viele Tage lang gewandert waren, kamen sie eines Tages in eine ganz einsame Gegend, wo sie nichts zu essen fanden. Da sie nun dem Verschmachten nahe waren, sahen sie in der Ferne ein schönes Schloß stehen und gingen darauf zu, um sich etwas Speise zu erbitten. Als sie aber an das Schloß kamen, war weit und breit kein Mensch zu sehen. Sie stiegen die Treppe hinauf und schritten durch alle Zimmer, es war aber niemand da.
In einem Zimmer war ein Tisch mit köstlichen Speisen gedeckt. »Mutter,« sprach der Königssohn, »es ist ja doch niemand hier. Wir wollen uns hinsetzen und essen.« Also setzten sie sich hin und nahmen von den Speisen, dann betrachteten sie die Zimmer und alle die Reichtümer, die sie enthielten.
Auf einmal sah die Amme von Weitem eine Schar Räuber kommen. »Ach, mein Sohn,« rief sie, »das sind gewiss die Besitzer dieses Schlosses, wenn sie uns hier finden, so schlagen sie uns gewiss tot.« Da nahm der Königssohn schnell eine vollkommene Rüstung, und legte sie an, nahm das beste Schwert von der Wand, wählte im Stall das beste Pferd und erwartete so bewaffnet die Ankunft der Räuber.
Als diese nun näher kamen, begann er zu kämpfen und weil er so stark war, so machte er sie alle tot, bis auf den Räuberhauptmann. »Laß mich leben,« rief ihm dieser zu, »so will ich deine Mutter heiraten und du sollst mein lieber Sohn sein.« Da ließ der Königssohn den Räuberhauptmann leben, und der heiratete die Amme.
Er konnte es aber nicht vergessen, daß ihm der Königssohn alle seine Gefährten umgebracht hatte und da er sich vor seiner riesen mäßigen Kraft fürchtete, so sann er darauf, wie er ihn durch eine List verderben könnte. Da rief er seine Frau und sprach: »Dein Sohn ist mir zuwider und ich will ihn mir aus den Augen schaffen. Stelle dich krank und sage ihm, es könnte dich nichts heilen als einige Zitronen, so will ich ihn schon in einen Garten schicken, aus dem er nicht zurück kehren soll.«
Die Amme weinte bitterlich und sprach: »Wie könnte ich meinen Sohn ins Verderben bringen? Lasst ihn doch leben, er hat euch ja nichts getan.« Der Mann aber drohte ihr: »Wenn du es nicht tust, so schlage ich euch Beiden den Kopf ab.« Da mußte sie wohl gehorchen und stellte sich krank. »Liebe Mutter, was fehlt euch?« frug der Königssohn.
»Sagt mir doch, ob ihr nach irgend etwas ein Gelüste habt, so will ich es euch verschaffen.« »Ach, lieber Sohn,« antwortete sie, »wenn ich nur ein paar Zitronen hätte, so würde ich gewiss genesen.« »Ich will sie euch holen, liebe Mutter!« rief der Jüngling. »Weißt du, wo du schöne Zitronen findest?« sprach nun der Stiefvater. »Du mußt in den und den Garten gehen,« und wies ihm einen Garten an, der lag weit weg in einer einsamen Gegend und wurde von wilden Tieren bewacht.
Als nun der Königssohn hinein dringen wollte, stürzten sich die Tiere auf ihn und wollten ihn zerreißen. Er aber zog sein Schwert und machte sie alle tot. Dann pflückte er ruhig einige Zitronen und kehrte wohlgemut nach Hause zurück. Als ihn sein Stiefvater kommen sah, erschrak er sehr und frug ihn, wie es ihm ergangen sei. »O,« antwortete der Jüngling, »in dem Garten war eine große Schar wilder Tiere, ich habe sie aber alle umgebracht.«
Der Räuberhauptmann erschrak noch mehr und konnte den Königssohn immer weniger leiden. Da sprach er wieder zu seiner Frau: »Dein Sohn ist mir zuwider und ich will ihn mir aus den Augen schaffen. Stelle dich krank und bitte ihn, dir einige Orangen zu holen.« »Nein, nein,« sprach die Amme, »das tue ich nicht wieder. Lasst den armen Jungen doch leben.«
Da drohte ihr der Mann, daß sie endlich doch gehorchen mußte und sich krank stellte. »Liebe Mutter, seid ihr wieder krank?« frug sie der Königssohn. »Ihr wünscht euch gewiss irgend etwas. Sagt mir nur was, so will ich es euch holen.« »Ach mein Sohn,« antwortete sie, »hätte ich doch nur einige Orangen, um meinen brennenden Durst zu löschen.« »Ist das Alles,« rief er, »die will ich euch schon holen.«
Da wies ihn der Stiefvater in einen anderen Garten, der war von noch wilderen Tieren bewacht, die wollten sich auf ihn werfen und ihn zerreißen. Er aber zog sein Schwert und brachte sie alle um, dann brach er ruhig einige der schönsten Orangen ab und brachte sie seiner Mutter.
Der Räuberhauptmann erschrak über die Maßen, als er ihn kommen sah und er ihm erzählte, wie er die Tiere alle umgebracht habe, und weil er sich vor ihm fürchtete, so wuchs auch sein Haß und er trachtete nur, wie er ihn los werden könnte. Da befahl er wieder seiner Frau sich krank zu stellen und dann sollte sie dem Königssohne sagen, es könne ihr nichts helfen, als ein Fläschchen vom Schweiß der Zauberin Parcemina.
Die Amme weinte und wollte es durchaus nicht tun, aber ihr Mann drohte ihr und sie mußte wohl gehorchen. Da stellte sie sich krank und als der Königssohn zu ihr kam, stöhnte sie: »Ach, was bin ich so krank, was bin ich so krank.« »Mutter,« sprach der Jüngling, »gibt es denn nichts, das euch Genesung verschaffen kann? Sagt es mir doch, so will ich die ganze, weite Welt durchwandern und es suchen.«
»Ach, mein Sohn,« antwortete die Amme, »wohl gibt es ein Mittel. Hätte ich ein Fläschchen von dem Schweiß der Zauberin Parcemina, so würde ich wohl genesen.« »Mutter,« rief er, »ich will ausziehen und das Mittel suchen, und wenn es irgendwo in der Welt zu finden ist, so will ich es euch bringen.«
Da zog er fort, und weil er den Weg nicht wußte, so wanderte er aufs Geratewohl viele Tage lang, bis er in einen finstern Wald kam. Dort verirrte er sich und als es Abend wurde, fand er keinen Ausweg mehr. Auf einmal erblickte er in der Ferne ein Licht, und als er sich näherte, sah er eine kleine Hütte, darin wohnte ein Einsiedler.
Er klopfte an und ein ganz alter Mann öffnete ihm, und frug nach seinem Begehr. »Ach, Vater,« antwortete er, »ich habe mich verirrt und bitte euch nun, laßt mich die Nacht hier zubringen.« »O, mein Sohn,« antwortete der Alte, »wie kommst du denn in diese Wildnis zu dieser Stunde?« »Meine Mutter ist krank,« erwiderte er, »und nichts kann ihr helfen, als ein Fläschchen von dem Schweiß der Zauberin Parcemina. So bin ich denn ausgezogen, es ihr zu holen.«
»O mein Sohn, laß ab von deinem törichten Vorhaben,« sagte der Alte. »So viele Prinzen haben es schon versucht, und keiner ist zurückgekehrt.« Der Königssohn aber ließ sich nicht überreden, und als der Morgen graute, wollte er wieder von dannen ziehen.
Da gab ihm der Einsiedler eine Kastanie und ein Fläschchen, und sprach zu ihm: »Ich kann dir nicht raten und helfen, eine Tagesreise weiter im Walde wohnt aber mein älterer Bruder; der kann dir vielleicht etwas sagen. Diese Kastanie aber verwahre wohl, sie wird dir einst nützen. Wenn es dir nun gelingt, den Schweiß zu finden, so bringe auch mir ein Fläschchen davon mit.« Dann gab er ihm seinen Segen und ließ ihn ziehen.
Nachdem er den ganzen Tag gewandert war, sah er am Abend wieder in der Ferne ein Licht, und als er näher ging, sah er die Hütte, in welcher der zweite Einsiedler wohnte. Da klopfte er an, und der Einsiedler öffnete ihm, der war noch älter als der erste. Da erzählte ihm der Königssohn, warum er in dem finstern Walde umherwandere, und auf alle Weise versuchte ihn der Einsiedler von seinem Vorhaben abzubringen, aber vergebens.
Am nächsten Morgen sprach nun der Einsiedler: »Ich kann dir nicht helfen; eine Tagesreise tiefer im Wald wohnt aber mein Bruder, der ist noch viel älter als ich, der kann dir vielleicht raten. Nimm diese Kastanie und verwahre sie wohl, sie wird dir einst nützen. Und wenn es dir gelingt, den Schweiß der Zauberin Parcemina zu erlangen, so bringe auch mir ein Fläschchen voll mit.« Damit gab er ihm eine Kastanie, ein Fläschchen und seinen Segen und ließ ihn ziehen.
Spät am Abend kam der Königssohn wiederum zu einem Einsiedler, der war noch viel älter als seine Brüder, und hatte einen großen weißen Bart. Als er nun hörte, wohin der Jüngling gehen wolle, versuchte auch er es, ihn von seinem Vorhaben abzubringen, aber vergebens; der Königssohn wollte nicht ohne den Schweiß der Zauberin Parcemina nach Hause zurückkehren.
Als ihn nun der Einsiedler am nächsten Morgen wieder entließ, gab auch er ihm eine Kastanie und ein Fläschchen, und wies ihn an seinen vierten Bruder, der wohnte noch eine Tagesreise tiefer im Wald.
Da wanderte der Königssohn wieder einen ganzen Tag in den Wald hinein, und als es Abend wurde, kam er zum vierten Einsiedler. Der wohnte nicht einmal in einer Hütte, sondern in einem Korb, der zwischen den Zweigen eines hohen Baumes hing, und er war so steinalt, daß sein langer weißer Bart über den Korb hinaus hing und fast bis an die Erde reichte.
Auch er fragte den Königssohn nach seinem Begehr, und der Jüngling erzählte ihm warum er so weit her gewandert sei. »Lagere dich unter den Baum,« sprach der Einsiedler, »morgen früh will ich dir sagen, was du zu tun hast.«
Am nächsten Morgen weckte der Einsiedler den Königssohn und sprach zu ihm: »Willst du denn durchaus dein Glück versuchen, so gehe mit Gott. Sieh jenen steilen Berg, den mußt du ersteigen. Auf dem Gipfel steht ein Garten mit einem Brunnen und dahinter ein wunderschönes Schloß, dessen Türe verschlossen ist. Die Schlüssel aber liegen auf dem Rande des Brunnens.
Hole sie und schließe leise die Türe auf, steige die Treppe hinauf und schreite durch alle die Zimmer. Hüte dich aber wohl, irgend etwas anzurühren von alle den Schätzen, die da umherliegen. Im letzten Zimmer wirst du eine wunderschöne Frau finden, die auf einem Ruhebett liegt und schläft. Das ist die Zauberin Parcemina, und der Schweiß fließt in Strömen von ihrem Gesicht.
Knie neben ihr nieder, sammle mit einem Schwämmchen den Schweiß, und drücke ihn in deine Fläschchen aus. Sobald sie voll sind, so entfliehe so schnell du kannst. Sei vorsichtig und flink, und Gott sei mit dir.« Damit segnete er ihn, und der Königssohn zog von dannen, dem steilen Berg zu. Je weiter er hinaufstieg, desto steiler wurde der Berg, aber er dachte an seine Mutter, und schritt mutig weiter.
Endlich gelangte er auf den Gipfel, und fand da alles, wie der Einsiedler ihm vorhergesagt hatte. Also nahm er schnell die Schlüssel von dem Rand des Brunnens, schloß das Tor auf, stieg die Treppe hinauf und schritt eilends durch alle Zimmer. Im letzten Saal fand er die Zauberin Parcemina, die auf einem Ruhebett lag und schlief, und der Schweiß floß in Strömen von ihrem Gesicht.
Da kniete er nieder, nahm das Schwämmchen, sammelte damit den Schweiß, der hernieder floss, und drückte ihn schnell in seine Fläschchen aus. Sobald sie voll waren, entfloh er so schnell er konnte. Als er nun das Tor verschloss, erwachte die Zauberin Parcemina und stieß einen durchdringenden Schrei aus, um die anderen Zauberinnen zu wecken.
Aber obgleich sie erwachten, konnten sie doch dem Königssohn nichts anhaben, denn er war mit einigen großen Sätzen den Berg hinunter gesprungen. Zuerst ging er nun wieder zum ältesten Einsiedler und dankte ihm für seine Hilfe. »Höre mein Sohn,« sprach der Greis, »du kehrst nun zu deinen Eltern zurück, und damit du schneller reisen kannst, gebe ich dir diesen Esel und diesen Quersack.
Wenn du nun zu deinem Stiefvater kommst, so wird er in große Wut geraten, daß dir dein Wagestück gelungen ist, und wird dich angreifen. Lass alles ruhig geschehen, und bitte ihn nur, wenn er dich umgebracht habe, möge er dich in den Quersack stecken, und auf den Esel laden.«
Nun setzte sich der Königssohn auf den Esel und ritt nach Hause; im Vorbeireiten aber überbrachte er den drei Einsiedlern ihre Fläschchen. Als er nun in die Nähe seines Hauses kam, sah ihn der Stiefvater schon von Weitem kommen, und ein grimmiger Zorn erfüllte ihn. Drohend näherte er sich ihm, und fing an, ihm Vorwürfe zu machen, daß er zu lange ausgeblieben sei.
»Vater,« antwortete der Königssohn, »ich sehe es wohl, ihr könnt mich nicht leiden, und wollt euren Zorn an mir auslassen. So tut denn mit mir, was ihr wollt, erfüllt mir nur eine Bitte: wenn ich tot bin, so steckt mich in diesen Quersack und bindet mich auf meinem Esel fest, daß er mich in die weite Welt hinaustrage.« Dann ergab er sich wehrlos seinem Stiefvater, der ihn im Zorn trat und stieß, endlich ihm den Kopf abschnitt, und den Körper in lauter kleine Stücke hackte.
Als er aber seine Wut gekühlt hatte, dachte er, er könnte wohl den letzten Willen des armen Jünglings erfüllen. Also steckte er alle die Stücke in den Quersack, und band ihn auf dem Esel fest. Kaum aber fühlte der Esel seine Last, so rannte er spornstreichs davon und lief ohne Aufhören, bis er zu dem alten Einsiedler kam, der ihn dem Königssohn geschenkt hatte.
Der nahm die Stücke aus dem Quersack, legte sie sorgfältig zusammen, und machte den Jüngling wieder lebendig. Dann sprach er zu ihm: »Höre, mein Sohn, zu deinen Eltern kannst du nun nicht zurück kehren. Sie sind aber ohnehin nicht deine Eltern. Denn du bist ein Königssohn, und dein Vater herrscht noch in dem und dem Reich. So ziehe nun hin, und kehre zu deinen Eltern zurück.«
Da machte sich der Königssohn auf, und wanderte, bis er in das Reich seines Vaters kam. Ehe er aber in die Stadt trat, vertauschte er seine Rüstung mit armseligen Lumpen, und band sich den Kopf in ein Tuch ein. Dann sagte er zu den Leuten, »ich habe einen bösen Grind.« Da nannten ihn bald alle Leute den »Grindkopf.«
Als er nun in die Stadt kam, sah er, daß alle Häuser festlich geschmückt waren, und viel Volk zog vor das königliche Schloß. Da frug er einen Mann auf der Straße, was denn los sei. »Heute ist ein großer Festtag,« antwortete der, »denn in einer Stunde wird der König von der Spitze des Turmes ein weißes Tuch herab flattern lassen, und auf wen das Tuch sich legen wird, der soll die Königstochter heiraten.«
Da erfuhr der Königssohn erst, daß er eine Schwester habe er ließ sich aber nichts merken, sondern sagte nur: »So? da will ich auch hingehen, und sehen, ob das Tuch vielleicht auf mich hernieder schweben wird.« Die Leute lachten ihn aus, und riefen: »Nein, seht doch, da will der Grindkopf die schöne Königstochter heiraten;« er aber kehrte sich nicht daran, sondern mischte sich unter das Volk, und siehe da, als der König das weiße Tuch herab warf, blieb es auf dem schmutzigen Grindkopf liegen.
Da wurde er vor den König gebracht, und ob die Königstochter auch weinte, so mußte sie ihn doch zum Manne nehmen, und das Hochzeitsfest sollte am Abend gefeiert werden. Der Königssohn aber ging zum Geistlichen und sprach: »Ehrwürdiger Herr, ihr sollt mich heut Abend mit der Königstochter trauen, sprecht aber die bindende Formel nicht aus; denn im Vertrauen will ich es euch sagen, daß sie meine Schwester ist. Verratet mich aber nicht, denn der Augenblick ist noch nicht gekommen, wo ich mich zu erkennen geben kann.«
Am Abend wurde die Hochzeit gefeiert, der Königssohn aber blieb in seinen schmutzigen Lumpen, und wollte sich weder waschen noch sauber anziehen. Als nun das junge Paar in die Kammer geführt wurde, brummte er: »Auf einem so feinen Bett kann ich nicht schlafen; werft mir hier an den Boden eine Matratze hin.« Da taten sie ihm den Willen, und er schlief immer in seinem Winkel auf der Matratze.
Nun begab es sich eines Tages, daß ein Krieg ausbrach, und vor den Toren der Stadt lagen die Feinde, und es sollte eine Schlacht geschlagen werden. Da zog der alte König auch in die Schlacht, und die Königstochter sprach zum Königssohn: »Meine Mutter und ich wollen der Schlacht von den Mauern aus zu sehen; willst du mitkommen?«
»Laß mich doch in Ruhe,« brummte er, »es ist mir ohnehin einerlei, wer den Sieg erringt.« Kaum aber waren sie fort, so biss der Königssohn eine der Kastanien auf, welche ihm die Einsiedler gegeben hatten, und fand darin eine vollständige Rüstung, wie man sie nicht schöner sehen konnte, und ein Pferd, wie es der König nicht besser hatte.
Da wusch er sich, legte die Rüstung an, und stürmte hinaus in die Schlacht, wo die Truppen des Königs schon anfingen zu weichen. Doch sein Erscheinen erfüllte die Ritter mit neuem Mut und die Feinde wurden geschlagen. Als aber der König den fremden Ritter zu sich beschied, um ihm für seine Hilfe zu danken, war der selbe verschwunden; und der Königssohn saß wieder in seinem Winkel, in seine schmutzigen Lumpen gehüllt.
Am anderen Tage kamen die Feinde mit neuen Kräften wieder, und der König mußte ihnen nochmals eine Schlacht liefern. Die Königstochter ging mit ihrer Mutter wieder auf die Mauer, und kaum waren sie alle fort, so biss der Königssohn seine zweite Kastanie auf, und fand darin eine Rüstung und ein Pferd, die waren noch schöner als die vom Tage zuvor.
Nun stürmte er wieder in die Schlacht und auch heute entschied erst sein Erscheinen den Sieg zu Gunsten des Königs. Nach der Schlacht verschwand er eben so spurlos wie am ersten Tage. Es hatte ihn aber eine Lanze am Bein verwundet. Am Abend nun bemerkte die Königstochter, daß der Grindkopf sein Bein verband, und frug ihn, was er da habe. »Nichts,« antwortete er, »ich habe mich gestoßen.«
Sie erzählte es aber am anderen Tage ihren Eltern, und sprach: »Sollte das nicht der unbekannte Ritter sein, der uns so treulich geholfen hat?« Der König und die Königin aber lachten sie aus.
Nun mußte der König zum dritten Mal seinen Feinden eine Schlacht liefern, und als alle fort waren, biss der Königssohn schnell die dritte Kastanie auf, und fand darin eine Rüstung und ein Pferd, die waren noch die aller schönsten. Als er in der Schlacht erschien, wurde wieder das Glück dem Könige günstig, und er schlug die Feinde so gut, daß sie nicht wiederkamen. Der fremde Ritter jedoch verschwand eben so schnell, als an den beiden ersten Tagen.
Am Abend war ein großes Fest am Hofe, um die herrlichen Siege zu feiern, und die Königstochter schmückte sich auch, und sprach zum Grindkopf: »Da sind königliche Kleider für dich; willst du dich nicht schmücken und auch zum Fest kommen?« »Lass mich in Ruhe,« brummte er, »was soll ich auf euren Festen?«
Kaum aber war sie fort, so wusch er sich, legte die königlichen Kleider an, und trat in den erleuchteten Saal, und da war er ein so schöner Jüngling, daß ihn alle ganz verwundert anschauten. Da trat er zum König und sprach: »Ich bin der schmutzige Grindkopf; ich bin aber auch der unbekannte Ritter, der dreimal in der Schlacht erschienen ist.«
Da umarmte ihn der König und dankte ihm, er aber sprach: »Ich bin auch zu gleich euer Sohn, lieber Vater.« Da erschrak der König und sprach: »Wie konntest du dann die Sünde begehen, deine Schwester zu heiraten?« Er aber antwortete: »Beruhigt euch, lieber Vater, ich bin mit meiner Schwester nicht verheiratet, der Pater kann es euch bezeugen.«
Als nun der Geistliche es bezeugt hatte, war die Freude erst recht groß, und der König und die Königin freuten sich sehr über ihren schönen Sohn. Da lebten sie glücklich und zufrieden, wir aber gehen leer aus.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DIE SPRACHE DER TIERE ...
Ein Vater hatte seinen Sohn zehn Jahre bei den Studien. Nach diesen zehn Jahren schrieb ihm der Lehrer des Sohnes einen Brief, daß er kommen und den Knaben zurück nehmen möge, da er nicht mehr wisse, was er ihn lehren solle. Der Vater nahm seinen Sohn zurück und gab ihm zu Ehren ein großes Gastmahl, zu dem er die vornehmsten Herren des Landes einlud.
Nach vielen Reden dieser Herren sagte einer der Gäste zu dem Sohn: »Nun, junger Herr, sagen Sie uns etwas Schönes von dem, was Sie gelernt haben.« – »Ich habe die Sprache der Hunde, der Frösche und der Vögel gelernt.« – Auf diese Worte brachen alle in ein großes Gelächter aus und gingen fort, spottend über den Stolz des Vaters und die Einfalt des Sohnes.
Über dessen Antwort schämte sich der Vater so und geriet in solchen Zorn gegen ihn, daß er ihn zwei Dienern übergab mit dem Befehl, ihn in einen Wald zu führen und zu töten, darauf ihm sein Herz zu bringen. Die beiden Diener hatten nicht den Mut, diesen Befehl auszuführen und töteten statt des Jünglings einen Hund, dessen Herz sie ihrem Herrn brachten.
Der Jüngling floh aus dem Lande und kam in ein sehr entferntes Schloß, wo der Schatzmeister des Fürsten wohnte, der unermessliche Schätze besaß. Er bat um Herberge und erhielt sie. Kaum aber war er im Hause, so umringte eine große Menge Hunde das Schloß. Der Schatzmeister fragte ihn, ob er wisse, weshalb so viele Hunde gekommen wären. Der Jüngling, der ihre Sprache verstand, antwortete, es wolle sagen, daß diesen Abend hundert Mörder das Schloß angreifen würden und daß er sich vorsehen möge.
Der Schloßherr legte darauf zweihundert Soldaten in Hinterhalt ringsum das Schloß, und abends nahmen sie die Mörder gefangen. Der Schloßherr war so voll Dank gegen den Jüngling, daß er ihm seine Tochter geben wollte. Er aber erwiderte, jetzt könne er sich nicht aufhalten, aber in einem Jahr und drei Tagen werde er zurück kehren.
Als er dann das Schloß verlassen hatte, kam er in eine Stadt, wo die Tochter des Königs sehr krank war, weil die sehr zahlreichen Frösche in einem Weiher nahe beim Palast mit ihrem Quaken sie nicht schlafen ließen. Der Jüngling verstand, daß die Frösche so quakten, weil das Mädchen ein Kreuz in den Weiher geworfen hatte, und kaum war das Kreuz heraus geholt, so genas die Prinzessin. Auch der König wollte den braven Jüngling mit seiner Tochter vermählen, der aber sagte auch hier, in einem Jahr und drei Tagen werde er wieder kommen. Er grüßte dann den König und reiste weiter auf dem Wege nach Rom.
Unterwegs traf er zwei Jünglinge, die sich ihm anschlossen. Eines Tages, da eine große Hitze war, legten sich alle drei zum Schlafen unter eine Eiche. Auf einmal flog ein großer Vogelschwarm auf die Eiche und sang so laut, daß die drei Wanderer aufwachten. »Warum singen diese Vögel so lustig?« fragte einer. – Der Jüngling antwortete: »Sie freuen sich über den neuen Papst, der einer von uns sein wird.« – Und sogleich setzte sich eine Taube ihm aufs Haupt.
Wirklich wurde er kurz darauf Papst. Dann schickte er nach seinem Vater, dem Schatzmeister und dem König, und alle drei erschienen zitternd vor ihm, weil sie wußten oder glaubten, sich irgendwie gegen ihn vergangen zu haben. Der Papst aber ließ sie von ihrem Leben erzählen, wandte sich dann zu seinem Vater und sagte: »Ich bin der Sohn, den du hast wollen töten lassen, weil ich gesagt hatte, ich verstünde die Sprache der Hunde, der Frösche und der Vögel. So hast du an mir getan, während ein Schatzmeister und ein König mir außerordentlich dankbar waren für dies mein Wissen.« –
Der Vater weinte bitterlich vor Reue, der Sohn aber verzieh ihm und behielt ihn bei sich bis an seinen Tod.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Monferrato
VON AUTUMUNTI UND PACCAREDDA ...
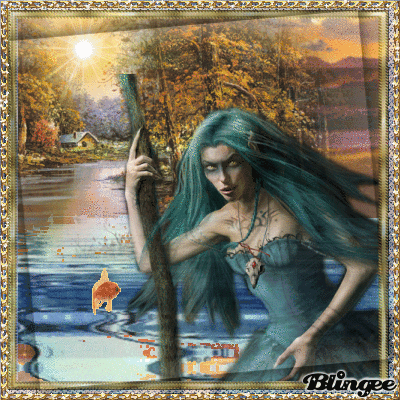
Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten ein schönes großes Reich. Sie hatten aber keine Kinder, und hätten doch so gerne einen Sohn gehabt, um ihm das Reich zu lassen. Da wandte sich die Königin an die Mutter Gottes von Autumunti, und sprach: »Heilige Mutter, wenn ihr mir einen Sohn gewährt, so will ich ihn Autumunti heißen, und euch sein Gewicht in Gold schenken.«
Ein Jahr war noch nicht vergangen, als die Königin einen wunderschönen Knaben gebar, und ihn Autumunti nannte. Das Gold aber schickte sie der Mutter Gottes nicht, sondern dachte: »Das hat immer noch Zeit, ich kann es ja auch einen anderen Tag schicken.«
Autumunti wuchs heran, und wurde mit jedem Tage schöner und stärker. Da er nun sieben Jahr alt geworden war, erschien ihm einmal die Mutter Gottes im Traum und sprach zu ihm: »Autumunti, sage deiner Mutter, sie solle ihres Gelübdes gedenken.« Am anderen Morgen erzählte Autumunti seiner Mutter, es sei ihm eine schöne liebliche Frau im Traum erschienen, und habe ihm das und das gesagt.
»Ach, Kind,« sprach die Königin, »das war die Mutter Gottes, die mahnt mich daran, daß ich gelobt habe, ihr dein Gewicht in Gold zu schenken, wenn du mir beschert würdest.« Da ließ die Königin aus der Schatzkammer einen Klumpen Goldes holen, der war so schwer als Autumunti, und sprach: »Mache dich auf, mein Kind, und bringe selbst das Gold zur Mutter Gottes von Autumunti.«
Also machte sich der Knabe auf, und brachte der Mutter Gottes das Gold, weil er aber noch so klein war, verirrte er sich auf dem Heimwege, und konnte den Weg nicht zurück finden. Endlich kam er an ein Haus, und weil er hungrig und durstig war, klopfte er an; in dem Hause aber wohnten der Menschenfresser und seine Frau. Zu denen war einige Zeit vorher ein wunderhübsches kleines Mädchen gekommen, das hieß Paccaredda und hatte sich auch verirrt.
Als der Menschenfresser die kleine Paccaredda sah, wollte er sie fressen, seine Frau aber fand Gefallen an dem schönen Kind, und sagte, sie wollten es bei sich behalten, als ihre kleine Magd. Also blieb Paccaredda bei dem Menschenfresser und seiner Frau, und diente ihnen, und die Hexe hatte sie sehr lieb, und hielt sie wie ihr eigenes Kind.
Als nun Autumunti an die Tür klopfte, machte ihm die Hexe auf, und dachte: »Nein, was für ein schönes Kind, das gibt einen herrlichen Braten.« Der Menschenfresser aber erbarmte sich des schönen Knaben, und sprach: »Als Paccaredda kam, hast du mir nicht erlaubt, sie zu fressen. Jetzt will ich auch nicht, daß du den Autumunti frisst, sondern er soll bei uns bleiben und uns dienen.« Also blieb auch Autumunti bei dem Menschenfresser und seiner Frau, und diente ihnen.
Die alte Hexe aber konnte ihn nicht recht leiden, und trug ihm immer schwere Arbeiten auf. Eines Tages ging sie in den Wald, und band ein großes Bündel Holz zusammen, und ließ es liegen, und als sie nach Hause kam, schickte sie den armen kleinen Autumunti hin, er solle das Holz holen. Paccaredda aber sprach zu ihm: »Wenn dir das Bündel zu schwer ist, so sprich nur: 'Holz, mache dich leicht, aus Liebe zu meiner Schwester Paccaredda.'«
Da ging Autumunti in den Wald, und als er das große Holzbündel sah, erschrak er, denn er konnte es nicht einmal aufheben, geschweige denn nach Hause tragen. Er sprach aber: »Holz, mache dich leicht, um meiner Schwester Paccaredda willen,« und siehe da, das Holz wurde so leicht, daß er es ohne Mühe nach Hause tragen konnte.
Wenn ihm die alte Hexe nun eine schwere Last zu tragen gab, so sprach er seinen Spruch, und als bald wurde sie leicht. So wuchsen Autumunti und Paccaredda heran, und kamen nach und nach in das Alter der Vernunft. Da sie nun Gefallen an einander fanden, sprach eines Tages Autumunti: »Weißt du, Paccaredda, ich bin eines großen Königs Sohn. Wir wollen entfliehen, und zu meinem Vater gehen, und uns dann heiraten.«
Paccaredda war es zufrieden, und in der Nacht, als der Menschenfresser und seine Frau fest schliefen, entflohen die Beiden mit einander. Als die Hexe am Morgen erwachte, war Paccaredda ihr erster Gedanke, sie mochte sie aber rufen, so viel sie wollte, Paccaredda kam nicht. Da sie nun gewahr wurde, daß Beide fehlten, geriet sie in einen heftigen Zorn, weckte den Menschenfresser und rief: »Dieser Autumunti, den du wie einen Sohn behandelt hast, ist mit meiner armen Paccaredda fortgelaufen. Schnell, mache dich auf und verfolge die Beiden.«
Da machte sich der Menschenfresser auf, und weil er viel schneller laufen konnte, als die beiden Flüchtlinge, so hatte er sie bald eingeholt. »Ach, Paccaredda,« rief Autumunti, »der Menschenfresser ist ganz dicht hinter uns!« »Sei nur ruhig,« antwortete sie, »ich werde zum Garten und du zum Gärtner darin.«
Da wurde sie in einen Garten verwandelt, und Autumunti in den Gärtner, und als der Menschenfresser herbei kam, frug er ihn: »Sagt mir, guter Freund, habt ihr vielleicht einen Jüngling und ein Mädchen gesehen, die hier vorbei liefen?« »Was wollt ihr? Kohlrabi? Die sind noch nicht reif!« antwortete Autumunti. »Nein, ich spreche ja nicht von Kohlrabi,« sagte der andere, »ich meine, ob ihr Zwei gesehen habt, die hier vorbei gelaufen sind?« »Ach so, ihr verlangt Lattich; da müßt ihr in einigen Wochen wiederkommen.«
Der Menschenfresser verlor die Geduld und rief ärgerlich: »So geh, und laß dich segnen!« Weil er aber nicht wußte, auf welche Seite hinaus die Beiden gelaufen waren, so kehrte er nach Hause zu seiner Frau zurück; die frug ihn: »Nun, hast du sie nicht mitgebracht?« »Ach was,« sprach er, »ich traf einen Gärtner, den frug ich, ob er sie hätte vorbei kommen sehen, er aber sprach nur von Kohlrabi und Lattich, da ließ ich ihn stehen und kehrte um.« »Was fällt dir ein!« rief die Frau, »gleich geh hin und laufe ihnen wieder nach.«
Also mußte sich der arme Mann aufmachen, und zum zweiten Mal den Beiden nachlaufen. Unterdessen hatten Autumunti und Paccaredda ihre natürliche Gestalt wieder angenommen, und waren weiter geflohen. Da sie nun den Menschenfresser abermals dicht hinter sich sahen, sprach Paccaredda: »Ich werde zur Kirche und du zum Sakristan,« und also bald wurde sie zur Kirche, und Autumunti zum Sakristan.
»Guter Freund,« sprach der Menschenfresser, »habt ihr einen Jüngling und ein Mädchen hier vorbei laufen sehen?« »Jawohl,« antwortete der Sakristan, »die Messe wird bald anfangen.« »Wer spricht denn von der Messe!« rief der Menschenfresser, »ich frage euch, ob Zwei hier vorbei gelaufen sind?« »Wenn ihr beichten wollt, so müßt ihr morgen wiederkommen,« erwiderte Autumunti.
Da verlor der Menschenfresser die Geduld und rief: »Geh, laß dich segnen!« und kehrte nach Hause zurück. Als nun seine Frau ihn frug, was er ausgerichtet habe, brummte er: »Laß mich in Ruhe; ich habe einen Sakristan gefragt, ob er sie nicht habe vorbei laufen sehen, er sprach aber von der Messe und vom Beichten, da habe ich ihn stehen lassen, und bin wieder umgekehrt.«
»Nein, seht doch die Dummheit!« rief die Frau, »gleich gehst du noch einmal zurück und holst die Beiden ein.« »Nein, jetzt habe ich es satt,« sprach der Mann, »jetzt kannst du selbst deiner Paccaredda nachlaufen.« Da machte sich die Frau auf den Weg und verfolgte die Beiden, und hatte sie beinahe eingeholt. Als Paccaredda sie kommen sah, rief sie: »Werde du zum Strom, und ich zum Fischlein darin!« Da wurde Autumunti zum Strom und Paccaredda wurde zum munteren Fischlein, das schwamm lustig hin und her.
Die Hexe aber wußte wohl, was es mit diesem Fischlein für eine Bewandtnis habe, und wollte es fangen. So oft sie es aber auch ergriff, sprang ihr das Fischlein doch gleich wieder aus der Hand, daß sie endlich die Geduld verlor, und rief: »Ja, geh nur, wenn aber die Zeit kommt, wo du ein Kind gebären sollst, dann will ich mich an dir rächen. Nicht eher sollst du deines Kindes genesen, als bis ich die Hände von meinem Kopf genommen habe.« Damit faltete sie die Hände über dem Kopf und ging nach Haus.
Autumunti und Paccaredda aber setzten ihren Weg fort, und kamen bald in die Stadt, wo der König wohnte. Autumunti aber schämte sich, seine schöne Braut in ihren zerrissenen Kleidern vor seine Eltern zu führen, deshalb sprach er zu ihr: »Bleibe hier vor der Stadt, derweil ich gehe, und dir im Schloß schöne Kleider hole.« »Ach nein, tue das nicht,« bat sie, »denn wenn du dich von deiner Mutter küssen lässt, so vergisst du mich, und kommst nicht wieder zu mir.«
Er aber versprach ihr, sie nicht zu vergessen, und ging allein aufs Schloß. Denkt euch nun, welche Freude der König und die Königin empfanden, als ihr lieber Sohn wiederkam, den sie so viele Jahre als tot beweint hatten, und der nun ein schöner Jüngling geworden war. Seine Mutter warf sich ihm an den Hals, und wollte ihn küssen, er aber ließ es nicht geschehen, sondern sprach:
»Nein, liebe Mutter, ihr dürft mich nicht küssen, sonst macht ihr mich unglücklich.« Weil er aber hungrig und müde war, wollte er erst schlafen, ehe er zu seiner Paccaredda zurück kehrte. Als er nun schlief, gedachte die Königin ihre große Sehnsucht zu stillen und ihn zu küssen. Da schlich sie hinzu und küßte ihn, und in dem selben Augenblick hatte er seine Paccaredda vergessen, blieb bei seinen Eltern und führte ein fröhliches Leben.
Die arme Paccaredda aber saß und wartete auf ihn, und als er immer noch nicht kam, so dachte sie endlich: »Gewiß hat er sich von seiner Mutter küssen lassen, und hat meiner vergessen.« Da weinte sie bitterlich und war sehr betrübt, sie verlor aber dennoch nicht den Mut, sondern ging hin, kaufte zwei Tauben, und sprach einen Zauberspruch über die selben aus.
Mit den Tauben ging sie aufs Schloß, und bot sie dem Königssohn zum Verkauf an, und der Königssohn, dem sie gar wohl gefielen, kaufte sie. Aber ob er gleich mit Paccaredda sprach, erkannte er sie doch nicht. Als er nun den Tauben ihr Futter vorstreute, fing die eine von ihnen an, und sprach zur anderen:
»Soll ich dir eine schöne Geschichte erzählen?« »Ja, tue das« antwortete die zweite Taube. Da erzählte die erste die ganze Lebensgeschichte des Autumunti, und wie er zusammen mit der armen Paccaredda bei dem Menschenfresser gelebt hatte. Als aber der Königssohn den Namen Paccaredda hörte, da erinnerte er sich seiner schönen Braut, und er machte sich eilends auf, mit schönen Kleidern und einem prächtigen Wagen, fuhr zu Paccaredda hinaus und führte sie im Triumph aufs Schloß.
Sie war aber nahe an der Zeit, wo sie gebären sollte, und die Königin pflegte sie, als ob sie ihre eigene Tochter gewesen wäre. Als aber ihre Stunde kam, konnte sie das Kind nicht zur Welt bringen, denn die Verwünschung der alten Hexe ruhte noch auf ihr.
Da rief der Königssohn einen treuen Diener seines Vater herbei, und schickte ihn in die Gegend, wo die Hexe wohnte, und befahl ihm, alle Totenglocken läuten zu lassen, und wenn die Alte frage, wer gestorben sei, so solle er sagen: »Eure Tochter Paccaredda.« -
»Wenn sie nun die Hände vom Kopf nimmt,« fuhr er fort, »dann lasse mit allen Glocken Gloria läuten, und wenn sie dich fragt, was nun geschehen sei, so antworte: 'Eure Tochter Paccaredda hat ein Kind zur Welt gebracht.'«
Der Diener tat, wie im befohlen war, und kam in die Gegend, wo die alte Hexe wohnte. Da nun alle die Totenglocken läuteten, stand er unter ihrem Fenster, und sie rief ihn an und sprach: »Sagt mir doch, für wen ist das Totengeläute?«
»Eure Toter Paccaredda ist gestorben,« antwortete der Diener. »O meine Tochter, meine liebe Paccaredda,« jammerte die Frau und zerschlug sich mit den Händen die Brust. In dem selben Augenblick genas Paccaredda eines wunderschönen Knaben. Da ließ der Diener mit allen Glocken Gloria läuten, und die Hexe horchte verwundert auf und frug, warum denn nun Gloria geläutet werde?
»Eure Tochter Paccaredda hat ein Kind zur Welt gebracht,« sprach der der Diener. Da merkte sie, daß sie betrogen worden war, und platzte vor Wut. Autumunti aber heiratete die schöne Paccaredda, und sie blieben reich und getröstet, wir aber sind hier sitzen geblieben.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DIE VIER KUNSTREICHEN BRÜDER ...
Ein nicht reicher, aber wohlhabender Vater hatte vier Söhne, durchaus hübsche, aufgeweckte Bursche, die er zu versorgen trachtete, und eine noch hübschere sehr reiche Mündel, die jeder von diesen zu heiraten wünschte.
Da führte er einst die Söhne auf einen Kreuzweg und sagte zu ihnen: »Gehe jeder von euch einen von diesen vier Wegen, lerne ein Handwerk, komme nach einem Jahre wieder auf diesen Punkt, und wenn ihr wieder beisammen seid, so kommt zu mir. Der das grösste Meisterstück in seiner Kunst ablegt, der soll meine Mündel haben, jeder andere aber ein Drittel meines Vermögens.«
Und so geschah es.
Der eine wurde ein Tischler, der andere ein Jäger, der dritte ein Dieb und der vierte ein Zauberer (mago).
Gerade nach einem Jahre fanden sich die vier Söhne wieder bei ihrem Vater ein, der, obgleich ihm das Handwerk der beiden letztern nicht sehr gefiel und ihm die Mündel unterdessen geraubt worden war, die Prüfung der Söhne vorzunehmen begann.
»Wohlan«, sagte er zum Dieb, »hier auf dem Baum ist ein Amselnest. Die Mutter sitzt auf den Eiern; bist du im Stande die Eier zu stehlen, ohne dass dich die Mutter sieht?« »Das ist sehr leicht«, antwortete dieser, stieg sachte auf den Baum, bohrte das Nest von unten an, so dass die Eier durch fielen, die Amsel aber im Glauben, die Eier unter sich zu haben, sitzen blieb.
Natürlich waren die Eier vom Fall zerbrochen. »Bist du so geschickt«, sprach der Vater hierauf zum Tischler, »die Eier wieder ganz zu machen?« »Wenn Sie befehlen«, antwortete der Tischler, und flickte die Eier, dass sie wie neue aussahen.
»Wohlan«, sagt der Vater zum Jäger, »binnen kurzem kommt das Männchen, bist du so ein guter Schütze, den Amseln auf einen Schuss die beiden Schnäbel vom Kopfe weg zu schießen?« »Ohne Zweifel«, antwortete der Jäger, und als bald darauf das Männchen kam, ließ er knallen und beide Amseln flogen ohne Schnabel vom Nest weg.
»Kinder!« sagte der Vater, »ihr seid brav in eurem Geschäfte, das muss ich sagen; jetzt aber habe ich eine schwere Aufgabe für dich«, fuhr er zum Zauberer gewandt fort: »Mir wurde während eurer Abwesenheit die Mündel geraubt, weißt du wo sie ist?« »O ja«, erwiederte dieser, »sie ist so eben im Garten des mächtigen Fürsten Segeamoro und speist einen Pfirsich.«
»Das wäre eine Hauptaufgabe für dich«, sagte der Vater zum Diebe, »die Mündel diesem zu stehlen.« »Das soll alsogleich geschehen«, sagte der Dieb, schlich sich in den Garten des Fürsten, ergriff sie und sprang mit ihr in eine Barke, die am Ufer des durchströmenden Flüsschens war. Vergebens war das Schreien und Laufen der fürstlichen Dienerschaft, den Dieb einzuholen; da ließ der Gärtner einen grimmigen, zum Schutz des Gartens angeketteten Drachen los.
In wenigen Augenblicken hatte der Drache die Barke eingeholt und schwebte wie ein zum Stoße bereiter Raubvogel über ihr; da knallte ein Schuss und tödlich getroffen von des Jägers sicherer Kugel stürzt das Ungeheuer aus der Luft – leider gerade auf die Barke herab, die es durch seine Schwere zerschmetterte.
Schon zappelten Dieb und Mündel dem Ertrinken nahe im Wasser, als sich der Tischler in den Fluss stürzt, in wenig Augenblicken die Barke ausbessert und Mündel und Bruder zu sich hereinzieht.
Da sprach der Vater hocherfreut: »Der Zauberer hat zwar die Mündel entdeckt, der Dieb hat sie gestohlen, der Jäger vom Drachen gerettet, aber ohne des Tischlers Schwimmkunst und Leim wäre sie doch verloren gewesen; sie möge also des Tischlers Frau werden, ihr anderen aber sollt mein Vermögen in drei Teile teilen.«
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
DIE HEIRAT MIT DER HEXE ...
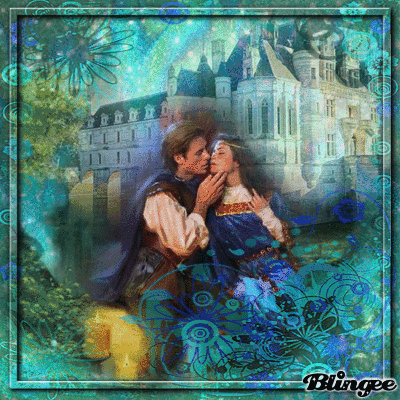
Ein Sohn sehr reicher Eltern hatte sich in eine arme aber sehr schöne Dienstmagd von unbekannter Herkunft verliebt und trug ihr die Heirat an. Sie willigte ein, stellte ihm jedoch die Bedingung, dass er sie nie beim Kerzenlicht ansehen dürfe. Er gelobte diese Bedingung zu erfüllen und die Heirat ging vor sich.
Seine Frau aber war eine Angane oder Hexe und er wusste es nicht; das tat jedoch dem ehelichen Glücke und Frieden keinen Abbruch. Nach einiger Zeit wurde er neugierig zu erfahren, warum ihm seine Frau verboten habe, sie beim Kerzenlichte zu besehen. In einer Nacht, als sie schlief, zündete er ein Licht an und sah ihr ins Gesicht; da er aber mit der Kerze zu nahe kam, träufelte ihr ein wenig geschmolzenen Wachses auf die Wange und sie erwachte.
Er blies das Licht schnell aus, sie aber weinte und schrie vor Zorn und machte ihm die heftigsten Vorwürfe, die er schweigend ertrug. Endlich schwieg auch sie wieder und er schlief ein. Als er am Morgen erwachte, fand er seine Frau nicht mehr; neben dem Bette aber stand ein Paar Schuhe mit eisernen Sohlen. Darin lag ein Zettel mit den Worten: »Geh, bis diese Sohlen zerrissen sind und du wirst mich noch nicht finden!« Da ärgerte er sich gewaltig und schwor im Zorn nicht zu rasten, bevor er sie nicht gefunden hätte.
Er ging und kam nach einiger Zeit auf eine Anhöhe, von der er in ein kleines Tal nieder sah. Dort sassen zwei Männer bei einem Haufen von Gerätschaften, welche sie unter sich verteilten. Er sah ihnen eine Weile zu und bemerkte, dass sie heftig zu streiten anfingen. Da stieg er nieder und fragte, warum sie stritten.
Der Eine erwiderte: »Es ist unser Vater gestorben und nun teilen wir uns das Erbe. Da sind aber zwei wichtige Dinge, nämlich dieser Mantel, welcher denjenigen, der ihn anlegt, unsichtbar macht und dieser Stuhl: wer sich darauf setzt, darf nur wünschen, dass er da oder dort sei und er ist dort.« Dann aber fuhren die zwei Brüder fort unter sich zu zanken und konnten nicht einig werden.
Da sagte er zu ihnen: »Hört, meine lieben Freunde, es tut mir weh, euch, die ihr doch Brüder seid, so zanken zu sehen. Lasst mir das Schiedsrichteramt und ich will es euch beiden recht machen.« Dessen waren sie zufrieden; er aber sagte: »Vorerst glaube ich gar nicht, dass dieser alte Plunder eine so merkwürdige Eigenschaft haben soll, ich möchte es doch mit dem Mantel versuchen.«
Da legte er den Mantel um und fragte: »Seht ihr mich?« »Nein«, riefen sie - aber sie hatten es noch kaum gerufen, da sass er mit dem Wunsche zu seiner Frau zu kommen, schon auf dem Stuhle und flog davon wie der Wind. »Kehr um! kehr um!« riefen die beiden Brüder voll Schrecken, aber er war schon zu weit weg und hörte ihren Ruf nicht mehr.
In kurzer Zeit befand er sich vor einem großen Schlosse; es war Nacht, das Schloss aber war auf das Prächtigste beleuchtet, aus den Zimmern erscholl Musik und es wurde ihm klar, dass da ein großes Fest gefeiert werde. Er nahm den Mantel ab und ließ ihn unten auf dem Stuhle zurück; dann ging er über die Stiege hinauf und wollte eintreten, aber der Pförtner wies ihn zurück.
»Was ist denn dies für ein Fest?« fragte er. »Mein Herr hält morgen Hochzeit mit einer schönen Braut«, sagte der Pförtner, »er hat heute abends alle seine Freunde eingeladen und es geht fröhlich zu. Aber so ein hergelaufener Kerl, wie Ihr, darf nicht hinein; seht zu, dass Ihr weiter kommt!«
Nun wusste er genug. »Da bist du noch gerade zu rechter Zeit gekommen,« sagte er zu sich selbst und ging wieder über die Stiege herab. Unten legte er sich den Mantel um, ergriff einen Besen und ging wieder hinauf. Da stand noch der Pförtner an der Türe, er aber schlug ihn mit dem Besen so auf den Kopf, dass der arme Mann schreiend entfloh.
So dann ging er in den Tanzsaal und sah da seine Frau am Arme ihres neuen Bräutigams unter einer Menge vornehmer Herrn und festlich gekleideter Damen. Er sah eine Weile zu; dann aber schlug er mit dem Besen bald auf seine Frau, bald auf ihren Bräutigam. Da entstand großer Schrecken; sie liefen alle den Türen zu und warfen im Gedränge Tische und Stühle um.
Auch seine Frau wollte fliehen, er aber hielt sie am Kleide fest, bis alle fort waren; dann sagte er: »Kennst du mich?« Zitternd erwiderte sie: »Ich sehe ja nichts, aber deine Stimme scheint die meines rechten Herrn und Gemahls zu sein.« Da nahm er den Mantel ab, sie erkannte ihn und warf sich um Verzeihung flehend vor ihm nieder.
»Willst du wieder meine Frau sein und getreulich bei mir bleiben?« fragte er sie. Sie versprach es, dann nahm er den Mantel wieder um, führte sie über die Stiege herab und setzte sich mit ihr auf den Stuhl. In kurzer Zeit waren sie wieder zu Hause und lebten nun in Frieden und Eintracht miteinander.
Stuhl und Mantel aber stellte er den Eigentümern wieder zurück; »denn«, dachte er sich, »es ist doch nicht Recht, dass ich sie behalte.« -
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
VOM LÖWEN, PFERD UND FUCHS ...
Der Löwe war einmal in einen Engpass geraten, und konnte nicht wieder heraus. Da kam eben ein Pferd vorbei, und der Löwe rief ihm zu: »Hilf mir aus diesem Engpass heraus.« »Das will ich schon tun,« antwortete das Pferd, »versprich mir aber, daß du mich nicht fressen willst.« Der Löwe versprach es, und das Pferd arbeitete so lange mit seinen Hufen, bis es den Löwen frei gemacht hatte. Als der sich aber frei sah, sprach er: »Jetzt fresse ich dich.«
»Wie waren die Bedingungen?« sagte das Pferd, »hatten wir nicht ausgemacht, ihr wolltet mich nicht fressen?« »Das ist jetzt einerlei,« rief der Löwe, »wenn du aber willst, so gehen wir vor einen Schiedsrichter.« »Gut,« erwiderte das Pferd, »wen wählen wir aber dazu?« »Den Fuchs,« sprach der Löwe.
Das Pferd war es zufrieden, und sie gingen zum Fuchs, und der Löwe legte ihm die Frage vor. »Ja,« antwortete der Fuchs, »es kommt mir vor, als wenn ihr recht haben müßtet, Herr Löwe; ich kann aber kein Urteil fällen, wenn ich nicht vorher gesehen habe, wie ihr beide standet.«
Also gingen sie alle drei zum Engpass, und das Pferd stellte sich auf den selben Platz, wo es vorher gestanden hatte. Den Löwen aber hieß der Fuchs sich wieder in den Engpass drücken. »Standet ihr gerade so?« frug er. »Dieses Bein war noch ein wenig mehr gedrückt,« antwortete der Löwe. »Nun, so presst euch nur noch ein wenig; ihr müßt euch genau so hinstellen, wie ihr in dem Augenblicke wart, als ihr das Pferd um Hilfe batet.«
Der Löwe drückte sich noch ein wenig, und der Fuchs frug wieder: »Standet ihr gerade so?« »Dieses Vorderbein war noch ein wenig weiter drin.« »Nun, so presst euch noch ein wenig weiter hinein.« Endlich hatte sich der Löwe so fest hineingepresst, daß er nicht wieder heraus konnte. »So,« sagte der Fuchs, »jetzt seid ihr gerade so weit, wie vorher; nun kann das Pferd zusehen, ob es euch noch einmal helfen will.«
Das Pferd aber wollte nicht, sondern warf so lange Steine herunter, bis es den Löwen erschlug.
»Ja, ja, der Fuchs ist schlau!«
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DER PRINZ MIT DEN GOLDENEN HAAREN ...
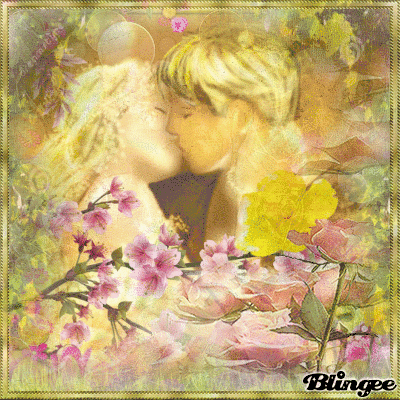
Ein König verlor sein Reich. Sein Sohn musste fliehen und irrte lange Zeit allein in Tälern und Wäldern herum, bis er eines Tages zu einem schönen Häuschen kam. Darin wohnte ein Herr, dieser nahm den flüchtigen Prinzen als Diener auf. Er musste die kleinen Dienste des Hauses versehen und sich besonders die Fütterung der Haustiere angelegen sein lassen. Diese waren aber nur eine Stute und ein Bär; die Stute musste - so befahl es der Herr - mit Fleisch, der Bär dagegen mit Heu gefüttert werden.
So dauerte es einige Zeit, als der Herr einmal verreisen musste. Vor der Abreise übergab er dem jungen Diener die Schlüssel zu allen Gemächern des Hauses und sagte: »Überall darfst du eintreten, nur die Türe, zu welcher dieser rostige Schlüssel gehört, darfst du nie aufsperren, sonst wehe dir!« Der Jüngling nahm die Schlüssel und der Herr reiste ab.
Eine Zeit lang widerstand der Prinz der Versuchung, die verbotene Türe zu öffnen; endlich aber vermochte er den Drang seiner Neugierde nicht mehr zu überwinden und sperrte die Türe auf. Er sah aber nichts, als einen kleinen See. »Gerade recht«, dachte er sich, »es ist heute ein so heißer Tag, ich will mich baden.« Gesagt, getan.
Als er sich wieder angekleidet hatte, ging er in den Stall hinab zur Stute, welche auf einmal zu reden anfing und sagte: »Ei, du bist im verbotenen Gemach gewesen, du hast goldene Haare!« Überrascht blickte der Prinz in einen Spiegel und erkannte, dass die Stute wahr gesprochen habe, denn seine Haare glänzten wie lauteres Gold in der Sonne.
Als die Stute sah, dass er erschrocken sei, hub sie wieder an und sprach: »Wir wollen beide fliehen, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Geh hinauf in dieses und dieses Zimmer, da wirst du einen Kamm, eine Schere und einen Spiegel finden. Nimm sie, komm aber schnell wieder zurück und steig auf mich, damit wir fliehen.«
Der Prinz holte schnell die benannten drei Dinge, stieg auf die Stute und floh.
Noch waren sie nicht gar weit, da hörten sie den Herrn hinter sich, der sie wütend verfolgte. Als er ganz nahe gekommen war, sagte die Stute: »Wirf den Kamm hinter dich!« Der Prinz tat es und es entstand ein hoher breiter Zaun, welcher dem Verfolger lange zu schaffen machte. Aber nach einiger Zeit merkten die Fliehenden, dass er wieder hinter ihnen sei.
Da sprach die Stute: »Wirf die Schere hinter dich!« Der Prinz warf die Schere auf den Boden und es entstand ein dichter undurchdringlicher Wald voll Dorngebüsche, so dass man glauben mochte, der Verfolger werde den selben nicht durchdringen können. Aber nach einer Weile war er den Fliehenden wieder auf den Fersen.
Da sprach die Stute: »Wirf den Spiegel hinter dich!« Der Spiegel fiel auf den Boden und es entstand ein großer breiter See. Da sagte die Stute: Jetzt sind wir sicher und können unsern Weg gemächlich fortsetzen.« Bald kamen sie zu einer großen Stadt. Der Prinz verhüllte seine Haare durch eine große Mütze, denn er wollte kein Aufsehen erregen.
Er ritt auf die königliche Burg zu und stellte dort die Bitte, man möchte ihn als Diener aufnehmen. Nun waren die Dienerstellen alle besetzt, nur einen Gärtnerjungen konnte man noch brauchen. Der Prinz war es zufrieden, doch stellte er die Bedingung die Stute behalten und in den königlichen Stall stellen zu dürfen, was ihm gern gewährt wurde.
Der neue Gärtnerjunge hatte nun ein angenehmes Leben. Er begoss und pflegte die Blumen, aber das ihm übertragene Hauptgeschäft war, dass er täglich für die drei Töchter des Königs Blumensträusse binden musste. Einmal kamen sie selbst in den Garten und da gefiel ihm die jüngste am besten. Seit dieser Zeit war auch der Strauss für die selbe immer ein wenig schöner, so dass es diese leicht bemerken konnte und mit Wohlgefallen auf den hübschen Gärtnerjungen sah.
Nur wusste sie sich nicht zu erklären, warum er sein Haar so sorgfältig verberge, er aber sagte ihr, er leide an einem bösen Ausschlag am Kopfe. Einmal aber arbeitete er im Garten, während die jüngste Prinzessin auf dem Balkon war und als er sich bückte und die Mütze sich ein wenig lüftete, da sah sie seine goldenen Haare. Sie kam sogleich zu ihm herab und hörte nicht auf zu bitten, bevor er nicht die Mütze abnahm, aber er tat es nur gegen das Versprechen, dass sie strenges Stillschweigen beobachten wolle.
Seit diesem Tage wurde ihr Wohlwollen für den goldhaarigen Gärtnerjungen, den sonst alle für einen armen Aussätzigen ansahen, noch grösser und bei ihrem unschuldsvollen Herzen wollte sie nur sich selbst nicht gestehen, dass sie ihn ernstlich liebe.
So verging wieder einige Zeit; da beschloss der König seine Töchter zu vermählen. Er schrieb daher ein großes Turnier aus und ließ verkünden, wer da siege, dem werde er seine älteste Tochter vermählen. Es fanden sich auch sehr viele Ritter und Prinzen ein.
Am Morgen des zum Turnier bestimmten Tages ging der Gärtnerjunge zur Stute und diese sagte ihm, er solle sich weiß kleiden und dann auf ihr zum Turnier reiten. Als nun die Ritter alle zum Turnier versammelt waren, da teilte sich die Volksmenge und heran sprengte hoch zu Ross ein weiß gekleideter Jüngling mit so schönen licht gold farbigen Haaren, dass man solche Pracht nie gesehen hatte.
Er überwand alle Gegner, die sich ihm entgegenstellten; als das Turnier zu Ende war, verschwand er auf seinem Pferde wie der Blitz, ohne dass man ihn gekannt hätte oder wusste, wohin er gekommen sei.
Der König befahl das Turnier am folgenden Tage zu erneuern und stellte überall Wachen aus mit dem Auftrag den Jüngling mit den goldenen Haaren nicht entkommen zu lassen und ihn an den königlichen Hof zu führen. Der Jüngling erschien diesmal in blauem Gewand und siegte wieder über alle Gegner, wie am vorigen Tage. Aber er entkam den Wachen trotz aller Aufmerksamkeit und niemand konnte sagen, wohin er geritten sei.
Das wurmte den König und er befahl am dritten Tage noch einmal ein großes Turnier zu halten; auch ließ er überall doppelte Wachen ausstellen. Diesmal erschien der Jüngling in purpurnem Gewand; vergebens nahmen es die stärksten und best erprobten Ritter mit ihm auf, er hob sie alle aus dem Sattel. Als ihn nach dem Turnier die Wachen aufhalten wollten, setzte das Pferd in gewaltigen Sprüngen über sie hinweg und er verschwand abermals spurlos aus ihren Augen.
Nun versuchte der König ein anderes Mittel. Er befahl, dass am folgenden Tage alle Ritter, Mann an Mann, unter dem Balkon seiner Burg vorbei ziehen sollten. Seinen Töchtern aber gab er goldene Kugeln; jener Ritter, welchem eine seiner Töchter ihre Kugel zu würfe, solle deren Gemahl und sein Eidam sein, das gelobte er mit seinem königlichen Worte.
Die Ritter zogen in langer Reihe am Balkon vorbei, aber der goldhaarige Jüngling war nicht darunter und keine der Prinzessinnen warf ihre Kugel. Am nächsten Tage erneuerte sich dieses Schauspiel. Die Ritter zogen abermals in langer Reihe vorüber; da warfen die beiden älteren Prinzessinnen ihre Kugeln denen zu, welche ihnen am besten gefielen - und das waren gar stattliche Herren und wohl würdig, des Königs Eidame zu werden. Nur die jüngste behielt ihre Kugel, denn der Jüngling mit den goldenen Haaren war nicht im Zuge.
Am dritten Tage mussten auf Befehl des Königs nochmals alle Ritter, dann auch alle Bürger und Männer der Stadt bis zum Letzten und Ärmsten herab am Schlosse vorüberziehen. Dies geschah, und es schien, als sollte der lange Zug gar nicht mehr enden. Einer der letzten kam auch der aussätzige Gärtnerjunge mit seiner großen Mütze auf dem Kopf und ihm warf die jüngste Prinzessin ihre goldene Kugel zu.
Dieser Vorfall erregte ungeheures Aufsehen. Der König war außer sich vor Zorn über die Wahl seiner jüngsten Tochter, aber er musste sein königliches Wort halten. Beim Hochzeitsmahl sass der Gärtnerjunge, das Haupt noch immer sorgfältig mit der Mütze bedeckt, mit der Prinzessin zu unterst an der Tafel und niemand achtete auf sie. Aber sie waren desto ungestörter in ihren traulichen Gesprächen und ihr Gesicht strahlte vor lichter Freude.
Auch in der darauf folgenden Zeit wurden beide vom ganzen Hofe vernachlässigt, ja geradezu verachtet; allein das machte ihnen geringen Kummer. Nach einiger Zeit erkrankte der König. Die Ärzte versuchten alles, aber endlich erklärten sie verzweifelnd, nur durch Drachenblut könne der Kranke noch gerettet werden.
Nun hauste wohl ein Drache in einer tiefen Schlucht; aber man musste, um den gefährlichen Kampf zu bestehen, durch einen noch gefährlicheren Wald gehen, in den schon viele hinein, aber nie Einer wieder heraus gekommen. Da ward es für die drei königlichen Schwiegersöhne eine Ehrensache, das Drachenblut zu holen und sie zogen dazu aus. Die beiden älteren Prinzessinnen waren sehr traurig und weinten beim Abschied; nur die jüngste war, wie immer, frohen Mutes.
Als sie an den Rand des gefährlichen Waldes gekommen waren, wandelte die beiden ersten eine große Furcht an und der helle Angstschweiß stand auf ihrer Stirne. Der arme Aussätzige aber - er trug noch immer die große Mütze - sagte: »Wenn ihr nicht mit wollt, so will ich es allein versuchen.« Damit waren sie zufrieden und versprachen hier bleiben und seine Rückkunft abwarten zu wollen.
Der Prinz ritt nun auf seiner Stute durch den Wald und kam durch alle Gefahren glücklich hindurch. Bald fand er den Drachen, erlegte ihn, füllte von seinem Blute eine Flasche und kehrte eben so glücklich wieder zurück. Als die beiden anderen ihn kommen sahen, bezeigten sie zwar große Freude, aber im Innern wurmte es sie sehr, dass der aussätzige Gärtnerjunge ihnen nun den Rang ablaufen sollte.
Daher sprachen sie: »Was müssen wir dir geben, wenn du uns das Drachenblut gibst?« Er erwiederte: »Das werde ich tun, wenn ihr mir die goldenen Kugeln gebt, welche die Prinzessinnen euch zugeworfen haben.« Sie gaben ihm die Kugeln und er gab ihnen das Drachenblut.
Das war trotz aller Trauer doch ein großer Jubel, als die Schwiegersöhne des Königs mit dem Drachenblut kamen; ganz verachtet zog auch der Gärtnerjunge hinter ihnen her. Der König war nun in kürzester Zeit wieder heil und gesund und veranstaltete zur Feier seiner Genesung ein großes Festmahl. Bei diesem sassen Prinz Goldhaar und die Prinzessin wieder wie gewöhnlich am untersten Ende der Tafel und schwiegen, während die beiden anderen Eidame des Königs gar schreckliche Wunderdinge davon erzählten, wie sie den Drachen gefunden und erlegt hätten.
Endlich ließen sie sich vom Weine erhitzt sogar verleiten, den verachteten Gärtnerjungen offen zu verhöhnen. Da stand dieser auf und fragte: »Wo habt ihr eure goldenen Kugeln, welche ihr von eueren Frauen erhalten habt?« Sie zogen nun die goldenen Kugeln hervor, welche sie sich inzwischen hatten machen lassen und legten sie dem Könige vor.
Prinz Goldhaar aber rief mit zürnendem Ernste: »Ihr Feiglinge, erst gebrach es euch an Mut mit dem Drachen zu kämpfen und jetzt wagt ihr es mich noch verhöhnen zu wollen? Eure Kugeln sind unecht, die echten habt ihr mir gegeben, als ich euch das Drachenblut brachte - hier sind sie!«
Der König prüfte die Kugeln und fand zu seinem Erstaunen, dass der Gärtnerjunge wahr gesprochen habe. Dieser nahm nun auch die Mütze vom Kopf und mit grösstem Erstaunen sahen alle Anwesenden sein licht gold farbiges Haar und erkannten den Jüngling, welcher in den drei Turnieren alle Gegner besiegt hatte. Die zwei anderen hätten vor Scham in die Erde sinken mögen und während der König den Prinzen Goldhaar umarmte, schlichen sie verwirrt aus dem Saale.
Darauf ging Prinz Goldhaar auch in den Stall, um der wackeren Stute zu danken. Da sprach sie: »Jezt ist auch meine Zeit aus, hau mir den Kopf ab!« Zögernd gehorchte der Prinz und sieh! vor ihm stand eine wunderschöne Prinzessin, welche lange verzaubert gewesen und nun befreit war.
Nach mehrtägigen Festen, die ihr zu Ehren bei Hofe gegeben wurden, kehrte sie fröhlich zu ihrem Vater zurück, welcher der mächtige König eines fern gelegenen Reiches war.
Prinz Goldhaar aber blieb fortan der Liebling und Vertraute des alten Königs und erbte nach dessen Tod Reich und Krone. Damit ist meine Geschichte aus; jetzt erzählt die eurige.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DIE DREI SELTENEN STÜCKE ...
Einmal war ein armer Knabe, der ging von Hause fort in die Welt um sein Brot zu verdienen. Als er bei heißem Sonnenscheine seines Weges ging, sah er neben der Strasse drei Feen, welche schliefen. »Die armen Frauen«, sagte der Knabe zu sich selbst, »sie liegen da an der Sonne und haben keinen Schatten!« Und er schnitt belaubte Weidenzweige ab und machte ein Dach über die Feen, so dass sie Schatten hatten.
Als sie erwachten, waren sie verwundert und sagten: »Ei, wer hat uns dieses schattige Häuschen gebaut?« Da trat der Knabe herbei und sagte, er sei es gewesen und als ihn die Feen wieder fragten, wer er sei, so antwortete er, er sei ein armer Knabe, welcher einen Dienst suche. »Willst du nicht bei uns bleiben und uns dienen?« fragten sie. Der Knabe willigte fröhlich ein, ging mit den Feen und diente ihnen treu und fleißig.
Als ein Jahr um war, sagte er zu den Feen, er wolle nun wieder zu seiner Mutter nach Hause gehen. »Ganz recht«, erwiderten sie; »da wir aber kein Geld haben, dich zu bezahlen, nimm dir den Esel dort. So oft du zu ihm sagst: Arri, scheiß Geld! - wirst du Geld haben, so viel du willst.«
Fröhlich führte der Knabe den Esel fort. Aber es wurde Nacht, bevor er nach Hause kam und er musste in einem Wirtshaus übernachten. Bevor er schlafen ging, sagte er zum Wirt: »Gebt wohl Acht, dass Ihr zu meinem Esel, der im Stalle unten steht, nicht sagt: Arri, scheiß Geld!« »Nein, nein«, erwiederte der Wirt, »das werde ich nicht sagen.«
Aber in der Nacht ging er in den Stall hinab zum Esel und sagte jene Worte; da bekam er Dukaten, Taler und alle Sorten von Geld. »Solch ein Tier kann ich just brauchen!« sagte der Wirt, führte den Esel in einen anderen Stall und stellte dafür einen anderen ganz ähnlichen hin.
Am Morgen machte sich der Knabe mit dem ausgewechselten Esel wieder auf den Weg. Als er nach Hause kam, erzählte er der Mutter freudig, welch ein Wundertier er gebracht habe, aber diese wollte es nicht glauben. »Ja, Mutter, so ist es«, rief er, »breite nur heute nachts ein reines weißes Leintuch unter und morgen früh da wirst du Augen machen!«
Die Mutter tat es. Als sie am Morgen in den Stall gingen und das schöne Linnen von Mist beschmutzt fanden, war der Knabe ganz verblüfft; die Mutter aber griff nach einem Stock und jagte ihn unter Schlägen aus dem Hause. Der arme Knabe ging wieder zu den drei Feen und diente ihnen abermals ein Jahr. Als dieses abgelaufen war, bat er um die Erlaubnis nach Hause gehen zu dürfen.
Die Feen gaben ihm die selbe und sagten: »Da wir kein Geld haben dich zu bezahlen, so nimm dieses Tischtuch hier; wenn du es ausbreitest und sagst: Tischtuch, deck auf! - so werden alle Speisen und Getränke darauf kommen, die du dir wünschst!«
Der Knabe nahm das Tischtuch und ging, aber er musste in dem selben Wirtshaus übernachten und sagte zum Wirt: »Gebet mir nur zu schlafen, denn für Essen und Trinken werde ich schon selbst sorgen,« Dann deckte er sich ein Tischchen mit seinem Tischtuch und sagte: »Tischtuch, deck auf!« Und im Nu standen prächtige Speisen und Getränke darauf.
Aber der Wirth hatte es gesehen und als der Knabe schlief, stahl er ihm das Tischtuch und legte ihm ein anderes ganz ähnliches hin. Am folgenden Tage ging der Knabe nach Hause und bat dort die Mutter, sie möge alle Verwandte und Bekannte einladen.
Als diese gekommen waren, deckte er einen Tisch mit dem Tischtuch und sagte: »Tischtuch, deck auf!« Aber es kam nichts und der Knabe wurde wieder mit Spott und Schlägen von Hause fort gejagt. Er kehrte wieder zu den Feen zurück und diente ihnen abermals ein Jahr und nach Ablauf des selben gaben ihm die Feen einen Stock und sprachen: »Wenn du zum Stocke sagst: Stock, rühr dich! so prügelt er alle, die du willst, bis du ihm befiehlst einzuhalten.«
Der Knabe ging und kehrte in dem selben Wirtshaus ein. Bevor er schlafen ging, erzählte er dem Wirt, er habe da einen Stock und wenn man zu ihm sage: »Stock, rühr dich!« - so geschehen unglaubliche Wunderdinge. Als der Knabe schlief, stahl ihm der Wirth den Stock und meinte, es müsse etwas ganz wunderbares dahinter stecken.
Sogleich machte er einen Versuch und sagte: »Stock, rühr dich!« Da fing der Stock an, so auf den Wirt loszuprügeln, dass er jämmerlich schrie und alle Leute im Hause wach wurden und herbei liefen. Auch der Knabe kam und sagte: »Her mit meinem Esel und meinem Tischtuch, sonst lass ich dich in Einem fort prügeln!«
Der Wirt versprach es und der Knabe sagte: »Stock, hör auf!« Da war der Stock wieder ruhig; der Wirt aber gab dem Knaben geschwind den Esel und das Tischtuch wieder, denn er fürchtete sich vor neuen Schlägen und hatte an den bereits erhaltenen für lange Zeit genug.
Nun ging der Knabe mit dem Esel, dem Tischtuch und dem Stock nach Hause. Als er heim kam, rief die Mutter: »Was will der dumme Junge schon wieder?« Zugleich rief sie den älteren Bruder, damit er den Angekommenen fort jage; aber als dieser kam, rief der Knabe: »Stock, rühr dich!« Und der Stock prügelte auf den älteren Bruder los, dass es eine Freude war und der selbe jämmerlich zu schreien anfing.
Sogleich befahl der Knabe dem Stock wieder einzuhalten. Da wurde die Mutter wieder freundlicher und sagte: »Aber was hilft uns der Stock, wenn wir kein Geld und nichts zu essen haben?« »Gemach, Mutter«, erwiderte der Knabe und wandte sich zum Esel und sprach: »Arri, scheiß Geld!« Da klingelten und rollten auf dem Boden die Taler und Dukaten, dass es eine Freude war.
Dann führten sie den Esel in den Stall und gingen in die Stube; dort breitete der Knabe das Tischtuch auf den Tisch und sagte: »Tischtuch, deck auf!« Und im Augenblicke standen Speisen und Getränke aller Art auf dem Tisch und sie hielten eine fröhliche Mahlzeit.
So taten sie noch gar oft und wenn der Esel inzwischen nicht gestorben und das Tischtuch nicht zerrissen und der Stock nicht zerbrochen ist, so müssen die drei seltenen Stücke ihre Wunderkraft noch bis auf den heutigen Tag bewahrt haben.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DER GOLDHAARIGE PRINZ ...
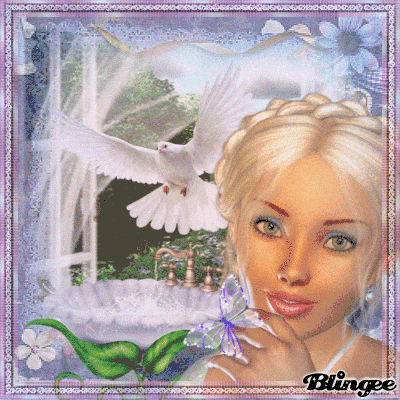
In alten Zeiten lebte einmal in einer Hauptstadt ein so schöner und guter Prinz, dass seine Eltern sich an ihm nie satt sehen konnten und liebevoll auf alles Acht gaben, was er tat. Nun muss man auch wissen, dass dieser Prinz goldenen Bart und goldene Haare hatte. Alle entzückten sich beim Anblicke der selben, denn niemand hatte noch etwas Ähnliches gesehen.
Der Prinz wurde immer grösser und stärker und seine Eltern beschlossen ihm eine Frau zu geben. »Suche dir nur eine aus, welche dir gefällt«, sagten sie; »was du immer für eine wählen magst, dessen sei versichert, dass wir sie freudig und mit offenen Armen aufnehmen wollen.« »Das will ich schon«, erwiderte der Prinz; »aber wenn ich nicht eine finde, die mir gleicht, so nehme ich keine und wäre es auch die reichste und schönste von der Welt!«
Darauf ließen seine Eltern sein Bild malen und das selbe vervielfacht an den Straßenecken aufhängen mit dem Bedeuten, jede Jungfrau, welche dem Prinzen gleiche, solle am königlichen Hofe erscheinen. Das selbe geschah auch in den entlegensten Städten des Reiches.
In einer dieser Städte lebte ein Kaufmann, dieser hatte drei Töchter, von denen die jüngste das Bild des Prinzen sah und sagte: »Ich gleiche dem Prinzen ganz!« Und je mehr sie das Bild ansah, desto mehr verliebte sie sich in den unbekannten Königssohn. Sie sann nun Tag und Nacht, was sie tun sollte; denn sie scheute sich es ihrem Vater zu sagen, noch weniger konnte sie es über sich bringen an den königlichen Hof zu gehen.
Da erinnerte sie sich, dass sie eine Freundin habe, die war eine große Zauberin und ihr vertraute sie ihr Geheimnis an. Diese belehrte sie, wie sie es anzufangen habe, um ihr Ziel zu erreichen. »Um mit dem Prinzen sprechen zu können«, sagte sie, »musst du drei Haare von seinem Kopfe und seinem Barte haben; diese lege mit warmer Asche in einen Topf, lass es ein wenig sieden und dann verwandelt sich der Prinz in eine Taube.
Sodann öffne das Fenster und stelle in die Mitte des Zimmers ein Wasserbecken und du wirst sehen, dass der Prinz in stürmischer Eile daher kommt.« »Ich danke dir, Freundin«, sagte die Kaufmannstochter; »du wirst sehen, dass ich deine Ratschläge bestens befolgen werde.« »Tue nur, wie ich dir gesagt habe«, erwiderte die Hexe, »und du wirst dein Glück finden.«
Nach einigen Tagen sagte der Kaufmann zu seinen Töchtern: »Was soll ich euch bringen, meine Kinder, denn ich muss in die Hauptstadt reisen meiner Geschäfte halber und komme in vierzehn Tagen wieder zurück.« »Ein schönes Kleid!« rief die Älteste. »Und mir eine goldene Kette!« sagte die Zweite. »Und was willst du?« sagte der Kaufmann zur dritten Tochter, welche die schönste war und schwieg.
»Lieber Vater«, erwiderte sie, »ich möchte nur drei Kopf- und Barthaare von unserem Königssohne und dann wäre ich zufrieden.« »Schon recht«, erwiderte der Kaufmann, »jeder Narr hat seine eigene Art, aber du kannst darauf rechnen, dass ich es dir bringe.«
Er verreiste und nachdem er in der Stadt seine Geschäfte besorgt hatte, kaufte er für seine älteste Tochter ein schönes Kleid und für die zweite eine schmucke goldene Halskette. »Aber wie soll ich es nur anfangen, einige Kopf- und Barthaare des Prinzen zu bekommen?« fragte er einen Freund. »Da gibt es kein anderes Mittel«, sagte dieser, »als dass du zum Barbier des Prinzen gehst und mit ihm redest.«
Der Kaufmann tat es. Der Barbier zeigte sich zwar bereit; »aber«, meinte er, »es wird mir schwer, recht schwer werden; denn so oft ich beim Prinzen bin, stehen die Wachen rings umher und lassen mich keinen Augenblick aus den Augen.« Da aber der Kaufmann nicht aufhörte zu bitten, versprach er das Mögliche tun zu wollen.
Am folgenden Tage hatte der Barbier beim Prinzen zu tun; aber nur mit der grössten Mühe gelang es ihm einige Barthaare mit dem Messer heimlich unter seinen Arm zu streichen und sie dem Kaufmanne bringen zu können. Dieser hatte große Freude und gab dem Barbier ein kostbares Geschenk.
Als der Kaufmann nach Hause kam, brachte er jeder seiner Töchter, was sie gewünscht hatten; die jüngste aber war viel zufriedener als die beiden Älteren. Kaum war sie ungestört allein in ihrem Zimmer, so kleidete sie sich, wie eine Königin, stellte ein Wasserbecken hin, öffnete das Fenster und tat, was ihr jene Freundin geraten hatte.
Sogleich flog in stürmischer Eile eine Taube durch das Fenster herein, tauchte sich in das Wasserbecken und verwandelte sich in einen wunderschönen Jüngling, der kein anderer war, als der Prinz mit den goldenen Haaren. Das Mädchen aber wurde vor Scham ganz rot. »Und was willst du von mir?« fragte der Prinz; »warum hast du mich in solcher Eile herbei gerufen?«
Da fasste sie sich ein Herz und sagte: »Großmächtiger Prinz, ich habe Euer Bild gesehen und weil ich glaube Euch zu gleichen, habe ich Euch her gerufen, denn ich getraute mich nicht an Euren Hof zu kommen.« Da sah der Prinz sie freundlich an und sagte: »Ja, es ist wahr, du gleichst mir und gefällst mir, dich will ich heiraten.« Und sie redeten noch viel und taten zärtlich mit einander und am Ende erlaubte ihr der Prinz, dass sie ihn am nächsten Sonntag wieder rufen dürfe.
Die älteste Schwester aber hatte den ganzen Vorgang und alle Reden vor der Türe belauscht und auf das Glück der jüngsten Schwester neidisch sann sie nach, wie sie ihr dieses Glück rauben könne. Es gelang ihr die jüngste Schwester am Sonntage mit der zweiten fast den ganzen Tag vom Hause fern zu halten; dann kleidete sie sich schön wie eine Prinzessin, nahm die Barthaare des Prinzen und den Aschentopf aus dem Kasten ihrer Schwester und tat damit, was sie ihre Schwester tun gesehen.
Aber die Unglückliche vergaß sowohl das Fenster zu öffnen, als auch das Wasserbecken mitten in das Zimmer zu stellen. Mit einem Schlage in das Fenster flog nun die Taube blutend herein, suchte vergebens das Wasserbecken und flog eben so schnell zornig girrend wieder hinweg mit Zurücklassung vieler Blutspuren auf dem Boden. Das tödlich erschrockene Mädchen las zwar die Scherben auf und wusch die Blutflecken weg, aber das Fenster war und blieb zerbrochen.
Als nun die jüngste Schwester nach Hause kam, merkte sie gleich, was geschehen war und fing an bitterlich zu weinen an. »Der Prinz ist tödlich verwundet und gewiss ist kein Arzt, der ihm helfen kann!« jammerte sie voll Angst. Am zweiten Tage darauf kleidete sie sich als Arzt und entfloh von zu Hause, willens den Prinzen aufzusuchen um zu sehen, ob sie ihm etwa helfen könnte.
Sie ging den ganzen Tag und ganz matt und müde befand sie sich abends in einem Walde so dunkel wie der Rachen des Wolfes. Verzweifelnd ging sie hin und her und weinte. »Mein Gott«, jammerte sie, »was soll ich tun? Gewiss werden die wilden Tiere mich noch zerreißen, doch es geschehe da, was Gottes Wille ist!« Gerade war sie bei einem großen Baum, da stieg sie, so weit sie konnte, in den Gipfel hinauf, um die Nacht hier zuzubringen.
Um zwölf Uhr Mitternacht hörte sie unter dem Baum reden und erblickte vier Hexen, welche um ein Feuer sassen und sich wärmten. Anfangs achtete sie wenig darauf; als sie aber hörte, dass die Hexen vom Prinzen mit den goldenen Haaren redeten, lauschte sie mit ängstlicher Spannung und ließ sich kein Wort entgehen.
»Der arme Prinz, er ist wirklich zum Tode krank«, sagte eine noch junge Hexe zu einer Älteren; »wüsstet Ihr denn gar nicht, wie etwa noch zu helfen sein möchte?« »O ja«, erwiderte die Befragte. »Es dürfte Jemand nur mit dem Blute der Schlange, die im Garten des Königs unter einem Steine ist, ein wenig Salbei sieden, den Kopf des Prinzen damit bestreichen und er wäre geheilt; denn eine solche Salbe hat die Kraft, dem Prinzen die Glasscherben aus dem Kopfe zu ziehen und keiner der Ärzte weiß darum.«
Das Mädchen wusste genug; »mein Gott, ich danke dir!« sagte sie und als der Morgen tagte, stieg sie vom Baum herab und machte sich getrost wieder auf den Weg. Noch an dem selben Tag abends kam sie in der Hauptstadt an. Sie erfuhr, dass der Königssohn in Todesgefahr schwebe und bereits von den Ärzten aufgegeben sei; jedoch stehe der königliche Palast noch jedem offen, der Hilfe zu bringen im Stande sei.
Da ging sie augenblicklich hin, stellte sich dem König vor und versprach Hilfe. »Ich erlaube Euch gerne, zum Prinzen zu kommen«, sagte der betrübte König, »aber mir scheint, Ihr seid für einen rechten Doktor doch gar zu jung. Nun, wir wollen sehen!« Sie wurde hinein geführt und als sie den Prinzen so elend sah, wollte sie in Tränen ausbrechen, aber sie hielt sich zurück und ordnete für die Nacht nur einen Fieber stillenden Trank an.
Am Morgen früh ließ sie die Schlange im Garten suchen und töten und in ihrem Blute den Salbei sieden; damit bestrich sie den Kopf des Prinzen. Und nur wenige Tage vergingen; da waren die Glasscherben nach und nach alle heraus gekommen und der Prinz konnte gesund sein Lager verlassen. Der König und die Königin konnten sich vor Freude gar nicht fassen und wussten nicht, wie sie dem jungen Doktor danken sollten.
»Schade«, sagte der König lächelnd, »dass Ihr nicht ein Mädchen seid; in diesem Falle hätten wir Euch unseren Sohn zum Gemahl gegeben, denn Ihr seht ihm ganz ähnlich. Da Ihr aber nun einmal dies nicht seid, so verlangt zum Lohne, was Ihr immer wollt und wir werden es Euch geben.« »Ich verlange nichts von Euch«, erwiderte sie, »als ein Pferd von Eurem Sohn, eine Locke von seinen Haaren zum Andenken und sein goldenes Waschbecken.«
Der König verwunderte sich zwar sehr über dieses Verlangen, aber er gab es ihr mit Freuden und sie ritt auf dem Pferde vergnügt nach Hause. Nach wenigen Tagen schloss sie sich allein in ihr Zimmer ein, kleidete sich prächtig, stellte das goldene Waschbecken hin, öffnete das Fenster und tat nun mit den Haaren des Prinzen, was sie das erste Mal getan hatte.
Sogleich kam die Taube wieder mit einem Schwert unter den Flügeln, tauchte sich in das Wasserbecken und vor ihr stand der Prinz mit zornigem Blicke und dem blanken Schwert in der Hand. »Warum rufst du mich wieder«, sagte er, »nachdem du mich das vorige Mal fast zum Sterben krank gemacht hast? Siehst du hier das Schwert? Damit sollte ich dich durchbohren, für dieses Mal will ich dir noch verzeihen, aber heiraten will ich dich nun und nimmermehr!«
Da warf sie sich vor ihm auf die Knie und beschwor ihn sie anzuhören. Nun erzählte sie, wie alles zugegangen war und wie sie ihn geheilt habe. »Das glaube ich nicht!« rief er. »Seht nur«, sagte sie, »hier ist Eure Haarlocke, dort steht Euer goldenes Waschbecken und unten im Stall ist das Pferd, das Ihr mir geschenkt habt!« Als der Prinz dies sah, war sein Zorn besänftigt, sie gaben sich wieder die Hände und wechselten die Ringe.
Vierzehn Tage später wurde die Hochzeit gefeiert und sie waren glücklich und zufrieden durch ihr ganzes Leben. Und ihr bestes Glück war, dass sie sich nicht nur äußerlich an Schönheit, sondern auch innerlich an Tugend gleich waren. -
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DAS PFEIFCHEN ...
Einmal war ein Hirtenknabe, der trug fröhlichen Sinn und lebte mit seinen Ziegen im grünen Walde und auf den luftigen Höhen, ohne dass er sich etwas Besseres wünschen mochte.
Eines Tages fand er im Walde zwei Frauen, welche schliefen. Da die Sonne heiß auf sie schien, schnitt er Zweige ab und machte ein grünes Dach über sie, dass sie nun im Schatten lagen. Bald darauf erwachten sie und verwunderten sich nicht wenig; »ei«, sagten sie, »wer hat uns doch das grüne Häuschen hergebaut?«
Der Knabe trat hinzu und sagte: »Ich hab es getan.« Da lobten sie ihn und die Eine sagte: »Jetzt darfst du von mir etwas verlangen und du sollst es bekommen.« Da erwiderte der Knabe: »So gib mir ein Pfeifchen, welches, wenn ich blase, alle tanzen macht, die es hören.« Die Frau gab es ihm.
Dann sagte die zweite: »Ich will dir auch etwas schenken; was willst du?« Der Knabe antwortete: »So gib mir ein Gewehr, mit dem ich ohne Pulver und Schrott alle Vögel treffe, welche ich in der Luft sehe!« Da gab sie ihm das Gewehr, er dankte und sprang mit seinen zwei herrlichen Geschenken lustig fort.
Das war jetzt ein Leben! Wenn er so im Walde blies, tanzten die Geisen lustig um ihn herum und die Hasen in den Gebüschen und die Eichhörnchen auf den Bäumen und sogar die Füchse in den Höhlen kamen auch und tanzten, als ob sie alle närrisch geworden wären.
Und wenn ein Raubvogel in den Lüften schwebte oder ein garstiger Rabe krächzte, nahm er sein Gewehr und schoss sie herab; den lieben Singvöglein aber tat er nichts zu Leide und ließ sie singen und hüpfen, so viel sie wollten.
Einmal ging ein Geistlicher durch den Wald; da hatte der Knabe gerade einen Vogel geschossen, welcher auf eine Stelle voll Dornengebüsch niedergefallen war. Der Geistliche ging hin und wollte den Vogel heraus holen. Da fing der Knabe an auf seinem Pfeifchen zu blasen und der arme Mann musste im Dorngestrüppe tanzen, bis er ganz zerrissen und voll Blut war.
Er ging zu Gerichte und verklagte den Hirten. Das Gericht schickte Schergen aus, den Knaben zu ergreifen; aber als sie ihm näher kamen, fing er an zu blasen und sie mussten tanzen, bis der Knabe aufhörte und sie vor Müdigkeit kaum mehr aufrecht stehen konnten.
So machte er es jedes Mal, wenn sie ihn fangen wollten. Einmal aber überfielen sie ihn unversehens, entrissen ihm das Pfeifchen und führten ihn gebunden in den Kerker. Nun wurde über ihn großes Gericht gehalten und die Richter sprachen das Urteil aus, dass er am Galgen sterben sollte.
Als er zum Galgen geführt worden war und schon darunter stand, bat er, man möge ihm noch eine letzte Bitte und Gnade gewähren. Man gestand es ihm zu und er bat, dass man ihm noch einmal sein Pfeifchen in die Hand geben möchte. Als er es bekommen hatte, fing er sogleich zu blasen an.
Da begann der Henker, welcher schon den Strick in der Hand hatte, lustig zu tanzen und die Richter und die Schergen und die Zuschauer tanzten auch alle, bis sie sterbensmüde waren. So entkam der Knabe leicht und ließ sich kein zweites Mal mehr fangen.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DIE SILBERNE NASE ...
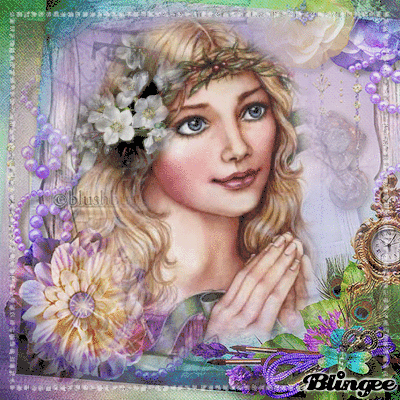
Es war einmal eine arme Wäscherin, die war Witwe und hatte drei Töchter. Alle vier gingen Wäsche waschen, aber sie konnten arbeiten, so viel sie mochten, sie litten doch Hunger dabei.
Eines Tages sagte die größte von den Töchtern: "Ich will von daheim weg, und wenn ich gehen müsste, um dem Teufel zu dienen." "Sprich nicht so, Tochter", sagte die Mutter. "Du weißt nicht, was dir zustoßen könnte."
Es vergingen nicht viele Tage, da stellte sich in ihrem Hause ein Herr ein, der war ganz schwarz gekleidet und hatte eine silberne Nase. "Ich weiß, dass ihr da drei Töchter habt", sprach er zur Mutter. "Wollt ihr nicht eine davon in meinen Dienst geben? Ich will sie gut entlohnen."
Die Mutter hätte sie so gleich gehen lassen, aber da war diese silberne Nase, die ihr nicht gefiel. Sie rief insgeheim ihre älteste Tochter und sagte: "Pass auf! Hast du in dieser Welt je einen Menschen mit einer silbernen Nase gesehen? Nimm dich in acht, wenn du mit diesem mitgehst!"
Die Tochter, welche die Stunde nicht erwarten konnte, da sie von daheim weg gehen durfte, reiste bald darauf mit dem Silbernasigen ab. Sie gingen weit und noch weiter, über Berg und Tal, durch Wälder und Wüsten, und an einem Punkt, sehr weit von daheim weg, sah man ein Leuchten wie von einem großen Brand.
"Was ist denn das da drüben?" fragte das Mädchen, das etwas ängstlich wurde. "Das ist mein Haus. Dorthin gehen wir", entgegnete der Silbernasige. Das Mädchen folgte ihm zaghaft, und es konnte sein Zittern nicht verbergen.
Sie kamen zu einem großen, großen Palast, und der Silbernasige zeigte ihr alle Zimmer, eines schöner als das andere. Und zu jedem Zimmer gab er ihr den dazu passenden Schlüssel. So kamen sie an die Türe des letzten Zimmers, auch dazu gab ihr der Silbernasige den Schlüssel, aber er sagte: "Diese Türe darfst du niemals und um keinen Preis öffnen, sonst wehe dir!" "Und die anderen Zimmer?" "In allen anderen Zimmern bist du die Herrin und kannst machen, was du willst. Von diesem Zimmer hier aber nicht!"
Das Mädchen dachte für sich: "Da muss aber etwas Besonderes darinnen sein", und es beschloss bei sich, das Zimmer zu besuchen, sobald es allein sei. Am Abend, nachdem es den Silbernasigen bedient hatte, ging das Mädchen in seine Kammer und schlummerte bald darauf ein. Als sie aber fest schlief, trat der Silbernasige heimlich ein, näherte sich ihrem Bett und steckte ihr eine Rose ins Haar. Dann machte er sich wieder leise, leise davon.
Am anderen Morgen sagte der Silbernasige zum Mädchen: "Ich gehe jetzt meinen Geschäften nach. Sieh zu, dass du das Haus in Ordnung bringst, aber hüte dich, jenes Zimmer zu betreten!" Kaum war er aus dem Hause, da hatte das Mädchen nichts Eiligeres zu tun, als zu dem verbotenen Zimmer zu laufen und die Türe aufzusperren. Als sie die Tür geöffnet hatte, sah sie Flammen und Rauch, und in dem Feuer brannten verdammte Seelen.
Da wusste das Mädchen, dass der Silbernasige der Teufel und das Zimmer die Hölle war. Sie stieß einen Schrei aus und schloss sofort die Türe, dann lief sie in das Zimmer, das von dem höllischen Gemach am weitesten entfernt lag. Aber eine höllische Flamme hatte ihr die Rose versengt, die sie im Haar trug.
Der Herr Silbernase kehrte nach Hause zurück und sah sofort, dass die Rose verbrannt war. "Ah! So hast du mir also gefolgt!" sagte er. Und er packte sie bei den Haaren und schleifte sie zu jenem Zimmer, öffnete die Türe und warf sie mitten in die höllischen Flammen.
Einige Tage später aber begab er sich zu jener Wäscherin. "Eure Tochter fühlt sich sehr wohl, aber die Arbeit ist zuviel. Sie braucht dringend eine Hilfe. Könnt ihr mir nicht auch eure zweite Tochter in Dienst geben?"
Und so kehrte er mit der Zweiten in seinen Palast zurück. Er zeigte ihr alle Zimmer und gab ihr zu jedem den passenden Schlüssel. Beim letzten Zimmer aber gab er ihr zwar den Schlüssel, sagte jedoch: "Diese Türe darfst du niemals und um keinen Preis öffnen, sonst wehe dir!" "Das kann mir nicht einfallen", erwiderte das Mädchen. "Was gehen mich eure Geschäfte an?"
Am Abend, nachdem das Mädchen den Silbernasigen bedient hatte, ging es in seine Kammer, legte sich zu Bett und schlummerte bald darauf ein. Als sie aber fest schlief, trat der Silbernasige leise, leise ein, näherte sich ihrem Bette und steckte ihr eine Nelke ins Haar. Dann machte er sich so heimlich davon, wie er gekommen war.
Am folgenden Morgen, kaum nach dem der Silbernasige ausgegangen war, machte sich das Mädchen so gleich daran, die Türe zum verbotenen Zimmer aufzuschließen. Da sah sie Flammen und Rauch und die verdammten Seelen, und mitten unter ihnen erkannte sie ihre eigene Schwester. "Schwester!" schrie diese. "Befreie mich aus dieser Hölle!"
Aber die Zweite fühlte sich einer Ohnmacht nahe. Sie verschloss so gleich wieder die Türe und rannte davon. Aber sie wusste nicht, wo sie sich verbergen solle, denn sie war nun sicher, dass der Silbernasige der Teufel war. Der kam bald darauf zurück. Er sah die versengte Nelke im Haar des Mädchens und sagte zu ihm: "Ah, so hast du mir also gefolgt!" Und er packte sie bei den Haaren und schleifte sie zu jenem Zimmer, öffnete die Türe und warf die Unglückliche mitten in die höllischen Flammen.
Kurze Zeit danach stellte er sich wieder bei der Wäscherin ein. "Die Arbeit in meinem Haus ist so viel, dass selbst zwei Mädchen nicht alles schaffen können. Wollt ihr mir nicht auch noch eure Dritte in Dienst geben?"
Und so kehrte er mit der Jüngsten, die Lucia hieß, in seinen Palast zurück. Lucia aber war nicht nur die jüngste, sondern auch die schlaueste von den dreien. Auch ihr zeigte der Silbernasige alle Zimmer und gab ihr dazu die Schlüssel. Und auch zu Lucia sagte er bei der letzten Türe: "Diese Türe darfst du niemals und um keinen Preis öffnen, sonst wehe dir!"
Am Abend, nachdem Lucia den Silbernasigen bedient hatte, ging sie in ihre Kammer, legte sich zu Bett und schlief gleich ein. Als sie aber fest schlummerte, trat der Silbernasige leise, leise ein, näherte sich dem Bette und steckte dem Mädchen eine Jasminblüte ins Haar. Dann machte er sich so heimlich davon, wie er gekommen war.
Am Morgen, als Lucia erwachte, stand sie auf und kämmte sich die Haare. Da sah sie im Spiegel gleich die Jasminblüte und sprach bei sich: "Da schau her! Herr Silbernase hat mir eine Jasminblüte ins Haar gesteckt. Was für ein hübscher Einfall! Aber ich will ihr frisches Wasser geben." Und sie steckte die Blüte in eine Vase.
Nachdem sie sich gekämmt hatte, ging sie im Hause herum und merkte, dass sie allein war. Da lief sie schnell zum verbotenen Zimmer und öffnete die Türe. Da sah sie Flammen und Rauch, und sie erkannte unter den verdammten Seelen ihre beiden Schwestern. "Lucia, Lucie!" schrien diese. "Lauf fort! Rette dich!"
Lucia verschloss zunächst wieder die Türe. Dann dachte sie nach, wie sie ihre Schwestern befreien könnte. Als der Teufel zurück kehrte, hatte sich Lucia die Jasminblüte wieder ins Haar gesteckt und tat, als ob nichts geschehen wäre.
Der Silbernasige sah die Blüte und sagte: "Ah, was für eine hübsche frische Blüte!" "Freilich, warum sollte sie nicht frisch sein! Trägt man etwa verwelkte Blumen im Haar?" "Nein, nein", entgegnete der Silbernasige. "Ich sagte es nur eben so hin. Du aber scheinst mir ein braves Mädchen zu sein. Und wenn du so weiter machst, werden wir uns immer gut verstehen. Bist zu zufrieden?"
"Ja, hier geht es mir gut. Aber es würde mir noch besser gefallen, wenn ich nicht eine Sorge hätte." "Und was für eine Sorge?" "Als ich von daheim weg ging, fühlte sich meine Mutter nicht recht gut. Und nun fehlen mir schon lange alle Nachrichten von ihr."
"Wenn's nicht mehr ist als das", sagte der Teufel, "dann werde ich gleich hin schauen und dir von ihr Nachricht geben." "Danke! Ihr seid sehr gütig. Wenn ihr morgen gehen könntet, würde ich euch einen Sack mit schmutziger Wäsche mitgeben. Falls es meiner Mutter wieder besser gehen sollte, könnte sie diese gleich waschen. Oder belaste ich euch damit zu sehr?" "Keine Rede!" sagte der Teufel. "Mir kann niemals etwas zu schwer sein."
Der Silbernasige war kaum ausgegangen, da öffnete Lucia die Türe zum höllischen Zimmer, zog ihre älteste Schwester aus dem Feuer heraus, steckte sie in den Sack und band diesen zu.
"Verhalte dich ruhig", sagte sie. "Der Teufel selbst wird dich heim tragen. Wenn du aber merkst, dass er den Sack unterwegs abstellt, dann sagst du: 'Ich seh dich, ich seh dich!"
Als der Silbernasige am nächsten Morgen sich auf den Weg machen wollte, sagte Lucia zu ihm: "Hier ist der Sack mit der schmutzigen Wäsche. Aber werdet ihr ihn auch wirklich bis zum Hause meiner Mutter tragen?" "Warum traust du mir nicht?" begehrte der Teufel zu wissen. "Doch, ich vertraue euch. Um so mehr als ich die Gabe besitze, in die Ferne zu sehen. Und wenn ihr immer wo den Sack abstellen würdet, könnte ich euch doch sehen!"
"Da schau her!" erwiderte der Teufel. Bei sich aber dachte er, dass das Mädchen zuviel Worte mache und man die Geschichte nicht ernst zu nehmen brauche. Er warf sich den Sack über die Schulter. "Der ist aber höllisch schwer!" sagte er empört. "Das kommt davon, weil ihr so viele Jahre nicht habt waschen lassen", antwortete das Mädchen.
Der Silbernasige machte sich auf den Weg. Aber als er die Hälfte der Strecke zurück gelegt hatte, sprach er bei sich: "Verdammt! Ich will doch einmal nach sehen, ob dieses Mädchen mir nicht mit der Ausrede, es sei schmutzige Wäsche, mein Haus ausplündert!" Und er machte sich daran, den Sack ab zu stellen.
"Ich sehe dich, ich sehe dich!" rief sogleich die Schwester im Sack. "Verflucht! Es ist wahr. Sie sieht in die Ferne", sprach der Teufel und lud sich fluchend den schweren Sack wieder auf die Schulter. Dann ging er ohne Halt bis zum Hause der Wäscherin. "Eure Tochter schickt euch diesen Sack schmutziger Wäsche und will wissen, wie es euch geht." Kaum war der Silbernasige aus dem Hause, da öffnete die Mutter den Sack, und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr sie sich darüber freute, ihre Älteste zu finden!
Nach einer Woche stellte sich Lucia wieder schwermütig, und auf sein Befragen äußerte sie den Wunsch, wieder Nachricht von ihrer Mutter zu erhalten. "Gut, wenn es nicht mehr ist als das, werde ich gleich morgen gehen, um deine Mutter zu besuchen", versprach der Teufel. "Dann könnt ihr mir auch wieder einen Sack mit schmutziger Wäsche mitnehmen."
Das passte dem Silbernasigen nun weniger, aber er konnte es Lucia nicht gut abschlagen. Das Mädchen aber versteckte seine zweite Schwester in dem Sack und sagte auch zu ihr: "Verhalte dich ruhig! Der Teufel selbst wird dich heim tragen. Wenn du aber merkst, dass er den Sack unterwegs abstellen will, dann sagst du: 'Ich sehe dich, ich sehe dich!'"
Am nächsten Tag machte sich der Teufel also mit dem Sack auf den Weg, und er hätte gern nach gesehen, ob im Sack wirklich nur schmutzige Wäsche wäre, aber so oft er den Sack abstellen wollte, hörte er eine Stimme: "Ich sehe dich, ich sehe dich." Und da gab er es auf und trug den Sack ins Haus der Wäscherin.
Als sie den Silbernasigen kommen sah, fürchtete sie sich sehr, denn sie wusste nun, dass das der Teufel war, und hatte Angst, er wolle die gewaschene Wäsche mitnehmen. Aber der Silbernasige wischte sich den Schweiß von der Stirne und sagte: "Die frische Wäsche nehme ich ein anderes Mal mit. Hier dieser schwere Sack hat mir genug Plage gemacht, so dass mich der ganze Rücken schmerzt. Ich will ohne Last den Rückweg antreten."
Als er weg war, öffnete die Mutter den Sack und fand ihre zweite Tochter. Voll Freude umarmte sie diese, aber umso mehr Angst litt sie um Lucia, die nun allein in Händen des Teufels war.
Und was machte nun Lucia? Einige Tage darauf plagte sie den Teufel wieder mit ihren Klagen, dass sie sich um ihre Mutter sorge. "Ich habe heute furchtbar Kopfweh!" sagte sie. "Aber ich habe den Sack mit Schmutzwäsche für morgen schon hergerichtet, so dass ihr ihn morgen früh mitnehmen könnt, ohne dass ich ihn erst richte. Denn wenn mir morgen nicht besser ist, muss ich im Bett bleiben. Ich bitte euch, lasst mich etwas länger schlafen!"
Der Teufel war zwar von dieser Aussicht wenig erbaut, aber da das Mädchen immer so brav und folgsam war, konnte er ihr die Bitte schlecht abschlagen. Nun muss man aber wissen, dass Lucia heimlich eine große Puppe genäht hatte. Die legte sie in ihr eigenes Bett, schnitt sich ihre Zöpfe ab und nähte sie der Puppe an den Kopf. Sich selbst aber versteckte sie im Sack.
Am Morgen öffnete der Teufel leise die Türe zum Schlafzimmer des Mädchens. Das war ganz unter der Decke begraben, nur die Zöpfe hingen herunter. "Die Arme ist wirklich krank!" sagte der Teufel, nahm den Sack auf die Schulter und machte sich auf den Weg.
Nach einer guten Strecke sprach er bei sich: "Wenn Lucia heute krank ist, dann wird sie auch sicher nicht so aufpassen wie sonst. Das ist eine gute Gelegenheit, im Sack nachzuschauen, ob tatsächlich nur schmutzige Wäsche darinnen ist." Und er stellte den Sack ab. "Ich sehe dich, ich sehe dich!" rief Lucia.
"Verdammt! Ganz ihre Stimme, so als ob sie selbst im Sacke wäre! Das ist ein Mädchen, mit dem man besser nicht anbindet!" Und er nahm den Sack wieder auf die Schulter und machte nicht mehr halt, bis er zur Wäscherin kam. "Ich werde ein andermal vorbei schauen, um die frische Wäsche mit zu nehmen", sagte er. "Jetzt muss ich gleich wieder heim, weil Lucia erkrankt ist."
So war die Familie glücklich wieder vereint, und da Lucia auch einiges Geld aus dem Palast des Teufels zu sich gesteckt hatte, konnte sie glücklich und zufrieden leben.
Am Eingang des Hauses aber stellten sie ein Kreuz auf, so dass sich der Silbernasige nicht mehr nähern konnte. Der aber hatte gar nicht die Absicht, denn er war froh, Lucia los geworden zu sein.
Märchen aus Italien
DAS ASCHENBRÖDEL ...
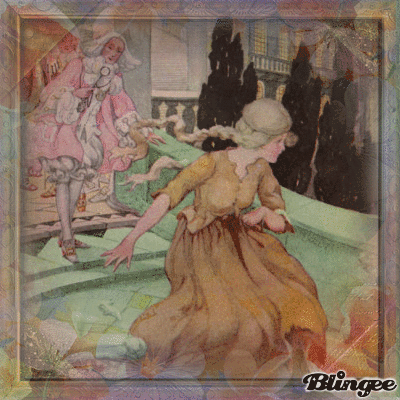
Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten zwei Töchter, eine schöner als die andere. Eine von ihnen hielt sich immer beim Herd auf, darum nannte man sie das Aschenbrödel. Ihre Mutter machte sich nichts aus ihr und schickte sie jeden Morgen mit ein paar Enten hinaus und gab ihr ein Pfund Hanf zum Spinnen mit.
Eines Morgens war sie mit den Enten zu einem Graben gekommen und schickt sie ins Wasser und sagt zu ihnen:
Enten, Enten, geht zum trinken,
Ist es trüb, sollt ihr nicht trinken,
Ist es helle, trinkt, und schnelle!
Kaum hat sie das gesagt, so sieht sie eine Alte vor sich. – »Was tust du hier?« sagt die Alte. – »Ich habe diese Enten hinaus geführt und soll dies Pfund Hanf spinnen.« – »Warum läßt man gerade dich das alles tun?« – »Meine Mutter will es.« – »Schickt sie nicht auch deine Schwester einmal mit den Enten hinaus?« – »Niemals.« – »Hier, liebes Kind! Ich will dir was schenken. Nimm diesen Kamm und versuche, dich damit zu kämmen.« –
Sie gab ihr einen Kamm, und Aschenbrödel kämmte sich, zuerst auf einer Seite, und während sie es tat, rollten ihr aus den Haaren Körner in Menge, und die Enten fraßen davon bis zum Platzen. Dann kämmte sie sich auf der anderen Seite, und von da rollten Brillanten und Rubine herunter. Dann zieht die Alte eine Schachtel heraus, gibt sie ihr und sagt: »Nimm sie und tue die Brillanten und Rubine hinein, trage sie nach Hause und verbirg sie gut in deiner Lade!« –
»Jetzt aber habe ich den Hanf zu spinnen,« sagte das Mädchen. – »Mach dir keine Sorgen, das ist meine Sache.« – Damit tut sie einen Schlag mit einer Gerte, die sie in der Hand hatte, und sagt: »Ich befehle, der Hanf soll gesponnen sein –« und im Handumdrehen war es geschehen. – »Jetzt geh nach Haus,« sagte die Alte, »und komm jeden Morgen wieder hier her, du wirst mich finden.«
Aschenbrödel ging nach Hause und sagte nichts und saß immer im Winkel am Herde. Jeden Morgen ging sie wieder nach jenem Ort, fand dort die Alte, die ließ sie kämmen und spann ihr den Hanf. Eines Morgens, nachdem der Hanf gesponnen war, sagte ihr die Alte: »Höre! Heute Abend gibt der Sohn des Königs einen Ball und hat deinen Vater, deine Mutter und deine Schwester eingeladen. Dich aber werden sie zum Spaß fragen, ob du mitkommen willst, du sage aber, du willst nicht. Sieh dies Vögelchen! Verbirg es in deiner Kammer, und heute Abend, wenn die anderen fort gegangen sind, geh zu dem Vögelchen und sprich:
Vöglein, Vöglein, her und hin,
Mach mich schöner, als ich bin!
Und du wirst sehen: auf einmal hast du Ballkleider an. Und nimm auch diese Gerte, tue einen Schlag damit, und ein Wagen wird erscheinen. Dann fahre auf den Ball, und niemand wird dich erkennen, und der Sohn des Königs wird mit dir tanzen. Du aber sieh dich vor! Wenn sie in den Saal gehen, sich zu erfrischen, laß den Wagen kommen und fahre weg, damit niemand sieht, wohin du fährst. Dann aber kehre zu deinem Vogel zurück und sprich:
Vöglein, Vöglein, her und hin,
Mach mich garst'ger, als ich bin!
und du wirst wieder werden wie vorher. Setz dich wieder in deinen Winkel am Herdfeuer und sage nichts.«
Das Mädchen nahm das Vögelchen, trug es nach Hause und verbarg es in ihrer Lade. Wirklich sagte, als sie sie zurück gekehrt war, die Mutter zu ihr: »Höre, der Sohn des Königs hat uns zum Ball geladen; möchtest du mit kommen?« – »Ich habe keine Lust,« antwortete sie. »Amüsiert ihr euch nur, ich bleibe zu Hause.«
Am Abend gingen sie und ließen sie bei dem Ascheherd. Kaum waren sie fort, geht sie zu dem Vögelchen und tut alles, was die Alte ihr gesagt hatte, und als sie auf dem Ball war, tanzte der Sohn des Königs mit ihr und verliebte sich in sie, aber sobald die Stunde der Erfrischungen kommt, steigt sie in den Wagen und fort, nach Hause.
Der Prinz, der sie nicht mehr sah, läßt sie überall suchen, sie wurde aber nicht gefunden, und niemand wußte, wer sie war und wo sie wohnte. In der Hoffnung, daß sie wenigstens wiederkommen würde, sagte der Sohn des Königs allen Geladenen, ehe sie sich verabschiedeten, auf morgen Abend lade er sie zu einem anderen Feste ein.
Papa, Mama und Schwester kommen nach Hause und finden Aschenbrödel im Herdwinkel. »Es war ein prachtvolles Fest,« erzählte ihr die Mutter, »und eine Dame war da, eine wahre Schönheit, und man wußte nicht, wer sie war. Wenn du gesehen hättest, wie schön sie war!« – »Mir liegt nichts dran,« erwidert Aschenbrödel. –
»Sieh,« sagt die Mutter, »morgen findet ein anderes Fest statt. Da könntest auch du kommen.« – »Nein, nein. Ich bleibe hier im Winkel beim Feuer, da befinde ich mich gut.«
Am anderen Morgen geht sie mit den Enten wie gewöhnlich hinaus und findet die Alte. »Wie ist es gegangen?« fragt diese. – »Gut ist es gegangen.« – »Heute Abend geh wieder hin und mach es, wie du es gestern gemacht hast. Aber gib acht! Du wirst sehen, daß sie dir folgen, wenn du gehst. Dann tue einen Schlag mit der Gerte und befiehl: Geld! Das Geld nimm dann und wirf es aus dem Wagen. Die Leute werden stehen bleiben, es aufzusammeln, und dich aus den Augen verlieren.«
Wirklich, als der Abend kam, gingen Vater, Mutter und Schwester auf den Ball und ließen sie zu Hause. Das Vögelchen ließ sie noch schöner werden als das erste Mal, sie fuhr hin, und der Sohn des Königs, hoch erfreut, als er sie sah, tanzte mit ihr und hatte der Dienerschaft Auftrag gegeben, sie im Auge zu behalten. In der Tat, als sie zur Stunde der Erfrischungen in den Wagen stieg, beeilten sich die Diener, ihr nachzulaufen. Sie aber warf eine Menge Geld aus, und die anderen machten sich daran, es aufzulesen, und verloren sie aus dem Gesicht.
Der Prinz, ganz verzweifelt, beschloss, am anderen Tage einen dritten Ball zu geben. Als sie heimkam, sagte die Mutter zu Aschenbrödel, morgen werde wieder ein Fest stattfinden, davon aber wollte die Tochter nichts wissen und stellte sich gleichgültig.
Am Morgen geht sie mit den Enten aus und begegnet der Alten. – »Bis jetzt ist es gut gegangen. Aber gib acht, heute Abend wirst du ein Kleid mit goldenen Glöckchen anhaben und goldene Schuhe. Du wirst sehen, sie laufen dir wieder nach. Dann wirf ihnen einen Schuh und Geld hin. Jetzt aber werden sie entdecken, wohin du fährst.«
Wirklich, als sie abends im Hause allein blieb, ließ ihr das Vögelchen ein prächtiges Kleid mit lauter goldenen Glöckchen bringen und für die Füße goldene Schuhe, die ein Wunder waren. Der Prinz tanzte mit ihr und wurde immer verliebter. Als sie fortging, um sich in ihren Wagen zu setzen, eilten ihr die Diener von weitem nach.
Sie stieg ein und fuhr fort, und die Diener hinter drein. Sie aber wirft einen Schuh hinaus und Geld. Die Diener aber hatten vom König gehört, bei Todesstrafe müßten sie entdecken, wo diese Dame wohnte. So achteten sie nicht auf das Geld. Einer hob den Pantoffel auf, und sie liefen so rasch, daß sie endlich sahen, wo der Wagen anhielt. Sie sagten es dem Könige und brachten ihm den Schuh, und der König gab ihnen eine große Belohnung.
Am anderen Morgen geht das Mädchen mit den Enten hinaus und trifft die Alte, und diese sagt ihr: »Heute morgen mußt du dich sputen, denn der Königssohn wird kommen, dich zu holen.« – Und zugleich gibt sie ihr den Kamm und die Schachtel und spinnt ihr den Hanf und schickt sie nach Hause.
Kaum sieht sie die Mutter, sagte diese: »Warum kommst du heute so früh zurück?« – »Seht nur die Enten, wie satt sie sind,« antwortete sie, und die Mutter sieht die Enten, die in der Tat satt waren, und schwieg. Mittags kommt der Königssohn zu Wagen. Er klopft, sie sehen, wer es ist, und alle laufen hinunter, außer dem Aschenbrödel. Die geht zu dem Vögelchen und spricht zu ihm:
Vöglein, Vöglein, her und hin,
Mach mich schöner, als ich bin!
Und das Vögelchen läßt ihr wieder das Kleid mit den goldenen Glöckchen und den goldenen Schuh kommen, doch nur einen. In dessen fragt der Fürst ihren Vater: »Wie viele Töchter habt Ihr?« – »Eine einzige, diese hier.« – »Wie? Habt Ihr nicht noch andere?« – »Ja, Majestät, ich habe noch eine, aber ich schäme mich – sie sitzt immer im Herdwinkel und ist voll Asche.« – »Sei sie, wie sie wolle, geht und ruft sie!«
Da rief sie der Vater: »He, Aschenbrödel, komm ein bißchen herunter!« – Sie tut es, und bei jedem Schritt auf der Stiege machen die Glöckchen dolin, dolin! »Seht das einfältige Ding!« sagte die Mutter, »da schleift sie sich Schaufel und Feuerzange nach!« –
Kaum aber erschien sie in ihrem Putz, daß es eine Pracht war, blieben alle ganz sprachlos. Der Fürst aber sagte: »Das ist die, die ich suche, und nichts fehlt ihr, als ein goldener Schuh; laßt sehen, ob es dieser vielleicht ist« – und zog den goldenen Schuh aus der Tasche und gab ihn Aschenbrödel, die ganz rot wurde und ihn an ihren Fuß tat und zeigte, daß er wirklich der ihre war.
Da begehrte sie der Sohn des Königs zur Frau, und die Eltern konnten nicht nein sagen. Das Aschenbrödel nahm das Vögelchen mit und alle Kleinodien, die sie von der kleinen Alten erhalten hatte, und ging mit dem Königssohn. Sie feierten eine prächtige Hochzeit, und Vater, Mutter und Schwester beschenkte sie reich und behandelte sie so gut, als wenn sie immer gut zu ihr gewesen wären.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Pisa
DAS ROTHHÜTCHEN ...
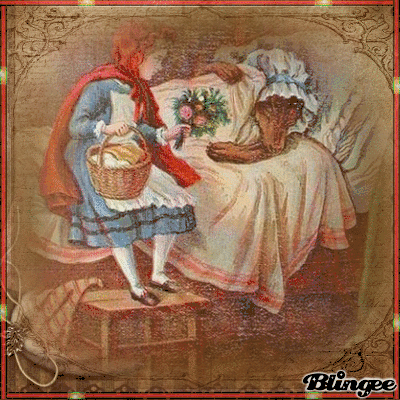
Einmal war eine Alte, die hatte eine Enkelin, welche das Rothhütchen hieß. Eines Tages waren sie auf dem Felde, da sagte die Alte: »Ich gehe nach Hause, über eine Weile magst du nach kommen und mir die Suppe bringen.«
Als nun Rothhütchen nach einer Weile auch heimging, begegnete es dem Orco (Menschenfresser), welcher sagte: »Ei, schönes Rothhütchen, wohin gehst du denn?« - »Ich gehe meiner Grossmutter die Suppe bringen.« »Gut«, erwiderte er, »da komm' ich auch mit. Aber wo gehst du, über die Steine oder über die Dornstauden?« »Ich geh über die Steine«, sagte das Mädchen. »So gehe ich über die Dornstauden!« versetzte der Orco.
Sie gingen. Aber Rothhütchen kam auf dem Wege zu einer Wiese, da blühten viele schöne Blumen von allen Farben und das Mädchen pflückte davon nach Herzenslust. In dessen lies sich der Orco die Eile angelegen sein und kam, obwohl er auf den Dornstauden ging, vor dem Rothhütchen zum Hause. Er ging hinein, erschlug und fraß die Alte und legte sich selbst in das Bett; vorher hatte er aber noch die Gedärme statt des Strickes an die Türe gehängt und das Blut, die Zähne und die Kiefern in den Küchenschrank gestellt.
Kaum war er im Bette, so kam Rothhütchen und klopfte an die Türe. »Herein«, rief der Orco mit dumpfer Stimme. Rothhütchen wollte die Türe aufmachen; aber als es merkte, dass es an etwas Weichem ziehe, rief es: »Ei, wie weich ist das Ding da, Grossmütterchen!« - »Zieh nur und schweig, es sind ja die Gedärme deiner Grossmutter!« »Was sagst du da?« - »Zieh nur und schweige!« -
Rothhütchen zog die Türe auf, trat ein und sagte: »Grossmütterchen, mich hungert!« Der Orco erwiederte: »Gehe nur hinaus zum Küchenschrank, da wird noch ein wenig Reis sein.« Rothhütchen ging und nahm die Zähne heraus. »Ei, wie hart ist das Ding da, Grossmütterchen!« - »Iss und schweig, es sind ja die Zähne deiner Grossmutter!« - »Was sagst du da?« »Iss und schweige.« -
Über eine Weile sagte Rothhütchen: »Grossmütterchen, mich hungert noch!« - »Gehe nur hinaus zum Schranke«, sagte der Orco, »da wirst du noch zwei Hackfleischschnittchen finden.« Rothhütchen ging und nahm die Kiefern heraus. »Ei, wie rot ist das Ding da, Grossmütterchen!« - »Iss und schweig; es sind ja die Kiefern deiner Grossmutter!« - »Was sagst du da?« - »Iss und schweige.« -
Über eine Weile sagte Rothhütchen wieder: »Grossmütterchen, mich dürstet!« - »Sieh nur im Schranke nach,« sagte der Orco, »es muss noch ein bißchen Wein da sein!« - Rothhütchen ging und nahm das Blut heraus. »Ei, wie rot ist dieser Wein da, Grossmütterchen!« - »Trink und schweig, es ist ja das Blut deiner Grossmutter!« - »Was sagst du da?« - »Trink nur und schweige.« -
Über eine Weile sagte Rothhütchen: »Grossmütterchen, mich schläfert!« - »Zieh dich aus und komm zu mir ins Bett!« erwiederte der Orco. Rothhütchen ging ins Bett und merkte etwas Haariges. »Ei, wie haarig du bist, Grossmütterchen!« - »Das kommt vom Alter,« sagte der Orco. -
»Ei, wie lange Beine du hast, Grossmütterchen!« - »Das kommt vom Gehen.« »Ei, wie lange Hände du hast, Grossmütterchen!« - »Das kommt vom Arbeiten.« - »Ei, wie lange Ohren du hast, Grossmütterchen!« - »Das kommt vom Horchen.« - »Ei, welch grosses Maul du hast, Grossmütterchen!« - »Das kommt vom Kinderfressen!« sagte der Orco und gnaf - verschlang er Rothhütchen auf einen Ruck.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DIE BÄRTIGE
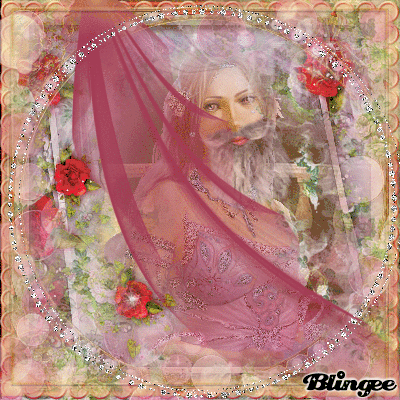
Es war einmal eine Frau, die hatte drei Töchter. Sie waren arm, ernährten sich mit spinnen, und jeden Tag ging eine andere der Töchter um Zichorienpflanzen zum Salat zu pflücken. Die sammelten sie in ein Körbchen, verkauften sie, und so lebten sie.
Eines Tages war die Kleinste ganz verzweifelt, denn sie fand keine Zichorie. Aber da sieht sie eine schöne Wiese, wo eine Menge wuchs und von den schönsten, und geht hin und pflückt davon. Da kommt ein Ungeheuer: »Ha! wie kommst du dazu, mir diese Zichorien zu stehlen?« – »Ich tue es, um nicht zu verhungern.« – »Schön! sieh diese Börse mit Geld, die bringe deinen Leuten, und komme dann wieder her.« –
Das Mädchen nimmt das Geld, geht nach Hause und erzählt alles der Mutter. Die Mutter, wie sie das Geld sieht, freut sich und sagt der Tochter, sie solle nur zu dem Ungeheuer zurück kehren. Das Ungeheuer bringt sie ans Ende einer breiten Straße, wo ein sehr schöner Garten war und ein prächtiger Palast. Der Palast aber war unterirdisch, und von außen sah man ihn nicht.
Es läßt sie zu dem Palast hinunter steigen und ein Bad nehmen, und kleidet sie wie eine Königin. In dem Garten war ein Zaun und rings herum einige schöne Sessel. »Geh«, sagte das Ungeheuer, »setz dich auf einen dieser Sessel, und wenn Jemand dir etwas sagt, komm zu mir und sage mir alles wieder.«
Das Mädchen gehorchte. Der Zufall wollte, daß der König des Landes auf die Jagd ging. Er kommt an dem Zaun vorbei, sieht das schöne Fräulein dort sitzen, gekleidet wie eine Königin, und kaum sieht er sie, so verliebt er sich in sie. Er tritt näher, grüßt sie und sagt ihr in wenig Worten, daß er sich in sie verliebt habe und ihr Gemahl werden wolle. Das Fräulein sagte weder Ja noch Nein. Sie antwortete, er möge wiederkommen, dann werde sie ihm eine Antwort geben.
Der König entfernte sich, das Mädchen aber ging zu dem Ungeheuer und erzählte ihm, was vorgegangen war. – »Ich bin zufrieden, daß du ihn heiratest, sagte das Ungeheuer, nur ehe du die Hochzeit hältst, sollst du mir Lebewohl sagen. Doch hüte dich wohl, es zu vergessen!«
Am anderen Morgen kommt der König mit dem Wagen. Das Mädchen hatte sich wieder auf den Sessel gesetzt in den Kleidern einer Königin. – »Nun?« fragte der König. – »Ich will es tun«, sagte das Mädchen. Der König, sehr vergnügt, dankte ihr und sagte, wenn sie in den Wagen einsteigen wollte, würde es gleich zur Hochzeit gehen.
Das Mädchen steigt in den Wagen, und in der Unruhe des Aufbruchs vergißt sie, dem Ungeheuer Lebewohl zu sagen. Als sie schon eine Strecke gefahren waren, fällt es ihr wieder ein. »O weh!« sagt sie, »ich habe vergessen, eine gewisse Sache mitzunehmen!« –
Der König befiehlt, umzukehren, das Mädchen steigt aus und geht zu dem Ungeheuer. – »Liebes Ungeheuerchen, sei nicht böse, ich hatte es vergessen.« – »Gut!« sagt das Ungeheuer, »also gehen wir! Gib mir einen Kuß und dann sprechen wir nicht weiter davon!« – Und es gibt ihr einen Kuß, und auf einmal wächst ihr ein langer Bart, daß es ganz schrecklich aussah.
Die Ärmste fängt an zu weinen und ist ganz verzweifelt: »Wie soll ich jetzt zum Könige gehen?« – Das Ungeheuer gab ihr einen langen, langen Schleier, in den wickelte sie sich ganz und kehrte zu ihrem Gemahl zurück. »O warum hast du dich so vermummt?« fragte der König als er sie sah. Sie antwortete, es sei ihr eine starke Entzündung an den Augen gekommen, darum hätte sie sich so einhüllen müssen.
Die Mutter des Königs und alle Damen im Palast standen und warteten. Sie aber kam mit dem Schleier, und unter dem Vorwand der Augenentzündung behielt sie ihn auch während der Trauung an und ließ sich von niemand sehen. Als aber der Abend kam und sie allein in ihrem Zimmer war, nahm sie den Schleier ab. Da kommt unangemeldet der König und sieht ihren großen Bart.
Stellt euch vor, wie ihm zumute war! Er wollte nichts mehr von ihr wissen, er ließ sie ergreifen und in ein Landhaus bringen. Nun waren der Vater und die Mutter des Königs alt und wollten, ihr Sohn sollte um jeden Preis eine Frau nehmen. Da er diese nicht mehr wolle, möge er eine andere wählen. Nun hatte der König seine Augen auf zwei schöne Bauernmädchen geworfen, die ihm alle beide sehr gefielen, so daß er nicht wußte, welche er wählen sollte.
Er sinnt und sinnt; endlich entschloß er sich, es so zu machen. Im Schloß war eine Hündin, die drei Junge geworfen hatte. Man ruft die beiden Bauernmädchen und die Bärtige und gibt jeder eins der jungen Hündchen. Diejenige, die das ihre am besten aufziehen würde, sollte des Königs Gemahlin werden.
Die arme Bärtige wußte nicht, was sie anfangen sollte. Sie weinte, mit ihrem Hündchen im Arm. – O, wie soll ich es machen, das Tierchen aufzuziehen! – Am Abend, als sie ganz betrübt da saß, sieht sie auf und erblickt das Ungeheuer vor sich. – »Warum weinst du?« – »O, ein schönes Geschenk hast du mir gemacht! Es wäre besser gewesen, du hättest mich Zichorien pflücken lassen!« und sie erzählt ihm von dem Hündchen.
Das Ungeheuer sagte ihr, sie solle es in den Fluß werfen, sie wollte aber nicht. Da nimmt es ihr das Hündchen, wirft es in den Fluß und geht davon. – Jetzt ist es um mich geschehen! sagt das Mädchen und ist noch verzweifelter als zuvor.
In dessen verging die Zeit, und die beiden Bauernmädchen zogen die Hündchen auf und sagten schon, es sei Zeit, sie zurück zu geben, und es wurde ein Tag bestimmt, wo das geschehen sollte. Die Bärtige seufzte, denn sie wußte nicht, was sie zurück zu bringen hätte. Am Abend vor der Rückgabe, während sie weinte, erscheint ihr das Ungeheuer. – »Nun also, was soll ich dem König zurück bringen?« sagte sie zu ihm. –
»Sieh dieses Schächtelchen,« sagte das Ungeheuer. »Wenn die beiden Anderen ihm den Hund bringen, gib du ihm dies.« – Am anderen Morgen gehen alle drei zum König, die beiden Bauernmädchen gaben ihre beiden Hündchen ganz sauber gewaschen und hübsch gekämmt; die Bärtige gibt die Schachtel. Wie der König sie öffnet, springt ein allerliebstes Hündchen heraus, mit einer Menge goldener Glöckchen am Halse und überhaupt hundertmal schöner als die Hündchen der Bauernmädchen.
Aber die Bärtige wollte der König nicht. Er denkt ein bißchen nach, dann schickt er sie alle drei fort mit hundert Scudi und einem Pfund Flachs für jede: »Wer mir diesen Flachs am besten spinnt, soll meine Frau werden.« – Sie kehren nach Hause zurück, und die arme Bärtige, die nicht gut zu spinnen verstand, außer grobes Zeug, war ganz betrübt.
Als der Tag der Ablieferung kam, und sie am Abend vorher ganz verzweifelt war, ist das Ungeheuer wieder da und gibt ihr eine Schachtel wie das vorige Mal. Die beiden Bauernmädchen liefern ihren Flachs ab, der sehr gut gesponnen war, die Bärtige gibt die Schachtel. Der König öffnet sie, und heraus kommt eine Menge Garn, so fein und schön, daß es ein Wunder war.
Und die Braut war nun die Bärtige. Aber der König wollte sie nicht. Er gab jeder hundert Scudi und lud alle drei zu einem Ballfest. – »Kommt«, sagte er, »dann will ich meine Wahl treffen.«
Die Bärtige wußte nicht, wo sie den Mut her nehmen sollte, sich auf dem Balle zu zeigen, mit diesem Bart. Am Abend vorher kam aber wieder das Ungeheuer und fand sie in Tränen. – »Geh nur auf den Ball,« sagte das Ungeheuer. »Aber geh in einen Winkel, nimm den Schleier ab und dann, ohne dich um wen zu kümmern, tritt in den Saal und stelle dich an den Platz der Braut, und du wirst sehen, der Bart fällt dir ab.« –
Da ging die Bärtige auf den Ball, ganz vermummt mit ihrem Schleier, und als man sie so sah, lachten alle und verspotteten sie. Sie sieht, daß der König einer der beiden Bauernmädchen die Hand gibt, also die Braut gewählt hatte. Da geht sie in einen Winkel, nimmt den Schleier ab, springt in den Ballsaal neben den König und nimmt den Platz der Braut ein, und gleich fällt der Bart zu Boden, und sie wird wieder schön wie zuvor.
Als der König sie so schön sieht, kommt ihm wieder die Liebe wie früher, er denkt nicht mehr an die Bauernmädchen und nimmt sie zur Frau. Und so lebten sie in Freuden und gaben mir nichts als ein kleines Konfekt, das habe ich in ein Büchlein gesteckt.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Pisa
DIE GOLDENE SÄULE ...
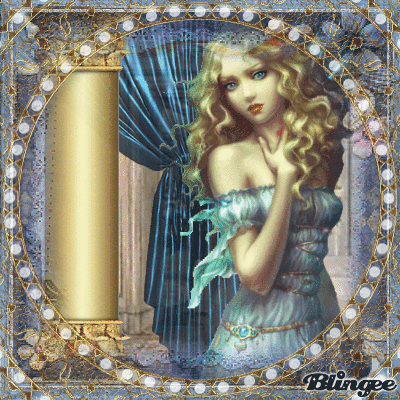
Es war einmal ein König und eine Königin, und sie hatten eine Tochter. Eines Tages erscheint am Hofe ein Herr, sieht das schöne Mädchen und fängt an, mit ihr zu sprechen. Er sagt ihr, er sei ein Prinz, Sohn eines Königs, und sie gefalle ihm so, daß er, wenn sie wolle, sie heiraten möchte.
Er war ein schöner Jüngling von gutem Betragen und gefiel ihr. Sie sprach davon mit ihren Eltern, und auch die, da sie sahen, daß der Herr eine Person von so einnehmendem Wesen war, hatten nichts dagegen, und so wurde die Hochzeit mit großer Befriedigung von beiden Seiten gefeiert.
Nach einem Monat sagte der junge Ehemann, er wolle seine Frau in sein Haus führen, und sie reisten ab. Der König und die Königin begleiteten das Paar eine Strecke, dann, an einem gewissen Punkt angelangt, umarmten sie sie und kehrten zurück.
Als die Neuvermählten allein waren, sagte der Gatte zu seiner Frau: »Verzeihe mir, aber du mußt wissen, daß ich dich getäuscht habe. Ich bin kein Prinz, ich bin der Hauptmann von zwölf Mördern. Wir wohnen alle in einem unterirdischen Bau in einem Walde hier in der Nähe.« –
Die Frau erschrak, er führte sie aber in den Wald zu einer Grotte, die hinter einem Gebüsch versteckt war, und beide stiegen unter die Erde hinunter. Da fanden sie viele Schätze und alle Bequemlichkeiten. Er zeigte ihr alles und sagte ihr: »Du bist hier Herrin von allem, und es wird dir an nichts fehlen.« –
Sie blieb stumm, aber innerlich bebte sie. Die zwölf Mörder blieben den ganzen Tag fort, samt ihrem Hauptmann. Früh am Morgen gingen sie fort und kehrten am Abend zurück. Ihr Mann aber zeigte ihr zwei Büchschen mit Salben, die Wunden heilten, und wies sie an, was sie zu tun hätte, wenn er oder seine Gefährten verwundet heimkehrten.
Jeden Abend brachten sie eine Menge Geld und Gold nach Hause und in Säcken Getötete, die trugen sie in ein Zimmer und verschlossen es. Die Königstochter befand sich dort wie in einer Hölle und sann, wie sie fliehen könnte. Am Tage zu gehen, wenn sie allein war, war unmöglich, weil sich die Mörder in dem der Grotte benachbarten Walde aufhielten, und wehe ihr, wenn sie ihr begegneten.
Da kam ihr der Gedanke, einen Abend aufzupassen, um zu sehen, wo sie den Schlüssel zu dem Zimmer der Toten hinlegten, und richtig gelang es ihr. Am anderen Tage, als sie allein war, öffnet sie das Zimmer und fand es ganz voller Toten. Aber auf einmal hört sie ein Wimmern und sieht, daß einer dieser Körper sich bewegte.
Sie tritt näher und sieht, daß es ein Jüngling ist, gekleidet wie ein Königssohn. Er war im Sterben und stöhnte. Geschwind läuft sie nach der Salbe und bemüht sich um ihn, und es gelingt ihr, ihn zu heilen. Sie fand einen Versteck an einer Stelle in dem unterirdischen Bau, wohin nie jemand kam, und hielt ihn dort verborgen, und alle beide überlegten, wie sie fliehen könnten.
Sie denkt und denkt, und eines Tages sagt die Königstochter zum Hauptmann den Mörder: »Höre, du mußt mir einen Mann schicken, der Steine verkauft, denn ich habe Steine nötig.« – »Gut!« sagte ihr Gatte, »ich werde ihn dir schicken.« Und er tat es.
Als der Mann mit seiner Fuhre Steinchen im unterirdischen Bau war und sie alle drei sich allein sahen, sagte die Königstochter zu dem Mann mit den Steinchen: »Höre, man hält uns hier mit Gewalt. Wenn du es möglich machen kannst, uns entwischen zu lassen, hast du dein Glück gemacht.« –
»Gern,« sagte der Mann, »aber heute ist es nicht möglich. Morgen will ich wieder kommen und euch zu retten suchen.« Auf dem Rückweg fand er im Walde die Mörder. »Nun? hast du meiner Frau die Steine gebracht?« fragte ihn der Hauptmann. »Ja, aber sie waren nicht, wie sie wünschte. Morgen bringe ich ihr andere.« –
Am anderen Tag kehrte der Mann zurück mit einem Lastwagen auf dem zwei große Körbe standen, die hatte er so hergerichtet, daß es aussah als wären sie ganz voll Steine. Im unterirdischen Bau versteckt er in den Körben die Königstochter und den Prinzen, bedeckt sie mit Stroh und kleinen Steinen, stellt sie auf den Wagen und fährt fort.
Er begegnet den Mördern außerhalb der Grotte, und der Hauptmann fragt wieder: »Nun, hast du meiner Frau die Steinchen gebracht?« – »Ja, Herr. Ich habe ihr viele gebracht, sie hat die ausgesucht, die sie gewünscht hat, diese hier nehme ich wieder mit.« – Und so ging er frei durch.
Der Prinz war schon in die Königstochter verliebt, und auch sie hatte ihn gern, und sie hatten ausgemacht, sie wollten zum Vater des Prinzen gehen, der ein großer König war, und sich heiraten. Der Mann mit den Steinchen, dem sie schon gesagt hatten, wohin er gehen sollte, kam mit dem Wagen zum Schloß des Königs, die Wachen aber wollten ihn nicht einlassen.
Er aber wollte um jeden Preis hinein, aber nicht sagen, was er in den Körben hatte. Endlich gingen sie zum König und sagten es ihm, und der König befahl, ihn passieren zu lassen. So kam er hinein, ließ die Körbe abladen und in den Saal zum König bringen. Und sachte, sacht nimmt er die Steinchen fort und das Stroh – und heraus kommen der Prinz und die Prinzessin.
Der König, der glaubte, sein Sohn sei getötet worden, starb fast vor Freude, als er ihn lebend und gesund vor sich sah. Er umarmte ihn, und der Prinz erklärte ihm, wie alles gegangen war und wer die junge Dame sei und was sie alles für ihn getan hatte, und sie sprachen von der Heirat, die als bald von statten ging.
Denn der König konnte kaum glauben, daß er für seinen Sohn eine so schöne und gute Frau gefunden hatte, die seine Lebensretterin geworden ist. Und sie feierten die Hochzeit, und dem Steinchenhändler gaben sie soviel Geld, daß er die Steinchen aufgab und von nun an sich darauf verlegte, den Herren zu spielen.
Während aber diese entwischt waren, kehrten die Mörder in die Grotte zurück und staunten, da sie niemanden mehr antrafen. Sie haben mir einen Streich gespielt, sagte der Hauptmann. Aber jetzt sollen sie es kriegen. – Er kleidet sich wie ein Herr und geht zu einem Goldschmied und trägt ihm auf, ihm eine goldene Säule zu machen, die man öffnen und von innen schließen könne, und gab ihm an, wie hoch und dick sie sein sollte.
Der Goldschmied macht sich an die Arbeit, und in wenig Tagen war die Säule fertig. Die Mörder holten sie ab, gekleidet wie Bediente und der Hauptmann stellte sich in voller Waffenrüstung hinein. Er schloß fest zu und ließ sich dann zum Palast des Königs tragen, ob er die Säule vielleicht kaufen wollte. Kaum sah sie der Sohn des Königs, so gelüstete ihn nach ihr, und er wollte sie kaufen, um sie in sein Schlafgemach zu stellen.
Seine Frau wollte sie nicht. Jene Leute waren verkleidet, und sie erkannte sie nicht gut, aber sie erschienen ihr verdächtig. Er aber setzte es durch, kaufte die Säule und ließ sie in sein Schlafzimmer bringen.
Der Hauptmann der Mörder hatte dem Prinzen einen falschen Brief schreiben lassen, unterzeichnet von einem benachbarten König, der ihn zu sich einlud, weil er mit ihm zu sprechen habe. Die Gefährten des Hauptmanns besorgten den Brief, und der Prinz sagte sofort zu seiner Frau, er müsse zu jenem König und sie für eine kurze Zeit verlassen.
Die Frau sagte: »Höre, wenn du fort gehst, mußt du die Wachen verdoppeln, denn ich gestehe dir, diese Säule macht mir Furcht, und ich will, daß sie, sobald ich klingle, an mein Bett kommen.« – Das befahl der Prinz und reiste ab.
Als die Stunde kam, zu Bett zu gehen, war die junge Frau sehr aufgeregt, legte sich nieder, konnte aber nicht einschlafen. Sie lauschte gespannt, und plötzlich hörte sie einen Knall. Sie bekam eine solche Angst, daß sie kaum die Kraft hatte, zu klingeln, und ohnmächtig wurde.
Indessen war der Prinz zu jenem König gekommen und hatte erfahren, daß der Brief erdichtet war, und war ganz bestürzt zurück gekehrt. Er findet seine Frau in Ohnmacht und im Palast alles drunter und drüber. Nach einer Weile kommt die Frau wieder zu sich und erzählt dem Prinzen, was sie gehört hatte und daß jener Knall von der Säule hergekommen sei.
Geschwind läßt der Prinz den Goldschmied kommen, und befiehlt ihm, die Säule durch zu sägen. So wurde der Mörder zersägt. Man erkannte ihn und machte Jagd auf seine Gefährten, die nach der Flucht jener beiden ihren Aufenthalt gewechselt hatten; endlich aber fand man ihr neues Versteck und alle wurden hingerichtet.
So lebte die Prinzessin mit ihrem Gemahl und brauchte sich nicht mehr zu fürchten.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Pisa
VOM SANT' ONIRIÀ ODER NERIÀ ...
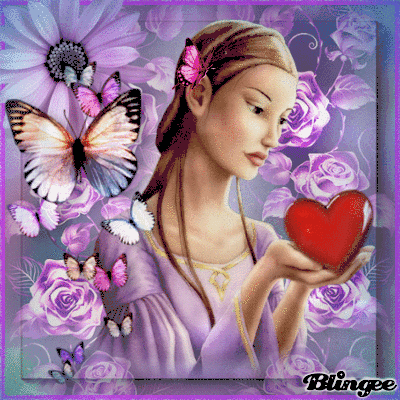
Es waren einmal zwei Jäger, die gingen zusammen auf die Jagd. Da sie nun im Walde waren, brach die Nacht herein, und sie konnten den Ausweg nicht mehr finden. Wie sie nun so herum irrten, sahen sie von Weitem ein kleines Licht, und da sie näher hin zu gingen, fanden sie eine Hütte, in der brannte ein helles Feuer. Es war aber keine menschliche Seele darin.
Da gingen sie hinein und fanden einen gedeckten Tisch, an den setzten sie sich, aßen und tranken soviel ihr Herz begehrte und rückten dann ihre Stühle an den Herd, um sich zu wärmen. Wie sie nun da saßen, sprach der Eine: »Riechst du nicht den paradiesischen Wohlgeruch, der die Hütte erfüllt? Wo mag der wohl her kommen?«
»Er scheint aus dem Feuer zu kommen,« antwortete der Andere, und riß das brennende Holz auseinander. Da fanden sie unter dem Holz ein großes, schönes Herz, das verbreitete einen solchen Wohlgeruch, wie man nirgends etwas Schöneres finden konnte.
»Nehmen wir es mit,« sagte der eine Jäger, bückte sich und nahm das Herz aus dem Feuer und steckte es ein. Die beiden Jäger brachten ruhig die Nacht in der Hütte zu, und als es Tag geworden war, fanden sie sich wieder aus dem Wald heraus.
Da sie nun eine Weile gegangen waren, kamen sie an einem Wirtshaus vorbei. Da sprach der Eine: »Mich hungert; wir wollen in dieses Wirtshaus eintreten und etwas essen.« Also traten sie ein, und der Wirt brachte ihnen etwas zu essen. Weil es aber ein warmer Tag war, so zogen die beiden Jäger ihre Jacken aus und legten sie auf einen Stuhl.
Nun hatte der Wirt eine einzige Tochter, die war ein wunderschönes Mädchen und dabei fromm und tugendhaft. Diese diente den beiden Jägern, und so oft sie an den Jacken vorbei kam, stieg ihr der Wohlgeruch in die Nase. Da wurde sie neugierig, und als die beiden Jäger mit ihrem Essen beschäftigt waren, untersuchte sie die Taschen, um nach zu sehen, was so wohl rieche.
Als sie nun das wunderschöne Herz erblickte, konnte sie dem Verlangen nicht widerstehen und nahm es mit in ihre Kammer. Die Jäger aber merkten nichts, nahmen ihre Jacken und gingen fort. Die Wirtstochter legte das schöne Herz auf ihren Tisch und erfreute sich an dem herrlichen Wohlgeruch, den es verbreitete.
Eines Tages nun, da sie es wieder anschaute, ergriff sie ein heftiges Verlangen, es zu essen, und so aß sie es. Nicht lange aber, so ward sie guter Hoffnung. Als nun ihr Vater es merkte, ward er sehr zornig und wollte sie tot schlagen. Die Mutter aber bat ihn, er möge sie doch verschonen, wenn sie gleich eine Sünde begangen habe; sie sei ja doch ihr einziges Kind.
»Was geht mich das an?« schrie der Wirt. »Sie hat Schmach und Schande auf mein Haus gebracht, und wenn sie mir nicht sagt, mit wem sie sich vergangen hat, so schlage ich sie tot.« »Ach, Vater,« weinte das Mädchen, »ich habe ja kein Unrecht getan.« Er aber wollte es ihr nicht glauben und schlug und mißhandelte sie jeden Tag.
Als er nun eines Tages wieder so schrie und tobte, kam die Patin des Mädchens vorbei, die war eine fromme, gottesfürchtige Frau, und hatte das Mädchen von Herzen lieb. »Gevatter,« sprach sie, »was seid ihr so erzürnt?«
Da erzählte ihr der Wirt im großen Zorn, wie es mit seiner Tochter stehe, die Frau aber sprach: »Gevatter, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das Mädchen ist doch sonst so fromm und tugendhaft gewesen, es wird sich jetzt nicht vergangen haben. Tut mir den Gefallen und mißhandelt es nicht, früher oder später muß die Wahrheit an das Licht kommen.«
Der Wirt wollte nichts hören, die Gevatterin aber träumte in der selben Nacht einen wunderbaren Traum. Es erschien ihr ein Heiliger, der sprach: »Ich bin Sant' Onirià, und bin vom Feuer verzehrt worden. Nur mein Herz ist übrig geblieben, auf daß ich von Neuem geboren würde. Dieses Herz hat die Tochter des Wirtes gegessen, und hat mich empfangen in ihrem Leib. Sie ist aber dennoch eine Jungfrau, wie Maria war. Sage dies Alles ihrem Vater, auf daß er sie nun nicht mehr mißhandle.«
Die Gevatterin weckte sogleich ihren Mann und erzählte ihm ihren Traum, der aber meinte: »Es war eben ein Traum, und hat wohl nichts zu bedeuten,« und schlief wieder ein. Da legte sich auch die Gevatterin wieder nieder, aber siehe da, sie träumte den selben Traum noch einmal.
»Das geht nicht mit rechten Dingen zu,« dachte sie, und als es Tag wurde, machte sie sich auf, ging zum Wirt und erzählte ihm alles. Der aber wollte es nicht glauben, schrie und tobte weiter, bis die Gevatterin sagte: »Gevatter, wenn ihr eure Tochter noch ferner mißhandelt, so beleidigt ihr den Sanct Johannes, denn ihr verweigert mir die einzige Bitte, die ich an euch richte. -
Als nun ihre Stunde kam, gebar die Wirtstochter einen wunderschönen Knaben, der wuchs und gedieh und wurde mit jedem Tage schöner. Sein Großvater aber mochte ihn nicht leiden, und mißhandelte ihn ebenso wie seine Mutter.« Als das Kind nun fünf Jahre alt war, sprach eines Tages der Wirt zum Mann von der Gevatterin: »Gevatter, ich gehe in die Stadt, wollt ihr mich begleiten?«
»Großvater, ich will auch mit,« rief der Knabe. »Geh weg, du Sohn einer nichtswürdigen Mutter,« schrie der Wirt, »muß ich dich erst noch überall auf meinem Wege finden?« »Laß es gut sein, Gevatter,« sprach der Andere, »ich will den Knaben schon führen.« Also machten sich die beiden Männer auf den Weg und gingen nach Catania.
Unterwegs kamen sie an einer Stelle vorbei, da lag viel Kot und Schmutz. »Seht, Großvater,« sprach der Knabe, »ich wünsche Euch, daß ihr darinnen wühlen möget.« »O, du ungeratenes Kind!« rief der Wirth, »solche gottlose Wünsche hegst du! Jetzt schlage ich dich tot.« Der Gevatter aber legte sich ins Mittel, und besänftigte den Wirt.
Wieder nach einer Weile sahen sie einen Toten, der war so arm gewesen, daß man ihm nicht einmal einen Sarg gemacht hatte, sondern zwei Männer trugen ihn auf einer Leiter in die Kirche. »Seht, Großvater,« sprach der Knabe, »ich wünsche Euch, daß ihr sein möget, wie dieser, wenn ihr einmal stirbt.« Da wurde der Wirth noch viel zorniger und wollte ihn mit aller Gewalt tot schlagen, der Gevatter aber beschützte das Kind, bis er sich beruhigt hatte.
Als sie nun noch eine Strecke gegangen waren, begegnete ihnen ein großer Leichenzug, denn es war ein reicher Mann gestorben, und seine Leiche wurde in einem kostbaren Sarg auf einem schönen Wagen gefahren, und die Mönche begleiteten ihn mit brennenden Kerzen.
»Warum wünschest du nicht, daß ich sein möge wie dieser?« sprach der Wirt. »Nein, Großvater, das wünsche ich euch nicht,« antwortete der Knabe, und der Wirt wollte ihn in seinem Zorn wieder totschlagen, so daß der Gevatter das Kind in Schutz nehmen mußte.
Als sie nun in Catania ihre Geschäfte beendigt hatten, kehrten sie wieder nach Hause zurück, und als sie an die Stelle kamen, wo sie dem großen Leichenzug begegnet waren, sprach der Knabe: »Großvater, legt euer Ohr an den Boden, und horcht ein wenig.« »Soll ich erst noch deinen Launen gehorchen?« schrie der Wirt.
Der Gevatter aber sagte: »Werdet doch nicht gleich so zornig, Gevatter, und tut dem unschuldigen Kinde seinen Willen.« Da ließ sich der Wirt bereden, und als er sein Ohr an den Boden legte, hörte er ein großes Getöse, wie von eisernen Keulen, und Heulen und Wehklagen.
»Seht ihr, Großvater,« sprach der Knabe, »das sind die Teufel, die die Seelen der Sünder peinigen, und die Seele, die sie eben empfangen, ist die Seele des reichen Mannes, dem wir an dieser Stelle begegnet sind.« Der Wirt richtete sich betroffen auf, und sah den Gevatter an und sagte leise: »das Kind muß mehr wissen als wir.«
Als sie nun eine Strecke gegangen waren, kamen sie an den Ort, wo sie den armen Mann auf der Leiter gesehen hatten. »Großvater, legt noch einmal euer Ohr an den Boden, und horcht ein wenig.« Diesmal widersprach der Wirt nicht, sondern legte so gleich sein Ohr an den Boden. Da hörte er die heiligen Engel Halleluja singen, und alle die Seligen mit ihnen.
»Seht, Großvater, das sind die Seligen und Heiligen, die mit Gesang die Seele des armen Mannes empfangen, dem wir an dieser Stelle begegnet sind, und deshalb wünsche ich euch zu sterben, wie dieser, und nicht wie jener reiche Sünder.« Der Wirt konnte gar nichts sagen, aber er nahm nun selbst das Kind an die Hand und führte es.
Nach einer Weile kamen sie an die Stelle, wo der Kot und der Schmutz lagen. »Großvater, grabt hier einmal nach,« sprach das Kind, und als der Wirt gehorchte, fand er einen großen Kessel voll Gold.
Da sprach das Kind: »Dieses Geld gehört euch, Großvater. Ihr seid freilich schon ein reicher Mann, aber ihr habt euer Geld nicht wohl angewendet, denn ihr seid ein hartherziger Mann und habt Wucher getrieben. Bessert euch, daß wir uns einst wiedersehen mögen. Ich bin Sant' Oniria, und meine Mutter ist eine Jungfrau wie Maria. Küsset ihr die Hand und haltet sie in Ehren, denn ich kehre nun ins Paradies zurück.«
»Werden wir dich denn niemals wiedersehen, mein Kind?« frug der Wirt. »Dann werdet ihr mich wiedersehn, wenn der Tote mit den Lebendigen spricht,« antwortete der Heilige, segnete seinen Großvater und ward in den Himmel erhoben. Der Wirth und sein Gevatter kehrten nach Hause zurück und erzählten alles, was sie gesehen hatten. Die Wirtstochter aber weinte um ihr verlorenes Kind. Nun vergingen viele Jahre.
Da begab es sich eines Tages, daß zwei Männer in dem Wirtshaus übernachteten, und in der Nacht ermordete der eine von ihnen seinen Gefährten, und versteckte ihn unter das Stroh. Am nächsten Morgen aber sprach er zum Wirt: »Mein Freund ist schon in der Nacht fort gegangen, weil er sehr eilig war, und hat mir das Geld für Euch zurück gelassen. Also wußte der Wirt nichts von dem Mord, der in seinem Hause geschehen war.«
Nach einiger Zeit aber kamen wieder einige Reisende, und schliefen in dem selben Zimmer, wo der Tote noch unter dem Stroh versteckt lag. Da sie aber einen so schlechten Geruch verspürten, so untersuchten sie das Stroh und fanden die Leiche. Da liefen sie eilends zum Gericht, das kam und verhafteten den Wirt, und weil ihn alle Leute für den Mörder hielten, so wurde er zum Tode verurteilt und zum Galgen geführt.
Als er nun schon auf der Leiter stand, kam auf einmal ein wunderschöner Jüngling auf einem weißen Roß angesprengt und wehte mit einem weißen Tuche und rief: »Haltet ein! Gnade, Gnade!« Als er nun heran kam, wurde er umringt und vor den Richter geführt, der frug ihn, warum er die Hinrichtung unterbrochen habe.
»Begleitet mich in die Kirche, wo der Ermordete liegt, so sollt ihr alles erfahren,« sprach der Jüngling, und so gingen sie in die Kirche, und viel Volks begleitete sie. Der Jüngling aber trat an den Sarg heran und sprach: »Steh auf, Toter, und sprich mit den Lebendigen, und sage uns, wer dich ermordet hat.«
Da richtete sich der Tote auf und sprach: »Der Wirt ist unschuldig; mein treuloser Gefährte hat mich umgebracht.« Als die Leute das hörten, befreiten sie den Wirt und baten ihn um Verzeihung, und der schöne Jüngling sprach zu ihm: »Kehrt nun nach Hause zurück, ich will euch begleiten.«
Wie sie aber nach Hause kamen, wo die Wirtin und ihre Tochter noch bitterlich weinten, sprach der schöne Jüngling: »Weint nicht, hier ist euer Mann und euer Vater, denn seine Unschuld ist an den Tag gekommen.«
Dann trat er auf die Wirtstochter zu, küßte ihr die Hand, ob sie es ihm gleich wehren wollte und sprach: »Segnet mich, Mutter; ich bin Sant' Onirià, euer Sohn, und bin wieder gekommen, die Unschuld meines Großvaters an den Tag zu bringen. Nun muß ich wieder von euch fort, aber wenn ihr heilig lebt, so werden wir uns im Himmel wieder sehen.«
Da segnete er sie, und ward in den Himmel erhoben. Seine Mutter aber und seine Großeltern führten ein heiliges Leben, und taten den Armen viel Gutes, und als sie starben, kamen sie auch in den Himmel. Und so möge es uns auch gehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DER DRACHE ...
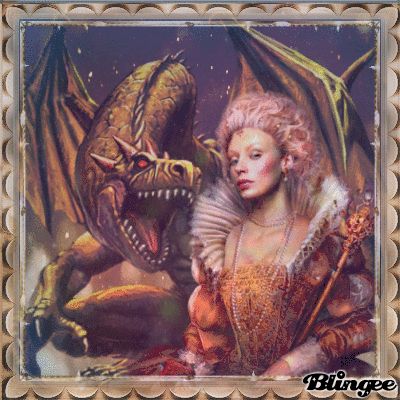
Es war einmal ein König von Alta-Marina, welcher solche Tyrannei und Grausamkeit verübte, dass eines Tages, als er von seiner Gemahlin fort gegangen war, um ein Schloss in einiger Entfernung von der Stadt zu besuchen, sich ein gewisses Weib, das eine Hexe war, des königlichen Sitzes bemächtigte. -
Als er deswegen eine hölzerne Bildsäule, welche Antworten zu erteilen pflegte, um Rat gefragt hatte, bekam er den Bescheid, dass er sein Besitztum nicht wieder erlange, als bis die Hexe blind würde. Da er nun sah, dass die Hexe, die außerdem wohl bewacht war, auf den ersten blick die Leute erkannte, die er ausschickte, um ihr nachzustellen, und Hundegerechtigkeit an ihnen ausübte, so viel er in Verzweiflung und beraubte aus Trotz jedes Weib, das ihm in die Hände fiel, seines Lebens.
Nachdem Hundert und aber Hundert das Unglück gehabt hatten, das Leben auf diese Weise einzubüßen, trug es sich zu, dass eine Jungfrau, Namens Portiella, das schönste Geschöpf auf der ganzen Erde, dahin kam. Ihre Haare waren Fesseln der Liebesschergen; ihre Stirn eine Tafel, auf welcher das Schild des Ladens der Liebesreize geschrieben war; ihre Augen zwei Leuchttürme, welche die Schiffe der Wünsche in den Sand setzten, das Steuer nach dem Hafen der Glückseligkeit zu richten; ihr Mund ein Honiggrübchen zwischen zwei Rosenhecken.
Als nun diese Portiella in die Hände des Königs fiel, und ihr Urteil an ihr vollzogen war, wollte er sie wie die übrigen töten. In dem Augenblicke aber, als er den Dolch erhob, ließ ein Vogel eine unbekannte Wurzel auf seinen Arm fallen, und er bekam ein solches Zittern, dass der Stahl seiner Hand entsank.
Dieser Vogel war eine Fee, die sich einige Tage zuvor in einem Walde zum Schlafen hingelegt hatte, wo sie im Schatten der Hitze Trotz bot, wie wohl es nicht ohne Gefahr war; als nun ein gewisser Satyr sie überfallen wollte, hatte Portiella sie geweckt, und aus Dankbarkeit folgte sie dieser nun beständig, um die Wohltat zu erwidern.
Als nun der König seinen Vorfall bemerkte, glaubte er, dass die Schönheit ihres Gesichtes so viel Einfluss auf seinen Arm gehabt habe, und der Dolch sie daher nicht wie so viele andere traf. Deshalb wollte er es nicht noch einmal versuchen, sondern beschloss, sie in einem Kerker seines Palastes einzumauern; dies führte er auch sehr schnell aus, indem er das unglückliche Geschöpf zwischen vier Mauern einsperrte, ohne ihr Speise und Trank zu lassen, damit sie sich nach und nach aufzehren und so allmählich sterben möchte.
Der Vogel, sie in diesem traurigen Zustande sehend, tröstete sie mit holden Worten und empfahl ihr heiter zu sein; denn er würde ihr, für den großen Dienst, den sie ihm erzeigt, helfen, und solle es ihm das Leben kosten. Trotz Allem, was Portiella sagte, behauptete er immer, ihr größere Verpflichtung schuldig zu sein, und fügte hinzu, dass er nichts unterlassen würde, um ihr zu dienen. -
Da er nun bemerkt, dass sie fast vor Hunger umkam, so flog er eilig fort, kam mit einem spitzen Messer wieder, dass er aus des Königs Kabinett genommen hatte, und befahl ihr, mit dem selben ein Loch in dem Winkel des Bodens, der über der Küche war, zu machen; durch diese wollte er ihr beständig Nahrung bringen.
Partiella bohrte, bis es groß genug war, um den Vogel durch zu lassen; dieser wartete, bis der Koch hinaus gegangen war, um Wasser zu holen, nahm ein zubereitetes Huhn und brachte es Portiella. Um ihren Durst zu stillen, nicht wissend, wie er ihr etwas zu trinken bringen sollte, flog er nach der Speisekammer, wo viele Weintrauben hingen und trug ihr eine schöne Traube zu, dies tat er viele Tage hintereinander.
Unterdessen brachte Portiella einen schönen Knaben zur Welt, den sie unter beständigem Beistand des Vogels aufsäugte. Als er aber stark geworden war, riet die Fee seiner Mutter, das Loch größer zu machen, und so viele Dinge aus dem Boden zu nehmen, als hinreichten, um Miuccio, so hieß der Knabe, durch zu lassen, wenn sie dieses nun getan und ihn an einigen Stricken, die der Vogel herbei brachte, herab gelassen habe, so solle sie die Dielen wieder an ihre Stelle legen, damit man nicht sehen könne, woher das Kind käme.
Portiella tat, wie der Vogel ihr gesagt hatte, prägte ihrem Sohne ein, niemals zu sagen, woher er käme, noch wessen Kind er sei, und ließ ihn hinab, als der Koch ausgegangen war. Als dieser nun bei seiner Rückkehr den hübschen Knaben sah, fragte er ihn, wer er sei, woher er käme, und was er wollte. Das Kind, der Ratschläge seiner Mutter eingedenkt, sagte, er sei ein armer verlassener Knabe und suche einen Herrn.
Als sie so miteinander sprachen, kam der Kellermeister herein, und da er sah, dass der kleine Mann so viel Verstand habe, so dachte er, dieser würde einen guten Pagen für den König abgeben. Deshalb führte er ihn in die königlichen Zimmer, und als man ihn so hübsch und so liebenswürdig fand, so nahm ihn der König in seinen Dienst als Page, gewann ihn plötzlich sehr lieb, und ließ ihn in allen ritterlichen Wissenschaften unterrichten, so dass er der vollkommenste junge Mann am Hofe wurde.
Der König liebt ihn weit mehr als seinen Stiefsohn, deshalb fing die Königin an, ihn zu hassen und schlecht zu behandeln; ihr Hass nahm immer mehr zu, je mehr Güte und Gnade der König dem Miuccio erzeigte. - Sie entschloss sich daher, die Treppen seines Glücks so mit Seife zu beschmieren, dass er von oben bis unten hinab fallen musste.
Demzufolge sagte sie eines Abends, als der König in guter Laune war, zu ihm: - "Da ist Miuccio, der sich gerühmt hat, Schlösser in die Luft bauen zu können." Der König, teils aus Verwirrung, teils um seiner Gattin zu gefallen, ließ am folgenden Morgen, sobald der Mond, der Schulmeister der Schatten, seinen Schüler einen Feiertag wegen des Festes der Sonne gegeben hatte, Miuccio rufen, und befahl ihm, drei Schlösser in der Luft zu bauen, wie er sich dessen gerühmt habe, sonst solle er selbst einen Tanz in der Luft machen.
Als Miuccio das hörte, ging er auf sein Zimmer und begann bitterlich zu klagen, indem er einsah, wie gläsern die Gunst der Fürsten ist, und wie kurz ihre Gnade währt. Während er nun so weinte und klagte, kam der Vogel zu ihm: "Ich bin im Stande, den Vogel aus dem Feuer zu ziehen. Fasse Mut und fürchte nichts, Miuccio, so lange du einen solchen Stamm zur Stütze hast." -
Darauf befahl er ihm, Pappe und Leim zu nehmen und drei große Schlösser zu machen; dann ließ er drei Greife kommen, band an jedes Schloss einen und diese flogen nun in die Luft. Miuccio rief dann den König, der mit seinem ganzen Hofe herbei eilte, um das zu sehen.
Als er nun Miuccio's Gewandtheit gewahrte, liebte er ihn noch mehr und verschwendete Liebkosungen aus der anderen Welt an ihn; das trug aber Schnee zu dem Neid der Königin und Feuer zu ihrem Zorn, da sie sah, dass nichts ihr gelang; deshalb wachte sie nie bei Tage, ohne daran zu denken, und schlief nie bei Nacht, ohne von etwas zu träumen, das den Dorn in ihrem Auge aus dem Wege räumen könnte.
Endlich kam sie nach einigen Tagen zu dem König und sagte: "Mein Gemahl, es ist Zeit, zu unserer Größe und den Freuden vergangener Tage zurück zu kehren; da Miuccio erklärt hat, er wolle die Fee blenden und dadurch nun, dass er ihre Augen auszahlte, Euch zu Eurem verlorenen Königreich wieder verhelfe." -
Der König, der den wunden Fleck berührt fühlte, rief so gleich Miuccio und sagte zu ihm: "Ich bin sehr erstaunt, dass du, da ich dich so innig liebe, die Macht gehabt hast, mir zu dem Sitze, von dem ich gestürzt bin, wieder zu verhelfen, und dennoch so sorglos und untätig bist, dich nicht bemühst, mich aus dem Elende, in dem ich jetzt bin, zu erretten, da du mich doch von einer Stadt auf ein armseliges Schloss und von der Herrschaft über so viele Leute darauf beschränkt siehst, von vier Brot- und Suppenträgern bedient zu werden; wenn du nun nicht mein Unglück willst, so eile gleich fort und blende die Augen der Fee, die mein Eigentum inne hat; denn indem du ihre Läden schließest, öffnest du das Warenlager meiner Größe - indem du ihre Laternen auslöschest, zündest du die Lampen meiner Ehre an, die jetzt trüb und finster sind.
Als Miuccio diesen Vorschlag hörte, wollte er dem König antworten, er sei schlecht unterrichtet und irre sich; denn er sei kein Rabe, der Augen aushacken oder ein Bohrer, der Löcher bohren könne. Aber der König erwiderte: "Kein Wort mehr, ich will es haben, und es muss geschehen. Mache deine Rechnung, damit ich in der Münze meines Gehirns die Bilanz fertig habe, in der einen Schale die Belohnung, wenn du tust , was ich dir sage; in der anderen die Strafe, wenn du unterlässt, was ich dir befehle."
Miuccio, der nicht gegen einen Felsen mit dem Kopfe laufen konnte, und mit einem Manne zu tun hatte, der unglücklicher Weise unter der Herrschaft der Königin stand, ging auf eine Brücke, sich zu beklagen; da kam der Vogel und sagte zu ihm: "Ist es möglich, Miuccio, dass du dich immer ins Wasser stürzen willst, um eines Glases Wasser wegen? Wenn ich tot wäre, ja dann könntest du die Torheit begehen. Weißt du nicht, dass ich dein Leben höher achte, als das meinige? Darum fasse Mut, komm mit mir und du sollst sehen, was ein Vogel tun kann."
Darauf flog er fort und ließ sich in einem Walde nieder, wo er zu singen begann; da kam ein ganzer Haufen Vögel um ihn herum, die er fragte, und ihnen versicherte, dass derjenige, der die Hexe ihres Gesichtes beraube, eine Sauvegarde gegen Habichte und Geyer, und eine Sicherheitskarte gegen Schießgewehre, Armbrüste, Bögen und Leimruten der Vogelsteller haben solle.
Unter ihnen war eine Schwalbe, die ihr Nest an einem Balken des Palastes gebaut hatte und die Hexe hasste, weil sie jedes Mal, wenn sie ihre verwünschten Beschwörungen angefangen, sie mit den Räucherungen fort getrieben hatte; daher, teils aus Rache, teils um die Belohnung zu erhalten, bot sich die selbe an, den Auftrag auszuführen.
Wie der Blitz so schnell, flog sie in die Stadt, und in den Palast kommend, fand sie die Fee auf einem Lager ausgestreckt, bei ihr zwei Jungfrauen, die ihr mit den Fächern Luft zu wehten. Die Schwalbe setzte sich gerade über die Augen der Fee hin, ließ ihren Kot hinein fallen und beraubte jene auf dieser Weise des Gesichts. Als nun die Fee Nacht am Mittag sah, so wusste sie, dass durch diese Schließung des Zollhauses die Waren des Königs verloren gingen, stieß das Geschrei einer verdammten Seele aus, ließ das Zepter fahren und eilte, sich in gewissen Höhlen zu verstecken, wo sie, mit dem Kopfe gegen die Wand laufend, ihre Tage endete.
Als die Hexe fort war, sandten die Minister eine Ambassade an den König, ihn zu bitten, wieder zu kommen und sich des Hauses zu erfreuen, da die Blindheit der Hexe diesen glücklichen Tag herbeigeführt habe. Zugleich mit dieser Ambassade kam Miuccio an, der, auf des Vogels Anweisung, zu dem König sagte. "Ich habe euch ehrlich gedient. Die Hexe ist geblendet, das Königreich euer; verdiene ich daher Belohnung, so verlange ich nichts weiter, als dass ich meinem eignen Schicksale überlassen werde, ohne wieder solchen Gefahren ausgesetzt zu sein."
Der König umarmte ihn mit äußerster Zärtlichkeit, und ließ ihn bei sich niedersetzen. Gott weiß, wie das die Königin kränkte; denn der vielfarbige Bogen, der sich auf ihrem Gesichte zeigte, gab den Sturmwind zu erkennen, den sie in ihrem Herzen gegen den armen Muiccio braute.
Nicht weit von dem Schlosse war ein furchtbarer Drache, der in der selben Geburt mit der Königin geboren war, und als ihr Vater die Astrologen zusammen berief, um diesen Vorfall zu deuten, sagten sie, dass seine Tochter sicher sein würde, so lange der Drache sicher wäre, doch wenn Eines stürbe, so sei das Andere auch genötigt zu sterben. - Eine Sache allein könne als dann die Königin wieder ins Leben zurückbringe, wenn man nämlich ihre Brust, ihren Leib und ihre Nasenlöcher mit dem Blute dieses Drachen salbte.
Die Königin nun, die die Wut und Stärke des Tieres kannte, fasste den Gedanke, ihm den Miuccio in den Rachen zu liefern, fest überzeugt, dass er nur einen Bissen aus diesem machen, und er gleich einer Erdbeere im Schlunde eines Bären sein würde. -
Deshalb wandte sie sich zu dem König und sagte zu ihm: "Ohne Zweifel ist Miuccio der Schatz deines Hauses, und du wärst undankbar, wenn du ihn nicht liebtest, besonders da er den Wunsch geäußert hat, den Drachen zu töten, der, wie wohl mein Bruder, doch dein sehr großer Feind ist, und mir ist ein Haar von meinem Gatten lieber, als hundert Brüder."
Der König, der den Drachen tödlich hasste, und nicht wusste, wie er ihn aus dem Wege räumen solle, rief sogleich den Miuccio und sagte: "Ich weiß, dass du allem, wenn du willst, Fesseln anlegen kannst; deshalb, da du schon so viel getan hast, musst du mir noch eine Freude machen, dann kannst du gehen, wohin du willst. -
Eile, und töte den Drachen, du erzeugst mir einen großen Dienst damit, und sollst eine gute Belohnung dafür bekommen." - Als Miuccio diese Worte hörte, verlor er beinahe den Verstand und sagte, sobald er wieder im Stande war, ein Wort zu äußern, zu dem Könige: "Ist das nun der Kopfschmerz, wegen dessen ihr mich zum Reiben angenommen habt? Ist es mein Leben die Milch einer schwarzen Ziege, dass ihr so verschwenderisch damit umgeht?
Dies ist kein Befehl: "Komm, tritt mir auf den Nacken!" denn es ist ein Drache, der mit seinen Klauen zerreißt, mit seinem Kopfe betäubt, mit seinem Schwanze zerschlägt, mit seinen Zähnen zermalmt, mit seinen Augen vergiftet. Ist das die Sinecure, zu der ihr mir verhelft, weil ich euch zum Königreiche verholfen habe? Wer ist die schlechte Seele, die diesen Würfel auf den Tisch gebracht hat? Wer ist der Höllensohn, der euch auf diese Sprünge gebracht und mit diesen Worten geschwängert hat?
Der König, der so leicht wie eine Blase im Versprechen, aber fester als ein Fels im Halten war, wenn er einmal etwas gesagt hatte, stampfte mit den Füßen und schrie; "Hast getan, hast getan, und kannst nun das Letzte nicht; aber kein Wort mehr; bringe mir die Plage aus dem Königreich, oder ich bringe dich ums Leben!"
Der unglückliche Miuccio, der da fühlte, dass ihm bald das Gesicht gestreichelt, bald ein Schlag in den Nacken gegeben, dass er bald heiß, bald kalt empfangen wurde, sah ein, wie Hofgunst veränderlich sei, und wünschte, den König gar nicht mehr zu kennen.
Da er aber wusste, dass einem mächtigen dummen Manne zu antworten so gut ist, wie einem Löwen am Barte zu zupfen, so ging er fort sein Schicksal verwünschend, das ihn an den Hof geführt hatte, um seine Lebenstage abzukürzen, und setzte sich nieder auf einer Stufe vor der Türe, mit dem Kopfe zwischen den Knien, seine Schuhe mit seinen Tränen waschend, und den Boden mit seinen Seufzern erwärmend, als - sieh! - der Vogel ankommt mit einem Kraut im Schnabel, es dem Miuccio in den Schoße wirft und sagt: "Steh auf Miuccio, und beruhige dich; Du wirst nicht "Lade ab den Esel" mit deinen Tagen spielen, sondern "Puff" mit dem Drachen.
Nimm dieses Kraut, und wenn du an die Höhle des verhassten Tieres kommst, so wirf es hinein; der Drache wird davon so entsetzlich müde werden, dass er sogleich in tiefen Schlaf fällt, dann kannst du mit einem guten Messer durch Stechen und Schneiden ihm bald den Rest geben. - Drum komme, es wird besser gehen, als du denkst. - Genug, ich weiß, was ich vermag, wir haben mehr Zeit, als Geld, und wer Zeit hat, hat Leben.
Als Miuccio das hörte, sprang er auf, versah sich mit einem guten Messer, nahm das Kraut und ging in des Drachen Höhle, die unter einem Berg von solcher Größe war, dass die drei Berge, welche Stufen für die Riesen abgaben, ihm nicht an den Leib reichten. Als er hin kam, warf er das Kraut in die Höhle, augenblicklich bemächtigte sich der Schlaf des Drachen, und Miuccio begann, ihn zurecht zu schneiden.
Während er nun so an der Bestie herum schnitt, fühlte die Königin, dass ihr Herz durchschnitten sei, und da sie einsah, wohin sie sich gebracht, bemerkte sie ihren Irrtum, sich den Tod so wohl feil gekauft zu haben. Sie rief ihren Gatten, erzählte ihm, was die Astrologen verkündet hatten, wie ihr Leben von dem Drachen abhinge, und sie befürchtete, Muiccio habe ihn bereits getötet, da sie sich immer schwächer werden fühle.
Der König erwiderte: "Wenn du wusstest, dass das Leben des Drachen der Halt deines Lebens und die Wurzel deiner Tage war, warum ließest du mich dem Miuccio diesen Befehl erteilen? Wessen Schuld ist es? Du hast Böses selbst getan und musst es beweinen; Du hast das Glas selbst zerbrochen und musst es bezahlen."
Die Königin antwortete: "Ich habe nie geglaubt, das ein simpler Bursche die Kraft und Gewandtheit hätte, ein Tier zu Boden zu werfen, das sich nichts aus einer Armee machte, und meinte, er würde seine Lungen da lassen; da ich aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht habe, und die Barke meiner Projekte aus ihrer Fahrt gekommen ist, so erzeige mir eine Freude, wenn du mich liebst. -
Wenn ich tot bin, so nimm einen in das Blut des Drachen getauchten Schwamm und salbe alle Extremitäten meines Körpers damit, bevor du mich begräbst." - "Das ist eine Kleinigkeit gegen die Liebe, die ich zu dir hege, sagte der König, und reicht das Blut des Drachen nicht hin, so will ich mein eigenes nehmen, um dich zufrieden zu stellen."
Die Königin wollte ihm danken, aber der Atem ging ihr aus, denn gerade zu der selben Zeit hatte Miuccio dem Drachen den Garaus gemacht. Er war kaum zu dem König gekommen mit der Nachricht, als dieser ihm befahl, zurück zu gehen, um Blut von dem Drachen zu holen; da er aber neugierig war, die von Miouccio's Hand vollbrachte Tat zu sehen, so folgte er ihm nach.
Kaum war Miuccio aus dem Palast, als sich auch schon der Vogel zu ihm gesellte und fragte: "Wo gehst du hin?" Miuccio antwortete: "Ich gehe, wohin der König mich sendet; denn er lässt mich vorwärts und rückwärts gehen, wie ein Weberschiff, und gestattet mir keine Ruhe." - "Was sollst du tun?" fragte der Vogel. "Blut vom Drachen holen," erwiderte Muiccio.
Darauf sagte der Vogel: "Unglücklicher Jüngling; diese Drachenblut wird böses Blut für dich sein, denn es wird deinen Untergang bereiten; durch diese Blut wird der böse Ursprung aller deiner Mühen, der dich beständig neuen Gefahren preisgibt, damit du dein Leben dabei einbüßest, neu belebt werden, und der König, der sich von einer edlen Schlange bei der Nase herumführen lässt, befiehlt dir, wie einem Verworfenen, dein Leben, das aus seinem eigenen königlichen Blute entspringt, das ein reiner Sprössling jener Pflanze ist, aufs Spiel zu setzen. -
Der unglückliche Mann kennt dich aber nicht, wie wohl die große Neigung, die er zu dir hegt, ein Zeichen der Verwandtschaft ist. - Obendrein sollten die Dienste, die du ihm geleistet hast, und der Vorteil, einen solchen vortrefflichen Erben an dir zu haben, machen, dass die unglückliche Portiella, deine Mutter, die schon vierzehn Jahre lang lebendig in dem Kerker begraben ist, wo sie in ihrer Jugendschönheit eingemauert wurde, Gnade vor ihm finde."
Als die Fee so sprach, kam der König, der jedes Wort vernommen hatte, näher, um besser zu hören, und da er fand, dass Miuccio nicht nur der Sohn der Portiella, sondern auch der Seinige sei, und dass Portiella noch in ihrem Kerker lebe, so gab er sogleich den Befehl, sie zu erlösen und zu ihm zu bringen. Als er sie nun schöner als je wiedersah, was sie der Sorgfalt des Vogels verdankte, so konnte er gar nicht aufhören, Mutter und Sohn wechselweise an sein Herz zu drücken, sie um Verzeihung bittend für die schlechte Behandlung, die sie erlitten hatte und die Gefahren, denen er ausgesetzt gewesen war.
Darauf ließ er Portiella mit den reichsten Gewändern der verstorbenen Königin bekleiden und machte sie zu seinem Weibe. - Da er nun erfahren hatte, dass ihre Erhaltung und die Rettung seines Sohnes aus so vielen Gefahren einzig und allein von der Nahrung, die der Vogel ihr gebracht und dem Rate, den er ihm gegeben herrühre, so bot er ihm seine Staaten und sein Leben an. -
Der Vogel aber sagte, er wolle keine andere Belohnung für alle Dienste, als Miuccio zum Gemahl, verwandelte sich bei diesen Worten in eine wunderschöne Jungfrau und wurde, zu des Königs und Partiella's größter Zufriedenheit, Miuccio's Gattin.
Während die tote Königin hinaus geworfen war, erntete das junge Paar Glück haufenweise. Um aber die Festlichkeit größer zu machen, gingen sie in ihr eigenes Königreich, wo sie mit Schmerzen erwartet wurden. Jedermann schrieb diese Glück der Fee zu, wegen der Wohltat, die Portiella ihr erwiesen hatte; denn, am Schluss der Schlüsse:
"Eine gute Tat geht nie verloren."
Neapolitanisches Märchen
VOM JOSEPH, DER AUSZOG SEIN GLÜCK ZU SUCHEN ...
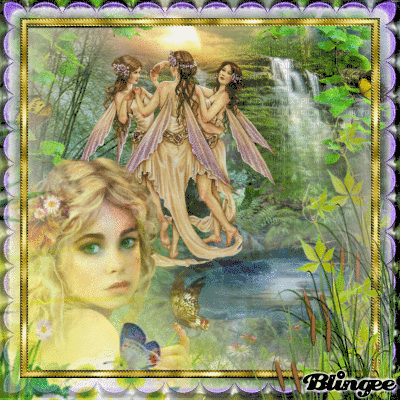
Es waren einmal ein armer Bauer und seine Frau, die hatten einen einzigen Sohn, der hieß Joseph. Die Leute waren arm und lebten kümmerlich. Da kam eines Tages Joseph zu seiner Mutter und sprach: »Liebe Mutter, gebt mir meine Kleider und euren Segen, denn ich will ausziehen und mein Glück suchen.« - »Ach, mein Sohn,« sprach da die Mutter, und fing an zu weinen, »was willst du uns verlassen? Ich habe schon sonst Kummer genug, wenn du auch noch fortgehst, mein einziges Kind, so bleibt mir nichts übrig als zu sterben.«
Joseph aber wiederholte immer nur: »Mutter, ich will ausziehen mein Glück zu suchen.« Da mußten denn endlich die Eltern nachgeben; sie packten ihm seine Kleider in einen Quersack, taten etwas Brot und Zwiebeln dazu und ließen ihn mit schwerem Herzen ziehen.
Als Joseph eine Zeit lang gewandert war, wurde er hungrig; er setzte sich also hinter eine Tür um etwas Brot und Zwiebeln zu essen. Während er so aß, kam ein feiner Herr zu Pferde vorbei, der redete ihn an, und frug ihn, wer er sei. »Ach,« antwortete Joseph, »ich bin ein armer Bursche, und bin ausgezogen, mein Glück zu suchen.« -
»Willst du mit mir kommen, und mir treu dienen,« sprach der Herr, »so sollst du es gut haben.« Joseph war es zufrieden und zog mit dem fremden Herrn davon. Der führte ihn in ein wunderschönes Schloß, in dem viele Schätze aufbewahrt waren. »Hier wohne ich,« sprach er zu Joseph, nachdem er ihm statt seiner Bauernkleidung einen feinen Anzug gegeben hatte, »und hier sollst du mit mir wohnen, und dein Leben genießen.
Du darfst so viel Geld nehmen, als du willst, nur mußt du mir einmal im Jahr einen Dienst tun.« »Alles was Ihr befehlt, werde ich tun,« antwortete Joseph, und lebte nun mit dem fremden Herrn herrlich und in Freuden. Als beinahe ein Jahr herum war, überkam ihn eine Sehnsucht nach seinen Eltern. Also kam er zu seinem Herrn und sprach: »Laßt mich auf einige Tage ziehen, daß ich meine Eltern besuchen kann.«
Anfangs wollte der Herr nicht, denn er dachte, Joseph würde nicht wieder kommen, als ihm aber Joseph versprach, binnen wenigen Tagen wieder da zu sein, ließ er ihn gehen.
Joseph kam nun in seine Heimat; auf der Straße steckten die Leute die Köpfe zusammen, und Einige sagten: »Ist das nicht der Sohn vom alten Joseph?« Andere aber meinten: »Das ist ja ein feiner Herr, und Joseph war nur ein Bauer.« So kam denn Joseph endlich an das Haus seiner Eltern, und als er hereintrat, war nur seine Mutter da.
Er grüßte sie, und sie verneigte sich vor dem feinen Herrn, dann sprach er: »Ist der alte Joseph nicht da?« »O ja,« sagte die Mutter, »ich will gleich gehen ihn rufen,« und ging in den Garten und sprach zu ihrem Mann: »Es ist ein fremder Herr da, der nach dir frägt.«
Da ging der alte Bauer in die Stube, nahm sein Mützchen ab, und sprach: »Womit kann ich euch dienen?« Da fing Joseph an zu lachen und sprach: »Erkennt Ihr mich denn nicht? Ich bin Joseph, euer Sohn.« Da war denn die Freude sehr groß, und Joseph mußte alles erzählen, was ihm begegnet war, und gab ihnen viel Geld, damit sie ruhig leben könnten, »denn ich,« sprach er, »muß gleich wieder fort und zu meinem Herrn zurück kehren.«
Da fing die Mutter an zu weinen, und bat: »Ach, lieber Sohn, bleibe doch bei mir.« Aber Joseph sagte: »Ich habe es versprochen, ich muß zu meinem Herrn zurück kehren.« Da ließen sie ihn ziehen, und Joseph kehrte zu seinem Herrn zurück.
Nach einigen Tagen sprach der Herr: »Joseph, heute mußt du mir den Dienst leisten, für den du bei mir eingetreten bist.« Und führte ihn in ein Zimmer, wo eine Jagdkleidung bereit lag; diese mußte Joseph anziehen, dann bestiegen sie beide ihre Pferde, und Joseph mußte noch ein drittes Pferd am Zügel führen, das mehrere leere Säcke trug.
Sie ritten nun fort und viele Stunden lang, bis sie auf eine Hochebene kamen, aus der ein einsamer Berg hervor ragte. Dieser Berg war so steil, daß keines Menschen Fuß ihn ersteigen konnte. Hier stiegen sie von den Pferden ab, und stärkten sich mit Speise und Trank. Dann befahl der Herr dem Joseph das dritte Pferd zu erschlagen, und ihm das Fell abzuziehen.
Dies tat Joseph, und dann legten sie das Fell in die Sonne zum Trocknen. »So lange können wir noch ein wenig ausruhen,« sagte der Herr. Bald aber rief er wieder unseren Joseph, gab ihm ein scharfes Messerchen, und sprach: »Ich werde dich nun samt den leeren Säcken in das Fell einnähen, dann werden Raben kommen und dich auf jenen Berg hinauf tragen. Dort mußt du mit dem Messerchen das Fell aufschneiden, und dann werde ich dir hinauf rufen, was du ferner tun sollst.«
Joseph war zu Allem bereit, und der Herr nähte ihn in das Fell ein. Sogleich kamen die Raben, hoben ihn auf und trugen ihn auf den Berg, wo sie ihn hin legten. Nun schnitt Joseph mit seinem Messer das Fell auf, und sah sich um. Da sah er, daß der ganze Berg mit Diamanten bedeckt war. »Was soll ich jetzt tun?« frug er seinen Herrn. -
»Fülle die Säcke einen nach dem anderen mit Diamanten und wirf sie mir hinunter,« rief der Herr. Als nun Joseph alle Säcke gefüllt und hinunter geworfen hatte, frug er wieder: »Was soll ich jetzt tun?« »Lebe recht wohl,« rief ihm der Herr zu, »und sieh zu, wie du wieder herunter kommst.« Damit lud er die Säcke auf Joseph's Pferd, bestieg sein eigenes und ritt lachend davon.
Da stand nun Joseph und sah keine Möglichkeit hinunter zu steigen. Wütend stampfte er mit dem Fuße auf, da hörte er auf einmal einen Ton, als wenn er Holz berührt hätte. Er bückte sich, und richtig, er stand auf einer hölzernen Tür, die mit einem Riegel geschlossen war. Da schloß er auf und dachte: »Hier unten können mich wenigstens die Raubvögel nicht fressen.«
Als er aber herein geschlüpft war, sah er eine Treppe, die stieg er vorsichtig hinunter, denn es war ganz dunkel, bis er endlich in einen hellen Saal kam. Als er aber noch stand und sich umschaute, öffnete sich eine Tür und ein Riese kam heraus, der sprach mit tiefer Stimme: »Was unterstehst du dich in meinen Palast zu kommen?«
Erst war Joseph sehr erschrocken, bald aber faßte er sich wieder und rief ganz munter: »Ach, lieber Onkel, seid ihr es? Wie freue ich mich euch zu sehen!« »Bist du denn mein Neffe?« frug der Riese, der ein wenig dumm war. »Gewiß,« sprach Joseph, »und ich will bei euch bleiben.« Der Riese war es zufrieden, und so lebte denn Joseph bei ihm, und hatte es gut.
Bald aber merkte er, daß der Riese jeden Tag zu einer gewissen Stunde von einem Übel befallen wurde, das ihn arg mitnahm. »Lieber Onkel,« frug er also, »woher kommt euch dieses Übel, und kann ich euch nicht helfen zum Gesundwerden?« »Ach, lieber Neffe,« antwortete der Riese, »wohl könnte mir geholfen werden, aber wie sollte dir das gelingen?«
»Sagt nur zu, lieber Onkel,« meinte Joseph, »vielleicht kann ich es doch.« »Siehst du,« sprach nun der Riese, »jeden Tag kommen vier Feen, die baden in dem Springbrunnen in meinem Garten, und so lange sie im Wasser sind, so lange werde ich von meinem Übel befallen.« »Wie kann ich euch denn von den Feen erlösen?« frug Joseph.
»Wenn sie ins Wasser steigen,« sprach der Riese, »so legen sie zuerst ihr Hemd ab und legen es auf die steinerne Brüstung. Dort mußt du dich verstecken, und wenn sie im Wasser sind, mußt du das Hemd der obersten Fee ergreifen, so kann sie nicht mehr fort fliegen, und ohne sie werden die anderen nicht wieder kehren.«
Nun versteckte sich Joseph hinter die steinerne Brüstung; bald hörte er ein Rauschen in der Luft, und die vier Feen senkten sich auf die Erde, legten ihre Hemden ab und stiegen ins Wasser. Da streckte Joseph seine Hand aus, und nahm der obersten Fee das Hemd weg, im selben Augenblick fuhren die Feen mit einem Schrei aus dem Wasser, ergriffen ihre Hemden und flogen fort.
Die oberste Fee aber konnte ohne ihr Hemd nicht fort fliegen. Da kam der Riese hervor und legte ihr Ketten an. Jeden Morgen brachte er ihr ein Schnittchen Brot und etwas Wasser, und frug sie: »Willst du meinen Neffen heiraten, so sollst du frei sein.« Die Fee aber antwortete immer: »Nein, ich will nicht.« »So bleibst du eben gefesselt,« sprach der Riese.
Nach einiger Zeit aber brachte er ein Lämpchen, stellte es auf ihren Kopf und sprach: »Willst du meinen Neffen nicht heiraten, so hast du nur noch so lange zu leben, bis das Öl in dem Lämpchen ausgebrannt ist.« Da sagte die Fee: »Gut, ich will ihn heiraten!« Also wurde sie von den Ketten befreit, und ein schönes Hochzeitsfest wurde gefeiert, und Joseph war sehr glücklich.
Am nächsten Tag sprach der Riese zu ihm: »Du kannst nun nicht länger bei mir bleiben, nimm deine Frau und gehe nach Haus zu deinen Eltern. Hier hast du auch das Hemd deiner Frau, du darfst es ihr aber um keinen Preis geben, erst wenn man dir eine Schnupftabackdose zeigt, die gerade so aussieht wie diese.«
Damit gab er ihm eine goldene Schnupftabackdose und einen Zauberstab, und hieß ihn gehen. Also nahm Joseph seine Frau und machte sich auf den Weg. Der Weg aber war lang und bald waren sie müde. Da sprach Joseph: »Ich wollte doch, wir wären zu Haus.« Und weil er gerade den Zauberstab in der Hand hatte, so hatte er kaum ausgesprochen, als sie schon zu Hause waren.
Da wünschte er sich ein schönes Haus, mit Wagen und Pferden, und Bedienten und schönen Kleidern für sich und seine Frau, und ging dann zu seinen alten Eltern. Die waren hoch erfreut, als sie ihn wieder sahen, und Joseph sprach: »Kommt mit mir in meinen Palast, dort will ich euch meine Frau zeigen.«
Da gingen sie mit ihm und wohnten bei ihm. Nun führte Joseph ein herrliches Leben, gab große Festlichkeiten und war der reichste und angesehenste Mann im ganzen Land. Das Hemd aber gab er seiner Mutter in Verwahr, zeigte ihr die goldene Dose, und sie mußte ihm schwören, sie würde das Hemd nicht eher ausliefern, als bis ihr eine gleiche Dose vorgezeigt würde.
Die Dose aber trug er immer auf sich. Seine Frau aber konnte sich gar nicht trösten, daß sie nicht mehr bei den anderen Feen sein sollte, und dachte nur, wie sie die goldene Dose erlangen könne.
Nun war eines Abends wieder großer Ball bei Joseph; und ein Herr trat zu Joseph's Frau und forderte sie zum Tanze auf. »Ich will gern mit euch tanzen,« sprach die Fee, »ihr müßt aber meinem Mann gegenüber tanzen, und müßt versuchen, ihm die goldene Schnupftabackdose, die er immer auf sich trägt, weg zu nehmen.«
Das versprach denn der Herr, und da Joseph gar nichts Schlimmes vermutete, war er auch nicht auf seiner Hut, und es gelang dem Herrn, ihm die Dose unbemerkt zu entwenden, die er sogleich der Fee brachte. Diese war sehr froh, schickte auch sogleich ihre Kammerfrau zu ihrer Schwiegermutter, und ließ ihr sagen: »Hier ist die goldene Dose, gebt mir statt dessen das Hemd meiner Herrin.«
Die alte Frau, da sie die Dose sah, lieferte arglos das Hemd aus, und die Kammerfrau brachte es gleich ihrer Herrin. Kaum hatte die Fee das Hemd angelegt, so war sie auch verschwunden, und mit ihr verschwand das schöne Schloß, die Dienstboten, die Wagen und die Pferde, und Joseph saß auf einem Stein am Wege in seiner alten Bauernkleidung.
Da war er sehr betrübt, denn er hatte seine Frau sehr lieb gehabt, und kehrte wieder zu seinen Eltern zurück. Er konnte sich aber gar nicht trösten, und eines Tages sprach er zu seiner Mutter: »Mutter, gebt mir euren Segen, ich will ausziehen, meine Frau zu suchen.« Die Mutter weinte bitterlich, und wollte ihn nicht ziehen lassen. Aber Joseph bestand darauf, und so mußten die Eltern endlich nachgeben.
Joseph ging nun geradewegs an den Ort hin, wo ihn der fremde Herr gefunden hatte, und setzte sich hinter die selbe Tür. Nicht lange so kam der fremde Herr vorbei geritten, und frug ihn wieder, wer er sei und wie er heiße. Er erkannte ihn aber nicht, denn er dachte Joseph sei längst gestorben. Joseph antwortete er heiße Johannes.
Da nahm ihn der Herr in seinen Dienst, und es ging ihm ganz wie das erste Mal. Nach dem er ein Jahr lang herrlich gelebt hatte, mußte er wieder seinen Herrn auf die Hochebene begleiten, und wurde dort in die Pferdehaut eingenäht, und von den Raben auf den Diamantenberg getragen. Anstatt aber seinem Herrn Diamanten in die Säcke zu füllen, ergriff Joseph große Steine und bewarf seinen Herrn damit.
Da erkannte ihn der Herr, und rief: »Ach, du bist es! Nun, diesmal hast du mich geprellt!« Weil aber Joseph immer mehr Steine warf, so mußte er Reißaus nehmen, und lief davon so schnell er konnte. Joseph aber öffnete schnell die hölzerne Thür, stieg die Treppe hinunter, und kam zum Riesen: »Wie, mein lieber Neffe, bist du wieder da?« frug ihn der Riese ganz erstaunt.
Da erzählte Joseph wie es ihm ergangen sei. »Hatte ich dir nicht gesagt, du solltest das Hemd wohl verwahren?« sprach der Riese. »Was willst du jetzt von mir?« »Ich will ausziehen meine Frau zu suchen,« sagte Joseph, »und ihr müßt mir dazu verhelfen.« - »Bist du denn ganz verrückt?« rief der Riese, »nie und nimmer kannst du deine Frau wieder finden, denn ein anderer Riese hält sie gefangen, und den kannst du unmöglich umbringen.«
Joseph aber bat so lange, er möchte ihm doch dazu verhelfen, bis der Riese sprach: »Helfen kann ich dir nicht mehr, aber den rechten Weg will ich dir zeigen, und hier hast du etwas Brot, damit du nicht Hungers stirbst.« Also zeigte er ihm den Weg, und Joseph zog aus seine Frau zu suchen.
Als er eine lange Zeit gewandert war, wurde er hungrig, setzte sich auf einen Stein und fing an etwas Brot zu essen. Dabei fielen einige Krumen auf die Erde, und sogleich kam eine Schaar Ameisen, die pickten sie auf. »Arme Tierchen! Ihr seid wohl recht hungrig,« dachte Joseph, und streute ihnen ein großes Stück Brod hin. Da kam der Ameisenkönig und sprach: »Du hast meine Ameisen so freundlich gespeist, zum Dank dafür schenke ich dir dieses Ameisenbein. Verwahre es wohl, es wird dir noch nützen.«
Joseph dachte zwar, so ein Ameisenbein könne ihm nicht viel nützen, um den Ameisenkönig aber nicht zu beleidigen, nahm er das Bein, wickelte es in ein Stück Papier und steckte es in die Tasche. Als er weiter ging sah er einen Adler, der war mit einem Pfeil an einem Baum fest genagelt. »Ach das arme Tier,« dachte er, und zog den Pfeil heraus. »Schönen Dank,« rief der Adler, »weil du mich so freundlich erlöst hast, so will ich dir auch etwas schenken. Zieh eine Feder aus meinem Flügel, sie wird dir nützen.«
Joseph zog ihm eine Feder aus und tat sie zu dem Ameisenbein. Wieder nach einer Weile sah er einen Löwen, der hinkte und stöhnte ganz jämmerlich dazu. »Armes Tier,« dachte Joseph, »es hat gewiß einen Dorn im Fuß,« bückte sich und zog ihm vorsichtig den Dorn heraus. »Weil du mir so freundlich geholfen hast,« sprach der Löwe, »so will ich dir zum Dank ein Haar aus meinem Bart schenken. Zupfe es mir aus, es wird dir nützen.«
Joseph nahm auch das Haar, und legte es zu den anderen Sachen. Nachdem er nun noch ein Weilchen gewandert war, wurde er müde und wollte fast verzagen, denn er hatte noch sehr weit zu gehen. Da fiel ihm die Adlerfeder ein, und er dachte: »Nun, probieren kann ich es doch einmal,« nahm die Feder zur Hand und sprach: »Ich bin ein Christ und werde ein Adler.« Also bald wurde er ein Adler, und flog durch die Lüfte bis vor den Palast des Riesen.
Dort sprach er: »Ich bin ein Adler und werde ein Christ.« So gleich bekam er wieder seine natürliche Gestalt. Nun nahm er das Ameisenbein hervor, und sprach: »Ich bin ein Christ und werde eine Ameise.« Da wurde er in eine Ameise verwandelt, und kroch durch eine Ritze in der Mauer in den Palast.
Er wanderte durch viele Zimmer, endlich kam er in einen großen Saal, da sah er seine Frau, die war mit schweren Ketten gefesselt, und mit ihr viele andere Feen, alle gefesselt. Da sprach er: »Ich bin eine Ameise und werde ein Christ.« So gleich stand er in seiner wahren Gestalt vor seiner Frau.
Als sie ihn sah war sie sehr erfreut, aber auch sehr erschrocken, und sprach: »Ach, wenn der Riese dich hier findet, so bringt er dich um.« »Das sei meine Sorge,« sagte Joseph, »sage mir nur, wie ich dich befreien kann.« »Ach,« sprach die Frau, »wenn ich es dir auch sage, was hilft es? Du kannst mich doch nicht befreien.«
»Sage es mir nur,« meinte Joseph. Da sagte die Frau: »Erst mußt du den Lindwurm mit den sieben Köpfen töten, der in den Bergen hinter dem Schloß haust. Wenn du ihm nun den siebenten Kopf abgehauen hast, mußt du ihn spalten, so fliegt ein Rabe heraus. Den mußt du sogleich ergreifen und töten, und ihm das Ei heraus schneiden, das er in seinem Leibe trägt.
Wenn du mit diesem Ei den Riesen genau in der Mitte der Stirn triffst, so wird er sterben. Aber es ist dir zu schwer, du kannst es doch nicht vollbringen.« Auf einmal hörten sie einen schweren Schritt sich nahen, und die Frau rief ganz ängstlich: »Ach Joseph, der Riese kommt.«
Sogleich ergriff Joseph sein Ameisenbein, sprach seinen Spruch und wurde gleich zur Ameise. Nun kam der Riese in den Saal und brummte mit tiefer Stimme: »Ich rieche Menschenfleisch!« Die Fee aber sprach: »Wie sollte ein Mensch zu uns kommen können, wir sind ja so sicher eingesperrt,« und beruhigte ihn.
Joseph aber kroch durch die Ritze in das Freie und sprach: »Ich bin eine Ameise und werde ein Christ,« nahm dann die Feder zur Hand und verwandelte sich in einen Adler, der mit raschen Flügelschlägen an den Fuß des Berges flog, wo der Lindwurm hauste. Dort sah er einen Schäfer, der betrübt am Wege saß; also wurde er wieder zum Menschen, trat zum Schäfer und frug ihn, was ihm fehle.
»Ach,« sprach der Schäfer, »ich hatte eine so große Herde Schafe, und der Lindwurm hat mir schon so viele gefressen, daß mir nur noch ein kleiner Teil übrig bleibt, und diese getraue ich mich nicht auf die Weide zu treiben, sonst frißt sie der Lindwurm.« »Wollt ihr mich in euren Dienst nehmen,« sprach Joseph, so kann ich euch vielleicht helfen. »Gebt mir vier Schafe mit und laßt sie mich austreiben.«
Der Schäfer wollte anfangs nicht, aber Joseph sprach ihm solange Mut ein, bis er ihm die vier Schafe übergab. Joseph wanderte nun den Berg hinauf, und nicht lange, so kam der Lindwurm zum Vorschein, durch den Geruch der Schafe angelockt. Alsbald nahm Joseph sein Löwenhaar zur Hand, sprach: »Ich bin ein Christ und werde ein Löwe,« und wurde in einen grimmigen Löwen verwandelt, so groß und stark, wie es noch keinen gegeben hatte.
Nun fiel er den Lindwurm an, und nach langem Kampf gelang es ihm, ihm zwei Köpfe abzubeißen. Da wurde er aber so matt, daß er nicht mehr kämpfen konnte. Glücklicherweise aber war der Lindwurm auch so matt, daß er sich in seine Höhle verkroch. Da nahm Joseph seine menschliche Gestalt wieder an, sammelte seine vier Schafe, die sich unterdessen satt gefressen hatten, und kam ganz vergnügt zu seinem Schäfer.
Der war nun höchst erstaunt, ihn und seine Schafe lebendig wieder zu sehen, und frug ihn, wie es ihm ergangen sei. Joseph aber meinte: »Was geht euch das an? Ich habe euch eure Schafe gesund wieder gebracht, gebt mir morgen acht mit.« Den nächsten Morgen trieb Joseph acht Schafe auf die Weide; der Schäfer aber war neugierig und folgte ihm leise nach.
Da sah er nun, daß als der Lindwurm zum Vorschein kam, Joseph sein Löwenhaar zur Hand nahm, seinen Spruch sagte, und so gleich in einen grimmigen Löwen verwandelt wurde, der mit dem Lindwurm kämpfte. Heute gelang es ihm, vier Köpfe abzubeißen, da wurde er aber so matt, daß er nicht weiter konnte, und auch der Lindwurm war ganz von Kräften.
»Ja,« sprach der Lindwurm, »wenn ich ein Glas von dem Wasser des Lebens hier hätte, so wollte ich dir schon die Kraft des Königs der Drachen zeigen.« »Und ich,« erwiederte Joseph, »wenn ich eine gute Suppe von Wein und Brot hier hätte, so wollte ich dir schon die Kraft des Königs der Löwen zeigen.« Da das der Schäfer hörte, lief er eilends nach seiner Hütte, kochte geschwind eine Suppe von Wein und Brot, und brachte sie dem Löwen.
Kaum hatte dieser die Suppe gefressen, so kehrte seine ganze frühere Kraft zurück; er fing noch einmal an zu kämpfen, und biß dem Lindwurm auch noch den siebenten Kopf ab. Nun sprach er: »Ich bin ein Löwe und werde ein Christ,« und spaltete den siebenten Kopf.
Da flog ein Rabe heraus und erhob sich gleich in die Lüfte. Joseph aber war auch bei der Hand: »Ich bin ein Christ und werde ein Adler,« und als Adler flog er dem Raben nach und tötete ihn. Nun nahm er wieder seine menschliche Gestalt an, schnitt dem Raben das Ei aus, und zog nun mit dem Schäfer und den Schafen wieder nach Haus.
Der Schäfer wollte ihn gern bei sich behalten, und versprach ihm alles, was er begehrte, wenn er nur bei ihm bleiben wollte. Joseph aber antwortete: »Ich kann nicht bei euch bleiben. Es freut mich, daß ich euch vom Lindwurm befreit habe, und danke euch für eure schnelle Hilfe.«
Also zog er von dannen, flog als Adler bis zum Schloß des Riesen, drang als Ameise durch die Ritze in den Saal. »Ich bin eine Ameise und werde ein Christ,« sprach er, und erzählte nun seiner Frau, daß er alles vollbracht habe und das Ei mitbringe.
Da sprach sie: »Der Riese schläft eben im Nebenzimmer, jetzt ist der Augenblick ihn zu töten.« Joseph schlich in das Nebenzimmer, zielte genau nach der Stirn des Riesen, und tötete ihn. Da wurden alle Feen von ihren Ketten befreit, und seine Frau fiel ihm um den Hals. Dann zeigte sie ihm alle die Schätze, die da gesammelt waren. Davon nahmen sie, soviel sie tragen konnten, und reisten wieder nach Hause, zu Joseph's Eltern.
Da bauten sie sich ein Haus, das war noch schöner als das erste, und lebten herrlich und in Freuden bis an ihr glückliches Ende.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
SCHNEEWEISS - FEUERROT
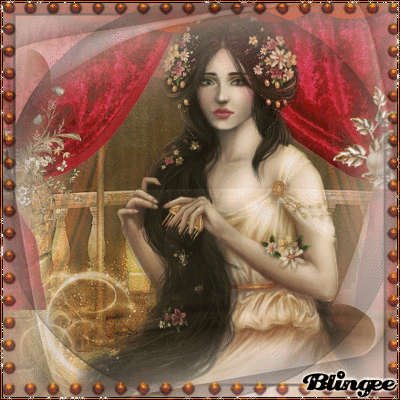
Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten noch kein Kind und wünschten sich doch so sehr, eins zu besitzen. Sie taten auch ein Gelübde und versprachen, so ihnen ein Kind geboren werde, sieben Jahre lang zwei Fontainen springen zu lassen: die eine mit Öl, die andere mit Wein. Und siehe, ihr Wunsch wurde erfüllt: die Königin bekam einen wunderschönen Sohn.
Also gleich wurden auch die zwei Fontainen errichtet, und die Leute aus dem Lande kamen und schöpften Oel und Wein sieben Jahre lang. Wie die sieben Jahre um waren, hörten sie auf zu fließen. Da kam ganz zuletzt noch eine Hexe. Sie fand die Brunnen vertrocknet, nahm einen Schwamm, trocknete die letzten Tropfen auf und drückte sie in ein Fläschchen.
Bei diesem Geschäft sah sie der junge Königssohn, und da er gerade mit Kugeln spielte, wirft er sie, mutwillig wie er war, der Alten gegen die Flasche, daß sie zerbricht. Da drohte ihm die Alte und sprach: »Ich kann dir nichts antun, denn du bist des Königs Sohn, aber das lasse ich dir: nicht Rast und nicht Ruhe findest du und nicht heiraten kannst, solange du nicht Schneeweiß-Feuerrot findest.« Der kluge Knabe merkt sich die Worte der Alten und schreibt sie auf ein weiß Papier, das er verschließt, sagt aber niemand etwas davon.
Wie er achtzehn Jahre alt geworden war, wollten ihn sein Vater und seine Mutter verheiraten. Er gedachte der Verwünschung, nahm das Papier hervor und sagte: »Ehe ich nicht Schneeweiß-Feuerrot finde, kann ich mich nicht verheiraten.« Er verabschiedete sich also von seinen Eltern und zog Mutter Seelen allein in die weite Welt hinein. Er ging und suchte, Monate verstrichen, aber er fand nichts.
So fand er sich eines Abends müde und erschöpft auf freiem Felde, in dessen Mitte ein Haus stand. Am Morgen sah er eine Hexe kommen, eine Ungestalt mit einem Gesicht, das Schrecken einflößte, die ruft: »Schneeweiß-Feuerrot, laß mir deine Zöpfe herunter, daß ich hinauf steigen kann.« Wie er den Namen hört, kehrt ihm der Mut zurück, und er sagt: »Hier also ist sie!«
In dessen hat auch Schneeweiß-Feuerrot ihre langen Zöpfe herunter gelassen, und an ihnen kletterte die Hexe hinauf. Oben angekommen, setzte sie sich zum Essen, das konnte der Prinz sehen, der hinter einem Baum versteckt war. Anderen Morgens stieg die Hexe wieder herunter, und kaum war sie fort, so kam er hinter dem Baum hervor und rief: »Schneeweiß-Feuerrot, laß mir deine Zöpfe herunter, daß ich hinauf steigen kann.«
Jene glaubte, es sei die Alte, löste ihre Zöpfe, und der Königssohn stieg hinauf. Wie er oben war, sagt er: »Ach, mein Schwesterchen, was habe ich ausgestanden, um dich zu finden!« Und er erzählte ihr seine Geschichte, die Verwünschung der Hexe, da er noch sieben Jahre alt war.
Sie ist freundlich zu ihm, reicht ihm Speise und Trank und sagt ihm: »Hüte dich, schöner Jüngling denn findet dich die Hexe hier, so frißt sie dich. Verbirg dich also.« Schon kam die Drachenmutter über das Feld her, und der Königssohn verbarg sich. Sie rief von unten: »Schneeweiß-Feuerrot, laß mir deine Zöpfe herunter, daß ich hinauf steigen kann.« Das Mädchen, um sie freundlich zu stimmen, ruft eilig: »Ich komme schon, ich komme, meine Mutter!«
Und läßt ihre Zöpfe hinab. Droben beim Essen dient sie ihr freundlich und gibt ihr dann wacker zu trinken, bis sie trunken war. Dann schmeichelte sie ihr und sprach: »Mütterchen mein, was doch müßte ich tun, um von hier fort zu kommen? Nicht daß ich die Meinung hätte, Euch zu verlassen, denn ich bin ja gern bei Euch, aber der Neugierde wegen. Bitte, sagt es mir, Mütterchen!« -
»Was du zu tun hast, um hier heraus zu kommen? Ah, das ist schwer. Da mußt du alles, was hier ist, bezaubern, daß ich Zeit verliere. Ich rufe und statt deiner muß mir der Stuhl antworten, der Schrank, die Lade. Wenn du dann dich nicht am Fenster zeigst, steige ich hinein, dich zu suchen, und finde ich dich nicht, verfolge ich dich. Da ist es nötig, daß du dir die sieben Fadenknäuel verschaffst, die ich verwahrt halte, denn erblickst du mich hinter dir, mußt du das erste davon fort werfen, um mich aufzuhalten, und so nach und nach alle anderen bis zum siebenten.«
Das Mädchen behielt die Worte der Hexe gar wohl im Gedächtnis, sie freute sich in ihrem Herzen, verhielt sich jedoch still. Als die Hexe am anderen Morgen weg gegangen war, beriet sie mit dem Königssohne, was sie zu tun habe. Sie lief durch das ganze Haus und rief die Dinge an: »Tischlein mein, wenn die Mutter kommt, antworte du für mich! Stühlchen mein, antworte du für mich, und du Schränkchen!« So verzauberte sie alles, steckte die Knäuel zu sich und entfloh mit dem Jünglinge, schnell, wie zwei Vögel.
Wie die Hexe zurück kommt, ruft sie wie gewöhnlich: »Schneeweiß-Feuerrot, laß mir deine Zöpfe herunter, daß ich hinauf steigen kann!« Da antwortete das Tischchen: »Ich komme, Mutter, ich komme!« Sie wartete ein Weilchen, und als niemand kam, wiederholte sie ihren Spruch. Da antwortete das Schränkchen: »Mutter, ich komme schon, ich komme!« Wieder wartet sie ein Weilchen. Wie auch jetzt niemand kommt, ruft sie aufs Neue hinauf, und jetzt antwortet die Lade: »Ich komme!«
So gewannen die Flüchtlinge Zeit und liefen, was sie laufen konnten. Da aber im Hause nichts mehr war, was Antwort geben konnte, merkte die Alte, was geschehen ist, und schrie: »Verrat! Verrat!« Sie setzt rasch eine Leiter an, steigt hinauf, sucht das Mädchen, findet es nicht, findet auch die Fadenknäuel nicht und ruft: »Ei du Verruchte, das hast du mir angetan? Jetzt will ich dein Blut trinken!« Und nun lief sie, dem Geruche folgend, hinter den Flüchtigen drein.
Nach langem Laufen erblickte sie die beiden in der Ferne und rief: »Schneeweiß-Feuerrot, sieh dich um, ich komme.« Hätte sich diese nun umgeschaut, so wäre sie verzaubert worden. Sie warf aber, wie die Hexe näher kam, das erste Knäuel hinter sich, und da erhob sich ein hoher Berg auf dem Wege. Der hielt die Hexe wohl etwas auf, dennoch erklimmte sie ihn und erreichte drüben bald wieder die Fliehenden.
Das Mädchen wirft das zweite Knäuel, und augenblicklich erscheint eine Fläche voller Messer und Stacheln, so daß die Alte beim darüber Laufen ganz zerschnitten und zerstochen wurde und das Blut nur so von ihr troff: dennoch war sie hinter drein. Da wirft Schneeweiß-Feuerrot das dritte Knäuel, und ein entsetzlicher Strom rauscht hervor, den die Hexe nur mit Mühe durch schwimmt. Halb tot steigt sie ans andere Ufer, aber die Verfolgung setzt sie fort.
Dem Flusse folgt eine Quelle voll giftiger Schlangen, dann andere Schrecknisse, und die Hexe, todmüde geworden, muß inne halten, schleudert aber dem Mädchen eine Verwünschung nach und ruft: »Daß dich der Königssohn beim ersten Kusse seiner Mutter vergesse!« Sie schrie so laut, daß ihr die Brust zersprang, so starb sie. -
Der Jüngling wandert und wandert mit seinem Mädchen, und endlich erreichten sie die Heimat, wo der Palast des Königs stand. Da sprach er zu dem Mädchen: »Bleibe hier und warte, bis ich zurück komme. Deine Kleider würden sich für den Königspalast nicht schicken, ich gehe dir schönere zu holen, um dich als dann meinem Vater und meiner Mutter zuzuführen.« So blieb sie.
Wie die Königin ihren geliebten Sohn wieder sieht, wirft sie sich ihm an die Brust, um ihn zu küssen. Er hält sie zurück und sagt: »Teuere Mutter, küsse mich nicht, ich habe ein Gelübde getan, mich von dir nicht küssen zu lassen.« Der Mutter tut das Herz weh und sie vermag sich solches nicht zu erklären, brannte aber vor Verlangen, dem Sohne den Kuß zu geben. Als er nun eines Nachts im tiefen Schlafe lag, schlich die Mutter in seine Kammer und küßte ihn ... Schneeweiß-Feuerrot war vergessen. -
Einsam stand das Mädchen mitten auf der Straße, ohne zu wissen wo und wohin. Kam eine Alte des Weges und sah das Mädchen, schön wie die Sonne, und wie es weinte bitterlich. »Was hast du, meine Tochter?« - »Was soll ich haben? Ich weiß selber nicht, wie ich hierher gekommen bin.« Die Alte tröstete sie und lud sie ein, mit in ihr Haus zu kommen. Das Mädchen hatte geschickte Hände zu aller Arbeit und wußte auch um die Zauberei.
Sie fertigte jetzt feine Sachen und die Alte ging, sie zu verkaufen; so brachten sie beide ihr Leben durch. Eines Tages verlangte die Junge, die Alte solle ihr zwei Flicken Zeug aus dem Königsschlosse bringen, sie brauche sie zu einer Arbeit. Die Alte ging und brachte wirklich die Flicken. Nun waren da zwei Tauben, ein Männchen und ein Weibchen, die bekleidete Schneeweiß-Feuerrot fein säuberlich mit Kleiderchen, die aus den Flicken gemacht waren, so daß es eine Pracht war, sie zu sehen.
Darauf flüstert sie den Tieren in die Ohren und sagt: »Du bist der Prinz und du bist Schneeweiß- Feuerrot. Der König sitzt zu Tisch und ißt, so fliegt hin, erzählt ihm alles, was ihr erlebt.« Da nun König und Königin, der Königssohn und alle Großen zu Tische saßen, kommen die schönen Tauben herein und setzen sich zu Mitten auf dem Tische nieder. Alle staunten und riefen: »Wie schön sind sie!«
Jetzt fing die Taube, welche Schneeweiß-Feuerrot sein sollte, an zu sprechen: »Lange ist es her, doch weißt du noch, wie dein Vater die Springbrunnen mit Wein und Öl versprach, daß du geboren werdest. Weißt du noch?« Und der Tauber antwortete: »Wohl weiß ich es noch.« Dann fuhr die Taube fort: »Denkst du noch an die Alte, der du das Fläschchen zerbrachst? Denkst du daran?« Und wieder antwortete der Tauber: »Ich denke daran.« -
»Und hast du die Verwünschung vergessen, welche dir die Alte zurief, nicht heiraten zu dürfen, wenn du nicht Schneeweiß-Feuerrot gefunden? Hast du sie vergessen?« - »Ich habe sie nicht vergessen«, erwiderte der Tauber. So gemahnte ihn die Taube nach und nach an alles, was geschehen war und was sie gemeinschaftlich erlebt hatten.
Zuletzt sagte sie: »Weißt du noch, wo die Alte uns nach lief, und hast du die andere Verwünschung vergessen: vom Kuß der Mutter? Hast du Schneeweiß-Feuerrot doch vergessen?« Wie die Taube von dem Kusse sprach, fiel es dem Königssohn wie Schuppen von den Augen, der König und die Königin wußten sich keine Deutung.
Dann nickten die Tauben, flogen zum Fenster und vom Fenster schwangen sie sich in die blaue Luft hinein. Der Königssohn rief: »Heda, schaut mir, wohin diese Tauben fliegen! Gebt Acht, wohin sie fliegen!« Die Diener laufen und sehen, wie sie sich auf einer Hütte im freien Felde nieder lassen. Zu dieser Hütte eilt der Königssohn, findet richtig Schneeweiß-Feuerrot, umarmt sie und ruft: »Ach, du Ärmste, was hast du um meinetwillen leiden müssen. Doch jetzt komm, alles ist gut!«
Er führte sie zu seiner Mutter, die staunte und sagte: »Was für eine Schönheit bringst du da!« Er erzählte seine Geschichte und erbat sich Schneeweiß-Feuerrot zur Frau. Die Eltern waren es wohl zufrieden, man wechselte die Ringe und feierte die Hochzeit mit großer Pracht und Herrlichkeit.
Das waren sie, und wir?
Wir sitzen nüchtern hier.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
DIE ZAUBERKUGELN ...
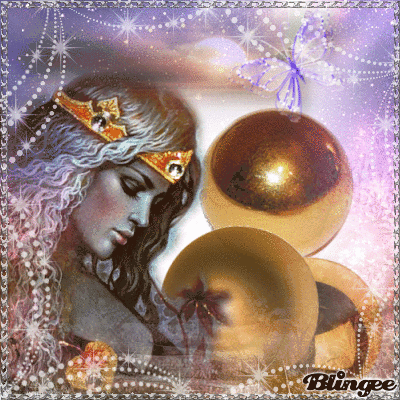
Es war einmal ein König, der glaubte der Schönste auf der Welt zu sein, und wenn er sich im Spiegel beschaute, fragte er diesen:
Lieber Spiegel, wer gefällt
Dir noch mehr auf dieser Welt?
Seine Frau hörte das zwei-, drei-, viermal mit an, zuletzt ward sie ärgerlich und sagte:
Lieber König, gib doch Ruh',
Einen Schönern gibt's als du.
Da sagte der König: »Jetzt sollst du mir binnen drei Tagen sagen, wer dieser Schönere ist, oder du mußt sterben.« Die arme Königin geriet in Verzweiflung, sie schloß sich in ihre Kammer ein und ließ sich vor niemand mehr sehen. Am dritten Tag schaute sie zum Fenster hinaus und sah eine Alte vorbei gehen, die bettelte und sagte: »Frau Königin, schenkt mir doch ein Almosen.«
Die Königin antwortete: »Ach laß mich in Ruhe, ich habe jetzt genug mit mir zu tun.« Sagt die Alte: »Ich weiß wohl, was Euch bedrückt, vermöchte auch Euch zu helfen.« - »So komm herauf«, rief die Königin; die Alte kam, und die Königin fragte: »Was weißt du also?« - »Ich weiß, was der König von Euch gefordert hat.« - »Und gibt es wirklich einen Ausweg?« - »Ja, Frau Königin.« - »Nun so gebe ich dir alles, was du begehrst.«
Aber die Alte sprach: »Ich begehre nichts. Geht nur heute Mittag mit dem König zu Tische und erfleht von ihm die Gewährung einer Bitte. Er wird Euch fragen: 'Ist es das Leben, um das Ihr mich bittet?' und Ihr antwortet: 'Nein.' Dann wird er Euch gewähren, und Ihr sprecht: 'Schöner als Ihr ist der Sohn des Kaisers von Frankreich, der in sieben Schleiern verhüllt ist.'«
Die Alte ging weiter, und die Königin begab sich zum Könige. Dort geschah alles, wie es die Alte gesagt hatte, und der König sprach zuletzt: »Ist er denn schöner als ich, so tue mit mir wie dir beliebt, zuvor aber will ich gehen und selbst zu sehen.« Darauf reiste er mit großem Gefolge ab und ging zum Kaiser von Frankreich. »Herr Kaiser, ich begehre nichts, als Euren Sohn zu sehen.« Der Kaiser antwortete: »Meinen Sohn? Den sollt Ihr sehen, aber jetzt schläft er.«
Kurz darauf führt er ihn in die Kammer, wo der Sohn schlief. Man hebt den ersten Schleier weg: und ein großer Glanz leuchtet hervor, den zweiten: und der Glanz wird stärker, immer mächtiger ward er beim dritten, beim vierten und so fort, bis endlich der Königssohn in voller Pracht vor ihnen stand, das Zepter in der Hand, das Schwert im Gürtel.
Wie der König so große Schönheit sah, erschrak er und fiel ohnmächtig zu Boden. Mit Mühe brachte man ihn wieder zu sich, und noch drei Tage blieb er am Hofe des Kaisers. Ehe er abreiste, kam der Königssohn zu ihm und fragte ihn: »Möchtest du mich wohl in deinem Hause sehen?« - »Ja, aber wie kann das geschehen?« - »Nimm diese drei Goldkugeln, willst du mich dann sehen, so wirf sie in ein goldenes Becken voll reiner Milch, und ich werde dir erscheinen, wie du mich hier siehst.« Der König nahm die drei Kugeln und zog davon.
Zu Hause angekommen, rief er seine Gemahlin und sagte: »Jetzt bin ich wieder hier, nun tue mit mir wie dir beliebt.« Die Königin antwortete: »Sei mir gesegnet, mein Herr!« Darauf erzählte ihr der König die Geschichte und gab ihr die drei Kugeln. Nach drei Tagen aber war er tot. Der Gram, daß ein anderer schöner als er sein sollte, hatte ihm das Herz gebrochen. So wurde die Königin zur Witwe.
Nachdem einige Zeit vergangen war, rief sie eine vertraute Dienerin und sagte: »Geh, hole mir drei Stübchen reiner Milch.« Mit dieser schloß sie sich ein, goß sie in das goldene Becken, warf die drei Kugeln hinein, und sofort erschien erst das Schwert, dann das Zepter und zuletzt der Jüngling selbst. Sie sprachen gar holdselig miteinander, worauf er wieder verschwand.
Jeden Tag schickte sie jetzt die Dienerin nach reiner Milch, und jeden Tag erschien ihr der Königssohn, bis endlich die Dienerin neugierig ward und der Sache auf den Grund kommen wollte. Was tat sie? Sie zerbrach ein geschliffenes Glas, stampfte es zu Pulver und verbarg dieses Pulver in ihrem Busen. Wie nun die Königin sie wie gewöhnlich nach Milch schickt, schüttet sie, da sie die Treppe herauf steigt, den Glasstaub in die Milch und bringt sie so der Königin.
Die Königin wirft die drei Kugeln hinein, der Königssohn erscheint, aber, wehe! mit zerschnittenen Adern, ganz in Blut gebadet, das hatte ihm das Glas angetan. Kaum erblickte er die Königin, so rief er: »Unselige, du hast mich betrogen, wir können uns nimmer wiedersehen!« Sie mochte bitten, wie sie wollte, er verschwand und blieb von da an in seinem Lande.
Der Kaiser von Frankreich aber ließ verkünden: »Wer meinen Sohn heilt, er sei auch wer er sei, dem wird jegliche Bitte gewährt werden.« Alle Häuser der Stadt bekleidete man mit Schwarz, alle Glocken läuteten wegen des Königssohnes, der zum Tode da nieder lag.
Als die Königin sah, daß der Jüngling nicht wieder kehrte, kleidete sie sich als Schäfer und machte sich auf den Weg nach seiner Stadt. Zur Nacht sieht sie sich mitten in einem dichten Walde. Hier ersteigt sie einen einzeln stehenden Baum, betet und schickt sich zum Schlafen an. Es war um die Mitternachtsstunde; da kommen auf einmal alle Teufel der Hölle heran und setzen sich um den Baum her in einem Kreise zusammen.
Einer fragt den anderen, was Böses er vollbracht, bis zuletzt die Reihe an den schwarzen Hinketeufel kam, den fragten sie: »Nun, Schwarzer, was Großes hast du getan?« - »Diesmal wirklich etwas Großes; woran ich schon manches Jahr gearbeitet hatte, das ist mir jetzt gelungen.« Und er erzählte ihnen die Geschichte vom König und der Königin, dem Königssohn und der bösen Magd. »Jetzt«, schloß er, »hat er nur noch drei Tage zu leben, und weil er an dem Herrn verzweifelte, dürfen wir ihn holen.«
Da fragte ihn der Großteufel: »Sage mir, haben sie nicht etwa ein Mittel, ihn zu heilen?« - »Oh«, antwortete der Hinkende, »ein Mittel gäbe es schon, aber das behalte ich für mich.« - »Ei, uns kannst du es ja sagen.« - »Euch wohl, aber wenn mich jemand anderes hörte!« - »Schweig, du Tier«, riefen alle, »wer könnte uns hier hören? Wäre jemand hier gewesen, der würde schon vor Angst umgekommen sein.«
So ging es noch eine Weile hin und her, bis der Hinketeufel endlich sein Mittel sagte: »Eine Tagereise von hier ist ein Wald, mitten im Walde liegt ein Kloster, und in dem Garten dieses Klosters wächst das Glaskraut. Davon muß man ein paar Körbe voll in einem Mörser stampfen, den Saft in einem Gefäße sammeln, und den Jüngling damit von Kopf bis zu Füßen einreiben, so wird er schöner denn zuvor.«
Die Königin hatte dies alles gehört und bewegte es in ihren Gedanken. Wie es tagte, stieg sie vom Baum und begab sich auf die Wanderung nach dem Kloster, wo das Glaskraut wuchs. Endlich kommt sie dort hin und ruft den Pförtner an. Der meint, einen bösen Geist zu hören, und fängt seine Beschwörung an. Sie aber sagt: »Wozu beschwörst du mich? Ich bin eine getaufte Seele wie du.«
Da ließ man sie hinein. Sie bat die Mönche um ein paar Körbe Glaskraut, das erhielt sie und zog anderen Morgens nach der Stadt des Kranken, wo alle Häuser mit Schwarz bekleidet waren. Als sie vor den Palast kam, wollten die Wächter sie, die noch immer als Hirt gekleidet war, nicht herein lassen, aber der Kaiser gab Befehl, den Hirten zu ihm zu führen.
Wie sie vor dem Kaiser stand, bat sie ihn, alle Ärzte fort zu schicken, denn in zwei Tagen wolle sie den Kranken heilen. Der Kaiser, welcher schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, ließ den Hirten nach seinem Willen schalten und walten und befahl den Dienern, ihm in allen Stücken zur Hand zu sein. Die verkleidete Königin ließ einen Mörser herbei schaffen, stampfte das Kraut darin und sammelte den Saft in ein Gefäß.
Darauf ging sie zu dem Kranken, bestrich ihn damit, und wo sie ihn bestrich, blutete es nicht mehr und die Wunden schlossen sich. Das tat sie den ganzen Tag, bis der Jüngling ganz heil war. Als der Kaiser kam, übergab sie ihm seinen Sohn, der schöner denn zuvor war. Aber die Schätze, die der Kaiser bot, wollte sie nicht, und nur den Ring, den ihr der Genesene gab als Andenken an seine wunderbare Heilung, den nahm sie, verabschiedete sich und ging auf und davon.
Sie hatte Eile, nach Hause zu kommen, und ging jetzt selbst, anstatt der untreuen Dienerin, die Milch zu holen, schüttete sie in das goldene Becken und warf wie gewöhnlich die drei Kugeln hinein. Der Königssohn erschien auch diesmal, wollte sie aber in seinem Zorn zerschmettern. Sie warf sich ihm zu Füßen und rief: »Was willst du? Ich habe keine Schuld. Deine Retterin bin ich. Siehe dies Zeichen!«
Dabei hielt sie ihm den Ring entgegen. Da wurde seine Seele ruhig, und wie sie ihm die Geschichte erzählte, und was sie von den Teufeln gehört, und wie sie das Kraut geholt und ihn geheilt habe, beschloss er, sie zu seiner Gemahlin zu machen. Er eilte nach Hause, seinen Vater zu bitten, und der gewährte mit Freuden alles.
So gingen sie vereint, die Königin abzuholen, worauf sie in ihr Land zurück kehrten, um die Hochzeit als bald mit großer Pracht zu feiern. Die böse Magd aber mußte ihr Leben lassen.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
LICHTMESS ...
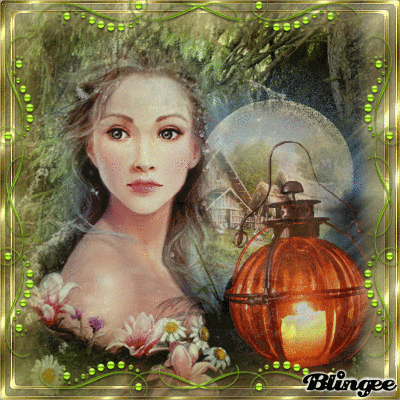
Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten kein Kind, und weil der König besorgt war, nie eins zu bekommen, erließ er ein Gebot in alle Lande, das lautete: »Jeder, dem es gelinge, der Königin zu einem Kind zu verhelfen, wird der Vornehmste im Lande nach dem Könige sein; gelingt es ihm aber nicht, muß er des Todes sterben.«
Da kamen viele schöne Männer, Prinzen und Ritter, aber keinem gelang es, und sie bezahlten ihre Kühnheit mit dem Leben. Ganz zuletzt kam ein armer zerlumpter Greis, der trat vor den König und sprach: »Herr König, führt mich zu Eurer Gemahlin, und ich werde ihr zeigen, wie sie Kinder haben kann.« Alle, die den gebrechlichen Alten sahen, verlachten und verspotteten ihn, trotzdem führte ihn der König zu seiner Frau.
Der Alte sah sie kaum an und sagte: »Herr König, laßt den Meerdrachen töten, laßt sein Herz von einem Jungfräulein kochen, wobei diese schon durch den bloßen Duft der Hoffnung werden wird, gebt das gekochte Herz der Königin zu essen, und es wird ihr das selbe geschehen, und beide, Jungfrau und Königin, werden gleichzeitig jede ein wunderschönes Knäblein gebären.«
Der König verwunderte sich zwar dieses Rates, tat aber dennoch wie der Alte gesagt hatte, und alles traf zu nach dessen Worten. Die Jungfrau wie die Königin schenkten je einem wunderschönen Knaben das Leben; der der Jungfrau wurde Lichtmeß, jener der Königin Emilio genannt. Doch nur im Namen waren sie verschieden, sonst glichen sie sich wie ein Ei dem anderen.
Sie liebten einer den anderen mit großer Liebe, und im Anfange liebte sie auch die Königin ohne Unterschied. Als sie jedoch heranwuchsen, ärgerte sich die Königin, wie so gar kein Unterschied zwischen beiden sei, und ihr Herz füllte sich mit Missgunst gegen den Sohn der Magd. Als bald behandelte sie ihn übel und wollte nicht, daß ihr eigener Sohn jenen als Bruder behandle. Das half ihr aber nichts, die Knaben liebten sich weiter mit unwandelbarer Liebe.
Eines Tages waren sie zusammen und vergnügten sich, Kugeln für die Jagd zu gießen. Emilio ging einen Augenblick bei Seite, da näherte sich die Königin dem Herde und gab dem armen Lichtmeß mit der Feuerschaufel einen Schlag auf den Kopf, daß das Blut sofort aus breiter Wunde floß. Der arme Knabe sagte nichts, wischte sich das Blut ab und verband die Wunde, beschloß aber im Herzen, für immer dieses ungastliche Schloß zu verlassen und ein besseres Glück zu suchen.
Als Emilio zurück kam und den Freund so fand, war er ganz außer sich und flehte ihn an, ihm das Geschehene zu erzählen. Weinend erzählte der andere ihm alles und sagte dann: »Lieber Bruder, unser Geschick will nicht, daß wir ferner zusammen leben, ich muß dich verlassen.« Und was immer Emilio tat, ihn zu halten, sein Entschluß stand fest.
Am nächsten Morgen nimmt Lichtmeß seine Doppelflinte, seinen Hund und sein Pferd, ruft den Bruder in den Garten und sagt: »Teuerer Bruder, die Stunde der Trennung ist gekommen, doch werde ich dir ein Andenken hinterlassen.« Mit einem Stabe grub er ein Loch in die Erde, und da sprang ein silberhelles Quellchen hervor.
Neben dieses Quellchen pflanzte er ein Myrtensträuchlein und sagte: »Siehst du jemals dies Wässerchen trüb, die Myrte welk, so ist dies ein Zeichen, daß ich in großer Trübsal bin.« Darauf umarmten sie sich, küßten sich unter Tränen, und Lichtmeß ritt davon.
Wie er so reitet, kommt er eines Tages an einen Scheideweg. Eine der Straßen führte in einen dichten Wald, wo, wer eintrat, niemals mehr heraus kommen konnte, die andere in die weite Welt. An der Wegkreuzung lag ein Garten, und in dem Garten zankten sich gerade zwei Gärtner und waren nahe dabei, sich zu schlagen.
Lichtmeß tritt zu ihnen und fragt sie um ihren Streit. Der eine der Gärtner antwortet: »Ich habe zwei Piaster gefunden, und davon will mein Gefährte einen haben, weil er bei dem Funde zu gegen war. Ich mag ihm aber nicht recht geben.« Da nahm Lichtmeß vier Piaster aus seiner Börse, gab jenem, der schon zwei gefunden, die ersten und dem Gefährten die anderen zwei. Ganz erfreut dankten die Gärtner und küßten ihm die Hand.
Lichtmeß ritt weiter und nahm die Straße nach dem Walde. Da rief ihm der Gärtner, welcher jetzt vier Piaster besaß, nach: »Herrlein, diese Straße dürft Ihr nimmer reiten, sie führt in den Wald, aus dem kein Entkommen ist, nehmt doch die andere!« Lichtmeß dankte und lenkte in die andere Straße ein. Wie er ein Stück geritten war, sieht er zwei Buben, die mit Stöcken eine Schlange verfolgen. Er ruft ihnen zu: »Laßt das arme Tier gehen!« Und die Schlange konnte entfliehen, doch hatten sie ihr schon ein Stück Schwanz abgeschlagen.
Eines Tages, da es dunkel wurde, fand sich Lichtmeß in einem großen, großen Walde. Die Nacht kam und mit ihr eine Kälte, daß er erfrieren wollte, dazu hörte man von allen Seiten das Geheul der wilden Tiere. Schon glaubte er sich verloren, als ihn ein wunderschönes Mädchen bei der Hand faßte. Sie trug eine Leuchte und sagte: »Armer Knabe! Komm! Erwärme und ruhe dich in meinem Hause aus.«
Er glaubte zu träumen, und schweigend folgte er dem Mädchen. Wie sie angekommen waren, fragte sie ihn: »Erinnerst du dich noch einer Schlange, die du aus den Händen böser Buben rettetest? Diese Schlange bin ich. Sieh, jene schlugen mir ein Stück des Schwanzes ab, und dafür fehlt mir jetzt die Spitze des kleinen Fingers der linken Hand. Wie du aber mich aus der Hand der Buben rettetest, rette ich dich jetzt vor Kälte und wildem Getier.«
Der Knabe wußte nicht, wie er danken sollte, denn sie zündete jetzt ein großes Feuer an, bereitete den Tisch und lud ihn zum Essen ein, dann gab sie ihm eine Kammer, zum Ruhen. Am nächsten Morgen küßte sie ihn und sagte: »Ziehe jetzt weiter, mein Freund! Du wirst vieles erdulden, dennoch wird der Tag kommen, wo wir im Glücke vereint sein werden.« Lichtmeß verstand sie nicht, doch umarmte und küßte er sie wieder, und ritt traurig davon.
Er kommt in einen anderen Wald und begegnet einer Schlange mit goldenen Hörnern. Die wollte er mit seinem Doppelgewehr erlegen, doch wand sich die Schlange hier hin und dort hin, um sich zu retten, und lockte ihn dergestalt in die Nähe einer Höhle. Und da brach ein furchtbares Unwetter los: Donner und Blitz, Sturm, Regen und Hagel so groß wie Hühnereier. Er flüchtete sich mit Pferd und Hund in die Höhle und zündete ein kleines Feuerchen an, seine Kleider zu trocknen.
Ein Schlänglein bat ihn, er möge es herein lassen, es wolle sich auch ein wenig wärmen, und er erlaubte es. Das Schlänglein aber sagte: »Ich fürchte mich vor Pferd, Hund und Gewehr!« Und der gute Knabe band Roß und Hund an, schoß das Gewehr ab und sagte: »Jetzt magst du ohne Furcht herein kommen.«
Sie kommt und verwandelt sich augenblicks in einen Riesen. Mit der einen Hand packte der den Jüngling bei den Haaren, mit der anderen hob er den Stein von einem Grabe, das in der Grotte war, und begrub den Ärmsten lebendig darin. -
Emilio, der Bruder, fand nach dem Lichtmeß abgereist war keinen Frieden mehr im Hause. Und wie er eines Tages in den Garten geht, findet er die Quelle trüb, das Myrtensträuchlein verwelkt.
»Wehe mir«, ruft er, »meinem Bruder ist ein Unglück geschehen. Ich muß mich aufmachen, ihn zu suchen. Ich muß wissen, was ihm Leides widerfahren!« Niemand konnte ihn zurück halten. Er stieg zu Pferd, und Hund und Gewehr zur Seite ritt er in die Welt hinein. Er kommt an den Kreuzweg, wo Lichtmeß die beiden Gärtner getroffen hatte, und der eine der selben läuft ihm schon von weitem mit dem Hut in der Hand entgegen und ruft:
»Willkommen, Herr! Erinnert Ihr Euch noch der Piaster, die Ihr mir jenes mal gegeben? Erinnert Ihr Euch noch, wie Ihr die böse Straße nehmen wolltet zum Walde, aus dem kein Entfliehen ist, und wie ich Euch die rechte gezeigt?« - »Wohl, wohl, lieber Mann, ich erinnere mich an alles«, antwortete Emilio, der recht wohl merkte, daß ihn der Gärtner mit seinem Bruder verwechsele.
So wußte er denn, daß Lichtmeß diese Straße geritten, und erfuhr auch den Weg, den er zu nehmen habe. Er gab dem Gärtner vier Piaster und ritt davon. Nach langem Ritt kam er in den Wald, wo Lichtmeß das schöne Mädchen gefunden, das er als Schlange gerettet und das sich ihm dann so freundlich erwies. Sie erschien auch ihm und sagte: »Willkommen, Freund meines Bräutigams.«
Emilio verwunderte sich der Anrede und fragte: »Wer seid Ihr, o Schöne?« - »Ich bin die Fee, welche deinen Bruder heiraten muß.« - »Wie«, rief er da erfreut, »Lichtmeß lebt noch? Wenn er lebt, o so gebt mir Kunde von ihm, denn ich will eilen, ihn zu umarmen.« Da traten dem Mädchen die Tränen in die Augen, als sie sagte: »Ziehe hin! Befreie unseren teueren Lichtmeß, der unter der Erde liegt und leidet! Hüte dich jedoch und laß dich nicht von dem Schlänglein betrügen!«
Mit diesen Worten verschwand sie. Dem Jüngling aber, in der Hoffnung, den Bruder zu retten, kam neuer Mut, und er ritt davon. Er kommt in den Wald, wo die Schlange mit den goldenen Hörnern hauste, und macht sich hinter sie her, sie zu erlegen. Auch ihn überrascht das Unwetter, und er flüchtet sich in die selbe Grotte, in die sich Lichtmeß geflüchtet hatte, und entzündet das Feuer.
Kommt das Schlänglein herbei gekrochen und bittet, herein kommen und sich wärmen zu dürfen. Das erlaubt er. Wie sie aber anfängt von der Furcht vor Hund, Pferd und Gewehr, kommt ihm die Warnung des Mädchens in den Sinn, und statt aller Antwort schießt er ihr seine Doppelflinte gegen den Kopf. Was geschah? An Stelle der Schlange lag ein Riese tot am Boden ausgestreckt, mit zwei Wunden in der Stirn, aus denen das Blut in Strömen floß.
Und sogleich hörte er eine Menge Stimmen rufen: »Hilfe! Hilfe! Heilige Seele! Gott hat dich uns zur Rettung geschickt.« Er öffnet das Grab, und hervor kommen zuerst sein Bruder, dann eine Menge Prinzen, Edelleute und Ritter, die seit langen Jahren bei Wasser und Brot da begraben lagen. Wie groß war die Freude, da sich die beiden Brüder einander wiedersahen!
Darauf stiegen sie alle zu Pferd, und in einem großen Reiterzug machten sie sich auf den Weg in die Heimat. Sie kamen durch den Wald, wo das Mädchen den Brüdern erschienen war, und auch diesmal ging sie ihnen entgegen, aber nicht allein, eine Schar Jungfrauen war bei ihr, und eine immer schöner als die andere. Sie jedoch war die aller schönste.
Sie nahm Lichtmeß bei der Hand, half ihm vom Pferde und umarmte ihn. »Jetzt, mein Teuerer«, sprach sie, »sind alle deine Leiden zu Ende. Du hast mich vom Tode errettet, und ich will dich zum glücklichsten der Sterblichen machen. Du wirst mein Gemahl werden.« Darauf rief sie die nächst Schönste und sagte: »Geh, schönes Mädchen, gib jenem Jüngling, der meinen Bräutigam so sehr geliebt, den bräutlichen Kuß.«
Und zu den übrigen sagte sie: »Jede von euch wähle sich den Bräutigam nach Belieben und gebe ihm den bindenden Kuß.« Das war ein Fest! Ein Fest auch, als Emilio und Lichtmeß, die Totgeglaubten, nach Hause kehrten. Der Jubel erscholl durch das ganze Land.
Ich war nicht dabei und konnte nichts kriegen,
Und sitze hier die Hände voll Fliegen.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
DIE SCHÖNE MIT DEN SIEBEN SCHLEIERN ...
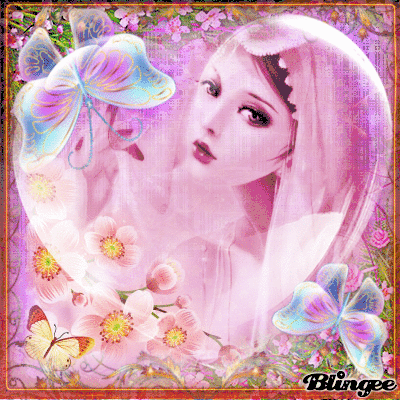
Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder, und hätten doch so gerne welche gehabt. Da wandte sich die Königin an die Mutter Gottes vom Carmel, und bat: »Ach, heilige Mutter Gottes, wenn ihr mir ein Kind beschert, so gelobe ich euch, daß ich in seinem vierzehnten Jahr im Schloßhof einen Brunnen errichten lassen will, aus dem soll ein ganzes Jahr lang Öl fließen.«
Nicht lange, so wurde die Königin guter Hoffnung, und als ihre Stunde kam, gebar sie einen wunderschönen Knaben, der wuchs einen Tag für zwei, und wurde immer schöner und stärker. Da er nun vierzehn Jahr alt geworden war, gedachten seine Eltern an ihr Gelübde, und ließen im Schloßhof einen Brunnen errichten, aus dem floß Öl. Der Königssohn aber stand gern am Fenster und betrachtete die Leute, die von nah und fern herbei kamen, um sich Öl zu schöpfen.
Nun war das Jahr herum und der Brunnen floß nur noch spärlich, da hörte auch ein altes Mütterchen davon, und dachte: »Konnte ich es nun nicht früher erfahren.« Wer weiß, ob der Brunnen jetzt noch fließt. Da nahm es ein Krüglein und einen Schwamm, und machte sich auf den Weg zum Brunnen. Der hatte nun schon aufgehört zu fließen, im Becken aber lag noch etwas Öl.
Da nahm die Alte den Schwamm, tauchte ihn ins Öl und drückte ihn dann ins Krüglein aus, und das tat sie so lange, bis endlich der Krug voll war. Der Königssohn aber stand am Balkon und hatte alles mit angesehen, und in seinem Übermut nahm er einen Stein und warf damit nach dem Krüglein, daß es zerbrach und das Öl verschüttet wurde.
Da geriet die Alte in einen großen Zorn und verwünschte ihn: »So mögest du denn nicht eher heiraten, als bis du die Schöne mit den sieben Schleiern gefunden hast.« Von dem Tag an wurde der Königssohn schwermütig und dachte immer nur an die Schöne mit den sieben Schleiern.
Eines Tages aber trat er vor seine Eltern und sprach: »Lieber Vater und liebe Mutter, gebt mir euren heiligen Segen, denn ich will in die weite Welt hinaus ziehen und mein Glück suchen.« »O mein Sohn,« rief die Mutter, »welches Glück willst du denn noch suchen? Du hast ja alles, was du dir wünschen kannst. Bleibe bei uns, mein Kind, du bist uns erst nach vielen Gelübden geschenkt worden, und bist unser einziges Kind.«
Der Königssohn aber ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen, sondern sprach: »Liebe Mutter, wenn ihr mir euren Segen nicht geben wollt, so werde ich eben ohne Segen fort ziehen, denn ich will nicht länger hier bleiben.« Da das die Eltern hörten, ließen sie ihn gewähren und segneten ihn, er aber steckte ein wenig Geld zu sich, bestieg ein schönes Pferd und ritt davon.
Da wanderte er eine lange Zeit, immer gerade aus, denn er wußte nicht, wo er die Schöne mit den sieben Schleiern zu suchen habe. Endlich, nach vielen Tagen, kam er eines Abends an den Saum eines großen Waldes. Vor dem Wald aber lag ein hübsches Häuschen, darin wohnte ein Bauer mit seiner Frau und seinen Kindern.
»Ich will hier übernachten,« dachte der Königssohn, »und morgen will ich dann in den Wald hinein reiten.« Also klopfte er an und begehrte ein Nachtlager, und der Bauer und seine Frau nahmen ihn auch freundlich auf. Am nächsten Morgen nahm er dankend Abschied von ihnen und ritt dem Walde zu.
Da rief ihm die Bäuerin nach: »Schöner Jüngling, wohin reitet ihr? Wagt euch doch nicht in den finsteren Wald hinein, denn ihr wißt nicht, welchen Gefahren ihr entgegen geht. In diesem Walde sind furchtbare Riesen und wilde Tiere, die bewachen den Eingang zu der Schönen mit den sieben Schleiern. Da könnt ihr nicht durch.«
Der Königssohn aber antwortete: »Wenn hier der Weg zu der Schönen mit den sieben Schleiern führt, so bin ich auf dem richtigen Weg und muß ihn ziehen.« »Ach, laßt euch warnen,« sprach die Bäuerin, »ihr wißt nicht, wie viele Prinzen und Königssöhne in den Wald hinein gezogen sind, und keiner ist je wieder herausgekommen.«
Der Königssohn ließ sich aber nicht von seinem Vorhaben abbringen, deshalb sagte endlich die Frau: »Wenn ihr denn durchaus euer Glück versuchen wollt, so hört einen guten Rat. Eine Tagesreise tief im Wald wohnt ein frommer Einsiedler; geht heute Abend zu ihm und fragt ihn um Rat.« Da dankte der Königssohn der guten Frau und ritt in den Wald hinein, immer tiefer, bis er bei Dunkel werden am Häuschen des Einsiedlers ankam.
Als er nun anklopfte, frug eine tiefe Stimme: »Wer bist du?« »Ich bin ein armer Wanderer, der um ein Obdach bittet,« antwortete der Königssohn. »Ich beschwöre dich bei dem Namen Gottes,« rief der Einsiedler. »Nein, beschwört mich nicht,« sagte der Jüngling, »denn ich bin eine getaufte Seele.« Da öffnete der Einsiedler die Tür und nahm den Königssohn auf, und frug ihn, woher er komme und wohin er gehe.
Als er aber hörte, daß er ausgezogen sei die Schöne mit den sieben Schleiern zu suchen, sprach er: »O mein Sohn,« laß dich warnen und kehre wieder um. »Du bist verloren, wenn du weiter gehst.« Der Königssohn wollte sich aber nicht warnen lassen.
Da sagte endlich der Einsiedler: »Ich kann dir nicht helfen, aber ich will dir einen guten Rat geben: Wenn du eine Tür siehst, die auf und zu schlägt, so hake sie fest. Ruhe dich jetzt aus und morgen will ich dir den Weg weisen, denn eine Tagesreise tiefer im Wald wohnt mein älterer Bruder, der kann dir wohl helfen.
Zu essen kann ich dir aber nur die Hälfte meines Brotes und meines Wassers geben, denn jeden Morgen bringt mir ein Engel vom Himmel einen Krug Wasser und einige Schnitte Brot, davon ernähre ich mich.« Da teilten sie das Brot und das Wasser und bei Tagesanbruch machte sich der Jüngling auf den Weg.
Bei Dunkel werden sah er wieder ein Licht von weitem, und als er sich näherte, sah er das Hüttchen des zweiten Einsiedlers, der nahm ihn freundlich auf wie sein Bruder und frug ihn, was er in dieser wilden Gegend suche. Als der Königssohn ihm alles erzählt hatte, wollte er ihn auch bereden wieder umzukehren, aber der Jüngling blieb standhaft und so sagte endlich der Einsiedler:
»Mein Bruder hat dir einen guten Rat gegeben, jetzt will ich dir auch etwas sagen. Wenn du einen Esel und einen Löwen siehst, von denen der Löwe das Heu des Esels im Maul hält und der Esel den Knochen des Löwen, so gehe nur mutig auf sie zu, und hilf ihnen, indem du jedem das Seine gibst. Ruhe dich jetzt aus, morgen will ich dir den Weg zu meinem ältesten Bruder weisen, der wohnt noch eine Tagesreise tiefer im Wald.«
Am nächsten Morgen machte sich der Königssohn wieder auf den Weg, und bei Dunkel werden kam er zum dritten Einsiedler, der war so alt, daß ihm sein Bart bis an den Boden reichte. Der Einsiedler nahm ihn freundlich auf und frug ihn nach seinem Begehr. »Gut,« sagte er, als der Königssohn alles erzählt hatte, »ruhe dich jetzt nur aus, morgen will ich dir Bescheid geben.«
Am anderen Morgen aber sprach er zu ihm: »Merke wohl auf jedes Wort, das ich dir sagen werde, denn wenn du eins davon vergißt, so bist du verloren. Drei Sachen mußt du mit nehmen: Einige Brote, einen Pack Besen und ein Bündel Wedel, um das Feuer anzufachen.
Wenn du nun auf diesem Weg weiter gehst, so wirst du zuerst einen Esel und einen Löwen treffen. Der Esel hält den Knochen des Löwen im Maul und der Löwe das Heu des Esels und streiten sich. Befolge aber nur den Rat meines zweiten Bruders, so werden sie dich durchlassen.
Dann wirst du einige Riesen treffen, die schlagen mit furchtbaren, eisernen Keulen auf einen Ambos. Warte bis alle zugleich ihre Keulen erheben und dich also nicht sehen können. Dann laufe unter den Keulen durch, so schnell du kannst.
Dann wirst du einen Feigenbaum am Wege stehen sehen, mit kleinen, kümmerlichen Früchten. Pflücke einige, wirf sie aber ja nicht weg, sondern iß sie und lobe den Baum. Wenn du am Feigenbaum vorbei bist, wirst du endlich an einen großen Palast kommen, darin wohnt die furchtbare Riesin, welche die drei Schönen mit den sieben Schleiern bewacht.
Du mußt in den Palast hinein dringen; gleich zu Anfang aber wird dich die Türe aufhalten, die schlägt immer auf und zu. Vergiß nur nicht den Rat meines ersten Bruders, so wird sie dich durch lassen. Nun werden dir einige grimmige Löwen entgegen stürzen, um dich zu fressen; wirf du ihnen aber das Brot vor, so werden sie dir nichts tun.
Wenn du nun die Treppe hinauf gehst, so werden dir die Diener der Riesin entgegen stürzen, mit großen Knüppeln, denn sie haben keine Besen und kehren den Boden nur mit Knüppeln. Zeige du ihnen aber deine Besen und weise ihnen, wie sie sie gebrauchen sollen, so werden sie dich nicht mehr aufhalten.
Weiter oben werden dir die Köche der Riesin entgegen kommen, schenke ihnen aber nur die Wedel, so werden sie dich durch lassen, denn sie haben keine. Endlich wirst du zur Riesin gelangen, die sitzt auf einem großen Thron, und wo ihr Ellenbogen ruht, liegen drei Kästchen, in jedem von diesen ist eine Schöne mit sieben Schleiern.
Gib ihr diesen Brief, den wird sie lesen und wird dir dann sagen, du sollst ein wenig warten, bis sie im anderen Zimmer die Antwort schreibe. Sie geht aber um ihre Zähne zu wetzen, damit sie dich fressen kann. Deshalb warte nicht auf sie, sondern ergreife schnell eines von den Kästchen und fliehe. Es ist einerlei, welches Kästchen du nimmst, hüte dich aber mehr als Eins zu berühren.
Alle die Wächter werden dich ruhig vorbei lassen, reite nur so schnell du kannst, daß dich die Riesin nicht einhole. Das Kästchen darfst du nicht eher auf machen, als bis du aus dem Walde und in der Nähe eines Brunnens bist. Denn wenn du es öffnest, so wird die Schöne rufen: 'Wasser!' und wenn du nicht gleich mit Wasser bei der Hand bist, so wird sie sterben.
Wenn du alle meine Worte genau befolgst, so kommst du vielleicht glücklich wieder.« Damit segnete der Einsiedler den Königssohn und ließ ihn ziehen.
Der Jüngling ritt immer weiter, bis er den Löwen und den Esel vor sich sah, die stritten sich, wie der Einsiedler ihm gesagt hatte.
Da ging er auf sie zu und gab jedem das Seine, und die ergrimmten Tiere beruhigten sich und ließen ihn durch. Als er nun weiter ritt, hörte er schon von Weitem ein furchtbares Getöse, das waren die Riesen, die mit ihren schweren, eisernen Keulen auf den Ambos schlugen.
Da wartete er, bis sie alle zugleich ihre Keulen erhoben und trieb dann sein Pferd unten durch, so schnell, daß die Riesen ihn nicht einmal bemerkten. Als er glücklich den Riesen entschlüpft war, sah er einen Feigenbaum am Wege stehen, der hing voll Früchte.
Da pflückte er einige Feigen, und ob sie gleich klein und kümmerlich waren, so aß er sie doch und sprach: »Wie süß sind diese Feigen.« Als er noch ein Weilchen geritten war, kam er zum Palast, in dem die Riesin hauste; die Türe aber schlug immer auf und zu.
Da stieg er vom Pferd und fasste die Türe mit fester Hand und hakte sie ein. Kaum aber war er durch gegangen, so sprangen ihm die grimmigen Löwen entgegen und wollten ihn fressen. Da warf er ihnen das Brot hin und sie ließen ihn durch.
Wie er die Treppe hinauf gehen wollte, kamen ihm die Diener der Riesin entgegen, die trugen große Knüppel und kehrten die Treppe. Als sie ihn aber erblickten, wollten sie ihn tot schlagen. Da nahm er einen von seinen Besen, und rief: »Seht, solch einen Besen solltet ihr haben, dann könntet ihr im Augenblick die Treppe kehren.«
Da fing er an zu kehren und sie waren so erfreut darüber, daß sie die Besen unter sich verteilten, und nicht mehr auf ihn achteten und er seinen Weg weiter fort setzen konnte. Er kam aber nicht weit, denn bald kamen ihm die Köche der Riesin entgegen, die hatten keine Wedel, sondern mußten das Feuer mit dem Atem anfachen.
Als er ihnen aber seine Wedel gab und ihnen zeigte, wie sie sie gebrauchen müßten, waren sie hoch erfreut und ließen ihn ruhig durch. Endlich kam er in einen großen Saal, darin saß die Riesin auf einem großen Thron, und war furchtbar anzusehen, und ihr Ellenbogen ruhte auf drei kleinen Kästchen an ihrer Seite.
Als sich nun der Jüngling verneigt hatte, übergab er ihr den Brief, den las sie, und sprach: »Warte hier ein wenig, schöner Jüngling, bis ich die Antwort geschrieben habe.« Der Königssohn aber wußte wohl, daß sie nur ging ihre Zähne zu wetzen, daher ergriff er augenblicklich das eine Kästchen und floh.
Er kam glücklich an den Köchen, den Dienern, den Löwen und der Türe vorbei, bestieg sein Pferd und ritt davon wie der Wind, und auch der Feigenbaum, die Riesen und der Löwe und der Esel ließen ihn durch.
Als die Riesin aus ihrem Zimmer kam und den Jüngling nicht mehr sah, zählte sie so gleich die Kästchen und fand, daß eins fehle. »Verrat, Verrat!« schrie sie da, und lief dem Königssohn nach. »Warum habt ihr ihn durch gelassen?« rief sie den Köchen zu.
Die aber antworteten: »So viele Jahre haben wir euch gedient, und ihr habt uns nie einen Wedel geschenkt, um uns die Arbeit zu erleichtern. Dieser Jüngling aber ist freundlich mit uns gewesen, deshalb haben wir ihn durch gelassen.« Da lief sie zu den Dienern und sprach: »Warum habt ihr ihn nicht mit euern Knüppeln tot geschlagen?«
»So viele Jahre haben wir euch gedient,« antworteten sie, »und ihr habt uns nie einen Besen geschenkt, um uns die Arbeit zu erleichtern. Der Jüngling aber hat uns geholfen, und wir sollten ihn tot schlagen?« »O ihr Löwen, warum habt ihr ihn nicht gefressen?« rief die Riesin den Löwen zu. »Wenn ihr nicht still seid, so fressen wir euch. Wann habt ihr uns jemals Brot gegeben, wie der schöne Jüngling getan hat!«
Da sprach die Riesin zur Tür: »Warum hast du ihn durch gelassen?« »So viele Jahre verschließe ich euer Haus,« antwortete die Tür, »aber euch ist es nie eingefallen, mich ein zu haken, wenn ich auf- und zuschlage.« »O Feigenbaum,« rief sie nun, »warum hast du ihn nicht aufgehalten?«
»So viele Jahre seid ihr täglich an mir vorbei gegangen,« erwiederte der Feigenbaum, »aber niemals habt ihr eine Feige genommen und sie gegessen. Das hat aber der schöne Jüngling getan und hat meine Früchte gelobt.« Da lief die Riesin zu den Riesen und machte ihnen Vorwürfe, daß sie ihn nicht mit ihren Keulen totgeschlagen hätten.
Sie aber antworteten: »Warum zwingt ihr uns auch den ganzen Tag auf den Ambos zu schlagen. Wenn wir die Keulen aufheben, können wir ja nicht sehen, wer vorbei kommt.« Die Riesin aber lief und machte auch dem Löwen und dem Esel Vorwürfe, daß sie ihn nicht gefressen hätten.
»Seid stille,« antwortete der Löwe, »sonst fresse ich euch. So viele Jahre seid ihr an uns vorbei gegangen, und habt nicht daran gedacht jedem das Futter zu geben, das ihm zu kam. Das hat aber der schöne Jüngling getan.« Da mußte die Riesin umkehren, denn niemand wollte ihr helfen, den Flüchtling zu verfolgen.
Der Königssohn aber eilte mit dem Kästchen durch den Wald, kam auch bei den drei Einsiedlern und bei den Bauersleuten vorbei, und dankte allen für ihre Hilfe. Als er nun aus dem Walde heraus war, gedachte er das Kästchen aufzumachen. Also ritt er weiter, bis er an einen Brunnen kam, dort stieg er ab und öffnete das Kästchen.
»Wasser,« rief eine Stimme, und als er Wasser in das Kästchen gegossen hatte, erhob sich ein wunderschönes Mädchen, das war so schön, daß die Schönheit durch die sieben Schleier hindurch strahlte, die es trug. Sonst aber war es unbekleidet.
Da sprach der Königssohn zur Schönen mit den sieben Schleiern: »Steige auf diesen Baum und verbirg dich in dem dichten Laub, derweil ich nach Hause gehe und dir Kleider hole.« »Ja,« antwortete sie, »aber laß dich nur nicht von deiner Mutter küssen, sonst vergisst du mich, und wirst erst in einem Jahr, einem Monat und einem Tag an mich denken.« Da versprach er ihr das und ritt nach Haus.
Als ihm nun seine Eltern entgegen kamen, rief er: »Liebe Mutter, küsst mich nicht, sonst vergesse ich meine liebe Braut.« Weil es aber Abend war, so dachte er, er wolle diese eine Nacht bei seinen Eltern ruhen und am nächsten Morgen zu seiner Schönen zurück kehren.
Da legte er sich hin, und als er schlief, kam seine Mutter herein, um ihn noch einmal zu sehen, und weil sie eine solche Sehnsucht hatte ihn zu küssen, so beugte sie sich über ihn und küßte ihn. Da vergaß er seine Braut und blieb bei seinen Eltern.
Die Schöne aber wartete auf ihn, und als er nicht mehr kam, wurde sie ganz traurig und dachte: »Gewiß hat er sich von seiner Mutter küssen lassen und mich vergessen. So will ich denn hier auf dem Baum sitzen bleiben, und ein Jahr, einen Monat und einen Tag lang auf ihn warten.«
Als nun ein Jahr vergangen war, begab es sich eines Tages, daß eine schwarze häßliche Sklavin an den Brunnen kam, Wasser zu schöpfen. Da sie aber hinein schaute, erblickte sie das Bildniß der Schönen mit den sieben Schleiern, dachte, es wäre ihr eigenes Bildnis und rief:
»Bin ich so schön, und sollte mit dem Krug zum Brunnen gehen?« Da zerbrach sie ihren Krug und ging nach Haus. Als sie aber zu ihrer Herrin kam und kein Wasser mit brachte, schalt die Herrin und frug, wo sie den Krug gelassen habe. »Ich sah mein Bildnis im Wasser,« antwortete die Sklavin, »und weil ich so schön bin, so will ich nicht mehr gehen Wasser zu schöpfen.«
Die Herrin aber lachte sie aus und schickte sie so gleich wieder zum Brunnen mit einem kupfernen Krug. Da schaute die Sklavin wieder ins Wasser und da sie das schöne Bildnis erblickte, so hob sie verwundert die Augen auf und sah die Schöne mit den sieben Schleiern.
»Schönes Mädchen,« rief sie, »was machst du da oben?« »Ich warte auf meinen Liebsten,« antwortete die Schöne, »der ist ein schöner Königssohn, und wird in einem Monat und einem Tag kommen, um mich zu seiner Frau zu machen.« »Ich will dich ein wenig kämmen,« sprach die Sklavin, stieg zu ihr auf den Baum und kämmte sie.
Sie hatte aber eine lange Nadel mit einem schwarzen Knopf, die nahm sie und steckte sie ihr unter dem Kämmen plötzlich in den Kopf. Die Schöne aber starb nicht, sondern wurde eine weiße Taube und flog davon. Nun blieb die schwarze, häßliche Sklavin auf dem Baum sitzen und wartete auf den Königssohn. Der war aber bei seinen Eltern und dachte nicht mehr an seine schöne verlassene Braut.
Nun wohnte in dem Schloß eine steinalte Kammerfrau, die war so alt, daß sie nicht mehr ordentlich sprechen konnte. Der Königssohn aber lachte sie aus, wenn sie so undeutlich sprach. Da er nun eines Tages wieder über sie lachte, und zu gleich eine Orange schälte, schnitt er sich in den Finger und ein Blutstropfen fiel auf den weißen Marmorboden.
Da rief die Alte: »So möget ihr nicht eher heiraten, als bis ihr eine Braut findet, so weiß wie der Marmorboden und so rot wie Blut.« In dem selben Augenblick waren ein Jahr, ein Monat und ein Tag vergangen, und der Königssohn rief: »Was soll ich länger suchen; ich habe ja eine schöne Braut.«
Da nahm er einen prächtigen Wagen und herrliche Kleider und fuhr zum Baum, wo er die Schöne gelassen hatte. Als er aber hin kam und die häßliche Gestalt erblickte, erschrak er und rief: »Was ist denn mit dir vorgegangen?« Sie antwortete:
»Die Sonne kam
Und mir die Farbe nahm,
Der Wind, der blies,
Die Stimme mich verließ.«
»Wenn ich denn Schuld daran bin,« antwortete der Königssohn, »so will ich dich heiraten, wie du auch sein mögest.« Da legte sie die herrlichen Kleider an und setzte sich in den schönen Wagen und fuhr auf das königliche Schloß. Als die Königin sie aber sah, sprach sie zu ihrem Sohn: »Konntest du keine Häßlichere finden? Dies ist also die Schöne, für die du so viel gelitten hast?«
»Ich habe sie verlassen,« antwortete der Königssohn, »und der Wind, der Regen und der Sonnenschein haben sie so entstellt. Deshalb will ich sie heiraten, sie mag sein, wie sie will.« Also wurde ein schönes Hochzeitsfest gefeiert und der Königssohn heiratete die falsche Sklavin.
Am anderen Morgen aber, als der Koch das Vorzimmer kehrte, kam eine weiße Taube herein geflogen, die sang: »Koch, Koch im Vorzimmer, was macht der König mit der Sklavin?« Dann flog sie fort, gegen Mittag aber, als eben der Koch die Speisen für des Königs Tisch anrichtete, kam die weiße Taube wieder und sang:
»Koch, Koch in der Küche, was macht der König mit der Königin?« Dann flog sie über die Speisen und schüttelte ihre weißen Flügel, daß Salz heraus fiel und alle die Speisen versalzen wurden. Der Königssohn aber, da man ihm die versalzenen Speisen brachte, ließ er den Koch vor sich kommen und frug ihn, wie das zugegangen sei.
»Ich bin wohl zerstreut gewesen,« antwortete der Koch. Als es aber jeden Tag so ging, wurde der Königssohn endlich böse und wollte den ungeschickten Koch fort jagen. Da gestand der Koch die Wahrheit und erzählte wie zweimal täglich eine weiße Taube komme, und nach ihm und der Königin frage.
»Gut,« antwortete der Königssohn, »bestreiche morgen den Fenstersims mit Leim, und wenn die Taube kommt, so rufe mich.« Als nun am nächsten Morgen die Taube kam, war der Königssohn schon in der Küche versteckt und sah, wie sie sich auf dem Fenstersims nieder ließ und sang:
»Koch, Koch in der Küche, was macht der König mit der Königin?« Als sie aber fort fliegen wollte, saß sie in dem Leim fest und konnte sich nicht los machen. Da sprang der Königssohn hinzu und nahm sie in seinen Arm und streichelte sie. Dabei bemerkte er den schwarzen Knopf und dachte: »Du armes Tier, wer hat dich so gequält?«
Da zog er die Nadel heraus, und also bald stand die Schöne mit den sieben Schleiern vor ihm, die war noch viel schöner geworden, und sprach: »Ich bin die Braut, die du auf dem Baum verlassen hast. Die schwarze Sklavin, die du zu deiner Frau genommen hast, hat mir die Nadel in den Kopf gestoßen, daß ich eine weiße Taube geworden bin, und hat meine Stelle eingenommen.«
Da ließ der Königssohn der Schönen herrliche Kleider anlegen und ließ sie in einem prächtigen Wagen auf das Schloß fahren, als ob sie von ferne her käme. Zur Sklavin aber sprach er: »Es ist eine fremde Hofdame gekommen, die mußt du mit allen Ehren empfangen und heute soll sie bei uns essen.«
Die Sklavin war es zufrieden und als die Schöne kam, erkannte sie sie nicht. Da sie nun gegessen hatten, sprach der Königssohn: »Edles Fräulein, wollt uns eure Lebensgeschichte erzählen.« Da erzählte die Schöne, wie es ihr ergangen war, und die Sklavin ward verblendet, also daß sie nichts merkte.
»Was dünkt euch,« frug nun der Königssohn seine Frau, »was verdient wohl diese falsche Sklavin?« »Die verdient nichts Besseres, denn daß man sie in einem Kessel mit siedendem Öl koche, und an einen Pferdeschwanz gebunden durch die ganze Stadt schleife,« antwortete die Sklavin.
Der Königssohn aber rief: »Du hast dein eigenes Urteil gesprochen, und so soll es mit dir geschehen.« Da wurde sie in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen, und nachher an einen Pferdeschwanz gebunden und durch die ganze Stadt geschleift.
Der Königssohn aber feierte eine noch glänzendere Hochzeit, und heiratete die Schöne mit den sieben Schleiern.
Da blieben sie reich und getröstet, und wir sind hier sitzen geblieben.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DIE KAISERIN TREBISONDA ...

Es war einmal ein Meerfischer, der wünschte sich seit langem schon einen Sohn, seiner Frau aber schien das Mutterglück versagt zu sein, und so hatten sie an nichts mehr Freude. Nach Jahren endlich ward ihre Bitte erhört und sie bekamen einen wunderschönen Sohn. Wie es nun kam, wer weiß das? Aber nach der Geburt des Kindes drehte sich das Glücksrad, so daß der Vater kein einziges Fischlein mehr bestricken konnte, so daß es seiner Familie gar oft an dem Nötigsten fehlte.
Inzwischen war Joseph, so hatten sie den Sohn genannt, herangewachsen, da sagte eines Tages der Vater zu ihm: »Mein Sohn, ich weiß nicht mehr, woher Brot schaffen, das Meer will mir nichts mehr geben, gehen wir hinaus in den Wald und schneiden wir dort Holz.«
Sie gingen und arbeiteten wacker mit Säge und Axt, als sie eine Stimme hörten, die rief: »Heda, ihr Wichte, was macht ihr da? Der Wald ist mein, wie dürft ihr hier Holz fällen?« Der Fischer schaut auf und erblickt eine schöne Frau, er zieht seine Mütze vor ihr und sagt: »Verzeiht mir, o Herrin! Der Hunger trieb uns zu diesem Werke, ist es unrecht, wir haben es nicht gewußt.«
Die Frau antwortete: »Arm bist du? So nimm diesen Beutel mit Gold und laß mir deinen Sohn, du kannst nach Hause gehen.« Der Vater wurde sehr betrübt und begann zu weinen; nach besserer Überlegung aber meinte er, es wäre besser so und das Glück seines Sohnes, so nahm er das Geld und ließ seinen Sohn zurück.
Wie er fort war, fragt die Frau den Sohn nach seinem Namen: »Joseph.« - »Nun, Joseph, so komme mit mir in jenen Palast.« Kaum jedoch waren sie eingetreten, so fand sich der Jüngling allein, und ein großes Gefolge trat an ihn heran, das ihn mit allen Ehren umgab. »Wir sind Euer Majestät untertänigste Knechte!« ... »Was befiehlt Euer Majestät« ... so scholl es von allen Seiten, und Joseph, der sich nicht denken konnte, daß man diese Worte an ihn richte, schaute sich um, ob irgend wer Großes hinter ihm stände.
Man führte ihn mit Bücklingen und Reverenzen in einen Saal, wo eine reich gedeckte Tafel stand; an diese mußte er sich setzen, und wieder warteten sie ihm auf, als ob er ein König wäre. Am Abend wurde er in das Gemach der Kaiserin Trebisonda geführt.
So floß ein Jahr voll Lust und Herrlichkeit dahin, am Ende dieses aber kam Joseph die Lust, Vater und Mutter wieder zu sehen, und sein Herz wurde von Sehnsucht ergriffen. Da sagte er eines Tages zu der Kaiserin: »Herrin, meine Seele verlangt nach Vater und Mutter, laß mich hin ziehen, ich komme dir wieder zurück.«
Sie willigte ein, sprach aber: »Du darfst gehen, aber genau nach einem Jahr mußt du wieder hier sein. Kommst du um Einen Tag zu spät, dann wehe dir und den Deinen! Nimm noch diesen Ring, bist du treu, so wird er dir in allen Lagen dienen.«
Joseph verließ sie und ging geraden Weges zum Hause seines Vaters, er fand es nicht mehr. Die Leute, die er danach fragt, antworten ihm: »Der Fischer? O, der ist zum reichen Mann geworden, dort der Palast ist sein.« Joseph eilt dahin, ein Kammerdiener empfängt und fragt ihn, ob er den Fürsten sprechen wolle, denn das war der Fischer jetzt, und der Prinz antwortet: »Führt mich denn zum Fürsten.«
Er fand seinen Vater, gab sich ihm aber nicht zu erkennen und stellte sich, als ob er wegen Geschäften gekommen wäre. Im Laufe des Gespräches fragte ihn Joseph, ob er keine Kinder habe. Er antwortete: »Ich hatte einen einzigen geliebten Sohn, den wollte die Kaiserin Trebisonda, und ich mußte ihn ihr lassen. Seitdem weiß ich nicht, lebt er noch oder ist er tot. Mein armer Sohn!« -
»Und würdet Ihr«, fragte Joseph weiter, »diesen Sohn wieder erkennen, so Ihr ihn sähet?« - »Ich weiß nicht, jetzt ist er wohl groß geworden, dennoch meine ich, ihn zu erkennen.« - »Nun, so seht mich genau an: ich bin Euer Sohn Joseph.«
Der Vater hörte das, sprang auf und umarmte den Sohn und rief: »Jetzt lasse ich dich nicht mehr, jetzt bleibst du bei mir. Siehe, ich bin so unermeßlich reich, daß ich nicht weiß, was ich mit meinen Reichtümern anfangen soll, und alles, alles ist dein!« -
»Davon sprechen wir nicht, mein Vater«, sagte Joseph, »ich bin Kaiser und meine Herrin gab mir nur ein Jahr Zeit, nach Ablauf dieses muß ich zu ihr zurück. Versäume ich nur Einen Tag, so droht dir und mir großes Unglück!« Bald auch verließ er seinen Vater, denn er wollte zu vor die Welt noch ein wenig sehen, und kam in ein Land, dessen König seine Tochter verheiraten wollte, und zwar sollte sie den Sieger im Turnier zum Gemahl nehmen.
Joseph geht zum Turnier, gewappnet und gerüstet, besteigt ein stattliches Roß - das alles hatte ihm der Ring gegeben - und reitet in die Schranken. Der Kampf begann, und er war der Ritter tapferster. Er siegte, aber sobald sein Gegner im Staube lag, sprengte er auf und davon, unbekümmert um den hohen Preis. So ging es das erste, so ging es das zweite mal, und der König erzürnte in seinem Herzen, daß der fremde Ritter den Preis verschmähte.
So gab er Befehl, ihn, wenn er wieder komme, zu verhaften, damit er erfahre, wer dieser sonderbare Ritter sei. Als er darum beim dritten Siege sein Roß wandte, fielen diesem die Herolde in die Zügel und führten den Ritter vor den König. Der König sagte: »Ist das ritterlicher Brauch, zu siegen und dem Preise zu entsagen? Warum kommt Ihr nicht, von mir meine Tochter zu verlangen?«
Da antwortete der Jüngling mit Stolz: »Herr König, Eure Tochter sollte ich nehmen? Ich sage Euch, Eure Tochter ist nicht Wert, meiner Herrin die Schuhriemen aufzulösen.« Bitter empfand der König diese Worte und rief: »Werft mir den da in den Kerker. Und wenn deine Frau, ihre Herrlichkeit zu offenbaren, nicht in drei Tagen hier ist, so hast du dein Leben verwirkt.«
Joseph, im Kerker angekommen, befiehlt dem Ringe, daß die Kaiserin mit samt ihrem ganzen Hofstaate in drei Tagen hier erscheine und sich dem Könige vorstelle.
Der erste Tag vergeht, es vergeht der zweite, der dritte bricht an, doch niemand kommt. Joseph wurde zum Tode geführt ... da auf einmal hört man ein großes Getöse: zahllose Wagen fahren heran, geleitet von Kriegern und Dienern zu Fuß und zu Roß. Jeder fragt: »Was ist das? Wer kommt?«
Und Joseph: »Das ist meine Herrin.« Eine prächtige Kutsche fährt vor, und der König meint, das müsse die Kaiserin sein. Aber nein! Diese und die anderen sind nur die Kutschen der Edelleute, der Damen und Diener. Immer schönere Kutschen kommen heran, und immer meint der König, dies müsse die Kaiserin sein; aber sie kam noch immer nicht.
Ganz zu letzt erscheint der Wagen der Kaiserin Trebisonda. Die aber war so prächtig, daß dem Könige und seinem ganzen Hofe der Mund vor Staunen offen stehen blieb. Wie die Kaiserin heraus steigt, gab es viele Komplimente und Entschuldigungen von seiten des Königs, daß er ihrem Gemahl so hart entgegen getreten. Sie machte es kurz und führte Joseph mit sich fort.
In einer Ebene angekommen, verschwindet mit einem mal alles: Wagen, Gefolge, auch die Kaiserin, und Joseph bleibt allein und einsam auf der weiten Heide zurück. »Was tue ich nun?« fragt er sich. Der Ring? Aber der Ring gehorchte ihm nicht mehr, und so war die letzte Zuflucht dahin. Wie er so verlassen stand, erblickt er drei Räuber, die einen Streit miteinander hatten.
Er nähert sich ihnen und fragt sie: »Was habt ihr da zu streiten?« - »O, Herr«, sagen sie, »wir haben da diese drei Dinge zu teilen und zanken uns, wer das eine oder das andere haben soll.« - »Laßt mich doch die drei Dinge sehen.« - »Hier sind sie: eine Börse, die sich, geleert, immer aufs neue mit Gold füllt, dann ein Paar Stiefel, welche so schnell wie der Wind laufen, und zuletzt ein Mantel, der seinen Träger unsichtbar macht.
Dieser will den Mantel, jener die Stiefel und ich den Beutel, und wir können uns nicht einigen.« - »Gebt mir die Sachen in die Hand«, sagte der Jüngling, »ich werde ihre Echtheit prüfen und dann entscheiden.« Sie gaben ihm die drei Dinge, er prüft die Börse, und richtig, so oft er sie leert, so oft füllt sie sich aufs neue.
Er zieht die Stiefel an und hängt den Mantel um, und jetzt fragt er: »Könnt ihr mich noch sehen?« - »Nein, Herr!« - »Nun, so werdet ihr mich auch nicht mehr sehen«, und mit diesen Worten machte er sich aus dem Staube.
Er kommt zu dem Palast der Kaiserin mit einem Windstoß, der alle Glasscheiben zerbricht, tritt ein und verbirgt sich unter dem Lager. Wie die Kaiserin zur Ruhe geht, klopft er an die Wand. Die Kaiserin erschrak und rief ihre Zofen herbei, die sahen in deß niemand. So geschah es noch zu dreien malen, dann sprach die Kaiserin: »Jetzt ist es gut, Joseph, komme herein.«
Er kam und sie sprach: »Du Böser, was hast du mir getan. Hatte ich dir nicht gesagt, daß du nur ein Jahr ausbleiben solltest, und bliebst so lange? Doch ich verzeihe dir! Wir sind jetzt Mann und Frau und wollen des heiligen Friedens genießen.«
Sie lebten glücklich und zufrieden,
Uns Armen, uns ist nichts beschieden.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

VON FELEDICO UND EPOMATA ...

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder, und hätten doch so gerne einen Sohn oder eine Tochter gehabt. Eines Tages, als sie am Balkon standen, ging eben ein Wahrsager vorbei. Da rief ihn der König herauf, daß er der Königin wahrsage, ob ihr Wunsch sich erfüllen werde.
Der Wahrsager schaute die Königin lange an, und dabei machte er ein so trauriges Gesicht, daß ihn der König erschrocken fragte: »Nun? Was seht ihr?« »Königliche Majestät!« antwortete der Wahrsager, »lasset mich ziehen, denn ich kann es euch nicht sagen, was geschehen wird.« Der König aber befahl ihm, sogleich zu sprechen, sonst werde er ihm den Kopf abhauen lassen, und so mußte denn der Wahrsager endlich antworten:
»Die Königin wird einen Sohn bekommen, wenn er aber achtzehn Jahre alt ist, muß der Jüngling sterben.« Als der König und die Königin das hörten, wurden sie tief betrübt, und sprachen: »Was hilft es uns, einen Sohn zu haben, wenn wir ihn bloß aufziehen müssen, um ihn nach achtzehn Jahren zu verlieren!« »Wenn ihr meinen Rat annehmen wollt,« sagte der Wahrsager, »so laßt einen festen Turm bauen, und schließt euer Kind mit der Amme darin ein, bis es achtzehn Jahre alt ist, denn sobald die Stunde vergangen ist, in der es achtzehn Jahre alt wird, so hat das Schicksal keine Macht mehr über dasselbe.« Nach diesen Worten verließ der Wahrsager den Palast.
Nach einigen Monaten aber wurde die Königin guter Hoffnung. Da ließ der König so gleich einen festen Turm bauen, und bestellte eine Hofdame, die sollte an dem Königssohn Mutterstelle vertreten. Als nun ihre Stunde kam, gebar die Königin einen wunderschönen Sohn, den nannte sie Feledico. Der König aber schickte das Kind mit der Hofdame und der Amme in den Turm, und sperrte sie dort ein.
Jeden Morgen mußte die Hofdame ins Schloß kommen, und berichten, wie es dem Kinde gehe, und jeden Abend spät, wenn der Königssohn schlief, kamen der König und die Königin in den Turm, und besuchten ihr liebes Kind.
So vergingen viele Jahre, und der Knabe wuchs an einem Tage für zwei, und wurde täglich schöner und stärker. Er meinte aber, die Hofdame wäre seine Mutter, und kannte niemanden als sie und die Amme.
Nun begab es sich eines Morgens, als er noch fest schlief, daß die Hofdame wieder wie gewöhnlich zur Königin ging. Auf einmal rief eine Stimme: »Feledico! Feledico!« Und als der Knabe erwachte, fuhr die Stimme fort: »Feledico, was bleibst du immer hier im Turm eingesperrt? Die Frau, die du Mutter nennst, ist gar nicht deine Mutter, sondern deine Eltern sind ein mächtiger König und eine schöne Königin, die wohnen in einem herrlichen Schloß und genießen ihr Leben; du aber bist immer hier so ganz allein eingesperrt.«
Es war aber das Schicksal des Knaben, das so sprach. Als nun Feledico diese Worte hörte, fing er an zu weinen, und die Hofdame, die eben nach Hause kam, hörte es, und lief voll Schrecken zu ihm und sprach: »Mein Sohn, mein lieber Sohn, was weinst du so? Deine Mutter ist ja wieder bei dir.« Feledico aber antwortete: »Warum nennt ihr mich euren Sohn? Ihr seid ja gar nicht meine Mutter, denn meine Mutter ist eine schöne Königin, und mein Vater ist ein mächtiger König, und sie wohnen in einem herrlichen Schloß.«
»Ach nein, Feledico,« rief die Hofdame, »was hast du für Gedanken? Ich bin ja deine Mutter, und du bist mein lieber Sohn.« So beruhigte sie ihn endlich mit vielen guten Worten, nach her aber ging sie mit großer Herzensangst zur Königin, und erzählte ihr alles. »Ach, mein armes Kind,« sprach die Königin, »nun wird ihn dennoch sein Schicksal ereilen.«
Nun vergingen wieder einige Tage, aber eines Morgens, als Feledico noch schlief, und die Hofdame zur Königin gegangen war, ertönte die selbe Stimme und rief: »Feledico! Feledico!« Der Königssohn erwachte und die Stimme fuhr fort: »Feledico, willst du meinen Worten nicht glauben? Sieh, wie bist du hier so allein, und bei deinen Eltern könntest du dein Leben genießen. Sage doch der Frau, die du Mutter nennst, sie solle dich zu deiner wahren Mutter führen.«
Feledico fing wieder an zu weinen, und als die Hofdame herbei lief, rief er: »Warum nennt ihr mich euren Sohn? Ihr seid ja meine Mutter nicht, und ich will zu meinen Eltern ins Schloß, und mit ihnen mein Leben genießen.« Die Hofdame gab ihm wieder viele gute Worte, und endlich gelang es ihr, ihn zu beruhigen.
Als aber wieder einige Tage verstrichen waren, ertönte die Stimme des Schicksals zum dritten Mal, und sprach die selben Worte, und diesmal ließ er sich nicht beruhigen, sondern antwortete auf alles Zureden: »Ich will nicht länger hier bleiben, und will zu meiner Mutter.« Da ging die Hofdame voll Trauer zur Königin, und klagte ihr alles, und die Königin erwiderte: »Das Schicksal verfolgt meinen armen Sohn. Was hilft es, daß wir ihn davor bewahren wollen? Bringt ihn also ins Schloß.«
Da wurde Feledico ins Schloß gebracht, und blieb bei seinen Eltern, und wuchs heran, und wurde mit jedem Tage schöner. Seine Eltern aber ließen ihn auf Schritt und Tritt bewachen, und ließen ihn niemals auf die Jagd gehen, damit er nicht zu Schaden käme.
Eines Tages aber, als Feledico schon siebzehn Jahre alt war, sprach er zum König: »Lieber Vater, ach laßt mich doch heute auf die Jagd gehen, ich möchte so gern einige Vögel schießen.« Der Vater wollte es ihm ausreden, aber Feledico bat immer wieder, und weil er sein einziger Sohn war, so konnte der König ihm nichts abschlagen, und ließ ihn mit zwei Ministern auf die Jagd gehen.
Vorher aber rief er die beiden Minister zu sich, und sprach zu ihnen: »Ihr müßt mir versprechen, daß ihr dem Königssohn stets zur Seite bleiben wollt, und ihn keinen Augenblick verlassen.« Das versprachen sie, und gingen mit dem Königssohn auf die Jagd. Als sie nun im Walde waren, sprach Feledico: »Was wollen wir alle zusammen gehen? Jeder gehe auf eine Seite hinaus, und nach her wollen wir sehen, wer die meisten Vögel getroffen hat.«
»Ach nein, königliche Hoheit, das kann nicht sein, denn wir haben dem König versprochen, euch keinen Augenblick aus den Augen zu lassen.« »Ach was, ich entferne mich ja nicht weit, und wenn mir etwas zustoßen sollte, werde ich so gleich in mein Jagdhorn blasen, daß ihr mir zu Hilfe eilen könnt.« Da willigten die Minister ein, und gingen auf die eine Seite hinaus, und Feledico ging auf die andre Seite.
Als er ein Weilchen gegangen war, sah er einen Vogel auf einem Zweige sitzen. »Ei!« dachte er, »der hübsche Vogel! Den will ich schießen.« Da legte er die Büchse an, zielte und schoß. Kaum aber hatte er geschossen, so ward er aus dem Walde entrückt, und befand sich in einem schönen großen Schlosse. Die Minister warteten eine Zeitlang, als aber Feledico nicht wieder kam, ward ihnen bange, sie suchten und riefen ihn, Feledico war aber nirgends zu finden.
Da kehrten sie endlich ins Schloß zurück, fielen dem Könige zu Füßen, und erzählten ihm alles, und der König und die Königin legten Trauerkleider an um ihren verlorenen Sohn, und sprachen: »Sein Schicksal hat ihn dennoch ereilt.« - Doch lassen wir nun den König und die Königin, und sehen wir, was aus Feledico geworden ist.
Das Schloß, in dem er sich befand, gehörte einer mächtigen Zauberin; ihr Mann aber war ein König der Heiden, und litt seit vielen Jahren an einem schrecklichen Aussatz. Es war ihm aber prophezeit worden, er könne genesen, wenn er seine Wunden bestreiche mit dem Blute eines Königssohnes, der in der selben Stunde hin gerichtet werde, in welcher er achtzehn Jahre alt werde. Darum hatte die Zauberin den armen Feledico durch ihre Macht entführt, und wollte ihn an dem Tage, da er achtzehn Jahr alt sein würde, hinrichten lassen.
Die Zauberin aber hatte eine wunderschöne Tochter, die hieß Epomata. Da sie nun den unglücklichen Feledico erblickte, entbrannte sie in heftiger Liebe zu ihm, und es tat ihr Leid um den schönen Jüngling, der so elendiglich hingerichtet werden sollte. Weil sie sich aber vor ihrer Mutter fürchtete, so wagte sie es nicht, bei Tage mit ihm zu sprechen, sondern kam nur des Nachts leise in sein Zimmer, und riet ihm, was er tun solle.
So blieb denn Feledico fast ein ganzes Jahr im Schloß bei der Zauberin, und hatte alles, was er wollte, nur aus dem Schlosse durfte er nicht hinaus. Eines Abends aber kam Epomata zu ihm und sprach: »In drei Tagen wirst du achtzehn Jahre alt sein, dann will dich meine grausame Mutter hinrichten lassen. Aber fürchte dich nicht, denn ich will dich erretten, wenn du genau tust, was ich dir sage.
Stehe morgen früh nicht auf, und wenn der erste Minister kommt, dir dein Frühstück zu bringen, so sage ihm, du hast starke Kopfschmerzen, und willst zu Bette liegen bleiben. Übermorgen stelle dich noch kränker, und bleibe abermals im Bette liegen. In der Nacht aber werde ich kommen, und dann wollen wir fliehen.«
Feledico tat alles, wie Epomata ihm befohlen hatte; als der Minister am Morgen kam, um ihm sein Frühstück zu bringen, lag Feledico noch im Bett und klagte, er sei krank, und wollte nicht aufstehen. Da der Minister dies der Zauberin hinter brachte, antwortete sie: »Lasst ihn gewähren, wenn er nur noch die zwei Tage lebt, daß wir ihn lebendig zum Richtplatz bringen.«
Am anderen Morgen, als der Minister wieder zu Feledico kam, frug er ihn: »Nun, königliche Hoheit, wie fühlt ihr euch heute?« »Ach, schlecht,« antwortete Feledico, »ich will auch heute zu Bette liegen bleiben.« Da ließen sie ihn ruhig liegen, und dachten: »Bis morgen wird er schon noch am Leben bleiben.«
Epomata aber rief eine vertraute Hofdame, und ließ sich durch sie einen großen Korb mit Kuchen und Süßigkeiten verschaffen, und mehre Flaschen mit feinem Wein, den vermischte sie mit einem starken Schlaftrunk.
Nun hatte die Zauberin zwei Zauberbücher, aus denen sie ihre Macht entnahm, das eine war schwarz, das andre weiß; das weiße war aber mächtiger als das schwarze. Diese Bücher hatte sie immer unter ihrem Kopfkissen versteckt; das wußte Epomata, und da es dunkel war, schlich sie hinzu, und nahm das weiße Zauberbuch hervor.
Als nun alle schliefen, schlich sie in das Zimmer des Feledico und brachte ihm ärmliche Kleidung, die mußte er anlegen. Auf den Kopf mußte er den Korb mit Süßigkeiten und die Flaschen mit dem Schlaftrunk nehmen, und nun hinter Epomata drein gehen. Das Schloß aber wurde von sieben Wachen bewacht, an denen mußten sie vorbei, um zu entfliehen.
Als sie nun an die erste Wache kamen, sprach Epomata: »Morgen ist ein Freudentag, weil da der Königssohn hingerichtet werden soll, und durch sein Blut der König von seinem Aussatz geheilt werden wird. Deshalb schickt euch die Königin hier etwas süßen Kuchen und guten Wein, auf daß auch ihr vergnügt seit.«
Als aber die Soldaten von dem Schlaftrunk genommen hatten, fielen sie in einen tiefen Schlaf. So machte es Epomata bei allen Wachen, und als sie alle eingeschlafen waren, gingen die beiden in den Stall, sattelten die zwei schnellsten Pferde und entflohen.
Am anderen Morgen früh schickte die Zauberin ihre Soldaten, um den armen Feledico zum Richtplatz abzuholen. Als sie aber in seine Kammer drangen, war Feledico verschwunden. Da liefen sie hin, und sagten es der Königin, die rief: »Ist Feledico entflohen, so kann nur meine Tochter ihm geholfen haben.« Also lief sie in das Zimmer ihrer Tochter, aber das Zimmer war leer, und so viel sie auch Epomata suchen mochte, sie fand sie nirgends.
»Diese ungeratene Tochter!« rief sie in ihrem Zorn, »aber ich will mich an ihr rächen. Und ist auch meine Gewalt über den Königssohn nun zu Ende, so soll Epomata mir doch nicht entwischen.« Da wollte sie ihre Zauberbücher mit sich nehmen, aber sie fand nur das schwarze, denn das weiße hatte Epomata mitgenommen.
Die Zauberin wurde nur noch viel zorniger, ließ sogleich die Pferde satteln, und ritt mit ihren Ministern den Flüchtlingen nach. Unterdessen ritten Feledico und Epomata so schnell als ihre Pferde zu laufen vermochten, und Epomata sprach: »Feledico, siehe dich um, und sage mir, was du siehst.« Da er sich nun umsah, erblickte er die Zauberin, die ihnen nahe gekommen war, und rief voll Schrecken: »Epomata! Epomata! Deine Mutter ist dicht hinter uns.«
Sogleich schlug Epomata das Zauberbuch auf, und sprach: »Ich werde zum Garten und du zum Gärtner darin!« Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, so ward sie in einen Garten verwandelt, und Feledico war der Gärtner darin. Als nun die Zauberin herzu kam, frug sie ihn: »Sagt mir, schöner Bursche, habt ihr nicht einen Mann und eine Frau gesehen, die hier vorbei ritten?«
»Was wollt ihr? Fenchel?« antwortete Feledico, »der ist noch nicht an der Zeit.« »Ach nein! Darnach frage ich nicht; ich frage euch, ob ihr einen Mann und eine Frau gesehen habt, die hier vorbei geritten sind?« »Was, was? Spargel? Die werden wir nächstens in Bündelchen binden.« »Seht ihr, königliche Majestät,« sprach der eine Minister, »dieser Mann versteht euch nicht, und die Flüchtlinge können wir doch nicht mehr einholen, die sind schon über alle Berge.«
Da kehrten sie um; Epomata und Feledico aber nahmen ihre menschliche Gestalt wieder an, und flohen weiter. Während nun die Zauberin zurück ritt, schlug sie ihr schwarzes Zauberbuch auf, und als sie darin las, der Garten und der Gärtner seien Epomata und Feledico gewesen, geriet sie in einen großen Zorn und sprach: »Ich muß mich doch an meiner ungeratenen Tochter rächen; wir wollen ihnen wieder nach reiten.«
Feledico aber schaute immer hinter sich, und als er die Zauberin in der Ferne erblickte, rief er: »Epomata! Epomata! Deine Mutter ist dicht hinter uns.« Da schlug Epomata ihr Buch auf, und sprach: »Ich werde zur Kirche und du zum Sakristan darin!« und sogleich verwandelte sie sich in eine Kirche, und Feledico war der Sakristan. Als die Zauberin an die Kirche kam, frug sie: »Guter Mann habt ihr vielleicht einen Mann und eine Frau gesehen, die hier vorbei geritten sind?«
»Der Pater ist noch nicht gekommen, deßhalb hat die Messe noch nicht angefangen,« antwortete Feledico. »Ach was! von der Messe spreche ich nicht, ich frage euch, ob ihr einen Mann und eine Frau habt vorbei reiten sehen?« »Wenn der Pater kommt, könnt ihr zur Beichte gehen,« antwortete Feledico. So trieb er es so lange, bis die Zauberin endlich die Geduld verlor, und umkehrte. Die Beiden nahmen nun ihre menschliche Gestalt wieder an und ritten weiter.
Die Zauberin aber las in ihrem Buche, daß die Kirche und der Sakristan die beiden Flüchtlinge gewesen waren. Da ward sie sehr zornig und sprach: »Wir wollen noch einmal umkehren, und diesmal sollen sie mir nicht entwischen.«
Also ritten sie ihnen nach, Feledico aber hatte sich schon lange nicht umgesehen. Da er nun einmal hinter sich sah, war die Zauberin schon ganz dicht bei ihnen.
»Epomata! Epomata!« rief er, »wir sind verloren!« »So werde du zum Teich und ich zum Aal darin!« sprach Epomata schnell, und sogleich wurde Feledico zum Teich, Epomata aber ward zum Aal, der lustig im Wasser umher schwamm. Die Zauberin aber hatte es wohl gemerkt, neigte sich über den Teich und wollte den Aal fangen. So oft sie ihn aber gefaßt hatte, entschlüpfte der Aal ihrer Hand, und sie mühte sich vergebens ab.
Da verlor sie endlich die Geduld und rief: »So möge Feledico deiner vergessen bei dem ersten Kusse, den er im Hause seines Vaters erhält.« Als sie diesen Fluch ausgesprochen hatte, bestieg sie ihr Pferd und ritt zurück. Feledico und Epomata aber nahmen ihre menschliche Gestalt wieder an, und nachdem sie noch eine lange Zeit geritten waren, kamen sie endlich in das Reich des Königssohnes.
Da sprach Feledico: »Ich bin ein Herrscher, und du sollst meine Frau sein, darum geziemt es dir auch nicht, in diesen schlechten Kleidern vor meinen Eltern zu erscheinen. Deshalb will ich dich in ein Wirtshaus führen, da sollst du bleiben, derweil ich zu meinen Eltern gehe, und dort alles hole, was nötig ist, damit du im Triumph einziehen kannst.«
»Ach, Feledico,« antwortete Epomata, »erinnerst du dich aber auch an den Fluch, den meine Mutter gegen mich ausgesprochen hat? Ich bitte dich, gedenke daran, daß du dich nicht küssen lässt, denn bei dem ersten Kuß, den du empfängst, wirst du meiner vergessen.« »Sei nur ruhig,« antwortete Feledico, »ich will daran denken.« Da führte er sie in ein Wirtshaus, und empfahl sie der Wirtin. Dann eilte er in das königliche Schloß zu seinen Eltern.
Als ihn nun der König und die Königin erblickten, und in ihm ihren lieben Sohn erkannten, den sie für tot beweint hatten, stürzten sie ihm entgegen, und wollten ihn in ihrer Herzensfreude küssen. Er aber rief: »Liebe Eltern, küßt mich nicht, denn sonst vergesse ich meine liebe Braut.« Darüber waren nun seine Eltern sehr betrübt, und sprachen: »So lange haben wir dich als tot beweint, und nun wir dich wieder haben, sollen wir dich nicht einmal küssen?«
Er aber verwehrte es ihnen und sprach: »Bereitet mir einen schönen goldnen Wagen mit sechs Pferden bespannt, und ruft mein ganzes Gefolge zusammen, daß ich gehe, und meine liebe Braut abhole. Unterdessen will ich aber ein wenig schlafen, denn ich bin müde.« Da legte er sich hin und schlief bald ein. Nun war aber die Hofdame, die Mutterstelle bei ihm vertreten hatte, die dachte: »Wie? so viele Jahre habe ich für seine Mutter gegolten, und ihn in meinen Armen getragen, und habe ihn aufgezogen, und sollte ihn nicht einmal küssen dürfen?«
Und weil sie es nicht länger aushalten konnte, schlich sie in sein Zimmer, neigte sich über ihn, und küßte ihn, während er schlief. In dem selben Augenblick erwachte er, aber Epomata war aus seinem Gedächtnis verschwunden. »Lieber Sohn,« sprach die Königin, »der Wagen ist bereit; willst du nun gehen, deine Braut abzuholen?« »Meine Braut? Ich habe ja keine Braut,« antwortete Feledico, und wollte nun nichts mehr von ihr wissen.
Unterdessen wartete die arme Epomata auf ihn, und da er nicht kam, dachte sie endlich: »Ach, gewiß hat er sich küssen lassen, und hat nun meiner vergessen.« Da rief sie die Wirtin, und sprach zu ihr: »Frau Wirtin, ich muß nun einige Zeit bei euch bleiben. Verschafft mir eine ältliche, ordentliche Frau, die mir diene, und mich begleite.« »Ja,« antwortete die Wirtin, »ich kenne eine solche Frau, die eben einen Dienst sucht, und die euch gewiß gefallen wird.«
Da brachte sie eine ältliche Frau, die hieß Donna Maria. Diese blieb bei Epomata, und diente ihr. Nun lag dem Wirtshaus gegenüber ein Kaffeehaus, in welchem sich immer viele junge, vornehme Leute versammelten; unter ihnen auch ein junger Fürst. Als dieser die schöne Epomata erblickte, und erfuhr, sie sei so allein, entbrannte er in heftiger Liebe zu ihr, und sprach eines Tages zu Donna Maria: »Donna Maria, wollet ihr mir einen Gefallen tun, so bringt eurer Herrin eine Botschaft von mir.«
»Ich bringe gar keine Botschaften,« erwiderte Donna Maria kurz, und ging ins Haus. Epomata aber frug sie: »Mit wem sprachet ihr, Donna Maria?« Die Frau wollte es erst nicht sagen, denn sie dachte: »Meine Herrin ist schön und noch sehr jung.« Epomata aber drängte sie, bis sie endlich antwortete: »Edle Frau, es war ein junger Fürst, der wollte mir eine Botschaft an euch auftragen, ich habe sie aber gar nicht anhören wollen.« »Ei! warum nicht?« antwortete Epomata, »überbringt mir nur so viele Botschaften, als er euch gibt.«
Als nun Donna Maria wieder ausging, stand auch schon der junge Fürst vor der Tür, und redete sie an: »Ach, Donna Maria, seid doch so gut, und hört an, was ich eurer Herrin zu sagen wünsche.« »Nun denn, so sagt mir, was ich meiner Herrin für eine Botschaft überbringen soll.« »Sagt eurer Herrin, ich würde ihr hundert Unzen verehren, und euch zwanzig, wenn sie mir erlaubt, heute Abend bei ihr zu essen, und die Nacht bei ihr zuzubringen.«
Diese Botschaft überbrachte Donna Maria der schönen Epomata, die antwortete: »Ohne Zweifel; sage ihm nur, ich erwarte ihn.« Als es Abend wurde, kam der Fürst, und brachte gleich einen großen Beutel voll Goldstücke mit für Epomata, und zwanzig Unzen für die Magd. Das Abendessen war bereit, und nachdem sie gegessen und getrunken hatten, sprach Epomata: »Ich werde zuerst in meine Kammer gehen; über ein Weilchen könnt ihr auch kommen.«
Als sie aber in der Kammer war, stellte sie ein Becken mit Wasser in die Mitte der Stube, schlug ihr Zauberbuch auf, und sprach einen Zauber über das Becken aus: »Einer soll herein und Einer heraus!« Dann stellte sie einen Stuhl neben das Becken, und sprach auch darüber einen Zauber aus, daß er Jeden festhielt, der sich darauf setzte, und legte sich zu Bette. Um das Bett aber hielten Zauberinnen mit entblößten Schwertern Wache.
Nach einer Weile kam der junge Fürst auch herein, und Epomata sprach zu ihm: »Edler Fürst, in meinem Vaterlande ist es Sitte, sich die Füße zu waschen, ehe man sich nieder legt; darum wollt euch dieser Sitte fügen, und euch in dem Becken die Füße waschen.« Der Fürst setzte sich auf den Stuhl, den Epomata verzaubert hatte, und steckte den einen Fuß ins Wasser, das war aber so kochend heiß, daß er den Fuß mit einem leisen Schrei heraus zog, und den anderen hinein steckte.
Aber er verbrannte sich wieder, und als er aufstehen wollte, hielt ihn der Stuhl fest. Er mochte wollen oder nicht, er mußte die ganze Nacht bald den einen, bald den anderen Fuß ins heiße Wasser stecken, bis sie beide dick geschwollen waren. Unterdessen schlief Epomata ruhig die ganze Nacht, und am Morgen, als sie aufwachte, sprach sie: »Was! Ihr seid noch da? Schnell, verlasst mein Zimmer, daß man euch nicht in diesem Zustand sehe, und es mir zur Unehre gereiche.«
Da schalt der Fürst, und schimpfte über sie, und verließ das Zimmer voll Zorn.
Als aber seine Freunde ihn frugen, wie es ihm ergangen, dachte er: »Habe ich gelitten, so könnt ihr es auch probieren,« und antwortete: »O, recht gut; sie ist ein herrliches Weib.« Das hörte ein anderer junger Mann, ein Edelmann, der kam zu Donna Maria und sprach: »Sagt eurer Herrin, ich wolle ihr achtzig Unzen schenken, und euch zwanzig, wenn sie mir erlaubt, heute Abend bei ihr zu essen, und die Nacht bei ihr zuzubringen.«
Als Donna Maria der schönen Epomata diese Botschaft überbrachte, antwortete sie: »Sage ihm, er könne kommen, wenn er wolle.« Am Abend kam der Edelmann und brachte das Geld mit. Da aßen sie, und Epomata sprach gar freundlich und höflich mit ihm. Nach dem Essen aber sprach sie: »Ich werde zuerst in mein Zimmer gehen, über ein Weilchen könnt ihr kommen.«
Da ging sie in ihre Kammer, stellte zwei angezündete Lichter auf den Tisch, schlug das Zauberbuch auf, und sprach einen Zauber über die Lichter: »Eines verlöscht, Eines wird angezündet!« Dann sprach sie auch einen Zauber über den Boden, daß sich keiner von seiner Stelle fort bewegen konnte. Nun ging sie zu Bette, und die Zauberinnen hielten unsichtbare Wache um ihr Lager.
Nach einem Weilchen kam auch der Edelmann in die Kammer, und Epomata sprach: »Edler Herr, die Lichter tun mir an den Augen weh, wollt sie auslöschen, ehe ihr euch nieder leget.« Da löschte der Edelmann das eine Licht aus, und dann das andere, unterdessen aber entzündete sich das erste wieder, und so brachte er die ganze Nacht zu, denn so oft er ein Licht ausblies, entzündete sich das andere so gleich wieder von selbst. Und als er im Zorn fort gehen wollte, konnte er sich nicht von seinem Platze bewegen, und mußte blasen, bis er einen ganz dicken Mund bekommen hatte.
Am Morgen erwachte Epomata und rief: »Wie? Ihr steht noch immer da? Schnell, verlasst mein Zimmer, denn wenn euch Jemand sieht, gereicht es mir zur Unehre.« Da verließ er das Zimmer mit vielen Schmähungen gegen Epomata, die ihm so übel mitgespielt hatte. Als er aber ins Kaffeehaus kam, und ihn seine Gefährten frugen, wie es ihm ergangen sei, antwortete er eben so wie der Fürst: »O, recht gut.«
Nun war auch der Sohn eines Kaufmanns, der kam auch zu Donna Maria, und sprach: »Sagt eurer Herrin, ich werde ihr fünfzig Unzen geben, und euch zehn, wenn sie mir erlaubt, heute Abend bei ihr zu essen, und die Nacht bei ihr zuzubringen.« Donna Maria überbrachte diese Botschaft der schönen Epomata, die antwortete: »Sage ihm nur, er könne kommen, wann er wolle.«
Am Abend kam der Kaufmannssohn, und Epomata empfing ihn freundlich, und sie aßen mit einander. Nach dem Essen sagte sie: »Ich werde zuerst in meine Kammer gehen; über ein Weilchen könnt ihr kommen.« In der Kammer aber schlug sie ihr Zauberbuch auf, und sprach einen Zauber über das Fenster aus: »Einer soll auf, und Einer zu!« Dann sprach sie auch über den Boden einen Zauber aus, daß sich keiner von seinem Platze bewegen konnte. Darauf ging sie ruhig zu Bett, denn sie wußte, daß die Zauberinnen Wache um sie hielten.
Nach einem Weilchen kam der Kaufmannssohn herein, und Epomata sprach zu ihm: »Edler Herr, das Fenster steht noch offen; wollt es schließen, ehe ihr euch nieder leget.« So oft er nun den einen Fensterflügel schloß, fuhr der andere auf, und versetzte ihm einen starken Schlag gegen die Brust; und das ging die ganze Nacht so fort, denn er konnte sich nicht von seinem Platze bewegen, bis ihm die Brust ganz aufgeschwollen war.
Am Morgen erwachte Epomata, und rief ihm zu: »Was? Ihr steht noch da? Verlasst sogleich meine Kammer, daß man euch nicht bei mir sehe, und es mir zur Unehre gereiche.« Da verließ er die Kammer mit vielen Schmähungen gegen Epomata, und schlich mühsam die Treppe hinunter, denn er konnte nicht einmal grade gehen. Als ihn seine Freunde in diesem Zustande sahen, gestanden auch sie, was ihnen begegnet war, und alle drei schimpften und schmähten die arme Epomata.
Nun war eine geraume Zeit verflossen, seit Feledico die arme Epomata verlassen hatte; da hörte sie eines Tages, er werde nun eine reiche Königstochter heiraten, und nächstens solle die Hochzeit sein. Da schlug sie ihr Zauberbuch auf, und wünschte sich zwei Puppen, einen Knaben, der auf der Geige spielte, und ein Mädchen, das sang, und sogleich standen die beiden Puppen vor ihr, und waren gar fein und zierlich anzusehen.
Da rief sie Donna Maria und sprach zu ihr: »Nimm diese beiden Puppen, und trage sie vor des Königs Schloß. Dort rufe laut aus: 'Wer kauft schöne Puppen! Ei was habe ich für schöne Puppen! Einen Knaben der spielt und ein Mädchen das singt!' und tue das so lange, bis der König oder sein Sohn dich anrufen. Dann verkaufe ihnen die beiden Puppen.«
Donna Maria tat, wie Epomata ihr befohlen hatte, trug die Puppen vor das königliche Schloß, und rief mit lauter Stimme: »Ei was habe ich für schöne Puppen! Einen Knaben, der geigt, und ein Mädchen, das singt!« Nun standen der König und sein Sohn gerade am Fenster, und Feledico sprach: »Lieber Vater, seht doch die schönen Puppen, die die Frau zum Verkauf anbietet; ich möchte sie wohl gerne kaufen.«
Da riefen sie die Frau herauf, wurden mit ihr handelseinig und kauften ihr die beiden Puppen ab. As sie nun bei Tische saßen, sprach der König: »Feledico, du hast heute zwei hübsche Puppen gekauft, bringe sie einmal her, daß sie vor der ganzen Gesellschaft ihre Künste zeigen.«
Feledico holte die Puppen, und stellte sie auf den Tisch, und sogleich fing der Knabe an zu geigen, und nach her sang das Mädchen und sprach: »Weißt du noch, wie du in einem Turm eingesperrt warst, und in der Nacht dein Schicksal dich rief, und dir sagte, du wärst eines reichen Königs Sohn, und das selbe so oft wiederholte, bis deine Eltern dich zu sich nehmen mußten? Weißt du das noch?«
»Nein!« antwortete der Knabe, und »paff!« bekam er von dem Mädchen eine tüchtige Ohrfeige. Diese Ohrfeige aber mußte Feledico fühlen, als ob er sie bekommen hätte, also daß er einen lauten Schrei ausstieß.
Das Mädchen fuhr fort: »Weißt du noch, wie du auf die Jagd gingst, und einen Vogel schießen wolltest, und plötzlich aus dem Walde in das Schloß der Zauberin versetzt wurdest? Wie du dort die schöne Epomata sahst, und sie dich vom Tode errettete, als ihre Mutter dich hinrichten lassen wollte, und wie sie endlich mit dir entfloh? Weißt du das noch?« »Nein!« antwortete der Knabe, und »paff!« bekam er wieder eine schallende Ohrfeige,
Feledico aber fühlte sie, so daß er laut aufschrie. »Weißt du noch, wie du mit Epomata flohest, und ihre Mutter euch verfolgte, und Epomata in einen Garten verwandelt wurde, und du in einen Gärtner? Wie sie dich frug, ob du einen Mann und eine Frau hast vorbei reiten sehen, und du antwortetest von Fenchel und Spargel? Weißt du das noch?« »Nein!«
Und wieder fühlte Feledico eine tüchtige Ohrfeige, daß er schrie. »Weißt du noch, wie die Zauberin uns wieder verfolgte, und ich in eine Kirche verwandelt wurde, und du in den Sakristan? Wie sie dich wieder nach uns frug, und du von der Beichte und vom Pater sprachest?« »Nein!« »Paff!« fühlte Feledico wieder eine Ohrfeige.
»Weißt du noch, wie die Zauberin uns wieder einholte, und du zum Teich wurdest, und ich zum Aal darin? Weißt du noch, wie meine Mutter mich fangen wollte, und ich ihr immer wieder entschlüpfte, bis sie im Zorn einen Fluch wider mich aussprach: 'So möge er denn deiner vergessen, sobald er zu Hause den ersten Kuß bekommt!' Wie du mir geschworen hast, du willst dich von niemand küssen lassen, und meiner nicht vergessen? Weißt du das noch?«
Als aber Feledico diese Worte hörte, erinnerte er sich auf einmal der armen Epomata, und fuhr auf von seinem Stuhl, und stürzte aus dem Haus, und lief eilend zum Wirtshaus, wo Epomata noch immer auf ihn wartete. Da er sie nun sah, fiel er ihr zu Füßen, und bat sie um Verzeihung und sprach: »Ja, du hast Recht, mir Vorwürfe zu machen, weil du so lange hast leiden müssen; doch nun bin ich gekommen, und will dich zu meinen Eltern bringen, und du allein sollst meine Gemahlin sein.«
Während sie noch so sprachen, kam ein schöner goldner Wagen, den schickte die Königin, um ihre Schwiegertochter abzuholen, und Epomata legte königliche Kleider an, und fuhr mit Feledico aufs Schloß, und da der König und die Königin sie sahen, waren sie hoch erfreut über ihre Schönheit, und sprachen: »Nun soll auch alles zur Hochzeit her gerichtet werden.«
Der anderen Braut aber ließen sie sagen, Feledico könne sie nun nicht mehr heiraten, denn er habe schon eine Braut. Epomata war aber noch eine Heidin, darum mußte sie erst getauft werden, und erhielt einen christlichen Namen.
Als nun die Hochzeit sein sollte, schickte Epomata einen Boten zu ihrer Mutter und ließ ihr sagen: »Liebe Mutter, verzeihet mir das Unrecht, das ich euch getan habe, denn ich habe viel gelitten darum. Wollt mir verzeihen, und zu meiner Hochzeit kommen.« Da nun so lange Zeit verflossen war, war auch der Zorn der Zauberin verraucht und sie erfüllte den Wunsch ihrer Tochter, und kam zur Hochzeit, die mit großer Pracht gefeiert wurde.
Nach einigen Tagen sprach die Zauberin zu Feledico: »Lieber Schwiegersohn, ich werde euch nun verlassen, erfüllt meinen Befehl, so wird es euch zu Gute kommen. Heute Abend, wenn ich von meiner Tochter Abschied genommen habe, werde ich in diese Kammer kommen; da müßt ihr mir den Kopf abschneiden, und ihn oben an die Decke hängen. Meine Glieder müßt ihr auch abschneiden, und in die vier Ecken legen; meinen Rumpf aber zerhaue in kleine Stücke, und streut sie im Zimmer umher.«
Da ging Feledico zu Epomata und sprach: »Das und das hat deine Mutter mir befohlen zu tun, ich werde es aber nicht tun, denn wie könnte ich Hand an deine Mutter legen?« »Ach was!« antwortete sie, »du kannst es nur getrost tun, wenn meine Mutter es dich geheißen hat, denn sie ist eine so mächtige Zauberin, daß ihr nichts zu schaden vermag.«
Am Abend nahm die Zauberin Abschied von ihrer Tochter, und ging dann in ihre Kammer, Feledico folgte ihr, und zerschnitt sie ganz so, wie sie ihm befohlen hatte. Als er aber am anderen Morgen wieder in die Kammer trat, sah er eine solche Pracht, daß er verwundert stehen blieb.
Wo der Kopf gehangen hatte, hing nun eine prächtige goldne Krone; die Glieder aber und der Rumpf waren zu großen Haufen lauteren Goldes und edler Steine geworden. Das Alles war das Hochzeitsgeschenk der Zauberin an ihre Tochter.
Feledico aber lebte glücklich und zufrieden mit seiner jungen Frau, und wir haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON CARUSEDDU ...

Es war einmal ein Vater, der hatte drei Söhne, davon hieß der Jüngste Caruseddu; der war der Klügste und Schönste, und mit mancherlei Zaubergaben versehen. Nun begab es sich, daß der Vater starb, und seine Söhne in der bittersten Armut zurück ließ. »Was tun wir nun?« frug der Eine. »Wir wollen ausziehen, und unser Brot damit verdienen, daß wir in den Gärten der Reichen arbeiten.«
Also zogen sie aus, und wo sie einen schönen Garten sahen, frugen sie an, ob sie darin arbeiten sollten, und so lebten sie kümmerlich. Eines Tages kamen sie an einem großen Garten vorbei; der Besitzer stand an der Türe und rief sie an: »Kommt herein, schöne Burschen, und arbeitet in meinem Garten.« Der sie aber so freundlich einlud, das war ein Menschenfresser, und dachte sie in der Nacht zu fressen.
Nachdem die drei Brüder den ganzen Tag gearbeitet hatten, sprach der Menschenfresser: »Bleibt über Nacht bei mir, und morgen könnt ihr weiter arbeiten.« Da führte er sie in ein Zimmer, in dem stand ein großes Bett; darin sollten sie alle drei schlafen. Nun hatte der Menschenfresser drei junge Töchter, die schliefen in dem selben Zimmer, wie die drei Brüder.
Caruseddu aber dachte bei sich: »Der Menschenfresser ist gar so freundlich mit uns, er will uns gewiß verraten!« Als nun die drei Mädchen und seine beiden Brüder schliefen, nahm er den Mädchen ihre Kopftücher ab, und band sie seinen Brüdern und sich selbst um; den Mädchen aber setzte er die wollenen Zipfelmützen seiner Brüder auf.
In der Nacht kam der Menschenfresser herein geschlichen, und befühlte leise die Köpfe, die im Bette lagen. Da fühlte er zuerst die drei Kopftücher; »ei,« dachte er, »das sind ja meine Töchter, da hätte ich bald ein Unglück angerichtet.« Da ging er auf die andre Seite, und da er die Mützen fühlte, meinte er, das wären die drei Brüder, und verschlang seine eigenen Töchter.
Als er nun wieder hinaus geschlichen war, weckte Caruseddu seine Brüder und sprach: »Eilt, wir müssen so gleich fliehen. Das und das ist geschehen, und wenn der Menschenfresser den Betrug merkt, bringt er uns alle um.« Da entflohen sie alle drei so schnell sie konnten, und entkamen glücklich. Vor dem Hause aber erhob Caruseddu seine Stimme und rief: »Menschenfresser! Menschenfresser! was hast du getan! Deine Töchter hast du gefressen, und wir sind glücklich entflohen.«
Als der Menschenfresser das hörte, raufte er sich die Haare aus, und rief: »Warte nur! elender Wicht! wenn du mir jemals in die Hände kommst, soll es dir schlecht ergehen.« - Die drei Brüder fuhren nun fort in den Gärten zu arbeiten, und da sie geschickte Leute waren, so hörte einst der König von ihnen und ließ sie zu sich rufen, damit sie für ihn arbeiten sollten.
Als sie nun in seinem Dienste standen, gewann der König den schönen Caruseddu von Herzen lieb und sprach: »Du sollst immer bei mir bleiben, und mein vertrauter Diener sein.« Also wurde Caruseddu der vertraute Diener des Königs, seine Brüder aber arbeiteten im Garten. Darüber wurden sie von Neid erfüllt und sprachen unter einander: »Da ist unser Bruder, der ist doch der Jüngste, und ist so viel größer geworden als wir. Was können wir tun, um ihn aus dem Weg zu räumen?«
Da gingen sie zum König und sprachen: »Königliche Majestät, ihr habt alles, was euer Herz begehrt, eines aber fehlt euch, das ist das sprechende Pferd.« »Wer hat denn das sprechende Pferd?« »Königliche Majestät, das hat der Menschenfresser, und unser Bruder Caruseddu ist wohl im Stande, es zu holen.«
Als der König das hörte, wollte er gar zu gern das sprechende Pferd haben und ließ den armen Caruseddu rufen, und sprach zu ihm: »Caruseddu, du mußt mir den Gefallen tun und mußt mir beim Menschenfresser das sprechende Pferd holen.« »Ach, königliche Majestät, wie kann ich das sprechende Pferd holen? Der Menschenfresser wird mich verschlingen.« »Nein, nein,« rief der König, »das wird er nicht. Deine Brüder haben mir gesagt, du könntest alles tun, darum mußt du nun auch gehen und das sprechende Pferd holen.«
Was konnte Caruseddu tun? Er mußte das Gebot des Königs erfüllen, kaufte ein großes Tuch voll Süßigkeiten und machte sich auf den Weg zum Menschenfresser. Als er hin kam, war der Menschenfresser nicht zu Haus, und hatte auch sein Pferd mit genommen. Da schlich sich Caruseddu leise in den Stall, und sprach: »Ich bin ein Christ und werde winzig klein.« Sogleich wurde er winzig klein, und versteckte sich unter dem Stroh.
Nach einem Weilchen kam der Menschenfresser nach Haus, führte sein Pferd in den Stall, gab ihm zu fressen und ging dann hinauf in sein Haus. Als es anfing dunkel zu werden, sprach Caruseddu: »Ich bin winzig klein, und werde ein Christ,« da wurde er ein Mensch, schlich sich zum Pferdchen und sprach: »Pferdchen, liebes Pferdchen, willst du nicht mit mir kommen? Sieh, ich gebe dir auch Zuckerwerk und bringe dich zum König.«
Das Pferd aber wieherte laut, um den Menschenfresser zu rufen. »Ich bin ein Christ und werde winzig klein!« rief Caruseddu, und versteckte sich unter dem Stroh. Der Menschenfresser aber kam herbei gelaufen und rief: »Was ist geschehen, mein Pferdchen?« »Caruseddu ist hier und will mich stehlen,« antwortete das Pferd. Da suchte der Menschenfresser im ganzen Stall umher, als er aber niemand fand, rief er: »Was? du willst mich zum Besten haben?« ergriff einen Stock und gab dem Pferd Hiebe.
Als er fort war, nahm Caruseddu seine menschliche Gestalt wieder an, kam hervor und sprach: »Siehst du, Pferdchen, wie er dich schlägt? Komm doch lieber mit mir, und du sollst es gut haben.« Das Pferd wieherte laut auf, und Caruseddu hatte nur eben die Zeit, sich zu verwandeln und zu verstecken, als der Menschenfresser in den Stall gelaufen kam und rief: »Was ist geschehen?« »Caruseddu ist hier und will mich stehlen?«
Der Menschenfresser durchsuchte den ganzen Stall, fand aber niemanden. Da schlug er wieder unbarmherzig auf das Pferd los und rief: »Ich will dich lehren, mich zum Besten zu haben. Wenn du jetzt noch so laut wieherst, werde ich doch nicht kommen.« Als er nun fort war, kroch Caruseddu wieder hervor und sprach: »Ach, Pferdchen, sei doch nicht so dumm; siehst du, du bekommst nur Schläge dafür.«
Das Pferd war die Schläge satt, darum ließ es sich geduldig los binden und folgte dem schlauen Caruseddu. Vor dem Hause aber wieherte das Pferd noch einmal laut auf, und Caruseddu rief: »Oh, Menschenfresser! Menschenfresser! wie bist du doch so dumm! Caruseddu ist dagewesen und hat dir dein Pferd gestohlen.« »Oh, Caruseddu! Du Bösewicht! Wirst du denn auch wieder kommen?« »Ja wohl,« antwortete Caruseddu, schwang sich aufs Pferd und sprengte davon.
Als er zum König kam, war natürlich große Freude am Hofe: »Vivat Caruseddu! Vivat Caruseddu!« und der König beschenkte ihn reichlich und hatte ihn lieber als vorher. Seine Brüder aber wurden immer neidischer, gingen zum König und sprachen: »Das sprechende Pferd hat Caruseddu nun gebracht; der Menschenfresser hat aber etwas noch viel schöneres; das ist die Decke mit dem goldnen Glöckchen, und nur Caruseddu kann sie holen.«
Da wollte der König so gerne auch die Decke mit den goldnen Glöckchen haben, ließ den glücklichen Caruseddu rufen und sprach: »Caruseddu, das Pferd hast du mir gebracht; nun mußt du mir auch die Decke mit den goldnen Glöckchen holen.« »Ach, königliche Majestät, die kann ich nicht holen, die hat ja der Menschenfresser auf seinem Bette liegen!«
»Da sieh du selber zu; hast du das Eine gekonnt, so mußt du auch dieses vollbringen.« Da ging Caruseddu in den Stall, setzte sich aufs Pferd und ritt zum Menschenfresser. Das Pferd band er am Tor an, er selbst aber schlich sich ins Haus, da der Menschenfresser gerade ausgegangen war und sprach: »Ich bin ein Christ, und werde winzig klein!« und versteckte sich unter das Bett.
Am Abende kamen der Menschenfresser und seine Frau nach Haus und legten sich zu Bette. Da kroch Caruseddu hervor, und fing ganz leise an, an der Decke zu ziehen. »Was ziehst du mir die Decke weg?« brummte der Menschenfresser seiner Frau zu. »Ich ziehe ja gar nicht dran,« antwortete sie, »du bist es.« Caruseddu aber hatte sich schnell unters Bette versteckt, und erst als die Beiden wieder eingeschlafen waren, kroch er hervor und zog wieder an der Decke.
Um es kurz zu sagen, er zog so lange, bis er endlich die ganze Decke herunter gezogen hatte, und während der Menschenfresser über seine Frau her fiel, um sie zu prügeln, entkam er glücklich. Vor dem Hause aber schüttelte er die Decke, daß alle Glöckchen hell erklangen. »Das war der Bösewicht, der Caruseddu,« rief der Menschenfresser im höchsten Zorn: »Caruseddu! wirst du wiederkommen?« »Ja, ja,« antwortete Caruseddu, »schwang sich aufs Pferd und ritt nach Haus.«
Als er vor den König kam und ihm die Decke mit den goldnen Glöckchen zu Füßen legte, rief der König: »Vivat, Caruseddu! Vivat Caruseddu!« machte ihm ein schönes Geschenk, und hatte ihn noch lieber als bisher. Die Brüder aber wußten sich vor Neid nicht zu fassen, und dachten: »Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Nun ist er schon zweimal beim Menschenfresser gewesen, und jedesmal glücklich zurück gekommen; wir müssen etwas Anderes ausdenken.«
Da gingen sie zum König und sprachen: »Königliche Majestät, wäre es nicht schön, wenn ihr den Menschenfresser hier in einem Käfig hättet?« »Das wäre wohl ein schöner Anblick,« antwortete der König, »wer soll ihn aber gefangen nehmen?« »O, schickt nur den Caruseddu, dem ist alles möglich.« Da rief der König seinen Diener und sprach: »Caruseddu, nun mußt du gehen und mir den Menschenfresser selbst her bringen; denn ich will ihn in einen Käfig stecken.«
»Aber königliche Majestät, ihr wollt ja meinen Tod! Wie kann ich den Menschenfresser her bringen?« »Da sieh du selber zu,« antwortete der König; »ich gebe dir drei Tage Zeit; dann will ich den Menschenfresser hier haben.« Da ging Caruseddu hin und verkleidete sich als einen Schreiner, nahm seine Bretter und Handwerkszeug mit, stellte sich vor dem Hause des Menschenfressers auf und fing an zu arbeiten.
Während er nun so schreinerte, kam der Menschenfresser heraus, und frug ihn: »Was machst du da?« »Wißt ihr nicht,« sprach der Schlaue, »daß Caruseddu gestorben ist? ich mache ihm eben den Sarg.« »Wäre er doch zehn Jahr früher gestorben, dieser Bösewicht!« rief der Menschenfresser, »er hat mir mein sprechendes Pferd gestohlen und meine Decke mit den goldnen Glöckchen und ist Schuld daran, daß ich meine eigenen Töchter verschlungen habe und daß meine Frau gestorben ist.«
Denn die Menschenfresserin hatte sich so über den Verlust des Pferdes und der Decke gegrämt, daß sie gestorben war. Als nun der Menschenfresser hörte, daß Caruseddu gestorben sei, war er so erfreut, daß er dem Schreiner zu sah, während er den Sarg zimmerte. Der Sarg war endlich fertig, und nur der Deckel sollte noch darauf genagelt werden, da schlug sich Caruseddu plötzlich mit der Hand an die Stirn und rief: »Ach, ich Dummkopf! nun habe ich das Beste vergessen, nämlich das Maaß! Caruseddu war aber gerade so groß wie ihr; tut mir doch den Gefallen, und legt euch eben auf einen Augenblick in den Sarg.«
Der Menschenfresser war dumm, und legte sich in den Sarg; gleich schlug Caruseddu den Deckel darüber, nagelte ihn zu und lud dann den Sarg mit dem Menschenfresser auf sein Pferdchen, und brachte ihn so zum König. »Hier ist der Menschenfresser, königliche Majestät! nun steckt ihn in den Käfig.« »Vivat, Caruseddu! Vivat Caruseddu!« rief der König, »ihm kommt doch Keiner gleich!« Da ließ er den Menschenfresser in einen Käfig stecken, Caruseddu aber beschenkte er reichlich.
Dadurch wurden seine Brüder noch viel neidischer und trachteten ihn zu verderben. Sie gingen also zum König und sprachen: »Königliche Majestät, ihr seid noch unverheiratet, und euer Volk hat immer den Wunsch, daß ihr doch eine Frau nehmen möchtet. Wir wüßten aber wohl, welche Königstochter euer Wert ist; das ist die Tochter von der Königin mit den sieben Schleiern, die ist schöner als der Mond und die Sonne.«
Als der König das hörte, dachte er an nichts anderes mehr, als an die schöne Königstochter, ließ seinen Diener rufen und sprach: »Caruseddu, du hast so Vieles vollbracht; nun mußt du mir auch die Tochter der Königin mit den sieben Schleiern holen, denn ich will sie zu meiner Gemahlin erheben; und wenn du sie nicht holen willst, so lasse ich dir den Kopf abschneiden.«
Da ging Caruseddu in den Stall zu seinem Pferdchen, fing an zu weinen und sprach: »Ach, Pferdchen, liebes Pferdchen, was soll ich tun? Der König will, daß ich ihm die Tochter der Königin mit den sieben Schleiern hole, und ich weiß nicht einmal, wo ich sie suchen soll.« »Sei du nur ruhig,« antwortete das Pferdchen; »setze dich auf meinen Rücken und nimm Lebensmittel für dich und für mich mit.« Das tat Caruseddu, bestieg sein Pferd und ritt fort.
Als sie eine Weile geritten waren, kamen sie an einen großen Ameisenhaufen. »Nimm ein Laib Brot und streue es den Ameisen hin,« sprach das Pferd; das tat Caruseddu und ritt weiter. Nach einer Weile kamen sie an einen Strom, da lag am Ufer ein Fisch und zappelte, und konnte nicht wieder ins Wasser zurück kehren. »Nimm den Fisch und wirf ihn ins Wasser,« sprach das Pferd, und Caruseddu tat es. Wieder nach einer Strecke Weges sahen sie ein Vögelchen, das hatte sich in einer Schlinge gefangen, und konnte nicht wieder los kommen. »Befreie das Vögelchen und laß es fliegen,« sprach das Pferd, und Caruseddu tat es.
Endlich kamen sie in die Stadt, wo die Königin mit den sieben Schleiern herrschte. »Sieh,« sprach das Pferd, »dort ist das königliche Schloß; steige ab und führe mich am Zügel vor dem Schloß spazieren, immer auf und ab. Die Königstochter wird Lust bekommen, auf mir zu reiten; sobald sie sich nun aufsetzt, schwinge du dich auf meinen Rücken, so werden wir sie entführen.«
Caruseddu ritt in die Stadt, und als er vor den königlichen Palast kam, stieg er ab und führte das Pferd am Zügel auf und ab. Nun stand oben die Königstochter am Fenster, und als sie das wunderschöne kleine Pferdchen sah, rief sie voll Freude den König herbei und sprach: »Ach, lieber Vater, seht doch das niedliche Pferdchen! ich möchte wohl gerne einmal darauf reiten.«
»Gut, mein Kind, tu was dir gefällt,« antwortete der König, und die Königstochter lief hinunter und sprach zu Caruseddu: »Ich will mich auf dein Pferdchen setzen, bringe es mir her.« Da brachte ihr Caruseddu das Pferd, und die Königstochter setzte sich auf den Sattel. Kaum aber saß sie darauf, so schwang sich Caruseddu hinter sie und hielt sie fest, während das Pferd im Galopp davon sprengte.
Die Königstochter schrie, aber es half nichts; das Pferd hielt in seinem Lauf nicht an. Da riß sie ihren Schleier vom Kopf, und warf ihn in die Luft; und als sie an den Strom kamen, streifte sie ihren Ring vom Finger und warf ihn ins Wasser. So kamen sie endlich zum König, und Caruseddu sprach: »Königliche Majestät, hier ist die Königstochter; ich habe euer Gebot erfüllt.«
Als der König nun das wunderschöne Gesicht der Königstochter sah, ward er hoch erfreut, lobte seinen treuen Caruseddu und hatte ihn noch lieber als vorher. Zur Königstochter aber sprach er: »Schönes Fräulein, ihr seid nun meine Braut, und so bald es euch gefällt, soll die Hochzeit sein.« »O, dazu hat es noch lange Zeit,« antwortete sie. »Ehe ich eure Gemahlin werde, müßt ihr mir meinen Schleier verschaffen, den ich unterwegs verloren habe.«
Da ließ der König den Caruseddu rufen und sprach zu ihm: »Caruseddu, die Königstochter hat auf dem Wege ihren Schleier verloren, den mußt du mir in drei Tagen verschaffen, sonst lasse ich dir den Kopf abschneiden.« Caruseddu ging traurig in den Stall, streichelte sein Pferdchen und sprach weinend: »Ach, Pferdchen, liebes Pferdchen, du hast mir einmal geholfen, nun mußt du mir wieder helfen. Die Königstochter hat auf dem Wege ihren Schleier verloren, und wenn ich ihn in drei Tagen nicht herbei schaffe, so läßt mir der König den Kopf abschneiden.«
»So gräme dich doch nicht, du Narr,« sprach das Pferd; »setze dich auf meinen Rücken, so sollst du bald den Schleier finden.« Also bestieg Caruseddu das Pferd, und ritt davon. Das Pferd lief, bis es an die Stelle kam, wo Caruseddu dem Vögelchen aus der Schlinge geholfen hatte. »Steige ab und rufe dreimal: 'O, König der Vögel, komm heraus und hilf mir!'« befahl das Pferd, und Caruseddu stieg ab, und rief dreimal: »O, König der Vögel, komm heraus und hilf mir!«
Sogleich erschien das Vögelchen und frug: »Was willst du?« »Die Königstochter hat hier ihren Schleier verloren, und ich soll ihn ihr wieder bringen.« »Mit dem Schleier spielen zwei Vögel; ich will ihn ihnen entreißen und dir bringen,« antwortete das Vöglein, flog fort, und in einigen Augenblicken kam es wieder, mit dem Schleier im Schnabel. Caruseddu dankte dem Vögelchen, nahm den Schleier, und brachte ihn dem König. »Vivat, Caruseddu!« rief der König; »auch dieses Heldenstück hat er mir vollbracht.«
Da beschenkte er ihn reichlich, den Schleier aber brachte er der Königstochter und sprach: »Schönes Fräulein, hier ist der Schleier, und nun soll die Hochzeit sein.« »O, dazu hat es noch lange Zeit,« rief die Königstochter, »die Hochzeit kann erst gefeiert werden, wenn ihr mir meinen Ring verschafft, der mir in den Strom gefallen ist.«
Der König war ganz verzweifelt, daß die Königstochter so schwere Dinge verlange, weil sie aber so schön war, konnte er ihr nichts abschlagen und sprach zu Caruseddu: »Caruseddu, nun mußt du mir auch noch einen Dienst erweisen. Die Königstochter hat auf dem Wege ihren Ring in den Strom fallen lassen; den Ring mußt du mir verschaffen.« »Aber, königliche Majestät, wie kann ich im tiefen Strom einen Ring finden?« »Das geht mich nichts an, und wenn der Ring innerhalb drei Tage nicht hier ist, so lasse ich dir den Kopf abschneiden.«
Da ging der arme Caruseddu in den Stall zu seinem Pferdchen, und sprach: »Ach, liebes Pferdchen, du hast mir zweimal geholfen, hilf mir auch dieses mal, das und das hat mir der König aufgetragen.« »Weine nicht,« sagte das Pferdchen, »sondern setze dich getrost auf meinen Rücken.« Da schwang sich Caruseddu auf das Pferdchen, und das Pferdchen trug ihn zum Strome, wo er damals den Fisch erlöst hatte. »Steige ab und rufe dreimal mit lauter Stimme: 'O, König der Fische, komm heraus und hilf mir!'«
Da stieg Caruseddu ab und rief dreimal: »O, König der Fische, komm heraus und hilf mir!« So gleich rauschte es in dem Wasser, und ein Fisch schwamm ans Ufer; das war der selbe Fisch, den er vom Tode errettet hatte, und er frug: »Was willst du?« »Die Königstochter hat ihren Ring ins Wasser fallen lassen, und ich soll ihn ihr wieder bringen.« »Ist es nichts weiter als das?« sagte der Fisch; eben spielen zwei Fischlein damit; »ich will aber zwischen ihnen durch schwimmen und ihn ihnen entreißen.«
Da schwamm der Fisch fort, und nach einigen Augenblicken kam er wieder und hatte den Ring im Maul; den nahm Caruseddu und brachte ihn dem König.
Denkt euch, wie dankbar der König sein mußte, und wie reich er ihn beschenkte! Als er aber der Königstochter den Ring brachte und frug, wann nun die Hochzeit sein solle, antwortete sie: »O, noch lange nicht! Wenn Caruseddu mir nicht in drei Tagen ein ganzes Magazin voll Weizen, Gerste und Hafer auseinander liest, also daß jede Art Korn abgesondert liege, und das Stroh auch auf einem besonderen Haufen, so kann ich mich nicht verheiraten.«
Der König raufte sich fast die Haare aus: »Wo kommen ihr nur alle die Launen her,« dachte er, und ließ wieder seinen treuen Diener rufen: »Caruseddu, wenn du mir nicht binnen drei Tagen dieses ganze Magazin voll Korn auseinander liest, also daß jede Art Getreide abgesondert liegt, und das Stroh auch auf einem besonderen Haufen, so lasse ich dir den Kopf abschneiden.«
Da ging Caruseddu zu seinem Pferdchen und sprach: »Ach, liebes Pferdchen, du hast mir schon so oft geholfen, hilf mir auch diesmal. Das und das hat mir der König aufgetragen.« »Setze dich auf meinen Rücken, und sei unbesorgt,« antwortete das Pferdchen, und trug ihn zum Ort, wo Caruseddu den Ameisen das Brot gestreut hatte.
»Steige ab, und rufe dreimal mit lauter Stimme: O, König der Ameisen, komm heraus und hilf mir!« befahl das Pferd, und Caruseddu stieg ab und rief laut; »O, König der Ameisen, komm heraus und hilf mir!« Dreimal. Da kam eine große Ameise aus dem Boden heraus und frug: »Was willst du?« »Der König hat mir aufgetragen, ein ganzes Magazin voll Korn auseinander zu lesen, also daß jede Art abgesondert liege, und das Stroh auch auf einem besonderen Haufen.«
»Das wollen wir schon besorgen,« sprach der Ameisenkönig, und rief seine Ameisen herbei. Da kamen von allen Seiten große Züge von Ameisen, die krochen in das Magazin, und binnen drei Tagen war die Arbeit vollendet. »Königliche Majestät,« sprach Caruseddu, »ich habe euer Gebot erfüllt.« »Vivat, Caruseddu!« rief der König, »dir kommt Keiner gleich.«
Da ging er zur Königstochter und sprach: »Schönes Fräulein, nun habe ich euren Wunsch erfüllt; nun kann auch die Hochzeit gefeiert werden.« Die Königstochter aber antwortete: »Caruseddu hat mich meinen Eltern geraubt, die mich noch beweinen und betrauern, darum muß er sterben, sonst verheirate ich mich nicht. Laßt also drei Tage und drei Nächte einen Kalkofen heizen, und befehlt dem Caruseddu, sich hinein zu werfen.«
»Wie,« rief der König, »Caruseddu hat mir so treu gedient, und so viele Heldentaten vollbracht, und nun soll ich ihn töten?« »Wenn ihr es nicht tut, so heirate ich euch eben auch nicht,« antwortete die Königstochter. Sie wußte aber wohl, daß Caruseddu unversehrt aus dem Kalkofen kommen würde.
Da ließ der König seinen treuen Caruseddu rufen, und sprach: »Caruseddu, ich kann dir nicht helfen; die Königstochter befiehlt, daß der Kalkofen drei Tage und drei Nächte geheizt werde, und dann mußt du dich hinein werfen, und wenn du es nicht tun willst, so lasse ich dir den Kopf abschneiden.«
Caruseddu ging weinend in den Stall zu seinem Pferdchen, streichelte es und sprach: »Ach, Pferdchen, liebes Pferdchen, lebewohl! Jetzt ist es aus mit mir, denn der König will meinen Tod. Er hat befohlen, man solle den Kalkofen heizen, drei Tage und drei Nächte, und dann muß ich mich hinein werfen.«
»Verliere nur nicht den Mut,« antwortete das Pferd, »und tue genau, was ich dir sage. Nimm einen Stock und prügle mich, bis mir der Schaum aus dem Munde fließt.« »Ach, Pferdchen,« rief Caruseddu, »ich bin dir so viel schuldig, und sollte dich so prügeln! Nein, das bringe ich nicht übers Herz!«
»Du mußt aber,« sagte das Pferd; »schlage nur darauf los, du tust mir nichts. Den Schaum aber, der mir zum Munde heraus fließt, mußt du sammeln und in ein Töpfchen tun. Wenn man dich nun ruft, damit du dich in den Kalkofen wirfst, so beschmiere dich erst vom Kopf bis zu den Füßen mit dem Schaum, und du wirst sehen, das Feuer wird dir nichts tun.«
Da nahm Caruseddu einen großen Stock, und fing an, auf das Pferd los zu schlagen, in dem er dazwischen weinend rief: »Ach, liebes Pferdchen, verzeih mir, daß ich dir weh tue.« »Nur zu!« sprach das Pferdchen, und schnob, daß ihm der Schaum in großen Flocken am Maule hing. Caruseddu aber sammelte den Schaum in ein Töpfchen und verwahrte ihn.
Als nun der Kalkofen seit drei Tagen und drei Nächten geheizt war, ließ der König den armen Caruseddu rufen und sprach zu ihm: »Nun ist es Zeit, Caruseddu; schnell, wirf dich in den Ofen.« Da warf Caruseddu seine Kleider ab, salbte sich vom Kopf bis zu den Füßen mit dem Schaum ein und stürzte sich in den Kalkofen; und siehe, die Hitze verletzte ihn nicht, und er kam unversehrt wieder heraus und war noch viel schöner geworden.
Als der König und alles Volk das sahen, schlugen sie alle vor Freude in die Hände und riefen: »Vivat Caruseddu!« Die Königstochter aber sprach zum König: »Caruseddu ist unverletzt aus dem Kalkofen heraus gekommen; habt ihr mich wirklich lieb, so müßt ihr nun auch in den Kalkofen hinein springen, sonst heirate ich euch nicht.«
Der König dachte: »Vielleicht werde ich auch verjüngt, wie Caruseddu; wenn ich nur wüßte, womit er sich gesalbt hat.« Da ließ er ihn rufen, und frug ihn: »Caruseddu, nun mußt du mir auch sagen, womit du dich bestrichen hast, daß dich das Feuer nicht verletzte.« Caruseddu aber dachte: »Wart nur, ich habe dir so viele Dienste geleistet, und du hast mich dafür in den Tod geschickt; jetzt will ich mich an dir rächen.«
»Königliche Majestät,« sagte er, »ich habe mich mit einem Topf voll Fett beschmiert, das hat mich gerettet.« »Schnell, bringt zwei Töpfe voll Fett her,« rief der König, und dachte es recht gut zu machen, daß er noch mehr Fett auf schmierte, als Caruseddu; und als man ihm das Fett brachte, schmierte er sich ganz ein und warf sich in den Kalkofen. Als er aber ans Feuer kam, gab es eine hohe Flamme, und der König verbrannte zu Asche.
Das eben hatte die Königstochter gewollt, denn der König war alt und häßlich; Caruseddu aber war jung und schön, und den wollte sie zu ihrem Gemahl. »Caruseddu,« sprach sie, »jetzt will ich meine Hochzeit feiern, und du sollst mein Gemahl sein, denn du hast für mich gearbeitet.«
Also wurde eine prächtige Hochzeit gefeiert, und Caruseddu wurde König, und so blieben sie Mann und Frau, wir aber halten ihnen das Licht.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON CATERINA UND IHREM SCHICKSAL ...

Es war einmal ein Kaufmann, der war über alle Maßen reich, und hatte solche Schätze, wie sie nicht einmal der König hatte. In seinem Zimmer, wo er Audienz gab, standen drei wunderschöne Stühle, der eine war von Silber, der zweite von Gold, der dritte von Diamanten. Dieser Kaufmann hatte eine einzige Tochter, die hieß Caterina und war schöner als die Sonne.
Eines Tages saß Caterina in ihrem Zimmer. Auf einmal sprang die Türe ganz von selbst auf, und es trat eine schöne, hohe Frau herein, die hielt in ihren Händen ein Rad. »Caterina,« sprach sie, »wann willst du lieber dein Leben genießen, in der Jugend oder im Alter?«
Caterina schaute sie ganz verwundert an, und wußte sich nicht zu fassen, und die schöne Frau frug noch einmal: »Caterina, wann willst du lieber dein Leben genießen, in der Jugend oder im Alter?« Da dachte Caterina: Wenn ich sage: in der Jugend, so werde ich dafür im Alter leiden müssen. Deshalb will ich lieber im Alter mein Leben genießen, und in der Jugend gehe es mir nach dem Willen Gottes.
Also antwortete sie: »Im Alter!« »Dir geschehe, wie du gewünscht hast,« sprach die schöne Frau, drehte einmal ihr Rad, und verschwand. Diese hohe, schöne Frau aber war das Schicksal der armen Caterina.
Nach einigen Tagen bekam ihr Vater plötzlich die Nachricht, einige von seinen Schiffen seien in einem Sturme gescheitert; wieder nach einigen Tagen erfuhr er, noch mehrere von seinen Schiffen seien untergegangen, und um es kurz zu fassen, es war kaum ein Monat verflossen, so sah er sich aller seiner Reichtümer beraubt. Er mußte alles verkaufen, was er hatte, aber auch das verlor er, bis er endlich ganz arm und elend blieb. Aus Kummer darüber erkrankte er und starb.
So blieb denn die arme Caterina ganz allein in der Welt zurück, ohne einen Grano, ohne jemanden zu haben, der sie hätte zu sich nehmen wollen. Da dachte sie: »Ich will in eine andere Stadt gehen, und mir dort einen Dienst suchen,« machte sich auf, und wanderte, bis sie in eine andere Stadt kam.
Wie sie durch die Straßen ging, stand eben eine vornehme Frau am Fenster, die frug sie: »Wohin gehst du so allein, du schönes Mädchen?« »Ach, edle Frau, ich bin ein armes Mädchen, und möchte gern in Dienst treten, um mir mein Brot zu verdienen. Könnt ihr mich nicht brauchen?« Da nahm die vornehme Frau sie zu sich, und Caterina diente ihr treu.
Nach einigen Tagen sprach eines Abends die Frau: »Caterina, ich muß einen Ausgang machen, und werde die Haustüre zu schließen.« »Gut,« sprach Caterina, und als ihre Herrin fort war, nahm sie ihre Arbeit, setzte sich hin und nähte. Plötzlich ging die Türe auf, und ihr Schicksal trat herein. »So?« rief das selbe, »hier bist du, Caterina? und meinst nun wohl, ich solle dich in Ruhe lassen?«
Mit diesen Worten lief das Schicksal an alle Schränke, riß die Wäsche und die Kleider von Caterinas Herrin heraus, und riß alles in tausend Stücke. Caterina aber dachte: »Ach, weh mir, wenn meine Herrin wieder kommt, und alles in diesem Zustand findet, so bringt sie mich gewiß um.« Und in ihrer Angst brach sie die Türe auf und entfloh.
Das Schicksal aber sammelte alle die zerrissenen und zerstörten Sachen, machte sie ganz und legte alles an seinen Platz. Als nun die Herrin nach Hause kam, rief sie nach Caterina, aber Caterina war nirgends zu sehen: »Sollte sie mich wohl bestohlen haben?« dachte sie, aber als sie nach sah, fehlte von ihren Sachen nichts. Sie verwunderte sich sehr, aber Caterina kam nicht zurück, sondern lief immer weiter, bis sie endlich in eine andere Stadt kam.
Als sie nun durch die Straßen ging, stand wieder eine Frau am Fenster, und frug sie: »Wohin gehst du so allein, du hübsches Mädchen?« »Ach, edle Frau, ich bin ein armes Mädchen, und möchte gern einen Dienst annehmen, um mein Brot zu verdienen; könnt ihr mich nicht brauchen?« Da nahm sie die Frau in ihren Dienst, und Caterina diente ihr, und meinte nun in Ruhe bleiben zu können.
Es währte aber nur einige Tage; als eines Abends ihre Herrin ausgegangen war, erschien das Schicksal wieder, und fuhr sie mit harten Worten an: »So, hier bist du jetzt? Und meinst du wohl, du könnst mir entgehen?« Damit zerriß und zerstörte das Schicksal alles, was es fand, also daß die arme Caterina in ihrer Herzensangst wieder entfloh.
Um es kurz zu sagen, dieses schreckliche Leben führte die arme Caterina sieben Jahre lang, lief aus einer Stadt in die andere, und versuchte es überall, einen Dienst anzunehmen. Nach wenigen Tagen aber erschien immer das Schicksal, zerriß und zerstörte die Sachen ihrer Herrschaft, und das arme Mädchen mußte fliehen. Wenn sie jedoch das Haus verlassen hatte, machte das Schicksal alles wieder ganz und legte es an seinen Platz.
Nach sieben Jahren endlich schien das Schicksal müde zu werden, die unglückliche Caterina immer zu verfolgen. Eines Tages kam Caterina wieder in eine Stadt, und sah eine Frau am Fenster stehen, die frug sie: »Wohin gehst du so allein, du schönes Mädchen?« »Ach, edle Frau, ich bin ein armes Mädchen und möchte gerne einen Dienst annehmen, um mein Brot zu verdienen. Könnt ihr mich nicht brauchen?«
Da antwortete die Frau: »Ich will dich gern zu mir nehmen, du mußt mir aber täglich einen Dienst leisten, und ich weiß nicht, ob du die Kraft dazu hast.« »Sagt mir, was es ist,« sprach Caterina, »und wenn ich es kann, will ich es tun.« »Siehst du jenen hohen Berg?« sprach die Frau. »Auf den mußt du jeden Morgen ein großes Brett mit frisch gebackenem Brot tragen, und mußt oben mit lauter Stimme rufen: 'O Schicksal meiner Herrin! o Schicksal meiner Herrin! o Schicksal meiner Herrin!' dreimal. Dann wird mein Schicksal erscheinen, und das Brot in Empfang nehmen.« »Das will ich gerne tun,« sprach Caterina, und die Frau nahm sie zu sich.
Nun blieb Caterina lange Jahre bei dieser Frau, und jeden Morgen nahm sie ein Tragbrett mit frisch gebackenem Brot, und trug es den Berg hinauf, und wenn sie dreimal gerufen hatte: »O Schicksal meiner Herrin!« erschien eine schöne, hohe Frau und nahm das Brot in Empfang. Caterina aber weinte oft, wenn sie dachte, daß sie, die so reich gewesen war, nun wie eine arme Magd dienen mußte.
Da sprach eines Tages ihre Herrin zu ihr: »Caterina, warum weinst du so viel?« Da erzählte Caterina, wie schlecht es ihr ergangen sei, und ihre Herrin sprach: »Weißt du was, Caterina? Wenn du morgen das Brot auf den Berg trägst, so bitte mein Schicksal, daß es dein Schicksal zu bewegen suche, dich nun in Ruhe zu lassen. Vielleicht hilft das.«
Dieser Rat gefiel der armen Caterina, und am nächsten Morgen, als sie dem Schicksal ihrer Herrin das Brot gebracht hatte, klagte sie dem selben ihre Not, und sprach: »O Schicksal meiner Herrin! bittet doch mein Schicksal, daß es mich nun nicht mehr verfolge.« Da antwortete das Schicksal: »Ach, du armes Mädchen, dein Schicksal ist eben mit sieben Decken bedeckt, deshalb kann es dich nicht hören. Wenn du aber morgen kommst, so will ich dich zu ihm hin führen.«
Als nun Caterina nach Hause gegangen war, ging das Schicksal ihrer Herrin zu dem Schicksal des Mädchens, und sprach: »Liebe Schwester, warum wirst du nicht müde, die arme Caterina leiden zu lassen? Lasse sie nun auch wieder glückliche Tage sehen.« Da antwortete das Schicksal: »Führe sie morgen zu mir, so will ich ihr etwas schenken, das soll ihr aus aller Not helfen.«
Als nun Caterina am nächsten Morgen das Brot brachte, führte das Schicksal ihrer Herrin sie zu ihrem eigenen Schicksal, das war mit sieben Decken bedeckt. Das Schicksal aber gab ihr ein Stränglein Seide, und sprach zu ihr: »Verwahre es wohl, es wird dir nützen.«
Da ging Caterina nach Hause, und sprach zu ihrer Herrin: »Da hat mir mein Schicksal ein Stränglein Seide geschenkt, was ich wohl damit tun soll? Es ist ja keine drei Grani wert.« »Nun,« sagte die Herrin, »verwahre es nur, wer weiß wozu es nützen kann.«
Nun begab es sich nach einiger Zeit, daß der junge König heiraten sollte, und sich deshalb königliche Kleider anfertigen ließ. Als der Schneider nun ein schönes Gewand nähen sollte, war nirgends Seide von der selben Farbe zu finden. Da ließ der König im ganzen Land verkünden, wer solche Seide habe, sollte sie an den Hof bringen, sie werde ihm gut bezahlt werden.
»Caterina,« sprach ihre Herrin, »dein Stränglein Seide ist ja von dieser Farbe; bringe es doch zum König, daß er dir ein schönes Geschenk mache.« Da legte Caterina ihre besten Kleider an, und ging an den Hof, und als sie vor den König trat, war sie so schön, daß er seine Augen nicht von ihr wenden konnte.
»Königliche Majestät,« sprach sie, »ich habe euch ein Stränglein Seide gebracht, von jener Farbe, die ihr nicht finden konntet.« »Wißt ihr was, königliche Mäjestät,« rief einer der Minister, »wir wollen dem Mädchen die Seide mit Gold aufwiegen.« Der König war es zufrieden, und es wurde eine Waage gebracht; auf die eine Seite legte der König die Seide, auf die andere ein Goldstück.
Nun denkt euch aber, was geschah; so viele Goldstücke der König auch auf die Waage legen mochte, die Seide war doch immer schwerer. Da ließ der König eine größere Waage holen, und alle seine Schätze auf die eine Schale legen, aber die Seide wog immer noch schwerer. Da nahm der König endlich seine goldene Krone vom Haupt, und legte sie zu all den anderen Schätzen, und siehe da, nun ging die Waagschale mit dem Golde hinunter, und wog genau eben so viel wie die Seide.
»Woher hast du diese Seide?« frug der König. »Königliche Majestät, ich habe sie von meiner Herrin geschenkt bekommen,« antwortete Caterina. »Nein, das ist nicht möglich,« rief der König, »und wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, so lasse ich dir den Kopf abschneiden.« Da erzählte Caterina alles, wie es ihr ergangen, seit sie ein reiches Mädchen gewesen war.
Am Hofe aber lebte eine weise Frau, die sprach: »Caterina, du hast viel gelitten, doch nun wirst du auch glückliche Zeiten sehen, und daß erst die goldne Krone die Waage ins Gleichgewicht brachte, ist ein Zeichen, daß du eine Königin sein wirst.« »Soll sie eine Königin sein,« rief der König, »so will ich sie dazu machen, denn Caterina und keine andere soll meine Gemahlin sein.«
Und so geschah es auch; der König ließ seiner Braut sagen, nun wolle er sie nicht mehr, und heiratete die schöne Caterina. Und nachdem Caterina in ihrer Jugend so viel gelitten hatte, genoß sie nun ihr Alter in lauter Glückseligkeit, und blieb glücklich und zufrieden, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
![]()
VON CICCU ...

Es war einmal ein armer Mann, der hatte drei Söhne; der älteste hieß Peppe, der zweite Alfin, und der jüngste Ciccu. Der Mann war sehr arm und eines Tages hatten er und seine Söhne nichts zu essen. Da berief er seine drei Söhne und sprach zu ihnen: »Meine lieben Kinder, ihr wißt wie arm wir sind. Ich sehe nun kein anderes Mittel, als daß ich betteln gehe, denn ich bin alt, und kann nicht mehr ordentlich arbeiten.«
»Nein, lieber Vater,« antworteten die Söhne, »betteln gehen dürft ihr nicht; lieber wollen wir selbst betteln und euch unterhalten. Wenn ihr es aber erlaubt, so wollen wir euch einen Vorschlag machen.« »Sprecht nur,« sagte der Vater. »Wir wollen euch in den Wald führen, dort könnt ihr mit unserer Axt Holz schneiden, wir binden die Bündel und tragen sie in die Stadt um sie zu verkaufen.« Der Vater war es zufrieden und sie machten sich auf den Weg nach dem Wald.
Weil aber der Vater schon alt und schwach war, so nahmen ihn die Söhne der Reihe nach auf die Schulter, und trugen ihn bis zum Wald. Dort errichteten sie eine kleine Strohhütte, wo sie die Nacht zubringen konnten, und nun ging der Vater jeden Morgen in den Wald und hieb Brennholz; die Söhne banden es zu Bündeln und trugen es in die Stadt, wo sie es verkauften, und dem Vater dafür Brot, Wein und andre Lebensmittel brachten. Während ihrer Abwesenheit hieb dann der Vater schon neues Brennholz, und die drei Brüder konnten somit jeden Morgen in die Stadt wandern.
Als sie einige Tage dieses Leben geführt hatten, frugen sie ihren Vater: »Wie fühlt ihr euch jetzt, lieber Vater?« »Recht gut; so können wir ja herrlich leben,« antwortete der Alte. So vergingen mehrere Monate, da wurde der Vater recht krank, und fühlte, daß er sterben müsse. Da sprach er zu seinen Söhnen: »Liebe Kinder, holt mir einen Notar, daß ich mein Testament machen kann.«
Als nun der Notar kam, sprach der Alte: »Ich besitze ein altes Häuschen im Dorf und den Feigenbaum der daneben steht. Das Haus laß ich meinen drei Söhnen zusammen, daß sie es bewohnen mögen; den Feigenbaum verteile ich folgendermaßen: meinem Sohn Peppe lasse ich die Zweige; meinem Sohn Alfin lasse ich den Stamm; meinem Sohn Ciccu lasse ich die Früchte.
Dann besitze ich eine alte Decke, die lasse ich meinem ältesten Sohn; eine alte Börse, die soll mein zweiter Sohn haben, und ein Horn, das lasse ich meinem jüngsten Sohn.« Als der Vater so gesprochen hatte, starb er. Da sprachen die Brüder unter einander: »Was sollen wir nun machen? Sollen wir wie bisher im Wald bleiben, oder sollen wir in das Dorf zurückkehren? Wir wollen lieber hier bleiben, wir haben ja hier unser gutes Auskommen.« So blieben denn die Brüder im Wald, hieben Brennholz, und verkauften es nach wie vor in der Stadt.
Eines Abends nun begab es sich, daß es sehr heiß war, und sie sich ins Freie vor die Strohhütte schlafen legten. Da kamen drei Feen vorbei; die sahen sie so liegen und die Eine sprach: »Seht doch, liebe Schwestern, diese hübschen Burschen. Wollen wir nicht Jedem eine Gabe schenken?« »Tun wir das,« sagten die Schwestern.
Da sprach die Erste: »Der Älteste hat eine Decke; ich schenke ihm, daß, wenn er sie umhängt, und sich an irgend einen Ort hin wünscht, er sogleich dort sein soll.« Da sprach die zweite Fee: »Der zweite Bursche hat eine Börse; ich schenke ihm, daß, so oft er zur Börse spricht: Liebe Börse, ich gib mir diese oder jene Summe Geldes, er sie darin finden soll.« Da sprach die dritte Fee: »Der Jüngste besitzt ein Horn; wenn er auf dem schmalen Ende bläst, so soll das Meer von Schiffen wimmeln; bläst er auf dem breiten Ende, so sollen alle wieder verschwinden.« Damit verschwanden sie.
Ciccu aber hatte nicht geschlafen, sondern alles mit angehört, und dachte: »Ei, da wäre ja allem Mangel abgeholfen.« Als sie nun am nächsten Tage mit einander arbeiteten, sprach er zu seinen Brüdern: »Die alte Decke und die Börse sind ja ganz ohne Wert; ich bitte euch, gebt sie mir.« Die Brüder hatten den Ciccu sehr lieb, und weil er sie so freundlich bat, so gaben sie ihm die Decke und die Börse.
Da sprach Ciccu: »Hört einmal, liebe Brüder, ich bin das Leben in dem Walde satt, wir wollen in die Stadt ziehen, und dort etwas anfangen.« »Ach nein, Ciccu, bleiben wir lieber hier,« sagten die Brüder, »hier haben wir es ja gut; wer weiß, wie es uns in der Welt ergeht.« »Wir können es ja einmal probieren,« meinte Ciccu, »wenn es uns schlecht geht, so kehren wir zum Wald zurück.« Da nahmen sie die fertigen Holzbündel und trugen sie zur Stadt, und Ciccu nahm die Decke, die Börse und das Horn mit.
Als sie in die Stadt kamen, fanden sie, daß auf dem Markt Brennholz im Überfluß war; sie bekamen also nicht viel Geld für ihr Holz, und als sie es überzählten, langte es nicht einmal zu einem Mittagessen für sie. Ciccu aber sagte: »Kommt nur mit in das Wirtshaus, ich will uns schon etwas zu essen verschaffen.« Da gingen sie in das Wirtshaus, und Ciccu sprach zum Wirt: »Bringt uns ein Mittagessen mit drei Gerichten, das Beste, was ihr habt, und einige Flaschen guten Wein dazu.«
Die Brüder erschraken, und flüsterten ihm zu: »Ciccu, was machst du denn? wie sollen wir bezahlen?« »Laßt mich nur machen,« antwortete Ciccu. Als sie nun gut gegessen und getrunken hatten, sprach Ciccu zu seinen Brüdern: »Geht ihr nur fort, ich will jetzt die Rechnung machen.« Die Brüder waren froh fort zu kommen, denn sie dachten: »da setzt es gewiß Prügel ab.«
Ciccu aber ließ sich von dem Wirt sagen, wie viel die Zeche betrage, und sprach dann zu seiner Börse: »Liebe Börse, gib mir eine Unze,« und sogleich fand er in der Börse eine Unze. Da bezahlte er den Wirt, und kehrte vergnügt zu seinen Brüdern zurück. »Wie hast du denn den Wirt bezahlt?« frugen sie ihn. »Was geht euch das an? ich habe ihn schon dazu gekriegt, mich gehen zu lassen.« Die Brüder aber wurden ängstlich, und wollten nicht gern länger mit Ciccu zusammen bleiben.
Da sprach Ciccu: »Hier schenke ich jedem von euch zwanzig Unzen, wendet sie wohl an; denn ich ziehe nun meine Straße und will mein Glück suchen.« Damit umarmte er sie und zog von dannen.
So wanderte er, bis er endlich in die Stadt kam, wo der König wohnte. Dort schaffte er sich schöne Kleider an, und kaufte sich ein schönes Haus, gerade dem königlichen Palast gegenüber. Dann verschloß er das Tor, und ließ nun aus seiner Börse Gold auf die Treppe regnen, bis die ganze Treppe mit Gold überzogen war; die Zimmer aber ließ er herrlich ausschmücken. Als er nun das Tor wieder öffnete und ein herrliches Leben begann, verwunderten sich alle Leute über die schöne goldne Treppe, und man sprach in der ganzen Stadt von nichts anderem.
Da hörte es der König, und ging hinüber, um das schöne Werk auch zu sehen, und Ciccu empfing ihn mit aller Ehrerbietung und führte ihn im ganzen Hause umher.
Nun hatte der König eine Frau und eine wunderschöne Tochter, die wollten auch gerne das schöne Haus mit der goldnen Treppe sehen. Da ließ der König bei Ciccu anfragen, ob er wohl seine Frau und seine Tochter in sein Haus führen dürfe, und Ciccu antwortete natürlich, es würde eine große Ehre für ihn sein, wenn die Königin und ihre Tochter zu ihm kommen wollten.
Als nun Ciccu die schöne Königstochter sah, gewann er sie von Herzen lieb und wollte sie gern zu seiner Frau haben. Die Königstochter aber wollte gern wissen, wie er es angefangen habe die Treppe zu vergolden. Sie stellte sich also, als ob sie Gefallen an ihm hätte, und schmeichelte ihm mit freundlichen Worten, bis er endlich nicht mehr wußte, was er tat, und ihr erzählte, wie die drei Feen im Walde den Zauberspruch über die Decke, die Börse und das Horn ausgesprochen hatten.
Da bat sie ihn, er möge ihr doch die Börse auf einige Tage leihen, damit sie sich eine eben solche Börse machen könne, und so groß war seine Liebe zu ihr, daß er alles vergaß und ihr die Börse gab.
Die Königstochter nahm sie mit nach Hause, und dachte nicht mehr daran, sie dem armen Ciccu wieder zu geben. Unterdessen hatte Ciccu alles Geld verbraucht, das er noch hatte, und weil er seine Börse nicht hatte, so wußte er auch nicht, wo er Geld hernehmen sollte. Da ging er zur Königstochter, und bat sie, ihm doch die Börse wieder zu geben, sie aber wußte ihn immer hin zu halten, bis er endlich eines Tages keinen Grano mehr hatte.
Da ging er zu ihr und sprach: »Heute mußt du mir durchaus meine Börse wieder geben, ich habe sie eilig nötig.« Sie antwortete: »Ach laß sie mir nur noch bis morgen früh dann sollst du sie gewiß bekommen.« Ciccu ließ sich wieder überreden, am nächsten Morgen aber erhielt er die Börse doch nicht. Da geriet er in einen großen Zorn und schwur, sich an dem Mädchen zu rächen.
Als es nun dunkle Nacht geworden war, nahm er einen Stock in die Hand, hing die Decke um, und wünschte sich in das Schlafzimmer der Königstochter. Kaum hatte er den Wunsch ausgesprochen, so war er auch schon dort. In einem schönen Bette lag die Königstochter, Ciccu aber riß sie unsanft heraus, und schlug sie so lange, bis sie ihm die Börse zurück gab; dann wünschte er sich in sein Haus zurück.
Die Königstochter aber eilte voll Zorn zu ihrem Vater und klagte ihm die Beleidigung, die ihr widerfahren war. Da geriet der König in große Wut, schickte so gleich in das Haus gegenüber, und ließ den armen Ciccu gebunden herüber führen. »Du hast den Tod verdient,« sprach er zu ihm, »ich will dir aber das Leben schenken, wenn du mir sogleich die Decke, die Börse und das Horn auslieferst.«
Was konnte Ciccu tun? Das Leben war ihm lieb, und so überbrachte er dem König die drei Gegenstände, und war nun wieder so arm als zuvor. Es war aber gerade die Zeit, als die Feigen reiften, da dachte er denn: »Ich will einmal gehen und nach sehen, ob der Feigenbaum Früchte getragen hat.« Als er nun an das Häuschen kam, fand er dort seine Brüder, die hatten ihr Geld durch gebracht, und lebten nun kümmerlich.
Der Feigenbaum aber war mit den schönsten Früchten beladen. Da nahm Ciccu ein Körbchen und wollte Feigen pflücken, sein Bruder Peppe aber sprach: »Halt, die Feigen gehören freilich dir, aber die Zweige gehören mir, und wenn du deine Feigen pflückst, so darfst du meine Zweige nicht berühren.«
Da legte Ciccu eine Leiter an, um die Feigen besser erreichen zu können, aber sein Bruder Alfin rief ihm zu: »Halt, der Stamm gehört mir zu und du darfst ihn nicht berühren.« Als sie sich nun darüber stritten, und sich nicht einigen konnten, sagte endlich der Eine: »Wir wollen die Sache dem Richter vortragen.« Da gingen sie zum Richter und erzählten ihm den ganzen Hergang, und der Richter sprach zu Ciccu: »Da du die Feigen nicht pflücken kannst, ohne dabei den Stamm und die Zweige zu berühren, so rate ich dir, den ersten Korb deinem Bruder Peppe zu geben, den zweiten deinem Bruder Alfin und den Rest kannst du behalten.«
Die Brüder waren es zufrieden, und im Nachhausegehen sprachen sie untereinander: »Wir wollen Jeder einen Korb Feigen dem König bringen, vielleicht schenkt er uns etwas dafür, und was er uns schenkt, das wollen wir redlich teilen.« Da pflückte Ciccu einen Korb der schönsten Feigen, und Peppe machte sich damit auf den Weg ins königliche Schloß.
Unterwegs begegnete ihm ein altes Männchen, das frug ihn: »Was trägst du in deinem Korb, schöner Bursche?« »Was geht euch das an,« rief Peppe »bekümmert euch um eure eignen Angelegenheiten.« Der Alte frug ihn mehrmals und endlich antwortete Peppe voll Ärger: »Dreck!« »Gut,« sprach das Männchen, »Dreck hast du gesagt und Dreck soll es werden!«
Als nun Peppe am Schloß ankam, klopfte er an, und ein Diener frug ihn, was er wünsche. »Ich habe hier ein Körbchen schöner Feigen,« antwortete Peppe, »sie sind zwar nicht wert vor den König zu kommen, aber seine Majestät möge sie doch annehmen, um sie der Dienerschaft zu geben.« Der König ließ den Peppe ins Zimmer hinein kommen, und befahl man solle einen Präsentierteller bringen, um die Feigen darauf zu legen.
Als Peppe aber den Korb ab deckte, lagen ganz oben einige Feigen, sonst aber war im Korb nichts als Dreck. Der König geriet in einen heftigen Zorn und ließ dem unglücklichen Burschen fünfzig Stockschläge aufzählen. Betrübt schlich Peppe nach Haus, erzählte aber seinen Brüdern nichts davon, sondern als sie ihn frugen, was der König ihm geschenkt habe, antwortete er: »Wenn wir alle dort gewesen sind, will ich es euch sagen.«
Als nach einigen Tagen wieder ein Körbchen reifer Feigen auf dem Baum waren, pflückte Ciccu sie ab, und Alfin machte sich damit auf den Weg zum König. Unterwegs begegnete ihm ein altes Männchen, das frug ihn: »Was trägst du in deinem Korb, schöner Bursche?« »Hörner!« antwortete Alfin. »Gut,« sprach der Alte, »Hörner hast du gesagt und Hörner sollen es werden.«
Als nun Alfin am Schloß ankam, klopfte er an, und sprach zum Diener: »Hier ist ein Körbchen schöner Feigen; sie sind freilich nicht wert auf des Königs Tisch zu kommen; Seine Majestät möge sie aber doch annehmen, um sie der Dienerschaft zu geben.« Der König ließ ihn herein kommen, und befahl seinem Diener, einen Präsentierteller zu bringen, und die Feigen darauf zu legen.
Als nun Alfin die Blätter abdeckte, lagen nur einige Feigen oben auf im Korb: alle anderen waren zu Hörnern geworden. Da wurde der König sehr erzürnt über die zugefügte Beleidigung und rief: »Habt ihr es darauf abgesehen, mich zum Besten zu haben? Gebt ihm sogleich hundertfünfzig Stockschläge!« Betrübt schlich Alfin heim, er wollte aber auch nicht sagen, wie es ihm ergangen war, sondern dachte: »Ciccu kann es auch einmal versuchen.«
Nach einigen Tagen pflückte Ciccu die letzten Feigen, die waren aber lange nicht so schön, als die ersten. Er machte sich aber dennoch auf den Weg zum König. Unterwegs begegnete ihm das alte Männchen und frug: »Was trägst du in deinem Korbe, schöner Bursche?« »Ich habe Feigen, die will ich dem König bringen,« sagte Ciccu. »Laß sie mich doch einmal sehen,« bat der Alte.
Da nahm Ciccu den Korb herunter, und zeigte dem alten Männchen die Feigen; da bat das Männchen: »Ach, gib mir doch eine kleine Feige, ich habe ein solches Gelüste danach.« »Wenn ich eine Feige herausnehme, so wird man die Lücke bemerken,« meinte Ciccu, weil er aber ein gutes Herz hatte, und der Alte ihn so bat, so konnte er es ihm doch nicht abschlagen, und gab ihm eine Feige.
Der Alte aß sie, behielt aber den Stumpf in der Hand, und bat sich noch eine aus, dann noch eine und noch eine, bis er einen guten Teil des Korbes aufgegessen hatte. »Wie soll ich nun die Feigen dem König bringen?« sagte Ciccu, »es fehlen ja so viele davon.« »Sei nur ruhig,« sprach das Männchen, und warf alle die Stümpfe in den Korb, »gehe hin und bringe dem König den Korb, es wird dein Glück sein. Decke aber unterwegs den Korb nicht auf.«
Da nahm Ciccu den Korb und brachte ihn dem König, wenn auch mit Angst und Zittern. »Hier sind einige Feigen,« sprach er zum Diener. »Sie sind freilich nicht wert auf des Königs Tisch zu kommen; Seine Majestät aber möge sie annehmen, und sie der Dienerschaft geben.« Als der König hörte, es sei wieder einer da mit Feigen, sprach er: »Will mich der auch zum Besten haben? Nun, laßt ihn einmal herein kommen.«
Als nun Ciccu den Korb abdeckte, war der selbe bis oben angefüllt mit den herrlichsten Feigen. Da freute sich der König, und schenkte ihm fünf Thaler und einen großen Teller mit Süßigkeiten, und weil ihm der schmucke Bursche so wohl gefiel, frug er ihn, wie er heiße, und ob er in seine Dienste treten wolle, denn er hatte ihn nicht erkannt. Ciccu sagte ja, er wolle nur zuerst die fünf Thaler seinen Brüdern bringen.
Als sie nun alle drei bei einander waren, sprach Peppe: »Jetzt laßt sehen, was jeder von uns vom König bekommen hat.« »Ich bekam fünfzig Stockschläge.« - »Und ich hundertfünfzig,« sprach Alfin. »Ich habe fünf Thaler bekommen, und diese Süßigkeiten,« sprach Ciccu. »Ihr könnt es aber unter einander teilen; denn der König hat mich in seinen Dienst genommen.« Also kam Ciccu an den Hof, und diente dem König, und der König gewann ihn immer lieber.
Nun waren aber seine beiden Brüder neidisch auf das Glück, das ihrem jüngsten Bruder zu Teil geworden war, und trachteten, wie sie ihm schaden könnten. Da kamen sie zum König und sprachen: »Herr König, euer Schloß ist sehr schön, erst dann aber wird man es mit Recht königlich nennen, wenn ihr den Säbel des Menschenfressers habt.«
»Wie kann ich denn den erlangen?« frug der König. »O, sagt es nur dem Ciccu, der kann den Säbel wohl holen.« Da ließ der König seinen treuen Ciccu vor sich kommen, und sprach: »Ciccu, es ist mir einerlei, wie du es anfängst, du mußt mir aber um jeden Preis das Schwert des Menschenfressers verschaffen.«
Nun war in dem Marstall des Königs ein verzaubertes Rößlein, das war klein und zierlich, und konnte sprechen. Ciccu aber hatte eine große Liebe zu dem Rößlein. Da ging er in den Stall, streichelte es und sprach: »Ach Rößlein, liebes Rößlein, nun werden wir uns wohl nimmer wieder sehen; denn ich soll dem König um jeden Preis das Schwert des Menschenfressers verschaffen.« -
»Sei nur ruhig,« sagte das Rößlein, »und tue was ich dir sage. Laß dir vom König fünfzig Unzen geben, und die Erlaubniß auf mir zu reiten, und dann wollen wir uns auf den Weg machen.« Da ging Ciccu zum König, erbat sich fünfzig Unzen und das Rößlein und ritt davon. Das Rößlein aber wies ihm den Weg, und sagte ihm immer, was er tun sollte.
Als er nun in das Land des Menschenfressers kam, berief Ciccu fünf oder sechs alte Weiber, und sprach: »Ich gebe jeder einen Thaler, wenn ihr mir einen ganzen Sack voll Läuse zusammen sucht.« Mit den Läusen aber ging Ciccu in das Haus des Menschenfressers, als er gerade nicht da war, und steckte alle die Läuse ins Bett, sich selbst aber versteckte er unter das selbe.
Als nun der Menschenfresser nach Hause kam, und sich zu Bette legen wollte, legte er sein Schwert ab, das verbreitete einen wunderbaren Glanz. Kaum aber war er zu Bette, so fingen die Läuse an, ihn zu quälen, daß er es nicht mehr aushalten konnte. Da stand er auf, brummte und schalt, und fing an, die Läuse zu suchen.
Diesen Augenblick benutzte Ciccu, ergriff das Schwert, sprang die Treppe hinunter, und schwang sich auf sein Rößlein, das wie der Wind mit ihm davon lief. Als Ciccu zum König kam, war der selbe hoch erfreut und gewann seinen treuen Ciccu lieber als je.
Die Brüder aber kamen wieder zum König und sprachen: »Das Schwert hat Ciccu wohl gebracht, wenn er aber den Menschenfresser selber holte, so würde dieses Schloß mit Recht ein königliches genannt werden können.« Da ließ der König seinen Diener rufen, und sprach: »Ciccu, du mußt mir um jeden Preis den Menschenfresser lebendig her bringen; es ist mir gleichgültig, wie du es anfängst, aber den Menschenfresser mußt du mir her schaffen.«
Betrübt ging Ciccu zum Rößlein in den Stall und klagte ihm seine Not, das Rößlein aber sprach: »Sei nur ruhig, und sage dem König, du müßtest fünfzig Unzen haben und willst mich mit nehmen.« Das tat Ciccu und wanderte nun mit seinem Gelde und dem Rößlein davon. Das Rößlein aber riet ihm immer, was er tun müsse.
Da sie nun in das Land des Menschenfressers kamen, ließ Ciccu in allen Kirchen die Totenglocken läuten, und überall verkündigen: »Ciccu, der Diener des Königs, ist gestorben.« Als der Menschenfresser das hörte, ward er sehr erfreut und rief: »Das ist gut, daß dieser Bösewicht gestorben ist, dieser Dieb, der mir mein Schwert gestohlen hat.«
Ciccu aber nahm eine Axt und eine Säge, und ging in den Wald des Menschenfressers und fing an eine Pinie umzuhauen. Der Menschenfresser aber rief: »Wer untersteht sich, in meinem Walde eine Pinie umzuhauen?« Da antwortete Ciccu: »Ach, edler Herr, es ist mir befohlen, einen Sarg für den Diener des Königs, für den Ciccu, herzurichten, und da wollte ich diese Pinie dazu benutzen.«
Der Menschenfresser erkannte ihn nicht, und weil er so erfreut war über Ciccus Tod, so rief er: »Warte ein wenig, ich will dir helfen,« lief in den Wald, und beide zusammen hieben die Pinie um; dann zersägten sie den Stamm, fügten die Bretter an einander, und bald war der Sarg fertig. Da kratzte sich Ciccu hinter den Ohren, und sprach: »Nein, was bin ich doch so dumm, ich habe ja kein Maß genommen; wie kann ich wissen, ob die Größe richtig ist?
Doch eben fällt mir ein, Ciccu war eben so groß als ihr; tut mir den Gefallen, und legt euch in den Sarg, damit ich eben einmal sehen kann, ob er groß genug ist.« Der Menschenfresser ging richtig in die Falle, und legte sich in den Sarg. Ciccu aber schlug den Deckel zu, band einen starken Strick darum, und lud mühsam den Sarg auf sein Rößlein, das lief wie der Wind ins Schloß zurück. Der König aber ließ einen großen eisernen Käfig machen und den Menschenfresser hinein sperren.
Nun begab es sich zu der selben Zeit, daß des Königs Gemahlin starb, und der König sollte sich wieder verheiraten. Er fand aber keine Königstochter die ihm gefallen hätte. Da kamen die neidischen Brüder wieder zu ihm, und sprachen: »Nur Eine ist würdig, eure Gemahlin zu sein, Herr König; das ist die Schönste der ganzen Welt.« »Wo ist sie denn zu finden?« frug der König. »O, sagt es nur dem Ciccu, der wird sie euch schon verschaffen.«
Da ließ der König seinen treuen Ciccu kommen, und sprach: »Ciccu, wenn du mir binnen acht Tagen nicht die Schönste der ganzen Welt herbringst, so lasse ich dich enthaupten.« Weinend ging Ciccu in den Stall zum Rößlein und sprach: »Ach, liebes Rößlein, nun sehen wir uns nicht wieder; denn in acht Tagen muß ich sterben, wenn ich nicht dem König die Schönste der ganzen Welt her bringe.« »Sei nur ruhig,« sprach das Rößlein, »laß dir vom König etwas Honig und Brot geben, und etwas Geld, und nimm mich mit.« Das tat Ciccu und machte sich mit seinem Rößlein auf den Weg.
Als er eine Weile geritten war, sah er am Boden einige erschöpfte Bienen liegen, die konnten vor Hunger nicht mehr fliegen. »Steig ab, und gib den armen Tierchen deinen Honig,« sprach das Rößlein. Das tat er und ritt weiter. Wieder nach einem Weilchen kamen sie an einen Strom, an dessen Ufer lag ein Fisch, der zappelte auf der trocknen Erde. »Steig ab, und wirf den Fisch ins Wasser, er wird dir nützen,« sprach das Rößlein. Da stieg Ciccu ab, warf den Fisch ins Wasser und ritt weiter.
Wieder nach einem Weilchen sah er einen Adler, der hatte sich mit dem Bein in einer Schlinge gefangen. »Steig ab, und befreie den armen Adler aus der Schlinge, er wird dir nützen,« sprach das Rößlein, und Ciccu stieg ab und half dem Adler.
Endlich kamen sie in die Nähe des Schlosses, wo die Schönste der ganzen Welt mit ihren Eltern wohnte.
Da sprach das Rößlein: »Steige ab, und stelle dich auf diesen Stein, denn ich muß nun allein in das Schloß. Wenn du mich mit der Königstochter zurück jagen siehst, so springe hinten auf, und halte sie fest, damit sie nicht herunter springt. Wenn du aber nicht aufpasst, und nicht zu rechter Zeit aufsitzt, so sind wir beide verloren.« Ciccu stieg ab, und stellte sich auf den Stein; das Rößlein aber sprang in den Schloßhof hinein, und fing an, gar zierlich darin herum zu traben.
Bald versammelten sich alle Leute aus dem Schloß, um das niedliche Tier zu sehen, das sich von allen streicheln ließ und so zahm war, und auch der König und die Königin kamen mit ihrer Tochter in den Schloßhof. Da sprach die Schönste der ganzen Welt: »Ach, Vater ich möchte gern ein wenig reiten,« und setzte sich auf das Rößlein, das so zahm aussah.
Kaum aber saß sie auf dem Rücken des Pferdes, so jagte das Rößlein mit ihr davon, und wenn sie nicht fallen wollte, so mußte sie sich an er Mähne fest halten. Als nun das Rößlein an dem Stein vorbei jagte, wo Ciccu stand, schwang sich dieser mit einem Satz hinter die Königstochter und hielt sie fest. Da nahm die Schönste der ganzen Welt ihren Schleier vom Kopf und warf ihn zu Boden, und als sie an den Strom kamen, zog sie einen Ring vom Finger, und warf ihn ins tief Wasser.
Als sie nun in das Schloß kamen, war der König hoch erfreut, eilte ihr entgegen, und sprach zur Schönsten der ganzen Welt: »Edles Fräulein, nun müßt ihr meine Gemahlin werden.« Da antwortete sie: »Dann erst werden wir Mann und Frau sein, wenn Ciccu mir den Schleier bringt, der mir unterwegs entfallen ist.« Der König rief seinen Diener herbei und sprach: »Ciccu, wenn du mir nicht sogleich den Schleier der Schönsten der ganzen Welt bringst, so lasse ich dich enthaupten.«
Da schlich Ciccu weinend zu seinem Rößlein in den Stall, und klagte ihm sein Leid; das Rößlein aber sprach: »Sei nur ruhig, laß dir Lebensmittel für einen Tag geben, und setze dich dann auf meinen Rücken.« Als sie nun ritten, kamen sie an den Ort, wo Ciccu den Adler aus der Schlinge befreit hatte, da sprach das Rößlein: »Rufe dreimal den König der Vögel, und wenn er dir antwortet, so sage ihm, er solle dir den Schleier der Schönsten der ganzen Welt verschaffen.«
Da rief Ciccu dreimal den König der Vögel, und nach dem dritten Mal frug eine Stimme: »Was ist dein Begehr?« »Schafft mir den Schleier der Schönsten der ganzen Welt,« rief Ciccu. »Warte einen kleinen Augenblick,« rief die Stimme, »ein Adler ergötzt sich damit; der wird ihn dir gleich her bringen.« Nicht lange, so rauschte es in den Lüften, ein Adler senkte sich herab, und trug in seinem Schnabel den Schleier.
Als Ciccu ihn aber genau ansah, war es der selbe Adler, den er befreit hatte. Da nahm Ciccu den Schleier, und eilte damit zum König, und der König brachte ihn der Schönsten der ganzen Welt, und sprach: »Hier ist der Schleier, nun müßt ihr meine Gemahlin werden.« »Das geht nicht so schnell,« antwortete die Königstochter, »nicht eher können wir Mann und Frau sein, als bis Ciccu den Ring wieder bringt, der mir in den Strom gefallen ist.«
Der König ließ wieder den Ciccu rufen, und sprach: »Bringe mir sogleich den Ring zurück, den die Schönste der ganzen Welt in den Strom hat fallen lassen, sonst lasse ich dir den Kopf abschneiden.« Da ging Ciccu wieder in den Stall, und klagte dem Rößlein sein Leid, das Rößlein aber sprach: »Nimm Lebensmittel für einen Tag und setze dich auf meinen Rücken.« Das Rößlein aber brachte ihn zu dem Strom und sprach: »Rufe dreimal den König der Fische, und sage ihm, er solle dir den Ring wieder schaffen.«
Da rief Ciccu dreimal den König der Fische, und eine Stimme antwortete: »Was ist dein Begehr?« »Schafft mir den Ring herbei, den die Schönste der ganzen Welt hier verloren hat.« »Warte einen Augenblick,« sprach die Stimme, »ein Fisch ergötzt sich eben damit, er wird ihn dir gleich herauf bringen.« Nicht lange, so rauschte es in dem Wasser, und ein Fisch kam an die Oberfläche, der hielt im Maul den verlornen Ring.
Als Ciccu ihn aber genau ansah, war es der selbe Fisch, den er damals vom Tode errettet hatte. Da nahm er den Ring und brachte ihn dem König, der gab ihn der Schönsten der ganzen Welt und sprach: »Hier ist der Ring, nun müßt ihr meine Gemahlin werden.« Sie aber antwortete: »Damit hat es noch Zeit, erst muß der Ziegelofen drei Tage und drei Nächte geheizt werden, und dann muß Ciccu sich hinein stürzen, dann erst können wir Mann und Frau werden.«
Da rief der König seinen treuen Ciccu, und befahl ihm, den Ziegelofen heizen zu lassen, und sich hinein zu stürzen, »und tust du es nicht, so lasse ich dir den Kopf abschneiden.« Da ging Ciccu zum Rößlein, und sprach: »Lebewohl, mein liebes Rößlein, nun bin ich so gut wie tot, denn nun kann mich nichts mehr retten,« und erzählte ihm den Befehl des Königs.
Das Rößlein aber sprach: »Laß nur nicht den Mut sinken; wenn der Ziegelofen ganz geheizt ist, so setze dich auf meinen Rücken, und jage mich so lange herum, bis der Schweiß in Flocken auf mir liegt; dann springe herunter, wirf deine Kleider ab, und streiche mir den Schweiß mit einem Messer ab. Damit mußt du dich bestreichen, und dann getrost in den Ofen springen«.
Das tat denn Ciccu ganz getreulich, und jagte das Rößlein so lange herum, bis der Schweiß in Flocken auf ihm lag, den strich er mit einem Messer ab, bestrich sich damit, und sprang so vor den Augen des Königs und der Schönsten der ganzen Welt ins Feuer. Das Feuer aber hatte keine Gewalt über ihn, und er kam heraus, schöner als er bis dahin gewesen war.
Als ihn aber die Schönste der ganzen Welt so sah, wurde ihr Herz von Liebe zu ihm erfüllt, und sie sprach zum König: »Noch kann ich eure Frau nicht werden; erst müsst ihr ebenso wie Ciccu in den Ziegelofen springen.« »Ja, das will ich tun,« sprach der König; insgeheim aber rief er seinen treuen Ciccu, und frug ihn: »Sage mir Ciccu, was hast du getan, daß das Feuer dich nicht verzehrt hat?«
Ciccu aber grollte dem König, der ihn in so viele Gefahren geschickt hatte, deßhalb antwortete er: »Ich habe mich mit altem Fette bestrichen, da hat mir das Feuer nichts getan.« Der König glaubte diesen Worten, bestrich sich mit altem Fett, und sprang in den Ofen; das Fett aber fing an zu brennen, und der ganze König verbrannte.
Die Schönste aber der ganzen Welt sprach zu Ciccu: »Nun wollen wir Mann und Frau sein, und der da kann uns das Licht halten«. Da heiratete Ciccu die Schönste der ganzen Welt und wurde König; und sie wurden Mann und Frau, wir aber halten ihnen die Kerze.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON BENSURDATU ...

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten drei wunderschöne Töchter. Diese Töchter hatten sie über die Maßen lieb, und taten alles, um sie zufrieden und glücklich zu sehen.
Eines Tages nun sprachen die drei Königstöchter: »Lieber Vater, wir möchten so gerne heute aufs Land fahren, und dort zu Mittag essen.« »Ja, liebe Kinder, tun wir das,« sprach der König, und gab sogleich seine Befehle. Ein schönes Mittagessen wurde bereitet, und der König, die Königin und ihre drei Töchter fuhren aufs Land.
Als sie nun gegessen hatten, sprachen die drei Mädchen: »Liebe Eltern, wir wollen uns ein wenig im Garten ergehen. Wenn ihr wieder nach Hause fahren wollt, so ruft uns nur.« Kaum aber waren die drei Mädchen in den Garten getreten, so senkte sich eine große schwarze Wolke herab, und trug sie fort.
Nach einer Weile wollten der König und die Königin nach Hause zurück kehren, und riefen deshalb ihre Töchter, die waren aber nirgends zu finden. Sie suchten im ganzen Garten, im Hause, auf dem Felde, - vergebens, die drei Mädchen waren und blieben verschwunden.
Denkt euch den Schmerz des Königs und der Königin. Die arme Mutter jammerte den ganzen Tag, der König aber ließ verkündigen, wer ihm seine Töchter wieder bringe, solle eine davon zur Frau haben und nach ihm König werden.
Nun befanden sich am Hofe zwei junge Generale, die sprachen zu einander: »Wir wollen uns auf machen, und die Königstöchter suchen, vielleicht ist es unser Glück.« Also machten sie sich auf, und es hatten jeder ein schönes Pferd, ein Bündel Kleider und etwas Geld.
Sie mußten aber eine lange, lange Zeit reiten, also daß ihr Geld zu Ende ging, und sie ihre Pferde verkaufen mußten. Nach einiger Zeit ging auch dieses Geld zu Ende, und sie mußten auch ihre Kleider verkaufen. Endlich blieben ihnen nur die Kleider, die sie auf dem Leibe trugen.
Da es sie nun hungerte, traten sie in ein Wirtshaus, und ließen sich zu essen und zu trinken geben. Als sie aber bezahlen wollten, sprachen sie zum Wirt: »Wir haben kein Geld, und haben nichts mehr als unsere Kleider. Nehmt diese als Bezahlung, und gebt uns statt dessen eine ärmliche Kleidung, so wollen wir bei euch bleiben und euch dienen.« Der Wirt war es zufrieden, brachte ihnen ärmliche Kleider, und so blieben die beiden Generale bei ihm und dienten ihm.
Unterdessen warteten der König und die Königin voll Sehnsucht auf ihre lieben Kinder, die kamen aber nicht wieder, und die Generale auch nicht. Nun hatte der König einen armen Soldaten, der Bensurdatu hieß, und ihm schon viele Jahre treu gedient hatte.
Als Bensurdatu sah, daß der König immer so traurig war, sprach er eines Tages zu ihm: »Königliche Majestät, ich will ausziehen, und eure Töchter suchen.« »Ach, Bensurdatu, drei Töchter habe ich schon verloren, und zwei Generale dazu, soll ich dich auch noch verlieren?«
Bensurdatu aber sprach: »Lasst mich nur ziehen, königliche Majestät; ihr sollt sehen, daß ich euch eure Töchter zurück bringe.« Da willigte der König ein, und Bensurdatu zog aus, und machte den selben Weg, den die Generale vor ihm gemacht hatten.
Endlich kam er an das selbe Wirtshaus und verlangte zu essen. Da kamen die beiden Generale, um ihn zu bedienen, in ärmlicher Kleidung; er erkannte sie aber doch, und frug ganz erstaunt, wie sie dahin gekommen seien. Sie erzählten ihm alles, und Bensurdatu rief den Wirt herbei, und sprach: »Gib den Beiden ihre Kleider zurück, so will ich dir bezahlen, was sie schuldig sind.«
Da nun der Wirth die Kleider brachte, legten die Generale die selben wieder an, und machten sich dann mit Bensurdatu wieder auf den Weg, um die schönen Königstöchter zu suchen. Sie wanderten wieder eine lange Zeit, und kamen endlich in eine öde, wilde Gegend, wo weit und breit keine menschliche Wohnung zu sehen war.
Als es aber schon dunkelte, sahen sie von ferne ein Licht, und da sie näher hin zu gingen, fanden sie ein kleines Häuschen und klopften an. »Wer ist da?« frug eine Stimme. »Ach, erweist uns die Barmherzigkeit, und gebt uns ein Nachtlager,« antwortete Bensurdatu, »wir sind müde Wandrer und haben uns verirrt.«
In dem Häuschen aber wohnte eine steinalte weise Frau, die machte ihnen auf und ließ sie herein. »Woher kommt ihr, und wohin geht ihr?« frug sie. Da antwortete Bensurdatu: »Ach, gute Alte, wir haben eine schwere Arbeit unternommen; wir sind ausgezogen, die drei Töchter des Königs zu suchen.«
»O, ihr Unglücklichen! das werdet ihr nimmer ausführen können, denn die Königstöchter sind von einer schwarzen Wolke geraubt worden, und dort, wo sie jetzt sind, kann sie niemand finden.« Da bat Bensurdatu die Alte, und sprach: »Wenn ihr wisst, wo sie sind, so sagt es uns, denn wir wollen unser Glück versuchen.«
»Wenn ich es euch auch sage,« sprach die Alte, »so könnt ihr sie doch nicht erlösen; denn dazu müßt ihr in einen tiefen Brunnen hinunter steigen, und wenn ihr unten angekommen seid, so werdet ihr zwar die Königstöchter finden, aber die beiden Älteren sind von zwei Riesen bewacht, und die Jüngste ist in der Gewalt eines Lindwurms mit sieben Köpfen.«
Da das die Generale hörten, fürchteten sie sich, und wollten nicht weiter, Bensurdatu aber sprach: »So weit sind wir gekommen, nun müssen wir auch die Arbeit vollenden. Sagt uns, wo dieser Brunnen ist, so wollen wir morgen früh hin gehen.« Da sagte es ihnen die Alte, und gab ihnen etwas Käse, Wein und Brot, damit sie sich stärken sollten, und nachdem sie gegessen hatten, legten sich alle schlafen.
Am nächsten Morgen bedankten sie sich bei der weisen Frau und zogen dann weiter. So wanderten sie, bis sie zum Brunnen kamen, und der eine General sprach: »Ich bin der Älteste, und will zu erst hinunter steigen.« Er ließ sich an einem Strick fest binden, nahm ein Glöckchen mit, und fing an hinunter zu steigen.
Kaum aber war er ein wenig in die Tiefe gekommen, so ertönte ein solches Donnern und Getöse, daß er ganz erschreckt das Glöckchen läutete, und sich so schnell als möglich wieder hinauf ziehen ließ. Nun kam der zweite General an die Reihe, es ging ihm aber nicht besser als dem ersten. Als er das Getöse hörte, erschrak er so, daß er sein Glöckchen läutete, und sich eilig wieder hinauf ziehen ließ.
»Was seid ihr für tapfere Leute,« rief Bensurdatu, »jetzt will ich es auch einmal versuchen.« Da ließ er sich anbinden, und ließ sich herzhaft in den Brunnen hinab, und als er das Donnern hörte, dachte er: »Lärme du nur, mir tust du damit nicht weh.«
Als er nun auf den Grund des Brunnens kam, fand er sich in einem großen, schönen Saal, und in der Mitte saß die älteste Königstochter, und vor ihr saß ein großmächtiger Riese, den mußte sie lausen, und er war dabei eingeschlafen. Als sie nun Bensurdatu erblickte, winkte sie ihm, um ihn zu fragen, weshalb er gekommen sei.
Da zog er sein Schwert, und wollte auf den Riesen zu; sie machte ihm aber schnell ein Zeichen, sich zu verstecken, denn der Riese war aufgewacht, und brummte: »Ich rieche Menschenfleisch!« »Ach, wo sollte das Menschenfleisch her kommen,« antwortete sie, »es kommt ja kein Mensch zu uns; schlaft nur ruhig wieder ein.«
Als aber der Riese schlief, machte ihr Bensurdatu ein Zeichen, sie solle sich ein wenig zurück biegen, zog sein Schwert, und hieb mit einem Streich den Kopf des Riesen ab, daß er in eine Ecke flog. Die Königstochter aber war hoch erfreut, und dankte ihm, und schenkte ihm eine goldne Krone.
»Jetzt zeigt mir, wo eure Schwester ist,« sprach Bensurdatu, »ich will sie auch erlösen.« Da machte die Prinzessin eine Tür auf, und führte ihn in einen zweiten Saal, darin saß die zweite Königstochter, und der Riese saß vor ihr, den mußte sie lausen, und er war dabei eingeschlafen.
Als sie aber herein kamen, machte ihnen die Königstochter ein Zeichen, sie sollten sich verstecken, denn der Riese war aufgewacht, und brummte: »Ich rieche Menschenfleisch!« »Wo sollte das Menschenfleisch her kommen!« antwortete sie, »es kann ja niemand herein dringen; schlaft nur ruhig ein.«
Als er aber schlief, kam Bensurdatu hervor, und hieb ihm mit einem Streiche den Kopf ab, daß der selbe weit weg flog. Die Königstochter dankte ihm voller Freude, und schenkte ihm auch eine goldne Krone. »Jetzt will ich auch noch eure jüngste Schwester erlösen,« sprach Bensurdatu; die Königstochter aber erwiderte: »Ach, das wird dir nimmer gelingen, denn sie ist in der Gewalt eines Lindwurms mit sieben Köpfen.« »Führt mich nur hin,« antwortete Bensurdatu, »ich will ihn schon bekämpfen.«
Die Königstöchter machten ihm eine Tür auf, und da er herein trat, stand er in einem großen Saal; darin war die jüngste Königstochter mit schweren Ketten gefesselt, vor ihr aber lag ein Lindwurm mit sieben Köpfen, der war grauenhaft anzusehen, und richtete sich auf, um den armen Bensurdatu zu verschlingen.
Der aber verlor den Mut nicht, sondern kämpfte mit dem Lindwurm, bis er ihm alle sieben Köpfe abgehauen hatte. Dann löste er die Ketten, mit denen die arme Königstochter gefesselt war, und sie umarmte ihn voll Freude, und schenkte ihm auch eine goldne Krone.
»Jetzt wollen wir auch an die Oberwelt zurück kehren,« sprach Bensurdatu, führte sie zu dem Grunde des Brunnens, und band die älteste Königstochter fest, und als er läutete, zogen die Generale sie glücklich hinauf. Dann warfen sie den Strick wieder hinunter, und Bensurdatu band die zweite fest.
Nun waren nur noch die Jüngste und Bensurdatu übrig; da sprach sie: »Lieber Bensurdatu, tue mir den Gefallen, und laß dich zu erst hinauf ziehen, denn sonst üben die Generale einen Verrat an dir aus.« »Nein, nein,« antwortete Bensurdatu, »ich will dich nicht hier unten lassen, sei ohne Sorgen, meine Gefährten werden mich nicht verraten.«
Da sprach die Königstochter: »Wenn du denn nicht anders willst, so will ich mich zu erst hinauf ziehen lassen. Eines aber verspreche ich dir: Wenn du nicht kommst um mein Gemahl zu werden, so werde ich mich niemals verheiraten.« Nun band er die Königstochter fest, und die Generale zogen sie hinauf.
Als sie aber nun den Strick noch einmal hinab werfen sollten, wurde ihr Herz von Neid erfüllt gegen den armen Bensurdatu, also daß sie ihn verrieten und verließen. Die Königstöchter aber bedrohten sie, und zwangen sie zu schwören, sie würden ihren Eltern sagen, die beiden Generale hätten sie erlöst. »Und wenn man euch nach Bensurdatu fragt, so sagt, ihr hättet ihn nicht erblickt,« sprachen sie.
Also mußten die Königstöchter schwören, und die beiden Generale brachten sie an den Hof; und der König und die Königin waren voll Freude, als sie ihre lieben Kinder wieder sahen. Weil aber die Generale erzählten, sie hätten die Königstöchter erlöst, so gab ihnen der König voll Freude seine beiden ältesten Mädchen zu Gemahlinnen. -
Lassen wir sie nun, und sehen nach dem armen Bensurdatu.
Erst wartete er eine lange Zeit, als aber der Strick nicht wieder herunter geworfen wurde, merkte er, daß seine Gefährten ihn verraten hatten, und dachte: »Ach, wehe mir! wie kann ich nun wieder hinaus.«
Da ging er durch alle Säle, und in einem der selben sah er einen schön gedeckten Tisch, und da ihn hungerte, setzte er sich hin und aß. Nun mußte er eine lange Zeit dort unten bleiben, denn er fand kein Mittel, wieder hinaus zu kommen.
Eines Tages aber, da er durch die Säle ging, sah er an der Wand einen Geldbeutel hängen, und als er ihn in die Hand nahm, da war es ein Zauberbeutel, der sprach: »Was befiehlst du?« Da wünschte er sich aus dem Brunnen heraus zu sein, und als er oben war, wünschte er sich ein großes, schönes Schiff, bemannt und bereit zur Abfahrt.
Und kaum hatte er es sich gewünscht, so lag da ein wunderschönes Schiff, und vom Maste wehte eine Fahne, darauf stand: »König von drei Kronen.« Da setzte er sich aufs Schiff, und fuhr in die Stadt, wo der König wohnte, und als er in den Hafen kam, fing er an zu schießen.
Als das der König hörte, und das schöne Schiff sah, dachte er: »Was muß das für ein mächtiger Herrscher sein, der drei Kronen hat, und ich habe nur eine.« Deshalb fuhr er ihm entgegen, und lud ihn ein, in sein Schloß zu kommen, und dachte: »Das wäre ein Mann für meine jüngste Tochter; denn die jüngste Königstochter war noch immer nicht verheiratet, und so viele Freier auch um sie geworben hatten, sie hatte keinen angenommen.«
Als nun der König mit Bensurdatu kam, erkannte sie ihn nicht, weil er so prächtige königliche Kleider trug. Der König aber sprach zu ihm: »Edler Herr, nun wollen wir essen und fröhlich sein, und wenn es möglich ist, so erweist mir die Ehre, und nehmt meine jüngste Tochter, zur Gemahlin.«
Bensurdatu war es zufrieden, und sie setzten sich alle zum Mahle nieder, und waren fröhlich und guter Dinge; nur die jüngste Königstochter war traurig, denn sie dachte an Bensurdatu. Da sprach der König zu ihr: »Liebe Tochter, dieser edle Herrscher will dich zu seiner Gemahlin erheben.« »Ach, lieber Vater,« antwortete sie, »ich habe ja keine Neigung, mich zu verheiraten.«
Da wandte sich Bensurdatu zu ihr, und sprach: »Wie aber, edles Fräulein, wenn ich Bensurdatu wäre, würdet ihr mich da wohl heiraten?« Und als ihn alle verwundert anschauten, fuhr er fort: »Ja, ich bin Bensurdatu, und so und so ist es mir ergangen.«
Als der König und die Königin das hörten, wurden sie hoch erfreut, und der König sprach: »Lieber Bensurdatu, du sollst meine jüngste Tochter zur Gemahlin haben, und wenn ich einst sterbe, so sollst du die Krone erben. Ihr Verräter aber müsst meine Staaten verlassen, und euch nie wieder blicken lassen.«
Also mußten die beiden Generale das Reich verlassen; der König aber hielt drei Tage Festlichkeiten, und verheiratete seine jüngste Tochter mit Bensurdatu. Und so blieben sie zufrieden und glücklich, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VOM LIGNU DI SCUPA ...

Es war einmal eine Frau, die hatte eine Tochter; die war so schön als die Sonne und der Mond. Die Frau war arm, darum schickte sie ihr Töchterchen zu ihrer eigenen Mutter, die nahm es freundlich auf und behielt es bei sich. Nun hatte die Großmutter eine Pfanne, die pflegte sie ihren Nachbarinnen zu leihen, wenn diese etwas backen wollten, und dafür mußten ihr diese, wenn sie die Pfanne zurück brachten, etwas von dem Gebackenen mit geben.
Nun begab es sich eines Tages, daß die Alte ausgehen mußte und die Enkelin allein zu Hause ließ. Da kam eine Nachbarin und sprach: »Ich habe einige Fische bekommen und möchte sie backen; tue mir den Gefallen und gib mir die Pfanne.« Da gab das Mädchen ihr die Pfanne, und die Nachbarin buk die Fische, und als sie die Pfanne zurück brachte, brachte sie auch vier gebackene Fische auf einem Teller.
Da nun das Mädchen die schön gebackenen Fische sah, die so angenehm rochen, konnte sie der Versuchung nicht widerstehen und aß ein kleines Stückchen davon, und da es ihr so gut schmeckte, so aß sie nach und nach alle vier Fische auf.
Als die Großmutter nach Hause kam, frug sie gleich: »Hat die Nachbarin keine Fische gebracht?« »Ich habe ihr die Pfanne geliehen,« sprach das Mädchen, »sie hat aber keine Fische dafür gebracht.« Da ging die Großmutter zornig zur Nachbarin und rief: »Was soll das heißen? Ihr habt euch meine Pfanne geholt und habt mir nichts von eurem Gebackenen gebracht!«
Die Nachbarin aber antwortete: »Was sagt ihr nur? Ich habe ja vier Fische bei Seite gelegt, und sie eurer Enkelin gegeben!« Da lief die Großmutter schnell nach Hause zurück und schalt und schlug ihre Enkelin, daß diese laut schrie und weinte.
Gerade in dem Augenblicke ritt der Königssohn vorbei, der auf die Jagd gegangen war. Als er nun den schrecklichen Lärm hörte, hielt er sein Pferd an und frug die alte Frau, warum sie das Mädchen so prügle. Die Großmutter aber schämte sich zu sagen, daß ihre Enkelin ihr die Fische aufgegessen hatte, darum antwortete sie: »Königliche Hoheit, meine Enkelin tut den ganzen Tag nichts als spinnen, und spinnt jeden Tag drei Rottoli Flachs. Zu ihrem eigenen Besten muß ich sie schlagen, damit sie nur einmal die Spindel weg legt.«
Als der Königssohn das hörte und das schöne Mädchen ansah, sprach er: »Wenn eure Enkelin so fleißig ist, so will ich sie auf mein Schloß mit nehmen, und sie soll meine Gemahlin werden.« Da nahm er sie mit und brachte sie auf sein Schloß zu seinem Vater, dem alten König, und erzählte ihm alles.
»Gut,« sprach der König, »wenn sie jeden Tag drei Rottoli Flachs spinnen kann, so muß sie in einem Monat sechzig Rottoli zu spinnen im Stande sein. Und wenn sie das vollbracht hat, so soll sie deine Frau werden.« Da führte er das Mädchen in ein großes Zimmer, in dem sechzig Rottoli Flachs lagen, und darin wurde sie eingesperrt, und nur jeden Abend ließ der König sie holen, damit sie an der Abendunterhaltung Teil nehme.
Das arme Mädchen aber weinte Tag und Nacht, denn es konnte ja unmöglich all den Flachs spinnen. Da sie nun eines Tages wieder so saß und weinte, stand auf einmal ein feiner Herr vor ihr, das war aber niemand anders als Meister Paul.
»Warum weinst du?« frug er sie. Da erzählte sie es ihm, und der Teufel antwortete: »Gut, ich will dir all diesen Flachs spinnen lassen, und am letzten Tag des Monats soll er fertig sein. Wenn ich ihn aber wieder bringe und du vermagst mir meinen Namen nicht zu sagen, so gehörst du mir und mußt mir folgen.« Das versprach das Mädchen, und Meister Paul nahm den Flachs mit und verschwand.
Nun sann aber das arme Mädchen Tag und Nacht darüber nach, wie der Fremde wohl heißen möge, und da ihr nichts einfiel, so weinte sie in Einem fort, und wurde mit jedem Tage magerer und trauriger, und wenn sie am Abend zum König geführt wurde, so saß sie still da, sprach nicht und lachte nicht. Dem König aber tat es leid als er sie so traurig sah, und er ließ im ganzen Land verkünden, wer die Braut seines Sohnes zum Lachen bringen könne, dem werde er ein königliches Geschenk machen.
Da kamen von allen Seiten Leute herbei, reiche und arme, und erzählten ihr jeden Abend spaßige Geschichten, aber sie lachte doch nicht, sondern wurde immer stiller, denn es fehlten noch drei Tage bis zum Ende des Monats. Da kam am letzten Abend noch ein altes Bäuerlein zum Schloß und wollte hinauf gehen.
»Was willst du im Palaste des Königs?« frugen ihn die Schildwachen. »Ich weiß eine spaßige Geschichte, die will ich der Braut des Königssohnes erzählen, ob ich sie vielleicht zum Lachen bringe.« »Ach, geh doch, du dummer Bauer, nun ist es bald ein Monat, daß jeden Abend Leute kommen, um die junge Königin zum Lachen zu bringen, und es ist noch Keinem gelungen. Was soll deine einfältige Geschichte nutzen!«
Der Bauer aber schrie immer fort: »Ich will hinauf gehen, vielleicht ist meine Geschichte doch nicht so einfältig.« Als nun der König den Lärm hörte, frug er, was es gebe. Da sagten ihm seine Minister, unten sei ein Bauer, der wolle der jungen Königin eine Geschichte erzählen, und die Schildwachen wollten ihn nicht durchlassen. »Warum denn nicht?« sprach der König, »laßt ihn doch nur heraufkommen.«
Da kam der Bauer herauf und trat vor das Mädchen und sprach: »Excellenz, hört wie es mir ergangen ist. Ich war heute in den Wald gegangen um Holz zu holen, als ich auf einmal einen sonderbaren Gesang hörte, der also lautete:
'Spinnet, spinnet, spinnen wir,
Die schöne Frau erwarten wir,
Spinnet, spinnet, spinnet fleißig,
Besenstiel, so heiß ich.'
Als das Mädchen das hörte, merkte sie gleich, wer da gesungen hatte, und fing in ihrer Freude an laut zu lachen, und wurde gleich munter und gesund. Da machte der König dem Bauer ein schönes Geschenk und entließ ihn voller Freude.
Als nun die Jungfrau wieder in ihre Kammer geführt wurde, sprach der König: »Morgen mußt du mit deinem Flachs fertig sein, und dann wollen wir auch gleich die Hochzeit feiern.« Da setzte sie sich in die Kammer und wartete auf den Meister Paul; um Mitternacht erschien er auch richtig und brachte den Flachs mit, der war wunderschön gesponnen und gehaspelt.
»Hier ist der Flachs,« sprach Meister Paul, »weißt du nun, wie ich heiße?« »Besenstiel heißest du,« rief sie lustig. Da hatte er keine Macht mehr über sie, und verließ sie im großen Zorn. Das Mädchen aber schlief ruhig die ganze Nacht, und als am Morgen der König in die Kammer trat, und den schön gesponnenen Flachs sah, ward er sehr erfreut und sprach: »Nun sollst du auch die Frau meines Sohnes werden.«
Da hielten sie drei Tage Festlichkeiten, und der Königssohn heiratete das schöne Mädchen, und sie blieben glücklich und zufrieden, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
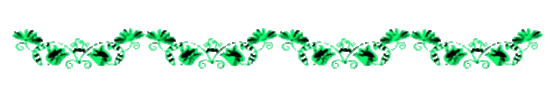
DIE GABEN DES NÖNNLEINS ...

Es waren einmal ein paar arme Leute, die lebten ihre Tage gar kümmerlich dahin. Wie der Vater eines Tages in den Wald auf die Arbeit gehen mußte, sagte er zu seiner Frau: »Wenn die Suppe fertig ist, schicke sie mir durch unser Töchterlein zu.« Die Suppe war gekocht, und die Tochter sollte sie hinaustragen, fürchtete sich aber den Weg zu verlieren.
Da gab ihr die Mutter eine Schürze voll Kleien, sie hinter sich auf den Weg zu streuen, damit sie den Rückweg finde. Wie sie beim Vater war, wehte ein starker Wind und verwehte die Kleien; so fand sie den Rückweg nicht. Es dunkelte bereits, und sie fing an zu weinen und zu sprechen: »Jetzt kommt die Nacht, ich finde mich nicht mehr nach Hause! Ach, was fang' ich an.«
Wie sie gar so sehr weinte, tritt ein Nönnlein daher, tröstet sie und zeigt ihr den rechten Weg, schenkt ihr auch ein Tafeltüchlein und sagt: »Nimm dies, das wird euch in eurer Armut gar gut helfen, denn willst du essen, brauchst du nur zu sagen, was du wohl möchtest.«
Das Mädchen hörte auf zu weinen und machte sich zufrieden auf den Heimweg, und weil sie gerade hungrig war, setzte sie sich an dem Feldrand nieder, verlangte bescheidentlich von dem Tüchlein ein wenig Mehlbrei, Fleisch und Brot, und siehe! das Tüchlein gab ihr alles.
Voller Freude zeigt sie der Mutter die Gabe, ihr die Kraft des Tüchleins rühmend, und da der Vater nach Hause kommt, setzen sie sich alle drei um den Tisch, das Mädchen wünscht Speise und Trank herbei, und sie essen und es bleibt noch in Fülle übrig. So lebten sie von da an herrlich und in Freuden.
Der Bruder des Vaters, ein reicher Geizhals, der die Leute bisher als blutarm gekannt hatte, verwunderte sich jetzt baß über das Leben dieser Familie. Er wollte wissen, wie dies zu gehe, und kam eines Tages und fragte die Frau: »Sag mir doch, wie mag es geschehen, daß ihr auf einmal ein so prächtiges Leben führt, ihr müßt ja goldene Schätze gefunden haben?«
Wie sie im Elend waren, hatte er sie nie besucht, und jetzt, wo er nicht zu fürchten brauchte, daß sie von dem Seinen verlangten, stellte er sich doch, als ob er in der Not wäre, und verlangte Hilfe von dem Bruder, dem er nie welche hatte angedeihen lassen.
Der mochte es nicht glauben, war aber gutmütig genug und erzählte dem reichen Bruder die Geschichte von der Gabe des Nönnchens und zeigte das Wundertüchlein vor. Wie es kam, wer weiß das? Kurzum, der Reiche ließ nicht nach mit Drängen und Drohen, bis er das Tüchlein in der Tasche hatte und es nach Hause trug. So war die Freude der Armen auf einmal aus. Dem Bruder aber gab das Tüchlein nicht her.
Wie nun der Arme eines Nachts mit knurrendem Magen im Bett liegt, erscheint ihm das Nönnlein und macht ihm Vorwürfe, daß er ihre Gabe so leichtsinnig verschenken konnte. Er fängt zu jammern an und erzählt ihr, wie er seinem Bruder, der sich über Hunger beklagte und ihm den ganzen Tag in den Ohren lag, diese seine Bitte um das Tüchlein nicht habe abschlagen können.
»Aber gebt mir ein anderes«, schloß er, »ich werde es besser benutzen. Gebt mir ein anderes, oder wir sterben vor Hunger.« Das Nönnlein neigte sich ihm in Gunst und gab ihm ein zweites Tuch. »Aber«, sagte sie, »das dient dir und deiner Frau und deinem Kinde, sonst niemand mehr. Verschenkst du auch dieses, so erwarte nichts mehr von mir.«
Am nächsten Mittag breiteten sie das Tüchlein über den Tisch, und wiederum hatten sie, was sie wünschten an Speise und Trank. Der Bruder und dessen Frau lagen auf der Lauer, und gar bald wußten sie, woher denen das neue Glück gekommen.
Sofort ging er wieder zu seinem Bruder, und es geschah nochmals, was nicht hätte geschehen sollen: der Bruder zeigte sich verhungert und arm, und der andere, gutmütig wie er denn war, ließ sich von ihm auch das zweite Tuch abschwatzen, und die alte Not begann von neuem.
Zu spät kam ihm die Reue, und er bat das Nönnlein, ihm zu erscheinen, er wolle ihr seine neue Bedrängniß vortragen. Sie kam, war aber bös und sprach: »Du hast gute Geschäfte gemacht! Auch die zweite Gabe hast du verschleudert? Nun will ich nichts mehr von dir wissen.«
Sein Flehen bewegte sie aber doch, und als er fest versprach, daß er nicht wieder so dumm sein werde, sagte sie: »Hier ist ein neues Tüchlein und ein Stock. Kommt dein Bruder wieder und bedrängt dich, auch dieses aus dir heraus zu locken, so befiehlst du dem Stocke und er wird ihm und dir, der in seiner Beschränktheit sein Bestes weg gibt, die Wege weisen. Und damit du lernst, wie es gemacht wird, will ich dir eine Probe geben, verdient hast du sie!«
Sie rief: »Stock, schlag zu!« Und der Stock tanzte auf dem Rücken des Mannes herum, bis er versprach, fort an vernünftiger zu sein. Er hat auch sein Wort gehalten.
Märchen gesagt und Märchen gesungen,
Erzähle jetzt deines, denn meins ist verklungen.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
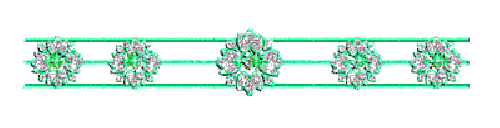
DIE VIER KÖNIGSKINDER ...

Ein König hinterließ bei seinem Tode seinem Sohne den Befehl die drei Schwestern mit dem ersten besten, der um sie anhielte, zu verheiraten. Ein Kaminfeger geht am Palaste vorüber und wird vom neuen König gerufen, damit er den Kamin fege. Statt aber dies zu tun, erklärt der Gerufene, nur gekommen zu sein, um die Schwester des Königs zu freien.
Obwohl widerstrebend, sieht sich der König doch gezwungen nachzugeben. Ähnlich geht es mit der zweiten und dritten Schwester, von denen jene an einen Kesselflicker, diese an einen Regenschirmtrödler verheiratet wird. Alle drei werden unmittelbar nach der Hochzeit von den Gatten unter dem Vorwand einer Spazierfahrt fort geführt, ohne dass der Bruder je Nachricht von ihnen erhält.
Eines Tages spielt der König mit goldenen Kugeln auf der Terrasse des Palastes. Der Zufall will, dass eine der Kugeln einer vorüber gehenden Alten in den Korb fällt und die darin befindlichen Eier zerschlägt. Es hilft Nichts, dass der König den Schaden wieder gut zu machen verspricht. Die Alte wünscht ihm alles Böse an.
Kurz nachher begibt sich der König auf die Reise um sich eine Braut zu holen.
Nicht lange, so kommt er an einen prächtigen Palast, in dem die älteste Schwester wohnt. An einen Zauberer war sie verheiratet; er wird freundlich empfangen, erhält auch, als er erzählt, er sei ausgezogen, um sich die schöne Margarethe zur Frau zu holen, auf der Schwester Bitten von deren Manne, dem König aller Tiere, den aber der Gast in der Tracht des Zauberers nicht sehen darf, eine Nuss zum Andenken, die er im Falle der Not zerbeißen soll.
Unter gleichen Verhältnissen findet er die beiden anderen Schwestern, an die Brüder des Gatten der ältesten verheiratet, wieder. Von dem Manne der zweitältesten Schwester erhält er eine Haselnuss mit derselben Anweisung, im Fall der Not sie zu zerbeißen. Der Mann der jüngsten Schwester gibt ihm eine Mandel, während sie selbst ihm einen Beutel schenkt, in dem sich ein Feuerzeug und ein Lichtchen befindet. Zugleich sagt ihm dieser Zauberer, die Alte mit dem Eierkorbe sei die Mutter der schönen Margarethe gewesen und gibt ihm endlich noch einen Brief an seinen Vater mit.
Dieser Letztere zeigt dann dem Könige den Weg nach dem Palast der schönen Margarethe, sagt ihm auch, wie er sich zu verhalten hat. Den ersten Tag dürfe er nicht sprechen, den zweiten sei ihm dies erlaubt, den dritten kann er den Arm bieten, und den vierten dürfe er küssen.
Im Palast empfing den König die Alte, welche ihm gleich die schöne Margarethe zuführt, mit der er den ersten Tag nicht spricht. Am Abend bringt ihn die Alte in eine Kammer und gebietet ihm, ein in dreihundert Säcken enthaltenes Gemisch von Bohnen, Buchweizen und Weizen zu sortieren.
Dies gelingt auch dadurch, dass, nach dem die Nuss zerbissen und der Befehl, die verschiedenen Fruchtarten auszusuchen, gegeben, Ameisen sich einstellen, um das Geschäft zu verrichten. Am Abend des folgenden wieder nach Vorschrift des Zauberers vom König zugebrachten Tages, wird die Aufgabe gestellt, dreihundert Pfund Schiffszwieback in der Nacht zu verzehren.
Auch dies gelingt mit Hilfe von Mäusen, welche, nach dem der König die Haselnuss zerbissen, herbei kommen. Am Abend des dritten Tages, an dem die gegebenen Vorschriften auch beobachtet worden, ist die Aufgabe, in der Nacht dreißig Schweine zu verspeisen. Das Zerbeißen der Mandel hilft auch hier. Es kommen Adler, welche das Werk verrichten.
Am Abend des vierten Tages endlich bringt die Alte Ferdinand und Margarethe in eine Kammer. In der Nacht soll von ihnen ein Kind erzeugt und geboren werden, das am folgenden Morgen die Alte mit einem: Guten Tag Großmutter, zu begrüssen hat. Als nun die Dunkelheit der Nacht zu erleuchten, Ferdinand Feuer schlägt und das Lichtchen anzündet, erscheint zugleich ein Kind, welches dann am folgenden Morgen den geforderten Gruß ausspricht, worauf die Alte stirbt, aber auch das Kind verschwindet, sobald das Licht ausgelöscht wird.
Italien: Georg Widter/Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
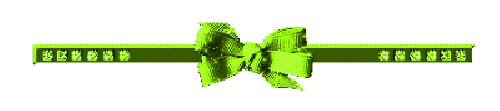
DIE DREI SCHWESTERN ...

Es waren einmal drei Schwestern, die standen ganz allein in der Welt und waren sehr arm. Eines Abends saßen diese armen Mädchen am Herd und plauderten untereinander. Die eine sagte: »Ich möchte die Kammerfrau unseres Königs sein.« Die andere sagte: »Ich möchte Seine Majestät bei Tische bedienen.« »Ich,« sagte die dritte, »möchte die Gemahlin Seiner Majestät sein.« -
Der König ging gerade bei dem Hause vorbei und hörte es. In sein Schloß dann zurück gekehrt, rief er einen Diener und sagte ihm: »Geh zu den drei verwaisten Schwestern so und so und sag ihnen, der König will sie sprechen, sie sollen so gleich vor sein Angesicht kommen.«
Der Diener ging und richtete die Botschaft aus. Die drei Schwestern wurden so bestürzt, daß sie zitterten und nicht wußten, was sie tun sollten. Dann aber faßten sie sich ein Herz und gingen zu dem König. - »Gestern Abend, was spracht ihr da von mir in eurem Hause?« sagte der König. - »Nichts, Majestät.« - »Wie nichts? Lügt nicht! Ich habe alles gehört.« - Da zitterten die Ärmsten wieder sehr. - »Zittert nicht,« sagte der König, »ich will euch Gutes tun, aber sprecht die Wahrheit.« -
Da erzählten sie Punkt für Punkt, was geschehen war und was sie gesagt hatten. Der König aber sagte: »Weil ihr Doppelwaisen seid und anständige und fleißige Mädchen, will ich euch genau das bewilligen, was ihr wünscht.« - Und die erste Schwester machte er zu seiner Kammerfrau, die zweite sollte ihn bei Tisch bedienen, und die dritte machte er zu seiner Gemahlin.
Der König war ein trefflicher Jäger und ging oft auf die Jagd. Nun begab es sich, daß seine Frau guter Hoffnung wurde, und als die Geburt nahe bevor stand, ging der König wieder zum Jagen aus, so daß, als das Kindchen zur Welt kam, der König nicht da war. Es war aber ein sehr schöner Knabe.
Die Schwestern beneideten sie sehr und sprachen unter sich: Wir sind nur Dienerinnen des Königs und unsere Schwester ist seine Frau. Wenn jetzt der König von der Jagd heimkehrt und findet, daß sie diesen wunderschönen Knaben geboren hat, wie viel mehr wird er sie noch lieben. Lassen wir das Kindchen ins Meer werfen, und dem König sagen wir, die Schwester habe ein Hündchen geboren.
So taten sie. Sie nahmen ein Kästchen, wattierten es inwendig aus und schlossen die arme unschuldige Kreatur darin ein und befahlen, das Kästchen ins Meer zu werfen. Dann nahmen sie ein Hündchen und legten es in die Wiege.
Da erscheint der König, der auf die Nachricht von der Niederkunft seiner Frau von der Jagd zurück gekehrt ist, und eilt zur Wiege. Die bösen Schwestern sagen ihm: »Das ist, was deine Gemahlin dir geboren hat« - und zeigen ihm das Hündchen. Als der König es sah, wurde er ganz entsetzt und ließ es fort tun.
Bald darauf kam die Königin wieder in die Hoffnung, und auch diesmal brachte sie einen sehr schönen Knaben zur Welt, als der König gerade wieder auf der Jagd war. Und wieder bringen die bösen Schwestern das Würmchen in einer Schachtel mit Baumwolle unter und lassen es ins Meer werfen, und weisen dem König ein Hündchen vor.
Als der König es gesehen hatte, wurde er so ergrimmt darüber, daß er sagte: »Wenn es zum dritten Mal geschieht, jage ich mein Weib fort.« - Richtig kommt die Ärmste zum dritten Mal nieder, da der König auf der Jagd war, und das Kind ist ein Mädchen schön wie die Sonne. Die schändlichen Schwestern tun mit ihr gerade so, wie sie es mit ihren zwei armen Brüderchen getan hatten, dem König aber, als er von der Jagd kam, zeigten sie diesmal in der Wiege statt eines Hündchens ein Kätzchen.
Als der König das sieht, läßt er augenblicklich einen Maurermeister rufen und seine Frau vollständig einmauern bis an den Kopf, und ließ der Armen täglich nichts anderes reichen, als ein Stück Brot und ein Glas Wasser.
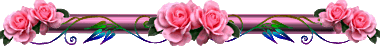
Verlassen wir nun aber das Haus des Königs und sehen einmal, wie es mit den drei armen Geschöpfen steht, die die beiden bösen Schwestern hatten ins Meer werfen lassen. Glaubt ihr, liebe Leute, sie seien wirklich ertrunken? Nicht doch! Nichts von ertrunken. Hört nur, liebe Leute, ob sich nicht recht eigentlich die Gerechtigkeit Gottes hier zeigte.
Als die beiden bösen Schwestern das erste Knäbchen ins Meer zu werfen befahlen, sank das Kästchen, in dem es verschlossen war, nicht unter, sondern schaukelte auf dem Wasser weiter. Ein reicher Kaufmann kommt auf einem Schiffe vorüber, sieht das Kästchen und läßt es auffischen. Er macht es auf, und wie er den wunderschönen Knaben sieht, wäre er fast vor Freude gestorben, denn bei all seinem Reichtum fehlten ihm gerade Kinder. Er nahm also das Kind und hielt es mit großer Liebe und ließ es erziehen, als wenn es sein eigener Sohn gewesen wäre.
Um es euch aber nicht lang und breit weiter zu erzählen, will ich gleich sagen, daß es ebenso, wie mit diesem ersten Knaben, auch mit dem zweiten erging und auch mit ihrem wunderhübschen Schwesterchen. Als der reiche Kaufmann diese fand, war er froher als je und sagte: »Jetzt bin ich Vater von drei Kindern, zwei Knaben und einem Mädchen. Ich kann sie erziehen und unterrichten und sie dann mein ganzes Vermögen erben lassen.«
Die Kinder waren schon heran gewachsen, da brachte sie der Kaufmann zu einem großen Landgut, das er neben anderen besaß, wo ein schönes Schloß stand, und sagte: »Das alles ist mein, aber eines Tages wird es euch gehören. Ihr bleibt jetzt hier; es soll euch an nichts fehlen, und ihr könnt euch so erlustigen, wie ihr wollt.« - Und damit ging er.
Die drei Geschwister blieben in dem Schlosse, und es war eine große Verträglichkeit zwischen ihnen. Die beiden Brüder gingen auf die Jagd, und wenn sie zurück kehrten, ging die Schwester ihnen entgegen und küßte sie vielmals. Die Brüder liebten sie sehr, schenkten ihr die schönsten Blumen, die sie auf dem Felde pflückten, zierliche Vögelchen und Hasen, die sie auf der Jagd fingen.
Eines Tages aber, als das schöne Mädchen allein im Hause war und die Brüder auf der Jagd, kam eine arme Alte in das Schloß, um zu betteln. Sie klopfte an das Tor - top, top, top! - »Wer ist draußen?« fragt das schöne Mädchen. - »Bei den armen Seelen im Fegefeuer, gebt der armen Alten ein Almosen, liebes Fräulein!« - »Komm nur herein, arme Alte,« sagt das gute Mädchen, »hier hast du einen halben Laib Brot!« -
»Wie schön Ihr seid, liebes Fräulein! Selig die Mutter, die Euch geboren hat! Ihr wohnt in diesem Schloß mit solcher Herrlichkeit, Ihr habt so viel Schätze und Reichtümer, aber Ihr kennt Euer Glück noch nicht! Euch fehlen noch drei Dinge: das gelbe Wasser, der singende Vogel und der tönende Baum. Wenn Ihr diese drei Dinge nicht findet, werdet Ihr nie Euer Glück kennen lernen.«
Das Mädchen wurde traurig und weinte, da sie an das dachte, was die Alte ihr gesagt hatte. Am Abend ging sie nicht wie sonst den Brüdern entgegen, als die von der Jagd kamen, und diese sahen, als sie im Schloß angelangt waren, daß sie geweint hatte und traurig war. Sie fragten sie, was sie hätte. Da erzählte ihnen das Mädchen alles, was ihr die alte Bettlerin gesagt hatte.
»Liebe Schwester,« sagte der älteste Bruder, »sei nur getrost, ich werde gehen, das Glück zu finden. Nimm dies weiße Tüchlein. So lange es weiß bleibt, ist es ein Zeichen, daß ich noch lebe; wenn es schwarz wird, bedeutet es, daß ich gestorben bin.« Damit ging er fort.
Er geht und geht und kommt mitten in einen großen Wald, wo ein Häuschen stand, darin die Einsiedler lebten. Als er zu dem Häuschen kam, war es Nacht. Er klopft an. - »Wer bist du, der an die Türe klopft?« fragte ein alter Einsiedler. - »Ich bin ein guter Christ.« - »Wenn du wirklich ein Mensch bist, stecke den kleinen Finger deiner rechten Hand durch das Schlüsselloch, damit ich dich erkennen kann.« -
Der Jüngling tat es, und als er erkannt war, wurde ihm geöffnet. - »Mein Sohn, was suchst du in diesen abgelegenen Gegenden?« fragte der Einsiedler. - »Ich gehe,« antwortete der Jüngling, »um das gelbe Wasser, den singenden Vogel und den tönenden Baum zu suchen.« -
»Ach, lieber Sohn, wohin willst du gehen? Du gehst in den sicheren Tod. Weißt du nicht, daß eine Menge Fürsten und Ritter die dorthin gehen wollten, nie zurück gekehrt sind?« - »Geh es, wie Gott will, ich will hin gehen,« sagte der Jüngling, »und wer weiß, ob das Glück mir nicht zufällt?« -
»Nun wohl,« sagte der Einsiedler, »weil du um jeden Preis dort hin willst, nimm diese Kugel, setze dich darauf, und sie wird dich bis an den Fuß eines Abhanges tragen. Da wird die Kugel stehen bleiben. Dann nimm ein Pferd und reite den Berg hinan, den du vor dir sehen wirst. Bist du bis zur Mitte gekommen, wirst du viel schrecklichen Lärm hören, wie von Ketten in der Hölle. Aber fürchte dich nicht. Reite immer weiter hinauf, und du wirst die Stätte des Glückes finden.
Wenn du aber auf der Mitte des Anstiegs beim Hören jenes Lärms Furcht empfindest, wirst du dort stehen bleiben und mit deinem Pferde zu einem Bilde von Marmor werden.« - »Schön!« sagte der Jüngling. »Ich werde keine Furcht haben.«
Er setzt sich auf die Kugel und fährt ab. Er kommt an den Fuß des Abhanges, wie der Einsiedler ihm gesagt hatte, die Kugel hält an, er steigt zu Pferde und fort im Galopp die Höhe hinan; kommt auch bis zur Mitte, als er aber den Lärm hört, erschrickt er und wird zu einem Marmorbild.
Die Schwester sieht nach dem Tüchlein und findet es schwarz. Da fängt sie an zu weinen und ruft laut: »Bruder! lieber Bruder!« - Der andere hört es und eilt herbei. - »Was hast du, liebe Schwester? Warum weinst du so?« - »Wehe, wehe! Unser Bruder ist tot! Sieh das Tüchlein, das er mir gelassen hat, wie schwarz es geworden ist! Wehe mir! Was sollen wir nun tun, lieber Bruder?« -
»Weine nicht so, liebe Schwester. Ich will gehen, um zu sehen, was ihm zugestoßen ist. Auch ich will den Weg zum Glück zu finden suchen. Nimm hier diesen Rubin. So lang er klar bleibt, wird es ein Zeichen sein, daß ich lebe; wenn er sich trübt, wird es anzeigen, daß ich gestorben bin.« -
So macht er sich auf den Weg und geht fort, und um nicht, was schon gesagt wurde, zu wiederholen, will ich sagen, daß es ihm genau so ging, wie dem anderen. Als er auf dem halben Weg den Berg hinan den Lärm hört, wurde er samt seinem Pferde zu einer Marmorstatue.
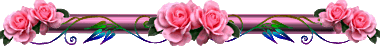
Die arme Schwester fand den Rubin verdunkelt. Stellt euch vor, wie sie weinte, das arme Mädchen. »Was soll nun aus mir werden, da ich allein geblieben bin! Ich Arme, ich Arme!« - Und weinte und weinte. Dann aber sagte sie: »Ich will gehen und sehen, wie es mit meinen Brüdern gegangen ist. Möchte es mir beschieden sein, das Glück zu finden.« - Sie kleidete sich wie ein Mann und ging fort.
Sie geht, geht, geht, kommt gleichfalls in dem Walde zum Hause des Einsiedels, klopft an, steckt den kleinen Finger der rechten Hand durch das Schlüsselloch, und der Einsiedel öffnet ihr und läßt sie eintreten. »Was hast du vor, schöner Jüngling?« sagt er. - »Ich suche das gelbe Wasser, den singenden Vogel und den tönenden Baum.« -
»Oh, lieber Sohn, geh nicht dorthin. So viel Fürsten und Ritter sind hin gegangen und nie zurück gekehrt. Vor wenigen Tagen sind auch zwei Jünglinge hin gegangen, und die Ärmsten! nicht einmal sie sind wieder gekommen.« -
»O, zwei Jünglinge? Das waren meine Brüder. Um so mehr will ich hin gehen und sehen, welches Schicksal meine Brüder gehabt haben, und so will auch ich mein Glück versuchen.« Der Einsiedel, als er sah, daß es unnütz war, ihr abzuraten, sagte ihr: »Nun gut! dann gehe nur!« -
Er gab ihr die Kugel, wie er sie ihren Brüdern gegeben hatte, und sagte ihr alles andere. »Ich werde keine Furcht haben,« erwidert sie. »Ich werde mir Baumwolle in die Ohren stecken und so den Lärm nicht hören, und meine Augen mit einem Tuch fest verbinden, um nichts zu sehen, und so werde ich mich nicht fürchten!« - »Bravo! recht so!« sagte der Einsiedel.
Das schöne Mädchen setzt sich auf die Kugel und fährt ab. Sie kommt an den Fuß der Anhöhe, die Kugel hält an, sie steigt zu Pferde und fort im raschesten Lauf. Sie kommt bis an die Mitte, der Lärm ist wieder da, aber das Mädchen hört nichts, sieht nichts und hat keine Furcht.
Das Pferd aber läuft so geschwind, daß Pfeile es nicht erreicht haben würden, und so kommt sie in weniger als drei Minuten oben an. Da nimmt sie die Baumwolle aus den Ohren und das Tuch von den Augen und sieht eine Kapelle und einen Teich mit gelbem Wasser, das außerordentlich glänzte.
An dem Teich war ein sehr schöner Vogel, der sprang hin und her und sang, daß es eine Lust war, und daneben stand ein Baum, der so schön tönte, daß man nie eine so herrliche Musik gehört hatte. Das war der See der Feen, denn der Vogel, der sang, war nichts anderes als eine Fee.
Als der Vogel auf das gelbe Wasser kam, sang er erst ein wenig und verwandelte sich dann in eine so schöne Jungfrau, daß jeder sich in sie verlieben mußte. Sie näherte sich dem verkleideten schönen Mädchen, das noch zu Pferde saß, und sagte: »Bravo! du warst mutig und hast gesiegt. Ich bin der Vogel, den du suchst, denn ich muß dich begleiten und dir dein Glück bescheren. Steig ab, nimm dies Fläschchen und fülle es mit gelbem Wasser, dann geh zu dem tönenden Baum und brich ein Zweiglein von ihm ab.« -
Das Mädchen gehorchte, und die Fee sagte ihr: »Bewahre Fläschchen und Zweig gut auf. Dann setz dich wieder aufs Pferd, du in der Mitte und ich auf der Kruppe, und dann soll es fort gehen.« So ritten sie zurück, den Abhang hinunter. Und nun hört weiter.
Während sie ritten, erwachten all die Fürsten und Ritter, die zum See der Feen gekommen und aus Furcht zu Marmorstatuen geworden waren, und jeder ritt auf seinem eigenen Pferde hinter dem schönen Mädchen und der Fee hinunter. - »O welch ein Trost!« rief das Mädchen; »siehst du, Fee, daß mein ältester Bruder aufgeweckt ist?« -
»Warte nur ein wenig, und du wirst auch den zweiten sehen.« - »Ja, wirklich! da ist er, auch mein zweiter Bruder ist aufgewacht. Oh welche Freude!« - Und die Brüder ritten sofort zu der Schwester, und alle drei jubelten und freuten sich miteinander, die Fee aber lachte. Dann folgten die Brüder der Schwester zu Pferde mit den anderen Fürsten und Rittern.
Trab, trab, trab kommen sie zu der Hütte des Einsiedels. Ihr könnt Euch denken, wie sehr die Geschwister ihm ihren Dank bezeigten und wie herzlich er sie und alle Fürsten und Ritter empfing, die von seiner Hütte ausgezogen und nicht zurück gekehrt waren. Es war ein förmliches Fest.
Dann verabschiedeten sich die beiden Brüder und die Schwester und reisten ab, und als sie mit der Fee zu ihrem Schloß gekommen waren, schrieben sie sofort an den Kaufmann, der sie wie seine Kinder hielt, und erzählten ihm ihr Glück. Der Kaufmann, der sie schon tot geglaubt hatte, war sehr froh und eilte gleich herbei, sie zu umarmen. -
»Jetzt,« sagte die Fee, »muß man ein großes Gastmahl bereiten und hundert von den größten Fürsten und Rittern einladen und auch den König.« - Und dieser König war gerade der Vater der drei Geschwister. Die Einladung geschah.
Der König wollte nicht hingehen, aber sie baten ihn so lange, bis er es tat. Er wurde von den beiden Brüdern und der Schwester empfangen und sie sagten ihm: »Majestät, wir sind nur arme Waisen, aber gute Leute, und wir wünschen, ihr möchtet uns mit eurer Gegenwart beehren.« - »Sei's denn!« sagte der König, »ich will euren Wunsch erfüllen.«
Man setzte sich an den Tisch, den die Fee gerüstet hatte. Wie glänzte der Eßsaal, in den man das gelbe Wasser gebracht hatte! Und welch ein Saal! Und dann tönte der Zweig von dem Baume, daß es ganz zauberhaft klang. Und die Fee wurde nun ein wunderschönes Mägdlein und bediente bei Tisch, und dann wurde sie ein sehr schöner Vogel und während das Zweiglein tönte, sang sie zum Entzücken. Stellt euch vor, wie herrlich das war!
Gegen Ende des Mahls sagte die Fee:
»Meine Herren, ihr seid hundert Eingeladene, und auf der Tafel sind hundert Gedecke von sehr großem Wert. Sorgt dafür, daß sich keins davon verliert.« - »Gewiß wird sich keins verlieren,« antworteten alle. -
Die Fee geschwinde, geschwinde stiehlt eins und steckt es heimlich dem König in die Tasche. Dann sammelt sie die anderen und zählt sie vor allen, und es finden sich nur neunundneunzig. - »Hier fehlt ein Besteck,« sagte die Fee. »Man muß die Taschen untersuchen, um zu sehen, wer es genommen hat.« - »Gewiß, gewiß!« sagten alle. »Untersucht muß es werden.«
Und erst suchte man in den Taschen der Fürsten und Ritter und fand es nicht. - »Jetzt, Majestät,« sagte die Fee, »muß man auch in euren Taschen suchen, sonst würden sich all die anderen Fürsten und Ritter beleidigt fühlen.« - »Freilich,« sagte der König. »Ihr habt Recht.« - Man suchte in seinen Taschen und fand das Besteck. Stellt euch vor, wie dem König zumute war!
»Nein,« sagte er, »ich habe das Besteck nicht gestohlen, ich bin unschuldig.« - »Es ist wahr,« sagte die Fee, »Ihr seid unschuldig, Majestät; das Besteck habe ich Euch in die Tasche geschoben. Aber wenn Ihr unschuldig seid, ist es auch Eure Frau, die Ihr seit so langen Jahren leiden laßt, da Ihr sie eingemauert haltet. Seht Ihr hier diese lieben Jünglinge und dies reizende Mädchen? Es sind Eure Kinder, und Eure Frau hat sie Euch geboren.« -
Und nun erzählte sie ihm Punkt für Punkt, wie es mit dem Betrug der beiden bösen Schwestern gegangen war, und zum Beweise der Wahrheit ließ sie ihn die beiden Hündlein und das Kätzchen sehen, die sie ihm vorgezeigt hätten statt seiner Kinder. Der König war sehr erstaunt. Dann aber war er sehr erfreut zu hören, daß er Vater von diesen drei lieben und schönen Kindern war, umarmte sie zärtlich und brachte sie sofort in großen Freuden nach seinem Palast.
Dann ließ er die beiden Schwestern ergreifen, ließ sie binden und öffentlich in einem Kessel mit Pech verbrennen. Sein armes unschuldiges Weib aber ließ er aus der Mauer befreien, gab ihr ihre Kinder und hielt sie von nun an immer, wie sie es verdiente, als Königin.
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
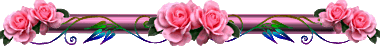
DIE BÖSE GRÄFIN ...

Es waren einmal zwei Schwestern, davon war die eine elend und arm, die andere reich und glücklich, denn sie war eine Gräfin. Die Arme hatte drei Töchter, die Reiche eine einzige, die war aber häßlich wie die Nacht.
Eines Tages wurde die Arme, da sie kein Geld hatte die Miete zu zahlen, auf die Straße gesetzt. Die Zofe der Gräfin sah sie stehen, ging zu ihrer Herrin, erzählte es und bat sie so lange, bis diese erlaubte, die Obdachlosen in einer Rumpelkammer unter der Treppe zu beherbergen. Am Abend setzten sich die drei Mädchen unter die Laterne der Haustür und arbeiteten da, denn sie konnten kein Öl ins Lämpchen kaufen. Wie das die böse Gräfin hörte, befahl sie, die Laterne zu löschen. Nun spannen und webten die Mädchen nur noch im Mondlichte.
Eines Abends wollte die Mittlere arbeiten bis zum Monduntergang, und immer fort spinnend ging sie dem Mond nach. Unterwegs kam ein Unwetter und scheuchte sie in ein nahes großes Haus. Dort fand sie zwölf Brüder. Die fragten sie: »Wie bist du hier her gekommen, meine Tochter?« Und sie erzählte ihre Geschichte.
Da sagte der älteste und wünschte ihr: »Daß du noch immer an Schönheit wachsen mögest!« Der zweite: »Daß dir beim Kämmen Perlen und Granaten aus den Haaren fallen mögen!« Der dritte: »Daß dir beim Waschen allerlei Fische aus den Händen hervor schlüpfen mögen!« Der vierte: »Deine Worte sollen zu allerlei duftenden Blumen werden!« Der Fünfte: »Die Arbeit soll dir schneller von statten gehen als jeder anderen!« Der sechste: »Deine Wangen sollen gleich zwei roten Äpfelchen leuchten!«
Darauf wiesen sie ihr den Weg und rieten ihr, sich auf des Weges Mitte noch einmal um zu sehen. Das tat sie und wurde nun noch schöner denn zuvor.
Zu Hause angekommen, nahm sie eine Schüssel, wusch sich, und da füllte sich die Schüssel mit köstlichen Aalen, die sprangen und schlangen sich, als ob sie eben erst gefangen worden wären. Wie staunten Mutter und Schwestern, und mehr noch, als sie die Geschichte erfuhren.
Sie kämmten ihr die Haare, da fielen Perlen und Edelsteine heraus, die lasen sie auf und brachten sie der Gräfin. Die wußte nicht, was sie denken sollte, doch als auch sie die Geschichte gehört, beschloß sie, ihre Tochter hin zu schicken, damit ihr die gleiche Gaben verliehen würden.
Am Abend setzte sich die Tochter auf den Balkon, und als der Mond untergehen wollte, stand sie auf und ging ihm nach. Wirklich kam sie auch an das Haus, wo die zwölf Brüder wohnten, und trat hinein. Die Brüder erkannten sie und der älteste wünschte ihr: »Daß du noch häßlicher werden möchtest, als du bereits bist!« Der andere: »Daß deine Worte sich in Schmuz und Kot verwandeln!« Der dritte: »Beim Kämmen sollen deinen Haaren Schlangen und Nattern entfallen.« Der vierte: »Wenn du dich wäschst, sollen unter deinen Händen giftige Würmer entstehen.« Und so fort.
Darauf schickten sie das Mädchen heim. Die Gräfin hatte die Rückkehr der Tochter kaum erwarten können. Sie lief ihr voll Freude entgegen. Wie groß aber war ihr Schreck, da die Tochter um so viel häßlicher denn zuvor nach Hause kam. Sie fragte, wo sie gewesen, und da jene zu sprechen anfing, verbreitete sich als bald ein übler Geruch. Die Gräfin wollte verzweifeln. -
Das schöne Mädchen saß eines Tages vor der Tür, als der König vorüber kam, sie sah und als bald in heftiger Liebe für sie entbrannte. Er wollte sie zur Braut haben, sprach mit der Gräfin darüber, sie konnte nicht Nein sagen, und so reisten sie am nächsten Tage nach der Stadt des Königs ab, begleitet von der bösen Gräfin.
Ehe sie die Stadt erreichten, stieg der König aus, um voraus zu eilen und den Empfang bereiten zu lassen. Da faßte die Gräfin den bösen Gedanken, der Schönen die Augen auszukratzen, sie in eine Höhle zu stecken, ihre Tochter an deren Stelle zu setzen und sie dem Könige zu zu führen. Und so geschah es.
Wie der König die häßliche Braut sah, erschrak er. Er fragte sie, und kaum tat sie den Mund auf, so verbreitete sich jener böse Geruch. Er fragte die Gräfin: »Wie geht das zu?« Und diese antwortete: »Herr König, Eure Braut ist unterwegs verhext worden.« Das wollte er jedoch nicht glauben und warf die Gräfin ins Gefängniß. -
Unterdessen schmachtete die wirkliche Braut in der Höhle, jammerte und rief um Hilfe. Ein alter Mann ging vorbei, und als er jene Stimme hörte, trat er herzu, fand die Unglückliche und führte sie mit sich in sein Haus. Dort angekommen, mußte der Alte ihre Diamanten verkaufen, und von dem Gelde befahl sie ihm, zwei Körbe mit Rosen zu füllen.
»Geh mit diesen Rosen«, sagte sie, »unter die Fenster des Königs und sage, daß du für die Rosen Augen eintauschen wollest.« So tat der Alte, eine Frau rief ihn und gab ihm für die Rosen ein Auge. Das brachte er dem Mädchen, und dieses wurde auf einem Auge sehend. Am nächsten Tage wiederholte sich das selbe, und nun sah sie auf beiden Augen.
Jene Frau war die böse Gräfin, sie gedachte den König doch noch zu betrügen, in dem sie ihn glauben machen wollte, der Duft der Rosen käme aus dem Munde ihrer Tochter. Das half ihr aber nichts.
Kaum hatte die rechte Braut ihr Augenlicht wieder, so machte sie sich daran, ein Tuch zu sticken, und stickte in die Mitte des selben ihr Bild. Das Tuch hängte sie in der Nähe des Königspalastes auf. Der König kam vorüber, sah das geliebte Bild und ließ den Alten rufen, von ihm zu erforschen, wer dies Tuch gestickt habe.
Der Alte berichtete alles und führte den König selbst zu der Schönen. Da erkannte er seine Braut und nahm sie mit sich in das Schloß. Jetzt wurden sie glücklich, alles Leid war vorbei; die böse Gräfin aber mußte mit ihrer Tochter im Gefängnisse verschmachten.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
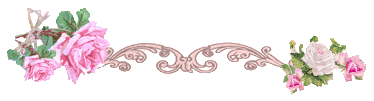
DIE DREI ORANGEN ...

Es war einmal ein König, der einen Sohn hatte, der immer ernsthaft war. Niemals war es gelungen, ihn zum Lachen zu bringen. Nachdem man alles versucht hatte, ihn zu erheitern, beschloß man, drei große Ölfässer aufzustellen, wo das Volk hin gehen und das Öl aus den Quellen schöpfen könnte.
Als der dritte Tag gekommen war und das Öl nur noch in kleinen Tropfen heraus floß, kam eine Alte mit einem Fläschchen, das zu füllen ihr nur mit großer Mühe gelang. Als sie sich dann anschickte zu gehen, warf ihr der Prinz vom Fenster aus einen Ball gegen das Fläschchen, das zersprang.
Der Prinz lachte, als das Glas zerbrach und das Öl hinaus lief. Da blickte die Alte zu ihm hinauf und rief: »Du wirst keine Ruhe finden, bis du die Schöne der drei Orangen gefunden hast!« – Von diesem Augenblick an wurde der Prinz von neuem ernst. Als der Vater eines Morgens aufstand und den Sohn suchte, fand er einen Brief, in dem stand, daß er abgereist sei, um die Schöne der drei Orangen zu suchen.
Der Prinz geht und geht, und nachdem er viele Länder durchwandert hatte, kam er endlich zu einem Häuschen und fragt, wo er die Schöne der drei Orangen finden könnte, und hört, es sei nicht mehr weit, sie sei aber bewacht von einem Menschenfresser, der, wenn er die Augen geschlossen habe, wache, wenn er sie offen haben, schlafe.
Als er zu dem Ort gelangt war, hielt er sich an die Weisung und nahm die drei Orangen, ohne daß der Menschenfresser sich rührte und es merkte. Er öffnete eine, und herauskam ein wunderschönes Fräulein und bat, Kleider zu erhalten. Der Prinz hatte dafür nicht gesorgt, und die Schöne verschwand.
Er kaufte ein sehr reiches Kleid und öffnete die zweite Frucht. Aus der kam eine andere Dame, die schöner noch war als die erste, und bat um Kleider. Als sie aber ganz angezogen war, fehlte ihr der Kamm. An den hatte der Prinz nicht gedacht, und die Schöne verschwand.
Endlich öffnete er die dritte, aus der kam wieder eine Dame, die schöner war als die beiden anderen, und wünschte gekleidet zu werden. Das geschah, und sie bat um den Kamm. Auch den gab ihr der Prinz, und da nun nichts mehr fehlte, beschloß er, sie an den Hof zu führen, doch scheint es ihm nicht anständig, zu Fuß mit ihr zu gehen, und so sagt er:
»Ich will gehen und schöne Wagen holen. Wo soll ich dich in des lassen?« – Sie erhebt die Augen und sieht einen dicht belaubten Baum. »Gut!« sagt sie; »ich werde dort hinauf steigen und in dessen mich kämmen.« So tat sie und fing an, sich zu kämmen. Der Prinz aber nahm sein ganzes Gefolge mit sich.
Nun war unter dem Baum ein Brunnen und ganz nah dabei ein Häuschen, wo drei sehr häßliche Schwestern wohnten. Die Älteste nahm den Eimer und ging zum Brunnen, Wasser zu schöpfen, in dem sich das Bild der Prinzessin spiegelte. Als sie den Eimer hinauf zog, sah sie dies schöne Bild, glaubte, es sei ihr eigenes, ließ den Eimer fallen und ging weg.
Als sie nach Hause kam, sagte sie: »Alle sagen mir, ich sei häßlich, und bin doch so schön. Das Wasser habe ich nicht schöpfen wollen.« – Die zweite machte es ebenso wie die Älteste. Die Jüngste, schlauer als beide, hob den Kopf, sah die schöne Prinzessin auf dem Baum, und sagte rasch: »Signora, ich werde kommen, Sie zu kämmen,« – und stieg hinauf.
Dann begann sie mit dem Kämmen und als sie fertig war, stieß sie ihr eine Nadel in den Kopf, worauf die Prinzessin eine schöne Taube wurde und davon flog. Die Häßliche aber zog ihre Kleider an.
Als der Prinz mit seinem ganzen Gefolge kam und sie sah, konnte er nicht glauben, daß er die, die er so schön gesehen, nun so häßlich fand. Alle Minister sahen sich an und lächelten, da sie sich nicht vorstellen konnten, wie die Beschreibungen des Prinzen von dieser großen Schönheit in einem Augenblick sich so verändert haben sollte. Sie fragten die Prinzessin, wie das gekommen sei, und sie sagte, da sie auf dem Baum in der Sonne gesessen habe, sei sie von ihr verbrannt und ganz verändert worden.
Als sie nach dem Palast gekommen waren, wurde ein prachtvolles Mahl veranstaltet. Sie mußten aber, da sie bis zum Braten gelangt waren, vergebens warten. Der Koch wurde gerufen und erklärte, der Braten sei verbrannt.
Ans Fenster sei eine Taube geflogen, die habe gesagt: Guten Tag, Herr Koch! – Er habe geantwortet: Guten Tag, Frau Taube! – Und sie darauf: Der Braten soll euch verbrennen, damit Serafine nicht davon essen kann. – »Dreimal,« sagte der Koch zum Prinzen, »habe ich den Braten wieder ans Feuer gestellt, aber jedesmal ist er verbrannt.«
Darauf sagte der Prinz zu der Braut: »Geht hinunter und fangt die Taube und bringt sie hier her!« – Die Braut aber wollte nicht, und da ging der Koch, und es glückte ihm, die Taube zu fangen und sie auf die Tafel zu bringen. Sofort ging sie nach dem Teller der Prinzessin und schüttete ihr von dem, was darauf lag, aufs Kleid, so daß sie wütend schrie und die Taube weg jagen wollte.
Der Prinz aber nahm sie und streichelte sie und fühlte dabei, daß ihr Köpfchen ein wenig geschwollen war. Als er die Geschwulst berührte, sah er, daß es eine Nadel war, zog sie heraus, und sogleich wurde die Taube wieder die Schöne von den drei Orangen, die seine Braut war.
Die Häßliche aber wurde auf dem Stadtplatz in einem Hemd von Pech verbrannt, die Schöne aber wurde glücklich mit ihrem Prinzen.
Sie führten ein fröhliches Leben,
Mir aber haben sie nichts gegeben.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen

DIE BEIDEN FÜRSTENKINDER VON MONTELEONE ...

Es war einmal ein Fürst, der Fürst von Munteleone. Der lebte mit seiner Gemahlin in einem herrlichen Schloß, war unermeßlich reich, und hatte alles was sein Herz begehrte. Dennoch waren sie Beide stets traurig, denn sie hatten keine Kinder.
»Ach,« dachten sie oft, »wem sollen wir denn alle unsere Schätze einmal hinterlassen?« Endlich, nach langen Jahren, hatte die Fürstin Aussicht ein Kind zu bekommen. Da ließ der Fürst in einer einsamen Gegend einen Turm ohne Fenster bauen, und ließ ihn herrlich ausstatten mit kostbaren Möbeln. Die Fürstin aber ließ sich gar nicht mehr sehen.
Als nun ihre Zeit kam, gebar sie einen Sohn und eine Tochter. Die ließ der Fürst in aller Stille taufen, nahm eine Amme, und schloß sie mit den Kindern in den Turm ein. Dort gediehen nun die Kinder, und wuchsen einen Tag für zwei, und wurden immer schöner. Als sie größer wurden, schickte ihnen der Vater einen Kaplan, der lehrte sie lesen, schreiben und alles was zu einer guten Erziehung gehört.
Nach einigen Jahren wurde die Fürstin krank und starb. Bald darauf wurde auch der Fürst schwer krank, und da er fühlte, daß es mit ihm zu Ende gehe, ließ er den Kaplan rufen und sprach zu ihm: »Ich fühle, daß ich jetzt sterben muß: dir empfehle ich meine Kinder an. Du sollst ihr Vormund sein und all mein Vermögen für sie verwalten. Laß sie aber den Turm nicht eher verlassen, bis sich eine gute Gelegenheit findet sie zu verheiraten.«
Der Kaplan versprach für die Kinder zu sorgen, wie wenn sie seine eigenen wären, und bald verschied der Fürst. Nun versiegelte der Kaplan alle die Schätze im Schloß, zog zu den Kindern in den Turm, entließ die Amme, nach dem sie hatte versprechen müssen niemanden von den Kindern zu erzählen, und lebte nun allein mit ihnen in der Einsamkeit.
Die Kinder wurden von Tag zu Tag schöner, und lernten auch fleißig. Wenn nun in den Büchern die Rede auf fremde Länder und Städte kam, verwunderte sich der Knabe sehr, und wollte gern wissen, wie die Welt beschaffen sei, und je älter er wurde, desto mehr erwachte in ihm der Wunsch auszuziehen und die Welt zu sehen.
Als er nun ein schöner Jüngling geworden war, trat er vor dem Kaplan, und sprach zu ihm: »Onkel, laßt mich hinaus, denn ich will die Welt kennen lernen.« Der Kaplan wollte es anfangs nicht zugeben, aber der junge Fürst bat so lange, daß er endlich nachgeben mußte.
Da ließ er ein wunderschönes Schiff bauen und bemannen, und füllte es mit kostbaren Schätzen, darauf sollte der Jüngling verreisen. Als er nun von seiner Schwester Abschied nahm, schenkte er ihr einen Ring mit einem kostbaren Stein, und sprach: »So lange der Stein klar ist, so lange bin ich gesund und werde zu dir zurück kehren; wenn aber der Stein trüb werden wird, dann bin ich tot und kann nicht zurück kehren.«
Darauf umarmte er sie, bestieg sein Schiff und reiste ab. Alles schien ihm schön, der Himmel, die Sonne, die Sterne, die Blumen, das Meer, alles war ihm unbekannt und alles freute ihn.
Nach dem er einige Tage gefahren war, kam er in eine schöne Stadt, darin wohnte der König. Als er nun in den Hafen einfuhr, fing er an zu schießen. Das hörte der König, wurde neugierig und fuhr an die Marine, und da er das schöne Schiff sah, bekam er Lust an Bord zu steigen. Dort wurde er von dem jungen Fürsten wohl empfangen, und er gewann den schönen und edelen Jüngling so lieb, daß er ihn mit ans Land und auf sein Schloß nahm, ihn hoch in Ehren hielt und zu seinem steten Begleiter machte.
Ins Theater, auf den Ball, überall nahm er ihn mit. Unter seinen Ministern aber waren Manche neidisch auf die Gunst, die er dem Jüngling erwies, denn die neidischen Menschen fehlen nirgends auf der Erde.
Als sie nun eines Tages bei dem König versammelt waren, erzählte der junge Fürst von seiner Schwester, die so schön sei, und die noch nie eines Mannes Auge erblickt habe, und rühmte ihre große Tugend. Darüber zuckte nun einer der Minister die Achsel, und meinte es gälte eben nur einen Versuch, und er wette es würde ihm gelingen.
Ein Wort gab das andere, und endlich gingen der Minister und der Jüngling die Wette ein, derjenige aber, der die Wette verlor, sollte gehängt werden. Nun bestieg der Minister ein Schiff, und nach dem er lange nach dem Orte Monteleone geforscht hatte, kam er endlich dahin.
Als er sich aber dort nach der Tochter des verstorbenen Fürsten erkundigte, lachten ihm alle ins Gesicht, und meinten der Fürst und die Fürstin seien ja ohne Kinder gestorben, und wie viel er auch fragen mochte, sie konnten ihm keine Auskunft geben. Da wurde er sehr bange, und fing an für sein Leben zu fürchten.
Als er nun so mißmutig durch die Straßen schlenderte, bettelte ihn eine arme Frau an. Er wies sie hart ab, sie aber frug ihn nach der Ursache seines Mißmutes. Endlich erzählte er ihr denn, wie er die junge Fürstin von Monteleone nicht finden könne, und welche Wette er eingegangen sei. »Wenn mir Jemand helfen könnte,« rief er, »ich wollte ihn reich belohnen.«
Die Frau aber war niemand anderes, als die Amme der beiden Kinder. Da ihr nun der Minister eine so reiche Belohnung versprach, ließ sie sich bestechen, und sprach: »Kommt morgen an diesen selben Ort, so will ich euch helfen.« Den nächsten Morgen machte sich die falsche Frau auf den Weg nach dem Turm, und pochte dort an.
Zufälligerweise war der Kaplan zur Stadt gegangen und das Mädchen allein im Haus. Als sie nun das Mädchen sah, sprach sie: »Liebes Kind, ich bin deine frühere Amme, und bin gekommen dir einen Besuch zu machen.« Da ließ das Mädchen sie hinein, und die Alte schritt durch die Zimmer und betrachtete alles ganz genau.
Als sie nun in das Schlafzimmer des Mädchens kamen, sprach sie: »Komm, liebes Kind, ich will dich hübsch ankleiden.« Das Mädchen aber hatte ein Muttermal auf der Schulter mit drei goldenen Härchen, die waren mit einem Fädchen geflochten. Auch trug sie den Ring ihres Bruders am Schnürleibchen fest genäht. Wie nun die Alte sie ankleidete merkte sie sich genau die Form des Muttermales, und entwendete ihr auch unbemerkt den Ring.
Dann verließ sie sie, und kehrte eilig zum Minister zurück, dem sie alles erzählte, was sie sich gemerkt hatte, und ihm auch den Ring gab. Nun kehrte der Minister eilig in sein Land zurück, trat vor den König und erzählte: »Ich habe die Wette gewonnen, so und so sieht es im Hause aus; auf der Schulter hat die Fürstin ein Muttermal mit drei goldenen Härchen, die mit einem Fädchen geflochten sind, und diesen Ring hat sie mir geschenkt.«
Da das der junge Fürst hörte, konnte er nichts erwidern, aber er wurde auch von einem heftigen Grimm gegen seine unschuldige Schwester erfüllt. »Wohl,« sprach er, »ich bin bereit zu sterben, und bitte nur um acht Tage Frist.« Der König, der sehr traurig war über das Schicksal seines Lieblings, gewährte ihm die Frist, und nun rief der junge Fürst seinen treuen Diener Franz herbei, und sprach zu ihm:
»Du hast mir bisher so treu gedient, nun mußt du auch meinen letzten Befehl erfüllen. Eile zu meiner nichtswürdigen Schwester, töte sie und bringe mir ein Fläschchen von ihrem Blut, daß ich es trinke, so werde ich freudig sterben.« Der Diener war sehr betrübt über diesen Auftrag; er mußte aber gehorchen und reiste also nach Monteleone.
Wie ihn die junge Fürstin sah, und bemerkte wie traurig er war, frug sie ihn nach der Ursache. »Ach,« erwiderte Franz, »ich muß euch töten, denn ihr habt eine schwere Sünde begangen und euretwegen muß mein armer Herr sterben.« »Was habe ich denn getan?« frug das arme Mädchen. »Wie? habt ihr nicht den Minister des Königs bei euch empfangen, und ihm sogar den Ring eures Bruders geschenkt?« -
Da merkte sie erst, daß der Ring fort war, und ihr Verdacht fiel gleich auf die Amme, die ihr wenige Tage vorher beim Ankleiden geholfen hatte. Nun warf sie sich dem Kaplan zu Füßen und rief: »Lieber Onkel, laßt mich ziehen, ich muß gehen und meinen Bruder retten.« »Ach Kind,« erwiederte der Kaplan, »das kann dir ja nimmer gelingen!« Sie aber bat so lange, bis er seine Einwilligung dazu gab.
»Nun, lieber Onkel,« fuhr sie fort, »müßt ihr mir die schönsten Perlen und Edelsteine meiner Mutter holen.« Der Kaplan ging hin, füllte ein Kistchen mit den edelsten Steinen und kostbarsten Perlen, und die Jungfrau machte sich mit Franz auf den Weg nach der Residenz. »Nun mußt du mir ein Zimmer in einem Wirtshaus mieten,« sprach sie, »dann töte einige Hühner, bringe meinem Bruder ein Fläschchen Blut und sage ihm, du hättest seinen Befehl erfüllt.«
Franz tat alles was seine Herrin ihm befahl, und als der junge Fürst das Blut getrunken hatte, kehrte er ins Wirtshaus zurück. Nun mußte er die Fürstin zum besten Goldschmied der Stadt begleiten, zu dem sprach sie: »Meister, aus diesen Perlen und Edelsteinen müßt ihr mir binnen drei Tagen eine Sandale machen, so kostbar, wie ihr nur könnt.«
Der Meister nahm sogleich eine Schaar neuer Gesellen, die Tag und Nacht arbeiten mußten, und binnen drei Tagen war die kostbare Sandale fertig. Zu gleich waren die acht Tage verronnen, und der arme junge Fürst sollte zum Galgen geführt werden. Nun ließ seine Schwester eine kleine Tribüne errichten, an dem Weg auf dem ihr Bruder zum Tode geführt werden sollte, und setzte sich darauf; vor ihr auf einem silbernen Teebrett lag die Sandale.
Als nun der Zug des Weges gezogen kam, wartete sie bis der König in seinem Wagen vorbeifuhr, und rief: »Königliche Majestät! Ich flehe um Eure Gerechtigkeit und Euren Schutz.« »Was ist denn dein Begehr?« frug der König. »Einer Eurer Minister hat mir eine Sandale gestohlen, die zu dieser hier gehörte, und der dort ist der Dieb.«
Damit wies sie auf den Minister, durch dessen Schuld ihr Bruder den Tod erleiden sollte. »Wie!« rief der Minister, »ich soll euch eine Sandale gestohlen haben? Wenn ich euch nun noch einmal sehe, so habe ich euch zum zweiten Mal gesehen.« »O Nichtswürdiger,« rief nun die Fürstin, »wenn du mich nicht einmal kennst, wie kannst du dich denn rühmen meine Gunst genossen zu haben? Ich bin die Schwester des Unglücklichen, der um deiner Verleumdungen willen den Tod erleiden soll.«
Als der König das hörte, befahl er sogleich den jungen Fürsten zu befreien; der Minister aber wurde ergriffen und an dem selben Galgen aufgehängt. Die beiden Geschwister führte der König auf sein Schloß, und weil das Mädchen so schön war, nahm er es zu seiner Gemahlin. Da ließen sie ihre Schätze kommen, und der Kaplan mußte auch zu ihnen ziehen. So lebten sie denn vergnügt und glücklich, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

DIE DREI MÄRCHEN DES PAPAGEIEN ...

Es war einmal ein reicher Kaufmann, dem kam die Lust sich zu verheiraten, und er fand denn eine Frau, die war so schön wie der junge Tag, so gütig wie die Sonne, und liebte ihren Mann über alle maßen.
Eines Tages kam der Kaufmann verdrießlich nach Hause, die Frau wollte wissen, was er habe. Er seufzte und sprach: »Ich muß eine weite Reise in Geschäften machen und soll dich hier allein zurück lassen, das verstimmt mich.« - »Wenn es weiter nichts ist«, sagte die Frau, »das ist nicht schlimm. Ihr schafft mir an, was ich zu essen und zu trinken brauche, laßt alle Türen und Fenster, bis auf eines hoch in der Mauer, vernageln, richtet an der Tür eine Drehscheibe ein und reist unbesorgt ab: es kann mir nichts geschehen.«
Der Rat gefiel dem Gemahl, er ließ Brot, Öl, Wein, Mehl und alles Nötige ins Haus schaffen, vernagelte Türen und Fenster bis auf eins, um Luft zu schöpfen, und richtete eine Drehscheibe ein, wie man sie in den Klöstern sieht. Dann hat er Abschied genommen und ist abgereist. Die Frau aber blieb allein mit der Magd zurück.
Es war eine Woche verstrichen, die Frau hatte nichts getan als geweint, und das Herz tat ihr weh. Die Magd suchte sie zu trösten und sprach: »Was wollt Ihr weiter weinen? Ich weiß Euch eine Zerstreuung. Rücken wir den Tisch unters Fenster und blicken wir ein wenig auf die Straße hinab.« Die Frau war es zufrieden, sie zogen den Tisch heran und sie lehnte sich weit zum Fenster hinaus.
Das tat ihr wohl und ein lautes »Ah« kam aus ihrem Munde. Gegenüber dem Fenster aber war die Schreibstube eines Notars, der gerade mit einem Edelmann vor der Tür stand. Wie sie das »Ah« hörten, wenden sie sich, schauen zur Höhe und erblicken die junge Frau. »Oh, welch schönes junges Blut«, rief der Edelmann, »die muß ich sprechen.« - »Hoho!« rief der Notar dagegen, »zu erst werde ich sie sprechen.« Zu erst ich, zu erst du, so ging es herüber und hinüber, und das Ende war, daß sie vierhundert Goldstücke wetteten, wer der erste sein werde.
Die Frau am Fenster merkte, um was es sich handelte, und zog sich als bald zurück, und ihr Gesicht zeigte sich nicht mehr. Der Edelmann und der Notar hatten keine Ruhe, jeder dachte die Wette zu gewinnen, und jeder sann auf Mittel, die Frau zu erst sprechen zu können.
Der Notar lief hinaus aufs Feld, seinen Vetter, den Teufel, zu rufen. Der läßt sich nicht lange bitten, und wie ihm der Notar voller Hast seine Geschichte erzählt hat, fragt er ihn: »Was gibst du mir, wenn ich dir helfe?« - »Meine Seele!« rief der Notar. -
»Die Seele? Gut, das ist deine Sache, jetzt verwandle ich dich in einen Papageien. Da fliegst du und fliegst auf das Fenster jener Frau. Die Magd wird dich fangen und ihrer Herrin bringen, und die wird dich in einen schönen Käfig stecken. Was den Edelmann betrifft, so gib wohl Acht, der wird eine Alte zur Frau schicken, die muß locken und suchen die junge Frau aus dem Hause zu bringen.
Das darfst du nimmer mehr geschehen lassen, du mußt ihr schmeicheln und fein bitten: 'Liebe Mutter mein, bleib hier, setz dich hier, daß ich dir ein Märchen erzähle.' Dreimal wird die Alte kommen und jedesmal mußt du dich ganz ungebärdig stellen, mußt zappeln und schreien, dir die Federn ausraufen und rufen: 'Bleib, bleib! Die Alte will dich betrügen, bleib, ich will dir ein Märchen erzählen!'
Dann erzählst du ihr, was dir gerade einfällt.« Darauf verwandelte er den Notar in einen Papageien, der hob sich auf und flog geradeswegs in das Fenster der Kaufmannsfrau. Es geschah, wie der Teufel gesagt hatte: die Magd fing den Vogel, übergab ihn der Herrin und diese liebkoste ihn und sprach: »Welch schöner Vogel bist du, nun werde ich nicht mehr traurig sein!« Der Papagei antwortete: »Oh du Schöne, auch ich liebe dich!«
Inzwischen zerbrach sich der Edelmann den Kopf, wie er es anfange, die Frau zu sehen. Da begegnet ihm eine Alte, die fragt ihn: »Was habt Ihr, schöner Herr?« Unwirsch antwortete der Edelmann: »Ach, was geht das dich an. Laß mich in Frieden.« Da er aber weiter gehen wollte, hielt ihn die Alte fest und ließ ihn nicht, bis er, um nur los zu kommen, ihr die ganze Geschichte erzählte.
Da lacht die Alte und sagt: »Die Frau wollt Ihr sprechen? Dazu kann ich Euch schon verhelfen. Laßt einmal fürs erste zwei Körbe mit schönen Früchten füllen.« Das tat der Edelmann, und nun ging die Alte mit den Früchten an die Tür der Frau, rief und gab sich für die Großmutter aus. Die junge Frau glaubte ihr, ein Wort gab das andere, und so sagte sie als Großmutter zur Enkelin: »Wie schade, du bist immer eingeschlossen, aber des Sonntags hörst du doch wohl die Messe?«
Die Junge seufzte: »Wie kann ich die Messe hören, da ich hier eingesperrt bin?« - »Höre, meine Tochter«, gegen redete die Alte, »die Sache geht nicht gut, du versündigst dich, Sonntags mußt du ohne Zweifel die Messe hören, und da heute Festtag ist, laß uns sogleich gehen.« Die Frau war noch unschlüssig, da fing der Papagei zu schreien an, und wie sie die Kleiderlade öffnete, um die Festkleider heraus zu nehmen, rief er mit bittender Stimme: »Schöne Frau, bleib, bleib! Die Alte will dich betrügen, bleib, ich erzähle dir ein Märchen.«
Die Sache kam der Frau jetzt selbst verdächtig vor, sie senkte den Kopf und sagte: »Geht, Großmutter, ich kann unmöglich mit Euch kommen.« Und die Alte ging fort. Wie sie fort war, setzte sich die Schöne zu dem Vogel; der strich seine Federn zu recht und fing an zu erzählen.
Des Papageien erstes Märchen
Es war einmal ein König, der hatte eine einzige Tochter, und diese Tochter liebte es, mit Puppen zu spielen. Eine von diesen Puppen hatte sie vor allen anderen lieb, sie zog sie an und aus, legte sie zu Bett und sorgte für sie wie für ein Kind.
Eines Tages geht der König hinaus aufs Land, die Tochter geht mit, nimmt aber ihre Puppe mit sich, und nach dem sie gespielt hatte, legt sie sie aus der Hand. Da es Essenszeit war, ging man zu Tische, und bald darauf fuhr der König und die Prinzessin wieder nach dem Schlosse zurück: die Puppe hatte sie vergessen.
Erst in dem Schlosse erinnert sie sich ihrer, da kehrt sie schleunigst um, die geliebte Puppe zu suchen. Wie sie nun vor das Tor kam, wußte sie keine Straße und verirrte sich. Ohne zu denken lief sie über Berg und Tal und ward ganz und gar verwirrt.
Endlich kam sie zu einem königlichen Palast. Sie fragte den Pförtner, welcher König hier wohne, und der antwortete: »Der König von Spanien.« Da bittet sie um Herberge und tritt vor den König. Der gab ihr denn Wohnung und alles, und weil er selbst keine Kinder hatte, hielt er sie wie seine Tochter und gab ihr Erlaubnis, zu tun und zu lassen, was sie nur wolle.
So waltete sie bald im Schlosse wie eine Herrin; der König gab ihr auch zwölf Edelfrauen zu ihrem Dienste. In den Herzen der Edelfrauen entstand gar bald Neid und Missgunst, und unter sich sprachen sie: »Wissen wir denn eigentlich, wer diese Fremde ist? Die soll unsere Herrin sein? Das dürfen wir nicht gestatten.«
Am anderen Morgen traten sie zu dem Königstöchterlein und sagten: »Wollt Ihr nicht ein wenig mit uns kommen?« - »Ich darf nicht«, sagte jene, »der König erlaubt es nicht, doch werde ich gehen, ihn zu fragen.« - »Geht nur, und wißt Ihr, was Ihr zu sagen habt, damit er es Euch nicht abschlage? Sagt: 'Bei der Seele deiner Tochter', hört er das, so willfahrt er Euch.«
So ging die Prinzessin zum Könige. Kaum hatte dieser die Worte gehört, erzürnte er heftig und rief: »Du böses Kind! Auf! Werft sie mir in den Abgrund!« Sie lag im Finstern, tastete sich aber weiter, kam nach und nach durch drei Türvorhänge, fand Stahl und Zunder und zündete eine Kerze an, die dabei stand.
Siehe, da lag ein schönes Mädchen, das hatte ein Schloß vor dem Munde und konnte dergestalt nicht sprechen. Durch Zeichen nur deutete es, wo der Schlüssel zu dem Schlosse liege. Die Prinzessin fand ihn und öffnete das Schloß.
Da fing das Mädchen als bald an zu sprechen und erzählte, wie sie die Tochter eines Königs sei, die ein Zauberer entführt habe, wie der Zauberer ihr alle Tage das Essen bringe, den Mund öffne und wieder schließe, um ihn erst anderen Tages wieder zu öffnen.
Da fragte die andere: »Sage mir, Schwesterchen, gibt es denn gar kein Mittel, dich zu befreien?« - »Ich weiß keins, es bleibt weiter nichts übrig, als den Zauberer, wenn er mir wieder den Mund geöffnet hat, darum zu fragen. Du lauschst inzwischen unter dem Bette, hörst es und mußt dann sehen, was du tun kannst.«
So blieben sie, das Königstöchterlein verschloß der anderen vorläufig wieder den Mund und wartete, unter dem Bett versteckt, der Dinge, die da kommen sollten.
Horch, um Mitternacht entstand ein großes Brausen: die Erde tut sich auf, und unter Blitz und Donner erscheint der Zauberer, in einen schwarzen Mantel gehüllt.
Hinter ihm ein Riese mit Speisen und zwei Diener mit Fackeln, das Zimmer zu erleuchten. Er schickt die Leute fort, schließt hinter ihnen zu und öffnet der Gefangenen nun den Mund. Sie aßen, und während des Essens fragt das Mädchen wie zufällig:
»Schon lange plagt mich die Neugierde, was es wohl brauche, mich von hier zu befreien.« Der Zauberer antwortete: »Das ist ein bißchen viel verlangt, liebe Tochter!« Die Königstochter: »Wenn du nicht willst, laß es bleiben, mich verlangt nicht weiter, es zu wissen.« -
»Dennoch will ich es dir sagen. Höre! Man muß eine Mine rings um den Palast graben. Genau um Mitternacht, in dem Augenblicke, wo ich herein will, muß man sie anzünden. Du fliegst deinem Vater in den Schoß, ich in die Luft. Nun weißt du es.« - »Es ist, als ob es niemand wüßte«, antwortete das Mädchen.
Gleich darauf ging der Zauberer fort, und die erste Königstochter kroch unter dem Bett hervor, tröstete voller Freude das Schwesterchen, nahm Abschied und ging fort.
Immer weiter dringt sie in der Schlucht vor, wie sie oben hell sieht, ruft sie um Hilfe. Der König hört es, läßt ein Seil hinab werfen und das Mädchen herauf ziehen. Wie sie wieder vor dem Könige steht, erzählt sie ihm alles. Der war wohl erstaunt, läßt aber die Mine graben und sie mit Pulver, mit Kugeln und Blei füllen, und das Mädchen, mit einer Uhr in der Hand, steigt wieder hinab und denkt bei sich:
»Entweder beide tot, oder beide lebendig.« Da tritt sie vor das Mädchen, nimmt ihr das Schloß ab, erzählt ihr, was geschehen, und huscht wieder unters Bett.
Wie die Mitternacht näher kam, zählte der König voller Sorge die Minuten. Punkt Mitternacht wird Feuer an die Mine gelegt: ein furchtbarer Krach macht das Schloß erbeben. Der Zauberer fliegt in die Luft, und die Mädchen fallen sich in die Arme und sind frei. Der König empfing sie voller Freude und rief: »O, meine Töchter! Dein Unglück ward ihr Glück. So nimm du, die du fremd ins Land kamst, meine Krone!«
Aber das Mädchen sagte: »Behaltet Eure Krone, Herr König, denn da ich eine Königstochter bin, besitze ich schon eine!« Diese Geschichte wurde bald in aller Welt bekannt und alle priesen den Mut und die Herzensgüte der Prinzessin. So lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. -
Hier endete das Märchen und der Papagei fragte die junge Frau: »Nun, meine Schöne, wie hat es Euch gefallen?« Und sie antwortete voller Freude: »Sehr schön!« So gingen wieder acht Tage herum, da stand auch schon wieder die Alte mit den Fruchtkörben vor der Tür und begehrte die Enkelin zu sprechen.
Der Papagei wurde unruhig und rief: »Hütet Euch, Schönste, die Alte kommt, Euch zu betrügen.« Richtig hub die Alte an: »Heute, meine Tochter, gehst du doch sicher mit zur Messe?« Und diesmal brauchte sie nicht lange zu bitten, die Frau war bald bereit, sich anzukleiden.
Als der Papagei dies sah, wurde er ganz wild, flatterte, riß sich die Federn aus und schrie: »Bleib, meine Schöne, bleib! Gehe nicht in die Messe, die Alte will dich ins Verderben stürzen. Wenn du bleibst, will ich dir auch ein schönes Märchen erzählen!«
Da sagte die Frau zur Alten: »Packt Euch nur fort, wegen der Messe da kann ich meinen Papageien unmöglich sterben lassen.« Die Alte ging, rief aber noch im Weggehen: »Maledeite, wegen eines Tieres soll deine Seele verdammt werden!« Die Frau setzte sich darauf zu dem Vogel, und er erzählte ihr das versprochene Märchen.
Des Papageien zweites Märchen
Es war einmal ein König, der hatte eine einzige Tochter, die war so schön wie die Sonne und der Mond zusammen mit allen Sternen. Da sie achtzehn Jahre alt geworden, kam ein türkischer König und warb um ihre Hand. Sie aber sprach: »Ein Türke? Was fange ich mit einem Türken an? Es fällt mir gar nicht ein, ihn zu nehmen.«
Nach einiger Zeit wurde sie schwer krank und kein Arzt vermochte ihre Krankheit zu erkennen. Zuckungen und Krämpfe verdrehten ihre Glieder und die Augen lagen so tief in ihren Höhlen, daß man sie kaum mehr sehen konnte. Der Vater rief in seinem Kummer den Rat zusammen und sprach:
»Ihr wißt alle, wie meine Tochter von Tag zu Tag elender wird, ratet mir, was ich zu tun habe.« Die Weisen antworteten: »Herr König, erfahrt, daß es ein Mädchen gibt, die dem Könige von Spanien die Tochter gerettet hat. Laßt diese fragen, wenn es jemand kann, so kann sie Euch sagen, wie Eurer Tochter zu helfen ist.«
Da freute sich der König, denn der Rat dünkte ihn gut, und er schickte Schiffe aus, das Mädchen zu holen, und befahl: »So Euch der König von Spanien das Mädchen nicht geben will, werft ihm diesen eisernen Fehdehandschuh vor die Füße und erklärt ihm den Krieg.«
Die Schiffe fahren ab und bald sind sie in Spanien. Der Gesandte steigt aus, stellt sich dem Könige vor und übergibt ihm ein versiegeltes Schreiben. Der König öffnet es, liest und liest und fängt zu weinen an: »Die Tochter kann ich nicht her geben, so sei es Krieg!«
Unterdessen war die Tochter eingetreten und fragte: »Was fehlt Euch, Herr König?« Und wie sie den Brief sah: »Was befürchtet Ihr, gern will ich zu jenem König gehen.« Der König erschrak: »Das wolltest du tun und mich allein hier zurück lassen?« Das Mädchen aber beruhigte ihn und sprach: »Bald bin ich wieder bei Euch. Ich gehe und sehe, was dem Mädchen fehlt, und komme zurück.«
Sie nimmt Abschied und reist ab. In dem fremden Lande angekommen, geht ihr der König entgegen und sagt: »Mein Kind, wenn du meine Tochter wieder gesund machst, gebe ich dir meine Krone.« Sie dachte bei sich: »Jetzt wären es derer zwei«, und laut: »Herr König, ich habe schon eine Krone. Schauen wir lieber, was dem Mädchen fehlt, und lassen wir die Kronen bei Seite.«
Sie geht und findet die Ärmste in einem erbarmenswerten Zustand und sagt zu dem Vater: »Lasst nur sogleich Suppen und Kraftbrühen zubereiten. Darauf schließe ich mich mit Eurer Tochter ein und öffne erst nach drei Tagen, worauf Ihr mich mit Eurer Tochter entweder lebend oder tot finden werdet. Und merkt wohl auf: auch wenn ich an die Tür pochen sollte, dürft Ihr mir nicht öffnen.«
Als alles bereitet war, schloß sie sich mit der Kranken ein und legte Schlösser und Riegel vor. Aber den Zunder zum Anzünden der Kerzen hatte sie vergessen, und das gab am Abend im Dunkeln eine große Verwirrung. Klopfen wollte sie nicht, schaute zum Kammerfenster hinaus und erblickte in der Ferne ein Licht.
Sie nimmt eine seidene Strickleiter, steigt mit einer Kerze in der Hand hinab, um diese anzuzünden, und geht auf das Licht los. Wie sie näher kommt, sieht sie einen großen Kessel auf einem Steinblock, ein Feuer darunter und daneben einen Türken, der mit einem eisernen Stabe im Kessel herumrührt.
Sie fragt: »Was machst du da, Türke?« Der Türke antwortet: »Mein Herr Tochter wollen von König, sie wollen nicht, ich sie behexen.« - »Du armes, gutes Türkchen, du bist so müde, nicht wahr? Weißt du was, lege dich hin, ruhe dich etwas aus, inzwischen will ich den Kessel rühren.«
Erfreut rief der Türke: »Ja, bei Mohammed, das wollen wir tun.« So stieg er herunter und sie hinauf und begann mit dem Eisen im Kessel zu rühren. »Gefällt dir es so?« fragte sie den Türken. Der rief wiederum: »Ja, bei Mohammed!« - »Nun schlafe du jetzt, ich rühre weiter.«
Als er fest eingeschlafen war, steigt sie herunter, packt ihn beim Kragen und wirft ihn in den kochenden Kessel, da wurde er augenblicklich ganz steif. Darauf zündet sie ihre Kerze an und kehrt nach dem Schlosse zurück. Wie sie in die Kammer tritt, findet sie die Kranke ohnmächtig auf dem Boden liegen. Da gibt sie ihr starke Wasser zu riechen, sie erholt sich und in drei Tagen ist sie frisch und gesund.
Nun klopft sie an die Tür, der König kommt und ist außer sich vor Freude, seine Tochter gesund zu finden. »O, mein Kind«, sagt er, »wie soll ich dir danken? Aber bleibe bei mir, du sollst es gut haben.« Sie aber spricht: »Das kann nimmer mehr sein. Anfangs wolltet Ihr meinem Vater den Krieg erklären, wenn er mich nicht zu Euch ließe, jetzt wird er ihn Euch erklären, so Ihr mich hier behalten wolltet.«
So blieb sie nur noch kurze Zeit da, darauf reiste sie heim, beladen mit Reichtümern und Kostbarkeiten, die ihr der König mit auf den Weg gegeben hatte.
So endigt das Märchen.
»Und wie hat es Euch gefallen, o, Schöne?« fragte der Papagei die Frau. Diese antwortete: »O, schön, sehr schön!« - »So bitte ich Euch, geht nicht mit der Alten, denn dahinter lauert Verrat.« Sie versprach es; aber nach acht Tagen, wie die Alte mit den Körben wieder kam und sagte: »Lieb Töchterchen, heute müßt Ihr mir unbedingt den Gefallen tun und mit mir kommen« - war sie doch so gleich bereit und sagte: »Ich komme!«
Da wurde der Papagei ganz ungebärdig, schrie, rupfte sich die Federn aus und sagte: »Nein, nein, nein! Ihr dürft mir nicht mit der Alten! Bleibt, ich erzähle Euch auch ein schönes Märchen.« - »Liebe Großmutter«, sagte die Frau, »Ihr seht, wie die Dinge stehen, erspart Euch fürder die Mühe, hier her zu kommen, denn wegen Euch kann ich doch meinen Vogel nicht verlieren!«
Hierauf dreht sie das Rad, schließt die Öffnung, und die Alte geht weg, böse Verwünschungen brummend. Nun setzt sich die Schöne zu dem Papageien und der hebt zu erzählen an.
Des Papageien drittes Märchen
Es lebten einmal ein König und eine Königin, die hatten einen einzigen Sohn, der außer der Jagd kein anderes Vergnügen kannte. So zog er einmal auf einen ganzen Monat aus, nur von einem Diener begleitet.
Wie er seinen Weg fürbaß ritt, kam er auch auf das Feld, wo die Puppe lag. Kaum sieht er sie, ruft er aus: »Meine Jagd ist zu Ende, auf! wir gehen wieder nach Haus!« Er steigt vom Pferde, hebt die Puppe vom Boden und setzt sie vor sich in den Sattel.
Er staunt sie immer an und ruft einmal über das andere: »Die Puppe ist schon schön, wie schön muß erst die Herrin der selben sein!« So kommt er ins Schloß zurück, läßt in seiner Kammer eine Nische ausmauern, stellt die Puppe hinein, ein Glas davor, und dort sitzt er nun täglich vierundzwanzig Stunden lang, im Anschauen der Puppe versunken, und ruft immer wieder:
»Die Puppe ist schön, wie schön muß ihre Herrin sein!« Nichts, gar nichts anderes wollte er mehr sehen, wurde ganz tief sinnig, so daß sein Vater die Ärzte des Landes zusammen rufen mußte. Die kamen, beschauten den Kranken und sagten: »Herr König, diese Krankheit kennen wir nicht, Ihr müßt sehen zu erfahren, welche Bewandtnis es mit der Puppe hat.«
Der Vater ging zum Sohn, der Sohn starrte die Puppe an und seufzte: »Ach, die Puppe ist schön, wie schön muß ihre Herrin sein!« Anderes brachte er aus ihm nicht heraus, und die Ärzte mußten, wie sie gekommen waren, wieder abziehen. Da berief der Vater in seiner Verzweiflung die Weisen des Landes und sprach:
»Seht meinen Sohn, wie ist er so herunter gekommen. Er hat kein Fieber, er hat kein Kopfweh, und doch wird er täglich elender, und mein Reich wird ein anderer erben. Wißt Ihr mir denn keinen Rat?« - »Aber, Herr König«, sagte der Älteste da, »habt Ihr denn nie von einem Mädchen gehört, das dem König von Spanien die Tochter gerettet hat und eine andere Königstochter heilte? Laßt diese herbei holen, und will sie ihr Vater Euch nicht freiwillig geben, erklärt ihm den Krieg. Das ist unser Rat.«
Der König sendet flugs seine Botschafter zum König, die haben zu sagen, er möge das Mädchen im Guten senden, sonst werde er sie mit Gewalt holen. Inzwischen tritt das Mädchen ein, das jene Wunder vollbracht hatte, und wie sie den König in dieser Verlegenheit findet, fragt sie: »Was doch habt Ihr, Herr König?« -
»Nichts, mein Kind, es handelt sich wieder um dich, ein anderer König will dich haben, und das bedeutet denn, daß ich nicht mehr Herr deiner bin. Was ist zu tun?« - »O«, rief das Mädchen, »laßt mich nur gehen, denn in kurzem bin ich wieder bei Euch.« So trat sie die neue Reise an.
Als sie den Königssohn sah, welcher sich wie eine Kerze fast verzehrt hatte, in dem er immer und immer nur wiederholte: »Die Puppe ist schön, wie schön muß erst die Herrin sein« - sagte sie zum Könige: »Fast zu spät habt Ihr mich gerufen, dennoch will ich sehen, was sich tun läßt. Gebt mir acht Tage Zeit, laßt Salben und Speisen hereintragen, nach acht Tagen ist er entweder frisch und gesund oder tot.«
Sie schloß sich nun mit ihm ein und lauschte auf die Worte des Königssohns, die man schon kaum noch verstehen konnte, da er die Seele schon zwischen den Zähnen hatte. Als sie ihn flüstern hörte: »Ah ... Pup ... schön ... wie ... Herrin sein« - erblickte sie ihre Puppe und rief: »Ah, Bösewicht, du hast mir meine Puppe gestohlen? Warte, ich will dir den Kopf zurecht setzen.«
Wie der Prinz diese Worte hörte, kam er wieder zu sich und fragte: »Wie? Ihr seid die Herrin der Puppe?« - »Ganz gewiß bin ich es!« Da kehrte er zum Leben zurück, aß die Suppe, die sie ihm gab, bis er wieder her gestellt war. Darauf verlangte das Mädchen zu wissen, wie er zu der Puppe gelangt sei, und er erzählte ihr alles.
Nach acht Tagen kam der König, und sie sagten ihm, daß sie Mann und Frau werden wollten. Der König fuhr vor Freude darüber, daß sein Sohn genesen, fast aus den Kleidern, schickte Briefe: einen an den König von Spanien, ihm zu melden, die Tochter habe die Puppe wiedergefunden, einen anderen an den König, dessen Tochter sie geheilt, und einen dritten an ihren Vater, worin geschrieben stand, seine Tochter sei wieder gefunden.
Die drei Könige kamen mit großem Gefolge an, es wurde ein prächtiges Hochzeitsfest gefeiert, denn der Königssohn heiratete wirklich die Königstochter, und sie lebten in Frieden bis an ihr Ende.
»Nun, meine Schöne«, fragte der Papagei, »hat Euch auch das Märchen gefallen?« - »Ja, mein Söhnchen!« - »Aber mit der Alten dürft Ihr mir nicht gehen, hört Ihr?«
Wie sie noch so sprachen, kam die Magd gelaufen und rief: »Frau, Frau, der Herr kommt!« Das war die Wahrheit. Der Herr kam, erschloß aufs neue Fenster und Türen und umarmte die Frau. Wie sie zu Tische gingen, setzten sie den Papageien in die Mitte der Tafel, und wie sie bei der Suppe waren, spritzt der Papagei dem Herrn etwas heiße Suppe in die Augen, der wird vor Schmerz zornig und will ihn schlagen.
Da packt ihn der Papagei an der Kehle, erwürgt ihn und fliegt fort. Er fliegt und kommt ins freie Feld. Hier ruft er: »Papagei bin ich, Mensch werde ich« - und steht als ein stattlicher Mann, wie zuvor, mitten auf dem Felde und kehrt nach der Stadt zurück. Es begegnet ihm der Edelmann, der berichtet ihm in Eile: »Habt Ihr es gehört, die arme Frau hat ihren Mann verloren, ein Papagei hat ihn erwürgt!« -
»Die Arme, die Arme«, sagt der Notar, »ist das wirklich wahr?« Sie gehen auseinander, ohne der Wette zu erwähnen. Der Notar aber wußte, daß die Frau eine Mutter hatte, zu der ging er, um sie wegen der Heirat mit ihrer Tochter zu befragen. Die Sache ging gut, Mutter und Frau willigten ein, und sie heirateten sich.
Am Abende fragte der Notar seine Frau: »Jetzt sage mir doch einmal, wer brachte deinen Mann um?« Sie antwortete: »Ein Papagei.« - »Und wie war die Geschichte mit dem Papageien? Erzähle sie mir.« Die Frau erzählte alles bis zu dem Augenblick, wo der Vogel dem Herrn die Suppe in die Augen gespritzt hatte und entflogen war.
»Ganz recht«, sagte der Notar, »ganz recht, denn war ich nicht der Papagei?« - »Ihr?« rief ganz erstaunt die Frau, »Ihr? Was doch sagt Ihr da?« - »Ja wohl, ich, und deinetwegen war ich Papagei geworden.«
Anderen Tages ging der Notar zum Edelmann und ließ sich die vierhundert Goldstücke auszahlen, denn er hatte die Wette gewonnen.
Sie lebten zufrieden und glücklich und wohl,
Wir sitzen und kauen, und kauen hohl.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

DIE ELSTER ...

Es wird erzählt von einem Herrn, der hatte eine Elster. Diese diente ihm im Hause und tat alles, was er ihr befahl. War aber der Herr ausgegangen, so eilte sie in den Garten des Nachbars, gegenüber dem Hause ihres Herrn, und aß die Feigen von den Bäumen, die darinnen standen.
Sie besaß einen Zauber, denn immer wenn sie in den Garten ging, schüttelte sie zuvor alle ihre Federn ab und wurde ein schönes Fräulein. Dann kam sie zurück, nahm ihr Federkleid wieder und war eine Elster wie zuvor, bereit ihrem Herrn zu dienen. Rief er sie, so flog sie geschwind herbei und setzte sich ihm aufs Knie, und das war seine Freude.
Einstmals kommt der Herr nach Hause, findet die Elster nicht, findet aber die Federn auf dem Stuhle. Er ruft, niemand antwortet. Da merkt er, daß hier ein Zauber walte, und verbrennt alle Federn. Jetzt kommt das Fräulein zurück, sieht ihre Federn nicht mehr und erschrickt. Da tritt der Herr vor und ruft: »Also du warst die Elster? Wenn die Dinge also stehen, will ich dich wohl zu meiner Frau nehmen.« Und so geschah es, sie heirateten sich, und er hat es nie bereut, die Elster zur Frau zu haben.
Märchen gesagt und Märchen gesungen,
Erzählt jetzt das eure, denn meins ist verklungen.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

ROMULUS UND REMUS ...

Einer der königlichen Nachkommen aus des Äneas Stamm war der Albanerkönig Prokas, der bei seinem Tode zwei Söhne, Numitor und Amulius, hinterließ. Selten sah man so große Unterschiede zwischen zwei Brüdern; Numitor, der ältere, hatte ein sanftes und gutmütiges Wesen, während Amulius aufbrausend und herrschsüchtig war.
Ehrgeiz und diese Herrschsucht trieben Amulius, den Bruder vom Throne zu stoßen und aus dem Lande zu verbannen. Aus Furcht vor der Vergeltung ließ er des Bruders Sohn auf der Jagd meuchlings töten. Die Tochter Numitors, Rhea Silvia, machte er zur Priesterin der Vesta, in deren Dienst sie unvermählt bleiben musste. So schien jede Bedrohung seines Thrones beseitigt.
Da begab es sich, dass der Kriegsgott Mars die schöne vestalische Jungfrau erblickte und sich heimlich mit ihr vermählte. Als Rhea Silvia ein Zwillingspaar gebar, kannte der Zorn ihres Oheims Amulius keine Grenzen; denn er fürchtete, dass die Kinder, Enkel des rechtmäßigen Königs Numitor, sich einst an ihm rächen könnten.
Nach dem strengen Gesetz der Göttin Vesta musste Rhea Silvia wegen ihres Vergehens mit dem Tode bestraft werden. Die Zwillinge aber sollte ein Diener nach des Königs Gebot in den Tiber werfen.
Nun war der Fluss gerade in jenen Tagen über seine Ufer getreten, und so überließen des Königs Beauftragte die Kinder ihrem Schicksal in einem Körbchen, das sie in das strömende Wasser setzten. Der Korb schaukelte auf den Wellen dahin und gelangte in eine Landschaft, die von sieben Hügeln gekrönt war. Dort blieb er im Geäst eines Feigenbaumes hängen, und als das Wasser gefallen war, stand er mit seiner wimmernden Fracht auf dem Trockenen.
Der Kriegsgott Mars war besorgt um das Schicksal seiner Söhne und sandte ihnen die ihm geheiligten Tiere. Von der Höhe des Berges Palatinus kam eine Wölfin, die ihren Durst im Fluss löschen wollte, und bemerkte die hilflosen Kinder; sie schleppte sie in ihre Höhle, bettete sie weich und säugte sie. Später brachte der Specht, der heilige Vogel des Mars, Körner und wohlschmeckenden Samen. So wurden die Zwillinge mit kräftiger Nahrung am Leben gehalten.
Eines Tages kam Faustulus, ein einfacher Ziegenhirt, auf der Suche nach einem seiner Tiere des Weges und gewahrte das wundersame Schauspiel in der Höhle. Er empfand Mitleid mit den Knaben und brachte sie zu seiner Frau, die eben ihr Söhnchen durch den Tod verloren hatte. Aus Mitleid nahm Acca Larentia, die Hirtenfrau, sich der Zwillinge an.
Die Pflegeeltern gaben ihnen die Namen Romulus und Remus. Als die Kunde von dem Schicksal Rhea Silvias und ihrer Kinder auch in diese Einsamkeit gelangte, wurde es Faustulus offenbar, wie es mit der Herkunft der beiden Knaben bestellt sei. Er erkannte, dass er Numitors Enkel gerettet hatte; doch aus Furcht vor der Rache des Königs Amulius behielt er sein Geheimnis bei sich.
In der ländlichen Freiheit wuchsen die Zwillinge zu kräftigen Jünglingen heran, durchstreiften mit ihren Altersgenossen Wald und Flur und bauten sich auf dem Palatinischen Berge ihre Hütten. Häufig mussten sie, jeder an der Spitze einer Schar von Getreuen, ihre Kraft mit wilden Tieren messen, welche die Herden bedrängten.
Oft lagen sie auch im Streit mit anderen Hirten, besonders mit denen des vertriebenen Königs Numitor, der auf einem kleinen Gehöft ein zurückgezogenes, stilles Leben führte.
Einst geschah es bei solchen Streitigkeiten, dass Remus sich der Übermacht der feindlichen Hirten nicht erwehren konnte und von ihnen gefangen weg geschleppt wurde. Sie brachten ihn vor ihren Herrn, den greisen Numitor.
Tief betroffen blickte dieser auf den Jüngling, die Ähnlichkeit mit seinem Sohn schien ihm unverkennbar. Bald darauf stellten sich auch, getrieben von der Sorge um Remus, der treue Faustulus und Romulus ein, um den Gefangenen frei zu bitten. Faustulus offenbarte dem Alten nun die ganze Wahrheit, und überglücklich umarmte Numitor, der rechtmäßige König, seine beiden jungen Enkel.
Vor allem Volk, das herbei geströmt war, schworen Romulus und Remus den Eid, die ihnen zustehende Herrschaft zu gewinnen. Die beiden Jünglinge riefen ihre Gefährten und die anderen Männer zum Vergeltungsfeldzug auf, zogen nach Alba Longa und drangen mit List in die Königsburg ein.
Im Kampf um die Burg fand Amulius den Tod, und unter dem Jubel des Volkes setzten Romulus und Remus ihren greisen Großvater wieder in seine königlichen Rechte ein. Numitor liebte seine Enkel zärtlich, und er war glücklich bei dem Gedanken, dass sie nach seinem Tode als Doppelkönige die Geschicke Alba Longas lenken würden.
Doch die Götter fügten es anders.

DER GOLDENE ADLER

Der König von Aragonien hatte ein Töchterchen mit Namen Helena, das so jung, schön, liebenswürdig, wohl gesittet und verständig war, wie man es sich nicht liebenswerter vorstellen konnte. Der Ruhm dieses edlen Wesens erleuchtete das ganze Land, und viele wackere Herren begehrten sie zur Frau; der Vater aber verweigerte sie allen und wollte sie nicht von sich lassen.
Einmal erfuhr der Sohn des Kaisers, Arrighetto, von der Schönheit dieser Prinzessin und entflammte in Liebe zu ihr. Von Stund an hatte er keinen anderen Gedanken als die Frage, wie er sie zur Frau bekommen könne, und verfiel rasch auf den folgenden Plan: Er hatte bei sich einen Goldschmied, den größten Meister, der sich finden ließ, und ließ sich von ihm einen prächtigen Adler anfertigen, der so groß war, dass ein Mensch darin stehen und sich verbergen konnte.
Als nun dieser Adler fertig war, prächtig und meisterhaft, dass man ihn kaum beschreiben kann, gab er ihn dem Goldschmied, der ihn hergestellt hatte, mit den Worten: "Reise mit diesem Adler nach Aragonien, richte dort eine Bude ein mit deinen Kunstwerken auf dem Platz gegenüber vom Schloss, in dem die Königstochter wohnt, stelle den Adler täglich auf die Bank hinaus und sage, du wollest ihn verkaufen. Ich werde zur selben Zeit hinkommen. Tue also, was ich dir sage, und kümmere dich um nichts weiter."
Der Goldschmied trug seine Arbeit weg, steckte viel Geld zu sich und zog nach Aragonien, wo selbst er eine Bude gegenüber dem Königspalast errichtete, und setzte die Arbeit an seinem Meisterstück fort. An gewissen Tagen der Woche stellte er seinen Adler aus. Und die ganze Stadt lief herzu, das Werk anzusehen, so wunderbar und schön war dieses.
Eines Tages nun schaute die Königstochter zum Fenster hinaus, sah den Adler und ließ ihrem Vater sagen, sie möchte ihn gern als Schmuckstück besitzen. Der Vater ließ bei dem Meister wegen des Kaufpreises anfragen. Inzwischen war Arrighetto bereits angekommen und hielt sich insgeheim beim Goldschmied auf, der sich mit ihm über den Preis besprach.
Da sagte Arrighetto zu dem Meister: "Gib zur Antwort, du mögest ihn nicht verkaufen, doch wenn er der Prinzessin gefalle, wollest du ihr ihn gern zum Geschenk machen." Also ging der Goldschmied zum König und sprach: "Mein Gebieter, ich möchte den Adler nicht verkaufen; aber wenn er Euch gefällt, so nehmt ihn bitte, ich mache Euch gern ein Geschenk damit."
Der König sprach: "So laßt ihn herauf bringen, wir werden dann schon miteinander einig werden." Der Meister erwiderte: "Es soll geschehen." Hernach kehrte er zu Arrighetto zurück und brachte ihm die Nachricht, der König wolle den Adler sehen. Da kroch Arrighetto als bald in den Vogel hinein und nahm einige feine Eßwaren mit, die der Natur aufhelfen konnten, dann machte er den Vogel inwendig so zurecht, dass man ihn nach Belieben öffnen und schließen konnte, und endlich ließ er ihn vor den König bringen.
Als dieser das schöne Stück sah, übergab er es seiner Tochter, und der Goldschmied stellte es in ihrem Schlafgemach neben dem Bett des Fräuleins auf.
Als das geschehen war, sprach er zu ihr: "Madonna, deckt das Schmuckstück mit nichts zu. Es ist nämlich aus einer Art Gold, das, sobald man es zudeckt, schwarz wird und seinen Glanz verliert." Weiter setzte er noch hinzu: "Madonna, ich werde oft hier her kommen, um nach dem Kunstwerk zu sehen."
Das Fräulein entgegnete freimütig, dass ihr das ganz recht sei. So kehrte der Goldschmied zum König zurück und meldete ihm, der Vogel gefalle dem Fräulein sehr. "Und", setzte er hinzu, "ich will machen, dass er ihr noch mehr gefällt, denn ich arbeite gerade an einer Krone, die der Adler auf dem Kopf tragen soll." Dem König bereitete das große Freude.
Er ließ eine Menge Geld herbei bringen und sprach: "Meister, bezahle dich selbst nach deinem Gutdünken." - "Gnädiger Herr", versetzte der Goldschmied, "ich bin schon bezahlt, da ich Eure Huld besitze." Und so sehr ihm der König auch zu redete, konnte er ihm keinerlei Geld aufdrängen, denn dieser wiederholte immer: "Ich bin schon bezahlt."
Als aber in der Nacht die Prinzessin Helena im Bett lag und schlief, schlüpfte Arrighetto aus dem Vogel, schlich leise ans Bett, in dem die lag, die er mehr liebte als sich selber, und küßte sanft ihre weiße und rote Wange. Das Mädchen erwachte aus seinem Schlummer, hatte eine unsägliche Angst und fing an zu beten: "Salve regina misericordia." Und zitternd rief sie nach Hilfe, während Arrighetto schleunigst in den Vogel zurückkehrte.
Eine Kammerfrau stand auf und sagte: "Was wollt Ihr?" - "Ich habe einen gespürt", rief die Prinzessin, "der mir das Gesicht berührte." Nun durchsuchte die Kammerfrau das ganze Zimmer, sah und hörte aber nichts. Und weil sie nichts fand, kehrte sie wieder in ihr Bett zurück und dachte sich: 'Sie hat sicher geträumt.'
Nach einer Weile kam Arrighetto wieder ganz vorsichtig an ihr Bett, küßte sie mit vieler Zärtlichkeit und sprach leise: "Teure Seele, erschrick nicht!" Das Fräulein erwachte und stieß einen lauten Schrei aus. Die Kammerfrauen standen auf und sagten: "Was hast du? Wahrscheinlich hast du nichts als Träume." Arrighetto hatte sich schnell wieder im Adler versteckt.
Die Zofen untersuchten Tür und Fenster, fanden sie jedoch verschlossen, und da sie nichts sahen, hüben sie an, die Prinzessin zu schelten, und sprachen: "Wenn du dich nochmals rührst, so sagen wir es deiner Hofmeisterin. Was sind das auch für Torheiten, dass du uns nicht willst schlafen lassen! Das ist schon eine schöne Sitte, in der Nacht zu schreien. Verhalt dich jetzt ruhig und mach, dass du schläfst, damit wir auch schlafen können."
Da fürchtete sich das Mägdlein, und nach einer Weile, als es Arrighetto an der Zeit zu sein schien, kam er wieder aus seinem Vogel hervor, trat leise an das Bett und sagte: "Meine Helena, schrei nicht und hab keine Angst!" Sie fragte: "Wer bist du?" - "Ich bin der Sohn des Kaisers", erwiderte dieser. "Wie bist du denn hier herein gekommen?" forschte sie weiter. " Das will ich dir sagen, verehrungswürdige Dame", versetzte der andre.
"Es ist schon lange Zeit her, dass ich mich in dich verliebte, weil ich deine Schönheit rühmen hörte. Und oftmals bin ich schon her gekommen, um dich zu sehen, aber umsonst. Und weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich diesen Adler herstellen lassen, und in diesem bin ich her gekommen, nur um mit dir reden zu können. Und darum bitte ich dich, dass es dir gefallen möge, Erbarmen mit mir zu haben, weil ich auf Erden nichts Lieberes besitze als dich, und siehe, ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt um deinetwillen!"
Als das schöne Mädchen die holden Worte hörte, die Arrighetto zu ihr sagte, wandte sie sich zu ihm, umarmte ihn und sprach: "In Anbetracht dessen, was du um meinetwillen gewagt hast, wäre es eine große Schändlichkeit von mir, wenn ich mich dafür nicht dankbar zeigte. Darum bin ich einverstanden, dass du mit mir verfahrest nach deinem Willen. Zuvor aber möchte ich doch wissen, wie du aussiehst. Darum kehre an deinen Ort zurück und sei ohne Sorgen, denn morgen will ich tun, als wünschte ich zu schlafen, und die Kammertür schließen. Dann bleibe ich allein, und dann können wir einander sehen und ausführlicher miteinander reden."
Arrighetto gab ihr zur Antwort: "Madonna, und wenn ich jetzt sterben sollte, so bin ich doch froh, dass du mich zu deinem Diener angenommen hast. Doch möge es dir gefallen, mich zum Beweis dessen ein einziges Mal zu küssen." Das edle Fräulein küßte ihn anmutig, denn sie fühlte schon im Herzen Flammen der brennenden Liebe. Darauf kehrte Arrighetto in den Vogel zurück.
Am folgenden Tag sagte das Fräulein, sie wolle schlafen, denn es schien ihr tausend Jahre zu dauern, bis sie endlich ihren Arrighetto sehen konnte. Sie schickte also die Kammerfrauen hinaus, verriegelte die Zimmertür und trat zu dem Vogel, aus dem Arrighetto als bald hervorkam und sich vor ihren Fußen verneigte.
Und als sie sah, wie rüstig und schön er war, fiel sie ihm um den Hals, und er Schloss sie in seine Arme: "Jetzt bin ich", sprach er, "der glücklichste Mensch auf der Welt, denn nun wird mir die Freude zu Teil, nach der ich mich so lange Zeit gesehnt habe." Alsdann erzählte er ihr seine ganze Abstammung und wer er war und schenkte ihr so süße und holde Worte, dass sie duftigen Veilchen glichen, vermischt mit innigen Küssen. Ich kann das Liebesglück nicht schildern, das sie miteinander erlebten.
Und auf diese Weise blieben sie mehrere Tage und Nächte beisammen. Das Fräulein versorgte ihn unterdessen mit Süßigkeiten und Weinen, dass er sich im Himmel glaubte. Auch kam der Goldschmied häufig, um nach dem Adler zu schauen, und fragte jeweils den Prinzen, ob er nichts wünsche; dieser antwortete aber jedes Mal: "Nein."
Eines Tages jedoch sagte Arrighetto zu der Dame: "Ich wünsche, dass wir zusammen nach Deutschland gehen in unser Haus." - "Mein lieber Arrighetto", erwiderte die Frau, "ich bin zufrieden mit dem, was dir gefällt." Da entgegnete der Prinz: "So will ich weg gehen und mit einem Schiff in die Nähe jener Burg am Meeresufer fahren, die deinem Vater gehört. Dort will ich in einer bestimmten Nacht auf dich warten. Dann musst du zu deinem Vater sagen, du wolltest spazieren gehen, um die Meeresküste zu sehen. Alsdann erwartest du mich in dem genannten Schloss. Ich komme in der Nacht dorthin, hole dich auf mein Schiff, und wir reisen von dannen."
Die Frau sprach: "So sei es." Danach ließ sie den Goldschmied rufen und sprach zu ihm: "Trag diesen Adler weg und mach mir die Krone darauf, so dass sie fertig ist, bis ich wieder komme." Der Meister sprach: "Wenn der König es will, bin ich einverstanden", und die Prinzessin sprach: "Tue, was ich dir sage." Und der Goldschmied ließ den Vogel wieder in seine Werkstatt bringen.
Als es dann Zeit war, schlüpfte Arrighetto heraus, nahm Abschied von dem Meister und zog heimlich fort in sein Land. Dort gab er Befehl, ein schönes Schiff auszurüsten samt einigen bewaffneten Galeeren, die zu dessen Verteidigung dienen sollten. Damit stach er in See und fuhr an die Meeresburg des Königs von Aragon, wie sie verabredet hatten.
Unterdessen sagte das Fräulein zu ihrem Vater: "Lieber Vater, ich möchte gern an den Hafenplatz gehen, um den Meeresstrand zu sehen, und einige Tage auf Eurer Burg da selbst zubringen." Der Vater war es zufrieden und ließ ihr zur Gesellschaft viele Damen und Fräulein mitgeben, damit sie am Meer mit ihr spazieren gingen. Also begab sich die Prinzessin mit ihrem Gefolge auf die Burg und wartete mit großer Freude auf Arrighetto, in dem sie Gott bat, er möge bald kommen. Den ganzen Tag schaute sie nun auf das Meer hinaus, ob sie sein Schiff nicht sehe.
In einer Nacht aber, zur bezeichneten Stunde, kam Arrighetto unten an der Burg an. Die Frau stieg als bald zu ihm hinunter und umarmte ihn, und unverweilt bestiegen sie das Schiff, spannten die Segel auf und fuhren mit Gottes Hilfe von hinnen, und Arrighetto brachte sie in seine Heimat. Als man am anderen Morgen die Prinzessin nicht fand, entstand ein großer Lärm, und es wurde dem König gemeldet, es seien Seeräuber in die Nähe der Burg gekommen und hätten seine Tochter entführt.
Der König war darüber schwer betrübt, denn er hielt seine Tochter für verloren. Und da er von dem wirklichen Sachverhalt nichts wusste, schickte er einen seiner Söhne aus und sprach zu ihm: "Ich befehle dir bei Todesstrafe, nicht eher zu mir zurück zu kehren, bis du erfahren hast, wo sie ist und wer sie geraubt hat."
Der Bruder begab sich auf See, folgte jenem Schiff nach und hörte und erfuhr, dass sie des Kaisers Sohn mitgenommen habe. Und sobald er sich dieser Tatsache vergewissert hatte, kehrte er zum Vater zurück und berichtete ihm, der Sohn des Kaisers sei in eigener Person her gekommen und habe sie gestohlen. Da machte der König große Heeresausrüstungen, um auszuziehen und den Feind in Deutschland selber zu befehden.
Und er bot dazu auf die Könige von Frankreich, von Engelland, von Navarra und der Insel Majolica, den König von Schottland, von Kastilien und dem Land Portugal nebst vielen anderen Herren und Fürstlichkeiten des Abendlandes. Als nun der Kaiser von den Rüstungen hörte, die jener machte, um ihn zu bekriegen, tat er ein gleiches und bot auf den König von Ungarn, den Herrn von Böhmen und außerdem viele Markgrafen, Grafen und Edle von Deutschland.
Die beiden Heere trafen in der Nähe einer Stadt aufeinander, die Wien heißt, und es entspann sich ein erbitterter Kampf, in dem viele mächtige Herren den Tod fanden und wobei auch Arrighetto verwundet wurde.
Als aber der Papst von den großen Heeresmächten vernahm, die beide Parteien aufgeboten hatten, schickte er zwei Kardinale, um sie zu versöhnen. Diesen gelang es nach vielen Bemühungen und unter Androhung des Kirchenbannes, endlich Frieden zu stiften, worauf Herr Arrighetto die entführte Prinzessin von Aragonien zur Frau bekam, während der Sohn des Königs von Aragon sich mit der Tochter des Kaisers, Arrighettos Schwester, vermählte.
Und als sie einander verziehen und Friede und Verwandtschaft geschlossen hatten durch Vermittlung der beiden Kardinale, verabschiedeten sie sich mit großer Freude und Zufriedenheit, und jeder kehrte beruhigt in sein Land zurück.
![]()
DIE GOLDENE WURZEL ...

Es war einmal ein ganz armer Gärtner, welcher trotz aller angestrengsten Arbeit nichts erübrigen konnte. Eines Tages kaufte er für die drei Töchter, die er besaß, drei Ferkel, damit sie diese auffüttern und so etwas zur Mitgift haben sollten.
Pascuzza und Cice, die ältesten der Mädchen, trieben ihre Schweinchen auf eine schöne Wiese, gestatteten aber nicht, dass ihre jüngste Schwester Parmetella mit ihnen ging, sondern jagten sie von sich, damit sie ihr Ferkel anders wohin auf die Weide führe. Parmetella trieb darum ihr Tierchen in einen Wald, in welchem die Dunkelheit sich gegen die Angriffe der Sonne befestigt hatte.
Als sie auf einer Lichtung anlangte, in deren Mitte eine Quelle, gleich einem Wirtshaus, in dem frisches Wasser geschenkt wird, mit silberner Zunge die Reisenden aufforderte, einen halben Schoppen zu trinken, sah sie einen Baum mit goldenen Blättern, von denen sie eins abpflückte und es dem Vater brachte, der es mit großer Freude für mehr als zwanzig Dukaten verkaufte und mit dem Geld ein und das andere Loch in seiner Wirtschaft zustopfte.
Als er nun aber seine Tochter fragte, wo sie es gefunden habe, erwiderte sie: "Nimm nur, was ich dir gebe, lieber Vater, und frage nicht weiter", worauf sie es am folgenden Tag wieder so machte und den Baum so lange seiner Blätter beraubte, bis er am Ende ganz entlaubt da stand, als wäre er von den Herbststürmen geplündert worden.
Da sie jedoch am Ende bemerkte, dass der Baum auch eine goldene Wurzel hatte, welche sie mit den Händen nicht auszureißen vermochte, so holte sie zu Hause eine Axt und fing an, den Fuß des Baumes ringsumher bloß zu legen, worauf sie die Wurzel emporhob und darunter eine schöne Treppe von Porphyr sah.

Parmetella, die ungeheuer neugierig war, stieg hinunter und durch schritt dann einen sehr tiefen, langen Gang, bis sie auf eine schöne Aue gelangte, auf der sich ein herrlicher Palast befand, der von lauter Gold und Silber schimmerte und Perlen und Edelsteine zeigte.
Als nun Parmetella, außer sich vor Staunen, diese Herrlichkeiten eine lange Zeit betrachtet hatte und in diesem prächtigen Wohnsitz keine lebende Seele erblickte, trat sie endlich in ein Zimmer. Darin erblickte sie eine große Anzahl Gemälde, welche viele schöne Dinge darstellten, unter anderem die Dummheit eines für klug gehaltenen Menschen, die Ungerechtigkeit eines, der die Waage hielt, und die vom Himmel bestrafte Gewalttätigkeit, alles so lebendig und treu dargestellt, dass es zum Erstaunen war.
Außerdem befand sich auch noch in dem Zimmer eine reich gedeckte Tafel. Parmetella, welche von ihrem Magen ungestüm gemahnt wurde und niemand sah, setzte sich zu Tisch und fing an, sich gut zu tun wie ein Graf.
Während sie aber mitten im besten Zugreifen war, trat ein Mohr herein, der zu ihr sprach: "Bleib hier und geh nicht von der Stelle, denn ich will dich heiraten und dich zur glücklichsten Frau der Welt machen." Obwohl nun Parmetella einen gewaltigen Schrecken bekam, so fasste sie dennoch bei dem freundlichen Versprechen wieder Mut, und indem sie auf den Antrag des Mohren einging, erhielt sie sogleich von ihm einen Wagen von Diamanten, welcher von vier Rossen aus Gold, mit Flügeln aus Smaragd und Rubinen, durch die Luft getragen wurde, damit sie darin spazieren führe.
Außerdem bestellte ihr Gemahl zu ihrem Dienst noch eine Schar Affen, die in Goldstoff gekleidet waren. Diese kleideten Parmetella als bald vom Kopf bis auf die Füße in neue Gewänder und schmückten sie so herrlich, dass sie wie eine Königin aussah. Als aber die Nacht erschien und die Sonne, voll Verlangen, an den Ufern des indischen Stromes von den Mücken unbelästigt zu schlafen, das Licht auslöschte, sprach der Mohr zu Parmetella:
"Wenn du Nina machen willst, mein liebes Kind, so lege dich in dieses Bett. Sobald du dich aber in die Decke gewickelt hast, lösche das Licht aus und tue, wie ich dir sage; denn sonst möchte es dir schlimm ergehen." Parmetella tat also, wie ihr geheißen war. Kaum hatte sie die Augen geschlossen, als sich der Mohr in einen schönen Jüngling verwandelte und neben sie legte.
Ehe sich jedoch Aurora erhob, um zur Stärkung ihres bejahrten Geliebten frische Eier zu holen, sprang der Jüngling aus dem Bett und nahm seine andere Gestalt wieder an, während Parmetella voll Neugier zurück blieb, um zu wissen, was für ein Leckermaul das Erstlingsei einer so schönen Henne ausgeschlürft habe.
Als nun wieder die Nacht erschien und sich Parmetella ganz so wie am vergangenen Abend hingelegt und die Lichter ausgelöscht hatte, erschien auch wieder der schöne Jüngling und wollte bei ihr sein. Sobald er, von seinen Kunststücken ermüdet, in Schlaf gesunken war, ergriff Parmetella ein Feuerzeug, das sie sich zur Hand gesetzt hatte, schlug den Stahl, zündete den Schwefelfaden und mit diesem das Licht an, worauf sie die Decke emporhob und das Ebenholz in Elfenbein, den Kaviar in Milch und Sahne und die Kohlen in ungelöschten Kalk verwandelt sah.
Indem sie jedoch mit offenem Munde da saß und den schönsten aller Pinselstriche, den die Natur jemals auf die Leinwand des Wunders getan, anstaunte, erwachte der Jüngling. Er fing an, Parmetella mit Vorwürfen zu überhäufen, indem er ausrief:
"Wehe mir, um deinetwillen muss ich noch sieben Jahre lang diese verwünschte Strafe erdulden, da du aus Neugier deine Nase in meine Geheimnisse gesteckt hast. Aber geh nur und mache, dass du fort kommst! Entferne dich aus meinen Augen und kehre zu deinen Bauernliesen zurück; denn du ahnst nicht, was für ein Glück du verlierst."
So sprechend, verschwand er wie Quecksilber, während die arme Parmetella starr und kalt vor Schrecken und mit gesenktem Haupte den Palast verließ. Als sie jedoch aus dem unterirdischen Gang getreten war, begegnete sie einer Fee, welche zu ihr sprach: "Dein Leid, meine Tochter, schmerzt mich in der tiefsten Seele; denn du Unglückliche gehst der Schlachtbank entgegen und hast eine haarbreite Brücke zu passieren.
Um daher deiner Gefahr zuvor zu kommen, nimm diese sieben Spindeln, diese sieben Feigen, dieses Näpfchen mit Honig und diese sieben Paar Eisenschuhe und wandere ohne auszuruhen so lange, bis sie zerreißen, dann wirst du auf dem Balkon eines Hauses sieben Frauenzimmer sehen, welche von oben herab spinnen und die Fäden auf Totenknochen aufgewickelt haben.
Weißt du nun, was du tun sollst? Halte dich ganz ruhig und versteckt, und immer, wenn ein Faden herunter kommt, so ziehe den Knochen heraus und stecke dafür eine mit Honig bestrichene Spindel an mit einer Feige statt des Kopfes; denn wenn sie diese herauf ziehen, so werden sie sagen: 'Wer uns versüßt hat unseren Mund, dem werde nur süßes Leben kund.'
Nach diesen Worten wird dann eine nach der anderen sprechen: 'O du, der du uns diese Süßigkeiten gebracht hast, lass dich sehen!', und du musst antworten: 'Ich will nicht, denn ihr fresset mich auf, und sie werden erwidern: 'Wir fressen dich nicht auf, so wahr uns Gott unseren Löffel behüten möge.
Du aber rühre dich nicht und bleibe ruhig an deinem Ort. Dann werden sie fort fahren: 'Wir fressen dich nicht, so wahr uns Gott unsern Spieß behüte.' Du jedoch halte dich bewegungslos, als wärst du an den Boden gewurzelt.
Dann werden sie weiter sprechen: 'Wir fressen dich nicht, so wahr uns Gott unseren Besen behüte.' Du aber traue ihnen nicht; und wenn sie auch sprächen: 'Wir fressen dich nicht, so wahr uns Gott unsern Eimer behüte', so halte du dennoch deinen Mund und muckse nicht, bis sie endlich sagen werden: 'So wahr uns Gott Donnerundblitz behüte, wir fressen dich nicht'; dann steige hinauf und sei sicher, dass sie dich nicht fressen werden."

So bald Parmetella dies vernommen hatte, fing sie an, über Berg und Tal so lange zu wandern, bis nach Verlauf von sieben Jahren die eisernen Schuhe zerrissen und sie an einem großen Hause anlangte, wo sie auf einem Balkon die sieben spinnenden Frauenzimmer erblickte.
Nachdem sie dem Rate der Fee gemäß gehandelt und jene endlich nach tausenderlei Finten und Lockungen den Schwur bei Donnerundblitz geleistet hatten, stieg sie hinauf, worauf die Frauenzimmer zu ihr sagten: "Du schändliche Bübin bist die Ursache, dass unser Bruder zweimal sieben Jahre fern von uns in der Gestalt eines Mohren in jener unterirdischen Behausung gelebt hat.
Sei jedoch unbekümmert, denn wenn du es auch verstanden hast, uns durch den Schwur ein Schloss vor unseren Rachen zu legen, so wirst du gleichwohl bei erster Gelegenheit die alte und die neue Rechnung begleichen. Jetzt aber tue folgendes:
Verbirg dich hinter diesem Trog, und wenn unsere Mutter nach Hause kommt, die dich ohne weiteres verschlingen würde, so sieh zu, dass du hinter ihren Rücken kommst, packe sie und ziehe sie aus Leibeskräften, ohne eher los zu lassen, als bis sie bei Donnerundblitz schwört, dir nichts zuleide zu tun."
Parmetella tat, wie ihr geheißen war, und nachdem die Hexe bei der Feuerschüppe, bei der Zange, bei dem Spinnrad, bei der Weife, bei dem Topfbrett und endlich bei Donnerundblitz geschworen hatte, ließ Parmetella sie los und trat vor diese Hexe, worauf diese zu ihr sprach:
"Du hast mich dieses Mal dran gekriegt, Bübin; aber sieh dich vor; denn bei der ersten Wäsche wirst du mit eingeseift." In dem nun so die Hexe eine gute Gelegenheit, Parmetella aufzufressen, wie mit dem Lichte suchte, nahm sie eines Tages zwölf Säcke verschiedener Hülsenfrüchte, als Erbsen, Kichern, Linsen, Wicken, Fasolen, Bohnen, Reis und Lupinen, mengte sie untereinander und sprach zu ihr:
"Hier, nimm diese Hülsenfrüchte und lese sie mir dergestalt aus, dass jede Fruchtart besonders sei. Wenn du aber bis heute Abend nicht fertig bist, so verzehre ich dich wie eine Dreiersemmel."
Die arme Parmetella setzte sich neben die Säcke hin und sprach weinend. "O du lieber Gott, wie ist mir doch die goldene Wurzel zur Wurzel so großen Drangsals geworden. Diesmal ist es mit mir vorbei; und weil ich ein schwarzes Gesicht weiß gesehen habe, wird mir jetzt dafür ganz schwarz vor den Augen.
Wehe mir, meine Stunde hat geschlagen, mir ist nicht mehr zu helfen! Schon scheint es so, als wäre ich zwischen den Zähnen der scheußlichen Hexe. Niemand ist da, mir beizustehen, niemand ist da, mir zu raten, niemand ist da, mich zu trösten."
Während sie so jammerte, erschien plötzlich wie ein Blitz Donnerundblitz, welcher die ihm durch eine Verwünschung auferlegte Verbannungszeit beendet hatte. Obwohl er noch voll Zorn gegen Parmetella war, so ließ ihm dennoch seine Liebe zu ihr keine Ruhe, und in dem er sie so laute Klagen ausstoßen hörte, fragte er sie:
"Was hast du denn, Verräterin, dass du so weinst?", worauf ihm Parmetella die üble Behandlung von Seiten seiner Mutter mitteilte und ihm sagte, wie sie es darauf abgesehen habe, ihr den Garaus zu machen und sie zu verschlingen.
"Beruhige dich und fasse Mut", erwiderte Donnerundblitz, "denn nichts von dem allen wird geschehen." Jetzt streute er alle Hülsenfrüchte auf die Erde und ließ eine Unzahl Ameisen hervor kommen, welche so gleich anfingen, alle Früchte einzeln auf- zuhäufen, so dass Parmetella jede Gattung für sich zusammen raffen und in die Säcke füllen konnte.
Als nun die Hexe nach Hause kam und alles bereit fand, geriet sie fast in Verzweiflung und rief aus: "Der verwünschte Donnerundblitz hat mir diesen Streich gespielt, aber du sollst mir nicht so davon kommen. Darum nimm hier diese Überzüge von Zwillich, welche für zwölf Unterbetten sind, und sieh zu, dass sie bis heute Abend voll Federn sind, sonst zerreiße ich dich in Stücke."
Die Ärmste nahm die Betttücher, setzte sich auf die Erde und fing an, ganz kläglich zu jammern, in dem sie sich ganz zerkratzte und ihre Augen in zwei Tränenquellen verwandelte. Wiederum erschien jedoch Donnerundblitz und sprach zu ihr:
"Weine nicht, Verräterin, sondern lass mich nur machen, ich werde schon für dich sorgen. Du aber löse dir deine Haare auf, breite die Betttücher auf die Erde und fange an zu weinen und zu heulen und rufe dabei, dass der König der Vögel gestorben sei, dann wirst du sehen, was geschieht."
Parmetella tat, wie ihr geheißen war, und plötzlich erschien eine Wolke von Vögeln, welche die Luft verdunkelten und mit den Flügeln schlagend die Federn haufenweise herunter fallen ließen, so dass in weniger als einer Stunde die Betten gefüllt waren.
Sobald die Hexe nach Hause kam und dies sah, schwoll sie vor Zorn dermaßen an, dass sie fast zerbarst, wobei sie ausrief: "Donnerundblitz hat es sich in den Kopf gesetzt, mich zu ärgern. Hol mich aber dieser und jener, wenn ich sie nicht einmal so ankriege, dass sie mir nicht entwischen kann."
Hierauf wandte sie sich zu Parmetella und sprach: "Lauf, eile zu meiner Schwester und sage zu ihr, sie soll mir die Instrumente schicken; denn Donnerundblitz soll sich verheiraten, und wir wollen ein königliches Hochzeitsfest feiern."
Zugleich aber ließ sie der Schwester sagen, dass, wenn Parmetella nach den Instrumenten käme, solle sie die selbe sogleich schlachten und kochen; denn sie würde zu ihr kommen, um an dem Mahle Teil zu nehmen.
Als nun Parmetella sah, dass ihr leichtere Dienste auferlegt wurden, war sie ganz erfreut, in dem sie glaubte, dass das Wetter jetzt heiterer würde. Aber wie blind sind doch oft die Menschen! In dessen begegnete ihr unterwegs Donnerundblitz. Als er sie so rasch drauflos schreiten sah, fragte er sie:
"Wohin gehst du da. Unglückliche? Du weißt nicht, dass du deinem Tod entgegen eilst, dir selbst deine Fesseln schmiedest, dir selbst das Messer schleifst, selbst das Gift mischst; denn du wirst zu einer Hexe geschickt, damit sie dich verschlinge.
Jedoch höre mir zu und sei ohne Furcht. Nimm dieses Brötchen hier, dieses Bund Heu und diesen Stein; und wenn du in dem Hause meiner Base anlangst, so wird ein bellender Fleischerhund auf dich los stürzen, um dich zu beißen. Du aber stopfe ihm mit diesem Brötchen den Rachen.
Nach dem Hunde wirst du ein Pferd frei herum laufen sehen. Das wird gegen dich ausschlagen und versuchen, dich unter seine Hufe zu treten. Gib ihm das Bund Heu, denn dadurch fesselst du ihm die Füße. Zuletzt wirst du an eine Tür kommen, die immer auf und zu schlägt. Lege daher diesen Stein vor, dadurch wirst du sie zum Stehen bringen.
Als dann steige hinauf. Dort wirst du die Hexe mit einem kleinen Kinde auf dem Arme finden und das Feuer sehen, das schon angezündet ist, um dich zu braten. Die Hexe wird dann zu dir sagen: 'Halte mir das Kind ein bisschen und warte so lange, bis ich die Instrumente herunter geholt habe.'
Sie wird jedoch nur gehen, um sich die Hauer zu wetzen und dich dann stückweise zu zerreißen. Du aber wirf inzwischen das Kind ohne Mitleid in den Ofen, denn es ist Hexenfleisch, nimm die Instrumente, welche hinter der Tür stehen, und mach dich davon, ehe die Hexe zurückkehrt; denn sonst ist es mit dir vorbei.
Jedoch merke dir, dass sich die Instrumente in einem Futteral befinden, das du nicht öffnen darfst, wenn es dir nicht sehr schlimm ergehen soll."

Parmetella tat, wie ihr Geliebter ihr riet; jedoch öffnete sie auf dem Heimweg das Futteral, in dem sich die Instrumente befanden. Da, mit einem Male, flog hier eine Flöte, dort eine Schalmei, huben eine Pfeife, drüben ein Dudlesack empor, welche in der Luft tausenderlei Musik machten, während sich Parmetella vor Kummer das ganze Gesicht zerkratzte.
Inzwischen war die Hexe in die Stube zurück gekommen, und als sie Parmetella nicht mehr vorfand, trat sie an ein Fenster und rief der Tür zu: "Quetsch die Verräterin tot!", worauf die Tür erwiderte:
"Warum soll ich der Armen Böses tun?
Durch sie kann ich ja endlich ruhn!"
Hierauf rief die Hexe dem Pferde zu: "Tritt die Spitzbübin mit deinen Hufen tot!" Aber das Pferd versetzte:
"Wenn ich sie träte, verspürte ich Reu',
sie gab mir ja ein Bündel Heu! "
Endlich rief die Hexe den Hund und sprach zu ihm: "Beiß die Schelmin tot!" Der Hund jedoch entgegnete:
"Fürwahr, ich beiße sie nicht tot,
sie gab mir doch ein großes Stück Brot!"
Parmetella aber, welche in dessen hinter den fort geflogenen Instrumenten her schrie, begegnete Donnerundblitz, welcher sie gehörig ausschalt und zu ihr sprach: "Hast du denn noch nicht auf deine Kosten gelernt, Verräterin, dass du dich durch deine verwünschte Neugier in diese große Not gebracht hast, in der du dich befindest?"
So sprechend, rief er die Instrumente durch einen Pfiff herbei und Schloss sie wieder in das Futteral ein, in dem er zu Parmetella sagte, dass sie sie nun der Mutter überbringen sollte. Sowie diese Parmetella erblickte, rief sie mit lauter Stimme: "O grausames Schicksal, sogar meine Schwester handelt mir zuwider, da sie mir nicht einmal diesen Gefallen hat tun wollen."
Bald nach her langte die Braut ihres Sohnes an, welche eine wahre Pest, ein wahres Unglück, eine Harpyie, ein Gespenst, ein Grauen, ein Scheusal, ein Ungeheuer von Hässlichkeit und dabei die leibhaftige Schwindsucht war und durch die Blumen und Reiser, mit denen sie sich aufgeputzt hatte, wie ein neu eröffnetes Wirtshaus aussah.
Die Hexe veranstaltete sogleich ein großes Fest, und da sie noch ganz voll von Gift und Galle war, ließ sie den Tisch nahe bei einem Brunnen aufstellen und setzte die sieben Töchter, jede mit einer Fackel in der Hand, daneben hin.
Parmetella aber gab sie deren zwei und wies ihr außerdem ihren Platz auf dem Rande des Brunnens an, damit sie hinunter stürze, wenn sie nun schläfrig würde. Während nun die Speisen auf- und abgetragen wurden und die Köpfe schon anfingen, warm zu werden, sprach Donnerundblitz, dem gar sehr übel zumute war, zu Parmetella:
"Liebst du mich, Verräterin?", worauf diese erwiderte: "Mehr als mich selbst." - "Nun denn, wenn du mich liebst", entgegnete Donnerundblitz, "so gib mir einen Kuss." - "Behüte Gott", versetzte Parmetella, "das sei fern von mir; du hast ja ein so niedliches Geschöpf neben dir, das der Himmel dir hundert Jahre lang bewahren möge."
"Man sieht wohl, was du für ein einfältiges Ding bist und bleiben wirst, wenn du auch ewig lebst", sprach nun die Braut, "da du die Spröde spielst und einem so hübschen Jüngling keinen Kuss geben willst; denn ich habe mich für ein paar Kastanien von einem Viehhirten nach Herzenslust küssen lassen."
Der Bräutigam wurde bei diesen Worten ganz giftig und schwoll an wie eine Kröte, so dass ihm das Essen im Hals stecken blieb. Gleichwohl machte er eine gute Miene zum bösen Spiel und verschlang die Pille, in dem er sich vornahm, sich späterhin zu revanchieren und die Rechnung auszugleichen.
Als man nun gegessen hatte, schickte er die Mutter und die Schwestern fort, während er selbst, die Braut und Parmetella zurück blieben, um zu Bett zu gehen. In dem er sich von Parmetella die Schuhe ausziehen ließ, sprach er zu seiner Braut: "Hast du Acht gegeben, liebes Weibchen, wie dieses hochmütige Ding mir einen Kuss verweigerte?" -
"Sie hat unrecht getan", versetzte die Braut, "dir den Kuss abzuschlagen, da du ein so hübscher Mann bist; denn ich habe mich für ein paar Kastanien von einem Schafhirten küssen lassen."
Donnerundblitz konnte sich nun nicht mehr länger halten, sondern mit Blitzen von Zorn und Donner von Taten ergriff er, da ihm diese Rede gar zu sehr in die Nase gefahren war, ein Messer, stach die Braut über den Haufen und vergrub sie als dann in einem Loche, das er in dem Keller machte.
Hierauf umarmte er Parmetella und sprach zu ihr: "Du bist mein Juwel, du bist die Blume der Frauen und der Spiegel der Ehre. Schau mich daher mit deinen Augen an, gib mir deine Hand, reiche mir deinen Mund, nähere dich mir, die du mein Leben bist, denn ich will dein sein, solange die Welt besteht."
So sprechend, ging er mit Parmetella zur Ruhe und scherzte mit ihr, bis die Sonne die Feuerrosse aus dem Wasserstall zog und auf die von Aurora besäten Felder zur Weide führte.
Als nun die Hexe mit frischen Eiern erschien, damit sich die Neuvermählten stärken sollten und die junge Frau sagen könnte: "Glückselig ist die, welche sich verheiratet und eine Schwiegermutter bekommt!", und sie Parmetella in den Armen ihres Sohnes fand so wie noch vernahm, was vorgefallen war, eilte sie zu ihrer Schwester, um mit ihr zu überlegen, wie sie sich diesen Dorn aus dem Auge schaffen könnte, ohne dass Donnerundblitz ihr zu helfen vermöchte.
Sie fand jedoch, dass sie aus Schmerz über ihre im Ofen gebratene Tochter gleichfalls in den Ofen gekrochen war, und da bereits der Brandgeruch die ganze Nachbarschaft verpestete, geriet die Hexe in solche Verzweiflung, dass sie gleich einem Widder so lange mit dem Kopf gegen die Mauer rannte, bis sie ihr Gehirn verspritzte.
Donnerundblitz aber söhnte Parmetella mit seinen Schwestern aus, worauf sie ein frohes und glückliches Leben führten und die Wahrheit des Sprichwortes erkannten: "Geduld überwindet alles."

DIE AFFEN ...

Es war einmal ein König, der hatte zwei Söhne, die in der selben Stunde geboren waren, was man Zwillinge heißt. Der eine hieß Giovanni, der andere Antonio. Da man nicht genau wußte, welcher zu erst zur Welt gekommen war, worüber am Hofe viel gestritten wurde, war der König zweifelhaft, wer ihm in der Regierung folgen sollte. Darum sagte er ihnen, als sie herangewachsen waren:
»Um gegen keinen von euch ungerecht zu sein, hört, was ich mir ausgedacht habe. Geht fort nach eurem Belieben und sucht euch eine Frau. Welche von den beiden mir das schönste und seltenste Geschenk machen wird, die soll entscheiden, wer von euch mir auf dem Thron folgen soll.« - Da stiegen Giovanni und Antonio zu Pferde, und jeder zog eine andere Straße.
Giovanni, nachdem er mehrere Tage geritten war, kam in eine große Stadt und stieg in einem Gasthof ab, dem gegenüber ein prachtvoller vornehmer Palast stand. Er fragte nach dem Besitzer und wer drin wohne, und erfuhr: Der Besitzer, der darin wohnt, ist ein reicher Marchese, der zwei Kinder hat, einen Jüngling und ein schönes Mädchen. - Giovanni fragte, ob man das Fräulein sehen und mit ihr sprechen könne. Warum nicht? wurde ihm geantwortet. Sie geht jeden Tag aus zum Spaziergang und abends in Gesellschaft zu Leuten ihres Ranges.
Giovanni sah also das Mädchen draußen, und sie gefiel ihm sehr, und als er sich ihr genähert hatte an den Orten, wohin sie ging, konnte er auch mit ihr sprechen. Endlich sagte er ihr, er suche eine Frau und würde das Reich seines Vaters erben, wenn seine Braut dem Könige ein Geschenk brächte, das schöner und seltener wäre, als das seines Bruders Antonio.
»Wenn Ihr imstande seid, ihm ein solches Geschenk zu machen, heirate ich Euch sogleich.« - Das Fräulein sagte Ja, und am anderen Tage ging Giovanni in ihr Haus, und sie gab ihm ein verschlossenes Schächtelchen. - »Dies ist das Geschenk. Bringt es Eurem Vater, und wenn es ihm gefällt, bin ich bereit, mich mit Euch zu vermählen.«
Giovanni kehrte darauf in seinen Palast zurück, gab dem König das Schächtelchen, und der König sagte: »Schön! Du kannst in dessen Hochzeit machen und deine Frau hier her bringen. Aber das Schächtelchen ist verschlossen, und ich öffne es nicht eher, als bis auch Antonios Geschenk gekommen ist, und ich die beiden vergleichen kann.« - Kurz, Giovanni heiratete, und seine Frau gefiel dem König sehr.
Auch Antonio hatte in dessen seine Reise fort gesetzt, aber länger als Giovanni. Eines Tages befand er sich in einem dichten Wald, der ganz weglos war und kein Ende zu nehmen schien. Er irrte hier hin und dort hin und kommt endlich zu einer großen öden Wiesenfläche, wo kein lebendes Wesen war, aber ringsherum Statuen und Pferde aus Marmor, und fern im Hintergrunde sah man einen herrlichen Palast.
Zu dem gelangt Antonio endlich, klopft an, und ihm öffnet ein Affe. Sofort springen zwei andere Affen heraus, helfen ihm abzusteigen, nehmen sein Pferd und führen ihn die Treppen hinauf. Überall sieht er nur Affen, die ihm stumm Komplimente machen und zu verstehen geben, er möge nur befehlen.
Antonio schwankte zwischen Argwohn und Verwunderung. So kam er zu einem Saal, wo sich ein Affe befand, der der Oberste der anderen zu sein schien. Sie deuten ihm an, daß er sich setzen möge. Der Oberste lädt ihn zu einem Kartenspiel ein, und er nimmt es an und spielt mit drei Affen, und der Oberste saß ihm gegenüber.
Endlich, gegen Abend, fragen sie ihn mit Zeichen, ob er zu Nacht essen wolle, und da er Hunger hatte, bejahte er es. Sie gehen also zu Tische, wo nur Affen waren, und Affen waren auch die Diener. Nach dem Abendessen führten ihn etliche Affen in ein prächtiges Zimmer mit einem guten Bett, verließen ihn und verschlossen die Tür.
Die Wahrheit zu sagen - obwohl Antonio nicht furchtsam war, fühlte er sich doch sehr unbehaglich in diesem Palast mit all diesen Tieren und wußte nicht, wie das noch enden sollte. In dessen, da er von dem langen Ritt todmüde war entschloß er sich zu Bett zu gehen, möge kommen was da wolle. Er entkleidet sich also, legt sich ins Bett und schläft augenblicklich ein.
Als er im besten Schlaf war, hört er eine Stimme, die ihn ruft. Er erwacht, öffnet die Augen, sieht aber niemand, weil er das Licht gelöscht hatte, und sagt: »Wer ruft mich?« - Die Stimme antwortet: »Antonio, weshalb bist du hier her gekommen?« - Da erzählt er der Stimme Punkt für Punkt die Ursachen, weshalb er seine Heimat verlassen hat.
Wieder spricht die Stimme: »Wenn du einwilligst, mich zu heiraten, wird der König das schönste und seltenste Geschenk erhalten, du aber das Reich.« - Antonio darauf: »Ich, von mir aus, habe nichts dagegen. Ich heirate Euch, wann Ihr wollt.« - Darauf die Stimme: »Nun gut. Morgen am Tage wirst du auf der Kommode Briefe finden, die nimm und gib sie am Tor des Palastes dem, der dort steht und auf sie wartet.«
Antonio steht am Morgen auf und findet an Briefen auf der Kommode einen ganzen Haufen. Er nimmt sie und geht hinunter und findet am Tor Gott weiß wie viele Affen, denen gibt er sie, und sie gehen fort und bringen sie seinem Vater, dem König, denn an den waren alle adressiert. Darin stand, wo Antonio sich befand und daß er wohl sei und eine Frau suche. Die Affen aber wurden in der Stadt des Königs einquartiert.
In der nächsten Nacht, als Antonio schlief, weckt ihn die nämliche Stimme. »Antonio bleibst du bei deinem Entschluß?« - Und er: »Ja!« - »Nun denn, so wirst du morgen dem König diese anderen Briefe schicken.« - Am Morgen nimmt Antonio wieder den Haufen Briefe und gibt sie den Affen, die auch diese dem Könige bringen, und auch sie werden in der Stadt einquartiert.
Der König aber sagt: Was mache ich mit all diesen Tieren? Sie haben mir fast schon die ganze Stadt angefüllt. - Was er davon denken sollte, wußte er nicht, denn in den Briefen stand, Antonio habe die Frau gefunden mit dem noch viel schöneren und selteneren Geschenk.
Auch in der dritten Nacht wurde Antonio von der selben Stimme geweckt. »Antonio bist du noch immer entschlossen?« - Und er: »Ja, ich bin es! Wenn ich mein Wort gegeben habe, ändere ich es nicht mehr.« - Da sagte die Stimme: »Nun gut! Morgen werden wir zusammen abreisen und zum König gehen und dort werden wir uns heiraten.«
Als es Tag wurde, stand Antonio auf, und ihr könnt denken, wie neugierig er war, seine Braut kennen zu lernen. Er geht hinunter und sieht vor dem Tor des Palastes eine prachtvolle Karosse angespannt mit vier großen Affen und einem Affen auf dem Bock. Die Tür des Wagens wird ihm geöffnet, und drin saß eine Äffin. Neben die setzt er sich, und sie fahren ab mit einer großen Begleitung von Affen, und so kommen sie endlich nach der Stadt des Königs, Antonios Vater.
Das ganze Volk war verblüfft durch diesen Aufzug, der König glaubte plötzlich noch einfältiger geworden zu sein, und bei Hofe sagten sie: Sicher wird Giovanni der Thronerbe sein.
Als sie ausgestiegen waren, gab die Äffin Antonio zu verstehen, daß sie in einem Zimmer allein bleiben möchte, und nachdem er sie dort hin geführt hatte, gab auch sie ihm ein Schächtelchen, das er dem König bringen solle. Als dieser hörte, daß Antonio sich diese Braut erwählt hatte, mußte er sich wohl darein ergeben, in die Vermählung einzuwilligen. Inzwischen legte er auch diese Schachtel zu der von Giovannis Frau, um beide gleichzeitig zu öffnen.
Als der Morgen kam, war in der königlichen Kapelle alles zur Trauung bereit. Antonio schickte also nach der Braut. Sie wollte aber ihr Zimmer nicht öffnen und gab zu verstehen, daß Antonio selbst kommen solle, sie zu holen. Der tut es auch und klopft an die Tür, die ihm geöffnet wird.
Als er aber eintritt, was sieht er? Die Äffin hatte sich in ein wunderschönes Mädchen verwandelt, gekleidet wie eine königliche Braut, ein Wunder anzuschauen. »Da seht Ihr Eure Braut,« sagt sie. »Laßt uns gehen.« - Antonio war fast außer sich vor Freude, führte die Braut in die Kapelle hinunter, und alle waren erstaunt, dies reizende Mädchenbild zu sehen, worauf der Priester, nachdem sie sich auf den Betschemel hingekniet hatten, Antonio und die Braut zusammen gab.
Nach der Zeremonie sagte der König: »Jetzt ist es Zeit, die Geschenke zu beschauen und zu bestimmen, wer Thronerbe sein soll.« - Er öffnet die Schachtel von Giovannis Frau, und herauskommt ein schönes Vögelchen. »Schön!« sagt der König. »Es ist wirklich schön, daß ein Vogel hier drinnen so lang hat am Leben bleiben können.« -
Dann nimmt er die Schachtel von Antonios Frau, öffnet sie und findet drin Leinwand, fängt an sie herauszuziehen und zieht bis hundert Ellen heraus. »Das ist noch wunderbarer und seltener,« sagt er, »daß hundert Ellen Leinwand in diesem Schächtelchen stecken konnten. Die Entscheidung ist schon gefallen: Thronerbe wird Antonio sein.«
Als er diese Worte hörte, wurde Giovanni ganz bestürzt. Aber Antonios Frau sagte sofort: »Antonio braucht das Reich seines Vaters nicht, weil er selbst schon eines hat, und darum ist Giovanni Thronerbe. Antonio, weil er seinem Vorsatz treu blieb, mich zu heiraten, obwohl ich die Gestalt einer Äffin hatte, hat die Verzauberung gebrochen, die über mich und meine Untertanen gekommen war. Also ist er jetzt König des Reichs, das ich ihm als Mitgift bringe.« -
Sie zog unter ihrem Kleide ein Stäbchen hervor und brach es in vier Stücke, die gab sie Antonio, damit er sie in die vier Winde über das Dach des königlichen Palastes würfe. Als Antonio nach dem Gebot seiner Gemahlin getan hatte, wurden alle Affen, die in der Stadt waren und die zu Hause geblieben waren auf einmal in Menschen zurück verwandelt, Frauen, Männer, Handwerker, Landleute, Pferde und Tiere jeder Art.
Nach wenigen Tagen aber, als die Hochzeitsfeste vorüber waren, reiste Antonio mit seiner Gemahlin ab, um ihr Reich in Besitz zu nehmen, wo sie froh und glücklich lebten und Kinder bekamen.
Sie konnten wohl in Freuden leben, haben mir aber nichts abgegeben.
(Montale)
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen

VOM HAHN UND DER MAUS ...

Ein Hahn und eine Maus gingen einmal zum Nußbaum, um Nüsse herunter zu schlagen. Der Hahn flog auf den Baum, schüttelte die Nüsse herunter und warf sie der Maus zu. Diese öffnete sie, fraß den Kern heraus und verschloß die Schalen dann wieder.
Gevatter Hahn merkte das und rief: »Höre, Gevatterin Maus, wenn ich jetzt hinunter komme, soll dir es schlecht gehen.« Er flog vom Baume hinab und zerhackte ihr tüchtig den Schädel. Die Maus lief davon, ging zum Arzt und rief:
Arzt, Arzt, Ärztchen,
Heil' mir meinen Schädel.
Hatt' ein Nüßlein nur gemaust,
Hat der Hahn mich so zerzaust.
Der Arzt antwortete: »Bring' mir Lappen!« Die Maus ging zum Lumpensammler und rief:
Lumpensammler, gib mir Lappen,
Lappen muß dem Arzte bringen.
Arzt, Arzt, Ärztchen
Heilt mir meinen Schädel.
Hatt' ein Nüßlein nur gemaust,
Hat der Hahn mich so zerzaust.
Sprach der Lumpensammler: »Bring' mir erst Pommade.« Und die Maus lief zum Kaufmann und sagte:
Kaufmann, gib mir schnell Pommade,
Muß zum Lumpenmann sie tragen.
Lumpensammler gibt mir Lappen,
Lappen muß dem Arzte bringen.
Arzt, Arzt, Ärztchen
Heilt mir meinen Schädel.
Hatt' ein Nüßchen nur gemaust,
Hat der Hahn mich so zerzaust.
Der Kaufmann sagte: »Erst bring' mir Eier.« Nun ging die Maus zu der Henne und rief:
Gib mir Eier, gute Henne,
Muß damit zum Kaufmann rennen.
Kaufmann gibt mir schnell Pommade,
Muß zum Lumpenmann sie tragen.
Lumpensammler gibt mir Lappen,
Lappen muß dem Arzte bringen.
Arzt, Arzt, Ärztchen
Heilt mir meinen Schädel.
Hatt' ein Nüßchen nur gemaust,
Hat der Hahn mich so zerzaust.
Da sagte die Henne: »Erst bring' mir Mehl.« Da kroch die Maus des Nachts unter die Tür des Müllers, lud sich das Mehl auf und brachte es der Henne. Die gab ihr Eier, die Eier brachte sie zum Kaufmann, der gab ihr die Pommade, die Pommade trug sie zum Lumpenhändler und sagte:
Lumpensammler, gib mir Lappen,
Lappen muß dem Arzte bringen.
Arzt, Arzt, Ärztchen
Heilt mir meinen Schädel.
Hatt' ein Nüßchen nur gemaust,
Hat der Hahn mich so zerzaust.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
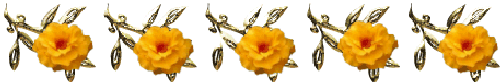
DER BÖSE SCHULMEISTER UND DIE WANDERNDE KÖNIGSTOCHTER ...

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten ein einziges Töchterchen, das sie sehr lieb hatten. Sie schickten es in die Schule zu einem Lehrer, zu dem auch noch viele andere Kinder gingen. Der Lehrer aber war ein böser Mann, und schlug oft die armen Kinder.
Jeden Tag nun sagte er zu ihnen: »Kinder, seid ganz ruhig und still, bis ich wieder komme.« Dann ging er in sein Zimmer, und kam erst nach mehreren Stunden wieder heraus. Nun wurden die Kinder neugierig und eines Tages sprachen sie: »Wir wollen uns an die Tür schleichen und durchs Schlüsselloch sehen.« Die Königstochter aber fürchtete sich und wollte nicht mit. Da sprachen die Anderen: »Gehen wir alle hin, so mußt du auch mitkommen,« und beredeten sie endlich, daß sie mitging.
Da schlichen sie an die Tür und schauten durchs Schlüsselloch, und sahen, daß der Lehrer mit einem Toten beschäftigt war; was er aber tat, konnten sie nicht sehen, denn er näherte sich gleich der Tür, und sie liefen alle fort und an ihre Plätze. Die Königstochter aber verlor unterwegs einen Schuh, und mußte ohne Schuh an ihren Platz. Als nun der Lehrer mit dem Schuh herein kam, zog sie ihren Fuß unter den Rock, damit er es nicht sehen solle.
Er frug aber: »Wer von euch hat einen Schuh verloren?« Da zeigten alle die anderen Kinder ihre Füße, und riefen: »Ich nicht!« und nur die arme, kleine Königstochter wollte ihren Fuß nicht zeigen. Da sprach der Lehrer: »Also bist du es gewesen, die durch das Schlüsselloch geschaut hat? Nun, warte nur, du sollst deiner Strafe nicht entgehen.«
Als nun um Mittag die anderen Kinder nach Hause gingen, kam auch der Bediente, um die Königstochter abzuholen. Der Lehrer aber sprach: »Sagt nur eurer Herrschaft, die Kleine wolle gern bei mir essen; sie würde heute Abend nach Haus kommen.« Die Königstochter weinte, aber sie mußte doch da bleiben. Als nun alle fort waren, schlug der Lehrer das arme Kind und mißhandelte es ganz schrecklich.
Endlich verwünschte er es noch, und sprach: »Sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage sollst du in deinem Bette zu bringen, und wenn du wieder gesund wirst, so soll eine Wolke kommen und dich auf den Calvarienberg tragen.«
Da ging das arme Kind nach Haus, und wurde krank, so krank, daß es sich zu Bette legen mußte, und blieb viele Jahre krank und kein Arzt konnte ihm helfen.
Als aber die sieben Jahr und die sieben Monate vergangen waren, fing es an etwas besser zu werden, und als noch die sieben Tage um waren, ward es ganz gesund und war zu einer wunderschönen Jungfrau herangewachsen. Da sprach eines Tages die Kammerfrau zu ihr: »Es ist ein so schöner, sonniger Tag, kommen Sie mit auf die Terrasse, so will ich Sie frisieren.«
Die Königstochter wollte nicht, aber die Kammerfrau überredete sie, auf die Terrasse zu steigen. Als sie nun oben waren, machte die Kammerfrau ihre schönen Flechten auf, und wollte sie frisieren. Da merkte sie, daß sie die Haarschnur vergessen hatte, und sprach: »Ich will nur eben gehen, die Schnur holen, und komme gleich wieder.«
Die Königstochter bat: »Ach, bleibe bei mir, es ist ja einerlei, du kannst mich auch ohne Schnur kämmen.« »Nein, nein,« rief die Kammerfrau, »ich will Sie hübsch frisieren, ich bin im Augenblick wieder da,« und eilte hinunter. Da kam eine Wolke, senkte sich auf die Terrasse herab, und entführte die Königstochter auf den Calvarienberg.
Als nun die Kammerfrau auf die Terrasse kam, sah sie, daß ihre junge Herrin verschwunden war, und fing an zu jammern: »Ach, wäre ich doch nicht fort gegangen!« Da lief sie zur Königin, und erzählte es ihr, und das ganze Schloß kam in Aufruhr, und alle suchten die Königstochter überall. Sie aber war und blieb verschwunden. Da waren die Eltern tief betrübt, und die Mutter sprach: »Gewiß ist mein armes Kind verwünscht worden.«
Lassen wir nun die Eltern, und sehen wir, was aus der Jungfrau geworden ist. Die Wolke trug sie also auf den Calvarienberg, und legte sie dort nieder. Es war aber ein so furchtbar steiler Berg, daß ihn gewiß noch niemand erstiegen hatte. Da befahl sie sich dem lieben Gott, und fing an langsam den Berg hinunter zu steigen.
Die Dornen und die Steine zerrissen ihre Kleider, und verwundeten ihre zarten Glieder, endlich aber kam sie doch an den Fuß des Berges. Da wanderte sie weiter und kam endlich an ein wunderschönes, großes Schloß, in da ging sie hinein, und schritt durch alle Zimmer. Sie sah keine menschliche Seele, wohl aber die schönsten Schätze, und einen Tisch, der war mit köstlichen Speisen besetzt.
Im letzten Saal aber lag ein schöner Jüngling am Boden, der war wie tot, und daneben lag ein Zettel, darauf stand: »Wenn mich eine Jungfrau sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage lang mit dem Gras vom Calvarienberg reibt, so würde ich ins Leben zurück kehren, und sie soll meine Gemahlin werden.«
Da dachte die Königstochter: »Ich bin ein armes Mädchen; zu meinen Eltern kann ich den Weg nicht zurück finden, zu tun habe ich auch nichts, so will ich ein gutes Werk tun.« Da ging sie zurück, und kletterte mühsam auf den Calvarienberg hinauf, und achtete nicht darauf, daß die Dornen ihre zarten Glieder zerrissen. Oben aber schnitt sie das Gras ab, und machte große Bündel davon, die sie den Berg hinunterwarf. Dann stieg sie selbst hinab, und kam mehr tot als lebendig unten an.
Als sie sich etwas erholt hatte, fing sie an die Bündel alle in das Schloß zu tragen. Dann begab sie sich an die Arbeit, den Jüngling zu reiben, Tag und Nacht, ohne zu schlafen und ohne zu ruhen. Nur einmal am Tag erhob sie sich um etwas zu essen von den schönen Speisen. So vergingen sieben Jahre und sieben Monate und von den sieben Tagen blieben auch nur noch drei übrig, da wurde sie so müde, daß sie kaum mehr fort fahren konnte.
Da hörte sie auf der Straße eine Sklavin zum Verkauf ausbieten, und dachte: »Die könnte ich kaufen, und sie auch ein wenig reiben lassen, während ich ein paar Stunden ruhe.« Da stand sie auf und kaufte die Sklavin, die war ganz schwarz und häßlich wie die Schulden, und befahl ihr, den schönen Jüngling ein wenig zu reiben, während sie ruhe.
Als sie sich aber hinlegte, war sie so müde, daß sie drei Tage lang in einem Stück schlief, und als sie aufwachte, waren die sieben Jahre, die sieben Monate und die sieben Tage herum, und der schöne Jüngling war erwacht, hatte die schwarze, häßliche Sklavin als seine Befreierin angesehen, und hatte ihr gesagt: »Du hast mich erlöst, du sollst auch meine Gemahlin sein.«
Als nun die Königstochter erschien, frug er: »Wer ist denn das schöne Mädchen?« Da sprach die Sklavin: »Das ist meine Küchenmagd.« Also mußte die arme Königstochter in die Küche und die niedrigsten Dienste tun. In dem Schloß aber wurde es ganz lebhaft von Bedienten und Jägern und dem ganzen Gefolge eines Königs, und der schöne Jüngling, der ein verwunschener Prinz war, feierte eine glänzende Hochzeit mit der schwarzen Sklavin. Die Königstochter aber mußte in der Küche arbeiten.
Des Königs Marschall aber, da er sie sah, fand er sie so schön und gut, daß er sie von Herzen lieb gewann. Da er nun eines Tages verreisen mußte, rief er sie und sprach: »Ich muß nach Rom reisen, soll ich dir etwas mitbringen?« Da sprach die Königstochter: »Bringt mir ein Messer mit und einen Geduldsstein.«
Der Marschall verreiste und in Rom suchte er so lange, bis er einen Geduldsstein fand, den brachte er ihr nebst einem Messer. Nun war er aber doch neugierig, was wohl die Königstochter mit den beiden Sachen machen wolle. Also schlich er ihr nach, und sah, daß sie in ihr Zimmerchen ging, und die Tür zu machte.
Als er nun durch das Schlüsselloch schaute, sah er, daß sie den Geduldsstein vor sich auf den Tisch gelegt hatte und das Messer daneben, und nun anfing zu jammern: »O Geduldsstein, höre doch an, wie es mir im Leben ergangen ist.« Da erzählte sie ihre ganze Lebensgeschichte, von der Zeit an wo sie noch in die Schule ging. Wie sie nun erzählte, fing der Stein an zu schwellen, und sie sprach: »O Geduldsstein, wenn du nun anschwillst bei der Erzählung meiner Leiden, denke doch wie es mir zu Mute sein muß.«
Als das der Marschall hörte, lief er eilends hin und rief den Prinzen, und bat ihn, er möge doch auch kommen, diese wunderbare Tatsache mit anzusehen. Da kam der Prinz und horchte am Schlüsselloch, und hörte, wie die Königstochter erzählte, daß sie den schönen Jüngling so viele Jahre gerieben habe, und selbst gegangen sei das Gras auf dem Calvarienberg zu holen.
Dabei schwoll der Stein immer mehr an, als aber die Königstochter gar erzählte, wie sie nach aller Mühe und Arbeit von der falschen Sklavin betrogen worden sei, zersprang der Stein mit einem gewaltigen Knall. »O Geduldsstein,« rief sie, »wenn du bei der Erzählung meiner Leiden zerspringst, so will auch ich nicht länger leben,« und ergriff das Messer und wollte sich umbringen.
Da sprengte der Prinz die Tür, und fiel ihr in den Arm, und sprach: »Du, und keine andere sollst meine Gemahlin werden, und die falsche Sklavin soll sich ihr Urteil selber sprechen.« Da ging er zur Sklavin, und sprach: »Heute wird meine Cousine zu Besuch her kommen; empfange sie gut.«
Als nun die Cousine an kam, war es niemand anders als die Königstochter, die hatte unterdessen köstliche Kleider angelegt; aber die Sklavin erkannte sie nicht. Als sie nun zu Tische saßen, sprach der Prinz zur Sklavin: »Was verdient ein Mädchen, das dies und das getan hat?«
Sie aber war verblendet, und antwortete: »Der kann man nichts Besseres antun, als daß man sie in eine Tonne mit siedendem Öl tue, und sie von einem Pferd durch die ganze Stadt schleifen lasse.« Da sprach der Prinz: »Du hast dir selbst dein Urteil gesprochen, und es soll auch an dir vollzogen werden.«
Also wurde sie in eine Tonne mit siedendem Öl gesteckt, und durch die ganze Stadt geschleift. Der Prinz aber heiratete die schöne Königstochter, die ließ es auch ihren Eltern sagen. Und da lebten sie alle glücklich und zufrieden, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
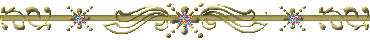
VOM CACCIATURINO ...

Es war einmal ein König, dem war seine Frau gestorben, und hatte ihm sieben Töchter hinterlassen, die waren eine immer schöner als die andere, die jüngste aber war die schönste und klügste. Die Minister des Königs rieten ihm wiederholt, er solle doch wieder eine Gemahlin nehmen, und sprachen: »Die Königin des benachbarten Staates ist Witwe, und hat sieben schöne und starke Söhne. So hört denn auf unsern Rat, und begehrt sie zur Gemahlin; eure sieben Töchter aber gebt ihren sieben Söhnen.«
Dem König gefiel dieser Rat gar wohl, und er sandte einen Boten zur Königin und ließ sie fragen, ob er wohl die Ehre haben könne, sie zu seiner Gemahlin zu nehmen, und ihre sieben Söhne mit seinen sieben Töchtern zu verheiraten. Die Königin war es zufrieden, und so wurden alle acht Hochzeiten an einem Tage gefeiert mit großer Pracht. Durch Gottes Gnade wurden die sieben Königstöchter denn auch bald guter Hoffnung.
Nun begab es sich aber eines Tages, daß ein Krieg ausbrach, und der König mit seinen sieben Schwiegersöhnen in den Krieg ziehen mußte. Da kamen die sieben Königssöhne zu ihrer Mutter und sprachen: »Liebe Mutter, euch empfehlen wir unsere Frauen an: pflegt sie wohl, wenn ihre Stunde kommt.« Darauf zogen sie in den Krieg.
Die Königin war aber eine böse Frau, die ihre Schwiegertöchter nicht leiden mochte, und da sie sie immer weinen und jammern sah, ward sie ungeduldig, rief die Schergen herbei, und sprach zu ihnen: »Nehmt diese sieben Frauen, die täglich nichts tun als weinen und klagen, führt sie in den Wald wo er am dichtesten ist; stecht ihnen die Augen aus und überlaßt sie dann ihrem Schicksal. Die sieben Paar Augen aber müßt ihr mir herbringen.«
Also mußten die armen Königstöchter das Schloß verlassen, und die Schergen führten sie in den Wald, wo er am dichtesten war, fielen über sie her, und stachen ihnen die Augen aus, ohne sich an ihr Weinen zu kehren. Dann überließen sie sie ihrem Schicksal, und brachten der bösen Königin die Augen.
Da standen nun die armen Königstöchter in ihrem Zustand, und konnten sich nicht helfen, mußten in dem Wald bleiben und sich kümmerlich von Wurzeln nähren. Endlich kam die Zeit, wo die älteste gebären sollte, und sie gebar ein schönes kleines Mädchen. Weil aber die armen Königstöchter so sehr vom Hunger litten, so brachten sie das unschuldige Kindlein um, und verzehrten es.
Kurze Zeit darauf gebar die zweite auch ein Mädchen, das aßen sie wie das erste. So kamen nach und nach sechs kleine Mädchen zur Welt, die aßen sie eins nach dem anderen. Endlich kam auch für die jüngste ihre Stunde und sie gebar einen wunderschönen kleinen Knaben. Da sprach sie: »Liebe Schwestern, lasst dies Kindlein am Leben, es ist ja ein Knabe, der wird uns später behilflich sein können. Lasst ihn uns aufziehen.«
Also ließen sie das Kindlein am Leben, und seine Mutter nannte es Cacciaturino. Cacciaturino wuchs heran und wurde mit jedem Tage schöner und kräftiger.
Aber lassen wir ihn nun im Walde mit seiner Mutter und seinen Tanten sehen wir uns nach den armen Königssöhnen um, die so lange Zeit im Kriege geblieben waren.
Als sie nach Hause kamen, war ihre erste Frage nach ihren Frauen. »Sie sind Alle gestorben,« antwortete die böse Königin. Denkt euch nun die Verzweiflung der sieben Königssöhne. »Und meine Frau ist auch gestorben? Und mein Kindlein auch?« frug ein Jeder. »Alle, alle tot!« antwortete die Mutter. Da wurden die sieben Königssöhne so traurig, daß sie ganz krank davon wurden, und keinen Trost annehmen wollten, und so vergingen drei oder vier Jahre.
Da begab es sich eines Tages, daß ihre Mutter sie in den Wald schickte, um zu jagen, denn sie meinte, das solle sie von ihren trüben Gedanken befreien. Wie sie nun so im Walde jagten, sehen sie auf einmal einen wunderschönen Knaben von drei oder vier Jahren, der war so schön, daß sie ihn anriefen und frugen: »Wie heißest du, mein Kind?« »Cacciaturino!« »Mit wem wohnst du hier im Wald?« »Mit meiner Mutter.«
»Hättest du wohl Lust, mit uns an den Hof zu kommen, und bei uns zu bleiben? Denn wir sind Königssöhne, und wollen dich halten wie unser eigenes Kind.« »Wartet hier ein wenig auf mich,« sprach Cacciaturino, »so will ich zuerst meine Mutter fragen.« Da lief er hin, und erzählte seiner Mutter, was die sieben Jäger zu ihm gesagt hatten. Seine Mutter aber antwortete: »Sage den Königssöhnen, du willst mit ihnen gehen, wenn sie dir erlauben wollen, jede Woche einmal in den Wald zu gehen, um mich zu besuchen. Und wenn du in Not bist, komme nur zu mir.«
Also ging Cacciaturino zu den Königssöhnen zurück, und sie nahmen ihn mit an den Hof und hielten ihn wie ihren Sohn, und besonders der Jüngste hatte ihn von Herzen lieb. Nun hatte aber die Königin eine Schwester, die war eine böse Menschenfresserin. Als nun Cacciaturino in seinem zwölften Jahre war, kam die Königin einst zu ihrer Schwester, die sprach zu ihr: »Weißt du auch, wer der kleine Cacciaturino ist, den deine Söhne wie ihren Sohn halten? Das ist das Kind deines jüngsten Sohnes und der jüngsten Königstochter. Seine Mutter aber wohnt noch mit ihren Schwestern im Wald, und du wirst sehen, eines Tages wird Cacciaturino schon erfahren, wer er ist, und wird dich umbringen.«
»Ach, liebe Schwester,« bat nun die Königin, »hilf mir doch, und gib mir einen guten Rat, wie ich ihn los werden kann.« »Weißt du was? wenn du nach Hause kommst, so stelle dich sterbenskrank, und lasse einen Arzt kommen, den du vorher bestochen hast, daß er sagen soll, nur das Blut des Menschenfressers könne dich retten. Du aber schickst dann den kleinen Cacciaturino hin es zu holen, so wird der Menschenfresser ihn verschlingen.«
Dieser Rat gefiel der Königin gar wohl, sie ging so gleich zu einem Arzt, und bestach ihn, daß er sagen sollte, wie sie ihm heißen werde, und als sie nach Hause kam, legte sie sich so gleich ins Bett, und weinte und klagte. »Ich sterbe! ich sterbe!« »Liebe Frau, was ist dir denn?« frug der König ganz besorgt. »Schnell, die Diener sollen sogleich einen Arzt rufen.«
So gleich wurde der Arzt gerufen, und als er die Königin im Bette liegen sah, sprach er: »Wenn die Königin nicht ein Fläschchen vom Blute des Menschenfressers bekommt, so muß sie sterben.« »Ach, wo sollen wir denn das her bekommen,« rief der König, »es kann ja Niemand zum Menschenfresser gehen.« »Schickt den Cacciaturino!« sprach die Königin, »der weiß, wo der Menschenfresser wohnt; aber schnell, sonst muß ich sterben.«
Da ließ der König den armen Cacciaturino kommen, und sprach zu ihm: »Cacciaturino, mache dich bereit; du mußt so gleich gehen, und ein Fläschchen vom Blute des Menschenfressers holen, denn die Königin ist krank, und kann sonst nicht genesen.« »Königliche Majestät,« sprach Cacciaturino, »ich will euer Gebot erfüllen. Vergönnt mir nur, vorher noch einmal in den Wald zu gehen, und von meiner Mutter Abschied zu nehmen.« »Das sei dir gewährt,« sprach der König, und Cacciaturino ging in den Wald zu seiner Mutter.
»Denkt euch nur, liebe Mutter, das und das hat mir der König aufgetragen.« Die jüngste Königstochter aber war sehr klug, und sprach zu ihrem Sohne: »Laß dir vom König ein feines Messerchen und ein Fläschchen geben, und mache dich getrost auf den Weg zum Menschenfresser. Wenn du hinkommst, wird er unter einem Baum liegen und schlafen, wenn du dich aber näherst, wird er dich ergreifen und verschlingen.
Fürchte dich nicht, sondern greife nur nach deinem Messerchen, schneide ihm im Leibe die Adern auf, und fülle dein Fläschchen mit dem Blut. Davon wird er sterben, und sein Mund wird sich öffnen, daß du wieder hinaus kriechen kannst. Gehorche deiner Mutter, mein Kind, so wird dir kein Leid zustoßen.«
Cacciaturino kam zum König und sprach: »Königliche Majestät, gebt mir ein Messerchen und ein Fläschchen, so will ich gehen und das Blut des Menschenfressers holen.« Da gab ihm der König ein scharfes, kleines Messer und ein Fläschchen, und Cacciaturino ging zum Menschenfresser, der lag unter einem Baum und schlief.
Als aber Cacciaturino sich näherte, erwachte er, griff so gleich nach dem kleinen Knaben und verschluckte ihn. Cacciaturino erschrak wohl ein wenig, als es im Leibe des Menschenfressers so finster war, aber er gedachte an die Worte seiner Mutter, zog sein Messerchen her vor, und schnitt alle die Adern auf. Nun konnte aber der Menschenfresser nicht länger leben, und als er starb, öffnete sich sein Mund wie ein großes Tor.
Da füllte Cacciaturino sein Fläschchen mit Blut, kroch wieder her vor und eilte vergnügt zum König. Der hatte natürlich eine große Freude, als ihm Cacciaturino das Blut brachte, die Königin aber stellte sich, als wäre sie nun ganz genesen.
Am nächsten Morgen ging Cacciaturino in den Wald, und erzählte seiner Mutter, daß er alles vollbracht habe, und seine Mutter sagte: »Wohl, mein Kind, folge nur stets meinem Rat, so wird es Dir immer gut gehen.«
Die Königin aber konnte keine Ruhe finden, darum, daß Cacciaturino gesund wieder gekehrt war. Sie ging also zu ihrer Schwester und sprach: »Ach, liebe Schwester, Cacciaturino ist zurück gekehrt, ohne daß der Menschenfresser ihn gefressen hätte.« »Ja, liebe Schwester,« antwortete die Menschenfresserin, »so müssen wir eben etwas anderes ausdenken, um ihn zu verderben.
Wenn du nach Hause kommst, mußt du dich stellen, als ob du plötzlich erblindet wärst. Den Arzt aber mußt du wieder bestechen, daß er dem König sage, wenn du nicht das Wasser des guten Gesichtes hättest, so würdest du blind bleiben. Dieses Wasser hat Niemand als nur ich, und wenn du Cacciaturino zu mir schickst, so will ich schon dafür sorgen, daß er nicht wiederkehre.«
Die Königin ging sogleich zum Arzt und bestach ihn, daß er sagte, was sie wollte. Als sie aber nach Hause kam, fing sie an zu jammern: »Ach, Hilfe! Hilfe! ich bin plötzlich blind geworden!« Der König eilte ganz erschrocken herbei: »Liebe Frau, was ist dir denn? Erkennst du mich denn nicht?« »Ach, was soll ich euch erkennen! ich sehe ja gar nichts mehr!«
Da ließ der König schnell den Arzt holen. Der betrachtete die Königin erst eine lange Weile, dann sprach er: »Wenn die Königin nicht das Wasser des guten Gesichtes findet, um sich die Augen damit zu waschen, so kann sie nie wieder sehend werden.« »Ach,« sprach der König, »wo sollen wir denn dieses Wasser her holen?« »Schickt nur den Cacciaturino,« rief die Königin, »der weiß, wo es zu haben ist.«
Also ließ der König den armen Cacciaturino vor sich kommen, und sprach zu ihm: »Cacciaturino, du mußt so gleich ausziehen und ein Fläschchen vom Wasser des guten Gesichts holen, denn die Königin ist blind geworden, und kann sonst nicht wieder sehend werden.« »Königliche Majestät,« antwortete Cacciaturino, »ich will euer Gebot erfüllen. Vergönnt mir nur vorher einmal in den Wald zu gehen und Abschied von meiner Mutter zu nehmen.«
»Das sei dir gewährt,« sprach der König, und Cacciaturino ging in den Wald zu seiner Mutter und erzählte ihr, was der König ihm aufgetragen habe. »Verliere nur nicht den Mut,« sagte sie, »und höre auf meine Worte. Das Wasser des guten Gesichts besitzt Niemand, als die Menschenfresserin. Geh zum König und bitte dir ein Pferd aus, denn es ist zu weit, um zu Fuß zu gehen.
Wenn du nun zur Menschenfresserin kommst, mußt du dich wohl hüten, jemals vom Pferde zu steigen; sie wird dich freundlich aufnehmen und dich einladen, bei ihr zu essen, dann antworte nur: 'Wenn ich bei euch essen soll, so müßt ihr mir einen Tisch decken, der so hoch sei, daß ich auf meinem Pferde davor sitzen kann.'
Das wird sie tun und wird zwei Teller bringen, einen für sich mit guten Speisen, den anderen für dich mit vergifteten Speisen. Ehe du nun auch nur einen Bissen davon nimmst, mußt du deine Gabel auf den Boden fallen lassen und die Menschenfresserin bitten, sie dir zu holen. Sie wird dir eine andere anbieten, nimm sie aber nicht, sondern nötige sie, sich zu bücken und deine Gabel aufzuheben. Während sie sich aber bückt, mußt du schnell die Teller vertauschen, daß sie selbst von den vergifteten Speisen ißt und stirbt.
Wenn sie nun tot ist, so reiße ihr das Kleid vorn auf und nimm die Zaubergerte, die sie im Busen trägt. In einem Schrank wirst du vierzehn Augen finden, das sind meine Augen und die meiner Schwestern, bringe sie uns mit. Endlich fülle dein Fläschchen mit dem Wasser des guten Gesichts, und komme zu erst hier her, ehe du es zum König bringst.«
Cacciaturino eilte zum König und bat ihn um ein Pferd, wie seine Mutter ihm befohlen hatte. Dann steckte er auch noch seine eigene Gabel in die Tasche, bestieg das Pferd und ritt zur Menschenfresserin. Als er an ihren Palast kam, stand sie am Fenster und rief ihm freundlich zu: »Ei, mein schöner Bursche, steigt herab von eurem Pferd, und kommt herein und setzt euch an meinen Tisch.«
Cacciaturino antwortete: »Wenn ich bei euch essen soll, so müßt ihr mir einen Tisch decken lassen, daß ich auf meinem Pferde davor sitzen kann; denn so bin ich es gewöhnt.« Weil ihn nun die Menschenfresserin vergiften wollte, tat sie ihm den Willen und ließ einen so hohen Tisch zurichten, daß er auf seinem Pferde daran sitzen konnte. Sie selbst aber mußte eine kleine Leiter nehmen, um hinauf zu gelangen.
Da brachte sie zwei Teller herein, und stellte den einen vor Cacciaturino und sprach: »Eßt nur, mein schöner Bursche.« Cacciaturino antwortete: »Ich bin nicht gewohnt, mit fremden Gabeln zu essen, erlaubt daher, daß ich meiner eigenen mich bediene.« Als er aber die Gabel aus der Tasche zog, stellte er sich, als glitte sie ihm aus der Hand und ließ sie fallen. »Ach, edle Frau,« bat er, »seid so gut und holt mir meine Gabel, denn ich kann mein Pferd nicht verlassen.«
»Hier ist eine andere Gabel,« sprach die Menschenfresserin. Er aber antwortete: »Nein, nein, edle Frau, ich bin nicht gewohnt, mit einer anderen Gabel zu essen, als mit meiner eigenen.« Da stieg sie hinunter, um die Gabel aufzuheben; Cacciaturino aber vertauschte schnell die beiden Teller.
Als nun die Menschenfresserin einige Bissen genommen hatte, fiel sie auf einmal um und war tot. Da aß sich Cacciaturino erst satt, dann stieg er vom Pferd und riß ihr das Kleid auf, und in ihrem Busen fand er richtig die Zaubergerte, die nahm er zu sich. Dann schaute er sich weiter um und fand die vierzehn Augen in einem Glasschrank, je zwei und zwei, die nahm er auch. Endlich füllte er sein Fläschchen mit dem Wasser des guten Gesichtes, bestieg sein Pferd, und ritt fröhlich dem Walde zu.
»Bist du wieder da, mein Sohn, mein lieber Sohn!« rief seine Mutter voll Freude. »Ja wohl, liebe Mutter, und hier habe ich euch auch eure Augen mitgebracht.« Da bestrich er die Augenhöhlen seiner Mutter mit dem Wasser des guten Gesichts, setzte ihr ihre Augen ein, und also bald ward sie sehend. So heilte er auch alle seine Tanten.
Dann zog er seine Zaubergerte hervor und wünschte sich prächtige Kleider für seine Mutter und ihre Schwestern und zwei goldne Wagen mit edeln Pferden bespannt, und zuletzt einen wunderschönen Palast, dem königlichen Schloß gerade gegenüber. Kaum hatte er sich das Alles gewünscht, so stand das auch schon da; sie setzten sich alle in die Wagen und fuhren in ihr schönes Schloß, wo Diener und Dienerinnen in Menge sie erwarteten, diese wuschen und badeten die armen Königstöchter mit wohl riechendem Wasser, bis sie wieder schön und gesund wurden.
Am Morgen trat der König auf den Balkon; da sah er sich gegenüber das herrliche Schloß, und die schönen Frauen standen mit einem wunderschönen Knaben am Fenster. Weil er aber neugierig war, schickte er einen Boten hinüber, um den fremden Knaben mit den schönen Damen zu sich einzuladen. Der Bote ging hinüber, um den Auftrag des Königs auszurichten. Cacciaturino aber antwortete: »Sagt dem König, meine Damen verließen ihre Wohnung nicht, darum möge er uns die Gnade erzeigen und mit der Königin und ihren sieben Söhnen zu uns zur Tafel zu kommen.«
Als der König das hörte, sprach er: »Nun wohl, so sei es,« und ging mit der Königin und den Schwiegersöhnen ins schöne Schloß. Denkt euch nun, wie die Tafel gedeckt sein mochte, und was für herrliche Speisen wohl darauf standen; genug, daß alles von Feenhand gemacht war, denn Cacciaturino brauchte seiner Gerte nur zu befehlen, so stand alles so herrlich da, wie es nicht einmal der König hatte.
Zu Tische aber ließ Cacciaturino jeden Königssohn neben seiner Frau sitzen. Als sie nun fertig gegessen hatten, sprach der König: »Wie wäre es, wenn Jeder von uns eine Geschichte erzählte?« »Wie es euch beliebt, königliche Majestät,« antwortete Cacciaturino, »und euch gebührt es, anzufangen.« »Nein, nein, fangt ihr an,« rief der König, »ihr seid ja der Jüngste.« »Ich gehorche, königliche Majestät,« sprach Cacciaturino, »aber unter einer Bedingung, gebt mir euer königliches Wort, daß keiner das Zimmer verlassen darf, während ich erzähle.« »Ihr habt mein königliches Wort,« rief der König, und befahl alle Türen zu verschließen.
Nun fing Cacciaturino an zu erzählen, und erzählte die ganze Geschichte, wie ich sie euch erzählt habe, von der Zeit an, wo der König um die Königin freite. Bei jedem Worte, das er sprach, wurde die Königin blaß und immer blässer und hätte gern den Saal verlassen, der König aber erlaubte es nicht, denn er hatte sein königliches Wort gegeben.
Als Cacciaturino nun die ganze Geschichte erzählt hatte, fuhr er fort: »Königliche Majestät, ich bin Cacciaturino, hier sind mein Vater und meine Mutter, und ihr seid mein Großvater. Die böse Königin aber ist an all dem Unglück schuld.« »Dafür soll sie auch ihre Strafe bekommen,« rief der König. »Schnell, ergreift sie, und werft sie in einen Kessel mit siedendem Öl, und werft sie den Hunden vor.«
Und so geschah es. Die böse Königin wurde in einem Kessel mit siedendem Öl gekocht und dann den Hunden vor geworfen. Der alte König lebte glücklich und zufrieden mit seinen sieben Töchtern und ihren sieben Männern. Cacciaturino aber war alles so wohl gelungen, weil er den Worten seiner Mutter gehorcht hatte, denn Gott verläßt den Gerechten nicht, und wer Gutes tut wird Gutes erhalten.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

DIE WEISSE ZWIEBEL ...

Ein reicher Vater, Herr vieler vieler Güter, war am Sterben. In der letzten Stunde rief er seinen einzigen Sohn, den er über alles geliebt hatte, und sprach zu ihm: »Mein teurer Sohn, mit mir geht es zu Ende. Alles, was ich besessen, ist jetzt dein, genieße es in Frieden. Höre aber eine Warnung: Hüte dich vor der weißen Zwiebel.« Dies gesagt, starb er.
Der Jüngling hatte viele Freunde, und gar oft wanderten sie zusammen durch die Straßen. Auf diesem Gange erblickte er eines Tags einen Bauer, der einen mit Zwiebeln beladenen Esel vor sich her trieb. Kaum sah er die Zwiebeln, so gedachte er an die Warnung seines Vaters, und die Angst trieb ihn, schleunigst davon zu laufen. Die Freunde blieben voll Verwunderung zurück und wußten nicht, wie sie sich die Sache deuten sollten.
Das selbe wiederholte sich noch einmal mit anderen Gefährten, auch sie fanden keine Erklärung und suchten darum den Jüngling auf, ihn zu befragen, da sie selbst sich beleidigt fühlten. Er entschuldigte sich jedoch und erzählte ihnen von der Warnung seines Vaters und wie er sich vor der weißen Zwiebel zu hüten habe. »So ist es besser«, schloß er, »ich laufe davon, wenn ich weiße Zwiebeln sehe.«
Die Freunde wollten vor Lachen bersten und sagten: »Du bist ein Narr! Denn wisse, diese weiße Zwiebel ist nicht die des Gärtners, sondern ein schönes Weib, das die Männer, welche um sie werben, zum Spiele verlockt und sich selbst als Preis des Spieles aus setzt, die Toren aber, die darauf eingehen, nur ausbeutet und dann ins Pfefferland schickt, denn gewonnen hat noch keiner. Sie aber ist so reich geworden, daß sie nicht weiß, wohin mit allem Reichtum.« So erzählten die Freunde, und fortan dachte der arme Knabe an nichts mehr als an die weiße Zwiebel, und nahm sich vor, sie aufzusuchen.
Der Gedanke war immer mächtiger geworden, und eines Tages hat er ihr einen Besuch gemacht. Wie er vor ihr stand, sagte er: »Schöne Frau, da bin ich endlich! Aus Liebe zu Euch, habe ich nicht mehr geschlafen, und gewiß würde ich verrückt geworden sein.« Sie lud ihn mit höfischen Manieren zu sich ein und sagte: »Kommt nur, eßt und trinkt zuvor, wenn Ihr mich dann im Spiele besiegt, bin ich Euere Braut, wenn nicht ... nun wir werden sehen.«
Sie aßen, tranken, darauf traten sie an den Tisch, zu spielen. Wer aber verlor und immer verlor, war der törichte Knabe. Er verlor, bis alles dahin war. Wie seine Taschen leer standen, sagte die Schöne ruhig: »So, Freund, jetzt könnt Ihr gehen.« Er stand und blickte in ihre schönen Augen, sah die zierliche Gestalt an, aber gehen mußte er. Er eilte nach Hause, füllte sich die Tasche aufs neue und war wieder da, denn er wollte sie durchaus zur Frau gewinnen.
Wieder empfing sie ihn mit höfischen Manieren, und bald auch saßen sie beim Spiele. Aber so viel Geld er immer her vor zog, alles gewann sie, bis er ohne einen Heller stand. Da sagte sie zu ihm: »Nun haltet nimmer mehr um meine Hand an, denn Ihr habt verloren; geht nur immer nach Hause.«
Verzweifelt geht er fort und läuft aufs freie Feld hinaus und jammert: »Alles ist dahin, ich soll sie nicht haben, und doch muß sie mein werden. Welch trauriges Geschick! Ach, Seele meiner Mutter, hilf mir. Jetzt verkaufe ich das letzte Gut, gewinne ich sie mit dem nicht, so mag ich nicht mehr leben.«
Wie er so bekümmert dahin schritt, hörte er eine Stimme: »Joseph, Joseph, was hast du? Laß die Tränen!« Er wendet sich und erblickt einen Mann, der tröstet ihn und spricht: »Verzweifle nicht, ich kann dir helfen. Erzähle mir nur deine Geschichte!« Er erzählte, und jener antwortete: »Verkaufe also das Gut und gehe aufs neue zu der Schönen, du wirst gewinnen. Höre nur, was du tun mußt.
Dieses Weib hat einen Ring, welchen sie beim Spiel abzieht und unter den Tisch legt. Dieser Ring ist verzaubert, und du mußt suchen, ihn an deinen Finger zu bringen, was dir ein Leichtes sein wird, wenn du, einen Schmerz am Fuße heuchelnd, dich bückst und ihn bei dieser Gelegenheit an den Finger steckst. Fahre dann ohne Sorge fort zu spielen, denn mit dem Ringe hältst du auch das Glück, wirst gewinnen und gewinnen, bis die weiße Zwiebel nichts mehr besitzt.«
Der Jüngling verkaufte das Gut und ging mit dem Gelde zu der Schönen. Sie war gar hold selig zu ihm und er erfreute sich ihrer großen Höflichkeiten. Nachdem sie gespeist hatten, forderte sie den Jüngling zum Spiele auf. Er verfolgte sie in dessen mit den Augen und bemerkte wohl, wie sie in einem Augenblicke den Ring abstreifte und unter den Tisch warf. So beginnt das Spiel.
Joseph läßt sie einige male gewinnen, dann aber stieß er plötzlich einen Schrei aus, als ob er einen heftigen Schmerz am Fuße empfinde, bückt sich, faßt den Ring und steckt ihn unbemerkt an den Finger. Jetzt wendete sich das Blättchen mit einem mal: so lange sie auch spielten, sie konnte nicht ein Spiel mehr gewinnen, und zuletzt hatte sie alle ihre Habe verloren. Da erhob sie sich und sprach: »Ihr seid mein Mann! Niemand vermochte es mit mir aufzunehmen, Ihr vermochtet es und ich bin Euer!«
So wurden Joseph und die weiße Zwiebel ein Paar und lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende.
Zufrieden und glücklich lebt ihr, das Zusehn haben wir.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

DER ZAUBERER VIRGIL ...

Es war einmal ein mächtiger und starker Zauberer, der hieß Virgil. Viel besser als irgend jemand auf der Welt verstand er die schwarze Kunst und wußte alle Geheimnisse.
In seiner Jugend hatte er sich einmal verheiratet, war aber übel dabei gefahren, denn seine Frau war eine von den schlimmsten, war voll Fehler und Laster, ränkesüchtig, trotzig und stolz. Dabei war sie wohl schön, doch darum nur um so gefährlicher, und setzte ihrem Manne die Hörner auf. Der trug sie geduldig lange Zeit, endlich aber drückten sie ihn gar zu sehr, und was er gelitten, wollte er ihr tausendfach zurück geben.
Er schloß einen Bund mit Malagigi, dem größten Meister im Reiche der Geister und Ritter vom Besen. Dem erzählte er alles, was er um seine Frau gelitten hatte, so daß selbst Malagigi Mitleid empfand und ihm das Sprüchlein sagte:
Dreh' dich! Dreh' dich fort und fort,
Die Frau sie fährt von Ort zu Ort.
Dreh' dich, dreh' dich um und um,
Drei Teufel sind um mich herum.
Ohne Zauberei und Spuk
Regiert die Frau voll List und Trug.
Dabei drehte er große und kleine Weifen und rührte den Stab: da kamen Teufel von allen Seiten herbei, wie Fliegen kamen sie, und ohne Besinnen unterwarfen sie sich Virgil als ihrem Meister. So wurde dieser der Mächtigsten einer, und auf drei Kreise und einen Ruf flogen die Teufel voll Angst herbei, die er denn bei Tag und Nacht zwang, seine Befehle, bald dieses, bald jenes zu vollführen, daß sie wie Hunde arbeiten mußten.
Die ärgste Arbeit jedoch hatten sie mit seiner Frau. Sie, die ihn zuerst rasend gemacht hatte durch ihre große Bosheit, wurde jetzt abgehetzt und im Kreise geführt wie ein Pferd in der Reitbahn. Erst gab ihr Virgil den Farfarello zum Mann, der mußte sie zerkratzen und Feuer und Schwefel auf sie fallen lassen, daß sie halb geröstet im Bette lag.
Dann gab er sie dem Lucifer, der sie mit Schwanzschlägen und Hörnerstößen so durchlöcherte, daß sie wie ein Sieb ward. Zuletzt überließ er sie dem Carnazza, der blies sie auf wie einen Dudelsack, den er dann nach Herzenslust bearbeitete. Auch kein Schatten von Güte fiel mehr auf die böse Frau, die aber diese Strafe gar wohl verdient hatte.
Wohl war es manchmal den Teufeln selbst zu toll, aber sie mußten der Zaubergerte ihres Meisters gehorchen, und was er befahl, auch ausführen. Endlich wußten sie aber auch nichts mehr, was sie tun sollten, und da kommt denn auch der Tod und holt sich den Zauberer Virgil.
Deß waren die Teufel froh, und laufen und schließen ein Bündniß mit den verdammten Seelen, dieser Quälgeist solle ihnen nicht herein kommen, er würde sonst alle zwingen und aufs neue zu herrschen anfangen. Eilig schließen sie die Pforten der Hölle und legten Schloß und Riegel vor.
Der Zauberer Virgil kommt an, er klopft. »Wer ist da?« - »Ich bin es, der Zauberer Virgil!« - »Der Zauberer Virgil? Mach daß du fortkommst, für dich ist hier kein Platz.« - »Aber wohin soll ich sonst, da ich doch verdammt bin?« - »Das ist deine Sache, hier ist kein Platz für dich.« So blieb Virgil draußen, er mochte flehen und weinen wie er wollte, denn seine Macht war dahin, da ihm der Tod seine Zauberrute abgenommen.
Malagigi ging das Geschick seines Freundes zu Herzen, er überlegte, was zu tun sei, und so nahm er die verlorene Seele und die Gebeine des Zauberers Virgil, flog auf und trug sie auf eine Insel, da, wo das Meer am breitesten und tiefsten war. Hier baut er ein Grab von Steinen, wie eine große Kiste ohne Deckel, legt die Seele mit samt dem Totengebein hinein, sagt ein paar dunkle Worte, zeichnet drei nötige Kreise darauf und spricht den Zauber darüber aus:
Drehe dich um und um, dreh' dich im Lauf,
Das Meer und die Welten tun sich auf.
Es zittert die Sonne, der Mond verliert sein Licht,
Fortuna verschleiert alles dicht.
Seit der Zeit nun dieser Zauber ausgesprochen worden, geschehen wunderbare Dinge auf der Insel. Kommt einer an das Grab, das Gebein zu beschauen, so umwölkt sich der Himmel, ein Ungewitter bricht los, Blitze zucken zu Tausenden herab, so daß es scheint als käme der Jüngste Tag.
Das Meer, kaum ist es zu sagen, bäumt sich unter dem Sturm in wilden Sturzwellen, ein Teufelslärm! Und Schiffe und Barken verschluckt es wie Pillen. Dort gilt keine Kühnheit, der Kühnste wird nur am tiefsten sinken und eines qualvolleren Todes sterben, denn so will es der Zauber. Gott verhüte, daß ein Muttersohn je dahin komme!
Und wer es erzählt den Kindern und Erben,
Den lass keines bösen Todes er sterben.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

DER BAUERNSOHN ...

Ein armer Bauer besaß als einzigen Reichtum einen schönen Feigenbaum. Da die Früchte des selben ganz ausgezeichnet waren, beschloss der älteste Sohn dem Könige welche davon zu bringen. Unterwegs begegnet ihm aber eine Alte, welche ihm, da er auf ihre Frage was er in seinem Korbe habe, Hörner antwortet, die darin befindlichen Feigen in solche verwandelt.
Als nun der König beim Überreichen des Korbes Hörner in dem selben findet, wird er zornig und lässt den Überbringer gehörig durch prügeln. Das selbe Schicksal hat der zweite Bruder, als er die aus gleichem Grunde wie das erste Mal, aus Feigen in Eselsohren verwandelte Gabe übergibt.
Dem dritten Sohne begegnet auch die Alte, da sie aber auf ihre Bitten einige Feigen von ihm erhält, lässt sie die übrigen so schön werden, dass der König den Überbringer mit Geld, Pferden und Getreide beschenkt. Vor dem Tore gehen jedoch die Pferde durch. Glücklicher Weise erscheint aber wieder die Alte und gibt ihrem Schützling eine Pfeife, ein Tischtuch und eine Keule.
Auf den Ton der Pfeife folgen die Pferde ruhig ihrem Besitzer, der aber die selben seinem Vater schenkt, und dann selbst die Welt zu durchstreifen anfängt. So kommt er in eine Stadt und wird hier der Hirt des Königs, trotzdem dass dieser ihm vorstellt, wie schon viele bei diesem Geschäfte umgekommen seien.
Er tritt seinen Dienst an; während seine Schafe weiden, lagert er sich und breitet sein Tischtuch auf der Erde aus. Augenblicklich bedeckt sich das selbe mit Speisen. Unterdessen tritt aus dem nahen Palaste ein Riese, welcher sogleich, als er dem Schäfer dort das Weiden verbieten will, von ihm mit der Keule erschlagen wird.
Der Sieger geht darauf in den Palast, findet dort Soldaten und Musiker, die sich ihm zur Verfügung stellen. Er befiehlt ihnen einstweilen da zu bleiben, aber seiner Befehle stets gewärtig zu sein. Nachdem er noch im Garten einen Strauss Nelken sich gepflückt hat, kehrt er heim.
Geschmückt mit jenem Strausse, sieht ihn am Abend die Königstochter unter ihrem Fenster vorüber gehen, verlangt und erhält von ihm jenen Strauss. Die Erlebnisse des folgenden Tages sind die gleichen, nur dass im Palaste sich Korporäle und Sergeanten befinden und ein Jasmin Strauss verschenkt wird. Der dritte Tag verläuft wie die beiden vorhergehenden, im Palaste aber sind höhere Offiziere und die Königstochter erhält einen Rosen Strauss.
Um diese Zeit hält der König von Spanien für seinen Sohn um die Tochter des Königs an. Diese schlägt aber den Antrag aus und erklärt sich offen für den Schäfer, worauf der König die Tochter einkerkern lässt und dem Schäfer mit dem gleichen Los droht.
Diesem aber weiß der Letztere sich nicht nur zu entziehen, sondern zwingt auch noch mit Hilfe des aus den drei Palästen herbei gerufenen Heeres den König, die Tochter heraus zu geben, welche sich ihm schließlich vermählt.
![]()
DER KÖNIGSSOHN ALS BÄCKER ...

Der König von Neapel hält für seinen Sohn um die Tochter des Königs von Paris an, empfängt aber eine abschlägige Antwort. Der Prinz macht sich nun mit seinem Sekretär selbst auf den Weg. In Paris angekommen tritt er in die Dienste des Hofbäckers. In dieser Stellung muss er dem Könige und dessen Tochter das Brot bringen. Da er sehr schön ist, verliebt sich des Königs Tochter bald in ihn, und trotzdem dass er ihr vorstellt, er sei sehr arm, beredet sie ihn zur Flucht mit ihr.
Sie machen sich auf den Weg nach Neapel, auf dem die Prinzessin viel von Hunger und Müdigkeit leidet. In der Nähe der Stadt sagt der Prinz seiner Frau, es sei ihm nicht erlaubt Neapel zu betreten, da er verbannt worden. Sie müssten in einer Hütte im Walde ihre Wohnung aufschlagen. Er wolle aber gehen um zu sehen ob er etwas verdienen könne.
Der Prinz geht nun in die Stadt zu seinem Vater, erzählt was vorgefallen und kehrt dann zur Gattin zurück. Den zweiten Tag geht er wieder in die Stadt unter dem Vorwand, einen Trödelkram zu kaufen. In der Tat aber legt er seine fürstlichen Kleider an und fährt als Königssohn im herrlichen Wagen am Hause, in dem seine Frau wohnt, vorbei. Diese bedauert bei seinem Anblick, dass sie seine Hand früher ausgeschlagen, indessen jetzt müsse sie ihrem Manne treu bleiben.
Da erkennt der Prinz, dass seine Frau ihn wahrhaft liebt und sagt dem Könige, er möge am folgenden Tage am Hause im Walde vorüberfahren, er selbst wolle dann, als scheinbar Verbannter, mit seiner Frau ihn um Gnade anflehen. Alles geschieht laut der Verabredung. Der König gewährt die erbetene Verzeihung, und macht den Begnadigten zu seinem Diener.
Als solcher müssen er und seine Frau mit der Dienerschaft essen. Am Abend beredet der vermeintliche Bediente seine Frau mit ihm den Palast zu besehen, und als er in die Kammer des Königssohnes kommt, erklärt er dort schlafen zu wollen. Trotz der Gegenvorstellungen der Frau setzt er seinen Willen durch, sowie auch, dass beide sich in königliche Kleider kleiden, als sie am folgenden Morgen ihren eigenen Anzug nicht mehr finden.
Im Palaste begegnen sie dann dem Könige, der endlich den Sohn mit seiner Gattin freudig begrüsst.

DIE GEDEMÜTIGTE KÖNIGSTOCHTER ...

Es war einmal ein König, der hatte eine sehr schöne Tochter, sie war aber auch sehr launenhaft und stolz, und nie war ihr ein Freier recht. So viele auch auf das Schloß kommen mochten, sie machte sich über alle lustig, und ließ sie mit Schimpf und Schande abziehen, der König machte ihr Vorwürfe, sie aber wollte nicht hören, und trieb nach wie vor mit den Freiern ihr Spiel. Endlich wollte kein Freier mehr kommen.
Da schickte der König in ferne Länder, wo man noch nichts von ihr wußte, und ließ die Bilder von den schönsten Prinzen kommen, sie gefielen ihr aber alle nicht. Endlich jedoch, weil der König ihr so viel Vorwürfe machte, zeigte sie auf das Bild eines sehr schönen Königs, und sprach: »Lasst Den kommen, ich will ihn zum Manne nehmen.« Da ward der alte König hoch erfreut, und ließ den jungen König mit allen Ehren abholen, und empfing ihn aufs Glänzendste. Er ließ ihm zu Ehren schöne Festlichkeiten geben, und alles schien gut weiter zu gehen.
Eines Tages aber, da sie zu Tische saßen, bemerkte die Königstochter, daß der junge König einen Stuhl genommen hatte, auf dem ein Federchen lag, und daß ihm beim Essen ein wenig Sauce auf die Brust fiel. »O,« rief sie gleich, »Feder auf dem Stuhl, Sauce auf der Brust!« und wollte ihn nun nicht mehr haben. Da ward der junge König sehr gekränkt, und mußte mit Beschämung in sein Land zurück kehren; der alte König aber ward so zornig, daß er seine Tochter verstieß, und sie mit einer Kammerfrau in die weite Welt hinaus jagte.
Da wanderte die Königstochter mit ihrer Kammerfrau, bis sie in ein Städtchen kamen, wo sie ein kleines Häuschen mieteten. Sie mußten aber doch leben. Also zog die Kammerfrau aus und verschaffte sich Weißzeug, das brachte sie nach Haus, und die Königstochter nähte es. So trieben sie es lange Zeit.
Der junge König aber hatte die Königstochter von Herzen lieb gewonnen, und hatte keine Ruhe ohne sie. Da er nun hörte, daß sie von ihrem Vater verstoßen worden war, verkleidete er sich in einen Hausierer, und wanderte mit seinem Kasten durch das ganze Reich, um sie wo möglich zu finden.
Eines Tages nun kam er in die Stadt wo sie wohnte, und da er seine Ware ausrief, fiel ihr ein, daß sie keine Nadeln mehr habe, und rief ihn, um bei ihm welche zu kaufen. Als er sie nun sah, ward er sehr erfreut, und verkaufte ihr allerlei, und dazwischen unterhielt er sich mit ihr. Als er nun hörte, daß sie Weißzeug nähe, bestellte er ein Dutzend Hemden bei ihr, und kam oft, um nachzusehen, wie weit sie wären. Er wollte sich aber an ihr rächen für die Demütigung, die sie ihm zugezogen hatte, also gab er sich nicht zu erkennen, sondern kam immer als Hausierer.
Nach einiger Zeit nahm er einmal die Kammerfrau bei Seite, und sprach zu ihr: »Wenn es ihr recht ist, möchte ich gern dies junge Mädchen heiraten. Ich kann sie zwar jetzt noch nicht heiraten, aber ich möchte sie doch mitnehmen in mein Land, denn ich kann nicht länger hier bleiben.« Da ging die Kammerfrau zu ihrer jungen Herrin, und redete ihr zu, sie solle den Hausierer doch nehmen, »denn,« sprach sie, »wenn ich sterben sollte, dann wärt ihr ja allein auf der Welt.«
Die Königstochter wollte zwar nicht gern, aber ihr Stolz war gebrochen, und sie sagte »ja«, und ging mit dem Hausierer in die weite Welt. Sie wanderten viele, viele Tage lang, bis sie in das Reich des jungen Königs kamen. Die arme Königstochter war so matt, daß sie kaum mehr vorwärts konnte; da führte sie ihr Mann in ein ärmliches Häuschen und sprach: »Siehst du, das ist meine Wohnung, da müssen wir uns behelfen.«
Nun mußte die zarte Königstochter alle Arbeit tun, kochen, und waschen und nähen, und jeden Morgen wanderte der Hausierer fort, und wenn er am Abend wieder kam, brachte er ihr eine Kleinigkeit mit, und sagte: »Siehst du, das ist alles, was ich verdient habe.« Er blieb aber den ganzen Tag in seinem Schloß bei seiner Mutter, der er erzählte, daß er die junge Königstochter bei sich habe, die ihn so gekränkt habe.
Nach einiger Zeit kam er einmal zur Königstochter und sprach: »Wir müssen nun ausziehen, denn ich kann die Miete nicht länger bezahlen. Ich will aber zur Königin gehen, und sie bitten, uns zu erlauben, in einem ihrer Ställe zu schlafen. Sie ist meine Gönnerin, und wird mir meine Bitte nicht abschlagen.« Da ging er fort, und als er wieder kehrte, sprach er: »Die Königin hat es mir erlaubt, und wir werden von nun an im Stall wohnen.«
Also mußte die zarte Königstochter im Stall wohnen, und auf dem Stroh schlafen. Sie ertrug es aber mit Geduld, und dachte nur: »Ich habe es verdient durch meinen Stolz.« Ihr Mann aber ging jeden Morgen mit seinem Kasten fort, um zu hausieren; er ging aber nur ein Paar Schritte, so lange sie ihn sehen konnte, dann trat er durch eine andere Türe in das Schloß, kleidete sich als König an, und ging nun immer an ihr vorüber, ohne daß sie in ihm ihren Mann erkannt hätte; sie sah aber wohl, daß er der von ihr verschmähte Freier war, und meinte, sie müsse in den Boden sinken vor Scham.
Eines Tages kam er nun zu seiner Mutter, und sprach: »Die Königstochter ist noch nicht genug gestraft für ihren Stolz; laßt sie herauf kommen, und im Schloß als Näherin arbeiten.« »Ach, mein Sohn,« sprach die Mutter, »laß doch das arme Mädchen in Ruh, und nimm es wieder zu Gnaden an.« »Nein,« antwortete er, »die Demütigung, die ich durch sie erfahren habe, soll sie auch erfahren.«
Da ging er zu seiner Frau, und sprach: »Im Schlosse wird jetzt viel Kinderzeug genäht, denn der König hat sich verheiratet, und die junge Königin erwartet ein Kind. Die alte Königin aber hat dich rufen lassen, damit du auch arbeiten hilfst.« »Ach nein,« antwortete sie, »laß mich hier bleiben, ich schäme mich dem jungen König unter die Augen zu kommen.«
»Ach was,« rief er, »wovon sollen wir denn leben? Geh gleich hinauf, der junge König wird sich nicht um dich kümmern. Und höre, sei nicht dumm, und wenn du ein Hemdchen oder ein Häubchen nehmen kannst, so tue es, du wirst es bald brauchen.« »Ach nein,« sprach sie, »wie könnte ich so etwas tun.« »Mache mich nicht bös,« rief ihr Mann, »und tue, was ich dir sage. Du kannst es ja im Busen verstecken.«
Die arme Königstochter ging also ins Schloß, und weil sie sich vor ihrem Mann fürchtete, so nahm sie ein Hemdchen unbemerkt weg, und versteckte es im Busen. Als sie aber so saß und nähte, kam auf einmal der junge König herein, und rief: »Wen habt ihr denn hier zum Nähen? ich kenne diese Frau als eine Diebin.« Die arme Königstochter wurde bald rot, bald blaß, und die alte Königin sprach: »Laß die Näherin in Ruhe, mein Sohn; es ist eine arme Frau, die bei uns im Stall wohnt.« »Nein,« sprach er, »sie ist eine Diebin, und ich will es euch beweisen.« Da griff er ihr in den Busen, und zog das Hemdchen heraus.
Die arme Königstochter erschrak so sehr, daß sie ohnmächtig wurde. »Mein Sohn,« sprach die Königin, »sieh, wie das arme Mädchen leidet. Ende nun ihre Leiden.« »Nein,« sprach er, »sie ist noch nicht genug gestraft,« und ließ sie in den Stall hinuntertragen.
Als er am Abend wieder kam, erzählte sie ihm weinend ihr Unglück, und sagte, sie wolle nicht wieder ins Schloß gehen. Er aber fuhr sie hart an, und befahl ihr den nächsten Morgen wieder hinauf zu gehen, und auch wieder etwas zu nehmen. Du kannst es ja unter die Schürze verstecken,« meinte er. Sie weinte zwar bitterlich, mußte aber doch gehorchen, und den nächsten Morgen ging sie wieder ins Schloß zum Nähen, und als sie Niemand beobachtete, nahm sie zwei Häubchen, und versteckte sie unter die Schürze.
Als sie aber nähte, kam der König herein, und rief: »Habt ihr diese Diebin schon wieder herauf kommen lassen? Ich will euch doch zeigen, daß nichts vor ihr sicher ist.« Da griff er ihr unter die Schürze, und zog die Häubchen hervor. Die Königstochter wurde ohnmächtig, und trotz der Bitten der alten Königin ließ sie der König wieder in den Stall zurück bringen.
In der Nacht aber kam ihre Stunde, und sie gebar einen wunderschönen Knaben. Da brachte ihr ihr Mann ein wenig Fleischbrühe, und sprach: »Die Königin schickt dir diese Fleischbrühe, und diese alten Windeln für unseren Sohn.« In der Fleischbrühe aber war ein Schlaftrunk; und als die Königstochter sie genommen hatte, schlief sie fest ein. Da ließ der König sie ins Schloß hinauf tragen, wo ein schönes Bett für sie bereit stand, und ließ ihr ein Hemd von der feinsten Leinwand anziehen, und sie ins Bett hinein legen.
Neben dem Bett aber stand eine kostbare Wiege für den jungen Prinzen, der auch gekleidet wurde, wie es sich für den Sohn eines Königs ziemte. Der junge König aber legte seine Hausierertracht ab, und zog königliche Kleider an. Als nun die Königstochter erwachte, schaute sie sich verwundert um, und glaubte zu träumen. Da trat der König herein, und frug sie freundlich, wie es ihr gehe. Sie aber wußte nicht, wie sie seinen Augen begegnen sollte.
»Kennst du mich nicht?« frug der König. »Ich bin ja dein Mann, der Hausierer. Ich habe dich für deinen Stolz strafen wollen, doch nun ist alles Leid vorbei, und du bist meine liebe Gemahlin.« Als nun die junge Königin gesund geworden war, feierten sie ein glänzendes Hochzeitsfest, und die Eltern der Königin mußten auch kommen, und freuten sich sehr, als sie ihre Tochter wieder sahen. Da lebten sie glücklich und zufrieden, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
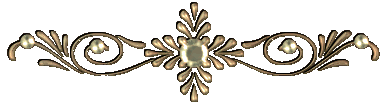
NENNILLO UND NENNELLA ...

Es war einmal ein Mann namens Jannuccio, welcher zwei Kinder besaß, Nennillo und Nennella, die er mehr liebte als sich selbst. Nach dem aber der Tod mit der Feile der Zeit alle Schlösser des Gefängnisses, darin die Seele seiner Frau eingesperrt war, durchgefeilt hatte, heiratete er ein nichtswürdiges Weibsbild, das kaum den Fuß über die Schwelle ihres Mannes setzte, als sie auch schon anfing, den Kopf hoch zu tragen und zu sagen:
»Bin ich denn hierher gekommen, um die Kinder einer anderen zu lausen? Das fehlte mir gerade, daß ich mir diese Bürde aufladen und den ganzen Tag lang diese Schreibälge um mich haben sollte. Lieber wollte ich, daß ich den Hals gebrochen hätte, ehe ich für schlechtes Essen, schlechteres Trinken und noch schlechteres Schlafen, wie es mir diese Brut bereitet, in diese Hölle kam. Dies Leben kann ich nicht länger ertragen; denn ich will Hausfrau und nicht Dienstmagd sein. Ich muß irgendein Mittel finden, um mich von diesem Gezücht zu befreien, oder ich selbst gehe drauf. Besser ist es, einmal zu erröten, als hundertmal zu erblassen. Ich will der Sache ein für allemal ein Ende machen und bin drum fest entschlossen, sie mir vom Halse zu schaffen oder selber davon zu laufen.«
Der arme Ehemann, der dieses Weib ziemlich lieb gewonnen hatte, erwiderte darauf: »Sei nur nicht so erbittert, liebe Frau, denn der Zucker ist teuer. Morgen früh, sobald der Hahn kräht, will ich dich von dieser Bürde befreien und dir so allen Anlass zum Ärger aus dem Weg räumen.« Ehe also noch des anderen Tages Aurora die rote Bettdecke zum Fenster des Ostens hinaus breitete, nahm der arme Vater seine zwei Kinder bei der Hand, einen großen Korb voller Lebensmittel an den Arm und führte jene in einen Wald, wo ein Heer von Pappeln und Buchen die Dunkelheit belagert hielt.
Dort angelangt, sprach Jannuccio zu seinen Kindern: »Meine lieben Kinder, bleibt hier an diesem Ort, esst und trinkt froh und fröhlich, und wenn es euch an etwas fehlt, so seht diesen Streifen Asche, den ich hier hin streue und der euch wie ein Faden aus dem Labyrinth heraus nach unserem Hause führen wird.« Hierauf gab er jedem Kind einen Kuß und kehrte weinend nach Hause zurück.
Um die Stunde der Nacht aber hatten die Kinder Angst, an jenem öden Ort allein zu bleiben, wo das Rauschen eines Flusses, welcher die kecken Steine peitschte, die ihm mutwillig in den Weg traten, selbst einen Rodomont hätte in Furcht setzen können. Sie zogen daher langsam den Aschenpfad entlang und kamen endlich gegen Mitternacht am Haus des Vaters an.
Pascozza aber, die Stiefmutter, gebärdete sich nicht wie ein Weib, sondern wie eine leibhaftige Furie und stieß ein gewaltiges Geschrei aus, in dem sie mit Händen und Füßen um sich schlug und wie ein scheues Pferd schnaubte, wobei sie ausrief: »Was ist das? Woher kommen zum Kuckuck diese Klunkern, diese Filzläuse? Kann denn kein Quecksilber sie vom Hause vertreiben? Willst du sie durchaus mir zur Kränkung im Hause behalten? Schaffe sie mir sogleich aus den Augen, sonst kehre ich morgen früh in das Haus meiner Eltern zurück. Nicht dazu habe ich so viele schöne Sachen ins Haus gebracht, um eine Sklavin von Kindern zu sein, die mich nichts angehen.«
Der arme Jannuccio sah, wie schlimm die Sachen standen und wie hitzig seine Frau wurde, faßte also wieder die Kinder bei der Hand und kehrte mit ihnen in den Wald zurück, wo selbst er ihnen wie das vorige Mal einen Korb mit Eßwaren gab und zu ihnen sprach: »Ihr seht, meine einzig geliebten Kinder, wie sehr eure Stiefmutter, die euch zum Verderben und mir zum Kummer in mein Haus gekommen ist, euch haßt.
Darum bleibt also nur in diesem Wald, wo die Bäume, mitleidiger als sie, euch gegen die Sonne schützen, wo der Fluß, wohl wollender als sie, euch ohne Groll zu trinken geben und die Erde, freundlicher als sie, euch Rasenlager ohne Gefahr darbieten wird, und wenn es euch an Lebensmitteln fehlt, so kommt diesen Pfad von Kleie entlang, den ich in gerader Linie bis an unser Haus mache, und holt euch, was ihr braucht.« So sprechend, wandte er sein Angesicht fort, um nicht zu zeigen, daß er weinte, und die armen Kinder nicht zu entmutigen.
Als diese nun das, was sich im Korb befand, verzehrt hatten, wollten sie nach Hause zurück kehren. Da aber zum Unglück, die auf die Erde gestreute Kleie von einem Eselchen weg gefressen worden war, verfehlten sie den Weg und irrten einige Tage lang in dem Wald um her und nährten sich von Eicheln und Kastanien, die sie auf der Erde fanden.
Durch die Fügung des Himmels jedoch, der stets seine Hand über die Unschuldigen hält, ging gerade um diese Zeit ein Prinz in jenem Wald auf die Jagd, und Nennillo bekam beim Bellen der Hunde so große Furcht, daß er in einen hohlen Baum kroch, während Nennella anfing, aus allen Kräften zu laufen, bis sie aus dem Walde hinaus zur Meeresküste gelangte. Dort wurde sie von Seeräubern, die Holz einnahmen, entführt und hierauf von dessen Anführer in sein Haus gebracht, wo er und seine Frau, unlängst durch den Tod einer Tochter beraubt, sie an Kindes Statt annahmen.
Inzwischen war Nennillo, der sich in den Baum verkrochen hatte, von Hunden umringt worden, die ein betäubendes Gebell erhoben, dem zufolge der Prinz endlich nachsehen ließ, was dazu Anlass gäbe. Und da man nun diesen schönen Knaben fand, der noch so klein war, daß er nicht zu sagen wußte, wer seine Eltern seien, so hieß er einen Jäger, ihn mit auf den Sattel zu nehmen und zum königlichen Palast zu bringen.
Dort ließ er Nennillo sehr sorgfältig erziehen und in allen schönen und nützlichen Dingen, besonders aber in dem, was ein Vorschneider wissen muß, unterrichten, so daß er nach einigen Jahren dermaßen geschickt in seiner Kunst wurde, daß er die Speisen aufs zierlichste vorzuschneiden verstand.
Während dieser Zeit nun entdeckte man, daß der Schiffseigentümer, in dessen Haus sich Nennella befand, ein Seeräuber war, und wollte ihn ins Gefängnis setzen. Weil er aber die Gerichtsleute zu Freunden hatte und sie in seinem Sold hielt, bekam er Wind und machte sich mit seinem ganzen Hause aus dem Staube.
Es war aber vielleicht die Gerechtigkeit des Himmels, die bewirkte, daß der, welcher sein Verbrechen auf dem Meere verübt, auch auf dem Meer dafür büßen sollte. Denn da er sich auf einer schwachen Barke eingeschifft hatte und sich nun mitten auf der See befand, kam ein solcher Windstoß und Wogengang, daß die Barke umschlug und alle ertranken. Nur Nennella, die nicht wie seine Frau und seine Kinder an den Räubereien Teil genommen hatte, entkam der Gefahr, in dem sich zur selben Zeit in der Nähe ein großer verzauberter Fisch befand, welcher seinen furchtbaren Rachen öffnete und Nennella verschlang.
Als sie aber eben glaubte, daß es mit ihr vorbei wäre, erblickte sie im Bauch des Fisches wunderbare Dinge. Denn es befanden sich darin herrliche Gefilde, wunderschöne Gärten und ein prächtiger Palast mit allen Bequemlichkeiten, darin sie wie eine Prinzessin wohnte. Der Fisch brachte sie hierauf mit größter Schnelligkeit an eine Seeküste, und da eben die drückende Glut des Sommers war, die wie ein Kalkofen sengte, hatte sich der Prinz gerade dort hin begeben, um sich an der Meeresfrische zu erquicken.
Während man nun ein prächtiges Mahl bereitete, war Nennillo auf einen Balkon des Palastes, der sich am Ufer befand, getreten und schliff dort einige Messer, in dem er, um sich Ehre einzulegen, seinem Amt mit vielem Eifer vorstand.
Sobald ihn daher Nennella durch die Kehle des Fisches erblickte, erhob sie ihre Stimme aus der Tiefe und rief:
»Mein Brüderlein, mein Brüderlein,
Die Messer sind geschliffen fein,
Der Tisch ist gedeckt nett und rein,
Doch schmerzt es mich gar bitterlich,
In diesem Fisch hier zu sein ohne dich!«
Nennillo selbst achtete zwar anfangs nicht auf diese Stimme. Der Prinz jedoch, der sich auf einem anderen Ausgang befand und diese klagenden Töne gleichfalls vernommen hatte, wandte sich nach dieser Richtung hin und erblickte so den Fisch. Als er nun die selben Worte noch einmal wiederholen hörte, geriet er vor Erstaunen ganz außer sich und schickte eine Anzahl Leute ab, um zu sehen, ob sie vielleicht den Fisch durch List oder sonst auf irgend eine Weise ans Land ziehen könnten.
Inzwischen hörte er immer die selben Worte »mein Brüderlein, mein Brüderlein« wiederholen und fragte daher jeden einzelnen seiner Diener, ob er vielleicht eine Schwester besäße, die sich von ihm verloren hätte, worauf endlich Nennillo erwiderte, er erinnere sich wie im Traum, daß er, als er im Wald gefunden wurde, eine Schwester gehabt habe, von der er nie mehr etwas gehört habe. Der Prinz sagte darauf zu ihm, er solle sich dem Fisch nähern und sehen, was da los sei, vielleicht ginge es ihn etwas an.
Nennillo ging an den Fisch heran, worauf dieser seinen Kopf dem Ufer nahe brachte und einen sechs Ellen hohen Rachen öffnete, aus dem Nennella in solcher Schönheit heraus trat, daß sie ganz wie eine Nymphe aussah, die in irgend einem Zwischenspiel durch die Zauberei eines Magiers aus dem Bauch eines Fisches hervor komme. Als der Prinz sie nun fragte, wie sie da hinein gekommen wäre, erzählte sie ihm einen Teil ihrer Leidensgeschichte und namentlich, wie sie von ihrer Stiefmutter gehaßt worden war.
Da sich jedoch weder sie noch ihr Bruder des Namens ihres Vaters oder ihres Wohnortes zu erinnern vermochten, ließ der Prinz öffentlich ausrufen, daß der, der zwei Kinder namens Nennillo und Nennella verloren hätte, in den königlichen Palast kommen solle; denn er würde dort eine erfreuliche Nachricht erhalten.
Jannuccio, der die ganze Zeit über ein trauriges und trostloses Leben verbracht hatte, in dem er glaubte, seine Kinder wären von den Wölfen gefressen worden, eilte, als er jene Bekanntmachung vernahm, voller Fröhlichkeit zum Prinzen und sagte ihm, er habe die Kinder verloren, wobei er zugleich erzählte, wie er von seiner Frau gezwungen worden sei, sie in den Wald zu bringen.
Der Prinz wusch ihm nun gehörig den Kopf und nannte ihn einen einfältigen Pinsel, daß er sich von einer Frau so habe ins Bockshorn jagen lassen und zwei solche Juwelen, wie seine Kinder gewesen seien, von sich gestoßen hätte. Nachdem er ihn aber gehörig herunter gemacht hatte, legte er ihm wieder das Pflaster des Trostes auf, in dem er ihm seine beiden Kinder zu führte, die nun der Vater nicht müde wurde, zu umarmen und zu küssen, worauf ihm der Prinz den Kittel abnehmen und statt dessen eine prächtige Kleidung anlegen ließ.
Als dann ließ er die Frau Jannuccios herbei rufen, zeigte ihr dessen schmuckes Kinderpaar und fragte sie, was derjenige wohl verdiene, der ihnen etwas Böses täte und sie in Lebensgefahr brächte. »Ich würde ihn«, erwiderte sie, »in ein zugemachtes Faß stecken und dies hierauf einen Berg hinunter rollen.« —
»So geschehe es«, versetzte der Prinz; »der Bock hat sich dieses Mal selbst gestoßen, wohlan, da du dir selbst dein Urteil gesprochen hast, so soll es auch ausgeführt werden, denn du hast diese deine Stiefkinder mit unverdientem Haß verfolgt.«
Demgemäß befahl er, den von ihr selbst gefällten Spruch zu vollstrecken, worauf er Nennella einem seiner Vasallen, einem sehr reichen Edelmann, die Tochter aber ihrem Bruder zur Frau gab, indem er ihnen hinlängliche Einkünfte anwies, damit sie und ihr Vater, ohne jemandes zu bedürfen, bequem leben könnten, während ihre Stiefmutter in ein Faß eingeschlossen und zugleich von fernerem Leben ausgeschlossen wurde, wobei sie bis zu ihrem letzten Atemzug immerfort durch das Spundloch schrie:
»Wohl langsam mahlt des Schicksals Mühlenstein,
doch packt er sicher und zermahlt ganz fein.«

SOLDATINO ...

Es war einmal eine arme Frau, die hatte einen Sohn namens Soldatino. Eines Tages sprach Soldatino zu seiner Mutter: »Wisst Ihr was, Frau Mutter, ich will zur Königstochter gehen und ihr drei Rätsel aufgeben.«
»Was sind denn das für Flausen, Junge? Fürsten und Edelleute haben ihr Heil versucht, doch sie hat alle Rätsel geraten.«
»Ich will es aber doch versuchen.«
»Höre, Junge, wenn die Königstochter die Rätsel löst, kostet es deinen Kopf. Aber warte wenigstens noch ein Weilchen, damit ich dir ein Brot backen kann, einen schönen Fladen.« Die Frau dachte bei sich: »Ehe ihn die Königstochter umbringt, töte ich ihn lieber selbst.« Und sie mischte unter den Teig für den Fladen ein Giftpülverchen. Sie gab ihm den Kuchen, und Soldatino sagte, bevor er aufbrach: »Mama, ich nehme Paula mit.« Paula war nämlich seine Mieze.
Als er ein ganzes Stück gewandert war, knurrte sein Magen vor Hunger. Da sah er einen Vogel, schoss aber statt des Vogels einen Hasen, der war trächtig. Soldatino trennte ihm die Jungen aus dem Leib; in der Tasche hatte er ein paar beschriebene Bogen Papier, die verbrannte er, briet die Häschen über dem Feuer und aß sie auf. »Das wäre ein hübsches Rätsel für die Königstochter«, sagte Soldatino bei sich:»Ich zielte auf etwas, was ich sah,
Traf aber etwas, was ich nicht sah,
Aß lebendiges, doch nicht geborenes Fleisch,
Das ich im Rauch von Worten briet.«
Er schritt weiter und gelangte zu einer Quelle. »Du kommst mir gelegen, da kann ich ein Stück Fladen essen.« Und er ließ sich mit seiner Paula nieder. Da sprach er zu sich selbst: »Ich glaube nicht, dass meine Mutter etwas in den Fladen gebacken hat. Trotzdem will ich lieber erst meiner Paula ein Stückchen geben; ist etwas drin, dann sehe ich es ja.«
Er brach ein Stück Kuchen ab und gab es Paula zu essen. Diese zuckte drei-, viermal und fiel tot zur Erde. Als er die tote Paula sah, meinte er: »Das wäre wieder ein hübsches Rätsel für die Königstochter: ›Der Fladen tötete Paula.‹« Während er noch in Nachdenken versunken ist, wendet er sich um und schaut der Quelle zu; das herab stürzende Wasser fließt über einen Felsblock, den es ausgehöhlt hat. Sagt Soldatino: »Schau einer an, das gäbe noch ein Rätsel für die Königstochter: ›Das Weiche besiegt das Harte‹, werde ich zu ihr sagen. Freu dich, Soldatino, jetzt haben wir sie!«
Während er sich zum Weitergehen anschickt, erblickt er drei Frauen. »Ach, du mein Gott, da kommen drei Weiber her! Die werden jetzt anfangen zu schwatzen und kein Ende finden; ich werde mich schlafend stellen.«
Die Frauen gingen vorüber, es waren drei Feen. »Da liegt ja Soldatino«, rief die eine, »er ist auf dem Weg zur Königstochter, um ihr drei Rätsel aufzugeben. Der Arme!« meinte die zweite: »Lassen wir dem armen Burschen doch eine Gabe hier!« Die eine sagte: »Ich lasse ihm die Serviette da«; die zweite: »ich diesen Geldbeutel«; die dritte: »und ich diese Hirtenflöte«. Und damit entfernten sie sich.
Soldatino konnte es gar nicht abwarten, bis sie außer Sicht waren, vor lauter Begierde, die Gaben anzuschauen. Er richtet sich auf und breitet die Serviette aus; und diese füllt sich mit einer solchen Fülle von Leckerbissen, dass Soldatino beim bloßen Anblick das Herz im Leibe lacht. Er aß sich satt, faltete seine Serviette zusammen und spricht: »Jetzt will ich nachschauen, was sich im Geldbeutel befindet.« Er schüttelt ihn, und heraus fielen hundert Skudi, und der Beutel wurde niemals leer. »Und nun will ich die Flöte ausprobieren.« Und er begann zu spielen.
In der Nähe waren ein paar Bauern bei der Feldarbeit, Frauen und Männer. Als nun Soldatino die Flöte an die Lippen setzte, begannen jene sich im Tanz zu wiegen, hüpften und tanzten und flehten schließlich: »Soldatino, hör auf, hör auf, Soldatino, wir brechen uns die Beine!« Da nämlich die Flöte verzaubert war, mussten sie solange tanzen, wie er spielte.
Soldatino hört auf und begab sich in die Stadt; er geht zum Königspalast und sagt, er wolle der Königstochter drei Rätsel aufgeben. Er ist ein rechter Bauerntölpel, der Bursche, und sie lassen ihn nur ungern passieren. Der König warnt ihn: »Überlegt es Euch gut! Wenn meine Tochter sie rät, seid Ihr des Todes.« Die Königstochter sitzt in einem schönen Saal inmitten von Edelleuten und vornehmen Herren.
»Los, lasst Euer Rätsel hören«, fordert sie ihn auf. Da Soldatino jeden Tag ein anderes aufsagen muss, beginnt er mit dem ersten:»
»Ich zielte auf etwas, was ich sah,
Traf aber etwas, was ich nicht sah,
Aß lebendiges, doch nicht geborenes Fleisch,
Das ich im Rauch von Worten briet. -
Ohne Deuteln, klipp und klar,
Ratet, was dieses Etwas war.«
Die Königstochter schlägt bald das eine, bald das andere Buch auf, zerbricht sich den Kopf und meint schließlich: »Ich weiß es nicht.«
Der Junge verlässt den Palast, und die Königstochter ist ganz aufgeregt, denn wenn sie die Lösung nicht findet, muss sie den Bauernburschen heiraten. Sie geht zum Vater und jammert: »O liebster Vater, ich habe das Rätsel nicht gelöst, wenn ich nun diesen Tölpel heiraten muss!«
»Daran hättet Ihr früher denken müssen, mein liebes Kind! Aber seid nur guten Mutes, es folgen ja noch zwei andere Rätsel.«
Inzwischen ist der zweite Tag angebrochen; der junge Bursche erscheint pünktlich und gibt das zweite Rätsel auf:»
»Der Fladen tötete Paula. -
Ohne Deuteln, klipp und klar,
Bringt des Rätsels Lösung dar.«
Die Prinzessin wälzt in den Büchern, sinnt hin und her, aber ihr fällt die Lösung nicht ein. Verzweifelt geht sie zum Vater und weint: »Liebster Vater, was soll ich tun? Ich habe das zweite Rätsel auch nicht heraus bekommen. muss ich diesen Bauernlümmel nun heiraten?«
»Verliert nur nicht die Geduld, es folgt ja noch eins!« beruhigt sie der Vater. Soldatino wartet den dritten Tag ab und sagt das letzte Rätsel auf:
»Das Weiche besiegt das Harte. -
Ohne Deuteln, klipp und klar,
Bringt des Rätsels Lösung dar.«
Und sie sucht und sucht, doch ach, sie kann auch dieses Rätsel nicht raten. Da ruft Soldatino: »Die Königstochter gehört mir!«
»Aber gewiss, lieber Soldatino«, versichert der König, »habt nur einige Tage Geduld, im Augenblick könnt Ihr sie nicht heiraten. Steigt einstweilen mit den anderen ins Gefängnis hinunter!« Sprach Soldatino: »I wo; ich habe die Rätsel aufgegeben, die Prinzessin hat sie nicht gelöst, und nun gehört sie mir.«
»Ihr habt ja recht, aber geduldet Euch nur noch wenige Tage.« Und der König redete so lange auf ihn ein, bis der arme Soldatino schließlich zu den zum Tode Verurteilten ins Gefängnis herab stieg. Kaum kommt er unten an, da brüllen sie ihm entgegen: »He, du Dummkopf, bist du auch gekommen, um mit uns zu sterben?« »I wo, ich nicht«, erwidert er.
Nun sendet ihnen der König zu Mittag einen Topf Bohnen ins Gefängnis, und der Wärter stellt sie auf den Tisch. Soldatino gibt dem Topf einen Stoß, dass die Bohnen alle zu Boden kullern. Die anderen: »O du blöder Schelm, umbringen sollte man dich! Wir vergehen vor Hunger, und du kippst die Bohnen auf die Erde!«
»Haltet doch den Mund, was ereifert ihr euch denn so?« Er zog seine Serviette aus der Tasche, breitet sie auf dem Tisch aus, und schon begann alles zu schmausen. »Bravo, Soldatino!« Und sie lärmten vor Begeisterung, umarmten und küssten ihn. Und so geschah es Tag für Tag; alles Essen, das ihnen der Hof sandte, wiesen die Gefangenen zurück. Das kommt dem König zu Ohren; verwundert steigt er ins Gefängnis hinab, um nachzuschauen, was da los sei; und die Gefangenen erzählen ihm, Soldatino habe eine Serviette, die ihnen zu essen liefere. Der König wendet sich an Soldatino. »Hör einmal, Soldatino, du musst mir einen Gefallen tun und mir deine Serviette leihen!« »I wo, die leih ich nicht her.«
»Doch, tu mir den Gefallen, ich muss ein paar Einladungen geben; ich bringe sie dir dann sofort zurück.« Und der König schmeichelt so lange, bis er ihm die Serviette ausgespannt hat. Die Gefährten: »O du Esel, jetzt kannst du den Riemen enger schnallen, jetzt iß nur die Bohnen!«
»I wo, regt euch nur nicht auf. Schaut lieber her, was ich hier habe!« Und er zeigt ihnen den Geldbeutel. Die allerbesten Sachen, die auf dem Markt zu finden sind, wandern nun ins Gefängnis. Das erfuhr der König und begab sich zu Soldatino. »O Soldatino, du musst mir eine Bitte erfüllen. Leih mir doch deinen Geldbeutel, ich muss eine größere Schuld bezahlen; später erhältst du dann all die geliehenen Sachen zurück, die Serviette und den Beutel.«
Der Dummkopf von Soldatino gibt ihm den Beutel, und die anderen spotten. »O du Einfaltspinsel, jetzt bleibt dir nichts andres übrig, als Bohnen zu essen.« Und er: »I wo! I wo!« Da aber Soldatino an dem Tage der Hunger plagte, musste er sich wohl oder übel über die Bohnen her machen.
Am Tag darauf brachte ihm der König weder Beutel noch Serviette zurück. Meint Soldatino: »Wartet nur, ich werde Euch schon Beine machen!« Er zieht seine Flöte hervor und setzt zum Spielen an. »Ihr werdet sehen, wie rasch er mir alles zurück bringt, der König!« Alles beginnt zu tanzen: im Gefängnis, am Königshof, heißassa, hopsassa, es gibt kein Ende; der bricht ein Bein, der einen Arm; der König, die Königstochter tanzen, und alle sind schon halb tot.
Da fängt Soldatino erst richtig an. Unaufhörlich tanzend schreit der König: »Soldatino, hör auf, Soldatino, hör auf! Wir sind halb tot!« Soldatino aber hörte nicht auf, er spielt und spielt. »Ich will meinen Geldbeutel und meine Serviette!« Mehr tot als lebendig holt der König, immer fort tanzend, den Geldbeutel und die Serviette. »Gut, Majestät, die beiden Dinge habe ich erhalten. Aber jetzt möchte ich wenigstens eine Nacht bei Ihrer Tochter schlafen; hernach verzichte ich gern darauf, sie zu heiraten. Sonst spiele ich weiter!«
Da sagt der König zu seiner Tochter: »Hör, liebes Kind, geh doch eine Nacht mit dem Mann schlafen, sonst bringt er uns alle um!« Sagt Soldatino: »Majestät, hören Sie mich gut an: Auf alles, was ich Eure Tochter frage, muss sie mit Nein antworten. Sie kann also unbesorgt kommen. Sie soll Wachen aufstellen, Türen und Fenster offen lassen, Licht im Zimmer anzünden, und im Bett liegt jeder für sich auf einer Seite. Mir scheint...«
Erleichtert sagt der König zu seiner Tochter: »Also, liebes Kind, du kannst ganz ruhig schlafen gehen, du legst dich auf die eine Seite und Soldatino auf die andere.«
Und so geschieht es. Als sie im Bett liegen, sagt Soldatino: »Prinzessin, finden Sie es schön, dass die Tür aufsteht?«
»Nein.«
»Habt ihr es gehört, Wachen? Macht sie zu! Prinzessin, finden Sie es schön, dass die Wachen die Tür behüten?«
»Nein.«
»Habt ihr es gehört? Fort mit euch! Prinzessin, finden Sie es schön, dass das Fenster offen steht?«
»Nein.«
»Habt ihr es gehört? Geschwind, schließt es zu! Prinzessin, finden Sie die vielen Lichter schön?«
»Nein.«
»Habt ihr es gehört? Löscht sie aus. Prinzessin, finden Sie es richtig, dass Sie auf der einen und ich auf der anderen Seite liege?«
»Nein.«
»Rücken wir also aneinander! Prinzessin, finden Sie es schön, dass wir gar nicht Arm in Arm liegen?«
»Nein.«
»Umarmen wir uns also!«
Am nächsten Morgen erscheint der König, um Soldatino fort zu jagen; da sieht er, dass keine Wachen mehr da stehen, alle Lichter erlöscht sind und Soldatino mit der Tochter in zärtlicher Umarmung liegt. Und die Königstochter sagt: »Das ist mein Mann.« Und Soldatino sagt: »Das ist meine Frau.« Und lebten glücklich und zufrieden.
Nur mir war nichts davon beschieden.
Der Hochzeit folgte ein leckerer Schmaus.
und was ist für mich geblieben?
Eine gebratene Maus.

DER GEVATTER TOD ...

Einst heiratete ein ziemlich betagter Mann ein junges Mädchen, das ihm einen hübschen Knaben gebar. Die Freude des Alten, in seinen Jahren noch taufen lassen zu können, war außerordentlich, und er beschloss, sich um einen tüchtigen Gevatter um zu sehen, jedoch müsse der selbe schlecht und gerecht sein.
Als er sich also auf den Weg machte, sich nach einem solchen um zu sehen, begegnete ihm ein ansehnlicher alter Herr. »Wohin lauft ihr?« redete ihn dieser an. »Mir einen Gevatter bitten.« »Nun, wenn ich euch anständig bin, so will ich euch das christliche Werk wohl erzeigen.«
»Ja, sagt mir aber früher, wer ihr seid?«
»Ich bin unser Herrgott.«
»Ah!« sagte der Alte, »dann kann nichts daraus werden, denn erstens seid ihr mir ein zu grosser Herr und dann nehmt ihr manchen ins Paradies, der wo anders hin gehörte.«
Da begegnet ihm darauf ein anderer Herr. Auch dieser fragte ihn und bot sich ihm als Gevatter an.
»Ja lieber Herr! wer seid ihr denn eigentlich?« fragte der Alte.
»Ich bin der Teufel«, antwortete der Herr.
»Nun«, meinte der Alte, »schlecht wärt ihr wohl hinlänglich und noch über das Bedürfnis hinaus, aber nicht gerecht. Wie viele habt ihr schon geholt, die ein besseres Loos verdient hätten. Nein, ihr seid kein Gevatter, wie ich ihn will.«
Bald darauf kommt ihm ein einfacher, aber sehr alter Mann entgegen, der ihn abermals befragt, und nachdem er sein Anliegen gehört, sich als Gevatter anbietet.
»Nun, und wer seid denn ihr?« fragte der Alte.
»Ich bin der Tod«, antwortete hierauf der Fremde.
»Ha! Ihr seid mein Mann. Ihr kennt keinen Unterschied zwischen reich und arm, Stand und Rang, ihr seid ein gerechter Mann; daher, wenn es euch gefällig ist, so kommt mit mir nach Hause.«
Und da gingen sie zusammen nach Hause, dann in die Kirche und das Kind wurde getauft.
Als die Taufe vorüber war und der Tod bei dem darauf folgenden Imbiss schon ein wenig lustig wurde, sprach er zu dem Alten:
»Gevatter! Ihr habt mir eine Ehre erwiesen und mir eine Freude gemacht, ich will euch dankbar dafür sein und euch reich machen. Folgt meinem Rat und werdet Doktor. Als solcher geht unbedenklich zu jedem Kranken, zu dem man euch ruft, nur seht beim Eintritt in das Haus genau hinter die Türe. Seht ihr mich dort stehen, so sagt unbedenklich, dass er sterben werde, seht ihr mich aber nicht, so verschreibt ihm viel oder gar nichts, der kommt sicher auf ohne oder trotz eurer Medicin.«
Diesen Rath befolgte der Alte. Sein erster Patient war ein grosser Herr, der äußerst gefährlich erkrankt war. Keiner der vielen gerufenen Ärzte wusste zu helfen, alle betrachteten ihn als rettungslos verloren, da liess seine Familie in der Verzweiflung den neuen Arzt rufen. - Dieser kam, und wie er ins Haus trat, sah er sich nach seinem Gevatter um; als er diesen nicht sah, bekam er Mut, schritt rasch auf den Kranken zu, raffte die Fläschchen und Pulver, die er neben ihm fand, zusammen und warf sie zum Fenster hinaus. »Was da Medicin!« rief er, »gebt ihm ein Stück Braten und ein Glas guten Wein, und ich stehe euch dafür, binnen kurzem ist er frisch und gesund wie ich.«
Richtig verliess der Kranke in wenigen Tagen das Bett.
Ein andermal wurde er zu einem kräftigen Manne geholt, der ein kleines Fieberchen hatte. Da sah er seinen Gevatter hinter der Tür »Lasst den Geistlichen holen, sagt er zur Familie, denn der stirbt.« Da lachte man ihm ins Gesicht und liess andere Doktoren kommen, aber des Kranken Zustand verschlimmerte sich stündlich, und man endete damit, den Geistlichen in der Nacht holen zu lassen.
Da kommt einmal Gevatter Tod und ladet unsern Doktor zum Mittagessen zu sich. Nach dem Essen zeigt er ihm alle Lokalitäten des Hauses, nur ein Zimmer nicht. »Gevatter«, sagte der Alte, »habt ihr dieses Zimmer vergessen oder darf ich es nicht sehen?«
»Warum denn nicht, wenn ihr wollt«, entgegnete der Tod und schloss es auf, und da sah er eine Unzahl kleiner Lämpchen teils brennen, teils verlöschen, teils sich erst entzünden.
»Was ist das?« fragte der Alte.
»Die Lichtchen, die verlöschen, sind die Lebensflammen derer, die in dem selben Moment sterben, die sich entzünden, sind die der Kinder, die geboren werden, die aber lustig flackern, sind die der Lebenden.«
»Ach Gevatter«, sagte der Alte hierauf, »zeigt mir doch mein Lämpchen.«
»Herzlich gerne«, entgegnete der Tod, und zeigte es ihm schon fast ganz ohne Öl, mit tief herab gebranntem Dochte, nahe dem Erlöschen.
»Nun«, meinte der Alte, »mir zu Liebe könntet ihr doch ein wenig Öl nach gießen. Ich bin jetzt reich, habe ein braves Weib, einen herzigen Buben, kurz ich lebte gar zu gern noch ein wenig länger.«
»Nein«, sagte der Tod, »ihr habt einen gerechten Gevatter gewollt, und den habt ihr an mir gefunden; der Gevatterschaft zu Liebe kann ich keine Ausnahme machen.«
Da ging der Alte traurig nach Hause, küsste sein Weib und Kind, legte sich nieder und starb.
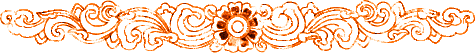
DER LISTIGE KNECHT ...

Einst hatte ein Bauer dreizehn Söhne, von denen der jüngste, ein sehr anstelliger Bursche, Tredesin (Dreizehn) hiess. »Vater«, sagte er einst, »das Leben hier zu Hause ist mir zu langweilig, ich will ein wenig in die Welt gehen und mich umsehen, wie es anderswo zugeht«, und somit ging er in den Dienst eines Edelmanns, der eine neidische, sehr boshafte Magd hatte.
Bald gewann der Edelmann seinen neuen Knecht sehr lieb, was die Magd nicht wenig ärgerte. Da nahe beim Schlosse des Edelmanns ein grosser Bär wohnte, so fiel ihr ein, ihrem Feinde diesen an den Hals zu hetzen. Sie suchte daher beide zu verfeinden. »Tredesin«, sagte sie einst zum Edelmann, »ist alles zu tun im Stande, was man ihm befiehlt, selbst dem Bär die Bettdecke (schiavina) vom Leibe zu stehlen, während er im Bette liegt«.
Da liess der Edelmann den Knecht rufen und fragte ihn: »Bist du im Stande, dem Bären die Decke vom Leibe zu stehlen?« »Nein, o Herr«, erwiederte Tredesin, »Hilft dir alles nichts«, sagte der Herr, »ich weiss du kannst es; bringst du mir nicht binnen drei Tagen die Decke, so lass ich dich hängen.« Da schlich sich Tredesin in des Bären Haus und zog ihm sachte die Decke vom Leibe, ohne ihn aufzuwecken, und brachte sie nach Hause.
Der Bär aber hatte einen sehr schönen Vogel, mit dem er täglich früh zu plaudern pflegte. Als er daher Morgens erwacht war, fragte er den Vogel, was für Wetter sei (Uccello bel verde, che tempo fa?), und dieser antwortete:
Il tempo si è bell' e buon,
Ma Tredesin l'ha fatto al padron.
Recht schön und gut lässt sich das Wetter an,
Doch Tredesin hat dir was angetan.
Da bemerkte der Bär erst, dass ihm die Bettdecke fehlte und ärgerte sich sehr. Die Magd aber ging zum Edelmann und sagte: »Tredesin ist auch im Stande, dem Bären sein schönes Pferd zu stehlen.« Da liess der Herr den Knecht rufen und fragte ihn, ob er das im Stande wäre, und als dieser es verneinte, sprach der Herr zu ihm: »Denke etwas nach, das Pferd muss binnen drei Tagen in meinem Stalle stehen, sonst hängst du.«
Da schlich sich Tredesin in des Bären Stall, umwand des Pferdes Hufe mit Stroh und führte es sachte in des Edelmanns Stall. Als am Morgen der Bär den Vogel um das Wetter befragte, sang dieser wieder:
Il tempo si è bell' e buon,
Ma Tredesin te l'ha fatto, Sior padron.
»Was hat mir der Schurke schon wieder gethan?« rief der Bär.
»Euch das Pferd gestohlen«, antwortete der Vogel.
Da wurde der Bär wild und brummte: »Wenn ich dem Kerl einmal wo begegne, so erwürge ich ihn ohne weiteres.«
Nur noch erboster über das Misslingen ihrer Anschläge sagte die Magd zu ihrem Herrn, Tredesin sei auch im Stande, dem Bären seinen Liebling, den Vogel zu stehlen, und wieder liess ihn der Herr rufen, befahl ihm den Vogel zu bringen, und drohte ihm mit dem Galgen, wenn er sich weigerte.
Da nahm Tredesin denn einen schönen, ganz mit Blumen umwundenen Käfig und ging damit zum Vogel. »Komme daher, schön grünes Vögelchen!« sagte er, »sieh den schönen Käfig.«
»Ich komme nicht«, antwortete der Vogel, »denn mein Käfig ist viel hübscher.«
»Nun probieren könntest du ihn doch«, erwiederte Tredesin, »denn wenn er dir nicht gefällt, so kehrst du in deinen wieder zurück.« Da ging der Vogel in den neuen Käfig, Tredesin aber machte schnell das Türlein zu und trug seinen Gefangenen nach Hause.
Nun geriet die Magd in grosse Verlegenheit und wusste kaum mehr, was sie sagen sollte. Da fiel ihr aber plötzlich ein, und schnell sagte sie es dem Edelmann, Tredesin habe sich gerühmt, den Bären selbst stehlen zu können. Dieser, dem die Idee gefiel, befahl also gleich seinem Knechte mit der gewöhnlichen Drohung, den Bären in sein Haus zu bringen.
Da ging er denn mit der Hacke in den Wald des Bären und machte eine grosse Truhe, aber auch der Bär ging in den Wald nachzusehen, wer denn da arbeite, und als er den Burschen sah, fragte er ihn: »Was machst du hier in meinem Walde, wer hat dir das erlaubt?«
»Ich mache eine Totentruhe für den armen Tredesin, der gestorben ist«, antwortete dieser dem Bären. »O, wenn die Truhe für diesen Spitzbuben ist, so arbeite nur zu, ich will dir sogar selbst noch helfen«, sagte der Bär.
»Danke schönstens«, entgegnete Tredesin, »ihr werdet mir damit einen grossen Dienst erweisen. Also habt die Güte und legt euch ein wenig hinein, damit ich sehe, ob die Truhe lang und breit genug ist.«
Da legte sich der Bär in die Truhe und Tredesin bat ihn, ihm nur noch zu erlauben, dass er auch den Deckel probiere. Als er den Deckel oben hatte, nagelte er ihn schnell und fest zu und schleppte die Truhe nach Hause.
Als nun der Edelmann seine grosse Freude darüber hatte, sagte Tredesin zu ihm: »Herr! ich glaube, mich habt ihr nun oft und schwer genug geprüft, versucht es jetzt auch einmal mit der Magd. Die hat geprahlt, dass sie auf dem Gipfel der Strohtriste sitzen bleiben könne, ohne dass ihr das Feuer etwas schadet, wenn man die Triste anzündet.«
Da liess der Herr die Magd rufen und befahl ihr, dieses Kunststück zu bestehen. Es half ihr kein Weigern und Bitten, sie wurde oben auf der Triste angebunden und der Herr selbst zündete die Triste an.
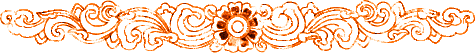
DAS KIND DER GESCHWISTER ...

Sterbend trug ein Gatte seiner Frau auf, bei ihrem Tode ein Testament zu machen. Dies tut die Frau auch, und zwar verbietet sie in ihrem letzten Willen ihren beiden Kindern, einem Sohn und einer Tochter, an dem bedeutenden Vermögen irgendwie zu rühren.
Die Geschwister sind dadurch verhindert sich zu verheiraten, und pflegen nun verbotenen Umgang unter sich. Die Frucht des selben war ein Sohn, den der Vater in den Fluss wirft. Das Kind treibt, in einem Kasten liegend, an eine Insel und wird von einem reichen Manne gefunden, der es mit seinem eigenen Sohne erziehen lässt. Da dieser Letztere aber dem Pflegesohn stets vorhält, dass keiner wisse wer sein Vater sei, so bittet der Kleine seinen Pflegevater ihm seinen Segen zu geben, er wolle sich aufmachen, seinen Vater zu suchen.
Auf dieser Fahrt wird er als Bettelknabe von seinen rechten Eltern, ohne dass diese ihn erkennen, aufgenommen und als er herangewachsen, an die eigene Mutter von dem Vater selbst, der das sündige Verhältnis aufgeben will, verheiratet; zu spät erkennt sie an einer roten Locke den Sohn. Nach dem dieser alles erfahren hatte, zieht er in die Einöde, um als Einsiedler die Sünden ab zu büssen.
Zwei Jahre hat er dies Leben geführt, da erkennen in ihm die, welche nach dem um diese Zeit erfolgten Tode des Papstes ausgezogen waren, um einen Einsiedler auf den päpstlichen Thron zu erheben, den Jenigen, der ihren Wünschen entspricht. Sie rufen ihn daher zum Papst aus. Als solcher verkündet er einen Sündenerlass für alle diejenigen, welche zu ihm kommen werden.
Kaum hören davon jener Bruder und jene Schwester, als sie sich auf den Weg nach Rom machen. Dort angekommen, begegnen sie auf der Strasse bei einer Prozession dem Papst, der sie zur Beichte in die Kirche kommen lässt. Nachdem er Beiden die Beichte abgenommen hatte, gibt der Papst sich seinen Eltern als Sohn zu erkennen.
Alle drei umarmen sich und sterben so vereint. Ihr Grabmal bewahrt noch jetzt die Peterskirche in Rom.
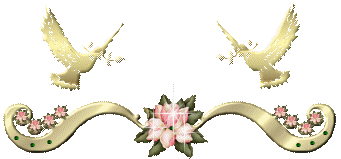
DAS SCHWARZE EI ..., von Luigi Capuana

Es war einmal ein altes Weibchen, das von Almosen lebte, und alles, was es bekam, teilte es genau in zwei Hälften, eine für sich, die andere für ihre Henne.
Jeden Tag in der Frühe fing die Henne an zu gackern; da hatte sie ein Ei gelegt. Die Alte verkaufte es für einen Kreuzer und kaufte dafür um einen Kreuzer Brot. Die Kruste zerkrümelte sie und gab sie der Henne, die Molle aß sie selbst. Dann ging sie herum und bettelte.
Da kam aber ein schlechtes Jahr. Eines Tages kam das Weibchen nach Hause und brachte nichts. »Ach, liebe Henne, heute wird unser Kropf leer bleiben.« »Nur Geduld. Morgen werden wir wieder essen.«
Am nächsten Tag, da es eben hell wurde, fing die Henne an zu gackern. Statt eines Eies hatte sie zwei gelegt, ein weißes und ein schwarzes. Die Alte ging fort, um sie zu verkaufen. Das weiße verkaufte sie gleich. Von dem schwarzen wollte niemand glauben, daß es ein Hühnerei sei. Die Alte kaufte wie gewöhnlich für den Kreuzer Brot und ging wieder nach Hause. »Ach, liebe Henne, das schwarze Ei will niemand.« »Bring es dem Könige!« Die Alte brachte es dem Könige.
»Was für ein Ei ist das?« »Majestät, ein Hühnerei.« »Was soll es kosten?« »Majestät, was Eure Güte Euch eingibt.« »Gebt ihr hundert Lire.« Mit den hundert Lire hielt sich das alte Weibchen für reicher als der König.
Grade in diesen Tagen hatte die Königin eine Henne zum Brüten hin gesetzt und zu den anderen Eiern tat sie nun auch dieses. Aber die Gluckhenne brütete es nicht aus. Der König ließ die Alte rufen.
»Das Ei war faul.« »Majestät, das kann nicht sein. Die Henne hatte es an dem selben Tage gelegt.« »Und doch ist es nicht ausgekrochen.« »Die Königin hätte es selbst ausbrüten sollen.« Die Sache schien sonderbar. Aber die Königin war neugierig und sagte:
»Ich will es ausbrüten.« Und sie steckte sich es in den Busen. Nach zweiundzwanzig Tagen fühlte sie, wie die Schale zerbrach. Herauskam ein reizendes weißes Küchlein.
»Majestät, Majestät, laßt mir ein Weinsüppchen kochen!« Und es piepte.
»Bist Du ein Hähnchen oder ein Hühnchen?« »Ein Hähnchen, Majestät.«
»Krähe!« »Kikiriki!«
Es war wirklich ein Hähnchen und belustigte den ganzen Hof. Aber, je mehr es wuchs, je unartiger wurde es. Bei Tische pickte es von den Tellern des Königs und der Königin; es kratzte, wie wenn es gar nichts wäre, auf den Tellern der Minister, die vor lauter Respekt nicht wagten Husch! zu sagen; es flog herum, hier hin und dort hin durch alle Zimmer des königlichen Palastes, setzte sich überall hin und beschmutzte alles. Und dann den ganzen Tag: Kikiriki! Kikiriki! daß allen die Ohren dröhnten. Die Hofleute wußten nicht mehr wohin.
Eines Tages hatte sich die Königin ein neues Kleid machen lassen, das eine wahre Pracht war und einen großen Sack Geld gekostet hatte. Ehe sie es anzog, flog das Hähnchen herzu und beschmutzte es. Die Königin wurde wütend. »Garstiges Hähnchen! Diesmal mag es hin gehen. Aber ein zweites Mal wirst du was erleben!«
Und sie bestellte bei der Schneiderin ein anderes Kleid, noch reicher als das erste. Die Schneiderin tat ihr Bestes. Man kann denken, was für ein Kleid das wurde. Aber ehe die Königin es anzog, fliegt das Hähnchen hin und besudelt es. »Garstiges Hähnchen! Jetzt sollst du mir büßen. Man rufe mir den Koch!«
Der Koch erschien.
»Man mache mir von diesem Hähnchen eine gute Tasse Brühe.« In der Küche drehen sie ihm den Hals um und fangen an es zu kochen. Kaum fängt das Wasser im Kessel an zu sieden: »Kikiriki!« Das Hähnchen war entwischt, als hätte man ihm nie den Hals umgedreht, es gerupft und die Federn abgesengt.
Der Koch lief zur Königin. »Majestät, das Hähnchen ist wieder aufgelebt.«
Die Sache war doch gar zu sonderbar, und das Hähnchen wurde sehr kostbar. Alle betrachteten es mit Respekt, einige auch mit ein bißchen Furcht. Und das mißbrauchte es. Bei Tisch pickte es schlimmer als früher von den Tellern des Königs und der Königin, scharrte, als wenn es gar nichts wäre, auf den Tellern der Minister, die nicht Husch! zu sagen pflegten aus Respekt vor dem König, setzte sich überall hin und beschmutzte sogar den königlichen Thron.
Und dann, Tag und Nacht: Kikiriki! Kikiriki! Das Volk aber verwünschte es mit verbissenem Grimm: »Zum Teufel das Hähnchen und die es aufziehen!« Eines Tages mußte Seine Majestät an einen anderen König schreiben, nahm Papier, Feder und Tintenfaß, schrieb den Brief und ließ ihn auf dem Tisch liegen, zum Trocknen. Mein Hähnchen fliegt hin und besudelt ihn, gerade wo die Unterschrift war.
»Garstiges Hähnchen! Diesmal gehe dir es hin, ein zweites Mal sollst du was erleben!« Der König schrieb den Brief noch einmal und ließ ihn auf dem Tisch liegen, zum Trocknen. Das Hähnchen fliegt hin und besudelt ihn, gerade wo die Unterschrift war. Der König geriet außer sich.
»Garstiges Hähnchen! Jetzt sollst Du mir büßen. Man rufe mir den Koch.«
Der Koch erschien. »Man soll mir es braten, zu Mittag.« In der Küche drehten sie ihm den Hals um und steckten es an den Spieß. Als die Essensstunde kam, trug der Koch es auf. Seine Majestät fing an, es zu tranchieren und auszuteilen, diesem einen Flügel, dem einen Schenkel, jenem ein Stück von der Brust, wieder einem den Bürzel. Für sich selbst behielt er den Hals und den Kopf mit dem Kamm und dem Halsgehänge.
Kaum hatte er sie aufgegessen, so bracht es aus der Tiefe seines Magens los: »Kikiriki!« Ein allgemeines Entsetzen. Man rief sogleich die Hofärzte.
»Man müßte dem König den Bauch aufschneiden. Aber wer will sich daran machen?« Und das Hähnchen, immer von Zeit zu Zeit ließ sich es aus dem Magen Seiner Majestät vernehmen: »Kikiriki!«
»Ruft mir die Alte,« sagte der König. Zufällig kam sie gerade jetzt um zu betteln nach dem königlichen Schlosse, und man holte sie herauf. »Teufelshexe! Was für einen Zauber hast du in das Ei gelegt? Ich habe den Kopf des Hähnchens gegessen, und jetzt kräht mir es im Magen. Wenn du mich nicht davon befreien kannst, bist du ein Kind des Todes.« »Majestät, gebt mir einen Tag Zeit. Ich laufe geschwind nach Hause.«
»Ach, liebe Henne, ich bin zum König gerufen worden. ›Er habe den Kopf des Hähnchens gegessen, und nun kräht es ihm im Magen.‹ Wenn ich ihn nicht davon befreien kann, muß ich sterben.«
»Liebe Alte, das ist nicht schwer. Nimm morgen ein bischen Hühnerfutter, geh wieder zum König und mache Put! Put! Wenn das Hähnchen deine Stimme hört, wird es herauskommen.«
Und so war's auch. Die Sache war gar zu seltsam. Das Hähnchen wurde berühmt und trieb es ärger als vorher. Eines Morgens, ehe die Sonne aufging: »Kikiriki! Majestät, ich will ein Huhn haben.« »Nun, so geben wir ihm ein Huhn!«
Am nächsten Tag in aller Frühe: »Kikiriki! Majestät, ich will noch ein Huhn.«
»Geben wir ihm noch ein Huhn.« Kurz, er wollte nach und nach zwei Dutzend Hühner.
Eines anderen Morgens in aller Frühe: »Kikiriki! Majestät, ich will goldene Sporen haben.« »Meinetwegen goldene Sporen!« Das Hähnchen, das ein schöner Hahn geworden war, brüstete sich mit seinen goldnen Sporen rings herum und pickte bald hier, bald dort.
Ein andermal am frühen Morgen: »Kikiriki! Majestät, ich will einen doppelten Kamm von Gold haben.« »Meinetwegen einen doppelten Kamm von Gold!«
Der König wurde es endlich müde, der Hahn aber mit seinen goldnen Sporen und dem goldnen Doppelkamm ging sich brüstend hin und her und pickte bald hier, bald dort.
Endlich an einem anderen Morgen in der Frühe: »Kikiriki! Majestät, ich will Euer halbes Königreich; ich habe eine Krone wie Ihr.« Dem König riß die Geduld.
»Schafft mir diesen unverschämten Hahn aus den Augen!« Aber wie sollte man das anfangen? Ihn töten half zu nichts; er lebte immer wieder auf. Ihn weit fort tragen, machte es nicht besser; er wäre wieder gekommen. Wenn man ihm gütlich zuredete, war es noch schlimmer; er antwortete höhnisch: Kikiriki!
Der König in seiner Verzweiflung schickte nach der Alten. »Wenn du mich nicht von diesem Hahn befreist, laße ich dir den Kopf abschlagen.« Die Alte ging gleich wieder nach Hause. »Ach, meine liebe Henne, ich bin zum König gerufen worden. – ›Wenn du mich nicht von diesem Hahn befreist, laße ich dir den Kopf abschlagen.‹ – Was soll ich antworten?« »Sage nur: Majestät, Ihr habt keine Kinder. Nehmt ihn an Sohnes statt an. Da wird er sich beruhigen.«
Der König, wie er sich an die Wand gedrängt sah, entschloß sich, ihn zu adoptieren. Aber es half wenig. Mit all diesen Hühnern war der königliche Palast der reine Hühnerhof geworden. Der König, die Königin, die Minister, die Hofdamen, die Dienerschaft, alle wurden mit Hühnermist bedeckt, vom Kopf bis zu den Füßen und wußten sich nicht zu lassen. Und dann, Gegacker hier, Kikiriki dort, allen dröhnte der Kopf.
Das Volk fluchte mit verbissenen Zähnen. »Hol der Henker den Hahn, die Hühner und den, der sie aufzieht!« »Höre, Hexe,« sagte der König, »wenn du mir bis morgen Hahn und Hühner nicht vom Halse schaffst, wirst du es mit deinem Kopf bezahlen.« »Majestät, hier kann nur die Fee Morgane helfen. Schickt nach ihr und laßt sie rufen.«
Der König schickte nach der Fee Morgane. Die Fee antwortete: »Wer will, mag gehen, wer nicht will, mag schicken.« Und der König mußte selbst hin gehen.
»Majestät, ehe der Hahn nicht ein Mensch geworden ist, wie Ihr, werdet Ihr keine Ruhe haben.« »Aber was muß geschehen, damit er ein Mensch wird, wie ich?«
»Dazu braucht es drei Sorten Hühnerfutter. Macht mit Euren Händen drei Furchen und sät diese drei Samenkörner hinein. Schneidet, drescht das Korn ohne es umzurühren und sprecht dazu: Putt, putt, putt Wem es gefällt, dem schmecke es gut! Und das wiederholt dreimal!«
Der König beeilte sich, alles genau nach Vorschrift zu tun. Als es so weit war: Putt, putt, putt! Wem es gefällt, dem schmecke es gut! Und von den Hühnern starb die Hälfte. Putt, putt, putt! Und die übrigen starben. Putt, putt putt! Und der Hahn fing an, die Körner allein aufzupicken, und als er das letzte Korn im Schnabel hatte, reckte er sich, dehnte sich, Kikiriki! schüttelte sich die Flügel vom Rücken und wurde ein großer, schöner junger Mann. Vom Hahn war ihm nur der Kamm und die Krone geblieben. Aber das machte nichts.
Der König sagte zum Volk: »Ich habe keine Kinder und dieser hier soll Kronprinz werden. Seht ihn dafür an.« »Hoch der Kronprinz! Hoch der Kronprinz!«
Aber heimlich sagten sie: »Wir wollen es abwarten. Wer als Hahn zur Welt kommt, muß krähen.«
Nach einigen Monaten wurde der Kronprinz schwermütig. Er wollte allein bleiben und sprach mit niemand. »Was habt Ihr, lieber Sohn?« »Nichts, Majestät.«
Er wollte es nicht sagen, er schämte sich, aber er hatte die größte Lust, Kikiriki zu machen.
Die Hofärzte wurden gerufen, auch andere von auswärts, die aller geschicktesten. Keiner begriff die Sache. »Vielleicht wollte der Kronprinz eine Frau?« »Nein, er wollte keine Frau.« Aber was wollte er denn? Was er auch gewünscht hätte, man würde es ihm geben. »Ich möchte Kikiriki machen.«
Man mußte es ihm erlauben, und er tat sich damit den ganzen Tag gütlich.
Da schnitt man ihm den Kamm ab, und nun wollte er nicht mehr krähen. Das Volk aber sagte: »Wir wollen sehen. Wer von einer Henne stammt, der muß scharren.«
Nach einigen Monaten wurde der Kronprinz wieder schwermütig. Er wollte allein sein, er sprach mit niemand. »Was habt Ihr, lieber Sohn?« »Nichts, Majestät.«
Er wollte es nicht sagen, er schämte sich, aber er fühlte die größte Lust, auf die Straße hinaus zu gehen und zu scharren.
Die Ärzte wurden wieder gerufen, aber sie wurden nicht klug daraus. »Vielleicht wollte der Kronprinz eine Frau?« »Nein, er wollte keine Frau.« Aber was wollte er denn? Was er auch gewünscht hätte, man hätte es ihm gegeben. »Ich möchte auf die Straße gehen und scharren.« Man mußte es ihm erlauben.
Da rissen sie ihm die Sporen ab, und nun wollte er nicht mehr scharren. Nun kam die Zeit, ihn zu verheiraten. »Würde Euch die Prinzessin von Spanien gefallen, lieber Sohn?« »Majestät, wenn ich heiraten muß, möchte ich ein Huhn heiraten.«
»Also fängt es immer von neuem an?« Der König hatte gerade seinen bösen Tag. Er zog den Säbel und hieb ihm den Kopf ab. Aber statt Menschenblut sprang Hühnerblut heraus.
Da erschien die Alte. »Majestät, damit ist es zu Ende.« Sie klebte ihm den Kopf wieder an mit Speichel, und der Kronprinz wurde wieder lebendig. Jetzt war er wirklich ein Mensch, verhielt sich ruhig, und bald darauf heiratete er die Prinzessin von Spanien. Später wurden sie König und Königin und taten allerlei Gutes.
Und nun ist das Märchen aus.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, von Luigi Capuana

DIE DREI BÄUMCHEN ODER DIE DREI BEFREITEN JUNGFRAUEN ...

Einst war ein König, der hatte drei wunderschöne Söhne von fünfzehn, siebzehn und achtzehn Jahren, und einen grossen Garten, in welchem er sie erziehen ließ. Eines Tages bekamen diese drei schöne ausländische Bäumchen zum Geschenk und pflanzten sie in die Erde, aber am anderen Morgen fanden sie die selben ausgerissen. Ganz verwundert darüber riefen sie den Gärtner und befragten ihn, wer das getan habe, aber der wusste nichts und somit setzten sie die selben von neuem.
Doch schon am anderen Tage fanden sie die Bäumchen neuerdings ausgerissen auf der Erde liegen. Nicht minder erstaunt als geärgert darüber beratschlagten sie, was denn zu tun sei; da ergriff der Älteste das Wort und sagte: »Wohlan, setzen wir sie abermals, ich will heute Nacht dabei wachen und doch sehen, wer sich untersteht, uns stets unsere Freude zu verderben.«
Richtig wachte er bei den Bäumchen, bis die Schlossuhr die Mitternachtsstunde schlug. Da erhoben sich die Bäumchen plötzlich selbst aus der Erde und ihnen nach folgte eine Totenbahre, begleitet von vier Männern, welche Windlichter trugen; dem Prinzen aber wurde gar schauerlich zu Mute, er floh in das Schloss zu seinen Brüdern und erzählte ihnen das Gesehene.
»Ach du lügst uns an«, sagte der mittlere Bruder, »warte nur, morgen will ich wachen.« Sie pflanzten wieder die Bäumchen, und als es dunkel zu werden begann, stellte sich der jüngere Prinz auf die Wache. Da kam die Mitternachtsstunde herbei, die Bäumchen erhoben sich wieder aus der Erde, hinter ihnen folgte der Sarg mit den Männern, aber auch der jüngere Prinz floh entsetzt zu den Brüdern und bestätigte, was der ältere erzählt hatte.
»Ach was«, sagte der jüngste der Brüder, »ihr seid mir schöne Helden! Morgen werde ich wachen, und ich stehe euch dafür, etwas neues sollt ihr durch mich erfahren.« Richtig wachte am anderen Abende der jüngste Prinz bei den wieder gepflanzten Bäumchen; als sich aber diese zur gewohnten Stunde wieder erhoben und der Sarg mit seinem Gefolge erschien, entfloh er nicht, sondern blieb auf dem Platze stehen, und als die Bahre um ihn herum getragen wurde, so fragte er entschlossen einen der Fackelträger, was dieses zu bedeuten habe und warum man ihnen täglich die Bäumchen ausreiße.
»Jüngling«, antwortete ihm dieser, »du hast viel Mut, und scheinst mir Wert zu sein, die Ursache dieser Erscheinung zu vernehmen. Wisse denn, dass unter jener Stelle ein großer Schatz vergraben ist. Gräbst du an der selben nach, so wirst du auf einen gemauerten Brunnen stoßen, in dessen Tiefe ein Sarg voll Gold bewahrt ist.« Die Erscheinung verschwand und ruhig kehrte der Prinz zu seinen neugierigen Brüdern zurück, denen er alles genau erzählte.
Schon zeitig am nächsten Morgen fanden sich die Prinzen mit einigen Arbeitern an der bezeichneten Stelle ein, als man aber nach langem Graben auf eine große Steinplatte gestoßen war und durch deren Beseitigung den Brunnen bloß gelegt hatte, wagte niemand hinab zu steigen. Da war es wieder der jüngste Prinz, der sich mutig hinab ließ, den Sarg öffnete und mit einer am Stricke befestigten Glocke stets das Zeichen gab, die mit Gold gefüllten Kessel hinaufzuziehen.
Nachdem der Sarg leer war, sah er sich unten im Brunnen etwas näher um und entdeckte einen gemauerten Gang, den er betrat und nach kurzer Strecke in einen prachtvollen Palast gelangte. Nachdem er viele und reich möblierte Säle durchschritten hatte, gelangte er in den Hof, in welchem er drei Mädchen von blendender Schönheit traf. »Unglücklicher«, riefen diese ihm zu, »wie kommst du hier her? Wisse, dass dieser Palast einer der mächtigsten Zauberinnen gehört. Entdeckt sie dich, so bist du verloren.«
Wenn dem so ist, meinte der Prinz, so verlange ich gerade nicht die Bekanntschaft dieser liebenswürdigen Dame zu machen, sondern gehe, woher ich gekommen bin. »O nimm uns mit!« riefen gleichzeitig die Mädchen, »denn auch wir sind der hässlichen, mürrischen Alten satt.« »Nun so folgt mir«, sagte er und führte sie in den Brunnen, von wo er sie eine nach der anderen hinauf ziehen ließ.
Als aber die Brüder oben die Menge Goldes gewahrten, und oben drein noch die schönen Mädchen, von denen die Jüngste, die zuletzt hinauf kam, ihnen am besten gefiel, da überwältigte sie der Neid, und sie beratschlagten, was zu tun sei, um ihrem Bruder seinen Anteil zu entziehen. »Sicher«, sagten sie, »wird er als der Jüngste auch das jüngste Mädchen für sich beanspruchen, sowie als Entdecker vielleicht den ganzen Schatz; es ist also das klügste, wir schneiden den Strick ab und lassen ihn so im Brunnen verhungern.« Und das taten sie auch.
Als der Prinz sah, dass der abgeschnittene Strick zu seinen Füssen fiel und kein anderer Strick mehr herab gelassen wurde, ahnte er den Verrat seiner Brüder und konnte daraus ermessen, dass für ihn keine Rettung mehr möglich war. Hunger und Durst nötigten ihn, durch den unterirdischen Gang in den Palast zurück zu kehren, und da begegnete er gleich im ersten Zimmer der alten Zauberin.
»Was suchst du hier, Verwegener! und wie bist du hier her gekommen?« schnauzte ihn diese grimmig an. »Wie ich hier her gekommen bin?« antwortete der Prinz, »das weiß ich selbst nicht, auch liegt mir gar nichts daran, es zu wissen, aber wie ich von hier recht bald wieder weg kommen könnte, das zu erfahren interessiert mich sehr, und könnt ihr mir dazu behilflich sein, so rechnet auf meine wärmste Dankbarkeit.«
War es die Meinung, dass er ihre Mädchen noch nicht gesehen hatte, oder gefiel der Alten der hübsche Jüngling mit seinem offenen, entschlossenen Wesen, kurz sie warf minder böse Blicke auf ihn, zog ein Ringlein vom Finger und sagte mit milder Stimme: »Nehmt diesen Ring, er wird tun, was ihr wünscht.« Da nahm er dankend den Ring und wünschte sich zurück in das Reich seines Vaters, aber nicht in dessen Palast, denn er fürchtete die Bosheit seiner Brüder.
Um unerkannt zu bleiben, nahm er Dienst bei einem Goldarbeiter, lernte das Handwerk und wurde so ein braver, fleißiger Geselle, dass ihn sein Meister sehr lieb gewann.
Unterdessen bewarben sich seine Brüder, obwohl vergeblich, um die Gunst des jüngsten Mädchens vom Brunnen, auch andere mächtige Freier hatten sich schon zahlreich eingefunden; da beschloss der König ein großes Turnier zu geben und setzte als Preis für den Sieger die Hand dieses Mädchens aus.
Von weit und breit kam zahlreiches Volk zur Stadt, das prachtvolle Schauspiel zu sehen; auch der Goldarbeiter ging und wollte seinen braven Gesellen mitnehmen, aber der entschuldigte sich mit Unwohlsein. - Kaum war jedoch sein Herr fort gegangen, so ließ er sich durch den Ring ein edles Pferd und eine prächtige Rüstung bringen und eilte zum Turnier. Niemand konnte ihm den Sieg streitig machen, aber als es zur Preisverteilung kam, war der Sieger nirgends zu finden.
Am folgenden Tage erschien er wieder auf dem Kampfplatz zur Verzweiflung aller Mitkämpfer; als er sich aber nach geendetem Ritterspiel wieder fort machen wollte, wurde er ertappt und fast mit Gewalt zum König geführt, der ihm das schöne Mädchen als Braut übergab. Da musste er denn kniend, wie es die Sitte gebot, seinen Dank aussprechen, und als er dabei sein Haupt tief neigte, entdeckte der König an seinem Halse ein ihm wohl bekanntes Muttermal und somit in dessen Träger seinen längst als tot beweinten Sohn.
Als am folgenden Tag mit unendlicher Pracht und Jubel die Hochzeit gefeiert wurde, erreichte der Neid seiner Brüder den höchsten Grad, und sie verschworen sich, ihn in der Brautnacht zu ermorden, aber die Verschwörung wurde noch rechtzeitig entdeckt.
Enttäuscht und tief gereizt erzählte er seinem Vater schon ihren früheren Angriff auf sein Leben im Brunnen, worauf sie der König im ersten Zorn zum Tode verurteilte, dann aber auf seine Fürbitte bloß mit Enterbung und ewiger Verbannung bestrafte, ihn aber zum Mitregenten annahm.
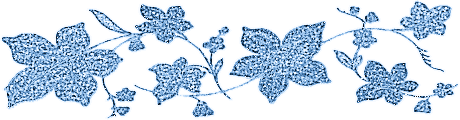
DER ZAUBERLEHRLING ...

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten einen einzigen Sohn. Der Vater wollte ihn die schwarze Kunst erlernen lassen und beschloß, ihn in die Stadt zum alten Hexenmeister zu bringen. Die Mutter war es zufrieden, nur solle der Sohn nicht länger als ein Jahr ausbleiben, denn sie liebte ihn so sehr. Das versprach der Mann und machte sich mit dem Sohne auf den Weg.
Als sie nahe bei der Stadt waren, stießen sie auf einen Brunnen, dem näherten sie sich, um zu trinken. Der Vater hatte getrunken, und vor Behagen, seinen Durst so schön gelöscht zu haben, rief er tief aufatmend: »Ah, wohl mir!« Da stand urplötzlich ein Mann vor ihm, ein Mann mit einem Barte, der bis auf die Knie fiel, und sprach: »Du hast mich gerufen, guter Mann, hier bin ich!« - »Ich dich gerufen?« fragte der Vater, »ich habe niemand gerufen.« - »Wie? Hast du nicht 'Wohl-mir gerufen?«
Da fing der Vater des Knaben an zu lachen, doch als bald stellte es sich heraus, daß jener Mann wirklich Wohl- mir heiße und ein großer Hexenmeister sei, der sich rufen hörte und erscheinen konnte, auch wenn er noch so weit entfernt war. Da meinte der Vater, den rechten Mann gefunden zu haben, und bot ihm hundert Dukaten an, wenn er seinen Sohn die Magie in einem Jahre lehren wolle. Der Alte nahm das Gebot an, der Vater übergab ihm den Sohn und kehrte heim. -
Nachdem das Jahr um, bat die Frau den Mann, ihren Sohn abzuholen, und er machte sich auf den Weg. Er kam an den Brunnen, wo sie sich vor einem Jahre getrennt hatten, und er fühlte einen Windstoß, und eine Stimme klang: »Wind bin ich, Mensch werde ich!«
Und da stand sein Sohn vor ihm, der sagte: »Ich habe das Jahr so gut genutzt, daß ich die ganze Zauberei erlernt habe, und der Meister will mich bei sich behalten. Er wird mich auch nicht eher fort lassen, als bis du eine Probe bestanden. Ich werde mich, in einen Raben verwandelt, unter hundert anderen Raben befinden, aus denen mußt du mich heraus suchen. Doch merke dir: der Rabe, der leise mit den Flügeln schlagen wird, bin ich.«
So hatte der Vater den Sohn als bald heraus gefunden und freute sich, daß der Schüler über seinem Meister war. Drauf sagte der Sohn: »Jetzt müssen wir darauf denken, reich zu werden. Zu diesem Zwecke verwandle ich mich zunächst in einen Jagdhund edelster Art, wie man nie einen gesehen, und du verkaufst mich um tausend Piaster.
Nachdem du mich verkauft, werde ich wieder Mensch, kehre zu dir zurück und verwandle mich in einen schönen fetten Ochsen, den du um zweitausend Piaster verkaufst. Auf dieselbe Weise werde ich ein edles Roß, wie selbst kein König es geritten und die größten Herren; aber auch mein Meister wird kommen, es zu kaufen, und du verkaufst es um zehntausend Dukaten. Nun vergiss aber Eins nicht: hast du den Hund verkauft, so nimm ihm das Halsband, nimm ferner dem Ochsen die Schelle und dem Pferde den Zügel ab; unterlässt du dieses, wirst du mich auf lange Zeit unglücklich machen.«
Zweimal tat es der Vater, beim dritten Handel jedoch vergaß er dem Pferde den Zügel abzunehmen, und der Hexenmeister hatte es gekauft. Das arme Pferd, um ihn zu erinnern, stampfte und wieherte, er aber ließ ihm den Zügel, und so konnte das Pferd nicht wieder in Menschengestalt zurückkehren. Da wurde der Sohn so wütend, daß er mit den Hufen den Sand auf- und seinem Vater in die Augen warf: und dieser erblindete.
Der Hexenmeister, sehr zufrieden mit seinem Kauf, um sich an dem Schüler, der ihn verlassen, zu rächen, ließ ihn mehrere Stunden des Tages durch seine Knechte auspeitschen und gab ihm zur Nahrung nichts als ein wenig Stroh und Wasser. Zum Glück aber hatte er den Knechten nichts von dem Geheimniß des Zaumes gesagt.
So kam es, daß einst, nach drei Jahren furchtbarster Qualen, ein Knecht das Pferd zum Trinken an einen Brunnen führte, und weil das arme Tier so gar elend aussah, hatte er Mitleid mit ihm und nahm, damit es bequemer zum Wasser könne, den Zaum ab. Augenblicklich erlangte das Pferd die so lange verlorene Zaubergewalt wieder und sagte: »Pferd bin ich, Aal werde ich« - und stürzte sich in den Wasserbehälter vor dem Brunnen.
Der Hexenmeister merkte in der Ferne, was geschah, kam herbei und rief: »Mensch bin ich, Hecht werde ich.« Und da war er auch schon im Wasser und hinter seinem Schüler her, der sich in einen Aal verwandelt hatte. Als er sich so hart verfolgt sah, rief er: »Aal bin ich, Taube werde ich!« ... schwang sich auf und entflog. Doch der Zauberer ebenso: »Hecht bin ich, Falke werde ich!« ... und strebte in eiligem Fluge hinter der Taube her.
So flogen sie, die Taube voran, der Falke hinter drein, drei Tage lang, bis sie zu dem Palast des Königs kamen. Das Königstöchterlein stand auf dem Altan, das sah die Taube, und gerade in dem Augenblicke, wo sie der Falke fast erreicht hatte, rief sie: »Taube bin ich, und Edelstein werde ich!« Und da ward sie zum Edelstein in dem Ringe, den die Königstochter am Finger hatte.
Der Zauberer war wütend und ließ den König als bald in eine böse Krankheit fallen, dergestalt, daß er am ganzen Körper gelähmt war und sich nicht mehr bewegen konnte. Da erging ein Aufruf durchs Land: »Wer den König heilt, bekommt seine Tochter zur Frau.«
Der Zauberer stellt sich zuerst dar und verspricht, den König zu heilen, doch nicht um den Preis seiner Tochter, sondern für den Edelstein nur, den jene am Finger der rechten Hand trägt. Deß war der König sehr froh; nicht so die Tochter, denn der Edelstein war für sie schon einmal zum wunderschönen Jüngling geworden und sie liebten sich bereits wie Braut und Bräutigam.
Er sagte ihr denn auch: »Wenn du mich liebst, so verweigerst du dem Zauberer, meinem Feinde, den Ring. Zwingt dich jedoch dein Vater, ihn her zu geben, so überreiche ihn nicht mit deinen Händen, sondern wirf ihn auf den Boden.« So tat sie. Kaum aber lag der Ring auf dem Boden, so hörte man: »Edelstein bin ich, Granatapfel werde ich!« Und es geschah.
Der Meister dagegen rief: »Mensch bin ich, Hahn werde ich« ... und fing an den Granatapfel zu behacken. Ein Körnlein sprang ihm aus dem Schnabel und der Prinzessin in den Schoß. Der Zauber war gebrochen, es rief: »Granatapfel bin ich, Fuchs werde ich!« Und nun machte sich der Schüler über den Meister Hahn her und würgte ihn.
Darauf heilte er den König und heiratete die Königstochter, ließ aus der Heimat die Mutter und den blinden Vater kommen, dem er das Gesicht wieder gab. Endlich gab ihm der König seine Krone, und er wurde ein König, groß an Schätzen und mächtig durch Soldaten und Magie. So lebte er glücklich mit seiner Gemahlin bis an sein Ende.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
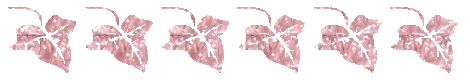
BIFARA ...

Der König von Spanien hatte einen Sohn, wie der herangewachsen war, bat er eines Tages seine Mutter, sie möge ihn in den Wald gehen lassen, er wolle mit seinen eigenen Händen ein Stück Wild erlegen.
Aber die Mutter sprach: »Mein Sohn, das kann nicht sein, denn du wirst dich verirren.« - »O, meine Mutter«, antwortete der Sohn, »laß mich nur, ich verirre mich nicht, nehme ich mir doch viele Soldaten zur Begleitung mit. Gebt mir zwei Regimenter, und Ihr könnt ohne Sorgen sein.« Die Königin ging zum Könige und sagte: »Unser Sohn will auf die Jagd gehen, eigenhändig ein Stück Wild zu erlegen, lassen wir ihn ziehen.«
Der König aber wollte nicht: »Wir werden den Knaben sicher verlieren.« Die Königin bat jedoch so lange, bis der König die Hauptleute rief und sprach: »Ich empfehle Euch meinen Sohn, haltet die Augen offen über ihn, verliert ihr ihn, so verliert ihr auch eure Köpfe.« Die Hauptleute begleiteten also mit ihren Mannen den Königssohn in den Wald.
Wie sie angekommen waren, waren sie müde geworden, und der Prinz sagte zu ihnen: »Jetzt, Kinder, legen wir uns etwas schlafen, um mit frischen Kräften weiter zu können.« So schliefen sie alle ein, und der Königssohn stand auf und schweifte allein in dem Walde herum. Als die Soldaten erwachen und den Prinzen nicht mehr finden, fingen sie an zu jammern: »Wehe uns Armen, wir sind verloren!« Sie durchsuchen den Wald nach allen Seiten, aber der Knabe wird nicht gefunden, und der Hauptmann sagt: »Was bleibt zu tun? Der Knabe ist dahin, kehren wir zum Könige zurück.«
Sie warfen sich dem Könige zu Füßen: »Herr König, tut mit uns, wie Ihr wollt. Während wir schliefen, ist der Knabe verschwunden.« Der König rief die Königin und sprach: »Siehst du jetzt, wie recht ich hatte? Er konnte seinem Geschicke nicht entfliehen, und dafür können diese Braven nicht, so will ich ihnen verzeihen.« Und er begnadigte die Hauptleute.
Der Knabe wanderte in dessen Tag und Nacht und kam in eine Höhle, wo ein Einsiedler hauste. »O, heiliger Vater«, rief er, »ich habe den rechten Weg verloren, willst du mir sagen, welche Richtung ich einschlagen muß?« - »Was soll ich dir sagen, mein Sohn? Doch höre, was du tun kannst. Gehe zu meinem älteren Bruder, er wohnt weiterhin, der kann dich besser berichten als ich.« Wie er zu dem anderen Einsiedler kam, fragte ihn der, was er so einsam da herumstreife, und der Knabe erzählte seine Geschichte.
Der Einsiedler sprach ihm Mut ein, beschrieb ihm einen Weg zu der Hütte eines Zauberers, der alles verschlang, berichtete ihm, wie der Zauberer eine Tochter habe, und gab ihm ein Brot. »Geh«, sagte er, »geh und sprich mit dieser Tochter, denn die versteht Latein.« Der Knabe ging weiter.
Die Tochter des Zauberers kam gerade vom Wasser; wie sie den Jüngling sah, rief sie ihn an: »Schöner Jüngling, sag, was machst du hier?« Und auch ihr erzählte er seine Geschichte und bat sie flehentlich um ihre Hilfe. »Gern«, sagte das Mädchen, »gern will ich dir helfen, aber wirst du mich zur Frau nehmen?« Der Jüngling sagte das zu und wollte ihren Namen wissen. »Ich heiße Bifara.
Und nun sieh dich wohl vor, bald wird mein Vater hier sein. Einstweilen führe ich dich zu meiner Mutter, die ist drinnen. Mein Vater wird dich fragen, ob du bei ihm bleiben willst, und dann wird er von dir verlangen, diesen Berg da in einer Stunde zu ebnen, darauf zu säen, zu ernten, zu dreschen. Hat dir mein Vater die Aufgabe gestellt, so mußt du sprechen:
'Berg, so hoch du bist,
eben mußt du werden.'
Darauf wird er dir einen Baum zeigen, hoch bis in die Wolken, von dem sollst du ihm das Nest mit den Vögeln holen. Zu ersteigen ist er aber nicht, und da mußt du sprechen:
So hoch du bist, neige dich itzt,
Wegen der Macht, die Bifara besitzt.
Sieh dann hier den Ofen, den heizt mein Vater, und wenn er schön rotglühend ist, wird er dich hinein schicken, ihn auszukehren, dann sprich nur:
So heiß du bist, erkalte itzt,
Wegen der Macht, die Bifara besitzt.
Jetzt gehe und sei auf deiner Hut, schöner Knabe!« Der Jüngling tritt in das Haus, dort trifft er die Mutter, die sagt:
Geruch vom Menschen wittert herein,
Ich fress ihn auf mit Haut und Bein.
»Ach was«, sagte die Tochter, »hört die Geschichte dieses Knaben, er hat sich verirrt und sucht unsere Hilfe. Schwört mir bei Euren Zähnen, daß Ihr mir ihn nicht freßt.« Das war der höchste Schwur der Alten, und sie schwor ihn der Tochter zu Liebe und ließ dann den Jüngling in eine Kiste kriechen.
Da kommt der Vater, und auch er ruft:
Geruch von Menschen wittert hier,
Ich fress ihn mit Haut und Haaren mir.
»Ach was«, sagte die Tochter neuerdings, »wer weiß, was Euch in die Nase kommt, hier ist nichts Derartiges.« Sie gaben dem Alten reichlich zu essen, doch immer kam er darauf zurück:
Geruch von Menschen wittert hier,
Ich fress ihn mit Haut und Haaren mir.
Erst als er ganz satt war, sagte die Tochter: »Jetzt will ich Euch die Wahrheit sagen, es ist ein junger Knabe hier her verirrt, und schwört Ihr mir bei Euren Zähnen, daß Ihr ihm kein Leid tut, will ich ihn Euch wohl zeigen, sonst fressen wir ihn allein.« Der Alte rief: »Laßt ihn her kommen.« Er kam, und er fragte ihn: »Ei, welch saftiger Bissen bist du, wie heißt du denn?« - »Ich heiße Salvatore.« - »So, Salvatore! Nun, Salvatore, komm und iß einstweilen, morgen früh dann sollst du erfahren, was für Arbeit ich für dich habe.«
Der Jüngling aß, der Alte ließ ihm ein Bett bereiten, und alle legten sich nieder, außer dem Mädchen. Das setzte sich in der Nähe nieder und hielt die Augen offen. Gegen Mitternacht rief der Alte: »He, Salvatore, jetzt sieh, wo du bleibst.« Und die Alte: »He, Salvatore, jetzt sieh, wo du bleibst.« Und die Tochter: »Auch ich will ihn fressen.« So verging die Nacht.
Beim Tagen sagte der Alte: »Salvatore, siehst du jenen Berg? Den sollst du mir in einer Stunde ebnen, darauf säen, dann schneiden und dreschen: auf einer Seite das Korn, auf der anderen das Stroh.«
Der Knabe gedachte der Worte Bifara's und sagte: »Berg, so hoch du bist, eben mußt du werden, und geerntet muß sein in einer Stunde.« Als alles vollendet war, kam der Alte herbei und sagte: »Siehe da, welche Gewalt du hast! Nun aber schaue jenen Baum!« - »Ich sehe ihn.« - »Bemerkst du, wie hoch er ist?« - »O gar wohl.« - »In dessen äußersten Wipfel mußt du jetzt steigen, mir das Nest mit den Vögeln holen.«
Der Jüngling trat vor den Baum hin und rief: So hoch du bist, neige dich itzt,
Wegen der Macht, die Bifara besitzt. Wie er darauf dem Alten das Nest brachte, sagte der: »Ei, welche Gewalt besitzest du. Nun habe ich aber noch etwas für dich. Du mußt mir den Ofen da heizen, bis er schön rot wird, dann kriechst du hinein und kehrst mir ihn fein säuberlich.«
Der Jüngling fing an zu heizen, und als der Ofen zu glühen begann, rief er: So heiß du bist, erkalte itzt, wegen der Macht, die Bifara besitzt. Die Sache ging gut, und der Alte verwunderte sich aufs neue. Darauf mußte er mit seiner Alten auf die Reise und sagte: »Ich werde eine Woche fort bleiben, du hütest mit Bifara zusammen das Haus.«
Kaum waren sie fort, so beriet sich Bifara mit dem Jünglinge und sprach: »Jetzt ist es Zeit zu fliehen, denn mein Vater riecht zwölf, meine Mutter zehn Meilen weit, und wir müssen einen Vorsprung haben.« Und die Kinder flohen.
Nach acht Tagen kommen die Alten zurück, und schon von weitem ruft der Vater: »Bifara! Bifara!« Aber Bifara antwortet nicht wie sonst. Da merkt der Alte den Braten und sagt: »Sie sind fort, fort sind sie. Nun ihnen nach, denn jetzt will ich sie fressen.« Spornstreichs läuft er hinter den Kindern drein und entdeckt sie auch endlich in der Ferne.
Bifara sieht ihn, wendet sich an ihren Bräutigam und ruft: »Schöner Knabe, dort kommt mein Vater! Doch sei ohne Sorge, ich verwandle mich in einen Gärtner und dich in eine Kohlpflanze.« Keuchend kommt der Alte an und findet den Gärtner: »He, Gevatter Gärtner, habt Ihr nicht einen Jüngling mit einem Mädchen vorbeigehen sehen?« Der Gärtner antwortete: »Ich verkaufe Kohl, Kraut und Rüben!« Und der Alte kehrte wieder um.
Seine Frau fragte ihn, was er ausgerichtet, er erzählte ihr von dem Gärtner und dem Kohl. Da rief voll Zorn die Alte: »O, warum brachst du die Kohlstaude nicht entzwei? Hättest ihn mitten durch gebrochen.« - »Daran hab ich nicht gedacht«, war die Antwort des Alten. »Laß mich jetzt gehen«, sagt die Frau und läuft wie der Wind hinter den Flüchtlingen her, ihr Kind zu töten.
»Schöner Knabe, meine Mutter kommt. Doch sei ohne Furcht, ich verwandle mich in einen Bach und dich in einen Aal.« Wie die Alte ankommt, konnte sie den Aal nicht fangen, verwünschte ihre Tochter und rief: »So möge er für immer deiner vergessen!«
Darauf machte sich der Alte wieder auf die Beine, fand aber eine Kapelle, mit einem Priester drinnen, auf dem Wege. Er fragt: »Gevatter, habt Ihr einen Jüngling und ein Mädchen hier vorüber ziehen sehen?« - »Wenn Ihr die Messe hören wollt, so tretet ein, es ist eben eingeläutet.« Da rief auch der Alte im hellen Zorn: »So möge er für immer deiner vergessen.«
Wie er fort war, sagte das Mädchen traurig zu dem Knaben: »O, Salvatore, du hast gehört, welche Verwünschung meine Eltern über mich ausgesprochen haben, sag, wirst du meiner vergessen?« - So erreichten sie die Stadt des Königssohnes, er ließ seine Braut vor den Toren warten, um sie mit aller Herrlichkeit seinen Eltern vorzuführen, und sie sprach:
Ich warte hier allein
Sitzend auf diesem Stein.
Küßt deine Mutter dich,
Vergißt du mich ...
Er schwor ihr, daß er sie nie vergesse, und geht nach dem Schlosse des Königs. Die Mutter, voller Glückseligkeit, umarmt und küßt ihn, und Bifara war vergessen. War vergessen, und der Königssohn suchte sich eine neue Braut.
Die einsame Bifara fühlt das in ihrem Herzen, und sie fertigt zwei Puppen, gibt ihnen Sprache in den Mund und geht, sie zu verkaufen, vor dem Schlosse auf und ab, immer rufend: »Wer kauft sprechende Puppen? Wer kauft sprechende Puppen?«
Wie der Königssohn den Ruf hörte, ließ er das Mädchen herein kommen und sprach: »Laß mich hören, was deine Puppen erzählen können.« Und die Puppen erzählten haarklein alles, was er und sie durch gelebt: die Geschichte von Salvatore und Bifara, zuletzt auch das Sprüchlein, da Bifara auf dem Steine saß und sang:
Ich warte hier allein
Sitzend auf diesem Stein.
Küßt deine Mutter dich,
Vergißt du mich.
Da kehrten dem Königssohn die entflohenen Gedanken zurück; er erkannte Bifara, warf sich an ihre Brust und küßte sie. So wurde Bifara seine Frau.
Sie lebten glücklich eins im anderen und wir, wir müssen barfuß wandern.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
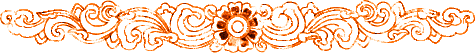
DAS LAVENDELSTÖCKCHEN ...

Es war einmal ein Vater, der hatte eine Tochter, die hieß Viola, und weil die Mutter tot war, schickte er sie zu einer Lehrerin, damit sie gut erzogen werde. Diese Lehrerin nun hatte ihr Haus gegenüber dem Schlosse des Königs, dort schaute der Sohn des Königs heraus, und wenn Viola ans Fenster trat, so blickte sie ihm gerade ins Gesicht. Eines Tages, wie sie gerade ihr Lavendelstöckchen goß, fragte sie der Prinz:
Viola, Viola, sag mir auch,
Wieviel Blätter hat der Lavendelstrauch?
Sie wußte es nicht, und ganz beschämt lief sie zur Lehrerin. Die fragte: »Was hast du?« Und Viola antwortete: »Der Königssohn hat mir eine Frage vorgelegt und gesagt:
Viola, Viola, sag mir auch,
Wieviel Blätter sind am Lavendelstrauch?«
»Höre, mein Kind«, antwortete die Lehrerin, »sollte er dich wieder fragen, so sprich nur:
Herr König, Herr König, sagt mir an,
Wieviel Sterne am Himmel stahn.«
So geschah es, und als der Königssohn am nächsten Morgen wieder ans Fenster trat und seine Frage tat, rief Viola dagegen:
Herr König, Herr König, sagt mir an,
Wieviel Sterne am Himmel stahn.
Der Königssohn wußte nicht zu antworten und es schien ihm das eine rechte Schande zu sein. So sann er darauf, sich an Viola zu rächen. Er ging im geheimen zur Lehrerin und sagte ihr: »Wenn du mich diesen Abend unter Viola's Bett verstecken läßt, so gebe ich dir, was du willst.« Die Lehrerin sagte Ja, und als es Nacht geworden war und Viola im tiefen Schlafe lag, nimmt der Königssohn eine lange spitze Nadel und sticht sie durch die Kissen hindurch hier und dort. Viola erwacht, wird unruhig und klagt der Lehrerin, wie sie vor Flöhen und Wanzen nicht schlafen könne.
Immer wieder fragte die Lehrerin: »Viola, warum schläfst du nicht?« Und immer wieder antwortete Viola: »Ach, weil mich Floh und Wanze sticht.«
Wie sich die zwei am anderen Morgen wiedersahen, rief der Königssohn herüber:
Viola, Viola, sag mir auch,
Wieviel Blätter sind am Lavendelstrauch?
Und sie dagegen:
Herr König, Herr König, sagt mir an,
Wieviel Sterne am Himmel stahn.
Dann lachte jener und sagte:
Viola, warum schläfst du nicht?
Ach, weil mich Floh und Wanze sticht.
Da lief Viola zu der Lehrerin und sagte: »Ihr habt mir da einen bösen Streich gespielt, und ich mag nicht länger bei Euch bleiben.« Sie kehrt also zu ihrem Vater zurück, klagt ihm weinend ihr Leid und erzählt ihm die Geschichte vom Königssohne und dem Verrat der Lehrerin. Der Vater tröstet sie und spricht: »Sei ruhig, meine Tochter, der Königssohn soll nicht über dich triumphieren. Laß mich nur machen.«
Er kauft jetzt ein wunderbares Pferd, und bei dem Goldschmiede läßt er einen Gürtel aus purem Golde machen. Beides bringt er zu der Tochter und sagt ihr: »Setze dich zu Pferde, nimm den Gürtel und reite am Schlosse des Königs auf und ab.« Wie sie unter den Fenstern war, wo der Prinz herausschaute, ließ sie den Gürtel in der Sonne blitzen und rief:
Wer mein Rößlein küßt unterm Schwanz,
Hat den Gürtel von Golde ganz!
Jenem stach das Gold in die Augen, er ließ sich herbei und sagte zur Reiterin: »Komm nur her, ich tue es wohl!« Und wirklich tat er es, dann aber sprengte das Mädchen spornstreichs davon und ließ den Prinzen, ohne ihm den Gürtel gegeben zu haben, zurück, ihm noch aus der Ferne zurufend:
Den Kuß, den gab der Königssohn,
Der Gürtel ward ihm nicht zum Lohn.
Am nächsten Morgen schickte der Vater sie wieder zur Lehrerin. Doch kaum zeigte sie sich am Fenster, als auch der Königssohn drüben heraus sah. Er grüßte sie und sprach: »Wie geht es der Viola? Es ist lange, daß ich sie nicht gesehen habe. Nun soll sie mir auch Rede und Antwort stehen:
Viola, Viola, sag mir auch,
Wieviel Blätter hat der Lavendelstrauch?«
Sie war schnell mit der Gegenfrage bereit:
Herr König, Herr König, sagt mir an,
Wieviel Sterne am Himmel stahn.
Da höhnte er sie aufs neue und sprach:
Viola, warum schläfst du nicht?
Ach, weil mich Floh und Wanze sticht.
Doch schnell gab sie ihm zurück:
Den Kuß, den gab der Königssohn,
Der Gürtel ward ihm nicht zum Lohn.
Da zog sich der Königssohn beschämt zurück und dachte nach, wie er der Viola einen neuen Tort an tun könne. Er verkleidete sich als Fischer, nahm einen Korb voll Fische und rief durch die Straße: »O, welch schöne Fische! O, welch schöne Fische!« Viola fragte, was er für die Fische wolle, und er rief hinauf: »Meine Fische sind für Geld nicht feil, aber für einen Kuß mögt ihr sie wohl haben!«
Viola verwunderte sich wohl, daß man Fische um Küsse verkaufe, und glaubte, er scherze nur. »Ich scherze nicht«, sagte er, und dann:
Für einen Kuß, o Mägdelein,
Sind alle meine Fische dein.
Viola dachte, auf einen Kuß soll mir es nicht ankommen, ging hinab und gab ihm den Kuß, worauf er mit seinen Fischen davon lief. Am anderen Morgen begann das Spiel aufs neue. Frage hier, Antwort da. Als aber Viola gesagt hatte:
Den Kuß, den gab der Königssohn,
Der Gürtel ward ihm nicht zum Lohn -
antwortete jener:
Am Kusse hab ich mich gelabt,
Die Fischlein hast du nicht gehabt.
Viola ging ärgerlich zu ihrem Vater, erzählte ihm alles, und der beschloß, sie nicht mehr zur Lehrerin zu schicken. Der Königssohn mochte jetzt hinüber blicken so oft er wollte, Viola erschien nicht mehr am Fenster. Da wurde er vor Kummer ganz krank. Wie sein Vater, der König, zu ihm kam, bat er ihn und sprach: »Ach Vater, Vater, ich bin so krank, ich bitte Euch, laßt die Ärzte kommen, ob sie mich wohl gesund machen.«
Die Ärzte kamen, aber keiner wußte, was dem Königssohn fehle, und die Krankheit wurde immer schlimmer und schlimmer. Da ließ der König eine Botschaft in alle Lande tragen und alle Ärzte der Welt auffordern, seinen Sohn zu heilen. Das hörte auch Viola, kleidete sich als bald wie ein fremder Arzt und ging in das Schloß. Sie wurde vor den König geführt und sprach: »Herr König, ich bin gekommen, Euren kranken Sohn gesund zu machen. Wo ist er?«
Der König führte sie in die Kammer des Königssohnes, und sie sprach: »Hört, was ich Euch sage. Laßt alle Fensterläden schließen, und ich verschließe die Tür von innen, denn nur im Finstern kann ich ihn besuchen. Hört Ihr dann Stimmen, so ist das ein Zeichen von Besserung, und Ihr braucht nicht etwa herbei zu laufen.« Der König tat alles, was ihm dieser Arzt sagte, denn er hoffte, seinen Sohn zu retten.
Kaum war Viola allein, so lief sie durch die Kammer des Kranken, rasselte mit Ketten und rief:
Es kommt der Tod, das Klapperbein,
O Königssohn, du bist jetzt sein.
Das wiederholte sie viele Male, und der arme Königssohn fing an aus Angst zu schwitzen. Nun ging sie fort, trat vor den König und sprach: »Euer Sohn ist geheilt. Morgen in der Frühe aber setzt ihn an das Fenster, dem gegenüber wohnt ein schönes Mädchen, Viola, das liebt er über die maßen, so hat er mir gebeichtet, und hat er es gesehen, so wird er ganz genesen sein.« Der König versprach, die Vorschriften des Arztes zu erfüllen, denn er hatte seinen Sohn zu lieb.
Anderen Tages war Viola bei der Lehrerin, und da saß auch schon der Königssohn und fragte: »Viola, bist du endlich wieder da?« Sie sagte, daß sie mit ihrem Vater eine Reise gemacht habe, und fragte ihn, wie es ihm gehe. Er seufzte und tat sofort seine alten Fragen wieder, und Viola blieb ihm keine Antwort schuldig. Kaum hatte er diesmal gesagt:
Am Kusse hab ich mich gelabt,
Die Fischlein hast du nicht gehabt -
antwortete Viola schon:
Es kommt der Tod, das Klapperbein,
O Königssohn, du bist jetzt sein!
Das hatte auch der König gehört, er ließ das Mädchen zu sich kommen, und sie mußte ihm ihre Geschichte erzählen, und wie er diese wußte, ließ er sie wieder nach Hause. Da fing der Sohn an zu klagen und zu weinen, er wolle Viola zur Frau, und klagte so lange, bis der König und die Königin sich entschlossen, zu Viola's Vater zu gehen und ihn um die Hand seiner Tochter zu bitten.
Der Vater war bereit, sagte aber, daß er zuvor noch mit seiner Tochter sprechen müsse, und die verlangte vierzig Tage Zeit. In dieser Zeit formte sie aus einer mächtig großen Flasche, aus Mehl und Honig eine Puppe, so groß wie sie selber und ihr ähnlich. Darauf wurde die Hochzeit gefeiert.
In der Nacht, wo sie sich schlafen legen wollten, legte sie an ihrer statt die Puppe ins Bett, band einen Faden daran, dessen Ende sie in der Hand hielt, und trat hinter die Tür. Wie der Königssohn herein trat, begann er: »Viola, gedenkst du des Tages, da ich dich fragte:
Viola, Viola, sag mir auch,
Wieviel Blätter hat der Lavendelstrauch?«
Die Puppe nickte mit dem Kopfe. »Denkst du weiter daran, wie ich dir die Fische um einen Kuß verkaufen wollte?« Wieder neigte die Puppe ihr Haupt.
»Erinnerst du dich daran, wie du mich mit dem Tode genarrt? Ja? Nun so frage ich dich, tut es dir leid, daß du mir solches getan?«
Jetzt schüttelte die Puppe mit dem Kopfe. Kaum sah er dies, so zog er sein Schwert und gab ihr einen Hieb in den Hals. Die Flasche brach und der Honig floß heraus. Er leckt das Schwert ab und ruft verwundert: »Ei, wie süß ist das Blut meiner Frau! Und eine so süße Frau hab ich umgebracht? Ach, so will ich mich auch umbringen!« Er zückt das Schwert gegen seine Brust ... da tritt Viola hinter der Tür hervor und ruft: »Halt! Ich lebe! Ich lebe!« Sie umarmten und küßten sich.
Die Puppe aus Zucker und Honig, schau,
aßen sie auf als Mann und Frau.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

DAS GOLDENE SCHACHSPIEL ...

Ein reicher Herr hatte einen Pächter, der war die Sparsamkeit selbst und gewann sich nach und nach eine Herde von zwölf Schafen. Als er starb, ließ er die Schafe seinem Sohne Peter und sprach zum Herrn: »Ich lege Euch meinen Sohn ans Herz, seid freundlich zu ihm.« Dieser Herr liebte nichts so sehr als das Schachspiel und meinte, er wolle es auch einmal mit dem Sohn seines Pächters versuchen.
Er rief ihn und sprach: »Peter, komm, wir wollen um ein Schaf spielen.« Peter antwortete: »Herr, was brauchen wir lange zu spielen, alle meine Schafe sind Euer.« Der Herr sagte: »Es ist nicht um die Schafe, es ist um das Spiel, und spielen müssen wir.« So setzten sie sich und begannen zu spielen. Sie spielen, und Peter gewinnt. »Setzen wir jetzt der Schafe zwei«, sagt der Herr. Und wieder gewinnt der Knabe.
Der Herr setzt vier Schafe, er setzt acht, dann sechzehn, zuletzt zweiunddreißig ... der Knabe gewinnt und gewinnt. Und da die Nacht herum war, hatte er alle Schafe und Ziegen seines Herrn gewonnen. Sagt zu ihm der Herr: »Peter, heute verkaufst du die Milch auf deine Rechnung.« - »O nein«, antwortet dieser, »wie kann das sein, Ihr seid der Herr und ich der Knecht.« Doch der Herr ließ nicht ab und sagte, es müsse so sein.
Am nächsten Abend ruft der Herr den Knaben wiederum zum Schachspiel und sagt: »Heute setze ich eine Kuh gegen acht von deinen Schafen.« Peter mußte gehorchen und gewann die Kuh. Der Herr sagt: »Jetzt eine Kuh gegen eine Kuh.« Und Peter gewann wieder. Er warnte den Herrn, dieser aber wollte nichts hören, und so setzte Peter, in der Hoffnung, seinen Herrn einen guten Gewinn machen zu lassen, hundert Schafe gegen zwölf Kühe; aber auch hier gewann er.
Der Herr setzte darauf vierundzwanzig Kühe, er setzte vierundvierzig ein, er verlor, und Peter gewann ihm alle seine Kühe ab. Der Herr ergrimmte, sagte aber doch: »Morgen verkaufst du auch die Kuhmilch auf deine Rechnung.« Und obschon sich der Knabe weigerte, blieb es doch dabei.
Jetzt besaß der Herr nur noch die Pferde und die Maultiere, und wie sie am Abend wieder beim Spiel saßen, setzte er diese gegen die Kühe: zwölf gegen zwölf, vierundzwanzig gegen vierundzwanzig, und so fort, bis er auch sie alle miteinander an Peter verloren hatte. Jetzt setzte er Haus und Hof ein, aber eins, zwei, drei, Peter gewinnt auch diesmal, und aus war es.
»Peter«, sagte darauf der Herr, »jetzt kannst du mich zu deinem Knecht nehmen. Willst du, so bleibe ich, willst du nicht, gehe ich meiner Wege.« Peter antwortete: »Wenn es Euch recht ist, so bleibt als Verwalter der Güter, ich bin es gar wohl zufrieden.« So versorgte der Herr die Geschäfte und kam oft in die Stadt, die Waren zu Markte zu bringen.
Eines Tages fand er an den Mauern große Zettel angeschlagen, darauf stand geschrieben, daß die Tochter des Königs von Spanien sich vermählen wolle, und zwar sollte derjenige ihr Mann sein, der sie im Schachspiel besiege. Eilig kam der Verwalter nach Hause und sagte es Peter an, wie er jetzt sein Glück machen könne. »Gehe hin«, sprach er, »du wirst siegen!«
Nun ließ sich der Jüngling bei einem Goldschmiede ein Schachbrett machen, das man nach Art eines Buches öffnen und schließen konnte. Das Schachbrett war golden, die Schachfiguren halb aus Silber, halb aus Gold. Darauf macht er sich, als Bauer gekleidet, auf den Weg, wandert und wandert; weil aber die Sonne gar zu mächtig war, schläft er unter einem Baume ein.
Drei Feen gehen vorüber, sehen den Jüngling und sagen: »Wie schön ist er! Wollen ihm eine Gabe zurück lassen.« So legte ihm die erste einen Beutel, die zweite ein Tafeltuch, und die dritte eine Violine zur Seite, und sie sprachen: »So oft er den Beutel öffnet, soll er ihn immer gefüllt finden. So oft er das Tafeltuch ausbreitet, soll es ihm Speise und Trank geben. So oft er auf der Violine spielt, muß tanzen, wer ihn hört.« Sie verschwanden, und Peter erwachte.
Erwachte und rieb sich die Augen und sprach: »War das ein Traum? Drei Frauen beschenkten mich?« Er sieht sich um und findet die Sachen: Beutel, Tafeltuch und Violine. Schnell nimmt er das Tuch, breitet es aus und wünscht sich, zu essen. Und da standen sie: Mehlspeisen, Braten, Fische, Würste, was das Herz begehrte, und er aß, wie er noch nie gegessen. Dann lud er sich die Sachen auf und ging vergnügt weiter.
Er kam aber an einen Kreuzweg und wußte nicht, welches die Straße nach Spanien war. Ein Schweinehirt war nicht weit davon, den rief er an und sprach: »He, Gevatter, wohin geht der Weg nach Spanien?« Der gab ihm, grob wie er war, keine Antwort, sondern drehte ihm den Rücken. »Ei«, sagte Peter, »den wollen wir geschmeidig machen; sehen wir einmal zu, was die Violine kann.«
Er zieht sie hervor, und beim ersten Striche schon fängt der Grobian mit samt seinen Schweinen zu tanzen an, tanzt und tanzt, daß er den Atem verliert und nur noch rufen kann: »Gnade, Gnade! Genug, genug! Um der Barmherzigkeit willen!« Jetzt erst hört Peter auf, setzt die Violine ab, und der Schweinehirt weist ihm ganz artig den Weg nach Spanien.
Er kommt dort an, geht durch die Stadt und sucht den Palast des Königs. Man zeigt ihm diesen, und da steht auch an der Tür angeschlagen wieder die Bekanntmachung des Königs. Er ist also zur Stelle und will eintreten, die Schildwache hält ihn zurück und fragt: »Was willst du?« - »Mit der Königstochter Schach spielen.« - »Ei du Bauernlümmel«, rief die Wache, »mach, daß du fort kommst! So viele Kaiser und Könige sind gekommen und haben mit der Prinzessin gespielt, wie darfst du es wagen?«
Peter zeigte auf die Bekanntmachung und wollte mit Gewalt hinein. Bei dem Lärm, der entstand, schauten die Hofleute zum Fenster heraus und fragten, was los sei. »O«, rief die Wache hinauf, »es ist hier ein Bauernlümmel, der durchaus mit der Prinzessin Schach spielen will.« Und jene: »Laßt ihn nur herein, der König will es also.« Da trat Peter ein und ging zum Könige; der läßt die Tochter rufen und sagt zu ihr: »Was willst du tun? Dieser Bauer verlangt, mit dir zu spielen, mit dem wirst du bald fertig.«
Die Königstochter nahm ganz stolz ihr Schachspiel und forderte den Jüngling auf, mit ihr zu kommen. Doch kaum sieht dieser das Schachspiel, so ruft er: »Wie, eine Königstochter will auf so schlechtem Brette spielen? Ist das auch schicklich? Das darf ich nicht leiden.« Und nimmt das Schachbrett und wirft es zum Fenster hinaus. Dann zieht er sein goldenes hervor. Wie das die Prinzessin sieht, denkt sie: »Ich muß auf meiner Hut sein, das ist sicher kein gemeiner Bauer.«
Als sie die Figuren teilten, gab er der Königstochter die goldenen und behielt die silbernen für sich. Das Spiel begann, und gar bald standen die Dinge für die Königstochter schlimm genug. Sie war nahe daran zu verlieren, da gibt sie ihm von hinten einen tüchtigen Knipp ins Fleisch, und wie sich Peter umsieht, versetzt sie rasch die Figuren, und er verliert. »Du hast verloren«, ruft sie triumphierend. »Herr König, er hat verloren, laßt ihn zu den anderen ins Gefängniß werfen!«
Es geschah so, und die anderen waren Könige, Königssöhne und Prinzen, an zwei Dutzend, die gleich ihm verloren hatten. Peter brachte Leben in die Gesellschaft, sie trieben ihren Witz mit ihm und hänselten ihn, wo sie nur konnten. Peter blieb erst ruhig und sagte: »Laßt mich in Frieden, es möchte euch schlecht bekommen, denn ich würde euch die Beine gehörig lupfen.« Das war aber nur Öl ins Feuer, und sie trieben es jetzt ärger als zuvor.
Da stellte sich Peter in einen Winkel, holte seine Geige hervor, strich darauf, und nun ging ein Tanzen los, daß die Herren nur so flogen. Gar bald hatten sie den Atem verloren und riefen: »Genug! Hör auf! Peterchen, hör auf!« Er aber spielte wacker drauf los und sprach: »Kühlt euch nur erst gehörig das Blut ab, dann wollen wir uns weiter sprechen.« Wie er glaubte, es sei genug, steckte er seine Geige ein, und jetzt wurden sie die aller besten Freunde, kamen herbei und nannten ihn ihren lieben Bruder.
Zwei oder drei Tage waren vergangen, da fragte die Kronprinzessin den Gefangenenwärter: »Nun, was macht man im Gefängniss?« - »O«, antwortete dieser, »seitdem der Bauer drinnen ist, herrscht eitel Lustbarkeit unter den Gefangenen.« - »So«, antwortete sie, »man muß ihnen also den Brotkorb höher hängen, du wirst ihnen nichts mehr zu essen bringen.« Da bekamen die Herren lange Gesichter und fragten Peter, ob er etwa auch aus Steinen Brot machen könne?
Und Peter antwortete: »Ja freilich kann ich das. Habt nur keine Angst, wir werden ein köstlich Mahl halten.« Jetzt paßten sie auf, wie er das machen wolle, aber die Küche blieb finster, kein Feuer ward angezündet, die Katze lag in der Asche und schlief. Da meinten sie wohl, er habe sie zum besten, denn die Essensstunde war gekommen. Plötzlich fragte sie Peter: »Nun, ihr Herren, was wollt ihr essen?« Sie antworteten: »Uns ist es gleich, gib uns, was du willst!«
Sie setzten sich, und Peter breitete das Tischtuch zwischen ihnen aus ... und da stand ein Essen für vierzig Personen und mehr bereitet: Suppe, Brot, Braten, Fisch, Kuchen und Wein von allen Sorten und aus aller Herren Ländern. Kaum war ein Gericht zu Ende, stand auch schon ein neues da; so ging es bis zum Gefrorenen und zum Kaffee. Anfangs hatten sie große Augen gemacht, dann aber langten sie zu und es ließ sich keiner nötigen. Den Rest des Mahles gab Peter dem Gefangenenwärter, denn so erfuhr es der König gewiß, daß sie in Saus und Braus lebten.
Wirklich lief dieser auch sofort zum Könige und erzählte ihm alles. Da befahl ihm die Prinzessin, den Bauer zu ihr zu führen. Er kam, und sie sagte: »Peter, wie hast du es angefangen, die Leute so köstlich zu traktieren?« - »Das möchtet Ihr wohl gern wissen? Nun, ich will es Euch sagen: ich habe da ein Tischtuch, das mir alles gibt, was ich verlange.« Das hätte die Prinzessin gern gehabt, und sie forderte Peter auf, mit ihr zu spielen, sie wolle ihre Person und er solle das Tischtuch einsetzen.
Sie begannen, und wieder war Peter fast Sieger, als ihm die Prinzessin mit der linken Hand einen Knipp gibt, und wie Peter sich umschaut, versetzt sie die Figuren, und Peter verliert die Partie. Und wieder mußte er ins Gefängniß. »Wie dumm bist du, Peter«, riefen ihm die Herren entgegen, »wie dumm, lässt dich zum anderen mal betrügen.« Er erzählte den Kniff der Prinzessin, fing dann an auf seiner Geige zu spielen, und alle waren lustig und guter Dinge acht Tage lang.
Nach acht Tagen fragte die Königstochter den Gefangenwärter: »Wie steht es im Gefängniss?« - »O Herrin«, antwortete der, »was ich Euch damals gesagt: man singt, lacht und tanzt und ist guter Dinge. Der Bauer hat eine ganz wunderbare Violine.« Da befahl sie, den Peter zu ihr zu führen, und sie begann: »Du bist ja ein Hexenmeister, Peter. Deine Violine möchte ich wohl haben. Wir spielen darum, du setzest die Violine, ich dagegen meine Person.«
Peter war bereit, das Schachspiel begann. Diesmal hatten ihn die Herren gewarnt und gesagt: »Gib wohl Acht, kneift sie dich wieder, so drehe dich nicht um, sonst kommst du aufs neue ins Gefängniß.« Peter trieb sie gar arg in die Enge, und sie merkte, daß sie sich helfen mußte wie die anderen mal. Peter aber paßte auf, und wie sie ihn von hinten knipp, packt er ihre Hand fest und sagt: »Jetzt spielt!« Sie bat ihn, ihre Hand los zu lassen, er aber zwang sie, erst fertig zu spielen, und da verlor sie.
Das war ihr gar nicht lieb, und sie sprach: »Ich habe da zwei Gegenstände von dir, nimm sie, setze sie, und ich halte meine Person dagegen.« Peter jedoch lachte sie aus und sagte: »Nein, nein, nichts da! Ich bin Sieger und will es bleiben.«
Sie kommen vor den König, und dieser, dem das Treiben seiner Tochter schon lange nicht gefallen hatte, sagte: »So ist es recht, meine Tochter hat ihren Mann gefunden, wenn es auch nur ein Bauer ist.« Einer der Edelleute redete dagegen: »Das kann unmöglich ein Bauer sein, seht doch nur, wie vortrefflich er Schach spielte, und Geld hat er auch. Dahinter muß etwas stecken.«
Peter, kaum frei geworden, schrieb seinem Verwalter einen Brief: »Eben habe ich die Prinzessin im Schach besiegt, ich habe nichts mehr nötig und mache Euch zum Herrn über meine Güter.« Dann zog man ihm prächtige Kleider an, und eine große Tafel wurde gedeckt. Peter ließ auch alle die königlichen Gefangenen aus dem Kerker holen, und nach Tische war ein großer Ball. Die Nacht kam, aber niemand fiel es ein nach Hause zu gehen, es schien, das Fest wollte kein Ende nehmen.
Peter währte das zu lang, er rief seine Gemahlin: »Komm, stelle dich zu mir.« Dann fing er an die Geige zu streichen, und nun begann ein Wirbeln und Walzen zur Tür hinaus, die Treppe hinunter, auf die Straße, und das Schloß war bald wie gekehrt. Nur der König und die Königin blieben zurück und Peter mit seiner jungen Frau.
Sie blieben glücklich und zufrieden; uns aber, uns ist nichts beschieden.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

WIE DER TEUFEL DEN HEILIGEN FRANZISKUS PLAGTE ...

Der heilige Franziskus tat Wunder über Wunder, so daß der Teufel vor Neid beinahe platzte. Nun stellt euch vor, wie er den Heiligen versuchte! Einmal trat er in sein Zimmer ein, hatte sich wie ein großer Herr gekleidet und trug eine Kiste voll Geld: 'Nimm davon, Franziskus', sagte er, 'bleibe nicht länger im Elend, sondern genieße das Leben. Der Lebensweg ist mit Rosen übersät, was willst du die Dornen aufsuchen?'
Sankt Franziskus ließ sich nicht beirren, er hob die Hand und machte das Zeichen des Kreuzes, und der große Herr verschwand im Schwefelrauch. Immer wieder kam der Teufel, um den Heiligen zu versuchen, aber Sankt Franziskus blieb ungerührt wie ein Holzklotz, nahm seine Zuflucht zum gewohnten Kreuzeszeichen, und der ganze Spuk verschwand.
Der Teufel wollte sich aber nicht damit zufrieden geben. 'Ist es denn nicht möglich, etwas zu erfinden, daß dieser unheimliche Mensch die Geduld verliert?' rief er, und nach langem Nachdenken glaubte er es endlich heraus zu haben. Er schuf die Mäuse, die sich zusehends vermehrten, und füllte damit das Zimmer des Heiligen.
Sankt Franziskus verjagte sie mit Händen und Füßen. Aber kaum waren sie zur Tür hinaus, so kehrten sie durchs Fenster zurück; und schloß er Tür und Fenster, so schlüpften sie durch die Ritzen des Fußbodens und der Wände wieder herein. Und sie kletterten in den Rock des Heiligen, sie krochen in den Strohsack, nisteten sich im Korb ein, und es fehlte nicht viel, so hätten sie ihr Geschäft auf seinem geschorenen Kopf besorgt.
Sankt Franziskus aber - ei sieh mal an! plötzlich fing er laut an zu lachen. Was war denn vorgefallen? Nach einem inbrünstigen Gebet, während dessen die Mäuse zu Haufen einen äußersten Angriff gewagt hatten, hatte Jesus Christus unter seiner Kutte einen schönen großen Kater geschaffen. Da rief Sankt Franziskus den Mäusen zu: 'Halt da! Ich beschwöre euch! geht an eure Sachen, oder ihr laßt die Haut!'
Aber die Mäuse spitzten ihr Schnäuzchen gegen ihn, als ob sie ihn durchbohren wollten. Da zog er den großen Kater unter seiner Kutte hervor, der warf sich auf die Mäuse, und mit dem wunderbaren Hunger, den er hatte, verschlang er sie, zwei auf einmal, wenn sie groß waren, und zu dreien oder vieren, wenn sie klein waren.
Sankt Franziskus wollte sie alle vertilgen lassen und lief, um einen Eingang zum Boden zu verschließen, danach machte er Fenster und Türen zu, aber er war nicht schnell genug: von den Mäusen konnten gerade ein Männchen und ein Weibchen entfliehen. Von diesen beiden stammt die ganze lästige Mäusegesellschaft ab. Aber nach einem Gebet des Heiligen erhielt auch der Kater eine Gefährtin, und so hat sich auch das Katzengeschlecht vermehrt.
Darum haben die frommen Hausbewohner des südlichen Italiens eine zärtliche Vorliebe für die Katze. Und das will ich meinen! Sie ist ja auch das Tier des heiligen Franziskus.
DIE PRINZESSIN IM APFEL ...

Ein König und eine Königin litten einst unter schwerem Kummer, denn der Himmel hatte ihnen Kinder versagt. Eines Tages jedoch sprach eine alte Frau zu der Königin: »Majestät, in neun Monaten werdet Ihr ein Kind zur Welt bringen.« »Wie kommst du darauf?« wunderte sich die Königin. »Mir hat doch alle Welt gesagt, ich könne keine Kinder bekommen.« »Ihr werdet guter Hoffnung sein, Majestät«, wiederholte die Alte, »aber es wird ein Apfel werden.« »Ein Apfel?« meinte die Königin enttäuscht. »Was fange ich mit einem Apfel an?« »Einstweilen gebt Euch damit zufrieden, Majestät«, sagte die Alte, »und gebt dem Apfel den besten Platz auf Eurer Terrasse.«
Nicht lange nach dieser Begegnung begann die Königin sich schlecht zu fühlen und spürte, dass sie guter Hoffnung war. Als neun Monate um waren, brachte sie einen wunderschönen Apfel zur Welt, so rosig und glänzend, dass es eine Pracht war. Darüber herrschte großer Jubel. Es wurden Feste gefeiert, zu denen alle Welt eingeladen wurde. Der König aber nahm den Apfel und legte ihn in ein kostbares Gefäß auf seiner Terrasse.
Dem Königspalast gegenüber wohnte ein anderer König mit seiner Stiefmutter. Als nun eines Tages der treue Diener dieses Königs - denn wie alle Könige hatte er natürlich einen Vertrauten - den Pferden zu trinken gibt, lässt er seine Blicke zufällig auf die Terrasse gegenüber schweifen. Und was erblickt er? Ein anmutiges Mädchen, das sich wäscht und kämmt; nach einer Weile sieht er es wieder verschwinden und in einen Apfel kriechen. Da spricht er zu sich selbst: »Das muss ich unbedingt meinem Herrn mitteilen.«
»Wenn Sie wüssten, Majestät, was ich Wunderbares auf der Terrasse der Königin gesehen habe!« »Was denn?« will der König wissen. »Einen herrlichen Apfel«, erwidert der Diener, »aus dem steigt ein liebliches Mädchen, das wäscht und kämmt sich und zieht sich dann wieder in den Apfel zurück.« »Du irrst dich gewiss«, entgegnete der König. »Nein, bestimmt nicht, Majestät; schon zwei Tage beobachte ich das Mädchen, und immer tut es dasselbe.« »Schön«, meinte der König, »morgen früh begleite ich dich. Doch wehe, wenn du lügst! Es kostet dich deinen Kopf.«
Am nächsten Morgen Schloss sich der König seinem Diener an und erblickte mit eigenen Augen das rosige Mädchen, das einem Apfel entstieg, sich wusch und kämmte und wieder im Apfel verschwand. Den König aber ergriff eine innige Liebe. »Was gäbe ich darum«, seufzte er, »wenn ich diesen Apfel besäße! Wie kann ich das nur erreichen? Was muss ich tun?« ruft er einmal übers andere. Den ganzen Morgen zerbricht er sich den Kopf. Schließlich meint er: »Ich werde einfach zur Königin gehen und sie darum bitten.« Und so geschieht es.
Am gleichen Morgen begibt er sich zur Königin. »Hoheit«, beginnt er, »ich habe eine große Bitte!« »Tragt sie nur vor«, ermuntert ihn die Königin, »Euer Wunsch soll in Erfüllung gehen.« »Ich flehe Euch an«, bat er, »schenkt mir den wunderschönen Apfel auf Eurer Terrasse.« Er verschwieg aber, dass er das Mädchen beobachtet hatte. »Was kommt Euch in den Sinn?« ruft die Königin erschreckt. »Ich habe so viel gelitten, um ihn zur Welt zu bringen, habe ihn so sehnlichst begehrt! Nein, den kann ich Euch beim besten Willen nicht schenken.« Doch der Jüngling ließ nicht ab mit Bitten und flehte so lange, bis sie am Ende nach gab; schließlich kann man einem König einen Wunsch nicht gut abschlagen. Freudig nahm er den Apfel und kehrte in sein Haus zurück.
Er legte ihn in sein Zimmer, und jeden Morgen gab er ihm frisches Wasser und bereitete alles aufs beste vor; dann schaute er zu, wie sich das Mädchen wusch und kämmte. Doch sie sprachen kein Wort miteinander. Von nun an hielt er sich nur noch in seinem Zimmer auf. Da erkundigte sich seine Stiefmutter bei der Dienerschaft, was der Herr wohl treibe, da sie ihn fast nie zu Gesicht bekomme. »Ich gäbe etwas drum, wenn ich wüsste, warum mein Stiefsohn nie mehr bei Tisch erscheint. Er kümmert sich um gar nichts mehr.«
Gerade in diesem Augenblick traf ein Befehl ein, der den Königssohn in den Krieg rief. Große Betrübnis erfüllte ihn, dass er sich von seinem Apfel trennen musste. Er rief seinen Vertrauten und sprach zu ihm: »Ich vertraue dir hier den Schlüssel zu meinem Zimmer an. Gib gut Acht, dass es niemand betritt. Jeden Tag zur gleichen Stunde musst du dem Apfel das Wasser wechseln und dafür sorgen, dass es ihm an nichts gebricht; bedenke, dass mir das Mädchen alles wiedererzählt.« Das sagte er nur, um den Diener einzuschüchtern, denn in Wirklichkeit sprach das Mädchen nie. »Merk dir, solltest du nicht alles pünktlich ausführen, was ich dir auftrage, so lasse ich dir den Kopf abschlagen, wenn ich wiederkehre.« Darauf verabschiedete er sich von der Stiefmutter und begab sich auf die Kriegsfahrt.
Ihr könnt euch vorstellen, wie gewissenhaft der Diener die Befehle seines Herrn ausführte! Die Stiefmutter aber dachte bei sich: »Endlich ist er fort; nun will ich versuchen, in sein Zimmer einzudringen. Aber wie? Das Beste wird sein, wenn ich den Diener zu mir zum Essen einlade.« Und eines Tages sprach sie: »Weißt du, ich fühle mich so einsam; komm doch zum Essen zu mir.« Der Diener aber zierte sich: »Das kann ich nicht annehmen, ich müsste mich schämen.« Doch die Königin beharrte auf ihrem Willen, und schließlich gab er nach. Er begab sich also zu Tisch. Doch die Stiefmutter hatte ihm Opium in den Wein geschüttet, und nachdem er reichlich und gut gegessen hatte, schlummerte er allmählich ein.
Als er in tiefem Schlafe liegt, schleicht sich die Stiefmutter an ihn heran, stöbert seine Taschen durch und findet den Schlüssel. Sie eilt zum Zimmer des Königssohns, öffnet die Tür und tritt ein. Jedermann weiß, dass die Königinnen stets einen Dolch im Gürtel tragen. Sie durchsucht das ganze Zimmer, kann aber nichts entdecken. Schließlich erblickt sie unter einem Fenster mitten in einem schönen Korb voller Blumen einen Apfel. »Es kann nur dieser Apfel sein, der ihm den Kopf verdreht hat«, meint sie. Und sie löst ihren Dolch vom Gürtel und durchsticht den Apfel. Sogleich füllt sich das Zimmer mit Blut. Verängstigt schließt die Königin rasch das Zimmer wieder ab, steckt den Schlüssel in die Tasche des Dieners und zieht sich in ihre Gemächer zurück.
Nach einer Weile wacht der Diener auf und findet sich allein im Zimmer. »Du lieber Gott«, ruft er aus, »was habe ich getan? Was wird die Königin gesagt haben!« Und plötzlich fällt ihm ein: »O du mein Gott, ich habe ja dem Apfel noch gar kein frisches Wasser gegeben! Wenn er es dem Herrn erzählt!« Und wie der Blitz ist er aus den Gemächern der Königin verschwunden. Er öffnet die Tür zum Zimmer seines Herrn, tritt ein und sieht den ganzen Raum in Blut schwimmen.
»O Gott, o Gott, das hat die teuflische Königin verbrochen, das ist ihr Werk«, jammert er. »Was kann ich tun? Alles ist verloren. Mir bleibt nichts anderes als fliehen... Was soll ich hier noch länger verweilen?« Und er verlässt das Haus. Unentwegt zieht er dahin. Als er bereits ein großes Stück zurückgelegt hat, begegnet ihm ein graues Mütterchen; es ist jene Alte, die der Königin die Geburt des Apfels geweissagt hatte. »Was fehlt dir denn, Unseliger?« spricht sie ihn an. Und er schüttet ihr sein Herz aus.
Da sagt sie zu ihm: »Nimm dieses Pulver und lauf wieder heim, aber spute dich, denn der König kommt heute Abend zurück. Du musst das Pulver überall im ganzen Zimmer verstreuen, und du wirst sehen, der Apfel kehrt ins Leben zurück.« Der junge Mann bedankt sich und tut, wie ihm das Mütterchen geheißen. Er bestreut das Zimmer an allen Ecken und Enden mit dem Pulver, und wahrhaftig, der Apfel kehrt ins Leben zurück. Schnell versorgt er ihn mit frischem Wasser und schließt das Zimmer ab.
Am Abend kehrte der König heim. Seine erste Frage galt dem Apfel. »Hast du ihn immer gut versorgt? Hast du ihm jeden Tag frisches Wasser gegeben?« »Seid unbesorgt, Hoheit«, erwiderte der Diener, »ich habe alle Eure Weisungen befolgt.« Der König geht ins Zimmer und ruft:»Äpfelchen, Äpfelchen, sprich:
Hast du entbehrt was ohne mich?«
Da tritt das Mädchen plötzlich aus dem Apfel hervor und beginnt das erste Mal in seinem Leben zu sprechen: »Höre, was mir geschehen ist«, und es erzählt ihm die Begebenheit. »Doch dein Diener, der Ärmste, ist unschuldig«, fügt es hinzu. »Du musst nämlich wissen, dass geschehen musste, was mir deine Stiefmutter angetan hat, damit ich mein achtzehntes Lebensjahr vollenden konnte. Nun kann ich nicht mehr in meinen Apfel zurückkehren, und wenn du mich haben willst, bleibe ich gern bei dir.«
Überglücklich ruft der König: »Das will ich meinen!« Er lädt den König und die Königin, des Mädchens Eltern, zur Hochzeit ein und führt ihnen ihre Tochter vor; während sie beim Festmahl sitzen, lässt er die Stiefmutter verbrennen.

DIE SCHÖNE ROSENBLÜTE ...

Ein König hatte vier Kinder, drei Mädchen und einen Knaben, und dieser sollte später einmal den Thron erben. Eines Tages sagte der König zum Prinzen: "Lieber Sohn, ich habe beschlossen, deine Schwestern mit dem erstbesten Manne zu verheiraten, der um zwölf Uhr mittags an unserem Palast vorübergeht."
Nun kam um die Mittagsstunde zuerst ein Schweinehirt, dann ein Jäger und zum Schluss ein Totengräber vorüber. Der König rief alle drei herauf und sagte zum Schweinehirten, er wolle ihm seine älteste Tochter zur Frau geben, dem Jäger die zweite und die dritte dem Totengräber. Die Armen glaubten zu träumen. Doch sie merkten gar bald, dass der König nicht scherzte, sondern es ihnen in vollem Ernst befahl. Da antworteten sie verwirrt, aber erfreut: "Majestät, Euer Wille geschehe!"
Allein der Prinz, der besonders die jüngste Schwester zärtlich liebte, wollte an der Hochzeit nicht teilnehmen und ging in den Garten hinunter, der sich zu Füßen des Palastes ausdehnte.
Und als nun der Priester im Hochzeitssaal die drei Schwestern segnete, erblühten auf einmal die schönsten Blumen im Garten, und aus einer weißen Wolke ertönte eine Stimme, die sprach: "Glücklich, wer einen Kuss von den Lippen der schönen Rosenblüte empfängt." Den Prinzen überfiel ein Zittern, dass er sich kaum aufrecht halten konnte; er lehnte sich an einen Olivenbaum und weinte, weil er seine Schwestern verloren hatte, und blieb so viele Stunden in Gedanken versunken. Dann aber schüttelte er sich wie nach einem Traum und sprach zu sich selber: 'Ich muss in die weite Welt ziehen und werde nicht ruhen, als bis ich einen Kuss von der schönen Rosenblüte erhalten habe.'
So zieht er und wandert dahin über Länder und Meere, über Berg und Tal, ohne je einem Menschen zu begegnen, der ihm Nachricht von der schönen Rosenblüte zu geben vermochte. Drei Jahre sind seit seinem Auszug verflossen, da kommt er eines Tages aus einem Wald und schreitet ein schönes Tal entlang. Plötzlich steht er vor einem Palast, vor dem ein Brunnen springt, und da er durstig ist, beugt er sich nieder, um zu trinken.
Ein zweijähriges Kind, das neben dem Brunnen spielt, hat ihn kommen sehen; es beginnt zu weinen und ruft die Mutter. Als jedoch die Mutter den Prinzen erblickt, läuft sie ihm entgegen, schließt ihn in die Arme und küsst ihn mit den Worten: "Willkommen, schön willkommen, Bruder mein!" Im ersten Augenblick hatte der Prinz sie nicht erkannt, aber als er sie näher betrachtete, erkannte er seine älteste Schwester wieder, umarmte sie innig und rief: "Welch glückliches Wiedersehen, Schwester mein", und der Freude war kein Ende.
Die Schwester lud ihn in den Palast ein, der ihr gehörte, und führte ihn zu ihrem Gatten, der ihn freundlich begrüßte. Und alle drei küssten voller Liebe das Kind, welches die Ursache für all die Freude war, weil es die Mutter gerufen hatte.
Darauf erkundigte sich der Prinz nach den beiden anderen Schwestern und erfuhr vom Schwager, es gehe ihnen gut und sie führten ein herrschaftliches Leben.
Darüber wunderte er sich nicht wenig: doch der Schwager berichtete ihm, sein und der anderen Schwäger Schicksal habe sich gewandelt, nachdem sie von einem Zauberer verzaubert worden seien. "Und könnte ich meine anderen Schwestern nicht auch besuchen?" fragte der Prinz. Der Schwager erwiderte: "Wenn du immer in der Richtung gen Sonnenaufgang wanderst, kommst du nach einem Tag zu deiner zweiten und nach zwei Tagen zu deiner jüngsten Schwester." -
"Aber ich muss den Weg wählen, der zu der schönen Rosenblüte führt, und ich weiß nicht, muss ich dem Aufgang oder dem Untergang der Sonne entgegengehen?" - "Dem Sonnenaufgang natürlich; und das Glück ist dir doppelt hold: Einmal siehst du deine Schwestern wieder, und zum andern kannst du von der Jüngsten auch etwas über die schöne Rosenblüte erfahren. Bevor du jedoch von uns scheidest, möchte ich dir ein kleines Andenken überreichen.
Nimm diese Schweinsborsten. Solltest du in eine Gefahr geraten, aus der du dich allein nicht befreien kannst, so wirf die Borsten auf die Erde, und sie werden dir Hilfe bringen!" Der Prinz steckte die Borsten ein, und nachdem er dem Schwager herzlich gedankt hatte, begab er sich wieder auf die Reise.
Am Tage darauf gelangte er zum Palast der zweiten Schwester, wo man ihn mit großem Jubel empfing. Und auch dieser Schwager wollte ihm vor seiner Abreise ein Andenken geben, und da er Jäger gewesen war, schenkte er ihm einen Strauß Vogelfedern, wobei er ihm das gleiche sagte wie der erste Schwager. Der Prinz aber bedankte sich und zog seines Weges. So gelangte er am dritten Tage zu seiner jüngsten Schwester.
Sie nahm ihren Bruder, der sie von allen Schwestern am meisten geliebt hatte, mit noch größerer Freude und Zärtlichkeit auf als die anderen, und ebenso tat ihr Mann. Dieser schenkte ihm zum Abschied einen Totenknöchel, indem er ihm den gleichen Rat gab wie die anderen Schwäger. Die Schwester sagte ihm noch, die schöne Rosenblüte wohne eine Tagereise entfernt, er solle sich aber genauere Auskunft bei einem alten Weibe holen, dem sie früher einmal Gutes getan hatte. Und sie schickte ihn auf den Weg zu der Alten.
Kaum war der Prinz am Wohnort der schönen Rosenblüte angelangt, welche die Tochter des Königs war, so lenkte er seine Schritte zu der Alten. Als diese hörte, er sei der Bruder der Dame, die ihr so viele Wohltaten erwiesen hatte, da nahm sie ihn auf wie ihren eigenen Sohn. Zum Glück stand das Haus der Alten gerade gegenüber der Fassade des Königspalastes, an dessen Fenstern die schöne Rosenblüte fast jeden Morgen bei Sonnenaufgang erschien.
Eines strahlenden Morgens nun lehnte sie wieder am Fenster, nur mit einem weißen Schleier bedeckt. Als der Prinz diese holde Blüte der Schönheit erblickte, war er so überwältigt, dass er gestürzt wäre, hätte ihn die Alte nicht festgehalten. Und da diese hörte, er habe es sich in den Kopf gesetzt, das Mädchen zu heiraten, so versuchte sie ihn mit allen Mitteln davon abzubringen. Sie erinnerte ihn daran, der König werde seine Tochter nur dem Manne zur Frau geben, der ein ganz bestimmtes Versteck erriete. Alle anderen aber ließ er töten, und schon viele Prinzen hatten auf diese Weise ihr Leben lassen müssen. Aber er erwiderte nur, wenn er die schöne Rosenblüte nicht bekomme, so wolle er sterben.
Nun hatte ihm die Alte erzählt, dass der König für seine Tochter die seltensten Musikinstrumente anschaffe. So hört denn, was sich der Prinz da ausdachte! Er ging zu einem Hersteller von Klavizimbeln und sprach zu ihm: "Ich möchte ein Klavizimbel haben, das drei Stücke spielt, und jedes Stück muss einen Tag lang dauern; dann muss das Klavizimbel so gebaut sein, dass sich ein Mensch darin verbergen kann. Dafür zahle ich dir tausend Dukaten. Wenn das Instrument fertig ist, krieche ich hinein, und du musst das Zimbel unter dem Palast des Königs spielen lassen, und wenn es der König kaufen will, so verkaufst du es ihm unter der Bedingung, dass du es alle drei Tage abholen musst, um es wieder instand zu setzen."
Der Instrumentenbauer war einverstanden und tat alles, was ihm der Prinz aufgetragen hatte. Der König kaufte das Klavizimbel in der Tat und ließ sich auf die Bedingung des Verkäufers ein. Dann ließ er das Instrument ins Schlafzimmer seiner Tochter bringen und sprach: "Schau, mein Töchterchen, was ich dir bringe! Es soll dir an keiner Unterhaltung fehlen; selbst wenn du zu Bett liegen musst und nicht schlafen kannst."
Neben der schönen Rosenblüte schliefen ihre Hofdamen. Während nun in der Nacht alles in tiefem Schlafe ruht, schleicht der Prinz aus seinem Versteck im Zimbel und ruft leise: "Schöne Rosenblüte, schöne Rosenblüte!" Sie erwacht erschrocken und schreit: "Hofdamen, rasch herbei, es ruft mich jemand!" Die Damen laufen herbei und sehen niemand, denn der Prinz ist schnell wieder in seinem Instrument verschwunden. Dies wiederholte sich noch zweimal, und jedes Mal waren die Hofdamen herbei geeilt, ohne jemanden zu entdecken. Da meinte die schöne Rosenblüte: "Dann habe ich wohl phantasiert. Wenn ich noch einmal rufe, so kommt auf keinen Fall."
Der Prinz im Klavizimbel hatte alles genau verfolgt und auch diese Worte vernommen. Kaum sind die Hofdamen wieder eingeschlummert, so stellt er sich neben das Bett der Geliebten und flüstert: "Schöne Rosenblüte, gib mir doch einen Kuss, sonst muss ich sterben." Am ganzen Leibe zitternd, ruft sie nach ihren Damen, doch infolge ihres Verbotes rührt sich keine von der Stelle. Da spricht sie zum Prinzen: "Du bist der Glückliche und hast gesiegt. Neige dich zu mir herab!" Und sie gibt ihm den Kuss, doch auf den Lippen des Prinzen bleibt eine herrliche Rose hängen.
"Nimm diese Rose", spricht sie, "und bewahre sie an deinem Herzen, sie wird dir Glück bringen." Der Prinz verbarg sie an seinem Herzen und erzählte dann der Geliebten seine Geschichte von dem Zeitpunkt an, da er das Vaterhaus verlassen hatte, bis zu dem Augenblick, da er in ihre Kammer gedrungen war. Die schöne Rosenblüte freute sich herzlich und zeigte sich gern bereit, ihn zum Mann zu nehmen.
Doch damit sie ihr Ziel erreichten, müsse er noch viele Schwierigkeiten überwinden, die ihm der König bereiten werde. Zuerst werde er den Weg erraten müssen, der in ein Versteck führe, wo der König sie mit hundert Hofdamen einschließen werde; dann müsse er sie unter den hundert Hofdamen herausfinden, die alle gleich gekleidet und obendrein verschleiert seien.
"Doch über diese Schwierigkeiten", meinte sie, "mach dir keine Gedanken, denn die Rose, die du mir von den Lippen gepflückt hast und die du ständig am Herzen tragen musst, zieht dich wie ein Magnet zuerst in das Versteck und dann in meine Arme. Doch der König wird dir noch andere Hindernisse, womöglich fürchterliche, in den Weg legen, und mit denen musst du allein fertig werden. Vertrauen wir auf Gott und auf unser Glück!"
Der Prinz ging unverzüglich zum König und bat ihn um die Hand der schönen Rosenblüte. Der König sagte nicht nein, stellte ihm aber die Bedingungen, von denen sie bereits gesprochen hatte. Er ging darauf ein und überwand die ersten Schwierigkeiten mit Hilfe der Rose. "Bravo", rief der König, als der Prinz die schöne Rosenblüte zwischen den vielen Hofdamen herausgefunden hatte, "allein damit ist es noch nicht getan."
Und er sperrte ihn in ein großes Zimmer ein, das von oben bis unten mit Früchten angefüllt war, und befahl ihm unter Todesstrafe, alle diese Früchte an einem Tag aufzuessen. Der Prinz ist verzweifelt, doch zum Glück fallen ihm die Schweinsborsten und der Rat ein, den ihm sein erster Schwager erteilt hat. Er wirft die Borsten auf die Erde, und schon trabt eine große Herde von Schweinen herbei, die alle diese Früchte verzehren und sogleich wieder verschwinden.
Doch der König hatte eine weitere Aufgabe bereit. Er verlangt vom Prinzen, dass dieser seine Braut, bevor er mit ihr ins Bett geht, von Singvögeln einschläfern lässt, welche die süßesten Stimmen und das schönste Gefieder besitzen. Dem Prinzen fällt sogleich der Strauß Federn ein, den ihm sein Schwager, der Jäger, geschenkt hat, und er wirft ihn zu Boden. Eine Schar bunt schillernder Vögel flattert herbei und singt so wunderlieblich, dass der König selbst in einen wohligen Schlummer versinkt.
Doch ein Diener, den der König damit beauftragt hat, weckt ihn wieder, und der König sagt zum Prinzen und zu seiner Tochter: "Jetzt könnt ihr euch nach Lust und Liebe umarmen. Doch wenn ihr morgen euer Lager verlasst, so muss ich bei euch ein Kind von zwei Jahren vorfinden, das sprechen und euch mit Namen nennen kann, andernfalls seid ihr des Todes." - "Jetzt legen wir uns erst einmal ins Bett, liebste Frau", sagt der Prinz zur schönen Rosenblüte, "und morgen wird uns schon irgendein Heiliger helfen."
Anderntags fällt dem Prinzen das Totenknöchlein ein, das ihm sein Schwager, der Totengräber, geschenkt hatte. Er steigt aus dem Bett und wirft es auf die Erde, und auf einmal steht ein bildhübscher Knabe vor ihnen, der hält einen goldenen Apfel in der Rechten und ruft die Eltern mit Namen. Der König tritt ins Zimmer, und der Knabe läuft ihm entgegen und will ihm den goldenen Apfel auf die Krone legen, die der König auf dem Kopfe trägt.
Da kann sich der König nicht enthalten, das Kind zu küssen, und er segnet die Brautleute, nimmt seine Krone vom Haupte und setzt sie seinem Schwiegersohn mit den Worten auf: "Von nun an gehört die Krone dir." Dann feierten sie ein prächtiges Hochzeitsfest, zu dem sie auch die drei Schwestern des Prinzen mit ihren Männern einluden. Und als der Vater des Prinzen die frohe Nachricht von seinem Sohn erhielt, den er bereits tot geglaubt hatte, kam er herbeigeeilt und überließ ihm ebenfalls seine Krone.
So wurden der Prinz und die schöne Rosenblüte König und Königin von zwei Reichen und lebten fortan froh und glücklich bis an ihr seliges Ende.

BEUTEL, MÄNTELCHEN UND WUNDERHORN ...

Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne, außer den drei Söhnen besaß er nichts als ein Haus, und auch dieses mußte er eines Tages, da Not an den Mann kam, verkaufen, bis auf drei Steine, die vor der Tür standen. Wie er sterben wollte, bat er die Nachbarn, ihm einen Notarius zu rufen, das Testament aufzusetzen.
Die Nachbarn lachten und sprachen: »Das Testament? Du hast ja nichts deinen Söhnen zu hinterlassen.« Die Söhne, die das hörten, meinten auch, es sei nicht von nöten. Der Vater bat aber so lange, bis einer kam und ihn fragte, was er schreiben sollte. »Ich hatte«, sagte der Sterbende, »ein Häuslein, dies verkaufte ich und behielt mir und meinen Söhnen nur die drei Steine vor, die vor der Tür stehen. Von diesen drei Steinen vermache ich meinem Erstgeborenen den ersten, meinem zweiten den anderen, und der jüngste soll den dritten haben.« So starb er.
Die Söhne wußten nicht, was anfangen, und da sie der Hunger plagte, sprach der Älteste: »Was soll ich ferner in diesem Lande? Wer weiß, wo mir mein Glück blüht! Jetzt grabe ich mir den Stein heraus, den mir der Vater hinterlassen, und ziehe fort von hier.« Die Herrin des Hauses wollte ihm den Stein abkaufen, er aber bestand auf seinem Rechte und grub ihn aus. Auf dem Grunde fand er ein kleines ledernes Beutelchen, das steckte er zu sich, lud den Stein auf und ging in ein anderes Land.
Dort angekommen, setzte er sich nieder, um auszuruhen. Er zog das Beutelchen hervor, es war leer, und er sprach traurig vor sich hin: »O, Beutelchen, wäre ein Hellerlein in dir, daß ich mir Brot kaufen könnte.« Kaum hatte er dies gesagt, so lag ein Heller im Beutel. Nun faßte er Mut und sprach: »Beutelchen, gib mir hundert Dukaten!« Und auch die gab ihm der Beutel, und so oft und so viel er sagte, alles bekam er, bis er unermeßlich reich wurde, so reich, um sich einen Palast zu bauen gegenüber dem Schlosse des Königs.
Dort schaute er jeden Morgen heraus, und weil auch die Königstochter herausschaute, so machte er ihr bald süße Augen, und sie fing an seinem Herzen über die maßen teuer zu werden. Um Ihr näher zu kommen, machte er dem Könige einen Besuch als Nachbar, und die Prinzessin merkte gar bald, daß er ein reicher Mann sein müsse, reicher selbst als ihr Vater.
Wie er darauf mit ihr sprach, sagte sie: »Gern nehme ich Euch zu meinem Gemahl, aber sagt mir zuvor, woher Euch solcher Reichtum kommt.« Der Thor zeigte ihr das Beutelchen und erklärte ihr, wie es zu benutzen wäre. Da wurde die Prinzessin froh, gab ihm beim Essen einen Schlaftrunk unterm Wein, nähte ein Beutelchen, genau wie das seine, das sie zu sich steckte, und kümmerte sich nicht weiter um den Betrogenen.
Der merkte nur zu bald, wie die Dinge standen, das Beutelchen gab nichts mehr her, und als er alles Vorhandene aufgezehrt, auch den Palast verkauft hatte, mußte er als ein armes Landläuferlein weiter wandern und wußte nicht, wohin er sein Haupt legen sollte. Da hörte er einst, wie sein mittlerer Bruder reich geworden wäre, zu dem machte er sich also auf den Weg, ihm sein Misgeschick zu erzählen.
Der Bruder kam ihm voll Liebe entgegen, und als ihn jener um den Grund seines Reichtums fragte, erzählte er, wie auch ihn der Hunger geplagt und er, da er nicht mehr wußte, was tun, den Stein ausgegraben und ein Mäntelchen gefunden habe. Das Mäntelchen aber hatte eine geheime Kraft besessen, denn als er es zum Scherz um seine Schultern warf, bemerkte er, daß ihn die Leute nicht mehr sehen konnten. So oft er den Versuch machte, immer geschah es, daß ihn niemand von den Umstehenden weiter sehen konnte.
»Als mich jetzt der Hunger plagte«, fuhr er fort, »ging ich in eine Schenke, nahm mir ungesehen Brot und Wein und ging weg, ohne daß mich jemand angehalten hätte. Mein Werk setzte ich bei Goldschmieden und Kaufherren fort, raubte auch die Geldpost des Königs aus und wurde schließlich so reich, daß ich nicht mehr wußte, was alles mit meinem Gelde anfangen.« - »Wenn das so ist«, sagte verwundert der andere, »so bitte ich dich, lieber Bruder, leihe mir das Mäntelchen ein wenig, bis ich wieder auf einen grünen Zweig gekommen, dann gebe ich es dir zurück.«
Der Bruder gab ihm das Mäntelchen und sprach: »Gehe hin und brauche seiner zu deinem Glücke.« Der Älteste nahm darauf Abschied und wanderte ins Land hinein. Das Mäntelchen tat seine Pflicht, und sein jetziger Besitzer trieb es ärger, denn zuvor sein Bruder; wo irgend Gold und Silber lag in Schränken und in Kisten, das wurde von ihm mitgenommen. Aber die Königstochter kam ihm nicht aus dem Sinn, und als er genug zusammengebracht hatte, ging er schnurstracks wieder zu ihr.
Wie die ihn reicher erfand denn zuvor, neigte sie sich ihm voll Holdseligkeit und fragte ihn schmeichelnd: »Gern will ich deine Gemahlin sein, aber sage mir, woher kommt dir solcher Reichtum, daß du selbst reicher bist als mein Vater?« Er vertraute ihr sein Geheimnis, zeigte ihr auch das Mäntelchen, und es geschah, was geschehen mußte: die Königstochter führte ihn zur Tafel und sprach: »Jetzt essen und trinken wir, ein Vergnügen findet sich dann schon.« Seelenvergnügt aß er und trank den roten Wein und merkte es nicht, der Thor, wie jene wieder falsches Spiel spielte und ihm einen Schlaftrunk in den Wein mischte.
Er schlief fest ein, die Prinzessin nahm ihm sein Mäntelchen weg, fertigte ein ganz gleiches an, das sie an Stelle des ersten steckte, und er merkte den Betrug nicht eher, als bis er in ein Haus trat, wo sechs starke Brüder wohnten, an deren Tisch er sich ungesehen zu setzen meinte. Sie sahen ihn aber gar wohl, und wie er ungeladen über ihre Speisen herfuhr, so prügelten sie ihn windelweich und warfen ihn zur Tür hinaus.
Nachdem sein Rücken heil geworden war, merkte er, daß er hier nichts mehr zu schaffen habe, die Reichtümer waren zu Ende, und er wollte nach Hause, um sich als Knechtlein zu verdingen. Hier hörte er jedoch, daß sein jüngster Bruder in dessen steinreich geworden sei, er habe einen Palast und große Dienerschaft. Da kamen ihm andere Gedanken, er beschloß zu diesem Bruder zu gehen, der werde ihn nicht in der Not sitzen lassen. So ging er hin.
Der Bruder freute sich gar sehr und rief: »O, mein Bruder, du? Wo bist du gewesen? Schon lange betrauerte ich dich als tot.« Darauf umarmte er ihn und küßte ihn von Herzen. Wie jener merkte, daß ihm der jüngste Bruder gar freundlich gesinnt sei, fragte er ihn: »Aber sage mir, Brüderlein, woher kam dir dieser Reichtum?«
Da hub der Jüngste an und erzählte: »Da unser Vater gestorben war, ging es mir gar schlecht, und da uns dieser statt Brotes einen Stein hinterlassen hatte, plagte auch mich der Hunger gar gewaltig. In der Verzweiflung reiße ich meinen Stein aus der Erde und finde darunter ein Hörnlein. Zum Spaß nur blase ich hinein, doch siehe, es erschien mit einem mal eine große Menge Kriegsknechte, diese fragten mich: 'Was ist Euer Befehl?' Da zog ich den Atem ins Horn zurück und sie verschwanden. Jetzt wußte ich, was ich zu tun hatte.
Ich streifte mit meinen Scharen durch Städte und Länder, bekriegte und eroberte, sammelte unermeßliche Beute, und als ich genug beisammen hatte, kehrte ich heim, baute mir diesen Palast und lebe als ein reicher Mann herrlich und in Freuden.« Der ältere Bruder hatte alles stillschweigend mit angehört, am Schlusse bat er ihn, ihm sein Wunderhörnlein so lange zu leihen, bis er sich wieder auf die Beine gebracht, dann wolle er es ihm schon zurückgeben.
Gern ließ es ihm der Bruder, küßte ihn, umarmte ihn und ließ ihn ziehen, sein Glück zu versuchen. Das erste, was dieser tat, war, eine Stadt zu erobern, die wegen ihrer Reichtümer in aller Welt bekannt war. Vor den Toren angelangt, stieß er ins Horn, und die Kriegsleute kamen, und so lange blies er, bis sich die ganze weite Ebene vor der Stadt mit Soldaten gefüllt hatte. Denen befahl er, die Stadt anzugreifen und zu plündern. So geschah es.
Die Mannen stürmten die Mauern, überstiegen sie und in bald kehrten sie zurück, reich beladen mit Gold und Silber und allen erdenklichen Kostbarkeiten. Mit diesen Reichtümern ging er nach der Stadt, wo die Königstochter wohnte, stieg in einem vornehmen Hause ab, verwahrte seine Schätze, steckte das Wunderhorn bei und suchte die Prinzessin auf. Diese war freundlich zu ihm, und auch der König und die Königin machten ihm ein zufriedenes Gesicht und luden ihn zur Tafel ein.
Die Prinzessin aber meinte es nicht gut, sie brannte der Gedanke, zu erfahren, wodurch er neuerdings reich geworden ist. So ließ sie denn nicht nach mit Bitten und Schmeicheln und erreichte, daß er ihr das Wunderhorn zeigte und sich rühmte, damit tausend Millionen Kriegsknechte aus dem Boden rufen zu können. Die Prinzessin ließ sich nichts merken, aber bei Tisch mischte sie ihm einen so starken Schlaftrunk, daß er vierundzwanzig Stunden lang schlafen mußte. Während dieser Zeit nahm sie ihm das Hörnlein weg und legte ein anderes an seine Stelle.
Anderen Tages, als er erwachte und sich die Augen rieb, kamen der König und die Königin, verspotteten ihn wegen seines Betrunkenseins und schickten ihn schnöde weg. Beschämt raffte er seine Reichtümer zusammen und reiste in ein anderes Land. Unterwegs fiel er unter die Räuber, die ihn ausplündern wollten.
Er aber, nicht faul, wischte mit dem Horn hervor und stieß hinein. Diesmal kamen jedoch keine Soldaten, er mochte blasen, daß er blau wurde: es kam niemand, ihm zu helfen. So mußte er seine Habe den Buschkleppern lassen und bekam außerdem noch so jämmerliche Prügel, daß er, über und über voller Striemen, halb tot am Wege liegen blieb. Mit dem Horn am Munde erwachte er, und nun wußte er ganz genau, daß ihm auch dieses vertauscht worden und daß er auch den jüngsten Bruder ins Unglück gestürzt hatte. Er wollte jetzt nicht länger leben und beschloß, sich von einem Felsen zu stürzen.
Er steigt hinauf, und auf der Spitze angekommen, springt er hinab in die Tiefe. Die Sinne schwanden ihm bereits, als er fühlte, wie er in den Ästen eines Baumes hängen blieb. Er macht die Augen auf und sieht einen schwarzen Feigenbaum, über und über mit Früchten bedeckt. Noch einmal erwacht in ihm die Lust zum Leben, und er denkt, es könne zum wenigsten nichts schaden, wenn er sich erst noch einmal satt an Feigen esse, sterben könne er ja dann immer noch.
So fing er an zu essen und merkte es anfangs gar nicht, wie ihm bei jeder Feige, die er verschluckt hatte, ein Horn aus dem Kopfe gewachsen war: Stirn, Wangen und Schläfe waren mit wunderlichsten Hörnern bedeckt. Wie er sich dessen bewußt ward, dachte er: jetzt ist es erst recht Zeit zu sterben, und ließ die Äste des Baumes los und fiel weiter hinab in die Tiefe, fiel und wurde von einem weißen Feigenbaum aufgefangen, der wie der erste mit Früchten übersät war.
Er kam zu sich, sah die Menge der köstlichen Früchte und dachte: Mehr Hörner, als ich jetzt habe, kann ich unmöglich bekommen, sterben muß ich einmal, also ... Und er begann die Früchte zu essen. Aber wie er aß, merkte er, daß sich bei jeder Feige ein Horn zurück zog und verschwand, er fühlt noch immer mehr schwinden, bis sie alle miteinander verschwunden waren. Jetzt kam ihm ein Gedanke. Vorsichtig kletterte er zu den schwarzen Feigen empor, pflückte sich alle Taschen voll und ging zurück in die Stadt.
Hier legte er die Feigen in ein nettes Körblein, kleidete sich als Bauer an und rief sie, weil sie außergewöhnlich zeitig waren, vor dem Königspalast aus. Der König hörte den Ruf, ließ ihn herein rufen und kaufte ihm alle Feigen ab. Mittags erschienen die schönen Feigen auf der königlichen Tafel, und alle aßen davon, am meisten jedoch die Königstochter, da sie ihr besonders gut schmeckten. Kaum waren sie fertig, so bemerkten sie mit Schrecken, daß sie die Gesichter voll Hörner hatten, am meisten wieder die Prinzessin. Da war guter Rat teuer!
Sie riefen die Ärzte der Stadt herbei, die schüttelten den Kopf und sagten: »Hier können wir nichts tun.« Der König schickte darauf einen Herold durchs ganze Land, der mußte verkünden: »Wer den König und seine Familie von der Plage der Hörner befreit, darf sich von ihm eine Gnade erbitten, was es auch sei, er wird es ihm gewähren.« Dies kam auch vor die Ohren des Feigenhändlers, und nun ging er zu dem weißen Feigenbaum, pflückte sich genügend davon, verkleidete sich als Arzt und ging zum König.
Der ließ ihn gern vor, und der Arzt begann: »Herr König, ich bin der Mann, der Euch und die Euren von den Hörnern befreien kann, aber ...« Die Königstochter fiel ihm ins Wort und rief: »O Vater, die meinen muß er zuerst weg schaffen.« Da ging der Arzt mit ihr in eine Kammer, schloß sie ab und fragte die Gehörnte: »Erkennst du mich? Ja oder Nein. So höre, was ich dir in zwei Worten sage: entweder gibst du mir meine Sachen: das Beutelchen, das Mäntelchen und das Wunderhorn, zurück und ich befreie dich von den Hörnern, oder ich lasse dir noch einmal so viele wachsen. Wähle!«
Die Königstochter, die so viel Kummer um den bösen Schmuck gelitten hatte und ihm eine Rache gar wohl zutraute, sprach: »Schaffe mir die Hörner weg, und du bekommst alles zurück, doch mußt du mich zu deiner Frau machen.« Das war er zufrieden, die Prinzessin gab ihm die Sachen zurück, und wie er sie hatte, ließ er sie so viel weiße Feigen essen, als sie Hörner hatte, und sie verschwanden sämmtlich. So geschah es auch mit dem König und der Königin und allen, so von den schwarzen Feigen gegessen hatten, und darauf erinnerte er den König an die versprochene Gnade und bat ihn um die Hand seiner Tochter.
So wurde gar bald Hochzeit gemacht. Mäntelchen und Horn gab er jetzt seinen Brüdern zurück, denn er brauchte sie nicht mehr, da er sein Beutelchen Gib-Geld wieder hatte. Als nach Jahr und Tag der alte König starb, wurde er König und seine Frau Königin, und sie lebten glücklich und zufrieden.
Sie täten des Glücks in Fülle genießen;
Wir aber sind ein Bündel Radieschen.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
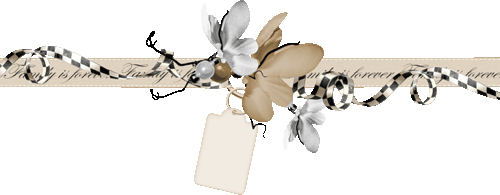
BAUER WAHRHAFT ...

Es war einmal ein König, der hatte eine Ziege, ein Lamm, einen Widder und einen Hammel. Weil er nun die Tiere sehr lieb hatte, wollte er sie nur jemanden übergeben in dem er ganzes Vertrauen hätte.
Nun hatte der König einen Bauer, den nannte er nur Bauer Wahrhaft, weil der selbe noch nie eine Lüge gesagt hatte. Den ließ der König kommen und übergab ihm die Tiere, und jeden Sonnabend mußte der Bauer in die Stadt kommen und dem König Bericht erstatten. Wenn er nun vor dem König kam, so zog er immer sein Mützchen ab und sprach:
»Guten Morgen, königliche Majestät!«
»Guten Morgen, Bauer Wahrhaft;
Wie geht es der Ziege?«
»Ist weiß und schalkhaft!«
»Wie geht es meinem Lamm?«
»Ist weiß und schön!«
»Wie geht es meinem Widder?«
»Ist schön zu sehen!«
»Wie geht es meinem Hammel?«
»Ist schön zu schauen!«
Wenn sie so mit einander gesprochen hatten, zog der Bauer wieder auf seinen Berg, und der König glaubte ihm immer alles.
Unter den Ministern des Königs war aber einer, der sah mit neidischen Augen die Gunst, die der König dem Bauer erwies, und eines Tages sprach er zum König: »Sollte der alte Bauer wirklich unfähig sein, eine Lüge zu sprechen? Ich wollte doch wetten, daß er euch nächsten Sonnabend anlügt.« »Und wenn mir mein Bauer eine Lüge sagt,« rief der König, »so will ich den Kopf verlieren.« Also gingen sie die Wette ein, und wer verlor sollte den Kopf verlieren.
Der Minister aber, je mehr er darüber nachdachte, desto schwerer wurde es ihm, ein Mittel auszudenken, den Bauern bis zum Sonnabend, in drei Tagen, zu einer Lüge zu bewegen. Den ganzen Tag dachte er vergeblich nach, und als es Abend wurde, und der erste Tag verstrichen war, ging er mißmutig nach Haus.
Als seine Frau ihn nun so schlechter Laune sah, sprach sie: »Was drückt euch, daß ihr so verstimmt seid?« »Laß mich in Ruhe,« antwortete er, »muß ich es dir erst noch erzählen!« Sie bat ihn aber so freundlich, daß er es ihr endlich sagte. »O,« sagte sie, »ist es weiter Nichts? Das will ich schon zu Wege bringen.«
Den nächsten Morgen kleidete sie sich in ihre schönsten Kleider, legte ihren besten Schmuck an, und befestigte über der Stirn einen diamantenen Stern. Dann setzte sie sich in ihren Wagen und fuhr auf den Berg, wo Bauer Wahrhaft die vier Tiere weidete. Als sie nun vor dem Bauer erschien, blieb dieser wie versteinert stehen, denn sie war über die Maßen schön.
»Ach,« sprach sie, »lieber Bauer, wollt ihr mir einen Gefallen tun?« »Edle Frau,« antwortete der Bauer, »befehlt mir was ihr wollt, so will ich es tun!« »Sieh,« sprach sie, »ich bin guter Hoffnung und habe ein unwiderstehliches Gelüst nach einer gebratenen Hammel Leber, und wenn du sie mir nicht gibst, so muß ich sterben.«
»Edle Frau,« sprach der Bauer, »verlangt von mir was ihr wollt, aber dies Eine kann ich euch nicht gewähren; denn der Hammel gehört dem König und ich kann ihn nicht töten.« »Ich Unselige,« jammerte die Frau, »so muß ich sterben, wenn du mein Gelüste nicht befriedigst. Ach, lieber Bauer, tue es doch. Der König weiß ja nichts davon, und du kannst ihm sagen, der Hammel sei den Berg heruntergestürzt.«
»Nein, das kann ich nicht sagen,« sprach der Bauer, »und die Leber kann ich euch auch nicht geben.« Da fing die Frau noch mehr an zu jammern, und tat als ob sie sterben müsse, und weil sie so überaus schön war, wurde das Herz des Bauern ganz davon berückt, er schlachtete den Hammel, briet die Leber und brachte sie ihr. Da aß die Frau voller Freude, nahm Abschied von dem Bauer und ging fort.
Nun fiel es dem armen Bauer schwer aufs Herz, was er dem König sagen sollte. In seiner Verlegenheit nahm er seinen Stock, pflanzte ihn in die Erde, und hing sein Mäntelchen darüber; ging dann einige Schritte darauf los, und fing an: »Guten Morgen, königliche Majestät!« Wenn er aber an die letzte Frage des Königs nach dem Hammel kam, blieb er immer stecken, und fand keine Antwort.
Er versuchte es mit Lügen: »Der Hammel ist geraubt worden,« oder »er ist den Berg hinuntergestürzt,« aber die Lügen blieben ihm in der Kehle stecken. Er steckte seinen Stock wo anders in die Erde, und hing wieder sein Mäntelchen darüber, aber es fiel ihm Nichts ein. Die ganze Nacht konnte er nicht schlafen, endlich, am Morgen fiel ihm eine passende Antwort ein. »Ja,« dachte er, »das wird gehen,« nahm seinen Stock und sein Mäntelchen und machte sich auf den Weg zum König, denn es war Sonnabend.
Unterwegs blieb er von Zeit zu Zeit stehen, stellte wieder den König vor mit seinem Stock und Mäntelchen und sagte die ganze Unterredung mit dem König her, und jedes Mal gefiel ihm seine Antwort besser. Als er nun in das Schloß trat, saß da der König mit seinem ganzen Hofstaat, denn nun sollte sich die Wette entscheiden. Da zog er sein Mützchen ab; und fing an wie gewöhnlich:
»Guten Morgen, königliche Majestät!«
»Guten Morgen, Bauer Wahrhaft;
Wie geht es meiner Ziege?«
»Ist weiß und schalkhaft!«
»Wie geht es meinem Lamm?«
»Ist weiß und schön!«
»Wie geht es meinem Widder?«
»Ist schön zu sehen!«
»Wie geht es meinem Hammel?« ...
»Mein Herr und König!
Die Lüge verhöhne ich.
Vom hohen Berg in weiter Fern
Erschien die Schöne mit ihrem Stern.
Es traf mich tief ihr Liebesblick -
Dem Hammel brach ich das Genick.«
Da klatschten Alle in die Hände, und der König beschenkte seinen treuen Bauer reichlich. Der Minister aber mußte seinen Neid mit dem Kopf büßen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

EIN ERDEGANG DES ERLÖSERS ...

Ein Vater wendet sich an den Befehlshaber des Platzes mit der Bitte, seinen Sohn zum Soldaten zu machen, da er dem Spiele nicht entsagen wolle. Der Wunsch wird gewährt und der frühere Spieler muss Soldatendienste tun. In einer stürmischen Nacht jedoch entwischt er und kommt glücklich in einem Walde gelegenes Wirtshaus an. Während er hier verweilt, gesellt sich ein Mann zu ihm, der wunderbarer Weise mit seinem ganzen Leben bekannt zu sein scheint und dessen Name »Erlöser« (Salvatore) ist.
Er weiß, dass Peter dem Dienste entlaufen, verfolgt wird, aber er will ihn erretten. Um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, schlägt er ihm vor, wollen sie gemeinsam ausziehen und Menschen heilen. Dazu bietet sich auch bald eine Gelegenheit. Ein reicher Mann ist krank und der Erlöser verspricht, ihn in drei Tagen wieder herzustellen. Es müssen sich Alle zurückziehen: er bereitet einen Trank aus Kräutern und heilt den Kranken.
Dankbar bieten die Verwandten dem Erlöser Kostbarkeiten aller Art an, er nimmt nur so viel als nötig ist, das Leben zu fristen. Ein so unverständiges Verfahren bringt seinen Begleiter der massen auf, dass er sich von ihm trennt. Auf eigne Hand will er die Leute heilen und verspricht als bald einem König die kranke Tochter des selben wieder gesund zu machen. Aber obwohl er alles genau so macht wie der Erlöser, so ist doch die Wirkung des gegebenen Trankes nur der Tod.
Kaum erfährt dies der König, so lässt er Peter ins Gefängnis werfen. Auf dem Wege dahin trifft er abermals den Erlöser, der auf seine Bitten wieder bereit ist, ihm zu helfen. So gleich sucht jener den König auf und verspricht ihm die Tochter aufzuerwecken, wenn er ihm den Gefährten frei gibt. Der König willigt ein, droht jedoch im Falle des Misslingens dem Erlöser mit dem Tode. Aber die Gestorbene kehrt ins Leben zurück. Dankbar lässt sie durch den Vater dem Erlöser ihre Hand anbieten. Doch dieser erklärt, sein Beruf sei, die Lande zu durchwandern. Man solle das Mädchen aber seinem Gefährten geben.
Mit der Bemerkung dass dies geschehen ist, schließt die Geschichte.
Italien: Georg Widter/Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
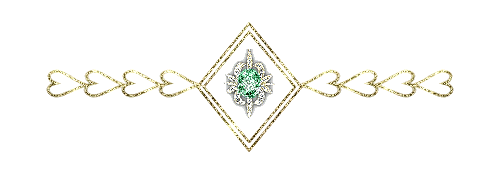
DIE ZWEI UNGLEICHEN BRÜDER ...

Vor langer Zeit lebten zwei Brüder, deren jeder einen Sack Geld besass. Der eine war ein guter Mensch, der andere neidisch und böse. Einst stritten sie sich bei irgend einer Gelegenheit. »Wer Gutes tut, tut gut«, sagte der eine; »nein, wer Böses tut, tut gut«, sagte der andere. - Sie wetteten dann um einen Sack Geld, und Richter sollte der Nächstbeste sein, der ihnen auf dem Wege begegnen würde. Und so machten sie sich auf und gingen auf die Strasse.
Siehe, da kam ihnen ein ansehnlicher und vornehmer Herr entgegen geritten. »Wohin eilt ihr guten Leute so sehr?« so sprach er sie an. »Wir suchen Jemanden, der unseren Streit entscheidet«, antworteten sie und erzählten ihm den Hergang. »Ganz natürlich«, rief der Herr, »nur wer Böses tut, handelt gut und noch oben drein weise.« Es war der Teufel.
Traurig ging hierauf der Gute nach Hause und gab seinem drängenden Bruder seinen Sack mit Geld. Arm, wie er nun ist, geht er ins Gebirge, sich als Hirt oder Knecht zu verdingen, da überfällt ihn Nacht und Sturm. Lange irrt und sucht er herum, einen Ort zum Ruhen zu finden, bis ihn der Zufall zur Hütte eines Einsiedlers führt.
Unwillig, weil er aus dem Schlafe geweckt, lässt ihn der Einsiedler erst dann zu sich hinein, nach dem er ein durch das Fenster gereichtes Crucifix andächtig geküsst und so sich als guten Christen erwiesen hatte. Ein Nachtlager gewährte er ihm nicht, weil die Zelle für zwei zu eng war und unser Verirrter als junger kräftiger Bursche nicht verlangen konnte, dass sich der Einsiedler, ein alter, schwacher Mann, seiner Bequemlichkeit halber dem Unwetter aussetze; jedoch gab ihm dieser den Rat, sich auf das Gesimse der nahe stehenden Martersäule zu legen, um nicht von wilden Tieren gefressen zu werden, und das breit genug sei, darauf schlafen zu können.
Kaum hatte er sich auf die Säule gelegt, so wurde es Mitternacht, und am Fusse der Säule erschienen vier Hexen, die Feuer an machten und für fünf Personen kochten. - Lange warteten sie auf die fehlende Person, da rief die eine von ihnen laut und wiederholt: »Margerita, Margerita! komme doch bald, das Essen verkocht sich.« Da erschien plötzlich die erwartete fünfte Hexe im grössten Aufputz und strahlend vor Freude.
»Wo warst du so lange? erzähle doch und warum bist du so in Gala?« riefen ihr die anderen entgegen. »Ja«, antwortete Margerita, »ich komme so eben vom Hofe, wo ich des Königs schönem Töchterlein sieben böse Geister in den Leib gejagt habe. Die bringt ihr keiner heraus, der sie nicht mit dem Wasser besprengt, das hier bei der Säule hervor quillt.«
Hierauf setzten sich alle fünf, aßen und tranken und plauderten lustig, bis das Mahl geendet war, worauf sie verschwanden. Unser armer Wanderer aber, dem von der vertraulichen Mitteilung Margerita´s keine Silbe entgangen war, konnte das Grauen des Tages kaum abwarten. Flugs eilt er zum Einsiedler, borgt sich dessen Kürbisflasche, füllt sie aus der Quelle mit Wasser und ging in die Stadt zum Hofe des Königs.
Dort begehrt er den König zu sprechen, der aber gibt niemanden Audienz aus Gram über den Zustand seines einzigen Kindes. Da gelingt es dem Jüngling, einen Ritter von des Königs Leibwache zu sprechen, dem er entdeckt, dass gerade die Heilung der Prinzessin der einzige Zweck seiner Reise sei. »Unglücklicher!« sagt ihm dieser, »an der Krankheit ist die Kunst der ersten Professoren gescheitert, nimm dich wohl in Acht, denn suchst du uns zu täuschen, oder täuschst du dich selbst, kostet es dir den Kopf.«
Endlich gab er seinen dringenden Bitten und Beteuerungen nach und meldete ihn dem König. Als er eingetreten, sagte ihm der König: »Heilst du mir mein Kind, so möge es dein sein und mit ihm mein Reich, belügst du mich aber, so ist der Galgen dein Lohn.« Hierauf führte er ihn zu seiner Tochter in das Gemach, wo sie in einem Zustand äußerster Entkräftung und unsäglichen Schmerzes lag.
Seiner Sache sicher, schüttete er ihr gleich die ganze Kürbisflasche über den Kopf, aber ach! war es Schrecken über das kalte Bad, oder die große Portion der Medizin, die Prinzessin verfiel hierauf in eine tödliche Ohnmacht. Voll Wut und Angst über sein Kind lässt ihn der König durch die Wache abführen, mit dem Befehl, ihn augenblicklich aufzuknüpfen. Zum Glück für ihn erholte sich die Prinzessin schnell, sprang munter und frisch vom Bette, so dass es noch Zeit war ihn zu retten.
Der König bereute seinen Jähzorn und hielt sein Wort. Die Liebe der schönsten Prinzessin und die Schätze eines Königreichs bewiesen ihm deutlich, dass nicht sein Bruder und der fremde Herr, sondern er Recht gehabt, und dass wer Gutes tut, auch gut tut. Unterdessen war die Mähre von so großem Glück auch bis zu seinem durch Laster ganz verarmten Bruder gedrungen. Schnell machte der sich auf den Weg, seinen Bruder zu verfolgen.
Glücklich gelangte er zu der selben Einsiedelei und schlief in Folge des Rats des Eremiten auf dem Simse der Säule. Wieder kamen die vier Hexen um Mitternacht und kochten für fünf. Margareta ließ dieses mal nicht so lange auf sich warten, dafür aber kam sie auch nicht in großer Pracht, sondern schmutzig, zerfetzt, mit zerrauftem Haar und in der übelsten Laune. -
»Hört!« schrie sie außer sich vor Wut, »hört, was mir geschah; das Töchterlein des Königs ist gänzlich geheilt. Wie wäre das möglich gewesen, wäre ich nicht belauscht worden, während ich euch kürzlich die Behexung erzählte. Nirgends kann der Lauscher gewesen sein, als auf der Säule oben.« Dabei warf sie einen Blick auf die Säule, und von dieser hing der Zipfel eines Bauernrockes herab, der unserm bösen Lauscher gehörte.
Ihn samt dem darin steckenden Eigentümer herabziehend und beide in tausend Stücke zerreißend, war das Werk eines Augenblicks.
Italien: Georg Widter/Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
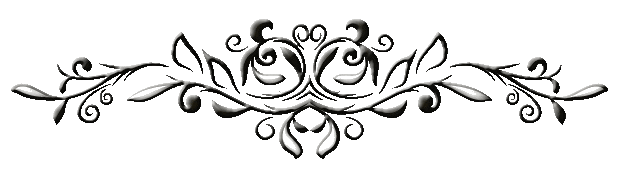
DER KAUFMANNSSOHN AUS GENUA ...

Ein Genueser Kaufmann hatte drei Schiffe zur See, die alle drei glücklich zurück kehren. Von den Kapitänen berichtet der Eine, wie er an einer Insel mit einem feuerspeienden Berge vorbei gekommen; der Zweite, er habe auf einer Insel einen herrlichen Palast erblickt; der Dritte, dass er eine Insel mit einem großen Platze gesehen habe, auf dem die ausgesuchtesten Blumen gewesen. Diese Erzählungen erregen in dem Sohne des Kaufmanns den Wunsch, jene Inseln zu besuchen.
Der Vater gestattet die Reise und befiehlt den Kapitänen, seinem Sohne zu gehorchen. Die beiden ersten Inseln werden ohne Unfall besucht, während aber der Kaufmannssohn auf der dritten einen Strauss sich zu pflücken beschäftigt ist, sieht der Kapitän des dritten Schiffes, welcher den Sohn seines Herrn begleitet hatte, ein starkes Gewitter heran nahen und schifft sich als bald ein, jenen auf der Insel zurücklassend.
Der Kaufmannssohn, der bloß noch drei Geldstücke hat, wird dafür von einem Fischer ans Festland gebracht, wo er bei einem anderen Fischer Aufnahme findet, denn Genua ist, wie er hört, noch 3000 Meilen weit. In des Fischers Hause sind mehrere Stuben, deren Schlüssel der selbe dem Fremden übergibt, in dem er ihm sagt, in welche Stube er zu gehen hat, wenn er essen, oder schlafen, oder sich ankleiden will. Nur den Eintritt in eine Stube verbietet er ihm.
Trotz des Verbotes aber geht der Kaufmannssohn in diese, nach dem ihn der Fischer allein im Hause gelassen, und findet in einer Kommode verborgen einen Diamanten, welcher die Kraft hat, jeden Wunsch dessen, der ihn trägt, zu erfüllen. So wird es ihm leicht, sich nach Genua zu versetzen. Dort aber hatte der König dem die Tochter zu geben versprochen, der einen ebenso schönen Palast erbaue, als der königliche. Mit Hilfe des Steines gelingt dies dem Kaufmannssohn, der nun die Königstochter heiratet.
Unterdessen ist aber auch der Fischer nach Genua gekommen, wo er als Lumpensammler auftritt. So erhält er von der Prinzessin die alten Kleider ihres Mannes, während dieser mit dem Könige auf der Jagd ist. Da nun aber in jenen alten Kleidern der Diamant sich befand, wird der Fischer wieder Besitzer des selben. Als solcher wünscht er das Verschwinden des Palastes. In Folge dessen sieht daher eines Morgens der König, wie seine Tochter und deren Mann vor seinem Palaste auf der Erde schlafen.
Sogleich lässt er seinen Schwiegersohn ins Gefängniss werfen. Sein Vater aber besucht ihn in dem selben und bringt ihm auf seinen Wunsch die Katze des Hauses. Dieser trägt der Gefangene auf, ihm den Diamant zu holen, was die Katze auch sehr geschickt ausführt. Mit Hilfe des Diamanten wird der Palast wieder hergestellt, weshalb der König dem Kaufmannssohne die Tochter wieder zurück gibt.
Der Letztere erklärt, wie im Diamanten seine Kraft bestehe, und wie dieser ihm vom Fischer geraubt worden. Während dieser Auseinandersetzung geht der Fischer gerade am Palaste vorüber. Als bald wird er festgenommen, in den Kerker geworfen, sowie auch alle Reichtümer, die er in seinem Hause aufgehäuft hatte, ihm genommen werden. So konnte der Kaufmannssohn ruhig leben.

DER KAUFMANNSSOHN AUS LIVORNO ...
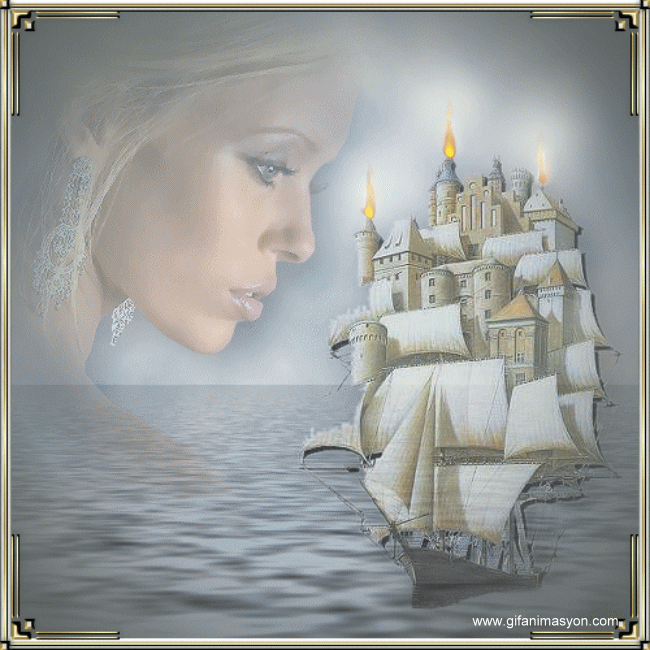
Der Sohn eines Kaufmanns zu Livorno macht mit dem Schiffe seines Vaters eine Reise, die zu nächst nach dem Orient geht. Hier erleidet er durch seine Schuld Schiffbruch, wird aber glücklich gerettet, während die ganze Mannschaft umkommt.
Am Lande trifft er eine Alte, welche ihm ein Schiff, während er selbst ruhig zum Schlaf sich niederlegen kann, zu erbauen verspricht. Beim Erwachen findet er in der Tat ein Schiff auf dem Lande, worauf ihn die Alte verlässt, nachdem sie ihm noch eine Keule gegeben hatte. Um ihm als Mannschaft zu dienen, stellen sich Riesen ein mit sehr verschiedenen Eigenschaften. »Stöpselbeisser« (sciupatappi) kann unendlich viel trinken, »Knochenfresser« (mangiaossa) verzehrt Fleisch nach Belieben, ein dritter macht bei jedem Schritt eine Meile, ein vierter kann, wenn er das Ohr an die Erde hält, hören was die Menschen machen, ein fünfter ist ein guter Steuermann, ein sechster versteht sich sehr gut auf den Kampf mit Kriegsschiffen.
Mit dieser Mannschaft an Bord wird durch einen Schlag mit jener Keule das Schiff ins Wasser versetzt. Es geht nach England, von dessen König der Livornese sich die Tochter zur Frau erbitten will. Als nach glücklicher Ankunft der Kaufmannssohn dem Könige seine Bitte vorträgt, ist dieser bereit einzuwilligen, doch muss der Bewerber vorher mit der Flotte des Landes kämpfen. Diese wird leicht besiegt mit Hilfe des im Kampfe geschickten Riesen. Damit ist noch nicht Alles geschehen.
Ein Fass Wein ist auszutrinken. Dies tut Stöpselbeisser, sowie Knochenfresser eine weitere Aufgabe löst, indem er einen Centner Fleisch verspeist. Um die Tochter verheiraten zu können, bedarf es aber noch der Einwilligung des Kaisers von Constantinopel, die in drei Stunden eingetroffen sein muss. Nachdem auch diese Aufgabe noch von dem schnellfüssigen Riesen für seinen Herrn gelöst worden, macht der König weiter keine Einwendung und gibt dem Livornesen die Tochter, welche der glückliche Gatte nach seiner Vaterstadt bringt, in der er von seinen Eltern und vom Könige freundlich aufgenommen wird.

DAS MILCHMÄDCHEN ...

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder. Eine alte Frau weissagte ihnen, sie hätten die Wahl zwischen einem Sohn, der das väterliche Haus auf nimmer Wiedersehen verlassen, und einer Tochter, die den Eltern verbleiben werde, wenn es ihnen gelinge, sie bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahre gut zu behüten, ohne dass sie etwas von der Außenwelt zu sehen bekomme. Sie gaben sich mit der Tochter zufrieden, und wirklich brachte die Königin bald darauf ein Mädchen zur Welt.
Der König ließ einen unterirdischen Palast errichten, wo das Mädchen aufwuchs und erzogen wurde, ohne von der Welt etwas zu ahnen. Als jedoch sein achtzehntes Lebensjahr heran rückte, hatte es seine Erzieherin nach wiederholten Bitten endlich dazu gebracht, dass sie ihm ein Pförtchen öffnete, das zum Garten führte. Es war ganz bezaubert von der Sonne, von den Farben und Blumen.
Eines Tages erging es sich wieder im Garten. Da schoss auf einmal ein riesiger Vogel auf das Mädchen herab, packte es und trug es mit sich fort durch die Lüfte, bis er es auf dem Dach eines Bauernhauses nieder setzte. Zwei Bauern, Vater und Sohn, sahen von ferne etwas in der Sonne glitzern, und als sie sich näherten, entdeckten sie auf dem Dach die Königstochter mit einer Krone aus Brillanten auf dem Haupt. Erstaunt kletterten sie über die Dächer zu ihr hin; das Mädchen erzählte ihnen ihre Geschichte und bat sie flehentlich, es herunter zu holen.
Die guten Bauern kamen seinem Wunsch gern nach und führten es in ihr Haus, wo sie es den fünf Bauerntöchtern zur Gefährtin gaben. Anfangs lebten sie vom Verkauf der Brillanten, doch mit der Zeit gingen diese zu Ende. Die Königstochter, die den armen Leuten nicht zur Last fallen wollte, sagte zur Frau des Bauern, die es jetzt Mutter nannte: "Ich bitte dich, geh zu der Königin des Landes und lass dir etwas für mich zum Sticken geben."
Die Königin, um die Bäuerin los zu werden, schickte dem Mädchen ein grobes Stück Leinwand. Als ihr die Bäuerin die fertige Arbeit überbrachte, hatte das Mädchen das Tuch mit so herrlichen Stickereien verziert, dass sich die Königin vor Staunen nicht fassen konnte, und sie schickte dem Mädchen zwei Goldstücke. Auch sandte sie ihm einen anderen Lumpen; wieder brachte die Bäuerin ihr eine Handarbeit zurück, die allerseits Bewunderung erregte. Um sie auf die Probe zu stellen, ließ sich die Königin ihre Verwunderung nicht anmerken und sandte dem Mädchen zusammen mit den zwei Goldstücken einen alten Rock.
Als aber die Bäuerin auch diesen schön gestickt zurück brachte, wollte die Königin um jeden Preis wissen, wie jene zu den Handarbeiten kam, die unmöglich aus den Händen einer Bäuerin stammen konnten. Die arme Frau redete ihr ein, ihre Tochter sei im Kloster bei den Nonnen erzogen worden, doch die Königin wollte es nicht glauben. Schließlich bestellte sie die ganze Aussteuer für die Hochzeit ihres Sohnes bei ihr. Der Prinz, dem seine Mutter diese Geschichte erzählt hatte, wollte das Milchmädchen gern kennen lernen. Er suchte es auf und leistete ihm Gesellschaft, während es über seine Arbeit gebeugt saß, und da er ein rechter Tölpel war, fiel er dem Mädchen lästig.
Eines Tages, ehe er sich versah, gab er ihm einen Kuss. Da durchbohrte ihm das Mädchen, ohne sich lange zu besinnen, mit dem Pfriem das Herz. Der Vorfall ließ sich nicht verheimlichen, und das arme Mädchen kam vor Gericht, das aus den Töchtern des Königs bestand. Die Älteste verurteilte es zu lebenslänglichem Gefängnis, die zweite zum Tode, die dritte zu zwanzig Jahren Gefängnis, die jüngste aber, die das weichste Herz hatte und die Missetäterin in ihrem Innern entschuldigte, verurteilte sie nur zu acht Jahren, doch sollte sie zusammen mit dem Leichnam des Königssohnes in einen Turm gesperrt werden, so dass sie ihn ständig vor Augen hatte und Reue über ihre Tat empfand.
Der Vorschlag der Jüngsten wurde angenommen, und diese flüsterte dem Milchmädchen ins Ohr, sie werde ihm schon bei stehen und helfen. Und sie hielt Wort. Als das Mädchen im Turm gefangen saß, brachte sie ihm jeden Tag die erlesensten Speisen. Drei Jahre waren vergangen, seit die unglückliche Gefangene in der Einsamkeit schmachtete. Da erblickte sie eines Tages in der Luft den Vogel, der sie geraubt hatte; dieser schüttelte die Federn und ließ zehn tote junge Vögel zu ihren Füßen niederfallen.
Das arme Mädchen konnte sich gar nicht darüber trösten, dass das Tier nicht nachlassen wollte, es zu verfolgen und zu peinigen. Doch zwei Tage darauf erschien der Vogel von neuem und ließ sich zu den Jungen herab, bestrich sie mit einem Kraut, das er mitgebracht hatte, und siehe da, alle zehn Vögelchen erwachten wieder zum Leben und flogen davon. Das Mädchen verstand sogleich, was der Vogel es hatte lehren wollen. Doch so sehr es auch suchte, es fand auf dem Boden auch nicht einen einzigen Halm von diesem Kraut.
Zwei Tage später erschien der Vogel wieder und warf ein ganzes Bündel von dem Kraut zu ihren Füßen. Erfreut lief das Mädchen zum Leichnam des Königssohnes und bestrich ihn damit von oben bis unten, so dass der Tote allmählich aus seinem Schlaf erwachte und die Augen aufschlug. Insgeheim ließ das Mädchen die jüngste Tochter des Königs rufen, und als die Prinzessin die Gefangene aufsuchte, bereitete diese sie auf die unerlaubte Nachricht vor.
Nun beschlossen sie gemeinsam, dass der Königssohn im Turm bleiben solle, bis das Milchmädchen ihre Strafe verbüßt habe. Und damit es den beiden Gefangenen an nichts fehle, sandte ihnen die Schwester täglich alles, was ihr Herz begehrte, und als der Königssohn um eine Gitarre bat, ließ sie ihm sogar eine Gitarre bringen. Die beiden Liebenden verbrachten nun die Abende mit Gitarrenspiel und Gesang.
Neben dem Turm aber befand sich der Palast des Vizekönigs. Als dieser das Spielen und Singen vernahm, beschwerte er sich bei den Schwestern über die Gefangene. Darauf stellten sie das Milchmädchen zur Rede; es leugnete jedoch alles ab. Und da der Königssohn wieder wie leblos auf seinem Totenbett ausgestreckt lag, verließen sie es im Glauben, es sei allein. Doch Spiel und Gesang tönten weiter. Der Vizekönig, der es nicht mit ansehen mochte, dass sich eine Gefangene vergnügte, ordnete an, das Mädchen solle in ein anderes Gefängnis überführt werden.
Die Gefangene beriet sich nun mit der guten Schwester des Prinzen, was sie tun sollten, und als die Wachen kamen, um sie abzuholen, verließ sie den Turm am Arme des Königssohns. Bei diesem Anblick geriet alles in Verwirrung. Doch der Königssohn erklärte sogleich, er wolle das Milchmädchen heiraten. Und so geschah es.
Die drei ältesten Schwestern konnten es nicht verwinden, ein Milchmädchen zur Schwägerin zu haben, und hörten nicht auf, dieses zu sticheln und zu hänseln.
Da beschloss das Mädchen, ihnen einen gehörigen Denkzettel zu erteilen. Es bekundete eines schönen Tages, es wolle sich für einige Zeit nach Hause begeben, und fragte, was sie ihnen mitbringen solle. "Mir eine Flasche Milch", sagte die Älteste; "mir Quarkkäse", die zweite; "mir einen Kranz Knoblauch", die dritte.
Das Milchmädchen brach auf und besuchte seinen königlichen Vater, der es erfreut in die Arme Schloss, nachdem er es so lange vergeblich im unterirdischen Palast gesucht hatte. Nach geraumer Zeit kehrte das Milchmädchen in einer prächtigen Kutsche zu seinem Gatten zurück. Die Prinzessinnen konnten es sich nicht erklären, wie ihre Schwägerin zu einer solchen Kutsche kam. Wie groß war aber erst ihre Überraschung, als sie die Geschenke zu Gesicht bekamen: Die Milchflasche war aus Silber und Gold gefasst; der Quarkkäse war ebenfalls aus Silber und mit Brillanten und kostbaren Steinen durchsetzt; und der Knoblauchkranz war ein wahres Kleinod der Goldschmiedekunst.
Aber auch die vierte Schwägerin war nicht vergessen worden, die einzige, die stets gut und liebevoll zu ihr gewesen war. Für sie hatte die Königin ihren jüngsten Bruder mitgebracht, der während ihrer Abwesenheit geboren worden war, und gab ihn der Schwägerin zum Gatten. Und so waren alle glücklich ... Und lebten fröhlich und zufrieden.
Nur mir war nichts davon beschieden.

VARDIELLO ...

Granonia von Aprano war eine sehr verständige Frau, hatte aber einen Sohn Namens Vardiello, welcher der größte Einfaltspinsel weit und breit war. Weil jedoch die Augen einer Mutter selten scharfsichtig sind, so war sie ihm dennoch mit solcher Zärtlichkeit zugetan, und schmeichelte und liebkoste ihn alle Zeit, als wenn er das liebenswürdigste Geschöpf von der Welt wäre.
Diese Granonia besaß eine Gluckhenne, welche brütete, und auf welche sie große Hoffnung gesetzt hatte. Da sie nun einmal ein Geschäft außerhalb des Hauses hatte, rief sie den Sohn und sagte zu ihm: „Mein liebes Söhnchen, gib wohl Acht auf diese Gluckhenne, und wenn sie etwa fort fliegen will, so siehe zu, dass du sie wieder in das Nest zurück jagst, sonst werden die Eier kalt und würden mir nichts einbringen." „Dafür lasst mich nur sorgen“, entgegnete Vardiello, „Ihr habt das keinem Tauben gesagt." „Noch Eins“, sprach die Mutter, „siehe, mein lieber Junge, hier in dieser Kammer befindet sich ein Gefäß mit einigen vergifteten Früchten; siehe wohl zu, dass dich die hässliche Sünde des Naschens nicht etwa verführt." „Ei nicht doch“, antwortete Vardiello, „das Gift wird mich nicht verlocken, und ich will mir den Rat wohl gesagt sein lassen." So ging nun die Mutter fort, und Vardiello blieb zu Hause.
Um keine Zeit zu verlieren, ging er in den Garten, einige kleine Arbeiten zu verrichten. Als er jedoch mitten in der Arbeit ist, sieht er, wie die Henne aus dem Neste fliegt; daher fängt er an zu rufen: „Husch, husch, st, st!" Aber die Henne kümmerte sich darum nicht, und Vardiello, als er ihren Eigensinn sah, und nach dem er vergebens sein: husch, husch! gerufen, stampfte mit dem Fuße, und nach dem er mit dem Fuße gestampft, wirft er die Mütze nach ihr, und nach dem er die Mütze nach ihr geworfen, wirft er einen Knüppel, der ihm gerade vor den Füßen lag, und macht ihr auf solche Art unversehens den Garaus.
Als Vardiello dieses Unglück gewahr wurde, wollte er dem selben so gut als möglich abhelfen, und aus der Not eine Tugend machend, und damit ihm die Eier nicht kalt würden, hat er nichts Eiligeres zu tun, als sich selbst auf das Nest zu setzen. Da er jedoch zu sehr darauf drückte, so machte er einen hübschen Eierkuchen. Als er den neuen Schaden wahr nahm, wollte er mit dem Kopf gegen die Mauer rennen; zuletzt jedoch, weil jeder Schmerz endlich nachlässt, und sein Magen anfing rebellisch zu werden, beschloss er, die Henne zu zubereiten, rupfte ihr die Federn aus, steckte sie an einen großen Bratspieß, machte ein gewaltiges Feuer und fing an sie zu braten.
Als sie nun fast gar war, breitete er ein reines Tischtuch über einen alten Kasten, nahm einen Krug und stieg in den Keller, um das Fässchen mit Wein anzuzapfen. Während er in des mitten in diesem Geschäft war, vernahm er plötzlich ein Geräusch, einen Lärm, ein Getöse im Haus, als wenn der Teufel sein Spiel darin hätte. Ganz bestürzt dreht er sich um und sieht eine große Katze, welche mit samt dem Spieß, die Henne weg geschleppt, und eine andere war hinter ihr her, in dem sie Beide abwechselnd gewaltig miauten.
Vardiello, um auch diesem Unglück abzuhelfen, stürzt wie ein wütender Löwe auf die Katzen los, lässt in der Eile das Fässchen mit offenem Hahn, und nachdem er die Katzen durch alle Winkel des Hauses verfolgt, bekommt er die Henne zwar glücklich wieder, inzwischen aber war aller Wein aus dem Fässchen heraus gelaufen. Als Vardiello dies bemerkte und sah, was er wiederum angerichtet, geriet er ganz außer sich vor Schrecken; da er sich aber als ein gescheiter Mensch wohl zu helfen wusste, so nahm er, um auch dieses Unglück best möglichst zu verbergen, damit die Mutter die Zerstörung nicht wahr nehme, einen Sack mit Mehl und schüttete ihn über den ausgelaufenen Wein.
Dem ungeachtet, in dem er das Maß des angerichteten Unglücks wohl erwog, und alle die Ungeheuern Albernheiten, die er begangen, überdachte, beschloss er, sich von der Mutter nicht lebendig wieder finden zu lassen. Er fällt dem nach über den Topf mit eingemachten Nüssen her, von dem die Mutter ihm gesagt, dass sie vergiftet seien, und hört nicht eher auf zu essen, als bis er den Boden sieht und den Wanst gehörig angefüllt hat; hierauf verkriecht er sich in einen Ofen.
Inzwischen kommt die Mutter nach Hause und klopft vergeblich lange Zeit an die Tür. Da es aber niemand hört, stößt sie die Tür mit den Füßen auf und ruft mit lauter Stimme nach ihrem Sohn. Da sie auch jetzt keine Antwort empfängt, so verwünscht sie ihr Leben, zeigt die äußerste Betrübnis und fängt noch lauter an zu schreien: „O Vardiello, Vardiello, bist du taub, dass du nicht hörst; bist du lahm, dass du nicht herbei kommst; bist du krank, dass du nicht antwortest; wo bist du denn, du Diebesgesicht? Wo hast du dich denn verkrochen, du nichtsnutziger Taugenichts?"
Vardiello, als er dieses Gekreisch hörte, sagte endlich doch mit kläglicher Stimme: „Hier bin ich, ich bin im Ofen, und du wirst mich nimmer wieder sehen, liebe Mutter." „Warum denn?", fragte die bekümmerte Mutter. „Weil ich vergiftet bin“, erwiderte der Sohn. „Ach“, sagte Granonia, „und wie hast du denn das angefangen? Was hast du denn für eine Veranlassung gehabt, dir das Leben zu nehmen, und wer hat dir denn das Gift gegeben?" Hierauf erzählte denn Vardiello der Reihe nach alle die hübschen Geschichten, die er angerichtet, wobei die Mutter fast vor Ärger hätte umkommen mögen.
Zudem hatte sie noch viel Mühe, dem Vardiello seine Einbildung aus dem Kopf zu bringen; weil sie ihn aber trotz alledem so herzlich liebte, gab sie ihm Einiges mit Sirup Angemachte, und brachte ihn dadurch endlich zu der Überzeugung, dass es kein Gift, sondern nur eine Magenstärkung gewesen sei, was er zu sich genommen habe. Nachdem sie ihm nun auf das Freundlichste zugesprochen und tausendfach geschmeichelt, zog sie ihn aus dem Ofen, gab ihm ein schönes Stück Leinwand und sagte, er solle hin gehen und es verkaufen, sich aber wohl vorsehen, sich nicht mit Leuten von zu vielen Worten einzulassen. „Seid unbesorgt“, sagte Vardiello, „und haltet mich nicht für so dumm."
Er nahm hierauf die Leinwand und zog nun durch die Straßen der Stadt Neapel, wohin er sich mit dieser Ware begeben, in dem er ausrief: „Wer kauft Leinwand, Leinwand?" Aber wie viele Leute ihn auch fragten: „Was ist das für Leinwand?", so entgegnete er immer: „Mit euch mag ich nichts zu schaffen haben, ihr macht mir zu viel Worte." Und wenn ihn Jemand fragte: „Wie teuer ist die Leinwand?“, so nannte er ihn einen unausstehlichen Schwätzer.
Zuletzt kam er in den Hof eines unbewohnten Hauses, wo selbst eine Bildsäule aus Gips stand. Der arme Mensch, ganz müde von dem vielen Umherlaufen, setzte sich auf einen Brunnenrand, und weil er niemanden in jenem Hause aus- und eingehen sah, sagte er ganz erstaunt zu der Statue: „Sagt mir, guter Freund, wohnt niemand in diesem Hause?" Da ihm die Statue, wie natürlich, keine Antwort gab, so schien sie ihm allerdings von sehr wenig Worten zu sein, und Vardiello sagte daher: „Wollt ihr diese Leinwand kaufen? Ich lasse sie euch sehr wohlfeil." Und da die Statue noch immer schwieg, sprach er: „Meiner Treu, ich habe meinen Mann gefunden; nehmt sie hin, und gebt mir, was ihr wollt, morgen komm ich nach dem Gelde." Damit lässt er die Leinwand auf seinem Sitze liegen, so dass der Erste Beste, der in das Haus zufällig eintrat, mit der Leinwand davon ging.
Als Vardiello zu seiner Mutter ohne Leinwand zurück kehrte und ihr seine Geschäfte mitteilte, wollte sie vor Ärger in Ohnmacht fallen und rief: „Wann wirst du endlich einmal vernünftig werden? Sieh mal, was du für dumme Streiche gemacht hast, Tölpel! Aber ich selbst bin daran Schuld, denn weil ich zu zärtlich gegen dich gewesen, habe ich dir nicht gleich Anfangs den Kopf zu Recht gesetzt, und jetzt sehe ich wohl ein, dass ein mitleidiger Arzt die Wunde unheilbar macht. Aber du machst mir der dummen Streiche zu viel, und wir werden eine lange Abrechnung halten." Vardiello dagegen sprach: „Seid nur ruhig, liebe Mutter, denn es wird nicht so schlimm sein, wie ihr sagt, ihr wollt ja nichts anderes, als die neuen blitzenden Taler; glaubt ihr denn, ich lasse mir ein T für ein U machen, dass ich gar so einfältig bin? Ihr werdet einmal morgen sehen, ob ich meine Sache nicht recht anzufangen weiß."
Am folgenden Morgen, als die Sonne kaum aufgegangen war, begab sich Vardiello in den Hof, wo die Bildsäule stand, und sagte: „Guten Tag, Gevatter, wär es euch wohl gefällig, mir die paar Groschen zu geben, die ich für die Leinwand noch bekomme?" Da aber die Statue stumm blieb, fasste Vardiello einen Prügel und traf sie damit gerade auf die Brust, so dass er ihr eine Ader entzwei brach, aus welcher ihm dann sein Glück zu strömte, denn er fand in der Statue einen Topf voll Goldtaler, den er sogleich mit beiden Händen packte, und über Hals und Kopf nach Hause lief, in dem er rief: „Mütterchen, Mütterchen, o seht einmal, welch ein Berg roter Dreier!"
Die Mutter, da sie die Goldtaler sah, und fürchtete, ihr alberner Sohn möchte das Vorgefallene unter die Leute bringen, sagte zu ihm, er solle sich unter die Haustür setzen und die Vorübergehenden um ein Paar Dreier ansprechen. Vardiello, der Einfaltspinsel, setzte sich also unter die Haustür, und nun ließ die Mutter länger als eine halbe Stunde Hände voll Rosinen und trockener Feigen aus dem Fenster herunter regnen. Als Vardiello dies gewahr wurde, rief er aus: „O Mutter, Mutter, stell Töpfe und Schüsseln unter, wenn dieser Regen fort dauert, werden wir bald reiche Leute sein!" Und als er sich so den Bauch gehörig angefüllt, legte er sich schlafen.
Nun trug es sich einmal zu, dass zwei Arbeitsleute mit einander zankten und vor Gericht gingen, weil jeder von ihnen auf einen Goldtaler, den sie gefunden, Anspruch machte. Da kam auch Vardiello dazu und sagte: „Was seid ihr doch für Esel, dass ihr um solch einen rochen Dreier so sehr mit einander zankt; ich mache mir wenig daraus, denn vor Kurzem hab ich einen ganzen Topf voll gefunden?"
Als der Richter dies vernahm, riss er seine Augen weit auf, und verhörte ihn auf das Genaueste, wie, wann und bei wem er diese Taler gefunden habe, worauf Vardiello antwortete: „Ich habe sie in einem Palast in einem stummen Menschen gefunden an dem Tage, als es Rosinen und trockene Feigen regnete."
Da der Richter diese ungereimte Antwort vernahm, so beachtete er die Sache weiter nicht, und verfügte bloß, den Vardiello in ein Narrenhaus zu bringen.
So machte die Unwissenheit des Sohnes die Mutter reich, und der Verstand der Mutter machte die Dummheiten des Sohnes wieder gut, woraus denn sehr klar hervorgeht: „Es muss sehr, sehr schlimm hergehen, wenn ein Schiff, das ein guter Lotse steuert, an einem Felsen scheitert."

DIE PILGER ...

Eine arme Familie hatte beschlossen eine Wallfahrt nach St. Jago de Compostella zu machen. Bevor diese aber gemacht werden kann, stirbt der Vater. Die Hinterbliebenen waren so arm, dass sie auf Stroh schliefen. Doch war das Bett des Vaters nicht verkauft worden. Eines Nachts will der älteste Sohn in diesem Bette schlafen, wird aber daran gehindert. Er hört sich nämlich beim Namen rufen und eilt nun aufgeschreckt zur Mutter. Ebenso macht es in einer anderen Nacht der zweite Sohn. Dagegen fragt der dritte Sohn, als dieser in dem Bette schläft, nach dem Begehren des Rufers. Es ist die Seele des Vaters, welcher die Wallfahrt anbefiehlt, damit er die ewige Seligkeit erlange.
So macht sich denn die Mutter mit den drei Söhnen auf den Weg. Des Abends wird sie müde, kann nicht weiter und die Pilger müssen im Walde übernachten. Um sich hier gegen wilde Tiere zu schützen, kommen die Brüder überein, abwechselnd Wache zu halten. Während der älteste Bruder wacht, kommt eine Schlange. Diese tötet Anton, steckt den abgehauenen Kopf der selben in die Tasche und verscharrt den Körper. Der zweite Sohn macht es mit einem Tiger, der sich zeigt, ebenso. Dem jüngsten Bruder erscheint ein Adler, dessen er sich vergebens zu bemächtigen sucht. Er entflieht in die Lüfte.
Wie Peter dann zu seiner Mutter und seinen Brüdern zurück kehren will, findet er diese nicht mehr, wohl aber kommt bald ein Riese des Wegs, welcher ihm Nachricht von seinen Verwandten zu geben verspricht. Zu dem Ende soll er in die Mauer eines Palastes ein Loch schlagen. Dies tut er auch, tötet jedoch bei dieser Gelegenheit auch den Riesen. Im Palaste, der von Peter untersucht wird, sieht er in einer schönen Kammer auf prächtigem Bette eine schlafende Jungfrau, welcher er die Ringe vom Finger zieht und die Pantoffeln zugleich entwendet. Darauf verlässt er den Palast und findet mit Hilfe einer Alten seine Mutter und seine Brüder wieder. Gemeinschaftlich wird dann die Wallfahrt gemacht.
Inzwischen ist jene Jungfrau erwacht und zu ihrem Vater, dem Könige, zurück gekehrt. Neugierig zu erfahren, wer sie befreit und beraubt hat, bewirtet sie in einem Hause alle Vorübergehenden unentgeldlich. So kehren bei ihr auch die Pilger ein, von denen sie sich genau berichten lässt, was ihnen alles begegnet ist. Auf diese Weise erfährt sie, dass Peter ihre Ringe hat, erkennt in ihm den, welcher sie aus den Händen des Riesen erlöst hat und vermählt sich ihm zum Danke.
Italien: Georg Widter/Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
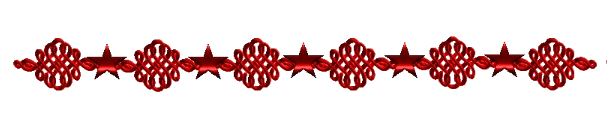
DIE SCHLANGE (2) ...

Vor langen Jahren herrschte einmal in Montserrat ein reicher und mächtiger Markgraf, der hätte so gerne Kinder gehabt, aber der Himmel schien ihm diesen Wunsch versagen zu wollen. Eines Tages nun ging die Markgräfin in ihrem Garten spazieren und von Müdigkeit überwältigt, setzte sie sich an den Fuß eines Baumes nieder, um auszuruhen. Während sie so in süßem Schlummer lag, näherte sich ihr eine kleine Schlange und schlüpfte, ohne dass sie es gewahr wurde, in ihren Mund.
Nach Verlauf einiger Zeit wurde die Markgräfin zur großen Freude des ganzen Volkes Mutter und gebar ein Mädchen, um dessen Hals ein Schlänglein dreimal gewunden war. Die Wärterinnen erschraken nicht wenig darüber; aber ohne dem Kinde irgendein Leid zu zufügen, löste sich die Schlange behutsam von seinem Halse, wand sich hinunter auf den Boden, kroch an der Erde hin und verlor sich in dem Garten.
Nachdem die Kleine gebadet und in weiße Tücher gehüllt war, kam an ihrem Halse eine feine goldene Kette zum Vorschein, die wunderschön anzusehen war, denn sie leuchtete zwischen Haut und Fleisch hervor, so wie etwa ein köstlicher Edelstein durch hellen Kristall blinkt; und gerade so oft umringelte sie den Hals, als sich die Schlange um den selben gewunden hatte.
Das Mädchen, welches man seiner außerordentlichen Schönheit wegen Biancabella nannte, wuchs zu solcher Tugend und Anmut heran, dass man nicht ihres Gleichen fand. Als sie zehn Jahr alt war, trat sie eines Tages auf den Balkon des Schlosses und da sie den Garten mit all den schönen Rosen und Veilchen erblickte, so fragte sie die Amme, welcher sie zur Aufsicht übergeben war, was das dort unten sei, sie habe das früher noch nie gesehen.
„Man nennt dies einen Garten“, versetzte die Amme, „und deine Mutter geht darin oft spazieren." „Ach“, rief das Mädchen, „so etwas Schönes hab' ich noch nie gesehen! für mein Leben gern möchte ich auch darin spazieren gehen." Die Amme nahm sie bei der Hand, führte sie in den Garten und nach dem sie eine Zeitlang mit ihr umher gegangen war, setzte sie sich unter eine dicht belaubte Buche, um ein wenig zu schlummern, während sie die Kleine sich selbst überließ.
Biancabella, ganz entzückt von diesem reizenden Aufenthalt, lief bald hier hin, bald dort hin und pflückte Blumen, und als sie ein wenig müde geworden, ließ sie sich unter einem schattigen Baum nieder. Doch kaum hatte sie sich hingesetzt, so kam eine Schlange hervor und näherte sich ihr, worüber das Kind in großen Schrecken geriet und schreien wollte.
Aber die Schlange sagte zu ihr: „Sei still, fliehe nicht und sei ohne Furcht vor mir, denn ich bin deine Schwester, mit dir an dem selben Tage von derselben Mutter geboren, und mein Name ist Bianca. Wenn du immer das tun wirst, was ich dir heiße, so will ich dich glücklich machen; sonst aber wirst du das unglücklichste und traurigste Geschöpf von der Welt werden. Gehe jetzt und sei ohne Furcht. Morgen aber lass zwei Kessel in den Garten bringen, den einen voll reiner Milch, den anderen mit feinem Rosenwasser, und dann komm zu mir, aber ganz allein, ohne irgend eine Begleitung."
Als die Schlange sich wieder entfernt hatte, stand das Mädchen auf, suchte ihre Amme, die sie noch schlafend fand, weckte sie und kehrte mit ihr nach Hause zurück, ohne ihr ein Wort von dem, was vorgefallen war, zu erzählen.
Am folgenden Tage, da Biancabella sich mit ihrer Mutter allein im Zimmer befand und ein wenig nieder geschlagen und betrübt aussah, fragte die Mutter: „Was fehlt dir, Biancabella? Was bist du so traurig? Du bist sonst immer so fröhlich und heute scheinst du so missvergnügt und betrübt?" „Ach, liebe Mutter“, sagte das Kind, „ich möchte so gern zwei Kessel in den Garten haben, einen voll Milch und den anderen voll Rosenwasser." „Wenn es weiter nichts ist“, versetzte die Mutter, „so gräme dich nicht, mein Kind; du weißt ja doch, wie gerne wir jeden möglichen Wunsch von dir erfüllen." — Hierauf ließ sie gleich zwei prächtige Kessel in den Garten tragen, voll Milch und Rosenwasser.
Als die bestimmte Stunde gekommen war, ging Biancabella ganz allein nach dem Garten, schloss die Tür hinter sich zu und setzte sich bei den Kesseln nieder. In dem selben Augenblicke erschien auch die Schlange, hieß ihr sich entkleiden und in die weiße Milch steigen, wusch sie damit von Kopf bis zu Fuß, beleckte sie mit der Zunge und glättete die Haut überall, wo ihr noch irgend ein Mangel erschien.
So dann nahm sie sie aus der Milch heraus und legte sie in das Rosenwasser, dessen angenehmer Duft sie wieder wie neu belebte, Sie kleidete sie hierauf wieder an und befahl ihr aufs Strengste, ja niemanden etwas davon zu sagen, selbst dem Vater und der Mutter nicht, denn sie wolle, dass kein Mädchen in der ganzen Welt sich ihr an Schönheit und Anmut vergleichen könne. Zuletzt begabte sie sie noch mit einer Menge trefflicher Eigenschaften und nahm von ihr Abschied.
Als Biancabella zu ihrer Mutter wieder zurück gekehrt war, fand diese sie so überaus schön und anmutig, dass sie nicht Worte fand, ihr Entzücken und ihre Verwunderung auszudrücken. Endlich fragte sie, wie sie es denn angefangen habe, zu einer so wunderbaren Schönheit zu gelangen. Biancabella versicherte jedoch, sie wisse es nicht. Die Mutter nahm hierauf einen Kamm, um ihre goldenen Locken in Ordnung zu bringen, und wie sie sie kämmte, fielen ihr Perlen und kostbare Edelsteine aus dem Haar, und als sie ihr die Hände wusch, fielen Rosen, Veilchen und andere Blumen nieder und erfüllten die Luft mit dem süßesten Wohlgeruch.
Bei diesem überraschenden Anblick eilte sie zu ihrem Gemahl und mit mütterlicher Freude sagte sie: „Mein Herr und Gemahl, unsere Tochter ist das schönste und liebenswürdigste Mädchen, welches je geboren wurde. Denn außer ihrer wunderbaren Schönheit fallen ihr noch Perlen und kostbare Edelsteine aus den Haaren und — stellt euch vor! ihre weißen Hände streuen Rosen und Veilchen und noch viel andere Blumen aus, die einen entzückenden Wohlgeruch verbreiten. Nie hätte ich das geglaubt, wenn meine eigenen Hände es nicht gefühlt, meine eigenen Augen es nicht gesehen hätten."
Der Markgraf, welcher von Natur ungläubig war und den Worten seiner Frau nicht so leicht traute, lachte und spottete darüber. Allein die wiederholten Beteuerungen reizten ihn doch, sich selbst zu überzeugen, was an der Sache sei. Er ließ also seine Tochter herbei rufen und fand alles noch viel wunderbarer, als es seine Frau beschrieben hatte. Darüber freute er sich so sehr und wurde so stolz darauf, dass er niemanden auf der Welt für würdig hielt, ihr Gatte zu werden.
Als sich nun der Ruf von Biancabellas einziger und himmlischer Schönheit überall hin verbreitete, so kamen auch Könige, Prinzen, Grafen und andere hohe Herren von allen Seiten herbei gereist, um ihre Liebe zu gewinnen und sie als Gemahlin heimzuführen. Aber keiner von ihnen erschien würdig sie zu besitzen, denn an Jedem war irgend etwas Mangelhaftes oder Tadelnswertes.
Endlich langte auch Ferrandino, der König von Neapel an, dessen Ruhm und Tugend wie die Sonne unter den kleinen Gestirnen hervor leuchtete, und hielt bei dem Markgrafen um die Hand seiner Tochter an. Dieser, welcher mit dem schönen, weit und breit geehrten, so mächtigen und reichen König wohl zufrieden war, willigte unbedenklich ein, ließ seine Tochter herbei holen und ohne Zögern reichten sie sich die Hände und umarmten sich als Verlobte.
Das Verlöbnis war nicht so bald geschehen, als Biancabella sich des Gebots ihrer Schwester Bianca erinnerte, ihren Bräutigam verließ, indem sie Geschäfte vorschützte, nach ihrer Kammer ging, sie hinter sich verschloss und durch einen ganz geheimen Ausgang der selben in den Garten eilte, wo sie mit leiser Stimme nach ihrer Schwester Bianca rief. Allein diese erschien nicht, wie sie sonst zu tun pflegte. Ganz verwundert suchte Biancabella in jedem Winkel des Gartens nach ihr und als sie sie nirgends fand, wurde sie sehr traurig und nieder geschlagen, denn sie sah wohl, dies geschehe nur deshalb, weil sie das Gebot ihrer Schwester außer Acht gelassen habe. Hierauf begab sie sich heimlich wieder in ihre Kammer und zu ihrem Gemahl, der sie schon lange erwartet hatte.
Als die Hochzeit vorüber war, führte Ferrandino seine Gemahlin nach Neapel, wo sie mit großer Pracht und Festlichkeit von der ganzen Stadt empfangen ward. Ferrandino aber hatte eine Stiefmutter mit zwei garstigen Töchtern aus einer anderen Ehe, von denen sie ihm eine gerne zur Frau gegeben hätte, und da ihr nun diese Hoffnung durch Biancabella so ganz vereitelt war, fasste sie gegen die Arme einen so wütenden Hass, dass sie, sie nicht vor Augen sehen konnte: gleichwohl aber stellte sie sich, als sei sie voll Liebe zu ihr.
Es begab sich nun, dass der König von Tunis große Zurüstungen zu Wasser und zu Lande machte, um Ferrandino mit Krieg zu überziehen (ob um dieser Ehe halber oder aus sonst einem Grunde, ist ungewiss) und er war bereits bis über die Grenzen des Königreichs vor gedrungen, so dass Ferrandino genötigt war, die Waffen zu ergreifen und dem Feinde entgegen zu gehen, um sein Land zu verteidigen. Nachdem er nun hinlänglich gerüstet war, empfahl er Biancabella seiner Stiefmutter und zog mit dem Heere in den Krieg.
Kaum war er fort, so beschloss diese boshafte, nichtswürdige Stiefmutter, Biancabella umbringen zu lassen. Sie rief zwei ihrer Diener, von deren Ergebenheit sie überzeugt war, und befahl ihnen, die Königin an einen entlegenen Ort spazieren zu führen, sie dort zu töten und ihr zur völligen Gewissheit bestimmte Zeichen ihres Todes zu bringen. Die Diener, schleuniger zum Bösen als zum Guten, taten nach dem Befehl ihrer Gebieterin, und in dem sie sich stellten, als wollten sie die Königin spazieren führen, führten sie die selbe in ein Gehölz, wo sie sich anschickten, ihr den Tod zu geben. Doch ihre große Schönheit und Anmut flößte ihnen so viel Mitleid ein, dass sie ihr wenigstens das Leben schenkten, aber sie schnitten ihr die Hände ab und rissen ihr die Augen aus, um sie dem bösen Weibe von Stiefmutter als Zeichen ihres Todes zu bringen.
Dieser Anblick stellte das ruchlose Weib ganz zufrieden, und um ihr nichtswürdiges Vorhaben gänzlich auszuführen, streute sie durch das ganze Land das Gerücht aus, ihre beiden Töchter seien gestorben, die eine an einem abzehrenden Fieber, die andere an einem Herzgeschwür. Biancabella aber sei, aus Gram über die Trennung von ihrem Gemahl, von einem toten Kinde entbunden worden und ein dreitägiges Fieber habe sie so angegriffen, dass wenig Hoffnung für ihr Leben sei. — Anstatt Biancabellas aber legte das schlechte, grausame Weib eine ihrer Töchter ins Bett und gab vor, es sei die Königin, die am Fieber krank liege.
Ferrandino, der inzwischen seinen Feind besiegt hatte, kehrte jetzt im Triumph nach Hause zurück, in der frohen Hoffnung, seine geliebte Biancabella gesund und freudig wieder zu finden: und nun fand er sie mager und entstellt im Bette liegen! Und da er näher trat und ihr Gesicht sah, so war er ganz erstaunt, das selbe so abschreckend zu finden und konnte sich gar nicht vorstellen, dass dies Biancabella sei. Darauf ließ er sie kämmen, allein statt der Perlen und Edelsteine, die sonst aus ihren blonden Haaren fielen, sah man verzehrendes Ungeziefer, und statt der Rosen und lieblichen Düfte ihrer Hände kam so viel Schmutz und Gestank, dass alle ein Ekel überfiel. Die nichtswürdige Stiefmutter aber beredete den König, dies käme alles von der langen Krankheit, die der gleichen Wirkungen hervorzubringen pflege.
Unterdes befand sich die arme Biancabella, mit verstümmelten Armen, der Augen beraubt, verlassen an einem einsamen Orte, in großem Jammer und rief unaufhörlich die Schwester Bianca um ihren Beistand an: aber niemand antwortete, außer dem Echo, welches von allen Seiten klagend zurück tönte. Als die Unglückliche in dieser traurigen Lage, jeder Hilfe beraubt, eine Zeitlang zugebracht hatte, kam ein Greis durch den Wald, ein Wohl wollender und mitleidiger Mann. Er hörte die klagenden Töne in der Ferne, näherte sich und fand die ihrer Hände und Augen beraubte Königin, die ihr Elend bejammerte.
Als der gute Alte sie in einem so bemitleidenswerten Zustand erblickte, konnte er es nicht übers Herz bringen, sie in den Sträuchern und Dornen allein zurück zu lassen, sondern, von einem väterlichen Mitgefühl bewegt, führte er sie mit sich nach Hause, wo er sie seiner Frau übergab, in dem er ihr dringend anempfahl, sie ja wohl zu behandeln. Auch seinen drei Töchtern, die wie drei Sterne leuchteten, gebot er, ihr Gesellschaft zu leisten, immer freundlich zu begegnen und es ihr an nichts fehlen zu lassen.
Allein seine Frau, die ein hartes, unbarmherziges Geschöpf war, geriet darüber in gewaltigen Zorn und sagte ziemlich ungestüm zu ihrem Manne: „Was sollen wir denn aber in aller Welt mit dieser blinden, händelosen Frau machen, die gewisslich nicht ihrer Tugenden halber, sondern zum Lohne ihrer Taten so zugerichtet ist?" „Tue nur, was ich dir sage“, versetzte der gute Greis, „und tust du es nicht, so nimm dich in Acht, wenn ich nach Hause komme."
Also blieb die arme Biancabella bei der Frau und ihren drei Töchtern, unterhielt sich mit ihnen über dies und jenes, und während sie dabei an ihr Unglück dachte, fiel es ihr ein, eins von den Mädchen zu bitten, es möge doch so gut sein, ihr das Haar zu kämmen. Die Mutter nahm dies sehr übel auf; sie wollte durchaus nicht zugeben, dass ihre Tochter sich zur Magd erniedrige. Allein die Tochter, welche freundlicher als die Mutter war und sich erinnerte, was der Vater ihnen befohlen hatte, auch aus dem Antlitz Biancabellas etwas von ihrem hohen Stande ahnte, breitete ihre weiße Schürze vor sich hin und fing an, ganz sanft das Haar zu kämmen.
Aber sie hatte kaum angefangen zu kämmen, als Perlen, Rubinen, Diamanten und andere Edelsteine von unschätzbarem Werte aus den Locken stürzten. Bei diesem Anblick geriet die Mutter ins größte Erstaunen, bereute von ganzem Herzen ihr unfreundliches Benehmen und der Hass welchen sie früher gehegt hatte, verwandelte sich mit einmal in Liebe. Als nun der gute Alte nach Hanse zurück kehrte, liefen ihm alle entgegen, umarmten ihn und freuten sich mit ihm, welches Glück ihnen in ihrer großen Armut zu Teil geworden sei.
Biancabella ließ hierauf einen Eimer mit frischem Wasser herbei bringen und sich das Gesicht und die verstümmelten Arme waschen, und vor den Augen Aller gingen Rosen, Veilchen und andere Blumen in Überfluss hervor. Da erschien sie Allen mehr als ein göttliches, denn als ein menschliches Wesen. Nach einiger Zeit beschloss Biancabella wieder an den Ort zurück zu kehren, wo der Greis sie gefunden hatte. In des dieser sowohl als seine Frau und die Töchter, welche den Reichtum, den sie ihnen brachte, nicht gern verlieren wollten, suchten sie auf das Freundlichste zurück zu halten, baten sie inständigst, nicht von ihnen zu gehen und führten ihr eine Menge Gründe an, um sie davon abzubringen.
Allein sie beharrte standhaft bei ihrem Entschluss, versprach jedoch wieder zu kommen. Der Alte gab ihr also nach und ohne Zögern führte er sie an den Ort, wo er sie zuerst angetroffen hatte. Hier befahl sie ihm, sie zu verlassen und gegen Abend wiederzukehren, dann würde sie mit ihm heimgehen.
Sobald der Alte fort war, fing die unglückliche Biancabella an, im Walde hin und her zu irren und ihre Schwester Bianca in einem fort um ihren Beistand anzurufen, so dass ihr Geschrei und ihre Klagen bis in den Himmel tönten. Aber Bianca, ob gleich sie ihr nahe war, ja sie niemals verlassen hatte, wollte ihr nicht antworten.
Als die arme Trostlose endlich sah, dass alle ihre Worte in den Wind geredet seien, rief sie weinend: „Was soll ich noch länger auf dieser Welt, da ich meiner Augen und meiner Hände beraubt bin und aller menschlichen Hilfe entbehre!" Und in dem Übermaß ihrer Verzweiflung, die ihr jeden Schein einer Hoffnung nahm, beschloss sie sich das Leben zu nehmen. Da sie kein anderes Mittel dazu hatte, schlug sie den Weg nach einem nahen Fluß ein, um sich hineinzustürzen und zu ertränken. Als sie aber an das Ufer gelangt und schon im Begriff war, sich hinab zu stürzen, hörte sie eine Stimme, die zu ihr sprach: „Halte ein, was willst du tun? Werde nicht deine eigene Mörderin! Bewahre dein Leben für eine bessere Zukunft."
Biancabella war so erschrocken über diese Stimme, dass sich ihr Haar vor Entsetzen sträubte: da ihr in des die Stimme bekannt schien, fasste sie wieder ein wenig Mut und entgegnete: „Wer bist du, der du in dieser Wildnis dich aufhältst?"
„Ich bin deine Schwester Bianca“, antwortete die Stimme, „die du so flehentlich angerufen hast." Als Biancabella diese Worte hörte, rief sie in tiefer Bewegung, von Seufzern unterbrochen: „O meine Schwester, meine Wohltäterin, stehe mir bei, und wenn ich deinen Rat außer Acht gelassen habe, so bitte ich dich jetzt, verzeihe mir, ich habe gefehlt und erkenne meinen Fehler. Aber ich habe nur aus Unwissenheit und nicht aus bösem Willen gefehlt."
Da Bianca sich von ihrer tiefen Reue überzeugte und betrachtete, wie sehr sie misshandelt worden war, empfand sie Mitleid, tröstete sie, so gut sie vermochte, pflückte verschiedene Kräuter, die eine wunderbare Kraft besaßen, legte sie ihr diese auf die Augen, fügte so dann zwei Hände an die Arme und machte so Biancabella auf der Stelle wieder heil und sehend. Nachdem dies geschehen, warf Bianca ihre Schlangenhaut von sich und ward zu einer schönen Jungfrau.
Als der Abend nahte und die Sonne schon ihre glänzenden Strahlen verbarg, während die Schatten der Nacht auf zu steigen begannen, kam auch der gute Greis mit hastigem Schritte in den Wald, wo er Biancabella neben einer anderen Jungfrau sitzend fand. Da er in ihr Antlitz schaute, war er ganz erstaunt und glaubte, sie könne es nicht sein. Er überzeugte sich in des bald und sprach zu ihr: „Wie, meine Tochter, diesen Morgen noch warst du blind und ohne Hände, wer hat dich denn so schnell geheilt?" „Nicht ich selbst, sondern die Macht und die Liebe dieser, die hier neben mir sitzt und meine Schwester ist."
Nun standen sie auf und gingen ganz vergnügt mit dem Alten nach Hause, wo sie von der Frau und den Töchtern sehr freundlich empfangen wurden. Einige Zeit darauf begaben sich Bianca, Biancabella nebst dem Alten, dessen Frau und Töchtern nach der Stadt Neapel, um dort ihren Wohnsitz zu nehmen. Bei ihrer Ankunft bemerkten sie einen großen leeren Platz, dem Schlosse des Königs gerade gegenüber: auf diesem setzten sie sich nieder und als die Nacht gekommen war, nahm Bianca eine Rute von einem Lorbeerbaum in die Hand und schlug damit dreimal auf die Erde, in dem sie einige Worte dabei aussprach, und siehe da, auf der Stelle stand der schönste und prächtigste Palast von der Welt da.
Als König Ferrandino am folgenden Morgen ans Fenster trat und ein so reiches, wunderbares Schloss erblickte, war er ganz erstaunt und rief seine Frau und seine Stiefmutter, damit sie es auch sähen. Diese aber befanden sich nicht wohl dabei, denn sie fürchteten, es könne ihnen irgend etwas Böses bedeuten. Während nun Ferrandino den Palast hin und her nach allen Seiten betrachtete und sich gar nicht satt sehen konnte, bemerkte er an dem Fenster eines der Zimmer zwei Frauen, die an Schönheit die Sonne verdunkelten. Als er sie näher betrachtete, geriet sein Herz in heftige Bewegung, denn es schien ihm, als sei die eine das wahre Ebenbild seiner Biancabella.
Er befragte sie um ihren Namen und woher sie kämen und erhielt zur Antwort, sie seien zwei Fremde aus dem Lande Persien, die mit Hab und Gut hier her gezogen, um in dieser Stadt zu wohnen. Darauf fragte er, ob sie erlaubten, dass er mit den Frauen seines Hauses ihnen seinen Besuch abstatte; worauf sie erwiderten, dies würde ihnen zwar sehr angenehm sein, allein es schicke sich weit mehr für sie, die Untertanen, jenen ihren Besuch zu machen, als dass er, ihr Herr, nebst den Königinnen ihnen eine solche Ehre erweise, die allzu groß sei, um ihnen zu zukommen.
Ferrandino jedoch ließ sogleich die Königin nebst den anderen Frauen rufen, obgleich sie, ihr nahes Verderben ahnend, nur mit Widerstreben gingen, und so begaben sie sich nach dem Palaste der beiden Frauen. Diese empfingen ihre Gäste mit Ehrerbietung und freundlichster Aufmerksamkeit und wiesen ihnen alle die schönen Gemächer, die weiten, prächtig geschmückten Säle, die Mauern von feinem Alabaster und reichem Porphyr.
Nachdem sie diesen prachtvollen und bewunderungswürdigen Palast genug besehen hatten, ließ Bianca eine der Töchter des Greises namens Silveria herbei holen und befahl ihr, dem König zu Ehren irgend etwas zu singen. Das junge Mädchen nahm ihre Laute, setzte sich dem Könige gegenüber und in dem sie anmutig in die Saiten griff, sang sie dazu die ganze Geschichte Biancabellas von Anfang bis zu Ende, doch ohne die Namen zu nennen. Als sie geendigt hatte, stand Bianca auf und fragte den König, welch eine Strafe wohl diejenige verdiene, die ein so schweres Verbrechen begangen habe.
Die Stiefmutter, welche durch eine rasche Antwort ihre Nichtswürdigkeit zu verbergen hoffte, sagte ganz dreist, ohne abzuwarten, was der König erwidere: „Ein glühender Ofen wäre die rechte Strafe dafür!" Da rief Bianca, vor Zorn glühender als eine Kohle im glühenden Ofen: „Du selber bist es, das nichtswürdige Weib, das einen solchen Frevel begangen hat. Ja, du elende, boshafte, verworfene Frau verdammst dich jetzt durch deinen eigenen Mund."
Hierauf wandte sie sich zum Könige und sagte mit freudigen Blicken zu ihm: „Hier ist deine Biancabella, hier ist deine teure Gemahlin, welche du so zärtlich liebtest, hier ist die, ohne welche du nicht leben konntest." Und zum Beweise befahl sie den drei Töchtern des Greises, in Gegenwart des Königs, der Biancabella, das Haar zu kämmen, worauf Perlen und kostbare Edelsteine aus ihren goldenen Locken fielen und aus ihren Händen Rosen und Veilchen. Endlich zum vollkommenen Beweis entblößte Bianca noch den Hals ihrer Schwester, der mit einer feinen Goldkette umschlungen war, die zwischen Fleisch und Haut hervorleuchtete, wie durch Kristall.
Ais der König aus diesen sicheren und augenscheinlichen Anzeichen erkannt hatte, dass es seine Gemahlin Biancabella sei, weinte er Freudentränen und umarmte sie aufs Zärtlichste. So dann ließ er einen Ofen glühend machen und die Stiefmutter nebst ihrer Tochter hinein werfen. So trugen sie den gerechten Lohn ihres Verbrechens davon. Die drei Töchter des Greises aber wurden anständig verheiratet und Ferrandino lebte mit seiner Biancabella viele Jahre glücklich und vergnügt und hinterließ bei seinem Tode das Reich seinen Kindern.

DIE SCHLANGE (1) ...

Es war einmal eine Bauersfamilie, die hätten für ihr Leben gern Kinder gehabt, und bekamen keine. Als eines Tages der arme Mann in den Wald gegangen war, um Reisigbündel zu sammeln, und sie nach Hause brachte, fand er darin eine hübsche kleine Schlange. Als Sabatella, dies war der Name der Bauersfrau, dies sah, stieß sie einen tiefen Seufzer aus und sagte: „Sogar die Schlangen haben ihre Brut, nur ich bin so unglücklich auf dieser Welt, dass ich kinderlos bleiben muss“, worauf die Schlange erwiderte: „Da ihr keine Kinder habt, so nehmt doch mich an Kindes statt an, denn es wird euch nicht gereuen, und ich werde euch mehr lieben als ein Kind."
Sabatella, da sie eine Schlange reden hörte, glaubte anfangs außer sich zu geraten vor Schrecken, fasste jedoch Mut und antwortete: „Wenn auch aus keinem anderen Grund, so will ich dich doch deiner Freundlichkeit halber so lieben, als wärst du mein eigenes Kind." Damit wies sie dem Schlänglein ein Loch im Hause zur Lagerstätte an, gab ihm von allem, was sie hatte, mit der größten Liebe zu essen, und da es von Tag zu Tag wuchs und groß wurde, sagte es endlich zu Cola-Mattheo, den es als seinen Vater betrachtete: „Lieber Papa, ich will mich verheiraten."
„Ich bin zufrieden“, sprach Mattheo, „wir wollen eine andere Schlange aufsuchen, wie du bist, und dieses Bündnis so dann schließen." „Wozu das“, erwiderte das Schlänglein, „dann werden wir eins sein mit den Vipern und jedem anderen Gezücht dieser Art. Wer sich aber mengt unter die Kleie, den fressen die Säue; ich will vielmehr die Tochter des Königs, und daher gehe stehenden Fußes, halte bei dem Könige um die selbe an, und sage ihm, dass eine Schlange sie zur Frau haben will."
Cola Mattheo, der ein einfältiger Mensch war, ging ohne Weiteres zum König, richtete seinen Auftrag aus und sagte: „Boten sind straflos; wisse also, dass eine Schlange deine Tochter zur Frau will, daher komme ich als ein Gärtner, der ich bin, um zu zusehen, ob ich wohl eine Schlange mit einem Täubchen kopulieren könnte." Der König, der ihm an der Nase ansah, dass er ein Tölpel war, sagte, um sich ihn vom Leibe zu schaffen: „Gehe' nach Hause, und sage dieser Schlange, dass wenn sie die Früchte dieses Gartens in Gold verwandeln kann, ich ihr meine Tochter geben werde“, und in dem er in ein gewaltiges Lachen ausbrach, verabschiedete er den Bauer.
Als Cola-Mattheo diese Antwort der Schlange zurück brachte, sagte sie: „Gehe morgen früh, sammle alle Fruchtkörner, die du in der Stadt findest, und säe sie in den königlichen Garten, dann wirst du dein Wunder sehen." Cola-Mattheo, der ein großer Gimpel war, sagte nichts und antwortete nichts, sondern so bald die Sonne mit ihrem goldenen Besen das Kehricht der Schatten zusammenfegte, nahm er einen Korb an den Arm, und ging von Straße zu Straße, alle Körner zusammen lesend, die er von Pfirsichen, Granaten, Aprikosen, Kirschen und allen anderen Früchten etwa fand; ging darauf in den königlichen Garten und säte sie aus, wie ihm die Schlange befohlen, worauf er als bald gewahr wurde, wie die Stämme der Bäume, die Blätter, die Blüten und die Früchte sich in glänzendes Gold verwandelten, über welches Wunder der König, als er es erblickte, ganz außer sich geriet und nicht wusste, was er davon denken sollte.
Als nun Cola-Mattheo von der Schlange zum König geschickt wurde, um ihn zur Erfüllung seines Versprechens anzuhalten, sagte dieser: „Nur nicht zu hitzig! denn wenn die Schlange meine Tochter will, so bedarf es noch anderer Dinge, und zwar muss sie die Mauern und den Boden meines Gartens in Edelsteine verwandeln." Als diese neue Forderung der Schlange hinterbracht wurde, entgegnete sie: „Geh morgen früh, sammle alle Scherben, welche du auf der Erde findest, wirf sie in die Gänge und auf die Mauern des Gartens, dann wollen wir den König schon fassen."
Und Cola-Mattheo, sobald die Nacht verschwunden, nimmt einen großen Korb unter den Arm, und fängt an alle Scherben von Töpfen, Tiegeln und Stürzen, Näpfen, Krügen, Lampen und allen Plunder der Art auf den Straßen zusammen zu lesen. Und sobald er damit getan, wie die Schlange ihm gesagt, sieht man den Garten bedeckt mit Smaragden, Chalcedonen, Rubinen und Karfunkeln, so dass der Glanz davon die Augen blendete, und das Herz mit Staunen erfüllte; bei welchem Schauspiel der König wie versteinert war und gar nicht wusste, wie ihm geschah. Da ihn aber die Schlange von Neuem an sein Versprechen erinnern ließ, antwortete er: „Was bis jetzt geschehen, ist alles nichts; viel mehr muss dieser Palast ganz mit Gold angefüllt werden."
Als nun Cola-Mattheo diese neue Ausflucht des Königs der Schlange hinterbrachte, sagte die selbe: „Gehe hin, nimm ein Bündel grüner Kräuter und bestreiche damit den Fußboden des Palastes, dann werden wir sehen, was weiter geschieht." Sogleich machte sich Mattheo ein großes Bund von Heidelbeeren, Portulak, Raute, Kerbel, bestrich damit den Boden des Palastes und sah ihn alsbald von Gold leuchten bis oben hinauf, so dass die Armut hundert Häuser weit sich hätte zurück ziehen müssen.
Da nun wiederum der Bauer im Namen der Schlange zu dem König zurück kehrte, um die Tochter von ihm zu fordern, und dieser sich nun wohl gezwungen sah endlich sein Wort zu halten, ruft er die Tochter und sagt: „Liebe Grannonia, um mich über Jemand der dich zur Frau haben wollte, lustig zu machen, habe ich Dinge von ihm gefordert, die mir unmöglich schienen; da ich aber gleichwohl mich nun gezwungen sehe, mein Versprechen zu erfüllen — ich weiß selbst nicht wie — so bitte ich dich, wenn du meine liebe Tochter bist, dass du mein Wort nicht zu Schanden werden lässt, sondern dich in das was der Himmel will, und ich zu tun gezwungen bin, sögest." „Tue was du willst, mein Herr und Vater“, antwortete Grannonia, „denn ich werde nicht ein Haar breit von deinem Willen abweichen."
Als der König dies vernahm, sagte er zu Cola-Mattheo, er solle die Schlange herbei bringen; welche denn auch auf einem Wagen, ganz von Gold, von vier goldenen Elefanten gezogen, sich an den Hof begab. Wo sie aber unterwegs durchzog, ergriffen die Leute, ganz entsetzt, die Flucht, da sie eine so große schreckliche Schlange herbei kommen sahen. Als nun die Schlange in dem Palast anlangte, zitterten und bebten alle Hofleute, selbst die Küchenjungen waren davon gelaufen, und der König und die Königin versteckten sich in ein entlegenes Gemach. Nur Grannonia behielt ihren guten Mut, und obgleich der König und die Königin riefen: „Fliehe, fliehe, Grannonia!“, rührte sie sich dennoch nicht vom Fleck, in dem sie sagte: „Ich will nicht vor dem Gemahl fliehen, den ihr mir gegeben habt."
Sobald nun die Schlange in das Zimmer getreten war, fasste sie mit dem Schwanz Grannonia um den Leib, küsste sie, trug sie so dann in ein anderes Zimmer, verschloss die Türe, und, die Haut abstreifend, verwandelte sie sich in einen sehr schönen Jüngling mit goldenen Locken und hell glänzenden Augen, der Grannonia auf das Zärtlichste umarmte, und ihr auf alle nur erdenkliche Art und Weise schmeichelte. Der König, da er die Schlange mit der Tochter sich in ein Zimmer einschließen sah, sagte zu seiner Frau: „Der Himmel sei unserer armen Tochter gnädig, denn mit der ist es ohne Zweifel vorbei! Diese verdammte Schlange hat sie gewiss verschluckt wie ein Eidotter." Worauf sie die Augen ans Schlüsselloch legten, um zu sehen, was geschehen war.
Als sie jedoch die ungewöhnliche Anmut und Schönheit jenes Jünglings und die Schlangenhaut, die er auf die Erde geworfen, erblickten, sprengten sie die Türe, drangen hinein, ergriffen die Haut und warfen sie ins Feuer, dass sie augenblicklich verbrannte, worauf der Jüngling ausrief: „Ach ihr Verwünschten, was habt ihr mir da getan!“, und sich in eine Taube verwandelnd, stieß er heftig an die Fensterscheibe, dass sie zerbrach, und entflog, wie wohl sehr übel zugerichtet.
Grannonia aber, die sich in einem und dem selben Augenblick froh und traurig, glücklich und unglücklich, reich und bettelarm sah, klagte bitterlich über diese Beraubung ihrer Freude, diese Vergiftung ihrer Süßigkeit, über eine so schlimme Wendung ihres Geschickes, die sie allein den Eltern Schuld gab, obwohl diese beteuerten, sie hätten es gar nicht böse gemeint. Jene aber jammerte in einem fort, bis die Nacht herab stieg, und sobald sämtliche Bewohner des Schlosses zu Bette waren, nahm sie alle ihre Edelsteine, und ging durch eine Hintertüre fort, in der Absicht, so lange zu suchen, bis sie das verlorene Glück wieder fände. In dem sie nun die Stadt verließ, geleitet vom Mondenschein, traf sie auf einen Fuchs welcher sich ihr zum Begleiter anbot, worauf Grannonia erwiderte: „Ihr seid mir herzlich willkommen, Gevatter, denn ich kenne die Gegend nicht zu genau."
Sie zogen nun mit einander weiter, und kamen in einen Wald, dessen volle hohe Wipfel sich zu anmutigen Laubzelten verschränkten. Da sie nun vom Gehen müde waren, und sich ausruhen wollten, begaben sie sich unter das dichte Laubdach, wo eine Quelle mit dem frischen Grase spielte, indem sie es mit ihrem klaren Wasser bespritzte.
Sie legten sich auf den grünen Rasenteppich nieder, zahlten der Natur für die Ware des Lebens die schuldige Steuer an Ruhe, und erwachten nicht eher, als bis die Sonne mit ihrem gewöhnlichen Feuer den Schiffern und Booten anzeigte, dass sie ihren Weg fort setzen könnten, und nach dem sie aufgestanden waren blieben sie noch eine Zeit lang stehen, um den Gesang der kleinen Vöglein mit anzuhören, da Grannonia große Freude daran fand, dem Zwitschern der selben zu lauschen.
Als der Fuchs dies bemerkte, sagte er zu ihr: „Verständest du das, was sie sagen, so wie ich, so wäre deine Freude noch viel größer."
Gereizt durch diese Worte, weil den Frauen ebenso die Neugierde, wie die Schwatzhaftigkeit von Natur angeboren ist, bat Grannonia den Fuchs, ihr doch zu sagen, was er von den Vögeln vernommen habe. Dieser ließ sich zwar anfangs eine Zeit lang bitten, um desto mehr Neugier für das, was er erzählen wollte, zu erwecken, doch sagte er endlich, dass jene Vöglein von einem Unglück sprächen, welches dem Sohn des Königs widerfahren, der, schön wie ein Gott, der zügellosen Lust einer verdammten Zauberin nicht hätte Genüge leisten wollen, und durch eine Verwünschung der selben auf sieben Jahre in eine Schlange verwandelt worden sei. Schon dem Ende dieser Zeit nahe, habe er sich in eine Königstochter verliebt, und da er sich mit dieser in einem Zimmer befunden, und seine Schlangenhaut abgestreift habe, seien die Eltern des Mädchens aus Neugier hinein gedrungen, und hätten die Haut verbrannt, worauf der Prinz in der Gestalt einer Taube davon fliegend beim Durchbrechen einer Fensterscheibe sich so übel zugerichtet habe, dass ihn die Ärzte aufgaben.
Grannonia, da sie von ihrem Cola reden hörte, fragte sogleich, wessen Sohn dieser Prinz sei, und ob Hoffnung zu seiner Heilung vorhanden wäre; worauf der Fuchs entgegnete, jene Vögel hätten gesagt, er sei der Sohn des Königs von Vallone-Grosso, und dass kein anderes Mittel vorhanden sei die Löcher in seinem Kopfe zu verstopfen, damit die Seele ihm durch diese nicht entflöhe: als ihm die Wunden mit dem Blute der nämlichen Vögel zu bestreichen, welche dies vorhin erzählt hätten.
Bei diesen Worten kniete Grannonia vor dem Fuchse nieder, und bat ihn inständigst, ihr doch die Liebe zu erweisen, jene Vögel zu fangen, um ihnen das Blut abzulassen; sie wollten als treue Freunde den Gewinn als dann auch mit einander teilen. „Nur langsam“, sagte der Fuchs, „wir wollen die Nacht abwarten; wenn dann die Vögel zur Ruhe gehen, so laß mich nur machen, ich steige hinauf und erwische sie einen nach dem anderen.
So brachten sie denn den Tag über zu, in dem sie bald von der Schönheit des Jünglings redeten, bald von dem Vater der Jungfrau, bald von dem Unglück das ihr zugestoßen, bis die Nacht endlich einbrach. Als der Fuchs nun die Vögel auf den Zweigen in Ruhe sah, stieg er ganz leise und vorsichtig hinauf, und erhaschte alle Finken, Stieglitze, Fliegenschnepper, und alle, die sich nur auf den Bäumen befanden, tötete sie, und fing das Blut in einer kleinen Flasche auf, die er bei sich trug, um sich unterwegs daraus zu erquicken.
Vor lauter Freude hing Grannonia der Himmel voller Geigen; der Fuchs aber sagte: «Liebe Tochter, deine Fröhlichkeit ist umsonst, denn du hast gar nichts getan, wenn du nicht zugleich, außer dem Blut der Vögel, auch das meinige besitzest"; und mit diesen Worten ergriff er die Flucht. Grannonia, welche ihre Hoffnung vernichtet sah, nahm zur gewöhnlichen Kunst der Frauen, der List und der Schmeichelei, ihre Zuflucht, in dem sie zu ihm sagte: „Gevatter Fuchs, du hättest Recht, dir dein Fell zu hüten, wenn ich dir nicht so sehr verpflichtet wäre, und es nicht andere Füchse noch in der Welt gäbe. Da du jedoch weißt, wie viel ich dir verdanke, und dass es an deines Gleichen auf diesen Feldern nicht fehlt, so kannst du dich getrost auf mich verlassen, und darum handle nicht wie die Kuh, welche den Eimer mit dem Fuß stößt, nachdem sie ihn mit Milch angefüllt; bleibe stehen, verlasse dich auf mich und begleite mich in die Stadt dieses Königs, damit er mich von dir als Magd kauft."
Der Fuchs, dem es nie in den Sinn gekommen war, dass selbst ein Fuchs hintergangen werden könnte, sah sich von einem Weibe hinter das Licht geführt; denn kaum hatte er eingewilligt mit Grannonia zu gehen, und hatte noch keine fünfzig Schritte mit ihr gemacht, als sie ihm mit dem Stock den sie trug, einen solchen Hieb auf den Kopf versetzte, dass er die Beine von sich streckte, worauf sie ihn vollends totschlug, das Blut ihm abließ, und in das Fläschchen goss.
Sodann fing sie an tüchtig drauf los zu laufen, bis sie Ballone-Grosso erreichte. Dort begab sie sich gerades Weges in den königlichen Palast und ließ den König wissen, sie sei gekommen, den Prinzen gesund zu machen.
Der König ließ sie als bald vor sich kommen, verwundert, dass ein Mädchen ihm dasjenige verheiße, was doch die geschicktesten Ärzte seines Reiches nicht im Stande gewesen waren. Weil in des ein Versuch nichts schadet, gestattete er ihr gern den selben anzustellen. Grannonia aber erwiderte ihm: „Wenn ich zu Stande bringe was ihr wünscht, so müsst ihr versprechen mir euren Sohn zum Gemahl zu geben." Der König, welcher seinen Sohn schon aufgegeben hatte, versetzte hierauf: „Mache ihn nur wieder frisch und munter, so sollst du ihn haben, wie er leibt und lebt. Denn es will nicht viel sagen einen Mann derjenigen zu geben, die mir einen Sohn gibt."
Und so gingen sie denn in das Zimmer des Prinzen. Nicht sobald hatte Grannonia den Prinzen mit seinem Blute bestrichen, als er sich aller Krankheit los und ledig fühlte. Da nun Grannonia ihn munter und gesund erblickte, sagte sie zu dem König, er solle jetzt sein Wort halten, worauf sich dieser zu seinem Sohn wandte und sprach: „Mein lieber Sohn, schon hielt ich dich für tot und sehe dich wieder lebendig, da ich es am wenigsten vermutete; da ich nun dieser Jungfrau versprochen habe, im Fall sie dich wieder gesund mache, dich ihr zum Ehegemahl zu geben, und der Himmel mir gnädig gewesen ist, so mache dass ich mein Versprechen erfülle, wenn du mich irgend lieb hast, denn die Pflicht der Dankbarkeit zwingt mich, diese Schuld zu bezahlen."
Bei diesen Worten erwiderte der Prinz: „Mein Herr und Vater, ich wollte, dass mein Wille so frei wäre, als meine Liebe zu euch groß ist. Da ich aber bereits mein Wort einem andern Weibe gegeben, so werdet ihr selbst nicht einwilligen dass ich mein Versprechen breche, und diese Jungfrau selbst wird mir nicht raten, dass ich eine so große Unbill derjenigen zufüge, die ich liebe, und dabei muss ich beharren."
Als Grannonia diese Worte hörte, und die Erinnerung an sich in dem Gedächtnis des Prinzen noch so lebendig sah, empfand sie eine unsägliche Freude, und sagte, wie mit Scharlach übergossen: „Wenn ich nun machte, dass die von euch geliebte Jungfrau mir ihre Rechte abträte, würdet ihr euch noch meinem Wunsche entziehen?" „Fern sei es von mir“, erwiderte der Prinz, „dass ich das schöne Bild meiner Liebe je aus meiner Brust verscheuche. Was auch immer ihr Verfahren sei, immer wird mein Wille und mein Sinn der selbe bleiben, und wenn ich selbst in Gefahr wäre, meinen Platz am Tische des Lebens zu verlieren, so würde ich doch nie in diesen Tausch willigen."
Grannonia, welche sich nicht länger zu verstellen vermochte, gab sich hierauf zu erkennen, denn das um der Krankheit des Prinzen willen ganz verhangene Gemach, so wie ihre Verkleidung, hatten sie durchaus unkenntlich gemacht. Sobald der Prinz sie erkannte, umarmte er sie mit unbeschreiblichem Jubel, und erzählte so dann seinem Vater, wer sie sei, und was er um ihretwillen getan und gelitten habe.
Hierauf ließen sie den König und die Königin von Starza-Longa zu sich einladen, und begingen nun das Hochzeitsfest mit großer Fröhlichkeit, so dass sich aufs Neue bewies, dass für die Freuden der Liebe, der Schmerz immer die größte Würze ist.

DIE SIEBEN SPECKSCHWARTEN ...

Es war einmal eine alte Bettlerin, welche mit der Kunkel in der Hand von Tür zu Tür ging und Almosen bettelte und weil man „durch List und Betrug ein halbes Jahr lebt“, so machte sie einigen mitleidigen und leichtgläubigen Frauen weiß, dass sie für eine magere Tochter ich weiß nicht was für eine fette Suppe machen wolle und erbettelte sich von ihnen sieben Speckschwarten. Diese trug sie nach Hause, gab sie mit einer Schürze voll Holzspäne, die sie unterwegs von der Erde aufklaubte, ihrer Tochter und befahl ihr die selben zu kochen, während sie selbst wieder ausging, von einigen Gemüsehändlerinnen etwas Grünzeug zu erbetteln, um aus Allem eine schmackhafte Suppe zu bereiten.
Die Tochter nahm die Schwarten, sengte die Haare ab, steckte sie in einen Topf und setzte sie ans Feuer. Doch sie wollten nicht sowohl in den Topf, als ihr in den Hals. Denn der emporsteigende Geruch reizte ihren Appetit so heftig, dass sie nach langem Widerstreben endlich, von dem Duft des Topfes angetrieben, von natürlicher Begierde und heftigem Hunger überwältigt, anfing ein wenig zu kosten, was ihr so gut schmeckte, dass sie bei sich sagte: „Wer die Gelegenheit hat, muss sie benutzen; ich bin einmal dabei, ich will darauf los essen, mag da werden was wolle; es ist ja nicht mehr als eine Schwarte!"
Und mit diesen Worten aß sie fürs erste die eine und nach dem sie auf den Geschmack gekommen, fasste sie die zweite, biss dann die dritte an, und so nach und nach aß sie alle sieben auf. Nachdem sie jedoch ihrer Mutter diesen schlimmen Streich gespielt hatte und nun. darüber nachdachte, was für Unheil daraus für sie selbst entstehen könne, wollte sie der Mutter ein X für ein U machen, nahm einen alten Schuh, schnitt die Sohle in sieben Stücke und steckte sie in den Topf.
Inzwischen kam die Mutter mit einem Bündel Kohl zurück, zerschnitt ihn, so wie er war, ohne irgend etwas davon weg zu werfen, und als sie das Wasser im Topf in vollem Sieden sah, warf sie die Blätter hinein nebst ein wenig Fett, das ihr ein Kutscher als Almosen gegeben hatte, tat dazu noch einige alte Brotkrusten und schüttete das Ganze auf einen hölzernen Teller. So dann fing sie mit großem Appetit an zu essen.
Sehr bald jedoch nahm sie wahr, dass ihre Zähne nicht die Fähigkeit einer spitzigen Schuhmacherahle besäßen, und dass die Schweineschwarten durch einen ganz besonderen Zufall sich in das zähste Büffelfell verwandelt hätten.
Sie wendete sich hierauf zu ihrer Tochter und sagte: „Ich sehe wohl, du hast mir einen bösen Streich gespielt, du verwünschtes Mädchen: was hast du denn hier in die Suppe hineingesteckt? Glaubst du denn, mein Bauch ist ein alter Schuh, dass du ihn mit solchen Lederflicken ausbessern willst? So gleich gestehe mir, was du getan hast, oder vielmehr, es ist gar keine Entschuldigung, und du verdienst, dass ich dir keinen Knochen im Leibe ganz lasse."
Saporita, dies war der Name der Tochter, leugnete zwar anfänglich, sah sich aber dennoch endlich zum Geständnis genötigt und gab die Schuld dem Dunste des Topfes, der ihr in die Nase gestiegen sei und sie diesen schlimmen Streich hätte begehen lassen. Die alte Frau, die ihr Essen so übel zugerichtet sah, packte darauf einen Besen und fing an ihre Tochter dergestalt zu bearbeiten, dass sie siebenmal aufhörte und eben so oft wieder von Neuem anfing.
Bei dem Geschrei des Mädchens trat ein Kaufmann, der zufällig vorüber ging, ins Haus und als er die üble Behandlung sah, welche jenes erduldete, nahm er der alten Frau den Besen aus der Hand und sagte zu ihr: „Was hat dir denn das arme Mädchen getan, dass du sie tot schlagen willst? Heißt das züchtigen und nicht vielmehr umbringen? Schämst du dich nicht, dass du auf diese Weise ein junges Mädchen behandelst?"
„Du weißt nicht“, antwortete die Frau, „was für einen Streich sie mir gespielt hat, das unverschämte Ding! Seht nur, wie arm ich bin, und dennoch will sie mich durch Arzt und Apotheker noch zu Grunde richten! Denn obgleich ich ihr befohlen habe, jetzt bei der großen Hitze nicht so viel zu arbeiten, um nicht krank zu werden, weil ich kein Geld habe, sie kurieren zu lassen: so hat mir doch das ungehorsame Ding recht zum Trotz heute früh sieben Spindeln voll gesponnen, auf die Gefahr hin, vor Schwäche nieder zu fallen und ein paar Monate lang krank und mir zur Last da zu liegen."
Als der Kaufmann dies hörte, bedachte er, welch ein großes Glück die Arbeitsamkeit dieses Mädchens für sein Haus sein könnte, und sagte zu der alten Frau: „Lass ab von deinem Zorn, denn ich will dich von dieser Gefahr befreien, deine Tochter heiraten und sie in mein Haus führen, wo sie wie eine Fürstin leben soll. Denn durch Gottes Gnade habe ich ein paar Hühner in meinem Hause, mäste mir mein Schwein, habe meine eigenen Tauben — mit einem Wort, ich kann, mich nicht in meinem Hause umdrehen, so voll ist es. Möge der Himmel mich segnen und ein böser Blick mir nichts an tun, denn meine Scheuern sind voll Getreide, meine Kisten voll Mehl, die Krüge voll Öl, die Töpfe voll Schmalz, die Haken voll Speckseiten, die Böden voll Holz. Ich habe herrliche Betten und die köstlichste Wäsche, genug, es geht mir an nichts ab."
Die alte Frau, da sie ein so unverhofftes Glück mit einmal vor sich sah, fasste Saporita an der Hand und übergab sie dem Kaufmanne nach alt neapolitanischer herkömmlicher Sitte, in dem sie zu ihm sagte: „Hier hast du sie; sie sei dein auf tausend Jahre mit Gesundheit und Wohlergehen!" Der Kaufmann umarmte seine Braut, führte sie hierauf nach Hause und konnte vor Ungeduld die Stunde gar nicht erwarten, wo er anfangen könnte sie zu beschäftigen.
Mit Anbruch der Woche nun stand er sehr zeitig auf, ging auf den Markt, kaufte zwanzig Bund Flachs, brachte sie der Saporita und sagte zu ihr: „Jetzt spinne nur immer, so viel du willst; du brauchst dich jetzt nicht mehr zu fürchten, dass eine Närrin, wie deine Mutter, dir die Knochen entzwei breche, weil du zu viel arbeitest, denn für jede zehn Spindeln werde ich dir zehn Küsse geben; arbeite also immer darauf los und wenn ich in drei Wochen von der Messe nach Hause komme, so lass mich diese zwanzig Bund Flachs gesponnen finden und du sollst auch dafür einen schönen Rock aus rotem Tuch, mit grünem Sammet besetzt, erhalten."
„Ja, geh nur immer“, murmelte Saporita ganz leise für sich, „du sollst dich wundern! Denkst du denn, ich kann hexen, dass ich in drei Wochen zwanzig Bund Flachs spinnen soll? Geh nur hin, denn es hat lange Zeit und du wirst diesen Flachs dann gesponnen finden, wenn die Leber Haare hat."
In dessen reiste der Mann ab, und sie, die eben so leckerhaft als faul war, tat weiter nichts, als Kuchen backen und aß vom frühen Morgen bis spät in die Nacht ohne Unterlass. Als aber die Zeit heran nahte, dass ihr Mann zurück kehren sollte, fing sie an zu sich zu kommen und zu überlegen, was es für Lärm und Geschrei geben würde, wenn der Kaufmann den Flachs unberührt, die Mehlkisten und Öltöpfe dagegen leer fände.
Sie nahm daher eine lange Stange, wickelte um die selbe zehn Bund Flachs mitsamt dem Werg, richtete diese Großmutter aller Spindeln in dem Hofe auf, so dass sie bis über das Dach reichte, ging dann auf das selbe hinauf, in dem sie eine große Schüssel mit Makkaronibrühe als Wassernäpfchen bei sich hatte und spann Faden so dünn und so fein wie zu Schiffstauen, und jedes Mal, wenn sie die Finger nass machte, spielte sie mit den Vorübergehenden Karneval, in dem sie ihnen Makkaroni zuwarf.
Es kamen nun gerade einige Zauberer vorüber, denen das, was sie da sahen, so viel Spaß machte, dass sie fast vor Lachen hätten bersten mögen, und sie wünschten ihr daher, dass aller Flachs, den sie im Hause habe, sich auf der Stelle nicht nur in Gespinst, sondern in Leinwand und zwar in gebleichte verwandeln möge, was auch als bald in Erfüllung ging, so dass Saporita in einem Meer von Freude schwamm, als sie dies Glück sich wie vom Himmel herab geregnet sah.
Damit ihr jedoch ihr Mann nicht wiederum etwas der Art zumuten solle, so legte sie sich zu Bette und schüttete ein Maß Nüsse neben sich hin.
Als nun der Kaufmann nach Hanse kam, fing sie an zu wimmern und sich nach allen Seiten hin zu werfen, knackte dabei die Nüsse, dass es schien, als krachten ihr alle Knochen im Leibe, und als der Mann sie fragte, wie sie sich befände, antwortete sie mit ganz schwacher Stimme: „Ich kann mich, lieber Mann, gar nicht schlechter befinden, als eben jetzt; denn scheint es dir etwa eine Kleinigkeit, in drei Wochen zwanzig Gebund Flachs zu spinnen und oben ein noch Leinwand daraus zu machen? Geh nur, geh, denn du hast mir zuviel aufgebürdet, du sollst mich nimmer wieder mit so schwerer Arbeit belasten, denn ich will nicht, um dir deine Spindel voll zu machen, meine Lebensspindel abspinnen."
Der Mann suchte sie zu besänftigen und sagte zu ihr: „Werde du nur gesund, liebe Frau, jetzt sehe ich ein, wie recht deine Mutter hatte, dich zu züchtigen, dass du so viel arbeitetest und darüber deine Gesundheit verlorst. Sei nur gutes Mutes, und sollte es mich selbst ein Auge kosten, gern gab ich es hin, dich wieder gesund zu machen." Und sogleich lief er, um den Meister Catruppolo zu holen.
Unterdessen aß Saporita die Nüsse auf und warf die Schalen zum Fenster hinaus. Als nun der Arzt kam, ihr an den Puls fühlte und das Gesicht betrachtete, so folgerte er mit Hippokrates und Galenus, dass ihr Übel von zu vielem Blut und zu weniger Arbeit her käme. Der Kaufmann, der da eine große Albernheit zu hören glaubte, jagte ihn mit Schimpf und Schande zum Hause hinaus und wollte so gleich nach einem anderen Doktor gehen: Saporita jedoch hielt ihn zurück und sagte, es sei nicht mehr Notwendig, denn der bloße Anblick des ersten hätte sie schon gesund gemacht.
Ihr Mann umarmte sie hierauf herzlichst und sprach zu ihr, von Stund an solle sie nicht mehr arbeiten, sondern sich auf das Beste pflegen, denn was helfe es, Geld erwerben und den Leib verderben.

DIE SIEBEN TAUBEN ...

Es war einmal in der Gegend von Arzano eine wackere Frau, die jedes Jahr einen Sohn zutage förderte, so daß deren Zahl bereits bis auf sieben gestiegen war und sie der Syrinxpfeife des Gottes Pan glichen, von deren sieben Röhren eine immer kleiner ist als die andere. Nachdem sie nun die Kinderschuhe ausgetreten hatten, sprachen sie zu ihrer Mutter Janetella, als sie sich wieder einmal in guter Hoffnung befand: »Gib wohl acht, liebe Mutter, was wir dir sagen; wenn du nach so vielen Söhnen jetzt nicht endlich einmal eine Tochter zur Welt bringst, so sind wir entschlossen, uns aufzumachen und wie verloren und verlassen in die weite Welt zu gehen.«
Sobald die Mutter diese unselige Rede vernahm, so bat sie den Himmel, ihre Söhne doch von diesem Entschluß abzubringen und sie vor dem Verlust solcher sieben Juwelen, wie ihre Kinder waren, zu schützen. Als nun die Mutter der Stunde ihrer Entbindung nahe war, sprachen ihre Söhne zu ihr: »Wir, liebe Mutter, werden uns inzwischen auf jene Halde oder Anhöhe, die hier gegenüber liegt, begeben, und wenn du einen Knaben gebierst, so stelle ein Tintenfaß nebst Feder ans Fenster, wenn aber ein Mädchen, so stelle einen Löffel und einen Rocken hin; denn wenn wir das letztere Zeichen sehen, so kehren wir zurück und verbringen den Rest des Lebens unter deinen Flügeln, im umgekehrten Falle aber magst du uns nur immer vergessen; denn dann ist unseres Bleibens nicht länger.«
Kaum hatten aber die Söhne das Haus verlassen, so fügte es der Himmel, daß Janetella ein hübsches Töchterlein gebar, so daß sie alsbald zu der Wehmutter sagte, daß sie den Söhnen das verabredete Zeichen geben sollte; diese jedoch war so verblüfft und verdutzt, daß sie das Tintenfaß und die Feder ans Fenster stellte. Beim Anblick dieses Zeichens nahmen die Brüder die Beine über den Buckel und gingen so lange, bis sie nach einem dreijährigen Umherziehen in einen Wald kamen, wo die Bäume zur Musik eines Flusses, der sich der Steine als Instrumente bediente, einen Blütenreigen aufführten.
In diesem Walde aber befand sich die Behausung eines wilden Mannes, dem seine Frau im Schlafe die Augen ausgestochen hatte und der daher ein solcher Feind der Weiber geworden war, daß er alle auffraß, die er bekommen konnte. Als nun die sieben Jünglinge ermattet von der Reise und fast tot vor Hunger an dem Hause des wilden Mannes anlangten, baten sie ihn, daß er ihnen doch aus Barmherzigkeit einen Bissen Brot geben möchte, worauf jener versetzte, daß er ihnen allen Lebensunterhalt geben würde, wenn sie Ihm dienen wollten, und zwar würden sie nichts weiter zu tun haben, als daß ihn jeder der Reihe nach einen Tag lang wie ein Hund bewachen sollte.
Dieses Anerbieten kam den Jünglingen wie gerufen, sie nahmen es daher sogleich an und traten in den Dienst des wilden Mannes, der sich ihre Namen merkte und bald Giangrazio rief, bald Cecchitiello, bald Pascale, bald Nuccio, bald Pone, bald Pezzillo und bald Carcavecchia; denn so hießen die Brüder, denen er eine Stube in seinem Hause anwies und ihnen so viel gab, daß sie davon leben konnten.
![]()
Inzwischen war die Schwester herangewachsen, und als sie vernahm, daß ihre sieben Brüder durch ein Versehen ihrer Mutter in die weite Welt gegangen waren und nie wieder etwas von sich hatten hören lassen, setzte sie es sich in den Kopf, sie aufzusuchen, und so sehr lag sie der Mutter in den Ohren, bis diese, betäubt von den immerwährenden Bitten, ihr eine Pilgertracht gab und sie ziehen ließ. Die Tochter nun ging, ohne sich irgendwo aufzuhalten, immer weiter, wobei sie alle Augenblicke fragte, wer sieben Brüder gesehen hätte, und so lange wanderte sie umher, bis sie endlich in einem Wirtshause erfuhr, wo sie sich befanden. Sobald sie sich nun den Weg nach jenem Walde hatte sagen lassen, zog sie wieder fort und langte eines Morgens, als die Sonne mit dem Federmesser der Strahlen die von der Nacht auf das Papier des Himmels gemachten Kleckse auskratzte, an dem Hause des wilden Mannes an, wo ihre Brüder sie mit vieler Freude erkannten und jenes Schreibzeug verwünschten, das für sie verräterischerweise so viele Leiden aufgeschrieben hatte.
Nachdem sie aber ihrer Schwester tausendfache Liebkosungen erwiesen, rieten sie ihr, sich ganz stille in ihrer Stube zu halten, damit der wilde Mann sie nicht sehe, und außerdem, daß sie von allem, was sie äße, der Katze, die sich in der Stube befand, ein Stück abgeben sollte, denn sonst würde sie ihr irgend etwas Böses antun. Cianna (dies war der Name der Schwester) schrieb diese Ratschläge in das Buch ihres Herzens und teilte immer redlich mit der Katze, indem sie alles ganz genau durchschnitt und mit den Worten: »Dies für mich und das für dich!« der Katze ihren gewissenhaft abgemessenen Anteil übergab.
Es trug sich jedoch eines Tages zu, daß, als die Brüder im Dienst des wilden Mannes auf die Jagd gegangen waren, sie der Schwester ein Säckchen mit Erbsen zum Kochen übergaben und diese beim Auslesen der selben unglücklicherweise darunter einen Haselnußkern fand, der der Stein des Anstoßes für ihre Ruhe wurde; denn, da sie den Kern aufaß, ohne der Katze die Hälfte davon zu geben, sprang diese voll Verdruß darüber auf den Herd und pißte so lange auf das Feuer, bis es ausging.
Indem nun Cianna dies sah und nicht wußte, was sie anfangen sollte, verließ sie gegen den Rat ihrer Brüder die Stube, trat in das Zimmer des wilden Mannes und bat ihn um etwas Feuer, worauf dieser, eine Weiberstimme hörend, alsbald sagte: »Guten Tag, Nachbarin, wartet ein wenig, ihr habt gefunden, was ihr sucht.« Und so sprechend, ergriff er einen Schleifstein, bestrich ihn mit Öl und fing an, seine Hauer zu wetzen. Cianna aber, welche sah, wie übel sie angekommen war, ergriff einen Brand, lief in ihre Stube zurück und verriegelte hinter sich die Tür, indem sie außerdem Querstangen, Stühle, Bettstellen, Kasten, Steine und was nur irgend noch sonst sich in ihrer Stube befand, vorschob. Sobald der wilde Mann sich die Zähne gewetzt hatte, lief er nach der Stube der Brüder, und da er sie verschlossen fand, so fing er an, mit den Füßen dagegen zu stoßen, um sie einzurennen.
Inzwischen kamen die Brüder nach Hause, und indem sie dieses Getümmel vernahmen und hörten, daß der wilde Mann sie Verräter nannte, weil sie ihre Stube zum Aufenthaltsort seiner Feindinnen gemacht, begann Giangrazio, der älteste und verständigste von allen, als er sah, wie schlecht die Sachen standen, also zu sprechen: »Wir wissen nichts von all dem, was hier vorgeht, und es ist leicht möglich, daß das verwünschte Frauenzimmer, während wir uns auf der Jagd befanden, in unsere Stube gekommen ist. Da sie sich aber inwendig verschanzt hat, so komm mit uns; denn wir wollen dich so führen, daß du sie erwischen wirst, ohne daß sie sich verteidigen kann.«
Hierauf führten sie ihn an einen tiefen, tiefen Graben, gaben ihm dann einen Stoß und stürzten ihn hinunter; alsdann ergriffen sie eine Schaufel, die sie auf der Erde fanden, und bedeckten ihn ganz mit Erde. Nachdem sie nun ihre Schwester hatten die Tür öffnen heißen, wuschen sie ihr tüchtig den Kopf dafür, daß sie wider ihren Rat gehandelt und sich einer solchen Gefahr ausgesetzt hatte; in Zukunft aber solle sie vorsichtiger sein und sich wohl hüten, in der Nähe des Ortes, wo der wilde Mann begraben läge, Gras abzupflücken; denn sonst würden sie sich in sieben Tauben verwandeln.
»Behüt' der Himmel, daß ich euch dies antun sollte«, erwiderte Cianna, worauf sie sich in Besitz des Hauses und aller Sachen des wilden Mannes setzten und anfingen, lustig zu leben, indem sie abwarten wollten, bis der Winter vorüber ginge, um sich dann, wenn die Sonne der Erde als Freudengeschenk bei der Besitznahme des Hauses »zum Stier« ein grünes, mit Blumen gesticktes Gewand verleiht, das heißt, wenn die Sonne ins Zeichen des Stieres tritt, auf den Weg zu machen und in ihre Heimat zurückzukehren.
Es geschah nun aber eines Tages, als die Brüder in den Wald gegangen waren, um Holz zu holen und sich damit gegen die Kälte zu schützen, die von Tag zu Tag zunahm, daß ein armer Wanderer bei dem Hause anlangte, der einer Meerkatze, die auf einer Pinie saß, eine neckende Gebärde gemacht und dafür von ihr eine Frucht jenes Baumes an den Kopf geworfen bekam, die ihm eine so gewaltige Beule machte, daß der arme Schelm schrie, als stecke er am Spieß.
Bei diesem Lärm trat Cianna aus dem Hause, und voll Mitleid mit ihm riß sie rasch von einem Rosmarinstrauch, der aus dem Grabe des wilden Mannes emporgewachsen war, ein paar Blätter ab, aus denen sie ihm mit gekautem Brot und Salz ein Pflaster machte, worauf sie ihm ein Frühstück gab und ihn dann entließ. Während Sie nun, die Brüder erwartend, den Tisch deckte, erschienen plötzlich sieben Tauben, die zu ihr sagten: »Wie viel Mal besser wäre es doch gewesen, man hätte dir die Hände abgehauen, du Urheberin unseres ganzen Unglücks, als daß du den verwünschten Rosmarin abpflücktest und uns in so großes Leid stürztest. Hast du denn Katzengehirn gegessen, Schwester, daß dir unser Rat so ganz und gar aus dem Gedächtnis entschwunden ist? –
Jetzt sind wir nun in Tauben verwandelt und den Klauen der Weihen, Sperber und Habichte ausgesetzt; jetzt sind wir Genossen der Bleßhühner, Schnepfen, Stieglitze, Baumhacker, Häher, Käuze, Elstern, Dohlen, Krähen, Stare, Auerhühner, Kiebitze, Strandläufer, Wasserhühner, Birkhühner, Amseln, Drosseln, Finken, Zaunkönige, Spechte, Hänflinge, Zeisige, Grasmücken, Kreuzschnäbel, Fliegenschnäpper, Haubenlerchen, Regenpfeifer, Taucher, Bachstelzen, Rotkehlchen, Gimpel, Spatzen, Kuppenenten, Krammetsvögel, Holztauben und Dompfaffen. Das war einmal ein kluger Streich; jetzt können wir immerhin in unsere Heimat zurückkehren, um uns dann mit Netzen und Leimruten fangen zu lassen!
Um einem Pilger den Kopf zu kurieren, hast du sieben Brüdern den Hals gebrochen; denn für uns ist keine Rettung, wenn du nicht die Mutter der Zeit auffindest und dir von ihr sagen läßt, was für uns zu tun sei.« Cianna stand da wie versteinert und bat endlich ihre Brüder wegen ihres Versehens um Verzeihung, indem sie versprach, solange in der Welt umher zu ziehen, bis sie die Behausung jener Alten auffände; zugleich legte sie ihren Brüdern ans Herz, sich, solange sie abwesend wäre, immer in dem Hause aufzuhalten, damit ihnen nicht ein Unglück widerführe.
![]()
Hierauf machte sie sich auf den Weg und wanderte überall umher, ohne je zu ermüden; denn obgleich sie zu Fuß ging, so diente ihr doch das Verlangen, ihren Brüdern zu helfen, als Gaul, mit dem sie die Stunde drei Meilen machte. Endlich kam sie an eine Küste, wo das Meer wie ein Schulmeister die Klippen mit seiner Wellenrute peitschte, weil sie auf die Fragen nicht antworten wollten, die es an sie richtete, und sah dort einen großen Walfisch, der zu ihr sprach: »Was suchst du, mein schönes Kind?« Worauf Cianna versetzte: »Ich suche das Haus der Mutter der Zeit.« –
»Weißt du, was du tun sollst?« erwiderte der Walfisch. »Gehe immer an diesem Ufer entlang, und an dem ersten Fluß, den du antriffst, gehe dann immer wieder stromaufwärts, dann wirst du jemand finden, der dir den übrigen Weg zeigen wird. Tu mir aber den Gefallen und bitte die Alte, wenn du sie gefunden hast, in meinem Namen, daß sie mir ein Mittel angeben möchte, wie ich sicher einher schwimmen kann, ohne sooft an Felsen zu stoßen und auf den Sand zu geraten.« –
»Laß mich nur machen«, versetzte Cianna, und sich bei dem Walfisch herzlich für den Weg bedankend, den er ihr gezeigt, fing sie an, immer an dem Ufer entlang zu ziehen, bis sie nach einer langen Reise endlich bei dem Fluß angelangt, der wie ein Fiskalkommissar große Summen Silbergeld in die Bank des Meeres ablieferte, worauf sie an ihm immer stromaufwärts ging und endlich auf einer schönen Au anlangte, die in ihrem mit Blumen gestirnten Mantel dem Himmel gleich zu sein glaubte.
Dort traf sie eine Maus, die zu ihr sagte: »Wohin so allein, schönes Kind?« worauf Cianna erwiderte: »Ich suche die Mutter der Zeit.« – »Da hast du noch sehr weit zu gehen«, versetzte die Maus, »doch verliere nur den Mut nicht; alles hat einmal ein Ende; geh nur immer auf jene Berge los, die als die Beherrscher dieser Ebene sich den Titel ›Hoheit‹ geben lassen; dort wirst du wieder Auskunft erhalten über das, was du zu wissen wünschst. Wenn du aber bei dem Hause, das du aufsuchst, anlangst, so tu mir den Gefallen und bitte die gute Alte, dir zu sagen, wie wir Mäuse es anfangen sollen, um uns von der Tyrannei der Katzen zu befreien; du erzeigst mir dadurch einen großen Dienst, und ich werde dir immer dafür dankbar sein.«
Cianna versprach, ihr diesen Gefallen zu erweisen und machte sich auf den Weg nach jenen Bergen, welche zwar sehr nahe schienen, aber gar nicht zu erreichen waren. Endlich jedoch langte sie bei ihnen an und setzte sich müde auf einen Stein nieder, wo sie ein Heer von Ameisen erblickte, die eine große Menge Getreideproviant fort schafften und von denen eine sich an Cianna wandte und sie fragte: »Wer bist du und wohin gehst du?«
Worauf Cianna, die gegen jedermann höflich war, erwiderte: »Ich bin ein unglückliches Mädchen und muß notwendigerweise das Haus der Mutter der Zeit aufsuchen.« – »Geh nur immer weiter«, versetzte die Ameise, »denn da, wo diese Berge sich in eine große Ebene verflachen, wirst du weitere Auskunft erhalten. Tu uns aber den Gefallen und suche von der Alten zu erfahren, wie wir Ameisen es anfangen sollen, um etwas länger zu leben als jetzt; denn es scheint mir eine große Ungereimtheit in dem irdischen Treiben, so viele Vorräte von Lebensmitteln für ein so kurzes Leben aufzuhäufen, das, wie das Licht eines Gauklers, mitten im Besten verlischt.« –
»Sei ganz ruhig«, versetzte Cianna, »ich werde dir schon deine Freundlichkeit vergelten.« Und über die Berge hinwegziehend, gelangte sie auf eine schöne Flur, auf der sie bald nachher eine große Zirneiche antraf, die ein Denkmal hohen Altertums war und deren Frucht dem armen Mädchen, das sich mit wenigem begnügte, wie Konfekt schmeckte, überhaupt aber ein Bissen ist, den die Urwelt diesem leidvollen Zeitalter als Andenken an die verlorene Glückseligkeit darreicht.
Der Baum nun bildete sich einen Mund aus seiner Rinde und eine Zunge aus dem Mark und sprach zu Cianna: »Wohin so traurig, mein Kind? Komm unter meinen Schatten und ruhe dich aus.« Cianna aber dankte ihm schönstens und lehnte seine freundliche Einladung ab, da sie Eile hätte und die Mutter der Zeit aufsuchen müsse. Als der Baum dies vernommen, begann er wieder: »Du bist nicht mehr sehr weit von deinem Ziel, denn du wirst keinen Tag mehr gewandert sein, so wirst du auf einem Berge ein Haus erblicken und darin die du suchst antreffen. Wenn du aber ebenso freundlich wie schön bist, so bemühe dich, zu erfahren, wie ich es anfangen soll, um meine verlorene Ehre wieder zu erlangen, da ich früher sogar Speise der Vornehmen war, jetzt aber nur Mast für Schweine liefere.«–
»Überlasse mir diese Sorge«, versetzte Cianna, »denn ich werde mich bemühen, dir gefällig zu sein.« Hierauf zog sie weiter und ging immerzu, ohne sich je Ruhe zu gönnen, bis sie am Fuß eines naseweisen Berges anlangte, der mit seiner Spitze den Wolken gerade ins Gesicht fuhr. Dort begegnete sie einem alten Mann, der, vom Weg ermüdet, sich in einen Heuschober gelegt hatte und, sobald er Cianna erblickte, sie sogleich als die erkannte, die ihn von der Beule geheilt hatte.
Als er nun vernahm, was sie suchte, sagte er zu ihr, daß er der Zeit den Pachtzins für das Stück Erde, das er bisher bebaut, überbringe und daß die Zeit eine Tyrannin wäre, die sich aller Dinge auf der ganzen Welt bemächtigt habe und von allen, besonders aber von den Leuten seines Alters, Tribut verlange; weil er aber von Cianna einst einen so freundlichen Dienst erhalten, so wolle er ihr ihn jetzt durch einen guten Rat über die Ankunft auf diesem Berge hundertfach vergelten; es täte ihm zwar leid, sie nicht selbst hinauf begleiten zu können, da sein Alter, wie er sagte, eher dazu bestimmt sei, hinunter- als hinauf zu steigen und ihn daher zwänge, am Fuße jenes Berges zu bleiben, um mit den Buchhaltern der Zeit, nämlich den Leiden, Mühseligkeiten und Krankheiten des Lebens seine Rechnung abzumachen und die Schuld der Natur zu bezahlen; jedoch erteilte er ihr folgenden Rat und sprach:
»Jetzt merke wohl auf, mein hübsches Kind, und verliere kein Wort von dem, was ich dir jetzt sage. Du wirst nämlich auf dem Gipfel dieses Berges ein ungeheuer großes Haus finden, dessen Erbauung sich niemand erinnert; die Mauern sind verfallen, der Grund morsch, die Türen geborsten, das Hausgerät veraltet und mit einem Worte alles in Verfall geraten; auf einer Seite wirst du zerbrochene Säulen, auf der anderen zertrümmerte Statuen und nichts anderes in gutem Zustande sehen als über einer Tür ein in Felder geteiltes Wappen mit einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt, einem Hirsch, einem Raben und einem Phönix.
Sobald du eingetreten bist, wirst du ferner auf der Erde Feilen, Sägen, Sicheln, Hippen und viele hundert Kessel voll Asche erblicken und Namen darauf, wie auf Kruken in einer Apotheke, die besagen: Korinth, Sagunt, Karthago, Troja und tausend andere Namen von Städten, die in die Brüche gegangen sind und deren Asche die Zeit als Trophäen ihrer Taten aufbewahrt. Wenn du nun an dieses Gebäude kommst, so verstecke dich abseits so lange, bis du die Zeit hinausgehen siehst, dann tritt ohne Zögern in das Haus, wo du eine hochbejahrte Alte finden wirst, deren Kinn die Erde berührt und deren Buckel bis in den Himmel reicht, während die Haare wie der Schwanz eines Schimmels ihr die Fersen bedecken; ihr Angesicht aber, dessen Falten durch das Stärkemehl der Zeit gesteift sind, gleicht einer gerippten Halskrause.
Diese Alte nun sitzt auf einer Uhr, die auf einer Mauer steht, und da ihre Brauen so lang sind, daß sie ihr die Augen bedecken, so wird sie dich nicht sehen können. Sobald du aber eingetreten bist, nimm rasch die Gewichte von der Uhr ab und bitte dann die Alte mit lauter Stimme, daß sie das erfüllen möge, was du von ihr verlangst; worauf sie alsbald ihren Sohn herbeirufen wird, damit er komme und dich auffresse; da aber der Uhr, auf der sie sitzt, die Gewichte fehlen werden, so wird ihr Sohn nicht gehen können und sie daher gezwungen sein, dir das zu bewilligen, was du forderst. Traue jedoch keinem Eide, den sie leistet, wenn sie nicht bei den Flügeln ihres Sohnes schwört; dann kannst du ihr Glauben schenken und tun, was sie dir sagt; denn dann wirst du deine Wünsche erfüllt sehen.«
![]()
Nachdem er dies gesprochen, sank der Arme hin und löste sich auf wie ein toter Körper, der aus einer Katakombe an das Tageslicht gebracht wird. Cianna sammelte hierauf die Asche, mischte ein Nößel Tränen hinein, grub dann ein Grab und beerdigte die Überreste des Hingeschiedenen, indem sie ein Gebet um Ruhe und Frieden für seine Seele verrichtete; alsdann stieg sie den Berg hinauf, wobei sie ganz den Atem verlor, und wartete, bis die Zeit herauskam, die ein Greis mit gewaltig langem Barte war, bekleidet mit einem ganz alten Mantel, auf den sich über und über Zettelchen mit den Namen von mancherlei Leuten genäht befanden; auch hatte er große Flügel und flog so rasch, daß Cianna ihn bald aus dem Gesicht verlor.
Sie trat nun ins Haus zu seiner Mutter und mußte über den Anblick der alten Schachtel lächeln; dann aber faßte sie plötzlich die Gewichte und sagte zur Alten, was sie verlange, worauf diese einen lauten Schrei ausstieß und den Sohn herbei rief, Cianna jedoch zu ihr sprach: »Wenn du auch mit dem Kopf gegen die Mauer rennst, so bekommst du dennoch gewiß nicht deinen Sohn zu sehen, solange ich die Gewichte festhalte.« Als so die Alte sah, daß nichts zu machen war, fing sie an, Cianna zu schmeicheln und zu sagen; »Laß die Gewichte los, mein Töchterchen, und hindere meinen Sohn nicht in seinem Lauf, was bis jetzt noch kein Sterblicher auf Erden getan hat; laß los, so wahr dir Gott helfe; denn ich schwöre dir bei dem Scheidewasser meines Sohnes, mit dem er alles zernagt, dir nichts zuleide zu tun.« –
»Du verlierst deine Worte«, versetzte Cianna; »du mußt mir stärkere Versicherungen geben, wenn du willst, daß ich die Gewichte los lasse.« – »Ich schwöre es bei den Zähnen, die alle irdischen Dinge zernagen«, erwiderte jene, »daß ich dir alles sagen werde, was du wünschest.« – »Das ist alles nichts«, entgegnete Cianna, »denn ich weiß, daß du mich hintergehen willst.« – »Nun denn«, antwortete die Alte, »so schwöre ich es dir bei den Flügeln, die überall hin fliegen, daß ich dir mehr Gutes erweisen werde, als du dir vorstellst.«
Worauf Cianna die Gewichte los ließ und der Alten die nach Schimmel riechende und nach Moder stinkende Hand küßte, so daß die Alte sich über die Höflichkeit Ciannas freute und zu ihr sprach: »Verstecke dich hinter jene Tür, denn wenn mein Sohn kommt, werde ich mir von ihm sagen lassen, was du willst; sobald er aber wieder fort geht, denn er bleibt nie ruhig an einer Stelle stehen, verlasse schnell das Haus und mache ja kein Geräusch; denn er ist solch ein Vielfraß, daß er seine eigenen Kinder nicht verschont, und wenn er gar nichts hat, so ißt er sich selbst auf und kommt dann wieder aufs neue zum Vorschein.«
Kaum hatte Cianna getan, wie die Alte sie geheißen, so kam auch schon jener schnell, hoch und leicht angeflogen, benagte alles, was sich ihm darbot, selbst den Schimmel auf den Wänden, und wollte eben wieder fort fliegen, als die Alte ihn nach allem fragte, was sie von Cianna gehört, und ihn bei der Milch, mit der sie ihn gesäugt, beschwor, genau auf alles zu antworten, was sie von ihm zu wissen wünschte, worauf der Sohn ihr nach langem Bitten antwortete:
Dem Baum kann man antworten, daß er bei den Menschen nie geachtet sein wird, solange er Schätze unter seinen Wurzeln begraben hält, den Mäusen, daß sie nie vor der Katze sicher sein werden, wenn sie ihr nicht eine Schelle ans Bein binden, um sie zu hören, wann sie kommt; den Ameisen, daß sie hundert Jahre lang leben werden, sobald sie das Fliegen aufgeben können, denn wie die Ameisen dem Tode nahe sind, bekommen sie Flügel; dem Walfisch, daß er guten Mutes sein und sich den Delphin zum Freunde halten soll, da er, wenn der ihm als Führer diente, nie stranden würde; und den Tauben, daß, wenn sie sich auf die Säule des Reichtums setzen, sie ihre frühere Gestalt wieder bekommen werden.« Nach diesen Worten begann die Zeit wieder ihren gewöhnlichen Lauf, und Cianna, von der Alten Abschied nehmend, stieg von dem Berge in die Ebene hinunter.
Inzwischen waren die sieben Tauben ihrer Schwester immer nach gefolgt und endlich am Fuße des Berges angelangt, wo selbst sie, von dem langen Fluge ermüdet, sich alle auf die Hörner eines toten Ochsen nieder setzten, und kaum hatten ihre Füße diese berührt, als sie auch ihre frühere Jünglingsgestalt wieder erlangten. Noch voll Staunen hierüber vernahmen sie von ihrer Schwester die Antwort der Zeit und sahen nun, daß das Horn, als Sinnbild der Fülle, die von der Zeit angedeutete Säule des Reichtums sei, worauf sie und die Schwester in größter Freude den selben Weg zurück nahmen, den Cianna auf der Hinreise gemacht hatte.
Indem sie nun wieder zu dem Eichenbaum kamen und ihm erzählten, was die Zeit in betreff seiner gesagt, so bat der Baum sie, den unter ihm befindlichen Schatz auszugraben, da dieser Anlaß wäre, daß seine Eicheln nicht mehr so geachtet würden wie früher. Die Brüder gruben daher mit einem Spaten, den sie in einem Garten fanden, so lange, bis sie einen großen Haufen Goldstücke fanden, welche sie unter sich und die Schwester in acht Teile verteilten, um sie bequem fort schaffen zu können.
Als sie sich jedoch nach einiger Zeit ermüdet von der Reise und der Last des Goldes neben einem Zaune schlafen gelegt hatten, wurden sie von etlichen Räubern, die dort vorüber kamen und die armen Schelme mit den Köpfen auf den Tüchern voll Geld liegen sahen, mit Händen und Füßen an Bäume gebunden, worauf jene ihnen die Spieße abnahmen und sich davon machten, die Gefesselten aber nicht nur über den eben so schnell gewonnenen wie zerronnenen Schatz, sondern auch wegen ihres Lebens zu jammern begannen, da sie, aller Hoffnung auf Hilfe beraubt, in Gefahr waren, entweder bald vor Hunger zu sterben oder den Hunger irgendeines wilden Tieres zu stillen.
Während sie aber so ihr trauriges Schicksal beweinten, erschien die Maus, die nach Anhörung des Bescheides der Zeit als Lohn für den empfangenen Dienst die Stricke, mit denen sie jene angebunden sah, zernagte und sie in Freiheit setzte. Als sie nun ein Stück weiter gegangen waren, begegneten sie auch der Ameise, und nachdem diese den Rat der Zeit vernommen, fragte sie Cianna, was sie denn hätte, daß sie so bleich und nieder geschlagen aussehe; Cianna erzählte ihr daher, was ihr widerfahren war, und den Streich, den ihr die Spitzbuben gespielt, worauf die Ameise versetzte:
»Seid nur ganz ruhig; denn ich bin gesonnen, mich für den erhaltenen Dienst dankbar zu erweisen. Wisset nämlich, daß, während ich eine Last Getreide unter die Erde trug, ich den Ort bemerkte, wo jene Bluthunde die geraubten Sachen verbargen; denn sie haben unter einem verfallenen Gebäude einige Höhlen angelegt, in die sie ihren Raub hin schleppen; da sie nun eben jetzt auf eine neue Unternehmung ausgezogen sind, so will ich euch den Ort zeigen und euch hinführen, damit ihr das Eurige wieder erlangen könnt.«
Nach diesen Worten machte sie sich auf den Weg zu einigen eingestürzten Häusern und zeigte den Brüdern den Eingang zur Höhle, aus der Giangrazio, der als der mutigste von allen hinunter gestiegen war und darin das ganze, ihnen geraubte Gold gefunden hatte, es bald wieder heraus brachte, worauf sie weiter zum Meeresufer zogen und da den Walfisch antrafen, dem sie den von der Zeit, dem Vater aller Ratschläge, gegebenen Rat mitteilten.
Während sie nun so von ihrer Reise und von allen ihren Abenteuern sprachen, sahen sie plötzlich das Diebsgesindel, das ihrer Spur gefolgt war, bis an die Zähne bewaffnet in der Ferne erscheinen, so daß sie bei ihrem Anblick ausriefen: »Wehe uns, dieses Mal sind wir gänzlich und rettungslos verloren; denn dort kommen die Schelme bewaffnet und werden uns das Fell über die Ohren ziehen!« –
»Seid ganz ohne Furcht« versetzte der Walfisch, »denn ich kann und will euch aus eurer Not erretten, um euch die Liebe zu vergelten, die ihr mir erwiesen habt. Steigt also auf meinen Rücken und seid überzeugt, daß ich euch an einen sicheren Ort bringen werde.« Da die Geschwister sich den Feind im Nacken und das Messer an der Kehle sahen, bestiegen sie den Walfisch, der sich sogleich von den Klippen entfernte und endlich auf der Höhe von Neapel anlangte; da aber die Geschwister dort wegen der Untiefen nicht zu landen wagten, fragte sie der Walfisch: »Wo wollt ihr nun, daß ich euch absetze? An der Küste von Amalfi?«
Worauf Giangrazio versetzte: »Sieh zu, lieber Fisch, ob sich das vermeiden ließe; da ich an keinem dieser Orte gern ans Land gehen möchte, denn es heißt: ›Zu Vico sprich: »Marsch, packe dich!« Sag zu Castellamare: »Zu allen Teufeln fahre!« Den Schelmen zu Sorrent man nimmer Gutes gönnt; die Schurken dort zu Masse ich ganz von Herzen hasse.‹« Um ihnen nun zu willfahren, machte der Walfisch kehrt und steuerte auf den »Salzfelsen« los, auf den er sie absetzte und von wo sie sich durch das erste Fischerboot, das vorüber kam, ans Land bringen ließen, worauf sie frisch und gesund und reich zur Freude ihrer Eltern in ihre Heimat zurückkehrten und hier durch die Liebe, welche Cianna ihnen bewiesen, ein glückliches Leben führten, das die Wahrheit des alten Wortes bezeugte:
Man tue Gutes, wenn man kann,
und denke dann nicht weiter dran.
![]()
HERR SCARPACIFICO ...

Auf Postema, einem Dorf in der Nähe der Stadt Imola, lebte einmal ein Mann, Namens Scarpacifico, der war sehr reich, aber eben so karg und geizig. Er hatte eine Haushälterin, mit Namen Nina, ein kluges, listiges Weib, die es mit jedem Manne aufnehmen durfte. Da sie zugleich verständig und gewissenhaft ihr Amt verwaltete, hielt sie ihr Herr sehr in Ehren.
Scarpacifico war in früheren Jahren einer der rüstigsten Burschen in der ganzen Umgegend gewesen, seit dem er aber alt geworden, konnte er kaum noch mit großer Anstrengung zu Fuße gehen, so dass ihm seine treue Dienerin beständig zuredete, er möge sich doch ein Pferd kaufen; er verkürze sein Leben, wenn er in solchem Alter seine Füße so sehr anstrenge.
Endlich gab Herr Scarpacifico den Bitten und überzeugenden Gründen seiner Haushälterin nach, und begab sich eines Tages nach dem Markt, wo er ein Maultier gesehen hatte, welches ihm für sein Bedürfnis grade geeignet schien. Er kaufte das selbe um sieben Goldgulden.
Nun traf es sich, dass zu gleicher Zeit drei lustige Gesellen auf dem Markt waren, die weit lieber von fremdem Gut lebten als von eigenem, wie das auch heut zu Tage noch häufig der Fall ist. Kaum sahen sie, dass Scarpacifico ein Maultier kaufe, so sprach der eine von ihnen zu seinen Spießgesellen: „Kameraden, ich sage euch, dieses Maultier muss unser werden." „Wie soll das geschehen?“, fragten jene. „Wir müssen, Einer von dem Anderen eine ziemliche Strecke entfernt, ihm auf der Straße begegnen, und dann muss Jeder von uns einzeln gegen ihn behaupten, das Maultier, welches er gekauft, sei ein Esel. Gebt Acht, wenn wir nur fest dabei verharren, so wird das Maultier bald unser sein." —
Da dieser Vorschlag auch den Übrigen gefiel, verteilten sich alle Drei wie verabredet aus der Straße. Als nun Scarpacifico vorüber kam, stellte sich einer der Spitzbuben, als käme er einen anderen Weg, als den vom Markt her, und sagte: „Gottbehüte euch, mein Herr!" — „Schönen Dank, mein Freund!“, erwiderte Jener. „Wo kommt ihr her?“, fragte der Dieb. „Vom Markt“, war die Antwort.
„Und was habt ihr Gutes da gekauft?“, fragte der Spitzbube weiter. „Dieses Maultier." „Welches Maultier?" „Das, worauf ich reite“, entgegnete Scarpacifico.
„Sprecht ihr im Ernst oder treibt ihr euren Scherz mit mir?" „Wie so?" „Weil mir das nicht ein Maultier, sondern ein Esel zu sein scheint." „Was, ein Esel?“, schrie Scarpacifico, und ritt, ohne ein Wort weiter zu verlieren, seines Weges.
Noch nicht zwei Bogenschüsse weiter, so begegnete er dem zweiten Spießgesellen. „Guten Tag, mein Herr“, redete dieser ihn an, „woher kommt ihr?" „Vom Markt“, antwortete Scarpacifico. „War dort billig zu kaufen?“, fragte der andere. „Ei ja“, erwiderte Scarpacifico. „Habt ihr auch einen guten Kauf gemacht?" „Ich habe das Maultier gekauft, welches ihr hier seht." „Ist es möglich?“, rief der Schelm, „das habt ihr für ein Maultier gekauft?" „Allerdings." „Du lieber Himmel, es ist ja ein Esel!" „Wie, ein Esel!“, wiederholte sich Scarpacifico; „wenn mir das noch ein Einziger sagt, so mache ich ihm ein Geschenk mit dem verwünschten Tier."
AIs er so seinen Weg fortsetzte, kam ihm der dritte Gauner entgegen und sprach ihn an: „Gott grüß euch, mein Herr; kommt ihr vielleicht vom Markte?" „Ja wohl“, entgegnete Scarpacifico. „Was habt ihr da Schönes gekauft?“, fragte der schelmische Gesell. „Ich habe das Maultier gekauft, welches ihr hier seht." „Wie, ein Maultier, sagt ihr das im Ernst oder habt ihr mich zum Besten?" „In allem Ernst“, sagte Scarpacifico, „es fällt mir nicht ein, zu spaßen." „O ihr armer Mann“, rief der Betrüger, „seht ihr denn nicht, dass das es ein Esel und kein Maultier ist? Das sind nichtswürdige Leute, die euch so angeführt haben." „Das haben mich vor kurzem schon zwei andere versichert“, sagte Scarpacifico, „aber ich hab es nicht glauben wollen."
Damit stieg er von dem Maultier herab und sprach: „Behaltet das Tier, ich mache euch ein Geschenk damit." Der Spitzbube nahm es, dankte verbindlichst und ritt zu seinen Gefährten, während Herr Scarpacifico seine Reise zu Fuß fortsetzte.
Scarpacifico war kaum zu Hause angelangt, so erzählte er gleich seiner Haushälterin, er habe ein Tier gekauft, in festem Glauben, dass es ein Maultier sei, es sei aber ein Esel gewesen, und weil ihm das Mehrere, denen er unterwegs begegnet, versichert hätten, habe er es zuletzt verschenkt.
„O ihr einfältiger Mann“, rief Nina, „merkt ihr denn nicht, dass man euch einen Streich gespielt hat? Wahrhaftig, ich hätte euch für verschlagener gehalten, meiner Treu, mich hätten sie nicht so anführen sollen!" „Gib dich zufrieden“, entgegnete Herr Scarpacifico, „sie haben mir einen Streich gespielt, ich will ihnen zwei spielen; denn ganz gewiss werden diejenigen welche mich einmal so angeführt haben, sich mit dem Esel nicht begnügen, sondern versuchen, ob sie mir nicht mit irgend einer neuen List noch etwas aus den Händen locken können."
Nun wohnte in jenem Dorfe nicht weit von Scarpacificos Hause ein Bauer, der hatte zwei Ziegen, die sich so ähnlich sahen, dass man sie nicht von einander unterscheiden konnte, Scarpacifico kaufte sie alle beide, bezahlte sie mit barem Gelde und hieß Nina am folgenden Tage ein gutes Mittagsmahl zubereiten, weil er einige seiner Freunde zu Gast bitten wolle. Er befahl ihr, Kalbfleisch zu kochen, die Hühner und das Nierenstück zu braten, und gab ihr das nötige Gewürze, um ein gutes Ragout und eine Torte nach ihrer Weise zu machen. So dann nahm er eine von den Ziegen, band sie an einen Zaun im Hofe, und gab ihr zu fressen; der anderen aber legte er einen Strick um den Hals und führte sie auf den Markt.
Kaum war er dort angekommen, als die drei Herren des Esels ihn augenblicklich entdeckten, an ihn heran kamen und sagten: „Schön willkommen, Herr Scarpacifico, was führt euch hierher, wollt ihr irgend etwas Schönes einkaufen?"
„Ich bin gekommen“, versetzte er, um Lebensmittel einzukaufen, weil einige meiner Freunde heut Mittag bei mir essen werden, und es sollte mich sehr erfreuen, wenn ihr mir ebenfalls diese Ehre erweisen wolltet."
Die Spießgesellen nahmen diese Einladung bereitwillig an. Nachdem nun Herr Scarpacifico alles eingekauft hatte, was er bedurfte, legte er den ganzen Vorrat auf den Rücken der Ziege und sagte in Gegenwart der drei Gauner zu der Ziege: „Geh jetzt nach Hause und bestelle bei der Nina, dass sie dies Kalbfleisch koche und dies Nierenstück und die Hühner braten lasse; sage ihr auch, dass sie von diesem Gewürz ein Ragout und eine gute Torte ganz nach ihrer Weise zubereite. Hast du mich auch verstanden? Nun, so geh mit Gott!"
Die mit den Lebensmitteln beladene Ziege sah sich nicht so bald in Freiheit, als sie über Hals und Kopf fort lief, und man weiß bis heutigen Tages nicht, in wessen Hände sie geraten ist. Scarpacifico aber, die drei und einige andere seiner Freunde gingen noch eine Zeit lang auf dem Markte umher und als es ihnen Zeit schien, begaben sie sich nach Scarpacificos Wohnung.
Als sie in den Hof traten, bemerkten sie die Ziege, die an einen Zaun gebunden das verzehrte Gras wiederkauend. Sie waren nicht wenig erstaunt darüber, denn sie glaubten, es sei dies die nämliche Ziege, welche Scarpacifico mit dem Vorrat beladen und nach Hause geschickt hatte. Sie waren kaum in das Haus getreten, als Herr Scarpacifico zu seiner Wirtschafterin sagte: „Nina, hast du getan, was ich dir durch die Ziege bestellen ließ?" Das pfiffige Weib, die ihren Herrn sogleich verstand, antwortete: „Ja wohl, ich habe die Hühner und das Nierenstück gebraten und das Kalbfleisch kochen lassen." „Nun, es ist gut so“, sagte Scarpacifico.
Die drei Gesellen, da sie den Braten, das Kochfleisch und die Torte am Feuer sahen und die Worte der Nina hörten, gerieten außer sich vor Verwunderung und fingen an unter sich zu ratschlagen, wie sie es anstellen sollten, die Ziege in ihre Gewalt zu bekommen. Endlich gegen Ende der Mahlzeit, nachdem sie vergebens auf eine List gesonnen hatten, mit der sie den Scarpacifico auf gute Art um die Ziege betrügen könnten, sagten sie zu ihm: „Mein werter Herr, diese Ziege müsst ihr uns verkaufen."
Scarpacifico entgegnete, er tue dies allerdings nicht gern, weil man den Wert dieses Tieres mit allem Gelde der Welt nicht bezahlen könne; Indes, wenn sie sich es einmal in den Kopf gesetzt hätten, sie zu haben, so wolle er sie um fünfzig Goldgulden ablassen. Die Gauner, welche einen trefflichen Handel zu machen glaubten, zahlten ihm ohne Weiteres die fünfzig Goldgulden hin. „Ich sage euch aber“, bemerkte Scarpacifico, dass ihr euch nicht über mich beklagt, wenn die Ziege anfänglich ihre Schuldigkeit noch nicht tut, denn in den ersten Tagen, so lange sie mit euch noch nicht bekannt ist, könnt ihr dies nicht von ihr verlangen."
Jene aber gaben ihm gar keine Antwort, gingen ganz vergnügt davon und führten die Ziege nach Hause, wo sie zu ihren Frauen sagten: „Morgen braucht ihr nicht eher das Mittagbrot zu kochen, als bis wir euch das Nötige dazu nach Hause schicken." Am anderen Tage gingen sie auf den Markt, kauften Hühner und andere Esswaren für den Mittagstisch und nachdem sie das Ganze auf den Rücken der Ziege gepackt hatten, welche sie mit sich führten, sagten sie ihr alles, was sie ihren Frauen bestellen sollte. Als die mit dem Vorrat beladene Ziege sich in Freiheit sah, lief sie davon und machte sich so weit aus dem Staube, dass sie nie wieder etwas von ihr zu Gesichte bekamen.
Als die Stunde des Mittagessens herangekommen war, begaben sich alle drei nach Hause und fragten ihre Frauen, ob nicht die Ziege mit den Lebensmitteln angekommen sei und ob sie das getan hätten, was die Ziege in ihrem Auftrag ihnen bestellt habe. „O ihr Narren und Dummköpfe, die ihr seid“, riefen die Weiber, „wie könnt ihr glauben, dass ein Tier eure Dienstmagd vorstellen könne? Man wird euch schön betrogen haben! Natürlich weil ihr alle Tage andere betrügt, so hat man euch wieder einen Streich gespielt und am Ende seid ihr die Angeführten geblieben."
Als die Genossen merkten, dass Scarpacifico sie zum Besten gehabt und sie um fünfzig Goldgulden gebracht habe, gerieten sie in so heftigen Zorn, dass sie ihn umbringen wollten und nahmen sogleich ihre Waffen, um ihn aufzusuchen.
Der schlaue Scarpacifico aber, der für sein Leben besorgt und in beständiger Furcht war, die drei Gesellen, die er immer vor Augen hatte, könnten ihm irgend etwas Schlimmes zufügen, sagte zu seiner Haushälterin: „Nina, nimm diese Blase, welche mit Blut gefüllt ist, und stecke sie unter deinen Mantel, denn, wenn jene Räuber kommen, so will ich alle Schuld auf dich schieben, ich werde mich sehr aufgebracht gegen dich stellen, mit dem Messer nach dir stoßen und die Blase durch stechen, dann musst du auf die Erde hin fallen, als ob du tot wärst; für das Übrige laß mich nur sorgen."
Kaum hatte Scarpacifico diese Worte gesagt, als die Räuber ankamen und auf ihn zuliefen, um ihn zu töten. „Meine Freunde“, rief ihnen Scarpacifico zu, „was ihr immer gegen mich habt, ich bin außer aller Schuld; vielleicht hat diese meine Haushälterin euch irgend eine Beleidigung zugefügt, von der ich nichts weiß!" Und mit diesen Worten wendete er sich gegen Nina, nahm das Messer, stieß nach ihr und durchstach die mit Blut gefüllte Blase. Die Haushälterin, welche sich tot stellte, fiel nieder und das Blut floss stromweise über den Boden.
Scarpacifico tat, als ob er bei dem Anblick dieses entsetzlichen Vorfalls von Reue ergriffen werde und schrie mit lauter Stimme: „Ach, ich Unglücklicher! was habe ich getan! wie ein Rasender hab ich diese Frau getötet, welche die Stütze meines Alters war! Wie werd ich länger ohne sie leben können!" Darauf nahm er eine Pfeife und blies hinein und wie er eine Zeitlang geblasen hatte, sprang Nina munter und gesund wieder in die Höhe.
Die Gauner gerieten hierüber in noch größere Verwunderung als früher, vergaßen allen Zorn, kauften die Pfeife um zweihundert Goldgulden und kehrten ganz vergnügt nach Hause zurück. Nicht lange indes, so zankte sich einer von ihnen mit seiner Frau und in der Wut stieß er ihr ein Messer in die Brust, so dass sie tot zur Erde fiel. Der Mann nahm die Pfeife, welche Scarpacifico ihnen verkauft hatte und blies aus allen Kräften, in der Hoffnung, sie wieder ins Leben zu rufen. Aber er blies vergebens, denn ihre arme Seele war bereits in ein anderes Leben hinüber gegangen.
Als der eine von seinen Gefährten dies vernahm, sagte er: „Dummkopf du, du hast es nicht recht gemacht, lass mich es einmal versuchen!" Und damit nahm er seine Frau bei den Haaren, schnitt ihr mit einem Rasiermesser die Kehle ab, nahm dann die Pfeife und blies nach allen Kräften, aber er konnte sie nicht wieder lebendig machen. Ebenso tat auch der Dritte, so dass sie nun alle Drei ohne Weiber waren. Voller Wut rannten sie nach dem Hause Scarpacificos, ließen sich durch keine Entgegnungen und Ausreden zurückhalten, sondern nahmen ihn und steckten ihn in einen Sack, um ihn in dem nahen Fluss zu ertränken.
Auf dem Wege dahin setzte sie plötzlich irgend ein Geräusch in Schrecken, so dass sie den Sack mit Scarpacifico in Stich ließen und sich davon machten. Bald darauf kam zufällig ein Schäfer mit seiner Herde vorüber, und während er langsam hinter den Schafen einherging, welche sich an dem fetten Grase ergötzten, hörte er eine klägliche Stimme: „sie wollen sie mir durchaus geben und ich will sie nicht, denn ich bin zu alt, ich kann sie nicht nehmen."
Der Schäfer war ganz verwundert, er konnte nicht begreifen, woher diese Worte kamen, welche einige Mal wiederholt wurden, und wandte sich bald da, bald dort hin. Endlich erblickte er den Sack, in welchem sich Scarpacifico befand, ging hinzu und während jener immer die selbe Klage wiederholte und laut jammerte, band er den Sack auf und fand den Scarpacifico, welchen er fragte, weshalb man ihn hier in diesen Sack gebunden habe.
Scarpacifico antwortete ihm, der Herr des Landes habe ihm durchaus eine seiner Töchter zur Frau geben wollen, allein er habe sie ausgeschlagen, weil er zu alt und zu hinfällig sei. Der arme Schäfer, welcher seinen Worten vollkommen Glauben schenkte, fragte ihn: „Glaubt ihr wohl, dass der Herr mir sie geben würde?"
„Ich glaube gewiss“, antwortete Scarpacifico, „wenn du, wie ich, in diesen Sack gebunden wärst. Darauf steckte er den einfältigen Hirten auf seine Bitte in den Sack, band ihn fest zu und trieb die Schafe weit fort.
Es war noch keine Stunde vergangen, siehe da, so kamen die drei Schelme zu dem Ort zurück, wo sie den Scarpacifico im Sack gelassen hatten, und ohne weiter hineinzusehen, nahmen sie den Sack auf die Schultern und warfen ihn in den Fluss. So endigte also der arme Schäfer anstatt Scarpacificos jämmerlich sein Leben. Jene, mit ihrer Rache zufrieden, machten sich nun auf den Weg nach Hause; da bemerkten sie eine Schafherde, die nicht weit von ihnen weidete. Sie hätten gern einige Lämmer davon gestohlen und näherten sich der Herde, — wie erstaunten sie aber, Herrn Scarpacifico, den sie im Fluß ertrunken meinten, als den Hirten der selben zu finden.
Sie fragten ihn, wie er es denn angefangen habe, aus dem Fluss zu kommen, worauf er ihnen zur Antwort gab: „Geht nur, ihr seid nichts weiter als dickköpfige Esel, ohne Verstand. Wenn ihr mich noch so viel tiefer hinein geworfen hättet, so wäre ich mit zehnmal so viel Schafen wieder zurückgekehrt." Als die Drei dies hörten, sagten sie zu ihm: „O mein Herr, möchtet ihr uns wohl die Liebe erweisen, uns in Säcke zu stecken und in den Fluss zu werfen, damit wir aus Dieben Besitzer von Schafherden würden?"
„Ich bin bereit“, sagte Scarpacifico, „zu tun, was euch gefällt; es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht aus Liebe zu euch täte." Und damit nahm er drei tüchtige Säcke von starkem Zwillich, steckte jene hinein, band sie so fest zu, dass sie sich nicht wieder los machen konnten und warf sie in den Fluss. Also fuhren die Seelen der drei Schelme zur Hölle, aus welcher sie gekommen waren.
Herr Scarpacifico aber kehrte reich an Geld und Schafen nach Hause zurück zu seiner treuen Nina und lebte noch manches Jahr fröhlich und guter Dinge.
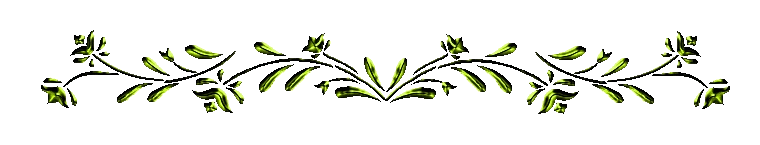
GAGLIUSO ...

Es war einmal in der Stadt Neapel ein alter, armer, armer Mann. Er war so elend, so runzlig, so eingeschrumpft, und hatte nicht einen einzigen Lumpen seine Blöße zu bedecken, so dass er umher ging, nackt wie eine Fliege.
Da er nun nahe daran war, die Säcke dieses Lebens abzuschütteln, so rief er seine Söhne, Oraziello und Pippo, und sagte zu ihnen: „Ich werde jetzt von dem Rechnungsführer gerufen, um die Schuld, die die Natur an mich zu fordern hat, zu bezahlen, und glaubt mir, wenn ihr Christen seid, dass es mir ein großes Vergnügen machen würde, diesen Elendshaufen, diese Wehschlucht zu verlassen, ließe ich euch nicht zurück, ein Paar erbärmlicher Gesellen, so dick wie St. Clara auf den fünf Straßen von Melito, ohne einen einzigen Stich an euch, so rein wie ein Barbierbecken, so glatt wie die Oberfläche eines Springbrunnens, so trocken wie ein Pflaumenstein; die ihr nicht soviel habt, um eine Fliege zu fangen; und lieft ihr hundert Meilen, nicht ein Staubkörnchen würde euch entfallen, da mein Unstern mich hinsetzte, wo nichts Gutes zu bekommen war, und sie mich gerade wie ich bin in den Büchern eintragen; obwohl ich immer mich beholfen und gestrebt habe, und bin ohne Licht zu Bette gegangen.
Dem ungeachtet will ich aber doch, da ich nun sterben muss, euch ein Zeichen meiner Liebe hinterlassen. Darum nimm du, Oraziello, mein Erstgeborener, das Sieb, das an der Mauer hängt, damit kannst du dir dein Brot erwerben; und du, der du der Jüngste bist, nimm die Katze und erinnere dich deines Papas." Als er das gesagt hatte, fing er an zu winseln, und nach einer Weile sprach er: „Gott sei mit euch, es wird Nacht." Oraziello ließ den Vater durch die Armenpfleger begraben, nahm das Sieb, und siebte hier und dort herum, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen; je mehr er siebte, desto mehr verdiente er.
Pippo, die Katze nehmend, rief: „Nun sehe mir einer, welches hübsche Vermächtnis mir der Vater hinterlassen hat. Ich bin kaum im Stande, mir selbst durch zu lesen, und muss nun für Zwei sorgen. Was nützt mir die erbärmliche Erbschaft? ich bin überzeugt, dass ich ohne die selbe viel weiter kommen würde." Die Katze, die dieses Selbstgespräch anhörte, sagte zu ihm: „Du quälst dich ohne Grund; du hast mehr Glück als Verstand, aber du kennst dein Glück nicht; ich bin im Stande dich reich zu machen, wenn ich darauf ausgehe."
Als Pippo das vernahm, bedankte er sich bei der Katze, streichelte ihr drei oder viermal den Rücken, und empfahl sich ihr auf das Wärmste. Die Katze hatte nun Mitleid mit dem unglücklichen Gagliuso, und jeden Morgen, wenn die Sonne mit dem Lichtköder die goldene Angel auswarf, und nach den Schatten der Nacht fischte, begab sie sich entweder an das Ufer von Chiaja oder nach dem Fischfelsen, und einen guten Steinbutt oder einen anderen feinen Fisch fangend, sackte sie ihn ein, brachte ihn zu dem Könige und sagte: „Mein Gebieter, Herr von Gagliuso, Euer Hoheit untertänigster Sklave, sendet euch ehrfurchtsvoll diesen Fisch und spricht: Für einen so großen Herrn ein sehr kleines Geschenk."
Der König erwiderte mit freudigem Antlitz, wie er es immer denen zu zeigen pflegte, die ihm etwas brachten: „Sage diesem Herrn, den ich nicht kenne, ich lasse ihm herzlich danken."
Ein anderes Mal lief die Katze dahin, wo man Vögel jagte in Sümpfen oder Feldern, und wenn die Jäger ein Rebhuhn oder eine Schnepfe herunter gebracht hatten, so raffte sie es auf, und brachte es dem Könige mit der selben Botschaft. Dies tat sie so lange, bis er eines Morgens zu ihr sagte: „Ich fühle mich diesem Lord Gagliuso so sehr verbunden, dass ich lebhaft wünsche, seine Bekanntschaft zu machen, um ihm die vielen Höflichkeiten zu erwidern."
Darauf antwortete die Katze: „Herr von Gagliuso wünscht sehnlichst, sein Leben und sein Blut für Euer Hoheit Krone zu wagen, und wird unfehlbar morgen früh, sobald die Sonne die Stoppeln des Luftfeldes angezündet hat, kommen, euch seine Aufwartung zu machen."
Am nächsten Morgen ging die Katze wieder zum Könige und sagte: „Majestät! Herr von Gagliuso lässt sich entschuldigen; seine Kämmerlinge sind heute Nacht davon gelaufen, und haben ihm nicht einmal ein Hemd gelassen." Als der König das hörte, ließ er sogleich eine Menge Kleider und Wasche aus feiner Garderobe nehmen, und sandte sie dem Gagliuso. Ehe zwei Stunden vergingen, begab sich dieser, von der Katze geleitet, nach dem Palast, wo er eine Menge Komplimente von dem Könige empfing, der ihn an seiner Seite sitzen ließ, und ihn so prächtig traktierte, dass ihr euch darüber wundern würdet.
Während sie aßen, wandte sich Gagliuso von Zeit zu Zeit zu der Katze und sagte zu ihr: „Mein Schätzchen, nimm deine vier Pfoten wohl in Acht, damit sie nicht auf den unrechten Weg kommen“, und die Katze pflegte zu antworten: „Seid ruhig, seid ruhig, sprecht nicht von solchen erbärmlichen Dingen." Da der König zu wissen wünschte, wovon die Rede sei, so antwortete die Katze, dass er eine kleine Zitrone verlange, und der König ließ sogleich einen ganzen Korb voll aus dem Garten holen.
Gagliuso fing wieder von Neuem so an, und die Katze hieß ihn wieder schweigen; der König fragte wieder, wo von die Rede sei, und die Katze hatte eine andere Entschuldigung für Gagliusos Albernheit bei der Hand. Nachdem sie nun eine gute Weile gegessen und geplaudert hatten, beurlaubte sich Gagliuso, und die Katze blieb bei dem König, die Vorzüge, den Verstand und den Geist Gagliusos, vor allem aber seine großen Reichtümer in den römischen und lombardischen Ebenen, die ihn wohl berechtigten, in eine Königsfamilie hinein zu heiraten, über die Maßen zu preisen.
Der König fragte, wie hoch sich wohl sein Vermögen beliefe, und die Katze erwiderte, Niemand könne die Mobilien, Immobilien und das Hausgerät dieses ungeheuer reichen Mannes, der selber nicht wisse, was er besäße, zählen. Wünsche aber der König, darüber Erkundigungen einzuziehen, so möge er nur Leute mit ihr aus dem Königreiche senden, und sie würde ihm beweisen, dass ihr Herr, was den Reichtum beträfe, in der ganzen Welt seines Gleichen suche.
Der König rief einige, zuverlässige Leute, und trug ihnen auf, die Sache genau zu erforschen. Diese folgten der Katze, welche, sobald sie über die Grenze des önigsreiches war, von Zeit zu Zeit, unter dem Vorwand, Erfrischungen zu besorgen, voraus zu laufen pflegte. Wo sie nun eine Herde Schafe, Kühe, Pferde oder Ferkel antraf, rief sie dem Hirten und den Hirtenjungen zu: „Nehmt euch in Acht! es kommt ein Trupp Räuber, um alles fort zu schleppen. Wünscht ihr euch nun der Wut der selben zu entziehen, und euer Besitztum verschont zu sehen, so sagt, es gehöre alles dem Herrn von Gagliuso, und kein Haar wird euch gekrümmt werden."
Das selbe sagte sie auf allen Meierhöfen, die sie unterwegs antraf, so dass des Königs Leute, wohin sie auch kamen, überall die Geige gestimmt fanden; denn alles gehörte dem Herrn von Gagliuso. Am Ende wurden sie des Fragens überdrüssig, gingen deshalb zurück zum König, und erzählten ihm Berge und Seen von den Reichtümern des Herrn von Gagliuso.
Als dieser es hörte, versprach er der Katze ein gutes Trinkgeld, wenn sie die Heirat zu Stande brächte. Der Katze, die den Kuppler zwischen ihnen spielte, gelang es auch endlich, die Sache in Richtigkeit zu bringen. Gagliuso kam, und der König gab ihm seine Tochter und eine reiche Mitgift.
Am Ende des Festmonates wünschte Gagliuso seine Frau auf seine Güter zu führen. Der König begleitete ihn bis an die Grenze, und er ging nach der Lombardei, wo er auf den Rat der Katze Güter kaufte, und ein Baron wurde. Als Gagliuso sich nun so außerordentlich reich sah, dankte er der Katze über allen Ausdruck, und sagte, dass er ihren guten Diensten sein Leben und seine Größe verdanke; und dass die Gescheitheit einer Katze mehr für ihn getan habe, als die Geschicklichkeit seines Vaters. Sie könne, fuhr er fort, mit seinem Leben und seinem Eigentum schalten und walten, wie es ihr gefalle, und er verspräche ihr, dass, wenn sie stürbe, was aber nach seinem Wunsche erst in hundert Jahren geschehen möge, so wolle er sie einbalsamieren, in einen goldenen Sarg legen, und auf sein Zimmer bringen lassen, damit ihm ihr Andenken beständig vor den Augen sein möge.
Die Katze hörte diese verschwenderischen Versprechungen an, und stellte sich in den nächsten Tagen tot, indem sie sich der Länge nach im Garten ausstreckte. Gagliusos Frau gewahrte es und rief: „Welch ein Unglück, die Katze ist tot, mein Gemahl!" — „Sterbe der Teufel mit ihr“, sagte Gagliuso, „besser sie, als wir." — „Was sollen wir mit ihr anfangen?“, fragte die Frau. — „Nimm sie bei den Beinen und wirf sie fort“, sagte er.
Die Katze, die diese böse Antwort hörte, als sie sie am wenigsten vermutete, rief: „Das ist wohl die Belohnung dafür, dass ich die Fliegen von euch abgewehrt habe? das ist wohl der Dank, dass ich euch von Lumpen befreit habe? das ist die Vergeltung, dass ich euch schön kleidete und fütterte, als ihr ein armer, verhungerter, erbärmlicher, schlotterhosiger Schuft wart?"
„Das kommt davon, wenn man einem Esel den Kopf wäscht. Verflucht sei alles, was ich für euch tat, ihr seid nicht wert, dass ich euch ins Gesicht speie. Einen schönen goldenen Sarg habt ihr mir machen lassen; ein schönes Leichenbegängnis wolltet ihr mir ausrichten! Geht nur! dienen, arbeiten, sich abquälen, schwitzen, um solchen Lohn dafür zu haben! —
Wehe dem, der eine gute Tat in Hoffnung auf Vergeltung tut. Wie richtig sagt nicht der Philosoph, wer als ein Esel schlafen geht, steht als ein Esel wieder auf. Wer am Meisten tut, hat am Wenigsten zu erwarten. Aber gute Worte und schlechte Taten täuschen sowohl Weise als Narren."
Als sie dieses sagte, schlug sie ihren Mantel um sich, und machte sich auf den Weg; was Gagliuso ihr auch sagen mochte mit der äußersten Demut, nichts war im Stande, sie zu besänftigen. Sie wollte nicht umkehren, sondern rannte immer weiter, ohne sich um zu sehen und rief:
„Gott behüte einen Jeden vor einem arm gewordenen Reichen, und vor einem reich gewordenen Armen."

DIE DREI ZITRONEN ...

Der König von Torre-Longa hatte einen Sohn, der sein Augapfel war und auf den er alle seine Hoffnung gegründet hatte, so dass er gar nicht die Stunde erwarten konnte, wo er für ihn eine gute Heirat finden und Großvater genannt werden würde. Aber dieser Prinz konnte die Frauen so wenig leiden, dass, wenn man nur von ihnen redete, er den Kopf schüttelte und sich hundert Meilen weit weg wünschte, so dass der arme Vater, als er die Hartnäckigkeit seines Sohnes sah, dermaßen traurig, verdrießlich und nieder geschlagen ward, wie ein Kaufmann, dessen Handelsfreund bankrott gemacht hat, wie ein Eseltreiber, dem das Vieh gefallen ist.
Aber weder die Tränen des Vaters erweichten den Prinzen, noch bewegten ihn die Bitten der Untertanen, noch erschütterten ihn die Nachschlüge redlicher Männer, welche ihm die Freude seines Vaters, das Bedürfnis; des Volkes und sein eigenes Interesse vorstellten, in dem er der letzte Sprössling des königlichen Blutes sei. Weil jedoch in einer Stunde sich oft mehr zu zutragen pflegt, als in hundert Jahren, und man nicht sagen kann, auf diesem Wege soll es nicht gehen, so begab es sich, dass, als man eines Tages bei Tafel saß, der Prinz eine Sahnetorte mitten durchschneiden wollte, und sich, in dem er seine ganze Aufmerksamkeit auf die Unterhaltung richtete, dabei einen Schnitt in den Finger gab.
Das Blut strömte auf die Sahnetorte und gab dieser eine so schöne Farbenmischung, dass den Prinzen plötzlich der Wunsch ergriff, eine Frau zu finden, die grade so weiß und rot sei, wie jenes von seinem Blut gefärbte Gericht, und er sagte zum Vater: „Herr Vater, wenn ich sie nicht so bekomme, wie ich sie wünsche, dann ist es mit mir vorbei. Nie erweckte irgend eine Frau mir das Blut und jetzt wünsche ich eine Frau, wie mein Blut. Daher entschließe dich, wenn du willst dass ich lebe und gesund sei, mir die Erlaubnis zu geben, die Welt zu durchstreifen, um eine Schönheit zu suchen, die ganz dieser schönen Farbenmischung entspricht. Sonst ist mein Lebenslauf bald beschlossen."
Als der König diesen seltsamen Entschluss hörte, so war es ihm, als stürze das Haus über ihm zusammen, und unaufhörlich wechselte er die Farbe, und als er wieder zu sich gekommen war und reden konnte, sagte er: „Mein lieber Sohn, Innerstes meiner Seele, mein einziges Herzblatt, Stütze meines Alters, was für eine Grille hat dich so plötzlich von Sinnen gebracht? Hast du deinen Verstand verloren? So lange hast du keine Frau haben wollen, um mir einen Erben zu geben, und jetzt hast du Lust, mich aus der Welt zu bringen? Wohin willst du denn so ohne Sinn und Verstand gehen, dein Leben zu zubringen und dein Haus zu verlassen, dein Haus, deinen Herd, dein Dach und Fach? Weißt du denn nicht, wie viel Mühsalen und Gefahren sich derjenige aussetzt, der da reist? Schlage dir doch diese Grillen aus dem Kopfe und höre auf das, was ich dir sage, bringe es doch nicht dahin, dass mein Leben ende, dies Haus verfalle, dieser Staat zu Grunde gehe."
Diese und ähnliche Worte aber gingen ihm zu einem Ohre hinein und zum anderen hinaus; alle waren eitel und weg geworfen, so dass der unglückliche König, da er sah, dass mit dem Sohne nichts weiter anzufangen sei, ihm eine Hand voll Taler, nebst einigen Dienern mit gab, und ihn entließ. Aber es war ihm dabei, als würde ihm die Seele von dem Körper los gerissen, und in dem er sich an ein Fenster stellte, bittere Tränen vergießend, folgte er ihm so lange mit den Augen, bis er ihn aus dem Gesicht verlor.
Als nun der Prinz abgereist war und den Vater traurig und trostlos zurück gelassen hatte, fing er an, durch Felder und Wälder, über Berg und Tal, über Hügel und Ebene dahin zu reiten, verschiedene Länder betrachtend und mit mannigfaltigen Leuten umgehend und immer die Augen offen, um zu sehen, ob er das Ziel seiner Wünsche entdecke, so dass er nach Verlauf von vier Monaten an eine Französische Meeresküste gelangte, wo er seine kranken Diener in einem Spital zurückließ und sich auf einer genuesischen Barke einschiffte.
In Gibraltar angelangt, ging er an Bord eines größeren Schiffes, das sich auf dem Wege nach Indien befand, indem er immer von Reich zu Reich suchte, von Provinz zu Provinz, von Land zu Land, von Straße zu Straße, von Haus zu Haus und von Stube zu Stube, ob er das jenem schönen Bilde, welches er im Herzen gemalt umher trug, entsprechende Wesen finden könne, und lief so weit umher, und setzte seine Beine in solche Tätigkeit, bis er am Ende an die Insel der wilden Frauen gelangte, wo selbst er vor Anker ging und ans Land stieg.
Dort fand er eine alte, alte Frau, die überaus mager war und ein schauderhaft hässliches Gesicht hatte. Dieser erzählte er die Ursache, welche ihn in dieses Land gebracht hatte. Als die Alte die seltsame Grille und den wunderlichen Einfall des Prinzen vernahm und die Mühsalen und Gefahren, die er deshalb erduldet hatte, geriet sie ganz außer sich und sagte zu ihm: „Mein Sohn, sieh dich wohl vor, denn wenn dich meine drei Töchter hier finden, die das Menschenfleisch gar sehr lieben, so ist dein Leben verloren; denn halb lebendig und halb gebraten werden sie dir die Schüssel zum Sarg und ihren Bauch zum Grabe machen. Mache dich also von hier weg, so bald und so rasch wie möglich, denn du wirst nicht weit gegangen sein, so wirst du dein Glück finden."
Als dies der Prinz vernahm, so geriet er in die größte Bestürzung, machte sich als bald auf und davon, und ohne auch nur ein Lebewohl zu sagen, fing er an zu laufen, bis er in ein anderes Land kam, wo er eine andere alte Frau fand, die noch hässlicher war, als die erste. Er teilte ihr gleichfalls seine Angelegenheiten auf das Genaueste mit, und wiederum sagte sie zu ihm: „Mache dich rasch von hier fort, wenn du meinen Töchtern, den kleinen Menschenfresserinnen, nicht zur Speise dienen willst; aber nicht weit von hier wirst du dein Glück finden."
Als dies der traurige Prinz vernahm, fing er an zu laufen, als wenn er gejagt würde, bis er eine andere alte Frau fand, die auf einem Rade saß, mit einem Korb am Arm voll Pasteten und Zuckerwerk, womit sie eine Schar von Eseln fütterte, die so dann am Ufer eines Flusses umher sprangen, und mit den Füßen gegen einige arme Schwäne ausschlugen. Der Prinz verneigte sich sehr artig gegen die alte Frau und erzählte ihr die Geschichte seiner Wanderung.
Diesmal tröstete ihn die alte Frau mit freundlichen Worten, gab ihm ein gutes Frühstück, dass er sich die Finger danach leckte und nachdem er von Tische aufgestanden war, schenkte sie ihm drei Zitronen, die nur eben erst vom Baum abgepflückt schienen, und dazu noch ein schönes Messer, indem sie sagte: „Du kannst auf dem selben Wege in deine Heimat zurück kehren, denn dein Rocken ist voll und du hast das gefunden, was du suchst; gehe also und wenn du nicht weit von Hause bist, so zerschneide bei der ersten Quelle, die du findest, eine Citrone, aus welcher sogleich eine Fee heraus steigen und zu dir sagen wird: Gib mir zu trinken! Du aber sei rasch mit dem Wasser zur Hand, sonst wird sie zerfließen wie Quecksilber, und wenn du nicht schneller bist bei der zweiten, so öffne die Augen und sei hurtiger bei der dritten, dass sie dir nicht entgeht, indem du ihr schnell zu trinken reichst, denn dann wirst du ein Weib nach deinem Herzen haben."
Der Prinz küsste ihr ganz vergnügt hundertmal die haarige Hand, die dem Rücken eines Stachelschweins glich, nahm Abschied und verließ jenes Land. An das Meeresufer gelangt, fuhr er nach den Säulen des Herkules hin, in unser Meer hinein, und nach tausend Stürmen und Gefahren landete er eine Tagesreise weit von seinem Reiche. Dort, in einem sehr anmutigen Haine, wo der Schatten die Wiesen überdachte, damit sie nicht von der Sonne gesehen würden, stieg er bei einer Quelle ab, die mit kristallener Zunge die Leute herbei rief, um sie zu erquicken.
Der Prinz setzte sich auf dem prächtigen Teppich nieder, welchen Gras und Blumen bildeten, nahm das Messer aus der Scheide und fing an, die erste Citrone aufzuschneiden. Siehe da, wie der Blitz kam ein sehr schönes Mädchen heraus, weiß wie Milch und rot wie eine Erdbeere, welches zu ihm sagte: „Gib mir zu trinken!" Der Prinz, ganz erstaunt und erstarrt über die Schönheit der Fee, war nicht rasch genug, ihr das Wasser zu geben, so dass ihr Erscheinen und Verschwinden fast zu gleich statt fand. Dies war nun ein Strich durch die Rechnung des Prinzen und es ging ihm so, als wie Einem, der etwas wünscht, und während er es zu haben glaubt, verliert.
Indem er aber die zweite Citrone durch schnitt, ging es ihm eben so, und dies war der zweite Strich, der ihm gemacht wurde, so dass seine Augen sich in zwei Bäche verwandelten und Tränen stromweise vergossen, mit der Quelle wetteifernd und ihr nichts nachgebend, während er jammernd bei sich selbst sagte: „Wie unglücklich bin ich doch, ich Ärmster! Zweimal habe ich mir sie entkommen lassen, als wenn mir die Hände gebunden wären! hol mich der Kuckkuck, ich bewege mich wie ein Bär, wo ich doch laufen sollte, wie ein Windhund! Meiner Treu, das hab ich wahrlich brav gemacht! Doch tröste dich Unglücklicher, noch ist ja eine da, aller guten Dinge sind drei — entweder soll dieses Messer mir die Fee verschaffen oder sonst ein wirksames Mittel gegen meinen Schmerz."
Mit diesen Worten durchschneidet er die dritte Citrone, die dritte Fee kommt heraus und sagt wie die übrigen: „Gib mir zu trinken!" Der Prinz reicht ihr als bald das Wasser und siehe da, vor ihm steht ein zartes Mädchen, weiß wie Sahne und rot wie Blut, etwas, was nimmer in der Welt war gesehen worden, eine Schönheit ohne Maß, von zartester Weiße und unvergleichlicher Anmut. Ihr Haar war golden und in ihren Augen hatte die Sonne zwei Sterne angezündet, damit sie in der Brust dessen, der sie sah, Feuer entzündeten. Ihre Lippen hatte die Göttin der Liebe rosenrot gefärbt — mit einem Wort, sie war so schön von Kopf bis zu Fuß, dass man nichts Reizenderes hätte sehen können, so dass der Prinz nicht wusste, wie ihm geworden war, und die so schöne Geburt einer Citrone nicht genug bewundern konnte, indem er bei sich sagte: „Schläfst du oder bist du wach? sind deine Augen bezaubert oder was ist das hier für eine weiße Gestalt, hervor gegangen aus einer gelben Schale? Was für ein süßes Zuckerwerk aus der Säure einer Citrone?"
Als er sich endlich überzeugt hatte, dass es kein Traum, sondern lauter Ernst und Wahrheit sei, umarmte er die Fee auf das Zärtlichste, und nachdem er ihr tausend liebevolle Worte gesagt hatte, fügte der Prinz hinzu: „Ich will dich nicht, du meine Seele, in das Land meines Vaters führen, ohne die Pracht, die deiner Schönheit würdig ist, und ohne die Begleitung, welche für eine Königin passt. Daher bitte ich dich, steige einstweilen in diese Eiche, die, wie es scheint, von der Natur selbst zu einem laubigen Schlupfwinkel gebildet wurde, und erwarte meine Zurückkunft; denn ich werde in der kürzesten Zeit zurück kehren, und dich mit mir führen, bekleidet und begleitet, wie es für meinen Stand sich ziemt— und so, nachdem er von ihr Abschied genommen hatte, verließ er sie und begab sich fort.
Inzwischen war eine schwarze Sklavin von ihrer Gebieterin geschickt worden, mit einem Krug an dieser Quelle Wasser zu holen. Als nun die Schwarze zufälligerweise in den Wellen das Bild der Fee erblickte, meinte sie sich selbst zu erblicken, und rief voller Verwunderung: „Wie, unglückliche Lucia, du bist so schön, und deine Gebieterin schickt dich, Wasser zu holen, und du willst das ertragen?" Mit diesen Worten zerbrach sie den Krug, kehrte nach Hause zurück, und als sie von ihrer Gebieterin befragt wurde, warum sie ihren Dienst so schlecht versehen habe, antwortete sie: „Ich bin an die Quelle gegangen und habe den Krug an einem Steine zerstoßen."
Die Frau verschluckte ihren Ärger und gab ihr am nächsten Tage ein schönes Fass, um es mit Wasser zu füllen. Aber da sie zur Quelle zurück kehrte und wiederum ein so schönes Bild in dem Spiegel des Wassers erblickte, stieß sie einen tiefen Seufzer aus und sagte: „Ich will keine Sklavin sein, denn ich bin nicht so hässlich; nein, ich bin schön und lieblich und soll dennoch ein Fass an die Quelle tragen!" Mit diesen Worten zerbrach sie auch das Fass in hundert Stücke, und daheim sprach sie brummend zu ihrer Gebieterin: „Ein Esel kam vorbei gelaufen, stieß an das Fass, da fiel es auf die Erde und ist mir ganz in Stücke zerbrochen."
Als die zornige Frau diesen neuen Unfall vernahm, verlor sie die Geduld, und einen Besen ergreifend, prügelte sie die Schwarze dermaßen durch, dass jene es ein paar Tage lang fühlte, gab ihr sodann einen Schlauch und sagte: „Jetzt lauf und mache rasch, du nichtswürdiges Geschöpf, lauf und trödle nicht und bring mir diesen Schlauch voll Wasser, denn sonst haue ich dich, bis du dich nicht mehr rühren kannst und ich dir für alle Zeit Vernunft beibringe."
Die Sklavin lief über Hals und Kopf, denn sie hatte den Blitz gefühlt, und wollte den Donner nicht abwarten, und nachdem sie den Schlauch voll gefüllt, schaute sie das schöne Bild von Neuem an und sprach: „Ich wäre eine große Närrin, wollte ich Wasser schöpfen; besser ist es, zu heiraten, wie es mir ziemt. Ich will mich nicht länger ruhig verhalten und einer solchen Gebieterin dienen." Mit diesen Worten nahm sie eine Nadel, die sie auf dem Kopfe trug, und fing an den Schlauch zu durchlöchern, dass er einem Springbrunnen ähnlich wurde und hundert Wasserstrahlen hervor sandte. Die Fee aber, da sie dieses lächerliche Benehmen erblickte, fing an, aus vollem Halse an zu lachen.
Als die Sklavin das Gelächter hörte, wandte sie ihre Augen nach jener Richtung, aus welcher es kam, und in dem sie das versteckte Mädchen wahr nahm, sagte sie bei sich selbst: „Du also bist die Ursache, dass mich meine Frau wie unsinnig durchgeprügelt hat? aber warte nur!“, und darauf redete sie die Fee an: „Was machst du da oben, hübsches Mädchen?" Die Fee, welche das wahre Bild der Höflichkeit war, teilte ihr alles haarklein mit, ohne auch nur eine Silbe auszulassen, was ihr mit dem Prinzen begegnet war, so wie auch, dass sie ihn von Stund zu Stund und von Augenblick zu Augenblick erwarte mit Kleidern und Dienerschaft, um ihn in das Reich seines Vaters zu begleiten und dort ein fröhliches Leben zu führen.
Als die rabenschwarze Sklavin dies vernahm, dachte sie daraus großen Vorteil zu ziehen und erwiderte der Fee: „Da du deinen Bräutigam erwartest, so lass mich hinauf kommen und dir dein Haar kämmen und dich schöner machen." Die Fee antwortete: „Sei mir vielmal willkommen!“, und indem die Sklavin hinauf kletterte, und jene die Hand ausstreckte, um ihr hinauf zu helfen, glichen diese beiden Hände einem Stück Kristall, in Ebenholz eingefasst. So stieg nun die Sklavin auf den Baum, während sie aber der Fee das Haar zu kämmen anfing, stieß sie ihr plötzlich eine Nadel in den Schädel.
Als die Fee dies fühlte, rief sie aus: „Taube! Taube!“, und in eine Taube verwandelt, schwang sie sich empor und flog fort. Die Sklavin zog sich hierauf nackend aus, machte aus den Lappen und Lumpen, womit sie bekleidet war, ein Bündel, warf es weit von sich, und nahm sich nun auf diesem Baum wie eine Statue von Gagat ( in einem Gehäuse von Smaragd, Schwarzer Bernstein ) aus.
Inzwischen kehrte der Prinz mit einem großen Gefolge zurück; als er ein Fass mit Kaviar statt einer Schüssel mit Milch fand, war er eine Zeit lang ganz außer sich und rief: „Wer hat diesen ungeheuren Klecks auf das Postpapier gemacht, auf welches ich die glücklichsten Tage meines Lebens zu schreiben gedachte? Wer hat dieses frisch geweißte Haus, welches meine Freude sein sollte, mit Trauer Gewändern behangen? Wer lässt mich diesen schwarzen Probierstein finden, wo ich ein Silberbergwerk hinterlassen hatte, durch das ich hätte reich und selig werden können?"
Allein die Sklavin, da sie das Erstaunen des Prinzen wahrnahm, entgegnete: „Wundere dich nicht, mein Prinz, denn ich, deine Lucia, bin verzaubert und aus einem weißen Schleier in eine schwarze Decke verwandelt worden." Der arme Prinz, da dem Übel nicht mehr abzuhelfen war, musste wohl gute Miene zum bösen Spiel machen. Nachdem die Schwarze herunter gestiegen war, bekleidete er sie von Kopf bis zu Fuß mit prächtigen Gewändern, und als er sie so auf das Beste heraus geputzt und gestutzt hatte, schlug er den Weg nach seiner Heimat ein, wo er von dem König und der Königin, die ihm sechs Meilen weit entgegen gegangen waren, empfangen wurde.
Als sie den herrlichen, von ihrem närrischen Sohne begangenen Streich sahen, dass er nämlich so lange umher gelaufen war, um eine weiße Taube zu finden, und eine schwarze Krähe nach Hause gebracht hatte, empfanden sie die Freude eines Verbrechers, der das Urteil empfängt, dass er gehängt werden soll. Da es nun aber einmal nicht anders war, so übergaben sie die Krone dem jungen Paar, und setzten den goldenen Reif auf jenes Mopsgesicht. So dann traf man Anstalt zu köstlichen Festen. Die Köche rupften Gänse, schlachteten Schweine und Kälber, spickten Braten, füllten Töpfe, drehten Klöße, spießten Kapaunen und machten tausend andere leckere Bissen.
Da geschah es, dass an ein Küchenfenster eine schöne Taube kam und sagte:
„In dieser Küche da, du bester Koch,
Was macht der König bei der Sarazenin doch?"
Der Koch in dessen achtete hierauf wenig; als aber die Taube zum zweiten und zum dritten Mal das Nämliche wiederholte, lief er in den Saal, wo man speiste und erzählte die wunderbare Begebenheit. Als bald befahl die Neu-Verlobte, da sie dies Lied hörte, dass man die Taube so gleich einfangen und braten solle. Der Koch kehrte also zurück und es gelang ihm wirklich, die Taube einzufangen. Nachdem er dem Befehl der Schwarzen Folge geleistet und die Taube, um sie zu rupfen, abgebrüht hatte, goss er das Wasser mit den Federn in den Garten hinab, der sich vor dem Fenster befand, und nicht drei Tage gingen vorüber, so sprosste ein schöner Zitronenbaum hervor, der eins, zwei, drei heranwuchs.
Nun geschah es, dass der König aus einem Fenster sah, welches dort hinaus ging, und den Baum wahr nahm, den er früher noch nie gesehen hatte. Er rief sogleich den Koch und befragte ihn, wann und von wem er dort wäre hin gepflanzt worden. Nachdem er von dem Meister Koch den ganzen Vorfall vernommen, Mutmaßte er den wahren Hergang der Sache und so befahl er denn bei Lebensstrafe, dass der Baum nicht berührt werden, sondern mit jeglicher Sorgfalt gehegt und gepflegt werden solle.
Als nun nach Verlauf mehrerer Tage drei sehr schöne Zitronen hervor gekommen waren, denen ähnlich, welche die alte Frau ihm gegeben, so ließ er sie, nachdem sie reif geworden, abpflücken, schloss sich mit einer Schale Wasser in seinem Zimmer ein, und mit dem selben Messer, welches er immer an der Seite trug, fing er an, die Zitronen aufzuschneiden. Es erging ihm mit der ersten und mit der zweiten Fee nicht anders als früher; nachdem er zuletzt aber die dritte Citrone aufgeschnitten und der Fee, welche daraus hervor kam, zu trinken gegeben hatte, wie sie es verlangte, verwandelte sie sich wieder in die nämliche Jungfrau, welche er auf dem Baum zurückgelassen hatte, und vernahm jetzt von ihr die ganze Missetat der Sklavin.
Wer kann nur den kleinsten Teil des Jubels schildern, welchen der König über dieses Glück empfand. Er schwamm in einem Meer von Seligkeit, er war außer sich vor Freude, und der Himmel hing ihm voller Geigen. Nachdem er sie in seine Arme gepresst, ließ er sie auf das Köstlichste ankleiden, nahm sie an der Hand und führte sie mitten in den Saal, wo der ganze Hofstaat und die anderen vornehmen Leute der Stadt dem Feste zu Ehren versammelt waren.
Der König rief alle, einen nach dem anderen, zu sich und fragte sie: „Sage mir, was verdient derjenige, welcher dieser schönen Dame etwas Böses antun will?" Worauf der eine antwortete: dass er ein Hanf Halsband verdiene; der andere: ein Frühstück von Steinen; der Dritte: eine Musik mit Keulen auf dem Trommelfell des Magens; der Vierte: einen Schluck Bilsenkraut, und die einen so und die anderen anders. Als endlich die schwarze Königin herbei gerufen wurde und der König die nämliche Frage an sie richtete, gab sie zur Antwort: „Er verdient, dass man ihn verbrenne und das Pulver in die Luft streue."
Als der König das vernahm, sagte er: „Du hast dir mit der Axt in den Fuß gehauen, du hast dir das Messer geschliffen, du hast dir das Gift gemischt, denn niemand hat ihr ein größeres Unheil zugefügt als du, nichts würdige Hündin. Weißt du, dass dies die schöne Jungfrau ist, die du mit der Haarnadel durchbohrtest? weißt du, dass dies jene schöne Taube ist, die du schlachten und langsam braten ließest? Du hast dir da eine schöne Suppe eingebrockt, du hast dir selbst den schlimmsten Streich gespielt; wie man es treibt, so geht es; wer Reisig kocht, bekommt Rauchsuppe, und wie man einem anderen tut, so wird uns wieder getan."
Mit diesen Worten ließ er sie ergreifen und lebendig in einen großen Haufen Holz werfen, und nachdem sie zu Asche verbrannt, diese von dem Schlossturm aus in die Luft streuen, in dem sich so wiederum die Wahrheit des Sprichwortes bewährte: Wer Dornen sät, gehe nicht barfuß.
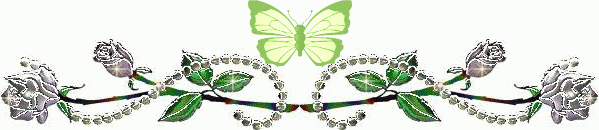
DIE MONATE ...

Es waren einmal zwei leibliche Brüder, Cianne und List. Jener hatte Geld, dieser war arm. Aber je ärmer der eine war, desto knickriger war der andere, der sich oder anderen unter keinen Umständen etwas zu gute getan hätte. Der arme List endlich, voller Verzweiflung über sein Missgeschick, verließ sein Vaterland und ging in die weite Welt, um da sein Glück zu versuchen.
Eines Abends nun, nach einer sehr beschwerlichen Tagesreise, gelangte er in ein Wirtshaus, wo er zwölf junge Leute fand, die um ein Feuer saßen und sich wärmten. Als diese den bejammernswerten List in einem so trübseligen Zustande ankommen sahen, zitternd vor Frost in der strengen Jahreszeit und weil seine Kleider ganz zerrissen waren, luden sie ihn ein, sich neben dem Herde nieder zu setzen. List nahm die Einladung an, denn er bedurfte dessen gar sehr und machte es sich bequem. Hierauf fragte ihn einer, jener Jünglinge, der ein so launisches verdrießliches runzliges Gesicht hatte, dass es lächerlich anzusehen war: „Was scheint dir, Landsmann, von diesem Wetter?"
„Was soll mir scheinen“, versetzte List, „es scheint mir, dass alle Monate des Jahres ihre Schuldigkeit tun. Aber wir, die wir nicht wissen, was wir wollen, nehmen uns heraus, dem Himmel Gesetze vorzuschreiben, und in dem wir die Dinge, so wie sie uns für gut scheinen, wünschen, bedenken wir eben nicht sehr, ob das gut oder schlecht, nützlich oder schädlich wäre, was uns eben in den Sinn kommt, so dass wir im Winter, wenn es regnet, die Sonne im Löwen, und im August Wolkenbrüche haben möchten, ohne zu bedenken, dass wenn dies geschähe, die Jahreszeiten drüber und drunter, die Saaten und Ernten zu Grunde gehen würden, die Menschen hin sterben, und die Natur verderben müsste.
Daher wollen wir dem Himmel seinen Lauf lassen, denn er hat die Bäume dazu geschaffen, um mit dem Holz die Heftigkeit des Winters, und mit ihren Laubdächern die Hitze des Sommers erträglich zu machen."
„Du sprichst wie ein vernünftiger Mensch“, erwiderte jener junge Mann, „allein du kannst doch nicht in Abrede stellen, dass dieser Monat März, in dem wir uns jetzt befinden, recht widerwärtig ist mit seinem vielen Frost und Regen, Schnee und Hagel, Wind, Nebel und Sturm und anderen Beschwerlichkeiten, die uns das Leben zum Überdruss machen."
„Du sprichst sehr übel von diesem armen Monat“, entgegnete List, „aber du erwähnst nicht den Nutzen, den er uns bringt, denn er ist es ja, welcher den Frühling einleitet, und dadurch alles wieder neu entstehen lässt. Ja, wenn irgend einer, so beweist er die Trefflichkeit seines gegenwärtigen Wetters, in dem er die Sonne in das Zeichen des Widders übergehen lässt."
Jener Jüngling fand an den Worten des List großen Gefallen, weil er selbst gerade der Monat März war, der mit den anderen 11 Monaten in jenem Wirtshaus eingekehrt war. Um nun die freundliche Denkungsart List´s zu belohnen, der es nicht vermocht hatte, von einem so unfreundlichen Monat Böses zu reden, gab er ihm ein schönes Kästchen, in dem er zu ihm sagte: „Nimm dies, sieh zu, was dir Not tut, und sage es dreist diesem Kästchen. Wenn du es aufmachst, wirst du das Gewünschte darin finden."
List bedankte sich bei dem Jünglinge mit demütigen Worten, und in dem er sich das Kästchen als Kissen unter den Kopf legte, überließ er sich dem Schlaf; mit Tagesanbruch wachte er auf, und nach dem er von den Monaten Abschied genommen, begab er sich auf den Weg. Er war aber noch nicht fünfzig Schritte von dem Wirtshaus entfernt, als er das Kästchen auf machte und sagte: „O Herr, könnte ich nicht eine mit Fries ausgeschlagene Sänfte und etwas Feuer darin haben, um recht behaglich warm in diesem Schnee vorwärts zu kommen."
Er hatte dies kaum gesagt, als eine Sänfte mit den Trägern erschien; sie hoben ihn hinein, nahmen die Sänfte auf die Schultern und begaben sich auf den Weg nach seinem Haus, welchen List sie gehen hieß. Als die Stunde des Essens gekommen war, öffnete er wiederum das Kästchen und sagte: „Nun etwas her zu essen!“, und als bald sah man Speisen und Getränke zum Vorschein kommen, und die Tafel war so besetzt, dass zehn gekrönte Häupter an der selben hätten Teil nehmen können.
Des Abends, in einem dunklen Walde angelangt, welcher der Sonne keinen Zutritt gewährte, öffnete List das Kästchen und sagte: „An diesem schönen Aufenthalt, bei dem Gemurmel des Flusses, der auf den Steinen den Contrabass spielt, um den Gesang der frischen Winde zu begleiten, möchte ich für heut mein Nachtlager halten„. Augenblicklich sah man ein feines Scharlachfarbenes Lager erscheinen unter einem kostbaren Zelte mit Matratzen von Flaumfedern, spanischer Decke, herrlichen Kissen und Laken, und als List zu essen forderte, wurde unter einem anderen Speisezelt ein Silberservice wie für einen Fürsten auf den Tisch gesetzt, so dass der Geruch sich hundert Meilen weit verbreitete.
Nachdem List gegessen hatte, legte er sich schlafen; mit Tagesanbruch aber öffnete er das Kästchen und sagte: „Nun wünsche ich mir ein schönes Kleid, denn ich werde heute meinen Bruder wieder sehen, und ich möchte ihn wohl ein wenig in Erstaunen setzen." Also bald sieht er vor sich ein kostbares Samtkleid mit einem roten Vorstoß und Schlitzen, unter denen ein gelbseidenes Untergewand hervorleuchtete, dass es aussah, wie ein Blumenbeet. Diese prächtigen Kleider legte Lise sich an, stieg in die Sänfte, und kam so nach Hause.
Cianne, da er ihn in einem so prachtvollen Aufzug anlangen sah, wollte gleich wissen, wo und wie er sein Glück gemacht habe, worauf ihm denn der Bruder erzählte, wen er in jenem Wirtshaus gefunden, und was für ein Geschenk man ihm gemacht hätte; dagegen erwähnte er nichts von den freundlichen und bescheidenen Worten, die ihm die Gunst jenes Jünglings erworben hatten.
Cianne konnte die Zeit nicht erwarten, um von seinem Bruder Abschied zu nehmen; er trieb ihn an, sich schlafen zu legen, da er gewiss recht müde sei, und gleich darauf nimmt er Courierpferde und begibt sich über Hals und Kopf nach jenem Wirtshaus, wo selbst er die nämlichen Jünglinge findet, und sich mit ihnen in ein Gespräch einlässt.
Da richtet jener Jüngling an ihn die selbe Frage, was er wohl von dem Monat März hielte; doch Cianne, als ein grober Tölpel, entgegnet ihm darauf folgendermaßen: „O dass doch Gott diesen verdammten Monat verwünsche, der den Hirten verhasst ist, die Säfte verdirbt, die Körper ruiniert, ein Monat, dessen wir uns bedienen, wenn wir irgend einem Menschen ein Unheil an den Hals wünschen wollen, indem wir sagen: „ „Dass dich ein böser März hole!", und wenn wir jemanden als einen aufgeblasenen, dünkelhaften Menschen bezeichnen wollen, so sagen wir von ihm: „„Was kümmert er sich um den März!" Mit einem Wort, es ist ein Monat, dass es ein Glück der Welt, das Heil der Erde, der Reichtum der Menschen wäre, wenn er aus der Liste seiner Brüder ausgestrichen würde."
Dem Monat März, da er sich so vom Cianne den Kopf waschen hörte, fuhr dies nicht wenig in die Nase, und er sann nach, wie er ihm für seine treffliche Rede eine entsprechende Belohnung geben könne. Als nun Cianne den folgenden Morgen abreisen wollte, gab er ihm einen schönen Stock, in dem er zu ihm sagte: ,,Immer, wenn du etwas brauchst, so sprich nur: Stock, gib mir hundert! und du wirst augenblicklich das Gewünschte erhalten."
Cianne dankt dem Jüngling, und fängt an darauf los zu reiten, denn er wollte den Stock nicht eher versuchen, als bis er sich in seinem Hause befände. Kaum aber hat er den Fuß in das selbe gesetzt, so begibt er sich in ein geheimes Zimmer, denn es sollte niemand um das Geld wissen, welches er von dem Stock zu erhalten hoffte, und sagte zu diesem: „Stock, gib mir hundert!"
Und der Stock fing an, ihm alles das Gewünschte und noch mehr zu geben, in dem er ihm auf Gesicht und Füßen herum tanzte, dergestalt, dass List auf das Geschrei herbei lief, und da er sah, dass der Stock sich nicht halten ließ, das Kästchen öffnete, und ihn so zum Stehen brachte. Als er nun den Cianne fragte, was denn vorgefallen sei, und die Geschichte hörte, sagte er zu seinem Bruder, er solle niemand anderes anklagen, als sich selbst, denn er habe sich das Übel selbst zu gezogen wie ein Gimpel, und habe gehandelt wie jenes Kamel, das Hörner zu haben wünschte, und die Ohren verlor; ein andermal aber möge er sich wohl vorsehen und die Zunge im Zaum halten, welche der Schlüssel gewesen, der ihm diesmal die Vorratskammer des Unglücks aufgeschlossen hatte. Denn hätte er von jenem Jüngling Gutes gesprochen, so hätte er vielleicht das selbe Glück erfahren; um so mehr aber solle man Gutes von anderen reden, da dies eine Ware sei, die nichts koste, und von welcher als dann dennoch ein unverhoffter Gewinn übrig bleibe.
Endlich aber tröstete er ihn und redete ihm zu, nicht mehr Güter zu suchen, als die der Himmel ihm gegeben, denn sein Kästchen reiche vollkommen hin, um dreißig Häuser geiziger Inhaber bis zum Rande mit Schätzen zu füllen. Cianne solle über all sein Gut frei schalten dürfen, denn bei dem freigebigen Menschen sei der Himmel Schatzmeister, und wenn gleich ein anderer Bruder ihm wegen der schlechten Behandlung, die er in seinem Elend von ihm erfahren habe, einen Groll nachtragen würde, so bedenke er hingegen, dass sein Geiz der günstige Wind gewesen sei, der ihn in diesen Hafen getrieben habe, und daher wolle er ihm Dank sagen, und für sein Glück sich erkenntlich beweisen.
Als Cianne dies vernahm, bat er ihn wegen der früheren üblen Behandlung um Verzeihung; in friedlichem Einverständnis genossen sie zusammen ihr gutes Glück, und von Stund an sagte Cianne von jeder Sache, wie schlimm sie auch sein mochte, dennoch nur Gutes; denn der abgebrühte Hund fürchtet das kalte Wasser.
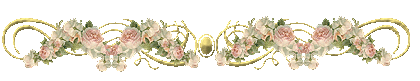
DIE GUTEN TAGE ...

Zu Casena in Romagna lebte eine arme Witwe, eine sehr wackere Frau namens Lucietta. Sie hatte einen einzigen Sohn, der an Dummheit und Faulheit seines Gleichen suchte. Bis zwölf Uhr mittags lag er im Bette und bevor er aufstand, rieb er sich erst eine ganze Stunde die Augen, reckte Arme und Beine, kurz um, gebärdete sich wie der ärgste Faulpelz von der Welt.
Hierüber betrübte sich die arme Mutter gar sehr, denn sie hatte gehofft, er würde eines Tages die Stütze ihres Alters sein. Um ihn nun unverdrossener und tätiger zu machen, hörte sie gar nicht auf ihn zu ermahnen und sagte zu ihm: „Mein Sohn, wer gute Tage in der Welt haben will, der muss sich anstrengen, fleißig sein und mit Tagesanbruch aufstehen; denn das Glück steht wohl dem Wachsamen und Arbeitsamen, nicht aber dem Trägen und Schläfrigen bei. Deshalb, mein Sohn, glaube und folge meinem Rat, so wirst du gute Tage erleben und es wird alles zu deiner Zufriedenheit ausschlagen."
Lucilio, so hieß der junge Mensch, einfältiger als die Einfalt selber, hörte zwar, was die Mutter sprach, verstand aber den Sinn ihrer Worte nicht. Und wie aus einem tiefen und schweren Schlafe erwachend, erhob er sich und schlenderte vor das Stadttor hinaus, wo er sich, um dort weiter zu schlafen, quer über den Weg legte, so dass alle, welche zur Stadt kamen oder hinaus gingen, über ihn fallen mussten.
Zufällig traf es sich, dass gerade in der vorigen Nacht drei Einwohner von Casena hinaus gegangen waren, einen Schatz zu graben, den sie entdeckt hatten. Sie hatten ihn auch glücklich gehoben und waren eben im Begriff, ihn nach Hause zu tragen, als sie auf Lucilio stießen, der am Wege lag, aber nicht mehr schlief, sondern eben aufgewacht war und sich nach dem guten Tag umsah, den seine Mutter ihm prophezeit hatte.
„Gott schenk euch einen guten Tag, mein Freund“, sagte der erste jener drei Männer, als er an ihm vorüberging. „Gott sei gelobt!“, rief Lucilio, da er von guten Tagen hörte, „da hab ich einen!" Der Schatzgräber, im Bewusstsein seiner Schuld, meinte nicht anders, als diese Worte bezögen sich auf ihn und das Geheimnis sei verraten. Natürlich, denn wer ein böses Gewissen hat, denkt bei den gleichgültigsten Sachen, es sei von ihm die Rede.
Der zweite ging ebenso vorüber, dem Lucilio einen guten Tag bietend, worauf Jener, an die guten Tage denkend, halb laut sagte: „Gottlob, nun hab ich ihrer zwei!" Nun kam auch der dritte und grüßte gleicherweise, in dem er Gott um einen guten Tag für ihn bat. Da sprang Lucilio voller Freuden auf und rief: „O vortrefflich, nun hab ich alle drei! Das ist mir ganz besonders geglückt."
Er meinte damit die drei guten Tage, allein die Schatzgräber dachten, er meine sie, und da sie sich fürchteten, er möge hin gehen, sie bei der Obrigkeit anzeigen, so riefen sie ihn bei Seite, erzählten ihm alles und gaben ihm, damit er schweige, den vierten Teil ihres Schatzes.
Ganz vergnügt darüber, nahm Lucilio seinen Anteil, brachte ihn nach Hause zu seiner Mutter und sagte: „Liebe Mutter, Gottes Segen ist mit mir gewesen, denn weil ich getan habe, wie ihr mich geheißen habt, so hab ich die guten Tage gefunden. Nehmt dies Geld und kauft dafür alles, was wir zum Leben brauchen."
Die Mutter freute sich nicht wenig über diese glückliche Begebenheit und ermahnte den Sohn, auch noch ferner recht betriebsam zu sein, damit er immer so gute Tage erlebe wie diese.
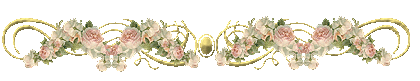
DIE DREI KÖNIGSKINDER ...

Vor langer Zeit lebten einmal drei Schwestern, die waren sehr sittsam, anmutig und schön, doch von niedriger Herkunft, denn sie waren die Töchter eines Bäckers. Eine von ihnen hieß Brunora, die andere Lionela« und die dritte Claretta.
Eines Tages befanden sich diese drei jungen Mädchen in ihrem Garten und waren außerordentlich vergnügt; da kam Lancelot, der König des Landes, vorüber, der mit reichem Gefolge auf die Jagd zog. Als Brunora, die älteste von den Schwestern, diese vornehme Gesellschaft sah, sprach sie zu ihren beiden Schwestern: „Wenn ich den Haushofmeister des Königs zum Mann bekäme, so wollte ich mich verpflichten, den ganzen Hof mit einem Becher Wein satt zu machen."
„Und ich," sagte Lionella, „ich will mich rühmen, dass wenn ich den geheimen Kämmerer des Königs heiratete, ich ganz allein mit einer Spindel, die ich besitze, so viel Leinwand spinnen wollte, um den ganzen Hof mit schönen, feinen Hemden zu versehen."
„Und ich," sagte Claretta, „darf mich rühmen, dass, wenn der König mein Gemahl würde, ich ihm drei Kinder schenken wollte, zwei Knaben und ein Mädchen, und jedes von ihnen sollte lange Locken vom feinsten Golde haben, eine goldene Kette um den Hals und einen Stern auf der Stirn."
Diese Worte hörte einer von den Hofleuten, der sofort zum Könige ging und ihm alles, was die Mädchen gesprochen hatten, Wort für Wort hinter brachte. Als der König dies hörte, ließ er die Mädchen so gleich vor sich kommen und befragte eine Jede von ihnen, was sie da im Garten unter einander gesprochen hätten. Da verbeugten sich alle drei ehrfurchtsvoll und wiederholten ihm, eine nach der anderen, jedes ihrer Worte.
Da dies dem Könige sehr wohl gefiel, so verheiratete er ohne Weiteres Brunora mit seinem Haushofmeister, der Kämmerer erhielt Lionela zur Frau und er selbst wählte Claretta. Dann gingen sie alle auf die Jagd und als man nach Hause zurück kehrte, wurden die Hochzeiten aufs Prächtigste gefeiert.
Aber die Mutter des Königs war damit sehr unzufrieden, denn wenn gleich ihre Schwiegertochter von bewunderungswürdiger Schönheit war und sehr anmutig zu reden verstand, so stammte sie doch aus niedrigem Geschlecht und schien ihr der Macht und der Würde des Königs durchaus nicht angemessen. Und ebenso war ihr der Gedanke unerträglich, dass der Haushofmeister und der Kämmerer die Schwäger des Königs sein sollten! Die Schwiegermutter fasste daher gegen ihre Schwiegertochter einen so heftigen Hass, dass sie, sie nicht vor Augen sehen konnte; verbarg dies aber, um ihren Sohn nicht zu erzürnen.
Nun traf es sich, dass der König in ein anderes Land reisen musste; er empfahl daher seiner Mutter auf das Angelegentlichste die Königin, und jene hieß ihn ohne Sorge reisen, da sie für ihre Schwiegertochter alle nur mögliche Sorgfalt haben wolle. Kaum war der König abgereist, so gebar die Königin drei Kinder, zwei Knaben und ein Mädchen, und alle drei (so wie die Königin, da sie noch Jungfrau war, es versprochen hatte) hatten goldenes Haar, welches lockig über ihre Schultern fiel, eine schöne goldene Kette und einen Stern mitten auf der Stirn. Die boshafte Schwiegermutter, bei welcher kein Mitleid zu finden war, entflammt von einem grausamen und tödlichen Hass, beschloss, als die zarten Kinderchen geboren waren, sie umbringen zu lassen, damit man nie wieder etwas von ihnen höre und die Königin bei dem Könige in Ungnade falle.
Dazu waren auch die Schwestern der Claretta von einem so heftigen Neid gegen sie entzündet worden, weil sie die Gemahlin eines Königs war, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe hatten und mit allen Ränken und Listen unaufhörlich danach trachteten, die Schwiegermutter noch viel mehr gegen sie aufzubringen.
Es traf sich nun, dass zu der nämlichen Zeit, als die Königin nieder kam, drei junge Hunde geboren wurden, zwei männliche und ein weiblicher, die vorn auf der Stirn eine Art Stern hatten und Streifen um den Hals, die wie Halsketten aussahen. Die zwei nichtswürdigen Schwestern also, von einem teuflischen Geist beseelt, nahmen diese drei jungen Hündchen, brachten sie zu der Königin Mutter, verbeugten sich ehrerbietig und sprachen: „Wir wissen wohl, dass eure Hoheit unsere Schwester nicht besonders lieben, und das mit allem Recht, weil sie von niedriger Herkunft ist und es eurem Sohn, unserm gnädigsten König, nicht ziemt, eine Frau solchen Standes zur Gemahlin zu haben. Da wir nun von der Gesinnung eurer Hoheit unterrichtet sind, so kommen wir hier und bringen euch drei kleine Hündchen, die mit einem Stern auf der Stirn geboren sind, und bitten, uns euren Willen hierüber vernehmen zu lassen."
Die Alte war über diesen Gedanken sehr erfreut und beschloss, die Hündchen ihrer Schwiegertochter zu bringen, die ihre Kinder noch nicht gesehen hatte, und ihr zu sagen, dies seien ihre Kinder. Und damit dieser ruchlose Anschlag nicht entdeckt würde, befahl das boshafte Weib der Hebamme, sie sollte die Königin benachrichtigen, sie habe drei junge Hündchen geboren. Darauf begaben sich die Schwiegermutter und die Schwestern der Königin nebst der Hebamme zu ihr und sprach: „Da sieh, du schöne Königin, was für reizende Kinderchen du geboren hast! Pflege sie nur ja recht sorgsam, damit der König, wenn er zurückkommt, diese artigen Kinder munter und gesund finde.
Bei diesen Worten legte die Hebamme die Hündchen zu ihr und tröstete sie heuchlerischer Weise, sie möge sich doch ja in Geduld fassen und nicht verzweifeln deshalb, denn der gleichen Dinge wären schon manchen vornehmen Leuten begegnet. So hatten nun diese schändlichen Weiber ihr boshaftes, gottloses Vorhaben ausgeführt und jetzt blieb nur noch übrig, diesen armen, unschuldigen Kindern den Tod zu geben.
Allein Gott wollte nicht, dass sie ihre Hände mit ihrem eigenen Blute befleckten; sie nahmen also einen kleinen, wohlverpichten Kasten, legten die Kinder hinein, warfen ihn in den nahen Fluß und ließen ihn mit dem Strom fort treiben. Der gerechte Gott, welcher immer die Unschuld schützt, sandte gerade, als der Kasten geschwommen kam, an das Ufer dieses Flusses einen Müller. Als dieser den Kasten erblickte, zog er ihn heraus, öffnete ihn und fand die drei Kinderchen, die ihn lächelnd ansahen.
Und weil sie so schön waren, glaubte er, es müssten die Kinder irgend einer vornehmen Frau sein. Er machte nun den Kasten halb wieder zu, nahm ihn auf die Schulter und trug ihn geradeswegs nach Hause, wo er zu seiner Frau sagte: „Da sieh einmal, ich bitte dich, liebe Frau, was ich an dem Ufer des Flusses gefunden habe! Ich mache dir ein Geschenk damit." Als die Frau diese hübschen Kinderchen sah, freute sie sich sehr und zog sie mit solcher Liebe auf, als ob es ihre eigenen gewesen wären. Den einen Knaben nannte sie Aquirino, den anderen Fluvio, weil er in einem Fluss gefunden worden und das Mädchen Serena.
König Lancelot inzwischen freute sich schon in voraus, wenn er an seine Heimkunft dachte, an die drei holden Kinderchen, die er finden würde. Seine Hoffnung aber wurde sehr vereitelt, denn die boshafter Mutter erfuhr kaum, dass ihr Sohn dem Palast nahe war, so lief sie ihm entgegen und erzählte ihm, seine teure Gemahlin habe anstatt dreier Kinder drei junge Hunde geboren. Hierauf führte sie ihn in das Zimmer, wo die unglückliche Claretta in tiefem Kummer lag und wies ihm die drei Hündchen an ihrer Seite.
Obgleich nun die Königin unter heißen Tränen versicherte, dies könnten ihre Kinder nicht sein, so bestätigten doch die nichtswürdigen Schwestern die Aussage der gottlosen Mutter. Der König geriet hierüber in die heftigste Bestürzung und wäre vor Schmerz fast zur Erde gesunken; als er jedoch wieder zur Besinnung kam, lieh er den Worten seiner Mutter unbedingt Glauben. Weil indes die arme Königin so geduldig war und standhaft die Angriffe des Neides und der Bosheit über sich ergehen ließ, so konnte es der König nicht übers Herz bringen, sie sterben zu lassen, sondern er befahl, sie unter den Ort zu bringen, wo man das Kochgeschirr und die Teller abwusch, und der Abgang aus diesem ekelhaften Spülwasser, der da hinab fiel, sollte ihr zur Nahrung dienen.
Während nun die arme Königin in diesem widerwärtigen Aufenthalt ihr Leben zu brachte, gebar die Frau des Müllers einen Sohn, den sie mit den drei anderen Kindern liebevoll erzog. Jeden Monat pflegte die Frau ihren Kleinen die Haare zu beschneiden, aus denen kostbare Perlen und Edelsteine heraus fielen, so dass der Müller sehr bald ein reicher Mann wurde, sein Handwerk aufgab und mit Frau und Kindern ganz vergnügt und behaglich lebte.
Als die drei fremden Kinder heranwuchsen, erfuhren sie, dass sie nicht die leiblichen Kinder des Müllers und der Müllerin seien, sondern dass man sie auf dem Fluss gefunden habe. Sie gerieten darüber in große Unruhe, entschlossen sich, ihr gutes Glück zu versuchen, nahmen Abschied von ihren Pflegeeltern und gingen davon, womit der Müller und dessen Frau gar nicht zufrieden waren, denn sie sahen sich dadurch des großen Gewinnes beraubt, der ihnen aus den goldenen Locken Jener zufiel.
Die drei Geschwister nun reisten so lange, bis sie endlich in der Hauptstadt ihres Vaters anlangten. Da selbst verweilten sie, mieteten sich ein Haus, welches sie miteinander bewohnten und ernährten sich von dem Ertrage der Edelsteine und Perlen, die ihnen vom Kopfe fielen.
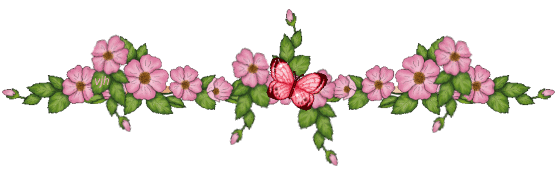
Eines Tages ging der König mit einigen anderen Hofleuten spazieren und zufällig traf es sich, dass sie vor dem Haus der drei Geschwister vorbeikamen. Diese, welche den König noch nie gesehen hatten, eilten so gleich hinab an die Haustür, entblößten ihr Haupt, beugten das Knie und verneigten sich ehrfurchtsvoll bis zur Erde. Der König, der einen Falkenblick hatte, betrachtete sie aufmerksam und sah, dass sie einen Stern auf der Stirn hatten, und so gleich durchzuckte ihn auch eine Ahnung, dies seien seine eigenen Kinder. Er hielt also an und fragte sie: „Wer seid ihr, woher kommt ihr?"
„Ich heiße Aquirino," erwiderte der eine, „und ich Fluvio," der andere, „und ich," sagte das Mädchen, „heiße Serena." „Nun wohlan," sagte der König, „ich lade euch ein, morgen bei mir zu speisen." — Die jungen Leute wurden zwar ein wenig verlegen hierüber; da sie indes die Ehre, welche ihnen der König erwies, nicht ablehnen konnten, so nahmen sie die Einladung an.
Als der König in seinen Palast zurück gekehrt war, sagte er zu seiner Mutter: „Als ich heute spazieren ging, sah ich zwei sehr schöne Jünglinge nebst einem sehr anmutigen Mädchen; alle drei hatten einen goldenen Stern auf der Stirn, und wenn mich meine Ahnung nicht täuscht, so sind das die Kinder, welche die Königin Claretta mir einst versprochen hat."
Bei diesen Worten wurde der ruchlosen Mutter, als ginge ihr ein Dolchstich durchs Herz. Sie ließ sogleich die Hebamme rufen, welcher man die Kinder übergeben hatte und fragte sie heimlich: „Was sagt ihr dazu, Mutter, dass die Kinder des Königs am Leben sind und schöner als je?" „Wie ist das möglich?" versetzte die Hebamme, „sind sie denn nicht im Fluss ertrunken? Und woher wisst ihr denn das?" „So viel ich aus den Worten des Königs entnehme," entgegnete jene, so sind sie am Leben, und ich habe also euren Beistand jetzt sehr nötig, sonst sind wir in Todesgefahr." „Ängstigt euch nicht, gnädige Frau," sagte die Hebamme, „denn ich hoffe mein Spiel so zu karten, dass sie alle drei ihren Tod finden."
Und damit ging sie schleunig hinweg und begab sich geradeswegs in die Wohnung der drei Geschwister, wo sie Serena ganz allein fand. Sie grüßte sie freundlich und nachdem sie eine Zeitlang über dies und jenes mit ihr geschwatzt hatte, sagte sie: „Mein schönes Kind, hast du nicht vielleicht ein wenig von dem tanzenden Wasser?" „Nein," sagte das Mädchen. „Ach, mein Töchterchen, was für herrliche Dinge würdest du sehen, wenn du von dem tanzenden Wasser hättest, und wenn du dir nur ein einziges Mal das Gesicht damit wüschest, so würdest du noch tausendmal schöner werden, als du schon jetzt bist". „Aber wieso soll ich es denn anfangen," fragte Serena, „um davon zu bekommen?" „Ei nun," sagte die Alte, „du musst deine Brüder aus schicken, es zu suchen und sie werden es auch ganz gewiss finden, denn es ist nicht gar weit von hier." — Nach diesen Worten ging sie fort.
Als die Brüder Fluvio und Aquirino nach Haufe kamen, lief ihnen Serena ihnen entgegen, bat sie, ihr doch die Liebe zu tun und sich alle Mühe zu geben, ihr von dem tanzenden Wasser zu verschaffen. Anfänglich spotteten die Brüder darüber und wollten nichts damit zu tun haben, da sie nicht wussten, wo sie es finden sollten. Endlich aber, bewogen von den inständigen Bitten ihrer Schwester, nahmen sie eine Flasche und machten sich auf den Weg.
Sie waren schon eine gute Strecke gegangen, als sie an eine sehr klare, frische Quelle gelangten, aus welcher eine schöne weiße Taube trank, die ganz ohne Furcht zu ihnen sagte: „Jünglinge, was sucht ihr?" Fluvio antwortete: „Wir suchen nach einem kostbaren Wasser, welches tanzt, wie man sagt." „O ihr Ärmsten," rief die Taube, „wer hat euch nach diesem Wasser ausgeschickt?" „Unsere Schwester," erwiderte Fluvio. Darauf sagte die Taube: „Wahrhaftig, ihr geht eurem Tod entgegen, denn es hat dort eine Menge giftiger Tiere, die euch auf der Stelle verschlingen werden. Aber lasst mich dafür sorgen, ich werde euch davon bringen."
Darauf nahm sie die Flasche, welche die Jünglinge mit gebracht hatten, band sie unter ihren rechten Flügel und flog davon. Sie flog nach dem Ort, wo sich das kostbare Wasser befand und nachdem sie die Flasche damit gefüllt hatte, kehrte sie zu den Jünglingen zurück, die sie mit großer Sehnsucht erwarteten. Diese empfingen das Wasser, sagten der Taube den gebührenden Dank und kehrten nach Hause zurück. Als sie jedoch das Wasser ihrer Schwester übergaben, baten sie die selbe sehr ernstlich, sie in Zukunft mit der gleichen Aufträgen zu verschonen, da sie in Todesgefahr gewesen wären.
Ein paar Tage darauf begegnete der König wiederum den jungen Leuten und sagte zu ihnen: „Warum seid ihr denn nicht am anderen Tag gekommen, mit mir zu speisen? Ihr hattet ja doch die Einladung angenommen?" „Verzeihen eure Majestät," antworteten sie, „dringende Geschäfte waren Schuld daran." Darauf sagte der König: „Nun, so erwarte ich euch morgen zu Mittag und bleibt dies Mal nicht aus," worauf sich die jungen Leute nochmals entschuldigten.
Als der König in den Palast zurück gekehrt war, erzählte er seiner Mutter, er habe die Jünglinge wieder gesehen mit dem goldenen Stern auf der Stirn. Sie geriet darüber in die äußerste Bestürzung und ließ auf der Stelle die Hebamme kommen, der sie alles erzählte und sie dringend bat, doch alles Mögliche zu tun, um die Gefahr abzuwenden. Die Alte tröstete sie und sagte, sie solle nur ganz ohne Sorge sein, sie wolle schon machen, dass man nie wieder etwas von ihnen höre. Darauf verließ sie schleunig den Palast und begab sich in die Wohnung der Jungfrau, fand diese allein und fragte sie, ob sie schon von dem tanzenden Wasser habe?"
Serena bejahte es, aber es sei nicht ohne große Gefahr für ihre Brüder geschehen. „Ich wünschte dir wohl, mein Töchterchen," sagte die Hebamme, „dass du nun auch noch einen singenden Apfel bekämst; denn in deinem ganzen Leben hast du noch nichts so Schönes gesehen und noch nie einen so anmutigen Gesang gehört." „Ich weiß aber nicht, wie ich ihn bekommen soll," versetzte Serena, „denn meine Brüder werden gewiss nicht danach gehen wollen, weil sie schon einmal dem Tode näher gewesen sind als dem Leben."
„Sie haben dir schon das tanzende Wasser gebracht," sprach das heuchlerische Weib, „und sind nicht davon gestorben, und wie sie dir das Wasser geholt haben, werden sie dir auch wohl den Apfel verschaffen können." Und damit nahm sie Abschied und ging hin weg. Sie war nicht sobald fort, als die Brüder kamen und Serena zu ihnen sagte: „Ach, meine lieben Brüder, ich möchte gar zu gern den singenden Apfel besitzen und mich an ihm ergötzen, wie er so anmutig singt, und wenn ihr nicht tut, um was ich euch bitte, so glaubt nur, dass ich in Kurzem tot sein werde."
Die Brüder waren sehr unwillig darüber und entgegneten ihr, sie hätten nicht Lust, um ihres Gelüstes willen ihr Leben aufs Neue in Gefahr zu setzen, wie sie es schon einmal getan hätten. Aber Serena bat so inständig, weinte und seufzte so kläglich, dass ihre Brüder sich endlich entschlossen, ihr zu Willen zu tun, es möge daraus entstehen, was da wolle, worauf sie zu Pferde stiegen und fort reisten.
Nach einiger Zeit kamen sie an ein Wirtshaus, traten hinein und fragten den Wirt, ob er ihnen sagen könne, wo der Apfel zu finden sei, der so schön singe. Er wisse es wohl, war die Antwort, aber dahin könnten sie unmöglich gelangen, denn er befinde sich in einem herrlichen Garten, der von einem furchtbaren Tier bewacht werde, welches Jeden verschlinge, der sich nur nahe. „Was sollen wir denn nun tun?" fragten die Jünglinge, denn haben müssen wir ihn, es komme, wie es wolle."
Da entgegnete der Wirt: „Wenn ihr tun wollt, was ich euch sage, so werdet ihr den Apfel bekommen, ohne dass euch das Tier etwas anhat. Ihr müsst," fuhr er fort, „diesen Mantel nehmen, der ganz mit Spiegeln bedeckt ist, und Einer von euch muss ihn sich umhängen und so bekleidet ganz allein in den Garten gehen, dessen Tür ihr offen finden werdet. Der andere aber bleibe draußen und lasse sich um Himmelswillen nicht sehen. Sobald nun Jener in den Garten tritt, wird ihm das Tier entgegen kommen und wenn es sich selbst in den Spiegeln erblickt, augenblicklich tot zur Erde fallen. Hierauf gehe er zu dem Baum mit dem singenden Apfel, pflücke diesen behutsam ab und hüte sich ja, rückwärts zu schauen, wenn er den Garten verlässt."
Die Jünglinge dankten dem Wirt verbindlichst und taten ganz so, wie ihnen Jener geraten hatte. So gelangten sie denn in den Besitz des singenden Apfels und brachten den selben ihrer Schwester, die sie ermahnten, ihnen ja zum letzten Mal einen so gefährlichen Auftrag gegeben zu haben.
Nach einigen Tagen traf der König wieder die beiden jungen Leute, ließ sie zu sich rufen und sprach: „Was für ein Grund hat euch abgehalten, zu mir zu kommen und mit mir zu speisen, nachdem ihr mir eure Zusage gegeben hattet?" „Geschäfte von sehr großer Wichtigkeit," antworteten die Jünglinge, „haben uns dieses Glückes beraubt." „Nun denn, so sei es also für morgen," sagte der König, „und dass ihr nur ja nicht aus bleibt!" Worauf Aqnirino versicherte, sie würden mit Vergnügen erscheinen, wenn sie nicht irgend wie durch sehr wichtige Angelegenheiten daran verhindert werden sollten.
Als der König nach Haufe kam, sagte er zu seiner Mutter, er habe schon wieder die jungen Leute gesehen, die ihm recht am Herzen lägen, weil er immer jener Kinder gedenke, die ihm Claretta einst versprochen habe, und er habe keine Ruhe eher, als bis sie einmal zu Mittag bei ihm gespeist hätten.
Die gottlose Mutter geriet bei diesen Worten in noch größere Sorge als je, denn sie fürchtete, nun würde alles entdeckt werden. Sie schickte also voller Angst nach der Hebamme, ließ sie holen und sagte zu ihr: „Gute Mutter, ich meinte schon, es wäre um die Kinder geschehen und man werde nie mehr etwas von ihnen hören; allein sie leben noch, während wir in Todesgefahr sind." „Kümmert euch doch ja nicht, Hoheit," versetzte die Hebamme, „denn ich will es schon dahin bringen, dass kein Hahn mehr nach ihnen kräht."
Und damit lief sie ganz aufgebracht und voller Bosheit zu Serena, bot ihr guten Tag und fragte, ob sie nun den singenden Apfel habe. Ja," sagte das Mädchen, „ich besitze ihn." Aber das schlaue Weib fuhr fort: „Der singende Apfel und das tanzende Wasser sind wohl ganz gut, bei alledem aber hast du noch nichts, wenn du nicht auch das besitzest, was ohne Vergleich tausendmal schöner und reizender ist, als jene ersten Beiden." „Nun, so sagt mir doch, was ist es denn?" fragte Serena neugierig. „Es ist ein schöner goldgrüner Vogel," versetzte jene, „der Tag und Nacht plaudert und wunderbare Dinge erzählt. Ja, wenn du den in deiner Gewalt hättest, so wärst du wohl das glücklichste Mädchen von der Welt." — Und mit diesen Worten ging sie fort.
Die Brüder waren kaum zu Hause angekommen, als Serena sie bat, sie möchten ihr doch nur noch eine einzige Gunst erweisen. Und als jene fragten, worin diese Gunst bestehen solle, antwortete sie, sie verlange den schönen goldgrünen Vogel. Fluvio, welcher dem giftigen Tiere entgegen gegangen war und jene außerordentliche Gefahr noch lebendig vor Augen hatte, schlug es ganz bestimmt ab, sich wieder auf den Weg zu machen. Aquirino aber, obgleich er sich auch anfänglich wiederholt weigerte, war endlich doch von seiner brüderlichen Liebe und von den heißen, unaufhaltbaren Tränen bewegt, welche Serena vergoss, und so beschlossen denn alle Beide miteinander, ihren Willen zu tun.
Sie setzten sich zu Pferde und nachdem sie mehrere Tage geritten waren, kamen sie auf eine grüne, blumige Wiese, in deren Mitte ein sehr schöner, hoher und dicht belaubter Baum stand, umgeben von mehreren Bildsäulen aus Marmor, die wie lebendig schienen; und dicht daneben lief ein kleiner Bach, der die ganze Wiese bewässerte. Auf diesem Baum nun hüpfte der goldgrüne Vogel lustig von Zweig zu Zweig und redete so klug und noch viel klüger als ein Mensch. Die Jünglinge stiegen von ihren Pferden, ließen sie auf der schönen Wiese weiden und näherten sich den Bildsäulen von Marmor, allein so bald sie die selben berührten, verwandelten sie sich gleichfalls in ein paar Bildsäulen.
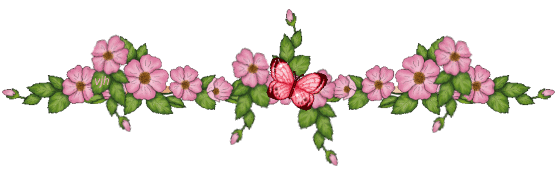
Als Serena ihre Brüder die längste Zeit vergebens erwartet hatte, meinte sie schon, sie auf immer verloren zu haben und gab jede Hoffnung auf, sie je wieder zu sehen. In diesem kummervollen Zustande, während sie unaufhörlich den jämmerlichen und elenden Tod ihrer Brüder beklagte, setzte sie sich zu Pferde, fest entschlossen, selbst ihr Glück zu versuchen. Sie ritt lange, Tag und Nacht, bis sie an den Ort gelangte, wo der goldgrüne Vogel auf dem Baum saß und anmutig redete. Sobald sie die Wiese betrat, erkannte sie sogleich die Pferde ihrer Brüder, die hier weideten, und indem sie ihre Blicke bald hier, bald dort hin wendete, erkannte sie auch ihre Brüder, die sich in Stein verwandelt hatten und denen die Bildsäulen so vollkommen glichen, dass Serena aufs Höchste darüber erstaunte. Sie stieg vom Pferde, näherte sich dem Baum, streckte die Hand aus und ergriff den schönen grünen Vogel.
Als dieser sich seiner Freiheit beraubt sah, bat er flehentlich, sie möge so barmherzig sein und ihn loslassen; er wolle es ihr gedenken zur rechten Zeit und Stunde. Serena entgegnete ihm, sie würde das nicht eher tun, als bis er ihre Brüder wieder in den früheren Zustand versetzt habe. Darauf sagte der Vogel zu ihr: „Schau unter meinen linken Flügel, so wirst du eine Feder bemerken, welche viel grüner ist als die übrigen und einige gelbe Punkte in der Mitte hat. Diese Feder zieh mir aus, gehe damit zu den Bildsäulen und sobald du ihnen die Augen mit der Feder berührt hast, werden deine Brüder in ihren früheren Zustand zurück kehren."
Das Mädchen hob den linken Flügel in die Höhe, fand die Feder, welche der Vogel ihr bezeichnet hatte und berührte damit nach einander die Augen der marmornen Bilder, worauf sie so gleich wieder zu Menschen wurden, zur großen Freude der Schwester, welche ihre Brüder gar nicht genug umarmen und küssen konnte.
Da Serena ihre Absicht nun erreicht hatte, so bat sie der grüne Vogel von Neuem, ihm jetzt doch seine Freiheit zu geben und versprach ihr, diesen Dienst eines Tages mit einem anderen zu vergelten, wenn sie je seines Beistandes bedürfe. Aber Serena war noch nicht zufrieden gestellt; sie entgegnete ihm, sie würde ihn nicht eher frei lassen, als bis sie erfahren hätte, wer ihre Eltern seien, und er möge also bis dahin geduldig sein Schicksal ertragen.
Nun war aber die große Frage, wer den Vogel tragen solle; nach langem Hin- und Herreden kam man endlich überein, dass ihn Serena nehme, die ihn mit großer Sorgfalt und Anmut bewahrte und ihn immerzu streichelte und liebkoste. Die Brüder stiegen jetzt zu Pferde und Serena, im Besitz des grünen Vogels, kehrte ganz vergnügt mit ihnen heim.
Der König, welcher an dem Hause der Geschwister oft vorüber ging, war sehr verwundert, sie gar nicht mehr zu erblicken und fragte die Nachbarn, was aus ihnen geworden sei; worauf er jedoch zur Antwort erhielt, man wüsste nichts weiter von ihnen und es sei schon sehr lange her, als man sie zuletzt gesehen habe. Als sie wieder zurück gekommen waren, vergingen nicht zwei Tage, so bemerkte sie auch der König schon und fragte, wo sie so lange Zeit gewesen seien, dass man sie gar nicht gesehen habe.
Aquirino erwiderte, es hätten sich sehr wunderbare Dinge mit ihnen zugetragen, und wenn sie nicht, ihrem Versprechen gemäß, gekommen wären, so bäten sie um seine Verzeihung und zugleich um die Erlaubnis, ihren Fehler wieder gut machen zu dürfen. Als der König von ihrem Missgeschick hörte, bedauerte er sie sehr und wollte nicht eher fort gehen, als bis sie mit ihm in seinen Palast kämen, um dort in seiner Gesellschaft zu speisen. Da nahm Aquirino heimlich das tanzende Wasser, Fluvio den singenden Apfel und Serena den schönen grünen Vogel und so folgten sie dem König fröhlich nach dem Palast und setzten sich mit ihm zur Tafel.
Wie die boshafte Mutter und die neidischen Schwestern das schöne junge Mädchen sahen und die feinen anmutigen Jünglinge, deren Augen wie Sterne leuchteten, wussten sie sich vor Angst und Grimm kaum zu lassen. Als die Mahlzeit vorüber war, sagte Aquirino zum Könige: „Wenn eure Majestät genehmigen, so wollen wir hier verschiedene Dinge zeigen, die sich gewiss eures Beifalls erfreuen werden."
Darauf nahm er einen silbernen Becher, goss das tanzende Wasser hinein und setzte es auf den Tisch. Dann zog sein Bruder Fluvio den singenden Apfel aus seinem Busen hervor und legte ihn neben das Wasser, und Serena, die den schönen grünen Vogel auf ihrem Schoß hatte, setzte ihn ebenfalls rasch auf die Tafel. Da hättet ihr einmal den lieblichen Gesang hören sollen, nach dessen Tönen das Wasser ganz wundersam zu tanzen begann! Der König und alle Anwesenden empfanden das lebhafteste Vergnügen dabei, nur der schändlichen Mutter und den nichtswürdigen Schwestern gereichte es zur größten Unlust, denn sie verzweifelten immer mehr an ihrem Leben.
Als Gesang und Tanz vorüber war, fing der Vogel an zu sprechen: „O großer König," sagte er, „was verdient derjenige, der zweien Brüdern und einer Schwester nach dem Leben getrachtet hat?" Die Mutter antwortete rasch: „Nichts Geringeres als den Feuertod," und alle Übrigen stimmten mit ein. Da erhoben das tanzende Wasser und der singende Apfel ihre Stimme und sagten: „O du falsche, abscheuliche Mutter, dein eigener Mund hat dich verdammt. Und ihr nichts würdigen Schwestern, ihr habt euch gleicherweise verdammt nebst der verräterischen Hebamme."
Der König war ganz erstaunt über diese Reden, aber der grüne Vogel nahm wieder das Wort und sprach: „Majestät, diese hier sind deine drei Kinder, nach denen du dich so lange gesehnt hast. Deine Kinder sind es, die einen goldenen Stern auf der Stirn tragen. Und ihre unschuldige Mutter ist jene, die bis jetzt ihr Leben an jenem abscheulichen Aufenthalt zugebracht hat."
Sogleich ließ der König sie aus jenem ekelhaften Ort hervor ziehen, standesgemäß bekleiden und herbei führen. Und obgleich sie in ihrem traurigem Kerker so lange Zeit und auf so elende Weise zugebracht hatte, war dennoch ihre frühere Schönheit vollkommen erhalten. Jetzt erzählte der grüne Vogel in Gegenwart Aller, wie sich alles von Anfang bis zu Ende zugetragen hatte. Als der König den ganzen Zusammenhang erfuhr, umarmte und küsste er seine geliebte Gemahlin und seine teuren Kinder unter vielen Tränen und Seufzern. Das tanzende Wasser aber, der singende Apfel und der schöne grüne Vogel waren mit einmal, da Niemand auf sie Achtung gab, verschwunden.
Am folgenden Tage ließ der König mitten auf dem Markte ein großes Feuer anzünden und die Mutter nebst den beiden Schwestern wurden vor allem Volk ohne Gnade verbrannt. Darauf lebte der König noch lange Zeit mit der Königin und seinen drei reizenden Kindern. Er verheiratete seine Tochter angemessen und hinterließ seinen Söhnen das Reich.
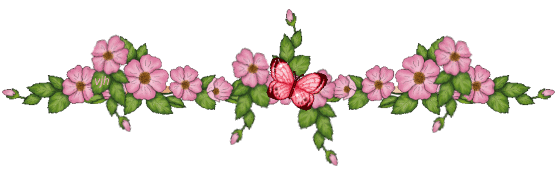
DER HÖLLENPFÖRTNER ...

Einstmals war ein alter Vater, der einen grossen Sohn hatte. Dieser wollte durchaus nichts arbeiten. Da sagte eines Tages der Vater zum Sohne: »Der Mensch ist zur Arbeit geboren, etwas muss der Mensch machen, sei es nun, was es wolle. Sage mir daher aufrichtig, willst du künftig arbeiten oder betteln oder in einen Dienst gehen?« Da antwortete der Sohn: »Ich will in einen Dienst gehen.« »Gut«, sagte der Vater, »ich bin zufrieden, und sollte der Teufel selber kommen, dich in seine Dienste zu nehmen, mir ist es recht.«
Da gingen beide, einen Dienst zu suchen. Unterwegs begegnete ihnen ein vornehmer Herr und befragte sie um das Ziel ihrer Reise. »Ich gehe, einen Dienst für meinen Sohn da suchen«, antwortete der Vater. »Gebt mir ihn«, fuhr der Herr fort, »ich brauche eben einen Portier, und der Bursche ist groß und stark.« »Was willst du für einen Lohn haben?« redete er den Sohn an. »Sieben Soldi«, antwortete dieser. »Das ist denn doch gar zu wenig«, sagte der Herr, »ich werde dir zwanzig Soldi geben. Du hast keine andere Arbeit, als die Türe auf und zuzumachen, aber wehe dir, wenn du hinein gehst.«
Da trat der Junge seinen Dienst an, war aber nicht wenig erstaunt, zu sehen, dass so viele Leute zur Türe hinein gingen, aber keiner mehr heraus kam. Unter den Hineingehenden waren dann viele, die er persönlich kannte, z.B. der Pfarrer und Gemeindevorstand (primo deputato) von seinem Orte, ja sogar sein eigener Großvater. Was mag das sein? dachte er oft; aber es dauerte lange, bis er eine Ahnung davon bekam, wer sein Herr sei.
Als er ein volles Jahr diesen Dienst versehen hatte, bekam er ihn satt und kündigte seinem Herrn. Diesem war es gar nicht recht, denn er musste sich um einen anderen Portier umsehen. »Nun«, sagte der Herr, »wenn du durchaus nicht bleiben willst, so komme her und nimm dir als Lohn, so viel du da willst«, und dabei führte er ihn zu einem großen Kasten voll Gold. »Nimm«, sagte er, »was du brauchst«, als er sah, dass der Diener zögerte. »Nein«, sagte dieser, »ich bitte bloß um meinen Lohn, um keinen Heller mehr noch weniger«, und als ihm der Herr die zwanzig Soldi gegeben hatte, zog er lustig seines Weges, bis er einem Armen begegnete, der ihn um ein Almosen ansprach.
»Da nimm fünf Soldi«, sagte er, »so bleiben für mich noch vier Soldi auf Tabak, fünf auf Brot und sechs Soldi auf Wein.« Dann begegnete ihm ein anderer Bettler, dem er wieder fünf Soldi gibt. »Nun«, sagte er zu sich, »jetzt muss ich mein Vermögen anders einteilen, denn jetzt bleiben mir nur drei Soldi auf Tabak, drei auf Brot und vier auf Wein«, und somit ging er weiter. Da begegnete ihm ein dritter Bettler: »Addio Tabak«, ruft er lachend aus, »aber man kann auch mit fünf Soldi Brot leben«, und somit gab er auch diesem fünf Soldi. Da kommt ein vierter Bettler. »Gott sei Dank«, sagt er und gibt ihm die letzten fünf Soldi, »jetzt brauche ich mir mit dem Rechnen nicht den Kopf zu zerbrechen.« Da erscheint endlich ein fünfter Bettler und bittet um ein Almosen. »Freund!« sagt er zu diesem, »was ich hatte, habe ich weg geben, und jetzt kann ich nimmer dafür gut stehen, dass ich den Nächsten, der mir begegnet, nicht selbst anbetteln muss.«
Da warf sich der Bettler in die Brust und sprach: »Ich brauche euer Almosen nicht, welche Gnade wollt ihr von mir, so begehrt es.« »Herr«, antwortete unser Reisender, »vom Almosen betteln bis zum Gnaden austeilen ist ein hübscher Sprung; Gevatter, gebt Acht, dass ihr euch dabei nicht den Fuß verstaucht. Das müssen saubere Gnaden sein, die ihr auszuteilen im Stande seid.«
»Fordert also«, erwiederte der Bettler, »ohne euch den Kopf lange zu zerbrechen, und ihr werdet sehen.« »Wohlan, so gebt mir eine Flinte, die nie fehlt.« »Gut, da habt ihr die Flinte«, sagte der Bettler, in dem er sie unterm Mantel hervor zog, »wollt ihr noch etwas?« »Ja, eine Geige, die Alles tanzen macht, so lange sie gespielt wird.« »Da habt ihr die verlangte Geige«, sagte der Bettler, »sonst wollt ihr nichts mehr?« »Ja, einen Sack, in den jeder springen muss, dem ich es befehle.« »Hier habt ihr auch den Sack, und jetzt lebt wohl«, sagte der Bettler und ging fort.
Groß war des Burschen Freude über den Besitz dieser drei Dinge, und er sehnte sich darnach, sie probieren zu können. Da fliegt ein schöner Vogel an ihm vorüber und setzt sich auf einen ziemlich weit entfernten Haufen Reisigholz. Halt, denkt der Bursche, an dem will ich meine Flinte probieren, und macht sich schussfertig. Da kommen zwei Fratres des Weges gezogen. »Sauberer Schütze ihr!« ruft einer, »ist das auch ein Augenmaß? Den Vogel zu treffen braucht ihr eine Kanone, die Flinte reicht auf diese Ferne nicht aus.« »Und doch werde ich ihn treffen«, antwortete unser Bursche.
»Nun«, sagt der Frater, »wenn ihr ihn trefft, so will ich ihn nackt aus dem Holze holen.« Da brennt er los, der Vogel stürzt und der Bursche sagt: »Nun, jetzt haltet euer Wort und holt ihn.« Der Frater aber war ein Mann von Wort, warf die Kutte weg und ging den Vogel holen. Kaum war der Frater im Holze, so nahm der Bursche die Geige und begann zu spielen, die beiden Fratres aber, der eine auf der Strasse, der andere im Holze, fingen an zu tanzen. Besonders übel war der Nackte daran, denn er ließ die halbe Haut an den Dornen hängen und schrie fürchterlich. Als dieser schon wie Lazarus voll Wunden war, hörte der Bursche zu geigen auf, die beiden Mönche aber gingen in die nächste Stadt und verklagten ihn bei der Polizei, die ihn, kaum als er angekommen war, sogleich rufen ließ.
Wirklich erschien er auch um Mittag, gerade als der Kommissär beim Essen war. »Wartet, bis ich gegessen habe«, fuhr ihn dieser unwillig an. »Gerne«, antwortete unser Bursche, »und wenn ihr mir erlaubt, so will ich euch zur Tafel Musik machen«, und nahm seine Geige zur Hand. Nach dem ersten Bogenstrich begann in dem Zimmer des Kommissärs ein sonderbares Ballet. Die Teller und Schüsseln, der Tisch, die Sessel, der Kommissär, seine Frau und Kinder, die Hauskatze, die Magd, die auftrug, ein Amtsdiener, der melden kam, alle tanzten mit teils erschrockenen, teils grimmigen Gesichtern einen Monferino.
Als der letzte Tropfen Suppe aus der Schüssel und der Wein aus der Flasche gesprungen war, als schon Tisch und Sessel einige Füsse und die lebenden Tänzer und Tänzerinnen den Atem verloren hatten, hörte er auf zu geigen, aber der erschöpfte Kommissär hatte durchaus keine Lust mehr, das Verhör zu beginnen, sondern das erste Wort, das er von sich zu geben im Stande war, war: »Geht zum Teufel!« –
Da ging er denn wieder auf die Strasse und setzte seine Reise fort. Der erste, der ihm begegnete, war sein früherer Herr. Flugs öffnete er seinen Sack und kommandierte: »Spring hinein!« Da bat der Herr so flehentlich, ihn heraus zu lassen, aber umsonst. »Warte, bis ich gegessen habe«, antwortete er ihm und trug ihn zu einem nahen Eisenhammer. »Ich habe hier Eisen zu klopfen«, spricht er beim Eintritt zum Hammerschmied. »So gebt es heraus«, antwortete dieser. »Nein, ich will, dass ihr es im Sacke hämmert.« »Und ich sage euch, dass ich nichts hämmere, was ich nicht sehe.«
Da nahm er seine Geige und machte den Hammerschmied und seine Gesellen tanzen, dass ihnen allen der Atem ausging. »Wollt ihr jetzt hämmern?« fragte er. »Jawohl«, schrien alle im Chor, »und wenn der Teufel selbst im Sacke steckte.«
»Der ist auch wirklich darin.« »Warum habt ihr das nicht gleich gesagt?« rief der Meister; »nun der soll geklopft werden, dass ihr eure Freude daran habt. Kein Horn soll ihm ganz bleiben, und wäre es noch so hart.« Als der Teufel durch eine ganze Stunde gehämmert worden war, so ließ er ihn aus dem Sacke. »Warte nur, Spitzbube!« sagte dieser im davon laufen, »wenn ich dich einmal unter die Sohlen (sotto le mie ciabatte) bekomme, dann sollst du das Kapital samt den Interessen zurückbekommen.«
Als er wieder weiter zog, begegnete er einem hübschen Bauernweibe, das ihm sehr gefiel. »Kommt doch mit mir«, sagte er ihr. »Lasst mich ungeschoren«, antwortete die Bäuerin. »Wollt ihr freiwillig mit mir kommen, so ist mir es lieb, wo nicht, so werdet ihr doch mit mir kommen müssen.« »Packt euch, ihr Lump«, erwiderte sie ihm und vergalt ihm eine Zärtlichkeit mit einer kräftigen Ohrfeige. Da öffnete er im Zorne seinen Sack und schrie: »Spring hinein«, aber in der Hast schloss er den Sack zu schnell, so dass sie mit dem Kopfe heraus blieb und um Hilfe rufen konnte. Er lief schnell mit ihr davon, aber die Bauern sprangen aus allen Häusern heraus, liefen ihm nach und suchten ihm den Weg abzuschneiden, so dass er endlich den Sack mit der Bäuerin weg werfen und zur Flinte greifen musste.
Erst als er einen seiner Verfolger niedergeschossen hatte, ließ die Verfolgung in soweit nach, dass er endlich atemlos in einen Ort gelangen konnte. Da begegnete er einem alten, in Fetzen gekleideten Mütterchen. »Alte!« sagte er zu ihr, »könnt ihr mir nicht einen Ort zum Schlafen geben?« »Meinetwegen«, antwortete sie, »kommt mit mir«, und führte ihn in einen großen herrlichen Palast. Große Lichter hingen angezündet in allen Zimmern und im Saale war eine glänzende Tafel bereitet, aber keine Seele zu sehen. Das gefiel ihm sehr.
Er setzte sich daher nieder und tat den köstlichen Speisen und Weinen alle Ehre an, bis er satt war, worauf er sich in ein Nebenzimmer begab und auf ein Bett schlafen legte. Da erwachte er um die Mitternachtsstunde und sah das ganze Zimmer voll Herren mit Mänteln und großen Perücken, die mit ernsten Gesichtern tanzten und sprangen, bis sie auf einmal verschwanden und er sich in einem Flammenmeere befand.
Ha! dachte er, jetzt stehe ich frisch, da muss ich trachten weiter zu kommen. Da zog auf einmal Kavallerie durch das Zimmer. Halt, dachte er, da ist Gelegenheit zur Flucht und sprang aus dem Bette auf ein leeres Handpferd; doch das zerfloss ihm unter den Füssen, und er sank und sank stets tiefer, bis er bei der Pforte anlangte, bei der er vor wenig mehr als einem Jahre seine Laufbahn als Portier begonnen hatte und die ihm jetzt sein Nachfolger aufmachte.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien

DIE BÄRIN ...

Es war einmal ein König von Rocca-Aspra, welcher die Mutter der Schönheit selbst zur Frau hatte, die jedoch im besten Lauf ihrer Jahre vom Rosse der Gesundheit fiel und sich das Leben brach. Bevor ihr aber das Licht des Lebens ausging, rief sie ihren Gemahl, und sagte zu ihm: „Ich weiß, du hast mich immer herzlich geliebt, darum erfülle mir jetzt eine Bitte und versprich mir, dich nie wieder zu verheiraten, im Fall du nicht eine zweite Frau triffst, die so schön ist, als ich es gewesen bin. Tust du das nicht, so hinterlasse ich dir eine furchtbare Verwünschung, und werde dich noch von einer anderen Welt aus meine Rache empfinden lassen."
Der König, welcher seine Frau von Grund des Herzens liebte, brach, als er diesen Wunsch vernahm, in ein heftiges Weinen aus, und konnte lange Zeit kein Wort erwidern. Endlich sagte er zu ihr: „Ehe ich mich wieder nach einer Frau umsehe, eher soll mich die Erde verschlingen. Glaube doch ja nicht, meine geliebte Frau, dass ich jemals wieder für ein anderes Weib Zuneigung empfinden könne. Du warst die Geliebte meines Herzens, du nimmst auch mein Herz mit dir fort."
Während dieser Worte schloss die arme Königin röchelnd die Augen. Der König, als er sich von ihrem Tode überzeugt hatte, ließ seinen Tränen von Neuem freien Lauf, und brach in ein solches Weinen aus, dass der ganze Hof davon lief, während der König in einem fort den Namen seiner geliebten Gattin laut ausrief, das Schicksal, das sie ihm geraubt, verfluchte, und sich den Bart ausriss, Verwünschungen gegen die Gestirne ausstoßend, die ein solches Unglück über ihn gesendet hätten.
Aber weil er das bekannte Sprichwort: „Der Schmerz am Ellenbogen und um eine, hin geschiedene Frau tut sehr weh, dauert aber nicht lange“, an sich erfahren sollte, so war kaum noch die Nacht auf dem Paradeplatz des Himmels erschienen, um die Musterung über die Sterne abzuhalten, als er anfing an den Fingern folgende Rechnung zu halten. Meine Frau ist jetzt tot, und ich bin Witwer; ist es nun nicht traurig, dass ich ohne Hoffnung bleiben soll, noch andere Kinder um mich zu sehen, als allein diese unselige Tochter, welche sie mir zurück gelassen hat? Es wird also notwendig sein, an eine neue Vermählung zu denken. —
Aber was fällt mir ein, wo finde ich eine Frau, die an Schönheit meinem verstorbenen Weibe gleich käme, da jede andere doch im Vergleich mit ihr nur hässlich erscheinen muss! wo finde ich eine zweite von solchem Wuchs, von solcher Anmut, von solcher Schönheit, da die Natur, nach dem sie jene gebildet, die Form zerbrochen zu haben scheint! O weh, in welch ein Labyrinth hab ich mich gestürzt, wozu das unselige Versprechen, welches ich geleistet habe! Wie aber, ich habe den Wolf noch nicht gesehen und fliehe schon? erst wollen wir suchen und dann ratschlagen. Sollte die Welt wirklich auf immer für mich verloren sein — für mich allein hier alle Hoffnung verschwunden?"
Nach diesen Worten ließ er als bald eine Bekanntmachung durch das ganze Reich ergehen, die schönsten Frauen der ganzen Welt sollten sich einfinden zur Prüfung ihrer Schönheit, denn die schönste wolle er zum Weibe nehmen, und ihr ein Königreich als Morgengabe bringen. Als das Gerücht hiervon sich überall hin verbreitet hatte, so gab es auch nicht eine Frau in der ganzen Welt, die nicht herbei geeilt wäre ihr Glück zu versuchen. Da blieb auch keine, noch so hässliche, zurück, die sich zur Probe nicht gestellt hätte; denn sobald nur von der Schönheit die Rede ist, will selbst die abschreckendste Missgestalt freiwillig nicht zurückstehen. Sie sei die Schönste, denkt eine Jede, und nimmt die Wahrheit gar übel hin.
Als nun die Stadt ganz voll von Frauen war, so ließ der König sie in Reih und Glied stellen, und begann zwischen ihnen hin und her zu gehen, und in dem er sie von oben bis unten betrachtete, und bald diese, bald jene beäugelte, so schien die eine ihm eine zu niedrige Stirn zu haben, die andere eine zu lange Nase, die dritte einen zu großen Mund, die vierte zu dicke Lippen, die fünfte war zu lang, die sechste zu kurz, die siebente zu dick, die achte zu mager. Die Spanierin gefiel ihm nicht wegen ihres Teints, die Neapolitanerin nicht wegen ihres Ganges, die Deutsche schien ihm zu kalt und phlegmatisch, die Französin zu wunderlich und launisch, die Venetianerin kam ihm wie ein Bündel Flachs vor, ihrer weißlichen Haare wegen: mit einem Wort, er schickte sie alle fort, die Eine aus dem einen, die andere aus dem anderen Grunde.
Da er nun sah, dass so viel schöne Gesichter sich leer und ungenügend erwiesen hatten, er aber entschlossen war, seinen Willen auszuführen, so fiel ihm seine eigene Tochter ein, und er sprach bei sich: „Wozu suche ich Wasser in der Wüste, da doch Preziosa, meine eigene Tochter, ein so vollkommenes Ebenbild der Mutter ist. Ich habe dieses schöne Gesicht in meinem Hause, und suche es, wer weiß wo!" Als er jedoch diesen Gedanken seiner Tochter mitteilte, erhob sie ein unbeschreibliches Jammern und Weinen, worauf der König ganz wütend zu ihr sagte: „Schweig und halte deinen Mund, heute Abend ist unsere Hochzeit, sonst ist das Ohr das Geringste, was ich dir nehme."
Als Preziosa diesen Entschluss vernahm, zog sie sich in ihr Gemach zurück, und fing an so heftig und anhaltend zu weinen an, bis ihr die Tränen versiegten. In dem sie nun so kummervoll da saß, kam eine alte Frau, welcher sie manchmal ein Almosen gab, und da die Alte ihre Wohltäterin so niedergeschlagen sah, fragte sie nach der Ursache ihres Schmerzes. Darauf, als sie diese erfahren, sagte sie zu ihr:
„Sei gutes Mutes, meine Tochter, verzweifle nicht, denn für alles ist ein Kraut gewachsen, nur nicht für den Tod.
Jetzt höre: Wenn dein Vater heute Abend seinen Entschluss ausführen will, so stecke dir nur diesen Span in den Mund, und du wirst dich augenblicklich in eine Bärin verwandeln. Mache dich sodann aus dem Staube, denn aus Furcht wird er dich fliehen lassen, und begib dich gerades Weges in den Wald, wo der Himmel dir dein Glück seit dem Tage, da du geboren wurdest, aufbewahrt hat. Sobald du dich aber wiederum in einen Menschen verwandeln willst, so nimm dir den Span aus dem Munde, und sogleich wirst du deinen Wunsch erfüllt sehen." Preziosa umarmte hierauf die alte Frau, ließ ihr einen großen Beutel mit Mehl geben, ein gewaltiges Stück Schinken und Speck, und nahm darauf von ihr Abschied.
Als der Abend heran nahte, ließ der König die Feuerwerker kommen, lud alle Großen seines Hofes ein, und veranstaltete ein prächtiges Fest; und als es Abend geworden war, setzten sie sich zu Tische und fingen an tüchtig drauf los zu trinken. Der König begab sich hierauf zur Ruhe, und befahl, die Jungfrau, seine Tochter, herbei zu rufen, welche rasch den Span in den Mund nahm, und, verwandelt in die Gestalt einer schrecklichen Bärin, auf ihn los ging, worauf der König, vor Schrecken ganz außer sich, sich in die Betttücher einhüllte, und vor dem nächsten Morgen den Kopf nicht wieder heraus streckte.
Unterdessen ergriff Preziosa die Flucht, und begab sich in einen großen und dunklen Wald, wo selbst sie ihren Aufenthalt nahm. Dort nun lebte sie in der angenehmen Gesellschaft so vieler anderer Tiere, bis einstmals der Sohn des Königs von Aqua-Currente durch jenen Wald kam, und da er die Bärin erblickte, vor Furcht fast des Todes war. Das Tier jedoch näherte sich ihm, schmeichelnd und liebkosend, und mit dem Schwanz wedelnd wie ein Hündlein, worauf er ein Herz fasste, die Bärin streichelte, und ihr die schönsten Worte gab. Sodann führte er sie nach Hause, befahl sie zu pflegen wie ihn selbst, und ließ sie in einen Garten bringen, der an den königlichen Palast stieß, um sie, so oft er wollte, vom Fenster aus sehen zu können.
Als nun eines Tages alle Leute sich aus dem Hause entfernt hatten, und der Prinz allein zurück geblieben war, trat er, um die Bärin zu sehen, ans Fenster, und sah nun, wie Preziosa um sich das Haar zurecht zu machen, nachdem sie den Span aus dem Munde genommen hatte, sich die goldenen Flechten kämmte. Als der Prinz ihre Schönheit wahr nahm, geriet er vor Erstaunen und Verwunderung ganz außer sich, und, sogleich die Treppe hinunter stürzend, eilte er in den Garten hinab.
Preziosa aber, welche wahr genommen hatte, dass der Prinz sie belausche, steckte sich wiederum den Span in den Mund, und nahm ihre frühere Gestalt als bald wieder an. Als Jener unten anlangte, und das nicht fand, was er von oben gesehen hatte, ging ihm diese getäuschte Erwartung so nahe, dass er in einen tiefen Trübsinn, und vier Tage nach her in eine schwere Krankheit verfiel, wobei er in einem fort sagte: „Liebe Bärin, liebe Bärin."
Die Mutter, da sie diese Worte vernahm, bildete sich ein, die Bärin habe ihm irgend ein Leid zu gefügt, und befahl, sie zu töten. Allein die Diener, welche die zahme Bärin lieb gewonnen hatten, wollten nicht so grausam gegen sie handeln, sondern führten sie in den Wald zurück, und meldeten der Königin, sie hätten ihr das Leben genommen. Als diese Nachricht zu den Ohren des Prinzen gelangte, gebärdete er sich wie ein Wahnsinniger, stand krank, wie er war, aus dem Bette auf, und wollte die Diener für das was sie getan hatten, hart züchtigen, vernahm aber von ihnen was vorgefallen war.
Hierauf setzte er sich zu Pferde, und trabte so lange umher und suchte so emsig, bis er am Ende die Bärin wieder auf fand. Er brachte sie nun von Neuem nach Hause, führte sie in sein Zimmer, und sagte zu ihr: „O schönes Juwel, das sich in dieser abschreckenden Haut befindet, o Liebeslicht, in dieser Höhle von Pelz eingeschlossen, wozu wollen wir miteinander Versteckens spielen? Ich sterbe vor Sehnsucht nach dieser Schönheit, und du siehst den offenbaren Beweis, denn wie gekochter Wein bin ich zu einem Drittel Meiner selbst geworden, so dass ich nur noch aus Haut und Knochen bestehe. Daher nimm fort den Vorhang dieses hässlichen Felles, und lass mich den Glanz dieser Schönheit sehen, nimm fort die Blätter von diesem Korbe, und gewähre mir einen Anblick dieser schönen Früchte. Wer hat je wohl in einen aus Haaren gewebten Kerker ein so herrliches Werk eingeschlossen?"
Und viele ähnliche Worte dieser Art fügte er hinzu, da er aber sah, dass alle seine Reden fruchtlos blieben, streckte er sich von Neuem auf das Bett, und wurde von einem so heftigen Krankheitsanfall ergriffen, dass die Ärzte ihn fast verloren gaben.
Die Mutter, welche kein andres Glück auf Erden kannte, als ihren Sohn, sagte zu ihm: „Mein teures Kind, woher dieser Kummer, woher dieser Gram? Du bist jung und geliebt, du bist groß und reich, — sprich, denn ein verschämter Bettler behält die Tasche leer. Willst du eine Gemahlin, so wähle, und ich verschaffe sie dir; nimm du und ich bezahle; siehst du denn nicht, dass dein Leid das meine ist? Dir pocht der Puls, mir das Herz, du hast nur das Fieber, ich aber bin todkrank, denn ich habe keine andere Stütze meines Alters als dich. Daher fasse ein Herz, und erfreue das meinige, stürze dieses Reich, dieses Haus und deine Mutter nicht in endlosen Jammer."
Als der Prinz seine Mutter so reden hörte, sagte er: „Nichts in der Welt kann mich erfreuen, als nur der Anblick der Bärin. Wenn du mich also gesund sehen willst, so lass sie bei mir bleiben; Niemand anders als sie soll mich pflegen, mir das Bett machen, und mir die Mahlzeit bereiten, denn ich werde dann ohne Weiteres gesund werden."
Die Mutter wunderte sich zwar sehr, dass die Bärin den Koch und den Kammerdiener vorstellen sollte, und fürchtete fast, ihr Sohn rede im Fieber. Um ihn jedoch zufrieden zu stellen, ließ sie die Bärin herbei holen. Diese, als sie sich an dem Bette des Prinzen befand, hob die Tatze auf, und fühlte ihm an den Puls, so dass die Königin sich eines Lächelns nicht erwehren konnte. Der Prinz aber sagte zur Bärin: „Meine Liebe, willst du mir nicht kochen, mir zu essen geben und mich pflegen?“, worauf die Bärin mit dem Kopf nickte, und, wie es schien, den Vorschlag annahm.
Die Mutter ließ daher ein Paar Hühner bringen, in der Stube des Prinzen Feuer auf dem Herde anzünden und Wasser aufsetzen, worauf die Bärin ein Huhn ergriff, es tötete, abrupfte, ausnahm, einen Teil davon an den Spieß steckte und von dem anderen ein Ragout bereitete, so dass der Prinz, der früher keinen Bissen hatte essen wollen, sich jetzt die Finger danach leckte.
Hierauf gab die Bärin ihm mit so vieler Anmut zu trinken, dass die Königin sie vor Vergnügen auf die Stirn küsste. Nachdem alles dies geschehen, und der Prinz sich zu den Ärzten hinunter begeben hatte, machte die Bärin sogleich das Bett, eilte in den Garten, pflückte Rosen und Pomeranzen Blüten und streute sie über das Lager hin, so dass die Königin sagte, diese Bärin sei in der Tat ein wahrer Schatz, und der Prinz wohl bei Verstande, dass er ihr in solchem Grade zugetan sei
Als der Prinz aber das freundliche Benehmen der Bärin gewahr wurde, entbrannte er nur noch mehr, und sagte zur Königin: „Meine liebe Mutter, wenn ich dieser Bärin nicht einen Kuss geben darf, so muss ich sterben“, worauf die Königin sich zu der Bärin wandte und sprach: „Küsse ihn immer, mein liebes Tier, und lass meinen armen Sohn sich nicht ganz verzehren."
Die Bärin näherte sich also dem Prinzen, und dieser, sie in seine Arme schließend, konnte sich gar nicht satt an ihr küssen. Dabei geschah es jedoch, ich weiß nicht wie, dass ihr das Holzstück aus dem Munde fiel, und so befand sich Preziosa plötzlich in vollem Glanze ihrer Schönheit in den Armen des Prinzen. Heftig drückte dieser sie in seine Arme und sagte: „Nun bist du ins Netz gefallen, und sollst mir nicht wieder entkommen."
Errötend über diesen unerwarteten Vorfall, entgegnete Preziosa: „Ich bin in deinen Händen, du bist mein Herr und Gebieter"; und nachdem der Prinz von der Königin gefragt worden, wer dieses schöne Mädchen sei, und wo durch sie zu diesem wilden Leben gekommen, erzählte sie der Reihe nach die ganze Geschichte ihrer Leiden.
Die Königin, welche sie in hohem Grade lobte, sagte hierauf zu ihrem Sohne, sie sei es wohl zufrieden, dass er ein so tugendhaftes Mädchen zur Gemahlin nehme. Da nun der Prinz nichts anderes auf der Welt wünschte, verlobte er sich sogleich mit ihr, und die Mutter gab beiden ihren Segen, und veranstaltete eine prächtige Hochzeitsfeier. Also bewährte sich an Preziosa wiederum die Wahrheit des Sprichwortes:
Wer Gutes tut, erwarte jederzeit wieder Gutes!
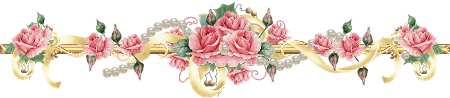
DER ZAUBERLEHRLING ... (1)

Auf der Insel Sizilien, in der schönen und berühmten Stadt Messina lebte ein Mann namens Lactantius, der war in zweierlei Künsten sehr geschickt. Bei Tage vor den Augen der Leute trieb er das Schneiderhandwerk; dagegen heimlich, zur Nachtzeit, die schwarze Kunst. Eines Abends hatte er sich in sein Zimmer eingeschlossen, und war eben mit allerhand magischen Vorkehrungen beschäftigt, als das Unglück einen jungen Menschen herbei führte, der sich bei ihm in der Lehre befand.
Dionysius, so hieß der Lehrling, war zurück gekehrt, um aus dem Zimmer des Lactantius Einiges zu holen, welches er vergessen hatte. Da er die Tür verschlossen fand, drinnen aber Geräusch vernahm, schlich er leise herzu, guckte durch die Öffnung des Schlüsselloches, und sah nun die Zauberkünste seines Meisters. Der junge Mensch empfand ein so lebhaftes Vergnügen dabei, dass er von jetzt auf nichts anderes sann, als wie er die Kunststücke des Schneiders heimlicherweise erlernen könnte.
Nun hatten Nadel, Fingerhut und Schere gute Ruhe bei ihm; er bekümmerte sich um nichts, als das zu lernen, was man ihn nicht lehren wollte, und so wurde er aus einem fleißigen, achtsamen, brauchbaren Arbeiter, als den er sich anfangs gezeigt hatte, ein schlaffer, träger und unaufmerksamer, der an seiner Beschäftigung nicht mehr wie sonst Vergnügen fand. Als Lactantius diese Veränderung seines Lehrlings wahrnahm, jagte er ihn aus seinem Dienst und schickte ihn seinem Vater zurück, der nicht wenig überrascht und betrübt war, seinen Sohn wieder zu haben, und nicht begreifen konnte, was mit ihm vorgegangen sei.
Einige Zeit darauf, nachdem der Vater des Dionys seinen Sohn wiederholt und unter Tränen zu seiner Pflicht ermahnt hatte, führte er ihn aufs Neue zu dem Schneider, und bat diesen inständigst, ihn wieder anzunehmen; wenn er sich aber in Zukunft schlecht aufführe und nicht arbeiten wolle, ihn derb zu züchtigen. Es sei sein einziger Wunsch, dass der Knabe das Handwerk erlerne. Lactantius, dem guten armen Manne zu Liebe, ließ sich nicht lange bitten, nahm seinen Lehrling wieder auf und unterwies ihn alle Tage mit großer Sorgfalt im Zuschneiden und Nähen.
Weil aber Dionys durchaus nichts lernen wollte, gab ihm sein Herr bei jeder Gelegenheit die Elle zu kosten, ließ sie nach Herzenslust auf seinem Buckel tanzen, und so fort, so dass der arme Teufel, der mehr Schläge bekam, als Bissen Brot, das Gesicht immer braun und blau geschlagen oder das Bügeleisen auf seinem Leibe abgedruckt hatte, welches alles er jedoch standhaft ertrug, so unempfindlich machte ihn das Verlangen, jene geheime Kunst zu erlernen, die er alle Nächte durch das Schlüsselloch seinen Meister treiben sah.
Dieser, welcher seinen Lehrburschen für einen albernen Tölpel hielt, da er das, was man ihm zeigte, nicht begreifen konnte, trug weiter keine Sorge, seine Hexenkünste vor ihm geheim zu halten, denn er meinte, wer nicht einmal das Zuschneiden erlernen könne, welches doch eine so leichte Sache sei, der werde um so viel weniger die Hexerei begreifen, welche doch ein so schwieriges Ding sei. Deshalb verheimlichte er seine Kunst nicht länger vor Dionys, der sich jetzt für den glücklichsten aller Menschen hielt, und trotz dem, dass man ihn für einen solchen Dummkopf und Esel hielt, der der Beachtung gar nicht einmal wert sei, in wenig Tagen schon ein solcher Meister in der Schwarzkunst wurde, dass er mehr davon verstand als sein Lehrherr.
Eines Tages nun ging der Vater des jungen Menschen an dem Hause des Lactantius vorüber, und da er seinen Sohn nicht in der Bude bemerkte, trat er ins Haus, und sah ihn dort statt Zuschneiden und sein Handwerk treiben, Holz in die Küche tragen, Wasser holen, das Kind wiegen, das Haus scheuern, kurzum alle Dienste eines Stubenmädchens verrichten. Der gute Mann geriet darüber in solche Betrübnis, dass er seinen Sohn mit sich nach Hause nahm, und ihn dort folgendermaßen auszuschelten anfing:
„Du weißt, Dionys, wie viel ich auf dich verwendet habe, in der Hoffnung, du wirst ein Handwerk erlernen, womit du eines Tages dich und mich ernähren könntest; aber ach! ich habe mein Korn ins Wasser gesät, denn du hast nie etwas lernen wollen. Wahrhaftig, dies ist mein Tod, denn ich befinde mich in einem solchen Elend, dass ich weder mir selbst zu raten noch zu helfen weiß, noch irgend ein Mittel kenne, dich zu ernähren. Deshalb beschwöre ich dich, mein Sohn, lerne, so viel nur in deinen Kräften steht, deinen Lebensunterhalt auf eine ehrliche Art erwerben."
Nach diesen Worten fing der gute Mann an zu weinen, Dionys aber, von seinen Tränen gerührt, entgegnete ihm: Lieber Vater, ich danke euch tausendmal von ganzem Herzen für alle Mühe und Sorge, die ihr um meinetwillen ertragen habt; aber ich bitte euch, glaubt nicht, dass, wenn ich auch das Schneiderhandwerk nicht erlernte, wie es euer Wunsch war, ich deswegen meine Zeit mit Nichtstun und an den Nägeln Kauend zugebracht habe. Nein, ich habe vielmehr durch meine langen Nachtwachen und unermüdliche Anstrengungen eine Kunst erlernt, die ich in Zukunft mit solchem Erfolge auszuüben gedenke, dass ihr und ich alle unsere Tage davon in Friede und Freude leben können. Beruhigt euch also, lieber Vater, ich bitte euch, und quält euch nicht länger, sondern Fasst guten Mut und tröstet euch. Damit ihr jedoch nicht meint, ich sage euch der gleichen Dinge nur so vor, um euch für den Augenblick zufrieden zu stellen, so will ich euch gleich den Beweis geben."
„Ich werde mich morgen, vermittelst meiner geheimen Kunst, in ein schönes Pferd verwandeln; dann legt mir Sattel und Zaum an, führt mich auf den Markt und verkauft mich. Wenn ihr euren Handel gemacht habt, so geht, die Tasche voll Geld, ruhig nach Hanse, und ihr werdet mich hier in der nämlichen Gestalt, in welcher ihr mich jetzt erblickt, wieder finden. Urteilt nun selber, ob ich etwas Nützliches gelernt habe oder nicht, da ihr in so kurzer Zeit euch auf so lange den nötigen Lebensunterhalt erwerben könnt. Aber vor Allem warne ich euch und bitte, euch ja in Acht zu nehmen, dass, indem ihr mich verkauft, ihr nicht auch den Zaum mit fort gebt; diesen müsst ihr, es komme, wie es wolle, durchaus zurück behalten, sonst könnte ich nicht mehr zu euch zurück kehren und ihr würdet mich vielleicht Zeit eures Lebens nicht mehr wieder sehen."
Am folgenden Morgen entkleidete sich Dionys im Beisein seines Vaters, und nachdem er sich den ganzen Leib mit einer Salbe eingerieben hatte, murmelte er einige Worte, worauf der gute Alte zu seinem größten Erstaunen statt seines Sohnes plötzlich ein schönes, kraftvolles Pferd erblickte, welches er anschirrte, wie sein Sohn ihn geheißen und auf den Markt führte. Kaum dass ihn dort die Kaufleute und Rosstäuscher erblickten, so umringten sie ihn, ganz entzückt über die Schönheit und den Anstand des Pferdes, welches seine Glieder und den ganzen Körper so ungezwungen regierte, mit solcher Leichtigkeit und solchem Feuer, dass es bewunderungswürdig war. Alle fragten, ob das Pferd zu verkaufen sei und der Alte bejahte es.
Zufällig befand sich auch Lactantius auf dem Markte, der, als er das Pferd gesehen und scharf ins Auge gefasst, sogleich erkannte, dass es ein verzaubertes sei. Er entfernte sich daher ohne alles Aufsehen aus dem Gewühl, lief schleunigst nach Hause, verkleidete sich als ein Kaufmann, steckte eine große Summe Geldes zu sich und kehrte nach dem Markte zurück, wo selbst er den guten Mann mit seinem Pferde noch antraf. Er näherte sich dem selben und in dem er es aufmerksam betrachtete, erkannte er, dass es sein Lehrling Dionys sei. Darauf fragte er den Alten, ob er es ihm verkaufen wolle; jener sagte zu, und sie wurden mit einander Handels einig. Lactantius zahlte ihm zweihundert Goldtaler für das Pferd.
Als er es aber beim Zaum ergreifen und mit fort führen wollte, entgegnete der Alte, er habe ihm das Pferd und nicht den Zaum verkauft, den er behalten wolle, oder der ganze Handel möge rückgängig werden. Indes Lactantius wusste ihn so wohl zu beschwatzen, ihn so mit glatten Worten zu überlisten, dass er den Zaum und das Pferd behielt, welches er nach Hause führte, in dem Stall an die Krippe fest band, und es zum Frühstück und Abendbrot mit so viel hundert Stockschlägen traktierte, dass das arme Tier in Kurzem zu Haut und Knochen abmagerte und das Mitleid eines Jeden erregte, der es ansah.
Lactantius aber hatte zwei Töchter; als diese die Grausamkeit ihres nichtswürdigen Vaters sahen, gingen sie täglich in den Stall, um nach dem unglücklichen Pferd zu sehen. Sie liebkosten es, schmeichelten ihm und behandelten es so gut, als sie nur konnten, ja einmal nahmen sie es sogar beim Halfter und führten es an den Fluss hinaus, um ihm zu trinken zu geben. Das Pferd aber befand sich kaum am Wasser, als es sich hineinstürzte und, in dem es sich in einen kleinen Fisch verwandelte, in den Wellen verschwand.
Als die Mädchen dieses seltsame Ereignis sahen, blieben sie ganz sprachlos vor Erstaunen, dann kehrten sie nach Hause zurück und ergaben sich dort der heftigsten Betrübnis, welche man je gesehen hat; sie zerschlugen sich die Brust, zerrauften ihre schönen, langen Haare und schluchzten in einem fort. Einige Zeit darauf kehrte Lactantius zurück; er war in dem Stall gewesen, um sein Pferd mit einem anderen Wischer als von Stroh zu striegeln, zu seinem größten Erstaunen aber war es verschwunden. Sehr erbost darüber, begab er sich zu seinen Töchtern, die er in Tränen fand.
Ohne nach der Ursache ihrer Tränen zu fragen, denn er wusste wohl, von welcher Seite ihr Unglück kam, sagte er zu ihnen: „Meine Kinder, seid ohne Furcht und sagt mir nur das Einzige, was aus dem Pferd geworden ist, damit ich augenblicklich meine Maßregeln treffen kann." Bei diesen Worten beruhigten sich die armen Mädchen und erzählten ihm alles, wie es sich begeben hatte. Als ihr Vater dies vernahm, entkleidete er sich sogleich, lief nach dem Fluß, verwandelte sich in einen Raubfisch, stürzte sich dann ins Wasser und verfolgte mit aller Kraft seiner Flossen das kleine Fischchen, um es zu verschlingen.
Als dieses den Raubfisch mit seinen furchtbaren Zähnen hinter sich bemerkte, war es in großer Sorge, von ihm verschlungen zu werden, näherte sich dem Ufer des Flusses, und verließ den selben, verwandelt in einen schönen, in Gold gefassten Rubin. Darauf sprang er in das Körbchen der Königstochter, welche gerade am Fluss spazieren ging und sich damit belustigte, kleine Steinchen, die am Ufer lagen, aus dem feinen Sande aufzulesen.
Kaum war die Prinzessin, welche Violante hieß und die einzige Tochter des Königs war, nach Hause gekommen, so nahm sie ihre Beute aus dem Körbchen und sah nun unter den Steinen den Ring leuchten. Ganz erfreut steckte sie ihn so gleich an den Finger und konnte nicht aufhören, ihn zu betrachten. Als die Nacht einbrach und die Prinzessin sich in ihr Schlafgemach zur Ruhe begeben hatte, verwandelte sich der Ring plötzlich in einen schönen Jüngling. Er hielt der Prinzessin, welche erschrocken laut aufschreien wollte, den Mund zu, dann warf er sich zu ihren Füßen und bat um Verzeihung. Sie möge nicht glauben, dass er in einer unehrerbietigen Absicht gekommen sei, sondern einzig um ihre Hilfe anzuflehen; worauf er ihr sein ganzes Missgeschick und die Verfolgungen erzählte, die er zu erdulden gehabt hatte.
Violante, durch den hellen Schein der Lampe, welche in ihrem Zimmer brannte, so wie durch die Worte des Jünglings, den sie sehr hübsch und einnehmend fand, einigermaßen beruhigt, empfand Mitleid mit ihm und sagte: „Junger Mann, du bist sehr verwegen, an einen Ort zu kommen, an welchen man dich nicht gerufen hat. Allein ich will dir in Rücksicht deines Missgeschicks verzeihen. Deine Erzählung hat mein ganzes Mitleid erweckt und ich will dir zeigen, dass ich nicht von Marmor bin, noch ein Herz von Diamant habe; ja ich bin entschlossen, dir von ganzem Herzen, so weit es meine Ehre erlaubt, in Allem beizustehen."
Der Jüngling bedankte sich hierauf ganz untertänig und als es Tag wurde, verwandelte er sich wieder in den Ring, welchen die Prinzessin zu ihren kostbarsten Juwelen legte.
Um diese Zeit geschah es, dass der König, Violantens Vater, in eine schwere Krankheit verfiel, bei der seine Ärzte keinen Rat wussten, sondern sie für unheilbar erklärten, so dass es von Tage zu Tage schlimmer damit wurde. Dies kam auch zu den Ohren des Lactantius, der es nicht so bald hörte, als er sich in einen Doktor verkleidete, nach dem königlichen Palast ging, und vor den König gebracht, sich genau von der Krankheit unterrichtete; darauf fühlte er den Puls, betrachtete das Antlitz und sagte: „Die Krankheit Eurer Majestät ist allerdings hartnäckig und sehr gefährlich, aber fassen Sie Mut, denn in Kurzem will ich Sie herstellen; ich besitze ein Mittel, mit welchem ich in wenig Tagen die aller gefährlichste, grausamste Krankheit, die es nur auf der Welt gibt, heben kann."
„Meister Arzt“, versetzte der König, „wenn ihr mir meine Gesundheit wieder geben könnt, wie ihr sagt, so verspreche ich euch dies dermaßen zu vergelten, dass ihr alle Zeit eures Lebens zufrieden sein sollt. „Mein König“, sagte hierauf der Arzt, „ich bitte Sie nicht um Stand, Würden und Reichtümer, sondern nur, dass es Eurer Majestät gefallen möge, mir eine einzige Gnade zu erweisen."
Dies versprach ihm der König, vorausgesetzt, dass er nichts Unmögliches oder Törichtes von ihm verlange. „Ich bitte Eure Majestät um weiter nichts“, sagte der Arzt, „als um einen in Gold gefassten Rubin, der sich gegenwärtig in dem Besitz Ihrer Tochter, der Prinzessin, befindet." Der König, da er eine so geringfügige Bitte vernahm, erwiderte: „Meister, wenn ihr nichts weiter wollt, so seid überzeugt, vollkommen zufrieden gestellt zu werden; worauf der Arzt sich bei dem Könige ganz untertänigst bedankte, und ihn mit solcher Sorgfalt zu kurieren anfing, dass der König in weniger als zehn Tagen wieder frisch und gesund war.
Als der König wieder hergestellt war, ließ er in Gegenwart des Arztes seine Tochter rufen, und hieß sie, ihre sämtlichen Juwelen herbei holen. Die Prinzessin gehorchte. Als der Arzt aber alles wohl besichtigt und durchmustert hatte, sagte er: der Rubin, welchen er wünsche, sei nicht darunter und die Prinzessin möge nachsehen, wo er sich befände. Die Prinzessin, welche ihren Rubin über alles liebte, versicherte jedoch, keine anderen Edelsteine weiter zu besitzen, als die, welche sich hier befänden; worauf der König zu dem Doktor sagte: „Geht jetzt und kommt morgen wieder, ich werde es schon dahin bringen, dass meine Tochter mir den Ring gibt."
Nachdem sich der Arzt entfernt hatte, rief der König Violante und fragte sie auf das Liebreichste, wo denn der schöne Rubin sei, welchen der Arzt zu haben wünsche, und sie möge ihn doch geben, er wolle ihr einen weit schöneren und größeren dafür schenken. Aber sie leugnete so standhaft, dass der König nichts anfangen konnte. Kaum befand sie sich wieder in ihrem Gemach, als sie sich einschloss, und bitterlich zu weinen anfing über den Verlust ihres armen Rubins, den sie ganz in Tränen badete, ihn auf das Zärtlichste küsste und den Tag und die Stunde verwünschte, da der Doktor seinen Fuß in den Palast des Königs, ihres Vaters, gesetzt habe.
Als der Rubin die heißen Tränen sah, welche den Augen der schönen Prinzessin entströmten und die tiefen Seufzer hörte, die aus ihrem Herzen drangen, nahm er seine menschliche Gestalt an und sagte zu ihr: „Prinzessin, von der mein ganzes Leben abhängt, ich beschwöre euch, bekümmert euch nicht der maßen über mein Unglück; lasst uns vielmehr auf irgend einen Ausweg sinnen, denn jener Arzt, der mich so eifrig in seine Gewalt zu bekommen trachtet, ist niemand anders als mein Todfeind Lactantius, der mich umbringen will. Also bitte ich euch, so klug, verständig und wohl beraten ihr seid, gebt mich nicht in seine Hände, sondern stellt euch erzürnt und werft mich gegen die Wand — für das Weitere lasst mich nur sorgen.
Am folgenden Morgen kam der Arzt wieder zum König, der ihm sagte, wie seine Tochter versichert habe, jenen Ring nicht zu besitzen. Als Lactantius dies hörte, ward er sehr unwillig, beteuerte das Gegenteil und behauptete, der Rubin befände sich in den Händen der Prinzessin. Der König ließ hierauf in Gegenwart des Arztes die Prinzessin noch einmal herbei rufen und sagte zu ihr: „Violante, du weißt, dass ich durch die Sorgfalt und die Kenntnis dieses Mannes meine Gesundheit wieder erlangt habe; zur Belohnung verlangt er nichts weiter von mir, als den Ring, der sich nach seiner Aussage in deinen Händen befindet und den du gleichwohl verweigerst. Ich hätte geglaubt, die Liebe, welche du für mich empfindest, würde dich nicht bloß einen Rubin, sondern dein Leben selbst hingeben lassen. Ich bitte dich bei dem Gehorsam, welchen du mir schuldig bist, bei dem Wohlwollen, welches ich für dich hege, verweigere mir nicht länger diesen Ring, für den ich dir geben will, was du nur verlangen magst."
Als die Prinzessin den so bestimmten Willen des Königs, ihres Vaters, vernommen hatte, ging sie in ihr Gemach, nahm alle ihre Juwelen, unter welche sie auch den Rubin legte, und in Gegenwart des Königs einen nach dem anderen in die Hand nehmend, wies sie die selben dem Arzte, der sogleich, als er den Rubin erblickte, die Hand darauf legen wollte, in dem er sagte: „Prinzessin, dies ist der Ring, den ich wünsche, und den mir der König versprochen hat."
Allein die Prinzessin, ihn zurück stoßend, entgegnete: „Halt, Meister, ihr werdet ihn bekommen!" — Und den Ring zwischen den Fingern haltend, rief sie aus: „Also dies mir so teure und kostbare Juwel ist es, welches ihr verlangt! Ihn soll ich fort geben, dessen Verlust mich für alle Zeiten meines Lebens trostlos machen wird. Aber ich gebe ihn nicht aus gutem Willen, sondern weil es der König, mein Vater, durchaus verlangt." Mit diesen Worten, warf sie den Rubin gegen die Wand. Sobald aber der Ring zur Erde fiel, verwandelte er sich augenblicklich in einen schönen Granatapfel, der aufsprang und seine Körner überall hin verstreute.
Als der Arzt dies sah, ward er auf der Stelle zu einem Hahn, um alle Körner aufzupicken und so den armen Dionys zu verderben; aber er täuschte sich; denn eins von den Körnchen hatte sich so verborgen, dass es der Hahn nicht bemerken konnte. Dieses Körnchen nun wartete die gute Gelegenheit ab, verwandelte sich in einen Fuchs, und mit Ungestüm auf den Meister Hahn zustürzend, packt er ihn beim Halse, erwürgt ihn und frass ihn auf in Gegenwart und zum großen Erstaunen des Königs und seiner Tochter Violante.
Nachdem dies geschehen war, nahm Dionys seine menschliche Gestalt wieder an, und erzählte nun alles dem Könige, welcher ihm hierauf die Prinzessin zur Frau gab. Sie lebten lange Zeit miteinander in Glück und Frieden, und der gute alte Vater des Dionys wurde jetzt aus einem dürftigen, armseligen Bettler ein reicher und vermögender Mann, während dem Lactantius seine eigene Bosheit das Leben gekostet hatte.

DER WALDMANN ...

Sizilien ist ein schönes, fruchtbares Land, berühmt wegen seines Altertums, und mit vielen herrlichen Städten und Schlössern geziert. Hier herrschte vor Zeiten Filippo Maria, ein guter und weiser König, dessen schöne Gemahlin ihm einen einzigen Sohn geboren hatte, dem man den Namen Guerrino gab.
Der König ergötzte sich sehr an der Jagd, denn er war ein starker, kräftiger Mann, dem solch eine Beschäftigung zusagte. Eines Tages war er ebenfalls mit vielen Rittern und Jägern ausgezogen, da sah er aus dem Dickicht einen riesenmäßigen Waldmenschen hervorspringen, von furchtbarem Ansehen und ungeheuren Kräften.
Der König, von zwei Rittern begleitet, ging auf ihn los, griff ihn mutig an und nach einem hartnäckigen Kampf überwand er ihn, ließ ihn binden und führte ihn mit sich nach seinem Palast. Darauf suchte er ein festes, wohl verwahrtes Behältnis aus, schloss ihn hinein und befahl, dass man ihn aufmerksam bewachen solle. Ja er wollte sogar die Schlüssel des Gefängnisses keinem anderen als der Königin anvertrauen, so viel war ihm an seinem Waldmenschen gelegen; und täglich machte er sich den Zeitvertreib, ihn zu besuchen.
Nach einigen Tagen ging der König wieder auf die Jagd und empfahl vorher der Königin, wohl auf die Schlüssel Acht zu haben. In der Abwesenheit des Vaters bekam der Knabe Guerrino Lust den wilden Mann zu sehen, und ging mit seinem Bogen, woran er einen besondern Gefallen hatte, und einem Pfeil in der Hand an das Gitter des Gefängnisses.
Sobald ihn das Ungeheuer erblickte, kam es heran und fing an, ganz zahm mit ihm zu sprechen; und während es so durch das Gitter mit ihm sprach und ihm liebkoste, wusste es ihm auf eine geschickte Weise den reichen, goldnen Pfeil aus der Hand zu reißen. Darüber weinte der Knabe bitterlich, konnte sich gar nicht zufrieden geben und wollte durchaus seinen Pfeil wieder haben. Der Waldmensch aber sprach: „Wenn du mir mein Gefängnis öffnen und mich befreien willst, gebe ich dir deinen Pfeil zurück, sonst bekommst du ihn nimmer mehr." —
„Wie kann ich dich denn herauslassen“, sagte der Knabe: „ich weiß ja nicht, wie ich es machen soll." — „Wenn du Lust hast, mich aus diesem Käfig zu befreien“, antwortete der Waldmensch: „will ich dir wohl das Mittel dazu angeben." — „Was ist das für ein Mittel“, fragte Guerrino. „Geh zur Königin, deiner Mutter, und wenn du sie in der Mittagszeit schlummern siehst, suche behutsam unter ihrem Kopfkissen nach, entwende ihr leise, dass sie dich nicht hört, die Schlüssel meines Gefängnisses, bringe sie hierher und öffne; sobald du geöffnet hast, gebe ich dir deinen Pfeil zurück. Und vielleicht werde ich dir diesen Dienst einst vergelten können."
Aus großer Begier, seinen goldnen Pfeil wieder zu haben, tat Guerrino alles, was ihm der Waldmann gesagt hatte, fand die Schlüssel, brachte sie ihm und sprach: „Hier ist, was du verlangst. Und wenn ich aufgeschlossen habe, so lauf, so weit dich deine Füße tragen, denn bekäme mein Vater, der ein geschickter Jäger ist, dich wieder in seine Gewalt, ganz gewiss ließe er dich töten." — „Sei unbesorgt, mein Sohn“, sagte der Waldmann, „sobald ich mich in Freiheit sehe, gebe ich dir deinen Pfeil zurück und fliehe so weit von hier, dass weder dein Vater noch ein anderer mich jemals antreffen sollen." Guerrino, der schon Manneskraft besaß, bemühte sich so lange, bis er das Gitter geöffnet hatte; der Waldmann gab ihm den Pfeil zurück, sagte ihm Dank für seine Befreiung und eilte davon.
Es war dieser Waldmensch früher ein schöner Jüngling gewesen, der aus Verzweiflung, sich von einer heiß geliebten Jungfrau verschmäht zu sehen, der Liebe und den Freuden der Geselligkeit entsagt hatte, um in dunklen Wäldern unter den Tieren zu leben, sich von Gras und Kräutern zu nähren und mit dem Wasser der Quelle seinen Durst zu stillen. Von dieser Lebensweise hatte der Unglückliche eine dicke, harte Haut und einen langen, struppigen Bart bekommen, und weil er nichts als Kräuter aß, waren ihm Haar, Bart und Haut so grün geworden, dass er einen wahrhaft furchtbaren Anblick gewährte.
Als die Königin erwachte, steckte sie die Hand unter das Kopfkissen, um die Schlüssel hervor zu nehmen, die sie stets mit sich führte. Wie bestürzt war sie aber, sie nicht zu finden; sie kehrte das ganze Bett danach um, doch all ihr Suchen war vergebens. Gleich einer Rasenden lief sie zum Gefängnis, und da sie es offen und den Waldmenschen nicht darin fand, durchstrich sie den Palast nach allen Seiten und befragte jeden, der ihr aufstieß, wer die Verwegenheit gehabt hätte, ihr heimlich die Schlüssel des Gefängnisses weg zu nehmen. Alle beteuerten, nichts davon zu wissen.
Da traf Guerrino auf die Mutter, sah sie so entrüstet und sprach: „Mutter, beschuldigt keinen wegen des Vorgefallenen, wenn jemand Strafe verdient, muss ich sie leiden, denn ich habe das Gefängnis geöffnet." Auf diese Nachricht war die Königin in noch weit größerer Not, als zuvor. Sie befürchtete, wenn der König von der Jagd nach Hause käme, würde er den Sohn in der Wut töten lassen; denn er hatte ihr die Schlüssel empfohlen, als hinge sein ganzes Wohl daran.
Um nun einen kleinen Fehler gut zu machen, beging die Königin einen weit größeren. Ohne Aufschub berief sie zwei treue Diener, empfahl ihnen aufs Dringendste, Sorge für ihren Sohn zu tragen, versah diesen mit einer Menge Goldes, vielen Kostbarkeiten und schönen Pferden und sandte ihn, von den Beiden begleitet, auf gut Glück in die Welt.
Guerrino hatte seine Mutter noch nicht lange verlassen, da kam der König von der Jagd zurück und ging, sobald er vom Pferde gestiegen, zum Gefängnisgitter, um seinen Waldmann zu besuchen. Wie wütete er aber, die Tür offen und diesen entflohen zu sehen. Er wollte den töten, der sich solch eines Vergehens schuldig gemacht, eilte zur Königin, die er traurig in ihrem Zimmer fand, und fragte sie, wer der Frevler sei, der es gewagt habe, das Gefängnis zu öffnen.
„O zürne nicht, Herr“, sprach die Königin mit zitternder Stimme: „Guerrino hat dieses Unheil verübt, er selbst hat es mir gestanden." — Hierauf teilte sie dem König, zu seinem nicht geringen Verdruss, alles mit, was ihr der Sohn erzählt hatte. Sie setzte hinzu, sie habe aus Furcht, er werde ihn töten, den Sohn in ferne Länder gesandt, begleitet von zwei treuen Dienern, und mit Geld und Kleinodien reichlich versehen.
Bei dieser Nachricht, die Leid zum Leide fügte, geriet der König ganz außer sich, und hätten ihn die Hofleute nicht zurück gehalten, er würde seine Frau in jenem Augenblick umgebracht haben. Als er wieder zu sich selbst gekommen und ein wenig besänftigt war, sprach er zur Königin: „Wie konnte es dir einfallen, o Frau, unseren Sohn nach unbekannten Ländern zu schicken? Glaubst du denn, dass mir mehr an diesem Wilden gelegen sei, als an meinem eigenen Fleisch und Blut?" —
Und als bald sandte er viele Reiter in alle vier Weltgegenden aus, mit dem Befehl, nichts unversucht zu lassen, um ihn wieder zu finden. Ihre Bemühungen waren aber fruchtlos, denn Guerrino und seine Diener schlugen so verborgene Wege ein, dass Niemand ihnen auf die Spur kommen konnte. So hatte nun unser Guerrino manchen Berg und manches Tal durchstreift, sich bald hier, bald dort aufgehalten, und war schön und blühend wie eine Rosenknospe zu dem Alter von sechzehn Jahren gelangt. Da gerieten seine Diener plötzlich auf den teuflischen Gedanken, ihn zu töten und seine Schätze unter sich zu teilen; sie kamen aber nicht zur Ausführung, weil sie niemals einig mit einander werden konnten.
Eines Tages begegnete ihnen auf ihrer Wanderschaft ein junger, schöner Mann auf einem herrlichen, reich geschmückten Pferde, begrüßte den Guerrino und sprach: „Wenn es euch, edler Ritter, nicht unangenehm ist, so erlaubt mir, euch zu begleiten." — „Ein Anstand, wie der eurige“, erwiderte Guerrino, „gestattet nicht, eure Gesellschaft auszuschlagen. Ich weiß euch dies Anerbieten Dank und bitte euch, mit uns zu kommen. Wir sind hier fremd und kennen die Wege nicht, ihr werdet die Güte haben, sie uns zu zeigen, und während des Reitens können wir einander etwas von unseren Begebenheiten erzählen, um uns die Reise zu verkürzen."
Der fremde Ritter war aber der selbe Waldmensch, den Guerrino aus der Gefangenschaft seines Vaters befreit hatte. Diesen, der lange unstet umhergeirrt war, hatte zufällig eine schöne Fee erblickt und über sein ungestaltes, wunderliches Ansehen so herzlich gelacht, dass ein Geschwür am Herzen, an dem sie lange gelitten hatte, plötzlich zersprang und sie sich von diesem Augenblick an völlig geheilt fühlte. Die Fee wollte nicht undankbar gegen eine solche Wohltat scheinen, sie sprach zu ihm: „O du, der du meine Genesung bewirktest, werde aus dem hässlichen Ungeheuer, das du jetzt bist, zum schönsten Jüngling, den die Welt gesehen hat. Und alle Macht und Gewalt, mit der die Natur mich begabte, teile ich dir mit, dass du nach deinem Willen über alles walten und schalten mögest." — Nach diesen Worten beschenkte sie ihn noch mit einem Zauberroß und entließ ihn.
Er reiste jetzt mit Guerrino, den er wohl kannte, aber nicht von ihm erkannt ward, immer weiter und weiter, bis sie endlich nach Irland kamen, welches damals König Zifroi beherrschte. Dieser König hatte zwei Töchter, Potenzia und Eleutheria genannt, von edlen Sitten, hohem Anstand und schön wie die Liebesgöttin, und so teuer waren sie dem Vater, dass er nur durch seiner Kinder Augen sah.
Als Guerrino mit dem unbekannten Ritter und den beiden Dienern in Irland angekommen war, nahm er eine Wohnung bei einem Bäcker, dem lustigsten Mann im ganzen Lande, von dem sie aufs Beste bewirtet wurden. Am anderen Tage tat der Unbekannte, als wollte er abreisen, nahm Abschied von Guerrino und sagte ihm vielen Dank für seine Gesellschaft. Allein Guerrino, der ihn lieb gewonnen hatte, wollte ihn durchaus nicht reisen lassen und bat ihn so lange, bis er einwilligte, bei ihm zu bleiben.
In Irland hielten sich in jener Zeit zwei furchtbare Tiere auf, ein wilder Hengst und eine wilde Stute, die alles in Schrecken versetzten und nicht allein die Felder gänzlich verwüsteten, sondern auch Tiere und Menschen aufs Grausamste zerrissen. Das Land war durch diese Bestien in einen so traurigen Zustand versetzt worden, dass kein Mensch mehr dort wohnen wollte. Die Bauern verließen ihre Hütten und Felder und zogen in ferne Gegenden, und niemand war stark oder mutig genug, sich den Verwüstern zu widersetzen.
Der König war sehr betrübt über ein solches Unglück; er sah sein Land wie ausgestorben da liegen, weder Lebensmittel, noch Vieh, noch Menschen waren mehr darin zu finden, und er wusste doch kein Mittel, dem Übel abzuhelfen. Dies brachte Guerrinos Diener auf den Gedanken, sie könnten vielleicht jetzt den Tod ihres Herrn ungestraft bewirken und sich dann seiner Schätze bemächtigen. Denn früher waren sie durch ihre eigene Zwietracht und durch die Ankunft des fremden Ritters an ihrem bösen Vorhaben gehindert worden.
In dieser Absicht nahmen sie sich vor, dem Wirt zu erzählen, welch ein mutiger, tapferer Jüngling ihr Herr sei und wie oft er sich gegen sie gerühmt, er könne jenen wütenden Hengst töten, ohne dass jemand dabei zu Schaden käme. Dieser Bericht, dachten sie, wird schnell zu den Ohren des Königs gelangen, der eifrigst wünscht, die Tiere umgebracht und sein Land befreit zu sehen; er wird als bald Guerrino rufen lassen und ihn über die Art befragen, dies zu bewerkstelligen, und weiß dieser dann nicht zu antworten, so lässt er ihn töten und seine Schätze bleiben uns.
Wie gesagt, so getan; sie banden dem Wirt ihre Lüge auf, dieser war außer sich vor Freuden darüber, eilte zum Palast, beugte ein Knie vor dem König und sprach: „Großer König, wisst, in meinem Hause wohnt ein schöner, fremder Ritter, Guerrino mit Namen. Von dem haben mir seine Diener erzählt, als ich mit ihnen über dieses und jenes sprach, ihr Herr stehe in großem Ruf wegen seiner Tapferkeit und wisse die Waffen zu führen, wie kein anderer in unseren Tagen. Und oft soll er sich gerühmt haben, ihm sei es ein Leichtes, das wilde Pferd zu besiegen, welches euer Reich verwüstet." —
Auf diese willkommene Nachricht befahl Zifroi ihm sogleich, er solle den Ritter zu ihm schicken. Der Wirt kehrte schnell nach Hause zurück und sagte zu Guerrino, er solle gleich zum Palast kommen, der König wünsche ihn allein zu sprechen.
Guerrino zögerte nicht, dieser Aufforderung Folge zu leisten; er trat vor den König und fragte, nach dem er ihm die schuldige Ehrerbietung bezeigt, was seine Majestät befehle.
„Ich habe dich rufen lassen, Guerrino“, erwiderte ihm Zifroi! „weil ich vernommen habe, du seist der tapferste Ritter aus der Welt und so gewaltig, dass du dich getraust, jenen wilden Hengst, der mein Land zerstört, zu bezwingen, ohne Gefahr für dich oder andere. Hoffst du nun, in einem so ruhmvollen Kampf zu siegen und willst ihn unternehmen, so gelobe ich bei diesem meinem Haupte, dich dergestalt zu belohnen, dass du dein ganzes Leben hindurch glücklich sein sollst." —
Über dieses Anmuten erstaunte Guerrino nicht wenig und leugnete, je dergleichen Reden geführt zu haben, wie man sie ihm nachsagte. Der König war höchst unwillig über seine Antwort und sagte zornig: „Ich befehle dir, Guerrino, diesen Kampf zu bestehen, es kostet dir das Leben, widerstrebst du meinem Willen."
Betrübt kehrte der Jüngling in seine Wohnung zurück und wagte nicht, jemanden seine Not zu klagen. Als der Unbekannte ihn so traurig sah, wie er nie zu sein pflegte, fragte er ihn teilnehmend um die Ursache seines Kummers. Guerrino konnte der brüderlichen Freundschaft, die zwischen ihnen herrschte, diese liebevolle Frage nicht unbeantwortet lassen und erzählte, was ihm begegnet war.
„Sei gutes Mutes“, sagte der andere: „ich werde dir den Weg zeigen, nicht nur dein Leben zu retten, sondern auch in diesem Kampf zu siegen und des Königs Begehren zu erfüllen. Kehre zu ihm zurück und sag ihm, er solle dir bei einem tüchtigen Hufschmied vier Hufeisen machen lassen, rund herum um zwei Zoll länger, als die gewöhnlichen, mit gezacktem Rande und zwei langen scharfen Haken hinten. Damit will ich mein Ross beschlagen lassen, welches gefeit ist, und das Übrige soll schon gehen." —
Guerrino begab sich also zum König und sprach, wie sein Freund ihm geraten hatte. Da musste ungesäumt ein geschickter Hufschmied kommen und erhielt den Befehl, er solle für den fremden Ritter arbeiten, völlig nach dessen Vorschrift. Guerrino ging darauf mit dem Meister zu seiner Werkstatt und bestellte die vier Hufeisen auf oben besagte Weise. Der Meister verlachte ihn aber als einen Narren und wollte sie nicht machen, denn der gleichen waren ihm in seinem Leben noch nicht vorgekommen. Er musste sich aber am Ende dennoch dazu bequemen, denn Guerrino beklagte sich beim König über ihn, und dieser befahl, der Meister solle entweder die Hufeisen machen oder an Guerrinos Statt mit dem Untier kämpfen.
Nachdem die Eisen fertig und das Pferd beschlagen und gesattelt war, sprach der Unbekannte zu Guerrino: „Besteig nun mein Ross, zieh unbesorgt aus, und wenn du das Wiehern des wilden Pferdes hörst, steig hinunter von dem deinigen, nimm ihm Sattel und Zaumzeug ab, und lass es in Freiheit. Du aber erklettre einen hohen Baum und warte dort das Ende ab." Guerrino, von seinem Gefährten wohl unterrichtet, wie er sich zu verhalten habe, nahm Abschied und ritt vergnügt davon.
Durch die ganze Stadt war schon das Gerücht erschollen, ein Jüngling habe unternommen, den wilden Hengst zu bekämpfen und wolle ihn gefangen dem Könige überbringen. Deshalb liefen Männer und Weiber an die Fenster, ihn vorbeikommen zu sehen, und alle wurden von seiner Schönheit und Jugend und seinem edlen Wesen so gerührt, dass sie sich der Tränen nicht erwehren konnten und bedauernd sprachen: „Der Arme, wie er sich freiwillig in den Tod stürzt! Wahrlich, es ist eine rechte Sünde, dass er auf eine so jämmerliche Weise um sein Leben kommen soll!" —
Allein Guerrino ritt heitern Sinnes und männlichen Mutes weiter, ohne sich an etwas zu kehren. Als er dem Aufenthalt des Untieres nahe war und es wiehern hörte, stieg er ab, band seinem Ross Sattel und Zaumzeug los, suchte Schutz auf einer hohen Eiche und erwartete dort, das blutige Schauspiel beginnen zu sehen. Kaum war er oben, da kam der Hengst wütend herbei gerannt, griff das Ross an und es begann ein furchtbarer Kampf. Denn gleich zwei entfesselten Löwen stürzten sie auf einander los, und der Schaum entfloss ihnen wie grimmigen Ebern, die von schnellen Hunden gehetzt werden. Nach langem mutigen Streit gab das Zauberross seinem Gegner einen derben Hufschlag mit dem scharfen Eisen, traf ihm den Kinnbacken und zerschmetterte ihn. Dadurch verlor der Hengst alle Kraft und konnte sich nicht länger verteidigen.
Da stieg Guerrino voller Freuden von dem Baum, schlang dem Tiere einen Strick um den Hals und führte es unter großem Jubel des Volks durch die Stadt zum König, der ihn auf das Ehrenvollste empfing. Den beiden Dienern aber war dieser Sieg ihres Herrn höchst unwillkommen, denn er vereitelte ihr böses Vorhaben. Voller Ärger darüber ließen sie von Neuem eine Botschaft an den König ergehen, Guerrino könne, wenn er Lust hätte, auch leicht das andere wilde Tier überwältigen.
Zifroi ließ ihn hierauf wieder vor sich kommen und trug ihm auch diese Unternehmung auf; und auf seine Weigerung drohte er ihm, ihn als einen Rebellen an einem Fuß aufhängen zu lassen. Als Guerrino dem Gefährten sein Unglück erzählte, sprach dieser lächelnd: „Fürchte nichts, Bruder, geh nur zum Hufschmied und bestelle vier andere Hufeisen, noch einmal so groß als die ersten, und mit tüchtigen scharfen Haken versehen. Dann wird es dir eben so gut gelingen, als mit dem Hengst, und du wirst noch weit größeren Ruhm davon tragen."
Die Eisen wurden gemacht, das Ross beschlagen; Guerrino zog wieder aus, und als er dorthin kam, wo die Stute sich aufhielt und sie wiehern hörte, tat er, wie er das erste Mal getan. Kaum hatte er das Zauberroß frei gelassen, da stürzte das Untier mit grimmigen Bissen darauf los, und jenes vermochte beinahe nicht, sich zu wehren. Es hielt sich aber wacker und gab der Stute einen so gewaltigen Hufschlag an das rechte Vorderbein, dass sie es nicht mehr rühren konnte.
Da verließ Guerrino den Baum, band die Stute, bestieg sein Ross und kehrte in die Stadt zurück. Hier empfing man ihn jubelnd; Alt und Jung lief neugierig herbei, das gelähmte Ungeheuer zu sehen, und im Triumph begleitete man den Sieger zum Palast, wo er dem König die gefangene Stute überbrachte, die bald darauf an ihrer schweren Verletzung starb. Und so ward das Land gänzlich von seiner Plage erlöst.
Guerrino war indes, in seine Wohnung zurückgekehrt und hatte sich niedergelegt, um auszuruhen; allein ein ungewöhnliches Geräusch in seinem Zimmer ließ ihn nicht schlafen. Er stand auf und hörte, dass es aus einem Gefäß mit Honig kam, worin etwas flatterte, als ob es heraus wolle. Da öffnete er das Gefäß und fand eine Wespe darin, die ängstlich mit den Flügeln schlug und sich nicht von dem Honig losmachen konnte. Mitleidig nahm er das Tierchen heraus und gab ihm die Freiheit.
Noch hatte der König den Guerrino nicht belohnt für seinen zwiefachen Sieg: er glaubte etwas für ihn tun zu müssen, ließ ihn rufen und sprach: „Guerrino, du hast mein Reich errettet und es ist billig, dass ich mich dankbar dafür zeige. Da mir aber kein anderes Geschenk deinem großen Verdienst angemessen scheint, habe ich beschlossen, dir eine meiner Töchter zur Frau zu geben. Wisse, dass ich deren zwei besitze, Potenzia, der die Locken, mit reizender Kunst geordnet, wie helles Gold glänzen, und Eleutheria, deren Haar wie feines Silber schimmert. Kannst du nun, wenn Beide verschleiert sind, die goldgelockte erraten, so erhältst du sie zur Frau nebst einer reichen Mitgift; errätst du sie aber nicht, so wird dir das Haupt vom Rumpf geschlagen."
Sehr bestürzt über dieses gefährliche Anerbieten des Zifroi, sprach Guerrino zu ihm: „Großer König, ist dies der Preis meiner Siege? Dies der Lohn meiner Bemühungen? Dies das Ehrengeschenk für die Errettung eures dem Untergang nahen Landes? Wahrhaftig, ich habe etwas Besseres verdient! Und nicht geziemt es einem so hohen Fürsten, dergestalt zu verfahren. Allein ihr wollt es und ich bin in euren Händen. Tut denn mit mir, wie es euch gefällt."
„Geh jetzt“, sagte der König, „und zaudre nicht zu lange, bis morgen Abend gebe ich dir Frist, darüber nachzudenken." Betrübt eilte Guerrino nach Hause und erzählte seinem lieben Gefährten, was der König von ihm verlange. „Sei ganz ruhig“, gab ihm dieser zur Antwort, „dir soll geholfen werden. Erinnere dich der Wespe, die du aus dem Honig befreitest, sie wird dich jetzt aus der Verlegenheit ziehen. Morgen nach der Mahlzeit wird sie zum Palast fliegen und dreimal das Gesicht der goldgelockten Prinzessin umschwirren, und diese wird sie jedes Mal mit ihrer weißen Hand verjagen. Durch dieses Zeichen wirst du dann erkennen, welches die dir bestimmte Gemahlin ist." —
„Niemals, und wenn ich tausend Jahr alt würde“, rief Guerrino aus, könnte ich dir so große Wohltat lohnen, allein der Vergelter alles Guten wird es gewiss statt meiner tun." — „Teuerster Bruder“, sagte der andere: „Du bist mir keinen Dank schuldig, es ist endlich Zeit, dass du erfährst, wer ich sei. Einst halfst du mir aus großer Not und jetzt wollte ich nur mich meiner Verpflichtung gegen dich entledigen. Mein Name ist Rubinetto und ich bin jener Waldmensch, den du einst aus der Gefangenschaft deines Vaters befreitest." Darauf erzählte er ihm, wie die Fee ihn verwandelt habe. Guerrino, verwundert und erfreut, umarmte und küsste ihn mit Tränen, und sie schworen einander brüderliche Treue.
Am anderen Tage gingen beide zum Palast. Der König befahl, seine geliebten Töchter, Potenzia und Eleutheria sollten, ganz in weiße Schleier gehüllt, vor ihm erscheinen. Als sie gekommen waren und niemand eine von der anderen unterscheiden konnte, sprach Ziftoi: „Guerrino, welche von Beiden willst du zur Gemahlin haben?" Guerrino antwortete nicht und stand sinnend da. Darüber wurde der König ungeduldig und trieb ihn an: „Die Zeit vergeht“, sprach er, entschließ dich." — „Mein König“, erwiderte Guerrino: „Du hast mir den ganzen heutigen Tag zur Überlegung gegönnt und noch ist er nicht vorüber."
So schwebte alles in Sorge und Erwartung; da flog die Wespe herbei und umschwirrte das Haupt der goldlockigen Potenzia. Diese erschrak und jagte sie mit der Hand fort; und als die Wespe sich ihr dreimal genaht und Potenzia sie dreimal verscheucht hatte, flog sie davon. Guerrino gab genau darauf Acht und das Vertrauen auf seinen geliebten Rubinetto hob nun jeden Zweifel. „Wohlan“, rief jetzt der König, „es ist Zeit, der Sache ein Ende zu machen, wähle also.«
Guerrino betrachtete beide Jungfrauen wohl, dann legte er die Hand auf das Haupt Potenzias, die er durch Hilfe der Wespe kannte und sprach: „Mein König, diese ist eure Tochter mit den goldenen Locken." Da nahm die Jungfrau den Schleier ab und alle sahen, dass es die Prinzessin Potenzia war. Der Vater gab sie ihm nun zur Gemahlin, zur großen Freude des ganzen Volks, und Rubinetto, sein treuer Gefährte, bekam die andere Schwester. Hierauf entdeckte Guerrino, dass er der Sohn des Königs von Sizilien sei und Zifroi, dessen Zufriedenheit dadurch vermehrt ward, feierte die Hochzeiten aufs Prächtigste.
Man unterließ nicht, den Eltern des Guerrino Nachricht von dieser Heirat zu geben; und ihre Freude bei einem so unerwarteten Glück war unbeschreiblich, denn sie hatten ihren Sohn für verloren geachtet. Bald darauf kehrte Guerrino in Begleitung seiner geliebten Gattin, seines treuen Bruders und seiner Schwägerin nach Sizilien zurück, wo ihn seine Eltern auf das Zärtlichste empfingen. Und dort lebte er lange Zeit in Glück und Frieden, mit einer blühenden Nachkommenschaft gesegnet.

DER RABE ...

Es war einmal ein König von Fratta-Umbrosa, namens Milluccio, der ein so großer Freund der Jagd war, dass er die Notwendigsten Angelegenheiten des Staates und seines Hauses versäumte, um einem Hasen oder einem Vogel nachzujagen. Während er nun dieser Neigung sich gänzlich hingab, führte ihn der Zufall eines Tages in einen Wald, welcher, von Bäumen dick belaubt, den Strahlen der Sonne den Durchgang verwehrte. Dort fand er auf einem schönen Marmorstein einen unlängst getöteten Raben.
Als der König den weißen Stein mit dem frischen Blute des Raben bespritzt sah, stieß er einen tiefen Seufzer aus und rief: „O Himmel, könnte ich nicht ein Weib bekommen, die so rot und weiß wär', wie jener Stein, und die so schwarze Haare und Brauen hätte, wie die Federn dieses Raben!" — Bei diesem Gedanken geriet er so ganz außer sich, dass er selbst einer Marmorstatue glich.
Weil er sich nun diese Grille in den Kopf gesetzt, so geschah es, dass er an nichts anderes dachte, als an jenes Bild, welches in seinem Herzen wohnte. Wo er auch immer die Augen hin wandte, begegnete ihm das selbe, und während er alle anderen Angelegenheiten hinten ansetzte, hatte er nichts anderes im Kopf, als jenen Marmorstein, so dass er sich der maßen abzehrte, dass er sichtbar dahin schwand.
Auf solche Weise nun wurde jener Stein ein Mühlstein für ihn, der ihm das Leben zermalmte, ein Porphyr, an dem die Farben seiner Tage sich zerrieben, ein Feuerstein, durch dessen Funken seine Seele in Brand geriet, so dass sein Bruder Jennariello, als er ihn so hin scheiden und abmagern sah, zu ihm sagte: „Lieber Bruder, was hast du denn, dass du den Schmerz so in deinen Augen und die Verzweiflung so in deinem Angesichte umher trägst? Was ist dir zugestoßen? sprich und öffne deinem Bruder dein Herz. Öffne immer deinen Mund, und sag mir, was du fühlst, denn du kannst überzeugt sein, dass, wenn ich kann, ich ein tausendfaches Leben daran setzen würde, um dir zu helfen."
Milluccio, welcher nur mit Mühe und unter tiefen Seufzern die Worte hervor stammelte, dankte ihm für seine Liebe und erwiderte: dass er an seiner Zuneigung zwar nicht zweifle, für sein Übel aber sei kein Kraut gewachsen, denn es entspränge aus einem Stein, in den er seine Wünsche ohne Hoffnung auf Frucht gesät hätte, aus einem Stein, von welchem er auch nicht die geringste Hoffnung hegen könne, einem Stein, der, wenn er bis auf den Gipfel seiner Wünsche gerollt worden, dann hurtig wieder hinunter stürze.
Endlich nach vielem Bitten sagte er ihm alles das, was mit seiner Liebe vorgegangen war. Als der Bruder dies vernommen, tröstete er ihn so gut er konnte und sagte zu ihm, er solle nur gutes Mutes sein und sich von seiner traurigen Liebe nicht fortreißen zu lassen, denn er selbst wäre entschlossen, um seinetwillen die Welt so lange zu durchstreifen, bis er eine Frau fände, die das Abbild jenes Steines wäre. Und nachdem er ein großes Schiff mit Waren hatte ausrüsten lassen und sich als Kaufmann gekleidet, begab er sich auf den Weg nach Venedig, jenem achten Wunder der Welt, ließ sich dort einen Freibrief erteilen, um nach der Levante zu reisen, und segelte nach Kairo ab.

Beim Eintritt in die Stadt begegnete Jennariello einem Mann, der einen sehr schönen Falken trug. Diesen kaufte er sofort für seinen Bruder, der ein so großer Freund der Jagd war, und als er bald darauf einem anderen Manne begegnete mit einem schönen Ross, so kaufte er auch dieses. So dann begab er sich in ein Wirtshaus, um sich von den Mühsalen der Seefahrt zu erholen. Den folgenden Morgen aber, als das Heer der Sterne auf Befehl des obersten Befehlshabers des Lichtes die Lagerzelte des Himmels abbrach und abzuziehen anfing, begann Jennariello durch die Stadt umherzugehen, indem er seine Augen wie ein Luchs überall hinwarf, bald nach dieser, bald nach jener Frau blickend, ob er vielleicht zufällig ein Gesicht von Fleisch, ähnlich jenem von Stein, fände.
Während er nun hie- und dorthin ging, und die Augen umher warf wie ein falscher Spieler, welcher fürchtet, ertappt zu werden, so begegnete er einem Bettler, welcher eine ganze Apotheke von Pflastern auf dem Leibe trug, und der ihn anredete: „Mein lieber Mann, was fehlt euch denn, ihr seid ja so niedergeschlagen?" Wenn ich dir auch sagte, wie es mir geht“, erwiderte Jennariello“, so würde mir das wenig genug helfen."
„Nicht so voreilig, mein guter Freund“, versetzte der Bettler, „man kann nicht wissen, was geschieht. Hätte Darius seine Verlegenheit nicht einem Stallknecht erzählt, so wär' er nicht König von Persien geworden; es ist daher nicht so was Törichtes, dass du einem armen Bettler deine Sorge mitteilst, denn es ist kein Span so dünn, dass er nicht zum Zahnstocher dienen könnte."
Als Jennariello diesen Armen so klug und verständig reden hörte, teilte er ihm die Veranlassung mit, die ihn in dieses Land gebracht hatte, worauf Jener erwiderte: „Jetzt sieh', mein Sohn, wie man Nichts gering schätzen darf, denn wenn ich auch gleich nur Kehricht wäre, so könnte ich doch den Garten deiner Hoffnungen düngen. Jetzt höre zu: Ich werde unter dem Vormunde, Almosen zu fordern, an die Tür eines schönen Mädchens, der Tochter eines Zauberers, klopfen: mach deine Augen gehörig auf, betrachte sie genau, dann wirst du das Bild derjenigen, welche dein Bruder wünscht, erblicken."
Mit diesen Worten klopfte er an die Tür eines nicht weit entfernten Hauses, worauf Liviella erschien und dem Bettler ein Stück Brot zuwarf. Jennariello zweifelte nicht, sobald er sie wahrnahm, das ersehnte Bild seines Bruders gefunden zu haben und nachdem er dem Bettler ein gutes Almosen gereicht, schickte er er ihn fort, ging in ein Wirtshaus und verkleidete sich als Tabulettkrämer. Er trug in zweien Kästchen die schönsten Sachen von der Welt mit sich umher und ging, seine Waren ausrufend, so lange vor dem Hause der Liviella auf und ab, bis sie ihn herbeiwinkte und alle die schönen Sachen, Tücher, Bänder, Nadeln, Fläschchen, Spitzen, Kanten, die er bei sich trug, beäugelte.
Zuletzt sagte sie zu ihm: er möge ihr jetzt noch etwas anderes Schönes vorzeigen, worauf Jennariello erwiderte: „In diesem Kasten trage ich nur wertlose, unbedeutende Dinge, wenn ihr aber in mein Schiff kommen wollt, so werde ich euch die prächtigsten Sachen von der Welt zeigen, denn dort hab ich welche von seltener Kostbarkeit und in großer Auswahl."
Liviella, der es an Neugierde nicht fehlte, sagte zu ihm: „Wahrhaftig, wenn mein Vater jetzt nicht aus wäre, möchte ich wohl mit dir mitgehen." „Desto besser“, erwiderte Jennariello, „komm nur mit, denn vielleicht würde dein Vater dir diese Freude nicht machen; ich verspreche dir, dich gar wunderbare Dinge sehen zu lassen." Liviella, welche allzu große Lust empfand, diese Wunder zu sehen, rief eine Nachbarin herbei, die sie begleiten sollte, und begab sich auf das Schiff.
Jennariello aber, während sie damit beschäftigt war, die schönen Dinge alle anzustaunen, ließ heimlich die Anker lichten und die Segel aufziehen, so dass, bevor Liviella die Augen von den Waren abwandte, er sich vom Lande entfernt und schon manche Meile zurückgelegt hatte. Als sie dies gewahr wurde, fing sie an, in Klagen und lauten Jammer auszubrechen; nachdem ihr jedoch Jennariello mitgeteilt hatte, wohin er sie bringe und welches Glück ihrer warte, und außerdem noch ihr die Schönheit und Tugenden seines Bruders lebhaft schilderte, sowie die Liebe, mit welcher er sie empfangen würde, brachte er es so weit, dass sie sich beruhigte und sogar den Wind bat, sie rasch dorthin zu bringen, wo sie das Vorbild des ihr von Jennariello entworfenen Gemäldes sehen sollte.
Während sie so fröhlich dahin schifften, vernahmen sie plötzlich, wie unter dem Schiffe die Wellen anfingen dumpf zu rauschen, und obwohl sie nur zur Zeit noch leise sprachen, so verstand doch der Schiffspatron, was sie meinten, und rief allen Leuten am Bord zu, sich fertig zu halten, weil ihnen ein heftiger Sturm drohe. Bei diesen Worten fing auch schon der Wind zu pfeifen an und plötzlich war der Himmel mit Wolken bedeckt und das Meer voll hoher Wogen, und weil die Wellen neugierig waren, zu wissen, was im Schiffe vorgehe, so stiegen sie uneingeladen in das selbe hinein.
Während nun alle Matrosen die Hände voll zu tun hatten, und der eine auf das Steuerruder, der andere auf die Segel und der dritte auf die Taue achtete, stieg Jennariello auf den Mastkorb, um mit einem Fernglas weit hinzusehen, ob er Land entdecke, um dort Zuflucht zu suchen. Da plötzlich, während er mit einer halben Elle Fernrohr hundert Meilen Entfernung ausfindig machte, sah er einen Täuberich und eine Taube heran fliegen, welche sich auf einer Segelstange niedersetzten, worauf der Täuberich ausrief: „Girr, Girr!" „Was hast du denn, mein liebes Männchen“, fragte ihn die Taube, worüber beklagst du dich?" Und der Täuberich antwortete: „Dieser unglückliche Prinz hat einen Falken gekauft, welcher, sobald er in die Hand des Bruders gekommen ist, diesem die Augen auskratzen wird, und wer ihm den selben nicht bringt oder ihn davon benachrichtigt, der wird in einen Marmorstein verwandelt werden."
Nachdem er dies gesagt, fing er von Neuem an: „Girr, girr!" Und das Weibchen fragte wiederum: „Warum bist du noch immer traurig?“, und der Täuberich erwiderte: „Er hat auch ein Pferd gekauft, und wenn der Bruder es zum ersten Mal reiten wird, so wird er sich den Hals brechen, und wer ihm das selbe nicht bringt oder ihn davon benachrichtigt, wird in einen Marmorstein verwandelt werden."
Und darauf fing er wieder an mit seinem Girr, Girr! „O weh!“, begann von Neuem das Weibchen, „so viele Girr, Girr, was gibt es denn noch?" Und der Täuberich fuhr fort und sagte: „Der Prinz bringt seinem Bruder auch eine schöne Frau, aber in der Hochzeitnacht werden sie Beide von einem hässlichen Drachen verschlungen werden, aber wer sie ihm nicht bringt, oder ihn davon benachrichtigt, wird in einen Marmorstein verwandelt werden."
Nach diesen Worten hörte der Sturm auf, das Meer beruhigte sich und der Wind legte sich. Aber ein weit größerer Sturm begann in der Brust des Jennariello wegen dessen, was er vernommen hatte, und mehr als viermal wollte er alle diese Dinge ins Meer werfen, um seinem Bruder nicht selbst das Verderben zuzuführen; andrerseits aber dachte er an sich selbst, in dem er befürchtete, wenn er sie nicht dem Bruder überbringe, oder ihn davon benachrichtige, in einen Stein verwandelt zu werden. Daher beschloss er, mehr auf das Hemd als auf den Rock zu achten.

Als er in den Hafen von Fratta-Umbrosa eingelaufen war, fand er den Bruder an der Meeresküste, welcher das Schiff hatte zurück kehren sehen und ihn mit großer Freude erwartete. Da der König sah, dass Jennariello ihm diejenige brachte, die er in seinem Herzen umher trug, war er so sehr erfreut, dass die große Fülle der Freude ihm fast das Leben genommen hätte. Hieraus umarmte er seinen Bruder und sagte zu ihm: „Was ist das für ein Falke, den du da in deiner Hand trägst?"
Jennariello entgegnete: „Ich habe ihn für dich gekauft." „Wohl kann man sehen“, antwortete Milluccio, „dass du mich liebst, da du alle meine Launen befriedigst, und sicherlich, wenn du mir einen Schatz gebracht hättest, würde er mir nicht mehr Freude machen, als dieser Falke. Bei diesen Worten wollte er ihn in die Hand nehmen, Jennariello aber schnitt mit einem Messer, welches er an seiner Seite trug, dem Falken rasch den Hals ab. Der König, hierüber ganz erstaunt, glaubte, sein Bruder sei wahnsinnig geworden. Um aber die Freude der Rückkehr nicht zu stören, verlor er kein Wort.
Als er hierauf das Pferd sah und fragte, wem es gehöre, und vernahm, dass es für ihn bestimmt sei, bekam er Lust, es zu reiten; allein während er sich den Steigbügel halten ließ, schnitt Jennariello dem Pferde rasch die Beine durch.
Dies fuhr dem König gewaltig in die Nase, denn er meinte nun gewiss zu sein, dass Jennariello ihm dies zum Trotz tue, aber auch diesmal verbarg er seinen Unwillen, um der Jungfrau keinen Anstoß zu geben, an deren Lieblichkeit er sich gar nicht satt sehen konnte.
Als sie hierauf an den königlichen Palast gekommen waren, lud er alle vornehmen Frauen der Stadt zu einem prächtigen Feste ein, wo selbst es auf das Herrlichste und Köstlichste herging und nach dessen Beendigung die Neuvermählten sich zur Ruhe begaben. Jennariello, der nichts anderes im Kopfe hatte, als wie er seinem Bruder das Leben retten könne, verbarg sich hinter dem Bette der Braut und passte wohl auf, bis er den Drachen kommen sähe.
Siehe, da erschien um Mitternacht in jenem Zimmer ein entsetzlicher Drache, welcher Flammen aus den Augen sprühte und Rauch aus seinem Rachen ausstieß. Als Jennariello ihn kommen sah, fing er an, mit einem Damaszenersäbel, den er bereit hielt, rechts und links um sich zu hauen und versetzte unter anderem einem Bettpfosten einen so gewaltigen Hieb, dass er ihn mitten aus einander schlug, bei welchem Lärm der Bruder aufwachte und der Drache verschwand.
Als Milluccio den bloßen Säbel in der Hand des Jennariello und den Bettpfosten durch gehauen sah, fing er an zu rufen: „Heda, Leute, zu Hilfe, zu Hilfe! dieser Verräter von Bruder ist gekommen, mich zu töten!" Auf dieses Geschrei liefen eine Menge Leute herbei, die im Vorzimmer schliefen, banden Jennariello und führten ihn auf Befehl des Königs ins Gefängnis. Sobald der Morgen heran brach, berief dieser seinen Rat und erzählte das Vorgefallene. Indem man nun seinen üblen Willen, den Jennariello bei der Tötung des Falken und des Pferdes an den Tag gelegt, gleichfalls in Erwägung zog, verurteilten sie ihn zum Tode.
Die Bitten der Liviella vermochten nicht, das Herz des Königs zu erweichen, welcher vielmehr sagte: „Du liebst mich nicht, weil du meinen Bruder höher achtest, als mein Leben. Du hast mit deinen eigenen Augen diesen Mörder mit dem Säbel in der Hand gesehen, und wäre es nach seinem Willen gegangen, so wäre ich in dieser Stunde tot." Mit diesen Worten befahl er der Gerechtigkeit ihren Lauf zu lassen.
Als Jennariello dieses Urteil sich vorlesen hörte und sich durch seine Lust, Gutes zu tun, in so viel Unglück gestürzt sah, wusste er nicht, was er tun solle, denn wenn er nicht sprach, so war es schlimm, und wenn er sprach, noch schlimmer. Wenn er schwieg, verlor er den Hals unter einem Eisen, und wenn er redete, so beendigte er seine Tage als Stein. Endlich nach verschiedenem Hin- und Hersinnen beschloss er, die Sache seinem Bruder mitzuteilen, und da er doch jedenfalls sterben musste, hielt er es für besser, den Bruder von der Wahrheit zu unterrichten und sein Leben als Unschuldiger zu beendigen, als die Wahrheit verborgen zu halten und als Verräter die Welt zu verlassen.
Er ließ daher seinen Bruder wissen, dass er mit ihm von etwas Wichtigem reden wolle, worauf Jener ihn vorführen ließ und Jennariello ihm eine lange Rede über die Liebe hielt, die er ihm stets an den Tag gelegt hatte. Er gedachte so dann des Betruges, durch welchen er ihm Liviella verschafft, und erzählte, was er von den Tauben in Betreff des Falken gehört habe, den er, um nicht in Marmor verwandelt zu werden und die Augen seines Bruders zu schützen, getötet hatte.
Bei diesen Worten fühlte er, wie die Beine ihm erstarrten und sich in Marmor verwandelten, und als er ebenso den Grund entdeckte, weshalb er jenes Pferd getötet, verwandelte er sich sichtbar auf eine jammervolle Weise bis an die Hüften in Stein; zuletzt aber, da er den Vorfall mit dem Drachen offenbarte, verwandelte er sich ganz und gar in Marmor, so dass er in der Mitte des Saales da stand wie eine Statue, worauf der König vor Entsetzen außer sich geriet, das unüberlegte Urteil, das er über seinen so guten und so liebevollen Bruder gefällt, verwünschte und ein ganzes Jahr lang trostlos einherging, und immer, wenn er daran dachte, einen Tränenstrom vergoss.

Inzwischen gebar Liviella Zwillinge, welche wunderschön waren. Als nun die Königin nach einigen Monaten auf dem Felde spazieren ging und der Vater mit den beiden Kindern sich in dem Saale befand, die Augen voll Tränen über seine Torheit, die ihm jenen Trefflichsten der Menschen entrissen hatte, siehe, da trat ein alter Mann in das Zimmer, welchem das Haar die Schultern bedeckte und der Bart bis auf die Brust hinunter hing. Er verbeugte sich ehrfurchtsvoll vor dem König und fragte ihn, was er ihm wohl bezahlen würde, wenn er diesem Bruder seine frühere Gestalt wieder gäbe; worauf der König erwiderte: „Ich gebe mein Reich darum."
„Das ist keine Sache“, versetzte der Greis, „wobei es auf Reichtümer ankommt, sondern da es sich um Leben handelt, so muss mit dem Leben bezahlt werden.«
Und der König, sowohl aus Liebe für Jennariello, als auch, weil die Schuld des Unglücks sein war, antwortete: „Glaube mir, Freund, ich würde mein Leben um das seinige geben und wenn er nur aus dem Steine heraus käme, wollte ich selber gern zum Stein werden."
Als der Greis dies hörte, sagte er: „Ohne dass du dein Leben daran wendest, da es so viel Mühe kostet, ehe ein Mensch heranwächst, würde das Blut dieser deiner Kinder, auf die Statue gespritzt, genügen, um sie zu beleben." Der König erwiderte bei diesen Worten: „Kinder kann ich auch wohl noch andere bekommen, einen Bruder aber wie diesen nimmer wieder." Und damit brachte er vor dem Götzen eines Steines ein bejammernswertes Opfer; die Statue aber, mit dem Blute bespritzt, wurde plötzlich lebendig.
Die beiden Brüder umarmten sich hierauf und freuten sich unsäglich; nachdem aber der König jene armen Geschöpfe in einen Sarg hatte legen lassen, um sie mit gebührender Ehre zu bestatten, kam plötzlich die Mutter nach Hause. Der König hieß Jennariello sich verbergen und fragte seine Frau: „Was gäbst du, mein Herz, wenn mein Bruder lebendig würde?" «Ich gäbe dieses ganze Reich“, erwiderte Liviella. „Gäbst du wohl das Blut deiner Kinder?« fuhr der König fort. „Das nicht“, erwiderte die Königin, „denn das hieße mir mit eigenen Händen das Herz aus dem Leibe zu reißen." „Wehe mir!“, sagte hierauf der König, „um meinen Bruder wieder lebendig zu machen, habe ich die Kinder getötet, denn dies war der Preis des Lebens Jennariello's."
Mit diesen Worten wies er ihr die Kinder im Sarge, bei welchem kläglichen Schauspiel die Mutter wie wahnsinnig ausrief: „O meine Kinder, o ihr Stützen meines Lebens, ihr Quellen meines Blutes, wer hat den Tag meines Lebens so sehr verdunkelt, wer hat die Pulsader meiner Lebenskraft durchschnitten? wehe mir, liebe Kinder, ihr verlorenen Hoffnungen meines Lebens, ihr vergifteten Süßigkeiten meines Daseins, ihr seid vom Eisen durchbohrt, ich von Schmerz zerrissen, ihr im Blute erstickt, ich in Tränen ertränkt! Um einem Oheim das Leben zu geben, habt ihr die Mutter getötet, o meine Kinder, meine Kinder, warum antwortet ihr nicht eurer Mutter, die jetzt ihr Blut durch die Augen vergießt! Da aber jetzt der Quell meiner Freuden vertrocknet ist, will auch ich nun nicht länger mehr leben!" Mit diesen Worten eilte sie an das Fenster, um sich hinab zu stürzen.
In dem nämlichen Augenblick aber schwebte ihr Vater auf einer Wolke durch das Fenster in den Saal, und sagte zu ihr: „Halt ein, Liviella, denn jetzt bin ich versöhnt, nachdem ich mich auf dreifache Weise gerächt, an Jennariello, der in mein Haus kam, um mir die Tochter zu entführen, dadurch, dass er so lange Monate in eine Marmorstatue verwandelt da stand; an dir, weil du ohne Rücksicht auf deinen Vater dich zum Schiff begabst und ihm entflohst, dadurch, dass du deine beiden Kinder von dem eigenen Vater getötet sahst, und an dem Könige für die Grille, sich eine Frau von so weit her kommen zu lassen, dadurch, dass er seinen eigenen Bruder verurteilt und seine Kinder getötet hat. Aber weil ich euch nur bestrafen, aber nicht habe martern wollen, will ich, dass der ganze Wermut sich in Zucker verwandle, und darum gehe hin und hole dir deine Kinder, welche jetzt schöner sind, als je. Und du, Milluccio, umarme mich, denn ich betrachte dich von nun an als meinen Sohn, und eben so verzeihe ich dem Jennariello seine Vergehungen, da er alles eines so würdigen Bruders willen getan hat."
Bei diesen Worten kamen die Kinder herbei, die der Großvater nicht genug betrachten und küssen konnte, und an allen diesen Freuden nahm nun auch Jennariello Teil, nachdem er so viele Leiden erduldet hatte, die er nimmer vergaß und die aufs Neue betätigten, wie vorsichtig der Mensch sein solle, damit er nicht in einen Graben falle, da alles menschliche Vorherbedenken nur schief und irrig ist.

DER FLOH ...

Es war einmal der König von Altamonte von einem Floh gebissen worden. Diesen fing er mit großer Geschicklichkeit, und als er ihn betrachtete, schien er ihm so groß und schön, dass er sich ein Gewissen daraus machte, ihn auf dem Folterbrett des Nagels sterben zu lassen. Er steckte ihn daher in eine Flasche, und da er ihn alle Tage mit dem Blut seines eigenen Armes fütterte, wuchs das Tier so gewaltig, dass man ihm nach Verlauf von sieben Monaten ein anderes Quartier anweisen musste, weil es fetter ward, als ein Hammel.
Als der König dies sah, so ließ er ihm die Haut abziehen und gerben, und so dann öffentlich ausrufen, wer erraten könne, von welchem Tier dies Fell sei, solle die Tochter des Königs zur Frau bekommen.
Als diese Bekanntmachung ergangen war, eilten die Leute haufenweise herbei und kamen aus den letzten Enden der Welt, um ihr Glück zu versuchen. Der Eine sagte, es wäre die Haut von einem Affen, der andere die von einem Luchs, der Dritte von einem Krokodil!, und wieder Einer, es wäre von dem, und wieder ein Anderer, es wäre von jenem Tiere. Alle aber waren hundert Meilen links und keiner traf den Nagel auf den Kopf. Endlich sah sich dieses Gerippe ein wilder Mann an, das abscheulichste Ungetüm von der Welt, bei dessen Anblick der keckste Bursche in Zittern und Beben geriet. Nachdem jener nun das Fell berochen und beschnüffelt hatte, wusste er sogleich, woran er war,, und sagte: „Dies Fell ist das Fell des Königs der Flöhe."
Der König, da er sah, dass der wilde Mann die Sache so gut getroffen hatte, wollte sein Wort nicht brechen, und ließ seine Tochter Porziella rufen, ein Mädchen wie Milch und Blut; sie war so gerade wie eine Spindel, und man hätte sie mit den Augen verschlingen mögen, so schön war sie.
„Mein liebes Kind“, sagte der König, „du kennst wohl das Manifest, das ich habe ergehen ließ, und weißt auch, wer ich bin. Mit einem Wort, ich kann mein Versprechen nicht zurück nehmen. Das Wort ist gegeben, ich muss es auch erfüllen, und wenn mir gleich das Herz darüber springt. Wer hätte sich denken können, dass dieser Gewinn einem wilden Manne zufallen würde! Aber da ohne den Willen des Himmels kein Blatt vom Baume fällt, so muss ich auch glauben, dass diese Heirat im Himmel geschlossen worden ist. Hab also Geduld und sei meine gute Tochter, und widersprich deinem Vater nicht, denn mein Herz sagt mir, dass du zufrieden leben wirst; man hat das Glück oft da gefunden, wo man es am wenigsten vermutete."
Als Porziella diese traurige Nachricht vernahm, so füllten sich ihr die Augen mit Tränen, die Wangen erbleichten, ihre Knie zitterten, und sie war nahe daran, in Ohnmacht zu fallen. Zuletzt brach sie in Tränen aus und sagte zum Vater: „Was hab ich dir denn zu Leide getan, dass du diesen Jammer über mich bringst? Wie hab ich mich doch gegen dich vergangen, dass du mich diesem Ungeheuer überlieferst?
O, erbarmungswürdige Porziella, wie ein unglückliches Schaf bist du jetzt der Fraß eines Wehrwolfs! Ist das die Liebe, welche du für dein Blut hegst, ist das die Zärtlichkeit, welche du der erweisest, die du deinen Augapfel nanntest? So reißest du dir aus dem Herzen die, welche ein Teil deines Blutes ist, o, Vater, grausamer Vater, du bist nicht von Menschen entsprossen, Seeungeheuer haben dir das Leben gegeben, und wilde Katzen dich gesäugt. Aber was sage ich, Ungeheuer des Meeres und der Erde — jedes Tier liebt seine Jungen, du allein hast kein Herz, du allein hasst deine Tochter! Hätte mich doch lieber die Mutter erwürgt! Wäre die Wiege mir doch zum Totenbett geworden, die Brust der Amme zum Giftbecher, die Windeln zu tödlichen Schlingen und die Klapper, die man mir umhängte, zur Keule, da es so weit mit mir kommen sollte, diesen schrecklichen Tag zu erleben, an dem ich von der Hand einer Harpie mich geliebkost, mich umarmt von Bärentatzen, von zwei Eberhauern mich geküsst sehen soll!"
Sie wollte noch weiter sprechen, als der König ganz entrüstet sie unterbrach: „Nur behutsam, denn der Becher ist von Glas. Gieße nur langsam, damit die Hefe nicht mitkommt. Halte deinen Mund und lass die Zunge nicht zu sehr laufen. Nicht allzu bitter, denn der Zucker ist teuer. Was ich tue, ist wohlgetan. Mache nicht, dass mir der Senf in die Nase steige, denn wenn ich dir erst über den Hals komme, so lass ich dir keinen Knochen im Leibe ganz. Schreibe ja deinem Vater keine Gesetze vor; seit wann ist es Sitte, dass ein Mädchen, dass ein Ding, welches den Windeln kaum entwachsen ist, sich meinem Willen widersetze? Rasch, gib ihm die Hand und geh in diesem Augenblick mit ihm in sein Haus, denn ich will nicht dieses unverschämte kecke Gesicht noch einen Augenblick vor Augen sehen."
Die betrübte Porziella, als sie sich in solcher Bedrängnis sah, fasste die Hand des wilden Mannes mit dem Gesicht eines zum Tode Verdammten, mit dem Blick einer Wahnsinnigen, mit dem Herzen eines, der sich zwischen dem Beil und dem Blocke befindet, und wurde von ihm in einen dichten Wald geschleppt, wo die Bäume den Rasen überwölbten, damit ihn die Sonne nicht schaue, wo die Bäche, weil sie im Dunkeln gingen, über die Steine stolperten und die wilden Tiere ohne Furcht und Scheu sich lustig machten, wo nie der Fußtritt eines Menschen hin kam, der nicht die Straße verloren.
An diesem unseligen schauerlichen Aufenthalt befand sich das Haus des wilden Mannes, ganz austapeziert und ausgeschmückt rings umher mit Knochen von Menschen, die er aufgefressen hatte. Denkt euch nun den Schrecken, das Grauen, das Zittern und Beben, das Entsetzen, welches das arme Mädchen empfand, so werdet ihr leicht glauben, dass jeder Tropfen Blut ihr zu Eis erstarrte. Aber das war noch nicht alles, denn zu Mittag bekam sie Erbsen und zu Abend Bohnen; und wieder Bohnen und Erbsen, Erbsen und Bohnen und so fort.
Inzwischen war der wilde Mann auf die Jagd gegangen; als er zurück kehrte, war er ganz beladen mit toten Leibern und sagte: „Nun kannst du dich nicht beklagen, liebe Frau, dass ich dich nicht pflege, hier hast du einen guten Vorrat von Essen; nimm und mach dich luftig, denn eher wird der Himmel auf die Erde fallen, eh ich dich an irgend etwas Mangel leiden lasse."
Die arme Porziella spuckte aus und wandte voll Abscheu das Gesicht fort. Der wilde Mann, der dies wohl bemerkte, entgegnete: „Das heißt Perlen den Schweinen vorwerfen, aber es hat nichts auf sich. Ich bin zu morgen auf eine Schweinsjagd eingeladen worden, von da werde ich dir ein paar Schweine nach Hause bringen; dann wollen wir mit unseren Freunden und Vettern ein herrliches Mahl veranstalten, und so luftig und guter Dinge unsere Ehe beginnen."
Hierauf begab er sich in den Wald, und während sie, ganz in traurigen Gedanken verloren, am Fenster steht, geht zufällig eine alte Frau an dem Hause vorüber, die, vor Hunger erschöpft, sie um ein Stück Brot bittet. „O liebe Frau“, erwiderte das arme Mädchen, „Gott weiß, dass ich mich in der Gewalt eines Ungeheuers befinde, das mir nichts anderes ins Haus bringt, als Menschenviertel, dass ich nicht weiß, wie ich diesen Gräuel auch nur ansehen soll, so dass ich das jämmerlichste Leben zubringe, welches nur je geführt worden ist, und bin doch eine Königstochter! Und bin doch mit Zuckerwerk groß gezogen worden, und habe doch stets gehabt, was ich wollte."
Und mit diesen Worten fing sie zu weinen an wie ein kleines Kind, dem man das Essen fortnimmt, so dass die alte Frau, von Mitleid ergriffen, zu ihr sagte: „Sei nur gutes Mutes, mein schönes Kind, zerstöre deine Schönheit nicht durch Weinen, ich werde dir nach allen Kräften zu helfen suchen. Jetzt höre. Ich habe sieben Söhne, wie die Riesen: Mast, Nardo, Cola, Micco, Petrullo, Ascadeo und Ceccone. Diese meine sieben Söhne besitzen ganz außerordentliche Kräfte. Wenn Mase das Ohr auf die Erde legt, so hört er alles, was dreißig Meilen im Umkreise sich regt. Wenn Nardo spuckt, so macht er ein großes Meer von Seifenschaum; wenn Cola ein Eisen auf die Erde wirft, so entsteht ein Feld voll scharfer Messer; wenn Micco nur ein Reis hinwirft, so erhebt sich ein dichter Wald; wenn Petrullo einen Wassertropfen ausgießt, so braust ein furchtbarer Strom; wenn Ascadeo einen Stein hin wirft, so steigt ein gewaltiger Turm aus der Erde, und Ceccone zielt so genau mit seiner Armbrust, dass er auf eine Meile weit einer Henne ein Auge ausschießt. Mit Hilfe dieser meiner Söhne nun, die voller Höflichkeit und Freundlichkeit sind, und gewiss Mitleid mit dir haben werden, will ich dich wohl den Klauen dieses wilden Mannes entreißen, denn dieser hübsche leckere Bissen passt nicht für die Schnauze eines solchen scheußlichen Ungeheuers."
„Das ist ja vortrefflich“, erwiderte Porziella, „und jetzt ist gerade die beste Zeit, denn das Ungetüm ist eben ausgegangen und kommt erst morgen Abend wieder; wir werden also Zeit haben, uns aus dem Staube zu machen." „Heut Abend kann es nicht geschehen“, entgegnete die alte Frau, „denn ich wohne ziemlich weit von hier. Es ist aber genug, wenn ich und meine Söhne uns morgen früh daran machen, dich aus deiner bedrängten Lage zu befreien."
Hierauf ging sie fort, und Porziella, der das Herz vor Freude schwoll, legte sich zur Ruhe nieder. Aber kaum dass die Vöglein der Sonne ihren Morgenruf zwitscherten, siehe, da kam auch die alte Frau, mit den sieben Söhnen, und Porziella in die Mitte nehmend, begaben sie sich auf den Weg zur Stadt. Sie waren aber noch keine halbe Meile gegangen, als Mase, die Ohren auf die Erde legend, ausruft: „Aufgepasst, es gilt, der Fuchs ist da! Der wilde Mann ist schon nach Hause gekommen, und da er die Jungfrau nicht gefunden, so hat er sich eiligst auf den Weg gemacht, um uns einzuholen."
Als Nardo dies vernahm, spuckte er auf die Erde und machte ein Meer von Seifenschaum. Der wilde Mann kommt heran, und als er diese Seifenlauge erblickt, eilt er nach Hause, nimmt einen Sack voll Werg, und wickelt ihn sich so um die Füße, dass er endlich, wenn auch mit großer Mühe, das Hindernis glücklich überwindet. Mase, der wiederum sein Ohr auf die Erde legt, spricht hierauf: „Der Tausend noch einmal, da kommt er ja wieder." Hierauf wirft Cola ein Stück Eisen auf die Erde, und als bald ersteht ein Feld von Rasiermessern.
Der wilde Mann, der sich den Weg versperrt sieht, eilt noch einmal nach Hause, hüllt sich von Kopf bis zu Fuß in Eisen, kehrt zurück und durchschreitet so das Feld.
Noch einmal legt Mase sein Ohr auf die Erde und ruft: „Jetzt vorgesehen! Da kommt der wilde Mann wieder angelaufen, als wenn er flöge. Alsbald lässt Micco durch ein Reis einen furchtbaren Wald emporwachsen, durch den man nur mit äußerster Schwierigkeit hindurch dringen kann. Als jedoch der wilde Mann an den Wald gelangt, nimmt er ein scharfes Jagdmesser, welches er an der Seite trug, haut rechts eine Pappel, links eine Hagbuche nieder, fällt auf der einen Seite eine Steineiche, auf der anderen eine Fichte, so dass er mit vier oder fünf Hieben den ganzen Wald zur Erde streckt, und dieses Hindernis aus dem Wege räumt.
Mase, welcher die Ohren immer steif hielt, ruft hierauf von Neuem aus: „Jetzt sind wir in der größten Not, denn der wilde Mann ist uns schon wieder auf den Fersen." Als Petrullo dieses hört, nimmt er aus einer Quelle, die ohne Unterlass aus einem Felsen hervorsprudelt, einen Schluck Wasser, spritzt es auf die Erde, und also bald sieht man einen breiten Strom vorüberrauschen, dessen Fluten tobend daher brausen. Der wilde Mann, als er dieses neue Hindernis gewahr wird, zieht sich sogleich die Kleider aus, nimmt sie auf den Kopf und schwimmt an das andere Ufer.
Mase, der seine Ohren in einem fort spitzt, hört das Geräusch der Fußtritte des wilden Mannes und sagt: „Es steht schlimm mit uns, denn der wilde Mann trabt so hinter uns her, dass der Himmel uns beistehen möge. Wir wollen uns daher wohl vorsehen und dem Sturm ausweichen. Wenn nicht, so ist es mit uns für immer vorbei." „Hab keine Furcht“, sagte Ascadeo, „ich werde mit dem Ungeheuer schon fertig werden." Und kaum hat er dies gesagt, so wirft er einen Stein hin, worauf ein Turm aus der Erde steigt, in welchen sie sich rasch hinein begeben und die Tür verrammeln. Sobald der wilde Mann ankommt und sie in Sicherheit sieht, eilt er nach Hause, nimmt eine Leiter auf den Rücken, und eilt mit ihr zum Turme zurück.
Mase, der nicht aufhört zu lauschen, hört von Ferne die Ankunft des wilden Mannes und spricht: „Jetzt sind wir an dem äußersten Rande unserer Hoffnungen, denn der wilde Mann kehrt zurück, und zwar mit großer Wut. Das Herz pocht mir vor Angst, und ich fürchte, es wird uns schlecht ergehen." „Hab nur keine Furcht“, erwiderte Eeccone, „und lass mich dafür sorgen; gib Acht, ich werde ihn gehörig ins Auge nehmen." Kaum hat er dies gesagt, so lehnt der wilde Mann auch schon die Leiter an die Mauer, und fängt an hinauf zu klettern. Aber Eeccone, scharf zielend, schießt seinen Bolzen ab, und das Ungeheuer stürzt hinunter auf die Erde.
Als Eeccone dies sieht, geht er aus dem Turm hinaus, und schneidet dem wilden Manne mit seinem eigenen Jagdmesser den Kopf ab, wie wenn es frischer Käse gewesen wäre. Diesen trugen sie so dann ganz vergnügt zu dem König, der voll Freude war, seine Tochter wieder zu bekommen, denn es hatte ihn schon hundertmal gereut, dass er sie mit einem wilden Manne vermählt hatte.
Er suchte nun für Porziella einen wohl gefälligen, ihr angemessenen Ehegemahl, und machte zugleich die Mutter und ihre sieben Söhne, die seine Tochter von einem so unglücklichen Leben befreit hatten, zu reichen Leuten, denn er unterließ nicht, tausendmal sein Unrecht zu bereuen dass er um eines Eigensinnes willen Porziella so großer Gefahr ausgesetzt habe, ohne zu bedenken, einen wie großen Fehler derjenige begeht, der Heil und Glück, da sucht, wo es nicht gefunden werden kann.
![]()
DAS ZAUBERPFERD ...

An Tunis, der königlichen Hauptstadt an der Küste Afrikas, herrschte vor Zeiten Dalfreno, ein berühmter und mächtiger König, dem seine schöne, verständige Gemahlin zwei Söhne geboren hatte; der älteste Listico, der andere Livoretto genannt; Beide gesund, wohlgeartet und dem Vater gehorsam.
Diesen Brüdern versagte ein Gesetz und lange bestehender Brauch des Landes, ihrem Vater in der Regierung zu folgen, in dem dort nur dem weiblichen Geschlecht ein Recht an die Erbfolge verliehen war. Der König grämte sich sehr hierüber, denn er sah sich ohne Töchter und durfte in seinem Alter nicht erwarten, noch Kinder zu bekommen. Über dies musste er befürchten, die Söhne würden nach seinem Tode gehasst, verfolgt und mit Schmach aus dem Reich gejagt werden. Der unglückliche Vater, von diesen traurigen Gedanken gequält, fand kein Mittel, dem Übel abzuhelfen.
Er wollte sich also bei der Königin, die er zärtlich liebte, Rat einholen und sprach zu ihr: „Teuerste Gemahlin, was bleibt uns wohl für unsere Söhne zu tun übrig, da Gesetz und Landessitte uns jede Möglichkeit rauben, sie zu Erben unserer Krone zu machen?" Die verständige Frau erwiderte: „Mein König, da ihr im Besitz so großer und unermesslicher Schätze seid, glaube ich, ihr tätet recht, die Söhne, reich ausgestattet mit Geld und Kostbarkeiten, außer Landes zu schicken, wo Niemand sie kennt. Vielleicht können sie die Gunst irgend eines vornehmen Herrn erlangen und dadurch aller Roth und Ungebühr entgehen. Oder wenn sie ja der gleichen erdulden müssten, was Gott verhüte!, weiß doch mindestens Niemand, wessen Kinder sie sind. Beide sind jung, wohlgebildet und zu jeder edlen Unternehmung bereit. Und wegen der Vorzüge, mit denen die Natur sie beschenkte, werden sie bei Königen, Fürsten und Herren willkommen und beliebt sein."
Dalfreno gab dem Rat der weisen Königin vollkommen Beifall, er ließ Listico und Livoretto rufen und sprach zu ihnen: „Ihr wisst, geliebten Söhne, dass ihr keine Hoffnung habt, nach meinem Tod auf diesen Thron zu gelangen. Nicht als haftete eine Schuld oder ein Laster an euch, sondern weil Gesetz und altes Herkommen es so bestimmen und weil die schaffende Natur euch zu Männern, nicht zu Weibern gebildet. Eure Mutter und ich haben deshalb, aus Rücksicht auf euer eigen Wohl den Entschluss gefasst, euch mit Geld und Kleinodien ausgerüstet, in die Fremde zu schicken. Vielleicht könnt ihr dort zu Ruhm und Ansehen gelangen und auf eine ehrenvolle Art durch die Welt kommen. Fügt euch also unserem Wunsch."
Dieser Vorschlag gefiel den Jünglingen ungemein, und die Ausführung lag ihnen eben so sehr am Herzen als ihren Eltern, denn sie wollten gern etwas Neues sehen und erfahren. Die Königin liebte, wie die Mütter es pflegen, den jüngsten Sohn am meisten; sie rief diesen bei Seite und schenkte ihm ein schäumendes, kriegerisches Ross mit scheckiger Haut, kleinem Kopf und feurigem Blick. Und über dies, war dies schöne Pferd gefeit, wie sein Besitzer Livoretto wohl wusste.
Die Söhne sagten also ihren Eltern Lebewohl, empfingen ihren Segen und machten sich mit ihren Schätzen ins geheim auf den Weg.
Sie ritten eine Zeit lang, ohne einen Ort zu finden, an dem sie hätten bleiben können, worüber sie sich sehr betrübten. Da sprach Livoretto zu seinem Bruder: „Wir sind bis jetzt miteinander gereist und haben noch keine tapfere, unser würdige Tat verrichtet. Ich dächte daher, wir trennten uns, wenn es dir genehm ist, und Jeder ginge für sich auf Abenteuer aus." Der andere billigte diesen Vorschlag, sie umarmten und küssten sich brüderlich und nahmen Abschied von einander. Listico, von dem man nie wieder eine Sylbe gehört hat, wandte sich nach Westen und Livoretto mit seinem Zauberross schlug den Weg nach Osten ein.
Livoretto war schon lange Zeit in der Welt umher gereist, ohne etwas auszurichten; alles Geld und alle Kostbarkeiten, womit ihn der liebevoller Vater versorgt hatte, waren aufgezehrt und nichts blieb ihm übrig als sein gefeites Ross. Da kam er nach Kairo, wo in jener Zeit Sultan Danebruno herrschte, ein schlauer Greis, mächtig durch seine Reichtümer und den Umfang seines Gebietes. Dieser empfand, seines hohen Alters ungeachtet, die glühendste Leidenschaft für Belisandra, die Tochter Attarants, Königs von Damaskus, und hatte ein Heer vor diese Stadt gelegt, die er erobern wollte, damit die Prinzessin freiwillig oder durch Zwang seine Gattin würde. Allein, abgeschreckt durch das Alter und die Hässlichkeit des Sultans, war sie fest entschlossen, sich eher zu töten, als die Seinige zu werden.
Livoretto, in Kairo angekommen, durchwanderte es nach allen Seiten; die Stadt gefiel ihm sehr wohl und er beschloss, hier zu bleiben, um womöglich bei Jemand als Diener anzukommen. Denn all sein Geld war ausgegeben, weil er sich keinen Wunsch versagt und nie etwas gespart hatte. In jener Absicht ging er zum Palast, fand im Vorhof viele Mamelucken und Sklaven und fragte, ob der Sultan nicht einen Diener nötig habe, er wünsche ein Unterkommen bei ihm zu finden. Sie gaben ihm zuerst eine verneinende Antwort; doch erinnerte sich einer von ihnen, dass es an Jemand fehle, der die Schweine hüte. Er rief ihn also zurück und fragte ihn, ob er dies Amt übernehmen wolle. Livoretto war zufrieden, stieg vom Pferd und ließ sich zu dem Saustall führen. Man fragte ihn nach seinem Namen. „Ich heiße Livoretto“, sagte er. Er wurde aber von Allen nur der Sauhirt genannt.
Livoretto, nun im Dienst des Sultans, verrichtete was ihm zu tun oblag, und war nur darauf bedacht, seine Schweine zu mästen; und so groß war sein Eifer, dass er in zwei Monaten zu Stande brachte, wozu ein Anderer würde sechs gebraucht haben. Des Sultans Leute bemerkten seine Tüchtigkeit und redeten ihrem Herrn zu, ihm ein anderes Amt zu geben; es sei Schade, dass ein so fleißiger Mensch der gleichen niedere Dienste verrichte. Es wurde ihm also auf Befehl des Sultans die Sorge für die Pferde übertragen und sein Gehalt vermehrt. Diese neue Beschäftigung war ihm um so lieber, weil er dadurch Gelegenheit bekam, sein eigen Ross abzuwarten, und er fing nun an, die ihm anvertrauten Pferde zu striegeln, zu glätten und zu putzen, bis ihre Haut so glänzend wurde wie Samt. Es war unter anderen ein mutiges Füllen in dem Stall, das er seiner Schönheit wegen besonders pflegte und so gut abzurichten wusste, dass es sich verbeugte, tanzte, Ellen hohe Sprünge machte und die Füße schnell wie Pfeile durch die Luft fliegen ließ.
Die Mamelucken und Sklaven waren ganz erstaunt über die Künste des Pferdes, die sie für etwas Übernatürliches hielten, und nahmen sich vor, ihrem Herrn davon zu erzählen, damit er sich gleichfalls daran ergötze. Allein dieser, durch sein hohes Alter und unbefriedigte Leidenschaft übel gelaunt und stets mit schwermütigen Gedanken an die Geliebte beschäftigt, fragte wenig nach der gleichen Zeitvertreib und wollte nichts davon wissen. Seine Diener drangen aber so lange in ihn, bis er sich eines Morgens ans Fenster stellte, um die Geschicklichkeit des Sauhirten und die Künste, die er mit seinem Pferde machte, mit anzusehen. Er fand seine Erwartung weit übertroffen und den Sauhirten so hübsch und wohl gebildet, dass er ihm zu dem niederen Geschäft, Tiere zu warten, viel zu gut schien. Und da er die großen, verborgenen Tugenden und das edle Wesen des Jünglings bei sich erwog und sah, wie er sich in allem auszeichnete, beschloss er, ihn auf eine höhere Stufe zu heben, ließ ihn zu sich rufen und sagte ihm: „Sauhirt, künftig sollst du nicht mehr im Stall dienen, sondern an meinem Tisch aufwarten und mir kredenzen."
Der Jüngling, nun Mundschenk des Sultans geworden, verrichtete sein Amt so zierlich und gewandt, dass der Sultan und alle, die ihn sahen, ihn bewundern mussten. Darüber entstand bei den Mamelucken und Sklaven des Sultans ein überaus großer Neid gegen ihn, und sie hassten ihn so sehr, dass nur die Furcht vor ihrem Herrn sie zurückhielt, dem Mundschenk das Leben zu rauben. Sie legten aber einen schlauen Plan an, dem Armen die Ungnade des Sultans zu zuziehen, damit dieser ihn tötete oder auf ewig von seinem Angesicht verbanne.
In solcher Absicht begann der Sklave Chebur eines Morgens, als er den Sultan bediente, folgendermaßen: „Herr, ich habe eine gute Nachricht für dich." —
„Und welche?“, fragte Danebruno. „Der Sauhirt, dessen eigentlicher Name Livoretto ist, rühmt sich, er allein könne die Tochter des Königs von Damaskus in deine Gewalt bringen." —„Unmöglich!“, rief der Sultan. „Es ist in der Tat so“, versetzte Chebur: „und wenn du es mir nicht glaubst, frage nur die Mamelucken und anderen Sklaven, in deren Gegenwart er mehrmals sich dessen gerühmt hatte. Du wirst dann bald sehen, dass ich dir nicht gelogen habe."
Nachdem der Sultan von seiner ganzen Dienerschaft die Bestätigung dieser Aussage hatte, berief er Livoretto und fragte ihn, ob das wahr sei, was man von ihm berichte. Der Jüngling, der kein Wort davon wusste, leugnete es mutig mit unerschrockener Miene. „Keine Weigerung“, rief der Sultan im höchsten Zorn: „geh augenblicklich, und schaffst du mir nicht Belisandra binnen dreißig Tagen her, so verlierst du deinen Kopf!"
Voller Schrecken über diesen harten Befehl entfernte sich der Arme und ging betrübt zum Stall, in dem ihm die heißen Tränen über die Wangen liefen. „Was fehlt dir, Herr?“, redete ihn hier sein Zauberross an: „Weshalb bist du so traurig?" Weinend und seufzend erzählte Livoretto, was ihm der Sultan auferlegt habe. Da schüttelte das Pferd mit dem Kopf, und es war, als lächle es. „Fürchte nichts“, sprach es zu seinem Herrn: „die Sache wird besser ausfallen, als du denkst.
Geh wieder zum Sultan und verlange von ihm ein Schreiben an seinen Feldherrn, der vor Damaskus liegt, des Inhalts: er solle augenblicklich nach Empfang dieses mit dem Reichssiegel versehenen Befehls die Belagerung ausheben. Auch begehre von dem Sultan Geld, Kleider und Waffen, damit du kühn die heldenmütige Tat unternehmen kannst. Und wenn dir auf dem Weg irgend ein Mensch oder ein Tier begegnet und dich um einen Gefallen bittet, sei dienstfertig und schlage nichts ab, was von dir verlangt wird, so lieb dir dein Leben ist. Und wenn Jemand mich dir abkaufen will, willige ein, fetze aber einen so ungeheuren Preis heraus, dass jener von dem Handel absteht. Sollte eine Frau mich zu besitzen wünschen, so bezeige dich ihr gefällig, erlaube ihr, mir Kopf, Ohren, Hals und Rücken zu streicheln und sich an mir zu belustigen, so viel sie will, denn ich werde geduldig alles mit mir vornehmen lassen, ohne ihr Leid zuzufügen."
Livoretto ging nun heiter zum Sultan, forderte und erhielt, was ihm sein Ross angegeben hatte, bestieg es und nahm seinen Weg nach Damaskus, zur großen Freude der vor Neid glühenden Mamelucken und Sklaven, die in ihrem gewaltigen Hass sicher glaubten, er würde nicht lebendig wieder nach Kairo kommen.
Livoretto war schon mehrere Tage gereist, da kam er zu einem Fluss, und aus dem Schlamm des Ufers stieg ein so übler Geruch auf, dass er kaum näher reiten konnte. In diesem Unrat steckte ein Fisch, der schon halb tot war. Sobald der Fisch ihn erblickte, sprach er: „O edler Ritter, sei großmütig, befreie mich aus diesen Banden, denn du siehst, dass ich kaum noch atme." Der Worte seines Rosses eingedenk, stieg Livoretto ab, zog den Fisch aus dem Schlamm hervor und wusch ihn rein ab. Der Fisch bezeigte ihm erst seinen Dank für diese Wohltat, dann sagte er noch: „Nimm die drei großen Schuppen von meinem Rücken, bewahre sie wohl, und wenn du einst Hilfe brauchst, lege sie an das Ufer des Flusses, dann werde ich unverzüglich bei dir sein und dir beistehen." Livoretto nahm die Schuppen, warf den Fisch in die klaren Wellen und bestieg wieder sein Ross.
Nachdem er eine Zeit lang geritten war, traf er auf einen Falken, der mit halbem Leibe im gefrorenen Wasser steckte und sich mit aller Mühe nicht daraus los machen konnte. Der Falke erblickte ihn und rief ihm zu: „O schöner Jüngling, habe Mitleid mit mir, ziehe mich aus diesem Eis hervor, in dem ich mich gefangen sehe, und sei gewiss, dass ich dir zum Dank für meine Rettung einst wieder Hilfe bringe, wenn du deren bedarfst." Livoretto fühlte Mitleid mit dem Falken, zog ein Messer heraus, das er in der Scheide seines Schwertes stecken hatte, und schlug mit der Spitze des selben so lange auf das Eis, bis es gänzlich zerbarst. Dann nahm er den Vogel und steckte ihn in seinen Busen, um ihn zu erwärmen. Als der Falke sich wieder erholt hatte, dankte er seinem Befreier und gab ihm zum Lohn für die erzeigte Gunst zwei Federn, die er unter seinem Flügel trug. „Bewahre sie zu meinem Andenken auf“, sagte er ihm dabei, „und wenn du einmal in Not bist, nimm die beiden Federn und stecke sie an den Rand des Flusses, dann werde ich dir zu Hilfe kommen."
Der Falke flog davon und der Jüngling setzte seine Reise fort, bis er zu dem Heer des Sultans kam. Er begab sich sogleich zum Feldherrn, der die Stadt hart bedrängte und übergab ihm sein Schreiben. Der Feldherr hob, nach dem er es gelesen, ohne weiteres die Belagerung auf und kehrte mit seinen Soldaten nach Kairo zurück. Am Morgen nach dem Abmarsch ritt Livoretto in aller Frühe allein nach Damaskus hinein und nahm seine Wohnung in einem Wirtshaus. Er zog sogleich ein schönes Kleid an, mit kostbaren Edelsteinen besetzt, die mit der Sonne um die Wette glänzten, bestieg sein Zauberross und begab sich damit nach dem Platz vor dem Palast des Königs, wo er es mit solcher Geschicklichkeit tummelte, dass Jedermann stehen blieb, ihm zu zusehen.
Belisandra, die Tochter des Königs, erwachte von dem Lärmen des herbei gelaufenen Volks, stand auf und stellte sich auf einen Balkon, von dem man den ganzen Platz übersehen konnte. Hier erblickte sie den anmutigen Jüngling auf feinem hohen, herrlichen Ross, und wurde so verliebt in das Ross, wie ein Jüngling in ein schönes Mädchen. Sie eilte zu ihrem Vater und bat ihn, es ihr zu kaufen, weil es ihr überaus gefiele. Um seine zärtlich geliebte Tochter zufrieden zu stellen, schickte der Vater so gleich einen seiner Ritter ab, den Jüngling zu fragen, ob er sein Pferd verkaufen wolle, er möge nur einen angemessenen Preis dafür setzen, denn die einzige Tochter des Königs finde großen Gefallen daran. Der Jüngling erwiderte, es gebe in der Welt nichts, das kostbar genug sei, es zu bezahlen. Und darauf forderte er eine Summe, die den Wert des ganzen Königreichs überstieg.
Als der König von diesem ungeheuren Preis hörte, rief er die Tochter und sagte ihr: „Mein Kind, ich kann nicht, um deinen Wunsch zu befriedigen, mein ganzes Reich für ein Pferd hingeben: entsage ihm also und gräme dich nicht darum, wir wollen schon ein besseres und schöneres für dich anschaffen." Allein Belisandra, die nicht von dem Pferd lassen .konnte, beschwur den Vater, ihr den Besitz des selben nicht zu versagen, koste es auch, was es wolle. Und als sie sah, dass alles Bitten und Flehen den Vater nicht bewegen konnte, lief sie wie eine Verzweifelte zur Mutter und sank ihr halb tot in die Arme. Voll Schrecken, ihre Tochter bleich und entstellt zu sehen, sprach die zärtliche Mutter ihr Trost zu und bat sie, sich nicht zu grämen. „Wenn dein Vater abwesend sein wird“, sagte sie: „wollen wir Beide mit dem Jüngling sprechen und um das Ross handeln, vielleicht lässt er es uns billiger, weil wir Frauen sind."
Durch die liebreichen Worte der gütigen Mutter ward Belisandra wieder ein wenig aufgeheitert. Man wartete ab, bis der König entfernt war, dann ließ die Königin dem Jüngling durch einen Boten sagen, er möchte zum Palast kommen und sein Ross mitbringen. Sehr erfreut über diese Aufforderung, säumte Livoretto nicht, sich am Hofe einzustellen. —„Meine Tochter wünscht sehnlich, euer Ross zu besitzen“, sagte die Königin zu ihm. „Was ist der Preis desselben?" „Wolltet ihr mir auch alles geben, was ihr auf der Welt besitzt, gnädige Frau, dennoch könnte eure Tochter mein Ross nicht dafür erkaufen. Will sie es aber als ein Geschenk von mir annehmen, so steht es ihr zu Diensten. Doch wünsche ich, dass sie es zuvor noch recht beschaue und es selber einmal versuche; es ist geschickt und sanft und man kann es ohne Furcht besteigen."
Bei diesen Worten stieg er ab und hob die Prinzessin in den Sattel, während er den Zügel hielt und das Ross leitete und regierte. Doch kaum hatte er Belisandra auf eine Steinwurfsweite von der Mutter entfernt, so schwang er sich hinter ihr auf das Pferd, gab ihm die Sporen, und schnell, wie ein Vogel durch die Lüfte fliegt, jagte es davon. „Bösewicht! Verräter! Wohin führst du mich!“, schrie das erschrockene Mädchen mit lauter Stimme. Allein das Schreien half ihr nichts, und Niemand war da, der ihr Hilfe gab. Sie setzten ihren Weg fort, und als sie an das Ufer eines Flusses kamen, zog Belisandra heimlich einen prächtigen Ring vom Finger und warf ihn in das Wasser.
Nach mehreren Tagereisen langte Livoretto mit der Prinzessin in Kairo an und übergab sie dem Sultan, der voller Freude über ihre große Schönheit, sie mit vielen Liebesbezeugungen empfing. Als Belisandra sich Abends mit dem Sultan in einem reich geschmückten Zimmer allein sah, sprach sie zu ihm: „Hoffet nicht, o Herr, dass ich jemals mich den Wünschen eurer Liebe füge, wenn ihr nicht zuvor jenen Verräter aussendet, den Ring zu suchen, der mir in den Fluss gefallen ist. Hat er ihn gefunden und mir wieder gebracht, bin ich die Eure."
Der Sultan, von Leidenschaft entflammt, wollte die Gekränkte nicht noch mehr betrüben; augenblicklich gab er dem Livoretto Befehl, den Ring aufzusuchen und bedrohte ihn mit dem Tode, wenn er ihn nicht fände. Der Arme durfte nichts einwenden gegen diesen ausdrücklichen Befehl seines Herrn, obgleich er keine Hoffnung hatte, den Ring jemals zu finden. Er entfernte sich traurig und ging zu dem Stall, wo er in heiße Tränen ausbrach. Sein Ross fragte ihn um die Ursache seiner großen Betrübnis. Auf seine Erzählung dessen, was vorgefallen, rief er aus: „Sei ruhig, Armer, gedenkst du denn der Worte des Fisches nicht mehr? Merk auf meine Rede, tue, was ich dir sage, und zweifle nicht an dem Erfolg."
Livoretto tat nach dem Rat seines Rosses, er begab sich an jene Stelle des Flusses, wo er mit der Prinzessin herüber gekommen war und legte die drei Schuppen an das grüne Ufer nieder. Siehe, da glitt auf einmal der Fisch einher durch die klaren, leuchtenden Wellen, tauchte bald hier, bald dort aus dem Wasser auf und näherte sich munter dem Jüngling, den kostbaren Ring im Munde tragend. Und als er ihm den Ring in die Hand gegeben hatte, nahm er seine drei Schuppen auf und tauchte wieder unter in die Flut.
Bei dem Anblick des Ringes verwandelte sich Livorettos Traurigkeit auf einmal in Freude; ohne Zögern kehrte er zum Sultan zurück, neigte sich ehrerbietig und überreichte in seiner Gegenwart der Prinzessin ihren Ring. Der Sultan hoffte, sie würde, nun sie ihr Begehren erfüllt sah, seine Liebe belohnen, vergebens waren aber Bitten und Liebkosungen. „Glaubt nicht, Herr“, sprach sie: „meine Einwilligung zu erschmeicheln. Ich schwöre, nicht eher die Eurige zu werden, bis dieser falsche Betrüger, der mich mit seinem Pferde auf eine so hinterlistige Weise hinterging, mir das Wasser des Lebens bringt."
Jeden Wunsch seiner geliebten Prinzessin zu erfüllen bereit, ließ der Sultan Livoretto rufen und trug ihm auf, ihr das Wasser des Lebens zu holen, sonst koste es ihm den Kopf. Glühend vor Zorn über diese neue Forderung, beklagte sich der Jüngling gegen seinen Herrn, dass er die treuen Dienste, die er ihm mit Gefahr seines Lebens geleistet, so übel belohne. Allein der verliebte Sultan dachte nur daran, sich Belisandra gefällig zu erzeigen und befahl ihm nochmals, ihr das Wasser des Lebens zu beschaffen.
Mit Tränen der Wut und des Schmerzes ging der Jüngling fort, in dem er sein böses Geschick verwünschte, und begab sich, wie er pflegte, zu seinem Ross. Als dieses ihn in so großer Bewegung sah, sprach es zu ihm: „Was bringt dich so außer dir, Herr? Beruhige dich, sei dir auch das Schlimmste begegnet, denn für alles gibt es Mittel, nur für den Tod nicht." Und als das Ross die Ursache seiner Bekümmernis hörte, erinnerte es ihn an den Falken, den er aus dem Eis befreit hatte, und an das schöne Geschenk der beiden Federn.
Da stieg der Jüngling zu Ross, hing eine gläserne wohl verwahrte Flasche an seinen Gürtel und ritt nach dem Ort, wo er den Falken erlöst hatte. Dort steckte er die beiden Federn in den Sand des Ufers, wie es ihm gesagt worden war. Sogleich erschien der Falke und fragte, was er begehre. „Das Wasser des Lebens!“, sagte Livoretto. „Es ist unmöglich, Ritter, dass du es jemals holest“, sprach der Falke: „denn es wird von zwei grimmigen Löwen und eben so vielen Drachen gehütet, welche unaufhörlich brüllen und alle jämmerlich zerreißen, die sich nähern, es zu schöpfen. Aber ich will dir die Wohltat vergelten, die ich einst von dir empfangen habe. Nimm die Flasche, die an deiner Seite hängt, befestige sie unter meinem rechten Flügel und erwarte hier meine Rückkunft." Livoretto tat nach des Falken Verordnung; dieser stieg in die Höhe, flog hin, wo das Wasser des Lebens zu finden war und füllte verborgener Weise die Flasche; dann kehrte er zu dem Jüngling zurück, übergab sie ihm, nahm seine beiden Federn und erhob sich wieder in die Luft.
Froh, das kostbare Wasser in seinen Händen zu sehen, ritt Livoretto eiligst nach Kairo zurück und begab sich sogleich zum Palast. Er fand den Sultan bei seiner geliebten Belisandra, sich mit schmeichelnden Reden um sie bemühend, und überreichte der Prinzessin freudig das Wasser des Lebens. Da begehrte der Sultan aufs Neue von ihr, nun die Seinige zu werden, doch wie ein Felsen unerschütterlich den Stürmen Trotz bietet, blieb auch sie fest und unbeweglich bei seinen dringenden Bitten und machte ihm die neue Bedingung, er solle dem Livoretto, der ihr eine solche Schmach angetan, mit eigenen Händen den Kopf abschlagen.
Der Sultan wollte nicht in diese grausame Förderung des erzürnten Mädchens einwilligen; es schien ihm zu hart, den Jüngling zum Lohn für all seine Mühseligkeiten so schmählich umzubringen. Allein die Unbarmherzige ließ nicht von ihrem bösen Vorsatz. Sie ergriff ein Messer, näherte sich dem Jüngling und mit männlicher Kühnheit stach sie ihm, in Gegenwart des Sultans, durch den Hals, so dass er tot zur Erde fiel, ohne dass Jemand wagte, ihm zu Hilfe zu kommen. Noch nicht zufrieden damit, hieb sie ihm das Haupt vom Rumpf, zerschnitt seine Glieder in kleine Stücke, riss die Nerven von einander und zerstieß die harten Knochen zu Pulver. Darauf nahm sie einen großen kupfernen Kessel, warf die verstümmelten Glieder, so wie alle Knochen und Nerven Stückweise hinein und knetete und rührte alles durcheinander, wie einen Brotteig. Und als sie durch langes Kneten Fleisch und Knochen und Nerven wohl mit einander verbunden hatte, bildete sie von dem Teig eine schöne menschliche Form und besprengte sie aus der Flasche, die das Wasser des Lebens enthielt. Siehe, da kehrte der Jüngling augenblicklich ins Leben zurück und war schöner und blühender als je.
Bei dem Anblick dieses Wunders stieg in dem Sultan, der schon sehr alt war, der Wunsch auf, sich auf diese Weise zu verjüngen. Er bat die Prinzessin, sie mochte es doch mit ihm eben so machen, wie mit dem Jüngling. Diese ließ sich nicht lange bitten, des Sultans Begehren zu erfüllen. Sie nahm das noch von Blut rauchende Messer, ergriff ihn mit der linken Hand bei den Haaren und gab ihm einen tödlichen Stich in das Herz. Dann warf sie ihn in einen nahen Graben, und anstatt sich zu verjüngen, war und blieb er tot und sein Leichnam diente den Hunden zur Speise.
Die Prinzessin ward aber von allen geehrt und gefürchtet wegen des Wunders, das durch sie geschehen war. Als sie vernommen hatte, der Jüngling sei der Sohn Dalfrenos, Königs von Tunis, und Livoretto sein Name, schrieb sie an seinen alten Vater, gab ihm Nachricht von ihren Begebenheiten und lud ihn ein, sich doch ja, bei ihrer Vermählung mit Livoretto, einzufinden.
Dalfreno, sehr erfreut über diese unerwartete glückliche Nachricht, machte sich augenblicklich auf den Weg nach Kairo, wo er von der ganzen Stadt mit großem Pomp empfangen ward. Wenige Tage nach seiner Ankunft wurde Belisandra die Gattin seines Sohnes Livoretto, der, mit vieler Feierlichkeit auf den Thron von Kairo erhoben, dieses Reich lange Zeit in Frieden beherrschte. Dalfreno aber kehrte vergnügt und froh über das Glück seines Sohnes nach Tunis zurück.

DER FEDERKÖNIG ...

Es war einmal ein armes Bauernpaar, das jeden Tag auf dem Feld hart arbeiten musste. Sie hatten auch ein kleines Kind, das in einem Körbchen am Feldrand lag, wenn gearbeitet wurde. Eines Tages kam eine wilde Katze aus dem nahen Wald geschlichen, nahm das Kind und trug es fort in ihre Höhle. Sie tat ihm aber nichts und brachte ihm Kräuter, Wurzeln und Erdbeeren, so dass es keine Not litt. So wuchs das Kind in der Höhle auf.
Als der Junge dann herangewachsen war, sprach die Katze: "Nun sollst du die Königstochter heiraten!" "Aber ich bin doch nackt", sprach der Junge, "soll ich so vor den König treten?" "Mache dir keine Sorgen", erwiderte die Katze, "ich werde dir gleich ein Kleid verschaffen." Da lief die Katze mit einem silbernen Pfeifchen in den Wald. Sie blies einmal darauf, und es zischte und raschelte, schon kamen viele Vögel und wilde Tiere zusammen. Von jedem Vogel nahm die Katze eine Feder, machte daraus ein Kleid und brachte es dem Jungen. Dann führte sie ihn zu den Tieren und sprach: "Gehe jetzt mit diesen Tieren zum König und sage ihm: "Herr König, der Federkönig schickt euch diese Tiere als Geschenk!" Da ging der Junge in die Burg und sagte es so, wie die Katze es ihm gelehrt hatte.
Als der König die vielen Tiere sah, freute er sich und sprach: "Das muss ein reicher König sein!" Am folgenden Tag schickte die Katze den Jungen wieder mit vielen Tieren hin, und er sollte sagen: "Das ist wieder ein Geschenk vom Federkönig". Und wenn der König seine Tochter gerne als Gemahlin an der Seite des Federkönigs sehen wollte, sollte der Junge sagen, dass der Federkönig in drei Tagen selber kommen werde, um die Hochzeit halten. Und so geschah es.
Als die drei Tage vergangen waren, lief die Katze in den Wald, blies dreimal auf dem silbernen Pfeifchen und es zischelte und raschelte nach Katzenart. Da kamen viele Vögel und wilde Tiere zusammen, und die Katze wählte jetzt die schönsten und farbigsten Federn aus. Daraus machte sie einen Mantel, der so schön wie der Sternenhimmel glitzerte, und gab ihn dem Jungen. Und dieses Mal ging auch die Katze mit zur Burg.
Als sie nicht weit vom Schlosse waren, sprach sie zum Jungen: "Jetzt wirf dein altes Federkleid fort, denn ich bringe dir gleich schöne Kleider aus dem Schlosse. Den Federmantel sollst du aber als Schmuck gebrauchen." Die Katze lief schnell ins Schloss und rief: "Gebt mir königliche Kleider. Der Federkönig ist bei seiner Anreise in den Sumpf gefallen. Er braucht frische Kleider!" Da gab der König seine besten Kleider her, und die Katze brachte sie dem Jungen und kleidete ihn ein.
So kam der Junge jetzt zur Burg, und viele Tiere folgten ihm. Nun legte er auch noch den Federmantel um. Der glitzerte und glänzte, dass man es kaum ertragen konnte. Da freute sich der König zusammen mit seiner Tochter über den reichen Bräutigam. Als aber die Hochzeit vorüber war, sprach der König: "Ich möchte doch gerne dein Land und deinen Palast sehen. Fahren wir doch einfach hin!"
Wie nun der Federkönig mit seiner jungen Frau im Wagen saß, sah er immerzu auf seine schönen Kleider und nicht auf seine Frau. Das merkte die Katze, sprang ihm in den Nacken, und tschak, kratzte sie ihn. "Sieh doch deine Frau an", flüsterte die Katze. "Wenn man dich aber fragt, warum du immer auf deine Kleider schaust, dann sage, du hättest daheim noch viel schönere." Damit lief die Katze fort und war dem Wagen immer ein Stück weit voraus. Der Federkönig sah bald wieder auf seine Kleider. Da fragte ihn die junge Frau: "Warum tust du das?" Er antwortete: "Ich habe daheim noch viel schönere."
Nun kam die Katze zu einer großen Schafherde. Die Katze lief zum Hirten, sprang ihm in den Nacken, und tschack, kratzte sie ihn, dass ihm das Blut floss. Sie sagte: "Wenn man dich fragt, wem diese Herde gehört, so sprich: ,Dem Federkönig!' Tust du es nicht, komme ich wieder und zerkratze dich in tausend Stücke!" Als nun der König und das junge Paar zur Schafweide kamen, fragte der König den Hirten: "Wem gehört denn diese schöne Herde?" Der Hirt sprach: "Die gehört dem Federkönig", denn er wollte nicht zerkratzt werden. "Ja, die gehört mir", sagte gleich der Junge, denn er merkte, das die Katze es angezettelt hatte.
Bald darauf kamen sie zu einer großen Büffelherde. Die Katze war aber schon da gewesen und hatte den Hirten gekratzt. Als nun der König fragte: "Wem gehört denn die schöne Herde?", sprach der Hirte: "Na, die gehört dem Federkönig", denn er wollte die Katze nicht wiedersehen. "Ja, die ist mein", sagte der Federkönig, und der König wunderte sich sehr und sprach: "Ich hätte nie geglaubt, dass du so reich bist!"
Kurz darauf kamen sie auch zu einer Rossherde. Die Katze war schon da gewesen und hatte den Hirten gekratzt. Und als der König fragte: "Wem gehört denn die große Rossherde?", antwortete er: "Na, dem Federkönig! "Ja, die ist auch mein!", sagte der Junge im Wagen. "Jetzt glaube ich, dass du viel reicher bist als ich", sprach der König, "und was wirst du uns erst daheim alles zeigen!"
Endlich gelangten sie zum Schloss eines Zauberers. Da war alles aus Gold und Silber, Kristall und Edelsteinen, und der Tisch war reichlich gedeckt. Sie setzten sich gleich und aßen. Die Katze aber blieb vor der Türe und hielt Wache. Auf einmal kam der Zauberer und polterte zornig: "Räuber in meinem Schloss, an meinem Tisch! Wehe euch!" Die Katze aber stand in der Türe und ließ ihn nicht durch. Sie sprach: "Sage mir, bist du wirklich der große Zauberer, für den man dich hält? Man erzählt, du könntest dich in große und kleine Tiere verwandeln!"
"Ha, das ist für mich eine Kleinigkeit!", rief der Zauberer und verwandelte sich gleich in einen mächtigen Löwen. Da fürchtete sich die Katze und sprang auf einen hohen Schrank. "Das ist dir wohl gelungen", sagte die Katze, "nun aber möchte ich sehen, ob du dich auch in eine Maus verwandeln kannst. Das ist gewiss viel schwerer!" Sogleich verwandelte sich der Zauberer in eine Maus. Im Nu sprang die Katze herunter, packte die Maus mit ihren Krallen und zerriss sie.
Nun rief sie den Jungen aus dem Saal heraus und sprach: "Das Schloss und alles, was dazu gehört, sind nun wirklich dein. Ich habe den Zauberer, dem alles gehörte, vernichtet! Jetzt aber verlange ich von dir einen Dienst. Nimm ein Schwert und schlage mir das Haupt ab." Der Junge wollte nicht und sprach: "Wie könnte ich so undankbar sein!" "Wenn du es nicht tust, kratze ich dir die Augen aus!", drohte die Katze. Da nahm der Junge ein Schwert von der Wand, und tschak, mit einem Hieb fiel das Haupt der Katze zu Boden.
Aber siehe, plötzlich war da eine wunderschöne Frau. Der Junge führte sie zum König und sprach: "Das ist meine Mutter!" Die Frau aber gefiel dem alten König sehr, und weil seine erste Gemahlin gestorben war, bat er um ihre Hand und sprach: "Sollen wir nicht auch die Hochzeit feiern?" Sie war nicht abgeneigt, und so dauerte das Fest noch ganze acht Tage. Darauf zog der alte König mit seiner neuen Frau heim. Der Junge aber blieb mit der Königstochter im Zauberschloss und war reicher als sieben Könige.
Quelle: Josef Haltrich
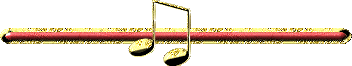
DAS MÄDCHEN IM SCHREIN ...

Thebaldo, Fürst von Salerno, hatte eine kluge, liebenswürdige Gemahlin, von vornehmer Abkunft, und eine Tochter, die an Schönheit und Sittsamkeit alle Jungfrauen von Salerno weit übertraf. Doch es wäre ihm besser gewesen, nie eine solche Tochter gehabt zu haben, denn es wäre ihm das nicht begegnet, was ihm so widerfuhr!
Als nun die Frau, welche jung an Jahren, aber alt an Verstand war, tödlich erkrankte, bat sie ihren Gemahl, den sie zärtlichst liebte, keine andere zur Frau zu nehmen, als die, welcher der Ring, den sie am Finger trug, vollkommen so passe wie ihr. Der Fürst, welcher seine Gemahlin nicht minder liebte als sie ihn, schwur ihr bei seinem Haupt, zu tun, was sie von ihm verlangte.
Nachdem die schöne Frau gestorben und mit allen Ehren bestattet worden war, bekam Thebaldo Lust, sich wieder eine Frau zu nehmen; doch gedachte er des Versprechens, welches er der Verstorbenen gegeben hatte, und wollte durchaus nicht gegen ihr Gebot handeln. Bald ward es überall bekannt, dass der Fürst von Salerno sich wieder vermählen wolle, und diese Nachricht gelangte auch zu den Ohren vieler Jungfrauen, die an Stand und Tugenden nicht unter Thebaldo waren. Der Fürst aber, welcher vor allen Dingen den Willen seiner verstorbenen Gattin zu erfüllen wünschte, verlangte zuerst, an allen den Jungfrauen, welche ihm zur Gemahlin angeboten worden, den Ring zu probieren, und da er keiner passen wollte, der einen zu eng, der anderen zu weit war, schlug er sie alle miteinander aus.
Da geschah es, dass die Tochter des Thebaldo, Doralise, als sie eines Tages mit ihrem Vater speiste, den Ring ihrer seligen Mutter auf dem Tisch liegen sah; sie steckte ihn an den Finger und sagte zum Vater: „Sieh doch, lieber Vater, wie gut mir der Ring meiner Mutter passt." Und der Vater fand, dass er wirklich wie angegossen an ihrem Finger saß. Allein es dauerte nicht lange, so kam dem Thebaldo der seltsame, teuflische Gedanke in den Kopf, Doralise, seine Tochter, zur Frau zu nehmen, und lange Zeit schwankte er zwischen ja und nein.
Endlich aber, besiegt von diesem ruchlosen Verlangen und entzündet von ihrer Schönheit, rief er sie eines Tages zu sich und sagte: „Liebe Tochter, als deine Mutter die Nahe des Todes fühlte, bat sie mich flehentlich, keine andere zur Frau zu nehmen, als die, welcher der Ring passen würde, den sie bei Lebzeiten an ihrem Finger trug, und ich schwur bei meinem Haupt, ihren Willen durchaus zu erfüllen." „Nun habe ich mit so vielen Jungfrauen die Probe gemacht, aber keiner von allen hat der Ring deiner Mutter gepasst außer dir, weshalb ich beschlossen habe, dich zur Gemahlin zu nehmen; denn so erreiche ich meinen Wunsch und breche auch das Versprechen nicht, welches ich deiner Mutter gegeben habe."
Doralise, welche nicht weniger tugendhaft als schön war, erschrak heftig, da sie die böse Absicht ihres ruchlosen Vaters vernahm, allein sie verbarg es; denn aus Furcht ihn zu erzürnen, wollte sie lieber auf seinen abscheulichen Vorschlag jetzt nichts antworten, zeigte sich scheinbar fröhlich und entfernte sich. Da sie Niemanden hatte, welchem sie mehr vertraute, als ihrer Amme, so nahm sie gleich zu dieser als zu der Quelle ihres Trostes ihre Zuflucht und bat um ihren Rat. Als diese von dem verdammungswürdigen Verlangen des Vaters hörte, zu gleich aber die Jungfrau standhaft und fest entschlossen sah, weit eher die größte Marter zu erdulden, als in die Raserei ihres Vaters zu willigen, tröstete sie die selbe und versprach ihr ihren ganzen Beistand, um sie vor dieser Schmach zu schützen.
Sie sann also hin und her auf ein Mittel, wie sie ihr Pflegekind aus der drohenden Gefahr erretten könne, und es fiel ihr bald dies, bald jenes ein, doch fand sie keins, das ihr vollkommen Sicherheit gewährte. Flucht und Entfernung von ihrem Vater schien allerdings das beste, zu gleich aber fürchtete sie von seiner List, er werde sie wieder einholen und dann gewisslich ums Leben bringen. Als nun die treue Amme dergleichen Überlegungen bei sich anstellte, kam ihr mit einmal ein ganz neuer Gedanke.
In dem Zimmer der verstorbenen Fürstin befand sich ein sehr schöner und kunstreich gearbeiteter Schrein, in welchem die Tote ihre prächtigen Kleider und kostbaren Juwelen aufbewahrte. Niemand verstand ihn zu öffnen als die kluge Amme. Diese nun nahm heimlich alle die Kleider und den Schmuck heraus, und setzte dafür einen Trank hinein, welcher eine so große Kraft hatte, dass Jeder, der davon nur einen Löffel voll oder selbst noch weniger zu sich nahm, lange Zeit ohne andere Nahrung leben konnte. Sodann rief sie Doralise, schloss sie in den Schrein ein und riet ihr, darin zu verweilen, bis ihr Gott ein günstigeres Geschick senden und ihr Vater von seinem bösen Vorhaben abstehen würde.
Das Mädchen gehorchte ihrer guten Amme und tat wie diese ihr riet. Der Vater, welcher seinem schändlichen Triebe nicht entsagte, seinen ungezügelten Willen nicht unterdrückte, fragte wiederholt nach seiner Tochter und da er sie nicht fand und nicht erfahren konnte, wo sie sei, geriet er in eine solche Wut, dass er drohte, sie umbringen zu lassen. Nach einigen Tagen trat Thebaldo eines Morgens in das Zimmer, in welchem der Schrein stand und der Anblick des selben wurde ihm mit einmal so unerträglich, dass er befahl, man solle ihn von dort wegnehmen und verkaufen, damit er einen so verdrießlichen Gegenstand nicht mehr vor Augen habe.
Die Diener beeilten sich also, das Gebot ihres Herrn zu erfüllen, nahmen den Schrein unverzüglich auf die Schultern und trugen ihn auf den Marktplatz.
Es traf sich, dass gerade in dem selben Augenblick ein reicher genuesischer Kaufmann auf den Markt kam, und als er den schönen, so kunstvoll gearbeiteten Schrein erblickte, gefiel ihm der selbe so sehr, dass er ihn um jeden Preis zu kaufen beschloss. Er ging also zu dem Diener hin, welchem der Verkauf übertragen worden war, machte den Handel mit ihm ab, lud den Schrein so gleich einem Lastträger auf den Rücken und ließ ihn in sein Schiff bringen.
Die Amme, welche alles sah, freute sich sehr darüber, denn obwohl es ihr nicht wenig nahe ging, dass sie ihr Pflegekind verlieren sollte, tröstete sie sich gleich wohl damit, dass, wann zwei große Übel drohen, man das kleinste wählen muss.
Der Kaufmann verließ Salerno, mit seinem Schrein und anderen Waren reich befrachtet, und gelangte zur Insel Britannien, welche heut zu Tag England genannt wird. Er landete in einer Gegend, bei welcher sich eine weite Ebene befand, und sah dort Genese, kürzlich erst zum Könige von England gekrönt, der an der Küste der Insel eine sehr schöne Hirschkuh eifrig verfolgte, die sich aus Furcht in die Wellen des Meeres stürzte.
Der König, müde und matt von dem langen Ritt, ruhte ein wenig aus und da er das Schiff sah, begehrte er von dem Schiffsherrn einen Trunk. Dieser stellte sich, als ob er den König nicht kenne, empfing ihn sehr zuvorkommend, begrüßte ihn auf das Höflichste und bewog ihn endlich, mit ihm in das Schiff zu gehen.
Als nun der König hier den schönen, zierlich gearbeiteten Schrein erblickte, empfand er großes Verlangen, ihn zu besitzen, fragte den Schiffsherrn, wie hoch er ihn halte, und jener forderte einen sehr ansehnlichen Preis. Aber der König, von diesem kostbaren Gegenstande ganz entzückt, ging nicht eher fort, als bis er sich mit dem Kaufmann über den Preis geeinigt hatte; dann ließ er das nötige Geld herbei holen, bezahlte, nahm Abschied und hieß den Schrein geradewegs nach seinem Palast tragen und in seinem Zimmer aufstellen.
Da Genese, noch sehr jung war, so hatte er sich noch nicht vermählt und sein größtes Vergnügen bestand darin, täglich ganz zeitig auf die Jagd zu gehen. Doralise, die Tochter Thebaldos, welche in dem Schrein verschlossen war, der in dem Zimmer des Königs stand, hörte alles, was da selbst vorging, und schöpfte nach so viel überstandenen Gefahren neue Hoffnung auf ein günstiges Geschick. Sobald nun der König sein Zimmer verlassen hatte, um, seiner Gewohnheit nach, auf die Jagd zu gehen, verließ die Jungfrau ihren Schrein, brachte das ganze Zimmer mit großer Sauberkeit und Behutsamkeit in Ordnung, fegte es aus und machte das Bett, in dem sie die Kopfkissen zurecht legte und eine mit großen Perlen und anderen Kostbarkeiten reich gestickte Decke darüber breitete. Dann streute das schöne Mädchen Rosen auf das Bett, Veilchen und noch viele andere Blumen und Kräuter, die einen ebenso angenehmen wie stärkenden Geruch verbreiteten. Dies alles tat sie einige Mal, ohne dass sie von Jemand gesehen wurde.
König Genese freute sich ganz ungemein darüber, denn wenn er von der Jagd zurück kehrte und in sein Zimmer trat, so war es ihm, als ob er sich mitten unter allen Wohlgerüchen und Spezereien des Orients befinde. Eines Tages wollte der König von seiner Mutter und ihren Fräuleins wissen, wer denn so freundlich und aufmerksam sei und ihm sein Zimmer so prächtig schmücke und mit Wohlgerüchen erfülle. Sie antworteten ihm aber, sie wüssten nichts davon, denn jedes Mal, wenn sie kämen, sein Zimmer aufzuräumen, fänden sie schon sein Bett mit Rosen und Veilchen bedeckt und von süßen Kräutern duftend.
Als der König diese befremdende Antwort erhielt, nahm er sich vor, durchaus zu erfahren, wie es damit zugehe, und statt eines Morgens, wie er vorgab, nach einem zehn Meilen weit von der Stadt entfernten Schlosse zu gehen, verbarg er sich heimlich in seinem Zimmer und beobachtete, durch eine Spalte sehend, was sich begeben würde. Nicht lange, so ging Doralise, leuchtender als die Sonne, aus dem Schrein hervor, reinigte das Zimmer, legte die Teppiche zurecht, bereitete das Bett und tat alles, wie sie es früher zu tun gewohnt war. Das liebenswürdige Mädchen hatte ihre freundlichen, sorgfältigen Dienst kaum vollendet, als sie wieder in ihren Schrein zurück kehren wollte, aber der König, welcher alles aufmerksam beobachtet hatte, kam schnell herbei, ergriff sie bei der Hand und fragte das Mädchen, welches schön und blühend wie eine Lilie aussah, wer sie sei.
Doralise antwortete zitternd, sie sei die einzige Tochter eines Fürsten, auf dessen Namen sie sich nicht mehr erinnern könne, weil sie so lange Zeit bereits im Schrein verborgen gewesen sei; weshalb sie aber darin gewesen, wollte sie ihm nicht entdecken. Der König nahm sie hierauf mit Zustimmung seiner Mutter zur Gemahlin und sie gebar ihm zwei Söhne.
Da Thebaldo, der in seinem verabscheuungswürdigen, ruchlosen Verlangen beharrte, so lange suchte und wieder suchte, ohne sie zu finden, fiel ihm ein, sie könne wohl in dem Schrein gewesen sein, den er verkauft habe, und nun in der Welt umherirrte. Er entschloss sich also, hingerissen von seinem Zorn, die ganze Welt zu durchstreifen, ob er sie irgendwo finden könnte. Er verkleidete sich als ein Kaufmann, nahm eine Menge Juwelen und andere kostbare Goldarbeiten mit und verließ so, ganz unkenntlich, Salerno. Nachdem er mehrere Länder durchwandert hatte, begegnete er zufällig dem, welchem er den Schrein zuerst verkauft hatte, und fragte ihn, ob er einen guten Gewinn dabei gemacht habe und in wessen Hände der Schrein gekommen sei. Der Kaufmann erwiderte ihm, er habe ihn an den König von England verkauft und mehr als das Doppelte daran verdient.
Über diese Nachricht war Thebaldo sehr erfreut und nahm sogleich seinen Weg nach England, und kaum war er in der Stadt angelangt, wo der König sich aufhielt, so stellte er alle seine Edelsteine und Kostbarkeiten, unter denen auch Rocken und Spindeln waren, an den Mauern des Palastes auf und fing an zu schreien: „Ihr Frauen, schaut meine kostbaren Rocken und Spindeln!"
Als eins der Fräulein im Schlosse dies hörte, lief es ans Fenster, und da es den Kaufmann mit seinem köstlichen Warenlager erblickte, eilte es unverzüglich zur Königin und erzählte ihr, es sei auf der Straße ein Kaufmann mit goldenen Rocken und Spindeln, so schön, so prächtig, wie es nie dergleichen gesehen.
Die Königin befahl, man solle ihn heraufkommen lassen, und er wurde also die Stiegen des Palastes hinauf bis in den Saal geführt, wo sich die Königin befand, die ihren Vater nicht erkannte, weil sie seiner nicht mehr gedachte: wohl aber erkannte der Kaufmann seine Tochter. Als die Königin die prächtigen Rocken und Spindeln sah, fragte sie den Kaufmann, wie viel sie kosten sollten. „Ich verlange viel dafür“, versetzte er, „wenn mir jedoch eure Hoheit gestatten wollten, eine Nacht in der Kammer eurer beiden Söhnchen zu schlafen, so würde ich euch alle diese Waren dafür zum Geschenk machen."
Die gute Frau, welche selber so ohne Arg und Falsch war und sich daher auch von dem Kaufmann nichts Böses versah, willigte auf das Zureden ihrer Fräulein in sein Gesuch. Bevor ihn aber die Diener zu Bett führten, trug sie einer ihrer Frauen auf, ihm einen Schlaftrunk zu geben. Als nun die Nacht gekommen war und der Kaufmann sich müde stellte, führte ihn eine der Frauen in das Schlafgemach der beiden Königskinder, wo man ihm ein prächtiges Bett bereitet hatte, und bevor er sich zur Ruhe legte, fragte ihn die Frau: „Guter Vater, habt ihr Durst?" „Ja, mein Kind“, sagte er, worauf sie einen silbernen Becher nahm und ihm einen Schlaftrunk reichte, der in den Wein gemischt war. Der schlaue, tückische Kaufmann aber stellte sich nur, als ob er trinke und schüttete den ganzen Wein unbemerkt in seine Kleider, worauf er sich zur Ruhe legte.
In dem Schlafzimmer der Kinder war eine kleine Tür, durch welche man in das Gemach der Königin gelangen konnte. Um Mitternacht, als alles in tiefem Schlafe lag, stand der Kaufmann auf, schlich leise in das Zimmer der Königin, näherte sich ihrem Bette und nahm ein kleines Messer, welches die Königin, wie er bemerkt hatte, den Tag vorher an ihrer Seite trug. Hierauf ging er zur Wiege, in welcher die Kinder lagen, tötete alle beide, trug das blutige Messer zurück und steckte es in die Scheide. So dann öffnete er ein Fenster und ließ sich mit Hilfe einer Strickleiter hinab. Kaum brach der Tag an, so ging er in eine Barbierstube, ließ sich den langen Bart abscheren, damit man ihn ja nicht wieder erkenne, zog andere Kleider an und wanderte durch die Stadt.
Als die Ammen, welche fest geschlafen hatten, zur gewohnten Stunde aufwachten, um den Kindern Nahrung zu geben, und sich über die Wiege beugten, fanden sie die Kleinen getötet. Da fingen sie laut an zu schreien, weinten und jammerten entsetzlich, zerrauften ihr Haar und rissen sich die Kleider vom bloßen Leibe. Bald gelangte auch diese traurige Neuigkeit zu dem König und der Königin, welche barfuß und unbekleidet aufsprangen und zu dem erbarmungswürdigen Schauspiel hin eilten. Bei dem Anblick ihrer toten Kinder brachen sie in die bittersten Tränen aus. Schon war die ganze Stadt voll von diesem entsetzlichen Morde und zugleich hatte sich auch die Nachricht verbreitet, ein berühmter Sterndeuter sei angelangt, der aus dem Lauf der Gestirne das Vergangene wie das Zukünftige erforschen könne.
Als dem Könige der Ruf seiner Kenntnisse zu Ohren kam, ließ er ihn holen und fragte ihn, ob er durch seine Kunst erforschen könne, wer seine Kinder getötet habe. Der Sterndeuter entgegnete, er wisse es und in dem er sich dem Ohre des Königs näherte, sagte er leise zu ihm: „Geheiligte Majestät, lass alle Männer und Frauen deines Hofes, die ein Messer an ihrer Seite tragen, vor dich führen, und derjenige, bei welchem du das Messer in der Scheide befleckt finden wirst, ist der wahre Mörder deiner Kinder."
Hierauf mussten auf Befehl des Königs alle Hofleute vor ihm erscheinen und mit eigener Hand untersuchte er sorgfältig einen nach dem anderen, ob er ein blutbeflecktes Messer habe. Da er kein einziges fand, welches die Zeichen jener blutigen Gewalttat trug, kehrte er zu dem Sterndeuter zurück und erzählte ihm alles, was er getan hatte, und dass er selbst bei allen nachgesucht, seine eigene Mutter und die Königin ausgenommen.
„Majestät“, sagte der Sterndeuter, „sucht wohl nach, ohne Ansehen der Person, dann werdet ihr ohne Zweifel den Täter finden." Der König suchte zuerst bei der Mutter nach und fand nichts bei ihr, endlich rief er auch die Königin, nahm die Scheide, welche sie an der Seite trug und fand das Messer ganz voll Blut. Als der König diesen augenscheinlichen Beweis ihrer Schuld sah, wandte er sich, vor Wut ganz außer sich, zu ihr und rief: „O unmenschliches, gottvergessenes Weib, du Feindin deines eigenen Blutes, Verräterin an deinen eigenen Kindern, wie war es dir möglich, deine Hände mit dem Blute dieser unschuldigen Kinder zu beflecken? Ich schwöre bei Gott, du sollst eine Strafe erdulden, wie sie deiner Tat zukommt!"
Wie sehr auch der König, von Wut entflammt, sich auf der Stelle durch einen schmachvollen Tod an ihr zu rächen verlangte, kam ihm doch bald ein neuer Gedanke, wie er sie eine weit größere und schmerzlichere Qual erdulden lassen könne. Er befahl, die Königin zu entkleiden und mit entblößtem Körper bis an den Hals in die Erde einzugraben und während die Würmer langsam ihr Fleisch verzehrten, ihr mit guten Speisen das Leben zu fristen, damit ihre Qual und ihre Strafe um so länger währe. Die Königin, welche schon so viel Elend erduldet hatte, unterwarf sich, im Bewusstsein ihrer Unschuld, dieser harten Todesstrafe ohne Murren.
Als der Sterndeuter, ihr Vater, vernahm, dass die Königin als schuldig verdammt worden sei, einen so grausamen Tod zu erleiden, freute er sich ungemein, nahm Abschied vom Könige und verließ England ganz zufrieden. Sobald er heimlich wieder in seinem Palast angelangt war, erzählte er der Amme ganz ausführlich alles, was ihm begegnet war, und wie seine Tochter zum Tode verurteilt worden sei. Bei dieser Nachricht stellte sich zwar die Amme sehr vergnügt, innerlich aber empfand sie die heftigste Betrübnis, und bewegt von Mitleid für die arme Unglückliche und hingerissen von inniger Liebe zu ihr, brach sie eines Tages frühzeitig von Salerno auf und wanderte so lange Tag und Nacht hindurch, bis sie endlich in England ankam.
Sie stieg die Stufen des königlichen Palastes hinauf und fand den König, der gerade allgemeine Audienz erteilte, in einem weiten Saal. Sie warf sich zu seinen Füßen und bat ihn um ein geheimes Gehör, weil sie ihm Dinge anzuvertrauen habe, welche die Ehre seiner Krone beträfen. Der König hob sie auf, nahm sie bei der Hand, entließ alle Übrigen und blieb ganz allein bei ihr.
Da sprach die Amme, welche von dem Vorgefallenen genau unterrichtet war: „Ihr müsst wissen, gnädigster Herr, dass Doralise, eure Gemahlin und meine Tochter, (denn wenn ich sie mich nicht unter diesem unglücklichen Herzen trug, so habe ich sie doch genährt und erzogen) unschuldig an dem Verbrechen ist, welches ihr fälschlich zugeschrieben wird und wegen dessen sie zu einem so grausamen Tode verdammt worden ist. Wenn ihr alles bis aufs Kleinste gehört und euch überzeugt haben werdet, wer der unmenschliche Mörder eurer Kinder gewesen ist und was ihn dazu bewogen hat: so bin ich gewiss, ihr werdet, von Mitleiden gerührt, die arme Königin augenblicklich von ihren so großen Qualen befreien. Findet ihr aber, dass ich nur mit einem Worte die Unwahrheit gesagt habe, so will ich die nämliche Strafe erdulden, welche jetzt die Königin leidet. —
Und damit erzählte sie ihm von Anfang bis zu Ende, wie alles sich zugetragen hatte. Als der König den ganzen Hergang vernahm, ward er vollkommen überzeugt, befahl sogleich, die Königin, welche mehr tot als lebendig war, aus ihrer Gruft zu ziehen und alles Mögliche für ihre Heilung zu tun, so dass sie denn auch in kurzer Zeit vollkommen wieder genas.
Hierauf ließ der König durch sein ganzes Reich große Zurüstungen machen, sammelte ein mächtiges Heer und schickte es gegen Salerno, welche Stadt nach kurzer Zeit erobert und Thebaldo gefangen, an Händen und Füßen gebunden, nach England geführt wurde. Da der König sich noch größere Gewissheit über das begangene Verbrechen verschaffen wollte, so ließ er ihm den Prozess machen und befahl, ihn auf die Folter zu spannen; Thebaldo aber gestand sogleich alles ein und am folgenden Tage wurde er auf einem mit vier Pferden bespannten Karren durch die ganze Stadt geführt, gevierteilt und sein Fleisch den Hunden preisgegeben.
So endete der ruchlose, verabscheuungswürdige Thebaldo elend sein Leben; der König aber und seine Gemahlin Doralise lebten noch viele Jahre sehr glücklich miteinander und hinterließen zahlreiche Kinder.

CORVETTO ...

In den Diensten des Königs von Fiume-Largo befand sich einmal ein wackerer Jüngling, Namens Corvetto, welcher wegen seines guten Benehmens von seinem Herrn von Herzen geliebt wurde, aus dem selben Grunde aber von allen Hofleuten von ganzem Herzen gehasst wurde, da sie, selbst ohne jeden Verdienst, die glänzende Tugend des Corvetto nicht anschauen konnten, der für das bare Geld, der Liebe und Treue sich die Gnade seines Herrn erwarb. Aber die Luft der Gunst, die ihn vom König anwehte, war ein Sirocco für den Neid jener, so dass sie in den Winkeln des Palastes zu aller Zeit nichts anderes taten, als ihm Böses nachzureden, ihn zu verleumden, anzuschwärzen, und diesem guten Jüngling allen Schaden zuzufügen. „Was hat denn“, sprachen sie, „dieser Bettelbube dem König angetan, dass er ihn dermaßen liebt? Warum ist er so glücklich, dass kein Tag vorübergeht, an dem er nicht einen neuen Beweis der Gunst empfängt? wogegen wir immer rückwärts gehen wie die Krebse, immer abnehmen an Gunst, und doch alles tun, was an uns liegt, wie die Pferde arbeiten, wie die Tagelöhner schwitzen, wie die Windhunde jagen, um es diesem König recht zu machen. Man muss wahrlich auf dieser Welt als ein Glückskind geboren werden, denn wer das Glück hat, fällt immer auf die Beine, aber was ist zu tun! Wir müssen Geduld haben und bersten!"
Solche und andere Worte flogen von dem Bogen ihres Mundes und waren wie die vergifteten Pfeile, welche gerade auf das Ziel, auf den Sturz Corvettos, gerichtet waren. O unglücklich ist ein zu der Hölle des Hofes Verdammter, wo die Schmeicheleien mäßchenweise, die bösen Dienste aber scheffelweise ausgeteilt, wo Betrug und Verrat zentnerweise gemessen werden. Wer kann aber die mannigfaltigen Schlingen erzählen, die sie ihm stellten, wer kann die Seife der Falschheit schildern, mit welcher sie die Treppe zu den Ohren des Königs einschmierten, um ihn fallen und den Hals brechen zu machen; wer kann die Gruben und mit Reisig bedeckten Löcher aufzählen, in die er, wie sie es wünschten, durch ihre Hinterlist stürzen sollte!'
Indes Corvetto, der ein pfiffiger Bursche war, und die Fallstricke sah, die Fallen bemerkte, die Listen entdeckte, hielt immer die Ohren gespitzt und die Augen offen, um sich nicht fangen zu lassen, denn er wusste, dass die Glücksgöttin der Hofleute gläsern ist. Aber je höher dieser junge Mensch in der Gunst des Königs stieg, desto tiefer war auch der Abgrund und der Hass der Anderen, welche, da sie am Ende nicht mehr wussten, auf welche Weise sie ihn sich vom Halse schaffen sollten, weil ihren Verleumdungen doch nicht geglaubt wurde, auf den Gedanken kamen, ihn auf der Straße des Lobes zu einem Abgrund zu führen; eine Kunst, in der Hölle erfunden, und bei Hofe verfeinert. Dieser bedienten sie sich nun auf folgende Weise.
Es lebte zehn Meilen von Schottland, wo der Sitz dieses Königs war, ein wilder Mann, der grimmigste und schrecklichste, der je im Lande der wilden Männer gelebt hat, und weil er von dem Könige verfolgt wurde, hielt er sich in einem dichten Wald auf der Spitze eines Berges verborgen. Und so hoch war der Berg, dass er den Vögeln selbst unzugänglich war, und so dicht der Wald, dass nie ein Strahl der Sonne hindurch drang. Dieser wilde Mann nun hatte ein sehr schönes Ross, welches unter anderen vorzüglichen Eigenschaften auch die der Sprache besaß, denn es redete durch Zauberei wie wir.
Da nun die Hofleute wussten, wie böse der wilde Mann war, wie schrecklich der Wald, wie hoch der Berg, und wie groß die Schwierigkeit, sich dieses Pferdes zu bemächtigen: gingen sie zum Könige, und schilderten ihm sehr lebendig die Vorzüge jenes Tieres, welches würdig sei, einem König anzugehören. Er möge deshalb irgend ein Mittel ausfindig machen, um es den Klauen jenes wilden Mannes zu entreißen, wozu Corvetto sich am besten eignen würde, weil er ein schlauer und gewandter Jüngling sei, der den Hund wohl vom Ofen zu locken verstehe.
Da der König nicht wusste, dass unter den Blumen dieser Worte sich die Schlange des Neides verberge, rief er als bald Corvetto und sagte zu ihm: „Wenn du mich liebst, so siehe zu, dass du das Pferd des wilden Mannes, meines Feindes, bald in deine Gewalt bekommst; ich will dir diesen Dienst reichlich vergelten und belohnen." Corvetto merkte wohl, wer ihm diesen Streich spiele; Indes um sich dem König gehorsam zu zeigen, macht er sich augenblicklich auf den Weg nach dem Berge, schleicht sich ganz leise in den Stall des wilden Mannes, sattelt das Pferd, schwingt sich hinauf, und begibt sich auf den Rückweg.
Das Pferd aber, da es sich aus dem Palast hinaus spornen sah, rief: „Aufgepasst! denn Corvetto führt mich fort." Als der wilde Mann dies vernahm, jagte er ihm nach mit allen Tieren, welche ihm dienten, mit allen Pavianen, Bären, Löwen, Wehrwölfen, um ihn seine Kühnheit hart büßen zu lassen. Der Jüngling Indes spornt darauf los, entfernt sich immer weiter von dem Berge, und stets mit verhängtem Zügel jagend, gelangte er an den Hof, wo er das Pferd dem König überreicht, der ihn vor Freude umarmt wie einen Sohn, so dann einen Beutel ergreift, und Corvetto die Hände mit Goldstücken füllt.
Den Hofleuten war dies ein neuer Stich ins Herz, als sie sahen, dass die List, durch welche sie das Glück des Corvetto zu zerstören gedachten, bloß dazu diente, ihm den Weg zu höherer Gunst zu bahnen. Da sie jedoch wussten, dass ein Baum nicht auf den ersten Streich fällt, wollten sie ihr Glück zum zweiten Mal versuchen und sagten zum Könige: „Heil dir zu dem schönen Pferde, welches für wahr die Zierde des königlichen Marstalles sein wird; nur fehlen dir noch die Tapeten des wilden Mannes, welche so kostbar sind, dass es sich gar nicht beschreiben lässt. Besitzest du auch diese, so ist wahrlich kein Monarch auf der Welt mit dir zu vergleichen. Niemand aber könnte dir besser zu diesem Schatz verhelfen, als Corvetto, denn der versteht es, wie man diese Dinge anzufangen hat."
Der König, der da tanzte, wie man ihm vorspielte, und von diesen bitteren, aber verzuckerten Früchten nur die Schale genoss, ruft Corvetto, und bittet ihn inständigst, ihm nun auch die Tapeten des wilden Mannes zu verschaffen, wie er ihm dessen Pferd schon verschafft habe. Corvetto, ohne ein Wort zu erwidern, begab sich augenblicklich nach dem Berge des wilden Mannes, schlich sich unbemerkt in das Zimmer, wo er schlief, verbarg sich unter dem Bette, und erwartete, zusammengeduckt, die Ankunft der Nacht. Darauf als der wilde Mann und die Frau sich zu Bette gelegt hatten, macht sich Corvetto an die Arbeit, nimmt die Tapeten behutsam herab, und in dem er auch die Bettdecke mit fortnehmen will, fängt er an ganz sachte zu ziehen.
Der wilde Mann aber erwachte als bald, und sagte zu der Frau, sie solle nicht so sehr ziehen, denn sie decke ihn auf, und er könne sich leicht erkälten. „Im Gegenteil, du deckst mich auf“, erwiderte die wilde Frau, „denn ich habe nichts mehr von der Decke auf dem Leibe." „Wo zum Kuckuck aber ist denn die Decke?“, rief der wilde Mann, und in dem er die Hand auf die Erde steckte, fasste er dem Corvetto ins Gesicht. So gleich fing er an zu schreien: „Ein Dieb, ein Dieb! Hilfe! Lichter!“, so dass bei diesem Geschrei das ganze Haus in Aufruhr geriet. Corvetto Indes, welcher die Sachen bereits durch das Fenster hinab geworfen hatte, springt ihnen nach, und nachdem er ein hübsches Bündel gemacht, begibt er sich auf den Weg nach der Stadt, und es lässt sich nicht sagen, wie sehr der König ihn liebkoste, und wie die Hofleute vor Ärger darüber grün und gelb wurden.
Dem ungeachtet sannen sie aufs Neue, wie sie dem Corvetto mit dem Nachtrab der Schelmereien in den Rücken fallen könnten, und begaben sich in solcher Absicht zu dem König, welcher vor Freude über die Tapeten ganz außer sich war, denn die selben waren nicht nur aus Seide und mit Gold gestickt, sondern es waren auch viele tausend verschiedenartige kunstreiche Dinge daraus eingewebt, die alle nur aufzuzählen meine Zeit nicht hinreichen würde.
Da sie nun, wie gesagt, den König ganz außer sich in vollem Jubel fanden, sagten sie zu ihm: „Da Corvetto gar so viel verrichtet hat, um dir gehorsam zu sein, so wäre es eben nichts Großes, wenn er, um dir ein ganz besonderes Vergnügen zu machen, nun auch noch den Palast des wilden Mannes verschaffte, der nicht zu schlecht ist, selbst die Wohnung eines Kaisers zu sein. Ja, er enthält so viele Gemächer, dass ein Heer darin Herberge finden könnte, und man könnte nicht leicht die Menge der Höfe zählen, der Säulengänge, Hallen und Säle, die sich darin in so großer Zahl vorfinden, dass die Kunst sich darüber ärgert, die Natur sich schämt, und das Erstaunen außer sich gerät.
Der König, der bei jeder Sache gleich in Flammen geriet, ging als bald darauf ein, rief den Corvetto, gestand ihm das Gelüst welches er nach dem Palast des wilden Mannes bekommen, und befahl und bat ihn inständigst, zu so viel Diensten die er ihm schon erwiesen, auch noch diesen hinzu zu fügen, wofür er ihn mit der Kreide der Dankbarkeit an die Wirtshaustafel des Gedächtnisses für immer anschreiben würde. Corvetto, der ein pfiffiger Bursche war, und den Hund wohl vom Ofen zu locken verstand, nahm als bald die Beine über den Buckel, und begab sich nach dem Palast des wilden Mannes.
Da selbst findet er die wilde Frau allein, welche im Kindbett gewesen; der Mann aber ist ausgegangen, um Gevattersleute zu bitten. Da die Frau aus dem Bette aufgestanden war, um alles zu dem bevorstehenden Feste zurecht zu machen, so begab sich Corvetto zu ihr hinein und sagte mit einer mitleidigen Miene: „Gott grüß euch, wackere Frau, ihr seid tüchtig hinter euren Sachen her, warum wollt ihr euch aber so sehr quälen? Gestern erst seid ihr in Wochen gekommen, und heute schon strengt ihr euch dermaßen an und habt kein Mitleid mit euch selbst." „Was soll ich tun“, erwiderte die wilde Frau, „wenn ich niemand habe, der mir hilft." „Ich bin bereit“, versetzte Corvetto, „euch mit Hand und Fuß beizustehen." „Nun denn, so seid mir willkommen“, sagte die wilde Frau, „und da ihr euch mir mit so vieler Freundlichkeit anbietet, so spaltet mir doch sogleich ein Paar Scheite Holz."
„Sehr gern“, antwortete Corvetto, „nicht nur ein Paar, sondern viele; nahm hierauf eine frisch geschliffene Art, doch anstatt aus das Holz zu hauen, gibt er der wilden Frau eins auf den Kopf, dass sie sogleich zu Boden fällt. Hierauf läuft er vor das Thor, gräbt da eine sehr tiefe Grube, die er mit grünen Zweigen und Erde zudeckt, und stellt sich hinter die Türe. Als er nun den wilden Mann mit den Gevattersleuten ankommen sah, fing er zu rufen an: „Geht ihr zum Kuckkuck, es lebe der König von Fiume-Largo." Da der wilde Mann diesen höhnischen Ausruf vernahm, eilte er blindlings mit den anderen auf Corvetto los, um ihn in kleine Stücke zu zerhacken; da sie aber alle, von Wut geblendet, über Hals und Kopf in die Grube stürzten, so machte Corvetto ihnen mit Steinwürfen vollends den Garaus, worauf er die Türe zuschloss, und die Schlüssel dem Könige überbrachte.
Als dieser nun den Mut und den seltenen Verstand des Jünglings überdachte, gab er ihm, trotz seines niedrigen Standes und dem Hohn des Neides, zum großen Verdruss der Hofleute, seine Tochter zur Frau. Also wurden die Schlingen des Neides die Stapeln, womit jener das Schiff seines Lebens in das Meer der Größe rollen ließ; seine Feinde aber waren zu Schanden gemacht, und außer sich vor Ärger, und mussten ohne Licht schlafen gehen, denn:
Mag noch so lange die Strafe weilen,
Sie wird die Schelme doch ereilen.
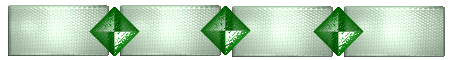
CANNETELLA ...

Es war einmal der König von Bello-Puojo, der wünschte nichts sehnlicher, als Kinder zu bekommen. Nachdem er diesen Wunsch lange Zeit vergebens mit sich getragen, und die Götter mit Bitten bestürmt hatte, beschenkte ihn endlich seine Gemahlin Renzolla mit einem hübschen Töchterlein, der er den Namen Cannetella beilegte.
Als sie nun wie eine Tanne herangewachsen war, sagte der König zu ihr: „Du bist jetzt groß genug, meine liebe Tochter, um zu heiraten; da ich dich aber von ganzem Herzen liebe, und hierin nur nach deinem Wunsche handeln möchte, so sage mir, was für einen Mann du haben willst; wähle du selbst, denn wie du willst, so will ich tun.
Cannetella, da sie dieses Anerbieten hörte, dankte ihrem Vater und entgegnete ihm, sie wünsche gar nicht zu heiraten. Da der Vater ihr jedoch mit Bitten unaufhörlich zusetzte, sagte sie endlich: „Um mich für so viel Liebe nicht undankbar zu beweisen, bin ich entschlossen, mich in deinen Willen zu fügen, nur wünsche ich einen solchen Mann wie kein zweiter mehr in der Welt zu finden ist."
Als der Vater dies vernahm, stellte er sich ganz vergnügt vom frühen Morgen bis spät in die Nacht ans Fenster und in dem er alle Vorübergehenden genau in Augenschein nahm, sagte er, da gerade ein Mann von schönem Äußeren vorbeikam, zu seiner Tochter: „Komm rasch, liebe Cannetella, und siehe zu, ob dieser da dir behagt."
Nachdem sie ihn hatten herauf rufen lassen, veranstalteten sie ein schönes Gastmahl, bei dem an Speisen und Getränken nichts fehlte, was man nur irgend wünschen konnte. Während sie nun bei Tafel saßen, fiel dem Jüngling eine Mandel aus dem Munde, die er jedoch geschickt wieder aufhob und unter das Tischtuch legte.
Nachdem das Mahl zu Ende, ging er fort, worauf der König Cannetella fragte: „Wie gefällt dir der Jüngling?"
Sie erwiderte: „Das ist mir ein schöner Tölpel! ein so großer Mensch wie der sollte sich doch wahrhaftig keine Mandel aus dem Mund fallen lassen!"
Da der König diese Antwort vernahm, trat er wiederum ans Fenster und als er einen anderen von empfehlendem Äußeren vorübergehen sah, rief er die Tochter herbei, um zu hören, wie ihr dieser gefiele. Cannetella erwiderte, er solle ihn nur herauf kommen lassen. Ein neues Gastmahl wurde veranstaltet und nachdem sich der Jüngling nach beendigter Tafel wieder fort begeben hatte, fragte der König seine Tochter, wie er ihr gefiele. „Was soll ich“, versetzte Cannetella, „mit einem Menschen anfangen, den jederzeit wenigstens ein Paar Diener begleiten sollten, um ihm den Mantel abzunehmen, da er selbst kein Geschick dazu hat!"
„Wenn das so ist“, erwiderte der König, „so sehe ich wohl, wo du hinaus willst; denn das sind lauter Ausflüchte eines schlechten Bezahlers! Aber fasse einen Beschluss, denn ich will dich verheiraten und mein Haus soll nicht aussterben."
Hierauf gab Cannetella ihrem Vater zur Antwort: „Nun denn, um es euch gerade heraus zu sagen, mein Herr Vater, Ihr gebt euch nutzlose Mühe und macht die Rechnung ohne den Wirt, denn nie werde ich mich einem Manne anvertrauen, der nicht einen Kopf und Zähne von Gold hat."
Der König, höchst erzürnt, seine Tochter so eigensinnig zu finden, genügte gleichwohl ihrem Willen und ließ dem zu Folge eine Bekanntmachung ergehen, dass wer irgend in seinem Königreiche die von seiner Tochter geforderten Eigenschaften besitze, vor ihn kommen solle, denn er würde ihm seine Tochter zur Frau und das Reich zur Mitgift geben.
Es hatte aber der König einen grimmigen Feind, Namens Scioravante, dessen Name selbst in seiner Gegenwart nicht erwähnt werden durfte. Als dieser nun jene Bekanntmachung vernahm, rief er, als ein geschickter Zauberer, einige von seinen dienstbaren Geistern herbei, und befahl ihnen, sie sollten ihm Kopf und Zähne vergolden. Obwohl ihm jene Geister im Anfang die Unmöglichkeit vorschützten und statt dessen ihm ein Paar goldene Hörner versprachen, taten sie dennoch, von dem Zauberer gezwungen, alles, was er wollte, woraus er mit Kopf und Zähnen vom allerfeinsten Golde unter den Fenstern des Königs spazieren ging.
Als der König das, was er gerade suchte, wahrnahm, so rief er auf der Stelle die Tochter und sagte zu ihr: „Da siehe, da ist es gerade, was wir suchen, es könnte in der Tat nicht besser sein, wenn ich mir es selbst gemacht hätte." Und in dem Scioravante vorübergehen wollte, rief der König ihn an: „Warte doch ein wenig, Bruder, du bist ja sehr eilig, als hättest du Quecksilber in den Beinen. So warte doch nur, du sollst alsbald Sachen und Leute bekommen, welche dich und meine Tochter begleiten sollen, die ich dir laut meines Versprechens zur Frau geben will."
„Ich danke euch vielmals", versetzte Scioravante, „es ist aber gar nichts weiter Notwendig. Gebt mir nur ein Pferd, und ich nehme sie dann vor mich auf den Sattel, denn in meinem Hause fehlt es weder an Dienern, noch an sonst etwas; es ist alles vorhanden wie Sand am Meer." Und so setzte denn Scioravante endlich seinen Willen durch, nahm Cannetella vor sich auf das Pferd und begab sich auf den Rückweg nach Hause.
Gegen Abend brachte er sie in einen Stall, wo einige Pferde angebunden standen, und sagte zu ihr: „Merke wohl auf, ich muss jetzt nach Hanse gehen, bis wohin es noch sieben Jahre weit ist; erwarte mich ja in diesem Stall und gehe nicht heraus und lass dich von keinem lebenden Wesen erblicken, sonst wird es dir schlimm ergehen." Hierauf erwiderte Cannetella: „Ich bin deine Magd und werde ganz nach deinem Willen handeln; aber ich möchte wohl wissen, wovon ich mich unterdessen ernähren soll." „Du kannst dir nehmen“, war die Antwort Scioravantes, „was den Pferden an Futter übrig bleibt."
Man wird sich leicht vorstellen, wie betrübt Cannetella wurde und wie sie die Stunde verwünschte, in der sie geboren war. Was ihr an Speise abging, ersetzte sie durch Jammern und Wehklagen, indem sie ihr Schicksal verwünschte, welches sie von dem königlichen Palast in den Stall, von den Matratzen zum Stroh, von den Leckerbissen der väterlichen Tafel zu den Überbleibseln des Pferdefutters getrieben hatte. Dieses elende Leben brachte sie nun ein Paar Monate zu, während welcher Zeit den Pferden, man sah nicht von wem, zu fressen gegeben wurde; was hiervon übrig blieb, diente zu Cannetellas Nahrung.
Nach Verlauf dieser Zeit guckte sie einmal durch eine Ritze in der Wand und erblickte einen sehr schönen Garten, in welchem sich so viele Pomeranzen Spaliere, so viele Zitronen Lauben, so viele Blumenbeete, Fruchtbäume und Weinlauben befanden, dass es eine wahre Freude war, dies alles nur zu sehen. In Folge dessen überfiel nun die arme Cannetella ein heftiges Gelüst, einige dieser anlockenden Früchte zu genießen und sie sagte bei sich selbst: „Ich will ganz leise hinaus gehen, um mir einige abzupflücken; mag nun entstehen, was da wolle. Indes wer könnte wohl dies meinem Manne wieder sagen! Und sollte er es dennoch unglücklicherweise erfahren, nun, so ist es ja eben nur eine Weintraube gewesen."
Sie ging also hinaus und stärkte und erquickte ihren durch Hunger ganz entkräfteten und abgemagerten Körper. Aber kurze Zeit darauf kehrte ihr Mann zurück und sogleich klagte eines der Pferde Cannetella an, dass sie Trauben gegessen, worüber Scioravante so in Wut geriet, dass er ein Messer aus der Tasche zog und sie töten wollte.
Da warf sich Cannetella vor ihm auf die Erde nieder und bat ihn, er möchte doch wohl überlegen, was er tue, denn der Hunger jage selbst den Wolf aus dem Walde, und sie redete so lange und brachte so viel vor, ihn zum Mitleiden zu bewegen, bis Scioravante endlich zu ihr sagte: „Diesmal verzeihe ich dir und schenke dir das Leben; aber wenn du noch einmal meinen Befehl übertrittst und ich erfahre, dass du dich aus dem Stalle hinaus begeben hast, so hat deine Stunde geschlagen. Darum hüte dich, denn ich reise noch einmal fort und werde sieben Jahre abwesend bleiben; gehorchst du mir nicht, so sollst du die alte und die neue Rechnung bezahlen."
Nach diesen Worten ging er fort, Cannetella aber ergoss sich in einen Tränen Strom, rang die Hände, schlug die Brust und riss sich die Haare aus dem Kopf, indem sie sagte: „Wäre ich doch nie geboren, da mir ein so jammervolles Schicksal bestimmt ist, ach Vater, wie unglücklich hast du mich gemacht! Doch warum klage ich über meinen Vater, da ich selbst Schuld bin an allen meinen Leiden! hier habe ich ja den gewünschten Kopf von Gold, der mich in dieses Unglück gestürzt hat; so straft mich der Himmel dafür, dass ich nicht nach dem Willen meines Vaters handelte! —
Kein Tag verging, dass sie diese Klagen und Seufzer nicht wiederholte, bis ihre Augen sich in zwei Quellen verwandelten und das Gesicht so mager und bleich wurde, dass es ein Jammer war sie anzusehen. Nach Verlauf eines Jahres nun zog zufälligerweise bei jenem Stall der Küfer des Königs, den Cannetella kannte, vorüber. Sie rief ihn an und ging hinaus. Jener, als er sich bei seinem Namen nennen hörte und gleichwohl die arme Königstochter nicht wieder erkannte, geriet außer sich vor Verwunderung.
Nachdem er aber gehört hatte wer sie sei, steckte er sie, teils aus Mitleid, teils um sich die Gnade des Königs zu erwerben, in ein leeres Fass, welches er auf einem Lasttier mit sich führte, und gelangte so um vier Uhr des Nachts an den Palast des Königs, wo selbst er heftig an das Tor pochte. Da nun die Diener eilig herbei kamen und sahen, dass es nur der Küfer sei, schimpften sie ihn tüchtig aus, wie er sich unterstehe, zu so ungelegener Stunde zu kommen und alle aus ihrem Schlaf zu stören.
Als der König diesen Lärm und den Grund des selben vernahm, ließ er den Küfer vor sich kommen in der Überzeugung, es müsse etwas ganz Ungewöhnliches vorgefallen sein, dass Jener zu so ungeeigneter Stunde sich der gleichen herausnehme. Nachdem der Küfer das Lasttier abgeladen, ließ er Cannetella aus dem Fasse herauskriechen, allein der Vater erkannte sie nicht eher wieder, als bis er ein Mal, welches sich auf ihrem rechten Arme befand, erblickt hatte. Sobald er jedoch volle Gewissheit erlangt, umarmte und küsste er sie tausendmal und ließ ihr sogleich eine gute Mahlzeit bereiten. Nachdem sie dieser aus allen Kräften zu gesprochen, sagte der Vater zu ihr: „Wer hätte das geglaubt, meine liebe Tochter, dass ich dich in einem solchen Zustand wieder sehen würde, wie siehst du aus, wer hat dich so herab gebracht?"
Cannetella erwiderte hierauf: „Jener ungläubige Heide hat mich wie einen Hund geplagt, so dass ich alle Augenblicke nahe daran war zu sterben, aber ich will dir gar nicht erzählen was ich alles ausgestanden, denn meine Leiden sind so groß gewesen, dass sie allen Glauben übersteigen. Genug, ich bin bei dir, lieber Vater, und will mich nicht mehr von deinen Füßen trennen und eher Magd sein in deinem Hause als Königin bei einem Anderen; eher will ich einen Kittel, wo du bist, als einen Mantel von Gold, entfernt von dir; eher will ich einen Spieß in deiner Küche drehen als einen Zepter unter dem Baldachin eines anderen tragen."
Inzwischen kehrte Scioravante in den Stall zurück und sogleich wurde ihm von den Pferden berichtet, dass der Küfer Cannetella in einem Fasse fort geführt habe. Als der wilde Mann dies hörte, eilte er voller Zorn nach Bello-Puojo und sprach eine alte Frau an, die gerade dem Palaste des Königs gegenüber wohnte, indem er zu ihr sagte: „Was willst du von mir haben, wenn du mich die Tochter des Königs sehen lässt?" Und da sie hundert Dukaten von ihm forderte, zog Scioravante den Beutel heraus und zählte ihr sie auf, worauf sie ihn auf den Söller hinauf stiegen ließ, von wo er Cannetella in dem obern Stockwerk erblickte, da sie sich gerade die Haare auskämmte.
Cannetella, als hätte sie geahnt, was geschehe ist, wandte ihre Augen nach jener Gegend hin, erblickte Jenen, eilte die Treppe hinunter und rief ihrem Vater zu: „Mein Herr und Vater, wenn du mich nicht auf der Stelle in ein Zimmer mit sieben eisernen Türen verschließest, so bin ich verloren."
„Wenn es weiter nichts ist“, versetzte der König, „das soll geschehen"; und sogleich wurden die Türen fest geschlossen.
Als Scioravante dies wahr nahm, kehrte er zu der alten Frau zurück und sagte zu ihr: „Ich gebe dir was du willst, wenn du in den Palast des Königs gehst, dich unter irgend einem Vorwand in das Zimmer der Prinzessin schleichst und ihr unter das Kopfkissen dieses Zettelchen steckst und dazu leise sprichst: „Alle mögen schlafen, nur Cannetella sei wach!"
Die alte Frau forderte noch hundert Dukaten und tat wie er wünschte. Hierauf kam ein so gewaltiger Schlaf über alle Leute im Hause, dass sie sämtlich wie tot lagen, nur Cannetella blieb wach. Als sie nun die Türen einstoßen hörte, fing sie aus Leibeskräften an zu schreien, gleich als wenn sie am Spieß steckte. Weil aber Niemand da war, der auf ihr Geschrei herbei geeilt wäre, so geschah es, dass Scioravante alle sieben Türen aufsprengte, in das Zimmer hinein drang und Cannetella mit samt ihren Betten aufpackte, um sie fort zu tragen.
Glücklicherweise jedoch fiel der Zettel, den die Alte unter das Kopfkissen gesteckt, auf die Erde und da die arme Prinzessin noch immer aus vollem Halse schrie, so erwachten die Leute im ganzen Hause. Bei dem Gekreisch der Cannetella eilten sie herbei, ergriffen den wilden Mann und machten ihm den Garaus, so dass er also in seinem eigenen Netz sich fing, welches er für die unglückliche Prinzessin ausgestellt hatte, und demnach zu seinem eigenen Schaden die Wahrheit des Sprichworts erfuhr:
„Wer Anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein."
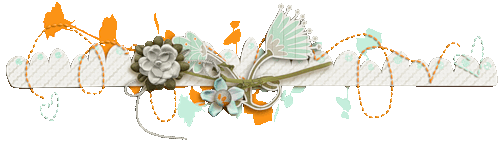
BEPPO PIPETTA ...

Beppo Pipetta, Soldat des Königs von Schottland, war auf Urlaub im väterlichen Hause, das auf einem hohen Berge lag, an dessen Fusse sich ein sehr übel berufenes Wirtshaus befand. Einst machte der König ganz allein eine Fußreise und bestieg auch der schönen Aussicht halber diesen Berg, auf dem er Peppo begegnete.
Obwohl der König ganz wie ein gewöhnlicher Fußreisender gekleidet war, so erkannte Beppo doch gleich auf den ersten Blick, dass es ein Mann von Stande sein müsse, und fragte ihn daher teilnehmend, wie er sich in so verrufener Gegend allein zu wandeln getraue. »Je nun, wenn dem so ist«, meinte der König, »so geht mit mir, ihr habt Gewehr und Degen bei euch und könnt mir nützlich sein.« Beppo nahm die Einladung an und so gingen sie unter allerhand Gesprächen, bis es spät und finster geworden war und sie bei dem Wirtshaus anlangten, wo sie vorsprachen.
Als sie zwei Betten verlangten, so tat dem Wirt leid um die zwei Reisenden, und er sagte ihnen, dass er zwar Betten habe, dass aber später auch Räuber bei ihm einkehren würden. »Gut«, antworteten diese, »so gebt uns einstweilen etwas zu essen.« »Meine Herrn«, entgegnete der Wirt, »ich habe nichts als Brot.« »Und was sind denn die Hühner da am Bratspieß?« fragte Beppo. »Die sind für die Räuber.« »Ach was, die Räuber!« rief Beppo, »gebt uns nur eins davon und lasst mich für das Weitere sorgen.«
Als die Reisenden gegessen hatten, verlangten sie ihre Betten und man führte sie in den oberen Stock. Während nun der König sich zur Ruhe begab, legte sich Beppo auf die Spähe, und da vernahm er denn bald, dass die Räuber angekommen waren. Als sie nach dem fehlenden Huhn fragten und hörten, zwei Fremde hätten es verzehrt, so riefen sie: »Wohlan, haben die unser Huhn vom Spieß genommen, so wollen wir ihnen dafür das Herz aus dem Leibe reißen.«
Als die Räuber den ersten Hunger und Durst gestillt hatten, so schickten sie einen von ihnen hinauf auf Kundschaft. Beppo aber, der im Hinterhalt stand, stieß ihm den Degen dergestalt in die Brust, dass er lautlos zu Boden stürzte, worauf er den Toten in ein Nebenzimmer warf. Da sagte nach einer Weile ein Räuber: »Mir däucht, unser Kamerad hat mit den Zweien da oben Brüderschaft getrunken, ich muss doch ein wenig nachsehen.« Hierauf erhob er sich und ging die Treppe hinauf, aber Beppo behandelte ihn gerade wie den ersten.
Wieder nach einiger Zeit sagte ein Räuber: »Unsere Kameraden kommen gar nicht mehr herab, die müssen sich gut unterhalten, ich will doch auch von der Partie sein, wenn sie lustig ist.« – Dies gesagt, ging auch er hinauf, aber auch ihn traf Beppo's sichere Hand. Nun dachte dieser, drei von den sieben Räubern haben wir vom Halse, mit den anderen vieren werden wir zwei schon fertig werden. Aber es sollte noch leichter werden, als er gedacht, denn die Räuber schickten noch einen hinauf mit dem Auftrag, die anderen drei herab zu bringen oder aber selbst gleich zurück zu kommen. Beides wurde ihm unmöglich, denn Beppo verfuhr mit ihm gerade wie mit seinen Vorgängern.
Da ergrimmten die übrig gebliebenen und gingen alle drei zugleich hinauf, aber Beppo erschoss den vordersten und stach die anderen zwei mit dem Degen nieder. »Herr Wirt!« rief Beppo hierauf die Stiege hinab, »he! sind noch Brathühner übrig geblieben und Wein, so bringt sie herauf!« Da dieses der Fall war, so machte er es sich erst recht bequem und tat sich gütlich.
Als der Tag angebrochen war, zahlte der König die Zeche für beide, belohnte den Wirt, und als sie an den Scheideweg gekommen waren, fragte er noch Beppo, ob er auch seinem König wohlwolle. »Ja«, antwortete dieser, »denn er ist ein sehr guter Herr, den alle gerne haben, und überdies bezahlt er mich gut und pünktlich.« Hierauf trennten sie sich freundschaftlichst und jeder ging seinen Weg, der König in seine Residenz und Beppo nach Hause und bald darauf in seine Garnison.
Kaum war Beppo bei seiner Compagnie angelangt, wurde er zum Könige gerufen, und als er im Schlosshof auf die Stunde der Audienz wartete, siehe da erblickt er auf einmal den Herrn, der mit ihm im Wirtshaus das Abenteuer mit den Räubern bestanden.»Was macht ihr hier?« sprach ihn der Herr an.
»Ich bin zum Könige gerufen worden.« »Ich auch, wisst ihr warum?« »Nein, aber ich werde es euch erzählen, wenn wir von der Audienz gehen.«
Da grüsste der Herr und ging fort. Beppo aber wurde bald darauf zum Könige in den Audienzsaal geführt, der mit Krone und Mantel auf dem Throne sass, so dass er ihn gar nicht erkannte.
»Pipetta!« rief ihm der König mit etwas veränderter Stimme zu, »von euch habe ich schöne Dinge gehört, ihr habt sieben Personen ermordet.« »Ja, mein Herr!« antwortete dieser, »es waren Räuber, die mich und noch einen Reisenden ermorden wollten.« »Davon steht hier nichts in der Anzeige. Habt ihr Zeugen?« »Ja, einen Herrn, der dabei war, der steht unten im Hofe.« »Das ist nicht wahr«, rief der König, »denn er steht hier im Saale und zwar vor euch.«
Da ging unserm Beppo ein Licht auf und er erkannte in dem Könige den Reisenden. Der König aber fuhr fort: »Ihr sollt nicht mehr Soldat sein, sondern bei mir bleiben oder wo es euch sonst gefällt, und es gut haben. Was ihr braucht, zahle ich alles für euch, denn ihr habt mir damals das Leben gerettet.«
Als die erste Freude über dieses Glück vorüber war, beschloss Beppo die Seinen zu besuchen. Da traf er auf der Strasse einen Mann, der sich mit ihm in ein Gespräch ein ließ, und so plauderten sie lange fort, bis sie endlich in ein Wirtshaus gingen, sich mit Speise und Trank zu erquicken. »Wie kommt es«, fragte da sein neuer Freund, der sich an Beppo's Schnacken weidlich ergötzte, »dass ihr als Soldat keinen Schnappsack mit euch führt?« »Hm«, meinte Beppo, »ich belaste mich nicht gerne auf dem Marsch mit unnötigen Dingen. Effekten habe ich keine und brauche ich etwas, so bekomme ich es überall, denn ich habe einen guten Herrn, der alles für mich bezahlt.«
»Nun«, sagte der Fremde, »so will ich euch einen Schnappsack schenken und zwar einen sehr kostbaren, denn wenn ihr zu jemand sagt: Spring hinab, so springt er in den Sack.« Darauf empfahl sich der Fremde und ging.
Warte, dachte Beppo, das will ich gleich probieren. Und wirklich bot sich dazu eine günstige Gelegenheit dar, denn so eben erschien der Wirt, um die Zeche zu begehren. »Was wollt ihr?« fragte Beppo.
»Die Zeche, das könnt ihr euch selbst denken.« »Lasst mich ungeschoren, ich habe jetzt kein Geld.«
»Was? ihr lumpiger Soldat ...« »Spring hinein!« sagte Beppo, und der Wirt stak bis über die Ohren im Sack. Nur nach langem Bitten und gegen Verzichtleistung auf die Zeche ließ er den Wirt wieder heraus. »Warte Kerl! ich werde dir über Soldaten schimpfen lehren«, sprach er zum Wirt und ging fort.
Nach langem Wege ermüdet und hungrig kehrte Beppo wieder in einem Wirtshaus ein. Da sieht er einen Menschen, der fortwährend einen Geldbeutel ausleert, aber nie fertig wird, denn er füllte sich immer wieder von neuem. Schnell reißt er ihm den Beutel aus der Hand und läuft zum Wirtshaus hinaus, aber nicht minder flink der Eigentümer ihm nach, und da er keinen so weiten Weg gemacht hatte, wie Beppo, der den ganzen Tag gewandert war, so war er ihm bald auf der Ferse. Da schrie dieser: »Spring hinein!« und der Eigentümer war im Sacke. »Höre«, sagte Beppo, nachdem er etwas zu Atem gekommen war, »höre und sei vernünftig. Du hast den Beutel lange genug gehabt, überlasse ihn jetzt mir, sonst bleibst du ewig im Sack.« Was konnte da der Eigentümer tun? Gerne oder ungerne musste er den Beutel abtreten, um aus dem verfluchten Sacke zu kommen.
Zwei Jahre hatte Beppo zu Hause mit dem Beutel viel Gutes und mit dem Sack viele Schelmereien getan, da sehnte er sich wieder nach der Residenz und reiste zurück; aber wie erstaunte er nicht, als er sie ganz schwarz behangen und Jedermann in Trauer sah. »Wisst ihr nicht von dem traurigen Falle«, antwortete man ihm auf seine Fragen um die Ursache dieser Trauer, »wisst ihr nicht, dass morgen der Teufel des Königs Tochter holen wird wegen eines leichtsinnigen Schwures, den ihr Vater getan?« Da lief er spornstreichs zum König, ihn zu trösten, aber der glaubte ihm nicht. »Herr!« sagte er, »Sie wissen noch nicht, was Beppo Pipetta im Stande ist. Lassen Sie nur mich machen.«
Da bereitete er in einem Zimmer der Burg einen großen Tisch mit Papier, Feder und Tinte, während die Prinzessin im Nebenzimmer betend ihr trauriges Geschick erwartete. Da hörte man um Mitternacht ein fürchterliches Brausen wie Sturmwind, und mit dem letzten Glockenschlag fuhr der Teufel beim Fenster herein – in Beppo's Sack, der ihn schon offen hielt und schnell »Spring hinein!« gerufen hatte.
»Was machst denn du hier?« fragte Beppo den tobenden Teufel. »Was geht es dich an? Ich habe meine Gründe«, erwiderte dieser keck. »Warte ein wenig, Halunke!« rief Beppo, »ich werde dir Manier lernen«, und ergriff hierauf einen Stock und prügelte so lange auf den Sack los, bis der Teufel darin vor Schmerz alle Heiligen anrief. »Willst du die Prinzessin noch holen?« »Nein, nein, lass mich nur aus dem infamen Sack.« »Versprichst du sie nimmer zu belästigen?« »Ich verspreche es, aber lass mich heraus.« »Nein«, sagte Beppo, »was du versprochen, musst du vor Zeugen wiederholen und auch schriftlich von dir geben.«
Da rief er einige Herren vom Hofe ins Zimmer, ließ sich das Versprechen wiederholen, erlaubte dem Teufel eine Hand aus dem Sacke zu strecken und folgendes zu schreiben: Ich Endesgefertigter Teufel verspreche hiermit, dass ich J.k. Hoheit die Prinzessin weder holen, noch je in Zukunft belästigen werde. Satanas, Höllengeist.
»Gut«, sagte Beppo, »das Geschäft mit der Prinzessin wäre jetzt abgetan; jetzt aber erlaube, dass ich dir wegen deiner früheren Grobheit noch einige Hiebe als Andenken an mich mit auf die Reise gebe.« Als dieses geschehen, öffnete er den Sack und der Teufel fuhr den Weg, den er gekommen, beim Fenster hinaus.
Da gab der König eine große Tafel, bei der Beppo zwischen ihm und der Prinzessin sass, und große Freude verbreitete sich darüber im ganzen Königreiche. Nach einiger Zeit machte Beppo eine Vergnügungsreise und kam an einen Ort, wo es ihm so gefiel, dass er dort zu bleiben beschloss, aber die Polizei machte ihm Umstände und wollte wissen, wer er sei, woher er sei und eine Menge anderer Dinge.
Da antwortete er: »Ich bin Ich, das sei euch genug. Wollt ihr aber mehr wissen, so schreibt an den König.« Wirklich wurde an den König geschrieben, der aber den Befehl erteilte, ihn zu respektieren und ungeschoren zu lassen. Schon hatte er viele Jahre in diesem Orte gelebt und war alt geworden, da kam der Tod und klopfte bei ihm an. Beppo öffnete und fragte: »Wer seid ihr?« »Ich bin der Tod«, war die Antwort. »Spring hinein!« schrie Beppo eiligst, und siehe, der Tod war im Sacke. »Was?« rief dieser, »ich, der so viel zu tun hat, soll hier meine Zeit versäumen?« »Bleib du nur darin, alter Spitzbube«, antwortete Beppo und ließ ihn anderthalb Jahr nicht heraus.
Da war allgemeine Zufriedenheit auf der Welt, besonders jubelten die Ärzte, denn keinem starb mehr ein Kranker. Da bat der Tod so demütig und stellte ihm die Folgen dieser Unordnung so vernünftig vor, dass Beppo ihn unter der Bedingung raus ließ, ja nicht ohne seinen Willen zu kommen. Der Tod aber entfernte sich und suchte durch ein paar Kriege und Pesten das Versäumte nachzuholen.
Endlich wurde Beppo so alt, dass ihm schon selbst das Leben zuwider wurde. Da schickte er um den Tod, der aber kam nicht, denn er befürchtete, die Botschaft könnte Beppo wieder reuen. Da entschloss er sich, selbst zum Tode zu gehen. Der Tod war nicht zu Hause, hatte aber in Erinnerung an seine Vakanzen im Sack vorsorglich den Auftrag hinterlassen, falls ein gewisser Beppo Pipetta komme, ihm ja den Rücken ordentlich durchzubläuen; was pünktlich ausgerichtet wurde.
Beim Tode geprügelt und hinaus geworfen, ging er ganz traurig zur Hölle, aber auch hier existierte beim Pförtner schon ein Befehl des Teufels, ihm gleiche Ehre wie beim Tode zu erweisen, und der auch gewissenhaft in Vollzug gesetzt wurde.
Voll Schmerzen über die erhaltenen Prügel und ärgerlich darüber, dass ihn der Tod nicht wolle, ja nicht einmal der Teufel, geht er zum Paradies. Hier meldete er sich beim heiligen Petrus, aber dieser meinte, er müsse erst darüber bei unserm Herrgott anfragen.
Da wirft Beppo unterdessen seine Kappe über die Mauer ins Paradies. Nach einigem Warten erscheint St. Peter und sagt: »Mir ist recht leid, aber unser Herrgott mag euch nicht hier.« »Nun«, sagt Beppo, »so lasst mich wenigstens meine Kappe wieder holen«, wischte schnell zur Türe hinein und setzte sich auf die Kappe. Als ihm hierauf St. Peter aufzustehen und sich weiter zu trollen befahl, erwiderte er gelassen: »Nur gemach, mein Herr! jetzt sitze ich auf meinem Eigentum und da lasse ich mir von niemand befehlen«, und somit blieb er im Paradiese.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
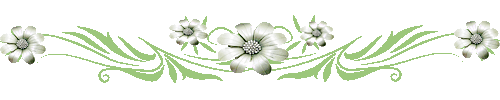
DER KÖNIGSSOHN UND DIE BAUERNTOCHTER ...

Auf den Wunsch seines alten Vaters zieht ein Königssohn mit einem Diener aus, sich eine Braut zu suchen. Vergebens erinnert jenen sein Begleiter doch auf die schönen Fräulein in der Stadt und auf dem Lande zu achten. Der Königssohn will Nichts von ihnen wissen. Abends kommen Beide in einen Wald, in welchem sie bald eine Hütte bemerken. In dieser kehren sie des schlechten Wetters wegen ein.
Der Bauer empfängt sie freundlich und lässt bald von seiner Frau das Essen anrichten. Da der Tisch für fünf gedeckt wird, erkundigt sich der Königssohn nach dem fünften Tischgenossen, den er nirgends sieht. Dies sollte die Tochter des Bauern sein, wird ihm geantwortet. Doch will sie aus Furcht vor den Herren nicht erscheinen. Indessen in dieser Beziehung beruhigt, kommt sie und sogleich bezeichnet sie der Königssohn seinem Begleiter als seine künftige Braut. Bei Tische zerlegt mit Erlaubniss des Bauern der Königssohn die Hühner und gibt dem Vater den Kopf, der Mutter den Bauch, der Tochter die Beine und die Flügel, während er selbst mit seinem Begleiter das Fleisch isst. Am folgenden Morgen verlangt dann der Königssohn die Tochter des Bauern zur Frau, erhält des Letzteren Einwilligung und kehrt dann zu seinem Vater zurück, von dem er sich einen schönen Wagen geben lässt, um seine Braut abzuholen.
Die alte Königin ist jedoch über die Bauernheirat aufgebracht. Sie weiß durch eine Intrige einen Krieg mit Spanien zu entzünden, in den sich dann der König mit seinem Sohne begeben muss. Der Letztere gibt beim Abschied von seiner Frau dieser noch den Auftrag, im Fall der Geburt eines Kindes in seiner Abwesenheit das selbe mit einem Zeichen zu versehen.
Wirklich gebiert Flavia zwei Kinder, denen sie sogleich ein Erkennungszeichen aufdrückt. Bald nachher kommt die Königin, nimmt die Kinder fort und legt an deren Stelle Hunde. Bei der Rückkehr des Sohnes redet die Mutter diesem vor, seine Frau habe jene Hunde zur Welt gebracht; worauf sie sogleich von dem erzürnten Vater getötet werden, während ihm das Schwert entfällt, als er auch seine Frau umbringen will. Diese wird von der Königin zwei Dienern übergeben, um getötet zu werden. Doch haben die Diener Mitleid und bringen Flavia ebenso wenig um als früher deren Kinder, wie die alte Königin seiner Zeit befohlen; sie begnügen sich vielmehr damit, dass sie die ihnen Übergebene in den Wald bringen. Dort irrt sie nun umher, wird jedoch bald von einem Bauer gastlich aufgenommen, in dessen Hause sie auch ihre Kinder, die der Bauer im Walde gefunden, entdeckt.
Nachdem der Königssohn lange getrauert und zu nichts Lust gezeigt, gelingt es endlich dem Vater ihn zu bereden, einmal auf die Jagd zu gehen. Auf dieser überrascht ihn die Nacht. Er kommt in jenes Bauernhaus und findet so Frau und Kinder wieder. Aufgeklärt über den gespielten Betrug, kehrt er in den Palast zurück, lässt einen Wagen anspannen und bringt Frau und Kinder wieder heim. Beschämt gesteht die Königin ihr Verbrechen, das sie mit dem Tode büßen muss.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien

DIE ESELSLEICHE ...

In dem reizenden Tal, das von Schio über Vallarsa gegen Roveredo führt und Valli genannt wird, weil es aus zwei Tälern besteht, nämlich Val di Conti und Val di Signori, lebte einst ein ziemlich bemittelter Bauer. Er besaß einen Esel, den er ungemein gerne hatte. Als dieser Esel endlich umstand, so war das Leidwesen seines Herrn nicht klein, und da er dem geliebten Griso sonst nichts Liebes mehr erweisen konnte, wollte er ihm eine förmliche Leiche halten lassen, und ging daher zum Pfarrer von Valli, dem er sein Anliegen vorbrachte.
Entrüstet fuhr der Pfarrer über diesen Antrag auf, und nachdem er den Bauern ärger als einen Heiden und Ketzer behandelt und ihm tüchtig die Leviten gelesen hatte, jagte er ihn zur Türe hinaus. Das ist aber eben nicht die rechte Art, wie man einem Bauern eine Idee aus dem Kopfe reden kann, und somit hatte auch des Pfarrers Strafpredigt keinen anderen Erfolg, als dass der Bauer schnurgerade vom Pfarrer im Tal, zu einem Pfarrer im Gebirge ging, und fester als je entschlossen, seinem Esel eine Leiche halten zu lassen, diesem den nämlichen Antrag machte.
Der Gebirgspfarrer hatte, wie viele seiner Mitbrüder, viel und beschwerlichen Dienst, aber eine weniger als mässig dotierte Pfründe, deren Hauptvorteile in einer sehr schönen Aussicht und sehr gesunden Luft bestanden. Nebenbei war er kein Feind von einem zuweilen etwas derben Spaß. Er hörte den Bauer sehr gelassen an und bemerkte bloß, dass die Leiche etwas kostspielig sein werde.
»Nun,« fragte der Bauer, »was kann sie kosten?«
»Wenigstens dreißig Lire, und diese sind im Voraus zu bezahlen.«
»Gut,« sagte der Bauer ganz zufrieden, »hier habt ihr die dreißig Lire, aber macht die Sache fein ordentlich, damit sich der Pfarrer zu Valli recht ärgert.«
Richtig fand sich zur fest gesetzten Stunde der Pfarrer mit dem Messner, Kirchendienern und Trägern ein und der Leichenzug begann. Auch der Pfarrer von Valli begegnete dem Zuge, anscheinend zufälligerweise, in Wirklichkeit aber in der Absicht, selbst zu sehen, ob der Skandal stattfinde oder nicht. Als ihn aber der Pfarrer vom Gebirge wahr nahm, stimmte er sogleich mit ernsthafter Miene und lauter Stimme folgendes Lied an:
L'arciprete delle Valli
Non ha saputo fare
Chiappar le Lire trenta
Per seppelir la giumenta,
Tira i can e tira i forbi,
Chi ne mangerà ne diventa orbi.
Der Pfarrer aus dem Tal
Hat nicht gekannt den Fall,
Für einen Esel begraben
Dreißig Schimmel zu haben.
Schieß die Hund und schieß die Füchs,
Von diesen dreißig kriegst du nichts.
Schallendes Gelächter empfing den armen Erzpriester von Valli, der seinen Ärger kaum zu verbergen im Stande war.
Als der Zug in dem Dorfe auf dem Berge angekommen war, ließ der Pfarrer den Esel über den Berg hinab werfen und sagte zum Bauern: »Guter Freund! die dreißig Lire habe ich redlich verdient, die Leiche habe ich gehalten, den Erzpriester geärgert, aber begraben müsst ihr den Esel schon selbst.«
Die Bauern aber von Enna, Valli, Gisberti und andern Orten in der Nähe lachten noch lange über den Possen, den der lustige Pfaffe vom Berge seinem grämlichen Confrater im Tale und dessen eigensinnigen Pfarrkinde gespielt.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien

DIE BESTOHLENEN DIEBE ...

Zu Caltran, einem Dorfe zwischen Thiene und Asiago, lebte vor langer, langer Zeit ein alter würdiger Pfarrherr. Er war bei dem Bischof und der Gemeinde beliebt und hatte gar keine Feinde. Wohl aber beneideten ihn Leute in der Nachbarschaft um das mächtige, schwarze Schwein, welches seine Haushälterin mit Sorgfalt und Fleiß gemästet hatte. Bekanntlich hilft der Teufel seinen Leuten und so ging es auch hier.
Kaum war gegen Weihnachten das Schwein geschlachtet und geputzt, so gelang es den Neidern auch, das selbe zu stehlen. Sie steckten es in einen Sack und verbargen es, um es Nachts aus dem Orte zu schaffen. Unglücklicher Weise waren sie von einem Bauern gesehen worden, der eben auf einer Anhöhe Kohlen brannte. Seinem würdigen Pfarrer das Schwein zu stehlen, wäre der Bauer viel zu gewissenhaft gewesen, aber es den Dieben wieder zu stehlen, trug er kein Bedenken, und obendrein, dachte er, sollen sie noch genarrt werden.
Als es kaum dunkel geworden war, zog er den Sack aus dem Verstecke, verbarg das Schwein bei sich zu Hause, in den Sack aber steckte er einen toten Esel und trug ihn wieder an den frühern Ort. Später kamen die Diebe, ihren Sack abzuholen, und schleppten ihn mühsam gar weit in den Wald, um dort die Teilung vorzunehmen.
Da griff der Eine in den Sack, zog aber die Hand schnell zurück, als er die Haare von dem Esel fühlte. »Teufel,« sagte er, »es muss heute doch sehr frisch sein, denn auch dem Schweine ist kalt geworden, es macht einen Pelz«. »Warum nicht gar?« meinte der Andere und griff auch in den Sack, und erwischte den Esel beim Hufe. »Meiner Treu!« rief er, »mir scheint gar, dem Schweine sind die Klauen zusammen gefroren.« Da leerten sie den Sack ganz aus und wussten nun, wie sie daran waren.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
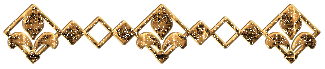
DIE MÄNNER VON COGOLO ...

In Cogolo, einem Dorfe am Fusse des Gebirges, wo die Strasse in die sette communi führt, war eine neue grössere Kirche erbaut worden. Sie war zur vollen Zufriedenheit der Einwohner ausgefallen, aber noch stand der alte Glockenturm, der an Umfang und Höhe wohl zur früheren kleinen Kirche passte, aber nicht zum neuen, stattlichen Gotteshaus.
Da versammelten sich denn die Männer von Cogolo, zu beratschlagen, wie diesem Übelstande könnte abgeholfen werden, und natürlich fand sich, dass nichts anderes zu tun sei, als den alten Turm abzubrechen und einen neuen, größeren dafür aufzubauen. Das aber wollten sie auch nicht, denn der Bau der Kirche hatte ihnen viel gekostet, und Geld war daher in der Gemeindekasse nicht vorhanden.
Da sprang der schlecht bezahlte, aber pfiffige Schulmeister auf und sprach: »Ihr Männer, wollt ihr den Turm grösser haben, so gebt ihm zu fressen, und ich stehe euch dafür, er wird an Größe und Dicke zunehmen. Seht nur unsern Pfarrer an, der als mageres Pfäfflein hier her kam und jetzt ein stattlicher Mann ist, und was einem Pfarrer so gut anschlägt, sollte das einem Kirchturm übel bekommen?«
Dieser Vorschlag fand einstimmigen Beifall und man machte sich also gleich ans Werk. Was nur jeder zu Hause an Salami und anderen Würsten aufzutreiben im Stande war, schleppte er herbei und so behängte man denn in wenig Stunden den armen Turm der Länge und Breite nach, dass er mehr dem Laden eines Wursthändlers (casolino) als einem Kirchturm gleich sah; aber nachts nahm der Schulmeister die ganz oberste Wurstreihe weg, so dass das Mauerwerk des Turmes hervor stand und die Männer von Cogolo, als sie am anderen Morgen nachzusehen kamen, voll Freude waren.
»Seht«, riefen sie, »der Turm hat schon angefangen zu fressen und gewachsen ist er auch gleich, er ragt schon eine Spanne über die Würste heraus.« Täglich füllten sie die entstandene Lücke mit neuen Würsten aus und als diese ihnen ausgegangen waren, verwendeten sie Speckseiten dazu, die dem Turm ebenso gut schmeckten.
Als aber der Schulmeister seinen Keller mit Würsten und Speck hinlänglich versehen hatte, sagte er: »Leute, gebt doch dem Turme nichts mehr zu essen, denn wie ihr seht, wächst er nur in die Höhe und nicht auch in die Breite, er könnte also so hoch werden, dass ihn die Grundfeste nicht mehr zu tragen vermag, oder ihn der Wind umwerfen kann.«
Da hielten sie mit der Mästung inne, hatten sie doch die Freude gehabt, ihn statt mit Ziegel und Mörtel, durch Salami und Speck um ein gutes Stück höher gemacht zu haben.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien

MIT VERSTAND DURCH DIE WELT ...
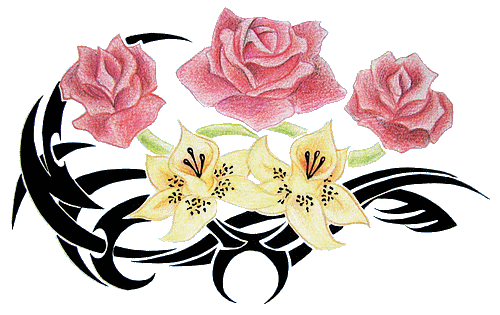
Einst hatten die Männer von Cogolo gar etwas Arges gemacht und es kanzelte sie dafür der Herr Pfarrer am nächsten Sonntag nicht wenig herab. »Ja«, schrie er, »Judicium (Giudizio) muss man haben, Verstand, Beurteilungskraft, um durch die Welt zu kommen, das aber habt ihr nicht, das haben schon eure Väter nicht mehr gehabt.«
Da dachten die Männer von Cogolo, wenn schon unsere Väter das Ding nicht mehr gehabt haben, so ist es klar, dass es unsere Großväter werden verloren haben, und somit müssen wir uns ein neues verschaffen. Sie gingen zum Pfarrer und fragten ihn, ob er nicht vielleicht einen Überfluss an Judicium habe und ihnen davon etwas ablassen wolle.
»Kinder!« sagte der Pfarrer, »ich habe gerade so viel davon, als ich selbst für das Haus brauche und kann euch daher nichts davon geben, aber geht nach Padua zum Bischof, das ist ein gar gelehrter Herr, der hat so viel davon, dass er euch etwas abtreten könnte.« Gut, dachten sie, dass wir wenigstens wissen, wo das Ding zu haben ist, und ordneten zwei aus ihrer Mitte, die sie für die gescheitesten hielten, als Gesandte nach Padua ab.
Als der Bischof ihr Anliegen vernommen hatte, merkte er freilich gleich, dass ihnen das Gesuchte abging; er suchte sie daher wohlmeinend aufzuklären und ihnen begreiflich zu machen, dass man so eine köstliche Gottesgabe nicht nach Belieben verkaufen oder verschenken könne, wie einen Scheffel (stajo) Polentamehl, aber sein Bemühen war fruchtlos, denn sie drängten und baten viel mehr, um so mehr auf Erfüllung ihrer Bitte, jemehr sie des Bischofs Gründe bloß für Ausflüchte hielten.
Da ward der Bischof müde, leeres Stroh zu dreschen, und hieß sie warten, er werde ihnen durch einen Domherrn das verlangte Judicium gleich übergeben lassen, schloss eine Eidechse in eine Schachtel ein und ließ sie den Deputierten mit dem Auftrage aushändigen, ja fein Obacht zu haben, dass es ihnen nicht davon laufe.
Voll Freude machten sich diese auf den Heimweg; aber nach kurzer Zeit reizte sie die Neugierde doch gar zu sehr. Sie gingen daher in einen Heustadel, der unweit der Strasse lag, denn hier, meinten sie, könne ihnen das Judicium nicht davon laufen, und machten die Schachtel auf; aber kaum war die Schachtel offen, so war auch schon die Eidechse heraus und lief an der Mauer hinauf, die Deputierten über das Heu ihr nach; da lief sie wieder herunter, die Deputierten purzelten nach, hier ist sie, dort ist sie, kurz die zwei machten einen solchen Lärm, dass endlich der Herr des Stadels mit seinen Knechten herbei lief und als er die Unordnung, die Hetze in seinem Stadel sah, in großen Zorn geriet.
»Was macht ihr Hundekerle (fioi de cani) hier für eine Unordnung in meiner Scheuer? Wer hat euch das erlaubt?«
»Herr!« erwiderten diese, »uns ist das Judicium davon gelaufen und wir suchen es wieder zu erwischen.«
Da glaubte der Hausherr, sie wollten ihn noch über dies zum Besten haben, griff nach einem Stück Holz und mit den Worten: »Wartet, ihr Halunken, ich werde euch ein anderes dafür geben«, begann er sie unbarmherzig durchzuprügeln.
Hinausgeworfen und wie gerädert von den Schlägen zogen die Deputierten ganz traurig nach Cogolo und berichteten dort, dass und auf welche Art sie um das Judicium gekommen seien, bevor sie noch die Grenze Paduas verlassen hatten.
In Cogolo aber, wo seither schon die Urenkel dieser Deputierten leben, hat die Gemeinde immer noch kein Judicium.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien

DIE BEIDEN GEVATTERN ...

Einst waren zwei Gevattersleute, der eine ein reicher Bauer im Gebirge, der andere Obsthändler in der Stadt, der nebenbei allerlei Tiere und anderes verkaufte.
Da kommt einmal der aus dem Gebirge in die Stadt, und wie er bei dem Gewölbe seines Gevatters vorbei geht, sieht er ein paar Melonen, die er nicht kannte. »Was sind das, Gevatter?« fragte er. »Das sind Eselseier«, antwortete der andere. »Was muss man mit ihnen machen, damit sie ausfallen?« »Tragt sie vierundzwanzig Stunden bei euch an der Brust oder im Beinkleide, und sie fallen sicher aus.« Einen Esel hätte ich schon längst gerne, dachte er, kaufte eine Melone um teures Geld dem Gevatter ab, knöpfte sie sich in die Hosen und ging seiner Heimat zu.
Schon hoch auf dem Berge und nahe seinem Hause treibt ihn ein unaufschiebbares Geschäft, die Hosen aufzuknöpfen, ohne dass er an die Melone denkt. Da fällt die Melone heraus und rollt über den Berg hinab in ein Gebüsch, aus dem erschrocken ein Hase aufsprang und davon lief. »Sieh da,« rief der Bauer, der den Hasen für ein junges Eselchen ansah, »der Gevatter hatte doch Recht, aber das Ei ist viel früher ausgefallen, und so bin ich um den Esel gekommen.«
Nach einiger Zeit geht unser Bauer wieder in die Stadt und zum Gevatter, der aber hatte einen Wolf zu verkaufen. »Was ist das für ein Vieh?« fragt er. »Das ist ein Tier für die Schafe zu bespringen, statt eines Widders.« »Was kostet es? ich könnte es gerade jetzt brauchen, denn ich habe fünfzig Schafe und kann keinen Sprungwidder dazu auftreiben.« »Das Tier kostet hundert Dukaten, aber bloß euch gebe ich es um diesen Preis.« Da zahlte der Bauer in barem Gelde die Dukaten auf und führte den Wolf mit sich.
Als er nach Hause kam, schrie ihm sein Weib schon von weitem die Frage entgegen, ob er einen Widder aufgetrieben habe. »Und was für einen!« antwortete er und sperrte den Wolf zu den Schafen. Kaum waren sie ins Zimmer getreten, hörten sie schon ein Schaf schreien: Bäh! »Aha«, sagte der Bauer, »das erste hat er schon.« Gleich darauf hörte er ein zweites und dann ein drittes schreien. »Der Kerl ist fleißig«, sagte er, »so kann es nicht fehlen, der deckt in einer Nacht fast alle Schafe«, und ganz zufrieden mit seinem Einkauf legte er sich zu Bette.
Zeitlich am Morgen will er in den Stall gehen, um nachzusehen, kann aber nicht bei der Türe hinein, denn es liegen inwendig ein paar tote Schafe davor. Das arme Vieh wird müde sein, dachte er, und hat sich jetzt gerade zur Türe gelegt; ich will beim Fenster hineinsehen. Als er aber das Stallfenster aufmachte, da sprang der Wolf heraus, stieß ihn über den Haufen und entfloh. Als er dann erst sah, auf welche Art der Wolf seine Schafe gedeckt hatte, geriet er in einen unbändigen Zorn gegen seinen Gevatter.
Und abermals, als er in der Stadt zu tun hatte, ging er zum Gevatter; der aber hatte jetzt einen Hasen zu verkaufen. »Was ist denn das wieder für ein neues Vieh?« fragte der Bauer. »Oh!« sagte der Händler, »das ist gar ein gutes liebes Tierchen. Er tut, was man sagt, und man kann es überall hin schicken; um Aufträge zu besorgen, gibt es kein besseres.« – »Wie heißt es denn?« »Portalettere (Briefträger) heißt der liebe Narr.« »Bravo!« sagt der Bauer, »ich habe schon längst einen Brief an meines Vaters Bruder zu schicken, das ist mir lieb, ich will es probieren.« »Kauft es euch also, gebt ihm eine Adresse, und der Brief wird schnell und sicher besorgt werden.«
Da kaufte der einfältige Bauer den Hasen teurer als ein Kalb und trug ihn nach Hause. Als er mit dem Briefschreiben fertig war, band er den Brief dem Hasen an den Hals und zeigte ihm den Weg. Da sagte er: »Mache den schnurgeraden Weg bis zum Seitenwege links, in diesen biege ein, und da wirst du zu einem großen Orte kommen, in dessen Mitte ein Palast steht, der dem Grafen Rodighieri gehört; in diesem wohnt mein Onkel, der bei dem Grafen Wirthschafter (fattore) ist. Gieb ihm den Brief und bringe mir die Antwort zurück.«
Als der Hase mit großen Augen und zurück gelegten Löffeln anscheinend sehr aufmerksam diese Worte angehört hatte, ließ ihn der Bauer los. Zufälligerweise lief der Hase gleich rechts in das Feld. »Nicht rechts, links, links hab' ich dir gesagt, musst du laufen«, schrie ihm der Bauer nach; als aber der Hase sich nicht daran kehrte, sprach er zu sich: »Dummer Tölpel, der ich bin! will ich einem Briefträger den Weg zeigen, den er besser wissen muss als ich, denn das ist ja sein Geschäft.« Lange erwartete er die Antwort auf seinen Brief, die ist aber zur Stunde noch nicht eingetroffen.
Erbost über den Gevatter, der ihn schon wieder betrogen hatte, beschloss er, ihn tüchtig abzuprügeln. Dieser mochte eine Ahnung davon haben, dass seine Späße dazu führen würden, und sagte seinem Weibe, wenn der Gevatter aus dem Gebirge komme, möge sie ihm nur sagen, er sei im Garten und spreche jetzt mit unserem Herrgott.
Als nun der Bauer das nächste Mal kam und nach ihrem Manne fragte, so richtete sie ihm den Auftrag wörtlich aus. »Was?« rief der, »mit unserem Herrgott sprechen! Das war schon längst mein Wunsch, das möchte ich auch.« Da schickte sie ihn in den Garten zu ihrem Manne, der eben bei einem Bienenstock stand, zu dem eine Leiter angelehnt war.
Als er diesem seinen Wunsch mitgeteilt, antwortete ihm der Händler: »Wollt ihr unseren Herrgott sprechen, so müsst ihr mit dem Kopfe in diese Röhre schlüpfen, achtet einige kleine Stiche, die ihr dabei bekommen werdet, nicht, dann werdet ihr ein Gesumse hören, das ist das Geräusch, das unser Herrgott macht, wenn er die Türe des Paradieses öffnet, und dann wartet, bis er euch fragt.«
Das tat unser Bauer getreulich; die Stiche wurden immer ärger, aber er hörte das Geräusch der Paradiesestür und wartete auf die Frage von unserem Herrgott, bis ihm der Kopf so anschwoll, dass er ihn nicht mehr aus der Röhre brachte. Da sprang ihm sein liebreicher Gevatter bei und zog ihm die Leiter unter den Füssen weg. Die Schwere seines wohlgenährten Körpers beschleunigte sein Herauskommen aus dem Bienenstock und er fiel ganz zerschunden zur Erde.
Da verband er sich mit nassen Tüchern und ließ sich nach Hause führen, um sich zu kurieren, der Händler aber sagte zu seinem Weibe: »Du, jetzt aber gib Acht, damit mich der Gevatter nicht mehr zu sehen bekommt, sonst bringt er mich sicher um.«
Diesen Vorsatz hatte der Bauer auch ernstlich gefasst. Als er nach mehreren Wochen wieder ein menschliches Aussehen erlangt hatte, steckte er eine große Pistole zu sich und ging in die Stadt schnurstracks zu seinem Gevatter. Als ihn die Gevatterin sah, fing sie an zu weinen und zu heulen. »Ach«, sagte sie, »ihr kommt gerade zur rechten Zeit, mein armer Mann ist eben gestorben.« »So«, sagte der Bauer, »so hat ihn also der Teufel geholt und mir eine Mühe erspart? Lasst doch, dass ich ihm die letzte Ehre erweise.«
Als sie ihn hierauf ins Nebenzimmer führte, sah er den Händler, der schnell sich in ein Leintuch gehüllt hatte, wie tot auf dem Bette ausgestreckt liegen. Da ergriff der Bauer einen Sessel, stieg darauf und bereitete sich dazu, ihm die beabsichtigte letzte Ehre zu erweisen; der Händler aber, der aus diesen Vorbereitungen auf die Beschaffenheit dieser letzten Ehre ganz richtig schloss, ließ es nicht dazu kommen, sondern biss ihn schnell und so heftig in den entblößten Teil, dass er schreiend davon lief.
»Nicht genug«, erzählte der Bauer zu Hause seinem Weibe, »dass er mich während seines Lebens stets betrogen hat, nein, schon tot hat er mich noch in den Hintern gebissen, der infame Kerl.«
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien

DER STANDHAFTE BÜSSER ...

Einst hauste auf einer Burg im Gebirge ein reicher Ritter (castellan), der, sehr schlimm und grausam wie er war, viel Übles verübte. So zum Beispiel gab er seinen Arbeitern statt des Lohnes Schläge, der Mägde hat er mehrere gemordet, teils weil sie sich weigerten, seinen Lüsten zu fröhnen, teils im Jähzorn. Als er älter geworden, bereute er sein früheres Leben und ging beichten.
Da gab ihm der Beichtiger eine dreijährige Busse auf; die weigerte er sich anzunehmen; »denn«, sagte er, »ich kann ein Jahr vor ihrem Ende sterben, was nützt mir dann die Busse, die ich durch zwei Jahre getan habe.« Da beschränkte sie der Beichtiger auf zwei Jahre, und als er sich wieder weigerte, auf ein Jahr und sogar auf einen Monat. »Noch immer ist sie zu lange«, sagte der Ritter, »aber wenn ihr zufrieden seid, so will ich einen Abend an einem Arbeitstage (giorno feriale) und einen Feiertag Busse tun.« »Nun gut, versucht es«, sagte der Beichtiger.
Hierauf ging er nach Hause, nahm Abschied von seiner Frau und sagte: »Erwartet mich heute Abends nicht, denn ich werde erst Morgen nach Hause kommen.« Hierauf bestieg er ein Pferd und ritt zur Kirche, die sehr weit von seiner Burg war.
Noch hatte er wenig Weg zurück gelegt, als ihm seine Tochter nach gelaufen kam. »Vater!« rief sie, »kommt schnell nach Hause, Räuber haben unsere Burg überfallen.« »Der Diener und Söldner habt ihr genug«, antwortete er, »um euch der Räuber zu erwehren.« Und er setzte seinen Weg ruhig weiter fort.
Da kommt ihm sein Leibknappe nachgelaufen. »Herr!« schreit dieser, »kommt schnell zurück, die Burg steht in Flammen.« »Ruft die benachbarten Bauern zu Hilfe und bezahlt sie, damit sie euch helfen, das Feuer zu löschen.« Nach kurzer Zeit kommt ihm seine Frau nach. »Mann!« ruft sie, »komme mir zu Hilfe, man hat mich verraten, man will mir Gewalt antun.« »Lasse dich von meinen Reisigen verteidigen«, entgegnet der Ritter, seinen Weg fortsetzend, »ich habe jetzt dazu nicht die Zeit.«
Da kam er endlich zur Kirche, trat ein und begann seine Busse. Noch hatte er wenig gebetet, so kam der Messner und sagte: »Herr! geht hinaus, denn ich muss die Kirche schließen.« »Ich bleibe hier«, sagte der Ritter, »schließt nur die Kirche, so werde ich um so ungestörter beten können.« Da kehrt der Messner zurück und sagt: »Geht hinaus, es kommen Leute zu beichten und die wollen nicht gestört sein.« »Sie mögen beichten, ich werde die Ohren zuhalten«, entgegnete der Ritter.
Da kommt ein Priester zur Messe gekleidet und sagt: »Geht hinaus, denn ich werde jetzt eine Messe lesen und ihr seid vielleicht nicht gelaunt oder würdig, sie anzuhören.« »Leset sie nur, ich bleibe und werde sie gerne anhören«, antwortete der Ritter. Da kamen um Mitternacht zwölf Wächter und befahlen ihm, mit ihnen zur Obrigkeit zu gehen. »Will mich die Obrigkeit«, entgegnete der Ritter, »so werde ich Morgen um zehn Uhr bei ihr sein, aber jetzt gehe ich nicht.« Um zwei Uhr kommt eine Schaar Söldner in die Kirche, umringt ihn und heißt ihn mit gehen, er aber sagt: »Wollt ihr mich außerhalb der Kirche, so tragt oder schleppt mich hinaus, aber gutwillig gehe ich nicht.«
Da erscheint die Zeit des Vaterunser und mit ihr ein wilder Haufen Volkes und schreit: »Jagen wir ihn hinaus zur Kirche, weil er nicht mit Gutem geht.« »Zerreißen«, sagt der Ritter, »könnt ihr mich, aber nicht gutwillig hinaus bringen.« Da fängt es in der Kirche zu brennen an und er befindet sich in einem Flammenmeere. Alles stürzt entsetzt hinaus, er aber sagt: »Geschehe, was da wolle, ich gehe nicht.«
Da schlägt endlich die vorgeschriebene Stunde für ihn, er bindet sein Pferd los und reitet nach Hause. Hier fragt er zuerst seine Tochter, warum sie ihm nach gelaufen, statt mit seinen Reisigen die Räuber verjagen zu helfen; diese aber antwortet: »Ich weiß nichts von Räubern.« Sie war gar nicht außer Hause. Da befragt er seine Frau und den Knappen, aber beide versichern, das Haus gar nicht verlassen zu haben.
»Ha«, sagte der Ritter, »jetzt begreife ich, dass dieses Alles des Teufels Werke waren, um meine Busse zu stören, aber ich begreife auch, dass der Beichtvater Recht hatte, mir eine lange Busse aufzugeben, denn ich bin ein gar großer Sünder. Wohlan denn, nicht zwei Jahre, nicht drei Jahre, sondern bis ans Ende meines Lebens will ich büßen.«
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
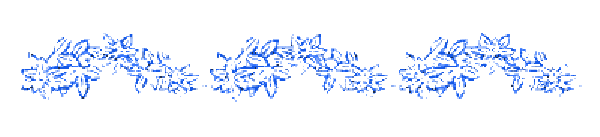
DAS RÄTSEL ...

Vor alten Zeiten existierte eine mächtige Königin, die zugleich eine Zauberin, sehr schön, aber auch mitleidlos und aller Heirat abgeneigt war. Um dem Wunsche ihrer Untertanen, einen König an ihrer Seite auf dem Throne zu sehen, wenigstens scheinbar nach zu geben, sich auch zugleich der Zudringlichkeiten und Belästigungen zahlreicher Freier zu entledigen, erklärte sie bloß denjenigen heiraten zu wollen, der im Stande wäre, ihr ein Rätsel aufzugeben, das sie nicht lösen könne; löse sie es aber, so müsse sein Haupt fallen.
Natürlich, dass sich da die Zahl der Bewerber sehr verminderte, und als die Ersten und Kühnsten den Versuch wirklich mit dem Kopfe bezahlten, bald ganz ein Ende nahm. Siehe, da fällt es plötzlich einem jungen Bauer aus dem Gebirge ein, der Königin ein Rätsel aufgeben zu wollen, um König zu werden. Er sagte diesen seinen Gedanken seiner alten Mutter, die natürlich darüber nicht wenig erschrak. »Was fällt dir dummen Jungen ein«, sagte sie, »einer so schlauen Frau ein Rätsel aufgeben zu wollen, wo doch schon viel gescheitere Leute das Leben dieser wegen eingebüßt haben?« »Meinetwegen«, antwortete er, »das Leben kann es mich kosten, aber dann will ich nicht allein sterben; also, liebe Mutter, backt mir einen vergifteten Laib Brot.«Da die Mutter sah, dass sie ihm diese Idee nicht ausreden konnte, so buk sie ihm den Laib und segnete ihn, er aber zog sein Maultier aus dem Stalle, band ihm statt des Sattels einen mit Stroh gefüllten Sack auf den Rücken und machte sich auf die Reise in die Stadt.
Lange war er schon geritten, da legte er sich auf einer Anhöhe im Schatten eines Baumes nieder, ließ das Tier neben sich grasen und dachte über das Rätsel nach, das er der Königin aufgeben wolle. Hitze und Müdigkeit überwältigten ihn endlich, er schlief ein und hätte wer weiß wie lange noch geschlafen, wäre er nicht durch ein starkes Stöhnen und das Geschrei seines Maultiers geweckt worden. Im Schlafe war ihm das Brot aus der Tasche gefallen, das Tier hatte, es gefressen und war so eben in Folge des Giftes dem Verenden nahe.
Da warf er denn das Maultier, um seine Leiden zu verkürzen, die Anhöhe hinab und sah, dass drei Raubvögel auf das selbe zuflogen, davon fraßen und also bald tot umfielen. Da nahm er denn die drei Vögel zu sich und ging weiter, bis er sieben Schnitter auf einer Wiese fand, die sich gerade ihr Mittagsmahl bereiteten. »Wollt ihr nicht einen Braten«, rief er ihnen zu und warf ihnen die Vögel hin, während er sich ins Gras setzte. »Herzlich gerne«, antworteten die Schnitter, rupften und brieten die Vögel, aber kaum, dass sie davon genossen hatten, erlagen auch sie der Stärke des Giftes. »Ha!« sagte er, »jetzt habe ich das Rätsel«, und ging, so schnell er konnte, zur Stadt.
Nachdem er sich am anderen Morgen gewaschen hatte, ließ er sich der Königin vorstellen. Sie empfing ihn mit verächtlichem Lächeln und befahl, er möge ihr denn sein Rätsel hören lassen. »Wohlan«, sagte er, »der Laib (pinza) hat die Perle (perla) umgebracht, die Perle hat drei umgebracht, drei haben sieben umgebracht, erklärt mir das.«
Vergebens zerbrach sich die Königin den Kopf, aber sie fand die Lösung nicht. »Wohlan«, sagte sie, »geht in den Gasthof gegenüber, lasst euch ein Zimmer geben, esst und trinkt, was ihr wollt, zahlen werde ich Alles, und morgen kommt wieder, dann werde ich euch die Lösung sagen.«
Diesem Befehle gehorchte er auch gerne, aß und trank tüchtig und legte sich dann zu Bette, wo er als bald und fest einschlief; die Königin aber legte Mannskleider an, ließ sich vom Wirte das nämliche Zimmer öffnen und legte sich zu ihm ins Bett. Als der junge Bauer morgens erwachte und jemand anderen in seinem Bette sah, begann er darüber nicht wenig zu schimpfen, denn das Zimmer und Bett gehöre ihm allein. »Haltet euch darüber nicht auf«, sagte sein Bettgenosse, »es war gestern kein anderer Platz mehr im Wirtshause und ich zahle auch die Hälfte für Bett und Zimmer recht gerne, aber sagt mir doch, wie seid ihr in so ein vornehmes Gasthaus geraten?«
»Nun«, sagte der Bauer, »ich habe der Königin gestern ein Rätsel aufgegeben, das sie diese Nacht gewiss weniger schlafen ließ als mich, und jetzt gehe ich zu ihr.« »Ach sagt mir es doch«, bat die verkleidete Königin, »ich bleibe ohne dem noch im Bette, von mir habt ihr keine Gefahr zu befürchten, dass ich euch verrate.« Da erzählte ihr denn der Bauer den ganzen Hergang, »aber jetzt«, sagte er, »endlich ist es an der Zeit, dass ich gehe«, stand auf und kleidete sich an; da er aber sah, dass das Hemd des Fremden ganz neu und sehr fein war, so legte er dieses statt seines groben und zerrissenen an.
Als er im Palaste erschien, musste er einige Zeit warten, bis die Königin erschien, aber endlich kam sie mit großem Gefolge und sagte: »Nun, die Lösung habe ich gefunden. Euer Brotlaib war vergiftet, euer Maultier hieß Perle, fraß ihn und krepierte, dieses fraßen drei Vögel an und starben gleichfalls, diese drei Vögel aßen sieben Schnitter, die gleichfalls an ihnen starben. Das ist die Lösung, nicht wahr? Ihr aber sollt jetzt erhalten, was ihr verdient habt, den Tod.«
Dem Bauer war anfangs bei den Worten Hören und Sehen vergangen, er merkte, dass man ihm die Lösung abgelistet hatte, aber bald fasste er sich wieder: »Halt«, rief er, »so tun wir nicht, diese Lösung habt nicht ihr gefunden, sondern mir abgeschwatzt, ich aber werde euch jetzt gleich ein anderes Rätsel aufgeben, das ihr aber auch gleich erraten sollt, nämlich: Ich war auf der Jagd, habe geschossen und das Futteral erwischt, was ist dieses?«
Da dachte die Königin lange nach und fand die Lösung nicht, er aber zog ihr Hemd hervor und fragte: Kennt ihr dieses Futteral? Natürlich war die Königin in Gegenwart der Minister, Hofkavaliere und Hofdamen dadurch derart in Verlegenheit gesetzt, dass ihr kein anderer Ausweg übrig blieb, als ihn zu heiraten.
Als die Hochzeit vorüber war, schlug die Königin vor, eine Spazierfahrt zu machen. »Ja wohl«, meinte der Bräutigam, »aber ich sehe hier weder Wagen noch Pferde.« »Lasst es gut sein«, sagte sie, »die Fahrgelegenheit werde ich besorgen«, und augenblicklich erschien auf ihr Geheiß eine Barke. »Was sollen wir mit der Barke machen«, meinte er, »wenn kein Wasser da ist?« »Habe nur Geduld«, erwiderte sie, und also gleich erschien eine Wolke, die, nachdem die Brautleute in die Barke gestiegen waren, diese auf den Rücken nahm und pfeilschnell davon flog.
Da unterhielten sie sich denn prächtig, bis die Königin einschlummerte, er aber benutzte schnell die Gelegenheit, ihre Taschen zu untersuchen, in welchen er ein kleines Büchlein und ein kleines Stöckchen fand, das er schnell zu sich steckte. Noch bevor die Königin erwachte, ließ er sich mit Allem zur Erde nieder und wünschte sich einen Wagen mit zwei Pferden bespannt herbei, und als sie endlich erwachte und nach ihrer Barke rief, sagte er: »Steige nur allein in die Barke und fahre mit ihr durch die Luft nach Sibirien, wo du immer bleiben sollst, ich aber fahre mit den Pferden zu Lande nach Hause, ich brauche dich und deine Barke nicht.«
Da flehte sie um Barmherzigkeit. »Die Barmherzigkeit sollst du finden«, rief er ihr im Wegfahren zu, »die du mit meinen Vorgängern gehabt hast, welche du köpfen ließest, und jetzt fort nach Sibirien mit dir.«
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien

DIE GRÖSSERE LÜGE ...
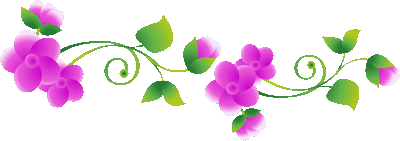
Einst wetteten zwei Bauern, wer von ihnen beiden eine grössere Lüge zu sagen im Stande sei.
»Ich hatte,« begann der Erste, »einen Bienenstock, den ich alle Abend zählte. Einmal ging mir eine Biene ab und also gleich schickte ich so viele Leute, als ich aufzutreiben im Stande war, die Biene zu suchen. Sie fanden nach zwei Tagen von ihr nur den vierten Teil, den Rest hatten die Hunde aufgefressen, das Viertel trugen ihrer fünfzehn mit Stricken und Latten nach Hause. Als ich dieses Viertel auspresste, erhielt ich fünfzehn Fässer Honig. Ich füllte ihn in einen Bottich, als unglücklicherweise ein Spatz auf den Rand des Bottichs flog und ihn umwarf.«
»Verflucht!« sagte der Zweite, »fünfzehn Fässer Honig vom Viertel einer Biene, das ist viel, das scheint kaum glaublich, aber mir ist auch so etwas Sonderbares begegnet. Ich ging eines Morgens mit meinem Netze fischen; da spüre ich, dass sich etwas gefangen hat; ich ziehe mein Netz in die Höhe, und was glaubt ihr, was darin war? Ihr erratet es nie; ein lebendiger Esel, voll mit irdenen Schüsseln beladen. Wie ich so meinen Esel nach Hause treibe, komme ich zu einem Bauernhof, der ganz voll von Saubohnen war. Als mich der Bauer aufforderte, sie ihm mit meinem Esel aus zu treten, war ich gleich bereit dazu, band dem Esel an jeden Huf eine irdene Schüssel und ließ ihn fleißig treten. Bis Abends hatte er so viel getreten, dass vierundzwanzig Säcke Bohnen auf meinen Anteil kamen.
Da nehme ich denn alle vierundzwanzig Säcke Bohnen und säe sie alle auf mein halbes campo (Acker), und warte, bis sie aufgehen. Wie erstaunte ich, als ich merkte, dass alle diese Bohnen als einziges Korn aufgingen, das so groß und hoch wurde, dass es die Türe des Himmels aufstieß. Ich, der ich einen Vetter im Himmel habe, der mir damals noch vierzehn Soldi schuldig war, packe schnell den Bohnenstengel, steige zu ihm hinauf, rufe meinen Vetter zur Türe, und nach dem er mir das Geld gegeben hatte, wollte ich wieder hinab, aber es kam ganz anders.
Während ich mit meinem Vetter sprach und er mir das Geld vorzählte, hatten die Ameisen den Bohnenstengel abgefressen, und der war umgefallen, ich konnte daher nicht hinab. »Vetter!« sagte ich, »was ist da zu tun? ich werde doch nicht gar wider meinen Willen im Himmel bleiben müssen?« »Nein, nein«, sagte er, »das dürftest du nicht einmal, ich kann dir nur einen Rat geben; schau, dass du bald weg kommst, bevor sie es merken und dich hinaus werfen.«
Da erwischte ich in der Verzweiflung einen Knäuel Hanf und begann mich hinunter zu lassen, und als dieses nicht auf die Erde reichte, wagte ich einen Sprung und fiel Schuh tief in die Erde hinein. Was war da zu tun? Nichts anderes, als nach Hause laufen, eine Schaufel nehmen und mich selbst aus zu graben, und so kam es, dass ich jetzt bei euch stehe und euch meine Erlebnisse der Wahrheit getreu erzähle.«
»Wartet ein wenig«, sagte der Erste, »ich werde jetzt einen Schatzmeister holen, der soll entscheiden, welche von beiden die grösste Lüge ist.« Fortgegangen ist er wohl, aber nicht wieder gekommen, und somit gewann der Zweite wenigstens die Ehre, das Schlachtfeld behauptet zu haben.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien