MÄRCHEN VON HANS CHRISTIAN ANDERSEN
VERZEICHNIS II
„Die Dryade“
„Der Garten des Paradieses“
„Das Heinzelmännchen bei dem Krämer“
„Das Schwanennest“
„Nach Jahrtausenden“
„Die kleine Seejungfer“
„Pieter, Peter und Per“
„Es ist ganz gewiss“
„Der Reisekamerad“
„Hühner-Gretes Familie“
„Der Dornenpfad der Ehre“
„Wie´s der Alte macht, ist immer richtig“
„Das ABC Buch“
„Der Schatten“
„Des Hauswarts Sohn“
„Der Krüppel“
„Der Vogel des Volkslieds“
„Die Wochentage“
„Am Spittelfenster“
„Die Muse des neuen Jahrhunderts“
„Turmwächter Ole“
„Odenwälder Lügenmärchen“
„Zwölf mit der Post“
„Das Kind im Grabe“
„Der letzte Tag“
"Die Hirtin und der Schornsteinfeger"
"Die Nachbarfamilien"
"Ein Herzeleid"
Die Schnellläufer"
Am äußerstem Meere"
„Der Halskragen“
„Der böse Fürst“
„Fünf aus einer Hülse“
„Unter dem Weidenbaume“
„Das Judenmädchen“
„Die Geschichte von einer Mutter“
„Ein Stück Perlenschnur“
„Etwas“
„Ein Blatt vom Himmel“
„Tölpel-Hans“
„Ein Bild vom Kastellwall“
„Suppe von einem Wurstspeiler“
„Eine gute Laune“
„Der Flaschenhals“
„Des Junggesellen Nachtmütze“
„Alles am rechten Platz“
„Sie taugte nichts“
„Ib und die kleine Christine“
„Die wilden Schwäne“
„Holger Danske“
"Vogel Phönix"
VOGEL PHÖNIX
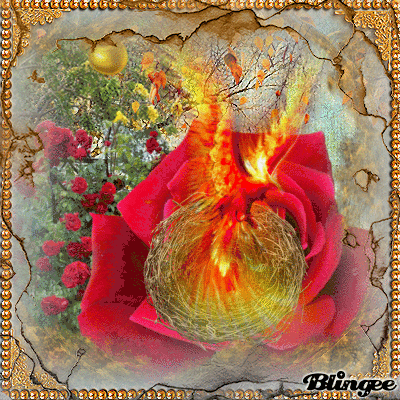
Im Garten des Paradieses, unter dem Baume der Erkenntnis, stand ein Rosenstrauch. Hier, in der ersten Rose, wurde ein Vogel geboren, dessen Flug war wie der des Lichts, herrlich war seine Farbe und herrlich sein Gesang.
Als aber Eva die Frucht der Erkenntnis brach und sie und Adam aus dem Garten des Paradieses gejagt wurden, fiel vom flammenden Schwerte des strafenden Engels ein Funken in das Nest des Vogels und zündete es an. Der Vogel starb in den Flammen, aber aus dem glühenden Ei flog ein neuer, der einzige, der stets einzige Vogel Phönix. Die Sage meldet, daß er in Arabien nistet und sich selbst jedes hundertste Jahr in seinem Neste verbrennt, und ein neuer Phönix, wieder der einzige in der Welt, fliegt aus dem glühenden Ei empor.
Der Vogel umflattert uns, schnell wie das Licht, herrlich von Farbe und herrlich klingt sein wundersamer Sang. Wenn die Mutter an der Wiege ihres Kindes sitzt, schwebt er über dem Kopfkissen und weht mit den Flügeln einen Glorienschein um des Kindes Haupt. Er fliegt durch die Stuben der Genügsamkeit, und Sonnenglanz breitet sich darüber und die ärmliche Kommode duftet nach Veilchen.
Doch der Vogel Phönix ist nicht allein der Vogel Arabiens. Er flattert im Nordlichtschein über die Eisfelder Lapplands, er hüpft zwischen den gelben Blumen in Grönlands kurzem Sommer. Über Faluns Kupferfelsen ist er zu sehen und in Englands Kohlengruben. Er huscht wie eine gepuderte Motte hin über das Gesangbuch in des frommen Arbeiters Händen. Er segelt auf dem Lotosblatt mit den heiligen Fluten des Ganges hinab und des Hindumädchens Augen leuchten bei seinem Anblick.
Vogel Phönix, kennst Du ihn nicht? Den Vogel des Paradieses, des Gesanges heiligen Schwan. Auf dem Tespiskarren saß er wie ein geschwätziger Rabe und schlug mit den schwarzen, hefetriefenden Flügeln. Über Islands Sängerharfe glitt des Schwanes roter, klingender Schnabel; auf Shakespeares Schultern saß er wie Odins Rabe und flüsterte ihm ins Ohr: Unsterblichkeit. Beim Sängerfeste flog er durch der Wartburg Rittersaal.
Vogel Phönix Kennst Du ihn nicht? Er sang Dir die Marseillaise vor, und Du küßtest die Feder, die aus seiner Schwinge fiel. Im Paradiesesglanze kam er, und Du wandtest Dich vielleicht fort und dem Sperling zu, der mit Schaumgold auf den Flügeln dasaß.
O, Du Vogel des Paradieses, in jedem Jahrhundert erneut, in Flammen geboren, in Flammen gestorben, Dein Bild hängt in Gold gefaßt in den Sälen der Reichen und selbst fliegst Du verirrt und einsam – eine Sage nur: Vogel Phönix in Arabien!
Im Garten des Paradieses, da Du geboren wurdest unter dem Baume der Erkenntnis in der ersten Rose, küßte Dich Gott und gab Dir Deinen rechten Namen – "Poesie."
HOLGER DANSKE ...

Es gibt in Dänemark ein altes Schloß, das Kronborg heißt. Das hält am Öresund Wacht, wo die großen Schiffe Tag für Tag zu hunderten vorbeisegeln, englische, russische und preußische; die grüßen mit Kanonen zu dem alten Schloß herüber: "Bum." und das Schloß antwortet mit Kanonen: "Bum." Denn so sagen die Kanonen "Guten Tag" und "Schönen Dank." Im Winter segeln keine Schiffe vorbei, dann liegt bis zum schwedischen Land hinüber alles mit Eis bedeckt. Die Wasserstraße ist gleichsam eine Landstraße geworden; da weht die dänische Flagge und die schwedische Flagge, und das dänische und das schwedische Volk sagt einander: "Guten Tag." und "Schönen Dank" aber nicht mit Kanonen, nein, mit freundlichem Handschlag, und der eine holt Weizenbrot und Brezeln bei dem andern; denn fremde Kost mundet am besten. Aber das Prächtigste ist doch das alte Kronborg, und dort unten, in dem tiefen finstern Keller, wohin niemand kommt, sitzt Holger Danske. Er ist in Eisen und Stahl gekleidet und stützt sein Haupt auf die starken Arme. Sein langer Bart hängt über den Marmortisch hinaus und ist darin festgewachsen. Er schläft und träumt; aber im Traume sieht er alles, was oben in Dänemark geschieht. Jeden Weihnachtsabend kommt ein Engel Gottes und sagt ihm, daß es richtig sei, was er geträumt habe, und daß er ruhig weiterschlafen könne, denn noch befinde sich Dänemark in keiner wirklichen Gefahr. Gerät es aber in Gefahr, dann wird der alte Holger Danske sich erheben, daß der Tisch berstet, wenn er den Bart herauszieht. Dann tritt er hervor und schlägt mit seinem Schwert an den Schild, daß es über alle Länder der Erde tönt.
Alles dies von Holger Danske erzählte ein alter Großvater, der bei seinem Enkel saß, und der kleine Knabe wußte, daß es wahr sei, was der Großvater erzählte. Während der Alte saß und erzählte, schnitzte er an einem großen Holzbilde, das Holger Danske vorstellen und den Bug eines Schiffes zieren sollte; denn der alte Großvater war Bildschnitzer. Das ist so ein Mann, der die Galionsfiguren ausschneidet, nach denen das Schiff benannt wird. Hier hatte er nun Holger Danske ausgeschnitten. Hoch und stolz stand er mit seinem langen Barte und hielt in der einen Hand das breite Schlachtschwert; mit der anderen stützte er sich auf das dänische Wappen.
Und der alte Großvater erzählte soviel von berühmten dänischen Männern und Frauen, daß es dem kleinen Enkelsohn zuletzt vorkam, als ob er nun eben so viel wisse, wie Holger Danske wissen könne, der ja nur davon träumte. Und als der Kleine in sein Bett kam, dachte er soviel daran, daß er schließlich sein Kinn an die Bettdecke drückte und glaubte, nun habe er einen langen Bart, der darin festgewachsen sei.
Der alte Großvater aber blieb bei seiner Arbeit sitzen und schnitzte den letzten Teil daran fertig; das war das dänische Wappen. Als das Ganze fertig da stand und er es betrachtete, dachte er an alles, was er gelesen und gehört hatte, und was er heute Abend dem kleinen Knaben erzählt hatte; und er nickte, trocknete seine Brille ab, setzte sie wieder auf und sagte: "Ja, zu meiner Zeit kehrt Holger Danske wohl nicht wieder. Aber der Knabe dort im Bette bekommt ihn vielleicht zu sehen und ist dabei, wenn es wirklich gilt." Und der alte Großvater nickte, und je länger er seinen Holger Danske ansah, desto deutlicher wurde ihm bewußt, daß er da ein gutes Bild gemacht habe. Es schien sich mit Farbe zu erfüllen, der Harnisch erglänzte wie Eisen und Stahl, die Herzen im dänischen Wappen wurden rot und röter, und die Löwen mit den goldenen Kronen sprangen.
"Es ist doch das prächtigste Wappen, das man in der Welt hat" sagte der Alte. "Die Löwen sind die Stärke und die Herzen die Milde und Liebe." Und er blickte auf den obersten Löwen und dachte an König Knud, der das mächtige Engeland an Dänemarks Königsstuhl fesselte; und er sah auf den zweiten Löwen und dachte an Waldemar, der Dänemark einigte und die wendischen Lande bezwang; er sah auf den dritten Löwen und dachte an Margarethe, die Dänemark, Schweden und Norwegen verband. Aber als er auf die roten Herzen sah, leuchteten sie noch stärker als zuvor; sie wurden zu roten Flammen, die sich fortbewegten, und seine Gedanken folgten ihnen.
Die erste Flamme führte ihn in ein enges, düsteres Gefängnis; dort saß eine Gefangene, ein herrliches Weib, Christians des Vierten Tochter: Eleonore Ulfeld. Und die Flamme setzte sich einer Rose gleich auf ihre Brust und blühte zugleich mit ihrem Herzen leuchtend empor, dem Herzen der edelsten und besten aller dänischen Frauen.
"Ja, das ist ein Herz in Dänemarks Wappen" sagte der alte Großvater.
Und seine Gedanken folgten der zweiten Flamme, die ihn aufs Meer hinaus führte, wo die Kanonen donnerten, und wo Schiffe in Rauch gehüllt lagen. Und die Flamme heftete sich wie ein Ordensband auf Hvitfeldts Brust, als er zur Rettung der Flotte sich und sein Schiff in die Luft sprengte.
Die dritte Flamme führte ihn zu Grönlands elenden Hütten, wo der Prediger Hans Egede mit Liebe in Wort und Werk stand. Die Flamme leuchtete gleich einem Stern auf seiner Brust, ein Herz zum dänischen Wappen.
Und des alten Großvaters Gedanken gingen der schwebenden Flamme voran, denn sie wußten, wo die Flamme hinwollte. In der ärmlichen Stube der Bauernfrau stand Friedrich der Sechste und schrieb seinen Namen mit Kreide an einen Balken. Die Flamme auf seiner Brust bebte in seinem Herzen. In dieser Bauernstube wurde sein Herz ein Herz in Dänemarks Wappen. Der alte Großvater trocknete seine Augen, denn er hatte König Friedrich mit dem silberweißen Haar und den treuen blauen Augen gekannt und für ihn gelebt, und er faltete seine Hände und blickte still vor sich hin. Da kam des alten Großvaters Schwiegertochter und sagte, es sei schon spät, nun solle er ruhen, denn der Abendtisch sei gedeckt.
"Aber schön ist es geworden, was Du da gemacht hast, Großvater!" sagte sie. "Holger Danske und unser ganzes altes Wappen! Mir ist gerade, als hätte ich sein Gesicht schon früher gesehen!"
"Nein, das hast Du wohl nicht gesehen!" sagte der alte Großvater, "aber ich habe es gesehen, und ich habe mich bemüht, es ins Holz zu schneiden, so wie es mir noch vor Augen schwebt. Es war damals, als die Engländer auf der Reede lagen, am zweiten April, und wo wir bewiesen haben, daß wir noch die alten Dänen sind! Auf dem Schiff 'Dänemark', wo ich in Steen Billes Bataillon stand, hatte ich einen Mann zur Seite: es war als ob die Kugeln ihm auswichen! Lustig sang er alte Weisen und schoß und kämpfte, als sei er mehr als ein Mensch. Ich sehe noch immer sein Antlitz vor mir; aber woher er kam, wohin er ging, weiß ich nicht, weiß niemand. Ich habe oft gedacht, es müsse wohl der alte Holger Danske selbst gewesen sein, der von Kronborg herabgeschwommen war, um uns zur Stunde der Gefahr beizustehen. Das war mein Gedanke, und dort steht sein Bild."
Das warf seinen großen Schatten über die Wand bis an die Decke, ja selbst ein Stück darüber hinweg; es sah aus, als sei es der wirkliche Holger Danske, der dahinter stehe, denn der Schatten bewegte sich; das konnte aber auch daran liegen, daß die Lichtflamme nicht ruhig brannte. Und die Schwiegertochter küßte den alten Großvater und führte ihn zu dem großen Lehnstuhl, der am Tische stand, und sie und ihr Mann, der ja des alten Großvaters Sohn und der Vater des kleinen Knaben war, der nun im Bette lag, setzten sich auch und aßen ihre Abendmahlzeit. Und der alte Großvater sprach von den dänischen Löwen und den dänischen Herzen, von der Stärke und der Milde, und bedeutsam erklärte er, daß es noch eine anders geartete Stärke gäbe, als die im Schwerte liegende, und er wies auf das Bücherbrett, wo alte Bücher lagen, alle Komödien von Holberg, die so oft schon gelesen worden waren; denn sie waren so ergötzlich, daß man meinen konnte, alle Leute darin von früheren Zeiten her zu kennen.
"Sieh, der hat auch drein zu schlagen verstanden!" sagte der alte Großvater. "Er hat das Rohe und Beschränkte im Volke gegeißelt, so lange er konnte!" Und der alte Großvater nickte zum Spiegel hinüber, wo der Kalender mit dem Runden Turm stand, und er sagte: "Tycho Brahe, das war auch einer, der das Schwert brauchte, nicht um in Fleisch und Bein zu hauen, sondern um den deutlicheren Weg zwischen den Sternen des Himmels zu bahnen. – Und dann er, dessen Vater meinem Handwerk zugehörte, des alten Bildschnitzers Sohn, er, den wir selbst gesehen haben mit seinem weißen Haar und den starken Schultern, er, dessen Name in allen Ländern der Welt genannt wird. Ja, er konnte hauen; ich kann nur schnitzen! Ja, Holger Danske kann auf vielen Wegen kommen, so daß in allen Ländern Dänemarks Lob widerhallt! Wollen wir ein Glas auf Bertel Thorwaldsens Wohl leeren."
Aber der kleine Knabe im Bette sah deutlich das alte Kronborg und den Öresund, den wirklichen Holger Danske, der tief unter der Erde saß, den Bart im Marmortische festgewachsen, und von allem träumte, was hier oben geschieht. Holger Danske träumte auch von der kleinen, ärmlichen Stube, wo der Bildschnitzer saß; er hörte alles, was gesprochen wurde, nickte im Traume und sagte:
"Ja, mein dänisches Volk, denkt nur an mich. Behaltet mich in Erinnerung. Ich komme in der Stunde der Not."
Und draußen vor Kronborg leuchtete der klare Tag, und der Wind trug die Töne des Waldhorns vom Nachbarlande herüber, die Schiffe segelten vorbei und grüßten: "Bum, Bum," und von Kronborg antwortete es: "Bum, Bum," Aber Holger Danske erwachte nicht, so stark sie auch schossen, denn es hieß ja nur: "Guten Tag." – "Schönen Dank." Da muß anders geschossen werden, wenn er erwachen soll. Aber er erwacht sicher einmal, denn seine Kraft schlummert nur.
DIE WILDEN SCHWÄNE ...
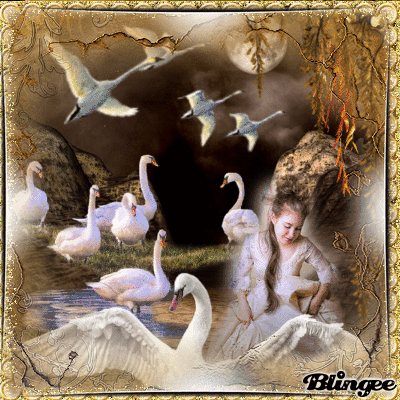
Weit von hier, dort, wo die Schwalben hinfliegen, wenn wir Winter haben, wohnte ein König, der elf Söhne und eine Tochter, Elisa, hatte. Die elf Brüder waren Prinzen und gingen mit dem Stern auf der Brust und dem Säbel an der Seite in die Schule. Sie schrieben mit Diamantgriffeln auf Goldtafeln und lernten eben so gut auswendig, als sie lasen; man konnte gleich hören, daß sie Prinzen waren. Die Schwester Elisa saß auf einem kleinen Schemel von Spiegelglas und hatte ein Bilderbuch, welches für das halbe Königreich erkauft war.
O, die Kinder hatten es so gut; aber so sollte es nicht immer bleiben!
Ihr Vater, welcher König über das ganze Land war, verheiratete sich mit einer bösen Königin, die den armen Kindern gar nicht gut war. Schon am ersten Tage konnten sie es merken. Auf dem ganzen Schlosse war große Pracht, und da spielten die Kinder: Es kommt Besuch; aber statt daß sie, wie sonst, allen Kuchen und alle gebratenen Äpfel erhielten, die nur zu haben waren, gab sie ihnen bloß Sand in einer Teetasse und sagte, sie könnten tun, als ob Dies etwas wäre.
Die Woche darauf brachte sie die kleine Schwester Elisa auf das Land zu einem Bauernpaare, und lange währte es nicht, da redete sie dem König so viel von den armen Prinzen vor, daß er sich gar nicht mehr um sie kümmerte.
"Fliegt hinaus in die Welt und ernährt Euch selbst!" sagte die böse Königin. "Fliegt, wie die großen Vögel ohne Stimme!" Aber sie konnte es doch nicht so schlimm machen, wie sie gern wollte; sie wurden elf herrliche wilde Schwäne. Mit einem sonderbaren Schrei flogen sie aus den Schloßfenstern hinaus über den Park und den Wald dahin.
Es war noch ganz früh am Morgen, als sie da vorbeikamen, wo die Schwester Elisa in der Stube des Landmanns lag und schlief. Hier schwebten sie über dem Dache, drehten ihre langen Hälse und schlugen dann mit den Flügeln; aber Niemand hörte oder sah es. Sie mußten wieder weiter, hoch gegen die Wolken empor, hinaus in die weite Welt; da flogen sie hin nach einem großen, dunkeln Walde, der sich bis an den Strand erstreckte.
Die arme, kleine Elisa stand in der Stube des Landmanns und spielte mit einem grünen Blatte; anderes Spielzeug hatte sie nicht. Und sie stach ein Loch in das Blatt, sah da hindurch gegen die Sonne empor, und da war es, als sähe sie ihrer Brüder klare Augen; und jedesmal, wenn die warmen Sonnenstrahlen auf ihre Wangen schienen, gedachte sie aller ihrer Küsse.
Ein Tag verging ebenso wie der andere. Strich der Wind durch die großen Rosenhecken draußen vor dem Hause, so flüsterte er den Rosen zu: "Wer kann schöner sein als Ihr?" Aber die Rosen schüttelten das Haupt und sagten: "Elisa ist es!" Und saß die alte Frau am Sonntage vor der Tür und las in ihrem Gesangbuche, so wendete der Wind die Blätter um und sagte zu dem Buche: "Wer kann frömmer sein als Du?" - "Elisa ist es!" sagte das Gesangbuch. Und es war die reine Wahrheit, was die Rosen und das Gesangbuch sagten.
Als sie fünfzehn Jahr alt war, sollte sie nach Hause; und als die Königin sah, wie schön sie war, wurde sie ihr gram und voll Haß. Gern hätte sie sie in einen wilden Schwan verwandelt, wie die Brüder; aber das wagte sie nicht gleich, weil ja der König seine Tochter sehen wollte.
Früh Morgens ging die Königin in das Bad, welches von Marmor erbaut und mit weichen Kissen und den prächtigsten Decken geschmückt war; und sie nahm drei Kröten, küßte sie, und sagte zu der einen: "Setze Dich auf Elisa's Kopf, wenn sie in das Bad kommt, damit sie dumm wird wie Du!" - "Setze Dich auf ihre Stirn," sagte sie zur andern, "damit sie häßlich wird wie Du, sodaß ihr Vater sie nicht kennt!" - "Ruhe an ihrem Herzen, flüsterte sie der dritten zu; "laß sie einen bösen Sinn erhalten, damit sie Schmerzen davon hat!" Dann setzte sie die Kröten in das klare Wasser, welches sogleich eine grüne Farbe erhielt, rief Elisa, zog sie aus und ließ sie in das Wasser hinabsteigen. Und indem Elisa untertauchte, setzte sich die eine Kröte ihr in das Haar, die andere auf ihre Stirn und die dritte auf die Brust. Aber sie schien es gar nicht zu merken; sobald sie sich emporrichtete, schwammen drei rote Mohnblumen auf dem Wasser. Wären die Tiere nicht giftig gewesen und von der Hexe geküßt worden: so wären sie in rote Rosen verwandelt. Aber Blumen wurden sie doch, weil sie auf ihrem Haupte und an ihrem Herzen geruht hatten. Sie war zu fromm und unschuldig, als daß die Zauberei Macht über sie haben konnte.
Als die böse Königin das sah, rieb sie Elisa mit Wallnußsaft ein, sodaß sie ganz schwarzbraun wurde, bestrich ihr das hübsche Antlitz mit einer stinkenden Salbe und ließ das herrliche Haar sich verwirren. Es war unmöglich, die schöne Elisa wieder zu erkennen.
Als der Vater sie sah, erschrak er sehr und sagte, es sei nicht seine Tochter. Niemand, außer dem Kettenhunde und den Schwalben, wollte sie erkennen; aber das waren arme Tiere, die nichts zu sagen hatten.
Da weinte die arme Elisa und dachte an ihre elf Brüder, die alle weg waren. Betrübt stahl sie sich aus dem Schlosse und ging den ganzen Tag über Feld und Moor bis in den großen Wald hinein. Sie wußte gar nicht, wohin sie wollte, aber sie fühlte sich so betrübt und sehnte sich nach ihren Brüdern, die waren sicher auch, gleich ihr, in die Welt hinausgejagt; die wollte sie suchen und finden.
Nur kurze Zeit war sie im Walde gewesen, da brach die Nacht an: sie kam ganz von Weg und Steg ab: darum legte sie sich auf das weiche Moos nieder, betete ihr Abendgebet und lehnte ihr Haupt an einen Baumstumpf. Es war da so stille, die Luft war so mild, und rings umher im Grase und im Moose leuchteten, einem grünen Feuer gleich, Hunderte von Johanniswürmchen; als sie einen der Zweige leise mit der Hand berührte, fielen die leuchtenden Insekten wie Sternschnuppen zu ihr nieder.
Die ganze Nacht träumte sie von ihren Brüdern; sie spielten wieder als Kinder, schrieben mit dem Diamantgriffel auf die Goldtafel und betrachteten das herrliche Bilderbuch, welches das halbe Reich gekostet hatte. Aber auf die Tafel schrieben sie nicht, wie früher, Nullen und Striche, sondern die mutigen Taten, die sie vollführt, Alles, was sie erlebt und gesehen hatten; und im Bilderbuche war alles lebendig: die Vögel sangen und die Menschen gingen aus dem Buche heraus und sprachen mit Elisa und ihren Brüdern. Aber wenn diese das Blatt umwandten, sprangen sie gleich wieder hinein, damit keine Unordnung hineinkomme.
Als sie erwachte, stand die Sonne schon hoch. Sie konnte die freilich nicht sehen: die hohen Bäume breiteten ihre Zweige dicht und fest über ihr aus. Aber die Strahlen spielten dort oben gerade wie ein wehender Goldflor; da war ein Duft von dem Grünen, und die Vögel setzten sich fast auf ihre Schultern. Sie hörte Wasser plätschern: das waren viele große Quellen, die alle in einen See fielen, in dem der herrlichste Sandboden war. Freilich wuchsen dort dichte Büsche rings herum, aber an einer Stelle hatten die Hirsche eine große Öffnung gemacht, und hier ging Elisa zum Wasser hin. Dies war so klar, daß man, wenn der Wind nicht die Zweige und Büsche berührte, so daß sie sich bewegten, hätte glauben müssen, sie wären auf dem Boden abgemalt gewesen: so deutlich spiegelte sich dort jedes Blatt, sowohl das, welches von der Sonne beschienen, als das, welches im Schatten war.
Sobald Elisa ihr eigenes Gesicht erblickte, erschrak sie, so braun und häßlich war es; doch als sie ihre kleine Hand benetzte und Augen und Stirn rieb, glänzte die weiße Haut wieder vor. Da entkleidete sie sich und ging in das frische Wasser hinein: ein schöneres Königskind, als sie war, wurde in dieser Welt nicht gefunden!
Als sie wieder angekleidet war und ihr langes Haar geflochten hatte, ging sie zur sprudelnden Quelle, trank aus der hohlen Hand und wanderte tiefer in den Wald hinein, ohne selbst zu wissen wohin. Sie dachte an ihre Brüder, dachte an den lieben Gott, der sie sicher nicht verlassen würde. Gott ließ die wilden Waldäpfel wachsen, um den Hungrigen zu sättigen: er zeigte ihr einen solchen Baum; die Zweige bogen sich unter der Last der Früchte. Hier hielt sie ihre Mittagsmahlzeit, setzte Stützen unter die Zweige und ging dann in den dunkelsten Teil des Waldes hinein. Da war es so stille, daß sie ihre eigenen Fußtritte hörte, sowie jedes kleine vertrocknete Blatt, welches sich unter ihrem Fuße bog. Nicht ein Vogel war da zu sehen, nicht ein Sonnenstrahl konnte durch die großen, dunkeln Baumzweige dringen; die hohen Stämme standen so nahe beisammen, daß es, wenn sie vor sich hin sah, ganz so schien, als ob ein Balkengitter dicht beim andern sich umschlösse. O, hier war eine Einsamkeit, wie sie solche früher nie gekannt!
Die Nacht wurde so dunkel! Nicht ein einziger kleiner Johanniswurm leuchtete aus dem Moose. Betrübt legte sie sich nieder, um zu schlafen. Da schien es ihr, als ob die Baumzweige über ihr sich zur Seite bewegten und der liebe Gott mit milden Augen auf sie niederblickte; und kleine Engel sahen über seinem Kopfe und unter seinen Armen hervor.
Als sie am Morgen erwachte, wußte sie nicht, ob sie es geträumt habe, oder ob es wirklich so gewesen.
Sie ging einige Schritte vorwärts, da begegnete sie einer alten Frau mit Beeren in ihrem Korbe; die Alte gab ihr einige davon. Elisa fragte, ob sie nicht elf Prinzen durch den Wald habe reiten
sehen.
"Nein!" sagte die Alte; "aber ich sah gestern elf Schwäne mit Goldkronen auf dem Haupte den Fluß hier nahebei hinab schwimmen!"
Und sie führte Elisa ein Stück weiter vor, zu einem Abhange; am Fuße desselben schlängelte sich ein Flüßchen; die Bäume an seinen Ufern streckten ihre langen, blattreichen Zweige einander entgegen, und wo sie, ihrem natürlichen Wuchse nach, nicht zusammenreichen konnten, da hatten sie die Wurzeln aus der Erde losgerissen und hingen, mit den Zweigen ineinander geflochten, über das Wasser hinaus.
Elisa sagte der Alten Lebewohl und ging längs dem Flüßchen, bis wo dieses nach dem großen, offenen Strand hinaus floß.
Das ganze herrliche Meer lag vor dem jungen Mädchen, aber nicht ein Segel zeigte sich darauf, nicht ein Boot war da zu sehen. Wie sollte sie nun dort weiter fortkommen? Sie betrachtete die unzähligen kleinen Steine am Ufer; das Wasser hatte sie alle rund geschliffen. Glas, Eisen, Steine, Alles, was da zusammengespült lag, hatte die Gestalt des Wassers angenommen, welches doch viel weicher war, als ihre feine Hand. "Das rollet unermüdlich fort, und so ebnet sich das Harte, ich will eben so unermüdlich sein. Dank für Eure Lehre, Ihr klaren, rollenden Wogen; einst, das sagt mir mein Herz, werdet Ihr mich zu meinen lieben Brüdern tragen!"
Auf dem angespülten Seegrase lagen elf weiße Schwanenfedern; sie sammelte sie in einen Strauß. Es lagen Wassertropfen darauf; ob es Tau oder Tränen waren, konnte Niemand sehen. Einsam war es dort am Strande, aber sie fühlte es nicht; denn das Meer bot eine ewige Abwechselung dar, ja, in einigen wenigen Stunden mehr, als die süßen Landseen in einem ganzen Jahre aufweisen können. Kam eine große, schwarze Wolke, so war das, als ob die See sagen wollte: "Ich kann auch finster aussehen;" und dann blies der Wind und die Wogen kehrten das Weiße nach außen. Schienen aber die Wolken rot, und schliefen die Winde: so war das Meer einem Rosenblatte gleich; bald wurde es grün, bald weiß. Aber wie still es auch ruhte, am Ufer war doch eine leise Bewegung; das Wasser hob sich schwach, wie die Brust eines schlafenden Kindes.
Als die Sonne unterzugehen im Begriff war, sah Elisa elf wilde Schwäne mit Goldkronen auf dem Kopfe dem Lande zufliegen; sie schwebten der eine hinter dem andern, es sah aus wie ein langes, weißes Band. Da stieg Elisa den Abhang hinauf und verbarg sich hinter einem Busch; die Schwäne ließen sich nahe bei ihr nieder und schlugen mit ihren großen weißen Schwingen.
Sowie die Sonne unter dem Wasser war, fielen plötzlich die Schwanengefieder, und elf schöne Prinzen, Elisa's Brüder, standen da. Sie stieß einen lauten Schrei aus; ungeachtet sie sich sehr verändert hatten, wußte sie doch, daß sie es waren, fühlte sie, daß sie es sein müßten. Und sie sprang in ihre Arme und nannte sie bei Namen; und die Prinzen fühlten sich so glücklich, als sie ihre kleine Schwester sahen, und erkannten sie, die nun so groß und schön war. Sie lachten und sie weinten, und bald hatten sie einander verstanden, wie böse ihre Stiefmutter gegen sie Alle gewesen war.
"Wir Brüder," sagte der Älteste, "fliegen als wilde Schwäne, so lange die Sonne am Himmel steht; sobald sie untergegangen ist, erhalten wir unsere menschliche Gestalt wieder. Deshalb müssen wir immer aufpassen, beim Sonnenuntergang eine Ruhestätte für die Füße zu haben; denn fliegen wir um diese Zeit gegen die Wolken an, so müssen wir als Menschen in die Tiefe hinunterstürzen. Hier wohnen wir nicht; es liegt ein eben so schönes Land, wie dieses, jenseits der See. Aber der Weg dahin ist weit: wir müssen über das große Meer, und es findet sich keine Insel auf unserem Wege, wo wir übernachten könnten; nur eine einsame, kleine Klippe ragt in der Mitte hervor, sie ist nicht größer, als daß wir dicht nebeneinander darauf ruhen können. Ist die See stark bewegt, so spritzt das Wasser hoch über uns, aber doch danken wir Gott für sie. Da übernachten wir in unserer Menschengestalt, ohne diese könnten wir nie unser liebes Vaterland besuchen, denn zwei der längsten Tage des Jahres brauchen wir zu unserm Flug. Nur einmal im Jahre ist es uns vergönnt, unsere Heimat zu besuchen, elf Tage dürfen wir hier bleiben und über den großen Wald hinfliegen, von wo wir das Schloß erblicken können, in dem wir geboren wurden und wo unser Vater wohnt, - den hohen Kirchturm sehen, wo die Mutter begraben ist. Hier kommt es uns vor, als wären Bäume und Büsche mit uns verwandt, hier laufen die wilden Pferde über die Steppen hin, wie wir es in unserer Kindheit gesehen; hier singt der Kohlenbrenner die alten Lieder, nach denen wir als Kinder tanzten, hier ist unser Vaterland, hierher fühlen wir uns gezogen, und hier haben wir Dich, Du liebe, kleine Schwester, gefunden! Zwei Tage können wir noch hier bleiben, dann müssen wir fort über das Meer, nach einem herrlichen Lande, welches aber nicht unser Vaterland ist! Wie bringen wir Dich fort? Wir haben weder Schiff, noch Boot!"
"Auf welche Art kann ich Euch erlösen?" fragte die Schwester.
Und sie unterhielten sich fast die ganze Nacht; es wurde nur einige Stunden geschlummert.
Elisa erwachte von dem Schall der Schwanenflügel, welche über ihr sausten: die Brüder waren wieder verwandelt. Und sie flogen in großen Kreisen und zuletzt weit weg; aber der eine von ihnen der jüngste, blieb zurück, und der Schwan legte den Kopf in ihren Schoß und sie streichelte seine Flügel; den ganzen Tag waren sie beisammen. Gegen Abend kamen die andern zurück, und als die Sonne untergegangen war, standen sie in ihrer natürlichen Gestalt da.
"Morgen fliegen wir von hier weg und können nicht vor Ablauf eines ganzen Jahres zurückkehren. Aber Dich können wir nicht so verlassen! Hast Du Mut, mitzukommen? Mein Arm ist stark genug, Dich durch den Wald zu tragen: sollten wir da nicht Alle so starke Flügel haben, um mit Dir über das Meer zu fliegen?"
"Ja, nehmt mich mit!" sagte Elisa.
Die ganze Nacht brachten sie damit zu, aus der geschmeidigen Weidenrinde und dem zähen Schilf ein Netz zu flechten, und das wurde groß und stark. Auf dieses Netz legte Elisa sich, und als die Sonne hervortrat und die Brüder in wilde Schwäne verwandelt wurden, ergriffen sie das Netz mit ihrem Schnabel und flogen mit ihrer lieben Schwester, die noch schlief, hoch gegen die Wolken an. Die Sonnenstrahlen fielen ihr gerade auf das Antlitz, deshalb flog einer der Schwäne über ihren Kopf, damit seine breiten Schwingen sie beschatten möchten.
Sie waren weit vom Lande entfernt, als Elisa erwachte, sie glaubte, noch zu träumen, so sonderbar kam es ihr vor, hoch durch die Luft, über das Meer getragen zu werden. An ihrer Seite lag ein Zweig mit herrlichen reifen Beeren und ein Bündel wohlschmeckender Wurzeln; die hatte der jüngste der Brüder gesammelt und ihr hingelegt. Sie lächelte ihn dankbar an, denn sie erkannte ihn; er war es, der über ihr flog und sie mit den Schwingen beschattete.
Sie waren so hoch, daß das größte Schiff, welches sie unter sich erblickten, eine weiße Möve zu sein schien, die auf dem Wasser lag. Eine große Wolke stand hinter ihnen: das war ein ganzer Berg. Und auf diesem sah Elisa ihren eigenen Schatten und den der elf Schwäne; so riesengroß flogen sie da. Das war ein Gemälde, prächtiger, als sie früher je eins gesehen. Doch als die Sonne höher stieg, und die Wolke weiter zurückblieb, verschwand das schwebende Schattenbild.
Den ganzen Tag flogen sie fort, gleich einem sausenden Pfeile durch die Luft: aber es ging doch langsamer, als sonst, denn jetzt hatten sie die Schwester zu tragen. Es zog ein böses Wetter auf; der Abend näherte sich; ängstlich sah Elisa die Sonne sinken, und noch war die einsame Klippe im Meere nicht zu erblicken. Es kam ihr vor, als machten die Schwäne stärkere Schläge mit den Flügeln. Ach! sie war Schuld daran, daß sie nicht rasch genug fort kamen. Wenn die Sonne untergegangen war, so mußten sie Menschen werden, in das Meer stürzen und ertrinken. Da betete sie aus dem Innersten des Herzens ein Gebet zum lieben Gott; aber noch erblickte sie keine Klippe. Die schwarze Wolke kam näher, die starken Windstöße verkündeten einen Sturm, die Wolken standen in einer einzigen, großen, drohenden Welle da, welche fast wie Blei vorwärts schoß; Blitz leuchtete auf Blitz.
Jetzt war die Sonne gerade am Rande des Meeres. Elisa's Herz bebte, da schossen die Schwäne hinab, so schnell, das sie zu fallen glaubte. Aber nun schwebten sie wieder. Die Sonne war halb unter dem Wasser: da erblickte sie erst die kleine Klippe unter sich. Sie sah nicht größer aus, als ob es ein Seehund wäre, der den Kopf aus dem Wasser steckte. Die Sonne sank so schnell, jetzt erschien sie nur noch wie ein Stern: da berührte ihr Fuß den festen Grund. Die Sonne erlosch gleich dem letzten Funken im brennenden Papier: Arm in Arm sah sie die Brüder um sich stehen, aber mehr Platz, als gerade für diese und für sie, war auch nicht da. Die See schlug gegen die Klippe und ging wie Staubregen über sie hin, der Himmel leuchtete in einem fortwährenden Feuer, und Schlag auf Schlag rollte der Donner, aber Schwester und Brüder faßten sich an den Händen und sangen Psalmen, aus denen sie Trost und Mut schöpften.
In der Morgendämmerung war die Luft rein und still; sobald die Sonne emporstieg, flogen die Schwäne mit Elisa von der Insel fort. Das Meer ging noch hoch; es sah aus, wie sie hoch in der Luft waren, als ob der weiße Schaum auf der schwarzgrünen See Millionen Schwäne wären, die auf dem Wasser schwammen.
Als die Sonne höher stieg, sah Elisa vor sich, halb in der Luft schwimmend, ein Bergland, mit glänzenden Eismassen auf den Felsen; und mitten darauf erhob sich ein wohl meilenlanges Schloß, mit einem kühnen Säulengange über dem andern; unten wogten Palmenwälder und Prachtblumen, so groß wie Mühlräder. Sie fragte, ob das das Land sei, wo sie hinwollten; aber die Schwäne schüttelten mit dem Kopfe, denn das, was sie sah, war der Fata Morgana herrliches, allezeit wechselndes Wolkenschloß; da durften sie keinen Menschen hineinbringen. Elisa starrte es an, da stürzten Berge, Wälder und Schloß zusammen, und zwanzig stolze Kirchen, alle einander gleich, mit hohen Türmen und spitzen Fenstern standen da. Sie glaubte die Orgel ertönen zu hören, aber es war das Meer, welches sie hörte. Nun war sie den Kirchen ganz nahe, da wurden diese zu einer ganzen Flotte, die unter ihr dahin segelte; sie blickte hinunter, da waren es nur Meernebel, die über dem Wasser hin glitten. So hatte sie eine ewige Abwechselung vor Augen, und dann sah sie das wirkliche Land, nach dem sie hin wollten; da erhoben sich die herrlichsten blauen Berge mit Zedernwäldern, Städten und Schlössern. Lange bevor die Sonne unterging, saß sie auf den Felsen vor einer großen Höhle, die mit feinen grünen Schlingpflanzen bewachsen war; es sah aus, als wären es gestickte Teppiche.
"Nun wollen wir sehen, was Du diese Nacht hier träumst," sagte der jüngste Bruder und zeigte ihr ihre Schlafkammer.
"Gebe der Himmel, daß ich träumen möge, wie ich Euch erretten kann!" sagte sie. Und dieser Gedanke beschäftigte sie lebhaft; sie betete recht inbrünstig zu Gott um seine Hilfe; ja, selbst im Schlafe fuhr sie fort zu beten. Da kam es ihr vor, als ob sie hoch in der Luft fliege, zu der Fata Morgana Morgenschloß; und die Fee kam ihr entgegen, so schön und glänzend; und doch glich sie ganz der alten Frau, die ihr Beeren im Walde gegeben und ihr von den Schwänen mit Goldkronen auf dem Kopfe erzählt hatte.
"Deine Brüder können erlöst werden," sagte sie; "aber hast Du Mut und Ausdauer? Wohl ist das Wasser weicher, als Deine feinen Hände, und doch formt es die Steine um; aber es fühlt nicht die Schmerzen, die Deine Finger fühlen werden; es hat kein Herz, leidet nicht die Angst und Qual, die Du aushalten mußt. Siehst Du die Brennnessel, die ich in meiner Hand halte? Von derselben Art wachsen viele rings um die Höhle, wo Du schläfst; nur die dort und die, welche auf des Kirchhofs Gräbern wachsen, sind tauglich: merke Dir das. Die mußt Du pflücken, obgleich sie Deine Hand voll Blasen brennen werden. Brich die Nesseln mit Deinen Füßen, so erhältst Du Flachs; aus diesem mußt Du elf Panzerhemden mit langen Ärmeln flechten und binden; wirf diese über die elf Schwäne, so ist der Zauber gelöst. Aber bedenke wohl, daß Du von dem Augenblicke, wo Du diese Arbeit beginnst, bis gerade, wo sie vollendet ist, wenn auch Jahre darüber vergehen, nicht sprechen darfst, das erste Wort, welches Du sprichst, geht als tötender Dolch in Deiner Brüder Herz! An Deiner Zunge hängt ihr Leben. Merke Dir das alles."
Und sie berührte zugleich ihre Hand mit der Nessel; es war einem brennenden Feuer gleich: Elisa erwachte dadurch. Es war heller Tag, und dicht daneben, wo sie geschlafen, lag eine Nessel, wie die, welche sie im Traume gesehen. Da fiel sie auf ihre Knie, dankte dem lieben Gott und ging aus der Höhle hinaus, um ihre Arbeit zu beginnen.
Mit den feinen Händen griff sie hinunter in die häßlichen Nesseln; diese waren wie Feuer; große Blasen brannten sie an ihren Händen und Armen; aber gern wollte sie es leiden, konnte sie nur die lieben Brüder befreien. Sie brach jede Nessel mit ihren bloßen Füßen und flocht den grünen Flachs.
Als die Sonne untergegangen war, kamen die Brüder; und sie erschraken, sie so stumm zu finden; sie glaubten, es wäre ein neuer Zauber der bösen Stiefmutter. Aber als sie ihre Hände erblickten,
begriffen sie, was sie ihrethalben tue; und der jüngste Bruder weinte; und wohin seine Tränen fielen, da fühlte sie keine Schmerzen, da verschwanden die brennenden Blasen.
Die Nacht brachte sie bei ihrer Arbeit zu, denn sie hatte keine Ruhe, bevor sie die lieben Brüder erlöst hätte. Den ganzen folgenden Tag, während die Schwäne fort waren, saß sie in ihrer Einsamkeit; aber noch nie war die Zeit ihr so eilig entflohen. Ein Panzerhemd war schon fertig, nun fing sie das nächste an.
Da ertönte das Jagdhorn zwischen den Bergen; sie wurde von Furcht ergriffen. Der Ton kam immer näher; sie hörte Hunde bellen; erschrocken floh sie in die Höhle, band die Nesseln, die sie gesammelt und gehechelt hatte, in ein Bund zusammen und setzte sich darauf.
Sogleich kam ein großer Hund aus der Schlucht hervorgesprungen und gleich darauf wieder einer, und noch einer; sie bellten laut, liefen zurück und kamen wieder vor. Es währte nicht viele Minuten, so standen alle Jäger vor der Höhle, und der schönste unter ihnen war der König des Landes. Er trat auf Elisa zu: nie hatte er ein schöneres Mädchen gesehen.
"Wie bist Du hierher gekommen, Du herrliches Kind?" fragte er. Elisa schüttelte den Kopf: sie durfte ja nicht sprechen; es galt ihrer Brüder Erlösung und Leben. Und sie verbarg ihre Hände unter der Schürze, damit der König nicht sehen möge, was sie leiden müsse.
"Komm mit mir!" sagte er; "hier darfst Du nicht bleiben. Bist Du gut, wie Du schön bist, so will ich Dich in Seide und Sammet kleiden, die Goldkrone Dir auf das Haupt setzen, und Du sollst in meinem reichsten Schlosse wohnen und hausen!" - Und dann hob er sie auf sein Pferd. Sie weinte und rang die Hände, aber der König sagte: "Ich will nur Dein Glück! Einst wirst Du mir dafür danken!" Und dann jagte er fort durch die Berge, und hielt sie vorn auf dem Pferde, und die Jäger jagten hinterher.
Als die Sonne unterging, lag die schöne Königsstadt mit Kirchen und Kuppeln vor ihnen. Und der König führte sie in das Schloß, wo große Springbrunnen in den hohen Marmorsälen plätscherten, wo Wände und Decken mit Gemälden prangten. Aber sie hatte keine Augen dafür, sie weinte und trauerte. Willig ließ sie die Frauen ihr königliche Kleider anlegen, Perlen in ihre Haare flechten und feine Handschuhe über die verbrannten Finger ziehen.
Als sie in aller ihrer Pracht dastand, war sie so blendend schön, daß der Hof sich noch tiefer vor ihr verneigte. Und der König erkor sie zu seiner Braut, obgleich der Erzbischof mit dem Kopfe schüttelte und flüsterte, daß das schöne Waldmädchen sicher eine Hexe sei: sie blende die Augen und betöre das Herz des Königs.
Aber der König hörte nicht darauf, ließ die Musik ertönen, die köstlichsten Gerichte auftragen und die lieblichsten Mädchen um sie tanzen. Und sie wurde durch duftende Gärten in prächtige Säle hineingeführt, aber nicht ein Lächeln kam auf ihre Lippen oder sprach aus ihren Augen: wie ein Bild der Trauer stand sie da. Dann öffnete der König eine kleine Kammer dicht daneben, wo sie schlafen sollte; die war mit köstlichen grünen Teppichen geschmückt und glich ganz der Höhle, in der sie gewesen war; auf dem Fußboden lag das Bund Flachs, welches sie aus den Nesseln gesponnen hatte, und unter der Decke hing das Panzerhemd, welches fertig gestrickt war. Alles dieses hatte einer der Jäger aus Kuriosität mitgenommen.
"Hier kannst Du Dich in Deine frühere Heimat zurück träumen!" sagte der König. "Hier ist die Arbeit, die Dich dort beschäftigte; jetzt, mitten in aller Deiner Pracht wird es Dich belustigen, an jene Zeit zurückzudenken."
Als Elisa das sah, was ihrem Herzen so nahe lag, spielte ein Lächeln um ihren Mund und das Blut kehrte in die Wangen zurück. Sie dachte an die Erlösung ihrer Brüder, küßte des Königs Hand, und er drückte sie an sein Herz und ließ durch alle Kirchenglocken das Hochzeitsfest verkünden. Das schöne, stumme Mädchen aus dem Walde war des Landes Königin.
Da flüsterte der Erzbischof böse Worte in des Königs Ohren, aber sie drangen nicht bis zu seinem Herzen. Die Hochzeit sollte stattfinden; der Erzbischof selbst mußte ihr die Krone auf das Haupt setzen, und er drückte mit bösem Unwillen den engen Ring fest auf ihre Stirn nieder, so daß es schmerzte. Doch es lag ein schwererer Ring um ihr Herz: die Trauer um ihre Brüder. Sie fühlte nicht die körperlichen Leiden. Ihr Mund war stumm; ein einziges Wort würde ja ihren Brüdern das Leben kosten; aber in ihren Augen sprach sich innige Liebe zu dem guten, schönen König aus, der Alles tat, um sie zu erfreuen. Von ganzem Herzen gewann sie ihn von Tag zu Tag lieber; o, daß sie nur sich ihm vertrauen und ihre Leiden klagen dürfte! Doch stumm mußte sie sein, stumm mußte sie ihr Werk vollbringen. Deshalb schlich sie sich des Nachts von seiner Seite, ging in die kleine Kammer, welche wie die Höhle geschmückt war, und strickte ein Panzerhemd nach dem andern fertig. Aber als sie das siebente begann, hatte sie keinen Flachs mehr.
Auf dem Kirchhof, wußte sie, wuchsen die Nesseln, die sie brauchen wollte; aber die mußte sie selbst pflücken; wie sollte sie da hinaus gelangen! -
"O, was ist der Schmerz in meinen Fingern gegen die Qual, die mein Herz erduldet!" dachte sie. "Ich muß es wagen! Der Herr wird seine Hand nicht von mir abziehen!" Mit einer Herzensangst, als sei es eine böse Tat, die sie vorhabe, schlich sie sich in der mondhellen Nacht in den Garten hinunter und ging durch die langen Alleen, in den einsamen Straßen, nach dem Kirchhofe hinaus. Da sah sie auf einem der breitesten Leichensteine einen Kreis Lamien sitzen. Diese häßlichen Hexen nahmen ihre Lumpen ab, als ob sie sich baden wollten, und dann gruben sie mit den langen, magern Fingern die frischen Gräber auf, holten die Leichen heraus und aßen ihr Fleisch. Elisa mußte nahe an ihnen vorbei, und sie hefteten ihre bösen Blicke auf sie; aber sie betete still, sammelte die brennenden Nesseln und trug sie nach dem Schlosse heim.
Nur ein einziger Mensch hatte sie gesehen: der Erzbischof; er war auf, wenn die Andern schliefen. Nun hatte er doch Recht mit seiner Meinung, daß es mit der Königin nicht sei, wie es sein solle; sie war eine Hexe, deshalb hatte sie den König und das ganze Volk betört.
Im Beichtstuhle sagte er dem Könige, was er gesehen hatte und was er fürchtete. Und als die harten Worte seiner Zunge entströmten, schüttelten die ausgeschnittenen Heiligenbilder die Köpfe, als wenn sie sagen wollten: "Es ist nicht so; Elisa ist unschuldig!" Aber der Erzbischof legte es anders aus; er meinte, daß sie gegen sie zeugten, daß sie über ihre Sünden die Köpfe schüttelten. Da rollten zwei schwere Tränen über des Königs Wangen herab; er ging nach Hause mit Zweifel in seinem Herzen und stellte sich, als ob er in der Nacht schliefe. Aber es kam kein ruhiger Schlaf in seine Augen; er merkte, wie Elisa aufstand. Jede Nacht wiederholte sie dieses und jedes Mal folgte er sachte nach und sah, wie sie in ihre Kammer verschwand.
Tag für Tag wurde seine Miene finsterer; Elisa sah es, begriff aber nicht, weshalb; allein es ängstigte sie, und was litt sie nicht in ihrem Herzen für die Brüder! Auf den königlichen Sammet und Purpur flossen ihre heißen Tränen; die lagen da wie schimmernde Diamanten, und Alle, welche die reiche Pracht sahen, wünschten Königin zu sein. Inzwischen war sie bald mit ihrer Arbeit fertig; nur ein Panzerhemd fehlte noch; aber Flachs hatte sie auch nicht mehr und nicht eine einzige Nessel. Einmal, nur dieses letzte Mal, mußte sie deshalb nach dem Kirchhof und einige Hände voll pflücken. Sie dachte mit Angst an diese einsame Wanderung und an die schrecklichen Lamien; aber ihr Wille stand fest, sowie ihr Vertrauen auf den Herrn.
Elisa ging; aber der König und der Erzbischof folgten nach. Sie sahen sie bei der Gitterpforte zum Kirchhof hinein verschwinden, und als sie sich ihr näherten, saßen die Lamien auf dem Grabsteine, wie Elisa sie gesehen hatte; und der König wendete sich ab, denn unter ihnen dachte er sich die, deren Haupt noch diesen Abend an seiner Brust geruht hatte.
"Das Volk muß sie verurteilen!" sagte er. Und das Volk urteilte, sie solle in den roten Flammen verbrannt werden.
Aus den prächtigen Königssälen wurde sie in ein dunkles, feuchtes Loch geführt, wo der Wind durch das Gitter hinein pfiff; statt Sammet und Seide gab man ihr das Bund Nesseln, welches sie gesammelt hatte; darauf konnte sie ihr Haupt legen; die harten, brennenden Panzerhemden, die sie gestrickt hatte, sollten ihre Decke sein. Aber nichts Lieberes konnte man ihr geben; sie nahm wieder ihre Arbeit vor und betete zu ihrem Gott. Draußen sangen die Straßenbuben Spottlieder auf sie; keine Seele tröstete sie mit einem freundlichen Worte.
Da schwirrte gegen Abend dicht am Gitter ein Schwanenflügel: das war der jüngste der Brüder. Er hatte die Schwester gefunden; und sie schluchzte laut vor Freude, obgleich sie wußte, daß die kommende Nacht wahrscheinlich die letzte sein würde, die sie zu leben hätte. Aber nun war ja auch die Arbeit fast beendet und ihre Brüder waren hier.
Der Erzbischof kam nun, um in der letzten Stunde bei ihr zu sein: das hatte er dem Könige versprochen. Aber sie schüttelte das Haupt und bat mit Blicken und Mienen, er möge gehen. In dieser Nacht mußte sie ja ihre Arbeit vollenden, sonst war Alles unnütz, Alles, Schmerz, Tränen und die schlaflosen Nächte. Der Erzbischof entfernte sich mit bösen Worten gegen sie, aber die arme Elise wußte, daß sie unschuldig sei, und fuhr in ihrer Arbeit fort.
Die kleinen Mäuse liefen auf dem Fußboden; sie schleppten Nesseln zu ihren Füßen hin, um doch etwas zu helfen; und die Drossel setzte sich an das Gitter des Fensters und sang die ganze Nacht so munter, wie sie konnte, damit sie nicht den Mut verlieren möchte.
Es dämmerte noch; erst nach einer Stunde ging die Sonne auf: da standen die elf Brüder an der Pforte des Schlosses und verlangten, vor den König geführt zu werden. Das könne nicht geschehen, wurde geantwortet; es wäre ja noch Nacht; der König schlafe und dürfe nicht geweckt werden. Sie baten, sie drohten, die Wache kam, ja selbst der König trat heraus und frug, was das bedeute: da ging gerade die Sonne auf, und nun waren keine Brüder zu sehen; aber über das Schloß flogen elf wilde Schwäne hin.
Aus dem Stadttore strömte das ganze Volk: es wollte die Hexe verbrennen sehen. Ein alter Gaul zog den Karren, auf dem sie saß; man hatte ihr einen Kittel von grobem Sackleinen angezogen; ihr herrliches Haar hing lose um das schöne Haupt; ihre Wangen waren totenbleich, ihre Lippen bewegten sich leise, während die Finger den grünen Flachs flochten. Selbst auf dem Wege zu ihrem Tode unterbrach sie die angefangene Arbeit nicht; die zehn Panzerhemden lagen zu ihren Füßen, an dem elften strickte sie. Der Pöbel verhöhnte sie.
"Sieh die Hexe, wie sie murmelt! Kein Gesangbuch hat sie in der Hand; nein, mit ihrer häßlichen Gaukelei sitzt sie da; reißt sie ihr in tausend Stücke!"
Und sie drangen Alle auf sie ein und wollten die Panzerhemden zerreißen: da kamen elf wilde Schwäne geflogen, die setzten sich rings um sie auf den Karren und schlugen mit ihren großen Schwingen. Nun wich der Haufen erschrocken zur Seite.
"Das ist ein Zeichen des Himmels! Sie ist sicher unschuldig!" flüsterten Viele. Aber sie wagten nicht, es laut zu sagen.
Nun ergriff der Henker sie bei der Hand: da warf sie hastig die elf Panzerhemden über die Schwäne. Und sogleich standen elf schöne Prinzen da. Aber der jüngste hatte einen Schwanenflügel statt des einen Armes, denn es fehlte ein Ärmel in seinem Panzerhemd: den hatte sie nicht fertig gebracht.
"Nun darf ich sprechen!" sagte sie. "Ich bin unschuldig!"
Und das Volk, welches sah, was geschehen war, neigte sich vor ihr wie vor einer Heiligen; aber sie sank leblos in der Brüder Arme: so hatten Spannung, Angst und Schmerz auf sie gewirkt.
"Ja, unschuldig ist sie!" sagte der älteste Bruder, und nun erzählte er Alles, was geschehen war.
Und während er sprach, verbreitete sich ein Duft wie von Millionen Rosen, denn jedes Stück Brennholz im Scheiterhaufen hatte Wurzel geschlagen und trieb Zweige: es stand eine duftende Hecke da, hoch und groß, mit roten Rosen; ganz oben saß eine Blume, weiß und glänzend; sie leuchtete wie ein Stern. Die pflückte der König und steckte sie an Elisa's Busen: da erwachte sie mit Frieden und Glückseligkeit im Herzen.
Und alle Kirchenglocken läuteten von selbst, und die Vögel kamen in großen Zügen. Es wurde ein Hochzeitszug zurück zum Schlosse, wie ihn noch kein König gesehen hatte!
IB UND DIE KLEINE CHRISTINE ...
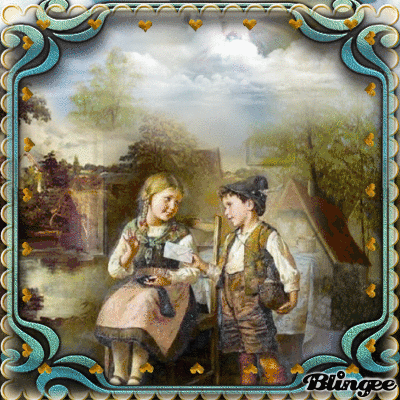
Bei Gudenaa, im Walde von Silkeborg, erhebt sich wie ein großer Wall ein Landrücken und am Fuße dieses Landrückens nach Westen zu, lag und liegt noch heute ein kleines Bauernhaus mit einigen mageren Feldern; der Sand schimmerte allerorten unter dem dünnen Roggen- und Gerstenboden hervor. Es sind nun ein gut Teil Jahre vergangen seitdem. Die Leute, die hier wohnten, bebauten ihren kleinen Acker und hielten drei Schafe, ein Schwein und zwei Ochsen; kurz gesagt, sie konnten recht wohl davon leben, wenn sie bescheidene Ansprüche stellten. Ja, sie hätten es wohl auch dazu bringen können, ein paar Pferde zu halten; aber sie sagten wie die anderen Bauern auch: "Das Pferd frißt sich selbst auf." – Es zehrt das Gute, was es schafft, reichlich wieder auf. Jeppe-Jäns beackerte sein kleines Feld im Sommer selbst und während des Winters war er ein flinker Holzschuhmacher. Dazu hatte er auch einen Gehilfen, einen Knecht, der es verstand, die Holzschuhe zurechtzuschneiden, so daß sie sowohl fest, als auch leicht und wohlgeformt waren. Löffel und Schuhe schnitzten sie, das brachte Geld; man konnte Jeppe-Jäns nicht zu den armen Leuten zählen.
Der kleine Ib, ein siebenjähriger Knabe, das einzige Kind des Hauses, saß dabei und sah zu, er schnitzte an einem Stecken, schnitt sich auch wohl in den Finger; aber eines Tages hatte er zwei Stücken Holz zurechtgeschnitzt, die kleinen Schuhen gleich sahen. Sie sollten, so sagte er, der kleinen Christine geschenkt werden; das war des Schiffers kleine Tochter. Sie war fein und zart wie vornehmer Leute Kind. Hätte sie Kleider gehabt, die ihrer lieblichen Erscheinung angemessen waren, so hätte niemand geglaubt, daß sie aus dem Torfhaus in der Seiser Heide stamme. Dort drüben wohnte ihr Vater. Er war Witwer und ernährte sich damit, aus dem Walde Brennholz nach Silkeborg, ja, oft noch weiter hinauf zu schiffen. Er hatte niemand, der auf die kleine Christine, die ein Jahr jünger als Ib war, geachtet hätte, und so war sie fast immer bei ihm auf dem Kahn oder zwischen dem Heidekraut und den Preißelbeerbüschen; und ging es einmal ganz bis nach Randers hinauf, so kam die kleine Christine zu Jeppe-Jäns hinüber.
Ib und die kleine Christine vertrieben sich prächtig die Zeit mit spielen und essen. Sie wühlten und gruben, sie krochen und liefen, und eines Tages wagten sich die beiden allein gar auf den Landrücken und ein Stück in den Wald hinein. Dort fanden sie Schnepfeneier; das war eine große Begebenheit.
Ib war bisher noch niemals aus der Seiser Heide fortgewesen, niemals war er durch die Seen geschifft bis nach Gudenaa aber nun sollte es geschehen; der Schiffer hatte ihn eingeladen, und am Abend vorher kam er mit zu des Schiffers Hause.
Auf den hochaufgestapelten Brennholzstücken im Schiffe saßen die Kinder schon am frühen Morgen und aßen Brot und Himbeeren. Der Schiffer und sein Knecht schoben sich mit ihren Staken vorwärts; es ging mit dem Strome in rascher Fahrt den Fluß hinab, durch Seen, die ganz von Wald und Schilf umschlossen schienen; aber zuletzt fand sich doch immer eine Durchfahrt, ob auch die alten Bäume sich tief zu ihnen nieder bogen und die Eichen ihre trockenen Äste ihnen entgegenstreckten, als hätten sie die Ärmel hochgestreift, um ihre nackten, knorrigen Arme zu zeigen. Alte Erlen, die der Strom vom Ufer gelöst hatte, hielten sich mit den Wurzeln am Boden fest und sahen wie kleine Waldinseln aus. Die Seerosen wiegten sich auf dem Wasser; es war eine herrliche Fahrt. – Und dann kam man zu der Aalfangstätte, wo das Wasser durch die Schleusen brauste. Das war etwas für Ib und die kleine Christine zum Schauen.
Damals war dort unten weder Fabrik noch Stadt, es stand dort nur das alte Gehöft mit dem Stauwerk, und die Besetzung war nicht stark. Der Fall des Wassers durch die Schleusen und der Schrei der Wildente waren damals fast die einzigen Laute, die das Schweigen der Natur unterbrachen. Als nun das Holz ausgeladen war, kaufte Christines Vater sich ein großes Bund Aale und ein kleines geschlachtetes Ferkel, und alles zusammen wurde in einen Korb hinten auf dem Schiffe verstaut. Nun ging es stromaufwärts heim; aber der Wind kam von hinten, und als sie das Segel aufgesetzt hatten, ging es ebenso gut, als hätten sie zwei Pferde vorgespannt.
Als sie mit dem Kahn bis an die Stelle im Walde gelangt waren, von wo der Knecht nur ein kurzes Stückchen zu laufen hatte, um zu seinem Hause zu kommen, gingen er und Christines Vater an Land, nachdem den Kindern anbefohlen war, sich ruhig und vorsichtig zu verhalten. Das taten sie jedoch nicht lange; sie mußten in den Korb gucken, in dem die Aale und das Ferkel aufbewahrt waren, und das Schwein mußten sie herausnehmen und wollten es halten, und da beide es halten wollten, ließen sie es fallen, und zwar gerade ins Wasser. Da trieb es mit dem Strome dahin, es war ein schreckliches Ereignis.
Ib sprang ans Land und lief ein kleines Stückchen am Ufer entlang, dann kam auch Christine. "Nimm mich mit" rief sie und bald waren sie im Gebüsch verschwunden. Der Kahn und der Fluß waren nicht mehr zu sehen; ein kleines Stück liefen sie noch weiter, dann fiel Christine und weinte; Ib hob sie auf.
"Komm nur mit" sagte er. "Das Haus liegt dort drüben!" Aber es lag nicht dort drüben. Sie gingen weiter und weiter über welkes Laub und dürre abgefallene Zweige, die unter ihren kleinen Füßen knackten. Nun hörten sie ein starkes Rufen – sie standen still und lauschten; ein Adler schrie, es war ein häßlicher Schrei, und sie erschraken heftig. Aber vor ihnen im Walde wuchsen die prächtigsten Blaubeeren, eine ganz unglaubliche Menge; es war allzu einladend, um nicht zu verweilen, und sie blieben und aßen und wurden ganz blau um Mund und Wangen. Nun hörten sie wieder einen Ruf.
"Wir bekommen Schläge für das Ferkel" sagte Christine.
"Laß uns zu mir nachhause gehen" sagte Ib, "Das muß hier im Walde sein." Und sie gingen und kamen auf einen Fahrweg, aber heim führte er nicht; es wurde dunkel und sie fürchteten sich. Die seltsame Stille ringsum wurde von dem dumpfen Schrei der Horneulen und anderen unbekannten Vogellauten unterbrochen. Endlich saßen beide in einem Busche fest; Christine weinte und Ib, weinte, und als sie beide wohl eine Stunde geweint hatten, legten sie sich ins Laub und schliefen ein.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sie erwachten. Sie froren, aber dicht dabei auf dem Hügel oben schien die Sonne zwischen den Bäumen hindurch, dort konnten sie sich wärmen und von dort aus, meinte Ib, müßten sie auch ihrer Eltern Haus erblicken können. Aber sie waren weit davon entfernt in einem ganz anderen Teil des Waldes. Sie kletterten den Hügel ganz hinauf und standen nun vor einem Abhang an einem klaren, durchsichtigen See, in dem es von Fischen wimmelte, die in der hellen Sonne blitzten. Was sie sahen, war so unerwartet, und dicht daneben stand auch ein großer Busch voller Nüsse; und sie pflückten und knackten und aßen die feinen Kerne, die eben in der Bildung begriffen waren – und dann kam noch eine Überraschung, ein Schrecken. Aus den Büschen hervor trat ein großes, altes Weib, deren Antlitz braun und deren Haare glänzend und schwarz waren; das Weiße in ihren Augen leuchtete wie bei einem Mohren. Sie hatte ein Bündel auf dem Rücken und einen Knotenstock in der Hand; es war eine Zigeunerin. Die Kinder verstanden nicht gleich, was sie sagte. Da nahm sie drei große Nüsse aus ihrer Tasche, in einer jeden lägen die herrlichsten Dinge versteckt, erzählte sie, es seien Wünschelnüsse.
Ib sah sie an, sie war so freundlich, und dann faßte er sich ein Herz und fragte, ob er die Nüsse haben dürfe, und das Weib gab sie ihm und pflückte sich eine ganze Tasche voll Nüsse von dem Busch.
Und Ib und Christine saßen mit großen Augen und sahen die drei Wünschelnüsse an.
"Ist in dieser ein Wagen mit Pferden davor?" fragte Ib.
"Es ist sogar ein goldener Wagen mit goldenen Pferden" sagte das Weib.
"Dann gib sie mir" sagte die kleine Christine, und Ib gab sie ihr, während die Frau die Nüsse in ihr Halstuch knüpfte.
"Ist in dieser hier, so ein hübsches kleines Halstuch, wie Christine es hat?" fragte Ib.
"Es sind zehn Halstücher darin" sagte das Weib, "auch feine Kleider und Strümpfe und ein Hut."
"Dann will ich sie auch haben" sagte Christine, und der kleine Ib gab ihr auch die andere Nuß; die dritte war eine kleine schwarze.
"Die kannst Du behalten!" sagte Christine, "sie ist ja auch ganz hübsch."
"Und was ist in dieser?" fragte Ib.
"Das allerbeste für Dich" sagte das Zigeunerweib.
Und Ib hielt die Nuß fest. Das Weib versprach ihnen, sie auf den rechten Weg nach Hause zu führen, und sie gingen, aber freilich gerade in entgegengesetzter Richtung, als sie hätten gehen müssen. Aber deshalb darf man sie noch nicht beschuldigen, daß sie es darauf anlegte, Kinder zu stehlen.
Mitten im dichten Walde trafen sie den Waldläufer Chrän, der Ib kannte, und durch ihn wurden Ib und die kleine Christine wieder nach Hause gebracht, wo man in großer Angst um sie war. Aber es wurde ihnen verziehen, obwohl sie beide tüchtig die Rute verdient hätten, einmal weil sie das Ferkel hatten ins Wasser fallen lassen, und sodann, weil sie davongelaufen waren.
Christine kam heim in die Heide, und Ib blieb in dem kleinen Waldhaus. Das erste, was er dort am Abend tat, war, daß er die Nuß hervorholte, die das "Allerbeste" enthielt. – Er legte sie zwischen Tür und Türrahmen, klemmte dann zu und die Nuß knackte. Aber nicht einmal ein Kern war darin. Sie war mit einer Art Schnupftabak oder Torferde gefüllt; sie hatte den Wurmstich, wie man es nennt.
"Ja, das hätte ich mir wohl denken können!" meinte Ib. "Wo sollte auch in der kleinen Nuß Platz für das Allerbeste sein. Christine bekommt ihre feinen Kleider oder die goldene Kutsche auch nicht zu sehen aus ihren zwei Nüssen."
Und der Winter kam und das neue Jahr kam.
Es vergingen mehrere Jahre. Ib sollte Konfirmationsunterricht beim Pfarrer haben, und der wohnte weit entfernt. In jener Zeit kam eines Tages der Schiffer und erzählte bei Ibs Eltern, daß die kleine Christine nun aus dem Hause solle, um ihr Brot zu verdienen. Es sei ein wahres Glück für sie, daß sie in gute Hände käme, sie habe bereits eine Stellung bei recht braven Leuten. Sie solle zu den reichen Krugwirtsleuten in Herning, das weiter nach Westen lag, ziehen. Dort solle sie der Hausfrau zur Hand gehen und später, wenn sie sich schickte und eingesegnet war, wollten sie sie behalten.
Ib, und Christine nahmen Abschied voneinander; sie wurden jetzt als versprochen angesehen. Sie zeigte ihm beim Abschied, daß sie noch immer die beiden Nüsse habe, die sie damals von ihm bekommen hatte, als sie verirrt im Walde umherliefen; sie sagte auch, daß sie in ihrer Wäschekiste die kleinen Holzschuhe aufbewahrte, die er als Knabe geschnitzt und ihr geschenkt hätte. Dann schieden sie.
Ib wurde eingesegnet, aber er blieb in seiner Mutter Haus; denn er war ein geschickter Holzschuhmacher und bearbeitete auch im Sommer das kleine Ackerfeld, daß es aufs beste gedieh. Seine Mutter hatte nur noch ihn, Ibs Vater war tot.
Nur selten, und dann durch einen Postboten oder durch einen Aalhändler, hörte man von Christine. Es ging ihr gut bei dem reichen Krugwirte, und als sie eingesegnet war, schrieb sie an ihren Vater einen Brief mit einem Gruße auch an Ib und seine Mutter. Im Briefe stand noch von sechs neuen Hemden und einem herrlichen Kleid, das Christine von ihrer Herrschaft bekommen hatte. Das waren wirklich gute Nachrichten.
Im nächsten Frühjahr, an einem schönen Tage, klopfte es an Ibs und seiner Mutter Tür. Es war der Schiffer mit Christine. Sie war für einen Tag zu Besuch gekommen. Es hatte sich gerade Gelegenheit zu einer Fahrt bis in die Nähe und wieder zurück geboten, und die hatte sie benützt. Sie war hübsch und sah wie ein feines Fräulein aus. Und schöne Kleider hatte sie an, die gut gearbeitet waren und zu ihr paßten. Da stand sie nun in ihrem vollen Staat, und Ib war in seiner alten Werktagskleidung. Er konnte gar keine Worte finden. Wohl nahm er ihre Hand, hielt sie fest und war so herzlich froh, aber den Mund konnte er nicht gebrauchen. Dafür konnte es die kleine Christine um so besser, und sie sprach und hatte so viel zu erzählen und küßte Ib mitten auf den Mund.
"Kennst Du mich auch wieder?" fragte sie. Aber selbst als sie beide allein waren und er noch immer mit ihrer Hand in der, seinen stand, war alles, was er sagen konnte: "Du bist ja eine feine Dame geworden! Und ich sehe so armselig dagegen aus. Wie oft ich an Dich gedacht habe. An Dich und die alten Zeiten."
Und dann gingen sie Arm in Arm den Hügel hinauf und schauten über Gudenaa nach der Seiser Heide mit den großen Heidehügeln hin, aber Ib sagte nichts. Doch als sie sich trennten, war er sich darüber klar geworden, daß sie seine Frau werden müsse; sie waren ja von klein auf Liebesleute genannt worden und waren, so schien es ihm, ein verlobtes Paar, obgleich keines von ihnen selbst es gesagt hatte.
Nur einige Stunden noch konnten sie zusammen sein, denn sie mußte wieder dorthin, von wo am nächsten Morgen der Wagen abfuhr. Der Vater und Ib begleiteten sie. Es war heller Mondschein und als sie angekommen waren, hielt Ib, noch immer ihre Hand und konnte sie nicht loslassen. In seinen Augen stand sein ganzes Herz geschrieben, aber die Worte fielen nur spärlich, doch jedes einzige kam aus innerstem Herzen: "Wenn Du Dich nicht zu fein gewöhnt hast," sagte er, "und Du könntest Dir denken, in unserer Mutter Haus mit mir als Deinem Ehemann zu leben, dann werden wir beiden einmal Mann und Frau – aber wir können ja noch ein wenig warten!"
"Ja, laß uns die Zeit abwarten, Ib!" sagte sie; und dann drückte sie seine Hand und er küßte sie auf den Mund. "Ich vertraue auf Dich, Ib!" sagte Christine, "und ich glaube, daß ich Dich lieb habe! Aber laß es mich beschlafen!"
Dann schieden sie. Ib sagte zu dem Schiffer, daß er und Christine nun so gut wie verlobt seien, und der Schiffer fand, daß es so wäre, wie er es sich gedacht hätte; und er ging mit Ib nach Hause und schlief dort in einem Bett mit ihm, und es wurde über die Verlobung nicht mehr gesprochen.
Ein Jahr war darüber vergangen; zwei Briefe waren zwischen Ib, und Christine gewechselt worden; "Treu bis zum Tode!" stand als Unterschrift darin. Eines Tages trat der Schiffer zu Ib herein, er brachte ihm einen Gruß von Christine; was er weiter zu sagen hatte, ging ihm ein wenig schwer von der Zunge, aber es war daraus zu entnehmen, daß es Christine wohl gehe, mehr als wohl sogar, sie wäre ja ein hübsches Mädchen und geachtet und beliebt. Des Krugwirts Sohn wäre zu einem Besuch zu Hause gewesen; er wäre in Kopenhagen in einem Kontor beschäftigt und habe dort eine große Stellung. Er möge Christine wohl leiden und sie fände ihn auch nach ihrem Sinn, seine Eltern wären ebenfalls nicht dagegen, aber es lag doch Christine schwer auf dem Herzen, daß wohl Ib noch immer an sie dächte, und so hätte sie beschlossen, das Glück von sich zu stoßen, sagte der Schiffer.
Ib sagte zuerst kein Wort, aber er wurde so weiß wie ein leinenes Tuch; dann schüttelte er den Kopf und sagte: "Christine darf ihr Glück nicht von sich stoßen!"
"Schreibe ihr das in ein paar Worten!" sagte der Schiffer.
Und Ib schrieb, aber er konnte nicht recht die Worte setzen, wie er wollte und strich durch und zerriß, aber am Morgen war ein Brief an die kleine Christine zustande gebracht, und hier ist er.
"Den Brief an Deinen Vater habe ich gelesen und sehe daraus, daß es Dir in jeder Beziehung wohl geht und Du es noch besser haben könntest! Frage Dein Herz, Christine! und bedenke wohl, was Deiner wartet, wenn Du mich nimmst! Was mein ist, ist nur geringe. Denke nicht an mich und wie ich es tragen werde, denke nur an Deinen eigenen Nutzen. An mich bist Du durch kein Versprechen gebunden, und hast Du mir in Deinem Herzen eins gegeben, so löse ich Dich davon. Alles Glück der Welt sei mit Dir, kleine Christine. Der liebe Gott wird wohl auch für mein Herz Trost wissen.
Immer Dein aufrichtiger Freund
Ib."
Und der Brief wurde abgesandt und Christine bekam ihn.
Um Martini wurde sie in der Kirche in der Seiser Heide und in Kopenhagen, wo der Bräutigam war, aufgeboten, und dorthin reiste sie mit ihrer Schwiegermutter, da der Bräutigam wegen seiner vielen Geschäfte nicht so weit fortreisen konnte. Christine war, wie verabredet, mit ihrem Vater in einem kleinen Dorfe, das auf ihrem Wege lag, zusammengetroffen; dort nahmen sie voneinander Abschied. Es fielen darüber ein paar Worte, aber Ib sagte nichts dazu, er wäre so nachdenklich geworden, sagte seine alte Mutter. Ja, nachdenklich war er, und deshalb kamen ihm auch die drei Nüsse nicht aus dem Sinn, die er als Kind von der Zigeunerin bekommen und von denen er zwei Christine abgegeben hatte. Es waren wirklich Wünschelnüsse gewesen. In den ihren hatten ja ein goldener Wagen und Pferde und schöne Kleider gelegen; es traf bei ihr zu. All diese Herrlichkeiten sollte sie nun drüben in Kopenhagen haben! Bei ihr ging es in Erfüllung. –
Für Ib war in der Nuß nur der schwarze Staub. "Das Allerbeste" für ihn, hatte das Zigeunerweib zu ihm gesagt, – ja, auch das ging in Erfüllung. Der schwarze Staub war für ihn das Beste. Nun verstand er deutlich, was das Weib damit gemeint hatte: die schwarze Erde, des Grabes Stille waren für ihn das Allerbeste.
Und es vergingen Jahre darüber – nicht viele, aber Ib, erschienen sie lang. Die alten Krugwirtsleute starben, einer kurz nach dem anderen; das ganze Vermögen, viele tausend Reichstaler, ging auf den Sohn über. Ja, nun konnte Christine wohl eine Kutsche und schöne Kleider bekommen!
Zwei lange Jahre hindurch, die nun folgten, kam kein Brief von Christine, und als dann der Vater einen bekam, war er nicht mehr in Wohlstand und Vergnügen geschrieben. Arme Christine! Weder sie noch ihr Mann hatten es verstanden, mit dem Reichtum Maß zu halten, er verging, wie er gekommen war, es ruhte kein Segen darauf; sie hatten es selbst so gewollt.
Die Heide stand in Blüte und die Heide verdorrte wieder. Der Schnee hatte manchen Winter über die Heide gefegt und über die Anhöhe, in deren Schutz Ib wohnte. Die Frühjahrssonne schien und Ib ließ den Pflug durch die Erde ziehen. Da stieß er damit, wie es ihm schien, an einen Feuerstein. Es kam ein großer, schwarzer Hobelspan über die Erde hervor, und als Ib ihn in die Hand nahm, fühlte er, daß er von Metall war, und an der Stelle, wo der Pflug daran geschlagen war, blitzte es blank. Es war ein schwerer goldener Armring aus dem heidnischen Altertum. Ein Hünengrab war hier geebnet worden und sein kostbarer Schmuck gefunden. Ib zeigte ihn dem Pfarrer, der ihm sagte, was das für ein herrliches und wertvolles Stück sei, und von ihm ging Ib, zum Landrat, der darüber nach Kopenhagen berichtete und Ib, anriet, den kostbaren Fund selbst zu überbringen.
"Du hast in der Erde das Köstlichste gefunden, was sie Dir zu geben vermag!" sagte ihm der Landrat.
"Das Beste" dachte Ib, "Das Allerbeste für mich – in der Erde. Dann hatte das Zigeunerweib also auch mit mir recht, wenn dies das Beste war."
Und Ib, fuhr mit der Fähre von Aarhuus nach Kopenhagen; es war für ihn, der bisher nur nach Gudenaa hinübergekommen war, wie eine Reise übers Weltmeer. Und er kam nach Kopenhagen.
Der Wert des gefundenen Goldes wurde ihm ausbezahlt; es war eine große Summe, sechshundert Reichstaler. Da wanderte nun Ib, aus dem Walde bei der Seiser Heide- in dem großen, lärmenden Kopenhagen umher.
Es war gerade an dem Abend, als er mit einem Schiffer wieder nach Aarhuus zurückfahren wollte, als er sich in den Straßen verirrte und in eine ganz andere Richtung geriete als er eigentlich wollte. Er war über die Knippelsbrücke nach Christianshafen gekommen anstatt zum Walle beim Westtor. Er war ganz richtig nach Westen gesteuert, aber nicht dorthin, wohin er sollte. Nicht ein Mensch war in den Straßen zu sehen. Da kam ein ganz kleines Mädchen aus einem der ärmlichen Häuser. Ib fragte sie nach dem Wege und die Kleine blickte auf. Da sah er, daß sie heftig weinte. Nun fragte er sie, was ihr fehle; sie sagte etwas, was er nicht verstand, und als sie beide unter eine Laterne kamen, deren Schein ihr Gesichtchen beleuchtete, wurde es ihm ganz wunderlich zumute; denn es war leibhaftig die kleine Christine, die da vor ihm stand, ganz wie er sich ihrer erinnerte, als sie beide noch Kinder waren.
Und er ging mit dem kleinen Mädchen in das ärmliche Haus, die schmale, ausgetretene Treppe hinauf bis zu einer kleinen, verkommenen Kammer hoch oben unter dem Dache. Es war eine schwere stickige Luft darin, kein Licht war entzündet, und in einer Ecke seufzte es und mühsame Atemzüge drangen daraus hervor. Ib strich ein Zündholz an. Es war die Mutter des Kindes, die in dem ärmlichen Bette lag.
"Kann ich Euch mit irgendetwas helfen?" sagte Ib. "Die Kleine hat mich auf der Straße getroffen, aber ich bin selbst fremd hier in der Stadt. Ist hier kein Nachbar oder irgend jemand, den ich Euch rufen könnte?" – Und er richtete ihr Haupt in die Höhe.
Es war Christine aus der Seiser Heide.
Jahre hindurch war ihr Name daheim in Jütland nicht mehr genannt worden, es würde Ibs stillen Gedankengang aufgerührt haben, und es war ja auch nichts Gutes, was Gerücht und Wahrheit meldeten, daß das viele Geld, das ihr Mann von seinen Eltern geerbt hatte, ihn übermütig und leichtlebig gemacht hätte. Er hatte seine feste Stellung aufgegeben und war ein halbes Jahr im Auslande umhergereist, dann kehrte er zurück, machte Schulden über Schulden, der Wagen neigte sich immer mehr und endlich stürzte er um. Seine vielen lustigen Tischfreunde sagten von ihm, es sei ihm nur nach Verdienst geschehen, er habe ja darauf los gelebt wie ein Narr. Eines Morgens war seine Leiche im Schloßkanal gefunden worden.
Nach seinem Tode ging Christine in sich; ihr jüngstes Kindchen, im Wohlstand empfangen, im Elend geboren, war, nur einige Wochen alt, gestorben und ruhte im Grabe, und jetzt war es mit Christine so weit gekommen, daß sie todkrank und verlassen in einer elenden Kammer lag, so elend, wie sie es in ihren jungen Jahren in der Seiser Heide wohl hätte ertragen können; aber nun, da sie es besser gewöhnt war, fühlte sie ihr Elend doppelt. Es war ihr ältestes Kind, auch eine kleine Christine, die Not und Hunger mit ihr litt und die Ib zu ihr herauf gebracht hatte.
"Ich habe Angst für das arme Kind, wenn ich sterbe" brachte sie seufzend hervor, "wo in aller Welt soll es dann hin." – Mehr konnte sie nicht sagen.
Ib brannte wieder ein Zündhölzchen an und fand einen Lichtstumpf, den er anzündete, nun fiel der trübe Lichtschein auf all das Elend in der Kammer.
Ib sah des kleine Mädchen an und dachte an Christine in ihren jungen Jahren. Um Christines willen konnte er ja an diesem Kinde, das er nicht kannte, Gutes tun. Die Sterbende sah ihn an, ihre Augen wurden größer und größer. – Erkannte sie ihn? Nie erfuhr er das, kein Wort mehr hörte er sie sprechen.
Es war im Walde bei Gudenaa in der Seiser Heide; die Luft war grau, die Heide stand ohne Blüten. Die Weststürme trieben das gelbe Laub der Wälder in den Fluß und über die Heide, wo das Torfhaus stand. Fremde Leute wohnten darin; aber am Fuße des Landrückens, im Schutze hoher Bäume, stand das kleine Haus, weiß und schmuck. Im Kachelofen in der Stube brannten Torfstücken, in der Stube hier war Sonnenschein, er strahlte aus zwei Kinderaugen, Frühling und Lerchengezwitscher klangen aus dem roten, lachenden Mund, Leben und Fröhlichkeit herrschten hier; es war die kleine Christine, die auf Ibs Knien saß. Ib war ihr Vater und Mutter, die beide von ihr gegangen waren, wie ein Traum vergeht. Ib saß in dem netten, reinlichen Hause, ein wohlhabender Mann; die Mutter des kleinen Mädchens lag auf dem Armenfriedhof in der Königstadt Kopenhagen.
Ib hatte Geld im Kasten, sagte man. Gold aus der Erde, und er hatte ja auch die kleine Christine.
SIE TAUGTE NICHTS ...

Der Stadtvogt stand am offenen Fenster. Er hatte ein Oberhemd an und eine Brustnadel in der Hemdkrause stecken und war außerordentlich gut rasiert, das hatte er eigenhändig getan und sich dabei nur einen kleinen Schnitt zugezogen, doch über diesen hatte er ein Stückchen Zeitungspapier geklebt.
"Hörst Du, Kleiner" rief er.
Der Kleine war aber niemand anderes als der Sohn der Waschfrau, der eben vorbeiging und ehrerbietig seine Mütze zog. Der Schirm war geknickt und auch sonst war sie nach und nach so eingerichtet worden, daß man sie in die Tasche stecken konnte. In seinen ärmlichen aber sauberen und durchaus ordentlich geflickten Kleidern und den schweren Holzschuhen stand der Knabe ehrerbietig da, als ob er vor dem Könige selber stehe.
"Du bist ein guter Junge" sagte der Stadtvogt, "Du bist ein höflicher Junge Deine Mutter spült wohl Wäsche unten am Fluß. Dahin sollst Du wohl auch mit dem, was Du in der Tasche hast. Das ist eine schlimme Sache mit Deiner Mutter. Wieviel hast Du da?"
"Ein halb Nößel," sagte der Knabe mit erschreckter, halb leiser Stimme.
"Und heute morgen bekam sie ebenso viel," fuhr der Mann fort.
"Nein, gestern war es" antwortete der Knabe.
"Zwei halbe geben ein ganzes. – Sie taugt nichts. Es ist traurig mit dieser Volksklasse. – Sag Deiner Mutter, sie sollte sich schämen. Und werde nicht auch zum Trunkenbold, aber das wirst Du ja doch. – Armes Kind. – Geh nun."
Und der Knabe ging; die Mütze behielt er in der Hand und der Wind blies durch sein blondes Haar, so daß es sich in langen Strähnen aufrichtete. Er ging um die Straßenecke in das Gäßchen zum Flusse hinab, wo die Mutter draußen im Wasser neben der Waschbank stand und mit dem Wäscheklöpfel auf das schwere Leinen schlug. Es war starke Strömung im Flusse, denn die Schleusen der Wassermühle waren geöffnet. Die Laken wurden vom Strome fortgetrieben und rissen fast die Waschbank mit sich; die Waschfrau mußte sich kräftig dagegenstemmen.
"Ich bin nahe daran, fortzuschwimmen." sagte sie, "es ist gut, daß Du kommst, denn eine Hilfe tut den Kräften schon not! Es ist kalt hier draußen im Wasser; sechs Stunden habe ich schon hier gestanden. Hast Du etwas für mich?"
Der Knabe zog die Flasche hervor und die Mutter setzte sie an den Mund und trank einen Schluck.
"Ach, das tut gut. Wie das wärmt. Das ist ebenso gut wie warmes Essen, und es ist nicht so teuer. Trink, mein Junge. Du siehst so blaß aus, Du frierst in den dünnen Kleidern; es ist ja auch Herbst. Hu, Das Wasser ist kalt. Wenn ich nur nicht krank werde. Aber das tue ich nicht. Gib mir noch einen Tropfen und trinke auch, aber nur einen kleinen Tropfen, Du darfst Dich nicht daran gewöhnen, mein liebes armes Kind."
Sie ging um die Brücke, auf der der Knabe stand, und trat aufs Land. Das Wasser triefte aus der Schilfmatte, die sie um den Leib gebunden trug und es triefte auch aus ihrem Hemde.
"Ich quäle und placke mich ab, daß mir das Blut fast unter den Nägeln hervor spritzt, aber das tut nichts, wenn ich Dich nur ehrlich durch die Welt bringe, mein Kind."
Im gleichen Augenblick kam eine etwas ältere Frau, ärmlich an Kleidung und Gestalt. Sie hinkte auf dem einen Bein und trug über dem einen Auge eine mächtige falsche Locke, das sollte von der Locke verdeckt werden, aber das Gebrechen fiel dadurch nur noch mehr in die Augen. Es war eine Freundin der Waschfrau, "Humpelmaren mit der Locke" nannten die Nachbarn sie.
"Du Ärmste, wie Du Dich quälen und placken und in dem kalten Wasser stehen mußt. Du hast doch wahrhaftig ein bißchen Warmes nötig, und doch mißgönnt man Dir noch den Tropfen, den Du bekommst!" Und nun war bald des Stadtvogts ganze Rede zu dem Knaben der Waschfrau zu Ohren gebracht; denn Maren hatte das Ganze mitangehört und es hatte sie geärgert, daß er zu dem Kinde so von seiner eigenen Mutter und von dem Tropfen, den sie zu sich nahm, sprach, wehrend er gleichzeitig große Essen abhielt, bei denen der Wein flaschenweise floß. "Feine Weine und starke Weine werden da getrunken, auch ein bißchen über den Durst bei vielen. Aber das nennt man beileibe nicht trinken! Sie taugen etwas, aber Du taugst nichts!"
"Hat er so zu Dir gesprochen, Kind" sagte die Waschfrau und ihre Lippen bewegten sich zitternd. "Du hast eine Mutter, die nichts taugt. Vielleicht hat er recht, aber dem Kinde hätte er das nicht sagen dürfen. Doch von diesem Hause kommt viel über mich."
"Ihr habt ja dort im Hause gedient, als des Stadtvogts Eltern noch lebten und dort wohnten; das ist viele Jahre her. Seit der Zeit sind viele Scheffel Salz gegessen worden, da kann man schon Durst bekommen!" und Maren lachte. "Heute ist großes Mittagessen beim Stadtvogt, es sollte abgesagt werden, aber es wurde zu spät, und das Essen war schon fertig. Ich habe es von dem Hausknechte. Vor einer Stunde ungefähr ist ein Brief gekommen, daß der jüngere Bruder in Kopenhagen gestorben ist."
"Gestorben" schrie die Waschfrau auf und wurde totenbleich.
"Aber ja doch" sagte die Frau. "Geht es Euch so nahe? Nun ja, Ihr habt ihn ja gekannt von der Zeit an, wo Ihr im Hause dientet."
"Ist er tot! Er war der beste Mensch auf Erden. Unser Herrgott bekommt nicht viele, wie er war." Und Tränen liefen über ihre Wangen. "O, mein Gott. Es dreht sich alles vor mir im Kreise. Das kommt, weil ich die Flasche ausgetrunken habe; ich habe es nicht vertragen können. Ich fühle mich so krank" und sie lehnte sich gegen einen Bretterzaun.
"Aber Mutter, Ihr seid ja ganz krank" sagte die Frau. "Seht nur, daß es vorübergeht! Nein, Ihr seid wirklich krank. Es wird das beste sein, daß ich Euch nachhause bringe!"
"Aber die Wäsche hier."
"Da laßt mich nur machen. Faßt mich unter den Arm. Der Junge kann hier bleiben und solange aufpassen. Nachher komme ich und wasche den Rest. Es ist ja nicht mehr viel übrig."
Und die Waschfrau schwankte auf ihren Füßen.
"Ich habe zu lange in dem kalten Wasser gestanden. Seit heute morgen habe ich weder etwas Warmes noch etwas Kaltes in den Magen bekommen! Ich fühle, wie das Fieber in meinem Körper sitzt. O, Herr Jesus, hilf mir nachhause. Mein armes Kind" und sie brach in Tränen aus.
Der Knabe weinte und saß bald allein am Flusse neben der nassen Wäsche. Die beiden Frauen gingen nur langsam, die Waschfrau schwankend, das Gäßchen entlang, sie bogen um die Ecke am Hause des Stadtvogts vorbei, und gerade vor diesem sank sie auf das Pflaster. Die Leute liefen zusammen.
Humpelmaren lief in das Haus um Hilfe. Der Stadtvogt mit seinen Gästen sah aus dem Fenster.
"Das ist die Waschfrau" sagte er. "Sie hat wohl eins über den Durst getrunken; sie taugt nichts. Es ist schade um ihren hübschen Jungen. Für das Kind habe ich etwas übrig. Aber die Mutter taugt nichts."
Dann wurde sie wieder zur Besinnung gebracht und in ihr ärmliches Heim geführt, wo man sie auf das Bett legte. Die brave Maren machte ihr eine Tasse warmes Bier mit Butter und Zucker zurecht, eine Medizin, die sie immer für die beste hielt. Und dann ging sie zum Flusse hinunter und spülte schlecht aber mit viel guter Meinung die Wäsche, sie zog das nasse Zeug eigentlich nur ans Land und nahm es mit sich.
Am Abend saß sie in der ärmlichen Stube bei der Waschfrau. Ein paar gebratene Kartoffeln und ein prächtig fettes Stück Schinken hatte sie von der Köchin des Stadtvogts für die Kranke bekommen, daran taten sich der Knabe und Maren gütlich; die Kranke freute sich am Geruche, der so nährend wäre, wie sie sagte.
Und der Knabe kam ins Bett, in das gleiche Bett, in dem die Mutter lag, aber er hatte seinen Platz quer zu ihren Füßen und zog einen alten Fußteppich über sich, der aus roten und blauen Streifen zusammengenäht war.
Der Waschfrau ging es ein wenig besser; das warme Bier hatte sie gestärkt und der Duft des feinen Essens ihr wohlgetan.
"Dank, Du gute Seele" sagte sie zu Maren. "Wenn der Junge schläft, will ich Dir auch alles sagen. Ich glaube, er tut es schon. Wie süß und lieb er doch aussieht mit den geschlossenen Augen. Er weiß nicht, wie schlecht es seiner Mutter geht. Der liebe Gott möge ihm ein anderes Schicksal bescheren! – Als ich bei Gerichtsrats, den Eltern des Stadtvogts diente, traf es sich, daß der Jüngste von den Söhnen, der damals Student war, heimkam; damals war ich jung, wild und warmblütig, aber anständig, das kann ich auch vor Gott getrost behaupten!" sagte die Waschfrau. – "Der Student war so lustig und fröhlich, ein prachtvoller Mensch. Jeder Blutstropfen in ihm war rechtschaffen und gut. Einen besseren Menschen gab es auf der ganzen Welt nicht. Er war der Sohn des Hauses und ich nur das Dienstmädchen, aber wir wurden uns einig in Zucht und Ehren. Ein Kuß ist doch keine Sünde, wenn man einander richtig lieb hat. Und dann sagte er es seiner Mutter, die für ihn der Herrgott hier auf Erden war. Und sie war auch so klug, so liebevoll und so gut. – Dann reiste er fort und setzte mir seinen goldenen Ring auf den Finger. Als er fort war, rief mich meine Dienstherrin in ihr Zimmer. Ernst und doch so mild stand sie da und sprach mit mir, wie der liebe Gott auch hätte sprechen können. Sie erklärte mir den Abstand in Geist und Bildung zwischen ihm und mir. Jetzt sieht er noch, wie hübsch Du aussiehst, aber die Schönheit vergeht! Du bist nicht in dem Stande erzogen wie er, Ihr seid in den Reichen des Geistes nicht gleich, und darin liegt das Unglück. Ich achte den Armen, sagte sie, bei Gott erhält er vielleicht einen höheren Platz als mancher Reiche, aber auf Erden darf man nicht in der verkehrten Spur fahren, wenn man vorwärts will, sonst schlägt der Wagen um, und Ihr beiden würdet umschlagen! Ich weiß, daß ein braver Mann, ein Handwerker, um Dich gefreit hat, es ist der Handschuhmacher Erik. Er ist Witwer, er hat keine Kinder und steht sich gut; denke darüber nach." -
"Jedes Wort, was sie sagte, schnitt mir wie ein Messer ins Herz, aber die Frau hatte recht. Und das drückte mich und lastete auf mir. Ich küßte ihr die Hand und weinte meine bittersten Tränen und noch mehr, als ich dann in meiner Kammer war und mich übers Bett warf. Es war eine schwere Nacht, die dieser Stunde folgte; der liebe Gott weiß es, wie ich gelitten und gestritten habe. Dann ging ich am Sonntag zum Abendmahl, um innere Klarheit zu finden. Da geschah es wie in einer Fügung, daß ich gerade den Handschuhmacher Erik traf, als ich aus der Kirche kam. Da war es mit meinen Zweifeln vorbei, wir paßten zu einander in Stellung und Verhältnissen, ja, er war sogar ein wohlhabender Mann, und so ging ich gerade auf ihn zu, nahm seine Hand und sagte: Sind Deine Gedanken immer noch bei mir? – Ja, ewig und immer werden sie das sein, sagte er. – Willst Du ein Mädchen haben, das Dich achtet und ehrt, wenn es Dich auch nicht liebt? Aber auch das kann wohl noch kommen. – Das wird kommen sagte er, und dann gaben wir einander die Hand. Ich ging heim zu meiner Dienstherrin. Den Goldring, den der Sohn mir gegeben hatte, trug ich auf meiner bloßen Brust, am Tage konnte ich ihn nicht auf meinen Finger setzen, aber jeden Abend, wenn ich mich ins Bett legte, setzte ich ihn auf. Ich küßte den Ring, daß meine Lippen dabei bluteten. Und dann gab ich ihn meiner Dienstherrin und sagte, daß ich in der nächsten Woche von der Kanzel herab mit dem Handschuhmacher aufgeboten werden würde. Da nahm sie mich in ihre Arme und küßte mich – sie sagte nicht, daß ich nichts tauge, aber damals war ich vielleicht auch noch besser, obgleich ich noch nicht so viel Widerstand im Leben hatte durchmachen müssen. Zu Lichtmeß fand dann die Hochzeit statt. Das erste Jahr ging es gut, wir hielten einen Gesellen und einen Burschen, und damals dientest Du auch bei uns, Maren."
"Ach, Ihr wart mir eine gute Dienstherrin" sagte Maren. "Niemals werde ich vergessen, wie freundlich Ihr und Euer Mann zu mir waret."
"Das waren die guten Jahre, in denen Du bei uns warst – Kinder hatten wir da noch nicht. – Den Studenten sah ich niemals mehr. – Doch, ich sah ihn, aber er sah mich nicht. Er kam zu seiner Mutter Begräbnis. Ich sah, ihn am Grabe stehen, er war kreideweiß und tiefbetrübt, aber es war um der Mutter willen! Als später der Vater starb, war er in fremden Ländern und kam nicht her, auch später ist er nicht mehr hier gewesen. Niemals hat er sich verheiratet, das weiß ich; er war wohl Rechtsanwalt. – An mich dachte er nicht mehr und hätte er mich gesehen, so hätte er mich wohl nicht mehr erkannt, so häßlich bin ich geworden. Und das ist ja auch gut so!"
Und sie sprach von den schweren Tagen der Prüfung, wie das Unglück geradezu über sie hergefallen war. Sie besaßen fünfhundert Reichstaler, und da in der Straße ein Haus für zweihundert zu haben war und es sich gelohnt hätte, es nieder zu reißen und ein neues zu bauen, wurde das Haus gekauft. Der Maurer und der Zimmermann machten einen Überschlag, wonach das weitere noch eintausendzwanzig Mark kosten würde. Kredit hatte der Handschuhmacher, das Geld bekam er in Kopenhagen geliehen, aber der Schiffer, der es bringen sollte, ging unter und das Geld mit.
"Damals war es, daß mein lieber Junge, der hier schläft, geboren wurde. – Der Vater fiel in eine schwere langwierige Krankheit. Dreiviertel Jahr lang mußte ich ihn aus- und anziehen. Es ging immer weiter rückwärts mit uns; wir liehen und liehen, all unser Eigentum ging verloren und der Vater starb. – Ich habe mich gequält und geplagt, habe gestritten und gestrebt um des Kindes willen, habe Treppen gescheuert und Wäsche gewaschen, grobe und feine. Aber Gott wollte, daß ich es nicht besser haben sollte, aber er wird mich wohl einmal erlösen und für den Knaben sorgen."
Dann schlief sie ein.
Am Morgen fühlte sie sich gekräftigt und, wie sie glaubte, stark genug, wieder an ihre Arbeit zu gehen. Sie war eben in das kalte Wasser gestiegen, als ein Zittern, eine Ohnmacht sie befiel. Krampfhaft griff sie mit der Hand nach vorwärts, machte einen Schritt an das Land und fiel dann um. Der Kopf war auf dem Trockenen, aber die Füße lagen draußen im Fluß. Ihre Holzschuhe, mit denen sie auf dem Grunde gestanden hatte – in jedem von ihnen war eine Strohlage – trieben in der Strömung; hier wurde sie von Maren aufgefunden, die mit Kaffee herunterkam.
Vom Stadtvogt war eine Bestellung zuhause, daß sie sogleich zu ihm kommen möge, er habe ihr etwas zu sagen. Das war zu spät. Ein Barbier wurde geholt, um sie zur Ader zu lassen; aber die Waschfrau war tot.
"Sie hat sich totgetrunken!" sagte der Stadtvogt.
In dem Briefe, der die Nachricht vom Tode des Bruders brachte, war der Inhalt des Testaments angegeben und darin stand, daß sechshundert Reichstaler der Handschuhmacherswitwe vermacht waren, die einmal bei seinen Eltern gedient habe. Nach bestem Gewissen sollte das Geld in kleineren oder größeren Teilen ihr und ihrem Kinde übergeben werden.
"Da hat einmal so ein Techtelmechtel zwischen meinem Bruder und ihr stattgefunden!" sagte der Stadtvogt. "Gut: daß sie aus dem Wege ist, nun bekommt der Knabe das Ganze. Ich werde ihn zu braven Leuten geben, daß ein guter Handwerker aus ihm wird." – Und in diese Worte legte der liebe Gott seinen Segen.
Der Stadtvogt rief den Knaben zu sich, versprach, für ihn zu sorgen und sagte zu ihm, wie gut es sei, daß seine Mutter gestorben wäre, sie taugte nichts.
Sie wurde auf den Kirchhof gebracht, auf den Armenfriedhof. Maren pflanzte einen kleinen Rosenstrauch auf das Grab – und der Knabe stand an ihrer Seite.
"Meine liebe Mutter" sagte er und seine Tränen strömten: "Ist es wahr, daß sie nichts taugte?"
"Ja, sie taugte!" sagte das alte Mädchen und sah zum Himmel auf. "Ich weiß das seit langen Jahren und seit der letzten Nacht noch mehr. Ich sage Dir, sie taugte. Und unser Herrgott im Himmelreich sagt es auch. Laß die Welt nur ruhig sagen: sie taugt nichts!"
ALLES AM RECHTEN PLATZ ...

Es ist über hundert Jahre her.
Da lag hinter dem Walde an dem großen See ein alter Herrenhof, der war rings von tiefen Gräben umgeben, in denen Kolbenrohr, Schilf und Röhricht wuchsen.
Drüben vom Hohlwege herüber erklangen Jagdhornruf und Pferdegetrappel, und deshalb beeilte sich das kleine Gänsemädchen, die Gänse auf der Brücke zur Seite zu treiben, ehe die Jagdgesellschaft
herangaloppiert kam. Sie kamen so geschwind daher, daß sie hurtig auf einen der großen Steine an der Seite der Brücke springen mußte, um nicht unter die Hufe zu kommen. Ein halbes Kind war sie
noch, fein und zierlich, doch mit einem wunderbaren Ausdruck im Antlitz und in den großen, hellen Augen; aber das sah der Gutsherr nicht. Während seines sausenden Galopps drehte er die Peitsche
in seiner Hand, und in roher Lust stieß er sie mit dem Schafte vor die Brust, daß sie hintenüber fiel.
"Alles am rechten Platze!" rief er, "in den Mist mit Dir." Und dann lachte er; denn es sollte ein guter Witz sein, und die anderen lachten mit. Die ganze Gesellschaft schrie und lärmte und die Jagdhunde bellten, es war ganz wie im Liede:
"Reiche Vögel kommen geflogen."
Gott weiß, wie reich er damals war.
Das arme Gänsemädchen griff um sich, als sie fiel und bekam einen der herabhängenden Weidenzweige zu fassen. An diesem hielt sie sich krampfhaft über dem Schlamm, und sobald die Herrschaft und die Hunde im Tore verschwunden waren, versuchte sie, sich herauf zu arbeiten. Aber der Zweig brach oben am Stamme ab und das Gänsemädchen fiel schwer zurück ins Rohr. Im selben Augenblick griff von oben her eine kräftige Hand nach ihr. Es war ein wandernder Hausierer, der ein Stückchen weiter davon zugesehen hatte und sich nun beeilte, ihr zu Hilfe zu kommen.
"Alles am rechten Platze!" sagte er höhnend hinter dem Gutsherrn her und zog sie auf das Trockene. Den abgebrochenen Zweig drückte er gegen die Stelle, wo er sich abgespalten hatte, aber "alles am rechten Platze" läßt sich nicht immer tun. Deshalb steckte er den Zweig in die weiche Erde. "Wachse, wenn Du kannst und schneide denen dort oben auf dem Hofe eine gute Flöte." Er hätte dem Gutsbesitzer und den seinen wohl einen tüchtigen Spießrutenmarsch gegönnt. Dann ging er in den Herrenhof, aber nicht oben in den Festsaal, dazu war er zu geringe. Er ging zu den Dienstleuten in die Gesindestube und sie beschauten seine Waren und handelten. Aber oben von der Festtafel tönte Gekreisch und Gebrüll, das sollte Gesang vorstellen, sie konnte es nicht besser. Es klang Gelächter und Hundegebell. Es war ein wahres Freß- und Saufgelage. Wein und altes Bier schäumten in Gläsern und Krügen und die Leibhunde fraßen mit.
Ein oder das andere von den Tieren wurde von den Junkern geküßt, nachdem sie ihnen erst mit den langen Hängeohren die Schnauzen abgewischt hatten. Der Hausierer wurde mit seinen Waren herauf gerufen, aber nur, damit sie ihre Späße mit ihm treiben konnten. Der Wein war drinnen und der Verstand draußen. Sie gossen Bier für ihn in einen Strumpf, daß er mit trinken könne, aber geschwind! Das war nun ein außerordentlich feiner Einfall und sehr zum Lachen. Ganze Herden Vieh, Bauern und Bauernhöfe wurden auf eine Karte gesetzt und verloren.
"Alles am rechten Fleck!" sagte der Hausierer, als er wohl behalten aus dem Sodom und Gomorra, wie er es nannte, entronnen war. "Die offene Landstraße, das ist der rechte Platz für mich, dort oben war mir nicht wohl zumute." Und das kleine Gänsemädchen nickte ihm von der Feldgrenze aus zu.
Und es vergingen Tage und es vergingen Wochen, und es zeigte sich, daß der abgebrochene Weidenzweig, den der Hausierer neben dem Wassergraben in die Erde gesteckt hatte, sich ständig grün hielt, ja er trieb sogar neue Zweige. Das kleine Gänsemädchen sah, daß er Wurzel gefaßt haben mußte und sie freute sich von ganzem Herzen darüber, denn es war ihr, als gehöre der Baum ihr.
Ja, mit dem Baume ging es vorwärts, aber mit allem anderen auf dem Hofe ging es durch Trunk und Spiel mit großen Schritten rückwärts. Das sind zwei Rollen, auf denen nicht gut stehen ist.
Nicht ganz sechs Jahre waren vergangen, da wanderte der Gutsherr mit Sack und Stock, als armer Mann, vom Hofe. Der wurde von einem reichen Hausierer gekauft und es war derselbe, der einst dort zum Spott und Gelächter gemacht worden war, als man ihm Bier in einem Strumpfe darbot. Aber Ehrlichkeit und Fleiß geben guten Fahrwind. Nun war der Hausierer der Herr auf dem Hofe. Und von Stund an kam kein Kartenspiel mehr dorthin. "Das ist eine schlechte Lektüre," sagte er, "sie entstand damals, als der Teufel das erste Mal die Bibel zu Augen bekam. Er wollte daraus ein Zerrbild schaffen, das ebenso große Anziehungskraft besäße, so erfand er denn das Kartenspiel."
Der neue Herr nahm sich eine Frau, und wer war sie? Es war das kleine Gänsemädchen, das immer sittsam, fromm und gut gewesen war. In den neuen Kleidern sah sie so fein und schön aus, als sei sie als vornehme Jungfrau geboren. Wie ging das zu? Ja, das würde eine zu lange Geschichte für unsere eilfertige Zeit werden, aber es war nun einmal so, und das Wichtigste kommt nun.
Gesegnet und gut war es auf dem alten Hofe. Die Hausmutter stand selbst dem inneren Hause vor und der Hausherr dem äußeren; es war gerade, als quelle der Segen überall hervor, und wo Wohlstand ist, kommt Wohlstand ins Haus. Der alte Hof wurde geputzt und gestrichen, die Gräben gereinigt und Obstbäume gepflanzt. Freundlich und gepflegt sah es hier aus und die Fußböden in den Zimmern waren blank wie poliert. In dem großen Saale saß an den Winterabenden die Hausfrau mit allen ihren Mägden und spann Wolle und Leinen. An jedem Sonntagabend wurde laut aus der Bibel vorgelesen, und zwar von dem Kommerzialrat selbst, denn der Hausierer war Kommerzialrat geworden, aber erst in seinen alten Tagen. Die Kinder wuchsen heran – denn Kinder waren auch gekommen – und alle lernten etwas Rechtes; sie hatten nicht alle gleich gute Köpfe, aber das geht ja in einer jeden Familie so.
Der Weidenzweig draußen war ein großer, prächtiger Baum geworden, der frei und unbeschnitten dastand. "Das ist unser Stammbaum" sagten die alten Leute, "und der Baum soll in Achtung und Ehren gehalten werden!" sagten sie zu den Kindern, auch zu denen, die keinen guten Kopf mitbekommen hatten.
Und nun waren darüber hundert Jahre vergangen.
Es war in unserer heutigen Zeit. Der See war zu einem Moor geworden und der alte Herrenhof war gleichsam wie weggewischt. Eine längliche Wasserpfütze mit ein wenig Steinumrandung an den Seiten war der Rest der tiefen Gräben, und hier stand ein prächtiger alter Baum, der seine Zweige ausbreitete. Das war der Stammbaum. Er stand und zeigte, wie schön ein Weidenbaum sein kann, wenn er wachsen darf, wie er Lust hat. – Er war freilich mitten im Stamme geborsten, von der Wurzel bis zur Krone hinauf und der Sturm hatte ihn ein wenig geneigt, aber er stand, und aus allen Rissen und Spalten, in die der Wind Erde hineingeweht hatte, wuchsen Gras und Blumen. Besonders ganz oben, wo die großen Zweige sich teilten, war gleichsam ein hängender kleiner Garten mit Himbeeren und Vogelgras, ja, auch ein winzig kleiner Vogelbeerbaum hatte dort Wurzel gefaßt und stand schlank und fein in der Mitte oben auf dem alten Weidenbaum, der sich in dem schwarzen Wasser spiegelte, wenn der Wind die Wasserlinien in eine Ecke der Wasserpfütze getrieben hatte. Ein schmaler Fußsteig über den Fronacker führte dicht hier vorbei.
Hoch auf dem Hügel am Walde, mit einer herrlichen Aussicht, lag das neue Schloß, groß und prächtig, mit Glasfenstern, so klar, daß man hätte glauben mögen, es seien gar keine darin. Die große Treppe vor der Tür sah wie eine Laube aus Rosen und großblättrigen Pflanzen aus. Die Grasflächen waren so sauber gehalten und so grün, als ob nach jedem Halm abends und morgens gesehen würde. Drinnen im Saale hingen kostbare Gemälde und mit Seide und Samt bezogene Stühle und Sofas, die fast auf ihren eigenen Beinen einhergehen konnten, Tische mit blanken Marmorplatten und Bücher in Saffian und Goldschnitt gebunden, standen da .... Ja, es waren wohl freilich reiche Leute, die hier wohnten, es waren vornehme Leute; hier wohnten Barone.
Eins paßte zum anderen. "Alles am rechten Fleck" sagten auch sie, und deshalb waren alle Gemälde, die einmal dem alten Hofe zu Schmuck und Ehre gereicht hatten, nun im Gange, der nach der
Dienerkammer führte, aufgehängt worden. Es war ja altes Gerümpel, besonders zwei alte Porträts, die einen Mann in rosenrotem Rocke mit einer Perücke und eine Dame mit gepudertem, hoch frisierten
Haar und einer roten Rose in der Hand darstellten, aber beide mit dem gleichen großen Kranze von Weidenzweigen umgeben. Es waren viele runde Löcher in den beiden Bildern, das kam daher, daß die
kleinen Barone immer ihre Flitzbogen auf die beiden alten Leute abschossen. Das war der Kommerzialrat und die Kommerzialrätin, von denen das ganze Geschlecht abstammte.
"Sie gehören aber nicht richtig in unsere Familie" sagte einer der kleinen Barone. "Er war ein Hausierer gewesen und sie eine Gänsemagd. Sie waren nicht so wie Papa und Mama."
Die Bilder waren altes, häßliches Gerümpel, und "alles am rechten Fleck" sagte man, und so kamen Urgroßvater und Urgroßmutter auf den Gang zur Dienerkammer.
Der Pfarrersohn war Hauslehrer auf dem Schloße. Eines Tages ging er mit den kleinen Baronen und ihrer älteren Schwester, die gerade kürzlich eingesegnet worden war, spazieren. Dabei kamen sie den Fußsteg entlang und zu dem alten Weidenbaume herunter. Und während sie gingen, band sie einen Feldblumenstrauß; "alles am rechten Fleck," er wurde ein kleines Kunstwerk. Währenddessen hörte sie aber doch recht gut alles, was gesagt wurde, und sie freute sich, wie der Pfarrersohn von den Kräften der Natur und der Geschichte großer Männer und Frauen erzählte; sie war eine gesunde, prächtige Natur, voller Adel des Geistes und der Seele und mit einem Herzen, das alles von Gott Erschaffene freudig umfaßte.
Sie machten unten bei dem alten Weidenbaume halt. Der kleinste der Barone wollte gern eine Flöte geschnitten haben, wie er sie schon oft von Weidenbäumen bekommen hatte, und der Pfarrersohn brach einen Zweig ab.
"O, tun sie es nicht" sagte die junge Baronesse; aber es war schon geschehen. "Das ist ja unser alter, viel berühmter Baum. Ich habe ihn so gern. Deshalb werde ich oft zuhause ausgelacht, aber
das tut nichts. Es umschwebt eine Sage den Baum."
Und nun erzählte sie alles, was wir über den Baum gehört haben, über den alten Herrenhof, über das Gänsemädchen und den Hausierer, die sich hier begegneten und die Stammeltern des vornehmen
Geschlechtes und auch der jungen Barone wurden.
"Sie wollten sich nicht adeln lassen, die alten, biederen Leute" sagte sie. "Sie hatten den Wahlspruch: Alles am rechten Platze und sie meinten, nicht dahin zu kommen, wenn sie sich durch Geld
erhöhen ließen. Ihr Sohn, mein Großvater, war es, der Baron wurde; er soll ein großes Wissen besessen haben und hoch angesehen bei Prinzen und Prinzessinnen gewesen sein. Er war bei allen ihren
Festen dabei. Ihn verehren die anderen zuhause am meisten, aber ich weiß selbst nicht, für mich ist etwas an dem alten Paar, was mein Herz zu ihnen zieht. Es muß so gemütlich und patriarchalisch
auf dem alten Hofe gewesen sein, wo die Hausmutter saß und mit allen ihren Mägden spann und der alte Herr laut aus der Bibel vorlas."
"Es waren prächtige Leute, vernünftige Leute" sagte der Pfarrersohn; und dann geriet das Gespräch in das Fahrwasser von Adel und Bürgertum und es war fast, als gehöre der Pfarrersohn nicht zur
Bürgerschaft, so hob er die Vorzüge hervor, von Adel zu sein.
"Es ist ein Glück, zu einem Geschlechte zu gehören, das sich ausgezeichnet hat, und gleichsam schon in seinem Blute den Ansporn zu haben, nach allem Tüchtigen vorwärts zu streben. Herrlich ist
es, eines Geschlechtes Namen zu tragen, der den Zugang zu den ersten Familien gewährleistet. Adel bedeutet edel, das ist wie eine Goldmünze, die ihren Wert aufgeprägt erhalten hat. Es liegt im
Zuge der Zeit, und viele Dichter stimmen natürlich in diesen Ton ein, daß alles, was adlig ist, schlecht und dumm sein soll, aber bei den Armen glänzt alles, und je tiefer man niedersteigt, desto
mehr. Aber das ist nicht meine Ansicht, denn sie ist irrig, völlig falsch.
In den höheren Ständen findet sich mancher ergreifende und schöne Zug. Meine Mutter hat mir einen erzählt und ich selbst könnte mehrere hinzufügen. Sie war zu Besuch in einem vornehmen Hause in
der Stadt, meine Großmutter, glaube ich, hatte die gnädige Frau gesäugt und aufgezogen. Meine Mutter stand im Zimmer mit dem alten, hochadligen Herrn. Da sah er, wie unten zum Hofe hinein eine
alte Frau auf Krücken gehumpelt kam. Jeden Sonntag kam sie und bekam ein paar Schillinge. 'Da ist ja die arme Alte,' sagte der Herr, 'das Gehen fällt ihr so schwer!' Und ehe meine Mutter es sich
versah, war er aus der Tür und die Treppen herunter, die siebzigjährige Exzellenz war selbst zu der armen Frau hinuntergegangen, um ihr den beschwerlichen Weg wegen des Schillings zu ersparen. Es
ist ja nur ein geringer Zug, aber wie das Scherflein der Witwe hat er den Klang eines Herzens in sich, den Klang einer wahren Menschennatur. Darauf sollte der Dichter zeigen, gerade in unserer
Zeit sollte er es besingen, denn es würde Gutes wirken, besänftigen und versöhnen. Wo jedoch ein Mensch, weil er von Geblüt ist und einen Stammbaum hat wie die arabischen Pferde, sich auf die
Hinterbeine setzt und in den Straßen wiehert, und im Zimmer sagt: 'Hier sind Leute von der Straße gewesen!' wenn ein Bürgerlicher drinnen gewesen ist, da ist der Adel in Verderbnis übergegangen
und zu einer Maske geworden, wie Tespis sich eine machte, und man lacht über die Person und macht sie zum Gegenstand des Spottes."
Das war die Rede des Pfarrersohns, sie war zwar etwas lang, aber unterdessen war die Pfeife geschnitten.
Es war eine große Gesellschaft auf dem Schlosse mit vielen Gästen aus der Umgegend und der Hauptstadt. Die Damen waren mit und ohne Geschmack gekleidet. Der große Saal war voller Menschen. Die Pfarrer aus der Umgegend standen ehrebietigst zu einem Knäuel zusammengedrängt in einer Ecke, es sah aus, als seien sie zu einem Begräbnis gekommen; und doch war ein Vergnügen angesagt, es war nur noch nicht in Gang gesetzt.
Ein großes Konzert sollte stattfinden, und daher hatte der kleine Baron seine Weidenflöte mit hereingebracht, aber er konnte ihr keinen Ton entlocken, auch Papa konnte es nicht; deshalb taugte sie eben nichts.
Nun kamen Musik und Gesang an die Reihe, und zwar von jener Art, die hauptsächlich den Ausübenden Freude macht; es war übrigens wirklich niedlich.
"Sie sind auch Virtuos?" sagte ein Kavalier, der das Kind seiner Eltern war, zum Hauslehrer. "Sie blasen Flöte und schneiden sie sogar selbst. Das Genie beherrscht alles, sitzt auf der rechten
Seite – Gott behüte. Ich gehe ganz mit der Zeit, das muß man. Nicht wahr, sie werden uns mit diesem kleinen Instrument entzücken!" Und dann reichte er ihm die Flöte, die von dem Weidenbaume unten
am Wassertümpel geschnitten war, und laut und vernehmlich verkündete er, daß der Hauslehrer ein kleines Flötensolo zum besten geben wolle.
Man wollte ihn zum Gespött machen, das war nicht schwer zu verstehen, und deshalb wollte der Hauslehrer auch nicht blasen, obwohl er es recht wohl gekonnt hätte; aber sie drängten ihn und
nötigten ihn und so nahm er die Flöte und setzte sie an den Mund.
Es war eine wunderliche Flöte. Es erklang ein Ton, so anhaltend wie bei einer Dampflokomotive, nur noch viel schriller. Er klang über den ganzen Hof, den Garten und den Wald und meilenweit ins Land hinaus, und mit dem Ton erhob sich ein Sturmwind, der brauste: "Alles am rechten Platze" – und da flog Papa wie vom Winde getragen aus dem Hause hinaus gerade in das Viehhüterhaus hinein, und der Viehhirt flog hinauf – nicht in den Saal, denn dort hinein gehörte er ja nicht, nein, in die Dienerkammer hinauf, mitten unter die feine Dienerschaft, die in seidenen Strümpfen einherging. Den stolzen Herren schlug der Schreck wie Gicht in die Glieder, daß so eine geringe Person sich mit ihnen an einen Tisch zu setzen wagte.
Aber im großen Saale flog die junge Baronesse an das oberste Tischende, wo zu sitzen sie würdig war, und der Pfarrersohn bekam den Sessel an ihrer Seite, und da saßen sie nun beide, als seien sie ein Brautpaar. Ein alter Graf aus dem ältesten Geschlechte des Landes blieb unverrückt auf seinem Ehrenplatz; denn die Flöte war gerecht, und das soll man sein. Der witzige Kavalier, der die Schuld am Flötenspiel trug, er, der das Kind seiner Eltern war, flog kopfüber zwischen die Hühner, aber nicht allein.
Eine ganze Meile ins Land hinaus klang die Flöte, und man hörte von großen Begebenheiten. Eine reiche Großhändlersfamilie, die mit Vieren ausgefahren war, wurde aus dem Wagen hinaus geblasen und
bekam nicht einmal den hinteren Platz; zwei reiche Bauern, die in letzter Zeit über ihre Kornfelder hinausgewachsen waren, wurden in einen sumpfigen Graben hinab geblasen; es war eine gefährliche
Flöte. Glücklicherweise sprang sie beim ersten Ton und das war gut, denn so kam sie wieder in die Tasche: "Alles am rechten Platze!"
Am nächsten Tage sprach man nicht über die Begebenheit, daher stammt die Redensart "die Pfeife wieder einstecken!" Alles war auch wieder in seiner alten Ordnung, nur daß die beiden alten Bilder,
der Hausierer und das Gänsemädchen, oben im großen Saale hingen. Sie waren dort an die Wand geblasen worden Und da ein wirklicher Kunstkenner sagte, daß sie von Meisterhand gemalt seien, blieben
sie dort hängen und wurden instand gesetzt. Man hatte ja vorher nicht gewußt, daß sie etwas taugten, und woher hätte man das auch wissen sollen. Nun hingen sie auf dem Ehrenplatze.
"Alles am rechten Platze!" und dahin kommt es auch meist! Die Ewigkeit ist lang, länger als diese Geschichte.
DES JUNGGESELLEN NACHTMÜTZE ...
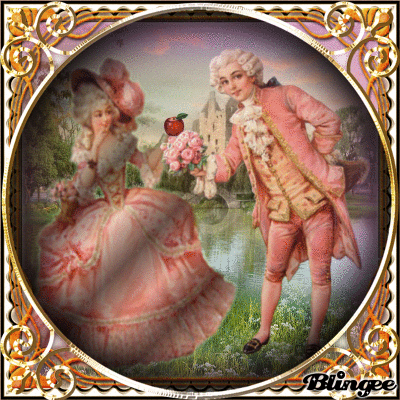
Da gibt es in Kopenhagen eine Gasse, die den wunderlichen Namen "Hyskengasse" trägt. Und weshalb heißt sie so, was hat es zu bedeuten? Es soll deutsch sein, aber damit tut man den Deutschen unrecht. "Häuschen" müßte es heißen und das bedeutet: kleine Häuser. Diese hier waren damals, und das ist viele Jahre her, eigentlich nichts anderes als hölzerne Buden, fast wie man sie heutzutage auf den Märkten aufgestellt sieht. Ein wenig größer waren sie wohl und mit Fenstern versehen, aber die Scheiben waren aus Horn oder Blasenhaut, denn in jener Zeit waren gläserne Scheiben zu teuer für die Häuser. Aber die Zeit liegt so weit zurück, daß Urgroßvaters Urgroßvater, wenn er davon sprach, es auch schon die alten Zeiten nannte. Es ist mehrere hundert Jahre her. Damals trieben die reichen Kaufleute in Bremen und Lübeck den Handel in Kopenhagen. Sie selbst kamen nicht herauf, sie sandten nur ihre Handlungsgehilfen, und diese wohnten in den Holzbuden der "Kleinhäuschengasse" und besorgten den Verkauf von Bier und Gewürz. Das deutsche Bier war so gut, und es gab so viele Sorten: Bremer, Prysinger, Emser Bier – ja, Braunschweiger Mumme, und dann alle die Gewürze wie Safran, Anis, Ingwer und besonders Pfeffer. Dieser spielte die Hauptrolle hier, und daher trug er auch den deutschen Handlungsgehilfen in Dänemark den Namen "Pfefferschwengel" ein. Sie mußten sich zuhause sonderbarerweise verpflichten, sich hier oben nicht zu verheiraten. Viele von ihnen wurden hier alt; selbst mußten sie für sich sorgen, im Hause umherpusseln und kramen, selbst ihr Feuer machen – daher wurden einige ganz eigenartige alte Burschen mit wunderlichen Gedanken und Gewohnheiten. Nach ihnen nannte man bald jede unverheiratete Mannsperson, die in ein gesetzteres Alter kam, einen "Pfefferschwengel." Alles dies muß man wissen, um die Geschichte zu verstehen.
Man macht sich über den Junggesellen lustig und sagt, er solle sich seine Nachtmütze über die Ohren ziehen und zu Bett gehen:
"Schneidet Holz zu Schwellen,
Ihr alten Junggesellen.
Die Nachtmütz liegt bei Euch im Bett,
Doch kein Feinsliebchen weich und nett."
Ja, so singt man von ihnen! Man verspottet den Junggesellen und seine Nachtmütze – just weil man ihn und sie so wenig kennt – ach, die Nachtmütze soll man sich nie herbeiwünschen! Und weshalb nicht? Ja, hört nur!
Die Kleinhäuschengasse war in jenen früheren Zeiten nicht gepflastert, die Leute traten von einem Loch in das andere; es war so enge dort, und die Häuser lehnten sich über die Gasse hinweg so dicht zueinander, daß oft von einem Haus zum anderen ein Seil gespannt wurde, und immer war in dieser Enge ein gewürziger Geruch von Pfeffer, Safran und Ingwer. Hinter dem Tische standen nicht viel junge Leute, meist waren es alte Burschen, doch waren sie nicht, wie wir sie uns denken, mit Perücke oder Nachtmütze bekleidet oder mit Kniehosen und hoch hinaufgeknöpften Westen und Röcken, nein, so ging Urgroßvaters Urgroßvater gekleidet, und so steht er noch heute auf dem gemalten Bilde, die Pfefferschwengel hatten nicht die Mittel, sich malen zu lassen, und doch wären sie es wert gewesen, daß man von ihnen ein Bild aufbewahrt hätte, so wie sie dort hinter den Tischen standen und im Feiertagsrocke zur Kirche wanderten. Der Hut war breitkrempig und hatte einen hohen Kopf, oft schmückte ein junger Gesell ihn mit einer Feder. Das wollene Hemd war von einem heruntergeklappten Leinenkragen bedeckt, das Wams war eng anliegend und fest zugeknöpft, der Mantel hing lose darüber und die Hosen reichten bis in die breiten Schnabelschuhe hinab, denn Strümpfe trugen sie nicht. Im Gürtel steckten Messer und Löffel und meist noch ein großes Messer, um sich damit wehren zu können, davon mußte man in jenen Zeiten oft Gebrauch machen.
Ganz, wie eben beschrieben, ging an den Feiertagen der alte Anton, einer der ältesten Pfefferschwengel der Kleinhäuschengasse, gekleidet, nur hatte er nicht den hochköpfigen Hut, sondern eine Kapuze auf, und unter dieser noch eine gestrickte Mütze, eine richtige Nachtmütze. An die hatte er sich so gewöhnt, daß sie immer auf seinem Kopfe sitzen blieb. Er besaß zwei Stück davon. Er war zum Malen wie geschaffen; dürr wie ein Stock, mit tiefen Runzeln um Mund und Augen, hatte er lange, knochige Finger und buschige, graue Augenbrauen. Über dem linken Auge hing ein zottiges Büschel Haare, schön war es nicht, aber man konnte ihn sogleich daran erkennen. Man wußte von ihm, daß er aus Bremen war, und doch kam er eigentlich nicht daher, nur sein Herr wohnte dort. Er selbst stammte aus Thüringen, aus der Stadt Eisenach, dicht unter der Wartburg. Davon pflegte der alte Anton nicht viel zu sprechen, desto mehr dachte er daran.
Die alten Handlungsgehilfen in der Gasse kamen selten zusammen, jeder blieb in seinem Laden, der zeitig am Abend geschlossen wurde. Dann sah es dort düster aus, nur ein matter Lichtschein drang durch das kleine Hornfenster am Dache hinaus, hinter dem gewöhnlich der alte Gesell mit seinem deutschen Gesangbuche auf dem Bettrand saß und sein Abendlied sang. Mitunter ging er auch bis tief in die Nacht hinein im Hause umher und pusselte allerlei Kram zurecht, kurzweilig war es sicherlich nicht. Fremd im fremden Lande leben zu müssen ist ein bitteres Los, niemand bekümmert sich um einen, außer, wenn man jemandem im Wege steht.
Oft, wenn draußen die Nacht so recht dunkel war und der Regen hernieder strömte, konnte es hier gar schauerlich und öde sein. Laternen gab es nicht, außer einer einzigen, die sehr klein war; sie hing gerade vor dem Bilde der heiligen Jungfrau, das an dem einen Ende der Gasse an die Wand gemalt war. Man hörte nur das Regenwasser laufen und die Tropfen gegen das Balkenwerk schlagen. Solche Abende waren lang und einsam, wenn man sich nicht etwas vornahm. Auspacken und einpacken, Tüten drehen und die Waagschale putzen ist nicht jeden Tag notwendig, aber dann nimmt man etwas anderes vor, und das tat der alte Anton. Er nähte sich selbst seine Sachen zurecht oder Dickte seine Schuhe. Wenn er dann endlich ins Bett kam, so behielt er nach seiner Gewohnheit seine Nachtmütze auf, zog sie noch ein wenig tiefer über den Kopf, aber sogleich schob er sie wieder hinauf, um zu sehen, ob auch das Licht gut gelöscht wäre. Er befühlte es, drückte noch einmal auf den Docht, legte sich dann auf die andere Seite und zog die Nachtmütze wieder herab. Doch oft kam ihm im gleichen Augenblick der Gedanke, ob wohl auch unten im Laden jede Kohle in dem kleinen Öfchen ganz ausgebrannt und gut abgedämpft sei. Ein kleiner Funke könne vielleicht doch zurückgeblieben sein, sich entzünden und Schaden anrichten. Und so kroch er wieder aus seinem Bette heraus und kletterte die Leiter hinunter, denn eine Treppe konnte man es nicht nennen. Kam er dann zum Ofen, so war dort kein Fünkchen mehr zu sehen, und er konnte wieder umkehren. Doch oft mußte er auf halbem Wege stehen bleiben, denn plötzlich war es ihm ungewiß, ob er auch die eiserne Stange vor die Tür gelegt und die Fensterläden verriegelt habe. Ja, dann mußte er auf seinen dünnen Beinen wieder hinab. Er fror und die Zähne klapperten ihm, wenn er wieder ins Bett kroch, denn die Kälte tritt erst dann richtig zutage, wenn sie weiß, daß sie nun fort soll. Er zog das Bett höher hinauf, die Nachtmütze tiefer über die Augen und wandle die Gedanken fort von des Tages Werk und Beschwer. Aber zu einer richtigen Behaglichkeit kam es doch nicht, denn nun kamen die alten Erinnerungen und hingen ihre Gardinen auf, darinnen stecken manchmal Stecknadeln, an denen man sich sticht, daß einem die Tränen in die Augen treten. Und so geschah es auch dem alten Anton oft; es kamen ihm heiße Tränen, die klarsten Perlen. Sie fielen auf die Bettdecke oder auf den Fußboden nieder und erklangen schmerzlich wie eine zerspringende Herzenssaite. Sie verdunsteten und loderten dabei zu einer hellen Flamme empor, die ein Lebensbild beleuchteten, das nie aus seinem Herzen schwand. Trocknete er dann seine Augen mit der Nachtmütze, so wurden Träne und Bild zerdrückt; doch die Quellen versiegten nicht, sie lagen in seinem Herzen. Die Bilder kamen nicht, wie sie in der Wirklichkeit aufeinander gefolgt waren. Oft kamen allein die schmerzlichen, oft aber leuchteten auch die wehmütig frohen auf, aber just diese waren es, die die stärksten Schatten warfen.
"Schön sind die Buchenwälder Dänemarks" hieß es, doch schöner noch erhoben sich vor Antons innerem Auge die Buchenwälder um die Wartburg. Mächtiger und ehrwürdiger erschienen ihm die alten Eichen droben um die stolze Ritterburg, wo die Schlingpflanzen über Felsen und Steinblöcke hinabhingen. Süßer dufteten dort des Apfelbaumes Blüten als im dänischen Land; lebhaft fühlte und empfand er es noch immer. Eine Träne rollte, erklang und leuchtete auf. Deutlich konnte er in dem klaren Schein zwei kleine Kinder, einen Knaben und ein Mädchen, spielen sehen. Der Knabe hatte rote Wangen, blondes Lockenhaar und ehrliche blaue Augen, das war des reichen Krämers Sohn, der kleine Anton, er selbst; das kleine Mädchen hatte braune Augen und schwarzes Haar; keck und klug sah sie aus, es war des Bürgermeisters Tochter, Molly. Die beiden spielten mit einem Apfel, sie schüttelten ihn und horchten, wie innen die Kerne klapperten. Dann schnitten sie ihn mitten durch, und jedes bekam ein Stück. Die Kerne teilten sie zwischen sich und aßen sie auf bis auf einen, der sollte in die Erde gelegt werden, meinte das kleine Mädchen.
"Dann sollst Du einmal sehen, was daraus wird; es wird etwas daraus, was Du Dir gar nicht denken kannst! Ein ganzer Apfelbaum wird daraus, aber nicht gleich."
Den Kern pflanzten sie in einen Blumentopf, beide waren sehr eifrig bei der Sache. Der Knabe bohrte mit seinem Finger ein Loch in die Erde, das kleine Mädchen legte den Kern hinein und beide bedeckten ihn mit Erde.
"Nun darfst Du ihn aber morgen nicht wieder herausnehmen, um zu sehen, ob er Wurzeln bekommen hat," sagte sie, "das darf man nicht. Ich habe es mit meinen Blumen auch getan, aber nur zweimal, ich wollte sehen, ob sie wüchsen. Damals wußte ich es nicht besser, und die Blumen starben!"
Der Blumentopf blieb bei Anton, und jeden Morgen, den ganzen Winter lang, sah er nach ihm, doch es war nur die schwarze Erde zu sehen. Nun kam das Frühjahr, die Sonne schien warm, da sproßten aus dem Blumentopf zwei kleine grüne Blättchen hervor.
"Das bin ich und Molly!" sagte Anton, "ist das hübsch, ach, ist das einzigschön!"
Bald kam auch ein drittes Blatt; wen sollte das bedeuten? Da kam wieder eins und noch eins. Jeden Tag und jede Woche wurde das Pflänzchen größer und schließlich wurde es ein ganzer Baum. Alles spiegelte sich in der einen Träne ab, die zerdrückt wurde und verschwand. Aber sie konnte wieder hervorquellen – aus des alten Antons Herzen.
Dicht bei Eisenach dehnt sich eine Kette steiniger Berge aus, einer von ihnen ist stumpf und rund und trägt weder Baum noch Strauch noch Gras, er wird der Venusberg genannt. In seinem Innern wohnt Frau Venus, eine Göttin aus heidnischer Zeit, die auch Frau Holle genannt wird; das wußte und weiß noch jetzt jedes Kind in Eisenach. Zu sich hinein hatte sie den Ritter Tannhäuser gelockt, den Minnesänger aus der Wartburg Sängerkreis.
Die kleine Molly und Anton standen oft an dem Berge, da sagte sie einmal: "Getraust Du Dich anzuklopfen und zu rufen: Frau Holle, Frau Holle, mach auf, hier ist Tannhäuser" Doch das wagte Anton nicht. Molly wagte es. Doch nur die Worte: "Frau Holle! Frau Holle" rief sie laut und deutlich, den Rest ließ sie im Winde verfliegen, so undeutlich, daß Anton überzeugt war, daß sie eigentlich gar nichts gesagt habe. So keck sah sie dabei aus, so keck wie zuweilen, wenn sie mit anderen Mädchen ihm im Garten begegnete, die ihn alle küssen wollten, gerade weil sie wußten, daß er nicht geküßt sein wollte und um sich schlug; sie allein wagte es.
"Ich darf ihn küssen!" sagte sie stolz und nahm ihn um den Hals; darin lag ihre Eitelkeit, und Anton fand sich darein und dachte nicht weiter darüber nach. Wie reizend sie war und wie keck! Frau Holle im Berge sollte auch schön sein, aber ihre Schönheit, sagte man, sei die verführerische Schönheit des Bösen. Die höchste Schönheit dagegen sei die der heiligen Elisabeth, der Schutzheiligen des Landes, der frommen thüringischen Fürstin, deren gute Taten in Sage und Legende so manchen Ort hier umraunten. In der Kapelle hing ihr Bild von silbernen Lampen umgeben; – doch sie glich Molly nicht im entferntesten.
Der Apfelbaum, den die beiden Kinder gepflanzt hatten, wuchs Jahr für Jahr; er wurde so groß, daß er in den Garten in die frische Luft gepflanzt werden mußte, wo der Tau fiel, die Sonne warm hernieder strahlte und er Kräfte bekam, um dem Winter zu widerstehen. Nach des Winters Drangsal war es im Frühjahr gleichsam, als setze er vor Freude Blüten an, und im Herbst trug er zwei Äpfel, einen für Molly, einen für Anton, weniger hätten es auch nicht sein dürfen.
Der Baum war lustig emporgeschossen, und Molly hielt es wie der Baum, sie war frisch wie eine Apfelblüte; aber nicht lange durfte er die Blüte schauen. Die Zeiten wechseln, alles wechselt! Mollys Vater verließ die alte Heimat, und Molly zog mit ihm, weit fort. Ja, in unserer Zeit ist es nur eine Reise von wenigen Stunden, doch damals brauchte man mehr als Nacht und Tag, um so weit östlich von Eisenach, ganz an die äußerste Grenze von Thüringen nach der Stadt, die noch jetzt Weimar genannt wird, zu gelangen.
Und Molly weinte und Anton weinte; – alle die Tränen rannen in einer einzigen Träne zusammen, und diese hatte den rötlichen, lieblichen Schimmer der Freude. Molly hatte ihm gesagt, sie mache sich mehr aus ihm als aus aller Herrlichkeit Weimars.
Es verging ein Jahr, es vergingen zwei, drei Jahre, und in dieser ganzen Zeit kamen zwei Briefe, den einen brachte ein Fuhrmann, den anderen hatte ein Reisender mitgenommen. Sie hatten einen langen, beschwerlichen Weg, mit vielen Umwegen an Städten und Dörfern vorbei, hinter sich.
Wie oft hatten nicht Anton und Molly zusammen die Geschichte von Tristan und Isolde gehört, und ebenso oft hatte er dabei an sich selbst und Molly gedacht, obwohl der Name Tristan bedeuten sollte, daß "er mit Trauer geboren war," und das paßte nicht auf Anton. Niemals wollte er auch, gleich wie Tristan, den Gedanken hegen müssen, "sie hat mich vergessen." Doch auch Isolde vergaß ja nicht den Freund ihres Herzens, und als sie beide gestorben und einzeln zu beiden Seiten der Kirche begraben waren, wuchsen die Lindenbäume aus ihren Gräbern über das Kirchendach hin und trafen einander dort blühend. Das erschien Anton so schön und doch zugleich so traurig – aber mit ihm und Molly konnte es nicht traurig ausgehen, und deshalb flötete er ein Lied des Minnesängers Walther von der Vogelweide:
"Unter der Linden.
An der Heide."
Und so besonders schön erklang es darin:
"Vor dem Wald mit süßem Schall
Tandaradei.
Sang im Tal die Nachtigall."
Die Weise lag ihm immerfort auf der Zunge, und er sang sie und flötete sie in der mondhellen Nacht, als er zu Pferde durch den tiefen Hohlweg ritt, um nach Weimar zu kommen und Molly zu besuchen. Er wollte unerwartet kommen, und er kam unerwartet.
Wohl empfing ihn ein freundliches Willkommen, ein voller Becher Weins, eine muntere Gesellschaft, ja eine vornehme Gesellschaft, eine gemütliche Stube und ein gutes Bett, und doch war es nicht, wie er sich gedacht und erträumt hatte. Er verstand nicht sich, verstand nicht die anderen; aber wir verstehen es. Man kann in einem Hause, in einer Familie sein, und doch nicht festen Fuß fassen, man plaudert miteinander, wie man in einem Postwagen plaudert, kennt einander, wie man im Postwagen sich kennt, geniert einander und wünscht sich selbst oder den guten Nachbar Meilen weit fort. Und so erging es Anton.
"Ich bin ein ehrliches Mädchen," sagte Molly zu ihm, "ich will es Dir selber sagen. Vieles hat sich verändert, seit wir als Kinder zusammen waren. Äußerlich und innerlich ist es anders geworden, Gewohnheit und Willen haben keine Macht über unser Herz. Anton. Ich will nicht, daß Du unfreundlich an mich zurückdenkst, jetzt, wo ich bald so weit fort von hier sein werde. Glaube mir, ich werde Dir stets ein gutes Gedenken bewahren, aber geliebt, wie ich nun weiß, daß man einen anderen Menschen lieben kann, habe ich Dich nie. Darein mußt Du Dich finden. Lebe wohl, Anton!"
Und Anton sagte auch Lebewohl; nicht eine Träne kam in seine Augen, doch er fühlte, daß keine Liebe zu Molly mehr in seinem Herzen war. Die glühende Eisenstange wie die gefrorene Eisenstange reißen die Haut mit der gleichen Empfindung für uns von den Lippen, wenn wir sie küssen, und er küßte gleich stark in Liebe wie in Haß.
Nicht einen Tag gebrauchte Anton, um wieder heim nach Eisenach zu kommen, doch das Pferd, das er ritt, war zugrunde gerichtet.
"Was will das sagen" rief er, "ich bin zugrunde gerichtet, und ich will alles vernichten, was mich an sie erinnern kann. Frau Holle, Frau Venus, Du heidnisches Weib! – Den Apfelbaum will ich zerbrechen und zerstampfen, mit Stumpf und Stiel soll er ausgerissen werden, nie soll er mehr blühen und Frucht tragen!"
Aber der Baum wurde nicht vernichtet; er selbst war innerlich vernichtet und lag fiebernd auf dem Bette. Was konnte ihm wieder aufhelfen? Eine Medizin kam, die es vermochte, die bitterste, die sich finden läßt, um den siechen Körper und die verkrampfte Seele wieder aufzurütteln: Antons Vater war nicht mehr der reiche Kaufmann. Schwere Tage, Tage der Prüfung, standen vor der Tür. Das Unglück wälzte sich heran, in großen Wogen drang es in das einst reiche Haus. Der Vater war ein armer Mann, die Sorgen und das Unglück lähmten ihn völlig. Da hatte Anton an anderes zu denken, als an Liebeskummer und seinen Zorn gegen Molly. Er mußte ordnen, helfen, tüchtig zupacken, selbst in die weite Welt hinaus mußte er, um sein Brot zu verdienen.
Er kam nach Bremen, machte Not und schwere Tage durch; das macht den Sinn entweder hart oder weich, oft allzu weich. So ganz anders waren Welt und Menschen, als er sie sich in seiner Kindheit gedacht hatte! Was waren ihm nun der Minnesänger Lieder: Kling und Klang, leere Worte. Ja, das war seine Meinung zu Zeiten, doch ein andermal klangen ihn die Weisen zu Herzen und ihm ward fromm zu Sinn.
"Gottes Wille ist der beste!" sagte er dann wohl. "Gut war es, daß der liebe Gott Mollys Herz nicht an mich band. Wozu hätte es wohl geführt, da sich das Glück so gewendet hat. Sie ließ von mir, bevor sie noch etwas wußte oder nur ahnte, daß solch ein Umschlag vom Wohlstand in sein Gegenteil bevorstand. Gott in seiner Gnade hat es so gefügt, und er hat es zum Besten gefügt. Alles geschieht nach seinem weisen Willen. Sie konnte nichts dafür, und doch war ich ihr so bitter feind!"
Und Jahre vergingen. Antons Vater war tot, Fremde wohnten in seinem Vaterhause. Doch Anton sollte es wiedersehen. Sein reicher Herr sandte ihn auf eine Geschäftsreise, die ihn durch seine Geburtsstadt Eisenach führte. Die alte Wartburg stand unverändert droben auf den Felsen, mit den versteinerten Gestalten des "Mönches und der Nonne." Die mächtigen Eichen bildeten noch immer den gleichen Umriß, wie in seiner Kindheit. Der Venusberg schimmerte nackt und grau aus dem Tale herauf. Gern hätte er gesagt: "Frau Holle, Frau Holle! Schließ auf den Berg, dann bleibe ich doch im Boden der Heimat!"
Das war ein sündhafter Gedanke, und er bekreuzigte sich. Da sang ein kleiner Vogel aus dem Gebüsch, und das alte Minnelied kam ihm in den Sinn:
"Vor dem Wald mit süßem Schall
Tandaradei.
Sang im Tal die Nachtigall."
So vieles fiel ihm wieder ein hier, in der Stadt seiner Kindheit, die er durch Tränen wiedersah. Sein Vaterhaus stand wie zuvor, aber der Garten war umgelegt. Ein Feldweg führte über eine Ecke des alten Gartenlandes, und der Apfelbaum, den er damals nicht zerstört hatte, stand noch dort, aber draußen vor dem Garten auf der anderen Seite des Weges. Doch die Sonne beschien ihn noch wie früher, er trug reiche Frucht, und seine Zweige bogen sich unter ihrer Last zu Boden.
"Er gedeiht!" sagte er, "er kann es."
Einer von seinen großen Zweigen war abgebrochen; leichtfertige Hände hatten es getan, der Baum stand ja am offenen Fahrweg.
"Man bricht seine Blüten ohne einen Dank, man stiehlt seine Früchte und knickt seine Zweige; hier kann man sagen, wenn man von einem Baume wie von einem Menschen sprechen kann: Es ist ihm nicht an der Wiege gesungen worden, daß er einst so dastehen würde. Seine Geschichte begann so schön, und was ist nun daraus geworden? Verlassen und vergessen, ein Gartenbaum am Graben beim Felde an der Landstraße. Dort steht er ohne Schutz, zerzaust und geknickt. Er verdorrt zwar nicht davon, doch mit den Jahren werden die Blüten weniger, die Früchte bleiben aus und zuletzt – Ja, dann ist seine Geschichte aus."
Das waren Antons Gedanken dort unter dem Baume, und das dachte er noch manche Nacht in der kleinen einsamen Kammer seiner Holzhütte im fremden Lande in der Kleinhäuschengasse in Kopenhagen, wohin ihn sein reicher Herr, der Kaufmann in Bremen, gesandt hatte unter der Bedingung, daß er sich nicht verheirate.
"Sich verheiraten! Ho, ho" lachte er so tief und seltsam.
Der Winter war zeitig gekommen, es fror hart. Draußen pfiff ein solcher Schneesturm, daß jeder, der irgend konnte, in seinen vier Wänden blieb. Daher kam es auch, daß Antons Gegenüber es nicht bemerkte, daß sein Laden zwei ganze Tage nicht geöffnet wurde und er selbst sich gar nicht zeigte, denn wer ging aus in dem Wetter, der es nicht mußte?
Es waren graue, dunkle Tage, und im Laden, dessen Fenster ja nicht aus Glas waren, wechselten nur Dämmerlicht und stockfinstere Nacht. – Der alte Anton hatte seit zwei Tagen sein Bett nicht verlassen, er hatte nicht mehr die Kraft dazu. Das harte Wetter draußen hatte er lange schon in seinen Gliedern gespürt. Verlassen lag der alte Junggeselle und konnte sich nicht helfen; kaum konnte er den Wasserkrug erreichen, den er neben das Bett gestellt hatte; nun war der letzte Tropfen auch ausgetrunken. Es war weder Fieber noch Krankheit, es war das Alter, das ihn lähmte. Es war fast wie eine beständige Nacht um ihn dort oben, wo er lag. Eine kleine Spinne, die er nicht sehen konnte, spann zufrieden und emsig ihr Netz über ihn hin, als sollte hier doch wenigstens ein klein wenig neuer frischer Trauerflor wehen, falls der Alte seine Augen schlösse.
So lang und schleppend leer war die Zeit; Tränen hatte er nicht mehr, Schmerzen auch nicht; Molly lebte nicht mehr in seinen Gedanken. Er hatte ein Gefühl, als versänken die Welt und ihr Treiben vor ihm, als läge er schon außerhalb der Grenze; niemand dachte ja an ihn. Einen Augenblick meinte er Hunger zu fühlen, auch Durst – ja, er fühlte es. Aber niemand kam, ihn zu erquicken, niemand wollte kommen. Er dachte an die heilige Elisabeth, seiner Heimat und Kindheit Heilige, Thüringens edle Herzogin, die hochvornehme Frau, die, als sie noch hier auf Erden wandelte, selbst in die Hütten der Armen stieg und den Kranken Hoffnung und Erquickung brachte. Ihre frommen Taten standen licht vor seiner Seele. Er dachte daran, wie sie für alle, die litten, Worte des Trostes fand, wie sie der Kranken Wunden wusch und den Hungernden Speise brachte, ob auch ihr gestrenger Gemahl ihr darob zürnte. Er entsann sich der Sage, wie einmal, als sie mit ihrem mit Wein und Brot gefüllten Korbe daherkam, ihr Gemahl, der ihre Schritte bewachte, hervortrat und zornig fragte, was sie im Korbe trüge, und wie sie da voller Schrecken antwortete, es seien Rosen, die sie im Garten gepflückt habe, wie er dann das Tuch vom Korbe riß und das Wunder um der frommen Frau willen geschah, daß Wein und Brot, ja alles, was im Korbe lag, sich in Rosen verwandelte.
So lebte die Heilige in den Gedanken des alten Anton, so stand sie leibhaftig vor seinem matten Blick vor dem Bette in der geringen Holzhütte im dänischen Land. Er entblößte sein Haupt, sah in ihre milden Augen, und alles ringsum war voller Glanz und Rosen, die sich immer duftender ausbreiteten. Da drang auch ein lieblicher Äpfelduft zu ihm; ein blühender Apfelbaum streckte seine Zweige über ihn hin, es war der Baum, den er mit Molly einst als kleinen Kern gepflanzt hatte.
Und der Baum streute seine duftenden Blüten auf seine heiße Stirn nieder und kühlte sie; sie fielen auf seine verschmachtenden Lippen und taten ihm wohl wie stärkender Wein und Brot, sie fielen auf seine Brust, und er fühlte sich so leicht, so wohlig wie zum schlummern.
"Nun schlafe ich" flüsterte er stille; "der Schlaf tut wohl. Morgen bin ich wieder richtig frisch und kann aufstehen. Herrlich, herrlich! Den Apfelbaum, in Liebe gepflanzt, sehe ich in all seiner Pracht."
Und er schlief.
Am Tage darauf, es war der dritte Tag, seit der Laden geschlossen blieb – der Schnee fegte nicht mehr vom Himmel – suchte der Nachbar nach dem alten Anton, der sich noch immer nicht zeigte. Er lag ausgestreckt, tot, seine alte Nachtmütze fest zwischen die Hände gedrückt. Im Sarge bekam er sie nicht auf, er hatte ja noch eine, rein und weiß.
Wo waren jetzt die Tränen, die er geweint hatte? Wo waren die Perlen? In der Nachtmütze blieben sie – die echten gehen in der Wäsche nicht aus – mit der Mütze wurden sie verwahrt und vergessen. – Die alten Gedanken, die alten Träume sind noch immer in des Junggesellen Nachtmütze. Wünsch sie Dir nicht. Sie würde Dir den Kopf allzu heiß machen, den Puls stärker schlagen lassen, Dir Träume bringen, schwer, als seien sie Wirklichkeit. Das erlebte der Erste, der sie aufsetzte, und doch war es ein halbes Jahrhundert später und der Bürgermeister selber, der mit einer Frau und elf Kindern wohlversorgt zwischen seinen vier Wänden saß. Er träumte sogleich von unglücklicher Liebe, Fallit und Nahrungssorgen.
"Puh! wie die Nachtmütze einheizt!" sagte er und riß sie vom Kopfe, und es rollte eine Perle und noch eine Perle zu Boden, sie erklangen und leuchteten. "Das ist die Gicht!" sagte der Bürgermeister, "die mir vor den Augen flimmert!"
Es waren Tränen, vor einem halben Jahrhundert geweint, geweint von dem alten Anton aus Eisenach.
Wer auch später die Nachtmütze aufsetzte, immer bekam er Geschichten und Träume, seine eigene Geschichte verwandelte sich in die Geschichte Antons. Es wurde ein ganzes Märchen, es wurden viele daraus, die mögen andere erzählen. Nun haben wir die erste erzählt, und das ist unser letztes Wort: Wünsche Dir nie des Junggesellen Nachtmütze.
DER FLASCHENHALS ...

In der engen, krummen Straße zwischen ärmlichen Häusern stand ein schmales, hohes Haus aus Fachwerk, das schon überall aus den Fugen ging. Arme Leute wohnten hier, und am ärmlichsten sah es in der Dachkammer aus, wo vor dem kleinen Fenster im Sonnenschein, ein altes verbeultes Vogelbauer hing, das nicht einmal ein ordentliches Trinknäpfchen hatte, sondern nur einen umgekehrten Flaschenhals mit einem Pfropfen unten. So ließ er sich mit Wasser füllen. Ein altes Mädchen stand an dem offenen Fenster, sie hatte eben den Käfig mit Vogelmiere geschmückt, in dem ein kleiner Hänfling von Stange zu Stange hüpfte und sang, daß es schallte.
"Ja, Du hast gut singen!" sagte der Flaschenhals. Freilich sagte er es nicht so, wie wir es sagen können, denn ein Flaschenhals kann ja nicht sprechen, aber er dachte es in der Art bei sich, wie wir Menschen auch mit uns selbst sprechen. "Ja, Du hast gut singen, Du hast Deine ganzen Glieder. Du solltest einmal in meiner Lage sein, Deinen Unterleib verlieren und nur noch Hals und Mund übrig behalten, noch dazu mit einem Pfropfen darin, dann würdest Du nicht singen. Aber es ist doch gut, daß wenigstens einer vergnügt ist. Ich habe keinen Grund zum Singen, und ich kann es auch nicht. Damals, als ich noch eine ganze Flasche war, konnte ich es, wenn man einen Pfropfen gegen mich rieb. Damals wurde ich die wahre Lerche, die große Lerche genannt! – Und dann damals, als ich mit der Kürschnersfamilie im Walde war, und die Tochter sich verlobte – ja, daran erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen! Ich habe doch viel erlebt, wenn ich es überdenke! Ich bin durch Feuer und durch Wasser gegangen, unten in der schwarzen Erde bin ich gewesen, und weiter in die Höhe hinauf gekommen als die Meisten, und nun schwebe ich draußen vor dem Vogelbauer in Luft und Sonnenschein. Es wäre wohl der Mühe wert, meine Geschichte zu hören, aber ich spreche nicht laut darüber, denn das kann ich nicht."
Und so erzählte sie sich, oder vielmehr, dachte sie sich ihre Geschichte, die merkwürdig genug war. Und der kleine Vogel sang lustig sein Liedchen, und unten auf der Straße fuhr man und ging man, jeder dachte an sich oder an überhaupt gar nichts, aber das tat der Flaschenhals.
Er dachte zurück an den flammenden Schmelzofen in der Fabrik, wo er ins Leben geblasen wurde. Er erinnerte sich noch, daß er ganz warm gewesen war und, als er in den glühenden Ofen hineingeschaut hatte, die größte Lust verspürt hatte, gerade wieder hineinzuspringen, sich aber später nach und nach, je nach dem Grade seiner Abkühlung, recht wohl befunden hatte, wo er war. Er stand in Reih und Glied in einem ganzen Regiment von Brüdern und Schwestern, alle aus demselben Ofen, aber einige waren zu Champagnerflaschen geblasen worden, andere zu Bierflaschen, und das ist ein Unterschied. Später in der Welt draußen kann freilich eine Bierflasche den köstlichsten Lacrimae Christi in dich fassen und eine Champagnerflasche mit Wichse gefüllt sein, aber wozu man geboren ist, kann man doch am Äußeren erkennen; Adel bleibt Adel, selbst mit Wichse im Leibe.
Bald wurden alle Flaschen eingepackt und unsere Flasche mit. Damals dachte sie noch nicht daran, daß sie einst als Flaschenhals enden würde, um sich nach und nach zu einem Vogelnäpfchen herauf zu dienen, was doch immerhin ein ehrlicher Beruf ist; man ist doch etwas. Sie sah erst das Tageslicht wieder, als sie mit anderen Kameraden im Keller eines Weinhändlers ausgepackt und das erste Mal gespült wurde; das war ein wunderliches Gefühl. Da lag sie nun leer und ohne Pfropfen und fühlte sich so merkwürdig flau. Es fehlte ihr etwas, aber sie wußte selbst nicht, was es war. Nun wurde sie mit einem guten, herrlichen Wein gefüllt; sie bekam einen Pfropfen, wurde mit Lack geschlossen und bekam die Aufschrift: "Prima Sorte," das war gerade, als habe sie beim Examen die beste Nummer erhalten. Aber der Wein war gut, und die Flasche war auch gut. Ist man jung, so ist man Lyriker, es sang und klang in ihr von Dingen, die ihr ganz unbekannt waren, von grünen, sonnigen Bergen, wo der Wein wächst und muntere Mädchen und fröhliche Burschen singen und sich küssen. Ja, es ist herrlich, zu leben! Von alledem sang und klang es in der Flasche wie in jungen Dichtern, die oft auch nichts von dem wissen, was sie besingen.
Eines Morgens wurde sie gekauft. Der Laufbursche des Kürschners sollte eine Flasche Wein vom besten bringen, und so kam sie in den Eßkorb zu Schinken, Käse und Wurst; dort gab es die herrlichste Butter, das feinste Brot. Die Kürschnerstochter selbst packte sie ein, sie war so jung, so schön; die braunen Augen lachten, ein Lächeln lag um ihren Mund, das ebenso sprechend war wie die Augen. Sie hatte feine weiche Hände; so weiß waren sie, doch Hals und Brust waren weißer noch, man konnte sogleich sehen, daß sie eins der hübschesten Mädchen in der Stadt war, und doch war sie noch nicht verlobt.
Der Eßkorb stand auf ihrem Schoß, als die Familie in den Wald hinaus fuhr. Der Flaschenhals lugte unter den Zipfeln des weißen Tuches hervor. Der Pfropfen war mit rotem Lack verziert und sie schaute gerade in des jungen Mädchens Antlitz; sie sah auch den jungen Steuermann an, der an des Mädchens Seite saß. Er war ihr Jugendfreund, der Sohn eines Porträtmalers. Vor kurzem hatte er seine Steuermannsprüfung mit Ehren bestanden und sollte morgen mit seinem Schiffe fort nach fremden Ländern fahren; hiervon war schon während des Einpackens viel die Rede gewesen, und während davon gesprochen wurde, war just nicht viel Vergnügen in den Augen und um den Mund der schönen Kürschnerstochter zu sehen gewesen.
Die beiden jungen Leute gingen in den grünen Wald und sprachen zusammen – wovon sprachen sie wohl? Ja, das hörte die Flasche nicht, sie stand noch immer im Eßkorb. Es dauerte merkwürdig lange, bis sie hervorgeholt wurde. Als es jedoch nun geschah, hatten sich auch erfreuliche Dinge ereignet. Aller Augen lachten und auch die Kürschnerstochter lachte, aber sie sprach weniger als zuvor, und ihre Wangen glühten wie zwei rote Rosen.
Der Vater nahm die gefüllte Flasche und den Korkenzieher. – Ja, es ist ein wunderliches Gefühl, so zum ersten Male geöffnet zu werden. Der Flaschenhals konnte seitdem niemals mehr diesen feierlichen Augenblick vergessen; es hatte ordentlich "Schwupp" in ihm gesagt, als der Pfropfen herausging, und dann gluckte es, als der Wein hinaus in die Gläser strömte.
"Den Verlobten zum Wohle" sagte der Vater; jedes Glas wurde bis zur Neige geleert und der Steuermann küßte seine schöne Braut.
"Glück und Segen!" sagten die beiden Alten, und der junge Mann füllte die Gläser noch einmal: "Auf Heimkehr und Hochzeit heut übers Jahr" rief er, und als die Gläser geleert waren, ergriff er die Flasche, hob sie hoch empor und sagte: "Du bist am schönsten Tage meines Lebens mit dabei gewesen, weiter sollst Du keinem dienen!"
Dabei warf er sie hoch empor. Damals dachte die Kürschnerstochter nicht daran, daß sie sie wiedersehen sollte, aber sie sollte es. Die Flasche fiel in das dichte Schilf an dem kleinen Waldsee. Der Flaschenhals erinnerte sich so lebhaft daran, als sei es heute geschehen, wie er dort im Schilfe gelegen und nachgedacht hatte: "Ich gab ihnen Wein und sie geben mir Sumpfwasser, aber es war gut gemeint!" Er konnte die Verlobten und die fröhlichen Alten nicht mehr sehen, aber noch lange hörte er sie jubilieren und singen. Dann kamen zwei kleine Bauernjungen, guckten zwischen das Schilf, erblickten die Flasche und nahmen sie mit; nun war sie versorgt.
Daheim in dem Waldhäuschen, wo sie wohnten, war gestern ihr ältester Bruder, der Seemann, gewesen und hatte Lebewohl gesagt, da er auf eine größere Reise gehen sollte. Die Mutter stand nun und packte noch ein und das andere ein, womit der Vater am Abend in die Stadt gehen sollte, um den Sohn noch einmal vor der Abreise zu sehen und ihm seinen und der Mutter Gruß zu bringen. Eine kleine Flasche mit Kräuterbranntwein war in das Päckchen gelegt worden, doch nun kamen die Knaben mit der größeren Flasche, die sie gefunden hatten. Dorthinein ging mehr als in die kleine, und außerdem war es doch ein so guter Schnaps gegen verdorbenen Magen; er war auf hypericum abgezogen. Es war kein roter Wein, wie zuvor, den die Flasche nun bekam, sie bekam gar bittere Tropfen, aber die sind auch gut – für den Magen. Die neue Flasche sollte mit, nicht die kleine – so kam die Flasche wieder auf die Wanderschaft, und sie kam an Bord zu Peter Jensen; das war gerade das gleiche Schiff, auf dem auch der junge Steuermann war. Aber er sah die Flasche nicht, er hätte sie wohl auch nicht wiedererkannt oder daran gedacht, daß es dieselbe sein könne, woraus er auf Verlobung und Heimkehr getrunken hatte.
Freilich war kein Wein mehr darin, aber etwas ebenso Gutes. Sie wurde auch jedesmal, wenn Peter Jensen sie hervorholte, "Der Apotheker" genannt. Aus ihr schenkte man die gute Medizin, die dem Magen half, und sie half solange, wie noch ein Tropfen darin war. Das war eine fröhliche Zeit, und die Flasche sang, wenn man sie mit dem Pfropfen rieb; damals bekam sie auch den Namen der wahren Lerche, "Peter Jensens Lerche."
Lange Zeit war vergangen, sie stand leer in einer Ecke, da geschah es – ob es auf der Hinreise oder Rückreise war, wußte die Flasche nicht so genau, denn sie war nicht mit an Land gewesen – da erhob sich ein Sturm; hohe Seen, schwarz und schwer, wälzten sich heran, sie hoben das Fahrzeug mit sich empor und schleuderten es wieder hinab. Eine Sturzsee schlug eine Planke ein, die Pumpen konnten nichts mehr ausrichten; es war stockfinstere Nacht und das Schiff sank Aber in der letzten Minute schrieb der junge Steuermann auf ein Blatt: "In Jesu Namen. Wir sinken!" Er schrieb den Namen seiner Braut, den seinen und den des Schiffes darauf, steckte den Zettel in eine leere Flasche, die da stand, drückte den Pfropfen fest hinein und warf die Flasche hinaus in das stürmende Meer.
Er wußte nicht, daß es die Flasche war, woraus einst der Hoffnung und der Freude Wohl getrunken worden war für ihn und für sie; nun schaukelte sie auf den Wellen mit einem Gruß und einer Todesbotschaft.
Das Schiff sank, die Mannschaft sank aber die Flasche flog wie ein Vogel, sie hatte ja ein Herz, einen Liebesbrief in sich. Und die Sonne ging auf und sie ging unter; es war für die Flasche fast ebenso anzusehen, wie der rote, glühende Ofen ihrer Jugend, und sie hatte Sehnsucht, wieder hineinzufliegen. Sie trieb in Windstille und neuen Stürmen dahin, doch stieß sie an keine Felsenklippe, kein Hai verschluckte sie; länger als Jahr und Tag trieb sie umher, bald nach Nord, bald nach Süd, wie die Strömung sie führte. Im übrigen war sie ihr eigener Herr, aber auch dessen kann man überdrüssig werden.
Das beschriebene Blatt, das letzte Lebewohl des Bräutigams an die Braut, sollte nur Trauer bringen, wenn es dereinst in die rechten Hände geriet. Aber wo waren die Hände, die so weiß geleuchtet hatten, als sie das Tuch in das frische Gras im grünen Walde ausgebreitet hatten am Verlobungstage? Wo war des Kürschners Tochter? Ja, wo war das Land, und welches Land war wohl das nächste? Die Flasche wußte es nicht; sie trieb und trieb und wurde schließlich des Treibens müde; es war ja nicht ihre Bestimmung, aber sie trieb trotzdem, bis sie endlich Land erreichte, ein fremdes Land. Sie verstand nicht ein Wort von dem, was gesprochen wurde, es war nicht die Sprache, die sie zuvor hatte sprechen hören; ja, es geht viel verloren, wenn man die Sprache nicht beherrscht.
Die Flasche wurde aufgehoben und betrachtet. Der Zettel darin wurde gesehen, herausgenommen und nach allen Seiten gedreht und gewendet, aber man verstand nicht, was darauf geschrieben stand. Sie begriffen wohl, daß die Flasche aus irgendeinem Grunde über Bord geworfen war und dieser Grund auf dem Papier geschrieben stand, aber was dort stand, war unbegreiflich – und der Zettel wurde wieder in die Flasche gesteckt, und diese kam in einen großen Schrank in einer großen Stube in einem großen Hause.
Jedesmal, wenn Besuch kam, wurde der Zettel hervorgeholt und gedreht und gewendet, so daß die Worte darauf, die nur mit Bleistift geschrieben waren, mehr und mehr unleserlich wurden. Zuletzt konnte niemand mehr erkennen, daß Buchstaben darauf waren. Die Flasche stand noch ein Jahr lang im Schranke, dann kam sie auf den Boden und wurde von Staub und Spinnweben bedeckt. Da dachte sie an die besseren Tage zurück, wo sie roten Wein im frischen Walde einschenkte und auf den Wogen schaukelte und ein Geheimnis zu tragen hatte, einen Brief einen Abschiedsseufzer.
Und nun stand sie wohl zwanzig Jahre auf dem Boden; sie hätte noch länger dort stehen können, wäre das Haus nicht umgebaut worden. Das Dach wurde abgerissen, und die Flasche gefunden und besprochen, aber sie verstand die Sprache nicht. Die lernt man nicht vom auf dem Boden stehen, selbst in zwanzig Jahren nicht. "Wäre ich unten in der Stube geblieben," sagte sie ganz richtig, "dann hätte ich sie wohl gelernt."
Sie wurde nun gewaschen und gespült und das hatte sie auch nötig; sie fühlte sich ganz klar und durchsichtig, sie wurde wieder jung in ihren alten Jahren; aber der Zettel, den sie in sich trug, war bei der Wäsche verloren gegangen.
Die Flasche wurde nun mit Samenkörnern gefüllt, von welcher Art, wußte sie nicht; sie wurde zugekorkt und gut eingewickelt und sah weder Licht noch Laterne, geschweige denn Sonne oder Mond, und etwas müsse man doch sehen, wenn man auf Reisen ginge, meinte die Flasche; aber sie sah nichts. Doch das Wichtigste tat sie – sie reiste und kam dorthin, wohin sie sollte; dort wurde sie ausgepackt.
"Was sie sich dort im Auslande für Umstände mit ihr gemacht haben" wurde gesagt, "und doch wird sie wohl gesprungen sein." Aber sie war nicht gesprungen. Die Flasche verstand jedes einzige Wort, das gesagt wurde; es war die Sprache, die sie am Schmelzofen und beim Weinhändler, im Walde und auf dem Schiffe vernommen hatte, die einzig richtige, gute alte Sprache, die man verstehen konnte. Sie war wieder in ihr Heimatland zurückgekommen, sie bekam ihren Willkommensgruß. Vor Freude wäre sie ihnen fast aus den Händen gesprungen; sie merkte es kaum, wie der Korken herausgezogen, sie ausgeschüttet und in den Keller gesetzt wurde, um weggestellt und vergessen zu werden. In der Heimat ist es doch am besten, selbst im Keller. Es kam ihr nie in den Sinn, darüber nachzudenken, wie lange sie dort lag, sie lag gut und lag jahrelang. Da kamen eines Tages Leute in den Keller herunter und holten mit den Flaschen auch sie herauf.
Draußen im Garten herrschten Pracht und Herrlichkeit. Brennende Lampen hingen an Girlanden. Papierlaternen strahlten wie transparente Tulpen; es war ein herrlicher Abend. Das Wetter war stille und klar, die Sterne blinkten hell und der Neumond stand am Himmel, eigentlich sah man den ganzen runden Mond wie eine blaugraue Kugel mit goldenem Rande und es sah gut aus für gute Augen.
Die Nebengänge waren auch illuminiert, wenigstens so hell, daß man darin vorwärts kommen konnte. Zwischen den Hecken waren Flaschen mit Lichtern aufgestellt. Dort stand auch die Flasche, die wir kennen und die dereinst als Flaschenhals enden sollte, als Vogelnapf. Sie fand in diesem Augenblicke alles unaussprechlich schön, sie war wieder im Grünen, nahm wieder teil an Freud und Fest, vernahm Gesang und Musik. das Geschwirre und Gesumme vieler Menschen, besonders von der Seite des Gartens, wo die Lampen brannten und die Papierlaternen ihre Farbenpracht zeigten. Sie selbst stand wohl abseits in einem Gang, aber just das regte sie zum Nachdenken an. Da stand nun die Flasche und trug ihr Licht, stand hier zum Nutzen und zur Freude, und das ist das Richtige: in solch einer Stunde vergißt man die zwanzig Jahre auf dem Boden, und es ist gut, das zu vergessen.
Dicht an ihr vorbei ging ein einzelnes Paar Arm in Arm wie das Brautpaar damals im Walde, der Steuermann und die Kürschnerstochter. Es war für die Flasche, als erlebe sie es noch einmal. Im Garten gingen Gäste und Leute, die diese und all die Pracht anschauen durften; unter diesen war auch ein altes Mädchen, die keine Verwandten mehr, wohl aber Freunde besaß. Sie dachte ganz an dieselben Dinge wie die Flasche, an den grünen Wald und ein junges Brautpaar, das sie recht nahe anging, war sie doch selbst der eine Teil desselben. Das war ihre glücklichste Stunde gewesen, und die vergißt sich nie, auch wenn man eine noch so alte Jungfer wird. Aber sie erkannte die Flasche nicht, und diese erkannte sie nicht, so geht man aneinander vorüber in der Welt – bis man sich wieder begegnet, und das taten die beiden, in der Stadt waren sie ja zusammengekommen.
Die Flasche kam aus dem Garten zum Weinhändler, wurde wieder mit Wein gefüllt und an den Luftschiffer verkauft, der am nächsten Sonntag mit dem Ballon aufsteigen sollte. Das war ein Gewimmel von Menschen, die alle zuschauen wollten; Regimentsmusik erschallte und Vorbereitungen wurden getroffen. Die Flasche sah alles von einem Korbe aus, worin sie zusammen mit einem lebendigen Kaninchen lag; das war ganz verzagt, weil es wußte, daß es mit aufsteigen sollte, um dann mit einem Fallschirm hinabgelassen zu werden; die Flasche wußte weder etwas von herauf noch herunter, sie sah, daß der Ballon dicker und immer dicker aufschwoll und, als er nicht mehr größer werden konnte, sich emporzuheben begann, höher und höher; immer unruhiger wurde er, da durchschnitt man die Taue, die ihn hielten, und er schwebte mit dem Luftschiffer, dem Korbe, der Flasche und dem Kaninchen himmelwärts; die Musik setzte wieder ein und alle Menschen riefen: Hurra!
"Es ist doch ein merkwürdig Ding, so in die Luft zu gehen," dachte die Flasche, "das ist eine neue Art zu segeln; da oben kann man doch nicht laufen!"
Viele tausend Menschen sahen dem Ballon nach, und die alte Jungfer sah ihm auch nach; sie stand an ihrem offenen Dachkammerfenster, vor dem das Vogelbauer mit dem kleinen Hänfling hing, der damals noch kein Wasserglas hatte, sondern sich mit einer Tasse begnügen mußte. Im Fenster stand ein Myrtenstock, der ein wenig beiseite gerückt worden war, um nicht hinunter gestoßen zu werden, während das alte Mädchen sich vorbeugte, um hinauszusehen. Sie sah deutlich den Luftschiffer im Ballon, der das Kaninchen mit dem Fallschirm hinab ließ, dann auf aller Menschen Wohl trank und die Flasche hoch in die Luft hinaus warf. Sie dachte nicht daran, daß sie just dieselbe Flasche schon einmal hatte so fliegen sehen, und zwar vor ihr und ihrem Freund an dem Freudentage draußen im grünen Walde in ihrer Jugendzeit.
Die Flasche hatte gar keine Zeit zum Denken übrig, so plötzlich, so unerwartet gelangte sie auf den Höhepunkt ihres Lebens, Türme und Dächer lagen tief unten, die Menschen waren nur wie kleine Pünktchen zu sehen.
Nun sank sie, und zwar mit einer anderen Geschwindigkeit als das Kaninchen; die Flasche schoß Purzelbäume in der Luft, sie fühlte sich so jung, so ausgelassen, sie war noch halbberauscht vom Weine in ihr, aber nicht lange. Welch eine Reise. Die Sonne schien auf die Flasche nieder, alle Menschen sahen ihrem Fluge nach, der Ballon war schon weit weg, und bald war auch die Flasche weg. Sie fiel auf eins der Dächer und dann war sie entzwei. Aber die Scherben waren noch so vom Fluge benommen, daß sie nicht liegen bleiben konnten, sie sprangen – und rollten, bis sie den Hof erreichten, um dort in noch kleinere Stücke zu zerspringen. Nur der Flaschenhals hielt; er sah aus wie von einem Diamanten abgeschnitten.
"Der könnte gut als Wassernäpfchen für einen Vogel verwendet werden!" sagte der Krämer im Keller, aber er selbst hatte weder einen Vogel noch ein Bauer, und es wäre wohl etwas zu weit gegriffen, sich diese anzuschaffen, weil er nun einen Flaschenhals hatte, der als Wassernäpfchen verwendet werden könnte. Aber die alte Jungfer in der Dachkammer konnte ihn gebrauchen; und so kam der Flaschenhals zu ihr hinauf, bekam einen Pfropfen zu schlucken, und was er früher nach oben gekehrt hatte, kam nun nach unten, wie es gar oft bei Veränderungen zu geschehen pflegt, er bekam frisches Wasser und wurde vor das Bauer zu dem kleinen Vogel gehängt, der so herzhaft sang, daß es schallte.
"Ja, Du hast gut singen!" Das war es, was der Flaschenhals sagte, und der war ja etwas Besonderes, weil er in einem Luftballon gewesen war. – Mehr wußte man nicht von seiner Geschichte. Nun hing er da als Vogelnäpfchen, konnte die Leute auf der Straße lärmen und sich tummeln hören und konnte das Gespräch der alten Jungfer drinnen in der Kammer mitanhören. Es war eben Besuch gekommen, eine gleichaltrige Freundin, und sie sprachen zusammen, nicht von dem Flaschenhals, sondern von dem Myrtenbaum am Fenster.
"Du solltest wahrhaftig nicht zwei Reichstaler wegwerfen für einen Brautkranz für Deine Tochter." sagte die alte Jungfer. "Du sollst von mir einen haben, und zwar einen hübschen ganz voller Blüten. Siehst Du, wie herrlich das Bäumchen steht? Ja, das ist ein Ableger von der Myrte, die Du mir am Tage nach meiner Verlobung gegeben hast, von dem Stock, von dem ich mir meinen Brautkranz schneiden sollte, wenn das Jahr um war. Aber der Tag kam nicht. Die Augen haben sich geschlossen, die mir zu Glück und Segen in diesem Leben leuchten sollten. Auf dem Meeresgrund schläft er süß, die Engelsseele. – Das Bäumchen wurde ein alter Baum, aber ich wurde noch älter, und als der Baum verdorrte, nahm ich den letzten frischen Zweig und setzte ihn in die Erde, und dieses Zweiglein ist nun ein großer Baum geworden und kommt nun doch endlich zu seinem Hochzeitsstaat, wird Deiner Tochter Brautkranz!"
Es standen Tränen In des alten Mädchens Augen; sie sprach von dem Freund ihrer Jugend, von der Verlobung im Walde; sie dachte an das Wohl, das damals ausgebracht wurde, dachte an den ersten Kuß, – aber das sagte sie nicht – war sie doch eine alte Jungfer. An so vieles dachte sie, aber daran dachte sie nicht, daß vor ihrem Fenster noch ein Andenken aus jener Zeit hing: der Hals jener Flasche, die damals "Schwupp" sagte, als der Pfropfen knallte. Aber der Flaschenhals erkannte sie auch nicht, denn er hörte nicht darauf, was sie erzählte, er dachte nur an sich.
EINE GUTE LAUNE ...

Von meinem Vater habe ich das beste Erbteil erhalten, nämlich eine gute Laune. Und wer war mein Vater? Ja, das geht den Humor nichts an! Er war lebhaft und wohlbeleibt, fett und rund, sein Äußeres und Inneres, stand mit seinem Amte gänzlich im Widerspruch. Und was war er seines Amtes und seiner Stellung nach in der bürgerlichen Gesellschaft? Ja, wenn es im Anfange eines Buches gleich niedergeschrieben und gedruckt würde, so würden Mehrere, wenn sie es lesen, das Buch zur Seite legen und sagen, es sieht mir so unheimlich aus, ich mag nichts von der Art. Und doch war mein Vater weder Schinder noch Scharfrichter; im Gegenteil, sein Amt stellte ihn an die Spitze der rühmlichsten Männer der Stadt, und er war dort ganz in seinem Rechte, ganz an seinem Platze; er mußte der Vorderste sein, vor dem Bischof, vor den Prinzen von Geblüt – und er war der Vorderste – er war Leichenwagenkutscher.
Nun ist's heraus! und das kann ich bekennen, daß, wenn man meinen Vater dort hoch oben auf dem Omnibus des Todes sitzen sah, bekleidet mit seinem langen, weiten, schwarzen Mantel, mit dem schwarzgarnierten, dreieckigen Hute auf dem Kopfe, und dazu mit seinem Gesichte, welches leibhaftig aussah wie man die Sonne zeichnet, rund und lachend, dann konnte man nicht an Trauer und Grab denken; das Gesicht sagte: »es macht nichts, macht nichts, – es wird viel besser, als man glaubt!«
Seht, von ihm habe ich meine gute Laune und die Gewohnheit angenommen, gar oft nach dem Kirchhofe zu gehen: und das ist sehr amüsant, wenn man nur mit gutem Humor dorthin kommt, – und dann halte ich das Intelligenzblatt, so wie auch er es tat.
Ich bin nicht jung, – ich habe weder Weib, Kinder noch eine Bibliothek, aber, wie gesagt, ich halte das Intelligenzblatt, das ist mir genug, es ist mir das liebste Blatt, und war es meinem Vater auch; es hat seinen großen Nutzen, und bringt Alles, was ein Mensch zu wissen nötig hat: wer in den Kirchen, und wer in den neuen Büchern predigt; und dann die viele Wohltätigkeit, und die vielen unschuldigen, harmlosen Verse, die es enthält! Ehen, welche gesucht werden und Stelldichein, auf welche man sich einlaßt! Alles einfach und natürlich! Man kann wahrlich sehr gut und glücklich leben und sich begraben lassen, wenn man das Intelligenzblatt hält – schließlich hat man am Ende seines Lebens so viel Papier, daß man weich darauf liegen kann, wenn man es nicht liebt auf Hobelspänen zu ruhen.
Das Intelligenzblatt und der Kirchhof waren immer meine, den Geist am meisten weckenden, Spaziergänge, meine beliebtesten Badeanstalten für den guten Humor.
Jeder kann nun für sich das Intelligenzblatt durchwandern: aber geht mit mir nach dem Kirchhofe; laßt uns dorthin gehen, wenn die Sonne scheint, und die Bäume grün sind; laßt uns zwischen den Gräbern wandeln. Jedes derselben ist ein geschlossenes Buch mit dem Rücken nach oben, man kann den Titel lesen, welcher besagt, was das Buch enthält, und doch nichts sagt; aber ich weiß Bescheid, weiß es von meinem Vater und von mir selbst. Ich habe es in meinem Grabbuche, und das ist ein Buch, welches ich selbst zum Nutzen und Vergnügen gemacht habe; dort liegen sie Alle beisammen, und noch Einige mehr!
Nun sind wir auf dem Kirchhofe.
Hier, hinter dem weiß bemalten Stabgitter, wo einst ein Rosenstrauch stand, – jetzt ist er fort, aber ein wenig Immergrün vom Grabe des Nachbars streckt seine grünen Finger hinein, um doch ein wenig Staat zu machen, – ruht ein sehr unglücklicher Mann, und doch stand er sich, als er lebte, wie man zu sagen pflegt, gut; er hatte sein gutes Auskommen und noch mehr, aber die Welt, das heißt die Kunst, ging ihm zu nahe. Saß er eines Abends im Theater, um mit ganzer Seele zu genießen, so war er außer sich, wenn der Maschinenmeister nur ein zu starkes Licht in eine der Wangen des Mondes setzte, oder wenn die Luftsoffiten vor den Kulissen hingen, wenn sie dahinter hängen sollten, oder wenn eine Palme im Berliner Tiergarten vorkam, oder Kaktus in Tyrol und Buchen hoch oben in Norwegen erschienen! Bleibt sich das nicht gleich? Wer kümmert sich um so etwas! Es ist ja Komödie, bei welcher man sich amüsieren soll. – Bald klatschte ihm das Publikum zu viel, bald zu wenig. »Das ist nasses Holz,« sagte er, »es will heute Abend nicht zünden!« als dann kehrte er sich um, um zu sehen, was für Leute es wären, und dann sah er, daß sie zu unrechter Zeit lachten, wo sie nicht lachen sollten; darüber ärgerte er sich, litt dabei, war ein unglücklicher Mensch, und nun ruht er im Grabe.
Hier schlummert ein sehr glücklicher Mann, das soll heißen, ein sehr vornehmer Mann, von hoher Geburt, und das war sein Glück, denn sonst würde nie etwas aus ihm geworden sein, aber Alles ist so weise in der Natur angeordnet, daß es ein Vergnügen ist, daran zu denken. Er schritt vorn und hinten gestickt einher, und war im Saale untergebracht, so wie man den kostbaren, perlengestickten Klingelzug anbringt, hinter dem immer eine gute, dicke Schnur, welche den Dienst verrichtet, hängt; er hatte auch eine gute Schnur hinter sich, einen Substituten, der den Dienst verrichtete, und ihn noch, hinter einem neuen, gestickten Klingelzuge, verrichtet. Alles ist weise eingerichtet, daß man wohl einen guten Humor haben kann.
Hier ruht, ja, das ist nun freilich sehr traurig –! hier ruht ein Mann, der siebenundsechzig Jahre darüber nachgedacht hat, wie er auf einen guten Einfall komme; er lebte nur um einen guten Einfall zu bekommen; endlich bekam er wirklich nach eigener Überzeugung einen, und wurde so froh darüber, daß er starb, vor Freude starb, ihn bekommen zu haben; Keiner hatte Nutzen davon, Keiner hörte den guten Einfall. Ich kann mir nun denken, daß er wegen des guten Einfalles nicht einmal Ruhe im Grabe hat, denn gesetzt, es wäre ein Einfall, den man nur beim Frühstück sagen könnte, wenn er von Wirkung sein sollte, und daß er als Toter, der allgemeinen Meinung nach, nur um Mitternacht erscheinen kann, so paßt der Einfall nicht für die Zeit, Niemand lacht, und der Mann kann mit seinem guten Einfalle wieder ins Grab steigen. Das ist ein trauriges Grab.
Hier ruht eine sehr geizige Frau; während sie lebte, stand sie in der Nacht auf und miaute, damit die Nachbarn glauben sollten, daß sie sich Katzen hielte: so geizig war sie!
Hier ruht ein Fräulein aus guter Familie; es mußte in Gesellschaften immer seine Stimme hören lassen, und dann sang es: »mi manca, la voce!« das war die einzige Wahrheit in ihrem Leben!
Hier ruht eine Jungfrau – eines anderen Schlages! Wenn der Kanarienvogel des Herzens zu schmettern beginnt, dann steckt die Vernunft die Finger in die Ohren. Schön Jungfrau stand in des Ehestands Glorie –! das ist eine Alltagshistorie – aber es ist hübsch gesagt: Laß die Toten ruhen.
Hier ruht eine Wittfrau, welche Schwanengesang im Munde und Eulengalle im Herzen trug. Sie ging in den Familien auf Raub nach Fehlern ihres Nächsten aus, sowie in alten Tagen das »Reibeisen« umher ging, um ein Rinnsteinbrett zu finden, welches nicht da war.
Hier ist ein Familienbegräbniß; jedes Glied dieses Geschlechts hielt so im Glauben zusammen, daß, wenn auch die ganze Welt und die Zeitung dazu sagte: so ist's, und der kleine Sohn kam nun aus der Schule und sagte: »ich habe es auf die Weise gehört!« so war die seinige die einzig richtige, denn er war von der Familie. Und gewiß ist's, daß, wenn es sich so traf, daß der Hofhahn der Familie um Mitternacht krähte, so war es Morgen, wenn auch der Wächter und alle Uhren der Stadt verkündeten, daß es Mitternacht sei.
Der große Goethe schließt seinen Faust damit: »kann fortgesetzt werden,« das kann unsere Wanderung nach dem Kirchhofe auch. Dahin komme ich oft, macht Einer oder der Andere meiner Freunde oder Nichtfreunde mir es zu bunt, gehe ich hinaus, suche einen Rasenplatz auf, und weihe denselben ihm oder ihr, irgend einer Person, die ich zu begraben wünsche, dann begrabe ich sie sogleich, und sie liegen tot und machtlos da, bis sie als neuere und bessere Menschen zurück kommen. Ihr Leben und ihre Taten, nach meiner Art und Weise betrachtet, schreibe ich in mein Grabbuch, und so sollten alle Menschen verfahren, sie sollten sich nicht ärgern, wenn Jemand es ihnen zu toll macht, sondern ihn sogleich begraben, auf ihren guten Humor halten, und auch auf das Intelligenzblatt, auf dieses, vom Volke selbst oft mit »geführter Hand« geschriebene Blatt.
Kommt die Zeit, daß ich selbst, sowie meine Lebensgeschichte, im Grabe eingebunden werden soll, dann setze man mir die Inschrift: Das ist meine Geschichte.
SUPPE VON EINEM WURSTSPEILER ...
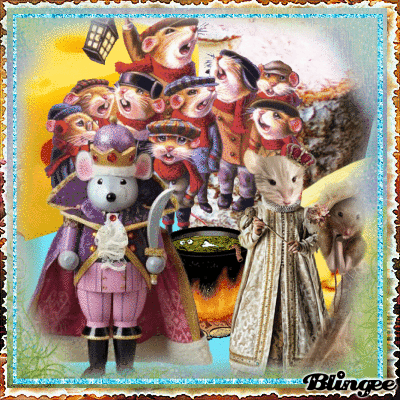
I. Suppe von einem Wurstspeiler.
"Das war gestern ein ausgezeichnetes Mittagessen" sagte eine alte Mäusedame zu einer anderen, die nicht mit dabei gewesen war. "Ich saß auf dem einundzwanzigsten Platz von dem alten Mäusekönig ab gerechnet, das ist etwas nichts Geringes. Über die Gänge kann ich Ihnen nur sagen, daß sie ausgezeichnet zusammengesetzt waren! Verschimmeltes Brot, Speckschwarte, Talglichte und Wurst und dann dasselbe noch einmal von vorne an. Es war ebenso gut, als hätten wir zweimal Mahlzeit gehalten. Es war eine behagliche Stimmung und ein gemütlicher Wirrwar wie in einem Familienkreise. Nichts ist übrig geblieben außer den Wurstspeilern. Darüber wurde natürlich gesprochen und jemand meinte sogar, man könne aus einem Wurstspeiler Suppe kochen. Gehört hatte ja schon jeder davon, aber niemand hatte solche Suppe je gekostet, geschweige denn, daß er sie zu bereiten verstünde. Es wurde ein sehr hübsches Wohl auf den Erfinder der Suppe ausgebracht, er verdiene, Armenhausvorstand zu werden. War das nicht witzig? Und der alte Mäusekönig erhob sich und gelobte, daß die jenige von den jungen Mäuschen, die die besprochene Suppe am wohlschmeckendsten herzustellen verstünde, seine Königin werden sollte. Jahr und Tag sollten sie Bedenkzeit haben."
"Das wäre gar nicht so übel!" sagte die andere Maus, "aber wie bereitet man die Suppe zu?"
"Ja, wie bereitet man sie zu?" Danach fragten alle kleinen Mäuschen, die jungen und die alten. Jede wollte gern Königin werden, aber keine wollte die Unbequemlichkeit auf sich nehmen, in die weite Welt hinauszugehen, um es zu erlernen, aber es würde wohl doch notwendig werden. Doch es ist nicht jedem gegeben, die Familie und die alten traulichen Ecken und Winkel zu verlassen. Da draußen geht man nicht jeden Tag über Käserinden und riecht Speckschwarten, nein, man kann sogar dazu kommen, zu hungern, vielleicht auch dazu, lebendigen Leibes von einer Katze gefressen zu werden.
Diese Gedanken waren es wohl auch, die die meisten davon abschreckten, auf Kundschaft auszuziehen. Endlich fanden sich zur Abreise nur vier Mäusejungfrauen, jung und heiter, aber arm, bereit. Jede wollte an eine der vier Ecken der Welt ziehen nun kam es nur darauf an, welcher das Glück folgte. Jede nahm einen Wurstspeiler mit, um nicht zu vergessen, weshalb sie reiste; er sollte ihr Wanderstab sein.
Anfang Mai zogen sie von dannen, und in den ersten Maitagen, nach einem Jahre, kamen sie zurück, doch nur drei von ihnen, die vierte meldete sich nicht und ließ auch nichts von sich hören. Und nun war der Tag der Entscheidung.
"Daß doch immer ein bitterer Tropfen im Freudenbecher sein muß" sagte der Mäusekönig, gab aber doch Befehl, alle Mäuse viele Meilen im Umkreise einzuladen: sie sollten sich in der Küche versammeln. Die drei weitgereisten Mäusejungfrauen standen für sich in einer Reihe; für die vierte, die fehlte, war ein Wurstspeiler mit schwarzem Flor hingestellt worden. Niemand wagte seine Meinung zu sagen, ehe die drei gesprochen und der Mäusekönig gesagt haben würde, was weiter geschehen solle.
II. Was das erste Mäuschen auf der Reise gesehen und gelernt hatte.
"Als ich in die weite Welt hinauszog," sagte das Mäuschen, "glaubte ich wie so viele in meinem Alter, daß ich alle Weisheit der Welt in meinem Kopfe hätte. Ich ging sogleich zur See, und zwar mit einem Schiffe, das nach Norden steuerte. Ich hatte gehört, daß der Koch auf See es verstehen müsse, sich zu helfen. Aber es ist leicht, sich zu helfen, wenn alles mit Speckseiten, Pökelfleisch und stockigem Mehl gefüllt ist; man lebt ausgezeichnet! Aber man lernt nicht, wie man aus einem Wurstspeiler Suppe bereitet. Wir segelten viele Tage und Nächte lang, bald schlingerte das Schiff, bald hatten wir mit eindringendem Wasser zu kämpfen. Als wir an Ort und Stelle ankamen, verließ ich das Schiff; es war hoch oben im Norden.
Es ist ein wunderlich Ding, aus dem heimatlichen Winkel auf ein Schiff zu kommen, das auch eine Art Winkel ist, und sich dann plötzlich über hundert Meilen entfernt im fremden Lande zu finden. Dort gab es wilde Tannen- und Birkenwälder; sie dufteten so stark. Aber ich mag das nicht. Die wilden Kräuter rochen so gewürzig, daß ich niesen und an Wurst denken mußte. Dort waren große Waldseen, in der Nähe sah ihr Wasser so klar aus, aber aus einigem Abstand gesehen war es schwarz wie Tinte. Da schwammen weiße Schwäne, ich hielt sie zuerst für Schaum, so stille lagen sie auf dem Wasser, doch dann sah ich sie fliegen und gehen und erkannte sie. Sie gehören zum Geschlecht der Gänse, das Blut läßt sich nicht verleugnen! Ich hielt mich zu meiner Art und schloß mich den Wald- und Feldmäusen an, die übrigens, besonders was feine Bewirtung angeht, blutig unwissend sind. Und das war es ja einzig und allein, wofür ich ins Ausland gereist war. Allein die Möglichkeit, aus einem Wurstspeiler Suppe zu kochen, schien ihnen ein so außerordentlicher Gedanke, daß es sich wie ein Lauffeuer durch den ganzen Wald verbreitete. Aber die Aufgabe zu lösen, rechneten sie durchaus zur Unmöglichkeit, und ich hätte am allerwenigsten gedacht, daß ich hier und noch in derselben Nacht in deren Zubereitung eingeweiht werden würde. Es war um Mittsommer; deshalb röche auch der Wald so stark, meinten sie, und deswegen seien auch die Kräuter so gewürzig, die Seen so klar und doch so dunkel mit den weißen Schwänen auf ihrem Wasser. Am Waldessaum, zwischen drei, vier Häusern war eine Stange aufgestellt, hoch wie ein Mastbaum, daran hingen Kränze und Bänder. Das war die Maistange. Mädchen und Burschen tanzten rund herum und sangen mit der Geige des Spielmanns um die Wette. Da ging es lustig zu beim Sonnenuntergang und im Mondenschein, aber ich ging nicht mit, was soll ein Mäuschen beim Ball im Walde! Ich saß in dem weichen Moos und hielt meinen Wurstspeiler in der Hand.
Der Mond schien vor allem auf eine Stelle, wo ein Baum mit dem feinsten Moos unter sich stand, ein Moos so fein, ja, ich erkühne mich zu sagen, so fein, wie unseres Mäusekönigs Fell, aber es war von grüner Farbe, so daß es für die Augen eine Wohltat war. Da kamen auf einmal die niedlichsten kleinen Personen aufmarschiert, nicht größer, als daß sie gerade bis zu meinen Knien reichten. Sie sahen wie Menschen aus, aber besser proportioniert, sie nannten sich Elfen und trugen die feinsten Kleider aus Blumenblättern mit Fliegen- und Mückenflügelbesatz, es sah gar nicht übel aus. Bald schien es mir, als suchten sie etwas, ich wußte nicht was. Doch dann kamen ein paar von ihnen auf mich zu, der vornehmste zeigte auf meinen Wurstspeiler und sagte: 'Das ist gerade so einer, wie wir ihn brauchen! Er ist zugespitzt, das ist ausgezeichnet!' Und er wurde immer entzückter, während er meinen Wanderstab betrachtete."
"Nur leihen, aber nicht behalten!" sagte ich.
"Nicht behalten" sagten alle, ergriffen den Wurstspeiler, den ich losließ, und tanzten damit zu dem feinen Moosfleckchen. Dort richteten sie den Wurstspeiler mitten im Grünen auf. Sie wollten auch eine Maistange haben, und die, die sie nun hatten, war ja auch wie dafür geschaffen. Nun wurde sie geschmückt; ja, da bekam sie ein Aussehen!
Kleine Spinnen spannen Goldfäden darum und hängten wehende Schleier und Fahnen daran, so fein gewebt, so schneeweiß im Mondenschein gebleicht, daß mir ordentlich die Augen schmerzten. Sie nahmen Farbe von den Schmetterlingsflügeln und streuten sie auf das weiße Linnen, da erschienen Blumen und Diamanten darauf, ich erkannte meinen Wurstspeiler nicht wieder. Solch eine Maistange fand gewiß nicht ihresgleichen in der Welt. Und nun kam erst die richtige große Elfengesellschaft, ganz ohne Kleider, das war das Feinste, und ich wurde eingeladen, den Staat mit anzusehen, aber aus einem gewissen Abstand, denn ich war ihnen zu groß.
Nun begann ein Musizieren. Es war, als ob tausend gläserne Glöckchen erklängen, so voll und lieblich tönte es; ich glaubte, es wären Schwäne, die dort sängen, ja, mir war fast, als hörte ich den Kuckuck und die Drossel heraus. Zuletzt war es gar, als erklänge der ganze Wald mit. Kinderstimmen, Glockenklang und Vogelsang verschmolzen zu einer einzigen lieblichen Melodie, und all die Herrlichkeit erklang aus der Maistange heraus wie aus einem Glockenspiel, und doch war es nur mein Wurstspeiler. Nie hätte ich geglaubt, daß so viel da herauskommen könnte, aber es kommt wohl immer darauf an, in welche Hände man gerät. Ich wurde wirklich ganz bewegt, ich weinte, wie nur ein Mäuschen weinen kann vor lauter Freude.
Die Nacht war allzu kurz! Aber sie ist nun einmal dort zu jener Zeit nicht länger. Beim Tagesgrauen wehte ein Lüftchen, der Wasserspiegel auf dem Waldsee kräuselte sich, all die feinen, schwebenden Schleier und Fahnen flogen durch die Luft dahin; die schaukelnden Lauben aus Spinneweb, die Hängebrücken und Balustraden oder wie sie nun heißen mögen, die dort von Blatt zu Blatt gespannt waren, verflogen wie nichts. Sechs Elfen kamen und brachten mir meinen Wurstspeiler, während sie fragten, ob ich irgend einen Wunsch hätte, den sie mir erfüllen könnten. Da bat ich sie, mir zu sagen, wie man Suppe aus einem Wurstspeiler bereiten könne.
"Wie wir das machen," sagte der Vornehmste und lachte "ja, das hast Du ja eben gesehen! Du kanntest wohl Deinen Wurstspeiler kaum wieder?"
"Also so meinen Sie es!" sagte ich und erzählte geradeheraus, weshalb ich auf Reisen wäre, und was man sich zuhause davon verspräche. "Welchen Gewinn," fragte ich, "hat der Mäusekönig und unser ganzes mächtiges Reich davon, daß ich all diese Herrlichkeit gesehen habe! Ich kann sie nicht aus dem Wurstspeiler herausschütteln und sagen: Seht, hier ist der Speiler, nun kommt die Suppe! Das wäre doch immerhin eine Art Nachgericht, wenn man satt wäre."
Da tauchte der Elf seinen kleinen Finger in die blaue Blüte eines Veilchens und sagte zu mir: "Gib acht, ich bestreiche Deinen Wanderstab, und wenn Du heim zum Schlosse des Mäusekönigs kommst, so berühre mit dem Stabe Deines Königs warme Brust. Dann werden Veilchen aus dem Stabe hervorblühen selbst in der kältesten Winterszeit, sieh, dann bringst Du doch etwas mit heim von uns, und nun bekommst Du noch etwas dazu." Aber bevor das Mäuschen sagte, was dieses Etwas wäre, richtete es den Stab gegen des Königs Brust, und wirklich, es sprang der herrlichste Blumenstrauß aus dem Stabe hervor. Er duftete so stark, daß der Mäusekönig den Mäusen, die am dichtesten am Schornstein standen, befahl, schnellsten ihre Schwänze über das Feuer zu halten, damit es ein bißchen angebrannt rieche, denn der Veilchenduft war nicht auszuhalten; er war nicht von der Art, wie man ihn hier schätzte.
"Aber was war das für ein Etwas dazu, von dem Du eben sprachst?" fragte der Mäusekönig.
"Ja," sagte das Mäuschen, "das ist das, was man den Knalleffekt nennt" und es drehte den Wurstspeiler um; da waren es keine Blumen mehr, nur den nackten Speiler hielt es in der Hand und erhob ihn wie einen Taktstock.
"Veilchen sind für die Augen, die Nase und das Herz," sagte der Elf zu mir, "doch es fehlt noch etwas für Ohren und Zunge." Dabei schlug es Takt und eine Musik setzte ein, nicht wie sie im Walde beim Fest der Elfen erklang, sondern wie sie in der Küche laut wird. Na, das war ein Tumult! Urplötzlich kam es, sauste wie der Wind durch alle Schornsteinrohre, Kessel und Töpfe kochten über, der Feuerhaken donnerte an den Messingkessel, und dann, ebenso plötzlich, war es wieder stille. Man hörte des Teekessels gedämpften Gesang, ganz wunderlich, man wußte nicht, wollte er beginnen oder aufhören. Und der kleine Topf kochte und der große Topf kochte, der eine kümmerte sich nicht um den anderen, es war, als habe der Topf seine Gedanken nicht beisammen. Und das kleine Mäuschen schwang seinen Taktstock wilder und wilder – die Töpfe schäumten, brodelten, kochten über, der Wind sauste, der Schornstein pfiff– hu ha, es wurde so grauen erregend, daß das kleine Mäuschen selbst den Stock fallen ließ.
"Das war eine schwierige Suppe" sagte der alte Mäusekönig, "wird sie nun angerichtet?"
"Das war alles!" sagte das Mäuschen und verneigte sich.
"Alles! ja, dann wollen wir hören, was die nächste zu sagen hat" sagte der Mäusekönig.
III. Was das zweite Mäuschen zu erzählen wußte.
"Ich bin in der Schloßbibliothek geboren," sagte die zweite Maus. "Ich und noch mehrere andere Mitglieder meiner Familie haben nie das Glück kennen gelernt, in ein Speisezimmer, geschweige denn in eine Speisekammer zu kommen. Als ich abreiste und dabei diesen Raum hier betrat, sah ich zum ersten Mal eine Küche. Wir litten wirklich Hunger auf der Bibliothek, doch dafür eigneten wir uns mancherlei Kenntnisse an. Dort oben erreichte uns das Gerücht von dem königlichen Preis, der für die Bereitung einer Suppe aus einem Wurstspeiler ausgesetzt war. Nach einigem Nachdenken zog meine alte Großmutter ein Manuskript hervor, das sie zwar nicht lesen konnte, aber sie hatte es einst lesen hören. Darin stand: Ist man ein Dichter, so kann man selbst aus einem Wurstspeiler Suppe kochen. Sie fragte mich, ob ich Dichterin wäre. Ich wußte mich frei davon, und sie sagte mir, daß ich eben sehen müsse, eine zu werden. Ich erkundigte mich, was dazu nötig sei, denn es schien mir ebenso schwierig zu sein, wie das Suppe kochen. Doch meine Großmutter war wohlunterrichtet; sie sagte, daß drei Dinge dazu notwendig wären: Verstand, Fantasie und Gefühl! Könnte ich mir diese zu eigen machen, so wäre ich eine Dichterin und würde auch die Sache mit dem Wurstspeiler ins rechte Lot bringen. Und so zog ich nach Westen in die weite Welt hinaus, um Dichterin zu werden.
Verstand, das wußte ich, ist das Wichtigste bei jedem Dinge, die beiden anderen Teile genießen nicht die gleiche Achtung. So ging ich also zunächst auf den Verstand aus. Ja, wo mochte er wohnen? Geh zur Ameise und werde weise! hat einst ein großer König der Juden gesagt. Und ich ruhte und rastete nicht, bis ich einen großen Ameisenhaufen gefunden hatte. Dort legte ich mich auf die Lauer, um weise zu werden.
Die Ameisen sind ein sehr respektables Volk, sie sind nur auf Verstand eingestellt. Alles ist bei ihnen ein Rechenstück, bei dem die Probe aufs Exempel gemacht ist; es geht auf. Arbeiten und Eier legen, sagen sie, ist in der Zeit leben und für die Zukunft sorgen, und danach handeln sie. Sie scheiden sich in reine und unreine Ameisen, der Rang besteht in einer Nummer. Die Ameisenkönigin ist Nummer eins, und ihre Meinung ist die einzig richtige. Sie hatte alle Weisheit gepachtet und das zu wissen war für mich von Wichtigkeit. Sie sagte vieles, was so klug war, daß es mir dumm vorkam. Sie sagte auch, ihr Haufen sei das Höchste in dieser Welt. Aber dicht bei dem Haufen stand ein Baum, der höher war, viel höher, das ließ sich nicht ableugnen, deshalb sprach man nicht davon. Eines Abends hatte sich eine Ameise dorthin verirrt, war den Stamm hinauf gekrochen, nicht einmal bis zur Krone, aber doch höher, als je eine Ameise gekommen war. Und als sie umgekehrt und wieder nachhause gekommen war, erzählte sie im Haufen, daß es etwas weit Höheres draußen gäbe. Doch das hatten alle Ameisen als Beleidigung des ganzen Gemeinwesens aufgefaßt, und so wurde die Ameise zum Maulkorb und lebenslänglicher Einsamkeit verurteilt. Aber kurze Zeit darauf kam eine andere Ameise zu dem Baum und machte die gleiche Reise und Entdeckung. Sie sprach auch davon, jedoch, wie man sagte, mit Besonnenheit und in unklaren Ausdrücken, und da sie außerdem eine geachtete Ameise, eine von den reinen war, so glaubte man ihr, und als sie starb, wurde ihr eine Eierschale als Monument für ihre Verdienste um die Wissenschaften gesetzt." - "Ich sah," sagte das Mäuschen, "daß die Ameisen häufig mit ihren Eiern auf dem Rücken umher liefen. Eine von ihnen verlor das ihre und machte große Anstrengungen, es wieder aufzuladen, doch wollte es ihr nicht glücken. Zwei andere kamen Ihr mit allen Kräften zu Hilfe, so daß sie fast ihre eigenen Eier verloren hätten, da ließen sie es augenblicklich sein, denn jeder ist sich selbst der Nächste, und die Ameisenkönigin äußerte darüber, daß hier bei sowohl Herz als Verstand bewiesen worden wären. Diese beiden Eigenschaften stellen uns Ameisen an die Spitze der Vernunftswesen. Der Verstand soll und muß das Überwiegende sein, und ich habe den größten!" sagte sie und erhob sich auf den Hinterbeinen. Sie machte sich dadurch so deutlich erkennbar – ich konnte gar nicht fehl gehen – und so verschluckte ich sie. Geh zur Ameise und werde weise! Nun hatte ich die Königin!
Ich ging nun näher an den besprochenen Baum heran; es war eine Eiche mit hohem Stamm und mächtiger Krone, die sehr alt war. Ich wußte, daß hier ein lebendiges Geschöpf, eine Frau, wohne, die Dryade genannt wurde. Sie wird mit dem Baume zugleich geboren und stirbt mit ihm. Ich hatte davon auf der Bibliothek gehört. Nun sah ich solch einen Baum, sah solch ein Lebewesen. Sie stieß einen furchtbaren Schrei aus, als sie mich so nahe erblickte; sie hatte, wie alle Frauenzimmer, die größte Angst vor einer Maus, doch sie hatte dazu mehr Ursache als die anderen, denn ich hätte ja den Baum durchnagen können, an dem ihr Leben hing. Ich redete freundlich und herzlich mit ihr, sprach ihr Mut zu, und sie nahm mich auf ihre feine Hand. Als sie erfuhr, weshalb ich in die weite Welt hinaus gegangen war, versprach sie mir, daß ich vielleicht schon am gleichen Abend einen der beiden Schätze, nach denen ich suchte, erhalten solle. Sie erzählte mir, das Phantasus ein recht guter Freund von ihr und schön wie der Liebesgott sei. Er pflege manche Stunde der Ruhe hier unter des Baumes dicht belaubten Zweigen, die dann noch voller über ihnen beiden rauschten. Er nenne, sie seine Dryade, und den Baum seinen Baum. Die knorrige, mächtige schöne Eiche sei gerade nach seinem Sinne, die Wurzeln klammerten sich tief und fest in die Erde, Stamm und Krone erhöben sich hoch in die frische Luft und kannten den fegenden Schnee, die scharfen Winde und den warmen Sonnenschein, wie sie gekannt werden sollen. Und die Vögel sängen dort oben und erzählten von den fremden Ländern. Auf dem einzigen verdorrten Zweige habe der Storch sein Nest gebaut, das schmücke so hübsch, und man erfahre doch einiges vom Lande der Pyramiden. "All dies hört Phantasus so gern," sagte sie, "es ist ihm sogar nicht genug, ich selbst muß ihm noch vom Leben im Walde erzählen von der Zeit an, wo ich noch klein war und der Baum so zart, daß eine Nessel ihn verbergen konnte, bis auf den heutigen Tag, wo er so groß und mächtig dasteht. Setz Dich nun hier unter den Waldmeister und gib acht: wenn Phantasus kommt, werde ich wohl Gelegenheit finden, ihn am Flügel zu zupfen und ihm dabei eine kleine Feder auszureißen. Die nimm dann, eine bessere bekam kein Dichter;– dann hast Du genug."
"Und Phantasus kam, die Feder wurde ihm ausgerissen und ich nahm sie," sagte das Mäuschen, "ich mußte sie aber erst in Wasser legen, damit sie weich würde, sie war immer noch sehr schwer verdaulich, aber ich knabberte, sie doch auf. Es ist gar nicht leicht, sich durchzubeißen, bis man ein Dichter ist, es ist gar viel, was man in sich aufnehmen muß. Nun hatte ich schon zwei von den Dingen, Verstand und Fantasie, und durch diese beiden wußte ich, daß das dritte auf der Bibliothek zu finden sei, denn ein großer Mann hat gesagt und geschrieben, daß es Romane gäbe, die nur dazu da seien, die Menschen von den überflüssigen Tränen zu befreien, sie seien so eine Art Schwamm, um die Gefühle aufzusaugen. Ich entsann mich ein paar dieser Bücher, sie waren mir immer ganz appetitlich vorgekommen, sie waren so zerlesen, so fettig, sie mußten ja ganze Gefühlsströme in sich aufgenommen haben.
Ich kehrte wieder nachhause in die Bibliothek zurück, aß sogleich ziemlich einen ganzen Roman auf, das heißt also das Weiche, das Eigentliche, die Rinde dagegen, den Einband, ließ ich liegen. Als ich ihn nun verdaut hatte und noch einen zweiten dazu, verspürte ich schon, wie es sich in mir regte; ich aß ein wenig von dem dritten, da war ich Dichterin. Das sagte ich mir selbst und den anderen auch. Ich hatte Kopfschmerzen. Leibschmerzen, ich weiß nicht mehr alle die Schmerzen, die ich hatte. Ich dachte nun darüber nach, welche Geschichte in Verbindung mit einem Wurstspeiler gesetzt werden könnte, und bald wimmelte es von Speilern in meinen Gedanken; die Ameisenkönigin hat einen ungewöhnlichen Verstand gehabt. Ich entsann mich des Mannes, der ein weißes Hölzchen in den Mund nahm, wodurch beide unsichtbar wurden, und so gingen über diese Geschichte meine Gedanken über alle Hölzchen und Speiler, von denen je eine Geschichte gehandelt hatte, sie gingen völlig in Speilern auf. Daraus müßte sich ein Gedicht machen lassen, wenn man Dichterin ist, und das bin ich, ich habe es mir sauer werden lassen. So werde ich nun jeden Tag mit einem Speiler, einer Geschichte, aufwarten können, ja, das ist eine Suppe."
"Nun wollen wir also die dritte hören" sagte der Mäusekönig.
"Piep, piep" sagte es in der Küchentür, eine kleine Maus, es war die vierte von ihnen, die tot geglaubte, eilte herein und rannte dabei den Wurstspeiler mit dem Trauerflor um. Sie war Tag und Nacht gelaufen, war auf der Eisenbahn mit einem Güterzug gefahren, wozu sie Gelegenheit gefunden hatte, und wäre doch fast zu spät gekommen. Sie drängte sich vor, sah ganz zerzaust aus und hatte wohl ihren Wurstspeiler, aber nicht ihre Sprache verloren; sie erzählte sogleich darauf los, als ob man nur auf sie gewartet hatte, das alles kam so unerwartet, daß niemand Zeit fand, sich über sie oder ihre Rede aufzuhalten, bevor sie damit fertig war. Nun wollen wir hören:
IV. Was die vierte Maus, die die Rede an sich riß, ehe die dritte Maus gesprochen hatte, zu erzählen wußte.
"Ich ging gleich in die Großstadt," sagte sie, "auf den Namen besinne ich mich nicht mehr, ich kann so schlecht Namen behalten. Von der Eisenbahn kam ich mit konfiszierten Gütern nach dem Rathause, und dort lief ich zu dem Kerkermeister. Er erzählte von seinen Gefangenen, besonders von einem, der unbesonnene Worte hatte fallen lassen, die dann weiter erzählt worden waren. Er habe gesagt, daß das Ganze nur eine Suppe aus Wurstspeilern wäre, und diese Suppe könne ihn leicht den Kopf kosten. Das weckte mein Interesse für den Gefangenen," sagte die kleine Maus, "und so nahm ich die Gelegenheit wahr und schlüpfte zu ihm hinein. Hinter verschlossene Türen führt immer ein Mauseloch. Er sah bleich aus, hatte einen großen Bart und große, leuchtende Augen. Die Lampe rußte und die Wände waren daran gewöhnt, sie wurden nicht schwärzer. Der Gefangene ritzte Bilder und Verse hinein, Weiß auf Schwarz, aber ich las sie nicht. Ich glaube, er langweilte sich, und so war ich ein willkommener Gast. Er lockte mich mit Brotkrumen, mit Pfeifen und sanften Worten; er war so froh über mich! Da faßte ich Vertrauen, und wir wurden Freunde. Er teilte Brot und Wasser mit mir und gab mir Käse und Wurst. Ich lebte flott; aber es war hauptsächlich der gute Umgang, der mich fesselte. Er ließ mich auf seiner Hand und seinem Arm umherlaufen, bis ganz hinauf in den Ärmel. Er ließ mich in seinen Bart kriechen und nannte mich seine kleine Freundin, ich gewann ihn ordentlich lieb, so etwas ist eben gegenseitig. Ich vergaß mein Geschäft draußen in der Welt und vergaß meinen Wurstspeiler in einer Fußbodenritze, wo er heute noch liegt. Ich wollte bleiben, wo ich war. Wenn ich ging, so hatte ja der arme Gefangene gar niemanden, und das ist zu wenig in dieser Welt! Ich blieb also, aber er blieb nicht. Das letzte Mal sprach er so traurig mit mir; er gab mir doppelt soviel Brot und Käserinde und warf mir noch eine Kußhand zu; er ging und kam niemals wieder. Ich kenne seine Geschichte nicht. 'Suppe aus einem Wurstspeiler' sagte der Kerkermeister, und zu ihm ging ich, aber ihm hätte ich nicht trauen sollen. Wohl nahm er mich auf seine Hand, aber er setzte mich in einen Käfig, in eine Tretmühle. Das ist etwas Grauenhaftes. Man läuft und läuft und kommt nicht weiter und wird obendrein ausgelacht!
Des Kerkermeisters Enkelin war ein liebes kleines Ding, mit goldblondem Lockenhaar, fröhlichen Augen und einem lachenden Mund. 'Armes kleines Mäuschen' sagte sie, guckte in meinen häßlichen Käfig hinein, schob den eisernen Riegel zurück– und ich sprang hinab auf das Fensterbrett und in die Dachrinne hinaus. Frei, frei! Daran allein dachte ich, und nicht an meinen Reisezweck.
Es war dunkel, und es ging auf die Nacht zu. In einem alten Turm nahm ich Herberge; dort wohnte ein Wächter und eine Eule. Ich traute keinem von ihnen über den Weg, am wenigsten der Eule. Sie gleicht einer Katze und hat den großen Fehler, daß sie Mäuse frißt. Doch man kann sich irren, und das tat ich. Es war eine respektable, überaus gebildete alte Eule, sie wußte mehr als der Wächter und ebensoviel wie ich. Die jungen Eulen machten um jede Kleinigkeit ein großes Geschrei. 'Kocht keine Suppe aus einem Wurstspeiler' sagte sie, das war das Härteste, was sie ihnen sagen konnte, sie hatte soviel Gefühl für ihre eigene Familie. Ich faßte ein solches Vertrauen zu ihr, daß ich von der Spalte aus, wo ich saß, Piep sagte. Dies Zutrauen gefiel ihr, und sie versicherte mir, daß ich jetzt unter ihrem Schutze stände. Kein Tier dürfe mir ein Leides tun, das wolle sie selbst im Winter tun, wenn es mit der Kost knapp würde.
Sie war in allen Dingen gleich beschlagen; sie bewies mir, daß der Wächter ohne Horn nicht tuten könne, er bilde sich schrecklich viel darauf ein und glaube, er sei Eule im Turm! Etwas Großes solle es sein und sei doch nur etwas ganz Geringes, Suppe aus einem Wurstspeiler! Ich bat sie um das Rezept, und darauf erklärte sie mir folgendes: Suppe aus einem Wurstspeiler sei nur eine menschliche Redensart, der verschiedener Sinn untergelegt werden könne. Jeder glaube, seine Auslegung sei die rechte. Doch sei das Ganze eigentlich nichts!
Nichts? fragte ich; ich war tief betroffen. Die Wahrheit ist nicht immer angenehm, aber sie ist das Höchste, das sagte auch die alte Eule, Ich dachte darüber nach und sah ein, wenn ich das Höchste brächte, so brächte ich weit mehr, als die Suppe aus einem Wurstspeiler. Und so eilte ich davon, um noch rechtzeitig nachhause zu kommen und das Höchste und Beste hierher zu bringen: die Wahrheit! Die Mäuse sind ein aufgeklärtes Volk und der König ist es vor ihnen allen. Er ist imstande, mich um der Wahrheit willen zur Königin zu machen!"
"Deine Wahrheit ist Lüge!" sagte das Mäuschen, das noch keine Erlaubnis zum sprechen bekommen hatte. "Ich kann die Suppe bereiten und werde es tun!"
Wie es gemacht wird.
"Ich bin nicht gereist," sagte die vierte Maus, "ich blieb im Lande, das ist das einzig Richtige! Man braucht nicht zu reisen, man kann ebenso gut alles hier bekommen. Ich blieb! Ich habe meine Weisheit nicht von übernatürlichen Wesen bekommen, habe sie auch nicht gefressen oder habe mit Eulen gesprochen. Ich habe es durch eigenes Denken erreicht. Wollen Sie jetzt den Kessel aufsetzen und mit Wasser füllen, ganz bis zum Rand! Machen Sie Feuer darunter! So, und nun lassen Sie das Wasser kochen, bis es brodelt. Nun werfen Sie den Speiler hinein! Darauf wollen Seine Majestät der Mäusekönig allerhöchst seinen Schwanz in das kochende Wasser tauchen und damit umrühren! Je länger er rührt, umso kräftiger wird die Suppe. Das kostet nichts, und man braucht keine Zutaten, nur umrühren!"
"Kann es nicht ein anderer tun?" fragte der Mäusekönig.
"Nein!" sagte die Maus, "die Kraft ist nur im Schwanze des Mäusekönigs!"
Und das Wasser brodelte und der Mäusekönig stellte sich daneben, es war ein ganz gefährlicher Anblick! Er streckte seinen Schwanz aus, wie die Mäuse es in der Milchkammer tun, wenn sie die Sahne von einer Schüssel schöpfen und sich dann den Schwanz lecken. Doch er brachte ihn nur bis in den heißen Dampf, da sprang er eiligst wieder hinab und sagte: "Natürlich wirst Du meine Königin! Mit, der Suppe wollen wir bis zur goldenen Hochzeit warten, dann haben die Armen in meinem Reiche etwas, worauf sie sich freuen können, das wird eine lange Freude!"
Und so hielten sie Hochzeit; aber einige der Mäuse sagten, als sie nachhause kamen, das könne man doch nicht eine Suppe aus einem Wurstspeiler nennen, es wäre eher Mauseschwanzsuppe! Ein und das andere von dem, was erzählt worden war, fanden sie ganz gut aber das Ganze hatte anders sein müssen. "Ich würde es so oder so erzählt haben."
Das war die Kritik, und die ist immer so klug, hinterher.
Die Geschichte ging durch die ganze Welt, die Meinungen darüber waren geteilt, aber die Geschichte selbst blieb ganz. Und das ist das Wichtigste im großen wie im kleinen, auch für die Suppe aus einem Wurstspeiler. Doch soll man nie auf Dank rechnen!
EIN BILD VOM KASTELLWALL ...

Es ist Herbst, wir stehen auf dem Wall, der das Kastell umschließt und sehen über das Meer, auf die vielen Schiffe und zu der schwedischen Küste hinüber die sich klar im Abendsonnenschein erhebt. Hinter uns fällt der Wall steil zur Tiefe ab. Dort stehen prächtige Bäume, das Laub fällt gelb von den Zweigen; unten liegen düstere Häuser mit Holzpalisaden, und innen, wo die Schildwache geht, ist es enge und finster. Aber noch dunkler ist es dort hinter dem vergitterten Loche; da sitzen gefangene Sklaven, die ärgsten Verbrecher.
Ein Strahl der niedergehenden Sonne fällt in die kahle Zelle. Die Sonne scheint auf Böse und Gute! Der finstere, mürrische Gefangene folgt mit einem bösen Blick dem kalten Sonnenstrahl. Ein kleiner Vogel fliegt gegen das Gitter. Der Vogel singt für Böse und Gute! Er zwitschert ein kurzes "Quivit," bleibt aber sitzen; er schlägt mit den Flügeln, zupft ein Federchen heraus, plustert die Halsfedern auf und der böse Mann sieht ihm zu. Ein milderer Ausdruck geht über das häßliche Gesicht; ein Gedanke, ihm selbst nicht ganz bewußt, leuchtet in seiner Brust auf, dem Sonnenstrahl verwandt, der durch das Gitter fällt, dem Dufte der Veilchen verwandt, die im Frühling so reich draußen blühen. Nun klingt das Waldhorn lieblich und kräftig herein. Der Vogel fliegt vom Gitter des Gefangenen fort, der Sonnenstrahl verschwindet, und es wird dunkel in der Zelle, dunkel in des bösen Mannes Herzen, aber die Sonne hat doch hineingeschienen und der Vogel hineingesungen.
Tönt fort, ihr schönen Klänge des Waldhorns! Der Abend ist mild, das Meer spiegelglatt und stille.
TÖLPEL-HANS
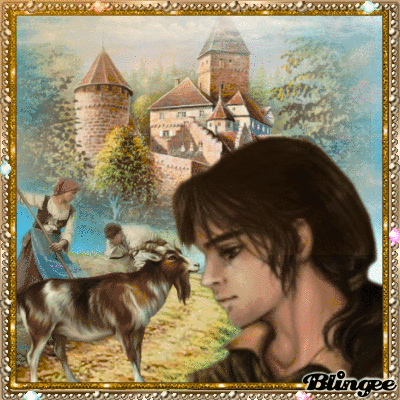
Tief im Innern des Landes lag ein alter Herrenhof; dort war ein Gutsherr, der zwei Söhne hatte, die sich so witzig und gewitzigt dünkten, daß die Hälfte genügt hätte. Sie wollten sich nun um die Königstochter bewerben, denn die hatte öffentlich anzeigen lassen, sie wolle den zum Ehegemahl wählen, der seine Worte am besten zu stellen wisse.
Die beiden bereiteten sich nun volle acht Tage auf die Bewerbung vor, die längste, aber allerdings auch genügende Zeit, die ihnen vergönnt war, denn sie hatten Vorkenntnisse, und wie nützlich die sind, weiß jedermann. Der eine wußte das ganze lateinische Wörterbuch und nebenbei auch drei Jahrgänge vom Tageblatte des Städtchens auswendig, und zwar so, daß er alles von vorne und hinten, je nach Belieben, hersagen konnte. Der andere hatte sich in die Innungsgesetze hineingearbeitet und wußte auswendig, was jeder Innungsvorstand wissen muß, weshalb er auch meinte, er könne bei Staatsangelegenheiten mitreden und seinen Senf dazugeben; ferner verstand er noch eins: Er konnte Hosenträger mit Rosen und anderen Blümchen und Schnörkeleien besticken, denn er war auch fein und fingerfertig.
"Ich bekomme die Königstochter!" riefen sie alle beide, und so schenkte der alte Papa einem jeden von ihnen ein prächtiges Pferd. Derjenige, welcher das Wörterbuch und das Tageblatt auswendig wußte, bekam einen Rappen, der Innungskluge erhielt ein milchweißes Pferd, und dann schmierten sie sich die Mundwinkel mit Fischtran ein, damit sie recht geschmeidig würden. – Das ganze Gesinde stand unten im Hofraume und war Zeuge, wie sie die Pferde bestiegen, und wie von ungefähr kam auch der dritte Bruder hinzu, denn der alte Gutsherr hatte drei Söhne, aber niemand zählte diesen dritten mit zu den anderen Brüdern, weil er nicht so gelehrt wie diese war, und man nannte ihn auch gemeinhin Tölpel-Hans.
"Ei!–" sagte Tölpel-Hans, "wo wollt ihr hin? Ihr habt euch ja in den Sonntagsstaat geworfen!"
"Zum Hofe des Königs, uns die Königstochter zu erschwatzen! Weißt du denn nicht, was dem ganzen Lande bekannt gemacht ist?" Und nun erzählten sie ihm den Zusammenhang.
"Ei, der tausend! Da bin ich auch dabei!" rief Tölpel-Hans, und die Brüder lachten ihn aus und ritten davon.
"Väterchen!" schrie Tölpel-Hans, "ich muß auch ein Pferd haben. Was ich für eine Lust zum Heiraten kriege! Nimmt sie mich, so nimmt sie mich, und nimmt sie mich nicht, so nehm ich sie – kriegen tu ich sie!"
"Laß das Gewäsch!" sagte der Alte, "dir gebe ich kein Pferd. Du kannst ja nicht reden, du weißt ja deine Worte nicht zu stellen; nein, deine Brüder, ah, das sind ganz andere Kerle."
"Nun," sagte Tölpel-Hans, "wenn ich kein Pferd haben kann, so nehme ich den Ziegenbock, der gehört mir sowieso, und tragen kann er mich auch!" Und gesagt, getan. Er setzte sich rittlings auf den Ziegenbock, preßte die Hacken in dessen Weichen ein und sprengte davon, die große Hauptstraße wie ein Sturmwind dahin. Hei, hopp! Das war eine Fahrt! "Hier komm" ich!" schrie Tölpel-Hans und sang, daß es weit und breit widerhallte.
Aber die Brüder ritten ihm langsam voraus; sie sprachen kein Wort, sie mußten sich alle die guten Einfälle überlegen, die sie vorbringen wollten, denn das sollte alles recht fein ausspekuliert sein!
"Hei!" schrie Tölpel-Hans, "hier bin ich! Seht mal, was ich auf der Landstraße fand!" – Und er zeigte ihnen eine tote Krähe, die er aufgehoben hatte.
"Tölpel!" sprachen die Brüder, "was willst du mit der machen?"
"Mit der Krähe? – Die will ich der Königstochter schenken!"
"Ja, das tu nur!" lachten sie.
"Hei – hopp! Hier bin ich! Seht, was ich jetzt habe, das findet man nicht alle Tage auf der Landstraße!"
Und die Brüder kehrten um, damit sie sähen, was er wohl noch haben könnte. "Tölpel!" sagten sie, "das ist ja ein alter Holzschuh, dem noch dazu das Oberteil fehlt; wirst du auch den der Königstochter schenken?"
"Wohl werde ich das!" erwiderte Tölpel-Hans; und die Brüder lachten und ritten davon; sie gewannen einen großen Vorsprung.
"Hei hoppsassa! Hier bin ich!" rief Tölpel-Hans; "nein, es wird immer besser! Heißa! Nein! Es ist ganz famos!"
"Was hast du denn jetzt?" fragten die Brüder.
"Oh," sagte Tölpel-Hans, "das ist gar nicht zu sagen! Wie wird sie erfreut sein, die Königstochter."
"Pfui!" sagten die Brüder, "das ist ja reiner Schlamm, unmittelbar aus dem Graben."
"Ja, freilich ist es das!" sprach Tölpel-Hans, "und zwar von der feinsten Sorte, seht, er läuft einem gar durch die Finger durch!" und dabei füllte er seine Tasche mit dem Schlamm.
Allein, die Brüder sprengten dahin, daß Kies und Funken stoben, deshalb gelangten sie auch eine ganze Stunde früher als Tölpel-Hans an das Stadttor. An diesem bekamen alle Freier sofort nach ihrer Ankunft Nummern und wurden in Reih und Glied geordnet, sechs in jede Reihe, und so eng zusammengedrängt, daß sie die Arme nicht bewegen konnten; das war sehr weise so eingerichtet, denn sie hätten einander wohl sonst das Fell über die Ohren gezogen, bloß weil der eine vor dem andern stand.
Die ganze Volksmenge des Landes stand rings um das königliche Schloß in dichten Massen zusammengedrängt, bis an die Fenster hinauf, um die Königstochter die Freier empfangen zu sehen; je nachdem einer von diesen in den Saal trat, ging ihm die Rede aus wie ein Licht.
"Der taugt nichts!" sprach die Königstochter. "Fort, hinaus mit ihm!"
Endlich kam die Reihe an denjenigen der Brüder, der das Wörterbuch auswendig wußte, aber er wußte es nicht mehr; er hatte es ganz vergessen in Reih und Glied; und die Fußdielen knarrten, und die Zimmerdecke war von lauter Spiegelglas, daß er sich selber auf dem Kopfe stehen sah, und an jedem Fenster standen drei Schreiber und ein Oberschreiber, und jeder schrieb alles nieder, was gesprochen wurde, damit es sofort in die Zeitung käme und für einen Silbergroschen an der Straßenecke verkauft werde. Es war entsetzlich, und dabei hatten sie dermaßen in den Ofen eingeheizt, daß er glühend war.
"Hier ist eine entsetzliche Hitze, hier!" sprach der Freier.
"Jawohl! mein Vater bratet aber auch heute junge Hähne!" sagte die Königstochter.
"Mäh!" Da stand er wie ein Mähäh; auf solche Rede war er nicht gefaßt gewesen; kein Wort wußte er zu sagen, obgleich er etwas Witziges hatte sagen wollen. "Mäh!"
"Taugt nichts!" sprach die Königstochter. "Fort, hinaus mit ihm!" Und raus mußte er. Nun trat der andere Bruder ein.
"Hier ist eine entsetzliche Hitze!" sagte er.
"Jawohl, wir braten heute junge Hähne!" bemerkte die Königstochter.
"Wie be – wie?" sagte er, und die Schreiber schrieben: "Wie be – wie?"
"Taugt nichts!" sagte die Königstochter. "Fort, hinaus mit ihm!"
Nun kam Tölpel-Hans dran; er ritt auf dem Ziegenbocke geradeswegs in den Saal hinein. "Na, das ist doch eine Mordshitze hier!" sagte er.
"Jawohl, ich brate aber auch junge Hähne!" sagte die Königstochter.
"Ei, das ist schön!" erwiderte Tölpel-Hans, "dann kann ich wohl eine Krähe mitbraten?"
"Mit dem größten Vergnügen!" sprach die Königstochter; "aber haben etwas, worin Sie braten können? Denn ich habe weder Topf noch Tiegel."
"Oh, das hab ich!" sagte Tölpel-Hans. "Hier ist Kochgeschirr mit zinnernem Bügel," und er zog den alten Holzschuh hervor und legte die Krähe hinein.
"Das ist ja ein ganze Mahlzeit," sagte die Königstochter, "aber wo nehmen wir die Brühe her?"
"Die habe ich in der Tasche!" sprach Tölpel-Hans. " Ich habe so viel, daß sogar etwas davon wegwerfen kann!" Und nun goß er etwas Schlamm aus der Tasche heraus.
"Das gefällt mir!" sagte die Königstochter, "du kannst doch antworten, und du kannst reden, und ich will dich zum Manne haben! – Aber weißt du auch, daß jedes Wort, das wir sprechen und gesprochen haben, niedergeschrieben wird und morgen in die Zeitung kommt? An jedem Fenster, siehst du, stehen drei Schreiber und ein alter Oberschreiber, und dieser alte Oberschreiber ist noch der schlimmste, denn er kann nichts begreifen!" Und das sagte sie nur, um Tölpel-Hans zu ängstigen. Und die Schreiber wieherten und spritzten dabei jeder einen Tintenklecks auf den Fußboden.
"Ah, das ist also die Herrschaft!" sagte Tölpel-Hans; "nun, so werde ich dem Oberschreiber das Beste geben!" Und damit kehrte er seine Taschen um und warf ihm den Schlamm gerade ins Gesicht.
"Das war fein gemacht!" sagte die Königstochter, "das hätte ich nicht tun können, aber ich werde es schon lernen!" –
Tölpel-Hans wurde König, bekam eine Frau und eine Krone und saß auf einem Throne, und das haben wir ganz naß aus der Zeitung des Oberschreibers und Schreiberinnungsmeisters – und auf die ist zu bauen.
DER ALTE GRABSTEIN
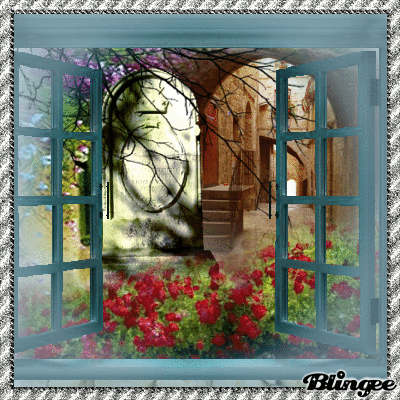
In einem der kleinen Marktflecken bei einem Manne, der seinen eigenen Hof hatte, saß abends in der Jahreszeit, in der die Abende länger werden, die ganze Familie im Kreise zusammen. Es war noch milde und warm. Die Lampe war angezündet, die langen Gardinen hingen vor den Fenstern nieder, auf denen Blumentöpfe standen, und draußen war herrlicher Mondschein. Aber davon sprachen sie nicht, sie sprachen von einem alten, großen Stein, der unten im Hofe lag, dicht bei der Küchentür, wohin die Mädchen oft das geputzte Kupferzeug stellten, damit es in der Sonne trocknen sollte, und wo die Kinder gern spielten, es war eigentlich ein alter Grabstein.
"Ja," sagte der Hausherr, "ich glaube, er stammt aus der alten, abgebrochenen Klosterkirche. Die Kanzel, die Denkmäler und die Grabsteine wurden ja verkauft! Mein seliger Vater kaufte mehrere davon; sie wurden zu Pflastersteinen zerschlagen, aber dieser Stein blieb übrig und liegt seitdem im Hofe."
"Man kann wohl sehen, daß es ein Grabstein ist," sagte das älteste von den Kindern. "Es ist darauf noch ein Stundenglas und ein Stück von einem Engel zu sehen, aber die Inschrift, die darauf gestanden hat, ist schon verwischt außer dem Namen Preben und einem großen 'S', das gleich dahinter steht, und ein bißchen weiter unten steht 'Marthe'. Mehr kann man nicht herausbekommen und auch das ist nur deutlich zu sehen, wenn es geregnet hat oder wir ihn gewaschen haben."
"Herrgott, das ist Preben Svanes und seiner Frau Leichenstein!" sagte ein alter, alter Mann im Zimmer. Seinem Alter nach hätte er gut und gerne der Großvater all der Alten und Jungen, die hier versammelt waren, sein können. "Ja, das Ehepaar war eines der letzten, die auf dem alten Klosterkirchhofe beerdigt worden sind! Das war ein altes, ehrenhaftes Paar aus meinen Knabenjahren! Alle kannten sie, und alle liebten sie; sie waren das Alters-Königspaar hier in der Gegend. Die Leute sagten von ihnen, daß sie über eine Tonne Gold besäßen, doch gingen sie einfach gekleidet, im gröbsten Zeug, aber ihr Linnen war blendend weiß. Das war ein prächtiges altes Paar. Preben und Marthe. Wenn sie auf der Bank oben auf der großen Steintreppe des Hauses saßen, über die der alte Lindenbaum seine Zweige breitete, und sie so freundlich und milde nickten, wurde man ordentlich fröhlich.
Sie waren unendlich gutherzig gegen die Armen! Sie speisten sie und kleideten sie, und es war Vernunft und wahres Christentum in all ihren Wohltaten. Zuerst starb die Frau. Ich entsinne mich noch so gut des Tages. Ich war ein kleiner Knabe und mit meinem Vater drinnen beim alten Preben, als sie gerade hinübergeschlummert war. Der alte Mann war so bewegt, er weinte wie ein Kind. Die Tote lag noch in der Schlafkammer, dicht neben dem Zimmer, in dem wir saßen. Und er sprach zu meinem Vater und ein paar Nachbarn davon, wie einsam es nun sein würde, wie gut sie gewesen sei, wieviele Jahre sie zusammen gelebt hätten und wie es zugegangen wäre, daß sie einander kennen gelernt und sich lieb gehabt hätten. Ich war, wie gesagt, klein und stand und hörte zu, aber es erfüllte mich seltsam stark, dem alten Mann zu lauschen und zu sehen, wie er immer lebhafter wurde und rote Wangen bekam, als er vom Verlobungstage sprach und davon, wie lieblich sie gewesen wäre und wieviele unschuldige, kleine Umwege er gemacht hätte, um mit ihr zusammenzutreffen.
Und er erzählte vom Hochzeitstag; seine Augen leuchteten auf dabei, er lebte sich gleichsam wieder zurück in die schönen Zeiten damals, und sie lag dicht dabei in der Kammer, tot, eine alte Frau, und er war ein alter Mann und sprach von den Zeiten der Hoffnung! – ja, ja, so gehts! Damals war ich ein Kind nur, und heute bin ich alt, alt wie Preben Svane. Die Zeit vergeht und alles verändert sich! Ich erinnere mich noch gut ihres Begräbnistages. Der alte Preben ging dicht hinter dem Sarge her. Ein paar Jahre vorher hatte das Ehepaar seinen Grabstein meißeln lassen mit Inschrift und Namen, bis auf den Todestag. Der Stein wurde am Abend hinausgefahren und auf das Grab gelegt, und ein Jahr später wurde er wieder emporgehoben und der alte Preben kam zu seiner Frau heim. – Sie hinterließen nicht solchen Reichtum, wie die Leute geglaubt und behauptet hatten.
Das was blieb, fiel an die Familie, die weit entfernt lebte, keiner hatte sie je gekannt. Das Fachwerkhaus mit der Bank auf der hohen Steintreppe unter dem Lindenbaum wurde vom Magistrat niedergerissen, denn es war allzu baufällig, als daß man es hätte stehen lassen dürfen. Später, als es der Klosterkirche ebenso erging und der Kirchhof aufgehoben wurde, kam Prebens und Marthes Grabstein, wie alles andere von dort, zu dem, der ihn kaufen wollte, und nun hat es sich gerade so getroffen, daß er nicht mit zerschlagen und verbraucht worden ist, sondern noch immer im Hofe liegt als Spielzeug für die Kleinen und als Trockenstelle für das gescheuerte Küchenzeug der Mädchen. Die gepflasterte Straße geht nun über die Ruhestätte des alten Preben und seiner Frau. Keiner kennt sie mehr."
Und der alte Mann, der all dies erzählte, schüttelte wehmütig das Haupt. "Vergessen" – "Alles wird vergessen" sagte er.
Und dann sprachen sie im Zimmer von anderen Dingen, aber der kleinste Knabe, ein Kind mit großen, ernsten Augen, kletterte auf den Stuhl hinter der Gardine und sah hinab in den Hof, wo der Mond hell auf den großen Stein schien, der ihm zuvor stets leer und flach erschienen war, nun aber da lag, wie ein großes Blatt im Buche der Geschichte. Alles, was der Knabe von Preben und seiner Frau gehört hatte, knüpfte sich an den Stein. Und er blickte auf ihn und hinauf in den klaren, lichten Mond in der reinen, hohen Luft, und es war, als ob eines Gottes Antlitz über die Erde hinschien.
"Vergessen. Alles wird vergessen!" klang es im Zimmer, und in diesem Augenblick küßte ein unsichtbarer Engel des Kindes Brust und Stirn und flüsterte leise: "Bewahre das empfangene Samenkorn gut. Bewahre es bis zur Zeit der Reife. Durch Dich, o Kind, sollen die verwischte Inschrift, der verwitterte Grabstein in leuchtenden, goldenen Zügen für kommende Geschlechter bewahrt bleiben. Das alte Ehepaar soll wieder Arm in Arm durch die alten Straßen wandern, mit frischen, roten Wangen lächelnd auf der Steintreppe unter dem Lindenbaum sitzen und arm und reich zunicken. Das Samenkorn aus dieser Stunde wird im Laufe der Jahre sich in eine blühende Dichtung verwandeln. Das Gute und Schöne wird nicht vergessen, es lebt in Sagen und Liedern."
EIN BLATT VOM HIMMEL
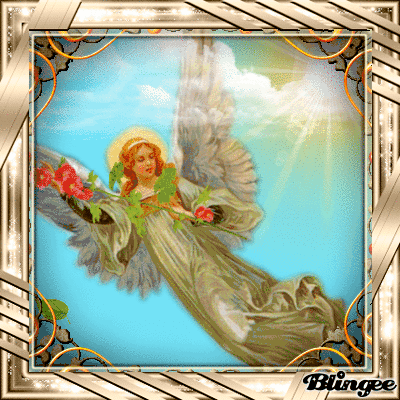
Hoch oben in der dünnen, klaren Luft flog ein Engel mit einer Blume aus dem Himmelsgarten, und während er einen Kuß auf die Blume drückte, löste sich ein winzig kleines Blättchen ab und fiel auf die nasse Erde mitten im Walde; da faßte es sogleich Wurzeln und begann mitten zwischen den anderen Kräutern zu sprossen.
"Das ist ja ein merkwürdiger Steckling" sagten sie, und keiner wollte sich zu ihm bekennen, weder die Distel noch die Brennessel.
"Es wird wohl eine Art Gartengewächs sein" sagten sie und lachten spöttisch. Und sie machten sich über das vermeintliche Gartengewächs lustig; aber es wuchs und wuchs wie keines von den anderen und trieb Zweige weit umher in langen Ranken.
"Wo willst Du hin?" sagten die hohen Disteln, die Stacheln an jedem Blatte hatten. "Du gehst zu weit. Deine Zweige haben keine Stütze und keinen Halt mehr. Wir können doch nicht stehen und Dich tragen!"
Der Winter kam und Schnee legte sich über die Pflanze; aber durch sie bekam die Schneedecke einen Glanz, als würde er von unten her mit Sonnenlicht durchströmt. Im Frühjahr stand dort ein blühendes Gewächs, herrlich wie kein anderes im Walde.
Da kam ein Professor der Botanik daher, der ein Zeugnis bei sich hatte, daß er war, was er war. Er besah sich die Pflanze, biß sogar in ihre Blätter, aber sie stand nicht in seiner Pflanzenkunde; es war ihm nicht möglich zu entdecken, zu welcher Gattung sie gehörte.
"Das ist eine Spielart!" sagte er. – "Ich kenne sie nicht, sie ist nicht in das System aufgenommen!"
"Nicht in das System aufgenommen" sagten die Disteln und Nesseln.
Die großen Bäume ringsum hörten, was gesagt wurde, und auch sie sahen, daß es kein Baum von ihrer Art war; aber sie sagten nichts, weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes, das ist immer das Sicherste, wenn man dumm ist.
Da kam ein armes, unschuldiges Mädchen durch den Wald; ihr Herz war rein und ihr Verstand groß durch ihren Glauben; ihr ganzes Erbteil in dieser Welt bestand in einer alten Bibel, aber aus deren Blättern sprach Gottes Stimme zu ihr: Wollen die Menschen Dir übel, so denke an die Geschichte von Joseph: "Sie dachten übles in ihren Herzen, aber Gott wendete es zum Besten" Leidest Du Unrecht, wirst Du verkannt und verhöhnt, so denke an den Reinsten und Besten, den sie verspotteten und an das Kreuz nagelten, wo er noch betete: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!"
Sie blieb vor der wunderbaren Pflanze stehen, deren grüne Blätter so süß und erquickend dufteten und deren Blüten im hellen Sonnenschein wie ein wahres Farbenfeuerwerk leuchteten. Und aus jeder sang und klang es, als verberge sie aller Melodien tiefen Born, der in Jahrtausenden nicht erschöpft wird. Mit frommer Andacht schaute sie auf all die Gottesherrlichkeit; sie bog einen der Zweige nieder, um die Blüte recht anschauen zu können und ihren Duft einzuatmen. Und ihr wurde licht und wohl ums Herz. Gern hätte sie eine Blüte mitgenommen, aber sie hatte nicht das Herz, sie zu brechen, sie würde nur zu schnell bei ihr welken, und so nahm sie nur ein einziges von den grünen Blättern, trug es heim, legte es in ihre Bibel und dort lag es frisch, immer frisch und unverwelklich.
Zwischen den Blättern der Bibel lag es verborgen, und mit der Bibel wurde es unter des jungen Mädchens Haupt gebettet, als sie einige Wochen später im Sarge lag, des Todes heiligen Ernst auf dem frommen Antlitz, als ob es sich in ihrer irdischen Hülle noch abpräge, daß sie nun vor ihrem Gotte stand.
Aber draußen im Walde blühte die wunderbare Pflanze, die bald wie ein Baum anzusehen war. Und alle Zugvögel kamen und neigten sich vor ihr, besonders die Schwalben und Störche.
"Das ist ein ausländisches Gehabe!" sagten die Distel und die Klette, "so würden wir uns doch hier niemals aufführen!"
Und die schwarzen Waldschnecken spuckten auf den Baum.
Da kam der Schweinehirt, er raufte Disteln und Ranken aus, um sie zu Asche zu verbrennen; den ganzen wunderbaren Baum, mit allen Wurzeln riß er aus und stopfte ihn mit in das Bund. "Er muß auch Nutzen bringen!" sagte er, und dann war es getan.
Aber nach Jahr und Tag litt des Landes König an der tiefsten Schwermut; er war fleißig und arbeitssam, aber es half nichts. Es wurden ihm tiefsinnige Schriften vorgelesen und auch die allerleichtesten, aber auch das half nichts. Da kam Botschaft von einem der weisesten Männer der Welt. Man hatte sich an ihn gewendet und er ließ sie wissen, daß sich ein sicheres Mittel finde, den Leidenden zu kräftigen und zu heilen. "In des Königs eigenem Reiche wächst im Walde eine Pflanze himmlischen Ursprungs, so und so sieht sie aus, man kann sich gar nicht irren!" – und dann folgte eine Zeichnung der Pflanze, sie war leicht zu erkennen. – "Sie grünt Sommer und Winter; man nehme jeden Abend ein frisches Blatt davon und lege es auf des Königs Stirn, da wird es seine Gedanken licht machen, und ein schöner Traum wird ihn für den kommenden Tag stärken!"
Das war nun deutlich genug, und alle Doktoren und der Professor der Botanik gingen in den Wald hinaus. – Ja, aber wo war die Pflanze?
"Ich habe sie wohl mit in mein Bund gepackt!" sagte der Schweinehirt. "Sie ist schon längst zu Asche geworden, aber ich verstand es nicht besser!"
"Er verstand es nicht besser!" sagten alle. "Unwissenheit! Unwissenheit wie groß bist Du." Und diese Worte konnte sich der Schweinehirt zu Herzen nehmen, denn ihm und keinem anderen galten sie.
Nicht ein Blatt war zu finden, das einzige lag in dem Sarge der Toten, und das wußte niemand.
Der König selbst kam in seiner Schwermut in den Wald zu dem Orte hinaus. "Hier hat der Baum gestanden" sagte er, "das ist ein heiliger Ort"
Und die Erde wurde mit einem goldenen Gitter eingefaßt und eine Schildwache stand Tag und Nacht davor.
Der Professor der Botanik schrieb eine Abhandlung über die himmlische Pflanze, und dafür wurde er vergoldet. Das war ihm ein großes Vergnügen. Und die Vergoldung kleidete ihn und seine Familie, und das ist das Erfreulichste an der ganzen Geschichte, denn die Pflanze war fort und der König war schwermütig und betrübt – "aber das war er auch schon vorher!" sagte die Schildwache.
ETWAS

"Ich will etwas sein," sagte der älteste von fünf Brüdern, "ich will etwas nützen in de Welt; mag es eine noch so geringe Stellung sein, wenn nur das, was ich ausrichte, etwas Gutes ist, dann ist es in der Tat etwas. Ich will Ziegelsteine machen, die sind nicht zu entbehren, und ich habe wirklich etwas gemacht!"
"Aber etwas gar zuwenig!" sprach der zweite Bruder. "Das, was du tun willst, ist so gut wie gar nichts, das ist Handlangerarbeit und kann durch eine Maschine ausgeführt werden. Nein, dann lieber Maurer sein, das ist doch etwas, das will ich sein. Das ist ein Stand! Durch den wird man in die Zunft aufgenommen, wird Bürger, bekommt seine eigene Fahne, seine Herberge; ja, wenn alles gut geht, kann ich Gesellen halten, werde ich Meister, und meine Frau wird Frau Meisterin heißen; das ist doch etwas!"
"Das ist gar nichts," sagte der dritte, "das ist doch außerhalb der eigentlichen Stände, und es gibt viele in einer Stadt, die weit über einen Handwerksmeister stehen. Du kannst ein braver Mann sein, allein du gehörst als "Meister" doch nur zu denen, die man den "gemeinen" Mann nennt, nein, da weiß ich etwas Besseres! Ich will Baumeister werden, will mich auf das Gebiet der Kunst, auf das des Denkens begeben, will zu den Höherstehenden im Reiche des Geistes zählen. Zwar muß ich von der Pike auf dienen, je, daß ich es geradeheraus sage: ich muß als Zimmerlehrling anfangen, muß als Bursche mit der Mütze einhergehen, obgleich ich daran gewöhnt bin, einen seidenen Hut zu tragen, muß den gewöhnlichen Gesellen Schnaps und Bier holen, und diese werden mich "du" nennen, das ist beleidigend! Aber ich werde mir einbilden, daß das Ganze ein Mummenschanz, daß es Narrenfreiheit ist! Morgen - das heißt, wenn ich Geselle bin, gehe ich meinen eigenen Weg, die andern gehen mich nichts an! Ich gehe auf die Akademie, bekomme Zeichenunterricht und heiße Architekt! Das ist etwas, das ist viel! Ich kann Wohl-, ja Hochwohlgeboren werden, ja, gar noch etwas mehr bekommen vorn und hinten, und ich baue und baue, ganz wie die andern vor mir gebaut. Das ist immer etwas, worauf man eben bauen kann! Das Ganze ist etwas!"
"Ich aber mache mir aus diesem Etwas gar nichts," sprach der vierte, "ich will nicht im Kielwasser anderer segeln, nicht eine Kopie werden; ich will ein Genie werden, will tüchtiger dastehen als ihr alle miteinander! Ich werde der Schöpfer eines neuen Stils, ich gebe die Idee zu einem Gebäude, passend für das Klima und das Material des Landes, für die Nationalität des Volkes, für die Entwicklung des Zeitalters, und gebe außerdem noch ein Stockwerk zu für mein eigenes Genie!"
"Wenn nun aber das Klima und das Material nichts taugen," sagte der fünfte, "das wäre unangenehmem, denn die üben ihren Einfluß aus! Die Nationalität kann auch dermaßen übertrieben werden, daß sie affektiert wird, die Entwicklung des Zeitalters kann mit dir durchgehen. Ich sehe es schon kommen, daß keiner von euch eigentlich etwas werden wird, wie sehr ihr es auch selber glaubt! Aber tut, was ihr wollt, ich werde euch nicht ähnlich sein, ich stelle mich außerhalb der Dinge, ich will über das räsonieren, was ihr ausrichtet! An jeder Sache klebt etwas, das nicht richtig ist, etwas Verkehrtes, das werde ich heraustüfteln und besprechen, das ist etwas!"
Und das tat er dann auch, und die Leute sagten von dem fünften: "An dem ist bestimmt etwas! Er ist ein kluger Kopf! Aber er tut nichts!" Doch gerade dadurch war er etwas!
Seht, das ist nur eine kleine Geschichte, und doch hat sie kein Ende, solange die Welt steht!
Aber wurde denn weiter nichts aus den fünf Brüdern? Das war ja nichts und nicht etwas!
Hören wir weiter, es ist ein ganzes Märchen.
Der älteste Bruder, der Ziegelsteine fabrizierte, wurde bald inne, daß von jedem Ziegel, wenn er fertig war, eine kleine Münze, wenn auch nur von Kupfer, abfiel; doch viele Kupferpfennige, aufeinandergelegt, machen einen blanken Taler, und wo man mit so einem anklopft, sei es beim Bäcker, beim Schlachter, Schneider, ja bei allen, dort fliegt die Tür auf, und man bekommt, was man braucht; seht, das werfen die Ziegel ab; einige zerbröckelten zwar oder sprangen entzwei, aber selbst die konnte man brauchen.
Auf dem hohen Erdwall, dem schützenden Deich an der Meeresküste, wollte Margarethe, die arme Frau, sich ein Häuschen bauen; sie bekam all die zerbröckelten Ziegel und dazu noch einige ganze denn ein gutes Herz hatte der älteste Bruder, wenn er es auch in der Tat nicht weiterbrachte, als Ziegelsteine anzufertigen. Die arme Frau baute selbst ihr Häuschen; es war schmal und eng, das eine Fenster saß ganz schief, die Tür war zu niedrig, und das Strohdach hätte besser gelegt werden können, aber Schutz bot es immerhin, und weit über das Meer, das sich mit Gewalt am Wall brach, konnte man von dem Häuschen hinausschauen; die salzigen Wogen spritzten ihren Schaum über das ganze Haus, das noch dastand, als der, der die Mauersteine dazu fabriziert hatte, schon tot und begraben war.
Der zweite Bruder, ja der verstand nun das Mauern besser, war er doch auch dazu angelernt. Als er die Gesellenprüfung bestanden hatte, schnürte er seinen Ranzen und stimmte das Lied des Handwerkers an:
Weil ich jung bin, will ich wandern,
draußen will ich Häuser baun,
ziehen von einem Ort zum andern;
Jugendsinn gibt mir Vertrauen.
Und kehr ich heim ins Vaterland,
wo mein die Liebste harrt!
Hurra, der brave Handwerksstand!
Wie bald ich Meister ward!
Und das war er dann auch. Als er zurückgekehrt und Meister geworden war, baute er in der Stadt ein Haus neben dem andern, eine ganze Straße, und als die Straße vollendet war, sich gut ausnahm und der Stadt zur Zierde gereichte, bauten die Häuschen ihm wieder ein Haus, das sein Eigentum sein sollte. Doch wie können die Häuser wohl bauen? Frage sie, und sie werden dir die Antwort schuldig bleiben; aber die Leute antworten und sagen: "Allerdings hat ihm die Straße sein Haus gebaut!" Klein war es und der Fußboden war mit Lehm belegt, aber als er mit seiner Braut über den Lehmboden dahintanzte, da wurde dieser blank wie poliert, und aus jedem Stein in der Wand sprang eine Blume hervor und schmückte das Zimmer wie die kostbarste Tapete. Es war ein hübsches Haus und ein glückliches Ehepaar. Die Fahne der Innung flatterte vor dem Hause, Gesellen und Lehrburschen schrien: "Hurra!" Ja, war der etwas! Und dann starb er, das war auch etwas!
Nun kam der Architekt, der dritte Bruder, der erst Zimmermannslehrling gewesen und mit der Mütze gegangen war und den Laufburschen gemacht hatte, aber von der Akademie bis zum Baumeister aufgestiegen war, "Hoch- und Wohlgeborner Herr!" Ja, hatten die Häuser der Straße den Bruder, der Maurermeister gewesen war, ein Haus gebaut, so erhielt nun die Straße seinen, des Architekten Namen, und das schönste Haus der Straße wurde sein Eigentum; das war etwas, und er war etwas - und das mit einem langen Titel vorn und hinten. Seine Kinder hieß man "vornehme" Kinder, und als er starb, war seine Witwe eine "Witwe von Stand" - das ist etwas! Und sein Name blieb für immer an der Straßenecke geschrieben und lebte in aller Munde als Straßenname - ja, das ist etwas!
Darauf kam das Genie, der vierte Bruder, der etwas Neues, etwas Apartes und noch ein Stockwerk darüber erfinden wollte, aber das fiel herunter, und er selbst fiel auch herunter und brach sich das Genick - allein er bekam ein schönes Begräbnis mit Zunftfahnen und Musik, Blumen in der Zeitung und auf der Straße über das Pflaster hin, und man hielt ihm drei Leichenreden, eine länger als die andere, und das hätte ihn sehr erfreut, denn er hatte es sehr gern, wenn von ihm geredet wurde; auch ein Monument wurde ihm auf seinem Grab errichtet, zwar nur ein Stockwerk hoch, aber das ist immerhin etwas!
Er war nun gestorben wie die drei anderen Brüder; der letzte aber, der, welcher räsonierte, überlebte sie alle, und das war ja eben richtig so, wie es sein sollte, denn dadurch hatte er ja das letzte Wort, und ihm war es von großer Wichtigkeit, das letzte Wort zu haben. War er doch ein kluger Kopf, wie die Leute sagten. Endlich schlug aber auch seine Stunde, er starb und kam an die Pforten des Himmels. Dort treten stets je zwei heran; er stand da mit einer anderen Seele, die auch gern hineinwollte, und das war gerade die alte Frau Margarethe aus dem Haus auf dem Deich.
"Das geschieht wohl des Kontrastes halber, daß ich und diese elende Seele hier zu gleicher Zeit antreten müssen!" sprach der Räsoneur. "Nur, wer ist Sie, Frauchen? Will Sie auch hier hinein?" fragte er.
Und die alte Frau verneigte sich, so gut sie es vermochte, sie glaubte, es sei Sankt Petrus selber, der zu ihr sprach. "Ich bin eine alte, arme Frau ohne alle Familie, bin die alte Margarethe aus dem Haus auf dem Deich."
"Nun, was hat Sie getan, was hat Sie ausgerichtet dort unten?"
"Ich habe wahrscheinlich gar nichts in dieser Welt ausgerichtet! Nichts, wodurch mir könnte aufgeschlossen werden! Es ist wahre Gnade, wenn man erlaubt, daß ich durchs Tor hineinschlüpfe!"
"Auf welche Weise hat Sie diese Welt verlassen?" fragte er weiter, um doch von etwas zu reden, da es ihm Langeweile machte, dort zu stehen und zu warten.
"Ja, wie ich sie verlassen habe, das weiß ich nicht! Krank und elend war ich ja während der letzten Jahre, und ich habe es wohl nicht verragen können, aus dem Bett zu kriechen und in Frost und Kälte so plötzlich hinauszukommen. Es war ein harter Winter, doch jetzt habe ich ihn ja überstanden. Es war einige Tage ganz stilles Wetter, aber sehr kalt, wie Euer Ehrwürden ja selbst wissen, die Eisdecke ging so weit ins Meer hinaus, als man nur schauen konnte; alle Leute aus der Stadt spazierten aufs Eis hinaus, dort war, wie sie sagten, Schlittschuhlaufen und Tanz, glaube ich, große Musik und Bewirtung war auch da; die Musik schallte in mein ärmliches Stübchen hinein, wo ich lag. Und dann war es so gegen Abend, der Mond war schön aufgegangen, aber noch nicht in seinem vollen Glanze, ich blickte von meinem Bett über das ganze weite Meer hinaus, und dort draußen, grade am Rande zwischen Himmel und Meer, tauchte eine wunderliche Wolke empor; ich lag da und sah die Wolke an, ich sah auch das schwarze Pünktchen inmitten der Wolke, das immer größer und größer wurde, und da wußte ich, was das zu bedeuten hatte; ich bin alt und erfahren, obwohl man das Zeichen nicht oft sieht.
Ich kannte es, und ein Grausen überkam mich. Habe ich doch zweimal früher bei Lebzeiten das Ding kommen sehen, und wußte ich doch, daß es einen entsetzlichen Sturm mit Springflut geben würde, die über die armen Menschen draußen käme, die jetzt tranken, umher sprangen und jubilierten; jung und alt, die ganze Stadt war ja draußen; wer sollte sie warnen, wenn niemand dort das sah und zu deuten wußte, was ich wohl kannte. Mir wurde ganz Angst, ich wurde so lebendig wie seit langer Zeit nicht mehr. Aus dem Bett heraus kam ich zum Fenster hin, weiter konnte ich mich vor Mattigkeit nicht schleppen. Es gelang mir aber doch, das Fenster zu öffnen; ich sah die Menschen draußen auf dem Eis laufen und springen, ich sah auch die schönen Flaggen, die im Winde wehten, ich hörte die Knaben Hurra schreien, Knechte und Mägde sangen, es ging fröhlich her, aber - die weiße Wolke mit dem schwarzen Punkt! Ich rief, so laut ich konnte, aber niemand hörte mich; ich war zu weit weg von den Leuten entfernt. Bald mußte das Unwetter losbrechen, das Eis platzen und alles, was draußen war, ohne Rettung verloren sein. Mich hören konnten sie nicht, zu ihnen hinauskommen konnte ich nicht; oh, könnte ich sie doch an Land führen! Da gab der gute Gott mir den Gedanken, mein Bett anzuzünden, lieber das Haus niederzubrennen, als daß die Vielen so jämmerlich umkommen sollten.
Es gelang mir, ein Licht anzuzünden; die rote Flamme loderte hoch empor - ja, ich entkam glücklich durch die Tür, aber davor blieb ich liegen, ich konnte nicht weiter; die Flamme leckte nach mir heraus, flackerte aus den Fenstern, loderte hoch aus dem Dach empor; die Menschen alle draußen auf dem Eis wurden sie gewahr, und alle liefen sie, was sie konnten, um einer Armen zu Hilfe zu eilen, die sie lebendig verbrennen wähnten; nicht einer war da, der nicht lief; ich hörte sie kommen, aber ich vernahm auch, wie es mit einemmal in der Luft brauste, ich hörte es dröhnen wie schwere Kanonenschüsse; die Springflut hob die Eisdecke, die in tausend Stücke zerschellte; aber die Leute erreichten den Damm, wo die Funken über mir dahin flogen; ich rettete sie alle! Doch ich habe wohl die Kälte nicht vertragen können und auch nicht den Schrecken, und so bin ich nun hier herauf an das Tor des Himmels gekommen; man sagt ja, es wird auch so einem armen Menschen, wie ich es bin, aufgetan, und jetzt habe ich ja kein Haus mehr auf dem Deich, doch das gibt mir wohl noch keinen Eintritt hier!"
Da öffnete sich des Himmels Pforte, und der Engel führte die alte Frau hinein; sie verlor einen Strohalm draußen, einen der Strohhalme, die in ihrem Lager gewesen waren, als sie es anzündete, um die vielen zu retten, und das hatte sich in das reinste Gold verwandelt, und zwar in Gold, das wuchs und sich in den schönsten Blumen und Blättern emporrankte.
"Sieh, das brachte die arme Frau!" sagte der Engel. "Was bringst du? Ja, ich weiß es wohl, daß du nichts ausgerichtet hast, nicht einmal einen Ziegelstein hast du gemacht; wenn du nur wieder zurückgehen und es wenigstens so weit bringen könntest; wahrscheinlich würde der Stein, wenn du ihn gemacht hättest, nicht viel wert sein, doch mit gutem Willen gemacht, wäre es doch immerhin etwas; aber du kannst nicht zurück, und ich kann nichts für dich tun!"
Da legte die arme Seele, das Mütterchen aus dem Haus auf dem Deich, ein gutes Wort für ihn ein: "Sein Bruder hat mir die Ziegelsteine und Brocken geschenkt, aus denen ich mein armseliges Haus zusammengebaut habe, und das war sehr viel für mich Arme! Könnten nun nicht all die Brocken und ganzen Ziegelsteine als ein Ziegelstein für ihn gelten? Es ist ein Akt der Gnade gewesen. Er ist ihrer jetzt bedürftig, und hier ist ja der Urquell der Gnade!"
"Dein Bruder, der, den du den Geringsten nanntest," sagte der Engel, "der, dessen ehrliches Tun dir am niedrigsten erschien, schenkt dir seine Himmelsgabe. Du sollst nicht abgewiesen werden, es soll dir erlaubt sein, hier draußen zu stehen und nachzusinnen und deinem Leben dort unten aufzuhelfen, aber hinein gelangst du nicht, bevor du nicht in guter Tat - etwas ausgerichtet hast!"
"Das hätte ich besser sagen können," dachte der Räsoneur, aber er sprach es nicht laut aus, und das war wohl schon "Etwas."
EIN STÜCK PERLENSCHNUR
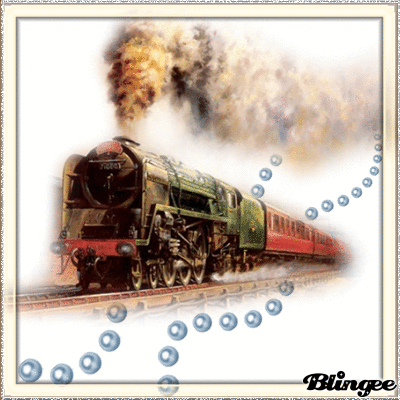
Die Eisenbahn in Dänemark erstreckt sich bis jetzt nur von Kopenhagen bis Korsör, sie ist ein Stück Perlenschnur, Perlen, an denen Europa so reich ist; die kostbarsten Perlen heißen da: Paris, London, Wien, Neapel! Mancher nennt jedoch nicht diese großen Städte seine schönsten Perlen, aber dagegen zeigt er auf eine kleine unauffällige Stadt, die ist das Heim der Heimat, da wohnen die Lieben! Ja, oft ist es nur ein einzelner Hof, ein kleines Haus zwischen grünen Hecken verborgen, ein Punkt, der hinfliegt, während der Eisenbahnzug vorbeijagt.
Wie viele Perlen sind da auf der Schnur von Kopenhagen bis Korsör? Wir wollen sechs betrachten, denen die meisten Aufmerksamkeit schenken müssen, alte Erinnerungen und die Poesie selber geben diesen Perlen einen Glanz, daß sie in unsere Gedanken strahlen.
Nahe vom Hügel, wo Friedrichs VI. Schloß liegt, Oehlenschlägers Kindheitsheim, glänzt im Schutz von dem Waldgrund der Südmark eine der Perlen, man nannte sie "Philemons und Baucis' Hütte," das heißt, das Heim zweier liebevoller alter Leute. Hier wohnte Rahbeck mit seiner Frau Camma; hier unter ihrem gastfreien Dach versammelten sich ein Menschenalter lang viele der Starken im Geiste aus dem eiligen Kopenhagen, hier war ein Heim des Geistes, ... und nun! Sag nicht: "Ach wie verändert!" nein, noch ist es das Heim des Geistes, das Treibhaus für die erkrankten Pflanzen! Die Blumenknospe, die nicht kräftig genug ist, sich zu entfalten, bewahrt doch verborgen, alle Keime zu Blatt und Frucht. Hier glänzt die Sonne des Geistes hinein in ein umschlossenes Heim des Geistes, belebt und macht lebendig; die Welt ringsum strahlt herein durch die Augen in des Geistes unerforschte Tiefe. Das Schwachsinnigenheim, umschwebt von Menschenliebe, ist eine heilige Stätte, ein Treibhaus für die kranke Pflanze, die einmal umgepflanzt werden soll und blühen in Gottes Blumengarten. Die Schwächsten im Geiste versammeln sich nun hier, wo einmal die Größten und Kräftigsten sich trafen, Gedanken tauschten und höher erhoben wurden - höher hinauf loht noch die Flamme der Seelen hier in "Philemons und Baucis' Hütte."
Die Stadt der Königsgräber mit Hroars Quelle, das alte Roskilde liegt vor uns! Der Kirche schlanke Turmspitze erhebt sich über die niedrige Stadt und spiegelt sich im Iselfjord. Ein Grab nur wollen wir hier besuchen, es betrachten in der Perle Schein; es ist nicht das der mächtigen Unionskönigin Margrethe - nein, drinnen im Kirchhof an dessen weißen Mauern wir dicht vorbeifliegen, ist das Grab, ein geringer Stein ist darübergelegt, der Orgelkönig, der Erwecker dänischer Lieder, ruht hier. Melodien in unserer Seele wurden die alten Sagen; wir empfanden, wie "die klaren Wogen rollten," - "es lag ein König im Felde!" - Roskilde, Stadt der Königsgräber, in deiner Perle wollen wir auf das geringe Grab blicken, wo in den Stein die Leier und der Name: Weyse gehauen ist.
Nun kommen wir nach Sigersted, bei der Stadt Ringsted; das Bachbett ist niedrig; das gelbe Korn wächst, wo Hagbarths Boot anlegte, nicht weit von Signes Frauengemach. Wer kennt nicht die Sage von Hagbarth, der in der Eiche hing, und von Signelils Gemach, das in Flammen stand, die Sage von der starken Liebe.
"Schönes Sorö, umkränzt von Wäldern!" Deine stille Klosterstadt hat einen Ausguck zwischen den moosbewachsenen Bäumen erhalten; mit Jugendblick sieht es von der Akademie über die See nach der Weltlandstraße hinaus, hört der Lokomotive Drachen keuchen, während er durch den Wald fliegt. Sorö, du Perle der Dichtung, die Holbergs Staub bewahrt! Wie ein mächtiger, weißer Schwan liegt dein Wissensschloß an dem tiefen Waldsee, und auf zu ihm, wie die weiße Sternblume im Waldgrund, schimmert ein kleines Haus, und das suchen unsere Augen, fromme Psalmen klingen von dort aus durch das ganze Land, das Wort wird dort gesprochen, der Bauer selber horcht darauf und kennt Dänemarks entschwundene Zeiten. der grüne Wald und der Vogelgesang gehören zusammen, so auch die Namen Sorö und Ingemann.
Zu Stadt Slagelse -! Was spiegelt sich hier in der Perle Schein? Verschwunden sind das Antvorwald-Kloster, verschwunden des Schlosses reiche Säle, selbst sein einsam stehender verlassener Flügel; doch ein altes Zeichen steht noch, erneut und wieder erneut, ein Holzkreuz auf der Höhe dort, wo zur Zeit der Legende der heilige Anders, der Priester von Slagelse, erwachte, der in einer Nacht von Jerusalem hierhin getragen wurde.
Korsör - hier wurdest du geboren, der uns gab:
"- Scherz mit Ernst gemischt
in Weisen von Knud Seeländer."
Du Meister in Wort und Witz! Die sinkenden, alten Wälle der verlassenen Festung sind nun hier die letzten sichtbaren Zeugen des Heims deiner Kindheit; wenn die Sonne untergeht, zeigen ihre Schatten hin auf den Fleck, wo dein Geburtshaus stand; von diesen Wällen nach Sprogös Höhe blickend sahst du, als du "klein warst," - "den Mond hinter die Insel gleiten" und besangst ihn unsterblich, wie du später die Berge der Schweiz besangst, du, der herumzog in dem Labyrinth der Welt und fand:
.".. nirgends blühen die Rosen so reich,
und nirgends sind die Dornen so klein,
und nirgends sind die Kissen so weich,
als wo unsere Unschuld schlummerte ein."
Der Fröhlichkeit bezaubernder Sänger! Wir flechten dir einen Kranz von Waldmeister und werden ihn in die See, und die Woge wird ihn zu der Kieler Bucht tragen, in deren Küste dein Staub gelegt ist; er bringt einen Gruß von dem jungen Geschlecht, einen Gruß von der Geburtsstand Korsör - wo die Perlenschnur aufhört.
II
"Das ist freilich ein Stück Perlenschnur von Kopenhagen bis Korsör," sagte die Großmutter, die vorlesen gehört hatte, was wir nun eben lasen. "Das ist eine Perlenschnur für mich, und das wurde sie mir schon von nun mehr als vierzig Jahren," sagte sie. "Da hatten wir keine Dampfmaschinen, wir brauchten Tage zu dem Weg, wo ihr jetzt nur Stunden braucht. Das war 1815; da war ich einundzwanzig Jahre alt; das ist ein schönes Alter; Aber schon in den Sechzigern, das ist auch ein schönes Alter, ein gesegnetes! In meiner Jugend, ja, da war es eine andere Seltenheit als jetzt, nach Kopenhagen zu kommen, der Stadt aller Städte, wie es uns schien. Meine Eltern wollten nach zwanzig Jahren wieder einmal einen Besuch dort machen, ich sollte mit; von der Reise hatten wir seit Jahren gesprochen, und nun sollte sie wirklich vor sich gehen! Mir schien, daß ein ganz neues Leben beginnen würde, und in einer Weise begann da auch für mich ein neues Leben.
Es wurde genäht, und es wurde gepackt, und als wir nun fort sollten, ja, wie viele gute Freunde kamen nicht, um uns Lebewohl zu sagen! Es war eine große Reise, die wir vorhatten! Spät am Vormittag fuhren wir aus Odense in meiner Eltern holsteinischem Wagen, Bekannte nickten von den Fenstern die ganze Straße entlang, fast bis wir ganz beim St. Jörgens Port heraußen waren. Das Wetter war schön, die Vögel sangen, man vergaß, daß es ein langer, schwerer Weg bis Nyborg war; gegen Abend kamen wir dahin; die Post traf erst zur Nacht ein, und früher ging die Fähre nicht ab; wir gingen da an Bord. Da lag nun vor uns das große Wasser, so weit unsere Augen reichten, ganz windstill! Wir legten uns in unseren Kleidern nieder uns schliefen. Als ich in der Morgenstunde erwachte und aufs Deck kam, war nicht das mindeste auf irgendeiner Seite zu sehen, solch einen Nebel hatten wir. Ich hörte die Hähne krähen, nahm war, daß die Sonne aufging, die Glocken klangen; wo waren wir? Der Nebel hob sich, und wir lagen wirklich noch gerade vor Nyborg. Später am Tage wehte endlich ein schwacher Wind, aber er stand entgegen; wir kreuzten und kreuzten, und endlich waren wir so glücklich, daß wir etwas nach elf Uhr Nachts Korsör erreichten, da hatten wir zweiundzwanzig Stunden zu den vier Meilen gebraucht.
Es tat gut, ans Land zu kommen; aber dunkel war es, die Laternen brannten schlecht, und alles war so wildfremd für mich, die nie in einer anderen Stadt als in Odense gewesen war.
'Sieh, hier wurde Baggesen geboren', sagte mein Vater, 'und hier lebte Birckner!'
Da schien es mir, daß die alte Stadt mit den kleinen Häusern auf einmal größer und lichter wurde; wir fühlten uns auch so froh, wieder festen Boden unter uns zuhaben; schlafen konnte ich diese Nacht nicht über all dem vielen, das ich schon gesehen und erlebt hatte, seit ich am Tag zuvor von zu Hause aufbrach.
Am nächsten Morgen mußten wir früh auf, wir hatten einen schlimmen Weg vor uns mit schrecklichen Hügeln und vielen Löchern, bis wir Slagelse erreichten, und von dort weiter auf der anderen Seite war es wohl nicht viel besser, und wir wollten so gerne beizeiten nach dem Krebshaus kommen, damit wir von dort noch am Tage nach Sorö hineingehen und Möllers Emil besuchen könnten, wie wir ihn nannten, ja, das war euer Großvater, mein seliger Mann, der Propst, er war Student in Sorö und damals gerade mit seinem zweiten Examen fertig.
Wir kamen am Nachmittag zum Krebshaus; das war damals ein eleganter Ort, das beste Wirtshaus auf dem ganzen Wege und die reizendste Gegend, ja, das müßt ihr doch alle einräumen, daß es das noch ist. Es hatte eine tüchtige Wirtin, Madame Plambek, alles im Hause war wie ein glatt gescheuertes Hackbrett. An der Wand hing in Glas und Rahmen Baggesens Brief an sie, das war wohl wert anzusehen! Mir war es eine große Merkwürdigkeit. - Dann gingen wir hinauf nach Sorö und trafen da Emil. Ihr könnt glauben, er war froh, uns zu sehen, und wir, ihn zu sehen, er war so gut und aufmerksam. Mit ihm sahen wir dann die Kirche mit Absalons Graf und Holbergs Sarg; wir sahen die alten Mönchsinschriften, und wir fuhren über den See zum 'Parnaß', es war der schönste Abend, dessen ich mich entsinne! Mir schien freilich, wenn man irgendwo in der Welt sollte dichten können, daß das in Sorö sein müßte, in diesem Frieden und dieser Schönheit der Natur. Dann gingen wir im Mondschein den Philosophengang, wie sie es nannten, den schönen einsamen Weg den See und Sumpf entlang hinaus auf die Landstraße zum Krebshaus; Emil blieb und aß mit uns, Vater und Mutter fanden, daß er so klug geworden war und so gut aussah. Er versprach uns, daß er in fünf Tagen in Kopenhagen bei seiner Familie und mit uns zusammen sein würde; es war ja Pfingsten. Die Stunden in Sorö und beim Krebshaus, ja, die gehörten zu den schönsten Perlen meines Lebens.
Am nächsten Morgen brachen wir sehr früh auf, denn wir hatten einen langen Weg, ehe wir Roskilde erreichten, und da mußten wir sehr beizeiten sein, damit wir die Kirche sehen und Vater gegen Abend einen alten Schulkameraden besuchen könnte; das geschah auch, und so blieben wir über Nacht in Roskilde und den Tag darauf, aber erst zur Mittagszeit, denn das war der schlechteste, der ausgefahrenste Weg, den wir zurückzulegen hatten, kamen wir nach Kopenhagen. Es waren ungefähr drei Tage, die wir von Korsör bis Kopenhagen gebraucht haben, nun macht ihr denselben Weg in drei Stunden. Die Perlen sind nicht köstlicher geworden, das können sie nicht; aber die Schnur ist neu und wunderbar geworden. Ich blieb mit meinen Eltern drei Wochen in Kopenhagen, mit Emil waren wir da ganze acht Tage zusammen, und als wir dann nach Fünen zurückreisten, begleitete er uns von Kopenhagen bis Korsör; dort verlobten wir uns, bevor wir uns trennten! So könnt ihr doch wohl verstehen, daß auch ich den Weg von Kopenhagen bis Korsör ein Stück Perlenschnur nenne.
Später, als Emil die Pfründe erhielt, heirateten wir; wir sprachen oft von der Kopenhagener Reise und davon, sie wieder einmal zu machen, aber da kam erst eure Mutter, und dann bekam sie Geschwister; und da war viel zu tun und zu behüten, und als nun Vater befördert und Propst wurde, ja, da war es schon eine Freude und ein Segen, aber nach Kopenhagen kamen wir nicht. Ich kam nie wieder hin, wie oft wir auch daran dachten und davon sprachen, und nun bin ich zu alt geworden, habe nicht mehr den rechten Körper, um auf der Eisenbahn zu fahren; aber über die Eisenbahnen bin ich froh, es ist ein Segen, daß man sie hat! Da kommt ihr schneller zu mir! Nun ist Odense ja nicht viel weiter von Kopenhagen, als in meiner Jugend Odense von Nyborg war! Ihr könnt nun ebenso schnell nach Italien fliegen, als wir nach Kopenhagen reisten! Ja, das ist etwas! - Trotzdem bleibe ich sitzen, ich lasse die andern reisen, lasse sie zu mir kommen! Aber ihr sollt doch nicht lächeln, weil ich so still sitze! Ich habe eine ganz anders große Reise vor als eure, eine weit schnellere, als mit den Eisenbahnen: wenn Gott will, reise ich hinauf zum Großvater, und wenn ihr dann euer Werk ausgerichtet und euch hier an dieser gesegneten Welt gefreut habt, dann weiß ich, daß ihr zu uns hinaufkommt und wir dann dort von den Tagen unseres Erdenlebens sprechen, glaubt mir, Kinder, ich sage auch dort wie jetzt: von Kopenhagen bis Korsör, ja, das ist freilich ein Stück Perlenschnur."
DIE GESCHICHTE VON EINER MUTTER
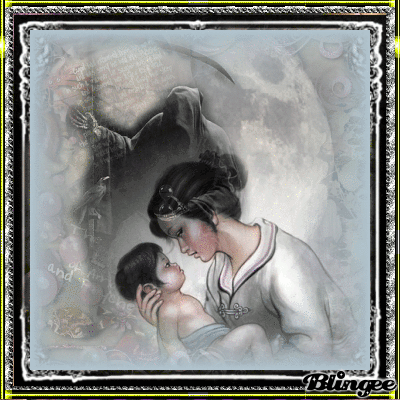
Eine Mutter saß bei ihrem kleinen Kinde. Sie war so betrübt und hatte so große Angst, daß es sterben würde. Es war so bleich; die kleinen Augen hatten sich geschlossen. Der Atem ging ganz leise, nur mitunter tat es einen tiefen Zug gleich einem Seufzer, und die Mutter blickte immer sorgenvoller auf das kleine Wesen.
Da klopfte es an die Tür, und herein kam ein armer, alter Mann, der, wie es schien, in eine große Pferdedecke gehüllt war; denn die wärmt, und das tat ihm not; es war ja kalter Winter. Draußen lag alles mit Eis und Schnee bedeckt, und der Wind blies, daß es einem ins Gesicht schnitt.
Da der alte Mann vor Kälte zitterte und das kleine Kind einen Augenblick schlief, ging die Mutter hin und setzte Bier in einem kleinen Topfe in den Kachelofen, um es für ihn zu wärmen. Der alte Mann saß und wiegte das Kind, und die Mutter setzte sich dicht neben ihn auf einen Stuhl, schaute auf ihr krankes Kind, das so tief Atem holte, und hob die kleine Hand empor.
"Glaubst Du nicht, daß ich es behalte?" fragte sie. "Der liebe Gott wird es mir nicht nehmen!"
Und der alte Mann – es war der Tod selbst – nickte so sonderbar, es konnte ebensogut ja wie nein bedeuten. Und die Mutter sah in ihren Schoß nieder und die Tränen liefen ihr über ihre Wangen. Das Haupt wurde ihr schwer, drei Tage und drei Nächte hatte sie ihre Augen nicht geschlossen, und nun schlief sie. Aber nur einen Augenblick; dann fuhr sie auf und zitterte vor Kälte: "Was ist das?" fragte sie und sah sich nach allen Seiten um. Aber der alte Mann war fort, und ihr kleines Kind war fort; er hatte es mit sich genommen. Hinten in der Ecke schnurrte und schnurrte die alte Uhr; das große Bleigewicht lief bis zum Fußboden hinab, bum und da stand auch die Uhr still.
Aber die arme Mutter lief zum Hause hinaus und rief nach ihrem Kinde.
Draußen, mitten im Schnee, saß eine Frau in langen, schwarzen Kleidern und sprach: "Der Tod ist in Deiner Stube gewesen; ich sah ihn mit Deinem kleinen Kinde davoneilen. Er geht schneller als der Wind, er bringt niemals zurück, was er genommen hat."
"Sage mir nur, welchen Weg er gegangen ist" sagte die Mutter. "Sag mir den Weg, dann werde ich ihn finden!"
"Ich weiß ihn" sagte die Frau in den schwarzen Kleidern; "aber ehe ich ihn Dir sage, mußt Du mir erst alle die Lieder singen, die Du Deinem Kinde vor gesungen hast. Ich liebe sie; ich habe sie schon früher gehört. Ich bin die Nacht und sah Deine Tränen, als Du sie sangst."
"Ich will sie singen, alle, alle" sagte die Mutter, "aber halt mich nicht auf, daß ich ihn einholen kann und mein Kind wiederfinde!"
Aber die Nacht saß stumm und still. Da rang die Mutter ihre Hände, sang und weinte, und es waren viele Lieder, aber noch mehr Tränen; und dann sagte die Nacht: "Geh nach rechts in den dunkeln Tannenwald, dorthin sah ich den Tod mit Deinem kleinen Kinde den Weg nehmen!"
Tief im Walde kreuzten sich die Wege, und sie wußte nicht, wo entlang sie gehen sollte. Da stand ein Dornenbusch, der hatte weder Blätter noch Blüten. Es war ja auch kalte Winterszeit, und Eiszapfen hingen an den Zweigen.
"Hast Du nicht den Tod mit meinem kleinen Kinde vorbeigehen sehen?"
"Ja," sagte der Dornenbusch, "aber ich sage Dir nicht, welchen Weg er eingeschlagen hat, wenn Du mich nicht vorher an Deinem Herzen aufwärmen willst. Ich friere sonst tot und werde ganz und gar zu Eis."
Und sie drückte den Dornenbusch an ihre Brust, so fest, er sollte ja gut aufgewärmt werden. Und die Dornen drangen tief in ihr Fleisch, und ihr Blut floß in großen Tropfen. Aber der Dornenbusch trieb frische, grüne Blätter und bekam Blüten in der kalten Winternacht. So warm war es an dem Herzen der betrübten Mutter. Und der Dornenbusch sagte ihr den Weg, den sie gehen mußte.
Da kam sie an einen großen See, auf dem weder Schiff noch Boot war. Der See war noch nicht fest genug zugefroren, daß er sie hätte tragen können, und auch nicht offen und seicht genug, daß sie ihn hätte durchwaten können. Und hinüber mußte sie doch, wollte sie ihr Kind finden. Da legte sie sich nieder, um den See auszutrinken. Das war ja unmöglich für einen Menschen. Aber die betrübte Mutter dachte, daß doch vielleicht ein Wunder geschehen würde.
"Nein, das geht nicht" sagte der See. "Laß uns beide lieber sehen, daß wir uns einigen. Ich liebe es, Perlen zu sammeln, und Deine Augen sind die zwei klarsten, die ich je gesehen habe. Willst Du sie für mich ausweinen, dann will ich Dich zu dem großen Treibhaus hinüber tragen, wo der Tod wohnt und Blumen und Bäume pflegt. Jedes von ihnen ist ein Menschenleben."
"O, was gäbe ich nicht, um zu meinem Kinde zu kommen!" sagte die vergrämte Mutter. Nun weinte sie noch mehr, und ihre Augen sanken nieder auf den Grund des Sees und wurden zwei kostbare Perlen. Der See aber hob die Mutter empor, als säße sie in einer Schaukel, und sie flog in einer einzigen Schwingung an die Küste auf der anderen Seite, wo ein meilenbreites, seltsames Haus stand. Man wußte nicht, war es ein Berg mit Wäldern und Höhlen, oder war es gezimmert. Aber die arme Mutter konnte es nicht sehen; sie hatte ja ihre Augen ausgeweint.
"Wo soll ich den Tod finden, der mit meinem kleinen Kinde fortgegangen ist" sagte sie.
"Er ist noch nicht gekommen!" sagte die alte Frau, die da ging und auf das große Treibhaus des Todes aufpassen sollte. "Wie hast Du hierher finden können, und wer hat Dir geholfen?"
"Der liebe Gott hat mir geholfen!" sagte sie, "er ist barmherzig, und das wirst Du auch sein. Wo kann ich mein kleines Kind finden?"
"Ja, ich kenne es nicht," sagte die Frau, "und Du kannst ja nicht sehen. – Viele Blumen und Bäume sind heute Nacht verwelkt. Der Tod wird gleich kommen und sie umpflanzen! Du weißt wohl, daß jeder Mensch seinen Lebensbaum hat oder seine Blume, je nachdem er nun beschaffen ist. Sie sehen aus wie andere Gewächse auch, aber sie haben Herzen, die schlagen. Kinderherzen können auch schlagen! Horche danach, vielleicht kannst Du den Herzschlag Deines Kindes erkennen. Aber was gibst Du mir, wenn ich Dir sage, was Du noch mehr tun mußt?"
"Ich habe nichts mehr zu geben," sagte die betrübte Mutter. "Aber ich will für Dich bis ans Ende der Welt gehen."
"Ja, da habe ich nichts zu suchen!" sagte die Frau, "aber Du kannst mir Dein langes, schwarzes Haar geben. Du weißt wohl selbst, daß es schön ist, und mir gefällt es. Du sollst mein weißes dafür haben, das ist doch immer etwas."
"Verlangst Du nicht mehr?" sagte sie. "Das gebe ich Dir mit Freuden." Und sie gab ihr schönes Haar und bekam das schneeweiße der Alten dafür.
Dann gingen sie in das große Treibhaus des Todes hinein, wo Blumen und Bäume wunderbar durcheinander wuchsen. Da standen feine Hyazinthen unter Glasglocken, und es standen baumstarke Pfingstrosen da. Es wuchsen Wasserpflanzen dort, einige ganz frisch, andere halb krank. Wasserschlangen legten sich darauf, und schwarze Krebse kniffen sich im Stiele fest. Da standen herrliche Palmenbäume, Eichen und Platanen, da stand Petersilie und blühender Thymian.
Jeder Baum und jede Blume hatte ihren Namen; jedes von ihnen war ja ein Menschenleben. Die Menschen lebten noch, einer in China, einer in Grönland, überall auf der Erde. Da gab es große Bäume in kleinen Töpfen, so daß sie ganz zusammen gepreßt und nahe daran waren, den Topf zu zersprengen. An manchen Stellen gab es auch kleine, schwache Blümchen in fetter Erde, mit Moos ringsherum und gehegt und gepflegt. Die betrübte Mutter beugte sich über alle die kleinsten Pflanzen und horchte auf jeden Schlag ihres Menschenherzens, und unter Millionen erkannten sie den ihres Kindes.
"Das ist es!" rief sie und streckte ihre Hand über einen kleinen blauen Krokus aus, der ganz krank nach der einen Seite hing.
"Rühre die Blume nicht an" sagte die alte Frau. "Aber stelle Dich hierher, und wenn dann der Tod kommt, den ich jeden Augenblick erwarte, so laß ihn die Pflanze nicht herausreißen; drohe ihm, daß Du es mit den anderen Pflanzen ebenso machen würdest, dann wird er bange; denn er muß dem lieben Gott dafür Rechenschaft ablegen. Keine darf herausgerissen werden ohne seine Erlaubnis."
Mit einem Male sauste es eiskalt durch den Saal, und die blinde Mutter merkte, daß es der Tod war, der kam.
"Wie hast Du den Weg hierher finden können?" fragte er. "Wie konntest Du schneller hierher kommen als ich?"
"Ich bin eine Mutter!" sagte sie.
Und der Tod streckte seine lange Hand aus nach der kleinen, feinen Blume; sie aber hielt ihre Hände so fest darum gelegt, so dicht und doch so besorgt, daß sie eins der Blättchen berühren könne. Da blies der Tod auf ihre Hände, und sie fühlte, daß dies kälter war als der kalte Wind, und ihre Hände fielen matt nieder.
"Du kannst gegen mich nichts ausrichten" sagte der Tod.
"Aber der liebe Gott kann es!" sagte sie.
"Ich tue nur nach seinem Willen!" sagte der Tod, "ich bin sein Gärtner. Ich nehme alle seine Blumen und Bäume und pflanze sie in den großen Paradiesgarten, in das unbekannte Land. Aber wie sie dort wachsen und wie es dort ist, darf ich Dir nicht sagen!"
"Gib mir mein Kind zurück!" sagte die Mutter und weinte und bat. Mit einem Male griff sie mit beiden Händen nach zwei anderen schönen Blumen und rief dem Tod zu: "Ich reiße alle Deine Blumen aus; denn ich bin in Verzweiflung!"
"Rühre sie nicht an!" sagte der Tod. "Du sagst, daß Du so unglücklich bist, und nun willst Du eine andere Mutter ebenso unglücklich machen –?"
"Eine andere Mutter!" sagte die arme Frau und ließ beide Blumen fahren.
"Da hast Du Deine Augen," sagte der Tod; "ich habe sie aus dem See gefischt, sie leuchteten so hell. Ich wußte nicht, daß es Deine waren. Nimm sie wieder. Sie sind jetzt klarer als früher. Sieh dann hinab in den tiefen Brunnen hier daneben. Ich werde Dir die Namen der beiden Blumen sagen, die Du ausreißen wolltest, und Du wirst ihre ganze Zukunft sehen, ihr ganzes Menschenleben, wirst sehen, was Du zerstören und vernichten wolltest!"
Und sie sah in den Brunnen hinab. Es war eine Glückseligkeit darin zu sehen, wie das eine Kind ein Segen für die ganze Welt wurde, und es war zu sehen, wie viel Glück und Freude es rings um sich verbreitete. Und sie sah des anderen Leben, und es war voller Sorge und Not, voller Kummer und Elend.
"Beides ist Gottes Wille!" sagte der Tod.
"Welches von ihnen ist die Blume des Unglücks, und welches die des Segens?" fragte sie.
"Das sage ich Dir nicht," sprach der Tod. "Aber das sollst Du von mir erfahren, daß die eine Blume die Deines eigenen Kindes war, es war Deines Kindes Schicksal, was Du sahst, Deines eigenen Kindes Zukunft."
Da schrie die Mutter vor Schrecken: "Welches von ihnen war mein Kind? Sage mir das! Rette das Unschuldige! Rette mein Kind vor all dem Elend. Trag es lieber fort! Trage es zu Gottes Reich. Vergiß meine Tränen, vergiß meine Bitten und alles, was ich gesagt oder getan habe."
"Ich verstehe Dich nicht" sagte der Tod. "Willst Du Dein Kind zurückhaben, oder soll ich mit ihm dorthin gehen, wovon niemand weiß?"
Da rang die Mutter ihre Hände, fiel auf ihre Knie und bat den lieben Gott: "Erhöre mich nicht, wenn ich gegen Deinen Willen bitte, der der beste ist. Erhöre mich nicht! Erhöre mich nicht!"
Und sie neigte ihr Haupt auf ihre Brust.
Der Tod aber ging mit ihrem Kinde in das unbekannte Land.
DAS JUDENMÄDCHEN

Unter den anderen Kindern in der Armenschule war auch ein kleines Judenmädchen, aufgeweckt und gut, die flinkeste unter allen; aber an einer der Lehrstunden konnte sie nicht teilnehmen, das war die Religionsstunde, sie war ja in einer christlichen Schule.
Sie durfte ihr Geografiebuch vor sich haben und darin lesen oder ihre Rechenaufgaben fertig machen, aber das war bald getan. Es lag wohl ein Buch aufgeschlagen vor ihr, aber sie las nicht darin, sie saß und hörte zu, und bald bemerkte der Lehrer, daß sie seinen Worten folgte, wie fast keines der anderen Kinder.
"Lies in Deinem Buche!" sagte er mild und ernst, aber sie sah ihn mit ihren strahlenden schwarzen Augen an, und als er sie auch fragte, wußte sie besser Bescheid als die andern alle. Sie hatte gehört, verstanden und wohl behalten.
Ihr Vater war ein armer, braver Mann; er hatte sich, als er seine Tochter der Schule anvertraute, ausbedungen, daß sie nicht im christlichen Glauben unterwiesen werden dürfe. Sie in dieser Lehrstunde fort gehen zu lassen, hätte vielleicht bei den anderen Ärgernis erregt, und den Kleinen Gedanken und Gefühle eingegeben, die nicht berechtigt waren, also war sie geblieben, aber das durfte nicht länger geschehen.
Der Lehrer ging zu dem Vater und sagte ihm, er müsse entweder sein Kind aus der Schule nehmen oder sie Christin werden lassen. "Ich kann es nicht ertragen, diese brennenden Augen, diese Innigkeit und diesen seelischen Durst nach den Worten des Evangeliums" sagte der Lehrer.
Der Vater brach in Tränen aus: "Ich selbst weiß nur wenig von unserer eigenen Religion, aber ihre Mutter war eine Tochter Israels, fest und stark in ihrem Glauben, und ihr gab ich auf ihrem Sterbebette das Versprechen, daß unser Kind niemals christlich getauft werden solle; ich muß mein Versprechen halten, es ist für mich dasselbe, wie ein Pakt mit Gott."
Und das kleine Judenmädchen wurde aus der christlichen Schule genommen.
Jahre waren vergangen. In einem der kleinsten Marktflecken Jütlands diente in einem geringen bürgerlichen Hause ein armes Mädchen mosaischen Glaubens; es war Sara. Ihr Haar war schwarz wie Ebenholz, ihre Augen dunkel und doch voller Licht und Glanz, wie es den Töchtern des Orients eigen ist. Der Ausdruck des nun völlig erwachsenen Mädchens war noch der gleiche wie bei dem Kinde, da sie auf der Schulbank saß und mit gedankenvollem Blick zuhörte.
Jeden Sonntag tönte aus der Kirche Orgelklang und der Gesang der Gemeinde; es klang über die Straße bis in das gegenüberliegende Haus hinein, wo das Judenmädchen bei seiner Arbeit stand, treu und fleißig in ihrem Beruf. "Gedenke des Sabbaths und halte ihn heilig" war ihr Gesetz, aber ihr Sabbath war den Christen ein Arbeitstag, und sie konnte ihn nur in ihrem Herzen heilig halten, doch das schien ihr nicht genug. Aber was sind Tag und Stunde vor Gott. Dieser Gedanke war in Ihrer Seele erwacht, und am Sonntag der Christen wurde nun ihre Andachtsstunde ungestörter.
Drang der Orgelklang und der fromme Gesang der Gemeinde zu ihr in die Küche hinüber, so wurde selbst dieser Ort still und geheiligt. Das alte Testament, ihres Volkes Schatz und Eigentum, las sie dann, und nur dies, denn was ihr Vater und der Lehrer zu ihr sprachen, als sie von der Schule genommen wurde, das Versprechen, das der Vater ihrer sterbenden Mutter gegeben hatte, daß Sara nie Christin werden und den Glauben der Väter verleugnen sollte, hatte einen tiefen Eindruck in ihrer Seele hinterlassen. Das Neue Testament war ihr ein verschlossenes Buch und sollte es bleiben, und doch wußte sie soviel noch daraus, leuchtend stand es in den Erinnerungen ihrer Kindheit. Eines Abends saß sie in einer Ecke der Stube und hörte den Hausherrn laut vorlesen, und sie durfte ihm lauschen, war es doch nicht das Evangelium, nein, aus einem alten Geschichtenbuche wurde vorgelesen; sie durfte getrost zuhören. Es handelte sich von einem ungarischen Ritter, der von einem türkischen Pascha gefangen worden war und der ihn mit den Ochsen zusammen vor einen Pflug spannen, ihn mit Peitschenschlägen antreiben und endlich verhöhnen und Hunger und Durst leiden ließ.
Des Ritters Gemahlin verkaufte all ihren Schmuck, verpfändete Burg und Land, seine Freunde schossen große Summen zusammen, denn fast unerschwinglich war das Lösegeld, das verlangt wurde. Aber es wurde zuwege gebracht und er wurde aus Schmach und Sklaverei erlöst. Krank und leidend kam er in seine Heimat zurück. Aber bald ertönte wieder der Ruf an Alle gegen die Feinde des Christentums. Der Kranke hörte davon und fand nicht Rast noch Ruhe, er ließ sich auf sein Streitroß heben, Blut durchströmte seine Wangen wieder, die Kräfte schienen zurückzukehren und er zog aus zum Siege. Just der Pascha, der ihn hatte vor den Pflug spannen, ihn verhöhnen und leiden lassen, wurde jetzt sein Gefangener und wurde von ihm in sein Burgverließ geführt. Aber schon nach der ersten Stunde kam der Ritter und fragte seinen Gefangenen: "Was glaubst Du wohl, was Deiner wartet?"
"lch weiß es" antwortete der Türke, "Vergeltung"
"Ja die Vergeltung des Christen!" sagte der Ritter. "Das Christentum gebietet uns, unseren Feinden zu vergeben, unsere Nächsten zu lieben. Gott ist die Liebe. Ziehe in Frieden nach Deiner Heimat zu Deinen Lieben, und werde milde und gut gegen die, welche leiden!"
Da brach der Gefangene in Tränen aus. "Wie hätte ich glauben können, daß solches möglich sei! Peinigungen und Martern schienen mir gewiß und ich nahm ein Gift, das mich in wenigen Stunden töten wird. Ich muß sterben, es gibt keine Hilfe. Aber bevor ich sterbe, verkünde mir die Lehre, die eine solche Liebe und Gnade in sich schließt, sie ist groß und göttlich! Laß mich in dieser Lehre sterben, als ein Christ sterben." Und seine Bitte wurde erfüllt.
Das war die Geschichte, die Legende, die vorgelesen wurde; alle hörten und folgten ihr mit Eifer. Doch am brennendsten, am lebendigsten davon erfüllt war die, welche stumm in der Ecke saß, das Dienstmädchen Sara, das Judenmädchen. Große schwere Tränen standen in ihren leuchtenden, kohlschwarzen Augen. Sie saß dort mit dem gleichen Kindersinn, mit dem sie einst auf der Schulbank gesessen und die Größe des Evangeliums in sich aufgenommen hatte. Tränen rollten über ihre Wangen.
"Laß mein Kind keine Christin werden!" waren der Mutter letzte Worte auf dem Sterbebette. Diese Worte klangen in ihrem Herzen und in ihrer Seele wieder, zugleich mit den Worten des Gesetzes: "Ehre Deinen Vater und Deine Mutter."
"Ich bin ja keine Christin Sie nennen mich das Judenmädchen. Des Nachbars Knaben riefen es mir am letzten Sonntag im Spott zu, als ich vor der offenen Kirchentür stehen blieb und hinein sah, wie die Altarlichter brannten und die Gemeinde sang. Von der Schulzeit bis auf diesen Tag liegt für mich eine Macht im Christentum, die wie Sonnenschein, ob ich auch meine Augen schließe, in mein Herz dringt. Aber, Mutter, ich will Dich im Grabe nicht betrüben. Ich werde das Versprechen, das der Vater Dir gab, nicht brechen! Ich will nicht die christliche Bibel lesen? ich habe ja den Gott der Väter, an den ich mein Haupt lehnen kann."
Und die Jahre vergingen.
Der Hausherr starb, die Hausfrau geriet in mißliche Verhältnisse, das Dienstmädchen war entbehrlich. Aber Sara verließ sie nicht, sie war die Hilfe in der Not, sie hielt das Ganze zusammen. Bis in die späte Nacht arbeitete sie und schaffte durch ihrer Hände Arbeit Brot ins Haus. Es gab keinen nahen Verwandten, der sich der Familie annahm, und die Frau wurde Tag für Tag schwacher und lag schon seit Monaten auf dem Krankenlager. Sara wachte, pflegte sie, arbeitete milde und fromm, ein Segen für das arme Haus.
"Dort liegt die Bibel" sagte die Kranke. "Lies mir an diesem langen Abend etwas vor, ich sehne mich so innig danach, Gottes Wort zu hören."
Sara senkte das Haupt; ihre Hände falteten sich um die Bibel, die sie öffnete und der Kranken vorlas. Oft brach sie in Tränen aus, aber ihre Augen wurden klarer und in ihrer Seele wurde es licht. "Mutter, Dein Kind wird nicht der Christen Taufe empfangen, nicht in ihrer Gemeinschaft genannt werden, das hast Du gefordert und das werde ich halten, auf dieser Erde sind wir eins, aber darüber hinaus ist es größer, mit Gott eins zu sein. Er führt uns über den Tod hinaus. Er suchet die Erde heim und macht sie durstig, um sie zu erquicken! Ich verstehe es und weiß doch selbst nicht, wie es gekommen ist. Es geschieht durch ihn und in ihm: Christus."
Und sie zitterte bei der Nennung dieses heiligen Namens, eine Feuertaufe durchströmte sie stärker, als ihr Leib es zu tragen vermochte. Und sie sank zusammen, kraftloser als die Kranke, bei der sie wachte.
"Arme Sara" sagte man, "sie ist von der Arbeit und den Nachtwachen überanstrengt."
Und sie wurde krank ins Armenhaus gebracht; dort starb sie und wurde begraben, aber nicht auf dem christlichen Friedhofe, da gab es kein Plätzchen für das Judenmädchen, nein, draußen an der Mauer wurde sie begraben.
Und Gottes Sonne, die auf die Gräber der Christen herableuchtete, schien auch auf des Judenmädchens Grab dort an der Mauer, und die Psalmen, die auf dem Kirchhofe der Christen gesungen wurden, erklangen auch über ihrem Grabe und auch die Verkündigung drang zu ihr hinaus: "Es gibt eine Auferstehung in Christo" in ihm, der zu seinen Jüngern gesprochen hatte: "Johannes taufte mit Wasser, aber Ihr sollt mit dem Heiligen Geiste getauft werden!"
UNTER DEM WEIDENBAUME
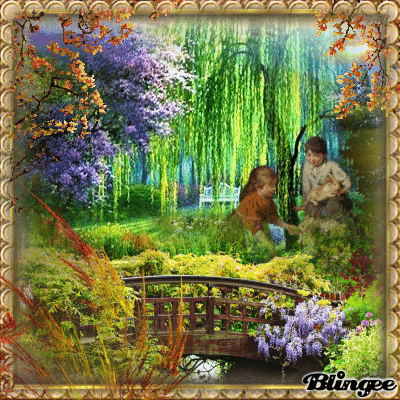
Die Gegend um das kleine seeländische Städtchen Kjöge ist sehr kahl; es liegt zwar am Meeresstrande, was immer schön ist, aber dort könnte es doch schöner sein als es eben ist: – rings umher sind ebene Felder und ein gar weiter Weg ist nach dem Walde. Doch wenn man in einem Orte recht zu Hause ist, so findet man dort immer irgend etwas Schönes, nach dem man später an dem reitzendsten Orte der Welt Sehnsucht empfindet. Und das müssen wir freilich gestehen, daß es am äußersten Weichbilde des Städtchens, wo selbst einige kleine ärmliche Gärten sich längs des Baches, der dort ins Meer fällt, hinstrecken, im Sommer ganz anmutig sein konnte, was auch namentlich die beiden Nachbarskinder fanden, die hier spielten und durch die Stachelbeersträucher sich wanden, um zu einander zu gelangen. In dem einen Garten stand ein Fliederbaum, in dem andern ein alter Weidenbaum, und namentlich unter diesem letzteren spielten die Kinder gar gern: das war ihnen erlaubt, obgleich der Weidenbaum in der Nähe des Baches stand, und sie leicht ins Wasser hätten fallen können; aber das Auge Gottes ruht ja auf den Kleinen – würde es doch sonst gar schlimm um sie aussehen! Sie waren aber auch sehr vorsichtig in Betreff des Wassers, ja, der Knabe war dermaßen wasserscheu, daß es nicht möglich, war, ihn im Sommer ins Meer hinaus zu locken, in dem doch die anderen, Kinder gar gern umher plantschten; er wurde deshalb auch gehörig geneckt und verhöhnt, und er mußte es geduldig ertragen. Einmal träumte es der Johanna, dem kleinen Mädchen des Nachbars: sie segle in einem Kahne und Kanut wate zu ihr hinaus, so daß das Wasser ihm erst bis an den Hals, später bis über den Kopf stiege und endlich ganz verschwinde. Von dem Augenblicke an, wo der kleine Kanut diesen Traum erfuhr, duldete er nicht mehr die Verhöhnungen der anderen Knaben; durfte er doch jetzt ins Wasser gehen; habe es Johanna doch geträumt! – Selbst tat er es freilich nie, aber jener Traum war immerhin sein Stolz.
Die armen Eltern kamen oft zusammen, und Kanut und Johanna spielten in den Gärten und auf der Landstraße, welche längs der Gräben mit einer Reihe von Weidenbäumen besetzt war, die zwar mit ihren verstutzten Kronen nicht schön sahen, aber auch dort nicht zum Staat standen, sondern des Nutzens wegen; schöner war der alte Weidenbaum im Garten, und unter demselben saßen die beiden Kinder. – In dem Städtchen selbst ist ein großer Marktplatz, und zur Zeit des Jahrmarktes standen dort ganze Straßen von Zelten und Buden mit seidenen Bändern, Stiefeln und allem, was man sich wünscht; es war ein arges Gedränge und in der Regel Regenwetter, und dann spürte man den Dunst der Frieswämse der Bauern, aber auch den schönsten Duft der Honig- oder Pfefferkuchen, von welchen eine Bude voll da stand, und was noch das herrlichste war: der Mann, der die Kuchen verkaufte, nahm immer während des Jahrmarktes seine Wohnung bei den Eltern des kleinen Kanut, und nun gab es dann und wann einen kleinen Pfefferkuchen, von welchem natürlich auch Johanna ihren Anteil erhielt. Aber was noch schöner war: – der Pfefferkuchenhändler wußte fast von allen möglichen Dingen Geschichten zu erzählen, selbst von seinen Pfefferkuchen; ja von diesen erzählte er eines Abends eine Geschichte, die einen so tiefen Eindruck auf die Kinder machte, daß sie dieselbe nie wieder vergaßen, und deshalb ist es wohl am besten, daß wir sie auch kennen lernen, um so mehr, da sie nur kurz ist.
»Auf dem Ladentische« – erzählte er – »lagen zwei Pfefferkuchen, der eine in Gestalt einer Mannsperson mit einem Hute, der andere in der einer Jungfrau ohne Hut; sie hatten ihre Gesichter auf der Seite, die nach oben gekehrt war, und von derselben sollte man sie auch besehen, nicht von der Kehrseite, von welcher man überhaupt nie einen Menschen betrachten darf. Der Mann trug auf der linken Seite eine bittere Mandel, das war sein Herz, die Jungfrau dagegen war lauter Honigkuchen, sie lagen Beide als Proben auf dem Ladentische, lagen dort sogar lange, und endlich liebten sie sich; aber keiner sagte es dem andern, und das muß doch geschehen, wenn etwas daraus werden soll.«
»»Er ist ein Mann, er muß das erste Wort sagen,«« dachte sie, wollte sich aber doch schon begnügen, wenn sie nur wüßte, daß ihre Liebe erwidert würde.
»Seine Gedanken waren nun zwar weit ausschweifender, und das ist immer der Fall mit den Männern; ihm träumte er sei ein leibhaftiger Straßenjunge, im Besitze von vier Schillingen und kaufe die Jungfrau und verzehre sie.«
»Und so lagen sie Tage und Wochen lang auf dem Ladentische und vertrockneten, und die Gedanken der Jungfrau wurden immer zarter und weiblicher: »»es genügt mir schon, daß ich auf dem selben Tische mit ihm zusammen gelegen habe!«« – dachte sie und knack! – brach sie mitten durch.«
»»Hätte sie nur meine Liebe gekannt, sie hätte wohl etwas länger gehalten!«« – dachte er.«
»Das ist die Geschichte, und hier sind sie alle Beide,« sagte der Kuchenbäcker. »Sie sind ihres Lebenslaufes und der stummen Liebe wegen, die nie zu etwas führt, merkwürdig; – da habt Ihr sie!« damit gab er Johanna die Mannsperson, die ganz war, und Kanut erhielt die geknickte Jungfrau; aber die Kinder waren der maßen von der Geschichte ergriffen, daß sie es nicht übers Herz bringen konnten, die Liebesleute zu essen.
Am folgenden Tage gingen sie mit ihnen auf den Friedhof und ließen sich dort an der Kirchenmauer nieder, die mit dem üppigsten Efeu, Sommer und Winter, wie mit einem reichen Teppiche behangen ist; hier stellten sie die Pfefferkuchen zwischen die grünen Ranken in den Sonnenschein und erzählten nun einer Schar anderer Kinder die Geschichte von der stummen Liebe, die nichts Wert sei, das heißt die Liebe; denn die Geschichte sei allerliebst, der Meinung waren sie alle; aber als sie wieder einen Blick auf das Honigkuchenpaar warfen, ja, da hatte ein großer Knabe – und zwar aus Bosheit – die geknickte Jungfrau aufgegessen; die Kinder weinten darüber, und nachher – dies geschah wahrscheinlich, damit der arme Liebhaber nicht allein in der Welt stehen sollte – nachher aßen sie auch ihn auf, doch die Geschichte vergaßen sie nie.
Immer waren die Kinder beisammen am Fliederbaume und unter dem Weidenbaume, und das kleine Mädchen sang die schönsten Lieder mit einer Stimme, klar wie eine Glocke; Kanut dagegen hatte keinen Ton in sich, aber er wußte den Text, und das ist immerhin etwas. Die Leute in Kjöge, selbst die Frau des Galanteriewaarenhändlers, blieben stehen und lauschten, wenn Johanna sang. »Die hat eine recht süße Stimme, die Kleine!« – sagten sie.
Das waren herrliche Tage, allein sie währten nicht immer. Die Nachbarn trennten sich; die Mutter des kleinen Mädchens war gestorben, der Vater war gesonnen, wieder zu heiraten, und zwar in der Residenz, wo man ihm versprochen hatte, daß er sein Brot haben und irgendwo Bote haben würde, und dies sollte ein sehr einträgliches Amt sein. Die Nachbarn trennten sich unter Tränen, namentlich weinten die Kinder, aber die Eltern gelobten sich einander wenigstens ein Mal jährlich zu schreiben.
Den Kanut gab man in die Lehre zu einem Schuhmacher, den großen Knaben konnten sie doch nicht länger sich umhertreiben lassen. Und er wurde nun auch konfirmiert.
Ach, wie gern wäre er an diesem Festtage in Kopenhagen gewesen bei der kleinen Johanna, aber er blieb in Kjoge und war nie nach Kopenhagen gekommen, obgleich die Hauptstadt nur fünf Meilen von dem kleinen Städtchen entfernt ist; doch über den Meeresbusen hinweg bei klarem Himmel hatte Kanut die Türme erblickt, und an dem Konfirmationstage sah er deutlich das goldene Kreuz an der Frauenkirche in der Sonne glänzen.
Ach, wie waren seine Gedanken bei Johanna! Ob sie wohl seiner gedacht? Ja! – Gegen Weihnachten kam ein Brief von ihrem Vater an die Eltern Kanut's an, es gehe ihnen sehr gut in Kopenhagen, und namentlich dürfe Johanna, ihrer schönen Stimme wegen, ein großes Glück zu Teil werden; sie sei bei der Komödie, in welcher gesungen wird, angestellt, etwas Geld verdiene sie schon jetzt dabei, und von diesem sende sie den lieben Nachbarsleuten in Kjöge einen ganzen Taler zum vergnügten Weihnachtsabend; sie sollten auf ihre Gesundheit trinken, das hatte sie selbst eigenhändig in einer Nachschrift hinzugefügt, und in derselben stand ferner: »Freundlichen Gruß an Kanut!«
Die ganze Familie weinte, und doch war das ja Alles gar erfreulich; aber sie weinte vor Freude. Alle Tage hatte Johanna die Gedanken Kanut's erfüllt, und jetzt überzeugte er sich, daß auch sie an ihn denke, und je näher die Zeit heranrückte, wo er ausgelernt haben würde, um so klarer stand es vor ihm, daß er Johanna gar lieb habe, daß sie seine Frau werden müsse, und dabei spielte ein Lächeln um seine Lippen und er zog den Draht noch einmal so rasch und stemmte den Fuß gegen den Knieriemen an; er stach den Pfriemen tief in den einen Finger hinein, aber das tat nichts! Er wollte wahrhaftig nicht den Stummen spielen, wie es die beiden Pfefferkuchen getan; die Geschichte sei ihm eine gute Lehre.
Jetzt war er Gesell und das Ränzel war geschnürt, endlich zum ersten Male in seinem Leben sollte er nach Kopenhagen gehen, dort habe er bereits einen Meister. Wie würde Johanna überrascht und erfreut sein! Sie zählte jetzt siebenzehn Jahre, er neunzehn.
Schon in Kjöge wollte er einen goldenen Ring für sie kaufen, aber er besann sich doch, daß man der gleichen gewiß weit schöner in Kopenhagen bekäme; und nun wurde Abschied von den Eltern genommen, und an einem späten regnerischen Herbsttage wanderte er zu Fuß aus der Stadt seiner Heimat; die Blätter fielen von den Bäumen herab, durchnäßt kam er in der großen Hauptstadt und bei seinem neuen Meister an. Künftigen Sonntag wollte er den Besuch bei dem Vater Johanna's machen. Die neuen Gesellenkleider wurden hervorgesucht und der neue Hut aus Kjöge aufgesetzt, der stand dem Kanut gar gut, früher hatte er immer nur eine Mütze getragen. Er fand das Haus, das er suchte, stieg die vielen Stufen hinan, es war zum Schwindeligwerden, wie die Menschen hier in der großen Stadt über einander gestellt seien.
In der Stube sah Alles wohlhabend aus, und der Vater Johanna's empfing ihn sehr freundlich, der Frau war er jedoch eine fremde Person, aber sie reichte ihm die Hand und den Kaffee.
»Es wird Johanna freuen, Dich zu sehen,« – sagte der Vater, »Du bist ja ein sehr netter junger Mann geworden! – Nun sollst Du sie sehen; ja, sie ist ein Mädchen, das mir Freude macht und, mit Gottes Hilfe, noch mehr machen wird! Sie hat ihre eigene Stube und die bezahlt sie uns!« – Und der Vater selbst klopfte höflich an die Türe, als wäre er ein fremder Mann, und darauf traten sie ein. Aber, wie war dort Alles niedlich; ein solches Stübchen fände man sicherlich nicht in ganz Kjöge; die Königin selbst könne es nicht anmutiger haben! Da waren Fußdecken, da waren Fenstervorhänge ganz bis zum Fußboden herab, sogar ein Stuhl von Sammet, und ringsum Blumen und Gemälde, und ein Spiegel, in den man hinein zu treten fast Gefahr lief: er war ja so groß wie eine Türe. Kanut sah dies Alles mit einem Blicke und nichts desto weniger sah er doch nur Johanna; sie war ein erwachsenes Mädchen und ein ganz anderes, als Kanut es sich gedacht, aber viel schöner; in ganz Kjöge war keine einzige Jungfrau wie sie, und wie war sie fein, und wie blickte sie den Kanut so sonderbar fremd an, aber nur einen Augenblick, als dann stürzte sie auf ihn zu, als wollte sie ihn küssen, – sie tat es zwar nicht, aber es war nahe daran. Ja, sie freute sich in der Tat bei dem Anblicke des Freundes ihrer Kindheit! Standen ihr doch die Tränen in den Augen, und dann hatte sie gar viel zu fragen und zu reden, von den Eltern Kanut's bis auf den Flieder- und den Weidenbaum herab, diese nannte sie Fliedermutter und Weidenvater, als ob sie auch Menschen wären, doch dafür konnten sie auch ebenso gut gelten, wie die Pfefferkuchen; von diesen sprach sie auch und von deren stummer Liebe, wie sie auf dem Ladentische lagen und entzwei gingen, und dabei lachte sie recht herzlich – aber das Blut flammte in den Wangen Kanut's und sein Herz klopfte schneller als sonst! – Nein, sie war gar nicht stolz geworden! – Sie war es auch, – das bemerkte er wohl – daß ihre Eltern ihn einluden, den ganzen Abend dort zu bleiben, und sie schenkte den Tee ein und reichte ihm selbst eine Tasse, und später nahm sie ein Buch zur Hand und las laut vor, und es war Kanut, als wenn gerade Das, was sie las, von seiner Liebe handele, so gar gut fiel es mit seinen Gedanken zusammen; darauf sang sie ein einfaches Lied, aber dasselbe wurde durch sie zu einer Geschichte, es war, als ströme ihr eigenes Herz davon über. Ja, sie habe ganz gewiß den Kanut lieb. Die Tränen rollten ihm über die Wangen, er konnte nichts dafür und er vermochte kein einziges Wort zu sagen, ihm selbst schien es, als sei er verdummt, und doch drückte sie ihm die Hand und sagte: »Du hast ein gutes Herz, Kanut – bleibe immer, wie Du bist!«
Das war ein Abend sonder gleichen; darauf zu schlafen, war nicht möglich, und das tat Kanut denn auch nicht.
Beim Abschiede hatte der Vater Johanna's gesagt: »Nun, jetzt wirst Du uns doch nicht ganz vergessen! Du wirst doch nicht den ganzen Winter verstreichen lassen, bis Du uns einmal wieder besuchst?« – also konnte er sehr wohl am folgenden Sonntag wieder hingehen, und das wollte er auch. Aber jeden Abend, nach den Arbeitsstunden, und es wurde bei Licht gearbeitet, ging Kanut in die Stadt; er ging durch die Straße, in welcher Johanna wohnte, blickte zu ihren Fenstern hinauf, sie waren fast immer erhellt, und an einem Abende sah er deutlich den Schatten ihres Antlitzes an dem Fenstervorhange – das war ein schöner Abend. Die Frau Meisterin lobte es gar nicht, daß er immer des Abends auf der Fahrt sein müsse, wie sie es nannte, und sie schüttelte den Kopf, aber der Meister lächelte: »Er ist ein junger Mensch!« sagte er.
»Sonntag sehen wir uns, und ich sage ihr, wie sie mir im Sinn und Herzen liegt, und daß sie mein Frauchen werden muß; ich bin zwar nur ein armer Schuhmachergesell, aber ich kann Meister werden, ich werde arbeiten und streben – ja ich sage es ihr; es kommt nichts bei der stummen Liebe heraus, das habe ich von den Pfefferkuchen gelernt!«
Der Sonntag kam und Kanut kam, aber wie unglücklich; Alle waren an dem Abende eingeladen, sie mußten es ihm sagen. Johanna drückte seine Hand und fragte: »Bist Du im Theater gewesen? Du mußt einmal hineingehen! Ich singe Mittwoch, und wenn Du Zeit an diesem Tage hast, dann will ich Dir ein Billet senden, mein Vater weiß, wo Dein Meister wohnt!«
Wie liebevoll war das von ihr! Und am Mittwoch Mittag erhielt er auch ein versiegeltes Papier ohne Worte, aber das Billet lag in demselben, und am Abende ging Kanut zum ersten Male in seinem Leben ins Theater; und was sah er? – er sah Johanna, wie war sie schön und anmutig; sie wurde zwar an eine fremde Person verheiratet, aber das war alles Komödie, Etwas, das sie vorstellten, das wußte Kanut, sonst hätte sie es auch nicht über's Herz bringen können, ihm ein Billet zu senden damit er es sehe, und alle Leute klatschten in die Hände, schrien laut auf, und Kanut schrie Hurrah!
Selbst der König lächelte der Johanna zu, als wenn er seine Freude an ihr habe. Gott, wie fühlte Kanut sich so klein, aber er liebte sie recht innig, und sie habe ja auch ihn lieb, – allein der Mann muß das erste Wort sagen, so dachte ja auch die Pfefferkuchen-Jungfrau: – in dieser Geschichte lag sehr Vieles.
Sobald der Sonntag kam, ging er wieder hin; er war in einer Stimmung als sollte er das heilige Abendmahl genießen; Johanna war allein und empfing ihn, das konnte nicht glücklicher treffen.
»Es ist gut, daß Du kommst!« sagte sie, »ich dachte schon daran, meinen Vater zu Dir zu senden, allein ich hatte eine Ahnung von Deinem Kommen heute Abend: – denn ich muß Dir sagen, daß ich auf den Freitag nach Frankreich reise; ich muß es, damit ich es zu etwas bringe!«
Aber Kanut schien es, als drehe sich die Stube um und um: ihm war zu Mute, als wollte das Herz ihm zerspringen; zwar trat keine Träne in seine Augen, aber es war deutlich zu sehen, wie betrübt er wurde. »Du ehrliche, treue Seele!« sprach sie, – und damit war nun die Zunge Kanut's gelöst, und er sagte ihr, wie innig lieb er sie habe und daß sie sein Frauchen werden müsse. In dem er dies sagte, sah er Johanna die Farbe wechseln und erblassen; sie ließ seine Hand fallen und erwiderte ernst und betrübt: »Mache nicht Dich selbst und mich unglücklich, Kanut! Ich werde Dir stets eine gute Schwester sein, auf die Du bauen kannst – aber auch nicht mehr!« und sie strich mit ihrer weichen Hand über seine heiße Stirn. »Gott gibt uns zu Vielem die Kraft, wenn wir nur selbst wollen!«
Da trat in demselben Augenblicke ihre Stiefmutter ins Zimmer.
»Kanut ist ganz außer sich, weil ich reise!« sagte Johanna. »Sei doch ein Mann!« und dabei legte sie ihre Hand auf seine Schulter; es war, als hatten sie nur von der Reise und sonst von nichts Anderem gesprochen. »Du bist ein Kind!« fuhr sie fort, »aber jetzt mußt Du gut und vernünftig sein, wie unter dem Weidenbaume, als wir noch Kinder waren!«
Aber Kanut war es, als sei die Welt aus ihren Fugen gegangen, sein Gedanke war wie ein loser Faden, der im Winde hin- und her flattert. Er blieb, er wußte nicht, ob sie ihn zu bleiben gebeten; aber sie waren freundlich und gut, und Johanna schenkte ihm den Tee ein und sang; es war nicht der alte Klang, und doch so unendlich schön, es war zum Herzzerspringen; darauf trennten sie sich. Kanut reichte ihr nicht die Hand, aber sie ergriff die seinige und sagte: »Du gibst doch Deiner Schwester die Hand zum Abschiede, mein alter Jugendgespiel!« sie lächelte durch Tränen, die ihr über die Wangen flossen, und sie wiederholte das Wort » Bruder«. Ja, das war ein schöner Trost! – So war der Abschied.
Sie segelte nach Frankreich, Kanut ging auf den schmutzigen Straßen Kopenhagens umher. – Die andern Gesellen in der Werkstätte fragten ihn, weshalb er so grübelnd umhergehe, er solle mit ihnen zusammen ein Vergnügen machen, er sei ja ein junges Blut.
Sie gingen miteinander auf den Tanzboden; dort waren viele schöne Mädchen, aber freilich keins wie Johanna, und hier, wo er gedacht, sie zu vergessen, hier gerade stand sie am lebhaftesten vor seinen Gedanken; »Gott gibt uns zu Vielem Kraft, wenn wir nur selbst wollen!« hatte sie gesagt, und eine Andacht kehrte in seinen Sinn ein; er faltete die Hände; die Violinen spielten auf und die Mädchen tanzten im Kreise umher; er erschrak förmlich, es schien ihm, als sei er an einem Orte, wohin er Johanna nicht hätte führen sollen, denn sie war doch mit ihm in seinem Herzen da; deshalb ging er hinaus, lief auf die Straßen und ging an dem Hause vorüber, wo sie gewohnt hatte; dort war es finster, überall war es finster, leer und einsam; die Welt ging ihren Weg und Kanut den seinigen.
Es wurde Winter und die Gewässer froren zu, es war, als wenn alles sich auf ein Begräbniß einrichte.
Als aber der Frühling wiederkehrte und das erste Dampfschiff ging, da ergriff ihn eine Sehnsucht, weit, weit in die Welt zu wandern, aber nicht nach Frankreich.
Er schnürte sein Ränzel und wanderte weit, weit ins deutsche Land hinein, von Stadt zu Stadt, ohne Rast und Ruhe; erst als er die alte prächtige Stadt Nürnberg betrat, war es, als würde er wieder Herr seiner Füße; er gewann es über sich, dort zu bleiben.
Nürnberg ist eine wunderliche, alte Stadt, wie aus einer Bilderchronik herausgeschnitten. Die Straßen liegen, wie sie eben selbst wollen; die Häuser lieben es nicht, in Reih' und Glied zu stehen; Erker mit kleinen Türmen, Schnörkeln und Bildsäulen springen hervor und über den Bürgersteig hinaus, und hoch von den Dächern laufen Dachrinnen bis über die Mitte der Straße hinaus, geformt wie Drachen und langbeinige Hunde.
Auf dem Marktplatze hier stand Kanut mit dem Ranzenl auf dem Rücken; er stand an einem der alten Springbrunnen mit den herrlichen biblischen und historischen Figuren, die zwischen den springenden Wasserstrahlen stehen. Ein schönes Dienstmädchen schöpfte eben Wasser, es gab Kanut einen Labetrunk; und da es die Hand voll Rosen hatte, gab es ihm auch eine Rose, und das schien ihm ein guter Vorbote zu sein.
Von der nahen Kirche brausten Orgeltöne ihm entgegen, sie klangen ihm so heimathlich, als kämen sie aus der Kirche zu Kjöge, und er trat in den großen Dom; die Sonne schien durch die gemalten Scheiben hinein zwischen die hohen, schlanken Säulen; Andacht erfüllte seine Gedanken, und stiller Friede kehrte in seinen Sinn ein.
Er suchte und fand einen guten Meister in Nürnberg, bei diesem blieb er und erlernte die deutsche Sprache.
Die alten Gräber um die Stadt herum sind in kleine Gemüsegärten umgewandelt, aber die hohen Mauern stehen noch da mit ihren schweren Türmen. Der Seiler dreht sein Seil aus dem von Balken erbauten Gange längs der Innenseite der Stadtmauer, und hier, ringsumher aus Ritzen und Spalten wächst der Flieder; er streckt seine Zweige über die kleinen niedrigen Häuser, die unten liegen, und in einem dieser wohnte der Meister, bei dem Kanut arbeitete; über das kleine Dachfenster, an welchem Kanut saß, senkte der Fliederbaum seine Zweige.
Hier wohnte er einen Sommer und einen Winter; aber als der Frühling kam, war's nicht mehr auszuhalten; der Flieder blühte und duftete so heimathlich, daß es ihm war, als sei er wieder in den Gärten von Kjöge, – als dann zog Kanut von seinem Meister weg zu einem andern, weiter in die Stadt hinein, wo kein Flieder wuchs.
Seine Werkstätte war in der Nähe einer alten gemauerten Brücke, über einer immer brausenden, niedrigen Wassermühle; draußen floß nur der reißende Strom, eingezwängt von Häusern, die alle mit alten morschen Erkern gleichsam behangen waren; es sah aus, als wollten sie diese alle ins Wasser hinabschütteln. Hier wuchs kein Flieder, hier stand nicht einmal ein Blumentopf mit wenigem Grün, aber gerade der Werkstätte gegenüber wurzelte ein großer alter Weidenbaum, der sich gleichsam an dem Hause festhielt, um nicht vom Strome hinweg gerissen zu werden; er streckte seine Zweige über den Fluß hinaus, wie der Weidenbaum im Garten bei Kjöge über den Bach.
Ja, er war freilich von Fliedermutter zum Weidenvater gezogen; der Baum hier, namentlich an Mondscheinabenden, hatte etwas, das ihm zu Herzen ging, aber es war durchaus nicht der Mondschein, sondern der alte Baum selbst.
Dessen ungeachtet litt es ihn doch nicht. Weshalb? Frage den Weidenbaum, frage den blühenden Flieder! – und deshalb sagte er dem Meister von Nürnberg Lebewohl und zog weiter.
Zu Niemanden sprach er von Johanna, in seinem Innern verbarg er seinen Kummer – und eine tiefe Bedeutung legte er der Geschichte von den beiden Pfefferkuchen bei; jetzt begriff er, weshalb die Mannsperson dort eine bittere Mandel links hatte, er selbst hatte einen bitteren Geschmack davon; und Johanna, die stets so mild und freundlich war, sie war lauter Honigkuchen. Es war, als preßte der Riemen seines Ränzels dermaßen, daß er kaum zu atmen vermochte; er löste ihn, allein es half nichts; nur die halbe Welt erblickte er um sich, die andere Hälfte trug er in sich, in seinem Innern, so stand es mit ihm!
Erst als er die hohen Berge erblickte, ward die Welt ihm freier, seine Gedanken wandten sich nach außen; Tränen traten in seine Augen.
Die Alpen schienen ihm die zusammen gefalteten Flügel der Erde zu sein; – wie, wenn sich diese entfaltete? die großen Schwingen mit ihren bunten Bildern von schwarzen Wäldern, brausenden Gewässern, Wolken und Schneemassen ausbreitete? Am jüngsten Tage erhebt die Erde die großen Flügel, steigt gen Himmel und zerplatzt wie eine Seifenblase in dem Strahlenglanze Gottes. »O, wäre es nur der jüngste Tag!« seufzte er.
Still wanderte er durch das Land, das ihm wie ein rasenbedeckter Fruchtgarten erschien; von den hölzernen Altanen der Häuser nickten ihm klöppelnde Mädchen zu, die Bergesgipfel glühten in der roten Abendsonne, und als er die grünen Seen zwischen den dunklen Bäumen sah – dachte er an die Küste bei dem Kjögemeerbusen, und wohl die Wehmut, aber nicht der Schmerz wohnte in seiner Brust.
Dort, wo der Rhein wie eine lange Woge dahinrollt, zerstäubt, und in schneeweiße, klare Wolkenmassen verwandelt wird, als ginge hier die Schöpfung der Wolken vor sich – der Regenbogen flattert wie ein loses Band darüber hin, – dort dachte er an die Wassermühle bei Kjöge, wo die Gewässer brausen und schäumen.
Gern wäre er hier in der stillen Rheinstadt geblieben, allein es waren hier gar zu viele Flieder- und Weidenbäume – deshalb zog er weiter, über die hohen, mächtigen Gebirge, durch zersprengte Felswände und auf Wegen, die Schwalbennestern gleich an der Bergwand hingen. Die Gewässer brausten in der Tiefe, die Wolken lagen unter ihm; über Disteln Alpenrosen und Schnee schritt er in der warmen Sommersonne dahin, – und sagte den Landen des Nordens Lebewohl und trat unter blühende Kastanienbäume, schritt durch Weingärten und Maisfelder; die Berge waren eine Mauer zwischen ihm und allen seinen Erinnerungen, und so mußte es sein.
Vor ihm lag eine große, prächtige Stadt, sie nannten sie Milano, und hier fand er einen deutschen Meister, der ihn in Arbeit nahm; es war ein altes, frommes Ehepaar, in dessen Werkstätte er arbeitete. Die beiden Alten gewannen den stillen Gesellen lieb, der wenig sprach, aber desto mehr arbeitete und fromm und christlich lebte. Ihm schien es auch, als habe Gott die schwere Last von seinem Herzen genommen.
Seine schönste Lust war, dann und wann auf die mächtige Marmorkirche zu steigen, die schien ihm wie von der Heimat Schnee geschaffen und zu Bildern, spitzen Türmen, bunt geschmückten offenen Hallen geformt zu sein; von jedem Winkel, jeder Spitze, jedem Bogen herab lächelten ihn die weißen Bildsäulen an. Über sich hatte er den blauen Himmel, unter sich die Stadt und die weit gedehnte, grüne lombardische Ebene, und gen Norden die hohen Berge mit dem ewigen Schnee, – dabei dachte er an die Kjögekirche mit ihren roten, von Efeu umrankten Mauern, aber er sehnte sich nicht fort; hier, hinter den Bergen, wollte er begraben sein.
Ein Jahr hatte er hier gelebt, es waren drei Jahre verflossen, seitdem er die Heimat verlassen; da führte sein Meister ihn eines Tages in die Stadt, nicht nach der Arena zu den Kunstreitern, nein, in die große Oper, – und dort war auch ein Saal, der des Beschauens wert war. In sieben Etagen hingen die schönsten seidenen Vorhänge her nieder, und vom Fußboden an, schwindelnd hoch bis zur Decke hinauf saßen die feinsten Damen mit Blumenbouquets in den Händen, als wenn sie auf den Ball gehen wollten, und die Herren waren in vollem Staat und viele von ihnen mit Gold und Silber geschmückt; es war dort so hell wie in dem klarsten Sonnenscheine, und die Musik brauste herrlich, es war viel prächtiger als die Komödie in Kopenhagen, aber dort war Johanna ... Hier war sie auch – ja, es war wie ein Zauber ... der Vorhang ging auf, und auch hier stand Johanna in Gold und Seide, mit der goldenen Krone auf dem Haupte; sie sang, wie nur ein Engel Gottes zu singen vermag, sie trat so weit hervor, wie sie nur konnte; sie lächelte, wie nur Johanna zu lächeln vermochte; sie blickte gerade auf Kanut herab. Der arme Kanut ergriff die Hand des Meisters, indem er laut »Johanna!« rief; doch kein Anderer hörte es, die Musik übertönte Alles, nur der Meister nickte mit dem Kopfe dazu. »Ja wohl, sie heißt Johanna!« – und dabei zog er ein gedrucktes Blatt hervor und zeigte Kanut ihren Namen, – der volle Name stand da zu lesen.
Nein, das war kein Traum! Alle Menschen jubelten und warfen ihr Blumen und Kränze zu, und jedes Mal, wenn sie abging, riefen sie sie auf's Neue; sie ging und kam immer wieder.
Auf der Straße scharten die Menschen sich um ihren Wagen und zogen denselben davon. Kanut war in der vordersten Reihe und jubelte am fröhlichsten auf; und als der Wagen vor ihrem prächtig erleuchteten Hause Halt machte, stand Kanut an der Wagentür, dieselbe sprang auf, sie trat heraus, die Lichtstrahlen fielen auf ihr liebes Antlitz und sie lächelte und bedankte sich freundlich mild, und war tief gerührt; Kanut blickte ihr gerade in's Gesicht, auch sie blickte ihm in's Gesicht, – aber sie kannte ihn nicht. Ein Mann, auf dessen Brust ein Stern strahlte, reichte ihr den Arm – die Beiden seien verlobt, sagte man.
Darauf ging Kanut nach Hause und schnürte sein Ränzel; er wollte, er mußte nach der Heimat zurück, zum Flieder-, zum Weidenbaum – ach, unter den Weidenbaum! In einer Stunde kann man ein ganzes Menschenleben durchlaufen.
Das alte Ehepaar bat ihn, zu bleiben; – Worte vermochten nicht, ihn zurückzuhalten, vergeblich machte man ihn auf den Winter aufmerksam, sagte ihm, daß der Schnee schon in den Bergen gefallen sei; – in der Spur des langsam fahrenden Wagens, dem man doch den Weg bahnen müsse, meinte er, mit dem Ränzel auf seinem Rücken, gestützt auf seinen Stab, dahin schreiten zu können.
Er schritt auf die Berge zu, schritt sie hinab, hinab; entkräftet erblickte er noch kein Städtchen, kein Haus; er schritt gegen Norden. Die Sterne blinkten über ihm, es schwankten ihm die Füße, es schwindelte ihm der Kopf; tief im Tale blinkten gleichfalls Sterne, es war, als sei der Himmel auch unter ihm; er fühlte sich krank; die Sterne dort unten vermehrten sich fortwährend und strahlten immer heller, sie bewegten sich hin und her. Es war ein kleines Städtchen, in dem die Lichter flimmerten, und als er das begriffen, strengte er seine letzten Kräfte an und erreichte dort eine ärmliche Herberge.
Die Nacht und auch den ganzen folgenden Tag blieb er dort, denn sein Körper bedurfte der Ruhe und Pflege; es war Tauwetter; es regnete im Tale. Aber am andern frühen Morgen trat dort ein Leiermann ein, er spielte eine Melodie aus der Heimat, und nun vermochte Kanut nicht länger hier zu weilen; er zog weiter gegen Norden, er ging Tage, viele Tage lang mit einer Hast, als gelte es in die Heimat zu gelangen, bevor Alle dort gestorben seien; aber zu Niemandem sprach er von seiner Sehnsucht, Niemand hatte an seines Herzens Kummer, den tiefsten, den man haben kann, geglaubt; ein solcher ist nicht für die Welt, er ist nicht unterhaltend, nicht einmal für die Freunde. Fremd wanderte er durch die fremden Länder nach Hause gegen Norden!
Es war Abend; er ging auf der offenen Landstraße, der Frost begann, sich geltend zu machen, das Land selbst wurde immer ebener, mehr Feld und Wiese; an der Straße stand ein großer Weidenbaum; Alles sah ganz heimatlich aus, er setzte sich unter den Baum, er fühlte sich sehr ermüdet; sein Kopf neigte sich, seine Augen schlossen sich zur Ruhe, aber er empfand doch, wie der Weidenbaum seine Zweige über ihn ausstreckte, herabsenkte; der Baum schien ihm ein alter, mächtiger Mann zu sein. – Es war der Weidenvater selbst, der ihn auf seine Arme hob und ihn, den müden Sohn, zurück in das Heimatland, an den offenen, bleichen Strand, nach Kjöge, in den Garten seiner Kindheit trug. Ja, es war der Weidenbaum selbst von Kjöge, der in die Welt gewandert war, um ihn zu suchen; und jetzt hatte er ihn gefunden und war in den kleinen Garten am Bache zurückgeführt, und hier stand Johanna in ihrer Pracht mit der goldenen Krone auf dem Haupte, wie er sie zuletzt gesehen, und rief ihm ein »Willkommen!« zu.
Vor ihm standen zwei sonderbare Gestalten, wenn sie auch viel menschlicher als in seiner Kindheit aussahen; auch sie hatten sich verändert; es waren die zwei Pfefferkuchen, der Mann und das Frauenzimmer, sie wendeten ihm die rechte Seite zu und sahen gut aus.
»Wir danken Dir!« sagten sie zu Kanut; »Du hast uns die Zungen gelöst, daß man frei seine Gedanken aussprechen soll, sonst käme Nichts dabei heraus, und jetzt ist Etwas dabei heraus gekommen: – wir sind verlobt!«
Darauf gingen sie Hand in Hand durch die Straßen Kjöge's und sahen auch sehr anständig auf der Kehrseite aus, da war Nichts an ihnen auszusetzen. Sie schritten gerade auf die Kirche zu, und Kanut und Johanna folgten; auch sie gingen Hand in Hand, und die Kirche stand da wie immer mit ihren roten Mauern, umrankt von dem grünen Efeu, und die große Tür der Kirche flog nach beiden Seiten auf, die Orgel brauste und sie schritten den breiten Hauptgang der Kirche entlang: »Die Herrschaften zuerst!« sagten die Pfefferkuchenbrautleute und machten Kanut und Johanna Platz, und diese knieten am Altare nieder; sie beugte ihr Haupt über sein Antlitz und eiskalte Tränen entfielen ihren Augen, es war das Eis, das um ihr Herz schmolz – durch seine starke Liebe; die Tränen fielen auf seine brennenden Wangen, und – er erwachte dabei, und saß unter dem alten Weidenbaume im fremden Lande, in dem winterkalten Abende; aus den Wolken fiel eisiger Hagel herab und peitschte sein Gesicht.
»Das war die schönste Stunde meines Lebens!« – sagte er, »und sie war – ein Traum! – Gott, laß mich nochmals träumen!« – Er schloß die Augen auf's Neue, er schlief, er träumte.
Gegen Morgen fiel Schnee. Er jagte vor dem Winde über ihn hin, er schlief. Dorfleute gingen zur Kirche, – an der Landstraße saß ein Handwerksbursch; er war tot, erfroren – unter dem Weidenbaume!
FÜNF AUS EINER HÜLSE
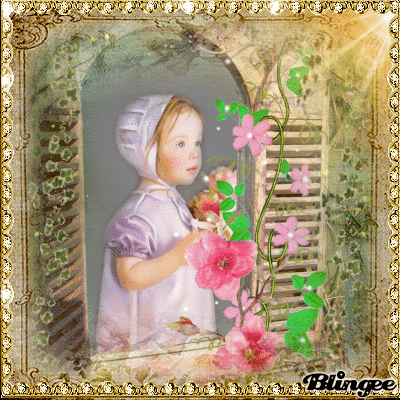
Es waren einmal fünf Erbsen in einer Hülse; sie waren grün und die Hülse war auch grün, und deshalb glaubten sie, die ganze Welt sei grün, und das war ganz richtig. Die Hülse wuchs und die Erbsen wuchsen; sie streckten sich eben nach ihrer Decke. – Alle standen schön in einer Reihe. –
Die Sonne schien draußen und wärmte die Hülse, und der Regen wusch sie sauber. Es war warm und gut da drinnen, hell am Tage und dunkel in der Nacht, eben wie es sein sollte, und die Erbsen wurden größer und immer nachdenklicher, wie sie so saßen, denn etwas mußten sie ja auch zu tun haben.
"Soll ich hier immer so sitzen bleiben?" fragten sie. "Wenn ich nur nicht hart von dem langen Sitzen werde! Ist es nicht gleichsam, als ob es auch draußen etwas gäbe; ich habe so eine Ahnung."
Und Wochen vergingen; die Erbsen wurden gelb und die Hülse wurde gelb. "Die ganze Welt wird gelb," sagten sie, und das durften sie wohl sagen.
Plötzlich verspürten sie einen Ruck an der Hülse; sie wurde abgerissen, kam in Menschenhände und dann mit mehreren anderen Erbsenhülsen in eine Rocktasche hinein. – "Nun wird uns bald aufgeschlossen werden!" sagten sie und warteten voller Spannung darauf.
"Nun möchte ich nur wissen, wer von uns es am weitesten bringt!" sagte die kleinste Erbse. "Ja, das wird sich nun bald zeigen!"
"Geschehe, was da wolle!" sagte die größte.
"Krach" da platzte die Hülse und alle fünf Erbsen rollten in den hellen Sonnenschein hinaus; sie lagen in einer Kinderhand, ein kleiner Knabe hielt sie fest und sagte, sie seien schöne Erbsen für seine Knallbüchse. Und gleich wurde eine Erbse in die Büchse gesteckt und weggeschossen.
"Nun fliege ich in die weite Welt hinaus. Halt mich, wenn Du kannst!" und dann war sie fort.
"Ich," sagte die zweite, "fliege gleich mitten in die Sonne, das ist gerade die passende Hülse für mich."
Weg war sie.
"Wir schlafen, wohin wir auch kommen!" sagten die beiden nächsten; "aber wir werden schon vorwärts kommen." Und dann rollten sie zuerst auf den Fußboden, ehe sie in die Knallbüchse kamen, aber hinein kamen sie. "Wir bringen es am weitesten."
"Geschehe, was da wolle" sagte die letzte und wurde in die Luft geschossen. Und sie flog auf das alte Brett unter dem Dachkammerfenster, gerade in einen Spalt hinein, der mit Moos und hineingewehter Erde gefüllt war; und das Moos schloß sich über ihr. Dort lag sie verborgen, aber nicht von Gott vergessen.
"Geschehe, was da wolle!" sagte sie.
In der kleinen Dachkammer wohnte eine arme Frau, die am Tage Öfen putzen, ja sogar Holz spalten ging und schwere Arbeit verrichten mußte, denn Kräfte hatte sie und fleißig war sie auch, aber sie blieb arm. Und zuhause in der kleinen Kammer lag ihre halberwachsene einzige Tochter, sie war ganz fein und zart; ein ganzes Jahr hatte sie nun im Bette gelegen und schien weder leben noch sterben zu können.
"Sie geht zu ihrer kleinen Schwester" sagte die Frau. "Ich hatte nur die zwei Kinder, und es war schwer genug für mich, für beide zu sorgen. Aber da teilte der liebe Gott mit mir und nahm die eine zu sich. Nun möchte ich freilich die andere gern behalten, die mir geblieben ist, aber er will vielleicht nicht, daß sie getrennt sind, und sie wird zu ihrer kleinen Schwester hinaufgehen."
Aber das kranke Mädchen blieb; und geduldig und still lag sie den ganzen Tag, während die Mutter fort war, um Geld zu verdienen.
Es war um die Frühjahrszeit und noch frühe am Morgen, gerade als die Mutter zur Arbeit gehen wollte, Die Sonne schien so schön in das kleine Fenster hinein, und das kranke Mädchen blickte durch die unterste Glasscheibe hinaus.
"Was mag nur das Grüne sein, was dort durch die Scheibe hereinguckt? Es bewegt sich im Winde."
Und die Mutter ging ans Fenster und öffnete es ein wenig. "Ach!" sagte sie, "das ist ja eine kleine Erbse, die da mit ihren grünen Blättchen heraussprießt. Wie kommt sie nur in die Spalte? Da hast Du ja einen kleinen Garten zum Anschauen."
Das Bett der Kranken wurde näher ans Fenster gerückt, damit sie die sprossende Erbse sehen konnte, und die Mutter ging zur Arbeit.
"Mutter, ich glaube, ich werde gesund!" sagte am Abend das kleine Mädchen. "Die Sonne hat heute so warm zu mir herein geschienen. Die kleine Erbse wächst so hübsch. Und ich werde sicherlich auch wachsen und wieder aufstehen und in den Sonnenschein hinauskönnen!"
"Wollte Gott, es wäre so" sagte die Mutter, aber sie glaubte nicht daran. Doch der kleinen Pflanze, das ihrem Kinde frohe Lebensgedanken eingeflößt hatte, gab sie ein Hölzchen an die Seite, damit sie nicht vom Winde geknickt werden könne. Sie band einen Bindfaden am Brett fest und zog ihn hinauf bis an den Fensterrahmen, damit die Erbsenranke etwas habe, woran sie sich festhalten und emporranken könne, wenn sie wüchse. Und das tat sie auch. Jeden Tag konnte man sehen, wie sie wuchs.
"Nein, sie bekommt ja sogar Blüten" sagte die Frau eines Morgens, und nun bekam auch sie Hoffnung und Glauben, daß ihr kleines krankes Mädchen wieder gesund würde. Es kam ihr in den Sinn, daß das Kind in letzter Zeit lebhafter gesprochen hatte, am vergangenen Morgen hatte es sich sogar selbst im Bette aufgerichtet und dagesessen und mit strahlenden Augen ihren kleinen Erbsengarten mit der einen einzigen Erbse darin angesehen. In einer Woche darauf war die Kranke zum ersten Male über eine Stunde auf. Glückselig saß sie im warmen Sonnenschein; das Fenster war geöffnet und draußen stand eine weißrote Erbsenblüte völlig aufgebrochen. Das kleine Mädchen neigte ihren Kopf nieder und küßte ganz leise die feinen Blättchen. Dieser Tag war für sie gleichsam ein Festtag.
"Der liebe Gott hat sie selbst gepflanzt und sie treiben lassen, um uns Hoffnung und Freude für Dich zu geben, mein liebes Kind, und für mich mit" sagte die frohe Mutter und lächelte der Blume zu, wie einem Engel, den Gott zu ihr geschickt hatte.
Aber nun zu den anderen Erbsen, – ja, die, die in die weite Welt hinausgeflogen war: "Halte mich, wenn Du kannst!" fiel in die Dachrinne und kam in einen Taubenkropf; dort lag sie wie Jonas im Walfisch. Die zwei Faulen brachten es ebenso weit, sie wurden auch von den Tauben verspeist, und dadurch brachten sie einen soliden Nutzen; aber die vierte, die in die Sonne hinauf wollte, die fiel in den Rinnstein und lag dort Wochen und Tage im schmutzigen Wasser, wo sie richtig aufquoll.
"Ich werde so furchtbar dick" sagte die Erbse. "Ich werde noch platzen, und weiter, glaube ich, kann es keine Erbse bringen und hat es wohl auch nie eine gebracht!"
Und der Rinnstein hielt es mit ihrer Ansicht.
Aber das junge Mädchen stand am Dachfenster mit leuchtenden Augen und dem Glanze der Gesundheit auf den Wangen, und sie faltete ihre feinen Hände über der Erbsenblüte und dankte Gott dafür.
"Ich halte es mit meiner Erbse," sagte der Rinnstein.
DER BÖSE FÜRST
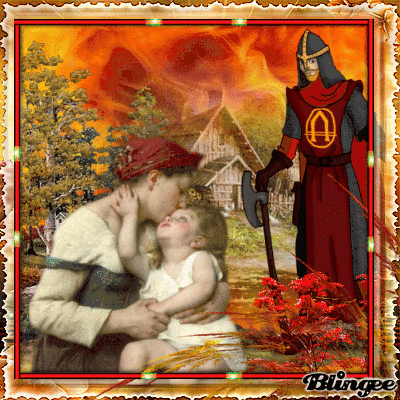
Es war einmal ein böser Fürst; all sein Dichten und Trachten ging darauf aus, alle Längen der Welt zu erobern und allen Menschen Furcht einzuflößen; mit Feuer und Schwert zog er umher, und seine Soldaten zertraten die Saat auf den Feldern und zündeten des Bauern Haus an, so daß die rote Flamme die Blätter von den Bäumen leckte und das Obst gebraten an den versengten, schwarzen Bäumen hing.
Mit dem nackten Säugling im Arm flüchtete manche Mutter sich hinter die noch rauchenden Mauern ihres abgebrannten Hauses, aber hier suchten die Soldaten sie auch, und fanden sie die Armen, so war dies neue Nahrung für ihre teuflische Freude: böse Geister hätten nicht ärger verfahren können als diese Soldaten; der Fürst aber meinte, gerade so sei es recht, so sollte es zugehen. Täglich wuchs seine Macht, sein Name wurde von allen gefürchtet, und das Glück schritt neben ihm her bei allen seinen Taten.
Aus den eroberten Städten führte er große Schätze heim; in seiner Residenzstadt wurde ein Reichtum aufgehäuft, der an keinem anderen Orte seinesgleichen hatte. Und er ließ prächtige Schlösser, Kirchen und Hallen bauen, und jeder , der diese herrlichen Bauten und großen Schätze sah, rief ehrfurchtsvoll: "Welch großer Fürst!" Sie gedachten aber nicht des Elends, das er über andere Länder und Städte gebracht hatte; sie vernahmen nicht all die Seufzer und all den Jammer, der aus den eingeäscherten Städten empor drang.
Der Fürst betrachtete sein Gold und seine prächtigen Bauten und dachte dabei wie die Menge: "Welch großer Fürst! Aber ich muß mehr haben, viel mehr! Keine Macht darf der meinen gleichkommen, geschweige denn größer als die meine sein!" Und er bekriegte alle seine Nachbarn und besiegte sie alle. Die besiegten Könige ließ er mit goldenen Ketten an seinen Wagen fesseln, und so fuhr er durch die Straßen seiner Residenz; tafelte er, so mußten jene Könige ihm und seinen Hofleuten zu Füßen liegen und sich von den Brocken sättigen, die ihnen von der Tafel zugeworfen wurden.
Endlich ließ der Fürst seine eigene Bildsäule auf den öffentlichen Plätzen und in den königlichen Schlössern errichten, ja, er wollte sie sogar in den Kirchen vor dem Altar des Herrn aufstellen; allein hier traten die Priester ihm entgegen und sagten: "Fürst, du bist groß, aber Gott ist größer, wir wagen es nicht, deinem Befehl nachzukommen."
"Wohlan denn!" rief der Fürst, "ich werde auch Gott besiegen!" Und in Übermut und törichtem Frevel ließ er ein kostbares Schifflein bauen, mit welchem er die Lüfte durchsegeln konnte; es war bunt und prahlerisch anzuschauen wie der Schweif eines Pfaus, und es war gleichsam mit Tausenden von Augen besetzt und übersäht, aber jedes Auge war ein Büchsenlauf. Der Fürst saß in der Mitte des Schiffes, er brauchte nur auf eine dort angebrachte Feder zu drücken, und tausend Kugeln flogen nach allen Richtungen hinaus, während die Feuerschlünde sogleich wieder geladen waren. Hunderte von Adlern wurden vor das Schiff gespannt, und pfeilschnell ging es nun der Sonne entgegen.
Wie lag da die Erde tief unten! Mit ihren Bergen und Wäldern schien sie nur ein Ackerfeld zu sein, in das der Pflug seine Furchen gezogen hatte, an dem entlang der grüne Rain hervorblickte, bald glich sie nur noch einer flachen Landkarte mit undeutlichen Strichen, und endlich lag sie ganz in Nebel und Wolken gehüllt. Immer höher flogen die Adler aufwärts in die Lüfte – da sandte Gott einen einzigen seiner unzähligen Engel aus; der böse Fürst schleuderte Tausende von Kugeln gegen ihn, allein die Kugeln prallten ab von den glänzenden Fittichen des Engels, fielen herab wie gewöhnliche Hagelkörner; doch ein Blutstropfen, nur ein einziger, tröpfelte von einer der weißen Flügelfedern herab, und dieser Tropfen fiel auf das Schiff, in welchem der Fürst saß, er brannte sich in das Schiff ein, er lastete gleich tausend Zentner Blei darauf und riß das Schiff in stürzender Fahrt zur Erde nieder; die starken Schwingen der Adler zerbrachen, der Wind umsauste des Fürsten Haupt, und die Wolken ringsum – die waren ja aus dem Flammenrauch der abgebrannten Städte gebildet – formten sich zu drohenden Gestalten, zu meilenlangen Seekrabben, die ihre Klauen und Scheren nach ihm ausstreckten, sie türmten sich zu ungeheuerlichen Felsen mit herabrollenden, zerschmetternden Blöcken, zu feuerspeienden Drachen; halbtot lag der Fürst im Schiff ausgestreckt, und dieses blieb endlich mit einem fruchtbaren Stoß in den dicken Baumzweigen eines Waldes hängen.
"Ich will Gott besiegen!" sagte der Fürst, "ich habe es geschworen, mein Wille muß geschehen!" Und sieben Jahre lang ließ er bauen und arbeiten an künstlichen Schiffen zum Durchsegeln der Luft, ließ Blitzstrahlen aus härtestem Stahl schneiden, denn er wollte des Himmels Befestigung sprengen. Aus allen Landen sammelte er Kriegsheere, die, als sie Mann an Mann aufgestellt waren, einen Raum von mehreren Meilen bedeckten. Die Heere gingen an Bord der künstlichen Schiffe, der Fürst näherte sich dem seinen: da sandte Gott einen einzigen kleinen Mückenschwarm aus.
Der umschwirrte den Fürsten und zerstach sein Antlitz und seine Hände; zornentbrannt zog er sein Schwert und schlug um sich, allein er schlug nur in die leere Luft, die Mücken traf er nicht. Da befahl er, kostbare Teppiche zu bringen und ihn in dieselben einzuhüllen, damit ihn keine Mücke fernerhin steche; und die Diener taten wie befohlen. Allein, eine einzige Mücke hatte sich an die innere Seite des Teppichs gesetzt, von hier aus kroch sie in das Ohr des Fürsten und stach ihn; es brannte wie Feuer, das Gift drang hinein in sein Gehirn; wie wahnsinnig riß er die Teppiche von seinem Körper und schleuderte sie weit weg, zerriß seine Kleidung und tanzte nackend herum vor den Augen seiner rohen, wilden Soldaten, die nun den tollen Fürsten verspotteten, der Gott bekriegen wollte und von einer einzigen kleinen Mücke besiegt worden war.
DER HALSKRAGEN
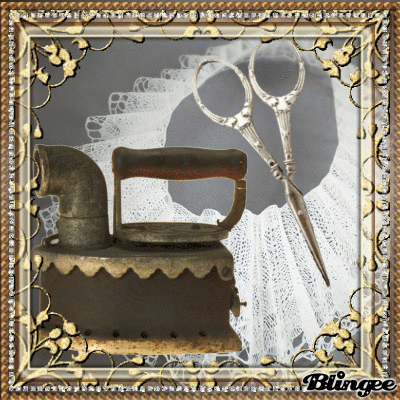
Es war einmal ein feiner Herr, dessen sämtliches Hausgerät aus einem Stiefelknecht und einer Haarbürste bestand, aber er hatte den schönsten Halskragen von der Welt, und dieser Halskragen ist es, dessen Geschichte wir hören werden. Er war nun so alt geworden, daß er daran dachte, sich zu verheiraten, und da traf es sich, daß er mit einem Strumpfband in die Wäsche kam.
Da meinte der Halskragen: "Habe ich doch nie jemand so schlank und so fein und so niedlich gesehen. Darf ich um Ihren Namen bitten?"
"Den nenne ich nicht!" sagte das Strumpfband.
"Wo sind Sie denn zu Hause?" fragte der Halskragen.
Aber das Strumpfband war beschämt und meinte, es sei doch etwas sonderbar, darauf zu antworten.
"Sie sind wohl ein Gürtel?" sagte der Halskragen, "ein Gürtel ist immer zu tragen. Ich sehe, Sie sind zum Nutzen und auch zum Staat!"
"Sie dürfen nicht mit mir sprechen!" sagte das Strumpfband, "mich dünkt, ich habe Ihnen durchaus keine Veranlassung dazu gegeben!"
"Ja, wenn man so schön wie Sie ist," sagte der Halskragen, "so ist das Veranlassung genug!"
"Kommen Sie mir nicht so nahe!" sagte das Strumpfband, "Sie sehen so männlich aus!"
"Ich bin auch ein feiner Herr!" sagte der Halskragen, "ich besitze einen Stiefelknecht und eine Haarbürste!" Das war nun nicht wahr, denn sein Herr hatte diese, aber er prahlte.
"Kommen Sie mir nicht so nahe!" sagte das Strumpfband, "ich bin das nicht gewohnt!"
"Zierliese!" sagte der Halskragen, und dann wurden sie aus der Wäsche genommen; sie wurden gestärkt, hingen auf dem Stuhl im Sonnenschein und wurden dann aufs Plättbrett gelegt; da kam das warme Eisen.
"Liebe Frau!" sagte der Halskragen, "liebe Frau Witwe. Mir wird ganz warm! Ich werde ein ganz anderer, ich komme ganz aus den Falten, Sie brennen mir ein Loch! Uh! – Ich halte um Sie an!"
"Laps!" sagte das Plätteisen und ging stolz über den Halskragen hin, denn das bildete sich ein, daß es ein Dampfkessel sei, der in eine Maschine kommen und Wagen ziehen sollte.
"Laps!" sagte es.
Der Halskragen faserte an den Kanten ein wenig aus, deshalb kam die Papierschere und sollte die Fasern wegschneiden.
"Oh!" sagte der Halskragen, "Sie sind wohl erste Tänzerin? Wie Sie die Beine ausstrecken können! Das ist das reizendste, was ich je gesehen habe, das kann Ihnen kein Mensch nachmachen!"
"Das weiß ich!" sagte die Schere.
"Sie verdienen, eine Gräfin zu sein!" sagte der Halskragen. "Alles, was ich besitze, ist ein feiner Herr, ein Stiefelknecht und eine Haarbürste! Wenn ich nur eine Grafschaft hätte!"
"Er freit wohl gar!" sagte die Schere, sie wurde böse und gab ihm einen tüchtigen Schnitt.
'Ich muß am Ende wohl um die Haarbürste freien!' dachte der Halskragen. "Was Sie für schönes Haar haben, liebes Fräulein!" sagte er. "Haben Sie nie daran gedacht, sich zu verloben?"
"Ja, das können Sie sich wohl denken!" sagte die Bürste. "Ich bin ja mit dem Stiefelknecht verlobt!"
"Verlobt!" sagte der Halskragen; nun gab es niemand mehr, um die er hätte freien können, und darum verachtete er es.
Es verging eine lange Zeit, und dann kam der Halskragen in den Kasten beim Papiermüller. Da gab es große Lumpengesellschaft, die feinen für sich, die groben für sich, so wie sich das gehört. Sie hatten alle viel zu erzählen, aber der Halskragen am meisten, das war ein gewaltiger Prahlhans.
"Ich habe ungeheuer viele Geliebte gehabt!" sagte der Halskragen, "man ließ mir gar keine Ruhe! Ich war aber auch ein feiner Herr mit Stärke! Ich besaß sowohl einen Stiefelknecht wie eine Haarbürste, die ich nie gebrauchte! Damals hätten Sie mich nur sehen sollen, wenn ich auf der Seite lag. Nie vergesse ich meine erste Geliebte, sie war ein Gürtel, fein, zart und niedlich, sie stürzte sich meinetwegen in eine Waschwanne. Da war auch eine Witwe, die für mich erglühte, aber ich ließ sie stehen und schwarz werden. Da war die erste Tänzerin, sie versetzte mir die Wunde, mit der ich gehe, sie war schrecklich bissig! Meine eigene Bürste war in mich verliebt, sie verlor alle Haare aus Liebesgram. Ja, ich habe viel dergleichen erlebt; aber am meisten tut es mir Leid um das Strumpfband, ich meine den Gürtel, der sich in die Waschwanne stürzte. Ich habe sehr viel auf meinem Gewissen; es wird mir wohl tun, weißes Papier zu werden!"
Und das wurde er, alle Lumpen wurden weißes Papier, aber der Halskragen wurde gerade das Stück Papier, was wir hier sehen, worauf die Geschichte gedruckt ist, und das geschah, weil er so gewaltig mit Dingen prahlte, die gar nicht wahr gewesen waren. Daran sollen wir denken, damit wir uns nicht ebenso betragen, denn wir können wahrlich nicht wissen, ob wir nicht auch einmal in den Lumpenkasten kommen und zu weißem Papier umgearbeitet werden und dann unsere ganze Geschichte, selbst die allergeheimste, aufgedruckt bekommen, womit wir dann selbst herumlaufen und sie erzählen müssen wie der Halskragen.
AM ÄUSSERSTEN MEERE

Große Schiffe waren hoch hinauf nach dem Nordpole gesandt, um dort die äußersten Grenzen, die letzten Meeresküsten aufzufinden, und zu versuchen, wie weit die Menschen dort oben wohl vorzudringen vermöchten.
Schon steuerten sie Jahr und Tag durch Nebel und Eis hindurch und standen viel Mühseligkeiten aus; endlich war der Winter herangekommen und die Sonne aus jenen Gegenden verschwunden; viele, viele Wochen würden nun eine lange Nacht sein; Alles, so weit der Blick ringsum reichte, war ein einziges Eisstück; jedes der Schiffe war an dasselbe vertäuet, der Schnee türmte sich in große Haufen, und aus ihm waren Hütten in der Form von Bienenkörben gebildet und errichtet, einige groß wie die alten Hünengräber, andere wiederum nicht größer, als daß sie zwei oder vier Männer beherbergen konnten; allein finster war es nicht, die Nordlichter strahlten rot und blau, es war ein ewiges, großartiges Feuerwerk; der Schnee flimmerte und leuchtete, die Nacht hier war eine einzige lange, flammende Dämmerstunde.
Wenn sie am hellsten strahlte, kamen die Eingeborenen scharenweise heran, wunderbar zu schauen in ihrer behaarten, rauhen Pelzkleidung; sie kamen in Schlitten von Eisstücken, brachten Felle und Pelze in großen Bündeln mit, und die Schneehäuser bekamen warme Fußteppiche; die Felle dienten abwechselnd als solche und als Deckbetten, die Matrosen betteten sich unter die Schneekruste, während es draußen fror, daß es knisterte, und zwar ganz anders als manchmal im Winter bei uns. Bei uns war es noch Spätherbst, und dessen gedachten sie dort oben; sie erinnerten sich an das gelbliche Laub der heimatlichen Bäume. Die Uhr zeigte, daß es Abend und Zeit zum Schlafen sei, und in einer der Schneehütten streckten sich bereits Zwei, die Ruhe suchend, aus.
Der Jüngste von diesen führte aus der Heimat seinen besten, teuersten Schatz, die Bibel, bei sich, welche ihm die Großmutter bei der Abreise geschenkt hatte. Jede Nacht ruhte die heilige Schrift unter seinem Kopfe, und noch aus den Kinderjahren wußte er, was in ihr geschrieben stand, täglich las er darin, und auf seinem Lager ausgestreckt, kamen ihm oft jene heiligen Worte in den Sinn, die da lauten: »Nähme ich Flügel der Morgenröthe und bliebe am äußersten Meere, so würde mich doch Deine Hand daselbst führen und Deine Rechte mich halten!« – Unter dem Einflusse des ewigen Wortes und des wahren Glaubens schloß er die Augen, und der Schlaf überkam ihn, und der Traum, die Offenbarung des Geistes in Gott; die Seele lebte und war tätig, während der Körper sich der Ruhe ergab; er empfand dieses Leben, es war ihm, als klängen alte liebe, bekannte Melodien, als umgaukelten ihn milde, sommerwarme Lüfte, und von seinem Lager sah er es über sich glänzen, als strahle es von außen durch die Schneekruste hinein; er hob sein Haupt empor, der strahlende helle Schimmer war jedoch kein Widerschein der Schneedecke, es waren die mächtigen Fittige an der Schulter eines Engels, in dessen mildes, strahlendes Angesicht er emporschaute.
Wie aus dem Kelche einer Lilie hob der Engel sich von den Blättern der Bibel empor, breitete seine Arme weit aus, und die Wände der Schneehütte versanken rings, als seien sie ein luftiger, lichter Nebelschleier; die grünen Matten und Hügel der Heimat mit den rotbraunen Wäldern lagen rings um ihn im stillen Sonnenglanze an einem schönen Herbsttage; das Nest des Storches war leer, aber noch hingen Äpfel an dem wilden Apfelbaume, wenn dieser auch schon entblättert war; die roten Hagebutten glänzten und der Star pfiff in dem grünen Käfige über dem Fenster der Bauernhütte, der heimatlichen Hütte; der Star pfiff die gelernte Melodie, und die Großmutter behing seinen Käfig mit grünen Vogelfutter, wie er, der Enkel, es stets getan; und die Tochter des Dorfschmieds, gar schön und jung, stand am Brunnen, schöpfte Wasser und nickte der Großmutter zu, die Großmutter winkte ihr und zeigte ihr einen Brief, der aus weiter Ferne gekommen war.
An diesem Morgen war der Brief aus den kalten Landen oben am Nordpole selbst gekommen, dort wo der Enkel war und in Gottes Hand stände. – Sie lächelten und weinten, und er, dort oben unter Eis und Schnee, unter den Fittigen des Engels, auch er lächelte und weinte im Geiste mit ihnen, denn er sah und hörte sie. Aus dem Briefe wurde laut vorgelesen, auch die Worte der heiligen Schrift: »am äußersten Meere, seine Rechte mich halten wird.« – Ringsum ertönte der schönste Psalmengesang und der Engel ließ seine Fittige, einem Schleier gleich, über den Schlafenden herab, – das Traumbild war verschwunden – es war finster in der Schneehütte, aber die Bibel ruhte unter seinem Kopfe, der Glaube und die Hoffnung wohnten in seinem Herzen. Gott war mit ihm und die Heimat trug er im Herzen – »am äußersten Meere«.
DIE SCHNELLLÄUFER
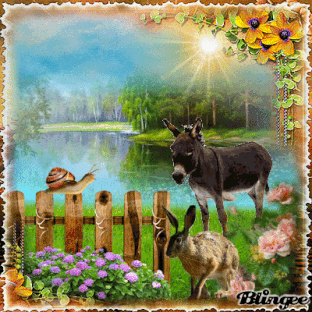
Ein Preis, ja zwei Preise waren ausgesetzt, ein kleiner und ein großer, für die größte Schnelligkeit, nicht in einem Laufe, sondern für die Schnelligkeit das ganze Jahr hindurch.
»Ich bekam den ersten Preis!« sprach der Hase; »Gerechtigkeit muß doch wenigstens da sein, wenn Verwandte und gute Freunde im Preiscollegium sitzen; – daß aber die Schnecke den zweiten Preis erhielt, finde ich fast beleidigend für mich!«
»Nein,« versicherte der Zaunpfahl, der Zeuge bei der Preisverteilung gewesen, »es muß auch Rücksicht auf Fleiß und guten Willen genommen werden, das sagten mehrere achtbare Leute, und das habe ich wohl begriffen. Die Schnecke hat freilich ein halbes Jahr gebraucht, um über die Thürschwelle zu gelangen; allein sie hat sich Schaden getan, hat sich das Schlüsselbein gebrochen bei der Eile, die es doch immerhin für sie war. Sie hat ganz und gar für ihren Lauf gelebt, und sie lief mit dem Hause auf dem Rücken! – Das Alles ist sehr charmant! – und sie bekam deshalb auch den zweiten Preis!«
»Mich hätte man doch auch berücksichtigen können!« sagte die Schwalbe; »ich sollte meinen, daß Niemand sich schneller als ich im Fluge und Schwunge gezeigt habe, und wie bin ich weit umher gewesen, weit, weit, weit!«
»Ja, das eben ist Ihr Unglück!« sprach der Zaunpfahl, »Sie sind zu flatterhaft! Immer müssen sie auf die Fahrt, ins Ausland, wenn es hier zu frieren beginnt; Sie haben keine Vaterlandsliebe! Sie können nicht berücksichtigt werden!«
»Wenn ich nun aber den ganzen Winter hindurch in der Moorhaide läge?« erwiderte die Schwalbe; »wenn ich die ganze Zeit schliefe, würde ich dann in Betracht gezogen werden?«
»Bringen Sie eine Bescheinigung der alten Moorfrau bei, daß Sie die Hälfte der Zeit im Vaterlande verschlafen haben, dann sollen Sie berücksichtigt werden.«
»Ich hätte wohl den ersten Preis und nicht den zweiten verdient!« sprach die Schnecke, »So viel weiß ich wenigstens, daß der Hase nur aus Feigheit gelaufen ist, weil er jedesmal wähnte, es sei Gefahr im Verzuge; ich hingegen habe mein Laufen zur Lebensaufgabe gemacht und bin im Dienste zum Krüppel geworden! Sollte überhaupt Jemand den ersten Preis haben, so müßte ich ihn haben: – aber ich verstehe das Klappern, das Aufschneiden nicht, ich verachte es vielmehr!«
»Ich werde mit Wort und Rede antworten können, daß jeder Preis, wenigstens meine Stimme zu demselben, mit gerechter Berücksichtigung gegeben worden ist!« nahm der alte Grenzpfahl im Walde, der Mitglied des beschließenden Rittercollegiums war, das Wort. »Ich gehe stets in gehöriger Ordnung, mit Überlegung und Berechnung vor. Siebenmal habe ich früher die Ehre gehabt, bei der Preisverteilung zugegen zu sein und mitzustimmen, aber erst heute habe ich meinen Willen durchgesetzt. Ich bin bei jeder Verteilung von einem bestimmten Etwas ausgegangen. Ich bin stets zu dem ersten Preise von vorne im Alphabet, zu dem zweiten von hinten im Alphabet gegangen. Belieben Sie mir Ihre Aufmerksamkeit zu schenken, ich will Ihnen auseinander setzen, wie man von vorne anfängt. Der achte Buchstaben von A ist H, da haben wir den Hasen, und deshalb teilte ich dem Hasen den ersten Preis zu; der achte Buchstabe von hinten ist S, und deshalb erhielt die Schnecke den zweiten Preis. Das nächste Mal wird I zum ersten Preise und R zum zweiten an der Reihe sein! – Es muß bei allen Dingen die gehörige Ordnung obwalten! Man muß einen bestimmten Anhaltepunkt haben!«
»Ich hätte freilich für mich selbst gestimmt, wenn ich nicht unter den Richtern gewesen wäre!« sagte der Maulesel, der gleichfalls Preisrichter war. »Man muß nicht allein die Schnelligkeit berücksichtigen, mit welcher man vorwärts kommt, sondern auch jedwede andere Eigenschaft, die vorhanden ist, z. :B. die, wie viel man zu ziehen vermag; doch Das wollte ich dieses Mal nicht hervorgehoben haben, auch nicht die Klugheit des Hasen auf der Flucht, oder die List, mit welcher er plötzlich einen Sprung seitwärts macht, um die Leute auf falsche Fährte zu leiten, daß sie nicht wissen, wo er sich versteckt hat; nein, es giebt noch Eins, auf welches Viele ein Gewicht legen, und das man nicht außer Acht lassen darf, ich meine das, was man das Schöne nennt; auf das Schöne richtet sich namentlich mein Augenmerk; ich schaute die schönen wohlgewachsenen Ohren des Hasen an, es ist eine wahre Freude zu sehen, wie lang die sind; mir kam es vor, als sähe ich mich selber in meiner Kindheit Tagen, und – so stimmte ich für den Hasen!«
»Pst!« sagte die Fliege, »ja, ich will nicht reden, ich will nur Etwas sagen, – will nur sagen, daß ich freilich mehr denn einen Hasen eingeholt habe. Letzthin zerschmetterte ich einem der jüngsten die Hinterläufe; ich saß auf der Locomotive vor dem Bahnzuge – das tue ich oft, man beobachtet so am besten seine eigene Schnelligkeit. Ein junger Hase lief lange Zeit der Locomotive voran, er hatte keine Ahnung, daß ich zugegen war; endlich aber mußte er innehalten und aus der Bahn weichen, allein da zerschmetterte die Locomotive ihm die Hinterbeine, denn ich saß auf derselben. Der Hase blieb liegen, aber ich fuhr weiter. Das heißt doch wohl ihn besiegen! – Allein ich brauche den Preis nicht!«
»Mir scheint nun freilich,« dachte die wilde Rose, aber sie sagte es nicht, denn es ist nun einmal nicht ihre Natur, sich auszusprechen, obwohl es gut gewesen wäre, wenn sie es getan hatte; – »mir scheint nun freilich, daß der Sonnenstrahl den ersten Ehrenpreis und auch den zweiten hätte haben müssen. Der Sonnenstrahl fliegt in einem Nu den unermeßlichen Weg von der Sonne zu uns herab, und kommt mit einer Kraft an, daß die ganze Natur dabei erwacht; der besitzt eine Schönheit, daß wir Rosen alle dabei erröten und duften! Die hohe richterliche Obrigkeit scheint dies gar nicht bemerkt zu haben! Wäre ich der Sonnenstrahl, ich gäbe einem jeden von ihnen einen Sonnenstich – allein, der würde sie nur toll machen, und das können sie ohnehin werden. Ich sage Nichts!« dachte die wilde Rose. »Friede herrscht im Walde! Herrlich ist's, zu blühen, zu duften und zu leben, in Sang und in Sage zu leben! Der Sonnenstrahl überlebt uns doch Alle!«
»Was ist der erste Preis?« fragte der Regenwurm, der die Zeit verschlafen hatte und nun erst hinzukam.
»Der besteht im freien Zutritt zu einem Kohlgarten,« antwortete der Maulesel; »ich habe diesen Preis vorgeschlagen. Der Hase mußte und sollte ihn haben, und so nahm ich als denkendes und tätiges Mitglied vernünftige Rücksicht auf Dessen Nutzen, der ihn haben sollte; jetzt ist der Hase versorgt. Die Schnecke darf auf dem Zaune sitzen und Moos und Sonnenschein lecken und ist fernerhin als einer der ersten Preisrichter beim Schnelllaufen angestellt. Es ist sehr viel wert, Einen vom Fache mitzuhaben in dem Dinge, was die Menschen ein Comité nennen. Ich muß sagen, ich erwarte viel von der Zukunft, wir haben schon einen recht guten Anfang gemacht!«
EIN HERZELEID

Diese Geschichte besteht eigentlich aus zwei Teilen; der erste Teil könnte zwar wegfallen, – aber er gibt uns einige Vorkenntnisse, und die sind nützlich!
Wir halten uns auf dem Lande, auf einem Herrenhause auf, wo es sich ereignet hatte, daß die Herrschaft auf einige Tage verreist war. Während dessen kam aus dem nächsten Städtchen eine Madame an; sie führte einen Mops bei sich, und kam, wie sie sagte, damit man Aktien auf ihre Gerberei nehmen möge. Sie hatte ihre Papiere mit, und wir rieten ihr, um dieselben ein Couvert zu legen und auf dieses die Adresse des Gutsbesitzers »Herrn Generalkiegskommissarius, Ritter etc.« zu schreiben.
Sie hörte uns aufmerksam zu, ergriff die Feder, hielt wieder inne, und bat uns, wir möchten die Aufschrift wiederholen, aber langsam. Wir taten es und sie schrieb; allein inmitten des »Generalkriegs ...« blieb sie stecken, seufzte tief auf und sagte: »ich bin nur ein Frauenzimmer!« – Ihr »Moppelchen« hatte sich, während sie schrieb, auf den Fußboden gesetzt und knurrte, war doch der Hund auch seines Vergnügens und seiner Gesundheit wegen mitgereist, und dann soll Einem nicht der Fußboden angetragen werden. Stumpfnase und Speckbuckel waren seine äußere Erscheinung.
»Er beißt nicht!« sagte die Dame, »er hat keine Zähne. Er ist gleichsam ein Mitglied der Familie, treu und knurrig, allein dazu haben ihn meine Enkel gereizt; sie spielen Hochzeit, und ihm wollen sie die Rolle der Brautjungfer geben, und das strengt ihn zu sehr an, das alte Fell!«
Und sie gab ihre Papiere ab und nahm das Moppelchen auf den Arm. – Dies ist der erste Teil, – dessen man füglich hätte entbehren können!
»Das Moppelchen starb!« das ist der zweite Teil.
Es war ungefähr eine Woche später; wir kamen in der Stadt an und kehrten im Gasthofe ein. Unsere Fenster führten auf den Hofraum, der durch eine Bretterwand in zwei Teile gesondert war; in deren einen Hälfte hingen Fälle und Häute, rohe und gegerbte. Hier befanden sich alle Materialien einer Gerberei, und dieselbe gehörte der Witwe. – Moppelchen war an diesem Morgen gestorben und in diesem Teile des Hofraumes begraben worden; die Enkel der Witwe, das heißt, die der Gerberwitwe, denn Moppelchen war nie verheirathet, deckten das Grab zu, und es war ein schönes Grab, es mußte ein wahres Vergnügen sein, darin zu liegen.
Das Grab war mit Topfscherben eingezäunt und mit Sand bestreut; ganz oben hatten sie eine halbe Bierflasche hingepflanzt, den Hals derselben nach oben gekehrt, und das war durchaus nicht allegorisch.
Die Kinder tanzten um das Grab herum, und der älteste der Knaben unter ihnen, ein praktischer Junge von sieben Jahren, machte den Vorschlag, daß eine Ausstellung der Moppelchen-Grabstätte stattfinden solle, und zwar für Alle aus dem Gäßchen; der Eintritt solle mit einem Hosenknopfe bezahlt werden, einen solchen besäße jeder Knabe, und jeder könne gleichfalls einen für ein kleines Mädchen hergeben; dieser Vorschlag wurde einstimmig genehmigt.
Alle Kinder aus dem Gäßchen, ja selbst aus dem Hintergäßchen strömten herbei, und jedes gab einen Knopf; gar Viele gingen an diesem Nachmittage nur mit einem Hosenträger umher, aber dafür hatte man das Grab des Moppelchen gesehen, und der Anblick war viel mehr wert.
Doch draußen vor dem Gerberhofe, dicht neben dem Eingange, stand ein kleines in Lumpen gekleidetes Mädchen, gar schön von Gestalt, mit gelocktem Haar und mit Augen, blau und klar, daß es eine Lust war; es sprach kein Wort, es weinte auch nicht, aber jedesmal, wenn das Pförtchen sich öffnete, warf es einen langen, langen Blick in den Hof. Es hatte keinen Knopf, das wußte es wohl, und deshalb blieb es traurig draußen stehen, bis alle die Anderen das Grab gesehen und sich wieder entfernt hatten; als dann setzte es sich nieder, hielt die kleinen braunen Hände vor die Augen und brach in Tränen aus; das Mädchen allein hatte Moppelchens Grab nicht gesehen. Es war ein Herzeleid, so groß wie ein Erwachsener es nur empfinden kann.
Wir sahen dies von oben – und von oben gesehen – dieses, wie manches eigene und Anderer Leute Herzeleid, ja, dann können wir darüber lächeln! – Das ist die Geschichte, und Derjenige, der sie nicht versteht, mag sich eine Aktie in der Gerberei bei der Witwe kaufen.
DIE NACHBARFAMILIEN
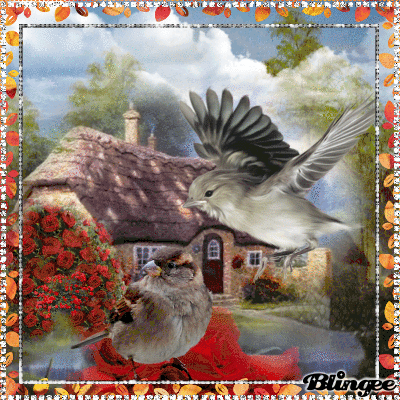
Man konnte wirklich glauben, daß im Dorfteiche irgendetwas im Werke sei; aber es war gar nichts los. Alle Enten, ob sie geruhsam auf dem Wasser lagen oder auf dem Kopfe standen, denn das konnten sie, ruderten plötzlich ans Land; man konnte in dem feuchten Boden die Spuren ihrer Füße sehen, und ein gutes Stück weit hören, was sie schrien. Das Wasser kam ordentlich in Bewegung, und eben war es doch noch blank wie ein Spiegel gewesen, so daß man jeden Baum, jeden Busch in seiner Nähe und das alte Bauernhaus mit den Löchern im Giebel und dem Schwalbennest daran sehen konnte, besonders aber den großen Rosenbusch mit allen seinen Blüten, der über die Mauer bis fast ins Wasser hinabhing. Und darin stand das Ganze wie ein Gemälde, aber alles auf dem Kopfe. Doch als jetzt das Wasser in Unruhe geriet, lief alles ineinander, und das ganze Bild verschwand.
Zwei Entenfedern, die den Enten beim Fliegen ausgefallen waren, schaukelten auf und nieder. Mit einem Male fingen sie an, fortzutreiben, als ob der Wind übers Wasser bliese, aber es war gar kein Wind. Dann lagen sie stille, das Wasser wurde wieder spiegelglatt, und man konnte deutlich darin den Giebel mit dem Schwalbennest und den Rosenstrauch wieder sehen. Jede Rose spiegelte sich, sie waren so prächtig und schön, doch sie wußten nichts davon, denn niemand hatte es ihnen gesagt. Die Sonne schien zwischen ihre feinen Blätter hinein, die ganz voller Duft waren, und das war für die Rosen gerade so schön, wie für uns, wenn wir in glückselige Gedanken versunken dasitzen.
"Wie herrlich ist das Leben!" sagte jede Rose, "das einzige, was ich noch wünschen möchte, wäre, daß ich die Sonne küssen dürfte, weil sie so warm und klar ist. Ja, und die Rosen dort unten im Wasser möchte ich auch küssen. Sie gleichen uns so sehr. Ich möchte die süßen, kleinen Vögel dort unten im Neste küssen; über uns sind auch welche, sie stecken die Köpfe heraus und piepen ganz leise und haben noch gar keine Federn, wie ihr Vater und ihre Mutter. Es sind gute Nachbarn, die wir über uns und unter uns haben. O, wie herrlich ist doch das Leben."
Die kleinen Vögel oben und unten – die unten waren ja nur ein Widerspiel im Wasser, – waren Spatzen, und Vater und Mutter waren Spatzen; sie hatten sich in das leere Schwalbennest vom vorigen Jahre gesetzt; dort lagen sie nun und fühlten sich zu Hause.
"Sind das Entenkinder, die dort schwimmen?" fragten die Spatzenjungen, als sie die Entenfedern auf dem Wasser dahintreiben sahen.
"Tut vernünftige Fragen, wenn Ihr fragt" sagte die Mutter. "Seht Ihr nicht, daß es eine Feder ist, lebendiges Kleiderzeug, wie ich es habe und Ihr es auch bekommen werdet? Aber unseres ist feiner. Wenn wir sie nur oben im Neste hätten, denn das wärmt. Ich möchte wohl wissen, was die Enten so erschreckt hat. Es muß etwas aus dem Wasser gewesen sein; denn ich war es gewiß nicht, obwohl ich freilich etwas laut 'Piep' zu Euch gesagt habe. Die dickköpfigen Rosen müßten es eigentlich wissen, aber sie wissen nie etwas; sie sehen nur sich selbst an und riechen. Ich habe diese Nachbarn herzlich über."
"Hört die süßen, kleinen Vögel da oben" sagten die Rosen, "sie wollen jetzt auch anfangen zu singen. – Sie können noch nicht recht, aber es wird schon kommen. – Was muß das für ein Vergnügen sein! Es ist doch ganz hübsch, solche lustige Nachbarn zu haben."
Da kamen zwei Pferde im Galopp daher, sie sollten getränkt werden; ein Bauernjunge saß auf dem einen. Er hatte alle seine Kleider ausgezogen bis auf seinen schwarzen Hut, der war so schön und groß und breit. Der Knabe pfiff, als sei er ein kleiner Vogel, und ritt in den Teich bis an die tiefste Stelle. Als er an dem Rosenstrauch vorbeikam, riß er eine der Rosen ab und steckte sie auf den Hut. So glaubte er recht geputzt zu sein und ritt wieder fort. Die anderen Rosen sahen ihrer Schwester nach und fragten einander: "Wo reiste sie hin?" aber das wußte niemand.
"Ich möchte wohl auch in die Welt hinaus!" sagte die eine zur andern; "aber hier zu Hause in unserem eigenen Grün ist es auch schön. Am Tage scheint die Sonne so warm, und nachts strahlt der Himmel noch schöner! Da können wir durch die vielen kleinen Löcher sehen, die darin sind!"
Es waren die Sterne, die sie für Löcher hielten, denn die Rosen wußten es nicht besser.
"Wir bringen Leben ins Haus" sagte die Spatzenmutter, "und die Schwalben bringen Glück, sagen die Leute. Aber die Nachbarn dort, so ein großer Rosenbusch an der Mauer, setzt nur Feuchtigkeit an. Ich hoffe, er kommt bald fort, dann kann doch Korn dort wachsen. Rosen sind nur da zum ansehen und daran riechen, höchstens noch zum an den Hut stecken. Jedes Jahr, das weiß ich von meiner Mutter, fallen sie ab, die Bauernfrau salzt sie ein, sie bekommen einen französischen Namen, den ich nicht aussprechen kann, und der mich auch nicht kümmert, und dann werden sie aufs Feuer gelegt, wenn es gut riechen soll. Seht, das ist ihr Lebenslauf; sie sind nur für Augen und Nase. Nun wißt Ihr es."
Als es Abend wurde und die Mücken in der warmen Luft tanzten und die Wolken sich rot färbten, kam die Nachtigall und sang den Rosen vor, daß das Schöne in der Welt wie der Sonnenschein sei, und daß es ewig lebe. Aber die Rosen glaubten, daß die Nachtigall von sich selbst singe, und das konnte man ja auch glauben. Es fiel ihnen gar nicht ein, daß ihnen der Gesang gelte; aber sie wurden fröhlich dabei und dachten daran, ob nicht all die kleinen Spatzenjungen auch zu Nachtigallen werden könnten.
"Ich verstand sehr gut, was der Vogel sang" sagten die Spatzenjungen; "es war nur ein Wort dabei, das ich nicht verstand: was ist 'das Schöne'?"
"Das ist gar nichts!" sagte die Spatzenmutter; "das ist nur so ein Ausdruck. Oben auf dem Herrenhofe, wo die Tauben ihr eigenes Haus haben und jeden Tag Erbsen und Korn in den Hof gestreut bekommen, – ich habe mit ihnen gegessen, und dazu werdet Ihr auch noch kommen! Sage mir, mit wem Du umgehst, so werde ich Dir sagen, wer Du bist! – da oben auf dem Herrenhofe haben sie zwei Vögel mit grünem Halse und einer Krone auf dem Kopfe. Ihr Schwanz kann sich ausbreiten, bis er wie ein großes Rad aussieht; das hat so viele Farben, daß einem die Augen weh tun. Pfauen werden sie genannt, und das ist 'das Schöne'. Sie sollten nur ein wenig gerupft werden, dann sähen sie auch nicht anders aus, wie wir anderen. Ich hätte auf sie losgehackt, wenn sie nur nicht so groß wären!"
"Ich will sie hacken!" sagte das kleinste Spatzenjunge; es hatte noch nicht einmal Federn.
Im Bauernhofe wohnten zwei junge Leute; die hatten einander so lieb. Sie waren fleißig und flink, und es war überall hübsch bei ihnen. Am Sonntag morgen ging die junge Frau hinaus, nahm eine ganze Hand voll der schönsten Rosen, setzte sie in ein Wasserglas und stellte sie mitten auf die Kommode.
"Nun kann ich sehen, daß Sonntag ist!" sagte der Mann, küßte seine süße, kleine Frau, und sie setzten sich nieder, lasen einen Psalm, hielten einander bei den Händen, und die Sonne schien in die Fenster hinein auf die frischen Rosen und die jungen Leute.
"Es ist wirklich langweilig, das immer wieder sehen zu müssen!" sagte die Spatzenmutter, die aus dem Neste gerade in die Stube hineinsah; und dann flog sie davon.
Dasselbe tat sie am nächsten Sonntag; denn jeden Sonntag kamen frische Rosen ins Glas, und immer blühte die Rosenhecke gleich schön. Die Spatzenjungen, die nun Federn bekommen hatten, wollten gern mitfliegen; aber die Mutter sagte: "Ihr bleibt hier" und so blieben sie da. – Sie flog, und wie es kam, wußte sie selbst nicht, jedenfalls hing sie plötzlich in einer Vogelschlinge aus Pferdehaaren fest, die ein paar Knaben an einem Zweig festgebunden hatten. Die Pferdehaare zogen sich fest um ihr Bein, ach, so fest, als ob sie es zerschneiden wollten. Das war ein Schmerz und ein Schreck. Die Knaben sprangen flugs hinzu und griffen den Vogel; sie faßten ihn grausam hart an. "Es ist nur ein Spatz" sagten sie; aber fliegen ließen sie ihn doch nicht. Sie nahmen ihn mit nach Hause und jedesmal, wenn er schrie, gaben sie ihm eins auf den Schnabel.
Im Bauernhof stand ein alter Mann, der verstand Seife zu machen für Bart und Hände, Seife in Kugeln und Seife in Stücken. Es war so ein umherwandernder, lustiger Alter, und als er den Spatz sah, mit dem die Knaben daherkamen, und aus dem sie sich gar nichts machten, wie sie sagten, fragte er sie: "Wollen wir ihn schön machen?" Die Spatzenmutter überlief ein Grausen, als er das sagte. Und aus seinem Kasten, worin die herrlichsten Farben lagen, nahm er eine ganze Menge glitzerndes Schaumgold. Die Jungen mußten hineinlaufen und ein Ei herbeischaffen. Von diesem nahm er das Weiße und bestrich damit den ganzen Vogel; sodann klebte er das Schaumgold darauf, und nun war die Spatzenmutter vergoldet. Aber sie dachte nicht an ihren Staat, sie zitterte an allen Gliedern. Und der Seifenmann nahm ein rotes Läppchen, das er vom Futter seiner alten Jacke abriß, schnitt das Läppchen zu einem gezackten Hahnenkamm aus und klebte ihn dem Vogel auf den Kopf.
"Nun sollt Ihr sehen, wie der Goldvogel fliegt!" sagte er und ließ den Sperling los, der in der entsetzlichsten Angst in dem hellen Sonnenschein davonflog. Nein, wie er glitzerte! Alle Spatzen, selbst eine große Krähe, und zwar eine vom vorigen Jahrgang, erschraken bei diesem Anblick; aber sie flogen doch hinterher, denn sie wollten wissen, was das für ein vornehmer Vogel sei.
"Woher? woher?" schrie die Krähe.
"Bleib stehn. Bleib stehn" sagten die Spatzen. Aber sie wollte nicht stehen bleiben. Erfüllt von Angst und Entsetzen flog sie heimwärts. Sie war nahe daran, umzusinken, und noch immer eilten mehr Vögel herbei, kleine und große. Einige flogen dicht heran, um auf sie loszuhacken. "So einer, So einer" schrien sie alle zusammen.
"So einer, So einer" schrien die Jungen, als sie endlich das Nest erreicht hatte. "Das ist bestimmt ein junger Pfau. Da sind alle die Farben, die den Augen wehe tun, wie Mutter sagte: 'Piep. Das ist das Schöne' " und dann hackten sie mit ihren kleinen Schnäbeln, so daß es ihr nicht möglich war, hineinzuschlüpfen. Und sie war so matt vor Angst, daß sie nicht einmal mehr "Piep" sagen konnte, viel weniger: "Ich bin Eure Mutter." Die anderen Vögel hackten nun auf sie los, daß die Federn flogen, und blutig sank die Spatzenmutter in den Rosenstrauch nieder.
"Das arme Tier!" sagten die Rosen. "Komm, wir wollen Dich verbergen! Bette Dein kleines Köpfchen auf uns!"
Die Spatzenmutter breitete noch einmal die Flügel aus, drückte sie dann wieder fest an ihren Leib, und dann war sie gestorben bei der Nachbarfamilie, den frischen, schönen Rosen.
"Piep!" sagten die Spatzenjungen im Neste, "wo mag nur Mutter bleiben, das kann ich gar nicht begreifen! Es sollte doch nicht etwa eine List von ihr sein, daß wir nun selbst für uns sorgen müssen! Das Haus hat sie uns als Erbteil überlassen, aber wer von uns soll es allein besitzen, wenn wir Familie bekommen?"
"Ja, ich kann Euch anderen nicht hier behalten, wenn ich mir erst Frau und Kinder anschaffe!" sagte der Kleinste.
"Ich bekomme wohl mehr Frauen und Kinder als Du!" sagte der zweite.
"Aber ich bin der älteste!," sagte ein dritter. Der Streit entfachte sich immer heftiger zwischen ihnen, sie schlugen mit den Flügeln, hackten mit dem Schnabel, und bums wurde einer nach dem andern aus dem Neste gepufft. Da lagen sie nun mit Wut im Herzen. Den Kopf wendeten sie nach der anderen Seite und blinzelten dabei mit dem einen Auge; das war so ihre Art zu trotzen.
Ein wenig konnten sie schon fliegen; nun übten sie etwas mehr, und zuletzt wurden sie darüber einig, daß sie, um sich erkennen zu können, wenn sie einander in der Welt begegneten, "Piep!" sagen und dreimal mit dem linken Fuße scharren wollten.
Das Junge, das im Neste zurückblieb, machte sich so breit wie es nur konnte; es war ja nun Hauseigentümer. Aber die Freude dauerte nicht lange. – In der Nacht leuchtete ein roter Feuerschein aus den Fenstern, die Flammen schlugen unter dem Dache heraus, und das dürre Stroh loderte empor – das ganze Haus verbrannte und der junge Spatz mit; die jungen Leute aber waren glücklich davongekommenen.
Als die Sonne am nächsten Morgen aufgegangen war, und alles erfrischt wie nach einem sanften Nachtschlaf dastand, war von dem Bauernhause nichts weiter übrig geblieben, als einige schwarze, verkohlte Balken, die sich an den Schornstein lehnten, der nun sein eigener Herr war. Der Boden rauchte noch stark; aber davor stand frisch und blühend der Rosenstrauch und spiegelte jeden Zweig und jede Blüte in dem stillen Wasser.
"Nein, wie hübsch sehen doch die Rosen vor dem abgebrannten Hause dort aus!" rief ein Mann, der vorüberkam. "Das ist ein gar liebliches kleines Bild. Das muß ich haben!" Und der Mann zog ein kleines Buch mit weißen Blättern aus der Tasche und nahm seinen Bleistift zur Hand; denn er war ein Maler. Dann zeichnete er den rauchenden Schutt, die verkohlten Balken an dem einsam ragenden Schornstein, der sich mehr und mehr neigte, und ganz im Vordergrunde den großen, blühenden Rosenstrauch. Der war freilich wunderschön, und er trug ja auch allein die Schuld daran daß das Ganze gezeichnet wurde.
Später am Tage kamen zwei von den Spatzen vorbei, die hier geboren waren. "Wo ist das Haus?" fragten sie, "wo ist das Nest? – Piep, alles ist verbrannt, und unser starker Bruder ist mit verbrannt. Das hat er davon, daß er das Nest behielt. Die Rosen sind gut davongekommen! Sie stehen noch immer mit roten Wangen da. Trauern tun sie also nicht über das Unglück der Nachbarn! Ich spreche nicht mit ihnen, und hier ist es häßlich, das ist meine Meinung!" Dann flogen sie davon.
Spät im Herbste gab es einen herrlichen Sonnentag. Man hätte fast glauben mögen, man sei mitten im Sommer. Im Hofe vor der großen Treppe beim Gutsbesitzer war es trocken und sauber; dort spazierten die Tauben, die schwarzen, die weißen und die bunten, und glänzten im Sonnenschein. Die alte Taubenmutter plusterte sich auf und sagte zu den Jungen: "Steht in Gruppen! Steht in Gruppen!" – denn so nahmen sie sich besser aus.
"Was ist das kleine graue, das zwischen uns herumläuft?" fragte eine alte Taube, deren Augen rot und grün leuchteten, "das kleine Graue, das kleine Graue!"
"Das sind Spatzen, gute Tierchen! Wir haben immer den Ruf gehabt, die frömmsten unter den Vögeln zu sein, deshalb wollen wir ihnen erlauben, mitzupicken! – Sie reden nicht mit und scharren so niedlich mit dem Füßchen."
Ja, sie scharrten, dreimal scharrten sie mit dem linken Bein, aber sie sagten auch "Piep," und da erkannten sie sich; es waren die drei Spatzen aus dem abgebrannten Haus.
"Hier ist ein über die Maßen gutes Futter!" sagten die Spatzen. Und die Tauben gingen umeinander herum, brüsteten sich und gaben innerlich nur etwas auf die eigene Meinung.
"Siehst Du die Kropftaube!" sagte die eine von der anderen. "Siehst Du, wie sie die Erbsen herunterschluckt? Sie bekommt zuviel, sie bekommt die besten Kurr, kurr. Siehst Du, was sie für einen kahlen Kopf bekommt? Sieh nur das alte, boshafte Tier! Knurre, knurre!" Und dann schillerten aller Augen ganz rot vor Bosheit. "Steht in Gruppen! Steht in Gruppen. Das kleine Graue, das kleine Graue! Knurre, knurre!" ging es in einem fort, und so geht es wohl noch in tausend Jahren.
Die Spatzen fraßen gut, und sie hörten gut, ja, sie stellten sich sogar mit in die Gruppen; aber das kleidete sie nicht. Satt waren sie nun, deshalb gingen sie von den Tauben fort und sprachen untereinander ihre Meinung über sie aus. Dann hüpften sie unter dem Gartenzaun hindurch, und da die Tür zum Gartenzimmer offen stand, hüpfte der eine auf die Türschwelle, denn er war übersättigt und deshalb mutig: "Piep!" sagte er, "das wage ich" – "Piep" sagte der andere, "das wage ich auch und noch etwas mehr!" Und so hüpfte er in die Stube. Es waren keine Leute darin, das sah der dritte wohl, und deshalb flog er noch weiter in das Zimmer hinein und sagte: "Ganz oder gar nicht." - "Das ist übrigens ein merkwürdiges Menschennest. Und was hier aufgestellt ist. Nein, was ist das nur?"
Gerade vor den Spatzen blühten ja die Rosen. Sie spiegelt sich dort im Wasser, und die verkohlten Balken lehnten sich gegen den hinfälligen Schornstein! – Nein, was war dies nur? Wie kam dies in die Stube des Gutsherrn?
Und alle drei Spatzen wollten über die Rosen und den Schornstein hinfliegen, aber sie flogen gegen eine flache Wand; das Ganze war ein Gemälde, ein großes, prächtiges Werk, das der Maler nach seiner kleinen Zeichnung angefertigt hatte.
"Piep!" sagten die Spatzen, "das ist nichts; es sieht nur so aus. Piep! Das ist das Schöne! Kannst Du das begreifen, ich kann es nicht!" Und dann flogen sie fort, denn es kamen Menschen in das Zimmer.
Nun vergingen Jahr und Tag; die Tauben hatten viele Male gekurrt, um nicht zu sagen geknurrt, die boshaften Tiere! Die Spatzen hatten im Winter gefroren und im Sommer lustig darauf los gelebt. Sie waren allesamt verlobt oder verheiratet oder wie man es sonst nennen will. Junge hatten sie auch, und ein jeder hatte natürlich die schönsten und klügsten. Einer flog hier hin, einer flog dort hin, und trafen sie sich, so erkannten sie sich an ihrem "Piep" und dem dreimaligen Scharren mit dem linken Fuße. Die älteste war nun schon eine alte Jungfer; sie hatte kein Nest und auch keine Jungen. Sie wollte gern einmal eine große Stadt sehen, und so flog sie nach Kopenhagen. –
Dort war ein großes Haus mit vielen Farben. Es stand dicht beim Schloß an dem Kanal, wo die Schiffe mit Äpfeln und Töpfen an den Ufern lagen. Die Fenster waren unten breiter als oben, und guckten die Spatzen hinein, so war jedes Zimmer, in das sie hinein sahen, wie eine Tulpe mit allen möglichen Farben und Schnörkeln geschmückt, und mitten in diesen Tulpen standen weiße Menschen. Die waren von Marmor; einige waren auch von Gips, aber für Spatzenaugen war das gleich. Oben auf dem Hause stand ein metallener Wagen mit metallenen Pferden davor, und die Siegesgöttin, ebenfalls aus Metall, lenkte sie. Das war das Thorwaldsen Museum.
"Wie das glänzt, Wie das glänzt" sagte das Spatzenfräulein; "das wird wohl das Schöne sein, Piep. Dies hier ist doch größer als ein Pfau." Sie erinnerte sich noch aus ihrer Kindheit, daß dieser das größte "Schöne" sei, was ihre Mutter gekannt hatte. Und sie flog in den Hof hinab. Dort war es auch prächtig. Palmen und Zweige waren auf die Wände gemalt, und mitten im Hofe stand ein großer blühender Rosenstrauch. Der breitete seine frischen Zweige mit den vielen Rosen über ein Grab. Sie flog dorthin, denn es gingen noch mehrere Spatzen dort auf und ab. "Piep" und dazu ein dreimaliges Scharren mit dem linken Fuß – diesen Gruß hatte sie Jahr und Tag jedem geboten, aber niemand hatte ihn verstanden; denn die sich einmal getrennt haben, treffen sich nicht jeden Tag wieder. Der Gruß war ihr bereits zur Gewohnheit geworden. Heute jedoch waren da zwei alte Spatzen und ein Junger, die sagten auch "Piep" und scharrten mit dem linken Fuße.
"Ei sieh, guten Tag, guten Tag." Es waren die drei Alten aus dem Spatzennest und ein Junger aus der Familie. "Müssen wir uns hier wiedersehen!" sagten sie. "Es ist ein vornehmer Ort hier, aber viel zu fressen findet sich nicht. Das ist das Schöne, Piep."
Viele Leute kamen aus den Seitengängen, wo die prächtigen Marmorfiguren standen, und gingen zu dem Grabe hin, das den großen Meister barg, der den herrlichen Marmorbildern Form gegeben hatte. Alle, die kamen, standen mit leuchtendem Antlitz um Thorwaldsens Grab. Einzelne sammelten die abgefallenen Rosenblätter vom Boden und bewahrten sie auf. Die Leute kamen von weither; sie kamen von dem großen England, von Deutschland und Frankreich. Die schönste Dame nahm eine von den Rosen und barg sie an ihrer Brust. Da glaubten die Spatzen, daß die Rosen hier das Regiment hätten und das ganze Haus um ihretwillen gebaut sei, und das schien ihnen ein bißchen übertrieben zu sein.
Aber da die Menschen alle soviel Wesens von den Rosen machten, wollten sie auch nicht zurückstehen. "Piep" sagten sie und fegten den Boden mit ihren Schwänzen. Dann schielten sie mit einem Auge zu den Rosen hinauf; aber nicht lange dauerte es, so waren sie davon überzeugt, daß es die alten Nachbarn waren. Und das waren sie auch. Der Maler, der den Rosenstrauch bei dem abgebrannten Hause gezeichnet hatte, bekam später, gegen Ende des Jahres, die Erlaubnis ihn auszugraben. Er hatte ihn dann dem Baumeister des Museums gegeben, denn nirgends konnte man herrlichere Rosen finden. Dieser hatte ihn auf Thorwaldsens Grab gesetzt, wo er als Wahrzeichen des Schönen blühte und seine duftenden roten Blätter hergab, um zur Erinnerung in ferne Länder getragen zu werden.
"Habt Ihr eine Anstellung hier in der Stadt erhalten?" fragten die Spatzen. Und die Rosen nickten; sie erkannten die grauen Nachbarn und freuten sich sie wiederzusehen.
"Wie schön ist es zu leben und zu blühen, alte Freunde bei sich zu sehen, und jeden Tag in freundliche Gesichter zu blicken! Hier ist es, als sei jeder Tag ein großer Festtag."
"Piep!" sagten die Spatzen, "ja, das sind die alten Nachbarn. Ihrer Herkunft vom Dorfteiche erinnern wir uns recht wohl! Piep, wie sie zu Ehren gekommen sind! Manche kommen im Schlafe dazu. Denn was an so einem roten Klumpen Schönes sein soll, weiß ich nicht! – Und da sitzt ein vertrocknetes Blatt, das sehe ich ganz genau!"
Dann zupften sie solange daran, bis das Blatt abfiel, und frischer und grüner stand der Strauch, und die Rosen dufteten im Sonnenschein auf Thorwaldsens Grab, an dessen unsterblichen Namen sich ihre Schönheit anschloß.
DIE HIRTIN UND DER SCHORNSTEINFEGER

Hast du wohl je einen recht alten Holzschrank, ganz schwarz vom Alter und mit ausgeschnitzten Schnörkeln und Laubwerk daran, gesehen? Gerade ein solcher stand in einer Wohnstube; er war von der Urgroßmutter geerbt und mit ausgeschnitzten Rosen und Tulpen von oben bis unten bedeckt. Da waren die sonderbarsten Schnörkel, und aus ihnen ragten kleine Hirschköpfe mit Geweihen hervor. Aber mitten auf dem Schranke stand ein ganzer Mann geschnitzt; er war freilich lächerlich anzusehen, und er grinste auch, man konnte es nicht lachen nennen. Er hatte Ziegenbocksbeine, kleine Hörner am Kopfe und einen langen Bart. Die Kinder nannten ihn immer den Ziegenbocksbein-Ober- und Unterkriegsbefehlshaber; das war ein langes Wort, und es gibt nicht viele, die den Titel bekommen.
Da war er nun! Immer sah er nach dem Tische unter dem Spiegel, denn da stand eine liebliche, kleine Hirtin von Porzellan; die Schuhe waren vergoldet, das Kleid mit einer roten Rose niedlich aufgeheftet, und dann hatte sie einen Goldhut und einen Hirtenstab; sie war wunderschön. Dicht neben ihr stand ein kleiner Schornsteinfeger, so schwarz wie Kohle, aber auch aus Porzellan; er war ebenso rein und fein wie irgendein anderer. Der Porzellanfabrikant hätte eben so gut einen Prinzen oder einen König aus ihm machen können, denn das war einerlei.
Da stand er mit seiner Leiter und mit einem Antlitz, so weiß und rot wie ein Mädchen, und das war eigentlich ein Fehler, denn etwas schwarz hätte es doch wohl sein können. Er hatte seinen Platz ganz nahe bei der Hirtin; und da sie nun so hingestellt waren, hatten sie sich verlobt - sie paßten ja zueinander, sie waren von demselben Porzellan und beide gleich zerbrechlich.
Dicht bei ihnen stand noch eine Figur, die war dreimal größer. Es war ein alter Chinese, der nicken konnte. Er war auch aus Porzellan und sagte, er sei der Großvater der kleinen Hirtin, aber das konnte er freilich nicht beweisen; er behauptete, daß er Gewalt über sie habe, und deswegen hatte er dem Ziegenbocksbein-Ober- und Unterkriegsbefehlshaber, der um die kleine Hirtin freite, zugenickt.
"Da erhältst du einen Mann," sagte der alte Chinese, "einen Mann, der, wie ich fast glaube, von Mahagoniholz ist. Der kann dich zur Ziegenbocksbein-Ober- und Unterkriegsbefehlshaberin machen; er hat den ganzen Schrank voll Silberzeug, ungerechnet, was er in den geheimen Fächern hat."
"Ich will nicht in den dunklen Schrank!" sagte die kleine Hirtin. "Ich habe sagen hören, daß er elf Porzellanfrauen darin hat."
"Dann kannst du die zwölfte sein!" sagte der Chinese. "Diese Nacht, sobald es in dem alten Schrank knackt, sollt ihr Hochzeit halten, so wahr ich ein Chinese bin!" Und dann nickte er mit dem Kopf und fiel in Schlaf.
Aber die kleine Hirtin weinte und blickte ihren Herzallerliebsten, den Porzellanschornsteinfeger, an.
"Ich möchte dich bitten," sagte sie, "mit mir in die weite Welt hinauszugehen, denn hier können wir nicht bleiben!"
"Ich will alles, was du willst!" sagte der kleine Schornsteinfeger. "Laß uns gleich gehen; ich denke wohl, daß ich dich mit meinem Handwerk ernähren kann!"
"Wenn wir nur erst glücklich von dem Tische herunter wären!" sagte sie. "Ich werde erst froh, wenn wir in der weiten Welt draußen sind."
Er tröstete sie und zeigte, wie sie ihren kleinen Fuß auf die ausgeschnittenen Ecken und das vergoldete Laubwerk am Tischfuße hinabsetzen sollte; seine Leiter nahm er auch zu Hilfe, und da waren sie auf dem Fußboden. Aber als sie nach dem alten Schranke hinsahen, war große Unruhe darin. Alle die ausgeschnittenen Hirsche steckten die Köpfe weit hervor, erhoben die Geweihe und drehten die Hälse; der Ziegenbocksbein-Ober- und Unterkriegsbefehlshaber sprang in die Höhe und rief zum alten Chinesen hinüber: "Nun laufen sie fort! Nun laufen sie fort!"
Da erschraken sie und sprangen geschwind in den Schubkasten.
Hier lagen drei bis vier Spiele Karten, die nicht vollständig waren, und ein kleines Puppentheater, das, so gut es sich tun ließ, aufgebaut war. Da wurde Komödie gespielt, und alle Damen saßen in der ersten Reihe und fächelten sich mit ihren Tulpen, und hinter ihnen standen alle Buben und zeigten, daß sie Kopf hatten, sowohl oben wie unten, wie die Spielkarten es haben. Die Komödie handelte von zwei Personen, die einander nicht bekommen sollten, und die Hirtin weinte darüber, denn es war gerade wie ihre eigene Geschichte.
"Das kann ich nicht aushalten!" sagte sie. "Ich muß aus dem Schubkasten heraus!" Als sie aber auf dem Fußboden anlangten und nach dem Tische hinaufblickten, da war der alte Chinese erwacht und schüttelte mit dem ganzen Körper; unten war er ja ein Klumpen.
"Nun kommt der alte Chinese!" schrie die kleine Hirtin und fiel auf ihre Knie nieder, so betrübt war sie.
"Es fällt mir etwas ein," sagte der Schornsteinfeger. "Wollen wir in das große Gefäß, das in der Ecke steht, hinab kriechen? Da könnten wir auf Rosen und Lavendel liegen und ihm Salz in die Augen werfen, wenn er kommt."
"Das kann nichts nützen!" sagte sie. "Überdies weiß ich, daß der alte Chinese und das Gefäß miteinander verlobt gewesen sind, und es bleibt immer etwas Wohlwollen zurück, wenn man in solchen Verhältnissen gestanden hat. Nein, es bleibt uns nichts übrig, als in die weite Welt hinauszugehen."
"Hast du wirklich Mut, mit mir in die weite Welt hinauszugehen?" fragte der Schornsteinfeger. "Hast du auch bedacht, wie groß die ist und daß wir nicht mehr an diesen Ort zurückkommen können?"
"Ja," sagte sie.
Der Schornsteinfeger sah sie fest an, und dann sagte er: "Mein Weg geht durch den Schornstein; hast du wirklich Mut, mit mir durch den Ofen, sowohl durch den Kasten als durch die Röhre zu kriechen? Dann kommen wir hinaus in den Schornstein, und da verstehe ich mich zu tummeln. Wir steigen so hoch, daß sie uns nicht erreichen können, und ganz oben geht ein Loch in die weite Welt hinaus."
Und er führte sie zu der Ofentür hin.
"Da sieht es schwarz aus!" sagte sie, aber sie ging doch mutig mit ihm sowohl durch den Kasten als durch die Röhre, wo eine pechfinstere Nacht herrschte.
"Nun sind wir im Schornstein!" sagte er. "Und sieh, sieh, dort oben scheint der herrlichste Stern."
Es war ein Stern am Himmel, der zu ihnen herab schien, gerade als wollte er ihnen den Weg zeigen. Und sie kletterten und krochen; ein gräulicher Weg war es, sehr hoch, aber er hob und hielt sie und zeigte die besten Stellen, wo sie ihre kleinen Porzellanfüße hinsetzen konnte; so erreichten sie den Schornsteinrand, und auf den setzten sie sich, denn sie waren tüchtig ermüdet, und das konnten sie auch wohl sein.
Der Himmel mit all seinen Sternen war oben über ihnen und alle Dächer der Stadt tief unten; sie sahen weit umher, weit hinaus in die Welt; die arme Hirtin hatte es sich nie so gedacht, sie legte sich mit ihrem kleinen Haupte gegen ihren Schornsteinfeger, und dann weinte sie, daß das Gold von ihrem Leibgürtel absprang.
"Das ist allzuviel!" sagte sie. "Das kann ich nicht ertragen, die Welt ist allzu groß! Wäre ich doch wieder auf dem Tische unter dem Spiegel; ich werde nie froh, ehe ich wieder dort bin! Nun bin ich dir in die weite Welt hinaus gefolgt, nun kannst du mich auch wieder zurückbringen, wenn du etwas von mir hältst!"
Der Schornsteinfeger sprach vernünftig mit ihr von dem alten Chinesen und vom Ziegenbocksbein-Ober- und Unterkriegsbefehlshaber, aber sie schluchzte gewaltig und küßte ihren kleinen Schornsteinfeger, daß er nicht anders konnte als sich ihr zu fügen, obgleich es töricht war.
So kletterten sie wieder mit vielen Beschwerden den Schornstein hinunter und krochen durch den Kasten und die Röhre. Das war gar nichts Schönes. Und dann standen sie in dem dunklen Ofen; da horchten sie hinter der Tür, um zu erfahren, wie es in der Stube stehe. Dort war es ganz still; sie sahen hinein - ach, der alte Chinese lag mitten auf dem Fußboden; er war vom Tische heruntergefallen, als er hinter ihnen her wollte, und lag in drei Stücke zerschlagen. Der ganze Rücken war in einem Stücke abgegangen, und der Kopf war in eine Ecke gerollt; der Ziegenbocksbein-Ober- und Unterkriegsbefehlshaber stand, wo er immer gestanden hatte, und dachte nach.
"Das ist gräßlich!" sagte die kleine Hirtin. "Der alte Großvater in Stücke zerschlagen, und wir sind schuld daran! Das werde ich nicht überleben!" Und dann rang sie ihre kleinen Hände.
"Er kann noch gekittet werden!" sagte der Schornsteinfeger. "Er kann sehr gut gekittet werden! Sei nur nicht heftig; wenn sie ihn im Rücken kitten und ihm eine gute Niete im Nacken geben, so wird er so gut wie neu sein und kann uns noch manches Unangenehme sagen."
"Glaubst du?" sagte sie. Und dann krochen sie wieder auf den Tisch hinauf.
"Sieh, soweit kamen wir," sagte der Schornsteinfeger. "Da hätten wir uns alle die Mühe ersparen können."
"Hätten wir nur den alten Großvater wieder gekittet!" sagte die Hirtin. "Wird das sehr teuer sein?"
Und genietet wurde er; die Familie ließ ihn im Rücken kitten, er bekam eine gute Niete am Halse, und er war so gut wie neu, aber nicken konnte er nicht mehr.
"Sie sind wohl hochmütig geworden, seitdem Sie in Stücke geschlagen sind!" fragte der Ziegenbocksbein-Ober- und Unterkriegsbefehlshaber. "Mich dünkt, daß Sie nicht Ursache haben, so wichtig zu tun. Soll ich nun die kleine Hirtin haben, oder soll ich sie nicht haben?"
Der Schornsteinfeger und die kleine Hirtin sahen den alten Chinesen rührend an, sie fürchteten sehr, er möchte nicken; aber er konnte nicht; und das war ihm unbehaglich, einem Fremden zu erzählen, daß er beständig eine Niete im Nacken habe. Und so blieben die Porzellanleute zusammen, und sie segneten des Großvaters Niete und liebten sich, bis sie in Stücke gingen.
DER LETZTE TAG
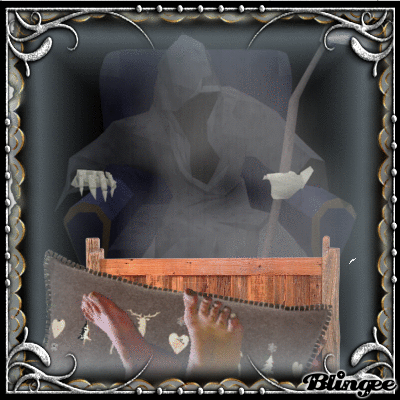
Der heiligste von allen unseren Lebenstagen ist der Tag, an dem wir sterben; das ist der letzte Tag, der heilige, große Tag der Verwandlung. Hast Du schon einmal von rechtem Ernste erfüllt über diese mächtige, und allen gewisse letzte Stunde auf Erden nachgedacht?
Da war einmal ein Mann, ein Strenggläubiger, wie er genannt wurde, ein Streiter für das Wort, das ihm Gesetz war, ein eifernder Diener eines eifernden Gottes. – Nun stand der Tod an seinem Bette. Der Tod mit seinem strengen himmlischen Antlitz.
"Die Stunde ist gekommen, da Du mir folgen sollst!" sagte der Tod; er berührte mit seinen eiskalten Händen seine Füße und sie erstarrten; der Tod berührte seine Stirn, und dann sein Herz, und es brach bei der Berührung und die Seele folgte dem Engel des Todes.
Aber in den wenigen Sekunden vorher, während der Weihe vom Fuße über die Stirn bis zum Herzen, brauste, wie eines Meeres große, schwere Woge, alles, was das Leben gebracht und erweckt hatte, über den Sterbenden dahin. So sieht man mit einem Blick hinab in die schwindelnde Tiefe und erfaßt mit einem blitzartigen Gedanken den unübersehbaren Weg, so sieht man mit einem Blick das zahllose Sternengewimmel, erkennt Körper und Welten im weiten Raume.
In solchem Augenblick schaudert der entsetzte Sünder und hat nichts, auf das er sich stützen könnte, es ist, als sänke er tief in eine unendliche Leere. Aber der Fromme birgt sein Haupt in Gottes Schoß und ergibt sich ihm wie ein Kind: "Dein Wille geschehe mit mir."
Doch dieser Sterbende hatte nicht eines Kindes Sinn; er fühlte, daß er Mann war. Er schauderte nicht wie der Sünder, er wußte, er war ein Rechtgläubiger. Die Gesetze der Religion hatte er in all ihrer Strenge erfüllt. Millionen, wußte er, mußten den breiten Weg der Verdammnis beschreiten; mit Schwert und Feuer hätte er ihren Leib hier zerstören mögen, wie ihre ganze Seele es bereits war und ewig bleiben würde! Sein Weg ging nun gen Himmel, wo ihm die Gnade die Tore öffnen würde, die verheißene Gnade.
Und die Seele ging mit dem Engel des Todes, aber einmal noch blickte sie zurück zu dem Lager, wo ihre irdische Hülle in dem weißen Totenhemd lag. Ein fremder Abdruck ihres Ich´s. – Und sie flogen und sie gingen – es war wie in einer mächtigen Halle und doch wie in einem Walde. Die Natur war beschnitten, gespannt, aufgebunden und in Reihen gestellt, verkünstelt, wie in den alten französischen Gärten; es war eine Maskerade.
"So ist das Menschenleben" sagte der Engel des Todes.
Alle Gestalten waren mehr oder weniger vermummt; es waren nicht immer die edelsten und mächtigsten, die mit Samt und Gold bekleidet waren, und es waren nicht die niedrigsten und geringsten, die in den Armeleutekleidern steckten. – Es war eine wunderliche Maskerade. Ganz besonders seltsam war es zu sehen, wie jeder unter seinen Kleidern sorgfältig etwas vor dem anderen verbarg; aber der eine riß am anderen, bis es zum Vorschein kam, und da sah man den Kopf eines Tieres hervorkommen; bei dem einen war es ein grinsender Affe, bei einem anderen ein häßlicher Ziegenbock, eine feuchte Schlange oder ein matter Fisch.
Es war das Tier, das wir alle in uns tragen, das Tier, das in jedem Menschen mit ihm zugleich wächst, und es hüpfte und sprang und wollte heraus, aber jeder hielt die Kleider fest darüber. Die anderen jedoch zerrten sie beiseite und riefen: "Siehst Du, sieh, das ist sie." Und einer entblößte des anderen Erbärmlichkeit.
"Und welches Tier war in mir?" fragte die wandernde Seele; und der Engel des Todes zeigte auf eine stolze Gestalt vor ihnen, um deren Haupt eine buntschillernde Glorie sich zeigte. Aber am Herzen des Mannes verbargen sich die Füße des Tieres, eines Pfauen Füße; der Glorienschein war nur des Vogels bunter Schweif.
Und als sie weiter wanderten, schrien große Vögel widerlich kreischend von den Zweigen der Bäume; mit deutlich vernehmbaren Menschenstimmen kreischten sie: "Du Wanderer des Todes, denkst Du an mich?" – Das waren alle die bösen Gedanken und Begierden aus den Tagen seines Lebens, die ihm jetzt zuriefen: "Denkst Du an mich?" –
Und die Seele schauderte einen Augenblick, denn sie erkannte die Stimmen, die bösen Gedanken und Begierden, die hier als Zeugen auftraten.
"In unserem Fleisch, in unserer bösen Natur wohnt das Gute nicht" sagte die Seele, "aber die Gedanken wurden bei mir nicht zu Taten, die Welt hat ihre böse Frucht nicht gesehen!" Und sie eilte vorwärts, um dem widerlichen Geschrei zu entgehen, aber die großen schwarzen Vögel umschwebten sie rings im Kreise und schrien und kreischten, als solle es über die ganze Welt gehört werden. Sie sprang wie die gejagte Hindin, und bei jedem Schritt stieß sie mit dem Fuße auf scharfe Feuersteine, die die Füße zerschnitten, daß es schmerzte. "Woher kommen diese scharfen Steine? Wie welkes Laub liegen sie auf der Erde."
"Das ist jedes unvorsichtige Wort, das Du fallen ließest und das Deines Nächsten Herz weit tiefer versehrte, als jetzt die Steine Deinen Fuß."
"Das habe ich nicht bedacht!" sagte die Seele.
"Richtet nicht, auf daß Ihr nicht gerichtet werdet!" erklang es durch die Luft. "Wir haben alle gesündigt!" sagte die Seele und erhob sich wieder. "Ich habe das Gesetz und das Evangelium gehalten, ich habe getan, was ich tun konnte, ich bin nicht wie die anderen."
Und sie standen an der Himmelspforte, und der Engel, der Hüter des Eingangs, fragte: "Wer bist Du? Bekenne mir Deinen Glauben und zeige ihn mir in Deinen Taten!"
"Ich habe alle Gebote streng erfüllt. Ich habe mich vor den Augen der Welt gedemütigt, ich habe das Böse und die Bösen gehaßt und verfolgt, sie, die auf dem breiten Weg zur ewigen Verdammnis schreiten, und das will ich noch jetzt mit Feuer und Schwert, wenn ich die Macht dazu habe."
"Du bist also einer von Mohammeds Bekennern!" sagte der Engel.
"Ich? – Niemals."
"Wer zum Schwerte greifet, soll durch das Schwert umkommen, sagt der Sohn! Seinen Glauben hast Du nicht. Bist Du vielleicht ein Sohn Israels, der mit Moses spricht: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein Sohn Israels, dessen eifernder Gott nur Deines Volkes Gott ist?"
"Ich bin ein Christ!"
"Das erkenne ich weder in Deinem Glauben noch in Deinen Taten. Christi Lehre ist Versöhnung, Liebe und Gnade."
"Gnade!" erklang es durch den unendlichen Raum und die Himmelspforte öffnete sich und die Seele schwebte der offenen Herrlichkeit entgegen.
Aber das Licht, das herausströmte, war so blendend, so durchdringend, daß die Seele zurückwich wie vor einem gezogenen Schwerte. Die Töne erklangen so weich und ergreifend, wie keine irdische Zunge es wiedergeben kann, und die Seele bebte und beugte sich tiefer und immer tiefer; doch die himmlische Klarheit durchdrang sie und sie fühlte und empfand, was sie niemals zuvor gefühlt hatte, die Bürde ihres Hochmutes, ihrer Härte und Sünde. – Es wurde licht in ihr.
"Was ich Gutes tat in der Welt, das tat ich, weil ich nicht anders konnte, aber das Böse – das kam aus mir selbst!"
Und die Seele fühlte sich von dem reinen, himmlischen Lichte geblendet; ohnmächtig versank sie, so schien es ihr, in sich selbst verkrümmt in die Tiefe. Gebeugt, unreif für das Himmelreich und mit den Gedanken bei dem strengen, gerechten Gott, wagte sie nicht hervorzustammeln: "Gnade."
Und nun war die Gnade da, die nicht erwartete Gnade.
Gottes Himmel war überall im unendlichen Raum, Gottes Liebe durchströmte ihn in unerschöpflicher Fülle.
"Werde heilig, herrlich, liebreich und ewig, o Menschenseele!" klang es und sang es. Und alle, alle sollten wir an unseres irdischen Lebens letztem Tage, wie die Seele hier, zurückbeben vor des Himmelreichs Glanz und Herrlichkeit, sollten uns beugen und tief und demütig niedersinken und doch getragen von seiner Liebe, seiner Gnade, aufrecht erhalten werden, schwebend in neuen Bahnen, geläutert, edler und besser, und immer näher des Lichtes Herrlichkeit, bis wir, von ihm gestärkt, Kraft erhalten, um zur ewigen Klarheit empor zu steigen.
DAS KIND IM GRABE
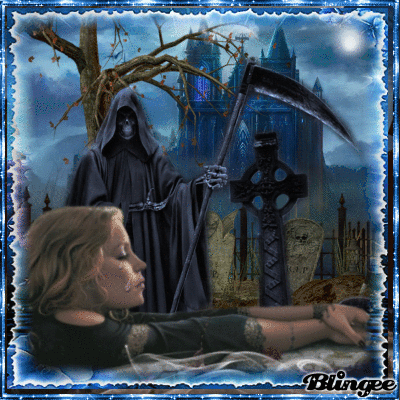
Trauer erfüllte das Haus, Trauer die Herzen; das jüngste Kind, ein Knabe von vier Jahren, die Freude und Hoffnung der Eltern, war gestorben. Es blieben ihnen zwar noch zwei Töchter, von denen die älteste gerade konfirmiert werden sollte, brave, herrliche Mädchen beide, aber das Kind, das man verloren hat, ist doch immer das liebste, und hier war es das jüngste und ein Sohn.
Es war eine schwere Prüfung. Die Schwestern trauerten, wie es junge Herzen tun, und waren namentlich von dem Schmerz der Eltern ergriffen, der Vater war tief gebeugt, die Mutter aber von dem großen Kummer überwältigt. Tag und Nacht war sie um das kranke Kind gewesen, hatte es gepflegt, gehoben, getragen; sie hatte gefühlt, wie es ein Teil ihrer selbst war. Sie konnte es nicht fassen, daß das Kind tot war, daß es in den Sarg gelegt werden und im Grabe ruhen sollte. Gott könne ihr dies Kind nicht nehmen, hatte sie gemeint, und als es doch so geschah und kein Zweifel mehr darüber aufkommen konnte, da sprach sie in ihrem krankhaften Schmerz:
"Gott hat es nicht gewußt; er hat herzlose Diener hier auf Erden, die nach eigenem Gutdünken verfahren, die die Gebete einer Mutter nicht beachten:" Sie ließ in ihrem Schmerz von Gott ab, und siehe, da kamen finstere Gedanken, die Gedanken des Todes, des ewigen Todes herauf, daß der Mensch Erde in der Erde werden und daß damit alles vorbei sei. Bei solchen Gedanken hatte sie aber keinen Halt, nichts, an das sie sich anklammern konnte, und sie versank in das bodenlose Nichts der Verzweiflung.
In den schwersten Stunden konnte sie nicht mehr weinen, sie dachte nicht an die jungen Töchter, die sie noch besaß; die Tränen des Mannes fielen auf ihre Stirn, aber sie blickte ihn nicht an; ihre Gedanken waren bei dem toten Kind, ihr ganzes Sinnen und Trachten war nur darauf gerichtet, jede Erinnerung an den Kleinen, jedes seiner unschuldigen Kindesworte zurückzurufen.
Der Tag der Beerdigung kam heran; Nächte vorher hatte die Mutter nicht geschlafen; in der Morgendämmerung dieses Tages aber schlummerte sie, von Müdigkeit überwältigt, ein wenig ein; unterdessen trug man den Sarg in ein abgelegene Zimmer, und dort wurde er zugenagelt, damit sie den Schlag des Hammers nicht höre.
Als sie erwachte und ihr Kind sehen wollte, sagte der Mann unter Tränen: "Wir haben den Sarg geschlossen; es mußte geschehen."
"Wenn Gott hart gegen mich ist, wie sollten die Menschen dann besser sein?" rief sie unter Schluchzen und Tränen.
Der Sarg wurde zu Grabe getragen; die untröstliche Mutter saß bei ihren jungen Töchtern; sie sah die Töchter an und sah sie doch nicht, ihre Gedanken hatten nunmehr nichts am heimatlichen Herd zu schaffen, sie gab sich dem Kummer hin, und dieser warf sie ruhelos hin und her wie die See ein Schiff ohne Ruder und Führer. So verstrich der Tag des Begräbnisses und ähnliche Tage, voll des dumpfen, lastenden Schmerzes, folgten. Mit feuchten Augen und betrübten Blicken betrachteten die trauernden Töchter und der gebeugte Mann sie, die ihre Trostworte nicht hörte, und was konnten sie ihr auch zum Trost sagen, waren sie doch selber schwer gebeugt.
Es war, als kannte sie den Schlaf nicht mehr, und der allein wäre doch jetzt ihr bester Freund gewesen, hätte den Körper gestärkt, Friede in die Seele gegossen; man überredete sie, das Lager aufzusuchen, und sie lag auch still dort, wie eine Schlafende. Eines Nachts lauschte der Mann, wie so oft, ihrem Atemzug und war überzeugt, daß sie nun Ruhe und Erleichterung gefunden habe; er faltete betend die Hände und schlief bald selber gesund und fest ein, merkte nicht, wie die Frau sich erhob, ihre Kleider über sich warf und still aus dem Hause schlich, um dorthin zu gelangen, wo ihre Gedanken bei Tag und bei Nacht weilten, zu dem Grab, das ihr Kind barg. Sie schritt durch den Garten des Hauses, über die Felder, wo ein Pfad zum Friedhof führte; niemand sah sie auf ihrem Gang, sie hätte auch niemanden erblickt, ihr Auge war starr nur auf das eine Ziel gerichtet.
Es war eine herrliche, sternenklare Nacht; die Luft war noch mild, es war Anfang September. Sie betrat den Kirchhof, sie stand an dem kleinen Grab, das gleíchsam nur ein großer Strauß von duftenden Blumen war. Sie setzte sich hin und beugte ihr Haupt tief über das Grab, als konnte sie durch die feste Erdenschicht hindurch ihr Knäblein schauen, dessen Lächeln ihr doch so lebhaft vorschwebte, dessen liebevoller Ausdruck der Augen, selbst auf dem Krankenlager, ja nimmer zu vergessen war; wie sprechend war sein Blick gewesen, wenn sie sich über ihn beugte und seine zarte Hand ergriff, die er selber nicht mehr erheben konnte. Wie sie an seinem Lager gesessen hatte, so daß sie jetzt an seinem Grabe, nur daß ihre Tränen hier freien Lauf hatten; sie fielen auf das Grab.
"Du möchtest zu deinem Kinde hinab," sprach eine Stimme ganz in ihrer Nähe; sie tönte so klar, so tief, sie klang ihr ins Herz hinein. Sie schaute empor, und neben ihr stand ein Mann, in einem schwarzen Mantel gehüllt, die Kapuze tief über den Kopf gezogen; aber sie blickte hinauf und in sein Gesicht unter der Kapuze hinein, es war streng, aber doch Zutrauen erweckend, seine Augen strahlten mit dem Glanz der Jugend.
"Hinab zu meinem Kinde!" wiederholte sie, und eine Bitte der Verzweiflung sprach aus ihren Worten.
"Getraust du dich, mir zu folgen?" fragte die Gestalt. "Ich bin der Tod."
Und sie senkt bejahend ihr Haupt. Da war es in einem Nu, als leuchteten droben die Sterne alle mit dem Glanz des Vollmondes, sie sah die bunte Farbenpracht der Blumen auf dem Grab, die Erddecke hier gab sanft und allmählich nach wie ein schwebendes Tuch, sie sank, und die Gestalt deckte sie mit dem schwarzen Mantel zu; es ward Nacht, die Nacht des Todes, sie sank tiefer, als der Spaten eindringen kann. Der Kirchhof lag wie ein Dach über ihrem Haupt.
Der Zipfel des Mantels glitt herunter, sie stand in einer mächtigen Halle, die sich groß und freundlich ausdehnte. Dämmerung herrschte ringsum, aber in demselben Augenblick lag ihr Kind eng an ihr Herz geschmiegt, ihr zulächelnd, und zwar in einer Schönheit, wie sie es noch nie zuvor gesehen hatte. Sie stieß einen Schrei aus, doch ward derselbe nicht hörbar, denn ganz nahe und dann wieder weit entfernt und wieder ihr näher tönte eine herrliche, lieblich schwellende Musik; noch nie hatten solche seligstimmenden Töne ihr Ohr erreicht; sie tönten jenseits des nachtschwarzen, dichten Vorhangs, der die Halle von dem großen Land der Ewigkeit trennte.
"Meine süße, meine Herzensmutter," hörte sie ihr Kind sprechen. Es war die bekannte, geliebte Stimme, und Kuß folgte auf Kuß in unendlicher Glückseligkeit; und das Kind deutete auf den dunklen Vorhang. "So schön ist es doch nicht auf Erden! Siehst du, Mutter, siehst du sie alle? Oh, welche Seligkeit!"
Aber die Mutter sah nichts dort, wohin das Kind zeigte, nichts als finstere Nacht; sie sah mit irdischen Augen, sah nicht wie das Kind, welches Gott zu sich gerufen hatte, sie hörte auch nur den Klang der Musik, die Töne, allein sie vernahm das Wort nicht, das Wort, an das sie zu glauben hatte.
"Jetzt kann ich fliegen, Mutter, fliegen mit all den anderen fröhlichen Kindern, ganz dort hinein zu Gott. Ich möchte es so gerne; wenn du aber weinst, wie du jetzt weinst, könnte ich dir verloren gehen, und ich möchte doch so gerne! Nicht wahr, ich darf fliegen? Du wirst ja doch recht bald zu mir dort hineinkommen, liebe Mutter!"
"O bleibe, o bleibe!" sprach die Mutter, "nur noch einen Augenblick, nur noch ein einziges Mal möchte ich dich anschauen, dich küssen, dich in meine Arme drücken." Und sie küßte und herzte das Kind. Da tönte ihr Name von oben her, wie klagend tönte er. Was das doch sein mochte? "Hörst du," sagte das Kind, "der Vater ist es, der dich ruft." Und wiederum, nach wenigen Augenblicken, wurden tiefe Seufzer laut wie von weinenden Kindern. "Es sind meine Schwestern," sagte das Kind, "Mutter, du hast sie doch nicht vergessen?"
Und sie erinnerte sich der Zurückgebliebenen. Angst überkam sie, sie schaute in den Raum hinaus, und immer schwebten Gestalten vorüber. Sie glaubte einige derselben zu erkennen, sie schwebten durch die Halle des Todes auf den dunklen Vorhang zu, dort verschwanden sie. Ob wohl ihr Mann, ihre Töchter auch vorüberschweben würden? Nein, ihr Rufen, ihre Seufzer tönten noch von dort oben her, fast hätte sie sie über den Toten ganz vergessen.
"Mutter, jetzt läuten die Glocken des Himmelreichs," sagte das Kind, "Mutter, jetzt geht die Sonne auf!"
Und ein überwältigendes Licht strömte auf sie ein - das Kind war verschwunden, und sie wurde in die Höhe getragen; es ward kalt rings um sie, sie erhob den Kopf und gewahrte, daß sie auf dem Friedhof lag, auf dem Grabe ihres Kindes. Allein Gott war im Traum eine Stütze für ihren Fuß geworden, ein Licht für ihren Verstand; sie beugte ihr Knie und betete:
"Herr, mein Gott! Vergib mir, daß ich eine ewige Seele von ihrem Flug zurückhalten wollte, daß ich meine Pflichten vergaß gegen die Lebenden, die du mir hier geschenkt hast!"
Und bei diesen Worten war es, als finde ihr Herz Erleichterung. Da brach die Sonne hervor, ein Vöglein sang über ihrem Haupt, und die Kirchenglocken läuteten zum Frühgottesdienst. Alles ward heilig um sie her, geweiht wie in ihrem Herzen. Sie erkannte ihren Gott, sie erkannte ihre Pflichten, und mit Sehnsucht eilte sie nach Hause. Sie beugte sich über ihren noch schlummernden Gatten, ihr warmer, inniger Kuß weckte ihn, und Worte des Herzens und der Innigkeit flossen von beider Lippen; und sie war stark und mild, wie es die Gattin sein kann, von ihr kam der Quell des Trostes: "Das Beste stets ist Gottes Wille." Und der Mann fragte sie: "Woher kam dir auf einmal diese Kraft, dieser tröstenden Sinn?" Und sie küßte ihn und küßte ihre Kinder: "Sie kamen mir von Gott, durch das Kind im Grabe!"
ZWÖLF MIT DER POST
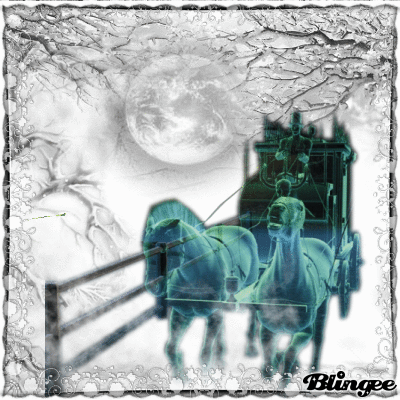
Es war eine schneidende Kälte, sternenheller Himmel, kein Lüftchen regte sich.
'Bums!' Da wurde ein alter Topf an die Haustüre des Nachbars geworfen. 'Puff, paff!' Dort knallte die Büchse; man begrüßte das neue Jahr. Es war Neujahrsnacht! Jetzt schlug die Turmuhr zwölf!
'Trateratra!' Die Post kam angefahren. Der große Postwagen hielt vor dem Stadttore an. Er brachte zwölf Personen mit, alle Plätze waren besetzt.
"Hurra! Hurra! Hoch!" sangen die Leute in den Häusern der Stadt, wo die Neujahrsnacht gefeiert wurde und man sich beim zwölften Schlage mit dem gefüllten Glase erhob, um das neue Jahr leben zu lassen.
"Prost Neujahr!" hieß es, "ein schönes Weib! Viel Geld! Keinen Ärger und Verdruß!"
Das wünschte man sich gegenseitig, und darauf stieß man mit den Gläsern an, daß es klang und sang – und vor dem Stadttore hielt der Postwagen mit den fremden Gästen, den zwölf Reisenden.
Und wer waren diese Fremden? Jeder von ihnen führte seinen Reisepaß und sein Gepäck bei sich; ja, sie brachten sogar Geschenke für mich und dich und alle Menschen des Städtchens mit. Wer waren sie, was wollten sie, und was brachten sie?
"Guten Morgen!" riefen sie der Schildwache am Eingange des Stadttores zu.
"Guten Morgen!" antwortete diese, denn die Uhr hatte ja zwölf geschlagen.
"Ihr Name? Ihr Stand?" fragte die Schildwache den von ihnen, der zuerst aus dem Wagen stieg.
"Sehen Sie selbst im Passe nach," antwortete der Mann. "Ich bin ich!" Und es war auch ein ganzer Kerl, angetan mit Bärenpelz und Pelzstiefeln. "Ich bin der Mann, in den sehr viele Leute ihre Hoffnung setzen. Komm morgen zu mir; ich gebe dir ein Neujahrsgeschenk! Ich werfe Groschen und Taler unter die Leute, ja ich gebe auch Bälle, volle einunddreißig Bälle, mehr Nächte kann ich aber nicht daraufgehen lassen. Meine Schiffe sind eingefroren, aber in meinem Arbeitsraum ist es warm und gemütlich. Ich bin Kaufmann, heiße Januar und führe nur Rechnungen bei mir."
Nun stieg der zweite aus, der war ein Bruder Lustig; er war Schauspieldirektor, Direktor der Maskenbälle und aller Vergnügungen, die man sich nur denken kann. Sein Gepäck bestand aus einer großen Tonne.
"Aus der Tonne," sagte er, "wollen wir zur Fastnachtszeit die Katze herausjagen. Ich werde euch schon Vergnügen bereiten und mir auch; alle Tage lustig! Ich habe nicht gerade lange zu leben; von der ganzen Familie die kürzeste Zeit; ich werde nämlich nur achtundzwanzig Tage alt. Bisweilen schalten sie mir zwar auch noch einen Tag ein – aber das kümmert mich wenig, hurra!"
"Sie dürfen nicht so schreien!" sagte die Schildwache.
"Ei was, freilich darf ich schreien," rief der Mann, "ich bin Prinz Karneval und reise unter dem Namen Februarius."
Jetzt stieg der dritte aus; er sah wie das leibhaftige Fasten aus, aber er trug die Nase hoch, denn er war verwandt mit den 'vierzig Rittern' und war Wetterprophet. Allein das ist kein fettes Amt, und deshalb pries er auch die Fasten. In einem Knopfloche trug er auch ein Sträußchen Veilchen, auch diese waren sehr klein.
"März! März!" rief der vierte ihm nach und schlug ihn auf die Schulter; "riechst du nichts? Geschwind in die Wachstube hinein, dort trinken sie Punsch, deinen Leib- und Labetrunk; ich rieche es schon hier außen. Marsch, Herr Martius!" – Aber es war nicht wahr, der wollte ihn nur den Einfluß seines Namens fühlen lassen, ihn in den April schicken; denn damit begann der vierte seinen Lebenslauf in der Stadt. Er sah überhaupt sehr flott aus; arbeiten tat er nur sehr wenig; desto mehr aber machte er Feiertage. "Wenn es nur etwas beständiger in der Welt wäre," sagte er; "aber bald ist man gut, bald schlecht gelaunt, je nach Verhältnissen; bald Regen, bald Sonnenschein; ein- und ausziehen! Ich bin auch so eine Art Wohnungsvermietunternehmer, ich kann lachen und weinen, je nach Umständen! Im Koffer hier habe ich Sommergarderobe, aber es würde sehr töricht sein, sie anzuziehen. Hier bin ich nun! Sonntags geh' ich in Schuhen und weißseidenen Strümpfen und mit Muff spazieren."
Nach ihm stieg eine Dame aus dem Wagen. Fräulein Mai nannte sie sich. Sie trug einen Sommermantel und Überschuhe, ein lindenblattartiges Kleid, Anemonen im Haare, und dazu duftete sie dermaßen nach Waldmeister, daß die Schildwache niesen mußte. "Zur Gesundheit und Gottes Segen!" sagte sie, das war ihr Gruß. Wie sie niedlich war! Und Sängerin war sie, nicht Theatersängerin, auch nicht Bänkelsängerin, nein, Sängerin des Waldes; – den frischen, grünen Wald durchstreifte sie und sang dort zu ihrem eigenen Vergnügen.
"Jetzt kommt die junge Frau!" riefen die drinnen im Wagen, und aus stieg die junge Frau, fein, stolz und niedlich. Man sah es ihr an, daß sie, Frau Juni, von faulen Siebenschläfern bedient zu werden gewohnt war. Am längsten Tage des Jahres gab sie große Gesellschaft, damit die Gäste Zeit haben möchten, die vielen Gerichte der Tafel zu verzehren. Sie hatte zwar ihren eigenen Wagen; allein sie reiste dennoch mit der Post wie die andern, weil sie zeigen wollte, daß sie nicht hochmütig sei. Aber ohne Begleitung war sie nicht; ihr jüngerer Bruder Julius war bei ihr.
Er war ein wohlgenährter Bursche, sommerlich angekleidet und mit Panamahut. Er führte nur wenig Gepäck bei sich, weil dies bei großer Hitze zu beschwerlich sei; deshalb hatte er sich nur mit einer Schwimmhose versehen, und dies ist nicht viel.
Darauf kam die Mutter selbst, Madame August, Obsthändlerin en gros, Besitzerin einer Menge Fischteiche, sie war dick und heiß, faßte selbst überall an, trug eigenhändig den Arbeitern Bier auf das Feld hinaus. "Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen!" sagte sie, "das steht in der Bibel. Hinterdrein kommen die Spazierfahrten, Tanz und Spiel und die Erntefeste!" Sie war eine tüchtige Hausfrau.
Nach ihr stieg wieder ein Mann aus der Kutsche, ein Maler, Herr Koloriermeister September; der mußte den Wald bekommen; die Blätter mußten Farbe wechseln, aber wie schön; wenn er es wollte, schillerte der Wald bald in Rot, Gelb oder Braun. Der Meister pfiff wie der schwarze Star, war ein flinker Arbeiter und wand die blaugrüne Hopfenranke um seinen Bierkrug. Das putzte den Krug, und für Ausputz hatte er gerade Sinn. Da stand er nun mit seinem Farbentopfe, der war sein ganzes Gepäck!
Ihm folgte der Gutsbesitzer, der an den Saatmonat, an das Pflügen und Beackern des Bodens, auch an die Jagdvergnügungen dachte; Herr Oktober führte Hund und Büchse mit sich, hatte Nüsse in seiner Jagdtasche – 'knick, knack!' Er hatte viel Reisegut bei sich, sogar einen englischen Pflug; er sprach von der Landwirtschaft; aber vor lauter Husten und Stöhnen seines Nachbars vernahm man nicht viel davon. –
Der November war es, der so hustete, während er ausstieg. Er war sehr mit Schnupfen behaftet; er putzte sich fortwährend die Nase, und doch, sagte er, müsse er die Dienstmädchen begleiten und sie in ihre neuen Winterdienste einführen; die Erkältung, meinte er, verliere sich schon wieder, wenn er ans Holzmachen ginge, und Holz müsse er sägen und spalten; denn er sei Sägemeister der Holzmacherinnung.
Endlich kam der letzte Reisende zum Vorschein, das alte Mütterchen Dezember mit der Feuerkiepe; die Alte fror, aber ihre Augen strahlten wie zwei helle Sterne. Sie trug einen Blumentopf auf dem Arme, in dem ein kleiner Tannenbaum eingepflanzt war. "Den Baum will ich hegen und pflegen, damit er gedeihe und groß werde bis zum Weihnachtsabend, vom Fußboden bis an die Decke reiche und emporschieße mit flammenden Lichtern, goldenen Äpfeln und ausgeschnittenen Figürchen. Die Feuerkiepe wärmt wie ein Ofen; ich hole das Märchenbuch aus der Tasche und lese laut aus ihm vor, daß alle Kinder im Zimmer still, die Figürchen an dem Baume aber lebendig werden und der kleine Engel von Wachs auf der äußersten Spitze die Flittergoldflügel ausbreitet, herabfliegt vom grünen Sitze und klein und groß im Zimmer küßt, ja, auch die armen Kinder küßt, die draußen auf dem Flure und auf der Straße stehen und das Weihnachtslied von dem Bethlehemsgestirne singen."
"So! Jetzt kann die Kutsche abfahren," sagte die Schildwache, "wir haben sie alle zwölf. Der Beiwagen mag vorfahren!"
"Laß doch erst die zwölf zu mir herein!" sprach der Wachhabende, "einen nach dem andern! Die Pässe behalte ich hier; sie gelten jeder einen Monat; wenn der verstrichen ist, werde ich das Verhalten auf dem Passe bescheinigen. Herr Januar, belieben Sie näher zu treten."
Und Herr Januar trat näher.
Wenn ein Jahr verstrichen ist, werde ich dir sagen, was die zwölf uns allen gebracht haben. Jetzt weiß ich es noch nicht, und sie wissen es wohl selbst nicht – denn es ist eine seltsam unruhige Zeit, in der wir leben.
ODENWÄLDER LÜGENMÄRCHEN
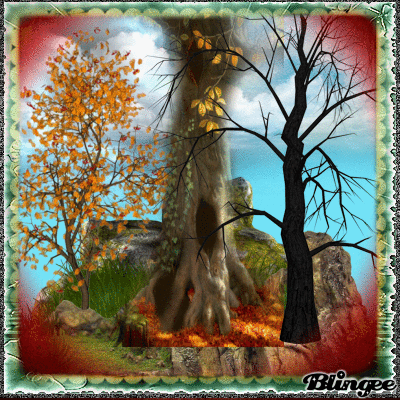
Mein Gickel, mein Hahn, das Märchen fängt an.
Geh ich einen hohen Berg hinauf, stehen drei stolze Eichbäume drauf;
der erste hat keinen Wipfel,
der andre hat keinen Ast,
der dritte hat keine Wurzel.
Nun weiß ich nicht, auf welchen ich steigen soll;
steig ich auf den der keinen Ast hat.
Wie ich hinauf komm, seh ich ein kleines Löchelein,
da schlupf ich hinein;
steht ein Ständer mit Buttermilch drein
mit Heu und Haberstroh eingebrockt.
Jetzt weiß ich nicht, womit ich essen soll.
Da erwisch ich eine Heugabel und esse mich so satt und so dick, daß ich nicht weiß, wie ich wieder 'rauskommen soll.
Schick ich in meines Herren Haus,
laß mir ein Beil holen und hau das Löchlein größer.
Da fällt das Beil und als ich komm herunter, ist der Helm verschwunden.
Da hab ich den Stiel verkauft und mir Steckbohnen dafür gekauft.
Die Bohnen hab ich gesteckt und mich dazugelegt.
Als ich erwachte, war der Bohnenstock so groß, daß ich nicht darüber hinwegsehen konnte.
Schick ich in meines Herren Haus und laß mir eine Leiter holen.
Steig ich hinauf,
steht ein papiernes Kirchlein drauf.
Geh ich hinein,
ist ein hölzerner Pfarrer drein
und ein hainbuchenes Schulmeisterlein.
Ruft der Pfarrer: Heut ist Fest!
Der Schulmeister: Halt ihn fest.
Spring ich zur Tür, stoß meine Ferse dran,
daß meine Zehen fangen zu bluten an.
Wie ich herunter kumm,
schlagen sich die Bettelbuben mit den Bettelsäcken herum;
weiß ich nicht, womit ich mich herumschlagen soll.
Zieh ich meine Schuh und Strümpf aus
und schlag mich auch mit herum.
Wie ich meine Schuh und Strümpf verschlagen hab,
weiß ich nicht was ich anfangen soll;
schau ich auf das papierne Kirchlein,
sitzt ein kleines Vöglein drauf,
werf ich einen Stein hinauf,
fällt ein Centner Federn und ein Pfund Fleisch herunter.
Hab ich meinen Centner Federn und mein Pfund Fleisch verkauft
und mir neue Strümpf und Schuh gekauft,
da kam die Katz mit der Maus,
mein Märchen ist aus.
TURMWÄCHTER OLE
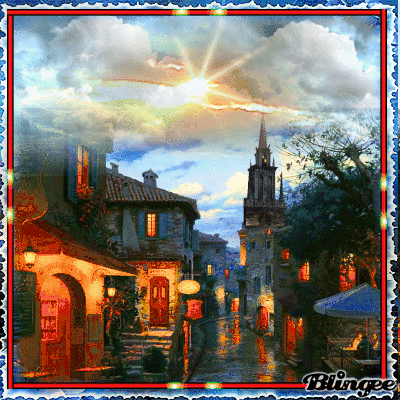
In der Welt geht es immer hinauf und hinunter und hinunter und hinauf! – "Jetzt kann ich nicht höher hinauf!" sagte der Turmwächter Ole, "Hinauf und hinunter müssen die meisten Leute erleben; im Grunde genommen werden wir alle zuletzt Turmwächter, schauen das Leben und die Dinge von oben an." So sprach Ole, mein Freund, der alte Wächter, ein kurioser, gesprächiger Kauz, der alles zu sagen schien und der doch gar vieles in seinem ersten Sinn tief im Herzen verbarg. Ja, er war guter Leute Kind, es gab welche, die da sagten, er sei der Sohn eines Geheimrates oder hätte es sein können; studiert hatte er, war Hilfslehrer, Hilfsküster gewesen, wozu nützte ihm das Alles! Damals wohnte er bei dem Küster, sollte dort alles im Hause haben, freien Unterhalt, wie man sagt, und war noch, wie es heißt, ein junger, feiner Herr. Er wollte seine Stiefel mit Glanzwichse geputzt haben, aber der Küster wollte nur Schmiere hergeben und darüber wurden sie uneins; der eine sprach von Geiz, der andere von Eitelkeit, die Wichse ward der schwarze Grund ihrer Feindschaft, und endlich trennten sie sich.
Was er vom Küster forderte, das forderte er von der Welt überhaupt: Glanzwichse, und er bekam stets nur Schmiere; deshalb zog er sich endlich von allen Menschen zurück und wurde ein Eremit; aber Eremitentum, Amt und Brot zugleich inmitten einer großen Stadt gibt es nur oben im Kirchturm. Dort stieg er denn auch hinauf und schmauchte seine Pfeife während seines einsamen Turmganges; er blickte hinab und hinauf, dachte nach dabei und erzählte in seiner Art und Weise von dem, was er sah und was er nicht sah, was er in Büchern und in sich selber las. Ich lieh ihm oft Bücher, gute Bücher, und an dem Umgang mit ihnen erkennt man den Mann. Er liebe weder die englischen Gouvernanten-Romane noch die französischen, die ein Gebräu aus Zugwind und Rosinenstengel seien, sagte er, nein, er wolle Lebensbeschreibungen, Bücher von den Wundern der Erde haben. Ich besuchte ihn mindestens einmal im Jahre, gewöhnlich gleich nach Neujahr, er sprach dann immer von diesem und jenem, das ihm beim Jahreswechsel in den Sinn gekommen war.
Ich will von drei Besuchen erzählen und werde seine eigenen Worte wiedergeben, wenn ich es vermag.
Erster Besuch
Unter den Büchern, die ich letzthin Ole geliehen hatte, war eins, welches ihn namentlich erfreute und erfüllte, nämlich ein Buch von den Gesteinen.
"Ja, das sind wahrhaftige Jubelgreise, diese Gesteine!" sagte er, "und an ihnen geht man gedankenlos vorüber! Ich selber habe es getan auf dem Feld und am Strand, wo sie in Mengen liegen. Und über das Straßenpflaster, die Pflastersteine, diese Brocken der allerältesten Überreste des Altertums, schreitet man auch so ohne weiteres dahin! Auch dies habe ich getan. Jetzt aber zolle ich jedem Pflasterstein meine Hochachtung. Schönsten Dank für das Buch, es hat mich mit Gedanken erfüllt und alte Ansichten und Gewohnheiten zum Weichen gebracht, hat mich erpicht gemacht, mehr von der Art zu lesen. Der Roman der Erde ist doch der ehrwürdigste aller Romane! Schade nur, daß man die ersten Teile nicht lesen kann, weil sie in einer Sprache abgefaßt sind, die wir nicht gelernt haben; man muß in den Erdschichten, in den Kieselsteinen, in allen Erdperioden lesen, und die handelnden Personen, Herr Adam und Frau Eva, treten erst in dem sechsten Teil auf; das ist dann vielen Lesern zu spät, sie möchten sie gleich im ersten Teil haben – mir ist das auch so recht. Ja, das ist ein Roman, ein höchst abenteuerlicher Roman, und wir alle kommen in ihm vor. Wir kribbeln und krabbeln umher und bleiben doch an demselben Ort, aber die Kugel dreht sich, ohne daß das Weltmeer über uns ausgegossen wird; die Scholle, auf der wir uns bewegen, hält schon, wir fallen nicht durch; und dann ist es eine Geschichte, die sich durch Millionen von Jahren hindurchzieht und die ewig weitergeht. Besten Dank für das Buch von den Gesteinen, das sind Kerle! Die könnten was erzählen, wenn sie es überhaupt könnten! Es ist so recht ein Vergnügen, einmal dann und wann ein Nichts zu werden, und vollends, wenn man so hoch sitzt wie ich, und dann zu denken, daß wir alle, selbst mit Glanzwichse, weiter nichts sind als Minutenameisen auf dem Erdenhaufen, wenn wir auch Ameisen mit Ordensbändern sind, Ameisen, die gehen und sitzen können! Es wird einem ganz grünschnabelig zumute neben diesen millionenjahralten, ehrwürdigen Gesteinen. Ich las am Neujahrsabend in dem Buch und hatte mich dermaßen darin vertieft, daß ich mein gewöhnliches Neujahrsvergrünen vergaß, nämlich 'Die wilde Jagd nach Amack', die kennen Sie sicher nicht!
Der Ritt der Hexen auf dem Besenstiel ist bekannt genug, der geht in der ersten Mainacht zum Brocken, aber wir haben auch eine wilde Jagd, die ist einheimisch und neuzeitig, die geht nach Amack in der Neujahrsnacht.
Alle schlechten Poeten, Poetinnen, Musikanten, Zeitungsschreiber und künstlerischen Notlabilitäten, die, welche nichts taugen, reiten in der Neujahrsnacht durch die Luft nach Amack hinaus; sie sitzen rittlings auf ihren Pferden oder Federkielen, Stahlfedern tragen sie nicht, die sind zu steif. Ich sehe das, wie gesagt, in jeder Neujahrsnacht, die Mehrzahl von den Reitern könnte ich beim Namen nennen, aber ich möchte doch nicht ihre Feindschaft auf mich laden, sie lieben es nicht, daß die Leute von ihrer Amackfahrt auf Federkielen etwas erfahren. Ich habe eine Art Nichte, die Fischweib ist und, wie sie sagt, drei geachteten Zeitungsblättern die Schmäh- und Schimpfwörter liefert; sie ist selber dort auf Amack als geladener Gast gewesen, sie wurde hinausgetragen, sie selber hält keinen Federkiel und kann nicht reiten. Die hat es erzählt. Die Hälfte von dem, was sie sagt, ist Lüge, aber die andere Hälfte unterrichtet uns zur Genüge. Als sie draußen war, begannen sie die Festlichkeiten mit Gesang, jeder der Gäste hatte sein Lied geschrieben, und jeder sang auch sein eigen Lied, denn das Lied war das beste, alles war eins, alles die selbe Melodie. Darauf marschierten in kleinen Kameradschaften diejenigen auf, die nur mit dem Maulwerk tätig sind, als da sind die Glockenspiele, die wechselweise singen; darauf kamen die kleinen Trommelschläger, die in den Familienkreisen austrommeln. Bekanntschaft wurde mit denjenigen gemacht, die da schreiben, ohne daß sie ihren Namen dazu hergeben, das heißt hier so viel wie diejenigen, die Schmiere anstatt der Glanzwichse gebrauchen; da war der Büttel und sein Bursche, und der Bursche war der Schlimmste, denn sonst beachtet man ihn nicht; da war auch der gute Straßenkehrer mit seinem Karren, der den Kehrichtkübel umstülpt und ihn 'gut', 'Sehr gut', 'ausgezeichnet' nennt. Und in all dem Vergnügen, das schon die Zusammenkunft gewähren mochte, schloß aus der großen Aasgrube auf Amack ein Stengel, ein Baum, eine ungeheure Blüte, ein großer Erdpilz, ein ganzes Dach hervor, das war die Schlaraffenschlange der geehrten Versammlung, an der alles hing, was sie während des alten Jahres der Welt geschenkt hatte; aus dem Baum sprühten Funken wie Feuerflammen, das waren all die von andern entliehenen Gedanken und Ideen, die sie benutzt hatten und die nun sich lösten und dahinfuhren, ein ganzes Feuerwerk. Man spielte 'der Prügel brennt', und die kleinen Poeten spielten 'das Herz brennt'; die Witzigen witzelten, und die Witze rollten donnernd dahin, als schlüge man leere Töpfe an den Türen entzwei. Es war höchst vergnüglich, sagte meine Nichte; eigentlich sagte sie noch vieles, was aber sehr maliziös, aber auch sehr amüsant war – ich sage es nicht wieder, man soll ein guter Mensch und kein Räsoneur sein. Sie werden indes wohl einsehen, daß wenn man wie ich einmal Bescheid über das Fest draußen auf Amack weiß, es natürlich ist, daß man jede Neujahrsnacht aufpaßt, damit man die wilde Jagd dahinfahren sieht; vermisse ich in einem Jahr einzelne, die früher dabei waren, so sind wiederum neue hinzugekommen, aber dieses Jahr versäumte ich es, mir die Gästen anzusehen, ich rollte davon auf den Gesteinen, rollte dahin durch Millionen von Jahren und sah die Steine sich losreißen hoch oben im Norden, sah sie auf den Eisschollen umhertreiben, lange bevor die Arche Noah gezimmert ward, sah sie auf dem Meeresgrund hinabsinken und wieder auftauchen mit einer Sandbank, die aus den Gewässern emporragte und sagte: 'Dies soll Seeland sein!' Ich sah sie die Heimat von Vögeln werden, die wir nicht kennen, bis endlich die Axt ihre Runenzeichen in ein paar von den Steinen hieb, die alsdann in die Zeitrechnung hineingerieten, aber ich war dabei aus aller Zeitrechnung herausgeraten und ganz und gar zu null und nichts geworden. Da fielen drei, vier herrliche Sternschnuppen, die klärten wieder auf, gaben den Gedanken einen anderen Schwung: Sie wissen doch, was eine Sternschnuppe ist? Die Gelehrten wissen das sonst nicht! Ich habe nun so meine eigenen Gedanken vom Sternschuß, wie der gemeine Mann die Sternschnuppen in vielen Gegenden nennt, und ich gehe von folgendem aus: wie oft wird nicht im geheimen Dank und Segen jedwedem gespendet, der etwas Schönes und Gutes ausgerichtet hat, öfter ist der Dank lautlos, aber er geht nicht verloren! Ich denke mir, er wird vom Sonnenschein aufgefangen, und der Sonnenstrahl bringt den stillempfundenen, verborgenen Dank über das Haupt des Wohltäters; ist es ein ganzes Volk, welches durch die Zeiten seinen Dank sendet, ja, dann erscheint der Dank als ein Blumenstrauß, fällt als eine Sternschnuppe auf das Grab des Wohltäters herab. Mir ist es in der Tat ein großes Vergnügen, wenn ich eine Sternschnuppe, namentlich in der Neujahrsnacht, erblicke und dann herausfinden, wem wohl der Dankesstrauß gelten mag. Letzthin fiel eine leuchtende Sternschnuppe im Südwest: ein Danksagen an viele, viele! Wem mochte die Sternschnuppe wohl gelten? Die fiel gewiß, dachte ich, auf den Abhang an dem Flensburger Meerbusen, wo der Danebrog über die Gräber Schleppergrells, Lässoes und deren Kameraden weht. Eine fiel auch mitten ins Land hinein, fiel auf Sorö herab, ein Strauß auf Holbergs Ruhestätte, eine Danksagung des Jahres von gar vielen, Dank für die herrlichen Komödien!
Es ist ein großer, ein freudiger Gedanke, zu wissen, daß eine Sternschnuppe auf unser Grab herabfällt; auf das meinige fällt nun freilich keine, kein Sonnenstrahl bringt mir eine Danksagung, denn hier ist nichts des Dankes wert! Ich bringe es nicht zu Glanzwichse," sagte Ole, "mein Los auf Erden ist nun einmal Schmiere."
Zweiter Besuch
Es war am Neujahrstag, ich stieg auf den Turm. Ole sprach von den Trinksprüchen, die beim Übergang vom alten ins neue Jahr, von der einen Traufe in die Andere, wie er sagte, ausgebracht werden. Und so gab er mir seine Geschichte von den Gläsern zum besten, und die hatte einen tiefen Sinn.
"Wenn in der Neujahrsnacht die Uhr zwölf schlägt, erheben sich die Leute an der Tafel, das volle Glas in der Hand, und leeren es und bringen dem neuen Jahr ein Hoch. Man beginnt das Jahr mit dem Glas in der Hand, das ist ein guter Anfang für Säufer! Man beginnt das Jahr damit, daß man sich zu Bett legt, das ist ein guter Anfang für Faule! Der Schlaf wird im Verlaufe des Jahres schon eine große Rolle spielen, das Glas desgleichen. Wissen Sie wohl, was in den Gläsern wohnt?" fragte Ole. "Ja, es wohnen im Glase Gesundheit, Freude und der maßloseste Sinnenrausch, es wohnen Verdruß und das herbste Unglück im Glase. Zählen wir einmal die Gläser, ich spreche natürlich von der unterschiedlichen Bedeutung der einzelnen für die verschiedenen Menschen.
Siehst du, das erste Glas, das ist das Glas der Gesundheit, in dem wächst das Kraut der Gesundheit; stelle es auf den Balken an der Decke, und am Ende des Jahres kannst du dann in der Laubhütte der Gesundheit sitzen.
Nimmst du das zweite Glas – ja, aus dem schwingt sich ein kleiner Vogel empor, der zwitschert unschuldig fröhlich, so daß der Mensch seinem Gezwitscher lauscht und vielleicht mit einstimmt: schön ist das Leben! Keine Kopfhängerei! Frischen Mut, freudig vorwärts!
Aus dem dritten Glas erhebt sich ein kleines geflügeltes Kerlchen ein Engelskind darf es freilich nicht genannt werden, denn das Blut eines Kobolds steckt in seinen Adern, und es hat auch das Gemüt eines Kobolds, nicht um dich zu ärgern und dir Verdruß zu bereiten, sondern nur zum Schabernack. Es setzt sich hinter dein Ohr und flüstert dir lustige Einfälle zu, es legt sich in deine Herzgrube und erwärmt dich, daß du recht ausgelassen, der 'gute Kopf' wirst, wie das Urteilsvermögen der anderen Köpfe es nennt.
In dem vierten Glas ist weder Kraut, Vogel noch Kerlchen, in dem Glas ist der Gedankenstrich für den Verstand, und über den Strich darf man nie hinaus!
Nimm das fünfte Glas, und du wirst über dich selber weinen, du wirst so recht innig-vergnüglich gerührt werden, oder es knallt in anderer Weise; aus dem Glas springt mit einem Knall Prinz Karneval, neunfach und über die Maßen lustig; er zieht dich mit sich fort, du vergißt deine Würde, wenn du eine hast, du vergißt mehr, als du vergessen sollst und darfst. Alles ist Tanz, Sang und Klang; die Masken reißen dich mit sich fort. Des Teufels Töchter, in Schleier und Seide, kommen, herzen mit aufgelöstem Haar und wunderherrlichen Gliedern – reiße dich los, wenn du es vermagst!
Das sechste Glas – ja, in dem sitzt der Satan selber, ein kleiner, wohlgekleideter, einnehmender, höchst angenehmer Mann, der dich durch und durch begreift, dir Recht in allem gibt, dein ganze zweites Ich ist! Er hat eine Laterne bei sich, um dir zu leichten, wenn er dich nach Hause begleitet. Es gibt eine alte Legende, die vom Heiligen, der eine von den sieben Todsünden wählen sollte und, wie ihm schien, die geringste, die Trunksucht, wählte, in dieser aber alle noch übrigen sechs Sünden beging. Der Mensch und der Teufel vermischten ihr Blut, es ist das sechste Glas, und mit dem treiben alle bösen Keime in unserm Innern – ein jeder erhebt sich mit einer Kraft wie das biblische Senfkorn, wird zum ganzen Baum und breitet sich über die ganze Welt aus, und die meisten Leute haben dann keine andere Wahl, als in den Schmelzofen zu kommen um umgegossen zu werden.
Das ist die Geschichte der Gläser," sagte der Turmwächter Ole, "und die kann mit Glanzwichse und auch mit Schmiere zum besten gegeben werden, je nach Belieben! Ich gebe sie mit beiden!"
Dritter Besuch
Dieses Mal stieg ich an dem allgemeinen Umzugstag zu Ole hinauf, weil es an dem Tag durchaus nicht angenehm auf den Straßen unten in der Stadt ist; sind sie doch über und über mit Kehricht, Scherben und Überbleibseln aller Art bedeckt, nicht zu reden von dem ausgedienten Bettstroh, in dem man umherwaten muß. Dabei kam ich gerade dazu, wie ein paar Kinder in diesem Schwall von Kehricht umherspielten; sie spielten "zu Bette gehen," das Feld schien ihnen recht passend zu diesem Spiele und höchst einladend zu sein, sie verkrochen sich in dem Bettstroh und zogen ein altes Stück zerfetzter Tapete als Deckbett über sich. "Das ist gar zu schön!" sagten sie; mir war das nun ein bißchen zu stark, und überhaupt mußte ich ja fort, mußte zu Ole hinauf.
"Es ist heute Umzugstag," sprach er, "Straßen und Gassen dienen als Kehrichtkübel, als großartige Kehrichtkübel! Mir genügt aber schon ein Wagen voll. Aus dem kann ich schon etwa herauskriegen und ich fand auch manches, einmal kurz nach Weihnachten. Ich ging die Straße hinaus, es war ein rauhes Wetter, naß, schmutzig, so recht ein Wetter zum Schnupfenholen; der Kehrichtmann war da mit seiner Karre, die war gefüllt, eine Art Farbkarte der Straßen, wie sie es am Umzugstage sind. Hinten in der Karre stand eine Tanne, noch ganz grün und mit Rauschgold an den Zweigen, die war zwar zum Weihnachtsfest bestimmt gewesen, jetzt aber war sie auf die Straße geworfen und vom Kehrichtmann hinten in der Karre aufgestellt worden. Es war lustig anzusehen oder auch zum Weinen; es kommt darauf an, was man sich dabei denkt; ich dachte mir etwas dabei und dachte ganz gewiß auch an dieses und jenes von dem, was auf der Karre lag, oder hätte daran wenigstens denken können, was ja ungefähr dasselbe ist. Da lag auch ein alter Damenhandschuh; was dachte der wohl? Soll ich es Ihnen sagen? Der Handschuh lag dort und zeigte mit dem kleinen Finger gerade auf die Tanne. 'Mich jammert der Baum,' dachte er, 'auch ich bin beim Fest mit Kronleuchtern gewesen! Mein eigentliches Leben war eine Ballnacht, ein Händedruck, und ich platzte! Dort bleibt meine Erinnerung stehen, und ich habe weiter nichts, wofür ich leben könnte!' Das dachte der Handschuh – oder hätte es denken können.
'Das ist dumm mit der Tanne!' sagten die Scherben. Scherben finden nun alles summ. 'Wenn man auf dem Kehrichtkarren ist', sagten sie, 'soll man sich nicht brüsten und Rauschgold tragen; ich weiß, daß ich in dieser Welt genützt habe, mehr genützt als so ein grüner Stecken!' 'Das war nun auch so eine Ansicht, und ich glaube, sie steht nicht gerade allein da; die Tanne sah doch gut aus, sie war gleichsam ein wenig Poesie auf dem Kehrichthaufen, und wahrlich, Kehricht gibt es in Mengen auf den Straßen am Umzugstage.' Der Weg wird einen schwer und mühsam, und ich muß dann vorwärts, aus dem Trubel heraus, und wenn ich auf dem Turm bin, muß ich oben bleiben und mit Humor hinabschauen.
Da spielen die lieben Leute unten Häusertausch! Sie schleppen und rackern sich ab mit ihrem Hab und Gut, und der Kobold sitzt im alten Fasse und zieht aus mit ihnen; all die kleinen Leiden der Wohnung und der Familie, die wirkliche Sorgen und der Kummer ziehen mit aus der alten Wohnung in die neue, und was kommt dann für sie und für uns bei der ganzen Geschichte heraus? – Ja, das steht freilich schon längst geschrieben in dem alten, guten Sinnspruch: 'Denke an den großen Umzugstag des Todes!' Das ist ein ernster Gedanken, es ist Ihnen doch nicht unangenehm, daß ich ihn anrege? Der Tod ist und bleibt der zuverlässigste Beamte, und zwar trotz seiner vielen Nebenbeschäftigungen. Ja, der Tod ist Omnibusschaffner, er ist Paßschreiber, er bescheinigt unser Führungszeugnis, und er ist Direktor der großen Sparkasse des Lebens. Verstehen Sie? Alle Taten unseres Erdenlebens, große und kleine, legen wir auf diese Sparkasse, und wenn der Tod dann kommt mit seinem Umzugsomnibus und wir steigen ein und müssen mitfahren in das Land der Ewigkeit, dann gibt er uns an der Grenze unser Führungszeugnis als Reisepaß. Als Zehrpfennig auf der Reise nimmt er aus der Sparkasse diese oder jene Tat, die wir verübt haben, und gibt sie uns mit; es kann dies sehr erfreulich, aber auch ganz entsetzlich sein. Noch niemand ist dieser Omnibusfahrt entronnen, man spricht und erzählt freilich von einem, dem es nicht gewährt ward, mitzufahren, dem Ewigen Juden, der mußte hinter dem Omnibus einher rennen; hätte man ihm einzusteigen erlaubt, so wäre er der Behandlung durch die Poeten entgangen.
Schau einmal in Gedanken in jeden großen Umzugsomnibus hinein. Die Gesellschaft ist gemischt: König und Bettler, Genie und Idiot sitzen nebeneinander; mit müssen sie, ohne Geld und Gut, nur das Führungszeugnis und den Sparkassenpfennig führen sie mit sich. Doch welche von unseren Taten wird wohl hervorgesucht und uns mitgegeben? Vielleicht eine ganz kleine, eine vergessene, aber doch eingeschriebene, klein wie eine Erbse, aber die Erbse kann eine blühende Ranke treiben. Der arme Tollpatsch, der auf dem niedrigen Schemel im Winkel saß und gepufft und geschimpft wurde, bekommt vielleicht seinen abgenutzten Schemel als Zehrpfennig mit; der Schemel wird zum Tragesessel ins Land der Ewigkeit, hebt sich dort als Thron empor, strahlend wie Gold, blühend wie eine Laubhütte. Derjenige, der hier auf Erden niemals umherschlenderte und der den Kräutertrank der Vergnügungen schlurfte, damit er das Verkehrte vergäße, das er hier tat, bekommt sein Fäßchen mit auf die Reise und muß aus demselben während der Omnibusfahrt trinken, und der Trank ist so rein und klar, so daß die Gedanken sich erhalten, alle guten und edlen Gefühle erweckt werden und er das sieht und empfindet, was er früher nicht sehen mochte oder sehen konnte, und alsdann hat er in seinem Innern die Strafe, den nagenden Wurm, der nicht stirbt in endlosen Zeiten. Stand auf den Gläsern geschrieben Vergessenheit, so steht auf de Fäßchen geschrieben Erinnerung.
Wenn ich ein gutes Buch, eine historische Schrift lese, so muß ich mir stets zuletzt die Person, von der das Buch handelte, und den Omnibus des Todes vorstellen, muß darüber nachdenken, welche von dessen Taten der Tod wohl aus der Sparkasse herausgenommen, welchen Zehrpfennig er ihm mit auf die Reise in die Ewigkeit gegeben haben mag. Es war einmal ein französischer König, ich habe seinen Namen vergessen, der Name guter Leute wird manchmal vergessen, auch von mir, allein er taucht schon wieder auf – es war ein König, der während einer Hungersnot der Wohltäter seines Volkes wurde, und das Volk errichtete ihm ein Monument aus Schnee, mit der Inschrift: 'Schneller als dieses schmilzt, brachtest du Hilfe!' Ich denke mir, daß der Tod ihn nun, im Hinblick auf das Monument, eine einzige Schneeflocke als Zehrpfennig gab, eine Flocke, die nie schmilzt, und diese flog, ein weißer Schmetterling, über seinem königlichen Haupt in das Land der Unsterblichkeit. – So gab es auch einen Ludwig den Elften, ja, seinen Namen habe ich behalten, das Böse behält man schon. Ein Zug seines Charakters kommt mir oft in die Gedanken, ich wollte, man könnte sagen, die Geschichte sei unwahr. Er ließ seinen Oberstallmeister hinrichten, und er konnte ihn hinrichten lassen, mit Recht oder Unrecht, aber er ließ auch die unschuldigen Kinder des Oberstallmeisters, eines von acht, eines von sieben Jahren, auf den Richtplatz bringen und mit dem warmen Blut ihres Vaters bespritzen, ließ sie darauf in die Bastille führen und in eiserne Käfige sperren, woselbst sie nicht einmal eine Decke zum Schutz gegen die Kälte bekamen. Und König Ludwig sandte jede Woche den Henker zu ihnen und ließ jedem einen Zahn ausziehen, damit sie es nicht zu gut hätten; und der älteste Knabe sagte: 'Meine Mutter würde vor Kummer sterben, wenn sie wüßte, daß mein kleiner Bruder so sehr leiden muß, deshalb zieh mir zwei Zähne aus und verschone ihn!' Dem Henker traten die Tränen in die Augen, allein des Königs Wille war stärken als die Tränen, und jede Woche wurden dem König zwei Kinderzähne auf einem silbernen Teller überbracht; er hatte sie verlangt, und er bekam sie. Diese zwei Zähne, denke ich mir, nahm der Tod aus der Sparkasse des Lebens und gab sie Ludwig dem Elften mit auf die Reise in das große Land der Unsterblichkeit; sie fliegen wie zwei Feuerflammen ihm voran, sie leuchten, sie brennen, sie zwacken ihn, die unschuldigen Kinderzähne.
Ja, das ist eine ernste Fahrt, die Omnibusfahrt an dem großen Umzugstag! Und wann muß sie wohl angetreten werden? Das ist eben der Ernst: jeden Tag, jede Stunde, jede Minute muß man den Omnibus erwarten. Welche von unseren Taten wird wohl der Tod aus der Sparkasse herausnehmen und uns mitgeben? – Gedenken wir des Umzugstages, der nicht im Kalender steht."
DIE MUSE DES NEUEN JAHRHUNDERTS
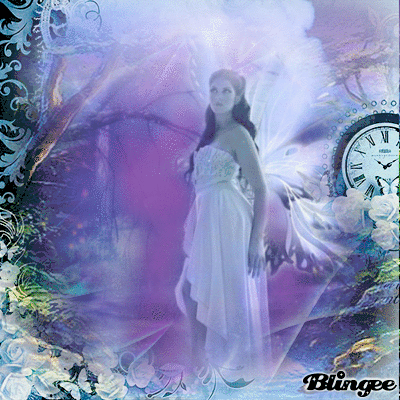
Die Muse des neuen Jahrhunderts, die die Kindeskinder unserer Kinder, vielleicht ein noch späteres Geschlecht, nicht aber wir kennenlernen werden, wann wird sie erscheinen? Wie wird sie aussehen? Was wird sie singen? Welche Saiten der Seele wird sie anschlagen? Auf welchen Höhepunkt wird sie ihr Zeitalter erheben?
So viele Fragen in unserer emsigen Zeit, wo die Poesie einem fast im Wege ist und man genau weiß, daß das viele "Unsterbliche," welches die Poeten der Gegenwart schreiben, in Zukunft vielleicht nur ein Dasein führen wird wie Kohleinschriften auf Gefängniswänden, gesehen und gelesen nur von einzelnen Neugierigen.
Die Poesie muß Hand anlegen, muß wenigsten die Vorladung hergeben in den Parteikämpfen, in denen hier Blut, dort Tinte fließt.
Das sei ein einseitiges Gerede, sagen viele. Die Poesie sei nicht vergessen.
Nein, es gibt noch Menschen, die an ihrem "blauen Montag" ein Bedürfnis nach Poesie haben und die als dann gewiß, wenn sie dieses geistige Knurren in ihren betreffenden edleren Teilen wahrnehmen, in den Buchladen schicken und für einen ganzen Groschen Poesie von der best empfohlenen kaufen lassen; einige begnügen sich mit der jenigen, die sie als Zugabe erhalten, oder sind mit den Stücken zufriedengestellt, das sie auf der Tüte aus dem Kaufladen bekommen; die ist billiger, und in unserer emsigen Zeit muß Rücksicht genommen werden auf Billigkeit. Ein Bedürfnis nach dem, was wir haben, ist vorhanden, und das genügt! Zukunftspoesie gehört wie Zukunftsmusik zu den Donquichotterien; von ihr zu reden, wäre wie von Reiseentdeckungen auf dem Uranus zu sprechen.
Die Zeit ist zu kurz bemessen und zu kostbar für Spiele der Phantasie, und was ist - damit wir einmal recht vernünftig reden - was ist Poesie? Diese klingenden Ergüsse der Gefühle und der Gedanken sind nur Schwingungen und Regungen der Nerven. Alle Begeisterung, alle Freude, jeder Schmerz, selbst das materielle Streben und Ringen sind, so sagen uns die Gelehrten, Nervenschwingungen. Wir sind, ein jeder von uns - ein Saitenspiel!
Allein wer greift in diese Saiten? Wer macht sie schwingen und zittern? Der Geist, der unsichtbare Geist der Gottheit, der läßt durch sie eine Regung, seine Stimmung erklingen, und er wird verstanden von den andern Saitenspielern, so daß sie dabei anklingen in zusammenschmelzenden Tönen und in des Gegensatzes kräftigen Dissonanzen. So war es, so bleibt es in dem freiheitsbewußten Vorwärtsschreiten der großen Menschheit!
Jedes Jahrhundert, jedes Jahrtausend, kann man auch sagen, hat den hohen Ausdruck seiner Größe in der Poesie; geboren in dem abgeschlossenen Zeitraum, tritt sie erst hervor und waltet in dem neuen, kommenden Zeitraum.
Geboren ist sie somit schon inmitten unserer emsigen, maschinenbrausenden Zeit, sie, die Muse des neuen Jahrhunderts. Unsern Gruß senden wir ihr! Sie hört ihn oder liest ihn einst, vielleicht zwischen jenen Kohleinschriften, die wir soeben erwähnten.
Ihre Wiege reichte von dem äußersten Punkt, den der Menschen Fuß bei den Nordpolforschungen betrat, bis dahin, wo das lebendige Auge die "schwarzen Kohlensäcke" des Polarhimmels hineinschaut. Vor lauter klappernden Maschinen, Pfeifen der Lokomotive, Zersprengung wirklicher Felsen und alter Bande des Geistes hörten wir aber ihren Gang nicht. Geboren ist sie in der großen Fabrik der Jetztzeit, in welcher der Dampf seine Gewalt ausübt, wo Meister Blutlos und seine Gesellen Tag und Nacht arbeiten.
Sie besitzt das große, liebeerfüllte Herz des Weibes, mit der Flamme der Vestalin und dem Feuer der Leidenschaft. Der Blitz des Verstandes ward ihr gegeben in allen durch die Jahrtausende wechselnden Farben der Prismen, die nach der Modefarbe geschätzt wurden. Das mächtige Schwanengefieder der Phantasie ist ihre Pracht und ihre Stärke, die Wissenschaft hat es gewebt, die Urkräfte verliehen ihr die Schwungkraft.
Väterlicherseits ist sie das Kind des Volkes, mit gesunden Sinnen und Gedanken, mit Ernst im Blick, Humor auf der Lippe. Die Mutter ist die hochwohlgeborene, akademieerzogene Tochter des Emigranten mit den goldenen Rokokoerinnerungen. Die Muse des neuen Jahrhunderts hat Blut und Seele von diesen beiden.
Herrliche Patengeschenke wurden ihr in die Wiege gelegt. Die verborgenen Rätsel der Natur und deren Lösung wurden ihr als Bonbons in Mengen hingestreut; aus der Taucherglocke sind wunderbare "Nippes" da, aus der Meerestiefe heraufgehört; die Himmelskarte, dieser aufgehängte stille Ozean mit Myriaden von Inseln, jede eine Welt, war abgedruckt auf ihrer Wiegendecke. Die Sonne malte ihr Bilder; die Photographie mußte ihr Spielzeug geben.
Ihre Amme hat ihr vorgesungen aus Eyvind des Skalden nordischen Liedern, aus den Minnegesängen und was Heine in knabenhaftem Übermut aus seiner wirklichen Díchterseele sang. Viel, gar zu viel hat ihre Amme ihr erzählt, sie kennt die Edda, die grausenerweckenden Sagas der alten Urgroßmutter, in welchen mehr denn ein Fluch mit blutigen Flügelschlägen dahinsaust. Sie hat die ganzen Tausendundeine-Nacht-Märchen während einer einzigen Viertelstunde erzählen hören.
Die Muse des neuen Jahrhundert ist noch ein Kind; allein sie ist aus der Wiege herausgesprungen, sie ist starken Willens, ohne zu wissen, was sie will.
Noch spielt sie in ihrer großen Kinderstube bei der Amme, wo es Kunstschätze aus dem Rokoko in Hülle und Fülle gibt. Die griechische Tragödie und das römische Lustspiel stehen dort in Marmor gemeißelt, die Volkslieder der Nationen hängen als getrocknete Pflanzen an den Wänden, durch einen Kuß schwellen sie wieder in Frische und Duft. Sie ist umbraust von ewigen Akkorden von Beethoven, Gluck, Mozart und den tönenden Gedanken aller großen Meister. Auf dem Bücherregal liegen gar viele, die zu ihrer Zeit unsterblich waren, und Platz ist genug für viele andere, deren Namen wir durch den Telegraphendraht der Unsterblichkeit klingen hören, die aber mit dem Telegramm verklingen.
Erstaunlich viel hat sie gelesen, viel zu viel, ist sie doch in unserer Zeit geboren, sehr viel muß wieder vergessen werden, und die Muse wird es zu vergessen wissen.
Sie denkt nicht an ihren Sang, der sich in einem neuen Jahrtausend emporschwingen und leben wird wie die Dichtung Moses und Bidpais goldgekrönte Fabel vom Glück und der Tücke des Fuchses. Sie denkt nicht an ihre Mission, an die tönende Zukunft, sie spielt noch während die Nationen kämpfen, einen Kampf, der die Luft erzittern macht, der kreuz und quer Klangfiguren von Schreibfedern und Kameen schafft, Runen, die schwer zu entziffern sind. Sie trägt einen Garibaldihut, liest ihren Shakespeare und denkt für einen kurzen Augenblick, er kann noch gespielt werden, wenn ich heranwachse! Calderon ruht im Sarkophag seiner Werke mit der Inschrift des Ruhmes; Holberg, ja, die Muse ist Kosmopolitin, sie hat ihn eingeheftet in ein und denselben Band mit Molière, Plautus und Aristophanes, aber sie liest hauptsächlich Molière.
Sie ist der Unruhe entbunden, die die Gemse der Alpen hetzt, und doch lechzt ihre Seele nach dem Salz des Lebens wie die Gemse nach dem des Berges; in ihrem Herzen wohnt eine Ruhe wie in den alten Sagen der Hebräer, dieser Stimme des Nomaden auf den grünen Auen in stillen, sternenhellen Nächten, und doch schwillt ihr im Herzen das Lied in volleren Tönen als das des begeisterten Kriegers des thessalischen Gebirges im griechischen Altertum.
Wie steht es um ihr Christentum? Sie hat das große und kleine Einmaleins der Philosophie gelernt; an dem Urstoff hat sie einen ihrer Milchzähne ausgebissen, aber sie hat einen neuen bekommen; in den Apfel der Erkenntnis biß sie schon in der Wiege, aß davon und wurde klug, so daß "Unsterblichkeit" ihr als der genialste Gedanke der Menschheit aufblitzte.
Wann erscheint das neue Jahrhundert der Poesie? Wann wird die Muse sich offenbaren, sich zu erkennen geben? Wann wird die Menschheit sie vernehmen?
An einem schönen Frühlingsmorgen kommt sie auf dem Drachen der Lokomotive dahergebraust durch Tunnel und über Viadukte oder über das reiche, stolze Meer auf dem schnaubenden Delphin oder durch die Luft auf dem Vogel Rock des Montgolfière und läßt sich herab in das Land, von dem aus ihre Stimme zum ersten Mal das Menschengeschlecht begrüßen wird. Wo? Wird es von dem Land des Columbus sein, dem Freiheitsland, wo der Eingeborene ein gehetztes Wild und der Afrikaner ein Lasttier wurde, dem Land, aus welchem das Lied von "Hiawatha" zu uns herüberklang? Wird es aus dem Erdteil der Antipoden sein, dem Goldklumpen der Südsee, dem Land der Gegensätze, wo unsere Nacht als Tag strahlt und schwarze Schwäne in Mimosenwäldern singen? Oder aus dem Land, wo die Memnonsäule klang und klingt, wir aber die Sphinx der Wüste nicht verstanden? Wird es von der Steinkohleninsel sein, wo Shakespeare der Herrscher ist seit Elisabeths Zeiten? Aus der Heimat Tycho Brahes. wo sie ihn nicht duldeten. oder aus dem Märchenland Kaliforniens, wo der Wellingtonbaum seine Krone als der Weltwälder König erhebt?
Wann wird der Stern leuchten, der Stern auf der Stirne der Muse, die Blütenkrone, in deren Blättern des Jahrhunderts Ausdruck vom Schönen in Form, in Farbe und Duft eingeschrieben ist?
"Und das Programm der neuen Muse? " fragen kundige Reichstagsabgeordnete unserer Tage. "Was will sie?"
Fragen wir lieber, was sie nicht will!
Sie wird nicht als ein Gespenst der dahingeschwundenen Zeit auftreten; sie wird keine Dramen aus den abgelegten Herrlichkeiten der Szene zusammenzimmern oder die Mängel dramatischer Architektur mit den blendenden Draperien der Lyrik decken; ihr Flug wird sein wie der vom Thespiskarren bis zu dem marmornen Amphitheater. Sie reißt nicht die gesunde Menschenrede in Stücke und nietet sie wieder zusammen zu einem künstlichen Glockenspiel mit einschmeichelndem Klang aus den Troubadour-Turnieren. Sie wird nicht das Versmaß hinstellen als den Adeligen und die Prosa als den Bürgerlichen; ebenbürtig sind sie in Klang, Fülle und Kraft. Sie wird nicht die alten Götter aus Islands Sagafelsen herausmeißeln, die sind tot; die neue Zeit hat keine Sympathie für sie, keine Verwandtschaft mit ihnen. Sie wird ihren Zeitgenossen nicht zumuten, daß sie ihre Gedanken in französischen Romankneipen einlogieren; sie wird nicht sanft betäuben mit dem Chloroform der Alltagsgeschichten; sie wird ein Lebenselixier bringen; ihr Sang in Vers und Prosa wird kurz, klar, reich sein! Der Herzschlag der Nationalitäten - jeder ein Buchstabe in dem großen Entwicklungsalphabet, den wird sie ergreifen, jeden Buchstaben mit derselben Liebe, und zu Worten zusammenstellen und die Worte zu Rhythmen schlingen in der Hymne ihres Zeitalters.
Und wann sind die Zeiten reif, zu kommen?
Uns, die wir noch hier sind, wird die Zeit lang erscheinen, kurz wird sie denjenigen sein, die vorausflogen!
Bald fällt die chinesische Mauer; die Eisenbahnen Europas erreichen das Kulturarchiv Asiens - die zwei Kulturströmungen begegnen sich! Dann vielleicht braust die Flut mit ihrem tiefen Klang, wir Alten der Gegenwart werden zittern bei den starken Tönen, und in dem allen ein Ragnarökkr, den Fall der alten Götter erblicken, werden vergessen, daß hienieden die Zeiten und Geschlechter verschwinden und nur ein kleines Bild von jedem, umschlossen von der Kapsel des Wortes, auf dem Strom der Ewigkeit als Lotosblume schwimmt und uns sagt, daß sie alle Fleisch von unserem Fleisch in verschiedenen Gewändern sind; das Bild der Juden strahlt aus der Bibel, das der Griechen aus der Ilias und Odyssee; und unser Bild? - fragte die Muse des neuen Jahrhunderts im Ragnarökkr, wenn das neue Gimle sich in Verklärung und Verständnis erhebt.
Alle Macht des Dampfes, aller Druck der Gegenwart waren die Hebel! Meister Blutlos und seine rüstigen Gesellen, die unserer Zeit mächtige Herrscher zu sein seinen, sind nur Diener, schwarze Sklaven, welche den Festsaal schmücken, die Schätze herbeitragen, die Tafel decken zu dem großen Fest, bei welchem die Muse mit der Unschuld des Kindes, der Begeisterung der Jungfrau und dem Frieden und Wissen der Matrone, sie, dieses reiche, volle Menschenherz und der Gottesflamme, die wunderbare Aladinslampe der Dichtung zutage fördert.
Sei gegrüßt, du Muse der Poesie des neuen Jahrhunderts! Unser Gruß erhebt sich und wird vernommen werden wie die Gedankenhymne des Wurmes, der unter dem Eisen des Pfluges zerschnitten wird, während ein neuer Frühling strahlt und der Pflug seine Furchen schneidend zieht und Würmer zerschneidet, damit der Segen wachse einem kommenden neuen Geschlecht.
Sei gegrüßt, du Muse des neuen Jahrhunderts!
AM SPITTELFENSTER

Nahe beim rasenbedeckten Walle, welcher sich rings um Kopenhagen zieht, liegt ein großes rothes Haus; Balsaminen und Ambra blicken uns aus den langen Fensterreihen des Hauses entgegen, in welchem es ärmlich genug aussieht, und arm und alt sind auch die Leute, die darin wohnen. Das Haus ist das Warton-Spittel.
Sieh da! Am Fenster lehnt ein altes Mädchen; es zupft das dürre Blatt von der Balsamine ab und blickt hinaus auf den rasenbedeckten Festungswall, wo fröhliche Kinder spielen. Woran denkt wohl das alte Mädchen? Ein ganzes Lebensdrama rollt sich vor dem innern Blicke auf.
Die armen Kleinen, wie glücklich sind sie, wie fröhlich spielen sie und tummeln sich! Welche rote Wangen und Engelsaugen! aber Strümpfe und Schuhe haben sie nicht an. Sie tanzen auf dem grünen Walle umher an der Stelle, wo, der Sage nach, vor vielen vielen Jahren der Boden stets eingesunken war, und wo man ein unschuldiges Kind durch Blumen, Spielzeug und Zuckergebackenes, in ein offenes ihm bereitetes Grab lockte; über dem spielenden, lächelnd genießenden Kinde wurde die Gruft vermauert.
Von Stunde an senkte sich aber der Boden nicht mehr, der Wall blieb hoch und fest liegen und überzog sich schnell mit herrlich grünendem Rasen. Die Kleinen, die jetzt an der Stelle spielen, wissen nichts von der Sage, sie würden sonst das Kindchen weinen hören dort unten in tiefer Erde, und die Tautropfen jedes Grashalms würden ihnen wie Schmerzenstränen sein. Sie wissen auch nichts von dem Dänenkönige, welcher hier im Angesichte des stürmenden Feindes seinen zitternden Hofleuten gegenüber den Schwur tat, er wolle mit den Bürgern seiner Hauptstadt ausharren und in seinem Neste sterben; nichts von den hier kämpfenden Männern oder von den Frauen, welche von hier aus die Feinde mit siedendem Wasser begossen, die weißgekleidet an der äußern Wallseite sich im Schnee verbargen und von hier aus die Stadt überrumpeln wollten.
Spiele nur immerhin, Du kleines Mädchen! bald kommen die Jahre – ja die herrlichen Jahre; die Confirmanden sind eingesegnet, Hand in Hand lustwandeln sie an dem grünenden Walle, Du trägst ein weißes Kleid, es hat Deiner Mutter viel Schweiß gekostet, und doch ist es aus einem größern, alten Kleide für Dich zugestutzt! Du wirst auch ein rotes Umschlagetuch tragen, und wenn es auch viel zu tief herabhängt, nun, so sieht man doch daraus wie groß, wie gar zu groß es ist! Du denkst an Deinen Putz und an den lieben guten Gott; ja, herrlich ist's auf dem grünenden Walle zu lustwandeln!
Die Jahre verstreichen und haben auch Überfluß an finsteren Tagen. Du hast Dein frisches jugendliches Gemüt, und das führt Dir einen Freund zu, Du weißt selbst nicht wie; Ihr begegnet Euch, wie oft! Ihr lustwandelt auf dem Walle im frühen Lenze, an dem Buß- und Bettage, an welchem alle Welt auf dem Walle lustwandelt, und alle Glocken der Kirchtürme dem nahen Lenze ein Ave läuten.
Noch sind kaum die Veilchen hervorgesprossen, aber dort auf dem Walle, gerade dem alten schönen Schlosse Rosenberg gegenüber, prangt ein Baum mit den ersten grünenden Knospen. Alljährlich treibt dieser Baum grüne Zweige, – ach, so nicht des Menschen Herz! »Trübe Wolken, in größerer Zahl als der reine nördliche Himmel sie kennt, ziehen in das Herz eines Menschen ein. Armes Kind! die Brautkammer Deines Freundes wird ein finsterer Sarg, und Du – wirst alte Jungfer; vom Spittelfenster aus, hinter der Balsamine schaust Du dereinst den fröhlichen, spielenden Kindern zu, siehst Du Deine eigene Geschichte sich erneuern.
Und das ist das Lebensdrama, welches an dem alten Mädchen vorüberzieht, indem es auf den Wall, den grünen sonnigen Wall hinausschaut, wo die Kinder mit den roten Wangen, barfuß ohne Schuhe und Strümpfe fröhlich aufjauchzen wie die andern freien Vögelein alle. –
DIE WOCHENTAGE

Die Wochentage wollten auch einmal sich freimachen, zusammenkommen und ein Festmahl abhalten. Jeder Tag war übrigens so in Anspruch genommen, daß sie, während des ganzen Jahres, nicht freie Zeit hatten, um darüber zu verfügen; sie mußten einen besonderen ganzen Tag haben, aber den hatten sie doch auch jedes vierte Jahr: den Schalttag, der wurde in den Februar belegt, um Ordnung in die Zeitrechnung zu bringen.
Auf den Schalttag wollten sie also zusammenkommen zum Festmahl, und da der Februar der Fastnachtsmonat ist, wollten sie karnevalsmäßig angekleidet kommen nach eines jeden Empfindung und Bestimmung; gut essen, gut trinken, Reden halten und einander Annehmlichkeiten sagen und Unannehmlichkeiten in ungenierter Kameradschaft. Die Helden der alten Zeit warfen einander bei den Mahlzeiten die abgenagten Fleischknochen an den Kopf, die Wochentage wollten einander überhäufen mit Leckereien von albernen Späßen und schelmischen Witzen, wie sie zu den unschuldigen Fastnachtsscherzen gehören mögen.
Dann war es Schalttag, und dann kamen sie zusammen.
Der Sonntag, der Vormann der Wochentage, trat auf in schwarzem Seidenmantel, fromme Menschen würden glauben, daß er einen Talar trug, um in die Kirche zu gehen; die Weltkinder sahen, daß er im Domino war, um auf ein Vergnügen zu gehen und daß die flammende Nelke, die er im Knopfloch trug, des Theaters kleine rote Laterne war, die sagte: "Alles ist ausverkauft, seht nun zu, daß ihr euch amüsiert!"
Der Montag, ein junger Mensch, dem Sonntag nah verwandt und besonders dem Vergnügen hingegeben, folgte nach. Er verlasse die Werkstatt, sagte er, wenn die Wachtparade aufzieht.
"Ich muß hinaus, um Offenbachs Musik zu hören; sie geht mir nicht zu Kopf und nicht zu Herzen, sie kitzelt mich in den Beinmuskeln, ich muß tanzen, ein Gelage haben, ein blaues Auge kriegen, um darauf zu schlafen, und dann packe ich am nächsten Tag die Arbeit an. Ich bin das Neue in der Woche!"
Dienstag, das ist Tyrs Tag, der Tag der Kraft.
"Ja, das bin ich!" sagte der Dienstag. "Ich packe die Arbeit an, spanne Merkurs Flügel an des Kaufmanns Schuhe, sehe in die Fabriken, ob die Räder geschmiert sind und sich drehen, sorge dafür, daß der Schneider auf der Bank und der Pflasterer auf den Pflastersteinen hockt; jeder achte auf sein Gewerbe: Ich halte mein Auge auf das Ganze, deshalb trage ich Polizeiuniform und nenne mich Poli-zienstag. Ist das ein schlechter Kalauer, so versucht ihr anderen, einen besseren zu machen!"
"Da komme ich!" sagte der Mittwoch. "Ich stehe mitten in der Woche, darum nennen mich die Deutschen so. Ich stehe wie der Kommis hinter dem Ladentisch, als Blume zwischen den andern geehrten Wochentagen! Marschieren wir alle auf, dann habe ich drei Tage vor, drei Tage hinter mir, das ist wie eine Ehrenwache, ich darf glauben, daß ich der ansehnlichste Tag bin!"
Der Donnerstag stellte sich ein, gekleidet als Kupferschmid mit Hammer und Kupferkessel, das war sein Adelsattribut.
"Ich bin von höchster Geburt," sagte er, "heidnisch, göttlich! In Nordens Landen werde ich nach Thor genannt, in denen des Südens nach Jupiter, die beide verstanden zu donnern und zu blitzen, das ist in der Familie geblieben."
Und dann schlug er auf den Kupferkessen und bewies seine hohe Geburt.
Freitag war gekleidet wie ein junges Mädchen und nannte sich Freya, auch zur Abwechslung Venus, das kam auf den Sprachgebrauch im Lande an, wo sie auftrat. Sie sei übrigens von stillem, ernsten Charakter, sagte sie, aber heute flott und frei; es war ja Schalttag, und der gibt der Frau Freiheit, da darf sie nach altem Brauch selber freien und muß sich nicht freien lassen.
Sonnabend trat auf als alte Haushälterin mit Besen und Sauberkeitsattributen. Ihr Leibgericht war Bierbrotsuppe, doch verlangte sie nicht, daß diese bei dieser festlichen Gelegenheit für alle mit aufgetischt werden sollte, sondern nur, daß sie sie bekommen könne – und sie bekam sie.
DER VOGEL DES VOLKSLIEDS

Es ist Winterzeit; die Erde hat eine Schneedecke, als sei sie von Marmor aus dem Felsen gehauen; die Luft ist hell und klar, der Wind ist scharf wie ein hart geschmiedetes Schwert, die Bäume stehen da wie weiße Korallen, wie blühende Mandelzweige, hier ist es frisch wie auf den hohen Alpen.
Die Nacht ist prächtig im Nordlichtscheine, im Glanze unzähliger funkelnder Sterne. Es kommen die Stürme, die Wolken erheben sich und Schütteln Schwanendaunen herab; die Schneeflocken jagen, decken Hohlweg und Haus, das offene Feld und die eingeschlossenen Straßen.
Aber wir sitzen in der warmen Stube, am glühenden Ofen und erzählen uns von alten Zeiten, wir hören eine Sage:
An dem offenen Meere lag ein Riesengrab, auf dem saß zur Mitternachtszeit der Geist des begrabenen Helden, der ein König gewesen war; der Goldreif leuchtete von seiner Stirn, das Haar flatterte im Winde, er war in Stahl und Eisen gekleidet; er beugte sorgenvoll sein Haupt und seufzte in tiefem Schmerze wie ein unseliger Geist.
Da segelte ein Schiff vorbei. Die Matrosen warfen den Anker aus und stiegen ans Land. Unter ihnen war ein Sänger; der trat zum Königs- Geiste und frage: "Warum trauerst und leidest du?"
Da antwortete der Tote: "Niemand hat die Taten meines Lebens besungen, sie sind tot und vergessen; der Gesang trägt sie nicht über die Länder hinaus und in die Herzen der Menschen; darum habe ich keine Ruhe, keinen Frieden!"
Und er sprach von seinen Werken und Großtaten, die seine Zeitgenossen gekannt, aber nicht besungen, denn unter ihnen war kein Sänger.
Da griff der Alte Barde in die Saiten der Harfe und sang von dem Jugendmut des Helden, von der Kraft des Mannes und der Größe, der guten Taten. Dabei leuchtete des Toten Angesicht wie der Wolkensaum im Mondenschein, froh und hochselig erhob sich die Gestalt in Glanz und Strahlen, sie entschwand wie ein Nordlichtschein; man sah nur noch den grünen Rasenhügel mit den runenlosen Steinen; aber darüber hin schwang sich beim letzten Klang der Saiten, so recht, als wenn er aus der Harfe käme, ein kleiner Vogel, der reizendste Singvogel mit dem klangvollen Schlage der Drossel, mit dem seelenvollen Schlage des Menschenherzens, dem Klange des Heimatlandes, wie der Zugvogel ihn hört. Der Singvogel flog über die Berge, über Tal, über Feld und Wald - das war der Vogel des Volkslieds, der niemals stirbt.
Wir hören den Gesang; wir hören ihn jetzt hier in der Stube, während die weißen Bienen draußen schwärmen und der Sturm starke Griffe tut. Der Vogel singt uns nicht bloß die Treueklage der Helden, er singt auch süße, sanfte Liebesgesänge, so warme und so viele, von der Treue im Norden; er hat Märchen in Worten und Tönen; er hat Sprichwörter und Liedersprüche, die - gleich Runen unter des Toten Zunge legt - ihn zum Sprechen nötigen, und so weiß das Volkslied von seinem Heimatlande!
In der alten Heidenzeit, in der Wikingerzeit, hing seine Rede in des Barden Harfe. In den Tagen der Ritterburgen, als die Faust die Waagschale der Gerechtigkeit hielt, nur die Macht das Recht war, ein Bauer und ein Hund von gleicher Bedeutung, wo fand da der Vogel des Gesanges Obdach und Schutz? Weder Roheit noch Dummheit dachten an ihn.
Aber in dem Erker der Ritterburg, wo die Burgfrau vor dem Pergament saß und die alten Erinnerungen in Gesängen und Sagen niederschrieb und das alte Mütterchen aus dem Walde und der Tabulettkrämer, der immer herumwandernde, bei ihr saßen und erzählten, da flog er über sie hin, da flatterte, zwitscherte und sang der Vogel, der niemals stirbt, solange die Erde einen Hügel für seinen Fuß hat, für den Vogel des Volkslieds.
Nun singt er zu uns herein. Draußen ist der Schneesturm und die Nacht; er legt die Runen unter unsere Zunge, wir kennen unser Heimatland; Gott spricht zu uns in unserer Muttersprache, in den Tönen des Vogels vom Volkslied. Die alten Erinnerungen tauchen auf, die erblichenen Farben frischen sich auf, die Sage und der Gesang geben einen Segenstrunk, der Sinn und Gedanken erhebt, so daß der Abend ein Weihnachtsfest wird.
Die Schneeflocken jagen, das Eis kracht, der Sturm herrscht, denn er hat die Macht, er ist der Herr - aber doch nicht unser Herr-Gott!
Es ist Winterzeit, der Wind ist scharf wie ein hartgeschmiedetes Schwert; die Schneeflocken jagen - es schneite, so schien es uns, Tage und Wochen, und der Schnee liegt wie ein ungeheurer Schneeberg über der großen Stadt: ein schwerer Traum in der Winternacht. Alles ist auf der Erde verborgen und fort, nur das goldene Kreuz der Kirche, das Symbol des Glaubens, erhebt sich über dem Schneegrabe und leuchtet in der blauen Luft, in dem klaren Sonnenscheine.
Und über der begrabenen Stadt fliegen die Vogel des Himmels, die kleinen und die großen; sie zwitschern und singen, wie sie es gerade können, jeder Vogel mit seinem Schnabel.
Zuerst kommt die Schar der Sperlinge; sie piepen bei allen Kleinigkeiten in der Straße und in der Gasse, Im Neste und im Hause; die wissen Geschichten vom Vorder- und Hinterhause. "Wir kennen die begrabene Stadt," sagten sie. "Alles Lebendige darin hat den Piep! Piep! Piep!"
Die schwarzen Raben und Krähen fliegen über den weißen Schnee. "Grab! Grab!" schreien sie. "Da unten ist noch etwas zu bekommen, etwas für den Schlund, das ist das wichtigste, das ist die Meinung der meisten da unten im Grunde, und die Meinung ist bra', bra', brav!"
Die wilden Schwäne kommen auf sausenden Flügeln und singen von dem Herrlichen und dem Großen, das noch aus den Gedanken und Herzen der Menschen hervorspießen wird dort unten, in der unter der Schneedecke ruhenden Stadt.
Da ist kein Tod, da waltet das Leben; wir vernehmen es in den Tönen, die gleich der Kirchenorgel brausen, die uns ergreifen wie der Klang von der Elfenhöhe, wie die Gesänge Ossians, wie der brausende Flügelschlag der Walküren. Welcher Einklang! Der spricht in unserm Herzen, erhebt unsere Gedanken - das ist der Vogel des Volkslieds, den wir hören!
Und in diesem Augenblick weht der warme Hauch Gottes vom Himmel herunter, die Schneeberge bersten in Spalten, die Sonne scheint hinein, der Frühling naht, die Vogel kommen, neue Geschlechter mit den heimatlichen, denselben Tönen.
Höre den Heldensang des Jahres: "Die Macht des Schneesturms, der schwere Traum der Winternacht - alles löst sich, alles erhebt sich im herrlichen Gesange des Vogels des Volkslieds, der niemals stirbt!"
DER KRÜPPEL

Es war einmal ein altes Schloß mit jungen, prächtigen Edelleuten. Reichtum und Segen hatten sie, amüsieren wollten sie sich, und Gutes taten sie. Alle Menschen wollten sie froh machen, so wie sie selber es waren.
Am Weihnachtsabend stand ein prächtiger, wunderschöner Weihnachtsbaum im alten Rittersaal, wo Feuer in den Kaminen brannte und wo Tannenzweige um die alten Bilder gehängt waren. Hier versammelten sich die Herrschaft und die Gäste, es wurde gesungen und getanzt.
Früher am Abend war schon Weihnachtsfreude in der Gesindestube gewesen. Auch hier stand ein großer Tannenbaum mit brennenden roten und weißen Lichtern, kleinen Danebrogflaggen, ausgeschnittenen Schwänen und Fischernetzen, die mit Bonbons gefüllt waren. Die armen Kinder aus dem Dorfe waren eingeladen; jedes hatte seine Mutter mitgebracht. Die sahen nicht viel nach dem Baume hin, sie sahen nur nach den Weihnachtstischen, wo Wolle und Leinwand, Stoff zu Kleidern und Hosen lag. Ja, dahin sahen die Mütter und die erwachsenen Kinder, nur die ganz kleinen streckten die Hände nach den Lichtern, dem Flittergolde und den Flaggen aus.
Die ganze Versammlung kam früh am Nachmittag, bekam Reisbrei und Gänsebraten mit Rotkohl. Wenn dann der Tannenbaum besehen und die Gaben verteilt waren, bekam jeder ein kleines Glas Punsch und Apfelkuchen mit Apfelmus darin.
Sie kamen heim in ihre eigene, arme Stube, und es wurde von "der guten Lebensweise" geredet, das heißt, von den Eßwaren, und die Gaben wurden noch einmal ordentlich besehen.
Da waren nun Garten-Kirsten und Garten-Ole. Sie waren miteinander verheiratet und hatten ihr Haus und ihr tägliches Brot, und dafür mußten sie im Schloßgarten jäten und graben. Jede Weihnachten bekamen sie ihren guten Anteil an den Geschenken; sie hatten auch fünf Kinder, alle fünf wurden von der Herrschaft gekleidet.
"Unsere Herrschaft, das sind wohltätige Leute!" sagten sie. "Aber sie können es auch, und es macht ihnen Vergnügen!"
"Hier sind gute Kleider für die vier Kinder gekommen!" sagte Garten-Ole. "Aber da ist ja nichts für den Krüppel. Den pflegen sie ja doch sonst auch zu bedenken, obwohl er nicht mit zum Tannenbaum kommen kann!"
Es war das älteste von den Kindern, das sie "den Krüppel" nannten, er war sonst auf den Namen Hans getauft.
Als kleines Kind war er das munterste und lebhafteste von ihnen allen, aber dann wurde er auf einmal "schlaff in den Beinen," wie sie es nannten, er konnte weder stehen noch gehen und lag nun schon im fünften Jahr zu Bett.
"Ja, etwas habe ich auch für ihn mitbekommen!" sagte die Mutter. "Aber es ist ja nichts weiter, es ist nur ein Buch, worin er lesen kann!"
"Davon soll er auch wohl fett werden!" sagte der Vater.
Aber froh wurde Hans dadurch. Er war ein sehr aufgeweckter Knabe, der gern las, aber er benutzte auch seine Zeit zur Arbeit, soweit er, der immer zu Bett liegen mußte, Nutzen schaffen konnte. Er machte sich mit seinen Händen nützlich, er brauchte seine Hände, strickte wollene Strümpfe, ja ganze Bettdecken. Die gnädige Frau auf dem Schlosse hatte sie gelobt und gekauft.
Es war ein Märchenbuch, das Hans bekommen hatte; darin war viel zu lesen, vieles, worüber er nachdenken konnte.
"Das schafft gar keinen Nutzen im Hause!" sagten die Eltern. "Aber laßt ihn nur lesen, dann vergeht ihm die Zeit schneller, er kann ja nicht immer Strümpfe stricken!"
Der Frühling kam; Blumen und Kräuter begannen zu sprießen, auch das Unkraut.
..
Es war viel zu tun im Schloßgarten, nicht nur für den Schloßgärtner und seine Lehrlinge, sondern auch für Garten-Kirsten und Garten-Ole.
"Das ist eine furchtbare Mühe!" sagten sie. "Und wenn man die Gänge eben geharkt hat und sie so recht hübsch gemacht hat, dann werden sie gleich wieder zertreten. Hier ist ein Ein- und Auswandern von Gästen auf dem Schloß. Was muß das kosten! Aber die Herrschaft ist ja reich!"
"Es ist doch sonderbar verteilt!" sagte Ole. "Wir sind ja alle Kinder unseres lieben Gottes, wie der Pfarrer sagt. Warum dann solch ein Unterschied?"
"Das kommt vom Sündenfall!" sagte Kirsten.
Darüber sprachen sie am Abend wieder, als der Krüppel-Hans mit seinem Märchenbuch da lag.
Bedrängte Verhältnisse, Mühe und Arbeit hatten die Hände der Eltern hart gemacht, aber sie waren auch hart in ihrem Urteil und ihren Ansichten geworden; sie begriffen es nicht, konnten es sich nicht erklären und redeten und redeten sich nun immer mehr in Zorn und Mißmut hinein.
"Einige Menschen bekommen Wohlstand und Glück, andere nur Armut! Warum sollen wir für den Ungehorsam und die Neugier unserer ersten Eltern bestraft werden. Wir hätten uns nicht so betragen wie die beiden!"
"Ja, das hätten wir!" sagte auf einmal Krüppel-Hans. "Es steht alles zusammen hier in diesem Buch!"
"Was steht in dem Buch?" fragten die Eltern.
Und Hans las ihnen das alte Märchen von dem Holzbauer und seiner Frau vor: die schalten auch über die Neugier von Adam und Eva, die an ihrem Unglück schuld waren. Da kam der König des Landes vorüber. "Kommt mit mir nach Hause," sagte er, "dann sollt ihr es ebenso gut haben wie ich: sieben Gerichte und ein Schaugericht. Das steht in einer geschlossenen Terrine, die dürft ihr aber nicht anrühren, denn dann ist es mit der Herrlichkeit vorbei!" – "Was kann doch in der Terrine sein?" sagte die Frau. "Das geht uns nichts an!" sagte der Mann. "Ja, ich bin nicht neugierig," sagte die Frau, "ich möchte nur wissen, warum wir den Deckel nicht aufheben dürfen; es ist wohl was ganz Delikates!" – "Wenn nur nicht eine Mechanik dabei ist!" sagte der Mann. "So ein Pistolenschuß, der knallt und das ganze Haus aufweckt." – "Ach was!" sagte die Frau, rührte aber nicht an der Terrine. Aber des Nachts träumte sie, daß der Deckel selbst sich hebe und ein Duft vom feinsten Punsch, wie man ihn auf Hochzeiten und Begräbnissen bekommt, der Terrine entsteige. Es lag eine große silberne Münze da mit der Inschrift: "Wenn ihr von diesem Punsch trinket, so werdet ihr die Reichsten in der Welt, und alle andern Menschen werden Bettler!" – Und dann erwachte die Frau, und sie erzählte ihrem Mann ihren Traum. "Du denkst zu viel an die Sache!" sagte er. "Wir können ja mit Vorsicht den Deckel aufheben!" sagte die Frau. "Ganz vorsichtig!" sagte der Mann. Und die Frau hob den Deckel ganz vorsichtig auf. – Da sprangen zwei kleine lebendige Mäuse heraus und verschwanden in einem Mauseloch. "Gute Nacht!" sagte der König. "Nun könnt ihr nach Hause gehen und euch in euer eigenes Bett legen. Scheltet nicht mehr auf Adam und Eva, ihr selber seid ebenso neugierig und undankbar gewesen!"
"Wie ist doch die Geschichte da in das Buch gekommen?" sagte Garten-Ole. "Es ist ja ganz, als ob sie uns gelten sollte. Das ist so recht zum Nachdenken!"
Am nächsten Tage gingen sie wieder auf Arbeit; sie wurden von der Sonne verbrannt und von dem Regen durchnäßt: in ihren Herzen waren zornige Gedanken, an denen sie fortwährend kauten.
Es war noch heller Abend daheim, sie hatten eben ihren Milchbrei gegessen.
"Lies uns noch einmal die Geschichte von dem Holzbauer vor," sagte Garten-Ole.
"Da sind so viele hübsche Geschichten im Buch!" sagte Hans. "So viele, die ihr noch nicht kennt!"
"Darauf mache ich mir gar nicht!" sagte Garten-Ole. "Ich will die hören, die ich kenne!"
Und er und die Frau hörten wieder dieselbe Geschichte.
Und immer wieder kamen sie auf die Geschichte zurück.
"So recht erklären kann ich mir das Ganze doch nicht!" sagte Garten-Ole. "Es ist mit dem Menschen wie mit der süßen Milch, die gerinnt; ein Teil davon wird feiner Käse, und aus dem andern wird nichts als dünne, wässerige Molke! Einige Leute haben Glück in allem, sitzen alle Tage an der Festtafel und kennen weder Sorge noch Mühe!"
Das hörte der Krüppel-Hans. Wohl war er schlaff in den Beinen, aber er war klug. Er las ihnen die Geschichte von "dem Mann ohne Kummer und Sorge" aus dem Märchenbuch vor. Ja, wo war der zu finden, und gefunden werden mußte er.
Der König lag krank danieder und konnte nur geheilt werden, wenn er das Hemd anbekam, das von einem Menschen getragen und auf dem Körper verschlissen war, der in Wahrheit sagen konnte, daß er niemals Kummer und Sorge gekannt hatte.
Boten wurden in alle Länder der Welt entsandt, auf alle Schlösser und Rittergüter, zu allen wohlhabenden und frohen Menschen; aber wenn man sie richtig ausfragte, so hatte doch jeder von ihnen Sorge und Kummer kennengelernt.
"Ich habe sie nicht kennengelernt!" sagte der Schweinehirt, der am Grabenrand saß, lachte und sang. "Ich bin der glücklichste Mensch!"
"Dann gib uns dein Hemd," sagten die Botschafter, "du sollst es mit einem halben Königreich bezahlt bekommen."
Aber er hatte kein Hemd – und nannte sich doch den glücklichsten Menschen.
"Das war ein famoser Kerl!" rief Garten-Ole, und er und seine Frau lachten, wie sie seit Jahr und Tag nicht gelacht hatten.
Da kam der Schullehrer vorbei.
"Wie vergnügt ihr seid!" sagte er. "Das ist etwas Seltenes und Neues hier im Hause. Habt ihr in der Lotterie gewonnen?"
"Nein, so was ist es nicht!" sagte Garten-Ole. "Aber Hans hat uns aus dem Märchenbuch vorgelesen; er las von dem 'Mann ohne Kummer und Sorge', und der Kerl hatte gar nicht mal ein Hemd. Einem geht ein helles Talglicht auf, wenn man so was hört, und noch dazu aus einem gedruckten Buch. Jeder hat wohl seine Last zu ziehen; man ist wohl nicht der einzige. Das ist doch immer ein Trost!"
"Wo habt ihr das Buch her?" fragte der Schullehrer.
"Das hat Hans vor mehr als einem Jahr zu Weihnachten bekommen. Die Herrschaft hat es ihm geschenkt. Sie wissen, daß er so gern lesen mag, und er ist ja ein Krüppel! Wir hätten es damals lieber gesehen, wenn er zwei Hemden aus Wergleinwand bekommen hätte. Aber das Buch ist sonderbar, das kann einem wirklich auf alle Gedanken antworten!"
Der Schullehrer nahm das Buch und öffnete es.
"Wir wollen dieselbe Geschichte noch einmal hören!" sagte Garten-Ole. "Ich weiß sie noch nicht richtig. Und dann muß er auch die von dem Holzbauer vorlesen!"
Die beiden Geschichten waren und blieben genug für Ole. Sie waren wie zwei Sonnenstrahlen in der armen Stube, in den niederdrückenden Gedanken, die sie verdrießlich und unzufrieden machten.
Hans hatte das ganze Buch gelesen, viele Male gelesen. Die Märchen trugen ihn in die Welt hinaus, wohin ihn die Beine nicht tragen konnten.
Der Schullehrer saß an seinem Bett; sie sprachen zusammen, und das war ein Vergnügen für die beiden.
Seit dem Tage kam der Schullehrer öfter zu Hans, wenn die Eltern auf Arbeit waren. Es war wie ein Fest für den Jungen, jedesmal wenn er kam. Wie lauschte er dem, was der alte Mann erzählte, von der Größe der Erde und von den vielen Ländern, und daß die Sonne noch fast eine halbe Million mal größer sei als die Erde und so weit entfernt, daß eine Kanonenkugel in voller Eile fünfundzwanzig ganze Jahre von der Sonne bis zur Erde braucht, während die Lichtstrahlen die Erde in acht Minuten erreichen können. Hierüber weiß nun jeder tüchtige Schuljunge Bescheid, aber für Hans war das alles neu und noch viel wunderbarer als alles, was in dem Märchenbuch stand.
Der Schullehrer kam ein paarmal im Jahr an die Tafel der Herrschaft, und bei einer solchen Gelegenheit erzählte er, welche Bedeutung das Märchenbuch in dem armen Haus erlangt habe und wie allein die zwei Geschichten zur Erweckung und zum Segen geworden seien. Der schwächliche, kleine Junge habe durch das Lesen Nachdenken und Freude ins Haus gebracht.
Als der Schullehrer sich verabschiedete, drückte ihm die Schloßherrin ein paar blanke Silbertaler in die Hand für den kleinen Hans.
"Die müssen Vater und Mutter haben!" sagte der Junge, als der Schullehrer ihm das Geld brachte.
Und Garten-Ole und Garten-Kirsten sagte: "Der Krüppel-Hans ist doch zum Nutzen und Segen!"
Ein paar Tage später, die Eltern waren auf Arbeit im Schloßgarten, hielt der herrschaftliche Wagen draußen vor dem Hause; es war die herzensgute Schloßherrin, die kam, erfreut darüber, daß ihr Weihnachtsgeschenk zu einem solchen Trost und so viel Freude für den Knaben und die Eltern geworden war.
Sie brachte feines Brot, Obst und eine Flasche süßen Saft mit; aber was noch schöner war, sie brachte ihm in einem vergoldeten Bauer einen kleinen schwarzen Vogel, der ganz allerliebst flöten konnte. Das Bauer mit dem Vogel wurde auf die alte Kommode gesetzt, ein wenig von dem Bett des Knaben entfernt; er konnte den Vogel sehen und seinen Gesang hören. Ja, die Leute, die auf der Landstraße vorüberkamen, konnten den Gesang hören.
Garten-Ole und Garten-Kirsten kamen erst nach Hause, nachdem die gnädige Frau wieder weggefahren war, sie merkten, wie froh Hans war, aber sie fanden doch, daß das Geschenk nur Mühe machte.
"Reiche Leute denken nicht recht nach!" sagten sie. "Sollen wir nun auch auf den Vogel aufpassen. Der Krüppel-Hans kann es ja nicht. Das Ende wird noch sein, daß ihn die Katze frißt!"
Es vergingen acht Tage, und noch acht Tage vergingen; die Katze war während der Zeit manchmal in der Stube gewesen, ohne den Vogel zu erschrecken, geschweige denn, ihm etwas zuleide zu tun. Dann ereignete sich etwas sehr Großes. Es war am Nachmittag, die Eltern und die andern Kinder waren auf Arbeit gegangen, Hans war ganz allein; er hatte das Märchenbuch in der Hand und las von der Frau des Fischers, der sämtliche Wünsche erfüllt wurden. Sie wolle König sein, das wurde sie; sie wollte Kaiser sein, das wurde sie; aber dann wollte sie der liebe Gott sein – und dann saß sie wieder in dem Morast, aus dem sie gekommen war.
Die Geschichte stand nun in gar keinem Zusammenhang mit dem Vogel oder der Katze, aber es war gerade die Geschichte, die er las, als das Ereignis eintraf, das er nie wieder vergessen sollte.
Das Bauer stand auf der Kommode, die Katze stand auf dem Fußboden und sah starr mit ihren grüngelben Augen zu dem Vogel hinauf. Da war etwas im Gesicht der Katze, als wolle sie zu dem Vogel sagen: "Wie bist du reizend, ich möchte dich wohl auffressen!"
Das konnte Hans verstehen; er las es ganz deutlich aus dem Gesicht der Katze.
"Weg, Katze!" rief er. "Willst du wohl machen, daß du aus der Stube hinauskommst!"
Es war, als schickte sie sich an, zu springen.
Hans konnte sie nicht erreichen, hatte nichts anderes, womit er nach ihr werfen konnte, als seinen liebsten Schatz, das Märchenbuch. Das warf er denn auch, aber der Einband löste sich, flog nach der einen Seite, und das Buch selber mit allen seinen Blättern flog nach der anderen Seite. Mit langsamen Schritten ging die Katze ein wenig in das Zimmer zurück und sah Hans an, als wollte sie sagen:
"Mische du dich nicht in diese Sache, kleiner Hans! ich kann gehen, und ich kann springen, du kannst nichts von beidem!"
Hans behielt die Katze im Auge und war in großer Unruhe. Der Vogel wurde auch unruhig. Kein Mensch war da, den er hätte rufen können; es war, als wüßte die Katze das. Sie schickte sich wieder an, zu springen. Hans schlug mit seiner Bettdecke nach ihr, die Hände konnte er gebrauchen; aber die Katze kehrte sich nicht an die Bettdecke; und als auch die nutzlos nach ihr geworfen war, sprang sie in einem Satz auf den Stuhl hinauf und in den Fensterrahmen hinein, hier war sie dem Vogel näher.
Hans konnte sein eigenes warmes Blut im seinem Körper spüren, aber daran dachte er nicht; er dachte nur an die Katze und an den Vogel. Allein konnte er ja nicht aus dem Bett herauskommen; auf den Beinen konnte er nicht stehen, noch weniger konnte er gehen. Es war, als ob sich ihm das Herz im Leibe umdrehe, als er die Katze von dem Fensterbrett gerade auf die Kommode hinüberspringen und an das Bauer stoßen sah, so daß es herunterfiel. Der Vogel flatterte ängstlich dadrinnen.
Hans stieß einen Schrei aus, ein Schrecken durchlief ihn, und ohne daran zu denken, sprang er aus dem Bett, auf die Kommode zu, riß die Katze herunter und hielt das Bauer fest, in dem der Vogel in Todesangst umherflatterte. Er hielt das Bauer in der Hand und lief damit zur Tür hinaus auf die Landstraße.
Da rollten ihm die Tränen über die Wangen; er jubelte und rief ganz laut: "Ich kann gehen! Ich kann gehen!"
Er hatte seine Beweglichkeit wieder bekommen; so etwas kann geschehen, und bei ihm geschah es.
Der Schullehrer wohnte ganz in der Nähe, und zu ihm lief er auf seinen nackten Füßen, nur in Hemd und Jacke und mit dem Vogel in dem Bauer.
"Ich kann gehen!" rief er. "Herr, mein Gott!" Und er schluchzte vor lauter Freude.
Und Freude ward im Hause bei Garten-Ole und Garten-Kirsten. "Einen froheren Tag könnten wir nicht erleben!" sagten die beiden.
Hans wurde auf das Schloß gerufen. Diesen Weg war er seit vielen Jahren nicht gegangen: es war, als ob die Bäume und Nußbüsche, die er so gut kannte, ihm zunickten und sagten: "Guten Tag, Hans! Willkommen hier draußen!" Die Sonne schien ihm ins Gesicht, bis ins Herz hinein.
Die Herrschaft, die jungen, herzensguten Edelleute, ließen ihn bei sich sitzen und sahen so froh aus, als ob er zu ihrer eigenen Familie gehörte.
Am glücklichsten aber war die gnädige Frau, die ihm das Märchenbuch geschenkt und den kleinen Singvogel gebracht hatte, der war freilich vor Schrecken gestorben, aber er war gleichsam das Mittel zu seiner Genesung geworden, und das Buch war ihm und den Eltern zur Erweckung geworden; das Buch hatte er noch, das wollte er aufbewahren und darin lesen, wenn er auch schon ganz alt sein würde. Jetzt konnte er auch seinen Eltern von Nutzen sein. Er wollte ein Handwerk lernen, am liebsten Buchbinder werden. "Denn," sagte er, "dann kann ich alle neuen Bücher zu lesen bekommen!"
Am Nachmittag ließ die gnädige Frau die Eltern zu sich rufen. Sie und ihr Mann hatten zusammen von Hans geredet; er war ein frommer und kluger Junge, hatte Lust zum Lernen, und es war ihm leicht. Der liebe Gott ist immer für eine gute Sache.
An dem Abend kamen die Eltern recht froh vom Schloß nach Hause, besonders Kirsten, aber eine Woche später weinten sie, denn da reiste der kleine Hans; er hatte gute Kleider bekommen; er war ein guter Junge; aber jetzt sollte er über das salzige Wasser, weit fort, in die Schule geschickt werden, in eine gelehrte Schule, und es würden viele Jahre vergehen, ehe sie ihn wiedersahen.
Das Märchenbuch bekam er nicht mit, das wollten die Eltern zum Andenken behalten. Und der Vater las oft darin, aber immer nur die zwei Geschichten, denn die kannte er.
Und sie bekamen Briefe von Hans, einer immer glücklicher als der andere. Er war bei guten Menschen, in guten Verhältnissen,und am allerschönsten war es, zur Schule zu gehen; da war so viel zu lernen und zu wissen; er wünschte nur, daß er hundert Jahre alt werden möchte und daß er einmal Schullehrer werden könnte.
"Wenn wir das erleben sollten!" sagten die Eltern, und die drückten einander die Hände wie beim Abendmahl.
"Was ist doch nur aus Hans geworden!" sagte Ole. "Der liebe Gott denkt doch auch an die armen Kinder! Gerade bei dem Krüppel sollte sich das zeigen! Ist es nicht, als ob Hans uns das alles aus dem Märchenbuch vorgelesen hätte!"
DES HAUSWARTS SOHN
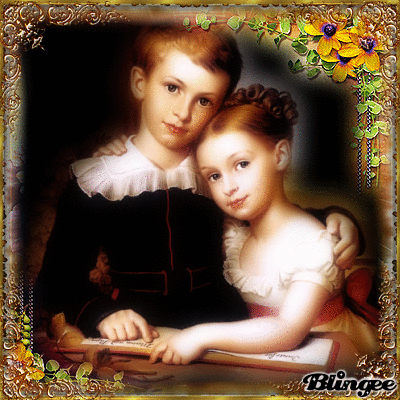
Der General wohnte im ersten Stockwerk, der Hauswart wohnte im Keller; es war ein großer Abstand zwischen den beiden Familien, das ganze Erdgeschoß und die Rangordnung; aber unter einem Dache wohnten sie und mit der Aussicht auf die Straße und den Hof. Und auf dem Hof war ein Rasenplatz mit einer blühenden Akazie, wenn sie blühte, und darunter saß zuweilen eine geputzte Amme mit dem noch mehr geputzten Kind des Generals, der "kleinen Emilie." Vor ihnen tanzte auf seinen bloßen Beinen des Hauswarts kleiner Junge mit den großen braunen Augen und dem dunklen Haar, und die Kleine lachte ihm zu und streckte die Händchen nach ihm aus, und wenn der General das von seinem Fenster aus sah, so nickte er hinunter und sagte: "Charmant!" Die Generalin selber, die so jung war, daß sie fast ihres Gatten Tochter aus einer frühen Ehe hätte sein können, sah nie zu dem Fenster auf den Hof hinaus, aber sie hatte Befehl gegeben, der kleine Junge aus dem Keller dürfe gern mit dem Kinde spielen, es aber nicht anrühren. Die Amme gehorchte genau dem Befehl der gnädigen Frau.
Und die Sonne schien zu den Bewohnern des ersten Stockwerks und zu denen im Keller hinein, die Akazie setzte Blüten an, und sie fielen wieder ab, und im nächsten Jahr kamen neue; der Baum blühte, und des Hauswarts kleiner Sohn blühte, er sah aus wie eine frische Tulpe.
Die kleine Tochter des Generals blieb fein und bleich wie das blaßrosa Blatt der Akazienblüte. Jetzt kam sie nur noch selten hinunter zu dem Baum, sie schöpfte frische Luft in der Kutsche. Sie fuhr mit Mama spazieren, und dann nickte sie immer Hauswarts Georg zu, ja, warf ihm ein Kußhändchen zu, bis ihre Mutter sagte, daß sie jetzt zu groß dazu sei.
Eines Morgens sollte er dem General die Zeitungen und Briefe hinaufbringen, die der Postbote unten beim Hauswart abgegeben hatte. Als er die Treppe hinauflief und an der Tür zum Sandloch vorbeikam, hörte er etwas da drinnen piepsen; er glaubte, es sei ein Küchlein, das sich dahinein verirrt habe, und statt dessen war es des Generals kleines Töchterchen in Flor und Spitzen.
"Sag es nur ja nicht Papa und Mama, denn dann werden sie böse!"
"Aber was ist denn dies hier, kleines Fräulein?" fragte Georg.
"Es brennt alles zusammen!" sagte sie. "Es brennt lichterloh!"
Georg öffnete die Tür zum Kinderzimmer. Die Gardine am Fenster war fast heruntergebrannt, der Gardinenhalter stand in Flammen. Georg sprang hinauf, riß die Stange herunter, rief Leute herbei; ohne ihn wäre ein Hausbrand entstanden.
Der General und die Generalin examinierten die kleine Emilie.
"Ich hab nur ein einziges Streichholz genommen," sagte sie, "da brannte es gleich, und die Gardine brannte auch gleich. Ich spuckte, um zu löschen, ich spuckte, soviel ich nur konnte, aber ich hatte nicht Spucke genug, und da lief ich hinaus und versteckte mich, weil Papa und Mama böse werden."
"Du spucktest!" sagte der General. "Was für ein Wort ist das! Wann hast du gehört, daß Papa oder Mama "spucken" gesagt haben? Das wirst du unten gehört haben!"
Aber der kleine Georg bekam vier Schilling. Die wurden nicht beim Konditor angelegt, sie wanderten in die Sparkasse, und bald waren da so viele Schillinge, daß er sich einen Malkasten kaufen konnte, und nun malte er alle seine Zeichnungen an. Er hatte eine ganze Menge Zeichnungen, die kamen ihm förmlich aus den Fingern und aus dem Bleistift heraus. Die ersten bunten Bilder schenkte er der kleinen Emilie.
"Charmant!" sagte der General; selbst die Generalin gab zu, daß man deutlich sehen könne, was der Kleine sich gedacht hatte. "Genie hat er!" Die Worte brachte die Frau des Hauswarts mit in den Keller hinab.
Der General und seine Frau waren vornehme Leute; sie hatten zwei Wappen an ihrem Wagen; eins für einen jeden von ihnen; die gnädige Frau hatte das Wappen auf jedem Kleidungsstück, auswendig und inwendig, auf ihrer Nachtmütze und ihrer Nachtzeugtasche. Das eine Wappen, das der Gnädigen, war ein kostbares Wappen, ihr Vater hatte es für blanke Taler gekauft, denn er war nicht damit geboren, sie auch nicht; sie war zu früh gekommen, sieben Jahre vor dem Wappen; dessen erinnerten sich die meisten Leute, nur nicht die Familie. Das Wappen des Generals war alt und groß, es war keine Kleinigkeit, es mit Anstand zu tragen, geschweige denn, zwei Wappen zu tragen. Das sah man der Generalin denn auch an, wenn sie steif und stattlich zum Hofball fuhr.
Der General war alt und grau, aber er saß gut zu Pferd, das wußte er, und jeden Tag ritt er aus, seinen Reitknecht in passendem Abstand hinter sich. Wenn er in Gesellschaft kam, so sah es aus, als komme er auf seinem hohen Roß hereingeritten, und er hatte so viele Orden, daß es fast unbegreiflich war, aber das war nun wirklich nicht seine Schuld. Als ganz junger Mann hatte er die militärische Karriere eingeschlagen und hatte alle die großen Herbstmanöver mitgemacht, die in Friedenszeiten über die Truppen abgehalten wurden. Aus jeder Zeit stammte eine Anekdote, die einzige, die er zu erzählen wußte: sein Unteroffizier schnitt einem der Prinzen den Rückzug ab und machte ihn zum Gefangenen, und nun mußte der Prinz mit seinem kleinen Trupp gefangener Soldaten, selber als Gefangener, hinter dem General her in die Stadt einreichen. Das war ein unvergleichliches Ereignis, das während all der Jahre von dem General wieder erzählt wurde mit genau denselben denkwürdigen Worten, die er gesagt hatte, als er dem Prinzen den Säbel wieder überreicht: "Nur mein Unteroffizier konnte Eure Hoheit gefangen nehmen, ich hätte es nie gekonnt!" Und der Prinz hatte ihm darauf geantwortet: "Sie sind unvergleichlich!" In einem wirklichen Krieg war der General niemals gewesen; als es wirklich Krieg gab, war der General zur Diplomatie übergegangen und hielt sich längere Zeit an drei verschiedenen ausländischen Höfen auf. Er sprach die französische Sprache so gut, daß er seine Muttersprache fast ganz vergaß; er tanzte gut, er ritt gut, eine Unmenge von Orden schmückten seine Brust; die Schildwachen präsentierten vor ihm, eins der schönsten Mädchen ward seine Gattin, und sie bekamen ein entzückendes kleines Kind, es war so liebreizend, daß man hätte denken können, es sei vom Himmel gefallen, und der Sohn des Hauswarts tanzte auf dem Hofe vor ihm und schenkte ihm alle seine bunt gemalten Zeichnungen, und die Kleine sah sie an und freute sich darüber und zerriß sie. Sie war so fein und so niedlich.
"Mein Rosenblatt!" sagte die Generalin. "Für einen Prinzen bist du geboren!" Der Prinz stand bereits draußen vor der Tür, man wußte es nur nicht; die Menschen sehen nicht weit über die Türschwelle hinaus.
"Neulich hat unser Junge, weiß Gott, sein Butterbrot mit ihr geteilt!" sagte die Frau des Hauswarts. "Es war weder Käse noch Fleisch darauf, aber es hat ihr geschmeckt, als wenn es Rinderbraten gewesen wäre. Das hätte was gegeben, wenn Generals die Mahlzeit gesehen hätten, aber sie haben es gottlob nicht gesehen!"
Georg hatte sein Butterbrot mit der kleinen Emilie geteilt; gern hätte er sein Herz mit ihr geteilt, wenn es ihr nur Vergnügen gemacht hätte. Er war ein guter Junge, er war aufgeweckt und klug, er besuchte jetzt die Abendschule der Akademie, um richtig zeichnen zu lernen. Die kleine Emilie machte ebenfalls Fortschritte in Bezug auf Kenntnisse; sie sprach französisch mit ihrer Bonne und hatte Unterricht beim Tanzmeister.
"Zu Ostern soll Georg eingesegnet werden!" sagte die Frau des Hauswarts; so weit war Georg.
"Am richtigsten wäre es wohl, wenn er dann in die Lehre käme," sagte der Vater. "Eine anständige Profession muß es sein! Und dann sind wir ihn aus dem Hause los!"
"Er wird doch bei uns schlafen müssen!" sagte die Mutter. "Es ist nicht leicht, einen Meister zu finden, der Platz hat. Kleiden müssen wir ihn ja auch, das bißchen Essen, was er ißt, werden wir auch schon aufbringen, mit ein paar gekochten Kartoffeln ist er ja zufrieden, freien Unterricht hat er. Laß du ihn nur seinen Weg gehen, du sollst sehen, wir werden Freude an ihm erleben, das hat der Professor auch gesagt!"
Der Konfirmationsanzug war fertig, Mutter hatte ihn selber genäht, aber er war vom Flickschneider zugeschnitten, und der hatte einen guten Schnitt; wäre er anders gestellt gewesen, so daß er eine Werkstatt mit Gesellen hätte halten können, so hätte der Mann sehr wohl Hofschneider werden können, sagte die Frau des Hauswarts.
Die Kleider waren fertig, und der Konfirmand war bereit. Georg erhielt an seinem Konfirmationstag eine große Tombakuhr von seinem Paten, dem alten Gehilfen des Speckhökers. der der wohlhabendste von Georgs Paten war. Die Uhr war alt und erprobt, sie ging immer vor, aber das ist besser, als wenn sie nachgeht. Das war ein kostbares Geschenk; und von Generals kam ein Gesangbuch in Saffianleder, von dem kleinen Fräulein gesandt, dem Georg so oft Bilder geschenkt hatte. Voran im Buch stand sein Name und ihr Name und "Huldvolle Gönnerin." Das war nach dem Diktat der Generalin geschrieben, und der General hatte es durchgelesen und "Charmant!" dazu gesagt.
"Das war wirklich eine große Aufmerksamkeit von einer so vornehmen Herrschaft," sagte die Frau des Hauswarts; und Georg mußte in seinem Konfirmationsanzug und mit dem Gesangbuch hinauf und sich bedanken. Die Generalin saß ganz eingehüllt da und hatte ihre großen Kopfschmerzen, die sie immer hatte, wenn sie sich langweilte. Sie sah Georg sehr freundlich an und wünschte ihm alles Gute und daß er niemals ihre Kopfschmerzen bekommen möchte. Der General war im Schlafrock und Zipfelmütze und hatte russische Stiefel mit roten Schäften an; er ging dreimal im Zimmer auf und nieder, in Gedanken und Erinnerungen versunken, dann blieb er stehen und sagte:
"Lieber Georg, so bist du denn also jetzt in die Christenheit aufgenommen! Sei auch ein braver Mann, der seine Obrigkeit ehrt! Wenn du einstmals ein alter Mann bist, kannst du sagen, daß dir der General diesen Ratschlag mit auf den Weg gegeben hat!"
Dies war eine längere Rede, als wie sie der General sonst hielt, darauf kehrte er wieder zu seinen stillschweigenden Betrachtungen zurück und sah vornehm aus. Doch von allem, was Georg hier oben sah und hörte, haftete das kleine Fräulein Emilie am festesten in seinem Gedächtnis. Wie süß und sanft war sie doch, wie schwebend, wie fein! Wenn sie abgezeichnet werden sollte, mußte es in einer Seifenblase geschehen. Es hing ein Duft in ihren Kleidern, in ihrem blondgelockten Haar, als sei sie ein eben erblühter Rosenstock; und mit ihr hatte er einmal sein Butterbrot geteilt! Sie hatte es mit mächtigem Appetit verzehrt und ihm bei jedem zweiten Bissen zugenickt. Ob sie sich dessen noch entsann? Freilich, sie hatte ihm ja in Erinnerung hieran das schöne Gesangbuch geschenkt, und als zum erstenmal wieder der erste Neumond im neuen Jahr am Himmel stand, ging er mit einem Stück Brot und einem Schilling hinaus und schlug im Gesangbuch auf, um zu sehen, welcher Gesang für ihn bestimmt sei. Es war ein Lob- und Danklied; und dann schlug er auf, um zu sehen, was der kleinen Emilie bestimmt sein würde; er nahm sich recht in acht, daß er nicht dort aufschlug, wo die Sterbelieder standen, und dann geriet er trotzdem zwischen Grab und Tod. Aber es war ja Unsinn, an so etwas zu glauben. Und doch ergriff ihn eine große Angst, als das reizende kleine Mädchen bald darauf das Bett hüten mußte und jeden Mittag der Wagen des Doktors vor der Tür hielt.
"Sie behalten sie nicht!" sagte die Frau des Hauswarts. "Der liebe Gott weiß auch, wen er gerne haben möchte!"
Aber sie behielten sie; und Georg zeichneten Bilder und schickte sie ihr; er zeichnete das Schloß des Zaren, den alten Kreml in Moskau, genau so, wie er dastand mit Kuppeln und Türmen, sie sahen aus wie sieben große grüne und vergoldete Gurken, wenigstens auf Georgs Zeichnung. Sie machten der kleinen Emilie so viel Vergnügen, und deswegen schickte ihr Georg im Laufe der Woche noch ein paar Bilder, alles Gebäude, denn dabei konnte er selber sich so viel denken hinter den Türen und Fenstern.
Er zeichnete ein chinesisches Haus mit einem Glockenspiel durch alle sechzehn Stockwerke; er zeichnete zwei griechische Tempel mit schlanken Marmorsäulen und einer Treppe ringsherum; er zeichnete eine Kirche aus Norwegen, man konnte sehen, daß sie ganz aus Balken war, ausgehauen und wunderlich zusammengestellt, jedes Stockwerk sah so aus, als habe es Wiegenkufen. Am schönsten war aber doch auf einem Blatt das Schloß, das er "Der kleinen Emilie Schloß" nannte. So sollte sie wohnen; das hatte sich Georg ganz genau ausgedacht, und er hatte zu diesem Schloß alles genommen, was er an den andern Gebäuden am schönsten fand. Es hatte geschnitzte Balken wie die norwegische Kirche, Marmorsäulen wie ein griechischer Tempel, ein Glockenspiel in jedem Stockwerk und ganz oben Kuppeln, grüne und vergoldete, wie am Kreml des Zaren. Es war ein richtiges Kinderschloß, und unter jedem Fenster stand geschrieben, wozu dieser Saal oder jenes Zimmer dienen sollte: hier schläft Emilie, hier tanzt Emilie, und hier spielt sie: Es kommt Besuch! Das war amüsant anzusehen, und es wurde gründlich angesehen.
"Charmant!" sagte der General.
Aber der alte Graf, denn da war ein alter Graf, der noch vornehmer war als der General und selber ein Schloß und ein Rittergut hatte, der sagte nichts; er hörte, daß es von dem kleinen Sohn des Hauswarts ersonnen und gezeichnet sei. Nun, so klein war er ja freilich nicht mehr; er war ja schon eingesegnet. Der alte Graf betrachtete die Bilder und hatte so seine eigenen, stillen Gedanken dabei.
Eines Tages, als das Wetter so recht grau und naß und gräßlich war, sollte sich der Tag für den kleinen Georg zu einem der lichtesten und besten gestalten. Der Professor der Kunstakademie ließ ihn zu sich kommen.
"Höre einmal, mein Freund, laß uns ein wenig miteinander plaudern! Der liebe Gott ist in Bezug auf Fähigkeiten sehr gut gegen dich gewesen, er ist auch in Bezug auf gute Menschen gut gegen dich. Der alte Graf dort von der Ecke hat mir von dir gesprochen; ich habe auch deine Bilder gesehen, darunter wollen wir einen Strich machen, es ist viel daran auszusetzen. Nun kannst du zweimal wöchentlich in meinen Zeichenunterricht kommen, dann wird es damit schon besser werden. Ich glaube, du hast mehr Anlage zum Baumeister als zum Maler; aber du hast ja Zeit genug, um dir das zu überlegen! Du mußt jedenfalls noch heute zu dem alten Grafen im Eckhaus gehen, und danke du deinem Schöpfer, daß er dir den Mann gesandt hat!"
Der Graf wohnte in einem großen Eckhaus; da waren ausgehauene Elefanten und Dromedare um die Fenster herum, alles aus alten Zeiten; aber der alte Graf interessierte sich am meisten für die neue Zeit und alles gute, was sie brachte, mochte es aus dem ersten Stockwerk, aus dem Keller oder der Mansarde kommen.
"Ich glaube," sagte die Frau des Hauswarts, "daß, je vornehmer die Leute wirklich sind, je weniger stellen sie sich an. Wie reizend und natürlich der alte Graf ist! Und er spricht, weiß Gott, geradeso wie du und ich; das können Generals nicht. Georg war ja gestern auch ganz aus dem Häuschen, weil der Graf so freundlich gegen ihn gewesen war; und heute, wo ich mit dem mächtigen Mann gesprochen hat, geht es mir geradeso! War es nun nicht ein Glück, daß wir den Jungen nicht in die Handwerkerlehre gegeben hatten! Talent hat er!"
"Aber das nützt alles nichts, wenn man keine Unterstützung von außen hat!" sagte der Vater.
"Die hat er jetzt!" sagte die Mutter. "Der Graf sprach sich ganz klar und deutlich darüber aus!"
"Von Generals ist das Ganze aber doch ausgegangen!" sagte der Vater. "Bei denen müssen wir uns auch bedanken."
"Das können wir ja gern tun," sagte die Mutter, "wenn ich auch gerade nicht einsehen kann, was wir denen groß zu verdanken haben. Aber dem lieben Gott will ich danken, und ich will mich auch bei ihm dafür bedanken, daß die kleine Emilie wieder besser wird!"
Die kleine Emilie machte wirklich Fortschritte, und Georg machte auch Fortschritte; im Lauf des Jahres bekam er die kleine silberne Medaille und später auch die große.
"Es wäre doch besser gewesen, wenn wir ihn in die Handwerkerlehre gegeben hätten," sagte die Frau des Hauswarts und weinte, "dann hätten wir ihn jetzt behalten. Was soll er in Rom? Ich krieg ihn nie wieder zu sehen, selbst wenn er je wieder nach Hause kommt, aber er kommt nie wieder nach Hause, das süße Kind!"
"Das ist aber doch sein Glück und sein Ruhm!" sagte der Vater.
"Ja, das sagst du wohl!" entgegnete die Mutter. "Du sagst auch vieles, was du gar nicht meinst! du bist ebenso betrübt wie ich!"
Und es hatte seine Richtigkeit mit der Betrübnis und mit der Abreise. Es sei ein großes Glück für den jungen Menschen, sagten alle Leute.
Und nun ging es ans Abschiednehmen. Auch beim General; aber die Gnädige ließ sich nicht blicken, sie hatte ihre großen Kopfschmerzen. Der General erzählte zum Abschied seine einzige Anekdote, was er zu dem Prinzen gesagt hatte und was der Prinz zu ihm gesagt hatte: "Sie sind unvergleichlich!" Und dann reichte er Georg die Hand.
Auch Emilie reichte Georg ihre Hand und sah beinahe betrübt aus, aber am allerbetrübtesten war doch Georg.
Die Zeit vergeht, wenn man etwas tut, sie vergeht auch, wenn man nichts tut. Die Zeit ist gleich lang, aber nicht gleich nützlich. Für Georg war sie nützlich und gar nicht lang, außer wenn er an die Lieben in der Heimat dachte. Wie mochte es untern und oben aussehen? Ja, darüber ward geschrieben; und man kann so viel in einen Brief hineinlegen, den lichten Sonnenschein und die schweren, trüben Tage. Die lagen im Brief, sie meldeten, daß der Vater gestorben und die Mutter allein zurückgeblieben war. Die kleine Emilie sei ein wahrer Engel des Trostes gewesen, sie sei zu ihr in die Kellerwohnung gekommen, schrieb die Mutter, und über sich selber fügte sie hinzu, daß man ihr erlaubt habe, den Hauswartposten zu behalten.
Die Generalin führte Tagebuch; darin waren jede Gesellschaft, jeder Ball, den sie besucht hatte, aufgeführt, auch alle Visiten, die sie erhielt. Das Tagebuch war mit den Visitenkarten der Diplomaten und des höchsten Adels illustriert. Sie war stolz auf ihr Tagebuch, es wuchs im Laufe langer Jahre, vieler Jahre, unter vielen großen Kopfschmerzen, aber auch in vielen hellen Nächten, das heißt auf Hofbällen. Emilie war zum erstenmal auf einem Hofball gewesen; die Mutter war in Rosa mit schwarzen Spitzen: spanisch! Die Tochter in Weiß, so klar und fein. Grüne, seidene Bänder flatterten wie Schilf in dem blonden Lockenhaar, auf dem ein Kranz von weißen Seerosen ruhte; die Augen waren so blau und klar, der Mund so fein und rot, sie glich einer kleinen Seejungfrau, so lieblich, wie man sie sich nur denken kann. Drei Prinzen tanzten mit ihr, daß heißt, erst der eine und dann der andere; die Generalin hatte acht Tage lang keine Kopfschmerzen.
Aber der erste Ball blieb nicht der letzte, das konnte Emilie nicht aushalten, daher war es gut, daß der Sommer mit Ruhe und Aufenthalt in der frischen Luft kam. Die Familie war auf das Schloß des alten Grafen eingeladen.
Das war ein Schloß und ein Garten, die es sich zu sehen verlohnte. Ein Teil davon war ganz wie in alten Zeiten mit steifen, grünen Hecken, als gehe man zwischen grünen Schirmwänden, in denen Gucklöcher waren. Buchsbaum und Taxus standen zu Sternen und Pyramiden ausgeschnitten da, das Wasser sprang aus großen Grotten, die mit Muschelschalen belegt waren; ringsumher standen steinerne Figuren aus allerschwerstem Stein, das konnte man den Gesichtern und auch den Kleidern ansehen; jedes Blumenbeet hatte seine Gestalt, als Fisch, Wappenschild oder Namenszug, das war der französische Teil des Garten; aus dem gelangte man gleichsam in den freien, frischen Wald hinein, wo die Bäume wachsen duften, wie sie wollten, und daher so groß und prächtig waren; das Gras war grün, und man durfte darauf gehen, es wurde auch gewalzt, geschnitten, gepflegt und gehütet; das war der englische Teil des Garten.
"Alte Zeit und neue Zeit!" sagte der Graf. "Hier gleiten sie auch so gut ineinander hinein! In zwei Jahren wird das Schloß selber sein richtiges Aussehen bekommen, das wird eine ganze Verwandlung zu etwas Schönem und Besserm werden; ich werde Ihnen die Zeichnungen zeigen, und auch den Baumeister werde ich Ihnen zeigen, er ist heute zu Tische hier!"
"Charmant!" sagte der General.
"Es ist paradiesisch hier!" sagte die Generalin. "Und da haben Sie ja eine Ritterburg!"
"Das ist mein Hühnerhaus!" sagte der Graf. "Die Tauben wohnen im Turm, die Kalikuten im ersten Stockwerk, aber im Erdgeschoß regiert die alte Else. Sie hat Fremdenzimmer nach allen Seiten: die Glucken für sich, die Hühner und Küchlein für sich, und die Enten, ja, die haben freien Zutritt zum Wasser!"
"Charmant!" wiederholte der General.
Und sie gingen alle hinein, um diese Herrlichkeit zu sehen.
Die alte Else stand mitten in der Stube, und neben ihr stand Georg; er und die kleine Emilie sahen sich nach mehreren Jahren im Hühnerhaus wieder.
Ja, hier stand er, und er war gar schön vom Aussehen; sein Gesicht war offen und bestimmt, er hatte schwarzes, glänzendes Haar und um den Mund ein Lächeln, das zu sagen schien: hinter meinem Ohr sitzt ein Schelm, der kennt euch aus und ein. Die alte Else hatte ihre Holzschuhe ausgezogen und stand auf Socken da, zu Ehren der vornehmen Gäste. Und die Hühner glucksten, und der Hahn krähte, die Enten watschelten "gack, gack!" Aber das feine, blasse Mädchen, die Tochter des Generals, stand da mit einem Rosenschimmer auf den sonst so bleichen Wangen, ihre Augen wurden so groß, und ihr Mund redete, ohne daß er auch nur ein einziges Wort gesagt hätte, und der Gruß, den Georg erhielt, war der entzückendste Gruß, den ein junger Mann sich von einer jungen Dame wünschen konnte, mit der er nicht verwandt war oder mit der er nicht sehr oft getanzt hatte; sie und der Baumeister hatten aber niemals zusammen getanzt.
Der Graf drückte ihm die Hand und stellte ihn vor. "Ganz fremd ist er Ihnen nicht, unser junger Freund, Herr Georg!"
Die Generalin verneigte sich, die Tochter war kurz davor, ihm die Hand zu reichen, aber sie reichte sie ihm doch nicht.
"Unser lieber Herr Georg!" sagte der General. "Alte Hausfreunde! Charmant!"
"Sie sind ja vollständig Italiener geworden!" sagte die Generalin. "Und Sie sprechen die Sprache wohl wie ein Eingeborener!"
Die Generalin singe die Sprache, spreche sie aber nicht, sagte der General.
Bei Tische saß Georg zu Emiliens Rechten, der General führte sie, der Graf führte die Generalin.
Herr Georg sprach und erzählte, und er erzählte so gut, er war das Wort und der Geist bei Tische, obwohl der alte Graf es auch sein konnte. Emilie saß stumm da, die Ohren hörten, die Augen strahlten.
Aber sie sagte nichts.
Auf der Veranda zwischen den Blumen standen sie und Georg, die Rosenhecke entzog sie den Blicken. Georg hatte wieder das Wort, hatte es zuerst.
"Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit gegen meine alte Mutter!" sagte er. "Ich weiß alles, in der Nacht, als mein Vater starb, kamen Sie zu Mutter hinunter und waren bei ihr, bis seine Augen sich geschlossen hatten, ich danke Ihnen!" Er ergriff Emiliens Hand und küßte sie, das konnte er wohl tun bei der Gelegenheit, sie ward dunkelrot, drückte ihm aber die Hand und sah ihn mit ihren blauen, herzensguten Augen an.
"Ihre Mutter war eine liebevolle Seele" Wie hat sie Sie geleibt! Und alle Ihre Briefe ließ sie mich lesen, ich glaube fast, ich kenne Sie! Wie freundlich waren Sie gegen mich, als ich noch klein war, Sie schenkten mir Bilder -!"
"Die Sie zerrissen!" sagte Georg. "Nein, ich habe mein Schloß noch, die Zeichnung!"
"Nun muß ich es wirklich bauen!" sagte Georg, und er wurde selber ganz warm bei dem, was er sagte.
Der General und die Generalin sprachen in ihren eigenen Zimmern über den Sohn des Hauswarts, er wisse sich ja zu bewegen und drücke sich mit Verstand und Kenntnissen aus. Er könnte Informator sein!" sagte der General. "Geist!" sagte die Generalin, und dann sagte sie nichts weiter.
In der schönen Sommerzeit kam Herr Georg häufiger auf das Schloß des Grafen. Er ward vermißt, wenn er nicht kam.
"Wieviel doch der liebe Gott Ihnen vor uns andern armen Menschen voraus gegeben hat!" sagte Emilie zu ihm. "Erkennen Sie das nun auch so recht an?" Es schmeichelte Georg, daß das schöne junge Mädchen zu ihm aufsah, erfand sie so ungewöhnlich begabt.
Und der General gelangte mehr und mehr zu der Überzeugung, daß Georg unmöglich ein Kellerkind sein könne. "Die Mutter war freilich eine sehr anständige Frau," sagte er, "das muß ich ihr im Grabe nachsagen!"
Der Sommer verging, der Winter kam, da sprach man wieder von Herrn Georg; er war selbst höchsten Ortes gern gesehen und gut aufgenommen, der General war ihm auf einem Hofball begegnet.
Jetzt sollte im Hause ein Ball zu Ehren von Emilie stattfinden. Ob man Herrn Georg einladen konnte?
"Wen der König einladet, den kann auch der General einladen!" sagte der General und erhob sich einen ganzen Zoll vom Fußboden in die Höhe.
Herr Georg wurde eingeladen und er kam; und es kamen Grafen und Prinzen und der eine tanzte immer noch besser als der andere; aber Emilie konnte nur den ersten Tanz tanzen; in dem vertrat sie sich den Fuß, nicht schlimm, aber sie fühlte es doch, und da mußte sie vorsichtig sein, mit dem Tanzen innehalten und den andern zusehen. So saß sie denn da und sah zu, und der Baumeister stand neben ihr.
"Sie schildern ihr wohl die ganze Peterskirche?" sagte der General, indem er vorüberging und wohlwollend lächelte.
Mit demselben Lächeln empfing er Herrn Georg einige Tage später. Der junge Mann kam natürlich, um für die Balleinladung zu danken, was sollte ihn sonst auch herführen? Ja, das Überraschendste, Erstaunlichste führte ihn her: mit wahnwitzigen Worten kam er, der General wollte seinen Ohren nicht trauen; "pyramidale Deklamation," ein ganz undenkbares Ansinnen: Herr Georg bat um Emiliens Hand!
"Mensch!" sagte der General und bekam einen dunkelroten Kopf. "Ich begreife Sie nicht! Was sagen Sie? Was wollen Sie? Ich kenne Sie nicht! Mein Herr! Mensch! Wie kommen Sie darauf, in mein Haus einzubrechen! Darf ich hier sein, oder darf ich nicht hier sein?" Und damit ging er rücklings in sein Schlafzimmer, drehte den Schlüssel um und ließ Herrn Georg allein dastehen. Der blieb einige Minuten stehen und drehte sich dann ebenfalls um. Im Korridor stand Emilie.
"Nun, was sagte mein Vater?" fragen sie, und ihre Stimme bebte.
Georg drückte ihr die Hand. Er lief vor mir davon! Aber es werden schon bessere Zeiten kommen!"
In Emiliens Augen standen Tränen; aus des jungen Mannes Augen strahlten Zuversicht und Mut; und die Sonne beschien die beiden und gab ihnen ihren Segen.
Kochend vor Wut saß der General in seinem Zimmer; ja, es kochte noch in ihm, es kochte über in Worten und Ausdrücken: "Wahnsinn! Hauswartsirrsinn!" -
Eine Stunde war vergangen, da hatte die Generalin es aus des Generals eignem Munde vernommen, und sie rief Emilie zu sich und schloß sich mir ihr ein.
"Du armes Kind! Dich so zu beleidigen! Uns so zu beleidigen! Auch du hast Tränen in den Augen, aber das steht dir! Du bist bezaubernd in Tränen! Du gleichst mir an meinem Hochzeitstage. Weine nur, liebe Emilie!"
"Ja, weinen muß ich," sagte Emilie, "falls du und Vater nicht ja sagt!"
"Kind," rief die Generalin, "bist du krank? Du redest im Irrsinn, und ich bekomme meine schrecklichen Kopfschmerzen. Ach, welch Unglück ist über unser Haus gekommen! Du willst doch nicht, daß deine Mutter stirbt! Emilie, dann hast du keine Mutter mehr!"
Und die Augen der Generalin wurden feucht, sie konnte es nicht aushalten, an ihren eignen Tod zu denken.
In der Zeitung stand unter andern Ernennungen zu Lesen: Herr Georg zum Professor ernannt, fünfte Rangklasse Nummer acht.
"Schade, daß seine Eltern im Grabe liegen und das nicht lesen können," sagten die neuen Hauswartsleute, die jetzt im Keller unter dem General wohnten; sie wußten, daß der Professor innerhalb ihrer vier Wände geboren und aufgewachsen war.
"Ja, für den Titel muß er ein gutes Stück Geld bezahlen!" sagte der Mann.
"Ach, was macht der sich aus den paar Talern," sagte die Frau, "die kann er sich leicht wieder verdienen. Und eine reiche Frau kriegt er natürlich auch. Wenn wir Kinder hätten, dann sollte unser Kind auch Baumeister und Professor werden."
Georg bekam eine gute Nachrede im Keller, aber auch im ersten Stockwerk wurde gut von ihm gesprochen, das erlaubte sich der alte Graf.
Die Zeichnungen aus der Kinderzeit gaben den Anlaß dazu. Aber weshalb sprach man von diesen Zeichnungen? Die Rede war auf Rußland gekommen, aus Moskau, und dann lag ja der Kreml so nahe, und ein Kreml hatte der kleine Georg einmal für Fräulein Emilie gezeichnet, er hatte so viele Bilder gezeichnet; des einen erinnerte sich der Graf noch ganz besonders: "Emiliens Schloß," wo sie schlief, wo sie tanzte und "Es kommt Besuch" spielte; der Professor besaß große Tüchtigkeit, er würde gewiß als alter Konferenzrat sterben, das war gar nicht unmöglich, und vorher würde er wohl auch ein Schloß für die jetzt noch so junge Dame erbaut haben; warum auch nicht?
"Das war ja eine sonderbare Ausgelassenheit!" bemerkte die Generalin, als der Graf gegangen war. Der General schüttelte nachdenklich den Kopf, ritt aus, den Reitknecht in geziemendem Abstand hinter sich, und saß stolzer denn je zu Roß.
Es war Emiliens Geburtstag, Blumen und Bücher, Briefe und Visitenkarten wurden gebracht; die Generalin küßte sie auf den Mund, der General auf die Stirn; es waren liebevolle Eltern. Und es kam hoher Besuch, zwei von den Prinzen. Man sprach von Bällen und vom Theater, von diplomatischen Sendungen, von der Regierung der Länder und Reiche. Man sprach von Tüchtigkeit, von des eignen Landes Tüchtigkeit, und dadurch kam die Rede auf den jungen Professor, den Herrn Baumeister.
"Der baut für seine Unsterblichkeit," wurde gesagt, "er baut sich auch wohl in eine unser ersten Familien hinein!"
"Eine der ersten Familien!" wiederholte später der General der Generalin gegenüber. "Wer ist eine unserer ersten Familien?"
"Ich weiß, worauf angespielt wurde," sagte die Generalin, "aber ich sage es nicht! Gott lenkt die Geschicke! Wundern soll es mich aber doch!"
"Ich möchte mich gern mit dir wundern!" sagte der General. "Ich habe keine Ahnung!" Und er versank in Gedanken.
Es liegt eine Macht, eine unaussprechliche Macht in dem Gnadenquell von oben; Hofgunst, Gottes Gunst - und die Gunst all dieser Gnade besaß der kleine Georg. Aber wir vergessen den Geburtstag.
Emiliens Zimmer duftete von Blumen, die ihr Freunde und Freundinnen gesandt, auf dem Tische lagen schöne Geschenke als Grund und zur Erinnerung, aber nicht die geringste Gabe von Georg. Die konnte nicht kommen, brauchte auch nicht zu kommen, das ganze Haus war eine Erinnerung an ihn. Selbst aus dem Sandloch unter der Treppe guckte die Erinnerungsblume hervor; dort hatte Emilie gepiepst, als die Gardine brannte und Georg als erste Spritze kam. Ein Blick zum Fenster hinaus und der Akazienbaum erinnerte an die Kinderzeit. Blüten und Blätter waren abgefallen, aber der Baum stand mit Reif bedeckt da wie ein ungeheurer Korallenzweig; und der Mond schien klar und groß zwischen den Zweigen hindurch, unverändert in all seiner Veränderlichkeit, ganz so wie damals, als Georg sein Butterbrot mit der kleinen Emilie teilte.
Sie nahm aus der Schublade die Zeichnungen von des Zaren Schloß und von ihrem eigenen Schloß, Erinnerungen an Georg. Und sie sah sie an und hatte ihre Gedanken dabei; sie gedachte des Tages, als sie unbemerkt von Vater und Mutter zu der Frau des Hauswarts hinabging, die in den letzten Zügen lag; sie hatte bei ihr gesessen, ihre Hand gehalten und ihre letzten Worte "Segen! - Georg!" gehört. Die Mutter dachte an ihren Sohn. - Jetzt legte Emilie ihre Bedeutung dahinein. Ja, Georg war an ihrem Geburtstag bei ihr!
An nächsten Tage war wieder ein Geburtstag dort im Hause, der Geburtstag des Generals; er war am Tage nach seiner Tochter geboren, natürlich früher als sie, viele Jahre früher. Und es kamen wieder Geschenke, und unter diesen ein Sattel von prächtigem Aussehen, bequem und köstlich, nur einer von den Prinzen hatte einen ebensolchen. Von wen kam der? Der General war entzückt. Ein kleiner Zettel lag dabei, und darauf stand geschrieben: "Von einem, den der Herr General nicht kennt!"
"Wen in aller Welt kenne ich nicht!" sagte der General. "Alle Menschen kenne ich!" Und sein Gedanke durchschweifte die ganze große Gesellschaft; er kannte sie alle. "Er ist von meiner Frau!" sagte er schließlich. "Sie will mich necken! Charmant!"
Aber die neckte nicht mehr, die Zeiten waren vorüber.
Und es war abermals ein Fest, ein großes Fest, aber diesmal nicht bei Generals; es war ein Kostümball bei einem der Prinzen; Masken waren ebenfalls gestattet.
Der General erschien als Rubens, in spanischer Tracht mit kleinem Tollenkragen, Degen und guter Haltung; die Generalin war Madame Rubens, in schwarzem Sammet, hoch am Halse, schrecklich warm, mit einem Mühlstein um den Hals, das heißt natürlich mit einem großen Tollenkragen, ganz nach einem holländischen Gemälde, das der General besaß und an dem namentlich die Hände bewundert wurden, die sahen ganz so aus wie die der Generalin.
Emile war Psyche, in Flor und Spitzen. Sie war wie eine schwebende Schwanenflaumfeder, sie brauchte gar keine Flügel, sie trug sie nur als Psyche-Abzeichen.
Da war ein Glanz, eine Pracht, da waren Licht und Blumen, Reichtum und Geschmack; da war so viel zu sehen, daß man Madame Rubens' schöne Hände gar nicht beachtete.
Ein schwarzer Domino mit einer Akazienblüte auf der Kapuze tanzte mit Psyche.
"Wer ist das?" fragte die Generalin.
"Seine königliche Hoheit!" sagte der General. "Ich bin meiner Sache ganz sicher, ich habe ihn gleich am Händedruck erkannt!"
Die Generalin zweifelte.
General Rubens zweifelte nicht, näherte sich dem schwarzen Domino und schrieb ihm königliche Buchstaben in die Hand; sie wurden verneint, aber es wurde ein Fingerzeig gegeben:
"Die Devise des Sattels" Einer, den der Herr General nicht kennt!"
"Aber dann kenne ich Sie ja!" sagte der General. "Sie haben mir den Sattel geschenkt!"
Der Domino erhob die Hand und verschwand unter der Menge.
"Wer ist der schwarze Domino, mit dem du tanztest, Emilie?" fragte die Generalin.
"Ich habe nicht nach seinem Namen gefragt," antwortete sie.
"Weil du es wußtest! Es ist der Professor! Ihr Protége, Herr Graf, ist hier!" fuhr sie fort und wandte sich an den Grafen, der in der Nähe stand. "Schwarzer Domino mit Akazienblute!"
"Wohl möglich, meine Gnädige!" antwortete der Graf. "Aber einer der Prinzen ist übrigens ebenso kostümiert."
"Ich kenne den Händedruck!" sagte der General. "Von dem Prinzen habe ich den Sattel. Ich bin meiner Sache so sicher, daß ich ihn zu uns einladen kann."
"Tun Sie das!" sagte der Graf. "Wenn es der Prinz ist, so kommt er sicher!"
"Und ist es ein anderer, so kommt er sicher nicht!" sagte der General und näherte sich dem schwarzen Domino, der gerade dastand und mit dem König redete. Der General bracht eine sehr ehrerbietige Einladung vor, damit sie einander kennenlernen könnten. Er lächelte so sicher in seiner Gewißheit, wen er einlud; er sprach laut und deutlich.
Der Domino lüftete seine Maske: es war Georg.
"Wiederholen der Herr General die Einladung?"
Der General wurde allerdings einen Zoll großer, nahm eine festere Haltung an, trat zwei Schritte zurück und einen Schritt vor wie bei einem Menuett, und es lag Ernst und Ausdruck in des Generals Gesicht, soviel sich hineinlegen ließ.
"Ich nehme niemals mein Wort zurück; der Herr Professor ist eingeladen!" Und er verneigte sich mit einem Blick auf den König, der sicher das Ganze gehört hatte.
Und dann war die Mittagsgesellschaft bei Generals, und es waren nur der alte Graf und sein Protége eingeladen.
"Wenn ich erst den Fuß unterm Tisch habe," meinte Georg, "so ist auch schon der Grundstein gelegt!"
Und der Grundstein wurde wirklich unter großer Feierlichkeit bei dem General und der Generalin gelegt.
Georg war erschienen und hatte sich, wie der General das ja an ihm kannte, ganz wie ein Mann aus der guten Gesellschaft unterhalten, war höchst interessant gewesen, der General hatte mehrmals sein "Charmant" sagen müssen. Die Generalin sprach von ihrem kleinen Diner, sprach auch zu einer der Hofdamen davon, und diese, eine der geistreichsten Hofdamen, bat sich eine Einladung für das nächste Mal aus, wo der Professor kommen würde. Da mußte er ja wieder eingeladen werden, und er wurde eingeladen und kam und war wieder charmant, konnte sogar Schach spielen.
"Der ist nicht aus dem Keller," sagte der General, "er ist ganz sicher von vornehmer Herkunft, und daran ist der junge Mann ganz unschuldig!"
Der Professor, der in des Königs Hause verkehrte, konnte sehr wohl in des Generals Haus verkehren, aber von einem Festwachsen war keine Rede, außer in der ganzen Stadt.
Es wuchs fest. Der Tau der Gnade fiel von oben!
Es war daher gar keine Überraschung, daß, als der Professor Etatsrat wurde, Emilie Etatsrätin würde.
"Das Leben ist eine Tragödie oder eine Komödie!" sagte der General. "In der Tragödie sterben sie, in der Komödie kriegen sie sich!"
Hier kriegen sie sich. Und sie bekamen drei prächtige Jungen, aber nicht sofort.
Die süßen Kinder ritten auf ihren Steckenpferden durch Stuben und Säle, wenn sie bei Großvater und Großmutter waren. Und der General ritt auch auf dem Steckenpferd, ritt hinter ihnen her, "als Jockey hinter den kleinen Etatsräten!"
Die Generalin saß auf dem Sofa und lächelte, selbst wenn sie ihre großen Kopfschmerzen hatte.
Wie weit brachte Georg es und noch viel weiter, sonst wäre es ja nicht wert gewesen, die Geschichte von des Hauswarts Sohn zu erzählen.
DER SCHATTEN ...
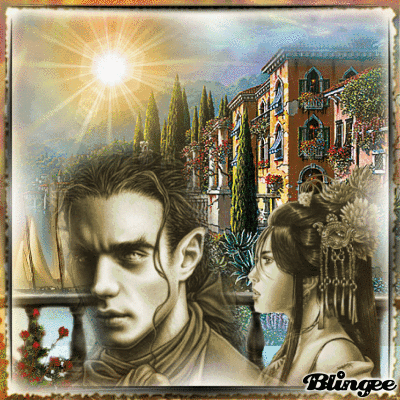
In den heißen Ländern brennt die Sonne freilich anders als bei uns. Die Leute werden ganz mahagonibraun, ja, in den allerheißesten Ländern brennen sie gar zu Mohren. Aber es war nur zu den heißen, wohin ein gelehrter Mann aus den kalten Ländern gekommen war. Der glaubte nun, daß er dort umherlaufen könne wie zu Hause; aber das gewöhnte er sich bald ab. Er und alle vernünftigen Leute mußten drinnen bleiben. Die Fensterläden und Türen blieben den ganzen Tag über geschlossen; es sah aus, als schliefe das ganze Haus oder als sei niemand zu Hause. Die schmale Straße mit den hohen Häusern, wo er wohnte, war nun auch gerade so gebaut, daß die Sonne vom Morgen bis zum Abend darauf liegen mußte; es war wirklich nicht auszuhalten!
Der gelehrte Mann aus den kalten Ländern – er war ein junger Mann und ein kluger Mann – meinte fast, er säße in einem glühenden Ofen. Das zehrte an ihm; er wurde ganz mager. Selbst sein Schatten schrumpfte zusammen; er wurde viel kleiner als zu Hause, die Sonne zehrte auch an diesem. – Erst am Abend lebten sie auf, wenn die Sonne untergegangen war. –
Es war ein wahres Vergnügen, es mit anzusehen; sobald das Licht in die Stube gebracht wurde, reckte sich der Schatten an der Wand hinauf, ja sogar bis an die Decke hin, so lang machte er sich. Er mußte sich strecken, um wieder zu Kräften zu kommen. Der Gelehrte ging auf den Altan hinaus, um sich dort zu strecken, und sobald die Sterne aus der klaren, herrlichen Luft herabschimmerten, war es ihm, als ob er wieder auflebte. Auf allen Altanen der Straße – und in den warmen Ländern hat jedes Fenster einen Altan – kamen die Leute hervor; denn Luft muß man haben, selbst wenn man daran gewöhnt ist, mahagonifarben zu sein. Überall oben und unten wurde es lebendig. Schuhmacher und Schneider, alle Leute zogen auf die Straße hinaus, Tische und Stühle kamen zum Vorschein, das Licht brannte, ja, über tausend Lichter brannten, und der eine sprach und der andere sang; die Leute spazierten, die Wagen fuhren, die Esel trabten: klingelingeling! denn sie trugen Glöckchen. Da wurden die Toten unter Psalmengesang begraben, die Straßenjungen schossen mit Leuchtkugeln, und die Kirchenglocken läuteten; fürwahr, jetzt herrschte Leben in der Straße! Nur in einem Hause, gerade gegenüber der Wohnung des fremden gelehrten Mannes, war es ganz stille. Und doch wohnte dort jemand, denn auf dem Altan standen Blumen, die gar herrlich trotz der Sonnenhitze gediehen, das hätten sie nicht gekonnt, ohne begossen zu werden, und jemand mußte sie ja begießen. Leute mußten also da sein. Die Tür drüben zum Altan hinaus wurde auch des Abends geöffnet, aber drinnen war es dunkel, wenigstens in dem vordersten Zimmer. Tiefer innen ertönte Musik. Dem fremden, gelehrten Mann erschien diese Musik unvergleichlich schön. Aber das war möglicherweise auch nur Einbildung von ihm; denn er fand alles unvergleichlich schön draußen in den warmen Ländern, wenn nur keine Sonne dagewesen wäre. Der Wirt des Fremden sagte, er wisse auch nicht, wer das gegenüberliegende Haus gemietet habe, man sähe ja keine Leute, und was die Musik anginge, meinte er, daß sie gräßlich langweilig wäre. "Es ist gerade, als säße einer und übte ein Stück, mit dem er nicht fertig werden kann, immer dasselbe Stück. Ich bekomme es noch heraus, denkt er, aber es gelingt ihm doch nicht, solange er, auch spielt."
Eines Nachts erwachte der Fremde. Er schlief bei offener Altantür; da lüftete sich der Vorhang vor derselben im Winde, und es kam ihm vor, als ob ein wunderbarer Glanz von dem Altan gegenüber käme. Alle Blumen leuchteten wie Flammen in den herrlichsten Farben, und mitten zwischen den Blumen stand eine schlanke, liebliche Jungfrau; es war, als ob auch von ihr ein Glanz ausginge. Es blendete ihn fast, er hatte aber die Augen auch gewaltig aufgerissen, als er so plötzlich aus dem Schlafe kam. Mit einem Sprung stand er auf dem Fußboden und schlich sich ganz leise hinter den Vorhang, aber die Jungfrau war fort, der Glanz war fort, und die Blumen leuchteten gar nicht, sondern standen nur sehr frisch und üppig wie immer. Die Türe drüben war angelehnt, und tief von innen heraus klang die Musik so sanft und lieblich, daß man dabei in die süßesten Gedanken versinken konnte. Das war wie ein Zauber, wer mochte nur da wohnen? Wo war der eigentliche Eingang? Im ganzen Erdgeschoß lag Laden an Laden, dort konnten die Leute doch nicht immer hindurchlaufen.
Eines Abends saß der Fremde draußen auf seinem Altan. In der Stube hinter ihm brannte Licht, und so war es ganz natürlich, daß sein Schatten auf die gegenüberliegende Wand fiel. Ja, er saß gerade gegenüber zwischen den Blumen auf dem Altan, und wenn der Fremde sich bewegte, bewegte sich der Schatten auch, denn das tut er.
"Ich glaube, mein Schatten ist das einzige Lebendige, was man da drüben sieht!" sagte der gelehrte Mann. "Sieh, wie nett er zwischen den Blumen sitzt. Die Tür steht nur halb angelehnt, nun sollte er so pfiffig sein, hineinzugehen und sich umzusehen; dann müßte er zu mir zurückkommen und erzählen, was er gesehen habe! Ja, Du solltest sehen, daß Du Dich nützlich machst!" sagte er im Scherz. "Sei so freundlich und gehe hinein! Na, wirst Du wohl gehen?" Und dann nickte er dem Schatten zu, und der Schatten nickte ihm zu. "Ja, geh nur, aber bleibe nicht dort!" Und der Fremde erhob sich und sein Schatten auf dem gegenüberliegenden Altan erhob sich auch; der Fremde wandte sich um und der Schatten wandte sich auch um; Ja hätte jemand genau acht gegeben, so hätte er deutlich sehen können, daß der Schatten in die halboffene Tür gegenüber hineinging, gerade als der Fremde in sein Zimmer ging und den langen Vorhang hinter sich niederfallen ließ.
Am nächsten Morgen ging der gelehrte Mann aus, um Kaffee zu trinken und die Zeitungen zu lesen. "Was ist das?" fragte er, als er in den Sonnenschein hinaustrat, "ich habe ja keinen Schatten! Also ist er wirklich gestern abend fortgegangen und nicht wiedergekommen; das ist recht unangenehm!"
Und es ärgerte ihn; jedoch nicht so sehr, daß der Schatten fort war, sondern weil er wußte, daß es eine Geschichte von einem Mann ohne Schatten gab, die jedermann daheim in den kalten Ländern kannte, und käme nun der gelehrte Mann dorthin und erzählte sein Erlebnis, so würden alle Leute sagen, daß es eine Kopie sei, und das hatte er nicht nötig. Er nahm sich daher vor, überhaupt nicht davon zu reden, und das war vernünftig gedacht.
Am Abend ging er wieder auf seinen Altan hinaus, Das Licht hatte er ganz richtig hinter sich gesetzt, denn er wußte, daß ein Schatten stets seinen Herrn als Schirm haben will; aber er konnte ihn nicht herbeilocken. Er machte sich klein, er machte sich groß, aber kein Schatten war da, es kam auch keiner. Er sagte: "Hm, hm," aber auch das half nichts.
Ärgerlich war es zwar, aber in den warmen Ländern wächst alles so geschwind. Nach Verlauf von acht Tagen merkte er zu seinem großen Vergnügen, daß ihm ein neuer Schatten von den Beinen aus wuchs, wenn er in die Sonne trat. Die Wurzel mußte sitzen geblieben sein. Nach drei Wochen hatte er einen ganz leidlichen Schatten, der, als er sich heimwärts nach den nördlichen Ländern begab, auf der Reise mehr und mehr wuchs, bis er zuletzt so lang und groß war, daß die Hälfte auch genügt hätte.
So kam der gelehrte Mann nach Hause, und er schrieb Bücher über die Wahrheit in der Welt und über das Gute und Schöne, und es vergingen Tage und Jahre; es vergingen viele Jahre.
Da sitzt er eines Abends in seinem Zimmer, und es klopft ganz leise an die Tür.
"Herein" sagte er, aber es kam niemand. Da schließt er auf, und vor ihm steht ein so außergewöhnlich magerer Mensch, daß es ihm ganz wunderlich zumute wurde. Im übrigen war der Mensch durchaus fein gekleidet; es mußte ein vornehmer Mann sein.
"Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen?" fragte der Gelehrte.
"Ja, das habe ich mir wohl gedacht!" sagte der feine Mann, "daß Sie mich nicht erkennen würden. Ich bin so sehr zum Körper geworden, daß ich mir habe Fleisch und Kleider zulegen müssen. Sie haben sich wohl auch nicht gedacht, mich in solchem Wohlstand wiederzusehen! Kennen Sie Ihren alten Schatten nicht wieder? Sie haben sicherlich nicht geglaubt, daß ich noch wiederkommen würde. Mir ist es überaus gut ergangen, seit ich zuletzt bei Ihnen war, ich bin in jeder Hinsicht sehr vermögend geworden! Wenn ich mich von meinem Dienst loskaufen will, kann ich es." Und dann rasselte er mit einem ganzen Bund kostbarer Berlocken, die an der Uhr hingen, und steckte seine Hand in die dicke goldene Kette, die er um den Hals trug; nein, wie an allen seinen Fingern die Diamantringe blitzten. Und alles war echt.
"Nein, ich kann mich noch gar nicht fassen!" sagte der gelehrte Mann, "was ist denn das nur?"
"Ja etwas Alltägliches ist es nicht." sagte der Schatten; "aber Sie selbst gehören ja auch nicht zu den Alltäglichen, und ich, das wissen Sie ja, bin von Kindesbeinen an in Ihre Fußstapfen getreten. Sobald Sie meinten, daß ich reif war, allein in die Welt zu gehen, ging ich meinen eigenen Weg. Ich bin in den allerbrillantesten Umständen, aber es kam eine Art Sehnsucht über mich, Sie noch einmal zu sehen, ehe Sie sterben, denn Sie müssen ja sterben! Ich wollte auch gerne diese Länder wiedersehen, denn man liebt ja das Vaterland doch immer. – Ich weiß, Sie haben wieder einen andern Schatten bekommen. Habe ich diesem oder Ihnen etwas zu bezahlen? Sie brauchen nur die Freundlichkeit haben, es mir zu sagen."
"Nein, bist Du es wirklich!" sagte der gelehrte Mann, "das ist doch höchst merkwürdig. Niemals hätte ich gedacht, daß der alte Schatten einem als Mensch wieder begegnen könnte!"
"Sagen Sie mir, was ich zu bezahlen habe" sagte der Schatten; "denn ich möchte ungern in jemandes Schuld stehen!"
"Wie kannst Du nur so sprechen!" sagte der gelehrte Mann, "von welcher Schuld ist hier die Rede? Sei so frei, wie nur irgend jemand. Ich freue mich außerordentlich über Dein Glück. Setze Dich, alter Freund, und erzähle mir nur ein bißchen davon, wie das zugegangen ist, und was Du bei den Nachbarsleuten gegenüber, dort in den warmen Ländern, gesehen hast!"
"Ja, das will ich Ihnen erzählen," sagte der Schatten und setzte sich nieder; "aber dann müssen Sie mir auch versprechen, daß Sie nie zu jemandem hier in der Stadt, wo Sie mich auch treffen mögen, sagen werden, daß ich Ihr Schatten gewesen bin. Ich habe nämlich die Absicht, mich zu verloben; ich kann mehr als eine Familie ernähren!"
"Sei ganz ruhig," sagte der gelehrte Mann, "ich werde niemand sagen, wer Du eigentlich bist. Hier ist meine Hand darauf. Ich verspreche es Dir und ein Mann, ein Wort."
"Ein Wort, ein Schatten" sagte der Schatten, und dann mußte er erzählen.
Es war übrigens wirklich merkwürdig, wie sehr er Mensch war. Ganz schwarz war er gekleidet, und zwar in das feinste schwarze Tuch; er hatte Lackstiefel und einen Hut, den man zusammenklappen konnte, bis er nur noch Deckel und Krempe war, nicht davon zu sprechen, was wir schon wissen, von den Berlocken, der goldenen Halskette und den Diamantringen. Ja, der Schatten war außerordentlich gut angezogen, und gerade das war es, was ihn vollkommen zum Menschen machte.
"Nun will ich erzählen!" sagte der Schatten, und dann setzte er seine Beine mit den lackierten Stiefeln, so fest er konnte, auf den Arm des neuen Schattens des gelehrten Mannes, der wie ein Pudelhund zu seinen Füßen lag. Das war nun entweder Hochmut von ihm, oder auch wollte er vielleicht, daß er an seinem Bein hängen bliebe. Aber der liegende Schatten verhielt sich ganz stille und ruhig, um gut zuhören zu können.
Er wollte gern auch wissen, wie man loskommen und sich zu seinem eigenen Herren heraufdienen könne.
"Wissen Sie, wer in dem Hause gegenüber wohnte?" sagte der Schatten; "das war das Schönste von allem, das war die Poesie. Ich war dort drei Wochen, und es hatte die gleiche Wirkung, als ob man dreitausend Jahre gelebt und alles gelesen hätte, was je gedichtet und geschrieben worden ist. Das sage ich, und das ist richtig. Ich habe alles gesehen und weiß alles."
"Die Poesie." rief der gelehrte Mann. "Ja, ja – sie lebt oft als Einsiedlerin in den großen Städten. Die Poesie. Ja, ich habe sie nur einen kurzen Augenblick lang gesehen, aber der Schlaf saß mir in den Augen. Sie stand auf dem Altan und leuchtete, wie Nordlichter leuchten! Erzähle, erzähle! Du warst also auf dem Altan, gingst in die Tür hinein und dann –?"
"Dann war ich im Vorgemach" sagte der Schatten. "Sie haben immer gesessen und zum Vorgemache hinübergeschaut. Dort war gar keine Beleuchtung, es war eine Art Dämmerlicht; aber eine Tür nach der andern stand offen durch eine ganze Reihe von Zimmern und Sälen. Dort war es so hell, daß mich das Licht sicherlich erschlagen hätte, wäre ich bis ganz zu der Jungfrau hineingekommen; aber ich war besonnen, ich nahm mir Zeit und das muß man tun."
"Und was sahst Du dann?" fragte der gelehrte Mann.
"Ich sah alles, und ich werde es Ihnen erzählen, aber – es ist kein Stolz von meiner Seite, jedoch als freier Mann und mit den Kenntnissen, wie ich sie habe, von meiner guten Stellung und meinen trefflichen Lebensumständen nicht zu sprechen, – ich würde gerne hören, wenn Sie mich mit 'Sie' anredeten!"
"Entschuldigen Sie!" sagte der gelehrte Mann, "das ist eine alte Gewohnheit, die noch festsitzt! – Sie haben vollkommen recht, und ich werde daran denken. Aber nun erzählen Sie mir alles, was Sie sahen."
"Alles" sagte der Schatten; "denn ich sah alles, und ich weiß alles!"
"Wie sah es in den innersten Sälen aus?" fragte der gelehrte Mann. "War es wie in dem frischen Walde? War es wie in einer heiligen Kirche? Waren die Säle wie der sternenklare Himmel, wenn man auf hohen Bergen steht?"
"Alles war dort!" sagte der Schatten. "Ich ging ja nicht bis ganz hinein, ich blieb in dem vordersten Zimmer im Dämmerlicht. Aber dort stand ich durchaus gut, ich sah alles und weiß alles! Ich bin am Hofe der Poesie im Vorgemache gewesen."
"Aber was sahen Sie? Schritten durch die großen Säle alle Götter der Vorzeit? Kämpften dort die alten Helden, spielten dort süße Kinder und erzählten ihre Träume?"
"Ich sage Ihnen, ich war dort, und Sie begreifen, daß ich alles sah, was dort zu sehen war! Wären Sie hinüber gekommen, so wären Sie nicht Mensch geblieben, ich aber wurde es! Und zugleich lernte ich meine innerste Natur kennen, das mir Angeborene, und meine Verwandtschaft mit der Poesie. Ja, damals, als ich bei ihnen war, dachte ich nicht darüber nach. Aber, Sie wissen es wohl, stets, wenn die Sonne aufging und unterging, wurde ich so seltsam groß. Im Mondschein war ich fast deutlicher als Sie selbst. Damals verstand ich meine Natur nicht, erst im Vorgemache ging sie vor mir auf. Ich wurde ein Mensch! – Reif ging ich daraus hervor, aber Sie waren nicht mehr in den warmen Ländern. Ich schämte mich, als Mensch so zu gehen, wie ich ging. Ich brauchte Stiefel, Kleider, all diesen Menschenfirnis, der den Menschen zu einem solchen macht. Ich verbarg mich, ja, zu Ihnen kann ich es ja sagen, Sie werden mich ja nicht in einem Buche bloßstellen, ich verbarg mich unter der Schürze einer Kuchenfrau. Die Frau ahnte ja nicht, wem Sie Schutz gewährte. Erst am Abend ging ich aus. Ich lief im Mondschein auf der Straße umher, ich reckte mich lang gegen die Mauer, das kitzelt so herrlich am Rücken! Ich lief hinauf und herunter, sah in die höchsten Fenster hinein, in die Säle und auf die Dächer. Ich sah dahin, wohin niemand sonst sehen konnte, und ich sah, was niemand sah und was niemand sehen sollte. Es ist im Grunde eine nichtswürdige Welt. Ich würde nicht Mensch sein wollen, wenn die Annahme nicht feststände, daß es etwas bedeutet, einer zu sein. Ich sah das allerundenkbarste bei Frauen, bei Männern bei Eltern und auch bei den süßen, unschuldigen Kindern; – ich sah," sagte der Schatten, "was kein Mensch wissen durfte, aber was alle so gern wissen möchten das Böse bei den Nachbarn."
"Wenn ich eine Zeitung geschrieben hätte, die wäre gelesen worden! Aber ich schrieb geradeswegs an die Leute selbst, die es anging, und es herrschte Entsetzen in allen Städten, in die ich kam. Sie fürchteten mich, und deshalb verehrten sie mich sehr. Die Professoren machten mich zum Professor, die Schneider machten mir neue Kleider, ich bin gut versorgt!
Der Münzmeister schlug Münzen für mich, und die Frauen sagten, ich wäre so schön. So wurde ich der Mann, der ich bin. Und nun sage ich Ihnen Lebewohl; hier ist meine Karte, ich wohne auf der Sonnenseite, und bei Regenwetter bin ich immer zuhause." Und dann ging der Schatten.
"Das war doch merkwürdig!" sagte der gelehrte Mann.
Jahr und Tag verging, da kam der Schatten wieder.
"Wie gehts?" fragte er.
"Ach," sagte der gelehrte Mann, "ich schreibe über das Wahre und das Gute und das Schöne; aber kein Mensch macht sich etwas daraus, dergleichen zu hören. Ich bin ganz verzweifelt, denn ich nehme es mir so zu Herzen."
"Das tue ich nie" sagte der Schatten, "ich werde fett, und danach soll man trachten! Ja, Sie verstehen sich nicht auf die Welt, und Sie werden dabei krank. Sie müssen reisen! Ich mache im Sommer eine Reise; wollen Sie mit? Ich würde gern einen Reisekameraden haben. Wollen Sie mitreisen, als Schatten? Es wäre mir ein großes Vergnügen, Sie mitzunehmen, ich bezahle die Reise."
"Das geht zu weit" sagte der gelehrte Mann.
"Ganz wie man es nimmt!" sagte der Schatten. "Es würde ihnen außerordentlich gut tun, zu reisen. Wenn Sie mein Schatten sein wollen, sollen Sie alles auf der Reise frei haben."
"Das ist zu toll" sagte der gelehrte Mann.
"Aber so gehts in der Welt" sagte der Schatten, "und so bleibt es auch." Und dann ging der Schatten.
Dem gelehrten Manne ging es gar nicht gut. Sorgen und Plagen verfolgten ihn, und was er über das Wahre und das Gute und das Schöne sprach, war für die meisten wie Rosen für eine Kuh! – er wurde ganz krank zuletzt.
"Sie sehen wirklich wie ein Schatten aus" sagten die Leute zu ihm, und es schauderte den gelehrten Mann, denn er dachte sich manches dabei.
"Sie sollten in ein Bad" sagte der Schatten, der ihn besuchen kam. "Es hilft nichts. Ich will Sie mitnehmen, weil wir alte Bekannte sind; ich bezahle die Reise und Sie machen eine Beschreibung darüber und versuchen, mir die Reise angenehm zu machen. Ich will in ein Bad; mein Bart wächst nicht so recht, wie er sollte, das ist auch eine Krankheit, denn einen Bart muß man haben. Seien Sie nun vernünftig und nehmen Sie mein Angebot an. Wir reisen ja als Kameraden."
So reisten Sie denn; der Schatten war der Herr und der Herr war der Schatten. Sie fuhren miteinander, sie ritten und gingen zusammen, Seite an Seite, vor- und hintereinander, wie eben die Sonne stand. Der Schatten verstand es, sich stets an der Herrenseite zu halten. Darüber dachte nun der gelehrte Mann nicht weiter nach; er hatte ein recht gutes Herz und war sanft und freundlich, und daher sagte er auch eines Tages zum Schatten: "Da wir doch nun einmal Reisekameraden geworden und von Kindheit an zusammen aufgewachsen sind, sollten wir da nicht Brüderschaft trinken? Das ist doch vertraulicher!"
"Sie haben da etwas gesagt!" sagte der Schatten, der ja nun der eigentliche Herr war, "was sehr geradezu und wohl auch gutgemeint war; ich will ebenso gerade" zu und wohlmeinend sein. Sie, als gelehrter Mann, wissen zur Genüge, wie seltsam die Natur mitunter ist. Manche Menschen können es nicht vertragen, graues Papier zu berühren, sonst wird ihnen schlecht, anderen geht es durch und durch, wenn man einen Nagel gegen eine Glasscheibe knirschen läßt. Ich habe ebenso ein Gefühl, wenn Sie Du zu mir sagen. Ich fühle mich geradezu zu Boden und in meine frühere Stellung bei Ihnen zurückgedrückt. Sie sehen, das ist eine reine Gefühlssache, kein Stolz; ich kann es nicht zulassen, daß Sie Du zu mir sagen, aber ich will gerne zu Ihnen Du sagen, dann habe ich Ihnen wenigstens den halben Gefallen getan."
Seitdem sagte der Schatten Du zu seinem früheren Herrn.
Das ist doch wohl zu toll," dachte der, "daß ich Sie sagen muß, und er sagt Du." Doch mußte er gute Miene zum bösen Spiel machen.
So kamen sie in ein Bad, wo viele Fremde waren und unter ihnen eine wunderschöne Königstochter, die an der Krankheit litt, daß sie viel zu viel sah, und das war eine sehr beängstigende Sache.
Sogleich merkte sie, daß der, der da eben angekommen war, eine ganz andere Person als alle übrigen war. "Er ist hier, um sich einen Bart wachsen zu lassen, sagt man, aber ich sehe die wahre Ursache: er kann keinen Schatten werfen."
Nun war sie neugierig geworden und fing sogleich auf der Promenade ein Gespräch mit dem fremden Herrn an. Als Königstochter brauchte sie ja keine besonderen Umstände zu machen, und so sagte sie: "Ihre Krankheit besteht darin, daß Sie keinen Schatten werfen können!"
"Eure königliche Hoheit müssen sich schon sehr auf dem Wege der Besserung befinden!" sagte der Schatten; "ich weiß, Ihr Übel liegt darin, daß Sie viel zu viel sehen, aber das hat sich verloren. Sie sind geheilt; ich habe nämlich gerade einen ganz ungewöhnlichen Schatten! Sehen Sie nicht die Person, die mich immer begleitet? Andere Menschen haben einen gewöhnlichen Schatten, aber ich bin nicht für das Gewöhnliche. Man gibt seinem Diener zuweilen feineres Zeug, als man selbst es trägt, und in der gleichen Weise habe ich meinen Schatten als Menschen aufputzen lassen! Ja, Sie sehen, daß ich ihm sogar einen Schatten gegeben habe. Das ist sehr kostspielig, aber ich liebe es, etwas für mich allein zu haben."
"Wie?" dachte die Prinzessin, "sollte ich mich wirklich erholt haben? Dieses Bad ist freilich als das beste dafür bekannt! Das Wasser hat ja in unserer Zeit wunderbare Kraft. Aber ich reise noch nicht fort, denn jetzt beginnt es, hier unterhaltsam zu werden. Der Fremde gefällt mir außerordentlich. Wenn nur sein Bart nicht wächst, sonst reist er ab!"
Am Abend im großen Ballsaal tanzte die Königstochter mit dem Schatten. Sie war leicht, aber er war noch leichter; solchen Tänzer hatte sie noch nie gehabt. Sie sagte ihm, aus welchem Lande sie stamme, und er kannte das Land. Er war dort gewesen, aber damals war sie nicht zu Hause. Er hatte oben und unten in die Fenster geschaut; er hatte sowohl das eine wie das andere erblickt, und so konnte er der Königstochter antworten und Andeutungen machen, über die sie sich höchlich verwunderte. Er mußte ja der weiseste Mensch auf der ganzen Erde sein. Sie bekam große Achtung vor seinem Wissen, und als sie wieder zusammen tanzten, wurde sie verliebt. Das konnte der Schatten recht wohl bemerken, denn sie sah ihn so unverwandt an, als wolle sie durch ihn hindurch sehen. Dann tanzten sie noch einmal, und da war sie nahe daran, es ihm zu sagen. Aber sie war besonnen; sie dachte an ihr Land und ihr Reich und an die vielen Menschen, über die sie regieren sollte. "Ein weiser Mann ist er," sagte sie bei sich, "das ist gut! und er tanzt herrlich, das ist auch gut, aber ob er auch gründliche Kenntnisse hat, das ist ebenso wichtige Das muß untersucht werden!" Und dann begann sie ihn ein bißchen über die allerschwierigsten Sachen auszufragen; sie hätte selbst nicht darauf antworten können. Und der Schatten machte ein ganz sonderbares Gesicht.
"Darauf können Sie mir nicht antworten!" sagte die Königstochter.
"Das gehört in mein Schulwissen," sagte der Schatten, "ich glaube, daß sogar mein Schatten dort an der Tür darauf wird antworten können!"
"Ihr Schatten," sagte die Königstochter, "das wäre doch höchst merkwürdig!"
"Ja, ich behaupte ja auch nicht bestimmt, daß er es kann" sagte der Schatten, "aber ich glaube es wohl, denn er ist mir nun so viele Jahre lang gefolgt und hat mir zugehört, – ich glaube es sicher. Aber – Eure königlicher Hoheit gestatten, daß ich darauf aufmerksam mache – er ist so stolz darauf, als Mensch zu gehen, daß, wenn er in richtig guter Laune sein soll, und das muß er sein, um gut zu antworten, er ganz wie ein Mensch behandelt werden muß."
"Das gefällt mir" sagte die Königstochter.
"Und dann ging sie auf den gelehrten Mann an der Tür zu, und sie sprach mit ihm von Sonne und Mond und vom Menschen, dem äußeren und dem inneren Menschen, und er antwortete gar gut und klug."
"Was muß das für ein Mann sein, der einen so weisen Schatten hat" dachte sie, "es wäre eine wahre Wohltat für mein Volk und mein Reich, wenn ich ihn zu meinem Gemahl erwählte; – ich tue es."
Sie waren sich bald einig, sowohl die Königstochter, wie der Schatten; aber niemand sollte darum wissen, bevor sie wieder heim in ihr eigenes Reich käme.
"Niemand, nicht einmal mein Schatten" sagte der Schatten, und dabei hatte er seine ganz besonderen Gedanken –
Dann kamen sie in das Land, wo die Königstochter regierte, wenn sie zuhause war.
"Hör, mein guter Freund" sagte der Schatten zu dem gelehrten Manne, "nun bin ich so glücklich und mächtig geworden, wie man es nur werden kann; nun will ich auch etwas ganz Besonderes für Dich tun. Du sollst immer bei mir im Schlosse wohnen, mit mir in meinem königlichen Wagen fahren und tausend Reichstaler im Jahre bekommen; aber dann mußt Du Dich Schatten nennen lassen von all und jedem Menschen. Du darfst nicht sagen, daß Du jemals Mensch gewesen bist, und einmal im Jahre, wenn ich im Sonnenschein auf dem Altan sitze und mich dem Volke zeige, mußt Du zu meinen Füßen liegen, wie es sich für einen Schatten gehört. Jetzt kann ich es Dir ja sagen, ich heirate die Königstochter. Heute abend soll die Hochzeit sein."
"Nein, das ist doch der Gipfel der Tollheit!" sagte der gelehrte Mann. "Das will ich nicht, und das tue ich nicht. Das heißt das ganze Land betrügen und die Königstochter dazu! Ich sage alles! daß ich der Mensch hin und Du der Schatten; Du bist ja nur angezogen!"
"Das wird Dir keiner glauben!" sagte der Schatten, "sei vernünftig, oder ich rufe die Wache!"
"Ich gehe stehenden Fußes zur Königstochter!" sagte der gelehrte Mann. "Aber ich gehe zuerst!" sagte der Schatten, "und Du gehst ins Gefängnis!" – Und das mußte er, denn die Schildwache gehorchte demjenigen, von dem sie wußte, daß die Königstochter ihn heiraten wollte.
"Du zitterst!" sagte die Königstochter, als der Schatten zu ihr hereintrat, "ist etwas geschehen? Du darfst nicht krank zu heute abend werden, jetzt, wo wir Hochzeit machen wollen."
"Ich habe das Greulichste erlebt, was man erleben kann!" sagte der Schatten, "denke Dir – ja so ein armes Schattengehirn kann nicht viel aushalten! – denke Dir, mein Schatten ist verrückt geworden. Er glaubt, er wäre der Mensch und ich – denke Dir nur – ich wäre sein Schatten!"
"Das ist ja furchtbar!" sagte die Prinzessin, "er ist doch eingesperrt?"
"Das ist er! Ich fürchte, er wird nie wieder zu Verstand kommen!"
"Armer Schatten!" sagte die Prinzessin, "er ist sehr unglücklich. Es würde eine wahre Wohltat sein, ihn von dem bißchen Leben zu befreien, das er hat. Wenn ich es recht bedenke, glaube ich, es wird notwendig sein, es mit ihm in aller Stille abzumachen!"
"Das ist freilich hart!" sagte der Schatten, "denn er war ja ein treuer Diener!" Und dann tat er, als ob er seufzte.
"Sie sind ein edler Charakter!" sagte die Königstochter.
Am Abend wurde die ganze Stadt illuminiert, und die Kanonen schossen: bum! und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Das war eine Hochzeit! Die Königstochter und der Schatten gingen auf den Altan hinaus, um sich sehen zu lassen und noch einmal ein Hurra! zu bekommen.
Der gelehrte Mann hörte nichts mehr von alledem, denn ihm hatten sie das Leben genommen.
DAS ABC BUCH

Es war einmal ein Mann, der hatte einige neue Verse zu einem "ABC-Buch" geschrieben, solche zwei Zeilen für jeden Buchstaben wie in dem alten ABC; ihm schien, daß man etwas Neues haben sollte, die alten Verse waren so abgenutzt, und der fand seine eigenen gerade immer so gut. Das neue ABC lag noch geschrieben da, und es war neben das alte, gedruckte in den großen Büchschrank gestellt worden, in dem so viele gelehrte Bücher und unterhaltende Bücher standen, aber das alte ABC wollte wohl nicht Nachbar des neuen sein und war deshalb vom Bord gesprungen und hatte zugleich dem neuen einen Stoß gegeben, so daß es auch auf dem Boden lag, und zwar waren alle seine losen Blätter ringsum verstreut. Das alte ABC kehrte die erste Seite nach oben, und das ist das wichtigste darin; da stehen alle Buchstaben, die großen und die kleinen. Das Blatt hat nun alles, wovon alle die übrigen Bücher leben, daß Alphabet, die Buchstaben, die doch die Welt regieren; eine schreckliche Macht haben Sie! Es kommt nur darauf an, in welche Stellung sie kommandiert sind; sie können Leben geben, töten, erfreuen und betrüben. Einzeln aufgestellt, bedeuten sie nichts, aber in Reih und Glied aufgestellt, ja, als Gott sie seine Gedanken ausdrücken ließ, vernahmen wir mehr, als wir zu ertragen vermochten, wir beugten uns tief, aber die Buchstaben vermochten die Gedanken zu ertragen.
Da lag es nun und kehrte sich nach oben! Und der Hahn in dem großen A strahle von roten, blauen und grünen Federn; er brüstete sich, denn er wußte, was die Buchstaben bedeuten und daß er der einzige lebendige darunter war.
Da das alte ABC-Buch auf den Boden fiel, schlug er mit den Flügeln, flog heraus und setzte sich auf eine Ecke des Bücherschranks, zupfte sich mit dem Schnabel glatt und krähte, so daß es nachhallte. Jedes Buch im Schrank, das sonst Tag und Nacht wie in einem Halbschlaf stand, wenn es nicht gebraucht wurde, vernahm den Trompetenstoß, und dann sprach der Hahn laut und deutlich von dem Unrecht, das dem würdigen, alten ABC-Buch geschehen war.
"Alles soll nun neu, soll anders sein!" sagte er, "alles soll so fortschreiten! Die Kinder sind so klug, daß sie nun lesen können, bevor sie die Buchstaben kennen." - "Sie sollen etwas Neues haben!" sagte er, der die neuen ABC-Verse schrieb, die da auf dem Boden verstreut liegen. "Ich kenne Sie! Mehr als zehnmal habe ich ihn gehört, sie sich selber vorlesen. Das war ihm so ein Vergnügen, nein, ich muß um meine eignen, die guten alten und Xanthus bitten, und um die Bilder, die dazu gehören, für die will ich kämpfen, danach will ich krähen! Jedes Buch im Schrank kennt sie wohl. Nun werde ich die geschriebenen neuen vorlesen, sie alle in Ruhe vorlesen: laßt uns dann darüber einig werden, daß sie nichts taugen!"
A Amme
Eine Amme geht im Sohntagskleide,
einer andern Kind ist ihre Freude.
B Bauer
Ein Bauer litt einst großen Schaden,
jetzt hat er zu viel in der Laden.
"Den Vers finde ich nun wirklich schwach!" sagte der Hahn, "Aber ich lese weiter!"
C Columbus
fuhr hin übers Meer,
und doppelt so groß war die Welt nachher.
D Dänemark
In Dänemark der Glaube gilt,
daß Gott ihm stets bleibt gut gewillt.
"Das werden nun manche nett Finden!" sagte der Hahn, "aber das tue ich nicht! Ich finde nun nichts Nettes hier! Weiter!"
E Elefant
Der Elefant geht schwer genug,
wenn auch sein Herz noch leicht und jung.
F Finsternis
Finsternis tut dem Monde gut,
er trägt solang den Priesterhut.
G Glücksschwein
Das Glücksschwein mit dem Nasenring
bleibt, was es ist, ein plumpes Ding!
H Hurra
Hurra kann oft auf unser Erden
von Toren nur gerufen werden.
"Wie sollen das nun die Kinder verstehen?" sagte der Hahn, "es steht freilich auf dem Titelblatt 'ABC-Buch für Große und Kleine', aber die Großen haben anders zu tun, als ABC-Verse zu lesen, und die Kleinen können das nicht verstehen! Alles hat seine Grenzen! Weiter!"
I Irdisch
Irdisch ist die Erde, rund und groß,
und wir Irdischen alle ruh'n einst ihr im Schoß.
"Das ist nun roh!" sagte der Hahn.
K Kuh, Kalb
Eine Kuh ist immer die Frau vom Stier,
und ein Kalb wird eins von beiden hier.
"Wie soll man nun einem Kinde die Verwandtschaft erklären?"
L Löwe, Lorgnette
Der wilde Löwe hat keine Lorgnette,
die hat nur der zahme im Nummernparkett.
M Morgensonne
Der Morgensonne Gold aufgeht,
doch nie bevor der Hofhahn kräht.
"Nun bekomme ich Grobheiten zu hören!" sagte der Hahn, "aber ich bin da in guter Gesellschaft, in Gesellschaft der Sonne! Weiter!"
N Neger
Schwarz ist der Neger, daß ihr's wißt,
noch keiner Weiß gewaschen ist.
O Oberstübchen
In manchem Oberstübchen steckt
mehr, als man jemals hat entdeckt.
P Palme
Das schönste Blatt, das ein Baum hat,
des ist des Friedens Palmenblatt.
Q Qual
Es kennt so mancher manchesmal
vom andern nicht die Not und Qual.
R Rundturm
Sei groß, zum runden Turm, erkoren,
du bist drum doch nicht hochgeboren.
S Schwein
Laß dich vom Schaden nicht betrüben,
den Schweine dir im Wald verüben!
"Gestatten Sie nun, daß ich krähe!" sagte der Hahn, "das verbraucht Kräfte, so viel vorzulesen! Man muß Atem schöpfen!" Und dann krähte er, daß es schrillte wie eine Messingtrompete, und das war ein großes vergnügen zu hören – für den Hahn nämlich. "Weiter!"
T Teekessel, Teemaschine
Teekessel hat nur Küchenrang,
hat doch der Teemaschin' Gesang.
U Unrecht
Ob uns das Unrecht stets bekriegt,
in Ewigkeit wird doch gesiegt!
"Das soll nun so tief sein," sagte der Hahn, "Aber ich kann es nicht ergründen!"
V Vieh
Besitz von Vieh, ein schönes Ding.
Ein Vieh zu sein, scheint mir gering.
W Waschbär
Waschbären waschen Zuckersachen,
bis sie sie ganz zunichte machen.
X Xanthippe
"Hier hat er doch nichts Neues finden können!"
Im Ehemeer gibt's eine Klippe,
die heißt seit Sokrates Xanthippe.
"Er mußte doch Xanthippe nehmen, Xanthus ist noch besser!"
Y Yggdrasil
Yggdrasil hieß der Götter Baum,
der Baum ward gefällt, die Götter sind Traum!
"Nun sind wir gleich durch," sagte der Hahn, "Das ist immer ein Trost! Weiter! Vorwärts!"
Z Zephir
Auf dänisch ist Zephir ein westlicher Wind,
der weht, daß im Pelze erfrieret das Kind.
"Da liegt es! Aber es ist nicht überstanden! Nun soll's gedruckt werden! Und dann soll's gelesen werden! Es soll an Stelle der würdigen, alten Buchstaben in meinem Buch geboten werden! Was sagt die Versammlung, gelehrte und ungelehrte, einzelne und gesammelte Schriften? Was sagt der Bücherschrank? Ich habe gesprochen – nun können die andern handeln!"
Und die Bücher standen, und der Schrank stand, aber der Hahn flog wieder zurück in sein großes A und sah sich stolz um. "Ich habe gut gesprochen, ich habe gut gekräht! Das soll mir das neue ABC-Buch nachmachen! Das stirbt bestimmt. Das ist schon tot! Das hat keinen Hahn!"
WIE'S DER ALTE MACHT, IST'S IMMER RICHTIG
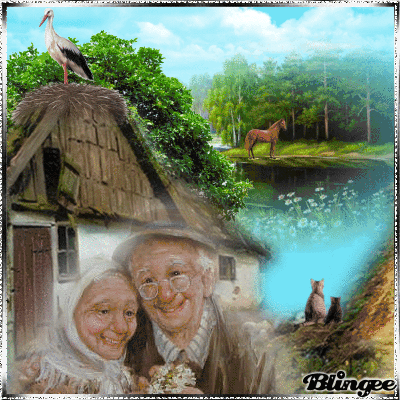
Eine Geschichte werde ich dir erzählen, die ich hörte, als ich noch ein kleiner Knabe war. Jedesmal, wenn ich an die Geschichte dachte, kam es mir vor, als würde sie immer schöner; denn es geht mit Geschichten wie mit vielen Menschen, sie werden mit zunehmendem Alter schöner.
Auf dem Lande warst du doch gewiß schon einmal; du wirst wohl auch so ein recht altes Bauernhaus mit Strohdach gesehen haben. Moos und Kräuter wachsen von selber auf dem Dach; ein Storchennest befindet sich auf dem First desselben, der Storch ist unvermeidlich! Die Wände des Hauses sind schief, die Fenster niedrig, und nur ein einziges Fenster ist so eingerichtet, daß es geöffnet werden kann; der Backofen springt aus der Wand hervor, gerade wie ein kleiner dicker Bauch; der Fliederbaum hängt über den Zaun, und unter seinen Zweigen ist ein Wassertümpel, in dem eine oder mehrere Enten liegen. Ein Kettenhund, der alle und jeden anbellt, ist auch da.
Gerade so ein Bauernhaus stand draußen auf dem Lande, und in diesem Hause wohnten zwei alte Leute, ein Bauer und eine Bäuerin. Wie wenig sie hatten, ein Stück war darunter, das nicht entbehrlich war – ein Pferd, das sich von dem Gras nährte, das es an den Einzäunungen der Landstraße fand. Der alte Bauer ritt zur Stadt auf diesem Pferd, oft liehen es sich auch seine Nachbarn aus und erwiesen den alten Leuten manch andern Dienst dafür. Aber am geeignetsten war es doch wohl, wenn sie das Pferd verkauften oder es gegen irgend etwas anderes, was ihnen mehr nützen könnte, weggaben.
Aber was konnte dies wohl sein?
"Das wirst du, Alter, am besten wissen!" sagte die Frau zu ihm. "Heute ist gerade Jahrmarkt, reite in die Stadt, gib das Pferd für Geld hin oder mache einen guten Tausch; wie du es auch machst, mir ist's immer recht. Reite zum Jahrmarkt!"
Und sie knüpfte ihm sein Halstuch um, denn das konnte sie besser als er, sie knüpfte es ihm mit einer Doppelschleife um: das macht sich sehr hübsch! Sie strich seinen Hut glatt mit ihrer flachen Hand und küßte ihn dann auf seinen warmen Mund. Dann ritt er fort auf dem Pferd, welches verkauft oder eingetauscht werden sollte. Ja, der Alte verstand dies schon!
Die Sonne brannte heiß, keine Wolke war am Himmel zu sehen. Auf dem Weg staubte es sehr, die vielen Leute, die den Jahrmarkt besuchen wollten, fuhren, ritten oder legten den Weg zu Fuß zurück. Nirgends gab es Schatten gegen den Brand der Sonne.
Unter anderen kam auch einer des Weges, der eine Kuh zum Markt trieb. Die Kuh war so schön, wie eine Kuh nur sein kann. "Die gibt gewiß auch schöne Milch!" dachte der Bauer, "Das wäre ein ganz guter Tausch: die Kuh für das Pferd!"
"Heda, du da, mit der Kuh!" sagte er, "weißt du was, ein Pferd, sollte ich meinen, kostet mehr als eine Kuh, aber mir ist das gleichgültig, ich habe mehr Nutzen von der Kuh; hast du Lust, so tauschen wir!"
"Freilich will ich das," sagte der Mann mit der Kuh, und nun tauschten sie. Das war also abgemacht, und der Bauer hätte nun füglich wieder umkehren können, denn er hatte ja das abgemacht, um was es ihm zu tun war; allein da er nun einmal den Jahrmarkt im Kopf hatte, so wollte er auch hin, bloß um ihn sich anzusehen, und deshalb ging er mit seiner Kuh auf die Stadt zu.
Die Kuh führend, schritt er mit ihr rasch aus, und nach kurzer Zeit waren sie einem Mann zur Seite, der ein Schaf trieb. Es war ein gutes Schaf, fett und mit guter Wolle.
"Das möchte ich haben," dachte unser Bauersmann, "es würde an unserem Zaun genug Gras finden, und über den Winter könnten wir es in der Stube halten. Eigentlich wäre es angemessenen, ein Schaf statt einer Kuh zu besitzen."
"Wollen wir tauschen?"
Dazu war der Mann mit dem Schaf sogleich bereit, und der Tausch fand statt. Unser Bauer ging nun mit seinem Schaf auf der Landstraße weiter.
Bald gewahrte er abermals einen Mann, der vom Feld her die Landstraße betrat und eine große Gans unter dem Arm trug.
"Das ist ein schweres Ding, das du da hast; es hat Federn und Fett, daß es eine Lust ist; die würde sich erst gut ausnehmen, wenn sie bei uns daheim an einer Leine am Wasser ginge. Das wäre etwas für meine Alte, für die könnte sie allerlei Abfall sammeln. Wie oft hat sie nicht gesagt: 'Wenn wir nur eine Gans hätten'. Jetzt kann sie vielleicht eine kriegen, und geht es, so soll sie sie haben! – Wollen wir tauschen? Ich gebe dir das Schaf für die Gans und schönen Dank dazu."
Dagegen hatte der andere nichts einzuwenden, und so tauschten sie denn. Unser Bauer bekam die Gans.
Jetzt befand er sich schon ganz nahe der Stadt; das Gedränge auf der Landstraße nahm immer mehr zu; Menschen und Vieh drängten sich; sie gingen auf der Straße und längs der Zäune, ja, am Schlagbaum gingen sie sogar in des Einnehmers Kartoffelfeld hinein, wo dessen einziges Huhn an einer Schnur einher spazierte, damit es über das Gedränge nicht erschrecken, sich verirren oder verlaufen sollte. Das Huhn hatte kurze Schwanzfedern, es blinzelte mit einem Auge und sah sehr klug aus. "Kluck; Kluck!" sagte das Huhn. Was es sich dabei dachte, weiß ich nicht zu sagen, aber unser Bauersmann dachte sogleich, als er es zu Gesicht bekam: das ist das schönste Huhn, das ich je gesehen habe, es ist sogar schöner als des Pfarrers Bruthenne. Potztausend! Das Huhn möchte ich haben! Ein Huhn findet immer ein Körnchen, es kann sich fast selber ernähren, ich glaube, es wäre ein guter Tausch, wenn ich es für die Gans kriegen könnte. – "Wollen wir tauschen?" fragte er den Einnehmer. "Tauschen?" fragte dieser, "ja, das wäre nicht übel!" Und so tauschten sie. Der Einnehmer am Schlagbaum bekam die Gans, der Bauer das Huhn.
Es war gar viel, was er auf der Reise zur Stadt erledigt hatte; heiß war es auch, und er war müde. Ein Schnaps und ein Imbiß taten ihm not; bald befand er sich am Wirtshaus. Er wollte gerade hineingehen, als der Hausknecht heraustrat und sie sich daher in der Tür begegneten. Der Knecht trug einen Sack.
"Was hast du denn in dem Sack?" fragte der Bauer.
"Verschrumpelte Äpfel!" antwortete der Knecht, "einen ganzen Sack voll, genug für die Schweine."
"Das ist doch eine zu große Verschwendung. Den Anblick gönnte ich meiner Alten daheim. Voriges Jahr trug der alte Baum am Torfstall nur einen einzigen Apfel; der wurde aufgehoben und lag auf dem Schrank, bis er ganz verdarb und zerfiel. 'Das ist doch immerhin Wohlstand', sagte meine Alte; hier könnte sie aber erst Wohlstand sehen, einen ganzen Sack voll! Ja, den Anblick würde ich ihr gönnen!"
"Was gebt Ihr für den Sack voll?" fragte der Knecht.
"Was ich gebe? Ich gebe mein Huhn in Tausch," und er gab das Huhn in Tausch, bekam die Äpfel und trat mit diesen in die Gaststube ein. Den Sack lehnte er behutsam an den Ofen, er selber trat an den Schanktisch. Aber im Ofen war eingeheizt, das bedachte er nicht. Es waren viele Gäste anwesend; Pferdehändler, Ochsentreiber und zwei Engländer, und die Engländer waren so reich, daß ihre Taschen von Goldstücken strotzten und fast platzten, und wetten tun sie, das sollst du erfahren.
"Susss! Susss!" Was war denn das am Ofen? – Die Äpfel begannen zu braten.
"Was ist denn das?"
"Ja, wissen sie," sagte unser Bauersmann; – und nun erzählte er die ganze Geschichte von dem Pferd, das er gegen eine Kuh vertauscht und so weiter herunter bis zu den Äpfeln.
"Na, da wird dich deine Alte derb knuffen, wenn du nach Hause kommst, da setzt es was!" sagten die Engländer.
"Was? Knuffen?" sagte der Alte, "küssen wird sie mich und sagen: wie's der Alte macht, ist's immer richtig."
"Wollen wir wetten?" sagten die Engländer, "gemünztes Gold tonnenweise! Hundert Pfund machen ein Schiffspfund!"
"Ein Scheffel genügt schon," entgegnete der Bauer, "ich kann nur den Scheffel mit Äpfeln dagegen setzen und mich selber und meine alte Frau dazu, das dächte ich, wäre doch auch ein gehäuftes Maß!"
"Topp! Angenommen!" und die Wette war gemacht.
Der Wagen des Wirts fuhr vor, die Engländer stiegen ein, und der Bauersmann stieg ein; vorwärts ging es, und bald hielten sie vor dem Häuschen des Bauern an.
"Guten Abend, Alte!"
"Guten Abend, Alter!"
"Der Tausch wäre gemacht!"
"Ja, du verstehst schon deine Sache!" sagte die Frau, umarmte ihn und beachtete weder den Sack noch die fremden Gäste.
"Ich habe eine Kuh für das Pferd eingetauscht."
"Gott sei Lob! Die schöne Milch, die wir nun haben werden, und Butter und Käse auf dem Tisch! Das war ein herrlicher Tausch!"
"Ja, aber die Kuh tauschte ich wieder gegen ein Schaf ein."
"Ach, das ist um so besser!" erwiderte die Frau, "du denkst immer an alles; für ein Schaf haben wir gerade Grasweide genug; Schafsmilch, Schafskäse, wollene Strümpfe und wollene Jacken! Das gibt uns die Kuh nicht, sie verliert ja die Haare! Wie du doch alles bedenkst!"
"Aber das Schaf habe ich wieder gegen eine Gans eingetauscht!"
"Also dieses Jahr werden wir wirklich Gänsebraten haben, mein lieber Alter! Du denkst immer daran, mir eine Freude zu machen. Wie herrlich ist das! Die Gans kann man an einen Strick anbinden und sie noch fetter werden lassen, bevor wir sie braten!"
"Aber die Gans habe ich gegen ein Huhn eingetauscht!" sagte der Mann.
"Ein Huhn! Das war ein guter Tausch!" entgegnete die Frau. "Das Huhn legt Eier, die brütet es aus, wir kriegen Küchlein, wir kriegen nun einen ganzen Hühnerhof! Ei, den habe ich mir gerade erst recht gewünscht!"
"Ja! Aber das Huhn gab ich wieder für einen Sack voll verschrumpelter Äpfel hin!"
"Was? Nein, jetzt muß ich dich erst recht küssen!" versetzte die Frau. "Mein liebes, gutes Männchen! Ich werde dir etwas erzählen. Siehst du, als du kaum fort warst heute morgen, dachte ich darüber nach, wie ich dir heute Abend einen recht guten Bissen machen könnte. Speckeierkuchen mit Schnittlauch, dachte ich dann. Die Eier hatte ich, den Speck auch, der Schnittlauch fehlte mir nur. So ging ich denn hinüber zu Schulmeisters, die haben Schnittlauch, das weiß ich, aber die Schulmeistersfrau ist geizig, so süß sie auch tut. Ich bat sie, mir eine Handvoll Schnittlauch zu leihen. 'Leihen?' gab sie zur Antwort. 'Nichts, gar nichts wächst in unserm Garten, nicht einmal ein verschrumpelter Apfel; nicht einmal einen solchen kann ich dir leihen, liebe Frau!' Jetzt kann ich ihr aber zehn, ja, einen ganzen Sack voll leihen. Das freut mich zu sehr, das ist zum Totlachen!" Und dabei küßte sie ihn, daß es schmatzte.
"Das gefällt uns!" riefen die Engländer wie aus einem Mund. "Immer bergab und immer lustig. Das ist schon das Geld wert!"
Und nun zahlten sie ein Schiffspfund Goldmünzen an den Bauersmann, der nicht geknufft, sondern geküßt wurde.
Ja, das lohnt sich immer, wenn die Frau einsieht und auch immer sagt, daß der Mann der Klügste und sein Tun das Richtige ist.
Seht, das ist meine Geschichte. Ich habe sie schon als Kind gehört, und jetzt hast du sie auch gehört und weißt, "wie's der Alte macht, ist's immer richtig!"
DER DORNENPFAD DER EHRE

Es lebt noch eine alte Mähr vom › Dornenpfad der Ehre‹, – ›von einem Schützen, welcher zwar zu Ehren und Würden gelangte, aber erst nach langen und vielen Widerwärtigkeiten und lebensgefährlichen Kämpfen.‹ – Wer hat nicht bei dieser Mähr seines eigenen stillen Dornenpfades und seiner vielen ›Widerwärtigkeiten‹ gedacht. Das Märchen und die Wirklichkeit grenzen gar nahe an einander, allein das Märchen hat seine harmonische Auflösung hier auf Erden, die Wirklichkeit weist dieselbe oft über das Erdenleben hinaus, auf Zeit und Ewigkeit deutend.
Die Weltgeschichte ist eine Laterna magica, die uns in Lichtbildern auf dem dunklen Grunde der Gegenwart zeigt, wie die Wohltäter der Menschheit, die Märtyrer des Genies, den Dornenpfad der Ehre und des Ruhmes wandern.
Aus allen Zeiten, aus allen Ländern strahlen diese Glanzbilder uns entgegen, jeder zwar nur auf Augenblicke, doch aber als ein ganzes Leben, ein Lebensalter mit seinen Kämpfen und seinen Siegen. Betrachten wir hier und dort Einzelne dieser Märtyrerschaar, – dieser Schaar, die erst dann zu Ende geht, wenn der Erdball zerstäubt.
Wir erblicken ein gefülltes Amphitheater. Aus den »Wolken« eines Aristophanes ergießt sich in Strömen der Spott und Humor über die Menge; auf der Schaubühne wird geistig und körperlich der merkwürdigste Mann Athens, er, welcher Schild und Hort des Volkes gegen die dreißig Tyrannen war Sokrates, lächerlich gemacht, Sokrates, welcher im Getümmel der Schlacht Alcibades und Xenophon rettete, und dessen Geist sich über die Götter des Altertums emporschwang. Er selbst ist hier zugegen; er hat sich erhoben von der Bank des Zuschauers und ist hervorgetreten, damit die lachenden Athenienser es recht inne werden, wie es sich mit der Ähnlichkeit zwischen ihm und dem Zerrbilde auf der Schaubühne verhält; da steht er vor ihnen, hoch über sie alle erhaben.
Du saftiger, grüner, giftiger Schierling und nicht du Ölbaum, wirf du hier deinen Schatten über Athen.
Sieben Städte stritten um die Ehre, Homers Geburtsort zu sein, das heißt, nachdem er tot war! Betrachten wir ihn bei Lebzeiten! – Er schreitet zu Fuß durch die Städte und spricht seine Verse her, um zu leben; der Gedanke auf den morgenden Tag macht sein Haar ergrauen! – Er, der große Seher ist erblindet und schreitet mühsam seinen Weg: der scharfe Dorn zerfetzt den Mantel des Dichterkönigs! – Seine Gesänge leben noch, und durch sie allein leben die Götter und Heroen des Altertums.
Ein Bild nach dem andern taucht empor aus Morgenland, aus Abendland, gar weit aus einander in Zeit und Raum und doch immer eine Strecke des Dornenpfades der Ehre, auf welchem die Distel, erst dann eine Blume treibt, wenn das Grab geschmückt werden soll.
Unter Palmen ziehen die Kamele hin, reich beladen mit Indigo und anderen köstlichen Schätzen, von dem Herrscher des Landes dem jenigen gesandt, dessen Gesänge die Freude des Volkes, der Ruhm des Landes sind; er, welchen Lüge und Neid in Verbannung schickten, er ist gefunden – die Karawane nähert sich dem Städtchen, in welchem er ein Asyl fand: eine arme Leiche wird durch das Stadttor hinausgetragen und der Leichenzug gebietet der Karawane Halt. Der Tote ist eben der jenige, den sie sucht: Firdusi – der Dornenpfad der Ehre ist zu Ende gewandert!
Der Afrikaner mit den plumpen Gesichtszügen, den dicken Lippen, dem schwarzen wolligen Haare, sitzt auf den marmornen Stufen des Palastes in der Hauptstadt Portugals und bettelt – er ist der treu ergebene Sklave des Camoez, ohne ihn und ohne die Kupfermünzen, welche diesem die Vorübergehenden zu werfen, würde sein Herr, der Sänger der Lusiade des Hungers sterben.
Jetzt erhebt sich ein kostbares Monument auf dem Grabe des Camoez.
Ein neues Bild!
Hinter dem eisernen Gitter zeigt sich ein Mann, blaß wie der Tod, mit langem, ungekämmtem Barte. »Ich habe eine Erfindung gemacht, die größte seit Jahrhunderten!« ruft er, »und man hat mich länger denn zwanzig Jahre hier eingesperrt gehalten!« – »Wer ist der Mann?« – »Ein Wahnsinniger!« antwortete der Wärter der Wahnsinnigen. »Auf was ein Mensch doch alles in der Irre kommen kann! Er bildet sich ein, man könne sich durch Dampf vorwärts bewegen!« – Es ist Salomon de Caus, der Entdecker der Dampfkraft, dessen Ahnung, in unklaren Worten ausgesprochen, von einem Richelieu nicht verstanden wurde; er stirbt in der Irrenanstalt.
Hier steht Columbus, den einst die Gassenbuben verfolgten und verspotteten, weil er eine neue Welt entdecken wollte – er hat sie entdeckt! Der Jubel hallt ihm aus Menschenbrust und Glockengeläute bei seiner Sieg gekrönten Rückkehr entgegen, aber die Glocken des Neides übertönten bald jene. Der Weltentdecker, er, welcher das amerikanische Goldland aus dem Meere hob und es seinem Könige schenkte, er wird mit eisernen Ketten belohnt! Er wünscht diese Ketten in seinen Sarg mitzunehmen, sie geben Zeugnis von der Welt und von der Art und Weise, wie die Zeitgenossen Verdienste schätzen.
Ein Bild nach dem andern drängt sich heran, der Dornenpfad der Ehre und des Ruhmes ist überfüllt:
Hier in finsteren Nacht sitzt Der, welcher die Mondberge ausmaß, Der, welcher in den unendlichen Raum zu Sternen und Planeten hinaus drang, er, der Mächtige, welcher den Geist der Natur vernahm und es empfand, daß die Erde sich unter seinen Füßen bewege: Galilei. Blind und taub sitzt er, ein Greis, gespießt an den Dorn der Leiden in den Qualen der Verleugnung, kaum noch im Stande den Fuß zu erheben, den selben, mit welchem er einst im Schmerze seiner Seele, als man die Wahrheit verwischte, die Erde stampfend, ausrief: »und sie bewegt sich doch!«
Hier steht ein Weib mit kindlichem Gemüt in Begeisterung und Glauben – dem kämpfenden Heere trägt sie das Panier voran, und bringt ihrem: Vaterlande Sieg und Rettung. Der Jubel schallt und der Scheiterhaufen flammt: Jeanne d´Arc! die Hexe wird verbrannt. – Ja, ein künftiges Jahrhundert spuckt aus vor der weißen Lilie. Voltaire, der Satyr des gefunden Menschenverstandes, singt von »La pucelle«.
Auf dem Thing zu Wiborg verbrennt der dänische Adel die Gesetze des Königs – sie flammen hoch empor, beleuchten das Zeitalter und den Gesetzgeber, werfen einen Glorienschein in den finstern Gefangenenturm hinein, wo ergraut, gebeugt, mit seinem Finger eine Ritze in die steinerne Tischplatte hinein arbeitend, er, der ehemalige Herrscher über drei Königreiche sitzt, der volkstümliche König, der Freund des Bürgers, des Bauern: Christian der Zweite. Feinde schrieben seine Geschichte nieder. – Seiner siebenundzwanzigjährigen Gefangenschaft wollen wir gedenken, wenn wir seine Blutschuld nicht leugnen können.
Ein Schiff segelt ab und verläßt die dänischen Strande; am Mastbaume lehnt ein Mann, zum letzten Male einen Blick auf die Insel Hveen werfend: – es ist Tycho Brahe; er hob den Namen Dänemarks bis in die Sterne, und man lohnte ihn mit Kränkungen, mit Schaden und Verdruß – er zieht nach einem fremden Lande: »Der Himmel wölbt sich überall über mir, was will ich mehr!« spricht er, und segelt dahin, der berühmte Däne, geehrt und frei in einem fremden Lande!
»Ach frei, wenn selbst nur für die unleidlichen Schmerzen des Leibes!« seufzt es durch die Zeiten und dringt an unser Ohr. Welches Bild! – Griffenfeld, ein dänischer Prometheus an die Felseninsel Munkholm gefesselt.
Wir befinden uns in Amerika am Ufer eines der größten Ströme; eine zahllose Menschenmenge hat sich versammelt, ein Schiff, heißt es, soll gegen Wind und Wetter, den Elementen trotzend, segeln können; Robert Fulton nennt sich der Mann, welcher diese Aufgabe zu lösen glaubt. Das Schiff beginnt die Fahrt; plötzlich aber bleibt es stehen – der Haufen lacht auf, pfeift und zischt, der eigene Vater des Mannes pfeift: »Hochmut! Tollheit! Jetzt kommt es, wie er's verschuldet,« heißt es, »hinter Schloß und Riegel mit dem wahnsinnigen Kopfe!« – Da bricht ein kleiner Nagel, welcher auf Augenblicke die Maschine hemmte, die Ruder schwingen sich wieder, die Schaufeln brechen auf's Neue die Gewalt der Wässer, das Schiff setzt seine Fahrt fort – –!
Der Webebaum des Dampfes kürzt die Stunden in Minuten zwischen den Ländern der Welt! Menschengeschlecht, erfassest Du die Seligkeit einer solchen Minute des Mitwissens, dieses Durchdrungensein des Geistes von seiner Mission, diesen Augenblick, in welchem alle Verzweiflung, jede Wunde, die der Dornenpfad der Ehre schlug – selbst diejenige der eigenen Schuld, – sich in Heil, Kraft und Klarheit verwandelt, die Disharmonie sich in Harmonie, gestaltet, diesen Augenblick, in welchem die Menschen die Offenbarung der göttlichen Gnade gewahr werden durch den Einzelnen und es empfinden, wie dieser sie ihnen Alles darbringt!
So zeigt der Dornenpfad der Ehre sich als eine Glorie, die Erde umstrahlend; dreimal glücklich hier zum Wanderer auserkoren zu sein, und ohne Verdienst durch die Gnade zwischen den Baumeister der Brücke, zwischen Gott und das Menschengeschlecht gestellt zu werden!
Auf mächtigen Flügeln schwebt der Geist der Geschichte durch die Zeiten und zeigt – ermutigend und tröstend, milde Gedanken erweckend – auf nächtlich finsterem Grunde in leuchtenden Bildern den Dornenpfad der Ehre, welcher nicht, wie in dem Märchen, in Glanz und Freude hier auf Erden, sondern über dieselbe hinaus in Zeit und Ewigkeit endet!
HÜHNER-GRETES FAMILIE
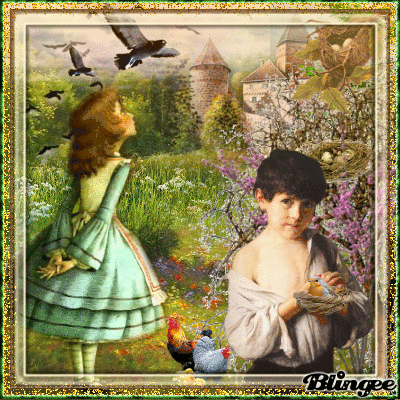
Hühner-Grete war der einzige ansässige Mensch in dem neuen stattlichen Haus, das für die Hühner und Enten auf dem Rittergut gebaut war; es stand da, wo das alte Ritterschloß gestanden hatte, mit Turm, gezacktem Giebel, Wallgraben und Zugbrücke. Dicht daneben war eine Wildnis von Bäumen und Büschen; hier war einst der Garten gewesen, er hatte sich bis hinab an den großen See erstreckt, der jetzt nur noch ein Moor war. Krähen, Dohlen und Elstern flogen mit Schreien und Krächzen über die alten Bäume hin, eine wimmelnde Menge von Vögeln; es wurden ihrer nicht weniger, wenn man in den Schwarm hineinschoß, sie vermehrten sich eher noch. Man konnte sie bis ins Hühnerhaus hinein hören, wo Hühner-Grete saß und die kleinen Entlein ihr über die Holzschuhe liefen. Sie kannte jedes Huhn, jede Ente, von dem Augenblick an, wo sie aus dem Ei krochen. Wie stolz war sie auf ihre Hühner und ihre Enten, stolz auf das stattliche Haus, das jetzt für sie gebaut war. Reinlich und nett war ihre kleine Stube, das verlangte die Frau des Gutsbesitzers, der das Hühnerhaus gehörte; sie kam oft mit ihren feinen vornehmen Gästen hierher und zeigte die Hühner- und Entenkaserne, wie sie das Hühnerhaus nannte.
Da waren ein Kleiderschrank und ein Lehnstuhl, ja, da war auch eine Kommode, und darauf stand eine blank geputzte Messingplatte aufgestellt, in die das Wort "Grubbe" eingraviert war, und das war gerade der Name des alten hochadligen Geschlechts, das hier in der Ritterburg gewohnt hatte. Die Platte war gefunden worden, als man hier grub, und der Küster sagte, sie habe keinen weiteren Wert als den einer alten Erinnerung. Der Küster wußte gut Bescheid über das Gut und die alten Zeiten, er hatte seine Gelehrsamkeit aus Büchern; es lag so viel Geschriebenes in seiner Tischschublade. Er wußte viel von den alten Zeiten, aber die älteste Krähe wußte vielleicht doch noch mehr und schrie es auf ihre Sprache in die Welt hinaus, die verstand jedoch der Küster nicht, wie klug er auch war.
Nach einem warmen Sommertag konnte das Moor so dunsten, daß es vor den alten Bäumen, in denen die Krähen, Dohlen und Elstern hausten, da lag wie ein ganzer See; so hatte es hier ausgesehen, als Ritter Grubbe noch lebte und das alte Schloß mit roten, dicken Mauern dastand. Damals reichte die Hundekette ganz bis vor das Tor; durch den Turm gelangte man in den steingepflasterten Gang, der zu den Gemächern führte. Die Fenster waren schmal, die Fensterscheiben klein, selbst in dem großen Saal, wo der Tanz abgehalten wurde, aber zur Zeit des letzten Grubbe war seit Mannesgedenken nicht getanzt worden, und doch lag da eine alte Kesseltrommel, die bei der Musik benutzt worden war. Hier stand ein kunstvoll geschnitzter Schrank, darin wurden seltene Blumenzwiebeln aufbewahrt, denn Frau Grubbe liebte es, zu pflanzen und Bäume und Kräuter zu ziehen; ihr Gemahl ritt lieber aus, um Wölfe und Wildschweine zu schießen und stets begleitete ihn seine kleine Tochter Marie. In einem Alter von fünf Jahren saß sie stolz zu Roß und sah mit großen schwarzen Augen kühn um sich. Es war ihre Lust, mit der Peitsche zwischen die Jagdhunde zu schlagen; der Vater sah es freilich lieber, daß sie zwischen die Bauernjungen schlug, die kamen, um die Herrschaft vorbeireiten zu sehen.
Der Bauer in der Erdhütte dicht am Schloß hatte einen Sohn Sören im selben Alter mit der kleinen hochadeligen Jungfer, er verstand sich auf das Klettern und mußte immer in die Bäume hinauf, um Vogelnester für sie auszunehmen. Die Vögel schrieen, so laut sie nur schreien konnten, und einer der größten hackte ihn gerade über das Auge, so daß das Blut herausströmte, man glaubte, das Auge sei mit drauf gegangen, aber es hatte doch keinen Schaden gelitten. Marie Grubbe nannte ihn ihren Sören, das war eine große Gunst, und die kam dem Vater, dem dummen Jörn, zugute; er hatte sich eines Tages versehen, sollte gestraft werden und auf dem hölzernen Pferd reiten: das stand auf dem Hofe mit vier Pfählen statt der Beine und einem schmalen Brett als Rücken; darüber solle Jörn rittlings reiten, und ein paar schwere Mauersteine sollten ihm an die Beine gebunden werden, damit er nicht allzuleicht saß; er schnitt schreckliche Grimassen, Sören weinte und flehte die kleine Marie an; sofort befahl sie, daß Sörens Vater heruntersteigen solle, und als man ihr nicht gehorchte, stampfte sie mit den Füßen auf das Steinpflaster und zerrte an des Vaters Rockärmel, so daß er zerriß. Sie wollte, was sie wollte, und sie bekam ihren Willen, Sörens Vater wurde befreit.
Frau Grubbe, die herzukam strich ihrer kleinen Tochter über das Haar und sah sie mit sanften Augen an, Marie verstand nicht, weshalb.
Zu den Jagdhunden wollte sie hinein und nicht mit der Mutter gehen, die dem Garten zuschritt, hinab an den See, wo die Wasserrosen in Blüte standen, wo sich Rohrkolben und Wasserviolen zwischen dem Röhricht wiegten; sie betrachtete all die Üppigkeit und Frische. "Wie angenehm!" sagte sie. In dem Garten stand ein zu jener Zeit seltener Baum, den sie selbst gepflanzt hatte, "Blutbuche" wurde er genannt, eine Art Mohr zwischen den andern Bäumen, so schwarzbraun waren die Blätter; er mußte starken Sonnenschein haben, sonst würde er im Schatten grün werden wie die andern Bäume und also seine Eigentümlichkeit verlieren. In den hohen Kastanien waren viele Vogelnester, ebenso in den Büschen und zwischen den grünen Kräutern. Es war, als wüßten die Vögel, daß sie hier geschützt waren, hier durfte niemand mit der Flinte knallen.
Die kleine Marie kam mit Sören hierher; daß er klettern konnte, wissen wir, und es wurden Eier und flaumige Junge aus den Nestern geholt. Die Vögel flogen in Angst und Schrecken davon, kleine und große flogen! Der Kiebitz draußen vom Felde, Dohlen, Krähen und Elstern flogen in die hohen Bäume und schrieen und schrieen, es war ein Geschrei, wie es das Vogelvolk noch heutigentags anstimmen kann.
"Was macht ihr denn da, Kinder? rief die sanfte Frau. "Das ist ja ein gottloses Unterfangen!"
Sören stand ganz verlegen da, die kleine hochadelige Jungfer sah auch ein wenig zur Seite, dann aber sagte sie kurz und energisch. "Mein Vater erlaubt es mir!"
"Raus! Raus!" schrieen die großen schwarzen Vögel und flogen davon; am nächsten Tage aber kamen sie wieder, denn hier waren sie zu Hause.
Die stille, sanfte Frau hingegen behielt ihr Heim dort nicht lange, der liebe Gott nahm sie zu sich, bei ihm hatte sie auch ihre wirkliche Heimat, weit mehr als hier im Schloß; und die Kirchenglocken läuteten prächtig, als ihre Leiche zur Kirche gefahren wurde, die Augen der armen Leute wurden feucht, denn sie war ihnen eine gute Herrin gewesen.
Als sie heimgegangen war, nahm sich niemand ihrer Anpflanzungen an, und der Garten verfiel.
Herr Grubbe sei ein harter Mann, so sagte man, aber die Tochter, so jung sie auch war, konnte ihn zügeln; er mußte lachen, und sie bekam ihren Willen. Jetzt war sie zwölf Jahre alt und starkgliedrig von Wuchs; sie sah mit ihren schwarzen Augen gerade in die Menschen hinein, ritt ihr Pferd wie ein Bursche und schoß ihre Büchse ab wie ein geübter Jäger.
Es kam hoher Besuch in die Gegend der allervornehmste, der junge König und sein Halbbruder und Kamerad, Herr Ulrik Frederik Gyldenlöve; sie wollten dort wilde Schweine schießen und in Herrn Grubbes Schloß übernachten.
Gyldenlöve saß bei Tische neben Marie Grubbe, er nahm ihren Kopf zwischen beide Hände und gab ihr einen Kuß, als wenn sie miteinander verwandt gewesen wären, sie aber gab ihm einen Schlag auf den Mund und sagte, sie könne ihn nicht ausstehen, und darüber ward weidlich gelacht, als wenn es etwas Ergötzliches sei.
Das ist es vielleicht auch gewesen; denn fünf Jahre später, als Marie ihr siebzehntes Jahr vollendet hatte, kam ein Bote mit einem Brief; Herr Gyldenlöve bat um die Hand der hochadeligen Jungfer; das war etwas!
"Es ist der vornehmste und galanteste Herr im Reich!" sagte Herr Grubbe. "Das ist nicht zu verachten!"
"Viel mache ich mir nicht aus ihm!" sagte Marie Grubbe, aber sie wies den vornehmsten Mann des Landes nicht ab, der an des Königs Seite saß.
Silbergerät, Leinenzeug und gewebte Wollstoffe gingen per Schiff nach Kopenhagen; sie machte die Reise zu Land in zehn Tagen. Die Aussteuer hatte widrigen Wind oder gar keinen Wind; es vergingen vier Monate, bis sie ankam, und als sie kam, war Frau Gyldenlöve weg.
"Eher will ich auf hedenem Laken liegen als in seinem seidenen Bett!" sagte sie. "Lieber gehe ich auf bloßen Beinen, als das ich mit ihm in der Kutsche fahre!"
An einem späten Abend im November kamen zwei Frauen in die Stadt Aarhus geritten, es waren Gyldenlöves Gemahlin, Marie Grubbe, und ihre Magd; sie kamen aus Vejle, dahin waren sie per Schiff von Kopenhagen gekommen. Sie ritten nach Herrn Grubbes festgemauertem Schloß. Er war nicht sehr erfreut über den Besuch. Er empfing sie mit zornigen Worten, gab ihr aber doch eine Kammer, in der sie ausruhen konnte. Speise und Trank erhielt sie, aber keine freundliche Behandlung; all das Böse, das im Vater wohnte, kam gegen sie zum Vorschein, und daran war sie nicht gewöhnt; auch sie war nicht sanften Sinnes, und wie man in den Wald hineinruft, so ruft es wieder heraus; sie gab bissige Antworten und sprach mit Haß und Bitterkeit von ihrem Eheherrn, mit dem sie nicht leben wollte, weil sie zu ehrbar und anständig war.
So verging ein Jahr, und es verging nicht gerade ergötzlich. Es fielen böse Worte zwischen Vater und Tochter, und das sollte niemals sein. Böse Worte tragen böse Frucht. Was für ein Ende sollte das nehmen?
"Wir beide können nicht unter einem Dache bleiben," sagte eines Tages der Vater. "Ziehe du fort von hier auf unser altes Gut, aber beiße dir eher die Zunge ab, als daß du Lügen in Umlauf bringst!"
Und dann schieden die beiden voneinander; sie zog mit ihrer Magd nach dem alten Gut, wo sie geboren und aufgewachsen war, wo die stille, fromme Frau, ihre Mutter, in der Grabkammer der Kirche lag; ein alter Viehhirt wohnte auf dem Gut, das war die ganze Dienerschaft. In den Zimmern hing Spinnengewebe, schwarz und schwer von Staub, der Garten wuchs so, wie er wollte, Hopfenranken und Winden schlangen ein Netz zwischen Bäume und Büsche, Schierling und Nessel breiteten sich immer dichter und kräftiger aus. Die Blutbuche war überwuchert und stand im Schatten, ihre Blätter waren jetzt grün wie die der anderen gewöhnlichen Bäume, mit ihrer Herrlichkeit war es vorbei. Dohlen, Krähen und Elstern flogen, ein wimmelnder Schwarm, über den hohen Kastanienbäumen hin, da war ein Lärmen und Schreien, als hätten sie einander wichtige Neuigkeiten zu erzählen. Jetzt war sie wieder hier, die Kleine, die ihre Eier und Jungen hatte stehlen lassen; der Dieb selber, der sie holte, kletterte jetzt draußen auf blätterlosen Bäumen, saß in dem hohen Mast und bekam seine tüchtigen Prügel mit dem Tauende, wenn er sich nicht schickte.
Das alles erzählte in unserer Zeit der Küster; er hatte es gesammelt und aus Büchern und Aufzeichnungen zusammengestellt; es lag mit viel anderem Geschriebenen in der Tischschublade.
"Auf und nieder, das ist der Welt Lauf!" sagte er. "Es ist wunderlich zu hören!" - und wir wollen gern hören, wie es Marie Grubbe erging, deswegen vergessen wir doch die Hühner-Grete nicht, sie sitzt zu unserer Zeit in ihrem stattlichen Hühnerhaus. Marie Grubbe saß zu ihrer Zeit auf dem alten Gut, aber nicht mit dem zufriedenen Sinn wie die alte Hühner-Grete.
Der Winter verging, der Frühling und der Sommer vergingen, dann kam wieder die rauhe, stürmische Herbstzeit mit den nassen, kalten Meernebeln. Es war ein einsames Leben, ein eintöniges Leben dort auf dem Gut.
Da nahm Marie Grubbe ihre Flinte und ging in die Heide hinaus, schoß Hasen und Füchse, schoß, was sie nur treffen konnte. Da draußen begegnete sie mehr als einmal dem adligen Herrn Paale Dyre aus Nörrebak, auch er ging mit seiner Flinte und mit seinen Hunden. Er war groß und stark, des rühmte er sich, wenn sie miteinander redeten. Er hätte sich mit dem seligen Herrn Brokkenhuus auf Egeskov auf Fünen messen können, von dessen Stärke soviel Wesens gemacht wurde. - Palle Dyre hatte nach seinem Beispiel in seinem Tor eine eiserne Kette mit einem Jägerhorn aufhängen lassen, und wenn er nach Hause ritt, ergriff er die Kette, hob sich mit dem Pferd von der Erde und blies auf dem Horn.
"Kommt selbst und seht es Euch an, Frau Marie!" sagte er. "Auf Nörrebak weht ein frischer Wind!"
Wann sie auf sein Schloß kam steht nicht aufgezeichnet, aber auf den Leuchtern in der Nörrebaker Kirche war zu lesen, daß sie von Palle Dyre und Marie Grubbe auf Nörrebak geschenkt seien.
Körper und Kräfte hatte Palle Dyre, er trank wie ein Schwamm, er war wie eine Tonne, die nicht zu füllen ist, er schnarchte wie ein ganzer Schweinestall; rot und aufgedunsen sah er aus.
"Verschlagen und boshaft ist er!" sagte Frau Palle Dyre, Grubbes Tochter. Bald hatte sie das Leben satt, aber dadurch wurde es doch nicht besser.
Eines Tages stand der Tisch gedeckt, und das Essen wurde kalt; Palle Dyre war auf der Fuchsjagd, und die Hausfrau war nicht zu finden. - Palle Dyre kam um Mitternacht wieder, Frau Dyre kam weder um Mitternocht noch am Morgen, sie hatte Nörrebak den Rücken gewendet, war ohne Gruß und Abschied davongeritten.
Es war graues, nasses Weter; der Wind wehte kalt, es flog ein Schwarm schwarzer schreiender Vögel über sie hin, sie waren nicht so obdachlos wie sie.
Zuerst zog sie gen Süden, ganz hinunter bis an das Deutsche Reich, ein paar goldene Ringe mit kostbaren Steinen wurden in Geld umgesetzt, dann ging sie gen Osten, dann kehrte sie um und ritt wieder gen Westen, sie hatte kein Ziel vor Augen, sie war zornig auf alle, selbst auf den lieben Gott, so elend war ihr Sinn; bald war auch ihr Körper elend, sie konnte kaum mehr den Fuß rühren. Der Kiebitz flog von seinem Erdhaufen aus, als sie darüberstrauchelte; der Vogel schrie: "Du Dieb! Du Dieb!," wie er immer zu schreien pflegt. Nie hatte sie ihres Nächsten Gut gestohlen, aber Vogeleier und junge Vögel hatte sie sich als kleines Mädchen aus Erdhaufen und Bäumen holen lassen; daran dachte sie jetzt.
Da, wo sie lag, konnte sie die Dünen am Strande sehen. Dort wohnten Fischer, aber so weit konnte sie nicht kommen, sie war zu krank dazu. Die großen weißen Strandmöwen kamen über sie hingeflogen und schrieen, wie daheim die Dohlen, die Krähen und die Elstern über den Bäumen des Gartens geschrieen hatten. Die Vögel flogen ganz nahe an sie heran, schließlich schien es ihr, als würden sie kohlschwarz, aber dann ward es auch Nacht vor ihren Augen.
Als sie die Augen wieder aufschlug, war sie gehoben und getragen; ein großer, starker Bursche hatte sie auf seine Arme genommen. Sie sah ihm gerade in sein bärtiges Gesicht, er hatte eine Narbe über dem Auge, so daß die Augenbraue gleichsam in zwei Teile geteilt war; er trug sie, so elend sie war, nach dem Schiff, wo er von dem Schiffer mit bösen Worten empfangen wurde.
Am Tage darauf segelte das Schiff. Marie Grubbe kam nicht an Land; sie fuhr also mit. Aber sie kam doch wohl zurück? Ja, wann und wo?
Auch davon wußte der Küster zu erzählen, und es war dies keine Geschichte, die er selber zusammensetzte, er hatte den ganzen eigentümlichen Verlauf aus einem glaubwürdigen alten Buch, das wir selber nehmen und lesen können. Der dänische Geschichtsschreiber Ludwig Holberg, der so viele lesewürdige Bücher und die ergötzlichen Komödien geschrieben hatte, aus denen wir so recht seine Zeit und ihre Menschen kennenlernen können, erzählt in seinen Briefen von Marie Grubbe, wie und wo er ihr in der Welt begegnet ist. Es verlohnt sich schon, das zu hören, darum vergessen wir die Hühner-Grete keineswegs, sie sitzt zufrieden und wohlgeborgen in dem stattlichen Hühnerhaus.
Das Schiff segelte von dannen mit Marie Grubbe; da waren wir ja stehengeblieben.
Jahre auf Jahre vergingen.
In Kopenhagen wütete die Pest, es war im Jahre 1711. Die Königin von Dänemark begab sich in ihre deutsche Heimat, der König verließ die Hauptstadt des Reiches, wer konnte, wandte der Stadt den Rücken. Einer von den Studenten, die noch in Borchs Kollegium, der Freiwohnung für Musensöhne, geblieben waren, zog nun auch von dannen. Es war in der Frühe des Morgens um zwei Uhr; er kam mit seinem Ranzen, der mehr mit Büchern und beschriebenen Papieren gefüllt war als gerade mit Kleidungsstücken. Ein kalter, feuchter Nebel lag über der Stadt, auch nicht ein Mensch war in der ganzen Straße zu sehen, die er durchschritt, ringsumher an Haustüren und Torwegen waren Kreuze gemalt, da drinnen herrschte die Seuche, oder die Bewohner waren ausgestorben. Auch in der breiteren, gewundenen Kjödmangergade, wie die Straße hieß, die vom runden Turm auf das Schloß des Königs zuführte, war niemand zu erblicken. Jetzt rasselte ein großer Leichenwagen vorüber; der Kutscher schwenkte die Peitsche, die Pferde jagten im Galopp dahin, der Wagen war mit Toten angefüllt. Der junge Student hielt die Hand vor das Gesicht und roch an einem starken Spiritus, den er auf einem Schwamm in einer Messingbüchse bei sich trug. Aus einer Kneipe in einer der Seitengassen erschollen kreischender Gesang und unheimliches Gelächter von Leuten, die die Nacht vertranken, um zu vergessen, daß die Seuche vor der Tür stand und auch sie auf den Leichenwagen laden wollte zu den andern Toten. Der Student lenkte seine Schritte der Schloßbrücke zu, wo ein paar kleine Schiffe lagen; eins davon lichtete gerade die Anker, um aus der pestverseuchten Stadt fortzukommen.
"Wenn uns Gott am Leben läßt und wir günstigen Wind haben, gehen wir in den Grönsund bei Falster," sagte der Schiffer und fragte den Studenten, der mitwollte, nach seinem Namen.
"Ludwig Holberg!" sagte der Student, und der Name klang wie jeder andere Name, jetzt klingt uns darauf einer des stolzesten Namen Dänemarks entgegen; damals war er nur ein junger, unbekannter Student.
Das Schiff glitt an dem Schloß vorüber. Es war noch nicht heller Morgen, als sie in das offene Fahrwasser hinausgelangten. Es kam eine leichte Brise auf, die Segel blähten sich, der junge Student setzt sich so, daß ihm der frische Seewind ins Gesicht blies, und bald war er eingeschlafen. Das war nun auch das Vernünftigste, was er tun konnte.
Schon am dritten Morgen lag das Schiff vor Falster. "Kennt Ihr hier jemand am Ort, bei dem ich gegen Entgelt Unterkunft finden kann?" frage Holberg den Kapitän.
"Ich glaube, Ihr werden gut daran tun, zu der Fährfrau im Borrehaus zu gehen!," sagte der. "Wenn Ihr sehr galant sein wollt, so redet sie Mutter Sören Sörensen Möller an! Doch es kann sein, daß es ihr nicht ansteht, wenn Ihr zu fein mit ihr verkehrt; der Mann sitzt wegen einer Missetat; sie selber führt das Fährboot, ein Paar Fäuste hat sie!"
Der Student nahm seinen Tornister und ging nach dem Fährhaus. Die Tür war nicht abgeschlossen, der Türgriff gab nach, und er betrat eine gepflasterte Stube, in der die Bettbank mit einer großen Felldecke das hauptsächlichste Stück Möbel war. Eine weiße Henne mit Küchlein war an die Bettbank gebunden und hatte den Wassernapf umgestoßen, so daß das Wasser über den Fußboden floß. Weder hier noch in der Kammer nebenan war ein Mensch zu sehen, da war nur eine Wiege mit einem Kind darin. Das Fährboot kam zurück, es saß nur eine Person darin, ob Mann oder Frau, war nicht leicht zu sagen. Ein großer Mantel verhüllte die Gestalt, und der Kopf verschwand in einer Kapuze. Das Boot legte an.
Es war eine Frau, sie kam und trat in die Stube. Sie sah recht ansehnlich aus, als die ihren Rücken geradereckte; zwei stolze Augen sahen unter den schwarzen Brauen hervor. Es war Mutter Sören, die Fährfrau; Dohlen, Krähen und Elstern würden einen andern Namen schreien, den wir besser kennen.
Unwirsch sah sie aus, viele Reden liebte sie offenbar nicht, aber so viel wurde doch geredet und abgemacht, daß der Student sich auf unbestimmte Zeit bei ihr einmietete, solange es in Kopenhagen so übel stand.
Und nach dem Fahrhaus kamen aus dem nahe gelegenen Städtchen häufig ein paar ehrenwerte Bürger. Da kamen Franz Messerschmidt und Sivert Sackgucker; sie tranken einen Krug Bier im Fährhaus und diskutierten mit dem Studenten; er war ein tüchtiger junger Mann, der seine Praktika, wie sie es nannten, konnte, er las Griechisch und Lateinisch und wußte Bescheid über gelehrte Sachen.
"Je weniger man weiß, desto weniger bedrückt es einen," sagte Mutter Sören.
"Ihr habt es schwer!" sagte Holberg eines Tages, als sie ihre Wäsche in der scharfen Lauge weichte und selber die Baumknorren für die Feuerung zuhauen mußte.
"Das ist meine Sache!" sagte sie.
"Habt Ihr von klein an so arbeiten und schleppen müssen?"
"Das könnt Ihr doch von meinen Händen ablesen!" sagte sie und zeigte zwei freilich kleine, aber harte, starke Hände mit abgebissenen Nägeln. "Ihr seid ja gelehrt genug, um lesen zu können!"
Um die Weihnachtszeit begann ein heftiges Schneetreiben; die Kälte biß gar arg, der Wind blies scharf, als führe er Scheidewasser mit sich, um den Leuten das Gesicht damit zu waschen. Mutter Sören ließ sich nicht anfechten, sie warf den Mantel um und zog die Kapuze über den Kopf. Dunkel war es im Hause schon am frühen Nachmittag; Holzscheite und Torf legte sie auf den Herd und setzte sich dann hin und flickte ihre Schuhe, da war niemand sonst, der es hätte tun können. Gegen Abend sprach sie mehr mit dem Studenten, als das sonst ihre Gewohnheit war; sie sprach von ihrem Mann.
"Er hat aus Fahrlässigkeit einen Mord an einem Schiffer aus Dragör begangen und muß deswegen drei Jahre auf der königlichen Schiffswerft in Ketten arbeiten Er ist nur ein gemeiner Matrose, darum muß das Gesetz seinen Lauf haben."
"Das Gesetz gilt auch für den höheren Stand!" sagte Holberg.
"Meint Ihr!" sagte Mutter Sören und sah in das Feuer hinein, dann begann sie aber wieder. "Habt Ihr von Kai Lykke gehört, der eine seiner Kirchen niederreißen ließ, und als der Pfarrer Mads darüber von der Kanzel herabdonnerte, ließ er Herrn Mads in Eisen und Ketten legen, berief ein Gericht und verurteilte ihn selber, daß er seinen Kopf verwirkt habe, der wurde auch abgehauen; das war keine fahrlässige Tötung, und doch ging Kai Lykke damals frei aus!"
"Er war in seinem Recht - nach der damaligen Zeit," sagte Holberg. "Jetzt sind wir darüber hinaus!"
"Das könnt Ihr Dummen vormachen!" sagte Mutter Sören, stand auf und ging in die Kammer, wo "das Gör," das kleine Kind, lag, sie nahm es auf und bettete es frisch, machte dann dem Studenten sein Lager auf der Bettbank zurecht; er hatte die Felldecke bekommen, er war frostiger als sie, und doch war er in Norwegen geboren.
Der Neujahrsmorgen brach mit klarem, hellem Sonnenschein an, der Frost war scharf gewesen und war noch so scharf, daß der gefallene Schnee hartgefroren dalag, so daß man darauf gehen konnte. Die Glocken in der Stadt riefen zur Kirche; Student Holberg nahm seinen wollenen Mantel um und wollte zur Stadt.
Über das Fährhaus flogen mit Gekrächz und Geschrei Dohlen, Krähen, Elstern, man konnte vor dem Lärmen kaum die Kirchenglocken hören. Mutter Sören stand draußen und füllte einen Messingkessel mit Schnee, um ihn über das Feuer zu setzen und Trinkwasser zu schmelzen, sie sah zu dem Vogelgewimmel empor und hatte ihre eigenen Gedanken dabei.
Studiosus Holberg ging in die Kirche; auf dem Wege dahin und auf dem Heimwege kam er an Sivert Sackguckers Haus am Tor vorüber, dort ward er auf ein Schälchen Warmbier mit Sirup und Ingwer eingeladen; die Rede kam auf Mutter Sören, aber der Sackgucker wußte eigentlich nichts über sie zu erzählen, es wisse wohl kaum jemand etwas. Von Falster sei sie nicht, sagte er, etwas Geld habe sie wohl einmal gehabt, ihr Mann sei ein gemeiner Matrose von heftigem Sinn, einen Schiffer aus Dragör habe er totgeschlagen, "Die Frau prügelt er, und doch verteidigt sie ihn."
"Ich ließe mir solche Behandlung nicht gefallen!" sagte die Frau des Sackguckers. "Ich bin freilich auch von besserer Herkunft! Mein Vater war königlicher Strumpfweber!"
"Daher habt ihr auch einem königlichen Beamten zum Ehebund die Hand gereicht!" sagte Holberg und machte eine Reverenz vor ihr und dem Sackgucker.
Es war Heiligendreikönigsabend. Mutter Sören zündete ein Heiliegendreikönigslicht für Holberg an, das heißt drei Talglichter, die sie selber gezogen hatte.
"Ein Licht für jeden Mann!" sagte Holberg.
"Für jeden Mann?" sagte die Frau und sah ihn starr an.
"Ja, für einen jeden der Weisen aus dem Morgenland!" sagte Holberg.
"Ach, so war es gemeint!" sagte sie und schwieg lange. Aber an jedem Heiliegendreikönigsabend bekam er mehr zu wissen, als er bisher gewußt hatte.
"Ihr habt einen liebevollen Sinn für den Mann, mit dem Ihr in der Ehe lebt!" sagte Holberg. "Und doch sagen die Leute, daß er übel mit Euch verfährt!"
"Das geht niemand etwas an außer mir!" entgegnete sie. "Die Schläge wären mir dienlich gewesen, als ich noch klein war; jetzt kriege ich sie wohl um meiner Sünden willen! Was er mir Gutes getan hat, das weiß ich!" Und sie richtete sich ganz auf. "Als ich krank auf der Heide lag und niemand etwas von mir wissen wollte außer den Krähen und Dohlen, die nach mir hackten, da hat er mich auf seine Arme genommen und bekam harte Worte für den Fang, den er auf sein Schiff brachte. Ich bin nicht dazu gemacht, krank zu liegen, und so erholte ich mich denn. Ein jeder hat es auf seine Weise, und so auch Sören; man soll den Gaul nicht nach dem Zaumwerk beurteilen! Mit ihm hab ich trotz allem zufriedener gelebt als mit dem, den sie den galantesten und vornehmsten von allen Untertanen des Königs nannten. Ich habe in Ehegemeinschaft mit dem Statthalter Gyldenlöve, des Königs Halbbruder, gelebt; später nahm ich Palle Dyre. Jacke wie Hose! Ein jeder auf seine Weise und ich auf meine. Das war eine lange Erzählung, aber nun wißt Ihr es!" Und damit ging sie zur Stube hinaus.
Das war Marie Grubbe! Ein so wunderlicher Spielball des Glücks war sie gewesen! Viele Heiligendreikönigsabende sollte sie nicht mehr erleben, Holberg hat niedergeschrieben, daß sie im Jahre 1716 starb, aber er hat nicht niedergeschrieben, denn er wußte es nicht, daß, als Mutter Sören, wie sie genannt wurde, im Borrehaus auf der Leichenbahre lag, eine Menge großer schwarzer Vogel über das Haus hinflogen, ohne zu schreien, als wüßten sie, daß zu einem Begräbnis Stille gehört. Sobald sie in der Erde lag, waren die Vögel nicht mehr zu sehen, aber am selben Abend wurde in Jütland über dem alten Gut eine Unmenge Dohlen, Krähen und Elstern gesehen, sie schrieen laut durcheinander, als hätten sie etwas zu verkündigen, vielleicht von ihm, der als kleiner Knabe ihre Eier und ihre flaumigen Jungen aus dem Neste nahm, von dem Sohn des Bauern, der auf der königlichen Schiffswert ein Strumpfband aus Eisen bekam,, und von der hochadeligen Jungfer, die als Fährfrau am Grönsund endete. "Brav! Brav"! schrieen sie.
Und die Familie schrie: "Brav! Brav!," als das alte Schloß niedergerissen wurde. "Sie schreien es noch, und da ist nichts mehr, worüber sie schreien könnten!" sagte der Küster, wenn er erzählte. Die Familie ist ausgestorben, das Schloß ist niedergerissen, und wo es einst stand, da steht jetzt das stattliche Hühnerhaus mit der vergoldeten Wetterfahne und mit der alten Hühner-Grete. Sie ist so glücklich über ihre hübsche Wohnung; wenn sie nicht hierhergekommen wäre, hätte sie im Armenhaus enden müssen.
Die Tauben gurrten über ihr, die Kalekuten plauderten ringsumher, und die Enten schnatterten.
"Niemand kannte sie!" sagten sie. "Angehörige hatte sie nicht. Es ist ein Werk der Barmherzigkeit, daß sie hier ist. Sie hat weder einen Entenvater noch eine Hühnermutter und keine Nachkommenschaft!"
Aber sie hatte eine Familie; sie kannte sie nur nicht, und der Küster kannte sie auch nicht, wieviel beschriebene Papiere er auch in seiner Tischshublade hatte, aber eine von den alten Krähen wußte davon, erzählte davon Sie hatte von ihrer Mutter und ihrer Großmutter von Hühner-Gretes Mutter und deren Großmutter gehört, die auch wir kennen seit der Zeit, da sie als Kind über die Zugbrücke ritt und stolz um sich sah, als gehörten die ganze Welt und alle Vogelnester ihr, wir sehen sie auf der Heide in den Dünen und zuletzt im Borrehaus. Die Enkelin, die Letzte des Geschlechts, war wieder in die Heimat zurückgekehrt, wo das alte Schloß gestanden hatte, wo die schwarzen, wilden Vögel schrieen. Aber sie saß zwischen den zahmen Vögeln, von ihnen gekannt und mit ihnen bekannt. Hühner-Grete hatte nichts mehr zu wünschen, sie war bereit zu sterben, alt genug, um zu sterben.
"Grab! Grab!" schrieen die Krähen.
Und Hühner-Grete bekam ein schönes Grab, das niemand kennt außer der alten Krähe, wenn die nicht auch schon tot ist.
Und nun kennen wir die Geschichte von dem alten Schloß, dem alten Geschlecht und von Hühner-Gretes ganzer Familie!
DER REISEKAMERAD
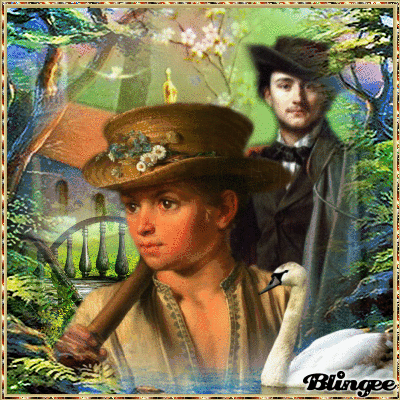
Der arme Johannes war tief betrübt, denn sein Vater war sehr krank und konnte nicht genesen. Außer den Beiden war Niemand in dem kleinen Zimmer; die Lampe auf dem Tische war dem Erlöschen nahe, und es war spät Abends.
„Du warst ein guter Sohn, Johannes!“ sagte der kranke Vater, „der liebe Gott wird Dir schon in der Welt forthelfen!“ Er sah ihn mit ernsten, milden Augen an, holte tief Atem und starb; es war gerade, als ob er schliefe. Aber Johannes weinte; nun hatte er gar Niemand in der ganzen Welt, weder Vater noch Mutter, Schwester oder Bruder. Der arme Johannes! Er lag vor dem Bette auf seinen Knien und küsste des toten Vaters Hand und weinte viele bittere Tränen; aber zuletzt schlossen sich seine Augen und er schlief ein mit dem Haupte auf dem harten Bettpfosten. Da träumte ihm ein sonderbarer Traum; er sah, wie Sonne und Mond sich vor ihm neigten, und er erblickte seinen Vater frisch und gesund und hörte ihn lachen, wie er immer lachte, wenn er recht froh war. Ein schönes Mädchen mit einer goldenen Krone auf ihrem langen, glänzenden Haar reichte Johannes die Hand, und sein Vater sagte: „Siehst Du, was für eine Braut Du erhalten hast! Sie ist die schönste in der ganzen Welt!“ Da erwachte er, und alle Herrlichkeit war vorbei, sein Vater lag tot und kalt im Bette, es war Niemand bei ihm. Der arme Johannes!
In der folgenden Woche wurde der Tote begraben; Johannes ging dicht hinter dem Sarge und konnte nun den guten Vater nicht mehr zu sehen bekommen, der ihn so geliebt hatte; er hörte, wie man die Erde auf den Sarg hinunter warf, sah noch die letzte Ecke desselben, aber bei der nächsten Schaufel Erde, welche hinab geworfen wurde, war auch sie verschwunden. Da war es gerade, als wollte sein Herz in Stücke zerspringen, so betrübt war er. Man sang noch am Grabe einen Psalm, was sehr schön klang, und die Tränen traten unserm Johannes in die Augen, er weinte, und das tat seiner Trauer wohl. Die Sonne schien herrlich auf die grünen Bäume, gerade als wollten sie sagen: „Du musst nicht so betrübt sein, Johannes! Siehst Du, wie schön blau der Himmel ist! Dort oben ist nun Dein Vater und bittet den lieben Gott, dass es Dir allezeit wohl ergehen möge!“
„Ich will auch immer gut sein!“ sagte Johannes. „Dann komme ich zu meinem Vater, und was wird das für eine Freude werden, wenn wir uns wiedersehen! Wie viel werde ich ihm dann erzählen können, und er wird mir viele Sachen zeigen, mich über die Herrlichkeit im Himmel belehren, gerade wie er mich auf Erden unterrichtete. O, was wird das für eine Freude werden!“
Johannes dachte sich das so deutlich, dass er dabei lächelte, während die Tränen ihm noch über die Wangen liefen. Die kleinen Vögel saßen oben in den Kastanienbäumen und zwitscherten: „Quivit, quivit!“ Sie waren munter, obgleich sie mit beim Begräbnisse waren, aber sie wussten wohl, dass der tote Mann oben im Himmel war, Flügel hatte, weit schönere und größere als die ihrigen und dass er glücklich sei, weil er hier auf Erden gut gewesen war, und darüber waren sie vergnügt. Johannes sah, wie sie von den grünen Bäumen weit in die Welt hinaus flogen, und da bekam er Lust mitzufliegen. Aber zuerst machte er ein großes Kreuz von Holz, um es auf seines Vaters Grab zu setzen, und als er es am Abend dahin brachte, war das Grab mit Sand und Blumen geschmückt; das hatten fremde Leute getan, denn sie hielten alle viel von dem lieben Vater, der nun tot war.
Früh am nächsten Morgen packte Johannes sein kleines Bündel zusammen und verwahrte in seinem Gürtel sein ganzes Erbteil, welches fünfzig Taler und ein paar Pfennige betrug; damit wollte er in die Welt hinauswandern. Aber zuerst ging er nach dem Kirchhofe zu seines Vaters Grab, betete ein Vaterunser und sagte: „Lebe wohl, Du lieber Vater! Ich will immer ein guter Mensch sein, darum bitte ich den lieben Gott, dass es mir wohl ergehe!“
Draußen auf dem Felde, wo Johannes ging, standen alle Blumen frisch und schön in dem warmen Sonnenschein, und sie nickten im Winde, gerade als wollten sie sagen: „Willkommen im Grünen! Ist es hier nicht schön?“ Aber Johannes wendete sich noch einmal zurück, um die alte Kirche zu betrachten, wo er als kleines Kind getauft worden, wo er jeden Sonntag mit seinem Vater zum Gottesdienst gewesen war und die schönen Lieder gesungen hatte; da sah er hoch oben in einer Öffnung des Turms den Kirchenkobold mit seiner kleinen, roten Mütze stehen, das Antlitz mit dem gebogenen Arm beschattend, da ihm sonst die Sonne in die Augen stach. Johannes nickte ihm Lebewohl zu, und der kleine Kobold schwenkte seine rote Mütze, legte die Hand auf das Herz und warf ihm viele Kusshände zu, um zu zeigen, wie er ihm Gutes und namentlich eine recht glückliche Reise wünsche.
Johannes dachte daran, wie viel Schönes er nun in der großen Welt zu sehen bekommen werde, und ging weiter, so weit, als er früher nie gewesen war; er kannte die Orte gar nicht, durch die er kam, oder die Menschen, denen er begegnete; er war in der Fremde.
Die erste Nacht musste er sich auf einen Heuschober auf dem Felde schlafen legen, ein anderes Bett hatte er nicht. Aber das war gerade hübsch, meinte er, der König könnte es nicht besser haben. Das ganze Feld mit dem Flusse, der Heuschober und der blaue Himmel darüber, das war gerade eine schöne Schlafkammer. Das grüne Gras mit den kleinen, roten und weißen Blumen war die Fußdecke, die Fliederbüsche und die wilden Rosenhecken waren Blumensträuße, und zum Waschbecken diente ihm der ganze Fluss mit dem klaren, frischen Wasser, wo das Schilf sich neigte und ihm guten Abend wie guten Morgen bot. Der Mond war eine große Nachtlampe, hoch oben unter der Decke, der zündete die Vorhänge nicht an mit seinem Feuer; Johannes konnte ganz ruhig schlafen, er tat es auch und erwachte erst wieder, als die Sonne aufging und alle die kleinen Vogel ringsumher sangen: „Guten Morgen! Guten Morgen! Bist Du noch nicht auf?“
Die Glocken läuteten zur Kirche, es war Sonntag. Die Leute gingen hin, den Prediger zu hören, und Johannes folgte ihnen, sang das geistliche Lied mit und hörte Gottes Wort; es war ihm gerade, als wäre er in der Kirche, in der er getauft worden war, wo er Psalmen mit seinem Vater gesungen hatte.
Draußen auf dem Kirchhofe waren viele Gräber und auf einigen wuchs hohes Gras. Da dachte Johannes an seines Vaters Grab, welches am Ende auch so aussehen werde, wie diese, da er es nicht rein halten und schmücken konnte. Er setzte sich also nieder und riss das Gras ab, richtete die Holzkreuze auf, welche umgefallen waren, und legte die Kränze, die der Wind vom Grabe fortgerissen hatte, wieder auf ihre Stelle, indem er dachte: „Vielleicht tut Jemand dasselbe an meines Vaters Grab, nun ich es nicht tun kann!“
Draußen vor der Kirchhofstür stand ein alter Bettler und stützte sich auf seine Krücke! Johannes gab ihm die Pfennige, die er hatte, und ging dann glücklich und vergnügt weiter fort, in die weite Welt hinaus.
Gegen Abend wurde es ein erschrecklich böses Wetter. Johannes sputete sich, unter Dach zu gelangen, aber es wurde bald finstere Nacht, da erreichte er endlich eine kleine Kirche, die ganz einsam auf einem kleinen Hügel lag; die Tür stand zum Glück nur angelehnt, und er schlüpfte hinein; hier wollte er bleiben, bis das böse Wetter sich gelegt hatte.
„Hier will ich mich in einen Winkel setzen“, sagte er; „ich bin ganz ermüdet und bedarf wohl der Ruhe.“ Dann setzte er sich nieder, faltete seine Hände und betete sein Abendgebet, und bevor er es wusste schlief und träumte er, während es draußen blitzte und donnerte.
Als er wieder erwachte, war es mitten in der Nacht, aber das böse Wetter war vorübergezogen und der Mond schien durch die Fenster zu ihm herein. Mitten in der Kirche stand ein offener Sarg mit einem toten Mann darin, denn er war noch nicht begraben. Johannes war durchaus nicht furchtsam, denn er hatte ein gutes Gewissen und wusste wohl, dass die Toten Niemand etwas zu Leide tun; es sind lebende böse Menschen, die Übels tun. Solche zwei lebende, schlimme Leute standen dicht bei dem toten Mann, der hier in die Kirche hineingesetzt war, bevor er beerdigt wurde; dem wollten sie Übels erweisen, ihn nicht in seinem Sarge liegen lassen, sondern ihn draußen vor die Kirchtür werfen, den armen, toten Mann.
„Weshalb wollt Ihr das tun?“ fragte Johannes. „Das ist böse und schlimm; lasst ihn in Jesu Namen ruhen!“
„O, Schnickschnack!“ sagten die beiden hässlichen Menschen. „Er hat uns angeführt! Er schuldet uns Geld, das konnte er nicht bezahlen, und nun, da er tot ist, bekommen wir keinen Pfennig; deshalb wollen wir uns rächen, er soll wie ein Hund draußen vor der Kirchtür liegen!“
„Ich habe nicht mehr als fünfzig Taler,“ sagte Johannes, „das ist mein ganzes Erbteil, aber das will ich Euch gern geben, wenn Ihr mir ehrlich versprechen Wollt, den armen, toten Mann in Ruhe zu lassen. Ich werde schon durchkommen ohne das Geld; ich habe starke, gesunde Gliedmaßen, und der liebe Gott wird mir allezeit helfen.“
„Ja,“ sagten die hässlichen Menschen, „wenn Du seine Schuld bezahlen willst, wollen wir beide ihm nichts tun, darauf kannst Du Dich verlassen!“ Sie nahmen das Geld, welches ihnen Johannes gab, lachten laut auf über seine Gutmütigkeit und gingen ihres Weges; Johannes aber legte die Leiche wieder im Sarge zurecht, faltete ihre Hände, nahm Abschied von ihr und ging dann durch den großen Wald zufrieden weiter.
Ringsumher, wo der Mond durch die Bäume hereinscheinen konnte, sah er die niedlichen kleinen Elfen lustig spielen; sie ließen sich nicht stören, sie wussten wohl, dass er ein guter, unschuldiger Mensch war, und es sind nur die bösen Leute, welche die Elfen nicht zu sehen bekommen. Einige von ihnen waren nicht größer, als ein Finger breit ist, und hatten ihre langen, gelben Haare mit goldenen Kämmen aufgeheftet; zwei und zwei schaukelten sie sich auf den großen Tautropfen, die auf den Blättern und dem hohen Grase lagen; zuweilen rollte ein Tropfen herab und fiel nieder zwischen den langen Grashalmen und das verursachte ein Gelächter und Lärmen unter den andern Kleinen. Es war allerliebst! Sie sangen und Johannes erkannte ganz deutlich alle die hübschen Lieder, die er als kleiner Knabe gelernt hatte. Große, bunte Spinnen mit silbernen Kronen auf dem Kopfe mussten von der einen Hecke zur andern lange Hängebrücken und Paläste spinnen, welche, da der feine Tau darauf fiel, wie glänzendes Glas im klaren Mondscheine aussahen. So währte es fort, bis die Sonne aufging. Die kleinen Elfen krochen dann in die Blumenknospen, und der Wind erfasste ihre Brücken und Schlösser, die als Spinnweben durch die Luft dahinflogen.
Johannes war nun aus dem Walde gekommen, als eine starke Mannsstimme hinter ihm rief: „Heda, Kamerad, wohin geht die Reise?“
„In die weite Welt hinaus!“ sagte Johannes. „Ich habe weder Vater, noch Mutter, bin ein armer Bursche, aber der Herr hilft mir wohl!“
„Ich will auch in die weite Welt hinaus!“ sagte der fremde Mann. „Wollen wir beide einander Gesellschaft leisten?“
„Ja wohl!“ sagte Johannes, und sie gingen mit einander. Bald wurden sie sich recht gut, denn sie waren beide gute Menschen. Aber Johannes merkte wohl, dass der Fremde viel klüger war, als er; er hatte fast die ganze Welt durchreist und wusste von allem Möglichen, was existierte, zu erzählen.
Die Sonne war schon hoch herauf, als sie sich unter einen großen Baum setzten, ihr Frühstück zu genießen; zur selben Zeit kam eine alte Frau daher. Sie ging ganz krumm, stützte sich auf einen Krückstock und hatte auf ihrem Rücken ein Bündel Brennholz holz, welches sie sich im Walde gesammelt hatte. Ihre Schürze war aufgebunden, und Johannes sah, dass drei große Ruthen von Farrenkraut und Weidenreisern daraus hervorsahen. Als sie ihnen ganz nahe war, glitt ihr ein Fuß aus, sie fiel und schrie gewaltig, denn sie hatte ein Bein gebrochen, die arme, alte Frau. Johannes meinte sogleich, dass sie die Frau nach Hause tragen wollten, wo sie wohnte, aber der Fremde machte sein Ränzel auf, und sagte, dass er hier eine Salbe habe, welche sogleich ihr Bein wieder ganz und kräftig machen werde, so dass sie selbst nach Hause gehen könne, und zwar, als ob sie nie das Bein gebrochen hätte. Aber dafür wollte er auch, dass sie ihm die drei Ruthen schenke, die sie in ihrer Schürze habe. „Das wäre gut bezahlt!“ sagte die Alte und nickte ganz eigen mit dem Kopfe; sie wollte die Ruthen eben nicht gern hergeben, aber es war auch nicht angenehm, mit gebrochenem Beine da zu liegen. So gab sie ihm denn die Ruthen, und sowie er nur die Salbe auf das Bein gerieben hatte, erhob sich auch die alte Mutter und ging viel besser als zuvor. Das hatte die Salbe bewirkt, aber die war auch nicht in der Apotheke zu haben.
„Was willst Du mit den Ruthen?“ fragte Johannes nun seinen Reisekameraden.
„Das sind drei schöne Kräuterbesen!“ sagte er. „Die liebe ich sehr, denn ich bin ein sonderbarer Mann!“
Dann gingen sie noch ein gutes Stück.
„Wie der Himmel sich umzieht!“ sagte Johannes und zeigte gerade aus. „Das sind erschrecklich dicke Wolken!“
„Nein“, sagte der Reisekamerad, „das sind keine Wolken, das sind Berge, die herrlichen, großen Berge, wo man ganz hinauf über die Wolken in die frische Luft gelangt! Glaube mir, das ist herrlich! Bis morgen sind wir sicher schon dort!“
Das war nicht so nahe, wie es aussah; sie hatten einen ganzen Tag zu gehen, bevor sie die Berge erreichten, wo die schwarzen Wälder gerade gegen den Himmel aufwuchsen, und wo es Steine gab, gerade so groß als eine ganze Stadt. Das mochte wahrlich eine schwere Anstrengung werden, da hinüberzukommen, aber darum gingen auch Johannes und der Reisekamerad in das Wirtshaus, um auszuruhen und Kräfte zum morgigen Marsche zu sammeln.
Unten in der großen Schenkstube im Wirtshaus waren viele Menschen versammelt, denn da war ein Mann, der gab ein Puppenspiel; er hatte gerade seine kleine Bühne aufgestellt, und die Leute saßen ringsumher, um die Komödie zu sehen. Ganz vorn aber hatte ein dicker Schlächter Platz genommen, und zwar den allerbesten; sein großer Bullenbeißer, der recht grimmig aussah, saß an seiner Seite und machte große Augen, gerade wie die andern Zuschauer.
Nun begann ein niedliches Stück mit einem Könige und einer Königin; die saßen auf dem schönsten Thron, hatten goldne Kronen auf dem Haupte und lange Schleppen an den Kleidern, denn das konnten sie haben. Die niedlichsten Holzpuppen mit Glasaugen und großen Schnurrbärten standen an allen Türen und machten auf und zu, damit frische Luft in das Zimmer kommen konnte. Es war gerade ein recht hübsches Stück und gar nicht traurig; aber wie die Königin aufstand und über den Fußboden hin ging, da – Gott mag wissen, was der große Bullenbeißer sich dachte – machte er, da der dicke Schlächter ihn nicht hielt, einen Sprung in das Theater, nahm die Königin mitten um den Leib, so dass es knick! knack! ging. Es war ganz erschrecklich!
Der arme Mann, der das Stück aufführte, war sehr erschrocken und betrübt über seine Königin, denn es war die aller niedlichste Puppe, die er hatte, und nun hatte ihr der hässliche Bullenbeißer den Kopf abgebissen; als aber die Leute später fort gingen, sagte der Fremde, der mit Johannes gekommen war, dass er sie wieder zurecht machen werde, und dann nahm er seine Flasche hervor und schmierte die Puppe mit der Salbe, womit er der alten Frau geholfen, als sie ihr Bein gebrochen hatte. Sowie die Puppe geschmiert war, wurde sie wieder ganz, ja sie konnte sogar alle ihre Glieder bewegen, man brauchte gar nicht mehr an der Schnur zu ziehen; die Puppe war wie ein lebendiger Mensch, nur dass sie nicht sprechen konnte. Der Mann, der das kleine Puppentheater hatte, wurde sehr froh; nun brauchte er diese Puppe gar nicht mehr zu halten, die konnte ja von selbst tanzen. Das konnte keine der andern.
Als es Nacht geworden und alle Leute im Wirtshaus zu Bett gegangen waren, da war Jemand, der erschrecklich tief seufzte und so lange damit fortfuhr, bis Alle aufstanden, um zu sehen, wer es sein könnte. Der Mann, der das Stück gegeben hatte, ging nach seinem kleinen Theater hin, denn dort war es, wo Jemand seufzte. Alle Holzpuppen lagen unter einander, der König und alle Trabanten, und die waren es, die so jämmerlich seufzten und mit ihren Glasaugen stierten, denn sie wollten so gern gleich der Königin ein wenig geschmiert werden, damit sie sich auch von selbst bewegen könnten. Die Königin legte sich gerade auf die Knie und streckte ihre prächtige Krone in die Höhe, während sie bat: „Nimm mir diese, aber schmiere meinen Gemahl und meine Hofleute!“ Da konnte der arme Mann, der die Komödie und alle Puppen besaß, nicht unterlassen, zu weinen, denn es tat ihm wirklich ihretwegen leid. Er versprach sogleich dem Reisekameraden, ihm alles Geld zu geben, was er am nächsten Abend für sein Spiel erhalten werde, wenn er nur vier bis fünf von seinen niedlichsten Puppen schmieren wollte; aber der Reisekamerad sagte, dass er durchaus nichts anderes verlange, als den großen Säbel, den jener an seiner Seite habe, und als er den erhielt, beschmierte er sechs Puppen, die sogleich tanzten, und das so niedlich, dass alle Mädchen, die lebendigen Menschenmädchen, die es sahen, sogleich mittanzten. Der Kutscher und die Köchin tanzten, der Diener und das Stubenmädchen, alle Fremden und die Feuerschaufel und die Feuerzange; aber diese fielen um, als sie die ersten Sprünge machten. Ja, das war eine lustige Nacht.
Am nächsten Morgen ging Johannes mit seinem Reisekameraden fort, auf die hohen Berge hinauf und durch die hohen Tannenwälder. Sie kamen so hoch hinauf, dass die Kirchtürme tief unter ihnen zuletzt wie kleine, rote Beeren unten in all' dem Grünen aussahen, und sie konnten weit hinsehen, viele, viele Meilen weit, wo sie nie gewesen waren! So viel Schönes der prächtigen Welt hatte Johannes früher nie gesehen und die Sonne schien warm aus der frischen Luft, er hörte auch zwischen den Bergen die Jäger das Waldhorn so schön und lieblich blasen, dass ihm vor Freude das Wasser in die Augen trat und er nicht unterlassen konnte auszurufen: „Du guter, lieber Gott, ich möchte Dich küssen, weil Du so gut gegen uns alle bist und uns all' die Herrlichkeit, die in der Welt ist, gegeben hast!“
Der Reisekamerad stand auch mit gefalteten Händen da und sah über den Wald und die Städte in den warmen Sonnenschein hinaus. Zu gleicher Zeit ertönte es wunderbar lieblich über ihren Häuptern; sie blickten in die Höhe; ein großer, weißer Schwan schwebte in der Luft und sang, wie sie früher nie einen Vogel hatten singen hören. Aber der Gesang wurde schwächer und schwächer, der schöne Vogel neigte seinen Kopf und sank ganz langsam zu ihren Füßen nieder, wo er tot liegen blieb.
„Zwei so herrliche Flügel“, sagte der Reisekamerad, „so weiß und groß wie die, welche der Vogel hat, sind Geldes wert, die will ich mitnehmen! Siehst Du nun wohl, dass es gut war, dass ich einen Säbel bekam?“ Und so hieb er beide Flügel des toten Schwanes ab, die wollte er behalten.
Sie reisten nun viele, viele Meilen weit fort über die Berge bis sie zuletzt eine große Stadt vor sich sahen, mit hundert Türmen, die wie Silber in der Sonne erglänzten; mitten in der Stadt war ein prächtiges Marmorschloss, mit Gold gedeckt, und hier wohnte der König.
Johannes und der Reisekamerad wollten nicht sogleich in die Stadt gehen, sondern blieben im Wirtshause draußen vor der Stadt, damit sie sich putzen konnten, denn sie wollten gut aussehen, wenn sie in die Stadt kamen. Der Wirth erzählte ihnen, dass der König ein ganz guter Mann sei, der nie einem Menschen das Geringste zu Leide tue, aber seine Tochter, ja Gott behüte uns! Das sei eine schlimme Prinzessin. Schönheit besaß sie genug, keine konnte so hübsch und niedlich sein, als sie war, aber was half das! Sie war eine Hexe, die schuld daran war, dass viele herrliche Prinzen ihr Leben verloren hatten. Allen Menschen hatte sie die Erlaubnis erteilt, um sie freien zu dürfen; ein Jeder konnte kommen, er mochte Prinz oder Bettler sein, das war ihr ganz gleichgültig; er sollte nur drei Sachen raten, an die sie gedacht hatte und um die sie ihn befragte; könne er das, so wolle sie sich mit ihm verbinden, und er solle König über das ganze Land sein, wenn ihr Vater sterbe; konnte er aber die drei Sachen nicht raten, so ließ sie ihn aufhängen oder ihm den Kopf abhauen. Ihr Vater, der alte König, war sehr betrübt darüber, aber er konnte ihr nicht verbieten, so böse zu sein, denn er hatte einmal gesagt, er wolle nie etwas mit ihren Liebhabern zu tun haben, sie könne selbst tun, was sie wolle. Jedes Mal wenn ein Prinz kam und raten sollte, um die Prinzessin zu erhalten, so konnte er es nicht, und dann wurde er gehängt oder geköpft; er war ja bei Zeiten gewarnt worden, er hätte das Freien unterlassen können. Der alte König war so betrübt über all' die Trauer und das Elend, dass er einen ganzen Tag des Jahres mit all' seinen Soldaten auf den Knien lag und betete, die Prinzessin möge gut werden, aber das wollte sie durchaus nicht. Die alten Frauen, die Branntwein tranken, färbten denselben ganz schwarz, bevor sie ihn tranken; so trauerten sie, und mehr konnten sie doch nicht tun.
„Die hässliche Prinzessin!“ sagte Johannes. „Sie sollte wirklich die Rute haben, das würde ihr gut tun. Wäre ich der alte König, so würde sie bald anders werden.“
Da hörten sie das Volk draußen Hurrah rufen. Die Prinzessin kam vorbei, und sie war wirklich so schön, dass alle Leute vergaßen, wie böse sie war, deshalb riefen sie Hurrah. Zwölf schöne Jungfrauen, allesamt in weißen Seidenkleidern und eine goldene Tulpe in der Hand, ritten auf kohlschwarzen Pferden ihr zur Seite; die Prinzessin selbst hatte ein kreideweißes Pferd, mit Diamanten und Rubinen geschmückt, ihr Reitkleid war von reinem Golde, und die Peitsche, die sie in der Hand hatte, sah aus, als wäre sie ein Sonnenstrahl; die goldene Krone auf dem Haupte war gerade wie kleine Sterne oben vom Himmel, und der Mantel war von mehr als tausend schönen Schmetterlingsflügeln zusammengenäht; dessen ungeachtet war sie viel schöner als alle ihre Kleider.
Als Johannes sie zu sehen bekam, wurde er so rot in seinem Antlitz, wie ein Blutstropfen, und er konnte kaum ein einziges Wort sagen; die Prinzessin sah ganz so aus wie das schöne Mädchen mit der goldenen Krone, von dem er in der Nacht geträumt hatte, in der sein Vater gestorben war. Er fand sie außerordentlich schön und konnte nicht unterlassen, sie recht zu lieben. Das sei gewiss nicht wahr, sagte er, dass sie eine böse Hexe sei, welche die Leute hängen oder köpfen lasse, wenn sie nicht raten könnten, was sie von ihnen verlangte. „Ein Jeder hat ja die Erlaubnis, um sie zu freien, sogar der ärmste Bettler; ich will nach dem Schlosse gehen, denn ich kann es nicht unterlassen!“ Jedermann sagte ihm, er möge das nicht tun, es werde ihm sonst bestimmt wie allen den Andern ergehen. Der Reisekamerad riet ihm auch davon ab, aber Johannes meinte, es werde schon gut gehen, bürstete seine Schuhe und seinen Rock, wusch sein Gesicht und seine Hände, kämmte sein hübsches, gelbes Haar, und ging dann ganz allein in die Stadt hinein und nach dem Schlosse.
„Herein!“ sagte der alte König, als Johannes an die Türe pochte. Johannes öffnete, und der alte König, im Schlafrock und gestickten Pantoffeln, kam ihm entgegen; die goldene Krone hatte er auf dem Haupte, das Zepter in der einen Hand und den Reichsapfel in der andern. „Warte ein bisschen!“ sagte er und nahm den Apfel unter den Arm, um Johannes die Hand reichen zu können. Aber sowie er erfuhr, er sei ein Freier, fing er an so zu weinen, dass das Zepter sowohl wie der Apfel auf den Fußboden fielen und er die Augen mit seinem Schlafrock trocknen musste. Der arme, alte König!
„Lass es sein,“ sagte er, „es geht Dir schlecht wie allen Andern. Nun, Du sollst es sehen.“ Dann führte er Johannes hinaus nach dem Lustgarten der Prinzessin. Da sah es erschrecklich aus! Oben an jedem Baum hingen drei, vier Königssöhne, die um die Prinzessin gefreit hatten, die Sachen aber nicht hatten raten können, die sie ihnen aufgegeben hatte. Jedes Mal, wenn es wehte, klapperten alle Gerippe, so dass die kleinen Vögel erschraken und nie in den Garten zu kommen wagten; alle Blumen waren an Menschenknochen aufgebunden und in Blumentöpfen standen Totenköpfe und grinsten. Das war wahrlich ein sonderbarer Garten für eine Prinzessin!
„Hier kannst Du es sehen!“ sagte der König. „Es wird Dir ebenso wie all' den Andern ergehen, die Du hier siehst. Unterlasse es deshalb lieber; Du machst mich wirklich unglücklich, denn ich nehme mir das sehr zu Herzen!“
Johannes küsste dem guten König die Hand und sagte, es werde schon gut gehen, denn er sei ganz entzückt von der schönen Prinzessin.
Da kam die Prinzessin selbst mit allen ihren Damen in den Schlosshof geritten; sie gingen deshalb zu ihr hinaus und sagten ihr guten Tag. Sie war wunderschön anzuschauen und reichte Johannes die Hand, und er hielt noch viel mehr von ihr als früher, sie konnte keine böse Hexe sein, wie alle Leute es ihr nachsagten. Dann gingen sie hinauf in den Saal, und die Diener boten ihnen Eingemachtes und Pfeffernüsse, aber der alte König war betrübt, er konnte gar nichts essen, und die Pfeffernüsse waren ihm auch zu hart.
Es wurde bestimmt, dass Johannes am nächsten Morgen wieder nach dem Schlosse kommen sollte, dann würden die Richter und der ganze Rath versammelt sein und hören, wie es ihm beim Raten ergehe. Wenn er gut dabei fahre, so sollte er dann noch zweimal kommen, aber es war noch nie Jemand dagewesen, der das erste Mal geraten hatte, sie hatten Alle das Leben verloren.
Johannes war gar nicht darum bekümmert, wie es ihm ergehen werde, er war vielmehr vergnügt, gedachte nur der schönen Prinzessin und glaubte ganz sicher, der liebe Gott werde ihm schon helfen, aber wie, das wusste er nicht, und wollte lieber nicht daran denken. Er tanzte auf der Landstraße dahin, als er nach dem Wirtshause zurückkehrte, wo der Reisekamerad auf ihn wartete.
Johannes konnte nicht fertig damit werden, zu erzählen, wie artig die Prinzessin gegen ihn gewesen und wie schön sie sei; er sehnte sich schon nach dem nächsten Tage, wo er in das Schloss sollte, um sein Glück mit Raten zu versuchen.
Aber der Reisekamerad schüttelte mit dem Kopfe und war ganz betrübt. „Ich bin Dir gut!“ sagte er. „Wir hätten noch lange zusammen sein können, und nun soll ich Dich schon verlieren! Du armer, lieber Johannes, ich könnte weinen, aber ich will am letzten Abend, den wir vielleicht zusammen sind, Deine Freude nicht stören. Wir wollen lustig sein, recht lustig; morgen, wenn Du fort bist, kann ich ungestört weinen.“
Alle Leute in der Stadt hatten erfahren, dass ein neuer Freier der Prinzessin angekommen war, und deshalb herrschte große Betrübnis. Das Schauspielhaus blieb geschlossen, alle Küchenfrauen banden Flor um ihre Zuckerherzen, der König und die Priester lagen auf den Knien in den Kirchen, es war allgemeine Betrübnis, denn man dachte, es könne Johannes nicht besser ergehen, als es allen den übrigen Freiern ergangen war.
Gegen Abend bereitete der Reisekamerad Punsch und sagte zu Johannes: „Nun wollen wir recht lustig sein und auf der Prinzessin Gesundheit trinken.“ Als aber Johannes zwei Glaser getrunken hatte, wurde er so schläfrig, dass es ihm unmöglich war, die Augen offen zu halten, er versank in tiefen Schlaf. Der Reisekamerad hob ihn ganz sachte vom Stuhle auf und legte ihn in das Bett hinein, und als es dann dunkle Nacht wurde, nahm er die beiden großen Flügel, die er dem Schwan abgehauen hatte, und band sie an seinen Schultern fest; die größte Rute, die er von der Frau erhalten hatte, welche gefallen war und das Bein gebrochen hatte, steckte er in seine Tasche, öffnete das Fenster und flog so über die Stadt, gerade nach dem Schlosse hin, wo er sich in einen Winkel unter das Fenster setzte, welches in die Schlafstube der Prinzessin hinein ging.
Es war ganz still in der großen Stadt. Nun schlug die Uhr drei viertel auf zwölf; das Fenster ging auf, und die Prinzessin flog in einem langen, weißen Mantel und mit schwarzen Flügeln über die Stadt weg, hinaus zu einem großen Berge; aber der Reisekamerad machte sich unsichtbar, so dass sie ihn nicht sehen konnte, flog hinterher und peitschte die Prinzessin mit seiner Rute, dass Blut floss, wohin er schlug. Ah, das war eine Fahrt durch die Luft! Der Wind erfasste ihren Mantel, der sich nach allen Seiten ausbreitete, gleich einem großen Schiffssegel, und der Mond schien durch denselben.
„Wie es hagelt! Wie es hagelt!“ sagte die Prinzessin bei jedem Schlage, den sie von der Rute bekam, und das geschah ihr schon recht. Endlich kam sie hinaus zum Berge und klopfte an. Es rollte gleich dem Donner, indem der Berg sich öffnete, und die Prinzessin ging hinein. Der Reisekamerad folgte ihr, denn Niemand konnte ihn sehen, er war unsichtbar. Sie gingen durch einen großen, langen Gang, wo die Wände ganz besonders glänzten; es waren über tausend glühende Spinnen, die an der Mauer auf und ab liefen und wie Feuer leuchteten. Dann kamen sie in einen großen Saal, von Silber und Gold erbaut. Blumen, so groß als Sonnenblumen, rote und blaue, glänzten von den Wänden, aber Niemand konnte die Blumen pflücken, denn die Stängel waren hässliche, giftige Schlangen, und die Blumen waren Feuer, welches ihnen aus dem Maule herausbrannte. Die ganze Decke war mit Johanniswürmern und himmelblauen Fledermäusen bedeckt, welche mit den dünnen Flügeln schlugen; es sah ganz schauerlich aus! Mitten auf dem Fußboden war ein Thron, der von vier Pferdegerippen, welche Zaumzeug von den roten Feuerspinnen hatten, getragen wurde; der Thron selbst war von milchweißem Glase, und die Kissen darauf waren kleine, schwarze Mäuse, die einander in den Schwanz bissen. Über demselben war ein Dach von rosenroten Spinngeweben, mit den niedlichsten, grünen, kleinen Fliegen besetzt, welche wie Edelsteine glänzten. Auf dem Throne saß ein alter Zauberer, mit einer Krone auf dem hässlichen Kopf und einem Szepter in der Hand. Er küsste die Prinzessin auf die Stirn, ließ sie sich zu seiner Seite auf den Thron setzen, und nun begann die Musik. Große, schwarze Heuschrecken spielten die Mundharmonika, und die Eule schlug sich auf den Leib, denn sie hatte keine Trommel. Das war ein possierliches Concert. Kleine, schwarze Kobolde mit einem Irrlicht auf der Mütze tanzten im Saale herum. Niemand aber konnte den Reisekameraden erblicken; er hatte sich gerade hinter den Thron gestellt und hörte und sah Alles.
Die Hofleute, die nun hereinkamen, waren fein und vornehm, aber der, welcher ordentlich sehen konnte, merkte wohl, wie es damit zusammenhing. Es waren nichts weiter als Besenstiele mit Kohlköpfen darauf, in die der Zauberer Leben gehext und welchen er gestickte Kleider gegeben hatte. Aber das war ja auch gleichgültig, sie wurden doch nur zum Staate gebraucht.
Nachdem nun etwas getanzt worden war, erzählte die Prinzessin dem Zauberer, dass sie einen neuen Freier erhalten habe, und fragte deshalb, woran sie denken solle, um ihn am nächsten Morgen darnach zu fragen, wenn er nach dem Schlosse komme.
„Höre,“ sagte der Zauberer, „das will ich Dir sagen! Du sollst etwas recht Leichtes wählen, denn so fällt er gar nicht darauf. Denke an Deinen Schuh. Das rät er nicht. Lass ihm dann den Kopf abhauen, doch vergiss nicht, wenn Du morgen Nacht wieder zu mir herauskommst, mir seine Augen zu bringen, denn die will ich essen!“
Die Prinzessin verneigte sich tief und sagte, sie werde die Augen nicht vergessen. Der Zauberer öffnete nun den Berg, und sie flog wieder zurück, aber der Reisekamerad folgte ihr und prügelte sie so sehr mit der Rute, dass sie tief feufzte über das starke Hagelwetter, und sich, so sehr sie konnte, beeilte, durch das Fenster in die Schlafstube zu gelangen; aber der Reisekamerad flog zum Wirtshause zurück, wo Johannes noch schlief, löste seine Flügel ab und legte sich dann auch auf das Bett, denn er konnte wohl ermüdet sein.
Es war ganz früh am Morgen als Johannes erwachte, der Reisekamerad stand auch auf und erzählte, dass er diese Nacht einen ganz sonderbaren Traum von der Prinzessin und ihrem Schuh gehabt habe, und bat ihn deßhalb, doch zu fragen, ob die Prinzessin nicht an ihren Schuh gedacht haben sollte, denn das war es ja, was er von dem Zauberer im Berge gehört hatte.
„Ich kann ebenso darnach als nach etwas Anderem fragen“, sagte Johannes; „vielleicht ist das ganz richtig, was Du geträumt hast, denn ich vertraue auf den lieben Gott, der mir schon helfen wird! Aber ich will Dir doch Lebewohl sagen, denn wenn ich falsch rate, so bekomme ich Dich nie mehr zusehen!“
Dann küssten sie sich, und Johannes ging in die Stadt nach dem Schlosse. Der ganze Saal war mit Menschen angefüllt, die Richter saßen in ihren Lehnstühlen und hatten Eiderdunenkissen hinter dem Kopfe, denn sie hatten so viel zu denken. Der alte König stand auf und trocknete seine Augen mit einem weißen Taschentuche. Nun trat die Prinzessin herein; sie war noch viel schöner als gestern und grüßte alle lieblich, aber dem Johannes gab sie die Hand und sagte: „Guten Morgen, Du!“
Nun sollte Johannes raten, woran sie gedacht habe. Wie sah sie ihn so freundlich an, aber sowie sie ihn das Wort „Schuh“ aussprechen hörte, wurde sie kreideweiß im Gesicht und zitterte am ganzen Körper; aber das konnte ihr nichts helfen, denn er hatte richtig geraten!
Wie wurde der alte König vergnügt! Er schoss einen Purzelbaum, dass es eine Lust war, und alle Leute klatschten in die Hände für ihn und für Johannes, der das erste Mal richtig geraten hatte.
Der Reisekamerad war auch erfreut, als er erfuhr, wie gut es abgelaufen war; aber Johannes faltete seine Hände und dankte Gott, der ihm sicher die beiden andern Male wieder helfen werde. Am nächsten Tage sollte schon wieder geraten werden.
Der Abend verging ebenso wie der gestrige. Als Johannes schlief, flog der Reisekamerad hinter der Prinzessin her zum Berge hinaus und prügelte noch stärker, als das vorige Mal, denn nun hatte er zwei Ruten genommen; Niemand bekam ihn zu sehen, und er hörte Alles. Die Prinzessin wollte an ihren Handschuh denken, und das erzählte er wieder dem Johannes, gerade als ob es ein Traum sei; so konnte derselbe richtig raten, und es verursachte eine große Freude auf dem Schlosse. Der ganze Hof schoss Purzelbäume, gerade so wie er es den König das erste Mal hatte machen sehen; aber die Prinzessin lag auf dem Sofa und wollte nicht ein einziges Wort sagen. Nun kam es darauf an, ob Johannes das dritte Mal richtig raten konnte. Glückte es, so sollte er ja die schöne Prinzessin haben und nach dem Tode des alten Königs das ganze Königreich erben; riet er falsch, so sollte er sein Leben verlieren und der Zauberer würde seine schönen, blauen Augen essen.
Den Abend vorher ging Johannes zeitig zu Bette, betete sein Abendgebet und schlief dann ruhig, aber der Reisekamerad band seine Flügel an den Rücken, schnallte den Säbel an seine Seite, nahm alle drei Ruten mit sich, und so flog er nach dem Schlosse.
Es war ganz finstere Nacht; es stürmte so, dass die Dachsteine von den Häusern flogen, und die Bäume drinnen im Garten, wo die Gerippe hingen, sich gleich dem Schilfe vom Sturmwind bogen; es blitzte jeden Augenblick, und der Donner rollte gerade, als ob es nur ein einziger Schlag sei, der die ganze Nacht währte. Nun ging das Fenster auf, und die Prinzessin flog heraus; sie war so bleich wie der Tod, aber sie lachte über das böse Wetter, meinte, es sei noch nicht stark genug, und ihr weißer Mantel wirbelte in der Luft herum gleich einem großen Schiffssegel. Aber der Reisekamerad peitschte sie mit drei Ruten, dass das Blut auf die Erde tröpfelte und sie zuletzt kaum weiter fliegen konnte. Endlich kam sie doch nach dem Berge.
„Es hagelt und stürmt,“ sagte sie; „nie bin ich in solchem Wetter aus gewesen.“
„Man kann auch des Guten zu viel haben,“ sagte der Zauberer. Nun erzählte sie ihm, dass Johannes auch das zweite Mal richtig geraten habe; wenn er dasselbe morgen tue, so habe er gewonnen, und sie könne nie mehr nach dem Berge hinauskommen, werde nie mehr solche Zauberkünste wie früher machen können; deshalb war sie ganz betrübt.
„Er soll es nicht raten können!“ sagte der Zauberer. „Ich werde schon etwas erdenken, was er sich nie gedacht hat, oder er müsste ein größerer Zauberer sein, als ich. Aber nun wollen wir lustig sein!“ Und damit fasste er die Prinzessin bei beiden Händen und sie tanzten mit allen den kleinen Kobolden und Irrlichtern herum, die in dem Zimmer waren, die roten Spinnen sprangen an den Wänden ebenso lustig auf und nieder; es sah aus, als ob Feuerblumen sprühten. Die Eulen schlugen auf die Trommel, die Heimchen pfiffen und die schwarzen Heuschrecken bliesen die Mundharmonika. Es war ein lustiger Ball!
Als sie nun lange genug getanzt hatten, musste die Prinzessin nach Hause, sonst wäre sie im Schlosse vermisst worden; der Zauberer sagte, dass er sie begleiten wolle, dann seien sie doch noch unterwegs beisammen.
Dann flogen sie im bösen Wetter davon, und der Reisekamerad schlug seine drei Ruten auf ihren Rücken entzwei; nie war der Zauberer in solchem Hagelwetter aus gewesen. Draußen vor dem Schlosse sagte er der Prinzessin Lebewohl und flüsterte ihr zugleich zu: „Denke an meinen Kopf!“ Aber der Reisekamerad hörte es wohl und gerade in dem Augenblicke, als die Prinzessin durch das Fenster in ihr Schlafzimmer schlüpfen und der Zauberer wieder umkehren wollte, ergriff er ihn an seinem langen, schwarzen Barte und hieb mit seinem Säbel seinen hässlichen Zaubererkopf gerade bei den Schultern ab, so dass der Zauberer ihn nicht einmal selbst zu sehen bekam; den Körper warf er hinaus in den See zu den Fischen, doch den Kopf tauchte er nur in das Wasser und band ihn dann in sein Taschentuch, nahm ihn mit nach dem Wirtshause und legte sich schlafen.
Am nächsten Morgen gab er Johannes das Taschentuch und sagte ihm dabei, dass er es nicht eher aufbinden dürfe, als bis die Prinzessin frage, woran sie gedacht habe.
Es waren so viele Menschen in dem großen Saale auf dem Schlosse, dass sie so dicht standen wie Radieschen, die in ein Bündel zusammengeknüpft sind. Der Rath saß in seinen Stühlen mit den weichen Kopfkissen, und der alte König hatte neue Kleider an, die goldne Krone und Zepter waren poliert, es sah ganz feierlich aus; aber die Prinzessin war ganz bleich und hatte ein kohlschwarzes Kleid an, als gehe sie zum Begräbnis.
„Woran habe ich gedacht?“ fragte sie Johannes, und sogleich band er das Taschentuch auf und erschrak selbst ganz gewaltig, als er das hässliche Zaubererhaupt erblickte. Es schauderte allen Menschen, denn es war erschrecklich anzusehen, aber die Prinzessin saß gerade wie ein Steinbild und konnte nicht ein einziges Wort sagen; zuletzt erhob sie sich und reichte Johannes die Hand, denn er hatte ja richtig geraten; sie sah ihn nicht an, sondern seufzte ganz laut: „Nun bist Du mein Herr! Diesen Abend wollen wir Hochzeit halten!“
„Das gefällt mir!“ sagte der alte König; „so wollen wir es haben!“ Alle Leute riefen Hurrah, die Wache machte Musik in den Straßen, die Glocken wurden geläutet, und die Küchenfrauen nahmen den schwarzen Flor von ihren Zuckerherzen, denn nun herrschte Freude. Drei ganze gebratene Ochsen, mit Enten und Hühnern gefüllt, wurden mitten auf den Markt gesetzt, Jeder konnte sich ein Stück abschneiden, in den Wasserkünsten sprudelte der schönste Wein, und kaufte man eine Brezel beim Bäcker, so bekam man sechs große Zwiebäcke als Zugabe und den Zwieback mit Rosinen darin.
Am Abend war die ganze Stadt erleuchtet und die Soldaten schossen mit Kanonen und die Knaben mit Knallerbsen, und es wurde gegessen und getrunken, angestoßen und gesprungen oben im Schlosse, alle die vornehmen Herren und schönen Fräuleins tanzten mit einander; man konnte in weiter Ferne hören, wie sie sangen:
Hier sind viele hübsche Mädchen,
Die gerne tanzen rund herum,
Dreh'n sich wie Spinnrädchen;
Hübsches Mädchen dreh' Dich um.
Tanzt und springet immer zu,
Bis die Sohle fällt vom Schuh.
Aber die Prinzessin war ja noch eine Hexe und mochte Johannes gar nicht leiden; das fiel dem Reisekamerad ein, und deshalb gab er Johannes drei Federn aus den Schwanenflügeln und eine kleine Flasche mit einigen Tropfen darin, sagte ihm dann, dass er ein großes Fass, mit Wasser gefüllt, vor das Bett der Prinzessin setzen lassen solle, und wenn die Prinzessin hineinsteigen wolle, solle er ihr einen kleinen Stoß geben, so dass sie in das Wasser hinunterfalle, wo er sie dreimal untertauchen müsse, nachdem er vorher die Federn und die Tropfen hineingeschüttet habe; dann werde sie ihre Zauberei verlieren und ihn recht lieb haben.
Johannes tat Alles, was der Reisekamerad ihm geraten hatte. Die Prinzessin schrie laut auf, indem sie unter das Wasser tauchte, und zappelte ihm unter den Händen als ein großer, schwarzer Schwan mit funkelnden Augen; als sie das zweite Mal wieder übel das Wasser heraufkam, war der Schwan weiß bis auf einen schwarzen Ring um den Hals. Johannes betete fromm zu Gott und ließ das Wasser das dritte Mal über den Vogel zusammenschlagen, und im selben Augenblicke wurde er in die schönste Prinzessin verwandelt. Sie war noch schöner als zuvor und dankte ihm mit Tränen in ihren herrlichen Augen, dass er ihre Bezauberung gehoben habe.
Am nächsten Morgen kam der alte König mit seinem ganzen Hofstaat, und da gab es ein Glückwünschen bis spät in den Tag hinein. Zu allerletzt kam der Reisekamerad; er hatte seinen Stock in der Hand und das Ränzel auf dem Rücken. Johannes küsste ihn vielmal und sagte, er dürfe nicht fortreisen, er solle bei ihm bleiben, denn er sei ja die Ursache seines ganzen Glückes. Aber der Reisekamerad schüttelte mit dem Kopfe und sagte mild und freundlich: „Nein, nun ist meine Zeit um. Ich habe nur meine Schuld bezahlt. Erinnerst Du Dich des toten Mannes, dem die bösen Menschen Übels tun wollten? Du gabst Alles, was Du besaßest, damit er Ruhe in seinem Grabe haben könnte. Der Tote bin ich!“
Zu gleicher Zeit war er verschwunden.
Die Hochzeit währte einen ganzen Monat. Johannes und die Prinzessin liebten einander innig, und der alte König erlebte manche frohe Tage und ließ ihre kleinen Kinderchen auf seinen Knien reiten und mit seinem Zepter spielen; aber Johannes wurde König über das ganze Land.
ES IST GANZ GEWISS!
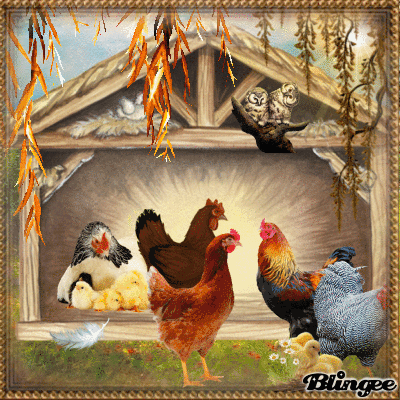
»Das ist eine entsetzliche Geschichte!« sagte eine Henne, und zwar in einem Stadtviertel, wo die Geschichte nicht passiert war. »Das ist eine entsetzliche Geschichte im Hühnerhause! Ich kann heute Nacht nicht allein schlafen! Es ist gut, daß unser viele auf der Steige zusammen sitzen!« – Und nun erzählte sie so, daß die Federn der andern Hühner sich aufplusterten, und der Hahn den Kamm fallen ließ. Es ist ganz gewiß!
Aber wir wollen mit dem Anfange beginnen, und der ist in einem Hühnerhause im andern Stadtviertel zu suchen. Die Sonne ging unter, und die Hühner flogen auf ihre Steige; eine Henne, weiß gefiedert und mit kurzen Beinen, legte ihre Eier reglementsmäßig, und war als Henne in jeder Art und Weise respectabel; indem sie auf die Steige flog, zupfte sie sich mit dem Schnabel, und eine kleine Feder fiel ihr aus.
»Da geht sie hin!« sagte sie, »je mehr ich mich zupfe, um so schöner werde ich!« Sie sagte es heiter, denn sie war der Ausbund unter den Hühnern, übrigens, wie gesagt, sehr respectabel; darauf schlief sie ein.
Dunkel war es rings umher, Henne saß bei Henne, aber die, welche der heiteren am nächsten saß, schlief nicht; sie hörte, und hörte auch nicht, wie es ja in dieser Welt sein soll, um recht ruhig zu leben; aber ihrer anderen Nachbarin mußte sie es doch erzählen: »Hörtest Du, was hier gesagt wurde? Ich nenne Keinen, aber hier ist eine Henne, welche sich rupfen will, um gut auszusehen! Wäre ich ein Hahn, ich würde sie verachten!«
Gerade über den Hühnern saß die Eule mit dem Eulenvater und ihren Eulenkindern; die Familie hat scharfe Ohren, sie alle hörten jedes Wort, welches die Nachbarhenne sagte; und sie rollten mit den Augen, und die Eulenmutter schlug mit den Flügeln und sprach: »Hört nur nicht darauf! Aber Ihr hörtet es wohl, was dort gesagt wurde? Ich hörte es mit meinen eigenen Ohren, und man muß viel hören, ehe sie Einem abfallen! Da ist eine unter den Hühnern, welche in solchem Grade vergessen hat, was sich für eine Henne schickt, daß sie sich alle Federn ausrupft, und es den Hahn sehen läßt!«
» Prenez garde aux enfants!« sagte der Eulenvater, »das ist Nichts für die Kinder!«
»Ich will es doch der Nachbareule erzählen; das ist eine sehr achtbare Eule im Umgange!« und darauf flog sie davon.
»Hu, hu! uhuh!« heulten sie Beide in den Taubenschlag des Nachbars zu den Tauben hinein. »Habt Ihr's gehört? Habt Ihr's gehört? Uhuh! Eine Henne ist da, welche sich des Hahns wegen alle Federn ausgerupft hat; sie wird erfrieren, wenn sie nicht schon erfroren ist. Uhuh!«
»Wo? wo?« girrten die Tauben.
»Im Hofe des Nachbars! ich habe es so gut wie selbst gesehen! Es ist beinahe unpassend, die Geschichte zu erzählen. Es ist ganz gewiß!«
»Glaubt, glaubt jedes einzelne Wort!« sagten die Tauben, und girrten in ihren Hühnerhof hinunter: »Eine Henne ist da, ja, einige sagen, daß ihrer zwei da sind, welche sich alle Federn ausgerupft haben, um nicht so wie die anderen auszusehen, und um die Aufmerksamkeit des Hahnes zu erwecken. Das ist ein gewagtes Spiel, man kann sich erkälten und am Fieber sterben, und sie sind Beide gestorben!«
»Wacht auf! wacht auf!« krähte der Hahn, und flog auf die Planke; der Schlaf saß ihm noch in den Augen, aber er krähte dennoch: »Drei Hennen sind vor unglücklicher Liebe zu einem Hahne gestorben! Sie hatten sich alle Federn ausgerupft! Das ist eine häßliche Geschichte; ich will sie nicht für mich behalten, sie mag weiter gehen!«
»Laßt sie weiter gehen!« pfiffen die Fledermäuse, und die Hühner gluckten und die Hähne krähten: »Laßt sie weiter gehen! Laßt sie weiter gehen!« und so ging die Geschichte von Hühnerhaus zu Hühnerhaus, und kam zuletzt an die Stelle zurück, von welcher sie eigentlich ausgegangen war.
»Fünf Hühner,« hieß es, »haben sich alle Federn ausgerupft, um zu zeigen, welche von ihnen aus Liebesgram für den Hahn am magersten geworden sei, – und dann hackten sie sich gegenseitig blutig und stürzten tot nieder, zum Spott und zur Schande für ihre Familie, und zum großen Verluste des Besitzers!«
Die Henne, welche die lose, kleine Feder verloren hatte, erkannte natürlich ihre eigene Geschichte nicht wieder, und da sie eine respektable Henne war, so sagte sie: »Ich verachte jene Hühner; aber es giebt mehrere der Art! So etwas soll man nicht verschweigen, und ich werde das Meinige dazu tun, daß die Geschichte in die Zeitung kommt, dann verbreitet sie sich durch das ganze Land; das haben die Hühner verdient, und ihre Familie auch.«
Es kam in die Zeitung, es wurde gedruckt, und es ist ganz gewiß: eine kleine Feder kann wohl zu fünf Hühnern werden!
PIETER, PETER UND PER
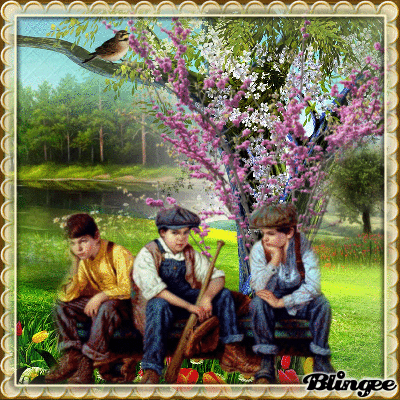
Es ist unglaublich, was Kinder in unserer Zeit alles wissen! Man weiß bald nicht mehr, was sie nicht wissen. Daß der Storch sie aus dem Brunnen oder Mühlteich geholt und, wie sie noch ganz klein waren, zu Vater und Mutter gebracht hat, ist nun eine so alte Geschichte, daß sie nicht mehr daran glauben, und es ist doch das einzig Richtige.
Aber wie kommen die Kleinen in den Mühlteich und Brunnen? Ja, das weiß nicht jeder, aber manche wissen es doch. Hast du den Himmel richtig betrachtet, in einer sternklaren Nacht die vielen Sternschnuppen gesehen, die sind, wie wenn ein Stern fiele und verschwände? Die Gelehrtesten können nicht erklären, was sie selber nicht wissen; aber es kann erklärt werden, wenn man es weiß. Es ist, wie wenn ein kleines Weihnachtslicht vom Himmel fiele und verlöscht; es ist ein Seelenfunken vom lieben Gott, der zur Erde herabfährt, und während er in unsere dichtere, schwerere Luft hineinkommt, schwindet der Glanz, es bleibt nur, was unsere Augen nicht zu sehen vermögen, denn es ist etwas weit Feineres als unsere Luft, es ist ein Himmelskind, das da ausgesandt wird, ein kleiner Engel, aber ohne Flügel, das Kleine soll ja Mensch werden; still gleitet es durch die Luft, und der Wind trägt es hin in eine Blume; das kann nun eine Nachtviole sein, eine Butterblume eine Rose oder Pechnelke; da liegt es und ruht aus. Luftig und leicht ist es, eine Fliege kann damit fliegen, geschweige denn eine Biene, und sie kommen wechselweise und suchen nach dem süßen in der Blume; liegt ihnen das Luftkind nun im Wege, so stoßen sie es nicht heraus, sie haben nicht das Herz dazu, sie legen es hin in die Sonne auf ein Seerosenblatt, und von dort krabbelt und kriecht es hinab ins Wasser, wo es schläft und wächst, bis der Storch es sehen und zu einer Menschenfamilie holen kann, die sich so ein süßes Kleines wünscht; aber ob es süß ist oder nicht, beruht darauf, ob das Kleine von dem klaren Wasser getrunken hat oder ob Schlamm und Entenflott ihm in die falsche Kehle gekommen ist; das macht so irdisch. Der Storch nimmt ohne Wahl das erste, das er sieht. Eins kommt in ein gutes Haus zu unvergleichlich guten Eltern, ein anderes kommt zu harten Leuten in großes Elend, so daß es viel besser gewesen wäre, in dem Mühlenteich zu bleiben.
Die Kleinen erinnern sich gar nicht, was sie unter dem Seerosenblatt träumten, wo am Abend die Frösche ihnen vorsangen: "Koax, koax! Strax, strax!" Das bedeutet in der Menschensprache: "Nun sollt ihr sehen, ihr könnt schlafen und träumen!" Sie können sich auch nicht erinnern, in welcher Blume sie zuerst lagen oder wie sie duftete, und doch ist da etwas in ihnen, wenn sie erwachsene Menschen werden, das sagt: "Die Blume haben wir am liebsten!" Und das ist die, in der sie als Luftkinder lagen.
Der Storch wird sehr alt, und immer gibt er darauf acht, wie es den Kleinen geht, die er gebracht hat, und wie sie sich in die Welt schicken; er kann freilich nichts für sie tun oder ihre Lage verändern, er hat seine eigene Familie, für die er sorgen muß, aber er verliert sie niemals aus den Augen.
Ich kenne einen alten, sehr ehrbaren Storch, der große Vorkenntnisse hat und viele Kleine geholt hat und auch ihre Geschichte weiß, in der immer etwas Schlamm und Entenflott aus dem Mühlenteich ist. Ich bat ihn, mir eine kleine Lebensbeschreibung von einem von diesen zu erzählen, und da sagte er, daß ich drei für eine haben sollte aus Pietersens Haus.
Das war eine besonders nette Familie, Pietersens; der Mann war einer der zweiunddreißig Ratsmänner der Stadt, und das war eine Auszeichnung; er lebte für die zweiunddreißig und ging auf in den zweiunddreißig. Hier kam der Storch hin und brachte einen kleinen Pieter, so wurde das Kind genannt. Im nächsten Jahr kam der Storch wieder mit noch einem, den nannten sie Peter, und als der dritte gebracht wurde, erhielt er den Namen Per, denn in den Namen Pieter- Peter-Per liegt der Name Pietersen.
Das waren also drei Brüder, drei Sternschnuppen, jeder in seiner Blume gewiegt, unter das Seerosenblatt in den Mühlenteich gelegt und von da vom Storch zu der Familie Pietersen gebracht, deren Haus an der Ecke liegt, wie du wohl weißt.
Die wuchsen auf an Körper und Geist, und so wollten sie noch etwas mehr werden als die zweiunddreißig Männer.
Pieter sagte, er wolle Räuber werden. Er hatte die Komödie von "Fra Diavolo" gesehen und sich für das Räuberhandwerk, als das hübscheste der Welt, entschieden.
Peter wollte Mistbauer werden, und Per, der ein so süßer und artiger Junge war, dick und rund, aber seine Nägel biß, das war sein einziger Fehler, Per wollte Vater werden. Das sagte nun ein jeder, wenn man sie fragte, was sie in der Welt werden sollten.
Und dann kamen sie in die Schule. Einer wurde Erster, und einer wurde Letzter, und einer kam gerade in die Mitte, aber deshalb konnten sie ja ebenso klug und ebenso gut sein, und das waren sie, sagten ihre sehr einsichtsvollen Eltern.
Sie kamen auf Kinderbälle, sie rauchten Zigarren, wenn keiner es sah, sie nahmen zu an Kenntnis und Erkenntnis.
Pieter war von Klein auf streitbar, wie ja ein Räuber sein muß; er war ein sehr unartiger Junge, aber das kam davon, sagte die Mutter, daß er an Würmern litt; unartige Kinder haben immer Würmer, das ist Schlamm im Leib. Ein Eigensinn und seine Streitlust gingen eines Tages über der Mutter neuen Seidenkleid hin.
"Stoß nicht an den Kaffeetisch, mein Gotteslamm!" hatte sie gesagt. "Du könntest den Sahnetopf umwerfen und ich bekäme Flecken auf mein neues Seidenkleid!"
Und das "Gotteslamm" nahm mit fester Hand den Sahnetopf und goß mit fester Hand die Sahne der Mama gerade in den Schoß, die nicht unterlassen konnte, zu sagen: "Lamm, Lamm! Das war nicht klug, mein Lämmchen!" Aber einen Willen hatte das Kind, das mußte sie einräumen. Wille zeigt Charakter und das ist so vielversprechend für eine Mutter.
Er hätte ganz gewiß Räuber werden können, aber er wurde es nicht buchstäblich; er kam nur dahin, auszusehen wie ein Räuber: er ging mit verbeultem Hut, bloßem Hals und langen, wirren Haaren, er sollte Künstler werden, aber er kam nur in die Künstlerkleider und sah dazu aus wie eine Stockrose; alle Menschen, die er zeichneten, sahen aus wie Stockrosen. Er hatte diese Blume sehr gern, er hatte auch in einer Stockrose gelegen, sagte der Storch.
Peter hatte in einer Butterblume gelegen. Er sah so geschmiert aus um die Mundwinkel, hatte eine gelbe Haut, man mußte glauben, wäre er angeschnitten worden, so wäre Butter herausgekommen. Er war geboren zum Butterhändler und hätte sein eigenes Firmenschild sein können, aber innerlich, so in seinem Innern, war er "Mistbauer," er war der musikalische Teil der Pietersenschen Familie, aber "Genug für sie alle zusammen," sagten die Nachbarn. Er machte siebzehn neue Polkas in einer Woche und setzt sie zusammen zu einer Oper mit Trompeten und Schellen; ei, wie war die schön!
Per war weiß und rot, klein und gewöhnlich; er hatte in einer Gänseblume gelegen. Niemals schlug er um sich, wenn die andern Jungen ihn hauten, er sagte, daß er der Vernünftigste sei, und der Vernünftigste gibt immer nach. Er sammelte zuerst Griffel, dann Marken, dann schaffte er sich ein kleines Naturalienkabinett, in dem das Skelett eines Stichlings, drei bildgeborene Rattenjungen in Spiritus und ein ausgestopfter Maulwurf waren. Per hatte Sinn für das Wissenschaftliche und Blick für die Natur, und das war erfreulich für die Eltern und für Per auch. Er ging lieber in den Wald als in die Schule, lieber in die Natur als in die Dressur; seine Brüder waren schon verlobt, als er noch dafür lebte, seine Sammlung von Wasservogeleiern zu vervollständigen. Er wußte bald viel mehr von den Tieren als von den Menschen, ja, er meinte, daß wir das Tier in dem, was wir am höchsten schätzen, nicht erreichen können, in der Liebe. Er sah, daß, während das Nachtigallweibchen auf seinen Eiern brütete, der Nachtigallvater dasaß und die ganze Nacht seiner kleinen Frau "Kluck, kluck! Zi, zi! Lo, lo, li!" vorsang. Das hätte Per nie tun oder sich dazu hergeben können. Wenn die Storchmutter mit ihren Jungen im Nest lag stand der Strochvater die ganze Nacht auf einem Bein auf dem Dachfirst, Per hätte so nicht eine Stunde stehen können. Und als er eines Tages das Gewebe der Spinne betrachtete und was darin saß, da gab er den Ehestand ganz auf. Herr Spinne webt, um unbedachtsame Fliegen zu fangen, junge und alte, blutreiche und winddürre, er lebt, um zu weben und seine Familie zu ernähren, aber Madame Spinne lebt einzig und allein für ihren Mann. Sie ißt ihn auf vor lauter Liebe, sie ißt sein Herz, seinen Kopf, seinen Leib, nur seine langen, dünnen Beine bleiben zurück im Spinngewebe, wo er mit Nahrungssorgen für die ganze Familie saß. Das ist die reine Wahrheit, direkt aus der Naturgeschichte. Das sah Per, das überdachte er, "so von seiner Frau geliebt zu werden, von ihr aufgegessen zu werden in gewaltsamer Liebe. Nein, so weit treibt es kein Mensch; und wäre es zu wünschen?"
Per beschloß, sich nie zu verheiraten! Nie einen Kuß zu geben oder zu nehmen, der wie der erste Schritt in den Ehestand aussehen könnte. Aber einen Kuß bekam er doch, einen, den wir alle bekommen, des Todes großen Kuß. Wenn wir lange genug gelebt haben, dann bekommt der Tod die Order: "Küß weg!" Und dann ist der Mensch weg; da leuchtet ein Sonnenblitz vom lieben Gott, so hell, daß es uns schwarz wird vor den Augen; die Menschenseele, die wie eine Sternschnuppe kam, fliegt wieder hin wie eine Sternschnuppe, aber nicht, um in einer Blume zu ruhen oder unter einem Seerosenblatt zu träumen; sie hat wichtigere Dinge vor, sie fliegt hinein in das große Ewigkeitsland, aber wie es dort ist und aussieht, kann niemand sagen. Keiner hat da hineingesehen, nicht einmal der Storch, wie weit er auch sieht und wieviel er auch weiß; er wußte nun auch nicht das mindeste mehr von Per, aber dagegen von Pieter und Peter, aber von denen hatte ich genug gehört, und das hast du wohl auch; so sagte ich dem Storch Dank für diesmal, aber nun verlangt er für diese kleine, gewöhnliche Geschichte drei Frösche und ein Schlangenjunges, er nimmt Bezahlung in Lebensmitteln. Willst du bezahlen? Ich will nicht! Ich habe weder Frösche noch junge Schlangen.
DIE KLEINE SEEJUNGFER
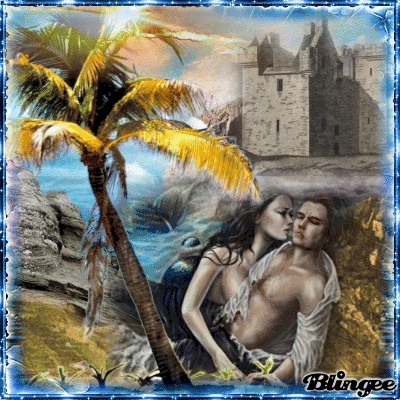
Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau, wie die Blätter der schönsten Kornblume, und so klar, wie das reinste Glas. Aber es ist sehr tief, tiefer, als irgend ein Ankertau reicht; viele Kirchtürme müßten aufeinander gestellt werden, um vom Boden bis über das Wasser zu reichen. Dort unten wohnt das Meervolk.
Nun muß man aber nicht glauben, daß da nur der nackte, weiße Sandboden sei; nein, da wachsen die sonderbarsten Bäume und Pflanzen, die so geschmeidig im Stiele und in den Blättern sind, daß sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, als ob sie lebten. Alle kleinen und großen Fische schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, wie hier oben die Vögel durch die Bäume. An der tiefsten Stelle liegt des Meerkönigs Schloß; die Mauern sind von Korallen und die langen Spitzbogenfenster vom klarsten Bernstein; aber das Dach bilden Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem das Wasser strömt. Es sieht herrlich aus, denn in jeder liegen strahlende Perlen; eine einzige davon würde großen Wert in der Krone einer Königin haben.
Der Meerkönig dort unten war seit vielen Jahren Witwer, während seine alte Mutter bei ihm wirtschaftete. Sie war eine kluge Frau, aber stolz auf ihren Adel; deshalb trug sie zwölf Austern auf dem Schwanze, die andern Vornehmen aber durften nur sechs tragen. – Sonst verdiente sie großes Lob, besonders weil sie viel auf die kleinen Meerprinzessinnen, ihre Enkelinnen, hielt. Es waren sechs schöne Kinder, aber die jüngste war die Schönste von allen, ihre Haut so klar und so fein wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie die tiefste See; aber ebenso, wie die Andern, hatte sie keine Füße; der Körper endete in einen Fischschwanz.
Den ganzen Tag konnten sie unten im Schlosse, in den großen Sälen, wo lebendige Blumen aus den Wanden hervor wuchsen, spielen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht, und dann schwammen die Fische zu ihnen herein, wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir die Fenster aufmachen; doch die Fische schwammen zu den Prinzessinnen hin, fraßen aus ihren Händen und ließen sich streicheln.
Draußen vor dem Schlosse war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Blumen; die Früchte strahlten wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, indem sie fortwährend Stengel und Blätter bewegten. Die Erde selbst war der feinste Sand, aber blau, wie die Schwefelflamme. Über dem Ganzen lag ein eigentümlich blauer Schein; man hätte eher glauben mögen, daß man hoch in der Luft stehe und nur Himmel über und unter sich habe, als daß man auf dem Grunde des Meeres sei. Während der Windstille konnte man die Sonne erblicken; sie erschien wie eine Purpurblume, aus deren Kelche alles Licht strömte.
Eine jede der kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Platz im Garten, wo sie graben und pflanzen konnte, wie es ihr gefiel. Die Eine gab ihrem Blumenfleck die Gestalt eines Walfisches; einer Andern gefiel es besser, daß der ihrige einem kleinen Meerweibe gleiche; aber die Jüngste machte den ihrigen rund, der Sonne gleich, und hatte Blumen, die rot wie diese schienen. Sie war ein sonderbares Kind, still und nachdenkend; und wenn die andern Schwestern mit den merkwürdigsten Sachen, welche sie von gestrandeten Schiffen erhalten hatten, prunkten, wollte sie außer den rosenroten Blumen, die der Sonne dort oben glichen, nur eine hübsche Marmorstatue haben. Dies war ein herrlicher Knabe, aus weißem, klarem Steine gehauen, der beim Stranden auf den Meeresgrund gekommen war. Sie pflanzte bei der Statue eine rosenrote Trauerweide; die wuchs herrlich und hing mit ihren frischen Zweigen über derselben, gegen den blauen Sandboden herunter, wo der Schatten sich Violet zeigte und gleich den Zweigen in Bewegung war; es sah aus, als ob die Spitze und die Wurzeln mit einander spielten, als wollten sie sich küssen.
Es gab keine größere Freude für sie, als von der Menschenwelt zu hören; die Großmutter mußte Alles, was sie von Schiffen und Städten, Menschen und Tieren wußte, erzählen; hauptsächlich erschien ihr besonders schön, daß oben auf der Erde die Blumen dufteten, denn das taten sie auf dem Grunde des Meeres nicht, und daß die Wälder grün wären, und daß die Fische, die man dort zwischen den Bäumen erblickte, laut und herrlich singen könnten, daß es eine Lust sei. Es waren die kleinen Vögel, welche die Großmutter Fische nannte, denn sonst konnten sie sie nicht verstehen, da sie noch keinen Vogel gesehen hatten.
»Wenn Ihr Euer fünfzehntes Jahr erreicht habt,« sagte die Großmutter, »dann sollt Ihr die Erlaubniß erhalten, aus dem Meer emporzutauchen, im Mondscheine auf der Klippe zu sitzen und die großen Schiffe vorbeisegeln zu sehen. Wälder und Städte werdet Ihr dann erblicken!« In dem kommenden Jahre war die eine der Schwestern fünfzehn Jahre alt, aber von den andern war die eine immer ein Jahr jünger als die andere; die jüngste von ihnen hatte demnach noch volle fünf Jahre zu warten, bevor sie von dem Grunde des Meeres hinaufkommen und sehen konnte, wie es bei uns aussehe. Aber die Eine versprach der Andern, zu erzählen, was sie erblickt und was sie am ersten Tage am Schönsten gefunden habe; denn ihre Großmutter erzählte ihnen nicht genug; da war so Vieles, worüber sie Auskunft haben wollten.
Keine war sehnsüchtiger, als die Jüngste, gerade sie, die noch die längste Zeit zu warten hatte und die stets still und gedankenvoll war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah durch das dunkelblaue Wasser empor, wie die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen plätscherten. Mond und Sterne konnten sie sehen; freilich schienen diese ganz bleich, aber durch das Wasser sahen sie größer aus, als vor unsern Augen. Zog dann etwas, einer schwarzen Wolke gleich, unter ihnen hin: so wußte sie, daß es entweder ein Walfisch sei, der über ihr schwamm, oder ein Schiff mit vielen Menschen; die dachten sicher nicht daran, daß eine liebliche, kleine Seejungfer unten stehe und ihre weißen Hände gegen den Kiel emporstrecke.
Nun war die älteste Prinzessin fünfzehn Jahre alt und durfte über die Meeresfläche emporsteigen.
Als sie zurückkam, hatte sie Hunderterlei zu erzählen, aber das Schönste, sagte sie, sei, im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen und die nah gelegene Küste mit der großen Stadt zu betrachten, wo die Lichter gleich hundert Sternen blinken, die Musik, das Lärmen und Toben von Wagen und Menschen zu hören, die vielen Kirchtürme zu sehen und das Läuten der Glocken zu vernehmen.
O! wie horchte die jüngste Schwester auf, und wenn sie später Abends am offenen Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser emporblickte, gedachte sie der großen Stadt mit dem Lärmen und Toben; dann glaubte sie die Kirchenglocken bis zu sich herunter läuten hören zu können.
Im folgenden Jahre erhielt die zweite Schwester die Erlaubniß aus dem Wasser empor zu steigen und zu schwimmen, wohin sie wolle. Sie tauchte auf, als die Sonne unterging, und diesen Anblick, fand sie, sei das Schönste. Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen, und die Schönheit der Wolken konnte sie nicht genug beschreiben! Rot und Violet waren sie über ihr dahin gesegelt, aber weit schneller, als diese, flog, einem langen weißen Schleier gleich, ein Schwärm wilder Schwäne über das Wasser hin, wo die Sonne stand, Sie schwamm derselben entgegen, aber die Sonne sank und der Rosenschein erlosch auf der Meeresfläche und in den Wolken.
Das Jahr darauf kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die Dreisteste von allen, deshalb schwamm sie einen breiten Fluß, der in das Meer mündete, aufwärts. Herrliche, grüne Hügel mit Weinranken erblickte sie; Schlösser und Burgen schimmerten aus prächtigen Wäldern hervor; sie hörte, wie alle Vögel sangen; und die Sonne schien so warm, daß sie oft unter das Wasser tauchen mußte, um ihr brennendes Antlitz abzukühlen. In einer kleinen Bucht traf sie einen Schwarm kleiner Menschenkinder. Diese waren völlig nackt und plätscherten im Wasser; sie wollte mit ihnen spielen, aber die flohen erschrocken davon, und es kam ein kleines, schwarzes Tier, ein Hund – aber sie hatte nie einen Hund gesehen – der bellte sie so schrecklich an, daß sie ängstlich die offene See zu erreichen suchte. Doch nie konnte sie die prächtigen Wälder, die grünen Hügel und niedlichen Kinder vergessen, die im Wasser schwimmen konnten, obgleich sie keinen Fischschwanz hatten.
Die vierte Schwester war nicht so dreist; sie blieb draußen im wilden Meere und erzählte, daß es dort am Schönsten sei! Man sehe ringsumher viele Meilen weit, und der Himmel stehe wie eine Glasglocke darüber. Schiffe hatte sie gesehen, aber nur aus weiter Ferne, die sahen wie Möwen aus; die possierlichen Delphine hatten Purzelbäume geschlagen, und die großen Walfische aus ihren Nasenlöchern Wasser emporgespritzt, so daß es ausgesehen hatte, wie Hunderte von Springbrunnen rings umher.
Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester; ihr Geburtstag war im Winter, und deshalb erblickte sie, was die Andern das erste Mal nicht gesehen hatten. Die See sah ganz grün aus, und rings umher schwammen große Eisberge; ein jeder erschien wie eine Perle, sagte sie, und war doch weit größer, als die Kirchtürme, welche die Menschen bauen. Sie zeigten sich in den sonderbarsten Gestalten und glänzten wie Diamanten, Sie hatte sich auf einen der größten gesetzt, und alle Segler kreuzten erschrocken draußen herum, wo sie saß und den Wind mit ihrem langen Haare spielen ließ; aber gegen Abend wurde der Himmel mit Wolken überzogen; es blitzte und donnerte, während die schwarze See die großen Eisblöcke hoch emporhob und sie im roten Blitze erglänzen ließ. Auf allen Schiffen raffte man die Segel ein; da war eine Angst und ein Grauen. Aber sie saß ruhig auf ihrem schwimmenden Eisberge und sah die blauen Blitzstrahlen im Zickzack in die schimmernde See fahren.
Das erste Mal, wenn eine der Schwestern über das Wasser emporkam, war eine jede entzückt über das Neue und Schöne, was sie erblickte; aber da sie nun, als erwachsene Mädchen, die Erlaubniß hatten, hinaufzusteigen, wann sie wollten, wurde es ihnen gleichgültig. Sie sehnten sich wieder zurück, und nach Verlauf eines Monats sagten sie, daß es unten bei ihnen am schönsten sei; da sei man so hübsch zu Hause.
In mancher Abendstunde faßten die fünf Schwestern einander an den Armen und stiegen in einer Reihe über das Wasser auf; herrliche Stimmen hatten sie, schöner, denn irgend ein Mensch; und wenn dann ein Sturm im Anzuge war, so daß sie vermuten konnten, es würden Schiffe untergehen, schwammen sie vor den Schiffen her und sangen so lieblich, wie schön es auf dem Grunde des Meeres sei, und baten die Seeleute, sich nicht zu fürchten, da hinunter zu kommen. Aber die konnten die Worte nicht verstehen und glaubten, es sei der Sturm; sie bekamen auch die Herrlichkeit dort unten nicht zu sehen, denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen als Leichen zu des Meerkönigs Schlosse.
Wenn die Schwestern so des Abends, Arm in Arm, hoch durch das Wasser hinauf stiegen, dann stand die kleinste Schwester allein und sah ihnen nach; und es war ihr, als ob sie weinen müßte; aber die Seejungfer hat keine Tränen, und darum leidet sie weit mehr.
»Ach, wäre ich doch fünfzehn Jahre alt!« sagte sie. »Ich weiß, daß ich die Welt dort oben und die Menschen, die darauf wohnen und hausen, recht lieben werde.«
Endlich war sie denn fünfzehn Jahre alt.
»Sieh, nun bist Du erwachsen!« sagte die Großmutter, die alte Königswitwe. »Komm nun, laß mich Dich schmücken, gleich Deinen andern Schwestern!« Sie setzte ihr einen Kranz weißer Lilien auf das Haar; aber jedes Blatt in der Blume war die Hälfte einer Perle; und die Alte ließ acht große Austern im Schweife der Prinzessin sich festklemmen, um ihren hohen Rang zu zeigen.
»Das tut so weh!« sagte die kleine Seejungfer.
»Ja, Hoffart muß Zwang leiden!« sagte die Alte.
O, sie hätte so gern alle diese Pracht abschütteln und den schweren Kranz ablegen mögen: ihre roten Blumen im Garten kleideten sie besser; aber sie konnte es nun nicht anders. »Lebt wohl!« sprach sie; und sie stieg dann leicht und klar, gleich einer Blase, aus dem Wasser auf.
Die Sonne war eben untergegangen, als sie den Kopf über das Wasser erhob; aber alle Wolken glänzten noch wie Rosen und Gold; und inmitten der bleichroten Luft strahlte der Abendstern so hell und schön; die Luft war mild und frisch und das Meer ruhig. Da lag ein großes Schiff mit drei Masten; nur ein einziges Segel war aufgezogen, denn es regte sich kein Lüftchen; und rings umher im Tauwerk und auf den Raaen saßen die Matrosen. Da war Musik und Gesang, und als es dunkelte, wurden Hunderte von bunten Laternen angezündet, die sahen aus, als ob aller Nationen Flaggen in der Luft wehten. Die kleine Seejungfer schwamm bis zum Kajütenfenster und jedes Mal, wenn das Wasser sie emporhob, konnte sie durch die spiegelhellen Fensterscheiben hineinblicken, wo viele geputzte Menschen standen. Aber der Schönste war doch der junge Prinz mit den großen, schwarzen Augen; er war sicher nicht viel über sechzehn Jahre alt; es war sein Geburtstag, und deshalb herrschte all diese Pracht. Die Matrosen tanzten auf dem Verdecke; und als der junge Prinz hinaustrat, stiegen über hundert Raketen in die Luft; die leuchteten, wie der helle Tag, so daß die kleine Seejungfer sehr erschrak und unter das Wasser tauchte; aber sie streckte bald den Kopf wieder hervor, und da war es, als ob alle Sterne des Himmels zu ihr herunterfielen. Nie hatte sie solche Feuerkünste gesehen! Große Sonnen sprühten umher, prächtige Feuerfische flogen in die blaue Luft, und Alles spiegelte sich in der klaren, stillen See. Auf dem Schiffe selbst war es so hell, daß man jedes kleine Tau, wie viel mehr also die Menschen sehen konnte. O, wie schön war doch der junge Prinz; er drückte den Leuten die Hand und lächelte, während die Musik in der herrlichen Nacht erklang.
Es wurde spät, aber die kleine Seejungfer konnte ihre Augen nicht von dem Schiffe und vom schönen Prinzen weg wenden. Die bunten Laternen wurden ausgelöscht, Raketen stiegen nicht mehr in die Höhe, es ertönten auch keine Kanonenschüsse mehr; aber tief unten im Meere summte und brummte es, inzwischen saß sie auf dem Wasser und schaukelte auf und nieder, so daß sie in die Kajüte hineinblicken konnte. Aber das Schiff bekam mehr Fahrt; ein Segel nach dem andern breitete sich aus; nun gingen die Wogen stärker; große Wellen zogen auf; es blitzte in der Ferne. O, es wird ein böses Wetter werden! Deshalb zogen die Matrosen die Segel ein. Das große Schiff schaukelte in fliegender Fahrt auf der wilden See; das Wasser erhob sich wie große, schwarze Berge, die über die Masten rollen wollten; aber das Schiff tauchte wie ein Schwan zwischen den hohen Wogen nieder und ließ sich wieder auf die hoch getürmten Wasser heben. Der kleinen Seejungfer dünkte es eine recht lustige Fahrt zu sein, aber so erschien es den Seeleuten nicht; das Schiff knackte und krachte; die dicken Planken bogen sich bei den starken Stößen; die See stürzte in das Schiff hinein; der Mast brach mitten durch, als ob es ein Rohr wäre, und das Schiff legte sich auf die Seite, während das Wasser in den Raum eindrang. Nun sah die kleine Seejungfer, daß sie in Gefahr waren; sie mußte sich selbst vor den Balken und Stücken vom Schiffe, die auf dem Wasser trieben, in Acht nehmen. Einen Augenblick war es so finster, daß sie nicht das Mindeste sah; aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, daß sie Alle auf dem Schiffe erkennen konnte; besonders suchte sie den jungen Prinzen, und sie sah ihn, als das Schiff sich teilte, in das tiefe Meer versinken. Sogleich wurde sie ganz vergnügt, denn nun kam er zu ihr hinunter. Aber da gedachte sie, daß die Menschen nicht im Wasser leben können, und daß er nicht anders als tot zum Schlosse ihres Vaters hinunter gelangen könnte. Nein, sterben durfte er nicht; deshalb schwamm sie hin zwischen Balken und Planken, die auf der See trieben, und vergaß völlig, daß diese sie hätten zerquetschen können. Sie tauchte tief unter das Wasser und stieg wieder hoch zwischen den Wogen empor, und gelangte am Ende so zu dem Prinzen hin, der nicht länger in der stürmischen See schwimmen konnte. Seine Arme und Beine begannen zu ermatten; die schönen Augen schlossen sich, er hätte sterben müssen, wäre die kleine Seejungfer nicht herzu gekommen. Sie hielt seinen Kopf über das Wasser empor, und ließ sich dann mit ihm von den Wogen treiben, wohin sie wollten.
Am Morgen war das böse Wetter vorüber; von dem Schiffe war kein Span zu erblicken; die Sonne stieg rot und glänzend aus dem Wasser empor; es war, als ob des Prinzen Wangen Leben dadurch erhielten; aber die Augen blieben geschlossen. Die Seejungfer küßte seine hohe, schöne Stirn und strich sein nasses Haar zurück, er kam ihr vor, wie die Marmorstatue in ihrem kleinen Garten; sie küßte ihn wieder und wünschte, daß er lebte.
Nun erblickte sie vor sich das feste Land, hohe, blaue Berge, auf deren Gipfeln der weiße Schnee glänzte, als wären es Schwäne, die dort lägen. Unten an der Küste waren herrliche, grüne Wälder, und vorn lag eine Kirche oder ein Kloster, das wußte sie nicht recht, aber ein Gebäude war es. Citronen- und Apfelsinenbäume wuchsen im Garten, und vor dem Tore standen hohe Palmbäume. Die See bildete hier eine kleine Bucht; da war sie still, aber sehr tief; gerade auf die Klippe zu, wo der weiße, feine Sand aufgespült war, schwamm sie mit dem schönen Prinzen, legte ihn in den Sand, sorgte aber besonders dafür, daß der Kopf hoch im warmen Sonnenscheine lag.
Nun läuteten alle Glocken in dem großen, weißen Gebäude, und es kamen viele junge Mädchen durch den Garten. Da schwamm die kleine Seejungfer weiter hinaus hinter einige hohe Steine, die aus dem Wasser hervorragten, legte Seeschaum auf ihr Haar und ihre Brust, so daß Niemand ihr kleines Gesicht sehen konnte, und dann paßte sie auf, wer zu dem armen Prinzen kommen würde.
Es währte nicht lange, da kam ein junges Mädchen dorthin; sie schien sehr zu erschrecken; aber nur einen Augenblick; dann holte sie mehrere Menschen, und die Seejungfer sah, daß der Prinz zum Leben zurückkam, und daß er Alle anlächelte. Aber ihr lächelte er nicht zu; er wußte ja auch nicht, daß sie ihn gerettet hatte, sie war sehr betrübt, und als er in das große Gebäude hineingeführt wurde, tauchte sie traurig unter das Wasser und kehrte zum Schlosse ihres Vaters zurück.
Immer war sie still und nachdenkend gewesen, aber nun wurde sie es noch weit mehr. Die Schwestern fragten sie, was sie das erste Mal dort oben gesehen habe; aber sie erzählte nichts.
Manchen Abend und Morgen stieg sie hinauf, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah, wie die Früchte des Gartens reiften und abgepflückt wurden; sie sah, wie der Schnee auf den hohen Bergen schmolz; aber den Prinzen erblickte sie nicht, und deshalb kehrte sie immer betrübter heim. Da war es ihr einziger Trost, in ihrem kleinen Garten zu sitzen und die Arme um die schöne Marmorstatue zu schlingen, die dem Prinzen glich; aber ihre Blumen pflegte sie nicht, die wuchsen wie in einer Wildnis über die Gänge hinaus und flochten ihre langen Stiele und Blätter in die Zweige der Bäume hinein, so daß es dort dunkel war.
Zuletzt konnte sie es nicht länger aushalten, sondern sagte es einer ihrer Schwestern; und gleich erfuhren es die andern, aber Niemand weiter als diese und einige andere Seejungfern, die es nur ihren nächsten Freundinnen weiter sagten. Eine von ihnen wußte, wer der Prinz war; sie hatte auch das Fest auf dem Schiffe gesehen und gab an, woher er war und wo sein Königreich lag.
»Komm, kleine Schwester!« sagten die andern Prinzessinnen und, sich umschlungen haltend, stiegen sie in einer langen Reihe aus dem Meere empor, wo sie wußten, daß des Prinzen Schloß lag.
Dieses war aus einer hellgelben, glänzenden Steinart aufgeführt, mit großen Marmortreppen, deren eine in das Meer hinunterreichte. Prächtig vergoldete Kuppeln erhoben sich über das Dach, und zwischen den Säulen, um das ganze Gebäude herum, standen Marmorbilder, die aussahen, als lebten sie. Durch das klare Glas in den hohen Fenstern blickte man in die prächtigen Säle hinein, wo köstliche Seidengardinen und Teppiche ausgehängt und alle Wände mit großen Gemälden verziert waren, so daß es ein wahres Vergnügen war, es zu betrachten. Mitten in dem größten Saale plätscherte ein großer Springbrunnen; seine Strahlen reichten hoch hinauf gegen die Glaskuppel in der Decke, durch welche die Sonne auf das Wasser und die schönen Pflanzen schien, die im großen Bassin wuchsen.
Nun wußte sie, wo er wohnte, und dort war sie manchen Abend und manche Nacht auf dem Wasser. Sie schwamm dem Lande weit näher als eine der andern es gewagt hätte; ja, sie ging den schmalen Canal hinauf, unter den prächtigen Marmoraltan, welcher einen großen Schatten über das Wasser warf. Hier saß sie und betrachtete den jungen Prinzen, der da glaubte, er sei ganz allein in dem hellen Mondscheine.
Sie sah ihn manchen Abend mit Musik in seinem prächtigen Boote segeln, auf dem Flaggen wehten; sie lauschte durch das grüne Schilf hervor, und ergriff der Wind ihren langen silberweißen Schleier, und Jemand sah ihn, so glaubte er, es sei ein Schwan, der die Flügel ausbreite.
Sie hörte in mancher Nacht, wenn die Fischer mit Fackeln auf der See waren, viel Gutes von dem jungen Prinzen erzählen; und es freute sie, daß sie sein Leben gerettet hatte, als er halbtot auf den Wogen umhertrieb; sie dachte daran, wie fest sein Haupt an ihrem Busen geruht, und wie herzlich sie ihn da geküßt hatte; er aber wußte nichts davon und konnte nicht einmal von ihr träumen.
Mehr und mehr fing sie an, die Menschen zu lieben; mehr und mehr wünschte sie, unter ihnen umherwandeln zu können, deren Welt ihr weit größer zu sein schien, als die ihrige. Sie konnten ja auf Schiffen über das Meer fliegen, auf den hohen Bergen über die Wolken emporsteigen; und die Länder, die sie besaßen, erstreckten sich mit Wäldern und Feldern, weiter, als ihre Blicke reichten. Da war so Vieles, was sie zu wissen wünschte; aber die Schwestern wußten ihr nicht Alles zu beantworten, deshalb fragte sie die Großmutter; diese kannte die höhere Welt recht gut, die sie sehr richtig die Länder über dem Meere nannte.
»Wenn die Menschen nicht ertrinken,« fragte die kleine Seejungfer, »können sie dann ewig leben? Sterben sie nicht, wie wir hier unten im Meere?«
»Ja,« sagte die Alte; »sie müssen auch sterben, und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer, als die unsere. Wir können dreihundert Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufhören, hier zu sein, so werden wir nur in Schaum auf dem Wasser verwandelt, haben nicht einmal ein Grab hier unten unter unsern Lieben. Wir haben keine unsterbliche Seele; wir erhalten nie wieder Leben; wir sind gleich dem grünen Schilfe; ist das einmal durchgeschnitten, so kann es nicht wieder grünen! Die Menschen hingegen haben ein Seele, die ewig lebt, die noch lebt, nachdem der Körper zu Erde geworden ist; sie steigt durch die klare Luft empor, hinauf zu den glänzenden Sternen! So wie wir aus dem Wasser auftauchen und die Länder der Welt erblicken, so steigen sie zu unbekannten herrlichen Orten auf, die wir nie zu sehen bekommen.«
»Weshalb bekamen wir keine unsterbliche Seele?« fragte die kleine Seejungfer betrübt. »Ich möchte meine hunderte von Jahren, die ich zu leben habe, dafür geben, um nur einen Tag Mensch zu sein und dann hoffen zu können, Antheil an der himmlischen Welt zu haben.«
»Daran darfst Du nicht denken!« sagte die Alte. »Wir fühlen uns weit glücklicher und besser, wie die Menschen dort oben!«
»Ich werde also sterben und als Schaum auf dem Meere treiben, nicht die Musik der Wogen hören, die schönen Blumen und die rote Sonne sehen? Kann ich denn gar nichts tun, um eine unsterbliche Seele zu gewinnen?« –
»Nein!« sagte die Alte. »Nur wenn ein Mensch Dich so lieben würde, daß Du ihm mehr als Vater und Mutter wärest; wenn er mit all seinem Denken und all seiner Liebe an Dir hinge und den Prediger seine rechte Hand in die Deinige, mit dem Versprechen der Treue hier und in alle Ewigkeit, legen ließe, dann flösse seine Seele in Deinen Körper über, und auch Du erhieltest Anteil an der Glückseligkeit der Menschen. Er gäbe Dir eine Seele und behielte doch seine eigene. Aber das kann nie geschehen! Was hier im Meere schön ist, Dein Fischschwanz, finden sie dort auf der Erde häßlich; sie verstehen es eben nicht besser; man muß dort zwei plumpe Stützen haben, die sie Beine nennen, um schön zu sein!«
Da seufzte die kleine Seejungfer, und sah betrübt auf ihren Fischschwanz.
»Laß uns froh sein,« sagte die Alte; »hüpfen und springen wollen wir in den dreihundert Jahren, die wir zu leben haben; das ist wahrlich lang genug; später kann man sich um so besser ausruhen. Heute Abend werden wir Hofball haben!«
Das war auch eine Pracht, wie man sie nie auf Erden erblickt. Die Wände und die Decke des großen Tanzsaals waren von dickem, aber durchsichtigem Glase, mehrere hundert kolossale Muschelschalen, rosenrote und grasgrüne, standen zu jeder Seite in Reihen mit einem blau brennenden Feuer, welches den ganzen Saal erleuchtete und durch die Wände hindurch schien, so daß die See draußen erleuchtet war,; man konnte die unzähligen Fische sehen, große und kleine, die gegen die Glasmauern schwammen; auf einigen glänzten die Schuppen purpurrot, auf andern erschienen sie wie Silber und Gold. – Mitten durch den Saal floß ein breiter Strom, und auf diesem tanzten die Meermänner und Meerweibchen zu ihrem eigenen, lieblichen Gesänge. So schöne Stimmen haben die Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Seejungfer sang am Schönsten von ihnen Allen, und der ganze Hof applaudierte mit Händen und Schwänzen; und einen Augenblick fühlte sie eine Freude in ihrem Herzen, denn sie wußte, daß sie die schönste Stimme von Allen auf der Erde und im Meere hatte! Aber bald gedachte sie wieder der Welt über sich; sie konnte den hübschen Prinzen und ihren Kummer, daß sie keine unsterbliche Seele, wie er sie besitze, nicht vergessen. Deshalb schlich sie sich aus ihres Vaters Schlosse hinaus, und während Alles drinnen Gesang und Frohsinn war, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie das Waldhorn durch das Wasser ertönen und dachte: Nun segelt er sicher dort oben, er, an dem meine Sinne hangen und in dessen Hand ich meines Lebens Glück legen möchte. Alles will ich wagen, um ihn und eine unsterbliche Seele zu gewinnen! Während meine Schwestern dort in meines Vaters Schlosse tanzen, will ich zur Meerhexe gehen, vor der mir immer so bange gewesen ist; aber sie kann vielleicht raten und helfen!«
Nun ging die kleine Seejungfer aus ihrem Garten hinaus nach den brausenden Strudeln, hinter denen die Hexe wohnte. Den Weg hatte sie früher nie zurückgelegt; da wuchsen keine Blumen, kein Seegras; nur der nackte, graue Sandboden erstreckte sich gegen die Strudel hin, wo das Wasser gleich brausenden Mühlrädern herumwirbelte und Alles, was es erfaßte, mit sich in die Tiefe riß. Mitten zwischen diesen zermalmenden Wirbeln mußte sie hindurch, um in den Bereich der Meerhexe zu gelangen; und hier war eine lange Strecke kein anderer Weg, als über warmen, sprudelnden Schlamm; diesen nannte die Hexe ihren Torfmoor. Dahinter lag ihr Haus mitten in einem seltsamen Walde, alle Bäume und Büsche waren Polypen, halb Tier und halb Pflanze; sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus der Erde hervor wuchsen; alle Zweige waren lange, schleimige Arme mit Fingern wie geschmeidige Würmer; und Glied vor Glied bewegte sich, von der Wurzel bis zur äußersten Spitze. Alles, was sie im Meere erfassen konnten, umschlangen sie fest und ließen es nie wieder fahren. Die kleine Seejungfer blieb vor demselben ganz erschrocken stehen; ihr Herz pochte vor Furcht; fast wäre sie umgekehrt; aber da dachte sie an den Prinzen und an die Seele der Menschen, und nun bekam sie Mut. Ihr langes, fliegendes Haar band sie fest um das Haupt, damit die Polypen sie nicht daran ergreifen möchten; beide Hände legte sie über ihre Brust zusammen, und schoß so dahin, wie der Fisch durch das Wasser schießen kann, immer zwischen den häßlichen Polypen hindurch, die ihre geschmeidigen Arme und Finger hinter ihr her streckten. Sie sah, wie jeder von ihnen Etwas, was er ergriffen hatte, mit Hunderten von kleinen Armen hielt, Menschen, die auf der See umgekommen und tief hinunter gesunken waren, sahen wie weiße Gerippe aus der Polypen Armen hervor. Schiffsruder und Kisten hielten sie fest, auch Skelette von Landtieren und ein kleines Meerweib, welches sie gefangen und erstickt hatten: das war ihr das Schrecklichste.
Nun kam sie zu einem großen, sumpfigen Platze im Walde, wo große, fette Wasserschlangen sich wälzten und ihren häßlichen weißgelben Bauch zeigten. Mitten auf dem Platze war ein Haus, von weißen Knochen ertrunkener Menschen errichtet; da saß die Meerhexe und ließ eine Kröte aus ihrem Munde fressen, wie die Menschen einen kleinen Kanarienvogel Zucker zu essen geben. Die häßlichen, fetten Wasserschlangen nannte sie ihre kleinen Küchlein und ließ sie sich auf ihrer großen, schwammigen Brust wälzen.
»Ich weiß schon was Du willst!« sagte die Meerhexe. »Es ist zwar dumm von Dir, doch sollst Du Deinen Willen haben; denn er wird Dich ins Unglück stürzen, meine schöne Prinzessin. Du willst gern Deinen Fischschwanz los sein und statt dessen zwei Stützen, wie die Menschen zum Gehen haben, damit der junge Prinz sich in Dich verliebt und Du ihn und eine unsterbliche Seele erhalten kannst!« Dabei lachte die Hexe laut und widerlich, so daß die Kröte und die Schlangen auf die Erde fielen, wo sie sich wälzten. »Du kommst gerade zur rechten Zeit,« sagte die Hexe; »morgen, wenn die Sonne aufgeht, könnte ich Dir nicht helfen, bis wieder ein Jahr um wäre. Ich werde Dir einen Trank bereiten, mit dem mußt Du, bevor die Sonne aufgeht, nach dem Lande schwimmen, Dich dort an das Ufer setzen und ihn trinken: dann verschwindet Dein Schwanz und schrumpft zu dem, was die Menschen niedliche Beine nennen, zusammen, aber es tut weh; es ist, als ob ein scharfes Schwert Dich durchdränge. Alle, die Dich sehen, werden sagen, Du seiest das schönste Menschenkind, das sie gesehen hätten. Du behältst Deinen schwebenden Gang; keine Tänzerin kann sich so leicht bewegen wie Du; aber jeder Schritt, den Du machst, ist, als ob Du auf scharfe Messer trätest, als ob Dein Blut fließen müßte. Willst Du alles Dieses leiden, so werde ich Dir helfen!«
»Ha!« sagte die kleine Seejungfer mit bebender Stimme, und gedachte des Prinzen und der unsterblichen Seele.
»Aber bedenke« sagte die Hexe; »hast Du erst menschliche Gestalt bekommen, so kannst Du nie wieder eine Seejungfer werden! Du kannst nie durch das Wasser zu Deinen Schwestern und zum Schlosse Deines Vaters zurück, und gewinnst Du des Prinzen Liebe nicht so, daß er um Deinetwillen Vater und Mutter vergißt, an Dir mit Leib und Seele hängt und den Priester Eure Hände in einander legen läßt, daß Ihr Mann und Frau werdet, so bekommst Du keine unsterbliche Seele! Am ersten Morgen, nachdem er mit einer Andern verheiratet ist, wird Dein Herz brechen, und Du wirst zu Schaum auf dem Wasser.«
»Ich will es,« sagte die kleine Seejungfer und war bleich wie der Tod.
»Aber mich mußt Du auch bezahlen!« sagte die Hexe; »und es ist nicht wenig, was ich verlange. Du hast die schönste Stimme von Allen hier auf dem Grunde des Meeres; damit glaubst Du wohl, ihn bezaubern zu können; aber diese Stimme mußt Du mir geben. Das Beste, was Du besitzest, will ich für meinen köstlichen Trank haben! Mein eigen Blut muß ich Dir ja geben, damit der Trank scharf wird, wie ein zweischneidig Schwert!«
»Aber wenn Du meine Stimme nimmst,« sagte die kleine Seejungfer, »was bleibt mir dann übrig?«
»Deine schöne Gestalt,« sagte die Hexe, »Dein schwebender Gang und Deine sprechenden Augen; damit kannst Du schon ein Menschenherz betören. Nun, hast Du den Mut verloren? Strecke Deine kleine Zunge hervor, dann schneide ich sie an Zahlungsstatt ab, und Du erhältst den kräftigen Trank!«
»Es geschehe!« sagte die kleine Seejungfer; und die Hexe setzte ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu kochen. »Reinlichkeit ist eine schöne Sache!« sagte sie und scheuerte den Kessel mit den Schlangen ab, die sie zu einem langen Knoten band; dann ritzte sie sich selbst die Brust und ließ ihr schwarzes Blut hineintröpfeln. Der Dampf bildete die sonderbarsten Gestalten, so daß Einem Angst und Bange werden mußte. Jeden Augenblick warf die Hexe neue Sachen in den Kessel, und als er kochte, war es, als ob ein Krokodil weinte. Endlich war der Trank fertig; er sah wie das klarste Wasser aus.
»Da hast Du ihn!« sagte die Hexe und schnitt der kleinen Seejungfer die Zunge ab, die nun stumm war, weder singen, noch sprechen konnte.
»Sollten die Polypen Dich ergreifen, wenn Du durch meinen Wald zurückgehst,« sagte die Hexe, »so wirf nur einen einzigen Tropfen dieses Getränkes auf sie: davon zerspringen ihre Arme und Finger in tausend Stücke!« Aber das brauchte die kleine Seejungfer nicht zu tun; die Polypen zogen sich erschrocken zurück, da sie den glänzenden Trank erblickten, der in ihrer Hand leuchtete, als sei er ein funkelnder Stern. So kam sie schnell durch den Wald, das Moor und die brausenden Strudel.
Sie konnte ihres Vaters Schloß sehen; die Fackeln waren in dem großen Tanzsaale erloschen; sie schliefen sicher Alle drinnen; aber sie wagte doch nicht, sie aufzusuchen, jetzt da sie stumm war und sie auf immer verlassen wollte. Es war, als ob ihr Herz vor Trauer zerspringen sollte. Sie schlich in den Garten, nahm eine Blume von jedem Blumenbeete ihrer Schwestern, warf Tausende von Kußhändchen dem Schlosse zu und stieg durch die dunkelblaue See hinauf.
Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als sie des Prinzen Schloß erblickte und die prächtige Marmortreppe hinaufstieg. Der Mond schien herrlich klar. Die kleine Seejungfer trank den brennenden, scharfen Trank, und es war, als ginge ein zweischneidiges Schwert durch ihren feinen Körper; sie fiel dabei in Ohnmacht und lag wie tot da. Als die Sonne über die See schien, erwachte sie und fühlte einen schneidenden Schmerz; aber gerade vor ihr stand der schöne, junge Prinz; er heftete seine schwarzen Augen auf sie, so daß sie die ihrigen niederschlug und wahrnahm, daß ihr Fischschwanz fort war und sie die niedlichsten, weißen Beine hatte, die nur ein Mädchen haben kann. Aber sie war nackt, deshalb hüllte sie sich in ihr langes Haar ein. Der Prinz fragte, wer sie sei und wie sie hierher gekommen wäre; und sie sah ihn mild und doch gar betrübt mit ihren dunkelblauen Augen an; sprechen konnte sie ja nicht. Da nahm er sie bei der Hand und führte sie in das Schloß hinein. Jeder Schritt, den sie tat, war, wie die Hexe im Voraus gesagt hatte, als trete sie auf spitze Nadeln und Messer; aber das ertrug sie gern; an des Prinzen Hand schritt sie so leicht einher wie eine Seifenblase, und er, sowie Alle, wunderten sich über ihren lieblichen, schwebenden Gang.
Sie bekam nun herrliche Kleider von Seide und Musselin anzuziehen; im Schlosse war sie die Schönste von Allen; aber sie war stumm, konnte weder singen noch sprechen. Herrliche Sklavinnen, in Seide und Gold gekleidet, traten auf und sangen vor dem Prinzen und seinen königlichen Eltern; die Eine sang schöner als alle Andern, und der Prinz klatschte in die Hände und lächelte sie an. Da wurde die kleine Seejungfer betrübt; sie wußte, daß sie selbst weit schöner gesungen hatte und dachte: »O, er sollte nur wissen, daß ich, um bei ihm zu sein, meine Stimme für alle Ewigkeit hingegeben habe.«
Nun tanzten die Sklavinnen niedliche, schwebende Tänze zur herrlichsten Musik; da erhob die kleine Seejungfer ihre schönen, weißen Arme, richtete sich auf den Fußspitzen auf und schwebte tanzend über den Fußboden hin, wie noch keine getanzt hatte; bei jeder Bewegung wurde ihre Schönheit noch sichtbarer, und ihre Augen sprachen tiefer zum Herzen, als der Gesang der Sklavinnen.
Alle waren entzückt davon, besonders der Prinz, der sie sein kleines Findelkind nannte; und sie tanzte mehr und mehr, obwohl es ihr jedesmal, wenn ihr Fuß die Erde berührte, war, als ob sie auf scharfe Messer träte. Der Prinz sagte, daß sie immer bei ihm bleiben solle, und sie erhielt die Erlaubniß, vor seiner Tür auf einem Sammetkissen zu schlafen.
Er ließ ihr eine Männertracht machen, damit sie ihn zu Pferde begleiten könne. Sie ritten durch die duftenden Wälder, wo die grünen Zweige ihre Schultern berührten und die Vögel hinter den frischen Blättern sangen. Sie kletterte mit dem Prinzen auf die hohen Berge hinauf, und obgleich ihre zarten Füße bluteten, daß selbst die Andern es sehen konnten, lachte sie doch darüber und folgte ihm, bis sie die Wolken unter sich segeln sahen, als wäre es ein Schwarm Vögel, die nach fremden Ländern ziehen.
Daheim in des Prinzen Schlosse, wenn Nachts die Andern schliefen, gingen sie auf die breite Marmortreppe hinaus; es kühlte ihre brennenden Füße, im kalten Seewasser zu stehen, und dann gedachte sie Derer dort unten in der Tiefe.
Einmal des Nachts kamen ihre Schwestern Arm in Arm; traurig sangen sie, indem sie über dem Wasser schwammen; sie winkte ihnen und sie erkannten sie und erzählten ihr, wie sehr sie alle betrübt seien. Darauf besuchte sie dieselben in jeder Nacht, und einmal erblickte sie weit draußen ihre alte Großmutter, die in vielen Jahren nicht über der Meeresfläche gewesen war, und den Meerkönig mit seiner Krone auf dem Haupte; sie streckten die Hände nach ihr aus, wagten sich aber dem Lande nicht so nahe, wie die Schwestern.
Tag für Tag wurde sie dem Prinzen lieber; er liebte sie, wie man ein gutes, liebes Kind liebt; aber sie zu seiner Königin zu machen, kam ihm nicht in den Sinn; und seine Frau mußte sie doch werden, sonst erhielt sie keine unsterbliche Seele und mußte an seinem Hochzeitsmorgen zu Schaum auf dem Meere werden.
»Liebst Du mich nicht am meisten von ihnen Allen?« schienen der kleinen Seejungfer Augen zu sagen, wenn er sie in seine Arme nahm und ihre schöne Stirn küßte.
»Ja, Du bist mir die Liebste,« sagte der Prinz, »denn Du hast das beste Herz von Allen. Du bist mir am meisten ergeben, und gleichst einem jungen Mädchen, das ich einmal sah, aber sicher nie wiederfinde. Ich war auf einem Schiffe, welches strandete; die Wellen warfen mich bei einem heiligen Tempel an das Land, wo mehrere junge Mädchen den Dienst verrichteten; die jüngste dort fand mich am Ufer und rettete mein Leben; ich sah sie nur zweimal, sie wäre die Einzige, die ich in dieser Welt lieben könnte; aber Du gleichst ihr und Du verdrängst fast ihr Bild aus meiner Seele; sie gehört dem heiligen Tempel an, und deshalb hat mein gutes Glück Dich mir gesendet; nie wollen wir uns trennen!« –
»Ach er weiß nicht, daß ich sein Leben gerettet habe!« dachte die kleine Seejungfer; »ich trug ihn über das Meer zum Walde hin, wo der Tempel steht; ich saß hier hinter dem Stamme und sah, ob keine Menschen kommen würden. Ich sah das hübsche Mädchen, die er mehr liebt, als mich!« sie seufzte tief: weinen konnte sie nicht, »Das Mädchen gehört dem heiligen Tempel an, hat er gesagt; sie kommt nie in die Welt hinaus; sie begegnen sich nicht mehr, ich bin bei ihm, sehe ihn jeden Tag; ich will ihn pflegen, lieben, ihm mein Leben opfern!«
Aber nun sollte der Prinz sich verheiraten und des Nachbarkönigs schöne Tochter zur Frau bekommen, erzählte man; deshalb rüstete er ein so prächtiges Schiff aus. Der Prinz reist, um des Nachbarkönigs Länder zu besichtigen, so heißt es wohl; aber es geschieht, um des Nachbarkönigs Tochter zu sehen. Ein großes Gefolge soll ihn begleiten. Die kleine Seejungfer schüttelte das Haupt und lächelte; sie kannte des Prinzen Gedanken weit besser, als alle Andern. »Ich muß reisen!« hatte er zu ihr gesagt; »ich muß die schöne Prinzessin sehen; meine Eltern verlangen es; aber sie wollen mich nicht zwingen, sie als meine Braut heimzuführen. Ich kann sie nicht lieben! Sie gleicht nicht dem schönen Mädchen im Tempel, dem Du ähnelst; sollte ich einst eine Braut wählen, so würdest Du es eher sein, mein stummes Findelkind mit den sprechenden Augen!« Und er küßte ihren roten Mund, spielte mit ihrem langen Haare und legte sein Haupt an ihr Herz, so daß dieses von Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte.
»Du fürchtest doch das Meer nicht, mein stummes Kind?« sagte er, als sie auf dem prächtigen Schiffe standen, welches ihn nach den Ländern des Nachbarkönigs führen sollte; er erzählte ihr vom Sturme und von der Windstille, von seltsamen Fischen in der Tiefe und von Dem, was die Taucher dort gesehen; und sie lächelte bei seiner Erzählung; sie wußte ja besser, als sonst Jemand, was auf dem Grunde des Meeres vorging.
In der mondhellen Nacht, wenn Alle schliefen, bis auf den Steuermann, der am Steuerruder stand, saß sie am Bord des Schiffes und starrte durch das klare Wasser hinunter; sie glaubte ihres Vaters Schloß zu erblicken; hoch oben stand die Großmutter mit der Silberkrone auf dem Haupte und starrte durch die reißenden Ströme zu des Schiffes Kiel empor. Da kamen ihre Schwestern über das Wasser hervor und schauten sie traurig an und rangen ihre weißen Hände; sie winkte ihnen, lächelte und wollte erzählen, daß es ihr gut und glücklich ginge; aber der Schiffsjunge näherte sich ihr und die Schwestern tauchten unter, so daß er glaubte, das Weiße, was er gesehen, sei Schaum auf der See gewesen.
Am nächsten Morgen segelte das Schiff in den Hafen von des Nachbarkönigs prächtiger Stadt, Alle Kirchenglocken läuteten, und von den hohen Türmen wurden die Posaunen geblasen, während die Soldaten mit fliegenden Fahnen und blitzenden Bayonetten dastanden. Jeder Tag führte ein Fest mit sich. Bälle und Gesellschaften folgten einander: aber die Prinzessin war noch nicht da; sie werde, weit von hier entfernt, in einem heiligen Tempel erzogen, sagten sie; dort lerne sie alle königlichen Tugenden. Endlich traf sie ein.
Die kleine Seejungfer war begierig, ihre Schönheit zu sehen, und sie mußte solche anerkennen: eine lieblichere Erscheinung hatte sie noch nie gesehen. Die Haut war fein und klar, und hinter den langen dunklen Augenwimpern lächelten ein paar schwarzblaue, treue Augen.
»Du bist Die!« sagte der Prinz, »die mich gerettet hat, als ich, einer Leiche gleich, an der Küste lag!« Und er drückte seine errötende Braut in seine Arme. »O, ich bin allzu glücklich!« sagte er zur kleinen Seejungfer. »Das Beste, was ich je hoffen durfte, ist mir in Erfüllung gegangen. Du wirst Dich über mein Glück freuen, denn Du meinst es am Besten mit mir von ihnen allen!« Und die kleine Seejungfer küßte seine Hand, und es kam ihr schon vor, als fühle sie ihr Herz brechen. Sein Hochzeitsmorgen würde ihr ja den Tod geben und sie in Schaum auf dem Meere verwandeln.
Alle Kirchenglocken läuteten; die Herolde ritten in den Straßen umher und verkündeten die Verlobung. Auf allen Altären brannte duftendes Oel in köstlichen Silberlampen. Die Priester schwangen die Rauchfässer, und Braut und Bräutigam reichten einander die Hand und erhielten den Segen des Bischofs. Die kleine Seejungfer war in Seide und Gold gekleidet und hielt die Schleppe der Braut; aber ihre Ohren hörten die festliche Musik nicht, ihr Auge sah die heilige Zeremonie nicht; sie gedachte ihrer Todesnacht und alles Dessen, was sie in dieser Welt verloren hatte.
Noch an dem selben Abende gingen die Braut und der Bräutigam an Bord des Schiffes; die Kanonen donnerten, alle Flaggen wehten, und mitten auf dem Schiffe war ein köstliches Zelt von Gold und Purpur und mit den schönsten Kissen errichtet: da sollte das Brautpaar in der kühlen, stillen Nacht schlafen!
Die Segel schwellten im Winde, und das Schiff glitt leicht und ohne große Bewegung über die klare See dahin.
Als es dunkelte wurden bunte Lampen angezündet, und die Seeleute tanzten lustig auf dem Verdecke. Die kleine Seejungfer mußte ihres ersten Auftauchens aus dem Meere gedenken, wo sie dieselbe Pracht und Freude erblickt hatte; und sie wirbelte sich mit im Tanze, schwebte, wie die Schwalbe schwebt, wenn sie verfolgt wird; und Alle jubelten ihr Bewunderung zu: nie hatte sie so herrlich getanzt. Es schnitt ihr wie scharfe Messer in die zarten Füße, aber sie fühlte es nicht; es schnitt ihr noch schmerzlicher durch das Herz. Sie wußte, es sei der letzte Abend, an dem sie ihn erblickte, für den sie ihre Verwandten und ihre Heimat verlassen, ihre schöne Stimme dahin gegeben und täglich unendliche Qualen ertragen hatte, ohne daß er es mit einem Gedanken ahnte. Es war die letzte Nacht, daß sie dieselbe Luft mit ihm einatmete, das tiefe Meer und den sternenhellen Himmel erblickte; eine ewige Nacht ohne Gedanken und Traum harrte ihrer, die keine Seele hatte, keine Seele gewinnen konnte. Und Alles war Freude und Heiterkeit auf dem Schiffe bis über Mitternacht hinaus; sie lachte und tanzte mit Todesgedanken im Herzen. Der Prinz küßte seine schöne Braut, und sie spielte mit seinem schwarzen Haare, und Arm in Arm gingen sie zur Ruhe in das prächtige Zelt.
Es wurde still auf dem Schiffe, nur der Steuermann stand am Steuerruder, die kleine Seejungfer legte ihre weißen Arme auf den Schiffsbord und blickte gegen Osten nach der Morgenröte; der erste Sonnenstrahl, wußte sie, würde sie töten. Da sah sie ihre Schwestern der Flut entsteigen; die waren bleich, wie sie; ihr langes schönes Haar wehte nicht mehr im Winde; es war abgeschnitten.
»Wir haben es der Hexe gegeben um Dir Hilfe bringen zu können, damit Du diese Nacht nicht stirbst! Sie hat uns ein Messer gegeben, hier ist es! Siehst Du, wie scharf? Bevor die Sonne aufgeht, mußt Du es in das Herz des Prinzen stoßen, und wenn dann das warme Blut auf Deine Füße spritzt, so wachsen diese in einen Fischschwanz zusammen und Du wirst wieder eine Seejungfer, kannst zu uns herabsteigen und lebst Deine dreihundert Jahre, bevor Du zu toten, salzigem Seeschaume wirst. Beeile Dich! Er oder Du mußt sterben, bevor die Sonne aufgeht! Unsere Großmutter trauert so, daß ihr weißes Haar, wie das unsrige, unter der Scheere der Hexe gefallen ist. Töte den Prinzen und komm zurück! Beeile Dich! Siehst Du den roten Streifen am Himmel? In wenigen Minuten steigt die Sonne auf, dann mußt Du sterben!« Und sie stießen einen tiefen Seufzer aus und versanken in den Wogen.
Die kleine Seejungfer zog den Purpurteppich vom Zelte und sah die schöne Braut mit ihrem Haupte an des Prinzen Brust ruhen; und sie bog sich nieder, küßte ihn auf seine schöne Stirn, blickte gen Himmel, wo die Morgenröte mehr und mehr leuchtete; betrachtete das scharfe Messer und heftete die Augen wieder auf den Prinzen, der im Traume seine Braut bei Namen nannte. Nur sie war in seinen Gedanken, und das Messer zitterte in der Hand der Seejungfer. – Aber da warf sie es weit hinaus in die Wogen; sie glänzten rot, wo es hinfiel; es sah aus, als keimten Bluttropfen aus dem Wasser auf. Noch einmal sah sie mit halb gebrochenen Blicken auf den Prinzen, stürzte sich vom Schiffe in das Meer hinab und fühlte, wie ihr Körper sich im Schaum auflöste.
Nun stieg die Sonne aus dem Meere auf: die Strahlen fielen so mild und warm auf den kalten Meeresschaum und die kleine Seejungfer fühlte nichts vom Tode. Sie sah die helle Sonne, und über ihr schwebten Hunderte von durchsichtigen, herrlichen Geschöpfen, sie konnte durch dieselben des Schiffes weiße Segel und des Himmels rote Wolken erblicken; die Sprache derselben war melodisch, aber so geisterhaft, daß kein menschliches Ohr sie vernehmen, ebenso wie kein irdisches Auge sie erblicken konnte, ohne Schwingen schwebten sie vermittelst ihrer eigenen Leichtigkeit durch die Luft. Die kleine Seejungfer sah, daß sie einen Körper hatte, wie diese, der sich mehr und mehr aus dem Schaume erhob.
»Wo komme ich hin?« fragte sie, und ihre Stimme klang wie die der andern Wesen, so geisterhaft, daß keine irdische Musik sie wiederzugeben vermag.
»Zu den Töchtern der Luft!« erwiderten die Andern. »Die Seejungfer hat keine unsterbliche Seele und kann sie nie erhalten, wenn sie nicht eines Menschen Liebe gewinnt; von einer fremden Macht hängt ihr ewiges Dasein ab. Die Töchter der Luft haben auch keine unsterbliche Seele, aber sie können durch gute Handlungen sich selbst eine schaffen. Wir fliegen nach den warmen Ländern, wo die schwüle Pestluft den Menschen tötet; dort fächeln wir Kühlung. Wir breiten den Duft der Blumen durch die Luft aus und senden Erquickung und Heilung. Wenn wir dreihundert Jahre lang gestrebt haben, alles Gute, was wir vermögen, zu vollbringen, so erhalten wir eine unsterbliche Seele und nehmen Teil am ewigen Glücke der Menschen. Du arme, kleine Seejungfer hast mit ganzem Herzen nach demselben, wie wir, gestrebt; Du hast gelitten und geduldet, hast Dich zur Luftgeisterwelt erhoben und kannst nun Dir selbst durch gute Werke nach drei Jahrhunderten eine unsterbliche Seele schaffen.«
Und die kleine Seejungfer erhob ihre verklärten Augen gegen Gottes Sonne, und zum ersten Male fühlte sie Tränen in ihren Augen, – Auf dem Schiffe war wieder Lärm und Leben; sie sah den Prinzen mit seiner schönen Braut nach ihr suchen; wehmütig starrten sie den perlenden Schaum an, als ob sie wüßten, daß sie sich in die Fluten gestürzt habe. Unsichtbar küßte sie die Stirn der Braut, fächelte den Prinzen an und stieg mit den übrigen Kindern der Luft auf die rosenrote Wolke hinauf, welche den Aether durchschiffte.
»Nach dreihundert Jahren schweben wir so in das Reich Gottes hinein!«
»Auch können wir noch früher dahin gelangen!« flüsterte eine Tochter der Luft. »Unsichtbar schweben wir in die Häuser der Menschen hinein, wo Kinder sind, und für jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind finden, welches seinen Eltern Freude bereitet und deren Liebe verdient, verkürzt Gott unsere Prüfungszeit. Das Kind weiß nicht, wann wir durch die Stube steigen, und müssen wir aus Freude über dasselbe lächeln, so wird ein Jahr von den dreihundert Jahren abgerechnet; sehen wir aber ein unartiges und böses Kind, so müssen wir Tränen der Trauer vergießen, und jede Träne legt unserer Prüfungszeit einen Tag zu!«
NACH JAHRTAUSENDEN

Ja, nach Jahrtausenden kommen sie auf den Flügeln des Dampfes durch die Luft über das Weltmeer. Amerikas junge Einwohner besuchen das alte Europa. Sie kommen zu den Denkmälern hier und zu unserer versunkenen Pracht, so wie wir heute nach Südasien wandern, um dessen bröckelnde Herrlichkeiten zu sehen.
Nach Jahrtausenden kommen sie.
Themse, Donau und Rhein rollen noch; der Montblanc steht mit seinem Schneegipfel, die Nordlichter schimmern über den Ländern des Nordens, aber Geschlecht auf Geschlecht wird zu Staub, die Mächtigen des Augenblicks werden vergessen, wie es schon jetzt diejenigen sind, die unter dem Hügel dort schlummern auf dem der wohlhabende Mehlhändler, dem der Grund und Boden gehört, sich eine Bank hat zimmern lassen um dort sitzen und über die flachen, wogenden Kornfelder hinschauen zu können.
"Nach Europa" heißt es bei Amerikas jungem Geschlecht, "nach der Väter Land, dem herrlichen Lande der Erinnerung und der Fantasie, Europa"
Das Luftschiff kommt; es ist überfüllt mit Reisenden, denn die Fahrt geht geschwinder als zur See. Der elektromagnetische Draht unter dem Weltmeer hat schon telegraphiert, wie groß die Luftkarawane ist. Schon kommt Europa in Sicht, es sind Irlands Küsten, die sich zeigen, aber die Passagiere schlafen noch; sie wollen erst geweckt werden, wenn sie über England sind. Dort betreten sie Europas Erde in Shakespeares Land, wie es die Söhne des Geistes heißen; das Land der Politik, das Land der Maschinen, wie es andere nennen.
Einen ganzen Tag wird hier Aufenthalt genommen, soviel Zeit widmet das eilfertige Geschlecht dem großen England und Schottland.
Dann geht die Fahrt durch den Kanaltunnel nach Frankreich, Karls des Großen und Napoleons Land. Moliere wird genannt, die Gelehrten sprechen von einer klassischen und romantischen Schule im fernen Altertum, und von Helden, Dichtern und Gelehrten, die unsere Zeit nicht kennt, die aber auf Europas Krater, Paris, geboren werden sollen.
Der Luftdampfer fliegt über das Land hin, von wo Kolumbus ausging, wo Cortez geboren wurde und wo Calderon Dramen in wiegenden Strophen sang. Herrliche schwarzäugige Frauen wohnen noch in den blühenden Tälern und in uralten Gesängen gedenkt man des Cid und der Alhambra.
Durch die Luft über das Meer nach Italien, wo das alte, ewige Rom lag; es ist ausgelöscht, die Campagne ist eine Wüste. Von der Peterskirche wird ein einsamer Mauerrest gezeigt, aber man zweifelt an seiner Echtheit.
Nach Griechenland, um eine Nacht in dem Luxushotel auf der Spitze des Olymps zu schlafen, dann ist man dort gewesen. Die Fahrt geht auf den Bosporus zu, um dort einige Stunden zu ruhen und die Stätte zu sehen, wo Byzanz einst lag. Ärmliche Fischer spannen ihre Netze dort, wo die Sage von den Gärten des Harems in der Zeit der Türken erzählt.
Überreste von mächtigen Städten an der breit dahinfließenden Donau, die unsere Zeit nicht kennt, werden überquert, aber hier und da – über Stätten reicher Erinnerungen, den kommenden, die die Zeit noch gebiert – hier und da senkt sich die Luftkarawane und hebt sich wieder.
Dort unten liegt Deutschland – das einmal vom dichtesten Netz von Eisenbahnen und Kanälen überspannt war, das Land, wo Luther sprach, Goethe sang und Mozart in seiner Zeit der Töne Zepter trug. Große Namen leuchteten dort in Wissenschaft und Kunst, Namen, die wir noch nicht kennen. Eines Tages Aufenthalt für Deutschland und einen Tag für den Norden, für Oerstedts und Linnés Vaterland, und für Norwegen, der alten Helden und jungen Nordmänner Land. Island wird auf dem Heimwege mitgenommen; die Geiser kochen nicht mehr, der Hekla ist erloschen, aber die Felseninsel, der Saga ewige Steintafel, steht stark mitten im brausenden Meer.
"In Europa gibt es viel zu sehen" sagt der junge Amerikaner. "Wir haben es in acht Tagen gesehen, und das läßt sich recht gut schaffen, wie der große Reisende" – ein Name wird genannt, der der kommenden Zeit angehört, "In seinem berühmten Werk, 'Europa in acht Tagen' bewiesen hat."
DAS SCHWANENNEST

Zwischen der Ostsee und der Nordsee liegt ein altes Schwanennest, das wird Dänemark genannt. Darin sind und werden Schwäne geboren, deren Name niemals sterben wird.
In grauer Vorzeit flog eine Schar von Schwänen über die Alpen hinab zu Mailands grünen Ebenen, wo gut wohnen war. Diese Schar Schwäne wurden Langobarden geheißen. Eine andere Schar, mit leuchtendem Gefieder und treuen Augen schwangen sich bis hinunter nach Byzanz. Dort ließen sie sich um den Thron des Kaisers nieder und breiteten ihre großen, weißen Schwingen wie Flügel aus, um ihn zu beschirmen. Sie erhielten den Namen Väringer.
Von Frankreichs Küsten erklang ein Angstschrei vor den blutigen Schwänen, die mit Feuer unter den Schwingen von Norden gezogen kamen, und das Volk betete: "Gott, befreie uns von den wilden Normannen!"
Auf Englands frischgrünen Wiesen am offenen Strande stand der dänische Schwan mit dreifacher Königskrone auf dem Haupte, und er streckte sein goldenes Zepter über das Land.
Die Knie beugten die Heiden an Pommerns Küste, als die dänischen Schwäne mit der Fahne des Kreuzes und gezogenem Schwerte kamen.
"Das war in lang vergangenen Tagen," sagst du.
Auch näher unserer Zeit sah man mächtige Schwäne aus dem Neste fliegen.
Es leuchtete durch die Luft, es leuchtete weit über die Länder der Welt; der Schwan teilte mit mächtigem Schwingenschlag die dämmernden Nebel und der Sternenhimmel wurde deutlicher sichtbar, es war als rücke er der Erde näher; das war der Schwan Tycho Brahe.
"Ja, damals!" sagst du, "aber jetzt in unseren Tagen." Da sahen wir Schwan auf Schwan in herrlichem Fluge dahinfliegen. Einer ließ seine Flügel über die Goldharfe hingleiten, und es klang durch den Norden. Norwegens Felsen erhoben sich höher im Sonnenlichte der Vorzeit; es sauste in Birke und Tanne; die Götter des Nordens, Helden und edle Frauen zeigten sich im tiefen, dunklen Waldesgrunde.
Wir sahen einen Schwan mit den Schwingen gegen den Marmorfelsen schlagen, daß der Felsen barst, und die im Gestein gebundenen Gestalten der Schönheit schritten in den sonnenlichten Tag hervor und die Menschen ringsum in den Ländern erhoben ihr Haupt um diese mächtigen Gestalten zu sehen.
Einen dritten Schwan sahen wir einen Gedankenfaden spannen, der nun von Land zu Land rings um die Erde reicht, so daß das Wort mit des Blitzes Geschwindigkeit durch die Länder fliegt.
Unser Herrgott hat das alte Schwanennest zwischen Ostsee und Nordsee lieb. Laß die mächtigen Vögel nur durch die Lüfte kommen, um es niederzureißen: "Das soll nicht geschehen!" Selbst die federlosen Jungen stellen sich im Kreise um des Nestes Rand, das haben wir gesehen, sie lassen sich in die junge Brust hacken, daß ihr Blut fließt, sie schlagen mit Schnabel und Klauen.
Jahrhunderte werden noch vergehen, die Schwäne fliegen vom Neste, gesehen und gehört von aller Welt, bevor die Zeit kommen wird, daß in Geist und Wahrheit gesagt werden kann: "Das ist der letzte Schwan, der letzte Sang vom Schwanenneste."
DAS HEINZELMÄNNCHEN BEI DEM KRÄMER
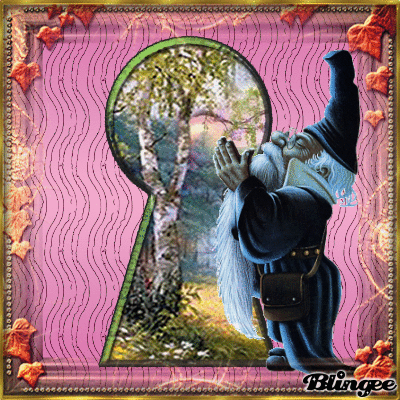
Es war einmal ein richtiger Student, der wohnte in einer Dachkammer, und ihm gehörte gar nichts; – es war aber auch einmal ein richtiger Krämer, der wohnte zu ebener Erde, und ihm gehörte das ganze Haus. Zu ihm hielt sich das Heinzelmännchen, denn beim Krämer gab es jeden Weihnachtsabend eine Schüssel voll Grützbrei mit einem großen Klumpen Butter mitten darin! Das konnte der Krämer ganz gut geben; darum blieb das Heinzelmännchen im Krämerladen, und das war sehr lehrreich.
Eines Abends trat der Student durch die Hintertür ein, um selbst Licht und Käse zu kaufen; er hatte niemand zu schicken, darum ging er selbst; er bekam, was er wünschte, bezahlte es, und der Krämer und auch dessen Frau nickten ihm einen 'guten Abend' zu; das war eine Frau, die mehr konnte als mit dem Kopfe nicken; sie hatte Rednergabe! – Der Student nickte ebenfalls, blieb aber auf einmal stehen, und zwar indem er den Bogen Papier las, in den der Käse gewickelt war. Es war ein Blatt, herausgerissen aus einem alten Buche, das eigentlich nicht hätte zerrissen werden sollen; denn es war ein Buch voller Poesie.
"Da liegt noch mehr von derselben Art!" sagte der Krämer, "ich habe einer alten Frau ein paar Kaffeebohnen für das Buch gegeben; wollen Sie mir zwei Groschen bezahlen, so sollen Sie den ganzen Rest haben."
"Ja," sagte der Student, "geben Sie mir das Buch für den Käse! Ich kann mein Butterbrot ohne Käse essen! Es wäre ja Sünde, wenn das Buch ganz und gar zerrissen werden sollte. Sie sind ein prächtiger Mann, ein praktischer Mann, aber auf Poesie verstehen Sie sich eben so wenig wie die Tonne da."
Und das war unartig gesprochen, namentlich gegen die Tonne, aber der Krämer lachte, und der Student lachte auch; es war ja nur aus Spaß gesagt. Aber das Heinzelmännchen ärgerte sich, daß man einem Krämer, der Hauswirt war und die beste Butter verkaufte, dergleichen Dinge zu sagen wagte.
In der Nacht, als der Laden geschlossen war und alle zur Ruhe gegangen waren, nur der Student nicht, trat das Heinzelmännchen hervor, ging in die Schlafstube und nahm der Hausfrau das Mundwerk weg; das brauchte sie nicht, wenn sie schlief; und wo er das einem Gegenstande in der Stube aufsetzte, bekam dieser Stimme und Rede und sprach seine Gedanken und seine Gefühle eben so gut aus wie die Hausfrau; aber nur ein Gegenstand nach dem andern konnte es benutzen, und das war eine Wohltat, sie hätten sonst durcheinander gesprochen.
Das Heinzelmännchen legte das Mundwerk auf die Tonne, in der die alten Zeitungen lagen. "Ist es wirklich wahr," fragte es, "daß Sie nicht wissen, was Poesie ist?"
"Freilich weiß ich es," antwortete die Tonne, "Poesie ist so etwas, was immer unten in den Zeitungen steht und manchmal herausgeschnitten wird! Ich möchte behaupten, ich habe mehr in mir als der Student, und ich bin doch nur eine geringe Tonne gegen den Krämer."
Und das Heinzelmännchen setzte der Kaffeemühle das Mundwerk auf, nein, wie die ging! Und es setzte es dem Butterfasse und dem Geldkasten auf; – alle waren sie derselben Ansicht wie die Tonne, und das, worüber die Mehrzahl einig ist, das muß man anerkennen.
"Jetzt werde ich's aber dem Studenten sagen!" – und mit diesen Worten stieg es leise die Hintertreppe zur Dachkammer hinauf, wo der Student wohnte. Der Student hatte noch Licht, und das Heinzelmännchen guckte durch das Schlüsselloch und sah, wie er in dem zerrissenen Buche las, das er unten im Laden geholt hatte.
Aber wie hell war es bei ihm drinnen! Aus dem Buche hervor drang ein heller Strahl, der wuchs zu einem Stamme und allmählich zu einem mächtigen Baume empor, der sich erhob und seine Zweige weit über den Studenten ausbreitete. Jedes Blatt war frisch, und jede Blume war ein schöner Mädchenkopf, einige mit Augen, dunkel und strahlend, andere mit wunderbar blauen und klaren; jede Frucht war ein glänzender Stern, und es sang und klang im Zimmer des Studenten.
Nein, eine solche Pracht hatte das kleine Heinzelmännchen noch nie erträumt, geschweige denn gesehen und vernommen. Es blieb auf den Fußspitzen stehen und guckte und guckte – bis das Licht in der Dachkammer erlosch; der Student blies es wahrscheinlich aus und ging zu Bett, aber das Heinzelmännchen blieb doch stehen, denn der Gesang ertönte noch immer sanft und herrlich als schönes Schlummerlied des Studenten, der sich zur Ruhe niedergelegt hatte.
"Hier ist es doch unvergleichlich!" sagte das Heinzelmännchen, "das hätte ich nicht erwartet! – Ich möchte bei dem Studenten bleiben." – Es sann darüber nach – und es war ein vernünftiges Männchen. Es seufzte: "Der Student hat keinen Brei!" – und darauf ging es wieder zum Krämer hinab; und es war sehr gut, daß es endlich dahin zurückkehrte, denn die Tonne hatte das Mundwerk der Frau fast ganz verbraucht, es hatte nämlich schon alles, was in seinem Innern wohnte, von einer Seite ausgesprochen und stand gerade im Begriff, sich umzukehren, um das gleiche von der andern Seite zum besten zu geben, als das Heinzelmännchen eintrat und das Mundwerk wieder der Krämerin anlegte; aber der ganze Laden, vom Geldkasten bis auf das Streichholz herab, bildete von der Zeit an seine Ansichten nach der Tonne, und alle zollten ihr dermaßen Achtung und trauten ihr soviel zu, daß sie fest glaubten, wenn später der Krämer die Kunst- und Theaterkritiken aus seiner Zeitung abends vorlas, das käme aus der Tonne.
Das Heinzelmännchen saß nicht länger ruhig, der Weisheit und dem vielen Verstande da unten lauschend; nein, sobald das Licht des Abends von der Dachkammer herabschimmerte, wurde ihm zumute, als wären die Strahlen starke Ankertaue, die es hinauf zogen, und es mußte hin und durchs Schlüsselloch gucken. Da umbrauste es ein Gefühl der Größe, wie wir es empfinden an dem ewig rollenden Meer, wenn Gott im Sturme darüber hinfährt, und es brach in Tränen aus. Es wußte selbst nicht, warum es weinte, aber ein eigenes, gar wohltuendes Gefühl mischte sich mit seinen Tränen! – Wie wunderlich herrlich mußte es sein, mit dem Studenten zusammen unter jenem Baume zu sitzen; allein das konnte nicht geschehen, und darum war es zufrieden und froh an seinem Schlüsselloch. Und als der Herbstwind durch die Bodenluke herein blies, stand das Heinzelmännchen noch immer abends auf dem kalten Flur. Es war bitterlich kalt, doch das empfand der Kleine erst, wenn das Licht in der Dachkammer erlosch und die Töne im Walde dahin starben. Hu, dann fror es – und es kroch wieder hinab in seinen warmen Winkel; da war es gemütlich und behaglich! Und als Weihnachten herankam und mit ihm der Brei mit dem großen Klumpen Butter – ja, da war der Krämer Meister.
Aber mitten in der Nacht erwachte das Heinzelmännchen durch einen schrecklichen Lärm; die Leute schlugen mit Gewalt gegen die Fensterscheiben; der Nachtwächter tutete, eine große Feuersbrunst war ausgebrochen; die ganze Stadt stand in Flammen. War es im Hause selbst oder bei den Nachbarn? Wo war es? Das Entsetzen war groß! Die Krämerfrau wurde dermaßen verdutzt, daß sie ihre goldenen Ohrringe aus den Ohren löste und sie in die Tasche steckte, um doch etwas zu retten; der Krämer rannte nach seinen Staatspapieren und die Magd nach ihrem schwarzseidenen Umhang – denn einen solchen erlaubten ihr ihre Mittel! Jeder wollte das Beste retten; und das wollte das Heinzelmännchen auch. In wenigen Sprüngen eilte es die Treppe hinan und in die Kammer des Studenten hinein, der ganz ruhig am offenen Fenster stand und das Feuer betrachtete, das im Hause des Nachbars gegenüber wütete. Das Heinzelmännchen ergriff das auf dem Tisch liegende Buch, steckte es in seine rote Mütze und umklammerte diese mit beiden Händen; der beste Schatz des Hauses war gerettet, und nun eilte es auf und davon, ganz auf das Dach hinaus, auf den Schornstein. Da saß es, beleuchtet von den Flammen des gegenüber brennenden Hauses, beide Hände fest um seine rote Mütze gepreßt, in der der Schatz lag, und jetzt erkannte es die wahre Neigung seines Herzens, wußte, wem es eigentlich gehörte. – Allein als das Feuer gelöscht und das Heinzelmännchen wieder zur Besinnung gekommen war – ja!...
"Ich will mich zwischen beide teilen," sagte es, "dann hat jedes von mir etwas, denn das geht doch nicht, ich kann den Krämer nicht ganz aufgeben, wegen des Grützbreis."
Und das war ganz menschlich gesprochen! Und wenn wir es uns ehrlich eingestehen, dann müssen wir zugeben, daß es nun einmal so in der Welt ist. Wir andern gehen auch zum Krämer – des Grützbreis wegen.
DER GARTEN DES PARADIESES
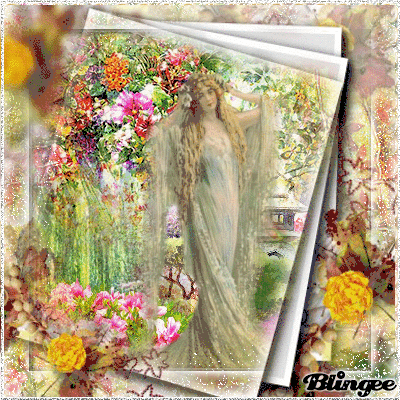
Es war einmal ein Königssohn; Niemand hatte so viele und schöne Bücher wie er; Alles, was in dieser Welt geschehen, konnte, er darin lesen und die Abbildungen in prächtigen Kupferstichen erblicken. Von jedem Volke und jedem Lande konnte er Auskunft erhalten; aber wo der Garten des Paradieses zu finden sei, davon stand kein Wort darin; und der, gerade der war es, an den er am meisten dachte.
Seine Großmutter hatte ihm erzählt, als er noch ganz klein war, aber anfangen sollte, in die Schule zu gehen, daß jede Blume im Garten des Paradieses der süßeste Kuchen und die Staubfäden der feinste Wein wären; auf der einen ständen Geschichte, auf der andern Geographie oder Tabellen; man brauche nur Kuchen zu essen, so könne man seine Lektion; je mehr man speise, um so mehr Geschichte, Geographie und Tabellen habe man inne.
Das glaubte er damals. Aber schon, als er ein größerer Knabe wurde, mehr lernte und klüger war, begriff er wohl, daß eine ganz andere Herrlichkeit im Garten des Paradieses vorhanden sein müsse.
"O, weshalb pflückte doch Eva vom Baume der Erkenntnis? Weshalb speiste Adam von der verbotenen Frucht? Das sollte ich gewesen sein, so wäre es nicht geschehen! Nie würde die Sünde in die Welt gekommen sein!"
Das sagte er damals, und das sagte er noch, als er siebenzehn Jahr alt war. Der Garten des Paradieses erfüllte alle seine Sinne.
Eines Tages ging er im Walde; er ging allein, denn das war sein größtes Vergnügen.
Der Abend brach an, die Wolken zogen sich zusammen; es entstand ein Regenwetter, als ob der ganze Himmel eine einzige Schleuse sei, aus der Wasser stürze; es war so dunkel, wie es sonst des Nachts nur im tiefsten Brunnen ist. Bald glitt er in dem nassen Grase aus, bald fiel er über die nackten Steine, welche aus dem Felsengrunde hervorragten. Alles triefte von Wasser; es war nicht ein trockener Faden an dem armen Prinzen. Er mußte über große Steinblöcke klettern, wo das Wasser aus dem hohen Moose quoll. Er war nahe daran, ohnmächtig zu werden. Da hörte er ein sonderbares Sausen, und vor sich sah er eine große erleuchtete Höhle. Mitten in derselben brannte ein Feuer, so daß man einen Hirsch daran braten konnte. Und das geschah auch. Der prächtigste Hirsch mit seinem hohen Geweihe war auf einen Spieß gesteckt und wurde langsam zwischen zwei abgehauenen Fichtenstämmen herumgedreht. Eine ältliche Frau, groß und stark, als wäre sie eine verkleidete Mannsperson, saß am Feuer und warf ein Stück Holz nach dem andern hinein.
"Komm nur näher!" sagte sie; "setze Dich an das Feuer, damit Deine Kleider trocknen." "Hier zieht es sehr!" sagte der Prinz und setzte sich auf den Fußboden nieder.
"Das wird noch ärger werden, wenn meine Söhne nach Hause kommen!" erwiederte die Frau. "Du bist hier in der Höhle der Winde; meine Söhne sind die vier Winde der Welt; kannst Du das verstehen?"
"Wo sind Deine Söhne?" fragte der Prinz.
"Ja, es ist schwer zu antworten, wenn man dumm fragt," sagte die Frau. "Meine Söhne treiben es auf eigene Hand; sie spielen Federball mit den Wolken dort oben im Königssaal!" Und dabei zeigte sie in die Höhe hinauf.
"Ach so!" sagte der Prinz. "Ihr sprecht übrigens ziemlich barsch und seid nicht so mild, wie die Frauenzimmer, die ich sonst um mich habe!"
"Ja, die haben wohl nichts Anderes zu tun! Ich muß hart sein, wenn ich meine Knaben in Respekt erhalten will; aber das kann ich, obgleich sie Trotzköpfe sind. Siehst Du die vier Säcke, die an der Wand hängen? Vor denen fürchten sie sich ebenso, wie Du früher vor der Rute hinterm Spiegel. Ich kann die Knaben zusammen biegen, sag' ich Dir, und dann stecke ich sie in den Sack; da machen wir keine Umstände! Da sitzen sie und dürfen nicht eher wieder herumstreifen, bis ich es für gut erachte. Aber da haben wir den Einen!"
Es war der Nordwind, der mit einer eisigen Kälte hereintrat; große Hagelkörner hüpften auf dem Fußboden hin, und Schneeflocken stöberten umher. Er war in Bärenfellbeinkleidern und Jacke; eine Mütze von Seehundsfell hing über die Ohren herab; lange Eiszapfen hingen ihm am Barte; und ein Hagelkorn nach dem andern glitt ihm vom Jackenkragen herunter.
"Gehen Sie nicht gleich an das Feuer!" sagte der Prinz; "Sie könnten sonst sich leicht Gesicht und Hände erfrieren!"
"Erfrieren?" sagte der Nordwind und lachte laut auf. "Kälte? Das ist gerade mein größtes Vergnügen! Was bist Du übrigens für ein Schneiderlein! Wie kommst Du in die Höhle der Winde?"
"Er ist mein Gast," sagte die Alte; "und bist Du mit dieser Erklärung nicht zufrieden, so kannst Du in den Sack kommen! - Verstehst Du mich nun?"
Sieh, das half; und der Nordwind erzählte, von wannen er kam und wo er fast einen ganzen Monat gewesen.
"Vom Polarmeere komme ich," sagte er; "ich bin auf dem Bäreneilande mit den russischen Wallroßjägern gewesen. Ich saß und schlief auf dem Steuer, als sie vom Nordcap wegsegelten; weil ich mitunter erwachte, flog mir der Sturmvogel um die Beine. Das ist ein komischer Vogel! Der macht einen raschen Schlag mit den Flügeln, hält sie darauf unbeweglich ausgestreckt und hat dann Fahrt genug."
"Mache es nur nicht so weitläufig!" sagte die Mutter der Winde. "Und so kamst Du dann nach dem Bäreneilande?"
"Dort ist es schön! Da ist ein Fußboden zum Tanzen, flach, wie ein Teller! Halb aufgetauter Schnee mit ein wenig Moos, scharfe Steine und Gerippe von Wallrossen und Eisbären lagen da umher, sowie auch Riesenarme und Beine mit verschimmeltem Grün. Man möchte glauben, daß die Sonne nie darauf geschienen hätte. Ich blies ein wenig in den Nebel, damit man den Schuppen sehen konnte; das war ein Haus, von Wrackholz erbaut und mit Wallroßhäuten überzogen; die Fleischseite war nach außen gekehrt; sie war voller Rot und Grün; auf dem Dache saß ein lebendiger Eisbär und brummte. Ich ging nach dem Strande, sah nach den Vogelnestern, erblickte die nackten Jungen, die schrien und den Schnabel aufsperrten; da blies ich in die tausend Kehlen hinab, und sie lernten den Schnabel schließen. Weiterhin wälzten sich die Wallrosse, wie lebendige Eingeweide oder Riesenmaden mit Schweineköpfen und ellenlangen Zähnen!" -
"Du erzählst gut, mein Sohn!" sagte die Mutter. "Das Wasser läuft mir im Munde zusammen, wenn ich Dich anhöre!"
"Dann ging das Jagen an! Die Harpune wurde in die Brust des Wallrosses geworfen, sodaß der dampfende Blutstrahl, einem Springbrunnen gleich, über das Eis spritzte. Da gedachte ich auch meines Spieles! Ich blies auf und ließ meine Segler, die turmhohen Eisberge, die Boote einklemmen. Hui! wie man pfiff und wie man schrie; aber ich pfiff lauter! Die toten Wallroßkörper, Kisten und Tauwerk mußten sie auf das Eis auspacken; ich schüttelte die Schneeflocken über sie und ließ sie in den eingeklemmten Fahrzeugen mit ihrem Fang nach Süden treiben, um dort Salzwasser zu kosten. Sie kommen nie mehr nach dem Bäreneiland!"
"So hast Du ja Böses getan!" sagte die Mutter der Winde.
"Was ich Gutes getan habe, mögen die Andern erzählen!" sagte er. "Aber da haben wir meinen Bruder aus Westen; ihn mag ich von Allen am besten leiden; er schmeckt nach der See und führt eine herrliche Kälte mit sich!"
"Ist das der kleine Zephyr?" fragte der Prinz.
"Ja wohl ist das Zephyr!" sagte die Alte. "Aber er ist doch nicht so klein. Vor Jahren war es ein hübscher Knabe, aber das ist nun vorbei!"
Er sah aus wie ein wilder Mann, aber er hatte einen Fallhut auf, um nicht zu Schaden zu kommen. In der Hand hielt er eine Mahagonikeule, in den amerikanischen Mahagoniwäldern gehauen. Das war nichts Geringes!
"Wo kommst Du her?" fragte die Mutter.
"Aus den Waldwüsten," sagte er, "wo die dornigen Lianen eine Hecke zwischen jedem Baum bilden, wo die Wasserschlange in dem nassen Grase liegt und die Menschen unnötig zu sein scheinen!"
"Was triebst Du dort?"
"Ich sah in den tiefen Fluß, sah, wie er von den Felsen herabstürzte, Staub wurde und gegen die Wolken flog, um den Regenbogen zu tragen. Ich sah den wilden Büffel im Flusse schwimmen, aber der Strom riß ihn mit sich fort. Er trieb mit dem Schwarm der wilden Enten, welche in die Höhe flogen, wo das Wasser stürzte. Der Büffel mußte hinunter; das gefiel mir, und ich blies einen Sturm, so daß uralte Bäume segelten und zu Spänen wurden."
"Und weiter hast Du nichts getan?" fragte die Alte.
"Ich habe in den Savannen Purzelbäume geschossen; ich habe die wilden Pferde gestreichelt und Kokosnüsse geschüttelt. Ja, ja, ich habe Geschichten zu erzählen! Aber man muß nicht Alles sagen, was man weiß. Das weißt Du wohl, Alte!" und er küßte seine Mutter, so daß sie fast hintenüber gefallen wäre. Es war ein schrecklich wilder Bube!
Nun kam der Südwind mit einem Turban und einem fliegenden Beduinenmantel.
"Hier ist es recht kalt, hier draußen!" sagte er und warf Holz zum Feuer. "Man kann merken, daß der Nordwind zuerst gekommen ist!"
"Es ist hier so heiß, daß man einen Eisbär braten kann!" sagte der Nordwind.
"Du bist selbst ein Eisbär!" antwortete der Südwind.
"Wollt Ihr in den Sack gesteckt werden?" fragte die Alte. - Setze Dich auf den Stein dort und erzähle, wo Du gewesen bist."
"In Afrika, Mutter!" erwiederte er. "Ich war mit den Hottentotten auf der Löwenjagd im Lande der Kaffern. Da wächst Gras in den Ebenen, grün wie eine Olive! Da lief der Straus mit mir um die Wette, aber ich bin doch noch schneller. Ich kam nach der Wüste zu dem gelben Sande; da sieht es aus, wie auf dem Grunde des Meeres. Ich traf eine Karavane; sie schlachteten ihr letztes Kamel, um Trinkwasser zu erhalten; aber es war nur wenig, was sie bekamen. Die Sonne brannte von oben und der Sand von unten. Die ausgedehnte Wüste hatte keine Grenze. Da wälzte ich mich in dem feinen, losen Sand und wirbelte ihn in große Säulen auf. Das war ein Tanz! Du hättest sehen sollen, wie mutlos das Dromedar dastand, und der Kaufmann zog den Kaftan über den Kopf. Er warf sich vor mir nieder wie vor Allah, seinem Gott. Nun sind sie begraben; es steht eine Pyramide von Sand über ihnen Allen. Wenn ich die einmal fortblase, dann wird die Sonne die weißen Knochen bleichen; da können die Reisenden sehen, daß dort früher Menschen gewesen sind. Sonst wird man das in der Wüste nicht glauben!"
"Du hast also nur Böses getan!" sagte die Mutter. "Marsch in den Sack!" und ehe er es merkte, hatte sie den Südwind um den Leib gefaßt und in den Sack gesteckt. Er wälzte sich rings umher auf dem Fußboden, aber sie setzte sich darauf und da mußte er stille liegen.
"Das sind muntere Knaben, die sie hat!" sagte der Prinz.
"Ja wohl," antwortete sie; "und ich weiß sie zu züchtigen. Da haben wir den vierten!"
Das war der Ostwind, der war wie ein Chinese gekleidet.
"Ach! kommst Du von jener Gegend?" sagte die Mutter. "Ich glaubte, Du wärest im Garten des Paradieses gewesen."
"Dahin fliege ich erst morgen!" sagte der Ostwind. "Morgen sind es hundert Jahre, seitdem ich dort war! Ich komme jetzt aus China, wo ich um den Porzellanturm tanzte, daß alle Glocken klingelten. Auf der Straße bekamen die Beamten Prügel; das Bambusrohr wurde auf ihren Schultern zerschlagen, und das waren Leute vom ersten bis zum neunten Grade. Sie schrien: ""Vielen Dank, mein väterlicher Wohltäter!"" Aber es kam ihnen nicht von Herzen, und ich klingelte mit den Glocken und sang: Tsing, tsang, tsu!"
"Du bist mutwillig!" sagte die Alte. "Es ist gut, daß Du morgen in den Garten des Paradieses kommst; das trägt immer zu Deiner Bildung bei. Trinke dann tüchtig aus der Weisheitsquelle und nimm eine kleine Flasche voll für mich mit nach Hause!"
"Das werde ich tun!" sagte der Ostwind. "Aber weshalb hast Du meinen Bruder vom Süden in den Sack gesteckt? Heraus mit ihm! Er soll mir vom Vogel Phönix erzählen; davon will die Prinzessin im Garten des Paradieses stets hören, wenn ich jedes hundertste Jahr meinen Besuch abstatte. Mache den Sack auf, dann bist Du meine süßeste Mutter, und ich schenke Dir zwei Taschen voll Tee, so grün und frisch, wie ich ihn an Ort und Stelle gepflückt habe!"
"Nun, des Tees halber und weil Du mein Herzensjunge bist, will ich den Sack öffnen!" Das tat sie, und der Südwind kroch heraus; aber er sah ganz niedergeschlagen aus, weil der fremde Prinz es gesehen hatte.
"Da hast Du ein Palmblatt für die Prinzessin!" sagte der Südwind. "Dieses Blatt hat der alte Vogel Phönix, der einzige, der in der Welt war, mir gegeben! Er hat mit seinem Schnabel seine ganze Lebensbeschreibung, die hundert Jahre, die er lebte, hineingeritzt. Nun kann sie es selbst lesen, wie der Vogel Phönix sein Nest in Brand steckte und darin saß und verbrannte, gleich der Frau eines Hindu. Wie knisterten doch die trockenen Zweige! Es war ein Rauch und ein Dampf! Zuletzt schlug Alles in Flammen auf; der alte Vogel Phönix wurde zu Asche; aber sein Ei lag glühend rot im Feuer; es barst mit einem großen Knall, und das Junge flog heraus; nun ist dieses Regent über alle Vögel und der einzige Vogel Phönix in der Welt. Er hat in das Palmblatt, welches ich Dir gab, ein Loch gebissen: das ist sein Gruß an die Prinzessin!"
"Laßt uns nun etwas essen!" sagte die Mutter der Winde. Und so setzten sie sich Alle heran, um von dem gebratenen Hirsche zu speisen; der Prinz saß zur Seite des Ostwindes; deshalb wurden sie bald gute Freunde.
"Höre, sage mir einmal," sagte der Prinz, "was ist das für eine Prinzessin, von der hier so viel die Rede ist, und wo liegt der Garten des Paradieses?"
"Ho, ho!" sagte der Ostwind; "willst Du dahin? Ja, dann fliege morgen mit mir! Aber das muß ich Dir übrigens sagen: dort ist kein Mensch seit Adam's und Eva's Zeit gewesen. Die kennst Du ja wohl aus Deiner Bibelgeschichte?"
"Ja wohl!" sagte der Prinz.
"Damals, als sie verjagt wurden, versank der Garten des Paradieses in die Erde; aber er behielt seinen warmen Sonnenschein, seine milde Luft und all' seine Herrlichkeit. Die Feenkönigin wohnt darin; da liegt die Insel der Glückseligkeit, wohin der Tod nie kommt, wo es herrlich ist! Setze Dich morgen auf meinen Rücken, dann werde ich Dich mitnehmen; ich denke, es wird sich wohl tun lassen. Aber nun mußt Du nicht mehr sprechen, denn ich will schlafen!"
Und dann schliefen sie alle samt.
In der frühen Morgenstunde erwachte der Prinz und war nicht wenig erstaunt, sich schon hoch über den Wolken zu finden. Er saß auf dem Rücken des Ostwindes, der ihn noch treulich hielt; sie waren so hoch in der Luft, daß Wälder und Felder, Flüsse und Seen sich wie auf einer illuminierten Landkarte darstellten.
"Guten Morgen!" sagte der Ostwind. "Du könntest übrigens füglich noch ein bischen schlafen, denn es ist nicht viel auf dem flachen Lande unter uns zu sehen, ausgenommen Du hättest Lust, die Kirchen zu zählen! Die stehen gleich Kreidepunkten auf dem grünen Brett." Das waren Felder und Wiesen, was er das grüne Brett nannte.
"Es war unartig, daß ich Deiner Mutter und Deinen Brüdern nicht Lebewohl gesagt habe!" meinte der Prinz.
"Wenn man schläft, ist man entschuldigt!" sagte der Ostwind. Und darauf flogen sie noch rascher von dannen. Man konnte es in den Gipfeln der Bäume hören, denn wenn sie darüber hinfuhren, rasselten alle Zweige und Blätter; man konnte es auf dem Meere und auf den Seen hören, denn wo sie flogen, stiegen die Wogen höher, und die großen Schiffe neigten sich tief in das Wasser, gleich schwimmenden Schwänen.
Gegen Abend, als es dunkel wurde, sahen die großen Städte ergötzlich aus; die Lichter brannten dort unten, bald hier, bald da; es war gerade, als wenn man ein Stück Papier angebrannt hat und alle die kleinen Feuerfunken sieht, wie einer nach dem andern verschwindet. Und der Prinz klatschte in die Hände; aber der Ostwind bat ihn, das sein zu lassen und sich lieber fest zu halten; sonst könnte er leicht hinunter fallen und an einer Kirchturmspitze hängen bleiben.
Der Adler in den schwarzen Wäldern flog zwar leicht, doch der Ostwind flog noch leichter. Der Kosak auf seinem kleinen Pferde jagte über die Ebenen davon, doch der Prinz jagte noch schneller.
"Nun kannst Du den Himalaya sehen!" sagte de Ostwind. "Das ist der höchste Berg in Asien; nun werden wir bald nach dem Garten des Paradieses gelangen!" Dann wendeten sie sich mehr südlich, und bald duftete es dort von Gewürzen und Blumen. Feigen und Granatäpfel wuchsen wild, und die wilde Weinranke hatte blaue und rote Trauben. Hier ließen sich Beide nieder und streckten sich in das weiche Gras, wo die Blumen dem Winde zunickten, als wollten sie sagen: "Willkommen!"
"Sind wir nun im Garten des Paradieses?" fragte der Prinz
"Nein, bewahre!" erwiederte der Ostwind. "Aber wir werden bald dorthin kommen. Siehst Du die Felsenmauer dort und die weite Höhle, wo die Weinranken gleich einer großen, grünen Gardine hängen? Da hindurch werden wir hineingelangen! Wickle Dich in Deinen Mantel; hier brennt die Sonne, aber einenSchritt weiter, und es ist eisig kalt. Der Vogel, welcher an der Höhle vorbeistreift, hat den einen Flügel hier draußen in dem warmen Sommer und den andern drinnen in dem kalten Winter!"
"So, das ist also der Weg zum Garten des Paradieses?" fragte der Prinz.
Nun gingen sie in die Höhle hinein. Hu, wie war es dort eisig kalt! Aber es währte doch nicht lange. Der Ostwind breitete seine Flügel aus, und sie leuchteten gleich dem hellsten Feuer. Nein, welche Höhle! Die großen Steinblöcke, von denen das Wasser träufelte, hingen über ihnen in den wunderbarsten Gestalten; bald war es da so enge, daß sie auf Händen und Füßen kriechen mußten, bald so hoch und ausgedehnt, wie in der freien Luft. Es sah aus, wie Grabkapellen mit stummen Orgelpfeifen und versteinerten Orgeln.
"Wir gehen wohl den Weg des Todes zum Garten des Paradieses?" fragte der Prinz. Aber der Ostwind antwortete keine Silbe, zeigte vorwärts, und das schönste blaue Licht strahlte ihnen entgegen. Die Steinblöcke über ihnen wurden mehr und mehr ein Nebel, der zuletzt wie eine weiße Wolke im Mondschein aussah. Nun waren sie in der herrlichsten milden Luft; so frisch wie auf den Bergen, so duftend wie bei den Rosen des Tales. Da strömte ein Fluß so klar wie die Luft selbst; und die Fische waren wie Silber und Gold; purpurrote Aale, die bei jeder Bewegung blaue Feuerfunken sprühten, spielten unten im Wasser; und die breiten Nixenblumenblätter hatten des Regenbogens Farben; die Blume selbst war eine rotgelbe, brennende Flamme, der das Wasser Nahrung gab, gleichwie das Oel die Lampe beständig am Brennen erhält; eine feste Brücke von Marmor, aber so künstlich und fein ausgeschnitten, als wäre sie von Spitzen und Glasperlen gemacht, führte über das Wasser zur Insel der Glückseligkeit, wo der Garten des Paradieses blühte.
Der Ostwind nahm den Prinzen auf seine Arme und trug ihn hinüber. Da sangen die Blumen und Blätter die schönsten Lieder aus seiner Kindheit, aber so schwellend lieblich, wie keine menschliche Stimme hier singen kann.
Waren es Palmbäume oder riesengroße Wasserpflanzen, die hier wuchsen? So saftige und große Bäume hatte der Prinz früher nie gesehen; in langen Girlanden hingen da die wunderlichsten Schlingpflanzen, wie man sie nur mit Farben und Gold auf dem Rande alter Heiligenbücher, oder durch die Anfangsbuchstaben geschlungen, abgebildet findet. Das waren die seltsamsten Zusammensetzungen von Vögeln, Blumen und Schnörkeln. Dicht daneben im Grase stand ein Schwarm Pfaue mit entfalteten, strahlenden Schweifen. Ja, das war wirklich so! Als aber der Prinz daran rührte, merkte er, daß es keine Tiere, sondern Pflanzen waren; es waren die großen Kletten, die hier gleich des Pfaues herrlichem Schweife strahlten. Der Löwe und der Tiger sprangen gleich geschmeidigen Katzen zwischen den grünen Hecken hin, die wie die Blumen des Olivenbaumes dufteten; und der Löwe und der Tiger waren zahm. Die wilde Waldtaube glänzte wie die schönste Perle und schlug mit ihren Flügeln den Löwen an die Mähne; und die Antilope, die sonst so scheu ist, stand daneben und nickte mit dem Kopfe, als ob sie auch mitspielen wollte.
Nun kam die Fee des Paradieses; ihre Kleider strahlten wie die Sonne, und ihr Antlitz war heiter, wie das einer frohen Mutter, wenn sie recht glücklich über ihr Kind ist. Sie war so jung und schön, und die hübschesten Mädchen, jede mit einem leuchtenden Stern im Haar, folgten ihr. Der Ostwind gab ihr das beschriebene Blatt vom Vogel Phönix und ihre Augen funkelten vor Freude. Sie nahm den Prinzen bei der Hand und führte ihn in ihr Schloß hinein, wo die Wände Farben hatten wie das prächtigste Tulpenblatt, wenn es gegen die Sonne gehalten wird. Die Decke selbst war eine große strahlende Blume, und je mehr man zu derselben hinauf sah, desto tiefer erschien ihr Kelch.
Der Prinz trat an das Fenster und blickte durch eine der Scheiben: da sah er den Baum der Erkenntniß mit der Schlange, und Adam und Eva standen dicht dabei. "Sind die nicht verjagt?" fragte er. Und die Fee lächelte und erklärte ihm, daß die Zeit auf jeder Scheibe ihr Bild eingebrannt habe; aber nicht, wie man es zu sehen gewohnt: nein, es war Leben darin; die Blätter der Bäume bewegten sich; die Menschen kamen und gingen, wie in einem Spiegelbilde. Und er sah durch eine andere Scheibe, und da war Jacob's Traum, wo die Leiter gerade bis in den Himmel ging; und die Engel mit großen Schwingen schwebten auf und nieder. Ja, Alles, was in dieser Welt geschehen war, lebte und bewegte sich in den Glasscheiben; solche künstliche Gemälde konnte nur die Zeit einbrennen.
Die Fee lächelte und führte ihn in einen großen, hohen Saal, dessen Wände transparent erschienen. Hier waren Portraits, das eine Gesicht immer schöner als das andere. Man sah Millionen Glücklicher, die lächelten und sangen, so daß es in eine Melodie zusammen floss; die Aller obersten waren so klein, daß sie kleiner erschienen als die kleinste Rosenknospe, wenn sie wie ein Punkt auf das Papier gezeichnet wird. Und mitten im Saale stand ein großer Baum mit hängenden, üppigen Zweigen; goldene Äpfel, große und kleine, hingen wie Apfelsinen zwischen den grünen Blättern. Das war der Baum der Erkenntniß, von dessen Frucht Adam und Eva gegessen hatten. Von jedem Blatte tröpfelte ein glänzender, roter Tautropfen; es war als ob der Baum blutige Tränen weinte.
"Laßt uns nun in das Boot steigen!" sagte die Fee; "da wollen wir Erfrischungen auf dem schwellenden Wasser genießen! Das Boot schaukelt und kommt nicht von der Stelle, aber alle Länder der Welt gleiten an unsern Augen vorüber." Und es war wunderbar anzusehen, wie sich die ganze Küste bewegte. Da kamen die hohen schneebedeckten Alpen mit Wolken und schwarzen Tannen; das Horn erklang so tief wehmütig, und der Hirte jodelte so hübsch im Tale. Dann bogen die Bananenbäume ihre langen, hängenden Zweige über das Boot nieder; kohlschwarze Schwäne schwammen auf dem Wasser, und die seltsamsten Tiere und Blumen zeigten sich am Ufer: das war Neuholland, der fünfte Weltteil, der mit einer Aussicht auf die blauen Berge vorbeiglitt. Man hörte den Gesang der Priester und sah den Tanz der Wilden zum Schall der Trommeln und der knöchernen Trompeten. Ägyptens Pyramiden, die bis in die Wolken ragten, umgestürzte Säulen und Sphinxe, halb im Sande begraben, segelten ebenfalls vorbei. Die Nordlichter leuchteten über ausgebrannte Vulkane des Nordens: das war ein Feuerwerk, was Niemand nachmachen konnte. Der Prinz war so glückselig; ja, er sah noch hundert Mal mehr, als was wir hier erzählen.
"Und ich kann immer hier bleiben?" fragte er.
"Das kommt auf Dich selbst an!" erwiederte die Fee. "Wenn Du nicht, wie Adam, Dich gelüsten läßt, das Verbotene zu tun, so kannst Du immer hier bleiben!"
"Ich werde die Äpfel auf dem Erkenntnißbaume nicht anrühren!" sagte der Prinz. "Hier sind ja Tausende von Früchten, ebenso schön wie die!"
"Prüfe Dich selbst, und bist Du nicht stark genug, so gehe mit dem Ostwinde, der Dich herbrachte. Er fliegt nun zurück und läßt sich vor hundert Jahren hier nicht wieder blicken; die Zeit wird an diesem Ort für Dich vergehen, als wären es nur hundert Stunden; aber es ist eine lange Zeit für die Versuchung und Sünde. Jeden Abend, wenn ich von Dir gehe, muß ich Dir zurufen: Komm mit! Ich muß Dir mit der Hand winken, aber bleibe zurück. Gehe nicht mit, denn sonst wird mit jedem Schritte Deine Sehnsucht größer werden. Du kommst dann in den Saal, wo der Baum der Erkenntniß wächst; ich schlafe unter seinen duftenden, hängenden Zweigen; Du wirst Dich über mich beugen, und ich muß lächeln; drückst Du aber einen Kuß auf meinen Mund, so sinkt das Paradies tief in die Erde, und es ist für Dich verloren. Der Wüste scharfer Wind wird Dich umsausen, der kalte Regen von Deinem Haupte träufeln. Kummer und Drangsal wird Dein Erbteil."
"Ich bleibe hier!" sagte der Prinz. Und der Ostwind küßte ihn auf die Stirn und sagte: "Sei stark, dann treffen wir uns nach hundert Jahren wieder! Lebe wohl! Lebe wohl!" Und der Ostwind breitete seine großen Flügel aus; sie glänzten wie das Wetterleuchten in der Erntezeit oder wie das Nordlicht im kalten Winter.
"Lebe wohl! Lebe wohl!" ertönte es von Blumen und Bäumen. Störche und Pelikane flogen wie flatternde Bänder in Reihen und geleiteten ihn bis zur Grenze des Gartens.
"Nun beginnen wir unsere Tänze!" sagte die Fee. "Zum Schlusse, wo ich mit Dir tanze, wirst Du, in dem die Sonne sinkt, sehen, daß ich Dir winke; Du wirst mich Dir zurufen hören: Komm mit! Aber tue es nicht! Hundert Jahre lang muß ich es jeden Abend wiederholen; jedesmal, wenn die Zeit vorbei ist, gewinnst Du mehr Kraft; zuletzt denkst Du gar nicht mehr daran. Heute Abend ist es zum ersten Mal; nun hab' ich Dich gewarnt.
Und die Fee führte ihn in einen großen Saal von weißen durchsichtigen Lilien; die gelben Staubfäden in jeder Blume bildeten eine kleine Goldharfe, die mit Saitenlaut und Flötenton erklang. Die schönsten Mädchen, schwebend und schlank, in wogenden Flor gekleidet, sodaß man die reizenden Glieder sah, schwebten im Tanze und sangen, wie herrlich es sei, zu leben, und daß sie nie sterben würden, und daß der Garten des Paradieses ewig blühen würde.
Und die Sonne ging unter; der ganze Himmel wurde ein Gold, welches den Lilien den Schein der herrlichsten Rosen gab; und der Prinz trank von dem schäumenden Wein, welchen die Mädchen ihm reichten, und fühlte eine Glückseligkeit, wie nie zuvor. Er sah, wie der Hintergrund des Saales sich öffnete, und der Baum der Erkenntniß stand in einem Glanze, der seine Augen blendete; der Gesang dort war weich und lieblich, wie seiner Mutter Stimme, und es war, als ob sie sänge: "Mein Kind! mein geliebtes Kind!"
Da winkte die Fee und rief so liebevoll: "Komm mit! Komm mit!" Und er stürzte ihr entgegen, vergaß sein Versprechen, vergaß es schon den ersten Abend, und sie winkte und lächelte. Der Duft, der gewürzige Duft rings umher wurde stärker; die Harfen ertönten weit lieblicher, und es war, als ob die Millionen lächelnder Köpfe im Saale, wo der Baum wuchs, nickten und sängen: "Alles muß man kennen! Der Mensch ist der Herr der Erde!" Und es waren keine blutigen Tränen mehr, welche von den Blättern des Erkenntnißbaumes fielen: es waren rote, funkelnde Sterne, die er zu erblicken glaubte. "Komm mit! Komm mit!" lauteten die bebenden Töne, und bei jedem Schritte brannten des Prinzen Wangen heißer, bewegte sein Blut sich rascher. "Ich muß!" sagte er. "Es ist ja keine Sünde, kann keine sein! Weshalb nicht der Schönheit und der Freude folgen? Sie schlafen sehen will ich; es ist ja nichts verloren, wenn ich es nur unterlasse, sie zu küssen; und küssen werde ich sie nicht; ich bin stark; ich habe einen festen Willen!"
Und die Fee warf ihren strahlenden Anzug ab, bog die Zweige zurück, und nach einem Augenblick war sie darin verborgen.
"Noch habe ich nicht gesündigt," sagte der Prinz, "und will es auch nicht!" Und dann bog er die Zweige zur Seite: da schlief sie bereits; schön, wie nur die Fee im Garten des Paradieses es sein kann. Sie lächelte im Traume, er bog sich über sie nieder und sah zwischen ihren Augenlidern Tränen beben!
"Weinst Du über mich?" flüsterte er. "Weine nicht, Du herrliches Weib! Nun begreife ich erst des Paradieses Glück! Es durchströmt mein Blut, meine Gedanken; die Kraft des Cherubs und des ewigen Lebens fühle ich in meinem irdischen Körper! Möge es ewig Nacht für mich werden: eine Minute, wie diese, ist Reichtum genug!" Und er küßte die Tränen aus ihren Augen; sein Mund berührte den ihrigen. -
Da krachte ein Donnerschlag, so tief und schrecklich, wie Niemand ihn je gehört. Und Alles stürzte zusammen; die schöne Fee, das blühende Paradies sank, sank tiefer und tiefer. Der Prinz sah es in die schwarze Nacht versinken; wie ein kleiner leuchtender Stern strahlte es aus weiter Ferne; Todeskälte durchschauerte seinen Körper; er schloß seine Augen und lag lange wie tot.
Der kalte Regen fiel ihm in das Gesicht, der scharfe Wind blies um sein Haupt: da kehrten seine Sinne zurück. "Was habe ich getan!" seufzte er. "Ich habe gesündigt, wie Adam - gesündigt, so daß das Paradies tief versunken ist!" Und er öffnete seine Augen; den Stern in der Ferne, den Stern, der wie das gesunkene Paradies funkelte, sah er noch - es war der Morgenstern am Himmel.
Er erhob sich und war in dem großen Walde dicht bei der Höhle der Winde; und die Mutter der Winde saß an seiner Seite; sie sah böse aus und erhob ihren Arm in die Luft.
"Schon den ersten Abend!" sagte sie. "Das dachte ich wohl! Ja, wärest Du mein Sohn, so müßtest Du in den Sack!"
"Da soll er hinein!" sagte der Tod. Das war ein starker, alter Mann mit einer Sense in der Hand und mit großen schwarzen Schwingen. "In den Sarg soll er gelegt werden; aber jetzt noch nicht; ich zeichne ihn nur, lasse ihn dann noch eine Weile in der Welt herum wandern, seine Sünde sühnen, gut und besser werden. - Ich komme aber einmal. Wenn er es gerade am wenigsten erwartet, stecke ich ihn in den schwarzen Sarg, setze ihn auf meinen Kopf und fliege gegen den Stern empor. Auch dort blüht des Paradieses Garten, und ist er gut und fromm, so wird er hinein treten; sind aber seine Gedanken böse und das Herz noch voller Sünde, so sinkt er mit dem Sarge tiefer als das Paradies gesunken, und nur jedes tausendste Jahr hole ich ihn wieder, damit er noch tiefer sinke oder auf den Stern gelange, den funkelnden Stern dort oben!"
DIE DRYADE

Wir reisen zur Pariser Ausstellung:
Jetzt sind wir da! Das war ein Flug, eine Fahrt, ganz ohne Zauberei; wir fahren mit Dampf auf der Landstraße dahin.
Unsere Zeit ist die Zeit des Märchens.
Wir sind mitten in Paris in einem großen Hotel. Blumen schmücken die Treppen bis oben hinaus, über die Stufen sind weiche Teppiche gebreitet.
Unser Zimmer ist gemütlich. Die Balkontür nach einem großen Platz hinaus steht offen. Da unten wohnt der Frühling, er ist nach Paris gefahren und zur selben Zeit eingetroffen wie wir, er kam in Gestalt eines großen jungen Kastanienbaumes mit eben ausgeschlagenen feinen Blättern; wie ist er in Lenzschönheit gekleidet vor allen andern Bäumen auf dem Platz! Einer von ihnen ist ganz ausgetreten aus der Zahl der lebenden Bäume und liegt, mit den Wurzel ausgerissen, auf die Erde geworfen, da. Wo er gestanden hat, soll jetzt der frische Kastanienbaum gepflanzt werden und wachsen.
Noch steht er, hoch aufgerichtet, auf dem schweren Wagen, der ihn heute morgen nach Paris brachte, mehrere Meilen weit vom Lande her. Dort hatte er seit Jahren dicht neben einer mächtigen Eiche gestanden, unter der oft der alte, prächtige Geistliche saß, der zu den lauschenden Kindern sprach und ihnen erzählte. Der junge Kastanienbaum hörte alles mit an; die Dryade, die in seinen Zweigen wohnte und die ja noch ein Kind war, konnte zurückdenken bis zu der Zeit, wo der Baum so klein war, daß er nur ein wenig über die hohen Grashalme und Farnkräuter aufragte. Die waren schon so groß, wie sie werden konnten, aber der Baum wuchs und nahm mit jedem Jahr zu, trank Luft und Sonnenschein, bekam Tau und Regen und wurde, was notwendig war, von den starken Winden gerüttelt und geschüttelt. Das gehört mit zur Erziehung.
Die Dryade freute sich ihres Daseins, freute sich über den Sonnenschein und den Vogelgesang, am meisten aber über die Stimme der Menschen, sie verstand ihre Sprache ebenso gut, wie sie die der Tiere verstand.
Schmetterlinge, Libellen und Fliegen, ja alles, was fliegen konnte, stattete ihr einen Besuch ab; plaudern konnten sie alle; sie erzählten von dem Dorf, den Weinbergen, dem Walde, dem alten Schloß mit seinem Park, in dem Kanäle waren und Teiche. Dort unten im Wasser wohnten auch lebende Wesen, die auf ihre Weise, unter dem Wasser, von Ort zu Ort fliegen konnten, Wesen mit Kenntnissen und Nachdenken; sie sagten nichts, so klug waren sie.
Und die Schwalbe, die ins Wasser hinabgetaucht war, erzählte von den schönen Goldfischen, von den fetten Brachsen, den dicken Schleien und den alten, bemoosten Karauschen. "Die Schwalbe machte eine sehr genaue Beschreibung, aber man sieht es doch besser selber," meinte sie; aber wie sollte jemals die Dryade die Wesen zu sehen bekommen! Sie mußte sich damit begnügen, über die schöne Landschaft hinauszusehen und die geschäftige Menschwirksamkeit zu spüren.
Schön war es, am schönsten aber doch, wenn der alte Geistliche hier unter der Eiche stand und von Frankreich erzählte, von den großen Taten von Männern und Frauen, deren Namen voller Bewunderung durch alle Zeiten hindurch genannt werden.
Die Dryade hörte von dem Hirtenmädchen Jeanne d'Ard, von Charlotte Corday, sie hörte von uralten Zeiten, von Heinrichs des Vierten und von Napoleons Zeit und, bis in die Jetztzeit hinauf, von Tüchtigkeit und Größe; sie hörte Namen, und in einem jeden war ein Klang, der in das Herz des Volkes drang: Frankreich ist das Land der Welt, der Erdboden der Klugheit mit dem Krater der Freiheit!
Die Dorfkinder lauschten andächtig, die Dryade nicht weniger; sie war ein Schulkind mit den andern. Sie sah in der Gestalt der segelnden Wolken Bild auf Bild von dem, was sie hatte erzählen hören. Der Wolkenhimmel war ihr Bilderbuch.
Sie fühlte sich so glücklich in dem schönen Frankreich, hatte aber doch ein Gefühl, daß die Vögel, daß jedes Tier, das fliegen konnte, weit begünstigter sei als sie. Selbst die Fliege konnte sich umsehen, konnte weit umherfliegen, weit über den Gesichtskreis der Dryade hinaus.
Frankreich war so ausgedehnt und herrlich, aber sie sah nur einen kleinen Fleck davon, weltweit erstreckte sich das Land mit Weinbergen, Wäldern und großen Städten, und von diesen allen war Paris die herrlichste und mächtigste. Dahin konnten die Vögel gelangen, sie aber nie.
Unter den Dorfkindern war auch ein kleines, zerlumptes, ärmliches Mädchen, das aber wunderschön anzusehen war; immer sang und lachte die Kleine und wand rote Blumen in ihr schwarzes Haar.
"Gehe nicht nach Paris!" sagte der alte Geistliche. "Arme Kleine! Wenn du dahin kommst, so wird es dein Verderben sein!"
Und doch ging sie dahin.
Die Dryade dachte oft an sie, sie hatten ja beide dasselbe Verlangen und dieselbe Sehnsucht nach der großen Stadt.
Es ward Frühling, Sommer, Herbst, Winter; einige Jahre vergingen.
Der Baum der Dryade trug seine ersten Kastanienblüten, die Vogel zwitscherten in dem herrlichen Sonnenschein umher. Da kam die Landstraße entlang eine stattliche Kutsche mit einer vornehmen Dame, sie lenkte selber die leicht springenden schönen Pferde; ein geputzter kleine Jockey saß hinten auf. Die Dryade erkannte sie wieder, der alte Geistliche erkannte sie wieder, schüttelte den Kopf und sagte betrübt:
"Du kamst in die große Stadt! Das ward dein Verderben, arme Marie!"
"Die und eine Arme!" dachte die Dryade. "Nein, welch eine Verwandlung! Sie ist gekleidet wie eine Herzogin! Das geschah in der Stadt der Verzauberung! Ach, wäre ich doch da, in all dem Glanz und der Pracht! Selbst die Wolken werden in der Nacht davon beleuchtet, das sehe ich, wenn ich den Blick dahin wende, wo, wie ich weiß, die Stadt liegt."
Ja, dahin, nach der Richtung, sah die Dryade jeden Abend, jede Nacht. Sie sah den strahlenden Nebel am Horizont; sie entbehrte ihn in hellen, mondklaren Nächten; sie entbehrte die segelnden Wolken, die ihr Bilder von der Stadt und aus der Geschichte zeigten.
Das Kind greift nach dem Bilderbuch, die Dryade griff nach der Wolkenwelt, ihrem Gedankenbuch.
Der sommerwarme, wolkenlose Himmel war ihr ein leeres Blatt, und jetzt hatte sie seit mehreren Tagen nichts weiter gesehen.
Es war warme Sommerzeit mit sonnenheißen Tagen ohne einen Lufthauch; jedes Blatt, jede Blume lag wie im Schlaf, auch die Menschen schienen zu schlafen.
Da türmten sich Wolken auf, und zwar in einer Richtung, wo in der Nacht der strahlende Nebel verkündete: hier ist Paris.
Die Wolken ballten sich zusammen, formten sich zu einer ganzen Gebirgslandschaft, schoben sich durch die Luft über das ganze Land, so weit die Dryade zu sehen vermochte.
Gleich mächtigen, schwarzblauen Felsblöcken lagen die Wolken in Schichten übereinander hoch in der Luft. Die Blitzstrahlen fuhren heraus. "Auch sie sind Diener das Herrn," hatte der alte Geistliche gesagt. Und es kam ein blendender Blitz, ein Aufzucken des Lichtes, als wolle die Sonne selber den Felsblock sprengen, der Blitz schlug nieder und zersplitterte die alte, mächtige Eiche bis zur Wurzel; ihre Krone teilte sich, der Stamm teilte sich, zerspalten fiel er als breite er sich aus, um den Sendboten des Lichts zu empfangen.
Keine Erzkanonen vermögen bei der Geburt eines Königskindes so durch die Luft und über das Land zu schallen wie das Dröhnen des Donners hier bei dem Heimgang der alten Eiche. Der Regen strömte herab, der erfrischende Wind lüftete aus, das Unwetter war vorüber, es war so sonntagsfestlich. Die Leute aus dem Dorf versammelten sich um die gefällte alte Eiche; der alte Geistliche sprach ehrende Worte, ein Maler zeichnete den Baum selbst zur bleibenden Erinnerung.
"Alles fährt dahin," sagte die Dryade, "Fährt dahin wie die Wolke und kehrt nimmer wieder!"
Der alte Geistliche kam nicht wieder hierher: das Schuldach war zusammengestürzt, der Katheder war weg. Die Kinder kamen nicht mehr hierher, aber der Herbst kam, der Winter kam, und auch der Frühling kam, und in allen den wechselnden Zeiten sah die Dryade nach der Richtung hinüber, wo jeden Abend und jede Nacht, fern am Horizont, Paris gleich einem schimmernden Nebel leuchtete. Und aus dem Nebel heraus flog eine Lokomotive nach der andern, sausend, brausend, zu allen Zeiten, des Abends, um Mitternacht und am Morgen, und während des ganzen hellen Tages kamen die Züge, und aus einem jeden und in einen jeden hinein strömten Menschen aus allen Ländern der Welt; ein neues Weltwunder hatte sie nach Paris gelockt.
Wie offenbarte sich dies Wunder?
"Eine Prachtblüte der Kunst und Industrie," hieß es, "ist auf dem pflanzenlosen Sand des Marsfeldes empor gesproßt: Eine Riesensonnenblume, aus deren Blättern man Geographie, Statistik lernen, zu Kunst und Poesie emporgehoben, des Landes Größe und Umfang erkennen kann." - "Eine Märchenblüte" sagten andere, "eine bunte Lotuspflanze, die ihre grünen Blätter wie Sammetteppiche über den Sand ausbreitet, ist im frühen Lenz emporgesproßt, die Sommerzeit wird sie in ihrer ganzen Prachtenfaltung sehen, die Stürme des Herbstes werden sie verwehen, es wird weder Blatt noch Wurzel davon übrig bleiben."
Vor der Militärschule dehnt sich die Kriegsarena zur Friedenszeit, das Feld ohne Gras, ohne Strohhalm aus, ein Stück Sandsteppe, aus der Wüste Afrikas ausgeschnitten, in der die Fata Morgana ihre seltsamen Luftschlösser und hängenden Gärten sehen läßt. Auf dem Marsfelde standen sie jetzt weit prächtiger, weit wunderbarer, denn sie waren durch Menschenklugheit Wirklichkeit geworden.
"Aladins Schloß ist erbaut, hieß es. "Tag für Tag, Stunde auf Stunde entfaltet es seine reiche Herrlichkeit mehr und mehr. Von Marmor und Farben prangen die unendlichen Hallen. Meister "Blutlos" bewegt hier seine Stahl- und Eisenglieder in dem großen Ringsaal der Maschinen. Kunstwerke in Metall, in Stein, in Gewebe verkünden das Leben des Geistes, das sich in allen Ländern der Welt regt. Bildersäle, Blumenpracht, alles was Geist und Hand in den Werkstätten der Natur schaffen kann, ist hier zur Schau gestellt; selbst die Erinnerungen des Altertums aus alten Schlössern und Torfmooren haben sich hier eingestellt."
Der überwältigend große, bunte Anblick muß klein gemacht, muß zu einem Spielzeug zusammen gedrängt werden, um wiedergegeben, aufgefaßt und als Ganzes gesehen werden zu können. Gleich einem großen Weihnachtstisch trug das Marsfeld ein Aladinschloß der Kunst und Industrie, und rund darum herum waren Nippesgegenstände aus allen Ländern aufgestellt; jede Nation erhielt eine Erinnerung an ihre Heimat.
Hier stand das Königsschloß Ägyptens, dort die Karawanserei des Wüstenlandes; der Beduine, der auf dem Kamel aus seinem Sonnenlande kam, jagte vorüber; hier breiteten sich russische Ställe mit feurigen, prächtigen Pferden aus den Steppen aus; das kleine, strohgedeckte dänische Bauernhaus stand mit seiner Danebrogflagge neben Gustav Wasas prächtigem hol geschnitztem Hause aus Dalarne; amerikanische Hütten, englische Cottages, französische Pavillons, Kioske, Kirchen und Theater lagen wunderlich zerstreut, und zwischen dem allen der frische, grüne Rasen, das klare rinnende Wasser, blühende Sträucher, seltene Bäume, Glashäuser, wo man sich in die tropischen Wälder versetzt glauben mußte; ganze Rosengärten prangten unter Dach und Fach, als seien sie aus Damaskus geholt; welche Farben, welch ein Duft! Tropfsteinhöhlen, künstlich aufgeführt, umschlossen Süß- und Salzwasserseen, gewährten einen Blick in das Reich der Fische; man stand unten auf dem Meeresgrund zwischen Fischen und Polypen.
Das alles, so hieß es, trägt jetzt das Marsfeld und bietet es dar, und über diese reichgedeckte Festtafel hin bewegt sich gleich geschäftlichen Ameisenschwärmen das ganze Menschengewimmel, zu Fuß oder in kleinen Wagen gezogen, denn alle Beine halten eine so ermüdende Wanderung nicht aus.
Hier hinaus strömen die Menschen vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Ein überfülltes Dampfschiff nach dem anderen gleitet die Seine hinab, die Wagenzahl nimmt fortwährend zu, die Menschenmenge zu Fuß und zu Pferd ist in beständiger Zunahme begriffen, Straßenbahnen und Omnibusse sind vollgestopft, gepfropft, mit Menschen garniert; alle diese Ströme bewegen sich einem Ziel zu: der Pariser Ausstellung! An allen Eingängen prangen die Flaggen Frankreichs, rings um das Basargebäude wehen die Fahnen aller Nationen; es saust und summt aus der Maschinenhalle, von den Türmen herab klingen die Melodien der Glockentürme, in den Kirchen spielen die Orgeln, und in das alles mischen sich heisere, näselnde Gesänge aus den morgenländischen Cafés. Es ist wie ein babylonisches Reich, ein babylonisches Zungengewirr, ein Weltwunder.
Ja, so war es, so lauteten die Beschreibungen, die man darüber hörte. Und wer hörte sie nicht? Die Dryade wußte alles, was hier von dem "neuen Wunder" in der Stadt der Städte gesagt ist.
"Fliegt, ihr Vögel! Fliegt hin, um zu sehen, kommt wieder und erzählt!" so lautete das Flehen der Dryade.
Die Sehnsucht schwoll zum Wunsch, ward zum Lebensgedanken. Und als in der stillen. schweigenden Nacht der Vollmond schien, da flog ein Funke aus seiner Scheibe heraus, die Dryade sah ihn, er fiel und leuchtete wie eine Sternschnuppe, und vor dem Baum, dessen Zweige erbebten wie in einem Sturmwind, stand eine mächtige, strahlende Gestalt, die redete in weichen und doch so starken Tönen wie eine Posaune des Jüngsten Tages, die zum Leben wach küßt, und zum Gericht ruft.
"Du sollst hin gelangen in die Stadt der Verzauberung, du sollst dort Wurzeln schlagen, sollst die sausenden Strömungen dort spüren und die Luft und den Sonnenschein. Aber deine Lebenszeit wird alsdann verkürzt werden, die Reihe von Jahren, die deiner hier draußen im Freien harrte, wird verkürzt werden, wird da drinnen zu einer geringen Summe von Jahren einschrumpfen. Arme Dryade, es wird dein Verderben sein! Dein Sehnen wird wachsen, dein Verlangen, dein Begehren wird stärker werden! Der Baum selbst wird dir ein Gefängnis werden, du wirst dein schützendes Heim verlassen, wirst deine Natur verlassen, wirst ausfliegen und dich unter die Menschen mischen, und da sind deine Jahre eingeschrumpft zu der halben Lebenszeit der Eintagsfliege, nur eine einzige Nacht wirst du leben; dein Lebenslicht wird ausgeblasen werden, die Blätter des Baumes werden welken und verwehen und nie wiederkehren."
So klang es, so sang es, und der Lichtschimmer schwand, nicht aber das Sehnen und Verlangen der Dryade; sie zitterte voller Erwartung in wildem Fieber der Vorfreude.
"Ich werde in die Stadt der Städte kommen!" jubelte sie. "Das Leben beginnt, schwillt zur Wolke an, niemand weiß, wohin es geht!"
Bei Tagesgrauen, als der Mond bleich ward und die Wolken erröteten, schlug die Stunde der Erfüllung, die Worte des Gelöbnisses wurden eingelöst.
Es kamen Leute mit Stangen und Spaten; sie gruben rings um die Wurzeln des Baumes, tief hinab, tief darunter; ein von Pferden gezogener Wagen fuhr vor, der Baum mit den Wurzeln und dem Erdklumpen, den die Wurzeln umschlangen, wurde in die Höhe gehoben, in Binsenmatten gewickelt wie in einen warmen Fußsack, und dann ward er auf den Wagen geladen und festgebunden, er sollte auf Reisen gehen, nach Paris, dort sollte er wachsen und bleiben, in Frankreichs stolzer Stadt, in der Stadt der Städte.
Die Zweige und Blätter des Kastanienbaumes bebten im ersten Augenblick der Erregung, die Dryade bebte in der Wollust der Erwartung.
"Fort! Fort!" klang es in jedem Pulsschlag. "Fort! Fort!" klang es in bebenden hinschwebenden Worten. Die Dryade vergaß, ihrer Heimat Lebewohl zu sagen, Abschied zu nehmen von den wogenden Grashalmen und den unschuldigen Gänseblümchen, die zu ihr aufgesehen hatten wie zu einer großen Dame in des lieben Gottes Blumengarten, wie zu einer jungen Prinzessin, die hier draußen im Freien die Rolle einer Hirtin spiele.
Der Kastanienbaum lag auf dem Wagen, er nickte mit seinen Zweigen. "Lebe wohl" oder "Fort von hier!," die Dryade wußte es nicht. Sie träumte von dem wunderbar Neuen und doch so Bekannten, das sich entrollen sollte. Kein Kinderherz in unschuldiger Freude, kein sinnlich wallendes Blut hat gedankenerfüllter wie sie die Reise nach Paris angetreten.
Das "Lebewohl!" war ja "Fort von hier!"
Die Wagenräder drehten sich um ihre Achse, das Ferne ward nah, lag bald überholt; die Gegenden wechselten, wie die Wolken wechseln; neue Weinberge, Wälder, Dörfer, Villen und Gärten tauchten auf, kamen zum Vorschein, rollten vorüber. Der Kastanienbaum bewegte sich vorwärts und mit ihm die Dryade. Lokomotiven entsandten Wolken, die Gestalten bildeten, und diese erzählten von Paris, woher sie kamen, wohin die Dryade wollte.
Alles ringsumher mußte und mußte ja begreifen, wohin ihr Weg ging; es war ihr, als strecke jeder Baum an dem sie vorüberkam, seine Zweige nach ihr aus, als flehe er: "Nimm mich mit - nimm mich mit!" In jedem Baum saß ja auch eine sehnsuchtsvolle Dryade.
Welch ein Wechsel! Welch ein Flug! Es war, als schössen die Häuser aus der Erde auf, mehr und mehr, immer düsterer. Die Schornsteine ragten auf wie Blumentöpfe, die aufeinander und nebeneinander auf die Dächer gestellt waren; große Inschriften mit ellenlangen Buchstaben, gemalte Schilder, schimmerten an den Häusern von unter bis unters Dach.
"Wo fängt Paris an, und wann bin ich da?" fragte sie die Dryade. Das Menschengewimmel nahm beständig zu, Leben und Geschäftigkeit wurden immer reger, ein Wagen folgte dem andern, den Fußgängern folgten Reiter, und ringsumher lag ein Laden neben dem andern, ertönte Musik, Gesang, Geschrei und Geplauder.
Die Dryade in ihrem Baum war mitten in Paris.
Der große, schwere Wagen hielt auf einem kleinen, mit Bäumen bepflanzten Platz; ringsumher lagen hohe Häuser, in denen jedes Fenster seinen Balkon hatte, von dort oben sahen die Laute auf den jungen, frischen Kastanienbaum herab, der gefahren kam und nun hier an Stelle des ausgegangenen, ausgerissenen Baumes, der an der Erde lag, eingepflanzt werden sollte. Auf dem Platz standen die Menschen still und sahen mit Lächeln und Freude das Frühlingsgrün an; die älteren Bäume, die erst in Knospen standen, grüßten mit rauschenden Zweigen: "Willkommen! Willkommen!," und der Springbrunnen, der seine Strahlen in die Luft emporschleuderte und sie in die breite Kumme niederplätschern ließ, entsandte durch den Wind Tropfen zu dem neu angekommenen Baum hinüber, als wolle er ihm einen Willkommenstrunk bieten.
Die Dryade fühlte, wie ihr Baum von dem Wagen gehoben und an seinen künftigen Platz gestellt wurde. Die Wurzeln des Baumes wurden in der Erde geborgen, frischer Rasen ward darübergelegt; blühende Büsche und Töpfe mit blühenden Gewächsen wurden um den Baum gepflanzt; es entstand ein ganzer Gartenfleck mitten auf dem Platz. Der abgestorbene, ausgerissene Baum, der hier drinnen von Gasluft, Speisenduft und der erstickenden Stadtluft getötet war, wurde auf den Wagen gelegt und weggefahren. Die Volksmenge sah das alles mit an, Kinder und alte Leute saßen auf der Bank im Grünen und sahen zwischen die Blätter des eben gepflanzten Baumes hinaus. Und wir, die wir davon erzählen, standen auf dem Balkon, sahen hinab in den jungen Lenz von da draußen aus der frischen Landluft und sagten, was der alte Geistliche gesagt haben würde: "Arme Dryade!"
"Glückselig bin ich, glückselig!" sagte die Dryade. "Und doch, ich kann es nicht recht begreifen, kann nicht recht aussprechen, was ich empfinde; alles ist so, wie ich es mir gedacht habe, und doch ist es nicht so, wie ich es dachte!"
Die Häuser waren so hoch, standen so nahe; die Sonne beschien nur eine einzige Wand, und die war mit Anschlägen und Plakaten bekleistert, vor denen die Leute stehenblieben und sich drängten. Wagen jagten vorüber, leichte und schwere; Omnibusse, diese überfüllten fahrenden Häuser, rummelten über den Platz; Reiter sprengten vorbei, Karren und Equipagen verlangten das gleiche Recht. "Würden sich," dachte die Dryade, "die hochgewachsenen Häuser, die so nahe standen, nicht auch bald auf- und davonmachen, ihre Gestalt verändern, so wie die Wolken des Himmels es können, zur Seite gleiten, damit sie in Paris hinein und darüber hinwegsehen konnte? Notre-Dame mußte sich zeigen, die Vendomesäule und das Wunderwerk, das alle die vielen Fremden hierhergerufen hatte und noch immer rief."
Die Häuser rührten sich nicht vom Fleck.
Es war noch Tag, als die Laternen angezündet wurden; aus den Läden leuchteten die Gasstrahlen, verbreiteten Licht zwischen die Zweige der Bäume; es war wie Sommersonnenschein. Die Sterne oben am Himmel kamen zum Vorschein, es waren dieselben, die die Dryade in ihrer Heimat gesehen hatte; sie glaubte, einen Lufthauch von da draußen zu spüren, so rein und mild. Sie fühlte sich gehoben, gestärkt und spürte eine Sehkraft durch jedes Blatt des Baumes, eine Empfindung in den äußersten Spitzen der Wurzeln. Sie fühlte sich in der lebenden Menschwelt, von milden Augen gesehen; ringsumher herrschten Gewimmel und Lärm, Farben und Licht.
Aus der Seitenstraße ertönten Blasinstrumente und zum Tanz anregende Melodien des Leierkastens. Ja, zum Tanz! Zum Tanz! Zu Freude und Lebensgenuß riefen die Töne.
Es war eine Musik, so daß Menschen, Pferde, Wagen, Bäume und Häuser dazu tanzen mußten, wenn sie tanzen konnten. Ein Freudenrausch stieg in der Brust der Dryade auf.
"Wie lieblich und herrlich!" jubelte sie. "Ich bin in Paris!"
Der Tag, der kam, und die Nacht, die auf diesen Tag folgte, und abermals der nächste Tag und die nächste Nacht boten denselben Anblick dar, dasselbe Treiben, dasselbe Leben, wechselvoll und doch immer dasselbe.
"Jetzt kenne ich jeden Baum, jede Blume hier auf dem Platz! Ich kenne jedes Haus, jeden Balkon und jeden Laden hier, wo man mich in diesen kleinen engen Winkel gestellt hat, der die mächtige Stadt meinen Blicken entzieht. Wo sind die Triumphbogen, die Boulevards, die Wunderwerke der Welt? Nichts von alledem sehe ich. Eingeschlossen wie in einem Käfig stehe ich zwischen den hohen Häusern, die ich nun mit ihren Inschriften, Plakaten und Schildern auswendig weiß, alles ist nur ein Honig-um-den-Mund-Streichen, das mir nicht mehr behagt. Wo ist doch nur alles das, wovon ich hörte, wovon ich weiß, wonach ich mich sehnte und weswegen ich hierher wollte? Was habe ich erfaßt, gewonnen, gefunden? Ich sehne mich ebenso wie ehedem, und doch weiß ich, es gibt ein Leben, das ich ergreifen, in dem ich leben muß! Ich will in die Reihen der Lebenden! Will mich dort tummeln, fliegen wie ein Vogel, sehen und fühlen, ich will ganz Mensch sein, will einen halben Tag des Lebens wählen statt eines jahrelangen Lebens in der Müdigkeit und Langeweile des Alltagslebens, in dem ich hinwelke, sinke, falle wie die Nebel der Wiese und verschwinde. Strahlen will ich wie die Wolke, strahlen in der Sonne des Lebens, auf das Ganze hinabsehen, wie die Wolke, hinfahren wie sie, niemand weiß, wohin!"
Das war der Seufzer der Dryade, der sich im Gebet empor schwang:
Nimm die Jahre meines Lebens, gib mir das Leben der Eintagsfliege! Erlöse mich aus meinem Gefängnis, gewähre mir für eine kurze Weile Menschenleben, Menschenglück, nur diese eine Nacht, wenn es nicht anders sein kann, und strafe mich dann nur für meinen kühnen Lebensmut, für die Sehnsucht meines Lebens! Lösche mich aus, laß mein Heim, den frischen, jungen Baum, hinwelken, möge er gefällt werden, zu Asche verbrennen, in alle Winde verwehen!"
Es sauste in den Zweigen des Baumes, ein kitzelndes Gefühl, ein Zittern durchrieselte jedes Blatt, als ströme ein Feuer hindurch oder gehe davon aus, ein Windstoß sauste durch die Krone des Baumes, und aus seiner Mitte erhob sich eine Frauengestalt, die Dryade selber. Im selben Augenblick saß sie unter den gasbestrahlten blätterreichen Zweigen, jung und schön wie die arme Marie, zu der gesagt worden war: "Die große Stadt wird dein Verderben!"
Die Dryade saß am Fuße des Baumes, vor ihrer Haustür, die sie abgeschlossen und deren Schlüssel sie weggeworfen hatte. So jung, so schön! Die Sterne sahen sie, die Sterne blinkten, die Gasflammen sahen sie, strahlen, winkten! Wie schlank und doch wie fest war sie, ein Kind und doch eine erwachsene Jungfrau, Ihre Kleidung war seidenfein, grün wie die eben entfalteten frischen Blätter in der Kröne des Baumes; in ihrem nußbraunen Haar hing eine halberschlossene Kastanienblüte; sie glich der Göttin des Frühlings.
Nur eine kurze Minute saß sie regungslos still, dann sprang sie auf, und mit einer Geschwindigkeit wie die der Gazelle stürzte sie davon, bog um die Ecke, sie lief, sie sprang wie das Aufblitzen eines Spiegels, der in der Sonne getragen wird, das Aufblitzen, das bald hierhin, bald dahin geworfen wird; und hätte man genau zusehen können, hätte man sehen können, was da zu sehen war, wie wunderbar! An jeder Stelle, wo sie einen Augenblick verweilte, verwandelte sich ihr Gewand, ihre Gestalt, der Eigenschaft des Ortes, des Hauses entsprechend, dessen Lampe sie beschien.
Sie erreichte den Boulevard; hier strömte ihr ein Lichtmeer von Gasflammen aus Laternen, Läden, Cafés entgegen. Hier standen Reihen von Bäumen, junge und schlanke, ein jeder behauste seine Dryade, schützte sie vor den Strahlen des künstlichen Sonnenlichts. Der ganze, unendlich lange Bürgersteig war wie ein einziger großer Gesellschaftssaal, hier standen gedeckte Tische mit allen möglichen Erfrischungen, Champagner, Chartreuse bis hinab zu Kaffee und Bier, hier war eine Ausstellung von Blumen, von Bildern, Statuen, Büchern und bunten Stoffen.
Von dem Gewimmel unter den hohen Häusern sah sie hinaus über den schreck einjagenden Strom außerhalb der Baumreihe: da wogte eine Flut von rollenden Wagen, Kabrioletts, Kutschen, Omnibussen, Droschken, Reitern und aufmarschierenden Regimentern. Es kostete Leben und Glieder, wenn man nach dem gegenüberliegenden Ufer hinüberkreuzen wollte. Jetzt leuchtete eine bewegliche Flamme auf, jetzt hatte wieder das Gaslicht die Herrschaft gewonnen, plötzlich stieg eine Rakete auf, woher, wohin?
Ja, das war die große Landstraße der Welt!
Hier ertönten weiche italienische Melodien, dort spanische Lieder, begleitet von den Schlägen der Kastagnetten, am stärksten aber, das Ganze übertäubend, schallten die Spieldosenmelodien, die kitzelnde Cancanmusik, die Orpheus nicht kannte und die nie von der schönen Helena gehört wurde, selbst die Schubkarre mußte auf ihrem einen Rad tanzen, wenn sie tanzen konnte. Die Dryade tanzte, schwebte, flog, wechselte die Farben wie der Kolibri im Sonnenlicht, jedes Haus und seine Welt da drinnen verliehen ihr den Reflex.
Gleich der strahlenden Lotusblüte, die von ihrer Wurzel losgerissen, von dem Strome davongeführt und auf seinen Wirbeln getragen wird, so trieb sie dahin, und wo sie stillstand, war sie immer wieder eine neue Erscheinung, daher vermochte niemand, ihr zu folgen, sie wiederzuerkennen, zu beschauen.
Wie Wolkenbilder flog alles an ihr vorüber, Gesicht neben Gesicht, aber nicht ein einziges kannte sie, nicht eine Gestalt aus ihrer Heimat sah sie. Da blitzten in ihren Gedanken zwei strahlende Augen auf, sie dachte an Marie, an die arme Marie. An das zerlumpte, fröhliche Kind mit der roten Blume in dem schwarzen Haar. Sie war ja in der Weltstadt, reich, strahlend, so wie damals, als sie am Hause des Pfarrers, an dem Baum der Dryade und an der alten Eiche vorübergefahren war.
Sie war sicher hier in dem betäubenden Lärm, war vielleicht eben ausgestiegen aus der harrenden, prächtigen Kutsche; elegante Wagen hielten hier mit galonierten Kutschern und seidenbestrumpften Dienern. Die Herrschaften, die ausstiegen, waren ausnahmslos Frauen, reichgekleidete Damen. Sie schritten durch die offenen Gitterpforten, die hohe, breite Treppe hinan, die zu einem Gebäude mit Marmorsäulen führte. War dies etwa das Weltenwunderwerk? Dort war sicher Marie!
"Sancta Maria!" sangen sie da drinnen, der Räucherduft wogte hervor unter den hohen, gemalten und vergoldeten Bogen, wo Dämmerung herrschte. Es war die Magdalenenkirche.
Schwarzgekleidet, in den köstlichsten Stoffen, nach der letzten, höchsten Mode, schritt hier die vornehme weibliche Welt über den blanken Fußboden. Das Wappen zierte den Silberbeschlag des in Sammet gebundenen Gebetbuches und das stark parfümierte feine Taschentuch mit den kostbaren Brüsseler Spitzen. Einige von den Frauen knieten im stillen Gebet vor den Altären, andere suchten die Beichtstühle auf.
Die Dryade empfand eine Unruhe, eine Angst, als sei sie an einen Ort geraten, den sie nicht betreten dürfe. Hier war das Heim des Schweigens, die Halle der Heimlichkeiten; alles wurde geflüstert und lautlos anvertraut.
Die Dryade sah sich selber in Seide und Schleier vermummt, sie glich in der Erscheinung den andern Frauen des Reichtums und Adels; ob wohl eine jede von Ihnen ein Kind der Sehnsucht war, so wie sie?
Da ertönte ein Seufzer, so schmerzlich tief; kam er aus der Ecke des Beichtstuhls oder aus der Brust der Dryade? Sie zog den Schleier fester um sich. Sie atmete Kirchenräucherduft und nicht die frische Luft. Hier war nicht die Stätte ihrer Sehnsucht.
Fort! Fort! In fliegender Eile, ohne Rast! Die Eintagsfliege hat keine Ruhe, ihr Fliegen ist Leben.
Sie war wieder da draußen unter strahlenden Gaskandelabern bei prachtvollen Springbrunnen. "Alle Wasserströme vermögen doch nicht das unschuldige Blut abzuspülen, das hier vergossen ist."
Die Worte wurden gesagt.
Hier standen fremde Leute, die sprachen laut und lebhaft, wie niemand zu sprechen wagte in dem großen Hochsaal der Geheimnisse, von woher die Dryade kam.
Eine große Steinplatte wurde gedreht, in die Höhe gehoben; sie verstand das nicht; sie sah den offenen Abstieg in die Tiefe der Erde; da hinein verschwanden sie aus der sternklaren Luft, aus den sonnenstrahlenden Gasflammen, aus all dem lebenden Leben.
"Ich ängstige mich davor!" sagte eine von den Frauen, die hier standen. "Ich habe nicht den Mut, da hinabzusteigen, ich mache mir auch nichts daraus, die Herrlichkeit da unten zu sehen! Bleib bei mir!"
"Sollen wir denn nach Hause reisen, Paris verlassen, ohne das Merkwürdigste gesehen zu haben, das eigentliche Wunderwerk der Jetztzeit, das durch die Klugheit und den Willen eines einzigen Mannes ins Leben gerufen ist?" entgegnete der Mann. "Ich gehe nicht mit hinab!" lautete die Antwort.
"Das Wunderwerk der Jetztzeit!" ward da gesagt. Die Dryade hörte es, verstand es; das Ziel ihrer heißesten Sehnsucht war erreicht, und hier war der Eingang, er führte in die Tiefe hinab, unter Paris. Das hatte sie nicht gedacht, aber jetzt hörte sie es, sie sah die Fremden hinabsteigen, und sie schloß sich ihnen an.
Die Treppe war aus gegossenem Eisen, schraubenförmig, breit und bequem. Eine Lampe leuchtete da unten und noch tiefer wieder eine.
Sie standen in einem Labyrinth von unendlich langen, sich kreuzenden Hallen und Bogengängen; alle Straßen und Gassen von Paris waren hier zu sehen wie in einem matten Spiegelbild, die Namen waren zu lesen, jedes Haus da oben hatte hier seine Nummer, seine Wurzel, die sich unter die menschenleeren, asphaltierten Bürgersteige schob, die sich um einen breiten Kanal mit einem fremden, sich vorwärtswälzenden Schlamm klemmte. Ein wenig höher ward über Bogen das frische, rinnende Wasser geführt, und ganz oben hingen, einem Netz gleich, Gasröhren, Telegraphendrähte. Lampen leuchteten in Zwischenräumen wie Widerscheinbilder aus der Weltstadt dort oben. Hin und wieder hörte man ein polterndes Rummeln, das waren schwere Wagen, die über die Einstiegdeckel fuhren.
Wo war die Dryade?
Du hast von den Katakomben gehört; sie sind nur ein verschwindender Strich in dieser neuen, unterirdischen Welt, dem Wunderwerk der Jetztzeit; den Kloaken unter Paris. Hier stand die Dryade und nicht draußen in der Weltausstellung auf dem Marsfelde.
Ausrufe der Verwunderung, Bewunderung, Anerkennung hörte sie.
"Von hier unten," so wurde gesagt, "wachsen jetzt Gesundheit und lange Lebensjahre zu Tausenden und Abertausenden da oben hinauf! Unsere Zeit ist die Zeit des Forschritts mit allen seinen Segnungen!"
Das war die Ansicht der Menschen, das waren die Worte der Menschen, nicht aber war es die Ansicht der Geschöpfe, die hier bauten, wohnten und geboren waren, der Ratten; sie pfiffen aus dem Spalt in einem Stück alten Mauerwerkes so deutlich, so hörbar, so verständlich für die Dryade.
Eine große männliche Ratte mit abgebissenem Schwanz pfiff durchdringlich ihr Empfinden, ihre Beklommenheit, ihre einzig richtige Meinung, und die Familie gab bei jedem Worte ihre Zustimmung zu erkennen.
"Mir wird schlimm und übel vor dem Menschenmiauen, den Worten der Unwissenheit! Ja, jetzt ist es hier herrlich mit Gas und Petroleum, ich fresse dergleichen nicht. Es ist so fein hier geworden und so hell, daß man dasitzt und sich über sich selber schämt und nicht weiß, weswegen man sich schämt. Ach, lebten wir doch in der Zeit des Talglichts! Sie liegt ja gar nicht so weit zurück! Das war eine romantische Zeit, wie man zu sagen pflegt!"
"Was erzählst du da? fragte die Dryade. "Ich habe dich noch nie gesehen. Wovon redest du?"
"Von der schönen alten Zeit," sagte die Ratte, "von den herrlichen Tagen der Urgroßvater- und Urgroßmutterraten; dazumal war es eine große Begebenheit, hier herunterzukommen. Hier war ein ganz anderes Rattennest als in ganz Paris! Die Pestmutter wohnte hier unten; sie tötete Menschen, nie aber Ratten. Räuber und Schmuggler atmeten frei hier unten. Hier war eine Zufluchtsstätte für die interessantesten Persönlichkeiten, die man jetzt nur auf den melodramatischen Theatern da oben sieht. Auch in unserm Rattennest ist die Zeit der Romantik vorüber; wir haben hier unten frische Luft bekommen und Petroleum."
So pfiff die Ratte! Sie pfiff auf die neue Zeit zu Ehren für die alte mit der Pestmutter.
Da hielt ein Wagen, eine Art offener Omnibus, mit kleinen flinken Pferden bespannt; die Gesellschaft setzte sich hinein, fuhr davon, über den Boulevard Sébastopol, aber unter der Erde; unmittelbar darüber erstreckte sich der bekannte menschenwimmelnde oben in Paris.
Der Wagen verschwand im Halbdunkel, die Dryade verschwand, in den Lichtkreis der Gasflamme, in die frische, freie Luft hinaufgehoben; dort und nicht unten in den sich kreuzenden Wölbungen mit ihrer dumpfen Atmosphäre war das Wunder zu finden, das Weltwunder, das sie in ihrer kurzen Lebensnacht suchte; es mußte stärker strahlen als alle Gasflammen hier oben, stärker als der Mond, der jetzt aus den Wolken auftauchte.
Ja, sicherlich! Und sie sah es in der Ferne, es strahlte vor ihr, es blinkte, winkte wie der Venusstern am Himmel.
Sie sah ein offenes Strahlentor, das in einen kleinen Garten voller Lust und Tanzmelodien führte. Gasflammen schimmerten dort als Rabatten und kleine, stille Seen und Teiche, wo künstliche Wasserpflanzen, aus Blechplatten ausgeschnitten, gebogen und angemalt, in all dem Lichtschimmer prangten und ellenhohe Wasserstrahlen aus ihren Kelchen emporsandten. Schöne Trauerweiden, wirkliche, lenzfrische Trauerweiden, senkten ihre frischen Zweige gleich einem grünen durchsichtigen und doch verhüllenden Schleier herab. Zwischen den Büschen brannte ein Feuer, sein roter Schein beleuchtete kleine, dämmerige, verschwiegene Lauben, die von Tönen durchbraust waren, von einer Melodie, die das Ohr kitzelte, betörend, lockend, die das Blut durch die Pulse der Menschen jagte.
Junge Frauen sah sie, schön, festlich gekleidet, mit dem Lächeln der Unschuld, dem leichten, lachenden Sinn der Jugend, eine "Marie" mit einer Rose im Haar, aber ohne Equipage und Jockey. Wie wogten sie umher, wie schwangen sie sich in wilden Tänzen! Was war oben, was war unten? Wie von der Tarantel gestochen sprangen sie, lachten sie, lächelten sie, glückselig bereit, die ganze Welt zu umfangen.
Die Dryade fühlte sich mit fortgerissen in dem Tanz. Ihren kleinen Fuß umschloß der seidene Stiefel, kastanienbraun wie das Band, das aus ihrem Haar auf die unbedeckte Schulter herabflatterte. Das seidengrüne Kleid wogte in großen Falten, verbarg aber nicht das schöngeformte Bein mit dem niedlichen Fuß, der vor dem Gesicht des tanzenden Jünglings Zauberkreise in die Luft zu schreiben schien.
War sie in Amidas Zaubergarten? Wie hieß der Ort?
Draußen erstrahlte der Name in Gasflammen: "Mabille."
Töne und Händeklatschen, Raketen und rieselnde Wasser knallten um die Wette mit dem Champagner hier drinnen, der Tanz war bacchantisch wild, und über dem Ganzen segelte der Mond, freilich mit etwas schiefem Gesicht. Der Himmel war ohne Wolken, klar und rein, man glaubte, von Mabille aus in den Himmel hineinsehen zu können.
Eine verzehrende, kitzelnde Lebenslust durchbebte die Dryade, sie fühlte sich wie in einem Opiumrausch. Ihre Augen sprachen, die Lippen sprachen, aber man hörte die Worte nicht vor dem Klang der Flöten und Violinen. Ihr Tänzer flüsterte ihr Worte ins Ohr, sie wogten im Takt des Cancans; sie verstand sie nicht, wir verstehen sie nicht. Er streckte seine Arme nach ihr aus, umschlang sie und faßte nur die durchsichtige, gaserfüllte Luft.
Die Dryade wurde von dem Luftstrom getragen, wie der Wind ein Rosenblatt trägt. Hoch oben vor sich erblickte sie eine Flamme, ein blinkendes Licht, auf der Spitze eines Turmes. Das Feuer schien herab von dem Ziel ihres Sehens, schien von dem roten Leuchtturm auf dem Marsfelde, der "Fata Morgana." Dahin wurde sie von dem Frühlingswind getragen. Sie umkreiste den Turm; die Arbeiter glaubten, es sei ein Schmetterling, den sie da hinabschweben sahen, um sein zu frühes Kommen mit dem Tode zu büßen.
Der Mond leuchtete, die Gasflammen und Laternen leuchteten in den großen Hallen und in den zerstreut liegenden "Gebäuden der ganzen Welt," warfen ihren Schein über die Rasenhügel und die durch Menschenschlauheit hergestellten Felsblöcke, über die der Wasserstrahl durch "Meister Blutlos'" Kraft herabstürzte. Die Höhlen der Meerestiefen und die Tiefen des Süßwassersees, die Reiche der Fische erschlossen sich hier, man war auf dem Boden des tiefen Teiches, man war unten im Meer in der gläsernen Taucherglocke. Das Wasser preßte gegen die dicken Glaswände, die nach außen und nach oben darüberlagen. Die Polypen, klafterlang, geschmeidig, sich windend wie Aale, bebende Därme, Arme, griffen um sich, hoben sich empor, wuchsen am Meeresboden fest.
Eine große Scholle lag bedenklich nahe, breitete sich übrigens bequem und behaglich aus; der Taschenkrebs krabbelte wie eine ungeheure Spinne über sie hin, während sich die Krabben mit einer Geschwindigkeit, einer Hast emporschwangen, als seien sie die Motten, die Schmetterlinge des Meeres.
In dem Süßwassersee wuchsen Wasserrosen, Röhricht und Schilf. Die Goldfische hatte sich in Reih und Glied aufgestellt wie rote Kühe auf dem Felde, alle mit den Köpfen nach derselben Richtung, um die Strömung ins Maul hineinzubekommen. Dicke, fette Schleie glotzten mit dummen Augen durch die Glaswände; sie wußten, daß sie auf der Pariser Ausstellung waren; sie wußten, daß sie in mit Wasser gefüllten Tonnen die ziemlich beschwerliche Reise hierher gemacht hatten und auf der Eisenbahn landkrank geworden waren, so wie die Menschen auf dem Meere seekrank werden. Sie waren gekommen, um die Ausstellung zu sehen, und sahen sie aus ihrer eigenen Süßwasser- oder Salzwasserloge, sahen das Menschengewimmel, das sich vom Morgen bis zum Abend vorüberbewegte. Alle Länder der Welt hatten ihre Menschen ausgestellt, damit die alten Schleie und Brachsen, die flinken Barsche und die bemoosten Karpfen diese Geschöpfe sehen und ihre Ansicht über dergleichen austauschen konnten.
"Es sind Schaltiere!" sagte eine schlammige kleine Bleie. "Sie wechseln die Schale zwei-, dreimal im Tage und geben Mundlaute von sich, Sprache nennen sie das. Wir wechseln nicht und machen uns auf eine leichtere Weise verständlich: Bewegungen der Mundwinkel und Glotzen mit den Augen! Wir haben viel vor den Menschen voraus!"
"Schwimmen haben sie aber doch gelernt!" sagte ein kleiner Süßwasserfisch. "Ich komme aus dem großen See, da baden die Menschen in der heißen Zeit, zuvor aber legen sie die Schalen ab, und dann schwimmen sie. Die Frösche haben es sie gelehrt; stoßen mit den Hinterbeinen und Rudern mit den Vorderbeinen; lange halten sie es aber nicht aus. Sie wollen uns gleichen, aber das gelingt ihnen nicht! Arme Menschen!"
Und die Fische glotzten; sie glaubten, daß das ganze Menschengewimmel, das sie in dem starken Tageslicht gesehen hatten, sich hier noch bewegte; ja, sie waren überzeugt, noch dieselben Gestalten zu sehen, die ihnen sozusagen zuerst auf die Auffassungsnerven gefallen waren.
Ein kleiner Barsch mit hübsch getigerter Haut und beneidenswert rundem Rücken versicherte, daß der "Menschenmorast" noch da sei; er sehe ihn noch. "Ich sehe ihn auch, ich sehe ihn so deutlich!" sagte ein gelbsuchtgoldiger Schlei. "Ich sehe so deutlich die schöne, gutgewachsene Menschengestalt, "hochbeinige Frau" oder wie sie sie nannten; sie hatte unsere Mundwinkel und Glotzaugen, hinten zwei Ballons und vorne einen Regenschirm, großes Entenflott-Gehängsel, Tingel-Tangel. Sie sollte das Ganze nur ablegen, so gehen wie wir, so wie sie geschaffen ist, und sie würde aussehen wie ein redlicher Schlei, soweit die Menschen das fertigbringen können!"
"Wo blieb der Mensch wohl ab, den sie an der Angel zogen?"
"Er fuhr in einem Stuhlwagen, saß mit Papier und Tinte und Feder da, schrieb alles auf, schrieb alles nieder. Was bedeutete er? Sie nannten ihn Rezensent."
"Er fährt noch da!" sagte eine bemooste, jungfräuliche Karausche, die die Prüfung der Welt in der Kehle hatte, so daß sie heiser davon war; sie hatte einstmals einen Angelhaken verschluckt und schwamm nun geduldig damit im Halse herum.
"Rezensent!" sagte sie. "Das ist vom Fischstandpunkt aus, verständlich ausgedrückt, eine Art Tintenfisch unter den Menschen."
So redeten die Fische auf ihre Weise. Aber mitten in der künstlich errichteten wassertragenden Grotte ertönten Hammerschläge und Gesang der Arbeiter: sie mußten die Nacht mit zu Hilfe nehmen, damit alles vollendet werde. Sie sangen in dem Sommernachtstraum der Dryade; sie selber stand hier drinnen, um wieder von dannen zu fliegen und zu verschwinden.
"Das sind die Goldfische!" sagte sie und nickte ihnen zu. "So bekam ich euch denn doch zu sehen! Ja, ich kenne euch! Ich habe euch lange gekannt! Die Schwalbe hat mir von euch erzählt in unserer Heimat! Wie schön seid ihr, wie schimmernd, wie liebreizend! Ich könnte euch alle nacheinander küssen! Auch die andern kenne ich! Das da ist gewiß die fette Karausche, dies hier der leckere Brachsen, und diese da sind die bemoosten Karpfen! Ich kenne euch, aber ihr kennt mich nicht!"
Die Fische glotzten, sie verstanden nicht ein einziges Wort; sie sahen in das dämmernde Licht hinaus.
Die Dryade war nicht mehr da, sie stand im Freien, wo die "Wunderblume der Welt" ihren Duft aus den verschiedenen Ländern ausströmte, aus dem Schwarzbrotland, von der Stockfischküste, dem Juchtenlederreich, dem Eaude-Cologne-Flußufer, dem Rosenölmorgenland.
Wenn wir nach einer Ballnacht halbwach heimfahren, klingen die Melodien, die wir gehört haben, noch deutlich in unseren Ohren; wir könnten eine jede singen. Und wie in dem Auge des Getöteten der letzte Blick von dem, was das Auge gesehen, nach eine Zeitlang photographisch dort verweilen soll, so weilten auch hier in der Nacht noch das Getümmel und der Schein des Lebens am Tage, es war nicht verbraust, nicht erloschen; die Dryade fühlte das und wußte: so braust es auch noch morgen am Tage weiter.
Die Dryade stand zwischen den duftenden Rosen, glaubte sie aus ihrer Heimat wiederzukennen. Rosen aus dem Schloßpark und aus dem Pfarrgarten. Auch die rote Granatblüte sah sie hier; eine solche hatte Marie in ihrem kohlschwarzen Haar getragen.
Erinnerungen aus der Heimat ihrer Kindheit draußen auf dem Lande blitzten in ihre Gedanken hinein. Das Schauspiel ringsumher sog sie mit der Begierde der Augen ein, während fieberhafte Unruhe sie erfüllte, sie durch die wunderbaren Säle trieb.
Sie fühlte sich ermüdet, und diese Müdigkeit nahm zu. Sie hatte ein Bedürfnis, sich auszuruhen auf den weichen morgenländischen Kissen und Teppichen hier drinnen oder sich mit der Trauerweide hinabzuneigen zu dem klaren Wasser und darin unterzutauchen.
Aber die Eintagsfliege kennt keine Ruhe. In wenigen Minuten war ihr Tag zu Ende.
Ihre Gedanken zitterten, ihre Glieder bebten, sie sank im Gras an dem rinnenden Wasser nieder.
"Du entspringst der Erde mit ewigem Leben!" sagte sie. "Netze meine Zunge, schenke mir Erquickung!"
"Ich bin kein lebendiges Wasser!" entgegnete der Bach. "Mich macht eine Maschine springen!"
"Gib mir von deiner Frische, du grünes Gras!" bat die Dryade. "Gib mir eine von den duftenden Blumen!"
"Wir sterben, wenn wir abgerissen werden!" sagten Gras und Blumen.
"Küsse mich, du frischer Luftstrom! Nur einen einzigen Lebenskuß!"
"Bald küßt die Sonne die Wolken rot," sagte der Wind, "und da bist du unter den Toten, bist hingefahren, wie alle Herrlichkeit hier hinfährt, ehe das Jahr um ist; dann kann ich wieder mit dem leichten, losen Sand hier auf dem Platz spielen, kann Staub über die Erde blasen, Staub in die Luft blasen, Staub, nichts als Staub!"
Die Dryade empfand eine Angst wie die Frau, die im Bade die Pulsader durchgeschnitten hat und verblutet, aber im Verbluten noch zu leben wünscht. Sie erhob sich, trat einige Schritte vor und sank vor einer kleinen Kirche wieder nieder. Die Tür stand offen, auf dem Altar brannten Lichter, die Orgel ertönte. Welch eine Musik! Solche Töne hatte die Dryade noch nie gehört, und doch war es ihr, als höre sie bekannte Stimmen darin. Die kamen aus der Herzenstiefe der ganzen Schöpfung. Sie glaubte das Sausen der alten Eiche zu vernehmen, sie glaubte den alten Geistlichen zu hören, der von großen Taten erzählte, von berühmten Namen und von dem, was Gottes Geschöpfe einer künftigen Zeit als Geschenk geben könnten, geben müßten, um selber dadurch ein bleibendes Leben zu erringen.
Die Töne der Orgel schwollen und klangen, sprachen im Gesang: "Dein Sehnen, deine Lust rissen sich mit der Wurzel aus dem dir von Gott angewiesenen Platz aus. Das ward dein Verderben, arme Dryade!"
Orgeltöne, weiche und sanfte, klangen wie von Tränen erstickt, starben hin in Tränen.
Am Himmel schimmerten die Wolken rot. Der Wind sauste und sang: "Fahret hin, ihr Toten, jetzt geht die Sonne auf!"
Der erste Strahl fiel auf die Dryade. Ihre Gestalt erschien in Farben, wechselnd wie die Seifenblase, wenn sie zerplatzt, verschwindet, ein Tropfen wird, eine Träne, die zur Erde fällt und verschwindet.
Arme Dryade! Ein Tautropfen, nur eine Träne, gekommen, verschwunden!
Die Sonne schien auf die "Fata Morgana" des Marsfeldes herab, schien herab auf das große bunte Paris, auf den Platz mit den Bäumen und dem plätschernden Springbrunnen zwischen den hohen Häusern, wo der Kastanienbaum stand, aber mit herabhängenden Zweigen und welken Blättern, der Baum, der gestern noch so lebensfrisch aufragte wie der Frühling selber.
Jetzt sei er eingegangen, sagte man.
Die Dryade war eingegangen, war hingefahren wie die Wolke, niemand weiß, wohin.
An der Erde lag eine welke, geknickte Kastanienblüte, das Weihwasser der Kirche vermochte sie nicht ins Leben zurückzurufen; der Menschenfuß zertrat sie bald im Kies.
Dies alles ist geschehen und erlebt. Wir sahen es selber, in der Ausstellungszeit in Paris 1867, in unserer Zeit, in der großen, wunderbaren Zeit des Märchens.
