MÄRCHEN AUS DEN BENELUXLÄNDERN ...
"Die Brüder vom guten Weingesicht" - 14 Kapitel
"Hondelingen"
"Jan, der Dieb"
"Die Frau von Stavoren"
"Von Piet Jan Clas, der den Tod suchte"
"Warum die Bachstelze einen zitternden Schwanz hat"
"Klein Däumchen"
"Das Reitpferd der Hexe"
"Die schöne Königstochter im Garten"
"Das Licht in der Nacht"
"Die singende Meerminne"
"Die weinende Mauer"
Die weinende Mauer
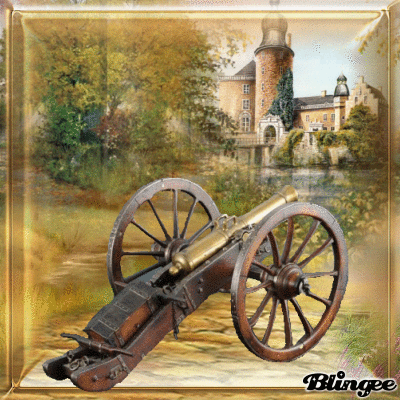
Etwa eine halbe Stunde nordöstlich von Barnich nach Steinfort hin stand ehemals auf einer Anhöhe ein gewaltiges Schloß, welches viele Jahrhunderte hindurch den heftigsten Stürmen der Elemente und
seiner Feinde siegreich widerstanden hatte. Das Schloß bestand aus sechs aneinander gebauten großen Türmen. In dem höchsten und stärksten derselben wohnte der Ritter mit seiner Familie, während
die fünf andren den Hauptturm schützend im Kreise umstanden und das Gesinde und die Reisigen beherbergten. Um die Türme herum lief eine sehr dicke Mauer, und ungeheure Tiefen umgaben das Ganze.
Weder Pfad noch Steg führten äußerlich sichtbar hinauf zu dem mächtigen Bollwerk, das trotzig jeden Verkehr mit der übrigen Welt zurückzuweisen schien. Nur auf einem geheimen unterirdischen Wege
gelangte man in das Innere der Burg, von deren stolzen Zinnen man weit ins Land hinein schauen konnte.
Vor etwa vierhundert Jahren gewährte der Schloßherr seinem Verwandten, dem Herrn von Rotburg, dessen Feste von einer aus Deutschland herüber gekommenen Kriegshorde an einem Tage zerstört worden
war, eine Zufluchtsstätte auf seinem Schloß. Ueber den Untergang seiner Feste näher befragt, erzählte der Rotburger:
»Eines frühen Morgens lagerten die Feinde auf der meiner Burg gegenüberliegenden Anhöhe. Bald darauf erschien ein Herold vor den Wällen meiner Feste und forderte mich gegen Recht und Billigkeit
zu gutwilliger Übergabe derselben auf. Selbstverständlich wies ich dieses Verlangen ganz entrüstet zurück, und der Herold verschwand. Kurze Zeit nachher flammte plötzlich ein Blitz bei den
Belagerern auf, ein furchtbarer Knall folgte, und eine unsichtbare Masse, bei deren Anprall die ganze Burg erbebte, riß ein großes Loch in den Wartturm. Unaufhörlich folgten Blitz und Knall
aufeinander, und ein Turm nach dem andern stürzte zusammen. Nicht einen einzigen Pfeil konnten wir der großen Entfernung wegen auf unsre Feinde abschießen; sie dagegen richteten gräßliche
Verheerungen unter meinen Leuten an. Die einen sanken tot, die andren gräßlich verstümmelt zu Boden und erfüllten die Luft mit ihrem Wehgeheul. Womit uns die Barbaren so furchtbar zusetzten, habe
ich nicht unterscheiden können.«
Ungläubig hatte der Schloßherr dem Rotburger zugehört. Als derselbe schwieg, sagte er schalkhaft lächelnd: »Lieber Vetter, du verstehst das Aufschneiden aber meisterhaft, und dein Märlein ist
nicht übel! Doch nun gestehe offen, daß du dich unklugerweise hast überrumpeln lassen; denn es ist und bleibt ein Ding der Unmöglichkeit, die festen Mauern einer Burg aus der Ferne zu
zertrümmern!« »Bei Gott! Ich habe die Wahrheit gesprochen, Vetter!« versetzte der Rotburger ernst. »Sei froh, wenn die Barbaren dich in Ruhe lassen, und die Ruinen deiner Burg nie die Wahrheit
meiner Worte zu bestätigen brauchen!«
»Laß sie nur kommen, deine Barbaren!« fuhr der Schloßherr lebhaft auf; »und du wirst sehen, daß sie unverrichteter Sache, so wie sie gekommen, wieder abziehen müssen. Diese Burg ist wie für alle
Ewigkeit gebaut, und Menschenkraft und Menschenlist werden ihr nie etwas anhaben können!«
»Das wünsche ich von ganzem Herzen!« erwiderte ruhig der Rotburger. »Doch Geduld, Vetter! Nach allem, was ich bei mir zu Hause erfahren, behaupte ich, daß es nunmehr mit der goldnen Herrscherzeit
unsrer Burgen und Schlösser zu Ende ist. Nichts, selbst die stärkste Feste nicht, vermag mehr den furchtbaren und heimtückischen Zerstörungsmitteln der Neuzeit zu trotzen. Sonst stritt Mann gegen
Mann; der Krieger war stolz auf seine Kraft, seine Stärke und seinen Mut; den Ruhm seiner Heldentaten verdankte er seiner persönlichen Tapferkeit, und begeistert zog er hinaus in den Kampf, der
immer etwas Großartiges an sich trug. Und jetzt! – Jetzt wirft ungesehen und aus der weitesten Entfernung ein schwacher Lausbub den tapfersten Ritter nieder! Glaube mir, Vetter, eine neue Zeit
ist angebrochen!« –
Wie mitleidig schaute der Schloßherr auf seinen Verwandten und dachte, bei dem sei es nicht mehr ganz richtig im Dachstübchen. Denn alles, was der Rotburger gesagt und erzählt, hielt er für
Faselei, da es ihm unbegreiflich und unmöglich schien. »Laß es gut sein, Vetter!« sagte er. »Da wir nun einmal verschiedner Meinung sind, so warten wir lieber ab, was die Zukunft uns bringen
wird!«
Einige Zeit darauf machte der Schloßherr in aller Frühe mit seinem Gaste einen Rundgang durch die Burg. Die Sonne war eben purpurn im Osten heraufgestiegen und ergoß ihre goldnen Strahlen über
die erwachende Landschaft. Hoch in dem blauen Äther begrüßte die Lerche trillernd das wohltätige Tagesgestirn, und unter dem schillernden Laubdach der Wälder sangen tausende von muntren Vöglein
zum Preise des gütigen Schöpfers ihr Morgenlied. Unzählige Insekten schwirrten summend durch das schimmernde Lichtmeer und nippten zum Frühtrunk hier und dort von den Millionen krystallhellen
Tautropfen, welche wie Perlen an den schlanken Gräsern glitzerten. Durch die Wohltat des milden Schlummerengels neugestärkt zog der Leibeigene hinaus, um im Schweiße seines Angesichtes den Acker
seines Herrn zu besorgen. Ueberall rührte und regte sich frischer Lebensmut.
Die beiden Ritter hatten den Hauptturm erstiegen, von dessen hohen Zinnen sie das erhabne Schauspiel, welches die Natur ihnen bot, in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit hätten bewundern
können. Doch dazu hatten beide weder Herz noch Sinn; sie achteten nur darauf, was sie in der Burg umgab und merkten nicht, wie dann und wann etwas in der Ferne seltsam aufblitzte und funkelte und
immer näher und näher kam. Plötzlich stieß der Turmwart ins Horn. Die beiden Ritter eilten an den Rand des Turmes und sahen einen bewaffneten Reiter, der sich schnell der Burg näherte und am
jenseitigen Rande des Abgrundes sein Pferd anhielt. Ueber den Grund seines Kommens befragt, verlangte derselbe im Namen seines Kriegsherrn die Uebergabe der Feste.
Der Schloßherr war über dieses ganz unbegründete Verlangen nicht wenig erstaunt und erwiderte hohnlachend: »Junger Mann, dein Herr muß doch ein gar sonderbarer Kauz sein! Mutet er mir zu, daß ich
ihm auf einige gute Worte hin meine Burg, die noch niemand bezwang, so ohne weiteres übergeben werde? Ha! ha! ha! Sieh, wie die Verteidigung schon durch die natürliche Lage der Feste so
vorteilhaft begünstigt wird! Hinter diesen eisenstarken Mauern wacht eine todverachtende Kriegerschar, und erprobte Wurfmaschinen halten siegreich jeden Sturm ab! Solang ein Tropfen Blut durch
unsre Adern rinnt, kann von Uebergabe keine Rede sein!«
»Eure persönliche Tapferkeit, die Stärke der Feste und der Löwenmut ihrer Besatzung, werter Ritter, sind uns bekannt!« versetzte der Reiter. »Allein wir haben furchtbare Angriffswaffen, denen
nichts zu widerstehen vermag. Verweigert nicht länger die Uebergabe, sonst fällt noch vor der Nacht das ganze Schloß in Schutt und Trümmer!« »Schweig', Grünschnabel!« polterte der Schloßherr, rot
vor Zorn. »Kein Wort mehr von Uebergabe! Wenn es deinen Herrn so sehr nach meiner Burg gelüstet, so komme er heran und stoße sich die freche Stirn an unsren Mauern ein!«
Der Reiter brach in ein schallendes Spottgelächter aus und rief: »Auf Wiedersehen, Herr Ritter! Eure Mauern schützen nicht mehr, als wenn sie bloß aus Käse oder Butter wären!« Dann wandte er
rasch sein Roß und sprengte in gestrecktem Galopp davon. Durch diesen Schimpf war der Ritter aufs äußerste gebracht. Er knirschte vor Ingrimm; drohend ballte er die Faust und sandte dem
Davonreitenden die gräßlichsten Verwünschungen nach.
»Was hältst du von den Worten des Buben, Vetter?« schrie er den Rotburger an. Dieser hatte inzwischen das seltsame Blitzen und Funkeln in der Ferne bemerkt und versetzte mit besorgter Miene:
»Schau', Vetter, dahinten kommt eine Abteilung bewaffneter Männer heranmarschiert! Sieh, wie ihre Waffen in der Morgensonne glänzen! Ich befürchte, du wirst es nun mit den nämlichen Hunden,
welche mein Schloß zerstörten, zu tun bekommen!« »Da ist halt nichts zu befürchten, Vetter!« sagte gereizt und trotzig der Burgherr. »Hier können wir getrost der Anstrengungen jener Raubgesellen
spotten; und kommen die Kerle uns zu nahe, so werden wir sie derart mit unsren Wurfmaschinen bearbeiten, daß die blauen Flecken noch nach der Auferstehung auf ihren Leibern sichtbar sein
sollen!«
Bald darauf gewahrten die beiden Ritter, wie die Feinde eine der umliegenden Höhen erstiegen und mühsam große eiserne Röhren hinter sich herschleppten. Auf dem Gipfel angelangt pflanzten sie die
Röhren nebeneinander in einer Reihe auf und richteten sie nach dem Schlosse hin. Beim Anblick des sonderbaren Kriegsgerätes und der in so großer Entfernung getroffenen Vorbereitungen begann der
Burgherr zu lachen und sagte zu einem der umstehenden Bogenschützen: »Von dort aus werden die Steine ihrer Wurfmaschinen uns nicht erreichen –!«
In demselben Augenblick sprühte es drüben flüchtig auf, ein fürchterlicher Knall erschütterte die Luft, und mit zerschmettertem Schädel stürzten der Bogenschütze und einer seiner Kameraden laut-
und leblos vor dem verblüfften Burgherrn nieder. »Ich habe die Tragweite und die Wirkungskraft der feindlichen Maschinen wahrlich unterschätzt!« sagte dieser. »Doch mit dem betäubenden Donnern
wird man uns bloß erschrecken wollen!« Dann eilte er hinunter nach den andren Türmen, um dort die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.
Inzwischen blitzte und brüllte es bei den Belagerern in einem fort, und die schwarzen eisernen Schlünde hörten nicht auf, Tod und Verderben zu speien. Mit Schmerz und Wut sah der Schloßherr, wie
die feindlichen Geschosse, von denen einige wie Feuer glühten, seine stolze Burg immer mehr und mehr zerrissen und zerstückelten und einen um den andren von seinen Getreuen niederstreckten. Unter
donnerndem Gekrach und Gepolter rollten die getroffenen Mauern in die Tiefe, und gierig fraßen schon züngelnde Flammen an dem dürren Holzwerk der Burg.
Trotz seiner verzweifelten Lage dachte der Schloßherr nicht an Uebergabe. Mit den wenigen Reisigen, welche ihm geblieben, eilte er nach dem großen Turm und glaubte sich dort in Sicherheit. Allein
noch ehe der Abend hereinbrach, stürzte auch dieses letzte Bollwerk, von einer Unmasse feindlicher Geschosse erschüttert, unter lautem Getöse zusammen.
Der Schloßherr war untröstlich, als er sah, daß seine gerühmte Feste nur mehr ein großer wehrloser Schutthaufen war. Sein Vetter und seine getreuen Reisigen lagen alle tot, erdrückt, zerquetscht
und zerstümmelt über und unter den rauchenden Trümmern; er selbst war auf den Tod verwundet. Unsägliche Bitterkeit erfüllte sein Herz; mühsam schleppte er sich bis an den Rand des Abgrundes und
rief: »Nun fahret hin, Tapferkeit und Manneskraft! Heldenmut und Klugheit, fahret hin! Die goldne Ritterzeit ist um und macht der Unmännlichkeit Platz! Ein elender Feigling kann jetzt den
tüchtigsten Kämpen bezwingen; ein armseliger Zwerg wirft den stärksten Riesen nieder, und ein Dummkopf wird fortan über unsre geschicktester Feldherrn triumphiren!« Dann brach er zornentflammt
sein Schwert entzwei, schleuderte den unter jubelndem Feldgeschrei heranstürmenden Feinden die beiden Stücke entgegen und stürzte sich kopfüber in den Abgrund.
So fand das unglückliche Schloß, das erste, welches in der Provinz Luxemburg durch Pulver und Kugel zerstört ward, seinen Untergang. Seitdem sickern krystallklare, aber bitterschmeckende
Wassertropfen aus einer schmalen Ritze unten an einem übriggebliebenen Mauerstück hervor. Das umwohnende Landvolk glaubt, das Schloß beweine noch immer seine grausame Vernichtung und nennt, den
noch stehenden Mauerstumpf »die weinende Mauer«
Nikolaus Warker: Sagen, Geschichten, Legenden und Märchen aus der Provinz Luxemburg
Die singende Meerminne
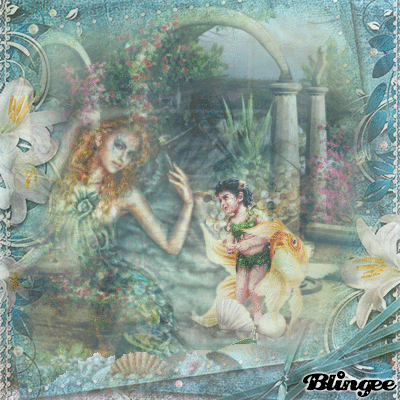
Es war einmal eine Fischersfrau, die wohnte mit ihrem einzigen Töchterchen in einem kleinen Haus am Meeresufer.
Das Mädchen spielte nirgends lieber als am Strand, wo die Wellen Muscheln und Schnecken, bunte Steine und fremde Pflanzen im gelben Sand zurückließen. Ganz besonders gern ging das Kind an den
Rand des Wassers und sprang mit beiden Füßen gleichzeitig über die Wellen, die vom Meer heranrollten.
Die Mutter, die Fischersfrau sah das nicht gerne. Sie konnte nicht vergessen, dass das Meer ihr einst – ein paar Jahre war es her – ihren Mann genommen hatte, und sie fürchtete, auch noch ihr
einziges Kind zu verlieren.
”Geh nicht so nah ans Wasser, Kind! Du weißt, das Meer ist tückisch. Es hat deinen Vater verschlungen! Bleib weg von dem trügerischen Wasser!” – Jeden Morgen ermahnte sie so das Kind und flehte:
”Geh nicht weiter als bis zum Rand der Düne!”
Doch sie hatte nicht die Zeit, immerzu auf das Kind aufzupassen, und so geschah es, dass es an einem Mittag nicht zum Essen nach Hause kam. Die Mutter wartete, sie rief, dann lief sie los und
suchte das Töchterchen überall. Sie lief meilenweit, sie lief durch die Dünen, sie befragte die Fischer – doch alles war vergebens.
Es wurde Abend, die Sonne versank hinter dem großen Meer, und die Frau kam allein zu ihrer Hütte zurück. Das Herz war ihr schwer.
Das Wasser stand hoch, die Wellen schlugen fast bis zum Rand der Düne.
Da vernahm die Fischersfrau plötzlich einen Gesang, einen wunderbaren Gesang. Was war das? Sie blieb stehen. Es kam vom Meer. Und dann sah sie eine Meerminne – ein Meerweibchen – mit langen
offenen Haaren voller Wasserblumen, wie sie die Frau noch nie gesehen hatte. Die Meerminne stieg bis zu den Hüften aus dem Wasser empor und sang:
”Ein Dach aus Wasser, ein Palast aus Kristall,
Da spielen meine Liebchen all.
Fischer, wirf deine Netze aus heute,
Der Walfisch kommt und sucht nach Beute.
Ein Dach aus Wasser, ein Palast aus Kristall....”
Die Fischersfrau hörte das und sie verstand die Worte. ”Ein Dach aus Wasser, ein Palast aus Kristall, da spielen meine Liebchen all. – Wer sind diese Liebchen? Ob mein Kind, ob mein Töchterchen
da wohl auch ist?” Die Frau fiel auf die Knie und flehte die Meerminne an: ”Sagt mir, habt ihr irgendwo mein kleines Mädchen gesehen, das alle Tage im Sand spielte?” ”Natürlich weiß ich, wo das
Mädchen ist. Es lebt gesund wie ein Fischchen in meinem Kristallpalast auf dem Grund des tiefen Wassers. Es ist vergnügt und spielt mit meinen anderen Lieblingen.”
Als die Mutter das hörte, begann sie noch lauter zu weinen und zu flehen: ”Bitte, gebt mir mein Kind zurück, meinen einzigen Schatz!” Und sie schluchzte herzerweichend. ”Ich kann deinen Schmerz
verstehen, Fischersfrau, und ich habe wohl Mitleid mit dir. Doch die See darf keine Menschenseele, die sie einmal genommen hat, an die Erde zurückgeben. Was das Meer verschlungen hat, kann nicht
lebend zurückkommen. Das einzige, was ich für dich tun kann: Ich kann dir erlauben, mit mir zu meinem Wasserschloss hinunterzukommen, dann kannst du dein Mädchen noch einmal sehen. Aber hast du
auch den Mut, mir zu folgen, hundert Stunden weit über das Wasser, dort nach dem Horizont im Westen, und dann mit mir niederzutauchen, wo die See am tiefsten ist.?” – ”Ja, das getrau ich micht
wohl. Ich bin bereit euch zu folgen.”
Da kam die Meerminne bis an den Rand der Düne und ließ die Fischerswitwe sich auf ihren Schuppenschwanz setzen. So fuhren sie über das Wasser dahin, schneller als das schnellste Schiff. Längst
war es dunkle Nacht über der ganzen endlosen See, und noch immer fuhren sie weiter fort, weiter nach Westen.
Endlich sahen sie aus der Tiefe ein wunderhelles Licht aufscheinen. Die Meerminne hielt an. ”Hier ist es. Nun hole noch einmal tief Atem und fasse Mut. Wir steigen nun hinab!”
Und schon sanken sie in die Tiefe. Das ging noch viel schneller als die Seereise. In wenigen Augenblicken waren sie in dem herrlichsten Palast, von dem ein Mensch je träumen konnte. Er war so,
wie die Meerminne gesungen hatte: Das Dach war von Wasser, die Mauern aus Kristall. Und ein himmliches goldenes Licht strahlte davon aus und leuchtete viele Stunden weit. Die arme Mutter aber
hatte keine Augen für all diese Pracht. Sie dachte nur an ihr Kind und sah sich überall danach um. Aber nein, da war keine Menschenseele zu sehen.
Nun brachte die Meerminne sie in einen großen Saal mit einem silbrigen Boden und führte sie an eine schöne gläserne Tür. Da hindurch erblickte sie in einem großen Saal Scharen von Kindern,
Mädchen und Jungen, die fröhlich herumsprangen und spielten. Hindurchgucken durfte die Mutter und schauen solange sie wollte; doch hineingehen war ihr verboten. Sie schaute und schaute und
endlich erblickte sie ihr Töchterchen inmitten einer Gruppe lachender Mädchen. Es hatte Wangen so rot wie Winteräpfel und war ebenso fröhlich wie die anderen.
Nun war die Fischerswitwe überglücklich und sie bat die Meerminne. ”Bitte, lasst mich hier in deinem Schloss bleiben, dann bin ich wenigstens in der Nähe meines Töchterchens!” Das wurde ihr
erlaubt. Fortan konnte sie alle Tage durch die Glastür schauen, sooft und solange sie Lust hatte, und ihre Augen konnten nicht genug davon bekommen.
Jeden Tag fiel sie vor der Meerminne auf die Knie und bat und flehte: ”Ach, bitte, gebt mir mein Kind zurück! Lasst uns wieder nach Hause gehen! Ihr habt doch so viele andere Kinder!” Doch die
Meerminne blieb bei dem, was sie gesagt hatte. Schließlich aber wurde ihr Herz gerührt und sie sprach: ”Ich werde dir das Kind zurückgeben, aber erst noch musst du eine Bedingung erfüllen.”
”Sagt, was es ist! Alles, was in meinen Kräften steht, will ich gerne tun.”
”Du sollst mir einen Mantel aus deinen eigenen Haaren weben. Ich gebe dir hier ein Töpfchen mit Fett, das bewirkt, dass dein Haar wieder rasch und kräftig nachwachsen wird.”
Die Mutter begann sogleich zu arbeiten und zu weben, sie arbeitete Tag und Nacht, ohne sich auszuruhen. Doch als sie alle ihre Haare bis an die Wurzel abgeschnitten und verwebt hatte, da war der
Mantel erst halb fertig. Was sollte sie nun tun, weiterweben konnte sie nicht, sie hatte kein Haar mehr. Aber vielleicht gibt sich die Meerminne mit einem halben Mantel zufrieden? – Doch all ihr
Flehen und Bitten half nichts. Die Meerminne hatt immer nur eine Antwort: ”Es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Erst musst du mir den ganzen Mantel weben.”
Die arme Muttter ging zurück in ihre Kammer, schier verrückt vor Verzweiflung. Sie musste nun warten, warten bis ihr Haar wieder gewachsen war. Jeden Morgen und jeden Abend rieb sie es sorgfältig
mit dem Fett ein, das die Meerminne ihr gegeben hatte, und immer wieder sah sie in den Spiegel. Waren die Haare schon lang genug gewachsen?
Endlich konnte sie weiterweben, dann musste sie wieder warten, dann konnte sie wieder weben und wieder warten. So ging das Jahr um Jahr – und dann endlich war der Wundermantel fertig bis zum
letzten Saume. Die Fischersfrau sprang auf und eilte damit zur Meerminne. Die prüfte den Mantel sorgfältig. – Der Mutter klopfte das Herz, als wolle es die Brust sprengen. – Endlich sah die
Meerminne auf und lobte die wunderbare Arbeit.
”Nun komm!” Sie führte die Mutter zu der gläsernen Tür, die wurde aufgetan und heraus trat das Töchterchen. Das war inzwischen zu einen großen schönen Mädchen herangewachsen und fiel der Mutter
in die Arme. Die war so froh, so glückselig, das lässt sich nicht mit Worten beschreiben! Nun ließ die Meerminne ein prächtige Kutsche kommen, spannte zwei Seepferdchen davor und fuhr die Mutter
mit ihrem Kinde über das große Wasser zurück nach Hause.
Märchen aus Flandern
Das Licht in der Nacht

Willem lauschte angestrengt. Was hatte es doch für eine Bewandtnis mit diesem güldenen Schatz? War es der Schatz des Meeres, von dem ihm sein alter Ohm Pieter, als er noch Kind war, oft erzählt
hatte? Ja, der alte Ohm hatte oft von einem güldenen Schatz erzählt; es mußte derselbe sein, von dem die Meerminne sang. Willem stand noch immer mit festgeschlossenen Augen; er fühlte wie der
schwere Nebel auf seine Lider drückte. - Jetzt erinnerte er sich genau der Einzelheiten der Geschichte. Wenn Ohm Pieter mit seinem Vater vom Fischfang zurück war, frühzeitig von den ziehenden
Nebeln heimgetrieben, dann brachte er seine lange Tonpfeife in Brand, setzte sich vor das steinerne Haardvuur der Diele, auf dem die Flammen züngelten, nahm ihn, den kleinen Willem, auf den Schoß
und erzählte. Willem hörte in seiner Versunkenheit wieder den alten Ohm sprechen:
"In einer nebligen Nacht zog auf Geheiß des Schwedenkönigs Karls XII., der zwar ein schrecklicher Despot war, doch der weiseste aller nordischen Herrscher, der Seeräuber Jan Bröeuk mit seiner
Piratenflotte heimlich gegen die niederländische Küste. Eingangs des Zuidersees am Helda lagen in der Seefeste Van die aufgestapelten Kronschätze Schwedens, die einst von den Niederländern
geraubt worden waren. Nach erbittertem Kampf zog sich Jan Bröeuk in den Nebel zurück. Er hatte den Schatz auf seinem Schiffe. Aber der schwere Schatz konnte die von Kugeln durchlöcherte und
zersplitterte Kokke auf den Grund des Meeres ziehen. Angelockt von dem Glanz, von der leuchtenden Pracht kamen die Fische und Geister des Meeres. Wenn nun die Nebel über den See ziehen, sucht die
Wasserfei ein irrendes Fahrzeug, um die Menschen in ihrer Gier nach dem Golde zu strafen. Die Fische und Geister in ihrem Dienste tragen den Schatz zu den Menschen aufs Schiff, das unter der
schweren Last versinken muß. - Oft schon traf es einen, der schuldlosen Herzens alle Reichtümer der Welt verlachte. Das ist der Spuk des güldenen Schatzes, wenn die Nebel wallen."- Wieder hörte
Willem die Meerminne singen:
Hohö, hohö, der Schatz vom See,
Der güldene Schatz ist dein!
Erschrocken riß Willem seine Augen auf: Der güldene Schatz aus dem See lag aufgehäuft auf dem Deck seines Kahnes und zwischen Kronen und Armspangen, goldenen Schwertern und Bändern saß ein
Nickelmann mit einem Hechtkopf und glotzte ihn an. Wiethen, häßliche Grätenfische, tanzten mit kleinen Elfen, Froschmänner faßten nach den Irrwischen und wiegten sich im Ringelreihn; um all das
wob die Nebelfee wallende Schleier. An dem Steuer, fast auf Willems Schoß, saß die wunderschöne Wasserfei mit silbernen Fäden im Haar. Ihre Augen waren grüne Smaragden und ihre Lippen rote
Korallen. Willem drückte Antjes Tulpenstrauß noch fester an sich. Sie aber blies seine Laterne aus, umschlang ihn und küßte ihn. Dem armen Willem grauste vor der kalten schuppigen Fischhaut der
grünen Nixe und er dachte immerzu an Antje. -
Antjes Herzeleid war groß. Willem war nicht wiedergekommen. Unentwegt saß sie oben am Ausguck ihrer Mühle und lugte aus. - Das Licht in der Nacht blieb verschwunden. Doch eines Abends war es ihr,
als steige fern aus dem Wasser ein Licht, als stiege es höher und höher und bliebe als heller Stern am Himmel stehen. - "Armer Willem!" seufzte Antje, und das kleine wehe Herz sprang ihr aus der
Brust in die Mühlsteine.
Quelle: Niederlande
Die schöne Königstochter im Garten
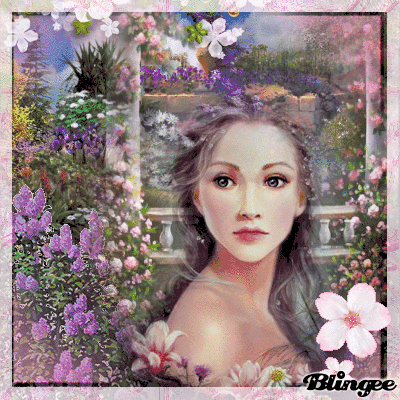
Eine arme Frau hatte drei Söhne und keinen Mann und auch nichts zu essen und das tat ihr so weh, so weh, dass sie meinte, das Herz im Leibe müsste ihr zerspringen vor lauter Jammer und Not, und sie setzte sich hin und weinte bittere Tränen. Als die drei Söhne das sahen, da tat es ihnen leid und der Älteste sprach zu seiner Mutter:
Moeder, geef me 'ne koeck,
Lapp me mijn broeck,
Ik zal uit reizen gaan."
(Mutter, gib mir einen Kuchen, flicke mir meine Hose, ich will auf Reisen gehn.)
Da gab ihm die Mutter einen Kuchen und flickte ihm seine Hose und er ging weg und kam in einen großen Wald; und darin ging er immer weiter und weiter, bis es stichdunkel geworden war. Da kletterte er auf einen hohen Baum und sah, wie von fern ein ganz kleines Lichtlein schimmerte; auf das Lichtlein ging er zu und wandelte die ganze Nacht, und als es Morgen geworden war, da stand er vor einem wunderschönen Schloss, das glänzte, als wenn es von lauter Diamanten gewesen wäre.
Weil das Tor nun offen stand, ging er hinein und kam in einen Garten; aber der war so schön, oh so schön, wie noch kein Mensch in der ganzen Welt einen gesehen hat. Wo er nur hinschaute, da standen Blumen und Bäume mit Äpfeln und Birnen und goldenen Nüssen und er hatte so große Freude daran, dass er immer weiter darin fort ging, bis er an das Ende kam, wo er eine Königstochter sitzen sah, die von so großer Schönheit war, dass er im ersten Augenblicke glaubte, es wäre ein Englein aus dem Himmel.
Er zog höflich sein Käpplein und sprach: „Gott grüß euch, schöne Jungfrau!" „Schönen Dank“, antwortete die Königstochter. „Aber sage mir nun auch, was dir am Besten gefällt in meinem Garten." Darauf antwortete der Älteste: „Ach, schöne Jungfrau, das sind die lieben Blümlein." — „Ei, du dummer Tölpel“, sprach da die Königstochter, „weißt du nichts Schöneres, dann marsch fort mit dir in den Keller!" und mit dem nahm sie ihn beim Kragen und setzte ihn in den Keller.
Als der Älteste nun nicht wiederkehrte, da sprach der Zweite zu seiner Mutter:
„Moeder, geef me 'ne koeck,
Lapp me mijn broeck,
Ik zal uit reizen gaan."
(Mutter, gib mir einen Kuchen, flicke mir meine Hose, ich will auf Reisen gehen.)
Da gab ihm die Mutter einen Kuchen und flickte ihm seine Hose und er zog fort und immer weiter bis in den großen Wald und endlich auch bis an das Schloss; da ging er hinein und rund herum in dem Garten, bis er an die Laube kam, wo die schöne Königstochter saß. „Gott grüß euch, schöne Jungfrau“, sprach er.
„Schönen Dank“, antwortete die Königstochter; „aber sage mir nun auch, was dir in meinem Garten am Besten gefällt." Darauf antwortete der Zweite: „Ach, schönste Jungfrau, das sind die roten Äpfel und die gelben Birnen und die goldenen Nüsse." — „Ei, du dummer Tölpel“, sprach da die Königstochter, „weißt du nichts Besseres, dann marsch fort mit dir in den Keller“; und sie fasste ihn am Kragen und setzte ihn in den Keller.
Als der Zweite nun auch nicht zurückkehrte, da beschloss der Jüngste, sein Glück auch einmal zu versuchen, und er sprach zu seiner Mutter:
„Moeder, geef me 'ne koeck,
Lapp me mijn broeck,
Ik zal uit reizen gaan."
(Mutter, gib mir einen Kuchen, flicke mir meine Hose, ich will auf Reisen gehen.)
Da gab ihm die Mutter einen Kuchen und flickte seine Hose und er zog aus und kam gleichfalls in den Wald und an das schöne diamantene Schloss. Er verwunderte sich über die Maßen ob der schönen Blümelein und der lachenden Früchte, bekam auch wohl Lust, einmal davon zu kosten, doch bezwang er sich und ging immer fort, bis er von ferne die Königstochter erblickte.
„Nein“, sprach er da zu sich selbst, „ein so bildschönes Mädchen habe ich doch in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen“, und er zog sein Käpplein und trat ihr naher und grüßte sie höflich: „Gott grüß euch, schöne Jungfrau!" „Schön Dank“, entgegnete die Königstochter; „aber sage mir doch, was dir in meinem Garten am Besten gefällt." —
„Ach, das seid ihr, schöne Jungfrau, denn neben euch sieht man keine Blümlein und keine Äpfel und nichts“, sprach der Jüngste schnell. Da fiel die Königstochter ihm um den Hals und sprach: „Du bist mein und ich bin dein und du bist mein lieber Mann“, und sie führte ihn in das Schloss und am anderen Tage wurde die schöne Königstochter seine Frau und sie lebten zufrieden und glücklich miteinander.
Das Reitpferd der Hexe

In alten Zeiten kamen die Hexen jede Nacht auf der Köricher Heide zusammen, schürten ein großes Feuer an und tanzten im Kreise herum, erzählten sich ihre Abenteuer und ritten dann wieder nach
Hause. Es waren diese Hexen aber auch Frauen aus der Umgegend.
Eines reichen Bauern Frau, welche auch Hexe war, kam jede Nacht zwischen elf und zwölf Uhr mit einem großen Zaum in das Schlafzimmer der beiden Knechte, von denen der jüngere vorn im Bette lag,
der ältere aber hinten. Sie warf dem jüngeren den Zaum über den Kopf und sofort war er in ein schönes, graugeflecktes Pferd verwandelt. Sie schwang sich auf dasselbe und im Galopp ging's fort
über Hecken und Steine zur Versammlung auf der Köricher Heide. War der höllische Spuk zu Ende, so bestieg sie wieder ihr Pferd und ebenso schnell, wie sie gekommen, kehrte sie nach Hause zurück.
Dort streifte sie dem Pferde den Zaum ab und es war wieder der junge Knecht.
Der arme Kerl wurde durch diese nächtlichen Fahrten so schwach und abgemagert, dass es dem größeren Knechte auffiel und dieser ihn nach der Ursache fragte. Da erzählte jener, was die Hexe
nächtlich mit ihm mache. Der Großknecht riet ihm, während der Nacht die Hände rückwärts über den Kopf zu legen und wenn die Frau nahe, um ihm den Zaum umzuwerfen, ihr selber denselben über den
Kopf zu werfen. So tat er in der nächsten Nacht und im Nu war die Hexe in ein Pferd verwandelt.
Der Knecht schwang sich auf dessen Rücken und ritt auf die Köricher Heide. Die Hexen konnten ihm nichts anhaben, da er auf dem Hexenpferde saß, und so machte er ihre Sprünge mit, kehrte wieder
nach Hause zurück und stellte das Pferd in den Stall. Den nächsten Morgen ging der Großknecht zum Meister und teilte ihm mit, es stehe ein Pferd im Stall, welches die Meisterin selbst sei.
Da merkte der Meister, dass seine Frau ihm ein Bund Stroh ins Bett gelegt habe und nicht im Hause war. Er führte das Pferd zur Schmiede, unter Begleitung des Bürgermeisters und des Pastors,
welcher ihn segnete, damit ihm kein Leid geschehe, und als der Schmied dem Pferde die Hufeisen abgenommen hatte, stand des Bauern Weib vor ihnen. Sie musste nun alle ihre Mitgenossinnen angeben
und so wurden alle Hexen der Umgegend auf der Köricher Heide verbrannt.
Sage aus Luxemburg
Klein Däumchen
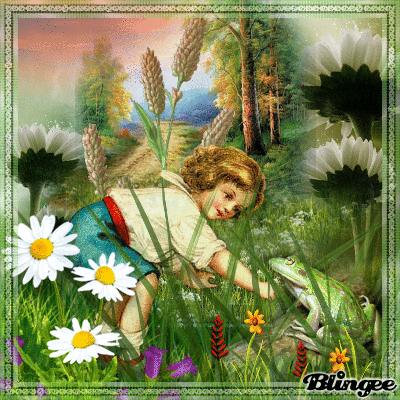
Es war einmal eine blutarme Frau, die hatte nichts auf der Welt als ein kleines Hüttchen und ein altes Tischchen und ein zerbrochenes Stühlchen und ein Söhnchen, und das war so klein, so klein, dass es nicht größer war als ein Daumen; darum hatte die Mutter es auch klein Däumchen geheißen.
Eines Tages wusste die arme Frau nicht, was sie kochen sollte, und da sprach sie in sich hinein: „Ach hätte ich doch ein Pfund Mehl, ich möchte mir so gerne einen Kuchen backen!" Das hatte klein Däumchen gehört, denn es saß zufällig in der Schürzentasche seiner Mutter; und es sprang flink heraus und sprach: „Nichts mehr als das, liebe Mutter? Das will ich schon schaffen“; und damit hüpfte es weg und lief in einen Laden und stahl sich dort ein Pfund Mehl.
Als es das nach Hause brachte, da war seine Mutter über die Maßen froh und sprach: „Ja, das ist wohl schön und gut, aber wenn ich Kuchen backen soll, dann muss ich auch Butter haben." —
„Hoho, nichts mehr als das?“, fragte Däumchen. „Die will ich schon schaffen“, und es hüpfte fort und in einen anderen Laden, wo es ein Pfund Butter stahl.
Als es dies seiner Mutter getragen brachte, da freute sich die arme Frau noch mehr, aber sie schüttelte doch noch den Kopf und sprach: „Mehl und Butter haben wir nun, aber um den Kuchen zu backen, muss ich auch noch eine Pfanne haben." —
„Ei, nichts mehr als das“, lachte Däumchen, „die will ich schon schaffen“; und es lief eilig in Nachbars Eisenladen und schnitt ritsch, ratsch eine Kordel durch, woran eine Pfanne hing, und rannte damit nach Hause zurück. „Nun fehlt nur noch eins“, sprach die Mutter da; „ich müsste auch noch Holz haben."
„He, nichts mehr als das“, sprach Däumchen, „das Holz will ich wohl schaffen“, und mit den Worten sprang es weg und in den Wald, um da selbst Holz zu lesen. Als es aber eben am Suchen war, da hörte es plötzlich viele Menschen sprechen.
„Halt“, dachte es, „das sind Räuber und vor denen muss ich mich verstecken; sonst sind sie im Stande und machen mich tot und dann kann ich kein Holz suchen und meine Mutter kann keinen Kuchen backen“; und indem es das sprach, versteckte es sich unter einem Wegerichblatt.
Die Räuber hatten Däumchen auch nicht gesehen; sie kamen aber immer näher und näher, wo der Wegerich stand, und als sie endlich ganz nahe waren, da tat der Eine von ihnen einen unglücklichen Tritt auf das Blatt und trat Däumchen tot, und so konnte es seiner Mutter kein Holz bringen und die konnte keinen Kuchen backen und die ganze Geschichte war aus.
Warum die Bachstelze einen zitternden Schwanz hat
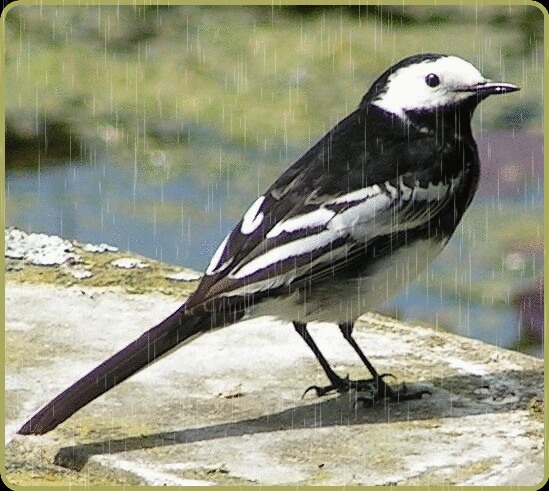
Eines Tages, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, hatten die Vögel den vierfüßigen Tieren den Krieg erklärt. Als nun die Schlacht geschlagen werden sollte, befand sich die Bachstelze in der
vordersten Reihe, und kurz ehe der Kampf begann, blickte sie sich noch einmal um und wollte sehen, wie stark das Heer der Ihrigen sei.
Aber ach! Fast alle ihre Kampfgenossen waren winzig klein im Vergleich zu den Feinden. Da klopfte ihr das Herz so, daß ihr Schwanz zu zittern anfing und auf und ab wippte. Obgleich damals die
Vögel siegten, so denkt die Bachstelze noch heute an diesen Tag der Angst, besonders wenn sie sich auf die Erde niederläßt; dann kommt jedesmal die Furcht wieder über den kleinen Vogel, und man
sieht seinen Schwanz auf und ab wippen.
Flämisch: Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Volksmärchen
Von Piet Jan Clas, der den Tod suchte
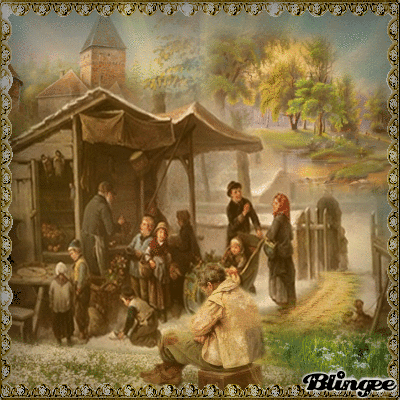
Es war einmal ein Mann, der hieß Piet Jan Clas, und der war so neugierig, oh, so neugierig, dass es nicht zu sagen ist. Eines Tages nun hörte er zufällig von dem Tode sprechen und die Leute sagten, das wäre zwar ein gar hässlicher und grimmiger Kerl, aber gerecht dabei! Wie kein anderer.
Als Piet Jan Clas das hörte, da dachte er bei sich: „Ach, den Tod möchte ich doch gern einmal sehen, das muss ein kurioser Kauz sein“; und damit ging er nach Hause und nahm seinen Stock und setzte seinen dreikantigen Hut auf und machte sich auf den Weg.
Als er nun schon weit gegangen war, da kam er in eine Stadt und sah da einen Schuhladen voll Schuhe und der Schuster saß an der Türe und machte immer noch neue Schuhe. „Guten Morgen, Meister“, sprach er und der Schuster dankte, ohne jedoch von seiner Arbeit aufzusehen.
„Was macht ihr da Gutes?“, fragte Clas. „Wie ihr seht, Schuhe und immer Schuhe“, antwortete der Meister und stach mit der Pfrieme ein Loch und zog, „Krrrr“, den Pechfaden durch. „Aber ihr habt ja schon so viel fertig da stehen“, sprach Clas weiter, „warum macht ihr denn noch immer neue?"
„Ah, um sie zu verschleißen und zu verkaufen und meine Frau und Kinder mit dem Gelde zu ernähren." „Krrrr!“ „Und wenn ihr das denn nun getan habt, was dann?“, fragte Clas weiter, und der Schuster entgegnete: „Ei, dann lege ich mich aufs Ohr und dann kommt der Tod und holt mich ab. „Krrrr!“ „Der Tod?“, schrie Clas verwundert, „Ach, lieber Meister, tut mir doch um Gottes willen den Gefallen und sagt mir, wo ich den finde. Habt ihr ihn nie gesehen?"
„Nein, nein“, lachte der Meister, „und dafür danke ich unseren lieben Herrgott, bin auch nicht gar neugierig darum." „Wo könnte ich ihn denn finden?“, fragte Clas und der Schuster sprach schmunzelnd: „Geht nur gerade aus und immer weiter eurer Nase nach, da findet ihr ihn vielleicht." Clas bedankte sich für den guten Bescheid und ging fröhlich weiter den ganzen Tag und die ganze Nacht und den folgenden Tag bis Mittag.
Da begegnete er in einem Walde einem Bauer, der hatte schon einen ganzen Wagen voll Holz gehauen und hieb noch immer mehr. „Aber sag mir doch, Bruderherz“, sprach Clas, nachdem er den Bauer gegrüßt und der ihn wieder gegrüßt hatte, „was willst du denn eigentlich mit all dem Holze anfangen?" —
„Ei“, sprach der Bauer, „ich binde Bündel daraus, die ich im Winter brenne, und was ich für mich nicht nötig habe, das verkaufe ich und hole mir Brot und Fleisch von dem Geld; so bring ich mein Leben hin bis zu meinem seligen Tode." Apropos (übrigens)“, fiel Clas ein, „mit dem Tod; wisst ihr nicht, wo der sich wohl aufhält und herumtreibt, ich möchte ihn so gern sehen, dass mir der Bauch weh tut."
„Da kann ich euch nicht dienen, Freund“, sprach der Bauer; „aber geht einmal ganz gerade aus, es ist möglich, dass ihr ihn antrefft." Clas dankte fein höflich für den Bescheid und ging weiter und weiter, immer geradeaus, bis er abermals in eine Stadt kam.
Da saß ein Schneider in einem schönen Hause auf dem Tische und nähte und um ihn herum war alles voll Kleider, so dass kein Fleckchen Wand blieb, wohin auch nur eine Fliege sich hätte setzen können. „Was tut ihr doch mit all den Kleidern“, fragte Clas, nachdem er eine Zeit lang das Haus angestaunt hatte.
„Die verkaufe ich“, antwortete der Schneider, „die wollenen im Winter, die linnenen im Sommer und die baumwollenen im Frühling und Herbst." „Und wenn ihr die dann verkauft habt?“, fragte Clas. „Nun, dann nähe ich wieder neue“, brummte der Schneider verdrießlich, „und die verkauf ich wieder und nähe noch einmal neue und verkauf' sie abermals, bis der Tod kommt." —
„Dann könnt ihr mir gewiss auch sagen, wo ich den Tod finden kann; nicht wahr, Meister?" fuhr Clas neugierig fort, aber der Schneider sprach, er solle sich nur geschwind aus der Tür machen, denn die Schneidermeister wären nicht gar gut Freund mit dem Tode, der hole ihnen zu viel Kunden weg.
„Das ist ein grober Kerl“, dachte Piet Jan Clas und ging seiner Nase nach weiter und als er wieder lange gegangen war, da kam er in einen Wald, der so groß war, dass man kein Ende davon sah.
Er schritt aber gütig hinein und fand dort einen Einsiedler mit langem, greisem Bart, kahlem Kopf, einer dicken groben Kutte und einem Rosenkranze in der Hand. „Ach“, dachte Clas, „wenn das nicht der Tod ist, dann weiß er mir doch sicherlich Bescheid davon zu geben“, und ging auf den Einsiedler zu und grüßte ihn und der Einsiedler grüßte Clas wieder und Clas fragte:
„Was tut ihr denn hier allein in der Einsamkeit; da wüsste ich nichts Angenehmes dran zu finden, so allein zu sein." „Ach“, sprach der Einsiedler, „ich habe mich von den Menschen abgesondert, um Gott besser dienen zu können und wohl vorbereitet zu sein, wenn der Tod kommt, um mich …"
„Ja, wegen dem Tode wollte ich euch just fragen“, fiel ihm Clas in die Rede, „den möchte ich für mein Leben gern einmal sehen; könnt ihr mir vielleicht dazu verhelfen?" — „Den Tod kann man nur einmal sehen“, antwortete der Einsiedler, „aber wollt ihr ihn sehen, nun so geht weiter, jeden Abend seit ihr ihm einen Tag näher."
Das gefiel Clas und er dankte dem Einsiedler aus vollem Herzen und sprach, als er die Klause eben aus den Augen verloren hatte, zu sich selbst: „Das nenne ich mir doch einmal einen vernünftigen Bescheid, nur wird es mir jeden Tag zu lang werden, ehe es Abend ist; aber ich hab es dem Alten gleich angesehen, dass er es wusste."
So schritt er munter fort über Berg und Tal, durch Wald und Wiese, bis er eines Abends in der Ferne ein großes Schloss sah; da ging er darauf zu. Als er an das Tor gekommen war, stand da ein Stein, Steinaltes Mütterchen, die war so mager, dass man jedes Knöchelchen an ihrem Leibe zählen konnte; dabei hatte sie feuerrote Augen, ganz eingefallene hohle Backen und eine dicke Hängelippe; auf ihrem Rücken saß ein dicker Buckel und darauf stand ein Korb voll Fläschchen und Salbentöpfchen; außerdem hatte sie ein großes Messer an ihrer Seite hängen.
„Das könnte leicht der Tod sein“, dachte Clas und trat zu ihr und zog seinen Dreispitz und sprach: „Gott grüß euch, Mütterchen." „Schönen Dank, mein Söhnchen“, sprach die Alte. „Ach, liebes Mütterchen, seid ihr nicht der Tod?“, fragte Clas alsdann. „Nein, im Gegenteil“, antwortete sie, „ich bin das Leben und heile mit meinen Salben und Medizinen alle Schäden und Wunden und Krankheiten." —
„Das ist doch schade“, sprach da Clas, „ich hatte schon so große Freude, indem ich dachte, ihr wärt der Tod; ich reise nun schon so lange über Berg und Tal, durch Wald und Wiese, um ihn zu suchen, und ich finde ihn nirgends; könntet ihr mir ihn nicht zeigen?" —
„Doch das kann ich wohl“, sprach die Alte. „Ach, lieb, lieb Mütterchen, dann tut das doch!“, rief Clas entzückt aus; „ich bitte euch um alles in der Welt, ihr könntet mir keinen größeren Gefallen erweisen." — „Ja, das will ich gern“, sprach das Mütterchen, „zieh dich nur vorerst ganz splitternackt aus."
Da warf Clas voller Freude Hut und Stock und Kittel hin und zog sich alsdann auch die übrigen Kleider vom Leibe. Als das geschehen war, da sprach das Mütterchen: „Nun knie dich nieder und leg deinen Kopf in meinen Schoß“, und als er das auch getan hatte, da nahm sie ihr scharfes Messer und schnitt ihm den Kopf ritsch ratsch ab, drehte ihn ganz geschwind herum und setzte ihn wieder so auf, dass das Gesicht nach dem Rücken gekehrt war.
Im selben Augenblicke sprang Clas auf und schrie ganz jämmerlich: „Oje, oje, oje! o weh! Hilfe, Hilfe! Oh rettet mich! Helft mir aus der grausamen Not! Oh was sehe ich für gräuliche Sachen!" Das alte Mütterchen hörte aber nicht darauf und ließ ihn zwei Stunden lang mit dem Gesichte auf dem Rücken.
„Du wolltest ja den Tod sehen, nun siehst du ihn“, sprach sie. Clas ermattete aber dermaßen von all dem Schrecken, den er ausstand, dass er endlich ohnmächtig zusammenfiel und kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Als die Alte das sah, schnitt sie ihm den Kopf wieder ab und setzte ihn wieder zurecht, strich ein bisschen Salbe aus einem ihrer Töpfchen auf die Wunde und in zwei Minuten war sie heil und Piet Jan Clas wieder so gesund wie vorher.
„Hast du nun den Tod gesehen?“, fragte das Mütterchen. „Ja, das sei Gott geklagt“, sprach Clas, „das ist nicht zum Spaßen“; und er zog sich so schnell, wie er konnte, an und lief, was er konnte, nach Haus zurück.
Die Frau von Stavoren

Einst war Stavoren eine reiche Stadt, berühmt für ihre Kaufleute und Kapitäne, über die Nord- und Ostsee brachten sie ihre Schätze nach Hause und erwarben große Macht, bis die Ströme ihren Lauf
veränderten und anderen Städten Reichtum brachten. Stavorens Ruhm verblasste und mit dem Wohlstand ging auch der Stolz dahin. Davon berichtet die alte Sage "Die Frau von Stavoren":
Einst wohnte in Stavoren eine reiche Kaufmannswitwe. Eines Tages beauftragte sie ihren Kapitän, ihr das Kostbarste zu bringen, das auf der ganzen Erde zu finden sei. Nach einer langen Reise
kehrte der Kapitän zurück, das Schiff voll beladen mit dem herrlichsten Weizen, den er jemals gesehen hatte.
Erwartungsvoll stand die Witwe am Kai. Als sie sah, daß die Ladung nur aus Weizen bestand, geriet sie außer sich vor Zorn. Erbost befahl sie dem Kapitän, die Ladung über Bord zu werfen.
Während der Weizen im Meer verschwand, rief ein alter Seemann: "Euer Hochmut wir bestraft werden. Es wird eine Zeit kommen, da ihr um euer Brot betteln werden müßt". Die Witwe nahm ihren goldenen
Ring, warf ihn in die Wellen und sagte: "Sowenig dieser Ring wieder aus dem Meer auftauchen wird, so wenig werde ich am Bettelstand landen".
Bald darauf fand die Witwe ihren Ring in einem Schellfisch wieder, der ihr zum Mittag serviert wurde. Am selben Tag erhielt sie die verhängnisvolle Nachricht, daß alle ihre Schiffe mit Mann und
Maus untergegangen waren. Von diesem Schlag erholte sie sich nie wieder. Vor dem Hafen entstand eine Sandbank. "Het Vrouwenzand" Angeblich wuchsen dort Getreide, Körner fand man jedoch nie in den
Ähren.......
So steht die Geschichte bis heute am Wahrzeichen von Stavoren geschrieben "De Vrouw van Stavoren".
Quelle: Niederlande
Jan der Dieb

Es war einmal eine blutarme Frau, die hatte nur einen Sohn namens Jan, aber der machte ihr nicht viel Freude, denn er war so langfingerig, dass er von allen, die ihn kannten, nicht anders geheißen wurde, als Jan der Dieb.
Die Frau hielt ihm häufig vor, dass er sein Leben ändern und sich bessern müsse, wolle er nicht zuletzt mit Seilers Tochter Hochzeit halten, aber das half alles nichts und Jan blieb stets der Alte. Der letzte und einzige Trost, der dem armen Weib blieb, war unser lieber Herrgott; alle Tage sah man sie in der Kirche, wo sie um nichts anders betete, als dass Gott doch ihrem Jan einen anderen Sinn geben solle.
Einmal hatte sie auch wieder lange gebetet und geweint; endlich seufzte sie wie in halber Verzweiflung: „Ach, ach, was soll aus meinem Jan doch noch werden!" Der Küster saß aber zufällig hinter dem Altar und als er den Seufzer hörte, antwortete er: „Dieb, großer Dieb, allzeit Dieb."
Da erschrak die arme Frau über die Maßen, denn sie meinte, unser Herrgott selber hätte ihr das zugerufen; doch fasste sie sich bald und sprach: „Herr, dein Wille geschehe" und ging mit rot geweinten Augen nach Haus. Da kam Jan ihr just entgegen; als er ihre Augen ansah, fragte er, warum sie denn wieder so betrübt wäre?
Sie erzählte ihm offenherzig, was ihr begegnet war, und sagte ihm dabei, dass sie ihm lieber auf den Rücken sähe, denn es tue ihr zu leid, ihn immer Dieb nennen zu hören und das selbst von unserm Herrgott. Jan war des zufrieden, sie gab ihm noch eine tüchtige Kruste Brot und ein Kännchen Wasser mit auf den Weg und so zog er in die weite Welt.
Nach langem Wandern und als von seinem Brot schon längst kein Krümchen mehr übrig war, kam er eines Tages an einen Bauernhof, ging da dreist hinein und fragte, ob sie keinen Knecht nötig hatten. Der Bauer sprach, er hätte wohl einen Knecht nötig, aber er könne ihn doch nicht so aufs Geratewohl nehmen und müsse doch wissen, wer er wäre.
„Wenn ihr das wissen wollt, das kann ich euch wohl sagen“, antwortete Jan, „alle, die mich kennen, heißen mich Jan den Dieb." — „Hm, hm, Dieb, Dieb“, brummte der Bauer, „und du baumelst noch nicht am Galgen?" Darob lachte Jan und sprach: „Ihr sprecht vom Galgen, ja davor nehme ich mich wohl in Acht, dem bin ich zu klug." —
„Bist du wirklich so klug“, sprach der Bauer, „dann will ich es mit dir wagen; ich nehme dich in Dienst, aber unter drei Bedingungen; kannst du damit fertig werden, dann gebe ich dir noch dazu meine Tochter zur Frau. Du musst nämlich in Zeit von drei Wochen dem Pastor all sein Geld, meiner Frau das Hemd vom Leibe und die Pferde unter den Knechten, die drauf sitzen, weg stehlen. Kannst du das, gut, dann weißt du, was du bekommst; bringst du es aber nicht fertig, dann lass ich dich hängen." —
„Ganz gut“, antwortete Jan, setzte sich zu Tische, aß und trank tüchtig und ging als dann an seine Arbeit. In den ersten Tagen wusste er noch nicht recht, wie er es angreifen sollte, um an das Geld des Pastors zu kommen; endlich aber fiel ihm etwas ein. Er ging hin und stahl dem Bauern zwei Hühner vom Hof, machte sie tot und rupfte ihnen die Federn aus; dann trug er sie zu Markte und schlug sie für gut Geld los; von dem Erlöse kaufte er sich einen Topf Sirup und schlenderte nach Hause zurück.
Des Nachmittags nun ging er in die Vesper und verbarg sich in der Kirche in einem Beichtstuhl, wo er still sitzen blieb bis gegen Abend. Dann zog er seine Kleider aus, bestrich sich den Leib mit dem Sirup und wälzte sich in den Federn herum, so dass er aussah, wie ein Engel, tat drei Züge an der Glocke und stellte sich schnell auf den Hochaltar.
Als der Pastor die Glocke lauten hörte, schrak er zusammen, denn er wusste wohl, dass es noch nicht Morgen war; weil er aber dachte, dass Diebe in der Kirche sein könnten, zog er sich schnell an und lief hin. Kaum hatte er die Türe aufgeschlossen, als Jan von dem Hochaltar herab rief:
„O du frommer und tugendsamer Hirte dieser Pfarre; lange genug hast du deines Amtes mit Sorgen und Mühen gepflegt und Gott sendet mich, dich nach dem Himmel zu führen. Zuvor aber will er dein Herz noch prüfen, ob es nicht am Irdischen hänge, darum gebietet er dir durch mich, dass du all dein Geld hier auf den Hochaltar bringst, auf dass es nach deinem Hingang unter die Armen verteilt werde."
Dem Pastor hüpfte das Herz im Leibe vor Freude über seine bevorstehende Himmelfahrt, doch gefiel es ihm nicht ganz, dass der Engel ihm sein Geld abfragte. Da er aber fürchtete, durch Zweifeln oder Zögern den Zorn Gottes auf sich zu laden, bat er den Engel nur, sein zu warten, und lief nach Hause zurück, um das Geld zu holen; Jan, der auf jeden Fall gehen wollte, sprang schnell vom Altar herab und folgte ihm, sah genau zu, was er tat, und eilte wieder zurück auf den Altar.
Gleich darauf kam der Pastor und stellte zwei Geldsäcke auf den Altar, sprach, da waren all seine Schätze, aber Jan wusste besser, wie es stand und antwortete: „O du, dessen Herz noch so sehr am Irdischen hängt, wie magst du einen Engel Gottes belügen wollen; hast du nicht noch einen Geldsack in deiner Kiste zurück gelassen?"
In seinem ganzen Leben hatte der Pastor keinen größeren Schreck bekommen, als in diesem Augenblick; rot bis hinter die Ohren lief er, auch den dritten Geldsack zu holen, denn er meinte, sonst gewiss und sicherlich für ewig verloren zu sein. Als er damit zu dem Altar kam, lobte Jan seine Treue und sprach:
„Nun bereite dich zu deiner Himmelfahrt. Damit ich aber gemächlicher mit dir fliegen könne, krieche in diesen Sack, ich lade dich dann auf die Schulter." Der Pastor folgte und Jan sprang vom Hochaltar, lief mit ihm die Turmtreppe hinauf, ließ sich am Glockenseil herunter und schritt mit großen Schritten nach dem Pfarrhause.
„Hier wären wir an der Tür“, sprach er, „aber wo mag Sankt Peter sein? Warte einen Augenblick, ich gehe zu ihm, den Schlüssel zu holen. Hüte dich aber zu sprechen, oder anderes Geräusch zu machen, denn das könnte dir übel bekommen, das Fegefeuer ist gleich hierbei." Mit den Worten lief Jan weg, holte das Geld in der Kirche und trug es zu dem Bauern, der vor Verwunderung stumm und steif stand.
Als die Köchin des Pastors morgens früh die Türe öffnete und den Sack sah, stieß sie einmal mit dem Fuße daran, um zu fühlen, was darin wäre; als sich aber nichts darin regte noch regte, schmiss sie ihn einmal herum, und damit fiel der arme Pastor so arg auf den Kopf, dass er unmutig rief: „So lasst mich doch in Ruhe, ihr stoßt mir den Kopf entzwei. Ein Engel hat mich hierher gebracht und holt eben die Schlüssel bei Sankt Peter."
Da lachte die Köchin laut auf und öffnete den Sack und ihr Herr kroch heraus. Man kann sich leicht denken, was der für Augen machte, als er sich statt an der Himmelstür an seiner Haustür fand.
Das zweite Diebesstückchen von Jan war viel schwerer, aber er verlor doch den Mut nicht. Er hatte gemerkt, dass der Bauer jeden Abend in die Schenke ging, sein Gläschen zu trinken, und um im Wiederkommen niemand im Schlafe zu stören, die Türe seiner Kammer nur einklinkte und nie fest schloss.
Am folgenden Abend schlich er ein wenig vor der Zeit, wo der Bauer zurückzukehren pflegte, in die Schlafkammer und legte sich ruhig zu der Frau ins Bett. Er lag aber noch keine fünf Minuten da, als er mit halber und heiserer Stimme sprach: „Frau, tue ein anderes Hemd an, ich habe gesehen, es ist gar schmutzig, das ist keine Reinlichkeit und dem Dienstvolk ein schlechtes Vorbild."
Die Frau wollte noch Einreden machen, aber es half nichts; als sie das frische Hemd nun anhatte, nahm Jan das andere still zu sich und brummte, er müsse noch einmal in den Hof gehen, ging aber, in sein Fäustchen lachend, nach seiner Kammer zurück.
Spät abends erst kam der Bauer nach Hause; als er in die Kammer trat, schaute die Frau groß auf und fragte verwundert: „Warum hast du dich denn wieder ganz angezogen und wo bist du so lange geblieben?" — „Wieder angezogen?“, fragte der Bauer verwundert; „ich habe mich diesen Abend noch nicht ausgezogen, wie kannst du von wieder Anziehen sprechen?" —
„Ei, du wirst mir doch nicht weis machen wollen, dass ich geträumt, so eben bist du im Hemde heraus gegangen und nun kommst du in deinen Kleidern wieder herein." Obgleich der Bauer nicht mehr nüchtern war, begriff er doch, dass da etwas anderes im Spiel sein müsse, fragte die Frau näher aus und erkannte, dass Jan sein zweites Stückchen auch fertig gebracht. Er ging zu ihm und Jan gab ihm das Hemd der Frau.
Um so mehr suchte der Bauer nun zu verhindern, dass Jan auch das dritte Stückchen gelänge, und er passte so wohl auf, dass der letzte Tag vor den festgesetzten drei Wochen da war, ohne dass Jan zum Ziele gelangt wäre. Des Abends rief er gar die Knechte zu sich und befahl ihnen, nicht nur in dem Stalle zu bleiben, sondern selbst auf den Pferden sitzend die Nacht zu durchwachen. Das gefiel Jan schlecht, doch verlor er den Mut nicht.
Gegen Abend begann es so schrecklich zu hageln und zu schneien, dass man keinen Hund vor die Türe hatte jagen sollen; als es dunkelte, gingen die Knechte alle zusammen in den Stall, zündeten eine Laterne an und setzten sich auf die Pferde. Sie hatten noch nicht lange da gesessen, als es an die Türe klopfte.
Anfangs schwiegen sie und gaben keine Antwort; als das Klopfen aber kein Ende nahm, rief endlich einer von ihnen: „Wer ist da?" — „Ach, ein armer Einsiedler“, war die Antwort, „der rund geht, sich ein Almosen zu erbetteln. Die Nacht hat mich überfallen, nirgends sehe ich mehr Licht, als hier, und ich bin ganz steif vor Nässe und Kälte. Gebt mir doch ein Eckchen, wo ich die Nacht durchbringen kann." —
„Nichts da, nichts da“, riefen die Knechte, „es geht jemand darauf aus, diese Nacht hier die Pferde zu stehlen und am Ende seid ihr selbst der Spitzbub." — „Ach Gott, ich ein Spitzbub“, antwortete der Einsiedler, „wie könnt ihr doch so hartherzig sein, mich bei meinem Leid noch zu schimpfen; öffnet mir nur und seht dann zu, ob ich ein Spitzbub sein kann. Ich will im Gegenteil euch wachen helfen und euch beistehen, so etwa ein Dieb in der Nähe sein sollte; lasst mich doch nur ein."
Da ließen die Knechte sich bewegen und gingen hin, zu öffnen; denn, dachten sie, ist der Einsiedler wirklich auch der Dieb, er kann doch nichts gegen uns alle ausrichten." So machten sie denn die Türe auf und ein stockalter Einsiedler trat ein, grüßte sie alle und kroch als dann in ein Hüttchen, wo er sich mit ein wenig Stroh deckte.
Den Knechten fiel die Zeit gewaltig lang auf den Pferden; darum begannen sie bald ein Gespräch mit dem Einsiedler und der erzählte ihnen von allerhand, so dass sie ihm endlich vertrauten. Als er nun aber eine Zeit lang erzählt hatte, da zog er ein Fläschchen aus der Tasche, setzte es an den Mund und tat einen tüchtigen Zug daraus.
Das hatten die Knechte nicht sobald gesehen, als sie auch schon neugierig fragten, was das denn wäre, was er tränke?— „Ach, das ist nicht viel", antwortete der Einsiedler; „ich stehe stets so viel Kälte aus auf meinen Wallfahrten, dass ich schon seit lang immer etwas mit mir trage, um mich zu erwärmen." —
Das machte den Knechten den Mund wässrig und sie baten ihn, doch ihnen etwas davon mitteilen zu wollen. „Ich habe zwar nicht viel“, antwortete der Einsiedler, „aber ich teile doch gern mit euch, weil ihr mir so viel Freundschaft bewiesen habt." Mit den Worten reichte er ihnen sein Fläschchen und sie tranken jeder einen tüchtigen Zug daraus; es dauerte kein Viertelstündchen mehr und die Augen fielen ihnen langsam zu und nach einer halben Stunde schnarchten sie wie Bären.
„Nun bin ich weit genug“, sprach Jan, denn wer anders konnte der Einsiedler sein? „und mein drittes Stückchen ist gespielt“; und damit nahm er den Einen und setzte den rittlings auf die Vorderwand der Krippe; dem anderen legte er einen Sattel auf eine Mistgabel und dem Dritten einen auf einen Rechen. Dann koppelte er die drei Pferde an einen Strick und ging mit ihnen nach dem Hause, wo der Bauer noch in der Küche saß.
Als der Bauer den Einsiedler sah, erschrak er gewaltig, aber Jan half ihm bald daraus, indem er seinen Bart abriss, die Kapuze hintenüber warf und laut lachend rief: „Da, da stehen die Pferde vor der Haustür." — „Und wo sind denn die Knechte?“, fragte der Bauer erstaunt, und Jan antwortete: „Geht nur in den Stall, da könnt ihr sie auf wunderlichen Pferden sehen."
Da ging der Bauer mit Jan in den Stall; wie er da gelacht haben muss, das ist leicht zu denken. „Heda, der Stall brennt!“, schrie der Bauer und alle drei Reiter fielen zugleich von Krippe, Mistgabel und Rechen herab, rafften sich aber bald zusammen und liefen mit all ihren Beinen weg, so schnell sie konnten; denn sie schämten sich in den Tod, dass sie sich also hatten anführen lassen.
Jan heiratete aber des Bauern Tochter und wurde ein reicher Mann und lebt vielleicht noch, wenn er nicht gestorben ist.
Hondelingen
Etwa eine Meile südlich von Arlon liegt das Dorf Hondelingen. Früher hieß die Ortschaft Rosenbur nach einer noch immer unter diesem Namen bekannten und nördlich vom Dorf fließenden Quelle. In der
Ortschaft selbst sieht man heutzutage ein altes schlecht verwahrtes Gehäuse, auf dessen Stelle einst das herrliche Schloß Rosenbur gestanden, und von dem man nicht weiß, wann und wie es zerstört
wurde. Rechts und dicht hinter der hohen Eingangspforte streckt noch heute eine dicke, über dreihundert Jahr alte Linde ihre zerfetzten und verstümmelten Arme über dem morschen Stamm in die
Höhe.
Woher die Ortschaft ihren Namen hat, erzählt die Sage, wie folgt:
Als das alte Schloß Rosenbur noch stand, gebar die Edelfrau sieben lebendige und gesunde Knäblein in einem Male. Obwohl von ihrer ehelichen Treue vollkommen überzeugt, fürchtete sie dennoch, ihr
abwesender Gemahl könnte sie bei seiner Rückkehr aus dem Kriege des Ehebruches beschuldigen oder verdächtigen. Sie ließ deshalb eine ihr sehr ergebene Dienerin zu sich kommen und gewann dieselbe
durch inständiges Bitten und große Geschenke, sechs von den Knäblein in dem nahen Bache zu ertränken.
Die Magd wickelte die sechs Kindlein in ihre Schürze und eilte auf das Wasser zu. Durch einen außerordentlichen Zufall begegnete sie dem unverhofft heimkehrenden Edelmanne, welchem das Benehmen
der Magd sehr verdächtig vorkam, und der sie deswegen um die Ursache ihrer Eile fragte. Die Dienerin stutzte und antwortete verlegen, ihre Herrin sei eines kräftigen Knäbleins genesen und habe
ihr aufgetragen, sechs Hündlein, die eine Hündin auf einmal geworfen, im Bache zu ertränken. Der Ritter schien den Worten des Mädchens keinen Glauben zu schenken und verlangte, die Tierchen zu
sehen. Darauf war die Dienerin nicht gefaßt; sie erbleichte und gestand zitternd dem Edelmann den wahren Sachverhalt. Doch der Herr beruhigte sie und gebot ihr, die Kinder unter strengster
Verschwiegenheit zu sechs verschiedenen Ammen zu tragen, bei denen sie ohne Vorwissen der Mutter bis zu ihrem siebenten Jahre verbleiben sollten. Dann eilte er zu seiner Gattin und
beglückwünschte sie zu ihrer glücklichen Entbindung.
Als die sieben Jahre vorüber waren, ließ der Edelmann die sechs bei den Ammen auferzogenen Knaben aufs Schloß kommen und dem auf dem Schlosse verbliebenen Sohn in allem ganz ähnlich kleiden.
Hierauf rief er sein ganzes Haus zusammen, stellte die sieben Kinder vor und sagte zu seiner Gemahlin: »Wie glücklich wären die Eltern, denen in einer einzigen Geburt eine so zahlreiche
Nachkommenschaft beschieden wäre!« –
»Solche Eltern wären in der Tat nicht nur glücklich, sondern überglücklich zu preisen!« versetzte etwas verlegen die Edelfrau. »Wohlan!« erwiderte darauf der Gatte; »dies sind die sieben
Knäblein, die du mir in einem Male geboren, und von denen sechs wie Hündlein hatten ertränkt werden sollen!« Erschrocken stürzte die Edelfrau dem Ritter zu Füßen und bat ihn unter Tränen um
Verzeihung, die er ihr auch großmütig gewährte.
Seit jener Zeit, d.h. seit ungefähr 1319 führten die Herren von Hondelingen die Hündlein im Wappen, und Burg und Dorf bekamen den Namen Hondelingen.
Nikolaus Warker: Sagen, Geschichten, Legenden und Märchen aus der Provinz Luxemburg
Die Brüder vom guten Weingesicht
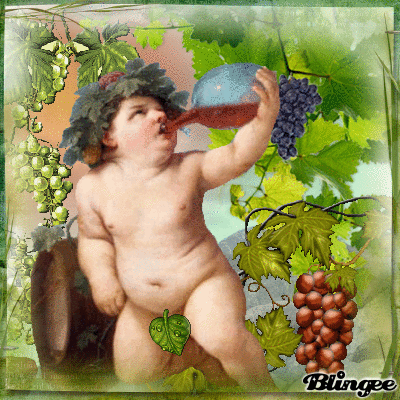
Erstes Kapitel
Von der kläglichen Stimme, die Pieter Gans in seinem Garten hörte, und wie eine Flamme dort über den Rasen lief.
Zu der Zeit, wo der Brabant, der gute Herzog regierte, waren in Uccle in dem Gasthof Zur Trompet die Brüder vom guten Weingesicht, alle Rechtens benamst; denn allesamt hatten sie lustige Antlitze, die zum Zeugnis ihres feisten Lebens zumindest mit einem Doppelkinn prangten, nämlich die der Jungen: die Alten hatten ein mehrfaches. Und mit der Gründung ihrer Brüderschaft hatte es sogenannte Bewandtnis:
Pieter Gans, der Wirt, der besagten Trompet, hörte eines Nachts, als er sich eben entwamste, um sich aufs Bett zu strecken, in seinem Garten ein gar klägliches Heulen: "Die Zunge dorrt mir. Netzung! Netzung! Ich sterbe vor üblem Durste." Sein erster Gedanke war, dies sei etwa ein voller Zecher, und so legte er sich in aller Stille nieder, obwohl es draußen im Garten ohne Unterlaß schrie: "Netzung! Netzung! Ich sterbe vor üblem Durste!" Aber das klang immer trauriger, so daß er schließlich auf und ans Fenster sprang, um zu sehen, wessen Schlags denn dieser verschmachtende Herr sei, der so mächtig schrie.
Da sah er nun eine lange, helle Flamme von hoher und absonderlicher Gestalt, die über den Rasen lief, und er hielt dafür, er könnte leicht die Erscheinung einer armen Seele des Fegefeuers sein, welche Gebete heischte. Darum sagte er mehr als hundert Litaneien her; aber das war umsonst, denn alleweil hörte er schreien: "Netzung, Netzung! Ich sterbe vor üblem Durste!" Beim Hahnenschrei hörte er nichts mehr, und zu seiner großen Freude, war auch die Flamme erloschen. Als es dann Tag geworden war, ging er in die Kirche; er erzählte den Vorfall dem Pfarrherrn, lies eine Messe lesen für die arme Seele und gab dem Sigristen einen Goldbatzen, auf daß noch mehr gelesen würde. Und er ging getröstet weg. In der Nacht wimmerte die Stimme abermals so erbärmlich wie ein Mensch, der nicht sterben kann.
Und so Nacht für Nacht. Davon wurde Pieter Gans völlig trübsinnig. Wer ihn vordem gekannt hatte, wie er, knallrot, stolz wie der Wanst und fröhlich das Gesicht, die Mette mit Butellien und die Vesper mit Flaschen einläutete, hätte ihn zweifelsohne nicht wiedererkannt; denn er war so bleich geworden, so dürr und mager, und sah so erbärmlich drein, daß ihn die Hunde anbellten wie einen Landstreicher mit dem Bettelsack.
Zweites Kapitel
Von dem guten Rate, den Jan Blaaskaak dem Pieter Gans zu dessem Troste gibt, und was für eine bittere Strafe Knauserei trifft.
Während er sich so in Eitel Schwermut und Verzweiflung abhärmte, allein in einem Winkel wie ein Aussätziger, kam von ungefähr der Bierbrauer Meister Jan Blaaskaak in den Gasthof, ein schlauer Gesell und weidlicher Schalk. Nachdem er sich Pieter Gans betrachtet hatte, der ihn wirr und verdutzt ansah und wie ein Greis mit dem Kopf wackelte, trat er auf ihn zu, schüttelte ihn und sagte: "Raffe dich auf, Gesell; es ist mir nicht lieb, daß du aussiehst wie ein Leichnam." "Ach", antwortete Pieter Gans, "mehr bin auch nicht, Gevatter." "Und woher kommt er, sagte Blasskaak, "dieser schwarze Trübsinn?" Darauf antwortete Pieter Gans: "Komm mit, wo uns niemand hören kann. Dort will ich dir mein Abenteuer haarklein erzählen."
Das tat er. Blaaskaak jedoch sagte, als er alles wußte: "Das ist keine Christenseele, sondern der Teufel; dem muß man willfahren. Hole darum aus dem Keller ein Tönnlein Bier und roll es in den Garten an den Fleck, wo sich die helle Flamme gezeigt hat." "Also will ich tun", sagte Pieter Gans. Zur Vesper aber dachte er, Bier sei doch zu köstlich, um es an den Teufel wegzuwerfen, und so stellte er ein großes Becken mit gar klarem Wasser hin. Um Mitternacht hörte Pieter Gans eine noch kläglichere Stimme heulen: "Netzung! Netzung! Ich sterbe vor üblem Durste!" Und er sah die Flamme wie verrückt auf dem Wasser tanzen, und dieses zerbarst alsbald mit mächtigem Gekrach und so erschrecklich, daß die Stücke bis an die Fenster des Hauses schlugen.
Da begann er vor Angst zu schwitzen und zu weinen, und er sagte: "Mit mir ist's aus, guter Gott mit mir ist's aus. Warum habe ich nicht den Rat des gescheiten Blaaskaak befolgt, der doch wirklich ein wohlberatener Mann ist! Lieber durstiger Teufel, töte mich nur nicht; morgen, Herr Teufel, sollst du gutes Bier trinken. Ja, weit und breit ist es als vortrefflich berufen; denn es ist Bier, wie es sich für einen König schickt und für einen guten Teufel, der du doch sicherlich bist."
Nichtsdestoweniger heulte die Stimme ohne Unterlaß: "Netzung! Netzung!" "Weh mir, weh mir, nur ein bißchen Geduld, Herr Teufel, morgen sollst du mein so gutes Bier trinken. Es hat mich Goldbatzen genug gekostet, Herr, aber du sollst ein ganzes Tönnlein voll haben. Du siehst doch wohl, daß es keinen Sinn hätte, mich heute zu erwürgen, morgen magst du es tun, wenn ich nicht Wort halte." Und so winselte er bis zum Hahnenschrei; als er aber diesen hörte und sich noch nicht tot fühlte, sagte er fröhlich sein Morgengebet her. Bei Sonnenaufgang holte er dann das Tönnlein Bier selber aus dem Keller und stellte es auf den Rasen mit den Worten: "Hier, vom frischesten und besten. Ich bin kein Geizhals, drum hab Erbarmen mit mir, Herr Teufel."
Drittes Kapitel
Wie Pieter Gans und Blaaskaak Lieder, Stimmen, Mauen und verliebter Küsse Geräusch in dem Garten hörten, und auf welch hübsche Art der Herr vom guten Weingesicht auf dem steinernenTönnlein saß.
Um die dritte Stunde stellte sich Blaaskaak ein und ließ sich alles erzählen. Als er dann wieder gehen wollte, hielt ihn Pieter Gans zurück und sagte zu ihm: "Vor meinem Gesinde habe ich das Geheimnis gewahrt, auf daß sie nicht hingehen und es dem Geistlich klatschen, und so bin ich so gut wie allein im Hause. Du darfst darum nicht so bald aufbrechen; es mag sich noch so böse Geschichte ereignen, und da wird es heißen, Herz im Leibe zu haben. Allein habe ich gar keines, zu zweit aber werden wir mehr als genug haben. Wir müssen nur kriegsmäßig waffnen. Und anstatt zu schlafen, wollen wir weidlich zechen und trinken."
Gegen Mitternacht hörte die zwei Gesellen, die mit aufgenestelten Bäuchen, freilich nicht ohne Angstgefühl, in einer Stube des Erdgeschosses schöppelten, wieder die Stimme; aber nun kam sie nicht mehr kläglich, sondern freudig, und da gab es gar liebliche Gesänge in einer durchaus fremden Sprache, wie von Engeln, mit Verlaub zu reden, die im Paradiese zuviel Nektar getrunken, himmlische Frauenstimmen, Tigerauen, Seufzen Geräusch von Umarmungen und verliebten Küssen. "Oho", rief Pieter Gans, "was ist denn da los? Ach, Jesus! Das sind leibhaftige Teufel, sie werden mir das Tönnlein bis auf den letzten Tropfen leeren. Und das Bier wird ihnen ausgiebig munden, und sie werden aber trinken wollen und Nacht um Nacht weiter heulen: Netzung, Netzung! Und ich werde zugrunde gerichtet sein; weh mir, weh mir! Wohlan, Blaaskaak, mein Gesell", und damit zog er sein Knijf – das ist, wie ihr wißt, ein starkes, gut gewetztes Messer – "wohlan, wir müssen sie verjagen, aber ich habe nicht Mut genug."
"Ich gehe meinetwegen", antwortete Blaaskaak, "aber nicht vor dem Hahnenschrei; dann beißen die Teufel nicht mehr, heißt es." vor Sonnenaufgang krähte der Hahn, und diesmal mit einer so martialischen Stimme, daß es wie Trompetengeschmetter klang.
Und kaum hatten die zechenden Teufel die Trompete gehört, so brachen sie ihre Reden und Lieder ab. Darob waren Pieter Gans und Blaaskaak mächtig froh und liefen eiligst in den Garten. Pieter Gans, dem es vor allem um sein Tönnlein zu tun war, sah dieses in Stein verwandelt, und auf ihm saß auf einem Hengst ein splitternacktes Knäblein, lustig mit Reben bekränzt, und Trauben hingen ihm über die Ohren; und in der Rechten hielt er einen Stab mit einem Pinienapfel am Ende, umwunden mit Reben und Trauben. Und wiewohl er aus Stein war, schien der Knabe zu leben mit seinem guten Weingesicht. Mächtig erschraken Gans und Blaaskaak bei dem Anblick des besagten Knaben. Und ihnen bangte vor einem Malefiz des Teufels und der Strafe des Geistlichen, und sie schwuren, vor niemand ein Sterbenswörtlein verlauten zu lassen, und brachten das Steinbild, das nicht gar hoch war, in einen finstern Keller, wo es nichts zu schürfen gab.
Viertes Kapitel
Wie die zwei Biedermänner nach Brüssel ziehen, der Hauptstadt von Brabant, und von Art
und Handwerk des Josse Kartuivels, dem
Garkoch.
Dies getan, machten sie sich selbander auf den Weg nach Brüssel, um sich Rats zu erholen bei einem alten Manne, Garkoch seines Zeichens, der samt seinem bißchen Tunkensudelei beim gemeinen Mann recht beliebt war wegen seiner mit seltsamen Kräutern gewürzten Kaninchenpasteten, für die er kein großes Stück Geld heischte. Die Frommen waren überzeugt, daß er Umgang mit dem Teufel habe, weil er mit seinen Kräutern Mensch und Vieh wunderbar heilte. Auch Bier bekam man bei ihm, und das bezog er von Blaaskaak. Er war häßlich, gichtich, kropfig, gelb wie eine Quitte und runzlig wie ein alter Apfel. Wohnen tat er in einem übel aussehenden Hause.
Gans und Blaaskaak trafen ihn in der Küche mit seinen Kaninchenpasteten beschäftigt. Als der Garkoch bemerkte, wie jämmerlich und trübsinnig Gans aussah, fragte er ihn, ob er etwa ein Leiden habe, wovon er geheilt zu werden wünsche. "Von nichts anderm braucht er geheilt zu werden", sagte Blaaskaak, "als der üblen Angst, die ihm seit einer Woche einen Höllenpein macht." Dann erzählte er ihm des langen und breiten Geschichte des kleinen Pausbackigen. "Herr Gott", sagte Josse Kartuivels – so war der Name dieses Pastetengelehrten – "diese Teufel kenne ich sehr wohl, und ich will euch sein Konterfei zeigen." Er führte sie in ein Stübchen im Obergeschoß und ließ sie ein hübsches Bild sehn, wo besagter Teufel in Gesellschaft holder Bäslein und lustigen Gesellen mit Bocksfüßen schlemmte und demmte.
"Und wie heißt denn das lustige Knäblein?" fragte Blaaskaak. "Bachus, denke ich", sagte Josse Kartuivels. "In längst veränderten Zeiten war er ein Gott; aber bei der glückseligen Ankunft unseres Herrn Jesus Christus", - hier bekreuzigten sich alle drei – "hat er alle Macht und Göttlichkeit verloren. Er war ein guter Gesell und sonderlich auch der Erfinder von Wein und Bier. Möglich, daß er dieserhalb anstatt in der Hölle nur im Fegefeuer ist. Dort hat er zweifelsohne Durst bekommen und hat mit himmlischer Verwilligung ein armseliges einziges Mal zur Erde heraufsteigen und hier das klägliche Lied singen dürfen, das ihr in eurem Garten gehört habt. Aber ich denke, das Durstgeschrei ist ihm in Ländern, wo Wein getrunken wird, nicht verstattet worden, sondern nur wo man Bier trinkt, und so ist er zu Meister Gans gekommen, bei dem er sicher war, das beste zu finden." "Wahrhaftig", sagte Gans, "wahrhaftig, Freund Kartuivels, das beste im ganzen Herzogtum, und er hat mit ein ganzes Tönnlein geleert, ohne mir auch nur das kleinste Goldbätzlein, oder einen Silbergroschen, ja einen Kupferheller zu geben; das ist nicht das Benehmen eines ehrlichen Teufels."
"Ah", sagte Kartuivels, "da bist du mächtig im Irrtum und weißt nichts von deinem Nutz und Frommen. Wenn du aber auf mich hören willst, so wirst du aus dem besagten Bachus offenbar Vorteil ziehen; denn er ist der Gott der lustigen Zecher und der guten Wirte und will dir, glaube ich, wohl." "Was sollen wir also tun?" fragte Blaaskaak. "Ich habe sagen hören, daß dieser Teufel ganz verrückt nach Sonne ist. Holt ihn fürs erste aus dem schwarzen Keller hervor, und dann stellt ihn ins helle Tageslicht, etwa auf einen hohen Schrein in euerer Zecherstube." "Jesus", rief Pieter Gans, "das wäre ja Götzendienst!" "Keineswegs", sagte der Garkoch; "ich meine ja nur, daß es ihn trefflich erquicken wird, wenn er, an den von mir genannten Ort gestellt, den Durst der Kannen und Flaschen schlürft und fröhliche Reden hört. Und so wirst du dem armen Toten nach Christenweise Linderung verschaffen."
"Aber, "sagte Pieter Gans, "wenn der Geistliche Wind bekommt, daß dieses Steinbild so schamlos allen gezeigt wird?" "Er wird dich keiner Sünde bezichtigen können; denn Harmlosigkeit verbirgt sich nicht. Du wirst diesen Bachus deinen Verwandten und Freunden geradezu zeigen und ihnen sagen, daß du ihn von ungefähr in der Erde gefunden hast in einem Winkel deines Gartens. So wird man ihn für ein Altertum nehmen, was er denn auch ist. Nenne nur niemand seinen Namen; nenne ihn scherzeshalber den Herrn vom guten Weingesicht und gründe ihm zu Ehren eine lustige Brüderschaft." "Das wollen wir tun", antworteten Pieter Gans und Blaaskaak einstimmig; und sie brachen auf, nicht ohne dem Garkoch für seine Mühe zwei dicke Groschen gereicht zu haben. Er wollte sie zurückhalten, um sie seine himmlische Kaninchenpastete versuchen zu lassen; aber Pieter Gans blieb taub, da er sich sagte, das sei Teufelsküche und jedem Christenmagen unzuträglich. So machten sie sich denn auf den Heimweg nach Uccle.
Fünftes Kapitel
Von den langen Reden und den mächtigen Bedenken Pieter Ganses und Blaaskaaks in Sachen des pausbackigen Teufels, und mit welchem Entschluß sie nach Uccle heimkehren.
Unterm Gehen sagte Gans zu Blaaskaak: "Wohlan, Gesell, was dünkt dich von dem Garkoch?" "Ketzergezücht", antwortete Blaaskaak, "ein Heide und ein Verächter alles Guten und jeglicher Tugend; denn sein Rat ist tückisch und böse." "Wahrhaftig, lieber Freund, wahrhaftig. Und ist es nicht schon Ketzerei, uns einreden zu wollen, daß dieser Pausbackige aus seinem Tönnlein das Bier und den Wein erfunden hätte, wo uns doch allsonntäglich in der Kirche gepredigt worden ist, daß diese Dinge durch Ratschluß unsers Herrn Jesus Christus" - hier bekreuzigten sich beide - "der heilige Noah erfunden hat." "Ich wenigstens", sagte Blaaskaak, "habe das mehr als hundertmal gehört." Damit setzten sie sich ins Gras und begannen sich an einer guten Gentner Wurst zu letzen, die Pieter Gans in Voraussicht des künftigen Hungers mitgenommen hatte.
"Ei, ei", sagte er, "vergessen wir das Benedikite nicht, mein Freund; so werden wir vielleicht doch nicht brennen müssen. Denn dieses Essen verdanken wir Gott, der uns allewege in seinem heiligen Glauben erhalten möge." "Amen", sagte Blaaskaak, "aber Gevatter, wir müssen dieses Bild zerschlagen." "Wer keine Schafe zu hüten hat, fürchtet den Wolf nicht; du hast gut reden, den Teufel zu zerschlagen." "Es wäre ein gar verdienstlich Werk." "Wenn er aber trotzdem allnächtlich wiederkommt mit dem kläglichen Geheul: Netzung! Netzung! und wenn ihn Zorn auf mich packt und er einen Zauber wirft auf mein Bier und meinen Wein, so daß ich arm werde wie Hiob? Nein; da ist's gescheiter, dem Rate des Garkochs zu folgen." "Und wenn der Geistliche von dem Bilde erfährt und uns vor sein Gericht lädt?" "Ach", sagte Gans", ich sehe schon, der liebe Gott und der böse Teufel wollen sich auf unserm Leibe schlagen. Um uns ist's geschehn, o weh, o weh!"
"Also", sagte Blaaskaak, "so gehen wir geradewegs zu den frommen Patres und erzählen ihnen alles ungelogen." "O weh, o weh, wir werden brennen müssen, unverzüglich brennen!" "Ich meinte doch, daß es ein Mittel gibt, uns aus solcher Fährlichkeit zu retten." "Es gibt keines, Freund, es gibt keines, und wir müssen brennen; ich komme mir schon ganz gebraten vor." "Ich habe es schon", sagte Blaaskaak. "Es gibt keines, Freund, es gibt keines sonst als die Gnade der frommen Patres. Siehst du nirgends einen Bettelmönch daherkommen?" "Nein." "Wenn du einen siehst, so müssen wir ihm unsere ganze Wurst geben – haben wir schon das Gratias gesprochen? – und unser ganzes Brot und müssen ihn ehrerbietig einladen, mit uns zu kommen und ein Lammsviertel zu verspeisen, gut angefeuchtet vom alten Wein. Ich habe ja davon nicht allzu viel, aber gern will ich ihm alles vorsetzen. Siehst du keinen kommen?" "Nein", sagte Blaaskaak.
"Aber nun tu einmal deine Hasenohren auf, ich werde dir einen guten Rat geben; denn ich meine es gut mit dir, du jammernder Wicht. Wir müssen den Rat des Garkochs zur Hälfte befolgen; zur Hälfte, verstehst du. Es wäre schamloser Götzendienst, das Bild in der Stube unserer Gelage aufzustellen."
"O weh, o weh, beim Teufel, da hast du recht." "Wir stellen ihn also dort in eine Nische, die ganz geschlossen sein muß bis auf eine Öffnung oben, auf das er Luft hat, und geben ihm ein Tönnlein Bier hinein und bitten ihn, sich nicht zu übernehmen. Dort in der großen Stube deines Wirtshauses wird er sich gewisslich ruhig verhalten, denn er wird sich weiden können an den Trinkliedern, dem Becherklang und dem Flaschengeläute." "Keineswegs", sagte Gans, "keineswegs. Wir müssen den Ratschlag des Garkochs befolgen, der sich besser als wir bei den Teufeln auskennt. Was diesen unserigen angeht, so werden wir ihn nach unsern schwachen Kräften bei guter Laune zu erhalten trachten; nichtsdestoweniger, denke ich, werden wir eines Tages brennen müssen. O weh, o weh!"
Sechstes Kapitel
Wo man sieht, daß es keinen guten Teufel gibt, und von dem tückischen Streich erfährt, den er den armen Frauen der Zecher spielte.
In der Trompet angelangt, holten die zwei Biedermänner den pausbackigen Teufel aus dem Keller und setzten ihn mit großer Ehrerbietung auf einen Schrein, der in der Naser Zecherstube stand. Am nächsten Tage kamen zu Pieter Gans schier alle Männer von Uccle, nachdem sie sich bei der öffentlichen Feilbietung zweier von dem verstorbenen Schöffen Jakob Maaltjens gut aufgefütterten Pferde getroffen hatten. Sein Sohn hatte sie nicht behalten mögen; denn er sagte, ein guter Bauer braucht keinen anderen Renner als seine Holzschuhe. Die von Uccle sperrten Mund und Augen auf über das Bild des kleinen Pausbackigen auf dem Schreine und wurden sonderlich lustig, als ihnen Blaaskaak sagte, das sei der Herr vom guten Weingesicht und nun gelte es ohne Verzug ihm zu Ehren und scherzeshalber eine lustige Brüderschaft zu gründen. Damit waren sie allesamt einverstanden und beschlossen, daß außer ihnen niemand sollte ein Bruder werden können, wenn er nicht zum Einstand vierundzwanzig erschreckliche Humpen voll Bier trinke, während man zwölf Schläge auf den bestgeblähten Wanst in der Gesellschaft tue.
Fortan versammelten sie sich an jeglichem Abend in der Trompet und tranken, bis sie genug hatten. Das Wunder aber war, daß sie trotzdem den ganzen Tag wacker arbeiteten in ihren Werkstätten, Läden und Feldern und jedermann zufrieden stellten. Nur ihre Frauen nicht; denn kaum war Vesperzeit, so machte sich jeder Gatte oder Bräutigam, ohne sich im mindesten um sie zu kümmern, auf den Weg in die Trompet, um dort bis zum Feuerverlöschen zu bleiben. Das gab es aber bei diesen Biedermännern nicht, daß sie wie es hin und wieder Trinkerart ist, nach der Heimkehr in ihr Biederheim ihre Frauen geprügelt hätten; sie legten sich neben sie und schliefen alsbald fest ein, ohne ein Wort gesagt zu haben, und bliesen Fanfaren mit der Nase wie das edle Borstentier mit dem Rüssel.
Die arme Frau mochte den Schläfer, auf daß er ihr andere Geschichten erzähle, puffen, kitzeln, anrufen, alles war umsonst; ebenso gut hätte man das Wasser schlagen können, um Feuer zu bekommen. Erst beim Hahnenschrei ermunterten sie sich; aber ihre Morgenlaune war so mürrisch und reizbar, daß sich ihnen die Frauen, soweit sie nicht selber vor Ermattung eingeschlafen waren, kein Wörtlein zu sagen getrauten, und ebenso zur Frühstücksstunde. Und dies fand statt durch die tückische Macht und Einwirkung des pausbackigen Teufels. Davon kam den Frauen eine gar große Traurigkeit, und allesamt sagten sie, wenn solches Spiel andauern sollte, so würde das Geschlecht derer von Uccle unfehlbar verlöschen, was wahrhaftig zum Erbarmen wäre.
Siebentes Kapitel
Von der Ratsversammlung der Frauen
Darum beschlossen sie untereinander, die Gemeinde zu retten, und so versammelten sie sich, während ihre Männer bei Pieter Gans zechten, bei der Dame Sijske, die groß und dick war, Haare auf den Zähnen und ein gar treffliches Mundwerk hatte und Witwe nach fünf oder sieben Männern war; genau möchte ich die Zahl nicht nennen, um nicht etwa der Lüge geziehen zu werden. Dort netzten sie sich, ihren trunksüchtigen Männern zum Trotz, mit guten klarem Wasser. Und als sie so gebührlich beisammen saßen, die jungen hie, die alten dort, die häßlichen unter die alten, ergriff Dame Sijske das Wort und sagte, nun gelte es unverzüglich in die Trompet zu gehen und die Zecher alle miteinander braun und blau und windelweich zu prügeln, daß sie für acht Tage genug hätten.
Die alten und die häßlichen zollten dieser Rede Beifall mit Hand und Fuß, Mund und Nase: "Das war ein schönes Getöse. Die jungen und die hübschen aber blieben stumm wie die Fische bis auf ein gar artiges, frisches und liebliches Mädchen, Wantje mit Namen, die mit großer Züchtigkeit und errötend sagte, es hätte keinen Zweck, die wackern Männer zu prügeln, sondern man müsse sie durch Sanftmut und Lachen auf den guten Weg zurückführen.
Darauf antwortete Dame Sijske: "Kleine, du verstehst dich noch nicht auf Männer; denn du bist, denke ich, Jungfrau. Ich aber, ich weiß genau, wie ich meine unterschiedlichen Männer gegängelt habe, und das ist nicht mit Sanftmut und Lachen geschehn, das kannst du mir glauben, sie sind verstorben die guten Männer, Gott habe sie selig, aber ich habe sie klar im Gedächtnis und weiß gar wohl, wie ich sie bei der geringsten Verfehlung mit dem Stocke auf dem Anger des Gehorsams tanzen ließ. Keiner hätte sich zu essen oder zu trinken getraut, zu niesen oder zu gähnen, ohne daß ich ihm zuvor gnädig die Erlaubnis gewährt hätte. Der kleine Job Sijske, mein letzter, kochte an meiner Statt. Er kochte mir gut, der arme Kerl. Aber ich habe ihn wacker prügeln müssen, bis ich ihn so weit hatte, und die andern gleichermaßen. Drum, Kleine, lassen wir von dem Lachen und Sanftmut; das nutzt nichts, du kannst es mir glauben, holen wir uns lieber gute, grüne Stöcke, wie sie jetzt im Frühling leicht zu haben sind, und gehen in die Trompet und besprengen diese ungetreuen Männer mit einem trefflichen Tau von Prügeln."
Da begannen die alten und häßlichen von neuem erschrecklich zu heulen und zu toben: "Drauf denn, drauf auf die Trunkenbolde; dreschen wir sie, hängen wir sie!" "O nein", sagte Wantje, und mit ihr die jungen und hübschen; "lieber lassen wir uns selber schlagen." "Diese dummen Dinger", heulten die alten, "diese dummen, nichtsnutzigen Dinger! In ihrem ganzen Leibe haben sie nicht eine Unze Stolz. Laßt euch nur mißhandeln, ihr sanften Lämmlein; wir werden an euerer Statt die besudelte Frauenwürde an diesen Trunkenbolden rächen." "Ihr werdet es nicht tun", sagten die jungen, "solange wir da sind." "Wir werden es tun", heulten die alten. Auf einmal sagte ein junges lustiges Weibchen, sich vor Lachen schüttelnd zu ihren Gefährtinnen: "Begreift ihr denn nicht, woher diesen Hexen diese mächtige Wut kommt und dieser Rachedurst? Das ist alles Flunkerei, um uns glauben zu machen, ihre heiseren Männer könnten ihnen noch etwas vorsingen!"
Auf diese Rede geriet das Lager der Vetteln in einen solchen Aufruhr, daß ihrer etliche auf der Stelle vor Wut starben. Andere zerbrachen ihre Schemel und wollten die jungen erschlagen, die über sie lachten – und es war eine schöne Musik, diese frischen, übermütigen Stimmen; aber Dame Sijske wehrte ihnen und sagte, in ihrem Hause habe man zu beraten, aber nicht einander umzubringen. Bei fortgesetzter Erörterung redeten, schwatzten, plapperten und tobten sie bis zum Feuerauslöschen; dann gingen sie auseinander, ohne einen Entschluß gefaßt zu haben, weil die Zeit zu kurz gewesen war, um sich auszusprechen. Und in dieser Frauenversammlung waren gesprochen mehr als 57784902 Worte, mit soviel Witz und Verstand darin wie in einer Froschlache alter Wein.
Achtes Kapitel
Von der Listigkeit, die in allen Frauen ist, und wie züchtig Jungfrau Wantje zu den Biedermännern redete.
Am nächsten Tage versammelten sich die Frauen wiederum und tranken wie tags zuvor viel klares Wasser; dann machten sie sich, mit Stöcken bewaffnet, auf den Weg zu den lustigen Zechern. Vor der Tür der Trompet blieben sie stehen, und es wurde Rat gehalten; die alten wollten mit den Stöcken hinein, die jungen waren durchaus dagegen. Als Pieter Gans mit seinen Hasenohren auf der Straße draußen etwas wie ein Gekläffe dräunender Worte hörte, schrie er: "Ach, ach, was ist denn da los meinte er? Teufel ganz sicher; mein süßer Jesus!" "Ich will nachsehn, elender Feigling", antwortete Blaaskaak; und als er die Tür geöffnet hatte, schüttelte er sich vor Lachen und sagte:
"Weingesichter, es sind unsere Frauen. Alsbald sprangen die Zecher allesamt auf und zur Tür; die einen hielten Bouteillen in den Händen, andere schwangen Flaschen, und wieder andere ließen ihre schönen Becher wie ein Glockenspiel zusammenklingen.
Blaaskaak trat aus der Stube, setzte über die Schwelle, stand auf der Straße still und sagte: "Wohlan, Fräulein, was führt euch hierher mit dieser Menge Grünholz?" Auf diese Worte hin ließen die jungen ihre Stöcke fallen; denn sie schämten sich, in diesem Aufzug betroffen worden zu sein. Eine alte aber antwortete, den ihrige in der Luft schwingend, für alle: "Wir sind gekommen, um euch Trunkenbolden Geschichten von Prügeln zu erzählen und euch nach Gebühr zu züchtigen." "Ach, ach", meinte Pieter Gans, "das ist wahrhaftig die Stimme meiner Großmutter." Während die guten Weingesichter, da sie dies hörten, vor Lachen ihre Wänste schüttelten, sagte Blaaskaak: "Kommt doch herein, kommt doch herein, Gevatterinnen, auf daß wir sehen, welchermaßen ihr uns dreschen wollt. Habt ihr gute Stöcke von grünem Holz?" "Jawohl." "Das höre ich gern. Wir aber haben gute Ruten da, trefflich mit Essig gesalbt, womit wir die ungehorsamen Knäblein streichen. Ein himmlisches Vergnügen wird euch eine solche Liebkosung sein in die Erinnerung an die Jugendzeit. Wollt ihr sie versuchen? Ihr könnt davon mehr als für fünfhundert Groschen haben."
Aber die Alten bekamen Angst bei dieser Rede und entflohen mit langen Schritten, allen voran die Dame Sijske, und heulten allesamt so dräuende Wort, daß es den lustigen Brüder war, als flatterten Raben mit mächtigem Gekrächze durch die schweigenden Straßen. Die jungen säumten noch vor der Tür, und es war zum Erbarmen, wie demütig, sanft und unterwürfig sie eines freundlichen Wortes ihrer Gatten oder Verlobten hatten.
"Wohlan denn", sagte Blaaskaak, "möchtet ihr vielleicht hereinkommen?" "Jawohl", sagten sie alle. "Tu es nicht", sagte Pieter Gans seinem Freunde ins Ohr, tu es nicht; sie werden dem Geistlichen von dem pausbackigen Teufel klatschen und uns auf den Scheiterhaufen bringen." "Ich bin taub", sagte Blaaskaak, "Kommt nur Schätzchen."
So traten denn die armen Weiblein ein und setzten sich, die einen zu ihren Gatten, andere zu ihren Verlobten und die ledigen, züchtig in eine Reihe auf eine Bank.
"Frauenzimmer", sagten die Zecher, "ihr wollt also trinken?" "Ja", sagten sie. "Und nichts als trinken?" "Nein", sagten sie. "Und euere Absicht war nicht, uns ein Liedchen von den Vorzügen des Wassers zu singen?" "O nein", sagten sie; "uns hat kein andres Verlangen hergeführt, als uns zu unsern guten Gatten und Verlobten zu fügen und mit ihnen, so Gott will, lustig zu sein." "Das sind wahrhaftig schöne Worte", sagte ein alter Mann, "aber ich vermute Weiberlist dahinter."
Niemand jedoch hörte auf ihn; denn da sich die Frauenzimmer rund um den Tisch gesetzt hatten, sagte jedermann: "Trink, mein süßes Kind, es ist ein Himmelstrank" oder: "Schenk ein, Nachbar, schenk ein, von diesem milden Tropfen " oder: "Wer ist besser dran als ich? Ich bin der Herzog: ich habe eine gute Flasche und ein gutes Weib!" oder: Vorwärts, tragt Wein auf, heute braucht es einen Sonntagswein, um den lieben Gevatterinnen Ehre zu erzeigen" oder: "Mein Mut ist zu groß, um nur zu trinken, ich will mir den Mond erobern; oder später. Vorderhand bleibe ich bei meiner guten Frau. Küsse mich, Schatz!" "Hier ist nicht der Ort dazu, vor soviel Leuten", sagten die Frauen; und jegliche sagten zu jeglichem mit viel Liebkosungen und süßem Wesen: "Komm heim."
Die Zecher hätten es gerne getan, aber sie getrauten sich nicht, da sich einer vor dem andern schämten. Die Frauenzimmer, die ihre Gedanken errieten, sprachen vom Aufbruch. "Da habt ihr's", sagte der alte Mann; "habe ich es nicht vorausgesagt? Sie wollen uns draußen haben." "Keineswegs Herr", antwortete Wantje gar sanft, "aber bedenkt, daß wir kein starkes Getränk gewohnt sind, ja, nicht einmal den Duft. Drum Herr, wenn wir in die frische Luft müssen, so wollen wir euch damit nicht erzürnen oder irgendwie kränken. Gott erhalte euch in Freuden alle miteinander." Und so gingen die guten Frauenzimmer, obwohl sie sie mit Gewalt zurückzuhalten versuchten.
Neuntes Kapitel
Worin man sieht, daß der gelehrte Thomas a Klapperibus wohl wußte, was einen Trinker auf einer Bank tanzen macht.
Wieder allein mit ihren Humpen und Schoppen, sahen sie einander verdutzt an und sagten: "Seht ihr die Weiber? Sollte man nicht immer demütig ihrem Willen gehorchen? Unterwürfig scheinen sie, tyrannisch sind sie. Wem steht denn von Natur das Gebot in allen Dingen zu, dem Mann oder der Frau? Dem Mann. Wir sind die Männer. Trinken wir. Und wir werden allwege unsern Willen vollbringen, und der geht augenblicklich dahin, hier zu schlafen, wenn es uns beliebt." So redeten sie hin und her und taten gar zornig; in Wirklichkeit begehrten sie nichts mehr, als sich ihren guten Frauen zu fügen. Dann redeten sie eine lange Weile kein Wort, gähnend die einen, die andern mit den Füßen scharrend, viele auch auf der Bank herumwetzend, als wären dort die spitzige Dornen gewesen. Plötzlich aber stand ein seit kurzem verheirateter Bürger auf und ging aus der Stube, indem er sagte, der Arzt habe ihm verboten, mehr als sechsundzwanzig Schoppen zu trinken, und die habe er allbereits.
Dies gehört, hatte auf einmal jeder seine Schmerzen, Leibschmerzen, Kopfreißen, Schwarzgalligkeit oder Verschleimung, und suchten allesamt ihr Heim auf bis auf ein paar Greise. Und sie gingen in großer Eile, um sich zu ihren Frauen zu fügen. Und so wurde bewährt, was der gelehrte Thomas a Klapperibus geschrieben hat in seinem großen Buche De more, cap. VI, wo er sagte, daß die Frau stärker ist als der Teufel.
Zehntes Kapitel
Vom Eisenzahn
Nichtsdestoweniger, geschah solches nur einmal; denn als die guten Frauenzimmer am nächsten Abend in die Trompet kamen, um die schöppelnden Zecher herauszuholen, wurden sie schändlich davongejagt. Und die Männer zechten allwege weiter und sangen lustige Lieder. Oftmals kam der Nachtwächter und verwies ihnen ernstlich ihr mächtiges Lärmen nach Sonnenuntergang. Sie hörten ihn gar angstvoll an und schienen völlig niedergeschlagen zu sein vor Zerknirschung über ihre Verfehlung, sprachen auch ihr Mea culpa; indessen gaben sie ihm überschüssig viel zu trinken, daß der Arme hinterher seine Runde gegen eine Mauer machte und dort schnarchte wie eine Baßgeige. Sie setzten ihr Gezeche fort mit dem schweren Schlaf nachher, worüber denn die betrübten Gattinnen nicht zu jammern aufhörten.
Und also einen Monat lang und vier Tage. Das große Unglück aber bloß war, daß sich, noch von dem Kriege her, den der gute Herzog von Flandern geführt hatte, trotz dem schon geschlossenen Frieden eine Rotte von nichtsnutzigen Schurken im Lande herumtrieb mit Verwüstung und Räuberei. Diese Rotte befehligte als Hauptmann ein Wüterich, Eisenzahn genannt, weil er als Helmkleinod einen langen, spitzigen, scharfen Zahn trug, ein Teufelszahn oder von einem höllischen Helfanten wunderfremd bossiert. Und im Kampfe rannte er oft mit diesem Zahn an wie ein Widder. So wurden viel wackere Soldaten getötet im Herzogtum Brabant.
Auf dem besagten Helm war auch ein böser Vogel, der mit dem Flügel gegen das Eisen schlug; wie es hieß, pfiff er im Handgemenge gar entsetzlich. Eisenzahn war es gewohnt, die Dörfer
nächtlicherweile zu überfallen, die armen Bürger ohne Gnade im Schlafe zu erwürgen und Kostbarkeiten, Hausgerät, Frauen und Mädchen wegzuschleppen, freilich nur die jungen; auch die alten ließ er
übrigens am Leben, weil man sie, wie er sagte, nicht zu töten brauche in Anbetracht, daß sie aus reiner Angst und ohne Nachhilfe sterben würden.
Elftes Kapitel
Worin man sieht, wie tapfer die guten Frauen von Uccle sich Männerwerks annehmen.
Eines Nachts, wo nur wenige Sternlein und nur eine schmale Mondsichel schienen, kam Meister Andries Bredaal nach Uccle gelaufen, mit mächtigen Schritten und völlig außer Atem. Er wollte die Zeitung bringen, wie an ihm, als er von der Straße von Paris von ungefähr hinter einem Busche gehockt hatte, eine Schar Männer vorbeigezogen waren, die er für das Volk Eisenzahns hielt, weil er den Helm des Schurken gesehn hatte. Während die Räuber haltgemacht hatten, um zu essen, hatte er sie sprechen hören, daß sie auf Uccle zögen, um Beute zu machen und ein Wohlleben zu halten, daß sie aber die Heerstraße gegen die Feldwege vertauschen müßten, um nicht ihre Ankunft laut werden zu lassen.
Meister Bredaal meinte, daß sie hinter der Kirche hervorbrechen würden. Also unterrichtet, war er auf der Pariser Heerstraße mit einem Vorsprung von einer guten halben Meile vor den Räubern nach Uccle gekommen und wollte nun den Bürgern anzeigen, daß sie sich trefflich waffnen sollten, um diese Bösewichter gebührend zu empfangen. Er klopfte also an die Tür des Gemeindehauses, um die Glocke läuten zu lassen, aber niemand tat ihm auf; denn der Wächter, auch ein Bruder vom guten Weingesicht, schlief gleich den andern wackern Zecher. Andries Bredaal griff darum auf zu einem andern Auskunftsmittel und schrie aus Leibeskräften:
"Feuer! Feuer! ‚t brandt! ‚t brandt!" , so daß alle Frauen, Greise und Kinder erwachten und voller Neugier mit einem Satz an den Fenstern waren. Andries Bredaal gab sich ihnen zu erkennen und bat sie, auf den Platz herunterzukommen, und das taten sie. Und als sie alle um ihn versammelt waren, vermeldete er ihnen die baldige Ankunft Eisenzahns und hieß eine jegliche, ihren Gatten zu wecken. Bei dieser Rede begannen die alten wie verrückt zu schreien: "Willkommen sei Eisenzahn, der Gotteszahn, der sie allesamt abtun wird. Ha, ihr Trunkenbolde, jetzt werden wir es erleben, wie ihr durch himmlische Strafe kurzerhand gehenkt, lebendig verbrannt und stracks ersäuft werdet; das ist noch gar nichts für euer Verbrechen." Und als hätten sie Flügel an den Beinen gehabt, liefen sie jede in ihr Haus.
Und vom Marktplatz konnte Meister Bredaal, der dort mit den jungen verblieben war, hören, wie die verrückten alten Weiber heulten, wimmerten, weinten, auf Truhen und Becken trommelten, um die Biedermänner zu erwecken, und mitten darunter riefen: "Auf, Galgenvögel! Ach, Herzliebste, kommt uns schützen! Trunkenbolde, nur das eine Mal tut euere Pflicht in eurem verdammten Leben! Ihr dürft es uns nicht nachtragen, daß wir euch haben prügeln wollen. Dumm waren wir damals so vorwitzig, gescheit waret ihr; aber jetzt rettet uns." Und so mengten sie zornige und linde Worte untereinander wie Milch und Essig. Von den Biedermännern aber wurde nicht ein einziger munter. "Was ist das?" fragte Bredaal.
"Ach", antworteten die jungen, "Ihr seht ja selbst; sie sind in der Nacht wie die Toten, und das schon seit einer langen Weile. Der Engel des Herrn vermöchte sie kaum zu erwecken. Ha, müssen denn diese Elenden, nicht genug davon, daß sie uns ansonsten meiden, auch noch unsern Tod verschulden?" "Weint kein Tränlein", sagte Andries Bredaal; "jetzt ist nicht die Zeit dazu. Liebt ihr diese Männer?" "Ja", sagten sie. "Und euere Söhne?" "Ja", sagten sie. "Und euere lieblichen, herzigen Töchterchen?" "Ja", sagten sie. "Und ihr möchtet sie gern verteidigen?" "Dann also", fuhr Bredaal fort, "holt die Waffen dieser Schläfer und kommt rasch wieder zu mir. Wir wollen auf Mittel denken, uns trefflich zu verteidigen."
Im Nu waren die Frauen wieder da mit den Bogen ihrer Gatten, Brüder oder Verlobten. Und diese Bogen waren gar wohl berufen im ganzen Lande, weil sie wie Stahl waren und die Pfeile mit einer mächtigen Wucht schleuderten. Dann kamen noch Knaben von zwölf Jahren und ein weniges darüber und etliche wackere Greise; aber die Frauen schickten sie wieder heim und sagten, es sei ihre Sache, die Gemeinde zu hüten. Sie standen allesamt auf dem Platze und sprachen mit viel Feuer und Mut, aber ohne Überhebung.
Und sie waren ganz weiß angetan mit Leibchen, Röcken und Hemden, wie herkömmlichermaßen die Nachtkleidung der Frauenzimmer ist; diesmal aber war das durch die besondere Gnade Gottes geschehn, wie ihr denn sofort sehn werdet. Wantje, die gar kühn und entschlossen, auch da war, sagte mit einem Male, man müsse beten. Und die Frauen fielen allesamt auf die Knie, und das Mädchen sprach also: "Heilige Jungfrau, die du Königin in den Himmeln bist, wie die Frau Herzogin Königin in diesem Lande, sieh uns hier demütig vor dir liegen, arme Frauen und Mädchen, die ob der Zecherei ihrer Gatten und Verwandten jetzt Männerwerk tun und sich zum Kampfe waffnen müssen. Wenn du den Herrn Jesus nur ein klein wenig bittest, uns beizustehn, so sind wir des Sieges gewiß. Und aus Dankbarkeit werden wir dir eine schöne Krone aus lauterem Golde spenden mit Rubinen, Türkisen und Diamanten, eine schöne Goldkette und ein schönes silbergeblümtes Brokatkleid und ebenso deinem Sohne. Darum bitt für uns, heilige Jungfrau!"
Und all die guten Frauen und Mädchen sprachen Wantje nach: "Bitt für uns, heilige Jungfrau!" Und als sie sich erhoben, sahen sie, wie ein schöner, heller Stern zur Erde herabsank, ganz in ihrer Nähe, und das war sicherlich ein Engel des guten Gottes, der also aus dem Paradies herabgestiegen war und sich ganz in ihrer Nähe hielt, um ihnen besser helfen zu können. In Anbetracht dieses verheißungsvollen Vorzeichens fassen die guten Frauen noch mehr Mut, und Wantje sprach wieder und sagte: "Die Jungfrau will uns erhören, ich habe die beste Hoffnung. Jetzt gehen wir aber zum Dorfeingang, zu der Kirche mit unserm Heiland drinnen, und dort wollen wir Eisenzahn und seine Gesellen kühnlich erwarten. Und wann wir sie kommen sehn, so müssen wir, ohne ein Wörtlein zu sprechen, ja ohne uns zu rühren, auf sie schießen. Die heilige Jungfrau wird wohl die Pfeile lenken." "Wohl gesprochen, wackeres Mädchen," sagte Meister Bredaal; "gehen wir. Ich sehe es an deinen Augen, die in der Nacht leuchten: der Geist Gottes, der Feuer ist, flammt in deinem Jungfrauenherzen. Ihr müßt ihr gehorchen, gute Frauen."
"Jawohl, jawohl", sagten sie. Das weibliche Heer ordnete sich auf dem Wege hinter der Kirche. Dort warteten sie in großer Beklemmung und Angst, als sie ein mählich wachsendes Geräusch von Schritten und Stimmen hörten, wie es näherkommende Leute verursachen. Und Wantje sagte: "Heilige Jungfrau, sie sind's; hab Erbarmen mit uns. Nun tauchten vor ihnen eine große Männerrotte auf mit Laternen. Und sie hörte die entsetzliche Stimme eines heiseren Teufels: "Drauf, Gesellen, drauf! Eisenzahn braucht Beute!" Aber schon schossen auch all die guten Frauen bedächtig ihre Pfeile ab, denn die Schurken waren durch ihre Laternen beleuchtet, und die Frauen sahen sie wie bei hellichten Tag, während sie selber im Schatten blieben.
Zweihundert fielen mit Pfeilen im Kopfe, im Halse und auch im Leibe. Eisenzahn war der erste, den die guten Frauen mit gewaltigem Dröhnen stürzen sahen; Wantje hatte ihn behend ins Auge getroffen. Einige waren auch nicht verwundert; aber in ihrem verstörten Gewissen hielten sie die weißen Gewänder vor sich für die Seelen derer, so sie vom Leben zum Tode gebraucht hatten, die nun mit Verwilligung Gottes gekommen wären, um sich an ihnen zu rächen. Sie fielen mit der Fratze voraus auf die Erde, schier tot vor Angst, und schrien erbärmlich: "Gnade, Herrgott, schicke doch diese Gespenster zur Hölle zurück!"
Als sie aber dann die guten Frauen über sich kommen sahen, gab die Furcht ihren Beinen Beweglichkeit, und sie entflohen Hals über Kopf.
Zwölftes Kapitel
Wie Pieter Gans näher ist dem Scheiterhaufen als dem Weitersaufen.
Nach Vollbringung dieses Handstreichs kehrten die Frauen auf dem Platz und vor das Rathaus zurück, nicht glorreich, sondern bekümmert, daß sie in dieser Fährlichkeit Christenblut vergießen müssen. Wohl aber dankte sie überquollendem Gefühl unserer lieben Frau und dem Herrn Jesus für den gewährten Sieg.
Auch des süßen Engels vergaßen sie nicht, der ihnen in der Gestalt eines hellen Sternes beigestanden hätte. Und sie sangen gar melodisch schöne Hymnen und Litaneien. Unterdessen erwachten rundum
im Gefild die Hähne und verkünden mit ihren Trompeten den ersten Schimmer des Tages. Das riß die Zecher aus dem Schlafe, und sie traten vor die Tür, um zu sehen, woher denn diese Musik komme. Und
Frau Sonne lachte in den Himmeln.
Und die Biedermänner kamen auf den Platz, und da sahen sie die Versammlung der Frauen. Einige wollten die ihrigen, als sie darunter bemerkten, prügeln, weil sie des Nachts die eheliche Kammer verlassen hatten; aber Andries Bredaal wehrte ihnen und erzählte ihnen das Geschehnis. Darum waren sie mächtig verdutzt, beschämt und reumütig, als sie sahen, was die wackeren Rockträgerinnen für sie getan hatten. Auch Pieter Gans und Blaaskaak waren auf den Platz gekommen, und ebenso der hochwürdige Herr Klaassens, Dechant von Uccle, ein gar frommer Mann. Und Meister Bredaal sprach, diese große Menge betrachtend: "Gesellen, ihr wißt nun, daß ihr Gottes Luft nur dank der Trefflichkeit euerer Frauen und Töchter atmet. Darum sollt ihr auf der Stelle versprechen und schwören, nicht mehr zu trinken, als sei denn mit ihrem Willen."
"Ganz recht, Meister Bredaal", sagte einer von den Bürgern; "aber es ist nicht das Trinken, das einen so schweren Schlaf macht. Ich kann aus Erfahrung sprechen, der ich mein Lebtag den Humpen geschwungen habe, wie ich es denn auch in Zukunft fröhlich zu halten gedenke. Da ist etwas andres Schuld, Teufelszeug und Malefix, argwöhne ich.
Komm her, Pieter Gans, komm nur ein wenig mit uns plaudern und erkläre uns das Abenteuer, wenn du etwas weißt." "O weh, o weh," sagte Pieter Gans mit wackelndem Kopfe und klappernden Zähnen denn er hatte Angst der Biedermann: "Oh weh, o weh, ich weiß nichts, meine lieben Freunde." "Oh nein", sagte der Bürger, "es ist nicht wahr daß du nichts wüßtest; dir wackelt ja der Kopf, und die Zähne klappern dir."
Schon aber stand der Dechant Klaassens vor Gans auf und sagte zu ihm: "Du schlechter Christ, ich sehe es genügsam, du hast Umgang mit dem Teufel zu großer Fährlichkeit für diese wackeren Leute. Bekenne demütig deine Sünde, und wir werden trachten, dir Gnade werden zu lassen; wenn du aber leugnest, mußt du die Strafe des Öls erleiden." "Ha", rief Pieter Gans weinend, "ich habe es richtig vorausgesagt, und ich werde gesotten werden, guter Gott. Blaaskaak, Gevatter, wo bist du? Gib mir einen Rat! O weh, o weh!"
Aber Blaaskaak hatte sich schon aus Furcht vor dem Geistlichen davongemacht. "Ha", sagte Pieter Gans, "seht den Verräter, wie er mich verläßt in dem Augenblick der Gefahr."
"Sprich!" sagte der hochwürdige Herr Klaassens. "Ja, Herr Dechant", sagte Pieter Gans weinend und seufzend, "ich will Euch alles erzählen und gar nichts auslassen." Und als er mit seiner Geschichte fertig war, fuhr er fort: "Straft mich nicht allzu hart, Herr; ich werde aus meinen paar armseligen Groschen der Kirche ein ewiges Jahrgeld stiften. Ich bin ein guter Christ, das beschwöre ich, und nicht mindest ein Ketzer. Bedenkt auch, daß ich vor meinem Abscheiden genügend Muße haben möchte, um eine lange Buße zu tun. Laßt mich nur auf der Stelle sieden, ich beschwöre Euch."
"Wir werden sehn", antwortete der Dechant; "führe uns nun sofort zum Teufel." Der Dechant trat vorerst in die Kirche, vor der sie standen, um Weihwasser zu holen, und dann begaben sie sich allesamt, Männer, Frauen und Kinder, in die Trompet. Dort fragte der Dechant um den, der auf so viele wackere Männer einen Zauber geworfen hatte, und Pieter Gans zeigte ihm gar demütiglich den lachenden Pausbackigen, der seinen mit Reben und Trauben gezierten Stab in der Hand hielt; und einmütig sagten die Frauenzimmer, daß er für einen Teufel gar schön sei.
Nachdem sich der Priester bekreuzigt hatte, tauchte er die Hand in das Weihwasser und bestrich dem Bilde damit Stirn, Leib und Herz; und unverzüglich zerfiel das Bild durch die Allmacht Gottes in Staub, und man hörte eine klägliche Stimme: "O moi, o phos, tethneka!" Und der Priester erklärte die Worte des Teufels, die in griechischer Sprache bedeuteten: "Weh mir, o Licht, ich sterbe!"
Dreizehntes Kapitel
Von der großen Überraschung und dem wunderbaren Staunen des Herzogs, als er die Wackerkeit der guten Frauen von Uccle innen ward.
Derweilen sandte die Gemeinde zwei Biedermänner zum Herzog mit dem Auftrage, dem trefflichen Fürsten gebührendermaßen zu Vermelden, was sich zugetragen. Diese trafen ihn schon auf dem Wege nach Uccle; denn er hatte seine Späher von Eisenzahns Plan, der nicht geheim geblieben war, vernommen und zog nun im Eilmarsche wider ihn mit einer großen Reiterschar. Die Biedermänner warfen sich, sobald sie ihn erblickten vor ihm auf die Knie; der gütige Herr aber wollte es nicht leiden: er hob sie auf und hieß sie an seiner Seite zu bleiben.
Bald waren sie in dem Orte, wo die Räuber niedergemacht worden waren. Und als der Herzog die Leichen sah, hielt er ihn in befriedigter Verwunderung und sagte: "Wer hat diese Schurken getötet?" "Unsere Frauen", sagte der eine Biedermann. "Mir willst du etwas weismachen, Bürger?" sagte der Herzog, die Stirn runzelnd. "Gott bewahre, gnädiger Herr", sagte der andere; "ich will Euch den Hergang berichten." Und er tat es. "Oho", sagte der Herzog, "wer hätte das den Frauen zugetraut? Ich will sie belohnen." Dies gesagt, ließ er Eisenzahns Helm aufheben, um ihn mitzunehmen; und dieser Helm war lange unter den Waffen des Herrn Karls V. zu sehen, der ihn mit großer Sorgfalt gehütet wissen wollte.
Vierzehntes Kapitel
Wie die Gilde der Bogenschützinnen von Uccle gestiftet ward, und von der schönen Belohnung, die der Herzog der wackeren Wantje gegeben hat.
In Uccle eingezogen, sah der gute Herzog eine Menge Leute auf sich zukommen und mitten unter ihnen einen Mann, der erbärmlich schrie: "Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, lasst mich nicht sieden!" Und darauf ward ihm die Antwort: "Wir werden sehen." "Was soll dieser Lärm?" fragte der Herzog. Kaum aber war Pieter Gans seiner ansichtig geworden, so lief er auf ihn zu und umfaßte die Knie seines Pferdes: "Gnädiger Herr", schrie er, "gnädiger Herr Herzog, leidet nicht, daß man mich siede!" "Und warum sollte man dir denn", sagte der Herzog, "einen meiner guten Leute von Uccle sieden?"
Daraufhin trat der hochwürdige Herr Klaassens vor und erzählte ihm das Vorgefallene mit mächtigem Zorn, während Pieter Gans gar trübselig jammerte; und es war ein gewaltiges Wirrwarr, wie der eine weinte und stöhnte und der andere erzählte und Schlüsse ableitete, so daß der Herzog nicht wußte, wen er von den beiden anhören sollte. Plötzlich trat Wantje aus dem Haufen hervor, der mit Pieter Gans schrie: "Gnade und Barmherzigkeit!" "Gnädiger Herr", sagte das Mägdlein, "der hat sich schwer an Gott versündigt, aber aus Herzenseinfalt und angeborener Zaghaftigkeit. Der Teufel hat ihm die Angst eingejagt, und er hat sich ihm ergeben. Verzeiht ihm, gnädiger Herr, um unseretwillen."
"Du sprichst gut, Mägdlein", sagte der Herzog, "und ich will dir Gehör geben." Aber der hochwürdige Herr Klaassens sagte: "Gnädiger Herr, Ihr denkt nicht an Gott." "Pater", antwortete der Herzog, "daran habe ich es nie fehlen lassen, und samt dem vermeine ich, daß es ihm nicht lieb ist, das Schwert eines Christenmenschen räuchern und eines Biedermanns Fleisch sieden zu sehn, sondern daß er die liebt, welche Milde üben und ihren Nächsten nicht auf dem Wege der Buße hemmen. Heute, wo die selige Jungfrau in ihrer Gnade ein Wunder an uns getan hat, will ich nicht ihr Mutterherz durch den Tod betrüben. Darum soll für diesmal kein Bezichtigter, weder Pieter Gans noch die übrigen, verbrannt werden." Dies gehört, brach Pieter Gans wie verrückt in ein Lachen aus und begann zu tanzen und zu singen und rief: "Heil dem gnädigen Herrn! Brabant und dem Herzog!" Und alle Bürger stimmten in seinem Ruf ein: "Heil dem gnädigen Herrn!"
Bis sie der Herzog schweigen hieß und lächelnd sagte: "Wohlan, ihr Frauen, die ihr heute Männerwerk getan habt, kommt her, auf daß ich euch Männerlohn gewähre. Der Tapfersten gebe ich diese gewichtige Goldkette. Welche ist es?" "Ach, du bist's", sagte er, "die treffliche Verteidigerin! Gibst du mir einen Kuß samt meinem Alter?" "Jawohl, gnädiger Herr", sage das Mägdlein, und sie tat es, wie sehr sie sich auch schämte.
Und nachdem ihr der gute Herzog die Kette um den Hals gehängt hatte, fuhr er in seiner Rede fort: "Was nun euch allesamt betrifft, ihr guten Frauen, die ihr heute Nacht tapfer gekämpft habt, so vereinige ich euch zu einer schönen Gilde unter dem Schutze der Jungfrau. Dabei meine ich, daß hier eine Stange von gehöriger Länge aufgepflanzt werde, und an jedem Sonntag sollt ihr herkommen, um das Bogenschießen zu pflegen, zum Gedächtnis, daß ihr mit diesem Bogen euren Gatten und Kindern das Leben gerettet habt. Und es werden da sein ein schöner Lorbeerkranz und eine schöne Börse, wohlgefüllt mit glitzernden und klingenden Goldstücken, und diese Dinge sollen alljährlich der gewandtesten gegeben und ihr von allen andern auf ein Kissen dargebracht werden. Und die Börse wird sie aussteuern, wenn sie eine Jungfrau ist, und ihr gegen die Teuerung helfen, wenn sie verheiratet ist. So ist die Gilde der Bogenschützinnen von Uccle gestiftet worden, die an jedem Sonntag unter dem Schutze der lieben Frau ein Bogenschießen hält.
Quelle: Flämische Mären - Charles De Coster
