MÄRCHEN AUS FRANKREICH ...,
VERZEICHNIS
"Der Orangenbaum und die Biene"
"Der kleine Däumling"
"Das kleine Rotkäppchen"
"Die gute kleine Maus"
"Der gestiefelte Kater"
"Der Widder"
" Blaubart"
"Die Feen", von Charles Perrault
"Rot, weiß und schwarz"
"Schönchen Goldhaar"
"Prinz Kobold"
" Ricdin-Ricdon"
"Rosette"
"Der Kobold"
"Die Hindin im Walde"
"Finette Aschenbrödel"
"Aschenputtel oder: Das gläserne Pantöffelchen", von Charles Perrault
"Bertha mit den großen Füßen"
"Der blaue Vogel"
"Die im Walde schlafende Prinzessin"
DIE IM WALDE SCHLAFENDE PRINZESSIN ...
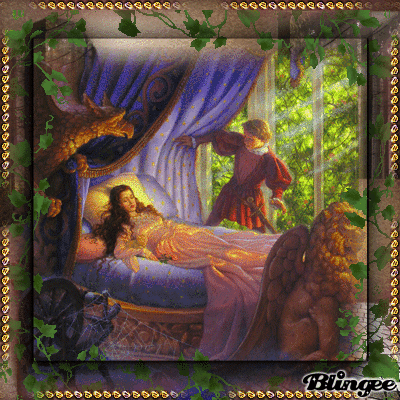
Es war einmal ein König und eine Königin, die waren sehr betrübt, dass sie keine Kinder hatten, so betrübt, es ist nicht zu sagen. Sie gingen in alle möglichen Bäder; Gelübde, Pilgerfahrten, alles wurde versucht, doch nichts wollte helfen. Endlich bekam die Königin ein Töchterchen. Man veranstaltete ein prächtiges Tauffest und wählte als Paten der kleinen Prinzessin alle Feen aus dem ganzen Lande, es waren ihrer sieben, damit eine jede von ihnen, wie es damals unter den Feen Sitte war, dem Kinde ein Geschenk mache und die Prinzessin auf solche Weise alle nur denkbaren Vollkommenheiten erhalte.
Nach den Zeremonien der Taufe begab sich die ganze Gesellschaft in den Palast des Königs, wo man ein herrliches Mahl für die Feen angerichtet hatte. Man legte vor eine jede ein Besteck mit einem Futteral von gediegenem Golde, in welchem Löffel, Gabel und Messer steckten, alles besetzt mit Diamanten und Rubinen. Als sich aber die ganze Gesellschaft schon zu Tische gesetzt hatte, trat plötzlich eine alte Fee herein, die man nicht gebeten hatte, weil sie seit länger als fünfzig Jahren aus ihrem Turm nicht heraus gegangen war und man daher geglaubt hatte, sie sei verstorben oder verzaubert. Der König ließ ihr sogleich ein Besteck auflegen, aber es war unmöglich, ihr eins von Gold zu geben, wie den anderen, weil er deren nur sieben für die sieben Feen hatte machen lassen.
Die Alte glaubte, man verachte sie und murmelte einige Drohungen zwischen den Zähnen. Eine der jungen Feen, die neben ihr saß, hörte es und vermutete, sie werde der kleinen Prinzessin irgend ein schlimmes Geschenk machen. Sie verbarg sich daher, als man von der Tafel aufstand, hinter die Tapete, um die Letzte zu sein, und möglicherweise das Übel, welches die Alte dem Kinde zufügen würde, wieder gut machen zu können.
Die Feen fingen nun an, der kleinen Prinzessin ihre Gaben auszuteilen. Die jüngste verlieh ihr vollkommene Schönheit, die zweite Geist wie ein Engel, die dritte bewunderungswürdige Anmut in allem, was sie tun würde; die vierte, die Gabe, vorzüglich schön zu tanzen; die fünfte, zu singen wie eine Nachtigall; und die sechste, alle Arten von Instrumenten auf das Vollkommenste zu spielen. Als nun die Reihe an die alte Fee kam, wackelte sie mit dem Kopf, mehr vor Bosheit, als vor Alter, und sagte, die Prinzessin solle sich mit einer Spindel in die Hand stechen und daran sterben.
Die ganze Gesellschaft erschrak über dieses entsetzliche Geschenk und alle brachen in Tränen aus. In diesem Augenblick trat die junge Fee hinter der Tapete hervor und sagte ganz laut zu dem Könige und der Königin: Beruhigt euch, eure Tochter wird nicht daran sterben; es steht zwar nicht in meiner Gewalt, was jene Boshafte getan hat, gänzlich ungeschehen zu machen: die Prinzessin wird sich mit einer Spindel in die Hand stechen, aber statt zu sterben, wird sie nur in einen tiefen Schlaf fallen; hundert Jahre dauert der Schlaf und dann wird sie der Sohn eines Königs aufwecken. Der König, um möglicherweise das von der Alten angedrohte Schicksal ganz zu vermeiden, ließ sogleich einen Befehl bekannt machen, durch welchen es Jedermann verboten wurde, an der Spindel zu spinnen oder nur eine Spindel im Hause zu haben, bei Todesstrafe.
Eines Tages, da die Prinzessin schon etwa fünfzehn oder sechzehn Jahr alt war, begaben sich der König und die Königin auf eines ihrer Lustschlösser, und da traf es sich, dass die junge Prinzessin, die im ganzen Schlosse umher lief, Treppe auf Treppe ab, aus einem Zimmer in das andere, endlich auch ganz hoch oben in ein kleines Dachstübchen kam, wo eine alte Frau mutterseelenallein an ihrer Spindel da saß und spann. Diese gute alte Frau hatte von dem Verbot des Königs kein Wort erfahren.
Was macht ihr denn da, gute Mutter? fragte die Prinzessin. Ich spinne, mein schönes Kind, antwortete die Alte, welche die Prinzessin nicht kannte. Ach, das ist ja allerliebst, rief die Prinzessin; wie macht ihr es denn? Gebt doch einmal her, ich möchte gern sehn, ob ich es auch so kann. Kaum aber hatte sie die Spindel genommen, als sie lebhaft und ein wenig unbesonnen, wie sie war (auch lag es einmal so im Beschluss der Feen) sich damit in die Hand stach und ohnmächtig zu Boden sank.
Das alte Mütterchen, in Todesschreck, schrie, nach Hilfe; man eilte von allen Seiten herbei, man spritzte der Prinzessin Wasser ins Gesicht, man schnürte sie auf, man rieb ihr die Hände und Schläfen mit starkem, wohlriechendem Wasser: aber nichts konnte sie aus ihrer Ohnmacht erwecken. Der König, welcher gleichfalls auf den Lärm herbei gekommen war, erinnerte sich der Prophezeiung der Feen, und da er wohl einsah, dass dies so hatte geschehen müssen, weil es die Feen gesagt hatten, so ließ er die Prinzessin in das schönste Gemach des Palastes tragen und auf ein Bett legen, welches mit Gold und Silber gestickt war. Sie war schön wie ein Engel, denn ihre Ohnmacht hatte die schönen Farben ihres Gesichts nicht verlöscht; ihre Wangen blühten wie Rosen und ihre Lippen glichen Korallen; nur ihre Augen waren geschlossen, aber man hörte sie leise atmen, woraus man sehen konnte, dass sie nicht tot war.
Der König befahl, man solle sie ruhig schlafen lassen, bis die Zeit ihres Erwachens gekommen sei. Die gute Fee, die ihr das Leben gerettet hatte, indem sie sie zu einem hundertjährigen Schlaf verdammte, befand sich eben in dem Königreich Mataquin, zwölftausend Meilen davon entfernt, als sich diese Begebenheit mit der Prinzessin zutrug; aber durch einen kleinen Zwerg mit Siebenmeilenstiefeln wurde sie in wenig Augenblicken davon benachrichtigt. Sogleich reiste die Fee ab, und bald darauf kam sie in einem feurigen, mit Drachen bespannten Wagen an.
Der König reichte ihr die Hand und hob sie aus dem Wagen. Sie billigte alles, was er getan hatte, aber da sie sehr vorsichtig war, fiel ihr ein, dass die Prinzessin, wenn sie aufwache, in großer Verlegenheit sein werde, sich in diesem alten Schloss ganz allein zu befinden. Was tat sie also!
Sie berührte mit ihrem Zauberstabe, den König und die Königin ausgenommen, alles, was sich in diesem Schlosse befand: Die Oberhofmeisterin, die Hofdamen, die Kammerfrauen, die Kammerherren, Offiziere, Hausmeister, Köche, Küchenjungen, Wachen, Türsteher, Läufer, Kammerdiener, Pagen; sie berührte gleichfalls alle Pferde im Marstalle, samt den Reitknechten, die großen Hofhunde und das kleine Toto, das Schoßhündchen der Prinzessin, welches neben ihr am Bette lag.
Sobald sie sie berührte, schliefen alle ein, um nicht eher, als mit ihrer Gebieterin wieder aufzuwachen, damit sie gleich bei der Hand wären, wenn die Prinzessin Etwas bedürfe. Selbst die Bratspieße am Feuer, die voll Rebhühner und Fasanen steckten, schliefen ein und das Feuer schlief auch. Das alles geschah in einem Augenblick, denn die Feen brauchen nicht viel Zeit zu ihren Geschäften. Hierauf verließen der König und die Königin, nachdem sie ihr geliebtes Kind noch einmal geküsst hatten, ohne dass es aufwachte, das Schloss, und ließen öffentlich bekannt machen, niemand, wer es auch immer sei, solle sich diesem Schlosse nähern.
Es bedurfte aber dieses Verbots gar nicht, denn in weniger als einer Viertelstunde wuchs rings herum ein so dichter Wald von großen und kleinen Bäumen, Sträuchern und Disteln, die alle so in einander verschlungen waren, dass weder Menschen noch Tiere hindurch konnten, so dass man von dem Schloss nichts weiter als die Turmspitze erblickte und auch die nur in ziemlicher Entfernung. Ganz ohne Zweifel war auch dies ein Werk der Fee, damit die Prinzessin während ihres Schlafes von Neugierigen nichts zu besorgen hätte.
Nach Verlauf von hundert Jahren ging der Sohn des damals regierenden Königs, der aus einer anderen Familie stammte als die schlafende Prinzessin, auf die Jagd, und da er an jenen Wald kam und die Turmspitze erblickte, fragte er, was das für ein Turm sei, der über dem dichten Wald hervorragte. Jeder erzählte ihm nun, was er davon gehört hatte; der Eine sagte, es sei ein altes Schloss, wo Geister ihre Zusammenkünfte hielten; ein Anderer, alle Hexen aus der Umgegend feierten dort ihren Sabbat. Die Meinung der Meisten war, dass ein Menschenfresser dort wohne, und dass er alle Kinder, die er nur erwischen könne, dahin schleppe, um sie nach seiner Bequemlichkeit zu verspeisen, da ihm niemand nachfolgen könnte, weil er allein durch dies verwachsene Gebüsch einen Weg wüsste.
Der Prinz wusste nicht, was er davon glauben sollte, bis endlich ein alter Bauer das Wort nahm und zu ihm sagte: „Mein Prinz, es sind schon über fünfzig Jahr, dass ich meinen Vater habe sagen hören, in diesem Schloss sei eine Prinzessin, die schönste, welche je gelebt hat; sie müsse aber hundert Jahre schlafen und werde dann von einem Prinzen erweckt werden, dem sie zur Gemahlin bestimmt sei." Bei diesen Worten wurde der junge Prinz voll Feuer und Flamme; er war sogleich überzeugt, dass er bestimmt sei, dieses schöne Abenteuer zu bestehen, und beschloss, auf der Stelle zu erfahren, wie es damit beschaffen sei. Kaum näherte er sich dem Gebüsche, so traten alle die großen Bäume, Sträucher und Dornen von selbst auf die Seite und ließen ihn ungehindert durch.
Er ging gerade auf das Schloss zu, welches er am Ende einer langen Allee liegen sah. Zu seiner Verwunderung hatte ihm keiner von seinen Leuten folgen können, weil die Bäume sogleich wieder hinter ihm zusammen rückten. Er kam in einen großen Vorhof, wo alles was er sah, wohl geeignet war, ihm Furcht und Grauen einzuflößen. Das schrecklichste Stillschweigen herrschte, überall sah man das Bild des Todes; Körper von Menschen und Tieren lagen ausgestreckt, wie ohne Leben; doch sah er wohl an den kupfrigen Nasen und rochen Gesichtern der Türsteher, dass sie nur schliefen; die Gläser, welche neben ihnen standen und in denen noch einige Tropfen Wein waren, zeigten, dass sie der Schlaf während des Trinkens überfallen hatte.
Der Prinz trat hierauf in einen großen mit Marmor gepflasterten Hof: er stieg eine Treppe hinauf und kam in einen Saal wo die Leibwachen, das Gewehr auf der Schulter und auf ihr Bestes schnarchend, in einer Reihe standen. Er ging durch mehrere Zimmer voll Kammerherren und Damen die alle schliefen, die Einen stehend, die anderen sitzend. Endlich gelangte er in ein Zimmer, welches über und über vergoldet war, und auf einem Bett, dessen Vorhänge von beiden Seiten offen waren, erblickte er das anmutigste Schauspiel von der Welt: eine Prinzessin von etwa fünfzehn bis sechzehn Jahren, deren leuchtendes Antlitz wie verklärt und überirdisch erschien.
Zitternd und voll Bewunderung näherte sich der Prinz und kniete neben ihr nieder. Da eben jetzt der Augenblick der Entzauberung gekommen war, so wachte die Prinzessin auf, und indem sie ihn mit so zärtlichen Blicken ansah, als kenne sie ihn seit langer Zeit, sagte sie zu ihm: „Seid ihr es, mein Prinz? Ihr habt lange auf euch warten lassen." Der Prinz war entzückt über diese Worte und noch mehr über die Art, mit welcher sie die selben sagte. Er wusste gar nicht, wie er ihr seine Freude und seine Erkenntlichkeit bezeugen sollte; er versicherte, er liebe sie mehr als sich selbst. Seine Worte waren schlecht gesetzt, aber sie gefielen der Prinzessin nur umso mehr, denn die Liebe ist umso zärtlicher, je weniger sie beredt ist.
Er war überhaupt weit verlegener als sie, worüber man sich nicht wundern darf: sie hatte Zeit genug gehabt, daran zu denken, was sie ihm sagen sollte, denn aller Wahrscheinlichkeit nach hatte die gute Fee während eines so langen Schlafes ihr das Vergnügen angenehmer Träume gewährt. Genug, sie sprachen vier ganze Stunden lang und hatten sich noch nicht die Hälfte von dem gesagt, was sie sich zu sagen hatten. Inzwischen war der ganze Palast zu gleich mit der Prinzessin aufgewacht: jedes dachte nun darauf, seinen Dienst zu verrichten, und da sie nicht alle von Liebe erfüllt waren, so starben sie fast vor Hunger. Die Hofdame wurde so gut wie die Übrigen ungeduldig, und sagte ganz laut zur Prinzessin, dass das Fleisch aufgetragen sei.
Der Prinz half der Prinzessin aufstehen, sie war vollständig und sehr prächtig angekleidet; aber er hütete sich wohl, ihr zu sagen, dass sie wie seine Großmutter angezogen sei, denn sie hatte einen hohen Steifkragen, war aber nicht weniger schön deshalb. Sie begaben sich in einen rings mit Spiegeln tapezierten Saal und speisten da selbst, während die Dienerschaft der Prinzessin ihnen aufwartete. Die Violinisten und Hornisten spielten einige alte Stücke auf, welche vortrefflich waren, obgleich man sie seit hundert Jahren nicht mehr spielte; und nach Tisch ging es gleich in die Schlosskapelle, wo der Hofkapellan das Paar traute.
Am anderen Morgen verließ der Prinz seine Gemahlin und kehrte nach der Stadt zurück, wo sein Vater in großer Sorge um ihn war. Der Prinz sagte zu ihm, er habe sich auf der Jagd im Walde verirrt und in der Hütte eines Kohlenbrenners geschlafen, der ihn mit Schwarzbrot und Käse bewirtet habe. Der König, sein Vater, war ein guter Mann und glaubte alles; aber seine Mutter war nicht so leicht zu überreden, und da sie sah, dass er fast alle Tage auf die Jagd ging, und immer eine Entschuldigung bei der Hand hatte, wenn er zwei oder drei Nächte außer dem Hause zubrachte, so zweifelte sie nicht, dass irgend ein Geheimnis dahinter stecke.
Denn er lebte mit der Prinzessin schon länger als zwei ganze Jahre so und sie hatte ihm zwei Kinder geschenkt, von denen das älteste eine Tochter war und Morgenrot hieß, das zweite ein Sohn, den man Prinz Tag nannte, weil er noch schöner war als seine Schwester. Die Königin suchte auf alle Art, ihren Sohn zu einem Geständnis zu bringen; aber er wagte nicht, ihr sein Geheimnis anzuvertrauen, denn er fürchtete sie, aller Liebe ungeachtet, weil sie aus einer Menschenfresserfamilie stammte und der König sie nur ihres großen Vermögens wegen geheiratet hatte. Ja, man sagte sich selbst bei Hof ganz leise ins Ohr, dass sie die Neigungen der Menschenfresser teile, und wenn sie kleine Kinder vorbeigehen sehe, sich kaum bezähmen könne, nicht über sie herzufallen.
Deshalb also wollte ihr der Prinz nichts entdecken. Als indes der König nach Verlauf von einigen Jahren gestorben war und der Prinz zur Regierung kam, machte er seine Vermählung öffentlich bekannt und holte die Königin, seine Gemahlin, mit großer Feierlichkeit aus ihrem Schlosse. Sie wurde in der Hauptstadt, wo sie mit ihren beiden Kindern einzog, aufs Prächtigste empfangen.
Einige Zeit darauf zog der König in den Krieg gegen seinen Nachbar, den Kaiser Kantalabutte. Er überließ die Verwaltung seines Reichs der Königin, seiner Mutter, und empfahl ihr die Sorge für seine Frau und Kinder sehr angelegentlich. Er musste den ganzen Sommer über ausbleiben; kaum war er fort, so schickte die Königin Mutter ihre Schwiegertochter und ihre Enkelkinder in ein Landhaus, welches mitten im Walde lag, um dort ihr abscheuliches Gelüst leichter befriedigen zu können.
Nach einigen Tagen begab sie sich gleichfalls dahin, und eines Abends sagte sie zu ihrem Haushofmeister: „Morgen Mittag will ich die kleine Morgenrotspeisen." „Um Himmelswillen, Ihre Majestät!“, rief der Haushofmeister. „Ich befehle es“, sagte die Königin, und sie sagte das mit einem rechten Menschenfresserton, dem man die Luft nach frischem Fleisch anhörte, „und ich will sie mit einer saueren Sauce essen."
Der arme Mann sah wohl, dass sich mit einer Menschenfresserin nicht spaßen lasse, nahm also sein großes Messer und ging in die Kammer der kleinen Morgenrot, die damals vier Jahr alt war. Sie kam springend und lachend auf ihn zu, schlang die Ärmchen um seinen Hals und bat ihn um Naschwerk. Er brach in Tränen aus, das Messer fiel ihm aus der Hand, er ging in den Hof, schnitt einem Lämmchen die Gurgel ab, und bereitete es mit einer so guten Sauce, dass ihn die Königin versicherte, nie etwas so Delikates gegessen zu haben. Zu gleicher Zeit hatte er die kleine Morgenrot zu seiner Frau gebracht, um sie in einer Kammer zu verbergen, die ganz versteckt tief drin im Hofe lag.
Acht Tage später sagte die nichtswürdige Königin zu ihrem Haushofmeister: „Ich will zum Abendbrot den kleinen Tag essen." Er entgegnete kein Wort, war aber fest entschlossen, sie wie das erste Mal zu hintergehen. Er ging zu dem kleinen Tag, der eben ein kleines Rappier in der Hand hatte und sich mit einem Affen herumfocht: gleichwohl war der Knabe nicht älter als drei Jahr. Er brachte ihn zu seiner Frau, die ihn als dann an den nämlichen Ort wie die kleine Morgenrot versteckte, und richtete anstatt des Knaben ein sehr zartes junges Reh zu, welches die Königin ganz vortrefflich fand.
Bis dahin war alles ganz gut gegangen; eines Abends aber sagte diese nichtswürdige Königin zum Haushofmeister: „Nun will ich die Königin mit der selben Sauce, wie ihre Kinder speisen." Diesmal geriet der arme Haushofmeister in Verzweiflung, denn er wusste nicht, wie er es anstellen solle, sie zu täuschen. Die junge Königin war über zwanzig Jahr alt, ohne die hundert Jahr zu rechnen, welche sie verschlafen hatte. Ihre Haut war also ein wenig hart, obgleich schön und weiß, und nun galt es in dem Tiergarten ein Tier aufzufinden, dessen Haut der ihrigen gliche!
Er entschloss sich also, um sein eigenes Leben zu retten, der Königin den Hals abzuschneiden, und ging auf ihr Zimmer, in der Absicht, es nicht so zu machen, wie die anderen beiden Male. Er versetzte sich, so viel als möglich in Wut, und trat, den Dolch in der Hand, in das Zimmer der jungen Königin; er wollte sie in des nicht unvorbereitet sterben lassen, sondern kündigte ihr mit aller Ehrfurcht den Befehl an, den er von der Königin Mutter erhalten hatte.
„Wohlan“, versetzte sie, indem sie ihm den Hals dar bot, „vollzieht eueren Befehl; so werde ich doch meine Kinder wieder sehen, meine armen Kinder, die ich so zärtlich geliebt habe" — sie hielt sie nämlich für tot, weil man sie fort gebracht hatte, ohne ihr etwas davon zu sagen. „Nein, nein, gnädigste Frau“, entgegnete der arme Haushofmeister ganz gerührt, „ihr sollt nicht sterben und sollt doch eure Kinder wieder sehen. Ich habe sie bei mir verborgen, und will die Königin noch einmal täuschen, in dem ich ihr statt eurer eine junge Hirschkuh vorsetze.
Er führte sie sogleich in seine Kammer, und während sie ihre Kinder umarmte und mit ihnen weinte, ging er, eine Hirschkuh zuzurichten, welche die alte Königin auch mit solchem Appetit zum Abend verspeiste, als ob es ihre Schwiegertochter selbst gewesen wäre. Sie war mit ihrer Grausamkeit ganz zufrieden, und beschloss, dem Könige bei seiner Rückkehr zu sagen, die Wölfe hätten die Königin, seine Gemahlin, so wie seine beiden Kinder aufgefressen.
Eines Abends, da sie, wie gewöhnlich, in allen Höfen des Schlosses umher schlich, um irgendwo frisches Fleisch zu erschnuppern, hörte sie in einem der Gemächer den kleinen Tag weinen, weil ihn die Königin, seine Mutter, einer Unart wegen strafen wollte, und eben so hörte sie auch die Stimme der kleinen Morgenrot die für ihren Bruder um Verzeihung bat.
Die Menschenfresserin erkannte sogleich die Stimme der Königin und ihrer Kinder und geriet in Wut, dass man sie hintergangen hatte. Sie befahl den anderen Morgen mit einem furchtbaren Ton, der alles zittern machte, mitten auf den Hof eine große Kufe zu setzen, sie mit Kröten, Vipern, Ottern und Schlangen zu füllen, und dann die junge Königin und ihre Kinder, den Haushofmeister, seine Frau und seine Dienerin hineinzuwerfen.
Sie hatte Befehl gegeben, sie, die Hände auf den Rücken gebunden, herbeizuführen, und schon waren die Henker im Begriff, sie in die Kufe zu stürzen, als der König, den man sobald nicht erwartet hatte, plötzlich in den Hof ritt. Ganz erstaunt fragte er, was dieses schreckliche Schauspiel bedeuten solle. Niemand wagte ihm zu antworten; da stürzte sich die Menschenfresserin, voller Wut, ihre Absicht so vereitelt zu sehen, selbst in die Kufe, und wurde in einem Augenblick von dem abscheulichen Gewürm, welches sich darin befand, aufgefressen.
Der König betrübte sich zwar darüber, denn sie war einmal seine Mutter; aber er tröstete sich bald in den Armen seiner schönen Gemahlin und seiner Kinder.
DER BLAUE VOGEL ...
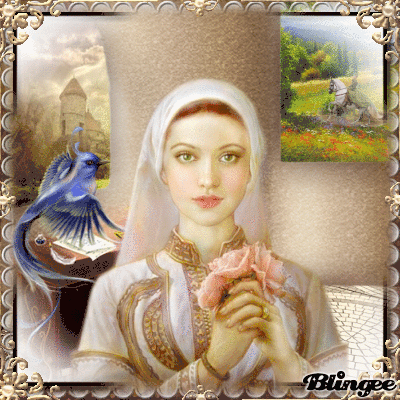
Es war einmal ein König, der sehr viele Länder und Schätze besaß; seine Gemahlin aber starb ihm und er war untröstlich deshalb. Er verschloss sich acht ganze Tage in ein kleines Kabinett, wo er den Kopf gegen die Wände rannte, so voller Verzweiflung war er. Man besorgte, er werde sich noch den Kopf einstoßen, und legte Matratzen zwischen die Wand und die Tapete, so dass er immer hin stoßen konnte und gleichwohl keinen Schaden nahm. Alle seine Untertanen beschlossen, zu ihm zu gehen und ihm alles zu sagen, was nur geeignet schien, seinen Kummer zu lindern. Die Einen studierten auf eine nachdrucksvolle, ernsthafte Anrede, andere auf etwas Erheiterndes, ja sogar auf etwas Lustiges: aber nichts von allem machte Eindruck auf ihn, er hörte kaum, was man zu ihm sprach.
Endlich erschien auch eine Frau, die mit schwarzen Floren, Schleiern, Tüchern und langen Trauergewändern dergestalt vermummt war und so über alle Maßen weinte und schluchzte, dass der König ganz erstaunte. Die Frau sagte zu ihm, sie komme nicht in der Absicht wie die Übrigen seinen Schmerz zu vermindern, sondern sie wolle ihn noch vermehren, denn nichts sei billiger, als eine gute Frau zu beweinen. Sie, die den besten aller Männer gehabt hätte, sei fest entschlossen, so lange um ihn zu weinen, als sie noch ein Auge im Kopf habe. Darauf verdoppelte sie ihr Geschrei und der König heulte nach ihrem Beispiele mit.
Er nahm diese Frau besser auf als alle übrigen; er unterhielt sich mit ihr von den guten Eigenschaften seiner verstorbenen Gemahlin, und sie erhob noch viel mehr die ihres verstorbenen Gemahls: und beide schwatzten so viel und so lange von ihrem Schmerz, bis sie zuletzt über ihren Schmerz nichts mehr zu sagen wussten. Als die schlaue Witwe diesen Gegenstand beinah erschöpft sah, lüftete sie ein wenig ihre Schleier und der betrübte König weidete sein Auge an dem Anblick dieser armen Betrübten, die mit vorzüglicher Geschicklichkeit zwei große blaue Augen, die mit langen, schwarzen Augenbrauen besetzt waren, um her zu werfen verstand.
Der König betrachtete sie mit vieler Aufmerksamkeit; allmählich sprach er immer weniger von seiner Frau, zuletzt sprach er gar nicht mehr von ihr. Die Witwe sagte, sie wolle ihren Mann ohne Aufhören beweinen, und der König bat, sie möge ihren Schmerz nicht verewigen. Endlich, zu aller Welt Erstaunen, vermählte sich der König mit ihr und das Schwarz verwandelte sich in Grün und Rosenfarben. So bedarf es oft nur, die Schwäche der Menschen zu kennen, um sich ihrer Neigung zu bemächtigen und alles mit ihnen zu machen, was man will. Der König hatte aus seiner ersten Ehe nur eine Tochter, die für das erste Wunder der Welt galt. Sie hieß Florine, weil sie wie die Göttin Flora so blühend und schön war. Prächtige Kleider liebte sie nicht, aber einen leichten Anzug mit einer Spange von Edelsteinen und Blumengirlanden, die in ihr schönes Haar verflochten, den reizendsten Anblick gewährten. Sie war erst fünfzehn Jahr alt, als sich der König verheiratete.
Die neue Königin ließ jetzt ihre eigene Tochter herbei holen, die bei ihrer Patin, der Fee Sussio, erzogen worden war; allein sie war deshalb um nichts anmutiger noch schöner geworden. Die Fee hatte sich alle mögliche Mühe mit ihr gegeben, doch ohne Erfolg; gleichwohl hörte sie nicht aus sie zärtlich zu lieben. Man nannte sie Forelline, weil ihr Gesicht so rote Flecken hatte, wie eine Forelle. Ihr schwarzes Haar war so fett und schmutzig, dass man es nicht anrühren mochte, und ihre gelbe Haut schwitzte Öl aus. Die Liebe der Königin zu dieser Tochter ging bis zur Narrheit: sie sprach von nichts als von ihrer reizenden Forelline, und geriet in Verzweiflung, dass Florine sie in jeder Art so weit übertraf; sie versuchte alles Mögliche, ihre Stieftochter bei dem König anzuschwärzen; und kein Tag verging, dass nicht die Königin und Forelline Florinen einen Streich spielten. Aber die sanfte und geistvolle Prinzessin setzte sich über dieses boshafte Betragen so viel als möglich hin weg.
Eines Tages sagte der König zu seiner Gemahlin, Florine und Forelline seien nun groß genug, um sich zu vermählen, und man müsse zusehen, dass man eine von ihnen an den ersten Prinzen, der sich bei Hofe sehen ließe, verheirate. Ich verlange, versetzte die Königin, dass meine Tochter zu erst vermählt wird, sie ist älter, als die eurige, und da sie tausendmal liebenswürdiger ist, so kann gar keine Wahl stattfinden. Der König, welcher nicht gern zankte, sagte, er sei es zufrieden, und sie solle darüber zu bestimmen haben. Nach einiger Zeit hörte man, dass der König Liebreiz sie nächstens besuchen würde. Nie gab es einen zuvor kommenden und prachtliebenden Prinzen; sein Geist und sein Äußeres entsprachen seinem Namen. Als die Königin diese Neuigkeit vernahm, setzte sie alle Stickermädchen, alle Schneider und alle übrigen Arbeiter für Forellinen in Bewegung; zu gleich bat sie den König, dass Florine nichts Neues haben solle, ja sie bestach sogar ihre Kammerfrauen und ließ ihr an dem nämlichen Tage, da Prinz Liebreiz eintraf, alle ihre Kleider, ihren Kopfputz und ihr Geschmeide stehlen, so dass Florine, als sie sich ankleiden wollte, nicht ein Band vorfand. Sie merkte wohl, wer ihr diesen schönen Dienst erwiesen habe, und schickte zu den Kaufleuten nach anderen Stoffen; aber die Kaufleute entgegneten, die Königin habe streng verboten, ihr etwas zu verkaufen, und so blieb ihr nichts, als ein altes, beschmutztes Kleidchen. Ganz beschämt setzte sie sich in einen Winkel des Saales, als der König Liebreiz anlangte.
Die Königin empfing ihn mit außerordentlichen Höflichkeits Bezeugungen; sie stellte ihm ihre Tochter vor, die heller als die Sonne flimmerte, durch ihren Putz aber nur noch hässlicher als sonst erschien. Der König wendete die Augen von ihr ab; aber die Königin wollte sich überreden, sie gefalle ihm so sehr, dass er in Besorgnis sei, sich von ihr fesseln zu lassen. Deshalb brachte sie ihm ihre Tochter immer wieder vor die Augen. Er fragte darauf, ob es nicht noch eine andere Prinzessin gäbe, Namens Florine?
„Ja“, antwortete Forelline, indem sie mit dem Finger auf sie zeigte, „die da ist es in der Ecke, die versteckt sich, weil sie wie ein Aschenbrödel aussieht. Florine errötete, und wurde so schön, so schön, dass der König Liebreiz wie geblendet da stand. Er stand rasch auf, machte der Prinzessin eine tiefe Verbeugung und sagte zu ihr: „Eure unvergleichliche Schönheit, meine Prinzessin, schmückt euch so sehr, dass ihr einer fremden Hilfe nicht erst bedürft." „Mein Prinz“, erwiderte sie, „ich gestehe, dass ich nicht gewohnt bin, ein so schlechtes Kleid zu tragen, wie dies hier, und ihr würdet mir ein Vergnügen gemacht haben, wenn ihr mich gar nicht bemerkt hättet. Das wäre unmöglich, rief Liebreiz; eine so wundervolle Prinzessin sollte sich irgendwo befinden und man könnte noch für eine andere Augen haben, als für sie?" „Ha“, fiel die aufgebrachte Königin ein, ich bringe meine Zeit wirklich schön zu, in dem ich euch zuhöre. Glaubt mir, mein Herr, Florine ist gefallsüchtig genug, man braucht ihr nicht erst so viele Schmeicheleien vorzusagen." Der König Liebreiz durchschaute sogleich die Gründe, welche die Königin so reden ließen, in des, da er keine Rücksicht zu nehmen brauchte, so gab er alle seine Bewunderung Florinen zu erkennen, und unterhielt sich mit ihr drei Stunden hinter einander.
Die Königin war in Verzweiflung und Forelline untröstlich, dass sie nicht den Vorzug vor der Prinzessin erhielt. Sie gingen nun den König mit heftigen Klagen an, und nötigten ihn, einzuwilligen, dass man, so lange König Liebreiz anwesend sei, Florinen in einen Turm sperre, wo sie sich nicht sehen könnten. Und wirklich war sie kaum wieder auf ihr Zimmer zurückgekehrt, so ergriffen sie vier Männer und trugen sie hoch hinauf in den Turm. Hier ließ man sie allein in der äußersten Trostlosigkeit, denn sie sah wohl, dies alles geschehe nur, um zu verhindern, dass der König Liebreiz ihr seine Neigung schenke, und Liebreiz gefiel ihr doch schon so wohl und sie würde ihn gern zu ihrem Gemahl gewählt haben. Da dieser von dem gewaltsamen Verfahren gegen die Prinzessin nichts wusste, so erwartete er die Stunde, wo er sie wieder zu sehen hoffte, mit größter Ungeduld. Er fragte nach ihr bei einigen Hofleuten, welche der König zu seiner Aufwartung geschickt hatte, aber auf Befehl der Königin sagten sie nur alles erdenklich Böse von ihr: sie sei gefallsüchtig, launig, boshaft; sie quäle ihre Freunde und ihre Dienerschaft; man könnte nicht unsauberer sein, sie triebe den Geiz so weit, dass sie lieber wie eine Gänsehüterin gekleidet ginge, als sich von dem Nadelgelde, welches der König, ihr Vater, ihr gebe, einen anständigen Anzug zu kaufen.
Bei allen diesen Schilderungen stand Liebreiz wahrhaft aus und konnte die Bewegungen seines Unwillens kaum zurückhalten. Nein, sagte er bei sich selbst, es ist unmöglich, dass der Himmel einem solchen Meisterwerk der Natur eine so hässliche Seele gegeben hat. Ich muss gestehen, sie war nicht eben sauber gekleidet, aber ihre Beschämung deshalb beweist hinlänglich, dass sie nicht gewohnt ist, sich so gekleidet zu sehen. Wie, so böse sollte sie sein, mit diesem bezaubernden Anschein von Bescheidenheit und Sanftmut? Das ist mir unbegreiflich; weit leichter kann ich mir denken, dass sie so auf Geheiß der Königin verleumdet wird; sie ist nicht umsonst ihre Stiefmutter, und die Prinzessin Forelline ist ein so garstiges Geschöpf, dass es ganz natürlich ist, wenn sie eine so vollkommene Schönheit beneidet. Während dieses Selbstgespräches errieten die Hofleute leicht aus seinen Mienen, dass sie ihm mit ihren Lästerungen der Prinzessin Florine kein Vergnügen gemacht hatten. Einer von ihnen, schlauer als die anderen, änderte sogleich Ton und Sprache, um die Gesinnung des Prinzen zu erforschen und fing an, die Prinzessin wie ein Wunderwerk heraus zu streichen. Bei diesen Worten erwachte der Prinz wie aus einem tiefen Schlaf, unterhielt sich lebhaft, und sein Antlitz glänzte vor Freude.
Die Königin, ungeduldig, zu erfahren wie es mit der Neigung des Königs Liebreiz stünde, brachte die halbe Nacht damit zu, die Hofleute auszufragen, aber alles, was sie ihr hinter brachten, bestärkte sie nur noch in dem Glauben, dass der König Florinen liebe. Was soll man aber von der Schwermut dieser armen Prinzessin sagen! Sie lag in jenem furchtbaren Turm, wohin man sie geschleppt hatte auf dem Boden, Ich wäre weniger zu beklagen, sagte sie zu sich, hätte man mich hier eingesperrt, bevor ich noch jenen liebenswürdigen König erblickte. Der Gedanke an ihn kann meinen Kummer nur vermehren. Ganz ohne Zweifel behandelt mich die Königin so grausam, um zu verhindern, dass ich ihn nicht mehr sehe. Ach, wie viel kostet mich das bisschen Schönheit, welches mir der Himmel verliehen hat. — Dabei weinte sie so bitterlich, so bitterlich, dass selbst ihre Feindin gewiss Mitleid mit ihr empfunden hätte, wenn sie Zeugin ihres Schmerzes gewesen wäre.
So verging die Nacht. Die Königin, welche den König Liebreiz durch alle möglichen Beweise von Aufmerksamkeit fesseln wollte, machte ihm ein Geschenk von den reichsten und geschmackvollsten Kleidern, nebst einem Orden, den der König an ihrem Vermählungstag gestiftet hatte. Es war ein goldenes Herz mit einem feuerfarbenen Schmelz, umgeben von Pfeilen, deren einer es durchbohrte, mit den Worten: Nur Einer hat mich verwundet. Die Königin hatte für Liebreiz ein Herz von einem Rubin, in der Größe eines Straußeneis, anfertigen lassen, jeder Pfeil bestand aus einem einzigen Diamant, von der Länge eines Fingers und die Kette, an welcher das Herz hing, war von Perlen, deren kleinste ein Pfund wog, so dass es, seit die Welt besteht, nichts Ähnliches gegeben hat. Der König war bei dem Anblick dieses Geschenks so überrascht, dass er eine Zeit lang sprachlos da stand; zu gleicher Zeit überreichte man ihm ein Buch, dessen pergamentene Blätter mit bewunderungswürdigen Miniaturgemälden geschmückt waren; der goldene Deckel strahlte von Edelsteinen, der Inhalt enthielt die Gesetze des Ordens. Man sagte dem König, die Prinzessin, welche er gesehen habe, übersende ihm dieses Geschenk, mit der Bitte, ihr Ritter zu sein.
Bei diesen Worten wagte er sich mit dem Gedanken zu schmeicheln, es könne die sein, welche er liebe. „Wie, die schöne Prinzessin Florine, rief er aus, denkt an mich auf eine so freigebige, bezaubernde Weise?" „Ihre Majestät“, entgegnete man, „irren sich im Namen, wir kommen von der liebenswürdigen Forelline." „Also Forelline will mich zu ihrem Ritter?“, sagte der König sehr kalt und ernsthaft, „ich bedaure, diese Ehre nicht annehmen zu können; aber ein König ist nicht so sehr sein eigener Herr, dass er jede Verbindlichkeit, wie er wünschte, annehmen könnte. Ich kenne die Pflichten eines Ritters und möchte sie gern alle erfüllen; ich ziehe es daher vor, die Gunst, welche sie mir anbietet, nicht anzunehmen, als mich ihrer unwürdig zu machen." Er legte sogleich das Herz, die Kette und das Buch wieder in den Korb und schickte darauf alles der Königin zurück, die gleich ihrer Tochter vor Wut zu ersticken meinte über die verächtliche Weise, mit welcher der fremde König eine so besondere Gunstbezeugung empfangen hatte. Sobald Liebreiz sich schicklicher Weise zu dem König und der Königin begeben konnte, eilte er dahin, in der Hoffnung, Florinen zu finden. Überall sah er sich nach ihr um; so oft er jemanden in das Zimmer treten hörte, wendete er den Kopf rasch nach der Tür zu; Unruhe und Mißlaune zeigte sich in seinem ganzen Wesen.
Die boshafte Königin erriete leicht genug, was in seiner Seele vorging, aber sie ließ sich nichts merken. Sie sprach von nichts als von Lustbarkeiten mit ihm; er antwortete ihr ganz zerstreut; endlich fragte er, wo die Prinzessin Florine wäre. „Der König, ihr Vater“, entgegnete die Königin stolz, „hat ihr verboten, sich eher sehen zu lassen, als bis meine Tochter vermählt sein wird." „Und aus welchem Grund“, fragte der König, „kann man diese liebenswürdige Prinzessin so gefangen halten?" „Ich weiß nicht“, versetzte die Königin, „und wenn ich es auch wüsste, könnte ich meine Gründe haben, es euch nicht zu sagen." König Liebreiz empfand einen heftigen Ingrimm; er sah Forelline mit zornigen Blicken an, denn dieses kleine Ungeheuer war ja die Ursache, dass man ihn des Vergnügens, die Prinzessin zu sehen, beraubte. Er entfernte sich sehr bald, die Gegenwart der Königin war ihm unerträglich. Als er sich wieder auf seinem Zimmer befand, sagte er zu einem jungen Prinzen, welcher ihn begleitete, und den er sehr liebte, er möge alles aufbieten und kein Geld scheuen, eine von Florinens Kammerfrauen zu gewinnen, dass er nur einen Augenblick mit der Prinzessin sprechen könne.
Es gelang dem Prinzen leicht, unter den Damen im Palast eine Vertraute zu gewinnen. Diese versicherte ihn, noch denselben Abend werde Florine an einem kleinen Fenster erscheinen, welches zu ebener Erde in den Garten ging, dort könne er mit ihr sprechen; doch müsste es mit der größten Behutsamkeit geschehen, damit man nichts gewahr werde; denn, fügte sie hinzu, der König und die Königin sind so streng, dass sie mich mit dem Tode bestrafen würden, wenn sie entdeckten, ich hätte die Neigung des Königs Liebreiz begünstigt. Der Prinz, entzückt, die Sache so weit gebracht zu haben, versprach ihr alles , was sie wollte, und eilte, den König von allem in Kenntnis zu setzen. Aber die nichtswürdige Vertraute sagte der Königin alles wieder, die sogleich den Gedanken fasste, ihre Tochter an das kleine Fenster zu schicken; sie unterrichtete diese vollständig, und Forelline, so einfältig sie sonst war, vergaß nichts.
Die Nacht war so finster, dass der König den Betrug, den man ihm spielte, unmöglich hätte merken können, selbst wenn er weniger eingenommen gewesen wäre, als er war. Er sagte also, da er sich mit unaussprechlicher Freude dem Fenster nahte, zu Forellinen alles, was er Florinen sagen wollte, um sie von seiner Liebe zu überzeugen. Forelline, seinen Irrtum benutzend, klagte ihm, wie unglücklich sie sei, eine so grausame Stiefmutter zu haben, und was sie alles noch zu erdulden haben würde, bis ihre Stiefschwester vermählt sei. Der König versicherte ihr dagegen, wenn sie ihn zum Gemahl annehmen wolle, so würde er entzückt sein, seine Krone und sein Herz mit ihr zu teilen. Darauf zog er einen Ring vom Finger und steckte ihn Forellinen an, zum Zeichen seiner ewigen Treue, und bat sie, die Zeit zu bestimmen, wenn sie heimlich von hier abreisen könnten. Forelline antwortete ihm so gut sie immer konnte; er merkte wohl, dass sie ihm nicht viel Kluges sagte, und das würde ihn besorgt gemacht haben, wenn er nicht vollkommen überzeugt gewesen wäre, dass ihr die Furcht, von der Königin überrascht zu werden, die Freiheit des Geistes benehme. Er verließ sie unter der Bedingung, dass sie morgen um die nämliche Stunde wieder hier erscheine, was sie ihm auch von ganzem Herzen versprach.
Als die Königin den glücklichen Erfolg dieser Unterredung erfuhr, versprach sie sich alles davon. In der Tat wurde auch der Tag festgesetzt und der König erschien in einem leichten Wagen von geflügelten Fröschen gezogen, die ihm ein befreundeter Zauberer zum Geschenk gemacht hatte. Die Nacht war sehr dunkel. Forelline schlich geheimnisvoll durch eine kleine Tür hinaus, und der König, der sie erwartete, schloss sie in seine Arme und schwor ihr hundertmal ewige Treue. Hierauf fragte er, wo sie wünsche, dass die Vermählung vollzogen werde. Sie antwortete ihm, eine sehr berühmte Fee, Namens Sussio, sei ihre Patin, und sie schlage vor, sich nach dem Schloss der selben zu begeben. Der König wusste zwar den Weg nicht; Indes er durfte nur seinen dicken Fröschen befehlen, ihn dahin zu bringen, sie hatten die Karte des ganzen Erdkreises im Kopf und in kurzer Zeit brachten sie den König und Forellinen zur Fee.
Das Schloss war so hell erleuchtet, dass der König bei seiner Ankunft da selbst seinen Irrtum sogleich erkannt haben würde, wenn die Prinzessin sich nicht sorgfältig in ihren Schleier gehüllt hätte. Sie fragte gleich nach ihrer Patin, und erzählte ihr unter vier Augen, wie sie den König Liebreiz ins Netz gelockt habe, und bat zugleich die Fee, ihn zu besänftigen. „Ach, mein Töchterchen“, entgegnete die Fee, „das wird gar nicht so leicht sein, er liebt Florinen allzu sehr; ich weiß gewiss, er wird uns viel zu schaffen machen." Inzwischen wartete der König in einem Saal, dessen Wände aus Diamanten bestanden und so klar und durchsichtig waren, dass er durch die Wand Sussio und Forellinen zusammen reden sehen konnte. Wie, sagte er, bin ich denn betrogen? Haben feindliche Geister diese Feindin unsrer Ruhe hier her getragen? Kommt sie, meine Vermählung zu stören? Meine teuer Florine erscheint nicht, sollte ihr Vater sie verfolgt haben? So drängten sich ihm tausend traurige Gedanken durch den Kopf, aber noch viel schlimmer ward es, als sie in den Saal traten und die Fee mit gebieterischem Tone zu ihm sagte: „König Liebreiz, hier ist die Prinzessin Forelline, der ihr Treue geschworen habt, sie ist mein Pflegekind, und ich wünsche, dass ihr sie auf der Stelle heiratet." „Ich“, schrie er, „ich sollte dies kleine Ungeheuer heiraten! Ihr haltet mich für sehr folgsam, dass ihr mir einen solchen Antrag tut. Wisst, dass ich ihr nichts versprochen habe; sagt sie anders, so hat sie... .
„Sprecht nicht aus“, unterbrach ihn die Fee, „seid nicht so verwegen, die Ehrfurcht gegen mich zu vergessen." „Ich gestehe euch alle Ehrfurcht zu, die man einer Fee schuldig ist“, entgegnete der König, „sobald ihr mir meine Prinzessin zurückgebt." „Und bin ich das nicht, Meineidiger“, sagte Forelline, indem sie ihm seinen Ring zeigte. „Wem hast du diesen Ring gegeben zum Pfand deiner Treue? Mit wem hast du an dem kleinen Fenster gesprochen, wenn nicht mit mir? „Also betrogen bin ich, getäuscht!“, rief er; „nein, nein, ich bin kein solcher Gimpel, Fort, meine Frösche, fort, ich will gleich abreisen." „Oho, das steht nicht so in euerem Belieben, wenn ich nicht darin einwillige“, sagte die Fee; sie berührte ihn und seine Füße blieben wie angenagelt am Boden stehen. „Und wenn ihr mich steinigt“, entgegnete der König, „und wenn ihr mir die Haut über die Ohren zieht, ich werde keiner anderen, als Florinen, meine Hand reichen. Das ist mein fester Entschluss und ihr könnt nun machen, was ihr wollt.
Sussio versuchte es mit Sanftmut, Drohungen, Versprechungen, Bitten. Forelline weinte, schrie, seufzte, erboste sich und besänftigte sich — der König sprach kein Wort; er betrachtete alle Beide mit den verächtlichsten Blicken von der Welt, das war seine ganze Antwort auf ihr Geschwätz. So vergingen zwanzig Tage und zwanzig Nächte, in denen sie unaufhörlich redeten, ohne zu essen, ohne zu schlafen, ja ohne sich nur zu setzen. Endlich wusste Sussio nicht mehr, was sie vorbringen sollte und sagte ganz ermüdet zum König: „Nun gut, ihr seid so halsstarrig, keine Vernunft annehmen zu wollen, wählt also, sieben Jahre in Buße zuzubringen, dafür, dass ihr euer Wort gegeben habt, ohne es zu halten, oder mein Pflegekind zu heiraten." Der König, welcher bis dahin ein tiefes Stillschweigen beobachtet hatte, schrie unverzüglich: „Macht mit mir, was ihr wollt, nur dass ich von diesem albernen Ding befreit werde.
„Alberner selbst“, schrie Forelline zornig; „ihr seid mir ein schöner Zaunkönig mit eurer Froschequipage, in mein Land zu kommen, mir Beleidigungen zu sagen, euer Wort zu brechen — wenn ihr nur für vier Pfennige Ehre hättet, würdet ihr euch nicht so benehmen." „Das sind rührende Vorwürfe“, versetzte der König spöttisch. „Ist es nicht entsetzlich, eine so schöne Dame nicht zur Frau nehmen zu wollen?" „Nein, nein, das sollt ihr auch nicht“, schrie die Fee im äußersten Zorn; „du brauchst nur durch dieses Fenster zu fliegen, wenn du willst, denn du wirst sieben Jahre lang ein blauer Vogel sein." In diesem Augenblick verwandelte sich die Gestalt des Königs, seine Arme überzogen sich mit Federn und wurden Flügel, seine Füße wurden schwarz und dünn; es wuchsen ihm krumme Krallen, sein Leib schrumpfte zusammen und lange feine, himmelblaue, glänzende Federn bedeckten ihn ganz und gar; seine Augen rundeten sich und funkelten wie die Sonne; seine Nase verwandelte sich in einen elfenbeinernen Schnabel; auf dem Kopf erhob sich ein weißer Federbusch in Form einer Krone; er sang zum Entzücken und sprach sogar. Der König stieß einen schmerzlichen Schrei aus über seine Verwandlung und flog eiligst davon, um nur den widerwärtigen Palast der Fee nicht mehr zu sehen.
Von Schwermut gebeugt, flatterte er von Zweig zu Zweig, aber er wählte nur solche Bäume, welche der Liebe oder der Trauer heilig sind; so saß er bald auf Myrten, bald auf Zypressen, und beklagte in schwermütigen Gesängen sein und Florinens unglückliches Geschick. An welchen Ort haben ihre Feinde sie verborgen? sagte er bei sich. Was ist aus ihr geworden? Hat die Grausamkeit der Königin sie noch am Leben gelassen? Wo soll ich sie suchen? Bin ich verdammt, sieben Jahre ohne sie zuzubringen? Vielleicht vermählt man sie inzwischen an einen anderen, und die einzige Hoffnung, die mich am Leben erhält, ist dahin. So mannigfaltige Gedanken bekümmerten den blauen Vogel, und brachten ihn endlich so weit, dass er sein Leben zu enden beschloss.
Unterdessen schickte die Fee Sussio Forellinen zur Königin zurück, die sehr ungeduldig war, zu erfahren, wie die Hochzeit vorüber gegangen wäre. Aber da ihre Tochter zurück kehrte und ihr alles erzählte, was vorgefallen war, geriet sie in einen furchtbaren Zorn, dessen ganze Folgen die arme Florine trafen. „Sie soll es bereuen, rief sie, mehr als einmal, dass sie gewusst hat, sich so in die Neigung des Königs einzuschleichen." Sie ging in den Turm mit Forellinen, die sich ihre prächtigsten Kleider angezogen hatte; auf dem Kopf trug sie eine Krone von Diamanten, und drei der vornehmsten jungen Damen trugen die Schleppe ihres königlichen Talars; am Finger hatte sie den Ring des Königs Liebreiz, den Florine bei ihrer ersten Unterredung mit dem König bemerkt hatte. Sie war sehr erstaunt, Forellinen in einem so prunkhaften Aufzug zu erblicken. „Meine Tochter“, sagte die Königin, „will dir ihre Hochzeitgeschenke zeigen; sie hat sich mit dem König Liebreiz vermählt. Er liebt sie bis zum Wahnsinn und es hat nie ein glücklicheres Paar gegeben." Sogleich breitete man vor der Prinzessin gold- und silberdurchwirkte Stoffe aus, Edelsteine, kostbare Spitzen und Bänder, die in großen Körben von Golddraht lagen. Und, indem man ihr alle diese Dinge vorzeigte, verfehlte Forelline nicht, den Ring des Königs spielen zu lassen.
So konnte die Prinzessin Florine nicht länger an ihrem Unglück zweifeln, und rief voll Verzweiflung, man solle alle diese traurigen Geschenke ihr aus den Augen nehmen, sie wolle nichts mehr tragen, als Schwarz, oder vielmehr, sie wolle gleich sterben. Bei diesen Worten viel sie in Ohnmacht, und die grausame Königin, voller Freude, dass ihr Anschlag so wohl gelungen war, erlaubte nicht, dass man ihr Hilfe leiste; sie ließ sie allein in dem beklagenswertesten Zustand von der Welt; ihrem Gemahl aber erzählte sie boshafter weise, Florine sei von Zärtlichkeit so hin gerissen, dass sie die unsinnigsten Dinge angebe, und man müsse sich ja hüten, sie aus dem Turm heraus zu lassen. Der König erwiderte, sie könne in dieser Angelegenheit tun, was sie wolle und er werde immer damit zufrieden sein. Als die Prinzessin aus ihrer Ohnmacht erwachte, und über das Betragen nach dachte, welches man sich gegen sie erlaubte, über die nichtswürdige Behandlung von Seiten ihrer boshaften Stiefmutter und über die so getäuschte Hoffnung, je die Gemahlin des Königs Liebreiz zu werden, so wurde ihr Schmerz so lebhaft, dass sie die ganze Nacht durch weinte. In diesem Zustande trat sie aus Fenster und überließ sich den zärtlichsten und rührendsten Klagen. Als der Tag anbrach, machte sie das Fenster zu und weinte von Neuem. In der folgenden Nacht öffnete sie wieder das Fenster, seufzte und schluchzte von Grund ihres Herzens und vergoss unzählige Tränen; der Tag kam und sie verbarg sich in ihrem Zimmer.
Inzwischen wurde König Liebreiz, oder vielmehr der schöne blaue Vogel, nicht müde, den Palast zu umflattern; er glaubte, dass seine teuere Prinzessin darin eingeschlossen sein müsse; und wenn sie trauer volle Klagen ausstieß so waren es die seinigen nicht minder; er näherte sich den Fenstern so viel er konnte, um in die Zimmer zu sehen; die Furcht, Forelline könne ihn bemerken und wieder erkennen, nötigten ihn, sich entfernt zu halten, auch sang er fast nur bei Nacht. Florinens Fenster gegenüber stand eine Zypresse von außerordentlicher Höhe; auf die setzte sich der blaue Vogel. Er hatte sich kaum auf ihr niedergelassen, so hörte er die Stimme einer Klagenden. „Wie lange soll ich noch dulden?“, sagte die selbe. „Wird mir der Tod nicht zu Hilfe kommen? Denen, die ihn fürchten, naht er allzu rasch; ich sehne mich nach ihm, und der Grausame flieht mich! Ach, barbarische Königin, was hab ich dir getan, um mich in einer so schrecklichen Gefangenschaft zu halten! Hast du sonst keinen Aufenthalt zur Qual für mich, Du darfst mich ja nur eine Zeugin des Glückes werden lassen, welches deine unwürdige Tochter mit dem König Liebreiz genießt."
Der blaue Vogel hatte kein Wort von diesen Klagen verloren und war nicht wenig erstaunt darüber. Er erwartete den Tag mit der äußersten Ungeduld, um die Klagende zu sehen; aber noch vor Tagesanbruch schloss sie das Fenster und verschwand. Der blaue Vogel versäumte nicht, in der folgenden Nacht wieder zu kommen; der Mond schien hell und er erblickte an dem Fenster des Turmes ein junges Mädchen, die wiederum zu klagen begann. „O Schicksal“, sagte sie, „du versprachst mir einen Königsthron, du gabst mir die Liebe meines Vaters — was hab ich dir getan, dass du mir plötzlich die bittersten Schmerzen bereitest? In einem so zarten Alter, wie dem meinigen, muss ich deine Unbeständigkeit erfahren? Komm zurück, Liebloser, komm zurück, wenn es möglich ist; ich bitte dich um nichts, als mein trauriges Leben zu enden." Je mehr der blaue Vogel hörte, desto mehr überzeugte er sich, dass die Klagende seine geliebte Prinzessin sei.
„Angebetete Florine“, sagte er zu ihr, „warum wollt ihr euer Leben so rasch beschließen? Eure Leiden sind nicht unheilbar!" „Wie, wer spricht zu mir“, rief sie, „wer will mich trösten?" „Ein unglücklicher König“, versetzte der Vogel, „der euch liebt und zeitlebens lieben wird." „Ein König, der mich liebt?“, wiederholte sie. „Ist das vielleicht eine Schlinge, welche meine Feindin mir legt? Aber was könnte sie damit erreichen? Wenn sie meine Gesinnungen erforschen will, ich will ihr nichts verhehlen." „Nein, meine Prinzessin“, entgegnete der Vogel, „der Liebende, welcher spricht, ist nicht fähig, euch zu verraten. Mit diesen Worten flog er zu ihr ans Fenster." Florine empfand anfänglich große Furcht vor einem so außerordentlichen Vogel, der so verständig wie ein Mensch zu ihr sprach, ob gleich er nur eine Stimme hatte, so fein wie eine Nachtigall: aber die Schönheit seines Gefieders und das, was er ihr sagte, beruhigte sie wieder.
„Ist es mir vergönnt“, rief er aus, „euch wieder zu sehen, meine Prinzessin! Kann ich ein so außerordentliches Glück genießen, ohne vor Freude zu sterben! Ach, aber diese Freude ist durch eure Gefangenschaft getrübt, und durch den Zustand, in welchen mich die boshafte Sussio auf sieben Jahre verdammt hat!" „Und wer bist du denn, liebreizender Vogel?“, fragte die Prinzessin, indem sie ihn streichelte. „Ihr habt meinen Namen genannt“, erwiderte der König, „und ihr solltet mich nicht erkennen?"
„Wie“, rief die Prinzessin, „ein so mächtiger König, der König Liebreiz wäre der kleine Vogel hier auf meiner Hand?" „Ja, schöne Florine“, antwortete der blaue Vogel, „es ist nur allzu wahr, und wenn mich etwas darüber trösten kann, so ist es, dass ich es vorzog, diese traurige Verwandlung zu ertragen, als auf die Liebe zu euch zu verzichten." „Zu mir?“, wiederholte Florine erstaunt.
„Ach, täuscht mich nicht! Ich weiß ja, dass ihr mit Forellinen vermählt seid; ich hab euren Ring an ihrem Finger gesehen; ich habe sie gesehen, funkelnd von Diamanten, die sie von euch erhalten hat; sie kam, mich in meiner traurigen Gefangenschaft zu verhöhnen, mit einer goldenen Krone auf dem Haupt, in einem königlichen Talar, die sie beide von eurer Hand empfing, während ich in Banden schmachtete." „Ihr habt Forellinen in einem solchen Aufzuge gesehen?“, unterbrach sie der König; „sie und ihre Mutter haben es gewagt, euch zu sagen, diese Geschenke kamen von mir? O Himmel, ist es möglich, dass ich so abscheuliche Lügen vernehmen muss, und mich nicht auf der Stelle dafür rächen kann! Wißt, sie haben mich hintergehen wollen; sie haben euren Namen missbraucht und mich dahin gebracht, die hässliche Forelline zu entführen: sobald ich aber nur meinen Irrtum erkannte, wollte ich sie auf der Stelle verlassen und zog es vor, lieber sieben Jahre lang in einen blauen Vogel verwandelt zu bleiben, als die Treue zu verletzen, die ich euch gelobt habe."
Florine empfand ein so inniges Vergnügen, den edlen König sprechen zu hören, dass sie der Leiden ihrer Gefangenschaft gar nicht mehr gedachte. Was sagte sie ihm nicht alles, um ihn über sein Missgeschick zu trösten und um ihn zu versichern, dass sie nicht weniger für ihn tun würde, als er für sie getan hätte. Der Tag brach an, ein Teil der Schloßbewohner war schon munter, und der blaue Vogel und die Prinzessin plauderten noch. Sie trennten sich mit großer Überwindung, nachdem sie versprochen hatten, alle Nächte zusammen zu kommen. Die Freude, sich gesunden zu haben, war so außerordentlich, dass es nicht zu beschreiben ist. Doch war Florine für den blauen Vogel in großer Sorge. Wer wird ihn vor den Jägern schützen? sagte sie, oder vor der scharfen Kralle eines Adlers, oder vor einem hungrigen Geier! O Himmel, wie würde mir werden, wenn seine weichen, feinen Federn mir vom Winde entgegen getrieben würden und mir in meine traurige Gefangenschaft die Schreckensbotschaft seines Todes brächten! —
Der schöne Vogel verbarg sich inzwischen in einem hohlen Baum; der Gedanke an seine geliebte Florine beschäftigte ihn den ganzen Tag. Wie glücklich bin ich, sie wieder gefunden zu haben, sagte er; wie bezaubernd ist sie! wie gut! Er rechnete die ganze Zeit seiner Buße nach, und wünschte sehnsuchtsvoll das Ende der selben herbei. Da er sich gegen Florine so aufmerksam als möglich zu beweisen wünschte, so flog er nach der Hauptstadt seines Königreichs und schlüpfte durch ein zerbrochenes Fenster in ein Kabinett seines Palastes. Dort nahm er ein Paar Ohrgehänge von Diamanten, die an Kostbarkeit und Schönheit nicht ihres Gleichen mehr hatten, brachte sie am Abend Florinen und bat sie, sich damit zu schmücken.
„Recht gern wollte ich es tun“, antwortete sie, „wenn ihr mich am Tage damit sähet; aber da ich euch nur bei Nacht spreche, so werde ich sie nicht anlegen." Der blaue Vogel versprach ihr, zu jeder Stunde, wenn sie nur wollte, ans Fenster zu kommen; sogleich hing sie die Ohrgehänge ein, und die Nacht verstrich ihnen, gleich wie die erste, in angenehmer Unterhaltung. Am folgenden Morgen kehrte der blaue Vogel in sein Königreich und in seinen Palast zurück, er schlüpfte durch die zerbrochenen Fensterscheiben in sein Kabinett und nahm da selbst die prächtigsten Armbänder, die man je gesehen hat. Sie bestanden aus einem einzigen Smaragd, rautenförmig geschliffen und in der Mitte ausgehöhlt, damit Hand und Arm hindurch konnten. „Glaubt ihr wohl“, sagte die Prinzessin, „dass meine Liebe für euch durch Geschenke genährt werden müsse! O wie falsch würdet ihr die selbe dann beurteilen." „Nein, gewiss nicht“, entgegnete Liebreiz; „ich glaube nicht, dass die Kleinigkeiten, die ich euch bringe, notwendig sind, um mir eure Liebe zu bewahren; aber der meinigen würde es empfindlich sein, wenn ich irgend eine Gelegenheit versäumte, euch meine Aufmerksamkeit zu beweisen. Und dann, wenn ihr mich nicht seht, werden diese kleinen Tändeleien mich euch ins Gedächtnis zurückrufen."
Sobald der Tag anbrach, flog der blaue Vogel wieder in seinen hohlen Baum, wo Früchte seine Nahrung waren. Zuweilen sang er auch, und so schön, dass die Vorübergehenden ganz entzückt waren. Da sie nicht sahen, von wem der Gesang kam, so mussten es natürlich Geister sein. Dieser Glaube ward so allgemein, dass sich niemand mehr in das Gehölz wagte: man erzählte sich tausend fabelhafte Abenteuer, die sich da selbst ereignet hätten und die allgemeine Furcht gereichte dem blauen Vogel zur besonderen Sicherheit. Es verging kein Tag, an welchem er nicht Florinen ein Geschenk machte, bald ein Halsband von Perlen, bald Ringe von Brillanten, aufs Schönste gefasst, Schleifen von Diamanten, Haarnadeln, Sträußchen von Edelsteinen, von den Farben der lieblichsten Blumen, Bücher und noch vieles andere. Genug, sie hatte bald einen ganzen Vorrat der ausgesuchtesten Kostbarkeiten; sie schmückte sich damit nur bei Nacht, um dem König zu gefallen, und bei Tag verbarg sie alles sorgfältig in ihrer Strohdecke.
So gingen zwei Jahre hin, ohne dass Florine ein einziges Mal noch ihre Gefangenschaft beklagte. Und worüber hätte sie auch klagen sollen? Sie genoss ja das Glück, die ganze Nacht sich mit dem, welchen sie liebte, unterhalten zu können. Sah gleich Florine keinen Menschen und brachte gleich der Vogel den Tag über in seinem hohlen Baum zu: so hatten sie sich doch immer etwas Neues zu erzählen. Ihr Stoff war unerschöpflich, denn ihr Herz und Geist boten hinlänglich Unterhaltung dar.
Inzwischen hatte die boshafte Königin, welche Florinen gefangen hielt, lauter vergebliche Bemühungen gemacht, Forellinen zu verheiraten. An alle Prinzen, deren Namen sie nur kannte, schickte sie Abgesandte und ließ ihnen Forellines Hand antragen; man wies sie aber ohne alle Umstände zurück. Ja, sagte man, wenn es Prinzessin Florine wäre, so hätte man euch mit Freuden aufgenommen — Forelline aber, die mag nur immer eine Vestalin bleiben, es wird niemand was dagegen haben.
Mutter und Tochter ärgerten sich über solche Antworten nicht wenig: aber ihr ganzer Grimm fiel auf die unschuldige Florine. „Wie, trotz ihrer Gefangenschaft“, sagten sie, „soll uns dies freche Geschöpf in den Weg kommen? Sie muss geheime Verbindungen im Auslande unterhalten; sie ist zum Allerwenigsten eine Staatsverbrecherin; als solche wollen wir sie auch behandeln und alles Mögliche aufbieten, sie zu überführen." Sie hielten so lange mit einander Rat, bis es beinah Mitternacht war; da entschlossen sie sich, noch in den Turm zu gehen und Florinen zu befragen. Diese stand eben bei dem blauen Vogel am Fenster, mit ihren Juwelen geschmückt, ihr schönes Haar wohl geordnet, mit einer Sorgfalt, wie man sie von einer betrübten Gefangenen nicht erwarten konnte. Blumen waren in ihrem Gemach und auf ihr Bett gestreut, und köstliches Räucherwerk verbreitete den angenehmsten Wohlgeruch. Die Königin lauschte an der Tür und vernahm den lieblichen Gesang zweier Stimmen.
„Ha, Forelline“, rief die Königin, „wir sind verraten!" Damit öffnete sie rasch die Tür und stürzte in das Zimmer. Wie wurde Florinen bei diesem Anblick! Sie warf hastig das kleine Fenster zu, damit der blaue Vogel Zeit gewinne zu entfliehen. Sie war weit mehr um seine Rettung, als um ihre eigene besorgt, sie war aber nicht stark genug, sich zu entfernen. Sein Falkenblick hatte ihm die Gefahr schon entdeckt, von welcher die Prinzessin bedroht wurde. Er hatte die Königin und Forellinen erblickt; o welcher Schmerz, dass er so unvermögend war, der Geliebten bei zu stehen. Wie Furien stürzten sie auf sie los, als ob sie sie verschlingen wollten. „Man kennt schon eure Ränke gegen den Staat“, schrie die Königin, „denkt nicht, dass eure Geburt euch vor der wohlverdienten Strafe schützen wird." „Ränke?“, versetzte Florine, „und mit wem sollte ich sie angesponnen haben? Seid ihr nicht selbst seit zwei Jahren meine Gefangenenwärterin? Hab ich in dieser Zeit jemand anders gesehen, als die ihr zu mir geschickt habt?"
Während sie so sprachen, betrachteten die Königin und ihre Tochter sie mit einem Erstaunen sonder gleichen; ihre bewunderungswürdige Schönheit und ihr kostbarer Schmuck blendeten sie. „Und woher habt ihr den“, fragte die Königin, „diesen Schmuck, der heller als die Sonne funkelt? Wollt ihr uns etwa glauben machen, dass es in diesem Turm eine Diamantengrube gibt?" „Ich hab ihn hier gefunden“,, entgegnete Florine, „das ist alles, was ich darüber zu sagen weiß."
Die Königin sah sie scharf an, als wollte sie bis auf den Grund ihres Herzens dringen. „Wir lassen uns nicht so hinter gehen“, sagte die Königin, „wir sind nicht so leichtgläubig, wie ihr denkt; ja, Prinzessin, wir wissen, was ihr von früh bis in die Nacht beginnt. Man hat euch alle diese Juwelen gegeben, nur in der Absicht, damit ihr das Königreich eures Vaters verraten sollt." „Ich wäre auch sehr wohl im Stande, es zu verraten“, erwiderte sie mit einem verächtlichen Lächeln, „ich, eine unglückliche Prinzessin, die schon so lange Zeit in Banden schmachtet, kann recht viel zu einem solchen Anschlag beitragen." „Und für wen denn“, fuhr die Königin fort, „habt ihr euch die schönen Locken gemacht, euch wie zu einem Hof Fest geputzt, euch mit Wohlgerüchen umgeben?" „Ich habe ja Zeit genug“, antwortete Florine; „ist es denn etwas so Außerordentliches, dass ich einige Augenblicke für meinen Anzug verwende? ich bringe so viele andere damit zu, mein Unglück zu beweinen, dass mir jene wohl nicht vorzuwerfen sind." „Nun, nun, lass doch sehen“, sagte die Königin, „ob diese unschuldige Person nicht mit den Feinden des Landes unterhandelt hat." — Sie suchte sogleich überall nach, und als sie den Strohsack durchwühlte, fand sie den ganzen Vorrat von Diamanten, Perlen, Rubinen, Smaragden und Topasen.
Sie hatte sich vorgenommen, irgendwo ein Papier unter zu schieben, welches die Beschuldigung gegen die Prinzessin bestätigte, und sie schob auch ein solches ganz heimlich ins Kamin; zum Glück aber hatte sich der blaue Vogel darauf gesetzt, und da er schärfer sah, als ein Luchs und alles wahrnahm, rief er: „Nimm dich in Acht, Florine, deine Feindin will dir einen Streich spielen." Diese so unerwartete Stimme erschreckte die Königin so sehr, dass sie ihr Vorhaben nicht auszuführen wagte. „Ihr seht" sagte Florine, „die Geister in der Luft wollen mir wohl." „Ja, ja“, erwiderte die Königin, „die bösen Geister wollen euch wohl; aber ihnen zum Trotz wird euer Vater schon sein Recht ausüben." „O wollte der Himmel“, rief Florine, „dass ich sonst nichts zu fürchten hätte, als den Zorn meines Vaters! Der eurige ist furchtbarer."
Die Königin entfernte sich, ganz verwirrt von dem allen, was sie gesehen und gehört hatte. Sie beratschlagten nun, was gegen die Prinzessin vorzunehmen sei. Man sagte ihr, wenn irgend eine Fee oder ein Zauberer sie unter ihren Schutz genommen hätten, so würde man die Sache noch schlimmer machen, wenn man sie länger quäle; man solle lieber ihre Ränke aufzudecken suchen.
Die Königin billigte diese Idee; sie schickte der Prinzessin zu ihrer Aufwartung ein junges Mädchen, die sich ganz unbefangen stellen sollte, um Florinen desto besser auszuforschen. Aber der Fallstrick war zu grob. Die Prinzessin erkannte ihn sogleich. Sie empfand den lebhaftesten Schmerz. „Wie" rief sie aus, „so soll ich nicht mehr mit meinem lieben blauen Vogel sprechen können? Er half mir mein Unglück ertragen, ich tröstete ihn über das seinige, unsere Liebe ließ alles ertragen. Was wird er jetzt anfangen? Und was soll aus mir werden?" Bei diesen Gedanken strömten unaufhaltsam ihre Tränen. Sie wagte nicht mehr, sich an das kleine Fenster zu stellen, obgleich sie ihn draußen flattern hörte; sie starb fast vor Sehnsucht, es ihm zu öffnen, aber sie fürchtete, sein teures Leben einer Gefahr auszusetzen. So verstrich ein ganzer Monat, ohne dass sie sich sehen ließ; der blaue Vogel war in Verzweiflung. Welche Klagen stieß er aus! Nie hatte er das Schmerzliche der Trennung und seiner Verwandlung so lebhaft empfunden. Umsonst sann er auf Hilfe; er fand keine Hilfe, keinen Trost.
Die Kundschafterin, die nun schon einen ganzen Monat gewacht hatte, ward endlich doch von Müdigkeit überwältigt und sank in einen tiefen Schlaf. Kaum bemerkte dies Florine, so öffnete sie das kleine Fenster und rief:
„Blau wie der Himmel über dir,
Blauer Vogel flieg rasch zu mir!"
Der blaue Vogel verstand diesen Ruf so wohl, dass er gleich auf das Fenster geflogen kam. Welche Freude des Wiedersehens! Wie viel hatten sie sich zu sagen! Sie wiederholten tausend und tausend Mal die Versicherungen ihrer Freundschaft und Treue. Endlich kam die Stunde der Trennung, und sie nahmen auf das Rührendste Abschied. Am folgenden Tage schlief die Aufpasserin noch immer; Florine eilte wieder ans Fenster und rief wie das erste Mal:
„Blau wie der Himmel über dir,
Blauer Vogel, flieg rasch zu mir!"
Sogleich kam der blaue Vogel herbei und die Nacht verging, wie die erste, ganz unbemerkt. Die Liebenden waren entzückt und schmeichelten sich, die Wächterin werde so viel Vergnügen am Schlafen finden, dass sie keine Nacht mehr wach bleiben würde. Wirklich ging auch noch die dritte Nacht ganz glücklich vorüber; aber in der folgenden hörte die Aufseherin ein Geräusch und lauschte, ohne sich etwas merken zu lassen. Sie erblickte im Mondschein den schönsten Vogel von der Welt, wie er mit der Prinzessin sprach, sie mit den Füßchen streichelte und den Schnabel sanft an sie schmiegte. Über ihre Unterhaltung war sie auch nicht wenig erstaunt, denn der Vogel sprach wie ein Liebender, und die schöne Florine antwortete ihm aufs Zärtlichste.
Der Tag brach an und sie nahmen Abschied von einander; als hatten sie ein Vorgefühl ihres nahen Unglücks gehabt, trennten sie sich mit schwerem Herzen. Die Prinzessin warf sich auf ihr Lager und benetzte es mit ihren Tränen und der König kehrte in seinen hohlen Baum zurück. Als bald lief ihre Aufpasserin zur Königin und hinter brachte ihr alles, was sie gesehen und gehört hatte. Die Königin ließ Forelline und ihre Vertrauten herbei holen; und nachdem sie lange hin- und her gesprochen hatten, waren sie endlich alle der Meinung, der blaue Vogel sei niemand anderes als König Liebreiz. „Welch ein Schimpf!“, schrie die Königin, „welch ein Schimpf, meine Forelline! Diese unverschämte Prinzessin, die ich von Kummer ganz gebeugt glaubte, führt in aller Ruhe mit unserem Undankbaren ganz angenehme Unterhaltungen. Aber ich will mich rächen, so rächen, dass sie daran denken sollen." Forelline bat sie, keinen Augenblick zu verlieren, und da sie sich noch mehr beleidigt glaubte, als die Königin, so war sie außer sich vor Freude bei dem Gedanken, wie übel es den Liebenden ergehen werde.
Die Königin schickte die Aufpasserin wieder in den Turm zurück, und befahl ihr, weder Argwohn noch Neugier zu zeigen und zu tun, als schliefe sie noch fester als sonst. Sie schlief also zur gehörigen Zeit wieder ein und schnarchte auf ihr Bestes; dadurch getäuscht, öffnete die arme Prinzessin das kleine Fenster und rief:
„Blau wie der Himmel über dir,
Blauer Vogel, flieg rasch zu mir!"
Aber sie rief vergebens die ganze Nacht durch; der blaue Vogel kam nicht, denn die boshafte Königin hatte Degen, scharfe Messer und Dolche an der Zypresse befestigen lassen; und als nun der blaue Vogel mit ausgebreiteten Schwingen sich darauf niederlassen wollte, durchschnitten ihm die mörderischen Waffen die Füße; er fiel auf andere, die ihm die Flügel zerschnitten, und so überall verwundet, rettete er sich mit großer Not in seinen Baum, eine lange Blutspur zurücklassend.
Warum warst du nicht da, schöne Prinzessin, um den Unglücklichen zu trösten! Aber nein, sie wäre gestorben bei einem so beklagenswerten Anblick. Er wollte keine Sorge weiter für sein Leben tragen, denn er bildete sich ein, Florine selbst habe ihn an ihre Stiefmutter verraten. „Grausame“, rief er schmerzhaft aus, „belohnst du so die reinste und zärtlichste Liebe? Wenn du meinen Tod wolltest, warum verlangtest du ihn nicht selbst? Er wäre mir von deiner Hand willkommen gewesen. Welches Vertrauen hatte ich zu dir! Was erduldete ich um dich, und hab es ohne Klagen erduldet! Wie, und du konntest mich der grausamsten aller Frauen opfern! Sie war unsre gemeinschaftliche Feindin; du hast sie mit meinem Leben versöhnen wollen!" — Voll von diesen niederschlagenden Gedanken, beschloss er zu sterben.
Inzwischen war sein Freund, der Zauberer, als er die fliegenden Frösche mit den Wagen zurück kommen sah ohne den König, so besorgt um ihn gewesen, dass er achtmal die ganze Erde durchlief, um ihn aufzusuchen. Da er ihn nicht finden konnte, trat er zum neunten Mal seine Wanderung an und gelangte dabei in das Gehölz, in welchem sich der König aufhielt; wie gewöhnlich stieß er fünfmal ins Horn, und schrie fünfmal aus Leibeskräften: „König Liebreiz, König Liebreiz, wo seid ihr?" Der König erkannte die Stimme seines besten Freundes und antwortete: „Kommt hier zu diesem Baum und erblickt den unglücklichen König, den ihr liebt, in seinem Blute schwimmend." Der Zauberer sah sich ganz erstaunt nach allen Seiten um, aber er sah nichts. „Ich bin der blaue Vogel“, sagte der König mit matter, erlöschender Stimme.
Nun fand ihn der Zauberer ohne Mühe in seinem kleinen Neste. Ein so geschickter Zauberer, wie er, brauchte nur ein paar Worte, um das Blut zu stillen, welches noch immer floss, und mit einigen Kräutern, die er im Walde fand, und über welche er einige Zaubersprüche murmelte, stellte er den König so vollkommen her, als wäre er gar nicht verwundet gewesen. Hierauf bat er ihn um Erklärung, durch welches Missgeschick er in einen Vogel verwandelt worden sei und wer ihn so grausam verwundet habe. Der König erzählte ihm alles, und sagte, Florine selbst müsse das Geheimnis ihrer nächtlichen Zusammenkünfte verraten haben, um sich mit der Königin auszusöhnen, ja sie müsse da eingewilligt haben, dass man die Zypresse mit Dolchen und Messern behänge, die ihn fast ganz zerschnitten hätten. Er brach in die bittersten Klagen über die Untreue der Prinzessin aus, und sagte, er würde sich glücklich schätzen, wenn er gestorben wäre, bevor er ihr falsches Herz hätte kennen gelernt.
Der Zauberer fing nun an, gegen Florinen und überhaupt gegen alle Frauen los zu ziehen und riet dem Könige, die Ungetreue zu vergessen. „Welches Unglück stünde euch bevor“, sagte er, „wenn ihr im Stande wärt, diese Undankbare noch länger zu lieben! Nachdem, was sie euch angetan hat, muss man alles von ihr befürchten." Gleichwohl konnte der König sich nicht dazu entschließen, denn er liebte Florinen noch allzu sehr. Der Zauberer vertröstete ihn auf die Zeit, welche jeden Schmerz lindre, und der blaue Vogel bat seinen Freund nur, ihn nach Hause zu versetzen, in einen Käfig, wo er vor den Krallen der Katzen und anderen mörderischen Nachstellungen geschützt sei.„Wollt ihr denn aber“, sagte der Zauberer, „noch fünf Jahre in einem so beklagenswerten Zustande bleiben, der euerem Beruf und eurer Würde so wenig angemessen ist? Dazu kommt, ihr habt Feinde, die das Gerücht von euerem Tode aussprengen; sie wollen sich eures Thrones bemächtigen, und ich fürchte sehr, ihr verliert ihn, noch ehe ihr eure natürliche Gestalt wieder empfangen habt." „Könnte ich denn nicht“, versetzte der König, „in meinen Palast zurück kehren und ganz wie sonst regieren?" „Ja, das ist eine missliche Sache! entgegnete der Zauberer. Man will wohl einem Menschen gehorchen, aber nicht einem Papagei. Man fürchtet euch als König, von Glanz und Größe umgeben; sieht man aber, dass ihr ein kleiner Vogel seid, so rupft man euch alle Federn aus." „O menschliche Schwäche!“, rief der König; „dieser trügerische Glanz, obschon er Verdienst und Tugend so wenig bezeichnet, hat doch so viel Verführerisches, dass man ihm kaum widerstehen kann." „Ich ergebe mich nicht so gleich“, sagte der Zauberer, „ich hoffe immer noch Mittel zu finden."
Inzwischen verweilte Florine, die kummervolle Florine, in Verzweiflung, den König nicht mehr zu sehen, Tag und Nacht an ihrem Fenster, und wiederholte in einem fort:
„Blau wie der Himmel über dir,
Blauer Vogel flieg rasch zu mir!"
Selbst die Anwesenheit ihrer Aufseherin hinderte sie daran nicht; ihre Verzweiflung war so heftig, dass sie keine Furcht mehr kannte. „Was ist aus euch geworden, König Liebreiz?“, rief sie. „Haben euch unsere gemeinschaftlichen Feinde die schrecklichen Folgen ihrer Wut empfinden lassen? Seid ihr das Opfer ihrer Grausamkeit geworden? Ach, seid ihr nicht mehr am Leben? Soll ich euch niemals wieder sehen? Oder habt ihr vielleicht, meines Unglücks müde, mich selbst verlassen? Tränen und Schluchzen unterbrachen ihre zärtlichen Klagen. Wie lang wurden ihr die Stunden, da sie den blauen Vogel nicht mehr sah. Kaum konnte sich noch die Prinzessin aufrecht erhalten, so hin fällig schwach und elend wurde sie; sie war überzeugt, dass dem König das Allertraurigste begegnet sei.
Die Königin und Forelline triumphierten; sie freuten sich noch mehr über ihre Rache, als sie sich vorher über die Beleidigung geärgert hatten. Unterdessen aber wurde Florinens Vater, der schon bei Jahren war, krank und starb. Nun bekam die Lage der boshaften Königin und ihrer Tochter eine ganz andere Gestalt. Man sah sie als Günstlinge an, die ihre Macht missbraucht hätten. Das empörte Volk drängte sich zum Palast und verlangte die Prinzessin Florine, die sie als ihre Herrin anerkannten. Die aufgebrachte Königin wollte die Sache mit Strenge behandeln; sie erschien auf dem Balkon und drohte den Empörern. Aber nun wurde der Aufstand allgemein; man stieß die Türen ihrer Wohnung ein, zertrümmerte alles und tötete sie selbst mit Schlägen und Steinwürfen. Forelline entfloh zu ihrer Patin, der Fee Sussio, denn sie lief nicht weniger Gefahr, als ihre Mutter.
Die Großen des Reiches versammelten sich in größter Eile und begaben sich nach dem Turm, wo sie die Prinzessin krank und betrübt fanden. Sie wusste noch nichts von dem Tode ihres Vaters, und von dem schrecklichen Ende ihrer Feindin. Als sie den Lärm hörte, glaubte sie, man komme, sie zum Tode zu führen; sie erschrak aber darüber nicht, denn das Leben war ihr seit dem Verlust des blauen Vogels verhasst. Doch es waren ihre Untertanen die sich ihr zu Füßen warfen, und sie von der Veränderung, welche ihr Schicksal erfahren hatte, in Kenntnis setzten. Auch das machte wenig Eindruck auf sie. Nun trug man sie in den Palast und krönte sie. Die außerordentliche Sorge, die man für ihre Gesundheit trug, und ihre Sehnsucht, den blauen Vogel aufzusuchen, trugen nicht wenig zu ihrer Herstellung bei und gaben ihr bald so viel Kraft, einen Staatsrat zu ernennen, der in ihrer Abwesenheit das Reich verwalte; darauf steckte sie für einige Millionen Edelsteine zu sich und begab sich einmal des Nachts auf den Weg, ohne dass irgend jemand wusste, wohin.
Der Zauberer, welcher sich die Lage seines Freundes, des Königs Liebreiz sehr zu Herzen nahm, hatte nicht Macht genug, das Werk der Fee zu zerstören; er entschied sich also, zu ihr zu gehen und ihr einen Vergleich vorzuschlagen, damit sie dem König seine natürliche Gestalt wieder gebe. Die Frösche wurden vorgespannt und flogen zur Fee, die eben mit Forellinen schwatzte. Von einem Zauberer bis zu einer Fee ist nur ein handbreiter Abstand; sie kannten sich seit fünf- oder sechshundert Jahren. „Was wünscht mein Herr Gevatter?“, fragte sie ihn, denn so nennen sie sich untereinander. „Kann ich ihm mit irgend etwas dienen, was von mir abhängt?" „Ja, Frau Gevatterin“, versetzte der Zauberer, „es hängt ganz allein von euch ab; es handelt sich um meinen besten Freund, den ihr unglücklich gemacht habt." „Ha, ich verstehe, Gevatter!“, rief Sussio, „es tut mir sehr leid, aber es ist keine Gnade für ihn zu hoffen, wenn er nicht mein Pflegetöchterchen hier heiraten will; sie ist schön und liebenswürdig, wie ihr seht; er mag sich es überlegen.
Der Zauberer verstummte, so hässlich fand er sie; er konnte sich aber doch nicht entschließen, fort zu gehen, ohne für seinen Freund etwas getan zu haben, denn der König befand sich in tausendfacher Gefahr, so lange er im Käfig war. Der Haken, an welchem der Käsig hing, war zerbrochen, der Käsig herunter gefallen und die gefiederte Majestät litt nicht wenig vom Falle! Die Katze, welche sich gerade im Zimmer befand, da sich der Unfall ereignete, kratzte ihn dabei so ins Auge, dass er einäugig zu werden meinte. Ein andermal hatte man vergessen, ihm zu trinken zu geben, und er war nahe daran, zu verschmachten, als man ihn noch durch einige Tropfen erfrischte. Ein kleiner schelmischer Affe, der entsprungen war, erwischte ihn durch das Gitterwerk seines Käfigs hin durch bei den Federn, die er der maßen zerrupfte, als hätte er eine Elster oder eine Amsel in der Mache. Doch das Schlimmste von allem war, dass er auf dem Punkt stand, sein Königreich zu verlieren; seine Erben dachten tagtäglich neue Ränke aus, um zu beweisen, dass er tot sei.
Endlich einigte sich der Zauberer mit seiner Gevatterin Sussio dahin, dass sie Forellinen in den Palast des Königs Liebreiz bringen, dass diese einige Monate da selbst bleiben, und dass sich der König inzwischen entscheiden solle, ob er sie heirate; für diese Zeit solle ihm die Fee seine menschliche Figur wiedergeben, doch mit dem Vorbehalt, ihn wieder in einen Vogel zu verwandeln, wenn er sich nicht mit Forellinen vermähle. Die Fee beschenkte ihre Pflegetochter mit den prächtigsten Kleidern, welche von Gold und Silber nur so starrten, dann bestieg sie mit ihr einen Drachen und sie begaben sich in das Königreich Liebreizes. Drei Schläge mit ihrem Zauberstäbchen stellten den König wieder her, wie er gewesen war, schön, liebenswürdig, geistreich. Aber wie teuer erkaufte er die Zeit, die ihm von seiner Buße erlassen wurde. Schon der bloße Gedanke, Forellinen zu heiraten, ließ ihn schaudern. Der Zauberer stellte ihm zwar, so viel er konnte, die eindringlichsten Beweggründe vor, aber sie machten keinen Eindruck auf ihn. Er dachte weniger an sein Reich als auf Mittel, die Frist, welche die Fee ihm gegeben hatte um Forellinen zu heiraten, noch zu verlängern.
Inzwischen hatte die Königin Florine, als Bäuerin verkleidet, mit fliegendem Haar, welches einen Teil ihres Gesichts bedeckte, einen Strohhut auf dem Kopf, einen Leinwandsack auf dem Rücken, ihre Wanderung angetreten, bald zu Fuß, bald zu Pferde, über Meer und Land; sie eilte, so sehr sie konnte, aber da sie nicht wusste, wo sie den König antreffen sollte, fürchtete sie immer, ihn irgendwo zu suchen, während er sich gerade wo anders befände. Eines Tages, da sie am Rande einer Quelle verweilte, deren Silberwellen über weiße Kiesel rollten, empfand sie Lust, sich die Füße zu baden; sie setzte sich auf den Rasen, band ihr blondes Haar mit einem Bande fest und tauchte mit den Füßen ins Wasser. Gerade ging eine kleine alte Frau vorüber, ganz gebückt und an einem großen Stock humpelnd; sie blieb stehen und fragte: „Was machst du da, mein schönes Töchterchen? bist du so ganz allein?"
„Mein gutes Mütterchen“, antwortete die Königin, „ich befinde mich in zahlreicher Gesellschaft, denn Kummer, Unruhe und Sorgen begleiten mich." Damit brach sie in Tränen aus. „Wie?“, fuhr die gute Alte fort, „so jung und so betrübt? Gräme dich nicht, meine Tochter, sag mir ganz aufrichtig, was dir fehlt, und ich hoffe, dich trösten zu können." Die Königin tat es gern und erzählte ihr alle ihre Leiden, von der Feindschaft der Fee Sussio, und endlich, dass sie jetzt umherwandre, den blauen Vogel aufzusuchen. Die kleine Alte richtete sich empor und war in einem Augenblick ganz verwandelt; sie erschien schön, jung und prachtvoll gekleidet. Sie blickte die Königin mit einem holden Lächeln an, und sagte zu ihr: „Liebenswürdige Florine, der König, den ihr sucht, ist kein Vogel mehr, meine Schwester Sussio hat ihm seine frühere Gestalt wieder gegeben und er befindet sich in seinem Königreich. Betrübt euch nicht länger, ihr werdet ihn wieder sehen und an das Ziel eurer Wünsche gelangen. Hier sind vier Eier, zerbrecht sie, sobald ihr in Not seid und ihr werdet darin finden, was euch dienlich ist." Mit diesen Worten verschwand sie.
Florine fühlte sich von dem was sie gehört hatte getröstet; sie steckte die Eier in ihren Sack und richtete ihre Schritte gerade nach dem Königreiche Liebreizes. Nachdem sie acht Tage und acht Nächte, ohne sich auszuruhen, gegangen war, gelangte sie an den Fuß eines ungeheuer hohen Berges, der ganz und gar von Elfenbein war und so steil, dass man keinen Fuß darauf setzen konnte. Sie machte hundert vergebliche Versuche, sie glitt immer wieder aus und wurde ganz müde davon. Voller Verzweiflung über ein so unüberwindbares Hindernis, setzte sie sich endlich am Fuße des Berges nieder, entschlossen, hier zu sterben — da erinnerte sie sich der Eier, welche ihr die Fee gegeben hatte. Sie nahm eins davon und sagte: „Lass doch sehen, ob sie mich nur zum Besten gehabt hat, als sie mir versprach, ich würde alles darin finden, was mir Not tue."
Als sie nun das Ei zerbrach, fand sie kleine Stacheln von Stahl darin, welche sie sich an Händen und Füßen befestigte, und damit ohne alle Schwierigkeit den elfenbeinernen Berg hinauf klimmte; denn die Stacheln fassten festen Fuß und verhinderten so das Ausgleiten. Als sie ganz oben war, zeigte sich eine neue Schwierigkeit, nämlich hinunter zu kommen, denn das ganze Tal bestand aus einer einzigen Spiegeltafel. Rings umher standen eine ungeheure Menge von Weibern, die sich mit dem größten Wohlgefallen darin bespiegelten; denn dieser Spiegel, welcher wohl zwei Meilen breit und sechs lang war, ließ eine jede sich so erblicken, wie sie zu sein wünschte. Hatte eine rotes Haar, so zeigte sie der Spiegel blond; die Brünette hatte schwarzes Haar, die alten glaubten jung zu sein; die jungen alterten nicht; mit einem Wort, man sah sich so ganz nach Wunsch, jeder Fehler wurde hier so umgewandelt, dass man aus allen Enden der Welt herbei kam. Man hätte sich tot lachen mögen über die Grimassen und das Mienenspiel dieser Schönen. Aus gleichem Grunde fanden sich auch nicht wenig Männer ein; denn ein solcher Spiegel gefiel ihnen gleichfalls. Dem einen lieh er schöne Haare, dem anderen einen edleren und schlankeren Wuchs, ein kriegerisches Ansehen und einen besseren Anstand. Die Frauen, über die sie spotteten, spotteten nicht weniger über sie; daher gab man diesem Berge sehr verschiedene Namen; bis auf den Gipfel aber war noch niemand gekommen, und als man Florinen oben erblickte, stießen alle Frauen ein lautes Geschrei aus. Wohin will diese Unbesonnene? riefen sie. Sie wird doch so klug sein, nicht auf unsern Spiegel herab zu sehen! auf den ersten Schritt zerbricht sie alles. Kurz, sie erhoben einen Lärm zum ohnmächtig werden.
Die Königin wusste nicht, was sie tun sollte, denn es schien allzu gefährlich, hier hinab zu steigen. Sie zerbrach also ein zweites Ei. So gleich kamen zwei Tauben heraus und ein Wagen, der auf der Stelle so groß wurde, dass sie bequem darin sitzen konnte. Darauf flogen die Tauben mit der Königin leicht hinab, ohne dass ihr nur das Mindeste widerfuhr. „Meine kleinen Freunde“, sagte sie jetzt zu ihnen, „wolltet ihr mich wohl dahin führen, wo König Liebreiz seinen Hof hält? Ihr würdet mich damit außerordentlich verpflichten." Die freundlichen, folgsamen Täubchen flogen Tag und Nacht, bis sie an den Toren der Residenz angelangt waren. Florine stieg ab, und gab jedem Täubchen einen Kuss zum Lohne. O, wie schlug ihr das Herz, als sie hier eintrat! Sie schwärzte sich das Gesicht, um nicht erkannt zu werden. Jeden, dem sie begegnete, fragte sie, wo sie den König zu sehen bekommen könne. „Den König sehen?“, wiederholten die Leute lachend. „Geh, was willst du von ihm, mein allerliebstes Schmutzbartel? Geh, geh und wasche dich erst; du siehst zu hässlich aus, um einen solchen Monarchen zu sehen." Die Königin erwiderte nichts, sie entfernte sich still und fragte immer wieder andere, denen sie begegnete, wo sie den König sehen könnte. „Morgen“, sagte man ihr, „wird er öffentlich mit der Prinzessin Forelline im Tempel erscheinen, denn er hat sich endlich entschlossen, ihr seine Hand zu reichen."
O Himmel, welche Nachricht! Forelline, die nichtswürdige Forelline auf dem Punkt, den König zu heiraten! Florine meinte, auf der Stelle vor Schmerz zu sterben, sie war so kraftlos, dass sie weder reden noch gehen konnte. Sie setzte sich unter ein Tor auf einen Steinhaufen; ihr langes, fliegendes Haar und ihr Strohhut verbargen das Gesicht hinlänglich. „O wie unglücklich bin ich!“, sagte sie zu sich; „ich komme hierher, um den Triumph meiner Feindin noch zu vermehren, und eine Zeugin ihres Glückes zu sein! War das der Grund, weshalb der blaue Vogel nicht mehr zu mir kam? Für dieses kleine Ungeheuer also beging er eine so grausame Untreue, während ich, von Gram verzehrt, mich um sein Leben ängstigte!" Wenn man sehr betrübt ist, hat man selten großen Hunger; die Königin suchte nur ein Lager und legte sich nieder, ohne gegessen zu haben. Mit Anbruch des Tages stand sie auf und eilte zum Tempel. Sie drängte sich hinein, nachdem sie hundertmal von den Wachen und Soldaten zurück gestoßen und geschlagen worden war. Sie sah den Thron des Königs und den Forellinens, die man schon als Königin betrachtete. Welch ein Gefühl für die zärtliche, gefühlvolle Florine!
Sie näherte sich dem Thron ihrer Nebenbuhlerin und blieb, an einen Marmorpfeiler gelehnt, unbeweglich stehen. Der König erschien zuerst, schöner und liebenswürdiger als je. Darauf kam Forelline, prachtvoll gekleidet, aber so hässlich, dass man ein Grauen empfand. Sie betrachtete die Königin mit einem finstern Blick und sagte zu ihr: „Wer bist du, dass du dich unterstehst, meiner Herrlichkeit und meinem Goldthron so nahe zu kommen?" „Ich heiße Schmutzeline“, antwortete Florine, „und komme von weit her, um euch einige seltene Kostbarkeiten zum Kauf anzubieten." Zugleich griff sie in ihren Leinwandsack und zog die Armbänder von Smaragd heraus, welche König Liebreiz ihr geschenkt hatte. „Oho!“, rief Forelline, „das sind ja allerliebste Glas Sächelchen! Willst du ein paar Groschen dafür haben?" „Weist sie Kennern“, versetzte die Königin, „und dann wollen wir unsern Handel schließen."
Forelline, die den König zärtlicher liebte, als man von einem solchen Geschöpf hätte erwarten sollen, war entzückt, eine Gelegenheit zu finden, mit ihm zu sprechen. Sie näherte sich seinem Thron, zeigte ihm die Armbänder und bat ihn, ihr seine Meinung darüber zu sagen. Bei dem Anblick dieser Armbänder erinnerte er sich an die, welche er Florinen gegeben hatte; er erblasste, seufzte und konnte lange Zeit nicht antworten, endlich, aus Furcht, seinen Zustand zu verraten, ermannte er sich und sagte: „Diese Armbänder gelten leicht so viel, als mein ganzes Königreich." Forelline begab sich auf ihren Thron zurück, auf dem sie sich schlechter ausnahm, als eine Schnecke in ihrem Häuschen. Sie fragte die Königin, wie viel sie, ohne Vorschlag, für diese Armbänder haben wolle? „Es wird euch nicht leicht sein, sie mir zu bezahlen“, entgegnete Florine; „ich will euch aber einen anderen Handel vorschlagen: wenn ihr mich eine Nacht in der Echogrotte, im Palast des Königs, schlafen lasst, so gebe ich euch meine Armbänder dafür."
„Ja, ja, ich will es, meine schöne Schmutzeline“, sagte Forelline, indem sie ein unsinniges Gelächter ausschlug, wobei sie ihre Zähne wies, die länger als Schweinshauer waren. Der König fragte nicht weiter, woher die Armbänder kämen, weniger aus Gleichgültigkeit gegen die Person, welche sie anbot, obgleich sie eben nicht geeignet schien, die Neugier zu reizen, als aus einer unüberwindlichen Abneigung gegen Forellinen. Nun muss man wissen, dass er als blauer Vogel der Prinzessin erzählt hatte, unter seinem Zimmer befinde sich ein Kabinett, die Echogrotte genannt, welches so kunstreich gebaut sei, dass er in seinem Zimmer das leiseste Wort, was darin gesprochen werde, hören könne; und da Florine ihm seine Treulosigkeit vorwerfen wollte, so hatte sie das beste Mittel dazu gewählt.
Man führte sie also auf Forellinens Geheiß in jenes Kabinett. Sie begann zu seufzen und zu klagen. „So ist mein Unglück“, rief sie aus, „an welchem ich so gern zweifeln möchte, nur zu gewiss! Grausamer blauer Vogel, du hast mich vergessen, du liebst meine unwürdige Feindin. Die Armbänder, die ich von deiner Hand empfangen habe, konnten mein Bild dir nicht zurückrufen, so sehr hast du mich vergessen!" — Schluchzen unterbrach ihre Worte; dann setzte sie ihre Klagen fort bis zum Anbruch des Tages. Die Kammerdiener, welche sie die ganze Nacht durch ächzen und seufzen gehört hatten, sagten es der Königin wieder, und diese fragte, warum sie in der Nacht solchen Lärm gemacht hätte. Florine versetzte, sie pflege lebhaft zu träumen und dann im Schlaf sehr laut zu sprechen. Was den König betrifft, so hatte er durch ein besonderes Verhängnis nichts gehört. Seitdem er nämlich Florine liebte, konnte er nicht mehr schlafen, und man gab ihm daher, wenn er sich zu Bette legte, Opium ein, damit er doch einige Ruhe genieße.
Florine brachte den ganzen Tag in großer Unruhe zu. „Wenn er mich gehört hat“, sagte sie bei sich, „gibt es eine grausamere Gleichgültigkeit? Und wenn er mich nicht gehört hat, was soll ich anfangen, damit er mich hört?" Seltenheiten besaß sie nicht mehr, denn obwohl Edelsteine immer schön sind, so musste es doch etwas sein, was gerade Forellinen reizte; sie nahm daher ihre Zuflucht zu ihren Eiern. Sie zerbrach eins und alsbald erschien eine kleine Karosse von geschliffenem Stahl, mit Gold eingelegt. Sie war mit sechs grünen Mäusen bespannt; ein rosenfarbenes Mäuschen machte den Kutscher und ein Kornblaues den Vorreiter. In der Karosse selbst saßen vier Marionetten, die an Munterkeit und Laune alles übertrafen, was man je davon gesehen, bewunderungswürdig tanzten und ganz erstaunliche Kunststücke machten.
Florine freute sich sehr über dieses neue Meisterstück der Zauberkunst. Abends, um die Stunde, wo Forelline auf die Promenade zu gehen pflegte, setzte sie sich in eine Allee und ließ die Mäuse mit der Karosse und den Marionetten nach Herzenslust galoppieren. Über dieses neue Schauspiel geriet Forelline so in Entzücken, dass sie einmal über das andere ausrief: „Schmutzeline, Schmutzeline, willst du ein paar Groschen für deine Karosse und dein Mäusegespann?" „Fragt die Gelehrten im ganzen Lande“, entgegnete Florine, „was ein solches Wunderwerk wert sei, und ich will mich dem Ausspruch des Gelehrtesten unterwerfen."Forelline entgegnete ihr auf ihre gewöhnliche herrische Weise: „Ohne mich noch länger mit deiner schmutzigen Gegenwart zu belästigen, sag mir gleich, was du dafür haben willst." „Noch einmal in der Echogrotte schlafen“, versetzte Florine, „das ist alles, was ich verlange." „Geh, du einfältiges Geschöpf“, erwiderte Forelline, „es soll dir gewährt sein! Was für eine dumme Kreatur“, sagte sie zu ihren Frauen, „von ihren Seltenheiten nicht mehr Vorteil zu ziehen."
Die Nacht kam; Florine sagte das Zärtlichste, was sie nur immer ersinnen konnte, aber eben so vergebens als früher, denn der König hatte auch in dieser Nacht sein Opium genommen. Die Kammerdiener sagten zu einander: „Diese Bäuerin muss wahrhaftig toll sein, was hat sie denn alle Nacht zu schwatzen?" „Bei alledem“, sprachen andere, ist nicht zu leugnen, dass sich in allem, was sie sagt, viel Verstand zeigt." Ungeduldig erwartete sie den Anbruch des Tages, um zu sehen, welche Wirkung ihre Reden gehabt hätten. „Ach, der Hartherzige ist meiner Stimme taub geworden!“, sagte sie. „Er hört seine geliebte Florine nicht mehr! O, welche Schwäche, ihn doch noch zu lieben! Ja, ich verdiene wohl die Zeichen seiner Geringschätzung." Doch es war vergebens, was sie sich vorsagte, sie konnte nicht aufhören, ihn zu lieben.
Sie hatte in ihrem Sack nur noch ein einziges Ei, auf dessen Beistand sie hoffen durfte; sie zerbrach es und eine Pastete zeigte sich mit sechs Vögeln, die gespickt, gebraten und sehr wohl zubereitet waren, und bei alle dem zum Entzücken sangen, wahrsagten, und Rezepte vorschrieben, besser als der erste Doktor. Die Königin war über dieses Wunderwerk außerordentlich erfreut und eilte mit ihrer redenden Pastete nach Forellinens Zimmer. Während sie darauf wartete, dass Forelline heraus kommen sollte, näherte sich ihr einer der Kammerdiener des Königs und sagte: „Wisst ihr auch, mein gutes Schmutzelinchen, dass, wenn der König nicht Opium eingenommen hätte, um schlafen zu können, ihr ihn sicherlich aufwecken würdet? Es ist ja erstaunlich, was ihr alle Nächte zusammen schwatzt!" Florine wusste nun, wie es kam, dass sie der König nicht gehört hatte; sie griff in ihren Sack und sagte: „Ich fürchte so wenig die Ruhe des Königs zu unterbrechen, dass, wenn ihr ihm diesen Abend kein Opium geben wollt, im Fall ich wieder in der folgenden Nacht in der Echogrotte schlafe, alle diese Perlen und Diamanten für euch sein sollen." Der Kammerdiener willigte ein und gab ihr sein Wort darauf.
Nach einigen Augenblicken kam Forelline heraus und erblickte Florinen, die im Begriff schien, ihre Pastete zu verzehren. „Was machst du da, Schmutzeline?“, sagte sie zu ihr. „Madame“, versetzte Florine, ich speise Wahrsager, Musikanten und Ärzte. Zugleich begannen alle Vögel einen wunderlieblichen Gesang, und dann riefen sie: Weist uns eure Hand, wir wollen euch wahrsagen." Eine Ente, welche alle anderen überschrie, rief: „Ich bin ein Doktor, und heile alle Krankheiten und Narrheiten, nur die der Liebe nicht." Dieses Wunderwerk setzte Forellinen noch mehr in Erstaunen, als alle übrigen; sie beteuerte mit einem Schwur, diese köstliche Pastete müsse sie haben. „He, Schmutzelinchen, was soll ich dir dafür geben?" „Den gewöhnlichen Preis“, versetzte diese, „noch einmal in der Echogrotte schlafen, nichts weiter." „Da“, sagte Forelline großmütig, denn sie war durch den Besitz einer solchen Pastete sehr guter Laune geworden, „da hast du noch einen Louisdor dazu"; Florine zahlte und begab sich zufriedener als je hin weg, denn nun konnte sie doch hoffen, von dem Könige gehört zu werden.
Kaum war es Nacht, so ließ sie sich in das Kabinett bringen und wünschte nur sehnlichst, dass der Kammerdiener Wort halte und dem Könige diesmal kein Opium, sondern vielmehr einen Trank gebe, der ihn ermuntere. Sobald sie nur vermuten konnte, dass alles schliefe, begann sie ihre gewöhnlichen Klagen. „Wie viel Gefahren setzte ich mich aus, um dich zu sehen, während du mich fliehst und und Forellinen heiraten willst! Was hab ich dir getan, Grausamer, dass du deine Schwüre vergisst? Erinnere dich, da du noch der blaue Vogel warst, wie zärtlich ich dich liebte, wie du jede Nacht an mein Fenster flogst" — und dabei erzählte sie ihm alles, was sie zusammen gesprochen hatten.
Der König schlief nicht; er erkannte deutlich Florinens Stimme und hörte jedes ihrer Worte. Er wusste nicht, was er davon denken sollte; aber sein Herz, von Liebe durchdrungen, rief ihm so lebhaft das Bild seiner teuren Prinzessin zurück, dass er nicht weniger Schmerz empfand, als da ihn die Dolche und Messer der Zypresse verwundeten. Er erwiderte die Klagen der Königin. „Ach, Florine“, sagte er, „du warst allzu grausam gegen einen König, der dich so innig liebte! Wie war es möglich, dass du ihn unseren gemeinschaftlichen Feinden zum Opfer bringen konntest?" Florine, die alles hörte, antwortete ihm, er solle nur Schmutzelinen fragen, so werde ihm das ganze Geheimnis klar werden.
Auf diese Worte rief der König voller Ungeduld nach einem seiner Kammerdiener und fragte ihn, ob er nicht Schmutzelinen auffinden und her bringen könne. Das sei sehr leicht, versetzte der Kammerdiener, denn sie schlafe ja in der Echogrotte. Der König konnte sich dies Rätsel nicht erklären. Florine und Schmutzeline in einer Person? Unmöglich! Und doch war es Florinens Stimme, und Schmutzeline wusste Geheimnisse, die außer Florinen niemanden bekannt sein konnten! In dieser Ungewissheit stand er auf, kleidete sich hastig an und eilte auf einer geheimen Treppe in die Echogrotte hinab. Er fand Florinen in einem leichten Gewande von weißem Taft, das sie unter ihrer armseligen Kleidung trug; ihr schönes, lockiges Haar wallte auf ihre Schultern herab, sie lag auf einem Ruhebett, auf welches der matte Schein eines Lämpchens fiel. Plötzlich trat der König herein, seine Liebe siegte über allen Groll, er erkannte sie kaum, so warf er sich zu ihren Füßen, benetzte ihre Hände mit Tränen und war nahe daran, vor Freude und Schmerz zu sterben, während tausend verschiedene Gedanken seine Seele zugleich bestürmten.
Die Königin war nicht weniger bewegt; ihr Herz war gepresst; kaum konnte sie atmen. Sprachlos, mit unverwandten Blicken, sah sie den König an, und als sie Kraft gewonnen hatte, zu sprechen, fehlte es ihr doch an Kraft, ihm Vorwürfe zu machen. Die Freude, ihn wieder zu sehen, ließ sie an keine Klagen denken. Endlich verständigten und rechtfertigten sie sich. Ihre Zärtlichkeit erwachte, und was sie allein noch beunruhigte, war die Fee Sussio. Doch in diesem Augenblick erschien der Zauberer, der Freund des Königs, mit einer mächtigen Fee, und das war eben die, welche Florinen die vier Eier gegeben hatte. Nach den ersten Begrüßungen erzählten sie, dass die Fee Sussio ihrer vereinigten Macht nicht habe widerstehen können, und dass also ihrer Verbindung kein Hindernis mehr im Wege stehe. Man kann sich die Freude der beiden Liebenden vorstellen! Kaum war es Tag, so wurde sie im ganzen Palaste bekannt gemacht; und alles war entzückt, Florinen zu sehen. Als Forelline diese unerwartete Neuigkeit erfuhr, lief sie gleich zum König: welche Überraschung, ihre schöne Nebenbuhlerin bei ihm zu finden! Sie öffnete schon den Mund, um sie mit Schmähungen zu überhäufen, als der Zauberer und die Fee her zu kamen und sie in ein Schwein verwandelten, eine Verwandlung, die ihrem natürlichen Charakter so wohl entsprach. Grunzend und brummend lief sie davon.
Der König Liebreiz und die Königin Florine, von ihrer widerwärtigen Feindin befreit, dachten nun an nichts weiter, als ihre Hochzeit zu feiern, auf welcher sich alle Pracht erschöpfte. Das Glück der beiden Liebenden war, nach so langen Leiden, um so größer.
BERTHA MIT DEN GROSSEN FÜSSEN ...

König Pippin von Franken warb, dem Rate seiner Barone folgend, um die ungarische Königstochter Bertha mit den großen Füßen. Das ungarische Königspaar nahm die Werbung an und sandte die Jungfrau in der Begleitung ihrer alten Amme Margiste, deren Tochter Aliste und ihres Hofmeisters Tybert an den Hof des Frankenherrschers.
An einem schönen Augusttage fand in Paris die Hochzeit statt, und mancher mächtige Fürst diente dem jungen Paare beim Mahle. Dann räumte man die Schüsseln fort, und drei Spielleute zeigten ihre Künste. Als diese ihr Spiel beendet hatten, erhob sich der König und die allgemeine Lustbarkeit begann. Fürsten und Barone umringten die junge Königin und führten sie auf ihr Zimmer.
Aber Margiste hatte in ihrem Herzen einen verräterischen Plan gefaßt: sie kniete vor der Königin nieder und flüsterte ihr ins Ohr: »Herrin, es schmerzt mich bei Gott, daß ich es sagen muß, aber gestern hat mir ein Freund berichtet, daß seit Anbeginn der Zeiten kein Mensch so zu fürchten war, wie der König Pippin es sein wird, wenn er bei Euch liegt. Ich fürchte sehr, daß er Euch tötet, wenn er heute Nacht sein Gattenrecht an Euch ausübt.«
Als Bertha solches hörte, begann sie fast sinnlos vor Angst zu weinen. »Herrin,« sagte die alte Hexe, »bekümmert Euch nicht, denn ich will Euch retten. Wenn die Bischöfe und Äbte von der Einsegnung des königlichen Bettes zurückgekehrt sind, werde ich Eure Kammer räumen lassen. Dann werde ich Aliste, meine Tochter, geschwind entkleiden und an Eurer Statt ins Bett legen. Ich habe schon mit ihr darüber geredet und sie hat ihre Einwilligung dazu gegeben. Denn ich will lieber, daß sie umkomme, als daß Ihr Schaden nehmt.«
Auf diese Worte hin umarmte Bertha die Alte und dankte Gott und allen Heiligen. Die böse Kammerfrau aber wandte sich von ihr und ging durch den königlichen Garten zum Fluss, wo sie ihre Tochter an einem Steinfenster lehnend fand. Diese glich Bertha, wie das Bild eines guten Malers dem Originale gleicht. Keine Frau konnte sich mit ihnen an Schönheit messen, so wenig wie eine dürre Heide mit einer blumigen Wiese.
Die Alte umarmte ihre Tochter und küßte sie auf die Stirn, dann verabredeten sie heimlich, wie sie Bertha verraten könnten. »Tochter,« sagte die Alte, »ich liebe dich, darum sollst du Königin werden, wenn es Gott und dem heiligen Petrus gefällt.« »Mutter,« entgegnete Aliste, »Gott erhöre Euer Gebet. Schickt nach Tybert, er soll uns seinen Rat erteilen. Befehlt ihm, daß er hier her kommt unter dem Vorwand, er habe gestern Almosen für mich ausgeteilt.« Die Alte, die zum Bösen stets bereit war, lief schnell wie ein Windhund davon.
Tybert kam eilends herbei und fand Gefallen an dem Plan. Alle drei beratschlagten eifrig, wie sie ihrer Herrin Bertha das Frankenreich weg stehlen möchten. »Tochter,« sagte Margiste, »zu einem guten Sprung gehört ein weiter Anlauf: du wirst ein wenig dabei leiden müssen. Heute Nacht soll Bertha in meiner Kammer schlafen; wenn es tagt, so werde ich sie zu Euch schicken, gleichsam als solle sie ihren Platz beim Könige einnehmen.
Dann mußt du dir ein Messer in den Schenkel stoßen, so tief, daß das helle Blut hervor spritzt. Darauf schreist du um Hilfe und tust, als ob sie dich habe ermorden wollen; ich werde nun in die Kammer treten und sie fesseln lassen. Das übrige laßt mich nur machen.« »Mutter,« sagte die Magd, »es geschehe, wie es dir gefällt.«
Als es Abend wurde, begaben sich Bischöfe und Äbte in das Schlafgemach, um das Lager zu segnen. Dann hieß die Alte alles Volk hinaus gehen und die Kerzen löschen. Ihre Tochter legte sie ins Bett König Pippins und steckte das Messer, mit dem sie den Verrat begehen sollte, in das Bettgestell. Die alte Hexe lachte hämisch, dann begab sie sich in ihre Kammer und sagte zu Bertha: »Herrin, voll Schmerz und Unmut verlasse ich meine Tochter. Es ist unbeschreiblich, was wir für Euch getan haben.«
»Gott lohne Euch dafür, Frau!« Dann hieß die Alte sie schlafen gehen und sagte ihr, bei Tagesanbruch müsse sie sich ankleiden und sich leise neben den König schleichen. Die ahnungslose Bertha sagte dieses ganz ruhig zu, sie wolle in nichts dem Willen ihrer Amme zuwider handeln. Darauf sprach sie ihre Gebete im Bette sitzend, denn sie war wohl gebildet und konnte sogar schreiben. Indessen tat der König an der Magd seinen Willen und erzeugte mit ihr einen Erben, der voll Falschheit und Tücke war.
Als es Tag wurde, rief die Alte den Verräter Tybert, der mit Freuden herbei kam. Bertha erwachte und begab sich leise, wie die Alte ihr aufgetragen hatte, in das Schlafgemach des Königs. Sie trat zu der Magd, die im geschmückten Brautbett lag. Die Magd bemerkte sie, und ohne Zaudern ergriff sie das Messer, schwang es und versetzte sich selbst einen solchen Stich hinten in den Schenkel, daß das helle Blut herausspritzte. Dann hielt sie ihr Messer Bertha hin und diese nahm es, ohne sich etwas Böses dabei zu denken. Dann fing die falsche Braut an zu schreien: »Ha! König Pippin, an Eurer Seite will man mich morden!«
Der König erwachte und sah das blutende Messer, welches die Königin in der Hand hielt. Er richtete sich auf, fast von Sinnen vor Zorn. Die Alte stellte sich wütend, als sie ihrer Tochter Blut erblickte, und schwur, daß die Täterin ohne Gnade sterben müsse. »O König,« sagte das Weib, »laßt sie schleunigst hinrichten. Habt kein Mitleid mit ihr. Nie in meinem Leben könnte ich sie wieder lieben!« Die alte Hexe packte Bertha und stieß sie mit einem gewaltigen Schlag aus der Kammer.
Bertha ließ alles ruhig über sich ergehen, denn noch glaubte sie, dies alles geschehe aus Freundschaft, obwohl ihr von dem Schlag die Tränen aus den Augen strömten. Tybert zerrte sie am Mantel fort, so daß der selbe fast zerrissen wäre: »Gott helfe mir,« sagte Bertha, »was ist mir begegnet, was haben diese Leute im Sinn?« Die böse Alte reichte Tybert ein Band, dann schlugen sie Bertha nieder, öffneten ihr gewaltsam den Mund wie einem Pferde, das man aufzäumt, und steckten ihr einen Knebel hinein, so daß sie um viel Geld kein Wort hätte reden können. Auch die Hände fesselten sie ihr, warfen sie auf ein Bett und breiteten eine Decke über sie.
Die Alte saß neben ihr und flüsterte ihr zu: »Wenn du schreist, wird dir der Kopf abgeschnitten.« Bertha war über diese Worte sehr erschrocken; sie merkte wohl, daß jene sie verraten hatten und daß sie in ihr Netz gegangen war, und vor Schmerz wurde sie ohnmächtig. Margiste ging nun fort und ließ die Königin in den Händen Tyberts. Sie begab sich in das Gemach des Königs, und als sie ihre Tochter erblickte, fiel sie vor ihr auf die Knie: »Gnade, Herrin,« flehte sie, »um Gottes willen. Wenn Ihr wüßtet, wie ich meine Tochter zugerichtet habe, würdet Ihr nicht sagen, daß ich mitschuldig wäre.« -
»Schweigt, alte Vettel,« sagte der König, »Eure Untreue ist erwiesen. Ihr wolltet insgeheim Bertha, meine Gemahlin, ermorden. Eure Tochter wird ohne Erbarmen verbrannt.« »Herr,« sagte Aliste, »glaubt nicht, daß diese Alte jemals einen Verrat begangen hätte, es gibt keine tüchtigere Frau auf der weiten Welt. Aber ihre Tochter hat stets für etwas beschränkt gegolten und gleichsam für irrsinnig. Herr, ich bitte Euch um eine Gnade, um die erste, seit ich Euer Weib bin und Krone trage: ich bitte Euch bei der Treue, die Ihr mir geschworen habt, daß diese Angelegenheit verschwiegen und verheimlicht werde.
Kein Mensch soll etwas davon erfahren, weil ich doch die Magd mitgebracht habe. Laßt viel mehr drei Diener die Magd fort bringen, sie sollen sie in ein fernes Land führen und dort eingraben oder erwürgen oder was sie wollen, jedenfalls soll sie sterben.« »Herrin,« stimmte die Alte bei, »Euer Rat ist gut. Auch ich wünschte, sie würde enthauptet oder ertränkt oder sonst wie zum Teufel geschickt.« Der König bewilligte die Bitte, und die Alte wurde beauftragt, die Sache zu Ende zu führen.
Der König erhob sich, denn er wünschte, daß die Angelegenheit schnell erledigt werde; er rief drei Diener und sandte sie, ohne ihnen die näheren Umstände dar zu legen, zu Margiste mit dem Auftrag, alles auszuführen, was ihnen diese befehlen würde. Die Alte zeigte ihnen das Zimmer, wo Bertha lag: »Kommt als bald wieder, die Sache eilt.« Dann wandte sie sich seufzend und weinend zum König: »Nun ruht aus, Herr. Ich versichere Euch, daß Ihr nie wieder von der Dirne sollt reden hören, ich erkenne sie nicht mehr als meine Tochter an, das schwöre ich Euch, weil sie meine Herrin ermorden wollte.«
Auch die Magd, ihre Tochter, begann zu weinen, und der König suchte sie zu trösten: »Weint nicht um die Mörderin und laßt sie gehen, sie könnte Euch nochmals töten oder vergiften wollen. Seid Ihr schwer verwundet, Liebste? Sagt es mir offen!« »Nein,« sagte sie, »es ist nicht so schlimm, nur als ich das Blut sah, erschrak ich. Ich will Euch die Wunde zeigen, geht und sperrt die Türe zu!«
Tybert und die Alte luden in dessen Bertha auf einen alten Klepper, und die drei Männer führten sie gleich nach Tagesanbruch davon, Tybert begleitete sie als vierter. Das Weib ersuchte Tybert, der ihr Vetter war, er möge ihr das Herz Berthas zurückbringen, und dieser versprach, es nicht zu vergessen. Bertha weinte und betete, denn sie wußte nicht, wohin man sie führte.
Fünf Tage lang reisten sie, bis sie in einen großen Wald gelangten, es war der von Le Mans. Hier machten sie unter einem Olivenbaum halt: »Ihr Herren,« sagte Tybert, »wir brauchen nicht weiter zu gehen.« Dann stiegen sie von den Rossen. Einer der drei Begleiter hieß Moraut, er war ein tüchtiger Ritter. Sie hoben die Königin vom Pferd; es war das erste Mal, daß sie sie mit ihren Händen berührten, denn Tybert hatte niemanden sich ihr nähern lassen.
Als sie sahen, wie schön sie war, klagten sie um sie, aber Tybert, der Schurke, zog sein Schwert und sprach: »Zieht euch zurück, ihr Herren, mit einem Schlage werde ich ihr jetzt den Kopf abtrennen.« Als Bertha das Schwert sah, streckte sie ihre Arme mit flehender Gebärde aus, denn reden konnte sie nicht wegen des Knebels. »Tybert,« rief Moraut, »schlage nicht zu, denn, beim allmächtigen Gott, ich würde dir Haupt und Glieder abhauen oder nie nach Frankreich zurückkehren.«
Tybert zürnte sehr, als es ihm nicht gestattet wurde, Bertha zu töten. Aber kaum hatte er sein Schwert gezogen, so packten ihn die drei Männer von der Seite und zwangen ihn auf die Knie. Sie rissen ihre Schwerter heraus, und während die beiden anderen den Schurken Tybert fest hielten, band Moraut mitleidig die Königin los und nahm ihr den Knebel aus dem Munde. »Flieht, schöne Frau, und der Herr geleite Euch!« Bertha eilte in den Wald und dankte Gott, als sie in Sicherheit war.
Als Tybert ihre Flucht bemerkte, sagte er zornig: »Schlecht habt ihr gehandelt, ihr Herren; ich werde euch alle hängen lassen, wenn wir daheim sind.« »Herr,« sagte Moraut, »wißt Ihr, was wir tun? Ich rate, daß wir das Herz eines Frischlings mit nehmen und es Frau Margiste zeigen, auf diese Weise werden wir uns vor Tadel wahren, denn Ihr wißt, daß wir versprochen haben, das Herz jener Frau heimzubringen. Wenn Ihr nicht einverstanden seid, Tybert, so töten wir Euch auf der Stelle.« »Der Rat ist gut,« sagte Tybert, »da sie entflohen ist, müssen wir sehen, uns vor Vorwurf zu wahren.«
Sie taten, wie Moraut geraten hatte. Die Alte hatte eine große Freude, als sie ihren Bericht hörte. »Ihr Herren,« sagte sie, »ich will euch reich belohnen. Jene war das schlechteste Weib, seit die Welt steht.«
Bertha hatte in dessen den Wald durch schritten und gelangte nach mannigfachen Gefahren in das Haus eines biederen Mannes Namens Simon, der ihr bereitwillig Unterkunft gewährte. Sie ernährte sich mit Handarbeiten und blieb neun Jahre lang im Hause Simons wohnen. Um diese Zeit brach die Königin Blancheflur von Ungarn auf, um ihre Tochter zu besuchen. Auf ihrer Reise traf sie einen Bauern und befragte ihn über die Königin, von deren Herrschaft sie nichts Gutes gehört hatte.
»Frau,« erwiderte jener, »ich muß mich über Eure Tochter beklagen! Ich hatte ein einziges Pferd, mit dem ich für mich, meine Frau und meine kleinen Kinder mein Brot verdiente. Sechzig Groschen hat es mich gekostet, und ich brachte auf ihm meine Waren in die Stadt. Das hat sie mir weg nehmen lassen. Gott strafe sie dafür!« Die Königin hatte Mitleid mit dem Bauern und ließ ihm hundert Groschen in die Hand drücken, wofür er ihr dankbar den Steigbügel küßte.
An einem Montag ritt die alte Königin in Paris ein. Pippin hörte es und brachte voll Freude seiner Gattin selbst die Nachricht. Als die Magd diese Botschaft hörte, wurde sie sehr bestürzt, doch stellte sie sich, als ob sie lache. Sogleich rief sie ihre Mutter und Tybert und fragte sie um Rat. »Ich rate,« sagte die Alte, »daß meine Tochter sich krank stellt. Um nichts in der Welt darf sie ihr Bett verlassen. Können wir den Betrug solange durchführen, bis die alte Königin heimkehrt, so brauchen wir für der hin nichts mehr zu fürchten.«
Der Rat wurde befolgt; sogleich wurde ein Lager her gerichtet, und die Magd legte sich nieder und stellte sich krank. Der König, den die angebliche Krankheit seiner Frau sehr bekümmerte, ging allein der alten Königin entgegen. »Was macht Bertha, meine Tochter?« war ihre erste Frage. »Ach, Herrin, sobald sie erfuhr, daß Ihr kämt, wurde ihr Herz von Freude so bewegt, daß sie sich nieder legen mußte, und seit dem ist sie nicht wieder aufgestanden. Aber wenn sie Euch erblickt, wird ihr gewiß so gleich besser werden.«
Als die Königin das Schloß betrat, warf sich Margiste ihr Schmerz heuchelnd zu Füßen: »Margiste,« sagte Blancheflur, »wo ist meine Tochter, ich will sie gleich sehen.« »Herrin,« jammerte das falsche Weib, »zum Unheil bin ich geboren! Eurer Tochter ist die Freude über Eure Ankunft so zu Herzen gegangen, daß sie ihr Bett nicht mehr verlassen kann. Laßt sie doch bis zum Abend ruhen!«
Als Blancheflur nach dem Essen ihre Tochter aufsuchen wollte, stellte sich ihr die böse Alte mit ausgebreiteten Armen entgegen. »Sie ist gerade ein wenig eingeschlafen, um Gottes willen, kehrt wieder um!« Blancheflur wartete, bis ihre Tochter erwachen würde; unter dessen unterhielt sie sich mit der Alten und fragte sie nach Aliste. »Herrin,« log das Weib, »sie starb auf dem Stuhle sitzend eines plötzlichen Todes, ich weiß nicht, welches Übel sie auf der rechten Brust hatte, ich glaube, sie wäre zuletzt noch aussätzig geworden. Ich ließ sie ganz im geheimen in der alten Kapelle bestatten.«
Endlich konnte sich Blancheflur nicht länger halten, sie befahl einer Jungfrau, sie mit einer Kerze ins Schlafzimmer der Königin zu begleiten, aber Tybert, der bei der Kranken Wache hielt, trieb das Mädchen so gleich mit Schlägen zurück: »Geh, Hündin, unsere Herrin will schlafen, sie kann durchaus kein Licht vertragen.«
Blancheflur trat im Dunkeln an das Bett der Magd. »Mutter, seid willkommen!« sagte diese mit so schwacher Stimme, daß man sie kaum verstand, und dann, auf eine Frage der Mutter nach ihrem Befinden: »Mutter, ich leide solchen Schmerz, daß ich weiß geworden bin wie Wachs. Die Ärzte sagen mir, daß die Helligkeit mein Leiden verschlimmern würde. Ich wage Euch daher nicht bei Licht zu begrüßen, so schmerzlich es mir auch ist. Aber nun laßt mich um Christi willen ruhen!«
Blancheflur erhob sich kopfschüttelnd: »Bei Gott!« sagte sie, »das ist meine Tochter nicht, die ich hier vor gefunden habe. Wenn sie halbtot wäre, so hätte diese mich umarmt und geküßt.« Dann rief sie ihr Gefolge und ließ trotz der Alten und Tyberts Widerstreben das Fenster öffnen und Licht bringen. Sie riß die Decken vom Bett herunter und betrachtete die Füße der Kranken: sie waren nur halb so groß wie die ihrer Tochter.
»Verrat!« schrie sie, »Betrug! das ist meine Tochter nicht, es ist die Tochter der Margiste! Weh! Sie haben mir mein Kind getötet, meine Bertha, die mich so sehr liebte!« Als der König den Betrug erfuhr, ließ er die alte Hexe zum Feuertode führen, Tybert wurde von vier wilden Rossen tot geschleift, die falsche Braut wurde um ihrer Kinder willen geschont, doch mußte sie das Land verlassen.
Einst hatte sich König Pippin auf der Jagd im Walde von Le Mans verirrt, da traf er auf Bertha, die ihn in das Haus Simons führte. Pippin, der schon lange im Sinn hatte, sich wieder zu verheiraten, fand an Simons sittsamer Pflegetochter Gefallen und ersuchte sie, ihm nach Paris zu folgen, um seine Gattin zu werden. Bertha wies die Werbungen des Fremden dadurch ab, daß sie sich ihm als Pippins Gattin offenbarte.
Der König gab sich nicht zu erkennen, sondern ritt, nachdem er sich nochmals überzeugt hatte, daß er auch wirklich Bertha vor sich habe, nach Paris zurück. Dann ließ er das ungarische Königspaar einladen und entbot auch Simon mit seiner Pflegetochter an seinen Hof, wo er sich ihnen als König zu erkennen gab. Ein großes Fest folgte dem freudigen Wiedersehen, der wackere Simon wurde zum Ritter geschlagen und auch Moraut, der Bertha das Leben gerettet hatte, erhielt reichen Lohn.
Französische Volksmärchen
ASCHENPUTTEL ODER: DAS GLÄSERNE PANTÖFFELCHEN

Vor Zeiten war einmal ein Edelmann, der sich zum zweiten Male verheiratete, und zwar mit der stolzesten und hochmütigsten Frau von der Welt. Sie brachte zwei Töchter in die Ehe mit, die ganz ihrer würdig und ihr in allen Dingen ähnlich waren, denn der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Der Edelmann seiner seits hatte ebenfalls eine Tochter, das sanfteste, gutmütigste Geschöpf, das man sich vorstellen kann, das rechte Ebenbild der seligen Mutter, die die Güte selbst gewesen. Warum besagter Edelmann nach einer so guten Frau eine so böse geheiratet, ist unbekannt. Diese Erscheinung wiederholt sich oft in der Welt, daß man zu der Annahme geneigt ist, das Leben an der Seite einer guten Frau sei den Männern langweilig und sie hätten eine wahre Sehnsucht nach dem Männer beherrschenden Pantoffel.
Die Stiefmutter war kaum ins Haus gekommen, als sie ihre bösen Launen schon an der vorgefundenen Stieftochter ausließ, da neben dieser die schlechten Eigenschaften ihrer rechten Töchter desto greller abstachen. Die niedrigsten Verrichtungen im Hause wurden ihr aufgetragen. Sie mußte Teller, Töpfe und Schüsseln spülen, die Treppen waschen, die Zimmer der Frau und ihrer Töchter wichsen. Sie schlief im Dachstübchen auf schlechtem Strohsack, während die Schwestern in parkettierten Zimmern wohnten, welche mit den modischsten Himmelbetten ausgestattet waren und mit so großen Spiegeln, daß sie sich darin vom Wirbel bis zur Zehe betrachten konnten.
Das arme Kind ertrug alles mit der größten Geduld, und dem Vater klagte es nicht, weil er es sonst gezankt hätte. So sehr stand er unter dem Pantoffel, der arme Mann. Wenn sie mit ihrer Arbeit fertig war, setzte sie sich in einen Winkel oder in die Asche am Herde, und daher kam es, daß man sie im Hause Aschenputtel nannte. Bei all dem war Aschenputtel in ihren schlechten Kleidern tausendmal schöner als die Stiefschwestern in ihren Prachtgewändern.
Da begab es sich, daß der Sohn des Königs ein Fest veranstaltete und daß er alle Personen vom Stande dazu einlud. Auch unsere zwei Fräulein waren gebeten, denn sie galten für sehr vornehm im Lande und machten viel von sich reden. Man kann sich denken, wie es da im Hause herging. Das arme Aschenputtel hatte nicht genug Füße, um zu laufen, und nicht genug Hände, um zu waschen, zu nähen, zu plätten. Tag und Nacht war nur von Putz und wieder Putz die Rede. Man beratschlagte, als ob es sich um das Heil der Welt handelte, und man ergrimmte und erzürnte sich wohl zwanzigmal des Tages über Dinge, die nicht den Wert eines Stecknadelkopfes hatten.
»Ich«, sagte die ältere, »ich ziehe mein rotes Samtkleid an und meine Brüsseler Spitzen.« »Ich«, sagte die jüngere, »ich nehme ein gewöhnlicheres Kleid, dafür aber binde ich meine Schleppe mit Goldblumen und tue mein diamantenes Halsband an, das auch nicht bitter ist.« Man berief die teuersten Haarkünstler und bestreute sich Haare, Hals und Nacken mit Goldstaub.
Aschenputtel verstand sich vortrefflich darauf, und ihre Schwestern zogen sie gern zu Rate und ließen sich auch von ihr den Kopfputz aufsetzen. Sie gab ihren besten Rat und verwandte auf den Kopfputz ihren besten Geschmack, denn dazu war sie zu gut, um absichtlich einen schlechten Rat zu geben oder den Kopfputz schief aufzusetzen, was hundert andere an ihrer Stelle getan hätten, um sich an den bösen Schwestern zu rächen.
Während sie ihnen das Haar strählte, fragten sie: »Aschenputtel, du gingst wohl auch gerne auf den Ball?« »Ach, meine Fräulein, Ihr macht Euch wohl lustig über mich armes Ding? So was wäre viel zuviel für mich.« »Du hast recht, so ein Aschenputtel auf dem Hofball würde sich komisch ausnehmen.«
Mehr als zwei Tage konnten die Stiefschwestern vor lauter Freude keinen Bissen hinunter bringen, und mehr als ein Dutzend Schnürriemen zerrissen, so eng ließen sie sich die Mieder zusammen ziehen, und beständig standen sie vor dem Spiegel und malten sich aus, wie sehr man sie bewundern werde. Endlich brach der große Tag an. Man fuhr ab, und Aschenputtel sah ihnen nach, als der Wagen längst um die Ecke verschwunden war.
Zu letzt konnte sie gar nichts mehr sehen, denn die Tränen stürzten ihr aus den Augen hervor. Ihre Pate, die sie weinen hörte, kam herbei und fragte, was ihr fehle. »Ich möchte – ich möchte«, mehr konnte sie vor Weinen nicht heraus bringen. Man braucht gerade keine Fee zu sein, wie es die Pate wirklich war, um zu erraten, was ihr fehlte, und sie sagte: »Du möchtest wohl auch gern auf den Ball?« »Ach ja!« erwiderte Aschenputtel mit einem tiefen Seufzer. »Nun gut, wenn du brav bist, will ich es wohl möglich machen.« Sie führte sie auf ihre Stube und sagte: »Jetzt gehe in den Garten und hole einen Kürbis.«
Aschenputtel lief und holte den schönsten, den sie finden konnte, obwohl sie nicht einsah, wie der Kürbis mit dem Ball zusammen hing. Aber sie war ein gläubiges Gemüt, und ein solches fragt nicht viel und tut, was man ihm befiehlt. Die Pate höhlte den Kürbis aus, ließ nur die dicke Schale stehen, schlug sie mit ihrem Zauberstäbchen, und siehe da, eine vergoldete Karosse stand da, daß es eine Pracht war. Dann ging sie an die Mausefalle, in der sich gerade sechs schöne, lebendige Mäuse gefangen hatten. Sie befahl Aschenputtel, die Klappe ein wenig in die Höhe zu ziehen, und jeder Maus, die herauskam, gab sie mit dem Zauberstäbchen einen kleinen Klaps, und jede Maus verwandelte sich sofort in einen kostbaren Grauschimmel, was im ganzen ein herrliches Sechsgespann von gleichen mausgrauen Apfelschimmeln ergab.
Da sie nicht gleich wußte, wo einen entsprechenden Kutscher her nehmen, sagte Aschenputtel: »Ich will einmal nach sehen, ob sich in der Rattenfalle nicht vielleicht eine Ratte findet, die man in einen Kutscher verwandeln könnte.« »Sehr klug«, sagte die Pate, »sieh einmal nach.« Aschenputtel brachte die Rattenfalle, und siehe da, es fanden sich drei ganz stattliche Ratten darin. Eine der drei hatte einen sehr fragwürdigen Bart; die berührte die Pate, und es gab einen so bärtigen Kutscher, wie sich ihn nur ein Gesandter wünschen kann. Dann sagte sie: »Geh wieder in den Garten und hole mir drei Eidechsen, die du hinter der Gießkanne finden wirst.« Aschenputtel hatte sie kaum herbei gebracht, als sie die Pate schon in ebenso viele galonierte, betreßte Bediente verwandelte, die sich so steif und stumm hinter der Karosse aufpflanzten, als hätten sie ihr Lebtag nichts anderes getan.
»Nun«, sagte die Fee, »da ist der Pracht genug, um auf den Hof ball zu gehen. Bist du zufrieden?« »Freilich – aber – aber – in diesen Kleidern –« Die Pate berührte sie mit ihrem Stäbchen, und sie stak in einer Toilette, die wir nicht weiter beschreiben wollen, um dem armen Aschenputtel nicht das gesamte weibliche Geschlecht zu Feinden zu machen; und dazu gab ihm die Pate noch ein Paar gläserne Pantöffelchen, ein wahres Wunder der Schuh- und Glasmacherei. So aufgeputzt stieg sie in die Karosse, und ehe sie abfuhr, empfahl ihr die Pate aufs dringlichste, den Ball ja vor Mitternacht zu verlassen, widrigenfalls sich ihr Wagen wieder in einen Kürbis, die Pferde in Mäuse, der Kutscher in eine Ratte, die Bedienten in Eidechsen und ihre prächtigen Kleider in die alten schmutzigen Lumpen verwandeln würden. Aschenputtel versprach zu tun, wie die gute Pate befahl, und fuhr ab, das Herz voll Glückseligkeit.
Als dem Prinzen die Ankunft einer mächtigen, aber unbekannten Prinzessin gemeldet wurde, eilte er höchst selbst die Treppe hinab, um sie zu empfangen, reichte ihr die Hand beim Aussteigen und führte sie in den Saal. Da wurde es mit einem Male ganz still, mäuschenstill. Alles hörte auf zu tanzen, die Violinen hörten auf zu spielen, und man tat gar nichts anderes, als die außerordentliche Schönheit der großen Unbekannten betrachten. Höchstens daß man hie und da den Ausruf hörte: »Oh, wie schön ist sie!« Selbst der alte König meinte, daß er seit langem keine so schöne und anmutige Person zu Gesicht bekommen. Darauf seufzte er und die Königin auch. Die Damen studierten vorzugsweise Stoff und Schnitt der Kleider sowie den Kopfputz der fremden Prinzessin, um gleich morgen alles genau nach machen zu lassen. Denn die Frauen meinen immer, der Anzug tue es, und sie würden geradeso schön sein wie die schönste Person, wenn sie nur erst auch so gekleidet wären.
Der Prinz führte Aschenputtel auf den höchsten Ehrenplatz, dann bat er sie um einen Tanz, und sie tanzte mit solcher Anmut, daß man sie noch mehr bewunderte als zuvor. Bei Tische brachte der Prinz keinen Bissen herunter, so sehr war er in Betrachtung der großen Schönheit verloren, und so stark hatte sich bei ihm schon jene Appetitlosigkeit eingestellt, welche als ein bedrohliches Zeichen der hitzigen Liebeskrankheit vorauszugehen pflegt. Aschenputtel setzte sich neben ihre Schwestern, überhäufte sie mit Liebenswürdigkeiten und gab ihnen von den Zitronen und Orangen, die ihr der Prinz vorlegte, was die beiden sehr verwunderte, weil sie Aschenputtel nicht erkannten. Da schlug es ein Viertel vor Mitternacht. Rasch erhob sich Aschenputtel, machte der ganzen Gesellschaft einen tiefen Knicks und entfernte sich, so schnell sie konnte.
Zu Hause angekommen, lief sie sogleich zu der guten Pate, dankte ihr für alles Genossene und sagte ihr, daß sie morgen wohl wieder auf den Ball zu gehen wünschte, da sie der Prinz so sehr darum gebeten. Und wie sie im besten Erzählen war, pochten die Schwestern an die Türe. Aschenputtel lief und öffnete, und gähnend, als ob sie eben aus dem Schlaf erwacht wäre, sagte sie: »Ach, wie lange seid ihr ausgeblieben!« »Wärst du mit uns gewesen«, antwortete die eine, »die Zeit hätte dir nicht lange geschienen. Es war eine wunderschöne Prinzessin auf dem Balle, die schönste Prinzessin, die man sich nur vorstellen kann. Sie war überaus gnädig gegen uns und gab uns Zitronen und Orangen.«
Aschenputtel wupperte bei diesen Worten das Herz vor Freude. Sie fragte nach dem Namen der Prinzessin, aber sie antworteten, daß sie ganz unbekannt sei, daß sich der Prinz darüber höchlichst gräme und daß er alles dafür gäbe, wenn er nur wüßte, wer sie wäre. Aschenputtel lächelte unter der Nase und sagte: »War sie wirklich so schön? Mein Gott, wie glücklich seid ihr! Könnte ich sie denn gar nicht zu sehen bekommen?« Tags darauf gingen die Schwestern wieder auf den Ball, Aschenputtel auch, nur noch viel schöner und prächtiger aufgeputzt als das erste Mal. Der Prinz wich nicht von ihrer Seite und sagte ihr die süßesten Sachen, die jedes Mädchen gerne hört und die auch Aschenputtel gerne hörte.
Sie hörte so aufmerksam zu, und die Zeit verging ihr so rasch, daß sie ganz die Warnungen und Anempfehlungen der Pate vergaß, und plötzlich ertönte der erste Glockenschlag der Mitternacht, als sie glaubte, es sei noch nicht elf Uhr. Erschrocken sprang sie auf und floh mit der Leichtigkeit eines Rehs davon. Der Prinz ihr nach, aber er konnte sie nicht erreichen. Er erwischte nichts als einen der gläsernen Pantoffeln, den Aschenputtel auf der Flucht fallen gelassen.
Ganz außer Atem kam sie zu Hause an, ohne Karosse, ohne Bediente, ohne Prachtkleider, in ihre alten Lumpen gehüllt wie sonst. Nichts war ihr geblieben als ein Pantoffel, dessen Bruder ihr vom Fuße gefallen war. Im Schlosse fragte man die Türsteher, ob sie nicht eine wunderschöne Prinzessin hätten hinaus gehen sehen. Sie antworteten, daß sie nichts gesehen hätten als ein schlecht gekleidetes Mädchen, das eher einer Bäuerin als einer Prinzessin ähnlich gewesen.
Als die Schwestern vom Balle heim kamen, fragte Aschenputtel sie, ob sie sich denn gut unterhalten hätten und ob die schöne Dame wieder da gewesen sei. Sie sagten ja! und fügten hinzu, daß aber die schöne Dame mit Schlag Mitternacht auf und davon gegangen und daß sie auf ihrer Flucht das reizendste Glaspantöffelchen von der Welt habe fallen lassen, daß der Prinz es aufgehoben und daß er in die Besitzerin des Glaspantöffelchens ganz verliebt sei.
Das mußte wohl wahr sein, denn wenige Tage darauf wurde unter Trompetenstößen überall kundgetan, daß der Prinz diejenige heiraten werde, deren Fuß in das Glaspantöffelchen passe. Man fing mit der Probe des Pantoffels bei den Prinzessinnen an, dann bei den Herzoginnen, dann bei allen Hofdamen – überall umsonst. Man brachte dann das Pantöffelchen zu den beiden Schwestern, die alles mögliche taten, um ihre Füße hinein zu zwängen, aber sie konnten es nicht durch setzen. Aschenputtel, die ihren Pantoffel erkannte, sah lächelnd zu und sagte: »Wie wäre es, wenn ich es auch einmal versuchte?«
Die Schwestern brachen in lautes Gelächter aus und wollten sie zur Tür hinaus treiben. Aber der mit der Pantoffelprobe beauftragte außerordentliche Gesandte betrachtete Aschenputtel genauer, blickte mit scharfen Augen mitten durch Lumpen und Schmutz, fand sie sehr schön und meinte, es sei nichts wie billig, und er habe Auftrag, den Pantoffel ohne Ansehen der Person und des Standes alle Mädchen probieren zu lassen.
Er bat Aschenputtel, sich gefälligst hin zu setzen, kniete vor ihr nieder, schob das Pantöffelchen über ihre Zehen – und siehe da, es saß wie angegossen. Das Erstaunen der beiden Schwestern war groß, sehr groß, und es wurde noch größer und allgemeiner, als Aschenputtel mit einem Male auch den anderen Glaspantoffel aus der Tasche zog und ihn, wie nichts, über den anderen Fuß schob. Dazu kam noch zur rechten Zeit die Pate, berührte Aschenputtel mit dem Zauberstäbchen, und so geputzt saß sie da, daß die Prachtgewänder der zwei Ballabende nichts dagegen waren.
Jetzt erst ging den beiden Schwestern ein Licht auf. Sie erkannten die schöne Person, die ihnen Zitronen und Orangen gegeben, warfen sich ihr zu Füßen und baten um Vergebung für die schlechte Behandlung, die sie ihr bisher hatten angedeihen lassen. Gute Menschen werden durch das Glück immer besser, und so hob Aschenputtel die bösen Schwestern auf, drückte sie ans Herz, versicherte sie ihrer Liebe und versprach, die ganze Vergangenheit zu vergessen.
Der Prinz, der in einiger Entfernung folgte, stürzte her bei, fand Aschenputtel schöner als je und heiratete sie wenige Tage darauf. Daß sie nun sehr glücklich war und eine große Königin wurde und ihren Stiefschwestern alles mögliche Gute tat – das versteht sich alles von selbst.

FINETTE ASCHENBRÖDEL ...

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten schlechte Wirtschaft getrieben und man jagte sie deshalb aus ihrem Königreich. Weil sie nichts zu leben hatten, verkauften sie ihre Kronen, so dann ihre Kleider, ihre Leibwäsche, ihre feine Wäsche und alle ihre Möbel Stück für Stück. Die Trödler wurden zuletzt überdrüssig zu kaufen, denn alle Tage kamen sie mit anderem Zeug.
Als nun der König und die Königin ganz verarmt waren, sagte der König zu seiner Frau: „Da haben wir nun kein Königreich mehr und haben auch sonst weiter nichts! wir müssen uns und unseren armen Kindern einen Lebensunterhalt verschaffen! Denken sie doch ein wenig nach, was wir tun sollen, denn bis dahin Habe ich mich nur auf das Regieren verstanden, und das ist keine schwere Sache."
Die Königin besaß viel Verstand; sie bat sich acht Tage Zeit aus, um gehörig darüber nachzudenken. Nach Verlauf der acht Tage sagte sie zu ihm: „Mein Gemahl, wir müssen uns nicht vom Kummer niederdrücken lassen; ihr ganzes Geschäft soll darin bestehen, dass sie Netze machen und auf die Jagd und den Fischfang gehen, um Vögel und Fische darin zu fangen. Während sich die Schnuren abnutzen, will ich fleißig spinnen, um wieder neue zu machen. Was unsere drei Töchter betrifft, so sind das hochmütige Faulenzerinnen, die sich noch immer einbilden, vornehme Damen zu sein und die Prinzessinnen spielen wollen. Man muss sie so weit, so weit von hier fortbringen, dass sie nie wieder kommen; denn es würde unmöglich sein, dass wir ihnen nur genug Kleider nach ihrem Geschmack schaffen könnten."
Der König brach in Tränen aus, als er hörte, dass er sich von seinen Kindern trennen sollte. Er war ein zärtlicher Vater, stand aber unter dem Pantoffel der Königin. Er willigte daher in alles ein, was sie beschloss und entgegnete ihr: „Stehen sie morgen bei guter Zeit auf, nehmen sie ihre drei Töchter und führen sie die selben so weit sie immer denken. Während sie dies so beratschlagten, horchte gerade die Prinzessin Finette, die kleinste von den Schwestern, am Schlüsselloch; und als sie nun von dem Entschluss ihres Vaters und ihrer Mutter hörte, lief sie gleich, so schnell sie nur konnte, nach einer ziemlich fern gelegenen Grotte, in welcher die Fee Merlusche, ihre Frau Patin, wohnte.
Finette hatte zwei Pfund frische Butter mitgenommen, Eier, Milch und Mehl, um ihrer Patin einen vortrefflichen Kuchen zu backen und freundlich aufgenommen zu werden. Sie machte sich ganz vergnügt auf den Weg, aber je mehr sie ging, desto müder wurde sie. Bis auf die letzte Sohle nutzten sich ihre Schuhe ab und ihre kleinen weichen Füßchen liefen sich so wund, dass es ein wahrer Jammer war; sie konnte nicht mehr und setzte sich weinend aufs Gras.
Da zeigte sich auf einmal ein schönes Ross, ganz gezäumt und gesattelt; es hatte so viel Diamanten an seiner Decke, dass man mehr als drei Städte davon hätte kaufen können. Als es die Prinzessin erblickte, kam es ganz sanft an sie heran und beugte das Knie, als ob es ihr eine Verbeugung machen wolle. Sie nahm es darauf beim Zügel und sprach: „Mein gütiges Pferdchen, möchtest du mich wohl zu meiner Frau Patin, der Fee, tragen? du würdest mir einen großen Gefallen damit tun, denn ich sterbe vor Müdigkeit; wenn du es aber tust, will ich dir auch vom besten Heu und Hafer geben und zur Streu sollst du frisches Stroh bekommen."
Das Pferd bückte sich fast bis auf die Erde vor ihr und die junge Finette stieg auf. Nun fing es zu laufen an so leicht, als ob es ein Vogel wäre. Am Eingang der Grotte hielt es still, als ob es den Weg schon gewusst hätte, und es wusste ihn auch sehr wohl, denn das schöne Ross war ja von der Fee Merlusche abgeschickt, welche vorher sah, dass ihr Patenkind sie wollte besuchen kommen.
Beim Eintreten machte Finette drei tiefe Verbeugungen vor ihrer Frau Pathe, nahm den Zipfel ihres Rockes, küsste ihn und sagte darauf: „Guten Tag, liebe Frau Pathe, wie befinden sie sich? Hier bring' ich ihnen Butter, Milch, Eier und Mehl, um einen schönen Kuchen zu backen."
„Sei mir willkommen“, entgegnete die Fee, „lass dich umarmen." Sie umarmte sie zweimal und das freute Finette nicht wenig, denn Madame Merlusche war eben keine Fee, wie sie zu Dutzenden sind. „Hier, mein liebes Patchen“, sprach sie darauf, „du sollst jetzt meine kleine Kammerfrau werden, mir den Kopfputz abnehmen und das Haar kämmen. Die Prinzessin nahm ihr den Kopfputz ab und kämmte ihr das Haar auf die geschickteste Weise von der Welt. „Ich weiß wohl“, sagte Merlusche, „weshalb du zu mir kommst, du hast gehört, dass der König und die Königin euch verstoßen wollen, und du möchtest dieses Unglück von euch abwenden. Da, nimm diesen Knäuel, dessen Faden unzerreißbar ist, knüpfe das Ende an die Tür eures Hauses und behalte den Knäuel in der Hand. Wenn die Königin euch verlassen hat, so brauchst du nur dem Faden zu folgen, um dich leicht wieder nach Hause zu finden."
Die Prinzessin bedankte sich bei ihrer Frau Patin, die ihr noch einen Sack voll schöner Kleider gab, ganz mit Gold und Silber besetzt. Sie umarmte sie, hob sie auf das hübsche Pferd hinauf und in zwei, drei Augenblicken befand sich die Prinzessin an der Tür der Hütte ihrer Majestäten. Finette stieg ab und sagte zu ihrem Pferd: „Mein kleiner hübscher kluger Freund, der rascher als ein Vogel fliegt, ich danke dir für deine Mühe, kehre zurück, woher du gekommen bist." Sie schlich sodann ganz sachte in das Haus, verbarg den Sack mit den Kleidern unter ihr Kopfkissen und legte sich schlafen, als ob nichts vorgefallen wäre.
Kaum brach der Tag an, so weckte der König seine Frau und sagte: „Stehen sie auf, stehen sie auf, es ist Zeit, sich auf den Weg zu begeben." Augenblicklich stand sie auf, zog ihre dicken Schuhe an, einen kurzen Rock, ein weißes Kamisol und nahm einen tüchtigen Reisestock. Sodann rief sie die älteste ihrer Töchter, welche Liebesblümchen hieß, die zweite, Nachtschönchen, und die jüngste, Feinöhrchen, denn so nannte man gewöhnlich Finette.
„Ich habe diese Nacht geträumt“, sprach die Königin, „wir sollten einmal meine Schwester besuchen, sie werde uns aufs Allerbeste empfangen und wir würden einen sehr vergnügten Tag haben." Liebesblümchen, die es überdrüssig war, beständig in einer Wüste zu leben, versetzte rasch: „Lassen sie uns gehen, wohin sie wollen, es ist mir gleich, nur dass ich ein wenig von hier fort komme. Die beiden anderen sprachen eben so. Sie nahmen Abschied vom König und alle Vier begaben sich auf den Weg. Sie gingen so weit, so weit, dass Feinöhrchen Furcht hatte, der Faden werde nicht reichen. Sie ging immer hinter ihren Schwestern, den Faden geschickt durch die Sträucher ziehend.
Als die Königin glaubte, ihre Töchter würden nun den Rückweg nicht wieder finden können, hielt sie in einem großen Walde an und sagte zu ihnen: „Meine kleinen Schäfchen, legt euch schlafen, ich will der Hirte sein, der bei euch wacht, dass der Wolf keins fort trägt." Sie legten sich aufs Gras nieder und schliefen ein. Die Königin verließ sie und meinte gewiss, sie nie wieder zu sehen. Finette schloss die Augen, schlief aber nicht. „Wenn ich boshaft genug wäre, sagte sie, „so würde ich mich augenblicklich auf den Weg machen und meine Schwestern hier umkommen lassen; denn sie schlagen und kratzen mich bis aufs Blut. Dem ungeachtet will ich sie nicht verlassen."
Sie weckte sie und erzählte ihnen alles. Da fingen sie an zu weinen und baten ihre Schwester inständigst, sie mit sich zu nehmen, sie wollten ihr schöne Puppen, ihr kleine Sparbüchsen und eine Menge Spielsachen und Näschereien geben. „Ich weiß wohl, dass ihr nichts davon tun werdet“, entgegnete Finette, „doch ich will deshalb nicht weniger eine gute Schwester sein." Damit stand sie auf und folgte dem Faden und die Prinzessinnen des gleichen, so dass sie fast zugleich mit der Königin eintrafen.
Als sie an der Tür standen, hörten sie den König sagen: „Mein Herz ist ganz bekümmert, sie so allein zurück kommen zu sehen." „Ach“, sprach die Königin, „unsere Töchter machten uns gar zu viel Sorge und Last." „Wenn sie noch“, sagte der König, „meine Finette wieder mitgebracht hätten, der anderen wegen würde ich mich trösten, denn das sind selbstsüchtige Geschöpfe, die für nichts Liebe haben." Sie klopften, poch, poch. „Wer ist da?“, fragte der König. Ihre drei Töchter“, entgegneten sie, „Liebesblümchen, Nachtschönchen und Feinöhrchen."
Die Königin zitterte vor Furcht; „öffnen sie nicht“, sagte sie zum König, „das müssen Geister sein, denn dass die Kinder zurück gekommen sind, ist ganz unmöglich." Der König war eben ein solcher Hase als seine Frau und sprach: „Ihr hintergeht mich, ihr seid meine Töchter nicht." Doch das kluge Feinöhrchen erwiderte ihm: „Ich will mich bücken, lieber Papa, betrachten sie mich durch das Schlüsselloch und wenn ich nicht Finette bin, mögen sie mir die Rute geben."
Da sah sie der König durchs Schlüsselloch an, erkannte sie und öffnete. Die Königin stellte sich ganz erfreut sie wieder zu sehen und sagte zu ihnen, sie habe nur zu Hause etwas vergessen gehabt und sei zurück gegangen, um es zu holen, in der bestimmten Überzeugung, sie da noch anzutreffen. Sie taten als glaubten sie daran und stiegen in einen kleinen hübschen Verschlag, wo sie schliefen. „Nun, liebe Schwestern“, sagte Finette, „ihr habt mir eine Puppe versprochen, gebt sie mir jetzt." „Wahrhaftig, da sollst du lange darauf warten, nichtswürdiges Geschöpf“, entgegneten sie; „du bist Schuld, dass sich der König nichts aus uns macht."
Darauf nahmen sie ihre Spindeln und schlugen ohne Barmherzigkeit auf sie los. Als sie sie genug geschlagen hatten, erlaubten sie ihr endlich, sich schlafen zu legen. Weil sie aber so zerkratzt und zerstoßen war, konnte sie nicht schlafen und so hörte sie, dass die Königin zum König sagte: „Ich will sie nach einer anderen Seite hin führen, noch viel weiter, so dass sie ganz gewiss nicht zurück finden sollen."
Als Finette diesen Anschlag hörte, stand sie ganz leise auf, um noch in der Nacht zu ihrer Frau Patin zu gehen. Vorher aber ging sie in den Hühnerstall, nahm zwei Hennen und einen Meister Hahn, dem sie den Hals umdrehte, so dann zwei kleine Kaninchen, welche die Königin mit Kohl auffütterte, um sich gelegentlich eine gute Mahlzeit damit zu machen, tat alles in einen Korb und begab sich auf den Weg.
Doch keine halbe Stunde noch war sie im Finsteren umhergetappt, halb tot vor Furcht, so kam das schöne Pferd der Frau Merlusche im Galopp herbei gerannt, schnaubend und wiehernd. Finette glaubte nichts anderes, als nun sei es um sie geschehen, aber das Pferd blieb ganz artig vor ihr stehen und ließ sie aufsteigen; und so gelangte sie ganz vergnügt, den Weg so nach aller Bequemlichkeit zurück legen zu können, sehr bald zu ihrer Patin. Nach den gewöhnlichen Komplimenten überreichte sie der Fee die Hühner, den Hahn und die Kaninchen und bat sie um ihren guten Rat, weil die Königin geschworen habe, sie bis ans Ende der Welt zu führen.
Merlusche tröstete sie, gab ihr einen Sack mit Asche und sagte: „Nimm diesen Sack, trage ihn vor dir her und schüttle ihn; du darfst nur immer auf die Asche treten und wenn du zurück kehren willst, so gehe deinen Fußstapfen nach. Deine Schwestern aber nimm nicht mit zurück, denn das sind gar zu boshafte Geschöpfe, oder ich will nie mehr wieder etwas von dir wissen." Finette bedankte sich und nahm Abschied, wobei ihr die Fee noch ein kleines Schächtelchen mit Diamanten in die Hand drückte. Das Pferd stand schon bereit und brachte sie, wie gewöhnlich, nach Hause.
Kaum brach der Morgen an, so rief die Königin ihre Töchter und sagte zu ihnen: „Der König befindet sich nicht wohl, und ich habe diese Nacht geträumt, wir müssten in ein gewisses Land reisen und ihm von den herrlichen Blumen und Kräutern pflücken, welche dort wachsen, sie würden ihn wieder her stellen; wir wollen uns also gleich auf den Weg machen."
Liebesblümchen und Nachtschönchen, die nicht glaubten, dass ihre Mutter sie noch einmal im Stich lassen wolle, bekümmerten sich nicht weiter über diese Neuigkeit. Man begab sich also auf den Weg und sie gingen so weit, dass vielleicht noch niemand eine so weite Reise gemacht hat. Finette sagte kein Wort, ging immer zuletzt und streute ganz geschickt ihre Asche aus, ohne dass der Wind oder der Regen etwas davon hin weg nahm. Als die Königin überzeugt war, sie so weit geführt zu haben, dass sie den Rückweg nicht mehr finden könnten, und alle Drei eines Abends in tiefem Schlaf lagen, nahm sie die Gelegenheit wahr, sie zu verlassen und kehrte nach Hause zurück.
Als der Tag anbrach und Finette ihre Mutter nicht mehr gewahr wurde, weckte sie ihre Schwestern auf und sagte: „Wir sind allein, unsre Mutter ist auf und davon." Da fingen Liebesblümchen und Nachtschönchen bitterlich an zu weinen, zerrauften ihr Haar und zerschlugen sich mit der geballten Faust das Gesicht. „Ach! was sollen wir anfangen!", schrien sie kläglich.
Finette war das gut herzigste Mädchen von der Welt, sie konnte sich des Mitleids mit ihren Schwestern nicht erwehren. „Seht, was ich wage“, sagte sie zu ihnen: „denn wenn auch meine Patin mir ein Mittel gegeben hat, den Weg zu finden, so hat sie mir doch verboten, ihn euch zu zeigen und mir gedroht, wenn ich ihr ungehorsam sei, solle ich nicht mehr vor ihre Augen kommen." Da warf sich Nachtschönchen Finetten um den Hals und ebenso Liebesblümchen und liebkosten sie so zärtlich, dass sie sich endlich entschließen musste, alle beide wieder mit nach Hause zu nehmen.
Der König und die Königin waren sehr verwundert, ihre Töchter wieder kommen zu sehen; sie sprachen die ganze Nacht davon, und die jüngste, welche nicht umsonst Feinöhrchen hieß, hörte, dass sie einen neuen Anschlag machten und dass die Königin sie am anderen Morgen wieder fort führen wolle.
Sie lief zu ihren Schwestern und weckte sie auf: „Ach!“, rief sie, „wir sind verloren. Die Königin will uns durchaus in irgend eine Wüste bringen und dort zurück lassen. Ihr seid Schuld, dass ich meine Patin erzürnt habe und nicht mehr wagen darf, zu ihr zu gehen, wie sonst." Sie waren lange Zeit in großer Sorge und eins fragte immer das andere: „Was sollen wir nun tun, liebe Schwester? was fangen wir jetzt an?" Endlich hub Nachtschönchen an: „Man muss nur den Mut nicht verlieren; so viel Verstand auch die alte Merlusche haben mag, so ist doch anderen Leuten auch noch ein wenig geblieben. Wir wollen die Taschen voll Erbsen stecken und sie auf den Weg hin streuen, so werden wir leicht zurück finden."
Liebesblümchen fand diesen Gedanken ganz unvergleichlich und sie steckten sich alle Taschen voll Erbsen; Feinöhrchen aber nahm statt der Erbsen ihren Sack mit den schönen Kleidern und ihre Schachtel mit Diamanten, und als die Königin sie rief, waren sie alle schon ganz fertig. Sie sagte zu ihnen: „Es hat mir diese Nacht geträumt, wir sollten in ein Land reisen, wo drei schöne Prinzen euch erwarten, um sich mit euch zu vermählen; ich will euch dahin führen, um zu sehen, ob mein Traum die Wahrheit gesprochen hat."
Die Königin ging voran und ihre Töchter nach; ganz unbekümmert streuten sie ihre Erbsen aus, denn sie wussten ja nun, wie sie wieder nach Hause kommen sollten. Diesmal führte sie die Königin noch viel weiter als früher; in einer dunkelen Nacht aber verließ sie die Prinzessinnen und kehrte allein zum Könige zurück, wo sie sehr müde, aber auch sehr zufrieden anlangte, nicht mehr eine so große Wirtschaft auf dem Halse zu haben.
Als die drei Prinzessinnen vor großer Müdigkeit bis elf Uhr Morgens geschlafen hatten, wachten sie auf. Finette war die erste, welche die Abwesenheit der Königin bemerkte. Obgleich sie darauf vorbereitet war, konnte sie sich doch nicht enthalten zu weinen; denn sie vertraute für ihre Rückkehr der Geschicklichkeit ihrer Schwestern weniger als der Fee, ihrer Patin.
Ganz erschrocken rief sie: „Die Königin ist fort, wir müssen ihr so rasch als möglich nach." „Schweig, du kleiner Maulaffe“, entgegnete Liebesblümchen, „wir werden den Weg schon finden, sobald wir wollen; behalte deinen Rat für dich bis wir dich fragen."
Finette wagte nichts zu entgegnen; aber da sie sich wieder nach Hause begeben wollten, fanden sie weder Weg noch Steg, denn die Tauben, welche in jenem Land sehr zahlreich waren, hatten die Erbsen alle aufgefressen. Als sie das sahen, fingen sie laut zu weinen au. Zwei Tage gingen hin, ohne dass sie einen Bissen zu essen hatten.
Da sagte Liebesblümchen zu Nachtschönchen: „Liebe Schwester, hast du nichts zu essen?" „Ach nein“, antwortete jene. Dann fragte sie das selbe auch Finette, die ihr entgegnete: „Ich habe auch nichts weiter als eine Eichel, die ich gefunden habe." „Gib mir die Eichel“, rief die eine; „nein, gib sie mir!“, rief die andere — jede wollte sie haben.
„Wir können uns alle Drei doch nicht an einer Eichel satt essen“, sagte Finette, „wir wollen sie lieber pflanzen, so wird ein Baum daraus, von dem wir uns ernähren können." Sie waren damit einverstanden, obgleich es wenig Anschein hatte, dass ein Baum in einem Lande wachsen sollte, wo man nirgends sonst einen Baum erblickte, wo man nichts sah als Kohl und Salat. Davon aßen nun die Prinzessinnen und schliefen unter freiem Himmel. Alle Morgen und alle Abend gingen sie abwechselnd, die Eichel zu begießen und sprachen zu ihr: "Wachse, wachse, schöne Eichel!“, und zusehends fing sie an zu wachsen.
Als sie schon ziemlich groß geworden war, wollte Liebesblümchen hinauf steigen, aber sie war zu schwer, die Eiche bog sich unter ihr, und da stieg sie gleich wieder herunter. Ebenso ging es mit Nachtschönchen. Finette aber, die leichter war, hielt sich lange Zeit oben. „Siehst du nichts?“, fragten ihre Schwestern. „Nein, ich sehe nichts“, antwortete sie. „Ach, die Eiche ist noch nicht hoch genug“, sagte Liebesblümchen, worauf sie fort fuhren die Eiche zu begießen und zu ihr zu sprechen: „Wachse, wachse, schöne Eichel!"
Finette stieg alle Tage zweimal hinauf; eines Morgens, als sie oben saß, sagte Nachtschönchen zu Liebesblümchen: „Ich habe einen Sack gefunden, den unsere Schwester vor uns versteckt hat; was kann sie nur darin haben?" Liebesblümchen antwortete: „Sie hat mir gesagt, es wären alte Spitzen, die sie ausbessern wolle." „Und ich glaube“, sagte Nachtschönchen, „es sind Bonbons." Und weil sie nun sehr genaschig war, so wollte sie gleich davon haben. Sie machten den Sack auf und fanden wirklich alte Spitzen des Königs und der Königin darin, allein sie dienten nur dazu, Finettens schöne Kleider und die Diamantenschachtel zu verstecken.
„Siehe, siehe!“, riefen sie aus, gibt es eine abscheulichere Spitzbübin! das alles müssen wir für uns behalten und Steine dafür hinein tun — was sie auch auf der Stelle ausführten. Finette kam herunter, doch sie merkte nichts von der Bosheit ihrer Schwestern, denn es fiel ihr nicht ein, sich in dieser Einöde zu putzen; sie dachte nur an ihre Eiche, welche die schönste Eiche von der Welt wurde.
Eines Tages, als sie wieder hinauf gestiegen war und ihre Schwestern sie, wie gewöhnlich, fragten: „Siehst du nichts?“, so schrie sie: „Ich sehe ein großes Haus, ach so schön, wie ich es nicht beschreiben kann! Die Mauern sind von Smaragden und Rubinen, das Dach von Diamanten, es ist über und über mit goldenen Glöckchen behangen und die Wetterhähne drehen sich hin und her." „Du lügst“, riefen die Schwestern, „es ist nicht so schön, wie du sagst." „Gewiss, ich lüge euch nichts vor“, antwortete Finette, „steigt lieber selbst herauf und seht, denn mir sind die Augen schon ganz geblendet."
Liebesblümchen stieg auf den Baum und als sie das Schloss sah, stieß sie einen lauten Schrei aus. Das neugierige Nachtschönchen stieg auch hinauf und war ebenso wie ihre Schwestern außer sich vor Entzücken. „Auf alle Fälle“, sagten sie, „müssen wir in jenen Palast gehen; vielleicht finden wir dort einige schöne Prinzen, die sich glücklich schätzen werden, uns zu heiraten."
Den ganzen Abend sprachen sie ohne Aufhören davon; als sie sich aber auf den Rasen nieder legten und Finette ganz fest eingeschlafen schien, sagte Liebesblümchen zu Nachtschönchen: „Weißt du, Schwester, was wir tun müssen? Wir wollen aufstehen und uns die schönen Kleider anziehen, die Finette mitgenommen hat." „Du hast Recht“, sagte Nachtschönchen, „das wollen wir tun." Dann standen sie auf, machten sich zurecht und zogen die schönen Kleider an, welche mit Silber, Gold und Diamanten über und über bedeckt waren, so dass man etwas Prächtigeres gar nicht sehen konnte.
Finette hatte keine Ahnung von dem Diebstahl, den ihre boshaften Schwestern an ihr begingen; sie nahm ihren Sack in der Absicht sich anzukleiden, und war nicht wenig betrübt, nichts als Steine darin zu finden. Zu gleicher Zeit bemerkte sie auch ihre Schwestern, die wie die Sonne strahlten. Sie weinte und beklagte sich über ihren Verrat, jene aber lachten nur darüber und machten sich lustig über sie.
„Ist es möglich“, sagte Finette zu ihnen, „dass ihr mich mit auf das Schloss nehmen könnt, ohne mich anständig anzukleiden?" „Wir haben kaum genug für uns“, versetzte Liebesblümchen, „und wenn du uns nicht in Ruhe lässt, so setzt es Schläge." „Aber“, fuhr jene fort, „diese Kleider, welche ihr anhabt, gehören ja mir; meine Patin hat sie mir geschenkt, sie gehen euch nichts an." „Wenn du noch ein Wort sprichst“, riefen sie, „so schlagen wir dich tot und vergraben dich hier, ohne dass ein Hahn danach kräht." Da musste die arme Finette wohl ruhig sein, um sie nicht zu reizen; sie folgte geduldig und ging ganz hinter drein, so dass man sie für nichts anderes als für ihre Magd halten konnte.
Je mehr sie sich dem Schlosse näherten, desto bewunderungswürdiger erschien es ihnen. „Ach!“, sagten Liebesblümchen und Nachtschönchen, „was für ein prächtiges Leben wollen wir hier führen! Was für gute Mahlzeiten wird es geben! Wir werden an der Tafel des Königs speisen, Finette aber wird in der Küche die Teller waschen, denn gegen uns sieht sie aus wie ein Küchenschmudel (Küchenhilfe). Wenn man uns nach ihr fragt, so wollen wir bei Leibe nicht sagen, dass sie unsere Schwester ist; wir wollen sagen, es sei die Gänsemagd aus dem Dorfe."
Unter solchen boshaften Reden, welche die hübsche, kluge Finette stillschweigend ertragen musste, kamen sie an das Schlosstor. Sie pochten an und als bald erschien eine alte Frau von furchtbarem Aussehen und öffnete. Sie hatte nur ein Auge mitten auf der Stirn, aber es war größer als fünf oder sechs andere zusammen, eine platte Nase und ein entsetzlich breites Maul. Sie war wenigstens fünfzehn Fuß hoch und maß wohl an dreißig im Umfang.
„Ihr Unglücklichen“, sagte sie, „was führt euch hier her? Wisst ihr nicht, dass dieses Schloss einem Menschenfresser gehört und dass ihr kaum etwa ein Frühstück für ihn abgebt? Doch ich bin mitleidiger, als mein Mann. Kommt herein, ich will euch wenigstens nicht gleich fressen; ihr sollt den Trost haben, noch zwei oder drei Tage am Leben zu bleiben."
Als sie die Menschenfresserin so reden hörten, machten sie sich eilig davon, in der Meinung, sich durch die Flucht retten zu können. Aber ein einziger Schritt jenes Weibes maß fünfzig von den ihrigen; sie lief ihnen nach und erwischte sie, die Eine bei den Haaren, die andere beim Genicke und steckte sie alle Drei in einen Keller, der voll Kröten und Schlangen war und wo man auf nichts trat, als auf Menschengebeine.
Sie hatte große Lust, Finette so gleich zu verspeisen und ging, Essig, Öl und Salz zu holen, um sich einen Salat von ihr zu machen. Da hörte sie ihren Mann kommen und weil sie die weißen und zarten Prinzessinnen für sich allein behalten wollte, steckte sie sie rasch unter eine große Kufe, aus der sie nur durch ein Loch herausgucken konnten.
Der Menschenfresser war noch sechsmal größer und dicker als seine Frau. Wenn er sprach, so zitterte das Haus und wenn er hustete, so schallte es wie der Donner. Er hatte nur ein einziges großes und tückisches Auge. Seine Haare waren ganz borstig. Auf einen Baumstamm stützte er sich wie auf einen Spazierstab. Er trug einen zugedeckten Korb unter dem Arm, aus welchem er fünfzehn kleine Kinder herausnahm, die er unterwegs geraubt hatte und die er wie fünfzehn frische Eier hinunter schluckte.
Als die drei Prinzessinnen ihn erblickten, zitterten sie heftig unter ihrer Kufe und wagten nicht zu weinen, aus Furcht, er könne sie hören; ganz leise aber sprachen sie zu einander: „O, Himmel, wie retten wir uns, er wird uns alle lebendig auffressen!" Jetzt sagte der Menschenfresser zu seiner Frau: „Höre, Frau, ich rieche Menschenfleisch, gib mir es her!"
„Ei ja!“, sagte die Menschenfresserin, „du glaubst immer Menschenfleisch zu riechen und es sind deine Schaffe, die hier vorbeigekommen sind." „O ich täusche mich nicht“, sprach er, „ich rieche ganz bestimmt Menschenfleisch und ich will es mir schon suchen." „Ja, suche nur“, entgegnete sie, „du wirst nichts finden." „Wenn ich es aber finde“, fuhr der Menschenfresser fort, „und du hast es vor mir versteckt, so schneide ich dir den Kopf ab und spiele Ball damit."
Diese Drohung machte der Frau doch ein wenig bange und sie sagte: „Sei nur nicht gleich so böse, mein kleines Männchen, ich will dir ja die Wahrheit gestehen. Ich habe heute drei junge Mädchen gefunden, aber es war wirklich Schade, sie aufzufressen; denn sie sind sehr geschickt in der Wirtschaft.
Ich bin alt und bedarf der Ruhe; du siehst selbst, wie unser schönes Haus so verwildert ist, die Suppe schmeckt dir nicht mehr so gut, das Brot ist auch nicht ordentlich gebacken und ich selbst komme dir lange nicht mehr so schön vor als früher, seitdem ich mich halb zu Tode arbeiten muss. Diese Mädchen nun sollen mir zur Hand gehen und uns bedienen. Ich bitte dich also, friss sie jetzt nicht. Solltest du ja einmal Appetit dazu haben, so steht es ja noch immer bei dir."
Dem Menschenfresser kam es sehr schwer an, seiner Frau das Versprechen zu geben, die Mädchen nicht auf der Stelle aufzufressen. „Lass mich nur“, sagte er, „ich will nicht mehr als zwei davon fressen." „Nein, nicht eine einzige sollst du." „Hör' doch, ich will ja nur die aller kleinste." „Nein, auch nicht eine bekommst du jetzt“, entgegnete sie. Endlich nach vielem Hin- und Herstreiten versprach er ihr, sie am Leben zu lassen.
Die Menschenfresserin aber dachte bei sich: Wenn er auf der Jagd sein wird, so will ich sie ganz allein verspeisen und ihm sagen, dass sie davon gelaufen sind. Nun verlangte der Menschenfresser, sie ihm wenigstens zu zeigen; die armen Mädchen starben beinahe vor Furcht. Das Weib holte sie heraus und als der Menschenfresser sie sah, fragte er, was sie denn könnten.
Sie antworteten, sie konnten auskehren, nähen und spinnen, gute Suppen machen, dass man gewiss nichts auf dem Teller lasse, Kuchen und Pasteten backen, dass man tausend Stunden weit aus der Umgegend danach käme. Der Menschenfresser, welcher gern etwas Leckeres aß, sagte: „Gut, gut! ihr sollt gleich etwas zu tun bekommen. Aber“, sagte er zu Finette, „wenn du Feuer im Ofen angemacht hast, wie kannst du denn wissen, ob er heiß genug ist?" „Gnädiger Herr“, antwortete sie, „ich werfe Butter hinein und versuche sie dann mit der Zunge." „Nun wohl“, sagte er, „so zünde denn Feuer im Ofen an."
Der Ofen war so groß wie eine Scheune, denn der Menschenfresser und seine Frau aßen mehr Brot als eine ganze Armee. Die Prinzessin machte jetzt ein gewaltiges Feuer an, dass der Ofen wie ein Schmelzofen flammte, und der Menschenfresser, während er auf das frische Brot wartete, fraß hundert Schafe und hundert kleine Spanferkel. Liebesblümchen und Nachtschönchen machten in dessen den Teig zurecht.
„Nun“, sagte der Menschenfresser, wie steht es? ist der Ofen heiß?" „Gnädiger Herr“, antwortete Finette, „ihr kömmt euch selbst davon überzeugen." Sie warf vor seinen Augen tausend Pfund Butter tief in den Ofen hinein und dann sagte sie: „Nun muss man die Butter mit der Zunge kosten; allein ich bin zu klein dazu." „Ich bin groß genug“, versetzte der Menschenfresser, bückte sich und stürzte so tief hinein, dass er nicht wieder heraus konnte, sondern mit Haut und Knochen verbrannte.
Als seine Frau an den Ofen kam, erstaunte sie nicht wenig, anstatt ihres Mannes einen Berg Asche zu finden. Liebesblümchen und Nachtschönchen trösteten sie in ihrer großen Betrübnis aufs Beste; sie standen aber nicht wenig Angst dabei aus, denn sie fürchteten, der Schmerz könne vielleicht ihren Appetit aufs Neue reizen und sie Salat aus ihnen machen, wie sie bereits im Sinne gehabt hatte. Sie redeten ihr also gut zu und sagten: „Beruhigt euch, denn es wird sich unfehlbar jetzt ein König oder ein Graf finden, der sich glücklich schätzen wird, euch zu heiraten."
Sie lächelte ein wenig und ließ dabei ihre langen, hässlichen Zähne blicken. Als die Mädchen sie so guter Laune sahen, sagte Finette zu ihr: „Wenn ihr nur diese abscheuliche Bärenhaut ablegen wolltet und euch ein wenig nach der Mode kleiden, wir wollten euch so allerliebst um den Kopf machen; ihr würdet schön wie ein Engel aussehen!" „Lass sehen, was du kannst“, versetzte die Frau, „ich verspreche dir aber, wenn dann noch eine andere schöner aussieht als ich, so hacke ich dich kurz und klein, wie Pastetenfleisch."
Hierauf nahmen die Prinzessinnen ihr die Mütze ab und schickten sich an, sie zu kämmen und zu frisieren, und während sie in einem fort mit ihr schwatzten, ergriff Finette ein Beil und gab ihr von hinten zu einen so heftigen Schlag, dass der Kopf vom Rumpfe flog. Eine solche Freude ist nie gewesen!
Sie stiegen auf das Dach des Hauses und belustigten sich an dem Klingeln der Goldglöckchen. Dann sprangen sie durch alle Zimmer — da gab es Perlen und Diamanten und so kostbare Möbel, dass sie vor Vergnügen ganz außer sich waren. Sie lachten und sangen in einem zu. Da fehlte nichts, Zuckerwerk, Früchte, allerliebste Tändeleien, kurzum, alles war im Überfluss da.
Liebesblümchen und Nachtschönchen legten sich in die Betten von Brokat und Samt schlafen und sagten zu einander: „Nun sind wir reicher als unser Vater, da er noch sein Königreich hatte. Nun fehlt nichts weiter, als dass wir uns gut verheiraten. Es wird aber Niemand hierher kommen, denn dieses Haus ist gewiss als eine Mördergrube verrufen und man weiß nicht, dass der Menschenfresser und seine Frau tot sind. Wir müssen also in die nächste Stadt gehen und uns dort in unsern schönen Kleidern zeigen, dann wird es auch nicht lange dauern, so werden sich angesehene und reiche Männer finden, die Lust haben, zwei Prinzessinnen zu heiraten."
Am anderen Morgen, als sie ausgeputzt waren, sagten sie zu Finette, sie gingen jetzt spazieren, sie solle zu Hause bleiben und die Küche und die Wäsche besorgen; wenn sie zurück kämen, müsse alles sauber und aufgeräumt sein und wenn sie irgend etwas nicht ordentlich mache, so solle sie für Schläge nicht sorgen.
Die arme Finette, das Herz von Kummer gepresst, blieb also allein zu Hause, kehrte, scheuerte, wusch, ohne sich auszuruhen, und weinte immer zu. „Wie unglücklich bin ich“, rief sie, dass ich meiner Patin nicht gefolgt habe; der Undank meiner Schwestern straft mich dafür auf alle Weise. Sie haben mir meine schönen Kleider gestohlen und putzen sich jetzt damit; ohne mich wäre der Menschenfresser und seine Frau noch frisch und gesund. Was hilft es mir, dass ich sie beide um das Leben gebracht habe! Wäre es nicht besser, sie hätten mich aufgefressen, als dass ich ein solches Leben fristen muss?"
Bei diesen Worten schluchzte sie so heftig, dass sie hätte ersticken mögen. Da kamen ihre Schwestern zurück mit einer Menge Orangen und Zuckerwerk und waren sehr vergnügt. „Ach!“, sagten sie, „was haben wir für einen schönen Ball besucht! Was für Leute waren alles da! Der Sohn des Königs war auch da und hat uns tausend Artigkeiten gesagt. Komm, zieh uns die Schuhe aus und bürste uns ab, denn dafür bist du da." Finette gehorchte und wenn sie etwa nur den Mund aufmachte, um sich darüber zu beklagen, so fielen sie über sie her und schlugen sie halb tot. Am folgenden Morgen gingen sie wieder fort und als sie zurück kamen, hatten sie Wunderdinge zu erzählen.
Eines Abends sass Finette beim Feuer auf einem Aschehaufen und vor langer Weile suchte sie in den Ritzen des Kamins. In dem sie nun so suchte, fand sie einen kleinen Schlüssel, der war so alt und schmutzig, dass sie die größte Mühe von der Welt hatte, ihn rein zu bekommen. Als er nun blank war, sah sie, dass er von Gold sei und schloss mit Recht, dass ein goldener Schlüssel gewiss auch etwas sehr Kostbares verschließen müsse. Sie lief also gleich durchs ganze Haus und versuchte den Schlüssel an allen Schlössern, bis sie endlich ein sehr kunstreich gearbeitetes Kästchen fand, zu welchem er passte. Sie machte es auf und fand darin die kostbarsten Kleider, Diamanten, Spitzen, Wäsche und Bänder.
Sie ließ nicht ein Wort von ihrem glücklichen Fund verlauten, aber mit Ungeduld wartete sie am anderen Tag, dass ihre Schwestern fort gingen. Sie waren ihr kaum aus den Augen, so kleidete sie sich an und war schöner als Sonne, Mond und Sterne. So geschmückt kam sie auf den nämlichen Ball, auf welchem ihre Schwestern tanzten, und obgleich sie keine Larve vor hatte, war sie doch so verändert, dass jene sie nicht erkannten.
Kaum erschien sie im Saal, so erhob sich ein Murmeln; die einen bewunderten, die anderen beneideten sie. Man forderte sie zum Tanz auf und sie übertraf auch im Tanz alle Übrigen so sehr an Anmut, wie überhaupt an Schönheit. Die Dame vom Hause kam zu ihr, machte ihr eine tiefe Verbeugung und bat sie um ihren Namen. Finette entgegnete höflich, sie heiße Aschenbrödel.
Man hatte nicht Augen genug, sie anzuschauen, nicht Worte genug, um ihre Schönheit und Anmut zu preisen. Liebesblümchen und Nachtschönchen, welche anfänglich überall, wo sie erschienen waren, großes Aufsehen erregt hatten, wollten vor Ärger umkommen, da sie sahen, welcher Empfang dieser neu Angekommenen zu Teil wurde. Finette benahm sich bei dem allen mit dem besten Anstand von der Welt; es schien ihrem ganzen Wesen nach, als sei sie nur zum Befehlen geboren. Liebesblümchen und Nachtschönchen, die sich ihre Schwester nur mit dem Ofenschmutz auf dem Gesicht dachten, waren so sehr von ihrer Schönheit überrascht, dass gar kein Gedanke, wer sie sei, in ihnen aufstieg, und sie Aschenbrödel, so gut wie die Übrigen, ihre Verehrung bezeigten.
Als der Ball fast zu Ende war, ging Aschenbrödel eiligst fort, kehrte nach Hause zurück, zog sich rasch aus und nahm wieder ihre Lumpen um. Als ihre Schwestern nach Hause kamen, sagten sie zu ihr: „Ach Finette, wir haben jetzt eine junge Prinzessin gesehen, die war über alle Maßen reizend, nicht so eine Meerkatze wie du.
Sie war weiß wie Schnee und rot wie eine Rose. Ihre Zähne glichen Perlen, ihre Lippen Korallen. Sie hatte ein Kleid, welches viele tausend, tausend Taler wert war, es war von lauter Gold und Diamanten. Ach, wie schön war sie, wie liebenswürdig!" Finette sagte ganz leise zwischen den Zähnen: „Das war ich, das war ich!" „Was brummst du da?“, fragten sie. Noch leiser wiederholte Finette: „Das war ich!“, und dieses Spiel dauerte eine ganze Weile.
Fast kein Tag verging, an welchem Finette nicht in einem anderen Kleid erschien, denn das Kästchen hatte die Gabe, dass je mehr man daraus nahm, desto mehr kam wieder hinein und so nach der Mode war alles, dass sich die Damen nur nach ihrem Muster kleideten.
Eines Tages hatte Finette mehr als sonst getanzt und sich ein wenig mit der Rückkehr verspätet. Da sie nun die verlorene Zeit wieder einholen und noch vor ihren Schwestern zu Hause sein wollte, ging sie sehr eilig und verlor dabei einen ihrer rot samtenen, ganz mit Perlen bestickten Pantoffel. Sie suchte zwar überall, um ihn wieder zu finden, aber es war so dunkel, dass alle ihre Mühe vergebens war.
Am anderen Morgen ging Prinz Herzlieb, der älteste Sohn des Königs, auf die Jagd und fand Finettens Pantoffel. Er hob ihn auf, betrachtete ihn, bewunderte die Kleinheit und Zierlichkeit des selben, drehte ihn hin und her und steckte ihn in seinen Busen. Von diesem Tage an verlor er alle Esslust, wurde mager und abgezehrt, gelb wie eine Quitte und ganz nieder geschlagen und schwermütig.
Der König und die Königin, die ihn zärtlich liebten, taten alles Mögliche, um ihn wieder herzustellen. Aber es war alles umsonst und er antwortete nicht einmal, was ihn die Königin fragte. Man ließ weit und breit die berühmtesten Ärzte herbei holen, man führte sie zu dem Prinzen und nachdem sie ihn drei Tage und drei Nächte unausgesetzt beobachtet hatten, so erklärten sie einstimmig, seine Krankheit komme von Liebe her und er müsse sterben, wenn man nicht Rat schaffe.
Die Königin, die ihren Sohn so unaussprechlich liebte, zerfloss in Tränen, dass sie nicht erfahren konnte, wen er liebe, um sie ihm zur Gemahlin zu geben. Sie führte die schönsten Damen in sein Zimmer, aber er würdigte sie nicht eines Blickes. Endlich sagte sie zu ihm: „Mein geliebter Sohn, du willst uns gewiss noch vor Kummer sterben sehen. Du liebst und verbirgst uns den Gegenstand deiner Liebe; nenne mir, wen du willst, und wir wollen sie dir geben, und wenn es nichts weiter als nur ein Schäfermädchen wäre."
Dies Versprechen der Königin machte dem Prinzen Mut. Er zog den Pantoffel unter seinem Kopfkissen hervor und zeigte ihn der Mutter. „Da ist“, sagte er zu ihr, „die Ursache meiner Leiden! Ich habe, als ich neulich auf die Jagd ging, diesen kleinen, niedlichen, reizenden Pantoffel gefunden, und ich werde nie eine andere heiraten, als die, an deren Fuß er passt." „Gut, gut, mein Sohn“, erwiderte die Königin, „betrübe dich nur nicht weiter, denn wir wollen sie sogleich aufsuchen lassen."
Sie eilte zum Könige und hinterbrachte ihm diese Nachricht. Er war nicht wenig überrascht und befahl auf der Stelle, man solle mit Pauken und Trompeten bekannt machen, alle Mädchen und Frauen sollten herbei kommen, den Pantoffel anzupassen, und die, an deren Fuß er passe, solle die Gemahlin des Prinzen werden. Da kamen Unzählige an den Hof und versuchten den Pantoffel, aber nicht Eine konnte ihn anziehen, und je mehr ihrer vergebens kamen, desto mehr betrübte sich der Prinz.
Liebesblümchen und Nachtschönchen putzten sich gleichfalls eines Tages aufs Beste heraus und als Finette fragte, wo sie denn hin gingen, antworteten sie, wir gehen in die Residenz, wo der König und die Königin wohnen, um den Pantoffel anzuprobieren, welchen der Sohn des Königs gefunden hat; wenn er einer von uns beiden passt, so heiratet sie der Prinz und sie wird eine Königin." „Soll ich nicht auch mit gehen?“, fragte Finette. „Wahrhaftig“, riefen sie spöttisch, du bist doch eine rechte dumme Gans. Geh, geh und begieße unsern Kohl, du taugst sonst zu nichts."
Finette war sogleich entschlossen, ihr schönstes Kleid anzuziehen und wie die anderen das Abenteuer zu bestehen, denn es ahnte ihr, dass es zu ihrem Glück ausschlagen würde. Sie zog sich also das Prächtigste an, ein Kleid von blauem Atlas, ganz mit Sternen und Diamanten besät, und sie strahlte so sehr, dass man sie gar nicht ansehen konnte, ohne mit den Augen zu blinzeln.
Als sie die Tür öffnete, um fort zu gehen, da stand zu ihrem großen Erstaunen das niedliche Pferd bereit, welches sie früher zu ihrer Patin getragen hatte. Sie liebkoste es, streichelte es und sagte zu ihm: „Willkommen, willkommen, mein allerliebstes Pferdchen. Tausend Dank meiner gute Patin Merlusche." Es fiel auf die Knie und sie schwang sich hinauf.
Es war ganz mit goldenen Schellen und Bändern bedeckt, Sattel und Zaum waren von unermesslichem Wert. Das kleine Pferdchen flog nur so dahin, während seine Glöckchen eine angenehme Musik machten. Als Liebesblümchen und Nachtschönchen es kommen hörten, drehten sie sich um und sahen ihm entgegen. Aber welche Überraschung! denn in diesem Augenblick erkannten sie ihre Schwester Finette. Sie waren sehr beschmutzt und ihre schönen Kleider mit Staub bedeckt. „Schwester“, sagte Liebesblümchen zu Nachtschönchen, „wahrhaftig, das ist Finette Aschenbrödel." Und gleich darauf schrie auch die andere: „Ja, ja, sie ist es."
Als Finette bei ihnen vorbeikam, bespritzte ihr Pferd die beiden über und über mit Kot, Finette aber rief ihnen lachend zu: „Meine hohen Damen, Aschenbrödel verachtet euch so sehr, wie ihr es verdient!" Darauf war sie wie der Wind vorüber.
Nachtschönchen und Liebesblümchen sahen sich gegenseitig an und riefen: „Träumen oder wachen wir? Wer kann Finette die Kleider und das Pferd gegeben haben? Was für ein Wunder! Nun fehlt nur, dass ihr das Glück wohl will und der Pantoffel ihr passt, dann haben wir unsere Reise vergebens gemacht."
Während sie so ganz in Verzweiflung geraten wollten, kam Finette im Palast an. Jeder der sie sah, hielt sie für eine Königin. Die Wachen präsentierten das Gewehr, man schlug die Trommel, man stieß in die Trompete, man öffnete alle Tore und die, welche sie auf dem Balle gesehen hatten, liefen ihr voran und riefen: „Platz, Platz, dies ist die schöne Aschenbrödel, das Wunder des ganzen Erdkreises."
So gelangte sie endlich in das Zimmer des tot kranken Prinzen. Kaum warf er einen Blick auf sie, so war er ganz bezaubert und sein Herz sagte ihm, dass der Pantoffel ihr passen müsse. Sie zog ihn mit Leichtigkeit an und wies nun auch den anderen gleichen, welchen sie mitgebracht hatte. Da schrie man einstimmig: „Es lebe die Prinzessin Herzlieb, es lebe die Prinzessin, die unsere Königin werden wird!" Der Prinz erhob sich von seinem Lager, küsste ihr die Hände und bewies ihr tausend Zärtlichkeiten.
Man benachrichtigte den König und die Königin, die so gleich herbei eilten; die Königin schloss Finette in ihre Arme, nannte sie ihre Tochter, ihr Herzpüppchen, ihre kleine Königin und machte ihr die kostbarsten Geschenke, welche der freigebige König noch überbot. Man feuerte die Kanonen ab, die Musikanten bliesen und geigten, man sprach von nichts als von Bällen und Lustbarkeiten.
Aschenbrödel erzählte nun in wenig Worten dem König, der Königin und dem Prinzen ihre Geschichte. Als sie hörten, dass sie eine geborene Prinzessin sei, war die Freude noch einmal so groß; als sie aber den Namen des Königs ihres Vaters und der Königin ihrer Mutter nannte, da entdeckte es sich, dass jene die früheren Beherrscher eben dieses Königreichs gewesen waren. Finette beteuerte, sie würde sich nicht eher vermählen, als bis ihr Vater wieder im Besitz seines Königreichs sei, was ihr der König ohne Weiteres bewilligte, denn er besaß mehr als hundert Königreiche und es kam ihm auf eins mehr oder weniger nicht an.
Inzwischen waren Nachtschönchen und Liebesblümchen eingetroffen. Das Erste, was sie hörten, war, dass Aschenbrödel den Pantoffel angezogen habe. Nun wussten sie nicht, was sie tun sollten; sie wollten wieder umkehren, ohne ihrer Schwester vor die Augen zu kommen; Finette aber erfuhr kaum ihre Anwesenheit, so ließ sie sie herein treten und anstatt sie mit einem finstern Gesicht zu empfangen und nach Verdienst zu bestrafen, ging sie ihnen entgegen und umarmte sie auf das Zärtlichste.
Sodann stellte sie sie der Königin vor und sagte: „Gnädige Frau, das sind meine lieben Schwestern; ich bitte, ihnen gleichfalls euer Wohlwollen zu schenken." Sie waren so bewegt von der Großmut ihrer Schwester, dass sie kein Wort hervor bringen konnten. Sie versprach ihnen, sie sollten in ihr Königreich wieder zurück kehren, denn der Prinz habe es ihrer Familie geschenkt, worauf sie ihr zu Füßen fielen und vor Freude weinten.
Mit aller nur ersinnlichen Pracht wurde die Hochzeit gefeiert. Finette schrieb an ihre Patin und packte den Brief mit samt einer Menge der schönsten Geschenke auf das niedliche Pferdchen. Sie bat die Fee, ihre Eltern aufzusuchen, sie von ihrem Glücke zu benachrichtigen, und dass sie nun in ihr Königreich zurück kehren dürften.
Die Fee Merlusche entledigte sich ihres Auftrags auf das Pünktlichste. Finettens Vater und Mutter kehrten in ihre Staaten zurück und ihre Schwestern heirateten gleichfalls zwei Prinzen.

DIE HINDIN IM WALDE ...
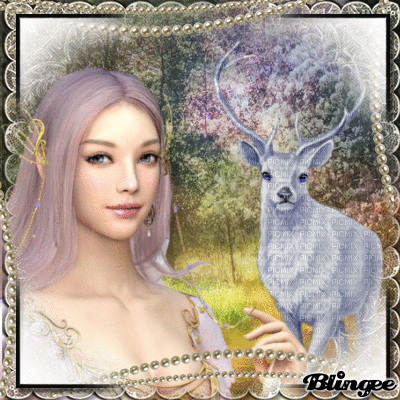
Es war einmal ein König und eine Königin, die lebten sehr glücklich mit einander. Sie liebten sich zärtlich und ihre Untertanen beteten sie an. Nur eins fehlte zu ihrer vollkommenen Zufriedenheit, sie hatten keine Kinder. Die Königin glaubte, ihr Gemahl werde sie dann noch viel mehr lieben und reiste alle Frühjahr nach einem großen Walde, in welchem mehrere heilsame Quellen sprudelten. Aus allen Gegenden der Welt kamen Leute hier her, um von dem Wasser dieser Quelle zu trinken.
Eines Tages als die Königin am Rande der einen saß, befahl sie allen ihren Frauen, sich zu entfernen und sie allein zu lassen. Darauf brach sie in ihre gewöhnlichen Klagen aus: „Wie unglücklich bin ich doch“, rief sie, „nicht ein Kind zu haben! Die ärmsten Frauen haben welche; seit fünf Jahren schon bitte ich täglich den Himmel darum und immer vergebens! Ja, ich werde dieses Glück nie erleben!"
Bei diesen Worten bemerkte sie in dem Wasser des Quells eine Bewegung; ein großer Krebs kam gleich darauf zum Vorschein und sprach zu ihr: „Erhabene Königin, euer Wunsch soll erfüllt werden. Hier in der Nähe befindet sich ein kostbarer Palast, von Feenhänden erbaut; doch kein Mensch kann ihn finden, denn er ist von so dichten Wolken eingeschlossen, dass das Auge eines Sterblichen nicht hindurch dringen kann. Wollt ihr euch in des der Leitung einer armen Krebsin anvertrauen, die eure untertänigste Dienerin ist, so erbiete ich mich, euch dahin zu führen."
Die Königin hörte ihr ohne Unterbrechung zu; einen Krebs reden zu hören, war ihr etwas ganz Neues und setzte sie nicht wenig in Erstaunen. Sie nahm das Anerbieten mit vielen Freuden an, entschuldigte sich jedoch, sie könne nicht rückwärts gehen. Die Krebsin lächelte und verwandelte sich auf der Stelle in eine alte Frau. „Nun“, sprach sie, „wollen wir nicht rückwärts gehen, ich bin ganz damit einverstanden. Betrachtet mich überhaupt als eine eurer Freundinnen, denn ich wünsche nichts weiter, als euch hilfreich zu sein."
Sie stieg trockenen Fußes aus dem Wasser; ihr Gewand war weiß, mit Karmoisin gefüttert, und ihr Haar mit grünen Bändern durch flochten. Man konnte nicht leicht eine anmutigere alte Frau sehen. Sie begrüßte die Königin und umarmte sie. Dann schlugen sie ohne Verzug einen Waldweg ein, den die Königin, so viele tausend - und tausendmal sie hier gewesen war, doch nie betreten hatte. Wie hätte dies auch geschehen können; es war der Weg, den die Feen nahmen, wenn sie die Quelle besuchten. Er war für gewöhnlich mit Sträuchern und Dornen verschlossen; kaum aber nahte sich die Königin, so trieb das Strauchwerk augenblicklich Rosen, Jasmin- und Orangenbäume schlangen ihre Zweige in einander und bildeten so einen schattigen Gang, mit Blättern und Blumen überwölbt.
Veilchen sprossen aus der Erde und Vögel aller Art flatterten auf den Bäumen und sangen zum Entzücken. Die Königin hatte sich von ihrem Erstaunen noch nicht erholt, als ihre Augen durch einen Anblick nie gesehener Pracht geblendet wurden. Sie sah einen Palast, ganz aus Diamanten erbaut; die Mauern, das Dach, die Decken, der Fußboden, die Treppen, die Balkons bis auf die Terrassen, alles war aus Diamanten. Von Bewunderung hingerissen, stieß sie einen lauten Schrei aus und fragte ihre freundliche Begleiterin, ob dies Schein oder Wirklichkeit sei. „Es kann nichts Wirklicheres geben“, versetzte jene.
Als bald öffneten sich die Tore des Palastes und sechs Feen traten heraus, aber was für Feen! Die schönsten und prachtvollsten, die man je gesehen hat. Sie machten der Königin eine tiefe Verbeugung und reichten ihr jede eine Blume von Edelsteinen zu einem Strauß; sie empfing eine Rose, eine Tulpe, eine Anemone, eine Akelei, eine Nelke und eine Granatblüte.
„Wir konnten euch“, sagten die Feen, „kein größeres Zeichen unserer Hochachtung geben, als euch den Besuch dieses Palastes zu erlauben. Es freut uns zugleich, euch verkündigen zu können, dass ihr die Mutter einer schönen Prinzessin sein werdet. Vergesst nicht, uns gleich nach ihrer Geburt zu rufen; denn wir wollen sie mit allen möglichen guten Eigenschaften begaben. Ihr dürft nur den Strauß nehmen, welchen wir euch gegeben haben, und mit dem Gedanken an uns jede Blume bei ihrem Namen nennen, dann werden wir augenblicklich in eurem Zimmer sein."
Überwältigt von Freude, warf sich die Königin an ihren Hals, und die Umarmungen dauerten länger als eine gute halbe Stunde. Darauf ersuchten sie die Königin, in ihren Palast zu treten, dessen wundersame Schönheit sich unmöglich beschreiben lässt. Der Baumeister der Sonne hatte ihn erbaut und das im Kleinen geschaffen, was der Sonnenpalast im Großen ist. Die Königin, die einen solchen Glanz kaum ertragen konnte, musste mehr als einmal die Augen schließen.
Aus dem Palast gingen sie in den Garten. Schönere Früchte hat es nie gegeben! Die Aprikosen waren größer als ein Kopf, an dem vierten Teil einer Kirsche hatte man genug, und sie war von so lieblichem Geschmack, dass die Königin, als sie davon genossen, ihr ganzes Leben nichts anders hätte essen mögen. Auch einen Obstgarten gab es da von lauter künstlichen Bäumen, die so gut Leben hatten und wuchsen wie die anderen.
Das Entzücken der Königin lässt sich gar nicht beschreiben; wie freute sie sich auf die kleine Prinzessin, wie dankte sie den liebenswürdigen Feen, die ihr eine so angenehme Nachricht verkündeten. Es gab kein Zeichen der Erkenntlichkeit, womit sie ihnen nicht ihren Dank ausgedrückt hätte; ganz besonders der Fee der Quelle. Die, Königin verweilte bis gegen Abend in dem Palast. Da sie die Musik liebte, so ertönte ihr zu Ehren ein Gesang wie von himmlischen Stimmen; man überhäufte sie mit Geschenken und nachdem sie allen diesen hohen Damen gedankt hatte, kehrte sie mit der Fee der Quelle zurück.
Zu Hause waren alle in großer Sorge um sie gewesen, man hatte sie überall gesucht und konnten sich nicht vorstellen, wo sie sein könne; man fürchtete sogar, irgend ein verwegener Fremdling habe sie um ihrer Schönheit und Jugend willen entführt. So bezeigte nun jeder bei ihrer Rückkehr eine außerordentliche Freude, und da sie ihrer seits auch über die freundlichen Aussichten, welche man ihr gegeben hatte, sehr vergnügt war, so unterhielt sie sich so aufgeweckt und fröhlich, dass alle Welt entzückt war.
Die Fee der Quelle hatte in der Nähe des königlichen Palastes Abschied genommen, wobei sich die Danksagungen und Freundschaftsbezeugungen verdoppelten; und da die Königin sich noch acht Tage bei der Quelle aufhielt, so unterließ sie nicht mit ihrer liebenswürdigen Führerin, die zuerst immer als Krebs erschien und dann ihre natürliche Gestalt annahm, in den Palast der Feen zurück zu kehren.
Die Königin reiste ab und nach einiger Zeit gebar sie eine Prinzessin, welche sie Sehnsuchtblüte nannte. Alsbald nahm sie den Strauß, den sie empfangen hatte, nannte alle Blumen nach der Reihe und auf der Stelle sah man die Feen erscheinen. Jede kam auf einem Wagen von verschiedenem Aussehen; der eine war von Ebenholz, gezogen von weißen Tauben, andere von Elfenbein, mit kleinen Raben bespannt, noch andere von Zedernholz. Das waren ihre Friedensequipagen, denn wenn sie böse waren, so kamen sie nur mit fliegenden Drachen einher, die aus Maul und Nase Feuer sprühten, Schlangen, Löwen, Leoparden, Tigern, auf denen sie von einem Ende der Welt bis zum anderen in kürzerer Zeit, als man Guten Tag oder Guten Abend sagt, dahin fuhren. Doch diesmal befanden sie sich in ihrer allerbesten Laune.
Mit einem heitern und würdevollen Aussehen traten sie in das Gemach der Königin, begleitet von ihren Zwergen und Zwerginnen, die mit Geschenken ganz beladen waren. Nachdem sie die Königin umarmt hatten, und die kleine Prinzessin geküsst, breiteten sie das Wickelzeug aus, welches von so feiner und so vortrefflicher Leinwand war, dass es hundert Jahr in Gebrauch sein konnte, ohne abgenutzt zu werden; die Feen hatten es in ihren Mußestunden gesponnen. Was die Spitzen anbetrifft, so waren sie noch bewundernswürdiger als die Leinwand, denn die ganze Weltgeschichte war hinein gestickt oder gewebt.
So dann zeigten sie die Windeln und die Deckbetten, die auch mit außerordentlichem Fleiß gestickt waren, und tausenderlei anmutige Kinderspiele dar stellten. Seit es Sticker und Stickerinnen gibt, ist etwas so Wunderbares nicht gesehen worden. Aber als nun die Wiege zum Vorschein kam, schrie die Königin laut auf, denn diese übertraf noch alles frühere. Sie war aus einer seltenen Holzart gefertigt, von der das Pfund hunderttausend Taler kostete. Vier kleine Liebesgötter hielten sie; alle vier waren Meisterwerke, an denen die Kunst den Wert des Stoffes noch übertraf, obgleich eine unbeschreibliche Menge von Diamanten und Rubinen dazu verwendet waren. Diese kleinen Liebesgötter hatten durch die Macht der Feen Leben erhalten, so dass, wenn das Kind schrie, sie es wiegten und einschläferten; was für die Ammen ganz erstaunlich bequem war.
Die Feen nahmen selbst die kleine Prinzessin auf ihre Knie, wickelten sie ein und küssten sie mehr als hundertmal, denn sie war so schön, dass man sie nicht ansehen konnte, ohne sie zu lieben. Als sie bemerkten, dass das Kind trinken wollte, schlugen sie mit ihren Zauberstäben auf die Erde, und sogleich erschien eine Amme, wie sie sich für dieses reizende Kind eignete.
Nun hatten sie nur noch das Kind zu begaben und die Feen beeiferten sich es zu tun. Die eine begabte sie mit Tugend, die andere mit Geist, die dritte mit außerordentlicher Schönheit, die vierte mit Reichtümern, die fünfte wünschte ihr eine lange Gesundheit und die letzte, dass ihr jede Arbeit, die sie unternähme, gelingen solle. Die Königin war ganz entzückt und bedankte sich tausend und aber tausendmal für die Geschenke, welche sie der kleinen Prinzessin gemacht hatten, als man plötzlich einen Krebs erscheinen sah, der so dick war, dass er nur mit Mühe zur Tür herein konnte.
„Ha, undankbare Königin“, sagte der Krebs, „ihr habt mich also nicht für Wert gehalten, euch meiner zu erinnern? Ist es möglich, dass ihr die Fee der Quelle so rasch vergessen habt, so wie die guten Dienste, die ich euch erwies, da ich euch zu meinen Schwestern führte? Wie? Alle habt ihr gerufen und mich allein vernachlässigt? Gewiss hatte ich ein Vorgefühl davon, welches mich nötigte die Gestalt eines Krebses anzunehmen, als ich euch das erste Mal sprach, und welches mir dadurch sagen wollte, dass eure Freundschaft anstatt vorwärts, rückwärts gehen würde."
Die Königin, untröstlich über den von ihr begangenen Fehler, unterbrach sie und bat um Verzeihung. Sie sagte ihr, wie sie geglaubt habe ihre Blume gleich denen der übrigen zu nennen, der Strauß von Edelsteinen habe sie irre gemacht, sie sei gewiss nicht fähig, die großen Verbindlichkeiten, welche die Fee ihr erwiesen habe, zu vergessen; sie bat sie inständigst, ihr ihre Freundschaft nicht zu entziehen und besonders der Prinzessin geneigt zu sein.
Sämtliche Feen, welche befürchteten, sie werde sie nur mit Elend und Missgeschick begaben, vereinigten sich mit der Königin, sie zu besänftigen. „Meine teure Schwester“, sagten sie zu ihr, „eure Hoheit erzürne sich nicht gegen eine Königin, die nie die Absicht gehabt, euch ein Missfallen zu erregen: habt doch die Gnade und verlasst diese Krebsfigur, zeigt euch in allen euren Reizen."
Die Fee der Quelle, die etwas eitel war, wurde durch die Schmeicheleien ihrer Schwestern ein wenig besänftigt. „Nun wohl“, sagte sie, „ich will, der Prinzessin Sehnsuchtblüte nicht alles das Böse zufügen, was ich mir vorgenommen hatte, denn ich hatte in der Tat Luft, sie zu verderben, und niemand hätte mich daran hindern können; aber ich sage euch, wenn sie vor ihrem fünfzehnten Jahr das Tageslicht erblickt, so wird sie Grund haben, es zu bereuen, ja es wird sie vielleicht das Leben kosten."
Die Tränen der Königin und die Bitten der Feen vermochten sie nicht von dem, was sie einmal gesagt hatte, etwas zurück zu nehmen. Sie entfernte sich auf ihren Krebsscheren, denn sie hatte ihr Krebskleid nicht ablegen wollen. Als sie sich aus dem Zimmer entfernt hatte, bat die betrübte Königin die Feen um ein Mittel, ihre Tochter vor dem Unglück, mit welchem sie bedroht war, zu bewahren.
Sie beratschlagten sogleich untereinander und endlich, nachdem sie mehrere verschiedene Vorschläge in Erwägung gezogen hatten, entschlossen sie sich, einen Palast ohne Türen und Fenster zu bauen, in den nur ein unterirdischer Eingang führe, und die Prinzessin an diesem Ort bis zu dem verhängnisvollen drohenden Jahr aufzuziehen.
Drei Schläge mit der Zauberrute brachten ein solches Gebäude vollkommen zu Stande. Es war von weißem und grünem Marmor, die Decken und Wände von Diamanten und Smaragden, die Blumen, Vögel und tausend anmutige Gegenstände bildeten. Die Fußdecken waren von buntem Samt, mit eigenhändigen Stickereien der Feen, welche, um der jungen Prinzessin das Wichtigste aus der Vergangenheit leichter einzuprägen, das selbe kunstreich darin dar gestellt hatten.
Im ganzen Palast schien kein anderes Licht, als das der Wachskerzen; aber sie brannten jederzeit in solcher Menge, dass es hell wie der Tag war. Alle die Lehrmeister, deren die Prinzessin zu ihrer vollkommenen Ausbildung bedurfte, wurden hierher geholt. Der lebendige Geist, die leichte Auffassungsgabe der Prinzessin trafen fast immer schon in voraus, was man ihr begreiflich machen wollte, und setzten jeden in Verwunderung, denn in einem Alter, wo andere kaum ihre Amme nennen können, sprach sie die erstaunlichsten Dinge. Aber freilich, wer von den Feen begabt ist, kann nicht unwissend und dumm bleiben.
Wenn ihr Geist alle, die in ihre Nähe kamen, entzückte, so brachte ihre Schönheit nicht minder mächtige Wirkungen hervor; sie riss die Unempfindlichsten hin und die Königin, ihre Mutter, hätte sich gar nicht von ihr getrennt, wenn ihre Pflicht sie nicht an den König, ihren Gemahl, gefesselt hätte. Die guten Feen kamen von Zeit zu Zeit die Prinzessin zu besuchen, und brachten ihr immer ganz unvergleichlich schöne Dinge mit, die prächtigsten und geschmackvollsten Kleider und vieles, vieles Andere. Aber unter allen Feen war Tulipane die, welche sie am zärtlichsten liebte, und der Königin, ihrer Mutter, auf das dringendste anempfahl, sie ja nicht das Tageslicht sehen zu lassen, bevor sie fünfzehn Jahr alt war.
„Unsre Schwester von der Quelle“, sagte sie, „ist rachsüchtig, und eben so sehr, wie wir an diesem Kinde Anteil nehmen, wird sie ihrer seits ihm nach Möglichkeit zu schaden suchen; darum könnt ihr gar nicht wachsam genug sein." Die Königin versprach ihr ohne Unterlass die äußerste Wachsamkeit zu beobachten; aber als ihre geliebte Tochter sich der Zeit näherte, wo sie das Schloss verlassen sollte, ließ sie sie malen und schickte ihr Bildnis an die vornehmsten Höfe von der ganzen Welt.
Keiner der Prinzen, die es sahen, konnte sich der Bewunderung erwehren, aber einer von ihnen wurde sogar so davon ergriffen, dass er sich nicht mehr davon trennen konnte; er stellte es in sein Kabinett, schloss sich mit ihm ein, sprach mit ihm, als ob es Leben hätte und ihn verstehen könnte und sagte ihm die zärtlichsten Dinge von der Welt. Der König, der seinen Sohn fast gar nicht mehr zu Gesicht bekam, fragte, was er treibe, und weshalb er nicht mehr so aufgeräumt sei wie sonst. Einige geschwätzige Höflinge antworteten ihm, es stehe zu befürchten, dass der Prinz den Verstand verliere, denn er verschließe sich ganze Tage in sein Kabinett und man höre ihn sprechen, als ob er sich mit jemanden unterhielte.
Diese Nachricht setzte den König in Unruhe. „Wäre es möglich“, sagte er zu seinen Vertrauten, „dass mein Sohn den Verstand verliert? Und er hat doch jederzeit so viel an den Tag gelegt; ihr wisst, wie sehr man ihn immer bewundert hat und ich finde noch gar nichts Irres in seinen Augen, er scheint mir mehr melancholisch; ich muss mit ihm reden, vielleicht entdecke ich, von welcher Art Torheit er angesteckt ist." Er ließ ihn sogleich holen und nachdem sich alle anderen entfernt hatten, fragte er ihn nach einigen gleichgültigen Dingen, worauf der Prinz ziemlich zerstreute Antworten gab, und zuletzt fragte er ihn, was er denn habe, dass seine Laune und sein Aussehen so verwandelt seien?
Der Prinz, welcher diesen Augenblick für günstig hielt, warf sich zu seinen Füßen und antwortete: „Ihr habt beschlossen, mir die Prinzessin Schwarzmaul zur Gemahlin zu geben, ihr werdet bei dieser Verbindung Vorteile finden, die ich euch bei der mit der Prinzessin Sehnsuchtblüte nicht versprechen kann; aber die Reize, welche ich bei dieser finde, finde ich bei der anderen nicht."
„Und wo hast du sie denn gesehen?“, fragte der König. „Man hat mir die Bildnisse Beider gebracht“, antwortete Prinz Tapfer, denn so nannte man ihn, seit er drei große Schlachten gewonnen hatte, „und ich bekenne euch, dass ich für die Prinzessin Sehnsuchtblüte eine so heftige Neigung gefasst habe, dass, wenn ihr euer der Prinzessin Schwarzmaul gegebenes Wort nicht zurücknehmt, ich sterben muss; glücklich, mein Leben zu beendigen, wenn ich ohne Hoffnung bin, der anzugehören, die ich liebe."
„Das ist also ihr Bildnis“, fragte der König ernst, „mit welchem es dir beliebt, Gespräche zu führen, die dich bei allen Höflingen lächerlich machen? Sie halten dich für verrückt, und wenn du wüsstest, was mir darüber zu Ohren gekommen ist, so würdest du dich schämen, eine solche Schwäche an den Tag zu legen." „Ich kann mir über eine so schöne Neigung keine Vorwürfe machen“, versetzte der Prinz. „Wenn ihr das Bildnis dieser reizenden Prinzessin gesehen hättet, so würdet ihr meine Gefühle für sie billigen."
„Nun, so geh und bring es her“, sprach der König mit einer Heftigkeit, die seinen Unwillen deutlich zu erkennen gab. Der Prinz würde in Sorge deshalb gewesen sein, wenn er nicht überzeugt gewesen wäre, dass nichts auf der Welt der Schönheit der Prinzessin Sehnsuchtblüte gleichkommen könne. Er eilte in sein Kabinett und brachte es dem König, der fast eben so entzückt davon war wie sein Sohn.
„Ja, mein teurer Sohn“, rief er aus, „ich stimme mit deinen Wünschen überein; ich werde selbst wieder jung werden, wenn ich eine so liebenswürdige Prinzessin an meinem Hofe habe; ich will auf der Stelle Gesandte an den Hof der Prinzessin Schwarzmaul schicken und mein Versprechen zurück nehmen; ja auf die Gefahr hin, dass es zu einem grausamen Kriege kommen sollte." Der Prinz küsste ehrfurchtsvoll die Hand seines Vaters und umarmte mehr als einmal seine Knie. Er war so vergnügt, dass man ihn kaum wieder erkannte, er drängte den König, Gesandte abzuschicken, nicht allein zur Prinzessin Schwarzmaul, sondern auch zur Prinzessin Sehnsuchtblüte.
Er wünschte, dass man für letztere den vermögendsten und fähigsten Mann wähle, weil er mit allem Glanz auftreten, und durch seine Beredsamkeit für die Wünsche der Prinzessin geneigt machen sollte. Der König warf demnach seine Augen auf Florindo, einen vornehmen jungen Herrn, der eine ausnehmende Beredsamkeit besaß und viele Millionen Taler jährlicher Einkünfte. Er hing an dem Prinzen mit außerordentlicher Liebe und ihm zu Gefallen traf er Zurüstungen zu dem prachtvollsten Aufzuge von der Welt.
Er betrieb sie mit der größten Schnelligkeit, denn die Liebe des Prinzen nahm täglich zu und ohne Unterlass beschwor ihn derselbe abzureisen. „Denkt, dass es sich um mein Leben handelt“, sagte der Prinz zu ihm, „dass ich den Verstand verliere, wenn ich daran denke, der Vater dieser Prinzessin könnte eine andere Verbindung eingehen und diese nicht wieder zu meinen Gunsten auflösen wollen, so dass ich die Prinzessin für immer verlieren könnte."
Florindo ermutigte ihn, um so viel als möglich Zeit zu gewinnen, denn er wünschte, dass sein Aufwand ihm Ehre mache. Er hatte vierundzwanzig Karossen ganz von Gold und Diamanten blitzend und mit der feinsten Miniaturmalerei geschmückt; außerdem fünfzig andere Wagen, vierundzwanzig tausend Pagen zu Pferde, prächtig gekleidet und der Rest dieses großen Gefolges stach in nichts davon ab.
Als der Gesandte sich von dem Prinzen beurlaubte, umarmte ihn der selbe zärtlich und sagte zu ihm: „Mein teurer Florindo, erinnert euch, dass mein Leben von der Heirat abhängt, die ihr zu vermitteln geht, bietet alles auf, um die liebenswürdige Prinzessin, die ich anbete, zu gewinnen und hier her zuführen." Er gab ihm zugleich tausend Geschenke mit, die eben so wertvoll waren, als in allen ihren Beziehungen artig und schmeichelhaft.
Der Gesandte trug das Portrait des jungen Prinzen, welches von einem Maler so kunstreich gefertigt worden war, dass es sprach und kleine Artigkeiten voll Geist sagte. Allerdings antwortete es nicht auf alles, was man zu ihm sagte, aber es mangelte ihm doch nur selten an einer Antwort. Florindo versprach dem Prinzen, nichts zu versäumen, seinen Wunsch zu befriedigen, und fügte hinzu, er nehme so viel Geld mit sich, dass, wenn man ihm die Prinzessin verweigere, er Gelegenheit finden würde, eine ihrer Kammerfrauen zu bestechen und sie zu entführen. „Nein“, schrie der Prinz, „ich kann mich nicht dazu verstehen, sie würde durch euer so wenig ehrerbietiges Verfahren beleidigt werden." Florindo antwortete hierauf nichts und reiste ab.
Das Gerücht seiner Reise ging seiner Ankunft voran. Der König und die Königin waren entzückt darüber. Sie schätzten den König, seinen Herrn, und kannten die Heldentaten des Prinzen Tapfer, aber noch mehr seinen vortrefflichen Charakter; so dass, wenn sie auf dem ganzen Erdkreis einen Gemahl für ihre Tochter hätten suchen sollen, sie keinen würdigeren hätten finden können. Man richtete einen Palast zur Wohnung des Gesandten ein, und traf alle Anstalten, den Hof in der äußersten Pracht erscheinen zu lassen.
Der König und die Königin hatten beschlossen, den Gesandten zu ihrer Tochter zu führen; aber die Fee Tulipane kam zur Königin und sagte: „Hütet euch ja, den Florindo zu unserm Kinde zu bringen, denn so nannte sie die Prinzessin; er darf sie nicht eher sehen und ihr dürft sie nicht eher zu dem Könige reisen lassen, der um ihre Hand anhält, als bis sie ihr fünfzehntes Jahr vollendet hat; denn ich bin überzeugt, wenn sie früher abreist, so begegnet ihr irgend ein Unglück." Die Königin umarmte die gute Tulipane, versprach ihrem Rat zu folgen und sie gingen auf der Stelle zur Prinzessin.
Der Gesandte langte an, sein Einzug dauerte dreiundzwanzig Stunden, denn er hatte sechs mal hundert tausend Maulesel; ihre Schellen und Hufeisen waren von Gold, ihre Decken aus Samt und Brokat mit Perlen gestickt; in den Straßen war ein Gedränge ohne Gleichen, alle Welt war herbei geströmt, um das Schauspiel mit anzusehen. Der König und die Königin gingen ihm entgegen, so erfreut waren sie über seine Ankunft.
Wir sagen nichts von der feierlichen Anrede, welche er hielt, und von den Höflichkeiten, die man sich gegenseitig erwies; als er jedoch die Prinzessin zu begrüßen verlangte, war er nicht wenig erstaunt, dass man ihm diese Bitte versagte. „Wenn wir euch, Herr Florindo“, antwortete der König, „eine anscheinend so billige Sache abschlagen, so geschieht dies nicht etwa aus einem besonderen Eigensinn — ich muss euch die merkwürdige Geschichte unserer Tochter erzählen, so werdet ihr uns beistimmen."
„Eine Fee fasste seit dem Augenblick ihrer Geburt einen Hass gegen sie und bedrohte sie mit einem sehr großen Unglück, wenn sie vor ihrem vollendetem fünfzehnten Jahr das Tageslicht sähe; wir halten sie daher in einem Palast, wo sich die schönsten Gemächer unter der Erde befinden. Als wir den Entschluss fassten, euch zu ihr zu führen, riet sie uns ab, dies zu tun."
„Wie, gnädiger Herr“, versetzte der Gesandte, „soll ich den Kummer haben, ohne sie zurück zu kehren? Ihr bewilligt sie dem König, meinem Herrn, für seinen Sohn, sie wird mit größter Ungeduld erwartet: ist es möglich, dass ihr euch durch solche Kleinigkeiten, wie die Prophezeiungen der Feen, abhalten lassen könnt? Hier ist das Portrait des Prinzen Tapfer, welches ich den Auftrag habe ihr zu überreichen; es ist so ähnlich, dass ich bei seinem Anblick ihn selbst zu sehen glaube."
Er wies es vor, und das Portrait, welches nur unterrichtet war, zur Prinzessin zu reden, sagte: Schöne Sehnsuchtblüte, ihr könnt euch nicht vorstellen, mit welcher Ungeduld ich euch erwarte; kommt bald an unsern Hof, und schmückt ihn mit eurer unvergleichlichen Anmut. Das Portrait sagte nichts weiter, und der König und die Königin waren so erstaunt, dass sie Florindo baten, es ihnen zu geben, um es zur Prinzessin zu tragen. Hocherfreut über diese Bitte, legte er das Bildnis in ihre Hände.
Die Königin hatte bis da hin mit ihrer Tochter über das Vorgefallene noch nicht gesprochen, ja sie hatte es sogar den Damen, welche um sie waren, verboten, ihr von der Ankunft des Gesandten das Mindeste zu sagen; Indes sie hatten ihr nicht gehorcht, und die Prinzessin wusste, dass es sich um ihre Vermählung handle; doch war sie klug genug, ihrer Mutter nichts davon merken zu lassen.
Als diese ihr das Portrait des Prinzen wies, und das selbe zu sprechen anfing und ihr ein eben so seines wie zärtliches Kompliment sagte, geriet sie in das größte Erstaunen, denn sie hatte nie etwas dem Ähnliches erlebt, und das liebenswürdige geistreiche Aussehen des Prinzen entzückte sie nicht weniger, als das, was ihr das Bildnis sagte.
„Würdest du böse sein“, fragte die Königin lachend, „einen Gemahl zu erhalten, der diesem Prinzen gleiche?" „Es hängt nicht von mir ab, eine Wahl zu treffen“, antwortete die Prinzessin; „doch ich werde immer mit der, welche ihr für mich trefft, zufrieden sein." „Nun aber“, fuhr die Königin fort, „wenn die Wahl auf diesen hier fiele, würdest du dich nicht glücklich schätzen?" Sie errötete, schlug die Augen nieder und antwortete nichts.
Die Königin schloss sie in ihre Arme und küsste sie mehrere Mal; sie konnte sich der Tränen nicht erwehren, wenn sie daran dachte, dass sie auf dem Punkt stehe, sie zu verlieren, denn es fehlten nur noch drei Monate, so wurde die Prinzessin fünfzehn Jahr alt. Sie verbarg jedoch ihren Schmerz, und erzählte ihr alles, was die Gesandtschaft Florindos anbetraf, ja sie gab ihr sogar die kostbaren Geschenke, welche der selbe für sie mitgebracht hatte.
Als der Abgesandte sah, dass seine Bitten, ihm die Prinzessin mit zu geben, vergebens waren und dass man sich begnüge, sie ihm zu versprechen, doch so feierlich, dass er keinen Grund hatte daran zu zweifeln, so kehrte er nach kurzer Zeit nach Hause zurück, um seinem Herrn von dem Erfolg seiner Unterhandlungen Bericht abzustatten.
Als der Prinz erfuhr, dass er seine geliebte Sehnsuchtblüte nicht unter drei Monaten erwarten dürfe, brach er in solche Klagen aus, dass der ganze Hof in Besorgnis geriet; er aß und schlief nicht mehr, wurde traurig und träumerisch, seine blühende Gesichtsfarbe erlosch, er blieb ganze Tage auf einem Sofa in seinem Kabinett liegen und betrachtete das Bildnis seiner Prinzessin: er schrieb ihr alle Augenblicke und überreichte die Briefe dem Portrait, als ob es im Stande gewesen wäre sie zu lesen; endlich wurde sein Körper immer schwächer; er verfiel in eine gefährliche Krankheit, und es fehlte nicht an Doktoren und Gelehrten, welche die Ursache davon errieten.
Der König war in Verzweiflung, er liebte seinen Sohn zärtlicher, als je ein Vater den seinigen geliebt hat. Er stand auf dem Punkt ihn zu verlieren; welcher Schmerz für einen Vater! Er sah kein Mittel, welches den Prinzen heilen könnte; denn dieser verlangte nach Sehnsuchtblüte, ohne welche er sterben müsse.
Der König entschloss sich also, in dieser großen Not, den König und die Königin, die Eltern der Prinzessin Sehnsuchtblüte, zu besuchen, und sie zu beschwören, mit dem Zustande, in welchen der Prinz gebracht sei, Mitleid zu haben, und eine Vermählung nicht zu verschieben, die niemals stattfinden würde, wenn sie durchaus darauf beständen, dass die Prinzessin ihr fünfzehntes Jahr vollendet habe.
Dieser Schritt war ungewöhnlich, aber es wäre noch sonderbarer gewesen, wenn er einen so liebenswürdigen teuren Sohn hätte sterben lassen. Indes es fand sich eine Schwierigkeit, die unüberwindlich war, das war sein hohes Alter, welches ihm nicht anders als in der Sänfte zu reisen erlaubte, und dieses Fuhrwerk passte schlecht zu der Ungeduld seines Sohnes. Er schickte deshalb den getreuen Florindo und schrieb die rührendsten Briefe von der Welt, um den König und die Königin für seine Wünsche zu gewinnen.
Inzwischen empfand Sehnsuchtblüte nicht weniger Vergnügen, das Bildnis des Prinzen zu betrachten, als er das ihrige. Sie ging alle Augenblicke an den Ort, wo es stand und wie sorgfältig sie auch ihr Gefühl zu verbergen suchte, so gelang ihr dies doch nicht gegen alle. Unter anderen bemerkten Viole und Langdorn, ihre Hoffräulein, die kleine Unruhe, von welcher sie gequält wurde, recht wohl.
Viole liebte ihre Prinzessin zärtlich und war ihr treu ergeben: Langdorn hingegen beneidete immer insgeheim den Rang und die Vorzüge derselben. Ihre Mutter hatte die Prinzessin erzogen, war ihre Hofmeisterin gewesen und war jetzt ihre Ehrendame: die selbe hätte sie also wie das Köstlichste von der Welt lieben sollen; da sie aber ihre eigne Tochter ganz närrisch liebte, und sah, dass diese die schöne Prinzessin hasste, so konnte sie ihr gleichfalls nicht wohlwollen.
Der Abgesandte, den man an den Hof der Prinzessin Schwarzmaul geschickt hatte, wurde eben nicht zum besten aufgenommen, als man den Auftrag erfuhr, mit welchem er beladen war. Diese äthiopische Prinzessin war das rachsüchtigste Geschöpf von der Welt; sie fand, es hieße sie sehr geringschätzig behandeln, nach dem man Verbindlichkeiten gegen sie eingegangen, ihr sagen zu lassen, dass man für sie danke. Sie hatte das Bildnis des Prinzen gesehen, welches ihr den Kopf ganz eingenommen hatte, und die Äthiopierinnen, wenn sie erst lieben, lieben weit leidenschaftlicher, als andere.
„Wie, mein Herr Gesandter“, sagte sie, „bin ich eurem Herrn nicht reich und schön genug? Durchreist meine Staaten, so werdet ihr finden, dass sie zu den größten der Welt gehören; kommt in meine Schatzkammer, so werdet ihr mehr Gold sehen, als alle Minen von Peru je geliefert haben: endlich, betrachtet die Schwärze meines Antlitzes, diese Plattnase, diese dicken Lippen — bin ich nicht schön?"
„Gnädigste Prinzessin“, antwortete der Gesandte, welchem nicht wohl zu Mute war, „ich tadle meinen Herrn so sehr, als es einem Untertan nur erlaubt ist, und wenn mich der Himmel auf den ersten Thron der Welt gesetzt hätte, so wüsste ich wahrhaftig wohl, wem ich den selben anböte." „Diese Worte retten euch das Leben“, entgegnete die Prinzessin; „ich hatte beschlossen, mit meiner Rache bei euch anzufangen, aber es wäre ungerecht gewesen, da ihr an dem schlechten Benehmen eures Prinzen nicht Schuld habt: geht und sagt ihm, dass es mir Vergnügen mache, mit ihm zu brechen, weil ich so schlechte Leute nicht liebe."
Der Gesandte, welcher nichts mehr wünschte, als seinen Abschied, hatte ihn kaum empfangen, als er auf der Stelle Gebrauch davon machte. Aber die Äthiopierin war gegen den Prinzen Tapfer zu erbittert, um ihm zu verzeihen; sie bestieg ihren Elfenbeinwagen, der von sechs Straußen gezogen wurde, welche zehn Meilen in der Stunde machten, und begab sich nach dem Palast der Fee der Quelle. Diese war ihre Patin und zugleich ihre beste Freundin; sie erzählte der selben ihr Begebnis und bat sie auf das inständigste, ihrer Rache bei zu stehen.
Die Fee wurde durch den Schmerz der Prinzessin bewegt: sie sah in ihr Zauberbuch und erkannte sogleich, dass Prinz Tapfer die Prinzessin Schwarzmaul nur um der Prinzessin Sehnsuchtblüte willen verlasse; dass er diese aufs heftigste liebe, und nur aus Ungeduld sie zu sehen, sogar krank geworden sei. Diese Entdeckung entflammte aufs Neue ihren Zorn, der beinah erloschen war, so dass, wenn die rachsüchtige Schwarze sie nicht darum beschworen hätte, sie wahrscheinlich nicht daran gedacht haben würde, der Prinzessin Sehnsuchtblüte, welche sie seit ihrer Geburt nicht gesehen hatte, etwas Böses zuzufügen.
„Wie“, schrie sie, „diese unglückliche Sehnsuchtblüte hört also noch nicht auf, mein Missfallen zu erregen? Nein, reizende Prinzessin, nein, mein Püppchen, ich werde es nicht dulden, dass man dir einen Schimpf an tue. Kehre nach Hause zurück und verlass dich auf deine treue Patin." Die schwarze Prinzessin dankte und überreichte ihr ein Geschenk von Blumen und Früchten, welches sie sehr freundlich aufnahm.
Der Gesandte Florindo legte in größter Eil den Weg nach der Hauptstadt zurück, wo der Vater von Sehnsuchtblüte seinen Hof hielt; er warf sich dem König und der Königin zu Füßen, und sagte ihnen mit weinenden Augen in den rührendsten Ausdrücken, dass Prinz Tapfer sterbe, wenn sie ihm noch länger das Vergnügen verweigerten, die Prinzessin, ihre Tochter, zu sehen; es fehlten nur noch drei Monate, so sei sie fünfzehn Jahr alt, und in einer so kurzen Zeit könne ihr nichts Böses begegnen; er nehme sich die Freiheit zu bemerken, dass die große Leichtgläubigkeit, welche man unbedeutenden Feen schenke, seine königliche Majestät beleidige — genug, er redete ihnen so zu, als er nur vermochte.
Man weinte mit ihm, indem man sich den traurigen Zustand vorstellte, in welchem sich der junge Prinz befand, und sagte dann zu ihm: es bedürfe einiger Tage, um sich zu entscheiden und ihm Antwort zu geben. Er entgegnete jedoch, er könne nur einige Stunden Zeit lassen, denn sein Herr befinde sich in der äußersten Gefahr, er würde sich einbilden, die Prinzessin sei ihm abgeneigt und sie sei es, welche die Reise auf schiebe. Man versprach ihm also, ihn schon auf den Abend wissen zu lassen, was man für ihn tun könne.
Die Königin eilte in den Palast ihrer geliebten Tochter und erzählte ihr alles, was sich zu getragen hatte. Sehnsuchtblüte empfand einen unbeschreiblichen Schmerz, bekam Herzbeklemmungen und fiel in Ohnmacht, und die Königin erkannte hieraus genug, welche Gefühle sie für den Prinzen hege. „Betrübe dich nicht“, mein geliebtes Kind, sagte sie zu ihr, „du vermagst alles zu seiner Heilung, ich bin nur unruhig wegen der Drohungen, welche die Fee der Quelle bei deiner Geburt ausgestoßen hat."
„Ich bin überzeugt“, versetzte Sehnsuchtblüte, „bei einigen Vorsichtsmaßregeln die boshafte Fee hintergehen zu können; könnte ich nicht zum Beispiel in einem ganz verschlossenen Wagen reisen, in dem ich kein Tageslicht sähe? Man brauchte ihn nur des Nachts zu öffnen, um uns Speisen zu reichen, so würde ich ganz ohne Gefahr zu dem Prinzen Tapfer kommen."
Der Königin gefiel dieses Auskunftsmittel sehr wohl, sie teilte es dem Könige mit, der es gleichfalls billigte, so dass man zu Florindo schickte und ihn schleunigst zu sich berief. Er empfing jetzt die gewisse Zusicherung, dass die Prinzessin früher abreisen würde; er könne also jetzt zu seinem Herrn zurück kehren und ihm diese gute Nachricht überbringen, und um sich noch mehr zu beeilen, so wolle man auf die Ausstattung und die prächtigen Kleider, welche ihrem Stande geziemten, weniger Rücksicht nehmen. Von Freude hingerissen, warf sich der Gesandte zu den Füßen ihrer Majestäten, um ihnen seinen Dank zu bezeigen, und reiste so dann ab, ohne die Prinzessin gesehen zu haben.
Die Trennung von dem König und der Königin würde Sehnsuchtblüte unerträglich erschienen sein, wenn sie weniger für den Prinzen eingenommen gewesen wäre; aber die Liebe ist ein Gefühl, welches fast alle anderen überwältigt. Man baute für die Prinzessin eine Karosse, die von außen mit grünem Samt beschlagen und mit großen Goldplatten verziert war und inwendig mit Silberbrokat, rosenfarbig bestickt; sie hatte nirgends Fenster, war sehr geräumig, schloss besser als eine Schachtel und einer der vornehmsten Herren des Königreichs hielt die Schlüssel in Gewahrsam, welche die Schlösser öffneten, die man an die Tore gelegt hatte.
Die Begleitung der Prinzessin bestand nur aus wenig Personen, damit ein zahlreiches Gefolge nicht aufhalte, und nachdem man ihr die kostbarsten Schmucksachen von der Welt, und einige sehr reiche Anzüge mit gegeben hatte; endlich, nachdem man Abschied genommen, wobei der König, die Königin und der ganze Hof fast in Tränen zerflossen, verschloss man die Prinzessin nebst ihren Ehrendamen, Viole und Langdorn, in die dunkle Karosse.
Man erinnert sich vielleicht, dass Langdorn die Prinzessin Sehnsuchtblüte eben nicht liebte, um so mehr liebte sie aber den Prinzen Tapfer, seit sie dessen sprechendes Portrait gesehen hatte. Die Neigung, welche sie ergriffen, war so lebhaft, dass, als sie im Begriff waren abzureisen, sie zu ihrer Mutter sagte, sie sterbe, wenn die Vermählung der Prinzessin zu Stande käme, und wenn sie ihr Leben wolle, so müsse sie durchaus ein Mittel ausfindig machen, diese Heirat zu hintertreiben. Die Ehrendame erwiderte ihr, sie möge sich nicht härmen, sie werde für ihren Kummer schon ein Gegenmittel finden, welches sie glücklich mache.
Als die Königin ihr geliebtes Kind fort schickte, empfahl sie es dieser nichts würdigen Frau auf das Allerdringendste. „Welchen Schatz vertraue ich euch an“, sagte sie zu ihr, „er gilt mehr als mein Leben! Nehmt die Gesundheit meiner Tochter recht in Acht, aber vor allem tragt die größte Sorge, dass sie das Tageslicht nicht erblickt; sonst ist alles verloren. Ihr wisst mit welchem Unglück sie bedroht ist und ich bin deshalb mit dem Gesandten des Prinzen Tapfer überein gekommen, dass man sie bis zu ihrem vollendeten fünfzehnten Jahr in einem Schloss wohnen lasse, wo sie kein Licht erblickt, als das der Wachskerzen."
Die Königin überhäufte die Ehrendame mit Geschenken, um ihrer Sorgfalt dadurch noch mehr versichert zu sein, und diese versprach ihr auch, die Prinzessin wie ihren Augapfel zu bewachen, und sobald sie angelangt wären, ihr sogleich Nachricht zu geben. So durften also der König und die Königin, im Vertrauen auf die getroffenen Maßregeln, um ihre geliebte Tochter außer Sorge sein, und dies half wenigstens den Schmerz mäßigen, den ihre Entfernung ihnen verursachte.
Als Langdorn, die jeden Abend von den Begleitern der Prinzessin, welche den Wagen öffneten, um ihr Speise zu reichen, hörte, dass man sich der Stadt nähere, in welcher sie erwartet wurden, drängte sie ihre Mutter, ihren Plan auszuführen, denn sie fürchtete, der König oder der Prinz könne ihnen entgegen kommen und es werde dann nicht mehr Zeit sein.
Um die Mittagszeit also, als die Sonne am hellsten schien, schnitt die Alte plötzlich mit einem großen Messer, welches sie mit genommen und ausdrücklich dazu hatte machen lassen, die Decke der Karosse, in welcher sie eingeschlossen waren, von einander. Prinzessin Sehnsuchtblüte sah nun zum ersten Mal das Tageslicht; aber kaum hatte sie es erblickt, so stieß sie einen tiefen Seufzer aus und stürzte sich in der Gestalt einer weißen Hindin aus dem Wagen, lief bis zum nächsten Walde und verbarg sich an einer dunkeln Stelle, um unbeobachtet sich ihrem Schmerz über diese Verwandlung hin zu geben.
Als die Fee der Quelle, welche diesen Streich leitete, sah, dass sämtliche Begleiter der Prinzessin, die einen ihr folgen, die anderen in die Stadt eilen wollten, den Prinzen Tapfer von diesem unglücklichen Ereignis zu benachrichtigen, so schien sie sogleich die Natur gänzlich in Aufruhr zu bringen; Blitz und Donner erschreckten die Mutigsten, und vermöge ihrer wunderbaren Kunst zerstreute sie alle diese Leute weit fort, um sie von dem Orte zu entfernen, wo ihre Anwesenheit ihr nicht gelegen war.
Nur die Ehrendame blieb, so wie Langdorn und Viole. Letztere lief ihrer Gebieterin nach, rief ihren Namen und erhob ein Wehklagen, dass Wald und Fels widerhallten. Langdorn zog nun die reichsten Kleider der Prinzessin Sehnsuchtblüte an. Der königliche Hochzeitsmantel war von einem Reichtum ohne Gleichen und die Krone hatte Diamanten, die zwei- oder dreimal so dick waren wie eine Faust, das Zepter war aus einem einzigen Rubin, der Reichsapfel, welchen sie in der anderen Hand hielt, aus einer Perle, größer als ein Kopf; er war sehr schwer zu tragen, aber die Leute sollten doch nun einmal Langdorn für die Prinzessin halten, und so durfte sie von all den königlichen Insignien nichts zurück lassen.
In diesem Aufzug ging Langdorn, gefolgt von ihrer Mutter, die ihr die Schleppe des Mantels trug, nach der Stadt. Ganz gravitätisch schritt diese falsche Prinzessin einher; sie zweifelte nicht, man werde ihr zum Empfang entgegen kommen, und in der Tat, sie waren noch nicht weit gegangen, so erblickten sie einen Haufen Reiter, in deren Mitte sich zwei Sänften befanden, die von Gold und Edelsteinen blitzten und von Mauleseln getragen wurden, die mit hohen grünen Federbüschen geschmückt waren, denn grün war die Lieblingsfarbe der Prinzessin.
Der König, welcher sich in der einen und der kranke Prinz, der sich in der anderen Sänfte befand, wussten nicht, für wen sie die beiden Damen halten sollten, die auf sie zukamen. Einige Reiter sprengten ihnen sogleich entgegen und schlossen aus dem prachtvollen Anzuge, dass es Personen von Stande sein müssten. Sie stiegen ab, und näherten sich ihnen ehrfurchtsvoll. „Habt doch die Güte und lasst uns wissen“, redete Langdorn sie an, „wer in diesen beiden Sänften ist."
„Meine Damen“, antworteten sie, „es ist der König und der Prinz, sein Sohn, die der Prinzessin Sehnsuchtblüte entgegen kommen." „Nun so geht, ich bitte euch“, fuhr sie fort, „und sagt ihnen, dass sie hier ist; eine Fee, welche auf mein Glück eifersüchtig ist, hat durch ein paar hundert Blitze, Donnerschläge und andere erstaunliche Wunder mein ganzes Gefolge zerstreut: aber hier ist meine Ehrendame, welche die Briefe des Königs, meines Vaters, und meinen Schmuck bei sich tragt."
Sogleich küssten die Herren den Saum ihres Kleides und beeilten sich dem Könige die Nachricht zu bringen, dass die Prinzessin in der Nähe sei. „Wie“, schrie er, „sie kommt zu Fuß, am hellen Tage?" — Der Prinz, vor Ungeduld brennend, rief sie zu sich und statt aller anderen Fragen, sagte er zu ihnen: „Nicht wahr, sie ist ein Wunder von Schönheit, eine Prinzessin von größter Vollkommenheit?" Ihr Schweigen überraschte den Prinzen. „Ihr würdet mit eurem Lob nicht fertig werden“, fuhr er fort, „und wollt also lieber schweigen?" „Gnädiger Herr, seht sie selbst“, entgegnete ihm der Kühnste von ihnen; „die Anstrengungen der Reise haben sie wahrscheinlich verändert."
Der Prinz war ganz bestürzt; wenn er weniger schwach gewesen wäre, so würde er aus seiner Sänfte gesprungen sein, um seine Ungeduld und seine Neugier zu befriedigen. Der König verließ die seinige und mit dem ganzen Hofstaat sich in Bewegung setzend, traf er auf die falsche Prinzessin. Aber kaum hatte er einen Blick auf sie geworfen, so stieß er einen lauten Schrei aus, ging einige Schritte rückwärts und sagte: „Was sehe ich, welcher Betrug?"
„Gnädiger Herr“, sagte die Ehrendame, kühn auf ihn zu schreitend, „dies ist die Prinzessin Sehnsuchtblüte mit den Briefen des Königs und der Königin, ich gebe sie mit dem Schmuckkästchen, welches mir bei der Abreise übergeben wurde, in eure Hände." Der König betrachtete bei dem allen ein tiefes Schweigen; jetzt näherte sich der Prinz, auf Florindo gestützt, seiner falschen Braut. O Himmel, wie wurde ihm, als er dieses Geschöpf betrachtete, deren Wuchs furcht erregend war.
Sie war so groß, dass die Kleider der Prinzessin ihr kaum die Knie bedeckten; ihre Magerkeit war entsetzlich, ihre Nase, gekrümmter als die eines Papageis, funkelte von einem glänzenden Rot, die Zähne standen ganz schief und schwärzere konnte es gar nicht geben; mit einem Wort, sie war grade so hässlich, als Prinzessin Sehnsuchtblüte schön war.
Der Prinz, ganz beschäftigt mit dem reizenden Bild seiner Prinzessin, war wie versteinert bei dem Anblick dieser hier; er war nicht im Stande nur ein Wort hervor zu bringen, er sah sie mit unbeschreiblichem Erstaunen an und sagte dann, sich zum Könige wendend: „Ich bin betrogen; dieses wundervolle Portrait, auf welches ich meine Freiheit hin gab, hat nichts von der Person, die man uns schickt; man hat uns zu täuschen gesucht und es ist ihnen gelungen; es wird mein Leben kosten."
„Wie meint ihr das, mein Herr“, sagte Langdorn, „man hat euch zu täuschen gesucht? das wird nie der Fall sein, wenn ihr mich heiratet." Ihre Unverschämtheit und ihre Kühnheit waren beispiellos. Aber die Ehrendame trieb es noch weiter: „Ha, meine schöne Prinzessin“, rief sie, „wo sind wir hin gekommen! Empfängt man so eine Dame eures Standes? Welche Unbeständigkeit, welches Benehmen! Der König, euer Vater, wird schon Rechenschaft dafür fordern —
„An uns ist es, sie zu fordern“, unterbrach sie der König, „er hatte uns eine schöne Prinzessin versprochen und schickt uns ein Skelett, eine Mumie, die Furcht einjagt. Ich wundere mich nicht, dass er diesen schönen Schatz fünfzehn Jahre lang verborgen gehalten hat, er wollte einen Betrug damit spielen und uns hat dies Los getroffen; aber es ist nicht unmöglich, dafür Rache zu nehmen."
„Welche Beleidigungen“, rief die falsche Prinzessin, „bin ich nicht sehr unglücklich, auf das Wort solcher Leute gekommen zu sein? Ist das ein so großes Vergehen, ein wenig schöner als man ist, gemalt worden zu sein? Begegnet das nicht alle Tage? Wenn in solchen Fällen die Prinzen ihre Verlobten immer zurück schicken wollten, so würden sich wenige verheiraten."
Der König und der Prinz von Zorn überwältigt, würdigten sie keiner Antwort, stiegen jeder in seine Sänfte und ohne weiteres setzte ein Reiter die Prinzessin hinter sich aufs Pferd und die Ehrendame wurde in gleicher Weise behandelt. So brachte man sie in die Stadt, wo sie auf Befehl des Königs in ein Schloss eingesperrt wurden.
Prinz Tapfer war von dem Schlage, der ihn getroffen hatte, so niedergedrückt, dass er seinen Kummer ganz in sich selbst verschloss. Als er Kraft genug hatte, in Klagen auszubrechen, was sagte er nicht alles über sein grausames Geschick! Er liebte noch immer, und der ganze Gegenstand seiner Neigung war nur ein Bildnis!
Seine Hoffnungen fanden keine Nahrung mehr, alle die reizenden Vorstellungen, die er sich von der Prinzessin Sehnsuchtblüte gemacht hatte, waren vernichtet; lieber wäre er gestorben, als dass er die, welche er dafür hielt, geheiratet hätte: genug, seine Verzweiflung war grenzenlos; er könnte es nicht mehr bei Hofe aushalten, und entschloss sich, sobald es seine Gesundheit erlauben würde, ihn heimlich zu verlassen und sich an irgend einen einsamen Ort zu begeben, um den Rest seines traurigen Lebens da selbst zuzubringen.
Er teilte seinen Entschluss niemanden mit, als dem getreuen Florindo, von dem er überzeugt war, dass er ihm überall hin folgen würde und mit welchem er auch öfter, als mit jedem anderen über den schlechten Streich sprach, den man ihm gespielt hatte. Kaum fing er an sich stärker zu fühlen, so reiste er ab und ließ auf dem Tisch seines Kabinetts einen langen Brief an den König zurück, in welchem er ihn versicherte, sobald sein Geist ein wenig ruhiger sei, werde er zu ihm zurück kehren; er bitte ihn zugleich, an ihre gemeinschaftliche Rache zu denken, und die hässliche Prinzessin fort dauernd gefangen zu halten.
Man kann sich eine Vorstellung von dem Schmerz machen, welchen der König empfand, als er diesen Brief empfing; er glaubte die Trennung von einem so geliebten Sohn nicht überstehen zu können. Während alle Welt damit beschäftigt war, ihn zu trösten, entfernten sich der Prinz und Florindo und nach Verlauf von drei Tagen befanden sie sich in einem weiten Wald, der durch die hohen dicht belaubten Bäume so schattig war, wie durch das frische Gras und die Bäche, die ihn nach allen Seiten durchflössen, anmutig. Der Prinz, durch den langen Weg ermüdet, denn er war noch immer krank, stieg vom Pferde und warf sich traurig aufs Gras, die Hand unter dem Kopf, ohne sprechen zu können, so schwach war er.
„Gnädiger Herr“, sagte Florindo, „während ihr euch ausruht, will ich einige Früchte suchen, um uns zu erfrischen und ein wenig die Gegend betrachten, in der wir sind." Der Prinz antwortete nicht, sondern gab ihm nur durch ein Zeichen die Erlaubnis zu gehen.
Wir haben die Hindin schon lange verlassen und wollen nun von dieser unvergleichlichen Prinzessin reden. Als sie ihre jetzige Gestalt in einer Quelle betrachtete, die ihr als Spiegel diente, weinte sie trostlos. „Wie, bin ich es?“, sagte sie; „musste ich heute das traurigste Geschick erleben, welches nur immer unter der Herrschaft der Feen einer so unschuldigen Prinzessin begegnen kann! Wie lange wird meine Verwandlung dauern? Wohin soll ich mich zurück ziehen, dass mich die Löwen, die Bären, die Wölfe nicht verschlingen? Wie kann ich Gras essen?" Sie tat noch tausend Fragen und der grausamste Schmerz, den man sich nur denken kann, zerriss ihr Herz. Nur ein geringer Trost konnte es sein, dass sie eine so schöne Hindin war, als sie eine schöne Prinzessin gewesen.
Der Hunger trieb Sehnsuchtblüte, Gras zu essen und es schmeckte ihr, worüber sie nicht wenig erstaunt war. Darauf legte sie sich aufs Moos nieder und brachte die Nacht in Angst und Schrecken zu. Sie hörte das Geheul der wilden Tiere in ihrer Nähe, und oft vergaß sie, dass sie eine Hindin war und wollte auf einen Baum klettern.
Der Anbruch des Tages gab ihr wieder etwas Mut; sie bewunderte seine Schönheit, und die Sonne schien ihr etwas so Herrliches, dass sie nicht müde wurde, sie anzublicken; alles, was sie davon hatte sagen hören, schien ihr weit unter dem, was sie sah; sie war der einzige Trost, den sie an einem so verlassenen Ort finden konnte. So blieb sie hier nun mehrere Tage ganz allein.
Die Fee Tulipane, welche die Prinzessin immer geliebt hatte, empfand lebhaftes Mitgefühl bei ihrem Unglück; aber sie war auch sehr erzürnt, dass die Königin so wie Sehnsuchtblüte ihre Ratschläge so wenig beachtet hatten, denn sie hatte ihnen öfter gesagt, wenn die Prinzessin, ehe sie fünfzehn Jahr alt wäre, das Schloss verließe, so würde es ihr schlimm ergehen. Dessen ungeachtet wollte sie die selbe dennoch nicht der Wut der Fee der Quelle überlassen und sie war es, welche die Schritte Violens in diesen Wald lenkte, damit diese treue Vertraute sie in ihrem Missgeschick trösten könne.
Die schöne Hindin weidete entlang eines Baches, als Viole, die fast nicht mehr gehen konnte, sich nieder setzte, um auszuruhen. Sie sann betrübt, nach welcher Seite sie wohl gehen solle, um ihre geliebte Prinzessin zu finden. Als die Hindin sie bemerkte, sprang sie plötzlich über den tiefen und breiten Graben auf Violen zu und erwies ihr tausend Liebkosungen. Diese war ganz überrascht, sie wusste nicht, was sie denken solle, ob die Tiere dieser Gegend vielleicht eine besondere Freundschaft zu Menschen hätten, oder ob sie sie kenne; doch immer blieb das Benehmen des Tieres sehr merkwürdig.
Als sie jedoch die Hindin aufmerksam betrachtete und zu ihrem unbeschreiblichen Erstaunen große Tränen aus ihren Augen rollen sah, zweifelte sie nicht mehr, dass es ihre teure Prinzessin sei. Sie nahm die Füße und küsste sie so ehrfurchtsvoll und zärtlich, als ob sie ihre Hände geküsst hätte. Sie sprach zu ihr, und erkannte, dass die Hindin sie verstehe, aber antworten konnte sie ihr nicht, und beider Tränen und Seufzer verdoppelten sich. Viole versprach ihrer Herrin sie nicht zu verlassen; die Hindin machte ihr tausend kleine Zeichen mit Kopf und Augen, die ihr sagten, welches Vergnügen sie darüber empfinde, und wie sehr ihr Kummer dadurch gelindert werde.
Sie blieben fast den ganzen Tag bei einander. Die Prinzessin, besorgt, dass ihre treue Viole Hunger leide, führte sie an eine Stelle, wo sie wilde Früchte in Menge bemerkt hatte. Viole nahm einige davon, aber nach dem sie gegessen hatte, denn sie starb fast vor Hunger, verfiel sie in eine große Unruhe, da sie nicht wusste, wohin sie sich zurück ziehen sollten, um zu schlafen; denn mitten im Wald zu bleiben, allen den Gefahren ausgesetzt, die sie treffen konnten, dazu konnte sie sich unmöglich entschließen.
„Fürchtet ihr euch die Nacht hier zuzubringen, meine reizende Hindin?“, sagte sie. Die Hindin hob die Augen zum Himmel auf und seufzte. „Aber“, fuhr Viole fort, „ihr seid ja schon einen Teil dieses wüsten Waldes durchlaufen, gibt es nirgends hier ein Haus, einen Holzschläger, einen Köhler, eine Einsiedelei?" Die Hindin antwortete durch eine Kopfbewegung, sie habe nichts davon gesehen.
„O Himmel!“, schrie Viole, „so werde ich morgen nicht mehr am Leben sein; denn wenn ich auch so glücklich sein sollte, den Tigern und den Bären zu entgehen, so bin ich doch gewiss, dass die Furcht allein mich tötet. Glaubt übrigens nicht, meine teure Prinzessin, dass ich um meinetwillen meinen Tod beklage, nein, ich beklage ihn um euretwillen. Ach, euch an diesem jedes Trostes beraubten Aufenthalt zu lassen, kann es etwas Traurigeres geben?"
Die kleine Hindin brach in Tränen aus und schluchzte fast wie ein Mensch. Ihre Tränen rührten die Fee Tulipane, welche sie zärtlich liebte; trotz ihres Ungehorsams hatte sie beständig über ihr Schicksal gewacht, und indem sie plötzlich zum Vorschein kam, sagte sie zu ihr: „Ich will euch nicht schelten, denn der Zustand, in welchem ich euch sehe, macht mir zu viel Kummer."
Die Hindin und Viole unterbrachen sie, indem sie sich zu ihren Füßen warfen: die erstere küsste ihr die Hände und liebkoste sie auf das anmutigste von der Welt; die andere beschwor sie Mitleid mit der Prinzessin zu haben und ihr ihre natürliche Gestalt wieder zu geben. „Das hängt nicht von mir ab“, versetzte Tulipane, „die, welche ihr ein so großes Unglück zugefügt hat, ist mächtiger als ich; aber ich will die Zeit ihrer Buße verkürzen, und um sie zu erleichtern, soll sie immer beim Anbruch der Nacht die Gestalt einer Hindin verlassen, doch früh mit Tagesanbruch muss sie sie wieder annehmen, und gleich den anderen Tieren, die Ebenen und Wälder durchstreifen."
Die Tiergestalt während der Nacht ablegen zu dürfen, war schon viel und die Prinzessin bewies ihre lebhafte Freude durch Hüpfen und Springen, was Tulipanen gleichfalls viel Freude machte. „Geht jetzt“, sagte sie zu ihnen, „auf diesem schmalen Fußsteig fort, so werdet ihr zu einem Häuschen kommen, welches für diese Gegend artig genug ist." Mit diesen Worten verschwand sie.
Viole gehorchte; sie ging mit der Prinzessin Hindin den bezeichneten Weg und auf der Türschwelle fanden sie eine alte Frau sitzen, die einen Korb von feinen Weidenruten flocht. Viole grüßte sie und fragte: „Gute Mutter, möchtet ihr mich wohl nebst meiner Hindin bei euch aufnehmen? Wir bedürfen nichts weiter als ein Kämmerchen." „Ja, mein schönes Kind“, antwortete sie, „ich will euch gern hier eine Zuflucht gewähren, kommt nur herein mit eurer Hindin." Sie führte sie sogleich in ein sehr niedliches Kämmerchen, getäfelt mit Vogelkirschholz; zwei Betten standen darin mit weißem Linnen und seinen Decken, und alles war so einfach und sauber, dass die Prinzessin seit langem nichts so nach ihrem Geschmack fand.
Kaum war die Nacht völlig herein gebrochen, so nahm Sehnsuchtblüte ihre menschliche Gestalt wieder an; sie umarmte hundertmal ihre treue Viole, dankte ihr für die Treue, die sie ihr in ihrem Missgeschick bewiesen habe, und versprach, wenn die Zeit der Verwandlung vorüber sei, sie so glücklich als möglich zu machen.
Die Alte kam und klopfte sacht an ihre Tür, und ohne einzutreten, reichte sie Violen einige schmackhafte Früchte, welche die Prinzessin mit großem Appetit verzehrte, worauf sie sich schlafen legten. Kaum brach der Tag an, so verwandelte sich Sehnsuchtblüte wieder in eine Hindin und kratzte an der Tür, damit Viole ihr öffne. Sie empfanden den lebhaftesten Schmerz, sich von einander zu trennen, obgleich es nur für kurze Zeit war. Die Prinzessin Hindin stürzte sich in das tiefste Dickicht des Waldes und fing dort an, nach ihrer Weise umher zu laufen.
Es ist schon gesagt, dass Prinz Tapfer in dem Wald geblieben war und dass Florindo nach einigen Früchten umher lief. Es war ziemlich spät, als er zu dem Häuschen der guten Alten gelangte, von der bereits erzählt ist. Er sprach sie höflich an und bat sie um das, was er für seinen Herrn bedurfte. Sie beeilte sich, einen Korb damit anzufüllen, gab ihm den selben und sagte: „ich fürchte, wenn ihr die Nacht draußen im Freien zubringt, dass euch irgend ein Unfall begegne; ich biete euch deshalb bei mir einen Zufluchtsort an, der zwar ärmlich genug ist, aber wenigstens vor den wilden Tieren Schutz gewährt."
Er dankte ihr verbindlich und antwortete, es sei noch einer seiner Freunde mit ihm, dem wolle er gleichfalls vorschlagen, hier her zu kommen. In der Tat wusste er den Prinzen dahin zu überreden, dass er sich zu dieser guten Frau führen ließ. Sie stand noch vor ihrer Tür und ohne alles Geräusch führte sie beide in eine Kammer, die derjenigen, welche die Prinzessin einnahm, ganz gleich und nur durch eine Bretterwand von ihr getrennt war. Der Prinz brachte die Nacht in seiner gewöhnlichen Unruhe zu; kaum vergoldeten die ersten Strahlen der Sonne sein Fenster, so stand er auf, und um seinen Trübsinn zu zerstreuen, ging er in den Wald, ohne jedoch Florindo mitzunehmen.
Er strich lange Zeit umher, ohne irgend einen bestimmten Weg zu nehmen; endlich gelangte er auf einen ziemlich geräumigen Platz, der mit Bäumen und Moos bedeckt war; in dem nämlichen Augenblick stürzte eine Hindin daraus hervor. Er konnte sich nicht enthalten, ihr zu folgen, denn er liebte die Jagd leidenschaftlich, obgleich nicht» mehr in dem Grade, seit die Neigung für die Prinzessin Sehnsuchtblüte sein Herz einnahm. Dessen ungeachtet verfolgte er die arme Hindin und von Zeit zu Zeit schickte er ihr einen Pfeil nach.
Sie starb fast vor Furcht, obgleich sie nicht getroffen wurde, denn ihre Freundin Tulipane schützte sie, und freilich bedurfte es auch eines nicht geringeren Beistandes, als der hilfreichen Hand einer Fee, um sie vor der Geschicklichkeit des Prinzen zu retten. Man konnte nicht müder sein, als es die arme Prinzessin war; die Anstrengung, welche sie machte, war ihr etwas ganz Ungewohntes. Endlich gewann sie einen Fußsteig so glücklich, dass der gefährliche Jäger sie aus dem Gesicht verlor, welcher, obgleich selbst, bis aufs Äußerste erschöpft, ihre Verfolgung dennoch nicht aufgab.
So ging der Tag hin; die Hindin sah mit Freude die Stunde ihrer Heimkehr nahen und richtete ihre Schritte nach dem Häuschen, wo Viole sie mit Ungeduld erwartete. Kaum befand sie sich in ihrer Kammer, so warf sie sich Atemlos auf das Bett, wie in Wasser gebadet. Viole erwies ihr tausend Liebkosungen, und hatte die größte Sehnsucht zu erfahren, was ihr begegnet sei. Die Stunde der Verwandlung war gekommen, die schöne Prinzessin nahm ihre natürliche Gestalt wieder an, schlang den Arm um den Hals ihrer treuen Dienerin und sagte:
„Ach! ich glaubte, nur die Fee der Quelle und die grausamen Tiere des Waldes fürchten zu dürfen, aber heute bin ich durch einen jungen Jäger verfolgt worden, den ich kaum einmal ansehen konnte, so sehr war ich mit der Flucht gedrängt. Tausend Pfeile, die er nach mir ab sandte, bedrohten mich mit einem unvermeidlichen Tode und durch welches besondere Glück ich gerettet worden bin, ist mir noch unbegreiflich."
„Ihr müsst nicht mehr ausgehen, meine teure Prinzessin“, versetzte Viole; „bringt die verhängnisvolle Zeit eurer Verwandlung in dieser Kammer zu, ich will in die nächste Stadt gehen, um Bücher zu eurer Unterhaltung einzukaufen." „Ach! meine teure Viole“, entgegnete die Prinzessin, „der Gedanke an den Prinzen Tapfer würde allein hin reichen, mich angenehm zu beschäftigen; aber die selbe Macht, die mich zwingt während des Tages die traurige Gestalt einer Hindin anzunehmen, nötigt mich auch wider meinen Willen alles zu tun, was der Natur dieser Tiere gemäß ist: ich laufe, ich springe und esse Kraut wie sie; zu der Zeit würde mir der Aufenthalt in einer Kammer unerträglich sein." Sie war von der Jagd so erschöpft, dass sie nur schleunig zu essen verlangte und darauf schlossen sich ihre schönen Augen bis zum Aufgang der Sonne. Kaum brach der Tag an, so ging die gewöhnliche Verwandlung vor sich und sie kehrte in den Wald zurück.
Der Prinz seiner seits war auf den Abend wieder zu Florindo zurück gekehrt. ,Ich habe die Zeit damit zugebracht“, erzählte er ihm, „der schönsten Hindin nach zu laufen, die ich jemals gesehen habe. Sie hat mich hundertmal mit einer bewunderungswürdigen Gewandtheit getäuscht; ich habe alle Geschicklichkeit aufgeboten, sie zu treffen und ich begreife nicht, wie sie meinen Pfeilen entgangen ist. Ich will sie gleich mit Tagesanbruch noch einmal aufsuchen und diesmal gewiss nicht verfehlen."
In der Tat begab sich dieser junge Prinz, der aus seinem Herzen eine Vorstellung verbannen wollte, die er für ein Luftgespinst hielt und der sich deshalb seiner Neigung zur Jagd gern hin gab, an den nämlichen Platz, wo er die Hindin gefunden hatte, aber sie hütete sich wohl, dahin zu kommen, denn sie fürchtete ein ähnliches Abenteuer wie gestern. Er warf die Augen nach allen Seiten, strich lange Zeit umher und bemerkte, als er müde und erhitzt war, mit Vergnügen einige Äpfel, deren schönes Aussehen ihn reizte; er pflückte, aß davon und fiel bald darauf in einen tiefen Schlaf, hin gestreckt auf frischem Gras, unter Bäumen, die durch den anmutigen Gesang von tausend Vögeln belebt wurden.
Während er schlief, kam unsre furchtsame Hindin, welche die einsamsten Stellen aufsuchte, auch dahin, wo er sich befand. Hätte sie ihn früher bemerkt, so würde sie die Flucht ergriffen haben, aber sie stand so nahe bei ihm, dass sie sich nicht enthalten konnte, ihn anzublicken und sein Schlummer gab ihr so viel Mut, dass sie sich Zeit nahm, alle seine Züge aufmerksam zu betrachten. O Himmel! wie ward ihr, als sie ihn wieder erkannte! ihrer Seele schwebte das reizende Bild des Prinzen zu lebendig vor, um es in so kurzer Zeit vergessen zu haben.
„O Liebe, Liebe, was beginnst du? soll ich dem Schicksal ausgesetzt sein, mein Leben durch die Hand des Geliebten zu verlieren? Ja, dieses Schicksal erwartet mich, es gibt kein Mittel mehr für meine Sicherheit." Sie legte sich einige Schritte von ihm nieder und ihre Augen, von seinem Anblick entzückt, konnten sich nicht wieder von ihm abwenden; sie seufzte tief auf und, kühner geworden, kam sie ihm näher und berührte ihn endlich, so dass er davon aufwachte.
Sein Erstaunen war unbeschreiblich, er erkannte die nämliche Hindin, die ihn so außer Atem gesetzt und die er so lange Zeit vergebens verfolgt hatte; es war ihm daher höchst überraschend, sie jetzt so zutraulich zu finden. Sie wartete nicht erst ab, dass er einen Versuch mache, sie zu fangen, sondern floh mit aller ihrer Kraft und er folgte ihr mit aller der seinigen.
Von Zeit zu Zeit hielten sie an, um Atem zu schöpfen, denn die schöne Hindin war noch von dem gestrigen Wettlauf müde, und der Prinz war es nicht minder: aber was die Flucht der Hindin am meisten verzögerte, war ihr Kummer, sich von dem zu entfernen, der doch ihr ganzes Herz besaß. Er bemerkte, wie sie öfters den Kopf nach ihm umwendete, als wolle sie ihn fragen, ob er wünsche, dass sie unter seinen Pfeilen sterbe; und sobald er auf dem Punkt war, sie zu erreichen, machte sie neue Anstrengungen, um sich zu retten.
„Ach! wenn du mich verstehen könntest, reizendes Geschöpf“, rief er ihr nach, „so würdest du nicht vor mir fliehen; ich habe dich lieb, ich will dich ernähren, ich will Sorge für dich tragen!“, aber seine Worte verhallten in der Luft, ohne dass sie bis zu ihr gelangten. Endlich, nachdem sie den ganzen Wald durchlaufen waren und unsere Hindin nicht mehr fort konnte, wurden ihre Schritte langsamer und der Prinz, welcher die seinigen verdoppelte, erreichte sie mit einer Freude, deren er sich nicht mehr für fähig gehalten hatte. Sie hatte alle ihre Kräfte verloren, lag da halb tot und erwartete nichts anderes als ihr Leben unter den Händen ihres Siegers zu endigen; aber anstatt ihr irgend ein Leid zuzufügen, fing der Prinz an sie zu liebkosen.
„Schöne Hindin“, sagte er zu ihr, „sei ohne Furcht, ich will dich mit mir führen und du sollst mir überall hin folgen." — Er schnitt einige Zweige ab, flocht sie geschickt ineinander, bedeckte sie mit Moos und warf Rosen darauf, die an den Gebüschen umher wuchsen, darauf nahm er die Hindin in seine Arme, stützte ihren Kopf an seinen Hals und legte sie sanft auf die Zweige.
Dann setzte er sich neben sie und suchte von Zeit zu Zeit einige feine Kräuter, die er ihr dar reichte und die sie aus seiner Hand aß. Der Prinz fuhr fort mit ihr zu reden, obgleich er überzeugt war, dass sie ihn nicht verstehe; aber welches Vergnügen sie auch empfand, ihn in ihrer Nähe zu sehen, so wurde sie doch unruhig, weil sich die Nacht näherte. „Wie“, sagte sie bei sich selbst, „wenn er mich plötzlich in meiner natürlichen Gestalt erblickte!"
Sie dachte nur darauf, auf welche Art sie immer könnte, sich zu retten, als er ihr selbst das Mittel dazu dar bot; denn da er fürchtete, sie könne Durst haben, so ging er irgend eine Quelle aufzusuchen, um sie dahin zu führen. Während er nun danach suchte, sprang sie rasch auf und eilte nach Hause, wo Viole sie erwartete. Sie warf sich auf ihr Bett, die Nacht kam, die Verwandlung hörte auf und sie erzählte ihr Abenteuer.
„Würdest du glauben, meine teure Viole“, sagte sie zu der selben, „dass Prinz Tapfer sich in diesem Walde befindet? Er ist es selbst, der mich seit zwei Tagen gejagt, der mich gefangen und mir tausend Liebkosungen erwiesen hat. Ach! das Bildnis, welches man mir von ihm gebracht hat, erreicht ihn nicht, er ist hundertmal schöner; die Wildheit, welche man so oft an Jägern bemerkt, entstellt sein Antlitz nicht, welches voller Güte ist und von einem Liebreiz, den ich dir nicht beschreiben kann.
Wie unglücklich bin ich nicht, dass mich das Schicksal zwingt, diesen Prinzen zu fliehen, ihn, der mir durch meine Eltern zum Gemahl bestimmt ist, ihn, der mich liebt und den ich wieder liebe! — Ja, eine boshafte Fee muss an dem Tage der Geburt einen Hass gegen mich gefasst haben, dass alle Hoffnungen meines Lebens zerstört werden!" Sie brach in Tränen aus und Viole tröstete sie mit der Aussicht, dass sich in kurzer Zeit ihr Kummer in Freude verwandeln könne.
Kaum hatte der Prinz eine Quelle entdeckt, so kehrte er zu seiner geliebten Hindin zurück, aber er fand sie nicht mehr an der Stelle, wo er sie gelassen hatte. Vergebens suchte er überall nach ihr und war so gegen sie erzürnt, als hätte er Verstand bei ihr voraussetzen dürfen. „Wie!“, rief er aus, „ich soll also immer nur Ursache finden, mich über dieses trügerische und ungetreue Geschlecht zu beklagen?" —
Schwermütig kehrte er zu der guten Alten zurück: er erzählte seinem Vertrauten das Abenteuer mit der Hindin und beschuldigte die selbe der Undankbarkeit. Florindo konnte sich nicht enthalten, über den Zorn des Prinzen zu lächeln und riet ihm, die Hindin, wenn er ihr wieder begegne, zu bestrafen. „Deswegen bleibe ich auch nur noch hier“, antwortete der Prinz; „wir reisen dann sogleich weiter."
Der Tag brach an und mit ihm nahm die Prinzessin wieder die Gestalt einer weißen Hindin an. Sie wusste nicht, zu was sie sich entschließen sollte; sollte sie die nämlichen Stellen besuchen, auf welchen sich der Prinz gewöhnlich einfand, oder sollte sie einen entgegen gesetzten Weg einschlagen, um ihm zu entgehen? Sie wählte das Letztere und entfernte sich ziemlich weit; aber der junge Prinz, welcher eben so schlau war wie sie, tat das Nämliche, da er diese kleine List von ihr vermutete, und so kam es, dass er sie in dem tiefsten Dickicht des Waldes entdeckte.
Sie war dort ganz sorglos, als sie ihn plötzlich gewahr wurde; sogleich sprang sie auf und über die Büsche hin weg und als ob sie ihn wegen des Streiches, den sie ihm gestern Abend gespielt hatte, noch mehr gefürchtet hätte, floh sie leichter als der Wind. Aber in dem Augenblick, als sie über einen Fußsteig setzte, nahm er sie so wohl aufs Korn, dass er sie mit einem Pfeil am Schenkel verwundete. Sie empfand einen heftigen Schmerz und da sie keine Kraft mehr zu fliehen hatte, stürzte sie nieder. Dieses traurige Ereignis war unvermeidlich, denn die Fee der Quelle hatte daran die Lösung ihres Geschickes geknüpft.
Der Prinz näherte sich und war schmerzlich betrübt, als er das Blut der Hindin fließen sah; er nahm Kräuter, legte sie auf die Wunde, um das Blut zu stillen und bereitete ihr wiederum ein Lager von Zweigen. Er hielt den Kopf der Hindin auf seinen Knien und sagte zu ihr: „Kleiner Schelm, bist du nicht selber Schuld an dem, was dir begegnet ist? was hatte ich dir gestern getan, um mich zu verlassen? Ich werde heute nichts anderes tun, als dich mit mir führen.
Die Hindin erwiderte nichts und was hätte sie auch sagen können? Der Prinz erwies ihr tausend Liebkosungen. „O wie leid tut es mir“, sagte er, „dich verwundet zu haben! du hassest mich und ich wünsche, du liebtest mich." Endlich war es Zeit zu seiner alten Wirtin zurück zu kehren und er belud sich deshalb mit seiner Beute, die ihm jedoch nicht wenig zu schaffen machte, denn bald musste er sie tragen, bald führen, ja, zuweilen auch mit Gewalt fort ziehen.
Sie hatte durchaus keine Lust, mit ihm zu gehen; „was soll aus mir werden?“, sagte sie bei sich. „Nein, lieber will ich sterben, als mich später ganz allein mit dem Prinzen befinden." Sie machte sich daher so schwer, als sie nur immer konnte; er war von dieser Anstrengung wie gebadet und obgleich er nicht mehr weit bis zu dem Häuschen der Alten hatte, so sah er doch, dass er ohne fremden Beistand nicht dahin gelangen könne.
Er beschloss also, seinen treuen Florindo zu holen; doch bevor er seine Beute verließ, band er sie aus Furcht, sie könne ihm zum zweiten Mal entfliehen, mit einigen Bändern an einem Baumstamm fest. Ach, wer hätte denken können, dass die schönste Prinzessin der Welt eines Tages durch einen Prinzen, der sie anbetete, so behandelt werden würde?
Sie bemühte sich vergebens, die Bänder zu zerreißen, aber ihre Anstrengungen knüpften sie nur noch fester und sie war nahe daran, sich mit einer Schlinge, welche er unglücklicherweise gemacht hatte, zu erwürgen, als Viole, die es überdrüssig war, den ganzen Tag in ihrer Kammer eingeschlossen zu sein, hinaus ging, um ein wenig Luft zu schöpfen und an den Ort kam, wo die weiße Hindin sich vergebens anstrengte. Wie ward ihr, als sie ihre teure Gebieterin erblickte! sie eilte, was sie nur konnte, sie aus dieser Lage zu erlösen, aber die Bänder waren mehrfach verknüpft und eben als sie die Hindin fortführen wollte, kam der Prinz mit Florindo herbei.
„Welche Ehrfurcht ich immer vor euch habe“, redete der Prinz sie an, „so muss ich mich doch dem Diebstahl widersetzen, den ihr an mir begehen wollt; ich habe diese Hindin verwundet, sie ist mein, ich liebe sie und bitte euch, sie mir zu überlassen." „Mein Herr“, entgegnete Viole artig, „diese Hindin hier hat mir eher gehört, als euch, ich würde auf der Stelle lieber mein Leben lassen, als sie und wenn ihr sehen wollt, wie sie mich kennt, so bitte ich euch, ihr nur ein wenig Freiheit zu lassen. Frisch, mein kleines Weißchen“, sagte sie, „umarme mich"; die Hindin warf sich an ihren Hals. „Küss mir die rechte Wange"; sie gehorchte. „Berühr mein Herz"; sie legte den Fuß darauf; „seufze"; sie seufzte.
Der Prinz konnte nicht mehr an dem zweifeln, was Viole ihm gesagt hatte; „ich gebe sie euch zurück“, sagte er gütig, „aber ich gestehe, dass es nicht ohne Kummer geschieht." Viole entfernte sich sogleich mit ihrer Hindin. Sie wussten nicht, dass der Prinz in einem Hause mit ihnen wohne; er folgte ihnen von weitem und war überrascht, sie bei der alten Frau eintreten zu sehen. Er traf nur um weniges später ein und in einer Anwandlung von Neugier, welche die weiße Hindin erregt hatte, fragte er die Alte, wer diese junge Person sei, welcher die Hindin angehöre.
Sie erwiderte ihm, sie kenne sie nicht; sie habe sie mit ihrer Hindin bei sich aufgenommen, die Fremde bezahle gut und lebe in großer Einsamkeit. Florindo erkundigte sich, wo ihr Zimmer sei und sie antwortete ihm, es liege ganz nahe an dem seinigen und sei nur durch eine Bretterwand davon getrennt. Als sich der Prinz auf seinem Zimmer befand, sagte Florindo zu ihm, er müsse sich gänzlich täuschen oder dieses Mädchen habe der Prinzessin Sehnsuchtblüte angehört und er habe sie während seiner Gesandtschaft dort im Palast gesehen.
„Welche traurige Erinnerungen ruft ihr mir da zurück“, rief der Prinz, „und durch welchen Zufall sollte sie sich hier befinden?" „Das weiß ich allerdings nicht, mein Prinz“, erwiderte Florindo, „aber ich bin begierig, sie noch einmal zu sehen, und da uns nur eine einfache Bretterwand trennt, so will ich ein Loch da rein machen." „Das ist gewiss eine vergebliche Neugier“, sagte traurig der Prinz, denn die Worte Florindos hatten seinen ganzen Schmerz erneuert. Er öffnete das Fenster, sah in den Wald hinaus und überließ sich seinen Gedanken; inzwischen ging Florindo ans Werk und hatte bald ein Loch zu Stande gebracht, welches groß genug war, um die reizende Prinzessin zu erblicken.
Sie war in ein Gewand von Silberstoff gekleidet, in welches purpurrote Blumen, mit Gold und Diamanten besetzt, eingewebt waren; ihr Haar fiel in langen Locken über den schönsten Nacken von der Welt, ein sanftes Rot durchschien ihre Wangen und das Feuer ihrer Augen war bezaubernd. Viole lag auf Knien vor ihr und verband ihr den Arm, aus welchem das Blut heftig floss.
Sie schienen alle Beide sehr in Verlegenheit wegen dieser Wunde. „Lass mich sterben“, sagte die Prinzessin, „der Tod wird mir angenehmer sein, als das beklagenswerte Leben, welches ich führe. Wie, den Tag über eine Hindin zu sein, den zu sehen, dem ich bestimmt bin, ohne ihn sprechen, ohne ihm mein verhängnisvolles Abenteuer mitteilen zu können? Ach, wenn du wüsstest, was er mir alles Rührendes in meiner Verwandlung gesagt hat, wie liebevoll der Klang seiner Stimme ist, wie edel und anmutig sein Benehmen, du würdest mich noch weit mehr beklagen, als jetzt, dass ich nicht im Stande bin, ihm mein Geschick zu entdecken."
Man kann sich leicht das Erstaunen Florindos denken, als er alles dies sah und hörte; er lief zum Prinzen, er riss ihn in der Aufwallung seiner Freude vom Fenster weg und sagte zu ihm: „Ach, gnädiger Herr, kommt sogleich an diese Bretterwand und ihr werdet das leibhaftige Original des Bildnisses sehen, welches euch entzückt hat."
Der Prinz sah und erkannte sogleich seine Prinzessin. Seine Freude hätte kein Maß gekannt, wenn er nicht zugleich gefürchtet hätte, durch irgend eine Bezauberung getäuscht zu werden, denn wie ließ sich ein so überraschendes Zusammentreffen mit Langdorn und ihrer Mutter vereinigen, die zu Hause in dem Schlosse eingesperrt waren und von denen die eine für die Prinzessin Sehnsuchtblüte und die andere für ihre Ehrendame galt?
Indes man hat einen natürlichen Trieb, sich das zu einzureden, was man wünscht. Wenn er nicht vor Ungeduld sterben wollte, so musste er sich auf der Stelle von der Wahrheit überzeugen; er ging also sogleich und klopfte sacht an die Tür des Zimmers, in welchem sich die Prinzessin befand. Da Viole nicht anders glaubte, als dass es die gute Alte sei und ihrer Hilfe eben so sehr bedurfte, um den Arm der Prinzessin zu verbinden, so beeilte sie sich, die Tür zu öffnen und war nicht wenig erstaunt, den Prinzen zu erblicken, der auf Sehnsuchtblüte zu eilte und sich ihr zu Füßen warf.
Die Aufregung, in welcher er sich befand, erlaubte ihm keine zusammen hängenden Reden, und die Prinzessin war nicht weniger verwirrt; aber die Liebe, die auch Stummen eine Sprache gibt, gesellte sich als Drittes hinzu und überredete beide, dass nie etwas Geistreicheres gesagt worden sei, und in der Tat wenigstens nichts Rührenderes und Zärtlicheres.
So verstrich die Nacht und der Tag brach an, ohne dass Sehnsuchtblüte daran gedacht hätte; aber diesmal blieb sie in ihrer natürlichen Gestalt. Ihre Freude darüber war grenzenlos. Sie liebte den Prinzen zu sehr, um ihm die Ursache der selben nicht mitzuteilen und begann sogleich mit großer Anmut und natürlicher Beredsamkeit ihr Abenteuer zu erzählen.
„Wie“, rief er, „meine reizende Prinzessin, euch also habe ich unter der Gestalt einer weißen Hindin verwundet? was soll ich tun, um ein so großes Verbrechen zu sühnen? Ist es genug, das ich aus Schmerz darüber vor euren Augen sterbe?" Die lebhafteste Betrübnis malte sich auf seinem Antlitz und Sehnsuchtblüte litt davon mehr, als von ihrer Wunde. Sie versicherte ihm, die Wunde habe so gut wie gar nichts auf sich und sie könne sich nicht enthalten, ein Leiden lieb zu haben, welches ihr ein so großes Glück verschaffe.
Die verbindliche Art, mit der sie dies sagte, überzeugte ihn noch mehr von ihrer Herzensgüte. Um sie nun seiner seits auch über alles aufzuklären, erzählte er ihr den Betrug, welchen Langdorn und ihre Mutter gespielt hatten und fügte hinzu, er müsse sich beeilen, den König seinen Vater in Kenntnis zu setzen, dass er das Glück gehabt habe, sie aufzufinden, weil derselbe im Begriff sei, einen schrecklichen Krieg anzufangen, um wegen des Schimpfes, den er erlitten zu haben glaubte, Rechenschaft zu fordern.
Sehnsuchtblüte bat ihn, durch Florindo zu schreiben und er wollte dies eben tun, als ein durchdringender Lärm von Trompeten, Klarinetten, Pauken und Trommeln in den Wald her schallte; ja, es schien ihnen sogar, als ob sie eine Menge Leute ganz nahe bei ihrem kleinen Hause vorbei marschieren hörten. Der Prinz sah durchs Fenster, erkannte mehrere seiner Offiziere, seine Fahnen und Standarten; er befahl ihnen zu halten und auf ihn zu warten.
Für die Soldaten des Prinzen konnte es gar keine angenehmere Überraschung geben; ein jeder war der Meinung, der Prinz werde sie anführen und an dem Vater der Sehnsuchtblüte Rache nehmen. Der Vater des Prinzen führte sie selbst, seines hohen Alters ungeachtet; er kam in einer Sänfte von Samt mit Gold bestickt, hinter ihr folgte ein bedeckter Wagen, in welchem sich Langdorn mit ihrer Mutter befand. Als Prinz Tapfer die Sänfte erblickte, lief er hinzu, der König breitete die Arme nach ihm aus und umarmte ihn auf das Zärtlichste.
„Wo kommst du her, mein teurer Sohn?“, rief er, „wie war es möglich, dass du mich dem lebhaften Schmerz, den deine Abwesenheit mir verursachen musste, Preis gabst?" „Mein Vater“, versetzte der Prinz, „vergönnt mir, euch alles zu erzählen." Der König stieg augenblicklich aus seiner Sänfte und in dem er sich mit ihm bei Seite begab, teilte ihm sein Sohn das glückliche Zusammentreffen mit der Prinzessin, so wie Langdorns Betrügerei mit.
Der König war über dies Ereignis entzückt und hob Hände und Augen zum Himmel empor, um ihm dafür zu danken. In dem nämlichen Augenblick sah er die Prinzessin Sehnsuchtblüte, schöner und glänzender als ein Stern. Sie saß auf einem prächtigen Ross, welches mit größter Leichtigkeit daher tanzte, hundert Federn von verschiedenen Farben schmückten ihr Haupt und ihr Kleid strahlte von großen Diamanten; sie war in Jagdkleidern. Viole, die hinter ihr kam, war nicht weniger geschmückt.
Dies alles nun verdankte man dem Schutz der Fee Tulipane, durch ihre Sorge war alles zu einem glücklichen Erfolg gediehen. Um der Prinzessin willen hatte sie das reizende Häuschen im Walde erbaut und in der Gestalt einer alten Frau sie mehrere Tage bewirtet. Sobald der Prinz seine Soldaten erkannt hatte und zu dem Könige, seinem Vater, geeilt war, trat die Fee in das Zimmer der Prinzessin, heilte durch einen Hauch auf ihren Arm die Wunde und gab ihr sodann die reichen Kleider, in denen sie vor dem Könige erschien, der so entzückt von ihr war, dass er sie fast für etwas Überirdisches gehalten hätte.
Er sagte ihr das Verbindlichste, was man bei solchen Gelegenheiten nur sagen kann und beschwor sie, seinen Untertanen das Glück nicht aufzuschieben, sie als Königin zu begrüßen, denn ich bin entschlossen, fuhr er fort, mein Königreich dem Prinzen Tapfer abzutreten, um ihn eurer desto würdiger zu machen.
Sehnsuchtblüte antwortete ihm mit aller der Höflichkeit, die man von einer so wohl erzogenen Person erwarten durfte. Als ihre Blicke so dann auf die beiden Gefangenen fielen, die sich im Wagen befanden und ihr Gesicht mit den Händen bedeckten, hatte sie den Edelmut, für sie um Gnade zu bitten, so wie, dass der nämliche Wagen, in welchem sie sich jetzt befanden, sie hinführen möge, wohin sie verlangten. Der König bewilligte ihr diese Bitte, nicht ohne ihr gutes Herz zu bewundern und ihr die größten Lobsprüche zu erteilen.
Man befahl der Armee, den Rückweg wieder an zu treten und der Prinz stieg zu Pferde, um seine schöne Prinzessin zu begleiten. In der Hauptstadt wurden sie mit tausendfachem Freudengeschrei empfangen, und man traf alle Anstalten zur Hochzeit, die durch die Gegenwart der sechs wohltätigen Feen, welche der Prinzessin wohl wollten, besonders feierlich wurde. Sie machten ihr die reichsten Geschenke, die man sich nur denken kann, unter anderen den prächtigen Palast, in welchem die Königin sie gesehen hatte.
Der treue Florindo bat seinen Herrn, bei Violen für ihn zu werben und ihn an dem nämlichen Tage, wenn er die Prinzessin heirate, mit ihr zu vereinigen. Der Prinz tat dies gern und auch das liebenswürdige Mädchen war erfreut, bei ihrem Eintritt in ein fremdes Königreich eine so vorteilhafte Partie zu treffen.
Die Fee Tulipane, die noch freigebiger, als ihre Schwestern war, schenkte ihr vier Goldminen in Indien, damit ihr Gemahl sich nicht rühmen könne, reicher zu sein, als sie. Die Hochzeit des Prinzen dauerte mehrere Monate, jeden Tag gab es ein neues Fest und die Abenteuer der weißen Hindin wurden weit und breit besungen.
DER KOBOLD ...

„Bleibt bei dem Ofen“, sagte die alte Margarethe zu ihren sieben Enkeln, „bleibt bei dem Ofen, der Mistral weht so heftig, dass unser Haus wankt; überdies ist heute Abend Feensabbat, und die Kobolde, die ihnen gehorchen, verlassen ihre Wohnungen und kommen in tausend Gestalten, die Leichtgläubigkeit der Menschen zu verhöhnen."
„Was, ich soll hier bleiben!“, sagte der älteste von den jungen Leuten, „nein, ich muss hin gehen und sehen, was die Tochter Jacobs, des Seilers, macht. Sie würde ihre großen blauen Augen die ganze Nacht nicht schließen, wenn ich nicht zu ihrem Vater käme, ehe der Mond untergegangen ist."
„Ich muss Krabben und Igel fangen“, rief der zweite, „und alle Feen und Kobolde auf der ganzen Welt sollen mich nicht daran hindern."
So wollten sie alle an ihr Geschäft oder ihr Vergnügen gehen und verschmähten den weisen Rat der alten Margarethe; nur der jüngste zögerte einen Augenblick, als sie zu ihm sagte: „Bleib du hier, mein kleiner Richard, und ich will dir schöne Geschichten erzählen." Aber er wollte sich einen Strauß von Thymian und Primeln im Mondschein pflücken und lief fort mit den anderen.
Als sie aus der Hütte waren, sagten sie: „Unsere Alte spricht immer von Wind und Sturm und nie war das Wetter schöner und der Himmel klarer; seht, wie majestätisch der Mond in den durchsichtigen Wolken einher schreitet." Sie bemerkten darauf ein kleines schwarzes Pferd, das ganz nahe bei ihnen war.
„Ach, ach“, sagten sie, „das ist des alten Valentins Pferd, das aus dem Stall gelaufen ist und ohne seinen Herrn in die Schwemme trabt." „Mein kleines hübsches Pferd“, sagte der älteste, das Tier mit der Hand klopfend, „du sollst dich nicht verlaufen, ich will dich selbst in die Schwemme führen."
Darauf schwang er sich ihm auf den Rücken und einer seiner Brüder lachte darüber und tat dasselbe, ihm folgte der dritte; kurz, sie bestiegen es alle, selbst der kleine Richard, der seinen älteren Brüdern nicht nach stehen wollte.
Als sie der Schwemme zu ritten, luden sie alle ihre jungen Bekannten, die ihnen begegneten, ein, aufzusitzen, und diese taten es unvorsichtiger Weise auch, so dass das kleine schwarze Pferd, dessen Rücken sich ausgedehnt hatte, endlich mehr als dreißig trug, trotz dem aber nur desto lustiger vorwärts lief. Es fing nun an in sanftem Trab zu laufen, aber das junge Volk schlug ihm die Seiten mit den Fersen und rief: „Galoppiere, Pferdchen, du hast nie so gute Reiter getragen."
Während dessen hatte der Wind wieder angefangen zu stürmen; sie hörten das Toben des Meeres, und das Pferdchen, anstatt nach der Schwemme zu trotten, trabte ohne Furcht vor dem Lärm, den die See machte, dem Ufer zu.
Richard fing an seinen Thymian und seine Primeln zu bereuen, und der älteste der Brüder packte das Pferdchen bei der Mähne und suchte es zum Umkehren zu zwingen, indem er an die blauen Augen der Tochter Jacobs, des Seilers, dachte: aber umsonst, das Pferd trabte immer gerade aus, bis die Welle kam und seinen linken Fuß benetzte. Es wieherte lustig, wie die Pferde der Menschen zu tun pflegen, wenn sie schönen Hafer vor sich haben oder bei einer ganz weißen jungen Stute sind, und sprang, statt still zu stehen, nur desto schneller in die See.
Als das Wasser den armen Kindern bis an den Leib trat, warfen sie sich ihre Unvorsichtigkeit vor und riefen: „Das verdammte kleine schwarze Pferd ist verhext. Hätten wir den Rat der alten Margarethe befolgt, so wären wir nicht verloren." Je weiter das Pferd trabte, desto höher stieg die See. — Endlich trat sie ihnen über den Kopf und sie ertranken alle jämmerlich.
Gegen Morgen ging die alte Margarethe raus, besorgt über das Schicksal ihrer Enkel. Sie suchte sie überall, ohne sie finden zu können, und fragte alle ihre Nachbarn, aber sie erfuhr nichts, ausgenommen, dass der älteste nicht bei der blauäugigen Tochter Jacobs, des Seilers, gewesen sei.
Als sie ganz traurig nach Hause zurück kehrte, sah sie ein kleines schwarzes Pferd ihr entgegenkommen, das Sprünge und Kapriolen machte. — Als es ihr nahe war, fing es an lustig zu wiehern und lief so schnell, dass es in einem Augenblick ihr aus dem Gesichte war.
ROSETTE ...
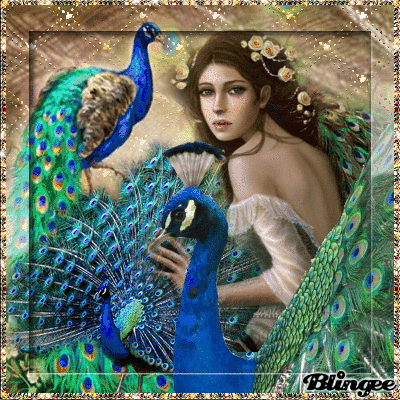
Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten zwei schöne Prinzen. Bei ihrer Geburt hatte die Königin jedes Mal die Feen dazu eingeladen und sie gebeten, ihr die Schicksale ihrer Kinder vorher zu sagen. Zum dritten Mal gebar sie eine Tochter, die so reizend war, dass man sie nicht ansehen konnte, ohne sie zu lieben. Nachdem die Königin die Feen, welche sie besuchten, aufs Beste bewirtet hatte, sagte sie beim Abschied zu ihnen: „Seid doch so gütig und sagt mir nun auch, was Rosetten, so nannte man die kleine Prinzessin, begegnen wird. Die Feen entschuldigten sich, sie hätten ihr Zauberbuch zu Hause gelassen. Sie wollten ein andermal wieder kommen und es mitbringen. „Ach!“, sagte die Königin, „das bedeutet nichts Gutes. Ihr wollt mich durch eine schlimme Weissagung nicht betrüben, aber ich bitte euch, verhehlt mir nichts, lasst mich alles wissen."
Die Feen wollten zwar durchaus nicht mit der Sprache heraus, dadurch aber wurde die Königin nur umso begieriger, zu erfahren, was es sei. Endlich sagte die vornehmste unter ihnen: „Wir fürchten, Rosette wird ihren Brüdern großes Unglück bereiten, sie werden um ihretwillen bei irgendeiner Gelegenheit den Tod finden. Das ist alles, was wir von dieser kleinen reizenden Prinzessin vorher wissen. Es tut uns sehr leid, euch eben nichts Besseres verkünden zu können." Damit gingen sie fort; die Königin aber wurde so traurig, so schwermütig, dass der König die Betrübnis in ihrem Gesicht las und sie fragte, was sie denn hätte. Sie antwortete, sie sei dem Feuer zu nahe gekommen und habe sich den ganzen Flachs verbrannt, der auf der Spindel gewesen. „Nichts weiter?“, sagte der König, ging in den Speicher und brachte ihr mehr Flachs, als sie in hundert Jahren verspinnen konnte.
Aber die Königin blieb traurig wie zuvor. Da fragte er wieder, was sie denn hätte. Sie antwortete ihm, als sie am Ufer des Flusses spazieren gegangen sei, habe sie ihren Pantoffel von grünem Atlas hinein fallen lassen. „Nichts weiter?“, fragte der König, ließ alle Schuster im ganzen Königreich zusammen holen und brachte ihr bald zehntausend Pantoffeln von grünem Atlas, aber sie hörte nicht auf traurig zu sein. Er fragte wieder, was sie denn hätte. Und sie antwortete, ihr Trauring sei ihr ins Essen gefallen und sie habe ihn hinunter geschluckt. Da sah der König, dass sie die Unwahrheit sprach, denn er selbst hatte den Ring in seinem Gewahrsam und entgegnete ihr: „Meine teure Gemahlin, du redest nicht die Wahrheit, denn ich habe ja selbst deinen Trauring bei mir wohl verwahrt."
Die Königin war sehr betroffen, auf einer Lüge ertappt zu werden, denn das ist die unangenehmste Sache von der Welt, und da sie sah, dass der König verdrießlich war, so gestand sie ihm, was ihr die Feen in Betreff der kleinen Rosette verkündigt hatten und bat ihn, wenn er ein Mittel dagegen wisse, es ihr zu sagen. Der König bekümmerte sich außerordentlich darüber; endlich sagte er zu der Königin: „Ich weiß wirklich kein anderes Mittel, unsere beiden Söhne zu retten, als dass wir die Kleine noch in der Wiege umbringen lassen. Aber die Königin schrie laut auf, weit eher würde sie selbst den Tod erleiden, als eine solche Grausamkeit zugeben und er möge nur ja auf etwas anderes denken. Als der König und die Königin noch damit beschäftigt waren, hinterbrachte man ihr, dass in einem großen benachbarten Walde ein alter Einsiedler lebe, der in einem Baumstamm wohne und den man weit und breit um Rat fragen komme. „Zu dem muss ich auch“, sagte die Königin, „die Feen haben mir nur das Nebel verkündigt, aber das Mittel dagegen zu sagen vergessen."
Sie bestieg also eines Morgens früh ein hübsches, weißes Maultier, welches ganz mit Gold beschlagen war, und machte sich mit zwei ihrer Hofdamen, deren jede ein niedliches Pferdchen ritt, auf den Weg. Als die Königin und ihre Frauen an den Wald kamen, stiegen sie aus Ehrfurcht vor dem Einsiedler herab und gingen zu Fuß auf den Baum zu, in welchem er wohnte. Der Einsiedler liebte eben nicht Frauen bei sich zu sehen, aber da er sah, dass es die Königin war, sagte er zu ihr: „Seid bestens willkommen, was verlangt ihr von mir?" Sie erzählten ihm, was die Feen von Rosette gesagt hätten und fragten ihn um seinen Rat. Da entgegnete er, man müsse die Prinzessin in einen Turm einsperren und diesen dürfe sie zeitlebens nicht verlassen. Die Königin bedankte sich sehr, reichte ihm ein ansehnliches Geschenk und eilte, ihren Gemahl davon in Kenntnis zu setzen. Als der König den Rat des Einsiedlers erfuhr, ließ er schleunigst einen großen Turm bauen und bestimmte ihn zu dem Aufenthalt seiner Tochter. Damit ihr die Zeit nicht lang werde, so besuchten sie der König, die Königin und ihre beiden Brüder alle Tage. Die Brüder liebten ihre Schwester, denn sie war das schönste und anmutigste Geschöpf, welches man je gesehen hat. Als sie fünfzehn Jahr alt war, erinnerten die Prinzen ihre Eltern, dass es wohl Zeit sei, ihre Schwester zu verheiraten; ihre Majestäten aber lachten darüber und gaben ihnen keine bestimmte Antwort.
Da verfielen der König und die Königin in eine schwere Krankheit und starben beide fast an ein und dem selben Tag. Alle Welt war in Trauer darüber. Man zog schwarze Kleider an und das Glockengeläut hörte gar nicht auf. Rosette aber war über den Tod ihrer guten Mama untröstlich. Als der König und die Königin begraben war, bestieg der älteste Prinz den Thron, der ganze Hof schrie dreimal: „Es lebe der König!“, und man dachte wiederum nur an Feste und Ergötzlichkeiten. Der König und sein Bruder sagten zu einander: „Da wir gegenwärtig zu befehlen haben, so müssen wir unsere Schwester aus dem Turm befreien, in welchem sie sich so lange Zeit schon gelangweilt hat." Sie durften nur durch den Garten gehen, so waren sie bei dem Turm, der ganz am Ende des selben erbaut war, so hoch, als nur immer möglich; denn das verstorbene Königspaar wollte, dass ihre Tochter zeitlebens darin zubringe. Rosette saß hinter einem Rahmen und stickte eben ein schönes Kleid. Als sie aber ihre Brüder kommen sah, stand sie auf, ergriff die Hand des Königs und sagte zu ihm: „Du bist nun der König und Gebieter und ich bin deine untertänige Dienerin. Ich bitte dich, befreie mich aus diesem Turm, wo ich vor Bangigkeit und langer Weile umkomme!" Dabei brach sie in Tränen aus. Der König umarmte sie und sagte zu ihr, sie möge nur nicht weinen, denn er komme eben, um sie aus diesem Turm zu erlösen und in ein schönes Schloss zu bringen. „Munter, liebe Schwester“, rief der jüngere Bruder, „fort aus diesem abscheulichen Turm, der König wird dir bald einen Gemahl geben; jetzt sei nur fröhlich."
Als Rosette den schönen Garten voll Blumen, Früchte und Springbrunnen sah, war sie so außer sich vor Erstaunen, dass sie kein Wort hervor bringen konnte. Alles war ihr neu, alles zog ihre Blicke auf sich. Bald blieb sie stehen, bald ging sie weiter, bald pflückte sie Früchte von den Bäumen, bald brach sie Blumen von der Erde. Ihr kleines Hündchen Fretillon, das so grün war wie ein Papagei, nur ein Ohr hatte und zum Entzücken tanzte, lief vor ihr her, bellte in einem zu und machte tausend Luftsprünge. Während er so luftig hin und her tanzte, verlor er sich mit einmal in ein kleines Gebüsch. Die Prinzessin folgte ihm und sah mit lebhafter Verwunderung einen großen Pfau, der ein Rad schlug und ihr so wunderschön vorkam, dass sie kein Auge von ihm wenden konnte. Der König und sein Bruder, welche nach kamen, wollten wissen, was sie so sehr beschäftige. Sie zeigte ihnen den Pfau und fragte, was das sei. Es sei ein Pfau, sagten sie, ein Vogel, welchen man auch zu essen pflege. „Wie“, rief die Prinzessin, „einen so schönen Vogel tötet und isst man? Ich erkläre euch hiermit, dass ich mich nie verheiraten werde, außer an den König der Pfauen, und wenn ich seine Gemahlin sein werde, so soll sich niemand mehr unterstehen, einen Pfau zu essen."
Das Erstaunen des Königs war unbeschreiblich. „Aber, liebe Schwester“, sagte er zu ihr, „wo sollen wir denn den König der Pfauen finden?" „Wo es euch beliebt, aber ich heirate keinen andern als ihn." Mit diesem Entschluss führten sie die beiden Brüder auf das Schloss. Sie verlangte nach dem Pfau; man musste ihn herbeiholen und auf ihr Zimmer bringen, so lieb hatte sie ihn. Die Damen alle, welche Rosette noch nicht gesehen hatten, eilten herbei, der Prinzessin ihr Kompliment zu machen; die Einen brachten ihr Zuckerwerk, die anderen goldbestickte Kleider, schöne Bänder und sonst artige Tändeleien, reich gestickte Schuhe, Perlen und Diamanten. Von allen Seiten beschenkte man sie und sie benahm sich mit solchem Anstand, so artig und zuvor kommend, dankte für alles, was man ihr schenkte, so zierlich und höflich, dass alle Herren und Damen sehr zufrieden von ihr gingen.
Während sie sich nun in angenehmer Gesellschaft die Zeit nicht lang werden ließ, sannen der König und sein Bruder auf nichts weiter, als wie sie den König der Pfauen auffinden könnten, wenn es anders einen solchen in der Welt gäbe. Da ihnen einfiel, dass es wohl nötig sei, ein Bildnis von der Prinzessin zu haben, so ließen sie ein so schönes malen, dass dem Bilde nichts fehlte als die Sprache. Darauf sagten sie zu ihr: „Weil du denn einmal niemand anders heiraten willst, als den König der Pfauen, so wollen wir beide uns aufmachen und ihn dir auf der ganzen Erde suchen gehen. Wir werden wahrhaftig froh sein, wenn wir ihn finden. Sorge du inzwischen für unser Königreich, bis wir zurück kehren." Rosette dankte sehr für die Mühe, die sie sich nehmen wollten, und versprach ihnen, sie wolle schon auf das Beste für alles Sorge tragen und ihr ganzer Zeitvertreib während der Abwesenheit ihrer Brüder solle darin bestehen, dass sie den schönen Pfau ansähe und Fretillon tanzen ließe. Unter vielen Tränen nahmen sie von einander Abschied.
Unterwegs fragten nun die beiden Brüder, wohin sie kamen und wen sie trafen: „Kennt ihr vielleicht den König der Pfauen?" Aber Jedermann antwortete: „Nein, nein." Da gingen sie immer weiter und weiter und so weit endlich, so weit, als noch kein Mensch je vor ihnen gekommen war. Sie kamen in das Königreich der Maikäfer, so viele hatten sie noch nie bei einander gesehen! Es war ein solches Geschwirr, dass der König in Furcht war, davon taub zu werden. Er fragte einen von ihnen, der ihm der vernünftigste schien, ob er nicht wisse, wo der Pfauenkönig zu finden sei. „Gnädiger Herr“, antwortete ihm der Maikäser, „sein Königreich ist dreißig tausend Meilen weit von hier, ihr habt einen gewaltigen Umweg gemacht." „Und woher weißt du das?“, fragte der König. „O, wir kennen euch ganz gut“, versetzte der Maikäfer, „wir kommen ja alle Jahre zwei bis drei Monat in eure Gärten und lassen es uns gut schmecken."
Der König und sein Bruder umarmten hierauf den Maikäferkaiser herzlich, schlossen Freundschaft mit ihm und speisten mit ihm zu Mittag. Sie besahen sich mit Erstaunen alle die Merkwürdigkeiten dieses Landes, wo das kleinste Baumblättchen einen Louisdor gilt, dann setzten sie ihre Wanderung fort und gingen so lange, bis sie endlich in das Land der Pfauen kamen. Da saßen die Pfauen auf allen Bäumen, alles wimmelte von ihnen und auf zwei Meilen weit hörte man sie schreien und schwatzen. Der König sagte zu seinem Bruder: „Wenn der Pfauenkönig selber ein Pfau ist, wie kann ihn unsere Schwester dann heiraten wollen? Nur ein Wahnsinniger könnte seine Zustimmung dazu geben, das wäre eine schöne Geschichte!" Der Prinz war nicht weniger in Sorge. „Was für ein unglücklicher Einfall“, rief er, „ist unserer Schwester in den Sinn gekommen! Wie hat es ihr nur ahnen können, dass es einen König der Pfauen auf der Welt gebe!" Als sie jedoch in die Hauptstadt kamen, so fanden sie, dass die selbe von Menschen bewohnt war, nur dass sie alle Kleider von Pfauenfedern trugen und diese überhaupt sehr in Ehren zu halten schienen. Sie begegneten dem König, der auf einem niedlichen Wagen von Gold und Diamanten, den zwölf Pfauen mit großer Schnelligkeit zogen, spazieren fuhr.
Der König der Pfauen war so schön, so überaus schön, dass die beiden Brüder ganz entzückt davon waren. Er hatte langes, blondes, schön gelocktes Haar und ein blühendes Antlitz; seine Krone bestand aus einem Pfauenschweif. Als er die Brüder erblickte, schloss er sogleich aus ihrer Tracht, dass sie Fremde sein müssten und um das Nähere zu erfahren, hielt er still und ließ sie herbei rufen. Sie nahten sich, begrüßten ihn und sagten: „Mein König, wir kommen weit her, um euch ein schönes Bildnis zu zeigen." Damit zogen sie das Bildnis ihrer Schwester hervor, welches der König der Pfauen mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. „Ich kann nicht glauben“, sagte er, „dass es ein Mädchen von solcher Schönheit auf der Welt gibt." „Sie ist noch hundertmal schöner“, versetzte der König, ihr Bruder. „Ihr habt mich zum Besten“, sprach der König der Pfauen. „Mein König“, sagte der Prinz, „dies hier ist mein Bruder, ein König so gut wie ihr, und das Bildnis stellt unsere Schwester, die Prinzessin Rosette, vor. Wir sind hierher gekommen, euch zu fragen, ob ihr sie zur Gemahlin annehmen wollt; sie ist schön und verständig und wir geben ihr einen Scheffel voll Goldstücke als Mitgift." „Mit Vergnügen“, erwiderte der Pfauenkönig, „mit größtem Vergnügen bin ich dazu bereit, ich werde sie zärtlich lieben, alles, was sie nur begehrt, soll sie bei mir haben, nur muss sie eben so schön sein als ihr Bildnis, und wenn nur ein Zug fehlt, so kostet es euer Leben." „Gut, wir sind es zufrieden“, sagten die beiden Brüder. „Wenn ihr damit zufrieden seid“, fuhr der Pfauenkönig fort, „so bleibt ihr inzwischen bei mir in Gefangenschaft, so lange bis die Prinzessin angekommen ist." Der König und sein Bruder machten durchaus keine Einwendung dagegen, denn sie waren zu sehr überzeugt, dass Rosette noch viel schöner sei als ihr Bildnis.
Der Pfauenkönig ließ sie in ihrer Gefangenschaft mit größter Auszeichnung, ihrem Stande gemäß, behandeln und besuchte sie häufig selbst. Das Bildnis der Prinzessin hatte einen solchen Eindruck auf ihn gemacht, dass er Tag und Nacht keine Ruhe hatte. Die beiden Brüder schrieben sogleich aus ihrem Gefängnis an die Prinzessin, sie möge auf das Schleunigste her kommen, weil der Pfauenkönig sie erwarte. Sie verschwiegen ihr jedoch, dass man sie gefangen hielt, aus Furcht, ihre Schwester zu sehr zu beunruhigen. Als die Prinzessin diesen Brief empfing, dachte sie vor Freude zu sterben. Aller Welt erzählte sie, dass der Pfauenkönig gefunden sei und dass er ihr Gemahl würde; da gab es überall Freudenfeuer, Feuerwerke und immer eine Schmauserei nach der anderen. Die Prinzessin übergab das Reich ihres Bruders den bejahrtesten und weisesten Männern in der Stadt und empfahl ihnen, auf alles Acht zu haben, wenig auszugeben und viel Geld zu sparen, bis der König zurückkomme. Sie bat auch, ihren lieben Pfau wohl in Acht zu nehmen, so dann begab sie sich auf die Reise, auf welche sie niemand mitnahm, als ihre Amme, ihre Milchschwester und Fretillon, das kleine grüne Hündchen. Sie bestiegen nun ein Schiff, welches auf dem Meer ihrer wartete, nachdem man vorher den Scheffel voll Goldtalern und Kleider auf zehn Jahr, täglich zweimal zu wechseln, eingepackt hatte. Da war ein Lachen und Singen, ohne Aufhören. „Sind wir bald da?“, fragte die Amme den Schiffer; „sind wir bald in dem Königreich der Pfauen?" „Noch nicht“, entgegnete er ihr. Ein andermal fragte sie wieder: „Sind wir bald, sind wir bald da?" „Bald“, sagte er, „bald." „Sind wir bald da, sind wir bald da?“, fragte sie wieder ein andermal. „Ja doch, ja“, versetzte der Schiffer. Als die Amme dies hörte, setzte sie sich neben ihn an das Ende des Schiffes und sagte: „Wenn du willst, so kannst du auf immer ein reicher Mann werden." Er antwortete: „Das will ich wohl“, und sie fuhr fort: „Wenn du willst, so kannst du dir eine Menge Gold verdienen." „Ich verlange nichts weiter“, war seine Antwort. „Nun denn“, sagte sie, „so musst du mir behilflich sein, diese Nacht, wenn die Prinzessin schläft, sie ins Meer zu werfen. Wenn sie ertrunken ist, so ziehe ich ihre schönen Kleider meiner Tochter an und wir bringen sie zum Pfauenkönig, der sie mit vielem Vergnügen heiraten wird. Dir aber will ich zum Lohn so viel Diamanten geben, als um deinen Hals gehen."
Der Schiffer war sehr erstaunt über den Antrag der Amme und entgegnete ihr, es sei doch Schade, eine so schöne Prinzessin zu ersäufen und er habe allzu viel Mitleid mit ihr; aber die Amme setzte ihm eine Flasche Wein vor und gab ihm so viel zu trinken, bis er zuletzt alle Bedenklichkeiten vertrunken hatte. Als die Nacht einbrach, legte sich die Prinzessin wie gewöhnlich zu Bett; ihr kleiner Fretillon schlief, zu ihren Füßen geschmiegt, und rührte keine Pfote. Rosette lag im tiefsten Schlummer, als die nichts würdige Amme, welche nicht schlief, den Schiffer holte. Sie gingen in das Zimmer der Prinzessin, nahmen sie, ohne sie aufzuwecken, samt ihren Federbetten, ihren Matratzen, ihren Tüchern, ihren Decken und warfen sie mit dem allen ins Meer, wobei die Milchschwester aus allen Kräften half. So fest aber schlief die Prinzessin, dass sie davon nicht aufwachte. Zum Glück bestand ihr Bett aus Phönixfedern, die sehr selten sind und die Eigenschaft haben, dass sie nicht versinken, so dass sie also in ihrem Bette wie in einem Kahn schwamm. In dessen drang doch das Wasser nach und nach in das Bett und durch die Matratze und Rosette wachte davon auf. Da sie sich unruhig von einer Seite zur anderen wendete, so wurde auch Fretillon munter. Er hatte eine so feine Nase, dass er gleich die Nähe der Plattfische und der Stockfische witterte und so nach ihnen zu kläffen und zu kläffen anfing, dass alle anderen Fische davon unruhig wurden. Sie schwammen hin und her und die großen Fische stießen mit dem Kopf gegen das Bett der Prinzessin, welches, da es keinen Halt hatte, sich wie ein Kreisel herum dreht. Die Prinzessin war sehr erstaunt darüber. „Tanzt denn“, rief sie, „unser Schiff auf dem Wasser? ich habe in meinem ganzen Leben noch keine so unruhige Nacht zu gebracht." Fretillon kläffte immerzu und machte einen heillosen Lärm. Die nichtswürdige Amme und der Fischer hörten ihn noch von weitem und sagten: „Ei siehe, das ist das kleine närrische Hündchen, es trinkt mit seiner Gebieterin auf unsere Gesundheit. Aber wir wollen uns nur beeilen, dass wir ankommen."
Sie befanden sich schon ganz dicht an der Hauptstadt des Königs der Pfauen. Dieser hatte seiner Braut an das Meeresufer hundert Karossen entgegen geschickt, welche mit allen möglichen Tieren bespannt waren. Da gab es Löwen, Bären, Hirsche, Wölfe, Pferde, Stiere, Adler, Pfauen. Der Wagen, in welchen sich die Prinzessin Rosette setzen sollte, wurde von sechs blauen Affen gezogen; die sprangen und tanzten und machten tausend luftige Kunststücke. Sie hatten ein schönes Geschirr von rotem Samt mit Goldplatten. Zur Unterhaltung der Prinzessin hatte der König gleichfalls sechzig junge Mädchen geschickt, gekleidet in alle Farben und blitzend von Gold und Silber. Die Amme hatte sich die größte Mühe von der Welt gegeben, ihre Tochter heraus zu putzen. Sie zog ihr das schönste Kleid der Prinzessin an, und steckte ihr deren Diamanten ins Haar, ans Kleid und wo es sonst nur immer gehen wollte; aber sie blieb mit allem ihrem Putz dennoch hässlicher als eine Meerkatze. Sie hatte schmutzige schwarze Haare, schielende Augen, krumme Beine und einen großen Buckel mitten auf dem Rücken, und dabei war sie boshaft, tölpisch und brummig. Als sie aus dem Schiff stieg, gerieten alle Leute des Pfauenkönigs in ein solches Erstaunen, dass sie kein Wort hervorbringen konnten. „Nun, was ist das?“, rief sie. „Seid ihr etwa im Schlafe? Frisch, hurtig, bringt mir zu essen her. Ihr seid mir schönes Volk! Aufhängen will ich euch lassen." Als die Leute dies hörten, sprachen sie ganz verwundert: „Was für ein nichts würdiges Geschöpf! Sie ist eben so boshaft als garstig, das ist eine schöne Heirat für unseren König! Das war wohl der Mühe wert, sie vom Ende der Welt her holen zu lassen!"
Inzwischen spielte sie immerfort die Gebieterin und um weniger als nichts teilte sie aller Welt Ohrfeigen und Faustschläge aus. Da ihr Gefolge sehr groß war, so ging es langsam vorwärts. Sie brüstete sich wie eine Königin in ihrer Karosse. Aber alle die Pfauen, die sich auf die Bäume gesetzt hatten, um sie im Vorbeifahren zu begrüßen, und die sich vorgenommen hatten zu rufen: „Es lebe die schöne Königin Rosette!“, schrien jetzt, da sie ein solches Ungetüm erblickten: „Pfui, pfui, wie hässlich ist sie!" Sie geriet darüber außer sich vor Wut und rief ihrer Leibwache zu: „Schießt mir gleich da diese nichts würdigen Pfauen tot, die mich so unverschämt verhöhnen." Aber die Pfauen flogen rasch davon und machten sich nur über sie lustig. Der Spitzbube von Schiffer, der dies alles mit ansah, sagte ganz leise zu der Amme: „Gevatterin, wir kommen übel an, eure Tochter sollte hübscher sein." „Schweig, du Dummkopf“, entgegnete sie ihm, „du wirst uns ins Unglück bringen." Man benachrichtigte den König, die Prinzessin sei im Anzug. „Nun“, fragte er, „haben ihre Brüder die Wahrheit gesagt? Ist sie noch schöner als ihr Bildnis?" „Gnädiger Herr“, erwiderte man, „es wäre schon genug, wenn sie auch nur eben so schön wäre." „Ja wohl“, sagte der König, „ich würde ganz zufrieden damit sein." Ein großer Lärm auf dem Schlosshof benachrichtigte ihn von ihrer Ankunft. In dem verworrenen Geräusch so vieler Stimmen konnte er nichts weiter unterscheiden, als: „Pfui, pfui, was für ein hässliches Geschöpf!" Der König glaubte, man spreche vielleicht von einem Zwerg oder von irgend einer Bestie, die man mitgebracht habe, denn es konnte ihm gar nicht in den Sinn kommen, dass dies in der Tat ihr selber gelte.
Das Bildnis der Prinzessin wurde ganz offen auf einer langen Stange getragen und der König ging mit würdevollem Ernst hinter her, nebst allen seinen Großen, seinen Pfauen und den Gesandten der benachbarten Königreiche. Der König der Pfauen empfand große Ungeduld, seine schöne Braut endlich zu Gesicht zu bekommen. Aber als er sie nun sah, fehlte wenig, dass er auf der Stelle den Tod gehabt hätte. Er geriet in die äußerste Wut, zerriss seine Kleider, und sie durfte ihm nicht zu nahe kommen; so entsetzte er sich vor ihr. „Wie“, rief er, „diese beiden Schurken, die ich gefangen halte, haben also die Kühnheit gehabt, mich so zu verspotten, mir eine Meerkatze wie dieses Geschöpf zur Gemahlin anzubieten? sie sollen mir mit dem Leben dafür büßen. Heda, man werfe sogleich dieses Ungeheuer samt ihrer Amme und dem, welcher sie her brachte, in die Tiefe des großen Turmes." Inzwischen warteten der König und sein Bruder, da sie wussten, dass ihre Schwester ankommen sollte, sehnsüchtig auf den Augenblick, sie willkommen zu heißen. Anstatt aber, dass man kam, ihr Gefängnis zu öffnen und sie in Freiheit zu setzen, wie sie mit Bestimmtheit hofften, erschien der Kerkermeister mit einer Schar Soldaten und ließ sie in eine ganz dunkle Höhle hinabsteigen, wo es von ekelhaftem Gewürm wimmelte und wo ihnen das Wasser bis an den Hals ging. Sie waren vor Erstaunen und Betrübnis ganz außer Fassung. „Ach!“, sprachen sie zu einander, „das ist eine traurige Hochzeit für uns! Was in aller Welt kann ein so großes Unglück über uns bringen?" Sie konnten nichts auffinden, nur das schien ihnen gewiss, dass man ihren Tod beschlossen habe, worüber sie außerordentlich bekümmert waren.
Drei Tage vergingen, ohne dass sie jemand sahen noch hörten. Nach Verlauf von drei Tagen kam der Pfauenkönig selbst und überhäufte sie mit Schmähungen. „Ihr habt euch“, rief er ihnen durch die kleine Öffnung ihres Gefängnisses zu, „den Titel eines Königs und eines Prinzen angemaßt, um mich zu fangen und zu verlocken, eure Schwester zu heiraten; aber ihr seid nichts als elende Bettler, die nicht des Wassers wert sind, welches sie trinken. Aber man wird sehr kurzen Prozess mit euch machen. Der Strick ist schon fertig, an welchem man euch aufknüpfen wird." „König der Pfauen“, antwortete der König, Rosettens Bruder, voll Zorn: „Geht nicht so rasch damit zu Werke, denn es möchte euch reuen. Ich bin ein König, so gut wie ihr. Ich besitze ein ansehnliches Königreich, Geld und Soldaten, ich habe nur zu befehlen. Hoho, was ist das für ein spaßhafter Einfall von euch, uns aufhängen lassen zu wollen. Haben wir euch denn etwas gestohlen?" Als der König diese entschlossene Sprache hörte, wusste er nicht, woran er war, und hatte fast Lust, sie nebst ihrer Schwester davon gehen zu lassen, ohne ihnen ein Leid zuzufügen. Aber einer seiner Höflinge, der ein Erzspeichellecker war, brachte ihn wieder auf andere Gedanken, in dem er ihm vorstellte, alle Welt werde sich über ihn lustig machen, wenn er nicht Rache nehme und man würde ihn einen kleinen Zaunkönig heißen. Er schwur daher, ihnen nicht zu verzeihen und befahl, ihnen den Prozess zu machen. Er dauerte nicht lange, denn man hatte kaum das Bildnis der wirklichen Prinzessin Rosette mit dem Scheusal verglichen, welches statt ihrer angekommen war und sich für sie ausgab, so verurteilte man beide Brüder zum Strange, weil sie Betrüger seien und dem König statt einer schönen Prinzessin, welche sie ihm versprochen, eine garstige Bäuerin gebracht hätten. Dieses Urteil wurde ihnen im Gefängnisse mit großen Feierlichkeiten bekannt gemacht. Aber die Brüder riefen, sie hätten nicht gelogen, ihre Schwester sei eine Prinzessin und schöner als der Tag. Es sei hier etwas Unbegreifliches im Spiele, und sie verlangten sieben Tage Frist, ehe man sie zum Tode führe, vielleicht komme in dieser Zeit ihre Unschuld ans Licht. Der König der Pfauen wollte sich, so erzürnt wie er war, kaum dazu verstehen, ihnen diese Gnade zu bewilligen, endlich aber gab er es zu.
Während dies alles bei Hofe vorgeht, wollen wir uns ein wenig nach der armen Prinzessin Rosette umsehen. Sie war bei Anbruch des Tages sehr erstaunt, sich mitten auf dem Meere, ohne Nachen, ohne Beistand zu finden, und Fretillon des gleichen. Sie brach in Tränen aus und weinte so bitterlich, so bitterlich, dass es die Fische zum Mitleid bewegte. Was sollte sie tun? was sollte aus ihr werden? „Gewiss“, sagte sie, „hat mich der König der Pfauen ins Meer werfen lassen, die Heirat wird ihn gereut haben, und um auf gute Art meiner los zu werden, ließ er mich ins Meer werfen. Was für ein seltsamer Mensch“, fuhr sie fort, „ich würde ihn doch so zärtlich geliebt haben! Wir hätten ein so glückliches Leben zusammen geführt." Darauf weinte sie noch viel heftiger, denn sie konnte auch jetzt noch nicht aufhören, ihn zu lieben. So schwamm sie zwei Tage lang auf dem Meere hin und her, bis auf die Haut durchnässt und fast erstarrt vor Kälte. Wenn nicht der kleine Fretillon gewesen wäre, der ihr ein wenig das Herz erwärmte, so wurde sie hundertmal des Todes gewesen sein. Dabei hungerte sie ganz entsetzlich. Zum Glück erblickte sie einige Austern, mit denen sie ihren Hunger stillte, und auch Fretillon, obgleich er diese Speise nicht sonderlich liebte, musste sich dazu bequemen. Die größte Angst aber empfand Rosette jedes Mal beim Einbruch der Nacht; dann rief sie ihrem Hündchen zu: „Belle, belle, mein Fretillon, dass uns die Raubfische nicht auffressen." So bellte er denn jede Nacht ohne Aufhören und inzwischen war das Bett der Prinzessin dem Ufer immer näher gekommen. An diesem Ufer, da wohnte ein guter alter Mann ganz allein in seiner Hütte in einer einsamen Gegend. Er war sehr arm und kümmerte sich gleich wohl sehr wenig um die Güter dieser Welt.Als er Fretillons Gebell hörte, war er ganz erstaunt, denn es ließ sich nicht leicht ein Hund in dieser Gegend blicken. Er glaubte also, Reisende hätten sich hier her verirrt und ging mitleidig wie er war, hinaus, um ihnen den Weg zu zeigen. Da sah er mit einmal die Prinzessin und Fretillon auf dem Meer treiben. Die Prinzessin aber hatte ihn kaum erblickt, so streckte sie die Arme nach ihm aus und rief ihm zu: „Guter Greis, rette mich, sonst komme ich um, denn ich verschmachte hier schon seit zwei Tagen." Als er sie so kläglich reden hörte, ging es ihm sehr nahe und er kehrte nach Hause zurück, um einen langen Haken zu holen. Mit diesem ging er bis an den Hals ins Wasser, und obgleich er mehr als einmal in Gefahr war, zu ertrinken, gelang es ihm doch, das Bett bis ans Ufer zu ziehen.
Rosette und Fretillon waren sehr vergnügt, wieder auf festem Boden zu sein; sie dankten von ganzem Herzen dem guten Manne, hüllten sich dann in ihre Decken und eilten barfuß in die Hütte. Dort zündete der Alte gleich ein kleines Feuer von dürrem Reisig an, nahm das schönste Kleid seiner seligen Frau aus dem Koffer nebst Strümpfen und Schuhen und die Prinzessin zog sich alles an. Der geringen bäuerischen Tracht ungeachtet blieb sie doch so schön wie der Tag. Fretillon tanzte um sie herum und suchte sie mit seinen Sprüngen zu erheitern. Der alte Mann sah wohl, dass Rosette eine vornehme Dame war, denn ihre Bettdecken waren ganz mit Gold und Silber gestickt und ihre Matratzen von Atlas. Er bat sie, ihm ihre Geschichte zu erzählen, und versprach, wenn sie es wünsche, niemanden nur ein Wort davon zu entdecken. Sie erzählte ihm alles, von Anfang bis zu Ende, unter häufigen Tränen, denn sie glaubte noch immer, der Pfauenkönig sei es, der sie ins Meer habe werfen lassen. „Was fangen wir nun an, meine Tochter?“, sagte der Alte. „Ihr seid eine vornehme Prinzessin, an gute Bissen gewöhnt, und ich habe nur Schwarzbrot und weiße Rüben, ihr werdet also sehr schlechte Mahlzeiten halten. Wenn ich euch einen Rat geben dürfte, so ginge ich hin und meldete dem Pfauenkönig, dass ihr hier seid. Gewiss, wenn er euch nur gesehen hätte, ihr wärt seine Gemahlin geworden." „Ach nein“, versetzte Rosette, „es ist ein böser Mensch, er würde mich umbringen lassen; aber wenn ihr ein kleines Körbchen habt, so bindet es meinem Hündchen um den Hals, und es müsste schlimm zugehen, wenn es mich nicht mit Essen versorgte." Der alte Mann gab der Prinzessin ein Körbchen; sie band es Fretillon an den Hals und sagte zu ihm: „Geh damit in die beste Küche in der Stadt, und hole mir was du darin findest."
Fretillon lief nach der Stadt und da es keine bessere Küche als die des Königs gab, so lief er dort hinein, deckte die Töpfe auf, nahm geschickt alles heraus, was darin war, und kehrte nach Hause zurück. Rosette sagte zu ihm: „Lauf wieder zurück, geh in die Speisekammer und hole mir das Beste, was du dort findest." Fretillon begab sich in die Speisekammer, nahm weißes Brot, Muskateller Wein, alle Arten von Früchten und Zuckerwerk und schleppte so viel fort, als er nur tragen konnte. Als der Pfauenkönig zu Mittag speisen wollte, waren Küche und Keller leer. Man sah sich verwundert an und der König geriet in einen schrecklichen Zorn: „Ich soll also wohl“, sagte er, „heute Mittag nichts essen; nun, so will ich mich wenigstens auf den Abend an einem guten Braten erholen." Der Abend kam und die Prinzessin sagte zu Fretillon: „Geh nach der Stadt in die beste Küche und hole mir einen guten Braten." Fretillon tat, wie seine Gebieterin ihm befahl, begab sich wieder ganz sacht in die Küche des Königs, da er keine bessere wusste, nahm den ganzen Braten, während die Köche den Rücken drehten, vom Spieße und lief damit fort. Der Braten hatte ein so appetitliches Aussehen, dass man die größte Luft zu essen bekam, wenn man ihn nur ansah. Fretillon brachte sein Körbchen ganz voll der Prinzessin, kehrte dann sogleich wieder um nach der Speisekammer und nahm das ganze Zuckerwerk und allerlei Eingemachtes mit sich fort. Weil der König nicht zu Mittag gespeist hatte, empfand er starken Hunger und wollte zeitig zu Abend essen; allein es war nichts da. Er geriet in einen ganz erschrecklichen Zorn und musste, ohne Abendbrot gegessen zu haben, zu Bette gehen. Am folgenden Tag zu Mittag und zu Abend ging es eben wieder so, so dass der König drei ganze Tage ohne Essen und Trinken blieb, denn wenn er sich zu Tisch setzen wollte, war alles fort. Sein Hofmarschall befand sich in großer Sorge deshalb, denn er befürchtete, der König werde zuletzt Hungers sterben. Er verbarg sich also in der Küche in einem Winkel und sah unverwandt nach dem Topf, der am Feuer stand. Ganz erstaunt sah er ein kleines grünes einöhriges Hündchen herein schleichen, welches den Topf aufdeckte und das Fleisch in sein Körbchen legte. Er folgte ihm, um zu erfahren, wo es hin ginge. Das Hündchen lief zum Thor hinaus und er folgte ihm immer zu, bis in die Hütte des guten Alten. Hierauf kehrte er zurück und hinter brachte dem Könige, dass seine Braten Mittags und Abends zu einem armen Bauern wanderten.
Der König war nicht wenig erstaunt darüber und befahl, den Bauern herbei zu holen. Der Hofmarschall ging selbst in Begleitung einiger Häscher, und sie fanden den Alten, wie er eben mit der Prinzessin von dem Braten der königlichen Tafel seine Mittagsmahlzeit hielt. Er ließ Beide gefangen nehmen und mit starken Stricken binden, des gleichen auch Fretillon. Als man den König benachrichtigte, dass sie da seien, sagte er: „Morgen ist ohne dies der siebente und letzte Tag, den ich jenen beiden Schurken bewilligt habe; die Bratendiebe mögen mit ihnen zugleich sterben. Daraus begab er sich in das Gerichtszimmer. Der Alte warf sich ihm zu Füßen und sagte, er wolle ihm die ganze Geschichte erzählen. Indem er erzählte, sah der König die schöne Prinzessin an und empfand Mitleid mit ihren Tränen. Als er nun aber von dem guten Alten hörte, dass dies die wirkliche Prinzessin Rosette sei und dass man sie ins Meer geworfen habe, sprang er hoch in die Höhe, wie schwach er auch von seinem dreitägigen Fasten war, lief die Prinzessin zu umarmen, löste die Stricke, mit denen sie gebunden war, und sagte ihr, dass er sie von ganzem Herzen liebe. Sogleich beeilte man sich, auch die Prinzen herbei zu holen, die nicht anders glaubten, als man führe sie zum Tode, und deshalb sehr traurig und mit gesenktem Haupt einher kamen; so dann brachte man auch die Amme und ihre Tochter. Alle erkannten sich auf den ersten Blick. Rosette fiel ihren Brüdern um den Hals, die Amme und ihre Tochter nebst dem Schiffer warfen sich auf die Knie und baten um Gnade.
Die Freude war so groß, dass der König und die Prinzessin ihnen verziehen, der gute Alte aber wurde reichlich belohnt und blieb für immer in dem Palast. Rosettens Brüdern gab der Pfauenkönig jede mögliche Genugtuung und bezeigte seinen Schmerz, sie so unwürdig behandelt zu haben. Die Amme gab der Prinzessin ihre schönen Kleider und ihren Scheffel voll Goldstücke zurück. Vierzehn Tage währten die Hochzeitsfestlichkeiten, und alles war vergnügt, Fretillon nicht zu vergessen, der lauter Rebhühnerflügel zu essen bekam.
RICDIN-RICDON ...
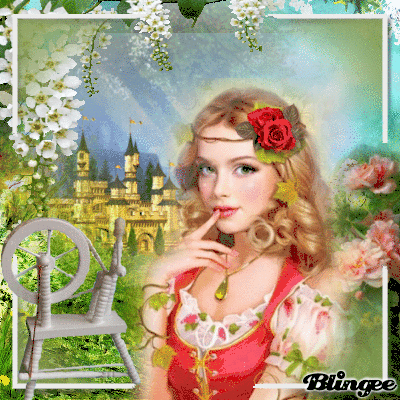
Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten zwei schöne Prinzen. Bei ihrer Geburt hatte die Königin jedes Mal die Feen dazu eingeladen und sie gebeten, ihr die Schicksale ihrer Kinder vorher zu sagen. Zum dritten Mal gebar sie eine Tochter, die so reizend war, dass man sie nicht ansehen konnte, ohne sie zu lieben. Nachdem die Königin die Feen, welche sie besuchten, aufs Beste bewirtet hatte, sagte sie beim Abschied zu ihnen: „Seid doch so gütig und sagt mir nun auch, was Rosetten, so nannte man die kleine Prinzessin, begegnen wird. Die Feen entschuldigten sich, sie hätten ihr Zauberbuch zu Hause gelassen. Sie wollten ein andermal wieder kommen und es mitbringen. „Ach!“, sagte die Königin, „das bedeutet nichts Gutes. Ihr wollt mich durch eine schlimme Weissagung nicht betrüben, aber ich bitte euch, verhehlt mir nichts, lasst mich alles wissen."
Die Feen wollten zwar durchaus nicht mit der Sprache heraus, dadurch aber wurde die Königin nur umso begieriger, zu erfahren, was es sei. Endlich sagte die vornehmste unter ihnen: „Wir fürchten, Rosette wird ihren Brüdern großes Unglück bereiten, sie werden um ihretwillen bei irgendeiner Gelegenheit den Tod finden. Das ist alles, was wir von dieser kleinen reizenden Prinzessin vorher wissen. Es tut uns sehr leid, euch eben nichts Besseres verkünden zu können." Damit gingen sie fort; die Königin aber wurde so traurig, so schwermütig, dass der König die Betrübnis in ihrem Gesicht las und sie fragte, was sie denn hätte. Sie antwortete, sie sei dem Feuer zu nahe gekommen und habe sich den ganzen Flachs verbrannt, der auf der Spindel gewesen. „Nichts weiter?“, sagte der König, ging in den Speicher und brachte ihr mehr Flachs, als sie in hundert Jahren verspinnen konnte.
Aber die Königin blieb traurig wie zuvor. Da fragte er wieder, was sie denn hätte. Sie antwortete ihm, als sie am Ufer des Flusses spazieren gegangen sei, habe sie ihren Pantoffel von grünem Atlas hinein fallen lassen. „Nichts weiter?“, fragte der König, ließ alle Schuster im ganzen Königreich zusammen holen und brachte ihr bald zehntausend Pantoffeln von grünem Atlas, aber sie hörte nicht auf traurig zu sein. Er fragte wieder, was sie denn hätte. Und sie antwortete, ihr Trauring sei ihr ins Essen gefallen und sie habe ihn hinunter geschluckt. Da sah der König, dass sie die Unwahrheit sprach, denn er selbst hatte den Ring in seinem Gewahrsam und entgegnete ihr: „Meine teure Gemahlin, du redest nicht die Wahrheit, denn ich habe ja selbst deinen Trauring bei mir wohl verwahrt."
Die Königin war sehr betroffen, auf einer Lüge ertappt zu werden, denn das ist die unangenehmste Sache von der Welt, und da sie sah, dass der König verdrießlich war, so gestand sie ihm, was ihr die Feen in Betreff der kleinen Rosette verkündigt hatten und bat ihn, wenn er ein Mittel dagegen wisse, es ihr zu sagen. Der König bekümmerte sich außerordentlich darüber; endlich sagte er zu der Königin: „Ich weiß wirklich kein anderes Mittel, unsere beiden Söhne zu retten, als dass wir die Kleine noch in der Wiege umbringen lassen. Aber die Königin schrie laut auf, weit eher würde sie selbst den Tod erleiden, als eine solche Grausamkeit zugeben und er möge nur ja auf etwas anderes denken. Als der König und die Königin noch damit beschäftigt waren, hinterbrachte man ihr, dass in einem großen benachbarten Walde ein alter Einsiedler lebe, der in einem Baumstamm wohne und den man weit und breit um Rat fragen komme. „Zu dem muss ich auch“, sagte die Königin, „die Feen haben mir nur das Nebel verkündigt, aber das Mittel dagegen zu sagen vergessen."
Sie bestieg also eines Morgens früh ein hübsches, weißes Maultier, welches ganz mit Gold beschlagen war, und machte sich mit zwei ihrer Hofdamen, deren jede ein niedliches Pferdchen ritt, auf den Weg. Als die Königin und ihre Frauen an den Wald kamen, stiegen sie aus Ehrfurcht vor dem Einsiedler herab und gingen zu Fuß auf den Baum zu, in welchem er wohnte. Der Einsiedler liebte eben nicht Frauen bei sich zu sehen, aber da er sah, dass es die Königin war, sagte er zu ihr: „Seid bestens willkommen, was verlangt ihr von mir?" Sie erzählten ihm, was die Feen von Rosette gesagt hätten und fragten ihn um seinen Rat. Da entgegnete er, man müsse die Prinzessin in einen Turm einsperren und diesen dürfe sie zeitlebens nicht verlassen. Die Königin bedankte sich sehr, reichte ihm ein ansehnliches Geschenk und eilte, ihren Gemahl davon in Kenntnis zu setzen. Als der König den Rat des Einsiedlers erfuhr, ließ er schleunigst einen großen Turm bauen und bestimmte ihn zu dem Aufenthalt seiner Tochter. Damit ihr die Zeit nicht lang werde, so besuchten sie der König, die Königin und ihre beiden Brüder alle Tage. Die Brüder liebten ihre Schwester, denn sie war das schönste und anmutigste Geschöpf, welches man je gesehen hat. Als sie fünfzehn Jahr alt war, erinnerten die Prinzen ihre Eltern, dass es wohl Zeit sei, ihre Schwester zu verheiraten; ihre Majestäten aber lachten darüber und gaben ihnen keine bestimmte Antwort.
Da verfielen der König und die Königin in eine schwere Krankheit und starben beide fast an ein und dem selben Tag. Alle Welt war in Trauer darüber. Man zog schwarze Kleider an und das Glockengeläut hörte gar nicht auf. Rosette aber war über den Tod ihrer guten Mama untröstlich. Als der König und die Königin begraben war, bestieg der älteste Prinz den Thron, der ganze Hof schrie dreimal: „Es lebe der König!“, und man dachte wiederum nur an Feste und Ergötzlichkeiten. Der König und sein Bruder sagten zu einander: „Da wir gegenwärtig zu befehlen haben, so müssen wir unsere Schwester aus dem Turm befreien, in welchem sie sich so lange Zeit schon gelangweilt hat." Sie durften nur durch den Garten gehen, so waren sie bei dem Turm, der ganz am Ende des selben erbaut war, so hoch, als nur immer möglich; denn das verstorbene Königspaar wollte, dass ihre Tochter zeitlebens darin zubringe. Rosette saß hinter einem Rahmen und stickte eben ein schönes Kleid. Als sie aber ihre Brüder kommen sah, stand sie auf, ergriff die Hand des Königs und sagte zu ihm: „Du bist nun der König und Gebieter und ich bin deine untertänige Dienerin. Ich bitte dich, befreie mich aus diesem Turm, wo ich vor Bangigkeit und langer Weile umkomme!" Dabei brach sie in Tränen aus. Der König umarmte sie und sagte zu ihr, sie möge nur nicht weinen, denn er komme eben, um sie aus diesem Turm zu erlösen und in ein schönes Schloss zu bringen. „Munter, liebe Schwester“, rief der jüngere Bruder, „fort aus diesem abscheulichen Turm, der König wird dir bald einen Gemahl geben; jetzt sei nur fröhlich."
Als Rosette den schönen Garten voll Blumen, Früchte und Springbrunnen sah, war sie so außer sich vor Erstaunen, dass sie kein Wort hervor bringen konnte. Alles war ihr neu, alles zog ihre Blicke auf sich. Bald blieb sie stehen, bald ging sie weiter, bald pflückte sie Früchte von den Bäumen, bald brach sie Blumen von der Erde. Ihr kleines Hündchen Fretillon, das so grün war wie ein Papagei, nur ein Ohr hatte und zum Entzücken tanzte, lief vor ihr her, bellte in einem zu und machte tausend Luftsprünge. Während er so luftig hin und her tanzte, verlor er sich mit einmal in ein kleines Gebüsch. Die Prinzessin folgte ihm und sah mit lebhafter Verwunderung einen großen Pfau, der ein Rad schlug und ihr so wunderschön vorkam, dass sie kein Auge von ihm wenden konnte. Der König und sein Bruder, welche nach kamen, wollten wissen, was sie so sehr beschäftige. Sie zeigte ihnen den Pfau und fragte, was das sei. Es sei ein Pfau, sagten sie, ein Vogel, welchen man auch zu essen pflege. „Wie“, rief die Prinzessin, „einen so schönen Vogel tötet und isst man? Ich erkläre euch hiermit, dass ich mich nie verheiraten werde, außer an den König der Pfauen, und wenn ich seine Gemahlin sein werde, so soll sich niemand mehr unterstehen, einen Pfau zu essen."
Das Erstaunen des Königs war unbeschreiblich. „Aber, liebe Schwester“, sagte er zu ihr, „wo sollen wir denn den König der Pfauen finden?" „Wo es euch beliebt, aber ich heirate keinen andern als ihn." Mit diesem Entschluss führten sie die beiden Brüder auf das Schloss. Sie verlangte nach dem Pfau; man musste ihn herbeiholen und auf ihr Zimmer bringen, so lieb hatte sie ihn. Die Damen alle, welche Rosette noch nicht gesehen hatten, eilten herbei, der Prinzessin ihr Kompliment zu machen; die Einen brachten ihr Zuckerwerk, die anderen goldbestickte Kleider, schöne Bänder und sonst artige Tändeleien, reich gestickte Schuhe, Perlen und Diamanten. Von allen Seiten beschenkte man sie und sie benahm sich mit solchem Anstand, so artig und zuvor kommend, dankte für alles, was man ihr schenkte, so zierlich und höflich, dass alle Herren und Damen sehr zufrieden von ihr gingen.
Während sie sich nun in angenehmer Gesellschaft die Zeit nicht lang werden ließ, sannen der König und sein Bruder auf nichts weiter, als wie sie den König der Pfauen auffinden könnten, wenn es anders einen solchen in der Welt gäbe. Da ihnen einfiel, dass es wohl nötig sei, ein Bildnis von der Prinzessin zu haben, so ließen sie ein so schönes malen, dass dem Bilde nichts fehlte als die Sprache. Darauf sagten sie zu ihr: „Weil du denn einmal niemand anders heiraten willst, als den König der Pfauen, so wollen wir beide uns aufmachen und ihn dir auf der ganzen Erde suchen gehen. Wir werden wahrhaftig froh sein, wenn wir ihn finden. Sorge du inzwischen für unser Königreich, bis wir zurück kehren." Rosette dankte sehr für die Mühe, die sie sich nehmen wollten, und versprach ihnen, sie wolle schon auf das Beste für alles Sorge tragen und ihr ganzer Zeitvertreib während der Abwesenheit ihrer Brüder solle darin bestehen, dass sie den schönen Pfau ansähe und Fretillon tanzen ließe. Unter vielen Tränen nahmen sie von einander Abschied.
Unterwegs fragten nun die beiden Brüder, wohin sie kamen und wen sie trafen: „Kennt ihr vielleicht den König der Pfauen?" Aber Jedermann antwortete: „Nein, nein." Da gingen sie immer weiter und weiter und so weit endlich, so weit, als noch kein Mensch je vor ihnen gekommen war. Sie kamen in das Königreich der Maikäfer, so viele hatten sie noch nie bei einander gesehen! Es war ein solches Geschwirr, dass der König in Furcht war, davon taub zu werden. Er fragte einen von ihnen, der ihm der vernünftigste schien, ob er nicht wisse, wo der Pfauenkönig zu finden sei. „Gnädiger Herr“, antwortete ihm der Maikäser, „sein Königreich ist dreißig tausend Meilen weit von hier, ihr habt einen gewaltigen Umweg gemacht." „Und woher weißt du das?“, fragte der König. „O, wir kennen euch ganz gut“, versetzte der Maikäfer, „wir kommen ja alle Jahre zwei bis drei Monat in eure Gärten und lassen es uns gut schmecken."
Der König und sein Bruder umarmten hierauf den Maikäferkaiser herzlich, schlossen Freundschaft mit ihm und speisten mit ihm zu Mittag. Sie besahen sich mit Erstaunen alle die Merkwürdigkeiten dieses Landes, wo das kleinste Baumblättchen einen Louisdor gilt, dann setzten sie ihre Wanderung fort und gingen so lange, bis sie endlich in das Land der Pfauen kamen. Da saßen die Pfauen auf allen Bäumen, alles wimmelte von ihnen und auf zwei Meilen weit hörte man sie schreien und schwatzen. Der König sagte zu seinem Bruder: „Wenn der Pfauenkönig selber ein Pfau ist, wie kann ihn unsere Schwester dann heiraten wollen? Nur ein Wahnsinniger könnte seine Zustimmung dazu geben, das wäre eine schöne Geschichte!" Der Prinz war nicht weniger in Sorge. „Was für ein unglücklicher Einfall“, rief er, „ist unserer Schwester in den Sinn gekommen! Wie hat es ihr nur ahnen können, dass es einen König der Pfauen auf der Welt gebe!" Als sie jedoch in die Hauptstadt kamen, so fanden sie, dass die selbe von Menschen bewohnt war, nur dass sie alle Kleider von Pfauenfedern trugen und diese überhaupt sehr in Ehren zu halten schienen. Sie begegneten dem König, der auf einem niedlichen Wagen von Gold und Diamanten, den zwölf Pfauen mit großer Schnelligkeit zogen, spazieren fuhr.
Der König der Pfauen war so schön, so überaus schön, dass die beiden Brüder ganz entzückt davon waren. Er hatte langes, blondes, schön gelocktes Haar und ein blühendes Antlitz; seine Krone bestand aus einem Pfauenschweif. Als er die Brüder erblickte, schloss er sogleich aus ihrer Tracht, dass sie Fremde sein müssten und um das Nähere zu erfahren, hielt er still und ließ sie herbei rufen. Sie nahten sich, begrüßten ihn und sagten: „Mein König, wir kommen weit her, um euch ein schönes Bildnis zu zeigen." Damit zogen sie das Bildnis ihrer Schwester hervor, welches der König der Pfauen mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. „Ich kann nicht glauben“, sagte er, „dass es ein Mädchen von solcher Schönheit auf der Welt gibt." „Sie ist noch hundertmal schöner“, versetzte der König, ihr Bruder. „Ihr habt mich zum Besten“, sprach der König der Pfauen. „Mein König“, sagte der Prinz, „dies hier ist mein Bruder, ein König so gut wie ihr, und das Bildnis stellt unsere Schwester, die Prinzessin Rosette, vor. Wir sind hierher gekommen, euch zu fragen, ob ihr sie zur Gemahlin annehmen wollt; sie ist schön und verständig und wir geben ihr einen Scheffel voll Goldstücke als Mitgift." „Mit Vergnügen“, erwiderte der Pfauenkönig, „mit größtem Vergnügen bin ich dazu bereit, ich werde sie zärtlich lieben, alles, was sie nur begehrt, soll sie bei mir haben, nur muss sie eben so schön sein als ihr Bildnis, und wenn nur ein Zug fehlt, so kostet es euer Leben." „Gut, wir sind es zufrieden“, sagten die beiden Brüder. „Wenn ihr damit zufrieden seid“, fuhr der Pfauenkönig fort, „so bleibt ihr inzwischen bei mir in Gefangenschaft, so lange bis die Prinzessin angekommen ist." Der König und sein Bruder machten durchaus keine Einwendung dagegen, denn sie waren zu sehr überzeugt, dass Rosette noch viel schöner sei als ihr Bildnis.
Der Pfauenkönig ließ sie in ihrer Gefangenschaft mit größter Auszeichnung, ihrem Stande gemäß, behandeln und besuchte sie häufig selbst. Das Bildnis der Prinzessin hatte einen solchen Eindruck auf ihn gemacht, dass er Tag und Nacht keine Ruhe hatte. Die beiden Brüder schrieben sogleich aus ihrem Gefängnis an die Prinzessin, sie möge auf das Schleunigste her kommen, weil der Pfauenkönig sie erwarte. Sie verschwiegen ihr jedoch, dass man sie gefangen hielt, aus Furcht, ihre Schwester zu sehr zu beunruhigen. Als die Prinzessin diesen Brief empfing, dachte sie vor Freude zu sterben. Aller Welt erzählte sie, dass der Pfauenkönig gefunden sei und dass er ihr Gemahl würde; da gab es überall Freudenfeuer, Feuerwerke und immer eine Schmauserei nach der anderen. Die Prinzessin übergab das Reich ihres Bruders den bejahrtesten und weisesten Männern in der Stadt und empfahl ihnen, auf alles Acht zu haben, wenig auszugeben und viel Geld zu sparen, bis der König zurückkomme. Sie bat auch, ihren lieben Pfau wohl in Acht zu nehmen, so dann begab sie sich auf die Reise, auf welche sie niemand mitnahm, als ihre Amme, ihre Milchschwester und Fretillon, das kleine grüne Hündchen. Sie bestiegen nun ein Schiff, welches auf dem Meer ihrer wartete, nachdem man vorher den Scheffel voll Goldtalern und Kleider auf zehn Jahr, täglich zweimal zu wechseln, eingepackt hatte. Da war ein Lachen und Singen, ohne Aufhören. „Sind wir bald da?“, fragte die Amme den Schiffer; „sind wir bald in dem Königreich der Pfauen?" „Noch nicht“, entgegnete er ihr. Ein andermal fragte sie wieder: „Sind wir bald, sind wir bald da?" „Bald“, sagte er, „bald." „Sind wir bald da, sind wir bald da?“, fragte sie wieder ein andermal. „Ja doch, ja“, versetzte der Schiffer. Als die Amme dies hörte, setzte sie sich neben ihn an das Ende des Schiffes und sagte: „Wenn du willst, so kannst du auf immer ein reicher Mann werden." Er antwortete: „Das will ich wohl“, und sie fuhr fort: „Wenn du willst, so kannst du dir eine Menge Gold verdienen." „Ich verlange nichts weiter“, war seine Antwort. „Nun denn“, sagte sie, „so musst du mir behilflich sein, diese Nacht, wenn die Prinzessin schläft, sie ins Meer zu werfen. Wenn sie ertrunken ist, so ziehe ich ihre schönen Kleider meiner Tochter an und wir bringen sie zum Pfauenkönig, der sie mit vielem Vergnügen heiraten wird. Dir aber will ich zum Lohn so viel Diamanten geben, als um deinen Hals gehen."
Der Schiffer war sehr erstaunt über den Antrag der Amme und entgegnete ihr, es sei doch Schade, eine so schöne Prinzessin zu ersäufen und er habe allzu viel Mitleid mit ihr; aber die Amme setzte ihm eine Flasche Wein vor und gab ihm so viel zu trinken, bis er zuletzt alle Bedenklichkeiten vertrunken hatte. Als die Nacht einbrach, legte sich die Prinzessin wie gewöhnlich zu Bett; ihr kleiner Fretillon schlief, zu ihren Füßen geschmiegt, und rührte keine Pfote. Rosette lag im tiefsten Schlummer, als die nichts würdige Amme, welche nicht schlief, den Schiffer holte. Sie gingen in das Zimmer der Prinzessin, nahmen sie, ohne sie aufzuwecken, samt ihren Federbetten, ihren Matratzen, ihren Tüchern, ihren Decken und warfen sie mit dem allen ins Meer, wobei die Milchschwester aus allen Kräften half. So fest aber schlief die Prinzessin, dass sie davon nicht aufwachte. Zum Glück bestand ihr Bett aus Phönixfedern, die sehr selten sind und die Eigenschaft haben, dass sie nicht versinken, so dass sie also in ihrem Bette wie in einem Kahn schwamm. In dessen drang doch das Wasser nach und nach in das Bett und durch die Matratze und Rosette wachte davon auf. Da sie sich unruhig von einer Seite zur anderen wendete, so wurde auch Fretillon munter. Er hatte eine so feine Nase, dass er gleich die Nähe der Plattfische und der Stockfische witterte und so nach ihnen zu kläffen und zu kläffen anfing, dass alle anderen Fische davon unruhig wurden. Sie schwammen hin und her und die großen Fische stießen mit dem Kopf gegen das Bett der Prinzessin, welches, da es keinen Halt hatte, sich wie ein Kreisel herum dreht. Die Prinzessin war sehr erstaunt darüber. „Tanzt denn“, rief sie, „unser Schiff auf dem Wasser? ich habe in meinem ganzen Leben noch keine so unruhige Nacht zu gebracht." Fretillon kläffte immerzu und machte einen heillosen Lärm. Die nichtswürdige Amme und der Fischer hörten ihn noch von weitem und sagten: „Ei siehe, das ist das kleine närrische Hündchen, es trinkt mit seiner Gebieterin auf unsere Gesundheit. Aber wir wollen uns nur beeilen, dass wir ankommen."
Sie befanden sich schon ganz dicht an der Hauptstadt des Königs der Pfauen. Dieser hatte seiner Braut an das Meeresufer hundert Karossen entgegen geschickt, welche mit allen möglichen Tieren bespannt waren. Da gab es Löwen, Bären, Hirsche, Wölfe, Pferde, Stiere, Adler, Pfauen. Der Wagen, in welchen sich die Prinzessin Rosette setzen sollte, wurde von sechs blauen Affen gezogen; die sprangen und tanzten und machten tausend luftige Kunststücke. Sie hatten ein schönes Geschirr von rotem Samt mit Goldplatten. Zur Unterhaltung der Prinzessin hatte der König gleichfalls sechzig junge Mädchen geschickt, gekleidet in alle Farben und blitzend von Gold und Silber. Die Amme hatte sich die größte Mühe von der Welt gegeben, ihre Tochter heraus zu putzen. Sie zog ihr das schönste Kleid der Prinzessin an, und steckte ihr deren Diamanten ins Haar, ans Kleid und wo es sonst nur immer gehen wollte; aber sie blieb mit allem ihrem Putz dennoch hässlicher als eine Meerkatze. Sie hatte schmutzige schwarze Haare, schielende Augen, krumme Beine und einen großen Buckel mitten auf dem Rücken, und dabei war sie boshaft, tölpisch und brummig. Als sie aus dem Schiff stieg, gerieten alle Leute des Pfauenkönigs in ein solches Erstaunen, dass sie kein Wort hervorbringen konnten. „Nun, was ist das?“, rief sie. „Seid ihr etwa im Schlafe? Frisch, hurtig, bringt mir zu essen her. Ihr seid mir schönes Volk! Aufhängen will ich euch lassen." Als die Leute dies hörten, sprachen sie ganz verwundert: „Was für ein nichts würdiges Geschöpf! Sie ist eben so boshaft als garstig, das ist eine schöne Heirat für unseren König! Das war wohl der Mühe wert, sie vom Ende der Welt her holen zu lassen!"
Inzwischen spielte sie immerfort die Gebieterin und um weniger als nichts teilte sie aller Welt Ohrfeigen und Faustschläge aus. Da ihr Gefolge sehr groß war, so ging es langsam vorwärts. Sie brüstete sich wie eine Königin in ihrer Karosse. Aber alle die Pfauen, die sich auf die Bäume gesetzt hatten, um sie im Vorbeifahren zu begrüßen, und die sich vorgenommen hatten zu rufen: „Es lebe die schöne Königin Rosette!“, schrien jetzt, da sie ein solches Ungetüm erblickten: „Pfui, pfui, wie hässlich ist sie!" Sie geriet darüber außer sich vor Wut und rief ihrer Leibwache zu: „Schießt mir gleich da diese nichts würdigen Pfauen tot, die mich so unverschämt verhöhnen." Aber die Pfauen flogen rasch davon und machten sich nur über sie lustig. Der Spitzbube von Schiffer, der dies alles mit ansah, sagte ganz leise zu der Amme: „Gevatterin, wir kommen übel an, eure Tochter sollte hübscher sein." „Schweig, du Dummkopf“, entgegnete sie ihm, „du wirst uns ins Unglück bringen." Man benachrichtigte den König, die Prinzessin sei im Anzug. „Nun“, fragte er, „haben ihre Brüder die Wahrheit gesagt? Ist sie noch schöner als ihr Bildnis?" „Gnädiger Herr“, erwiderte man, „es wäre schon genug, wenn sie auch nur eben so schön wäre." „Ja wohl“, sagte der König, „ich würde ganz zufrieden damit sein." Ein großer Lärm auf dem Schlosshof benachrichtigte ihn von ihrer Ankunft. In dem verworrenen Geräusch so vieler Stimmen konnte er nichts weiter unterscheiden, als: „Pfui, pfui, was für ein hässliches Geschöpf!" Der König glaubte, man spreche vielleicht von einem Zwerg oder von irgend einer Bestie, die man mitgebracht habe, denn es konnte ihm gar nicht in den Sinn kommen, dass dies in der Tat ihr selber gelte.
Das Bildnis der Prinzessin wurde ganz offen auf einer langen Stange getragen und der König ging mit würdevollem Ernst hinter her, nebst allen seinen Großen, seinen Pfauen und den Gesandten der benachbarten Königreiche. Der König der Pfauen empfand große Ungeduld, seine schöne Braut endlich zu Gesicht zu bekommen. Aber als er sie nun sah, fehlte wenig, dass er auf der Stelle den Tod gehabt hätte. Er geriet in die äußerste Wut, zerriss seine Kleider, und sie durfte ihm nicht zu nahe kommen; so entsetzte er sich vor ihr. „Wie“, rief er, „diese beiden Schurken, die ich gefangen halte, haben also die Kühnheit gehabt, mich so zu verspotten, mir eine Meerkatze wie dieses Geschöpf zur Gemahlin anzubieten? sie sollen mir mit dem Leben dafür büßen. Heda, man werfe sogleich dieses Ungeheuer samt ihrer Amme und dem, welcher sie her brachte, in die Tiefe des großen Turmes." Inzwischen warteten der König und sein Bruder, da sie wussten, dass ihre Schwester ankommen sollte, sehnsüchtig auf den Augenblick, sie willkommen zu heißen. Anstatt aber, dass man kam, ihr Gefängnis zu öffnen und sie in Freiheit zu setzen, wie sie mit Bestimmtheit hofften, erschien der Kerkermeister mit einer Schar Soldaten und ließ sie in eine ganz dunkle Höhle hinabsteigen, wo es von ekelhaftem Gewürm wimmelte und wo ihnen das Wasser bis an den Hals ging. Sie waren vor Erstaunen und Betrübnis ganz außer Fassung. „Ach!“, sprachen sie zu einander, „das ist eine traurige Hochzeit für uns! Was in aller Welt kann ein so großes Unglück über uns bringen?" Sie konnten nichts auffinden, nur das schien ihnen gewiss, dass man ihren Tod beschlossen habe, worüber sie außerordentlich bekümmert waren.
Drei Tage vergingen, ohne dass sie jemand sahen noch hörten. Nach Verlauf von drei Tagen kam der Pfauenkönig selbst und überhäufte sie mit Schmähungen. „Ihr habt euch“, rief er ihnen durch die kleine Öffnung ihres Gefängnisses zu, „den Titel eines Königs und eines Prinzen angemaßt, um mich zu fangen und zu verlocken, eure Schwester zu heiraten; aber ihr seid nichts als elende Bettler, die nicht des Wassers wert sind, welches sie trinken. Aber man wird sehr kurzen Prozess mit euch machen. Der Strick ist schon fertig, an welchem man euch aufknüpfen wird." „König der Pfauen“, antwortete der König, Rosettens Bruder, voll Zorn: „Geht nicht so rasch damit zu Werke, denn es möchte euch reuen. Ich bin ein König, so gut wie ihr. Ich besitze ein ansehnliches Königreich, Geld und Soldaten, ich habe nur zu befehlen. Hoho, was ist das für ein spaßhafter Einfall von euch, uns aufhängen lassen zu wollen. Haben wir euch denn etwas gestohlen?" Als der König diese entschlossene Sprache hörte, wusste er nicht, woran er war, und hatte fast Lust, sie nebst ihrer Schwester davon gehen zu lassen, ohne ihnen ein Leid zuzufügen. Aber einer seiner Höflinge, der ein Erzspeichellecker war, brachte ihn wieder auf andere Gedanken, in dem er ihm vorstellte, alle Welt werde sich über ihn lustig machen, wenn er nicht Rache nehme und man würde ihn einen kleinen Zaunkönig heißen. Er schwur daher, ihnen nicht zu verzeihen und befahl, ihnen den Prozess zu machen. Er dauerte nicht lange, denn man hatte kaum das Bildnis der wirklichen Prinzessin Rosette mit dem Scheusal verglichen, welches statt ihrer angekommen war und sich für sie ausgab, so verurteilte man beide Brüder zum Strange, weil sie Betrüger seien und dem König statt einer schönen Prinzessin, welche sie ihm versprochen, eine garstige Bäuerin gebracht hätten. Dieses Urteil wurde ihnen im Gefängnisse mit großen Feierlichkeiten bekannt gemacht. Aber die Brüder riefen, sie hätten nicht gelogen, ihre Schwester sei eine Prinzessin und schöner als der Tag. Es sei hier etwas Unbegreifliches im Spiele, und sie verlangten sieben Tage Frist, ehe man sie zum Tode führe, vielleicht komme in dieser Zeit ihre Unschuld ans Licht. Der König der Pfauen wollte sich, so erzürnt wie er war, kaum dazu verstehen, ihnen diese Gnade zu bewilligen, endlich aber gab er es zu.
Während dies alles bei Hofe vorgeht, wollen wir uns ein wenig nach der armen Prinzessin Rosette umsehen. Sie war bei Anbruch des Tages sehr erstaunt, sich mitten auf dem Meere, ohne Nachen, ohne Beistand zu finden, und Fretillon des gleichen. Sie brach in Tränen aus und weinte so bitterlich, so bitterlich, dass es die Fische zum Mitleid bewegte. Was sollte sie tun? was sollte aus ihr werden? „Gewiss“, sagte sie, „hat mich der König der Pfauen ins Meer werfen lassen, die Heirat wird ihn gereut haben, und um auf gute Art meiner los zu werden, ließ er mich ins Meer werfen. Was für ein seltsamer Mensch“, fuhr sie fort, „ich würde ihn doch so zärtlich geliebt haben! Wir hätten ein so glückliches Leben zusammen geführt." Darauf weinte sie noch viel heftiger, denn sie konnte auch jetzt noch nicht aufhören, ihn zu lieben. So schwamm sie zwei Tage lang auf dem Meere hin und her, bis auf die Haut durchnässt und fast erstarrt vor Kälte. Wenn nicht der kleine Fretillon gewesen wäre, der ihr ein wenig das Herz erwärmte, so wurde sie hundertmal des Todes gewesen sein. Dabei hungerte sie ganz entsetzlich. Zum Glück erblickte sie einige Austern, mit denen sie ihren Hunger stillte, und auch Fretillon, obgleich er diese Speise nicht sonderlich liebte, musste sich dazu bequemen. Die größte Angst aber empfand Rosette jedes Mal beim Einbruch der Nacht; dann rief sie ihrem Hündchen zu: „Belle, belle, mein Fretillon, dass uns die Raubfische nicht auffressen." So bellte er denn jede Nacht ohne Aufhören und inzwischen war das Bett der Prinzessin dem Ufer immer näher gekommen. An diesem Ufer, da wohnte ein guter alter Mann ganz allein in seiner Hütte in einer einsamen Gegend. Er war sehr arm und kümmerte sich gleich wohl sehr wenig um die Güter dieser Welt.Als er Fretillons Gebell hörte, war er ganz erstaunt, denn es ließ sich nicht leicht ein Hund in dieser Gegend blicken. Er glaubte also, Reisende hätten sich hier her verirrt und ging mitleidig wie er war, hinaus, um ihnen den Weg zu zeigen. Da sah er mit einmal die Prinzessin und Fretillon auf dem Meer treiben. Die Prinzessin aber hatte ihn kaum erblickt, so streckte sie die Arme nach ihm aus und rief ihm zu: „Guter Greis, rette mich, sonst komme ich um, denn ich verschmachte hier schon seit zwei Tagen." Als er sie so kläglich reden hörte, ging es ihm sehr nahe und er kehrte nach Hause zurück, um einen langen Haken zu holen. Mit diesem ging er bis an den Hals ins Wasser, und obgleich er mehr als einmal in Gefahr war, zu ertrinken, gelang es ihm doch, das Bett bis ans Ufer zu ziehen.
Rosette und Fretillon waren sehr vergnügt, wieder auf festem Boden zu sein; sie dankten von ganzem Herzen dem guten Manne, hüllten sich dann in ihre Decken und eilten barfuß in die Hütte. Dort zündete der Alte gleich ein kleines Feuer von dürrem Reisig an, nahm das schönste Kleid seiner seligen Frau aus dem Koffer nebst Strümpfen und Schuhen und die Prinzessin zog sich alles an. Der geringen bäuerischen Tracht ungeachtet blieb sie doch so schön wie der Tag. Fretillon tanzte um sie herum und suchte sie mit seinen Sprüngen zu erheitern. Der alte Mann sah wohl, dass Rosette eine vornehme Dame war, denn ihre Bettdecken waren ganz mit Gold und Silber gestickt und ihre Matratzen von Atlas. Er bat sie, ihm ihre Geschichte zu erzählen, und versprach, wenn sie es wünsche, niemanden nur ein Wort davon zu entdecken. Sie erzählte ihm alles, von Anfang bis zu Ende, unter häufigen Tränen, denn sie glaubte noch immer, der Pfauenkönig sei es, der sie ins Meer habe werfen lassen. „Was fangen wir nun an, meine Tochter?“, sagte der Alte. „Ihr seid eine vornehme Prinzessin, an gute Bissen gewöhnt, und ich habe nur Schwarzbrot und weiße Rüben, ihr werdet also sehr schlechte Mahlzeiten halten. Wenn ich euch einen Rat geben dürfte, so ginge ich hin und meldete dem Pfauenkönig, dass ihr hier seid. Gewiss, wenn er euch nur gesehen hätte, ihr wärt seine Gemahlin geworden." „Ach nein“, versetzte Rosette, „es ist ein böser Mensch, er würde mich umbringen lassen; aber wenn ihr ein kleines Körbchen habt, so bindet es meinem Hündchen um den Hals, und es müsste schlimm zugehen, wenn es mich nicht mit Essen versorgte." Der alte Mann gab der Prinzessin ein Körbchen; sie band es Fretillon an den Hals und sagte zu ihm: „Geh damit in die beste Küche in der Stadt, und hole mir was du darin findest."
Fretillon lief nach der Stadt und da es keine bessere Küche als die des Königs gab, so lief er dort hinein, deckte die Töpfe auf, nahm geschickt alles heraus, was darin war, und kehrte nach Hause zurück. Rosette sagte zu ihm: „Lauf wieder zurück, geh in die Speisekammer und hole mir das Beste, was du dort findest." Fretillon begab sich in die Speisekammer, nahm weißes Brot, Muskateller Wein, alle Arten von Früchten und Zuckerwerk und schleppte so viel fort, als er nur tragen konnte. Als der Pfauenkönig zu Mittag speisen wollte, waren Küche und Keller leer. Man sah sich verwundert an und der König geriet in einen schrecklichen Zorn: „Ich soll also wohl“, sagte er, „heute Mittag nichts essen; nun, so will ich mich wenigstens auf den Abend an einem guten Braten erholen." Der Abend kam und die Prinzessin sagte zu Fretillon: „Geh nach der Stadt in die beste Küche und hole mir einen guten Braten." Fretillon tat, wie seine Gebieterin ihm befahl, begab sich wieder ganz sacht in die Küche des Königs, da er keine bessere wusste, nahm den ganzen Braten, während die Köche den Rücken drehten, vom Spieße und lief damit fort. Der Braten hatte ein so appetitliches Aussehen, dass man die größte Luft zu essen bekam, wenn man ihn nur ansah. Fretillon brachte sein Körbchen ganz voll der Prinzessin, kehrte dann sogleich wieder um nach der Speisekammer und nahm das ganze Zuckerwerk und allerlei Eingemachtes mit sich fort. Weil der König nicht zu Mittag gespeist hatte, empfand er starken Hunger und wollte zeitig zu Abend essen; allein es war nichts da. Er geriet in einen ganz erschrecklichen Zorn und musste, ohne Abendbrot gegessen zu haben, zu Bette gehen. Am folgenden Tag zu Mittag und zu Abend ging es eben wieder so, so dass der König drei ganze Tage ohne Essen und Trinken blieb, denn wenn er sich zu Tisch setzen wollte, war alles fort. Sein Hofmarschall befand sich in großer Sorge deshalb, denn er befürchtete, der König werde zuletzt Hungers sterben. Er verbarg sich also in der Küche in einem Winkel und sah unverwandt nach dem Topf, der am Feuer stand. Ganz erstaunt sah er ein kleines grünes einöhriges Hündchen herein schleichen, welches den Topf aufdeckte und das Fleisch in sein Körbchen legte. Er folgte ihm, um zu erfahren, wo es hin ginge. Das Hündchen lief zum Thor hinaus und er folgte ihm immer zu, bis in die Hütte des guten Alten. Hierauf kehrte er zurück und hinter brachte dem Könige, dass seine Braten Mittags und Abends zu einem armen Bauern wanderten.
Der König war nicht wenig erstaunt darüber und befahl, den Bauern herbei zu holen. Der Hofmarschall ging selbst in Begleitung einiger Häscher, und sie fanden den Alten, wie er eben mit der Prinzessin von dem Braten der königlichen Tafel seine Mittagsmahlzeit hielt. Er ließ Beide gefangen nehmen und mit starken Stricken binden, des gleichen auch Fretillon. Als man den König benachrichtigte, dass sie da seien, sagte er: „Morgen ist ohne dies der siebente und letzte Tag, den ich jenen beiden Schurken bewilligt habe; die Bratendiebe mögen mit ihnen zugleich sterben. Daraus begab er sich in das Gerichtszimmer. Der Alte warf sich ihm zu Füßen und sagte, er wolle ihm die ganze Geschichte erzählen. Indem er erzählte, sah der König die schöne Prinzessin an und empfand Mitleid mit ihren Tränen. Als er nun aber von dem guten Alten hörte, dass dies die wirkliche Prinzessin Rosette sei und dass man sie ins Meer geworfen habe, sprang er hoch in die Höhe, wie schwach er auch von seinem dreitägigen Fasten war, lief die Prinzessin zu umarmen, löste die Stricke, mit denen sie gebunden war, und sagte ihr, dass er sie von ganzem Herzen liebe. Sogleich beeilte man sich, auch die Prinzen herbei zu holen, die nicht anders glaubten, als man führe sie zum Tode, und deshalb sehr traurig und mit gesenktem Haupt einher kamen; so dann brachte man auch die Amme und ihre Tochter. Alle erkannten sich auf den ersten Blick. Rosette fiel ihren Brüdern um den Hals, die Amme und ihre Tochter nebst dem Schiffer warfen sich auf die Knie und baten um Gnade.
Die Freude war so groß, dass der König und die Prinzessin ihnen verziehen, der gute Alte aber wurde reichlich belohnt und blieb für immer in dem Palast. Rosettens Brüdern gab der Pfauenkönig jede mögliche Genugtuung und bezeigte seinen Schmerz, sie so unwürdig behandelt zu haben. Die Amme gab der Prinzessin ihre schönen Kleider und ihren Scheffel voll Goldstücke zurück. Vierzehn Tage währten die Hochzeitsfestlichkeiten, und alles war vergnügt, Fretillon nicht zu vergessen, der lauter Rebhühnerflügel zu essen bekam.
PRINZ KOBOLD ...
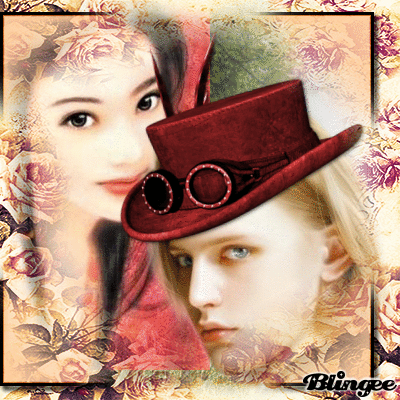
Es war einmal ein König und eine Königin, die nur einen Sohn hatten und ihn, obwohl er äußerst hässlich war, dennoch leidenschaftlich liebten. Er war so dick wie der dickste Mann und so klein wie der kleinste Zwerg. Doch die Hässlichkeit seines Gesichtes und die Missgestalt seines Körpers verschwanden in Vergleich zu seiner Bosheit, welche so groß war, dass er sich Mühe gab, Jedermann Böses zuzufügen.
Der König zwar bemerkte dies seit seiner frühsten Kindheit, allein die Königin liebte ihn ganz närrisch und trug durch ihre übertriebene Nachgiebigkeit, die ihrem Sohne zeigte, welche Gewalt er über sie habe, noch mehr dazu bei, ihn zu verderben; so wie denn auch, um der Königin nicht zu missfallen, Jedermann zu ihr sagen musste, dass ihr Sohn schön und geistreich sei. Nachdem sie lange nach gesonnen hatte, welchen Namen sie ihm geben sollte, der Achtung und Furcht einflöße, nannte sie ihn „Wüterich."
Als er das Alter erreicht hatte, in welchem man ihm einen Erzieher geben musste, wählte der König einen Prinzen, welcher selbst von Alters her Rechte auf die Krone hatte und sie auch mutig verteidigt haben würde, wenn seine Angelegenheiten sich in einer bessern Lage befunden hätten; er dachte aber schon lange nicht mehr daran und wandte vielmehr alle seine Bemühungen darauf, seinen einzigen Sohn gut zu erziehen. Dieser besaß den liebenswürdigsten Charakter von der Welt, einen lebhaften und durchdringenden Verstand. Alles, was er sagte, zeichnete sich durch eigentümliche Anmut aus und sein Äußeres war im höchsten Grade einnehmend.
Nachdem der König jenem vornehmen Herrn die Erziehung Wüterichs übergeben hatte, befahl er diesem, seinem Erzieher gehorsam zu sein; indes Wüterich gehörte zu den Strohköpfen, die man hundertmal züchtigen kann, ohne sie einmal zu bessern. Leander, der Sohn seines Erziehers, war bei Jedermann beliebt, besonders bei den Damen, aber er kümmerte sich wenig darum, und hielt sich fast immer nur in der Gesellschaft Wüterichs auf. Dieser erschien dadurch nur umso garstiger und unangenehmer. Er hatte für alle Welt und so auch für die Mädchen und Frauen der Königin nur Grobheiten. Bald waren sie schlecht gekleidet, bald hatten sie ein kleinstädtisches Aussehen, bald sagte er ihnen vor aller Welt geradezu ins Gesicht, dass sie geschminkt wären.
Er bekümmerte sich nur um sie, um sie gelegentlich bei der Königin anzuschwärzen, welche sie dann ausschalt und zur Strafe fasten ließ. Alles dieses machte, dass man Wüterich eben so hasste, wie man Leander liebte. Er merkte dies auch sehr wohl, schob aber alle Schuld auf Leander. „Du bist doch ein glücklicher Mensch“, sagte er öfters zu diesem, indem er ihn boshaft anschielte, „alle Damen sind dir hold, nur mir nicht!" „Gnädiger Prinz“, pflegte Leander bescheiden zu erwidern, „nur die Ehrfurcht hält sie von einem zutraulichen Benehmen gegen euch zurück." „Da tun sie auch ganz wohl“, sagte dann gewöhnlich der Prinz, „es sollte ihnen schlecht bekommen!"
Einstmals waren von weit her fremde Gesandte angekommen und der Prinz stand in Begleitung Leanders auf einer Galerie, um ihren Einzug mit anzusehen. Sobald die Gesandten Leander bemerkten, gingen sie auf ihn zu, verbeugten sich tief und legten ihm auf alle Weise ihre Ehrerbietung und Bewunderung an den Tag. Den Prinzen Wüterich aber hielten sie für seinen Zwerg, fassten ihn am Arm, drehten ihn, trotz alles seines Sträubens, hin und her und trieben ihren Spaß mit ihm.
Leander geriet hierüber in die äußerste Angst und Verlegenheit; er gab sich alle erdenkliche Mühe, ihnen bemerkbar zu machen, dass es der Sohn des Königs sei; sie verstanden ihn aber nicht, und der Dolmetscher hatte sich unglücklicherweise schon zum König begeben, um sie dort zu erwarten. Als Leander sah, dass seine Winke ihnen nicht verständlich waren, so bezeigte er sich gegen den Prinzen noch weit ehrfurchtsvoller. Die Gesandten indes, so wie ihr ganzes Gefolge, hielten dies nur für Scherz, lachten, dass ihnen der Leib weh tat, und wollten dem Prinzen, wie sie es daheim gewohnt waren, Nasenstüber geben.
Wüterich dagegen zog voller Zorn seinen kleinen Degen, der nicht länger war als ein Fächer und würde sicher ein Übel damit angerichtet haben, wenn nicht der König so eben dazu gekommen wäre, der, ganz erstaunt über das Benehmen seines Sohnes, die Gesandten, deren Sprache er verstand, sehr um Entschuldigung bat. Sie erwiderten ihm, es habe nichts weiter auf sich, sie sähen ja wohl, dass dieser hässliche Zwerg übel gelaunt sei. Der König war nicht wenig betrübt darüber, dass die garstige Gestalt seines Sohnes ihn der gleichen Missverständnissen aussetzte.
Kaum waren die Gesandten fort, so ergriff Wüterich Leander bei den Haaren, riss ihm zwei oder drei Hände voll aus, und würde ihn, wenn er gekonnt hätte, erwürgt haben; verbot ihm auch, sich je wieder vor ihm sehen zu lassen. Leanders Vater, über das Benehmen Wüterichs höchst erzürnt, schickte nun seinen Sohn auf eins seiner Landhäuser. Hier lebte er nichts weniger als müßig, fischte, ging spazieren und Bücher, Musik und Malerei beschäftigten ihn abwechselnd. Er schätzte sich glücklich, einem so launenhaften Prinzen nicht mehr dienen zu müssen und empfand trotz der Einsamkeit doch keinen einzigen Augenblick Langeweile.
Eines Tages, nach einem langen Spaziergang in seinen Gärten, trieb ihn die zunehmende Hitze in ein kleines Wäldchen, dessen hohe und dicht belaubte Bäume einen angenehmen Schatten gewährten. Zum Zeitvertreib fing er an, auf der Flöte zu blasen, als er mit einem Mal fühlte, wie sich etwas um seinen Fuß wand und ihn fest zusammendrückte. Als er nachsah, was dies sein möge, entdeckte er mit Erstaunen eine große Natter. Er nahm sein Schnupftuch, packte sie beim Kopf und war im Begriff, sie zu töten. Allein sie schlang sich um seinen Arm und sah ihn unverwandt an, als ob sie um Gnade bitten wolle.
In diesem Augenblick kam einer von den Gärtnern dazu. Kaum erblickte dieser die Natter, so rief er seinem Herrn zu: „Gnädiger Herr, haltet sie fest, denn ich verfolge sie schon länger als eine Stunde. Es ist das verschlagenste Tier, das es auf der Welt gibt, es verwüstet unaufhörlich unsere Blumenbeete." Leander betrachtete die Natter noch einmal; sie glänzte von tausenderlei schönen Farben und sah ihn, ohne sich zu verteidigen, noch immer bewegungslos an. „Da sie bei mir ihre Zuflucht gesucht hat“, sagte er hierauf zu seinem Gärtner, „so verbiete ich dir, ihr irgend ein Leid zuzufügen, denn ich will sie füttern und wann sie ihre schöne Haut abgeworfen hat, wieder in Freiheit setzen."
So dann kehrte er in das Schloss zurück, setzte sie in ein großes Zimmer, von welchem er allein den Schlüssel hatte, und ließ ihr Kleie, Milch, Blumen und Kräuter bringen, um sie zu füttern und ihr den Aufenthalt angenehm zu machen. Das war einmal eine glückliche Natter! Zuweilen sah er, was sie machte; dann kam sie ihm sogleich entgegen, kletterte an ihm hinauf und erwies ihm alle möglichen Schmeicheleien, deren eine Natter fähig ist. Der Prinz wunderte sich zwar darüber, achtete aber nicht besonders darauf.
Alle Damen am Hofe trauerten indes über Leanders Abwesenheit, sie sprachen nur von ihm und wünschten ihn wieder zurück. „Ach!“, sagten sie, „seit dem Leander fort ist, gibt es kein Vergnügen mehr bei Hofe, und daran ist nur der böse Wüterich Schuld. Musste er darum dem Leander so gehässig sein, weil dieser liebenswürdiger und geliebter ist, als er? Hätte sich denn etwa Leander, ihm zu gefallen, einen Buckel machen sollen oder sein Gesicht zerkratzen? Sollte er, um ihm ähnlich zu sehen, sich die Knochen verrenken, den Mund bis an die Ohren aufreißen, die Augen zusammen und die Nase platt drücken? Das ist einmal eine kleine boshafte Kröte. Er wird nimmer in seinem Leben Freude haben, denn er wird nie Jemand finden, der hässlicher ist als er."
Auch die schlechtesten Fürsten haben immer doch ihre Schmeichler und die bösen sogar noch mehr, als die guten. So hatte auch Wüterich die seinigen. Die Gewalt, die er über seine Mutter ausübte, machte ihn furchtbar. Man hinterbrachte ihm daher auch, was die Damen über ihn sagten, und er geriet darüber in heftigsten Zorn. Er ging auf der Stelle zu seiner Mutter und sagte, er werde sich vor ihren Augen umbringen, wenn sie nicht irgendein Mittel fände, dem Leander das Leben zu nehmen. Die Königin, welche Leander ohnehin hasste, weil er schöner war, als ihr Affe von Sohn, erwiderte, sie habe schon seit langem Leander für einen Verräter gehalten, und würde also sehr gern zu seinem Tode die Hand bieten. Der Prinz solle mit seinen vertrautesten Leuten auf die Jagd gehen, Leander werde auch dahin kommen, und da könne man ihn lehren, sich noch ferner bei aller Welt beliebt zu machen.
Wüterich begab sich also auf die Jagd. Als Leander Hundegebell und Hörnerblasen in der Nähe seines Schlosses hörte, stieg er zu Pferd und ritt in den Wald, um zu sehen, was es gäbe. Er war über das unvermutete Zusammentreffen mit dem Prinzen sehr überrascht, stieg jedoch ab und begrüßte ihn ehrfurchtsvoll. Wüterich empfing ihn besser, als Leander erwartet hatte, und sagte, er solle ihm folgen. Zugleich aber schlug er selbst einen Seitenweg ein und winkte den Mördern, gut zu zielen.
Doch indem er sich rasch entfernte, sprang ein Löwe von ungeheurer Größe aus seiner Höhle hervor, auf ihn los und warf ihn zu Boden. Seine Begleiter ergriffen die Flucht und Leander blieb allein zurück, dieses wütende Tier zu bekämpfen. Er griff es, auf die Gefahr verschlungen zu werden, mit dem Degen in der Faust an und rettete durch seine Tapferkeit und Gewandtheit seinem grausamsten Feinde das Leben. Der Prinz war unterdessen vor Furcht in Ohnmacht gefallen und Leander leistete ihm, nachdem er das Tier erlegt hatte, jeden möglichen Beistand. Als er sich ein wenig erholt hatte, bot ihm Leander sein Pferd an, um sein Gefolge wieder aufzusuchen.
Jeder andere würde so große und noch ganz frische Verpflichtungen aufs Tiefste empfunden und jede möglichen Beweise seiner Dankbarkeit durch Worte und Taten an den Tag gelegt haben. Nicht so der undankbare Prinz. Er blickte Leander nicht einmal an und bediente sich seines Pferdes nur, die Mörder wieder aufzusuchen, denen er seinen Befehl, Leander umzubringen, wiederholte. Sie umringten Leander und er wäre unfehlbar verloren gewesen, wenn er weniger Mut gehabt hätte. Er lehnte sich mit dem Rücken an einen Baum, um nicht von hinten angegriffen zu werden, focht wie ein Verzweifelter und streckte alle seine Gegner zu Boden. Wüterich, welcher ihn schon für tot hielt, eilte herbei, um sich an dem Anblick seines Leichnams zu weiden. Allein er fand ein ganz anderes Schauspiel, als das, welches er erwartet hatte; denn alle jene Bösewichter hauchten eben ihr Leben ans.
Als Leander ihn erblickte, ging er auf ihn zu und sagte zu ihm: „Gnädiger Prinz, wenn ich auf euren Befehl ermordet werden sollte, so tut es mir leid, mich verteidigt zu haben." „Unverschämter Mensch“, erwiderte der Prinz voller Zorn, „wenn du dich je wieder vor meinen Augen blicken lässt, so bist du des Todes." Leander entgegnete nichts; er kehrte sorgenvoll nach Hanse zurück und brachte die ganze Nacht damit zu, darüber nachzudenken, was er beginnen solle; denn er sah wohl ein, dass er dem Sohne des Königs nicht Stand halten könne. Er beschloss endlich auf Reisen zu gehen; doch indem er im Begriff war, das Schloss zu verlassen, erinnerte er sich der Natter, nahm Milch und Früchte und trug sie nach ihrem Zimmer.
Als er die Tür des Zimmers öffnete, nahm er in einer Ecke des selben einen außerordentlichen Lichtglanz wahr, und als er genauer darauf hinsah, erblickte er zu seinem höchsten Erstaunen eine Dame, deren edles und majestätisches Aussehen ihre hohe Geburt vermuten ließ. Ihr Gewand war aus violettem Seidenstoff, mit Diamanten und Perlen gestickt. Sie ging ihm mit freundlichen Blicken entgegen und sagte: „Junger Prinz, sucht die Natter nicht mehr, die ihr hierher gebracht habt, sie ist fort; statt ihrer findet ihr mich, euch zu vergelten, was sie euch schuldig ist. Doch ich muss verständlicher zu euch sprechen.
So erfahrt denn, dass ich die Fee „Wunderhold" bin, deren heitere und lustige Streiche weit und breit berühmt sind. Wir Feen leben hundert Jahre, ohne zu altern, ohne Krankheit, ohne Kummer und ohne Sorge. Nach hundert Jahren verwandeln wir uns auf acht Tage in Schlangen. Dieser Zeitraum ist uns allein gefährlich, denn während des selben können wir keinen Unfall vorhersehen, noch von uns abwenden, und wenn man uns tötet, so kehren wir nicht wieder ins Leben zurück. Nach Verlauf dieser acht Tage aber erlangen wir unsere frühere Gestalt wieder, und damit unsere Schönheit, unsere Macht und unseren Reichtum. Jetzt wisst ihr, wie große Verpflichtungen ich gegen euch habe, und es ist nicht mehr als billig, dass ich mich ihrer entledige. Überlegt also, worin ich euch nützlich sein kann und rechnet auf mich."
Der junge Prinz, der bis dahin nichts mit Feen zu tun gehabt, war so erstaunt, dass er lange Zeit kein Wort hervorbringen konnte. Endlich machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, nachdem er das Glück gehabt habe, ihr einen solchen Dienst zu erweisen, scheine ihm kein anderer Wunsch weiter übrig zu bleiben. „Es würde mir sehr leid tun“, erwiderte die Fee, „wenn ihr mir keine Gelegenheit geben wolltet, mich dankbar zu erweisen. Bedenkt, ich kann euch zu einem mächtigen König machen, euer Leben verlängern, euch noch mehr Anmut und Liebenswürdigkeit verleihen, euch Paläste voll Gold, Gruben voll Diamanten schenken, euch zu einem trefflichen Redner, Dichter, Musiker und Maler bilden, euch die Gunst der Damen zuwenden, euch in einen Luft-, Wasser- und Erdkobold verwandeln."
Hier unterbrach sie Leander: „Erlaubt mir, euch zu fragen, was wird es mir denn nützen, wenn ich ein Kobold war'?" „Zu tausend Vorteilhaftem und Angenehmen“, erwiderte die Fee. „Ihr seid unsichtbar, wann es euch gefällt, ihr durcheilt in einem Augenblick den unermesslichen Weltraum, ihr erhebt euch ohne Flügel in die Lüfte und dringt lebendig in die Tiefen der Erde; ihr taucht, ohne zu ertrinken, in die Abgründe des Meeres; ihr findet überall Eingang, wenn auch Fenster und Türen verschlossen sind und lasst euch nach eurem Belieben dann wieder in eurer natürlichen Gestalt sehen."
„Ach“, rief hierauf Leander, „wenn es so ist, so wünsche ich, ein Kobold zu werden. Ich bin im Begriff, auf Reisen zu gehen und verspreche mir tausendfache Ergötzlichkeiten davon; ich ziehe dieses Geschenk allen übrigen vor, die ihr mir großmütig angeboten habt." „Sei denn ein Kobold“, versetzte Fee Wunderhold, indem sie ihm dreimal mit der Hand die Augen und das Gesicht berührte; „sei ein liebenswürdiger, ein geliebter Kobold; sei ein vollkommener Kobold." Hierauf umarmte sie ihn, gab ihm einen kleinen roten, mit zwei Papageienfedern besetzten Hut und sprach: „wenn ihr diesen Hut aufsetzet, werdet ihr unsichtbar, wenn ihr ihn abnehmet, werdet ihr sichtbar sein."
Leander drückte sich ganz entzückt den kleinen runden Hut auf den Kopf und wünschte, nach dem Walde versetzt zu werden, um wilde Rosen zu pflücken, die er dort bemerkt hatte. In dem selben Augenblick wurde sein Körper so leicht, wie seine Gedanken, und wie ein Vogel dahinfliegend, schwebte er durch das Fenster in den Wald. Freilich war er nicht ohne Furcht, als er sich so hoch in der Luft und über dem Fluss hin schweben sah, denn er besorgte hineinzufallen und dass die Macht der Fee nicht ausreiche, ihn dagegen zu schützen. Er gelangte indes glücklich an den Fuß des Rosenstrauchs, von welchem er drei Rosen pflückte, sich sogleich in das Zimmer zurückbegab, wo er die Fee noch antraf und ihr die selben überreichte, hoch erfreut, dass sein kleiner Versuch ihm so wohl gelungen war.
Die Fee sagte zu ihm, er möge diese Rosen für sich behalten, die eine werde ihm so viel Geld verschaffen, als er bedürfe, die andere, wenn er sie an das Herz seiner Geliebten drücke, ihn von ihrer Treue oder Untreue belehren, und die dritte endlich ihn gegen jede Krankheit schützen. Hierauf wünschte sie ihm, ohne seinen Dank abzuwarten, eine glückliche Reise und verschwand. Leander freute sich unendlich über die schönen Geschenke, die er so eben erhalten hatte. „Hätte ich je denken können“, sprach er bei sich selbst, „als ich eine arme Natter aus den Händen meines Gärtners rettete, dass ich so reich und wunderbar dafür belohnt werden sollte?"
O welche Vergnügen werde ich haben! was für angenehme Augenblicke! Was werde ich dann nicht alles entdecken, wenn ich unsichtbar bin! Das Geheimste kann nicht vor mir verborgen bleiben." Er freute sich nicht wenig auf irgendeine Rache, die er an Wüterich nehmen wollte. Er hinterließ sogleich alle nötigen Befehle, bestieg das schönste Ross seines Marshalls, mit Namen „Lichtblau", und begab sich, von einigen seiner Bedienten begleitet, an den Hof zurück, wo das Gerücht von seiner Rückkehr sich sehr rasch verbreitete. Nun muss man wissen, dass Wüterich, der ein großer Lügner war, vorgegeben hatte, Leander würde ihn ohne seinen Mut auf der Jagd ermordet haben, eben so wie sein ganzes Gefolge, und er verlange deshalb Leanders Bestrafung.
Der König, hierauf von den ungestümen Bitten der Königin überwältigt, befahl also, Leander gefangen zu nehmen. In diesem Augenblick wurde Wüterich benachrichtigt, Leander komme so eben und sehe ganz zuversichtlich und entschlossen aus. Wüterich, der viel zu furchtsam war, um ihn selbst aufzusuchen, lief in das Zimmer seiner Mutter, erzählte ihr, dass Leander da sei und bat sie, ihn doch gefangen nehmen zu lassen. Die Königin, die alles tat, was ihr Affe von Sohn nur immer wünschen mochte, eilte gleich zum König, der Prinz aber, ungeduldig zu erfahren, was man beschließen würde, folgte ihr still schweigend nach.
Er blieb an der Tür stehen, legte das Ohr dicht daran und strich, um noch besser hören zu können, die Haare zurück. Indem trat Leander in den großen Saal des Palastes, das kleine rote Hütchen auf dem Kopfe; Niemand also konnte ihn sehen. Kaum bemerkte er den lauschenden Wüterich, so nahm er einen Hammer und einen Nagel und nagelte ihm das Ohr mit einem Schlag an die Tür. Der Prinz geriet in die äußerste Wut, schlug wie wahnsinnig an die Tür und schrie aus Leibeskräften. Als die Königin sein Geschrei vernahm, eilte sie herbei, die Tür zu öffnen, und riss dabei das Ohr ihres Sohnes vollends ab.
Er blutete, als ob man ihm die Kehle abgeschnitten hätte und zog ein jämmerliches Gesicht. Die Königin, ganz untröstlich, nahm ihn auf den Schoß, küsste ihn und suchte ihm das Ohr, so gut es ging, wieder anzudrücken und zu verbinden. Leander aber ergriff eine Hand voll Ruten, mit denen man die jungen Hündchen des Königs züchtigte, und schlug die Königin damit einige Mal tüchtig auf die Hände, so dass sie aus hellem Halse schrie, man bringe sie um, man bringe sie um! Der König kam dazu, alle Welt lief herbei, aber man sah nichts und raunte sich ganz leise ins Ohr, die Königin müsse wahnsinnig geworden sein vor lauter Schmerz über das abgerissene Ohr ihres Wüterichs. Der König war der Erste, der dies glaubte, und wich ihr aus, sobald sie sich ihm nähern wollte; es war ein höchst drolliger Auftritt.
Endlich versetzte noch der gute Kobold, Wüterich eine gehörige Anzahl Hiebe, verließ sodann das Zimmer und begab sich in den Garten. Dort pflückte er, nachdem er sich wieder sichtbar gemacht hatte, ganz keck die Kirschen, Aprikosen, Erdbeeren und Blumen von den Beeten der Königin. Sie pflegte die selben ganz allein zu begießen, und es war bei Todesstrafe verboten, sie nur anzurühren. Ganz bestürzt eilten die Gärtner herbei und meldeten ihren Majestäten, Prinz Leander verwüste die Fruchtbäume und den Blumengarten. „Welch eine Frechheit!“, schrie die Königin; „mein kleiner Wüterich, mein einziges Püppchen, vergiss einen Augenblick dein böses Ohr, lauf hin und züchtige den Bösewicht; nimm unsere Leibwache, unsere Bedienten, stelle dich an ihre Spitze, falle über ihn her und haue ihn in kleine Stücke."
So durch seine Mutter ermutigt und von einer großen Schar Bewaffneter begleitet, langte Wüterich in dem Garten an. Leander, der sich gütlich tat, empfing ihn mit einem großen Apfel, der ihm den Arm zerquetschte und begrüßte seine Begleitung mit mehr als hundert Pomeranzen. Man eilte auf Leander zu, aber schon in dem nämlichen Augenblick sah man ihn nicht mehr. Er stand schon hinter Wüterich, der sich von dem Apfelwurf sehr übel befand, und zog ihm einen Strick um die Beine — da lag Wüterich mit einmal auf der Nase. Man hob ihn auf und brachte ihn in einem erbärmlichen Zustande zu Bett.
Mit dieser Rache zufrieden, kehrte Leander an den Ort zurück, wo seine Leute ihn erwarteten. Er beschenkte sie und schickte sie auf sein Schloss zurück, denn er wollte auf seinen Reisen niemand mit sich nehmen, damit die Geheimnisse des roten Hütchens und der Rosen nicht bekannt würden. Er hatte sich noch nicht bestimmt, wohin er reisen wollte, bestieg also sein schönes Ross Lichtblau und ließ es aufs Geratewohl in die Welt traben. So durchzog er Felder, Wälder, Täler und Berge ohne Zahl und Namen, ruhte sich von Zeit zu Zeit aus und aß und schlief, ohne irgend etwas Merkwürdiges anzutreffen. Endlich gelangte er in einen Wald und da es sehr heiß war, so stieg er ab, um sich ein wenig im Schatten zu erholen.
Kaum hatte er wenige Augenblicke hier verweilt, so hörte er Seufzer und Schluchzen. Er sah sich überall um und erblickte einen Menschen, der bald lief, bald stehen blieb, bald schrie und bald schweigend sich die Haare ausriss und die Brust zerschlug, so dass Leander nicht zweifelte, dieser Unglückliche sei wahnsinnig geworden. Der arme Mensch schien ihm jung und wohlgebildet; seine Kleidung, obwohl ganz zerrissen, zeigte von ihrer ehemaligen Pracht. Leander, von Mitleid ergriffen, näherte sich ihm und bot ihm seine Hülfe an.
„Ach! gnädiger Herr“, erwiderte der Jüngling, „für mein Unglück gibt es keine Hilfe mehr. Ein Mädchen, welches ich aufs Zärtlichste liebe, soll heute mit einem alten, eifersüchtigen Mann verheiratet werden, der freilich sehr reich ist, sie aber gleichwohl zur unglücklichsten Person von der ganzen Welt machen wird." „Liebt sie euch denn?“, fragte Leander. „Ich darf es wohl überzeugt sein“, erwiderte er. „Und wo hält sie sich auf?“, fragte Leander weiter. „In einem Schlosse am Ausgang dieses Waldes." „Nun gut, so erwartet mich hier“, versetzte Leander, „ich denke euch in Kurzem angenehme Nachrichten zu hinterbringen."
Zugleich setzte er den kleinen roten Hut auf und wünschte sich in das Schloss. Er war noch auf dem Wege dahin, so vernahm er schon eine anmutige Musik. Als er hin kam, war alles voll von Lärm und Jubel und dem Schall der Instrumente. Er trat in einen großen Saal, der mit den Verwandten und Freunden des Bräutigams und der Braut angefüllt war. Es konnte nichts Reizenderes geben, als das junge Mädchen, aber die Blässe ihrer Wangen, die Schwermut, die sich auf ihrem Gesicht malte, und die Tränen, die sich ihr bisweilen aus den Augen drängten, verrieten nur zu sehr den Zustand ihres Herzens. Leander blieb unsichtbar in einem Winkel verborgen, um die Anwesenden kennen zu lernen.
Er hörte, wie die Eltern dieses hübschen Mädchens sie heimlich schalten, dass sie so traurig aussehe. Leander stellte sich hierauf hinter die Mutter und sagte ihr leise ins Ohr: „Wenn du deine Tochter zwingst, ihre Hand diesem alten Affen zu geben, so sollst du noch binnen acht Tagen zur Strafe dafür des Todes sein." Die Frau schrie laut auf und sank zu Boden vor Entsetzen, eine Stimme zu hören, ohne zu sehen, von wem sie käme; noch weit mehr aber erschreckte sie die Drohung, welche sie vernommen hatte. Ihr Mann trat rasch hinzu und fragte, was ihr denn fehle. Sie würde des Todes sein, versetzte sie, wenn die Heirat ihrer Tochter vor sich ginge und sie wolle dies für alle Schätze der Welt nicht zugeben. Ihr Mann lachte nur darüber, und behandelte sie wie eine närrisch gewordene Frau.
Aber Kobold näherte sich ihm und sagte: „Du alter Ungläubiger, wenn du deiner Frau nicht glaubst, so wird es dich dein Leben kosten. Hebe sogleich die Verbindung deiner Tochter auf und gib sie ohne Verzug dem, der sie liebt." Diese Worte brachten eine wunderbare Wirkung hervor. Man schickte sogleich den alten Bräutigam fort, und zwar, wie man sagte, auf den ausdrücklichen Befehl des Himmels. Er wollte dies anfangs bezweifeln und sich nicht zufrieden geben, aber Kobold schrie ihm ein so fürchterliches Hu, Hu ins Ohr, dass jener auf der Stelle taub zu werden meinte, und zu guter letzt trat Leander noch dermaßen auf seine gichtischen Füße, dass er vor Schmerz außer sich geriet und so rasch er nur konnte, aus einem solchen Hause fort humpelte.
Nun schickte man sogleich in den Wald, um den Jüngling aufzusuchen, der noch immer wie ein Verzweifelter umher irrte. Leander erwartete ihn mit einer Ungeduld, die nur von der des jungen Mädchens übertroffen wurde. Die Liebenden waren überglücklich. Das Fest, welches man zu der Hochzeit des Greises veranstaltet hatte, diente jetzt zu der des jungen Paares, und Leander, der seine natürliche Gestalt wieder annahm, erschien plötzlich an der Tür des Saales wie ein Fremder, den das Geräusch des Festes herbei gezogen. Sobald der Bräutigam ihn erblickte, eilte er auf ihn zu und warf sich zu seinen Füßen, in dem er sich auf alle Weise bemühte, ihm seine Dankbarkeit auszudrücken. Zwei Tage brachte Leander sehr vergnügt auf diesem Schlosse zu und verließ es nur mit Bedauern.
Er setzte hierauf seine Reise fort und gelangte in eine große Stadt, in welcher eine Königin residierte, die ihre Freude daran fand, die schönsten Personen ihres Königreichs am Hofe zu haben. Leander ließ sich den prächtigsten Wagen machen, den man jemals hier gesehen hatte, und er konnte das wohl, denn er durfte ja nur die Rose schütteln, so hatte er Geld in Überfluss. Da er schön, jung und geistreich war und mit so großem Glanze auftrat, so kann man leicht denken, dass ihn die Königin und ihre Damen mit aller nur möglichen Auszeichnung empfingen. Unter den Hoffräuleins der Königin bemerkte Leander eine, welche man Schönblondchen nannte. Sie war sehr schön, aber dabei so kalt und ernsthaft, dass Leander, welcher ihr zu gefallen wünschte, gar nicht wusste, wie er dies anfangen solle.
Er veranstaltete alle Abend ihr zu Ehren prachtvolle Feste, Bälle und Schauspiele, beschenkte sie mit den seltensten Kostbarkeiten, die er von weit und breit kommen ließ, aber nichts machte Eindruck auf sie. Je gleichgültiger sie erschien, desto mehr bemühte sich Leander, ihr zu gefallen. Um sich indes zu überzeugen, ob er nicht etwa einen glücklicheren Nebenbuhler habe, beschloss er, einen Versuch mit seiner Rose zu machen. Er hielt sie scherzend Schönblondchen ans Herz und siehe da, die Blume, vorher noch frisch und glänzend, schrumpfte plötzlich welk zusammen. Diese Entdeckung war für Leander sehr empfindlich; um sich mit eignen Augen zu überzeugen, wünschte er sich an dem selben Abend noch in Schönblondchens Zimmer.
Nicht lange, so sah er einen ganz erbärmlichen Sänger herein treten, welcher drei oder vier Verse, die er für Schönblondchen gemacht und deren Melodie und Worte abscheulich waren, auf die widerlichste Weise hergurgelte. Schönblondchen aber ergötzte sich daran, wie an dem schönsten Gesang von der Welt. Er machte Gebärden wie ein Besessener; sie fand alles wunderschön, so närrisch war sie für ihn eingenommen, und endlich reichte sie ihm gar zur Belohnung die Hand zum Kuss. Außer sich vor Zorn stürzte Leander auf den unverschämten Musikanten los, stieß ihn nach einem Balkon und stürzte ihn in den Garten hinunter, wobei er sich seine übrigen Zähne noch vollends ausschlug. Schönblondchen war wie vom Blitz getroffen, sie glaubte nicht anders, es müsse ein böser Geist hierbei im Spiele sein.
Leander verließ das Zimmer, ohne sichtbar zu werden, und kehrte sogleich nach Hause zurück, dankte seine Dienerschaft ab, indem er sie reichlich belohnte, schwang sich auf seinen treuen Lichtblau und kehrte der Stadt den Rücken. Er entfernte sich mit der größten Schnelligkeit und gelangte so nach einiger Zeit in eine andere Stadt; dort erfuhr er, dass eben eine große Feierlichkeit vor sich gehen werde, weil ein junges Mädchen das Gelübde ewiger Keuschheit ablegen und zur Vestalin geweiht werden sollte, obgleich gegen ihre Neigung und Willen.
Der Prinz empfand Mitleid mit dem armen Mädchen und es schien fast, als ob sein kleiner roter Hut dazu bestimmt sei, den Traurigen und Hilfsbedürftigen Trost und Beistand zu bringen. Er eilte in den Tempel und sah dort das junge Mädchen in einem weißen Gewand, mit Blumen bekränzt. Zwei von ihren Brüdern führten sie an der Hand und die Mutter folgte ihr mit einer großen Schar von Männern und Frauen, während die älteste der Vestalinnen sie an der Tür des Tempels erwartete. Plötzlich erhob Kobold seine Stimme und rief aus Leibeskräften: „Haltet ein, haltet ein, ihr lieblosen Brüder und du, törichte Mutter, der Himmel widersetzt sich diesem erzwungenen Opfer. Noch einen Schritt und ihr werdet in tausend Stücke zerschmettert." Man sah sich nach allen Seiten um, woher diese schrecklichen Drohungen kämen, bemerkte aber nichts.
Die Brüder sagten, es müsse wohl der Geliebte ihrer Schwester sein, der sich irgendwo verborgen hätte, um so das Orakel zu spielen; Kobold aber ergriff zornig einen dicken Stock und versetzte ihnen damit mehr als ein Dutzend hageldichte Schläge. Man sah den Stock sich emporheben und auf ihre Schultern niederfallen, wie einen Hammer auf einen Amboss, so dass man an der Wirklichkeit der Streiche nicht zweifeln konnte. Die Vestalinnen, von Schrecken ergriffen, flohen nach allen Richtungen und alle Übrigen taten des gleichen, so dass Kobold mit dem jungen Mädchen allein blieb. Er nahm rasch sein Hütchen ab und fragte sie, ob er ihr irgendwie dienen könne. Das Mädchen erwiderte mit mehr Unerschrockenheit, als man von ihrer Jugend hätte erwarten sollen, sie liebe einen jungen Edelmann, der sich um ihre Hand beworben hätte, aber den Ihrigen zu arm gewesen sei. Sogleich schüttelte Leander die Rose der Fee Wunderhold und schenkte ihr eine Million zum Brautschatz, worauf sie sich verheirateten und sehr glücklich lebten.
Aber das letzte Abenteuer, welches Leander bestand, war das angenehmste. Beim Eintritt in einen großen Wald hörte er das Angstgeschrei einer weiblichen Stimme. Er sah sich nach allen Seiten um und erblickte endlich vier bewaffnete Männer, die ein Mädchen von etwa fünfzehn Jahren mit Gewalt fort schleppten. Er eilte rasch auf sie los und rief ihnen zu: „Was hat euch dieses Mädchen getan, dass ihr es so wie eine Sklavin behandelt?" „Ho, ho“, mein junges Herrchen“, versetzte der Ansehnlichste von ihnen, „was kümmert ihr euch um Dinge, die euch nichts angehen?" „Ich befehle euch“, sprach Leander, sie unverzüglich frei zu lassen." „O ja doch, gleich, wartet nur ein bisschen“, versetzten sie lachend. Der Prinz sprang vom Pferd und setzte das rote Käppchen auf, denn er hielt es nicht für ratsam, ganz allein vier Männer anzugreifen, die stark genug schienen, um zwölf in die Flucht zu schlagen. Kaum hatte er sein Hütchen auf dem Kopf, so war er auch wie gewöhnlich unsichtbar; die Räuber sagten: „Er ist davon gelaufen; es lohnt nicht der Mühe, ihn zu verfolgen, wir wollen nur sehen, dass wir sein schönes Pferd bekommen."
Während nun Drei dem Lichtblau nachliefen, der sie nicht wenig in Atem setzte, blieb Einer als Wache bei dem jungen Mädchen zurück. Diese schrie und jammerte in einem fort. „Ach, meine schöne Prinzessin“, rief sie, „wie glücklich war ich in eurem Palast, wie werde ich die Entfernung von euch ertragen können! wenn ihr mein trauriges Geschick wüsstet, würdet ihr eure Amazonen der armen „Abrikotine" zu Hilfe schicken." Leander, der alles wahrnahm, ergriff unverzüglich den Arm des Räubers, welcher zu ihrer Bewachung zurück geblieben war und band ihn an einen Baum, ohne dass Jener Zeit oder Kraft gehabt hätte, sich zu verteidigen, denn er sah nicht einmal den, welcher ihn wehrlos machte.
Auf sein Geschrei kam einer seiner Spießgesellen ganz atemlos herbei gelaufen und fragte ihn, wer ihn da angebunden habe. „Das weiß ich selbst nicht“, erwiderte Jener, „ich habe keine Menschenseele gesehen." „Das sagst du nur, um dich zu entschuldigen“, versetzte der andere, „aber ich weiß lange, dass du eine Memme bist, warte, ich will dich behandeln, wie du es verdienst“, und damit zählte er ihm eine gehörige Tracht Prügel auf. Dieser Auftritt machte Leander vielen Spaß; er näherte sich hierauf dem zweiten Räuber, fasste ihn beim Arm und band ihn fest, gegenüber von seinem Kameraden. Dieser sah dies nicht sobald, als er ihm zurief: „Wie nun, du tapferer Held, wer hat denn dich da angebunden? bist du nicht eine rechte Memme, dass du es gelitten hast?" Der andere sagte kein Wort dazu und sah ganz beschämt auf die Erde, ohne sich erklären zu können, wie er angebunden worden sei, da er doch niemanden gesehen hatte.
Abrikotine benutzte indes diesen Augenblick zur Flucht, ohne zu wissen, wohin. Leander, der sie nicht mehr sah, rief dreimal nach seinem Lichtblau, der kaum die Stimme seines Herrn vernahm, als er mit zwei Hufschlägen sich von beiden Räubern befreite und damit dem einen den Kopf, dem anderen drei Rippen zerschlug. Nun war nur noch Abrikotine wieder aufzusuchen, die dem Prinzen ungemein gefallen hatte. Unverzüglich wünschte er sich zu ihr hin und sogleich war er dort. Er fand sie so müde, dass sie sich an jeden Baum lehnte, weil sie sich vor Müdigkeit nicht mehr aufrecht halten konnte. Als sie Lichtblau bemerkte, der so lustig einher trabte, rief sie: „O wie schön, da ist ein hübsches Pferd, welches Abrikotine in den Freuden-Palast zurückbringen wird."
Kobold hörte sie wohl, aber sie sah ihn nicht. Er näherte sich ihr, Lichtblau blieb stehen und sie schwang sich hinauf. Leander nahm sie in seine Arme und setzte sie sanft vor sich hin. O welche Furcht empfand Abrikotine, als sie sich umschlungen fühlte und niemanden gewahr wurde. Sie wagte nicht, sich zu rühren, schloss die Augen aus Furcht, einen Geist zu sehen und sagte kein Sterbenswörtchen. Der Prinz, welcher die Taschen voll Zuckerwerk hatte, wollte ihr etwas davon in den Mund stecken, sie schloss aber die Zähne und die Lippen fest zusammen. Endlich nahm er sein Hütchen ab und sagte zu ihr: „Wie furchtsam bist du, Abrikotine, dich so vor mir zu fürchten! ich bin es ja, der dich aus den Händen der Räuber errettet hat."
Sie schlug die Augen auf und erkannte ihn. „Ach, gnädiger Herr“, rief sie, ihr seid es, dem ich alles verdanke? Ich empfand freilich große Furcht, bei einem unsichtbaren Wesen allein zu sein." „Ich war nicht unsichtbar“, erwiderte er, eure Augen müssen euch einen Streich gespielt haben, dass ihr mich nicht gesehen habt." Abrikotine glaubte es, obwohl sie sonst eben nicht einfältig war. Nachdem sie sich hierauf eine Zeit lang von gleichgültigen Dingen unterhalten hatten, fragte Leander sie nach ihrem Alter, ihrer Heimat und wie sie den Räubern in die Hände gefallen wäre.
„Ich bin euch zu sehr verpflichtet“, sagte Abrikotine, um eure Neugier nicht zu befriedigen. Ich bitte euch nur, weniger auf meine Erzählung zu achten, als unsere Reise zu beschleunigen." „Eine Fee, deren Wissenschaft sonder Gleichen ist, fasste eine so heftige Neigung zu einem Prinzen, dass sie sich mit ihm vermählte, zum großen Ärger aller übrigen Feen, die ihr unaufhörlich vorstellten, welche Schmach sie ihnen durch ein solches Zeichen von Schwäche antue. Ihr Unwille ging so weit, dass sie sie länger nicht unter sich dulden wollten, und so blieb der Fee nichts anders übrig, als dass sie sich in der Nähe des Feenreiches einen großen Palast baute."
„Indes der Prinz, welcher sie geheiratet hatte, wurde bald ihrer überdrüssig. Er war in Verzweiflung darüber, dass sie alles, was er nur irgend tat, sogleich mit Hilfe ihrer Kunst erriet, so dass, wenn er nur die geringste Zuneigung zu einer anderen Dame fasste, sie ihm die heftigsten Vorwürfe machte und die hübschesten Mädchen in wahre Scheusale verwandelte." „Der Prinz, welchem ein solches Übermaß von Zärtlichkeit äußerst lästig wurde, nahm eines Tages Postpferde und fuhr in die weite, weite Welt. Er versteckte sich in eine Höhle im Grund eines Berges, damit die Fee ihn nicht finden solle. Allein sie fand ihn doch und beschwor ihn, zu ihr zurückzukehren, versprach ihm Geld, Pferde, Hunde und Waffen und was er sonst nur irgend wünschen möchte." „Es half aber alles nichts, denn er war von Natur starrsinnig und liebte die Ungebundenheit. Er sagte ihr nichts als Grobheiten und nannte sie eine alte Hexe, eine Vogelscheuche."
„Du kannst dich glücklich schätzen“, entgegnete sie ihm, „dass ich vernünftiger bin, als du, denn wenn ich wollte, so könnte ich dich in eine Katze verwandeln oder in eine hässliche Kröte, in einen Kürbis, in eine Eule: aber die größte Strafe, die ich dir auferlegen kann, ist die, dass ich dich deinem Eigensinn überlasse. Bleibe nur in deiner dunklen Höhle, in deinem Loch bei den Bären; rufe nur die Schäferinnen aus der Nachbarschaft zu dir, du wirst mit der Zeit schon erkennen lernen, welch ein Unterschied ist zwischen Bauerndirnen und einer Fee, wie ich, die sich so schön machen kann, wie sie immer will." „Sie stieg sogleich wieder in ihren fliegenden Wagen und eilte schneller davon, als ein Vogel.
So bald sie zurückgekehrt war, versetzte sie ihren Palast an einen anderen Ort, entließ ihre männlichen Wachen und Offiziere und nahm, statt ihrer, Frauen aus dem Amazonengeschlecht in ihren Dienst, welche aufs Sorgfältigste darüber wachen mussten, dass kein Mann diese Insel betrete. Sie nannte diesen Ort „die Insel stiller Freuden", denn wahre Freuden, pflegte sie oft zu sagen, könne man nicht genießen, wenn man in der Gesellschaft von Männern lebe. Ganz nach dieser Ansicht erzog sie auch ihre Tochter. Dies ist die Prinzessin, der ich diene; sie ist die schönste Dame, die es je gegeben hat, und da bei ihr nur die Freude herrscht, so altert man in ihrem Palast nicht. Ich bin, so wie ihr mich seht, mehr als zweihundert Jahr alt. Als meine Gebieterin herangewachsen war, überließ ihr die Fee, ihre Mutter, die Insel, gab ihr treffliche Lehren, wie sie glücklich leben könne und kehrte in das Feenreich zurück, seit welcher Zeit die Prinzessin der Insel stiller Freuden ihren Staat auf bewundernswürdige Weise regiert."
„Ich erinnere mich nicht, dass ich in meinem ganzen Leben andere Männer gesehen habe, als euch und die Räuber, welche mich entführten. Diese Bösewichte! sagten mir, sie seien von einem hässlichen Zwerge, Namens Wüterich, ausgeschickt, der sich in meine Gebieterin bloß auf ihr Bildnis hin verliebt habe. Sie umstreiften lange Zeit die Insel, wagten es aber nicht, sie zu betreten, denn unsere Amazonen sind zu wachsam, um Jemand durch zu lassen. Zum Unglück aber ließ ich, der die Sorge für die Vögel der Prinzessin übertragen ist, eines Tages ihren Lieblingspapagei fort fliegen, und aus Furcht, ausgescholten zu werden, wagte ich mich unkluger weise über die Grenzen hinaus, um ihn zu suchen. Die Räuber erwischten mich und hätten mich ohne eure edelmütige Hilfe mit sich fortgeführt."
„Wenn ihr irgend eine Erkenntlichkeit für mich fühlt, schöne Abrikotine“, sagte Leander, „darf ich da nicht hoffen, dass ihr mir behilflich seid, diese Insel der stillen Freuden zu betreten und eure Gebieterin, die wunderbare, nie alternde Prinzessin zu sehen?" „Ach, gnädiger Herr“, versetzte Abrikotine, „wir wären Beide verloren, wenn wir so Etwas wagten. Es muss euch ja wohl ein Leichtes sein, ein Gut zu entbehren, welches ihr noch nicht kennt. Ihr seid noch nicht in dem Palast gewesen, stellt euch also vor, dass er gar nicht vorhanden sei."
„Es ist nicht so leicht, wie ihr glaubt“, erwiderte der Prinz, „aus dem Gedächtnis Etwas zu verwischen, was unsere Phantasie angenehm beschäftigt hat. Auch kann ich nicht zugeben, dass es ein sicheres Mittel zum Genus wahrer Freuden sei, unser Geschlecht gänzlich zu verbannen." „Es kommt mir nicht zu, darüber zu entscheiden“, versetzte Abrikotine; „ich gestehe selbst, wenn alle Männer euch glichen, so möchte die Prinzessin das Gesetz immerhin widerrufen: aber von Fünfen, die ich gesehen habe, sind Vier Bösewichte gewesen und ich muss daraus wohl schließen, dass es mehr böse als gute gibt, und folglich ist es besser, die Gemeinschaft mit allen zu fliehen."
Unter diesem Gespräch gelangten sie an das Ufer eines breiten Stromes, wo selbst Abrikotine leicht vom Pferde sprang und indem sie dem Prinzen eine tiefe Verbeugung machte, zu ihm sagte: „Lebt wohl, gnädiger Herr! Ich wünsche euch so viel Glück, dass die ganze Welt für euch die Insel der Freuden sei; aber entfernt euch schleunigst, damit unsere Amazonen euch nicht gewahr werden." „Und ich, schöne Abrikotine“, erwiderte der Prinz, „ich wünsche, nicht gänzlich von euch vergessen zu werden." Mit diesen Worten entfernte er sich und begab sich tief in das Dickicht eines Waldes, der sich in der Nähe des Flusses befand. Dort nahm er seinem Lichtblau Sattel und Zaum ab, damit er nach Belieben auf dem frischen Grase weiden könne, setzte sich das rote Hütchen auf und wünschte sich nach der Insel der stillen Freuden. Sein Wunsch ward auf der Stelle erfüllt und er befand sich an dem schönsten, wunderbarsten Orte der ganzen Welt.
Der Palast war aus reinem Golde und wurde von Figuren aus Kristall und Edelsteinen getragen, welche den Tierkreis und alle Wunder der Natur, die Wissenschaften und Künste, die Elemente, das Meer mit seinen Fischen, die Erde mit ihren Tieren, die edlen Übungen der Amazonen, die Freuden des Landlebens, Schäferinnen mit ihren Herden und Hunden, ländliche Arbeiten, den Ackerbau, die Ernte, Gärten, Blumen und Bienen vorstellten. Aber unter so tausend mannigfaltigen Dingen sah man doch nirgends die Gestalt irgendeines Mannes oder auch nur eines Knaben. „Abrikotine hat mich nicht getäuscht“, sagte der Prinz bei sich, „es ist alles so, wie sie gesagt. Man hat an diesem Orte jede Erinnerung an uns verbannt."
Er betrat hierauf den Palast und stieß bei jedem Schritt auf so viel Wunderbares, dass er die Augen kaum wieder davon abwenden konnte. Gold und Diamanten überraschten hier nicht allein durch ihre Kostbarkeit, sondern mehr noch durch die geschmackvolle Art und Weise, wie man sie angebracht hatte. Überall erblickte er junge Mädchen von sanftem, unschuldigem, fröhlichem Aussehen und schön wie der junge Tag. Leander ging durch eine lange Reihe von Sälen; die einen waren mit köstlichen chinesischen Gefäßen gefüllt, deren eigentümlicher Geruch nebst ihren seltsamen Farben und Formen so viel Vergnügen macht. Die Mauern anderer bestanden aus so feinem Porzellan, dass das helle Tageslicht durch schien, wieder andere waren aus geschliffenem Kristall, aus Bernstein, Korallen, Lapislazuli, Achat und Karneol; das Zimmer der Prinzessin aber bestand aus lauter großen Spiegelgläsern, denn ein so lieblicher Gegenstand konnte nicht oft genug vervielfältigt werden.
Ihr Thron war aus einer einzigen, muschelartig geschnittenen Perle gefertigt und mit Armleuchtern von Rubinen und Diamanten umgeben. Aller dieser Schimmer aber verschwand vor der unvergleichlichen Schönheit der Prinzessin. Ihr kindliches Wesen vereinigte alle Anmut der Jugend mit der feinen, sicheren Bewegung eines späteren Alters. Nichts kam der Sanftheit und Lebhaftigkeit ihrer Augen gleich. Genug, es war unmöglich, irgendeinen Mangel an ihr zu finden. Mit holdseligem Lächeln dankte sie ihren Ehrendamen, welche sich heute, um ihr eine Überraschung zu machen, als Nymphen verkleidet hatten. Da sie Abrikotine vermisste, so fragte sie nach ihr. Die Nymphen antworteten, sie hätten sie vergebens überall gesucht, aber nirgends gefunden.
Leander, welcher der Lust zu sprechen nicht widerstehen konnte, ahmte die Stimme eines Papageien nach, deren sich mehrere im Zimmer befanden und sagte: „Reizende Prinzessin, Abrikotine wird bald wieder kehren. Sie war nahe daran, entführt zu werden, wenn ihr ein junger Prinz nicht zu Hilfe kam." Die Prinzessin war von dem, was der Papagei zu ihr sagte, ganz überrascht. „Du plauderst ganz artig, mein kleiner Papagei“, sprach sie zu ihm, „du wirst dich aber doch wohl geirrt haben, und wenn Abrikotine zurück kommt, so wird sie dir die Rute geben." „Sie wird mir nicht die Rute geben“, erwiderte Kobold, indem er noch immer die Stimme des Papageien nach ahmte, „sie wird euch vielmehr erzählen, wie große Lust der fremde Prinz hatte, diesen Palast zu betreten, um euch zu zeigen, wie großes Unrecht ihr seinem Geschlecht antut."
„Fürwahr, Papagei“, rief die Prinzessin aus, „es ist Schade, dass du nicht immer so gesprächig bist, ich würde dich dann recht lieb gewinnen." „Ach“, erwiderte Prinz Kobold, „wenn ich nur zu plaudern brauche, um mir eure Gunst zu erwerben, so werde ich keinen Augenblick mehr zu schwatzen aufhören." „Sollte man aber nicht schwören“, fuhr die Prinzessin fort, „dieser Papagei sei ein Hexenmeister?" In diesem Augenblick trat Abrikotine ins Zimmer und warf sich ihrer schönen Gebieterin zu Füßen. Sie teilte ihr so dann ihr Abenteuer mit und entwarf ihr das Bildnis des Prinzen mit den lebhaftesten und vorteilhaftesten Farben. „Ich würde“, fügte sie hinzu, „vor wie nach alle Männer hassen, wenn ich diesen nicht gesehen hätte. Ach, er ist so liebenswürdig! Sein Äußeres, sein ganzes Benehmen hat so etwas Edles und Geistreiches! Gleichwohl meine ich recht getan zu haben, dass ich ihn nicht hierher brachte."
Die Prinzessin erwiderte nichts darauf, fuhr aber fort, Abrikotine über den Prinzen auszufragen, ob sie nicht seinen Namen, seine Heimat, seine Geburt wisse, woher er käme, wohin er ginge — und versank dann in tiefes Nachdenken. Kobold beobachtete alles und fuhr darauf zu sprechen fort, wie er angefangen hatte. „Abrikotine ist eine Undankbare“, sagte er, dieser arme Fremde wird vor Kummer sterben, dass er euch nicht sehen darf." „Mag er sterben, Papagei“, erwiderte die Prinzessin seufzend, „dir aber, der du wie ein verständiger Mensch reden willst und nicht wie ein kleiner Papagei, dir verbiete ich, mir je wieder von diesem Unbekannten zu reden."
Leander war höchst erfreut, dass die Worte Abrikotinens und des Papageis einen solchen Eindruck auf die Prinzessin gemacht hatten. „Ist es möglich“, sagte er bei sich selbst, in dem er die Prinzessin mit dem größten Wohlgefallen betrachtete, „dass dieses Meisterwerk der Natur ewig auf einer Insel eingesperrt bleiben soll, ohne dass irgend ein Sterblicher sich ihr zu nahen wagen dürfe?" „Aber“, fuhr er fort, „mögen doch alle anderen Männer von hier verbannt sein, da ich ja das Glück habe, mich in ihrer Nähe aufhalten, sie sehen, hören, bewundern und lieben zu können."
Es war schon spät; die Prinzessin begab sich in einen Saal von Marmor und Porphyr, wo mehrere Springbrunnen eine angenehme Kühlung verbreiteten. So wie sie hinein trat, begann eine herrliche Musik und ein köstliches Abendmahl wurde aufgetragen. Längs den Seiten dieses Saales befanden sich große Vogelhäuser, voll der seltensten Vögel, deren Pflege Abrikotinen übertragen war. Leander hatte auf seinen Reisen gelernt, den Gesang der Vögel nachzuahmen und ahmte jetzt sogar einige Arten nach, die sich nicht hier befanden. Die Prinzessin horchte auf, sah sich um, war ganz verwundert, stand von der Tafel auf und ging zu den Vögeln. Kobold sang hierauf noch viel anmutiger und lauter und in dem er die Stimme eines Kanarienvogels annahm, aus dem Stegreif ein kleines sehr artiges Gedicht.
Die Prinzessin, noch viel mehr erstaunt, ließ Abrikotine rufen und fragte sie, ob sie einen von den Kanarienvögeln singen gelehrt hätte. Sie verneinte dieses zwar, meinte aber, ein Kanarienvogel könne wohl eben so viel Verstand besitzen, als ein Papagei. Die Prinzessin lächelte und bildete sich gleichwohl ein, Abrikotine müsse dem Vögelchen Unterricht gegeben haben. Hierauf setzte sie sich wieder zur Tafel, um ihr Abendbrot zu beendigen. Leander hatte sich an diesem Tage hinlängliche Bewegung gemacht, um einen guten Appetit zu haben. Er näherte sich daher der Tafel, deren Duft allein schon erquickend war.
Nun besaß die Prinzessin eine blaue Katze, welche sie sehr liebte; eine von ihren Ehrendamen hielt die selbe auf dem Schoß. „Gnädige Prinzessin“, sagte sie, „Blauhaar hat Hunger." Hierauf setzte man die Katze an die Tafel, wo ihr ein kleiner goldner Teller vorgesetzt wurde, auf welchem sich eine zierlich zusammen gelegte Serviette befand. Die Katze hatte ein Halsband aus Perlen und eine goldne Schelle und fing nun an, tüchtig zu schmausen. „Hoho“, sagte Kobold bei sich selbst, „ein dicker blauer Kater, der vielleicht nie Mäuse gefangen hat und sicherlich nicht von besserer Herkunft ist, als ich, hat die Ehre, mit der schönen Prinzessin zu speisen! Ich möchte wohl wissen, ob er sie ebenso liebt wie ich und ob es billig ist, dass ich mich mit dem Geruch begnüge, während er so köstliche Bissen speist?"
Hierauf nahm er die blaue Katze ganz leise fort von dem Lehnstuhl, setzte sich hinein und nahm die Katze auf den Schoß. Kobold wurde von niemanden gesehen; wie wäre dies auch möglich gewesen? Er hatte ja das rote Hütchen auf. Die Prinzessin legte indes junge Rebhühner, Wachteln und Fasanen auf den Teller Blauhaars, und Rebhühner, Wachteln und Fasanen verschwanden in einem Augenblick, so dass der ganze Hof sagte: „Blauhaar hat noch nie einen solchen Appetit gezeigt." Es befanden sich auch auf der Tafel herrliche Ragouts. Kobold ergriff eine Gabel und indem er den Fuß der Katze festhielt, versuchte er die Ragouts. Oft drückte er die Pfote ein wenig zu sehr und dann schrie und miaute Blauhaar jämmerlich und wollte kratzen.
Als die Prinzessin dies bemerkte, sagte sie: „Gebt doch dem armen Blauhaar diese Torte und dieses Frikassee; seht doch einmal, wie er schreit, um Etwas davon zu bekommen." Leander lachte ganz leise über diesen Spaß; aber er hatte auch großen Durst und da er nicht gewohnt war, so lange zu tafeln, ohne zu trinken, fasste er mit der Pfote der Katze eine große Melone und löschte damit ein wenig seinen Durst. Dann, als das Mahl beendet war, eilte er zum Schenktisch und nahm dort zwei Flaschen von einem nektargleichen Weine.
Die Prinzessin begab sich in ihr Zimmer, sie hieß Abrikotinen folgen und die Tür schließen. Kobold schlich ihnen auf dem Fuß nach und befand sich ungesehen in dem Gemach. „Gestehe nur“, sprach die Prinzessin zu ihrer Vertrauten, „du hast in der Schilderung jenes Unbekannten übertrieben, er kann unmöglich so liebenswürdig sein, wie du sagtest." „Ich beteure euch, gnädige Prinzessin“, erwiderte Abrikotine, „dass ich nicht nur nicht zu viel, sondern vielmehr bei weitem zu wenig gesagt habe." Die Prinzessin schwieg einen Augenblick und seufzte. „Ich danke dir gleichwohl“, fuhr sie fort, dass du ihn nicht mitgebracht hast." „Aber, gnädige Prinzessin“, versetzte Abrikotine, welche schlau genug war, um die Gedanken ihrer Gebieterin zu durchschauen, „wenn er nun her gekommen wäre, die Wunder dieser herrlichen Insel anzustaunen, was hätte das euch schaden können? Wollt ihr in einem Winkel der Welt ewig unbekannt bleiben, verborgen den übrigen Sterblichen? Wozu dient euch so viel Größe, so viel Pracht und Herrlichkeit, wenn sie von niemand gesehen wird?"
„Schweig, schweig, du kleine Schwätzerin“, sagte die Prinzessin, „und störe nicht die glückliche Ruhe, die ich seit sechshundert Jahren genieße. Glaubst du, dass, wenn ich ein unruhiges, geräuschvolles Leben führte, ich so alt geworden wäre? Nur schuldlose, stille Freuden können unser Dasein so verlängern. Haben wir nicht in unsern Geschichtsbüchern von den Umwälzungen der größten Reiche gelesen, von den unsicheren Launen eines unbeständigen Glückes, von den Verkehrtheiten der Liebe, den Schmerzen der Trennung, den Qualen der Eifersucht? Was ist die Ursache, all dieses Kummers und all dieser Leiden gewesen? Was anders als der Umgang der Menschen mit einander? Ich bin, Dank sei es der Fürsorge meiner Mutter, von all der gleichen befreit geblieben! Ich kenne nicht Schmerzen, noch vergebliche Wünsche, weder Neid, noch Liebe, noch Hass. Ja, in solcher Ruhe wollen wir immer leben."
Abrikotine wagte nichts zu entgegnen, die Prinzessin hielt einige Augenblicke inne, dann fragte sie, ob sie ihr nichts darauf zu sagen habe. Abrikotine versetzte, dann wäre es ja aber unnötig gewesen, dass die Prinzessin ihr Bildnis an verschiedene Höfe geschickt hätte, wo es doch nur so Manchen unglücklich machen werde, denn Jeder, der es erblicke, werde das größte Verlangen empfinden, die Prinzessin zu sehen, ohne es je befriedigen zu können. „Gleichwohl gestehe ich dir“, sagte die Prinzessin, „dass ich den Wunsch hege, mein Bildnis käme in die Hände jenes Unbekannten, dessen Namen ich nicht weiß."
„Wie, gnädige Prinzessin!“, rief Abrikotine, „ist sein Verlangen, euch zu sehen, nicht schon groß genug, und wolltet ihr es noch vermehren?" „Ja“, erwiderte die Prinzessin, „eine Regung von Eitelkeit, die mir bisher unbekannt gewesen ist, macht mir Lust dazu." Kobold hörte dies alles mit an, ohne nur ein Wort davon zu verlieren; Manches erweckte schmeichelhafte Hoffnungen in ihm, andere zerstörte sie gänzlich. Es war schon spät; die Prinzessin begab sich in ihr Schlafgemach und Leander schlüpfte in ein Seitenkabinett, um das Vergnügen zu haben, sie doch reden zu hören. Die Prinzessin fragte eben Abrikotine, ob sie auf ihrer Reise nichts Außerordentliches gesehen hätte.
„O ja“, versetzte sie, „ich bin durch einen Wald gekommen, wo ich Tiere gesehen habe, die fast wie kleine Kinder aussehen; sie hüpfen springen in den Bäumen, wie die Eichhörnchen; ihr Aussehen ist sehr hässlich, aber ihre Geschicklichkeit außerordentlich." „Ach“, sagte die Prinzessin, „wie gern möchte ich einige von diesen Tieren besitzen; wenn sie nicht so schnell wären, könnte man wohl einige fangen." Kobold, welcher durch diesen Wald gekommen war, erriet gleich, dass die Rede von Affen war. Sogleich wünschte er sich dahin, fing ein Dutzend große und kleine Affen von verschiedenen Farben, steckte sie mit vieler Mühe in einen großen Sack und wünschte sich dann nach Paris, da er gehört hatte, dass man dort für Geld alles haben könne, was man nur wünsche.
Bei einem berühmten Goldschmied kaufte er einen kleinen Wagen ganz aus Gold, an den er sechs grüne Affen spannte, mit einem Geschirr von feuerfarbenem Maroquin, mit Gold ausgelegt. Hierauf begab er sich zu einem bekannten Marionettenspieler, von dem er zwei vorzüglich gut abgerichtete Affen kaufte und den einen als König gekleidet in den Wagen setzte, den anderen als Kutscher auf den Bock. Die übrigen Affen waren als Pagen angezogen und das Ganze gewährte einen sehr possierlichen Anblick. Er steckte hierauf den Wagen und die gestiefelten Affen, den König wie die Dienerschaft, wieder in seinen Sack und ehe noch die Prinzessin sich zu Bett gelegt hatte, hörte sie plötzlich in dem Vorzimmer das Geräusch des kleinen Wagens, und ihre Nymphen meldeten ihr die Ankunft des Königs der Zwerge. Zugleich rollte die Karosse mit dem Affenzug in ihr Zimmer.
Kobold leitete das Ganze; zuletzt ließ er den Affenkönig aus seiner kleinen Goldkarosse steigen und der Prinzessin mit sehr gutem Anstand ein mit Diamanten besetztes Kästchen überreichen. Sie machte es auf und fand einige sehr artige Verse darin. Man kann sich ihr Erstaunen denken. Nun tanzten die beiden Pariser Affen miteinander, die an Geschicklichkeit die berühmtesten Affentänzer ihrer Zeit übertrafen. Die Prinzessin belustigte sich ungemein daran, und lachte anfangs so sehr, dass sie beinahe Kopfweh bekam; aber unruhig, den Verfasser der Verse nicht erraten zu können, entließ sie die Tänzer früher, als sie es sonst getan hätte. Vergebens strengte sie all ihr Nachdenken an, das so verborgene Geheimnis zu enträtseln.
Leander, hoch erfreut darüber, dass die Prinzessin seine Verse mit so großer Aufmerksamkeit gelesen und die Affen mit so vielem Vergnügen hatte tanzen sehen, dachte nun daran, ein wenig Ruhe zu genießen, deren er freilich sehr bedurfte. Er hielt sich eine Weile in dem großen Vorfall auf und stieg dann hinab. In dem Erdgeschoß stand eine Tür auf; er trat ganz leise in ein Gemach, welches so schön und anmutig war, wie er noch nie eins gesehen hatte. Es befand sich darin ein prächtiges Bett mit goldbestickten Gardinen von grüner Gaze, die mit Perlenschnüren zierlich aufgebunden waren; die Eicheln bestanden aus Rubinen und Smaragden. Es war schon hell genug, um die außerordentliche Pracht dieses Lagers bewundern zu können. Nachdem Leander die Tür verschlossen, streckte er sich auf das Bett und fiel in einen tiefen Schlaf.
Er erwachte so früh, dass ihm die Zeit, bis wo er die Prinzessin sehen konnte, sehr lang erschien. Da er sich überall umsah, bemerkte er eine zum Malen aufgespannte Leinewand, Pinsel und Farben. Zugleich erinnerte er sich, was die Prinzessin am Abend vorher mit Abrikotinen über ihr Bildnis gesprochen hatte und da er besser malte, als die ausgezeichnetsten Meister, so setzte er sich vor einen großen Spiegel und malte sein Bildnis, wie er mit einem Knie sich auf die Erde stützte, und das Portrait der Prinzessin, deren treues Bild ihm seine lebhafte Phantasie vorspiegelte, in der Hand hielt; in der anderen Hand trug er eine Rolle mit den Worten: „Lebendiger ist sie noch in meinem Herzen."
Wie erstaunt war die Prinzessin, als sie ihr Zimmer betrat, da selbst das Bildnis eines Mannes zu finden. Sie betrachtete es aber mit noch größerem Erstaunen, als sie auch das ihrige erkannte und die Worte auf der Rolle ihrer Neugier und ihrem Nachdenken einen reichen Stoff gaben. Sie war allein, sie verlor sich in Vermutungen; endlich aber kam sie zu der Überzeugung, Abrikotine müsse die Urheberin dieser anmutigen Überraschung sein. Nun wollte sie nur noch wissen, ob das Portrait dieses schönen Jünglings nur ein Werk ihrer Einbildungskraft sei oder ein Original besäße. Sie stand hastig auf und rief Abrikotine herbei. Unterdessen war Kobold, das rote Hütchen auf dem Kopf, bereits im Zimmer, voll Neugier, das Weitere zu hören.
Die Prinzessin hieß Abrikotinen das Bildnis zu betrachten und ihr ihre Meinung darüber zu sagen. Sie hatte es kaum erblickt, so rief sie: „Fürwahr, gnädige Prinzessin, dies ist das Portrait des edelmütigen Fremden, welchem ich das Leben verdanke. Ja, er ist es selbst, dies sind seine Züge, sein Wuchs, seine Haare und sein ganzer Anstand." „Du stellst dich überrascht“, sagte die Prinzessin lächelnd, „und du hast es doch selbst hierher gebracht." „Ich, gnädige Prinzessin?“, erwiderte Abrikotine, „ich schwöre euch, dass ich Zeit meines Lebens dieses Gemälde nicht gesehen habe und wie sollte ich so kühn sein, euch irgend etwas zu verheimlichen, das von Interesse für euch ist? durch welches Wunder auch sollte es in meine Hände geraten sein? Ich kann weder malen, noch hat je ein Mann diesen Ort betreten und doch seid ihr hier zu gleich mit ihm gemalt."
„Ich fange an mich zu fürchten“, sagte die Prinzessin; „irgend ein Geist muss es hier her gebracht haben." „Wenn ich es wagen darf, euch einen Rat zu geben“, versetzte Abrikotine, „so verbrennt es auf der Stelle." „Wie Schade!“, sagte die Prinzessin mit einem Seufzer; mich dünkt, mein Zimmer könnte nicht schöner geschmückt sein!“, und in dem sie dieses sagte, betrachtete sie es mit unverwandten Blicken. Abrikotine aber bestand darauf, man müsse durchaus einen Gegenstand verbrennen, der nur durch Zauberei könne hierher gebracht worden sein. Sie lief auf der Stelle fort, um Feuer zu holen, während die Prinzessin an ein Fenster trat, weil sie ein Bildnis, das so großen Eindruck auf ihr Herz machte, nicht länger ansehen wollte. Da aber Kobold keineswegs gesonnen war, es verbrennen zu lassen, benutzte er diesen Augenblick, um es zu nehmen und sich unbemerkt damit zu entfernen.
Er hatte kaum das Gemach verlassen, als die Prinzessin sich umwandte, um das schöne Gemälde, welches ihr so wohl gefiel, noch einmal zu betrachten. Welches Erstaunen, als sie es nicht mehr fand! Sie suchte es überall, natürlich aber vergebens. Sie fragte Abrikotine, die jetzt zurückkam, ob sie es mitgenommen habe. Abrikotine versicherte das Gegenteil und dieses letzte Abenteuer setzte sie vollends in Schrecken. Sobald Kobold das Bildnis verborgen hatte, kehrte er wieder in das Zimmer zurück, denn er empfand das größte Vergnügen, die schöne Prinzessin so oft als möglich zu sehen und sprechen zu hören. Er speiste daher auch alle Tage an ihrer Tafel mit Blauhaar, der freilich nicht zum Besten dabei fortkam; indes war Kobold weit davon entfernt, sich zufrieden zu fühlen, da er weder sprechen, noch sich sehen lassen durfte, und es ist wohl keine Kleinigkeit, sich unsichtbar Gegenliebe zu erwerben.
Die Prinzessin hatte Sinn für alles Schöne und in ihrer gegenwärtigen Stimmung bedurfte sie der Zerstreuung. Eines Tages äußerte sie im Kreise ihrer Damen, es würde ihr viel Vergnügen machen, zu wissen, wie die Damen an den verschiedenen Höfen der Welt gekleidet wären, um dann die geschmackvollste Mode für sich selbst auswählen zu können. Mehr bedurfte es nicht, um Kobold zu veranlassen, die ganze Erde zu durchfliegen. Er setzte sein rotes Hütchen auf und wünschte sich nach China, kaufte dort die schönsten Stoffe und nahm das Muster einer Frauentracht mit; er flog nach Siam und tat dort das Nämliche, er durcheilte vier Weltteile in drei Tagen und immer wenn er eine gehörige Bürde aufgesammelt hatte, kehrte er in den Palast der stillen Freuden zurück, um sie in einer entlegenen Kammer zu verbergen.
Als er nun auf diese Weise eine große Anzahl kostbarer Seltenheiten gesammelt (denn Geld hatte er, so viel er wollte, die Rose gab alles her), begab er sich nach Paris, kaufte da selbst fünf bis sechs Dutzend Puppen, ließ sie mit all den Stoffen bekleiden und stellte sie sämtlich dann in dem Gemach der Prinzessin auf. Als diese herein trat, empfand sie die angenehmste Überraschung, die sie nur je gehabt hatte. Jede der Puppen hielt ein Geschenk in der Hand, Uhren, Armbänder, Ringe von Diamanten; und die, welche am meisten in die Augen fiel, trug eine Kapsel. Die Prinzessin öffnete dieselbe und fand darin das Portrait Leanders, denn das Bild des selben hatte sich ihr von jenem ersten Gemälde so tief eingeprägt, dass sie ihn auf der Stelle wieder erkannte.
Sie stieß einen lauten Schrei aus und sagte zu Abrikotine: „Ich kann nicht begreifen, was seit einiger Zeit in meinem Palast vorgeht. Meine Vögel reden so vernünftig, und es scheint, dass ich nur meine Wünsche zu äußern brauche, um sie erfüllt zu sehen; ich finde zweimal das Bildnis dessen, der dich aus den Händen der Räuber errettet hat, und sieh da, welche Stoffe, Diamanten, Stickereien, Spitzen und kostbare Seltenheiten! Was für eine Fee ist es, was für ein Geist, der es sich so angelegen sein lässt, mir der gleichen Annehmlichkeiten zu erweisen? Als Leander dies hörte, schrieb er in seine Schreibtafel folgende Worte und warf sie der Prinzessin zu Füßen:
„Ich bin nicht Geist und bin nicht Fee,
Doch fühle ich tiefes Liebesweh,
Nicht wage ich, vor euch zu erscheinen,
O wollt zum wenigsten mein Los beweinen!"
Die Schreibtafel glänzte so von Gold und Edelsteinen, dass die Prinzessin sie sogleich gewahr wurde; sie öffnete sie und las mit dem größten Erstaunen die Verse Kobolds. „Dieser Unsichtbare“, sagte sie hierauf, „ist also ein Ungeheuer, weil er es nicht wagt, sich mir zu zeigen?" „Ich habe sagen hören, gnädige Prinzessin“, erwiderte Abrikotine, „dass die Kobolde aus Luft und Feuer bestehen, dass sie keinen Körper haben und dass nur ihr Geist und ihr Wille tätig ist." „Ich bin zufrieden damit“, versetzte die Prinzessin, „ein solcher Liebhaber kann die Ruhe meines Lebens nicht besonders stören."
Leander war entzückt, die Prinzessin mit seinem Bilde so beschäftigt zu sehen und zu hören. Er erinnerte sich, dass in einer Grotte, welche sie öfters besuchte, ein Fußgestell stand, welches für eine noch unvollendete Diana bestimmt war. Auf dieses Piedestal nun stellte sich Leander, in einer ganz ungewöhnlichen Kleidung, mit einem Lorbeerkranz aus dem Kopf und einer Lyra in der Hand. Mit Ungeduld erwartete er den Augenblick, wo die Prinzessin, wie sie täglich es gewohnt war, hier her kommen würde.
Als sie die Grotte betrat, winkte sie, dass man ihr nicht folgen solle, da sie allein zu sein wünschte, worauf ihre Dienerinnen sich in den Alleen des Gartens zerstreuten. Die Prinzessin warf sich auf eine Ruhebank und sprach vor sich hin, aber so leise, dass Kobold nichts davon verstehen konnte. Dieser hatte anfänglich das rote Hütchen aufgesetzt, damit sie ihn nicht sogleich gewahr werde, dann nahm er es ab. Ihr Erstaunen war unbeschreiblich; anfangs glaubte sie, es sei eine Bildsäule, da er unbeweglich in der Stellung blieb, welche er angenommen hatte. Sie betrachtete ihn mit einem Gefühl von Furcht und Freude, aber das Vergnügen, welches diese so unerwartete Erscheinung ihr gewährte, siegte schon über die Furcht, als der Prinz plötzlich in Begleitung der Lyra einen sanften, lieblichen Gesang anhob. So anmutig auch die Stimme Leanders war, so konnte die Prinzessin doch dem Schrecken, der sie ergriff, nicht widerstehen, sie erbleichte plötzlich und sank ohnmächtig zu Boden.
Leander sprang bestürzt von dem Fußgestell herab und nach dem er sein rotes Hütchen, um von niemanden gesehen zu werden, wieder aufgesetzt hatte, leistete er ihr mit dem größten Eifer jeden möglichen Beistand. Nach einiger Zeit schlug sie die Augen wieder auf und sah sich überall um, als ob sie ihn suche. Niemand war zu sehen, doch fühlte sie, dass man ihre Hände festhielt und küsste. Lange Zeit wagte sie kein Wort zu reden, zwischen Furcht und Hoffnung geteilt; obwohl sie den Kobold fürchtete, so lieb war er ihr doch, wenn er die Gestalt des Unbekannten annahm. Endlich rief sie aus: „Kobold, artiger Kobold, warum bist du nicht der, den ich wünsche?"
Bei diesen Worten war Leander nahe daran, sich zu entdecken, aber er wagte es noch immer nicht. „So lange ich sie noch erschrecke“, sagte er bei sich selbst, „so lange sie mich noch fürchtet, darf ich nicht auf ihre Liebe hoffen." Er schwieg daher und zog sich in einen Winkel der Grotte zurück. Die Prinzessin, welche allein zu sein glaubte, rief Abrikotine herbei und erzählte ihr das Wunder von der lebendig gewordenen Statue, wie anmutig ihre Stimme gewesen sei und wie hilfreich sich der Kobold bei ihrer Ohnmacht erwiesen habe. „Wie Schade“, sagte sie, „dass dieser Kobold so hässlich und ungestaltet ist, denn unmöglich kann irgend Jemand liebenswürdigere und gefälligere Sitten haben!" „Und wer hat euch denn gesagt, gnädige Prinzessin“, versetzte Abrikotine, „dass er so hässlich ist, wie ihr glaubt?" „Ach“, sagte die Prinzessin, „wenn er dem Unbekannten gleichen würde, so würde es mir schwer werden, den Vorschriften meiner Mutter zu gehorchen!" Man kann sich leicht vorstellen, welches Vergnügen Leander bei dieser Unterhaltung empfand!
Inzwischen wartete der kleine Wüterich, welcher in die Prinzessin verliebt war, ohne sie je gesehen zu haben, mit Ungeduld auf die Rückkehr der vier Männer, die er nach der Insel der stillen Freuden abgesandt hatte. Indes nur einer kehrte zurück, der ihm jedoch über alles ausführlich berichtete. Er erzählte ihm, dass die Insel von Amazonen verteidigt würde und nur ein mächtiges Heer ihm den Eingang verschaffen könnte. Der König, sein Vater, war so eben gestorben und Wüterich also unumschränkter Herr geworden. So gleich sammelte er ein Heer von mehr als viermal hunderttausend Mann und zog an ihrer Spitze zur Eroberung der Insel aus. Das war einmal ein schöner General, der erste beste Affe hätte sich besser benommen, als er!
Als die Amazonen dieses gewaltige Heer erblickten, benachrichtigten sie die Prinzessin davon, welche ohne Verzug die treue Abrikotine nach dem Feenreiche sandte und ihre Mutter um Rat fragen ließ, wie sie den kleinen Wüterich aus ihren Staaten vertreiben solle. Abrikotine aber fand die Fee ganz in Zorn. „Ich weiß alles“, sagte sie, „was bei meiner Tochter vorgeht. Der Prinz Leander ist in ihrem Palast, er liebt sie und sie liebt ihn. Alle meine Sorgfalt hat sie nicht vor einem solchen Schicksal bewahren können. Gehe, Abrikotine, ich will nichts mehr von dieser Tochter hören, deren Ungehorsam mir solchen Kummer macht."
Als Abrikotine diese schlimme Nachricht der Prinzessin hinterbrachte, geriet diese in die größte Verzweiflung. Kobold befand sich unsichtbar in ihrer Nähe und nahm an ihrem Schmerz den innigsten Anteil. Doch wagte er nicht, sie in diesem Augenblick anzureden. Er erinnerte sich, dass Wüterich sehr geldgierig sei und hoffte ihn dadurch vielleicht zum Rückzug zu bewegen. Sogleich verkleidete sich Leander als Amazone und wünschte sich in den Wald zu seinem Pferde. Kaum hatte er Lichtblau gerufen, als dieser springend und wiehernd herbei kam, denn er hatte, so lange von seinem lieben Herrn entfernt, die größte Langeweile empfunden.
Leander langte in dem Lager Wüterichs an und Jedermann hielt ihn für eine Amazone, so schön und jugendlich sah er aus. Man meldete dem König, dass eine junge Dame im Auftrage der Prinzessin der stillen Freuden-Insel ihn zu sprechen wünsche. Wüterich warf sogleich seinen königlichen Mantel um und setzte sich auf den Thron, auf welchem er sich ausnahm wie eine Meerkatze, die den König spielen will. Leander trat ein und sagte ihm, die Prinzessin, welche ein stilles, friedliches Leben den Unruhen des Krieges vorziehe, lasse ihm so viel Geld anbieten, als er nur irgend wolle, im Fall er ihr Frieden gewähre; schlüge er jedoch dieses Anerbieten aus, so werde sie nichts zu ihrer Verteidigung unversucht lassen.
Wüterich erwiderte, er wolle Mitleid mit der Prinzessin haben und ihr die Ehre seines Schutzes bewilligen; sie brauche ihm nur hundert tausend Millionen Goldstücke zu schicken, so werde er augenblicklich in sein Reich zurückkehren. Leander entgegnete ihm, da es zu viel Zeit kosten würde, hundert tausend Millionen Goldstücke zu zählen, so möge er doch lieber sagen, wie viel Zimmer voll er zu haben wünsche; die Prinzessin sei edelmütig und reich genug, um ein paar mehr nicht anzusehen.
Wüterich war außerordentlich erstaunt, dass man, anstatt zu handeln, die geforderte Summe freiwillig noch erhöhte. Es schien ihm das Beste, so viel zu nehmen, als er immer könnte, und dann die Amazone töten zu lassen, damit sie zu ihrer Gebieterin nicht wieder zurückkehren könne. Hierauf sagte er zu Leander, er verlange dreißig große Säle ganz mit Goldstücken gefüllt und gebe sein königliches Wort, so gleich dann umzukehren. Leander wurde in die Zimmer geführt, die er mit Gold anfüllen sollte, nahm seine Rose und schüttelte sie so lange, bis Pistolen, Quadruples, Louisdor, Goldtaler, Rosenobles, Souveraine, Guineen und Zechinen wie in einem Platzregen herab stürzten. Es gibt wohl nichts Reizenderes auf der Welt, als so ein Regen.
Wüterich geriet außer sich vor Entzücken und je mehr Gold er sah, desto größere Luft empfand er, die Amazone umzubringen und die Prinzessin in seine Gewalt zu bekommen. Sobald die dreißig Zimmer voll waren, rief er den Wachen zu: „Ergreift diese Spitzbübin, sie hat mir falsches Gold gebracht." So gleich stürzten sich alle auf die Amazone, in dem selben Augenblick aber setzte Kobold sein rotes Hütchen auf und war verschwunden. Man glaubte, er sei entwischt, lief ihm nach und ließ Wüterich allein. In diesem Augenblick ergriff ihn Kobold bei den Haaren und schnitt ihm den Kopf ab, wie einem Huhn.
Als Kobold den Kopf hatte, wünschte er sich in den Palast der Freuden zurück. Die Prinzessin ging im Garten auf und nieder, sehr betrübt über die Antwort ihrer Mutter und auf ein Mittel sinnend, wie sie Wüterich zurücktreiben könne. Letzteres schien ihr allerdings sehr schwer, da sie den viermal hunderttausend Mann des Tyrannen nur eine kleine Anzahl von Amazonen entgegen zu stellen hatte. Plötzlich sah sie einen Kopf in der Luft schweben, ohne dass ihn irgendjemand hielt. Dieses Wunder setzte sie in solches Erstaunen, dass sie nicht wusste, was sie davon denken sollte, und ihr Erstaunen wuchs noch viel mehr, als man den Kopf zu ihren Füßen nieder legte, ohne dass sie die Hand erblickte, welche dies tat.
Zugleich vernahm sie eine Stimme, welche zu ihr sagte: „Seid ohne Furcht, anmutige Prinzessin, Wüterich wird euch nichts mehr zu Leide tun." Abrikotine erkannte sogleich die Stimme Leanders und rief aus: „Fürwahr, gnädige Prinzessin, der Unsichtbare, der hier spricht, ist der Fremde, der mich befreit hat." Die Prinzessin schien erstaunt und entzückt. „Ach!“, sagte sie, „wenn es wahr ist, dass der Kobold und der Fremde eins und das selbe sind, so würde es mir großes Vergnügen gewähren, ihm meine Dankbarkeit zu bezeigen." Der Kobold erwiderte: „Ich will mich bemühen, sie noch mehr zu verdienen."
In der Tat kehrte er sogleich zu der Armee Wüterichs zurück, wo das Gerücht seines Todes sich schon verbreitet hatte. Kaum zeigte sich Leander, so kamen alle auf ihn zu, die Hauptleute und Soldaten umringten ihn mit lautem Freudengeschrei und erkannten ihn als ihren König an, dem die Krone rechtmäßiger Weise zugehöre. Er überließ ihnen sogleich mit großer Freigebigkeit die dreißig Säle voll Gold, um sie unter sich zu verteilen, so dass selbst die gemeinen Soldaten für ihr Lebtag reiche Leute wurden. Leander schickte sie hierauf in kleinen Märschen wieder in ihre Heimat und kehrte dann zur Prinzessin zurück.
Die Prinzessin aber schlief schon und so begab er sich auf das Zimmer, wo er gewöhnlich die Nacht zubrachte. Da er heute ziemlich müde und der Ruhe bedürftig war, so vergaß er die Tür, wie sonst, sorgfältig zu verschließen. Die Prinzessin indes konnte vor Unruhe nicht schlafen. Sie stand mit dem frühesten Morgen auf und begab sich hinab in ihr Zimmer; welche Überraschung aber, als sie dort Leander auf dem Bett schlafend fand! Sie hatte Zeit genug, ihn unbemerkt zu betrachten und sich zu überzeugen, dass es der nämliche Jüngling sei, dessen Bildnis sie in der Kapsel von Diamanten besaß.
„Ist es möglich“, sagte sie bei sich selbst, „dass dies ein Kobold ist? schlafen denn die Kobolde auch? Ist dies ein Körper von Luft und Feuer, wie Abrikotine sagt?" Sie berührte leise seine Haare, lauschte aufmerksam auf seine Atemzüge und fühlte bald die größte Freude, ihn gefunden zu haben, bald wieder die tiefste Unruhe. Während sie nun so, in seinen Anblick versenkt da stand, trat plötzlich ihre Mutter herein mit einem so schrecklichen Getöse, dass Leander aus dem Schlaf auffuhr. Wie groß aber war seine Überraschung und sein Schmerz, als er die Prinzessin in der größten Verzweiflung erblickte, wie sie von ihrer Mutter unter den härtesten Vorwürfen fortgerissen wurde. O, welch' ein Schmerz für Leander und die Prinzessin, welche jetzt nahe daran waren, für immer getrennt zu werden! Die Prinzessin wagte keine Widerrede gegen die schreckliche Fee; sie warf nur ihre Augen auf Leander, als ob sie ihn um Beistand anflehe.
Leander sah wohl ein, dass er sie wider den Willen einer so mächtigen Fee nicht zurück halten könne, versuchte jedoch, ob er durch Beredsamkeit und Unterwürfigkeit die erzürnte Mutter besänftigen könne. Er eilte ihr nach, warf sich zu ihren Füßen und beschwor sie, Mitleid mit ihm zu haben, der sein ganzes Glück darin finden würde, ihre Tochter glücklich zu machen. Auch die Prinzessin, durch sein Beispiel ermutigt, umarmte die Knie ihrer Mutter und beteuerte, dass sie ohne Leander nicht leben könne und die größten Verpflichtungen gegen ihn habe. Die unerbittliche Fee ließ sie indes unerhört zu ihren Füßen liegen; vergebens flehten sie in den rührendsten Ausdrücken, die Fee schien ohne alles Gefühl zu sein und gewiss würde sie ihnen nicht verziehen haben, wenn nicht in diesem Augenblick die anmutige Fee Wunderhold glänzender als die Sonne in dem Zimmer erschienen wäre.
Sie umarmte die ältere Fee und sprach zu ihr: „Meine teure Schwester, ich bin überzeugt, ihr habt die Dienste nicht vergessen, die ich euch damals erwies, als ihr in unser Reich zurück kehren wolltet; ohne mich wärt ihr nie wieder aufgenommen worden. Ich habe nie von euch einen Gegendienst gefordert; endlich aber ist der Augenblick gekommen, mir eure Dankbarkeit zu bezeigen. Verzeiht dieser schönen Prinzessin, willigt in ihre Vermählung mit diesem jungen König ein und ich bürge euch dafür, dass seine Neigung unverändert bleiben wird. Ihre Tage werden ein Gewebe von Gold und Seide sein. Diese Verbindung wird euch mit der Vergangenheit versöhnen, ich aber werde euch die Freude, welche ihr mir dadurch bereitet, nie vergessen."
„Ich willige in alles, was ihr nur wünscht, meine teure Wunderhold“, rief die Fee, „kommt, meine Kinder, kommt in meine Arme und empfangt die Versicherung meines steten Wohlwollens." Bei diesen Worten umarmte sie die Prinzessin und Leander, worauf die Fee Wunderhold und ihr ganzes Gefolge, welches in dessen genaht war, einen anmutigen Freudengesang anstimmten. Der ganze Hofstaat der Prinzessin wurde dadurch aus seinem Morgenschlummer erweckt und eilte herbei, um die Veranlassung zu erfahren.
Welche angenehme Überraschung für Abrikotine! Sie hatte kaum die Augen auf Leander geworfen, als sie ihn wieder erkannte und da sie die Hand der Prinzessin in der seinigen sah, so gleich erriet sie, was vorgefallen war. Sie wurde in ihren Vermutungen noch mehr bestätigt, als die Fee, die Mutter der Prinzessin, sagte, sie wolle die Insel der stillen Freuden, den Palast und all die Wunder, welche er enthielt, nach dem Königreiche Leanders versetzen, dort für immer bei ihnen leben und sie mit noch viel größeren Glücksgütern überhäufen.
Da Wunderhold an alles dachte, so hatte sie durch ihre Zaubermacht die Generale und Hauptleute der Wütrichschen Armee in den Palast der Prinzessin versetzt, damit sie Zeugen wären von dem prachtvollen Fest, welches sie zur Hochzeitsfeier veranstalten wollte. Sie ließ es sich in der Tat sehr angelegen sein und eine Menge Bände würden nicht hin reichen, die Schauspiele, Opern, Konzerte, Ringelrennen, Turniere, Wettkämpfe, Jagden und andere Festlichkeiten zu beschreiben, welche bei dieser großartigen Hochzeitsfeier stattfanden.
Wir übergehen die selben also und melden nur noch, dass Leander und seine Gemahlin bis an ihr Ende ein zufriedenes Leben führten, dessen Glück durch nichts gestört wurde.
SCHÖNCHEN GOLDHAAR ...
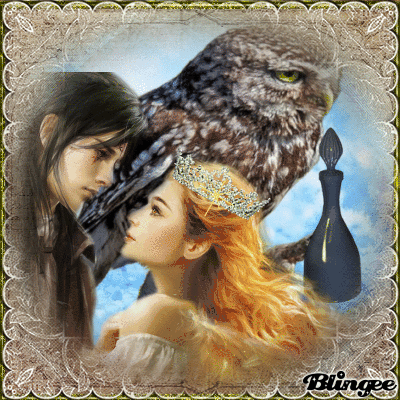
Es war einmal eine Königstochter, die war so schön, dass es nichts Schöneres auf der Welt gab und deshalb nannte man sie Schönchen Goldhaar; denn ihr goldgelbes krauses Haar war weit feiner, als Gold und fiel in langen Locken bis auf die Knie herab. Sie war wie eingehüllt darin, trug fast immer einen Blumenkranz auf dem Kopf und Kleider, die mit Diamanten und Perlen besetzt waren. Niemand konnte sie sehen, ohne sie zu lieben.
In ihrer Nachbarschaft befand sich ein junger König, der noch unverheiratet war, sehr hübsch und sehr reich. Als er hörte, was man alles von Schönchen Goldhaar erzählte, empfand er, ohne sie noch gesehen zu haben, eine so heftige Liebe zu ihr, dass er alle Luft zum Essen und Trinken verlor und sich entschloss, einen Gesandten abzuschicken und sie zu seiner Gemahlin zu verlangen. Er ließ seinem Gesandten eine prächtige Karosse bauen, gab ihm mehr als hundert Pferde und hundert Bedienten mit und empfahl ihm angelegentlich, ihm die Prinzessin ja mitzubringen. Als der Gesandte von dem König Abschied genommen hatte und abgereist war, sprach der ganze Hof von nichts anderem, und der König, der keinen Augenblick zweifelte, dass Schönchen Goldhaar ja sagen werde, ließ schon prächtige Kleider machen und wunderschöne Möbel.
Während nun die Arbeitsleute in voller Beschäftigung waren, traf der Gesandte bei Schönchen Goldhaar ein und richtete seinen Auftrag aus. Aber sei es nun, dass sie diesen Tag nicht bei guter Laune war, oder gefiel ihr etwa das Kompliment nicht, genug, sie entgegnete: sie danke dem König schönstens, habe indes keine Lust sich zu verheiraten. Sehr betrübt über diesen Bescheid, verließ der Gesandte den Hof der Prinzessin und brachte alle die Geschenke wieder mit, die er ihr von Seiten des Königs überreicht hatte; denn wohlerzogen wie sie war, wusste sie, dass Mädchen von jungen Männern keine Geschenke annehmen dürfen und wollte daher auch weder die schönen Diamanten, noch alles Übrige behalten. Nur einen Brief feiner englischer Stecknadeln nahm sie an, um den König nicht zu beleidigen.
Als der Gesandte in der Residenz des Königs, wo er mit großer Ungeduld erwartet wurde, wieder anlangte, betrübte sich Jedermann, dass er Schönchen Goldhaar nicht mitbringe und der König weinte wie ein Kind: alle Bemühungen, ihn zu trösten, waren vergebens.
An dem Hof des Königs befand sich ein junger Mann, schön wie der Tag; seiner Anmut und seines Geistes halber hatte man ihm den Namen Liebhold gegeben. Jedermann liebte ihn, einige neidische Höflinge ausgenommen, welche sich ärgerten, dass der König ihm Wohl wollte und ihn zu seinem Vertrauten machte. Als sich Liebhold einmal unter diesen Leuten befand und von der Rückkehr und der verunglückten Bewerbung des Gesandten gesprochen wurde, äußerte er unvorsichtigerweise: „Wenn mich der König zu Schönchen Goldhaar geschickt hätte, so bin ich überzeugt, sie wäre mit mir gekommen."
Auf der Stelle gingen diese boshaften Menschen zum König und sprachen: „Wissen Euer Majestät, was Liebhold so eben gesagt hat? Wenn er zu Schönchen Goldhaar geschickt worden wäre, er hätte sie mitgebracht! Seht nur den Hochmut, er will schöner sein als Ihr und bildet sich ein, die Prinzessin würde so entzückt von ihm gewesen sein, dass sie ihm überall hin gefolgt wäre." Auf diese Rede hin geriet der König in Zorn und so sehr, so sehr in Zorn, dass er ganz außer sich war. „Ha!“, rief er: „Macht sich dieses niedliche Püppchen über mein Unglück lustig und dünkt sich mehr, als ich? Man bringe ihn gleich in den großen Turm und lasse ihn da verhungern."
Die Leibwache des Königs ergriff Liebhold, der gar nicht mehr an das dachte, was er gesagt hatte und schleppte ihn ins Gefängnis, wo er mit der äußersten Härte behandelt wurde. Der arme Mensch erhielt nichts weiter, als ein wenig Stroh zum Lager und würde verschmachtet sein, hätte er nicht aus einer kleinen Quelle, die am Fuß des Turmes floss, trinken und sich erfrischen können.
Eines Tages, da er kaum noch atmen konnte, sagte er seufzend: „weshalb zürnt der König mir, er hat keinen treueren Untertan, ich habe ihn nie beleidigt." Zufällig ging der König an dem Turm vorüber und als er die Stimme dessen vernahm, den er sonst so sehr geliebt hatte, blieb er stehen, um ihn zu hören; obgleich seine Begleiter, welche Liebhold hassten, den König davon abzuhalten suchten, indem sie sagten: „wozu verweilt Ihr, gnädiger Herr, Ihr wisst ja, dass er ein Bösewicht ist"; aber der König antwortete: „Lasst mich, ich will ihn hören."
Als er seine Klagen vernahm, konnte er sich der Tränen. nicht erwehren, öffnete selbst die Tür seines Kerkers und rief ihn. Liebhold erschien in seinem trübseligen Zustand, warf sich vor ihm auf die Knie, küsste seine Füße und sagte zu ihm: „wodurch habe ich diese harte Behandlung verdient, mein König?" „Du hast dich über mich und meinen Abgesandten lustig gemacht“, versetzte der König; „du hast gesagt, wenn ich dich zu Schönchen Goldhaar geschickt hätte, du würdest sie wohl mitgebracht haben."
„Ganz recht, gnädiger Herr“, erwiderte Liebhold, „denn ich würde eure erhabenen Eigenschaften so beredt geschildert haben, dass ich überzeugt bin, sie hätte sich durchaus nicht weigern können und damit glaube ich nichts gesagt zu haben, was euch missfällig sein könnte." Der König fand, dass er in der Tat gar nicht Unrecht habe, warf denen, welche ihm von seinem Günstlinge Böses gesagt hatten, einen zornigen Blick zu und nahm ihn mit sich, indem er sein hartes Verfahren gegen ihn sehr bereute.
Nachdem sich Liebhold durch eine kräftige Mahlzeit gestärkt hatte, rief ihn der König in sein Kabinett und sagte: „Liebhold, ich liebe Schönchen Goldhaar noch immer, ihre abschlägige Antwort hat mich nicht zurück geschreckt; aber ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll, um sie für mich zu gewinnen. Ich habe also Lust, dich zu ihr zu schicken, vielleicht gelingt es dir besser." Liebhold antwortete: „er sei bereit, ihm in allen Dingen zu gehorchen und werde gleich am nächsten Morgen seine Reise antreten." „Oh!“, sagte der König, „ich will dir ein stattliches Gefolge mitgeben." „Das ist nicht Notwendig“, erwiderte er, „ich brauche nur ein gutes Pferd und einen Brief von euch."
Der König umarmte ihn und war entzückt, ihn gleich so bereitwillig zu finden. An einem Montag Morgen nahm er von dem König und seinen Freunden Abschied und trat seine Gesandtschaftsreise an, ganz allein, ohne Prunk und Geräusch. Sein einziger Gedanke war, durch welche Mittel er Schönchen Goldhaar dahin bringen könne, den König zu heiraten. Er trug ein Schreibzeug in der Tasche und wenn ihm irgend ein glücklicher Gedanke einfiel, der in seine Anrede passte, so stieg er vom Pferde, setzte sich unter einen Baum und schrieb ihn auf, um ihn nicht zu vergessen.
Eines Morgens, als er in der Dämmerung aufgebrochen war und über eine große Wiese ritt, kam ihm ein besonders artiger Gedanke; er stieg ab und setzte sich unter die Weiden und Pappeln, die einen Fluss, am Rande der Wiese, beschatteten. Nachdem er seinen Einfall aufgezeichnet hatte, sah er sich nach allen Seiten um, denn die Gegend gefiel ihm sehr wohl. Da bemerkte er auf dem Grase einen großen Goldkarpfen, der nach Luft schnappte und kaum noch atmete; er war, indem er Mücken haschte, so hoch aus dem Wasser gesprungen, dass er aufs Gras fiel, wo er nahe daran war, sein Leben aufzugeben.
Liebhold empfand Mitleid mit ihm und obgleich er ihn zu seiner Mittagsmahlzeit ganz gut hätte brauchen können, nahm er ihn auf und setzte ihn ganz gemächlich wieder ins Wasser. Kaum fühlte der Karpfen die Frische des Wassers, so wurde er ganz munter und schlüpfte behaglich zum Grunde nieder, kam dann ganz frisch ans Ufer und sagte: „Liebhold, ich danke dir für die Wohltat, welche du mir erwiesen hast. Ohne dich wäre ich nicht mehr am Leben, du hast mich gerettet und ich will es dir vergelten." Mit dieser Versicherung verschwand er im Wasser und Liebhold war über einen so vernünftigen und ungemein höflichen Karpfen nicht wenig erstaunt.
Ein anderes Mal sah er auf seinem Wege einen Raben in großer Angst; das arme Tier wurde von einem großen Adler verfolgt, der nahe daran war, ihn zu erwischen und ihn wie eine Linse verschlungen haben würde, wenn nicht Liebhold mit dem Schicksal dieses Vogels Mitleid gehabt hätte. „Sieh da“, sagte er, „wie der Starke den Schwächeren unterdrückt! Welches Recht hat der Adler, einen Raben zu fressen?"
Er nahm seinen Bogen, den er immer bei sich trug, legte einen Pfeil auf und so dann den Adler gut aufs Korn nehmend, drückte er ab und durchbohrte ihn, dass er tot zur Erde fiel. Voller Freude flog der Rabe auf einen Baum und sagte: „Liebhold, du bist mir edelmütig zu Hilfe geeilt, obgleich ich nichts weiter bin als ein armer Rabe; doch ich werde nicht undankbar sein, ich werde es dir vergelten." Liebhold verwunderte sich über die gute Gesinnung des Raben und setzte seinen Weg fort.
Als er ein anderes Mal in einen großen Wald gelangte, so früh am Tage, dass er kaum den Weg vor sich sah, hörte er eine Eule jämmerlich krächzen. „Horch“, sagte Liebhold, „da ist eine Eule, die in großer Not scheint, sie hat sich vielleicht in einem Netz gefangen." Er suchte überall, bis er endlich ein großes Netz entdeckte, welches die Vogelsteller in der Nacht aufgespannt hatten, um die kleinen Vögel einzufangen. „Wie erbarmungslos!“, sagte er, „die Menschen sind nur gemacht, sich unter einander zu quälen, oder arme Tiere zu verfolgen, die ihnen weder Leid, noch Schaden zufügen."
Er nahm sein Messer und schnitt die Schnüre entzwei. Die Eule flog auf, kehrte aber im vollen Fluge zurück und sprach: „Liebhold, ich brauche dir nicht erst eine lange Rede zu halten, um dir zu sagen, welche Verbindlichkeit ich gegen dich habe: sie liegt am Tage; die Jäger wären gekommen, ich war gefangen und ohne deinen Beistand hätte ich sterben müssen. Ich habe ein erkenntliches Herz und werde es dir vergelten." Diese drei Abenteuer waren das Erheblichste, was Liebhold auf seiner Reise begegnete.
Er beeilte sich so sehr, dass er in Kurzem in dem Palast von Schönchen Goldhaar eintraf; alles war darin bewunderungswürdig. Man sah hier die Diamanten wie Kieselsteine zu ganzen Haufen; prachtvolle Kleider, Leckereien, Gold und Silber, es war zum Erstaunen und Liebhold dachte wohl bei sich, wenn sie alles das verließe, um zu dem König, seinem Herrn, zu kommen, so hätte er wirklich von Glück zu sagen. Er wählte zu seinem Anzug ein Kleid von Goldstoff, einen Kopfschmuck von weißen und roten Federn, und hing eine reich gestickte Schärpe um, mit einem kleinen Körbchen, worin sich ein allerliebstes Hündchen befand, welches er unterwegs in Bologna gekauft hatte.
Liebhold war so liebenswürdig, zeigte in Allem, was er tat, einen so edlen Anstand, dass, als er an der Tür des Palastes erschien, die Wache ihm eine tiefe Verbeugung machte und man sogleich zu Schönchen Goldhaar lief, um ihr zu sagen, dass Liebhold, der Abgesandte des Königs, ihres nächsten Nachbars, sie zu sehen wünsche. Bei dem Namen Liebhold sagte die Prinzessin: „Das ist eine gute Vorbedeutung; ich möchte wetten, er ist ein liebenswürdiger Mensch, der aller Welt gefällt."
„Ja gewiss“, versicherten einstimmig alle ihre Damen, „wir haben ihn schon vom Dach aus gesehen, als wir euer Garn auslegten und so lange er unter dem Fenster stand, haben wir nichts tun können." „Das ist ja allerliebst“, versetzte die Prinzessin, „euch damit zu unterhalten, junge Männer anzusehen! Nun rasch, mein Staatskleid von blauem Atlas, meine hohen Schuh und meinen Fächer, und dass mir die Locken ja gut fallen, und frische Blumenkränze; denn ich will, der Gesandte soll überall sagen, dass ich mit Recht Schönchen Goldhaar heiße."
Alle ihre Frauen beeiferten sich nun, sie wie eine Königin zu schmücken und das geschah in solcher Hast, dass eine immer an die andere stieß und man dabei kaum vorwärts kam. Endlich begab sich die Prinzessin in ihre große Spiegelgalerie, um zu sehen, ob auch nichts fehle und dann setzte sie sich auf ihren Thron, der aus Gold, Elfenbein und Ebenholz gearbeitet war und wie Balsam duftete. Ihre Mädchen mussten Instrumente nehmen und dazu singen, aber nur ganz leise, um niemanden zu übertönen.
Man führte Liebhold in das Audienz-Zimmer und er war so von Bewunderung überwältigt, dass er kaum sprechen konnte, wie er später oft gestanden hat; indes fasste er doch Mut und hielt eine bewunderungswürdige Anrede, in welcher er die Prinzessin bat, sie möchte ihm nicht den Kummer machen, ohne sie zurückzukehren.
„Mein artiger Liebhold“, erwiderte sie ihm, „alle die Gründe, welche ihr vorgebracht habt, sind in der Tat sehr erheblich und ihr dürft überzeugt sein, dass ich euch lieber als jeden anderen begünstigen möchte; aber ihr müsst wissen, dass ich vor einem Monat etwa, als ich mit allen meinen Damen am Fluss spazieren ging und man mir eine Erfrischung reichte, beim Abziehen meines Handschuhs zugleich einen Ring vom Finger zog, der unglücklicherweise in den Fluss fiel.
Dieser Ring war mir lieber als mein Königreich. Ihr könnt leicht denken, in welche Betrübnis mich dieser Verlust versetzte; ich tat einen Schwur, nie irgend einem Heiratsantrag Gehör zu geben, wenn der Gesandte, der mir einen König antrüge, mir meinen Ring nicht wiederbringe. Seht nun zu, was ihr dafür tun könnt, denn wenn ihr auch noch vierzehn Tage und vierzehn Nächte zu mir sprächet, so würdet ihr mich nicht überreden, meinen Entschluss zu ändern."
Liebhold war von dieser Antwort sehr betroffen, er machte ihr eine tiefe Verbeugung und bat sie, wenigstens das kleine Hündchen, den Korb und die Schärpe anzunehmen, allein sie erwiderte ihm, sie wolle keine Geschenke und er möge nur darauf denken, das zu tun, was sie ihm gesagt habe.
Als er nach Hause kam, legte er sich nieder, ohne gegessen zu haben, und sein Hündchen, welches Kabriol hieß, wollte auch nicht essen und setzte sich neben ihn. Die ganze Nacht hörte Liebhold nicht auf, zu seufzen. „Wie soll ich es anfangen“, sagte er, „einen Ring wieder zu finden, der vor einem Monat in einen großen Fluss gefallen ist? Es ist eine Torheit, so etwas nur zu versuchen. Die Prinzessin hat das nur gesagt, um mir eine ganz unmögliche Bedingung vorzuschreiben."
Er seufzte dabei und war ungemein bekümmert. Da sprach Kabriol, der alles hörte: „Mein teurer Herr, ich bitte euch, vertraut doch nur eurem guten Glück, ihr seid zu liebenswürdig, um nicht glücklich zu sein. Lasst uns morgen mit Tagesanbruch an das Ufer des Flusses gehen." Liebhold gab ihm ein paar leise Schläge mit der Hand, ohne zu antworten. Endlich schlief er ein, von Kummer ganz erschöpft.
Als Kabriol den Morgen anbrechen sah, machte er so viel Sprünge, bis Liebhold aufwachte und dann sagte er zu ihm: „Lieber Herr, kleidet euch an und lasst uns gehen." Liebhold folgte ihm, stand auf, zog sich an, ging in den Garten hinab und aus dem Garten kamen sie unbemerkt bis ans Ufer des Flusses, wo er, den Hut ins Gesicht gedrückt und die Arme übereinander geschlagen, nur in Gedanken an seine Abreise, auf und abging.
Plötzlich hörte er, dass man ihn rief: „Liebhold, Liebhold!" Er sah sich nach allen Seiten um, wurde niemanden gewahr und glaubte geträumt zu haben. Als er seinen Weg fort setzte, rief es wieder: „Liebhold, Liebhold." „Wer ruft mich?“, fragte er. Kabriol, der sehr klein war und ganz nah am Wasser umher guckte, antwortete ihm: „Ihr sollt mir nie mehr Etwas glauben, wenn es nicht der große Goldkarpfen ist, den ich hier sehe."
Als bald erschien auch der Karpfen und sagte zu Liebhold: „Du hast mir auf jener Wiese das Leben gerettet und ich habe versprochen, es dir zu vergelten. Hier, guter Liebhold, ist der Ring von Schönchen Goldhaar." Liebhold bückte sich, nahm ihn dem Karpfen aus dem Maul und sagte tausend Dank. Anstatt nach Hause zurück zu kehren, ging er geraden Weges mit dem kleinen Kabriol, der sehr vergnügt war, seinen Herrn an das Ufer des Flusses gebracht zu haben, in den Palast.
Man hinterbrachte der Prinzessin, dass er sie zu sehen wünsche. „Ach“, sagte sie, „der arme Mensch, er will Abschied von mir nehmen. Er hat eingesehen, dass er meine Bedingungen unmöglich erfüllen kann und will nun seinem Herrn die Nachricht überbringen." Da trat Liebhold herein, überbrachte ihr den Ring und sagte: „Gnädigste Prinzessin, Euer Befehl ist vollzogen. Ist es euch jetzt gefällig, den König, meinen Herrn, zum Gemahl zu nehmen?"
Als sie ihren Ring erblickte, geriet sie in ein solches Erstaunen, dass sie zu träumen meinte. „Wahrhaftig, "sagte sie, „anmutiger Liebhold, ihr müsst von irgend einer Fee begünstigt werden, denn auf natürlichem Wege kann das nicht zugehen." „Prinzessin“, entgegnete Liebhold, „ich kenne keine Fee, ich habe nur den Wunsch, euch zu gehorchen." „Da ihr so guten Willen habt“, fuhr sie fort, „so müsst ihr mir noch einen anderen Dienst erweisen, ohne welchen ich mich nie verheiraten werde.
Nicht weit von hier, ist ein Prinz mit Namen Galifron, der sich in den Kopf gesetzt hat, mich zu heiraten. Er ließ seinen Antrag mit den fürchterlichsten Drohungen begleiten, und wollte, im Fall, dass ich ihn aus schlage, mein ganzes Königreich verwüsten. Urteilt jedoch selbst, ob ich ihn annehmen kann; er ist ein Riese, weit über Turmhöhe und frisst einen Menschen, wie ein Affe eine Kastanie speist. Wenn er ins Feld zieht, so trägt er in seinen Taschen, statt der Pistolen, kleine Kanonen, die er ganz wie Pistolen gebraucht und wenn er recht laut spricht, so werden die, welche nahe bei ihm stehen, taub. Ich ließ ihm sagen, ich wolle mich nicht verheiraten und er möge mich entschuldigen, allein er hat nicht aufgehört, mich zu verfolgen. Er tötet alle meine Untertanen und vor allen Dingen müsst ihr diesen Riesen bekämpfen und mir seinen Kopf bringen."
Liebhold war über diesen Antrag ein wenig betroffen, indes nach einigem Bedenken sagte er: „Nun wohl, Prinzessin, ich will Galifron bekämpfen, ich weiß, dass ich unterliegen muss; aber ich werde als ein tapferer Mann sterben." Die Prinzessin war ganz erstaunt und sagte ihm tausend Dinge, um ihn von diesem Unternehmen abzubringen. Aber es half zu nichts, er entfernte sich, um sich Waffen und alles, was er sonst noch brauchte, zu besorgen.
Als dies geschehen war, setzte er den kleinen Kabriol in sein Körbchen, bestieg sein gutes Ross und begab sich in das Land Galifrons. Er erkundigte sich bei allen, denen er begegnete, nach ihm, und Jedermann sagte ihm, der Riese sei ein wahrer Teufel, dem man nicht zu nahe kommen dürfe. Je öfter er dies hörte, desto bänger ward ihm. Kabriol machte ihm Mut und sagte: „Mein teurer Herr, während ihr ihn angreift, will ich ihn in die Beine beißen, er wird den Kopf umdrehen, um mich fort zu jagen und da könnt ihr ihn töten." Liebhold bewunderte den Verstand des Hündchens, aber er wusste wohl, dass ihm sein Beistand zu nichts helfen würde.
Endlich kam er ganz nah an das Schloss Galifrons; alle Wege waren mit Knochen und Gerippen von Menschen bedeckt, die er gefressen oder in Stücke zerrissen hatte. Es dauerte nicht lange, so sah er ihn zwischen einem Gebüsch daher kommen, sein Kopf ragte über die größten Bäume und mit erschrecklicher Stimme sang er:
„Wo treff' ich kleine Kinder an
Zum Fraß für meinen guten Zahn?
Mich packt ein Hunger, Hunger, Hunger an,
Die Welt hat nicht genug daran."
Sogleich erhob Liebhold seine Stimme in der nämlichen Weise:
„Hierher, hierher, da kommt ein Mann,
Der dir den Zahn ausbrechen kann
Und ist er nicht der größte Mann,
Groß genug, dass er dich töten kann."
Als Galifron diese Worte hörte, sah er sich nach allen Seiten um und bemerkte Liebhold, welcher, den Degen in der Hand, ihm noch einige Schmähreden zurief, um ihn in Zorn zu bringen. Es bedurfte ihrer gar nicht. Er geriet in eine fürchterliche Wut und seine schwere eiserne Keule schwingend, würde er den artigen Liebhold mit einem Schlage zermalmt haben, wenn nicht ein Rabe gekommen wäre, der sich dem Riesen auf den Kopf setzte und ihn mit seinem Schnabel so gut in die Augen traf, dass er sie ihm beide aushackte; das Blut strömte ihm übers Gesicht, er gebärdete sich wie ein Verzweifelter und schlug nach allen Seiten um sich.
Liebhold wich ihm aus und brachte ihm mit seinem Schwert so viele und so tiefe Wunden bei, dass er endlich erschöpft von dem vielen Blutverlust auf die Erde stürzte. Sogleich hieb ihm Liebhold den Kopf ab, ganz erfreut über sein unverhofftes Glück. Da sprach zu ihm der Rabe, welcher sich auf einen Baum gesetzt hatte: „Ich habe den Dienst nicht vergessen, den du mir durch den Tod des Adlers, der mich verfolgte, erwiesen hast. Ich versprach dir, ihn zu vergelten und ich glaube, es heute getan zu haben."
„O weit mehr noch, als das, mein guter Herr Rabe“, erwiderte Liebhold; ich bleibe alle Zeit dein Schuldner." Damit schwang er sich aufs Pferd, den fürchterlichen Kopf Galifrons vor sich. Als er in die Stadt kam, lief ihm Alt und Jung nach und rief: „seht da den tapferen Liebhold, der das Ungeheuer getötet hat." Die Prinzessin, welche diesen Lärm hörte, zitterte, man komme sie von dem Tode Liebhold' zu benachrichtigen und wagte gar nicht zu fragen, was geschehen sei.
Da trat Liebhold selbst mit dem Kopfe des Riesen herein und sagte zu ihr: „Prinzessin, euer Feind ist tot, ich hoffe, ihr werdet eure Hand nun dem Könige, meinem Herrn, nicht länger verweigern." „Und doch“, versetzte Schönchen Goldhaar, „werde ich sie verweigern, wenn ihr nicht ein Mittel findet, mir vor meiner Abreise Wasser aus der dunklen Grotte zu bringen."
„Es gibt nämlich hier in der Nähe eine tiefe Grotte, die wohl sechs Stunden im Umfange hat. Den Eingang zu dieser Grotte verwahren zwei Drachen, die aus Maul und Augen Feuer sprühen. Ist man glücklich in die Grotte gelangt, so findet man ein tiefes Loch voll Kröten, Nattern und Schlangen, und in das muss man hinab steigen. Ganz unten am Boden aber befindet sich eine kleine Höhle, in welcher die Quelle der Schönheit und der Gesundheit fließt, und dies ist das Wasser, welches ich durchaus haben will.
Es übt auf alles, was man damit wäscht, eine wunderbare Wirkung aus. Wenn man schön ist, bleibt man beständig schön; wenn man hässlich ist, wird man schön; wenn man jung ist, so bleibt man jung; wenn man alt ist, wird man wieder jung. Ihr seht wohl, mein guter Liebhold, dass ich mein Königreich nicht verlassen kann, ohne davon mitzunehmen." „Prinzessin“, entgegnete er ihr, „ihr seid so schön, dass euch dieses Wasser gewiss unnütz ist; aber ich bin einmal ein unglücklicher Gesandter, dessen Tod ihr wünscht; ich will also gehen, euch das Verlangte zu holen, obschon ich die Gewissheit habe, dass ich nicht mehr zurück kehre."
Schönchen Goldhaar bestand indes auf ihrer Forderung und Liebhold begab sich mit dem Hündchen Kabriol auf den Weg, um aus der dunklen Grotte das Wasser der Schönheit zu holen. Alle Leute, denen er unterwegs begegnete, sagten mitleidig: „es ist doch ein Jammer, einen so liebenswürdigen jungen Mann zu sehen, der seinem Tode freiwillig entgegen geht! Er wagt sich ganz allein in die Grotte, während doch ihrer hundert nichts ausrichten würden. Warum verlangt die Prinzessin nur so unmögliche Dinge?"
Liebhold setzte seinen Weg fort, ohne zu antworten, aber er war sehr niedergeschlagen. Er gelangte an den Gipfel eines Berges, und setzte sich hier nieder, um ein wenig auszuruhen, während sein Ross weidete und Kabriol nach Mücken schnappte. Er wusste, dass die dunkle Grotte nicht weit davon war und sah sich um, ob er sie nicht gewahr würde.
Endlich bemerkten einen fürchterlichen Felsen, der schwarz wie Tinte war und aus welchem ein dicker Rauch aufstieg, und gleich darauf erblickte er einen von den Drachen, der aus Maul und Augen Feuer auswarf. Sein Leib war gelb und grün, er hatte furchtbare Klauen und einen langen Schweif, der mehr als hundert Ringe machte. Kabriol geriet bei diesem Anblick in solche Furcht, dass er nicht wusste, wohin er sich verbergen sollte.
Liebhold, ganz entschlossen zum Tode, zog seinen Degen und stieg mit einer Phiole, welche Schönchen Goldhaar ihm gegeben hatte, um sie mit dem Wasser der Schönheit zu füllen, den Berg hinab. Zu seinem Hündchen Kabriol sagte er, „es ist um mich geschehen. Niemals werde ich von diesem Wasser schöpfen können, welches von den Drachen bewacht wird. Wenn ich tot bin, fülle die Phiole mit meinem Blut und bringe sie der Prinzessin, damit sie sieht, wie viel sie mich kostet, dann geh zu dem König, meinem Herrn, und erzähle ihm mein Unglück."
Als er so sprach, hörte er, dass Jemand: „Liebhold, Liebhold!“, rief. „Wer ruft mich?“, fragte er und erblickte in der Höhlung eines alten Baumes eine Eule, die zu ihm sagte: „Du hast mich aus dem Jägernetz, in welchem ich gefangen war, befreit und mir das Leben gerettet. Ich versprach dir diesen Dienst zu vergelten und der Augenblick ist da. Gib mir deine Phiole, ich kenne jeden Weg in der dunklen Grotte und will dir von dem Wasser der Schönheit holen." Wer war froher als Liebhold, er gab ihr rasch seine Phiole und die Eule flog ohne irgend ein Hindernis in die Grotte. In weniger als einer Viertelstunde brachte sie das Fläschchen wohl verwahrt zurück.
Liebhold war überglücklich, er bedankte sich bei ihr von ganzem Herzen und nahm dann frohen Mutes seinen Rückweg über den Berg nach der Stadt. Er ging graden Wegs nach dem Palast und überreichte seine Phiole Schönchen Goldhaar, welche nun keine Einwendungen mehr hatte. Sie dankte Liebhold und ließ alles zu ihrer Abreise in Stand setzen, sodann trat sie die Reise mit ihm an.
Sie fand ihn sehr liebenswürdig und sagte mehr als einmal zu ihm: „Wenn ihr gewollt hättet, so hätte ich euch zum König gemacht, wir hätten mein Königreich gar nicht verlassen." „Nicht um alle Königreiche der Erde“, entgegnete Liebhold, „möchte ich meinem Herrn ein so großes Leid zufügen, obgleich ich euch schöner finde, als die Sonne."
Endlich trafen sie in der Hauptstadt des Königs ein und da derselbe wusste, dass Schönchen Goldhaar mitkäme, ging er ihr entgegen und machte ihr die prächtigsten Geschenke von der Welt. Darauf wurde die Hochzeit mit so viel Festlichkeiten begangen, dass man lange Zeit von nichts anderem redete. Aber Schönchen Goldhaar, welche im Grunde ihres Herzens Liebhold liebte, war nur vergnügt, wenn sie ihn sah und lobte ihn beständig. „Ohne Liebhold würde ich nicht gekommen sein“, sagte sie zum Könige; „er hat für mich das Unmögliche möglich machen müssen. Ihr seid ihm vielen Dank schuldig; er hat mir das Schönheitswasser gebracht, ich werde nie altern, sondern immer schön bleiben."
Die Neider, welche die Königin so reden hörten, sagten zum Könige: „Ihr seid gar nicht eifersüchtig, und habt doch so guten Grund, es zu sein, denn die Königin liebt diesen Liebhold so sehr, dass sie Essen und Trinken darüber vergisst, um nur von ihm und den Verpflichtungen zu sprechen, welche Ihr gegen ihn habt; als ob ein Anderer, den ihr geschickt hättet, nicht das Nämliche getan hätte." „Wahrhaftig“, versetzte der König, „es fällt mir nun auf. Man werfe ihn in den Turm, an Händen und Füßen geschlossen."
Man ergriff Liebhold und zum Lohn dafür, dass er dem Könige so redlich gedient hatte, warf man ihn in den Turm, mit Eisenfesseln an Händen und Füßen. Er sah niemanden als den Kerkermeister, der ihm durch ein Loch ein Stück schwarzes Brot zuwarf und Wasser in einem irdenen Krug reichte. Nur sein Hündchen Kabriol verließ ihn nicht, tröstete ihn und hinterbrachte ihm alle Neuigkeiten.
Kaum erfuhr Schönchen Goldhaar sein Missgeschick, so warf sie sich dem Könige zu Füßen und bat ihn, in Tränen schwimmend, Liebhold aus dem Gefängnis zu lassen, aber je mehr sie bat, desto zorniger wurde er, weil ihn dies nur in seinem Verdacht bestärkte, und schlug es ihr rund ab. Sie sprach also nicht mehr davon, war aber tief betrübt. Es fiel dem Könige ein, sie finde ihn vielleicht nicht schön genug und dies brachte ihn auf den Gedanken, sich das Gesicht mit dem Schönheitswasser zu waschen, um sich der Liebe der Königin mehr zu versichern.
Die Phiole mit diesem Wasser stand im Zimmer der Königin auf dem Rande des Kamins; sie hatte es dahin gestellt, weil es ihr Freude machte es anzusehen; aber eins ihrer Kammermädchen warf, als sie eine Spinne mit dem Besen tot schlagen wollte, unglücklicherweise die Phiole auf die Erde; sie zerbrach und alles Wasser war dahin. Sie wischte es rasch auf und in der Angst, was sie nun tun sollte, erinnerte sie sich, in dem Kabinett des Königs eine ganz gleiche Phiole gesehen zu haben, mit einem Wasser gefüllt, welches eben so klar war, wie das der Schönheit. Ohne ein Wort zu sagen, nahm sie heimlich das Fläschchen und setzte es auf den Kamin der Königin.
Das Wasser, welches sich im Kabinett des Königs befand, diente dazu, die zum Tode verurteilten Prinzen und Großen des Hofes hinzurichten; anstatt ihnen den Kopf abzuschlagen oder sie aufhängen zu lassen, wusch man ihnen nur das Gesicht mit diesem Wasser: sie schliefen ein und wachten nicht wieder auf.
Eines Abends nun nahm der König die Phiole und wusch sich tüchtig das Gesicht damit; darauf schlief er ein und war tot. Das Hündchen Kabriol erfuhr es gleich und hinterbrachte diese frohe Nachricht seinem Herrn, der es zu Schönchen Goldhaar schickte und sie bitten ließ, sich des armen Gefangenen zu erinnern. Kabriol schlüpfte behutsam durch das Gedränge, denn der Tod des Königs hatte bei Hofe alles in große Bewegung gesetzt, und sagte leise zur Königin: „Gnädige Frau, vergesst den armen Liebhold nicht."
Sie hatte ihn nicht vergessen, sie erinnerte sich sehr wohl der Gefahren, die er um ihretwillen ausgestanden hatte, gleichwie seiner großen Treue. Ohne Jemanden ein Wort zu sagen, ging sie geraden Weges nach dem Turm, nahm Liebhold selbst die Fesseln von Händen und Füßen ab, setzte ihm eine goldne Krone auf den Kopf, hing ihm den königlichen Mantel um die Schultern und sagte zu ihm: „Kommt, kommt, liebenswürdiger Liebhold, ich erwähle euch zum Könige und zu meinem Gemahl."
Er warf sich zu ihren Füßen und dankte gerührt. Jedermann war erfreut, ihn zum Gebieter zu erhalten. Die fröhlichste Hochzeit von der Welt wurde begangen und Schönchen Goldhaar und Liebhold lebten lange Zeit glücklich und zufrieden mit einander.
ROT, WEISS UND SCHWARZ ...

Der älteste Sohn eines mächtigen Königs ging einmal ganz allein im Winter auf einem Felde, welches mit Schnee bedeckt war. Er bemerkte einen Raben und schoss ihn. Der Vogel stürzte tot hernieder und bespritzte den weißen Schnee mit seinem Blut. Der Glanz seines schwarzen Gefieders, die blendende Weiße des Schnees und die Röte des Bluts gaben ein Farbengemisch, dessen lebhafter Reiz den Prinzen entzückte.
Er konnte die Vorstellung davon nicht wieder los werden, so schwebten ihm die Farben beständig vor Augen, bis in seinem Herzen endlich ein heftiges Verlangen erwachte, eine Frau zu besitzen, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarzhaarig wie das Gefieder des Raben.
Eines Tages, da er ganz in Gedanken daran versunken war, hörte er eine Stimme, die sagte zu ihm: „Mein Prinz, begebt euch in das Wunderland, so werdet ihr mitten in einem ungeheuren Walde einen Apfelbaum finden, mit schöneren und größeren Früchten, als ihr sie je gesehen habt; pflückt drei davon, bezähmt euch aber ja, sie eher als vor eurer Rückkehr zu öffnen; sie werden euch eine Schönheit darbieten, gerade wie ihr sie wünscht."
Das Wunderland war weit entfernt und schwer zugänglich, aber nichts konnte den Prinzen von der Reise dahin abhalten. Er machte sich augenblicklich auf den Weg, zog über Meer und Land und durchsuchte mit außerordentlicher Sorgfalt den ganzen Wald, bis er den Baum fand. Er brach drei schöne Äpfel und da er in dem ersten Gefühl seiner Freude der Neugier, die ihn quälte, nicht widerstehen konnte, so öffnete er einen davon.
Sogleich kam ein junges Mädchen heraus, so bezaubernd schön und so ganz nach seinem Wunsch, dass er von Bewunderung hingerissen war. Aber diese Schönheit, weit entfernt, ihm gewogen zu sein, betrachtete ihn mit zornigen Blicken und indem sie sich beklagte, dass er sie entführt habe, verschwand sie in dem nämlichen Augenblick. Die Ungeduld, welcher er fast unterlag, musste ihn natürlich in Verzweiflung bringen; doch da sein Gemüt für Trost leicht empfänglich war, so beruhigte er sich bald damit, die beiden anderen Äpfel würden ihm seinen Verlust ersetzen.
Voll von dieser süßen Hoffnung, beschloss er, sie nicht eher zu öffnen, als bis er in seinem Vaterland angekommen sei. Die traurigsten Erfahrungen sind oft nicht im Stande, vor einer Schwachheit zu bewahren. Die Ungeduld des Prinzen war noch stärker als seine Vernunft, und er konnte auch das zweite Mal dem Verlangen nicht widerstehen, einen dieser Äpfel zu öffnen.
Er befand sich gerade auf dem Meere, und da man selten einige Zerstreuung auf diesem traurigen Element genießt, so hätten wohl sehr wenige Leute in einem ähnlichen Falle anders gehandelt. Er bildete sich ein, wenn er das ganze Schiff, auf dem er fuhr, bedecken ließe, so könnte die Schöne nicht entwischen. Er öffnete also den zweiten Apfel, und wie das erste Mal kam ein Mädchen von unvergleichlicher Schönheit heraus, sie bezeigte ihm aber ganz eben so ihr Missvergnügen, und aller Vorsichtsmaßregeln ungeachtet, welche der Prinz genommen hatte, verschwand sie in gleicher Weise, wie die erste verschwunden war. Diese beiden Erfahrungen waren indes kaum hinreichend, den Prinzen klug zu machen.
Endlich langte er in seiner Heimat an und als er den letzten Apfel, der ihm geblieben war, aufmachte, kam ein junges Mädchen heraus, eben so schön, aber sanfter, als die beiden früheren. Er vermählte sich als bald mit ihr und lebte in der glücklichsten Ehe von der Welt.
Einige Zeit nach der Hochzeit musste er in den Krieg ziehen und seine schöne Rot-weiß-schwarz verlassen. Die Königin Mutter, in deren Gewalt sich jetzt die junge Königin befand, hatte diese Heirat nie gebilligt. Sie ließ nun ihre Schwiegertochter auf eine grausame Art umbringen, warf den Leichnam in den Schlossgraben, und um ihrer Bosheit die Krone aufzufetzen, schob sie an die Stelle der unglücklichen Königin eine Person unter, welche ihr völlig ergeben war.
Als der Prinz heimkehrte, war er sehr erstaunt, eine Frau zu finden, die von der, welche er verlassen hatte, so verschieden war. Aber die Königin, seine Mutter, versicherte ihm ganz bestimmt, die Person, welche sie ihm vorstellte, sei seine Gemahlin. Sie leugnete alle die augenscheinlichen Verschiedenheiten nicht, schrieb aber diese Verwandlung den Folgen der Zauberei zu.
In der Tat gab die Art, auf welche der Prinz seine Gemahlin gefunden hatte, dieser Rede einige Wahrscheinlichkeit; genug, sei es nun aus Sanftmut oder aus Mangel an Misstrauen, der Prinz glaubte, was man ihm sagte. Aber nichts war fähig, ihn von seiner ersten Neigung zu heilen. Tag und Nacht träumte er von der Vergangenheit, und er verweilte oft ganze Stunden, an einem Fenster seines Palastes gelehnt.
Eines Tages, da er wieder in dieser traurigen Beschäftigung zubrachte, erblickte er in dem Schlossgraben einen Fisch, dessen glänzende Schuppen rot, weiß und schwarz waren. Dieser Anblick ergriff ihn so sehr, dass er kein Auge mehr von dem Fisch wendete.
Die alte Königin, die eine so besondere Aufmerksamkeit für eine Folge seiner ersten Neigung hielt, beschloss, jeden Gegenstand, der ihn daran erinnere, zu zerstören. Sie befahl daher heimlich der falschen Prinzessin, auf das heftigste Verlangen zu bezeigen, den Fisch, an welchem ihr Gemahl so außerordentlich hing, zu verzehren.
Es war ihm unmöglich eine Bitte zu verweigern, die in den Augen aller Welt so geringfügig erscheinen musste. Man fing den Fisch, man trug ihn der vermeinten Königin auf und der Prinz fiel wieder in seinen früheren Trübsinn zurück.
Ein andermal ward er durch den Anblick eines Baumes getröstet, der rot, weiß und schwarz war. Dieser Baum war von einer unbekannten Art; niemand hatte ihn gepflanzt, noch gesät: er war plötzlich auf der Stelle emporgewachsen, wo man die Fischschuppen hingeworfen hatte. Der schöne Baum verursachte dem Prinzen das nämliche Vergnügen und folglich der Königin den nämlichen Verdruss; sogleich beschloss sie sein Verderben, ungeachtet der Einwendungen des betrübten Prinzen.
Man riss den Baum heraus und verbrannte ihn; aber aus der Asche des Baumes stieg augenblicklich ein prächtiges Schloss empor, aus roten Rubinen, weißen Perlen und schwarzem Schmelz. Die drei Farben, welche der Prinz so sehr geliebt hatte, machten hier eine bezaubernde Wirkung.
Lange Zeit bemühte er sich vergebens, in dieses schöne Schloss zu gelangen, die Tore blieben verschlossen und er begnügte sich, sie unaufhörlich zu betrachten, und verweilte mehrere Tage in dieser Beschäftigung, die ihm den Gegenstand seiner Wünsche zurück rief.
Seine Ausdauer wurde endlich belohnt; die Türen öffneten sich, er trat in den Palast, und nachdem er eine Menge Gemächer, die auf das Kostbarste geschmückt waren, durchschritten hatte, fand er in einem Kabinett seine erste Gemahlin, die er so zärtlich geliebt hatte und deren Andenken ihm so teuer war.
Sie machte ihm Vorwürfe, dass sie durch seine zu große Nachgiebigkeit so viel gelitten habe; zugleich aber bewies sie ihm die lebhafte Freude, welche sie empfand, da sie sah, dass er die Verzeihung, welche sie ihm so gern bewilligte, so sehr verdiene.
Das Glück der beiden Wiedervermählten wurde nun durch nichts mehr gestört und sie lebten mit einander und ihrem Schicksal vollkommen zufrieden.
DIE FEEN ..., von Charles Perrault

Illustrationsvorlage von Gustave Doré, 1867
Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter: die Ältere glich ihr so sehr in ihrem Wesen und in ihrem Äußeren, dass man bei ihrem Anblick die Mutter zu sehen glaubte. Beide waren sie so widerwärtig und so hochmütig, dass man nicht mit ihnen auskommen konnte. Die jüngere dagegen war in ihrer Sanftmut und Freundlichkeit das wahre Ebenbild ihres Vaters; darüber hinaus war sie eines der schönsten Mädchen, das man sich denken konnte. Wie man nun gemeinhin sein Ebenbild liebt, so war diese Mutter ganz vernarrt in ihre ältere Tochter und hegte gleichzeitig eine tiefe Abneigung gegen die jüngere. Sie liess sie in der Küche essen und ohne Unterlass arbeiten.
So musste dieses arme Kind unter anderem zweimal täglich eine gute halbe Meile vom Hause entfernt Wasser schöpfen gehen und einen großen Krug bis zum Rande gefüllt heimtragen. Eines Tages, als sie zu dem Brunnen gegangen war, trat eine arme Frau auf sie zu und bat sie, ihr zu trinken zu geben. »Gerne, liebes Mütterchen«, sagte das schöne Mädchen, spülte seinen Krug, schöpfte ihr an der klarsten Stelle des Brunnens Wasser und bot es ihr dar, wobei sie den Krug stützte, damit sie leichter trinken konnte.
Nachdem die gute Frau getrunken hatte, sagte sie zu ihr: »Ihr seid so schön und so gut und so freundlich, dass ich Euch gern ein Geschenk machen möchte. (Es war nämlich eine Fee, die die Gestalt einer armen Bäuerin angenommen hatte, um zu prüfen, wie weit die Freundlichkeit des jungen Mädchens ginge.) Ich verleihe Euch die Gabe«, fuhr die Fee fort, »dass bei jedem Wort, das ihr sprecht, eine Blume oder ein Edelstein aus Eurem Munde fällt.«
Als das schöne Mädchen nach Hause kam, schimpfte seine Mutter, weil es sich so lange am Brunnen aufgehalten hatte. »Ich bitte um Verzeihung, liebe Mutter«, sagte das arme Mädchen, »dass ich so lange ausgeblieben bin.« Als sie aber diese Worte sprach, fielen ihr zwei Rosen, zwei Perlen und zwei große Diamanten aus dem Mund. »Was sehe ich da«, sagte die Mutter ganz erstaunt, »ich glaube, ihr fallen Perlen und Diamanten aus dem Munde! Wie kommt denn das, meine Tochter?« Es war das erste Mal, dass sie sie ihre Tochter nannte.
Da erzählte ihr das arme Kind ganz harmlos, was ihr begegnet war, nicht ohne eine Unzahl von Diamanten auszustreuen. »Wahrhaftig«, sagte die Mutter, »da muss ich meine Tochter hinschicken. Da, Fanchon, seht nur, was aus dem Munde Eurer Schwester fällt, wenn sie spricht; wäre es nicht schön für Euch, wenn Ihr auch diese Gabe hättet? Ihr müsst nur zum Brunnen gehen und Wasser schöpfen, und wenn Euch eine arme Frau um einen Trunk bittet, ihr recht freundlich zu trinken geben.« »Wie sieht denn das aus? Zum Brunnen gehen?« entgegnete das unfreundliche Mädchen. »Ich will, dass Ihr dorthin geht«, versetzte die Mutter, »und zwar sofort. « Sie ging, doch ließ sie nicht ab zu murren.
Sie nahm die schönste silberne Karaffe, die im Hause war, und kaum war sie am Brunnen angelangt, als sie aus dem Walde eine prächtig gekleidete Dame hervor treten sah, die sie bat, ihr zu trinken zu geben. Es war die selbe Fee, die ihrer Schwester erschienen war, sie hatte jedoch die Erscheinung und Kleidung einer Prinzessin angenommen, um zu prüfen, wie weit die Unfreundlichkeit dieses Mädchens ginge.
»Bin ich denn hierher gekommen, um Euch zu trinken zu geben?« sagte sie unfreundlich und hochmütig, »ich habe wohl diese silberne Karaffe eigens mitgenommen, um der gnädigen Frau zu trinken zu geben? So hört einmal gut zu: trinkt doch aus dem Brunnen, wenn Ihr Durst habt.« »Ihr seid nicht gerade freundlich«, versetzte die Fee, ohne zornig zu werden, »nun gut, wenn Ihr so unhöflich seid, will ich Euch die Gabe verleihen, dass Euch bei jedem Wort, das Ihr sprecht, eine Schlange oder eine Kröte aus dem Mund fällt.«
Als die Mutter ihre Tochter erblickte, rief sie: »Wie war es, meine Tochter?« »So war es, Mutter«, entgegnete das unfreundliche Mädchen, indem es zwei Vipern und zwei Kröten aus spie. »Um Himmels willen«, schrie die Mutter, »was sehe ich? Daran ist deine Schwester schuld: ich will es ihr heimzahlen!« Und augenblicklich eilte sie davon, um sie zu schlagen.
Das arme Mädchen aber entfloh und konnte sich im nahen Wald verstecken. Dort traf es der Sohn des Königs, der von der Jagd heimkehrte, und da er es so schön fand, fragte er es, was es hier so alleine treibe und warum es weine. »Ach, gnädiger Herr, meine Mutter hat mich aus dem Hause gejagt.« Der Königssohn, der fünf oder sechs Perlen und ebenso viele Diamanten aus seinem Munde fallen sah, bat es, ihm zu erzählen wie es dazu gekommen sei.
Es erzählte ihm alles, was sich zugetragen hatte. Der Königssohn verliebte sich in das Mädchen, und da er wohl bedachte, dass eine solche Gabe mehr wog als irgendeine andere Mitgift, nahm er es mit auf das königliche Schloss seines Vaters und heiratete es.
Ihre Schwester indes zog sich solchen Hass zu, dass ihre eigene Mutter sie aus dem Hause jagte; und die Unglückliche irrte vergebens umher, um jemand zu suchen, der sie aufnahm, bis sie einsam an einem Waldrand den Tod fand.

BLAUBART ...
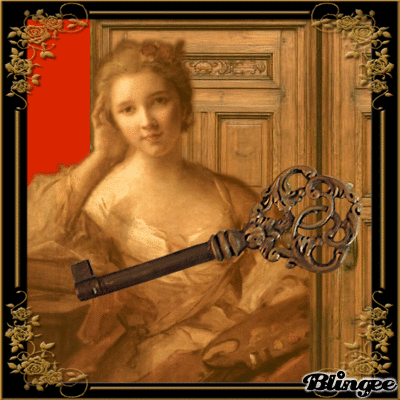
Es war einmal ein Mann, der hatte auf dem Lande und in der Stadt die schönsten Häuser, Gold und Silberzeug in Menge, kostbare Möbeln und Karossen über und über vergoldet; unglücklicherweise aber hatte dieser Mann einen blauen Bart, und das gab ihm ein so abschreckendes und hässliches Aussehen, dass alle Frauen und Mädchen, sobald er sich nur sehen ließ, vor ihm die Flucht ergriffen.
Eine vornehme Dame in seiner Nachbarschaft hatte zwei wunderschöne Töchter. Er hielt um eine von ihnen an und ließ der Mutter die Wahl, welche von beiden sie ihm geben wolle. Sie mochten ihn aber alle beide nicht und die eine schob ihn immer der andern zu, denn keine konnte sich entschließen, einen Mann zu nehmen, der einen blauen Bart habe. Was sie aber außerdem noch abschreckte, war, dass er bereits mehrere Male verheiratet gewesen war und dass Niemand wusste, was aus seinen Frauen geworden sei.
Um ihre nähere Bekanntschaft zu machen, lud Blaubart sie nebst ihrer Mutter und drei oder vier von ihren besten Freundinnen, nebst einigen jungen Leuten aus der Nachbarschaft, auf eins seiner Landhäuser und dort blieb man ganze acht Tage zusammen. Da gab es nun nichts als Spazierfahrten, Jagd- und Fischpartien, Bälle und gastliche Empfänge zu Mittag und Abend. Man schlief nicht, man brachte die ganze Nacht in Scherz und Lustbarkeit zu: genug, man unterhielt sich so gut, dass die jüngste zuletzt zu der Überzeugung gelangte, der Bart ihres Wirtes sei doch so gar blau nicht und überhaupt es sei ein ganz liebenswürdiger Mann. Und kaum war man wieder nach der Stadt zurückgekehrt, so heiratete sie ihn.
Nach Verlauf eines Monats sagte Blaubart zu seiner Frau, eine wichtige Angelegenheit nötige ihn, eine Reise von wenigstens sechs Wochen zu machen. Sie solle sich die Zeit während seiner Abwesenheit nicht lang werden lassen, gute Freundinnen zu sich bitten, mit ihnen Landpartien machen, wenn sie Luft dazu habe, kurzum sich ja nichts abgehen lassen. „Hier hast du“, sagte er zu ihr, „die Schlüssel zu den beiden Vorratskammern; diese hier sind zu dem Gold - und Silbergeschirr, welches nicht täglich gebraucht wird; diese hier zu den eisernen Kasten, in denen mein Geld verwahrt ist; dieser zu meinem Juwelenkästchen und da ist der Hauptschlüssel zu allen Gemächern.
Endlich dieser kleine Schlüssel hier, schließt das Kabinett auf, welches sich am Ende der langen Gallerte des Erdgeschosses befindet: öffne alles, gehe überall hin, was aber dieses kleine Kabinett betrifft, so verbiete ich dir, hineinzugehen und ich verbiete es dir so streng, dass, wenn es dich ja gelüsten sollte, es zu öffnen, du alles Mögliche von meinem Zorn zu befürchten hast." Sie versprach, alles, was er ihr gesagt, auf das Pünktlichste zu befolgen, und darauf umarmte er sie, setzte sich in seinen Wagen und fuhr fort.
Die Nachbarinnen und guten Freundinnen warteten nicht erst, bis die junge Frau zu ihnen schicke und sie bitten lasse: so ungeduldig waren sie alle, die kostbaren Sachen, die sich in jenem Hause befanden, zu besehen, denn in Blaubarts Anwesenheit wagten sie es nicht, zu kommen, weil ihnen sein blauer Bart solche Furcht machte.
Da ging es nun gleich Treppe auf Treppe ab, durch alle Stuben und Kammern, von denen die eine immer schöner und prächtiger war als die andere. Hierauf gingen sie in die Vorratsgewölbe, wo sie sich nicht genug verwundern konnten über die Menge und Schönheit der Tapeten, der Betten, der Sofas, der Lehnstühle, der Kronleuchter, Schränke, Tische und Spiegel, in denen man sich von Kopf bis zu Fuß beschaute und deren Rahmen von Glas, Silber und Email so schön und so prächtig waren, wie man nie gesehen hatte. Genug, sie hörten nicht auf, außer sich zu geraten und das Glück ihrer Freundin zu beneiden.
Diese aber fand wenig Vergnügen daran, alle diese Herrlichkeiten in Augenschein zu nehmen, denn sie konnte ihre Ungeduld kaum bezähmen, zu dem verbotenen Kabinett im untern Stockwerk zu kommen und es zu öffnen. Ihre Neugier drängte sie so sehr, dass sie, ohne daran zu denken, wie unhöflich es sei, ihre Gäste zu verlassen, eine heimliche Treppe hinab stieg und so über Hals und Kopf, dass sie ein paar Mal nahe daran war, den Hals zu brechen.
Als sie nun an der Tür des Kabinetts stand, hielt sie doch ein wenig inne, denn sie dachte an das Verbot ihres Mannes und überlegte, welche üble Folgen wohl ihr Ungehorsam haben könne; allein die Versuchung war zu stark, als dass sie sie überwinden konnte. Sie nahm also den kleinen Schlüssel und öffnete zitternd die Tür des Kabinetts. Anfänglich sah sie nichts, weil die Fensterladen zu waren, nach einigen Minuten aber fing sie an gewahr zu werden, dass der Fußboden über und über mit geronnenem Blut bedeckt war, in welchem sich die Leichname mehrerer Frauen spiegelten, die längs an der Wand hingen. Dies waren alle die Frauen, welche Blaubart geheiratet und eine nach der anderen ums Leben gebracht hatte.
Sie meinte zu sterben vor Furcht und als sie den Schlüssel zum Kabinett wieder aus dem Schlosse zog, entfiel er ihrer zitternden Hand. Nachdem sie ein wenig zur Besinnung gekommen war, hob sie den Schlüssel auf, verschloss die Tür und begab sich auf ihr Zimmer, um sich zu erholen; aber sie konnte kaum zu sich selbst kommen, so außer sich war sie. Da sie bemerkte, dass der Schlüssel mit Blut befleckt war, rieb sie zwei- oder dreimal; aber das Blut wollte nicht abgehen; sie mochte ihn waschen, ja selbst mit Sande scheuern, so viel sie konnte, es blieb immer Blut daran, denn der Schlüssel war verzaubert und es gab kein Mittel, ihn gänzlich zu reinigen: wenn das Blut auf der einen Seite verschwand, so kam es auf der anderen wieder zum Vorschein.
An dem selben Abend noch kehrte Blaubart von seiner Reise zurück und sagte, er habe unterwegs Briefe empfangen, die ihn benachrichtigt hätten, dass das Geschäft, um dessen willen er verreist sei, bereits glücklich beendigt wär. Seine Frau tat alles Mögliche, was sie nur konnte, um ihn glauben zu machen, dass sie über seine schleunige Rückkehr sehr erfreut sei. Am folgenden Morgen verlangte er die Schlüssel zurück und sie gab sie ihm, aber mit so zitternder Hand, dass er ohne Mühe alles erriet, was vorgefallen war. „Wie kommt es denn“, fragte er sie, dass der Schlüssel zum Kabinett nicht dabei ist?" „Ich muss ihn wohl oben auf meinem Tischchen haben liegen lassen“, entgegnete sie. „Vergiss nicht“, sagte Blaubart, „mir ihn bald zu geben." Nachdem sie vergebens unter allerlei Vorwänden nach Aufschub gesucht hatte, musste sie ihn endlich doch herbei holen.
Blaubart betrachtete ihn und sagte zu seiner Frau: „Wie kommt dies Blut auf den Schlüssel?" „Ich weiß es nicht“, antwortete die arme Frau, welche bleicher als der Tod wurde. „Du weißt es nicht?“, fragte Blaubart, aber ich weiß es! Du hast also Lust gehabt, in das Kabinett zu gehen. Nun wohl, du sollst hinein kommen und den Frauen, welche du dort gesehen hast, Gesellschaft leisten." Sie warf sich zu den Füßen ihres Mannes, bat ihn weinend um Verzeihung und bezeigte die lebhafteste Reue über ihren Ungehorsam. Doch die schöne, in Tränen aufgelöste Frau hätte wohl eher einen Felsen bewegt, als das Herz ihres Mannes, welches härter als Stein war.
„Du musst sterben“, sprach er, „und das auf der Stelle." „Ach!“, entgegnete sie, in dem sie ihn mit Augen anblickte, die in Tränen schwammen, „wenn ich nun einmal sterben muss, so vergönne mir zum wenigsten doch eine kurze Zeit, Gott um Verzeihung meiner Sünden zu bitten." „Ich gebe dir eine halbe Viertelstunde“, sagte Blaubart, „aber nicht einen Augenblick länger." Damit ging er fort.
Als sie sich nun allein befand, rief sie ihre Schwester und sagte zu ihr: „Liebe Schwester Anna“, denn so hieß sie, „steig doch, ich bitte dich, auf den Turm und sieh, ob meine Brüder nicht kommen: sie haben mir versprochen, mich heute zu besuchen, und wenn du sie siehst, so gib ihnen ein Zeichen, sich zu beeilen." Schwester Anna stieg auf den Turm und die arme geängstigte Frau rief von Zeit zu Zeit zu ihr hinauf: „Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen?" Und Schwester Anna antwortete ihr: „Ich sehe nichts als die Ständchen der Sonne und das grünende Gras."
Unterdes schrie Blaubart, ein großes Schlachtmesser in der Hand, aus Leibeskräften zu seiner Frau hinauf: „Komm gleich herunter oder ich komm hinauf!" „Nur noch einen Augenblick“, antwortete seine Frau, und dann rief sie wieder ganz leise: „Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen?" Und Schwester Anna antwortete: „Ich sehe nichts als die Stäubchen der Sonne und das grünende Gras."
„Komm gleich herunter“, schrie Blaubart wieder, „oder ich komme hinauf!" „Ich komme schon“, antwortete seine Frau, und dann rief sie leise wieder: „Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen?" „Ich sehe“, antwortete Schwester Anna, „eine dicke Staubwolke, die von jener Seite da kommt." „Sind es meine Brüder?" „Ach nein, liebe Schwester, es ist eine Herde Schafe."
„Willst du denn nicht herunter kommen?“, schrie Blaubart. „Noch einen kleinen Augenblick“, antwortete seine Frau, und dann rief sie wieder leise: „Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen?" „Ich sehe“, antwortete diese, „zwei Reiter, welche von jener Seite her kommen, aber sie sind noch sehr weit. Gott sei gelobt!“, rief sie einen Augenblick darauf, „es sind meine Brüder. Ich winke ihnen, so sehr ich kann, sich zu beeilen."
Jetzt schrie Blaubart so übermäßig, dass das ganze Haus erzitterte. Die arme Frau kam herab und warf sich ganz in Tränen und mit aufgelösten Haaren zu seinen Füßen. „Das hilft dir alles nichts“, sagte Blaubart, „du musst sterben!" Darauf fasste er sie mit der einen Hand bei den Haaren und mit der anderen schwang er sein Schlachtmesser in der Luft, um ihr den Kopf abzuhauen. Die arme Frau wandte sich nach ihm zu, sah ihn mit sterbenden Augen an und bat ihn, ihr nur noch einen Augenblick zu gönnen, um sich zu sammeln.
„Nein, nein“, sagte er, „empfehle dich Gottes Gnade“, und hob seinen Arm auf... In dem nämlichen Augenblick pochte man so stark an die Tür, dass Blaubart einen Augenblick einhielt. Die Tür sprang auf und zwei Jünglinge stürzten herein, den Degen in der Hand, gerade auf Blaubart zu. Er erkannte in ihnen die Brüder seiner Frau und suchte sich rasch durch die Flucht zu retten; aber die beiden Brüder verfolgten ihn so hastig, dass sie ihn einholten, noch ehe er die Treppe erreichen konnte. Sie stießen ihm ihre Degen durch den Leib und ließen ihn tot liegen. Die arme Frau war gleichfalls mehr tot als lebendig und hatte nicht die Kraft aufzustehen und ihre Brüder zu umarmen.
Es fand sich, dass Blaubart keine Erben weiter hatte und so blieb also seine Frau in dem alleinigen Besitz aller seiner Reichtümer. Sie wendete einen Teil dazu an, ihre Schwester Anna mit einem jungen Edelmann zu verheiraten, der sie schon lange Zeit liebte, mit einem anderen Teil bedachte sie ihre beiden Brüder und sie selbst verheiratete sich mit einem wackeren Manne, der sie die schreckliche Zeit vergessen ließ, die sie bei Blaubart ausgestanden hatte.
DER WIDDER ...
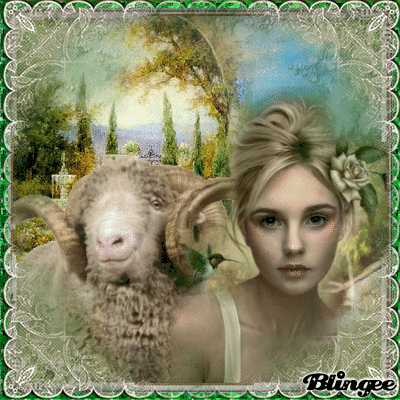
An jenen glücklichen Zeiten, da es noch Feen gab, herrschte ein König, der hatte drei Töchter; sie waren alle drei jung und schön, und alle drei besaßen Verstand und Talente, aber die jüngste war die liebenswürdigste von ihnen und der Liebling des Königs, ihres Vaters; sie führte den Namen Wunderhold. Der König schenkte ihr mehr Kleider und Bänder in einem Monat, als ihren Schwestern in einem Jahre, sie hatte aber ein so gutes Herz, dass sie alles mit ihren Schwestern teilte, so dass sie immer in größter Eintracht lebten.
Der König hatte böse Nachbarn, die ihm den Frieden nicht gönnten und ihn mit Krieg überzogen, so dass er genötigt war, alle mögliche Gegenwehr zu treffen, wenn er nicht unterliegen wollte. Er sammelte also eine große Armee und zog ins Feld. Die drei Prinzessinnen blieben mit ihrer Hofmeisterin auf einem Schloss zurück, und empfingen täglich die besten Nachrichten von ihrem Vater. Bald hatte er eine Stadt erobert, bald eine Schlacht gewonnen. Endlich gelang es ihm, seine Feinde ganz und gar aufs Haupt zu schlagen und sie aus seinen Staaten zu vertreiben, worauf er schleunigst nach Hause zurückkehrte, um seine kleine Wunderhold wieder zu sehen, die er so zärtlich liebte.
Die drei Prinzessinnen hatten sich schöne Kleider von Atlas machen lassen, um ihren Vater zu bewillkommnen, die eine ein grünes, die andere ein blaues und die jüngste ein weißes. Die Edelsteine stimmten mit der Farbe der Kleider überein. Die Grüne hatte Smaragden, die Blaue Türkise, die Weiße Diamanten, und so geschmückt gingen sie dem König entgegen und begrüßten ihn mit einem Gesang, den sie zur Feier seiner Siege gemacht hatten. Als er sie so schön und so vergnügt sah, umarmte er sie alle Drei sehr zärtlich, die meisten Liebkosungen aber erwies er Wunderhold, der Jüngsten.
Man trug ein prächtiges Mahl auf, der König und seine drei Töchter setzten sich zur Tafel und da er auf alles Acht gab, fragte er die Älteste: „Sag mir doch, warum du dir ein grünes Kleid gewählt hast?" „Gnädiger Herr Vater“, antwortete sie, „als ich von euren Taten hörte, glaubte ich, Grün bezeichne am besten meine Freude und die Hoffnung, euch bald zurück kehren zu sehen." „Gut geantwortet!“, versetzte der König. „Und du, meine Tochter“, wandte er sich zur Mittelsten, „warum hast du ein blaues Kleid gewählt?" „Gnädiger Herr Vater“, sagte die Prinzessin, „damit wollte ich andeuten, dass ich die Götter ohne Unterlass für euch anflehe, und weil, wenn ich euch sehe, ich den Himmel und die herrlichsten Gestirne zu sehen meine." „Du sprichst wie ein Buch“, sagte der König; „und du Wunderhold, weshalb hast du dich in Weiß gekleidet?" „Gnädiger Herr Vater“, antwortete sie, „weil diese Farbe mich am besten kleidet." „Wie“, rief der König erzürnt, „du eitles Geschöpf, also hattest du keine andere Absicht, als dich zu putzen?" „Ich hatte die, euch zu gefallen“, entgegnete die Prinzessin, „und es scheint mir, ich durfte keine andere weiter haben."
Der König fand diese Antwort so vortrefflich, dass er ganz zufrieden gestellt wurde; er lobte ihren Geist und wunderte sich, dass er den wahren Sinn nicht sogleich verstanden hätte. Nun fuhr er fort: „Ich habe so gut gespeist und will mich noch nicht schlafen legen, erzählt mir doch, was ihr die Nacht vor meiner Ankunft geträumt habt." Die Älteste sagte, sie hätte geträumt, der Vater brächte ihr ein Kleid mit, das von Gold und Edelsteinen heller als die Sonne blitzte. Die Zweite, sie habe geträumt, er brächte ihr ein Kleid und einen goldenen Rocken mit, um ihm Hemden zu spinnen. Die Jüngste sagte, sie habe geträumt, ihre mittelste Schwester mache Hochzeit, und an dem Hochzeittage halte der König ein goldenes Waschbecken und sage zu ihr: „Komm, Wunderhold, ich will dir Wasser auf die Hände gießen." Über diesen Traum wurde der König sehr unwillig, runzelte die Stirn und machte das grimmigste Gesicht von der Welt. Jedermann sah, dass er sehr böse war.
Er ging in sein Schlafgemach und legte sich gleich zu Bette, aber der Traum seiner Tochter ging ihm immerzu durch den Kopf. „Das unverschämte Ding“, sagte er, „sie möchte mich am Ende wohl noch zu ihrem Bedienten machen. Ich wundere mich jetzt gar nicht, dass sie das weiße Kleid gewählt hat, ohne an mich zu denken, sie hält mich ihrer Gedanken für unwert! Aber ich will ihren boshaften Anschlägen zuvorkommen, das will ich!" Er stand wütend auf und obgleich es noch nicht Tag war, schickte er nach dem Hauptmann seiner Leibwache und sagte zu ihm: „Ihr habt gehört, welchen Traum Wunderhold gehabt hat, er bedeutet mir wenig Gutes; ich befehle euch also, sie auf der Stelle in den Wald zu führen und dort zu töten. Zum Beweise, dass ihr meine Befehle vollzogen habt, bringt ihr das Herz und die Zunge zurück; und wenn ihr es wagt, mich zu hintergehen, so sollt ihr die schrecklichste Todesstrafe leiden."
Der Hauptmann war über einen so grausamen Befehl nicht wenig erschrocken. Er wollte dem Könige nicht widersprechen, aus Furcht, er möchte ihn noch mehr erzürnen und der König einen anderen damit beauftragen. Er antwortete also, er wolle die Prinzessin sogleich in den Wald führen, töten und ihr Herz und ihre Zunge ihm zurück bringen. Er begab sich auf der Stelle in ihr Zimmer und benachrichtigte Wunderhold, dass der König nach ihr verlange. Sie stand rasch auf, eine kleine Mohrin, Patypata genannt, trug ihr die Schleppe und ihre Meerkatze und ihr Möpschen, die ihr immer auf dem Fuß folgten, liefen mit. Grabüschon hieß die Meerkatze und Tintin das Möpschen.
Der Hauptmann führte die Prinzessin nach dem Garten, wo, wie er vorgab, sich der König befand, um frische Luft zu schöpfen. Er stellte sich, als ob er ihn aufsuche und da sie ihn nicht fanden, sagte er: „Ganz gewiss ist der König hinaus in den Wald gegangen." Er öffnete die Gartentür und führte sie in den Wald. Der Tag dämmerte schon ein wenig, und als die Prinzessin ihren Führer ansah, standen ihm die Tränen in den Augen und er war so betrübt, dass er kein Wort reden konnte. „Was fehlt euch“, fragte sie ihn mit der liebenswürdigsten Freundlichkeit, ihr scheint mir so niedergeschlagen?" „Ach, gnädigste Prinzessin“, rief er aus, „wer würde es nicht sein über den grausamsten Befehl, der je gegeben worden ist. Der König befiehlt, dass ich euch hier das Leben nehme und ihm euer Herz und eure Zunge zum Beweise der Tat zurück bringe, oder ich bin des Todes."
Die arme erschrockene Prinzessin wurde totenblass und Tränen glitten über ihre Wangen; sie war wie ein Lamm, welches man zum Opfer führt. Sie richtete die schönen Augen auf den Hauptmann und sagte in rührendem Tone zu ihm: „Hättet ihr wohl den Mut, mich zu töten, mich, die euch nie ein Leid zugefügt, die dem Könige nur Gutes von euch gefügt hat? Wenn ich noch den Hass meines Vaters verdient hätte, so würde ich die Folgen davon ohne Murren ertragen. Ach, ich habe ihm jederzeit so viel Ehrfurcht und Liebe bewiesen, dass er sich, ohne ungerecht zu sein, nicht über mich beklagen kann." „Fürchtet euch nicht, schöne Prinzessin“, entgegnete der Hauptmann, „dass ich fähig bin, ihm meine Hand zu einer so grausamen Handlung zu leihen, viel lieber wollte ich den Tod erdulden, mit dem er mir droht; aber wenn ich mich auch selbst ums Leben brächte, so würdet ihr darum nicht sicherer sein: man muss vielmehr ein Mittel auffinden, dass ich zum Könige zurück kehren und ihn überreden kann, ich hätte euch wirklich umgebracht." „Was können wir aber auffinden“, sagte Wunderhold, „ihr sollt ihm ja meine Zunge und mein Herz überbringen, und ohne das wird er euch nicht glauben?" Patypata, welche alles mit angehört hatte, aber von dem Hauptmann und der Prinzessin in ihrem Kummer ganz übersehen worden war, warf sich jetzt voll Mut zu den Füßen ihrer Gebieterin und sagte: „Gnädige Prinzessin, ich biete euch mein Leben an, lasst mir den Tod geben, ich schätze mich glücklich, für eine so gütige Herrin mein Leben zu lassen."
„Ach, meine teure Patypata“, entgegnete die Prinzessin, indem sie sie umarmte und küsste, „nach einem solchen Beweis deiner zärtlichen Freundschaft darf mir dein Leben nicht weniger wert sein, als mein eigenes." „Ihr tut Recht, meine Prinzessin“, fiel Grabüschon, die Meerkatze, ein, „eine so treue Sklavin wie Patypata hoch zu halten. Sie kann euch nützlicher sein, als ich; aber ich biete euch meine Zunge und mein Herz mit Freuden dar, ich will mich durch diese Tat unter den Meerkatzen unsterblich machen."
„Ach, meine liebenswürdige Grabüschon“, entgegnete die Prinzessin, „ich kann den Gedanken nicht ertragen, dir das Leben zu nehmen." „Unerträglich wäre es für mich“, schrie jetzt Tintin, das Möpschen, „dass ein Anderer, als ich, sein Leben für meine Gebieterin hingeben sollte, nein, nein, wenn Jemand sterben muss, so bin ich es." Es erhob sich nun ein sehr lebhafter Streit zwischen Patypata, Grabüschon und Tintin, bis endlich die Meerkatze, ungeduldiger, als die Anderen, auf einen Baum kletterte und sich von dem Wipfel desselben herabstürzte und den Kopf zerschmetterte.
Wie sehr auch die Prinzessin den Tod der treuen Meerkatze beklagte, willigte sie doch da ein, da sie nun einmal tot war, dass der Hauptmann ihr die Zunge ausschneide; allein zum Unglück war dieselbe so klein, dass man nicht hoffen durfte, den König damit zu hintergehen. „Ach, meine liebe kleine Meerkatze“, rief die Prinzessin, „so bist du also gestorben, ohne dass dein Tod mir das Leben rettet." „Diese Ehre ist mir aufbewahrt“, unterbrach sie die Mohrin, ergriff zu gleicher Zeit das Messer, dessen man sich bedient hatte, die Zunge der Meerkatze auszuschneiden und durchbohrte sich die Brust. Der Hauptmann wollte ihre Zunge mitnehmen, allein sie war so schwarz, dass kein Gedanke war, den König damit zu täuschen. „Wie unglücklich bin ich“, rief die Prinzessin in Tränen, „ich verliere alles, was ich liebe, und doch wird mein Schicksal um nichts gebessert." Wenn ihr meinen Vorschlag angenommen hättet“, sagte Tintin, „so würdet ihr nur mich allein zu beklagen haben, und ich hätte den Vorteil, allein beklagt zu werden." — Bei diesen Worten verschied das treue Hündchen vor Schmerz um seine Gebieterin.
Wunderhold küsste ihr kleines Hündchen und weinte bitterlich; sie entfernte sich rasch, weil sie diesen Anblick nicht länger zu ertragen vermochte. Als sie zurückkam, erblickte sie ihren Führer nicht mehr. Sie legte die Mohrin, die Meerkatze und das Hündchen in eine Grube, die sie am Fuß eines Baumes bemerkte, und dann dachte sie an ihre Sicherheit. Da dieser Wald dem Schloss ihres Vaters so nahe lag, dass die ersten besten Vorübergehenden sie sehen und erkennen, oder da die Löwen und Wölfe sie wie ein Huhn hier verspeisen konnten, so fing sie so rasch als möglich an zu zuschreiten; aber der Wald war so groß und die Sonne so glühend, dass sie vor Hitze, Furcht und Müdigkeit fast umkam. Nach keiner Seite hin, wo sie auch sehen mochte, konnte sie das Ende dieses Waldes erblicken. Alles jagte ihr Schrecken ein; sie war in beständiger Angst, der König käme hinter ihr her, um sie zu töten — ihr kläglicher Zustand war nicht zu beschreiben.
Sie ging immerzu, ohne einen bestimmten Weg zu verfolgen, das Strauchwerk zerriss ihr schönes Kleid und verwundete ihre zarte Haut. Endlich hörte sie einen Widder blöken. „Ganz gewiss“, sagte sie, „sind Schäfer mit ihren Herden in der Nähe; sie werden mich zu irgendeinem Dorfe führen können, wo ich mich unter der Tracht einer Bäuerin verbergen will." „Ach“, fuhr sie fort, „Könige und Fürsten sind nicht immer am glücklichsten! Wer sollte glauben, dass ich jetzt flüchtig umherirre, dass mein Vater ohne allen Grund meinen Tod verlangt, und dass ich mich verkleiden muss um ihm zu entfliehen. Unter solchen Betrachtungen schritt sie immer nach der Richtung hin, wo sie das Blöken gehört hatte, aber welche Überraschung! Auf einer ziemlich umfangreichen Wiese, die mit Blumen rings umgeben war, erblickte sie einen großen Widder, weiß wie Schnee, dessen Hörner vergoldet und mit Blumenkränzen behangen waren; um seinen Hals hingen Perlenschnüren von außerordentlicher Größe und eine Kette von Diamanten.
Er lag auf Orangenblüten und über ihm war ein Zelt von Goldstoff ausgespannt, um ihn vor den Strahlen der Sonne zu schützen. Hundert geputzte Widder standen um ihn herum, und weideten nicht etwa auf dem Grase, sondern die einen genossen Kaffee, Sorbet, Eis, Limonade, die anderen Erdbeeren, Milch und Backwerk, dabei spielten sie mit Karten und Würfeln; mehrere davon trugen goldene Halsbänder mit witzigen Inschriften, kostbare Ohrgehänge, und waren überall mit Blumen und Bändern umhangen. Wunderhold war so erstaunt, dass sie fast unbeweglich stehen blieb. Ihre Augen suchten den Schäfer einer so wunderbaren Herde, als der schönste Widder hüpfend und springend auf sie zukam und zu ihr sagte: Tretet näher, reizende Prinzessin, fürchtet euch nicht vor so sanften und friedfertigen Geschöpfen, wie wir sind. Welches Wunder! rief sie, Widder, die reden!
Prinzessin, entgegnete er, eure Meerkatze und euer Hündchen plauderten so artig und ihr habt euch nicht darüber gewundert. Eine Fee hatte ihnen die Gabe zu sprechen verliehen, versetzte Wunderhold, und es war daher nichts so Außerordentliches. Vielleicht ist dies mit uns der nämliche Fall, erwiderte der Widder lächelnd. Aber schöne Prinzessin, was führt euch hierher? Großes Unglück, Herr Widder, antwortete die Prinzessin; ich bin die unglücklichste Person von der Welt, ich suche vor der Wut meines Vaters eine Freistatt. So kommt mit mir, sprach der Widder, ich biete euch eine Freistatt an, in der euch niemand entdecken soll, und wo ihr die unbeschränkte Herrin sein werdet. Ach, es ist mir unmöglich, euch zu folgen, sagte Wunderhold, ich bin müde bis zum Tode. Der Widder mit den goldnen Hörnern befahl seinen Wagen zu holen, und sogleich sah man sechs Ziegen herbeikommen, die an einen hohlen Kürbis von so wunderbarer Größe gespannt waren, dass zwei Personen ganz bequem darin sitzen konnten. Die Sitze inwendig waren von Flaumfedern und mit Sammet überzogen.
Die Prinzessin setzte sich hinein, die seltene Equipage bewundernd; der Herr Widder setzte sich neben sie und die Ziegen rannten wie im Flug einer Höhle zu, deren Eingang mit einem großen Steine verschlossen war. Der vergoldete Widder berührte den selben mit seinem Fuß und sogleich öffnete sich die Tür. Er bat die Prinzessin, ohne Furcht hinein zu gehen. Sie hielt diese Höhle für einen so abschreckenden Aufenthalt, dass sie unter anderen Verhältnissen die selbe um keinen Preis betreten haben würde; jetzt aber in der Heftigkeit ihrer Angst hätte sie sich wohl in einen Brunnen gestürzt. Sie folgte also dem Widder, der vor ihr her ging, ohne Zögern. Sie stiegen so tief, so tief hinab, dass sie bis in den Grund der Erde zu kommen meinte, und sie zuweilen die Furcht anwandelte, ihr Führer bringe sie in das Totenreich. Da breitete sich mit einmal eine weite Ebene vor ihnen aus, mit tausenderlei mannigfaltigen Blumen geschmückt, deren Wohlgeruch den aller Blumen in dem Garten des Königs weit übertraf. Ein breiter Strom von Orangenwasser umfloss die Ebene, auf allen Seiten sprangen Quellen von spanischem Wein und köstliche Liköre bildeten anmutige Wasserfälle und kleine Bäche.
Die ganze Ebene war mit sonderbaren Bäumen bedeckt. Ganze Alleen waren mit köstlich gebratenen und gespickten Rebhühnern besetzt, die an den Zweigen hingen; andere Alleen mit Fasanen, Wachteln, Truthähnen und jungen Hühnchen. An einigen Stellen, ward die Luft verdunkelt durch einen Regen von Krebsen, Torten, Pasteten, Zuckerwerk, Gold, Silber, Perlen und Diamanten. Dieser seltene und kostbare Regen würde gewiss viel Gesellschaft herbei gezogen haben, wenn der Ernst des schönen Widders und sein würdevolles Wesen sie nicht zurück geschreckt hätten. Da man sich in der schönsten Jahreszeit befand, als Wunderhold in diesem reizenden Aufenthalt anlangte, so erblickte sie keinen Palast; aber eine Reihe von Orangenbäumen, Jasmin, Geißblatt und Rosenhecken bildeten mit verschlungenen Zweigen eine Menge Säle, Zimmer und Kabinetts, die sämtlich auf das Prächtigste und Geschmackvollste eingerichtet waren.
Der Widder sagte zur Prinzessin, sie möge sich als die unumschränkte Gebieterin dieses Orts betrachten; er habe seit einigen Jahren besonderen Grund zu Kummer und Tränen gehabt, aber es werde nur von ihr abhängen, ihn seine Leiden vergessen zu lassen. Ihr bezeugt euch so freundlich und großmütig, liebenswürdiger Widder, antwortete die Prinzessin, und alles, was ich hier sehe, scheint mir so außerordentlich, dass ich nicht weiß, was ich davon denken soll. Kaum hatte sie das gesagt, so sah sie eine Menge reizender Nymphen erscheinen, die ihr Früchte in Körbchen von Ambra dar boten; aber da sie sich ihnen nähern wollte, entfernten sie sich; sie streckte ihre Arme aus, um sie zu berühren, aber sie fühlte nichts und erkannte nun, dass es bloße Luftgebilde waren. Ach, was ist das? rief sie, wo bin ich? Und dabei brach sie in Tränen aus. Als König Widder (denn so nannte man ihn), der sie auf einige Augenblicke allein gelassen hatte, wieder zurückkehrte und sie in Tränen fand, war er so außer sich darüber, dass er zu ihren Füßen fast gestorben wäre. Was ist euch begegnet, schöne Prinzessin, fragte er sie, hat es Jemand an Ehrfurcht gegen euch fehlen lassen? Nein, nein, antwortete sie, ich habe mich über nichts der Art zu beklagen, aber alles hier setzt mich in Furcht, ich bin nicht gewöhnt, mit Geistern zu leben, und ich bitte euch, führt mich wieder auf die Oberwelt zurück.
„Seid ohne alle Furcht“, versetzte der Widder, „würdigt mich, die Geschichte meines traurigen Geschickes ruhig anzuhören, und ich hoffe, eure Angst wird verschwinden." „Ich bin auf dem Thron geboren, der Nachkömmling einer langen Reihe von Königen. Ich beherrschte das schönste Königreich von der Welt und wurde von meinen Untertanen geliebt, von meinen Nachbarn geachtet und gefürchtet. Ich war ein leidenschaftlicher Liebhaber der Jagd, und als ich eines Tages einen Hirsch mit großem Eifer verfolgte und mich von allen meinen Begleitern entfernt hatte, sah ich den Hirsch sich plötzlich in einen Teich stürzen. Ich trieb mein Pferd mit eben so viel Kühnheit als Unvorsichtigkeit ihm nach, aber je weiter ich vordrang, fühlte ich, statt der Kühle des Wassers eine desto größere Hitze; endlich versiegte der Teich und ich stürzte in einen Schlund hinab, aus welchem schreckliche Flammen empor schlugen. Ich glaubte mich schon verloren, als ich eine Stimme hörte, die zu mir sagte: Undankbarer, nicht weniger Feuer bedarf es, um dein Herz zu entzünden. Wie, wer beklagt sich hier über meine Kälte? entgegnete ich. Eine Unglückliche, erwiderte die Stimme, die dich ohne Hoffnung anbetet.
Zu gleicher Zeit erlosch das Feuer und ich erblickte eine Fee, die ich seit meiner frühesten Jugend kannte, deren Alter und Hässlichkeit aber mir immer abschreckend gewesen waren. Sie stützte sich auf eine junge Sklavin von außerordentlicher Schönheit, die, zum Zeichen ihrer Dienstbarkeit, goldene Ketten trug. Welches Wunder geht hier vor, Ragotte? redete ich die Fee an, geschieht das alles auf euren Befehl? Auf wessen Befehl sonst? entgegnete sie. Hast du meine Zuneigung bisher nicht bemerkt? Muss ich die Schande erfahren, sie dir selbst zu gestehen? Haben denn meine Augen, die sonst so unwiderstehlich waren, alle Kraft verloren? Bedenke, wie sehr ich mich erniedrige, dass ich dir meine Schwäche eingestehe, denn wenn du gleich ein großer König bist, so bist du doch gegen eine Fee, wie ich, nur ein Insekt. Ich will alles sein, was ihr wollt, entgegnete ich ungeduldig, aber sagt nur endlich, was verlangt ihr? Meine Krone, mein Reich, meine Schätze? Du Ohnmächtiger, erwiderte sie mit verächtlichem Ton, meine Küchenjungen sind mächtiger als du, wenn ich will. Ich verlange dein Herz, meine Augen haben es tausend und aber tausend Mal von dir begehrt; aber du hast sie nicht verstanden, oder vielmehr, du hast sie nicht verstehen wollen. Besäße eine andere deine Liebe, fuhr sie fort, so würde ich mich zu trösten wissen, aber ich habe dich zu genau beobachtet, um nicht zu wissen, welche Gleichgültigkeit in deinem Herzen herrscht. — Wohlan, liebe mich, lass mich deine geliebte Ragotte sein und ich will dir zu deinem Königreich noch zwanzig andere schenken, hundert Türme voll Gold, fünfhundert voll Silber, mit einem Wort, du sollst alles haben, was du begehrst.
Madame Ragotte, antwortete ich, es würde sich wenig schicken, in einem solchen Loche, wo ich gebraten zu werden meine, einer Dame von eurem Stande eine Liebeserklärung zu machen; ich ersuche euch, bei allen den Reizen, die euch schmücken, mich in Freiheit zu setzen und dann wollen wir sehn, was ich tun kann, um euch zufrieden zu stellen. Ha, Verräter! schrie sie, wenn du mich liebtest, so würdest du nicht erst in dein Königreich wollen; aber glaube ja nicht, dass ich so unerfahren bin; du meinst mir zu entwischen, ich schwöre dir aber, dass du hier bleibst, und das Erste, was du tun sollst, ist, meine Widder zu hüten; sie haben Verstand und sprechen wenigstens eben so gut als du. Zu gleicher Zeit führte sie mich auf die Ebene, in der wir uns jetzt befinden, und wies mir ihre Herde, der ich keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, weil die schöne Sklavin, welche die Fee begleitete, meine Augen fesselte. Die grausame Ragotte bemerkte dies kaum, so stürzte sie auf sie zu, und stieß ihr eine Nadel so tief ins Auge, dass sie sogleich tot zur Erde sank.
Bei diesem entsetzlichen Anblick sprang ich mit dem bloßen Schwert in der Hand auf Ragotten zu, entschlossen, das reizende Opfer ihrer Grausamkeit an ihr zu rächen: aber ein Zauberwort von ihr machte mich unbeweglich. Meine Anstrengungen waren vergeblich, ich warf mich auf die Erde und wollte mir das Leben nehmen, um mich von dem Zustand zu befreien, in welchem ich mich befand, als sie mit einem spöttischen Lächeln zu mir sagte: Du sollst meine Macht kennen lernen; jetzt bist du ein Löwe, du sollst aber ein Lamm werden. Alsbald berührte sie mich mit ihrem Zauberstab, und ich erhielt die Gestalt, in welcher ihr mich hier seht. Ich verlor aber weder den Gebrauch meiner Sprache, noch das schmerzliche Gefühl meines Zustandes. Du sollst fünf Jahre in dieser Verwandlung bleiben, sagte sie, und der unumschränkte Beherrscher dieser schönen Gegend sein, während ich entfernt von dir, ohne deine anmutige Gestalt mehr zu erblicken, meinem Hass gegen dich nachhängen werde. Sie verschwand; und wenn Etwas mein Unglück mildern konnte, so war es ihre Entfernung. Die sprechenden Schafe, welche ich hier fand, erkannten mich für ihren König; sie erzählten mir, dass sie das Unglück gehabt hätten, der mächtigen Fee aus verschiedenen Gründen zu missfallen, und gleich mir von ihr verwandelt worden seien, die Einen auf längere, die Anderen auf kürzere Zeit.
In der Tat, sagte der Widder, empfangen einige auch von Zeit zu Zeit ihre menschliche Gestalt wieder und verlassen die Herde. Die Schatten aber gehören Nebenbuhlerinnen und Feindinnen der Fee an, welche sie auf ein Jahrhundert oder weniger getötet hat, und die dann auf die Welt zurückkehren. Die junge Sklavin, von der ich euch erzählte, befindet sich gleichfalls unter dieser Zahl; ich habe sie in der Folge öfters mit Vergnügen gesehen, aber sie konnte nicht zu mir sprechen, und wenn ich mich ihr nähern wollte, erkannte ich zu meinem Verdruss, dass es nur ein Schatten war. Seit drei Jahren habe ich keinen anderen Wunsch, als den meiner Freiheit; und das ist es, was mich zuweilen in den Wald lockt. Dort habe ich euch öfters gesehen, schöne Prinzessin, fuhr er fort; ach, wenn ich es hätte wagen dürfen, euch die Empfindungen meines Herzens zu gestehen, wie viel hätte ich euch zu sagen gehabt! Aber wie hättet ihr das Geständnis der Neigung eines unglücklichen Widders aufgenommen!
Wunderhold war über alles das, was sie vernommen hatte, so verwirrt, dass sie kaum wusste, was sie darauf antworten sollte; sie bewies sich indes so freundlich gegen den Widder, dass er wohl einige Hoffnung schöpfen konnte. Sie fragte auch, sie habe nun weniger Furcht vor den Schatten, da sie wüsste, dass sie eines Tages wieder ins Leben zurück kehrten. Ach, fuhr sie fort, wenn meine arme Patypata, meine teuere Grabüschon und der reizende Tintin, die um meinetwillen sich dem Tode opferten, doch ein gleiches Los haben könnten, wie glücklich würde ich mich schätzen! Seines Missgeschickes ungeachtet besaß König Widder doch sehr annehmliche Vorrechte. Geht, sagte er zu einem seiner Untergebenen, einem sehr gutmütig aussehenden Widder, geht und holt die Mohrin, die Meerkatze und das Hündchen, ihre Schatten sollen der Prinzessin zur Unterhaltung dienen. Nach wenigen Augenblicken sah Wunderhold alle Drei, und obgleich sie ihr nicht so nahe kamen, um von ihr berührt werden zu können, so gereichte doch schon der bloße Anblick ihr zum größten Trost.
König Widder besaß so viel Geist und Feinheit, dass seine Unterhaltung äußerst angenehm war. Er liebte die Prinzessin so leidenschaftlich, dass er ihr gleichfalls Liebe einflößte. Warum sollte auch ein so aufmerksamer, zärtlicher, liebenswürdiger Widder nicht gefallen, zumal wenn man weiß, dass er ein König ist und seine Verwandlung ein Ende nehmen muss! — So verlebte die Prinzessin ihre Tage ganz angenehm, in Erwartung einer noch glücklicheren Zukunft. Der Widder beschäftigte sich nur mit ihr, veranstaltete Feste, Konzerte, Jagden, und seine Herde unterstützte ihn aufs Beste. Eines Tages, als die Boten zurück kehrten, die er beständig nach Neuigkeiten aus sandte, hinterbrachten sie ihm die Nachricht, dass die älteste Schwester der Prinzessin Wunderhold im Begriff sei, sich mit einem angesehenen Prinzen zu verheiraten, und dass man alle Anstalten zu einer überaus prächtigen Hochzeitsfeier treffe.
Ach, rief Prinzessin Wunderhold, wie unglücklich bin ich, so viele schöne Dinge nicht sehen zu können! Da befinde ich mich hier unter der Erde, in Gesellschaft von Schatten und Schafen, und kann meine liebe Schwester nicht sehen, die wie eine Königin geschmückt sein wird, und kann allein an ihrer Freude keinen Teil nehmen! Warum beklagt ihr euch? entgegnete der König der Widder, habe ich euch denn schon abgeschlagen, zur Hochzeit eurer Schwester zu reisen? Reist, wann es euch gefällt, aber versprecht mir, zurückzukehren. Haltet ihr aber euer Wort nicht, so werdet ihr mich zu euren Füßen sterben sehen; denn meine Liebe ist zu heftig, als dass ich euch verlieren könnte, ohne zugleich mein Leben zu lassen. Wunderhold, gerührt, versprach dem Widder, nichts auf der Welt solle sie abhalten, zu ihm zurückzukehren. Er gab ihr eine Equipage, die ihrem Stande angemessen war, sie zog sich ein kostbares Kleid an und vergaß nichts, was den Glanz ihrer Schönheit noch erhöhen konnte; darauf setzte sie sich in einen Wagen von Perlmutt, welchen sechs isabellfarbene Flügelpferde zogen, und eine Menge reich gekleideter Bedienten, die König Widder weit und breit zu seinem Gefolge hatte herbei holen lassen, begleiteten sie.
Sie langte an dem Palast des Königs, ihres Vaters an, in dem Augenblick, wo man die Hochzeit feierte. Als sie eintrat, war das Aufsehen, welches ihre Schönheit und ihr kostbarer Anzug erregten, allgemein; sie hörte rund um sich nichts als Ausrufungen des Beifalls und der Bewunderung. Der König betrachtete sie so aufmerksam, dass sie schon fürchtete, von ihm erkannt zu werden, aber er war von ihrem Tode so überzeugt, dass er gar keinen Gedanken hatte, wer sie sein könne. Doch die Furcht, man könne sie zurückhalten, ließ sie das Ende der Feierlichkeit nicht abwarten. Sie entfernte sich bald wieder, ließ aber ein kleines Kästchen von Korallen und Smaragden zurück, auf welchem mit diamantenen Buchstaben geschrieben stand: Schmuck für die Braut. Man öffnete es sogleich, und welche Kostbarkeiten fand man darin! Der König, der vor Begierde brannte, zu erfahren, wer sie sei, war in Verzweiflung, sie nicht mehr zu sehen, und befahl ausdrücklich, wenn sie je wieder komme, alle Türen hinter ihr zu verschließen, und sie da zu behalten.
Wie kurz auch die Abwesenheit der Prinzessin gewesen war, schien sie dem König der Widder doch eine Ewigkeit. Er erwartete sie am Rande einer Quelle, in dem Dickicht des Waldes; kaum hatte er sie erblickt, so lief er auf sie zu, hüpfend und springend, und erwies ihr tausend Zärtlichkeiten, legte sich zu ihren Füßen, küsste ihr die Hände und erzählte ihr, welche Unruhe und Ungeduld er inzwischen ausgestanden habe. Seine Liebe gab ihm eine Beredsamkeit, von der die Prinzessin entzückt war. Nach einiger Zeit verheiratete der König seine zweite Tochter. Wunderhold erfuhr es, und bat den Widder um die Erlaubnis, auch diesem Feste, an welchem sie so großen Anteil nahm, beiwohnen zu dürfen. Bei diesen Worten konnte der Widder seinen Schmerz kaum bezwingen, allein die Gefälligkeit gegen die Prinzessin siegte über alles Andere; er hatte nicht die Kraft, ihre Bitte abzuschlagen. Ihr wollt mich verlassen, sagte er zu ihr; nicht ihr, mein unglückliches Geschick trägt die Schuld. Ich willige, in alles, was ihr wünscht, aber dies ist das größte Opfer, welches ich euch bringen kann.
Die Prinzessin versicherte ihm, sie werde eben nicht länger ausbleiben, als das erste Mal und beschwor ihn, sich nicht zu beunruhigen. Sie bediente sich der nämlichen Equipage, und langte wie damals gerade bei dem Anfang der Feierlichkeit an. Der Aufmerksamkeit ungeachtet, welche die selbe in Anspruch nahm, erhob sich bei dem Erscheinen der Prinzessin Wunderhold ein allgemeiner Schrei der Freude und Bewunderung. Aller Augen waren auf sie gerichtet, man konnte sich nicht satt an ihr sehen, und fand ihre Schönheit so ungewöhnlich, dass man beinahe geneigt war, die Fremde für keine Sterbliche zu halten. Am Meisten freute sich der König, sie wieder zusehen; er wandte kein Auge von ihr ab und befahl, alle Türen wohl zu verschließen, um sie da zu behalten. Als die Feierlichkeit ihrem Ende nahte, stand die Prinzessin rasch auf und wollte sich unter der Menge verlieren, doch wie erschrocken und bekümmert war sie, alle Türen verschlossen zu finden!
Der König näherte sich ihr ehrfurchtsvoll und mit einer Freundlichkeit, die ihr Mut einflößte. Er bat sie, ihm nicht sobald das Vergnügen ihrer Gegenwart zu entziehen, sondern das Festmahl zu verherrlichen, welches er den Prinzen und Prinzessinnen gebe. Er führte sie in einen prächtigen Saal, wo der ganze Hof versammelt war, nahm ein goldenes Waschbecken und eine Kanne, und reichte es ihr dar, um sich die Hände zu waschen. In diesem Augenblick konnte sie ihr Gefühl nicht länger zurückhalten; sie warf sich zu seinen Füßen, umschlang seine Knie und sagte: „So ist also mein Traum erfüllt, ihr habt mir an dem Hochzeitstage meiner Schwester das Waschwasser gereicht, ohne dass euch ein Unglück widerfahren wäre." Der König erkannte sie jetzt ohne Mühe; schon mehr als einmal hatte er gefunden, dass sie seiner Tochter Wunderhold außerordentlich ähnlich sehe. „Ach, meine geliebte Tochter, rief er, sie umarmend und in Tränen ausbrechend, kannst du meine Grausamkeit verzeihen? Ich habe deinen Tod gewollt, weil ich glaubte, dein Traum bedeute den Verlust meiner Krone. Er bedeutete ihn auch, fuhr er fort; deine beiden Schwestern sind verheiratet, jede trägt eine Krone, die meinige aber soll für dich sein."
Mit diesen Worten stand er auf, setzte seine Krone der Prinzessin Wunderhold auf und rief: „Es lebe die Königin Wunderhold!" Und der ganze Hof schrie mit. Die beiden Schwestern der jungen Königin eilten herbei, umarmten sie und erwiesen ihr die zärtlichsten Liebkosungen. Wunderhold weinte und lachte zu gleicher Zeit; sie umarmte die Eine, sie sprach zu der Anderen, sie dankte dem Könige und dazwischen erinnerte sie sich des Hauptmanns, dem sie ihr Leben zu danken hatte. Sie fragte dringend nach ihm, aber man sagte, dass er tot sei, was ihr sehr nahe ging. Als sie bei Tische saßen, bat sie der König, alles zu erzählen, was ihr seit jenem traurigen Tage begegnet sei. Sie nahm sogleich das Wort und alle hörten mit großer Aufmerksamkeit zu. Während sie jedoch bei dem Könige und ihren Schwestern saß und alles Übrige vergaß, sah der ungeduldige Widder die Stunde verstreichen, in welcher die Prinzessin hatte zurückkehren wollen, und seine Ungeduld wurde so heftig, dass er ihrer nicht Herr werden konnte.
„Sie will nicht mehr zurückkehren“, rief er aus, „meine unglückliche Verzauberung schreckt sie zurück! O ich Unglücklicher, was werde ich ohne Wunderhold anfangen? Ragotte, grausame Fee, welche Rache nimmst du für meine Gleichgültigkeit!" — So klagte er lange Zeit; da aber die Nacht heran nahte, ohne dass die Prinzessin erschien, so lief er in die Stadt. In dem Palast des Königs fragte er nach Wunderhold; da aber alle bereits ihr Abenteuer kannten, und man nicht wollte, dass sie mit einem Widder zurückkehre, so verweigerte man ihm hartnäckig, sie zu sehen. Er brach in die rührendsten Klagen aus, die jeden Anderen bewegt hätten, nur jene hartherzigen Türsteher nicht, welche den Palast bewachten. Endlich, im Übermaß seines Schmerzes, stürzte er zu Boden und gab sein Leben auf.
Der König und Wunderhold hatten von dieser trübseligen Begebenheit keine Ahnung. Jetzt schlug der König seiner Tochter vor, mit ihm in den Wagen zu steigen und sich die Stadt zu besehen, die heute mit vielen tausend und tausend Lampen auf das Prächtigste erleuchtet war. Welch ein Anblick aber, da sie ihren geliebten Widder am Eingang des Palastes hingestreckt fand, ohne ein Zeichen des Lebens! Sie stürzte aus dem Wagen, sie lief auf ihn zu, sie weinte und jammerte, sie wusste, dass nur der Mangel ihrer Pünktlichkeit den Tod des Widders verschuldet habe. Sie befand sich in solcher Verzweiflung, dass sie selbst jeden Augenblick zu sterben gedachte — aber vergebens. —
So sind die Höchsten der Erde den Schlägen des Schicksals nicht weniger unterworfen, als andere, und oft erfahren sie den härtesten Schlag in dem Augenblick, wo sie sich auf dem Gipfel ihrer Wünsche glauben.
DER GESTIEFELTE KATER ...
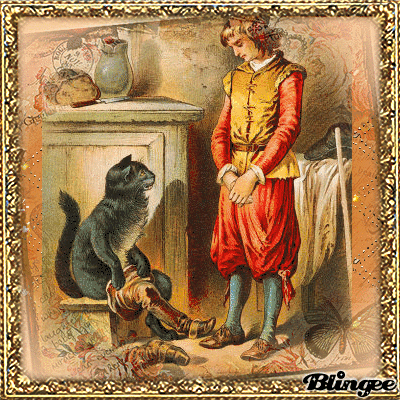
Ein Müller hinterließ bei seinem Hinscheiden seinen drei Söhnen nichts weiter, als seine Mühle, seinen Esel und seine Katze. Die Teilung war bald gemacht, ohne dass man die Gerichte dazu brauchte, die von der kleinen Erbschaft gewiss nichts übrig gelassen hätten. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel und der Jüngste nichts als die Katze.
Dieser konnte sich über ein so armseliges Erbteil gar nicht zufrieden geben. „Meine Brüder“, sagte er, „können doch, wenn sie gemeinschaftliche Sache machen, ihren Lebensunterhalt auf eine anständige Art verdienen; aber ich, wenn ich meinen Kater aufgegessen und mir aus seinem Fell einen Muff gemacht habe, ich muss ja Hungers sterben!"
Der Kater, welcher diese Rede wohl hörte, obgleich er sich gar nicht so anstellte, sagte zu ihm mit einer ernsthaften und gesetzten Miene: „Bekümmert euch doch nicht, lieber Herr, ihr braucht mir nur einen Sack zu geben und mir ein Paar Stiefeln machen zu lassen, damit ich in das Gesträuch gehen kann, und ihr werdet sehen, dass ihr mit euerem Anteil nicht so übel bedacht wart, als ihr glaubt."
Der arme Mensch rechnete zwar nicht sehr auf die Versprechungen des Katers, Indes er hatte ihn so manchen listigen Streich ausführen sehen, wie er sich bald, um die Ratten und Mäuse zu fangen, bei den Beinen aufhing, bald sich in das Mehl hinstreckte, als ob er tot sei, dass er gleichwohl nicht daran verzweifelte, er könne ihm in seinem Unglück irgendwie nützlich sein.
Als der Kater das, was er verlangte, erhalten hatte, zog er mutig die Stiefelchen an, hing seinen Sack um den Hals, fasste die Schnüre mit den beiden Vorderpfoten und marschierte so auf einen Berg, wo es eine große Menge Kaninchen gab. Er tat Kohl und Kleie in seinen Sack und indem er sich hinstreckte, als ob er tot sei, erwartete er, dass irgend ein junges Kaninchen, mit den Listen dieser Welt noch wenig bekannt, hinein kröche, um von dem Kohl und der Kleie zu naschen.
Kaum hatte er sich hingelegt, so geschah es auch, wie er dachte. Ein junges unbedachtsames Kaninchen spazierte in den Sack und Meister Kater zog gleich die Schnüre zu, packte und erwürgte es ohne Barmherzigkeit. Ganz stolz auf seine Beute, ging er damit zum Könige und verlangte vor gelassen zu werden.
Man ließ ihn in das Gemach Seiner Majestät hinaus steigen, der Kater trat ein, machte einen tiefen Bückling vor dem Könige und sagte zu ihm: „Hier bringe ich Euer Majestät ein Kaninchen, welches der Herr Graf von Karabas (dies war der Name, welchen er für gut fand, seinem Herrn zu geben) mir aufgetragen hat, euch zu überreichen." „Sage deinem Herrn“, antwortete der König, „dass ich ihm danke und dass er mir ein Vergnügen damit gemacht hat."
Ein anderes Mal legte sich der Kater, den Sack immer offen haltend, ins Korn und als zwei Rebhühner darin waren, zog er die Schnüre zu und fing sie alle beide. Hierauf ging er wieder zum König und überreichte sie ihm, so wie er es mit dem Kaninchen gemacht hatte. Der König nahm auch die beiden Rebhühner gnädig an und ließ ihm ein Trinkgeld geben. So fuhr der Kater durch zwei oder drei Monate fort, dem Könige von Zeit zu Zeit Wildbret aus dem Forst seines Herrn zu bringen.
Eines Tages hatte er erfahren, dass der König mit seiner Tochter, der schönsten Prinzessin von der Welt, an dem Ufer des Flusses eine Spazierfahrt machen wolle, und sagte zu seinem Herrn: „Wenn ihr jetzt meinem Rate folgt, so ist euer Glück gemacht. Ihr habt nichts weiter zu tun, als dass ihr euch in dem Fluße, an der Stelle, die ich euch zeigen werde, badet und das Übrige laßt mich nur machen."
Der Graf von Karabas tat, wie sein Kater ihm riet, ohne zu wissen, wozu es gut sein würde. Während er nun badete, kam der König vorüber und sogleich fing der Kater aus Leibeskräften an zu schreien: „Zu Hilfe, zu Hilfe, der Herr Graf von Karabas ist am Ertrinken." Auf dies Geschrei steckte der König den Kopf aus dem Wagen und als er den Kater erkannte, welcher ihm so oft Wildbret gebracht hatte, befahl er seinen Leuten, dem Grafen von Karabas schleunigst zu Hilfe zu eilen.
Während man nun den armen Grafen aus dem Fluß zog, trat der Kater an den Wagen heran und sagte zum Könige: während sein Herr sich gebadet, seien Diebe gekommen und hätten alle Kleider mit fort genommen, obgleich er ihnen aus Leibeskräften nach geschrien habe. — Der Spitzbube von Kater hatte sie selbst unter einen großen Stein versteckt!
Sogleich befahl der König seinen Kammerdienern aus seiner Garderobe eins seiner schönsten Kleider für den Herrn Grafen von Karabas zu holen. Der König erwies ihm alle nur möglichen Höflichkeiten, und da der schöne Anzug, mit welchem man ihn bekleidete, ihm sehr wohl stand (denn er war von Natur hübsch und gut gewachsen), so fand ihn die Tochter des Königs ganz nach ihrem Geschmack und der Graf von Karabas hatte ihr nur etwa zwei bis drei ehrfurchtsvolle und ein wenig zärtliche Blicke zugeworfen, so wurde sie, wie närrisch, in ihn verliebt. Der König ersuchte ihn in seine Karosse zu steigen und die Spazierfahrt mit zu machen.
Der Kater, außer sich vor Vergnügen, dass ihm sein Anschlag so gut gelungen war, lief voraus und als er auf einige Bauern traf, welche eine Wiese mähten, rief er ihnen zu: „Ihr guten Leute, wenn ihr dem Könige nicht sagt, dass die Wiese, die ihr mäht, dem Grafen von Karabas gehört, so werdet ihr alle kurz und klein gehackt, wie Pastetenfleisch."
Wirklich unterließ der König nicht, die Bauern zu fragen, wem die Wiese gehöre, die sie mähten? „Sie gehört dem Grafen von Karabas“, sagten alle einstimmig, denn die Drohung des Katers hatte sie in Furcht gesetzt. „Da habt ihr ein schönes Erbstück“, sagte der König zu dem Grafen von Karabas. „Wie Ihre Majestät sehen“, antwortete der Graf; „diese Wiese bringt alle Jahr ihren reichlichen Ertrag."
Meister Kater, der immer voraus lief, traf jetzt auf einige Schnitter und rief ihnen zu: „Ihr guten Leute, wenn ihr nicht sagt, dass alle diese Getreidefelder dem Herrn Grafen von Karabas gehören, so werdet ihr alle kurz und klein gehackt, wie Pastetenfleisch."
Der König, der einen Augenblick darauf vorüber kam, wollte wissen, wem alle diese Getreidefelder gehörten, die er vor sich sähe. „Sie gehören dem Herrn Grafen von Karabas“, antworteten die Schnitter, und der König bezeugte dem Grafen gleichfalls seine Freude darüber. Der Kater, welcher immer vor dem Wagen einher lief, sagte zu Allen, die er unterwegs traf, immer das Nämliche, und der König war über die großen Besitztümer des Herrn Grafen von Karabas ganz erstaunt.
Endlich kam Meister Kater auch an ein schönes Schloss, welches einem wilden Manne gehörte, dem reichsten, der jemals gelebt hat, denn das ganze Land, durch welches der König gekommen war, gehörte zu diesem Schlosse. Der Kater erkundigte sich vorher, wer dieser wilde Mann sei und was er für Geschicklichkeiten besäße, und bat dann, ihm aufwarten zu dürfen, wobei er sagte: er habe, so nahe seinem Schloss, nicht vorbei gehen wollen, ohne die Ehre zu haben, ihm seinen untertänigen Diener zu machen.
Der wilde Mann empfing ihn mit aller Höflichkeit, deren ein wilder Mann fähig ist und ließ ihn nieder sitzen. „Man hat mich versichert“, sagte der Kater, „dass ihr die Fähigkeit hättet, euch in alle Arten von Tieren zu verwandeln. Ihr könntet z. B. die Gestalt eines Löwen oder eines Elefanten annehmen." „Das ist auch wahr“, antwortete der wilde Mann, „und um es dir zu beweisen, will ich mich gleich in einen Löwen verwandeln." Der Kater war so erschrocken, einen Löwen vor sich zu sehen, dass er gleich auf die Dachrinne kletterte, nicht ohne Mühe und Gefahr der Stiefeln halber, die auf den Ziegeln ausglitten.
Als der Kater nach einer Weile sah, dass der wilde Mann seine Löwengestalt wieder abgelegt hatte, kam er herab und gestand, er sei in Todesangst gewesen. „Man hat mich“, fuhr er fort, „auch noch versichert, was ich aber kaum glauben kann, dass es auch in eurer Macht stünde, die Gestalt der kleinsten Tiere anzunehmen, z. B, euch in eine Ratte oder in eine Maus zu verwandeln. Ich muss gestehen, dass ich das für ganz unmöglich halte." „Unmöglich?“, rief der wilde Mann; „das sollst du sehen." Und sogleich verwandelte er sich in eine Maus, die auf dem Fußboden dahin lief; aber der Kater hatte sie kaum erblickt, so erwischte er sie und fraß sie auf.
Inzwischen kam der König auch bei dem schönen Schloss des wilden Mannes vorüber und wünschte einzutreten. Der Kater, welcher den Wagen über die Zugbrücke rollen hörte, lief ihm entgegen und sagte zum Könige: „Eure Majestät seien bestens willkommen in dem Schloss des Herrn Grafen von Karabas." „Wie, mein Herr Graf“, rief der König, „dieses Schloss gehört euch auch noch? Es kann nichts Schöneres geben, als diesen Hof und alle diese Gebäude, die es umgeben. Lasst uns nun auch das Innere besehen, wenn es euch gefällt."
Der Graf reichte der jungen Prinzessin den Arm und folgte dem Könige, der voran ging. Sie traten in einen großen Saal und fanden daselbst eine prächtige Mahlzeit aufgestellt, welche der wilde Mann für seine Freunde hatte zurichten lassen, die ihn gerade an diesem Tag besuchen wollten, aber nicht hineinzugehen wagten, weil sie hörten, dass der König darin sei.
Der König war über die guten Eigenschaften des Herrn Grafen von Karabas ganz entzückt, und seine Tochter noch bei weitem mehr. In Betracht des großen Vermögens, welches er besaß, sagte er zu ihm, nachdem sie fünf oder sechs Gläser geleert hatten: „Es kommt nur auf euch an, mein Herr Graf, ob ihr mein Schwiegersohn werden wollt."
Der Graf machte einen tiefen Bückling und nahm die Ehre, welche ihm der König anbot, mit großem Dank an. Noch an dem nämlichen Tage heiratete er die Prinzessin. Der Kater wurde ein vornehmer Herr und lief jetzt den Mäusen nur noch zum Spaß nach.
DIE GUTE KLEINE MAUS ...
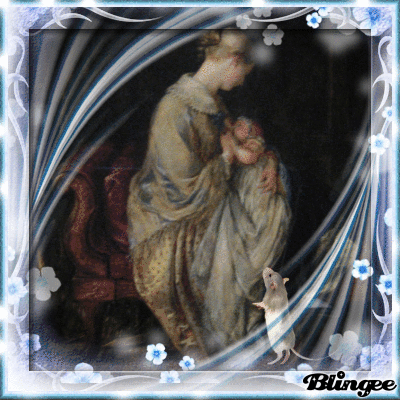
Es war einmal ein König und eine Königin, die liebten sich so sehr, dass sie gegenseitig das Glück ihres Lebens machten. Ihre Gedanken und Wünsche waren immer im Einverständnis.
Alle Tage gingen sie zusammen auf die Jagd, um Hasen und Hirsche zu schießen, oder sie gingen auf den Fischfang, Schollen und Karpfen zu fangen, oder auf den Ball, zu einem Gastmahl, in die Komödie und in die Oper. Sie lachten, sie sangen, kurzum, sie taten alles Mögliche, um ihr Leben angenehm hinzubringen. Die Untertanen folgten dem Beispiel des Königs und der Königin und belustigten sich mit einander um die Wette. Aus allen diesen Gründen nannte man dies Königreich das Land der Freude.
Nun traf es sich, dass ein benachbarter König des Freudenlandes ein ganz entgegengesetztes Leben führte. Er war ein erklärter Feind von Vergnügungen. Beulen und Wunden, das war seine Freude. Er hatte ein verdrießliches Aussehen, einen großen Bart, eingefallene Augen, war bleich und mager, kleidete sich immer in Schwarz und hatte borstiges Haar, welches ganz verworren umher hing.
Wanderer, welche durch sein Land zogen, ließ er anfallen und ermorden. Er knüpfte mit eigener Hand die Verbrecher auf und es machte ihm den größten Spaß, sie so viel als möglich zu quälen. Wenn er von einer Mutter hörte, die ihr kleines Töchterchen oder ihren kleinen Sohn zärtlich liebte, ließ er sie vor sich bringen, brach ihrem Kinde vor ihren Augen Arme und Beine oder drehte ihm den Hals um. Man nannte dies Königreich das Land der Tränen.
Als dieser boshafte König von dem Glück seines Nachbars hörte, wusste er sich vor Neid kaum zu lassen und beschloss, eine große Armee zu sammeln und den guten König so lange zu bekriegen, bis er ihn ums Leben oder wenigstens ins Elend gebracht habe. Er schickte daher allenthalben aus, um Truppen anzuwerben und ließ eine Menge Waffen anfertigen. Jedermann zitterte. Man fragte sich; „Über wen wird dieser boshafte König her fallen? da wird von keiner Barmherzigkeit mehr die Rede sein."
Als nun alles in Bereitschaft war, zog er gegen das Land seines Nachbars. Dieser rüstete sich schleunigst zur Gegenwehr, aber die Königin starb beinahe vor Furcht und sagte zu ihm: „Lass uns lieber die Flucht ergreifen, so viel Geld als möglich mit uns nehmen und so weit gehen, als die Erde uns trägt." „Pfui!“, antwortete der König. „Ich müsste kein Herz haben, wenn ich dies täte. Es ist besser, zu sterben, als sich feig zu betragen." Er zog hierauf alle seine Truppen zusammen, sagte der Königin ein zärtlich Lebewohl, bestieg sein gutes Ross und ritt fort.
Als sie ihn aus dem Gesicht verloren hatte, fing sie bitterlich zu weinen an, rang die Hände und jammerte: „Ach! wenn der König im Felde getötet wird, so wird man mich gefangen nehmen und der boshafte König wird mir alles ersinnliche Leid antun." Dieser Gedanke machte ihr solche Unruhe, dass sie weder essen noch schlafen konnte.
Der König schrieb ihr alle Tage, eines Morgens aber, da sie über die Mauer hinaus blickte, sah sie einen Kurier aus Leibeskräften heran gesprengt kommen. Sie rief ihn an: „Kurier, was für Nachrichten bringst du?" „Der König ist tot“, schrie er, „die Schlacht ist verloren und der böse König wird im Augenblick hier sein." Die arme Königin fiel bei diesen Worten ohnmächtig nieder, man trug sie auf ihr Bett, alle ihre Hofdamen standen um sie her und weinten, die eine um ihren Vater, die andere um ihren Sohn, sie rangen die Hände, zerrauften sich das Haar, es war der erbarmungswürdigste Anblick von der Welt.
Plötzlich hört man ein lautes Getöse auf dem Hofe. Es war der boshafte König mit allen seinen elenden Untertanen, die ohne Barmherzigkeit umbrachten, was ihnen in den Weg kam. Er trat ganz bewaffnet in den königlichen Palast und begab sich in das Zimmer der Königin. Als sie ihn herein treten sah, empfand sie so große Furcht, dass sie sich tief in ihr Bett verbarg und die Bettdecke über den Kopf zog.
Er rief sie zwei-, dreimal, aber sie antwortete nicht. Darüber wurde er so zornig, dass er sagte: „Ich glaube, du willst deinen Spaß mit mir treiben, weißt du wohl, dass ich dich auf der Stelle erwürgen kann?" Er zog die Decke weg, und riss ihr die Haube vom Kopfe, dass ihr schönes langes Haar auf die Schultern herab fiel, wickelte es dreimal um die Hand, lud sie auf den Rücken, wie einen Sack Getreide, schleppte sie so die Treppe hinunter und bestieg sein Pferd, welches über und über schwarz war.
Sie bat ihn, doch Mitleid mit ihr zu haben; er verhöhnte sie aber nur und sagte: „Schrei und winsle, so viel du Luft hast, ich lache darüber und es macht mir Spaß." So brachte er sie in sein Königreich und schwur den ganzen Weg über, dass er fest entschlossen sei, sie aufhängen zu lassen. Da man ihm aber sagte, dass die Königin ihre Niederkunft erwarte, ward er anderen Sinnes und beschloss, wenn sie eine Tochter zur Welt brächte, diese mit seinem Sohne zu verheiraten.
Um darüber Gewissheit zu erlangen, ließ er eine Fee zu sich einladen, die in der Nähe seines Königreichs wohnte. Als sie kam, bewirtete er sie besser, als es sonst seine Gewohnheit war und führte sie darauf in einen Turm, in welchem ganz hoch oben die arme Königin eine kleine, sehr ärmlich eingerichtete Kammer hatte. Sie lag auf der Erde, auf einer elenden Matratze, die sie Tag und Nacht mit ihren Tränen benetzte. Die Fee wurde von diesem Anblick gerührt, sie begrüßte sie und flüsterte, indem sie sie umarmte, ihr ganz leise zu: „Fasst Mut! edle Frau, eure Leiden werden ein Ende nehmen und ich hoffe, das Meinige dazu beizutragen."
Die Königin wurde durch diese Worte ein wenig getröstet und bat sie, mit einer armen Prinzessin Mitleid zu haben, die ehemals ein so großes Glück genossen und sich jetzt in einem so traurigen Zustande befinde. Als sie so mit einander sprachen, rief ihnen der boshafte König zu: „Heda, nicht so viel Komplimente! ich habe euch hierher geführt, um mir zu sagen, ob dieses Weib einen Knaben oder ein Mädchen zur Welt bringen wird."
„Ein Mädchen“, antwortete die Fee, „und zwar wird es die schönste und artigste Prinzessin werden, welche man je gesehen hat"; und darauf wünschte sie ihr alle Güter und Ehrenbezeugungen von der Welt. „Wenn sie aber nicht so schön und artig ist“, sagte der boshafte König, „so hänge ich sie mit samt ihrer Mutter an einen Baum auf und nichts auf der Welt soll mich davon abhalten."
Nach diesen Worten ging er mit der Fee weg, ohne die gute Königin nur anzusehen. Sie weinte bitterlich. „Ach“, sagte sie, als sie wieder allein war, was soll ich anfangen! Wenn ich ein liebenswürdiges Töchterchen zur Welt bringe, so wird er es seinem Ungeheuer von Sohn geben und wenn es hässlich ist, so wird er uns alle beide aufhängen. Welches unsägliche Elend ist über mich gekommen!"
Die Zeit ihrer Niederkunft kam immer näher und die Unruhe der Königin wurde immer heftiger; sie hatte niemanden, dem sie ihr Leid klagen und der sie trösten konnte, sie sah keinen Menschen als den Kerkermeister, der sie bewachte und ihr für den ganzen Tag nur drei gekochte Erbsen und ein kleines Stück Schwarzbrot brachte. Sie wurde magerer als ein Hering und hatte fast nur noch Haut und Knochen.
Eines Abends, als sie so saß und spann (denn der boshafte König, welcher zugleich sehr geizig war, ließ sie Tag und Nacht arbeiten), sah sie aus einem Loch in der Mauer ein kleines niedliches Mäuschen hervorschlüpfen. „Ach“, sagte sie zu ihm, „mein liebes Tierchen, was suchst du hier? — ich habe selbst nur drei Erbsen für den ganzen Tag, wenn du nicht fasten willst, so mach dich fort."
Indes das Mäuschen lief hin und her, tänzelte und sprang, wie ein kleiner Affe; so dass die Königin, die mit großem Vergnügen zusah, ihm endlich die einzige Erbse gab, die sie zum Abendessen übrig hatte. „Da, mein artiges Tierchen“, sagte sie, „iss; ich habe nicht mehr, aber ich gebe es dir gern." Kaum hatte sie dies gesagt, so erblickte sie auf ihrem Tisch ein vortreffliches Rebhuhn, welches auf das Schönste gebraten war, und daneben zwei Teller mit Zuckerwerk. „Wahrhaftig“, sprach sie, „eine gute Handlung bleibt niemals unbelohnt." Sie aß ein wenig, aber das lange Fasten hatte ihr den Appetit genommen; sie warf der Maus ein Bonbon hin, die es beknabberte und dann noch lustigere Sprünge machte, als vorher.
Am anderen Morgen brachte der Kerkermeister der Königin zur gehörigen Stunde die drei Erbsen, welche er, um die Unglückliche zu verspotten, in eine große Schüssel gelegt hatte. Das kleine Mäuschen schlich sacht herbei und fraß sie alle drei mit samt dem Brot. Als die Königin zu Mittag speisen wollte, fand sie nichts mehr. Da wurde sie recht böse auf das Mäuschen; als sie aber die große leere Schussel zu decken wollte, fand sie die köstlichsten Gerichte darin, von denen sie nach Herzenslust zulangte.
Während sie aber aß, fiel ihr ein, dass der boshafte König sie vielleicht in zwei, drei Tagen nebst ihrem Kinde umbringen lassen werde. Sie stand weinend vom Tisch auf und rief, indem sie die Augen zum Himmel erhob: „Ach, gibt es denn kein Mittel, uns zu retten?"
Indem sie dies sagte, sah sie, dass das Mäuschen mit einigen langen Strohhalmen spielte. „Wenn ich genug Stroh hätte“, fuhr die Königin fort, „so könnte ich mir eine Decke flechten, um mein Kind hinein zu fetzen; ich würde es zum Fenster hinaus irgendeiner mitleidigen Seele, welche Sorge dafür tragen wollte, hinunter lassen." Sie gewann neuen Mut und fing gleich an zu arbeiten. An Stroh fehlte es ihr nicht, denn das Mäuschen schleppte immer mehr herbei und erhielt dafür von der Königin zur Essenszeit ihre drei Erbsen, an deren Stelle sie jedes Mal die ausgewähltesten Gerichte fand. Sie war sehr erstaunt darüber und hatte gar keine Ahnung, wer ihr so köstliche Speisen zusende.
Eines Tages sah die Königin zum Fenster hinaus, um zu sehen, wie lang sie wohl das Seil machen müsse, an welches sie den Korb befestigen wollte, um ihn hinunter zu lassen. Da erblickte sie unten eine kleine alte Frau, die sich auf eine Krücke stützte und zu ihr sagte: „Ich weiß eueren Kummer, gnädige Frau, wenn ihr wollt, so will ich euch beistehen." „Ach! meine teure Freundin!" versetzte die Königin, „ihr werdet mir einen sehr großen Gefallen erweisen können; kommt alle Abend an den Fuß dieses Turmes, ich will euch dann mein armes Kind hinunterlassen, sorgt für dasselbe und ich werde euch, wenn ich je wieder in bessere Verhältnisse gelange, reichlich dafür belohnen."
„Ich bin nicht eigennützig“, erwiderte die Alte, „aber ich liebe eine gute Mahlzeit und nichts auf der Welt lieb ich mehr, als eine runde, fette Maus. Wenn ihr etwa in eurem Kerker eine finden solltet, so tötet sie und werft sie mir herab; ich werde nicht undankbar dafür sein, euer Töchterchen soll es gut bei mir haben." Als die Königin diesen Vorschlag vernahm, brach sie in Tränen aus, ohne ein Wort zu entgegnen. Nach einer kleinen Weile fragte die Alte, warum sie denn weine.
„Ach“, versetzte sie, „in meine Kammer kommt nur ein einziges Mäuschen und das ist so freundlich, so allerliebst, dass ich es nicht über mein Herz bringen kann, es zu töten!" „Wie“, rief die alte Frau voll Zorn, „also habt ihr eine spitzbübische Maus, die alles benagt, lieber als euer Kind? Ich sehe wohl, ihr verdient kein Mitleid, bleibt immer in so guter Gesellschaft; ich werde schon ohne euch Mäuse bekommen. Das macht mir wenig Sorge." Damit ging sie brummend und murrend weg.
Der guten Mahlzeit ungeachtet, und wie niedlich das Mäuschen vor ihr hin- und her tanzte, schlug die Königin die Augen kaum auf und weinte in einem fort. Noch in derselben Nacht gebar sie eine Prinzessin, die ein Wunder von Schönheit war. Anstatt zu weinen, wie andere Kinder, lächelte sie ihre Mutter an und streckte die kleinen Händchen nach ihr aus, als ob sie schon ganz verständig wäre. Die Königin liebkoste und küsste sie mit schwerem Herzen. „Du armes, teures Kind“, rief sie aus, „wenn du in die Hände dieses boshaften Königs gerätst, so ist es um dich geschehen!"
Dann legte sie es in den Korb mit einem Zettel, der an dem Wickelzeug befestigt war und auf welchem geschrieben stand: „Dieses unglückliche kleine Mädchen heißt Joliette!" Alle Augenblicke machte sie den Korb wieder auf und fand das Kind immer noch schöner; dann küsste sie es, weinte immer heftiger und wusste nicht, was sie tun sollte. Aber, siehe da, das kleine Mäuschen kam herbei und schlüpfte zu Jolietten in den Korb.
„Ach, du kleines Tier“, sagte die Königin, „wie teuer kommt mich dein Leben zu stehen, vielleicht verliere ich um deinetwillen meine geliebte Joliette. Eine andere als ich hätte dich getötet und der leckerhaften Alten gegeben — aber ich konnte es nicht über mein Herz bringen." Da fing die Maus plötzlich zu sprechen an und sagte: „Lasst euch das nicht gereuen, edle Frau, ich bin eurer Freundschaft nicht so unwürdig, als ihr glaubt."
Die Königin starb fast vor Furcht, da sie die Maus reden hörte; aber ihre Furcht vermehrte sich noch, als sie bemerkte, dass ihr kleines Schnäuzchen die Gestalt eines Gesichtes annahm, ihre Pfötchen zu Händen und Füßen wurden und sie plötzlich in die Höhe wuchs. Endlich erkannte die Königin, welche kaum noch hinzusehen wagte, in ihr die Fee, welche mit dem boshaften König zu ihr gekommen war und sich so liebreich erwiesen hatte.
„Ich wollte euer Herz nur auf die Probe stellen“, sagte die Fee zu ihr, „ich sehe, dass es gut ist und dass ihr der Freundschaft fähig seid. Wir Feen besitzen Schätze und Reichtümer im Überfluss; wir bedürfen zum Genuss des Lebens nur der Freundschaft und diese finden wir so selten." „Ist es möglich, schöne Dame“, versetzte die Königin, sie umarmend, „dass es bei eurem Reichtum und eurer Macht euch so schwer fallen sollte, Freundinnen zu finden?"
„Gewiss“, entgegnete jene, „denn man liebt uns nur aus Eigennutz und was ist eine solche Liebe! Ihr aber habt mich in der Gestalt eines kleinen Mäuschens geliebt, ohne dass ihr irgendeinen eigennützigen Beweggrund haben konntet. Ich wollte euch noch auf eine stärkere Probe stellen und nahm die Gestalt einer alten Frau an — ich war es, die am Fuß des Turmes mit euch sprach: aber ihr seid mir durchaus treu geblieben."
Bei diesen Worten umarmte sie die Königin, küsste darauf dreimal die kleine Prinzessin und sagte zu ihr: „Ich verleihe dir, mein Kind, der Trost deiner Mutter zu sein und reicher und glücklicher zu werden, als dein Vater. Du wirst hundert Jahre leben in vollkommener Schönheit, ohne zu altern und ohne je krank zu sein." Sehr erfreut dankte die Königin und bat die Fee, Jolietten fortzubringen und für sie Sorge zu tragen; sie möge sie als ihr Kind betrachten.
„Von Herzen gern“, erwiderte die Fee, legte die Kleine in den Korb und ließ ihn hinab. Aber, da sie einen Augenblick verweilt hatte, um die Gestalt des Mäuschens wieder anzunehmen, und nach ihr an dem Seile hinab glitt, fand sie das Kind nicht mehr. Ganz erschrocken stieg sie wieder hinauf und sagte zu der Königin: ,,Alles ist verloren! Meine Feindin Cancaline hat die Prinzessin entführt! Diese grausame Fee nämlich ist meine ärgste Feindin und da sie unglücklicherweise älter ist, als ich, so reicht ihre Macht weiter als die meinige — ich weiß kein Mittel, Jolietten ihren nichtswürdigen Klauen zu entreißen."
Als die Königin diese traurige Nachricht vernahm, meinte sie, vor Schmerz sterben zu müssen — unter den heißesten Tränen beschwor sie ihre Freundin, alles aufzubieten, die Kleine wieder zu erlangen.
Inzwischen benachrichtigte der Kerkermeister den König von der Niederkunft der Königin. Sogleich kam der König und verlangte das Kind. Sie sagte ihm jedoch, eine Fee, deren Namen sie nicht wisse, habe es ihr mit Gewalt fort genommen. In welche Wut geriet da der boshafte König! er biss sich die Nägel ab und stampfte mit den Füßen. „Ich habe dir versprochen“, rief er, „dich aufzuhängen: ich will auch auf der Stelle mein Wort halten!"
Sogleich schleppte er die arme Königin in einen Wald, stieg auf einen Baum und schickte sich an, die Königin aufzuknüpfen; aber die Fee, welche unsichtbar zugegen war, gab ihm einen solchen Stoß, dass er von oben herunterfiel und sich vier Zähne einschlug. Während seine Leute um ihn beschäftigt waren, entführte die Fee die Königin in ihrem fliegenden Wagen und brachte sie auf ein schönes Schloss. Sie trug die größte Sorgfalt für sie und wenn die Königin jetzt noch die Prinzessin Joliette gehabt hätte, so hätte zu ihrer Zufriedenheit nichts weiter gefehlt. Allein man konnte nicht entdecken, wohin Cancaline sie gebracht hatte, wie wohl das kleine Mäuschen sein Möglichstes tat.
Endlich, im Verlauf der Zeit ließ auch die heftige Betrübnis der Königin nach. Schon fünfzehn Jahre waren verflossen, da hörte man, dass sich der Sohn des boshaften Königs mit einem Gänsemädchen vermählen wolle und dieses kleine Geschöpf wolle ihn nicht. Das war freilich recht erstaunlich, dass ein Gänsemädchen Königin zu werden ausschlug — wiewohl die Brautkleider fertig da lagen und so festliche Anstalten zur Hochzeit getroffen waren, dass man hundert Stunden aus der Umgegend dazu herbei kam.
Das kleine Mäuschen begab sich in das Land des boshaften Königs, sie wollte das Gänsemädchen ganz unbemerkt beobachten. Sie kroch in den Hühnerstall und fand sie da, in groben Zwillich gekleidet, barfüßig und einen schmutzigen Lappen um den Kopf. Rund umher lagen Kleider, mit Gold und Silber gestickt, Diamanten, Perlen, Bänder, Spitzen, welche die Hühner und Gänse auf der Erde umherschleppten und beschmutzten.
Das Gänsemädchen saß auf einem großen Steine und der Sohn des boshaften Königs, welcher verwachsen, einäugig und lahm war, sagte in drohendem Tone zu ihr: „Liebe mich oder ich bringe dich um." Sie entgegnete ihm aber ruhig: „Nein, ich heirate euch nicht, ihr seid gar zu hässlich, Ihr gleicht eurem grausamen Vater, lasst mich in Ruhe mit meinen jungen Gänschen, ich liebe sie mehr, als alle eure Schmucksachen." Das Mäuschen betrachtete sie mit Bewunderung, denn sie war schön wie der Tag. —
Als sich der Sohn des boshaften Königs entfernt hatte, nahm die Fee die Gestalt einer alten Schäferin an und sagte zu ihr: „Guten Tag, mein Püppchen, sieh da, deine Gänschen gedeihen ja recht." Das junge Mädchen sah die Alte mit freundlichen Blicken an und versetzte: «Ich soll sie um einer elenden Krone willen verlassen, was meint ihr dazu?" „Mein Töchterchen“, antwortete die Fee, „eine Krone ist eine schöne Sache, aber du kennst weder den Wert, noch die Last der selben!" „O ich kenne sie wohl“, fiel rasch das Gänsemädchen ein, „und deshalb bin ich entschlossen, sie nicht auf mich zu nehmen; wenn ich auch nicht weiß, wer ich bin, noch wer mein Vater und meine Mutter ist, denn ich habe weder Eltern, noch Freunde!"
„Du bist schön und tugendhaft, mein Kind“, erwiderte die verständige Fee, „und das ist mehr wert, als zehn Königreiche. Erzähle mir doch, ich bitte dich, wer dich hierher gebracht hat, da du weder Eltern noch Freunde hast." „Eine Fee, namens Cancaline, ist Schuld, dass ich hierher gekommen bin — sie misshandelte mich ohne allen Grund. Eines Tages lief ich davon, und da ich nicht wusste, wohin ich mich wenden sollte, so blieb ich in einem Walde. Da traf mich der Sohn des boshaften Königs und fragte mich, ob ich auf seinem Hofe einen Dienst nehmen wolle — ich sagte ja und wurde Gänsemädchen. Alle Augenblicke kam er, nach den Gänsen zu sehen, lind dabei sah er auch mich. Ach, ganz ohne meine Schuld hat er sich in mich verliebt, und diese Liebe wird mir sehr lästig."
Bei dieser Erzählung ward es der Fee sehr wahrscheinlich, dass das Gänsemädchen niemand anders sein könne, als die Prinzessin Joliette. „Meine Tochter“, sagte sie zu ihr, „wie ist dein Name?" „Ich heiße Joliette, euch zu dienen“, versetzte jene. Als die Fee dies hörte, zweifelte sie nicht länger an der Wahrheit ihrer Vermutung, umarmte sie und liebkoste sie aufs Zärtlichste. Sodann sagte sie zu ihr: „Meine liebe Joliette, ich kenne dich schon seit langer Zeit und freue mich recht sehr, dass du so klug und artig geworden bist — aber ich wünschte wohl, du wärest besser angezogen, denn du siehst aus, wie ein kleiner Schmutzbartel; nimm die schönen Kleider da und zieh sie dir an."
Joliette gehorchte; sie nahm den schmutzigen Lappen ab, welchen sie um den Kopf trug, und sogleich fielen ihre blonden Locken, die wie Gold glänzten, über den Rücken herab bis auf die Erde. Sodann schöpfte sie mit ihren zarten Händen aus einer Quelle, die in der Nähe des Hofes floss, Wasser und wusch sich das Gesicht, welches so glänzend ward, wie eine orientalische Perle. Mund und Wangen blühten wie Rosen, ihr Wuchs war schlank wie eine Binse, ihre Haut so weiß wie Schnee und so weich wie Seide. Als sie die schönen Kleider und die Diamanten angelegt hatte, betrachtete die Fee sie mit größter Bewunderung und sagte zu ihr: „Nun, meine geliebte Joliette, wer glaubst du wohl, dass du bist?"
„Wahrhaftig“, antwortete sie, „ich komme mir vor, wie die Tochter irgend eines großen Königs!" „Würdest du dich darüber freuen?“, fragte die Fee. „O gewiss, meine gute Mutter“, antwortete Joilette, „ich würde sehr zufrieden damit sein." „Nun wohlan“, rief die Fee, „so sei zufrieden — morgen wirst du mehr von mir hören." Sie kehrte eilig nach ihrem schönen Schlosse zurück, wo sie die Königin beschäftigt fand, Seide zu spinnen. „Wollt ihr wetten, Frau Königin“, rief ihr das Mäuschen entgegen, „um eure Spindel und euren Rocken, dass ich euch die schönsten Nachrichten bringe, die ihr je gehört habt?"
„Ach“, versetzte die Königin, „seit dem Tode meines Gemahls und dem Verluste meiner Joliette gebe ich für alle Neuigkeiten nicht eine Stecknadel." „Nur still und betrübt euch nicht länger“, rief die Fee, „die Prinzessin befindet sich vortrefflich, ich habe sie eben erst gesehen; sie ist so schön, so schön, dass es nur auf sie ankommt, eine Königin zu werden." Sie erzählte ihr darauf die ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende und die Königin weinte vor Freude, dass ihre Tochter so schön war und vor Betrübnis, dass sie eine Gänsemagd sei.
„Da wir unser Königreich noch besaßen“, sagte sie, „und alles vollauf hatten, mein armer Gemahl und ich, hätten wir wahrlich nicht geglaubt, dass unser Kind eine Gänsemagd werden könne!" „Daran ist die grausame Cancaline Schuld“, versetzte die Fee — „sie hat es mir zum Verdruss getan, weil sie weiß, wie sehr ich euch liebe; aber verlasst euch darauf, Joliette soll nicht länger in diesem Stande bleiben oder ich will all meine Bücher verbrennen“. „Nur dass sie nicht etwa den Sohn des boshaften Königs heiratet“, fiel die Königin ein — „ lasst uns doch gleich morgen hinreisen und sie hierher holen."
Nun geschah es, dass der Sohn des boshaften Königs, aus Ärger über Joliettens abschlägige Antwort, sich unter einen Baum setzte und dermaßen weinte und weinte, dass es ein wahres Geheul war. Sein Vater hörte es, kam ans Fenster und schrie ihm zu: „Was hast du denn da zu weinen, warum gebärdest du dich denn so einfältig?" „Ja, unsere Gänsemagd will mich nicht lieben“, gab er zur Antwort. „Wie“, rief der boshafte König, „sie will dich nicht lieben — ich befehle es, sie soll dich lieben oder es soll ihr schlecht gehen!"
Hierauf schickte er einige Soldaten ab, das Mädchen herbeizuholen. „Ich will ihr so begegnen, "sagte der König, „dass sie ihre Hartnäckigkeit wohl bereuen wird." Sie gingen in den Hof und fanden Jolietten in einem schönen Kleide von weißem Atlas, ganz mit Gold gestickt und von Edelsteinen blitzend. In ihrem ganzen Leben hatten sie eine so schöne Dame nicht gesehen, sie hielten sie für eine Prinzessin und wagten nicht, sie anzureden. Joliette aber fragte sie sehr freundlich: „Sagt mir doch, wen suchet ihr hier?" „Gnädige Frau“, versetzten sie, „wir suchen ein kleines unglückliches Geschöpf, Namens Joliette." „Ach, das bin ich ja“, versetzte sie, „was wollt ihr denn von mir?"
Sogleich ergriffen sie sie und banden sie an Händen und Füßen mit starken Stricken, damit sie ihnen nicht entfliehe und führten sie vor den boshaften König, welcher sich bei seinem Sohne befand. Da er sah, wie schön sie war, fühlte er sich doch ein wenig bewegt und ganz gewiss würde er Mitleid mit ihr gehabt haben, wenn er nicht eben das boshafteste und grausamste Geschöpf von der Welt gewesen wäre.
„Heda, du kleine Kröte, du kleine Spitzbübin, „du willst also meinen Sohn nicht lieben? Er ist hundertmal schöner, als du — ein einziger Blick von ihm ist mehr wert, als deine ganze Person. Nun rasch und lieb ihn auf der Stelle oder ich will dir die Haut über die Ohren ziehen." Die Prinzessin, die wie ein Espenlaub zitterte, warf sich auf die Knie vor ihm und sagte: „Allergnädigster Herr, ich beschwöre euch, zieht mir nicht die Haut über die Ohren, das wäre gar zu schrecklich; gebt mir nur ein oder zwei Tage Bedenkzeit, dann könnt ihr ja immer noch mit mir machen, was ihr wollt."
Der Sohn des Königs, voller Wut, wollte, dass man sie auf der Stelle umbringe; endlich aber beschlossen sie doch, sie in einen Turm zu sperren, wohin weder Sonne noch Mond schien. Als die gute Fee in ihrem fliegenden Wagen mit der Königin ankam, erfuhren sie alle diese Neuigkeiten. Die Königin vergoss die bittersten Tränen und jammerte, dass sie zum Unglück bestimmt sei. Lieber aber wollte sie, dass ihre Tochter tot wäre, als dass sie den Sohn des boshaften Königs heirate. „Nur Mut“, versetzte die Fee, „ich will sie dermaßen quälen, dass ihr zufrieden und gerächt sein sollt."
Als nun der boshafte König zu Bette war, verwandelte sich die Fee wieder in ein Mäuschen und schlüpfte unter das Kopfkissen. Kaum war er eingeschlafen, so biss sie ihn in das Ohr: er schrie vor Schmerzen laut auf und drehte sich auf die andere Seite — nun biss sie ihn in das andere Ohr; er schrie, als ob man ihn umbringe und rief nach Hilfe. Man kam und fand beide Ohren zerbissen, die so stark bluteten, dass man das Blut nicht stillen konnte. Während man überall nach der Maus suchte, spielte sie auf gleiche Weise dem Sohne des Königs mit. Er ließ seine Leute kommen und zeigte ihnen seine Ohren. Man fand sie ganz geschunden und legte ihm Pflaster darauf.
Inzwischen kehrte das Mäuschen in das Zimmer des boshaften Königs zurück, der ein wenig eingeschlummert war, und biss ihn in die Nase, und da er mit den Händen danach fuhr, biss und zerkratzte sie ihm die Hände. Nun schrie er: „Hilfe! ich bin verloren!“, — sie kroch ihm in den Mund und biss ihn in die Zunge und in die Lippen. Man kam herbei; er war außer sich, aber er konnte kaum noch reden, so übel stand es mit seiner Zunge. Er machte ein Zeichen, dass eine Maus da sei; man suchte in dem Strohsack, unter dem Kopfkissen, in allen Ecken und Winkeln — aber sie war schon wieder bei dem Prinzen und fraß ihm sein einziges noch gutes Auge aus — denn er war einäugig.
Er sprang wie ein Wahnsinniger auf, griff nach dem Degen und lief in seiner Blindheit in das Zimmer seines Vaters. Dieser hatte auch seinen Degen ergriffen und tobte und schwor, dass er alles umbringen wolle, wenn man die Maus nicht erwische. Als er seinen Sohn so wie toll herein kommen sah, fuhr er ihn zornig an, und dieser, welcher in seiner Betäubung die Stimme seines Vaters nicht erkannte, stürzte sich auf ihn. Der boshafte König gab ihm voller Wut einen Stich durch den Leib, und empfing eine gleiche Wunde. Darauf stürzten alle beide tot zu Boden.
Ihre Diener, welche sie tödlich hassten und ihnen nur aus Furcht gehorcht hatten, banden sie jetzt mit Stricken an den Füßen und schleppten sie in den Fluss, indem sie sich glücklich priesen, ihrer los zu sein. So war nun der boshafte König nebst seinem Sohne tot. Die gute Fee, welche Zeugin von dem Allen gewesen war, holte jetzt die Königin herbei und sie gingen zusammen zu dem schwarzen Turm, wo Joliette unter mehr als vierzig Schlössern eingeschlossen war.
Die Fee schlug mit einem kleinen Haselnußstäbchen dreimal an eine große eiserne Tür, welche sogleich aufsprang, und ebenso an die anderen. Sie fanden die arme Prinzessin in stummer Betrübnis da sitzen, die Königin fiel ihr um den Hals und rief: „Mein geliebtes Kind, ich bin deine Mutter, die Königin des Freudenlandes“, und darauf erzählte sie ihr ihre ganze Geschichte.
Guter Gott! als Joliette so gute Neuigkeiten vernahm, fehlte wenig, dass sie vor Freuden gestorben wäre. Sie warf sich der Königin zu Füßen, umarmte ihre Knie, benetzte ihre Hände mit Tränen und küsste sie tausendmal. Sie bedankte sich aufs Zärtlichste bei der Fee, die ihr Körbe voll Schmucksachen mitgebracht hatte, und auch das Bildnis des Königs, welches in kostbare Edelsteine gefasst war. „Halten wir uns nicht länger auf“, sagte die Fee; „es gilt jetzt einen entscheidenden Streich, wir müssen uns in den großen Schloßsaal begeben und eine Anrede an das Volk halten."
Sie ging voran, Ernst und Würde auf ihrem Antlitz; sie trug ein prächtiges Kleid, welches eine Schleppe von mehr als zehn Ellen hatte und die Königin hatte noch eine längere. Die Kronen, welche sie aufgesetzt hatten, funkelten wie das hellste Sonnenlicht. Prinzessin Joliette in ihrer Schönheit und Bescheidenheit, die keines Glanzes weiter bedurfte, ging hinterher. Sie grüßten alle Leute, denen sie unterwegs begegneten, Klein und Groß. Man folgte ihnen, alles drängte sich herbei, um zu erfahren, wer diese schönen Damen wären.
Als nun der Saal ganz voll war, sagte die gute Fee zu den Untertanen des boshaften Königs, sie wolle ihnen die Tochter des Königs vom Freudenlande, welche sie hier erblickten, zur Königin geben; unter ihrer Herrschaft würden sie glücklich leben, und aller Trübsinn würde, so lange sie regiere, aus Aller Herzen verbannt sein.
Bei diesen Worten schrien alle: „Ja, ja, wir wollen sie zur Königin, wir sind lange genug traurig und unglücklich gewesen." Zu gleicher Zeit ertönten von allen Seiten hunderte von Instrumenten und stimmten eine fröhliche Melodie an. Man gab sich die Hände und tanzte im Kreise herum, um die Königin, um Joliette und die Fee und sang dabei: „Ja, ja, wir wollen sie zur Königin."
Die allgemeine Freude war unbeschreiblich. Man schlug Tafeln auf, aß und trank und ging vergnügt schlafen. Am anderen Morgen stellte die Fee der jungen Prinzessin den schönsten Prinzen vor, der je gelebt hat. Sie hatte ihn in ihrem Luftgespann von dem Ende der Welt herbei geholt. Er war ganz so liebenswürdig, wie Joliette. Sie sah ihn kaum, so liebte sie ihn. Er seinerseits war von ihr entzückt und die Königin-Mutter war vor Freude ganz hin.
Man traf alle Anstalten zur Hochzeit und unter allgemeinem Jubel wurde sie aufs Prächtigste gefeiert.
DAS KLEINE ROTKÄPPCHEN ...
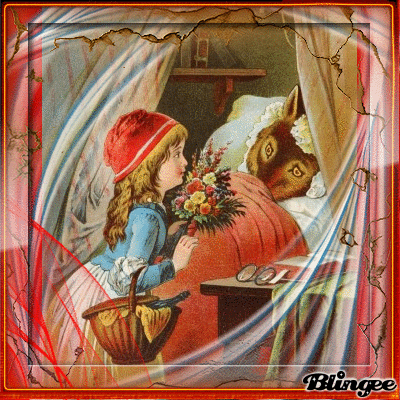
Es war einmal ein kleines Bauernmädchen, so hübsch und niedlich als es je eins gegeben hat. Ihre Mutter war ganz vernarrt in sie und ihre Großmutter noch viel mehr. Diese gute Frau ließ ihr ein kleines rotes Käppchen machen, welches ihr so gut stand, dass man sie allgemein das kleine Rotkäppchen nannte.
Eines Tages hatte die Mutter Brotkuchen gebacken und sprach zu ihr: „Geh und sieh einmal, was die Großmutter macht. Man hat mir gesagt, sie sei krank. Nimm ihr einen Kuchen mit und dies kleine Töpfchen mit Butter."
Das kleine Rotkäppchen machte sich rasch auf den Weg zur Großmutter, die in einem anderen Dorfe wohnte. Als sie unterwegs durch ein Gehölz kam, begegnete sie dem Meister Wolf, welcher nicht übel Lust hatte, sie aufzufressen, aber er traute sich doch nicht, weil einige Holzhauer gerade in der Nähe waren. Er fragte also nur, wo sie hin ginge.
Das arme Kind, welches keine Ahnung hatte, wie gefährlich es sei, einem Wolfe Rede zu stehen, erwiderte ihm: „Ich gehe meine Großmutter besuchen und ihr ein Stückchen Kuchen und ein kleines Töpfchen mit Butter bringen, welches die Mutter ihr schickt." „Wohnt sie weit von hier?“, fragte der Wolf. „O ja!“, sagte das kleine Rotkäppchen, „das ist noch über die Mühle hinaus, die du dort unten, ganz unten stehst, gleich das erste Haus im Dorfe." „Nun gut“, sagte der Wolf, „ich will sie doch auch besuchen. Gehe du jenen Weg und ich will diesen Weg hier gehen. Wir wollen einmal sehen, wer eher da sein wird."
Nun fing der Wolf aus Leibeskräften an zu laufen und zwar den kürzesten Weg; das kleine Mädchen aber ging gerade den längsten und hielt sich außerdem noch auf, indem es bald Haselnüsse suchte, bald den Schmetterlingen nachlief und von den Blümchen, die es hie und da pflückte, Sträußchen band. Der Wolf brauchte nicht lange Zeit, so stand er an dem Hause der Großmutter. Er pochte an: Poch, poch.
„Wer ist da?“, rief die Großmutter. „Euer Töchterlein, das kleine Rotkäppchen“, antwortete der Wolf mit verstellter Stimme. „Ich bringe euch einen Brotkuchen und ein Töpfchen mit Butter, die Mutter schickt es euch." Die gute Großmutter, die im Bette lag, weil sie nicht ganz wohl war, rief hinaus: „Zieh an der Klinke, so wird der Riegel aufgehen."
Der Wolf zog an der Klinke und die Tür ging auf. Er fiel über die gute Frau her und verschlang sie wie im Umsehen, denn er hatte seit länger als drei Tagen nichts gefressen. Darauf machte er die Tür wieder zu, legte sich in das Bett der Großmutter und wartete nun auf das kleine Rotkäppchen, welches nach einer Weile kam und an die Tür pochte: Poch, poch.
„Wer ist da?“, fragte der Wolf. Rotkäppchen, da es die grobe Stimme des Wolfes hörte, fürchtete sich anfangs, dann aber dachte es, die Großmutter möge wohl heiser sein und antwortete: „Euer Töchterchen ist es, das kleine Rotkäppchen. Ich bringe euch einen Brotkuchen und ein Töpfchen mit Butter, die Mutter schickt es euch."
Da rief der Wolf, indem er die Rauheit seiner Stimme so viel als möglich mäßigte: „Zieh nur an der Klinke, so wird der Riegel aufgehen." Das kleine Rotkäppchen zog an der Klinke und die Tür öffnete sich. Als der Wolf sie kommen sah, kroch er unter die Bettdecke und sprach: „Setz nur den Kuchen und das Töpfchen mit Butter da auf den Brotkasten und dann komm und leg dich ein wenig zu mir."
Das kleine Rotkäppchen zog sich aus und wollte sich ins Bett legen, aber wie erschrak es, da es seine Großmutter so in der Nähe sah. „Ach, Großmutter“, sagte es, was habt ihr für lange Arme?" „Die hab ich, um dich besser umarmen zu können, mein Töchterchen." „Ach, Großmutter, was habt ihr für lange Beine?" „Mein Kind, die hab ich, um besser laufen zu können." „Ach, Großmutter, was habt ihr für große Ohren?" „Mein Kind, die hab ich, um besser hören zu können." „Ach Großmutter, was habt ihr für große Augen?" „Mein Kind, die hab ich, um desto besser sehen zu können." „Ach, Großmutter, was habt ihr für große Zähne?" „Die hab ich, um dich aufzufressen!" und mit diesen Worten fiel der abscheuliche Wolf über das kleine Rotkäppchen her und fraß es auf.
DER KLEINE DÄUMLING ...
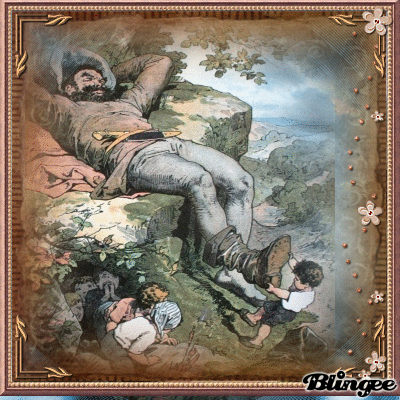
Es war einmal ein Holzhauer, der hatte mit seiner Frau sieben Kinder, lauter Knaben, von denen der älteste nicht älter als zehn Jahre, der jüngste noch nicht sieben war. Die guten Leute waren sehr arm und ihre sieben Kinder fielen ihnen nicht wenig zur Last, weil noch keines davon sich sein Brot selbst verdienen konnte. Auch waren sie sehr bekümmert darüber, dass der jüngste so gar zarter Natur war und so wenig sprach; sie hielten dies für ein Zeichen von Dummheit, obgleich es gerade ein Zeichen von seinem Verstande war.
Der Knabe war sehr klein und da er auf die Welt kam, nicht größer etwa, als ein Daumen, darum nannte man ihn auch den kleinen Däumling. Das arme Kind war der Kreuzträger des ganzen Hauses und wenn es etwas gab, ward immer die Schuld auf ihn geschoben. Gleichwohl war er der schlauste und aufgeweckteste von allen seinen Brüdern und wenn er wenig sprach, so hörte er umso aufmerksamer zu.
Da kam ein Missjahr und es entstand eine solche Hungersnot, dass die armen Leute den Entschluss fassten, sich ihrer Kinder zu entledigen. Eines Abends, als die Kinder schon zu Bette waren und der Holzhauer mit seiner Frau am Feuer saß, sagte er mit kummervollem Herzen zu ihr: „Du siehst wohl, dass wir unsere Kinder nicht länger ernähren können und ehe wir sie vor unsern Augen Hunger sterben sehen, will ich sie lieber morgen in den Wald führen und dort zurücklassen. Während sie damit beschäftigt sind, das Reisig zusammen zu binden, können wir uns davon machen, ohne dass sie es merken."
„Ach“, versetzte die Frau, „könntest du wohl selbst deine Kinder ins Verderben führen?" Ihr Mann mochte immerzu ihr ihre große Armut vorhalten, sie konnte nicht da einwilligen; so arm sie war, so hatte sie doch das Herz einer Mutter. Endlich jedoch, da sie überlegte, welchen Schmerz es ihr machen würde, die Kinder vor Hunger sterben zu sehen, gab sie nach und ging weinend zu Bette.
Der kleine Däumling hatte alles mit angehört, was sie sprachen, denn da er drin in seinem Bette merkte, dass es sich um etwas Wichtiges handle, war er ganz sacht aufgestanden und unter den Schemel seines Vaters geschlüpft, wo er hörte, ohne gesehen zu werden. Er kroch wieder in sein Bett, schlief aber die ganze Nacht nicht, sondern dachte daran, was zu tun sei. Frühzeitig stand er auf und ging an den Bach, wo er sich die Taschen mit kleinen weißen Kieselsteinen füllte, und darauf kehrte er nach Hause zurück.
Man machte sich auf den Weg, der kleine Däumling aber sagte seinen Brüdern kein Wort von dem, was er wusste, Sie kamen in einen dicken Wald, wo keiner den anderen zehn Schritte weit sehen konnte. Der Holzhauer fällte Holz und die Kinder lasen Reisig auf, um Bündel davon zu machen. Als die Eltern sie so beschäftigt sahen, entfernten sie sich unbemerkt und liefen dann auf einem krummen Fußsteige rasch davon.
Als die Kinder merkten, dass sie allein waren, fingen sie aus Leibeskräften zu schreien und zu weinen an. Der kleine Däumling ließ sie schreien, er wusste wohl, wie er sich wieder nach Hause finden sollte, denn auf dem Herwege hatte er den ganzen Weg entlang die kleinen weißen Kiesel verstreut, die er in den Taschen trug.
Er sagte also zu seinen Brüdern: „Fürchtet euch nicht, Vater und Mutter haben uns hier zurückgelassen, aber ich will euch schon wieder nach Hause bringen, folgt mir nur." Sie folgten ihm und er führte sie bis an ihr Haus, auf dem selben Wege, auf welchem sie in den Wald gekommen waren. Sie wagten nicht, sogleich hinein zu gehen, sondern stellten sich dicht an die Tür, um zu hören, was Vater und Mutter zusammen sprächen.
Eben als der Holzhauer mit seiner Frau zu Hause angekommen war, schickte ihnen der Herr des Dorfes zehn Taler, die er ihnen seit langer Zeit schuldig war und auf die sie kaum noch gerechnet hatten. Dies gab ihnen neues Leben, denn die armen Leute starben beinahe vor Hunger. Sogleich schickte der Holzhauer seine Frau in die Fleischbank und da sie lange Zeit kein Fleisch gegessen hatten, so kaufte sie dreimal mehr, als zu einer Mahlzeit für zwei Leute nötig war.
Als sie sich nun satt gegessen hatten, sagte die Frau: „Ach, wo werden jetzt unsere armen Kinder sein, sie würden noch von dem, was übrig geblieben ist, eine gute Mahlzeit haben! Aber du, du hast darauf bestanden, sie ins Verderben zu führen — ich habe dir wohl gesagt, dass es uns gereuen würde. Was werden sie jetzt in dem Walde machen! Ach, mein Gott, die Wölfe haben sie vielleicht schon gefressen! — o du Rabenvater, deine eigenen Kinder so umzubringen!"
Der Holzhauer wurde endlich ungeduldig, denn sie wiederholte mehr als zwanzigmal, dass sie es bereuen würden und dass sie es wohl gesagt hätte. Zuletzt drohte er ihr mit Schlägen, wenn sie nicht still schweige. Nicht etwa, dass der Holzhauer weniger bekümmert gewesen wäre, als seine Frau, aber er war nur ärgerlich, dass sie ihm den Kopf so voll redete; und es ging ihm, wie vielen anderen Männern, die es zwar gern sehen, wenn ihre Frauen Recht haben, die aber nur nicht leiden können, dass sie es immerzu sagen.
Die Frau hörte nicht auf zu weinen — „ach“, schrie sie, „wo sind jetzt meine Kinder, meine armen Kinder!“, und einmal sagte sie das so laut, dass die armen Kinder, welche an der Tür standen, es hörten. Darauf fingen sie alle miteinander an zu rufen: „Da sind wir, da sind wir!" Sie lief rasch hin, machte ihnen die Tür auf, herzte und küsste sie und sagte: „Ach, wie froh bin ich, euch wieder zu sehen, meine lieben Kinder! Ihr seid wohl recht müde, ihr habt wohl rechten Hunger? ach, wie hast du dich schmutzig gemacht, Peter, komm her, dass ich dich reinige."
Dieser Peter war der Älteste und sie liebte ihn von allen am meisten, weil er reichliches Haar hatte, wie sie selbst. Sie setzten sich hierauf zu Tisch und aßen, mit gutem Appetit, was ihren Eltern viele Freude machte; darauf erzählten sie, welche Furcht sie in dem Walde ausgestanden hätten und sprachen fast immer alle auf einmal.
Die guten Leute waren voller Freude, ihre Kinder wieder zu haben und diese Freude dauerte so lange, als die zehn Taler dauerten. Aber als das Geld alle war, ging die alte Sorge wieder an; sie entschlossen sich, ihre Kinder noch einmal fort zu führen und um ihrer Sache gewiss zu sein, sie noch viel weiter zu führen als das erste Mal.
Das alles aber konnten sie nicht so heimlich abmachen, dass es der kleine Däumling nicht gehört hätte. Er gedachte, sich wie das erste Mal aus der Verlegenheit zu helfen; als er aber ganz in der Frühe aufstand, um kleine Kieselsteine zu holen, fand er die Haustür mit einem doppelten Riegel verschlossen. Er wusste nicht, was er tun sollte — als aber die Mutter einem Jeden von ihnen ein Stück Brot zum Frühstück gab, fiel ihm ein, er könne ja wohl sein Brot statt der Kiesel brauchen, indem er es längs des Weges, den sie gingen, verstreute. Er aß es also nicht, sondern steckte es in die Tasche.
Die Elftem führten sie immer tiefer in den Wald hinein, wo er am dicksten und dunkelsten war, und dort machten sie sich auf und davon und ließen die Kinder zurück. Der kleine Däumling machte sich wenig Sorge deshalb, denn er meinte den Rückweg leicht zu finden, weil er überall, wo er gegangen war, Brotkrumen ausgestreut hatte. Wie bestürzt wurde er aber, da er kein einziges Krümchen mehr fand; die Vögel waren gekommen und hatten alles aufgefressen. Da war nun die Not groß, denn sie verirrten sich und gerieten immer tiefer in den Wald hinein.
Die Nacht brach an und es erhob sich ein Sturm, der ihnen entsetzliche Angst machte. Von allen Seiten glaubten sie das Geheul der Wölfe zu hören, die herbei kämen, um sie aufzufressen; kaum getrauten sie sich, ein Wort zu reden oder sich um zu sehen. Nun fiel ein Regen, der sie bis auf die Haut durchnässte — bei jedem Schritt glitten sie aus und fielen auf die Erde, wo sie sich ganz beschmutzten.
Der kleine Däumling kletterte auf den Gipfel eines Baumes, um zu sehen, ob er nicht irgendwo ein Haus entdeckte. Als er den Kopf nach allen Seiten gedreht hatte, bemerkte er endlich einen schwachen Lichtschimmer, wie von einer Lampe — aber er war noch sehr weit über den Wald hinaus. Er stieg wieder vom Baum herab und als er auf der Erde war, sah er Nichts mehr: das war ein schlechter Trost.
Indes marschierte er mit seinen Brüdern immer nach der Gegend zu, wo er das Licht gesehen hatte, und als sie aus dem Walde heraus kamen, sahen sie das Licht wieder. Endlich kamen sie an das Haus, wo die Lampe darin war, aber mit welcher Angst und Roth! Denn so oft sie in die Tiefe kamen, verloren sie den Lichtschein aus dem Gesicht.
Sie klopften an die Tür; eine alte Frau kam, machte ihnen auf und fragte, was sie wollten. Sie wären arme Kinder, antwortete der kleine Däumling, die sich im Walde verirrt hätten, und die recht sehr um ein Plätzchen zum Nachtlager bäten.
Als die Frau die hübschen Kinderchen sah, fing sie an zu weinen und sagte: „Ach, ihr armen Kinder, wo seid ihr hin geraten! Wisst ihr wohl, dass dies hier das Haus eines Menschenfressers ist, der die kleinen Kinder auffrisst?"
Als der kleine Däumling und seine Brüder dies hörten, zitterten sie an allen Gliedern. „Ach, meine liebe gute Frau“, sagte der kleine Däumling, „was sollen wir tun? Nehmt ihr uns diese Nacht nicht auf, so fressen uns im Walde draußen die Wölfe; und da wollen wir doch lieber von dem Herrn gefressen sein; vielleicht hat er Mitleid mit uns, wenn ihr ihn recht schön darum bitten wollt."
Die Frau des Menschenfressers, die sie vor ihrem Mann bis an den anderen Morgen zu verbergen hoffte, hieß sie herein treten und sich am Feuer wärmen, welches lichterloh brannte, denn ein ganzer Hammel steckte am Bratspieß zum Abendessen für den Menschenfresser.
Die Kinder fingen kaum an, sich ein wenig zu erwärmen, so hörten sie drei oder viermal mit starken Schlägen an die Tür pochen: es war der Menschenfresser, welcher nach Hause kam. Die Frau steckte sie geschwind unter das Bett und dann ging sie und machte die Tür auf. Die erste Frage des Menschenfressers war, ob das Abendessen schon fertig sei, und ob sie den Wein abgezogen habe, und dann setzte er sich gleich zu Tisch.
Der Hammel war noch ganz blutig, aber umso besser schmeckte er ihm. Darauf schnupperte er rechts und links; „Frau“, sagte er, „ich rieche frisches Menschenfleisch." „Ach“, versetzte die Frau, „das muss das Kalb sein, welches ich eben ausgeweidet habe, und das riechst du." „Ich rieche frisches Menschenfleisch, sage ich dir noch einmal“, wiederholte der Menschenfresser und sah seine Frau grimmig an; es steckt hier irgendwas dahinter." Bei diesen Worten stand er vom Tisch auf und ging gerade auf das Bett zu ...
„Aha“, rief er, „sieh' da! also du willst mich hintergehen, nichtswürdiges Weib? Ich weiß nicht, was mich abhält, dass ich dich nicht gleichfalls auffresse! Sei froh, dass du so alt und zäh bist. — Das ist ein Wildbret, welches mir gerade recht kommt, um drei meiner Freunde zu traktieren, die mich in diesen Tagen besuchen werden."
Er zog eins nach dem anderen unter dem Bett hervor. Die armen Kinder vielen auf die Knie vor ihm und baten ihn um Gnade; aber sie hatten es mit dem grausamsten aller Menschenfresser zu tun, der weit entfernt, sich ihrer zu erbarmen, sie schon mit den Augen verschlang und zu seiner Frau sagte, das würden leckere Bissen abgeben, wenn sie eine gute Brühe dazu mache.
Er ging gleich und holte ein großes Schlachtmesser, und indem er dicht an die armen Kleinen herantrat, wetzte er es auf einem Schleifstein, den er in der linken Hand hielt. Er hatte schon eins von den Kindern gepackt, als seine Frau zu ihm sagte: „Was willst du es denn noch so spät tun, hast du nicht morgen Zeit genug dazu?" „Schweig'", versetzte der Menschenfresser, „sie werden dann umso mürber sein." „Aber du hast noch so viel Fleisch“, sagte die Frau wieder, „da ist ein Kalb, zwei Schöpse und ein halbes Schwein." „Du hast Recht“, sprach der Menschenfresser, „nun, so gib ihnen tüchtig zu essen, dass sie nicht mager werden, und bringe sie zu Bette."
Die gute Frau war sehr vergnügt darüber und setzte ihnen eine gute Mahlzeit vor, aber sie konnten nicht essen, so sehr ängstigten sie sich. Der Menschenfresser dagegen trank eine Flasche nach der anderen aus, ganz entzückt, eine so gute Mahlzeit für seine Freunde erwischt zu haben. Er trank ein Dutzend Gläser mehr als gewöhnlich; der Wein stieg ihm zu Kopf und er musste sich zu Bett legen.
Der Menschenfresser hatte sieben Töchter, die alle noch klein waren. Diese kleinen Menschenfresserinnen sahen frisch und gesund aus, denn sie aßen auch rohes Fleisch, wie ihr Vater; aber sie hatten kleine runde, graue Augen, gebogene Nasen und sehr breite Mäuler, mit langen, ganz spitzigen, und auseinander stehenden Zähnen. Die Kleinen waren noch nicht ganz so schlimm wie ihr Vater; aber sie versprachen bereits viel, denn sie bissen schon die kleinen Kinder, um ihnen das Blut auszusaugen.
Sie waren zeitig schlafen gegangen und alle sieben lagen in einem großen Bett, und jedes hatte eine goldene Krone auf dem Kopf. In der nämlichen Kammer stand noch ein zweites Bett von derselben Größe, in dieses legte die Frau des Menschenfressers die sieben kleinen Knaben, und darauf und dann begab sie sich selbst zu Bette.
Der kleine Däumling, der bemerkt hatte, dass die Töchter des Menschenfressers goldene Kronen auf hatten und fürchtete, es könne den Menschenfresser gereuen, ihn und seine Brüder nicht an dem nämlichen Abend noch geschlachtet zu haben, stand um Mitternacht auf, nahm ihre Mützen und setzte sie ganz behutsam den sieben Töchtern des Menschenfressers auf den Kopf; die goldenen Krönchen aber setzte er sich und seinen Brüdern auf, damit der Menschenfresser sie für feine Töchter hielt und seine Töchter für die Knaben, die er schlachten wollte.
Es kam, wie er gedacht hatte, denn der Menschenfresser, als er in der Nacht aufwachte, bereute, auf den folgenden Morgen verschoben zu haben, was er schon den Abend vorher hätte ausführen können. Er sprang also hastig aus dem Bett und griff nach dem großen Schlachtmesser. „Lass sehen“, sprach er, „was diese kleinen Spitzbuben da machen. Diesmal soll es ihnen nicht geschenkt sein."
Er tappte also im Finsteren nach der Kammer seiner Töchter und näherte sich dem Bette, in welchem die sieben kleinen Knaben lagen, die alle fest schliefen, nur der kleine Däumling nicht, der Todesangst aus stand, als er die Hand des Menschenfressers fühlte, der ihm und seinen Brüdern auf dem Kopf herumtappte. Da der Menschenfresser jedoch die goldenen Kronen fühlte, sagte er: „Wahrhaftig, da hätte ich bald was Schönes gemacht! Ich merke wohl, dass ich gestern Abend zu viel getrunken habe“.
Er ging darauf an das Bett seiner Töchter und nachdem er die kleinen Mützchen der Knaben auf ihren Köpfen gefühlt hatte, sprach er: „Aha! da sind sie, unsere kleinen Bürschchen; frisch an die Arbeit!" Damit schnitt er ohne Weiteres seinen sieben Töchtern die Kehlen ab, und ganz zufrieden mit dem, was er getan hatte, legte er sich wieder schlafen.
Als der kleine Däumling den Menschenfresser schnarchen hörte, weckte er sogleich seine Brüder und hieß sie sich rasch ankleiden und ihm folgen. Sie schlichen leise in den Garten hinab und sprangen über die Mauer. Fast die ganze Nacht durch liefen sie unter Zittern und Zagen, ohne zu wissen, wohin.
Als der Menschenfresser am Morgen aufwachte, sagte er zu seiner Frau: „Gehe hinauf und mache die kleinen Spitzbuben von gestern Abend zurecht." Die Frau war ganz erstaunt über die Güte ihres Mannes, denn da sie hörte, sie solle die Kinder zu Recht machen, glaubte sie nicht anders, als sie solle sie ankleiden. Sie ging also auf die Kammer hinauf — welcher Schreck aber, da sie ihre sieben Töchter geschlachtet und im Blut schwimmend fand! Bei diesem Anblick fiel sie in Ohnmacht.
Der Menschenfresser, welcher besorgte, seine Frau werde sich zu lange bei der Arbeit aufhalten, ging ihr nach, um zu helfen. Er war fast nicht weniger erschrocken, als seine Frau, da er dies schreckliche Schauspiel sah. „Ach, was habe ich getan!“, schrie er, „sie sollen es mir bezahlen, die Nichtswürdigen, und das auf der Stelle!" Sogleich goss er seiner Frau einen Eimer Wasser über den Kopf, und als sie dadurch wieder zu sich selbst gekommen war, sagte er: „Gib mir rasch meine Siebenmeilenstiefeln, damit ich die Spitzbuben wieder einhole."
Er machte sich auf den Weg, und nachdem er nach allen Seiten umher gelaufen war, kam er endlich auf die Straße, welche die armen Kinder gingen, die nur noch hundert Schritte von dem Hause ihres Vaters entfernt waren. Sie sahen den Menschenfresser, der über Täler und Hügel mit einem Schritt wegsetzte und einen breiten Strom so leicht überschritt, als ob es ein Bächlein wäre.
Glücklicherweise entdeckte der kleine Däumling ganz in der Nähe einen hohen Felsen, kroch da mit seinen sechs Brüdern hinein und gab genau Acht, was der Menschenfresser anfangen würde. Der Menschenfresser, welcher von dem langen Wege, den er unnütz gemacht hatte, sehr ermüdet war (denn die Siebenmeilenstiefeln greifen ihren Mann gewaltig an) wollte sich ein wenig ausruhen und von ungefähr setzte er sich gerade auf denselben Felsen, unter welchem sich die kleinen Knaben verborgen hatten.
Nachdem er eine Weile da gesessen, schlief er vor großer Müdigkeit ein und fing so entsetzlich an zu schnarchen, dass die armen Kinder fast nicht weniger Angst aus standen, als da er ihnen sein großes Schlachtmesser an die Gurgel setzte. Der kleine Däumling fürchtete sich am wenigsten; er sagte zu seinen Brüdern sie sollten nur, während der Menschenfresser in so tiefem Schlaf läge, rasch nach Hause laufen und seinetwegen ganz ohne Sorge sein.
Darauf schlich der kleine Däumling ganz sacht an den Menschenfresser heran und zog ihm behutsam seine Stiefeln aus und sich selber an. Die Stiefeln waren sehr hoch und sehr weit, da sie aber verzaubert waren, so hatten sie die Eigenschaft, sich dem Fuß eines Jeden anzupassen, der sie anzog, so dass sie ebenso wohl an den Füßen des kleinen Däumlings saßen, als ob sie für ihn gemacht wären.
Er ging geradeswegs nach dem Hause des Menschenfressers, wo er die Frau bei den Leichen ihrer Kinder in Tränen fand, und sagte zu ihr: „Euer Mann befindet sich in großer Gefahr, er ist einem Trupp Räuber in die Hände gefallen, die geschworen haben ihn umzubringen, wenn er ihnen nicht all sein Gold und Silber gebe. Eben da sie ihm das Messer an die Kehle setzten, wurde er mich gewahr und bat mich, euch von dem Zustande, in welchem er sich befindet, zu benachrichtigen, und mir alles und jedes von Wert von euch geben zu lassen, was er irgend besitzt, denn sonst werden sie ihn ohne Barmherzigkeit ums Leben bringen. Da nun die Sache solche Eile hat, so gab er mir seine Siebenmeilenstiefel, damit ich rasch wieder zurück sei, und zugleich, damit ihr seht, dass ich euch nichts vorlüge."
Die gute Frau, in vollem Schreck, gab ihm sogleich alles, was sie hatte. Denn obgleich der Menschenfresser die kleinen Kinder fraß, hatte sie dennoch ihren Mann lieb, und so kehrte also der kleine Däumling, mit allen Reichtümern des Menschenfressers beladen, nach Hause zurück, wo er von seinen Eltern mit großer Freude empfangen wurde.
Über diesen letzten Umstand ist man jedoch nicht ganz einig und Manche behaupten, der kleine Däumling habe dem Menschenfresser nicht seine Schätze gestohlen, sondern ihm nur ohne Bedenken seine Siebenmeilenstiefeln abgenommen, weil der Bösewicht sie nur benutzte, um auf die kleinen Kinder Jagd zu machen. Jene Leute versichern, dies sehr genau zu wissen, da sie selbst in dem Hause des Holzhauers gegessen und getrunken hätten.
Sie erzählen auch, dass, als der kleine Däumling die Stiefel des Menschenfressers angezogen, er damit an den Hof des Königs gegangen sei, weil er wusste, dass man sich da selbst über den Zustand einer Armee, die an zweihundert Meilen weit entfernt war, und über den Ausgang einer Schlacht, die man geliefert hatte, in großer Sorge befand.
Er ging also, erzählen sie, zum König und sagte, er wolle ihm noch vor Ende des Tages Nachricht von der Armee bringen. Der König versprach ihm zur Belohnung eine große Summe Geldes, und der kleine Däumling überbrachte die gewünschte Nachricht noch an dem nämlichen Abend.
Durch diesen ersten Botengang machte er sich bekannt und verdiente jetzt so viel Geld, als er nur irgend wollte, denn der König bezahlte ihn sehr reichlich dafür, dass er seine Befehle der Armee hinterbrachte, und auch für andere übernahm er noch unzählige Aufträge, die ihm nicht wenig einbrachten.
Nachdem er eine Zeit langt als Courier hin- und hergelaufen war und sich ein unermessliches Vermögen gesammelt hatte, kehrte er nach Hause zu seinen Eltern zurück, die eine unbeschreibliche Freude hatten, ihn wieder zu sehen. Er sorgte für seine ganze Familie, welche durch ihn zu Wohlstand und Ehren gelangte, und machte selbst eine ansehnliche und ehrenvolle Laufbahn.
DER ORANGENBAUM UND DIE BIENE ...
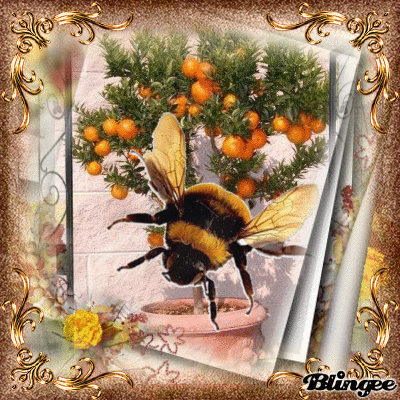
Es war einmal ein König und eine Königin, denen fehlte zu ihrem Glück nichts weiter, als dass sie keine Kinder hatten. Endlich gebar die Königin, die schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, ein wunderschönes Töchterchen. Da gab es nun keine geringe Freude im königlichen Hause. Jeder suchte nach einem Namen für die kleine Prinzessin, welcher Alles ausdrücke, was man für sie empfinde. Endlich nannte man sie Vielgeliebt, und die Königin ließ diesen Namen auf ein Herz von Türkis eingraben: Vielgeliebt, Tochter des Königs der glücklichen Insel.
Dieses Herzchen von Türkis hing sie der Prinzessin um den Hals, in der Meinung, es werde ihr Glück bringen; allein dergleichen Hoffnungen sind trüglich, denn eines Tages im Sommer, als die Amme bei ganz heiterem Wetter auf dem Meer spazieren fuhr, erhob sich mit einmal ein so furchtbarer Sturm, dass es unmöglich war, ans Land zu gelangen, und die kleine Barke, welche nur dazu bestimmt war, längs des Ufers auf- und abzufahren, wurde bald in Stücke zerschmettert.
Die Amme und das ganze Schiffsvolk kamen um. Die kleine Prinzessin, welche ruhig in ihrer Wiege schlief, schwamm auf dem Wasser hin und her, bis die Wellen sie endlich an das Ufer, eines reizenden Landes führten, welches aber fast unbewohnt war, seitdem der Menschenfresser Ravagio und seine Iran Turmentine hier hausten; denn diese fraßen alles auf. Wenn dies abscheuliche Volk erst einmal Menschenfleisch gekostet hat, so finden sie alle andern Gerichte unschmackhaft, und Turmentine fand immer Mittel, sich welches zu verschaffen, denn sie war eine halbe Fee.
Auf eine Stunde weit roch sie die arme kleine Prinzessin und lief gleich ans Ufer, um sie aufzusuchen, bevor sie Ravagio fände, denn sie waren Beide Eins so gefräßig als das andere und Eins eben so hässlich als das andere. Sie hatten jedes nur ein Auge, welches mitten auf der Stirn stand, ein Maul, welches so groß wie ein Backofen war, eine breite, eingedrückte Nase, lange Eselsohren, borstige Haare und einen Buckel vorn und hinten.
Gleichwohl wurde Turmentine bei dem Anblick der kleinen Prinzessin von einem Mitleid bewegt, welches sie sonst nie empfunden hatte. Als sie das Kind betrachtete, wie es in seiner Wiege lag, mit den Windeln spielte, die Bäckchen wie weiße Rosen, rot angehaucht, das Mündchen zum Lächeln halb geöffnet, so beschloss Turmentine, es nicht aufzufressen, wenigstens nicht sogleich, sondern es borstige aufzuziehen. Sie nahm es auf ihre Arme, band sich die Wiege auf den Rücken und in diesem Aufzuge kehrte sie nach ihrer Höhle zurück.
„Da, Ravagio“, sagte sie zu ihrem Mann, „da ist Menschenfleisch, fett und zart, aber bei meiner Seele, du sollst es mir mit keinem Zahn anrühren. Es ist ein wunderhübsches kleines Mädchen, ich will es aufziehen und wir wollen es mit unserm Söhnchen verheiraten, damit wir in unserm Alter hübsche Enkelchen kriegen, die uns Freude machen."
„Das ist nicht übel gedacht“, antwortete Ravagio; „du bist wahrhaft so dumm nicht. Laß mich doch einmal das Kind ansehen, es scheint ja wunderhübsch zu sein."
„Aber iss es ja nicht auf“, versetzte Turmentine und legte ihm die Kleine in seine langen Klauen. „Nein, nein“, sprach er, „lieber stürb' ich vor Hunger." Und nun überhäuften Ravagio, Turmentine und der kleine Menschenfresser Vielgeliebt mit solchen Liebkosungen und gingen so behutsam mit ihr um, dass es ein wahres Wunder war.
So wuchs nun das arme Kind, von einer Hindin genährt, welche Turmentine ihr zur Amme gegeben hatte, unter den hässlichen Menschenfressern auf, während man sie am Hofe ihres Vaters Tag und Nacht beweinte und in der Tiefe des Meeres begraben glaubte. Der König dachte darauf sich einen Erben zu wählen und fragte die Königin, was sie dazu meine. Sie antwortete, er möge tun, was er für gut halte, ihre teure Vielgeliebt sei gewiss tot; es sei nun bereits fünfzehn Jahre, dass sie sie verloren hätten, und also durchaus keine Hoffnung mehr, sie je wieder zu finden.
Der König beschloss demnach, seinen Bruder bitten zu lassen, denjenigen seiner Söhne, der ihm der Herrschaft am würdigsten schiene, auszuwählen und schleunigst zu ihm zu schicken. Als die Abgesandten alle nötigen Befehle empfangen hatten, schifften sie sich ein. Der Wind war günstig und der großen Entfernung ungeachtet langten sie in kurzer Zeit bei dem Bruder des Königs an, der ein großes Königreich besaß. Er nahm sie sehr freundlich auf und als sie ihn baten, einen seiner Söhne mit ihnen zu senden, damit er dem Könige ihren Herrn dereinst in der Herrschaft nachfolge, weinte er vor Freuden, und antwortete ihnen, da sein Bruder ihm die Wahl überlassen habe, so werde er ihm denjenigen von seinen Söhnen schicken, den er selbst für sich gewählt haben würde. Dies sei der zweite Sohn, dessen Neigungen so sehr mit seiner hohen Geburt übereinstimmten, dass er Alles, was man von einem Prinzen nur wünschen könne, in größter Vollkommenheit besitze.
Man holte den Prinzen Vielgeliebt (dies war sein Name) und wie viel die Gesandten auch schon vorher von ihm gehört hatten, wurden sie doch durch seinen Anblick ganz überrascht. Er war achtzehn Jahr alt, von bewundernswürdiger Schönheit, die durch ein edles männliches Aussehen, welches zugleich Ehrfurcht und Liebe einflößte, noch erhöht wurde. Man teilte ihm den Wunsch seines Oheims mit, ihn bei sich zu haben, und den Entschluss des Königs, seines Vaters, ihn sogleich mitreisen zu lassen. Nun wurde Alles zur Reise in Stand gesetzt, der Prinz nahm Abschied, schiffte sich ein, und befand sich bald auf dem hohen Meer.
Möge das Glück ihm günstig sein! Wir verlassen ihn einstweilen und kehren zu Ravagio zurück um zu sehn, was unsre junge Prinzessin macht. Sie ward mit jedem Tage schöner und alle Reize schienen in ihr vereinigt. Die Grausamkeit, welche sie an den Ungeheuern sah, die sie umgaben, machte sie um so sanfter; und seit sie den schauderhaften Appetit derselben nach Menschenfleisch kannte, tat sie alles Mögliche die Unglücklichen, die den Menschenfressern in die Hände fielen, zu retten, so dass sie sich öfters dadurch der ganzen Wut Ravagios und Turmentinens aussetzte. Ja sie würden sie zuletzt noch aufgefressen haben, wenn sie der kleine Menschenfresser nicht wie seinen Augapfel geliebt hätte. Was vermag die Liebe nicht! die Blicke der schönen Prinzessin konnten das kleine Ungeheuer ganz zahm machen.
Aber ach! wie ward ihr zu Mut, wenn sie daran dachte, dass sie dieses abscheuliche Geschöpf heiraten sollte! Obgleich sie von ihrem Stande nichts wusste, schloss sie doch aus dem Reichtum ihrer Windeln, der goldnen Kette und dem Türkis, die an ihrem Halse hingen, dass sie von hoher Geburt sei und in ihren Empfindungen und ihrer Denkungsart fand sie die Bestätigung. Sie konnte weder lesen noch schreiben, sie verstand keine Sprache als das Kauderwelsch der Menschenfresser, sie lebte in allem, was die Welt betraf, in vollkommener Unwissenheit, aber sie hatte so richtige Grundsätze von Tugend und Ehre, als ob sie die sorgfältigste Erziehung genossen hätte.
Sie hatte sich ein Kleid aus Tigerhaut gemacht, ihre Arme waren halb nackend, ein Köcher mit Pfeilen hing über ihrer Schulter und ein Bogen an ihrer Seite. Ihre blonden Haare waren nur mit einer Schnur von Meerbinsen befestigt, und fielen ganz frei über Brust und Rücken herab; die Halbstiefeln, welche sie trug, waren gleichfalls aus Binsen geflochten. In diesem Aufzuge durchstrich sie die Wälder, ohne zu wissen wie schön sie war. In dem Spiegel der Quellen sah sie das Bild ihrer Schönheit, aber ohne dadurch selbstgefällig und eitel zu werden. Sie aß nichts, als was sie auf der Jagd oder beim Fischfang erbeutete, und unter diesem Vorwand entfernte sie sich oft aus der schrecklichen Höhle, um sich dem Anblick der widerwärtigsten Ungeheuer, die es nur auf der Welt geben konnte, zu entziehen.
„O Himmel“, rief sie unter Tränen aus, „was hab' ich denn verbrochen, dass du mich diesem grausamen Menschenfresser zum Weibe bestimmt hast? Warum ließest du mich nicht in den Fluten des Meeres untergehen? Warum hast du mir ein Leben erhalten, welches ich auf eine so jammervolle Art zubringen muss? Hast du kein Erbarmen mit meinem Zustande?" So klagte sie, den Himmel um Beistand anflehend.
Wenn das Wetter stürmisch war, so eilte sie ans Ufer, um den Unglücklichen, die das Meer etwa ans Land geworfen hätte, nach Kräften beizustehen, und zu verhüten, dass sie nicht in die Höhle der Menschenfresser kämen. Einstmals hatte es die ganze Nacht furchtbar gestürmt, sie eilte also, da kaum der Tag anbrach, ans Meer, und erblickte einen Menschen, der ein Brett zwischen den Armen hielt und sich bemühte das Ufer zu gewinnen, obgleich ihn der heftige Wellenschlag immer wieder zurücktrieb.
Die Prinzessin wäre ihm gern zu Hülfe gekommen, sie suchte ihn durch Zeichen auf die zugänglichsten Stellen hinzuweisen, aber er sah und hörte nicht. Bisweilen kam er so nahe, dass es schien, als brauche er nur noch einen Schritt zu tun; aber plötzlich bedeckte ihn eine Welle und schleuderte ihn wieder zurück. Endlich wurde er auf den Sand geworfen und lag eine Zeitlang bewegungslos und ohne Besinnung. Vielgeliebt näherte sich ihm und obgleich seine Blässe sie fürchten ließ, dass er tot sei, so leistete sie ihm alle nur mögliche Hülfe; sie pflückte eine Art Kräuter, deren Geruch so stark war, dass er aus jeder Ohnmacht erweckte, zerdrückte sie zwischen den Händen und rieb ihm die Lippen und Schläfe damit. Er schlug die Augen auf und war von dem Aufzuge der Prinzessin und ihrer Schönheit so überrascht, dass er nicht einig werden konnte, ob er träume oder wache.
Er sprach sie zuerst an, sie antwortete ihm, aber Keins verstand das Andre und sie betrachteten sich aufmerksam mit Blicken voll Erstaunen und Freude. Die Prinzessin hatte in ihrem Leben noch keine Männer gesehen, außer einigen armen Fischern, die den Menschenfressern in die Hände geraten waren, und die sie, wie schon erzählt, gerettet hatte. Was musste sie also denken, als sie einen sehr reich gekleideten Jüngling erblickte, so schön, wie es keinen schöneren auf der Welt gab? Denn mit einem Wort, es war der Prinz Vielgeliebt, ihr Vetter, dessen Flotte, von einem furchtbaren Sturm ergriffen, an den Klippen gescheitert war, wobei ein Teil der Mannschaft in den Wogen seinen Tod fand, ein andrer Teil an unbekannte Küsten verschlagen wurde.
Der junge Prinz war seinerseits nicht wenig verwundert unter einer solchen Tracht und in einem anscheinend wüsten Lande eine so wunderbare Schönheit zu finden, die Alles übertraf, was er am Hofe seines Vaters gesehen hatte. In dieser gegenseitige Überraschung fuhren sie fort zu sprechen, ohne einander zu verstehen. Aber ihre Augen und Gebärden halfen ihnen sich den Sinn ihrer Worte verständlich zu machen. Plötzlich fiel der Prinzessin die Gefahr ein, welcher der Fremdling ausgesetzt sei, und dies versetzte sie in eine tiefe Schwermut und Niedergeschlagenheit, die sich sogleich in ihren Mienen ausdrückten. Der Prinz in Furcht, sie könne von einem Unwohlsein befallen sein, näherte sich ihr und wollte ihre Hände ergreifen, aber sie stieß ihn zurück und machte ihm, so gut sie konnte, begreiflich, er solle sich von hier fortbegeben. Sie fing an zu laufen, kehrte wieder zurück und gab ihm zu verstehen, er solle es eben so machen. Er floh und kehrte wieder um. Als er wieder zurückkam, wurde sie böse, nahm einen Pfeil und richtete ihn auf sein Herz, um ihm anzudeuten, dass man ihn töten würde. Er glaubte, sie wolle ihn töten, kniete nieder und erwartete seinen Tod.
Nun wusste sie nicht mehr, was sie tun und wie sie sich verständlich machen sollte, und indem sie ihn liebevoll anblickte, sagte sie: Wie, du solltest das Opfer dieser Unmenschen werden? Diese nämlichen Augen, welche dich mit Vergnügen betrachten, sollen mit ansehen, wie man dich in Stücken zerreißt und ohne Barmherzigkeit verschlingt? Sie brach in Tränen aus, und der bestürzte Prinz konnte nichts von Allem, was sie tat, begreifen.
Indes gelang es ihr doch ihm verständlich zu machen, sie wolle nicht dass er ihr folge; darauf nahm sie ihn bei der Hand, und führte ihn zu einem Felsen, dessen Eingang nach dem Meere zuging. Die Höhle war sehr tief, die Prinzessin kam oft hierher, ihr Unglück zu beweinen; auch brachte sie zuweilen die Nächte hier zu, und mit der ihr eigenen Geschicklichkeit hatte sie die Höhle mannigfach ausgeschmückt. Sie hatte eine Tapete aus Schmetterlingsflügeln von den verschiedensten Farben gemacht, und über Rohr, welches so ineinander geflochten war, dass es eine Art Ruhebett bildete, hatte sie einen Teppich von Binsen gebreitet; große Muscheln, deren sie sich als Blumenvasen bediente, standen umher; und so gab es tausend artige Kleinigkeiten von ihrer Hand, teils aus Fischgräten und Muscheln, teils aus Binsen und Rohr, und diese kleinen sauberen Arbeiten zeigten, bei aller Einfachheit, von dem Geschmack und der Geschicklichkeit der Prinzessin.
Der Prinz war über den Anblick alles dessen ganz erstaunt, und da er die Höhle für den Aufenthalt der Prinzessin hielt, so entzückte ihn der Gedanke, hier mit ihr zusammen zu leben; denn schon war sein Herz von Liebe zu der schönen Wilden ergriffen, die er allen Kronen vorzog, zu denen ihn seine Geburt und der Wille seiner Angehörigen beriefen.
Die Prinzessin hieß ihn niedersitzen und um ihm anzudeuten, dass er hier bleiben solle, bis sie ihm zu essen gebracht hätte, machte sie das Band los, welches ihr Haar zusammenhielt, schlang es um den Arm des Prinzen und band ihn an das kleine Bett; hierauf ging sie fort, und aus Furcht ihr zu missfallen wagte er es nicht seinem Wunsche nachzugeben, ihr zu folgen.
Als er allein war, überließ er sich seinen Betrachtungen. „Wo bin ich?“, sprach er zu sich selbst. „In welches Land hat mich das Schicksal geführt? Mein Schiff ist zertrümmert, meine Leute ertrunken, und entblößt von allem finde ich statt einer Krone, die sich mir darbot, einen trübseligen Felsen als letzte Zuflucht. Was soll hier aus mir werden? Was wird das für ein Volk sein, welches diese Gegend bewohnt? Wird es dem schönen Mädchen gleichen, welches mich rettete, oder wird es, roh und grausam, mich noch ein traurigeres Schicksal finden lassen als bisher?" Furcht und Hoffnung wechselten in seinem Herzen, aber der Gedanke an die Schönheit der jungen Wilden verdrängte jeden andern.
Sie kehrte so rasch als möglich zurück, ganz Atemlos und mit allerhand Speisen beladen, die sie vor den Prinzen hinsetzte, Vogeleier, in der Sonne gebraten, Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen und anderen Früchte. Die Schüsseln waren aus Zedernholz, das Messer von Stein, große weiche Baumblätter dienten als Servietten, eine Muschel als Trinkschale.
Der Prinz bezeigte ihr auf alle Weise seine Dankbarkeit, die sie mit freundlichem Lächeln aufnahm. Aber die Stunde der Trennung war gekommen; sie machte ihm verständlich, dass sie fortgehen müsse, Beide seufzten und brachen in Tränen aus, die jedes dem andern zu verbergen suchte. Sie stand auf und wollte gehen; der Prinz stieß einen lauten Schrei aus, warf sich zu ihren Füßen, und bat sie zu bleiben; aber sie stieß ihn sanft zurück, und er sah wohl, dass er ihr gehorchen müsste.
Beide brachten die Nacht sehr traurig hin. Als die Prinzessin sich wieder in der Höhle mitten unter den Menschenfressergezücht befand, als sie das schreckliche Ungetüm betrachtete, welches ihr Gemahl werden sollte, und den liebenswürdigen Fremdling dagegen hielt, den sie eben verlassen hatte, war sie nahe daran sich kopfüber ins Meer zu stürzen. Dazu kam die Furcht, dass Ravagio und Turmentine das Menschenfleisch riechen und gradenwegs nach dem Felsen rennen und den Prinzen Vielgeliebt auffressen möchten.
Diese mannigfachen Besorgnisse hielten sie die ganze Nacht wach. Mit Tagesanbruch stand sie auf, und eilte oder flog vielmehr nach dem Ufer, beladen mit Früchten, Milch und Allem, was sie Schmackhaftes hatte finden können. Der Prinz schlief noch, von der Anstrengung des vorhergehenden Tages erschöpft. Sie weckte ihn auf und sagte ihm, sie stehe Todesangst aus, dass Ravagio und Turmentine ihn entdecken könnten; sie wage nicht zu hoffen, dass er sich in diesem Felsen noch länger in Sicherheit befinde, und wie schmerzlich ihr auch seine Entfernung sei, so beschwöre sie ihn doch, so weit als möglich von hier zu fliehen.
Bei diesen Worten füllten sich ihre Augen mit Tränen, sie faltete die Hände und bat ihn auf das Rührendste. Sie deutete auf den Weg, bis er endlich den Sinn ihrer Zeichen und Worte verstand; aber er gab ihr seinerseits zu verstehen, dass er lieber sterben als sie verlassen wolle. Dieser Beweis seiner Anhänglichkeit rührte sie so sehr, dass sie die goldene Kette und das Herz von Türkis, welche die Königin, ihre Mutter, ihr um den Hals geschlungen hatte, abnahm und es um den Arm des Prinzen band. Dieser bemerkte sogleich die Schriftzeichen, welche auf den Türkis eingegraben waren; er betrachtete sie mit Aufmerksamkeit und las: Vielgeliebt, Tochter des Königs der glücklichen Insel.
Sein Erstaunen war unbeschreiblich. Er wusste, dass die kleine Prinzessin, die verloren gegangen war, Vielgeliebt hieß, und zweifelte nicht, dass dieser Türkis ihr angehöre, aber das wusste er nicht, ob die schöne Wilde die Prinzessin sei oder ob das Meer etwa den Stein ans Ufer geworfen habe. Er betrachtete Vielgeliebt mit der größten Aufmerksamkeit, und je länger er sie betrachtete, desto mehr entdeckte er gewisse Familienzüge, und sein Herz vor allem versicherte ihn, dass er sich nicht täusche.
Mit Erstaunen verfolgte sie seine Blicke und Gebärden; wie er die Augen zum Himmel aufschlug, um ihm zu danken, ihre Hände ergriff und ihr seine Freude und Erkenntlichkeit auf jede Weise zu erkennen zu geben suchte. — So verstrichen vier Tage; jeden Morgen brachte die Prinzessin so viel an Speisen herbei, als er bedurfte; sie blieb so lange sie konnte in seiner Gesellschaft, und die Stunden flogen rasch dahin, obgleich ihre Unterhaltung noch sehr unvollständig war.
Eines Abends kam sie ziemlich spät nach Hause und fürchtete schon von der bösen Turmentine tüchtig ausgescholten zu werden: aber wie erstaunte sie den freundlichsten Empfang zu finden. Der Tisch war mit Früchten besetzt und Ravagio sagte ihr, sie seien alle für sie bestimmt und sein Söhnchen habe sie gepflückt; es sei endlich Zeit, dass er heirate und in drei Tagen solle die Hochzeit sein.
Welche Nachricht! Was konnte es auf der ganzen Welt für diese liebenswürdige Prinzessin Schrecklicheres geben? Sie meinte vor Angst und Abscheu auf der Stelle sterben zu müssen; aber sie verbarg ihren Kummer, und antwortete, sie gehorche ohne Widerstreben, nur möchten sie die Hochzeit noch einige Tage aufschieben.
Ravagio ergrimmte über diese Antwort und schrie: „Was hält mich denn zurück, dich nicht auf der Stelle aufzufressen?"
Die arme Prinzessin fiel ohnmächtig vor Furcht Turmentinen und ihrem Sohn in die Klauen, und der letztere, welcher in die Prinzessin sehr verliebt war, bat bei Ravagio so lange für sie, bis er ihr verzieh.
Vielgeliebt machte die Nacht kein Auge zu, sie erwartete den Tag mit größter Ungeduld; kaum brach er an, so eilte sie zum Felsen, und als sie den Prinzen erblickte, stieß sie ein schmerzhaftes Geschrei aus und vergoss einen Strom von Tränen. Er war ganz bestürzt darüber und konnte die Ursache ihrer Betrübnis nicht begreifen. Endlich fand sie doch ein Mittel, sich ihm verständlich zu machen. Sie band ihr langes Haar los, setzte einen Blumenkranz auf ihr Haupt und indem sie seine Hand ergriff, gab sie ihm zu verstehen, dass sie gezwungen werde, einem Andern ihre Hand zu reichen.
Sein Schmerz war unbeschreiblich; er kannte nicht Mittel noch Wege zu ihrer Rettung und sie eben so wenig, sie weinten, sahen sich an und beschlossen lieber zu sterben als sich zu trennen.
Sie blieb bis auf den Abend bei ihm; aber die Nacht brach früher ein, als sie erwartete, und da sie, ganz in Gedanken versunken, auf ihre Schritte nicht Acht gab, geriet sie im Wald auf einen wenig betretenen Weg und trat sich einen langen Dorn tief in den Fuß. Zum Glück war sie von ihrer Höhle nicht mehr weit entfernt, mit großer Anstrengung schleppte sie sich bis nach Hause und ihr Fuß schwamm ganz in Blut. Ravagio, Turmentine und die kleinen Menschenfresser bezeigten sich sehr hilfreich; sie zogen ihr den Dorn aus der Wunde, wobei sie nicht geringe Schmerzen erduldete, legten heilsame Kräuter auf den Fuß und verbanden ihn.
Man kann sich denken, in welcher Sorge sie um ihren geliebten Prinzen war. „Ach“, sagte sie, „morgen werde ich nicht ausgehen können, was wird er denken, wenn er mich nicht sieht? Wird er nicht glauben, man habe mich zur Heirat gezwungen? Und wer wird ihm Nahrung bringen? Ach, er wird mich aufsuchen und dann ist er verloren. Wenn ihn Ravagio entdeckt, so ist sein Tod gewiss." In Tränen und Seufzen brachte sie die Nacht zu; am andern Morgen wollte sie zeitig aufstehen und fortgehen; aber sie konnte kaum auftreten, und Turmentine hielt sie zurück und sagte drohend: „Wenn du einen Schritt tust, so fress' ich dich auf."
Inzwischen stand der Prinz, da die Stunde verstrich, in der sie zu kommen pflegte, große Angst aus, und sein Kummer und seine Besorgnis vermehrten sich mit jedem Augenblick; endlich beschloss er, nicht länger zu warten,' sondern ohne Furcht vor dem Tode, seine geliebte Prinzessin aufzusuchen.
Er ging fort, ohne zu wissen wohin, er verfolgte einen betretenen Fußsteg, den er am Eingang des Waldes bemerkte. Nachdem er eine Stunde zugeschritten war, hörte er ein Geräusch und erblickte die Höhle, aus welcher ein dicker Rauch aufstieg. In der Hoffnung dort von seiner Geliebten Nachricht zu erhalten, trat er hinein und kaum hatte er einige Schritte vorwärts getan, als ihn Ravagio erblickte, ihn plötzlich mit seinen furchtbaren Klauen ergriff und ihn verschlingen wollte.
Aber das Geschrei, welches der Prinz ausstieß, indem er sich gegen den Menschenfresser wehrte, drang zu den Ohren der Prinzessin, die in einer Nebenhöhle lag; bei diesem Ton konnte sie nichts zurückhalten, sie verließ ihr Lager, näherte sich Ravagio, welcher den Prinzen in seinen Krallen hielt, und bleich und zitternd, als solle sie selber gefressen werden, warf sie sich vor ihm auf die Knie und beschwor ihn diesen Leckerbissen bis auf ihren Hochzeitstag aufzusparen, wo sie mit davon essen wolle.
Ravagio war über diese Bitte und den Gedanken, dass die Prinzessin die Sitten ihrer Schwiegereltern annehmen wolle, so erfreut, dass er den Prinz losließ und in die Höhle einsperrte, wo die kleinen Menschenfresser schliefen.
Vielgeliebt bat um Erlaubnis ihn gut füttern zu dürfen, damit er nicht mager werde und dem Hochzeitsschmaus Ehre mache. Der Menschenfresser erteilte sie ihr und sie brachte also dem Prinzen das Beste, was sie nur bekommen konnte. Als er sie eintreten sah, war seine Freude so groß, dass er sein Unglück fast vergaß; aber die Wunde an ihrem Fuß setzte ihn aufs neue in Schrecken. Sie weinten lange Zeit mit einander, und der Prinz würde keinen Bissen gegessen haben, wenn ihm seine teure Prinzessin nicht Alles so anmutig und flehend dargereicht hätte, dass er es unmöglich zurückweisen konnte.
Sie ließ durch die kleinen Menschenfresser frisches Moos herbeischaffen, breitete einen Teppich von Vogelfedern darüber, und bedeutete den Prinzen, dass dies sein Lager sei. Turmentine rief nach ihr und sie konnte ihm nur noch die Hand zum Lebewohl reichen, die er zärtlich küsste.
Ravagio, Turmentine und die Prinzessin schliefen in einer der Seitenhöhlen; und die Menschenfresserkinder mit dem Prinzen in einer andern; sie trugen, wie es bei ihnen gebräuchlich ist, sämtlich statt der Schlafmützen in der Nacht goldene Krönchen auf dem Kopf. Als nun Alles schlief, empfand die Prinzessin mit einmal bei dem Gedanken an den Prinzen Vielgeliebt eine tödliche Unruhe. Es fiel ihr nämlich ein, dass es um den Prinzen unfehlbar geschehen sei, des Versprechens ungeachtet, welches Ravagio und Turmentine gegeben hatten, ihn nicht aufzufressen, wenn sie ja in der Nacht Hunger empfänden.
Und das begegnete ihnen fast immer, wenn sich Menschenfleisch zu Hause befand. Der Gedanke einer solchen Möglichkeit beunruhigte sie dermaßen, dass sie nach einiger Zeit aufstand, ihre Tigerhaut umnahm, und ganz leise in die Höhle schlich, wo die kleinen Menschenfresser schliefen; sie nahm dem ersten besten die Krone vom Kopf und setzte sie dem Prinzen auf, der, obschon er wach war, sich doch ganz ruhig verhielt, weil er nicht wusste, wer da sei. Darauf kehrte die Prinzessin auf ihr Lager zurück.
Sie hatte sich kaum niedergelegt, als Ravagio, welcher von der guten Mahlzeit träumte, die er von dem Prinzen halten würde, bei dem Gedanken aufwachte, und je mehr er daran dachte, desto heftigeren Appetit danach empfand, so dass er rasch aufstand und gleichfalls in die Höhle zu den Kindern ging. Da er nichts deutlich erkennen konnte, so fühlte er mit der Hand an den Köpfen umher, packte den, der keine Krone auf dem Kopf hatte, und verspeiste ihn wie ein junges Huhn. Die arme Prinzessin, welche auf ihrem Lager hörte, wie er die Knochen des Unglücklichen zermalmte, starb fast vor Furcht, es könne gleichwohl der Prinz sein, und der Prinz seinerseits, der ganz nahe dabei war, empfand alle die Unruhe, die man in einem solchen Fall haben kann.
Der Anbruch des Tages befreite die Prinzessin von ihrer furchtbaren Besorgnis: sie eilte zu dem Prinzen, dem sie durch Zeichen die Qual, welche sie ausgestanden hatte, zu erkennen gab; er hatte ihr so viel zu erwidern, aber Turmentine, die nach ihren Kindern sehen kam, störte ihn darin. Als sie die Höhle voll Blut sah und fand, dass ihr jüngstes fehle, stieß sie einen entsetzlichen Schrei aus. Ravagio überzeugte sich bald, welchen schönen Streich er gespielt hatte, aber das Übel war nicht wieder gut zu machen. Er sagte ihr ins Ohr, er habe sich vor Hunger in der Wahl vergriffen, und geglaubt Menschenfleisch zu fressen.
Turmentine musste sich wohl dabei beruhigen, denn Ravagio war so wild, dass, wenn sie seine Entschuldigungen nicht im Guten hätte gelten lassen, er sie selber vielleicht aufgefressen hätte.
Die Prinzessin hörte nicht auf, auf Mittel zu denken, dem Prinzen das Leben zu retten. In der folgenden Nacht stand sie, von der nämlichen Besorgnis gequält, ganz leise auf, begab sich in die Höhle, wo der Prinz lag, nahm behutsam einem kleinen Menschenfresser die Krone vom Kopf und setzte sie ihrem Geliebten auf.
Die Prinzessin hatte nie einen glücklicheren Einfall gehabt. Ohne diese Vorsicht wär es um den Prinzen geschehen. Nämlich die grausame Turmentine fuhr plötzlich aus dem Schlaf auf und da sie an den Prinzen dachte, der ihr sehr schmackhaft vorgekommen war, empfand sie eine solche Furcht, Ravagio könne ihn ganz allein verzehren, dass sie es für das Beste hielt, ihm zuvorzukommen. Ohne ein Wort zu sagen, schlich sie in die Kammer ihrer Kleinen, fühlte behutsam nach ihren Kronen auf dem Kopf und eins der kleinen Menschenfresser, welches keine hatte, verschwand auf drei Mundbissen.
Der Prinz und die Prinzessin hörten, vor Furcht zitternd, Alles mit an, aber Turmentine verlangte, nachdem sie dies Geschäft abgemacht hatte, nur nach Schlaf und sie brachten den übrigen Teil der Nacht in Sicherheit zu.'
„O Himmel steh uns bei“, sagte leise die Prinzessin! „Zeig mir ein Mittel, welches uns aus dieser äußersten Gefahr rettet." Der Prinz flehte nicht minder; zuweilen fiel es ihm ein, die Ungeheuer anzugreifen und zu bekämpfen, aber auf welchen Erfolg durfte er hoffen gegen diese riesenhaften Geschöpfe, deren Haut fast undurchdringlich war? Nein, nur die List konnte sie aus diesen schrecklichen Aufenthalt befreien.
Als der Tag anbrach und Turmentine merkte, was sie angerichtet hatte, so erfüllte sie die Luft mit einem furchtbaren Geheul. Ravagio schien nicht weniger außer sich, und es fehlte nicht viel, so hätten sie den Prinzen und die Prinzessin gepackt und ohne Barmherzigkeit aufgefressen.
Plötzlich fiel der Prinzessin, welche sich in einem fort den Kopf zerbrach, ein, dass Turmentine ein Stäbchen von Elfenbein besitze, mit dem sie allerhand Wunder verrichtete, ohne dass sie selbst die Ursache davon angeben konnte. Wenn nun das Stäbchen, dachte die Prinzessin, bloß auf ihre Worte so erstaunliche Dinge verrichtet, warum sollte es sie nicht gleichfalls auf die meinigen tun?
Von diesem Gedanken voll, lief sie in die Höhle, wo Turmentine schlief, suchte das Stäbchen, welches tief in einer Höhlung steckte, und als sie es in der Hand hielt, sagte sie: „Ich wünsche im Namen der königlichen Fee Trusio die Sprache reden zu können, die der spricht, den ich liebe."
Sie hätte wohl noch mehr gewünscht, aber Ravagio nahte. Die Prinzessin schwieg, legte das Stäbchen wieder an seinen Ort und eilte zum Prinzen. Wie angenehm überrascht wurde dieser, die schöne Wilde in seiner Sprache reden zu hören! Sie entdeckte ihm die Macht des Zauberstäbchens und er unterrichtete sie über ihre Abkunft und ihre Angehörigen. Doch es war keine Zeit zu verlieren, es galt so schleunig als möglich sich aus den Klauen der erbosten Ungeheuer zu retten und die Prinzessin sagte zu ihrem Geliebten, sie müssten sich, sobald die Menschenfresser in der nächsten Nacht eingeschlafen wären, auf Ravagios großes Kamel setzen, und es dem Himmel überlassen, wohin er sie führen werde.
Die so ersehnte Nacht kam heran: die Prinzessin nahm Mehl und knetete mit ihren weißen Händen einen Kuchen, in den sie eine Bohne tat; darauf sagte sie, das Zauberstäbchen in der Hand: „O du Bohne, kleine Bohne, ich wünsche im Namen der königlichen Fee Trusio, dass du redest, sobald es nötig ist, so lange bis du gebacken bist."
Sie legte den Kuchen in die heiße Asche und eilte zu dem Prinzen, der sie mit Ungeduld erwartete. „Rasch fort“, sagte sie zu ihm, „das Kamel steht angebunden im Walde."
„Liebe und Glück mögen uns leiten“, antwortete ganz leise der junge Prinz. So eilten sie fort, der Mond leuchtete ihnen, sie fanden das Kamel, stiegen auf, und machten sich auf den Weg, ohne zu wissen wohin.
Inzwischen wälzte sich Turmentine, die noch voll Grimm und Betrübnis war, unruhig im Schlafe hin und her, bis sie aufwachte. Sie streckte den Arm aus, um zu fühlen, ob die Prinzessin schon in ihrem Bett wäre und da sie sie nicht fand, so rief sie mit einer Donnerstimme: „Wo bist du denn, Mädchen?"
„Ich stehe hier beim Feuer“, antwortete die Bohne.
„Willst du wohl schlafen kommen“, brummte Turmentine.
„Gleich, gleich“, versetzte die Bohne, „schlaft nur ganz ruhig."
Turmentine fürchtete sich den Ravagio aufzuwecken und schwieg; aber da sie nach einigen Stunden wieder aufwachte, und das Bett der Prinzessin noch immer leer fand, so schrie sie: „Wie, du kleine Hexe, du willst dich also nicht schlafen legen?"
„Ich wärme mich so viel ich kann“, antwortete die Bohne.
„So wollt' ich, dass du zur Strafe mitten im Feuer lägst“, sagte die Menschenfresserin.
„Ich lieg' auch darin“, entgegnete die Bohne, „und man kann sich nicht besser wärmen als ich."
So führten sie noch mehrere Gespräche, welche die Bohne für eine Bohne ganz vortrefflich beantwortete. Endlich gegen Morgen rief Turmentine die Prinzessin noch einmal; aber die Bohne, welche bereits gebacken war, antwortete nicht mehr. Dies Schweigen beunruhigte sie, sie stand hastig auf, sah sich um, rief und suchte überall. Die Prinzessin, der Prinz und das Zauberstäbchen waren verschwunden. Nun schrie sie so laut, dass Wald und Tal davon widerhallte: „Wach auf, mein Schatz, steh auf, lieber Ravagio, wir sind verraten, unser Menschenfleisch ist fort."
Ravagio öffnete sein Auge, sprang mitten in die Höhle wie ein Löwe, kupferrot vor Zorn, brüllte, heulte und schäumte. „Rasch, rasch“, rief er, „meine Siebenmeilenstiefeln, meine Siebenmeilenstiefeln, dass ich den Fortläufern nachsetze. Ich will sie bald erwischt haben, die sollen mir trefflich schmecken."
Er zog nun seine Stiefeln an, in welchen er auf jeden Schritt nicht weniger als sieben Meilen machte. Ach, was hilft da alle Schnelligkeit eines Kamels gegen solche Schritte!
Voll Freude, bei einander zu sein, sich verstehen zu können, und nicht mehr verfolgt zu werden, setzten der Prinz und die Prinzessin ihren Weg fort, als die Prinzessin, welche zuerst den schrecklichen Ravagio bemerkte, schrie: „Mein Prinz, wir sind verloren, seht das furchtbare Ungeheuer, welches wie ein Donner auf uns zustürmt."
„Was fangen wir an“, sagte der Prinz, „was soll aus uns werden? Ach, wenn ich allein wär', so würd' ich mein Leben nicht achten; aber das deinige, meine teure Gebieterin, ist in Gefahr."
„Ich weiß keine Rettung“, versetzte die Prinzessin Vielgeliebt weinend, „wenn uns der Zauberstab nicht hilft; sonst sind wir unfehlbar verloren. — Ich wünsche“, sprach sie darauf, „im Namen der königlichen Fee Trusio, dass unser Kamel in einen See, der Prinz in eine Barke und ich in ein altes Weib, welches die Barke führt, verwandelt werde."
Augenblicklich ging die Verwandlung vor sich. Ravagio gelangte an das Ufer des Sees und schrie: „Holla, ho, alte Mutter, habt ihr nicht ein Kamel, einen jungen Menschen und ein Mädchen vorbeikommen sehn?"
Die Schifferfrau, welche mitten auf dem See hielt, setzte ihre Brille auf die Nase, und indem sie Ravagio aufmerksam betrachtete, gab sie ihm durch Zeichen zu verstehen, sie habe sie gesehen und sie wären die Wiese entlang geritten.
Der Menschenfresser glaubte ihr und nahm den Weg zur Linken. Die Prinzessin wünschte hierauf ihre natürliche Gestalt wieder anzunehmen, und berührte sich dreimal mit ihrem Zauberstab und eben so die Barke und den See. Nachdem sie wieder ihre vorige Gestalt erhalten hatten, stiegen sie auf das Kamel und schlugen den Weg zur Rechten ein, um ihrem Verfolger nicht zu begegnen.
Sie eilten so rasch als möglich vorwärts, und wünschten sehr Jemanden zu finden, der ihnen den Weg nach der glücklichen Insel zeigte. Sie lebten nur von Früchten, tranken Quellwasser, und des Nachts schliefen sie unter den Bäumen. Die Gefahr,» in der sie schwebten, erschreckte sie nicht so sehr, dass sie nicht das Vergnügen, der Höhle entronnen und bei einander zu sein, lebhaft empfunden hätten. Seitdem sie sich verstanden, hörten sie nicht auf sich zu unterhalten und fanden in ihrer gegenseitigen Liebe unerschöpflichen Stoff dazu.
Als Ravagio die Berge, die Wälder, die Täler durchirrt hatte, kehrte er in seine Höhle zurück, wo Turmentine und die kleinen Menschenfresser ihn mit Ungeduld erwarteten. Er war mit fünf, sechs Menschen bepackt, die ihm unglücklicherweise in die Klauen geraten waren.
„Nun“, schrie ihm Turmentine entgegen, „hast du sie gefunden und aufgefressen, die Nichtswürdigen, das Diebespack, das Menschenfleisch? Hast du nicht wenigstens mir die Hände oder die Füße aufgehoben?"
„Ich glaube, sie sind davongeflogen“, versetzte Ravagio, „ich bin nach allen Seiten gelaufen wie ein Wolf, und habe nichts von ihnen gesehen; nur eine alte Frau, die auf einem Teich in einer Barke fuhr, gab mir Nachricht von ihnen."
„Und was hat sie dir denn von ihnen gesagt?“, fragte Turmentine ungeduldig.
„Sie hätten sich links gewendet“, versetzte Ravagio.
„So wahr ich lebe“, schrie sie, „du hast dich anführen lassen; ich glaube gewiss, sie war es selbst, mit der du gesprochen hast. Kehr' wieder um und wenn du sie erwischst, so verschon' sie nicht einen Augenblick."
Ravagio schmierte seine Siebenmeilenstiefeln und machte sich über Hals und Kopf wieder auf den Weg. Unser junges Paar kam eben aus einem Walde heraus, wo es übernachtet hatte. Ihr Schreck war nicht gering, als sie ihn erblickten. „Meine Geliebte“, sagte der Prinz, „da naht unser Verfolger, ich fühle Mut genug, mich ihm entgegenzustellen, würdest du nicht so viel haben, um ganz allein die Flucht zu ergreifen?"
„Nein, Nein“, entgegnete sie, „ich verlasse dich nie. Aber verlieren wir keine Zeit; das Zauberstäbchen wird uns vielleicht von großem Nutzen sein." — „Ich wünsche“, sagte sie, „im Namen der königlichen Fee Trusio, dass sich der Prinz in ein Bildnis verwandle, das Kamel in einen Pfeiler und ich in einen Zwerg."
Die Verwandlung geschah und der Zwerg schickte sich an, ins Horn zu stoßen, als sich Ravagio mit großen Schritten näherte und ihn fragte: „Sage mir, du kleines Ungeheuer, hast du nicht einen hübschen Jüngling, ein junges Mädchen und ein Kamel hier vorbeikommen sehn?"
„Da kann ich euch Auskunft geben“, versetzte der Zwerg: „Wenn ihr etwa ein feines Herrchen meint, mit einer wunderschönen Dame und ihrem Reittier, so hab' ich sie gestern zu der nämlichen Stunde gesehen; sie waren samt sehr wohlgemut!, der feine Kavalier empfing den Dank im Ringen und Turnieren, welches sie zu Ehren der schönen Merlusine anstellten, die ihr auf diesem Bilde in sprechender Ähnlichkeit abgemalt seht. Viel vornehme Herren und tapfere Ritter brachen hier Lanzen, Helme und Pickelhauben; es war ein harter Strauß, und der Dank eine schöne Armspange von Gold, besetzt mit Perlen und Diamanten. Bei der Abreise sagte die unbekannte Dame zu mir: „Freund Zwerg, ohne lange Redensarten, ich bitte dich um eine Gunst, im Namen deiner liebsten Freundin"; worauf ich ihr antwortete: „Sie soll euch nicht versagt werden, ich 'verspreche sie euch, im Fall sie in meiner Macht steht." „Wenn du den großen Riesen gewahr wirst, der sein Auge mitten auf der Stirn trägt, so bitte ihn höflichst, dass er uns in Frieden ziehen lasse." Darauf spornte sie ihren Zelter an und sie entfernten sich."
„Wohin?“, fragte Ravagio.
„Über die grüne Wiese hin, die sich am Walde hinzieht“, versetzte der Zwerg.
„Wenn du mich belügst“, sagte der Menschenfresser, „so sei versichert, kleiner Taugenichts, dass ich dich auffresse, dich, mitsamt deinem Pfeiler und dem Bildnis der Merlusche."
„Trug und List war nie in mir“, erwiderte der Zwerg, „aus meinem Munde ist nie eine Lüge hervorgegangen, kein Mensch auf Erden kann mich eines Betruges zeihen: aber beeilt euch, wenn ihr sie noch vor Untergang der Sonne erreichen wollt."
Der Menschenfresser entfernte sich. Der Zwerg nahm seine vorige Gestalt wieder an und berührte das Bild und den Pfeiler, die sich wieder in den Prinzen und das Kamel verwandelten.
Welche Freude für die Liebenden! „Nein“, sagte der Prinz, „nie hab' ich eine so lebhafte Unruhe ausgestanden, meine teure Vielgeliebt. Wie meine Liebe für dich in jedem Augenblicke wächst, so vermehrt sich auch meine Angst, sobald ich dich in Gefahr sehe."
„Und mir schien es“, sagte sie, „als empfände ich gar keine Furcht, denn Ravagio frisst keine Bilder, und was mich betraf, die ich allein seiner Wut ausgesetzt war, so war mein Aussehen wenig appetitlich, und endlich würde ich ja gern mein Leben hingeben, um das deinige zu retten."
Ravagio lief vergebens umher; er fand weder den Prinzen noch die Prinzessin; er war müde wie ein Hund, und trat den Rückweg nach seiner Höhle an.
„Wie, du kommst wieder ohne unsere Gefangnen?“, schrie Turmentine, indem sie ihre schmutzigen Haare zerraufte. „Komm mir nicht zu nahe, oder ich erwürge dich."
„Ich habe Niemanden angetroffen“, antwortete er, „als einen Zwerg, einen Pfeiler und ein Bild."
„So wahr ich lebe“, fuhr sie fort, „das waren sie! Ich bin wohl eine rechte Närrin, dass ich dir die Sorge für meine Rache überlasse, als wenn ich zu klein wäre, sie selbst zu nehmen. Ja ja, ich will mich auf den Weg machen, ich will mir die Siebenmeilenstiefel anziehen und werde so schnell damit gehen wie du."
Sie zog die Siebenmeilenstiefel an und machte sich auf den Weg. Wie schnell auch der Prinz und die Prinzessin reisten und welchen Vorsprung sie gewonnen hatten, den Siebenmeilenstiefeln konnten sie nicht entgehen. Sie sahen die Menschenfresserin daher kommen, die eine bunte Schlangenhaut übergeworfen hatte und über der Schulter eine Eisenkeule von entsetzlichem Gewicht trug. Sie sah sich scharf nach allen Seiten um und würde den Prinzen und die Prinzessin jedenfalls entdeckt haben, wenn sie nicht eben tief im Walde verborgen gewesen wären.
„Wir sind verloren“, sagte die Prinzessin Vielgeliebt weinend, „da ist die grausame Turmentine, bei deren Anblick mein Blut gerinnt; sie ist klüger als Ravagio, wenn einer von uns Beiden mit ihr spricht, so wird sie uns erkennen und damit ansangen, dass sie uns auffrisst. Ach, es wird bald mit uns zu Ende sein!"
„O Liebe, Liebe“, rief der Prinz, „verlass uns nicht; gibt es zärtlichere Herzen als die unsrigen, eine reinere Neigung? Ach meine teure Vielgeliebt“, fuhr er fort, indem er ihre Hand ergriff, „solltest du bestimmt sein auf eine so schreckliche Art deinen Tod zu finden?"
„Nein, nein“, sagte sie, „ich fühle mich aufs neue von Mut und Standhaftigkeit durchdrungen; wohlan, mein kleines Stäbchen, tue deine Pflicht. Ich wünsche im Namen der königlichen Fee Trusio, dass das Kamel sich in einen Kübel verwandle, mein teurer Prinz in einen schönen Orangenbaum und ich in eine Biene." Sie tat wie gewöhnlich ihre drei Schläge auf jedes von ihnen und augenblicklich war die Verwandlung geschehen, so dass Turmentine, als sie ankam, nicht das Mindeste davon merkte.
Das schreckliche Weib hatte sich ganz außer Athem, gelaufen und setzte sich unter den Orangenbaum. Die Prinzessin Biene machte sich's zum Vergnügen sie an tausend Orten zu stechen und wie hart auch Turmentinens Haut war, so drang der Bienenstachel dennoch durch und brachte sie zum Schreien. Sie wälzte sich auf dem Grase wie ein Stier oder ein junger Löwe, der von Bremsen gestochen ist, denn die eine Biene verrichtete so viel als ihrer hundert. Prinz Orangenbaum war in Todesangst, sie könne sich erwischen lassen und getötet werden. Endlich aber entfernte sich Turmentine, ganz mit Beulen bedeckt.
Nun wollte die Prinzessin wieder ihre natürliche Gestalt annehmen, als unglücklicherweise einige Reisende durch den Wald kamen, den schönen elfenbeinernen Stab bemerkten, ihn aufhoben und mit fort nahmen.
Es konnte nicht leicht etwas Unangenehmeres begegnen. Der Prinz und die Prinzessin hatten zwar den Gebrauch der Sprache nicht verloren; aber dies war ein schwacher Trost in dem Zustand, in welchem sie sich befanden. „Wie unglücklich bin ich“, rief der Prinz, „in die Rinde eines Baumes eingeschlossen zu sein, ohne mich bewegen zu können. Was soll aus mir werden, wenn du mich verlässt? Aber“, fuhr er fort, „warum solltest du dich von mir entfernen? Du wirst auf meinen Blüten süßen Tau finden und einen Saft, der köstlicher ist als Honig. Du wirst dich davon nähren können, und meine Blätter werden dir zum Lager dienen, wo du nichts von der Bosheit der Spinnen zu befürchten hast."
„Fürchte nichts“, versetzte die Biene, „ich verlasse dich nie; nicht Jasmin, nicht Rosen und Lilien, noch die schönsten aller Blumen können mich eine solche Untreue begehen lassen. Ohne Unterlass werd' ich dich umfliegen, und du wirst erkennen, dass der Orangenbaum der Biene nicht weniger teuer ist, als es Prinz Vielgeliebt der Prinzessin Vielgeliebt war." — Und wirklich schloss sie sich in eine der größten Blüten wie in einen Palast ein.
Der Wald, in welchem der Orangenbaum stand, diente einer Prinzessin, die in der Nähe einen prächtigen Palast bewohnte, häufig zum Spaziergang. Sie hieß Linda und war jung, schön und klug. Sie wollte sich nicht verheiraten, weil sie befürchtete, von dem, welchen sie zum Gemahl wähle, nicht immer geliebt zu werden; und da sie sehr reich war, so ließ sie ein kostbares Schloss bauen, und sah Niemanden darin bei sich als Damen und Greise von Erfahrung und Weisheit. Allen übrigen Männern war es nicht gestattet sich demselben zu nähern.
Die Hitze des Tages hatte die Prinzessin länger als sie wollte, im Zimmer zurückgehalten; auf den Abend nun ging sie mit allen ihren Damen im Walde spazieren. Der Duft des Orangenbaums, den sie niemals hier gesehen hatte, zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Man begriff nicht, durch welchen Zufall er hierher gekommen sein könnte und die ganze Gesellschaft umringte und bewunderte ihn.
Die Prinzessin verbot, nur eine einzige Blüte davon abzubrechen und ließ ihn in ihren Garten tragen, wohin die treue Biene nachfolgte. Von seinem köstlichen Geruch entzückt, setzte sich Linda unter seinem Schatten nieder, und als sie wieder aufstand, um sich nach ihrem Palast zu begeben, wollte sie sich ein paar Blüten von dem Baume brechen. Aber die wachsame Biene, die es wohl bemerkte, flog aus dem Kelch, in welchem sie verborgen war, heraus und stach die Prinzessin so heftig, dass diese beinah in Ohnmacht gefallen war' und ganz krank, ohne den Baum seiner Blüten beraubt zu haben, auf ihr Zimmer zurückkehrte.
Sie gab jedoch ihren Plan nicht auf, denn sie empfand nun einmal eine unüberwindliche Lust einen Strauß von Orangenblüten zu haben, stand am andern Morgen zeitig auf und ging in den Garten, um sich von dem Baume einen Strauß zu pflücken. Als sie aber die Hand ausstreckte, empfing sie von der Biene wieder einen so empfindlichen Stich, dass sie allen Mut dazu verlor.
Sie kehrte sehr übler Laune auf ihr Zimmer zurück und sagte: „Ich begreife nicht was das mit dem Baume ist, den wir gestern im Walde gefunden haben; sobald ich mir nur die kleinste Knospe davon abbrechen will, werd' ich von Bienen gestochen, die ihn bewachen."
Eine ihrer Kammerfrauen, die einen aufgeweckten muntern Geist besaß, entgegnete ihr lächelnd: „Ich würde euch rächen, gnädige Prinzessin, euch wie eine Amazone zu bewaffnen und dann noch einmal mutig daran zu gehen die schönsten Blüten dieses allerliebsten Baumes abzupflücken."
Linda fand diesen Gedanken gar nicht übel; sie ließ sich sogleich einen Helm, einen leichten Panzer und eiserne Handschuhe machen, und bei dem Schall der Trompeten, Pauken, Pfeifen und Hörner, betrat sie den Garten in Begleitung ihrer sämtlichen Damen, die ganz eben so bewaffnet waren. Als sie an den Orangenbaum kam, zog sie mit leichtem Anstand den Degen, hieb einen Zweig desselben ab und rief: „Erscheinet, ihr fürchterlichen Bienen, erscheinet, ich komme euch herauszufordern; seid ihr mächtig genug, euern geliebten Baum zu verteidigen?"
Aber wie ward der Prinzessin und allen ihren Begleiterinnen, als sie aus dem Stamme des Orangenbaums ein wehmütiges Ach hörten, von einem tiefen Seufzer begleitet, und aus dem abgehauenen Zweige Blut fließen sahen. „O Himmel“, rief Linda erschrocken, „was hab' ich getan? Welche Erscheinung!" Sie nahm den blutenden Zweig, aber vergebens versuchte sie ihn an den Baum wieder anzufügen.
Die arme kleine Biene war bei dem Anblick des traurigen Schicksals ihres geliebten Orangenbaums in Verzweiflung; schon wollte sie ihn rächen und auf der Spitze des Degens ihren Tod finden; doch sie entschloss sich, lieber für ihn zu leben und ihm das Heilmittel zu verschaffen, dessen er bedurfte. Sie beschwor ihn um die Erlaubnis;, nach Arabien fliegen zu dürfen, um ihm Balsam zu holen. Nachdem sie Abschied von einander genommen hatten, machte sie sich auf den Weg, von ihrem Instinkt und der Liebe geleitet. In kurzer Zeit kehrte sie glücklich zurück und brachte auf ihren Flügeln und an ihren Füßchen den wundersamen Balsam, mit welchem sie den Prinzen vollkommen heilte.
Linda war über das, was sie gesehen hatte, so erschrocken, dass sie weder aß noch schlief. Endlich entschloss sie sich einige berühmte Feen zu sich einzuladen, um über eine so außerordentliche Begebenheit ins Klare zu gelangen; sie schickte ihre Gesandten ab und gab ihnen eine Menge kostbarer Geschenke mit.
Eine der ersten, welche der Einladung folgten, war die Fee Trusio. Eine geschicktere Fee als sie, hat es nie gegeben. Sie untersuchte Zweig und Baum, sie roch an seine Blüten und fand den Geruch derselben ganz ungewöhnlich. Sie sparte keinerlei Beschwörungen und diese bewirkten endlich, dass der Orangenbaum plötzlich verschwand, und man statt seiner den wohlgebildetesten Prinzen von der Welt erblickte.
Linda stand bei diesem Anblick ganz unbeweglich, sie war so überrascht und von Bewunderung erfüllt, dass ihr Herz schon seine frühere Gleichgültigkeit zu verlieren anfing, als der junge Prinz, nur mit seiner geliebten Biene beschäftigt, sich der Fee Trusio zu Füßen warf.
„Große Königin“, sagte er zu ihr, „ich verdanke dir unendlich viel; du gibst mir mit meiner natürlichen Gestalt den Gebrauch meines Lebens wieder; wenn du aber willst, dass ich dir meine Ruhe verdanke, mein Glück, ja mehr als mein Leben, so gib mir meine geliebte Prinzessin wieder."
Bei diesen Worten nahm er die kleine Biene, auf die seine Augen ohne Unterlass gerichtet gewesen waren.
„Du sollst glücklich werden“, antwortete die edelmütige Fee Trusio; sie begann auf s neue ihre Beschwörungen, und die Prinzessin Vielgeliebt stand da mit allen ihren Reizen.
Linda wusste nicht recht, ob sie sich über dieses außerordentliche Abenteuer freuen oder betrüben sollte, besonders über die Verwandlung der Biene. Endlich siegte die Vernunft über eine kaum entstandene Neigung. Sie umarmte die Prinzessin Vielgeliebt auf das Zärtlichste und Trusio bat dieselbe um die Erzählung ihrer Abenteuer.
Vielgeliebt erfüllte diese Bitte mit größter Anmut. Die Art, wie sie dieselben vortrug, nahm die ganze Gesellschaft für sie ein und als sie Trusio erzählte, dass sie durch die Kraft ihres Namens und ihres Zauberstabes so viele Wunder verrichtet habe, schrien alle vor Freude laut auf und allgemein bat man die Fee, ihr schönes Werk zu vollenden.
Trusio empfand ihrerseits ein außerordentliches Vergnügen über alles das, was sie vernahm, und schloss die Prinzessin zärtlich in ihre Arme. „Reizende Vielgeliebt“, sagte sie zu ihr, „da ich euch schon so nützlich gewesen, ohne euch zu kennen, so könnt ihr daraus schließen, um wie viel mehr ich mich jetzt beeifern werde, euch zu dienen, da ich euch kenne. Mein fliegender Wagen soll uns rasch nach der glücklichen Insel führen, wo ihr Beide die günstigste Aufnahme finden werdet."
Linda bat sie jedoch auf das Inständigste noch einen Tag bei ihr zu verweilen; sie machte ihnen die kostbarsten Geschenke, und die Prinzessin Vielgeliebt legte ihre Tigerhaut ab, und zog ein prächtiges Kleid an, welches ihrer Schönheit angemessener war.
Am andern Tage reisten sie ab. Trusio führte sie mitten durch die Luft nach der glücklichen Insel, wo sie von dem König und der Königin, welche jede Hoffnung, sie wieder zu sehen, aufgegeben hatten, mit unaussprechlicher Freude empfangen wurden. Die Reize, der Verstand und die Sittsamkeit der Prinzessin Vielgeliebt gaben ihr die Bewunderung und die Liebe Aller, und eben so fanden die trefflichen Eigenschaften des Prinzen Vielgeliebt den größten Beifall.
Mit großer Pracht wurde die Hochzeit vollzogen und der erste Sohn, welchen die Prinzessin Vielgeliebt ihrem Gemahl schenkte, erhielt den Namen Treulieb.
