MÄRCHEN AUS SPANIEN ...
VERZEICHNIS
"Der Schatz der Höhle von Son Creus"
"Der Schatz der Häuser von Aufabi"
"Der Raimund vom Pujol"
"Der Mann, der Bäume stutzte"
"Der Hirt von Galatzó"
"Das Gespenst von Concas"
"Das Gespenst vom Rafal"
"Das Gespenst der Bufera"
"Die Sage vom Prinz Achmed al Kamel, dem Liebespilger
"Der Zauberer Palermo"
"Die drei schönen Prinzessinen"
"Die Frau, die auszog, ihren Mann zu erlösen"
"Blancaflor, oder die Tochter des Teufels"
"Alarcos"
"Das Kettchen"
"Das Messmerchen"
"Der Falistroncos"
"Des Bockes"
"Das Mäuschen"
"Das Mönchlein"
"Der blinde Maure"
"Das Negerchen aus der Coma"
"Das Schloss der Rosen"
"Der alte Guayta"
"Der Anwalt und der Bauer"
"Der Hirte des Brunnens von Ses Basses"
"Der Lügensack"
"Der Magenpeter"
"Der Mann, der ein Esel wird"
"Der Mann, welcher den Schatz der Fátima suchte"
"Der rothhaarige Mann"
"Der Sklave, der entfloh"
"Der Sklave von Son Fé"
"Der Sklave Gabelli"
"Der Sklaven-Patron"
"Der Sklave mit den Ledersohlen"
"Der Sohn des Pächters von Son Forteza"
"Die Boyets-Teufel von Son Martí"
" Der Ziegenhirt der Plana"
"Der Wagen aus Gold"
"Die Dunkelheit gegen die Mauren"
"Die drei Brüder"
"Die Landung der Mauren"
"Die drei Ratschläge"
"Die Mauren, welche nach Son Jordi gingen"
"Die Feuerbläserin"
"Die Mauren, welche nach Sa Mesquida kamen"
"Des Turmes von Cañamel"
"Die Mauren des Castell von Santueri"
"Die Mauren des Castellêt"
"Die Mauren in der Höhle"
"Die Simoneta"
"Die Verzauberung der Fátima"
"Die Verzauberung im Borino-Brunnen"
"Die Wasserfrau"
"Wenn es Gott gefällt"
" Die zwölf Diebe"
"Die alte Frau mit der Lampe"
"Frau Fortuna und Herr Geld"
"Die Xorrigos-Quelle"
"Die drei Geisslein und das Ungeheuer"
"Die Waschfrau"
"Juan Hexenmeister"
"Der verzauberte Feigenbaum"
"Die Ritter vom Fisch"
"Des Teufels Schwiegermutter"
"Juan Holgado und Frau Tod"
"Die drei wundersamen Dinge"
"Die drei Wunder der Welt"
DIE DREI WUNDER DER WELT
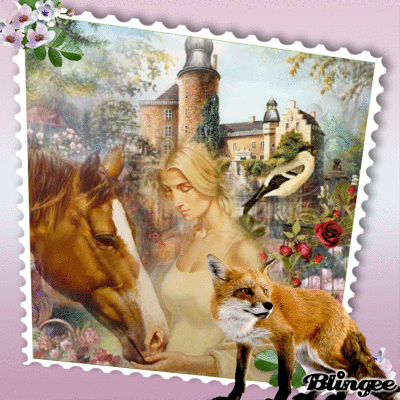
Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Als er alt und krank wurde, erklärten ihm die Ärzte, er könne nur genesen, wenn jemand ihm die drei Wunder der Welt herbeischaffe.
Der älteste Sohn sagte: »Vater, laß mich es versuchen.«
Und der Vater antwortete: »Nein, Sohn, das kann nicht sein. Du bist derjenige, der einmal die Krone erben wird.«
Der junge Mann gab aber so lange keine Ruhe, bis der Vater einwilligte und er sich auf die Suche begeben konnte. Als der älteste Sohn nach den drei Wundern der Welt ausschaute, kam er an einer Höhle vorbei, in der wohnten Diebe; die griffen sich ihn, zerrten ihn in die Höhle und hielten ihn dort gefangen.
Als nun der Älteste nach ziemlich langer Zeit noch nicht heimgekehrt war, sagte der Nächste: »Vater, mein Bruder kommt nicht zurück. Laßt mich ziehen und schauen, ob ich ihn finden und für Euch die drei Wunder der Welt mitbringen kann. «
Der Vater sagte: »Nein, mein Sohn, das kann nicht sein. Da dein Bruder nicht heimgekehrt ist, bist du derjenige, der einmal das Reich regieren wird.«
Aber der Mittlere bettelte so lange, bis der Vater auch ihm schließlich erlaubte, in die weite Welt zu ziehen.
Er sah sich hier und da um. Aber dann geschah mit ihm dasselbe wie mit dem Ältesten. Er kam zu eben dieser Höhle. Die Diebe griffen sich ihn und zerrten ihn hinein, und er traf seinen Bruder, den sie dort schon gefangen hielten.
So manches Jahr ging ins Land. Die beiden ältesten Prinzen waren immer noch nicht heimgekehrt, da trat der jüngste vor den Vater hin und sprach: »Vater, meine beiden Brüder sind verschollen. Erlaubt mir, daß ich nach ihnen suche und schaue, ob ich nicht für Euch die drei Wunder der Welt finde. «
»Unmöglich«, antwortete ihm der Vater. »Jetzt, da du es bist, der die Krone erben wird, lasse ich dich nicht in die weite Welt ziehen. «
Der jüngste bat und bettelte. Er sagte, König könne er immer noch werden, wenn seine Brüder nicht heimkämen und der Vater an seiner Krankheit sterben werde. Für einen angehenden König sei es gewiß von Nutzen, wenn er zuvor viel von der Welt gesehen habe.
Dagegen ließ sich schwer etwas einwenden, und also ließ der Vater am Ende auch den Jüngsten ziehen.
Er wanderte lange, ehe er eine Höhle erreichte, das war die Höhle der Luft. Eine alte Frau kam heraus. Das war die Mutter der Luft, und sie sprach zu ihm: »Sag mir, wer hat dich diesen Weg geschickt?«
Er antwortete: »Ich bin auf der Suche nach den drei Wundern der Welt. «
Und die alte Frau rief: »Sohn, da kommt der, welcher die drei Wunder der Welt sucht, um seinen Vater zu heilen.«
Und die Luft sprach: »Ich kann ihm dabei nicht helfen. E soll weiter ziehen. Nur mein Bruder, der Sonnenmann, dessen Strahlen überall hinreichen, kann so etwas wissen. Er soll meinem Bruder, dem Sonnenmann, sagen, ich hätte ihn geschickt, und er möge ihm doch bitte helfen, die drei Wunder der Welt zu finden. «
Am nächsten Tag brach der junge zur Höhle der Sonne auf.
Nachdem er viele Tage und Nächte gelaufen war, erreichte er diesen Ort und bat um ein Nachtquartier. Da kam wie der eine alte Frau heraus und sprach zu ihm: »Wer hat dich diesen Weg geschickt?«
Und er antwortete. »Ich bin ausgezogen, um die drei Wunder der Welt zu finden und um meinen Vater wieder gesund zu machen. Und bei der Luft war ich schon. Dort hieß es, der Sonnenmann solle mir den Weg weisen.«
Da hieß ihn die alte Frau, sich in einer Kiste verbergen, und sprach zu ihm: »Bleib da drinnen, denn sonst würde mein Sohn, der Sonnenmann, dich versengen. «
Dann kam der Sonnenmann und sprach: »Es riecht nach Menschenfleisch. Wo ist der Fremdling, damit ich ihn verbrennen kann?«
»Sohn«, sagte die alte Frau, »er ist ein armer Junge, der die drei Wunder der Welt sucht. Er ist von deinem Bruder, der Luft, hergeschickt worden ist. «
Darauf erwiderte der Sonnenmann: »Dann soll er hervorkommen, denn ich kann ihm auch nicht helfen. Den Weg zu den drei Wundern der Welt kann ihm nur meine Schwester weisen. Er soll weiterziehen und ihr sagen, daß ich ihn geschickt habe.«
Am nächsten Tag brach der junge zur Suche nach der Höhle der Mondfrau auf. Er reiste durch viele Königreiche, ohne daß er zu ihr gelangte, aber schließlich kam er nach vielen Tagen und den Nächten, die dazu gehören, doch an der Höhle der Mondfrau an.
Eine alte Frau trat heraus und sagte: »Nenn mir jene, die dich hierher geschickt haben?«
Er sagte: »Ich bin gekommen, um die drei Wunder der Welt zu suchen, die meinen Vater heilen können. «
Da sprach die alte Frau: »Gut, aber versteck dich dort in der Ecke, denn wenn meine Tochter, die Mondfrau, kommt und dich hier findet, würde sie dich verschlingen. «
Die Mondfrau kam leuchtend über den Himmel und rief: »Hier riecht es nach Menschenfleisch. Wo ist das Menschenkind? Ich will es verschlingen.«
Die alte Frau aber sprach: »Nicht doch, Tochter. Es ist doch nur ein armer Junge, den dein Bruder, die Sonne, geschickt hat. «
Und die Mondfrau sagte: »Wenn das so ist, wenn er nach den drei Wundern der Welt sucht, um seinen Vater zu heilen, dann soll er hervorkommen. Nur, mein Bruder, der König der Vögel, kann ihm verschaffen, wonach er sucht. Er zieht ständig durch die Welt. Der Junge soll zu ihm gehen und ihm sagen, daß ich ihn geschickt habe.«
Also brach der Junge am nächsten Tag wieder auf, er lief und lief, bis er zu der Höhle kam, in der der König der Vögel lebte.
Als eine alte Frau heraustrat, sprach sie: »Sage mir, wer dich geschickt hat? «
Darauf er: » Die Mondfrau schickt mich. Ich komme, um nach den drei Wundern der Welt zu suchen, damit will ich meinen Vater heilen, der schon lange schwer krank ist. «
Und die alte Frau antwortete ihm: »Stell dich dort in die Ecke, denn wenn mein Sohn, der König der Vögel, heimkommt und dich hier findet, wird er dich zum Abendessen fressen.«
Der König der Vögel kam und rief gleich: »Hier riecht es nach Menschenfleisch. Wo steckt das Menschenkind? Ich will es zum Abendessen verspeisen. «
»Nicht doch, Sohn«, sagte die alte Frau, »es ist doch nur ein armer Junge, den uns deine Schwester, die Mondfrau, geschickt hat, weil er nach den drei Wundern der Welt sucht.«
»Dann soll er wieder gehen, denn ich kann sie ihm auch nicht verschaffen«, sagte der König der Vögel, »dererlei wissen nur meine Untertanen, die überall herumkommen.«
Dann gingen sie alle schlafen.
Am nächsten Tag, sehr zeitig, wurde der Junge geweckt, und der König der Vögel sagte: »Ich werde jetzt ein paar Vögel von jeder Art rufen. Du stelle dich mitten unter sie und frage sie, wo du die Wunder der Welt finden kannst. Du mußt zu ihnen sagen: Ihr kleinen Vögel, die ihr auf der Welt überall hinkommt, könnt ihr mir bitte sagen, wo die drei Wunder der Welt zu finden sind? Wenn du das dreimal gesagt hast, und sie antworten nicht darauf, dann wissen sie es auch nicht.«
Alle Vögel, die der König gerufen hatte, kamen. Der Junge stellte sich unter sie und fragte dann dreimal: »Ihr Vögel, die ihr überall hinfliegt, sagt mir, wißt ihr, wo ich die drei Wunder der Welt finden kann?«
Keiner der Vögel antwortete, denn sie wußten es nicht. Der lahmende Adler war noch nicht da. Als er endlich eintraf, fragte ihn der König der Vögel: »Kleiner Adler, warum hat es bei dir so lange gedauert?«
Und der Adler sprach: »Weil ich von den drei Wundern der Welt gefressen habe.«
Da sagte der König der Vögel zu dem Jungen: »Hier kommt endlich einer, der dir den Weg zu den drei Wundern der Welt weisen kann. «
Und er fragte den lahmenden Adler: »Traust du dir zu, diesen Jungen dorthin zu bringen, wo er die drei Wunder der Welt finden kann?«
Der Junge stieg auf den Rücken des Adlers, und auf der anderen Seite des Meeres setzte der Vogel den Jungen auf den Weg zu einem Schloß ab und sprach zu ihm: »In diesem Schloß wirst du die drei Wunder der Welt finden. «
Der Junge brach allein in Richtung auf das Schloß auf. Er wanderte dahin, bis er an ein kleines Haus kam. Er klopfte an die Tür, eine Frau kam heraus und fragte, was er wolle. Als der Junge ihr sagte, er suche ein Nachtlager und sei im übrigen auf der Suche nach den drei Wundern der Welt, sagte ihm die Frau: »Eine gute Unterkunft findest du hier schon, aber die Sache hat einen Haken.«
»Und der wäre? «
»Vor drei Tagen ist mein Mann gestorben. Die Leiche liegt immer noch unter der Treppe. Ich habe nicht die fünf Duros, um die Beerdigung zu bezahlen.«
Da sagte der Junge: »Hier hast du zweihundert Reales, das wird für ein ordentliches Begräbnis reichen.«
Also wurde der Mann begraben, der Junge kam zu einem Nachtlager, und am nächsten Tag schlug er den Weg zum Schloß ein.
Als er nun endlich am Schloßtor ankam, strich ein Fuchs heran und sagte zu ihm: »Schau in die große Halle. Dort findest du einen Vogel, einen Käfig, eine Frau und Kleider. In einem Stall etwas weiter entfernt steht ein Pferd. Nimm von all diesen Dingen nur eines. «
Der junge betrat ganz glücklich die Halle und sah, daß der Fuchs ihn nicht getäuscht hatte. Er wollte den Vogel nehmen und den Käfig stehen lassen, da begann der Käfig zu sprechen und sagte zu ihm: »Was willst du mit einem Vogel ohne einen Käfig?«
Er rannte also mit Käfig und Vogel davon, doch ein Riese, der das Schloß bewachte, wurde auf ihn aufmerksam und rief: »Achtung und Alarm. Hier ist einer, der die drei Wunder der Welt stehlen will. «
Da kamen Soldaten, ergriffen den Jungen und warfen ihn in ein Verließ; sie schlugen ihn und trieben Löwen in den Raum, damit sie ihn auffressen. Als er nun dort saß, kam wieder der Fuchs und sprach: »Habe ich dir nicht gesagt, du solltest von den Dingen nur eines nehmen? Denke daran, ich kann dir nur dreimal helfen, dann aber nicht mehr.«
Er half ihm aus dem Kerker und sagte ihm, er solle diesmal unbedingt so verfahren, wie er es ihm geraten habe. Der Junge kam wieder zurück ins Schloß und wollte die Frau mitnehmen, die aber sagte: »Willst du mich ohne Kleider hier fort holen?«
Da griff er sich auch die Kleider, aber als er durch die Tür hinauswollte, stand da wieder der Riese und brüllte, wie er schon zuvor gebrüllt hatte: »Achtung und Alarm, jemand will uns die Wunder der Welt stehlen.«
Und wieder ergriffen die Wachen den Jungen. Sie verprügelten ihn, warfen ihn in den Kerker und trieben die Löwen herein. Wieder erschien das Füchslein und sagte: »Nun kann ich dir nur noch einmal helfen. Geh jetzt in, den Stall und nimm das Pferd, aber nicht den Sattel.«
Der Junge tat wie ihm geheißen, und der Sattel sprach: »Warum nimmst du das Pferd und läßt mich zurück?«
Er führte das Pferd ungesattelt hinaus, und draußen standen schon der Käfig mit dem Vogel und die Frau in ihren Kleidern. Und er ritt mit dem Pferd, der Frau und dem Vogel davon, und dies waren die Wunder der Welt.
Auf der Straße heimwärts traf er seine beiden Brüder. Als sie sahen, daß er die drei Wunder der Welt bei sich trug, nahmen sie sie ihm fort und ließen ihnen mutterseelenallein zurück. Sie gingen zu ihrem Vater, gaben ihm die drei Wunder, und er wurde geheilt. Der Vater fragte sie, ob sie etwas von ihrem jüngeren Bruder gehört hätten. Da erwiderten sie, nachdem, was ihnen zu Ohren gekommen sei, treibe er sich in der Welt herum, stehle und töte. Der Vater gab Befehl, ihn zu fangen und ihn heimzubringen, lebendig oder tot. Man fand ihn. Aber daheim wurde er gleich in den Kerker geworfen, und da die Brüder behaupteten, er sei ein Dieb und ein Mörder, sollte er gehängt werden. Da zeigte sich das Füchslein in der Gestalt eines Mannes und klärte den König darüber auf, wer tatsächlich die drei Wunder der Welt gefunden hatte.
Da erzählte der jüngste Sohn dem Vater, was er alles erlebt hatte, wie die beiden anderen Brüder ihn auf der Landstraße getroffen und ihm die drei Wunder fortgenommen hätten. Der Fuchs, der in Menschengestalt erschienen war, erklärte, er sei jener Tote, dessen Frau der jüngste Sohn das Geld für das Begräbnis gegeben habe. Da der Junge ihm geholfen habe, in der Erde seine Ruhe zu finden, sei er ihm in der Not auch zu Hilfe gekommen. Nun aber dürfe er nicht länger auf der Erde verweilen.
Kaum hatte er das gesagt, war er auf der Stelle verschwunden.
Der Vater sagte seinem Jüngsten, er werde seine beiden älteren Brüder enterben, denn es hatte sich ja erwiesen, daß sie böse waren und Lügner dazu. Und also bekam der Jüngste die Krone und das Reich. Die Frau, die er aus dem Zauberschloß mitgebracht hatte, heiratete er.
Sie wurden glücklich, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch.
Quelle: Andalusische Märchen
DIE DREI WUNDERSAMEN DINGE
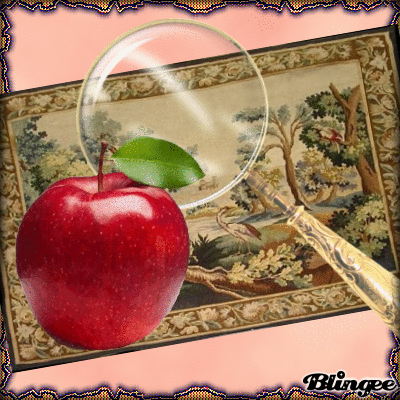
Es waren einmal drei Brüder, drei Prinzen und der älteste von ihnen wollte seine Cousine heiraten. Ihr Vater, der König jedoch stellte zur Bedingung, daß alle drei gleichzeitig heirateten. So
rief der König die drei zu sich und fragte sie, wer ihre Braut sein sollte. Alle drei antworteten: ihre Cousine.
Daraufhin schickte der König sie fort in andere Städte, damit sie Dinge mit nach Hause brächten, die man noch nie gesehen hatte. Wer das Beste mitbringen würde, sollte die Cousine zur Frau
bekommen.
So machten sich die drei Brüder auf den Weg in eine andere Stadt. Dort trafen sie auf einen Händler, der ihnen einen Teppich zeigte. Einer der Prinzen sagte: "In unserer Stadt gibt es viel
schönere Teppiche als diesen, wozu sollten wir ihn kaufen."
"Sicher gibt es schönere als diesen", sagte der Mann, "aber kein anderer Teppich kann, was dieser vermag. Man sagt einfach nur: "Bring mich nach da und da" und schon ist man dort. Ich kann es
Euch beweisen. Kommt her!
Die drei Jünglinge und der Händler traten auf den Teppich und er sagte: "Teppich, bring uns in eine andere Stadt, bring uns hin und wieder zurück." Gleich darauf waren sie in einer anderen Stadt
und einen Moment später wieder zurück. Kaum waren sie zurück, kaufte der älteste der Brüder den Teppich.
Am folgenden Tag trafen sie auf einen Händler, der eine Lupe verkaufte. Sie sagten: "Zeig uns deine Lupe. Wozu taugt sie?"
"Wenn man jemanden sehen möchte, der gerade in einer entfernten Stadt ist, hält man sie einfach in diese Richtung und kann die entsprechende Person sehen. Schaut hindurch!" Er hielt die Lupe in
die Richtung, in der sein Bruder wohnte und alle sahen seinen Bruder. Der zweite der Prinzen kaufte die Lupe.
Am darauffolgenden Tag trafen sie auf einen Händler mit einem Apfel. "Sag, was vermag dein Apfel?"wollten die Brüder von ihm wissen. "Dieser Apfel kann einen Toten wieder zum Leben erwecken, sogar zwei bis drei Tage nachdem er gestorben ist. Man steckt ein Stück des Apfels in seine Nase, und er wird wieder lebendig. Ich kann es euch zeigen."
Ein Tag und eine Nacht zuvor war in dieser Stadt die Frau eines reichen Mannes gestorben. Man hatte sie noch nicht begraben, da man noch wartete, bis die Verwandten aus einer anderen Stadt eintrafen. Sie gingen zu dem Mann und baten ihn, seine Frau wiederbeleben zu dürfen. Der Mann war einverstanden. So beugte sich der Händler über die Verstorbene und steckte ihr ein Stück von dem Apfel in die Nase. Daraufhin öffnete sie die Augen und erhob sich. Der jüngste Bruder kaufte den Apfel.
Kurz darauf schauten sie durch die Lupe und sahen ihre Stadt, sie sahen alle ihre Verwandten und sahen auch, wie ihre Cousine auf dem Sterbebett lag und ihre Augen für immer schloß. "Steigt auf
den Teppich", sagte der älteste Bruder, "damit wir noch vor der Beerdigung zu Hause sind."
Im Handumdrehen waren die drei bei ihrer verstorbenen Cousine. Nun steckte der jüngste der Brüder ihr ein Stück seines Apfels in die Nase. Daraufhin erwachte sie zu neuem Leben.
Nachdem ein paar Tage vergangen waren, rief der König seine Söhne zusammen, um herauszufinden, wer das beste Stück mitgebracht hatte und die Cousine heiraten sollte.
Der Älteste sagte: "Ich habe diesen Teppich mitgebracht. Mit seiner Hilfe konnten wir in Windeseile hier sein."
"Mit Hilfe meiner Lupe haben wir gesehen, daß unsere Cousine gestorben ist", sagte der Mittlere.
"Mit diesem Apfel konnte ich unsere Cousine wieder zum Leben erwecken", sagte der Jüngste.
"Alle drei Dinge sind gleich wichtig", sagte der König. "Ohne die Lupe hättet ihr nicht gewußt, daß eure Cousine gestorben ist, ohne den Teppich wäret ihr nicht so schnell hier gewesen und ohne
den Apfel wäre sie nicht wieder erwacht."
Dem König gelang es nicht, eine Entscheidung zu treffen. So beschloß er, einen Rat einzuberufen. Er rief die weisesten Männer zu sich, um sich von ihnen beraten zu lassen.
Der Älteste empfahl dem König, einen Bogen und drei Pfeile zu kaufen. Der Reihe nach sollte nun jeder der drei Söhne einen Pfeil abschießen und wer am weitesten schoß, sollte die Cousine heiraten. So tat es der König. Er kaufte einen Bogen und drei Pfeile und sagte zu seinen Söhnen: "Morgen wird sich entscheiden, wer die Cousine heiratet, nämlich der, dessen Pfeil am weitesten fliegt." Der älteste der Brüder schoß zuerst. Sein Pfeil flog ungefähr dreihundertfünfzig Yard weit. Danach war der mittlere Bruder an der Reihe, aber sein Pfeil erreichte nicht den des Bruders.
Nun schoß der Jüngste seinen Pfeil ab. Der Pfeil flog über die der beiden Brüder hinweg bis in die Berge, wo er verschwand und nicht mehr zu sehen war. Drei, vier Tage lang suchten sie den Pfeil in den Bergen. Da sie ihn nicht fanden, beschloß der König, den ältesten Sohn mit der Cousine zu verheiraten, da sein Pfeil weiter geflogen war als der des mittleren Bruders. Die beiden anderen Brüder sollten sich eine andere Frau auswählen.
"Nein, Vater", sagte der Jüngste, "ich werde nicht heiraten. Sollen meine Brüder heiraten, ich aber werde meinen Pfeil suchen." Zwei, drei Tage nach der Hochzeit seiner Brüder brach er auf, seinen Pfeil zu suchen. Während dieser Pfeil durch die Luft flog, angelte ihn sich eine Fee und nahm ihn mit. Der Prinz wanderte bereits zwei Tage. Er schlief in den Bergen. Als er am dritten Tag aufbrach, dauerte es nicht lange und er kam zu einer Felswand, in der sein Pfeil steckte. Nur mit viel Mühe konnte er ihn herausziehen. In der Nähe der Felswand stieß er auf einen Weg. Nachdem er ein Stückchen gelaufen war, gelangte er an einen Fluß. Gerade als er sich über das Wasser beugte, um etwas davon zu trinken, rief ihm die Fee zu: "Trink das Wasser nicht so. Es kann deinen Augen schaden. Ich bringe Dir einen Becher, aus dem du trinken kannst." Sie ging ihm einen Becher holen. Nachdem er das Wasser getrunken hatte, fragte sie ihn, was er hier machte. Er erzählte ihr, was geschehen war und warum er hier war.
Darauf antwortete sie: "Ich habe diesen Pfeil hierhergebracht, weil ich möchte, daß du mein Mann wirst. Wenn du einverstanden bist, werde ich deine Frau."
Er stimmte zu. Am darauffolgenden Tag heirateten sie. Anschließend sagte sie ihm: "Morgen werde ich meinen Bruder rufen, um ihm zu sagen, daß ich dich geheiratet habe. Aber du darfst dich nicht
vor ihm erschrecken. Er sieht furchterregend aus. Er ist sieben Fuß hoch und hat einen fünfundzwanzig Fuß langen Bart. Aber erschrick nicht vor ihm, wenn du dich doch erschreckst, wird er dich
töten."
Am nächsten Morgen stand sie auf und machte Rauch. Mit Hilfe von Stöcken erzeugte sie eine gewaltige Rauchsäule, die zum Himmel heraufstieg. Auf diese Weise konnte sie ihren Bruder rufen. Kaum
war der Rauch aufgestiegen, erschien ihr Bruder.
"Ich habe dich gerufen, um dir zu sagen, daß ich geheiratet habe."
"Gut, Du hast also geheiratet, aber ich hoffe nicht, so einen Feigling, der stirbt, wenn er mich sieht, so daß du nicht noch einmal Witwe wirst. Ruf nun Deinen Mann. Ich möchte ihn kennenlernen."
Sie rief ihn und er erschien. Der Bruder fragte: "Ist er das? Er scheint ein wirklicher Mann zu sein. Ich bin froh, deinen Mann kennenzulernen. Er scheint ein wirklicher Mann zu sein. Er hat sich nicht vor mir gefürchtet." Er wandte sich dem Schwager zu: "Wann immer du meine Hilfe brauchst, werde ich da sein." Danach verschwand der Bruder.
Es verging ungefähr ein Monat. Der Prinz bekam Sehnsucht nach seinen Eltern, die er, seit er losgelaufen war, nicht mehr gesehen hatte. Als seine Frau spürte, was mit ihm los war, sagte sie ihm:
"Wenn du möchtest, geh deine Eltern besuchen. Ich werde alles vorbereiten, daß du übermorgen gehen kannst."
In der Stadt, in der der König lebte, gab es eine Hexe, die bereits wußte, daß der Prinz die Fee geheiratet hatte und dies dem Königspaar erzählte.
Der Prinz machte sich auf den Weg. Nach zwei Tagen erreichte er die Stadt seiner Eltern. Der König und die Königin freuten sich sehr, ihren Sohn wiederzusehen. Der König fragte ihn: "Wie ist es
dir ergangen? Du hast geheiratet?"
"Ja, da, wo mein Pfeil gelandet ist, habe ich geheiratet."
Da trat die Hexe zum König und sagte ihm: "Erzähl deinem Sohn, daß du sehr krank bist und nur das Singende Wasser dich retten kann. Bitte ihn, dir dieses Wasser zu bringen."
"Gut", sagte der Sohn, "ich kenne dieses Wasser nicht, aber ich werde losgehen und es dir bringen, wenn ich es finde. Finde ich es nicht, liegt mein Schicksal in deinen Händen."
"Bring mir dieses Wasser. Nur so kann ich wieder gesund werden."
Der Prinz ging zurück zu seiner Frau und erzählte ihr, worum ihn der Vater gebeten hatte.
"Mach dir deswegen keine Sorgen. Laß die Zeit herankommen und du wirst dieses Wasser finden", antwortete sie ihm. Als es soweit war, sagte sie ihm: "Töte einen Hammel und teile ihn in zwei
gleichgroße Teile. Dann mach dich auf den Weg zum Singenden Wasser. Aber gib acht. Es wird von einem Löwen und einem Tiger bewacht. Wirf beiden Tieren je eine Hälfte des Hammels zu. Während sie
das Fleisch verzehren, kannst du das Wasser holen." Genauso tat es der Prinz und kam mit dem Wasser zurück. Am nächsten Tag brachte er dem Vater das Wasser.
Daraufhin wurde der König schnell wieder gesund.
Abermals kam die Hexe zum König und sagte ihm: "Nun bitte deinen Sohn, dir ein Zelt zu bringen, in dem ein ganzes Heer Platz hat und das in einen gewöhnlichen Rucksack paßt."
"Nun", sagte der König, " bring mir ein Zelt, in dem ein ganzes Heer Platz hat und das in einen gewöhnlichen Rucksack paßt. Du hast zehn Tage Zeit dazu."
Wieder ging der Prinz zurück zu seiner Frau und erzählte ihr, was der Vater von ihm verlangte.
"Es ist nicht unmöglich", sagte sie, "aber dein Vater wird dich somit in den Ruin stürzen." Das alles liegt nur an dieser Hexe, sie will dich kaputtmachen. Aber mach dir keine Sorgen. Zünde ein
Feuer im Hof an und wirf feuchte Zweige darein, um meinen Bruder zu rufen. Er hat dir seine Hilfe versprochen und dieses Mal wirst du sie benötigen."
Er zündete das Feuer an und bald stieg Rauch auf. Etwas später erschien der sieben Fuß hohe Mann mit dem fünfundzwanzig Fuß langen Bart und fragte: "Was ist los, Bruder?"
"Ich habe dich gerufen, weil ich deine Hilfe brauche. Mein Vater bat mich, ihm das Singende Wasser zu bringen und ich brachte es ihm. Aber jetzt verlangt er von mir ein Zelt, in dem ein ganzes
Heer Platz hat und das in einen gewöhnlichen Rucksack paßt."
"Mach dir deswegen keine Sorgen", beruhigte ihn der Schwager. "Ich kann dir dieses Zelt besorgen." Der Schwager blieb über Nacht bei den beiden. Am nächsten Morgen übergab er dem Prinzen das
Zelt. Dieser brach auf und brachte es seinem Vater.
Wieder drang die Hexe ins Königshaus ein. Diesmal redete sie dem König ein, er solle von seinem Sohn verlangen, daß er ihm den sieben Fuß hohen Mann mit dem fünfundzwanzig Fuß langen Bart
brächte, um ihn kennenzulernen. So sagte der König seinem Sohn: "Nun möchte ich, daß du mir den sieben Fuß hohen Mann mit dem fünfundzwanzig Fuß langen Bart bringst. Ich möchte ihn kennenlernen."
"Nun gut, ich gehe ihn holen."
Zuhause angekommen, erzählte er seiner Frau, was sein Vater diesmal verlangte. Daraufhin sagte sie: "Dein Vater will dich in den Ruin stürzen. Diesmal geht es um meinen Bruder. Nun gut, rufe ihn
übermorgen, und sag ihm, wonach dein Vater verlangt."
Wieder machte er ein Feuer und nach Kurzem erschien der sieben Fuß hohe Mann.
"Was gibt es? Warum habt ihr mich gerufen?"
"Ich habe meinem Vater das Zelt gebracht und er war zufrieden damit. Doch nun will er, daß ich ihm den sieben Fuß hohen Mann mit dem fünfundzwanzig Fuß langen Bart bringe."
"Nun", sagte der Schwager, "Wann willst du losgehen? Ich bin bereit. Dein Vater hat vor, uns beide zu erschießen. Das hat ihm diese Hexe eingeredet. Ich bin bereit. Ruf mich, wenn du gehen
möchtest."
Als es soweit war, rief der Prinz seinen Schwager. Noch bevor sie in der Stadt des Königs ankamen, rief man dem König zu: "Da kommen dein Sohn und dein Schwager."
Die Kanonen waren schon aufgestellt, um sie anzugreifen. Die Kanonenschüsse fielen und wo die Kugeln landeten, entstanden Berge aus Stahl, aber sie trafen nicht die beiden. Dafür vernichteten die
beiden die gesamte Armee. Alle außer der Hexe kamen ums Leben. Schließlich schlug der Schwager die Hexe entzwei, so daß sie auch starb. Danach kehrten der Prinz und der sieben Fuß hohe Mann heim.
Quelle: Unbekannt Märchen aus Spanien
JUAN HOLGADO UND FRAU TOD
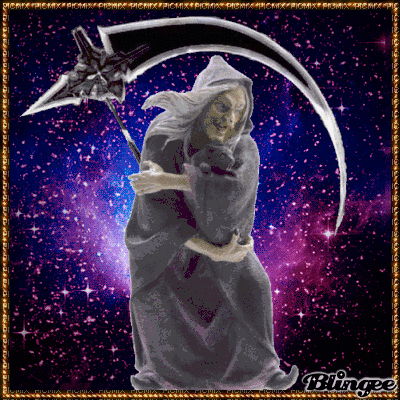
Meine Herren! Ihr sollt wissen, daß es einmal einen Mann gab, der Juan Holgado hieß. Sein Name paßte ihm aber sehr schlecht, denn da er arm war, besaß er Morgens und Abends nur drei Pfennige Hunger und drei Pfennige Mangel.
Eines Tages sagte Juan Holgado zu seiner Frau: "Unsere Kinder sind eine Rotte Freßmäuler, und im Stande, das Brot sammt dem Ofen, wo es bäckt, zu verschlingen. Ich möchte wohl einmal einen Hasen essen, aber ohne diese Raubvögel, die mir den Bissen aus dem Munde nehmen."
Seine Frau, die herzensgut war, verkaufte ein Dutzend Eier, die ihre Hühner gelegt hatten, und kaufte einen Hasen, bereitete ihn zu, und sagte am andern Morgen zu ihrem Manne: "Dort im Topfe steht ein Hase für Dich und daneben liegt Brot: gehe auf's Feld, verzehre ihn und laß ihn Dir gut bekommen." Juan Holgado war nicht taub, er nahm den Topf und das Brot und begab sich damit fort.
Nachdem er anderthalb Meilen gegangen war, setzte er sich unter einem Olivenbaum zufriedener als ein König nieder, befahl sich der heiligen Jungfrau der Einsamkeit und begann sein Mittagsmahl. - Doch ohne zu wissen, wie und woher sie gekommen, stand plötzlich eine alte Frau mit schwarzem Kleide und so häßlich wie ein falscher Schwur vor ihm und setzte sich ihm gegenüber hin. Sie war so gelb und trocken wie ein Pergament von Simancas; die Augen lagen ihr tief im Kopf und waren erloschen wie eine Nachtlampe, der es an Oel fehlt; der Mund war groß wie eine große Tasche, und was Nase anbetrifft, hatte sie gar keine, selbst keine Spur davon.
Dieser ungerufene Gast kam Juan Holgado nicht im Geringsten angenehm, aber er konnte die Gesellschaft nun nicht vermeiden und da er kein Grobian war, so fragte er, ob sie an seiner Mahlzeit teilnehmen wolle. Die Alte, die nichts sehnlicher wünschte, antwortete, um nicht unhöflich und undankbar zu sein, nehme sie seine Einladung an, und fing an zu essen. Meine Herren! Das war aber kein Essen, sondern ein Schlingen, denn eins, zwei, drei, saß ihr der ganze Hase zwischen Rücken und Brust.
Wäre es nicht viel besser gewesen, dachte seufzend Juan Holgado, daß ich den Hasen ruhig zu Hause mit Weib und Kindern verzehrt hätte und nicht die Teufelsalte?
Als die Alte fertig war und selbst den Schwanz vom Hasen verschlungen hatte, sagte sie: "Juan Holgado, Dein Hase hat mir sehr gut geschmeckt."
"Das hab' ich wohl gemerkt!" antwortete Juan Holgado.
"Ich will Dir Deine Artigkeit vergelten."
"Lebt tausend Jahre," antwortete trocken Juan Holgado.
"Das werd' ich wohl," erwiederte die Alte, "denn Du mußt wissen, daß ich der Tod in eigener Person bin."
Juan Holgado fuhr zusammen, als wenn vor seinen Ohren ein Kanonenschuß abgeschossen worden wäre.
"Erschrecke nicht," fuhr die Alte fort, "ich werde Dich nicht mitnehmen. Um Dir aber Deine Aufmerksamkeit zu vergelten, will ich Dir einen Rat geben. Werde Arzt, und ich werde dafür sorgen, daß es bald keinen andern geben wird, der mehr Ruhm und Geld gewinnen soll als Du."
"Gnädige Frau Tod, ich bin schon ganz zufrieden und werde es Ihnen danken, wenn Sie sich meiner recht lange nicht erinnern. Was das Arztwerden betrifft, so paßt das nicht für mich."
"Warum denn nicht?"
"Weil ich keine feinen Studien gemacht habe."
"Das tut nichts."
"Ich weiß weder Griechisch, noch Latein."
"Ganz gleich."
"Gnädige Frau, ich kann ja nicht einmal schreiben, weil mir der Puls zittert, und auch nicht lesen, weil mir das Schwarze auf dem Papier im Wege ist."
"Noch Eins!" rief die Frau Tod, welche über alle diese Bedenklichkeiten ärgerlich wurde. "Potztausend, Juan Holgado, Dein Kopf ist wirklich bombenfest; hörst Du denn nicht, daß ich Dir sage, das tue Alles nichts? Ich sage Dir, daß ich mir gar nichts aus der Gelehrsamkeit der Doctoren mache. Ich komme und gehe nicht nach ihrem Willen, sondern nach meinem; und ganz wie und wann es mir beliebt, kriege ich Einen von Euch beim Ohr und nehme ihn mit, ohne mich um die Doctoren zu kümmern. Als die Welt bevölkert wurde, gab es noch keine Doctoren und deshalb ging auch damals alles schnell und gut; seitdem aber die Aerzte erfunden sind, sind keine Methusalems mehr vorhanden. Du sollst Arzt sein, auf meine Ehre, und wenn Du Dich weigerst, so nehme ich Dich mit, so wahr zwei und drei fünf sind. - Nun schweige und höre mich an: Du sollst in Deinem Leben dem Kranken nichts Anderes als klares Brunnenwasser verschreiben, hast Du gehört?"
"Ja, ich hör' es," antwortete Juan Holgado, der so ärgerlich auf die Frau Tod war, daß er ihr lieber eine Ohrfeige gegeben, als sie noch weiter angehört hätte.
"Wenn Du in's Zimmer des Kranken trittst und mich am Kopfende des Bettes sitzen siehst, so sage nur bestimmt heraus, daß er stirbt und daß er sich dazu vorbereite. Siehst Du mich aber nicht da, so versichere, der Kranke werde wieder gesund, und verschreibe ihm Wasser." Bei den letzten Worten machte die häßliche Dame eine französische Reverenz und empfahl sich.
"Gute Frau," rief ihr Juan Holgado nach, "ich möchte mich nicht von Euch mit dem gewöhnlichen 'Auf Wiedersehen' verabschieden und hoffe, daß Ew. Gnaden auch nicht den Wunsch hegen, mich wieder zu besuchen, denn ich habe nicht immer Hasen, um Sie zu bewirten."
"Mach' Dir keine Sorge, Juan Holgado," - antwortete die Alte; "so lange Du nicht Deine Wohnung zusammenfallen siehst, werde ich nicht zu Dir kommen."
Juan Holgado kehrte nach Hause zurück und erzählte seiner Frau alles, was ihm begegnet war. Seine Frau, die klüger war als er, meinte, daß er nur alles, was ihm die Frau Tod gesagt, glauben könnte, denn nichts sei auf der Welt wahrhafter und zuverlässiger als der Tod. Darauf ging sie im ganzen Dorfe herum und kündigte an, daß ihr Mann der beste Arzt unter den Sternen sei, dergestalt, daß er gleich auf den ersten Blick erkenne, ob der Kranke leben oder sterben werde.
Eines Nachmittags stand eine Menge junger Dirnen vor der Tür eines Hauses, als Juan Holgado vorüberging.
"Seht doch Juan Holgado," sagte eine von ihnen, "der sich auf einmal noch in seinem Alter vor uns für einen Arzt ausgeben will!"
"Er ist wohl verrückt oder will uns zum Besten haben."
"Hat sich der Narr eingebildet, daß er nur eine Sache zu sagen braucht, damit man sie glaube? Es ist pure Eitelkeit, er will, daß man ihn Don nenne und der Don paßt ihm, wie dem Esel der Dreimaster."
"Wir wollen doch diesen aufgeblasenen Narren einmal anführen," sagte wieder eine Andere; "ich stelle mich krank, und was gilt's, er glaubt es?"
Gesagt, getan. Sie ließen einen großen Korb Cactusfeigen, davon sie gegessen hatten, vor der Tür stehen und im nu lag die, die den Spaß ausgedacht hatte, im Bett und stöhnte Ach und Weh, daß es bis zum Himmel scholl.
Die andern unterdrückten das Lachen und liefen schnell zu Juan Holgado, um ihn herbeizuholen. Er folgte ihnen sogleich und bemerkte vor dem Hause die große Menge von Cactusschalen. Im Zimmer der Kranken war das Erste, was sich seinen Augen darbot, die Frau Tod, die ganz ernst am Bett des Mädchens saß.
"Die Kranke ist sehr schwach," sagte Juan Holgado, "und stirbt."
"Was hat sie denn?" fragten die andern Mädchen, die sich des Lachens nicht enthalten konnten.
"Sie hat," erwiederte Juan Holgado, "zu viel Cactusfeigen gegessen, die sie nun nicht verdauen kann und wovon sie keinem mehr etwas erzählen wird."
Zwei Stunden darauf stand das Mädchen vor Gott. - Nun mögt Ihr Euch selbst vorstellen, meine Herren, welchen Ruf dies Ereigniß dem Juan Holgado gab! Es gab bald in der ganzen Gegend keinen Kranken und keine ärztliche Consultation mehr, dazu man nicht Juan Holgado berufen, und so gewann er so viel Geld, daß er gar nicht wußte, was er damit anfangen sollte. Er kaufte seinen Söhnen Sterne, die man vorn, und Schlüssel, die man hinten trägt. Was ihn aber selbst anlangte, wollte er nicht solchen Flitter, sondern strebte mehr nach einem behäbigen Leben. So kam es, daß er so dick wurde und so gut aussah, daß es ein wahres Vergnügen war, ihn anzusehen. Sein Gesicht war so rund und voll wie die liebe Gottessonne, seine Beine wurden wie Säulen und sein Bauch wie die halbe Kirchkuppel. Während dessen pflegte Juan Holgado sehr eifrig sein Haus. Ritzten die Kinder etwas an der Wand, so ritzte ihnen der Vater zur Strafe in die Haut. Immer hielt er Baumeister, die das Haus in gutem Stande erhalten mußten, eingedenk der Worte der Frau Tod, daß sie ihn nicht besuchen werde, so lange sein Haus nicht baufällig sei.
Doch die Jahre, die je mehr bergunter, desto schneller laufen, brachten nichts Gutes mit sich. Juan Holgado machte ihnen schlechte Miene und um sich zu rächen, nahm ihm nun das eine die Haare, das andere die Mundwerkzeuge, ein drittes bog ihm das Rückgrat krumm, und noch ein anderes schenkte ihm ein lahmes Bein.
Eines Tages ward er bettlägerig und Frau Tod ließ ihn durch eine Fledermaus grüßen, was dem Juan Holgado gar nicht scherzhaft vorkam. Eines andern Tages bekam er den Altenhusten und Frau Tod ließ ihm durch eine Eule sagen, daß sie ihn bald besuchen werde. Juan Holgado sagte der Eule, sie solle sich fortscheeren. Am folgenden Tage hatte er eine Ohnmacht und Frau Tod ließ ihm durch das Heulen seines Hundes ankündigen, daß sie schon auf dem Wege sei. Juan Holgado warf im Aerger mit der Krücke nach dem Hunde. Aber was half es. Es wurde immer schlimmer mit ihm und Frau Tod klopfte endlich selbst an die Tür. Schnell ließ Juan Holgado die Thür verschließen und verriegeln, aber Frau Tod huschte durch das Schlüsselloch und nun war sie da.
"Frau Tod," sagte Juan Holgado mit einem sauren Gesicht, "habt Ihr mir nicht gesagt, daß Ihr nicht kommen würdet, so lange mein Haus nicht baufällig würde? Ich habe deshalb trotz Eurer Boten Ew. Gnaden gar nicht erwartet."
"Ei was," antwortete Frau Tod, "hast Du nicht Deine Kräfte verloren, sind Dir nicht Zähne und Haare ausgefallen? Dein Körper ist Dein Haus."
"Das wußte ich nicht," sagte der Kranke, "und deshalb macht mich Eure Ankunft bestürzt."
"Desto schlimmer für Dich, Juan Holgado," - entgegnete Frau Tod, "denn derjenige, der immer vorbereitet ist, erschrickt nicht, wenn ich komme. Aber Ihr Lebenden seid blind, wenn Ihr nicht einseht, daß Ihr geboren werdet, um zu leiden, und sterbt, um zu ruhen."
Quelle: Spanische Volks- und Kindermärchen
DES TEUFELS SCHWIEGERMUTTER
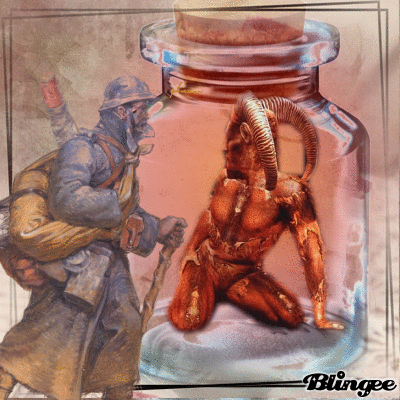
Es lebte einmal in einem Orte, Bauerndorf genannt, eine alte Wittwe, so häßlich wie der Sergeant von Utrera, der vor Häßlichkeit barst, so mager und dürr wie Spartgras, so alt wie das "zu Fuß gehen" und so gelb wie das gelbe Fieber. Dabei hatte sie einen so unerträglichen Charakter, daß selbst der geduldige Hiob es mit ihr nicht hätte aushalten können. Man hatte sie Frau Holofernes genannt, und kaum zeigte sie ihren Kopf an der Tür, so liefen alle Gassenbuben. - Die Frau Holofernes war so reinlich wie das Wasser und so tätig und häuslich wie eine Ameise und hatte deshalb viel Aerger mit ihrer Tochter Panfila, die so faul und träge war und dem Gevatter "Unbeweglich" so ergeben, daß kein Erdbeben im Stande gewesen wäre, sie von der Stelle zu bringen.
Frau Holofernes schalt und brummte deshalb jeden Tag von dem Augenblick an, wann Gott das Licht sandte, bis zum Abend, wann er es wieder zurücknahm. "Du bist," sagte sie zu ihrer Tochter, "so schlaff und locker wie holländischer Taback, und um Dich aus dem Bette zu bringen, wären ein Paar Ochsen nötig; Du läufst vor der Arbeit wie vor der Pest und kennst kein anderes Vergnügen, als wie der Affe am Fenster zu sitzen; und verliebt bist Du wie Cupido; aber ich werde es Dir schon beibringen, grader zu gehen als eine Spindel und schneller als der Wind!" Als Panfila das hörte, stand sie gähnend auf, reckte und streckte sich und trat, ohne daß die Mutter es bemerkte, an's Fenster.
Währenddessen kehrte Frau Holofernes emsig die Stube und begleitete das Scharren des Besens mit diesen und ähnlichen Selbstgesprächen:
"Zu meinen Zeiten arbeiteten die Mädchen wie Maultiere." Der Besen ging risch, rasch. "Lebten eingezogen wie Nonnen." Risch, rasch. "Heutzutage sind sie wie toll und verrückt," risch, rasch; "faulenzen," risch, rasch; "denken nur an die Liebhaber," risch, rasch; "und das sind alle miteinander Taugenichtse," risch, rasch - bei den letzten Worten gewahrte sie die Tochter am Fenster und im schnellsten Nu machte der Besen ein kräftiges Halt auf dem Rücken des Mädchens, was das Wunder tat, die Dirne zum Laufen zu bringen. Frau Holofernes steckte darauf ihren Kopf zum Fenster hinaus und setzte damit wie gewöhnlich Alle in Flucht, vorzüglich Panfila's Anbeter, dessen Füße Flügel zu haben schienen.
"Vermaledeite verliebte Dirne," schrie Frau Holofernes ihrer Tochter nach, "was willst Du denn eigentlich mit Deinem abscheulichen Betragen bezwecken?"
"Heiraten, Mutter."
"Was sagst Du? Heiraten? Ausgelassene Dirne, das wirst Du nicht, so lange ich lebe."
"Aber habt Ihr Euch denn nicht verheiratet und Eure Mutter und Großmutter?"
"Es hat mich auch sehr gereuet. Denn hätte ich es nicht getan, hätte ich Dich, unverschämtes Mädchen, nicht zur Welt gebracht. Und ob auch ich und meine Mutter und meine Großmutter geheiratet haben, so will ich doch nicht, daß Du Dich verheiratest, noch meine Enkelin, noch meine Urenkelin. Verstanden?"
Mit solchen süßen Unterhaltungen brachten Mutter und Tochter ihr Leben hin, ohne andere Folge, als daß die Mutter jeden Tag sauertöpfischer und die Tochter immer übermütiger wurde.
Eines Tages hatte Frau Holofernes Wäsche, und als die Lauge siedete, rief sie ihre Tochter zu Hilfe, um den Kessel mit der heißen Lauge über den Waschkorb auszugießen. Die Tochter hörte nur mit einem Ohr darauf, denn das andere war mit dem Liebhaber, der am Fenster sang, beschäftigt. Die Liebesgespräche boten ihr natürlich eine viel angenehmere Aussicht als der Laugenkessel und so ließ sie sich ihre Mutter heiser schreien und ging zum Fenster.
Als nun Frau Holofernes sah, daß ihre Tochter nicht kam und die Zeit mit dem Warten verging, wollte sie selbst den Kessel umwenden und die Lauge auf die Wäsche gießen. Da sie aber klein und etwas schwach war, fiel ihr der Kessel aus den Händen und verbrannte ihr den einen Fuß.
"Vermaledeite, doppelt vermaledeite Dirne," schrie sie, böse wie ein Basilisk, "die nur an den Liebhaber denkt! Wollte Gott, daß Du den Teufel zum Manne kriegtest."
Einige Zeit nachher stellte sich ein Bewerber für Panfila ein, wie es wenige gibt: jung, weiß, blond, von feinen Manieren und gutgefülltem Beutel. Es war nichts gegen ihn einzuwenden, und auch Frau Holofernes konnte in ihrem Arsenal von Verweigerungen nichts gegen ihn finden. Panfila war fast toll vor Freude. Es wurden also unter den nötigen Brummereien der zukünftigen Schwiegermutter des Bräutigams die Anstalten für die Hochzeit gemacht. Alles ging schnell und ohne Hindernisse von Statten, als die Stimme des Volkes, die untrüglich wie das Gewissen ist, laut wurde und ein Verdammungsurteil gegen jenen Fremden aussprach, wiewohl er sich einschmeichelnd, freigebig und freundlich zeigte, gut sprechen und noch besser singen konnte und mit seinen feinen, mit Ringen geschmückten Händen die braungebrannten, rauhen Hände der Bauern drückte. - Die Bauern glaubten sich durch Alles dies gar nicht geehrt und ließen sich durch diese Höflichkeiten nicht im Geringsten verführen. Ihr Verstand war wohl ungebildet, aber zugleich derb und kräftig wie ihre Hände.
"Das muß ich gestehen," sagte Vater Blas, "der fremde Junker nennt mich Señor Blas, als wenn ich ein hochmütiger Narr wäre, der nur Señor genannt werden möchte."
"Und mir kommt er entgegen," sagte Vater Gil, "und gibt mir seine Pfote, als wenn wir alte Bekannte wären, und nennt mich Citoyen, mich, der ich nie aus meinem Dorfe gekommen bin."
Frau Holofernes ihrerseits sah gleichfalls den zukünftigen Schwiegersohn, je mehr sie ihn ansah, mit desto schlimmern Augen an. Es kam ihr so vor, als wenn sich unter seinen unschuldigen blonden Locken auf dem Hirnschädel gewisse Wichte von sehr übler Art befänden, und sie dachte mit Angst an den Fluch, den sie an jenem Tage (an dem sie, traurigen Angedenkens, genau erfuhr, wie sehr eine Brandwunde von siedender Lauge schmerzt) gegen die Tochter ausgesprochen hatte.
Der Hochzeitstag kam heran. Frau Holofernes hatte Kuchen und Betrachtungen gemacht: die ersten süß und die andern bitter; eine große Olla podrida für das Mittagsessen und ein verderbliches Project zum Abendbrot; hatte daneben eine sehr generöse Weintonne und einen durchaus nicht generösen Verhaltungsplan präparirt.
Als sich die Neuvermählten nach ihrem Zimmer begeben wollten, rief Frau Holofernes ihre Tochter und sagte ihr: "Wenn Ihr in Euerm Zimmer seid, so schließe Türen und Fenster zu und verstopfe alle Ritzen. Darauf nimm einen geweihten Olivenzweig und prügele Deinen Mann damit, bis ich Dir sage aufzuhören. Das ist eine Ceremonie, die bei allen Heiraten üblich ist und bedeuten soll, daß in der Schlafstube die Frau das Regiment hat. Zugleich dient sie dazu, diese Herrschaft zu begründen und zu bestätigen."
Die dumme Panfila glaubte ihrer Mutter und war zum ersten Male im Leben gehorsam. Pünktlich tat sie Alles, was ihr die schlaue Alte gesagt.
Kaum sah nun der neue Ehemann den Olivenzweig in der Hand seiner Frau, als er eilig die Flucht suchte. Wo sollte er aber hinaus? Türen und Fenster waren verschlossen, jede Ritze verstopft; es blieb ihm nichts als das Schlüsselloch. Er huschte hindurch als wenn es ein Scheuntor wäre - denn meine Herren Zuhörer werden wohl gemerkt haben (so gut wie Frau Holofernes), daß der blonde, weiße, schmucke Junker, der so schön plauderte, nichts mehr und nichts weniger als der Teufel in eigener Gestalt war, nach seiner Ansicht durch den Fluch der Frau Holofernes berechtigt, die Lustbarkeiten und Leckerbissen einer Hochzeit zu genießen und sich einmal auf eigene Rechnung eine Frau zu holen, worum ihn täglich die Ehemänner mit Rücksicht auf ihren Vorteil baten.
Aber dieser Herr, wiewohl er bekannterweise sehr schlau ist, bekam es diesmal mit einer noch schlauern Schwiegermutter zu tun (und Frau Holofernes ist nicht die einzige dieser Art). Kaum war Se. Gnaden durch das Schlüsselloch geschlichen und gratulierte sich, wie gewöhnlich eine Ausflucht gefunden zu haben, als er sich in einer großen Flasche, welche seine vorsichtige Schwiegermutter am Schlüsselloche angesetzt hatte, gefangen sah. Die Alte verstopfte die Flasche luftdicht und an Entwischen war nun für's Erste nicht zu denken. Der Schwiegersohn bat mit den zärtlichsten Worten, mit den demütigsten Bitten, mit pathetischen Gebärden, sie möchte ihm die Freiheit geben. Er stellte ihr vor, wie sie ganz willkürlich und gegen alles Völkerrecht handle und durch ihren Despotismus die Constitution verletze. Frau Holofernes ließ sich aber nicht vom Teufel überlisten; Vorträge machten auf sie keinen Eindruck und Großsprechereien imponierten ihr nicht. Sie nahm die Flasche mit ihrem Inhalte, ging nach einem Berge, kletterte heftig arbeitend hinauf, setzte oben auf dem Gipfel die Flasche hin, die demselben wie dem Hahne sein Kamm stand, und entfernte sich, indem sie ihrem Schwiegersohn noch eine Faust machte.
Seine Gnaden verweilten dort zehn Jahre. Welche zehn Jahre, meine Herren! Die Welt war auf einmal so ruhig wie ein Meer von Oel. Jeder bekümmerte sich nur um das, was ihn anging, und mischte sich nicht in Dinge, über die er nichts zu sagen hatte. Niemand begehrte seines Nächsten Amt, Weib oder Eigentum. Das Stehlen ward ein Wort ohne Bedeutung, die Waffen rosteten ein, das Pulver ward zu Feuerwerken verbraucht, die Wahnsinnigen rasten nie und waren stets bloß drollig, die Gefängnisse standen leer. In dieser Decade des goldenen Zeitalters fand bloß ein beklagenswertes Ereigniß Statt: die Advocaten starben, weil sie nichts zu streiten und zu essen hatten.
Aber ach, ein so glücklicher Zustand sollte nicht dauern. Alles hat in dieser Welt ein Ende, ausgenommen die Reden einiger beredten Väter des Vaterlandes. Das Ende dieser glücklichen Decade war folgendes: Ein Soldat, Namens Unerschrocken, hatte Urlaub erhalten, nach seinem Dorfe zu gehen. Sein Weg führte ihn um den Berg herum, auf welchem der Schwiegersohn der Frau Holofernes verweilte, der sich die Zeit damit vertrieb, daß er alle Schwiegermütter, gegenwärtige, vergangene und zukünftige, verwünschte, diese Schlangenbrut, wenn er seine Macht wieder hätte, durch das einfache Mittel der Abschaffung des Ehestandes gänzlich zu vertilgen gelobte und Satiren auf die Erfindung der Wäsche dichtete. Als Unerschrocken unten am Berge ankam, wollte er nicht ausweichen, sondern sagte, wenn er ihm nicht aus dem Wege gehe, so werde er über ihn wegsteigen, wäre er auch so hoch, daß er sich am Himmel eine Beule stoßen sollte. Mit der Zeit langte er oben an und war ganz verwundert, die Flasche da zu sehen. Er hob sie auf, hielt sie gegen das Licht und rief, als er den Teufel darin sah, welcher in dieser langen Zeit durch Fasten, Gefangenschaft, Traurigkeit und Sonnenhitze wie eine Backpflaume ausgedörrt war: "Was für ein Ungeziefer ist das! Was für eine Mißgeburt!"
"Ich bin ein Biedermann und wohlverdienter Teufel," sprach freundlich und demütig der Gefangene. "Die Ruchlosigkeit einer boshaften und treulosen Schwiegermutter (die in meine Krallen fallen möge!) hält mich hier gefangen. Befreie mich, tapferer Kriegsmann, und ich will Dir jede Gunst gewähren, die Du forderst."
"Ich will meinen Abschied," sagte Unerschrocken, ohne sich zu bedenken.
"Du sollst ihn haben - aber öffne schnell, damit ich frei werde, denn es ist ein Widerspruch, in diesen revolutionären Zeiten den Hauptrevolutionär gefangen zu halten."
Der Sergeant Unerschrocken zog am Pfropfen und zugleich stieg aus der Flasche ein mephitischer Dampf, der ihm bis in's Gehirn drang. Er nieste und drückte den Pfropfen eiligst wieder in die Flasche, und zwar so tief, daß er den Teufel zusammendrückte und dieser vor Schmerz schrie.
"Was machst Du, armseliger Erdenwurm, tausendmal treuloser als meine Schwiegermutter?"
"Ich will in unserm Handel eine andere Bedingung setzen: es scheint mir, daß es der Dienst, den ich Dir leisten soll, wert ist."
"Und welche, langweiliger Erlöser?" fragte der Teufel.
"Ich verlange vier Duros täglich, so lange ich lebe. Ueberlege es, es gibt keine weitere Wahl, drinnen oder draußen."
"Beim Satan, Lucifer und Belzebub!" entgegnete zornig der Teufel, "Elender, Habsüchtiger, ich habe kein Geld."
"Ei, seht doch, was für eine hübsche Einwendung für einen so mächtigen Herrn wie Ihr, eine Einwendung, wie sie wohl für einen Minister passen mag, aber nimmermehr für Euern Mund, noch für meine Ohren."
"Da Du mir nicht glauben willst, so laß mich hinaus, und ich werde Dir behilflich sein, das Geld zu erwerben, wie ich schon vielen Andern dazu behilflich gewesen bin. Da ich in den letzten zehn Jahren Bankrott gemacht, so ist das Alles, was ich für Dich tun kann. Laß mich hinaus, bei tausend Meinesgleichen, laß mich hinaus!"
"Nur gemach," erwiederte der Sergeant Unerschrocken, "Niemand hetzt uns und Du wirst gar nicht in der Welt vermißt. Ich werde Dich beim Schwanze festhalten und nicht eher loslassen, bis Du Dein Versprechen erfüllt hast."
"Traust Du mir denn nicht, Unverschämter?" rief der Teufel.
"Nein," erwiederte Unerschrocken.
"Was Du verlangst, ist gegen meine Würde," sagte der Gefangene mit allem Hochmute, den eine gedörrte Pflaume zeigen kann.
"Nun, so gehe ich," sagte der Sergeant.
Als der Teufel sah, daß sich Unerschrocken entfernte, wälzte er sich unbändig in der Flasche herum und schrie:
"Komm' zurück, komm' zurück, herzlieber Freund," - brummte aber zugleich für sich: "daß Dich ein vierjähriger Stier auf die Hörner nähme, abscheulicher Landstreicher!" und dann sprach er wieder laut: "Komm', komm', wohltätiges Geschöpf, komm' und befrei' mich nur, fass' mich meinetwegen an den Schwanz oder an die Nase, verdienter Krieger," und für sich setzte er hinzu: "Es bleibt auf meiner Rechnung, mich an Dir zu rächen, ruchloser Soldat, und wenn ich nicht, wie ich wünsche, erreichen kann, daß Du der Schwiegersohn der Frau Holofernes wirst, so werde ich wenigstens dafür sorgen, daß Ihr Beide nebeneinander auf demselben Scheiterhaufen brennen sollt!"
Der Sergeant Unerschrocken kehrte um, machte die Flasche auf und heraussprang der Schwiegersohn der Frau Holofernes wie ein Küken aus dem Ei, erst mit dem Kopf, dann mit den andern Gliedern und zuletzt mit dem Schwanze, den Unerschrocken kräftig festhielt, ob ihn der Teufel auch noch so einzog.
Der Exgefangene, der ganz steif und lahm war, schüttelte sich, reckte und dehnte Arme und Beine und fort gings nach der Residenz, der Teufel vorauskriechend, der Sergeant hinterdrein, den Schwanz seines Vordermannes in der Hand.
Als sie in die Stadt kamen, sagte der Teufel zu Unerschrocken: "Ich fahre jetzt in den Körper der Prinzessin, welche von ihrem Vater außerordentlich geliebt wird, und werde ihr solche Schmerzen bereiten, daß kein Arzt sie heilen kann. Präsentiere Dich dann und erbiete Dich, sie unter der Bedingung, daß man Dir für Lebenszeit täglich vier Duros gebe, gesund zu machen. Ich fahre dann aus, sie wird gesund und unsere Rechnung ist abgemacht."
Alles kam, wie es der Teufel angeordnet und vorhergesehen hatte. Nur hatte er nicht vorhergesehen, daß ihn, als er gehen wollte, Unerschrocken beim Schwanze festhielt und zu ihm sagte:
"Wohl bedacht, mein Herr, vier Duros sind eigentlich eine Knickerei, weder Euer noch meiner würdig. Sucht ein Mittel, Euch etwas generöser zu zeigen. Das würde Euch nebenbei in der Welt Ehre machen, wo, verzeiht meine Offenherzigkeit, man keine besonders gute Meinung von Euch hat."
"Daß ich Dich nicht mitnehmen kann!" sagte der Teufel für sich, "aber ich bin so schwach, daß ich mich selbst kaum fortbringe. Ich muß Geduld haben, Geduld, die die Menschen eine Tugend nennen. Jetzt begreife ich, warum so viele in meine Gewalt geraten: weil sie nicht Geduld geübt haben. Geh' nur, gehe, Du Vermaledeiter, vom Galgen kommst Du in meinen Kessel. Wir wollen nach Neapel und dort das besprochene Mittel anwenden, Deine Habgier zu sättigen."
Alles ging wohl von Statten. Die Prinzessin wand sich auf ihrem Lager vor Schmerzen. Der König war in großer Angst und Sorge. Sergeant Unerschrocken stellte sich mit dem Hochmute vor, den Alle haben, die da wissen, daß ihnen der Teufel hilft. Der König nahm seine Dienste an, stellte aber die Bedingung, daß Unerschrocken, wenn er nicht in drei Tagen, wie er mit so großer Sicherheit versprach, die Prinzessin heilte, gehängt würde. Der Sergeant, seines Erfolges gewiß, machte keine Einwendung. Aber unglücklicherweise hatte der Teufel gleichfalls diese Worte gehört und sprang vor Freude, daß sich ihm eine gute Gelegenheit zur Rache böte, so sehr im Leibe der Prinzessin, daß dieselbe vor Schmerzen schrie, man möchte ihr den Doctor aus den Augen schaffen. Tags darauf wiederholte sich dasselbe. Unerschrocken merkte, daß der Teufel sein eigenes Spiel trieb und ihn aufhängen lassen wollte; aber er war nicht ein Mann, der leicht den Kopf verlor. Als der sogenannte Doctor am dritten Tage ankam, war schon der Galgen vor der Tür des Palastes aufgerichtet. Er trat in die Stube der Prinzessin, deren Schmerzen sich wieder verdoppelten, so daß sie, wie an den beiden Tagen vorher, schrie, man sollte den falschen Heilkünstler hinausjagen.
"Noch sind nicht alle meine Mittel erschöpft," sagte gravitätisch Unerschrocken. "Geruhen Ew. Gnaden einen Augenblick zu warten."
Darauf ging er hinaus und befahl im Namen der Prinzessin, alle Glocken der Stadt zu läuten. Als er wieder in die Stube zurückkam, fragte ihn der Teufel, der vor dem Glockengeläut ein Todesgrauen empfand und zugleich neugierig war, für welchen Heiligen man läute.
"Die Glocken läuten zu Ehren Eurer Schwiegermutter, welche ich habe kommen lassen!"
Kaum hörte der Teufel, daß seine Schwiegermutter unterwegs sei, als er so schnell davonlief, daß ihn selbst ein Sonnenstrahl nicht hätte erreichen können: Unerschrocken erhielt aber große Auszeichnung für seine Kunst und die bestimmten vier Duros wurden ihm täglich ausgezahlt.
Quelle: Spanische Volks- und Kindermärchen
DIE RITTER VOM FISCH
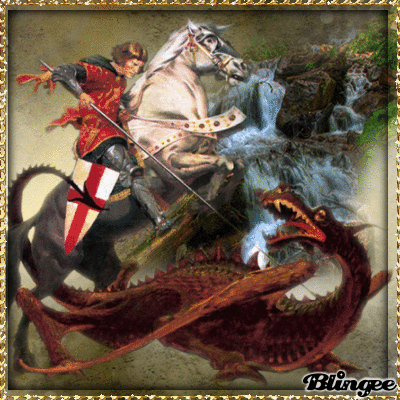
Es war einmal ein Land, in welchem man so viele Eisenbahnen, Luftballons, Canäle und Dampfschiffe baute, daß die Leute das Zu-Fuß-Gehen ganz verlernten und darum auch alle Schuhmacher und Schuhflicker zu Grunde gingen. Mit dem Gleichgewicht der bürgerlichen Gesellschaft ist es wie mit dem der Erde: wenn das Meer auf der einen Seite mit seinem Rachen ein Stück Land verschlingt, so wirft es auf der andern wieder ein Stück aus - was es aber ausspeit, ist jedesmal von ihm so ausgesogen und ausgedörrt, wie die Wüste. Was das Meer tut, hatte in besagtem Lande die Civilisation getan, als sie sich aller Communicationsmittel bemächtigt hatte; dürr und elend saßen die armen Schuster da, ihrem Schicksale überlassen.
Eins dieser Opfer warf in seinem Unmut mit seinem Leisten nach dem ersten Eisenbahnzug, der ihm entgegenkam, mit seiner Ahle nach dem aufgeblähetsten Dampfschiffe, mit seiner Schürze nach dem aufgeblasensten Ballon, kaufte ein kleines Boot und Netz und wollte Fischer werden. So oft nun ein Dampfer in der Nähe seines Bootes hinfuhr, rief er mit lauter Stimme hinüber: "In seinem kleinen Kahne trotzt ein Schuhflicker den Dampfschiffen, wie der Fels den Meereswogen. Bilde Dir nicht in Deinem Stolze ein, daß ich mich Dir je unterwerfe!
Nein, immer soll mein Bötelein
Mein einz'ger Locomotor sein."
So sang unser Fischer; was aber die Fische betrifft, so fing er damit keinen einzigen. Seine Baßstimme und das Geräusch der Dampfschiffe trieben sie alle weg. Es gab für ihn auf dem Meere grade so wenig Fische, wie auf dem Land zerrissene Schuhe. Da verzweifelte er denn endlich und nahm sich vor, sich in's Meer zu werfen, indem er meinte: "Esse ich keine Fische, so sollen die Fische mich essen, se va lo uno por lo otro - so oder anders, gleichviel."
Aber das Meer sah grade so grimmig aus, so schwarzgrau, so wild und unbändig, daß unser Schuster eine bessere Gelegenheit für seinen Plan abwarten wollte. Indeß warf er auch sein Netz wieder aus, und siehe da, auf einmal fühlte er es ganz schwer. Aha, dachte er, es war doch gescheut, meinen Kopfsprung etwas aufzuschieben. Er zog das Netz und fand einen Petersfisch darin. Die Petersfische sind aber ganz außerordentlich feine Fische mit zwei runden schwarzen Flecken, die von der Legende als durch die Finger des heiligen Petrus eingedrückt angesehen werden. Mag sich in diesem Glauben, der ja freilich kein Dogma ist, auch weder ein frommes Gefühl, noch ein schöner poetischer Gedanke aussprechen, wie in andern Inspirationen des Volksglaubens, so beweist er doch, daß das spanische Volk, das von den englischen Propagandisten stets als höchst unwissend in religiösen Dingen geschildert wird, ganz in den Gedanken und Geschichten des Evangeliums lebt und Herrn John Bull in vielen Dingen wohl belehren könnte.
Wir kehren zu unserer Erzählung zurück. Sobald der Schuster den schönen Fisch in Händen hatte, sprach der Fisch, der, wie es scheint, nicht so stumm wie seine Brüder war, zu ihm:
"Trage mich nach Deinem Hause; schneide mich in acht Stücke; bereite mich mit Salz und Pfeffer, Zimmt und Nägelein, Krausemünze und Lorbeerblättern. Zwei Stücke gib Deiner Frau zu essen, zwei Deiner Mutterstute, zwei Deiner Hündin und die beiden übrigen pflanze in Deinen Garten." Der Schuhflicker tat buchstäblich Alles, was ihm der Fisch sagte, so groß war sein Vertrauen zu den Worten desselben. Dies bestätigt wieder eine ganz gegen die Ansicht der Parlamentsmänner laufende Tatsache, daß nämlich die, welche wenig sprechen, mehr Zutrauen einflößen als die Vielsprecher.
Nach neun Monaten gebar des Schusters Frau zwei Knaben, seine Stute warf zwei Füllen, seine Hündin zwei Hündchen und im Garten gingen zwei Lanzen auf, die als Blüten zwei Wappenschilde trugen, welche einen Silberfisch in blauem Felde hielten. Alles dies wuchs friedlich und gedeihlich miteinander auf, so daß später aus des Schusters Hause zwei schöne stattliche Ritter auf prächtigen, wunderschön gesattelten Rossen, mit zwei aufgerichteten Lanzen und zwei glänzenden Schilden, von zwei tüchtigen Windhunden begleitet, herausritten.
Die Brüder, sich gegenseitig so ähnlich, daß man sie beide den Doppelritter nannte, wollten, wie es auch ganz recht war, ihre Persönlichkeit nicht verlieren und beschlossen darum, sich zu trennen und einzeln die Welt zu durchziehen. Sie umarmten sich zärtlich und gingen der Eine gen Osten, der Andere gen Westen.
Nach einigen Reisetagen kam der Erste nach Madrid und fand die königliche Stadt, wie sie das Salzwasser ihrer Tränen in die reinen und süßen Wellen ihres geliebten Manzanares mischte. Alle Welt weinte, selbst die Maria blanca vom Sonnentor. Unser schöner Ritter fragte nach der Ursache dieser allgemeinen Trostlosigkeit und erfuhr, daß ein fürchterlicher Drache, der Sohn einer höllischen Alten, jährlich ein junges Mädchen erhalte, um sich während der übrigen Zeit ruhig zu halten, und daß das Loos diesmal auf die Königstochter gefallen, die eine so schöne und herzensgute Prinzessin, wie keine andere, sei. Der Ritter fragte weiter, wo sich die Prinzessin befinde, und man sagte ihm, sie erwarte eine Viertelmeile von der Stadt den Drachen, der jedesmal um zwölf Uhr komme, seine Beute mitzunehmen. Der Ritter eilte schnell nach dem bezeichneten Orte und fand die Prinzessin vom Kopf bis zu den Füßen zitternd und ganz in Tränen zerflossen.
"Fliehet," rief sie dem nahenden Ritter zu, "fliehet, Unbesonnener! Der Drache kommt sogleich und dann seid Ihr verloren."
"Ich werde nicht weichen," antwortete der Ritter; "sondern komme, Euch zu retten."
"Mich retten? das ist unmöglich."
"Wir wollen sehen," entgegnete der tapfere Ritter, "gibt es hier Deutsche?"
"Ja," antwortete verwundert die Prinzessin.
"Ihr werdet es schon erfahren," sagte der Ritter und sprengte blitzschnell zur trostlosen Stadt zurück. Nach wenigen Minuten kam er mit einem großen Spiegel zurück, den er in einem deutschen Laden gekauft hatte. Er stellte ihn gegen einen Baum, bedeckte ihn mit dem Schleier der Prinzessin, stellte diese vor den Spiegel und sagte ihr, sobald der Drache nahe sei, solle sie schnell den Schleier zurückziehen und sich hinter den Baum verstecken. Darauf entfernte er sich etwas und verbarg sich.
Es dauerte nicht lange, so erschien der Drache und kam langsam auf die Prinzessin zu, sie keck und unverschämt ansehend, so daß ihm nur das Lorgnon fehlte, um andern kleinern und weniger gefährlichen Drachen zu gleichen. Als er nun endlich ganz nahe war, zog die Prinzessin schnell den Schleier vom Spiegel und versteckte sich hinter den Baum. Der Drache war ganz verblüfft, als er seine verliebten Augen auf sein gräßliches Ebenbild gerichtet sah. Er verzerrte sein Gesicht - sein vis-à-vis tat dasselbe; seine Augen wurden wie zwei feurige Kohlen - die seines Gegenmannes blieben nicht zurück; im Zorn sträubte er seine Schuppen wie ein Igel in die Höhe - und ganz eben so hoch stiegen die des andern Drachen; er öffnete seinen fürchterlichen Rachen, der nicht seines Gleichen gehabt haben würde, hätte nicht sein Gegner, ohne sich schrecken zu lassen, den seinen eben so weit aufgethan. Ungestüm stürzte er nun auf seinen unerschrockenen Gegner los und stieß sich dabei so heftig gegen das Spiegelglas, daß er ganz betäubt wurde. Ueberdies sah er nun in allen den kleinen Stücken des entzwei gestoßenen Spiegels Teile seines Körpers und glaubte nicht anders, als daß er sich selbst in lauter Stücke zerstoßen habe. Der Ritter benutzte diesen Augenblick, fiel mit seiner guten Lanze und seinem treuen Hund über den Drachen her und tötete ihn.
Man kann sich die Freude und den Jubel der Madrileños, die lustige Leute sind, denken, als sie den Ritter vom Fisch ankommen sahen. Derselbe hatte die Prinzessin so froh wie ein Osterfest neben sich auf dem Pferde, und schleifte den toten Drachen, den er an den Schweif des Pferdes gebunden, wie eine Schleppe hinter sich her.
Man wird sich auch wohl denken, daß man die hohe Tat des edeln Ritters mit nichts Anderem belohnen konnte, als mit der weißen Hand der Prinzessin, und daß es eine Hochzeit mit Gastmählern, Stiergefechten und Ritterspielen gab, und daß ich auch dabei war, ohne übrigens von den Herrlichkeiten etwas zu bekommen.
Einige Tage nach der Hochzeit sagte nun der Ritter zu seiner Frau, er möchte auch gern einmal den ganzen Palast sehen, der so groß war, daß er eine Meile Landes bedeckte. Die Prinzessin willigte ein und sie machten sich auf den Weg. Endlich nach drei Tagen war die Wanderung durch alle Gemächer beendet und am vierten stiegen sie auf die Terrasse. Wie erstaunt war der Ritter über die herrliche Aussicht! Da sah man ganz Spanien und Mohrenland und selbst den Kaiser von Marokko, der den Tod seines Freundes, des bösen Drachens, bitterlich beweinte.
"Was für ein Schloß ist das dort in der Ferne, das so einsam und düster aussieht?" fragte der Ritter.
"Es heißt," erwiederte die Prinzessin, "Schloß 'Erschrecklich' und ist verzaubert, ohne daß Jemand den Zauber lösen kann. Wer hineingeht, kommt nicht wieder heraus."
Der Ritter schwieg. Da er aber mutig war und Abenteuer liebte, so stieg er des andern Morgens, ohne Jemand etwas davon zu sagen, auf sein Pferd, nahm Degen, Lanze und Hund mit und machte sich auf den Weg nach jenem Schlosse.
Das Schloß war so entsetzlich, daß sich ein Jeder fürchtete, der es nur sah, schwarz wie eine Gewitternacht, schweigsam wie eine Leiche, unwirsch wie ein Bösewicht. Aber der Ritter wußte von Furcht nichts weiter als den Namen, kehrte den Rücken nur dem überwundenen Feinde und klopfte also laut an der Tür an. Alle schlafenden Echos des Schlosses wachten auf und ließen näher und ferner das Klopfen im Chore nachklingen: doch kam keine andere Antwort. Da klopfte er noch einmal stärker mit der Lanze und es öffnete sich nun ein kleines Gitterloch im Tore, hinter dem die Spitze von der langen Nase eines alten häßlichen Weibes hervorguckte.
"Was wollt Ihr, dreister Ruhestörer?" fragte die Alte mürrisch.
"Hineingelassen werden," antwortete der Ritter und hob dabei sein Visir in die Höhe.
Als die Alte das schöne Gesicht sah, ward sie ganz freundlich und machte ihm gleich die Tür auf.
"Nun, gute Alte, -" begann der Ritter.
"Ich heiße Berberisca," fiel ihm die Alte empfindlich in's Wort, "und bin Erb- und Gerichtsfrau vom Schloß Erschrecklich."
"Schrecklich, schrecklich," riefen die Echos.
"Wollt Ihr wohl schweigen, Ihr Schreihälse!" schalt die Alte und zum Ritter gewandt, fuhr sie fort: "Wollt Ihr mich heiraten, so sollt Ihr Herr sein und ein Leben haben wie der Pascha."
"Ah," lachten in Einem fort die Echos.
"Euch sollt' ich heiraten, Euch Hundertjährige?" antwortete der Ritter, "Ihr seid recht einfältig fürwahr."
"Wahr, wahr, wahr," riefen die Echos.
"Was ich will," fuhr der Ritter fort, "ist nur das Schloß durchsuchen und fortgehen nach dem Examen."
"Amen, amen, amen" - klang es nach.
Die Alte sah aufgebracht den Ritter von der Seite an und sagte, er solle ihr folgen, sie werde ihm Alles zeigen. So geschah es und der Ritter sah gar viele, viele prächtige Sachen. Doch konnte er sich nicht Alles merken, denn die boshafte Berberisca führte ihn schnell weiter in einen dunkelen Gang, wo sich plötzlich eine Falltür öffnete. Der Ritter, der nichts davon ahnte, fiel in einen tiefen Abgrund und einte nun seine Stimme mit denen der Echos, denn alle jene Echos waren nichts als Stimmen anderer schöner und vortrefflicher Ritter, welche die ehrwürdigen Reize der Alten gleichfalls verschmäht hatten und von ihr in derselben Weise betrogen worden waren.
Wir kommen nun zum andern Ritter vom Fisch. Derselbe gelangte auf seiner Reise auch zuletzt nach Madrid. Aber welche Aufnahme wartete seiner daselbst: kaum trat er in das Tor, als die Soldaten vor der Wache aufmarschierten, Trommeln wirbelten und Trompeten schmetterten und der Königsmarsch erklang. Die Diener vom Palast umringten ihn und teilten ihm mit, daß die Prinzessin in Tränen zerfließe und über seine lange Abwesenheit sich viel geängstet und viel geweint habe.
Gewiß, dachte der Ritter, hält man mich für meinen Bruder, der vermutlich hier sein besonderes Glück gemacht hat. Ich will doch sehen, wo das hinausgeht.
Man führte ihn wie im Triumphe nach dem Palast und König und Prinzessin empfingen ihn mit hohen Freuden.
"Du bist also nach dem Schlosse Erschrecklich geritten? Sage, wie bist Du wieder herausgekommen und wie ist es Dir dort ergangen. Ich habe gefürchtet, Dich nie wiederzusehen."
"Es ist mir nicht erlaubt, ein einziges Wort darüber mitzuteilen, bis ich nicht nochmals da gewesen bin."
"Wie," rief die Prinzessin, "Du bist der Einzige, der je vom verzauberten Schlosse wiedergekehrt ist, und Du willst das Abenteuer zum zweiten Male wagen?"
"Ich muß es."
Darüber war der Abend angekommen und beide begaben sich zum Schlafgemach. Der Ritter nahm seinen Degen und legte ihn auf das Lager der Prinzessin.
"Warum tust Du das?" fragte sie.
"Weil ich ein Gelübde getan," antwortete er, "auf keinem Lager zu ruhen, bis ich nicht von jenem Schlosse wiedergekehrt bin."
Des andern Morgens bestieg er sein Pferd und machte sich auf den Weg nach dem Schlosse, in Ungewißheit und Furcht wegen seines Bruders. Jetzt stand er am Tor und klopfte. Berberisca's Nasenspitze zeigte sich alsbald am Gitterloch; wurde aber sogleich noch einmal so lang und kreideweiß, denn die Alte dachte, als sie den Ritter sah, nicht anders, als die Toten stünden auf.
"Heiliger Belzebub," rief sie, denn für diesen Heiligen hatte sie eine besondere Devotion, "heiliger Belzebub, befreie mich von dieser Erscheinung," und mit diesen Worten lief sie weg.
"Frau Unsterblich," rief ihr der Ritter nach, "ist hier ein Ritter angekommen, der mir ähnlich aussah? Nein oder ja."
"Ja, ja, ja," riefen die Echos.
"Lebt er oder ist er tot?"
"Tot, tot, tot," klagten die Echos.
Als der Ritter das hörte, lief er der Alten nach und durchbohrte sie mit seinem Degen, und da sie klein und mager war und der Wind grade stark wehte, so drehte sie sich wie ein Windmühlflügel um den Degen herum.
"Wo ist mein Bruder, Du tückische Hexe?" fragte der Ritter.
"Ich wollte es Euch gern sagen," antwortete sie, "aber ich bin sterbend und von allem Drehen schwindelt mir der Kopf. Macht mich erst wieder lebendig."
"Wie kann ich das, alter Drache?"
"Geht nach dem Garten, nehmt Eisenhut, Klatschrosen und Drachenblut, kocht das in einem Kessel und badet mich darin," und kaum hatte die Alte das gesagt, als sie starb, ohne noch "Jesus" zu sagen.
Der Ritter tat Alles, wie ihm gesagt, und machte die Alte wieder lebendig, nur war sie noch häßlicher als vorher, denn ihre große Nase hatte im Kessel keinen Platz gefunden und sah totenstarr und weiß wie ein Elephantenzahn aus.
Sie sagte nun dem Ritter, wo sein Bruder sei, und als der Ritter in jenen Abgrund hinunterstieg, fand er daselbst nicht allein seinen Bruder, sondern noch viele andere Ritter und sehr viele schöne Fräulein, die der Drache ehemals dahin gebracht. Er steckte sie darauf alle, einen nach dem andern, in den Kessel und machte sie so alle wieder lebendig. Die Echos nahmen wieder von ihren Kehlen Besitz, die Herrlein und die Fräulein bedienerten und beknicksten sich gegenseitig, gingen dann alle zum Ritter, ihm zu danken und nach wenigen Secunden standen lauter schmucke Pärchen da, denn die Ritter und Fräulein waren lauter verzauberte Bräutigame und Bräute gewesen. Als Berberisca diese Lust und Freude sah, platzte sie vor Neid und starb nun für immer.
Quelle: Spanische Volks- und Kindermärchen
DER VERZAUBERTE FEIGENBAUM
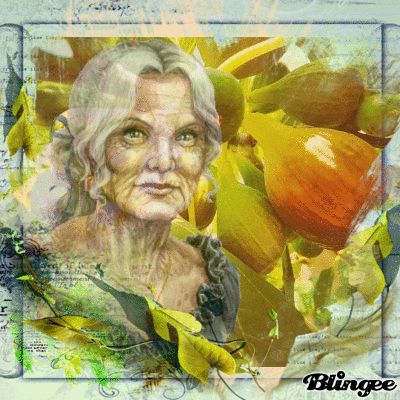
Im Jahr des Herrn 1640 gingen in der schönen Stadt Granada im Viertel von Albaicin die Leute ihren täglichen Beschäftigungen nach. In einer schmalen Straße, durch die man zu einer verborgenen
Zisterne gelangt, lag der kleine Garten der Maria Tomillo. Sie lebte allein, war ein böses Weib und jammerte viel. Den Nachbarn war sie unheimlich. Sie verwandte all ihre Liebe darauf, ihren
Garten zu pflegen, dessen prächtige Obstbäume für die jungen aus der Nachbarschaft eine große Versuchung darstellten.
Sah die alte Frau einmal nicht hin, gleich kletterten sie ins Geäst und füllten sich die Taschen mit den Früchten. Doch die Hexe erwischte sie immer. Dann taten die Bengel gut, sich möglichst
rasch in Sicherheit zu bringen, denn die Alte bedachte sie nicht nur mit Flüchen. sondern auch mit Steinwürfen, die ihr Ziel selten verfehlten. Was die alte Hexe am meisten verabscheute, war,
dass jemand von den Früchten eines großen Feigenbaumes aß, der mit seinem dichten Blattwerk dem Garten Schatten spendete und dessen Früchte sich besonders des Zuspruchs durch die jungen erfreute,
die in den Garten kamen, um sich zu versorgen.
Solcher Übergriffe überdrüssig, bat die Frau den Teufel, dass er den Baum auf eine Art verzaubere, dass niemand mehr von den Feigen essen könne. Von da an wurden die Feigen so bitter, dass
selbst, wenn ein Junge dazu kam, eine zu pflücken und sie in den Mund steckte, er sie sofort wieder ausspuckte, was die Alte, wenn sie es beobachtete, jedes Mal mit großer Genugtuung erfüllte.
Selbst der Schatten des Feigenbaumes war verzaubert. Wer sich dort hinlegte, wurde von einer unbekannten Krankheit befallen.
Viele Jahre vergingen, ohne dass es jemand gewagt hätte, die Feigen zu versuchen, da starb die alte Frau plötzlich, und ihr Leichnam verschwand auf den Friedhof. Von der Nacht ihres Todes an
hörten die Nachbarn merkwürdige Geräusche in der nahegelegenen Zisterne, und zwar immer um Mitternacht. Und jeder von ihnen war sicher, dass die Alte nun in ihrem geliebten Garten spuke.
Nun gab es da ein paar neugierige Frauen, die sich an einem Fenster, von dem aus man in jenen Garten sah, versammelten und nur darauf warteten, dass es Mitternacht wurde. Als die zwölf Schläge
der Kirchturmuhr verklungen waren, sahen sie tatsächlich, wie der Schatten der alten Frau der Zisterne entstieg. Hohe schrille Schreie ausstoßend, begann sie den Feigenbaum zu umkreisen, an
dessen Zweigen darauf goldene Früchte zu sehen waren. Gleich danach erschienen weitere Schattengestalten und umschritten den Baum. Sie tanzten schneller und schneller bis zum ersten Lichtschimmer
des neuen Tages. Dann verwandelte sich die alte Frau plötzlich in eine Eule, die unter Gekreisch wieder in der Zisterne verschwand. Aus den anderen Schatten wurden hässliche Vögel, die wild um
den Baum herumflogen, bis dessen Stamm ein lautes Stöhnen von sich gab, worauf sie der Eule in die Zisterne folgten.
Die Frauen waren bestürzt, und als sie in ihre Häuser zurückkehrten, erzählten sie in den Familien, was sie gesehen und gehört hatten. Einige der Jungen meinten, das sei alles nicht weiter ernst
zu nehmen. Sie verschlossen die Zisterne und legten sich auf die Lauer. Die Schatten stiegen aus der verschlossenen Zisterne und verprügelten die Burschen so heftig, dass ihre Wunden vom Arzt
behandelt werden mussten. Die Kirche nahm sich der Sache an und veranlasste, dass wiederholt exorziert wurde.
Die Bäume im Garten wurden gefällt, aber der Feigenbaum schlug erneut aus. Wie oft man seine Wurzel auch ausgrub, er schlug aus, blühte erneut, trug Früchte, und niemand brachte es fertig, ihn
endgültig zu beseitigen. Die Zisterne der alten Dame gibt es noch immer, und einige Mädchen warten in der Nacht darauf, dass der Schatten erscheint und Feigen aus Gold in seine Zweige zaubert.
Quelle: Märchen aus Spanien
JUAN HEXENMEISTER
Juan, der Bauernjunge, der in einem kleinen Dorf lebte, wurde von allen nur "großer Schlingel" gerufen. Eines Tages beschloß er etwas Besonderes, nämlich Hexenmeister, zu werden. Er ging also zu
einem alten, weisen Mann und bat ihn um Unterricht.
"Wenn du Hexenmeister werden willst, mußt du erst dreimal drei Jahre Hexenmeisterlehrjunge, dann dreimal neun Jahre Hexenmeister sein und dann darfst du die Hexenmeisterprüfung machen."
Juan willigte ein und begann seine Lehre. Er lernte, wie man Leuten Goldmünzen aus Ohren, Nasen und Taschen zieht, wie man weiße Kaninchen unter einem Hut hervorholt und wie man Kindern die
Langeweile wegzaubert.
Nach drei Jahren meinte er genug zu wissen, dankte dem Hexenmeister und zog fort.
Er wanderte durchs ganze Land, zeigte überall auf den Dorfplätzen seine Kunststücke und wenn ihn jemand fragte, wer er sei, antwortete er: "Ich bin Juan Hexenmeister, der größte Hexenmeister.
Aber hier zeige ich nur meine kleinen Künste, die großen sind nicht für alle Tage."
Bald sprach man im ganzen Land von Juan Hexenmeister. Auch der König hörte von ihm und ließ ihn rufen. Als Juan vor ihm stand, dachte der König: Wie ein Hexenmeister sieht der Bursche nicht aus,
eher wie ein großer Schlingel.
"Juan Hexenmeister, vor einer Woche wurde mir mein schönster Ring gestohlen", wandte sich der König an Juan. "Für Dich mit deinen Hexenkünsten wird es sicher leicht sein, ihn wieder
herbeizuzaubern. Damit dir niemand helfen kann, werde ich dich in ein tiefes Kellerloch sperren lassen und dir drei Tage Zeit geben. Wenn du mir den Ring beschaffst, sollst du Hofhexenmeister
werden, schaffst du es nicht, lasse ich dir den Kopf abschlagen."
Juan, in seinem Kellerloch, meinte nur noch drei Tage zum Leben zu haben, denn so einen schwierigen Trick hatte er in der kurzen Lehrzeit nicht gelernt.
Den Ring des Königs hatten drei seiner Diener gestohlen. Am Abend brachte der eine Diener dem Juan Hexenmeister das Abendmahl. Juan dachte, daß nun der erste von seinen letzten Tagen vorbei war
und seufzte: "Da geht der erste hin, so wahr ich Hexenmeister bin!"
Der Diener hörte Juans Worte und dachte er sei gemeint. Zitternd rannte er davon und lief zu den zwei anderen Dienern und erzählte alles.
"Ach", meinten die beiden anderen, "das hast du sicher nur geträumt.!"
Am nächsten Abend brachte der zweite Diener das Abendmahl. Als er gerade gehen wollte, hörte er Juan seufzen: "Da geht der zweite hin, so wahr ich Hexenmeister bin!"
Auch dieser Diener dachte, er sei gemeint und berichtete den anderen davon. Der dritte Diener meinte: "Das hast du bestimmt falsch verstanden!"
Als am nächsten Abend der dritte Diener das Essen zum verzweifelten Juan brachte, seufzte dieser: "Da geht der dritte hin, so wahr ich Hexenmeister bin!"
Da erschrak der Diener gar fürchterlich, fiel auf die Knie und gestand alles.
Juan befahl: "Kommt alle drei zu mir, bringt mir den Ring und ich werde euch nicht verraten! Solltet ihr aber wieder Lust zum Stehlen bekommen, denkt daran: Ich bin der größte
Hexenmeister..."
Als der König erfuhr, daß Juan die Probe bestanden hat, ließ er ihn aus dem Kerker holen und wollte ihn zum Hofhexenmeister ernennen. Juan aber wollte nicht. Was wenn ihn der König ein zweites
Mal auf die Probe stellen würde. So einfach käme er dann nicht mehr davon.
Der König belohnte Juan reich und ließ ihn ziehen. Juan kehrte in sein Heimatdorf zurück, kaufte sich ein schönes Haus, Felder und Wiesen. Und wenn die Kinder sich langweilten, führte er ihnen
seine Kunststücke vor.
"Was für ein Glück", sagten die Dorfleute, "daß unser großer Schlingel heimgekommen ist."
Quelle: Unbekannt-spanisches Märchen
DIE WASCHFRAU

Es waren einmal eine Mutter und eine Tochter, die verdienten ihr Brot damit, dass sie die Wäsche für ihre Nachbarinnen wuschen. Die Tochter war sehr schön, und der Mutter tat es leid, dass sie waschen musste, aber da sie nicht wusste, wovon sie sonst leben sollten, sah sie es mit an, dass das Mädchen ihr half. Und wenn sie mit der Wäsche fertig waren, gingen sie hinaus und sammelten Reisig, das sie nach Hause trugen, um die andere Wäsche zu kochen.
Eines Tages, als sie noch bei der Wäsche waren, ging der Krämer vorbei, blieb stehen und sagte: "Donnerwetter, wie riecht es hier nach Chinarinde!" Er blickte um sich und sah, dass der Geruch,
auf den er aufmerksam geworden war, von dem Holz kam, das man verbrannte.
Er trat in das Haus ein und sagte: "Was macht ihr denn da, liebe Nachbarinnen?" - "Was sollen wir schon machen! Wir plagen uns zu Tode, um nicht Hungers zu sterben. Den Armen bleibt nichts
anderes übrig, als zu arbeiten, wenn sie essen wollen." - "Wer hat euch denn das Holz gebracht?" - "Wir holen es selber, denn wenn wir es kaufen müssten, würde uns das Wäschegeld für das Holz
draufgehen." - "Sagt mir doch: gibt es da noch mehr von diesem Holz?" - "Ja, Herr, sehr viel." - "Gut, wenn ihr wollt, braucht ihr nicht mehr zu waschen. Ihr müsst nur jeden Tag ein Bündel von
diesem Reisig sammeln und es zu mir bringen. Ich bezahle euch so viel dafür, dass ihr nicht mehr als eure eigene Wäsche zu waschen braucht." Und so geschah es. Mutter und Tochter gingen jeden Tag
hinaus und sammelten ein Bündel Reisig; dann brachten sie es dem Krämer, ohne zu wissen, dass es Chinarinde war, und der bezahlte ihnen dafür das, was er für richtig hielt. Und sie waren sehr
zufrieden.
Eines Tages, als sie draußen waren, ging die Tochter ein wenig vom Weg ab und verirrte sich in dem Wald; und als sie zufällig einen Zweig abbrach, öffnete sich plötzlich die Erde, und es kam ein großer Neger heraus, der blieb stehen und betrachtete sie. Sie erschrak und wollte fliehen, doch als der Neger sah, wie schön sie war, fasste er sie am Arm und zog sie mit sich in die Erde. Als die arme Mutter ihr Kind vermisste, begann sie laut zu rufen und durchsuchte alles weit und breit. Doch soviel sie auch suchte, sie konnte das Mädchen nicht finden und musste ohne sie traurig nach Haus gehen. Sicherlich hatte ein wildes Tier sie gefressen.
Nun wollen wir sehen, was mit der Tochter indessen geschah:
Als sie die Hände des Negers fühlte, wurde sie ohnmächtig, und wie sie wieder zu sich kam, befand sie sich in einem prunkvoll eingerichteten Saal. Der Neger, der dort war, sagte ihr, sie solle nicht weinen, denn er werde ihr kein Leid antun, im Gegenteil, sie solle hier die Herrin sein, und sie brauche nichts weiter zu tun als befehlen. Wenn sie nur brav sei, würde sie auch glücklich werden. Das Mädchen begann zu weinen und fragte, was aus ihrer Mutter ohne sie werden sollte, sie sei doch schon alt und werde Hungers sterben. Der Neger antwortete, sie brauche sich darüber keine Gedanken zu machen, denn der, der ihr zu essen gebe, würde schon dafür sorgen, dass es auch ihrer Mutter an nichts fehle.
Da es keinen anderen Ausweg gab, blieb sie, wo sie war, und da sie merkte, dass man sie gut behandelte und sie alles hatte, ergab sie sich allmählich in ihr Schicksal; und als sie eines Tages durch die Gemächer ging, sah sie, dass sie sich in einem wunderbaren Palast befand, in dem es alles gab, was man sich nur wünschen konnte. Der Neger deckte zur gewohnten Stunde den Tisch, und zum Schlafen hatte sie ein Gemach mit einem herrlichen Bett. Wenn sie nachmittags spazieren gehen wollte, so lustwandelte sie in einem Garten, in dem die verschiedensten Vögel und Blumen waren. So verstrich die Zeit, ohne dass sie jemand anders als den Neger sah. Nur nachts, wenn sie das Licht ausgelöscht hatte, legte sich jemand zu ihr, der wieder fort ging, bevor es Tag wurde, so dass sie ihn niemals sehen konnte. Sie wusste nur, dass der, der mit ihr schlief, ein Mann war.
Aber dann, als sie sich schwanger fühlte, sehnte sie sich nach ihrer Mutter, und sie sagte es dem Neger, der der einzige war, mit dem sie sprechen konnte; doch der Neger erklärte ihr, sie dürfe
nicht fortgehen. Sie bat nun so sehr, dass der Neger schließlich sagte, es sei gut, sie solle gehen, doch nur unter der Bedingung, dass sie nicht mehr als vierundzwanzig Stunden fortbleibe und
niemandem erzähle, was hier geschehe, soviel man sie auch fragen möge; sollte sie es dennoch tun, würde es ihr Verderben sein.
Sie versprach alles, und dann brachte sie der Neger an die Stelle, wo sie damals den Zweig abgebrochen hatte.
Sie machte sich auf den Weg und kam zu Hause an, wo die Mutter vor Freude außer sich geriet, als sie ihre Tochter wieder sah. Doch die erklärte, dass sie nur für vierundzwanzig Stunden gekommen sei und dass sie dann unter allen Umständen wieder fortgehen müsse, denn sie sei nur hier, um die Mutter einmal wieder zu sehen. Die Mutter fragte sie, wo sie denn solange gewesen sei, doch sie antwortete, dies könne sie nicht sagen, es sei ein Geheimnis, und sie könne ihr nur sagen, dass sie sehr gut aufgehoben sei und es ihr an nichts fehle.
Dann kam die Großmutter, die war sehr alt und umarmte sie wieder und wieder und stellte ihr immer neue Fragen, doch antwortete sie ihr ebenso wie ihrer Mutter. Da die Alten ja aber nun einmal so beharrlich sind, drang die Großmutter mit Fragen so sehr in sie, dass ihr das Mädchen schließlich alles erzählte, was sie erlebt hatte. "Hör, mein Kind", sagte die Großmutter, "nimm diese kleine Kerze und dieses Streichholz. Wenn du merkst, dass er eingeschlafen ist, zünde die Kerze an, damit du sehen kannst, ob der Neger oder ein anderer bei dir schläft." Nun, so geschah es. Sie nahm ihre kleine Kerze und ihr Streichholz, steckte es in die Tasche und machte sich auf den Weg nach dem Schloss. Als sie im Wald an den Platz kam, griff sie nach dem Zweig; sogleich kam der Neger heraus, der sie anfasste und hineinzog.
In ihrem Zimmer fragte der Neger sie, ob man ihr irgendeinen Rat gegeben habe. Sie aber antwortete, nein, man habe ihr nichts gesagt.
"Hör", sagte der Neger zu ihr, "wenn du einen Rat bekommen hast, sag ihn mir, denn ich weiß, ob du ihn befolgen darfst oder nicht. Nicht lange dauert es mehr, und du bist gerettet; wenn du ihn
mir aber nicht sagst und es etwas ist, was du nicht tun darfst, und du es doch tust, so muss ich dich töten, wie ich schon andere getötet habe, die vor dir hier gewesen sind." Das Mädchen
versicherte ihm: nein, und legte sich schlafen.
Um Mitternacht aber, als sie merkte, dass der, der bei ihr lag, eingeschlafen war, zog sie ihr Hölzchen heraus und steckte ihre Kerze an; da sah sie einen wunderschönen Jüngling neben sich liegen, der herrlich anzusehen war. Da er auf dem Rücken lag, bemerkte sie, dass er auf seiner Brust einen Spiegel trug, und sie beugte sich über ihn, um hineinzuschauen. Da sah sie einen großen Saal, in dem sechs Frauen an einer Ausstattung für ein kleines Kind nähten und stickten. Sie betrachtete dieses Bild voller Entzücken, und sie bemerkte nicht, dass ein Wachstropfen an der Kerze entlanglief und auf die Brust des Jünglings fiel, der von der Hitze des Tropfens erwachte und ausrief: "Weh, Unglückselige, nun hast du meine Verzauberung erneuert!" Und mit diesen Worten verschwand er, und sie war allein.
Da hörte man eine Stimme, die rief: "Töte sie, Neger! Töte sie, Neger!" Der Neger kam herein, um sie zu töten, und sie brach in Weinen aus und sagte, sie habe das getan, weil ihr Großmütterchen es ihr gesagt habe, doch man möchte ihr verzeihen, denn sie wolle es nie wieder tun. Der Neger, der sie gern hatte, bekam Mitleid mit ihr, und er sprach: "Hab ich dir nicht gesagt, du solltest mir erzählen, wenn man dir einen Rat gegeben hat? Hättest du es getan, so wärst du jetzt nicht in dieser Lage. Ich müsste dich töten, doch tu ich es nicht: Was du unter deinem Herzen trägst, bewahrt dich davor; aber hier kannst du auch nicht bleiben, du musst fortgehen. Nimm diese beiden Knäuel Garn, und wenn du hinausgehst, befestige das eine Ende an dem Zweig, den du abbrechen wolltest, und dann mach dich auf den Weg, und da, wo der Knäuel zu Ende ist, verbringst du die Nacht. Am nächsten Tag knüpfe das Ende an den anderen Knäuel und mach dich auf den Weg, und wo das Garn zu Ende ist, dort verbringst du wieder die Nacht."
Nun also, das arme Mädchen nahm ihre beiden Knäuel und befestigte beim Hinausgehen den einen an dem Zweig, den der Neger ihr genannt hatte, und machte sich auf den Weg und ging weiter und immer weiter, und da das Garn sehr lang war, brach die Nacht herein, bevor sie das Ende hatte; und es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich auf das Gras hinzulegen und dort zu schlafen. Als der Morgen dämmerte, knüpfte sie beide Knäuel zusammen und setzte ihren Weg fort und bat den lieben Gott, er möchte sie doch eine Hütte oder ein Haus finden lassen, wo sie die Nacht verbringen könnte, damit sie nicht wieder auf freiem Feld schlafen müsse. Als der Knäuel zu Ende war, stand sie gerade einem Gebäude gegenüber, das wie ein Schloss aussah. Und sie trat ein und erfuhr, dass dies das Sommerschloss der Königin sei, die sich dort für eine Zeitlang niedergelassen hatte. Sie bat, man möchte die Königin fragen, ob sie ihr erlauben würde, die Nacht im Schloss zu verbringen, um nicht auf freiem Feld schlafen zu müssen, denn sie sei krank. Die Königin sagte ja und befahl, ihr ein gutes Abendessen und ein schönes Bett zum Schlafen zurechtzumachen.
Am nächsten Tag, als die Königin sah, wie schön und bescheiden sie war und ihren Zustand erkannte, hatte sie Mitleid mit ihr und sagte ihr, sie solle nicht eher von hier fortgehen, bis sie das Kind zur Welt gebracht habe. Da das arme Mädchen kein Zuhause hatte, bedankte sie sich bei der Königin und blieb bei ihr, doch wusste sie nicht, wie sie alles wiedergutmachen sollte, was die Königin für sie tat.
Die Zeit verstrich, und sie gebar einen Knaben, der war so schön, dass es nicht zu beschreiben war. Die Königin hatte sie sehr ins Herz geschlossen, und wenn sie davon redete, wegzugehen, um ihr nicht lästig zu fallen, sagte sie immer wieder, daran dürfe sie nicht denken, auf keinen Fall dürfe sie von ihr gehen, um so weniger, da der Knabe mit einem Sohn von ihr, der verzaubert sei, eine so große Ähnlichkeit habe, dass sie ihn immer vor sich zu sehen glaube, wenn sie das Kind anschaue. Als das Mädchen sah, wie gern die Königin sie hatte, mochte sie ihr nicht mehr widersprechen und gab nach, und so verging die Zeit, und die beiden wurden von Tag zu Tag immer bessere Freunde.
Jeden Nachmittag, wenn sie gegessen hatten, nahm die Königin das junge Mädchen beim Arm, und sie gingen hinunter in den Garten. Und bei ihren Spaziergängen bemerkten sie, dass immer eine Taube heran flog und das Mädchen umkreiste. Eines Tages, als sie nicht in den Garten gingen, öffneten sie ein Fenster, und kurze Zeit darauf flog die Taube herein und an die Wiege des Kindes, auf der sie sich niedersetzte. Das Mädchen stand auf und kam näher, um sie wegzuscheuchen; aber da es sah, dass sie ruhig sitzen blieb, ging es zu ihr, ergriff sie und sagte zu der Königin: "Seht nur, welch schöne Taube." Die Königin nahm sie und begann, sie zu streicheln, doch als sie mit der Hand über ihren Kopf strich, bemerkte sie eine kleine Geschwulst und fragte: "Weh! Was hat sie denn hier am Kopf?"
Das junge Mädchen nahm die Taube, und als sie die Federn auseinandermachte, sah sie, dass es eine Stecknadel war. Sie zog sie heraus, und dabei verwandelte sich die Taube in einen Jüngling, und in was für einen Jüngling! Als die Königin ihn sah, stieß sie einen Schrei aus und umarmte ihn mit den Worten: "Hier ist mein Sohn, von dem ich dir sagte, dass er verzaubert sei." - "Ja, das bin ich", sagte der Prinz, "und dies ist meine Frau und mein Kind." - "Nicht ohne Grund sagte ich, dass er dir ähnlich ist", sprach die Königin.
Der Prinz umarmte seine Frau und seinen Sohn und sprach: "Diese Nadel war der Wachstropfen, den du auf mich fallen ließest, weil du mich vor der Zeit sehen wolltest, und es war nötig, dass du sie herauszogst, um meine Verzauberung, die sich verlängert hatte, zu beenden." Da trat der Neger ein, der brachte in einigen Körben die Ausstattung für das Kind, die das Mädchen schon in dem Spiegel gesehen hatte, den der Prinz in jener Nacht auf seiner Brust trug und an der damals sechs Frauen gestickt hatten; und dies alles war für ihren Sohn bestimmt.
Dann heirateten sie und lebten sehr glücklich mit ihrem Kind und anderen Kindern, die sie noch bekamen.
Quelle: Märchen aus Spanien
DIE DREI GEISSLEIN UND DAS UNGEHEUER
Es war einmal eine Geiß, die lebte mit ihren drei Kindern in einem kleinen Haus im Wald. Jeden Morgen ging sie Gras und Kräuter für die Geißlein suchen. Sie schloß die Tür zu und ermahnte ihre
Kinder niemandem zu öffnen, denn im Wald lebte ein riesiges Ungeheuer.
Als die Geiß eines Tages wieder in den Wald ging, sah sie in einem Bach eine Wespe, die ins Wasser gefallen war. Die Geiß hielt ihren Vorderfuß ins Wasser und half der Wespe so heraus.
"Ich bin nur eine kleine Wespe, aber vielleicht können meine Schwestern und ich dir auch einmal helfen. Wenn du in Not bist, komme zu unserem Nest und rufe nach uns."
Als die Geiß nach Hause kam, klopfte sie an die Tür und rief:
"Ich bin es, eure liebe Mutter,
ich komme heim mit Futter.
Ihr meine lieben Geißelein,
laßt mich bitte ein!"
Die drei Geißlein öffneten die Tür. In der Nähe aber hatte das riesige Ungeheuer, das immer hungrig war, gelauscht. Als die Geiß am nächsten Tag wieder nach Nahrung ging, schlich das großmäulige
Ungeheuer zum Geißenhaus, verstellte seine Stimme und rief:
"Ich bin es, eure liebe Mutter,
ich komme heim mit Futter.
Ihr meine lieben Geißelein,
laßt mich bitte ein!"
Die drei Geißlein meinten, die Mutter sei aus dem Walde zurück und öffneten die Tür. Wie erschraken sie, als das furchtbare Ungeheuer mit weitaufgerissenem Maul vor ihnen stand. In ihrer Angst
rannten sie hin und her und versteckten sich schließlich auf dem Dachboden. Das Ungeheuer suchte polternd nach ihnen.
Als die Geiß nach Hause kam, sah sie die offene Tür und hörte ihre Kinder aus dem Dachfenster rufen: "Das Ungeheuer ist im Haus. Wir armen Kleinen kommen nicht raus."
Da rannte die Geißenmutter zum Wespennest: "Ihr lieben Wespen im Nest, meine armen Geißlein sitzen fest. Das Ungeheuer ist im Haus, die Geißlein können nicht heraus."
Sogleich kamen die Wespen im Schwarm geflogen, umsurrten das Ungeheuer und stachen es, wo sie es nur stechen konnten. Das Ungeheuer heulte und floh in den Wald. Die Wespen ihm immer hinterher. Da
rannte das Ungeheuer immer weiter und kam nie wieder.
Die Geiß und ihre Kinder tanzten und sangen vor ihrem kleinen Häuschen:
"Das Ungeheuer, das Ungeheuer,
das rennt, als wär' hinter ihm Feuer.
Es rennt und kommt nie wieder her,
ihr lieben Wespen, danke sehr."
Quelle: Unbekannt-spanisches Märchen
DIE XORRIGOS-QUELLE
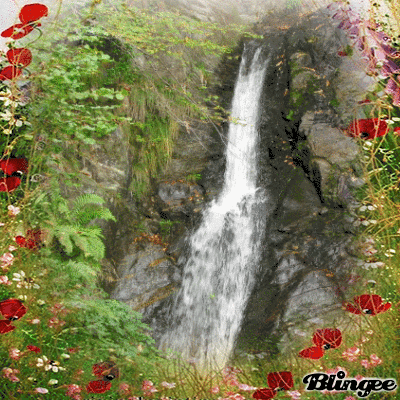
Als die Mauren und die Christen sich heftig anfeindeten, so dass diese, wenn sie eine Mauren-Galiote (Schiff) sahen, selbe sogleich verfolgten, oder die Mauren es den unsrigen ebenso machten,
geschah es, dass man in Xorrigo einen Hirten benöthigte und die Pächterin sagte zu dem Pächter:
- Schau Gabriel, ich glaube, es wäre für uns vortheilhaft, wenn wir erfahren können, dass eine Schiffsladung Mauren zu verkaufen ist, dass du zur Stadt gehen würdest, um einen Sklaven zu kaufen,
der uns den Hirten machte; und so hätten wir nur für seinen Unterhalt zu sorgen.
- Ja, sagte der Pächter, ich hatte mir dasselbe auch gedacht.
- Also werden wir es machen; vielleicht werde ich dich begleiten und zugleich werden wir die Schwester besuchen, die seit langer Zeit uns darum gebeten hat.
Nach vierzehn Tagen erfuhren sie, dass man eine Galiote gekapert hatte, spannten den zweispännigen Karren ein und fuhren langsam, langsam der Stadt zu. Angekommen, stellten sie den Wagen bei ihrer Schwester ein, die sich über ihren Besuch freute und der Pächter ging dann nach dem Rathhaus. Hier fand er die Mauren, die traurig und nachdenkend das Schicksal erwarteten, das sie treffen sollte und auf die vorübergehenden Leute schauten. Der Pächter Gabriel gewahrte einen Jungen, schön und kräftig gebaut, von dem er die Augen nicht abwenden konnte. Nachdem er den Kauf abgeschlossen und die vereinbarte Summe bezahlt hatte, nahm er diesen Mauren mit sich, der von nun an sein Sklave war.
Am Abend kehrten sie wieder nach Xorrigo zurück und unterwegs sagten sie zu dem Sklaven:
- Bei uns zu Hause wird es dir gut ergehen, weil du den Hirten machen musst und wenn du dich wie ein Mann beträgst, wird es dir so sein als wenn du zu Hause wärst.
- Ja, fügte die Pächterin hinzu, wir werden dich wie einen Sohn halten.
Der Maure äusserte sich nicht und zeigte sich recht traurig, was natürlich ist für einen, der sich in seiner Lage befand.
Angekommen in Xorrigo, begab sich jedes an seine Arbeit und der Hirte zu seinen Schafen um sie zu pflegen. Die Zeit verging und der Maure wurde sehr gut behandelt, ohne dass ihm etwas abginge.
Es kamen einige sehr schlechte Jahre und da es nicht regnete, hatten sie gar kein Wasser mehr, weil es damals keine Quelle wie jetzt gab. Das Vieh verendete vor Durst und der Pächter war ganz
verzweifelt. Eines Tages, während des Abendessens, sagte der Maure über diesen Gegenstand sprechend:
- Was gebet ihr mir für eine Quelle, die euch täglich mehr Wasser liefern würde als der grosse Wasserbehälter von hier draussen fasst.
- Viel.
- Und was würdet ihr mir geben wenn ich sie fände?
- Schau, lasse das gehen; ebensogut könntest du wollen, dass ein Feigenbaum Orangen trägt.
- Warum! Euch frage ich, was würdet ihr geben wenn ich sie auf dem Besitztum fände.
- Was ihr wollet.
- Also wenn ihr mir die Freiheit versprecht, werde ich euch Wasser schaffen für das Vieh, für die Besitzung und für die benachbarten Güter.
- Hast du es schon sicher?
- Ganz sicher, aber vorher müsst ihr mir versprechen, dass ihr mir, sobald ihr das Wasser bekommen werdet, die Erlaubnis gebet, fortzugehen.
- An dem Tage, an dem du eine solche Quelle, wie du sagst, finden wirst, werde ich dir sogleich die Freiheit geben.
- Versprechet ihr es mir?
- Ja, ich verspreche es dir.
- Also kommt mit mir.
Der Pächter nahm eine Laterne und der Maure eine Spitzhacke und sie gingen beide von Hause fort, nach einem tiefen Tale das zur Besitzung gehörte.
Als sie am Fusse eines sehr hohen Felsens angekommen waren, begann der Sklave an einer Fuge zu hämmern, wo es schien, dass man schon einmal angefangen habe, zu bohren; als er eine gute Zeit
gehämmert hatte, fiel ein Stück Stein herab und es sprang ein Wasserstrahl heraus, stärker wie ein Bein, der über den Pächter, welcher davor Licht machte, stürzte, und taufte ihn von oben nach
unten. Gut, dass es Sommer war. Nun sagte er ganz erstaunt zu Amet:
- Niemals hätte ich das gedacht, du bist der wirkliche Teufel.
- Versprechen heisst Halten; erwiederte der Sklave, und nun kann ich frei nach meiner Heimat gehen.
- Schau, lasse das gehen. Du hast es gut genug.
- Meinetwegen; ich habe nichts zu klagen weder über euch noch über die Pächterin, aber ich will fortgehen. Versprechen heisst Halten.
- Ei, ich will Zeit haben, um zu sehen, ob das Wasser immer fliesst; vielleicht versagt es morgen schon!
- Wenn bis in acht Tagen das Wasser ausbleibt, werde ich euer Sklave bleiben, wenn es aber fortfliesst, verlange ich die Freiheit.
- Es ist schon abgemacht, sagte der Pächter.
Es vergingen die acht Tage, und das Wasser floss in gleicher oder noch grösserer Menge wie am ersten Tag, aber der Pächter wollte ihm seine Freiheit nicht geben und mit Worten und Ausreden
darüber hinwegkommen, indem er ihm sagte, dass ihm nie etwas fehlen würde, bis endlich der Maure ärgerlich darüber, ihm sagte:
- Wenn ihr mir nicht die Erlaubniss gebet, wegzugehen, verspreche ich euch und mit einem zuverlässigeren Versprechen, als das euere, dass ich euch das Wasser verstopfen werde und ihr werdet es
niemals wieder auffinden.
- Du bist dazu nicht im Stande, diese Quelle verstopft Niemand.
- Nun wir wollen es sehen.
- Pächter Gabriel, ihr werdet an manchem Tag bereuen, was ihr gemacht habt.
Einen Monat darauf hielten folgendes Gespräch der Maure und eine Hirtin, von einer benachbarten Besitzung, die zur Quelle kam, um zu trinken, und mit der der Maure schon andere Male gesprochen
hatte.
- Ich sah dich aus jener Anhöhe, sagte der Sklave, und kam hierher, um von dir Abschied zu nehmen, weil ich ganz fest entschlossen bin, heute Nacht zu entfliehen. Lasse es doch Niemanden
erfahren.
- Und warum Amet?
- Der Pächter versprach mir, dass, wenn ich eine Quelle finde, er mir die Freiheit schenken würde, die Quelle ist da und jetzt will er mich nicht frei lassen.
- Es wird der Tag kommen wo er dich gehen lässt.
- Es ist schon lange Zeit her, dass er mir nein sagt, und heute Nacht warte ich nicht weiter, ich muss fliehen; aber zuerst komme ich um die Quelle zu verstopfen, weil der Pächter mir einen
schlechten Streich gespielt hat.
- Es steht fest, dass er es dir so gemacht hat, aber ich erbitte für mich eine Gunst und das ist, dass wenn du sie verstopfest, du mir wenigstens ein Strählchen fliessen lässt, damit ich im
Sommer wo es hier so warm ist, trinken kann.
- Es kann nicht sein, weil der Pächter es finden könnte.
- Wenn es noch so klein wäre, Amet, tue es meinetwegen.
- Es tut mir leid für den Pächter, aber ich werde es nur für dich fliessen lassen; wenn du den Pächter siehst, sage ihm, warum ich entflohen bin und dass er auf seine Haut acht geben solle, denn
wenn ich Gelegenheit finden werde, wird er es mir teuer zahlen.
- Lasse ihn gehen.
- Er hat es verdient.
- Es ist wahr, aber sei nicht so.
Amet verschüttete die Quelle und verabschiedete sich von der Hirtin, die ihm für das Wasserstrählchen dankte, das er für sie gelassen hatte.
In jener Nacht entfloh er, ohne dass Jemand es bemerkte; und als der Pächter die Quelle nachsuchte, konnte er nur den Durst löschen, den die Ermüdung und der Aerger ihm verursacht hatte. Sehr
bereute er, dass er ihm nicht alles, was er wollte, zugestanden hatte und er lief noch nach der Stadt, um zu sehen ob er ihn fände, aber es war umsonst, weil er schon das Wasser gewonnen hatte;
er hatte sich eingeschifft und er war schon doppelt so weit von Mallorca entfernt als die Besitzung von der Stadt lag.
Sehr ärgerlich kehrte er nach Hause zurück und umsonst hämmerte er auf den Stein und suchte das Wasser, er musste sich mit dem Strählchen begnügen, welches, dank der Hirtin, der Maure
zurückgelassen hatte.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
FRAU FORTUNA UND HERR GELD

Nun, meine Herren, so wisset denn, daß Frau Fortuna und Herr Geld ineinander so verliebt waren und so unzertrennlich lebten, daß man nie den Einen ohne den
Anderen sah. Natürlich fingen die Leute mit der Zeit an, dies Verhältniß zu tadeln, und beide beschlossen deshalb endlich, sich ehrlich zu heiraten.
Herr Geld war ein kleiner dicker Mann mit einem runden Kopfe von peruanischem Golde, einem runden Bauche von mexikanischem Silber und runden Beinen von
segovianischem Kupfer, mit Papierschuhen aus der großen Fabrik von Madrid. Frau Fortuna dagegen war eine capriciöse, hirnlose, unbeständige und unverschämte, eigensinnige Frau, dabei blind wie
ein Maulwurf.
Kaum hatte das neue Ehepaar die Flitterwochen verlebt, als es auch mit dem Hausfrieden vorbei war. Die Frau wollte befehlen und der stolze und aufgeblasene Herr
Geld wollte sich nicht befehlen lassen. - Meine Herren, mein Vater (Gott habe ihn selig) sagte, wenn sich der Ocean verheiraten würde, würde er schon fein demütig werden: aber Herr Geld war
hoffährtiger als der Ocean und verlor seinen Hochmut nicht.
Weil nun beide die Oberhand haben wollten, und keiner dem andern nachgeben mochte, so kamen sie endlich überein, daß eine Probe über die streitige Herrschaft
entscheiden sollte. "Siehe," sagte die Frau zu ihrem Manne, "siehst Du dort am Fuß des Olivenbaumes jenen armen Mann, der so elend und betrübt da sitzt? Wir wollen sehen, wer ihm eine bessere
Lage verschafft, Du oder ich."
Herr Geld ging darauf ein und sie machten sich auf den Weg, er rollend, sie mit einem Sprunge.
Der Mann, der immer unglücklich gewesen war und nie den einen noch den andern vor seinen Augen gehabt hatte, machte Augen, so groß wie Oliven, als er die
vornehme Herrschaft vor sich sah.
"Gott grüß Euch," sagte Herr Geld.
"Euch auch," entgegnete der arme Mann.
"Kennt Ihr mich nicht?"
"Ich kenne Euer Gnaden nur, um ihr zu dienen."
"Nie hast Du mein Gesicht gesehen?"
"In meinem ganzen Leben nicht."
"Wie so? besitzst Du denn gar nichts?"
"O ja, Herr, sechs Kinder, so nackt wie Riegel, mit Kehlen so weit wie alte Strümpfe, aber was Einnahme betrifft, so habe ich nur ein 'Nimm und iß,' wenn ich
arbeite."
"Und warum arbeitest Du nicht?"
"Nun, weil ich keine Arbeit finde, das Glück ist mir so zuwider, daß sich alles zu meinem Schaden wendet. Seit ich mich verheiratet habe, scheint mein Weg
gefroren zu sein, alles tot und trocken."
"Ich will Dir zu Hilfe kommen," sagte Herr Geld, indem er pompös einen Duro aus seiner Tasche zog, und ihm den gab.
Dem armen Mann schien das ein Traum und er lief schneller als der Wind gradesweges zu einem Bäckerladen, um Brot zu kaufen. Als er aber das Geldstück aus der
Tasche ziehen wollte - fand er nichts! nichts als ein Loch, durch welches sich der Duro, ohne Abschied zu nehmen, davon gemacht hatte.
Der arme Mann war aber ganz außer sich und fing an zu suchen; fand aber nichts. "Das Lamm, das bestimmt ist, im Rachen des Wolfes zu sterben, kann kein Hirt
dafür behüten." Nach dem Duro verlor er die Zeit, nach der Zeit die Geduld und er fing an, sein Schicksal zu verwünschen.
Frau Fortuna wollte sich indeß darüber fast totlachen und dem Herrn Geld, dessen Gesicht vor Aerger noch gelber ward als es schon war, blieb nichts übrig, als
die Hand noch einmal in die Tasche zu stecken und dem armen Mann eine Unze zu geben, worüber sich dieser so freuete, daß ihm die Freude vom Herzen zu den Augen herausstrahlte.
Er ging nun nach einem Kaufladen, um Zeug für seine Frau und Kinder zu kaufen. Als er aber mit seiner Unze bezahlen wollte, sagte der Kaufmann, die Unze sei
falsch, er sei wohl selbst gar ein Falschmünzer und man werde ihn beim Gerichte angeben. Der arme Mann wurde darüber so feuerrot vor Scham und Verlegenheit, daß man an seinem Gesichte hätte
Bohnen rösten können. Er lief fort und erzählte Herrn Geld, was ihm begegnet war und dabei liefen ihm immer die hellen Tränen herunter.
Frau Fortuna lachte immer mehr und lauter und Herr Geld wurde immer ärgerlicher. "Ihr habt wahrlich rechtes Unglück," sagte er zu dem armen Manne, indem er ihm
zweitausend Realen gab, "aber ich werde Euch vorwärts bringen oder meine Macht für verloren geben."
Der arme Mann entfernte sich und war so außer sich vor Freude, daß er ein paar Räuber, die ihm nachstellten, erst bemerkte, als er sie vor der Nase hatte.
Dieselben zogen ihn aus, nahmen ihm alles weg, was er hatte, und ließen ihn, wie ihn einst seine Mutter zur Welt brachte.
Jetzt machte Frau Fortuna ihrem Mann eine lange Nase und dieser konnte vor Zorn und Unwillen keinen Laut herausbringen. "Nun ist die Reihe an mir," sagte sie,
"und wir werden sehen, wer mehr kann, der Weiberrock oder die Hose."
Mit diesen Worten näherte sie sich dem armen Manne, der sich auf die Erde geworfen hatte und sich die Haare ausraufte. Sie pustete ihn bloß an, und in demselben
Augenblick sah er neben seiner Hand den verlorenen Duro. "Etwas ist immer Etwas," sagte er zu sich selbst; "kann ich doch meinen Kindern Brot kaufen."
Als er an dem bewußten Zeugladen vorbeikam, rief ihn der Kaufmann und sagte, er möchte ihm doch verzeihen; er habe gemeint, die Unze sei falsch, als er sie aber
in der Münze habe prüfen lassen, habe man ihm gesagt, daß das Gold ganz echt und das Gewicht ganz vollkommen sei; er gebe sie ihm hiermit wieder und schenke ihm das gekaufte Zeug noch
obendrein.
Der arme Mann war damit zufrieden und zog mit der Unze und dem Zeuge weiter. Als er über den Markt ging, begegnete er einer Abteilung Gensdarmen, welche die
Räuber eingefangen hatten. Der Richter, der ein Richter war, wie es wenige gibt, befahl, daß man dem armen Manne sein Geld zurückgebe, ohne Kosten, noch andern Abzug.
Der arme Mann wollte darauf dies Geld in einer Mine anlegen und kaum hatte er drei Ellen tief gegraben, als er eine starke Goldader und eine Silberader und eine
Eisenader fand. Er wurde nun bald Don genannt, darauf Ew. Gnaden, und zuletzt Excellenz. - Seitdem hat Frau Fortuna ihren Mann unter dem Pantoffel, und ist ausgelassener, unbeugsamer und
capriciöser als je und fährt fort ihre Gunst wie der Blinde seine Prügel auszuteilen.
Quelle: Spanische Volks- und Kindermärchen
DIE ALTE FRAU MIT DER LAMPE
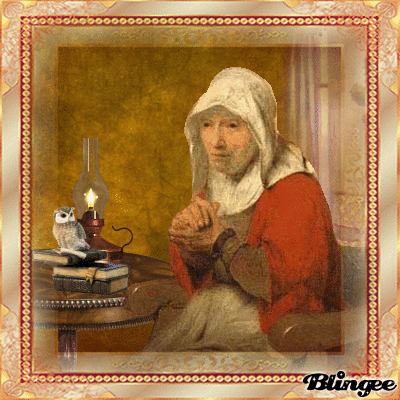
Die Geschichte trug sich zu in Sevilla in jenen Jahren, als der gerechte Don Pedro I. von Kastilien regierte. In einer dunklen Nacht wurde eine entlegene finstere Gasse zum Schauplatz eines turbulenten Ereignisses. Zwei Adlige kreuzten die Degen miteinander, und nach einem kurzen Gefecht stürzte der eine mit einem Loch in der Brust zu Boden. Blut rann ihm aus dem Mund, und er konnte gerade noch flüstern: »Gott helfe mir. Ich sterbe! « Dann war sein Lebenslicht erloschen.
Der Kampflärm lockte eine freundliche alte Frau, mit schon zerknitterter Haut und knochigem Schädel, an eines der Fenster, von denen aus man die Straße überblickte. Und, das Gesicht von Angst gezeichnet, ein Gebet auf den Lippen, versuchte sie, im Schein einer schwachen Lampe genauer zu sehen, was da vor sich ging. Sie sah den blutbefleckten Körper des Mannes in den letzten Zuckungen. Sie erkannte neben ihm einen schwarzgekleideten Mann, der einen Degen in der Hand hielt, von dem Blut tropfte.
Der Mörder betrachtete seinen toten Gegner mit grimmigem Blick, als das Licht der Lampe auf sein Gesicht fiel. Er verbarg es rasch und ging fort wie einer, der nichts zu befürchten hat. Wie er davonging, konnte man das Geräusch vernehmen, das seine Sporen machten.
Aber dann wusste die alte Frau auch, in wessen Gesicht sie eben gesehen hatte, und bei dieser Erkenntnis erschrak sie so sehr, dass sie die Lampe fallen ließ, deren Licht erlosch, als sie hinab in die Gasse fiel. Rasch schlug die Alte darauf das Fenster zu.
»Jungfrau Maria, steh mir bei! « rief sie aus und legte sich, immer noch zitternd, schlafen.
Der Morgen des nächsten Tages brach an. Der Bürgermeister von Sevilla, Don Martin Fernández Cerón schritt durch die großen Tore der Burg von Sevilla und ließ sich dem jungen König Pedro I. melden. Er beugte seine Knie und entblößte sein Haupt. Sein Haar war schon im Dienst für die Krone ergraut.
»Nun?« sagte Don Pedro, »wie können wir solche Ungerechtigkeit in unserem Königreich dulden! Ein toter Mann liegt mitten auf der Gasse, und der Mörder läuft immer noch frei herum!«
»Herr«, antwortete der Bürgermeister, »meine Nachforschungen sind erfolglos geblieben. Die Sache ist geheimnisvoll. Ihr wißt- die Juden, die Mauren. In ihren Vierteln hätte ich vermutet, den Mörder zu finden. Aber wir haben keine Spur, die dorthin führt.«
»Was ist mit Vermutungen getan? Habt Ihr Zeugen? Habt Ihr nicht eine Lampe gefunden? Sucht nach dem Eigentümer und zwingt ihn zu gestehen, wer der Mörder ist. Und beeilt Euch damit, wenn Euch Euer Leben lieb ist! «
Als der Bürgermeister ging, zitterte er am ganze Leibe. Don Pedro folgte ihm. Er wollte sich noch eine Weile mit seinen abgerichteten Falken vergnügen. Danach ritt er aus.
Als die Nacht kam, verließ er, schwarz gekleidet, seinen Palast durch eine Hintertür. An seinem Gürtel aber hing ein Degen aus bestem Toledaner Stahl. So huschte er durch die Gassen der Stadt.
Unterdessen verhörte der Bürgermeister im Gefängnis die alte Frau. Er wollte sie unbedingt zum Sprechen bringen. Obwohl sie vor Angst und Schrecken zitterte, weigerte sie sich zu reden. Die Folterknechte verfluchten sie und drohten ihr mit der Folter.
Aber weiterhin hörte man von der alten Frau kein Wort, außer Schreien und Klagen.
»Ich weiß von nichts, habe niemanden gesehen. Diese Lampe gehört mir nicht«, rief sie immer wieder.
In diesem Augenblick trat ein Fremder ein und verbarg sich hinter einer Säule.
»Nun redet schon, alte Frau!« rief der Bürgermeister. »Wer ist der Mörder?«
»Ich weiß es nicht«, beharrte die Unglückliche. »Foltert sie! « befahl der Bürgermeister.
Man zerrte sie zu der Folterbank und spannte ihren Körper ein. Hebel wurden bewegt. Ihre Knochen gaben ein krachendes Geräusch von sich.
Endlich war der Schmerz zu furchtbar, dass sie es nicht mehr aushielt, und die alte Frau stieß hervor: »Es war der König, der ihn getötet hat. «
Ein von Furcht bestimmtes Schweigen folgte auf ihre Worte. Der Fremde trat hinter der Säule hervor und gab sich zu erkennen.
Es war Don Pedro, der König selbst. Jene, die anwesend waren, fuhren erschrocken zusammen und waren so überrascht, dass sie fast vergaßen, vor ihrem Herrscher die Knie zu beugen. Der ging auf die Zeugin zu, holte einen Beutel mit hundert Goldmünzen hervor, gab ihn der alten Frau und sagte: »Diese Frau hat die Wahrheit gesprochen. Wer die Wahrheit sagt, den sollten der Himmel und die Justiz schützen. Geht in Frieden und fürchtet nichts. Was das Verbrechen angeht, so bin ich der Mörder dieses Mannes. Aber nur Gott kann über den König richten. «
Aber der König der weltlichen Gerechtigkeit wollte diese denn doch auch walten lassen, und so befahl er einem seiner Diener, an jener Ecke, an der das Gefecht stattgefunden hatte, eine Steinplastik des königlichen Hauptes anzubringen, die sich in dem düsteren Licht der Gasse wie der Kopf eines zum Tod Verurteilten ausnahm.
Quelle: Frederik Hetman "Der verzauberte Feigenbaum : Andalusische Märchen"
DIE ZWÖLF DIEBE
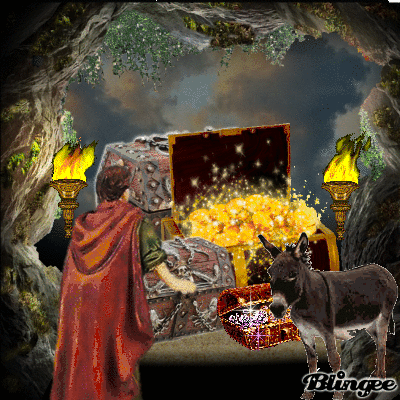
Ein Mann hatte Söhne, von denen einer verheiratet war. Dieser Mann war sehr arm und er suchte täglich durch Holztragen etwas zu verdienen. Eines Tages suchte er Holz in der Nähe von einer Höhle
und da sah er zwölf Diebe darauf zugehen und sagte:
- Was soll ich jetzt tun? Wenn sie mich erblicken, werden sie mich töten, es sind ihrer so viele. Ich will auf diesen Baum steigen. Und er stieg hinauf.
Die Diebe kamen an und sagten:
- Oeffne bitsoch, und die Höhle öffnete sich und sie gingen hinein.
Nach kurzer Zeit kamen sie wieder heraus aus der Höhle und sagten:
- Schliesse bitsoch, die Höhle schloss sich und sie gingen fort.
Als sie nicht mehr da waren, stieg er vom Baume und sagte: Oeffne bitsoch, die Höhle öffnete sich und er ging hinein. Hier fand er viel Geld, er belud seinen Esel damit und sagte dann:
- Schliesse bitsoch. Die Höhle schloss sich und er ging fort.
Als er nach Hause kam, sagten seine Kinder zu ihm:
- Mein Vater, was bringst du uns, was bringst du uns?
- Etwas Gutes, antwortete er ihnen und seinem Aeltesten befahl er, zum Hause des verheirateten Bruders zu gehen, er solle ihm ein Mass leihen.
Dieser verheiratete Sohn hatte einen Verkaufsladen, es ging ihm sehr gut und täglich kamen seine Brüder, um zu sehen, ob er ihnen etwas zu essen gebe und er jagte sie immer fort.
- Was willst du mit dem Mass machen, hast du Läuse zu messen?
- Ich weiss nicht was wir damit machen sollen, antwortete ihm der Bruder.
Er brachte das Mass nach Hause und sie massen das Geld darin.
Als sie mit dem Messen fertig waren, brachte er das Mass wieder zurück und was machte der verheiratete Sohn, er zerlegte das Mass, um zu sehen, was sie gemessen hatten und fand in den Fugen ein
kleines Goldstück. Nun ging er zum Hause seines Vaters, um zu erfahren, was er gemacht habe, um so viel Geld zu bekommen.
Sein Vater wollte es ihm anfangs nicht sagen, allein nach vielen Bitten seines Sohnes sagte er ihm alles.
Was macht der Sohn, er geht zu jener Höhle und sagt: Oeffne bitsoch und er geht hinein. Als er im Innern war, hatte er vollständig vergessen, was er sagen müsse, dass sich die Höhle öffne und um
zu sehen, wie er herauskäme, sagte er:
- Oeffne Simona, öffne Peter, öffne Johanna, Anna, aber die Höhle öffnete sich nicht und er und der Esel blieben daselbst eingeschlossen.
Als er sah, dass er auf keine Art und Weise herauskommen konnte, versteckte er den Esel in einem Goldhaufen und er versteckte sich ebenfalls darin, aber mit einem Ohr heraussen, um hören zu
können, was die Diebe sagten, um die Höhle zu öffnen und um es dann selber sagen zu können und herauszukommen.
Die Diebe kamen in die Höhle herein, warfen einen Blick auf den Goldhaufen und sahen, dass davon fehlte und sagten:
- Man hat an diesem Goldhaufen etwas gemacht.
Sie durchsuchten alles genau, sahen das Ohr jenes Mannes, das herausragte, sie zogen daran und es kam der Versteckte zum Vorschein.
Er sagte ihnen, dass wenn sie ihn nicht töten würden, er ihnen sage, wer das Geld hätte, dass er keines weggetragen habe, dass er lediglich nach seinem Vater gekommen sei und dass dieser es sei,
der das fehlende Geld besitze.
Um aus dem Hause des Vaters das Geld wieder zu erhalten, verabredeten sich die Diebe, dass sich ein jeder in einen Schlauch stecken solle und der Sohn solle seinem Vater sagen, dass er zwölf
Schläuche Oel kaufen solle, welche grossen Gewinn einbrächten, da man es sehr billig verkaufte.
Also machten sie es und als die zwölf Schläuche im Innern des Hauses waren, sagte ein Diener zu einer Magd.
- Wollen wir Krapfen machen, weil jetzt viel Oel da ist? Machen wir sie.
Er begann, einen Schlauch zu öffnen und als der Dieb, der darin war, das Geräusch hörte, sagte er:
- Ist es schon Zeit? damit meinte er, ob es schon Zeit sei, aus den Schläuchen herauszukommen, um das Geld zu nehmen, indem er dachte, dass es der verheiratete Sohn sei, der sie nach der
Verabredung, aus den Schläuchen herausziehen sollte.
Als der Diener das hörte, antwortete er:
- Nein, es ist noch nicht Zeit.
Er ging zur Magd und sagte ihr was ihm zugestossen war und die Magd erwiderte, dass er Furcht gehabt habe und dass diese es ihn habe hören lassen, er solle nicht furchtsam sein und einen anderen
Schlauch aufmachen.
Er begann nun, einen anderen Schlauch aufzumachen und aus dessen Innerem fragte man ihn dasselbe. Als er das hörte ging er zum Pächter, um es ihm mitzuteilen und als es der Pächter vernommen
hatte, sagte er:
- Das ist mein verheirateter Sohn, jener Dieb, der mir diesen Streich gespielt hat.
Was macht der Pächter? Er lässt von den Dienern ein Feuer anmachen, mit vielem Holz, damit es eine grosse Flamme wurde, um die Schläuche hinein zu werfen.
Wie das Feuer angemacht war, warfen sie alle Schläuche hinein. Die Diebe verbrannten und er besass das ganze Geld, das in der Höhle war.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
WENN ES GOTT GEFÄLLT
Es war einmal ein Galizier, der lange in Andalusien gearbeitet und sich daselbst viel Geld verdient hatte und nun wieder nach seiner Heimat zurückwanderte. Als er so nahe war, daß ihn nur noch ein kleiner Bach von seinem Dorfe trennte, begegnete ihm ein anderer Wanderer, der zu ihm sprach:
"Wohin, mein Freund?"
"Nach Hause," antwortete ganz fröhlich unser Galizier.
"So es Gott gefällt," erwiederte der Erste fromm und bedächtig.
"Ob's Gott gefällt oder nicht - ich komme doch nach Hause," sagte darauf keck der Galizier, und indem er es kaum gesagt, nahm er einen Anlauf, über das Wasser zu springen und - fiel hinein und ward ein Frosch.
So vergingen zwei Jahre. Da kam eines Tages ein anderer Galizier desselben Dorfes aus der Fremde zurück und wieder erschien jener Wanderer, der schon dem Ersten begegnet.
"Wohin, mein Freund?" sprach der Wanderer.
"Nach Hause," antwortete der Gefragte.
Und siehe! ein Frosch steckte seinen Kopf aus dem Wasser, öffnete sein breites Maul und schrie:
"Wenn es Gott gefällt!"
Kaum hatte er das fromme Wort ausgesprochen, als er auch wieder ein Mensch wurde, der nun vergnügt und fröhlich seinen Weg nach Hause fortsetzen konnte und dort auch glücklich anlangte. Seine Frau traf er ganz gesund, seine Kinder groß und munter und seine Kuh hatte ein prächtiges Kalb. Er bearbeitete fleißig sein Grundstück, pflügte und säete und brachte eine herrliche Ernte ein - Alles, weil es Gott gefiel.
Quelle: Spanische Volks- und Kindermärchen
DIE WASSERFRAU
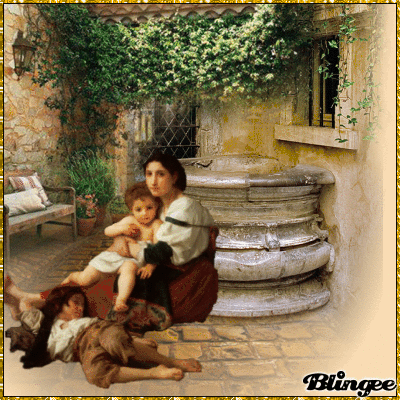
Gabriel Perxanch war ein älterer Junggeselle, welcher ganz allein in seinem Hause wohnte und vom Ertrag seiner Güter lebte. Eu Vilá gehörte ihm auch und er brachte dort viele Tage zu, um die
Feldarbeit zu verrichten und verkehrte im Dorfe, um zu Abend zu essen und dort zu schlafen.
Eines Tages, als er nach seinem Hause zurückgekehrt war, bemerkte er, dass alle Hausarbeiten schon fertig waren, die Teller gespült, die Krüge voll Wasser, das Bett gemacht, das Haus gekehrt, und
im Hofe waren die Hühner mit Futter versorgt.
Wie ist denn das, dachte Gabriel, ich nehme doch den Schlüssel mit und wenn ich nicht im Dorfe bin, betritt Niemand mein Haus.
Und jeden Abend, wenn er zurückkam, fand er alle Arbeiten gemacht.
- Ich werde schon erfahren, wer das Haus in Ordnung macht, und eines Tages, wo er vorgehabt hatte, nach Eu Vilá zu gehen, blieb er zu Hause, ohne Jemanden etwas davon zu sagen, und versteckte
sich, um aufzupassen, wer ihm die Arbeiten mache.
Es dauerte nicht lange, dass er im Verstecke war, als er einen Lärm innerhalb der Brunnen-Mündung hörte, und nach kurzer Zeit sah er eine Frau aus derselben herauskommen, welche anfing, das Haus
in Ordnung zu machen.
- Sage mir, bist du die Magd die jeden Tag kommt mich zu bedienen? fragte er sie.
- Ja antwortete sie.
- Und wer bist du?
- Ich bin die Wasserfrau.
- Die Wasserfrau! ich sehe, dass du auch verstehst, Hausfrau zu sein.
Sie antwortete nichts und nach einer kleinen Pause fing er wieder zu sprechen an:
- Nun denn, wenn du doch einmal die Frau dieses Hauses bist, könntest du auch meine Frau werden. Wenn du dich mit mir vermählen willst, können wir heiraten.
- Ja sagte sie, aber es soll nur unter der Bedingung geschehen, dass du mich niemals die Wasserfrau nennen kannst.
- Also vermählen wir uns, dass dies leicht zu machen ist.
Jene Frau kehrte nun nicht mehr in den Brunnen zurück und sie verheirateten sich und bekamen zwei Kinder, ein Knabe und ein Mädchen.
Eines Tages, es war im Monat Februar, ging die Frau nach Eu Vilá und anstatt aus den Saaten das Unkraut auszujäten, riss sie alle Blüten der Saubohnen- Pflanzungen ab. Am folgenden Morgen ging
der Mann dahin und gewahrte den Schaden, den seine Frau angerichtet hatte und nach Hause zurückgekehrt, frug er sie warum sie die Blüten der Saubohnenpflanzungen vernichtet habe.
- Weil es ohnehin einen Frost machen sollte und dann dieselben verderben würden, erwiederte sie ihm.
Aber der Mann, der mit diesem Beweggrund nicht einverstanden war, gab ihr böse Scheltworte und nannte sie Wasserfrau.
Sobald sie diese Worte vernahm, nahm sie auf jeden Arm ein Kind und kehrte in den Brunnen zurück und kam niemals mehr heraus.
Dieser Brunnen der Wasserfrau ist derselbe Brunnen, der jetzt noch in Can Garrit, in der Gasse von Montision gelegen, besteht.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE VERZAUBERUNG IM BORINO-BRUNNEN
Ihr müsst denken und glauben, dass in dem Borino- Brunnen eine Schlange versteckt ist, welche in Unzen platzen soll.
Diese Schlange kommt in hundert Jahren nur einmal heraus, am Tage des heiligen Johannes genau um die Mittagszeit und um den Schatz zu erhalten, welchen sie in ihrem Bauche hat, muss man warten,
bis sie herauskommt und ihr drei Schnitten von geweihtem Brod in das Maul geben.
Es waren Viele, die gewagt hatten, ihr die erste Schnitte zu geben, aber aus Furcht, die sie ihnen einflösste, als sie bemerkten, wie sie sich anschwoll, entflohen sie gleich und kamen nicht
dazu, ihr die zweite zu geben.
Ein waghalsigeres Mädchen als die Anderen sagte, dass sie den Schatz erobern werde, und gesagt, gethan, mit drei geweihten Brodschnitten macht sie sich am Tage des heiligen Johannes nach dem
Hochamt dahin auf den Weg.
Genau in der Mittagszeit kommt die Schlange heraus, sie gab ihr die erste Schnitte, sie frisst dieselbe und die Schlange wird sehr dick. Das Mädchen zittert vor Furcht und will weglaufen, dennoch
wagt sie es und giebt ihr die zweite, und die Schlange wird dicker wie ein Oelmühlen-Balken.
Als sie ihr die dritte Schnitte geben will, ist sie dazu nicht mehr im Stande und so voll Schrecken erfüllt, dass sie entflieht und eine Stimme hört, die zu ihr sagt:
Hast begonnen und nicht vollendet, Die Armuth wird dein Stand sein.
Und man sagt, dass seither Niemand mehr den Versuch gewagt hat, den Schatz aus dem Borino- Brunnen zu gewinnen.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE VERZAUBERUNG DER FÁTIMA
Es war ein Mann, der auf dem Puig (Berg) der Fátima Holzspäne machte, und es erscheint ihm ein anderer, der ihm sagt:
- Willst du reich werden?
Er erwidert darauf:
- Ja, was soll ich machen?
- Du sollst gehen und drei Kerzen kaufen, sie am Tage des heiligen Johannes weihen lassen und dieselben am folgenden Tage hierher bringen. Und wie willst du, dass ich dir erscheine? ich kann
nicht so wieder erscheinen, wie ich jetzt bin, entweder in Gestalt einer Schlange, oder in Gestalt eines Rindes.
Wenn du willst in der Gestalt einer Schlange, sollst du mit einer Schnitte Brod am Tage des heiligen Blasius in die Kirche gehen und mir dieselbe bringen.
Wenn du die Gestalt eines Rindes wählst, wirst du eine der drei Kerzen an der Lampe des Hochaltars anzünden, mit dieser wirst du die beiden anderen anzünden, die du mir jede auf ein Horn stellen
wirst und die andere wirst du in der Hand tragen und mit der anderen Hand wirst du mich beim Schweif führen und so wirst du nach dem Felsen der Fátima gehen, allwo der Schatz im Zauberbann
liegt.
Wenn wir angekommen sind, wird sich der Felsen öffnen. Lasse den Schweif nicht aus der Hand, trete hinein, dort ist ein Gebäude aus Gold, ich voran, du hinter mir, werden wir um jenes goldene
Gebäude herum gehen, und wenn ich es berühre, werde ich so dick, dass ich platzen werde und alles wird massives Gold sein und wir werden bleiben oberhalb des Felsens.
Also machte es jener Mann, aber als das Rind in den Felsen eintrat, bekam er Furcht, liess es los, kehrte um und rannte gegen das Dorf und das Rind hinter ihm. Als das Rind ihn erreicht hatte,
war der Mann halbtodt und das Rind sagte zu ihm:
- Da und deine ganze Nachkommenschaft, ihr werdet elend und arm bleiben.
Und man erzählt sich, dass über hundert Personen diese Worte gehört hätten; sie sagten aber nicht, dass sie das Rind auch gesehen hätten.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE SIMONETA
Die Mauren fingen eine Frau, die Simoneta hiess, führten sie nach Algier und dort blieb sie als Sklavin. Als sie nach Mallorca zurückkehren konnte, machte sie Gedichte über das was sie erlebt
hatte und ein Gedicht heisst also:
Durch drei Jahre blieb ich eingesperrt
In einem sehr festen Thurm,
Wenn ich mich nicht gefügt hätte,
Hätte mich der Tod abgeholt,
Doch Gott half mir stets.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE MAUREN IN DER HÖHLE
Ein Ziegenhirte des Rafal des Porchs sah, dass Mauren in einer Barke kamen und bevor sie am Ufer ankamen, zieht er die Schleuder heraus und so lange wirft er dieselben, dass er sie auf keinerlei
Weise anlegen liess.
Als sie erschöpft waren, sagten sie zu ihm:
- Komm näher, komm näher, beim Glauben der Mauren, die wir sind, werden wir dir nichts zu Leide tun.
Er näherte sich ihnen, die Mauren landeten, sie wurden mit einander bekannt und dann gingen sie fort.
Nach einigen Tagen kehrten die selbigen wieder zurück und wieder liess er Steine auf sie fliegen bis sie endlich ihm sagten:
- Komm näher, komm näher, beim Glauben der Mauren, die wir sind, werden wir dir nichts zu Leide tun.
Er näherte sich und sie rauchten und assen zusammen.
Dann kehrten sie zurück und eines Tages ging der Ziegenhirt zur Höhle des Drach (nicht jene von Manacó, diese Höhle liegt in Rafal), um dort eine Ziege zu suchen, die er verloren hatte, und
gerade bei der Mündung der Höhle hörte er:
- Töte mich nicht, töte mich nicht bei Allah!
Und es war ein Maure, der am Land zurückgeblieben war, als die Andern wegfuhren und der sich hier versteckt hatte.
Er nahm sogleich Brot und Käse aus seiner Tasche und gab es ihm und nun liess er ihm jeden Tag davon auf einem Stein, damit er essen konnte und der Maure sagte ihm, wenn er weggehe, werde er den
Zweig eines Mastixstrauches oberhalb der Höhlenmündung stecken als Zeichen dass er entflohen sei.
Nach einer Anzahl Tage kam eine andere Ladung Mauren an und sie fingen den nämlichen Ziegenhirten und nahmen ihn mit sich fort.
In Algier führten sie ihn auf den Platz, wo man die Sklaven verkaufte und derselbe Maure, den er in der Höhle verköstigt hatte, erwartete schon, dass man ihn dort bringen würde und jeden Tag ging
er zu dem Platze, um zu sehen, ob er dort sei.
Er fand ihn, kaufte ihn und führte ihn zu seinem Hause. Als er zu Hause war, bekleidete er ihn, gab ihm zu essen und nach drei Tagen, frug er ihn, ob er traurig sei und er sagte ihm ja, weil er
seine Frau und seine Kinder in Santañi zurückgelassen habe. Der Maure sagte ihm, dass er nicht missmutig sein solle, er sei derjenige, den er in der Höhle des Drach verköstigt hatte, und dass er
am ersten Tag wo er wolle, nach Mallorca reisen könne, um seine Frau und Kinder zu sehen, aber er wollte, dass er mit ihnen zurückkehre, um dort zu leben und es werde ihnen gut gehen.
Er ging und holte sie ab und sie kehrten nicht mehr nach Mallorca zurück.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE MAUREN DES CASTELLET
Im Castellêt wohnten vier Mauren, die von dem lebten, was sie stahlen. In die Mühle nahe vom Castellêt gingen sie, um Mehl zu stehlen und um nicht ertappt zu werden, gingen sie auf dem Rückweg
rücklings, damit man aus den Fussstapfen nicht erkennen konnte, wohin sie gegangen waren.
Ein Hirte, der in jener Umgebung Schafe hütete, hörte eines Tages die Mauren ein Gespräch führen und behorchte sie: Sie sprachen davon, dass sie wussten, man trachte darnach, sie gefangen zu
nehmen und auf welche Weise sie sich befreien sollten. Wenn ihre Lage eine verzweifelte geworden, würden sie sich den Felsen herabstürzen innerhalb eines Oelkruges und derjenige, der sich zuerst
herabstürzte, solle den anderen sagen, ob er sich weh getan habe und so könnten alle entfliehen.
Der Hirt erzählte das im Orte und eine Anzahl Männer verabredeten sich, sie oberhalb des Felsens zu verfolgen. Der Hirt blieb unten und als die Mauren sich auf's Aeusserste getrieben sahen,
bereiteten sie die Oelkrüge vor und einer warf sich damit herab und wurde zerschmettert.
Die anderen Mauren erwarteten dessen Rufen, dass es ihm gut gegangen sei. Der Hirte schrie den drei andern von unten hinauf:
- Werfet euch herunter, weil ich mir nichts getan habe.
Die drei Anderen stürzten sich ebenfalls herunter und alle blieben tot.
Diese vier Mauren waren die letzten, welche in Deyá hausten.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE MAUREN DES CASTELL VON SANTUERI
Es war noch nicht den Mallorquinern gelungen, den Mauren das Castell de Santueri zu nehmen und sie beschlossen einen Tanz in Badalona aufzuführen. Sie begannen den Tanz, die Mauren wurden davon
gewahr und gingen, um die Musik zu hören, nach der Seite, wo der Tanz stattfand, und während sie zerstreut waren, wurde das Castell von der anderen Seite erstürmt. Die Mauren sahen sich verloren
und sprangen, den Kopf in einem Oelkruge, vom Castell herab.
Einige der Entflohenen versteckten sich in der Höhle von Covafonda und dort wurden sie belagert, aber jeden Tag fingen sie Fische und zeigten sie den Christen, damit sie sehen sollten, dass sie
noch nicht vor Hunger sterben würden und das kam daher, weil die Höhle ein Loch hatte, das bis zum Meere ging und das Niemand kannte, ausgenommen die Mauren.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DES TURMES VON CANAMEL
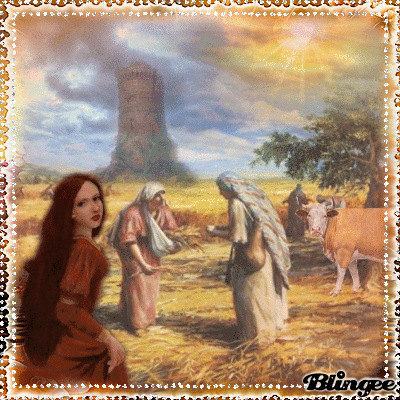
Es war ein Vater, welcher zwei Söhne und eine Tochter hatte, diese gingen Anfang Juni um Korn zu schneiden auf die Felder beim Turme von Cañamel. Sie banden eine Kalbin, die sie mitgeführt
hatten, am Ufer des Torrenten von Ñana an und begannen zu mähen.
Die Tochter ging zur Quelle von Bagura um Wasser zu holen und nahm etwas Wäsche mit, um sie zu waschen.
Es war ungefähr um neun oder zehn Uhr, als sie drei Männer sahen, welche auf der oberen Seite des Torrenten herabstiegen, die Kalbin losbanden, und sie auf der anderen Seite hinter dem Turme
wegführten; es waren Mauren.
Als die beiden Söhne sahen, dass die Mauren die Kalbin wegtrieben, eilten sie ihnen nach, der eine mit seiner Sichel, der andere nahm sie nicht mit.
Als sie sie eingeholt hatten, fingen sie Streit mit ihnen an, weil sie die Kalbin wieder zurück haben wollten und sie nicht bekamen. Einer der Mauren schlug mit einem jener Stöcke, die sie
mitzuführen pflegten, welche eine Spitze hatten, denjenigen, der eine Sichel hatte, betäubte ihn, dass er die Sichel verlor.
Während dieses Streites blies der Turmwächter auf dem Schneckenhorn, weil er eine andere Horde Mauren gesehen hatte, die von der Meeresseite heraufstiegen. Die Männer, die sich stritten,
entflohen, und die übrigen Arbeiter aus der ganzen Umgebung und Alle kamen zu dem Turme, um sich darin zu verbergen.
Als sie beim Turme waren, erinnerten sie sich der Schwester, welche zum Wasser holen gegangen und nicht wieder erschienen war, beim Klange des Schneckenhornes; sie entschlossen sich die Schwester
suchen zu gehen, gemeinsam mit ihrem Vater und den anderen Männern, welche zum Turm gekommen waren.
Sie gingen fort und als die Mauren sie sahen, liefen sie davon, aber wie sie bei der Gola (Torrenten-Mündung) waren, in der Nähe des Strandes, bei den Höhlen, liessen sie die Kalbin zurück, weil
sie dieselbe nicht über die Gola mitnehmen konnten.
Jene die ihnen nachliefen, fanden jenes Mädchen, das zum Wasser holen gegangen war, an einem Baum bei der Quelle festgebunden und misshandelt. Die Mauren hatten sie nämlich bei der Quelle
gefunden und so zugerichtet, dass sie am Sterben war.
Ihr Vater und die Brüder hoben die Tochter auf, trugen sie noch lebend nach Artá, aber sie starb daran und die anderen Männer, um sie zu rächen, liefen den Mauren nach, bis an das Meeresufer,
aber dort hatten diese auf dem Ufersand ein Boot bereit, worin sie sich einschifften. Die am Lande konnten sie nicht mehr verfolgen, aber sie beobachteten sie, dass sie die Fahrt nach der Cova
des Coloms nahmen, wie, um der der Cova de Hermita gegenüber zu gelangen, und sie stiegen auf Bergeshöhe und bemerkten, bevor sie das Cap Vermey erreichten, eine grössere Barke, und in dem Boote
war schon Niemand darin.
Die grosse Barke segelte ab und die Männer von Artá konnten den Tod jenes Mädchens nicht rächen.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE MAUREN, WELCHE NACH SA MESQUIDA KAMEN
Die Magd von Sa Mesquida ging zum Brunnen, beim Meeresufer, um Wasser zu holen. Eines Tages wurde sie von Mauren gefangen, die ihr sagten, wenn sie ihnen einen Laib Käse und ein Brot brächte,
würden sie ihr nichts antun, aber wenn sie sie verrate, werde sie getötet.
Sie ging fort, brachte ihnen Brot und einen Käselaib, und immer schwieg sie und sagte nichts.
Eines Abends, als die Frau abhaspelte und die Haspel: Gich Gich machte, sagte die Magd, dass sie bedeutete: Die Mauren werden heute Nacht kommen, die Mauren werden heute Nacht kommen.
Also war es auch, in jener Nacht kamen die Mauren und nahmen sie alle gefangen. Und jene Magd, welche ihnen Brot und Käse gebracht hatte, war die erste.
Der Herr legte eben die Socken ab, als er die Mauren gewahrte und schon hatten sie ihn gefangen.
Die Tochter des Hauses, ein Mädchen von fast zwanzig Jahren, hatte einen Rosenkranz und als sie sah, dass die Mauren sie gefangen nahmen, versteckte sie den Rosenkranz in dem Futter des Rockes.
Die Mauren zerrten sie in den Hof hinaus und banden sie an einen Zirbelbaum, der dort stand. Als sie festgebunden war, wollten sie sie von unserer Religion abtrünnig machen, und sie tat es nicht;
sie zogen sie bei den Haaren, an den Ohren, zwickten sie und sie sagte immer nein. Zuletzt begannen sie Pfahlrohr zu spalten um es ihr unter die Nägel zu stossen, und um das zu verhüten, rief
sie:
- Jó llenech - ich rutsche - ich rutsche, ich rutsche, anstatt zu sagen jo renéch, ich verläugne.
Die Mauren dachten, dass sie abtrünnig sei und sie hörten schon auf, sie zu martern.
Dann führten sie Alle fort und schifften sie ein, nach dem Maurenlande.
Dort machten sie sie zu Sklaven und dem Herrn und der Tochter ging es sehr schlecht. Den Herrn liess man mahlen und seine Tochter war in Gefahr, jeden Tag ermordet zu werden.
Der Magd, welche den Mauren den Käse und das Brot getragen hatte, ging es gut; sie war als Magd im Dienst eines guten Hauses und jeden freien Augenblick lief sie zu dem Herrn, sie liess ihn
ausruhen, indem sie eine Zeitlang das Rad drehte.
Auch zur Tochter ging sie und tröstete sie.
Als Sklaven wurde es ihnen ermöglicht, nach Mallorca zu schreiben und ihre Verwandten bekamen aus dem Kirchenfonde der Mutter Gottes von Son Salvado d'Arta eine Geldsumme ausgeliehen, um sie zu
befreien, und sie kauften sie los, worauf sie nach Mallorca, lebend, aber nach Ueberstehung vieler Mühsale, zurückkehrten.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE FEUERBLÄSERIN
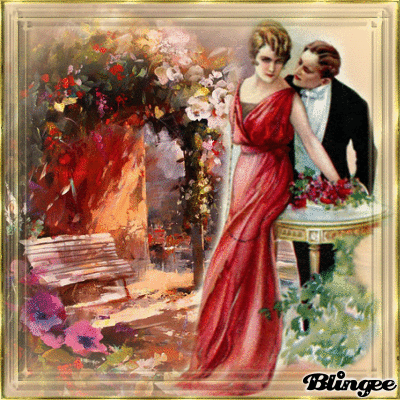
Es gab einen Mann, der Wittwer war und eine sehr schöne Tochter hatte, der heiratete von Neuem. Die Stiefmutter konnte das Mädchen nicht ausstehen und quälte es sehr, bis sie es eines Tages aus
ihrem Hause fort jagte. Das Mädchen weinte und weinte immerfort, dachte sich als Dienstmädchen zu verdingen und als es zu diesem Zwecke ein Haus aufsuchen wollte, erschien ihm eine sehr schöne
Frau und frug, warum es so viel weine; es erzählte ihr, dass die Stiefmutter es weggeschickt habe und dass es sich jetzt verdingen wolle. Jene Dame tröstete es und gab ihm zwei Flaschen, indem
sie sagte:
- Wenn du dich mit dem Wasser der einen Flasche wäschest, wirst du sehr garstig werden, aber wenn du es aus der anderen nimmst, wirst du wieder sehr schön werden.
Jene Dame gab ihr auch drei Mandeln, damit es sie öffnen könne, wenn es einen Wunsch habe.
Sie wusch sich mit dem Wasser der ersten Flasche, ging fort in ein Haus und sagte:
- Guten Tag, könnt ihr nicht ein Dienstmädchen brauchen?
- Nein wir brauchen keines, antwortete die Dame.
Die Köchin, welche dem Mädchen aufgemacht hatte, sagte zur Frau:
- Dame ich glaube, sie sollten sie nehmen, sie wird wenigstens zum Feueranblasen zu gebrauchen sein.
Sie blieb im Hause und alle hiessen sie die Feuerbläserin.
Eines Tages sagte sie zu ihm:
- Feuerbläserin decke doch den Tisch.
Und sie deckte auf und vergass das Salznäpfchen darauf zu setzen.
- Feuerbläserin das Salznäpfchen, schrie der Herr, der ein Sohn der Dame war. Die Feuerbläserin brachte ihm gleich das Salznäpfchen.
Am folgenden Tage deckte sie wieder auf und vergass eine Gabel zu legen.
- Feuerbläserin, Salznäpfchen und Gabel fehlen auf dem Tische, schrie wieder der Herr und die Feuerbläserin brachte ihm die Gabel.
Der Herr konnte das Mädchen nicht leiden und wollte es nicht dulden.
Inzwischen ereignete es sich, dass man einen Ball in jenem Dorfe gab, auf den der Herr ging.
Die Feuerbläserin ging zur Dame und bat sie, dass sie ihr erlaube, ebenfalls hinzugehen und die Dame sagte ihr:
- Nein, mein Sohn soll hingehen und wenn er dich sehen würde, möchte er sich ärgern.
- Dämchen lasst mich gehen, er wird mich nicht erkennen.
- Nein, sagte wieder die Dame, wenn er es erfahren würde, möchte er sich ärgern.
- Lassen sie mich gehen Dämchen, ich versichere sie, dass er mich nicht erkennen wird.
Sie bat so viel; bis schliesslich die Dame es zugab.
Sie ging nun weg, wusch sich mit dem Wasser aus jener Flasche, das schön machte, zerschnitt eine der Mandeln, die jene Dame ihr gegeben hatte, darin war ein rosenfarbiges Kleid, das zog sie an
und ging auf den Ball.
Der Herr, der schon anwesend war, kam gleich wie er sie sah, auf sie zu, sagte ihr, dass er mit ihr tanzen wolle und schenkte ihr ein Armband. Als der Ball zu Ende war, wollte der Herr um jeden
Preis sie heimbegleiten und sie wollte dies auf keinem Falle, endlich sagte sie ihm, dass, wenn er sie nicht begleite, so werde er sie am folgenden Tag auf einem anderen Balle sehen und sie
versicherte ihm, dass sie dahin kommen werde. So verabredeten sie es und sie eilte schnell davon, wusch sich wieder mit dem Wasser, welches hässlich werden liess und legte sich zu Bette. Als der
Herr nach Hause kam, schlief sie schon und er konnte nichts bemerken.
Am folgenden Morgen ging der Sohn zur Mutter.
- Jesus, meine Mutter! Was für ein schönes Mädchen habe ich auf dem Balle gesehen, ich bin in dasselbe verliebt und ich will es heiraten.
- Aber wer ist sie?
- Ich weiss es nicht, sie war mir unbekannt, aber sie hat mir versprochen, dass sie heute Abend wieder auf den Ball kommen wird und dass wir uns würden sehen.
Als es Abend war, kam die Feuerbläserin wieder zur Dame.
- Liebe Dame, er hat mich nicht erkannt, lasst mich auch heute hingehen.
- Nein, wenn er dich erkennen möchte würde er sich ärgern, dass ich dich hingehen liess.
- Dämchen, er wird mich nicht kennen, lasset mich hingehen.
So lange bat sie, bis es ihr erlaubt wurde, wieder hinzugehen.
Sie ging weg, wusch sich mit dem Wasser aus der Flasche, das schön machte, zerschnitt eine andere Mandel und fand darin ein ganz rotes Kleid.
Sie zog es an und ging zum Balle.
Der Herr, als er sie sah, setzte sich gleich an ihre Seite, sagte ihr abermals, dass er mit ihr tanzen wolle und schenkte ihr Ohrgehänge.
Als es Zeit war, heimzugehen, wollte er sie begleiten, sie erlaubte es ihm nicht und sagte ihm, dass, wenn er sie nach Hause begleite, würde sie nicht mehr kommen, er solle sie allein gehen
lassen und sie würde am folgenden Tage, an dem der letzte Ball war, wiederkommen. Er stimmte zu, nur um sie auf dem kommenden Ball wieder sehen zu können.
Als sie wieder zu Hause war, wusch sie sich mit dem anderen Wasser und legte sich zu Bette, ohne dass Jemand etwas bemerkte.
Am folgenden Tag ging sie zur Dame und sagte zu ihr:
- Dame, er hat mich nicht erkannt, ich bitte, lasst mich heute Nacht wieder dahin.
- Nein, denn er wird dich diesmal erkennen und wenn er erfährt, dass ich dich hingehen liess, wird er sich ärgern.
- Dämchen, lasset mich noch den letzten Abend hingehen, er wird mich nicht erkennen.
Sie bat so lange, bis sie sie gehen liess.
Am Abend wusch sie sich wieder mit dem Wasser, welches schön machte, zerschnitt die andere Mandel und darin war ein Kleid, ganz himmelfarbig mit Gold gestickt, sie zog es an und ging zum
Ball.
Dort kam der Herr, sowie er sie sah, zu ihr, setzte sich an ihre Seite, tanzte den ganzen Abend mit ihr und schenkte ihr ein Brustnädelchen. Weil es der letzte Ball war, wünschte er sehr, sie
nach Hause zu begleiten, um zu erfahren, woher sie sei, aber sie wollte es um keinen Preis und ging fort, ohne dass er es bemerkte.
Sie ging nach Hause, wusch sich mit dem anderen Wasser, welches garstig machte und legte sich zu Bett, ohne Jemanden etwas davon zu sagen.
Der Herr, als er sah, dass sie ihm entlaufen war, ging sehr traurig nach Hause, erzählte der Mutter alles, was ihm zugestossen war, und sagte ihr, dass er gehen wolle, um jenes Mädchen zu
suchen.
Am folgenden Tag reiste er ab, um sie zu suchen und trug der Mutter auf, sie solle schauen, ob sie auch etwas von ihr erfahren möchte.
Einige Tage nach seiner Abreise musste man ihm Brot schicken und die Feuerbläserin sagte zur Dame:
- Dämchen, wollt ihr, dass ich das Brot knete?
- Nein, wenn mein Sohn es erfährt, möchte er nicht davon essen.
- Er wird es nicht erfahren, Dämchen, lasset mich Brot kneten.
Sie bat so lange, bis die Dame endlich zustimmte.
Sie begann zu kneten und in jeden Laib Brot steckte sie ein Briefchen, welches hiess:
Erbe des Hauses
Wohin gehst du und woher kommst du
Das was du suchest
In deinem eigenen Hause hast du es.
Als der Herr das erste Brot brach, fand er das Briefchen, er las es und sehr befriedigt sagte er zu den Dienern, die ihn begleiteten:
Gehen wir, weil meine Mutter das Mädchen schon gefunden hat, und voll Freude reiste er rasch ab.
Als er ankam fragte ihn seine Mutter:
- Hast du sie schon gefunden, dass du sobald zurückkehrst?
- Was wollen Sie sagen, haben Sie sie nicht gefunden, erwiderte er.
- Ich nicht.
- Sie haben es mir doch sagen lassen! und er erzählte ihr, was er in dem Brot gefunden hatte.
Um nicht zu verraten, dass die Feuerbläserin das Brot geknetet habe, sagte sie, dass es sehr sonderbar wäre und dass sie nicht wüsste, wie es war.
Der Sohn ging wieder fort, um das Mädchen zu suchen und beauftragte seine Mutter, sie solle es ihm mittheilen, wenn sie etwas erfahre.
Als man ihm wieder Brot schicken musste, sagte die Feuerbläserin wieder:
- Dämchen, lasset mich das Brot kneten.
- Nein, dass du mir wieder einen Streich machst, wie das letzte Mal, das will ich nicht.
- Dämchen, lasset mich das Brot kneten, er soll es nicht erfahren, dass ich geknetet habe.
So lange bat sie, bis sie sie kneten liess. Sie bereitete das Brot und steckte in jeden Laib wieder ein Briefchen, welches dasselbe sagte:
Erbe des Hauses
Wohin gehst du, woher kommst du
Das was du suchest
In deinem eigenen Hause hast du es.
Als der Herr wieder das Briefchen las sagte er:
Dieses Mal wird es wahr sein; meine Mutter muss sie schon gefunden haben.
Und ganz befriedigt kehrte er nach Hause zurück.
Als er ankam, ging die Mutter auf ihn zu.
- Was bringst du dieses Mal? hast du sie schon gefunden?
- Nein ich habe sie nicht gefunden.
Und er sagte ihr, wie er wieder das Briefchen gefunden habe.
Von dem Tage an fing er an zu kränkeln und vermochte sich nicht wieder auf den Weg zu begeben, um das Mädchen zu suchen. Er siechte dahin und verlor täglich mehr die Kräfte.
Eines Tages musste er sich zu Bette legen, man sollte ihm Süppchen geben und die Feuerbläserin sagte zur Dame:
- Dämchen, soll ich es ihm bringen?
- Nein, damit er im Stande wäre, dir die Suppenschale an den Kopf zu werfen, ich will es nicht.
- Erlaubt, dass ich es ihm bringe, ihr werdet sehen, dass er sie essen wird.
So lange bat sie, bis schliesslich die Dame sagte:
- Gehe, bringe es ihm.
Sie ging weg, goss das Süppchen in die Suppenschale, darauf tat sie das Brustnädelchen, dass ihr der Herr auf dem Balle gegeben hatte, dann stellte sie eine andere Suppe darauf, dann die
Ohrgehänge, dann eine andere Suppe, dann das Armband und wieder eine andere Suppe darauf und so brachte sie es ihm.
Als der Herr sie sah begann er zu schreien:
Augenblicklich hinaus, ich will sie nicht hier darin haben, ich will sie nicht sehen.
- Lieber Herr, verkosten sie doch, sie werden sehen, dass sie gut ist.
- Nein, ich will es nicht.
- Verkosten sie, es wird ihnen schmecken.
- Nein, geh hinaus.
- Lieber Herr, essen sie eine.
- Nur damit du weggehst, und er ass die obere Suppe und als er das Armband fand, erstaunte er und sagte:
- Du weisst von meinem Mädchen; du kannst mir sagen, wo es ist, gestehe, wer dir dies gab.
Sie sagte nichts weiteres als:
- Lieber Herr, essen sie die andere, die noch viel besser sein wird.
Er ass sie und fand die Ohrgehänge.
- Esst auch die andere, die noch besser ist.
Und er ass sie und fand das Brustnädelein.
- Du kannst mir schon sagen, wo mein Mädchen ist, du weisst es.
- Wollen sie sie sehen?
- Ja und sofort.
Die Feuerbläserin wusch sich mit dem Wasser, zog das rosenfarbige Kleid an, zeigte sich dem Herrn und fragte:
- War es diese?
- Ja sie war es, das ist mein Mädchen.
Sie ging wieder weg, zog das rote Kleid an und fragte wieder:
- War es diese?
- Ja sie war es.
Und sie ging wieder weg, um das himmelblaue, ganz mit Gold gestickte Kleid anzuziehen und fragte wieder:
- War es diese?
- Ja sie war es, ja meine Mutter, diese ist mein Mädchen.
Nach wenigen Tagen war er gesund, sie heirateten und beide lebten, bis sie starben.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE MAUREN, WELCHE NACH SON JORDI GINGEN
Als die Mauren auf Son Jordi erschienen, wurden sie von der Pächterin bemerkt. Sie hatte noch Zeit zuzusperren und im Turm sich einzuschliessen. Als sie im Turme war, gingen die Mauren in ihr Haus, dann versuchten sie durch ein Fenster in den Turm zu steigen, und legten Strandkiefern an, die sie gefällt hatten. Die Pächterin bemerkte es und begann Schalen und Teller auf sie zu werfen, aber sie liessen nicht davon ab. Sodann erinnerte sich die Pächterin der Bienenkörbe und warf dieselben auf sie herunter. Die Mauren wehrten sich dagegen und wehrten sich und je mehr sie sich wehrten, desto mehr stachen die Bienen und sie mussten davonlaufen.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE DREI RATSCHLÄGE

Es waren ein Mann und eine Frau, welche vor kurzer Zeit geheiratet hatten. Sie waren sehr arm, und der Mann entschloss sich, in die weite Welt zu gehen, um zu sehen, ob er nicht ein Kapitälchen
zusammen bringen könnte. Er geht und geht immer weiter; endlich fand er eine Gasse und in einem Hause hörte er einen Herrn, welcher Rechnungen machte und dazu sagte:
- So viel und so viel ist so viel ...
- Aber nein, das geht nicht gut ...
- So viel, so viel und so viel ist so viel, aber nein, meine Rechnung stimmt nicht. Jener Mann blieb ein wenig stehen, um ihn anzuhören und betrat dann das Haus.
Er fragte:
- Herr, mit was sind sie verlegen?
Er sagte:
- Ich habe eine Rechnung zu ordnen, und ich kann sie nicht abschliessen.
- Wollen sie, dass ich sie ihnen mache?
Er sagte:
- Wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid.
- Das ist eine sehr leichte Sache, antwortete er.
Nun also.
Er sagte:
- So viel, so viel und so viel ist so viel.
- Ihr seid geschickt zum Rechnungen abschliessen, sagte der Herr, und wenn ihr bleiben wollt, um mir die Rechnungen zu führen, könnt ihr jetzt gleich dableiben.
Der Mann sagte zu und der Herr fragte ihn, welchen Lohn er wolle und er antwortete ihm:
- Was sie mir geben werden.
Nach langer Zeit, als er sich schon viel Geld erspart hatte, entschloss er sich, nach Hause zurückzukehren, um seine Frau wiederzusehen, welche er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte; und
er sagte es dem Herrn, und dieser bemerkte ihm, dass es ihm sehr leid tue, aber über sein Weggehen habe er zu verfügen.
Bei der Abreise liess ihn der Herr für das, was er mit dem Schweisse seiner Stirne verdient hatte, wählen zwischen einer grossen Geldsumme und drei Ratschlägen, und er wählte die drei
Ratschläge.
Der erste war, dass er nie die alten Wege für neue vertauschen solle.
Der zweite war, dass er nie fragen solle, warum eine Sache sei und warum nicht.
Der dritte Ratschlag war, bevor er eine Sache beginne, solle er dreimal darüber nachdenken.
Sodann gab er ihm einen Laib Brot und sagte ihm, dass er es nicht eher anschneiden solle, bis zu dem Tag, an dem er die grösste Freude hätte.
Er reiste ab und auf dem Wege fand er zwei Männer an einer Stelle, wo sich zwei Wege kreuzten. Sie sagten zu ihm:
- Gehet mit uns, auf diesem Wege werden wir früher ankommen, und er dachte an den Ratschlag des Herrn und sagte zu sich - Nein, ich will die alten Wege nicht für die neuen vertauschen.
Die Männer gingen fort auf dem kürzeren Weg und er auf dem alten Weg. Sie gingen weiter, immer weiter und fanden sich endlich zusammen, und von den zweien, die er verlassen hatte, erschien nur
einer, weil der andere durch Diebe, die sie getroffen hatten, ermordet worden war. Der Mann, der am Leben geblieben, sagte zu ihm:
- Wisset, dass ihr gut getan habt, die alten Wege nicht für die neuen zu vertauschen.
Er verfolgte seinen Weg weiter, es überraschte ihn die Dunkelheit und er erblickte ein Lichtchen und ging geradeaus darauf zu. Da fand er ein Landgut und fragte, ob man ihm für jene Nacht
Unterkunft geben wolle.
Sie sagten ja und am folgenden Morgen fragte er, ob er fortgehen könne und sie sagten ihm nein, weil alle, welche dahin kämen, drei Tage bleiben mussten. Er blieb die drei Tage und sie gaben ihm
gut zu essen und zu trinken und dann frug er abermals, ob er weggehen könne.
Der Pächter bejahte es, indessen könnt ihr sagen, dass ihr der Glücklichste seid von allen Leuten, die hierher gekommen sind, weil sie immer gefragt hatten, warum es so sei, warum es nicht so
sei, dass sie drei Tage dableiben sollten und alle, die das fragten, seien in einem Zimmer aufgehängt worden, wo bereits viele Totengerippe sind.
Er reiste ab und ging weiter und immer weiter und kam endlich in seiner Ortschaft an und bevor er sein Haus aufsuchte, erkundigte er sich bei einem Nachbar, weil er sich schon nicht mehr
erinnerte, wo das Haus seiner Frau war. Er stieg auf die Terrasse jenes Hauses und sah seine Frau am Fenster an der Seite eines Geistlichen. Er vermuthete Böses und wollte auf sie einen Schuss
abfeuern, aber er dachte an den dritten Ratschlag, den ihm der Herr gegeben hatte und schoss nicht auf sie. Er beobachtete weiter und es kam ihm wieder das Verlangen, auf sie zu schiessen und
wieder hielt er sich zurück.
Zuletzt stieg er herab und frug die Nachbarin, ob sie die Bewusste kenne. Die Frau bejahte es und er frug sie, ob sie sich erinnern könne, dass deren Mann in die weite Welt fortgegangen sei und
was für ein Leben jene Frau geführt habe, seitdem ihr Mann fort sei.
Sie antwortete ihm, dass sie eine rechtschaffene Frau sei, nachdem ihr Mann fortgegangen war, hatte sie ein Kind geboren, dieses sei ein Geistlicher geworden, nachdem eine gute Person für ihn die
Kosten bezahlt hatte und dass derselbe am nächsten Tage die erste heilige Messe lesen werde.
Er sagte zu ihr:
- Ich bin ihr Mann und die Nachbarin, sehr erfreut, begleitete ihn zum Hause seiner Frau.
Am folgenden Tag feierte der Sohn seine erste heilige Messe und sie bereiteten ein grosses Essen und weil das der schönste Tag seines Lebens war, schnitt er das Brot an, welches sein Herr ihm
gegeben hatte und jenes Brot war voll Goldmünzen.
Sie lebten alle gesellschaftlich mitsammen, bis sie starben.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE LANDUNG DER MAUREN
Eine Galiote legte am Lande an, die Mauren schifften sich aus und stiegen hinauf gegen Es Grau.
Als sie in die Ebene von Sa Cometa kamen, trafen sie einen Mann, einen Knaben seinen Sohn und zwei Frauen, die mähten.
Der Mann, der schon alt und Obrë des Heiligen Antonius war, versteckte sich in die Saat, indem er sagte:
- Heiliger Antonius, beschütze uns.
Der Knabe versteckte sich ebenfalls, aber als er die Schritte der Mauren hörte, dachte er, dass sie seinen Vater gefangen hätten und sagte:
- Jetzt führen sie meinen Vater fort.
Die Mauren, die ihn nicht bemerkt hatten, hörten ihn, kehrten zurück und nahmen ihn mit sich. Seinen Vater suchten sie, konnten ihn aber nicht finden, weil er gesagt hatte: Heiliger Antonius,
beschütze uns.
Die beiden Frauen begannen bergauf zu laufen, aber bei der Hecke des Carritxá blieben die Röcke der einen an der Hecke hängen und die Mauren fingen sie.
Diese und den Knaben führten sie nach Algier und den Knaben kaufte ein hervorragender Maure, der viele Frauen und Kinder hatte und behandelte ihn sehr gut. Er liess ihm seine Kinder
beaufsichtigen und gab ihm Morgens Brod und Honig zum Frühstück. Aber einmal gab ihm ein anderer Maure, der auf ihn eifersüchtig war, eine solche Ohrfeige, dass die Nase schief wurde.
Nach fünfzig Jahren kehrte er nach Estallenchs zurück, er war unterdessen Maure geworden und sagte das Gebet der Mauren, er heirathete aber noch und hatte ein Mädchen.
Nun die andere Frau, welche die Mauren weggeführt hatten, diese blieb dort nicht solange. Als sie in Algier war, wollte ein Maure bei ihr schlafen und sie machte ein Versprechen, dass sie, wenn
sie sich darauf befreien konnte, kein Wort mehr sprechen werde, bis sie vor San Juan, welche die Kirche dieser Ortschaft ist, angekommen wäre. Sie liess dahin melden, man möge sie loskaufen, und
um das zu ermöglichen, möge man ein Grundstück verkaufen, das nur für einen Gefangenen oder Kranken verkauft werden durfte. Als sie losgekauft war, kehrte sie hierher zurück und blieb nicht eher
stehen, bis sie vor der Kirche war und ihr erstes Wort, das sie sprach, war, man möge ein Te Deum singen für ihre Befreiung von den Mauren.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE DREI BRÜDER
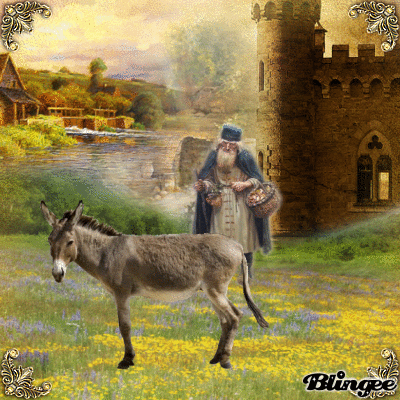
Es waren drei Brüder, welche weder Vater noch Mutter hatten.
Und ihr Vater war ohne Testament gestorben.
Sie beschlossen, zum König zu gehen, damit er unter sie die Güter verteile, sie gingen hin und auf dem Wege ging der Erstgeborene voran, der zweite ging hinter dem ältesten und der jüngste hinter
allen.
Sie fanden einen Mann, der eine Mauleselin suchte.
Er sagte zu dem Erstgeborenen:
- Bruder, hast du eine Mauleselin gesehen?
Der Erstgeborene sagte:
- War sie einäugig?
- Ja.
- Alsdann habe ich sie nicht gesehen.
Indem er den zweiten fand, fragte er:
- Bruder, hast du eine Mauleselin gesehen?
Dieser sagte:
- War sie grau?
- Ja.
- Alsdann habe ich sie nicht gesehen.
Er fand den dritten.
Und sagte ihm:
- Bruder, hast du eine Mauleselin gesehen?
- War sie hinkend?
- Ja.
- Alsdann habe ich sie nicht gesehen.
Dann frug er sie, wohin sie gingen, und sie sagten es ihm; und jener Mann eilte voran und ging zum Hause des Königs und erzählte hier, was ihm mit den drei Brüdern zugestossen war.
Als die Brüder beim Hause des Königs ankamen, baten sie ihn, dass er ihnen die Güter verteile. Der König befahl einem Diener, dass er ihnen ein gutes Frühstück gebe und er solle ihm alles
aufschreiben, was sie zusammen sprechen werden, während sie frühstücken.
Zum Frühstück wurde ihnen ein gebratenes Ferkel und dazu Wein gebracht.
Der Jüngste sagte:
- Gut wäre dies Ferkel, wenn es nicht mit Lausmilch aufgezogen worden wäre.
Der zweite sagte:
- Gut wäre dieser Wein, wenn er nicht aus Setzlings-Trauben gemacht wäre.
Der Erstgeborene sagte:
- Schön wäre der König, wenn er nicht Bastard und Sohn eines Mauren wäre.
Jener Diener brachte das Aufgeschriebene dem König, und als er es gelesen hatte, liess er Jenen rufen, der ihm das Ferkel geschenkt hatte.
Der König sagte zu ihm:
- Wie zogst du jenes Ferkel auf?
Der Mann sagte:
- Das Mutterschwein starb, und wir hatten eine kleine Hündin, die nährte es.
Sodann liess der König den Mann rufen, der ihm den Wein geschenkt hatte und fragte ihn:
- Woher ist dieser Wein?
- Er ist aus Setzlingstrauben.
Dann liess der König seine Mutter rufen und fragte sie:
- Wessen Sohn bin ich?
Sie sagt:
- Ei - deines Vaters Sohn.
Der König sagt:
- Und wer war mein Vater?
Seine Mutter sagt:
- Es war in einem Jahre, in welchem Krieg war, wir hielten uns im Maurenland auf und du bist der Sohn eines Mauren.
Dann frug er die drei Brüder, zu ihnen sagend:
- Wie wusstest du, dass das Maultier hinkend war?
Er sagte:
- Weil ich auf dem ganzen Wege nur drei Fussstapfen fand.
- Und wie wusstest du, dass es grau sei?
Er sagte:
- Weil ich einige Wälzplätze fand und es waren dort weisse und schwarze Haare.
- Und wie wusstest du, dass es einäugig war?
Er sagte:
- Weil beide Seiten mit Getreide bewachsen waren und ich fand es nur auf einer Seite abgefressen.
Da sagte zu ihnen der König:
- Und jetzt frage ich euch, könnt ihr das Bild eueres Vaters auf ein Papier malen?
Sie bejahten es und malten ihren Vater.
Als sie ihn gemalt hatten gab er ihnen eine Pistole und sagte, dass Jeder von ihnen einen Schuss abfeuern solle und derjenige, der am besten treffen würde, sollte alle Güter erhalten.
Der Aelteste und der Zweite schossen darauf, der Letzte wollte nicht schiessen.
Der König sagte:
- Und du, warum schiessest du nicht darauf, du siehst, dass das nicht dein Vater ist, sondern nur sein Bild.
Der Jüngste erwiderte:
- Das macht keinen Unterschied, ich will nicht darauf schiessen.
So viel der König auch bat, er wollte nicht auf seinen Vater schiessen und der König sagte zu ihm:
- Also die Güter gehören dir.
Sie kehrten alle drei nach Hause zurück und der Jüngste besass die Güter und die Erzählung ist schon zu Ende.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE DUNKELHEIT GEGEN DIE MAUREN
Die Mauren waren im Zuge, einen grossen Angriff zu machen und wollten sich bei Cala Retjada ausschiffen. Die Gabellins (Name, den man den Leuten aus Capdepera gibt) wussten, dass dieses Mal eine grosse Anzahl kommen würden und hatten grosse Befürchtung. Sie riefen die Mutter Gottes der Hoffnung aus dem Castell von Capdepera an und sogleich erhob sich aus dem Castell eine Nebelwolke, welche sich nach dem Meere zu bis zu den Schiffen der Mauren ausdehnte. Die Mauren fuhren wieder ab, weil sie in dem Nebel nicht anlegen konnten, dann ging er vorüber und sie kehrten wieder zurück und drei Mal versuchten sie es und sie konnten sich nicht ausschiffen und die Gabellins dankten sehr der Mutter Gottes der Hoffnung.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER WAGEN AUS GOLD
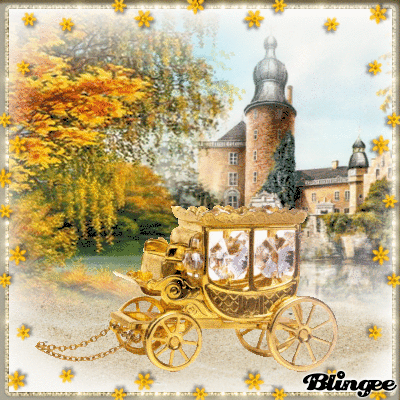
Es war ein König, der wollte sich einen Wagen ganz von Gold machen lassen, er liess seinen ersten Diener rufen und sagte zu ihm:
- Schau, lasse einen Aufruf machen, welcher besagt, dass ich die Tochter desjenigen heiraten werde, welcher mir mitteilt, wie ich es machen muss, um einen Wagen ganz von Gold zu erhalten.
Der Diener sagte ihm: Seid unbesorgt, Herr König, und schon eilt er fort wie eine Rakete, um den Mann zu suchen, der den Ausrufer macht.
Dem Mann sagte er, der König schickt mich und hat mir gesagt, dass ihr einen Aufruf von dem und dem machen sollt.
Dieser nimmt die Trommel und marschiert sogleich tum-pa-tan-tum, um den Aufruf zu bestellen.
Am folgenden Morgen erscheint vor dem Königshause frühzeitig ein Mann.
- Klopft, klopft, kann ich eintreten? fragt er den Pförtner.
Wenn ihr Böses bringt
überschreitet nicht die Türe.
Wenn ihr Gutes bringt,
bleibt nicht auf der Gasse.
- Ich komme, um dem König zu sagen, wie man einen goldenen Wagen machen kann.
- Tretet ein, tretet ein, guter Mann und wartet ein wenig, bis der König aufsteht und ihr werdet es ihm sagen.
Nach einer guten Weile stand der König auf und befahl, dass man jenen Mann sogleich in sein Schlafzimmer führe.
- Saget mir, guter Mann, wie soll ich es machen, einen Wagen von Gold zu erhalten.
- Meine Ansicht über diese Sache geht dahin, dass in drei Frösten, welche nicht kommen werden und drei Tauniederschlägen, welche stattfinden, ein Wagen von Gold zu erhalten ist.
Als der König das hörte, erstaunte er sehr und er sagte ihm darauf:
- Nun guter Mann, ich verstehe euch nicht, was wollt ihr sagen? Dass, wenn drei Fröste nicht kommen und drei Tauniederschläge stattfinden, die Feldfrüchte vorzüglich gedeihen und die Oelmühlen
voll sein werden.
Der König erkannte, was jener Mann sagen wollte, dass der ganze Reichthum aus der Fruchtbarkeit der Erde kommen, er war sehr zufrieden mit ihm und heiratete dessen Tochter.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER ZIEGENHIRT DER PLANA
Ein Ziegenhirt der Plana wollte seine Ziegen melken, fand aber keine einzige.
- Was kann das sein, dachte er, und begann sie zu suchen und aus einiger Entfernung sah er seine Heerde und die Mauren, die sie wegtrieben.
Sogleich zieht er seine Schleuder hervor, setzt einen Stein darein und fängt an zu schreien:
- Up, Up, lasset die Ziegen gehen.
Und Steinwurf auf Steinwurf fällt, seine ersten schlugen auf einen Stein und gingen in Stücke. Die Mauren hatten vor nichts so sehr Furcht, als vor Steinwürfen, sie liessen die Ziegen gehen und
flohen meerwärts. Der Hirte verfolgte sie mit seinen Steinen, bis zum Meere und ein Paar wurden schwer verwundet.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DIE BOYETS-TEUFEL VON SON MARTI
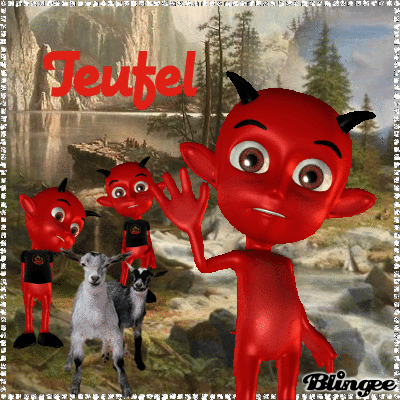
Die Höhlen der Armaris waren die Schlupfwinkel der Boyets-Teufel von Son Martí. Und diese Boyets-Teufel waren der Teufel selbst, welche schlechte Streiche machten! Bald waren sie hier, bald
erschienen sie dort, man konnte über sie nie die Wahrheit erfahren. Don Gabriel, der Herr von Son Martí ritt eines Tages spazieren und im besten Augenblick machte ein Boyet-Teufel in Gestalt
eines Zickleins einen Sprung und setzte sich hinter ihn auf das Pferd, um mit ihm weiter zu reiten. Der Herr, der in Gedanken war, hatte es nicht bemerkt, aber nach einigen Augenblicken fand er
ein anderes Zicklein, das an der Seite des Pferdes stehen blieb und sagte:
- Wohin gehst du Schmutziger?
- Ich lasse mich tragen, antwortete das Zicklein, welches hinten auf dem Pferde sass.
- Mit wem, sagte das am Boden stehende.
- Mit Don Gabriel Martí.
Als der Herr diese Stimme hörte, drehte er sich nach rückwärts und bemerkte das Zicklein und sagte zu ihm:
- Entfliehe von hier, ich will keine Zicklein, die mit mir reiten.
Und die beiden Zicklein verwandelten sich in Boyets-Teufel und flohen eilends davon.
Sie wussten nicht was sie alles anstellen sollten, weil ihr ganzes Bestreben nur darin bestand, sich viele Arbeit zu machen.
Ein anderes Mal geschah es, dass bei einem starken Regen ein Felsblock von oben herab, in eine Thalfurche rollte, eine Menge Boyets-Teufel die es beobachteten, kamen dazu, hielten ihn auf und
dort steht er noch.
Sie gaben nie Ruhe. Eines Tages stiegen sie zum Kaminloch in die Häuser hinein und heraus kamen sie durch das Loch, das für die Katze gemacht ist. Einen anderen Tag fand der Hirte einen Teufel
hinter dem Stamme eines Oelbaumes, er verscheuchte ihn und in einem zu und aufmachen der Augen war der schon auf dem nächsten Berge.
Im Grau de Son Martí befand sich eine Mühle und die Müllerin nannte sich Frau Angelina. Sie war ungehalten darüber, weil sie die Teufel den ganzen Tag vor ihr und hinter sich hatte, welche
dasselbe Liedchen hören liessen.
- Frau Angelina, Frau Angelina gebet uns Weizen und wir wollen euch Mehl machen.
Und sie wusste nicht wie sie dieselben vertreiben sollte. Eines Tags sagte sie:
- Jetzt weiss ich wie ich es machen muss.
Und sie füllte ein Paar Körbe mit schwarzer Wolle und am ersten mal, dass sie sich vor ihr wieder sehen liessen, sagte sie zu ihnen:
- Hier nehmet diese Wolle und waschet sie, bis sie weiss werden wird.
Sie trugen sie schreiend fort, und weil es ihre besondere Liebhaberei ist, sich immer viele Arbeit zu machen, so gingen sie gleich zum Torrent und waschen und waschen immerfort.
Und was denkt ihr euch! es gibt deren, welche sagen, dass sie noch waschen und dass man zuweilen ihr Geschrei, das sie dabei ausstossen, hört.
Frau Angelina wusste, wie sie es machen musste. Sie liessen sich nicht mehr bei ihr sehen.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER SOHN DES PÄCHTERS VON SON FORTEZA
Die Schnitter von Son Forteza verliessen eines Morgens ihre Häuser und gingen zum mähen, sie trafen Mauren, aber diese hatten Furcht vor den Sicheln und sagten ihnen nichts.
Die Schnitter kehrten sogleich um, zu den Häusern zurückgehen, und zu sagen, dass man vor den Mauren auf der Hut sei, aber schon war es zu spät. Die Mauren waren ihnen zuvorgekommen und hatten
den Pächter gefangen genommen. Als die Schnitter sahen, dass der Pächter fortgeführt werde, gingen sie sofort zu dem Sohne, der sich auf einem eingezäunten Felde, in der Nähe, befand.
Als der Sohn das vernahm geht er nach Hause und nimmt ein Pferd mit weissem Gesichte und ein Stück von einem Säbel und eine Flinte ohne Schloss und jagte hinter den Mauren her. Als er sie fand,
rannte er den einen um, warf den andern zu Boden und verwirrte sie alle mit seinem Pferde, sie entflohen und er befreite seinen Vater. Die Mauren fanden dann einen Hirten am Meeresufer und sie
führten ihn mit sich nach Algier. Dort, man weiss nicht was er arbeitete, er verdiente jedoch so viel Geld, dass es genügend war, um sich loszukaufen und er kehrte nach Mallorca zurück.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER SKLAVE MIT DEN LEDERSOHLEN
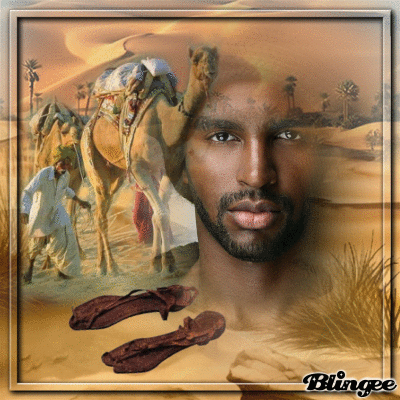
Ein Mann und ein Knabe waren in Sa Gruta, um Holz zu fällen, als plötzlich der Vater zu dem Knaben sagte:
- Wir sind verloren, hier ist die Barke der Seeräuber, ich weiss, was wir tun müssen, ich werde das Maultier besteigen und nach Son Servera reiten und du wirst in einen Mastixstrauch versteckt
bleiben, sie werden dich nicht sehen, gehe auch nicht heraus, bis in ein oder zwei Stunden und ich kann entfliehen, oder sie werden mich fangen.
Er setzte sich auf das Maultier und dieses fing zu laufen an; als er höher hinauf kam, waren Stricke ausgestreckt und gezogen, an denen das Maultier stolperte und fiel und Mauren kamen, nahmen
ihn und das Maultier gefangen und brachten ihn in ihrer Barke nach Algier.
Als sie dort angekommen waren, stellten sie ihn in eine Mühle, wo sie ihn mahlen liessen.
Nach sieben oder acht Tagen sagten sie zu ihm:
- Du musst mit diesem Mauren zu einem Gemüsegarten gehen und dort arbeiten.
Im Gemüsegarten befand er sich gut, weil die Arbeit, den Boden zu bepflanzen, nicht schwer war und da er sich verständig erwies, behandelte ihn der Eigentümer des Gartens gut.
Nach kurzer Zeit wurde er losgekauft und sein Herr sagte zu ihm:
- Für dich ist der Betrag bezahlt, aber bevor ich dich gehen lasse, werde ich dir Ledersohlen geben und wenn du sie verdorben haben wirst, werde ich dich erst zu den Deinigen fortgehen
lassen.
Der Maure, der mit ihm arbeitete, sagte zu ihm:
- Die Ledersohlen sind schwierig zu verderben, aber wenn du machst, was ich dir sage, werden sie in zwei Tagen verdorben sein. Du musst sie einen ganzen Tag in die Erde vergraben und wenn du sie
Abends herausholst, werden sie schon verfault sein.
Er machte es so und am anderen Tage zeigte er sie dem Herrn und sagte ihm, dass er sie schon jetzt nicht mehr tragen könne.
Der Herr erwiderte ihm:
- Verdammt sei der Rat und derjenige, der ihn dir gegeben hat. Wenn man dir nicht so geraten hätte, hättest du sie nicht so rasch verdorben.
Er liess ihn gehen und er kehrte nach Son Servera zurück.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER SKLAVEN-PATRON
In Andraitx lebte ein Patron bei dem Vordach des Platzes. Dieser Patron hatte die Gewohnheit, jedes Jahr am Weihnachtstag, bevor er zu Mittag speiste, vor die Tür seines Hauses zu treten und wenn
er irgend einen Fremden unter dem Vordach sah, lud er ihn in sein Haus zum Speisen ein.
Eines Jahres am Weihnachtstage sah er einen Mauren unter dem Vordach stehen, und obwohl er gegen die Mauren nicht günstig gesinnt war, weil er sie auf dem Meere sehr nahe gesehen hatte, so lud er
ihn dennoch zum Essen ein, um die Gewohnheit nicht zu verlieren.
Nach langer Zeit nahm eines Tages eine Barke mit Mauren, die Barke dieses Patrons mit, macht ihn zum Gefangenen und führten ihn fort, um ihn auf dem Markt von Algier zu verkaufen.
Hier ging ein Maure mittleren Alters vorüber, sah ihn, kaufte ihn und führte ihn nach seinem Hause.
Als sie zu Hause waren, gab ihm der Maure ein gutes Essen und als sie mit dem Essen fertig waren, sprach er zu ihm:
- Ihr seid Mallorquiner, nicht wahr?
- Ja Herr, antwortete ihm der Patron.
- Ich war schon auf Mallorca. Und von welcher Ortschaft seid ihr? Seid ihr nicht aus Andraitx?
- Ja Herr, sagte wieder der Patron etwas erstaunt.
- Ich war auch in Andraitx, erinnert ihr euch nicht meiner?
- Nein, ich erinnere mich nicht Sie je gesehen zu haben, sagte der Patron.
- Und ihr erinnert euch nicht an einen Mauren, den ihr am Weihnachtstag zum Essen eingeladen habt, der unter dem Vordache des Platzes von Andraitx stand?
- Ja, ja, jetzt erinnere ich mich.
- Nun, jener Maure bin ich und um euch die Guttat, die ihr mir erwiesen habt zu vergelten, habe ich euch auch zum Mittagsmahl eingeladen und ich werde euch die Freiheit geben, damit ihr in euere
Heimat zurückkehren könnt.
Der Patron war sehr dankbar und kehrte nach Mallorca zurück; aber nach vier oder fünf Jahren nahmen ihn die Mauren wieder gefangen, und sie verkauften ihn. Es kaufte ihn wieder der gleiche Maure,
der ihn wieder zum Essen einlud und ihm wieder die Freiheit schenkte.
Vier oder fünf Jahren später geschah ihm nochmals das nämliche und der Maure, als sie mit dem Mittagsmahl fertig waren, sagte zu ihm:
- Drei mal habe ich euch zum Mittagsmahl eingeladen und euch die Freiheit gegeben, aber jetzt bin ich alt und kann von einem Tag auf den anderen sterben. Und wenn ich sterbe, kann ich euch nicht
mehr zum Essen einladen und euch nicht mehr die Freiheit geben. Deswegen rate ich euch, schifft euch nicht mehr ein und so werden sie euch nicht ein viertes Mal fangen. Geht weg und fahret fort,
eure gute Sitte zu befolgen, an Weihnachten denjenigen ein Mittagsmahl zu geben, die von ihrem eigenen Hause weit weg sind.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER SKLAVE GABELLI
Die Mauren fingen den Colau Vey und machten ihn zum Sklaven.
Sie führten ihn nach Algier und dort verkauften sie ihn an einen sehr hervorragenden Mauren, welcher eine sehr schöne Tochter, eines der schönsten Mädchen der Mauren hatte.
Sie hielten ihn gut bewacht, damit er ihnen nicht entfliehen könne. Die Tochter des vornehmen Mauren sagte zu ihm eines Tages, wenn er entfliehen wolle, müsse er sich blödsinnig stellen, weil, da
er sehr gewandt und ein schöner Junge sei, würde man ihm die Freiheit sonst nie schenken.
Er machte den Blödsinnigen und als sie sahen, dass er zu nichts brauchbar war, bewachten sie ihn schon nicht mehr so streng und eines Tags während der Nacht gelang es ihm den Schlüsselbund zu
nehmen. Er begann Türen aufzumachen und sie wieder zuzuschliessen und als er zu der letzten kam, die auf die Strasse führte, entfloh er und ging nach dem Meeresufer, wo er ein Schiff fand mit dem
er nach Mallorca zurückkehrte.
Als er hier angekommen war, ging er sogleich zur Mutter Gottes der Hoffnung, liess ihr die Schlüssel und sie wurden in der Kapelle des Rosenstockes aufgehängt und waren viele Jahre dort zu sehen.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER SKLAVE VON SON FÉ
Der Herr von Son Fé kaufte einen Sklaven, der im Alter von achtzehn oder neunzehn Jahren war. Eines Tages, im Gespräch, sagte der Sklave zu dem Herrn:
- Wenn sie mir die Freiheit geben kann ich ihnen eine Quelle auffinden und sie hinleiten wo sie wollen.
Der Herr erwiderte ihm:
- An dem Tage, an dem du eine Quelle findest und nach meinem Hause leitest, werde ich dir die Freiheit geben.
Wie er die Quelle hatte, so sehr liebte er den Sklaven, er wollte ihn nicht frei geben und als der Sklave sah, dass er ihm nicht die Freiheit gab, liess er die Quelle mit Hilfe eines Blasebalges
versiegen. Als er mit dem Blasebalg anfing die Quelle zu versiegen, fand sich dort ein ihm befreundeter Hirte ein, der ihn bat, er möge ihm die Gunst erweisen und ihm ein Wasserstrählchen
fliessen zu lassen, falls er Durst hätte.
Als die Quelle versiegt war, kamen viele Baukundige und fanden es unbegreiflich, weil jenes Mauerwerk sehr fest und in Ordnung war.
Die Vorliebe des Herrn für den Sklaven war so groß, dass er ihm bei seinen Verpflichtungen die Feldarbeiten zu erledigen, freie Hand gegeben hatte.
Seit vielen Jahren behackten seine Nachbarn bereits die Saat und der Sklave hatte noch zu säen und wartete bis zum geeigneten Zeitpunkt, indem er jeden Abend die Erde kostete.
Es geschah eines Tages, dass er Abends hinausging um die Erde zu kosten und er sagte zu dem Herrn:
- Morgen früh werden sie alle Pfluggespanne mieten, die sie erhalten können und wir werden den Weizen säen.
Sie machten es so und sie hatten einen solchen Überfluss zu ernten, dass sie den Weizen nicht in ihrem Besitzhause unterbringen konnten.
Noch gibt es ein Stück Kanal von der Quelle, den der Maure gemacht hatte.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER SKLAVE, DER ENTFLOH
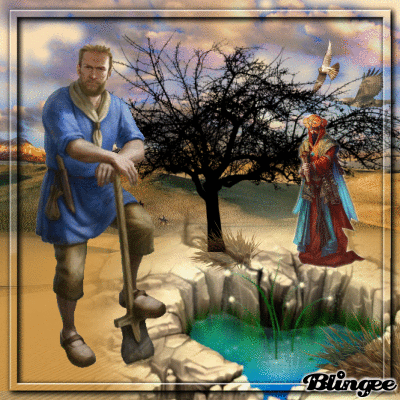
Ein Maure hatte einen mallorquischen Sklaven aus dieser Ortschaft und eines Tages schickte er ihn aus, um Holz zu fällen; als es Abend wurde, kam der Sklave nicht zurück und es wurde später und
er kam auch nicht.
Es sagte der Herr:
- Er wird mir gewiss entflohen sein, und am folgenden Morgen ging er dahin, wo er ihn hingeschickt hatte, und er fand ihn noch Holz fällen und sagte zu ihm:
- Warum hast du so viel gefällt?
Der Sklave erwiderte:
- Ich wollte alles fällen und dann müsste ich nicht hierher zurückkehren.
Der Herr hiess ihn nach Hause gehen und am andern Tage schickte er ihn zum Wasser holen und er kam ebenfalls nicht zurück.
Der Herr sagte:
- Er muss etwas angestellt haben.
Er ging ihn zu suchen und er fand ihn, wie er eine Rinne rings um den Brunnen grub und frug ihn, was er mache.
Der Sklave erwiderte:
- Ich wollte den Brunnen mit der Wurzel bringen, so müssten wir nicht hierher zurückkehren, um Wasser zu holen.
Der Herr hiess ihn die Rinne anfüllen und nach Hause gehen.
Nach einigen Tagen entschloss sich der Sklave zu entfliehen, er nahm einen Käselaib mit und entfloh.
Bald bemerkte der Herr, dass er ihm entflohen war und ging ihm nach, um zu sehen, ob er ihn noch erreichen könne.
Nach kurzer Zeit fand er ihn auf einem Hügel und sagte zu ihm:
- Bleib stehen, bleib stehen oder du wirst es teuer bezahlen.
Der Sklave erwiderte ihm:
- Schau, wenn du dich näherst, werde ich aus deinem Kopf so viele Stücke machen, wie aus diesem Stein.
Und er warf den Käselaib auf einen Felsen und er zerfiel in tausend Stücke. Der Herr dachte, dass es ein Stein sei, den er zerbröckelt hatte und sagte sich:
- Dieser Sklave hat viele Kraft, nun er fällte mir fast den ganzen Strandkiefernwald, als ich ihn zum Holzfällen schickte und er wollte mir den Brunnen mit den Wurzeln ausheben; ich will mich ihm
nicht nähern.
Er hatte Furcht sich zu nähern, der Sklave entfloh und fand am Meeresstrand ein Boot, dem er ein Zeichen machte, er schiffte sich ein und kehrte nach Mallorca zurück.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER ROTHAARIGE MANN
Es waren drei sehr arme Brüder.
Der Älteste sagte zu seinem Vater:
- Mein Vater, ich will gehen und die Welt durchwandern.
Sein Vater sagte zu ihm:
- Mein Sohn, hüte dich vor dem Kettenhund, rundem Stein und dem rothaarigem Mann.
Auf einem Wege fand er einen Kettenhund und er ging zu ihm hin und der Hund biss ihn in die Fersen. Weitergehend sah er einen runden Stein, er wollte darauf steigen, derselbe zerschlug ihm die
Kniee und weiterhin fand er den rothaarigen Mann und sagte zu ihm:
- Wollt ihr mich anstellen?
- Ja, sagte jener Mann, aber du musst essen, ohne den Topf aufzudecken, hast Wein zu trinken, ohne die Flasche aufzumachen und Brot zu essen, ohne die Kruste zu zerschneiden und wenn nach drei
Tagen es dir leid tut, darf ich dich töten.
Er wurde angestellt und nach drei Tagen kam der Herr und fragte ihn, ob es ihm leid tue.
- Er sagte ja, weil er nichts zum Essen habe und der Herr tötete ihn.
Der zweite Sohn sagte zu seinem Vater dasselbe, was der älteste zu ihm gesagt hatte und ging fort und es geschah ihm genau dasselbe, wie seinem ältesten Bruder.
Der jüngste sagte zu seinem Vater:
- Mein Vater ich will gehen und die Welt durchwandern, und sein Vater sagte ihm:
- Mein Sohn, hüte dich vor dem Kettenhund, rundem Stein und dem rothaarigem Manne.
Er reiste ab und es begegnete ihm das gleiche, wie seinen Brüdern, aber als er den Kettenhund sah, machte er einen Umweg, er sah den runden Stein, aber er hütete sich, ihn zu besteigen und als er
den rothaarigen Mann fand, geschah ihm das nämliche, wie seinen anderen Brüdern, aber als er Mittags speisen wollte, machte er ein Loch in den Boden des Topfes und ein anderes in den Korken, um
Wein zu trinken und das Brot durchschnitt er, ass das Innere und fügte die Kruste wieder zusammen.
Nach drei Tagen kam der rothaarige Mann und frug, ob es ihm leid tue. Er sagte nein, und als der rothaarige Mann sah, dass er so aufgeweckt war, da sagte er nichts mehr zu ihm und behandelte ihn
gut. Als er starb, machte er ihn zu seinem Erben und er ging nach Hause und war reich sein ganzes Leben lang.
[Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca]
DER MANN, WELCHER DEN SCHATZ DER FÁTIMA SUCHTE

Es war ein Mann, der einen Hund hatte, welcher Tomeu hiess, und dieser Mann beschloss, den Schatz von Na Fátima zu suchen. Er ging, Erkundigungen einzuziehen, zu einem Herrn aus der Stadt, der
Dinge zu errathen pflegte, der aber niemals in Puigpuñent gewesen war, und dieser sagte ihm:
- Und liegt nicht Son Forteza oberhalb Puigpuñent?
- Ja.
- Und zwischen Son Forteza und dem Dorfe steht dort nicht eine Tenne?
- Ja.
- Und wenn man bei dieser Tenne ist und weiter hinaufgeht, liegt die Fátima nicht zu unserer rechten Seite?
- Ja.
- Also steiget ein Stück höher hinauf vor den Collet d'es forn des vidre (Berg zu den vier Hügeln), und bei einem Felsengrund schauet alles gut an und ihr werdet einen Asphodel mit zwei
Blüthenstengeln finden. Bei diesem Asphodel beginnet zu graben, aber wenn ihr den Schatz nicht gleich das erste Mal findet, dann werdet ihr ihn nie mehr finden können.
- Und muss ich sehr tief graben?
- Nein, ihr werdet bald das Loch finden.
Nun verabschiedete er sich von dem Errather und als er sich entschloss, den Schatz aufzusuchen, nahm er auch zwei Stiere, d.h. zwei Männer, die den Militärdienst gemacht hatten, zu seiner
Begleitung und ebenso seinen Hund, der Tomeu hiess.
Als sie den Asphodel fanden, begannen sie zu graben und als sie kurze Zeit gegraben hatten, machte die Erde wie ein Wirbel, sank zusammen und es zeigte sich ein Loch. Als sie das Loch fertig
sahen, beschaute es sich der wackerste von ihnen allen und hatte keinen Muth, hineinzusteigen. Die beiden anderen sahen sich, einer den anderen, an.
- Gehen wir nicht hinein?
- Wir gehen hinein.
Als sie im Innern waren, fanden sie gepflasterten Boden und eine Art Anwurf aus alter Vorzeit mit Tropfsteinen überzogen. Sie gingen ein Stück weiter hinein, mehr erschrocken wie ein Kaninchen,
der Hund mit dem Schweif zwischen den Füssen lief hinter die Füsse des Herrn. An einer gewissen Stelle fanden sie eine Pfütze schwarzen Wassers, und sie bekamen Furcht, da sie genug davon hatten,
wendeten sie sich nach dem Ausgang und auf dem Rückweg wollte keiner der Zwei mehr hinter dem anderen gehen, aus Furcht, darin bleiben zu müssen, darum gingen sie beide hart neben einander. Als
sie herauskamen, trafen sie jenen Muthigen noch, welcher mehr Mann war, bevor er das Unternehmen begonnen hatte, und der sie erwartete.
Es geschah ihnen nichts, aber es blieb ihnen nichts Anderes übrig, als die Verzauberung zu lassen. Das Loch, das sie gemacht hatten, fanden sie nicht mehr.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER MANN, DER EIN ESEL WIRD
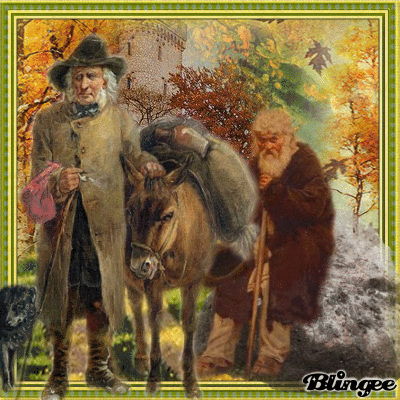
Eine sehr arme Wittwe, die drei Kinder hatte, war sehr kummervoll, weil sie nichts hatte, was sie ihnen geben konnte.
Eines Tages kamen zu ihr zwei kleine alte Männer, die aussahen, wie wenn sie die ganze Welt durchwanderten und frugen an, ob sie übernachten könnten und ob man ihnen ein Abendessen geben wolle.
Jene Frau war sehr betrübt und sagte ihnen:
- Wie kann ich euch Abendessen geben, da ich Kieselsteine im Topfe habe, um die Kinder zu unterhalten, damit sie einschlafen?
- Nun, schauet einmal, ob sie gesotten sind, sagten die kleinen Alten.
- Und würdet ihr einfältiger wie die Kinder sein, habe ich euch nicht gesagt, dass es Kieselsteine sind?
- Lasset es gehen, schauet wieder nach, ob sie gekocht sind?
Sie baten so viel, bis schliesslich die Frau ging, nachzusehen und sie fand den Topf voll Saubohnen und sie sagte zu jenen Männern:
- Jesus, ja ihr könnt schon zu Abend essen, aber ich habe nichts mehr, was ich hinzufügen könnte.
- Gehet und schauet in euere Krüge.
Sie ging hin und fand sie mit Oel gefüllt und ihre Körbe voll Brod.
- Schaut, sagte sie, seit meines Mannes Tod war noch fast kein Brod da gewesen.
Sie assen Alle zu Abend und als sie gegessen hatten, sagte die Frau zu ihnen, sie möchten in ihrem Bette schlafen, aber sie wollten das nicht und gingen schlafen auf den Dachboden.
Als die Frau sie am anderen Morgen rufen wollte, fand sie Niemanden mehr, aber in ihrem Hause gingen nie mehr die Speisen aus.
Jene kleinen Alten kamen am anderen Abend zu einem Landgut und frugen, ob sie übernachten und Abendessen könnten und der Pächter sagte zu ihnen:
- Abendessen geben wir nicht, übernachten ja.
Und alle Armen, welche zu ihm kamen, liess er in einem Stalle schlafen, wo zwei Hunde waren, die sie auffrassen.
Jene beiden Alten enthüllten sich als der heilige Peter und der gute Jesus und als sie im Stalle waren, sagte der gute Jesus:
Peter setze dich auf einen der zwei Hunde und ich werde mich auf den anderen setzen.
Am folgenden Morgen fand man jene beiden Männer auf den Fleischerhunden reitend und als der Pächter sah, dass die Hunde sie nicht aufgefressen hatten, sagte er:
- Diese Männer treiben böse Künste, und er rief die Knechte zusammen, damit sie sie gefangen nehmen und in den Kerker führen sollten.
Als sie unterwegs waren, sagte der eine der alten Männer, man glaubt es war der gute Jesus:
- Pächter, diese Knechte verlieren ihre Arbeit und es wäre nicht nothwendig, dass sie sie verlören, weil wir euch nicht entfliehen werden und ihr seid Leute genug, um uns zu begleiten.
Jene Männer gingen weg und als sie nicht mehr da waren, sagte der gute Jesus zum heiligen Peter:
- Peter setze dich auf diesen Esel, und der Pächter war zum Esel geworden.
Und mit dem Esel kamen sie zu dem Hause jener Wittwe und der heilige Peter sagte zu ihr:
- Frau nehmet hier diesen Esel und verwendet ihn, lasset ihn die Wasserhebebrunnen (Noria) drehen, bestellet mit ihm den Gemüsegarten, ihr werdet viel Gemüse bekommen und beladet den Esel wenn
ihr geht, um es zu verkaufen und ihr dürft ihm nie zu Fressen geben und dürft ihm den Maulkorb nie abnehmen und nie wird er ermüden.
So machte es jene Wittwe und sie hatte den Esel sieben Jahre lang. Eines Tages kam der älteste Knabe jener Frau, der bereits gross geworden war, der eine Ladung Gemüse mit dem Esel geführt hatte
und dieser frass einen Asphodel und fiel todt nieder und nun hatten sie keinen Esel mehr.
Indessen kamen jene kleinen Alten wieder und der älteste Sohn sagte zu seiner Mutter:
- Meine Mutter, jene zwei kleinen Alten, die uns den Esel geschenkt und die wir seither nicht mehr gesehen hatten, sind wieder zurückgekehrt und folgen mir sogleich nach.
Als sie angekommen waren, sagte ihnen die Frau:
- Ach meine Herrchen, jener Esel, den ihr mir gabet, ist todt, noch könnte ich den Asphodel finden, der ihm, als er ihn frass, den Tod brachte.
- Wir wollen also gehen, sagten jene kleinen Alten, um zu sehen, ob noch etwas von ihm übrig geblieben ist.
- Ja, sagte die Frau, ich denke, dass noch der Kopf vorhanden ist.
Sie gingen hin und fanden noch den Kopf des Esels.
Einer der zwei kleinen Alten gab ihm einen Fusstritt und sagte zu ihm:
- Stehe auf, weil Gott dir schon verziehen hat.
Mit dem stand er auf und verwandelte sich in den Pächter, den Besitzer der Hunde und der kleine Alte sagte zu ihm:
- Wenn Arme wieder zu dir kommen, gebe ihnen zu essen und sperre sie nicht mehr in den Stall mit den Fleischerhunden.
Als jener Mann wieder bei seinem Hause angekommen war, wollten sie ihn nicht aufnehmen, weil sie meinten, dass er schon lange todt sei und die Aasgeier ihn gefressen hätten.
Aber er erzählte ihnen den ganzen Hergang und sie nahmen ihn auf und jetzt ist er gläubig geworden.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER MAGENPETER
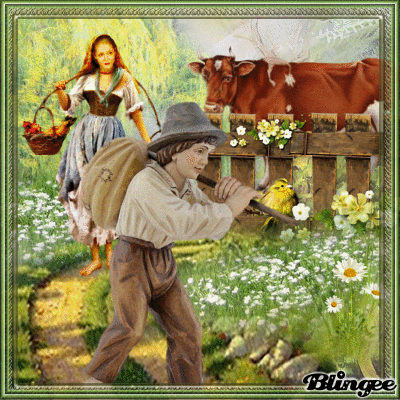
Sie hiessen ihn den Magenpeter weil seine Mutter eines Tages ihn zum Fleisch holen schickte und ihm sagte, er solle dasselbe ohne Knochen bringen. Er brachte einen Magen und als er nach Hause
zurückkehrte betrat er die Kirche, um zu sehen, was es gäbe, weil er viele Leute darin sah. Es war soeben das Hochamt und darnach kam die Predigt. Der Prediger sprach über die Butla (Päpstliche
Bulle) und da er wiederholt die Butla nannte, die Butla so und die Butla anders, meinte zuletzt der Peter, dass er die Butza (Magen) die Butla nannte und dass er den seinigen gesehen hätte,
darüber ärgerte sich der Peter so sehr, dass er ihn nach der Kanzel warf und dem Prediger zurief:
- Nun also, so viel Butza, so viel Butza, hier habt ihr die Butza.
Als seine Mutter das Geschehene vernahm, sagte sie zu ihm:
- Ach Peter, Peter, dummer Peter, du musst mehr Geduld haben und immer zu dir sagen;
Gott gebe mir Ruhe.
An demselben Tage musste er zum Hafen gehen und seine Mutter sagte ihm, er solle den Magen mitnehmen und bevor er ihn zurückbrächte, im Meere waschen, damit er gereinigt würde.
Als er ihn wusch, sah er ein Boot im Begriff hinauszufahren, um zu fischen; es war windstill und er sagte zu den Matrosen auf dem Boote:
- Gott gebe euch Ruhe.
Jene Matrosen, welche derselben schon überdrüssig waren, ruderten dem Ufer zu und fragten ihn, warum er das gesagt habe und prügelten ihn tüchtig.
Er fragte sie:
- Was soll ich also sagen?
- Was du sagen sollst? Gott gebe euch guten Wind.
Als er nach dem Dorfe zurückkehrte, erhob sich ein sehr starker Wind und auf dem Wege begegnete er einem Schafhirten mit seiner Heerde, welche fast nicht fortkommen konnten, weil sie gegen den
Wind ankämpfen mussten und er sagte zu ihm:
- Gott gebe euch guten Wind.
Der Hirte prügelte ihn wieder und der Peter frug ihn:
- Also was soll ich sagen?
- Was du zu sagen hast? Gott gebe euch Kraft.
Seinen Weg nach dem Dorfe weiter verfolgend, traf er, als er gegen Can Contes kam, zwei Fuhrleute, die sich zankten und er sagte ihnen:
- Gott gebe euch Kraft.
Jene zwei schauten ihn an und schlugen tüchtig auf ihn ein und er fragte sie:
- Also was soll ich sagen?
- Was du zu sagen hast? Gott trenne euch.
Er ging seinen Weg fort und als er ein Stück weitergegangen war, fand er ein Ehepaar, er beeilte sich und als er vor den Mann und die Frau gekommen war, sagte er zu ihnen:
- Gott trenne euch.
Die Frau fing an zu lachen, aber der Mann nahm es übel und gab ihm auch eine gute Prügelstrafe. Der Peter fragte ihn:
- Also was soll ich sagen?
- Was du zu sagen hast? Gott gebe euch viele Lebensjahre, um miteinander zu verleben.
Er verliess das Ehepaar und begann rasch gegen Felanitx zu gehen. Nach kurzer Zeit fand er zwei Männer, welche bis zum Gürtel in einem Wasserbehälter zur Seite des Weges im Koth staken und sagte
zu ihnen:
- Gott gebe euch viele Lebensjahre um mit einander zu verleben.
Einer der beiden Männer arbeitete sich aus dem Behälter heraus und so schmutzig wie er war, gab er ihm eine Ohrfeige und er fragte ihn:
- Also was soll ich sagen?
- Was du zu sagen hast? Dass, so wie der eine herausgekommen ist, auch der andere herauskommen möge.
Als er in die Nähe von Es collêt kam, fand er einen Einäugigen und er sagte sogleich zu ihm:
- So wie einer herausgekommen ist, möge auch der andere herauskommen.
Dieser Einäugige, ja der gab ihm tüchtig Prügel und Peter frug ihn:
- Also was soll ich sagen?
- Was du sagen sollst? Gott gebe euch gute Augen.
Er traf Niemanden mehr an und als er nach Hause kam, sagte er zu seiner Mutter:
- Gott gebe euch gute Augen.
- Amen, antwortete seine Mutter, hast du den Magen gut gereinigt?
- Ja, sagte er, aber der Rücken ist sehr schmutzig von Hieben.
- Ja, du musst was angerichtet haben?
- Mir hat man es angerichtet und er erzählte seiner Mutter alles, was ihm zugestossen war und dann musste er sich niederlegen, da er in Folge der Hiebe sich nicht mehr aufrecht erhalten konnte
und er dachte nach, was ihm eigentlich seine Mutter gesagt hatte, er solle immer wiederholen: Gott gebe mir Ruhe. Gott gebe mir Ruhe, was das beste war.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER LÜGENSACK
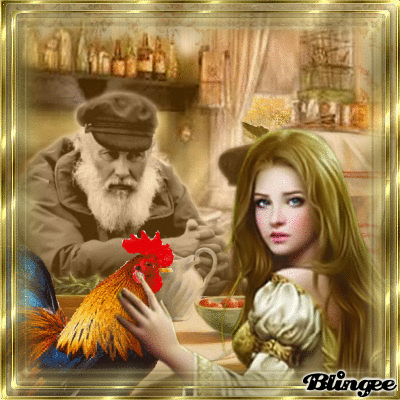
Es war ein sehr reicher Herr, der eine wunderschöne Tochter hatte, und gerade vor seinem Hause stand eine sehr grosse Pinie, die ihm die Aussicht verdeckte und diese
war sehr schwer zu entfernen.
Der Herr liess einen Ausruf machen, dass derjenige, der die Pinie entfernen könnte, seine Tochter heirathen dürfe.
Ein Mann aus einem benachbarten Dorfe erfuhr davon, machte sich auf den Weg nach dem Hause jenes Herrn und nahm zwei Brode mit sich, um sie unterwegs zu
verzehren.
Er ging und immer weiter gehend, fand er eine Schlange und die Schlange sagte zu ihm:
- Wo geht's hin?
- Er sagte: zu diesem Platze und für das und das.
- Nun, gebet mir euer halbes Brod und es wird euch besser gehen.
- Ich weiss zwar nicht, ob es weit oder nahe ist, aber nimms, und er gab ihr das halbe Brod.
Er begann weiterzugehen und weiter immer weiter gehend, fand er ein Regiment Ameisen, welche zu ihm sagten:
- Wo geht's hin?
Er sagte dahin und für das und das.
- Nun, gebet uns ein halbes Brod und es wird euch besser gehen.
- Ich weiss nicht, ob es weit oder ob es nah ist, wohin ich gehen will, aber nehmt es, ich werde es schon sehen und er gab ihnen das halbe Brod.
Er ging weiter, immer weiter, und weiterhin fand er einen Falken.
- Wo geht's hin? frug der Falke.
- Er sagte: dahin und für das und das.
- Nun, gebet mir ein halbes Brod und es wird euch besser gehen.
- Ich weiss nicht, ob es weit ist, oder nah und für mich ist nur noch ein Brod übrig geblieben, indessen, nehmt die Hälfte davon.
Nun kam er zu dem Hause jenes Herrn, bat um die Werkzeuge, um die Pinie zu fällen und begann zu arbeiten.
Die Tochter jenes Herrn hatte eine besondere Gabe, dass, wenn sie auf einen Schnitt oder einen Sprung ausspuckte, sich dieselbe sofort schloss und weil dieser Mann
alt und hässlich war und sie ihn durchaus nicht wollte, ging sie hin, um in den Schnitt des Pinienstammes zu spucken, damit er sich wieder schliesse; aber die Schlange verhinderte es, sie entfloh
aus Furcht und konnte nicht spucken, und der Baum war bald gefällt.
Aber nun sagte ihm der Herr, dass das noch nicht genügend sei, dass, wenn er sich mit seiner Tochter vermählen wolle, müsse er ihm dreihundert corteres (Maass)
gemischte Saat am selben Abend ausscheiden und am folgenden Morgen müsse er ihm getrennt die hundert Maass Weizen, die hundert Maass Xexa (eine feinere Weizensorte) und die hundert Maass Gerste
bringen.
Jener Mann sah, dass er dies nicht zu thun im Stande war, aber er sagte ja, und das Regiment Ameisen kam und in einem Augenblick hatten sie es
geschieden.
Aber der Herr wollte ihm seine Tochter noch nicht geben und gab ihm dreizehn Hähne und sagte ihm, wenn er sie nach einem Jahr und einem Tag noch besitze, dann dürfe
er sie heirathen.
Er ging mit den dreizehn Hähnen fort nach seinem Hause und nach einigen Wochen kam die Magd jenes Herrn zu ihm, um zu fragen, ob er ihr einen Hahn verkaufen
wolle.
Er sagte ihr, dass er keinen verkäuflich habe, aber sie bat ihn so lange, bis er endlich ihr versprach, dass er ihr einen verkaufe, wenn sie am Abend mit ihm zu
Abend essen wolle. Sie sagte ihm ja, und als sie gegessen hatten, gab er ihr den Hahn und sie ging weg.
Indessen kam es, als sie unterwegs war, dass der Falke, der von jenem Manne das halbe Brod verlangt hatte, ihr den Hahn abnahm und es seinem Eigenthümer
zurückbrachte.
Nach mehreren Monaten ging die Tochter jenes Herrn zu ihm, aber verkleidet, damit er sie nicht erkenne und fragte ihn, ob er ihr einen Hahn verkaufen wolle. Der Mann
versprach es ihr, wenn sie am Abend mit ihm speisen wolle. Sie war es zufrieden und als sie zu Abend gegessen hatten, gab er ihr den Hahn und das junge Mädchen ging weg, aber der Falke nahm ihn
unterwegs ihm ab und brachte ihn jenem Manne wieder zurück.
Nach einiger Zeit ging der Herr selbst hin, ebenfalls verkleidet und verlangte, dass er ihm einen Hahn verkaufe.
Er antwortete ihm bejahend, wenn er sich eine gute Tracht Prügel mit einem Stocke, um Karren vollzuladen, gefallen lasse.
Der Herr sagte ja und brachte den Hahn weg, aber mit einem sehr warmen Rücken.
Unterwegs nahm ihn der Falke ihm wieder ab und brachte ihn dem Manne zurück.
Inzwischen waren das Jahr und der Tag vorüber und jener Mann ging mit den Hähnen nach dem Hause des Herrn, um sich mit seiner Tochter zu
verheirathen.
Der Herr hatte eine Anzahl Knaben gemiethet, damit sie ihn erwarten sollten, und so wie sie ihn erblickten, ihm die Hähne mit Steinen bewerfen und sie ihm entfliehen
liessen.
Er sah die Knaben von weitem und versteckte alle seine Hähne in einer Sandhöhle und setzte sich, um zu rauchen, auf die Mauer.
Als die Knaben bei ihm ankamen, fragten sie ihn:
- Habet ihr einen Mann gesehen, der eine Hähnenheerde führt?
- Er sagte ja, ich habe ihn gesehen, weit oben.
Die Knaben liefen weg, er holte seine Hähnen und brachte sie alle zum Hause jenes Herrn.
Aber dieser wollte noch nicht zugeben, dass er sich mit seiner Tochter verheirathe und sagte ihm, dass, wenn er sie heirathen wolle, müsse er noch einen Sack mit
Lügen anfüllen.
- Also sagte er, bringet mir einen Sack.
Sie brachten ihm den Sack und er frug die Magd.
- Saget, erzählet die Wahrheit, dass ihr mit mir eines Abends zu Abend gegessen habt.
- O, sagte sie, was für eine grosse Lüge!
- Er sagte: Also stecke sie in den Sack. Ei nun, sagte er zu dem Mädchen, erzähle wahrheitsgetreu, hast mit mir eines Abends zu Abend gegessen?
- Oh, sagte sie, welch grossartige Lüge.
- Er sagte: Also stecke sie in den Sack.
Dann wandte er sich zu dem Herrn und begann zu sagen:
- Nun sie - - -
- Schliesset den Sack, weil er schon voll ist, sagte sogleich der Herr zu ihm, ohne dass er ihn ausreden liess, weil er nicht wollte, dass sie erfahren sollten, dass
er sich hatte prügeln lassen.
Und dann verheirathete sich jener Mann mit jenem ebenso reichen als schönen Mädchen. Und wenn sie nicht lebend sind, sind sie todt; und wenn sie nicht todt sind,
sind sie lebend.
[Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca]
DER HIRTE DES BRUNNENS VON SES BASSES

Es war ein Hirte, den die Mauren verfolgten und den sie nie fangen konnten.
Eines Tages fanden ihn zehn oder zwölf Mauren und liefen ihm nach. Er entfloh über eine Klippenreihe und blieb erst bei der letzten und äussersten von allen stehen und hier setzte er sich nun,
die Flöte zu spielen und die Mauren zu verlachen, welche sich fürchteten, die Klippen zu überschreiten und ihn nicht fangen konnten.
Die Mauren sagten ihm:
- Wir werden dich schon fangen, es wird ein Tag kommen, an dem du uns nicht entfliehen wirst.
Einmal fanden ihn fünf Mauren, als er einen Topf Milch am Feuer hatte, und sie umringten ihn.
- Jetzt bin ich schon eurig, sagte er zu ihnen, aber nachdem ich euch doch nicht mehr entfliehen kann, lasset mich wenigstens einen Teller Milch essen und wenn ihr auch davon wollet, so gibt es
noch genug davon.
Sie sagten ja, und wie er ihnen die kochende Milch ausschenkte, verbrühte er sie alle, und unter Löffelhieben liess er sie entfliehen.
Ein anderes Mal fanden sie ihn innerhalb eines Brunnens, in den er hineingegangen war, um Wasser zu trinken und von oben herab riefen sie ihm zu:
- Dieses Mal entfliehst du uns ja nicht.
- Ich sehe es schon, erwiderte er aus dem Innern des Brunnens, jetzt werde ich herauskommen, umringet die Brunnenöffnung, aber wenn ich herauskomme, könnt ihr mich nur durch die Gerte, die durch
meinen Gürtel geht, fangen.
Als er aus dem Brunnen kam, hielten die Mauren ihn sofort an die Gerte fest, er machte einige Windungen, liess die Gerte in ihren Händen und entfloh.
Ein anderes Mal fanden sie ihn in einer Höhle.
- Von hier kannst du ja nicht entfliehen, sagten sie. Wir werden warten, bis er herauskommt und wenn er nicht kommt, wird er vor Hunger sterben. Es wird nicht so gehen, wie damals beim
Brunnen.
Als er sie hörte, steckt er den Kopf durch ein Loch aus der Höhle heraus und bricht in ein grosses Gelächter aus.
- Lache nur, sagten die Mauren, diesmal entkommst du uns ja nicht.
Aber er hatte ein Brod und was macht er, er zeigt es ihnen durch dasselbe Loch der Höhle, indem er ihnen sagte:
- Ich theile das Brod.
Sodann theilte er es schnell, zeigte ihnen die Hälfte und sagte ihnen:
- Ich theile das Halbe.
Er nimmt ein anderes Stück davon weg und sagt zu ihnen:
- Ich theile das Stück.
Er schneidet schnell eine Schnitte, zeigt sie ihnen und sagt:
- Ich theile die Schnitte.
Als die Mauren dies sahen, sagten sie:
- Er hat Brod für vierzehn Tage, gehen wir, gehen wir, es ist nichts zu machen, mit diesem Hirten.
Sie konnten ihm nichts anhaben und diese Höhle wurde seit dieser Zeit die Höhle von Theile Brod, (cova d'escata pá) genannt und noch heute nennt man sie so.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER ANWALT UND DER BAUER
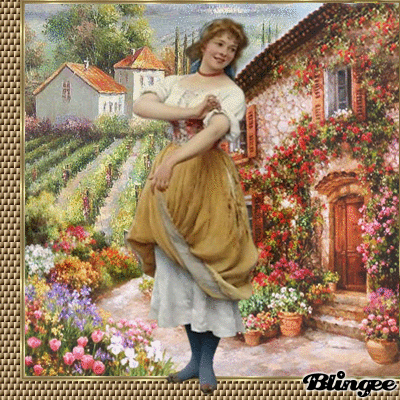
Ein Herr, der Anwalt war, ging zu Fuss nach der Stadt und als er gegen San Navata kam, begegnete ihm ein Bauer.
- Wohin geht's, fragte er ihn.
- Ich, bis zur Stadt, sagte der Bauer und ihr?
- In die Stadt.
- Also können wir zusammen gehen.
- Ja, sagte der Herr.
Als sie ein Stück weiter gegangen waren, sagte der Herr:
- Bruder, willst du mich führen, oder soll ich dich führen?
Der Bauer schaute ihn an, und gab ihm darauf keine Antwort, indem er überlegte:
- Welche Frage! Wie kann ich ihn führen, der ich ein so alter Mann bin?
Sie gingen weiter und unterhielten sich mitsammen und als sie bei Son Gornals waren, sahen sie Gerste, die sehr schnittreif und noch nicht geschnitten war, und der Herr fragte den Bauern:
Brüderchen, ist diese Gerste geschnitten oder nicht geschnitten?
Der Bauer schaute ihn an, gab ihm aber keine Antwort.
Weiter gehend unterhielten sie sich mit anderen Dingen und als sie an Porreras schon vorüber gegangen waren, begegneten sie einer Leiche, welche man zum Grabe trug und der Herr sagte zu dem
Bauern:
- Brüderchen, dieser Mann, den man begraben will, ist der tot oder lebendig?
Der Bauer gab ihm auch darauf keine Antwort.
Mit allerlei Dingen sich unterhaltend, gingen sie weiter und weiter und kamen nach dem Prat, als es schon Dämmerung war.
Der Bauer war der Pächter einer Besitzung in der Ebene, nahe bei der Stadt und er sagte dem Herrn, es würde schon zu spät werden, bis er nach der Stadt käme; desshalb solle er in seinem Hause
übernachten und am folgenden Morgen weitergehen.
Der Herr sagte ja, er wolle bleiben, und als sie bei dem Hause jenes Bauern, der einen Sohn und eine Tochter hatte, ankamen, stand die Tochter unter der Türe.
- Welch schönes Portal, sagte der Herr, wenn nicht ein Stück daraus fehlen würde.
Der Mann wusste wieder nicht, was er von dem, was der Herr sagte, denken sollte, weil an dem Portal kein Stein fehlte.
Das Abendessen wurde bereitet und als es fertig war, setzten sie sich zu Tische.
Es wurde ein Hahn gebracht und der Hausvater bat den Herrn, dass er ihn zerteile. Der Herr gab den Kopf dem Manne, die Brust der Frau, die Füsse dem Sohne, die Flügel der Tochter und den Rücken
behielt er für sich.
Als sie gespeist hatten, unterhielten sie sich noch eine Zeit lang und sagten dann dem Herrn, wenn er Lust habe, schlafen zu gehen, sei das Bett schon bereitet.
Der Herr ging schlafen und als die Familie ganz allein war, erzählte ihnen der Vater, dass jener Herr ihm mehrere seltsame Fragen vorgelegt habe. Er sagte ihnen, dass er ihn sogleich wie er ihm
begegnet war, gesagt habe, ob er wollte, dass er ihn führen solle oder ob er ihn führen wollte.
- Ach, mein Vater, mein Vater, sagte seine Tochter, verstehst du nicht, dass er fragen wollte, ob du das Gespräch führen wolltest, oder ob er es tun sollte.
- Ach, sagte ihr Vater, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Aber dann frug er mich wegen einer Gerste, die schnittreif aber noch nicht geschnitten war, ob sie geschnitten sei oder nicht.
- Ach, mein Vater, mein Vater, sagte seine Tochter, verstehst du nicht, dass, wenn der Eigentümer ihm schuldet, wenn es auch noch nicht geschnitten ist, für jenen ist es schon.
- Du magst Recht haben, sagte ihr Vater, aber als wir in der Nähe des Friedhofes von Porreras waren, sahen wir eine Leiche und er hat mich gefragt, ob ich wisse, ob sie tot oder lebendig
sei.
- Ach, mein Vater, mein Vater, sagte die Tochter, merkst du nicht, dass, wenn jener Tote selig geworden ist, er für immer lebend ist und wenn er verdammt ist, so ist es dasselbe, wie wenn er tot
wäre.
- Aber wie wir hier ankamen, hat er zu mir gesagt, siehe welch schönes Portal, schade aber, dass ein Stück fehlt.
- Ach, mein Vater, mein Vater, merkst du nicht, dass ich unter dem Portal stand, und da mir ein Vorderzahn fehlt, bezog er das auf meinen Mund. Und als wir zu Abend assen, hat er euch den Kopf
gegeben, weil ihr das Haupt des Hauses seid, die Brust der Mutter, weil sie es ist, welche die Last des Hauses trägt, die Füsse meinem Bruder, weil er willige Füsse haben soll, überall hin zu
gehen, wohin ihr ihn schicket und mir die Flügel, weil ich fliegen und ausfliegen muss und noch nicht weiss, wo ich mich niederlassen werde.
- Ja, sagte ihr Vater, jetzt verstehe ich Alles. Dieser Herr scheint sehr verständig zu sein und du wärest sehr gut, mit ihm zu gehen.
- Also sagte auch ich, dachte bei sich der Herr, der alles gehört hatte, weil sein Zimmer nebenan und er noch nicht eingeschlafen war. Und wie gut wäre es für sie, mit mir zu kommen. Und sie wird
kommen, wenn sie will, ich will bei ihrem Vater anfragen, um sie zu heiraten.
Und er schlief während der ganzen Nacht nicht; am anderen Morgen sagte er, dass er jenes Mädchen zu heiraten wünsche. Sie war einverstanden, sie vermählten sich und lebten in glücklicher Ehe.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER ALTE GUAYTA
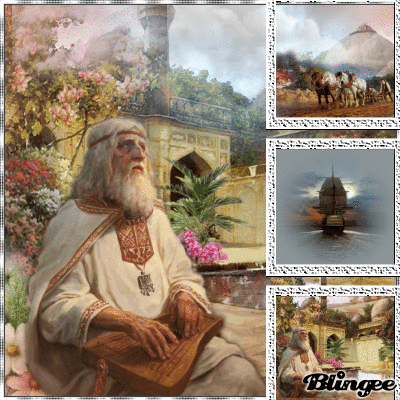
Es war ein Mann, der auf dem Felde von Cala Murada pflügte und eines Morgens, als ein Nebel herrschte, was man nicht sagen kann, sah er sich plötzlich von einer Anzahl Mauren umrungen, die ihn gefangen nahmen und wegführten, während sie das Pfluggespann gekoppelt zurück liessen.
Sie verbanden ihm die Augen und führten ihn zu ihrem Boote und als sie ihm die Binde entfernten, sah er nichts mehr als Himmel und Wasser.
In Algier angekommen, brachten sie ihn auf den ersten Markt, der stattfand, zum Verkaufe, und es kaufte ihn ein sehr reicher Maure, aber nach kurzer Zeit verarmte er und verkaufte alles was er hatte, und auch jenen Sklaven.
Dieser Sklave kam in die Hände eines anderen, sehr reichen Mannes, der aus Jerusalem war, und der nach seinem eigenen Lande zurückkehrte und ihn mitnahm. Dort diente er ihm als Gemüsegärtner und weil er ein sehr guter Mensch war, liess er ihn seine Religion befolgen und er besuchte von Zeit zu Zeit die Brüder des heiligen Franziskus und befreundete sich sehr mit einem von ihnen, der sein Beichtvater war.
Eines Tages, zur Belohnung seiner Ehrlichkeit und christlichen Gesinnung, fügte es der liebe Jesus, dass er auf folgende Weise seine Freiheit erhielt.
Ein kleiner Knabe, den der Sklave dort angetroffen hatte, denn es waren fünfundzwanzig Jahre, dass er mit jenem Herrn stand, war gross geworden, hatte geheiratet und ging spazieren mit seiner Braut und anderen Leuten in dem Gemüsegarten, wo der Sklave als Gärtner arbeitete.
Der Sklave hörte ein Jammergeschrei, lief schnellstens herbei, sah, dass die Braut in den Wasserbehälter gefallen war, er achtete nicht darauf, ob er verschwitzt war, oder ob sein Leben in Gefahr kam, springt in das Wasser und zieht die Braut heraus, ohne dass sie Schaden genommen hätte.
Ihr könnt selbst urteilen, wie sehr der Schwiegervater und ihr Mann dem Sklaven dankbar waren.
Sogleich luden sie ihn ein, am selben Tag, mit ihnen zu speisen und das war eine grosse Vergünstigung von ihnen, weil niemals einer der Bediensteten mit ihnen speisen durfte.
Als sie gegessen hatten, sagte der Herr zu ihm:
- Siehe ich muss euch belohnen für den Dienst, den ihr mir geleistet habt. Saget mir was wählet ihr. Zieht ihr vor, euer ganzes Leben hindurch, bei uns zu bleiben, und wenn ich sterbe, werde ich euch so viel hinterlassen, als ihr zum Leben braucht, oder wollt ihr nach Hause zurückkehren?
Er erwiderte, dass er es überlegen und gleichzeitig mit seinem Beichtvater beraten wolle, der ein Mönch vom Orden des heiligen Franziskus war, und der Mönch sagte ihm:
- Wenn ihr noch eigene Verwandte auf Mallorca habet, dann ziehet hin, denn sie müssen sich sehr nach euch sehnen.
Diese Worte brachen sein Herz und ohne mehr darüber zu denken ging er zum Herrn und sagte ihm:
- Mein kleiner Herr, ich ziehe vor, nach Hause zu gehen und wenn ich Jemanden aus meiner Familie am Leben finde, werde ich noch Zeit haben sie umarmen zu können.
Der Herr erwiderte ihm:
- Also gehet auf dem Molo und benachrichtigt mich von dem ersten Schiffe, das nach Spanien geht, ich werde euch die Reise bezahlen. Denket euch, wie gerne jenes Männchen am Ufer aufpasste. Eines Tages, als er ein Schiff mit einer gelb-roten Flagge gewahrte, und wissend, dass es aus Spanien sei, lief er eilends zum Kapitän und fragte ihn ob er Raum habe, um ihn einzuschiffen.
Der Kapitän bejahte es, und sehr befriedigt darüber, ging er zum Herrn, um sich zu verabschieden, der Herr gab ihm Geschenke mit und er kehrte nach Mallorca zurück.
In seinem Hause hielten sie ihn für gestorben und Niemand dachte mehr an ihn. Eines Morgens früh, trat er in sein Haus, worin er seine zwei Töchter fand, die leichte Arbeiten verrichteten und diese waren die einzigen Überlebenden von seiner ganzen Familie.
Als sie ihn sahen, erhoben sie ein grosses Geschrei, fielen ihm um den Hals und weinten und weinten vor Freude, sie konnten sich nicht fassen, dass sie ihn wiedersahen.
Er zog ein Kästchen heraus, worin die Geschenke seines maurischen Herrn waren und gab dieselben seinen Töchtern.
Er lebte in Felanitx noch viele Jahre und wenn man ihn befragte, wer ihn aus dem Maurenlande befreit hatte, antwortete er:
- Meine Ehrlichkeit.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DAS SCHLOSS DER ROSEN
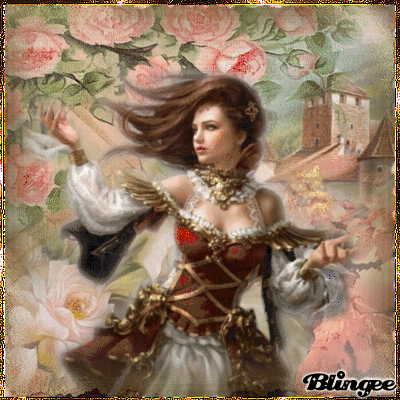
Es war ein Haus, in dem zwei Kinder waren, ein Knabe und ein Mädchen, sie waren vom Mittelstande, weder arm noch reich.
Und es war ein anderes Haus, wo auch ein Bruder und eine Schwester war und diese waren sehr reich.
In diesen beiden Häusern waren sie sehr befreundet und eines Tages verabredeten sich die beiden Knaben, ein Schloss von Rosen zu machen, die beiden Schwestern sollten über das Schloss springen, und derjenigen, welche das Schloss überspringen würde, ohne eine Rose zu brechen, sollten alle Güter gehören. Diese beiden durften noch nichts davon erfahren.
Als sie das Schloss verfertigt hatten, nahmen sie die beiden Schwestern mit und als sie bei dem Schlosse angekommen waren, sagten sie ihnen, dass diejenige die darüber springe, ohne eine Rose abzubrechen, die Güter erhalten würde.
Die Arme sagte zu der Reichen:
- Springe du darüber.
Und die Reiche sagte zu der Armen:
- Springe du darüber.
Die Reiche sprang darüber und nahm eine Rose mit und dann sprang die Arme darüber und nahm ein Blatt mit, und damit man es nicht bemerke, ass sie dasselbe auf.
Sie gewann die Güter und sie und ihr Bruder schifften sich ein.
Er begann zu studieren, und sie gebar von dem Rosenblatt ein Mädchen und damit der Bruder es nicht merkte, hielt sie es bei einer Amme, und liess sich einen unterirdischen Gang bauen, der vom Hause der Amme zu ihrem eigenen führte.
Das Mädchen wurde gross und wusste nicht woher es war, und man sagte ihm, wenn Jemand darnach frage, solle es antworten:
Meine Mutter war Rose,
Rose bin ich auch,
Und ich hab Rosen gepflückt,
Vom selben Rosenstrauch.
Eines Tages fand sie der Bruder jenes Mädchens und frug sie, woher sie sei und sie antwortete:
Meine Mutter war Rose,
Rose bin ich auch,
Und ich hab Rosen gepflückt,
Vom selben Rosenstrauch.
Ihre Worte waren ihm unverständlich und eines Tages ging er vorüber und warf ihr ein Nadelbüchschen zu und das traf sie am Kopfe und steckte sich dort fest. Die Mutter zog ihr alle Nadeln heraus und als sie dachte, dass keine mehr im Kopfe sei, fing sie an zu kämmen, aber eine Nadel stiess sich ganz hinein, sie fiel in Ohnmacht und man dachte, dass sie tot sei und die Mutter liess ihr einen Sarg machen, verschloss ihn in einem Zimmer ihres Hauses und öffnete dasselbe nicht mehr.
Indessen kehrte der Bruder zurück, er fand die Schwester sehr traurig, und er fragte sie, was sie habe. Sie sagte, dass sie nichts hatte, erkrankte und starb. Vor ihrem Tode hatte sie ihm alle Schlüssel ihres Hauses gegeben und ihm gesagt, er könne alle Zimmer öffnen, nur das eine nicht.
Er öffnete es dennoch und fand darin jenes Mädchen lebend und er nahm es als Dienstmädchen an.
Eines Tages sollte der Bruder auf die Reise gehen und er fragte sein Dienstmädchen, welches man die kleine Sklavin nannte:
- Kleine Sklavin, was willst du?
- Sie sagte ihm, dass er ihr doch nicht das bringen würde, was sie sich wünschte.
- Ja, ich werde es dir bringen, sagte ihr Herr.
- Nun denn, ich wünsche einen blühenden Myrthenzweig, ein Messer mit zwei Schneiden und ein Herz von Stein.
Er ging auf die Reise, besorgte seine Geschäfte und dachte nicht an die kleine Sklavin.
Auf der Rückreise nach Hause, blieb das Schiff, das ihn führte, stehen und war auf keine Weise vorwärts zu bringen. Der Patron frug nach, ob nicht Jemand da sei, der irgend ein Versprechen gemacht habe.
Er sagte, dass er an die kleine Sklavin nicht gedacht habe, das Schiff kehrte zurück und er begann alles zu suchen, was er der kleinen Sklavin bringen sollte.
Als er zu Hause ankam, gab er ihr alles das, was er mitgebracht hatte.
Die kleine Sklavin klagte jeden Abend bevor sie schlafen ging:
O Herz steinernes
Warum tötest du mich nicht?
O blühender Myrthenzweig
Warum nimmst du mir nicht das Leben?
O Messer mit zwei Scheiden
Warum trägst du mir nicht meine Sorgen weg?
O Herr, wenn ihr wüsstet,
Von wem ich die Tochter bin.
Eines Abends hörte es der Diener und ging, es seinem Herrn zu erzählen.
Der Herr ging zuhören und als er es gehört hatte, klopfte er an die Türe, und wie sie das Klopfen hörte, löschte sie das Licht aus.
Er klopfte abermals und sie öffnete.
Der Herr fragte sie, was sie habe, dass sie also spreche.
- Sie sagte, dass sie nicht gesprochen habe, dass sie wahrscheinlich träumte.
Er bat sie und sie begann zu sprechen:
O Herz steinernes
Warum tötest du mich nicht?
O blühender Myrthenzweig
Warum nimmst du mir nicht das Leben?
O Messer mit zwei Schneiden
Warum trägst du mir nicht die Sorgen weg?
O Herr wenn ihr wüsstet
Von wem ich die Tochter bin.
Der Herr wurde ohnmächtig.
Als er wieder zu sich kam, liess er sich alles erzählen und die kleine Sklavin wurde nun die Herrin.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DAS NEGERCHEN AUS DER COMA
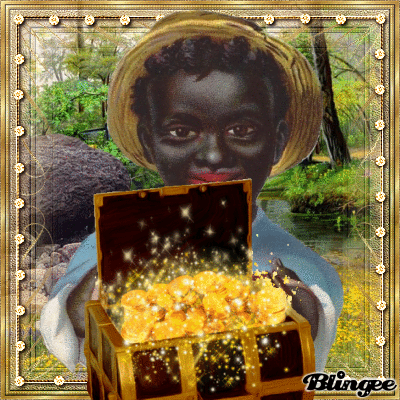
Ein Negerchen hütet einen Goldhaufen und nur am Ostersamstag beim Glorialäuten kommt er heraus. Um den Schatz zu gewinnen, muss man mit einer geweihten und mit dem neugesegneten Feuer angezündeten Kerze dahin gehen.
Um ihm den Schatz zu entreissen, muss man mit dem Munde und mit einem Kusse einen Ring von Gold, den es am Munde hat, wegnehmen.
Wenn man ihm den Ring nimmt, fällt es leblos hin und derjenige, der ihm den Ring genommen hat, trägt den Schatz weg.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER BLINDE MAURE
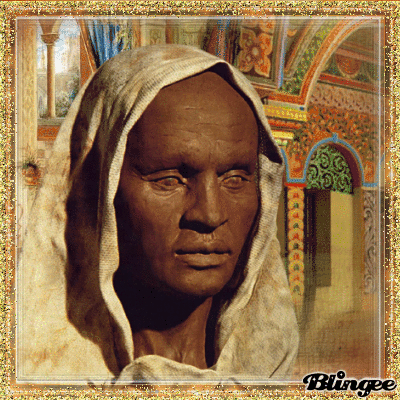
In Algier war ein Mallorquinischer Gefangener im Hause eines maurischen Herrn, der blind war und der ihn als Sklaven gekauft hatte.
Dieser Gefangene war bei seinem Herrn sehr beliebt, weil er ein sehr braver Junge war und alle Arbeiten sehr gut zu verrichten wusste.
Eines Tages sagte der Herr zu ihm:
- Wenn du machtest, was ich dir sagen würde und mich nicht betrügtest, würde ich dir die Freiheit und so viel Geld als du willst geben.
- Sagen sie was soll ich tun.
- Wenn ich dich nach Mallorca schicke, würdest du nicht mehr zurückkehren, weil es deine Heimat ist, aber ich versichere dich, wenn du zurückkehren möchtest, würdest du zufrieden mit mir sein.
- Sagen sie mir, was ich auf Mallorca tun soll und vertrauen sie auf mein Wort.
- Von welcher Ortschaft bist du?
- Von Valldemosa.
- Du musst den Puig de na Fátima kennen?
- Ja Herr und sehr genau, weil ich ihn durchwandert habe, um dort Gras zu mähen.
- Also gut. Ich werde dir sieben Paar Schuhe geben, mit diesen sieben Paar Schuhen wirst du nach Mallorca gehen.
Wenn du dort bist, wirst du an einem Montag ein Paar Schuhe anziehen und mit den angezogenen Schuhen auf den Puig de na Fátima steigen und den ganzen Tag dort spazieren gehen.
Am Abend wirst du die Schuhe ausziehen, ein Zeichen daran machen, dass es jene des Montags sind und sie aufbewahren, gut aufbewahren.
Anderen Tages Dienstag, wirst du ein anderes Paar Schuhe anziehen und mit den angezogenen anderen Schuhen wirst du auf den Puig de na Fátima zurückkehren und dort den ganzen Tag spazieren gehen. Am Abend wirst du ein Zeichen daran machen, damit man erkenne, dass es die Schuhe sind, die du den Dienstag getragen hast, und sie aufbewahren, gut aufbewahren.
Am Mittwoch wirst du ein anderes Paar Schuhe anziehen und wirst dasselbe machen; am Donnerstag das gleiche, ebenso Freitag und Samstag, endlich am Sonntag wirst du das siebente Paar anziehen, und an allen wirst du den Tag bezeichnen, an dem du sie getragen hast.
Sodann wirst du gleich hierher zurückkehren und mir die sieben Paar Schuhe gut eingewickelt bringen und sehr behutsam, damit keiner verloren gehe.
- Haben sie keine Angst, es wird alles so gemacht werden, wie sie sagen, sagte der Sklave.
- Gut sagte der Herr. Wenn du wieder zurückkehrst, ich versichere dich, du wirst es nicht bereuen, weil ich dir dann die Freiheit und so viel Geld, als du verlangst, geben werde.
Der Gefangene kam nach Mallorca, machte alles so wie sein Herr ihm gesagt hatte, kehrte dann wieder nach Algier zurück und brachte die gut zugerichteten Schuhe mit.
Als der Herr vernahm, dass er zurückgekehrt sei, war er sehr zufrieden, weil er sich schon gedacht hatte, dass er nicht zurückkehren würde, und sofort nahm er das Paar Schuhe vom Montag, brachte sie vor seine Augen und rieb sie .... und nichts.
Alsdann nahm er das Paar des Dienstags, brachte sie vor seine Augen .... und nichts.
Alsdann das Paar des Mittwochs, des Donnerstags, des Freitags, des Samstags, und alle brachte er vor seine Augen .... und nichts.
Alsdann nimmt er das siebente Paar, welches das vom Sonntag war, und brachte es vor seine Augen und sogleich war er von seiner Blindheit geheilt und konnte sehr gut sehen. Und das kam von der Heilkraft der Kräuter, auf welchen jene Schuhe getreten waren.
Der Herr warf sich an den Hals des Gefangenen und begann ihn zu küssen und er gab ihm die Freiheit und eine Anzahl Beutel mit Gold.
Der Gefangene kehrte nach Mallorca zurück, er blieb wohlhabend sein ganzes Leben und seine Nachkommen sind noch reich.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DAS MÖNCHLEIN

Es war, oder auch nicht, eine gute Reise mache der Stieglitz, für dich einen Anmut und für mich eine Barcella.
Es war ein Mönchlein, das auf einem Weg ging und ein Sauböhnelein fand. Weiterhin fand er ein Häuschen, dem er sich näherte und er sagte:
- Ave Maria Purisima. Wollt ihr mir dieses Sauböhnelein aufbewahren?
- Ja, leget es auf den Knetetrog.
Das Mönchlein legt das Böhnelein auf den Knetetrog und geht weg.
In jenem Hause hatten sie ein Hähnchen, das Hähnchen sprang herum, hüpfte auf den Knetetrog und frass das Sauböhnelein.
Am folgenden Tag kehrte das Mönchlein zurück.
- Ave Maria Purisima. Wollt ihr mir wiedergeben das Sauböhnelein?
- Oh Mönchlein! Das Hähnchen hat es gefressen.
- Also, sagte das Mönchlein, entweder will ich das Sauböhnelein oder das Hähnchen.
- Nehmet das Hähnchen, welches das Sauböhnelein gefressen hat.
Das Mönchlein trug das Hähnchen fort und ging weiter und immer weiter; da hörte es zur Messe läuten. Es ging in ein Häuschen und fragte:
- Ave Maria Purisima! Wollet ihr mir dies Hähnchen aufbewahren, damit ich in die Messe gehen kann?
- Ja, lasset es im Hofe.
In ihrem Hause war ein Schweinchen, das herumschnupperte, das Hähnchen fand und auffrass.
Am folgenden Tag kam das Mönchlein wieder.
- Ave Maria Purisima! Gebet mir das Hähnchen wieder.
- O Mönchlein! Wir haben ein Schweinchen und das hat das Hähnchen gefressen.
- Also entweder das Schweinchen oder das Hähnchen.
- Nehmet das Schweinchen, welches das Hähnchen gefressen hat.
Das Mönchlein trug das Schweinchen fort und ging weiter und immer weiter, da hörte es zu einer anderen Messe läuten. Es blieb bei einem Häuschen stehen und sagte:
- Ave Maria Purisima. Wollt ihr mir dieses Schweinchen aufbewahren, damit ich in diese Messe gehen kann?
- Ja, sperret es in die Strohkammer.
In jenem Hause hatten sie ein Maultierchen und das Maultier schlug aus und tötete das Schweinchen.
Am folgenden Tag kehrte das Mönchlein zurück.
Ave Maria Purisima. Wollt ihr mir das Schweinchen geben?
- Oh Mönchlein. Wir haben ein Maultierchen, das hat ausgeschlagen und es getötet.
- Also entweder das Schweinchen oder das Maultierchen?
- Nehmet das Maultierchen, welches das Schweinchen getötet hat.
Das Mönchlein führte das Maultierchen fort und ging mit ihm weiter und immer weiter. Da hörte es zu einer anderen Messe läuten. Es blieb bei einem Häuschen stehen und sagte:
- Ave Maria Purisima! Wollet ihr mir dieses Maultierchen aufbewahren, dass ich in die Messe gehen kann.
- Ja, lasset es in die Strohkammer.
In diesem Hause war ein Mädchen, das Catalineta hiess.
- Mutter, wollt ihr, dass ich das Maultierchen zur Tränke führe?
- Nein, es könnte dir entfliehen und wir müssten es bezahlen.
- Nein Mütterchen, es wird mir nicht entfliehen.
- Also gehe hin.
Catalineta ging, es zu tränken und das Maultierchen entfloh.
Am darauffolgenden Tage kehrte das Mönchlein zurück und sagte:
- Ave Maria Purisima! Wollet ihr mir das Maultierchen wieder geben?
- Oh Mönchlein! Die Catalineta hat es zur Tränke geführt und es ist ihr entflohen.
- Also das Maultierchen oder die Catalineta.
- Nehmet die Catalineta, welche das Maultierchen verloren hat.
Das Mönchlein steckte die Catalineta in den Hadernsack und geht weiter und immer weiter, da hörte es zu einer anderen Messe läuten.
Es blieb bei einem Häuschen stehen und sagte:
- Ave Maria Purisima! Wollet ihr mir diesen Hadernsack aufbewahren, damit ich in die Messe gehen kann?
- Ja, hängt ihn an jenen Wandkloben.
Das Mönchlein liess den Hadernsack und als es fortgegangen war, hörte die Hausfrau, dass die Catalineta im Hadernsack weinte, sie öffnete ihn und sah, dass es ein sehr schönes Mädchen war. Sie hatte keines und sagte zu ihr:
- Schau; verrate nichts, du kannst bei uns bleiben, wir wollen einen gebundenen, wütenden Hund, anstatt deiner, in den Hadernsack stecken.
Also machte es die Frau und am folgenden Tag kam das Mönchlein wieder.
- Ave Maria Purisima! Wollet ihr mir den Hadernsack geben?
- Ja nehmet ihn.
Das Mönchlein nahm den Hadernsack und als es weit vom Hause entfernt war, fing es an, mit sich zu sprechen.
- Aus einem Sauböhnelein ein Hähnchen, aus einem Hähnchen ein Schweinchen, aus einem Schweinchen ein Maultierchen, aus einem Maultierchen eine Catalineta.
- Catalineta komm heraus und gebe mir ein Küsschen.
Er öffnete den Hadernsack und es sprang ein Hund heraus, der ihm die Nase abfrass.
- Catalineta klagte er, welchen Ärger verursachst du mir! Jetzt habe ich kein Näschen mehr.
Das ist das Märchen des Mönchleins, es ist gesagt, esse es gebacken und wenn es dir nicht gefällt, werfe es auf das Dach.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DAS MÄUSCHEN
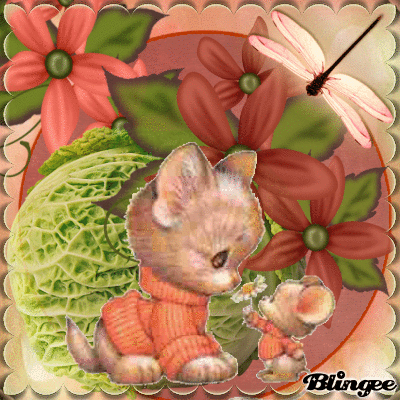
Es war ein Mäuschen, welches den Platz kehrte und darauf ein Geldstückchen fand und sagte:
Was soll ich damit machen, was soll ich damit machen?
- Kaufe ich Haselnüsschen? Nein, sonst müsste ich die Schälchen wegwerfen. Kaufe ich Nüsschen? Nein, ich müsste die Schälchen wegwerfen. Kaufe ich Mandelchen? Nein, ich müsste die Schälchen wegwerfen.
Ich werde mir einen Krautkopf kaufen und mir daraus ein Häuschen machen. Aus den Stengeln mache ich die Balken, aus den grösseren Blättern die Wände, aus den kleineren Blättern werde ich die Scheidewände, aus den feinsten Blättchen werde ich ein Bettchen und Leintüchlein machen.
Also begann es zu machen und wie das Häuschen fertig war, stellte es sich auf den Balkon. Inzwischen ging eine Lämmerherde vorbei.
- Mäuschen willst du mich heiraten? sagten viele.
- Wenn ihr gut singet.
- Bèèèè ...
- Gehet weiter, gehet weiter, das ganze Häuschen erzittert und mich erschreckt ihr.
Es kam eine Herde Truthühner vorbei.
- Mäuschen, willst du mich heiraten?
- Wenn ihr gut singet.
- Piöp, piöp, piöp ...
- Gehet vorüber, gehet vorüber, das ganze Häuschen erzittert und mich erschreckt ihr.
Es ging eine Hahnenherde vorbei.
- Mäuschen, willst du mich heiraten?
- Wenn ihr gut singet.
- Quet-que-requech, quet-que-re-quech -
- Gehet vorüber, gehet vorüber, das ganze Häuschen erzittert und mich erschreckt ihr.
Es ging eine Herde von grossen Katzen vorüber.
- Mäuschen, willst du mich heiraten?
- Wenn ihr gut singet.
- Miau, miau, miau ...
- Gehet vorüber, gehet vorüber, das ganze Häuschen erzittert und mich erschreckt ihr.
Es ging eine Herde kleiner Katzen vorbei.
- Mäuschen, willst du mich heiraten? fragte ein hinkendes Kätzchen.
- Wenn ihr gut singet.
- Mièu, mièu, mièu ...
- Tretet herein, tretet herein, damit ihr das ganze Häuschen erheitert und mich auch.
Es traten die kleinen Kätzchen herein und das Mäuschen heiratete das hinkende Kätzchen.
Das Abendessen der Hochzeit schadete ihm und in der Nacht machte das Mäuschen seine Bedürfnisse in das Bett.
Am Morgen nach dem Aufstehen ging es mit den Leintüchern zum Trog, um sie zu waschen, fand aber dort kein Wasser.
Es nahm das Leintüchlein und ging zu einem Wasserbehälter, um zu waschen, und fiel hinein.
Als das Kätzchen hinkam, sah es, dass es am Ertrinken war, und sagte zu ihm:
- Mäuschen, willst du, dass ich dich bei einem Oehrchen herausziehe?
- Nein, du würdest mir wehe tun.
- Mäuschen, willst du, dass ich dich bei einem Beinchen herausziehe?
- Nein, du würdest mir wehe tun.
- Mäuschen, willst du, dass ich dich bei einem Füsschen herausziehe?
- Nein, du würdest mir wehe tun.
Das Kätzchen nahm es beim Schwänzchen und zog es sorgsam heraus, ohne ihm wehe zu tun. Das Mäuschen stellte sich unter einen Mandelbaum, um sich zu trocknen. Es war die Zeit der reifen Mandeln und eine Mandel fiel auf das Mäuschen herab und spaltete ihm das Schnäuzchen.
Das Kätzchen ging zum Hause eines Schusters und fragte ihn:
- Schuster, willst du mir Wichs geben, um meinem Mäuschen das Schnäuzchen zusammenzukleben?
Dieser sagte:
- Wenn du mir Borsten gibst.
Das Kätzchen ging zu einem Schwein.
- Schwein, willst du mir Borsten geben? Borsten werde ich dem Schuster geben, der Schuster wird mir Wichs geben, um das Schnäuzchen meines Mäuschens zu heilen.
Dieses sagte:
- Wenn du mir Kleie gibst.
Es ging zu einem Bäcker.
- Bäcker, willst du mir Kleie geben? Kleie werde ich dem Schwein geben, das Schwein wird mir Borsten geben, die Borsten werde ich dem Schuster geben, der Schuster wird mir Wichs geben, um das Schnäuzchen meines Mäuschens zu heilen.
Dieser sagte:
- Wenn du mir Mehl gibst.
Es ging zu einem Müller.
Müller, willst du mir Mehl geben? Mehl werde ich dem Bäcker geben, der Bäcker wird mir Kleie geben, die Kleie werde ich dem Schwein geben, das Schwein wird mir Borsten geben, Borsten werde ich dem Schuster geben, der Schuster wird mir Wichs geben, um das Schnäuzchen meines Mäuschens zu heilen.
Dieser sagte:
- Wenn du mir Weizen gibst.
Es ging zu einem Feld.
- Feld, willst du mir Weizen geben? Weizen werde ich dem Müller geben, der Müller wird mir Mehl geben, Mehl werde ich dem Bäcker geben, der Bäcker wird mir Kleie geben, Kleie werde ich dem Schwein geben, das Schwein wird mir Borsten geben, Borsten werde ich dem Schuster geben, der Schuster wird mir Wachs geben, um das Schnäuzchen von meinem Mäuschen zu heilen.
Dieses sagte:
-- Wenn du mir Wasser gibst.
Es ging zu einem Brunnen.
- Brunnen, willst du mir Wasser geben? Wasser werde ich dem Feld geben, das Feld wird mir Weizen geben, Weizen werde ich dem Müller geben, der Müller wird mir Mehl geben, Mehl werde ich dem Bäcker geben, der Bäcker wird mir Kleie geben, Kleie werde ich dem Schwein geben, das Schwein wird mir Borsten geben, Borsten werde ich dem Schuster geben, der Schuster wird mir Wichs geben, um das Schnäuzchen meines Mäuschens zu heilen.
Dieser sagte:
- Wenn du mir einen Strick gibst.
Es ging zu einem Spartgrasflechter.
- Spartgrasflechter, willst du mir einen Strick geben? Den Strick werde ich dem Brunnen geben, der Brunnen wird mir Wasser geben, das Wasser werde ich dem Feld geben, das Feld wird mir Weizen geben, Weizen werde ich dem Müller geben, der Müller wird mir Mehl geben, das Mehl werde ich dem Bäcker geben, der Bäcker wird mir Kleie geben, die Kleie werde ich dem Schwein geben, das Schwein wird mir Borsten geben, die Borsten werde ich dem Schuster geben, der Schuster wird mir Wichs geben, um das Schnäuzchen meines Mäuschens zu heilen.
Dieser sagte:
- Ich will dir nichts davon geben.
Das Kätzchen kehrte zum Mäuschen zurück und leckte ihm das Schnäuzchen, um zu sehen, ob es heilen würde und wie es das Blut kostete, und merkte, dass es gut schmeckte, bekam es Lust und frass das Mäuschen.
Und daher kommt es, dass die Katzen die Mäuschen fressen.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DES BOCKES

Es war ein König, der wollte sich vermählen und man sagte ihm, dass ein gewecktes und witziges Mädchen vorhanden sei, das für ihn geeignet wäre.
Sobald der König dies erfuhr, ging er zum Hause dieses Mädchens und sagte zu demselben:
- Guten Morgen und was machtest du jetzt?
- Ich kochte Hinauf und Hinunter.
Der König, etwas überrascht über diese Antwort, frug es abermals:
- Und deine Mutter, wo ist sie?
- Sie macht das, was man an Eurer Majestät machte, als sie klein waren.
- Und dein Vater?
- Zieht Leute aus ihrem Hause heraus.
- Und dein Bruder?
- Mein Bruder ist auf der Jagd, tötet das Wild und bringt das lebende zurück.
Während der König verwundert noch dastand, kommt die Mutter an.
- Oh Herr König! So vornehme Besuche in meinem Hause. Sprechen sie, was wünschen sie von mir?
- Ich wünsche, ihr sagt mir, was das Hinauf und Hinunter ist, das eure Tochter kocht, woher ihr kommt und was ihr gemacht habt, und das man auch an mir machte, als ich klein war.
- Nun gilt es, nun gilt es, das muss ihnen meine Tochter gesagt haben. Die Hinauf und Hinunter sind die Kichererbsen, welche steigen und sinken, wenn sie kochen, ich komme von einer Taufe, zu der ich ein Kind getragen habe, denn ich bin Hebamme; mein Mann zieht Wurzeln aus der Erde, und mein Sohn, der eine Krankheit hatte, ist voll Läuse, und jetzt geht er hinter eine Wand und tötet alle, die er kann, und diejenigen, die er nicht töten kann, bringt er lebend wieder zurück.
- Das ist sehr gut, sagte der König, also du wirst mir morgen einen Korb voll Gelächter in meinen Palast senden.
- Werde damit dienen, antwortete sie.
Als der König fortgegangen war, kam der Vater an; die Mutter beklagte sich über die Kühnheit der Tochter, und er fragte diese: Wie willst du aber dem König morgen einen Korb voll Gelächter senden? Nun gilt es, nun gilt es.
- Habt keine Furcht, mein Vater, ihr nehmt die Netze, geht jagen und bringt mir alle Vögel, die ihr fangen könnt.
Ihr Vater ging auf die Jagd (alles wurde dort so gemacht, wie sie sagte) und kehrte Abends zurück, mit Sperlingen beladen. Sie band dem einen einen Fuss, rupfte dem anderen die Federn des Kopfes aus, schnitt einem den Schweif ab, dem anderen rupfte sie den Bauch, einem anderen den Rücken, und als sie einen Korb voll hatte, sagte sie zu ihrem Vater, er möge den Korb in den Palast bringen, um den Befehl des Königs zu erfüllen.
Der König liess ihn auf einen Tisch umwerfen, und ich glaube es schon, dass alles ein Gelächter war. Alsdann sagte er zu ihrem Vater:
- Sagt eurer Tochter, dass es sehr gut sei und dass dieses hier ein Dutzend Eier sind (und er gab sie ihm, zerquetscht, in einen Topf), dass sie sie von einer Henne ausbrüten lassen solle, und wenn die Küchlein ausgekrochen sind, dass sie mir dieselben bringen solle.
- Ei, ei, dachte der Vater, was wird meine Tochter jetzt machen? Sie aber, als sie das vernommen, verabschiedete sich fröhlich vom König.
- Mein Vater, nehmt diese Barcella (ein Maass Getreide) Gerste, geht und mahlt sie, und wenn sie gemahlen ist, bringt sie dem König und sagt ihm, er soll sie säen, und wenn es schnittreif sein wird, werden es die Hähnchen aufpicken. Also machte es ihr Vater und als der König es vernahm, antwortete er ihm, er soll zu seiner Tochter gehen und ihr mitteilen, er lasse ihr sagen, sie solle auf dem Wege und ausserhalb des Weges gehen, nicht angekleidet und nicht ausgezogen.
Der Vater, ganz verzweifelt, teilte der Tochter mit, was der König ihm gesagt hatte und sie nahm munter ein Fischernetz, bedeckte sich damit und setzte sich auf einen Bock. Der Bock begann zu laufen und bald ging er auf dem Wege, bald ausserhalb desselben.
Als der König merkte, dass er sie nicht fangen konnte, frug er sie, ob sie ihn heiraten wolle, aber mit der Bedingung, dass sie weder Ratschläge, noch Hilfsmittel geben dürfe, und wenn sie deren gäbe, müsste sie den Palast verlassen.
Es ist gut, sagte sie, aber ich mache auch die Bedingung, wenn ich weggehen muss, dass ich mitnehmen kann, was mir am meisten gefällt und was ich am liebsten habe.
Der König willigte ein und sie heirateten.
Bei der Hochzeit erschienen viele Ritter aus allen Ländern und als sie frühstückten, warf die Stute eines der Ritter ein Füllen und das Füllen stellte sich unter einen Hengst. Als das Frühstück beendet war, fanden die Ritter das Füllen und der Besitzer des Hengstes beanspruchte dasselbe als sein Eigentum und wollte es nicht dem Eigentümer der Stute zurückgeben, der, wie ihr wohl verstehen könnt, ein Recht darauf hatte und dieser ging, den Vorfall der Königin mitzuteilen.
- Sagt nichts, sagte ihm die Königin. Der König wird jetzt mit seinen Rittern spazieren gehen, geht zu dem Wege, auf dem sie zurückkommen müssen und lasst in der Mitte desselben ein so grosses Loch graben, dass sie dort fast nicht vorüber gehen können. Der König wird euch fragen, was ihr macht und ihr sollt ihm antworten, dass ihr Sardinen herauszieht, und wenn er euch weiter fragt, so antwortet ihm dies und das.
Der Ritter machte es so, wie die Königin es ihm gesagt hatte. Es geschah, dass der König ihn frug, was er mache und er antwortete ihm, dass er Sardinen herauszöge und dass der König ihm sagte:
- Wie ist es möglich, aus einem so trockenen Boden, Sardinen herauszuziehen.
- Es ist leichter möglich, aus einem trockenen Boden Sardinen herauszuziehen, antwortete ihm der Ritter, als dass ein Hengst ein Füllen werfe.
Das ist meine Frau, die euch diesen Rat gegeben hat. Ich gehe augenblicklich zu ihr und schicke sie fort, nach ihrem Hause.
Es ist sehr gut, was ich soeben höre, antwortete die Frau, aber ich bitte dich, lass mich noch zu Abend essen, bevor ich weggehe.
Der König willfahrte ihr und sie tat Mohn in sein Glas und gab es ihm zu trinken. Als er fest eingeschlafen war, steckte sie ihn in einen Sack, legte ihn auf einen Karren und brachte ihn zu ihrem Hause, wo sie ihn auf ein Strohlager, hoch oben auf dem Dachboden, legte.
Als der König am anderen Morgen erwachte und sich ganz von Spinnengeweben umgeben fand, wusste er nicht, was mit ihm vorgegangen war. Seine Frau, die vor ihm stand, sagte ihm, dass sie die Bedingung, die sie vor der Heirat gemacht, erfüllt habe, dass sie, indem sie nach Hause zurückgekehrt sei, auch ihn mitgenommen habe, weil er das sei, was sie am meisten liebe.
Der König erlaubte ihr nun, dass sie machen könne, was sie wünsche, dass sie so viele Ratschläge und Hilfsmittel geben dürfe, als sie wolle und ihr gut scheine und beide gingen mitsammen in den Palast zurück und wenn sie noch nicht tot sind, dann leben sie noch heute.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER FALISTRONCOS
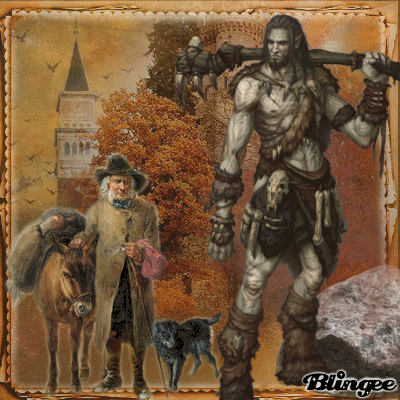
Es war ein Mann, der war sehr arm und er hatte einen Bruder, der sehr reich war. Eines Tages entschloss er sich, seinen Bruder aufzusuchen und seine Frau sagte zu ihm:
- Gehe nicht hin, so wie so, wird er dir nichts geben.
Er hörte nicht auf sie, reiste ab und es war sehr weit. Als er schon lange gegangen war, fand er einen alten Mann und fragte ihn, ob er ihn begleiten wolle. Jener Mann bejahte es. Als sie ein Stückchen weit waren sagte dieser ihm:
- Wenn er dir sagt, setze dich, dann setze dich nicht, wenn er dich fragt, ob du speisen willst, dann verneine es, wenn er dich fragt, was du willst, dann verlange den Ring, den er an seinem Finger hat. Er wird ihn dir geben, und es wird dir gut ergehen.
Also machte er es und wie er den Ring erhielt, ging er mit jenem wieder fort und er sagte zu demselben:
- Ringelchen, für die Bekehrung des heiligen Paulus, bringe uns zum Speisen. Sie speisten und der alte Mann verabschiedete sich dann von ihm.
Weiter gehend fand er einen Riesen. Der Riese sagte ihm, dass er ihn verspeisen wolle, er sagte ihm nein, und zu seinem Ringe:
- Ringelchen, für die Bekehrung des heiligen Paulus, bringe zu Essen und zu Trinken für den Riesen. Es erschien ein reich gedeckter Tisch und als der Riese dies sah, fragte er ihn:
- Willst du mir diesen Ring gegen diese Falistroncos vertauschen?
- Und welche Geschicklichkeit haben die Falistroncos?
- Wenn man ihnen sagt schlage, dann schlagen sie und wenn man ihnen sagt töte, dann töten sie.
- Ja, sagte er und vertauschte sogleich den Ring gegen die Falistroncos und sagte:
- Falistroncos tötet den Riesen.
Der Riese blieb tot und er hatte den Ring und die Falistroncos.
Darauf kam die Riesin heraus.
- Ringelein, sagte er, für die Bekehrung des heiligen Paulus, bringe Essen für die Riesin.
Als die Riesin das sah, sagte sie zu ihm:
- Willst du mir deinen Ring mit dieser Börse vertauschen?
- Und welche Geschicklichkeit hat diese Börse?
- Dass jedes Mal, wenn man sie öffnet, ein Geldstück herausfällt.
- Ja! und dann sagte er gleich:
- Falistroncos töte die Riesin.
Die Riesin blieb tot und er hatte die Falistroncos, den Ring und die Börse.
Darnach ging er in ein Gasthaus, übernachtete, da es schon Abend geworden war, und am folgenden Morgen ging er nach Hause und sagte seiner Frau:
- Wisse, dass ich reich zurückkomme.
Die Frau sagte darauf:
- Arm gingst du weg und arm wirst du zurückgekehrt sein.
- Cotre! sagte er, ich bringe eine Börse und so oft man sie öffnet, fällt ein Geldstück heraus.
Er öffnete sie und es fiel keins heraus.
- Siehst du, was ich dir sagte, bemerkte seine Frau.
- Also die Wirtin muss sie mir vertauscht haben. Er geht zum Gasthaus und verlangte von der Wirtin seine Börse und sie sagte, dass sie nichts davon wisse.
- Falistroncos, sagte er, schlagt die Wirtin bis sie die Börse herausgibt.
- Schlagt nicht, schlagt nicht, rief sie, ich werde sie schon herausgeben. Und sie gab sie ihm.
Er kehrte nach Hause zurück, öffnete die Börse und es fiel ein Geldstück heraus und so oft er öffnete, fiel ein anderes heraus.
Dann sagte er:
- Ringelchen für die Bekehrung des heiligen Paulus bringe zu Essen für die Frau und die Kinder.
Das Ringelchen brachte es ihnen, und als sie gegessen hatten, sagte er:
- Ringelchen für die Bekehrung des heiligen Paulus mache, dass ich morgen früh einen Palast habe, wie jener des Königs.
Der Palast erstand und als der König ihn sah, wollte er es nicht leiden, er ging zu seinem Hause und fand dort dessen Frau, welche einen Wasserkrug hinauf trug, und sagte zu ihr:
- Gebet ihn mir, ich werde ihn euch hinauftragen.
Sie sagte ihm nein, und er erwiderte ja und als sie sah, dass er darauf bestand, gab sie ihm den Krug und sagte zu dem Ring:
- Ringelchen für die Bekehrung des heiligen Paulus mache, dass er die Treppe hinauf- und hinabsteige, ohne sich aufhalten zu können mit dem Krug auf der Schulter.
Der König begann zu laufen die Treppe hinauf und hinunter, bis sie ihm sagte, es sei genug.
Der König wollte ihren Mann töten lassen und befahl seinen Dienern, ihn zu prügeln.
Da sagte dieser:
- Ringelchen für die Bekehrung des heiligen Paulus mache, dass statt meiner sie jenen Esel prügeln gehen.
Sie gingen, den Esel zu prügeln und liessen den Mann unbehelligt.
Eines anderen Tages ging die Königin zu ihrem Hause und fand sie wie sie ein Schwein schlachtete und Würste hackte und sagte zu ihr:
- Lasset es mich machen, ich werde sie hacken.
- Ringlein, sagte sie, für die Bekehrung des heiligen Paulus mache, dass in ihr Gesicht warmes Wasser spritze, und dass sie mit dem Hacken nicht aufhören könne, bis ich sage, es sei genug.
Als sie ihr sagte es sei genug, ging die Königin zum König, um es ihm zu erzählen, und der König sagte:
- Dieses Mal werden wir ihr den Mann töten.
Sie führten den Mann zu einem Baum, um ihn festzubinden und zu töten und dort war ein Esel, welcher weidete.
- Ringelchen, sagte er, für die Bekehrung des heiligen Paulus mache, dass sie jenen Esel töten gehen.
Sie gingen den Esel töten und als der König sah, dass er ihm nichts anhaben könne, liess er ihn gehen und er lebte im Reichthum sein ganzes Leben lang.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DAS MESSMERCHEN
Es war ein kleiner Knabe, der seinen Vater verlor und die Mutter sagte zu ihm:
- Mein Sohn, jetzt wirst du mir helfen müssen zu verdienen, weil wir arm sind. Ich werde zum Pfarrer gehen und sehen, ob er dich als Messmerchen nehmen will.
Also ging sie zu dem Pfarrer und der Pfarrer sagte ihr ja.
Das Messmerchen war sehr aufgeweckt und die anderen Messmer waren ihm neidisch. Sie verabredeten sich untereinander, um ihm einen Streich zu spielen. Der erste Messmer stellte einen ausgestopften Mann an den Strick, an dem die Abendglocke geläutet wurde und als die Stunde kam, sagte er dem Messmerchen, das Bernhardchen hiess:
- Bernhardchen, gehe und läute die Abendglocke.
Bernhardchen nahm den Schlüssel des Glockenturmes und ging ganz mutig hinein. Im Glockenturm fasste er den Strick und fand jenen Mann.
- Was machst du hier? frag er ihn und als er sah, dass er ihm keine Antwort gab, begann er die Abendglocke zu läuten.
Da jener Mann sich nicht bewegte, sagte er zu ihm:
- Mich hat man geschickt, um die Abendglocke zu läuten, aber wenn du dich bewegen willst, wollen wir beide sie läuten.
Als der erste Messmer und die anderen, welche gedacht hatten, dass Bernhardchen Furcht bekomme und die Abendglocke nicht läuten wolle, das Läuten hörten, waren sie sehr gefoppt und beschlossen, etwas Schwereres ihm anzurichten, um ihn in Furcht zu versetzen, damit er nicht mehr Messmer bleiben sollte, weil sie auf ihn sehr neidisch waren, da der Pfarrer ihn, weil er lebhaft war, sehr liebte.
Am anderen Abend nahmen sie den Strick von der Glocke weg und sagten ihm, er solle gehen und die Abendglocke hoch vom Glockenturm aus läuten.
Bernhardchen ging und als er ein Paar Stufen erstiegen hatte, fand er einen Mann.
- Was machst du hier? fragte er ihn.
Als der Mann ihm nicht antwortete, gab er ihm sogleich eine Ohrfeige und warf ihn hinunter.
Der Mann war ausgestopft und rollte die Treppe des Glockenturms herab.
Höher hinauf fand er einen anderen Mann und machte mit ihm dasselbe. Er stieg vollends hinauf und fand im Ganzen sechs Männer.
Er warf sie alle hinunter und begann die Abendglocke zu läuten.
Als der erste Messmer und die anderen, welche ihm den Schrecken einjagen wollten, hörten, dass die Abendglocke läutete, sahen sie ein, dass sie nichts erreicht hatten und sie beschlossen, ihm einen noch schwereren Streich zu spielen.
Sie schickten ihn mit einer Ausrede zur Höhle von Son Sabaté, wo Geister erschienen und er tat, was sie ihm befohlen hatten, betrat dort die Höhle und fand Niemanden.
Er kehrte zum Dorfe zurück und als der Messmer sah, dass er so aufgeweckt war, gewann er ihn nach und nach lieb und er wurde später das beste Messmerchen der Kirche.
[Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca]
DAS KETTCHEN
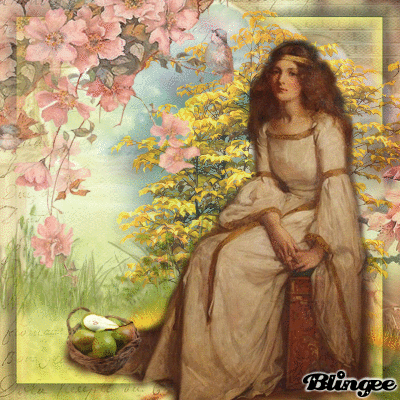
Es war ein Vater, der hatte drei Söhne, einer hiess Anton, einer Johann und ein anderer Bernhard.
Er fühlte sich krank, die drei Söhne waren schon erwachsen und er sagte zu ihnen:
- Ich sehe, dass meine Tage zu Ende gehen und ich wünschte, dass ich euch viel hinterlassen könnte, aber da ich nur wenig habe, so werde ich euch alles geben, was ich besitze und wenn ihr es wisset auszunützen, wird es euch viel sein. Wenn ich tot und begraben bin, werdet ihr alle drei zusammen auf jenem Weg spazieren gehen und nachdem ihr weit gegangen seid, werdet ihr eine Höhle finden. Der erstgeborene wird zuerst hinein gehen, dann der zweite und dann der jüngste. Wenn ihr weit hinein gegangen seid, werdet ihr einen Türflügel finden und ihr sollt sagen:
- Türflügel öffne dich, Türflügel schliesse dich.
Es wird sich ein Loch öffnen, ihr werdet die Hand hinein strecken und herausziehen, was ihr findet.
Der Vater starb nach einigen Tagen, sie besorgten die Leiche und als er begraben war, gingen die drei Söhne um das zu tun, was der Vater ihnen gesagt hatte. Sie fanden die Höhle, gingen hinein und fanden den Türflügel. Der älteste Sohn, als es Zeit war, zu sagen: Türflügel öffne dich - Türflügel schliesse dich, bekam Furcht und wollte sich nicht nähern.
Der zweite Sohn sagte:
- Ich werde kühner sein, wie du.
Er ging zum Türflügel, als er aber gesagt hatte:
Türflügel öffne dich, bekam er viel Furcht und kehrte schnell zurück.
Bernhardchen, welches der jüngste war, ging hin und machte alles so, wie der Vater es gesagt hatte, er streckte die Hand in das Loch und zog eine Börse heraus.
- Was hast du herausgezogen? fragten ihn die anderen zwei Brüder.
- Er sagte: eine Börse.
Für eine Börse hätte ich sie schon entbehren können, antwortete der eine.
Er sagte: aber sie ist mit Geld gefüllt. Wollt ihr, dass wir es zählen?
Sie zählten es und wenn sie noch so viel zählten, so war immer mehr Geld darin.
Bernhardchen sagte ihnen:
- Ärgert euch nicht, das ist die Börse, die man nie erschöpft. Wir wollen das Geld unter uns teilen.
Aber der zweite antwortete:
- Ich will sehen, was mein Loos sein wird.
Er kehrte zum Türflügel zurück indem er sagte: Türflügel öffne dich, Türflügel schliesse dich, streckte die Hand hinein und brachte eine Kette von vier Spannen heraus.
- Ich will auch hineingreifen, sagte nun der Älteste, will auch mein Loos sehen. Er ging hin und sagte: Türflügel öffne dich, Türflügel schliesse dich und brachte ein Horn heraus.
Die beiden älteren Brüder wurden zornig, als sie das betrachteten, was sie heraus gezogen hatten, weil sie meinten, dass es ihnen zu nichts dienen könnte. Der zweite warf seine Kette in ein Loch, aber gleich fand er sich selber bei der Kette und sagte:
- Kette bringe mich zurück, wo ich war!
Und die Kette brachte ihn dahin zurück.
Der Älteste begann auf dem Horn zu blasen und als er blies kamen viele Soldaten aus demselben.
- Kehret wieder in das Horn zurück, sagte er ihnen und alle Soldaten versteckten sich wieder in dem Horn.
Als der Jüngste das sah, sagte er zu ihnen:
- Nun, ihr könnt auch zufrieden sein mit dem, was ihr erhalten habt. Ich werde auch jedem einige Münzen geben, wir wollen uns bei diesen drei Wegen trennen, ein jeder wird einen anderen Weg einschlagen und nach einem Jahr wollen wir wieder zusammentreffen und sehen wie es uns ergangen ist.
Sie nahmen Abschied und trennten sich und Bernhardchen kam zu einer Ortschaft und verliebte sich in die Tochter eines Grafen; aber die Tochter des Grafen wollte ihn nicht. Er wusste nicht was er beginnen sollte, damit sie ihn möchte und eines Nachmittags ging er spazieren und dachte immer und immer an das Mädchen. Er fing an, Birnen zu essen und er bemerkte, dass für jede Birne, die er gegessen hatte, an seinem Kopf ein grosser Dorn heraus kam. Ganz verdriesslich weitergehend, findet er einen Feigenbaum und begann Feigen zu essen und für jede Feige, die er ass, fiel ihm ein Dorn ab.
- Gut geht es, sagte er, das muss mir dazu dienen, dass die Tochter des Grafen mich will.
Er fand einen Hirten; fragte ihn, ob er ihm sein Kleid umtauschen wollte, und, das glaube ich gern, der Hirte sagte ihm gleich ja, besonders weil das Seinige, welches er trug, schon sehr alt war. Als er wie ein Hirte angezogen war, suchte er einen Korb, füllte ihn mit Birnen, ging vor dem Hause des Grafen auf und ab, indem er schrie:
- Wer will Birnen kaufen?
Die Tochter des Grafen, welche sehr naschhaft war, rief ihn gleich herbei, kaufte ihm Birnen ab und fing an, dieselben zu essen. Das glaube ich schon! Gleich hatte sie den Kopf voll Dornen. Als sie sich im Spiegel beschaute und das sah, erschrak sie dermassen, dass sie fast starb und von den vielen Ärzten, die sie zu sich rufen liess, wusste ihr keiner die Dornen zu entfernen, weil sie sehr stark und sehr trocken waren.
Bernhardchen verkleidete sich als Arzt, ging zum Hause des Grafen und sagte ihm, dass er im Stande sei, die Dornen vom Kopfe seiner Tochter wegzubringen. Der Graf erwiderte ihm, dass, wenn er das möglich machen könne, dürfe er sich mit ihr vermählen. Er liess sie Pillen von jenen Feigen nehmen und alle Dornen fielen ab.
Als sie genesen war, sagte ihr Bernhardchen, dass er derjenige sei, den sie nicht wollte, dass es keine andere Hilfe für sie gäbe, als sich mit ihm zu vermählen. Ihr gefiel er schon, aber der Graf wünschte, dass sie sich mit einem sehr reichen und sehr mächtigen Mann vermählen solle.
- Reich? sagte er, ich habe eine Börse, in der nie das Geld ausgeht und er zog seine Börse heraus und fing an, Geld herauszunehmen und hörte damit nie auf.
- Ja, sagte der Graf, ich sehe, dass ihr ein reicher Mann seid, aber ich wünschte, dass ihr auch viele Macht und viele Truppen hättet.
- Ich habe alles, was ich will, nur wartet bis Morgen und ich werde euch meine ganze Macht zeigen, sagte Bernhardchen.
An jenem Tage war es ein Jahr, dass er sich von seinen Brüdern verabschiedet hatte, am Nachmittag ging er auf jenen Weg und traf sie beide.
Er sagte ihnen: Ihr müsst mir das Horn und die Kette borgen, ich werde beides euch wieder zurückgeben.
Die Brüder gaben es ihm und er kehrte zum Hause des Grafen zurück.
- Graf, fragte er ihn, wohin wollen sie jetzt reisen?
Er sagte: Nach China.
- Kette, sagte er, bringe uns nach China.
Sofort befanden sie sich in China.
- Kette, bringe uns nach Hause zurück.
In einem »Sanctus amen« waren sie wieder zu Hause.
- Graf, tretet mit eurer Tochter auf den Balkon.
Der Graf und seine Tochter gingen auf den Balkon hinaus und sahen den ganzen Hof voll Soldaten aller Art.
- Mein Vater, sagte die Tochter, verlange nichts mehr, weil dieser Mann der meinige ist, ich will keinen anderen mehr.
Bernhardchen gab seine Hand der Tochter des Grafen, in einigen Tagen heirateten sie und lebten zufrieden, bis sie starben.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
ALARCOS
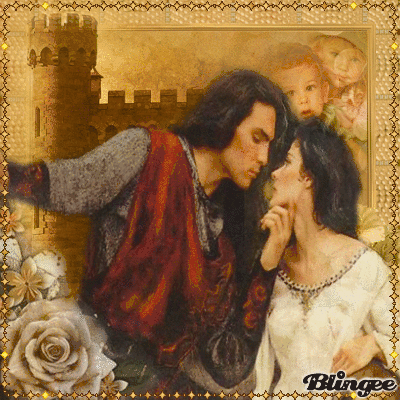
Die Infantin hielt sich abseits, wie sie die Gewohnheit hatte zu tun, sie war betrübt über das Leben, das sie führte, denn sie sah, wie die Blüte ihrer Tage verging, ohne daß der König sie verheiratete, ja, ohne daß er daran zu denken schien. Sie bedachte sich, wem sie sich anvertrauen sollte und kam zu dem Entschluß, nach ihrer früheren Gewohnheit ihren Vater zu rufen, um ihm ihr Geheimnis zu enthüllen und ihren Wunsch anzuvertrauen. Der König ward gerufen und kam sogleich. Er fand seine Tochter abseits von ihrem Gefolge. Ihr schönes Antlitz zeigte, daß sie noch trauriger war als gewöhnlich. Der König bemerkte auf der Stelle den Schmerz, den seine Tochter trug.
»Was ist dir, Infantin, was fehlt dir, meine Tochter? Sage mir deinen Kummer und laß von deiner Schmermut: laß mich die Wahrheit wissen, man wird ein Heilmittel für alles finden.« »Man müßte, guter König, ein Heilmittel bringen für mein Leben, das euch von meiner Mutter anempfohlen ward. Gebt mir, guter König, einen Gatten; mein Alter verlangt es. Mit Scham viel eher als mit Freude bitte ich euch darum, denn solche Sorgen, König, stehen euch zu!«
Als der König diese Worte gehört hatte, antwortete er ihr: »Es ist dein Fehler und nicht der meine, Infantin, wenn du nicht mit dem Prinzen von Ungarn vermählt bist. Du hast den Gesandten nicht anhören wollen, den er dir geschickt hatte. Und hier, an meinem Hofe, liebe Tochter, haben wir wenig Hilfskräfte. In meinem ganzen Reiche dürfte sich nur einer als Gatte für dich ziemen, das wäre der Graf Alarcos, aber der hat Frau und Kinder.«
»König, ladet eines Tages den Grafen Alarcos ein, und wenn ihr gespeist habt, so sagt ihm meinen Auftrag, sagt ihm, er möge sich des Wortes erinnern, das er mir gab, des Eides, den er mir schwur, ohne daß ich ihn verlangt hätte, daß er mein Gatte und ich sein Weib werden sollte. Ich war mit diesem Versprechen zufrieden und bereute es nicht. Er hat die Gräfin geheiratet, ohne zu bedenken, was aus mir würde, aus mir, die ich um seinetwillen die Hand des Prinzen von Ungarn ausschlug. Er hat die Gräfin geheiratet, das war sein Fehler, nicht der meine.«
Als der König dieses hörte, verlor er die Besinnung; dann, nachdem er wieder zu sich gekommen war, sprach er voll Zorn: »Das sind nicht die Ratschläge, die deine Mutter dir gab! Infantin, du hast auf meine Ehre wenig Rücksicht genommen! Wenn all das wahr ist, so ist deine Ehre verloren, du kannst dich nicht verheiraten, solange die Gräfin lebt. Heiratest du aber, so wirst du mit Recht für ein schlechtes Frauenzimmer gehalten werden. Gib mir einen Rat, liebe Tochter, ich weiß nicht, was ich tun soll, denn deine Mutter ist tot, die ich sonst um Rat zu fragen pflegte.«
»Ich will euch einen Rat geben, guter König, mit dem geringen Witz, den ich habe: der Graf soll die Gräfin töten, ohne daß es jemand erfährt, er soll das Gerücht verbreiten, sie sei an einer Krankheit gestorben, an der sie litt, und dann soll meine Hochzeit stattfinden, ohne daß jemand etwas argwöhnt. Auf diese Weise, guter König, wird meine Ehre gerettet werden.« - Der König ging trauervoll von dannen: er war schmerzlich bewegt über das, was er gehört hatte.
Er gewahrte den Grafen Alarcos, welcher inmitten einer Schar von Edelleuten stand und sprach: »Was hilft es, ihr Ritter, zu lieben und einer Freundin zu dienen? Die Dienste sind verloren, wo keine Beständigkeit dabei ist. Auf mich kann man das nicht anwenden, was ich eben gesagt habe, denn vor Zeiten habe ich einer Frau gedient und sie sehr geliebt, und wenn ich sie damals innig liebte, so liebe ich sie jetzt noch mehr. Was mich betrifft, so kann man sagen: Alte Liebe rostet nicht.« Während er diese Worte sprach, bemerkte er, daß der König kam. Mit dem König redend entfernte er sich von den Edelherrn.
Der gute König sprach mit höflichen Worten zum Grafen: »Ich möchte euch für morgen einladen, Graf; ich wünsche, daß ihr bei mir speist und mir Gesellschaft leistet.« »Ich tue gern, was eure Hoheit gebietet. Ich küsse eure königlichen Hände für die Gnade, die ihr mir erweist. Ich werde morgen hier bleiben, obwohl ich abreisen müßte, denn die Gräfin erwartet mich, wie sie mir schreibt.« -
Am folgenden Tage nach der Messe setzte sich der König zur Tafel, nicht daß er dazu Verlangen gehabt hätte, sondern um dem Grafen zu sagen, was er ihm mitteilen mußte. Sie wurden gut bedient, wie es sich für einen König ziemte. Nachdem sie gegessen hatten und die Leute hinausgegangen waren, blieb der König mit dem Grafen an der Tafel, wo er gespeist hatte. Der König begann die Botschaft auszurichten, mit der er beauftragt war:
»Ich habe Dinge erfahren, Graf, die mich beunruhigen und derenwegen ich mich über eure Untreue beklagen muß. Ihr habt der Infantin versprochen, ohne daß sie euch darum bat, ihr wolltet ihr Gatte werden, und sie war damit zufrieden. Wenn es anders gekommen ist, so darf ich nichts davon wissen. Was ich euch weiter zu sagen habe, Graf, wird euch viel Schmerz verursachen. Ihr müßt die Gräfin töten: das verlangt meine Ehre. Ihr werdet das Gerücht verbreiten, sie sei an einer Krankheit gestorben, an der sie litt, und dann wird die Hochzeit stattfinden, ohne daß man etwas argwöhnt. Auf diese Weise wird meine Tochter, die ich liebe, nicht entehrt sein.«
Als der gute Graf diese Worte gehört hatte, erwiderte er: »Ich kann nicht ableugnen, König, was die Infantin gesagt hat. Ich erkenne die Berechtigung dessen, was sie verlangt, an. Aus Scheu vor euch heiratete ich nicht die, welche ich hätte heiraten müssen, ich dachte nicht, daß eure Hoheit es erlauben würde. Ich würde die Infantin gern heiraten, aber was die Tötung der Gräfin betrifft, Herr König, so kann ich das nicht tun. Wer es nicht verdient, darf nicht sterben.«
»Sie muß sterben, guter Graf, um meine Ehre zu retten, da ihr von Anfang an nicht bedacht habt, was ihr hättet bedenken müssen. Wenn die Gräfin nicht stirbt, so kostet es euch das Leben. Um der Ehre des Königs willen sterben viel Unschuldige, so soll auch die Gräfin sterben, da ist nicht viel dabei.«
»Ich werde sie töten, guter König, aber gegen meinen Willen. Ihr werdet Gott Rechenschaft dafür ablegen am Ende eurer Tage. Ich verspreche eurer Hoheit auf meine Ehre, daß man mich für einen Verräter erachten soll, wenn ich meinen Eid, die Gräfin zu töten, nicht halte, obwohl sie es nicht verdient. Guter König, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, so werde ich sogleich abreisen.«
»Geht mit Gott, guter Graf, rüstet alles zu eurer Abreise.« Weinend entfernte sich der Graf, weinend wegen der Gräfin, die er mehr liebte als sich selbst. Auch wegen der drei Kinder, die er hatte, weinte der Graf; das eine lag noch an der Brust, die Gräfin nährte es. Es wollte nicht die Brust der drei Ammen nehmen, die es hatte, es wollte nur die Milch seiner Mutter, denn es kannte sie gut. Die anderen waren noch klein und hatten wenig Verstand.
Vor der Ankunft sprach der Graf zu sich selbst: »Wer könnte aus eurem freudestrahlenden Antlitz schließen, Gräfin, wenn ihr kommen werdet, mich zu empfangen, daß ihr am Ende eures Lebens steht? Ich bin der Schuldige, der Fehl liegt einzig bei mir.« Während er diese Worte sprach, erschien die Gräfin: ein Page hatte ihr gesagt, daß ihr Mann ankäme. Sie bemerkte die Trauer des Grafen, sie sah seine feuchten Augen, welche geschwollen waren von den Tränen, die er auf dem Weg vergossen hatte bei dem Gedanken an das Gut, das er verlor.
»Seid willkommen, Glück meines Lebens! Was fehlt euch, Graf Alarcos? Warum weint ihr, mein Leben? Ihr seid so verändert, daß man euch kaum wiedererkennt. Ihr habt nicht euer Antlitz und euren gewöhnlichen Gesichtsausdruck, teilt mir euren Kummer mit, wie ihr mir an eurer Freude Anteil gewährtet. Was habt ihr Graf? Ihr tötet mich!«
»Ich werde es euch sagen, Gräfin, wenn die Stunde gekommen ist.« »Wenn ihr es mir nicht sagt, Graf, so werde ich gewiß nicht mehr leben!«
»Drängt mich nicht, Herrin, der Augenblick ist noch nicht gekommen. Speisen wir sogleich, Gräfin, von dem, was es im Hause gibt!«
»Ich habe euer Mahl bereitet, wie ich es alle Tage zu tun pflege.«
Der Graf setzte sich zu Tisch, er aß nichts und konnte nichts essen in Gegenwart seiner Kinder, die er sehr liebte. Er senkte den Kopf auf die Brust und tat, als ob er schliefe. Mit den Tränen seiner Augen netzte er die Tafel. Die Gräfin betrachtete ihn, ohne die Ursache seines Schmerzes zu kennen und verstand es nicht und vermochte es nicht, ihn darum zu fragen. Der Graf erhob sich alsbald und sagte, er wolle schlafen; auch die Gräfin sprach, sie möchte schlafen gehen, aber, um die Wahrheit zu sagen, sie verlangte nicht nach Schlaf.
Der Graf und die Gräfin gingen in das Gemach, wo sie zu schlafen pflegten; sie ließen die Kinder draußen. Der Graf wollte ihnen den Eintritt nicht gestatten. Nur das kleinste, das die Gräfin nährte, nahmen sie mit. Der Graf versperrte die Tür, was er sonst nicht tat; dann begann er mit brennendem Schmerz zu reden: »O unglückliche Gräfin, groß war dein Mißgeschick!«
»Ich bin nicht unglücklich, Graf, ich halte mich für glücklich, da ich eure Frau geworden bin. Das war für mich eine große Freude.«
»Wißt, Gräfin, daß es euer Unglück war! Wißt, daß ich ehemals eine Frau liebte, die ich nicht lieben durfte, und das war die Infantin. Zu eurem und meinem Unheil versprach ich, sie zu heiraten und sie war einverstanden. Jetzt verlangt sie mich bei dem Wort, das ich ihr gegeben habe, zum Gatten. Sie kann es mit Recht tun. Das ist es, was mir der König, ihr Vater, gesagt hat, welcher alles von ihr erfahren hat. Der König befiehlt noch etwas anderes, was mich in der Seele verwundet: er befiehlt, daß ihr sterben sollt, Gräfin, daß man euch das Leben nehme, weil er seine Ehre nicht wiedererlangen kann, solange ihr lebt.«
Wie die Gräfin dies hörte, fiel sie wie tot zu Boden. Als sie wieder zu sich gekommen war, sprach sie diese Worte: »Das ist der Lohn, Graf, für die Dienste, die ich euch geleistet habe! Tötet mich nicht, Graf, ich gebe euch einen guten Rat! Schickt mich in meine Heimat und mein Vater wird mich aufnehmen; ich werde eure Kinder besser erziehen als jene, die kommen wird, und ich werde euch meine Keuschheit bewahren, wie ich sie stets bewahrt habe.«
»Ehe der Tag anbricht, müßt ihr sterben, Gräfin!«
»Man merkt wohl, Graf Alarcos, daß ich allein in der Welt stehe, daß mein Vater alt und meine Mutter tot ist, daß man meinen Bruder, den guten Grafen Don Garcia erschlagen hat: der König ließ ihn ermorden, weil er ihn fürchtete. Nicht der Tod erschreckt mich, denn einmal muß jeder sterben; aber ich bin betrübt beim Gedanken an meine Kinder, welche meiner Pflege verlustig gehen sollen. Laßt sie kommen, Graf, auf daß sie meinen letzten Segen erhalten.«
»Ihr werdet sie niemals wiedersehen, Gräfin. Umarmt diesen Säugling, denn er verliert am meisten. Ich leide für euch, Gräfin, so viel ich nur leiden kann. Ich kann euch nicht schützen, Gräfin, denn es handelt sich um mehr als das Leben. Empfehlt euch Gott: es muß sein!«
»Laßt mich ein Gebet sagen, Graf, das ich weiß.«
»Sagt es schnell, Herrin, ehe der Tag anbricht.«
»Ich werde es sogleich gesagt haben, Graf, es ist nicht länger als ein Ave Maria.« Sie kniete auf den Boden nieder und sprach dies Gebet: »In deine Hände, Herr, empfehle ich meine Seele. Richte nicht über meine Sünden, wie ich es verdiene, sondern nach deiner großen Güte und deiner unendlichen Gnade! Es ist vollbracht, guter Graf, das Gebet, das ich weiß. Ich empfehle euch diese Kinder an, die ich von euch gehabt habe. Bittet Gott für mich während eures ganzen Lebens: ihr seid dazu verpflichtet, denn ich sterbe unschuldig. Laßt mich mein kleines Kind ein letztes Mal säugen!«
»Weckt es nicht, Gräfin, laßt es, es schläft! Ich bitte euch, daß ihr mir verzeiht, denn seht, der Tag bricht an.«
»Ich verzeihe euch, Graf, bei der Liebe, die ich zu euch trug. Aber dem König und der Infantin, seiner Tochter, verzeihe ich nicht. Ich rufe sie vor den höchsten Richter, daß sie innerhalb dreißig Tage vor dessen Richterstuhl zu erscheinen haben.«
Sie sagte diese Worte und der Graf rüstete sich: er umschlang ihr den Hals mit einem Kopfputz, den sie trug, er schnürte ihn mit seinen beiden Händen so stark er konnte zusammen, er ließ die Kehle nicht los, solange Leben in ihr war. Als der Graf sah, daß seine Gattin tot und leblos war, zog er ihr die Kleider aus, mit denen sie angetan war, legte sie aufs Bett und bedeckte sie, wie sie es gewöhnlich war. Er entkleidete sich an ihrer Seite in so kurzer Zeit wie man braucht, um ein Ave zu sagen, dann erhob er sich und rief die Leute, die ihm dienten:
»Zu Hilfe, meine Knappen, die Gräfin stirbt!«
Als sie eintraten, fanden sie die Gräfin ohne Leben. So starb sie ohne Schuld und ohne Gericht; aber auch die anderen starben innerhalb dreißig Tagen: nach zwölf Tagen die Infantin, der König nach fünfundzwanzig und nach dreißig Tagen der Graf selbst. Sie traten vor den göttlichen Richterstuhl, um Rechenschaft abzulegen. Gott gebe uns hienieden seine Gnade und dort droben die ewige Seligkeit.
Spanien; Ernst Tegethoff: Märchen, Schwänke und Fabeln
BLANCAFLOR, ODER DIE TOCHTER DES TEUFELS
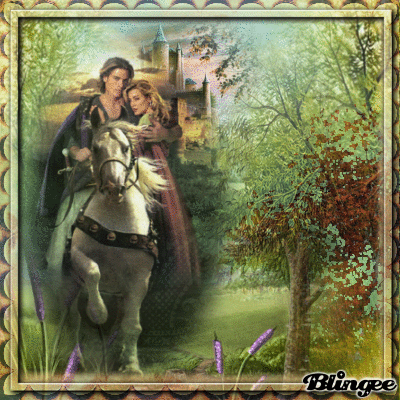
Es waren einmal ein König und eine Königin, die nach ihrer Heirat lange ohne Nachkommenschaft blieben. Die Königin ging jeden Tag hin und her und bat Gott, ihr doch einen Sohn zu schenken, bis sie sich nach zwanzig Jahren dann schließlich an den Teufel wandte.
Der König ging alle Tage zur Jagd in den Wald, aber so viele Tiere ganz allein zu jagen, machte ihm keinen Spaß. Also sagte er zu seiner Frau: "Den ersten Sohn, den wir bekommen, verspreche ich dem Teufel."
Endlich schenkte ihnen Gott einen so schönen Sohn, wie es keinen zweiten auf der Welt gab. Er war auch so stark, dass er schon mit drei Jahren mehr Tiere auf der Jagd erlegte als sein Vater.
Er war aber auch ein großer Spieler und gewann gegen alle Welt. Eines Tages begegnete er einem Reiter, das war der Teufel. Der schlug ihm vor, mit ihm zu spielen, und der Teufel ließ ihn alles Geld gewinnen. Sie trafen sich wieder am folgenden Tag, und diesmal gewann der Teufel und zwar alles Geld, das der Königssohn besaß.
Darauf fragte er ihn, ob er vielleicht nun seine Seele einsetzen wolle, und der Königssohn stimmte zu. Sie spielten, und der Teufel gewann die Seele.
Der Teufel sprach zu dem Jungen, wenn er seine Seele wiederhaben wolle, so möge er auf sein Schloss kommen und dort drei Arbeiten verrichten, die er ihm auftragen werde. Zu dieser Zeit war der Königssohn zwanzig Jahre alt, und er sagte zu seinem Vater:
"Vater, gib mir ein Pferd und etwas Mundvorrat. Ich will ausreiten."
Der Vater gab ihm das beste Pferd, das er im Stall hatte. Die Mutter bereitete ihm etwas zu essen, hörte aber nicht auf zu weinen. Und als der Sohn sie fragte, warum sie denn ständig weine, erzählte sie ihm, dass sie einst Gott um einen Sohn gebeten habe, der aber habe ihren Wunsch nicht erfüllt, da habe sie sich schließlich an den Teufel gewandt, deshalb habe dieser nun Gewalt über ihn. Der Sohn sagte ihr, sie solle sich keine Sorgen machen und ritt fort.
Unterwegs begegnete er einer armen alten Frau, die bat ihn um ein Stückchen Brot. Der Junge gab ihr alles, was er bei sich trug. Da fragte sie ihn: "Wohin gehst du?"
"Ich gehe zum Schloss des Teufels."
"Dann gute Verrichtung", sprach die Alte. "Ich will dir etwas sagen: Nahe dem Schloss kommst du an einen Fluss. Dort baden jeden Tag drei Tauben. Das sind die Töchter des Teufels. Wenn du den Fluss erreichst, werden sie gerade wieder baden. Nimm die Kleider der Kleinsten fort. Sie heißt Blancaflor. Gib sie ihr nicht wieder, ehe sie nicht dreimal darum gebeten und dir Hilfe bei allem, was du brauchst, versprochen hat."
"Und wie komme ich an diesen Fluss?", fragte der Prinz.
"Im nächsten Dorf lebt die Herrin der Vögel. Sie ist die Schwester der Sonne und des Mondes. Frage sie nach dem Weg."
Der Prinz ging weiter und kam schließlich an das Haus der Vögel. Er klopfte an die Tür, da kam eine Hexe heraus, die sprach: "Wer hat dich denn hierher geschickt?"
"Ich suche das Schloss des Teufels und bin zu Euch gekommen, damit Ihr mir sagt, wo es liegt."
"Ha, das weiß ich auch nicht. Aber einer meiner Vögel, die in allen Teilen der Welt herumkommen, wird es wohl wissen. Heute Abend, nachdem die Sonne untergegangen ist, kommen sie, und wir werden sie fragen. Aber verkriech dich dort in die Ecke, damit dich nicht mein Bruder, der Sonnenball, mit seinen Strahlen versengt, und auch meine Schwester, die Mondfrau, dich nicht entdeckt."
Da kam der Sonnenball und schrie: "Ich rieche Menschenfleisch! Und wenn du mir den Menschen nicht gibst, werde ich dich töten."
Darauf erwiderte die Hexe: "Ach, spiel dich nicht so auf. Das ist nur ein armer Bursche, der zum Schloss des Teufels will. Er wartet hier auf die Vögel, um sie zu befragen."
Danach kam die Mondfrau herein und auch sie sagte: "Ich rieche Menschenfleisch. Wenn du den Kerl nicht herausrückst, werde ich dich töten."
"Ach, lass doch, das ist ein armer Bursche, der zum Schloss des Teufels will. Er wartet hier nur auf die Vögel, um sie zu fragen, wo es liegt."
Nun, endlich kamen auch die Vögel aus allen Teilen der Welt, aber keiner hatte je etwas von einem Schloss des Teufels gehört.
Da sagte die Hexe: "Jetzt bleibt nur noch der lahme Adler. Er ist immer der letzte."
Endlich kam er. Sie befragte ihn, und er antwortete: "Ja, ich glaube, ich weiß, wo es liegt, nämlich auf der anderen Seite des Meeres."
"Könntest du den Jungen dorthin bringen?", fragte die Hexe den Adler.
"Es ist wirklich sehr weit", erwiderte der Vogel, "und ich brauche viel Futter, wenn ich das Meer überqueren soll. Zumindest ein ganzes Pferd muss vorhanden sein, und davon muss mir immer wieder ein Stück in den Schnabel gestopft werden, wenn ich es verlange."
Der Prinz sagte, dann werde er sein Pferd töten und es unterwegs an den Adler verfüttern. Also tötete er das Tier und stieg auf den Rücken des Adlers. Der Vogel aber erhob sich in die Lüfte. Nach einiger Zeit sagte der Adler: "Prinz, ich will Fleisch!"
Der Prinz gab ihm ein Stück von dem Pferd. Aber es dauerte nicht lange, da hatte der Adler alles Fleisch verzehrt, und immer noch hatten sie das Meer nicht ganz überquert. "Ja", sprach der Vogel, "wenn das so ist, muss ich dich jetzt leider abwerfen."
"Nein, warte", rief der Prinz, "in diesem Fall werde ich mir ein Stück von meinem eigenen Fleisch abschneiden, und es dir geben."
Der Adler hatte Mitleid. Er sagte: "Nein, das sollst du nicht. Ich werde mich anstrengen und dich nahe an den Fluss bringen, an dem das Schloss liegt."
Und so geschah es. Als der Prinz dort ankam, traf er tatsächlich die drei Töchter des Teufels beim Baden an, und er nahm die Kleider der jüngsten weg und versteckte sie.
Die beiden Ältesten kamen aus dem Wasser, kleideten sich an und flogen als Tauben davon.
Die Jüngste, die die Schönste von allen war, näherte sich dem Jungen und bat ihn, ihre Kleider herauszugeben: Er aber sprach: "Du kannst deine Kleider haben, aber dann musst du mich heiraten."
"Gut", antwortete Blancaflor, denn so hieß sie tatsächlich, "Ich wusste schon, dass du kommen würdest. Nimm diesen Ring hier."
Der Prinz gab ihr ihre Kleider wieder. Sie nahm sie, und augenblicklich verwandelte sie sich in eine Taube.
"Steige auf meinen Rücken", forderte sie den Prinzen auf. "Wir wollen zu meinem Schloss fliegen."
Als sie dort ankamen, trat der Teufel heraus und stellte dem Prinzen die erste Aufgabe:"Morgen", sprach er, "gehst du zu jenem Bergabhang dort. Du mähst, drischst und mahlst den Weizen und bringst mir das daraus gebackene Brot."
Der Junge nahm sich die Sense und machte sich auf den Weg ins Gebirge. Als er dort ankam, sah er nichts als lauter Steine. Da begann er zu weinen. Er weinte, und als er sich die Tränen abwischen wollte, berührte er mit dem Ring seine Augen. Da stand plötzlich Blancaflor vor ihm.
"Was ist mit dir?", fragte sie ihn.
"Ach nichts", sagte er und erzählte ihr, was ihr Vater von ihm verlangt hatte.
"Leg deinen Kopf in meinen Schoß und schlafe."
Als der Junge aufwachte, war das Brot schon fertig. Er brachte es dem Teufel und der sagte:
"Sehr gut. Aber hätte dir Blancaflor nicht geholfen, du wärst ein armer Teufel wie ich. Heute sollst du auf jenem Feld dort hinten einen Weinberg pflanzen und am Nachmittag mir schon die Trauben bringen."
Wieder ging alles so wie beim ersten Mal. Der Prinz weinte. Blancaflor erschien. Sie hieß den Prinzen sich schlafen legen, und als er aufwachte, stand da schon der Korb voller Trauben, den trug er zum Teufel und der sprach: "Sehr gut, aber hätte dir Blancaflor nicht geholfen, wärst du ein armer Teufel wie ich. Die Hauptsache steht dir noch bevor. Einst spazierte eine Tortenbäckerin durch die Straße von Gibraltar. Sie ließ einen Ring ins Meer fallen. Ich will, dass du ihn suchst und ihn mir bringst."
Abermals war Blancaflor zur Stelle, und als sie gehört hatte, was ihr Vater von dem Prinzen verlangte, sagte sie: "Nun, diesmal musst du mich mit diesem Messer töten und mein Blut in dieser Flasche auffangen. Nicht ein Tropfen darf verloren gehen. Danach wirf mich ins Meer und spiele in einem fort Gitarre."
"Aber ich kann dich doch nicht töten", rief der Junge.
Sie aber sagte, doch, genau das müsse er tun. Der Junge tat alles so, wie sie es ihm aufgetragen. Es fiel aber doch ein Tropfen ihres Blutes auf den Boden. Er spielte auf der Gitarre und nach einer Weile stieg das Mädchen mit dem Ring im Mund aus dem Wasser, und sie war nun noch schöner als je zuvor. Es fehlte nur ein Stückchen von ihrem Finger, eben weil der Prinz einen Tropfen Blut verloren hatte. Der Prinz gab den Ring dem Teufel und dieser sagte wieder:
"Ja, wenn dir Blancaflor nicht geholfen hätte, wärst du so ein armer Teufel wie ich es bin. Gut ... Ihr dürft heiraten. Aber es wird keine Hochzeit geben, und ihr dürft nicht zusammen schlafen. Und sobald es Nacht wird, musst du, ohne die Mädchen zu sehen, herausfinden, welche von ihnen Blancaflor ist. Wenn dir das nicht gelingt, töte ich dich, obwohl du all die anderen Aufgaben schon erledigt hast."
Als es Nacht geworden war, sperrte der Teufel seine Töchter in ein Zimmer, und die Tür blieb nur einen Spalt offen stehen, die Mädchen aber ließen durch den Spalt ihre Finger sehen, und nun sollte der Prinz, die Richtige herausfinden. Bei Blancaflor fehlte an dem einen Finger ein kleines Stückchen. Daran erkannte der Prinz sie.
Er wollte, obwohl der Teufel es verboten hatte, nun mit ihr zu Bett gehen, aber Blancaflor sprach: "Wenn mein Vater merkt, dass wir miteinander schlafen, wird er uns töten. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu fliehen. Geh in den Stall. Dort wirst du zwei Pferde finden. Das eine ist kräftig und hübsch. Es heißt Wind. Das andere ist dürr und hässlich. Es heißt Gedanke. Du musst das zweite der beiden Pferde nehmen, dazu auch noch einen rostigen Degen, der im Schrank neben einem anderen, neuen und glänzenden, liegt."
Der Prinz aber meinte, als er in den Stall kam, es sei doch wohl besser, das dicke Pferd und den neuen Degen zu nehmen, und das tat er denn auch.
Blancaflor hatte auf das Bett ein paar Tropfen Wein fallen lassen und in ein Glas etwas Speichel getan. Das eine oder das andere antwortete jedes Mal, wenn der Teufel von der anderen Seite der Tür her etwas fragte. Aber langsam trockneten sie ein, und so wurden die Stimmen immer schwächer, bis der Teufel meinte, das Paar sei eingeschlafen. Da ging er hinein, um sie zu töten und entdeckte, dass sie nicht mehr da waren..
"Dieses Pferd ist der Wind. Du hast das falsche Pferd genommen", rief Blancaflor, als sie sich mit dem Prinzen traf. "Fort, nur fort, oder wir sind verloren!"
Als der Teufel nun merkte, dass sie entkommen waren, fing er das Pferd, das Gedanke hieß, und setzte ihnen nach.
Als er sie eingeholt hatte, verwandelte er sich in ein Raubtier, um sie aufzufressen. Der Junge sah ihn kommen. Da sprach er zu Blancaflor. "Da kommt ein wildes Tier. Das will uns fressen!"
Da zog sie ein Haar aus dem Schwanz des Pferdes. Aus dem einen Haar aber wurde ein ganzes Gestrüpp von Haaren, und der Teufel brauchte eine ganze Zeit, um da hindurchzukommen.
Als er sie abermals fast eingeholt hatte, sagte Blancaflor: "Nimm dieses Taschenmesser und wirf es hinter dich."
Der Prinz tat, wie ihm geheißen, und aus dem Messer wurde ein ganzer Wald von Messern und wieder wurde der Teufel aufgehalten, und wie er sich durch den Messerwald mühte, holte er sich viele schmerzhafte Wunden.
Danach holte er sie wieder ein, und diesmal gab das Mädchen dem Prinzen eine Prise Salz und hieß ihn, diese hinter sich zu werfen.
Das Salz verwandelte sich in einen Salzberg.
Als der Teufel sich hindurchmühte, brannte das Salz in den Wunden, die er sich durch die Messerklingen geholt hatte, und er stieß einen Schrei aus, dass das ganze Land erzitterte.
Danach verwandelte sich das Pferd in eine Einsiedelei, Blancaflor in einen Spiegel, der Prinz in einen Einsiedler. Als der Teufel nun herankam, fragte er, ob der Einsiedler ein junges Paar auf einem Pferd gesehen habe. Der Eremit antwortete: "Klingelzug, Klingelzug. Es ruft die Glocke zur Messe. Wenn Ihr vielleicht eintreten wollt!"
Er hörte nicht auf, diesen Satz zu rufen, bis der Teufel müde wurde und umkehrte. Als er auf sein Schloss zurückkam und er von seinen Abenteuern erzählte, sprach die Teufelin zu ihm:
"Du Dummkopf. Der Spiegel und der Einsiedler: das waren doch gewiss die beiden."
Und der Teufel sprach: "Möge Gott es so einrichten, dass der Prinz unsere Tochter vergisst."
Der Prinz aber und die Tochter des Teufels setzten ihre Reise zum Schloss des Königs fort.
Als sie zum Dorf kamen, das in der Nähe des Schlosses seiner Eltern lag, ließ der Junge das Mädchen an einem Brunnen zurück und hieß es dort auf ihn warten.
"Hüte dich davor, irgend jemanden zu umarmen. Denn wenn du das tust, wirst du mich verlieren", sprach sie zu ihm.
Der Prinz kam auf das Schloss. Seine Eltern kamen ihm entgegen, und er sprach zu ihnen: "Dass keiner mich umarmt. Lasst eine Kutsche bereitmachen, damit ich meine Frau heimholen kann."
Da kam die alte Großmutter herbei, und da sie sich so sehr freute, fiel sie dem Jungen um den Hals. Sogleich vergaß er Blancaflor.
Blancaflor wurde es müde zu warten. Sie konnte sich schon vorstellen, was da geschehen war. Sie verwandelte sich in eine Taube und begann, um das Schloss herumzufliegen. Dabei gurrte sie: "Arme, die ich bin. Auf dem Feld und ganz allein!"
Und die Königin sprach zu ihrem Sohn: "Hast du nicht gesagt, du brauchtest eine Kutsche, um deine Frau heimzuholen?"
"Welche Frau denn?", antwortete der Prinz, "Ich bin doch gar nicht verheiratet."
Nach einiger Zeit suchte sich der Prinz eine andere Verlobte und traf Vorbereitungen für seine Hochzeit. Blancaflor hörte davon, denn sie hatte sich inzwischen als Magd auf dem Schloss verdingt. Nun war es zu dieser Zeit üblich, dass derjenige, der heiratete, dem Gesinde etwas schenkte. Da fragte der Prinz die Magd, die Blancaflor war: "Und was für ein Geschenk wünschst du dir?"
"Einen Stein der Schmerzen und ein Messer der Liebe", antwortete sie.
Der Prinz unternahm eine Reise, um diese Geschenke zu beschaffen, aber nirgends konnte er einen Stein der Schmerzen oder ein Messer der Liebe auftreiben.
Endlich traf er einen alten Mann, der in Wirklichkeit der Teufel war, und der sprach zu ihm: "Von mir kannst du bekommen, was immer du brauchst."
"Ich brauche aber einen Stein der Schmerzen und ein Messer der Liebe."
"Kein Problem", sagte der Alte und verkaufte ihm die beiden Dinge.
Der Prinz kehrte auf das Schloss zurück. Er gab allen ihre Geschenke, aber da er sich wunderte, warum die Magd gerade diese beiden Dinge hatte haben wollen, nahm er sich vor, bei ihr besonders aufzupassen, was sie damit machen werde.
Blancaflor nahm die Geschenke und legte sie auf den Tisch. Dann sprach sie zu dem Stein:
"Stein der Schmerzen, war ich es, die am Berghang den Weizen gemäht, ihn gemahlen und das Brot daraus gebacken hat, damit der Prinz es zu meinem Vater tragen konnte?"
Und der Stein antwortete: "Ja, freilich bist du das gewesen."
Da dämmerte dem Prinzen etwas. Aber die Tochter des Teufels sprach weiter:
"Stein der Schmerzen: Bin ich es nicht gewesen, die das Feld mit Weinstöcken bepflanzt und die Trauben gepflückt hat, damit der Prinz sie zu meinem Vater bringen konnte?"
Und der Stein antwortete: "Ja, freilich hast du das getan." Jetzt fiel dem Prinzen alles wieder ein.
Da sagte Blancaflor: "Messer der Liebe, was verdiene ich?"
Und das Messer sprach: "Dass du dir den Tod gibst, Blancaflor!"
Als sie nun das Messer nahm und sich umbringen wollte, trat der Prinz rasch hinzu, nahm ihr das Messer fort und sprach: "Verzeih mir, Blancaflor. Verzeih mir, dass ich, der ich dein Ehemann bin, dich vergessen habe."
Und dann sagte er allen, dass Blancaflor seine Frau sei.
Märchen aus Spanien
DIE FRAU, DIE AUSZOG, IHREN MANN ZU ERLÖSEN
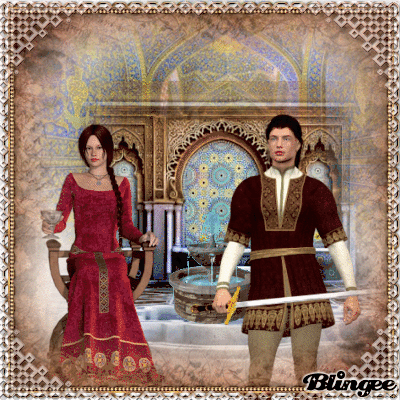
Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Der älteste der Prinzen war auch schon wieder verheiratet mit einer wunderschönen Prinzessin. Eines Tages erkrankte der König schwer, und er verlor darüber sein Augenlicht. Der König war verzweifelt, doch keiner konnte ihm helfen. Darauf ließ er alle Magier seines Reiches zusammenrufen. Die berieten sich lange, und am Abend trat ihr Ältester vor den Thron des Königs und sprach: »0 Herr, es gibt nur ein Mittel, um Euch das Augenlicht wiederzugeben. Weit am Ende der Welt liegt mitten im Meer eine einsame Insel. Auf dieser Insel steht am Felsengipfel ein Schloß. Im Hofe dieses Schlosses fließt ein Brunnen. Es ist der Brunnen des Lebens und der Gesundheit. Wenn ein Toter mit dem Wasser des Brunnens besprengt wird, wird er wieder lebendig, und ist einer blind wie Ihr, Herr, und das Wasser des Brunnens fällt auf seine Augen, so werden sie wieder sehend. Doch es ist sehr gefährlich, dieses Wasser zu holen, denn das Schloß mit dem Brunnen gehört einer Hexe, und keiner der Männer, die ausgezogen sind, das Wasser des Lebens zu holen, ist je wiedergekommen.«
Da ließ der König seine drei Söhne kommen, und er erzählte ihnen, was ihm die Magier offenbart hatten. Und er sprach zu ihnen: »Wer von euch auszieht, mir das Wasser des Lebens bringt und mir das Augenlicht wiederschenkt, dem werde ich das Reich und die Krone geben.«
Da sattelte der Jüngste sein Pferd und ritt eilends zum Tor hinaus, und er ritt 49 Tage und 49 lange Nächte. Und er kam zum Ende der Welt an das weite Meer. Am Meeresufer saß ein alter grauer Fischer bei seinem Boot.
»Gott grüße dich, Vater! « rief der jüngste Königssohn. »Rudere mich hinüber zu der Felseninsel. Ich muß das Wasser des Lebens und der Gesundheit holen, damit ich die Krone und das Reich bekomme. «
»Ach, mein Sohn«, sprach der alte Fischer, »bleibe hier. Die Hexe, die über die Insel herrscht und der der Brunnen gehört, ist eine mächtige Zauberin. So viele Ritter habe ich hinübergerudert, und keiner ist je wiedergekehrt.«
»Rudere mich hinüber!« rief der Jüngste. »Ich will das Reich und die Krone bekommen!«
Da ruderte der alte Fischer den jüngsten Königssohn zu der Felseninsel. Und der Prinz suchte sich den Weg zum Schloß. Als er den Schloßhof betrat, da sah er den Brunnen mit dem Wasser des Lebens und der Gesundheit. Sein silbernes Wasser plätscherte in ein Marmorbecken. Neben dem Brunnen aber stand ein wunderschönes junges Mädchen; ihre langen schwarzen Haare flossen bis zum Gürtel, und ihre Augen leuchteten dunkel wie die Nacht. Ihr Angesicht war zart und rein wie eine Magnolienblüte. Süß lächelte sie den Prinzen an und sprach mit sanfter Stimme: »Willkommen, mein Prinz; nimm deinen Krug und fülle ihn mit dem Wasser des Lebens.« Der Prinz tat, wie das schöne Mädchen ihm sagte. Darauf sprach sie zu ihm: »Bestimmt bist du hungrig und durstig. Ich will dir ein Stück Brot und einen Becher Wein bringen, und dann ruhe dich von deinem weiten Ritt bei mir aus. «
»Gerne! « rief der Prinz. »Aber wo ist die alte Hexe, der das Schloß und der Brunnen gehört?«
»Fürchte dich nicht«, sprach das Mädchen mit leiser, zarter Stimme. »Sie ist nicht hier .«
Das Mädchen ging in das Schloß und kam bald wieder mit einem Brot und einem Becher Wein zurück. Sie reichte dem Jüngling den Becher, und als dieser seine Lippen an den Becherrand setzte, erstarrte er zu Stein vom Scheitel bis zur Fußsohle. Die Hexe aber, denn das war das schöne sanfte Mädchen, rief ihre Diener und befahl ihnen, den Versteinerten in ein tiefes Gewölbe zu tragen.
Als nun der jüngste Prinz nicht wiederkehrte, sattelte der zweite Königssohn sein Pferd, und er ritt eilends zum Tor hinaus. Auch er ritt 49 Tage und 49 lange Nächte. Und er kam zum Ende der Welt an das weite Meer. Am Meeresufer saß ein alter grauer Fischer bei seinem Boot.
»Gott grüße dich, Vater!« rief der zweite Königssohn. »Rudere mich hinüber zu der Felseninsel. Ich muß das Wasser des Lebens und der Gesundheit holen, damit mein Vater das Augenlicht wiederbekommt und ich die Krone und das Reich erringe. «
»Ach, mein Sohn«, sprach der alte Fischer, »bleibe hier. Die Hexe, die über die Insel herrscht und der der Brunnen gehört, ist eine mächtige Zauberin. So viele Ritter habe ich hinübergerudert, und keiner ist je wiedergekehrt, und zuletzt brachte ich einen jungen Prinzen hinüber, und auch er kam nicht zurück.«
»Das war mein Bruder!« rief der zweite Königssohn. »Rudere mich hinüber, ich muß das Wasser des Lebens und der Gesundheit bekommen und versuchen, meinen Bruder zu befreien, und ich will die Krone und das Reich bekommen!«
Da ruderte der alte Fischer den zweiten Königssohn zu der Felseninsel. Und der Prinz suchte sich den Weg zum Schloß. Als er den Schloßhof betrat, da sah er den Brunnen mit dem Wasser des Lebens und der Gesundheit. Sein silbernes Wasser plätscherte in ein Marmorbecken. Neben dem Brunnen aber stand ein wunderschönes junges Mädchen; ihre langen schwarzen Haare flossen bis zum Gürtel, und ihre Augen leuchteten dunkel wie die Nacht. Ihr Angesicht war zart und rein wie eine Magnolienblüte. Süß lächelte sie den Prinzen an und sprach mit sanfter Stimme: »Willkommen, mein Prinz; nimm deinen Krug und fülle ihn mit dem Wasser des Lebens.« Der Prinz tat, wie das schöne junge Mädchen ihm sagte. Darauf sprach er: »Weißt du nicht, wo mein Bruder ist? Er ist hier in die Gewalt einer alten Hexe gefallen.«
»Ich werde dir helfen, ihn zu befreien«, sprach das Mädchen und lächelte den Prinzen an. Da bat er sie: »Willst du dann mit mir gehen und meine Frau werden? Denn ich liebe dich! «
Das schöne Mädchen lächelte und küßte ihn zur Antwort auf den Mund. Und als ihre Lippen die seinen berührten, erstarrte er zu Stein vom Scheitel bis zur Fußsohle. Die Hexe aber rief ihre Diener und ließ den Versteinerten in ein tiefes Gewölbe tragen.
Als nun auch der zweite der Prinzen nicht wiederkehrte, ließ der König seinen ältesten Sohn kommen. »Es ist sehr gefährlich, das Wasser des Lebens und der Gesundheit zu holen. Deine beiden Brüder sind nicht wiedergekehrt. Darum reite du. Du bist der Älteste. Versuche die Aufgabe zu erfüllen.«
Da nahm der älteste Prinz Abschied von seiner Frau und ritt langsam und traurig zum Tor hinaus, und er ritt 49 Tage und 49 lange Nächte. Und er kam zum Ende der Welt an das weite Meer. Am Meeresufer saß ein alter grauer Fischer bei seinem Boot.
»Gott grüße dich, Vater! « rief der älteste Königssohn. »Rudere mich hinüber zu der Felseninsel. Ich muß das Wasser des Lebens und der Gesundheit holen, damit mein Vater das Augenlicht wiederbekommt.«
»Ach, mein Sohn « , sprach der alte Fischer, »bleibe hier. Die Hexe, die über die Insel herrscht und der der Brunnen gehört, ist eine mächtige Zauberin. So viele Ritter habe ich hinübergerudert, und keiner ist je wiedergekehrt, und zuletzt brachte ich zwei Prinzen hinüber, und auch sie kamen nicht zurück.«
»Das waren meine Brüder!« rief der älteste Königssohn.
»Rudere mich hinüber, ich muß das Wasser des Lebens und der Gesundheit bekommen und versuchen, meine Brüder zu befreien, und ich will doch die Krone und das Reich bekommen! «
Da ruderte der alte Fischer den ältesten Königssohn zu der Felseninsel. Und der Prinz suchte sich den Weg zum Schloß. Als er den Schloßhof betrat, sah er den Brunnen mit dem Wasser des Lebens und der Gesundheit. Sein silbernes Wasser plätscherte in ein Marmorbecken, und der Hof war menschenleer.
Da betrat der Prinz das Schloß. Er ging durch alle Räume, und er sah keine Menschenseele darin, bis er in den letzten Raum kam. Da saß beim Feuer des Herdes eine alte, häßliche Hexe. »Gib meine Brüder heraus!« rief der Prinz. »Ich bin gekommen, um sie zu befreien!«
Höhnisch lachte die Hexe: »Ich ließ sie zu Stein erstarren. Sie liegen in meinem tiefsten Gewölbe, und bald wirst du ihr Schicksal teilen! «
Der Prinz aber zog sein Schwert und wollte auf sie eindringen. Doch siehe! Die Hexe verwandelte sich plötzlich in das Bild seiner Frau und sprach mit deren Stimme zu ihm: »Sei ohne Furcht. Ich bin gekommen, um dir beizustehen.« Der Prinz ließ sein Schwert sinken, die Hexe legte ihre Hand auf sein Herz, und da hörte es auf zu schlagen, und er erstarrte zu Stein vom Scheitel bis zur Fußsohle. Die Hexe aber rief ihre Diener und ließ den Versteinerten in ein tiefes Gewölbe tragen, wo schon all die anderen Versteinerten lagen.
Als nun der älteste Königssohn nicht wiederkehrte, fiel der König in die Nacht der Verzweiflung. Er wurde so krank, daß er dem Tode nahe war. Die Frau des ältesten Prinzen aber weinte und klagte zwölf lange Tage und zwölf lange Nächte, und als sie keine Tränen mehr hatte, legte sie die Kleider ihres Mannes an und ritt schnell zum Tor hinaus, und sie ritt 49 Tage und 49 lange Nächte. Und sie kam zum Ende der Welt an das weite Meer. Am Meeresufer saß ein alter grauer Fischer bei seinem Boot.
»Gott grüß dich, Vater«, rief die Prinzessin, »rudere mich hinüber zu der Felseninsel, wo der Brunnen mit dem Wasser des Lebens und der Gesundheit fließt.«
»Ach, mein Söhnchen«, sprach der alte Fischer, »bleibe hier. Die Hexe, die über die Insel herrscht und der der Brunnen gehört, ist eine mächtige Zauberin. So viele Ritter habe ich hinübergerudert, und keiner ist je wiedergekehrt. Zuletzt brachte ich drei Prinzen hinüber, und auch sie kamen nicht zurück. Darum bleibe hier, du bist noch so jung und zart.«
Da weinte die Prinzessin und bat: »Rudere mich hinüber! « Der alte Fischer sah sie aufmerksam an und sprach: »Deine Gestalt ist so fein, deine Stimme klingt so hell. Wenn du nicht wie ein Mann gekleidet wärst, würde ich denken, du seist eine Frau.«
»Ich bin es, Vater«, sprach die Frau, »ich bin die Frau des ältesten Prinzen, den du hinübergerudert hast. Und wenn es mir nicht gelingt, die Prinzen und vor allem meinen lieben Mann zu erlösen, will ich lieber tot sein.«
Da rief der Fischer: »Wenn du eine Frau bist, wird es dir vielleicht gelingen, was so vielen Männern nicht gelungen ist. Die Hexe versteht es, in die Herzen der Männer zu schauen, und sie nimmt die Gestalt der Frau an, die er in seinem Herzen trägt. Du aber bist eine Frau, und sie wird in deinem Herzen nicht das Bild einer Frau erkennen. Aber sieh dich vor; nimm drüben weder Speise noch Trank und sprich kein Wort.«
»Danke, Vater, für den Rat! « rief die Prinzessin, sprang in den Nachen, und der Fischer ruderte sie zur Felseninsel. Und die Prinzessin suchte sich den Weg zum Schloß. Als sie den Schloßhof betrat, da sah sie den Brunnen mit dem Wasser des Lebens und der Gesundheit. Sein silbernes Wasser plätscherte in ein Marmorbecken. Die Prinzessin schöpfte von dem Brunnen in ihren Krug; als sie sich aber umwandte, stand ein schönes, zartes Mädchen hinter ihr .
»Sei gegrüßt, schöner Held«, sprach es freundlich. »Bestimmt bist du hungrig und durstig von dem langen Weg. Iß und trink und ruhe dich aus bei mir. « Doch die Prinzessin sprach kein Wort und zog ihr Schwert. Die Hexe erschrak, denn sie konnte im Herzen ihres Gegners kein Frauenbild erkennen. Sie verwandelte sich in ein freundliches altes Mütterchen, das mit zitternder Stimme bat: »Wirf dein Schwert weg, mein Sohn!« Doch die Prinzessin ließ sich nicht täuschen und bedrohte die Hexe weiter. Noch mehrmals wechselte diese ihre Gestalt, aber unbeirrt kämpfte die Prinzessin weiter, und die Spitze ihres Schwertes drang in das Herz der Hexe. Da erkannte diese, wer ihr Gegner war, und sie rief: »Eine Frau ist der Tod!« Dann hauchte sie ihre schwarze Seele aus und fuhr zur Hölle.
In diesem Augenblick fiel der Zauber von dem Schloß und den Versteinerten; sie kamen in den Schloßhof und dankten der Prinzessin, die sie erlöst hatte. Am glücklichsten aber waren die drei Brüder, und der älteste Prinz umarmte seine Gemahlin und küßte sie. Da nahmen die Erlösten die Schätze der Hexe, belohnten den alten Fischer reichlich und ritten heim. Als der kranke König sie heimkommen hörte, trat er unter das Tor, und die Prinzessin besprengte seine Augen mit dem Wasser des Lebens. Da wurde der König wieder sehend, nahm seine Krone, setzte sie der Prinzessin aufs Haupt und übergab ihr das Reich, und alle waren es zufrieden, und sie lebten in Glück und Frieden miteinander.
Märchen aus Spanien
DIE DREI SCHÖNEN PRINZESSINNEN
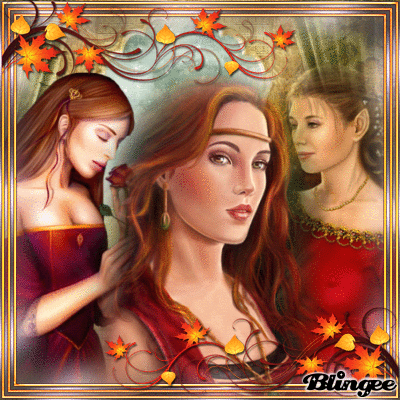
In alten Zeiten regierte in Granada ein maurischer König namens Mohammed, den seine Untertanen el Hayzari, den Linkshänder nannten. Einige Chronisten meinen, man habe ihm diesen Beinamen gegeben, weil er mit seiner linken Hand so gut umgehen konnte wie mit der rechten; andere glauben, daß er alles verkehrt anfaßte und linkisch verpfuschte, was zu regeln gewesen wäre. Wie auch immer dem sei, sicher ist, daß während seiner Regierungszeit Granada von schweren Revolutionen heimgesucht wurde. Er selbst konnte nie in Frieden leben, und vom Unglück verfolgt oder infolge schlechter Verwaltung wurde er dreimal vom Throne gestoßen; dabei mußte er sogar bei einer Gelegenheit als Fischer verkleidet bis Afrika hinüberflüchten, um sein Leben zu retten. Doch war König Mohammed so tapfer wie ungeschickt und führte linkshändig den Krummsäbel so kräftig, daß er sich nach schweren Gefechten den Thron immer wieder zurückeroberte. Aber anstatt aus dem Missgeschick zu lernen und klug zu werden, wurde er hartherzig, eigenwillig und halsstarrig und bediente sich seines linken Armes, um seine Willkür zu behaupten. Über das Unglück, daß er so über sich und sein Reich brachte, berichten dem Forscher die alten arabischen Annalen Granadas; die hier folgende Geschichte soll nur von seinem häuslichen Leben erzählen:
Als dieser Mohammed eines Tages mit seinen Höflingen am Fuße der Sierra Elvira einen längeren Spazierritt unternahm, begegnete er einem Trupp seiner Leute, der von einem Streifzug durchs Grenzland der Christen siegesfroh zurückkehrte. Die Reiter führten einen langen Zug mit Beute schwer beladener Maulesel mit sich; auch sah man viele Gefangene beiderlei Geschlechts. Unter den Frauen und Mädchen fiel dem Herrscher ein schönes und reich gekleidetes Mädchen auf, das weinend auf einem kleinen Pferd saß, kaum auf die ihr zur Seite reitenden Duena hörte und deren tröstende Worte nicht zu verstehen schien. Der König, von der Schönheit des Mädchens bezaubert, erkundigte sich sogleich nach der Herkunft der Gefangenen. Der Anführer der Truppe konnte ihm melden, daß es sich um die Tochter der Alciden, des Burgvogtes einer Grenzfestung handle, die man im Handstreich eingenommen und dann geplündert habe. Mohammed forderte das Christenmädchen als königlichen Beuteanteil und ließ es in den Harem der Alhambra bringen. Hier tat man alles, um die Auserkorene des Fürsten zu zerstreuen, ihren Kummer zu dämpfen und ihre Stimmung zu heben. Der närrisch verliebte König beschloß daraufhin, das schöne Mädchen zu seiner Gemahlin zu machen. Die Christin wies anfangs seinen Antrag schroff ab, denn der Bewerber war ein Ungläubiger, ein offener Feind ihres Vaterlandes und, was das Schlimmste war, er zählte nicht mehr zu den jüngeren Jahrgängen, denn Silberlocken umrahmten sein ehrwürdiges Haupt.
Als der König sah, daß alle Bemühungen fruchtlos blieben, beschloß er mit der Duena, die damals mit dem Mädchen gefangengenommen war, zu reden, da diese auf ihre junge Herrin bestimmt einen großen Einfluß ausübte. Dieser dienstbare Geist war Andalusierin von Geburt; doch kennt man ihren christlichen Namen nicht, denn in den maurischen Sagen nennt man sie immer „Die kluge Kadiga“, und klug war sie in der Tat, was aus ihrer Geschichte klar hervorgeht. Der maurische König hatte mit ihr eine kurze, geheime Unterredung. Dabei begriff sie, daß es ihm ernst war, also machte sie seine Sache bei ihrer jungen Herrin zur ihrigen. „Schluß jetzt!“ rief sie eindringlich, „was gibt es denn da zu weinen und zu jammern? Ist es nicht besser hier die Herrin zu sein, in diesem wundervollen Palast mit all den schönen Gärten und Brunnen, als in Eures Vaters alten Grenzturm zwischen nackten Felsen eingeschlossen zu leben? Daß dieser Mohammed ein Ungläubiger ist, was tut dies schon groß zur Sache? Ihr heiratet ihn und nicht seine Religion. Und daß er alt ist? Desto eher werdet Ihr Witwe und dann Eure eigene Herrin sein. Auf jeden Fall seid Ihr in seiner Gewalt und habt nur die Wahl zwischen Königin oder Sklaven dasein. Sagt man nicht, es sei immer noch besser, seine Ware an den Räuber zu einem annehmbaren Preis zu verkaufen, als sie sich mit Gewalt nehmen lassen?“ Die Vorhaltungen der klugen Kadiga hatten Erfolg. Das spanische Mädchen trocknete ihre Tränen und wurde die Gemahlin Mohammeds des Linkshänders. Sie nahm auch zum Schein den Glauben ihres königlichen Gatten an; ihre Duena aber wurde sofort eine eifrige Bekennerin der Lehren des Propheten. Sie erhielt den arabischen Namen Kadiga und blieb die vertraute Dienerin ihrer Herrin.
Nach angemessener Zeit wurde der maurische König stolzer und glücklicher Vater von drei hübschen Töchtern, die alle zur selben Stunde geboren wurden. Ihm wären wohl Söhne lieber gewesen, doch er tröstete sich mit der Überlegung, daß immerhin drei gleichzeitig geborene Töchter für einen einigermaßen bejahrten und obendrein noch linkshändigen Mann eine beachtenswerte Leistung wären. Wie es bei den moslemischen Sitten war, rief er bei diesem glücklichen Ereignis die bekanntesten Astrologen zu sich und bat sie, den drei kleinen Prinzessinnen ihr Horoskop zu erstellen. Gerne kamen die weisesten Männer des Reiches dem Wunsch ihres Landesherren nach, und ernst, mit den gelehrten Häuptern nickend, sagten sie: „Töchter, o König, sind immer ein unsicherer Besitz; aber diese hier werden deiner Wachsamkeit ganz besonders bedürfen, wenn sie in das heiratsfähige Alter kommen. Dann nimm sie in deine alleinige Obhut und vertraue sie keinem anderen Menschen an.“ Mohammed der Linkshänder wurde von seinen Höflingen und Hofschranzen als weiser König anerkannt, und er selbst betrachtete sich auch als einen von Gott gesegneten Landesvater. Die Prophezeiung der Astrologen verursachte ihm und seinem Hofstaat also wenig Kopfzerbrechen; er traute ihrem und seinem Verstande zu, die Überwachung der Infantinnen zu gegebener Zeit umsichtig zu organisieren und damit des Geschickes Mächte überlisten zu können. Die Drillingsgeburt war übrigens die letzte und einzige Trophäe des Königs. Seine Gemahlin gebar ihm darauf keine Kinder mehr und starb einige Jahre später, ihre jungen Töchter der Obhut seiner Liebe und der Treue der klugen Kadiga überlassend.
Viele Jahre gingen ins Land, ehe die Prinzessinnen das von den Astrologen genannte gefährliche Alter der Heiratsfähigkeit errreichten. „Ein kluger Mann baut vor“, sagte sich der schlaue König und beschloß, den Wohnsitz seiner Töchter und ihres Hofstaates nach dem königlichen Schloß Salobrena zu verlegen und sie dort erziehen lassen. Dieser prächtige Palast stand inmitten einer starken maurischen Festung; die vor Jahren einer der granadinischen Fürsten auf den uneinnehmbaren Gipfel eines Berges an den Ufern des Mittelmeeres hinaufgebaut hatte. Salobrena war also so etwas wie ein Fruchtkern, von einer harten Schale umschlossen, und unmöglich schien es, mit den Bewohnern von außen her in Kontakt zu treten. Hier oben, fern von Granada und den Hofintrigen, den Ränken und politischen Verschwörungen, war eine Art von königlicher Pfalz, wo die mohammedanischen Potentaten unliebsame Verwandte einsperrten, die ihnen im Wege standen oder ihre Sicherheit zu gefährden schienen. Den Bewohnern dieses politischen Sanatoriums wurde übrigens jede Art von Wohlbefinden und Unterhaltung geboten, in deren unbeschränktem Genuß sie ihr Leben in üppiger Trägheit und wollüstiger Faulheit hinbrachten, bis sie endlich verfettet ins bestimmt nicht bessere Jenseits hinüberschlummerten. Nachdem diese Residenz von vielen Arbeitern und Künstlern zweckdienlich hergerrichtet worden war, übersiedelten die drei Infantinnen dorthin.
Hier lebten sie von aller Welt abgeschlossen, doch mit ihren Freundinnen und von Sklaven bedient, die ihnen jeden Wunsch von den Augen ablasen. Sie spaziertem in den königlichen Schlossgärten umher, wo die herrlichsten Blumen wuchsen und die Bäume seltene Früchte trugen; sie spielten in duftenden Hainen und erfrischten sich in wohlriechenden Bädern. Von drei Seiten schaute die Burg auf ein reiches und gepflegtes Tal nieder, und weit hinten am Horizont leuchteten die Berge der Alpurjarra; in der anderen Richtung ging der Blick aufs sonnenbestrahlte offenen Meer hinaus, wo Fischer ihrem schweren Handwerk nachgingen und Kauffahrer dahinsegelten. Die Prinzessinnen wuchsen in dieser Umgebung unter ewig blauem Himmel im mildesten Klima der Welt zu wahren Schönheiten heran. Obgleich alle drei Schwestern die gleiche Erziehung genossen, waren sie in Bezug auf ihre Charaktereigenschaften von klein auf grundverschieden. Sie hießen Zaida, Zoraida und Zorahaida; und das war auch die Reihenfolge ihres Alters. Genau drei Minuten lagen zwischen der Geburt einer jeden. Zaida, die älteste, hatte einen unerschrockenen Geist und war ihren Schwestern in allem voraus, was sich ja schon bei ihrem Eintritt in diese Welt gezeigt hatte. Sie war neugierig und wissensdurstig, fragte viel und ging den Dingen gern auf den Grund. Zoraida war eine Künstlernatur von feinem Geist und Gefühl. Ein besonderer Sinn für alles Schöne und Ästhetische zeichnete sie aus, was ohne Zweifel der Grund war, weshalb sie so gerne in Spiegeln und Blumen ihr eigenes Bild betrachtete; Blumen, Juwelen und kunstvoller Putz ließen ihr kleines Herz rascher schlagen.
Zorahaida wieder war sanft und schüchtern, äußerst empfindsam und dazu noch von hingebungsvoller Zärtlichkeit. Mit Liebe pflegte sie die Blumen, Vögel und andere Tiere. Sanft und voll Liebe unterhielt sie sich mit ihren Schwestern; und nie sprach sie einen ihrer Wünsche in einem arroganten Tone aus. Sinnend und träumend saß sie oft stundenlang auf dem Balkon und schaute in milden Sommernächten zu den funkelnden Sternen hinauf oder auf das weite vom Mond bestrahlte Meer hinaus. In solchen Momenten konnte ein fernes Fischerlied; der leise Ton einer maurischen Flöte oder gar der Ruderschlag einer vorbeigleitenden Barke sie ganz und gar verzücken. Der geringste Aufruhr der Elemente aber erfüllte sie mit Schrecken und Angst, und ein einziger Donnerschlag reichte oft hin, sie in Ohnmacht fallen zu lassen.
So gingen ruhig und heiter die Jahre dahin. Treu erfüllte die kluge Kadiga ihre Pflicht und sorgte unermüdlich für das Wohl der ihr anvertrauten Prinzessinnen. Das Schloß Salobrena lag wie bereits erwähnt, auf einem Berg an der Seite des Hügels. Die Anlage zog sich hin bis zu einem vorspringenden Felsen, der über die See hinausragte. Die Wellen schlugen sanft auf einen kleinen Strand, dessen Ufersand der Küste jede Rauheit nahm. Oben auf dem Felsenriff stand ein alter Wachtturm, der zu einem schönen Pavillon umgebaut worden war, durch dessen vergitterte Fenster die frische Seeluft hereinkam. Hier verbrachten die Infantinnen gewöhnlich die schwülen Stunden während der Siesta-Zeit dann ruhig und zufrieden. Die neugierige Zaida saß eines Tages an einem der Fenster des Pavillons und schaute übers Meer hin, während ihre beiden Schwestern auf weichen Ottomanen schliefen. Aufmerksam beobachte sie eine Galeere, die mit gleichmäßigen Ruderschlägen die Küste entlangfuhr und sich dem Turm näherte. Bald konnte sie auch feststellen, daß es sich um ein militärisches Fahrzeug handelte, das es mit Bewaffneten bemannt war. Die Galeere warf unterm Turm beim Felsen Anker, und eine große Anzahl maurischer Soldaten brachten mehrere christliche Gefangene an Land und stellten diese am schmalen Sandstrand auf.
Zaida weckte sofort ihre Schwestern und berichtete ihnen eingehend über den Vorfall. Alle drei lugten dann vorsichtig durch die dichten Fenstergitter zur Küste hinunter, derart, daß sie von draußen nicht gesehen werden konnten. Unter den Gefangenen befanden sich drei reich gekleidete spanische Ritter. Sie standen in der Blüte ihrer Jugend und waren von edlem Aussehen; aus ihrem Wesen sprach Vornehmheit, und stolz schauten sie zu ihren Feinden und Wächter hinüber, die auf weitere Anordnungen, bezüglich der mit Ketten beladenen Christen, zu warten schienen. Die Infantinnen blickten voll gespanntem Interesse hinunter und konnten sich an den schönen jungen Männern nicht sattsehen. Was Wunder, daß die Erscheinung der drei Ritter aus adeligem Hause ihre jungen Herzen einigermaßen beunruhigte.
Im Schloß kamen sie fast ausschließlich mit weiblicher Dienerschaft zusammen und sahen vom männlichen Geschlecht nur schwarze Sklaven und dann und wann einen Fischer oder einen Soldaten der Küstenwache. Die etwas arrogante Schönheit der drei hübschen Ritter in der Blüte ihrer Jugend mußte die Infantinnen aufs tiefste bezaubern. „Hat jemals ein edleres Wesen die Erde betreten, als jene Ritter in Scharlachrot?“ rief Zaida, die älteste der Schwestern. „Schau, wie stolz er sich benimmt, als ob alle rings um ihn seine Sklaven wären!“ „Aber seht nur jenen in Grün!“ rief Zaida, „welche Anmut, welche Hoheit, welche Eleganz!“ Zorrahaida aber schwieg und verriet ihren Schwestern nichts, doch insgeheim gefiel ihr der Ritter im blauen Gewand am besten. Die Prinzessinnen wandten von den Gefangenen kein Auge ab, bis sie in der Ferne ihren Blicken entschwanden. Dann seufzten die drei Infantinnen tief, drehten sich um, schauten sich einen Augenblick an und setzten sich sinnend und träumend in ihre Ottomanen. So traf sie bald danach die kluge Kadiga. Die Mädchen erzählten ihrer treuen Duena, was sie gesehen hatten. Schwärmend ließen sie ihren Zungen freien Lauf, daß sogar das welke Herz Kadigas rascher zu schlagen begann.
„Arme Jungen!“ rief sie aus, „ihre Gefangenschaft und das harte Los, das ihrer harrt, wird manch edlem und schönem Mädchen in ihrem Heimatland großen Kummer und schweres Herzeleid verursachen! Ach, liebe Kinder, ihr habt keinen Begriff von dem Leben, das diese Ritter auf ihren Burgen und Schlössern, in Palästen und am Hofe ihres Königs führen! Welche Pracht bei den Turnieren herrscht, welche Bewunderung von seifte schöner Frauen ihnen entgegengebracht wird. Und dann dieser Minnedienst mit Liedern und Serenaden!“
Bei Zaida stieg die Neugierde aufs höchste. Ihre Fragen wollten kein Ende nehmen, und nach und nach entlockte sie der alten Dienerin die lebendigsten Schilderungen von Festen und Spielen, die sie in der Jugend in ihrem Heimatlande gesehen und erlebt hatte. Die schöne Zoraida richtete sich schnell auf, als Kadiga von den Reizen der spanischen Frauen berichtete, und ging zum großen Wandspiegel, wo sie sich insgeheim mit kritischem Blick, doch hochzufrieden betrachtete. Die zarte Zorahaida drückte sich wieder tief in die Kissen auf ihrer Ottomane und seufzte traurig in sich hinein, als von den feurigen Mondscheinserenaden die Rede war. Jeden Tag kam die neugierige Zaida wieder mit ihren Fragen, und jeden Tag wiederholte die kluge Duena ihre Erzählungen, denen die edlen Zuhörinnen mit größter Aufmerksamkeit lauschten, und manchmal seufzten sie tränenden Auges dabei. Endlich merkte die alte Frau, daß sie dabei war, ein großes Unheil anzurichten. Sie hatte übersehen, daß aus den ihr anvertrauten drei Kindern nunmehr kokette junge Frauen im heiratsfähigen Alter geworden waren, durch deren Adern heiß das Blut pulsierte und deren Herzen nach Liebe verlangten. Es wird Zeit, dachte sich die Duena daher, daß der König benachrichtigt wird, mag er dann verfügen, was ihm richtig erscheint.
Mohammed der Linkshänder saß eines Morgens in einer der kühlsten Hallen der Alhambra auf dem Diwan, als ein Bote von der Festung Salobrena in den Thronsaal geführt wurde, der Kadigas Glückwünsche zum Geburtstag seiner drei Töchter überbrachte. Die kluge Duena sandte dem König ein mit Blumen verziertes, feines Körbchen, in dem auf Weinlaub und Feigenblättern gebettet wie ein Pfirsich, eine Aprikose und eine Nektarine lagen. Als der Monarch die frischen Früchte im verführerischen Reiz beim Anflug ihrer Reife sah, da erriet er sogleich die Bedeutung dieses Geschenkes. Ernst geworden, überlegte er sich: „Die von den Astrologen angedeutete gefährliche Zeit ist also gekommen; meine Töchter sind im heiratsfähigen Alter. Vorsicht ist geboten! Doch was soll ich tun? Richtig ist, daß sie den Blicken der Männer entzogen sind; daß Kadiga klug und treu ihrer Pflicht nachkommt, aus das ist wahr! Die Astrologen verlangten aber, daß ich selbst die Mädchen in Obhut nehme und sie keiner anderen Person anvertraue! Um künftigen Verdruß und Ärger zu vermeiden, muß ich mich ab heute selbst um meine Töchter kümmern.“ So sprach Mohammed und ließ einen Turm auf der Alhambra zum Aufenthaltsort der Infantinnen ausbauen. Dann ritt er an der Spitze seiner Leibwache bis Salobrena, um die drei Schönheiten mit Kadiga und dem Hofstaat in höchst eigener Person auf die Königspfalz in Granada zu bringen.
Ungefähr drei Jahre waren verflossen, seitdem der König seine Töchter zum letzten Mal gesehen hatte. Er traute seinen Augen nicht, als er die wunderbare Veränderung gewahrte, die während dieses Zeitraums mit ihrem Äußern vor sich gegangen war. Sie hatten in wenigen Monaten jene mysteriöse Grenzlinie des weiblichen Lebens überschritten, welche das wilde, ungezähmte, eckige und gedankenlose Mädchen von der aufblühenden und selbstständig urteilenden jungen Frau trennt. Aus Kindern waren Erwachsene geworden!
Ähnliches erlebt der Reisende, der aus der reizlosen und kahlen Mancha des kastilischen Hochlandes in die üppigen Täler und schwellenden Hügel Andalusiens gelangt. Zaida war schlank und schön gewachsen, von stolzer Haltung, und unter fein geschwungenen Brauen leuchteten durchdringend tiefe Augen. Sie trat mit gemessenen Schritten ein und machte vor Mohammed eine tiefe Verbeugung, die mehr dem König als dem Vater gelten schien. Zoraida war von mittlerem Wuchs, sie hatte ein bezauberndes Wesen. Sie unterstrich es vorteilhaft durch ausgesuchte Kleidung und geschmackvollen Schmuck und Putz. Lächelnd kam sie auf ihren Vater zu, küsste ihm die Hände und begrüßte ihn mit einigen Versen aus einem arabischen Gedicht, was dem König große Freude bereitete. Zorahaida war schüchtern und scheu, etwas kleiner als ihre Schwestern, und ihre Schönheit hatte jenen zarten einschmeichelnden Charakter, der Liebe und Schutz sucht. Sie war keine Herrschernatur, so wie ihre ältesten Schwestern, auch war sie nicht von blendender Schönheit, wie die zweite; sie schien dazu geschaffen, sich an die Brust des geliebten Mannes zu schmiegen, verwöhnt zu werden und sich glücklich zu fühlen. Schüchtern und zögernd näherte sie sich ihrem Vater und getraute sich auch nicht nach seiner Hand zu fassen, um sie zu küssen. Erst als sie sein väterliches Lächeln sah, kam ihre Zärtlichkeit zum Ausbruch. Voll Freude warf sie sich an seine Brust, umarmte und küsste ihn mit kindlicher Liebe.
Mit Stolz, doch auch mit sorgenvoller Verwirrung blickte Mohammed der Linkshänder auf seine Töchter, denn während er sich über ihre große Schönheit freute, fiel ihm die ernste Prophezeiung der Astrologen ein. „Drei Töchter! Drei Töchter!“ murmelte er mehrmals in seinen weißen Bart hinein, „und alle im heiratsfähigen Alter! Das sind wahrhaftig lockende Hesperidenfrüchte, die einen Drachen zum Wächter brauchten!“ Bald hatte er alles geordnet und bereitete seine Rückkehr nach Granada vor. Doch vorher ließ er durch die königlichen Herolde verkünden, daß sich jedermann vom Wege fernzuhalten haben, den der König mit seinen Töchtern und Gesinde nehmen wolle, und daß beim Herannahen des Zuges Fenster und Türen zu schließen seien, denn die Infantinnen sollten niemand sehen. Als so alles geregelt schien, brach er auf, geleitet von einem Trupp schwarzer Reiter, häßlichstem Aussehen; deren Rüstungen im Schein der ersten Sonnenstrahlen funkelten. Auf feurigen weißen Pferden ritten die Prinzessinnen neben dem Vater. Weite Seidenmäntel und dichte Schleier verhüllten die so schönen Gesichtszüge der wundervollen Mädchen. Die Schimmel, auf denen sie im Sattel saßen, trugen samtene Decken, reich an Gold und Silber bestickt; Zügel mit Perlen und Diamanten verziert. Am Zaumzeuge hingen Dutzende von silbernen Glöckchen, deren melodischer Klang das Ohr erfreute. Aber wehe dem Unglücklichen, der am Wege zögernd stehenblieb, wenn er den wohlklingenden Ton der Silberschellen hörte! Die Wachmannschaft hatte den strikten Befehl ihn ohne Gnade niederzuhauen!
Der königliche Geleitzug näherte sich bereits Granada, als er am Ufer des Genil eine Abteilung maurischer Soldaten einholte, die einen Trupp christlicher Gefangener begleitete. Schon war es zu spät, aus dem Weg zu gehen und sich seitlich in die Büsche zu schlagen, wie es befohlen war. Sie warfen sich also auf den Boden, mit den Gesichtern zu Erde. Ihren Gefangenen befahlen sie, es ihnen nachzutun. Unter den Gefangenen befanden sich aber auch die drei spanischen Ritter, welche den Infantinnen vor einigen Tagen im Pavillon zu Salobrena das Herz hatten höher schlagen lassen. Die Ritter hatten den Befehl des Hauptmanns der Wache wohl nicht verstanden, oder sie waren zu stolz, ihm zu gehorchen. Aufrecht blieben sie stehen und sahen voller Interesse dem prunkvollen Reiterzug entgegen.
Als Mohammed diese Missachtung seiner Befehle gewahr wurde, riß er zornig seinen Krummsäbel aus der Scheide, sprengte vorwärts und wollte gerade einen seiner linkshändigen Streiche führen, der wenigstens einen der trotzigen Gaffer zu Boden gestreckt hätte, als die Prinzssinnen ihn umringten und für die Gefangenen um Gnade baten. Sogar die zarte Zorahaida hatte plötzlich ihre Schüchternheit vergessen und setzte sich für die Christen ein. Noch hielt der Maure seinen Säbel hoch in der Luft, als der Führer der Wache vor ihm sein Knie beugte und sagte: „Möge Eure Majestät nicht eine Tat begehen, die im ganzen Reich großen Ärger erregen würde. Dies sind drei spanische Ritter aus edelster Familie, die wir nach hartem Kampfe gefangen nehmen konnten; mutig wie Löwen kämpften sie, und erst als ihre Waffen unbrauchbar geworden waren, ergaben sie sich uns. Von hohem Adel sind sie und werden Euch ein hohes Lösegeld einbringen.“
Langsam ließ der König die Hand mit der Waffe sinken und rief: „Nun denn! Ich werde den Christen hier das Leben schenken! Doch ihre Verwegenheit und ihr Trotz verlangen Strafe. Bringt sie daher zu Torres Bermejas und weist ihnen die härteste Arbeit an!“ Das war wieder einer der linkischen Streiche, die Mohammed hin und wieder zu machen pflegte. In dem Aufruhr und dem stürmischen Hin und Her der eben beschriebenen Szene wurde nämlich die außerordentliche Schönheit der drei Prinzessinnen nur allzu deutlich ins Bild gerückt, da sich bei den raschen und unüberlegten Bewegungen ihre Schleier verschoben und sich so der Glanz ihrer schönen Augen und ihre zarte Haut enthüllte. Die spanischen Ritter hatten so die Gelegenheit, den gütigsten Feen aus dem granadinischen Morgenland tief in die Augen zu blicken, was in ihren so jungen Herzen eine lohende Flamme entfachte.
Es ist jedoch seltsam und wirklich der Erwähnung wert, daß sich jeder von ihnen in eine andere Infantin verliebt hatte, die ihrerseits vom adligen Auftreten der Gefangenen überrascht waren und alles, was sie von der männlichen Tapferkeit und ihrer spanischen Grandezza gehört hatten, wie Zauberblumen in ihrer Phantasie aufgehen ließen. Der Reiterzug setzte seinen Weg fort, die drei Prinzessinnen ritten nachdenklich auf ihren Zeltern dahin, und von Zeit zu Zeit spähten sie mit verstohlenen Blicken zu den christlichen Gefangenen hinüber, in die sie sich so heftig verliebt hatten. Auf der Alhambra angekommen, sahen sie noch, wie die drei Spanier in den roten Turm gebracht wurden. Das kaum begonnene Idyll schien schon zu Ende zu sein.
Die für die Infantinnen hergerichtete Wohnung war so vorteilhaft und schön. Das neue Heim der Königstöchter befand sich im ersten Turm, der etwas abseits vom Hauptpalast der Alhambra stand, doch mit diesem durch die Burgmauer verbunden war, die die ganze Anhöhe umschloß. Auf der einen Seite überschaute man von dort das Innere der Festung und sah auf einen hübschen Blumengarten mit den seltensten Gewächsen. Auf der anderen Seite hatte man die Aussicht auf eine tiefe, schattige Schlucht, die das Gelände der Alhambra von dem des Generalife trennte. Das Innere des Turms war in kleine, gemütliche Gemächer unterteilt. Sie waren in feinstem arabischen Stil gehalten, und ihre Wände waren mit kunstvollem Zierwerk geschmückt. Diese wundervollen Kemenaten umgaben eine hohe Halle, deren gewölbte Decke fast bis zur Spitze des Turms hinaufreichte. Hier konnte man Arabesken, sinnvolle Inschriften, Stuckarbeiten und Stalakiten bewundern sowie zahlreiche in Gold und glänzenden Farben gehaltene Fresken. Der Boden war mit weißem Marmor belegt, und in der Mitte stand ein fein gearbeiteter Alabasterbrunnen; duftende Sträucher und Blumen fassten ihn ein, und schillernde Wasserstrahlen kühlten den Raum, während ihr leises Plätschern ein sanft einschläferndes Geräusch verursachte. Im Saal hingen Goldkäfige und Bauer aus Silberdraht geflochten, mit den schönsten Singvögeln, deren liebliches Zwitschern und Trillern jedes Ohr erfreute.
Wie man dem König berichtet hatte, waren die Prinzessinen auf Schloß Salobrena immer heiter und guter Dinge gewesen; so erwartete er natürlich, daß es ihnen auf der Alhambra in ihrem Feenpalast ganz besonders gefallen werde. Zu seinem Verdruß war das nicht der Fall; sie waren melancholisch, mit allem und jedem unzufrieden und schienen sich über irgend etwas tief zu grämen. Die Blumen teilten ihnen ihren Duft nicht mit, der Gesang der Nachtigall störte ihre Nachtruhe, und der Alabasterbrunnen mit seinem ewigen Rinnen und Plätschern, das vom Morgen bis zum Abend und wieder bis zum Morgen dauerte, war ihnen eine Qual und griff ihre Nerven an. Kurz gesagt, den drei jungen Frauen schien alles lästig zu sein und nichts eine Freude zu machen. Der König, ein Mann von aufbrausender und tyrannischer Gemütsart, nahm dieses Verhalten anfangs sehr ungnädig auf; aber bald fiel ihm ein, daß seine Töchter ja eigentlich keine Kinder mehr waren, sondern bereits erwachsene junge Frauen, deren Interesse natürlich nicht durch Spielereien gefesselt werden könne. „Da gehören jetzt andere Sachen her!“ sagte er sich und verschaffte allen Schneidern, Schustern, Webern und Juwelieren, Goldschmieden und Silberarbeitern des ganzen Zacatin Granadas Beschäftigung. Handwerker kamen und gingen, Kaufleute aus den fernsten Ländern brachten ihre Waren auf die Alhambra, Händler zogen reich beladen den Schlossberg hinauf und verkauften dem König ihre Kostbarkeiten.
Der besorgte Vater überschüttete seine gemütskranken Töchter mit Geschenken, nur um sie zufrieden zu sehen und ihren Sinn aufzuheitern. Es füllten sich die Kemenaten mit Gewändern aus Seide, Goldstoffen und Brokat, mit feinen Schultertüchern und Kaschmirschals; auf den Tischen lagen Halsbänder von Perlen und schweren Goldketten mit klaren Edelsteinen besetzt, auf Samtkissen wieder sah man Armbänder und Ringe; in kunstvollen Fläschchen und Dosen dufteten wohlriechende Essenzen und milde Salben. Doch das half alles nichts; die Prinzessinnen blieben bleich, bedrückt und traurig mitten in ihren Kostbarkeiten und glichen drei welken Rosenknospen, die von einem abgeschnittenen Zweige nieder hingen. Der König wußte nun wirklich nicht mehr, was er anfangen sollte. Für gewöhnlich vertraute er seinem eigenen Urteil, holte sich bei niemandem Rat und nahm natürlich auch keinen an. Die Launen der Einfälle dreier heiratsfähiger Töchter indessen reichen hin, um den klügsten Kopf in Verlegenheit zu bringen, also suchte er zum ersten Mal in seinem Leben fremden Rat. Er wandte sich an die erfahrene und kluge Duena und sagte zu ihr: „Kadiga, ich weiß, daß du eine der klügsten und treuesten Frauen auf der ganzen Welt bist. Dies war auch der auschlaggebende Grund, daß ich dich immer bei meinen Töchtern ließ. Väter können in der Wahl solcher Vertrauenspersonen nicht vorsichtig genug sein! Ich wünsche jetzt von dir, daß du die geheime Krankheit ausfindig machst, die den Frohsinn der Prinzessinnen zum Schwinden brachte und an ihrem Gemüte nagt. Suche mir ein Mittel, das meine Töchter wieder gesund und froh macht!“ Kadiga versprach, sich der Sache anzunehmen und ihr auf den Grund zu gehen. In Wirklichkeit wußte sie natürlich mehr von der Krankheit der Prinzessinnen als die Töchter selbst.
Indessen blieb sie mit ihnen zusammen, ließ sie keinen Augenblick allein und bemühte sich, ihr unbedingtes Vertrauen in der Herzenssache zu erlangen. „Meine lieben Kinder, warum seid ihr so traurig und betrübt an einem der schönsten Orte der Welt, wo ihr alles habt, was das Herz begehrt?“ fragte sie. Die Infantinnen schauten gedankenlos im Zimmer herum und seufzten dann tief auf. „Kinder, sprecht! Was fehlt euch denn? Soll ich euch den wunderbaren Papagei bringen lassen, der alle Sprachen spricht und von dem ganz Granada entzückt ist?“ „Greulich!“ rief die energische Zaida. „Ein häßlich keifender Vogel, der Worte ohne Gedanken plappert und schnattert. Nur Menschen ohne Verstand und Hirn können solch ein Tier um sich haben.“ „Soll ich um einen Affen vom Felsen von Gibraltar schicken, damit ihr euch an seine Posen ergötzen könnt?“ „Ein Affe? Nur nicht. Das hätte gerade noch gefehlt. Der Affe ist der abscheulichste Nachahmer des Menschen, häßlich und von widerlichem Geruch. Mir ist dieses Tier ausgesprochen verhaßt!“ So sprach die hübsche Zoraida mit fester Stimme, die keinen Widerspruch zu dulden schien.
„Und was sagt ihr zu dem bekannten Sänger Casem aus dem königlichen Harem von Marokko? Man erzählt von ihm, daß seine Stimme so fein sei wie die eines Frauenzimmers“, schlug Kadiga vor. „Wollt Ihr uns auf den Tod erschrecken“, sagte die zarte Zorahaida, „volle Freude an der Musik und am Gesang hat sich bei mir vollkommen verloren.“ „Ach, mein Kind, so würdest du bestimmt nicht reden“, erwiderte listig die Alte, „wenn du die Musik gehört hättest, die gestern Abend die drei spanischen Ritter machten, als sie nach des Tages Arbeit ausruhten. Erinnerst du dich noch der gefangenen Edelleute, die wir auf unserer Reise trafen? Aber Gott steh mir bei, Kinder! Was gibt es denn, daß ihr so errötet und plötzlich vor Aufregung zittert?“ „Nichts! Nichts, gute Mutter, bitte erzähle nur weiter.“ „Gut, wie ihr wollt. Als ich gestern abends bei den Torres Bermejas vorbeikam, sah ich die drei Ritter am Fuß des roten Turms sitzen und musizieren. Der eine spielte rührend schön auf der Gitarre, und die beiden anderen sangen zum Klang der Gitarre, so anmutig und hinreißend, daß selbst die hartherzigen Wächter bewegungslos da standen und verzauberten Bildsäulen glichen. Allah möge mir vergeben! Auch ich konnte mich der Wehmut und der Tränen nicht erwehren, als ich diese Lieder aus meiner Heimat hörte. Und dann erst drei so edle hübsche Jünglinge in Ketten und als Sklaven zu sehen!“ Jetzt wurde es für die gutherzige alte Frau wirklich zuviel. Laut schluchzte sie auf, und große Tränen kullerten ihr über die welken Wangen. „Vielleicht, Mutter, könntest du es einrichten, daß wir die drei Ritter einmal sehen dürfen“, sagte Zaida. „Etwas Musik würde bestimmt auch uns aufheitern“, warf Zoraida ein.
Die schüchterne Zorahaida schwieg und sagte gar nichts; doch legte sie liebevoll ihre schneeweißen Arme um den Hals der alten Kadiga. „Der Himmel bewahre mich vor so einer unsinnigen Tat“, klage die kluge alte Frau. „Was schwatzt ihr da, Kinder? Wißt ihr, was ihr da von mir verlangt? Euer Vater würde uns alle töten, wenn ihm so etwas zu Ohren käme. Gewiß, diese Ritter sind augenscheinlich edle und wohlerzogene Jünglinge; aber was liegt uns daran? Uns interessieren sie bestimmt nicht! Auch sind sie Feinde unseres heiligen Glaubens, und ihr dürft ohne Abscheu nicht an sie denken.“ Die drei Prinzessinnen ließen alle Register ihrer Überredungskunst spielen. Sie umarmten ihre Duena, schmeichelten, flehten, weinten und erklärten, daß eine abschlägige Antwort ihnen das Herz brechen würde. Was sollte sie tun? Sie war gewiß die klügste alte Frau auf der ganzen Welt und einer der treuesten Dienerinnen des Königs; aber konnte sie zusehen, wie drei schöne Prinzessinnen das Herz brach, wie ihre Gesundheit, ihr Frohsinn dahinschwanden?“
Kadiga lebte nun schon viele Jahre unter den Mauren und hatte seinerzeit gleich ihrer Herrin den Glauben gewechselt und diente seither treu dem Propheten.
Doch innerlich war sie Spanierin geblieben, und eine leise Sehnsucht nach dem Christentum, ihrem früheren Gottesglauben, konnte sie nie aus dem Herzen bannen. Sie sann daher nach, wie man die Wünsche der Prinzessinnen leicht und gefahrlos erfüllen könne, denn ganz so einfach war die Sache nicht. Die im roten Turm eingeschlossenen Gefangenen standen unter der Aufsicht eines langbärtigen und breitschultrigen Renegaten namens Hussein Baba, von dem die Sage ging, daß er leicht zu bestechen wäre. Ihn besuchte Kadiga heimlich, ließ vorsichtig ein großes Goldstück in seine Hand gleiten und sagte mit leiser Stimme: „Hussein Baba, meine Herrinnen, die Königstöchter, die im Turm dort eingeschlossen sind, kommen vor Einsamkeit um, denn keine Unterhaltung zerstreut sie. Vor einigen Tagen wurde ihnen von den musikalischen Talenten der drei spanischen Ritter erzählt, und nun möchten sie gerne eine Probe ihrer Künste hören. Ich kenne dich, alter Freund, und weiß, daß du in deiner Gutherzigkeit den armen Mädchen nicht diese unschuldige Freude versagen wirst.“ „O du alte Hexe! Fahr zum Teufel mit deinem Ansinnen! Du willst wohl meinen aufgespießten Kopf von der Spitze des Turms heruntergrinsen sehen? Denn das wäre der Lohn für die Untat, wenn der König sie entdeckte oder auch nur dieses Gespräch ihm zu Ohren käme.“ „Aufrichtig gesagt, ich sehe keine Gefahr dabei. Man muß nur die Sache so einrichten, daß die Laune der Prinzessinnen befriedigt wird und ihr Vater doch nichts davon erfährt. Du kennst die tiefe Klamm außerhalb der Burgmauer; vom Turm der Infantinnen sieht man direkt hinunter auf die grünen Hänge. Bring die drei Christen dorthin zur Arbeit und lasse sie in den Ruhestunden spielen und singen, und jedermann wird glauben, daß sie dies zu ihrer eigenen Unterhaltung täten. Die Prinzessinnen hören vom Fenster ihres Turms aus die Musik und den Gesang, und du kannst sicher sein, daß sie dich dafür reichlich und gut bezahlen werden.“
Als die gute alte Frau geredet hatte, drückte sie freundlich die rauhe Hand des Renegaten und ließ noch ein weiteres Goldstück darin zurück. Einer solch wohlklingenden und so überzeugender Beredsamkeit konnte natürlich niemand widerstehen, und auch Hussein nicht. Am nächsten Tag schon arbeiteten die Ritter mit ihren Kameraden in der Schlucht. Während der Mittagszeit schliefen ihre Unglücksgefährten im Schatten der dicht belaubten Bäume, die drei spanischen Ritter aber setzten sich auf den weichen Rasen am Fuße des Turms der Infantinnen und sangen ein Lied aus ihrer Heimat, daß einer von ihnen auf der Gitarre begleitete. Die Wachen dösten auf ihren Posten und taten schläfrig ihre Pflicht.
Das Tal und die Schlucht waren tief, und der Turm ragte hoch in die Lüfte, aber die Stimmen der Sänger stiegen in der Stille des heißen Sommermittags bis zu den Fenstern und dem Balkon empor. Dort lauschten die schönen Mädchen dem Lied, dessen Melodie und zärtliche Worte sie zutiefst rührten, denn die Duena hatte sie die spanische Sprache so gut und genau gelehrt, daß sie auch die feinsten Tonschattierungen hören, verstehen und fühlen konnten. Die alte Kadiga tat hingegen furchtbar erschrocken und rief angstvoll: „Allah behüte uns! Sie singen ein Liebeslied, das an euch gerichtet ist. Ja, kann sich jemand so eine Frechheit vorstellen? Ich werde gleich zum Aufseher laufen und ihnen eine Bastonade geben lassen, denn das ist wirklich zuviel!“ „Was, solch edlen Rittern willst du die Bastonade geben lassen, nur weil sie schön und lieblich singen?“ Voll Schauder schüttelten die Prinzessinnen ihre hübschen Köpfchen. Bei all dieser tugendhaften Entrüstung war die Alte versöhnlicher Natur und ließ sich beruhigen und besänftigen. Zudem schien die Musik ihre jungen Herrinnen wirklich wohltuend beeinflussen. Die Wangen der Mädchen zeigten einen feinen rosa Schimmer, ihre Augen fingen an zu glänzen, und die zarten Lippen schienen zu lächeln. Die kluge Kadiga dachte also nicht daran, das Liebeslied der Ritter zu unterbinden. Als die letzte Strophe verklungen war, blieb alles eine Weile still, nachdenklich schauten die Prinzessinnen vor sich hin.
Dann aber griff Zoraida nach der Laute und sang mit lieblicher Stimme leise und gerührt eine hübsche maurische Weise mit dem vielsagenden Refrain: „Wenn die Rosenknospe sich auch hinter Blättern birgt, so lauscht sie doch mit Entzücken der Nachtigall.“ Von dieser Zeit arbeiteten die Ritter fast täglich in der Schlucht. Der gewissenhafte Hussein Baba wurde immer nachsichtiger und von Tag zu Tag schläfriger auf seinem Posten. Eine Zeit lang bestand ein gar seltsamer Verkehr zwischen Turm und Außenwelt. Dem gegenseitigen Gedankenaustausch dienten nämlich Lieder und Romanzen, deren Inhalt sich einigermaßen entsprach und dazu diente, den Gefühlen der Liebespaare Ausdruck zu geben. Dieser geheime Verkehr wirkte wahre Wunder. Die Prinzessinnen wurden froh wie früher, ihre Augen glänzten feuriger als je, neckisch klangen ihre Stimmen, melodisch die Lauten, Zimbeln und Gitarren. Niemand jedoch konnte glücklicher sein als der König selbst, den diese Veränderung so überraschte, daß er die kluge Kadiga reichlich beschenkte und volle Freude seine drei Töchter besuchte.
Aber auch dieser fernschriflicher Verkehr hatte eines Tages sein Ende, denn die drei Ritter erschienen nicht mehr auf dem Arbeitsplatz unterm Turm. Vergebens spähten die Prinzessinnen umher, vergebens beugten sie sich weit über den Balkon, um eine Spur ihrer Ritter zu finden, vergebens sangen sie wie Nachtigallen, vergebens schlugen sie die Saiten. Keine Stimme antwortete aus dem Gebüsch, kein Lautenspiel war zu vernehmen, keine Ritter zeigten sich. Die kluge Kadiga ging besorgt fort, um etwas über die drei Spanier zu erfahren. Bald kam sie mit kummervollem Gesicht wieder heim und erzählte den verliebten Mädchen die traurige Neuigkeit, die man ihr mitgeteilt hatte. „Ach, meine Kinder! Ich sah es voraus, daß alles so kommen würde! Doch ihr wollt ja unbedingt euren Willen durchsetzen. Nun ist das Ende da, und ihr könnt eure Lauten zerschlagen oder an einen Weidenbaum hängen. Die spanischen Ritter wurden von ihren Familien losgekauft und wohnen nun unten in Granada, wo sie ihre Heimreise vorbereiten.“
Untröstlich waren die drei Mädchen, als sie diese Nachricht vernommen hatten. Die schöne Zaida zürnte ihrem Ritter, daß er ohne Abschied dahin gegangen war, denn diese Geringschätzung ihrer Person konnte sie nicht verschmerzen. Zoraida rang die Hände und weinte, sah in den Spiegel, wischte die Tränen ab und begann wieder zu weinen. Die schöne Zorahaida lehnte an der Brustwehr des Balkons, und ihre Tränen fielen hinunter auf den Abhang, wo die Ritter gesessen hatten, ehe sie ihre angebetenen Maurenprinzessinnen so treulos verließen. Die kluge Kadiga tat alles, um den großen Schmerz zu stillen, der die Mädchenherzen peinigte. So sagte sie oft: „Tröstet euch, meine Kinder. Das hat nichts zu bedeuten; man muß sich nur daran gewöhnen und sich mit derlei Dingen abfinden. Das ist eben der Lauf der Welt. Wenn ihr einmal so alt seid wie ich, dann werdet ihr die Männer schon kennen und wissen, wie man sie zu beurteilen hat. Diese drei Ritter haben sicherlich in Cordoba oder Sevilla ihre Bräute oder Geliebten, unter deren Balkon sie bald Serenaden und Ständchen singen werden, ohne jemals wieder an die maurischen Schönheiten auf der Alhambra zu denken. Deshalb tröstet euch, meine lieben Kinder, und verbannt sie aus euren Herzen, denn die Männer sind keine Tränen wert.“
Die tröstende Worte der klugen Kadiga verdoppelten aber den tiefen Kummer der drei Prinzessinnen, die zwei Tage lang nicht aus ihren Zimmern zu bringen waren und nur still vor sich hin weinten. Am dritten Morgen nun kam die alte Frau außer sich vor Aufregung daher gelaufen, stürzte fassungslos in den großen Salon und schrie voll Zorn: „Wer hätte einem sterblichen Menschen eine solche Frechheit zutrauen können! Aber mir geschieht ganz recht, denn nie hätte ich zugeben dürfen, daß euer ehrwürdiger Vater hintergangen wird. Erwähnt mir also mit keinem Worte mehr die spanischen Ritter, diese schlechten Menschen, die mich solcher Art beleidigt haben.“ „Nun, beste Kadiga, was ist denn geschehen?“ riefen die drei Mädchen aufgeregt durcheinander."
„Was geschehen ist, fragt ihr? Verrat ist geschehen; oder was noch schlimmer ist, zum Verrat sollte ich verleitet werden! Mir, der treuesten aller Untertanen, der vertrauenswürdigsten aller Duenas mutet man zu, daß ich meinen Herrn und König hintergehen könnte. Ja, meine Kinder staunt nur! Die spanischen Ritter haben es gewagt, mir vorzuschlagen, ich solle euch überreden, mit ihnen nach Cordoba zu fliehen, um sie dort zu heiraten!“ Die drei schönen Prinzessinnen ihrerseits wurden blaß und rot, und rot und blaß, und zitterten, schauten sich verstohlen und vielsagend in die Augen, sprachen aber kein einziges Wort. Die alte Frau konnte sich nicht beruhigen. Heftig bewegte sie sich hin und her, schüttelte die Fäuste und rief von Zeit zu Zeit zornig aus: „Daß mir eine solche Beleidigung angetan wurde! Mir, der treuesten aller Dienerinnen!“
Endlich trat die älteste Infantin, die den meisten Mut hatte und immer die erste war, zu ihr hin, legte ihre Hände auf die Schultern und sagte liebevoll: „Nun, beste Mutter, angenommen wir wären bereit, mit den drei christlichen Rittern zu fliehen. Wäre so etwas überhaupt möglich?“ Die gute Alte hörte bei diesen Worten zu jammern auf und erwiderte schnell: „Möglich? Wäre das schon! Die Ritter haben schon den Hussein Baba bestochen und mit ihm den ganzen Plan besprochen. Wer kann aber euren Vater hintergehen, diesen besten aller Könige! Euren Vater, der so viel Vertrauen in mich setzt!“ Wieder begann die brave Frau zu weinen, und händeringend lief sie im Saale auf und ab.
„Aber dieser beste aller Väter hat nie Vertrauen zu uns gehabt!“, rief die älteste Prinzessin selbstbewusst, „immer hielt er uns wie Gefangene hinter Schloß und Riegel! Nie konnten wir frei hingehen, wohin es uns behagte, nie tun, was wir wollten.“ „Freilich, das ist nur zu wahr“, ließ sich die Alte hören und blieb vor den jungen Damen stehen, „er hat euch wirklich ungerecht behandelt. Eingeschlossen ward ihr immer und musstet die schönsten Jahre eurer Jugend in einem alten Turm verbringen, gleich den duftenden Rosen, die man in einem Blumentopf welken läßt. Aber bedenkt doch, was es bedeutet, aus eurer schönen Heimat zu fliehen!“ „Und ist nicht das Land, das uns aufnehmen will, die Heimat unserer guten Mutter? Werden wir dort nicht in Freiheit leben? Und wird nicht jede von uns statt des strengen Vaters einen jungen und liebevollen Ehemann haben?“
„Freilich, das ist wohl wahr, und, ich muß gestehen, er war mit euch wirklich ein harter Tyrann, aber“, und wieder brach der Jammer aus ihr, „wollt ihr mich dann zurücklassen, allein und verlassen? Seid sicher, daß sein Zorn und seine Rache mich hier zerschmettert.“ „Doch gewiß nicht, meine gute Kadiga! Kannst du nicht mit uns fliehen?“ „Das wäre wohl möglich, um bei der Wahrheit zu bleiben, muß ich euch sagen, daß ich bereits mit Hussein Baba gesprochen habe. Er versprach, auch mir zu helfen, wenn ich euch auf eurer Flucht begleiten wollte. Aber Kinder, nein, schlagt euch das besser alles aus dem Kopf? Ihr könnt doch nicht euren Väterglauben verleugnen!“ „Der christliche Glaube war das ursprüngliche Religionsbekenntnis meiner Mutter, ehe sie auf die Alhambra kam“, sagte wieder die älteste Infantin, „und ich bin bereit, ihn anzunehmen, und meine Schwestern auch, davon bin ich überzeugt!“ „Recht hast du!“ rief die alte Frau voll Freude aus, „ja, es war der Glaube deiner Mutter. Bitterlich beweinte sie oft ihren Abfall, und auf dem Totenbett mußte ich ihr versprechen, für euer Seelenheil zu sorgen.
Heute nun bin ich glücklich und froh, denn ich weiß, daß ihr auf dem richtigen Weg seid, auf dem Weg, der zur Taufe und ins Glück führt. Ich freue mich, daß ihr Christinnen werden wollt, weil auch ich es war und im Herzen immer geblieben bin. Jetzt ist die Gelegenheit dazu da. Ich sprach darüber schon mit Hussein Baba; er ist Spanier von Geburt und übrigens ein freundlicher Mensch. Wir stammen aus der gleichen Gegend, und auch er will in seine alte Heimat zurück. Die drei edlen Ritter drunten in Alhambra sagten hochherzig ihre Hilfe zu und werden uns anständig ausstatten, wenn wir dann im Heimatdorf eine Ehe eingehen sollten.“
Kurz und gut, es ergab sich, daß diese außergewöhnlich kluge und vorsichtige Frau mit den Rittern und dem Renegaten bereits den ganzen Fluchtplan entworfen hatte, der nun verwirklicht werden sollte.
Die älteste Prinzessin war sofort einverstanden, und ihr energisches Verhalten bestimmte und beeinfußte wie immer den Willen ihrer beiden Schwestern. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muß allerdings gesagt werden, daß die jüngste Prinzessin etwas zauderte und nicht gleich wußte, was sie machen sollte. Ihr sanftes und schüchternes Wesen wollte keinen so brüsken Bruch, und allsogleich begann in ihrem Herzen ein schwerer Kampf, in dem sich das Gefühl kindlicher Pflicht und jugendlicher Leidenschaft gegenüberstanden. Wie es schon immer ging, siegte in diesem ungleichen Zwiespalt die Liebe zum fremden Ritter, der drang nach Gattenliebe. Still und leise weinend schloß sie sich also ihren Schwestern an und rüstete sich zur Flucht.
Durch den Hügel, auf dem die Alhambra steht, führte in früheren Zeiten eine große Zahl von unterirdischen Gängen. Diese bildeten ein wahres Netz von Irrwegen, auf denen der Eingeweihte von Alhambra ungesehen in die Stadt und selbst bis zu den entfernten Ausfallspforten und Schlupftüren an den Ufern der Darro und des Genil gelangen konnte. Im eigenen Interesse und aus Staatsräson ließen die Maurenkönige im Laufe der Jahrhunderte die Asabica durchbohren, und durch diesen Gang liefen sie, wenn Empörer ihnen nach dem kostbaren Leben trachteten; aber oft zogen sie auch diese geheimen Wege den öffentlichen Straßen vor, denn heikle Unternehmungen waren nie für jedermanns Auge und Ohr. Dem Fluchtplan nach sollte Hussein Baba die Prinzessinnen durch einen der genannten Gänge bis zur geheimen Schlupfpforte jenseits der Stadtmauern führen, wo die Ritter mit schnellen Pferden zu warten versprachen, um alle über die Grenze in Sicherheit zu bringen.
Die vorher bestimmte Nacht kam: Der Turm der Infantinnen war wie gewöhnlich verschlossen worden, und die Alhambra lag in tiefem Schlummer. Gegen Mitternacht bezog die kluge Kadiga ihren Horchposten auf dem Balkon und lauschte gespannt in den Garten hinab. Bald kam Hussein Baba daher und gab das verabredete Zeichen. Die Duena befestigte sogleich das obere Ende einer Strickleiter am Balkon und ließ sie dann vorsichtig in den Garten hinab. Mit großer Behendigkeit schwang sich die alte Frau über die Brüstung und stieg resolut hinunter. Ihr folgten klopfenden Herzens die beiden älteren Prinzessinnen.
Als aber die Reihe an Zorahaida kam, da zauderte diese; mehrmals setzte sie ihren kleinen Fuß auf die Leiter, aber ebenso zog sie ihn wieder zurück. Ihr Körper zitterte, das kleine Herz pochte heftig, und zögernd blieb die jüngste Königstochter auf dem Balkon stehen. Sie warf einen kummervollen Blick ins Zimmer zurück, dessen Wandschmuck, Decken und Polster im hellen Mondlicht gleißten. Wie ein Vogel in seinem Käfig hatte sie im Turm gelebt, sorglos, ruhig und ohne Aufregungen, geborgen und beschützt waren die Tage dahingegangen. Wer konnte ihr sagen, was geschah, wenn sie frei in die weite Welt hinausflatterte! Aber schon erinnerte sie sich ihres Ritters aus dem Land der Christen, und rasch saß sie auf der Brüstung und setzte den Fuß auf die Leiter. Hinunter wollte sie zu ihm! Doch da kam ihr der alte Vater in den Sinn, und sie zuckte wieder zurück. Schrecklich war der Kampf, der im Herzen dieses zarten Wesens tobte. Voll Ehrfurcht liebte sie ihren Vater; beim Gedanken an den jungen Christen wurde ihr heiß und kalt zugleich, und voll Liebe und Zuneigung erinnerte sie sich seiner. Aber sie war noch so jung, schüchtern und wußte nichts von der Welt, von Liebe und Familienglück.
Vergebens flehten ihre Schwestern, schalt die Duena und fluchte gotteserbärmlich der Renegat. Das kleine Maurenfräulein schaute oben am Balkon zu ihren Schwestern hinunter; sie konnte sich nicht entschließen. Der Gedanke an die Flucht und die Freiheit lockte sie, doch die Furcht vor ungewissen Gefahren riet ihr zum Bleiben. Aus der Ferne erschollen nun gar noch Schritte! Jeden Augenblick konnte man entdeckt werden! Rauh rief der Renegat zum Balkon hinauf: „Die Wachen machen die Runde; wenn wir zögern sind wir verloren. Steigt augenblicklich herunter, oder wir gehen allein und lassen Euch zurück, denn keine Zeit ist mehr zu verlieren.“ Zorahaida kämpfte mit sich selbst, und niemand erfuhr jemals, was in diesen wenigen Sekunden im Innern des Mädchens vergangen war. Mit verzweifeltem Entschluß machte sie die Strickleiter los und warf sie in den Garten hinunter. „Es ist entschieden!“ rief sie, „ich kann nicht mit. Allah geleite und segne euch und schenke euch, meine geliebten Schwestern, Glück und Liebe.“
Schaudernd schrien die Prinzessinnen auf und wollten noch zögern. Sie konnten doch ihre kleine Schwester nicht allein zurücklassen! Die Wache kam aber näher und immer näher. Wütend stieß der Renegat die drei Frauen in ein dunkles Felsloch und führte sie kreuz und quer sicher unterirdische Gänge, und sie gelangten glücklich an ein eisernes Tor vor der Stadt. Hussein sperrte auf, und verabredungsgemäß nahmen sie die drei spanischen Ritter die die Uniform der vom Renegaten befehligten Turmwache trugen, in Empfang. Zorn und Trauer überkam Zorahaidas Anbeter, als er sah, daß das schöne Mädchen nicht gekommen war. Kurz berichtete Kadiga ihm, was sich ereignet hatte, und daß man keine Zeit verlieren dürfe. Die beiden Prinzessinnen wurden hinter ihre Verehrer gesetzt, und die kluge Kadiga stieg zum Renegaten aufs Pferd; dann sprengten alle im wildesten Tempo auf den Paß von Lope zu, über den sie durchs Gebirge nach Cordoba kommen wollten. Doch bald darauf hörte man von der Alhambra her die Alarmzeichen; Hornsignale und Trompetenstöße tönten von den Zinnen des Wachtturms durch die Stille der Nacht.
„Unsere Flucht ist entdeckt worden“, sagte der Renegat. „Wir haben flinke Rosse, der Mond hat sich verzogen, und die Nacht ist nun stockdunkel. „Wir werden es schaffen!“ antworteten die Ritter. Sie gaben ihren Pferden die Sporen und jagten durch die Vega. Schon kamen sie an den Fuß der Sierra Elvira, die wie ein Vorgebirge sich weit in die Ebene hineinstreckt. Der Renegat hielt an und horchte: „Bis jetzt ist noch niemand auf unserer Spur; die Flucht in die Berge wird gelingen!“ Aber während er noch sprach, leuchtete auf der Wehrplatte des Bergfrieds der Alhambra eine helle Flamme auf. „Hölle und Teufel!“ brüllte der Renegat, „das Leuchtfeuer ruft die ganzen Wachmannschaften in den Bergen auf ihre Alarmposten. Fort und weiter! Gebt den Pferden die Sporen. Es ist keine Zeit zu verlieren!“ Es war ein halsbrecherischer Galopp. Dumpf tönten die Hufe ihrer Pferde auf dem felsigen Weg, der um die Sierra Elvira herumführt.
Von Augenblick zu Augenblick wurde die Lage dramatischer, und nun sahen die Reiter gar, daß von allen Berggipfeln und Hängen Lichtsignale aufflammten, als Antwortzeichen von der Alhambra. „Vorwärts! Vorwärts!“ rief Hussein fluchend dazwischen, „zur Brücke, zur Brücke, ehe das Alarmzeichen dort gesehen wird!“ Scharf ritten sie um eine Felsennase herum und erblickten die bekannte Puenta de Pios, die über einem Wildbach führende Holzbrücke, um deren Besitz Mauren und Christen stritten. Zum Schrecken lag der Brückenkopf schon im hellsten Kreidelicht und strotzte von bewaffneten Männern. Der Renegat riß sein Pferd zurück, erhob sich in den Steigbügeln und sah sich wie suchend um.
Alles dauerte nur wenige Augenblicke, dann winkte Hussein den Rittern und sprengte weiter, doch vom Weg ab, den Fluß entlang. Nach Minuten stützte er Hals über Kopf und hoch zu Roß in das schäumende Wasser. Die Ritter ermahnten die Prinzessinnen sich gut festzuhalten und folgten beherzt ihrem Führer. Hoch schlugen die Wogen, die Strömung trieb sie weit flussabwärts, und die Gischt durchnäßte sie bis auf die Haut, doch glücklich erreichten sie alle das andere Ufer. Auf schwer zugängigen und einsamen Pfaden, durch wilde Schluchten und über hohe Pässe führte der Renegat seine Schützlinge aus dem Maurenreich, und nach schweren Strapazen erreichten sie endlich Cordoba, die schönste Stadt am Guadalquivit. Dort gab es helle Freude, und die Heimkehr der tapferen Ritter wurde festlich begangen und gefeiert, denn sie gehörten zu den ersten Familien des kastilischen Reichs. Die Prinzessinnen wurden sofort getauft, und in den Schoß der Kirche aufgenommen, sie heirateten in wenigen Tagen, im prächtigen Dom ihrer neuen Heimatstadt ihrer Ritter und Retter.
In unserer Eile, um die Flucht der Infantinnen quer durch den Strom und über Berg und Tal durchs Gebirge hinauf zu einem glücklichen Ende zu führen, haben wir die kluge Kadiga ganz vergessen, denn auch ihr Schicksal ist erwähnenswert. Sie hatte sich beim wilden Ritt über die Vega wie eine Katze an Hussein Baba geklammert, schrie bei jedem Sprung laut auf, entlockte dem bärtigen Renegaten manchen Fluch, saß aber fest auf der Kruppe hinterm Sattel. Doch als der Reiter ins reißende Wasser setzt, da kannte ihre Angst keine Grenzen mehr. „Umklammere mich nicht so fest“, schrie der Renegat, „fasse mit beiden Händen meinen Gürtel und fürchte nichts.“ Sie tat wie ihr geheißen und hielt sich an dem breiten Leibriemen Husseins fest. Als aber dieser nach dem Höllenritt endlich mit den Rittern auf der Passhöhe anhielt, um Atem zu schöpfen, da war die Duena nicht mehr zu sehen.
„Was ist aus Kadiga geworden?“ riefen voll Schrecken die Prinzessinnen. „Allah allein weiß es!“ erwiderte der Renegat. „Es war ein reines Unglück! Als wir mitten im Fluß waren, löste sich mein Gürtel und Kadiga wurde mit ihm stromwärts gerissen. Allahs Wille geschehe! Aber es war ein schöner, golddurchwirkter Gürtel von großem Wert.
Die Reiter hatten natürlich keine Zeit zu langen Klagen und mußten weiter, und die Prinzessinnen beweinten bitterlich den Verlust ihrer treuen Ratgeberin. Jene Frau aber verlor nur die Hälfte von den neun Leben, die sie, einer Wildkatze gleich, besaß. Ein Fischer zog sie nämlich weiter unten ans Ufer und dürfte über den seltsamen Fisch im Netzt wohl gestaunt haben. Was dann aus der klugen Kadiga wurde, darüber schweigt die Geschichte. Doch so viel ist sicher, daß sie ihre Klugheit abermals unter Beweis gestellt hat und sich niemals mehr in den Machtbereich Mohammeds des Linkshänders wagte. Auch wissen wir nicht, was der scharfsinnige König tat, als ihm die Flucht seiner Töchter gemeldet wurde. Es war, wie gesagt, das erste Mal, daß er fremden Rat gesucht hatte. Und wie schnöde war er hintergangen worden! Nie hörte man wieder, daß er sich eine ähnliche Blöße gegeben hätte.
Seine jüngste Tochter, die ihm treu geblieben war, ließ er aufs strengste bewachen, und man glaubt, sie habe es bitter bereut, damals nicht mit ihren beiden Schwestern geflohen zu sein. Dann und wann sah man sie auf den Zinnen des Turmes; müde lehnte sie an der Brüstung und schaute traurig zu den Bergen hinüber, hinter denen Cordoba lag. Klagend sang sie zur Laute herzzerbrechende Lieder und beweinte den Verlust ihrer Schwestern und des geliebten Mannes. Jung beschloß sie ihr einsamens Leben und wurde, so erzählt man sich, in einem Gewölbe unterm Turm begraben. Viele Sagen erzählen uns von ihr und ihrem frühen Tod.
Märchen und Sagen aus Spanien
DER ZAUBERER PALERMO
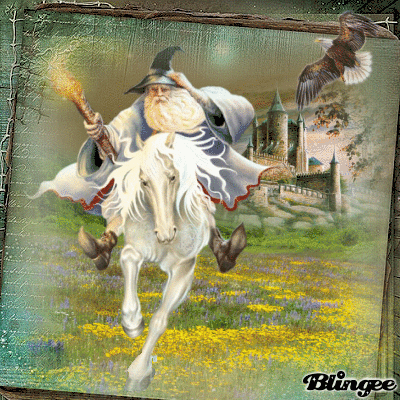
Nun lieber Herr, also:
Es war einmal eine Königin, die hatte einen Sohn, der war sehr leichtsinnig und verspielte alles, was er hatte. Eines Tage spielte er sogar um seine Juwelen und Besitzungen und verlor alles. Da zog er ganz verzweifelt in die Welt hinaus. Er hatte sagen hören, daß der Zauberer Palermo unglaublich reich sei und alles könne, was er wolle, weil er ja ein Zauberer war. Der Prinz, der nichts wußte, was er sonst anfangen sollte, beschloß, ihn auf gut Glück zu suchen, denn er konnte nichts herausbekommen, wo er wohnte.
Und eines Tages, als er es am wenigsten erwartete, stand der Zauberer plötzlich vor ihm: „Ich weiß, daß du mich hier suchst“, sagte der Zauberer, „was willst du von mir?“ „Ich suche Euch, denn ich habe alles verspielt, was ich besaß, und ich möchte, daß Ihr mir helft, es wiederzuerlangen.“ „Gut; ich will dir einen Beutel geben, damit wirst du stets beim Spiel gewinnen; doch gebe ich ihn dir nur, wenn du mir an einem Tag in diesem Jahr alles in meinem Hause, das jenseits des Meeres liegt, bezahlst und eine meiner Töchter heiratest.“ „Abgemacht“, sagte der Prinz, „das will ich tun.“
Er nahm den Beutel, begann zu spielen und bekam nicht nur das Verlorene zurück, sondern gewann stets soviel, daß keiner mit ihm spielen mochte. Das Jahr verstrich, und da er sein Versprechen einlösen wollte, machte er sich auf die Suche nach dem Zauberer Palermo. Er brach auf und zog weiter und immer weiter, bis er an ein Schloß kam.
Eine Alte kam heraus und er fragte sie, ob sie wisse, wo das Schloß des Zauberers Palermo sei. „In meinem ganzen Leben habe ich diesen Namen noch nicht gehört“, sagte die Alte, „doch wartet ein Weilchen, denn dies ist das Schloß der kleinen Vögel, und vielleicht weiß einer von ihnen, wo es liegt.“ Er blieb die Nacht über dort, und immer, wenn einige Vögel zurückkamen, fragte die Alte sie, ob sie wüßten, wo der Zauberer Palermo wohne; doch keiner konnte es ihr richtig sage. „Nun, Ihr hört ja“, sagte die Alte, „keiner weiß es. Geht ins Schloß der großen Vögel, die haben den Zauberer vielleicht gesehen, da sie doch weiter fliegen als die kleinen.“
Der Prinz brach auf und schritt rüstig voran, immer weiter und immer weiter, bis er schließlich wieder ein Schloß erreichte, daß den großen Vögeln gehörte. Als er ankam, erschien eine Alte und fragte ihn, womit sie ihm zu Diensten sein könne. „Liebe Frau, ich suche das Schloß des Zauberers Palermo und möchte Euch bitten, mir zu sagen, wenn Ihr es wißt.“ „Das kenne ich nicht“, sagte die Alte, „doch tretet ein; hier schlafen alle großen Vögel und es kann angehen, daß einer von ihnen, das Schloß gesehen hat.“ Die Vögel kamen zurück, um sich auszuruhen, und jeden fragte die Alte nach dem Schloß, doch alle sagten, daß es ihnen nicht bekannt sei.
Schließlich erschien der Adler, und die Alte sagte zu ihm: „Hör einmal! Hier ist ein Jüngling angekommen, der sucht das Schloß des Zauberers Palermo und er möchte wissen, ob du, der du stets so große Strecken zurücklegst, es vielleicht ausfindig gemacht hast.“ „Ja“, sagte der Adler, „ich weiß, wo es ist, doch wird es für ihn nicht leicht sein, dahin zu kommen, denn es liegt jenseits des Wassers, und diese Reise kann er nicht machen.“ „Und könntest du ihn nicht dahin bringen?“ „Wenn du es gern willst, werde ich ihn dahin bringen; doch dazu ist es nötig, daß er sein Pferd und einen Hammel tötet, und jedes Mal, wenn ich ihn um etwas zu fressen bitte, muß er mir das eine Viertel des Hammels geben; denn wenn ich unterwegs schwach werde, fallen wir beide ins Meer, und da der Weg sehr weit ist, so weiß ich nicht, ob ich mit meinen Kräften ausreiche. Wenn er damit einverstanden ist, soll er morgen früh reisefertig sein.“
Die Alte erzählte dem Prinzen, was der Adler gesagt hatte, und da er unbedingt ins Schloß des Zauberers wollte, tötete er sein Pferd und einen Hammel und machte sich reisefertig. Sobald es zu dämmern begann, belud er den Adler mit dem Pferd und dem Hammel und bestieg ihn dann selbst; der Adler schwang sich empor und begann loszufliegen, doch ging es zuerst recht langsam wegen des schweren Gewichtes, das er trug. Als sie eine Zeitlang geflogen waren, krächzte er und drehte den Schnabel zur Seite, und der Prinz gab ihm das eine Viertel des Pferdes.
Nach einiger Zeit mußte er ihm noch eines geben, und so warf er ihm nacheinander die anderen beiden Viertel des Pferdes und die vier Viertel des Hammels zu, doch immer noch sah man nichts von dem Wasser. Schon war das Fleisch ausgegangen, als der Adler wieder krächzte; da sage er zu ihm: „Pick von meinem Oberschenkel, denn ich habe kein Fleisch mehr.“ Da sah man in der Ferne Land, und obwohl der Adler sich sehr schwach fühlte, raffte er noch einmal seine Kräfte zusammen, überflog das Meer, setzte ihn an Land und sagte zu ihm: „Hätten wir noch etwas länger gebraucht, wären wir ins Wasser gefallen, denn ich war schon am Ende meiner Kräfte. Siehst du dort das Gebäude in der Ferne? Das ist das Schloß, das du suchst; solltest du dich in irgendeiner Verlegenheit befinden, so sage nur: „Adler beschütze mich!", dann komme ich dir zu Hilfe.“ Damit stieg der Adler in die Lüfte und verschwand.
Der Prinz ging in das Schloß; kaum war er eingetreten, da kam ihm schon der Zauberer entgegen. „Ich bin gekommen, um Euch den Beutel zu bezahlen, den Ihr mir gegeben habt, damit Ihr seht, daß ich mein Wort halte“, sagte der Prinz. „Gut“, antwortete der Zauberer, „auch mir gefällt es, mein Versprechen zu halten; ich habe eine meiner Töchter zur Heirat angeboten, doch vorher mußt du einige Proben bestehen, die ich dir stelle. Tritt an dies Fenster. Was siehst du dort?“ „Himmel, Wasser und ödes Land.“ „Nun gut; du musst in vierundzwanzig Stunden das Land dort roden, die Erde pflügen, Saat streuen und mir von dem Weizen, den du erntest ein warmes Brötchen zu meiner Tasse Schokolade bringen.“
„Ja, aber wie soll ich das alles in vierundzwanzig Stunden machen?“ „Ich gebe dir keine Minute mehr. Wenn du es bis morgen nicht vollbracht hast, gehört dein Leben mir.“ „Jetzt sind wir ja wirklich schön dran!“ sprach der Prinz bei sich; und er ging auf das Feld hinaus und sagte: „Adler, beschütze mich.“ Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, da stand ein wunderschönes Mädchen vor ihm, das sagte: „Ich bin die jüngste Tochter des Zauberers Palermo und bin gekommen, das Wort zu halten, das der Adler, der in meinem Dienst steht, dir gab. Mein Vater nimmt an, dass du mich von seinen drei Töchtern zur Frau wählen wirst; und da er nicht will, dass ich fortgehe, versucht er, dir Schwierigkeiten in den Weg zu legen, damit du ihn von seinem Versprechen entbindest, wenn du sie nicht überwinden kannst. Doch hab keine Angst, ich werde dir stets zu Hilfe kommen. Was hat er denn heute von dir gefordert?“
„Er will, daß ich innerhalb von vierundzwanzig Stunden das Ödland pflüge, Saat streue und ihm daraus ein warmes Brötchen zu seiner Tasse Schokolade beschaffe.“ „Gut; mach dir darüber keine Gedanken. Leg dich schlafen; ich werde dafür sorgen, dass alles so geschieht.“ Und so geschah es auch; er legte sich zu Bett, und als er am nächsten Morgen aufstand, war das ganze Land in ein Stoppelfeld verwandelt, und er sah die Tochter des Zauberers kommen, die ihm in einem kleinen Tuch ein warmes Brötchen gab. „Nimm, bring das Brötchen meinem Vater, doch habt acht und sage nichts davon, daß ich dir geholfen habe.“
Der Prinz nahm das Brötchen und brachte es dem Zauberer. Der ging sogleich ans Fenster, um hinauszuschauen; als er das Stoppelfeld erblickte, fragte er ihn, wie er das nur zuwege gebracht habe. „Das ist für mich ein leichtes“, sagte der Prinz. „Nun gut; jetzt mußt du eine weitere Probe bestehen.“ Und er führte ihn in den Stall und zeigte ihm ein sehr schönes Pferd, das da stand. Dann sagte er: „Du mußt dieses Pferd zähmen; doch ich mache dich darauf aufmerksam, daß es sehr wild ist und die geringste Unachtsamkeit dich das Leben kosten kann.“
Der Prinz sagte gut, er wolle das machen; dann ging er hinaus aufs Feld und rief den Adler, und wieder erschien die Tochter des Zauberers. „Was willst du von mir?“ „Dein Vater hat mir befohlen, ein Pferd zu zähmen, das er in seinem Stall hat, und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß es sehr wild ist.“ „Gut, nun hör genau zu: hole morgen das Pferd, das dann schon gezäumt sein wird, aus dem Stall, doch steige nicht auf; führ es aufs Feld und nimm einen starken Stock mit, der nicht entzwei bricht. Denk daran, daß das Pferd mein Vater ist, der Sattel meine Mutter, die Steigbügel meine Schwestern und die Zügel ich. Sobald du dann draußen auf dem Feld bist, beginn auf das Pferd, den Sattel und die Bügel loszuhauen, doch schlag nicht auf die Zügel, denn dann schlägst du mich.“
Und wirklich, so wie sie ihm gesagt hatte, tat er. Am nächsten Morgen führte er das Pferd aufs Feld, und mit einer Peitsche, die er vorsichtshalber gleich mitgenommen hatte, verabreichte er dem Pferd derartige Hiebe, daß ihm die Knochen krachten. Das Pferd bäumte sich auf, doch er schlug und schlug auf das Tier los, auf den Sattel und die Bügel, bis das Pferd schließlich zu Kreuze kroch. Dann ging er ins Schloß zurück, und das erste was er tat, war, den Zauberer, seine Frau und seine ältesten Töchter aufzusuchen, die alle vier zu Bett lagen und dicke Verbände trugen. Er fragte sie, was ihnen geschehen sei, und sie antworteten ihm, eine Wand sei eingestürzt und habe sie so zugerichtet.
Es vergingen einige Tage und es ging ihnen wieder besser. Doch der Zauberer war jetzt mißtrauisch, denn er hatte bemerkt, daß seine jüngste Tochter nichts von den Schlägen abbekommen hatte, und er fürchtete, daß sie es war, die dem Prinzen half. „Hör mal“, sagte er zu dem Jüngling, „ich will dich jetzt zum letzten Mal auf die Probe stellen. Vor vielen Jahren fiel meiner Großmutter ein Ring ins Meer, der für mich sehr wertvoll ist, du sollst ihn jetzt rausholen.“ „Gut“, antwortete der Prinz, „ich will ihn jetzt herausholen.“
Er ging hinaus aufs Feld und sagte: „Adler, beschütze mich", und zugleich erschien Luise, denn so hieß die jüngste Tochter des Zauberers, und fragte ihn: „Was willst du? Was verlangt mein Vater von dir?“ „Er will, daß ich ihm einen Ring aus dem Meer hole, den seine Großmutter hineinfallen ließ.“ „Das ist schon ein gefährliches Unternehmen, doch wir werden das auch noch schaffen. Aber dazu mußt du mich töten.“ „Dann kann lieber der Ring im Meer bleiben, denn töten tue ich auf keinen Fall.“ „Doch, du mußt mich töten; aber keine Angst, ich komme ins Leben zurück. Du nimmst ein Messer, tötest mich und schneidest meinen Körper in Stücke, legst sie zusammen in ein Tuch und wirfst sie ins Meer. Doch paß auf, daß nichts auf die Erde fällt, denn das fehlt meinem Körper nachher.“
Der Prinz konnte es nicht über sich bringen, das zu tun, doch Luise beteuerte ihm so sehr, ihr werde nichts geschehen, daß er schließlich tat, was sie ihm gesagt hatte. Nachdem er sie getötet hatte, schnitt er den Körper in Stücke und warf sie ins Meer, doch blieb am Tuch ein Stückchen Fleisch kleben, das auf den Boden fiel.
Nach einiger Zeit begann das Wasser zu schäumen, und gleich darauf kam Luise mit dem Ring hervor, den sie dem Prinzen gab; aber ihr fehlte der kleine Finger. „Siehst du“, sagte sie zu ihm, „du hast nicht genügend achtgegeben, und dafür fehlt mir nun dieser Finger. Wenn mein Vater das sieht, weiß er gleich, daß ich dir geholfen habe.“ Der Prinz ging zum Zauberer und gab ihm den Ring, und als der ihn sah, sprach er bei sich: „Ganz bestimmt steckt Luise dahinter!“ Und als die drei Töchter kamen, beobachtete der Vater sie genau, und als er sah, daß die Jüngste ein Taschentuch um die eine Hand gebunden hatte, fragte er sie, was ihr fehle.
„Es ist nichts“, antwortete sie, „ich habe mich geschnitten; aber das ist bald wieder besser.“ Doch der Vater ließ sich nicht täuschen und sprach bei sich: „Ich wußte ja, daß meine Tochter dahintersteckt; doch das soll sie mir büßen.“ Und da er nicht mehr umhin konnte, sein Versprechen zu erfüllen, sagte er zu dem Prinzen: „Du hast alles vollbracht, was ich von dir verlangt habe, jetzt ist es an mir, mein Wort zu halten; du kannst dir nun eine meiner Töchter auswählen; doch mußt du sie dir mit verbundenen Augen wählen.“ Der Jüngling wurde durch diese Laune des Zauberers in große Verlegenheit versetzt, doch als er Luise ansah, die auf die eine Hand wies, an der der Finger fehlte, nahm er den Vorschlag an.
Man verband ihm die Augen, und der Zauberer rief seine drei Töchter zu sich. Der Prinz ergriff nacheinander ihre Hände, und als er die von Luise faßte, sagte er, die wolle er heiraten. Dem Vater gefiel das gar nicht, aber er konnte jetzt nicht mehr zurück und mußte sie verheiraten, doch schwor er, daß die beiden es ihm büßen sollten. Am Abend als sie zu Bett gingen, hörten sie die Stimme des Vaters: „Luise, Luise!“ „Ihr wünscht, Vater?“ Und indem sie ihren Mann ansah, sagte sie: „Mein Vater ist wütend auf mich, weil wir ihn besiegt haben, und er hat beschlossen, uns zu töten; deswegen müssen wir an unsere Rettung denken. Geh in den Pferdestall, dort wirst du zwei Pferde finden. Das dickere läuft dreißig Meilen in einer Stunde und das dünnere vierzig. Nimm dieses und gib mir Bescheid, wenn es gesattelt ist.“
Der Prinz ging fort; indessen holte Luise ein Gefäß und spie hinein. Als er zurückkam, hörten sie den Vater wieder rufen, und sie antwortete wieder, wie das erste Mal. „Siehst du“, sagte sie zu ihrem Manne, „er wartet darauf, daß ich nicht mehr antworte, um dann herauszukommen und uns zu töten; doch mein Speichel, der hier in dem Gefäß ist, wird statt meiner antworten; bis er ausgetrocknet ist, sind wir schon weit weg.“ Sie stiegen in den Hof hinunter, und als sie das Pferd erblickten, sagte sie: „Mein Gott, Mann! Du hast das falsche Pferd genommen!“ „Wenn du willst, hole ich schnell das andere.“ „Nein, es ist keine Zeit mehr; laß uns so schnell wie möglich eilen.“
Sie stiegen auf das Pferd, und wie im Fluge rasten sie dahin. Indessen rief der Vater von Zeit zu Zeit Luise wieder: „Luise, Luise!“ Und der Speichel antwortete: „Ihr wünscht, Vater?“ Doch da der Speichel allmählich trocknete, wurde das Echo von Mal zu Mal schwächer, bis es schließlich ganz aufhörte. Da sagte der Vater: „Jetzt sind sie eingeschlafen; nun sollen sie büßen.“ Er ergriff ein Schwert und schritt geradewegs auf das Bett zu, und als er merkte, daß sie dort nicht lagen, begriff er, daß sie entwischt waren, und ging in den Stall hinunter. Als er das Pferd sah, sagte er: „Noch kann ich sie zu fassen bekommen, denn sie haben das Vierzigmeilenpferd hier gelassen.“
Er stieg aufs Pferd und raste hinter ihnen her, und obwohl sie ihm ein gutes Stück voraus waren, dauerte es doch nicht lange, bis sie ihn kommen sahen, denn sein Pferd legte ja zehn Meilen mehr die Stunde zurück. „Wir sind verloren“, sagte Luise, „denn mein Vater folgt uns auf dem Fuße, aber ich weiß schon, wie wir ihm entkommen können. Sobald mein Vater hier ist, verwandle ich das Pferd in einen Garten, dich in den Gärtner und mich in einen Kopfsalat; wenn er dich etwas fragt, stell dich taub!“ Und wirklich, so wie sie es sagte, geschah es auch.
Der Vater kam an, und als der den Gärtner sah, fragte er ihn: „Lieber Mann, habt Ihr hier einen Mann und eine Frau auf einem Pferd vorbeikommen sehen?“ „Ich habe nur diesen Salat, aber der ist gut.“ „Davon rede ich doch nicht, ich möchte wissen, ob hier zwei junge Leute zu Pferd vorbeigekommen sind.“ „Dieses Jahr gibt es wenig; aber nächstes Jahr wird es mehr geben.“ „Der Teufel soll dich holen!“ sagte der Zauberer und kehrte in sein Schloß zurück, wo er seiner Frau erzählte, was er erlebt hatte. „Du bist ein Dummkopf“, sagte seine Frau zu ihm, „sie haben dich getäuscht, denn der Garten, der Gärtner und der Kopfsalat sind sie selber gewesen.“
Der Vater eilte davon, doch fand er jetzt den Garten nicht mehr, denn als er umgekehrt war, hatten die beiden sofort ihren Weg fortgesetzt. Aber bald war er ihnen wieder ganz dicht auf den Fersen; da sagte Luise: „Da kommt mein Vater schon wieder. Das Pferd soll sich in eine Einsiedelei, du dich in einen Einsiedler und ich mich in das Heiligenbild verwandeln!“ Sofort verwandelte sich alles, wie sie gesagt hatte, und als der Vater ankam, sagte er: „Einsiedler, habt Ihr hier zwei junge Leute vorbeikommen sehen?“ „Öl für die Lampe! Öl für die Lampe!“ Davon red' ich doch gar nicht, sondern ob Ihr hier zwei junge Leute habt vorbeikommen sehen?“ „Bald ist es ausgebrannt!" Bald ist es ausgebrannt!“ Der Zauberer schickte alle Tauben zum Teufel und kehrte fluchend heim.
Als die Mutter die Geschichte hörte, sagte sie: „Der Einsiedler war er und sie das Bild; lauf noch einmal hinunter, und bring diesmal mit, was du auch findest, denn immer werden sie es sein.“ Der Zauberer eilte also wieder wütend auf und davon und schwor, sie nicht noch einmal entwischen zu lassen. Schon war er ihnen ganz nahe, als Luise schnell ein Ei herausholte und es auf die Erde warf. Es verwandelte sich sofort in ein Meer, daß die beiden von ihrem Vater trennte. Als der Zauberer sah, daß er sie nicht einholen konnte, sagte er zu dem Jüngling: „Wenn dich ein Hund berührt oder dich eine Frau umarmt, so mögest du Luise vergessen, das gebe Gott!“ Und er kehrte in sein Schloß zurück.
Sie setzten indessen ihren Weg fort und kamen in sein Land; doch bevor sie seine Heimatstadt erreichten, sagte der Prinz zu ihr: „Warte hier auf mich, ich hole die Droschken und alles, was sonst noch nötig ist, damit du in die Stadt einziehen kannst, wie es sich für uns gehört.“ „Ich möchte mich nicht von dir trennen, denn du wirst mich vergessen. Denk doch an den Fluch meines Vaters!“ „Hab keine Angst! Ich werde schon aufpassen, daß keiner mich umarmt.“
Er ging in das Schloß, und kaum sahen sie ihn, da kamen sie alle entgegen, um ihn zu beglückwünschen und zu umarmen, vor allem seine Mutter; doch alle, die ihn umarmen wollten, wehrte er ab. Er befahl, die Droschken auffahren zu lassen und ein Gefolge zusammenzustellen, um die zu holen, die seine Frau werden sollte. Dann sagte er zu seiner Mutter: „Ich bin sehr müde und möchte mich ein wenig ausruhen, wenn alles fertig ist, soll man mir Bescheid geben.“ Er legte sich hin und schlief ein.
Da kam seine Großmutter, und schlafend, wie er da lag, umarmte sie ihn. Als alles vorbereitet war, rief die Königin ihn und sprach: „Das Gefolge und die Droschen sind fertig.“ „Welches Gefolge?“ fragte der Prinz. „Welches? Das Gefolge, das du haben wolltest, um deine Frau zu holen.“ „Ihr träumt; ich will nichts haben und habe auch keine Frau; ich will hier bleiben.“ Die Königin glaubte, ihr Sohn habe den Verstand verloren und wollte sie zum Narren halten; aber da ihn seine Großmutter umarmt hatte, hatte er alles vergessen, gerade so, wie der Zauberer es ihm gewünscht hatte.
Indessen wartete die arme Luise vergeblich auf ihn, und als sie merkte, daß er nicht zurückkam, ging sie in die Stadt und verdingte sich als Hausfräulein bei einem sehr reichen Ehepaar. Dieses Ehepaar hatte eine wunderschöne Tochter, in die der Prinz sich verliebte und um deren Hand er anhielt. Der Tag der Hochzeit wurde festgesetzt; da schlug nun Luise ihrer Herrin vor, zur Unterhaltung ein Puppenspiel zu geben mit Puppen, die sie selbst besaß. Die Herrin sagte, es sei gut, und Luise machte sich nun daran und kleidete zwei Puppen an, eine als Frau mit einem Kleid wie ihr eigenes und die andere als Mann mit einem Gewand, wie das war, das der Prinz trug, als er fortging, um Geld zu suchen.
Es kam der Hochzeitstag, und als die ganze Gesellschaft zugegen war, ging man in einen Saal, wo ein Puppentheater aufgestellt war, hinter dem sich Luise verborgen hielt. An Drähten zog sie die Puppen auf die Bühne; die eine Puppe trug einen Stock und sagte zu der anderen: „Christoph, weißt du noch, daß du das Schloß des Zauberers Palermo suchtest und dich ein Adler auf seinen Flügeln dahin brachte?“ „Nein“, erwiderte die Puppe, die wie der Prinz gekleidet war, und da bekam sie von der anderen einen Schlag mit dem Stock.
Der Prinz zuckte zusammen, denn er fühlte den Hieb, als ob er ihn selbst bekommen habe. Die Puppen fuhren fort: „Christoph, weißt du noch, daß der Zauberer dir befahl, das Ödland zu bebauen und aus dem Weizen ein Brötchen zu seiner Tasse Schokolade zu backen?“ „Nein.“ Wieder ein Schlag. „Weißt du noch, daß du das Pferd zähmen mußtest. „Nein.“ Weißt du noch, daß er dir befahl einen Ring aus dem Meer zu holen?“ „Nein.“ Obwohl der Prinz die Schläge fühlte, sagte er kein Wort, und Luise war schon ganz verzweifelt darüber, daß er sich an nichts mehr erinnerte.
Dann sagte wieder: „Weißt du nicht, daß mein Vater, als er uns verfolgte, uns zuletzt verfluchte und er wünschte, du solltest mich vergessen, wenn eine alte Frau dich umarmt?“ Und als die Puppe wieder „Nein“ antwortete, bekam sie einen Schlag, daß sie in tausend Stücke zerbrach. Da fühlte der Prinz einen so heftigen Schmerz, daß er aufsprang, mit der Hand über seine Stirn fuhr, wobei ihm allmählich alles wieder zum Bewußtsein kam. Er fragte seine Braut, wer das Puppenspiel gemacht habe, und als sie antwortetet, es sei ihr Kammermädchen gewesen, ließ er sie zu sich kommen; und als Luise vor ihm stand, erinnerte er sich an alles.
Er faßte sie bei der Hand, ging mit ihr zu seiner Mutter und sprach: „Mutter, hat mich irgend jemand umarmt, als ich mich nach Rückkehr von der Reise schlafen legte?“ „Ja“, sagte die Königin, „deine Großmutter hat dich umarmt.“ „Dann hat mich diese Umarmung den Auftrag vergessen lassen, den ich Euch gab, bevor ich mich hinlegte. Hier ist die Frau, die auf mich gewartet hat, nur sie will ich heiraten.“ Dann gingen sie ins Schloß, und er heiratete Luise, und sie wurden sehr glücklich; die andere aber unverhofft ihren Bräutigam los. Das Märchen ist aus, wir gehen nach Haus.
Märchen aus Spanien
DIE SAGE VOM PRINZ ACHMED AL KAMEL, DEM LIEBESPILGER
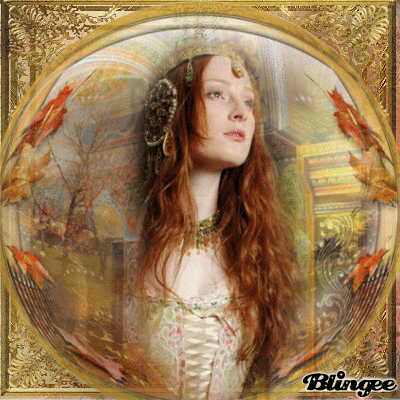
Es lebte einmal in Granada auf der Alhambra ein maurischer König, dessen einziger Sohn Achmed hieß. Die Höflinge gaben ihm den Beinamen Al Kamel, der Vollkommene, wegen der unzweifelhaften Beweise und der vielen Anzeichen von Klugheit und Charakterstärke, die sie schon in seiner Kindheit an ihm bemerken konnten.
Die Astrologen bestätigten in ihren Auskünften die Meinung der Hofleute und prophezeiten dem Prinzen für die Zukunft all das, was einen Herrscher vollkommen, glücklich und beliebt machen konnte. Eine einzige Gewitterwolke nur schwebte über ihm, und auch die wäre rosigster Natur, so sagten die sternkundigen Weisen: Er wurde, meinten sie, sich leicht und heftig verlieben, und in Folge dieser zärtlichen Leidenschaft zu Liebeshändeln und galanten Abenteuern in große Gefahr geraten. Wenn er aber bis in sein mannbares Alter allen Lockungen und Zartheiten der Liebe fest widerstünde, dann, so meinten die Astrologen weiter, könnten derartige Gefahren und deren Folgen vermieden werden, und das spätere Leben des Prinzen Thronfolgers werde glücklich verlaufen.
Um alle derartigen Widerwärtigkeiten zu vermeiden, beschloß der König in seiner Weisheit, den Prinzen in einer Umgebung erziehen zu lassen, wo er nie ein weibliches Wesen zu Gesicht bekäme oder auch nur das Wort Liebe hören könnte. Zu diesem Zweck baute er auf dem der Alhambra gegenüberliegenden Berg einen herrlichen Palast, ließ dort die wundervollsten Gärten anlegen und dann herum eine hohe Mauer errichten. In diesem Prunkgebäude wurde der jugendliche Prinz eingeschlossen und der Obhut des Eben Bonabben anvertraut.
Er war ein großer Gelehrter aus Arabien, trocken und uncharmant wie seine Papyrusrollen, der den größten Teil seines Lebens in Ägypten mit dem Studium der Hieroglyphen und dem Erforschen der Pharaonengräber hingebracht hatte. Ein solcher Hauslehrer entsprach natürlich den strengen Wünschen des Königs, denn der Alte zog alte Ägyptologie, Papyrusrollen und Mumien vor. Auf Anordnung der Hofkanzlei sollte der Weise den Prinzen in allen Disziplinen unterrichten und ihm jedes Wissen vermitteln, mit einer einzigen Ausnahme, denn nie durfte er erfahren, fühlen und kennen, was Liebe sei.
Streng sagte der König zu dem Weisen aus dem Morgenland: „Wende zu diesem Zweck jede Vorsichtsregel an, die du für geeignet hältst; allein bedenke, o Eben Bonabben, daß du sonst einen Kopf kürzer gemacht werden wirst, wenn mein Sohn während seiner Studienzeit mit dir etwas von den verbotenen Kenntnisse erfahren würde." Mit trockenem Lächeln antwortete der weise Bonabben auf die Drohung und sprach dann überlegt und jedes Wort betonend: „Möge dein königliches Herz so unbesorgt um deinen Sohn sein, wie es das meinige um meinen Kopf ist. Glaubst du etwa, daß ich etwas von Frauenschönheit verstünde und über die Liebe dozieren könnte?“
Unter der wachsamen Obhut wuchs der Prinz in der Abgeschiedenheit des Palastes und Einsamkeit der ummauerten Gärten auf. Zur Bedienung hatte er schwarze Sklaven, häßliche Geschöpfe, die bei ihrer Scheußlichkeit nichts von Liebe wussten, oder, wenn es der Fall sein sollte, keine Worte hatten, es anderen mitzuteilen, denn alle waren sie stumm, die einen von Geburt her, die anderen auf Grund eines Eingriffes des königlichen Scharfrichters.
Auf die Heranbildung der geistigen Anlagen des Prinzen verwandte Eben Bonabben besondere Sorgfalt und suchte ihn möglichst bald in die geheimen Weisheiten Ägyptens einzuweihen. Doch in diesem Fach machte der Prinz nur wenig Fortschritte, und bald zeigte es sich, daß er absolut keine Neigung hatte. Aber er war ein auffallend gehorsamer junger Mann. Ließ sich leicht beeinflussen und gab in der Regel seinen guten Ratgerbern recht. Auch war er sehr höflich, unterdrückte das Gähnen und hörte geduldig den langen und gelehrten Ausführungen Eben Bonabbens zu, von denen er gerade so viel verstand, daß er sich mit der Zeit ein etwas allgemeines Wissen aneignen konnte, das für seine zukünftige Herrscherlaufbahn unumgänglich notwendig war.
Achmed erreichte so glücklich das zwanzigste Lebensjahr, ein Wunder prinzlicher Weisheit, allein Ignorant in Sachen Liebe, von deren Existenz er nie gehört hatte. Um diese Zeit änderte sich jedoch merklich das Benehmen des Prinzen. Er vernachlässigte vollständig seine Studien, streifte viel in den Gärten umher oder saß stundenlang am Brunnenbecken und schaute grübelnd ins Wasser.
Früher hatte er manchmal etwas Musik betrieben; doch jetzt nahm sie einen großen Teil seiner Zeit in Anspruch. Sein Sinn für Dichtkunst und Gesang war erwähnenswert, und den von ihm verfaßten Liedern und Gedichten konnte eine gewisse Poesie nicht abgesprochen werden. Bei all diesen merkwürdigen Anzeichen wurde der weise Bonabben unruhig und bemühte sich, die eitlen Launen mit einem tiefschürfenden Vortrag über Algebra auszutreiben. Aber der Prinz unterbrach ihn voll Unlust und sagte:
„Ich kann die Algebra nicht ausstehen; sie ist mir verhaßt. Ich will etwas hören, das zum Herzen spricht!“ Der Weise schüttelte bei diesen Worten sein welkes Haupt und dachte bei sich: „Jetzt ist es mit der Philosophie aus! Der Prinz hat entdeckt, daß er ein Herz hat.“ Mit ängstlicher Sorgfalt überwachte er seinen Zögling und sah, wie es in seinem Inneren arbeitete.
Ziellos wandelte Achmed durch die Gärten der schönen Generalife, um dort ein Wesen zu finden, das er beglücken könnte. Wie weltfern träumte er manchmal vor sich hin, dann griff er zur Laute und entlockte ihr die rührendsten Melodien, bis ihn auch das Saitenspiel ermüdete und das herrliche Instrument seinen Händen entfiel, wobei er tief seufzend und laut klagend auf den Boden starrte. Nach und nach nahm aber die Liebe des Prinzen festere und konkrete Formen an. So pflegte er seine Lieblingsblumen mit ganz besonderer Sorgfalt und lag dann wieder träumend im Schatten einer schlanken Pinie, der seine spezielle Zuneigung galt; in ihre Rinde schnitt er Namen und astrologische Schriftzeichen, hing Blumengewinde in ihr Gezweig und besang des Baumes Schönheit in zarten Versen, während er dazu die Laute schlug.
Eben Bonabben beruhigte natürlich dieses exaltierte Benehmen seines Zöglings wenig, den er gleichsam schon vor der verschlossenen Pforte sah, die zu jenem Wissen führte, das ihm sein Vater vorenthalten wollte. Das unscheinbarste Ereignis konnte diese Tür weit öffnen, der leiseste Wink ihm das verhängnisvolle Geheimnis kundtun. Um das Wohl des Prinzen besorgt und um die Sicherheit des eigenen Kopfes zitternd, beschloß er schnell zu handeln, denn nur so konnte das Schlimmmste vermieden werden.
Der lammfromme Jüngling mußte im Schloßturm seine Wohnung aufschlagen, und scharfe Wachen unterbanden seine, die Nerven aufreizenden Spaziergänge durch den weiten Garten mit seinen verführerischen Rondellen, Laubengängen und Brunnenanlagen. Die neuen Gemächer lagen im höchsten Stockwerk des Bergfrieds, waren mit ausgezeichnetem Geschmack eingerichtet, und von den Balkonen genoß man eine herrliche Rundsicht über die Vega. Allerdings bis zu diesen Wohnräumen hinauf drang kein süßer Duft von Blumen und Blüten, kein Rauschen der springenden Wasser und auch nicht das Summen der Honig suchenden Bienen, nichts von all dem, was in Achmeds Gemüt Veränderungen herbeigeführt und in ihm bisher unbekannte Gefühle plötzlich hatte aufkommen lassen.
Doch war es notwendig, ihm diesem Zwang auszusöhnen und dafür zu sorgen, daß er anderweitige Abänderungen, Ablenkungen fand. Das schien allerdings anfänglich schwierig, denn der weise Lehrer hatte bereits alle seine Kenntnisse zerstreuender Art erschöpft, und über Algebra, Physik, Astronomie und Heilkunde durfte man mit dem jungen Mann ja nicht mehr sprechen. Aber auch hier fand Eben Bonabben einen Ausweg. Glücklicherweise verstand er die Sprache der Vögel; während seines Aufenthaltes in Ägypten lehrte sie ihn ein jüdischer Rabbinner, der seine Kenntnisse in gerader Linie bis auf Salomon den Weisen zurückführte, welcher bekanntlich bei der Königin von Saba darin unterrichtet war.
Schon bei der Erwähnung eines solchen Studiums funkelten dem Prinzen vor Erregung die Augen, und er arbeitete mit solchem Eifer, daß er in kürzester Zeit diese Kunst ebenso beherrschte wie sein Lehrer. Von nun an war für ihn der Turm des Generalife kein gar so einsames Gefängnis mehr; er hatte einige Gefährten, mit denen er reden konnte und die ihm allerhand Neuigkeiten brachten und erzählten. So machte er zu allererst die Bekanntschaft mit einem Habicht, der in einer Mauerspalte auf der hohen Turmzinne sein Nest gebaut hatte, von wo aus er weit und breit herumstreifte und die Gegend nach Beute absuchte.
Der Prinz indessen fand eigentlich wenig Gefallen an dem gefederten Strauchritter. Er war ein simpler Pirat der Lüfte, ein großsprecherischer Prahlhans, dessen Geschwätz sich nur um Raub, Totschlag und mörderische Greueltaten drehte. Darauf lernte er eine Eule kennen; das war ein sehr weise aussehender Vogel, mit einem riesigen Kopf und starr glotzenden Augen, der tagsüber in einem Mauerloch vor sich hinblinzelte und nur während der Nacht ausflog. Viel bildete sich der Uhu auf seine tiefschürfende Weisheit ein, hielt Vorträge über Astrologie, sprach von Mond und Sternen und gab gelegentlich auch Aufklärungen, die ganz geheimes Fachwissen betrafen. Doch er redete auch über Metaphysik und der Prinz fand, daß die diesbezüglichen Vorlesungen noch viel langweiliger waren als die unausstehlichen Belehrungen des Eben Bonabben.
Dann war da noch die Fledermaus da, die den ganzen Tag an ihren Beinen in einer der dunkelsten Ecken des Gewölbes hing und erst in der Dämmerung aufwachte, um schrill aufpfeifend durch Hallen und Gärten zu flattern. Es war ein merkwürdiges Tier; es hatte von allen Dingen nur ganz verschwommene Ideen, und mit zwielichtigem Verständnis spottete es über Sachen und Gedanken, von denen es kaum gehört hatte. Auch war der Flatterer sehr mürrisch und schien an nichts Gefallen zu finden.
Zu diesem Genossen stellte sich auch noch eine Schwalbe ein, die anfangs dem Prinzen wirklich sehr gut gefiel, denn sie war eine nette Gesellschafterin und zerstreute den einsamen Jüngling mit ihrem Gezwitscher. Doch war sie ruhelos, und geschäftig flog sie von einem Ort zum anderen; immer unterwegs, blieb sie selten genug auf einem Fleck, um ein ordentliches Gespräch führen zu können. Es erwies sich, daß sie eine ganz gewöhnliche Schwätzerin und Klatschbase war, die über alles Bescheid zu wissen meinte und doch nichts wußte.
Dies waren die gefiederten Freunde, die Achmed hatte. Der Turm war viel zu hoch, als daß andere Vögel ihn hätte erreichen können. Bald wurde der arme Prinz seiner gefiederten Bekannten überdrüssig, deren Unterhaltung weder seinen Verstand und schon gar nicht sein Herz ansprachen. Wieder saß er verlassen und trübsinnig in seinem einsamen Turmzimmer und starrte traurig vor sich hin.
So verging der kalte Winter, und der Frühling hielt seinen Einzug mit all den Bäumen und Blüten, dem saftigen Grün und den lieblichen Düften, die diese Jahreszeit auszeichnen. Die Natur erwachte aus ihrem Winterschlaf; alles begann zu sprießen und zu wachsen. Die Zeit war da, wo die Vögel sich paarten und ihre Nester bauten. In den Hainen und Gärten des Generalife hörte man ein Singen und Raunen, das bis ins einsame Turmzimmer zum gefangenen Prinzen hinaufklang; von allen Seiten erschollen Lieder, ein Fragen und Werben mit dem gleichen Thema Liebe-Liebe-Liebe...ausklang.
Schweigend und verwirrt horchte Achmed erstaut auf und fragte sich verwundert: „Was mag wohl diese Liebe sein, von der die ganze Welt so voll ist? Was kann dieses Ding nur bedeuten, von der ich noch niemals gehört habe?“ Er wandte sich also an seinen Freund, den Habicht, und bat ihn um Aufklärung. Doch der wilde Vogel antwortete verächtlich: „Du mußt dich schon an die gewöhnlichen Vögel wenden, die in Gärten und Wäldern friedlich ihr Dasein fristen und dazu da sind, uns den Fürsten der Lüfte, als Jagdbeute zu dienen. Mein Handwerk ist der Krieg und Kämpfen meine Freude. Ich bin ein harter Mann und weiß nichts von Dingen, die man Liebe nennt.“
Mit Abscheu wandte sich der junge Prinz vom wilden Habicht ab und suchte die philosophierende Eule an ihrem Zufluchtsort auf. Das ist ein Vogel von friedlichen Sitten und Bräuchen, sagte er sich, und wird sicherlich imstande sein, meine Frage zu beantworten. So bat er denn die Eule, ihm zu sagen, was es mit der Liebe für eine Bewandtnis habe, von der alle Vögel unten in den Wäldchen und Gärten sängen.
Als der Uhu diese Frage hörte, schaute er würdevoll auf und sagte mit beleidigender Stimme: „Ich bin Forscher und verbringe die Nächte mit klugen und klaren Studien, und während des Tages denke ich über das nach, was ich gelernt habe und was mir gelehrt wurde. Die Singvögel von denen du sprichst, sind für mich nicht vorhanden; ich höre sie nicht und verachte ihre dummen Lieder. Allah sei gepriesen! Ich kann nicht singen, aber ich bin Philosoph und Astronom, der von den Dingen da, die man Liebe nennt, nichts weiß.“
Verwirrt begab sich Achmed ins Gewölbe, wo seine Freundin, die Fledermaus, wie gewöhnlich mit ihren Füßen kopfabwärts hing und stumm vor sich hinträumte. Er legte auch ihr die für ihn so wichtige Frage vor. Die Fledermaus runzelte ihre Nase und antwortete recht schnippisch: „Warum störst du mich mit dieser blöden Frage in meinem Morgenschlaf? Du solltest wissen, ich fliege nur in der zwielichtigen Dämmerung umher, wenn alle Vögel schlafen und kümmere mich um ihr Treiben nicht. Ich bin weder Vogel noch Säugetier, wofür ich dem Himmel danke. Ich habe sie alle als Schurken kennengelernt und hasse alles, was da fleucht und kreucht. Mit einem Wort: Ich verachte dieses Gesindel und ihre Welt und weiß nichts von den Dingen, die man Liebe nennt.“
Nun blieb dem Prinz nur noch die Schwalbe, an die er sich wenden konnte. Er suchte sie sogleich auf und traf sie nach längerem Suchen oben auf der Turmspitze, wo er sie sogleich anhielt und ihr sein Herz ausschüttete. Die Schwalbe war gewöhnlich in großer Eile und hatte kaum Zeit zu antworten: „Auf mein Wort“, schnatterte sie gleich los, „ich habe so viele öffentliche Geschäfte zu besorgen und so viel zu tun, daß ich bis heute noch keine Zeit gefunden habe, über dieses Thema nachzudenken. Ich habe jeden Tag tausend Besuche zu machen, mich um tausend Sachen von Wichtigkeit zu kümmern, so daß mir kein Augenblick frei bleibt, mich mit derartig unbedeutendem Firlefanz zu beschäftigen. Ich bin eine freie Weltbürgerin und weiß nichts von dem, was man Liebe nennt.“ Mit diesen Worten schoß die Schwalbe ins Tal hinunter und war im Nu in der Ferne verschwunden.
Der junge Mann war zutiefst enttäuscht, daß keiner seiner Freunde ihm sagen konnte, was Liebe eigentlich sei. Die Schwierigkeiten, etwas darüber zu erfahren, aber stachelten seine Neugier noch mehr an, und er beschloß, der Sache nun auf den Grund zu gehen, koste es, was es wolle. In dieser gefährlichen Gemütsverfassung traf ihn der alte Lehrer auf der Plattform des Turmes an. Der Prinz ging schnell auf ihn zu und rief aufgeregt: „O Eben Bonabben, weisester aller Lehrer, du hast mich viel gelehrt, mir viele irdischen Geheimnisse enthüllt! Es gibt aber einen Gegenstand, von dem ich nichts weiß, dessen Sinn und Form ich nicht kenne. Ich bitte dich, mich darüber aufzuklären, denn ich will erkennen, worum es sich handelt.“
„Mein Prinz hat nur die Frage zu stellen, und alles was im beschränkten Bereich meiner Kenntnisse ist, steht ihm bedingungslos zur Verfügung.“ „So sage mir denn, du größter aller Weisen, was ist die Natur der Dinge, die man Liebe nennt?“ Eben Bonabben war wie vom Blitz getroffen. Ihm wurde ganz übel zumute, er zitterte, das Blut wich aus seinen Wangen, und es schien ihm, als säße sein Kopf nur mehr ganz lose auf den Schultern. „Wie kommt mein Prinz auf solche Gedanken und zu solcher Frage? Wo mag er wohl so eitle und überflüssige Worte gehört haben?“ Der Prinz führte ihn ans Turmfenster und auf den Balkon hinaus und sagte ernst mit verschleierter Stimme: „Hör einmal hin, o Eben Bonabben!“
Und der Weise lauschte mit hellhörigem Ohr. Unten im Gebüsch saß eine Nachtigall und sang ein Liebeslied der Rose zu; aus jedem Wäldchen, von den Beeten, ja aus jedem Blütenzweig stiegen melodienreiche Hymnen auf, und tausendfach hörte man immer wieder: „Liebe! Liebe! Liebe!“ „Allah Akbar! Gott ist groß!“ rief der weise Bonabben aus, „wer könnte sich anmaßen, dieses Geheimnis dem Herzen des Menschen vorenthalten zu wollen, wenn es sogar die Vögel der Luft laut in die Natur hinausschmettern.“ Dann wandte er sich Achmed zu und fuhr fort:
„Junger Mann, verschließe dein Ohr, auf daß du nicht diese verführerischen Töne hörst! Und laß ab, nach dem Sinn und dem Sein von Dingen zu forschen, deren Kenntnisse deinem Geist und deiner Seele nur Unheil bringen werden. Wisse, diese Liebe ist die Ursache allen Übels, oder wenigstens fast aller Übel und der Hälfte aller Wehs, das die sterblichen Menschen dieser armen Welt zwischen den Mühlsteinen zu zermahlen droht. Sie ist es, die Haß und Streit zwischen Brüdern und Freunden zeigt, die den meuchlerischen Mord gebiert und furchtbare Kriege entfacht. Kummer und Sorge, traurige Tage und schlaflose Nächte sind ihr Gefolge. Sie bringt die Schönheit der Jugend zum Welken und vergiftet ihre frohen Stunden, was Übel und Elend und ein vorzeitiges Altern zur Folge hat. Allah bewahre dich, mein Prinz, er möge dich schützen! Dringe nie darauf, das zu wissen, was man Liebe nennt!“ Nach diesen Worten verließ der weise Bonabben eiligst seinen Schüler. Er ließ ihn in größter Verwirrung zurück.
Achmed konnte keine Ruhe finden; vergebens versuchte er, sich alle Gedanken an die Liebe aus dem Kopf zu schlagen, die ihn ständig quälten und seinen Geist erschöpften. Er kam über eitle Vermutungen nicht hinaus und konnte der Sache nicht auf den Grund kommen. „Merkwürdig“, überlegte er, „ich kann aus diesen herrlichen Melodien keinen Kummer heraushören“, als er dem Gesang der Vögel wieder und immer wieder lauschte, „in allem klingt Zärtlichkeit, aus jedem Ton spricht Freude! Wenn die Liebe wirklich die Ursache von so viel Elend und Streit wäre, warum trauern dann diese Vögel schmachtend in der Einsamkeit der Wälder? Warum werden sie nicht zu wilden Faltern und reißen einander in Stücke? Warum flattern diese wunderbaren Geschöpfe fröhlich und zufrieden in den Gärten und Wäldchen herum und spielen miteinander unter Blumen und Blüten, wenn Liebe nur Haß, Zwietracht und Unglück zeugt?“
Eines Morgens lag Achmed auf seinem Diwan und dachte angestrengt über diesen noch immer ungeklärten und ihm unerklärlichen Tatbestand nach. Das Fenster seines Zimmers stand offen, um den sanften Morgenwind hereinzulassen, der mit dem feinem Duft aus den Orangengärten im Darrotal heraufkam. Leise hörte man den Sang der Nachtigall, das Zwitschern der Schwalben und Zirpen der Grillen und aus der Ferne her liebliches Saitenspiel. Während nun der Prinz melancholisch diesem zauberhaften Konzert lauschte, weckte ihn lauter Flügelschlag aus seinen Träumen. Eine von einem Habicht verfolgte Taube schoß durchs Fenster ins Zimmer und fiel erschöpft auf den Fußboden, während der um seine Beute gebrachte Verfolger wieder zu seinem Horst in den Bergen zurückflog.
Der jugendliche Prinz nahm den schwer keuchenden Vogel auf, strich ihm das Gefieder glatt und drückte ihn liebevoll an seine Brust. Es war ein Täuberich. Als es ihm endlich gelungen war, den schönen Vogel zu beruhigen, setzte er ihn in einen goldenen Bauer und gab ihm eigenhändig den feinsten Weizen und das reinste Wasser zur Atzung. Doch das Tier nahm keine Nahrung zu sich.Traurig und gramvoll saß er auf der Sprosse und seufzte ehrbarmungswürdig. „Was fehlt dir?“ fragte Achmed besorgt. „Hast du nicht alles, was dein Herz begehrt?“ „O nein“, erwiderte der Täuberich, „ich bin von der Gefährtin meines Herzens getrennt, und noch dazu im schönen Frühling, der glücklichsten Jahreszeit der wahren Liebe!“
„Der Liebe?“ wiederholte Achmed. „Ich bitte dich, liebes Tier, kannst du mir sagen, was Liebe ist?“ „Nur zu gut kann ich das, mein Prinz. Sie ist die Qual bei einem, das Glück bei zweien, sie bringt Streit und Feindschaft bei dreien. Sie ist der Zauber, der zwei Wesen zueinander hinzieht, sie ist bei vorhandener Seelenverwandtschaft vereinigt und ihr Beieinandersein zum Glück, ihr Getrenntsein aber zum Unglück werden läßt. Gibt es kein Wesen, zu dem du in zärtlicher Neigung dich hingezogen fühlst?“ Ich liebe meinen alten Lehrer Eben Bonabben mehr als jedes andere Wesen; aber er redet oft so langweilig, und hin und wieder fühle ich mich ohne seine Gesellschaft weit glücklicher.“
„Das ist nicht die Seelenverwandtschaft, die ich meine. Ich rede von der Liebe, dem großen Geheimnis und dem schöpferischen Prinzip allen Lebens, für die Jugend ist es ein Rausch und dem Alter ruhige Freude. Blicke hinaus, mein Freund, und sieh, wie zu dieser Jahreszeit die ganze Natur von Liebe erfüllt ist. Jedes lebendige Wesen hat seinen Liebesgenossen; der unscheinbare Vogel singt seiner Liebsten ein Lied, aus dem seine Gefühle sprechen, selbst der Käfer im Staub und Mist, wirbt jetzt um sein Weibchen, und jene Schmetterlinge, die du hoch über dem Turm flattern und in der Luft spielen siehst, sind glücklich in der Liebe. Ach, mein guter Prinz, wie konnten nur so viele Jahre deiner Jugend verstreichen, ohne daß du von der Liebe erfahren hast? Gibt es kein zartes Wesen des anderen Geschlechts, eine schöne Prinzessin, ein liebenswürdiges Burgfräulein, die dein Herz gewonnen und bei dir den Wunsch, von ihnen geliebt zu werden, erweckt hat?“
„Ich fange an zu verstehen“, sagte der junge Prinz seufzend“, oft habe ich durchaus solche Empfindungen und eine ähnliche Unruhe verspürt, aber ohne deren Ursache zu kennen. Doch wo sollte ich in meiner Einsamkeit und Abgeschlossenheit jenes Wesen suchen, in das ich mich verlieben könnte?“ Lange noch unterhielten sich beide, bis die erste Liebeslektion des Prinzen beendet war. Ernst blickte Achmed, dann murmelte er leise: „Wenn die Liebe wirklich eine solche Wonne ist und man ohne sie nur in seelischem Elend leben kann, so möge Allah verhüten, daß ich ein verliebtes Paar unglücklich mache!“ Rasch öffnete er den Käfig, nahm den Vogel heraus, küsste ihn zärtlich und trug ihn zum Fenster. „Fliege, glücklicher Vogel, genieße die Jugend und freue dich zusammen mit deiner Gefährtin darüber, daß es Frühling ist. Du sollst in diesem traurigen Turm nicht mein Zellengenosse sein, hier, wo die Liebe keinen Zutritt hat.“
Glücklich breitete die Taube ihre Flügel aus, hob sich mit einem Schwung in die Luft und schoß dann im Sturzflug hinunter zu den blühenden Lauben am Darro. Der Prinz folgte ihm mit den Augen, bis er seinen Blicken entschwand. Nichts machte dem jungen Mann von nun an mehr Freude; nicht das Singen der Vögel, nicht das Zirpen der Grillen und auch nicht der berauschende Blumenduft von Rosen, Nelken und Orangenblüten. All das verstärkte nur seine Bitterkeit. Nach Liebe lechzte sein Herz. Ach, nun verstand er die Melodie, das Lied der Geschöpfe, das von Liebe sprach. Seine Augen sprühten Feuer, als er nach einigen Tagen den weisen Bonabben wieder sah. Voll Zorn rief er ihm zu:
„Warum hast du mich in solcher Unwissenheit aufwachsen lassen? Warum ließest du mich nicht das große Geheimnis des Lebens und das Wunder allen Seins kennen, welches selbst den niedrigsten Insekten bekannt ist. Sieh und hör, die ganze Natur befindet sich in einem Taumel des Entzückens! Jedes Wesen freut sich seines Gefährten. Das ist die Liebe, von der du mir hättest erzählen müssen. Warum versagt man mir allein ihren Genuß? Warum wurde mir all die Jahre, ja selbst heute noch, diese Freude vorenthalten?“ Der weise Bonabben sah ein, daß jede weitere Geheimnistuerei vollkommen nutzlos wäre, daß der Prinz bereits all das wußte, was ihm nicht gelehrt und gesagt werden sollte. Also sprach er zu ihm von der Vorhersagung der Astrologen und den Vorsichtsmaßregeln, die man bei seiner Erziehung getroffen hatte, um das drohende Unheil abzuwenden, das über ihm schwebte.
„Und jetzt mein Sohn“, fügte er hinzu, „liegt mein Weh und Wollen in deinen Händen. Wenn dein königlicher Vater erfährt, daß du trotz meiner Aufsicht und Obhut die Leidenschaft der Liebe kennengelernt hast, so kostet mich das meinen Kopf, denn unser Sultan pflegt Wort zu halten.“ Der Prinz war Eben Bonabben durchaus zugetan, und da er bis jetzt das Feuer der Liebe nur unbewußt spürte, so versprach er, sein neues Wissen für sich zu behalten, um den Kopf des Philosophen nicht zu gefährden.
Doch das Schicksal wollte es, daß seine Großmut noch auf harte Proben gestellt werden sollte. Als er einige Tage später frühmorgens auf der Plattform des Bergfrieds auf und ab ging, seinen Gedanken nachhängend, da kam der Tauber wieder geflogen und setzte sich furchtlos auf seine Schulter. Voll Freude liebkoste ihn der Prinz und sagte mit bewegter Stimme: „Glücklicher Vogel, der du wie auf Schwingen der Morgenröte bis ans Ende der Welt fliegen kannst! Wo warst du seit jenem Tag, an dem ich dir die Freiheit schenkte?“
„In einem fernen Land, mein Prinz, aus dem ich dir zur Belohnung für deine Großmütigkeit eine Nachricht bringe. Einmal sah ich auf meinem weiten Flug über wilde Berge und fruchtbaren Ebenen tief unter mir einen herrlichen Garten voll der schönsten Blumen und Blüten mit Bäumen, deren Äste und Zweige sich unter der Last der wundervollsten Früchte bogen. Er lag in einer grünen Aue, an den Ufern eines Flusses, dessen klare Wasser sich durch die Ebene dahin schlängelten. In der Mitte dieses Paradieses stand ein prächtiges Schloß. Ich flog auf eine Baumgruppe zu, um dort auszuruhen, denn anstrengende Tage lagen hinter mir.
Es war ein schönes Plätzchen; rundherum Blumen in allen Farben des Regenbogens; angenehm riechende Früchte, und unten auf der Rasenbank saß eine junge Prinzessin, die in ihrer Schönheit und Anmut einem Engel glich. Junge Dienerinnen, feengleich wie sie, waren ihre Hofdamen, sie schmückten das Mädchen mit Blumenkränzen. Doch keine der Blumen, selbst die nicht aus den hängenden Gärten der Semiramis, konnten mit dem Königskind an Schönheit wetteifern. Allein die Prinzessin blühte dort, einem Veilchen gleich im Verborgenen, denn der Garten war von hohen Mauern umgeben, und kein Sterblicher durfte eintreten. Als ich dieses schöne Mädchen sah, so jung, so unschuldig; so rein und ohne Makel, da sagte ich mir sofort:
„Das ist ein Wesen, das der Himmel geschaffen hat, damit mein freundlicher Prinz die Liebe kennenlernt.“ Diese Worte fielen wie zündende Funken in das Herz Achmeds, dessen Liebessehnsucht endlich das erwünschte Wesen gefunden hatte. Aufgeregt schrieb er einen leidenschaftlichen Brief an die schöne Prinzessin; in wohlgesetzten Sätzen gestand er ihr seine Liebe und beklagte traurig sein hartes Los. Nur die Gefangenschaft, so stand in dem Brief, hindere ihn daran, sie aufzusuchen und sich ihr zu Füßen zu werfen. Er fügte Verse hinzu, in denen er mit zärtlicher Beredsamkeit seinen Gefühlen Ausdruck gab. Als Aufschrift trug der Brief die Worte: „An die schöne Unbekannte, von dem gefangenen Prinzen Achmed.“
Schließlich schüttete er noch Moschus und Rosenöl über das Schreiben und übergab es dann dem Tauber. „Nun, lieber Bote!“ sagte er. „Fliege über Berge und Täler, über Flüsse und Ebenen, Wiesen und Wälder! Raste aber nicht im Gebüsch und Laub der Bäume, setze deine Füße nicht eher auf die Erde, bis du diese Botschaft der Geliebten meines Herzens übergegeben hast.“
Der Täuberich schwang sich hoch in die Luft, nahm Richtung und schoß dann davon. Der Prinz folgte ihm mit den Augen, bis nur mehr ein ganz kleiner Punkt am fernen Horizont zu sehen war, der allmählich in der Weite entschwand. Tag um Tag wartete Achmed auf die Rückkehr des Liebesboten; aber vergebens suchte er stundenlang den Himmel nach dem Tauber ab. Schon fing er an, ihn der Vergesslichkeit zu schelten, als der treue Vogel eines Abends gegen Sonnenuntergang in sein Zimmer flatterte, dort auf den Boden fiel und starb. Der Pfeil eines mutwilligen Bogenschützen hat ihm die Brust durchbohrt, und dennoch flog er mit den letzten Lebenskräften weiter bis auf den Turm des Prinzen, der ihn so dringlich erwartet hatte.
Als dieser sich kummervoll über den Märtyrer der Treue beugte, bemerkte er, daß der tote Tauber eine feine Perlenschnur um seinen Hals trug, an der, versteckt unterm Flügel, ein kleines Medaillon hing, auf dem ein wundervolles Emailbildchen zu sehen war. Dieses zeigte eine schöne Prinzessin in der ersten Blüte ihrer Jahre. Ohne Zweifel handelte es sich um die schöne Unbekannte, von der der gute Tauber einst gesprochen hatte. Wie hatte sie seinen Brief aufgenommen, und war das kleine Bildchen wirklich eine Zusage und eine Antwort, ein Zeichen der Genehmigung seiner Leidenschaft? Die tote Taube aber schwieg und blieb für immer stumm, und der feurige Liebhaber sollte auf seine Fragen keine Antwort mehr bekommen.
Er blickte sehnsuchtsvoll auf das Bild, bis seine Augen in Tränen schwammen; dann küßte er es, drückte es an sein Herz und betrachtete es wieder stundenlang mit zärtlicher Leidenschaft. „Schönes Bild“, sagt er, „ach du bist nur ein Bild! Doch deine frischen Augen strahlen mir zärtlich entgegen, deine rosigen Lippen scheinen mich zu ermutigen! Eitle Einbildung, alles ist Phantasie! Lächelten sie einem glücklichen Nebenbuhler nicht ebenso lieblich zu? Mein Gott im Himmel, wo kann ich wohl dieses schöne Mädchen finden, das der Künstler hier malte? Wer weiß, welche Berge und Länder uns trennen. Wer kennt die Gefahren, die uns drohen? Vielleicht drängen sich jetzt, gerade jetzt, Freier um sie, während ich hier im Turm gefangen sitze und meine Zeit mit Seufzen und der Anbetung eines geheimen Schattens verliere!“
Rasch entschlossen sagte Achmed: „Ich will aus diesem Palast entfliehen, denn er wurde mir zum verhaßten Gefängnis! Und als Pilger der Liebe werde ich durch die ganze Welt ziehen und suchen, bis ich die unbekannte Prinzessin finde und an mein Herz drücken kann.“ Weiter überlegend sagte sich der junge Mann, daß tagsüber, wenn die Diener und Wächter alle aus und ein liefen, eine Flucht wohl schwerlich gelingen dürfte, er also den Einbruch der Nacht abwarten müsse, denn da stünden dann nur ganz wenige Posten auf den Mauern, und selbst die schliefen oft, denn niemand befürchtete einen Ausbruch des lammfrommen Prinzen. Aber wie sollte er auf seiner Flucht in dunkler Nacht den rechten Weg finden? Er kannte doch die Gegend nicht! In dieser unangenehmen Lage fiel ihm die Eule ein, die Rat wissen mußte, denn sie war es gewohnt, bei Nacht herumzustreifen und auf geheimen Pfaden und Wegen auf die Pirsch zu ziehen. Umgehend begab er sich nun in ihre Klause und fragte sie diesbezüglich ihrer Landeskenntnisse aus.
Die Eule setzte eine gewichtige Miene auf und sagte ernst, jedes Wort betonend: „Du mußt wissen, mein Prinz, daß wir Eulen eine weitverzweigte und alte Familie darstellen; es ist richtig, daß wir etwas verarmt und heruntergekommen sind, aber noch immer nennen wir in allen Teilen Spaniens viele hundert verfallene Schlösser und Türme unser eigen. Es gibt kaum eine Bergwacht auf schroffem Fels, keine Festung in den Ebenen, keinen Palast in einer kastilischen Stadt und keine Pfalz auf den Hügeln Andalusiens, in der nicht ein Bruder, ein Oheim oder Vetter wohnte. Oft besuchte ich schon meine lieben Verwandten und kam dabei durch das ganze Land, das ich meinen Wissensdrang genauestens durchforschte. Ich kenne also jeden Winkel, jeden Weg und Steg von nah und fern und auch, den geheimsten Unterschlupf, den Menschen je betreten hatten.“
Achmed war hocherfreut, in der Eule eine so kundige Beraterin gefunden zu haben und berichtete ihr nun im Vertrauen von seiner zärtlichen Liebe und seinen Fluchtplänen. Auch bat er sie inständig, ihn auf der Reise zu begleiten, da er ihren Rat so notwendig brauche, denn allein käme er in seiner Unerfahrenheit nicht weiter. „Wieso ich!“ schnauzte ihn die Eule unfreundlich an, „glaubst denn du wirklich, daß ich mich mit Liebeshändeln befasse? Ich, deren Zeit, Tun und Lassen ausschließlich der sinnenden Betrachtung, dem Studium und dem Mondkult geweiht ist?“ „Sei nicht böse, höchst ehrwürdige Eule“, war Achmeds Antwort, „opfere mir deine kostbaren Tage, und laß eine Weile die Meditation und den Mond. Hilf mir bei meiner Flucht, und sei mein Führer durchs unbekannte Land. Ich will dich reichlich dafür belohnen, denn alles sollst du haben, was dein Herz wünscht.“ „Ich habe alles, was mein Herz begehrt“, schnarrte der unfreundliche Vogel, „ein paar Mäuse als frugales Mahl, dieses Mauerloch als Wohnung sind reichlich genug für mich, denn ein Philosoph braucht nicht mehr.“
„Bedenke, weiseste aller Eulen und Uhus, hier im Verborgenen gehen deine großen Talente und Kenntnisse für die Welt verloren; niemandem nützten sie, und niemand kennt sie. Ich werde eines Tages regierender Fürst sein, und dann kann ich dich auf einen Posten von Rang und Ehren setzen, von wo du mit deinen weisen Entschlüssen das ganze Land beglückend organisieren und seine Bewohner als guter Kanzler führen könntest.“ Wenn auch die Eule ein Philosoph war und sich über die gewöhnlichen Bedürfnisse des Lebens erhaben fühlte, so hatte sie dennoch noch nicht jeden Ehrgeiz verloren, und Minister konnte man schließlich und endlich nicht alle Tage werden. Der kluge Vogel ließ sich nach einigen Versprechungen ohne Mühe dazu bringen, daß er zusagte, den jungen Prinzen auf seiner Liebesfahrt zu begleiten und sein Führer und Ratgeber zu werden. Verliebte pflegen rasch zu handeln und ihre Pläne umgehend zu verwirklichen.
Der Königssohn suchte alle seine Juwelen, Goldmünzen und Schmuckstücke zusammen und versteckte das Reisegeld in seinen Kleidern. In derselben Nacht noch ließ er an zugeknüpften Gürteln vom Balkon herunter, lief durch den Garten und sprang ungesehen über die Außenmauer der Generalife. Einmal draußen, übernahm gleich die Eule die Führung, und beide erreichten noch vor Tagesanbruch glücklich das Gebirge, wo sie in Sicherheit waren. Der Prinz und sein Mentor setzten sich nun zusammen und berieten, was weiterhin zu tun sei und welchen Weg man nehmen müßte.
Ernst und gewichtig, wie alle Hofräte hub die Eule allsogleich zu sprechen an: „Wenn ich dir raten darf, so schlage ich vor, daß wir uns nach Sevilla begeben. Du mußt wissen, daß ich vor Jahren mehrmals dort meinen Oheim besuchte, einen Vogel von hoher Würde und großem Ansehen. Er wohnte in einem verfallenen Flügel des Sevillaner Alcazars und empfing nachts seine Besuche, daß ich also gar viele Bekanntschaften machen konnte. Allein oder mit guten Freunden durchstreifte ich dann die Stadt und konnte dabei viel sehen und lernen. Auf meinen nächtlichen Spazierwegen hatte ich auch bemerkt, daß in einem Turm in der Nähe des königlichen Alcazars fast immer eine Ölfunzel brannte, was natürlich meine Neugierde ganz gewaltig erregte. Ich ging der Sache nach, flog zum Turm und ließ mich vorsichtig auf der Zinne nieder. Von dort aus sah ich einen arabischen Zauberer, der beim Schein der rauchenden Lampe emsig arbeitete und wissenschaftliche Versuche machte.
Vor, neben und hinter ihm lagen stoßweise Bücher und gelbe Pergamentrollen, und auf seinen Schultern saß ein alter Rabe, der vertrauteste Freund, den er seinerzeit aus Ägypten mitgebracht hatte. Mit dem Raben bin ich sehr gut bekannt und verdanke ihm einen großen Teil meiner Kenntnisse. Der Magier selbst ist seitdem gestorben, aber der Rabe selbst lebt noch im gleichen Turmzimmer, denn du weißt ja, daß diese Vögel ein wunderbar langes Leben haben. Ich möchte dir nun raten, o Prinz, diesen Raben aufzusuchen; er ist ein großer Wahrsager und Beschwörer, ein Astrologe und Fachmann in der schwarzen Kunst, wegen der gemeinhin alle Raben, vorzugsweise aber die aus Ägypten, bekannt und berühmt sind.“
Dem Prinzen leuchtete der weise Rat ein, und seinem zukünftigen Minister folgend, zogen sie in Richtung Sevilla weiter. Achmed reiste seinem Genossen zuliebe nur des Nachts und ruhte bei Tag in irgendeiner dunklen Höhle oder in einem verfallenen Wachtturm, denn die Eule war mit den Unterkünften und Schlupfwinkeln solcher Art wohlbekannt, und außerdem hatte sie von je her eine wahre Leidenschaft für jede Art von alten Bauten und archäologischen Kunstschätzen. Alles hat einmal sein Ende, und so erreichten auch die beiden Reisenden eines schönen Tages kurz vor Sonnenaufgang die Stadt Sevilla. Die Eule blieb draußen vor den Mauern. Sie verabscheute die Helligkeit und den großen Lärm in den dichtgedrängten Straßen. In einem hohlen Baum bei einer Muhme schlug sie ihr Quartier auf, wo sie von niemandem belästigt wurde.
Der Prinz schritt rasch durchs Tor und fand bald den beschriebenen Turm, der sich gleich einer Palme hoch über die Häuser der Stadt erhob. Es war in der Tat derselbe, der heute noch steht und unter dem Namen Giralda als das berühmteste maurische Bauwerk Sevillas bekannt ist. Achmed stieg die Wendeltreppe bis zur Spitze des Turms hinauf und traf dort tatsächlich den zauberkundigen Raben. Es war ein alter Vogel, grauköpfig, mit struppigem Gefieder; auf einem Auge schien er blind zu sein, denn eine weiße Haut deckte es zu, was seinen Anblick gespensterhaft, ja furchterregend machte. Als der Prinz kam, stand er auf einem Bein und starrte einäugig mit zur Seite geneigtem Kopf vor sich hin auf die kabbalistischen Zeichen, die auf den Bodenfliesen zu sehen waren. Leise und ehrerbietig näherte sich ihm der königliche Besucher, mit jener Scheu, die das würdige Aussehen und sein übernatürliches Wissen jedem unwirklich einflößten.
„Verzeih mir, o ältester Meister in der Kabbala“, rief er aus, „wenn ich einen Augenblick diese Studien unterbreche, die die gesamte Welt in Bewunderung versetzen. Du hast einen Mann vor dir, der sich der Liebe geweiht hat und dich nun um Rat fragen möchte, wie er ans Ziel, zum Gegenstand seiner Leidenschaft gelangen könne.“ „Mit anderen Worten“, sagte der Rabe, ihn bedeutungsvoll anschielend, „du willst meine Kenntnisse in der Chiromantie erproben. Komm, zeig mir deine Hand, und laß mich die geheimnisvollen Schicksalslinien entziffern.“ „Entschuldige“, versetzte der Prinz, „ich komme nicht um einen Blick in die Zukunft zu tun, auch will ich nicht das wissen, was Allah dem Auge der Sterblichen verborgen hält; ich bin ein Pilger der Liebe und suche den Weg, der mich ans Ziel und zum Gegenstand meiner Irrfahrten führt.“
„Aber mein guter Junge, wie ist es möglich, daß du im fröhlichen und leichtlebigen Andalusien nicht ein deiner Liebe wertes Leben finden kannst?“ krächzte der alte Rabe und blickte ihn von der Seite her an, „hier im üppigen Sevilla kannst du doch unmöglich in Verlegenheit kommen, hier, wo unter Orangenbäumen auf den Straßen und Gärten glutäugige Mädchen Zainbra tanzen?“ Der Prinz wurde rot vor Verlegenheit und staunte einigermaßen darüber, einen so alten Vogel, der übrigens bereits mit einem Fuß im Grabe stand, locker sprechen zu hören.
„Glaube mir“, sagt er dann ernst, „ich bin auf keines jener leichtfertigen Liebesabenteuer aus, wie du vielleicht vermutest. Die leichtgeschürzten, schwarzäugigien Mädchen Andalusiens, die unter Orangenbäumen an den Ufern der Guadalquivirs tanzen, sind für mich nicht vorhanden, und ich kümmere mich keineswegs um sie. Ich suche eine unbekannte, aber makellose Schönheit, das Mädchen, das zu diesem Bild Modell stand. Ich ersuche dich, höchst mächtiger Rabe, sage mir, wenn du kannst und es dein Wissen erlaubt, wo ich das begehrte Geschöpf suchen muß und finden werde.“
Der alte Graukopf war wirklich etwas betroffen, als er den Prinzen mit solchem Ernst sprechen hörte. Er erwiderte daher abweisend: „Was weiß ich von Jugend und Schönheit! Ich besuche ja nur Alte und von Krankheiten gezeichnete Wesen; nichts habe ich mit Frische und Schönheit zu tun! Ich bin des Schicksals Bote und krächze von den Schornsteinen herab meine traurigen Weissagungen, die fast immer eine Todesnachricht enthalten, und schlage dann und wann mit meinen Flügeln an die Fenster eines Krankenzimmers, wenn der Sensenmann sich nähert. Du mußt schon anderswo nach deiner unbekannten Schönen forschen, denn ich bin wirklich nicht der Richtige dazu, der dir darüber Nachricht geben könnte.“ „Aber bei wem soll ich suchen, als bei den Söhnen der Weisheit, ich bin ein Prinz königlichem Geblüts, von den Sternen zu geheimnisvollen Unternehmungen auserwählt, von denen die Zukunft und das Schicksal ganzer Länder und Nationen abhängen kann.“
Als der Rabe merkte, daß die Angelegenheit von Wichtigkeit war und daß deren Verwirklichung von den Sternen abhänge, da änderte er gleich seinen Ton: „Über diese Prinzessin kann ich dir leider keine Auskunft geben, denn in Garten und Lauben, wo Frauen sind, halte ich mich in der Regel nicht auf. Aber ziehe nach Cordoba weiter und gehe dort zur ehrwürdigen Palme des großen Abderrahman, die im Hof der Mezquita steht, und dort wirst du einen Weisen finden, der alle Länder und alle königlichen Residenzen besucht hat und ein Liebling vieler Königinnen und Fürstinnen gewesen ist. Man wird dir dort sicherlich die gewünschte Auskunft geben können.“ „Vielen Dank für diese wertvolle Nachricht“, sagte Achmed, „und lebe wohl, du ehrwürdiger Astrologe.“ Der Prinz eilte aus der Stadt hinaus, holte seinen Reisegenossen, die Eule, ab, die noch immer im hohlen Baum bei ihrer Gevatterin schlummerte, und zog eiligst in Richtung Cordoba weiter.
Sie wanderten das fruchtbare Tal des Guadalquivirs aufwärts, durch duftende Haine, Orangenpflanzungen und Zitronenwälder, und kamen endlich an den hängenden Gärten Cordobas vorbei, die die Umgebung der Stadt zierten. Am stark bewachten Tor trennten sich die beiden Fahrtgenossen; die Eule blieb draußen und flog in ein dunkles Mauerloch unter dem Wachtturm, während der Prinz eilig weiterging, um die Palme zu suchen, die der große Abderrahman vor uralten Zeiten gepflanzt hatte. Leicht war es ihm, sie zu finden, denn sie stand im Vorhof der Hauptmoschee und überrage weit die üppigen Bäume. Derwische und Fakire saßen gruppenweise in den Säulengängen der Patios und erörterten diskutierend und gestikulierend irgendein theologisches Problem. Auch waren viele fromme Gläubige da; sie verrichteten ihre rituellen Waschungen, ehe sie das Gotteshaus betraten.
Am Fuße der Palme drängte sich eine Menge von Menschen und horchte aufmerksam auf die Weise eines Redners, der mit gewandter Geläufigkeit zu sprechen schien. „Dies“, sagte sich der Prinz“, muß der Weise sein, der mir Auskunft über die unbekannte Prinzessin geben soll.“ Achmed mischte sich unter die Leute und bemerkte mit Erstaunen, daß alle einem Papagei zuhörten, der mit seinem hellgrünen Rock, den verschmitzten Äuglein und einem wehenden Federbusch auf dem Kopf den Eindruck eines eitlen und von sich selbst eingenommenen Wesens machte. „Wie kommt es“, sagte der Prinz zu einem der Zuhörer, „daß so viele ernste Personen an dem dummen Geschwätz eines plappernden Vogels Gefallen finden können?“
„Freund, ihr wisst nicht, von wem und was ihr sprecht!“ antwortete leise der andere, „dieser Papagei ist ein direkter Nachkomme des berühmten persischen Papageis, der wegen seines Erzählertalents auf der ganzen Welt berühmt war. Dieser kluge Vogel hier hat alle Gelehrsamkeit des Morgenlandes auf seiner scharfen Zungenspitze; er ist Philosoph und Dichter, und er spricht in gereimten Versen ebenso schnell wie der klügste Derwisch seine auswendig gelernten Koranzitate. Weit kam er herum! Er besuchte fremde Königshöfe, Universitäten und hohe Schulen, und überall bestaunte ihn jung und alt wegen seiner Gelehrsamkeit. Auch war er der allgemein bekannte Liebling schöner Damen und verbrachte viel Zeit in Kemenaten und Harems, was bei der Vorliebe des schwachen Geschlechtes für dichtende und gebildete Papageien leicht verständlich ist.“
Hier unterbrach Achmed den Bürger von Cordoba und rief: „Genug, ich will eine private Unterredung mit diesem berühmten Weisen haben.“ Die Audienz wurde ihm gewährt, und der Liebespilger setzte dem weisen und viel gereisten Vogel Ziel und Zweck seiner Wanderschaft auseinander. Doch kaum hatte dieser vom Herzeleid Achmeds gehört, als er auch schon in ein trockenes und lautes Lachen ausbrach, daß ihm die Tränen aus den Augen flossen. „Entschuldige meine Heiterkeit“, sagte der Papagei, schon die bloße Erwähnung des Wortes Liebe bringt mich zum Lachen.“ Der Prinz war von dieser unhöflichen Heiterkeit keineswegs erbaut und sagte etwas verletzt: „Ist die Liebe nicht das große Geheimnis der Natur, das heilige Prinzip des Lebens, das gemeinsame Band, das in zarter Seelenverwandtschaft Mann und Frau sich finden läßt?“
„Ja, was du nicht alles weißt!“ rief der Papagei, ihn laut unterbrechend, „sag mir doch, woher hast du eigentlich dieses sentimentale Geschwätz? Glaub mir, Liebe ist aus der Mode! In der guten Gesellschaft, bei Leuten von feiner Bildung und Witz wird darüber nicht mehr gesprochen.“ Mit Wehmut dachte Achmed an seine arme Freundin, die gute Taube, und wie die ganz anders von der Liebe gesprochen hatte. Der Prinz fand aber das Verhalten des Papageis verständlich und nahm es ihm nicht übel, denn das lange Hofleben, so dachte er sich, habe den Vogel affektiert und eingebildet gemacht, was ja auch Männern von Ruf zustoßen soll. Keineswegs jedoch wollte er seine innersten Gefühle dem Spott des schwatzenden Papageis nochmals preisgeben. Er kam daher rasch auf den unmittelbaren Zweck seines Besuches zu sprechen.
„Sage mir, hochgebildeter Freund von Königen, Fürsten und Prinzessinnen, der du überall, selbst in die geheimsten Gemächer der adeligen Schönen Zutritt hattest, begegnetest du einmal auf deinen Reisen diesem schönen Mädchen, das hier abgebildet ist?“ Der Papagei nahm das kleine Rundbildchen in seine Krallen, wackelte mit dem Kopf von einer Seite zur anderen und prüfte mit neugierigen Äuglein die Gesichtszüge des Mädchens. „Blitz und Donnerschläge“, rief er, „wirklich ein recht hübsches Gesicht; wirklich schön und zart. Aber ich habe auf meinen Reisen so viele nette Frauenzimmer gesehen, daß ich mich wirklich nicht erinnern kann. Doch halt, wahrhaftig! Wenn ich recht sehe....nun bin ich ganz sicher: Es ist die Prinzessin Aldegunda! Wie konnte ich nur diesen Engel vergessen, bei dem ich in so hoher Gunst stand!“
"Die Prinzessin Aldegunde“, wiederholte Achmed. „Und wo kann ich sie finden?“ Immer langsam“, antwortete der Papagei, „sie ist nämlich viel leichter zu finden als zu gewinnen. Aldegunde ist die einzige Tochter des christlichen Königs von Toledo. Wegen einer Prophezeiung von Astrologen und Wahrsagern, die sich ja bekanntlich in alle Sachen mischen, auch wenn diese sie selbst nichts angehen, hält man das schöne Mädchen bis zu ihrem siebzehnten Geburtstag von aller Welt abgeschlossen. Du wirst sie nicht bewundern können, denn kein Sterblicher darf sie sehen. Ich wurde seinerzeit eingeführt und zugelassen, um sie zu zerstreuen und zu unterhalten, was mir bei dem guten Kind auch leicht gelang. Auf mein Ehrenwort kann ich dir versichern, daß ich auf der Welt kein hübscheres und liebeswerters Wesen gesehen habe.
„Ein Wort im Vertrauen, lieber Papagei“, sagte Achmed, „du mußt wissen, daß ich der Erbe eines großen Königreiches bin und eines Tages auf dem Thron von Granada sitzen werde. Ich sehe, daß du ein kleiner Vogel bist und die Welt kennst. Hilf mir die Prinzessin freien, und du sollst einer meiner höchsten Hofbeamten werden.“ Ernst antwortete der Papagei: „Von Herzen gern, lieber Freund! Was aber die Stellung bei Hof anbelangt, so möchte ich dich bitten, mir eine gute Pfründe ohne Amtsgeschäfte zu geben, denn wir Schöngeister haben einen gewissen Widerwillen gegen Arbeit.“ Bald war alles geordnet, das Anstellungsdekret unterzeichnet, und Prinz und Papagei verließen die Kalifenstadt durch dasselbe Tor, durch das vor Stunden die königliche Hoheit ratsuchend allein hergekommen war.
Draußen vor der Stadtmauer pfiff Achmed die Eule aus dem Mauerloch heraus, machte seine beiden Kronräte miteinander bekannt, und gemeinsam zogen sie dann nach Erledigung einiger Förmlichkeiten gegen Norden und den Bergen zu. Die Fahrt ging allerdings nicht so schnell vonstatten, wie es der Prinz wohl wünschte; er mußte einige Unannehmlichkeiten mit in Kauf nehmen: Da war einmal der verwöhnte und an ein bequemes Leben gewohnte Papagei, der in der Frühe nicht gestört sein wollte. Die Eule ihrerseits wieder hielt eine ausgiebige Siesta und döste bis in den späten Nachmittag hinein; dazu kam noch ihr Fimmel für alte Bauten und archäologische Kunstschätze, die sie alle sehen wollte. Bei jeder Ruine machte sie halt, kroch in allen Mauerlöchern herum, besuchte Basen und Vettern, Uhus und Käuze und erzählte dann gar lange Geschichten von den Burgen und Türmen, von deren einstigen Bewohnern und den Umständen, die ihre Mauern zum Bersten brachten.
Zu all dem kamen noch unangenehme Familienzwistigkeiten: Eule und Papagei vertrugen sich nämlich ganz und gar nicht. Obschon beide Vögel sehr gebildet waren, behagte keinem die Gesellschaft des anderen; den ganzen Tag hindurch stritten sie, kaum daß sie sich irgendwo trafen. Der Papagei war ein Schöngeist, die Eule ein Philosoph. Erster rezitierte Verse, kritisierte die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten und Bücher, wobei er mit beißendem Spott, aber ohne Fachwissen, die verschiedensten Disziplinen der Gelehrsamkeit eingehendst behandelte. Für die Eule waren natürlich derartige Kenntnisse ganz und gar bedeutungslos und reiner Unsinn, und sie antwortete mit einem Vortrag über Metaphysik. Dann wieder sang der Papagei mancherlei Lieder, die nicht für jedermanns Ohr waren; er erzählte gute Witze und unterhielt sich auf Kosten seines Reisegenossen. Solches Gehabe verletzte natürlich die Würde der Eule, die sich furchtbar ärgerte, vor Wut fast barst und den weiteren Rest des Tages wie ein Grab schwieg.
Der junge Prinz gab sich ganz seinen Träumen hin und betrachtete stundenlang das Bildnis der schönen Tochter des christliches Königs von Toledo. Er ließ also die beiden Reisegefährten um des Kaisers Bart streiten, mischte sich nicht in ihre langen Diskussionen und sorgte nur dafür, daß nicht zuviel Zeit verlorenging. So kamen sie durch die hohen Bergtäler der Sierra Morena, über die ausgedörrten Ebenen Kastiliens und der Mancha, dann den Tajo entlang, der sich durch halb Spanien und Portugal hindurchwindet. Endlich erblickten sie in der Ferne eine feste Stadt mit starken Mauern und Türmen. Sie erhob sich auf einem felsigen Vorgebirge, das weit ins Tal hinausschaute und an dessen Fuß die Wasser des Tajo wild aufspritzten.
„Seht“, rief die Eule aus, „das berühmte Toledo, bekannt seiner historischen Schätze wegen. Beachtet dort die ehrwürdigen Türme und die hohen Kuppeln; der Staub von Jahrhunderten deckt sie, und reiche Sagen heiligen den Ort, an dem so viele meiner Vorfahren sich dem Studium und der stillen Meditation hingaben und noch hingeben.“ „Still und halt den Schnabel!“ rief unwillig der Papagei und schnitt weitere kunsthistorische Erörterungen kurz ab. „Was kümmern uns die Altertümer, Monumente aus vergangenen Zeiten, Sagen und Geschichten von deinen Vorfahren? Sieh hinüber, dort zur Wohnstätte der Jugend und Schönheit! Das ist es, was wir wollen, denn, o Prinz, hier lebt deine langgesuchte und so heiß ersehnte Prinzessin!“
Achmed blickte in die vom Papagei angedeutete Richtung und sah in einer herrlichen Au am Ufer des Tajo einen prächtigen Palast, der aus vielen Hunderten von Baumkronen hervorzuwachsen schien. Es war wirklich der Ort, den die Taube ihm beschrieben hatte. Klopfenden Herzens starrte der verliebte Prinz zum Schloß und murmelte leise vor sich hin: „Vielleicht lustwandelt jetzt das schöne Kind unter jenen schattigen Baumgruppen oder schwebt mit leicht beschwingtem Schritt über die kunstvolle Terrasse dort; vielleicht ruht und schlummert sie in einem kühlen Mirador des Palastes. Als der junge Mann allmählich wieder zu sich kam, bemerkte er voll Schreck, daß der Ansitz der Toledaner Königstochter von unübersteiglich hohen Mauern umgeben war und daß die bis an die Zähne bewaffneten Soldaten ununterbrochen die Runde machten, um zu verhinderten, daß jemand sich der Prinzessin nähern konnte.
Als der Prinz die Lage erfasst hatte, wandte er sich umgehend an den immer noch den schwätzenden Papagei und sagte zu ihm: "Vollkommenster aller Vögel! Du hast die Gabe der menschlichen Sprache, und durch große Klugheit zeichnest du dich aus! Fliege eiligst in den Schlossgarten, suche die Abgöttin meiner Seele und sag dem schönen Mädchen, daß Prinz Achmed als Pilger der Liebe nun an die blumigen Ufer des Tajos gekommen ist, um sie aufzusuchen und sich ihr zu Füßen zu werfen.“ Stolz auf sein Amt flog der Papagei, allsogleich zum Garten, schwang sich über die hohe Mauer, schwebte wie suchend eine kurze Weile über den Wiesen und Beeten und ließ sich dann rasch auf dem Balkon eines Lusthäuschens nieder, das am Flussufer stand.
Neugierig schaute er durchs Fenster und sah drinnen im Zimmer die Prinzessin auf einem reichen Diwan sitzen, die Augen auf ein Stück Papier geheftet, das ihre Tränen, die langsam über ihre blassen Wangen herunterflossen, netzten. Der Papagei putzte einen Augenblick seine Flügel, zog seinen hellgrünen Rock zurecht, richtete seine Kopfschleife in die Höhe und ließ sich mit höflichem Anstand an ihrer Seite nieder. Im zärtlichsten Ton sagte er dann: „Trockne deine Tränen, schönste aller Prinzessinnen, ich bringe dir Trost und zaubere wieder Lächeln auf deine zarten Lippen.“
Verständlicherweise erschrak die Prinzessin heftigst, als sie eine Stimme hinter sich hörte. Rasch drehte sie sich um und den grünröckigen Vogel betrachtend, der sich untertänigst verneigte, sagte sie traurig: „Ach, welchen Trost willst du mir schon bringen, du bist ja nur ein Papagei?“ Es verdroß den Papagei solche Rede, aber er schluckte seinen Ärger hinunter und sagte in schnippischem Ton: „Wisse liebes Kind, gar manch schöne Dinge tröstete ich schon in meinem Leben, und mit Erfolg! Doch dies nur nebenbei, denn heute komme ich als Gesandter des königlichen Prinzen Achmed. Der künftige Herrscher von Granada weilt gegenwärtig an den blumenreichen Ufern des Tajo und will dir seine Aufwartung machen.“
Scharf blitzten die Augen der schönen Prinzessin bei diesen Worten und leuchteten heller als die Diamanten ihrer Krone. „O süßester aller Papageien“, rief sie aus, „herrlich klingen in der Tat deine Nachrichten! Schwach und verzagt war ich, und die Zweifel an Achmeds Treue machten mich krank. Eile zurück und sage ihm, daß die Worte seines Briefes in meinem Herzen gemeißelt stehen und daß seine liebevollen Verse seit Monaten die geistige Nahrung meiner Seele sind, daß nur die Gedanken an ihn mich aufrecht hielten. Trage ihm aber auch auf, daß er sich umgehend rüste, denn mit der Waffe in der Hand wird er im Kampfspiel seine Liebe zu mir unter Beweis stellen müssen. Morgen an meinem siebzehnten Geburtstag veranstaltet mein Vater ein großes Turnier, an dem die besten Klingen und mutigsten Helden in die Schranken treten werden, denn meine Hand soll als Preis dem Sieger gehören.“
Der Papagei erhob sich, rauschte durchs Gebüsch und flog zum Prinzen zurück, der schon ungeduldig auf eine Antwort wartete. Groß war die Freude Achmeds, als er hörte, daß im Schloße wirklich die Prinzessin, deren Bild er im Medaillon gesehen hatte, wohne und daß sie seiner in sehnsuchtsvoller Liebe gedachte. Laut jubelte er auf, denn sein Traum war Wirklichkeit geworden. In den Freudenbecher fielen allerdings einige Tropfen bitteren Wermuts; denn das nun bevorstehende Kampfspiel machte ihm einige Sorgen, was leicht verständlich ist, wenn man bedenkt, daß er nicht von Kriegern und Rittern erzogen worden war, sondern von einem gelehrten Philosophen.
Schon sah man stahlgepanzerte Ritter den Tajo entlang und in die Stadt hinauf reiten. Hell glänzten ihre Waffen im Sonnenschein, und laut schallten die Trompeten und Posaunen der Schildknappen. Viele edle Herrschaften drängten sich durch die Gassen der alten Gotenstadt, und alles wollte dem Turnier beiwohnen, wo man erstmals die schöne Königstochter zu Gesicht bekommen sollte. Die Vorsehung wollte es, daß das Geschick der beiden jungen Königskinder vom selben Stern gelenkt und beeinflußt wurde. Daher war auch die Prinzessin bis zu ihrem siebzehnten Geburtstag von aller Welt abgeschlossen gewesen, um sie vor den gefährlichen Einflüssen einer vorzeitigen Liebe zu schützen. Dies verhinderte jedoch nicht, daß ihre Schönheit allgemein bekannt wurde und sich bereits mehrere mächtige Prinzen um sie beworben hatten.
Der König aber, ein Mann von außerordentlicher Klugheit wollte sich der Tochter wegen mit niemanden verfeinden; er gab keinem der Freier eine eindeutige Antwort, sondern verwies alle auf ein Kampfspiel und sagte, daß der Sieger die Prinzessin als Ehefrau heimführen könne. Klar, daß sich unter diesen Umständen gar mancher waffengewandte Haudegen unter den Bewerbern befand, dessen Mut bekannt und gefürchtet war. Eine wirklich unangenehme Lage für den unglücklichen Achmed, der weder mit Waffen versehen, noch in ritterlichen Übungen erfahren war. “Oh, ich unglücklichster aller Prinzen“, rief er verzweifelt aus. „Wozu nützen mir nun Algebra und Astronomie und all die anderen Wissenschaften, die mich ein Philosoph in klösterlicher Abgeschiedenheit lehrte? Ach, Eben Bonabben, warum hast du es versäumt, mich in der Führung von Waffen zu unterweisen?“
Aufmerksam hatte die Eule zugehört, und fromm zum Himmel aufblickend, sagte sie laut dem Prinzen: „Allah akbar! Gott ist groß! Alle geheimen Dinge liegen in seiner Hand. Er allein lenkt das Schicksal von Königen und Fürsten, und kein Vogel fällt ohne seinen Willen vom Baum und aus dem Nest.“ Nach dieser religiösen Einstellung, die seinem Charakter als frommer Mensch entsprach, fuhr der Uhu fort: „Wisse, o Prinz, daß dieses Land voll von Geheimnissen ist, die nur ganz wenige Menschen kennen, weil man dazu in der Kabbala schon sehr bewandert sein muß. Ich bin es, und mir ist alls erschlossen! Merke also gut auf und höre.
In den benachbarten Bergen gibt es eine Höhle. Drinnen befindet sich ein eiserner Tisch, und darauf liegt eine vollständige Zauberrüstung. Auch steht seit Generationen ein verwunschenes Pferd dort, das der Spruch eines Magiers gleichzeitig mit dem Panzerkleid und den Waffen in die Grotte gebannt hatte.“ Der Prinz war außer sich vor Staunen aufgesprungen, während die Eule mit ihren großen Augen blinzelte und die gefiederten Hörner spitzend fortfuhr: „Vor vielen Jahren begleitete ich hier und da meinen Vater auf den Rundreisen durch seine Besitzungen, und wir kamen dabei in die erwähnte Höhle. Mehrmals übernachteten wir dort bei ansässigen Vettern und Basen, so daß ich also bald das Geheimnis kannte.
Als ich noch eine ganz kleine Eule war, erzählte mir auch einmal mein Großvater, daß diese Rüstung und das gewappnete Pferd einem magischen Zauberer gehörten, der nach der Einnahme von Toledo durch die Christen in dieser Höhle Zuflucht suchte, hier starb er, Roß und Waffen hatte er unter einem geheimnisvollen Bann zurückgelassen. Allein ein Maure, sagte mir mein Großvater weiter, könne den Zauber brechen, und das nur von Sonnenaufgang bis zum Mittag; jeder aber, der sich in dieser Zeit der Rüstung bediene, werde seine Gegner besiegen, wer immer sie auch seien.“ „Genug, gehen wir zur Höhle!“ rief Achmed aus.
Von seinem sagenreichen Begleiter geführt, stand der Prinz bald vor der Höhle, wo einst der maurische Magier seine letzte Zufluchtsstätte gefunden hatte. Sie lag in einer der wildesten Bergschluchten hinter Toledo, und den Höhleneingang konnte nur das scharfe Auge einer Eule oder der Späherblick eines Archäologen entdecken. Eine sich nie verzehrende Ölfunzel verbreitete im Innern der Grotte ein feierliches Dämmerlicht, und das Auge Achmeds mußte sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, ehe er die sich darin befindlichen Gegenstände unterscheiden konnte. Auf einem eisernen Tisch in der Mitte der Höhle sah er die erwähnte Zauberrüstung, daneben lehnte eine Lanze, und etwas im Hintergrund stand unbeweglich ein kampfmäßig aufgezäumter Hengst, schön wie ein klassisches Standbild. Die Rüstung, der Harnisch und das Zaumzeug glänzten hell. Als habe sie ein eifriger Knappe erst vor Stunden wieder einmal aufpoliert.
Das Roß schien gerade von der Weide gekommen, und als ihm der Prinz die Hand streichelnd auf den Kamm legte, da scharrte es mit den Hufen im Boden und wieherte vor Freude, daß die Wände zitterten. Im Besitz von Roß und Waffen beschloß der granadinische Königssohn, sich im bevorstehenden Turnier zum Kampf zu stellen und um die Hand der schöne Aldegunde zu werben. Der entscheidende Morgen brach endlich an. Die Schranken für den Kampf waren in der Vega gerade unter den Felsmauern Toledos aufgestellt; rund um den Platz hatte man Bühnen und Galerien errichtet, die reichsten Teppichschmuck zeigten. Kunstvolle Baldachine aus reiner Seide spendeten Schatten und schützten die Zuschauer vor der heißen kastilischen Sonne.
Die edelsten und schönsten Damen des Landes waren auf der Tribüne versammelt; besprachen das Tagesereignis und unterhielten sich über die Ritter, die mit Pagen und Knappen stolz den Turnierplatz überquerten; und als die Prinzen erschienen und mit geöffneten Visieren den reichen Damenflor grüßten, da hob ein allgemeines Murmeln an, ein Rätselraten, denn unter diesen Kavalieren mußte ja der künftige Gemahl Aldegundes sein, der im ritterlichen Wettstreit seine Gegner aus dem Sattel zu werfen hatte. Aber all das schien in den Schatten gerückt, als die Prinzessin selbst erschien und auf der Tribüne des Königs, ihres Vaters Platz nahm.
Alles erhob sich ehrerbietigst von den Sitzen, voll Bewunderung schwenkten die Edelmänner ihre Waffen, und Barden stimmten einen Lobgesang an; denn wenn auch der Ruf von der Schönheit des Königskindes über die Mauern ihres Jungfernsitzes bis weit in die fremden Lande gelangen konnte, so übertraf ihre Schönheit doch alle Erwartungen. Kein Wunder also, daß die ritterlichen Bewerber sich im Sattel zurechtsetzten, jeder seine Lanze fester faßte und die Gegner abwägend zu messen schien. Die Prinzessin machte indessen gar keinen fröhlichen Eindruck. Ihre Wangen wurden bald rot, bald blaß, und ihre Augen streiften mit ruhelosem und unbefriedigtem Ausdruck die Reihen stolzer Krieger entlang.
Schon sollten die Trompeten den Beginn der Kampfspiele ankünden, als der Herold die Ankunft eines fremden Ritters meldete, der auch noch am Turnier teilnehmen wollte. Achmed ritt in die Schranken! Alle staunten. Ein mit Edelsteinen besetzter Helm saß fest auf seinem Turban, Panzer, Harnisch und Schienen waren mit Gold ausgelegt, Schwert und Dolch stammten aus den Werkstätten in Fez, und in Scheide, Griff und Korb glänzen kostbare Diamanten. Ein runder Schild hing an seiner Schulter, und in der Hand trug er die zauberkräftige Lanze. Die prächtigen Decken, Schabracke und Schabrunke waren reich gestickt und schleiften über den Boden, während das stolze Roß sich hoch aufbäumte, durch die Nüstern schnaubte und vor Freude laut wieherte, wieder einmal Waffenglanz zu sehen und seinen gepanzerten Ritter in reichem Waffenschmuck mit Krummschwert und Halbmond tragen zu können.
Die stolze Haltung Achmeds fiel allgemein auf, und viele Damen schauten recht huldvoll zu ihm hinunter; und als gar sein Name „Der Liebespilger“ angekündigt wurde, da entstand unter den feurigen Kastilianerinnen geradezu ein Tumult, denn allzu groß war die weibliche Neugier. Doch die Schranken blieben unserem Ritter geschlossen, denn, so sagte man ihm, nur Prinzen königlichen Geblüts dürften kämpfen. Er nannte also seinen vollen Namen, Rang und Herkunft. Aber das war noch viel schlimmer! Er war Mohammedaner und durfte somit nicht an einem Turnier teilnehmen, dessen Preis die Hand einer christlichen Prinzessin war. Die adeligen Bewerber, aus nah und fern, umringten Achmed mit drohenden Mienen, wobei sich einer von herkulischer Gestalt durch sein unverschämtes Benehmen ganz besonders hervortat. Laut verlachte er den jungen Mauren seines zierlichen Körperbaues wegen und spottete über den vulgären Beinamen, der, wie er sagte, eines kriegerischen Ritters unwürdig sei.
Solche Beleidigungen konnte der Prinz natürlich nicht auf sich beruhen lassen. Voll Zorn forderte er den rüden Nebenbuhler zum Zweikampf heraus. Beide nahmen alsogleich Distanz, legten ihre Lanzen an und gingen aufeinander los; voll Wut der Spanier, überlegt und berechnend der Maure. Aber schon bei der ersten Berührung mit der Zauberlanze flog der muskulöse Spötter aus dem Sattel und wälzte sich am Boden. Achmed hätte jetzt gerne innengehalten und seinem Feind versöhnend die Hand gereicht, aber er hatte nicht mit seinem Araberhengst, und mit der dämonischen Waffe gerechnet, die einmal in Tätigkeit, nicht zu zügeln waren, bis kein Gegner sich mehr blicken ließ.
Das wilde Roß stürzte sich ins dichte Gedränge, und die Lanze warf jeden zu Boden, der sich ihr in den Weg stellte. Der sanfte Prinz ritt wie toll auf dem Kampfplatz herum, schlug alles nieder, und bald lagen Ritter und Bauern, Adelige und Bürger, Knappen und Knechte auf dem Rasen und wussten nicht, wie das zugegangen war, während er voll Kummer über seine unfreiwilligen Heldentaten das höllische Roß zu zügeln trachtete. Der König raste voller Wut über die ihm angetane Schmach und um seine Gäste und Untertanen zu rächen, ließ er umgehend seine Leibgarde ausrücken, die den Mauren gefangennehmen und bändigen sollte. Doch in wenigen Sekunden lagen auch diese Ritter besiegt und geschlagen auf dem Boden. Nun griff der König persönlich ein. Er legte seine Staatsgewänder ab, griff nach Schild und Lanze und ritt gewappnet auf den Turnierplatz, denn er wollte dem Ungläubigen schon zeigen, wie man sich am Hof eines christlichen Fürsten zu benehmen habe. Aber auch Seiner Majestät erging es nicht besser als den Höflingen und Untertanen. Roß und Lanze achteten weder Rang noch Namen, und zu Achmeds Verdruß ging sein Hengst den König scharf an, und ehe er noch richtig überlegen konnte, fiel dieser bereits aus dem Sattel, und die Krone rollte in den Staub.
In diesem Augenblick stand die Sonne auf voller Höhe; der magische Bann verlor seine Kraft, und Rüstung, Roß und Speer mußten in die Höhle zurück, wo sie seit vielen Lustren bereits gestanden hat. Der Araberhengst durchflog die Bahn, setzte über die Schranken, sprang in den Tajo, durchschwamm diese wilde Strömung, galoppierte mit dem atemlosen Prinzen, der sich an Kamm und Mähne festhielt, durch die Bergschlucht zur Grotte. Dort stellte er sich neben den eisernen Tisch und wurde wieder unbeweglich wie eine Bildsäule. Herzlich froh stieg Achmed ab, legte die Rüstung auf ihren Platz und lehnte die Lanze an die Wand. Dann setzte er sich wieder auf den Boden und begann zu grübeln und zu seufzen, denn das Zauberzeug hatte ihn in eine wirklich verzweifelte Lage gebracht. Niemals mehr durfte er sich in Toledo zeigen, nachdem er dessen Ritterschaft solche Schmach und dem König und Landesherrn solche Beschimpfung zugefügt hatte. Und was sollte erst die Prinzessin von ihm denken, von seinem rohen und draufgängerischen Benehmen? Voll Angst und Furcht schickte er seine beiden gefiederten Ratgeber auf Kundschaft aus, um ihm dann Nachricht zu bringen, was man in Toledeo von dem Vorfall hielt.
Der Papagei trieb sich auf allen öffentlichen Plätzen herum, trat in die besuchtesten Schenken Toledos und war bald wieder mit einem ganzen Sack voll Neuigkeiten beim Prinzen in der Höhle. Ganz Toledo war bestürzt. Die Prinzessin trug man nach dem Vorfall besinnungslos in den Palast; das Kampfspiel hatte ein jähes und unvorhergesehenes Ende genommen, und alles sprach von dem plötzlichen Erscheinen, den wunderbaren Taten und dem seltsamen Verschwinden des mohammedanischen Ritters. Einige aus dem Volke erklärten ihn für einen maurischen Hexenmeister, andere wieder hielten ihn gar für einen Teufel, der menschliche Gestalt angenommen habe, und die Alten schließlich erzählten auf dem Markt und vor den Kirchen Geschichten von verwunschenen Schätzen und gebannten Kriegern, und meinten, daß es einer von diesen sein könnte, der plötzlich aus der Höhle hervorgekommen sei, um die ganze spanische Christenheit zu schrecken. Was man auch immer erzählen mochte, alle stimmten darin überein, daß kein Sterblicher derartige Wundertaten vollbringen und solch brave und wackere Streiter aus dem Sattel heben könne, ohne mit dem Teufel selbst oder wenigstens mit einem seiner Anhänger im Bund zu sein.
Die Eule flog des Nachts fort, flatterte durch in die Dunkelheit gehüllte Stadt und ließ sich auf Dächern und Schornsteinen nieder, um so etwas zu erfahren. Sie kam natürlich auch zum königlichen Palast, der auf felsiger Höhe über der Stadt emporragte, und stöberte dort in einsamen Zimmern, auf Zinnen und Terrassen herum; lauschte an jeder Mauerritze und Türspalte und glotzte durch die beleuchteten Fenster der Diensträume und, neugierig wie sie war, auch in die Frauengemächer, so daß beim Anblick der großen starren Augen einige der Hofdamen in Ohnmacht fielen. Als der Morgen dämmerte, kam sie endlich wieder zurück und erzählte dem hart wartenden Prinzen alles, was sie gesehen und gehört hatte. Nach einem ausführlichen Lagebericht erzählte der Uhu schließlich:
„Als ich einen der höchsten Türme auskundschaftete, sah ich in einem schön eingerichteten Schlafzimmer die holde Prinzessin auf einem Ruhebett liegen. Ärzte und Dienerinnen, Hofdamen und Räte umgaben das Lager, doch die Königstochter wollte von ihren Diensten nichts wissen und bat alle, sie allein zu lassen um sich endlich zurückzuziehen. Als sie weg waren, sah ich, wie sie einen Brief aus ihrem Busen zog, ihn las, küßte und laut zu weinen begann. Ich muß dir ehrlich sagen, o Prinz, daß solche Klagen und solch bittere Tränen selbst mich, den ruhigsten aller Philosophen, zutiefst rührten. Achmeds zärtliches Herz betrübten diese Nachrichten. „Nur zu wahr waren deine Worte, o weiser Eben Bonabben“, rief er laut aus! „Sorge und Kummer, schlaflose Nächte und heiße Tränen sind das traurige Los der Liebenden. Allah behüte die Prinzessin vor den verderblichen Folgen jenes Zustandes, den man Liebe nennt!“
Weitere Nachrichten aus Toledo bestätigten den Bericht der Eule. Die Stadt war in heller Aufregung. Die Prinzessin hatte man in den festeren Turm des Palastes gebracht, und scharfe Wachen wehrten jedermann den Zugang zur Kemenate. Krank saß indessen die arme Aldegunde in ihrem Gemach. Es hatte sich ihrer eine verzehrende Schwermut bemächtigt, deren Ursache niemand kannte. Trank und Speise wies sie voll Ekel zurück und hörte auf keines der Trostworte ihrer Umgebung. Die geschicktesten Ärzte des Landes standen vor einem unlösbaren Rätsel und äußerten, denn irgend etwas müßten sie ja dem König sagen, daß eine Hexe ihre Hand im Spiel habe. Der besorgte Vater ließ daher öffentlich verkünden, wer seine Tochter heilen würde, könne sich als Lohn den kostbarsten Juwel aus der königlichen Schatzkammer nehmen.
Als die Eule diese wichtige Nachricht hörte, schlummerte sie gerade in einem Winkel der Höhle. Sie wurde wach, rollte geheimnisvoll ihre großen Augen und rief: „ Allah, Akbar! Glücklich ist der Mann, dem die Heilung gelingt; aber er muß wissen, was er aus der Schatzkammer dafür fordert!“ „Was meinst du, höchst ehrenwerte Eule?“ fragte kurz Achmed. „Höre, o Prinz, auf das, was ich dir nun erzählen will. Wie du sicherlich schon wissen wirst, bilden wir Eulen eine gelehrte Vereinigung von Forschern, die ihre Aufmerksamkeit ganz besonders den Altertümern und historischen Monumenten zuwenden. Während meines letzten Nachtfluges zu den Türmen und Palästen Toledos stieß ich ganz zufällig in einem Gewölbe des Münzturmes auf eine Akademie von weisen Eulen. Alle waren auf Numismatik, Heraldik und Kunstgeschichte spezialisiert, und man besprach mit Klugheit die Schriftarten und Zeichen an mehreren goldenen Kelchen und Reliquien, die in der königlichen Schatzkammer aufgehäuft lagen und noch von Roderich dem Gotenkönig herstammen sollten.
Allgemeines Interesse erregten die mystischen Zeichen auf einem orientalischen Kästchen aus Sandelholz, denn sie waren den meisten Gelehrten unbekannt. Schon in mehreren Sitzungen behandelten die Akademiker dieses Thema, konnten sich aber trotz der gründlichsten Ausführungen von Fachleuten nicht einig werden, was wohl die kabbalistischen Zeichen darauf bedeuten möchten. Während meiner Anwesenheit erklärte nun eine alte Eule, sie war auch eigens zu diesem Zweck aus Ägypten eingeladen worden, daß, im Einklang mit der Inschrift auf dem Kästchen, dieses das seidene Throntuch von Salomon dem Weisen enthalten müsse, das ohne Zweifel nach der Zerstörung von Jerusalem von Juden nach Toledo gebracht worden war und aus unerklärlichen Gründen hier in einem Winkel der Schatzkammer vergessen liege.“
Als die Eule ihren wissenschaftlichen Vortrag beendet hatte, blickte der Prinz eine Zeitlang sinnend vor sich hin und sagte dann in Gedanken versunken wie zu sich selbst: „Eben Bonabben erzählte mir von den wunderbaren Eigenschaften dieses außerordentlichen Gewebes. Es war bei der Eroberung von Jerusalem durch die Römer verschwunden, und man glaubte, daß dieses zauberkräftige Kunstwerk für die Menschheit verloren sei. Ohne Zweifel wissen die Christen nicht, welch Wunderwerk sie ihr eigen nennen. Wenn ich in den Besitz dieses Tuches gelangen kann, dann allerdings wäre mein Glück gesichert.“ Am nächsten Morgen legte Achmed seine reichen Gewänder ab und kleidete sich in eine einfache Tracht eines armen Wüstenarabers. Das Gesicht färbte er sich dunkelbraun, so daß niemand in ihm den stolzen Ritter vom Turnier erkannt hätte, der dort solche Bewunderung und auch solchen Ärger und Verdruß verursacht hatte. Einen Wanderstab in der Hand, den Reiseranzen an der Seite und im Sack eine kleine Hirtenflöte schritt er rasch auf Toledo zu.
Ohne Beanstandung ließ man ihn durchs Tor, und er gelangte bald an die Pforte des Palastes.
Dort meldete er sich beim diensthabenden Wachbeamten und sagte, daß er die Prinzessin heilen könne und die versprochene Belohnung erwarte. Ritter und Gardisten wiesen ihn aber zurück und wollten den armen Bewerber verprügeln. „Was kann wohl ein herumstrolchender Araber helfen, wo einheimische Kapazitäten und Größen bis heute nichts ausgerichtet haben?“ schrien sie derart laut, daß der König sie hörte und befahl, den Araber kommen zu lassen.
„Mächtigster König“, sagte höflich Achmed, „du hast einen armen Beduinen vor dir, der den größten Teil seines Lebens in den Einöden der Wüste verbrachte. Wie du wissen wirst, sind diese Stätten der Sammelplatz von bösen Geistern und Dämonen; auf einsamen Wachen fallen sie uns Hirten an, fahren dann zwischen die Hirten, zerstreuen die flüchtigen Tiere und bringen manchmal selbst das geduldigste Kamel bis zur Tollwut. Musik ist das einzige Gegenmittel, das die Dämonen bannt. Von den Vätern her haben wir alte Weisen, die wir singen oder auf der Flöte spielen, wenn es Not tut, um die Teufel aus der Wüste auszutreiben und fernzuhalten. Ich gehöre einem alten Beduinenstamme an und kenne solche Melodien; wenn also deine Tochter unter dem Einfluß eines bösen Geistes steht oder gar behext wurde, dann, meinen Kopf verpfände ich dafür, kann das schöne Kind gesund werden.“
Der König, wie alle Könige, ein Mann von großem Verstand, hatte bereits von solchen Wundermelodien gehört und wußte auch, daß nur ganz bestimmte Wüstenbeduinen sie beherrschten. Rasch faßte er Hoffnung, denn Achmed hatte überzeugend gesprochen, und glücklich führte er ihn in den Palast und zum hohen Turm, wo hinter verschlossenen Türen im obersten Stock die Prinzessin saß und weinte. Die Fenster des Wohngemaches von Aldegunden gingen auf einen Gang hinaus, von wo man einen herrlichen Rundblick auf Toledo und die umliegenden Berge hatte. Jetzt waren Fenster und Balkontüren verhängt, denn das liebeskranke Kind konnte kein grelles Licht vertragen, zu groß war sein Kummer. Auf dem Gang vor der Kemenate hieß man den Prinzen sich setzen und seine Kunst zu versuchen.
Er zog auch gleich seine Hirtenflöte hervor und blies darauf einige wilde und feurige Araberweisen. Auf dem Generalife zu Granada hatte ihn sein Leibdiener solche Stücke gelehrt, wenn er des Lernens müde, Bücher und Papyrusrollen in eine Ecke geworfen hatte. Nervenaufpeitschend und schrill hallten die Flötentöne durch die Fenster in das Schlafgemach der Prinzessin; doch diese blieb teilnahmslos und reagierte nicht darauf. Spöttisch lächelnd schauten die gelehrten Doktoren auf den armen Araberjungen, der das zuwege bringen wollte, was sie, die Weisen des Landes, nicht geschafft hatten. Endlich legte Achmed sein Instrument weg und sang nach Art der Barden einige einfache Verse voll Liebe und Zärtlichkeit. Es war der Text des Briefes, den er einstens an die unbekannte Geliebte geschrieben hatte und dessen Überbringer der arme Tauber war.
Aldegunde erkannte sofort den Inhalt des Liedes, und eine jähe Freude durchzuckte ihr kleines Herz. Sie hob den Kopf und lauschte gespannt auf Worte und Melodie; dann stürzten Tränen der Freude aus ihren Augen und liefen ihr über die bleichen Wangen, die sich schon leicht sanft röteten. Ihr Busen hob und senkte sich im Aufruhr der Gefühle, und nur allzu gern hätte sie den Sänger gesehen. Doch Anstand und Scham verschlossen ihr den Mund. Der König las aber diesen Wunsch aus den Mienen seines geliebten Kindes und befahl, Achmed ins Zimmer zu führen. Geistesgegenwärtig benahmen sich die beiden Liebenden; sie schauten sich nur in die Augen, und beide wussten gleich, wie sie sich verhalten mußten, daß niemand Verdacht schöpfte und erriete, was sie dachten. Die Musik hatte gesiegt und einen vollkommenen Triumph errungen!
Pfirsichroter Schimmer legte sich auf die zarten Züge der Prinzessin; frisch leuchteten ihre Lippen, und schmachtenden Auges blickte sie versonnen und glücklich vor sich hin. Einen seidenen Überwurf streifte sie von den Schultern, denn heiß floß das Blut durch ihre Adern. Alle anwesenden Ärzte schauten einander erstaunt an und wussten nicht, was sie denken und sagen sollten. Voll Bewunderung und Scheu betrachtete der König den arabischen Sänger und sagte: „Wunderbarer Jüngling! Du sollst hinfort mein Leibarzt sein, und kein Mittel will ich künftig nehmen, das nicht du mir verschrieben hast; und deine Musik, soll allen helfen, wie sie meinem Kind geholfen hat. Sage mir, welche Belohnung willst du haben? Das kostbarste Kleinod meiner Schatzkammer sei dein.“
„O König“, erwiderte Achmed, „ich frag nicht nach Gold, Silber oder Edelsteinen, denn die Schätze dieser Welt sind für mich ohne Wert. Aber du hast in deiner Schatzkammer eine Reliquie aus der Maurenzeit, als diese noch in Toledo saßen; es ist ein Kästchen von Sandelholz und drinnen ist ein altes seidenes Gewebe. Gib mir dieses Kästchen mit dem Tuch, und ich bin zufrieden.“ Die Anwesenden waren von der großen Bescheidenheit des Beduinenjünglings überrascht, und ihr Erstaunen wuchs noch, als sie das Kästchen und das Gewebe sahen. Einfach war die Schatulle und einfach das Tuch. Es handelte sich um ein grünseidenes Stück Stoff, ohne besonderen Schmuck, das hebräische und chaldäische Schriftzeichen zeigte. Augenzwinkernd sahen sich die Hofärzte an und lächelten, denn zu groß war die an Dummheit grenzende Selbstlosigkeit ihres neuen Kollegen, der anscheinend nicht wußte, was er wollte.
Der Prinz schien nichts von all dem zu bemerken und sagte ernst: „Dieser Teppich bedeckte einstens den Thron Salamons des Weisen; er ist es wert, daß man in zu Füßen des schönsten und holdesten Wesen lege.“ Mit diesen Worten breitete er ihn auf dem Balkon vor dem Diwan der schönen Prinzessin aus, setzte sich darauf und sagte jedes Wort betonend: „Gott ist groß, sein Wille geschehe! Was im Buch des Schicksals geschrieben steht, muß sich erfüllen und niemand kann es verhindern. Seht, die Prophezeiung der Astrologen erfüllte sich! Wisse, o König, Aldegunde und ich wollen ein Paar werden, denn wir lieben uns im geheimen schon seit langer Zeit. Schau mich nur genau an. Ich bin der Liebespilger!“ Kaum hatte Achmed diese Worte gesprochen, als sich das Tuch langsam in die Luft erhob und die beiden Liebenden davontrug.
Der König, die Ärzte und Hofleute starrten ihnen nach, Mund und Augen weit aufgerissen, bis sie nur mehr ein kleiner Punkt waren, der auch bald am fernen Horizont verschwand. Der König tobte vor Wut und ließ den Schatzmeister kommen. „Wie konnte so etwas geschehen“, schrie er ihn an, „ wie konntest du einem Ungläubigen nur solche Kostbarkeit ausliefern?“ „Es ist ein Jammer, Majestät! Wir kannten die Wunderkraft des Stoffes nicht; niemand wußte die Inschrift auf dem Kästchen zu entziffern! Wenn es sich in der Tat um den Überwurf von Salomons Thron handelt, was ich nach dieser gegenwärtigen Sachlage annehme, dann können dessen Besitzer auf ihm durch die Lüfte fliegen, denn das ist eine magische Kraft.“ Der König ließ Alarm schlagen und sammelte ein gewaltiges Heer, an dessen Spitze er gegen Granada zog, um die Flüchtlinge zu verfolgen und die ihm angetane Beleidigung zu rächen. Lange war der Marsch und beschwerlich der Weg, aber endlich kam die Christenschar doch ans Ziel und schlug in der Vega ihr Lager auf.
Am nächsten Morgen schon sandte der König Herolde in die Stadt, um die Rückgabe seiner Tochter zu fordern. Der Maurenkönig ritt ihnen mit seinem ganzen Hofstaat entgegen, und zu ihrer Bestürzung erkannten sie in ihm den Sänger aus der Wüste Arabiens, der die Prinzessin erst heilte und dann entführte. Achmed hatte nämlich unterdessen nach dem Tod seines Vaters den Thron Granadas bestiegen und die schöne Aldegunde geheiratet. Als der König von Toledo erfuhr, daß seine Tochter ihren christlichen Glauben beibehalten durfte, war er bald besänftigt und gab nachträglich zur stattgehabten Hochzeit seinen Segen; nicht daß er gerade besonders fromm gewesen wäre, aber bei Fürsten und ähnlichen Potentaten ist ja bekanntlich die Religion eine Ehrensache und Mittel zur leichteren Handhabung des untertänigen Volkes.
In Granada gab es nun statt dessen der vorgesehenen blutigen Schlachten eine Reihe von Festen und Feiern, nach deren Ablauf der König und die Seinen recht vergnügt nach Toledo zurück kehrten, während das junge Paar glücklich weiterlebte und von der Alhambra aus weise sein Reich beherrschte. Es wäre noch hinzuzufügen, daß die Eule und er Papagei dem Prinzen in kurzen Tagreisen einzeln nach Granada gefolgt waren. Erstere reiste bei Nacht, besuchte Vetter und Basen, durchstöberte Gehöfte, Türme und Höhlen und frischte so die alte Freundschaft wieder auf. Der Papagei wiederum machte seine Aufwartung nur in feinen Kreisen, so beim Landadel, wo er ganz besonders bei Damen großes Glück hatte.
Achmed belohnte dankbar die Dienste, die sie ihm auf seiner Pilgerfahrt geleistet hatten. Die Eule machte er zu seinem Staatskanzler und den Papagei zum Haus – und Hofmarschall. Es ist wohl nicht notwendig, ganz speziell zu vermerken, daß kein Land je weiser regiert und kein Hofstaat je prunkvoller geführt wurde, als der zu Granada zur Zeit Achmeds und Aldegundens.
Märchen und Sagen aus Spanien
DAS GESPENST DER BUFERA
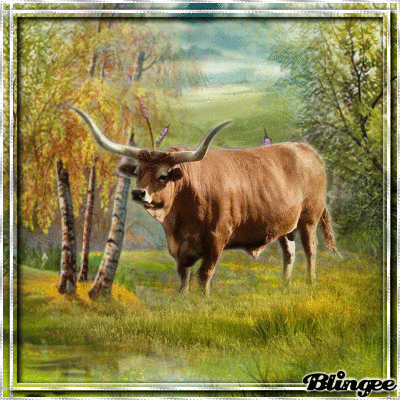
Ein Mann fischte mit Würmchen Aale in der Bufera und trug einen Korb auf dem Rücken.
Es war ein Ochse in der Bufera aufgezogen worden, den man Pau nannte, und eines Tages als ein Sturm losbrach, fing der Ochse an zu rennen und zu brüllen, und brüllend lief er von einer Seite zur anderen.
Jener Mann der mit Würmchen fischte, hörte das Brüllen, erschrak und rief:
- Jesus, Heiliger Antonius, sprang in den Wassergraben und warf den Korb weg.
Der Pau, jener Ochse blieb nicht stehen bis La Pobla und als er zu dem Hause gekommen war, wo er geboren worden, klopfte er mit dem Fuss an die Thüre und der Herr des Hauses, der klopfen hörte fragte:
- Wer ist da?
Keine Antwort, er fragte wieder:
- Wer ist da?
Und wieder keine Nachricht.
Zuletzt, steckte er den Kopf zum Fenster hinaus und sieht den Ochsen.
- Es ist der Pau, sagte er, und ging sogleich hinunter, um aufzumachen, packte ihn bei einem Horn, führte ihn in die Strohkammer, gab ihm ein Bündel Futter und ging, um den Schlaf zu tödten.
Dieser Ochse ward das Gespenst der Bufera, weil jener Mann der Aale fischen wollte, aussagte, dass er ein Gespenst gehört habe und wenn ihr es nicht glaubt, in Ca na Bassera wissen sie das weitere.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DAS GESPENST VOM RAFAL

Im Rafal ging ein Gespenst um, von dem man sagte, dass es überall war, und dass man es nirgends sehen konnte. Es ging durch alle Zimmer der Häuser, ausgenommen vor der Kirche. Niemand hatte es je gesehen, wenn es nicht einige Knaben waren, welche am Allerseelentage Zirbeln assen, die einen Mann mit einem sehr langen Bart auf einem Balkon sahen, der aus einer sehr grossen Pfeife rauchte. In der Nacht hörten sie vielen Lärm, Teller und Töpfe zerschlagen, aber am anderen Morgen fanden sie alles wieder heil und ganz. Niemand wollte um keinen Preis mehr in jenem Hause schlafen.
Ein Geistlicher, der sehr waghalsig war, sagte, dass er dort schlafen würde; er ging hin übernachten, und als er sich niederlegte, liess er das Brevier auf einem Stuhl beim Bette liegen. Er war noch nicht eingeschlafen, als er hörte, wie man das Brevier nahm. Er zündete ein Zündhölzchen an, sah aber Niemanden und das Buch lag noch genau so wie er es gelassen hatte. Nach einigen Augenblicken hörte er wieder Lärm und fragte:
- Wer berührt das Buch?
- Ich halte das Buch, sagte eine Stimme; er zündete sofort ein Zündhölzchen an, sah aber Niemanden und das Buch lag am selben Ort.
Am anderen Tag sagte er, dass er nie mehr dort schlafen wolle.
Ein anderes Mal ging ein sehr mutiger Ritter hin, um daselbst zu schlafen und liess seinen Degen neben der Bettlehne. In der Nacht hört er Geräusch von Ketten, stand vom Bette auf, ergriff den Degen und schlug kräftig um sich. Am anderen Tage als er aufstand, fand er nichts als die Spuren der Degenhiebe an Wänden und Stühlen.
Ein anderes Mal und zwar endete dies den Geisterspuk, ging ein Jüngling in dem selben Zimmer schlafen, und wie er sich niedergelegt hatte, fühlte er, dass man das Bett, welches auf Rädern war, von der Stelle bewegte; er brach in ein Gelächter aus und sagte: Hier nehmt diesen; das Bett bewegte sich nicht mehr und der Spuk war zu Ende.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DAS GESPENST VON CONCAS
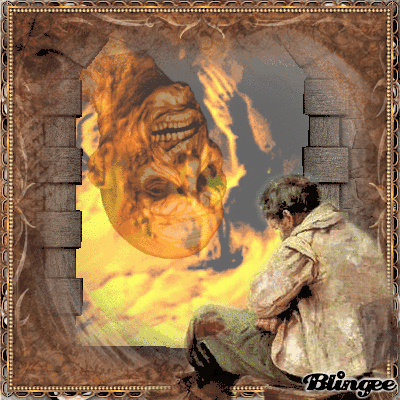
Es ging das Gerücht, dass in Concas ein Gespenst umgehe und Niemand wollte dort übernachten.
Ein kühner Mann erklärte sich bereit, wenn man ihm eine Wurst gebe, die er gedörrt essen könne, eine ganze Nacht dort zuzubringen, um zu sehen, was das Gespenst war.
Man gab ihm die Wurst, er ging weg, und wie er bei dem betreffenden Besitzhause war, betrat er das Innere und ging bis zum Feuerheerd, wo er ein starkes Feuer machte, um sich zu wärmen, da es Winter war. Als das Feuer schon Kohlen gemacht hatte, fing er an, Schnitten von der Wurst zu machen, und sie auf das Feuer zu legen. Während er die erste Schnitte ass, hörte er eine Stimme von oben aus dem Kamin, welche sagte:
- Ich falle, ich falle.
- Falle, antwortete er, sollst in Stücke fallen!
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, tuptup fiel aus dem Kamin vor seinen Augen das Bein eines Mannes herab.
Er achtete nicht darauf und fuhr fort, Wurst zu essen.
Nach kurzer Zeit hörte er wieder:
- Ich falle, ich falle.
- Falle, antwortete er, sollst in Stücke fallen!
Und tuptup fiel ein anderes Bein eines Mannes herab.
Wie wenn nichts gewesen wäre, fuhr er fort, gedörrte Wurst zu essen.
Nach einer Weile hörte er dieselben Worte wieder:
- Ich falle, ich falle.
- Falle, sollst in Stücke fallen!
Und es fiel ein Arm und dann ein anderer, und in kurzer Zeit immer dieselben Worte wiederholend, fiel ein Rumpf herab von einem menschlichen Leibe.
- Nun, was wird das sein, dachte der Mann und fuhr fort zu essen, als er von oben aus dem Kamin dasselbe, aber stärker und flehentlicher wie die früheren Male hörte:
- Ich falle, ich falle, ich falle.
- Falle, sollst in einem ganzen Stücke fallen, antwortete er.
Und sogleich fiel ein Kopf herab, und wie derselbe auf den Boden kam, fügte sich alles, was gefallen war, aneinander, und es bildete sich ein ganzer und lebendiger Mann.
Als er denselben sah, fragte er ihn:
- Was wünschet ihr in Gottes Namen?
Aber jener Mensch, ohne ihm eine Antwort zu geben, setzte sich am Feuer, neben ihm, nieder.
- Wir werden schon sehen, dachte er und begann eine andere Schnitte Wurst zu dörren. Als er sie geröstet hatte und im Begriffe war zu essen, befeuchtete jener Mensch sich den Finger mit Speichel und Asche und beschmutzte ihm die Wurst.
Als er das sah, sagte er:
- Beschmutzet mir nicht mehr die Wurst, sonst gebe ich euch eine Ohrfeige.
Aber jener Mensch gab ihm wieder keine Antwort und wartete bis er ein anderes Stück Wurst dörrte.
Kaum er dieselbe wieder gedörrt hatte, befeuchtete er wieder den Finger mit Speichel und Asche und beschmutzte sie ihm ganz.
Er wendet sich um und gibt ihm eine Ohrfeige, die ihn auf den Rücken fallen lässt. Nun stand der Mann auf und sagte zu ihm:
- Brüderchen danke. Es sind sieben Jahre, dass ich im Fegfeuer war, weil ich im Leben meinem Vater eine Ohrfeige gegeben hatte und ich konnte nicht in den Himmel kommen, bis man mir auch eine solche gegeben hatte. Jetzt dürft ihr sicher sein, dass hier kein Gespenst mehr erscheinen wird.
Und er verschwand durch das Kaminloch.
Dieser ass seine Wurst fertig, in der Früh kehrte er nach Hause zurück und sagte, dass er das Gespenst für immer verschwinden gelassen habe, und also war es.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER HIRT VON GALATZÓ
Ein Hirte des bösen Grafen war mit diesem im Streite und der erzürnte Graf sagte ihm:
- Gib Acht du wirst sterben und wirst nicht wissen wo.
- Ja ich werde es doch wissen wo immer man mich tötet, ich werde es wissen.
Eines Tages nimmt ihn der Graf mit drei oder vier seiner Leute gefangen, sie führten ihn mit verbundenen Augen weg, und der Graf sagte zu denen, die ihn begleiteten, dass sie gar keinen Lärm machen sollten, damit er nicht wüsste, durch welche Gegend sie ihn führten. Aber der Hirte, - was wirst du sagen, - als sie durch ein Gässchen kamen, das hinter den Häusern lag, sagte zu ihnen:
- Jetzt habe ich das Gässchen hinter den Häusern durchschritten.
Als sie eine Strecke weiter gegangen waren, sagte ihm der Graf:
- Diesmal kannst du es nicht erraten.
Und sie führten ihn über den Collet de ses egos, um ihn in den Avench (Schlucht) de s'esquena des ases zu werfen, und was glaubst du, was er sagte? Er sagte:
- Wenn ihr mir nicht den Kopf abschneidet, bevor ihr mich hineinwerfet, so weiss ich, von wo ich wieder herauskomme und ich werde bei den Häusern von Galatzó schneller sein als ihr, weil die Schlucht, wohin ihr mich führt, in eine Höhle im camp de ses sinis mündet, welche euch nicht bekannt ist.
Der Graf, sehend, dass er alles erriet und dass mit ihm nichts zu machen sei, sagte:
- So gewiss wird er eines Tages in meiner Gewalt sein, nimmt ihm die Binde von den Augen weg und befiehlt, er solle weggehen.
Nach langer Zeit sagte eines Tages der Hirte zu dem Grafen:
- Herr Graf, wollen sie den Avench des puig des caragol sehen?
- Nein, ich gehe mit dir nirgends hin, sagte der Graf zu ihm, denn du siehst mehr mit verbundenen Augen, wie ich mit offenen.
Und nun wollte er ihn nicht mehr töten und sagte ihm nichts mehr.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER MANN, DER BÄUME STUTZTE
Es war ein Mann, der Bäume stutzte in Ses Sorts Llargues und bei der Arbeit gähnte er.
- Ich habe gegähnt, sagte er und wenn man drei Mal gähnt, stirbt man, ich muss schon sehr Acht geben.
Er fuhr fort zu stutzen und nach kurzer Zeit gähnte er wieder.
- Ei, Ei, sagte er, ich habe schon zwei Mal gegähnt, wenn ich es wieder thue, gibt es keine Hülfe mehr für mich.
Er stutzte und stutzte weiter und sang und sang, um zu sehen ob er sich damit zerstreuen würde, aber er gähnte zum dritten Mal und er sagte:
- Nun bin ich verloren, ich habe drei Mal gegähnt, ich sterbe.
Er stieg vom Mandelbaum herab, legte sich auf den Boden, schloss die Augen und bewegte sich nicht mehr.
Allmählig wurde es Abend und seine Frau, welche ihn zum Abendessen erwartete, begann zu denken, dass er sich verspätet habe. Es wurde Nacht und sie wartete und wartete noch immer und der Mann kam
nicht und sie bekam Angst und ging, es ihren Nachbarn mitzutheilen.
Weil es so spät war und der Mann noch nicht heimgekommen war, entschlossen sie sich, ihn zu suchen.
- Und wo war dein Mann? frugen die Nachbarn der Frau.
Fonna! antwortete die Frau fast weinend, am Morgen hat er mir gesagt, dass er zu Ses Sorts Llargues de can Massanet gehen wolle, um die Bäume zu stutzen.
- Also gehen wir hin und sehen, ob ihm etwas zugestossen ist, sagten einige der Nachbarn.
Sie zündeten Oellampen an und gingen ihn zu suchen.
Als sie zu Ses Sorts Llargues kamen, suchten sie und suchten und schliesslich fanden sie ihn auf der Erde liegend, unter dem Mandelbaum und sie hielten ihn für todt. Sie legten ihn auf eine
Leiter und zwei Männer trugen ihn zum Dorfe.
Als sie in Can Guixó damit angekommen waren, wo zwei Wege sich kreuzen, wollten die einen diesen Weg, die andern den andern nehmen und als sie noch im Zweifel waren, öffnete derjenige, den sie
für todt gehalten hatten den Mund und sagte ihnen, indem er einen der zwei Wege zeigte:
- Als ich lebend war, ging ich immer auf dieser Seite.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER RAIMUND VOM PUJOL

Der Raimund vom Pujol hatte drei Söhne und der Älteste sagte zu seinem Vater:
- Mein Vater, ich will gehen und die Welt durchwandern.
- Es ist gut, sagte sein Vater.
Und er gab ihm ein Brot und einen Käse mit.
Der Sohn reiste ab, über das Coll des recó und als er den Sattel überschritten hatte, fand er einen Bettler und eine Bettlerin und sie sagten zu ihm:
- Brüderchen, willst du uns ein Almosen geben, um der Liebe Gottes?
Er hörte sie nicht an und ging seines Wegs.
Weiter unten fand er einen anderen Bettler, und er fragte ihn:
- Weisst du nicht, wo ich eine Herberge finden kann, um die Nacht zuzubringen?
- Ja, sagte ihm der Arme; weiter unten, bei dem Hause des Zolleinnehmers steht ein Haus und eine Palme davor. Gehet hin, klettert auf die Palme und wartet bis zum Abend, wo der Riese weggeht, um
Bösem nachzugehen und sobald er nicht mehr da ist, steiget von der Palme herunter und tretet in sein Häuschen, wo ihr Alles finden werdet.
- Gut sagte er, er ging weiter ohne dem Armen gedankt zu haben.
Er ging und ging weiter und fand das Haus des Riesen, er ging auf den Fussspitzen, damit der Riese es nicht merkte und bestieg die Palme.
Am Abend kam der Riese heraus und begann zu sprechen:
- Ich rieche Menschenfleisch, ich rieche Menschenfleisch, nun wir werden heute Nacht davon essen. Als er den Kopf erhob, gewahrte er ihn auf der Palme und er schüttelte sie, dass er herunter auf
den Boden fiel. Er teilte ihn in Stücke und ass ihn.
Als der jüngste Sohn des Raimund vom Pujol sah, dass sein Bruder nicht zurückkehrte, sagte er zu seinem Vater:
- Es muss meinem Bruder gut gehen, weil er nicht zurückkehrt. Mein Vater, willst du, dass auch ich gehe, um die Welt zu durchwandern?
- Nun gehe hin, sagte sein Vater, und er gab ihm ein Brot und einen Käse.
Der jüngste Sohn reiste ab und kam auch über das Coll des recó und wie er den Sattel überschritten hatte, traf er einen Bettler und eine Bettlerin und diese sagten zu ihm:
- Brüderchen, willst du uns ein Almosen geben, um der Liebe Gottes.
- Ja, sagte er, hier, nehmet das halbe Brot und den halben Käse.
- Möge der gute Jesus euch vor dem Riesen bewahren, sagten die beiden kleinen Alten zu ihm.
- Und, wo wohnt dieser Riese? fragte er, und sie antworteten:
- Also, ihr gehet nach dieser Richtung fort und wenn ihr am Hause des Zolleinnehmers vorüber seid, werdet ihr ein Haus finden, vor dessen Türe eine Palme steht. Das ist das Haus des Riesen. Gehet
hin, ohne Geräusch zu machen, und steiget auf die Palme. Wenn es Abend geworden, wird der Riese aus seinem Häuschen herauskommen, um Bösem nachzugehen und sobald er fort ist, tretet in sein
Häuschen, ihr werdet Alles finden und reich sein.
Er dankte sehr den beiden Alten, ging nach der Richtung, die sie ihm angegeben hatten und fand das Haus mit der Palme vor der Türe. Er stieg auf die Palme und als es Abend geworden war, ging der
Riese fort, ohne Menschenfleisch zu riechen.
Als der Riese nicht mehr da war, trat er in sein Haus und fand darin viel Geld.
Er füllte sich damit die Taschen, den Korb und den Sack und den Kopf seines Hutes und kehrte nach Hause zurück und war reich.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER SCHATZ DER HÄSER VON AUFABI
Man sagt, dass unter den Häusern von Aufabi eine Höhle war mit einem Schatz, bestehend aus einem Haufen Geld, den eine Schlange hüte.
Um den Schatz zu heben, musste man der Schlange einen Heller (diné) Petersilie, die in can Cayetano de Sóller gekauft ist, in das Maul geben.
Ein waghalsiger Mann, von zwei anderen begleitet, ging, den Schatz zu suchen und brachte der Schlange die Petersilie; aber als sie dieselbe entdeckten, fingen Felsen herabzustürzen an und sie
bekamen einen solchen Schrecken, dass in Folge dessen zwei starben.
Jener Mann, der lebend verblieb, kehrte ein anderes Mal wieder hin, gab ihr den Heller Petersilie, die Schlange frass es und verendete und der Schatz war von jenem Mann gewonnen.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
DER SCHATZ DER HÖHLE VON SON CREUS
Zwei Männer aus Buñola, welche in Pollensa Kohlen brannten, entschlossen sich, den Schatz der Höhle von Son Creus zu suchen, sie gingen hin, fanden aber nichts. Als sie aus der Höhle herauskamen,
fanden sie auf einem Felsen ein paar kleine Knochen und sie betrachteten sie.
Als sie wieder nach Pollensa zurückgekehrt waren, sagte eines Tages ein Mann, der Schmied war und sie zum Trinken einlud, zu ihnen:
- Und was habt ihr in jener Höhle von Son Creus gemacht?
Die Beiden waren sehr überrascht und antworteten ihm:
- Wir gingen nicht hin.
- Nicht hingegangen? Gebet doch zu, dass ihr dort ward, denn wie ihr jene Knochen auf jenem Felsen beschaut habt, sah ich euch so gut wie ich euch jetzt sehe. Wisst ihr nicht, von wem jene
Knochen waren?
Sie antworteten ihm mit Nein.
- Also, sie waren von einer Fleischpastete (panada), die wir assen, ich und mein Gefährte. Brachtet ihr viel Zeug von da drinnen heraus?
- Nein, wir fanden fast nichts.
- Wenn ihr mit mir gehet, könnten wir das ganze Erz und so viel Geld als wir wollten, herausbekommen.
- Was! sie ist innen verschüttet und bis dahin gibt es gar nichts?
- Nein, da gibt es nichts! Aber wenn wir beim Schutte sind, können wir daran vorüber kommen und nichts mehr wird uns aufhalten. Im Hineingehen wird das erste, was wir finden werden, nachdem wir
die verschüttete Stelle passiert haben, ein Mönch sein. Ihr braucht euch nicht zu erschrecken, ich werde vorausgehen. Der Mönch wird zu uns sagen:
- Was sucht ihr hier?
- Wir wollen etwas Geld suchen, erwidern wir ihm.
- Vereinbarung, wird der Mönch sagen.
- Vier Stunden.
- Nein.
- Zwei Stunden.
Wieder wird er sagen:
- Nein.
Und immer mehr setzen wir herunter, wieder herunter, bis wir es um eine Minute vereinbaren werden. Dort werden wir vielen Lärm hören, aber ihr braucht nicht zu erschrecken. Wir werden weiter
gehen und tiefer im Innern werden wir eine Nonne finden, welche uns dasselbe sagen wird, wie der Mönch und wir erwiedern ihr das Gleiche, und wir werden noch mehr Lärm hören, aber wir müssen
nicht darauf achten. Wir werden weiter hineingehen, zu einem Strom kommen, den wir auf drei Steinen überschreiten und dann einen anderen Mönch finden, der das Geld hütet und dort ist es, wo wir
den meisten Lärm hören werden. Der Mönch wird sagen:
- Vereinbarung.
Er wird uns nicht mehr wie eine Minute geben wollen und wir werden mit dem gleichen Beding wie wir eintraten auch herauskommen, aber mit Geld beladen.
Sie verabredeten sich, nach vier Monaten hineinzugehen, aber nach zweien starb jener Mann, und die beiden anderen konnten den Schatz nicht finden.
Katalonien: Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca
