MÄRCHEN VON LUDWIG BECHSTEIN ...
"Von dem Wolf und den Maushunden"
"Von zwei Affen"
"Vogel Holgott und Vogel Mosam"
"Die Könige Widewuto und Bruteno"
"Vom Inselberg"
"Der Schmied in Ruhla"
"Die Kuhhirten"
"Wie das Märchen geboren wurde"
"Die drei Hostien"
"Die weißen Tauben"
"Der Mann ohne Herz"
"Die Knaben mit den goldnen Sternlein"
"Vom edlen Ritter Tannhäuser"
"Das tapfere Bettelmännlein"
"Vom Knaben, der das Hexen lernen wollte"
"Der Wandergeselle"
"Der gastliche Kalbskopf"
"Das Mäuslein Sambar, oder die treue Freundschaft der Tiere"
"Der Mann und die Schlange"
"Der Hahn und der Fuchs"
"Die Lebensgeschichte der Maus Sambar"
"Der weiße Wolf"
"Des kleinen Hirten Glückstraum"
"Mann und Frau im Essigkrug"
"Zitterinchen"
"Das Gruseln"
"Der kleine Däumling"
"Die Kornähren"
"Julin"
"Hela"
"Vineta"
"Zwergenmützchen"
"Der Fuchs und der Krebs"
"Der Hase und der Fuchs"
"Der Garten im Brunnen"
"Der König im Bade"
"Vom Zornbraten"
"Das klagende Lied"
"Das Natterkrönlein"
"Das Märchen vom Mann im Monde"
"Das Hellerlein"
"Aschenbrödel"
"Aschenpüster mit der Wünschelgerte"
"Star und Badewännlein"
"Seelenlos"
"Schneider Hänschen und die wissenden Tiere"
"Oda und die Schlange"
"Siebenschön"
"Fippchen Fäppchen"
"Die verzauberte Prinzessin"
"Die verwünschte Stadt"
"Helene"
"Hirsedieb"
"Die schlimme Nachtwache"
"Die schöne junge Braut"
"Die Nonne, der Bergmann und der Schmied"
"Die Jagd des Lebens"
"Die hoffärtige Braut"
"Die beiden kugelrunden Müller"
"Die dankbaren Tiere"
"Des Hundes Not"
"Wie der Teufel den Branntwein erfand"
"Der undankbare Sohn"
"Der Schmied von Jüterbogk"
"Der Schäfer und die Schlange"
"Der Zauber-Wettkampf"
"Der Müller und die Nixe"
"Das winzige, winzige Männlein"
"Das Tränenkrüglein"
"Der Hasenhüter und die Königstochter"
"Die Rosenkönigin"
"Die Probestücke des Meisterdiebes"
"Der schwarze Graf"
"Der Richter und der Teufel"
"Die Goldmaria und die Pechmaria"
"Die sieben Schwaben"
"Vom Büblein, das sich nicht waschen wollte"
"Das Kätzchen und die Stricknadeln"
"Der beherzte Flötenspieler"
"Der starke Gottlieb"
"Das Nußzweiglein"
"Der alte Zauberer und seine Kinder"
"Die drei Bräute"
"Der goldne Rehbock"
"Die Perlenkönigin"
DIE PERLENKÖNIGIN ...
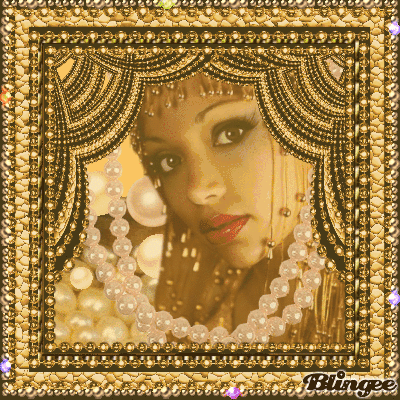
Nicht weit von einem friedsamen Dörflein, welches am Seegestade lag und meist von Fischern bewohnt war, ließ sich alle Jahre zu etlichen bestimmten Malen eine überirdisch schöne Jungfrau am Ufer sehen; die selbe kam allemal in einem wunderschönen Schifflein, welches gerade aussah wie von puren hellfarbigen Perlen zusammengefügt, daher gesegelt, und niemand wußte, woher sie kam, oder wohin sie wieder zurück kehrte, wenn sie verschwand.
Die treuherzigen Fischerleute hatten sie aber gar lieb, zumal die Kinder, denen sie jedesmal schöne Perlen die Menge ans Ufer streute und ihnen zuwinkte, die selben aufzulesen. Da waren die Kleinen dann geschäftig und lasen die Perlen auf und erfreuten sich an deren Farben Glanz.
Und dann kamen die Fischer und Fischerinnen und trugen der guten schönen Perlenkönigin eine Mahlzeit zusammen: Fische und Brot und guten Wein, und die holde Jungfrau war gegen alle freundlich, aß einige Bissen und trank ein wenig Wein.
Oft auch zur Zeit, da die schöne Unbekannte dort am Ufer zu landen pflegte, kamen aus anderen fremden Ländern Prinzen und viele Edle herbei, um die schöne Jungfrau zu sehen und vielleicht zu freien; denn es ging von ihr weit und breit die Rede, daß sie ebenso reich an Erdenschätzen wie an Leibesschönheit sei.
Aber alle mußten auch wieder unbefriedigt von dannen ziehen. Die hohe Jungfrau verlangte von jedem, der um sie warb, daß er zuvor drei Proben bestehe, die sie ihm aufgegeben. Und diese waren bisher für alle zu schwer und hoch. Keiner vermochte sie zu lösen, und so mußten die hohen Bewerber dann zurückstehen und ein wenig beschämt und verstimmt wieder abziehen.
Das erste war, was die Jungfrau aufgab, zu erraten, was für Haare sie habe; denn sie trug stets das Haupt ganz dicht verschleiert; das hatte noch keiner erraten, wiewohl schon alle Farben - schwarz, rot, blond, braun, weiß, grün, grau, blau - geraten worden waren.
Das zweite war, die Halskette der Jungfrau umzuhängen. Wurden dann die glänzend hellen Perlen davon trübe, so war es ein böses Zeichen, dann weinte die schöne Dame allemal, und ihre Tränen wurden eine ebenso helle Perle wie die an der Kette und fügten sich der selben an. Und so wie die Perlenschnur wieder am Halse der Jungfran hing, glänzte sie auch wieder hell und wundersam.
Das dritte war, zu erraten, was die Jungfrau auf der Brust trage. Und dies erriet keiner. Und so gewann auch keiner, und wäre er auch der reichste Fürst gewesen, die Gunst der Jungfrau, also daß sie ihm Hand und Herz schenke. Sie blieb geheimnisvoll.
Alle List, um etwas Näheres über sie selbst und über ihre Heimat zu erfahren, blieb fruchtlos; denn allzu schnell war das Perlenschifflein allemal vor den Blicken der Menschen auf dem Gewässer verschwunden. Doch zur bestimmten Zeit kam sie wieder, so freundlich und liebreich wie zuvor, und streute Perlen aus am Ufer.
Und da war ein Knäblein, das hatte sie unter allen Kindern am liebsten, das nahm sie allemal in ihre Arme und drückte es herzlich, und der Knabe hatte die schöne gütige Dame auch gar sehr lieb; doch als er größer wurde, wurde er verschämt und schüchtern und wagte zuletzt gar nicht mehr Perlen aufzulesen, mußte auch meist mit seinem Vater auf die See fahren und fischen.
So war die Jungfrau schon mehrere Male dort ans Ufer gestiegen und hatte ihren lieben Fischerknaben nicht gesehen; da wurde sie betrübt, denn ach, ihr Herz hatte sich gerade diesen Jüngling auserwählt, und sie wünschte nichts mehr, als daß einst dieser schöne Fischer imstande sein möge, die drei Aufgaben zu lösen und ihr dann auf immer nach der schönen Perlen-Insel, ihrer Heimat, zu folgen.
Sie beschloß im stillen, als sie wieder einmal, ohne den geliebten Fischerjüngling gesehen zu haben, mit ihrem Schifflein vom Ufer abstieß, am selbigen Abend wiederzukommen, um dem Teuren unsichtbar nahe zu treten. Und ja, als der goldne Mond aufgegangen war und sich auf den Wassern spiegelte, fuhr das Perlenschifflein wieder durch die Wellen dem befreundeten Ufer zu, wo dort in der kleinen Fischerhütte der Geliebte längst entschlummert ruhte.
Die holde Jungfrau trat ein in das kleine Gemach und beugte sich sanft zu dem Schläfer, dem nur Moos zum Lager diente. Und sie löste ihre Perlenschnur vom Hals und hing sie dem Jüngling um, und die Perlen blieben so hell und klar wie zuvor, o welche Freude durchströmte da ihr liebendes Herz!
Sie küßte den Teuren segnend, schied und kehrte alle Abende wieder und hing allemal die Perlen um des Jünglings Hals, und die Perlen blieben allemal hell und glänzend. Der Jüngling war aber in seinem Herzen ebenfalls in Liebe zur schönen Perlenkönigin entbrannt und war dabei fromm und gut, nur war er allzu schüchtern und verzagt, um ihr öffentlich zu nahen.
Als sie nun wieder einmal des Nachts an des Jünglings Lager weilte, erwachte der selbe, blieb aber ruhig, so daß sie wähnte, er schlafe. Da nahm sie wieder die Perlenschnur vom Hals, hing sie ihm um, weinte warme Tränen auf seine Wangen, warf den Schleier zurück und nahm ihre Haare und trocknete die Tränen damit ab.
Da sah der Jüngling, daß ihre Haare golden waren. Dann schlug sie das Busentuch zurück, da glänzte ein heller Spiegel auf ihrer Brust, aus welchem des Jünglings Bild sanft und schön herausblickte. Doch wann sie schied, wurde sie allemal betrübt und traurig; denn sobald die helle Perlenschnur nur ein einziges Mal trüb werden mochte am Halse ihres geliebten Fischers, hätte sie nimmer wieder ihm nahen dürfen.
So kam die bestimmte Zeit, wo die schöne Perlenkönigin wieder nahe dem Fischerdörflein ans Ufer stieg und nach ihrer gewohnten Weise für die frohen Kinder Perlen ausstreute; und dieses Mal waren viele edle Fürsten und Herren gekommen, um die reiche, schöne Prinzessin zu erwerben; auch der Fischerjüngling stand von ferne und faßte Mut, der Angebeteten zu nahen.
Doch es kam zuletzt an ihn, als alle anderen wieder beschämt von ihr gewichen waren. Da trat er bescheiden hin und bat um die drei Aufgaben, und die Jungfrau glühte vor Freude und gab sie ihm und sandte heimlich flehende Blicke gen Himmel, daß doch ihr geliebter Jüngling die Proben bestehen möge. Kein anderer konnte sie ja lösen.
Der schöne Fischer beugte sich sittsam vor der Holden und sprach: "Oh, deine Haare müssen golden sein." Und im Augenblick fiel der Schleier herab, und ihre goldnen Locken wallten hernieder. Dann hing die freudige Jungfrau die Perlenschnur um den Hals des Jünglings, und sie blieb rein und glänzend.
Und wieder sprach der Fischer: "Und deine Brust muß ein reiner schöner Spiegel sein, holde Jungfrau!" Und auch das Busentuch rauschte im Augenblick zur Erde, und der klare Spiegel auf der Brust der Jungfrau zeigte ein sanftes schönes Bild, das Bild des Jünglings.
Da erscholl vom Perlenschifflein ein heller Jubel und Freude tönende Musik, und ein Kreis von schönen Frauen und blühenden Männern erhob sich freudevoll vom Schifflein und nahm das holde Paar auf, und der kleine schöne Perlennachen glitt auf der Spiegel hellen Wasserfläche dahin, nach der wunderlieblichen Perleninsel, als der Heimat der lieben Braut des Fischerjünglings, um nimmer, nimmer wiederzukehren.
DER GOLDNE REHBOCK ...

Es waren einmal zwei arme Geschwister, ein Knabe und ein Mädchen, das Mädchen hieß Margarete, der Knabe hieß Hans. Ihre Eltern waren gestorben, hatten ihnen auch gar kein Eigentum hinterlassen, daher sie ausgehen mußten, um durch Betteln sich fortzubringen. Zur Arbeit waren beide noch zu schwach und klein; denn Hänschen zählte erst zwölf Jahre und Gretchen war noch jünger.
Des Abends gingen sie vors erste beste Haus, klopften an und baten um ein Nachtquartier, und vielmal waren sie schon von guten mildtätigen Menschen aufgenommen, gespeist und getränkt worden; auch hatte mancher und manche Barmherzige ihnen ein Kleidungsstückchen zugeworfen.
So kamen sie einmal des Abends vor ein Häuschen, welches einzeln stand; da klopften sie ans Fenster, und als gleich darauf eine alte Frau heraus sah, fragten sie diese, ob sie hier nicht über Nacht bleiben dürften? Die Antwort war:
"Meinetwegen, kommt nur herein!" Aber wie sie eintraten, sprach die Frau: "Ich will euch wohl über Nacht behalten, aber wenn es mein Mann gewahr wird, so seid ihr verloren; denn er isst gern einen jungen Menschenbraten, daher er alle Kinder schlachtet, die ihm vor die Hand kommen!"
Da wurde den Kindern sehr angst; doch konnten sie nunmehr nicht weiter, es war schon ganz dunkle Nacht geworden. So ließen sie sich gutwillig von der Frau in einem Faß verstecken und verhielten sich ruhig. Einschlafen konnten sie aber lange nicht, zumal da sie nach einer Stunde die schweren Tritte eines Mannes vernahmen, der wahrscheinlich der Menschenfresser war.
Des wurden sie bald gewiß, denn jetzt fing er an mit brüllender Stimme auf seine Frau zu zanken, daß sie keinen Menschenbraten für ihn zugerichtet hatte. Am Morgen verließ er das Haus wieder und tappte so laut, daß die Kinder, die endlich doch eingeschlummert waren, darüber erwachten.
Als sie von der Frau etwas zu frühstücken bekommen hatten, sagte diese: "Ihr Kinder müßt nun auch etwas tun, da habt ihr zwei Besen, geht oben hinauf und kehrt mir meine Stuben aus, deren sind zwölf, aber ihr kehrt davon nur elf, die zwölfte dürft ihr um Himmelswillen nicht aufmachen. Ich will derzeit einen Ausgang tun. Seid fleißig, daß ihr fertig seid, wenn ich wieder komme."
Die Kinder kehrten sehr emsig, und bald waren sie fertig. Nun mochte Gretchen doch gar zu gerne wissen, was in der zwölften Stube wäre, das sie nicht sehen sollten, weil ihnen verboten war, die Stube zu öffnen. Sie guckte ein wenig durchs Schlüsselloch und sah da einen herrlichen, kleinen, goldenen Wagen, mit einem goldenen Rehbock bespannt.
Geschwind rief sie Hänschen herbei, daß er auch hinein gucken sollte. Und als sie sich erst tüchtig umgesehen, ob die Frau nicht heimkehre, und da von dieser nichts zu sehen war, schlossen sie schnell die Türe auf, zogen den Wagen samt Rehbock heraus, setzten drunten sich hinein in den Wagen und fuhren auf und davon.
Aber nicht lange, so sahen sie von weitem die alte Frau und auch den Menschenfresser sich entgegen kommen, gerade des Wegs, den sie mit dem geraubten Wagen eingeschlagen hatten. Hänslein sprach: "Ach, Schwester, was machen wir? Wenn uns die beiden Alten entdecken, sind wir verloren."
"Still!" sprach Gretchen, "ich weiß ein kräftiges Zaubersprüchlein, welches ich noch von unserer Großmutter gelernt habe:
Rosenrote Rose sticht;
Siehst du mich, so sieh mich nicht!"
Und als bald waren sie verwandelt in einen Rosenstrauch. Gretchen wurde zur Rose, Hänslein zu Dornen, der Rehbock zum Stiele, der Wagen zu Blättern.
Nun kamen beide, der Menschenfresser und seine Frau, daher gegangen und letztere wollte sich die schöne Rose abbrechen, aber sie stach sich so sehr, daß ihre Finger bluteten und sie ärgerlich davon ging. Wie die Alten fort waren, machten sich die Kinder eilig auf und fuhren weiter und kamen bald an einen Backofen, der voll Brot stund.
Da hörten sie aus dem selben eine hohle Stimme rufen: "Rückt mir mein Brot, rückt mir mein Brot." Schnell rückte Gretchen das Brot und tat es in ihren Wagen, worauf sie weiter fuhren. Da kamen sie an einen großen Birnbaum, der voll reifer schöner Früchte hing, aus diesem tönte es wieder: "Schüttelt mir meine Birnen, schüttelt mir meine Birnen!"
Gretchen schüttelte sogleich, und Hänschen half gar fleißig auflesen und die Birnen in den goldenen Wagen schütten. Und wieder kamen sie an einen Weinstock, der rief mit angenehmer Stimme: "Pflückt mir meine Trauben, pflückt mir meine Trauben!" Gretchen pflückte auch diese und packte sie in ihren Wagen.
Unterdessen aber waren der Menschenfresser und seine Frau daheim angelangt und hatten mit Ingrimm wahrgenommen, daß die Kinder ihren goldenen Wagen samt Rehbock gestohlen hatten, gerade wie diese beiden ebenfalls vor langen Jahren Wagen und Rehbock gestohlen und noch dazu bei dem Diebstahl auch einen Mord begangen hatten, nämlich den rechtmäßigen Eigentümer erschlagen.
Der mit dem Rehbock bespannte Wagen war nicht nur an und für sich von großem Wert, sondern er besaß auch noch die vortreffliche Eigenschaft, daß, wo er hin kam, von allen Seiten Gaben gespendet wurden, von Baum und Beerenstrauch, von Backofen und Weinstock.
So hatten denn die Leute, der Menschenfresser und seine Frau, lange Jahre den Wagen, wenn auch auf unrechtmäßige Weise, besessen, hatten sich gute Eßwaren spenden lassen und dabei herrlich und in Freuden gelebt. Da sie nun sahen, daß sie ihres Wagens beraubt waren, machten sie sich flugs auf, den Kindern nachzueilen und ihnen die köstliche Beute wieder abzujagen.
Dabei wässerte dem Menschfresser schon der Mund nach Menschenbraten; denn die Kinder wollte er sogleich fangen und schlachten. Mit weiten Schritten eilten die beiden Alten den Kindern nach und wurden die selben bald von ferne ansichtig, weil sie voraus fuhren.
Die Kinder kamen jetzt an einen großen Teich und konnten nicht weiter, auch war weder eine Fähre noch eine Brücke da, daß sie hinüber hätten flüchten können. Nur viele Enten waren darauf zu
sehen, die lustig umher schwammen. Gretchen lockte diese ans Ufer, warf ihnen Futter hin und sprach:
"Ihr Entchen, ihr Entchen, schwimmt zusammen,
Macht mir ein Brückchen, daß ich hinüber kann kommen!"
Da schwammen die Enten einträchtig zusammen, bildeten eine Brücke, und die Kinder samt Rehbock und Wagen kamen glücklich ans andere Ufer. Aber flugs hinterdrein kam auch der Menschenfresser und
brummte mit häßlicher Stimme:
"Ihr Entchen, ihr Entchen, schwimmt zusammen,
Macht mir ein Brückchen, daß ich hinüber kann kommen!"
Schnell schwammen die Entchen zusammen und trugen die beiden Alten hinüber - meint ihr? nein! in der Mitte des Teiches, da das Wasser am tiefsten war, schwammen die Entchen auseinander, und der böse Menschenfresser nebst seiner Alten plumpsten in die Tiefe und kamen um.
Und Hänschen und Gretchen wurden sehr wohlhabende Leute, aber sie spendeten auch von ihrem Segen den Armen viel und taten viel Gutes, weil sie immer daran dachten, wie bitter es gewesen, da sie noch arm waren und betteln gehen mußten.
DIE DREI BRÄUTE ...
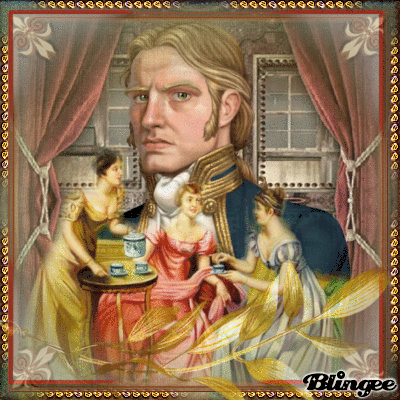
Es war einmal ein Müller, der hatte drei schöne Töchter von aufgeweckter Gemütsart; die jüngste aber war die verständigste unter ihnen. Einst waren sie in der Stadt gewesen und kehrten nun zu ihrer Mühle zurück. Unterwegs plauderten sie dies und das, und die eine sprach: "Wenn wir nur nicht so streng gehalten würden, so hätten wir auch Liebhaber, und der meinige hätte mir gewiss auch ein so schönes seidenes Halstuch gekauft, wie die Margarethe von ihrem Liebsten geschenkt bekam."
"Ja", sagte die andere darauf, "und der meinige hätte mich gewiss zu Tanze geführt, wie es die Mädchen alle von ihren Burschen wurden." Die dritte sprach nichts; das Leid ihrer Schwestern schien ihr wenig zu Herzen zu gehen.
Ehe sie es sich aber versahen, war ein hübscher Mann bei ihnen, der sprach sie freundlich an und kramte allerlei kleine Geschenke aus, die er unter sie verteilte; die Mädchen nahmen sie errötend an, und nachdem er ihnen noch versprochen, sie bei ihrem Vater wiederzusehen, ging er seines Wegs.
Die Mädchen tauschten nun ihre Bemerkungen und Mutmaßungen über ihn aus, darin aber waren alle einig, dass er ein hübscher liebenswerter Mann sei. Der Müller schüttelte den Kopf, als sie ihm ihr Abenteuer erzählten, aber noch mehr erstaunte er, als der Fremde eines Tages in der Mühle erschien, den Müller bei Seite nahm und ihn um die Hand einer seiner Töchter bat. Die beiden Männer hielten eine lange Zwiesprache, deren Resultat war, dass der Müller dem Freier die Wahl unter seinen Töchtern frei stellte.
Der Fremde wählte sich die Älteste; Kisten und Kasten wurden gepackt, und die junge Braut zog mit dem Bräutigam nach dessen weit entlegenem Schlosse. Hier war alles aufs beste eingerichtet, und der jungen Braut blieb kein Wunsch unerfüllt.
Da sprach er eines Tages zu ihr: "Du sollst Herrin meines Schlosses sein, wenn ich dich in allen Stücken gehorsam gefunden habe. Dieses weiße Tuch binde um deinen Leib, es ist ein Ei darin; und hier hast du die Schlüssel zu allen Gemächern meines Schlosses, du darfst in alle gehen, nur in das eine nicht, zu dem dieser große Schlüssel passt.
Ich verreise; wenn ich zurückkomme und finde, dass du gehorsam gewesen bist, so will ich dich als mein treues Weib auf den Händen tragen, wo nicht, so wirst du einen schlimmen Mann an mir finden."
Als er abgereist war, ging die junge Frau mit der Serviette, dem Ei und den Schlüsseln im Hause umher, schloss alle Türen auf und sah sich in den Zimmern um; endlich in einem abgelegenen Teil des Schlosses kam sie an eine Tür, zu welcher der große Schlüssel passte.
Sie dachte an das Verbot ihres Mannes, aber die Neugier siegte, schon hatte sie den Schlüssel im Schloss umgedreht, die Tür knarrte, sie trat über die Schwelle, ließ aber das Ei vor Schreck aus der Serviette fallen und floh. Als der Mann zurück kam, sah er denn gleich, was geschehen war und gab der Ungehorsamen trotz ihres Flehens den Tod.
Darauf ging er zum Müller, klagte ihm, dass ihm seine Frau an einer kurzen, aber unheilbaren Krankheit gestorben und bat ihn um die Hand seiner zweiten Tochter. Der Müller versagte ihm diese nicht, und so zog der Fremde abermals mit einer jungen Frau auf sein Schloss.
Aber es begab sich mit dieser nicht anders als mit der ersten, und der Fremde erschien wieder beim Müller und sagte, die junge Frau sei mit einem seiner Bedienten davon gelaufen, und bat ihn um die dritte Tochter. Der Müller war zwar sehr betrübt, dass er all seine Kinder verlieren sollte, willigte aber endlich doch ein.
Als sie mit ihrem Manne nun aufs Schloss gekommen, gab er ihr die selbe Prüfung wie ihren Schwestern. Sie war aber klüger als diese und dachte: Ei, was sollst du dich mit dem Ei schleppen? Sie ließ das Ei und die Serviette deshalb in ihrer Kammer zurück und besichtigte das Schloss.
Auch sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, die verbotene Tür zu öffnen, und als sie über die Schwelle trat, sah sie mit Entsetzen eine Reihe von Leichen, und die letzten waren ihre beiden Schwestern. Sogleich dachte sie daran, den Bösewicht zur Strafe zu ziehen, aber sie wusste auch, dass sie es listig anzufangen habe.
Sie nahm den abgeschnittenen Kopf ihrer zuletzt ermordeten Schwester, schloss sorgfältig die Tür wieder zu, verbarg den Kopf in einer Blumenscherbe, schüttete Erde darauf und pflanzte eine Hyazinthe hinein. Ihren zurück kehrenden Mann empfing sie freundlich, und als er sah, dass das Ei unverletzt war, war er zärtlich gegen sie und pries ihren Gehorsam.
So war einige Zeit vergangen, da bat sie ihn, er möge sie doch zu ihrem Vater begleiten, der unruhig über ihr Schicksal sein werde. Er konnte ihr diesen Wunsch nicht abschlagen, und so fuhren sie in einem prächtigen Wagen nach der Mühle; die herrlich aufgeblühte Hyazinthe hatte sie mitgenommen.
Der Müller freute sich sehr, als er seine Tochter wohl behalten und anscheinend glücklich wiedersah, diese aber konnte keinen Augenblick gewinnen, mit dem Vater allein zu sein; überall bewachte sie ihr Mann, sei es zufällig oder weil ihm das böse Gewissen eine Ahnung eingab.
Da schrieb sie ein kleines Briefchen, um es dem Vater zuzustecken, und als sie eben nach sann, auf welche Weise, flog ein Rabe auf ihre Schulter, der sang ihr ins Ohr:
"Gib, gib, gib!
Wir fangen den Dieb! "
Der Rabe nahm das Briefchen in seinen Schnabel und flog zum Müller; dieser las es mit Entsetzen und sandte in die nahe Stadt nach den Dienern der Gerechtigkeit, und ehe eines Morgens der Fremde sich noch den Schlaf aus den Augen gerieben, sah er sich ergriffen und gefesselt.
Sein Leugnen half nichts; als man die Hyazinthe aus dem Topfe riss, sah man das halb vermoderte Haupt der gemordeten Müllerstochter, das der Müller noch an seinen schönen braunen Flechten erkannte. Das Raubschloss wurde zerstört und der Mörder zur Strafe für seine Verbrechen hingerichtet.
Der Hingerichtete hatte aber noch Spießgesellen, die den Tod ihres Hauptmanns zu rächen beschlossen. Als einst die unglückliche junge Witwe zufällig unter ihr Bett griff, fühlte sie einen behaarten Gegenstand; sie erschrak, denn sie wusste wohl, dass es der Kopf eines Mannes war, tat aber, als hielte sie ihn für die Katze, indem sie rief:
"Bist du wieder da, Katze? Nun, heute magst du noch da bleiben; dass du mir aber deine Jungen nicht aufs Bett trägst!" Sie machte sich noch eine Weile zu schaffen, ging dann zur Tür hinaus und entdeckte das Geheimnis ihrem Vater; der rief die Mühlknappen zusammen; das Haus ward durchsucht, und man fand die Spießgesellen des hingerichteten Räubers in verschiedenen Räumen des Hauses versteckt.
Sie wurden alle dem Gericht überliefert. Die junge Frau hatte nun zwar fürder Ruhe, aber sie konnte den Mann nicht vergessen, der ein Mörder gewesen war und den sie doch geliebt hatte. Sie trauerte bis an ihr Lebensende, und der weise Vater sah sie noch vor sich zur Grube sinken.
DER ALTE ZAUBERER UND SEINE KINDER ...
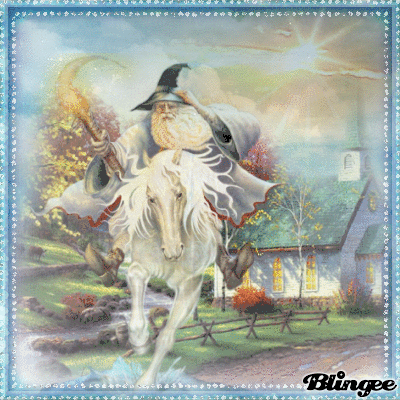
Es lebte einmal ein böser Zauberer, der hatte vorlängst zwei zarte Kinder geraubt, einen Knaben und ein Mägdlein, mit denen er in einer Höhle ganz einsam und einsiedlerisch hauste. Diese Kinder hatte er, Gott sei es geklagt, dem Bösen zu geschworen, und seine schlimme Kunst übte er aus einem Zauberbuch, das er als seinen besten Schatz verwahrte.
Wenn es nun aber geschah, dass der alte Zauberer sich aus seiner Höhle entfernte und die Kinder allein in der selben zurück blieben, so las der Knabe, welcher den Ort erspäht hatte, wohin der Alte das Zauberbuch verbarg, in dem Buch und lernte daraus gar manchen Spruch und manche Formel der Schwarzkunst und lernte selbst ganz trefflich zaubern.
Weil nun der Alte die Kinder nur selten aus der Höhle ließ und sie gefangen halten wollte bis zu dem Tage, wo sie dem Bösen zum Opfer fallen sollten, so sehnten sie sich um so mehr von dannen, berieten miteinander, wie sie heimlich entfliehen wollten, und eines Tages, als der Zauberer die Höhle sehr zeitig verlassen hatte, sprach der Knabe zur Schwester:
»Jetzt ist es Zeit, Schwesterlein! Der böse Mann, der uns so hart gefangen hält, ist fort, so wollen wir uns jetzt aufmachen und von dannen gehen, soweit uns unsere Füße tragen!«
Dies taten die Kinder, gingen fort und wanderten den ganzen Tag. Als es nun gegen den Nachmittag kam, war der Zauberer nach Hause zurück gekehrt und hatte sogleich die Kinder vermisst. Als bald schlug er sein Zauberbuch auf und las darin, nach welcher Gegend die Kinder gegangen waren, da hatte er sie wirklich fast eingeholt; die Kinder vernahmen schon seine zornig brüllende Stimme, und die Schwester war voller Angst und Entsetzen und rief:
»Bruder, Bruder! Nun sind wir verloren; der böse Mann ist schon ganz nahe!« Da wandte der Knabe seine Zauberkunst an, die er gelernt hatte aus dem Buch; er sprach einen Spruch, und als bald wurde seine Schwester zu einem Fisch, und er selbst wurde ein großer Teich, in welchem das Fischlein munter herum schwamm.
Wie der Alte an den Teich kam, merkte er wohl, dass er betrogen war, brummte ärgerlich: »Wartet nur, wartet nur, euch fange ich doch!« und lief spornstreichs nach seiner Höhle zurück, Netze zu holen, und den Fisch darin zu fangen. Wie er aber von hinnen war, wurden aus dem Teich und Fisch wieder Bruder und Schwester, die bargen sich gut und schliefen aus, und am anderen Morgen wanderten sie weiter, und wanderten wieder einen ganzen Tag.
Als der böse Zauberer mit seinen Netzen an die Stelle kam, die er sich wohl gemerkt hatte, war kein Teich mehr zu sehen, sondern es lag eine grüne Wiese da, in der es wohl Frösche, aber keine Fische zu fangen gab; da wurde er noch zorniger wie zuvor, warf seine Netze hin und verfolgte weiter die Spur der Kinder, die ihm nicht entging, denn er trug eine Zaubergerte in der Hand, welche ihm den richtigen Weg zeigte.
Und als es Abend war, hatte er die wandernden Kinder beinahe wieder eingeholt; sie hörten ihn schon schnauben und brüllen, und die Schwester rief wieder: »Bruder, lieber Bruder! Jetzt sind wir verloren, der böse Feind ist dicht hinter uns!« Da sprach der Knabe wiederum einen Zauberspruch, den er aus dem Buch gelernt, und da ward aus ihm eine Kapelle am Weg und aus dem Mägdlein ein schönes Altarbild in der Kapelle.
Wie nun der Zauberer an die Kapelle kam, merkte er wohl, dass er abermals geäfft war, und lief fürchterlich brüllend um die selbe herum; er durfte sie aber nicht betreten, weil das immer im Pakt der Zauberer mit dem Bösen stand, dass sie niemals eine Kirche oder eine Kapelle betreten durften.
»Darf ich dich auch nicht betreten, so will ich dich doch mit Feuer anstoßen und auch zu Asche brennen!« schrie der Zauberer und rannte fort, sich aus seiner Höhle Feuer zu holen.
Während er nun fast die ganze Nacht hindurch rannte, wurden aus der Kapelle und dem schönen Altarbild wieder Bruder und Schwester; sie bargen sich und schliefen, und am dritten Morgen wanderten sie weiter und wanderten den ganzen Tag, während der Zauberer, der einen weiten Weg hatte, ihnen aufs neue nachsetzte.
Als er mit seinem Feuer dahin kam, wo die Kapelle gestanden, stieß er mit der Nase an einen großen Steinfelsen, der sich nicht mit Feuer anstoßen und zu Asche verbrennen ließ, und dann rannte er mit wütenden Sprüngen auf der Spur der Kinder weiter fort.
Gegen Abend war er ihnen nun ganz nahe, und zum dritten Mal zagte die Schwester und gab sich verloren; aber der Knabe sprach wieder einen Zauberspruch, den er aus dem Buch gelernt, da ward er eine harte Tenne, darauf die Leute dreschen, und sein Schwesterlein war in ein Körnlein verwandelt, das wie verloren auf der Tenne lag.
Als der böse Zauberer heran kam, sah er wohl, dass er zum dritten Mal geäfft war, besann sich aber diesmal nicht lange, lief auch nicht erst wieder nach Hause, sondern sprach auch einen Spruch, den er aus dem Zauberbuch gelernt hatte; da ward er in einen schwarzen Hahn verwandelt, der schnell auf das Gerstenkorn zu lief, um es aufzupicken.
Aber der Knabe sprach noch einmal einen Zauberspruch, den er aus dem Buch gelernt hatte, da wurde er schnell ein Fuchs, packte den schwarzen Hahn, ehe er noch das Gerstenkorn aufgepickt hatte, und biß ihm den Kopf ab, da hatte der Zauberer, wie dies Märlein, gleich ein Ende.
DAS NUSSZWEIGLEIN ...
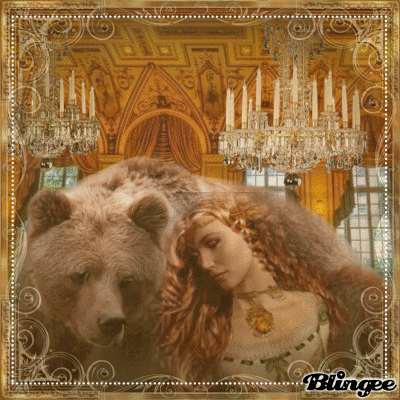
Es war einmal ein reicher Kaufmann, der mußte in seinen Geschäften in fremde Länder reisen. Da er nun Abschied nahm, sprach er zu seinen drei Töchtern: »Liebe Töchter, ich möchte euch gerne bei meiner Rückkehr eine Freude bereiten, sagt mir daher, was ich euch mitbringen soll?«
Die Älteste sprach: »Lieber Vater, mir eine schöne Perlenhalskette! « Die andere sprach: »Ich wünschte mir einen Fingerring mit einem Demantstein « Die Jüngste schmiegte sich an des Vaters Herz und flüsterte: »Mir ein schönes, grünes Nußzweiglein, Väterchen.« »Gut, meine lieben Töchter!« sprach der Kaufmann, »ich will mir es aufmerken und dann lebt wohl.«
Weit fort reiste der Kaufmann und machte große Einkäufe, gedachte aber auch treulich der Wünsche seiner Töchter. Eine kostbare Perlen Halskette hatte er bereits in seinen Reisekoffer gepackt, um seine Älteste damit zu erfreuen, und einen gleich wertvollen Demantring hatte er für die mittlere Tochter eingekauft.
Einen grünen Nußzweig aber konnte er nirgends gewahren, wie er sich auch darum bemühte. Auf der Heimreise ging er deshalb große Strecken zu Fuß und hoffte, da sein Weg ihn vielfach durch Wälder führte, endlich einen Nußbaum anzutreffen; doch dies war lange vergeblich, und der gute Vater fing an betrübt zu werden, daß er die harmlose Bitte seines jüngsten und liebsten Kindes nicht zu erfüllen vermochte.
Endlich, als er so betrübt seines Weges dahin zog, der ihn just durch einen dunklen Wald und an dichtem Gebüsch vorüber führte, stieß er mit seinem Hut an einen Zweig, und es raschelte, als fielen Schlossen darauf; wie er aufsah, war es ein schöner, grüner Nußzweig, daran eine Traube goldner Nüsse hing.
Da war der Mann sehr erfreut, langte mit der Hand empor und brach den herrlichen Zweig ab. Aber in dem selben Augenblick schoß ein wilder Bär aus dem Dickicht und stellt sich grimmig brummend auf die Hintertatzen, als wollte er den Kaufmann gleich zerreißen. Und mit furchtbarer Stimme brüllte er: »Warum hast du meinen Nußzweig abgebrochen, du? Warum? Ich werde dich auffressen.«
Bebend vor Schreck und zitternd sprach der Kaufmann: »O lieber Bär, friß mich nicht, und laß mich mit dem Nußzweiglein meines Weges ziehen, ich will dir auch einen großen Schinken und viele Würste dafür geben!«
Aber der Bär brüllte wieder: »Behalte deinen Schinken und deine Würste! Nur wenn du mir versprichst, mir dasjenige zu geben, was dir zu Hause am ersten begegnet, so will ich dich nicht fressen.« Dies ging der Kaufmann gerne ein, denn er gedachte, wie sein Pudel gewöhnlich ihm entgegenlaufe, und diesen wollte er, um sich das Leben zu retten, gerne opfern.
Nach derbem Handschlag tappte der Bär ruhig ins Dickicht zurück; und der Kaufmann schritt, aufatmend, rasch und fröhlich von dannen. Der goldene Nußzweig prangte herrlich am Hut des Kaufmanns, als er seiner Heimat zueilte.
Freudig hüpfte das jüngste Mägdlein ihrem lieben Vater entgegen; mit tollen Sprüngen kam der Pudel hinterdrein, und die ältesten Töchter und die Mutter schritten etwas weniger schnell aus der Haustüre, um den Ankommenden zu begrüßen.
Wie erschrak nun der Kaufmann, als seine jüngste Tochter die erste war, die ihm entgegen flog! Bekümmert und betrübt entzog er sich der Umarmung des glücklichen Kindes und teilte nach den ersten Grüßen den Seinigen mit, was ihm mit dem Nußzweig widerfahren ist. Da weinten nun alle und wurden betrübt, doch zeigte die jüngste Tochter den meisten Mut und nahm sich vor, des Vaters Versprechen zu erfüllen.
Auch ersann die Mutter bald einen guten Rat und sprach: »Ängstigen wir uns nicht, meine Lieben, sollte je der Bär kommen und dich, mein lieber Mann, an dein Versprechen erinnern, so geben wir ihm, anstatt unserer Jüngsten, die Hirtentochter, mit dieser wird er auch zufrieden sein.«
Dieser Vorschlag galt, und die Töchter waren wieder fröhlich und freuten sich recht über diese schönen Geschenke. Die Jüngste trug ihren Nußzweig immer bei sich; sie gedachte bald gar nicht mehr an den Bären und an das Versprechen ihres Vaters.
Aber eines Tages rasselte ein dunkler Wagen durch die Straße vor das Haus des Kaufmanns, und der häßliche Bär stieg heraus und trat brummend in das Haus und vor den erschrockenen Mann, der Erfüllung seines Versprechens begehrend. Schnell und heimlich wurde die Hirtentochter, die sehr häßlich war, herbei geholt, schön geputzt und in den Wagen des Bären gesetzt. Und die Reise ging fort.
Draußen legte der Bär sein wildes zotteliges Haupt auf den Schoß der Hirtin und brummte:
»Graule mich, grabble mich,
Hinter den Ohren zart und fein,
Oder ich freß dich mit Haut und Bein!«
Und das Mädchen fing an zu grabbeln; aber sie machte es dem Bären nicht recht, und er merkte, daß er betrogen wurde; da wollte er die geputzte Hirtin fressen, doch diese sprang rasch in ihrer Todesangst aus dem Wagen.
Darauf fuhr der Bär abermals vor das Haus des Kaufmanns und forderte furchtbar drohend die rechte Braut. So mußte denn das liebliche Mägdlein herbei, um nach schwerem bitteren Abschied mit dem häßlichen Bräutigam fort zu fahren. Draußen brummte er wieder, seinen rauhen Kopf auf des Mädchens Schoß legend:
»Graule mich, grabble mich,
Hinter den Ohren zart und fein,
Oder ich freß dich mit Haut und Bein!«
Und das Mädchen grabbelte, und so sanft, daß es ihm behagte und daß sein furchtbarer Bärenblick freundlich wurde, so daß allmählich die arme Bärenbraut einiges Vertrauen zu ihm gewann.
Die Reise dauerte nicht gar lange, denn der Wagen fuhr ungeheuer schnell, als brause ein Sturmwind durch die Luft. Bald kamen sie in einen sehr dunklen Wald, und dort hielt plötzlich der Wagen vor einer finster gähnenden Höhle. Diese war die Wohnung des Bären. Oh, wie zitterte das Mädchen! Und zumal da der Bär sie mit seinen furchtbaren Klauenarmen umschlang und zu ihr freundlich brummend sprach:
»Hier sollst du wohnen, Bräutchen, und glücklich sein, so du drinnen dich brav benimmst, daß mein wildes Getier dich nicht zerreißt.« Und er schloß, als beide in der dunklen Höhle einige Schritte getan, eine eiserne Türe auf und trat mit der Braut in ein Zimmer, das voll von giftigem Gewürm angefüllt war, welches ihnen gierig entgegen züngelte. Und der Bär brummte seinem Bräutchen ins Ohr:
»Seh dich nicht um!
Nicht rechts, nicht links;
Gerade zu, so hast du Ruh!«
Da ging auch das Mädchen, ohne sich umzublicken, durch das Zirnmer, und es regte und bewegte sich so lange kein Wurm. Und so ging es noch durch zehn Zimmer, und das letzte war von den scheußlichsten Kreaturen angefüllt, Drachen und Schlangen, Gift geschwollenen Kröten, Basilisken und Lindwürmern. Und der Bär brummte in jedem Zimmer:
»Seh dich nicht um!
Nicht rechts, nicht links;
Gerade zu, so hast du Ruh!«
Das Mädchen zitterte und bebte vor Angst und Bange wie in Espenlaub, doch blieb sie standhaft, sah sich nicht um, nicht rechts, nicht links. Als sich aber das zwölfte Zimmer öffnete, strahlte beiden ein glänzender Lichtschimmer entgegen, es erschallte drinnen eine liebliche Musik, und es jauchzte überall wie Freudengeschrei, wie Jubel.
Ehe sich die Braut nur ein wenig besinnen konnte, noch zitternd vom Schauen des Entsetzlichen und nun wieder dieser überraschenden Lieblichkeit - tat es einen furchtbaren Donnerschlag, also daß sie dachte, es breche Erde und Himmel zusammen.
Aber bald ward es wieder ruhig. Der Wald, die Höhle, die Gifttiere, der Bär - waren verschwunden; ein prächtiges Schloß mit Gold geschmückten Zimmern und schön gekleideter Dienerschaft stand dafür da, und der Bär war ein schöner junger Mann geworden, war der Fürst des herrlichen Schlosses, der nun sein liebes Bräutchen an das Herz drückte und ihr tausendmal dankte, daß sie ihn und seine Diener, das Getier, so liebreich aus seiner Verzauberung erlöste.
Die nun so hohe, reiche Fürstin trug aber noch immer ihren schönen Nußzweig am Busen, der die Eigenschaft hatte, nie zu verwelken, und trug ihn jetzt nur noch um so lieber, da er der Schlüssel ihres holden Glückes geworden ist. Bald wurden ihre Eltern und ihre Geschwister von diesem freundlichen Geschick benachrichtigt und wurden für immer, zu einem herrlichen Wohlleben, von dem Bärenfürsten auf das Schloß genommen.
DER STARKE GOTTLIEB...
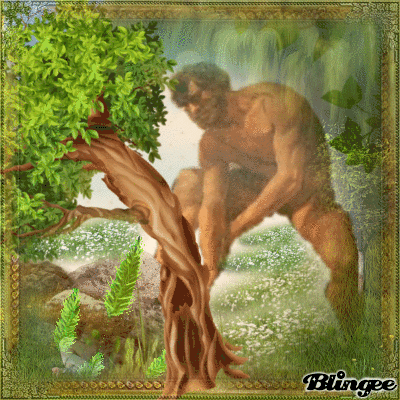
Es war einmal ein reicher Rittergutsbesitzer, dem dienten viele Knechte, und einer von diesen wollte sich verheiraten. Wie nun der selbe seinen Herrn um die Heiratserlaubnis bat, so sagte dieser: »Heirate nur zu in Gottes Namen! Ich wünsche dir einen recht starken Sohn, und wenn du einen solchen hast, so will ich ihn dir zuliebe gern auch in meinen Dienst nehmen.«
Also heiratete der Knecht und wurde Vater eines kräftigen Sohnes, dem er den Namen Gottlieb gab. Dem Vater blieb das Versprechen seines Herrn unvergessen, und er war darauf bedacht, Sorge zu tragen, den Jungen recht stark werden zu lassen. Zu diesem Zwecke dünkte dem Vater notwendig, daß sein Kleiner recht lange Muttermilch trinke.
Erst stillte ihn daher seine Mutter in ihren Armen, dann ließ sie ihn auf ihrem Schoße sitzen, dann lernte der kleine Gottlieb laufen und trug sich, wenn er trinken wollte, ein Hützschchen bei, auf das er trat, weil er der Mutter auf dem Schoße schon zu schwer wurde, und trank sehr flott und trank sieben Jahre lang Muttermilch und wurde groß und stark.
Nach Verlauf der sieben Jahre nahm der Knecht seinen Gottlieb mit zum Gutsherrn und sagte: »Schaut Herr, den kapitalen Jungen! Er kann schon etwas tun für sein Alter.« Da stand im Garten, wo Vater und Sohn den Gutsbesitzer angetroffen hatten, ein junger Baum, und da sprach der Herr: »Reiße dies Bäumchen heraus, Gottlieb!«
Der Knabe versuchte seine Kraft an dem Bäumchen, aber er vermochte nicht, das selbe auszureißen, und der Herr sprach: »Der Kleine ist noch zu jung und zu schwach. Es wäre auch zu viel von ihm verlangt, jetzt schon schwere Arbeit zu tun.«
Da ging der Knecht mit seinem Gottlieb hinweg und ließ ihn noch sieben Jahre Muttermilch trinken, und als die sieben Jahre um waren, führte der Vater seinen Sohn wieder zum Rittergutsbesitzer, dem Gottlieb nun groß und stark genug schien, um ihn in seine Dienste zu nehmen; er sollte daher einen Tag zur Probe dienen.
Der Gottlieb war aber von Natur und durch die Muttermilch schrecklich stark geworden und riß gleich als Probestück einen ziemlich dicken Baum mit dem kleinen Finger heraus, so daß alles erschrak, absonderlich die Gutsherrin, und ihm gleich abgeneigt wurde.
Nun ging es an die Arbeit, die Gottlieb nur ein Spiel war; dann kam die Essenszeit; die Magd trug eine Schüssel voll Kartoffeln nebst Buttermilch auf und ging, die übrigen Knechte zu rufen; Gottlieb, der zuerst mit seiner Arbeit fertig geworden, war schon da und begann einstweilen allein zu speisen.
Er zeigte, daß er nicht nur von Muttermilch, sondern auch von Buttermilch sich trefflich zu nähren verstehe und mit den Kartoffeln den Magen zuspitzen könne. Als die übrigen Knechte kamen und essen wollten und murrten, daß das Essen noch nicht aufgetragen sei, trat Gottlieb hinter dem Ofen hervor, allwo er sich ausgeruht, kraulte sich hinter den Ohren und sagte: »Es war etwas da, aber nicht viel, ich hab gemeint, es sei für mich, und hab es derweil gegessen.«
Da kam die andere ein Grauen an vor Gottliebs Appetit, und sie verwünschten einen Mitgenossen, der nicht mit ihnen, sondern der alles allein genoß. Nach dem Essen ging es an das Dreschen.
Als neuem Ankömmling schenkte der Gutsherr dem Gottlieb einen neuen Dreschflegel, der war in Gottliebs Hand wie eine Feder, er warf ihn in die Luft und fing ihn wieder, wie Knaben mit leichten Stöckchen tun, und dann warf er ihn gar weg, riß sich einen Baum aus und drosch darauf los, daß die Körner gleich zu Mehl wurden und das Stroh klein wie Häckerling, und schlug alles in Grund und Boden hinein.
Das war dem Gutsherrn doch zu bunt - er erschrak vor dem gefährlichen Knecht und sann darauf, den selben mit einer guten Manier wieder los zu werden. Er fragte daher den Gottlieb, welchen Lohn er begehre, wenn er wirklich in den Dienst trete. Gottlieb trat nahe zu dem Herrn heran und sagte ihm etwas ins Ohr. Darauf wurde der Herr rot und sagte: »Es ist gut, aber stille davon« - und nahm Gottlieb zum Knechte an - darob sich die anderen Knechte nicht im aller entferntesten freuten.
Als der Gutsherr mit seiner Frau allein war, verlangte diese zu wissen, welchen Lohn Gottlieb sich ausbedungen habe; der Herr wurde wieder rot und wollte es erst nicht sagen, wodurch seine Frau um so mehr in ihn drang, mit der Sprache herauszurücken.
Der Rittergutsbesitzer war sehr geizig, gab gar zu gern so wenig Lohn als nur möglich, und das hatte Gottlieb erwogen, dem gar nichts daran gelegen war, daß er hatte so stark werden müssen, um für andere sich zu plagen und zu arbeiten So sagte jetzt der Gutsherr etwas verlegen zu seiner Frau:
»Siehe, mein Schatz, es hat damit seine eigene Bewandtnis. So billig bekomme ich nie einen so kräftigen Arbeiter. Der Gottlieb verlangt gar keinen Lohn.«
»Gar keinen Lohn? Das ist nicht menschenmöglich!« rief ganz erstaunt die Gutsherrin. »Dahinter steckt etwas! Mann, du belügst mich!«
»Nun beruhige dich nur, liebe Frau«, besänftigte der Gutsherr, »etwas verlangt er schon, und ich hab es ihm zugestanden, in Betracht, daß es uns nichts kostet - doch bleibt das geheim, unter uns - «
»Unter uns!« erwiderte die Frau. »Das heißt, ich muß darum wissen!« »Der Gottfried will mir etwas geben, wenn das Jahr herum ist«, stammelte der Gutsherr. »Dir? Das wäre! Was kann der Sohn deines Knechts dir geben?« fragte die Frau. »Eine Feige«, antwortete der Mann, »will er mir geben.«
»Eine Feige? Mann, du lügst, oder es rappelt bei dir!« schrie die Frau und wurde zornig. »Wo sollen denn auf unserem Gute Feigen herkommen?« »Oh«, versetzte der Gutsherr, »die gibt es, es regnet bisweilen der selben - der Gottlieb meint eine Ohrfeige.«
Wenig hätte gefehlt, so hätte der Gutsherr schon jetzt eine solche Frucht zu schmecken bekommen, aber starrer Schreck lähmte einige Minuten lang der Edelfrau Hand und Mund - bis sie endlich kreischte: »O du Tropf! Das ist wieder ein Stückchen deines Geizes! Du willst dich lieber entehren lassen, als einem Knecht Lohn zu zahlen.
Totschlagen wird dich der Gottlieb, denn so viel habe ich gemerkt, wo der hin schlägt, da wächst kein Gras! Nein, einen solchen Vertrag einzugehen, ist himmelschreiend. Doch, laß mich nur machen, ich wende das Unglück von dir - er muß fort - ich duld ihn nicht!« »Wenn du ihn fortbringen kannst, liebe Frau«, versetzte kleinmütig der Gutsherr, »so habe ich nichts dagegen.«
Die Gutsfrau machte sich gleich ein Plänchen - Auf dem Gute befand sich eine Mühle, in der es furchtbar spukte. Vielen war in der selben von dem Spukgeiste der Hals umgedreht worden. I - dachte sie, der kann dem Gottlieb den Hals auch umdrehen, das ist ein Aufwaschen, und da sind wir ihn los.
»Gottlieb! Heute trägst du ein halbes Malter Korn in die Mühle und mahlst es!« »Zu Befehl, gnädige Frau!« antwortete Gottlieb, holte einen großen Maltersack, faßte ein oder zwei Malter Korn hinein und warf sich ihn über die Schulter, ging und pfiff das Lied: »Da droben auf jenem Berge, Da steht ein Mühlenrad.«
Als er an die Mühle kam, war deren Türe verschlossen. Gottlieb klopfte höflich an, einmal, zweimal, dreimal. Da noch immer niemand auftat, so tat er einen sanften Tritt an die Türe, daß sie aufsprang und nebenbei entzwei krachte. Mitten im Wege zum Werke lagen eine Menge Mühlsteine; Gottlieb schob sie sanft mit den Füßen nach rechts und links und gelangte nun an das Werk.
Bevor er aufschüttete und das Werk anließ, schürte er sich ein Feuerlein und kochte sich eine Morgensuppe, in die er einen kleinen Schinken steckte, daß sie besser geschmerzt sei. Da kam eine große Katze mit feurigen Augen, die riß ihr Maul auf, starrte den starken Gottlieb an und schrie: »Miau!«
»Hui Katz!« schrie Gottlieb und gab ihr einen Tritt, daß sie eilend kehrt machte. Jetzt schüttete er auf, setzte das Mühlwerk in Gang und verzehrte sein Frühstück. Gleich war die Katze wieder da, fauchte und schrie abermals: »Miau!«
»Hui Katz!« schrie Gottlieb und warf ihr den Schinkenknochen auf den Kopf, daß sie um und um zwirbelte und verschwand. Plötzlich stand ein schrecklicher Riese vor dem starken Gottlieb und brüllte: »Mehlwurm! Wer heißt dich hier mahlen?«
Gottlieb, nicht faul, nahm einen Mühlstein, warf ihn dem Riesen an die Stirne und schrie: »Mühlwurm, wer heißt dich hier prahlen?« Da stürzte der Riese hinterrücks nieder und tat einen Brüller, daß das ganze Werk wackelte. Gottlieb aber sackte das Mehl ein und in einen mitgebrachten zweiten Sack die Kleie, nahm die Säcke auf beide Schultern und ging nach Hause.
»Hilf Himmel!« barmte die Gutsherrin. »Der Lümmel lebt und kommt wieder!« Und bald darauf sann sie auf neue Tücke.
»Der Ziehbrunnen muß gefegt werden!« ordnete die Frau am anderen Tage an. »Das Wasser schmeckt ganz schlecht und schlammig. Gottlieb kann hinuntersteigen.« Und zu den anderen Knechten sagte sie heimlich. »Wenn er drunten ist, nehmt euch ja in acht, daß dem Fresser, der euch alles weg frißt, kein Stein vom von ungefähr auf den Kopf fällt!«
Die verstanden den bösen Wink und lasen ihn aus dem höhnischen Lächeln der Gutsfrau. Und wie Gottlieb drunten im Brunnen war, schoben sie, in dem sie sich über den Rand bogen, die oberen Steine hinunter. Gottliebs Vater war nicht dabei, der war vor kurzem gestorben. Die Steine polterten und plumpsten in den tiefen Brunnen und fielen auf den starken Gottlieb, der aber schrie herauf:
»Dummheit da droben! Wer schüttet denn Streusand in das Tintenfaß? Wartet, wenn ich hinauf komme, will ich euch ledern!« Da liefen die Knechte erschrocken vom Brunnenrand weg und versteckten sich, und Gottlieb stieg heraus, wie ein Schornsteinfeger aus dem Schlot, nur weniger trocken, aber mit ebenso vielem Durst.
Kaum wußte nun die Edelfrau, was sie anfangen sollte mit dem starken Gottlieb, oder vielmehr, wie sie es anfangen sollte, ihn vom Hofe zu bringen. Da fiel ihr ein, daß ja in der Nähe sich ein verwünschtes Schloß befinde, das auf dem Berge, an dessen Fuße das neue Schloß des Rittergutsbesitzers stand, in Trümmern lag.
In diesem verwünschten Schlosse war es, wie schon diese Bezeichnung ausdrückt, gar nicht geheuer; es ging darin um, und es spukte in ihm der Geist eines alten Riesen, der vor urgrauen Zeiten darin gehaust und schlimme Taten genug verübt hatte, weshalb er denn auch da hinauf verwünscht und gebannt war.
Eine der schlechten und schlimmen Taten des alten Riesen war die gewesen, daß er die Vorfahren des jetzigen Rittergutsbesitzers, denen er das Gut verkaufte, um eine große Summe Geldes betrogen hatte, und war das zugleich auch wieder mit ein Grund, weshalb der Riese im alten Schlosse so greulich spuken mußte.
Die Edelfrau ließ Gottlieb zu sich rufen, verstellte sich und verbarg ihre Abneigung gegen den Knecht und sprach zu ihm: »Höre mein guter Gottlieb! Unser Herr wird dir nächstens eine ganz besondere Belohnung dafür geben, daß du so fleißig bist und so viel schaffst, dabei vertraut er dir auch ganz allein.
Droben auf dem alten Schlosse, weißt du, da wohnt der alte Rittergutsbesitzer, dem mein Mann das Gut abgekauft hat; das ist ein geiziger Hund und ist uns noch vieles schuldig, zahlt es aber im guten nicht aus - so gehe du einmal hinauf, Gottlieb, und sprich im unguten mit dem alten Spuk, denn du bist stark und herzhaft - alle anderen sind Hasenfüße und Hasenherzen und fürchten sich. Wenn du uns das Geld bringst, so sollst du auch ein gutes Teil davon haben und dir etwas Rechts dafür zugute tun.«
»Die Sache wird sich machen, gnädige Frau!« antwortete Gottlieb. »Ich will gleich gehen, und wenn Geld da droben zu holen ist, so bringe ich es, darauf verlaßt Euch.«
Bald war Gottlieb droben auf dem Berggipfel und wunderte sich. »Hm, hm!« machte er. »Immer haben sie drunten gesagt, da oben stände ein altes, verfallenes Schloß, hab deswegen mir auch noch nie die Mühe genommen, hier herauf zu klettern, und nun sehe ich ein nagelneues, schönes Haus, viel schöner als das untere Schloß. Da gibt es ganz sicher Geld genug.«
Gottlieb kam an die Eingangspforte des prächtigen Gebäudes, und da er keinen Klingelzug daran finden konnte, so klopfte er, aber die Türe blieb, gleich jener der Mühle, fest verschlossen.
»Dumm!« brummte Gottlieb, »da muß ich schon wieder der Schlosser sein und meinen Dietrich gebrauchen.« Trat daher ein wenig an die Pforte, doch schütterte davon das ganze Torgewände, und die Türe sprang mit Donnerkrachen auf. Aber wie Gottlieb in den inneren Raum trat, umschwebten ihn gleich eine Legion Geister, und an ihrer Spitze stand der greuliche Riese, welchem Gottlieb in der Mühle den Mühlstein an den Kopf geworfen hatte.
»Aha! Ein alter Bekannter!« rief Gottlieb. »Bist du vielleicht der Herr von Zahlungern, der andere Leuten ihr Geld aufhebt? Dann rücke heraus! Mein Herr braucht es, und meine Frau - das heißt, meines Herrn Frau - will es haben!«
»Menschenwurm!« brüllte der Riese und schnitt ein entsetzliches Gesicht. »Was wagst du zu wagen? Wer ist so frech, von dem Besitzer eines alten Schlosses Geld zu verlangen? Was geht mich Geld an? Hab acht, wie ich mit dir umspringen werde, du Knirps!«
»Holla, hoh! Da werde ich auch dabei sein!« rief Gottlieb, riß einen Türflügel ab und warf ihn dem Riesen an die Stirne, wo man noch die Schramme vom Mühlstein sah, dann den zweiten - und da machte sich der alte Riese eilend aus dem Staube und warf mit einem Sacke voll Geld nach Gottlieb, den dieser sogleich aufraffte und sich auf die Schulter lud.
So kam er im untern Schlosse wieder an, und wenn der Edelfrau auch Gottliebs Kommen nicht recht war, so war doch dem Edelmann das Kommen des Geldes äußerst recht, und er lobte den Gottlieb und sagte: »Einen so braven Knecht findet man selten.«
Heimlich aber wünschte er doch den Gottlieb zum Kuckuck, denn bei dessen Kraft graute ihn furchtbar vor der unvermeidlichen Ohrfeige. Er nahm daher Rücksprache mit seinem Schäfer und traf ein Übereinkommen mit diesem, daß er gegen ein gutes Stück Geld die bewußte Ohrfeige in Empfang nehmen wollte, dann rief er seine Knechte zusammen, ohne den Gottlieb, und sagte ihnen, er werde sie morgen in den Wald schicken, Holz zu holen, da möchten sie Sorge tragen, daß sie zeitig wieder herein kämen, denn wer zuletzt komme, der komme vom Dienst. Und er werde es nicht ungern sehen, wenn Gottlieb der letzte sei.
Solches geschah, alles eilte nach dem Holze, und niemand weckte Gottlieb, und als er endlich noch ziemlich schlaftrunken erschien und sich die Augen rieb, schrie ihn sein Herr an: »Ei, du fauler Geselle! Alles ist schon zu Holze, und wer zuletzt nach Hause kommt, kommt vom Dienst.«
»Ah!« rief Gottlieb, streckte die Arme hoch in die Höhe, dehnte sich, gähnte laut und sagte: »Das ist mir etwas ganz Neues.« »Schönen Dank, daß du mich nicht verschlungen hast, wie du dein Maul so aufrissest!« spottete der Gutsherr. »Neu oder nicht, es bleibt dabei.«
»Wohl, hin!« sagte Gottlieb, nahm sein Beil und ging nach dem Walde zu. Da waren seine Mitgesellen schon mit der Arbeit fertig, und er sah sie von weitem sich entgegen kommen. Da ging er nach einem nahen großen Teiche, über dessen Abfluß ein Steg führte, über den einzig und allein der Weg vom Walde nach dem Gute führte, riß die Schleusen auf, daß die volle Flut sich in den breiten Abflußkanal ergoß, trat mit dem Fuße den Steg in Stücken und ließ die Balken vom Wasser fort fluten.
Dann ging er seinen Mitknechten gemachsam entgegen, die ihn tüchtig auslachten und froh waren, ihn heute noch aus dem Dienste gejagt zu sehen; er aber rief: »Eilt nicht zu sehr, wartet ein wenig auf mich, ich komme bald wieder!« und ging nach dem Walde.
Jene aber eilten, was sie eilen konnten, nach dem Schlosse zu kommen, da kamen sie an die rauschend vorbeischießende Wasserflut ohne Steg und Brücke, und hätten sie den Teich umgehen wollen, hätten sie Stunden gebraucht. Sie mußten also warten, bis Gottlieb wieder kam, der sein Tagewerk leicht und schnell im Verlauf einer kleinen Stunde vollbracht hatte.
Und wie er nun kam, brachte er einen Heubaum mit, den stemmte er in den Fluß wie einen Turnerspringstock und schwang sich an das andere Ufer hinüber, dann warf er den Heubaum wieder über den Fluß und schrie seinen Kameraden zu: »Macht es wie ich!«
Aber von diesen hatten an dem Heubaume zwei zu heben, und sie mußten sitzen bleiben, bis der Teich alle seine Wasser vorüber geschickt hatte, welches mehr als einen Tag dauerte.
Immer lebhafter wurde der Wunsch der Gutsherrschaft, den starken Gottlieb los zu sein, und daher machte ihm der Rittergutsbesitzer den Vorschlag, ihm seinen Lohn zu gewähren; er habe einen Ersatzmann als Ohrfeigenempfänger, der solle die Zahlung erhalten, und dann soll Gottlieb gehen, wohin er Lust habe, und bleiben, wo er wolle.
Gottlieb sagte: »Es kommt auf eine Probe an; ich habe ja auch proben müssen.«
Jetzt stellte sich der Schäfer als Ersatzmann, Gottlieb sah ihn mit mitleidigem und spöttischem Blicke an und sagte: »Du? Wahrlich, du dauerst mich!« - nahm ihn, hob ihn leicht, wie einen Nußknacker, in die Höhe und schlug ihm eine so derbe Ohrfeige ins Gesicht, daß der Schäfer in die Luft flog wie der Spielball eines Knaben, aber gar nicht wieder herunter kam.
Der Gutsherr und seine Frau bekreuzigten und segneten sich und waren froh, daß er nicht diese Ohrfeige bekommen hatte, und sagten: »So, nun kannst du gehen.«
»Nä«, sagte Gottlieb. »Gehen? Nä - selbes kann ich nicht. Es war nicht der rechte; mit Euch, gnädiger Herr, hab ich gedingt. Ich liebe nicht Zichorien oder Runkelrüben statt Kaffee, ich bin kein Freund von Ersatzmannschaften. Ihr habt gesagt: ich solle gehen, wohin ich Lust habe, und bleiben, wo ich wolle. Habt Ihr nicht so gesagt?«
»Ja, allerdings, ich sagte so«, antwortete verdrießlich der Gutsherr. »Nun«, versetzte Gottlieb, »so gehe ich in mein Bett und bleibe hier auf dem Gut.«
Da wurde der Gutsherr sehr böse und rief: »So bleibe in des Kuckucks Namen, du Kobold! So gehe ich! Mit dir will ich nicht leben und zuletzt noch wie der arme Schäfer als Luftballon oder als Sternschnuppe am Himmel herumfahren. Nimm alles, und helfe dir der böse Feind hausen und wirtschaften!«
»Nun, wenn ihr denn nicht anders wollt, gnädiger Herr!« sprach Gottlieb sehr sanftmütig, »so bedank ich mich fein recht schön und wünsche Euch und der gnädigen Frau recht viel Liebes und Gutes! Ihr könnt auch Eure Sachen mitnehmen, und ich will Euch bis in die nächste Stadt in meiner Kutsche und mit meinen Pferden fahren lassen.«
»Fahre du selbst zur Hölle!« schrien außer sich der gewesene Gutsherr und seine Ehehälfte und enteilten. Gottlieb aber nahm die Knechte und Mägde in seinen Dienst und ließ seine alte Mutter, an der er vierzehn Jahre getrunken hatte, in das Schloß ziehen, und gab ihr ein goldenes Bett und seidene Kissen und Bettdecken und alle Tage den besten Wein zu trinken und alles Gute zu essen.
Ein Jahr danach, es war just Heu Erntezeit, und die Knechte und die Mägde waren auf der Wiese mit Heumachen beschäftigt, kam etwas aus der Luft herunter gefallen, das war der Schäfer, der hatte so lange oben herumgezwirbelt und war über alle Wasser und Weltteile weg geflogen; er lebte noch und blieb auch am Leben, denn er fiel auf einen großen Heuhaufen, und das war sehr gut für ihn, sonst hätte das alte Lied auf ihn gepaßt, welches anhebt: »Kuckuck hat sich zu Tod gefallen.«
DER BEHERZTE FLÖTENSPIELER ...
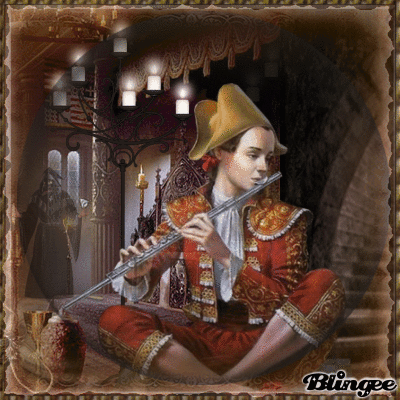
Es war einmal ein lustiger Musikant, der die Flöte meisterhaft spielte; er reiste daher in der Welt herum, spielte auf seiner Flöte in Dörfern und in Städten und erwarb sich dadurch seinen Unterhalt.
So kam er auch eines Abends auf einen Pächtershof und übernachtete da, weil er das nächste Dorf vor einbrechender Nacht nicht erreichen konnte. Er wurde von dem Pächter freundlich aufgenommen, mußte mit ihm speisen und nach geendigter Mahlzeit einige Stücklein auf seiner Flöte vorspielen.
Als dieses der Musikant getan hatte, schaute er zum Fenster hinaus und gewahrte in kurzer Entfernung bei dem Scheine des Mondes eine alte Burg, die teilweise in Trümmern zu liegen schien. »Was ist das für ein altes Schloß?« fragte er den Pächter. »Und wem hat es gehört?«
Der Pächter erzählte, daß vor vielen, vielen Jahren ein Graf da gewohnt hätte, der sehr reich, aber auch sehr geizig gewesen wäre. Er hätte seine Untertanen sehr geplagt, keinem armen Menschen ein Almosen gegeben und sei endlich ohne Erben (weil er aus Geiz sich nicht einmal verheiratet habe) gestorben. Darauf hätten seine nächsten Anverwandten die Erbschaft in Besitz nehmen wollen, hätten aber nicht das geringste Geld gefunden.
Man behaupte daher, er müsse den Schatz vergraben haben und dieser möge heute noch in dem alten Schloß verborgen liegen. Schon viele Menschen wären des Schatzes wegen in die alte Burg gegangen, aber keiner wäre wieder zum Vorschein gekommen. Daher habe die Obrigkeit den Eintritt in dies alte Schloß untersagt und alle Menschen im ganzen Lande ernstlich davor gewarnt.
Der Musikant hatte aufmerksam zugehört, und als der Pächter seinen Bericht geendigt hatte, äußerte er, daß er großes Verlangen habe, auch einmal hinein zu gehen, denn er sei beherzt und kenne keine Furcht. Der Pächter bat ihn aufs dringendste und endlich schier fußfällig, doch ja sein junges Leben zu schonen und nicht in das Schloß zu gehen. Aber es half kein Bitten und Flehen, der Musikant war unerschütterlich.
Zwei Knechte des Pächters mußten ein Paar Laternen anzünden und den beherzten Musikanten bis an das alte schaurige Schloß begleiten. Dann schickte er sie mit einer Laterne wieder zurück, er aber nahm die zweite in die Hand und stieg mutig eine hohe Treppe hinan. Als er diese erstiegen hatte, kam er in einen großen Saal, um den ringsherum Türen waren.
Er öffnete die erste und ging hinein, setzte sich an einen darin befindlichen altväterischen Tisch, stellte sein Licht darauf und spielte die Flöte. Der Pächter aber konnte die ganze Nacht vor lauter Sorgen nicht schlafen und sah öfters zum Fenster hinaus. Er freute sich jedesmal unaussprechlich, wenn er drüben den Gast noch musizieren hörte.
Doch als seine Wanduhr elf schlug und das Flötenspiel verstummte, erschrak er heftig und glaubte nun nicht anders, als der Geist oder der Teufel, oder wer sonst in diesem Schlosse hauste, habe dem schönen Burschen nun ganz gewiß den Hals umgedreht. Doch der Musikant hatte ohne Furcht sein Flötenspiel abgewartet und gepflegt; als aber sich endlich Hunger bei ihm regte, weil er nicht viel bei dem Pächter gegessen hatte, so ging er in dem Zimmer auf und nieder und sah sich um.
Da erblickte er einen Topf voll ungekochter Linsen stehen, auf einem anderen Tische standen ein Gefäß voll Wasser, eines voll Salz und eine Flasche Wein. Er goß geschwind Wasser über die Linsen, tat Salz daran, machte Feuer in dem Ofen an, weil auch Holz dabei lag, und kochte sich eine Linsensuppe. Während die Linsen kochten, trank er die Flasche Wein leer, und dann spielte er wieder Flöte.
Als die Linsen gekocht waren, rückte er sie vom Feuer, schüttete sie in die auf dem Tische schon bereitstehende Schüssel und aß frisch darauf los. Jetzt sah er nach seiner Uhr, und es war um die zwölfte Stunde. Da ging plötzlich die Türe auf, zwei lange schwarze Männer traten herein und trugen eine Totenbahre, auf der ein Sarg stand. Diesen stellten sie, ohne ein Wort zu sagen, vor den Musikanten, der sich keineswegs im Essen stören ließ, und gingen ebenso lautlos, wie sie gekommen waren, wieder zur Türe hinaus.
Als sie sich nun entfernt hatten, stand der Musikant hastig auf und öffnete den Sarg. Ein altes Männchen, klein und verhutzelt, mit grauen Haaren und grauem Barte lag darinnen, aber der Bursche fürchtete sich nicht, nahm es heraus, setzte es an den Ofen, und kaum schien es erwärmt zu sein, als sich schon Leben in ihm regte. Er gab ihm hierauf Linsen zu essen und war ganz mit dem Männchen beschäftigt, ja fütterte es wie eine Mutter ihr Kind.
Da wurde das Männchen ganz lebhaft und sprach zu ihm: »Folge mir!« Das Männchen ging voraus, der Bursche aber nahm seine Laterne und folgte ihm sonder Zagen. Es führte ihn nun eine hohe verfallene Treppe hinab, und so gelangten endlich beide in ein tiefes schauerliches Gewölbe.
Hier lag ein großer Haufen Geld. Da gebot das Männchen dem Burschen: »Diesen Haufen teile mir in zwei ganz gleiche Teile, aber daß nichts übrig bleibt, sonst bringe ich dich ums Leben!« Der Bursche lächelte bloß, fing sogleich an zu zählen auf zwei große Tische herüber und hinüber und brachte so das Geld in kurzer Zeit in zwei gleiche Teile, doch zuletzt - war noch ein Kreuzer übrig.
Der Musikant besann sich kurz, nahm sein Taschenmesser heraus, setzte es auf den Kreuzer mit der Schneide und schlug ihn mit einem dabei liegenden Hammer entzwei. Als er nun die eine Hälfte auf diesen, die andere auf jenen Haufen warf, wurde das Männchen ganz heiter und sprach:
»Du himmlischer Mann, du hast mich erlöst! Schon hundert Jahre muß ich meinen Schatz bewachen, den ich aus Geiz zusammengescharrt habe, bis es einem gelingen würde, das Geld in zwei gleiche Teile zu teilen. Noch nie ist es einem gelungen, und ich habe sie alle erwürgen müssen. Der eine Haufen Geld ist nun dein, den anderen aber teile unter die Armen. Göttlicher Mensch, du hast mich erlöst!« Darauf verschwand das Männchen. Der Bursche aber stieg die Treppe hinan und spielte in seinem vorigen Zimmer lustige Stücklein auf seiner Flöte.
Da freute sich der Pächter, daß er ihn wieder spielen hörte, und mit dem frühesten Morgen ging er auf das Schloß (denn am Tage durfte jedermann hinein) und empfing den Burschen voller Freude. Dieser erzählte ihm die Geschichte, dann ging er hinunter zu seinem Schatz, tat wie ihm das Männchen befohlen hatte, und verteilte die eine Hälfte unter die Armen.
Das alte Schloß aber ließ er niederreißen, und bald stand an der vorigen Stelle ein neues, wo nun der Musikant als reicher Mann wohnte.
DAS KÄTZCHEN UND DIE STRICKNADELN ...
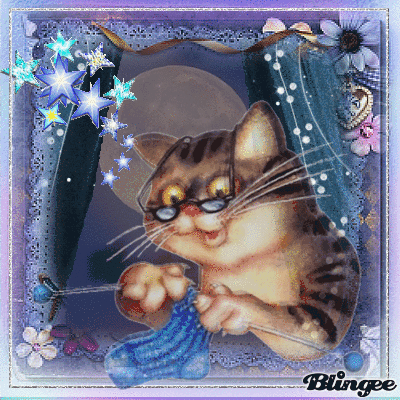
Es war einmal eine arme Frau, die in den Wald ging, um Holz zu lesen. Als sie mit ihrer Last auf dem Heimweg war, sah sie ein krankes Kätzchen hinter einem Zaun liegen. Es wimmerte gar kläglich, und die arme Frau nahm es mitleidig in ihre Schürze. Auf dem weiteren Weg nach Hause gesellten sich ihre beiden Kinder zu ihr.
Als sie sahen, dass die Mutter etwas trug, fragten sie: "Mutter, was hast du da?" Gleich wollten sie das Kätzchen haben, doch die Mutter gab es ihnen nicht. Sie sorgte sich, dass das Spiel der Kinder dem erschöpften Kätzchen Schaden zufügen könne. Zu Hause angekommen legte die Mutter das Kätzchen auf alte weiche Kleider und gab ihm Milch zu trinken. Als das Kätzchen sich gelabt hatte und wieder gesund war, machte es sich mit einem Male auf und davon.
Eines Tages ging die arme Frau wieder in den Wald. Als sie mit ihrer Bürde Holz an die Stelle kam, wo das kranke Kätzchen gelegen hatte, da stand eine vornehme Dame dort. Sie winkte die arme Frau zu sich und warf ihr fünf Stricknadeln in die Schürze. Die Frau wusste nicht recht, was sie davon halten sollte. Auch schien ihr diese absonderliche Gabe etwas zu gering. Doch am Abend legte sie die fünf Stricknadeln noch auf den Tisch, bevor sie müde auf das Nachtlager sank.
Als die Mutter dann am nächsten Morgen erwachte, lagen fertig gestrickte Strümpfe auf dem Tisch. Das wunderte die arme Frau über alle Maßen, also legte sie die Nadeln am nächsten Abend wieder auf den Tisch. Und am Morgen darauf lagen wieder neue Strümpfe da. Da erkannte die Mutter, dass die fleißigen Nadeln eine Belohnung waren, weil sie sich um das kranke Kätzchen gesorgt hatte.
Von nun an ließ sie die Nadeln jede Nacht stricken, bis sie und ihre Kinder genügend Strümpfe für das ganze Jahr hatten. Dann verkaufte sie auch noch Strümpfe, was ihr ein guten Lebensunterhalt bescherte. So lebte sie bescheiden und glücklich bis an ihr seliges Ende.
VOM BÜBLEIN, DAS SICH NICHT WASCHEN WOLLTE ...
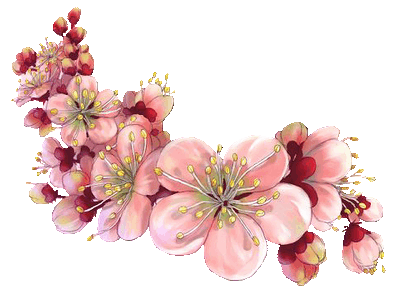
Es ist einmal ein Büblein gewesen, das wollte sich schon als ganz kleines Kind immer nicht waschen lassen, und als es größer wurde, so hat es sich vor dem Wasser über alle Maßen gegruselt und hat sich vor dem Naßwerden ärger gefürchtet als vor dem Feuer. Und da hat der unsaubere Geist, der Teufel, Macht genommen über das Büblein und hat zu ihm gesagt, er wolle es an einen Ort führen, wo es sich sein Lebtag nicht zu waschen brauche, und wenn es ihm sieben Jahre diene, dann solle es ein gutes Leben haben.
Das war dem Büblein recht, und es ging mit dem Teufel, und der führte es fort, daß keine Seele mehr von ihm weder hörte noch sah, und es wurde ganz und gar vergessen.
Nach sieben Jahren aber erschien in des Bübleins Heimat ein Geselle, der sah aus wie des Teufels rußiger Bruder. Seine Haut war schwarz, sein Haar wirr und ungekämmt, sein Wesen war schweigsam. Aber wenn er Kinder sah, so warnte er sie vor Unreinlichkeit und ermahnte sie, daß sie sich ja recht fleißig sollten waschen lassen.
Nachher geschah es wohl auch, daß er erzählte, wie er am Höllentore im Dienste des unsauberen Geistes habe Wache halten müssen, weil er selbst so unsauber gewesen war, und wer alles durch das Tor gekommen aus dem Dorfe und der ganzen Umgegend.
Wie aber die Leute von den Kindern vernahmen, was des Teufels gewesener Torwart erzählte, schalten sie ihn einen schwarzen Unhold und liefen haufenweise zu ihm und gaben ihm vieles Geld, daß er schweige und nicht sage, wessen Vater, Großvater, Mutter, Schwester, Muhme und ganze werte Verwandtschaft er in die Hölle habe einziehen sehen.
Da nahm er das Geld, wenn ihn aber einer wieder zu schelten anhub, so sagte er: "Ich wasche meine Hände in Unschuld, ich kann nichts dafür, daß Eure Sippschaft in die Hölle spaziert ist, statt in den Himmel." Und fing an und wusch sich fleißig, des Tages mehr als einmal, und verdiente vieles Geld mit Schweigen, während andere es mit Schwätzen verdienen müssen.
DIE SIEBEN SCHWABEN ...
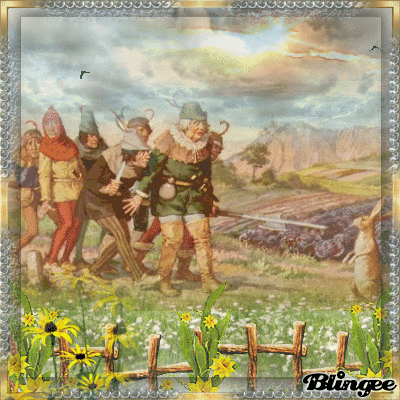
Einmal waren sieben Schwaben beisammen, der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jackli, der dritte der Marli, der vierte der Jergli, der fünfte der Michal, der sechste der Hans, der siebente der Veitli; die hatten alle siebene sich vorgenommen, die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen und große Taten zu vollbringen. Damit sie aber auch mit bewaffneter Hand und sicher gingen, sahen sie's für gut an, daß sie sich zwar nur einen einzigen, aber recht starken und langen Spieß machen ließen.
Diesen Spieß faßten sie alle siebene zusammen an, vorn ging der kühnste und männlichste, das mußte der Herr Schulz sein, und dann folgten die andern nach der Reihe, und der Veitli war der letzte.
Nun geschah es, als sie im Heumonat eines Tages einen weiten Weg gegangen waren, auch noch ein gut Stück bis in das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mußten, daß in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Roßkäfer oder eine Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbei flog und feindlich brummelte. Der Herr Schulz erschrak, daß er fast den Spieß hätte fallen lassen und ihm der Angstschweiß am ganzen Leibe ausbrach.
"Horcht, horcht", rief er seinen Gesellen, "Gott, ich höre eine Trommel!"
Der Jackli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ich weiß nicht was für ein Geruch in die Nase kam, sprach: "Etwas ist ohne Zweifel vorhanden, denn ich schmeck das Pulver und den Zündstrick."
Bei diesen Worten hub der Herr Schulz an, die Flucht zu ergreifen, und sprang im Hui über einen Zaun, weil er aber gerade auf die Zinken eines Rechens sprang, der vom Heumachen da liegen geblieben war, so fuhr ihm der Stiel ins Gesicht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag.
"O wei, o wei", schrie der Herr Schulz, "nimm mich gefangen, ich ergebe mich, ich ergebe mich!"
Die anderen sechs hüpften auch alle einer über den anderen herzu und schrien: "Gibst du dich, so geb ich mich auch, gibst du dich, so geb ich mich auch." Endlich, wie kein Feind da war, der sie binden und fort führen wollte, merkten sie, daß sie betrogen waren; und damit die Geschichte nicht unter die Leute käme und sie nicht genarrt und gespottet würden, verschwören sie sich untereinander, so lang davon still zu schweigen, bis einer unverhofft das Maul auf täte.
Hierauf zogen sie weiter. Die zweite Gefährlichkeit, die sie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Nach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachfeld, da saß ein Hase in der Sonne und schlief, streckte die Ohren in die Höhe und hatte die großen gläsernen Augen starr auf stehen.
Da erschraken sie bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres insgesamt und hielten Rat, was zu tun das wenigst gefährliche wäre. Denn so sie fliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer setzte ihnen nach und verschlänge sie alle mit Haut und Haar.
Also sprachen sie: "Wir müssen einen großen und gefährlichen Kampf bestehen, frisch gewagt ist halb gewonnen!" faßten alle siebene den Spieß an, der Herr Schulz vorn und der Veitli hinten. Der Herr Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten, der Veitli aber war hinten ganz mutig geworden, wollte losbrechen und rief: "Stoß zu in aller Schwabe Name, sonst wünsch i, daß ihr möcht erlahme."
Aber der Hans wußt ihn zu treffen und sprach: "Beim Element, du hascht gut schwätze, bischt stets der letscht beim Drachehetze."
Der Michal rief: "Es wird nit fehle um ei Haar, so ischt es wohl der Teufel gar."
Drauf kam an den Jergli die Reihe, der sprach: "Ischt er es nit, so ischt's sei Muter
oder des Teufels Stiefbruder."
Der Marli hatte da einen guten Gedanken und sagte zum Veitli: "Gang, Veitli, gang, gang du voran, i will dahinte vor di stahn."
Der Veitli aber hörte nicht drauf, und der Jackli sagte: "Der Schulz, der muß der erschte sei, denn ihm gebührt die Ehr allei."
Da nahm sich der Herr Schulz ein Herz und sprach gravitätisch: "So zieht denn herzhaft in den Streit hieran erkennt man tapfre Leut."
Da gingen sie insgesamt auf den Drachen los. Der Herr Schulz segnete sich und rief Gott um Beistand an; wie aber das alles nicht helfen wollte und er dem Feind immer näher kam, schrie er in großer Angst: "Hau! hurlehau! hau! hauhau!"
Davon erwachte der Has, erschrak und sprang eilig davon. Als ihn der Herr Schulz so Feld flüchtig sah, da rief er voll Freude: "Potz, Veitli, lueg, lueg, was ischt das? "Das Ungehüer ischt a Has."
Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und kam an die Mosel, ein moosiges, stilles und tiefes Wasser, darüber nicht viel Brücken sind, sondern man an mehreren Orten sich muß in Schiffen überfahren lassen. Weil die sieben Schwaben dessen unberichtet waren, riefen sie einem Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüberkommen könnte.
Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten, und fragte auf sein Trierisch: "Wat? Wat?" Da meinte der Herr Schulz, er spräche nicht anders als: "Wate, wate durchs Wasser", und hub an, weil er der Vorderste war, sich auf den Weg zu machen und in die Mosel hineinzugehen.
Nicht lang, so versank er in den Schlamm und in die antreibenden tiefen Wellen, seinen Hut aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige Ufer, und ein Frosch setzte sich dabei und quakte "wat, wat, wat". Die sechs anderen hörten das drüben und sprachen: "Unser Gesell, der Herr Schulz, ruft uns, kann er hinüberwaten, warum wir nicht auch?"
Sprangen darum eilig alle zusammen in das Wasser und ertranken, also daß ein Frosch ihrer sechse ums Leben brachte und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Haus kam.
DIE GOLDMARIA UND DIE PECHMARIA ...
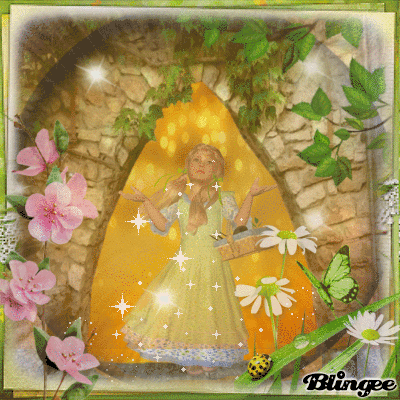
Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Eine richtige Tochter und eine Stieftochter, doch beide hießen Maria. Die richtige Tochter war als Kind von ihrer Mutter sehr verhätschelt worden. Auch war sie vom Wesen her nicht gut und fromm. Als sie nun heranwuchs, zeigte sich schon bald, dass sie eigensinnig und hinterhältig, aber auch sehr herrisch und gefühllos sein konnte. Es kam ihr immer nur in den Sinn, sich mit schönen Kleidern herauszuputzen, in den Spiegel zu sehen und vergnügliche Orte zu besuchen.
Die Stieftochter war dagegen stets bescheiden und brav, aber sie musste gar viele Kränkungen von Mutter und Schwester erdulden. Trotzdem blieb sie freundlich und tat die Küchenarbeit unverdrossen. Nur manchmal weinte sie heimlich in ihrem Kämmerlein, wenn sie durch Mutter und Schwester besonders hatte leiden müssen. Es brauchte aber nicht lange, so war sie wieder fröhlich, und sprach zu sich selbst: "Sei guten Mutes, der liebe Gott wird dir schon helfen." Dann tat sie fleißig ihre Arbeit, und machte alles nett und sauber.
Ihrer Stiefmutter meinte aber, dass sie nicht genug arbeite. Und eines Tages sagte sie sogar: "Maria, ich kann dich nicht länger zu Hause behalten. Du arbeitest zu wenig und isst zu viel. Und deine leibliche Mutter hat dir kein Vermögen hinterlassen, auch dein Vater nicht. Daher ist im Hause alles mein, und ich kann und mag dich nicht länger ernähren. Du musst jetzt gehen und dir einen Dienst bei einer Herrschaft suchen." Dann machte die Stiefmutter noch aus Asche und Milch einen Kuchen, füllte ein Krüglein mit Wasser, gab beides der armen Maria und schickte sie weg.
Maria war sehr betrübt über diese Ungerechtigkeit. Trotzdem schritt sie mutig durch Felder und Wiesen und dachte: "Es wird dich schon jemand als Magd nehmen, und vielleicht sind ja fremde Menschen gütiger als die eigene Stiefmutter." Als sie nun den Hunger fühlte, setzte sie sich ins Gras nieder, zog ihren Aschekuchen hervor und aß etwas davon. Dann trank sie aus ihrem Krüglein, und viele Vöglein flatterten herbei. Sie pickten an ihrem Kuchen, und Maria goss etwas Wasser in ihre Hand, auf dass die muntere Vogelschar trinken konnte.
Da verwandelte sich plötzlich ihr Aschekuchen in eine süße Torte und ihr Wasser in köstlichen Wein. Gestärkt und froh zog die arme Maria weiter und kam, als es dunkel wurde, an ein seltsames Haus. Das Haus hatte vorne zwei Tore, eines pechschwarz, das andere glänzend wie pures Gold.
Bescheiden ging Maria durch das unansehnliche Tor in den Hof, und klopfte an die Haustüre. Ein Mann von schrecklich wildem Aussehen tat die Türe auf und fragte barsch nach ihrem Begehren. Sie sprach zitternd: "Ich wollte nur fragen, ob Ihr nicht so gütig sein könntet, mich über Nacht zu beherbergen?" Der Mann brummte: "Komm herein!" Sie folgte ihm und zuckte noch mehr zusammen, als sie drinnen im Zimmer nur Hunde und Katzen sah, die ein abscheuliches Geheul veranstalteten.
Der wilde Thürschemann, der die arme Maria hereingelassen hatte, brummte nun: "Bei wem willst du schlafen, bei mir oder bei Hunden und Katzen?" Maria sprach: "Bei Hunden und Katzen." Dennoch musste sie neben dem wilden Thürschemann schlafen. Er gab ihr ein so schönes weiches Bett, dass Maria ganz herrlich und ruhig schlief.
Am Morgen brummte Thürschemann wieder: "Mit wem willst du frühstücken, mit mir oder mit Hunden und Katzen?" Sie sprach: "Mit Hunden und Katzen." Da musste sie mit ihm trinken, Kaffee und süßen Rahm. Als Maria dann fortgehen wollte, brummte Thürschemann abermals: "Zu welchem Tor willst du hinaus, zum Goldtor oder zum Pechtor?" Sie sprach: "Zum Pechtor."
Da musste sie durchs goldene gehen. Und als sie gerade darunter war, saß Thürschemann oben darauf und schüttelte es so derb, dass das Tor erzitterte und Maria mit Gold bedeckte.
Nun ging Maria wieder heim. Und als sie schon nahe beim Elternhaus war, kamen ihr die Hühner freudig entgegen, die sie sonst gefüttert hatte, und der Hahn schrie: "Kikiriki, da kommt die Goldmarie! Kikiriki!" Ihre Mutter kam aufgeregt die Treppe herunter und knickste so ehrfurchtsvoll vor der goldenen Dame, als wenn es eine Prinzessin wäre. Aber Maria sprach: "Liebe Mutter, kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin ja die Maria."
Jetzt kam auch die Schwester ganz erstaunt und verwundert, so wie die Mutter. Beide waren voll des Neides, und Maria musste erzählen, wie wunderbar es ihr ergangen war. Nun nahm die Stiefmutter Maria freundlicher auf, und hielt sie auch besser wie zuvor. Sie wurde von jedermann geehrt und geliebt. Und schon bald war ein braver junger Mann gefunden, der sie als Gattin heimführte und glücklich mit ihr lebte.
Der anderen Maria aber wuchs der Neid im Herzen. Sie beschloss, ebenso fortzugehen und mit Gold überhäuft wieder zu kommen. Da gab die Mutter ihr süßen Kuchen und Wein mit auf die Reise. Doch als Maria davon aß und die Vöglein geflogen kamen, jagte sie diese ärgerlich davon. Da verwandelte sich ihr Kuchen unvermerkt in Asche, und ihr Wein in mattes Wasser.
Am Abend kam Maria ebenfalls an Thürschemanns Tore. Sie ging stolz zu dem goldenen hinein, und klopfte an die Haustüre. Als Thürschemann aufmachte und brummig nach ihrem Begehren fragte, sagte sie schnippisch: "Nun, ich will hier übernachten." Und er brummte: "Komm herein!"
Dann fragte er sie: "Bei wem willst du schlafen, bei mir oder bei Hunden und Katzen?" Sie antwortete schnell: "Bei euch, Herr Thürschemann!" Aber er führte sie in die Stube, wo Hunde und Katzen schliefen, und schloss sie hinein. Am Morgen war das Angesicht der stolzen Maria gar hässlich zerkratzt und zerbissen.
Thürschemann brummte wieder: "Mit wem willst du Kaffee trinken, mit mir oder mit Hunden und Katzen?" "Ei, mit euch", sagte sie. Da musste sie nun gerade wieder mit Katzen und Hunden trinken.
Maria hatte jetzt genug von diesem Possenspiel und wollte fort. Thürschemann brummte abermals: "Zu welchem Tor willst du hinaus, zum Goldtor oder zum Pechtor?" Sie sagte: "Zum Goldtor, das versteht sich doch von selbst!" Aber dieses wurde sogleich verschlossen, und sie musste zum Pechtor hinaus. Thürschemann saß obendrauf, rüttelte und schüttelte, dass das Tor bedenklich wackelte. Da fiel so viel Pech herunter, dass die stolze Maria über und über damit bedeckt war.
Als sie nun voll Wut und gar hässlich nach Hause kam, krähte der Gockelhahn ihr entgegen: "Kikiriki, da kommt die Pechmarie! Kikiriki!" Und ihre Mutter wandte sich voll Abscheu von ihr ab. Denn mit dieser hässlichen Tochter konnte und wollte sie sich nicht bei den feinen Leuten sehen lassen. Das war die größte Strafe für die Pechmaria, denn sie war auf das Gold aus, um gerade bei diesen Leuten Eindruck zu schinden.
DER RICHTER UND DER TEUFEL ...
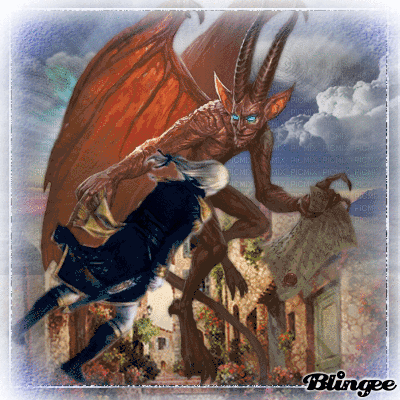
In einer Stadt saß ein Mann, der hatte alle Kisten voll mit Geld und Gut. Er selbst aber war so voller Laster, dass die Leute sich schon wunderten, dass die Erde ihn nicht verschlang. Dieser Mann war noch dazu ein Richter, das heißt ein Richter voll von Ungerechtigkeit.
An einem Markttage ritt er des Morgens aus, seinen schönen Weingarten zu sehen. Da trat ihm der Teufel entgegen, in reiche Kleider gewandet, wie ein gar vornehmer Herr. Der Richter wusste nicht, wer dieser Fremdling war, mochte es doch aber gern wissen. So fragte er ihn nicht eben höflich, wer und von woher er denn sei.
Der Teufel antwortete: "Es ist besser, wenn Ihr es nicht wisst, wer und woher ich bin!" "Hoho!", fuhr es dem Richter heraus, "Egal wer ihr seid, so muss ich es doch wissen: Denn ich bin der Mann, der Gewalt hier hat. Und wenn ich Euch dies und das zu Leide tue, so ist niemand da, der es mir verwehren kann. Ich nehme Euch Leib und Gut, wenn Ihr mir nicht auf meine Frage Bescheid gebt!"
"Steht es so schlimm", antwortete der Arge, "so muss ich euch wohl meinen Namen und meine Herkunft sagen; ich bin der Teufel." "Hm!", brummte der Richter. "Und was ist hier dein Gewerbe? Auch das will ich wissen!"
"Schau, Herr Richter", antwortete der Böse, "mir ist Macht gegeben, heute in diese Stadt zu gehen und das zu nehmen, was mir in vollem Ernst gegeben wird." "Wohlan", versetzte der Richter, "tue es also! Aber lass mich deine Zeuge sein, dass ich sehe, was man dir geben wird!"
"Fordre nicht, dabei zu sein, wenn ich nehme, was mir beschieden ist", antwortete der Teufel dem Richter. Dieser aber schickte sich an, den Fürsten der Hölle mit mächtigen Worten zu beschwören, und sprach: "Ich gebiete und befehle dir bei Gott und allen Geboten, bei Gottes Gewalt und Gottes Zorn, und bei allem, was dich und deine Genossen bindet, dass du nur vor meinem Angesicht nimmst, was man dir ernstlich geben wird."
Der Teufel erschrak und zitterte bei diesen fürchterlichen Worten. Er machte ein gar verdrießliches Gesicht und sprach: "Ei, so wollte ich, dass ich das Leben nicht hätte! Du bindest mich mit einem so starken Band, dass ich kaum jemals in größerer Bedrängnis war. Ich gebe dir aber mein Wort als Fürst der Hölle, das ich als solcher niemals breche, dass es dir nicht wohl bekommen kann, wenn du bei deinem Sinnen bleibst. Stehe ab davon!"
"Nein, ich stehe nicht ab davon!", rief der Richter empört. "Was mir auch geschehe, das muss ich über mich ergehen lassen. Ich will jenes nun einmal sehen, und sollte es mir ans Leben gehen!"
Nun gingen beide, der Richter und der Teufel, miteinander auf den Markt, wo gerade Markttag war. Daher war viel Volks versammelt, und überall bot man dem Richter und seinem fremden Begleiter volle Becher und hieß sie, einen guten Schluck zu tun.
Der Richter tat das wie gewohnt und reichte auch dem Teufel eine Kanne. Dieser aber nahm den Trunk nicht an, weil er wohl wusste, dass es des Richters Ernst nicht war.
Nun geschah es, dass eine Frau ein Schwein daher trieb, welches nicht nach ihrem Willen ging. Das Schwein lief kreuz und quere, so dass die zornige Frau im höchsten Ärger rief: "Ei, so geh doch zum Teufel, dass der dich mit Haut und Haar hole!"
"Hörst du, Geselle?", rief der Richter dem Teufel zu. "Jetzt greife hin und nimm das Schwein." Aber der Teufel antwortete: "Es ist leider der Frau nicht Ernst mit ihrem Wort. Sie würde ein ganzes Jahr lang trauern und sich grämen, nähme ich ihr das Schwein. Nur was mir im Ernste gegeben wird, das darf ich nehmen."
Ähnliches geschah bald hernach mit einer Frau und einem Kind. Das letztere ging auch nicht so, wie die Frau es lenken wollte. Da schrie die Frau vor lauter Wut: "Hol dich der Teufel, dass er dir den Hals umdrehe!" "Hörst du, Geselle?", fragte da wieder der Richter. "Das Kind ist dein, hörst du nicht, dass man es dir ernstlich gibt?"
"O nein, es ist auch nicht ihr Ernst!", antwortete der Teufel. "Sie würde bitterlich wehklagen, nähme ich sie beim Wort. Das Kind wird sie nicht fahren lassen."
Jetzt sahen beide eine Frau, die hatte viel mit einem Kinde zu schaffen, welches heftig schrie und sich sehr unartig gebärdete. Die Frau war voll Unwillens und rief aus: "Willst du mir nicht
folgen, so nehme dich der böse Mann, du Balg!"
"Nun, willst du auch dieses Kind nicht?", fragte der Richter ganz verwundert. Und der Teufel antwortete: "Ich habe keine Macht, das Kindlein zu nehmen. Diese Frau nähme nicht zehn, nicht hundert und nicht tausend Pfund und gönnte mir nicht im Ernst das Kind. Wie gern ich es auch nähme, ich darf nicht, denn der Frau ist es nicht rechter Ernst."
Nun kamen die beiden mitten auf den Markt, wo ein dichtes Gedränge war. Sie mussten ein wenig stille stehen und konnten nicht gleich weiter gehen. Da sah eine arme, alte und kränkliche Frau den Richter an. Die Frau trug ein schweres Los und begann laut zu weinen und zu schreien:
"Weh über dich, du Richter! Weh über dich, dass du so reich bist und ich so arm. Du hast mir ohne Schuld meine einzige Kuh genommen, von der ich meinen ganzen Unterhalt hatte und die mich ernährte. Weh über dich, der du sie genommen hast, ohne Barmherzigkeit! Ich flehe und schreie zu Gott, dass er mir die Bitte gewähre, und deinen Leib und deine Seele dem Teufel zur Hölle führe!"
Auf diese Rede tat der Richter nicht ein einziges Wort, aber der Teufel fuhr ihn höhnisch an und sprach: "Siehst du, Richter, das ist Ernst, und das sollst du gleich gewahr werden". Da streckte der Teufel seine Krallen aus, nahm den Richter beim Schopf und fuhr mit ihm durch die Lüfte, wie der Geier mit einem Huhn.
Alles Volk erschrak und staunte, und weise Männer sprachen diese Lehre:
"Es ist ein unweiser Rat,
Der mit dem Teufel umgaht.
Wer gern mit ihm umfährt,
Dem wird ein böser Lohn beschert."
DER SCHWARZE GRAF ...
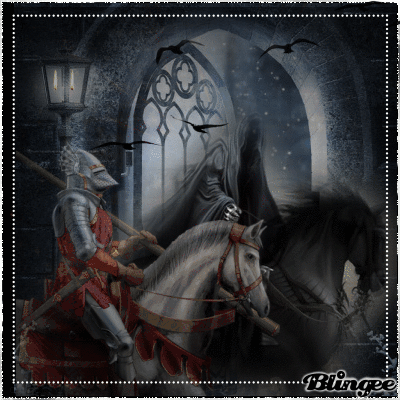
Einst zog ein Ritter durch den Wald, gefolgt von seinem Knappen. Es wurde schon Abend und die Gegend war verrufen, doch der Ritter kannte keine Furcht. Der Weg führte die beiden am Schlosse eines befreundeten Ritters vorüber, dessen Tochter gerade Hochzeit hielt.
Da entschlossen sie sich, als Gäste dort eine kurze Zeit zu verweilen. Der befreundete Ritter wollte sie länger bei sich halten, konnten sie doch im Hochzeitshause übernachten. Aber der Ritter trieb zur Eile und lehnte alle Einladungen zum Bleiben ab. Da warnte man ihn, im Walde hause der "schwarze Graf", ein gespenstischer Ritter. Dieser bereite jedem, den er im Walde antreffe, gar fürchterlichen Schrecken. Es half aber nichts.
Der Weg durch den Wald war stockfinster, und der Ritter und der Knappe waren schon drei Stunden lang geritten. Noch war ihnen nichts begegnet, und der Ritter war guten Mutes, dass sein Schwert ihn gegen Angriffe von irdischen und unterirdischen Mächten schützen könnte.
Da drängte der Knappe plötzlich sein Ross neben das von seinem Herrn und flüsterte ängstlich: "Herr! Es reitet einer hinter uns. Der Hufschlag seines Rosses klingt hohl, und schaut Euch um, Herr: Seht nur, wie der Feuerschaum vom Gebisse des Rosses fällt, und seht, wie seine Nüstern Funken sprühen."
Schnell hatte der schwarze Reiter, der ihnen folgte, aufgeholt. "Hollah! Gesellschaft! Wackere Kumpane!", rief eine tiefe, hohle Stimme. "Gott zum Gruße!", antwortete der Ritter. Der Rappe des Fremden stieg bäumend in die Höhe und schnaubte lange schmale Feuerströme aus den Nüstern, in deren Schein die Eisenrüstung des schwarzen Ritters erglühte.
"Für solchen Gruß dankt euch der Teufel, nicht ich!", grollte der riesige Nachtgeselle und hieb wild auf den bäumenden Rappen ein. "Doch wisst, ihr habt euch verirrt! Kommt mit mir auf mein Schloss, es ist ganz nah. Dort drüben seht ihr schon die Fenster schimmern."
"Ich danke euch, aber ich habe nicht die Zeit zur Einkehr!", antwortete der Ritter. Doch der schwarze Ritter rief gebietend: "Zeit wird sich finden!" Und er lachte so laut, dass es noch lange im Walde hallte.
Quer vor dem Weg lag eine lange schwarze Mauer mit einem halb verfallenen Tor. Der Weg führte geradewegs hindurch, und dann kamen sie zum Schloss des schwarzen Ritters, ein gar gewaltiger Bau. Droben im Gewirre der Türme und Türmchen kreischten Eulen. Und am Tor des Hauses ringelten sich steinerne dickleibige Drachen, die sich mit ihren Hälsen um die Säulen wanden. Schwarz ragte der ganze Bau zum dunklen Himmel empor, und nur wenige Fenster waren erhellt.
Der schwarze Graf schwang sich vom Ross, und das Ross versank hinter ihm in die Erde. "Folgt mir hinein!", rief der schwarze Graf seinen gezwungenen Gästen zu. Doch der treue Knappe flüsterte seinem Herrn ins Ohr. "Nicht hinein! Um Himmels willen nicht hinein!" "Schweige Knecht!", schrie der schwarze Graf gebieterisch. "Hier herrscht nicht der himmlische Wille, sondern einzig und alleine meiner! Hinfort mit dir!"
Da entschwand vor den Augen des Knappen das Schloss, und er stand jetzt auf öder einsamer Heide, nahe bei einem alten Gemäuer. Drei Türme ragten daraus empor. Das war aber nicht mehr das Schloss des schwarzen Grafen, es war ein anderes Haus.
Der Ritter folgte dagegen dem schwarzen Grafen mutig auf den Stufen einer Wendeltreppe. Von Zeit zu Zeit streckte sich eine Greifenklaue aus der Wand, die eine brennende Kerze hielt. Die Kerzen waren aber schwarz und weiß, und hässlicher Ruß bedeckte dunkel die Wände.
Die Rüstung des Grafen war nach uralter Art gemacht. Ein schwarzer Kettenpanzer umkleidete ihn völlig. Und auf dem Haupte trug er einen seltsam geformten Helm. Der Kamm dieses Helmes war nicht gegossen und nicht geschmiedet. Vielmehr war er lebendig, denn ein kleiner Drachen hing mit seinen Klauen daran. Manchmal drehte er den Kopf, so dass die schwarzen Funkelaugen wie Diamanten blitzten. Der Schwanz des Drachen hing lang vom Helm herab und schlenkerte bald nach links, bald nach rechts.
Als der schwarze Graf dann oben an der Treppe stand, wandte er sich wieder seinem Gaste zu. Bleich war sein Antlitz, bleich und abgezehrt. Seine Augen lagen tief in ihren Höhlen, als blickten sie dem Tod ins Auge. Der schwarze Graf keuchte nun schwer, und sein Atem glühte wie der Hauch der Wüste.
Da sprach der Graf: "Nun folge mir und schaue, was ich tat und wie ich leide!" "Einem jeden, der mir um Mitternacht begegnet, muss ich meine Missetat zeigen. Brauchst nicht für mich zu beten, Mann! Meine Tat wird nicht durch Reue gesühnt, nicht durch Fürbitte, und nicht durch Gebet."
Jetzt sprang die Türe eines Saales auf, der mit phantastischen Bildwerken verziert war. Kalter Eishauch, wie von einem Gletscher, wehte ihnen aus dem Raum entgegen. Der Saal schien unfreundlich und leer, doch in der Mitte stand etwas, erhellt von einem Leuchter, der von der Decke hing. Und was dort stand, das war ein Sarg, in dem eine Leiche lag. Es war eine alte kleine Frau, ganz weiß gekleidet, die Hände wie zum Gebete aneinander gelegt. Über den Händen aber ragte der schwarze Griff eines Dolches aus der Brust.
"Hier meine Mutter!", rief der schwarze Graf. "Hier der Mörder!", rief er noch einmal, dass es schaurig im Saale hallte. Dann fiel der Graf am Sarge auf die Knie. Plötzlich hob sich die Leiche im Sarge empor, wurde groß und größer, ja riesengroß, bis sie den Saal mehr und mehr füllte.
Dieser grausige Spuk deckte sich auch über den schwarzen Grafen, und der Ritter wich zurück, bis die Wand ihn hemmte. Immer grausiger wurde die entsetzliche Gestalt, und ihre Hände gruben in der Brust des schwarzen Grafen, gruben ihm das Herz aus der Brust.
Der Ritter war nun wie von den Sinnen! Er zog sein Schwert und schrie: "Unholde! Weichet im Namen des Gekreuzigten!" Da gellte ein entsetzlicher Schrei, da krachte das Gebälk, und da wankte das Haus. Der Sarg, die Wände, der Graf, das Schreckgespenst, alles sank hinab in die undurchdringliche Nacht.
Der Ritter erwachte aus seiner Betäubung. Sein treues Schwert hielt er noch in Händen. Schwarze Nacht war rings umher, und sein Fuß trat auf moorigem Grund. Seine Hand ertastete Mauerwerk und feuchtes Gras. Nachtluft umwehte ihn kühl und schaudernd.
"Was war das? Und wo bin ich?", fragte sich der Ritter, und sein Herz klopfte rasend schnell. Er rief laut den Namen seines Knappen, worauf er leise Antwort hörte: "Herr, wo seid Ihr?", rief der Knappe von weitem. Der Ritter antwortete: "Hier! Hier im Moor, unter Trümmern." Da kam der Knappe näher und führte die beiden Rosse an den Zügeln heran.
Mit Mühe half der Knappe seinem Herrn aus dem Sumpf zu steigen. Darüber begann der Morgen zu dämmern, und nun sahen Herr und Diener allmählich, wo sie waren. - Auf sumpfiger Heide, neben einem ganz verfallenen Bau am Ende eines Waldes.
Und eine Strecke weit entfernt sahen sie im Nebeldämmer jenes Gebäude, an dem der Knappe gerastet hatte. Es war ein Galgengerüst. Drei hohe Steinpfeiler erhoben sich wie weiße Türme, aber die verbindenden Balken waren längst verrottet und herab gefallen.
Kühl wehte es vom Osten her und feucht schlug sich der Nebel nieder. Der Ritter und sein Knappe machten sich wieder auf den Weg. Und nie mehr vergaß der Ritter sein gespenstisches Abenteuer im Schloss des schwarzen Grafen.
DIE PROBESTÜCKE DES MEISTERDIEBES ...
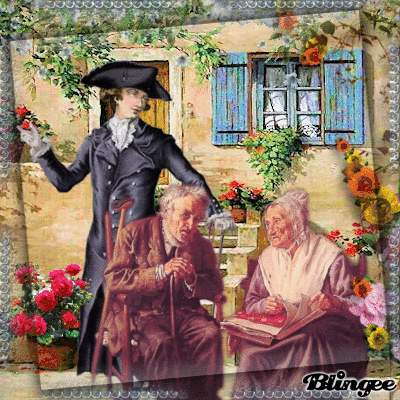
In einem Dorfe lebte einst ein armes altes Ehepaar in einem kleinen Häuschen. Die beiden Alten waren brav und fleißig, aber sie waren mutterseelenallein. Ihr einziger Sohn war ein ungezogener Bursche gewesen. Heimlich machte er sich auf und davon, und er hatte auch sein Lebtag nichts wieder von sich hören und sehen lassen. Die beiden Alten glaubten nun, dass ihr Sohn schon lange tot und bei Gott gut aufgehoben sei.
An einem Feiertag saßen die beiden Alten vor ihrer Haustür. Da fuhr ein stattlicher Wagen zum Dorfe herein, gezogen von sechs schönen Rössern. Darin saß nur ein einzelner Herr, doch stand ein Diener auf, dessen Rock vor Gold und Silber strotzte.
Der Wagen fuhr durch das ganze Dorf, und die Bäuerlein meinten, es fahre ein Herzog oder gar ein König vorbei. Denn solch eine Pracht konnte selbst der Edelmann nicht aufwenden, der droben im alten Schlosse wohnte.
Da hielt der Wagen mit einem Male vor dem letzten Häuslein an. Der Bediente sprang vom Bocke und öffnete dem feinen Herrn den Schlag. Der stieg aus und eilte geradewegs auf die beiden Alten zu, die sich ganz bestürzt von ihrem Bänkchen erhoben.
Der Herr bot ihnen freundlich guten Tag und fragte, ob er mit ihnen nicht Kartoffelklöße essen könne? Darüber verwunderte sich am meisten das Mütterlein. Aber der junge, hübsche und vornehm gekleidete Herr stillte als bald ihr Staunen.
Er sagte, dass ihm noch kein Koch diese Klöße habe recht machen können. Er wolle sie einmal von Landleuten zubereitet wissen, so wie in seiner Jugend. Da luden die Alten ihn freundlich in ihre Hütte ein.
Der junge Herr ließ den Wagen mit Kutscher und Diener einstweilen zum Wirtshaus fahren. Und das Mütterlein holte eilends Kartoffeln aus dem kleinen Keller. Die schälte, rieb und presste sie, und ließ Wasser im Topfe sieden. Nun ballte sie Klöße, zusammen mit etwas Schmalz, und ließ sie im Wasser ziehen.
Zu der Zeit, als die Alte das Mahl bereitete, war ihr Mann mit dem Fremdling ins Hausgärtchen gegangen. Der Alte wollte nach den jungen Bäumen schauen, die er kurz zuvor gepflanzt hatte. Die Haltepfähle, an welche die Stämmchen mit Weide gebunden waren, hielten noch fest. Der Wind hatte aber hier und da die Weide losgerissen. Wo dieses geschehen war, da band der Alte das Stämmchen wieder fest.
Da fing der junge Fremde an zu fragen: "Warum bindet Ihr dieses kleine Stämmchen hier dreimal an?" "Nun ja", sprach der Alte, "es ist dreimal krumm geraten. Darum bind ich es an, dass es besser gerade wachse." "Das ist recht, Alter!", sprach der Fremde.
"Aber dort habt Ihr ja einen alten krummen und knorrigen Baum! Warum bindet Ihr den nicht auch an einen Pfahl?" "Hoho", lachte der Alte, "alte Bäume werden nicht wieder gerade, wenn sie erst einmal krumm gewachsen sind. Will man sie gerade haben, muss man sie in der Jugend gut ziehen."
"Habt Ihr denn auch Kinder?", fragte der Fremde weiter. "Oh lieber Gott, Euer Gnaden!", antwortete der alte Mann. "Ich habe einen Jungen gehabt, der war ein arger Nichtsnutz. Wilde und böse Streiche hat er gemacht, und ist mir zuletzt davon gelaufen. Sein Lebtag ist er nicht wiedergekommen. Wer weiß, wo ihn der liebe Gott hingeführt hat, oder war es der Böse?"
"Warum habt Ihr denn euren Sohn nicht bei Zeiten gerade gezogen, wie diese da, eure Bäumchen!", sprach der Fremde betrübt und vorwurfsvoll. "Wenn er nun ein krummer Knorz und Wildling geworden ist, so ist es doch eure Schuld. - Aber wenn er euch nun wieder unter die Augen käme, würdet Ihr ihn überhaupt erkennen?"
"Weiß auch nicht, lieber Herr!", erwiderte der Alte. "Er wird wohl in die Höhe geschossen sein, wenn er noch lebte. Doch hatte er ein Muttermal am Leibe, daran ich ihn wohl kennen könnt´. Doch bis zum Sankt Nimmerleinstag kommt der nicht wieder heim."
Da zog der Fremde seinen Rock aus, und zeigte dem Alten ein Muttermal. Der Alte schlug die Hände über dem Kopf zusammen, und schrie: "Herr Jesus! Du bist ja mein Sohn. - Aber nein, du kommst doch so schrecklich vornehm daher. Bist du denn ein Graf oder gar ein Herzog geworden?"
"Das nicht, Vater", sprach der Sohn leise, "aber etwas Anderes. Ein Spitzbub bin ich geworden, weil ihr mich nicht gerade gezogen habt. Doch lasst es gut sein, ich hab meine Kunst tüchtig studiert und bin nicht etwa ein miserabler Pfuscher, wie es derer viele gibt."
Der alte Mann war ganz stumm vor Schreck und auch vor Freude. Er führte den Sohn zur Mutter, gerade als sie die Klöße fertig hatte. Dann sagten sie ihr alles. Da fiel das Mütterlein ihrem Sohn um den Hals, küsste ihn weinend und sagte: "Dieb hin, Dieb her! Du bist doch mein lieber Sohn, den ich unterm Herzen getragen habe. Und mir hüpft das Herz in der Brust, dass ich dich auf meine alten Tage wiedersehen darf! -
Ach, was wird dein Herr Pate nur sagen, droben auf dem Schloss, der Edelmann?" "Ja", sprach der Vater, als sie nun tapfer die Klöße teilten, "dein Herr Pate wird nichts von dir wissen wollen. Wenn er erfährt, wie es mit dir steht, wird er dich zuletzt am lichten Galgen zappeln lassen." Da sagte der Sohn: "Nun, besuchen will ich ihn aber doch, den Herrn Paten!"
Der Schlossherr war sehr erfreut, sein Patenkind so stattlich wieder vor sich zu sehen. Hatte sich der Edelmann doch in Gnaden erbarmt, das arme Kind zur Taufe zu heben. Die Freude währte aber nicht lange, als der Edelmann erfuhr, was aus seinem Schützling geworden war, nämlich ein ausgelernter Spitzbube.
Da überlegte der Edelmann schon bald, wie er mit guter Art einen so gefährlichen Menschen bei Zeiten los werden könnte. "Wohlan", sprach der Edelmann zu seinem Schützling, "wir wollen sehen, ob du das Deinige ordentlich gelernt hast. Bist du ein großer Dieb geworden, den man mit Ehren laufen lassen kann, oder nur ein kleiner, den man an den erstbesten Galgen henkt? Letzteres werde ich in meinem Gerichtsbezirk mit dir sicher tun, wenn du nicht die drei Proben bestehst, die ich dir auferlegen werde!"
"Nur her damit, gestrenger Herr Pate! Ich fürchte mich vor keiner Arbeit." Der Edelmann überlegte eine kleine Weile und sprach: "Höre an! Dieses sind die drei Proben:
Als erstes stiehl mir mein Lieblingspferd aus dem Stalle. Ich werde alles gut von Stallburschen und Soldaten bewachen lassen, die jeden totschlagen, der sich dem Stalle nähert.
Als zweites stiehl mir das Bettuch unterm Leibe weg, wenn ich mit meiner Frau im Bette liege. Und zieh auch meiner Frau den Trauring vom Finger. Doch wisse, dass ich geladene Pistolen zur Hand haben werde.
Als drittes und letztes kommt das schwerste Stück: Stiehl mir Pfarrer und Schulmeister aus der Kirche. Steck sie beide in einem Sack und hänge sie lebend in meinen Schornstein. Tor und Türen sollen dir dazu im Schlosse offen stehen."
Der Meisterdieb bedankte sich freundlich bei seinem Herrn Paten, dass er so leichte Stücklein aufgegeben hatte, und ging seiner Wege. Der Edelmann aber traf alle Anstalten, sein Lieblingsross gut zu bewachen.
Sein erster Reitknecht musste sich darauf setzen, ein anderer Diener musste das Zaumzeug fassen, und ein dritter den Schwanz. Damit nicht genug ordnete der Herr eine Soldatenwache vor der Türe an.
Die wachten und wachten nun, bis sie froren und fluchten. Denn es war kalt, und alle waren durstig. Da zeigte sich ein altes müdes Mütterlein. Sie trug ein Fässlein auf einem Korb, hüstelte schwer und keuchte mühsam zum Schlosshof hinein.
Das Fässlein aber weckte wohlige Gedanken bei den Soldaten, sollte es vielleicht ein schöner Branntwein sein? Und war der Branntwein nicht eine gute Medizin gegen Nachtfrost und den bösen Nebel?
Kurz entschlossen riefen die Soldaten das alte Mütterlein zum Feuer, auf dass sie sich gut wärme. Nun forschten sie mit Fragen nach, was denn da wohl im Fässlein sei. Und richtig, ein zünftiger Branntwein war darin, noch dazu veredelt. Auch ein Hähnlein war am Fässlein angebracht, was den Ausschank sehr erleichterte.
Da kauften die Soldaten ein Becherlein ums andere, und sie sagten es auch den Wächtern im Stalle. Da hatte das alte Frauchen gar alle Hände voll zu tun, und das Fässlein leerte sich schnelle.
Noch wusste keiner, dass die Alte in Wahrheit der verkleidete Meisterdieb war, und dass er den Branntwein mit einen barbarischen Schlaftrunk gemischt hatte. Es währte also nicht lange, da fiel ein Soldat nach dem anderen in tiefen Schlaf. Dann fielen auch den Wächtern im Stalle die Augen zu.
Darauf hatte der Meisterdieb nur gewartet. Er stand schon bei dem Pferd im Stall, als der Reitknecht gerade herab glitt. Der Meisterdieb fing ihn auf, setzte ihn auf einen Holzbock und band ihn fest. Sollte der arme betrunkene Mensch doch nicht gleich zu Boden fallen und womöglich Schaden erleiden.
Dem Kutscher aber, der das Zaumzeug hielt, und in der Ecke schnarchte, lieh der Dieb einen Strick für die Hand. Und der Stallknecht bekam statt Rossschweif ein dickes Strohseil in die Hand gedrückt. Dann nahm der Dieb eine Pferdedecke, schnitt sie in Stücke, wickelte sie um des Rosses Füße und schwang sich in den Sattel. Und hast du nicht gesehen, war der Dieb schon zum Stall hinaus.
Als es heller Tag war, schaute der Edelmann zum Fenster hinaus. Ein stattlicher Reiter kam geschwind daher. Das Ross, auf dem er saß, war nicht minder stattlich und schien dem Edelmann wohl bekannt. Der Reiter hielt an und rief: "Guten Morgen, Herr Pate! Euer Pferd ist Goldes wert!" "Ei, dass dich der Teufel hole!", rief der Edelmann. "Du bist ein arger Pferdedieb! Nur zu, nur zu, lass mich deine Kunst weiter sehen!"
Der Edelmann nahm seine Reitpeitsche und ging voller Zorn zum Stalle. Als er da die wunderlichen Gestalten der schlaftrunkenen Wächter sah, musste er laut lachen. Insgeheim dachte er aber: "Wenn der Gauner diese Nacht kommt, mir das Bettuch zu stehlen, will ich ihm eine Kugel verpassen. Denn solch einen gefährlichen Kerl möchte ich nicht in meiner Nähe wissen."
Da es nun Nacht war, legte sich der Edelmann mit seiner Frau zu Bette. Neben sich tat er eine geladene Pistole und noch andere Waffen. Dann stellte er sich schlafend und horchte, ob sich nichts rege. Lange blieb alles still, doch endlich schien es ihm, als würde eine Leiter an die Außenmauer gestellt.
Bald darauf trat draußen am Fenster die Gestalt eines Menschen hervor. "Erschrick nicht, Frau!", warnte der Edelmann. Er nahm die Pistole zur Hand, drückte ab, und schoss den Räuber von der Leiter. "Der steht nicht wieder auf", sprach der Edelmann, "doch möchte' ich Aufsehen vermeiden. Ich will geschwind die Leiter hinabsteigen, und ihn in der alten Grube bei Seite schaffen."
Das war der Edelfrau ganz recht, und ihr Mann tat, wie er gesagt. Bald darauf kam er wieder die Leiter hinauf und sprach: "Der Räuber ist wirklich mausetot. Ich will den armen Teufel aber noch in ein Laken hüllen, bevor ich ihn in die Grube werfe. Und da er um deines Ringes willen sein Leben gelassen hat, so wollen wir ihm diesen anstecken. Gib mir also den Ring und auch das Bettuch."
Die Frau gehorchte, und ihr vermeintlicher Mann stieg wieder eilends hinab.
In der dunklen Nacht hatte der wahre Edelmann aber nicht erkannt, wer da gestorben war. Der Meisterdieb hatte just einen frisch Gehenkten vom Galgen abgeschnitten und sich auf die Schulter
geladen.
So stieg er die Leiter bis zum Fenster empor. Kaum war der Schuss gefallen, warf er die Leiche flink herab und stieg rasch von der Leiter. Nun kam auch der Edelmann herunter, um die Leiche fort zu schaffen. Da schlich sich der Dieb wieder zur Kammer hinauf, machte den Edelmann nach und forderte Ring und Bettuch von der Frau.
Am anderen Morgen sah der Edelmann wieder zum Fenster hinaus. Ein Mann ging unten auf und ab. Ein großes weißes Bündel hing über seine Schulter, und er ließ einen schönen Ring in der Morgensonne blitzen. Mit einem Male rief der Mann hinauf: "Schönsten guten Morgen, Herr Pate! Ich wünsche Ihnen und der Frau Patin recht wohl geruht zu haben!"
Der Edelmann war wie vom Donner gerührt, als er den Meisterdieb leibhaftig vor sich stehen sah. Hastig fragte er seine Frau nach Ring und Tuch. "Nun, du hast es mir doch diese Nacht abverlangt!," erwiderte sie. "Der Satansbraten! Aber nicht mit mir!", tobte der Edelmann. Er ballte dem Patenkind eine Faust zum Fenster hinaus und rief: "Erzgauner! Jetzt das Dritte! Das bringt dich sicherlich an den Galgen!"
In der folgenden Nacht begab sich nun etwas Seltsames auf dem Gottesacker. Der Schulmeister, der in der Nähe wohnte, merkte es zuerst und meldete es dem Herrn Pfarrer. Über den Gräbern wandelten kleine brennende Lichtlein gar unruhig umher. "Das sind die armen Seelen, Schulmeister", flüsterte der Pfarrer mit Grausen.
Und plötzlich erschien eine große schwarze Gestalt auf den Stufen der Kirche, die mit hohlem Tone rief: "Kommt alle zu mir, kommt alle zu mir, der Jüngste Tag ist vor der Tür! O Menschenkinder, betet still, die Toten sammeln schon ihre Gebeine. Wer mit mir in den Himmel will, der krieche in diesen Sack hier still!"
"Wollen wir?", fragte der Schulmeister den Pfarrer mit Zähneklappern. "Jetzt ist noch Zeit", antwortete dieser. "Der heilige Apostel Petrus ruft uns, das ist keine Frage." "Aber was ist mit Reisegeld? Ich habe mir doch mühsam zwanzig Kronen gespart", flüsterte das Schulmeisterlein. Darauf der Pfarrer: "Auch ich habe hundert Taler für den Notfall zurückgelegt! Wir holen das Geld und nehmen es besser mit!"
Das taten die beiden denn auch und näherten sich der schwarzen Gestalt mit Furcht und Zittern. Diese war aber in Wahrheit der Meisterdieb. Der hatte Krebse gekauft und ihnen brennende Wachslichter auf den Rücken geklebt. Das waren die armen Seelen auf den Gräbern.
Der Dieb hatte sich auch einen Mönchsbart, eine Mönchskutte und einen großen Hopfensack gekauft, in den er die beiden Schwarzröcke nun steckte. Das Ersparte nahm er ihnen jedoch weg. Jetzt schnürte er den Sack zu, und schleifte ihn hinter sich her.
So ging es durch das ganze Dorf und durch einen seichten Tümpel, wobei er rief: "Hab Acht, jetzt geht es durch das Rote Meer!" Dann schleifte er den Sack durch den Bach und rief: "Jetzt geht es durch den Bach Kidron." Dann weiter über die Schlossgüter, wo es schon ziemlich kühl war. Der Dieb rief nun: "Aufgepasst, jetzt geht es durch das Tal Josaphat."
Dann schleifte er den Sack zur Schlosstreppe hinauf: "Dieses ist schon die Himmelsleiter." Und endlich hängte er den Sack im Schornstein auf einen Haken, daran man die Schinken räuchert. Der Dieb machte auch noch einen ziemlichen Qualm darunter und rief mit schrecklicher Stimme: "Dieses ist das Fegefeuer, welches etliche Jahre dauert." Dann machte er sich von dannen.
Da schrien der Pfarrer und der Schulmeister Zeter und Mordio, bis das ganze Hausgesinde zusammenlief. Der Meisterdieb aber trat keck vor den Edelmann: "Herr Pate, meine dritte Probe habe ich auch bestanden. Pfarrer und Schulmeister hängen im Schornstein, und wenn es euch gefällig ist, könnt Ihr sie selber zappeln und schreien sehen!"
"O du Erzschalk und Erzgauner, du Erzbösewicht und Meister aller Meisterdiebe!", rief da der Edelmann, und gab gleich Befehl, die beiden Schwarzröcke aus dem Fegefeuer zu erlösen.
Dann wandte sich der Edelmann wieder an den Dieb und sprach : "Du hast mich überwunden, hebe dich von dannen! Hier hast du ein Goldstück. Hebe dich von dannen, und komme mir nicht wieder vor Augen. Lass dich doch irgendwo henken, wo es dir gefällig ist."
"Allerliebsten Dank, gestrenger Herr Pate, so will ich es tun", antwortete der Spitzbub, "aber wollt Ihr nicht den Pfand auslösen, den ich redlich von euch erworben habe? Euer Lieblingsross samt all dem Sattelzeug, eurer Gemahlin Trauring und das Tuch mit den 100 Talern vom Herrn Pfarrer und mit des Schulmeisters Geld! Wenn nicht, so fahr ich damit von dannen."
Da traf den Edelmann fast der Schlag, und er sprach: "Liebes Patenkind, das war ja alles nur ein Spaß. Du wirst diese Güter nicht bei dir behalten wollen, schenke ich dir doch das Leben." "Nun so will ich gehen und alles holen", sprach der Meisterdieb, ging und ließ seinen Wagen anspannen.
Dann ließ er seinen alten Vater und seine Mutter einsteigen, setzte sich selbst auf des Edelmanns Ross und steckte den prächtigen Ring an den Finger. Dem Edelmann schickte er aber das Bettuch mit einem Brieflein, darin stand: "Gebt dem Pfarrer und dem Schulmeister ihr Geld zurück, sonst stiehlt es euch eure Frau. Hochachtungsvoll, der Meisterdieb."
Da bekam der Edelmann große Furcht, trug den Schaden mit Fassung und wollte fortan nichts mehr von seinem Patenkind wissen. Auch erfuhr er nichts mehr von ihm, denn der war mit seinen Eltern in ein fernes Land gezogen und ein ehrlicher und angesehener Mann geworden.
DIE ROSENKÖNIGIN ...
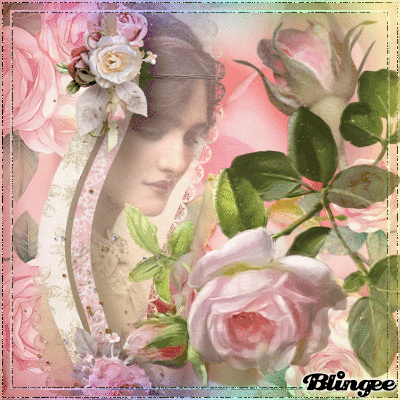
Es war einmal ein König, der war sehr glücklich mit seiner schönen und gutmütigen Gemahlin. Ein einziger Sohn war ihnen vom Himmel geschenkt, und dieser war die ganze Freude der Eltern.
So herrschte in des Königs Familie Friede, aber auch im ganzen Lande. Überall, selbst in den kleinsten Dörfern, war guter Verdienst und Wohlstand, und das Volk zeigte sich zufrieden und freundlich.
Der gute König hatte jedoch ein hartes Schicksal. Seine liebe Gemahlin starb und ließ ihn mit dem Prinzen einsam zurück. Der König trauerte tief und lange, und das ganze Land mit ihm. Auch das kleine fromme Herz des Prinzen war sehr betrübt, denn es hatte mit großer Liebe an der Mutter gehangen.
Noch auf dem Sterbebett hatte sie ihm gesagt: "Wenn du ein Jüngling geworden bist, dann wähle nur ein frommes Mädchen mit gutem Herzen zur Gemahlin. Ehre das Andenken deiner Mutter und erinnere dich bei Zeiten an ihre letzten Worte."
Das hatte tiefen Eindruck auf den Knaben gemacht, und oft kam es dem Prinzen so vor, als schwebe die Mutter im Geiste noch über ihm und lächle ihm zu. So wuchs der Prinz in frommer Sitte heran und wurde ein schöner, blühender Jüngling.
Die Zeit verging und eine listige Frau von hohem Adel verblendete dem König immer mehr die Augen. Mit ihren Reizen wusste die Fürstin den König schlau zu fesseln, bis sie ihn völlig beherrschte. Und schon bald fand ein glänzendes Hochzeitsgelage statt.
Der alte König, sonst so gut und milde, ließ sich immer mehr zum Narren machen und war nun an ein listiges, böses Schlangenherz gekettet. Diese Torheit sollte ihm noch teuer zu stehen kommen, denn das böse Weib stiftete überall Unheil, hetzte den Vater gegen den Sohn, den Sohn gegen den Vater und die Herrschaft gegen die Diener. Auch war ihre Verblendungskunst so groß, dass sie viele Herzen von alten und jungen Männern für sich entflammte.
Der alte König erging sich bald in Reue, doch sein Lebensende kündigte sich schon an. Als der König dann starb, wurde der Prinz zum neuen König ausgerufen. Und er herrschte mit Klugheit und Milde, was sehr zum Wohle des Landes war. Die listige Stiefmutter konnte ihm dabei nichts anhaben, denn der junge König verachtete sie und suchte sich immer in heilsamer Entfernung von ihr zu halten.
Da wünschte das ganze Land, der jugendliche König möge sich nun endlich vermählen. Dem König war es recht, sein Glück fortan mit einer würdigen Gemahlin zu teilen. Aber nicht Stand und Reichtum oder gar eine Krone sollten das Maß der Dinge sein, sondern ein gutes und frommes Herz, wie es die Mutter einst auf dem Sterbebett gewünscht hatte.
Der junge König fand auch heimlich, was er suchte. Sie war zwar nur eine arme Gärtnertochter, aber ihr Herz war voll von reiner Liebe und frommem Glauben. Diese Jungfrau war dem König bald so inniglich befreundet, dass der Jüngling ihr ewige Liebe und Treue schwur.
Zärtlich und in Tränen schmiegte sich das liebliche Mädchen an seine Brust und sagte leise: "Ach, du darfst mich ja doch nicht zur Gemahlin nehmen. Siehe, ich bin arm und von niederer Geburt." "Halte ein, mein Herz", rief der Jüngling, "nur du sollst meine Gemahlin, meine Königin werden, du und keine andere."
Der Wunsch nach des Königs Vermählung wurde im Lande immer lauter und dringender, denn der Jüngling hatte seine Liebe zur Gärtnertochter bisher geheim gehalten. Von allen Seiten begannen die fürstlichen Väter dem König Heiratsvorschläge zu machen. Und die böse Stiefmutter glaubte sogar, es sei ihre Aufgabe, die passende Gemahlin zu wählen. Sie ordnete große Festlichkeiten an, und es kamen viele Prinzessinnen, die reich geschmückt und voller Hoffnung waren.
Acht Tage hatten die Festlichkeiten bereits gedauert, doch der König hatte keine Prinzessin zur Braut erwählt. Da half auch kein Bitten und Drängen durch die Stiefmutter. Am neunten und letzten Festtage sollte aber die Entscheidung fallen, wie es der junge König selbst verkündet hatte.
Die Stiefmutter glaubte jetzt voll Zuversicht, dass der König doch noch gehorchen würde, denn sie hatte eine hohe Prinzessin auserwählt, die unsäglich reich an Gut und Geld war. Was kümmerte es da, dass die Prinzessin ziemlich hässlich war und ein wenig auf den Kopf gefallen schien?
Ein glänzender Ball sollte jedenfalls die Festlichkeiten beschließen, und dieses Mal waren alle Prinzessinnen doppelt mit Schmuck und Juwelen beladen. Die Prinzessinnen standen aufgeregt im Saale und jede glaubte, den Sieg davonzutragen. Da tat sich eine Flügeltüre auf, und der König trat lächelnd mit seinem lieblichen Gärtnermädchen herein. Sie hatte nur ein weißen Kleid auf dem Leibe und war völlig ohne Schmuck.
Im Kreise der Prinzessinnen sprühten die Augen voll Ärger und Wut. Und die Stiefmutter schleuderte dem Liebespaar grimmige Blicke zu, als wolle sie das Glück mit ihren Augen erdolchen. Als das Brautpaar dann die in der Mitte des Saales stand, von boshaft lächelnden Prinzessinnen umgeben, sprach der König mild und freundlich:
"Hohe, verehrte Stiefmutter, hier bringe ich euch meine liebe, fromme Braut und bitte mit ihr um euren Segen." Die Stiefmutter aber zischte in kochender Wut: " Herr König, denkt an eure Ehre! Wollt ihr wirklich eine arme Dirne von niederer Geburt ehelichen? - Oh, ihr solltet euch schämen, mich so tief zu kränken und meinen Segen für eine schlechte Magd zu erbitten."
Der König blieb stumm, worauf sich die Stiefmutter tief gekränkt abwandte und den Saal verließ. Doch der König folgte ihr nach und sprach mit drohendem Ernst: "Törichtes Weib, deine Worte waren mit Bosheit gespickt. Ich will euch zeigen, dass dieses arme Mädchen würdiger ist, Königin zu sein, als ihr selbst und die eitlen Prinzessinnen."
Der junge König hatte Mühe, sich zu beherrschen und atmete tief durch. Dann sagte er: "Ich habe einst eine Kunst von einem alten Mann erlernt. Ich kann Menschen verzaubern, um ihre Herzen zu prüfen, ob sie gut oder böse sind. Ich werde hier im Saale alle anwesenden Jungfrauen in die Gestalt von Blumen verzaubern. Und ihr, Stiefmutter, sollt mir sagen, welche Blume die schönste ist. Ist es eine von den Prinzessinnen, so will ich euch gehorsam sein.
Fällt eure Wahl aber auf mein armes Gärtnermädchen, wird der Zauber euch auf ewig verstricken." Der König schwieg, und die stolze Dame grinste voll Zuversicht. Sie ließ sich auf einem feinen Sessel nieder und harrte der Dinge, die da kommen sollten.
Der junge König breitete ein großes weißes Tuch aus, führte schweigend eine Prinzessin um die andere in das Gemach und schließlich auch das Gärtnermädchen. Als alle beisammen waren verhüllte er die Jungfrauen mit dem Tuch, wo sie bald einschlummerten. Dann schnitt der Könige den Jungfrauen das Herz heraus, zuletzt auch seinem geliebten Gärtnermädchen.
Der Ballsaal verwandelte sich nun in eine grünende Gartenflur, von einem goldenen Zaun umschlossen und von singenden Vögeln durchflattert. Dort vergrub der Jüngling die Herzen nacheinander und sprach bei jedem:
"Blühe, blühe, blühe,
aus der Erde auf!
Bist du rein,
wirst du hold gedeihn.
Doch treibe wilde Dornen,
wenn du böse wirst sein."
Bald keimten Zweiglein und Blättlein empor. Es wuchsen wilde Dornensträucher rasch aus der Erde, und nur hier und da zeigte sich eine farbige Blüte. Aber in der Mitte des Gartens stand ein Blütenstängel, gekrönt von herrlichen Rosenblüten. Glänzender Tau lag auf den Blättern, und das grüne Laub schmiegte sich zärtlich an die Blüten. Jetzt kam eine Schar Nachtigallen geflogen. Sie umkreisten den Rosenstrauch und sangen:
"Holde Rose, holde Rose,
hehre Blumenkönigin!
Du die Schönste unter allen,
du die Reinste unter allen,
sollst die ganze Welt bezwingen,
mit der frommen Liebe Sinn.
Lob dir, du holde Rosenkönigin!"
Um die Dornensträucher flogen aber schwarze Raben und krächzten:
"Wilde Dornen, wilde Dornen,
schwarz wie unser Nachtgewand.
Sollt am besten uns gefallen,
mit den tausendfachen Krallen.
Sollet dienen in der Höllen,
in der ewgen Pein, zum Brand.
Schwarze Dornen, Nachtgewand."
Da führte der König die Stiefmutter aus dem Nebengemach herein, auf dass sie im Garten die schönste der Blüten für ihn wähle. Die Stiefmutter sah die zauberhafte Rose und hörte die Nachtigallen singen. Ihr war, als fühlte sie eine warme Liebe, und es überkam sie tiefe Reue im Gedanken an ihre Bosheiten und Verführungskünste.
Und als sie nun die Dornensträucher sah und die schwarzen Raben ein Hohnlied krächzten, da überlief sie Angst und Todesgrauen. Sie sprach: "Mein Königssohn, ich muss die holde Rose wählen. Sie ist wahrlich die Schönste." Kaum hatte sie das gesagt, verschmolzen Zweige, Blätter und Blüten der Rose zum Körper eines lieblichen Mädchens. Es war das fromme Gärtnermädchen. Und sie schien jetzt noch schöner und bescheidener als zuvor.
Aus den anderen Blumen und Dornensträuchern bildeten sich wieder Prinzessinnen, die wie aus einem schweren Traum erwachten. Die Stiefmutter des Königs war vor Scham und Reue aber nieder gesunken und verwandelte sich in einen Stein, umgeben von blühenden Dornenrosen.
Die Prinzessinnen eilten nun scheu und erschreckt davon, aber mit einem Funken Demut in ihren Herzen. Und der König lebte fortan glücklich und fromm mit seiner Gemahlin, der Rosenkönigin, und der Segen des Himmels war mit ihnen.
DER HASENHÜTER UND DIE KÖNIGSTOCHTER ...
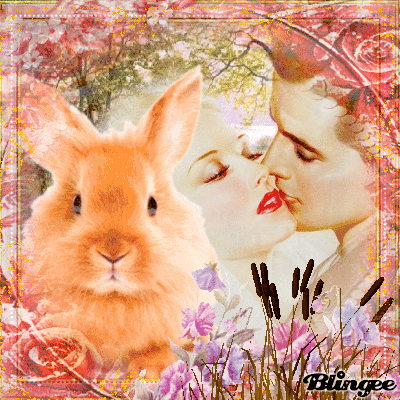
Ein reicher König hatte eine sehr schöne Tochter. Als diese sich verheiraten wollte, mussten sich alle Bewerber auf einer großen grünen Wiese versammeln. Dort warf sie nun einen goldenen Apfel mehrmals in die Luft. Wer ihn auffing und sich traute, drei Aufgaben zu lösen, die sie selbst aufgab, der sollte sie zur Gemahlin haben.
Da hatten nun viele den Apfel aufgefangen, zuletzt auch ein schöner munterer Schäferbursche. Aber keiner von allen war im Stande, die drei Aufgaben zu lösen. Da kam nun die Reihe an den Schäferburschen, also an den letzten und geringsten unter den Bewerbern.
Die erste Aufgabe war die: Der König hatte in einem Stall hundert Hasen. Wer sie auf die Weide trieb, hütete und am Abend wieder alle zurück brachte, der hatte die erste Aufgabe vollbracht. Als der Schäferbursche das vernahm, sprach er, er wolle sich erst noch einen Tag darüber besinnen. Am anderen Tag werde er aber ganz gewiss bestimmen, ob er sich traue, die Sache zu unternehmen oder nicht.
Nun lief aber der Schäferbursche auf den Bergen umher und war traurig, denn er scheute sich vor dem gewagten Unternehmen. Da begegnete ihm ein altes Mütterchen und fragte ihn nach der Ursache seiner Traurigkeit. Er aber sagte: "Ach, mir kann niemand helfen."
Da sprach das graue Mütterchen: "Urteile nicht so vorlaut. Sage lieber dein Anliegen, vielleicht kann ich dir ja helfen." Also erzählte der Schäferbursche von seiner Aufgabe. Da gab ihm das Mütterchen ein Pfeifchen und sagte: "Hebe es wohl auf, es wird dir nützen!" Und ehe noch der Bursche sich bedankt hatte, war das Mütterchen verschwunden.
Nun ging er fröhlich hin zum König und sprach: "Ich will die Hasen hüten!" Und da wurden sie aus dem Stall heraus gelassen. Als aber der letzte heraus war, sah man den ersten nicht mehr, denn der war schon über alle Berge.
Der Bursche aber ging hinaus aufs Feld und setzte sich auf einen grünen Hügel und dachte: "Was fang ich an?" Da fiel ihm sein Pfeifchen ein. Er tat es schnell heraus und pfiff. Da kamen die hundert Hasen alle wieder gesprungen und weideten lustig um ihn herum am grünen Hügel.
Dem König und der schönen Prinzessin aber war nicht daran gelegen, dass der Schäfer die Aufgabe zu Ende brachte, war er doch ein armer Schlucker und auch nicht hochgeboren. Also sannen sie auf Listen, damit der Hasenhüter seine Herde nicht vollzählig heimbringe.
Die Königstochter kam verkleidet und mit verändertem Gesicht daher, sollte der Schäferbursche sie doch nicht erkennen. Aber er erkannte sie doch. Als sie nun die Hasen alle erblickte, fragte sie: "Kann man hier nicht einen von den Hasen kaufen?"
Da sagte der Bursche: "Zu verkaufen gibt es keinen, aber zu verdienen!" Da fragte sie weiter: "Wie ist das zu verstehen?" Der Bursche sprach: "Wenn ihr mich mit Küssen überhäuft und eine süße Schäferstunde mit mir haltet!" Das aber war ihr gar nicht recht.
Da sie dann aber doch gern einen Hasen haben wollte, und er keinen hergab, sagte sie nach langem Zögern endlich zu. Als der Bursche sie nun geherzt und geküsst hatte, fing er ihr einen Hasen und steckte ihn in ihr Handkörbchen. Dann ging die verkleidete Prinzessin fort.
Sie war wohl eine Viertelstunde weit gegangen, da pfiff der Schäferbursche auf seinem Pfeifchen. Geschwind drückte der Hase den Deckel vom Körbchen auf, sprang heraus und kam wieder gesprungen.
Es dauerte gar nicht lange, da kam der alte König auf einem Esel geritten, der links und rechts einen Korb hängen hatte. Auch der König hatte sich vermummt, aber der Bursche kannte ihn doch. Der König fragte: "Wird hier kein Hase verkauft?"
"Nein, verkauft nicht, aber verdient kann er werden!", antwortete ihm der Bursche dreist. "Wie ist das zu verstehen?", fragte der König. "Wenn ihr den Esel hier unter den Schwanz küsst", begann der Bursche, "sollt ihr einen haben!" Das wollte der König aber nicht tun und bot ihm schweres Geld für den Hasen. Der Bursche aber tat es nicht.
Da nun der König sah, dass er keinen Hasen kaufen konnte, fügte er sich endlich und gab dem Esel einen tüchtigen Schmatz unter den Schwanz. Dann wurde ein Hase gefangen, in einen Korb am Esel gesteckt, und der König zog fort. Er war aber noch nicht weit, da pfiff der Bursche, und der Hase hüpfte aus dem Korb heraus und kam zurück.
Darauf kam der König nach Hause und sagte: "Er ist ein loser Bursche, ich konnte keinen Hasen bekommen!" Was der Bursche getan hatte, sagte er aber nicht. "Ja!", erwiderte die Prinzessin. "Auch mir ist es so ergangen!" Was sie aber getrieben hatte, gestand sie nicht ein.
Als es Abend war, kam der Bursche mit seinen Hasen und zählte sie dem König vor, alle hundert zum Stall hinein. "Nun", begann der König, "die erste Aufgabe ist gelöst und nun geht es an die zweite! Merke auf! Hundert Maß Erbsen und hundert Maß Linsen liegen auf meinem Boden. Diese sind zusammengeschüttet und wohl durchmengt. Wenn du diese in einer Nacht ohne Licht auseinander bringst, dann hast du die zweite Aufgabe vollbracht."
Der Bursche sprach: "Ich kann es!" Und da wurde er auf den Boden gesperrt und die Türe fest verschlossen. Als es im Schloss dann ruhig war, pfiff der Bursche auf seinem Pfeifchen. Da kamen viele tausend Ameisen gekrochen und wimmelten und krabbelten so lange, bis die Erbsen wieder auf einem besonderen Haufen waren, und die Linsen auch.
Als nun der König in der Frühe nach sah, war die Aufgabe gelöst. Die Ameisen aber sah er nicht, die waren wieder fort. Der König wunderte sich und wusste nicht, wie es der Bursche machte. Darauf sprach er: "Ich will dir nun auch die dritte Aufgabe sagen. Wenn du dich in der kommenden Nacht durch eine große Kammer voll mit Brot isst, dass nichts übrig bleibt, dann hast du die dritte Aufgabe vollbracht. Und dann sollst du meine Tochter haben!"
Als es nun dunkel war, wurde der Bursche in eine Brotkammer gesteckt, die so voll war, dass bei der Türe nur ein kleines Plätzchen für ihn blieb. Als es aber im Schloss wieder ruhig war, pfiff der Bursche auf seinem Pfeifchen. Da kamen so viele Mäuse daher, dass es ihm schier unheimlich wurde. Und als der Tag erwachte, war das Brot ganz aufgefressen.
Der Bursche polterte an der Türe und schrie: "Macht auf! Ich habe Hunger!" Da war nun auch die dritte Aufgabe vollbracht. Der König aber sagte: "Erzähle uns zum Spaß noch einen Sack voll Lügen, dann sollst du meine Tochter haben!"
Da fing der Bursche an und erzählte schreckliche Lügen, einen halben Tag lang. Aber der Sack wollte nicht voll werden. Da sagte der Bursche endlich: "Ich habe mit der allerliebsten Prinzessin, meiner Braut, auch schon ein Schäferstündchen gehalten!"
Bei diesen Worten wurde sie feuerrot. Der König sah sie an und erkannte sofort, dass es keine Lüge war. Vielmehr fragte er sich schon, wie und wo es geschehen konnte. "Der Sack ist aber noch nicht voll!", rief der König empört.
Da begann der Bursche listig: "Der Herr König hat auch den Esel ..." "Er ist voll, er ist voll! Knotet den Sack schon zu!", rief der König. Denn er schämte sich und wollte vor der Versammlung verheimlichen, welche Ehre der Esel durch seinen königlichen Mund erfahren hatte.
Dann wurde die Hochzeit des Schäferburschen mit der Königstochter gefeiert. Vierzehn Tage lang ging es so hoch her und so lustig zu, dass jeder sich wünscht als Gast mit dabei gewesen zu sein.
DAS TRÄNENKRÜGLEIN ...
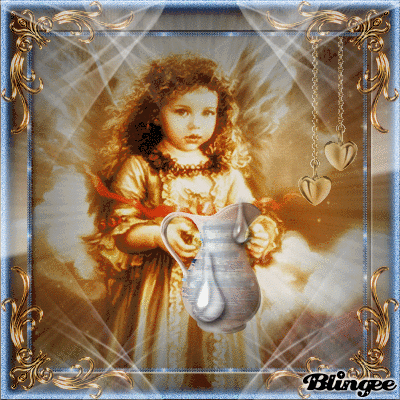
Es waren einmal eine Mutter und ein Kind, und die Mutter hatte das Kind, ihr einziges, lieb von ganzem Herzen und konnte ohne das Kind nicht leben und nicht sein. Aber da sandte der Herr eine große Krankheit, die wütete unter den Kindern und erfasste auch jenes Kind, dass es auf sein Lager sank und zum Tod erkrankte.
Drei Tage und drei Nächte wachte, weinte und betete die Mutter, die nun allein war auf der ganzen Gottes Erde, ein gewaltiger und namenloser Schmerz, und sie aß nicht und trank nicht und weinte, weinte wieder drei Tage lang und drei Nächte lang ohne Aufhören und rief nach ihrem Kinde.
Wie sie nun so vollen tiefen Leides in der dritten Nacht saß, an der Stelle, wo ihr Kind gestorben war, Tränen müde und Schmerzensmatt bis zur Ohnmacht, da ging leise die Türe auf, und die Mutter schrak zusammen, denn vor ihr stand ihr gestorbenes Kind.
Das war ein seliges Engelein geworden und lächelte süß wie die Unschuld und schön wie in Verklärung. Es trug aber in seinen Händchen ein Krüglein, das war schier übervoll. Und das Kind sprach: "O lieb Mütterlein, weine nicht mehr um mich!
Siehe, in diesem Krüglein sind deine Tränen, die du um mich vergossen hast; der Engel der Trauer hat sie in diesem Gefäß gesammelt. Wenn du noch eine Träne um mich weinst, so wird das Krüglein überfließen, und ich werde dann keine Ruhe haben im Grabe und keine Seligkeit im Himmel.
Darum, o lieb Mütterlein, weine nicht mehr um dein Kind, denn dein Kind ist wohl aufgehoben, ist glücklich, und Engel sind seine Gespielen." Damit verschwand das tote Kind und die Mutter weinte hinfort keine Träne mehr, um des Kindes Grabesruhe und Himmelsfrieden nicht zu stören.
DAS WINZIGE, WINZIGE MÄNNLEIN ...
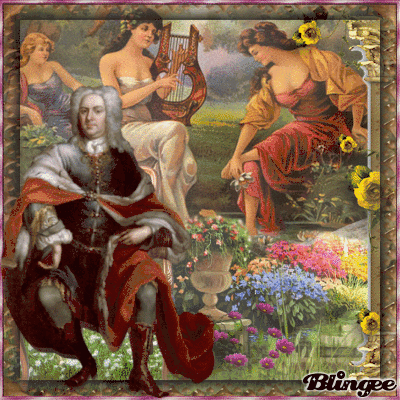
Es waren einmal drei lustige Gesellen, ein Schmied, ein Schneider und ein Jäger, die waren gute Freunde zueinander, kamen öfters zusammen und besprachen sich, miteinander in die Fremde zu gehen, weil es ihnen in der Heimat nicht mehr so recht gefallen wollte.
Wie sie nun ihren Entschluss ausführten und wanderten, führte sie ihr Weg in einen tiefen Wald, aber heraus führte er sie nicht; sie verirrten sich und liefen im Walde umher, bis die Nacht einbrach und sie weder Weg noch Steg sehen konnten.
Endlich stieg der Schmied auf einen Baum und erblickte in einiger Entfernung ein Licht, merkte sich die Richtung, stieg vom Baum herab und ging nun mit seinen Gefährten auf das Licht zu. Sie kamen alle drei an ein Haus, welches offen stand, aber leer war, wenigstens ließ sich niemand blicken, aber das Licht stand darin und schien.
"Wer hier wohnt, wird es uns nicht so sehr übel nehmen, wenn wir hier die Nacht verbringen, wir können nun einmal doch nicht weiter!" sprachen die drei einer zum anderen und legten sich nieder, wo sich just für jeden ein geeignetes Plätzchen fand. Ohne alle Störung schliefen die drei Gesellen die ganze Nacht und erwachten, als der Morgen da war, fröhlich und wohlgemut.
"Es ist hübsch in diesem Häuschen", sprach der Schmied. "Ich dächte, wir verließen es nicht so schnell, damit wir dem Bewohner danken für die Gastfreundschaft, die wir uns angeeignet." "Vielleicht kann ich ihm etwas flicken", meinte der Schneider. "Ich bin auch nicht dagegen, hier zu rasten", sprach der Jäger, "aber wenn wir das wollen, so müssen wir nun etwas zu essen haben, denn hier scheint Schmalhans Küchenmeister zu sein. Ich schlage daher vor, einer von uns bleibt hier und zwei gehen in den Wald und fangen oder schießen etwas, damit wir zu leben haben."
"Der Rat ist richtig", sagte der Schmied. "Draußen springt ein Quellbrunnen; der daheim bleibt, macht in des ein Feuerlein an und setzt Wasser bei, dass wir uns hernach eine gute Suppe kochen können."
Der Schmied und der Jäger gingen, und der Schneider blieb im Häuschen, entzündete ein Feuer, setzte Wasser bei und sich daneben. Da erschien mit einem Male ein winzig, winzig kleines Männchen und
sagte:
"Schneider, Schneider, Schneiderlein,
Ich blas dir aus dein Feuerlein."
"Ja, untersteh dich!" rief der Schneider voller Mut, weil das Männlein so winzig war, aber das machte - ft! - und da war das Feuer aus und das Männlein verschwunden.
Bald kamen der Jäger und der Schmied und brachten ein Stück Wild und gute Wurzeln, der Schneider erzählte, was ihm begegnet sei, und nun mussten sie von neuem Feuer anzünden und Wasser beisetzen.
Als das Wild verzehrt war, gingen der Schmied und der Schneider in den Wald, und der Jäger hütete das Haus und machte ein schönes Feuer an, setzte Wasser bei und sich dazu. Da kam abermals das
winzige, winzige Männchen, und wisperte:
"Jäger, Jäger, Jägerlein!
Ich lösch dir aus dein Feuerlein."
"Probier es nur! Ich drehe dir den Hals um!" rief der Jäger, aber - ft! - und das Feuer erlosch, und das Männlein verschwand.
Wie die Kameraden kamen, hatten sie kein Wild und kein Feuer; zwar rühmte sich der Schneider, dem der Jäger sein Gewehr geliehen, er habe bald einen Bock geschossen, aber nur bald, das Gewehr habe einen Fehler, die Kugel sei links gegangen.
"Nun probiere ich es einmal!" rief der starke Schmied. "Habt acht, ich zahle den Knirps aus." Nun blieb er zu Hause, und der Jäger ging mit dem Schneider auf die Jagd.
Der Schmied saß noch gar nicht lange bei dem Feuer, das er angezündet, nachdem er einen Schraubstock hergerichtet, als das winzige, winzige Männlein zum dritten Male erschien und wisperte:
"Schmied, Schmied, Schmiedelein!
Ich lösch dir aus dein Feuerlein."
Aber anstatt zu antworten, griff der Schmied dem Männlein an den Kragen, schüttelte es tüchtig und klemmte es in dem Schraubstock fest, dass es erbärmlich zappelte und heulte. Das half ihm aber nichts, denn der Schmied bearbeitete es auch noch äußerst handgreiflich, und wie nun der Jäger und der Schneider kamen, so putzte der erstere das winzige Männchen auch noch aus, und der Schneider freute sich und flickte es ebenfalls gehörig durch.
Das Zaubermännchen im Schraubstock tat aber gar erbärmlich und sagte: "Lasst mich los, und gehe einer mit mir! Einen kann und will ich glücklich machen. Schneiderlein, geh du mit mir!" "Männlein, ich geh nicht mit dir!" antwortete der Schneider. "Jäger, so gehe du mit mir!" bat das winzige, winzige Männlein. "Ei, der Kuckuck geh mit dir!" antwortete der Jäger.
"Schmied, Schmied, gehe du mit mir!" bat gar zu kläglich das Männlein. Da sagte der Schmied: "Gut, ich will mit dir gehen, aber denke nicht, dass ich dich loslasse, denn du würdest mich sonst schön führen. Und die anderen zwei müssen ein Stück hinter uns drein gehen." "Meinetwegen, ich bin alles zufrieden!" winselte das winzige, winzige Männlein. "Macht mich nur aus dem Schraubstock los!"
Das tat denn der Schmied, hielt aber das Männlein fest am Kragen, und nun ging es durch eine Türe in der Stube und durch einen Kellergang in ein großes, matt erhelltes Gewölbe. In diesem Gewölbe saß auf einem elfenbeinernen Stuhle der Menschenfresser, und hinter ihm stand seine Frau und kämmte ihm mit einem beinernen Kamme das lange, zottelige Wirrhaar.
Jetzt sprach der Menschenfresser: "Hup, hup! Es riecht nach Menschenfleisch! Hup, hup - Menschenfleisch", und schnappte behaglich. "Ach", antwortete die Frau, "wer weiß was du riechst?"
Doppelt fest hielt der Schmied das winzige Männlein am Kragen, denn hätte er es losgelassen, so hätte das selbe ihn und seine Gesellen dem Menschenfresser überliefert - aber so führte er den Schmied in einen Seitengang, und die anderen folgten, und da kamen sie an ein Bergloch, davor lag ein großer Stein, und da sagte das Männlein: "Wälze diesen Stein hinweg, krieche dann durch die Öffnung hinaus und rufe: 'Vivat! Ich bin erlöst!'" -
"Zum Steinwälzen brauch ich aber zwei Arme", sagte der Schmied, gab dem Jäger das zappelnde Männlein am Kragen festzuhalten, denn dem Schneider mochte er es nicht anvertrauen, der dünkte ihn nicht stark genug. Gleichwohl half auch der Schneider halten, er hielt das Männlein an beiden Beinchen fest.
Jetzt wälzte der Schmied den Stein; da entstand im Gewölbe ein Poltern und Krachen, als wenn alles zusammenbreche, vor ihnen aber strahlte blendender Schimmer, Tageshelle, und vor aller Augen lag ein stattliches Schloss. Geschwinde krochen alle drei, eigentlich vier, heraus. Erst der Schmied, dann der Jäger mit dem Männlein, zuletzt der Schneider, der des winzigen Männleins Beine hielt, und jeder schrie: "Vivat, ich bin erlöst."
Und siehe, das winzige Männlein schrie auch mit und verschwand jenen unter den Händen. Aus dem Schlosse aber trat ein prächtig gekleidetes Musikkorps und spielte einen wunderschönen Tanz, dann kamen drei herrliche Prinzessinnen, die tanzten dem Schmied, dem Jäger und dem Schneider entgegen; dann ein kleiner Mann, aber angetan wie ein König, mit Krone und Szepter, im hermelinverbrämten Purpurmantel, und seine Züge waren die des winzigen Männleins.
"Dank euch, die ihr uns erlöst habt!" sprach der kleine König mit gravitätischer Würde. "Dank und Lohn!"
Hierauf erhob der König die drei munteren Gesellen in den Prinzenstand, jeder durfte eine von den drei wunderschönen Prinzessinnen heiraten, alle lebten glücklich beisammen in dem schönen Schlosse, bedient von zahlreichem Hofgesinde, und keinem wurde wieder sein Feuerlein ausgeblasen.
DER MÜLLER UND DIE NIXE ...
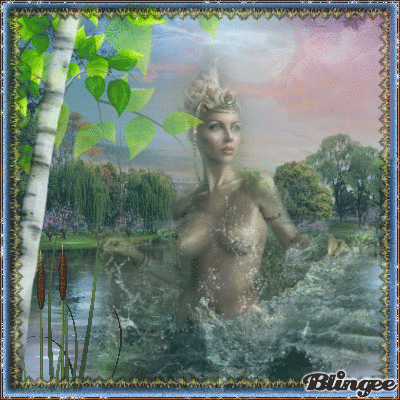
Es war einmal ein Müller, der war reich an Geld und Gut und führte mit seiner Frau ein vergnügtes Leben. Aber Unglück kommt über Nacht; der Müller wurde arm und konnte zuletzt kaum noch die Mühle, in der er saß, sein eigen nennen.
Da ging er des Tages voll Kummer umher, und wenn er abends sich niederlegte, fand er keine Ruhe, sondern verwachte die ganze Nacht in traurigen Gedanken.
Eines Morgens stand er früh vor Tage auf und ging ins Freie; er dachte es sollte ihm leichter ums Herz werden.
Als er nun auf dem Damme an seinem Mühlteiche sorgenvoll auf und nieder ging, hörte er es auf einmal in dem Weiher rauschen, und als er hinsah, da stieg eine weiße Frau daraus empor. Da erkannte er, dass es die Nixe des Weihers sein müsse und vor großer Furcht wusste er nicht, ob er davon gehen, oder stehen bleiben sollte.
Indem er so zauderte, erhob die Nixe ihre Stimme, nannte ihn bei Namen und fragte ihn, warum er so traurig wäre? Als der Müller die freundlichen Worte hörte, fasste er sich ein Herz und erzählte ihr, wie er sonst so reich und glückselig gewesen wäre und jetzt sei er so arm, dass er sich vor Not und Sorgen nicht zu raten wisse.
Da redete ihm die Nixe mit tröstlichen Worten zu und versprach ihm, sie wolle ihn noch reicher machen, als er je gewesen sei, wenn er ihr dagegen das gebe, was eben in seinem Hause jung geworden sei.
Der Müller dachte, sie wolle ein Junges von seinem Hunde oder seiner Katze haben, sagte ihr also zu, was sie verlangte, und eilte guten Mutes nach seiner Mühle. Aus der Haustür trat ihm seine Magd mit freudiger Geberde entgegen und rief ihm zu, seine Frau habe soeben einen Knaben geboren.
Da stand nun der Müller und konnte sich über die Geburt seines Kindes, die er nicht so bald erwartet hatte, nicht freuen. Traurig ging er ins Haus und erzählte seiner Frau und seinen Verwandten, die herbei kamen, was er der Nixe gelobt hatte.
"Mag doch alles Glück, das sie mir versprochen hat, verfliegen", sprach er, "wenn ich nur mein Kind retten kann." Aber niemand wusste anderen Rat, als dass man das Kind sorgfältig in acht nehmen müsse, damit es niemals dem Weiher zu nahe käme.
Der Knabe wuchs fröhlich auf und unterdessen kam der Müller nach und nach zu Geld und Gut, und es dauerte nicht lange, so war er reicher als er je gewesen war. Aber er konnte sich seines Glückes nicht recht freuen, da er immer seines Gelübdes gedachte und fürchtete, die Nixe werde über kurz oder lang auf die Erfüllung dringen.
Aber Jahr auf Jahr verging, der Knabe wurde groß und lernte die Jägerei, und weil er ein schmucker Jäger war, nahm ihn der Herr des Dorfes in seinen Dienst, und der Jäger freite sich ein junges Weib und lebte friedlich und in Freuden.
Einstmals verfolgte er auf der Jagd einen Hasen, der endlich auf das freie Feld ausbog. Der Jäger setzte ihm eifrig nach und streckte ihn mit einem Schuss nieder. Sogleich machte er sich ans Ausweiden und achtete nicht darauf, dass er sich in der Nähe des Weihers befand, vor dem er sich von Kind auf hatte hüten müssen.
Mit dem Ausweiden war er bald fertig und ging nun an das Wasser, um seine blutigen Hände zu waschen. Kaum hatte er sie in den Weiher getaucht, als die Nixe emporstieg, ihn mit nassen Armen umfing und ihn mit sich hinab zog, dass die Wellen über ihm zusammenschlugen.
Als der Jäger nicht heimkehrte, geriet seine Frau in große Angst, und als man nach ihm suchte und am Mühlteiche seine Jagdtasche liegen fand, da zweifelte sie nicht mehr daran, wie es ihm ergangen sei. Ohne Rast und Ruhe irrte sie an dem Weiher umher und rief wehklagend Tag und Nacht ihren Mann.
Endlich fiel sie vor Müdigkeit in einen Schlaf, darinnen es ihr träumte, wie sie durch eine blühende Flur zu einer Hütte wanderte, worin eine Zauberin wohnte, die ihr ihren Mann wieder zu schaffen versprach.
Als sie am Morgen erwachte, beschloss sie der Eingebung zu folgen und die Zauberin aufzusuchen. So wanderte sie aus und kam bald zur blühenden Flur und dann zu der Hütte, worin die Zauberin wohnte. Sie erzählte ihren Kummer und dass ein Traum ihr Rat und Hilfe von ihr versprochen habe.
Die Zauberin gab ihr zum Bescheid: sie solle beim Vollmond an den Weiher gehen und dort mit einem goldenen Kamm ihre schwarzen Haare strählen und dann den Kamm ans Ufer legen. Die junge Jägersfrau beschenkte die Zauberin reichlich und begab sich auf den Heimweg.
Die Zeit bis zum Vollmond verging ihr langsam; als es aber endlich Vollmond war, ging sie zum Weiher und strählte sich mit einem goldenen Kamm ihre schwarzen Haare und als sie fertig war, legte sie den Kamm am Ufer nieder und sah dann ungeduldig in das Wasser.
Da rauschte es und brauste es aus der Tiefe und eine Welle spülte den goldenen Kamm vom Ufer und es dauerte nicht lange, so erhob ihr Mann den Kopf aus dem Wasser und sah sie traurig an. Aber bald kam wiederum eine Welle gerauscht und der Kopf versank, ohne ein Wort gesprochen zu haben.
Der Weiher lag wieder ruhig wie zuvor und glänzte im Mondscheine und die Jägersfrau war um nichts besser dran als vorher. Trostlos durchwachte sie Tage und Nächte, bis sie wieder ermüdet in Schlaf sank, und der selbe Traum, der sie an die Zauberin gewiesen hatte, wieder über sie kam.
Abermals ging sie am Morgen nach der blühenden Flur und nach der Hütte und klagte der Zauberin ihren Kummer. Die Alte gab ihr zum Bescheid: sie solle beim Vollmond an den Weiher gehen, auf einer goldenen Flöte blasen und dann die Flöte an das Ufer legen.
Als es Vollmond geworden war, ging die Jägersfrau zum Weiher, blies auf einer goldenen Flöte und legte sie dann ans Ufer. Da rauschte es und brauste es aus der Tiefe und eine Welle spülte die Flöte vom Ufer und bald erhob der Jäger den Kopf über das Wasser und tauchte immer höher empor, bis über die Brust, und breitete seine Arme nach seiner Frau aus.
Da kam wieder eine rauschende Welle und zog ihn in die Tiefe zurück. Die Jägersfrau hatte voller Freude und Hoffnung am Ufer gestanden und versank in tiefen Gram, als sie ihren Mann in dem Wasser verschwinden sah.
Aber zum Troste erschien ihr wiederum der Traum, der sie zu der blühenden Flur und zu der Hütte der Zauberin verwies. Die Alte gab diesmal den Bescheid: sie solle, sobald es Vollmond sein werde, an den Weiher gehen, dort auf einem goldenen Rädchen spinnen und dann das Rädchen ans Ufer stellen.
Als der Vollmond kam, befolgte die Jägersfrau das Geheiß, ging an den Weiher, setzte sich nieder und spann auf einem goldenen Rädchen und stellte dann das Rädchen ans Ufer. Da rauschte es und brauste es aus der Tiefe und eine Welle spülte das goldene Rad vom Ufer, und bald erhob der Jäger den Kopf über das Wasser und tauchte immer höher empor, bis er endlich an das Ufer stieg und seiner Frau um den Hals fiel.
Da fing das Wasser an zu rauschen und brausen und überschwemmte das Ufer weit und breit und riss beide, wie sie sich umfasst hielten, mit sich hinab. In ihrer Herzensangst rief die Jägerin den Beistand der Alten an und auf einmal war die Jägerin in eine Kröte und der Jäger in einen Frosch verwandelt.
Aber sie konnten nicht beisammen bleiben, das Wasser riss sie nach verschiedenen Seiten hin, und als die Überschwemmung vergangen war, da waren zwar beide wieder zu Menschen geworden, aber der Jäger und die Jägerin waren jedes in einer fremden Gegend und wussten nichts voneinander.
Der Jäger entschloss sich als Schäfer zu leben und auch die Jägerin ward eine Schäferin. So hüteten sie lange Jahre ihre Herden, eines vom anderen entfernt.
Einstmals aber trug es sich zu, dass der Schäfer dahin kam, wo die Schäferin lebte.
Die Gegend gefiel ihm und er sah, dass sie recht fruchtbar gelegen sei zur Weide seiner Herde. Er brachte also seine Schafe dorthin und hütete sie wie zuvor. Schäfer und Schäferin wurden gute Freunde, aber sie erkannten einander nicht.
An einem Abend aber saßen sie im Vollmond beieinander, ließen ihre Herden grasen und der Schäfer blies auf seiner Flöte. Da gedachte die Schäferin jenes Abends, wo sie am Weiher bei Vollmond auf der goldenen Flöte geblasen; sie konnte sich nicht länger halten und brach in lautes Weinen aus.
Der Schäfer fragte sie, was sie so weine und klage? - bis sie ihm erzählte, was ihr alles widerfahren sei. Da fiel es wie Schuppen von den Augen des Schäfers, er erkannte seine Jägerin und gab sich ihr zu erkennen. Nun kehrten sie fröhlich in ihre Heimat zurück und lebten zusammen ungestört und in Frieden.
DER ZAUBER - WETTKAMPF ...
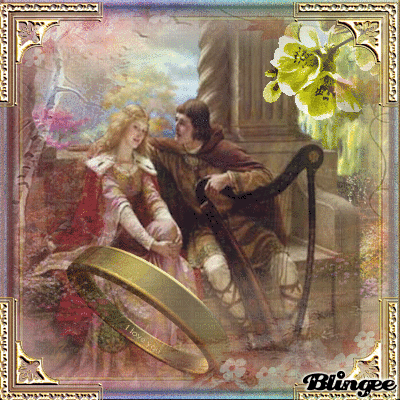
Einstmals ging ein junger Buchbindergeselle in die Fremde und wanderte, bis kein Kreuzerlein mehr in seiner Tasche klimperte. Da endlich nötigte ihn sein gespanntes Verhältnis mit dem schlaff gewordenen Geldbeutel, ernstlich der Arbeit nachzufragen, und bald ward er auch von einem Meister angenommen und bekam es sehr, sehr gut.
Sein Meister sprach zu ihm: "Gesell, du wirst es gut bei mir haben; die Arbeit, die du täglich zu tun hast, ist ganz geringe - Du kehrst nur die Bücher hier alle Tage recht säuberlich ab und stellst sie dann nach der Ordnung wieder auf. Aber dieses eine Büchlein, welches hier apart steht, darfst du nicht anrühren, viel weniger hinein sehen, sonst ergeht es dir schlimm, Bursche, merk es dir. Dagegen kannst du in den anderen Büchern lesen, so viel du nur magst."
Der Geselle beherzigte die Worte seines Meisters sehr wohl und hatte zwei Jahre lang die besten Tage, in dem er täglich nur die Bücher säuberte, dann in manchem der selben las und dabei die vortrefflichste Kost hatte - jenes verbotene Büchlein ließ er gänzlich unangerührt. Dadurch erwarb er sich das volle Vertrauen seines Herrn, so dass dieser öfters tagelang vom Hause entfernt blieb und auch zuweilen eine Reise unternahm.
Aber wie stets dem Menschen nach Verbotenem gelüstet, so regte sich einstmals, als der Meister auf mehrere Tage verreist war, in dem Gesellen eine mächtige Begierde, endlich doch zu wissen, was in dem Büchlein stehe, das immer ganz heilig an seinem bestimmten Orte lag. Denn alle anderen Bücher hatte er bereits durchgelesen.
Zwar sträubte sich sein Gewissen, das Verbotene zu tun, aber die Neugierde war mächtiger; er nahm das Büchlein, schlug es auf und fing an darinnen zu lesen. In dem Büchlein standen die größten kostbarsten Geheimnisse, die größten Zauberformeln waren darinnen enthalten, und es stellte sich dem staunenden, höchst verwunderten Gesellen nach und nach alles so sonnenklar heraus, dass er schon anfing, Versuche im Zaubern zu machen.
Alles gelang. Sprach der Bursche ein kräftiges Zaubersprüchlein aus diesem Büchlein, so lag im Nu das Gewünschte vor ihm da. Auch lehrte das Büchlein jede menschliche Gestalt in eine andere zu verwandeln. Nun probierte er mehr und mehr, und zuletzt machte er sich zu einer Schwalbe, nahm das Büchlein und flog im schnellsten Fluge seiner Heimat zu.
Sein Vater war nicht wenig erstaunt, als eine Schwalbe zu seinem Fenster einflog und plötzlich dann aus ihr sein Sohn wurde, den er zwei Jahre lang nicht gesehen hatte. Der Bursche aber drückte den Alten herzlich an seine Brust und sprach: "Vater, nun sind wir glücklich und geborgen, ich bringe ein Zauberbüchlein mit, durch das wir die reichsten Leute werden können."
Das gefiel dem Alten wohl, denn er lebte sehr dürftig. Bald darauf machte sich der junge Zauberer zu einem überaus großen, fetten Ochsen und sprach zu seinem Vater: "Nun führt mich zum Markt und verkauft mich, aber fordert ja viel, recht viel, man wird mich teuer bezahlen, und vergesst ja nicht das kleine Stricklein, welches um meinen linken Hinterfuß gebunden ist, abzulösen und wieder mit heim zu nehmen, sonst bin ich verloren."
Das machte der Vater alles so; er verkaufte den Ochsen für ein schweres Geld, denn als er nun mit ihm auf dem Markte erschien, versammelte sich gleich ein Haufen Volk um ihn, alles bewunderte den Raritäts-Ochsen, und Christen und Juden schlugen sich darum, ihn zu kaufen. Der Käufer aber, der das höchste Gebot tat und bezahlte und den Ochsen im Triumph von dannen führte, hatte am anderen Morgen statt des herrlichen Ochsen ein Bündlein Stroh in seinem Stalle liegen.
Und der Buchbindergeselle - der war wohlgemut wieder daheim bei seinem Vater und lebte mit ihm herrlich und in Freuden von dem Gelde. Manch einer macht sich auch zu einem großen fetten Ochsen, aber keiner kauft ihn teuer.
Bald darauf verzauberte der Bursch sich in einen prächtigen Rappen und ließ sich von seinem Vater auf den Rossmarkt führen und verkaufen. Da lief wieder das Volk zusammen, um das wunderschöne,
glänzend schwarze Ross zu sehen.
Jener Meister Buchbinder aber, als er nach Hause zurück gekehrt war, hatte gleich gesehen, was vorgegangen, und da er eigentlich kein Buchbinder, sondern ein mächtiger Zauberer war, der nur zum
Schein diese Beschäftigung trieb, so wusste er auch gleich, wie viel es geschlagen hatte, und setzte dem Entflohenen nach.
Auf jenem Rossmarkt nun war der Meister unter den Käufern, und da er alle Stücklein des Zauberbüchelchens kannte, so merkte er als bald, was es für eine Bewandtnis mit dem Pferd habe, und dachte: Halt, jetzt will ich dich fangen. Und so suchte er für jeden Preis das Pferd zu kaufen, was ihm auch ohne große Mühe gelang, weil er es gleich um den ersten Kaufpreis annahm.
Der Vater kannte den Käufer nicht, aber das Pferd fing an, heftig zu zittern und zu schwitzen, und gebärdete sich äußerst scheu und ängstlich, doch es konnte der Vater die nun so gefährliche Lage seines Sohnes nicht ahnen.
Als das Pferd des neuen Eigentümers eingeführt und an den für das selbe bestimmten Platz gestellt war, wollte der Vater wieder das Stricklein ablösen; aber der Käufer ließ dieses durchaus nicht zu, da er sehr wohl wusste, dass es dann um seinen Fang geschehen wäre.
So musste denn der Vater ohne Stricklein abziehen und dachte in seinem Sinn: er wird sich schon selbst helfen, kann er so viel, dass er sich zu einem Pferde macht, kann er sich gewiss auch wieder durch seine Zauberkunst dort in dem Stall los machen und heimkommen.
In jenem Pferdestall aber war ein mächtiges Gedränge von Menschen; groß und klein, alt und jung - alles wollte das ausgezeichnet schöne Ross beschauen. Ein kecker Knabe wagte sogar, das Pferd zu streicheln und liebkosend zu klopfen, und es ließ sich dieses, wie es schien, gar gerne gefallen, und als dieser Knabe sich immer vertraulicher näherte und das Pferd am Kopf und am Hals streichelte, da flüsterte es dem Knaben ganz leise zu: "Liebster Junge, hast du kein Messerchen einstecken?"
Und der froh verwunderte Knabe antwortete: "O ja, ich habe ein recht scharfes. "
Da sprach der Rappe wieder ganz leise: "Schneide einmal das Stricklein an meinem linken Hinterfuß ab", und schnell schnitt es der Knabe entzwei.
Und in diesem Augenblicke fiel das schöne Ross vor aller Augen zusammen und ward ein Bündlein Stroh, und daraus flog eine Schwalbe hervor, und aus dem Stall empor in die hohen blauen Lüfte. Der Meister hatte das Ross nur einen Augenblick außer acht gelassen, jetzt war keine Zeit zu verlieren.
Er brauchte seine Kunst, verwandelte sich rasch in einen Geier und schoss der flüchtigen Schwalbe nach. Es bedurfte nur noch einer kleine Weile, so hatte der Geier die Schwalbe in seinen Klauen, aber das Schwälblein merkte den Feind, blickte nieder auf die Erde und sah da gerade unter sich ein schönes Schloss, und vor dem Schloss saß eine Prinzessin, und flugs verwandelte sich das Schwälblein in einen goldenen Fingerreif, fiel nieder und gerade der holden Prinzessin auf den Schoß.
Die wusste nicht, wie ihr geschah, und steckte das Ringlein an den Finger. Aber die scharfen Augen des Geiers hatten alles gesehen, und rasch verwandelte sich der Zaubermeister aus einem Geier in einen schmucken Junker und trat heran zur Prinzessin und bat sie höflichst und untertänigst, dieses Ringlein, mit welchem er soeben ein Kunststück gemacht habe, ihm wieder einzuhändigen.
Die schöne Prinzessin lächelte errötend, zog das Ringlein vom Finger und wollte es dem Künstler überreichen, doch siehe, da entfiel es ihren zarten Fingern und rollte als ein winziges Hirsekörnlein in eine Steinritze.
Im Augenblicke verwandelte sich der Junker und wurde ein stolzer Gockelhahn, der mit seinem Schnabel emsig in der Steinritze nach dem Hirsekörnlein pickte, aber gleich darauf wurde aus dem Hirsekörnlein ein Fuchs, und dieser biss dem Gockel den Kopf ab. Und somit war der Zaubermeister besiegt.
Jetzt aber nahm der junge Geselle wieder seine Gestalt an, sank der Prinzessin zu Füßen und pries sie dankend, dass sie ihn an ihrem Finger getragen und sich so mit ihm verlobt habe. Die Prinzessin war über alles, was vorgegangen war, mächtig erschrocken, denn sie war noch sehr jung und unerfahren und schenkte ihm ihr Herz und ihre Hand, doch unter der Bedingung, dass er fortan aller Verwandlung entsage und ihr unwandelbar treu bleibe.
Dies gelobte der Jüngling und opferte sein Zauberbüchlein den Flammen, woran er in des sehr übel tat, denn er hätte es ja dir, lieber Leser, oder mir schenken und vermachen können; in Ochsen hätten wir zwei uns gewisslich nicht verwandelt.
DER SCHÄFER UND DIE SCHLANGE ...
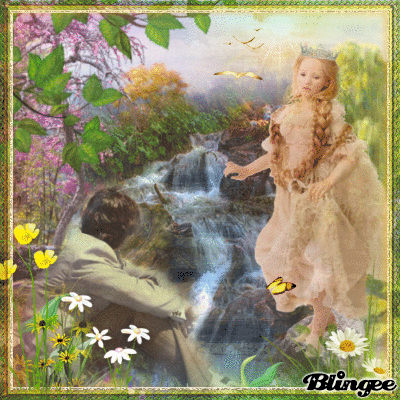
Es war einmal ein armer Schäferknabe in einem friedlichen, anmutig gelegenen Dörfchen; bei dem Dörfchen war ein Tal und ein gar trautes Ortlein, an welches der Schäferknabe immer seine Herde hintrieb, und es schien, als habe der Schäfer diesen stillen Ort sich zum Lieblingsplätzchen erwählt. Er aß nicht eher sein Mittagsbrot und suchte nicht eher die kühle Ruhe, bis er an das traute Plätzchen kam. Dorthin zog ihn immer eine unerklärliche Sehnsucht.
Das Plätzchen selbst war ganz einfach: ein roher Stein lag nur da, unter welchem eine Quelle murmelte, und ein wilder Birnbaum stand dabei, der den Stein überschattete mit seinen dicht belaubten Zweigen.
Doch der Knabe fühlte sich immer so froh, wenn er an diesem Stein aß, aus der Quelle trank, und wenn der Stein sein Ruhekissen war, und es war ihm dann, als höre er ein geheimnisvolles Singen und Seufzen unter dem Stein; dann lauschte er, entschlummerte dann und träumte.
Immer war ihm, als umschwebe seine Seele ein geheimes, überirdisches Glück. War er fort getrieben mit der Herde, und war er abends heimgetrieben, so bemächtigte sich seiner wieder diese unerklärliche Sehnsucht; er mochte unter der Schar der muntern Dorfburschen und Mädchen nicht lustig singend und schäkernd mit umherziehen, wenn es Feierabend war, vielmehr ging er still und allein und wurde sogar traurig.
Doch brach der neue schöne Morgen wieder an und zog er mit seiner Lämmer Herde wieder hinaus auf Flur und Raine, so wurde sein Sinn heiter und immer heiterer, bis er den lieben Stein, den Schatten des trauten Birnbaums erreicht hatte.
Oft auch, wenn er dort rastete und auf seiner Flöte blies, begab es sich, dass eine silberweiße Schlange unter dem Stein hervorkam, die sich erst vertraulich an seine Füße schmiegte, sich dann empor wand und den Schäfer anblickte, bis zwei große Tränen aus ihren Augen quollen, und die dann leise wieder unter den Stein schlüpfte.
Da wurde dem Schäfer allemal so eigentümlich, so wunderbar zumute. Sein Herz war froh und doch unaussprechlich wehmütig. Zuletzt ging der Schäfer gar nicht mehr unter die muntere Zahl der Burschen und Mädchen, das helle lustige Getöse war ihm ganz zuwider, dagegen tat ihm die einsame Stille so wohl und wurde ihm immer lieber.
An einem schönen Frühlingssonntag, dem Sonntage Trinitatis, den die Landleute den "goldenen Sonntag" nennen und besonders hochhalten und festlich feiern, wo unter der Dorflinde ein lustiger Tanz gehalten werden sollte, lenkte der stille Schäferknabe, von jener unaussprechlichen Sehnsucht getrieben, in der Mittagsstunde seine Schritte dem einsamen Tal zu, wo der Stein und der Birnbaum waren.
Er grüßte heiter das traute Plätzchen, setzte sich still denkend nieder und lauschte dem Flüstern der Baumblätter und dem geheimnisvollen Geplauder unter dem Steine. Da wurde es mit einem Mal so licht vor seinen Blicken, ein Bangen durchzitterte sein Herz, er blickte auf und sah eine holde Gestalt in weißem Kleide, gleich einem Engel, vor sich stehen, mit sanftem Blick und gefalteten Händen; und trunkenen Sinnes hörte der Schäfer eine süße Stimme ihm zuflüstern:
"O Jüngling, sei nicht bange, O höre das Flehen eines unglücklichen Mädchens, stoße mich nicht von dir und entfliehe nicht vor meinem Jammer. Ich bin eine edle Prinzessin, bin unermesslich reich an Perlen- und Goldschätzen; aber ich schmachte schon viele Jahrhunderte verzaubert und verbannt hier unter diesem Stein und muss in einem Schlangenleib umherschleichen.
So erschaute ich dich hier oft und gewann die Hoffnung, du könntest mich erlösen, du seiest noch rein im Herzen wie ein Kind. Und diese jetzige Stunde, am goldnen Sonntag um die Mittagsstunde, diese allein im ganzen Jahr ist mir vergönnt, in meiner wahren Gestalt auf der Erde zu wandeln; und fände ich da einen Jüngling reinen Herzens, so dürfe ich ihn um meine Erlösung ansprechen.
Befreie mich, du Teurer, befreie mich, um alles Heiles willen flehe ich dich an." Da sank das Mädchen nieder vor die Füße des Schäfers, und umfasste sie fest und blickte in Tränen zu ihm empor.
Dem Jüngling aber bebte das Herz vor Entzücken, und er hub das Engelmägdlein auf und stammelte: "O sage nur, was soll ich tun, wie soll ich dich befreien, du schöne Liebe?"
Sie sprach: "Komm morgen um die selbe Stunde wieder hierher, und wenn ich da in meinem Schlangenleib dir erscheine und dich umwinde und dich dreimal küsse, so erschrick nur nicht, O so erschrick nur nicht, sonst muss ich abermals auf Hunderte Jahre hier verzaubert schmachten."
Sie verschwand in diesem Augenblick; und es tönte wieder ein leises Singen und Seufzen unter dem Stein hervor.
Am folgenden Tage um die Mittagsstunde harrte der Schäfer, nicht ohne Bangen, an jenem Ort, er flehte zum Himmel um Stärke und Standhaftigkeit in dem grauenvollen Augenblick des Schlangenkusses.
Und schon wand sich die Schlange silberweiß unter dem Stein hervor, schlich dem Jüngling zu, ringelte sich um seinen Leib und hob das Schlangenhaupt mit den hellen Augen empor zum Kusse; aber der Jüngling blieb stark und duldete die drei Küsse.
Da geschah ein mächtiger Schlag, da rollten furchtbare Donner um den ohnmächtig hin gesunkenen Jüngling, und wie er wieder erwachte, lag er auf weichen, seidenen Kissen in einem wundervoll geschmückten Zimmer, und das holde Mädchen kniete vor seinem Lager und hielt seine Hand an ihr Herz.
"O sei gedankt, Himmel!" rief sie, als er die Augen aufschlug, "O habe Dank, Herzensjüngling, für meine Rettung, und nimm zum Lohn mein schönes Land und dieses schöne Schloss mit allen kostbaren Schätzen, und nimm mich als deine treue Frau an. Du sollst nun glücklich sein und sollst Freuden die Fülle haben."
Und dieser Schäfer wurde glücklich und froh; jene Sehnsucht seines Herzens, die ihn so oft hin nach dem Stein, zur stillen Einsamkeit, getrieben - ward herrlich befriedigt. Er lebte, der Welt entrückt, im Schoße des Glücks, mit seiner schönen Gemahlin; und er sehnte sich nicht auf die Erde, nicht zu seinen Lämmern zurück.
Aber in jenem Dorfe war ein großes Leid um den so plötzlich verschwundenen Schäfer, die Leute suchten ihn im Tal, bei dem Stein unterm Birnbaum, wo er zuletzt hingegangen war, doch weder der Schäfer, noch der Stein, noch die Quelle, noch der Birnbaum waren mehr zu finden, und kein Auge sah von diesen allen je das mindeste wieder.
DER SCHMIED VON JÜTERBOGK ...
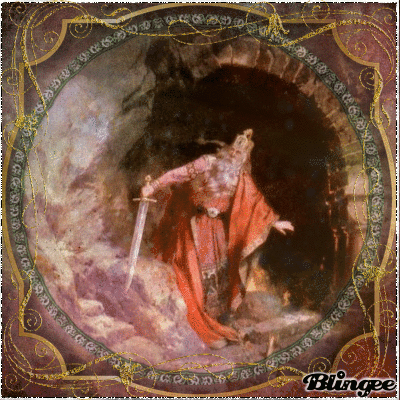
Im Städtlein Jüterbogk hat einmal ein Schmied gelebt, von dem erzählen sich Kinder und Alte ein wundersames Märlein. Es war dieser Schmied erst ein junger Bursche, der einen sehr strengen Vater hatte, aber treulich Gottes Gebote hielt.
Er tat große Reisen und erlebte viele Abenteuer, dabei war er in seiner Kunst über alle Maßen geschickt und tüchtig. Er hatte eine Stahltinktur, die jeden Harnisch und Panzer undurchdringlich machte, welcher damit bestrichen wurde, und gesellte sich dem Heere Kaiser Friedrichs II. zu, wo er kaiserlicher Rüstmeister wurde und den Kriegszug nach Mailand und Apulien mitmachte.
Dort eroberte er den Heer- und Bannerwagen der Stadt und kehrte endlich, nach dem der Kaiser gestorben war, mit vielem Reichtum in seine Heimat zurück. Er sah gute Tage, dann wieder böse und wurde über hundert Jahre alt.
Einst saß er in seinem Garten unter einem alten Birnbaum, da kam ein graues Männlein auf einem Esel geritten, das sich schon mehrmals als des Schmiedes Schutzgeist bewiesen hatte. Dieses Männchen herbergte bei dem Schmied und ließ den Esel beschlagen, was jener gern tat, ohne Lohn zu heischen.
Darauf sagte das Männlein zu Peter, er solle drei Wünsche tun, aber dabei das Beste nicht vergessen. Da wünschte der Schmied, weil die Diebe ihm oft die Birnen gestohlen, es solle keiner, der auf den Birnbaum gestiegen, ohne seinen Willen wieder herunter können - und weil er auch in der Stube öfters bestohlen worden war, so wünschte er, es solle niemand ohne seine Erlaubnis in die Stube kommen können, es wäre denn durch das Schlüsselloch.
Und dann tat der Schmied den dritten Wunsch, sagend: "Das Beste ist ein guter Schnaps, so wünsche ich, dass diese Bulle niemals leer werde!" "Deine Wünsche sind gewährt", sprach das Männchen, strich noch über einige Stangen Eisen, die in der Schmiede lagen, mit der Hand, setzte sich auf seinen Esel und ritt von dannen. Das Eisen war in blankes Silber verwandelt.
Der vorher arm gewordene Schmied war wieder reich und lebte fort und fort bei gutem Wohlsein, denn die nie versiegenden Magentropfen in der Bulle waren, ohne dass er es wusste, ein Lebenselixier. Endlich klopfte der Tod an, der ihn so lange vergessen zu haben schien; der Schmied war scheinbar auch gern bereitwillig, mit ihm zu gehen, und bat nur, ihm ein kleines Labsal zu vergönnen und ein paar Birnen von dem Baum zu holen, den er nicht selbst mehr besteigen könne aus großer Altersschwäche.
Der Tod stieg auf den Baum, und der Schmied sprach: "Bleib droben!" denn er hatte Lust, noch länger zu leben. Der Tod fraß alle Birnen vom Baum, dann gingen seine Fasten an, und vor Hunger verzehrte er sich selbst mit Haut und Haar, daher er jetzt nur noch so ein scheußlich dürres Gerippe ist.
Auf Erden aber starb niemand mehr, weder Mensch noch Tier, darüber entstand viel Unheil, und endlich ging der Schmied hin zu dem klappernden Tod und akkordierte mit ihm, dass er ihn in Ruhe lasse, dann ließ er ihn los. Wütend floh der Tod von dannen und begann nun auf Erden aufzuräumen.
Da er sich an dem Schmied nicht rächen konnte, so hetzte er ihm den Teufel auf den Hals, dass dieser ihn hole. Dieser machte sich flugs auf den Weg, aber der pfiffige Schmied roch den Schwefel voraus, schloss seine Türe zu, hielt mit den Gesellen einen ledernen Sack an das Schlüsselloch, und wie Herr Urian hindurch fuhr, da er nicht anders in die Schmiede konnte, wurde der Sack zugebunden, zum Amboss getragen, und nun wurde ganz unbarmherzig mit den schwersten Hämmern auf den Teufel losgepocht, dass ihm Hören und Sehen verging, er ganz mürbe wurde und das Wiederkommen auf immer verschwur.
Nun lebte der Schmied noch gar lange Zeit in Ruhe, bis er, wie alle Freunde und Bekannte ihm gestorben waren, des Erdenlebens satt und müde wurde. Machte sich deshalb auf den Weg und ging nach dem Himmel, wo er bescheidentlich am Tor anklopfte. Da schaute der heilige Petrus heraus, und Peter der Schmied erkannte in ihm seinen Schutzpatron und Schutzgeist, der ihn oft aus Not und Gefahr sichtbarlich errettet und ihm zuletzt die drei Wünsche gewährt hatte.
Jetzt aber sprach Petrus: "hebe dich weg, der Himmel bleibt dir verschlossen; du hast das Beste zu erbitten vergessen: die Seligkeit!"
Auf diesen Bescheid wandte sich Peter und gedachte, sein Heil in der Hölle zu versuchen, und wanderte wieder abwärts, fand auch bald den rechten, breiten und viel begangenen Weg. Wie aber der Teufel erfuhr, dass der Schmied von Jüterbogk im Anzug sei, schlug er das Höllentor ihm vor der Nase zu und setzte die Hölle gegen ihn in Verteidigungsstand.
Da nun der Schmied von Jüterbogk weder im Himmel noch in der Hölle seine Zuflucht fand, und auf Erden es ihm nimmer gefallen wollte, so ist er hinab in den Kyffhäuser gegangen zu Kaiser Friedrich, dem er einst gedient hatte. Der alte Kaiser, sein Herr, freute sich, als er seinen Rüstmeister Peter kommen sah und fragte ihn gleich, ob die Raben noch um den Turm der Burgruine Kyffhausen flögen?
Und als Peter das bejahte, so seufzte der Rotbart. Der Schmied aber blieb im Berge, wo er des Kaisers Handpferd und die Pferde der Prinzessin und die der reitenden Fräulein beschlägt, bis des Kaisers Erlösungsstunde auch ihm schlagen wird.
Und das wird geschehen nach dem Munde der Sage, wenn der einst die Raben nicht mehr um den Berg fliegen, und auf dem Ratsfeld nahe dem Kyffhäuser ein alter dürrer abgestorbener Birnbaum wieder ausschlägt, grünt und blüht. Dann tritt der Kaiser hervor mit all seinen Wappnern, schlägt die große Schlacht der Befreiung und hängt seinen Schild an den wieder grünen Baum. Hierauf geht er ein mit seinem Gesinde zu der ewigen Ruhe.
DER UNDANKBARE SOHN ...
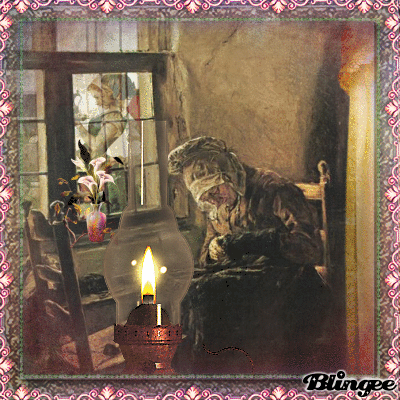
Eine alte Mutter hatte einen Sohn, der wollte heiraten und bat die Mutter, sie möge ihm doch ihr Häuschen und ihr Gütchen geben, er und ihre zukünftige Schwiegertochter wollten es auch gar gut mit ihr meinen, sie bei sich hegen und pflegen und sie sozusagen auf den Händen tragen.
Die alte Mutter war vom Herzen gut und vom Hirn etwas einfältig; sie kannte das Sprichwort nicht: Ziehe dich nicht eher aus, bis du dich schlafen legst, und gab her, was sie hatte. Zum Danke wurde sie sehr übel gehalten, war über nichts mehr Herrin, und jeder Bissen Brot wurde ihr erst schmal genug vor geschnitten, dann vorgerechnet und jeder Tropfen Trankes ihr vergällt; aber Sohn und Schwiegertochter ließen es sich ganz gütlich und wohl sein.
Einst speisten letztere beiden miteinander und mit Knecht und Magd ein gebratenes Truthuhn, ohne die Mutter dazu einzuladen; zufällig kam diese aber dennoch, musste jedoch anklopfen, denn die Türe war zugeschlossen. "Holla, die Alte kommt, fort mit dem Huhn! Setze es derweil in die Ofenröhre und mache deren Türe zu!" gebot der Sohn dem Knechte, und dieser vollzog als bald den erhaltenen Befehl.
Jetzt wurde die Stubentüre aufgerissen von dem Sohne und die arme Alte angefahren: "Nun, was soll es denn? Hat der alte Drache etwa schon wieder Hunger? Ei, so wollt ich doch! Da, nehmt, hier ist Brot, und nun trollt Euch von hinnen!"
Weinend wankte mit dem trockenen Stückchen Brot die alte Mutter aus der Stube; der böse Sohn warf hinter ihr die Türe in das Schloss, dass es krachte, und eiferte: "Keinen Bissen kann man doch in Ruhe und ohne Ärger genießen! Ich möchte nur wissen, ob die Alte ewig leben will."
"Bringe das Huhn wieder her!" gebot die Sohnesfrau dem Knechte - dieser öffnete die Ofentüre und sprang mit einem lauten Schrei des Schreckens drei Schritte vom Ofen zurück und verfärbte sich.
"Nun, was hat denn der tölpelhafte Narr? Er ist wohl verrückt!" rief der Mann und gebot der Magd, das Huhn aus der Röhre zu holen. Diese ging und griff in die Röhre und kreischte als bald vor Entsetzen auf, in dem auch sie zurücksprang.
"Was soll das heißen, ihr dummes Volk?" schalt der Herr. "Und wenn der lebendige Teufel drinnen saß, so würde ich nicht solchen Lärm aufschlagen! Geh du hin, Frau." "Ich?" fragte die Frau, "nicht um die Welt, ich tu es nicht - ich danke; ich bin satt."
"Ei, so muss ich selbst nachsehen und will es, und wenn der Donner drinnen säße!" rief der Mann, stieg auf und ging an die Röhre.
Hu! da schoss eine armdicke und klafterlange Schlange heraus, schnellte gegen ihn und ringelte sich um seinen Hals, eiskalt, und als er sie abzuwenden strebte, riss sie ihren Rachen gräulich auf und zeigte ihre Giftzähne und ihre Gabelzunge, und weder er noch sonst jemand anders durfte sie berühren, und wenn man Miene machte, sie von weitem zu beschädigen, so zog sie sich gleich fester um den Hals, dass der Mann zu ersticken Gefahr lief und ängstlich schrie, man solle die Schlange unberührt und ungeschädigt lassen.
Und die Schlange wich nicht von ihn; sie um seinen Hals legte er sich schlafen, sie um seinen Hals stieg er wieder auf. Ehe er einen Becher Getränk zum Munde führte, trank erst die Schlange aus dem selben Becher, jeden Bissen, den er aß, beleckte sie oder biss Stücke davon ab, ach, und dabei roch sie, so wie sie nur den Rachen aufriss, fürchterlich aus dem Halse, dass dem Mann eine Ohnmacht um die andere anstieß, und niemand es in seiner Nähe aushalten konnte.
Wer zu erst von ihm weg lief, das war seine Frau, die doch die meiste Schuld daran trug, dass er die Schlange des Undanks gegen seine betagte Mutter in seinem Herzen getragen, die schlimmer und scheußlicher ist als jener Wurm, den er jetzt am Halse tragen musste, zur quälenden Strafe.
Knecht und Magd liefen auch davon; Hund und Katze wanderten aus; der Vogel im Käfig krepierte; Motten und Mücken starben, die Spinnen machten sich hinweg, die Mäuse entflohen so schnell sie nur konnten; die Wanzen zogen in langen Zügen langsam an den Türpfosten nieder und schlüpften zwischen Türe und Angel hinaus - nicht das armseligste Läuschen bewies dem Undankbaren, von Gottes Strafgericht hart Heimgesuchten noch freudige Anhänglichkeit und Treue - alles, was lebte, floh ihn.
Nur ein Wesen, welches lebte, floh ihn nicht, hielt treu bei ihm aus, und das war seine arme alte Mutter - sie pflegte sein, sie betete zu Gott um Erlösung für ihren undankbaren Sohn, und da diese nicht erfolgte, so griff sie endlich furchtlos mit ihrer zitternden Hand und doch kräftig die drohende, zischende, Zähne zeigende, Gift hauchende Schlange an, und in dem Augenblicke, wie die alte Mutter das tat, fiel die Schlange ab vom Halse des Sohnes und - verschwand.
Der Sohn aber stürzte nieder zu den Füßen seiner Mutter und küsste ihr die Füße und ihres Kleides Saum und weinte heiße Reue Tränen auf die treuen Mutterhände und begann fortan ein neues Leben voll Demut gegen sie, voll Sorgfalt, voll Liebe, voll Gehorsam, voll Zuvorkommenheit, und sie lebte noch lange glücklich mit dem durch ihre starke Mutterliebe ihr und sich selbst geretteten Sohne bis in das höchste Greisenalter.
WIE DER TEUFEL DEN BRANNTWEIN ERFAND ...

Es hatten einmal zwei Landesherren einen Grenzstreit; da waren auf jeder Seite Zeugen, die das Recht behaupteten, und darunter waren zwei, die hatten vom Teufel die Schwarzkunst erlernt und ihm dafür ihre Seelen verschrieben.
Diese beiden haben einmal ein jeder in der Nacht wollen falsche Grenzsteine setzen, so, wie jeder von ihnen die Grenze behauptete, und haben die Steine mit schwarzer Kunst wollen machen, dass sie aussähen, als ob sie schon viele, viele Jahre da gestanden hätten.
Da sind sie alle zwei als feurige Männer hinauf auf die Höhe gegangen. Und wie der eine hinauf kommt, da ist der andere schon da. Aber keiner hat etwas von dem anderen gewusst, dass dieser den selben Gedanken hatte. Da fragte der eine den anderen: "Was machst du da?" "Was hast du danach zu fragen? Sage mir zuvor, was du da machen willst?" "Grenzsteine will ich setzen und will den Grenzzug machen, wie dieser eigentlich sein muss." "Das habe ich selbst schon getan, und da stehen die Steine, und so geht der Grenzzug."
"Das ist nicht richtig, und so geht der Grenzzug. Mein Herr hat gesagt, ich hätte recht, und ich solle nicht nachgeben." "Wer ist denn dein Herr? Das wird auch ein schöner Musjö sein!" "Der Teufel ist mein Herr! Hast du nun Respekt?" "Das ist nicht wahr, das ist mein Herr, und mein Herr hat mir gesagt, ich habe recht und solle nicht nachgeben. Packe dich den Augenblick, oder es geht dir schlecht!"
Und so kamen die zwei hintereinander, und zuletzt da gab der eine feurige Mann dem anderen eine Maulschelle, dass ihm der Kopf herab flog und kullerte den ganzen Berg hinab. Und der feurige Mann ohne Kopf rannte hinter seinem feurigen Kopfe her und wollte ihn haschen und ihn sich wieder aufsetzen.
Aber er konnte ihn nicht einholen bis ganz drunten im Graben. Wie nun der eine dem anderen die Maulschelle gegeben hatte, und jener hinter seinem Kopfe herlief, da kam auf einmal ein dritter feuriger Mann dazu und fragte den, der oben blieb: "Was hast du da gemacht?" "Was geht es dich an, und was hast du mir zu befehlen? Den Augenblick packe dich deiner Wege, oder ich mache es dir gerade so wie jenem."
"Halunke! Hast du nicht mehr Respekt vor mir? Weißt du nicht, dass ich dein Herr, der Teufel, bin?" "Und wenn du zehnmal der Teufel selbst bist, so liegt mir daran gar nichts; du kannst mich meinetwegen recht schön rein machen!" "Diesen Gefallen will ich dir tun, du sollst aber dein Lebtag daran gedenken!"
Und da fing der Teufel an und machte ihn rein, dass die Feuerputzen auf dem ganzen Bergrücken herum flogen. Aber wie er ihn so rein machte, da ersah mein feuriger Mann den günstigen Augenblick und griff hin und erwischte den Teufel im Nacken, hielt ihn fest und sagte ihm: "Nun bist du in meiner Gewalt; nun sollst du sehen, dass du in der Menschen Hände bist! Du hast dein Leben lang genug armen Leuten den Hals herumgedreht, nun sollst du auch selbst einmal erfahren, wie es tut, wenn einem der Hals umgedreht wird!"
Und fing an und wollte dem Teufel den Hals umdrehen. Wie der Teufel sah, dass der feurige Mann Ernst mit ihm machte, legte er sich aufs Bitten und gab ihm die himmelbesten Worte, er solle ihn doch gehen lassen und solle ihm den Hals nicht herumdrehen; er wolle ihm auch alles tun, was er nur von ihm verlangte.
Da sagte ihm der: "Weil du also erbärmlich tust, so will ich dich nur gehen lassen; aber zuvor musst du mir meine Verschreibung wiedergeben, in welcher ich dir meine Seele verschrieben habe, und musst mir auch versprechen, ja, du musst mir das bei deiner Großmutter beschwören, dass du kein Teil mehr an mir haben willst, auch all deine Lebtage von keinem Menschen dir wieder die Seele verschreiben lassen."
Wollte der Teufel wohl oder übel, einmal stak er in der Klemme, und wenn er loskommen wollte und wollte nicht den Hals herumgedreht haben, so musste er in einen sauren Apfel beißen, und gab ihm seine Verschreibung wieder und versprach es ihm und verschwur sich bei seiner Großmutter, dass er keinen Teil mehr an ihm haben wolle und wolle auch alle sein Lebtag von keinem Menschen sich wieder lassen die Seele verschreiben. Wie er das alles getan hatte, ließ jener den Teufel los.
Wie aber der Teufel wieder ledig war, da tat er einen Sprung zurück, dass ihn jener nicht etwa unversehens noch einmal erwische, und stellte sich hin und sagte: "So, nun bin ich wieder ledig; wenn ich dir, du Schalksnarr, nun auch deine Verschreibung wiedergegeben habe und habe dir versprochen und beschworen, dass ich kein Teil mehr an dir haben wolle, so habe ich dir doch nicht versprochen, dass ich den Hals dir nicht auch umdrehen wolle, so ich wieder ledig wäre. Und auf dem Hecke da sollst du alleweil sterben, dafür, dass du mich gegurgelt hast und hast mir wollen den Hals umdrehen!"
Und damit fuhr der Teufel auf ihn hinein und wollte ihm den Garaus machen, der aber riss aus und lief zum Wald hinein. Und der Teufel immer hinter ihm her. Endlich ersah es jener und kam an eine alte Buche, die war hohl und hatte unten ein Loch.
Da kroch er geschwind hinein und wollte sich verstecken vor dem Teufel. Aber er war nicht weit genug hinein gekrochen, und die Fußzehe guckte ihm noch heraus. Und weil er über und über feurig war, da leuchtete die Zehe durch die Nacht, und der Teufel wurde es gewahr, wo jener sich hin versteckt hatte, und kam und wollte ihn an der Fußzehe erwischen.
Aber der in seinem Baum hörte es, wie der Teufel getappt kam, wie er nach ihm greifen und ihn erwischen wollte; da zog er sich vollends hinein und machte sich weiter im Baum hinauf. Da kroch der Teufel auch hinein, und jener machte immer weiter im Baum hinauf und der Teufel immer hinter ihm her.
Endlich da hatte der Baum oben in der Höhe ein weites Astloch, da kam jener dran und kroch heraus. Und wie er draußen war, da nahm er etwas und verkeilte das Astloch, wo er heraus gekrochen war, und stieg geschwind herab und verkeilte auch das untere Loch und machte es mit schwarzer Kunst so fest, dass es der Teufel selbst und seine Großmutter und die ganze Hölle nicht wieder aufbringen konnten. Danach ging er seiner Wege.
Und da steckte nun der Teufel in der alten Buche und konnte nicht heraus kommen, und es half ihm alles nichts, er musste drin stecken bleiben. Und da hat er lange Zeit darin gesteckt, und vielmal zu jener Zeit, wenn die Leute des Wegs über jenen Berg gegangen sind, da haben sie ihn darin hören blöken und grunzen in seiner Buche.
Endlich aber, wie der Holzschlag dort hinauf gekommen ist, da ist die Buche abgehauen worden. Da ist er endlich wieder heraus gekommen und ist wieder frei geworden, der Teufel. Wie er nun wieder los war, da machte er sich auf und ging heim in die Hölle und wollte sehen, wie es aussähe.
Aber da war alles leer darin, wie es in der Kirche in der Woche ist, und war keine Seele mehr zu hören noch zu sehen. Seit der Teufel damals fort gegangen und nicht wieder gekommen war, und auch kein Mensch nicht gewusst hatte, wo er hingekommen war, da war nicht eine einzige Seele wieder in die Hölle gekommen.
Und da war seine Großmutter aus Herzeleid gestorben, und wie die tot war, da packten alle die armen Seelen, die dazumal in der Hölle waren, auf und machten sich auf und davon und gingen alle miteinander in den Himmel.
Und da stand er, Maus-Mutter-Stern-allein in der Hölle, und wusste seines Leides keinen Rat, wie er es wohl anfinge, dass er wieder arme Seelen bekäme, weil er es nicht mehr tun durfte, und hatte es damals bei seiner Großmutter verschwören müssen, dass er von keinem Menschen sich wieder wollte die Seele verschreiben lassen, und auf andere Weise bekam er damals keine Menschen in die Hölle.
Und da stand er und wusste seines Herzeleids kein Ende und wollte sich die Hörner aus dem Kopfe raufen vor lauter Herzeleid und Jammer. Da fiel ihm auf einmal etwas ein. Wie er in der alten Buche gesteckt hatte und nicht heraus gekonnt, da war ihm zuletzt die Zeit lang geworden, und da hatte er über allerlei nach simuliert und den Branntwein erdacht und erfunden.
Das fiel ihm alleweil mitten in seinem Herzeleid wieder ein, und da dachte er sich, das müsse ein Mittelchen sein, wie er doch wieder arme Seelen in die Hölle bekommen könne. Und da packte er auf der Stelle auf und ließ die Hölle Hölle sein und ging nach Nordhausen und wurde ein Schnapsbrenner und machte Branntwein drein und drauf und schenkte ihn in die Welt hinein.
Und er zeigte auch den Nordhäusern allen miteinander, wie der Schnaps gemacht wird, und versprach ihnen viel Geld und Gut, wenn sie es lernten und Branntwein brannten. Und die Nordhäuser ließen es sich auch nicht zweimal sagen und wurden alle Schnapsbrenner und machten Branntwein und schenkten ihn in die Welt hinein.
Seit dieser Zeit schreibt es sich her, dass bis auf den heutigen Tag so viel Branntwein in Nordhausen gebrannt wird wie an keinem anderen Orte in der ganzen Welt.
Aber wie es sich der Teufel gedacht hatte, also ging es auch. Wenn die Leute erst ein wenig Branntwein im Leibe hatten, da fingen sie an zu fluchen und zu schwören, und fluchten und schwuren ihre Seele zum Teufel, dass sie der Teufel bekam, wenn sie gestorben waren, und brauchte ihnen darum nicht zu dienen, wie er sonst hatte tun müssen, wenn er eine arme Seele hatte haben wollen.
Und wenn sie sich den Kopf erst richtig voll gesoffen hatten im Branntwein, da fingen sie auch an und zankten sich und prügelten sich und brachen sich selber die Hälse, dass sich der Teufel nicht erst brauchte die Mühe zu geben und brauchte sie ihnen herum zu drehen.
Und wenn der Teufel sonst mit aller Mühe und Not hatte alle Wochen einmal eine arme Seele in die Hölle bekommen können, da kamen sie jetzt Dutzend- und schockweise alle Tage hinein, und es dauerte kein Jahr, da war die Hölle zu klein geworden und konnte der Teufel die Seelen nicht mehr unterbringen und musste ein ganz neues Stück lassen anbauen an die Hölle.
Und kurz und gut, seit der Teufel aus der alten Buche jenes Mal wieder los gekommen ist, seit der Zeit ist der Branntwein aufgekommen, und seit der Branntwein in der Welt ist, da kann man erst recht eigentlich sagen: "Der Teufel ist los! "
DES HUNDES NOT ...
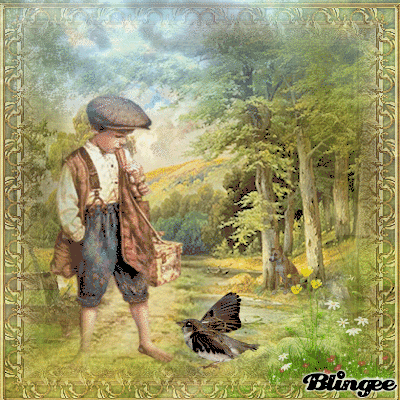
Es war ein Hund, der lag hungrig und kummervoll auf dem Felde, da sang über ihm eine Lerche ihr wonnigliches Lied. Als der Hund das hörte, da sprach er: "O du glückliches Vögelein, wie froh du bist, wie süß du singst, wie hoch du dich aufschwingst! Aber ich - wie soll ich mich freuen? Mich hat mein Herr verstoßen, seine Türe hinter mir versperrt, ich bin lahm, bin krank, kann kein Essen erjagen und muss hier Hungers sterben! "
Wie die Lerche den hungrigen Hund so klagen hörte, flog sie nahe zu ihm und sprach: "O du armer Hund! Mich bewegt dein Leiden, wirst du mir auch Dank wissen, wenn ich dir helfe, dass du satt wirst? "
"Womit, Frau Lerche?" fragte der Hund mit matter Stimme, und die Lerche antwortete: "Sieh, dort kommt ein Kind gegangen, das trägt Speise zu jenem Ackersmann; ich will machen, dass es die Speise niederlegt und mir nachläuft, indes gehst du hinzu und isst den Käse und das Brot und stillst deinen Hunger! "
Der Hund bedankte sich für dieses freundliche Anerbieten, und die Lerche flog nun dem Kind entgegen und begann es zu äffen. Bald lief sie vor ihm, bald flatterte sie auf dieser, bald auf jener Seite, bis das Kind dachte: "Die Lerche muss ich fangen."
Die Lerche stellte sich flügellahm und ließ einen ihrer kleinen Flügel hängen wie gebrochen. Das Kind griff oft nach ihr, aber tat es vergebens mit der einen Hand, und da legte es sein Tüchlein nieder, darin es das Essen trug, und lief der Lerche nach, die immer voran in einen Grund flog; indessen erhob sich der Hund, hinkte nach dem Tuch und schnüffelte hinein, da lag ein Stück Brot, ein Quarkkäse und vier gute Eier, die fraß er ungesotten und ungeschält und danach den Käse, und das Brot nahm er mit, als er fortkroch und sich im Korn versteckte.
Die Lerche, als sie merkte, dass der Hund sein Teil hatte, flog in die Lüfte und sang lustig; das geäffte Kind aber verwünschte sie und noch viel mehr, als es sein Tüchlein leer fand. Weinend ging es zurück zu seiner Mutter, und ob es Schläge bekommen hat, weiß ich nicht; es wird aber wohl etwas dergleichen abgefallen sein.
Die Lerche flog zum Hund hin und fragte ihn, wie er sich jetzt befinde? Er sagte ihr schönen Dank, und nie sei ihm wohler gewesen. "Nur eine Bitte, liebe Frau Lerche, habe ich noch auf dem Herzen", sprach er, "wer satt ist, der ist gern froh. O bitte, erzählet mir noch etwas, davon ich ein wenig lachen und lustig werden kann."
"Wohlan!" sprach die Lerche. "Folge mir." Und da flog die Lerche voran, und der Hund folgte ihr zu einer Scheuer, auf deren Dachboden man von der Erde leicht gelangen konnte; da hinauf hieß die Lerche den Hund steigen und hinuntergehen, denn der Boden war schadhaft und durchgebrochen.
Unten auf der Tenne standen zwei Kahlköpfe, die droschen; da setzte sich flugs die Lerche dem einen auf die Glatze, und flugs klapste der andere mit der Hand darauf, vermeinend, die Lerche zu fangen; das kluge Vöglein war aber schneller als er und flog zur Seite.
"Nun, Geselle, was soll das? Was schlägst du mich?" fragte der erste Kahlkopf den anderen. Der entschuldigte sich, dass ein Vöglein sich jenem auf den Kopf gesetzt, dieses habe er fangen wollen; habe der Klaps weh getan, sei es ihm leid.
Indem setzte sich die Lerche auf die Glatze dessen, der eben sprach, und da schlug gleich der andere hin, so hart, dass der Kopf gewiss zersprungen, wenn er von Glas gewesen wäre, wenigstens brummte er dem Geschlagenen tüchtig.
Nun ging gleich das Schelten los, und beide Drescher warfen ihre Flegel hin und wollten einander in die Haare. Weil sie nun keine Haare hatten, so konnte keiner dem anderen welche ausraufen, und so kratzten sie einander und stießen sich hart; da ging es Glatz wider Glatz und Kratz wider Kratz, auch zerrten sie sich an den Ohren, und darüber musste der Hund so unbändig lachen, dass ihm ganz weh wurde, und er weder liegen noch stehen konnte, und da purzelte er vor Lachen von dem Boden hoch herunter, den Dreschern gerade auf die Kahlköpfe, dass sie stutzten, denn der Hund war schwer, und diese Art, Haare auf den Kopf zu bekommen, kam ihnen spanisch vor.
Sie wandten ihren Zorn gleich vereint gegen den Hund, und da sie Drescher waren, so droschen sie ihn, so lange, bis er mit Ach und Krach durch ein Loch in der Scheuerwand und durch den Zaun fuhr, wobei ihm nicht nur das Lachen, sondern schier Hören und Sehen verging.
Ganz mürb und krumm legte er sich in das Gras hinter den Zaun, und da kam die Lerche geflogen und fragte: "Edler Herr, wie befinden Sie sich? "
"Ach, Frau Lerche", ächzte der Hund, "ich habe vollauf genug. Ich bin ein ganz geschlagener Mann! Ich glaube, meiner Treu, ich habe gar keinen Rücken mehr, die Drescher haben mir das Fell bei lebendigem Leibe abgeschunden und gegerbt. Ach, soll ich länger leben, so muss ich einen Wundarzt haben!"
"Wohl und getrost! Ich hole dir auch den, so es irgend möglich ist", sprach die Lerche und flog von dannen. Bald fand sie einen Wolf, den redete sie an: "Herr Wolf? Ihr habt wohl gar keinen Appetit? " "Ach, Frau Lerche", war die Antwort, "was das betrifft, so kann ich mit Wolfshunger dienen."
"Nun, wenn Ihr mir es danken wollt", sprach die Lerche weiter, "so wollte ich Euch wohl weisen, wo ein feister Hund liegt, der Euch kaum entrinnen wird! "
"O meine edle Königin, wie gnädig Ihr seid!" schmeichelte und schmunzelte der Wolf und leckte sich die Zähne.
Die Lerche flog vor ihm her, und er folgte ihr, und wie sie zu dem Hund kam, redete sie ihn an: "Nun, Geselle? Schläfst du? Willst du nicht den Arzt sehen? Richte dich auf, dort kommt der Doktor!"
"Wo? Frau Lerche, wo?" fragte der Hund ganz müde; aber als er den Wolf sah, da schrie er: "Nein, Frau Lerche, nein! Diesen Doktor nicht! Haltet ihn zurück! Ich bin gesund!" Und mit einem Satz war der Hund auf den Beinen und fort - dass ihm kein Zaun zu hoch und kein Graben zu breit war.
DIE DANKBAREN TIERE ...

Es reiste einst ein Pilger über Land, der kam auf seinem Wege durch den Wald an eine Wolfsgrube und nahm wahr, dass etwas Lebendiges darin sei. Und wie er hinunterblickte, sah er darin einen Menschen, der war ein Goldschmied, und bei ihm war ein Affe, eine Schlange und eine große Natter. Die waren alle unversehens in die Grube gefallen.
Da dachte der Pilger bei sich: Übe Barmherzigkeit mit den Elenden und hilf den Menschen von seinen Feinden. Da warf er ein Seil in die Grube und hielt das eine Ende fest in der Hand, willens, den Goldschmied heraufzuziehen, schnell sprang aber der Affe herzu, kletterte herauf und sprang aus der Grube. Zum zweiten Mal warf der Pilger das Seil hinab, da ringelte sich die Natter daran empor. Und zum dritten Mal erfasste die Schlange das Seil und kam auch zutage.
Diese drei Tiere dankten dem Pilger für seine Güte und sprachen zu ihm: "Was du uns Gutes getan, das wollen wir dir wieder zu vergelten suchen, und wann dich dein Weg in unsere Nähe trägt, so magst du auf uns rechnen, dass wir nach Kräften dir zu Diensten sind; sei aber treulich gewarnt vor dem Menschen da drunten, denn nichts, was da lebt, ist so undankbar, wie er. Dieses haben wir erfahren und sagen es dir an, dass du weißt, dich zu verhalten. "
Damit schieden die drei Tiere von dem Pilger, dieser aber gedachte an seine Pflicht, dass dem Menschen zieme, dem Menschen zu helfen, und er warf das Seil wiederum in die Grube und zog den Goldschmied heraus. Dieser bedankte sich mit vielen Worten für die Gnade und Barmherzigkeit, die der Pilger an ihm getan. Er bat, ihn ja in der Königsresidenz, wo er wohne, zu besuchen und verließ ihn.
Auf seinem weiteren Weg kam der Pilger in die Nähe der Residenz und an den Ort, wo der Affe, die Natter und die Schlange wohnten. Die freuten sich, und der Affe brachte ihm, der sehr ermattet war, Obst und süße Feigen, die Natter zeigte ihm eine kühle, angenehme Grotte, wo er ruhen und rasten konnte, und legte sich davor und bewachte seinen Schlaf, denn niemand wagte sich dorthin, wo die große Natter lag.
Die Schlange aber schlüpfte in die Königsburg und stahl dort einige goldene Kleinode, die gab sie dem Pilger zur Verehrung, sagte ihm aber nicht, woher sie die selben hatte. Als dieser von den Tieren aufbrach, ging er in die Königsstadt und suchte den Goldschmied auf, dem zeigte er die Kleinode und bot sie ihm zum Kauf an.
Der Goldschmied sah, dass sie des Königs Eigentum waren, schwieg still, ging zum König und zeigte an, dass er den Dieb dieser Kleinode in seinem Haus gefangen habe. Dafür empfing er eine stattliche Belohnung, und der König sandte seine Häscher, die fingen den Pilger, schlugen ihn, führten ihn durch die Straßen und hinaus zum Galgen, um ihn zu henken.
Da gedachte der alte Mann auf dem Wege an die Warnung der Tiere und seufzte laut: "O hätte ich euren Rat befolgt, ihr getreuen Tiere, so wäre diese Trübsal mir nicht beschieden worden! "
Nun hatte die Schlange just ihre Wohnung an dem Weg, der zum Hochgericht führte, und hörte die Klagerede des unschuldigen Mannes, an dessen Unglück sie mit schuld war und betrübte sich und dachte darauf, wie sie ihm helfen könne.
Da nun der Königssohn, ein junger Knabe, auch des Weges geführt wurde, damit er des Diebes Strafe zusehe, kroch sie hin und biss ihn in das Bein, dass es bald aufschwoll. Da blieb alles Volk erschrocken stehen und man sandte eiligst nach Ärzten und nach Astrologen die helfen sollten.
Die Ärzte brachten Theriak herbei, eine Arznei, die gepriesen war gegen den Schlangenbiss, er half jedoch nichts. Die Astrologen aber lasen in den Sternen, dass der zum Tode geführte Pilger unschuldig war, und der Königsknabe rief selbst mit heller Stimme: "Bringt mir den Mann her, dass er seine Hand auf meine Wunde und mein Geschwulst lege, so werde ich heil sein! "
Da wurde der Pilger vor den König geführt, der fragte nach seinem Schicksal, und der Pilger erzählte dem König alles treulich, von den guten dankbaren Tieren und dem schändlichen Undank des Goldschmieds, den er vom Tod errettet. Und dann hob er Hände und Augen zum Himmel und flehte: "O allmächtiger Gott, so wahr es ist, dass ich unschuldig bin an dem Diebstahl, so wahr wird meine Hand diesen Menschen heilen!" -
Und da wurde von Stund an der Königssohn gesund. Als das der König sah, wurde sein Herz froh und freudvoll. Er ehrte den Pilger mit köstlichen Gaben, ließ ihm auch alle Kleinode, um derentwillen der Pilger Todesangst ausgestanden hatte, und ließ den Goldschmied auf der Stelle henken, zur Strafe seines großen Undanks.
DIE BEIDEN KUGELRUNDEN MÜLLER ...
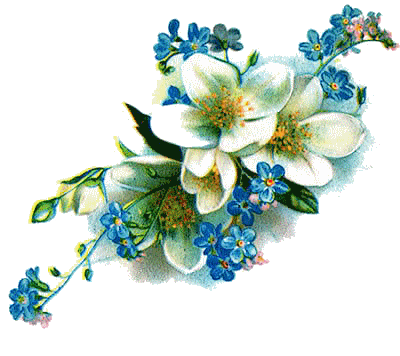
Es war einmal ein Müller, der war schon an sich sehr stark und dick, wollte aber auch fest sein gegen Hieb und Stich, gegen Bolz und Pfeil, darum steckte er sich in eine wunderliche Kleidung.
Er ließ sich zuvörderst ein Wams machen, das fütterte er mit Kalk und Sand, und ließ, um das zu verbinden, geschmolznes Pech hineinfließen, hinten machte er ein Futter von mehreren Körben und vorn beblechte er es mit alten Reibeisen und eisernen Hafendeckeln, da wurde das Wams schwerer als der schwerste Brust- und Rückenharnisch, den jemals ein streithafter Ritter trug.
Darüber zog dieser Müller nun drei Hemden, und unter das Wams legte er einen wirklichen Panzer an, über die Hemden auch einen Panzer, und darüber zog er neun lodene Röcke, wie sie die Wollenweber im Schwabenlande noch heute fertigen.
Wenn nun der Müller sich mit diesem stattlichen Kleiderbollwerk angetan, wobei er die Beine mit mehr als vier alten übereinander gezogenen Lederhosen verwahrt, so war er ein so stattliches kugelrundes Kerlchen, dass er eben so breit war als hoch, wie eine rechte Kugel sein muss, und konnte schier nicht ohne Gezwang durch ein Stadttor aus- und eingehen, konnte sich auch kaum rühren und regen, und musste denn seine Freundschaft mit ihm gehen, ihn führen und geleiten.
Da er nun alljährlich zu St. Oswalds Kirchtag ging und sich auch sehen lassen wollte vor den Leuten, so fuhr er einher auf einem Karren in seiner Rüstung und so gewappnet, wie jedermänniglich noch nie gesehen hatte. Den Wagen zogen vier starke Ochsen, und hinterdrein gingen alle Bauern seines Orts mit ihren Weibern und Kindern, die steckten sich, wenn sich ein Feind zeigte, hinter ihres Müllers Karren, wie hinter eine Feste und Schirmhut.
Er war gewaffnet mit zween Spießen und einer Armbrust, an seiner Seite hing ein Schwert einer Mannslänge lang, ein Zweihänder; und neben ihm lag noch ein Bogen nebst einem Pfeilköcher.
Wenn nun der kugelrunde Müller mit seinem Karren und seinen vier Ochsen an einen gewissen Berg kam, über welchen der Weg führte, so harrten seiner dort ein paar Neffen mit Weib und Kindern, die halfen den Wagen in die Höhe hinauf schieben, während vorn noch sechs Ochsen als Vorspann zogen, und so brachten sie ihn denn endlich hinauf mit Ach und Krach und Vergießung vieler Schweißtropfen.
Ging es nun auf der anderen Seite des Berges wieder abwärts, so musste eingehemmt werden so viel als nur möglich, dass es nicht mit dem Kugelrunden kopfüber kopfunter ging. Wenn seine Sippschaft ihn nun endlich am Ziele hatte, so wurde er mit Leitern und Hebebäumen vom Wagen herabgeschrotet, wie ein großes volles Weinfass, und dann scharten sie sich um ihn her und zumeist hinter ihm wie die Philister hinter ihrem Goliath.
Dabei war der runde Mehlsack von großer Stärke und Unerschrockenheit, und es ging von ihm die Rede, dass er einst in einem Schimpfspiel, wo ein Kämpfer einen Apfel, der andre eine Birne an der Spitze seiner Klinge geführt, und sich ein großer Lärm erhob, dermaßen in den Haufen mitten hinein geschlagen, wie ein Hagelschauer in das Getreide, so dass er vielen Bauern viel Leids gebracht.
Aber da war ihm ein Gegner entgegengetreten, stark und kräftig, der führte einen Hauptstreich nach dem Müller, dass seine Blechhaube gleich zu Boden fiel, und meinten alle, die das sahen, der Kopf wäre mit vom Rumpfe geflogen; der kugelrunde Kämpe hatte aber, wie sein Gegner ausholte, seinen Kopf aus der Haube schnell heraus unter die hohe Halsberge gezogen, und jetzt tat er einen Streich nach dem Gegner, der ihm so tief in den Hals schnitt, wie die Sense des Mähers in das Gras. Da fürchteten sich alle vor dem gewaltigen Mann, dem die Taten, die man von Recken las, nur ein Spaß schienen.
Nun war aber ein andrer Müller in der Nachbarschaft, der war ebenso stark und groß, ebenso kugelrund und trug auch so ein wohlausgefüttertes und geblechtes Wams, und keiner mochte den anderen leiden, weil keiner dem anderen nachstand.
Und hassten und bekriegten einander schon zehn Jahre. Auf jedem Kirchweihtag, wo sie hin kamen, gerieten sie aneinander, und fochten gegeneinander mit Worten und Waffen; es konnte aber ihrer keiner dem anderen etwas anhaben, und beide waren zwei gar sehr gefürchtete Kampfhelden.
Der eine Müller hatte einen Sohn, der andere eine Tochter, welche beide einander so sehr liebten, als die Väter einander hassten, darüber wurde der Zwiespalt noch größer, bis endlich gute und einsichtsvolle Freunde sich ins Mittel schlugen und beiden Müllern rieten, gute Freunde zu werden und ihre Kinder miteinander zu verheiraten.
Wie das Gerücht vom Bündnis der beiden Müller ins Land erscholl, und dass sie sogar ihre Kinder miteinander verheiraten wollten, da erhob sich große Unruhe und Besorgnis, denn jedermänniglich konnte sich nun an den Fingern abzählen, dass die beiden Kugelrunden sein würden wie zwei Mühlsteine, zwischen denen alles, was ihnen zu nahe käme, würde aufgerieben werden.
Und wer jetzt dem einen Müller zu nahe trat, der hatte es gleich mit beiden zu tun, und konnte kein Fürst beide Wämser überwinden, denn die Müller glichen runden Burgen, waren auch nicht auszuhungern durch eine Belagerung, denn sie hatten auch in ihren Wämsern manche Metze gefasst, von der sie zehren konnten lange Zeit.
Da aber nun die beiden unüberwindlichen Helden also mannhaft waren, dass selbst der Kaiser große Mühe gehabt haben würde, sie zu überwältigen, so musste man nur froh sein, dass sie ihre große Macht gegen die Feinde des Reiches kehrten, und begehrten gar keinen Sold und Lohn, sondern nur die Ehre, fechten und streiten zu dürfen.
Und war das nur ihre einzige Klage, dass so mancher Tag verging, an dem sie keines Gegners ansichtig wurden, weil ihr Ruf so weit und breit genannt war, dass sich alles vor ihnen fürchtete.
Viele tapfere Taten vollführten die beiden kugelrunden Müller, seit sie miteinander verbunden waren, und wenn man diese Taten und die Abenteuer, die durch sie bestanden wurden, niedergeschrieben hätte, so wäre das ein Buch geworden, zweimal so stark wie die Bibel und die Weltchronik.
Auch taten sie mehr Wundertaten als alle die Recken, von denen die alten Lieder und Geschichten sagen. Endlich schlugen sie ihre Wohnung in einer Wüste hinten an der Welt Ende auf, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch.
DIE HOFFÄRTIGE BRAUT ...
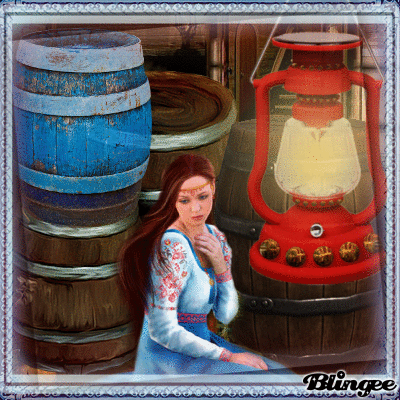
Ein Pfarrer hatte eine schöne Tochter, die war über die Maßen eitel und hoffärtig, also dass sie jeden jungen Burschen, der sich in ihr hübsches Lärvchen vergaffte, über die Achsel ansah, denn sie trug das Näschen so hoch, dass sie sich einbildete, irgendein reicher Graf oder gar ein Prinz müsse kommen und sie heimfahren.
Der Pfarrer war darüber sehr betrübt, weil er sie gern an einen braven Mann, am liebsten an einen Amtsbruder, verheiratet hätte. Wollte man aber glauben, die schöne Pfarrerstochter habe gar nicht nach den Männern sich umgesehen, so würde man sehr irren; jeden schönen jungen Mann, wenn er nur vornehm gekleidet war, musterte sie mit verstohlenen Blicken, ob sie nicht aus irgendeiner Falte den verkappten Prinzen herausfinde.
Das kränkte den Vater noch mehr, und er hatte gar nicht Augen genug, sie zu hüten. Einst musste er eine notwendige Reise unternehmen und die Tochter unter der Obhut der alten Magd zurück lassen. Er schärfte ihr aufs strengste ein, fein sittsam zu Hause zu bleiben, ja nicht einmal zum Fenster hinauszusehen; aber es ist eine bekannte Sache, dass man manchen Frauen nur verbieten darf, was sie tun sollen, so tun sie es gewiss.
Der Vater hatte kaum den Rücken gewendet, als die gehorsame Tochter schon zum Fenster hinaus sah, und siehe da, der Zufall wollte es, dass ein junger schöner Herr auf einem stolz sich räumenden Rosse die Straße daher sprengte; sie konnte sich nicht satt an ihm sehen, und auch er hatte sie bemerkt, denn er wandte mehrmals den Kopf nach ihr um.
Es war ihr auf einmal so sonderlich zu Sinn, als sei es ihr angetan; sie hatte keine Ruhe und Rast und hätte vor Freude laut aufjubeln mögen, als ein zierlich gefaltetes Briefchen an sie kam, worin sie gebeten wurde, sich zu der und der Stunde an einem bestimmten Orte einzufinden.
Die Glocke hatte noch nicht geschlagen, als sie, aufs beste geschmeckt, sich auf den Weg machte; die alte Magd wurde durch eine Notlüge begütigt, und so stand die Pfarrerstochter bald vor dem jungen schönen Manne, den sie ins Herz geschlossen.
Dieser war denn auch nicht blöde, gestand ihr, dass er sie liebe, Küsse und Schwüre wurden ausgetauscht, und der Fremde, der sich für einen Baron ausgab, versprach ihr, in den nächsten Tagen wiederzukommen und sie auf sein Schloss, das er ihr nannte, heimzuführen.
Die Pfarrerstochter schwamm von nun an in Lust und Wonne; Baronin zu werden erreichte zwar nicht das Ziel ihrer Wünsche, aber der Baron war so schön und fein, wie wohl mancher Fürst nicht. Aber Tag um Tag verging, und er kam nicht, sie abzuholen, auch der Vater war noch nicht von seiner Reise zurückgekehrt.
Darüber wurde die schöne junge Braut ungeduldig und entschloss sich kurz, den Baron selbst heimzusuchen. Sie schmeckte sich deshalb mit ihren besten Gewändern und all ihrem Geschmeide, steckte ein großes Stück Schinken zu sich und machte sich zur Nachtzeit auf den Weg .
Vor der Tür lag aber ein großer Kettenhund, der fing an zu knurren, als sie sich behutsam davon schleichen wollte und murrte:
"Bleibst du da, so bist du klug!
Gehst du fort, so siehst du Trug! "
Aber sie hörte nicht darauf und schnitt ein Stück von ihrem Schinken ab, warf es dem Wächter hin, und während dieser danach schnappte und daran kaute, eilte sie davon.
Sie musste lange lange gehen, bis sie das Schloss ihres Geliebten vor sich aufsteigen sah; mit klopfendem Herzen stieg sie den Berg hinan und trat ungehindert in das Tor, das offen stand und nur von einem großen mächtigen Hund bewacht wurde, der sie mit feurigen Augen ansah und murrte:
"Kehrst du um, so ist es gut,
Bleibst du da, so siehst du Blut! "
Aber sie warf auch ihm ein Stück Schinken vor, und er ließ sie eintreten. Alles im Schloss war aber so wunderbar ruhig, dass ihr fast graute.
Sie stieg die Wendeltreppe hinan, trat in das erste beste Gemach, wo verschiedene männliche Kleidungsstücke unordentlich umher lagen, von diesem in ein zweites, das mit allerlei Waffen angefüllt war, darauf in ein drittes, das noch die Spuren eines wüsten Zechgelages an sich trug, und endlich in ein viertes, in dem an beiden Seiten große Fässer standen.
Sie wollte eben in das folgende treten, als sie Stimmen hörte; rasch verbarg sie sich hinter einem Fass und sah bald den Baron und mehrere wild aussehende Gesellen hereintreten, die ein junges, schön geschmücktes Frauenzimmer mit sich schleppten.
Das Frauenzimmer wimmerte leise und rang flehend die Hände, als der Baron mit rauer Stimme zu ihr sagte: "Bereite dich zum Tode!" Sie beschwor ihn bei seiner Liebe, sie zu schonen; er möge all ihren Schmuck nehmen, und sie wolle ihm schwören, nichts zu verraten, nur möge er sie zu ihrem armen Vater heimkehren lassen.
Der Baron sagte kalt: "Du musst sterben! Und du wirst bald Gesellschaft bekommen, die Tochter eines Pfarrers, auch so ein hoffärtiges Ding als du, wird dir folgen!"
Da gerann der Versteckten freilich das Blut zu Eis, aber sie hatte noch so viel Besinnung, sich mit keinem Atemzug zu verraten. Und bald hörte sie das Röcheln der Sterbenden, deren Blut über die Dielen floss bis in ihr Versteck, und sie musste sehn, wie die wilden Gesellen ihren Schmuck abnahmen und ihr die Ringe von den Fingern ziehen wollten; die Finger waren aber geschwollen, deshalb griffen die Mörder nach einem Beile und hackten sie ab.
O Entsetzen, einer davon sprang auf den Schoß der Pfarrerstochter! Sie hätte laut aufgeschrien, wenn der Schreck ihr nicht die Zunge gelähmt hätte. Die Räuber suchten nach den Fingern und vermissten den einen. Wehe, wenn sie sorgfältig danach suchten, und das schienen sie wirklich tun zu wollen, und einer näherte sich schon dem Fasse, hinter dem die Pfarrerstochter verborgen war.
Diese betete in ihrer Angst gar inbrünstig zum Himmel und das Gelübde, alle Hoffart abzulegen, wenn sie nur diesmal aus der Mörderhöhle befreit würde. Da sprach der Baron: "Genug für heute; morgen ist auch ein Tag; ich bin schläfrig und müde." Die Gesellen ließen ab vom Suchen und begaben sich in das anstoßende Gemach, durch welches die Pfarrerstochter gekommen war.
Bald hörte sie ein tiefes Schnarchen und dachte nun daran, das Schloss wieder heimlich zu verlassen. Sie schlich auf den Zehen aus ihrem Versteck, aber, o wehe! die Schläfer lagen knapp an der Schwelle und so dicht aneinander, dass sie nicht über sie hinweg schreiten konnte, ohne sie zu berühren.
Sie fasste sich jedoch ein Herz, in dem sie dachte: bleibst du hier, so bist du gewiss verloren, wagst du jetzt zu entfliehen, so gelingt dir es vielleicht! Mit Gott und keck schritt sie über die Schläfer hinweg.
Da regten sich diese, stießen sich an, und einer sprach zum anderen: "Was stößt du mich denn?" "Der Satan vergelte es dir, du hast mich gestoßen!" antwortete der andere, und sie gerieten darüber fast in Streit, schliefen aber wieder ein, während das Mädchen sich nieder geduckt hatte.
Als sie fest schliefen, eilte das Mädchen durch die anderen Gemächer, die Wendeltreppe hinab, warf dem Hunde den Rest ihres Schinkens vor und flog davon, so schnell sie konnte.
Zum Tod erschöpft kam sie an ihres Vaters Hause an. Er war zurückgekehrt, und sie fand ihn in großer Sorge um sie. Sie gestand ihm alles mit Tränen, zeigte ihm den Finger, den sie mitgenommen, und er dankte Gott für ihre Rettung und nahm sich vor, den Bösewicht zu entlarven.
Einige Tage vergingen, als der schöne junge Baron wieder durch das Dorf ritt und die Pfarrerstochter zu sich berief. Der Pfarrer gab ihr Anweisung, was sie tun solle, und schön geschmückt ging sie nach dem Platz des Stelldicheins.
Er sagte, er sei gekommen, sie mit auf sein Schloss zu nehmen; sie aber tat ängstlich und sagte, sie habe einen bösen Traum gehabt. Als er in sie drang, ihm den Traum zu erzählen, da schilderte sie alles, was ihr wirklich begegnet war, dass der Baron sie betroffen ansah, jedoch sie mit den Worten zu beruhigen suchte:
"Träume sind Schäume, liebes Kind!" "Aber der Traum war gar zu natürlich", antwortete sie, "so natürlich, dass ich selbst den Finger noch habe, der mir auf den Schoß flog." Dabei zog sie den Finger aus der Tasche.
Als den der Baron sah, zog er einen Dolch und wollte sie niederstoßen; er hatte jedoch nicht Zeit dazu, denn er sah sich von Häschern umringt und fest gehalten. Man durchsuchte das Schloss, fing die ganze Bande des Räubers und fand eine Menge geraubter Kostbarkeiten.
Die Fässer aber waren alle voll Menschenfleisch. Dem Baron und seinen Gesellen wurde ihr Recht angetan, die Pfarrerstochter war ganz von ihrer Hoffart geheilt und ist später die brave Hausfrau eines Landgeistlichen geworden.
DIE JAGD DES LEBENS ...

Es war einmal ein Jäger, der ging zu Wald in eine öde Wildnis, dort zu jagen. Da kam er einem Tiere auf die Fährte, als er dieses aber endlich entdeckte, wünschte er es nimmer mehr gesehen zu haben, denn es war ein mächtiges Einhorn, welches sich gegen ihn stellte.
Eilig wandte er sich zur Flucht, und stets verfolgte ihn das Einhorn, bis er auf eine steile Felswand kam, deren schroffen Abhang tief unten die Wellen eines dunklen Sees bespülten.
In dem See schwamm ein ungeheurer Drache, der den Rachen gähnend aufriss, und plötzlich glitt der Jäger aus und wäre gerade hinab in den See und in des Drachen Schlund gestürzt, wenn er nicht an einem einer Felsritze entsprossten Strauch sich festgehalten hätte.
Da war nun des Jägers Lage eine Tod ängstliche. Droben stand, wie ein Wächter, das schreckliche Einhorn, drunten lauerte auf seinen Hinabsturz der gräuliche Seedrache. In dieser Not ward seine Angst und Qual aber noch vermehrt, denn mit einem Male erblickte er zwei Mäuse, eine weiße Maus und eine schwarze Maus; die begannen an den Wurzeln der Staude zu nagen, und der Jäger vermochte nicht, sie hinweg zu scheuchen, weil er sich mit beiden Händen anhalten musste.
So musste er jeden Augenblick gewärtig sein, dass die Wurzeln des Strauchs diesen nicht mehr halten würden. Über ihm stand ein Baum, von dem träufelte süßer Honig nieder, und gar zu gern hätte der Jäger diesen Baum erlangt, denn damit meinte er aller Qual erledigt zu sein, und über den Baum vergaß er aller ihm drohenden Gefahr.
Wir wissen nicht, ob es ihm gelungen ist, aus seiner dreifachen Qual erlöst zu werden, oder ob die Mäuse des Strauches Wurzeln ganz abgenagt hatten.
Der alte Dichter dieser Märe gibt ihr eine allegorische Deutung, in dem er sagt:
Der Jäger, das ist der Mensch, und das Einhorn, das ist der Tod, der ihm begegnet, ehe er es vermeint, und ihn immerdar verfolgt. Die steile Felswand ist die Erde, und der Strauch ist das Lehen, daran der Mensch nur mit schwachen Banden hängt.
Die weiße und die schwarze Maus, welche das Leben an der Wurzel benagen, sind Tag und Nacht oder die rastlose Zeit, die an unserm Leben zehrt. Der dunkle See ist die Hölle, und sein Drache der Teufel, die darauf lauern, dass der Mensch falle und in ihren Rachen stürze.
Der Honigbaum aber ist die Liebe, die das Leben versüßende, welcher der Mensch zustrebt und sie zu erlangen hofft zwischen Not und Tod, zwischen Qual und Pein, keiner Gefahr achtend, und mit deren Erringung er seine irdische Seligkeit findet.
Doch soll der Mensch sich täglich hüten, da die Mäuse ihm an der Lebenswurzel zehren, dass er nicht in den See des Verderbens falle.
DIE NONNE, DER BERGMANN UND DER SCHMIED ...
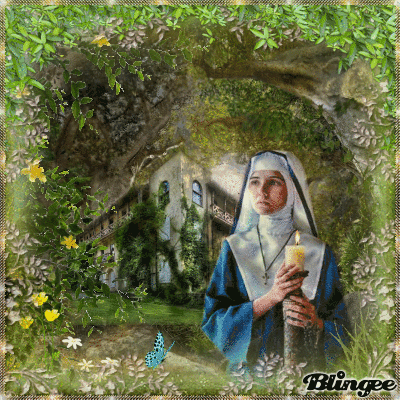
Eine Nonne, ein Bergmann und ein Schmied wanderten miteinander durch die Welt. Einmal hatten sie sich in einem großen finsteren Walde verirrt, so dass sie froh sein mussten, als sie endlich in der Ferne ein Gemäuer erblickten, darin sie Obdach zu finden dachten.
Sie gingen also darauf zu und sahen, dass es ein altes wüstes Schloss war, schon halb verfallen, doch noch so weit erhalten, dass man allenfalls und zur Not noch darin wohnen konnte. Darum beschlossen sie, darin zu bleiben, und hielten Rat, wie sie sich einrichten wollten.
Bald wurden sie einig, dass immer eins von ihnen daheim bleiben und die Wirtschaft bestellen sollte, während die beiden anderen aus wären, um Nahrungsmittel herbeizuschaffen.
Das Los, zu Hause zu bleiben, traf zuerst die Nonne. Als nun der Bergmann und der Schmied in den Wald gegangen waren, so besorgte die Nonne die Küche, und als ihre Gefährten zur Mittagszeit nicht heimkamen, verzehrte sie einstweilen ihren Teil von der Mahlzeit.
Da trat auf einmal ein graues Männchen zur Tür herein, schüttelte sich und sprach: "O wie friert mich!" Die Nonne antwortete: "Setze dich zum Ofen und wärme dich." Das Männchen tat, wie ihm die Nonne gebot, aber bald rief es: "O wie hungert mich!" Die Nonne sagte: "Auf dem Ofen steht Essen, so iss."
Da machte sich das Männchen über das Essen und aß in Geschwindigkeit alles auf, was da war. Darüber wurde die Nonne zornig und schalt es, dass es für ihre Gefährten gar nichts übrig gelassen hätte. Da geriet auch das Männchen in einen großen Zorn, nahm die Nonne, schlug sie und warf sie von einer Wand zur anderen. Darauf ließ das böse Männchen die Nonne liegen und ging seines Weges.
Am Abend kamen die beiden Gefährten der Nonne nach Hause, und als sie hungrig ihr Essen verlangten und nichts mehr fanden, so machten sie der Nonne heftige Vorwürfe und wollten ihr nicht glauben, als sie ihnen erzählte, was ihr widerfahren wäre.
Den folgenden Tag erbot sich der Bergmann, das Haus zu hüten, und versprach, er werde schon dafür sorgen, dass niemand hungrig zu Bette gehen müsse. So gingen nun die beiden anderen in den Wald, und der Bergmann besorgte das Essen, verzehrte seinen Teil und setzte dann das übrige auf den Ofen.
Da trat das Männchen herein, aber wie erschrak der Bergmann, als er sah, dass es zwei Köpfe hatte. Es schüttelte sich und sprach: "O wie friert mich!" Ganz voller Furcht verwies es der Bergmann zum Ofen. Bald darauf fing es an zu Klagen: "O wie hungert mich!" "Auf dem Ofen steht Essen, so iss!" antwortete der Bergmann.
Da fiel das Männchen mit seinen beiden Köpfen über das Essen her, und bald war alles aufgezehrt und die ganze Schüssel wie ausgeleckt. Als der Bergmann das Männchen deswegen ausschalt, erging es ihm, wie es der Nonne ergangen war - das Männchen schlug ihn braun und blau, warf ihn gegen alle Wände, dass es krachte und ihm Hören und Sehen verging, ließ ihn dann liegen und ging davon.
Als nun am Abend der Schmied mit der Nonne heimkam und nichts für beider Hunger fand, geriet er mit dem Bergmann in Streit und vermaß sich hoch und teuer, morgen, wo an ihm die Reihe sei, das Haus zu hüten, da sollte es keinem an Essen fehlen.
Als am anderen Tage das Essen fertig war, kam das Männchen wieder, und diesmal hatte es drei Köpfe. Es klagte über Frost, und der Schmied hieß es, sich an den Ofen setzen.
Als es darauf über Hunger klagte, teilte der Schmied von dem Essen etwas ab und setzte es ihm hin. Damit war das Männchen geschwind fertig; es sah sich mit seinen sechs Augen begierig um und verlangte mehr, und als der Schmied sich weigerte, ihm mehr zu reichen, wollte es ihm mitspielen wie der Nonne und dem Bergmann.
Der Schmied aber war nicht faul, nahm seinen großen Schmiedehammer, ging auf das Männchen los und schlug ihm zwei von seinen Köpfen ab, so dass das Männchen seinen dritten Kopf zwischen die Ohren nahm und eilig die Flucht ergriff.
Der Schmied lief ihm durch viele Gänge nach, bis es bei einer eisernen Tür plötzlich vor ihm verschwand. Nun musste der Schmied es aufgeben, das Männchen weiter zu verfolgen, nahm sich aber vor, nicht eher zu ruhen, als bis er mit seinen beiden Gefährten alles glücklich bestanden hätte.
Indessen waren der Bergmann und die Nonne nach Hause gekommen. Der Schmied brachte ihnen, wie er versprochen hatte, ihr Essen und erzählte ihnen sein Abenteuer und zeigte ihnen die beiden abgehauenen Köpfe, die sie mit verdrehten Augen anstarrten.
Darauf beschlossen alle drei, sich von dem grauen Männchen, wenn es möglich wäre, ganz zu befreien, und gleich am folgenden Tage gingen sie ans Werk. Sie mussten lange suchen, ehe sie die eiserne Tür fanden, bei der das Männchen gestern verschwunden war, und es kostete große Mühe, ehe sie sie aufzusprengen vermochten.
Da tat sich ein weites Gewölbe vor ihnen auf; darin saß ein schönes junges Mädchen an einem Tisch und arbeitete. Sie sprang auf und fiel ihnen zu Füßen, in dem sie ihnen für ihre Befreiung dankte und erzählte, sie sei eine Königstochter und von einem mächtigen Zauberer hierher gebannt worden; gestern Mittag habe sie auf einmal empfunden, dass der Zauber gelöst sei und seitdem habe sie jede Stunde auf Befreiung gehofft.
Aber außer ihr sei noch eine andre Königstochter in dieses Schloss gebannt. Darauf gingen jene und suchten auch diese andere Königstochter auf und befreiten sie. In großen Freuden dankte sie ihnen ebenfalls und sagte, dass auch sie gestern zu Mittag es gefühlt habe, wie ihre Verzauberung gelöst sei.
Nun erzählten die beiden Königstöchter ihren Befreiern, in verborgenen Kellern des Schlosses sei ein großer Schatz, den ein schrecklicher Hund bewache. Sie gingen nun danach und fanden endlich den Hund, und der Schmied erschlug ihn mit seinem schweren Hammer, wie er sich auch zur Wehr setzen mochte.
Der Schatz aber war Gold und Silber, ganze Pfannen voll, und dabei saß als Hüter ein schöner Jüngling. Der ging ihnen entgegen und dankte ihnen, dass sie ihn erlöst hätten. Er sei der Sohn eines Königs, aber von einem Zauberer in dieses Schloss gebannt und in das dreiköpfige Männchen verwandelt worden.
Als er zwei von seinen Köpfen verloren hatte, da sei die Verzauberung der beiden Königstöchter gehoben worden, und als der Schmied den grässlichen Hund erschlagen hatte, da sei auch er erlöst gewesen. Dafür sollten sie nun den ganzen Schatz zum Lohne haben.
Darauf ward der Schatz geteilt, und ehe sie damit fertig wurden, hatten sie lange zu tun; die beiden Königstöchter aber heirateten aus Dankbarkeit für ihre Erlösung die eine den Schmied und die andere den Bergmann, und der schöne Königssohn heiratete die Nonne.
So lebten sie in Frieden und Freude zusammen bis an ihr Ende.
DIE SCHÖNE JUNGE BRAUT ...
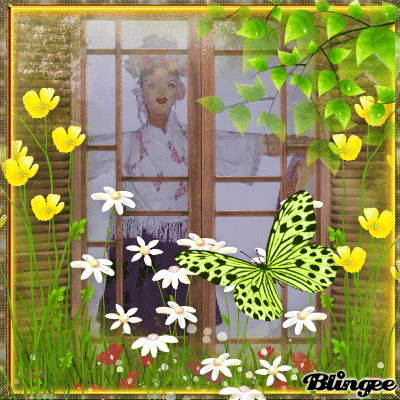
Es ging einmal ein hübsches Landmädchen in den Wald, um Futter für seine Kuh zu holen; wie sie nun in Gottes Namen graste und an gar nichts Arges dachte, so kamen auf einmal vier Räuber, umringten sie und führten sie mit sich fort, ohne Gnad und Barmherzigkeit, sie mochte schreien und zappeln, bitten und betteln, so viel sie wollte.
Weit ab von des Mädchens Heimat in einem finstern Walde hatten die Räuber ein Haus, worin sie sich aufhielten, wenigstens blieben immer einige daheim, wenn die anderen auf Raub auszogen. Dem Mädchen taten aber die Räuber weiter nichts zu Leide, als dass sie sie eben aus ihrer Heimat fort führten und sie in dem Hause gleichsam gefangen hielten; sie musste den Haushalt besorgen, kochen, backen und waschen, sonst hatte sie es gut, wurde aber immer scharf bewacht. Dabei hatten ihr die Räuber den Namen gegeben: Schöne junge Braut.
So war nun das Mädchen schon einige Jahre in der Räuberherberge, als es sich einmal traf, dass ein Hauptraub ausgeführt werden sollte, an dem, wenn er gelingen sollte, die ganze helle Bande Teil nehmen musste.
Da das Mädchen sich an das Leben in der Räuberhöhle gewöhnt zu haben schien, auch noch keinen Versuch zu entfliehen gemacht hatte und auch schwerlich durch den wilden Wald die Wege finden würde - so dachte der Hauptmann -, so blieb sie dieses Mal allein und unbewacht im Waldhaus zurück.
Aber die Räuber waren kaum fort, so sann die schöne Braut darauf, wie sie unerkannt entfliehen könne. Sie machte geschwind eine Gestalt von Stroh, zog der selben ihre Kleider an, setzte ihr ihre Haube auf, sich selbst aber bestrich sie von Kopf bis zu den Füßen mit Honig, wälzte sich darauf über und über in Federn, so dass sie ganz unerkennbar wurde und aussah wie ein seltsamer Vogel.
Die Gestalt in ihren Kleidern lehnte sie an ein Fenster über der Haustür und ließ sie hinaussehen, doch mit verdecktem Gesicht, und dann eilte sie von dannen.
Mochte es aber nun sein, dass dem Hauptmann eine Ahnung von des Mädchens beabsichtigter Flucht kam oder dass etwas vergessen worden war, genug, er sandte einige seiner Räuber nach dem Hause zurück, und gerade musste es sich treffen, dass ihnen auf ihrem Wege das fiedrige Käuzlein aufstieß.
Sie dachten aber, es wäre einer ihrer Kumpane, der sich unkenntlich gemacht hätte, und riefen die Gestalt lachend und fragend an: "Wohin, wohin, Herr Federsack? Was macht die schöne junge Braut?"
Diese, die es selbst war, war zwar sehr erschrocken, doch fasste sie sich ein Herz und antwortete mit verstellter Stimme: "Sie fegt und säubert unser Haus
Und schaut wohl auch zum Fenster heraus!"
Damit machte sie, dass sie den Räubern aus dem Gesichte kam, kam auch glücklich aus dem Walde, erreichte ein Dorf, kaufte sich Kleider, badete sich und erlangte glücklich und wohlbehalten, obschon nach langer Wanderung, ihre Heimat wieder, und da sie nicht gerade das Beste in der Räuberherberge zurück gelassen hatte, sondern für ihren Jahrlohn mitgehen heißen, so hatte sie auch wohl zu leben und heiratete einen wackeren Burschen.
Jene Räuber, wie die nun des Hauses ansichtig wurden, sahen die Gestalt der schönen jungen Braut am Fenster und grüßten schon von weitem, in dem sie riefen: "Grüß Gott, O schöne junge Braut, die freundlich uns entgegen schaut."
Da aber der Gruß unerwidert blieb, so verwunderten sich die Räuber, und als sie näher kamen, vermeinten sie, die schöne junge Braut sei eingeschlafen. Vergebens riefen sie, sie ermunterte sich nicht; vergebens geboten sie ihr zu öffnen, all ihr Pochen und Schreien, Rufen und Schelten war erfolglos, und wütend traten sie zuletzt die Türe in Trümmern, stürmten die Treppe hinauf und fassten die Gestalt der schönen jungen Braut hart an, da fiel ihnen die Strohpuppe in die Arme.
Da riefen die Räuber: "Fahr wohl, du schöne junge Braut! Ein Tor ist, wer auf Weiber baut! "
DIE SCHLIMME NACHTWACHE ...
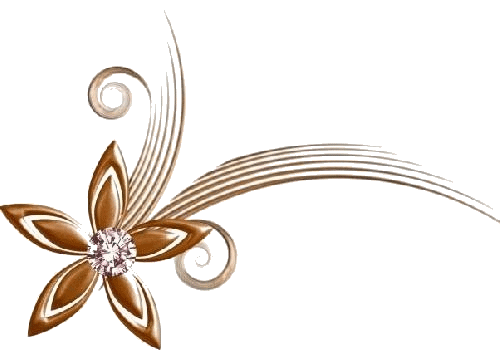
Es war einmal eine Gastwirtin, die taugte sehr wenig; sie wog falsch, sie maß falsch, sie log und trog. Wer in ihr Haus kam, kam nicht ungerupft wieder heraus. Nach Geld stand all ihr Sinn, um Geld hätte sie dem Bösen ihre Seele verkauft, wenn dieser sie gemocht hätte.
Manche Untat geschah in dem Hause dieser Wirtin, die nicht an den Tag kam. Endlich war das Maß ihrer Sünden voll.
Ein vornehmer Herr kam zugereist, der über Nacht bleiben wollte. Er aß und trank und sagte vor dem Schlafengehen zur Kellnerin: "Es muss jemand vor meiner Türe wachen; ich zahle dafür hundert Gulden und mehr. Magst du die verdienen, Kellnerin? "
"Nein!" antwortete die Kellnerin. "Zur Nacht schlafe ich, am Tage wach ich, und abends bin ich müde genug. Ich will es aber meiner Frau sagen, dass die dem Herrn jemand zur Nachtwache anschafft."
"Denkt Euch, Frau!" sprach zur Wirtin die Kellnerin: "Der fremde Herr will hundert Gulden und mehr zahlen, wenn jemand vor seiner Türe wacht. Ich hab mich dafür bedankt." "So?" sagte die Wirtin. "Nun, so gehe du schlafen, ich will schon jemand anschaffen."
Die Wirtin gönnte aber selbiges Wachtgeld niemandem als sich selbst. Sie ging zum Fremden und sagte ihm: "Es ist niemand da, der Euch wachen will; ich muss es schon selbst tun, Ihr müsst aber noch was darauf legen."
"Schon recht, Frau Wirtin! Ich lege noch etwas darauf. Wacht nur fein." Dann verschloss er sein Zimmer, und die Wirtin blieb draußen auf dem Flur und wachte und zählte in Gedanken schon das leicht verdiente viele Geld.
Um Mitternacht war es der Kellnerin, als höre sie ein winselndes Gestöhne aus dem Vorsaal, aber es gruselte sie darob, und sie blieb hübsch unter ihrer Bettdecke.
Als es Tag war, saß die Frau Wirtin vor des Fremden Türe und hatte einen Beutel voll Geld in der Hand; sie sah aber jämmerlich aus, und mit Entsetzen sah das Gesinde, dass nur die Kleider und die Haut der Wirtin noch da waren. Das andere hatte der Teufel mitgenommen.
HIRSEDIEB ...
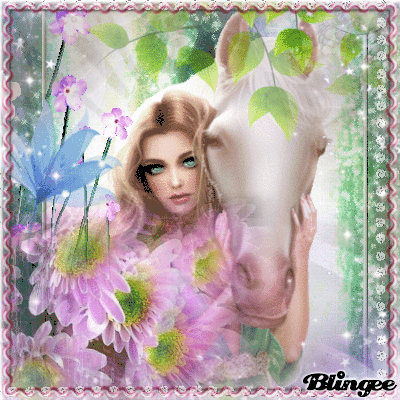
In einer Stadt wohnte ein reicher Kaufmann, der hatte an seinem Haus einen großen und prächtigen Garten, in dem auch ein Stück Land mit Hirse besät war.
Als dieser Kaufmann einmal in seinem Garten herumspazierte - es war zur Frühjahrszeit, und der Samen stand frisch und kräftig -, da sah er zu seinem großen Verdruss, dass vergangene Nacht von frecher Diebeshand ein Teil von seinem Hirsesamen abgegrast worden war. Und gerade dieser kleine Acker, auf den er alle Jahre Hirse säte, war ihm ganz besonders lieb.
Er beschloss, den Dieb zu fangen und dann am Morgen zu strafen oder dem Gericht zu übergeben. Also rief er seine drei Söhne, Michel, Georg und Johannes, zu sich und sprach: "Heute Nacht war ein Dieb in unserem Garten und hat mir einen Teil Hirsesamen abgegrast, was mich sehr ärgert. Dieser Frevler muss gefangen werden und soll mir büßen! Ihr, meine Söhne, sollt nun die Nächte hindurch wachen, einer nach dem anderen, und wer den Dieb fängt, der soll von mir eine stattliche Belohnung bekommen."
Der älteste, Michel, wachte die erste Nacht; er nahm sich etliche geladene Pistolen und einen scharfen Säbel, auch zu essen und zu trinken mit, hüllte sich in einen warmen Mantel und setzte sich hinter einen blühenden Holunderbusch, hinter dem er bald einschlief.
Als er am hellen Morgen erwachte, war ein noch größeres Stück Hirsesamen abgegrast als vorige Nacht. Und als nun der Kaufmann in den Garten kam und das sah und merkte, dass sein Sohn, anstatt zu wachen und den Dieb zu fangen, geschlafen hatte, wurde er noch ärgerlicher und schalt und höhnte ihn als einen braven Wächter, der ihm samt seinen Pistolen und Säbel selbst gestohlen werden könne!
Die nächste Nacht wachte Georg; dieser nahm sich nebst den Waffen, die sein Bruder vorige Nacht bei sich geführt hatte, auch noch einen Knüppel und starke Stricke mit. Aber der gute Wächter Georg schlief ebenfalls ein und fand am Morgen, dass der Hirsedieb wieder tüchtig gegrast hatte. Der Vater wurde ganz wild und sagte: "Wenn der dritte Wächter ausgeschlafen hat, wird die Hirsesaat vollends beim Kuckuck sein!"
Die dritte Nacht kam nun Johannes an die Reihe. Dieser nahm trotz allem Zureden keine Waffen mit; doch hatte er sich im geheimen mit Waffen gegen den Schlaf versehen; er hatte sich Disteln und Dornen gesucht und diese vor sich aufgebaut. Wenn er nun einnicken wollte, stieß er mit der Nase an die Stacheln und wurde gleich wieder munter.
Als die Mitternacht herbei kam, hörte er ein Getrappel. Es kam näher und näher, näherte sich dem Hirsesamen, und da hörte Johannes ein recht fleißiges Abraufen. Halt, dachte er, hab ich dich! Und er zog einen Strick aus der Tasche, schob leise die Dornen zurück und schlich vorsichtig näher.
Aber wer hätte das vermutet? Der Dieb war ein allerliebstes kleines Pferd. Johannes war hoch erfreut, hatte auch mit dem Einfangen gar keine Mühe; das Tierchen folgte ihm willig zum Stall, den Johannes fest verschloss. Und nun konnte er sich ganz bequem in seinem Bette ausschlafen.
Am Morgen, als seine Brüder aufstanden und hinunter in den Garten gehen wollten, sahen sie mit Staunen, dass Johannes in seinem Bett lag und schlief. Da weckten sie ihn und höhnten ihn, dass er der beste Wächter sei, der es nicht einmal die Nacht ausgehalten habe auf seiner Wache.
Aber Johannes sagte: "Seid nur still, ich will euch den Hirsedieb schon zeigen." Und sein Vater und seine Brüder mussten ihm zum Stall folgen, wo das seltsame Pferd stand, von dem niemand zu sagen wusste, woher es gekommen war und wem es gehörte. Es war allerliebst anzusehen, von zartem Bau, und dazu ganz silberweiß.
Da hatte der Kaufmann eine große Freude und schenkte seinem wackeren Johannes das Pferd als Belohnung; der nahm es freudig an und nannte es Hirsedieb.
Bald aber hörten die Brüder, dass eine schöne Prinzessin verzaubert sei in einem Schloss, das auf einem gläsernen Berge stehe, zu dem niemand wegen der großen Glätte empor klimmen könne. Wer aber glücklich hinauf- und dreimal um das Schloss herumreite, der könne die schöne Prinzessin erlösen und bekomme sie zur Gemahlin.
Unendlich viele hätten schon den Bergritt versucht, wären aber alle wieder herabgestürzt und lägen tot umher. Diese Wundermär erscholl durchs ganze Land, und auch die drei Brüder bekamen Lust, ihr Glück zu versuchen, nach dem gläsernen Berg zu reiten und die schöne Prinzessin zu gewinnen.
Michel und Georg kauften sich junge, starke Pferde, deren Hufeisen sie tüchtig schärfen ließen, und Johannes sattelte seinen kleinen Hirsedieb, und so ging es aus zum Glücksritt. Bald erreichten sie den gläsernen Berg, der älteste ritt zuerst, aber ach - sein Ross glitt aus, stürzte mit ihm nieder, und beide, Ross und Mann, vergaßen das Wiederaufstehen.
Der zweite ritt, aber ach - sein Ross glitt aus, stürzte mit ihm nieder, und beide, Mann und Ross, vergaßen ebenso das Aufstehen. Nun ritt Johannes, und es ging trapp trapp trapp trapp trapp - droben waren sie, und wieder trapp trapp trapp trapp trapp, und sie waren dreimal ums Schloss herum, als ob Hirsedieb diesen gefährlichen Weg schon hundertmal gelaufen wäre.
Nun standen sie vor der Schlosstür; diese ging auf, und es trat die schöne Prinzessin heraus; sie war ganz in Seide und Gold gekleidet und breitete freudig die Arme nach Johannes aus. Und dieser stieg schnell vom Pferd und eilte, die holde Prinzessin zu umfangen.
Und die Prinzessin wandte sich dem Pferd zu, liebkoste es und sprach: "Du kleiner Schelm, warum bist du mir entlaufen? Nun darfst du uns nimmermehr verlassen." Und da begriff Johannes, dass sein Hirsedieb das Zauberpferd seiner schönen Prinzessin war.
Seine Brüder kamen wieder auf von ihrem Fall, Johannes aber sahen sie nicht wieder, denn der lebte glücklich, und allen Erdensorgen entrückt, mit seiner Prinzessin im Zauberschloss auf dem gläsernen Berg.
HELENE ...
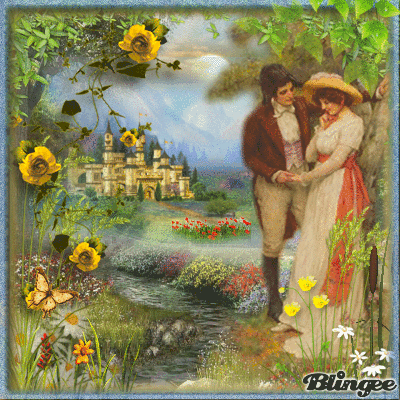
Es war einmal ein schönes Mädchen, das hieß Helene. Ihre Mutter war früh gestorben, und die Stiefmutter, die sie bekommen hatte, tat ihr alles gebrannte Herzeleid an.
Helene gab sich alle Mühe, ihre Liebe zu gewinnen, sie verrichtete die schweren Arbeiten, die ihr auferlegt wurden, fleißig und unverdrossen, aber die böse Stiefmutter blieb in ihrem harten Herzen ungerührt und verlangte immer mehr von ihr. Denn weil Helene so emsig und unermüdlich war, dass sie immer bei Zeiten mit ihrer Arbeit fertig wurde, so glaubte sie, was sie ihr auferlegt habe, sei noch zu leicht und zu gering gewesen, und sann auf neue schwere Beschäftigungen.
Eines Tages verlangte die Alte von Helene, diese solle zwölf Pfund Federn in einem Tag abschleißen, und drohte ihr mit harten Strafen, wenn sie abends nach Hause zurück käme und die Arbeit sei nicht getan. Das arme gequälte Mädchen setzte sich mit Angst und Tränen zu ihrer Arbeit und konnte vor Kummer kaum einen Anfang machen. Wenn sie aber endlich ein Häufchen geschlissener Federn vor sich liegen hatte, da musste sie wieder an ihre Not denken und bitterlich weinen, und dann stoben die Federn von ihrem Seufzen auseinander.
So ging es ihr immer wieder, und ihre Angst stieg auf das Höchste. Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen, bückte sich über den Tisch und rief weinend aus: "Ach! Ist denn niemand auf Gottes Erdboden, der sich meiner erbarme?"
Da antwortete auf einmal eine sanfte Stimme: "Tröste dich, mein Kind, ich bin gekommen dir zu helfen." Erschrocken sah Helene auf und erblickte eine Fee, die freundlich fragte: "Was weinst du so?" Helene hatte lange kein freundliches Wort gehört, sie fasste Vertrauen zu der Erscheinung und erzählte, was ihr für eine Arbeit aufgegeben sei und dass sie damit unmöglich zur bestimmten Zeit fertig werden könne.
"Sei ohne Sorgen, mein Kind!" sprach die freundliche Fee, "lege dich ruhig schlafen; unterdessen will ich deine Arbeit verrichten." Helene legte sich zur Ruhe, und unter den Händen der Fee flogen die Federn selbst von den Kielen, so dass die Arbeit lange vor der gesetzten Frist fertig war. Darauf weckte die Fee Helene, die allen Kummer verschlafen hatte, und verschwand, als diese ihr danken wollte.
Am Abend kam die böse Stiefmutter nach Hause. Wie erstaunte sie, als sie Helenen neben der fertigen Arbeit ruhig sitzend fand. Sie lobte zwar ihren Fleiß, dachte aber bei sich auf neue und schwerere Arbeiten.
Am anderen Tag befahl sie Helene, einen großen Teich, der in der Nähe lag, mit einem Löffel auszuschöpfen, und der Löffel, den sie ihr dazu gab, war durchlöchert. Helene machte sich an ihre Arbeit, aber bald sah sie ein, dass es unmöglich war, das Gebot ihrer bösen und tückischen Stiefmutter zu erfüllen.
Voll tiefer Kümmernis und Angst wollte sie schon den Löffel von sich werfen, als plötzlich die gute Fee vor ihr stand und sie freundlich fragte, warum sie so betrübt sei? Als Helene ihr von dem Gebote der Stiefmutter erzählt hatte, sprach sie: "Verlass dich auf mich; ich will deine Arbeit für dich verrichten. Lege dich unterdessen ruhig schlafen."
Helene war getröstet und legte sich zur Ruhe, aber bald ward sie von der Fee leise geweckt und erblickte das vollbrachte Werk. Voller Freuden eilte sie zu ihrer Stiefmutter und hoffte, ihr Herz würde sich endlich erweichen. Aber diese ärgerte sich darüber, dass ihre Tücke so wunderbar vereitelt worden war, und sann auf noch schwierigere Aufgaben.
Als es Morgen geworden war, befahl sie Helene, bis zum Abend ein schönes Schloss zu bauen, das so gleich bezogen werden könne und an dem nichts fehlen dürfe, weder Küche noch Keller noch irgend etwas. Helene setzte sich niedergeschlagen auf den Felsen, der ihr zum Bau angewiesen war, und tröstete sich nur mit der Hoffnung, dass ihr die gute Fee auch diesmal aus ihrer Not helfen werde. So geschah es auch.
Die Fee erschien, versprach, das Schloss zu bauen und schickte Helene wieder zur Ruhe. Auf das Wort der Fee erhoben sich Felsen und Steine und fügten sich ineinander, so dass bald ein prächtiges Schloss da stand. Vor Abend war auch inwendig alles fertig und in vollem Glanz. Wie dankbar und freudig war Helene, als sie die schwere Aufgabe ohne ihr Zutun erfüllt sah.
Aber die Stiefmutter freute sich nicht, sondern ging schnüffelnd und spürend durch das Schloss von oben bis unten, ob sie nicht irgendeinen Fehler fände, wegen dessen sie Helene ausschelten und strafen könnte. Endlich wollte sie auch den Keller betrachten, aber in dem Augenblicke, wo sie die Falltüre erhoben hatte und hinab steigen wollte, schlug die schwere Türe plötzlich zurück, so dass die böse Stiefmutter die Treppe hinabstürzte und sich zu Tode fiel.
Nun war Helene selber Herrin des Schlosses und lebte in Ruhe und Frieden. Bald kamen viele Freier, die von ihrer großen Schönheit gehört hatten. Unter ihnen war auch ein Königssohn mit Namen Laßmann, und dieser erwarb sich die Liebe der schönen Helene.
Eines Tages saßen beide vertraulich vor dem Schlosse unter einer hohen Linde beisammen, und Laßmann sagte Helene, dass er von ihr zu seinen Eltern reisen müsse, um ihre Einwilligung zu seiner Heirat sich zu holen, und bat sie unter der Linde seiner zu warten.
Er schwur ihr, sobald als möglich zu ihr zurückzukehren. Helene küsste ihn beim Abschiede auf die linke Backe und bat ihn, so lange er von ihr entfernt sein werde, sich von niemand anderem auf diese Backe küssen zu lassen. Unter der Linde wolle sie ihn erwarten.
Helene baute felsenfest auf Laßmanns Treue und saß ganze drei Tage lang von Morgen bis zum Abend unter der Linde. Als aber ihr Bräutigam immer noch nicht kam, geriet sie in schwere Sorge und beschloss, sich auf den Weg zu machen und ihn zu suchen.
Sie nahm von ihrem Schmuck so viel sie konnte, auch von ihren Kleidern nahm sie drei der schönsten, eins mit Sternen, das andere mit Monden, das dritte mit lauter Sonnen von reinem Golde gestickt. - Weit und breit wanderte sie durch die Welt, aber nirgends geriet sie auf eine Spur ihres Bräutigams.
Am Ende verzweifelte sie ganz daran, ihn zu finden, und gab ihr Suchen auf, aber nach ihrem Schlosse wollte sie doch nicht heimkehren, weil ihr dort ohne ihren Bräutigam alles öde und verlassen vorkommen musste; lieber wollte sie in der Fremde bleiben. Sie vermietete sich bei einem Bauern als Hirtin und vergrub ihren Schmuck und ihre schönen Kleider an einem verborgenen Ort.
So lebte sie nun als Hirtin und hütete ihre Herde, in dem sie an ihren Bräutigam dachte. Sie gewöhnte ein Kälbchen von der Herde an sich, fütterte es aus ihrer Hand und richtete es ab, vor ihr nieder zu knien, wenn sie zu ihm sprach:
"Kälbchen, knie nieder
Und vergiss deiner Ehre nicht, wie der
Prinz Laßmann die arme Helene vergaß,
Als sie unter der grünen Linde saß."
Nach einigen Jahren, die sie so verlebte, hörte sie, die Tochter des Königs in dem Lande, wo sie jetzt wohnte, werde ein Königssohn mit Namen Laßmann heiraten. Darüber freuten sich alle Leute, aber Helene überfiel ein noch viel größerer Schmerz, als sie bisher erlitten hatte, denn sie hatte immer noch auf Laßmanns Treue vertraut.
Nun traf es sich, dass der Weg zur Königsstadt nicht weit von dem Dorfe vorbei ging, wo Helene sich als Hirtin verdingt hatte und so geschah es oftmals, wenn sie ihre Herde hütete, dass Laßmann an ihr vorüber ritt, ohne sie zu beachten, in dem er ganz in Gedanken an seine Braut versunken war.
Da fiel es Helene ein, sein Herz auf die Probe zu stellen und zu versuchen, ob es nicht möglich sei, ihn wieder an sie zu erinnern. Nicht lange darauf kam Laßmann wieder einmal vorüber; da sprach Helene zu ihrem Kälbchen:
"Kälbchen, knie nieder
Und vergiss deiner Ehre nicht, wie der
Prinz Laßmann die arme Helene vergaß,
Als sie unter der grünen Linde saß."
Als Laßmann Helenens Stimme hörte, da war es ihm, als solle er sich auf etwas besinnen, aber hell wurde ihm nichts, und deutlich hatte er auch nicht die Worte vernommen, da Helene nur leise und mit zitternder Stimme geredet hatte.
So war auch ihr Herz viel zu bewegt gewesen, als dass sie hätte Acht geben können, welchen Eindruck ihre Worte machten, und als sie sich fasste, war Laßmann schon wieder weit von ihr fort. Doch sah sie noch, wie er langsam und nachdenklich ritt, und deshalb gab sie sich noch nicht ganz verloren.
In diesen Tagen sollte in der Königsstadt mehrere Nächte hindurch ein großes Fest gegeben werden. Darauf setzte sie ihre Hoffnung und beschloss, dort ihren Bräutigam aufzusuchen.
Als es Abend war, machte sie sich heimlich auf, ging zu ihrem Versteck und legte das Kleid, das mit goldenen Sonnen geziert war, und ihr Geschmeide an, und ihre schönen Haare, die sie bisher unter einem Tuch verborgen hatte, ließ sie fessellos rollen. So geschmeckt ging sie in die Stadt zum Feste.
Als sie sich zeigte, da wandten sich aller Augen auf sie, alles verwunderte sich über ihre Schönheit, aber niemand wusste, wer sie war. Auch Laßmann war von ihrer Schönheit wie verzaubert, ohne zu ahnen, dass er einst mit diesem Mädchen ein Herz und eine Seele gewesen war.
Bis zum Morgen wich er nicht von ihrer Seite, und nur mit großer Mühe konnte sie in dem Gedränge ihm entkommen, als es Zeit war heimzukehren. Laßmann suchte sie überall und erwartete sehnlich die nächste Nacht, wo sie versprochen hatte, sich wieder einzufinden.
Am anderen Abend begab sich die schöne Helene wiederum so zeitig, als sie konnte, auf den Weg. Diesmal hatte sie das Gewand an, das mit lauter silbernen Monden geziert war, und einen silbernen Halbmond trug sie über ihrer Stirne.
Laßmann war froh, sie wiederzusehen, sie schien ihm noch viel schöner zu sein als gestern, und die ganze Nacht tanzte er allein mit ihr. Als er sie aber nach ihrem Namen fragte, antwortete sie, sie dürfe ihn nicht nennen, wenn er nicht erschrecken solle. Darauf bat er sie inständig, den nächsten Abend wiederzukommen, und dies versprach sie ihm.
Am dritten Abend war Laßmann vor Ungeduld frühzeitig in dem Saal und wandte kein Auge von der Tür. Endlich kam Helene in einem Gewand, das mit lauter goldenen und silbernen Sternen gestickt war und von einem Sternengürtel fest gehalten wurde; ein Sternenband hatte sie um ihre Haare geschlungen.
Laßmann war noch mehr als vorher von ihr entzückt und drang in sie mit Bitten, sich ihm endlich zu erkennen zu geben. Da küsste Helene ihn schweigend auf die linke Backe, und nun erkannte Laßmann sie auf einmal wieder und bat voll Reue um ihre Verzeihung; und Helene, froh ihn wiedergewonnen zu haben, ließ ihn nicht lange darauf warten.
DIE VERWÜNSCHTE STADT ...
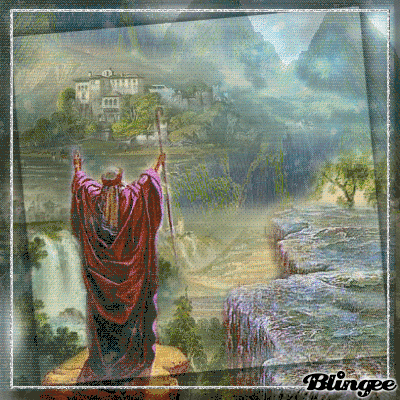
Auf hohem Alpengebirge lag eine große blühende Stadt, umgeben von hochragenden Bergzackenhörnern, die ewiger Schnee bedeckte, die Stadt aber lag auf einer weithingebreiteten sonnigen Matte, auf welcher zahlloses Vieh weidete, denn das Volk, das jene Alpenstadt bewohnte, war ein Hirtenvolk, das fast ganz abgesondert lebte von den Bewohnern der tieferen Gegenden.
Selten zog ein Wanderer oder ein Saumross die Gebirgspfade, die über jene Hochalpen hinweg nach Welschland führten, selten sahen die Bewohner jener Gebirgsstadt einen Fremdling.
Eines Tages aber sahen sie einen fremden Wanderer durch ihren Ort schreiten, eine hohe ernste Gestalt; sein Gesicht war bräunlich von Farbe, aber bleich, mit langem Barte, sein Haar schwarz mit grau gemischt, sein Gewand ein langer brauner Talar, mit einem Stück umgürtet, seine Fußbekleidung starke Schuhe, mit Riemen um die Knöchel befestigt.
Müde schien der Mann und der Ruhe sehr bedürftig, aber er trug einen Fluch, dass er sich nicht setzen und weilen durfte, bevor ihn jemand sitzen und verweilen hieß.
Die Bewohner der Hochgebirgsstadt sahen den fremden Mann mit einer eigenen Scheu an, und er flößte ihnen ein seltsames Grauen ein. Und der Mann ging von Haus zu Haus und stand vor jeder Türe und harrte, dass jemand zu ihm sage: "Sitze nieder und raste" - aber niemand sprach solche Worte, wohl aber sammelte sich des Volkes mehr und mehr und gaffte ihn neugierdevoll an. Und der müde Mann stand und seufzte.
Da trat der Stadtälteste heran, der zugleich ein Priester war, der sprach zu ihm: "Höre, du fremder Mann, wer du bist, das wissen wir und sehen es dir an. Du bist kein anderer als der ewige Jude. Du bist verdammt, zu wandern ewiglich, weil du den Heiland der Welt auf seinem Gange zum bittern Kreuzestode die kurze Ruhe auf der Steinbank vor deinem Hause zu Jerusalem versagt hast - darum so hebe dich von hinnen aus unserer Stadt, denn du kannst allda nicht weilen und darfst nicht weilen, und wir können und dürfen dich nicht hegen und beherbergen, zu unserem eigenen Leid. Gehe mit Gott!"
Da öffnete der ewige Jude seine bleichen Lippen und sprach: "Ich werde gehen jetzt und ihr bleibt, ihr aber werdet vergehen, und ich werde bleiben. Wann ich werde wiederkommen an diesen Ort, so werde ich hier finden zwar eine Stätte, aber keine Stadt - und wann ich werde kommen zum dritten Male, so werde ich auch nicht mehr finden die Stätte, da eure Stadt gestanden hat."
Alle, die das Wort hörten, erschraken und traten scheu zur Seite, als der finstere Mann seinen Stab schüttelte und durch ihre gedrängten Reihen schritt und müden Ganges aus dem Orte wanderte, hoch hinauf in das unwirtbare Gebirge. Keiner von allen sah in wieder.
Seit diesem Tage wurde kein neues Haus mehr errichtet in jener Stadt - keine Herde mehrte sich - kein Kindlein wurde geboren - manches Haus starb bald aus - nach einer Reihe von Jahren standen viele Häuser ganz leer und verfielen.
Von den Bergen stürzten Lawinen herab und zerschmetterten die Häuser. Bergstürze ereigneten sich, und mächtige Felsblöcke lagen jetzt da, wo früher in den Straßen der Stadt ein reges fröhliches Leben war. Die große Stadt war noch fünfzig Jahr ein Alpendorf mit weit und zerstreut voneinander liegenden Häusern, mit dürftiger Nahrung, magern Herden, siechen Bewohnern.
Sie kamen nicht mehr herab zu den tiefer gelegenen Ortschaften, und niemand stieg aus letzteren zu ihnen hinauf - und so wurde endlich alles droben wüst und leer - und über die letzten Toten wölbte sich kein Grabeshügel, sondern die brechenden Häuser begruben sie unter Trümmern, dann begruben Steinrutschen, welche im Alpenlande Muren heißen, wiederum jene Trümmer, oder Schlammbäche von den Berggipfeln quollen nieder und deckten alles zu.
Nach hundert Jahren kam der Wanderer wieder; an der Lage der Bergrücken umher erkannte er die Stätte, hohe Bäume waren gewachsen aus den Trümmern, hie und da stand noch ein Mauerrest, man konnte aber nicht mehr recht unterscheiden, ob es Felsen waren oder Werke von Menschenhand.
Mächtige Sträucher mit bunten Alpenblumen waren da emporgeschossen, wo vor dessen Straße war, und Gras stand da, wo sonst der Menschen friedliche Wohnstätte gewesen.
Und der ewige Jude seufzte und sprach: "Was hat gesungen einst David, der König über Israel? Er hat gesungen: 'Wenn Du nach des Gottlosen Stätte sehen wirst, wird er weg sein.' " Und hob den Fuß und wandelte wieder rast- und ruhelos über das Hochgebirge.
Und die Stätte jener Stadt blieb nicht die selbe, wie sie gewesen, sie wurde immer öder, kahler, schauriger, doch ganz allmählich und so langsam, Jahr um Jahr. Die Alpensträucher gingen aus, das Gras verdorrte, es fiel in dieser hohen Bergregion kein Regen mehr hinweg, auch wenn die Sommersonne am höchsten stand.
Die Quellen, die von den höheren Spitzen des Gebirges früher als reizende Wasserfälle nieder rauschten, gefroren und bildeten über sich Decken von grünlichem Eis; sie wurden zu Gletschern, und diese Gletscher wurden größer und größer und schoben sich über die einst so herrlich grünen sonnigen Matten mehr und mehr und bedeckten sie ganz.
Als der ruhelose Wanderer, nachdem abermals hundert Jahre vergangen waren, wieder hinauf kam auf das Gebirge, da fand und erkannte er die Stätte nicht mehr, auf welcher einst die blühende Stadt gestanden hatte, und tat seinen Mund auf und sprach:
"Erfüllt ist nun das Wort des Herrn, das er tat durch den Mund des Propheten, seines Knechts: 'Ich will meine Hand über sie ausstrecken und das Land wüst und öde machen.' "
DIE VERZAUBERTE PRINZESSIN ...

Es war einmal ein armer Handwerksmann, der hatte zwei Söhne, einen guten, der hieß Hans, und einen bösen, der hieß Helmerich. Wie das aber wohl geht in der Welt, der Vater hatte den bösen mehr lieb als den guten.
Nun begab es sich, dass das Jahr einmal ein mehr als gewöhnlich teures war und dem Meister der Beutel leer war. Ei! dachte er, man muss zu leben wissen. Sind die Kunden doch so oft zu dir gekommen, nun ist es an dir, höflich zu sein und dich zu ihnen zu bemühen. Gesagt, getan.
Früh morgens zog er aus und klopfte an mancher stattlichen Tür; aber wie es sich denn so trifft, dass die stattlichsten Herren nicht die besten Zahler sind, die Rechnung zu bezahlen hatte niemand Lust. So kam der Handwerksmann müde und matt des Abends in seine Heimat, und trübselig setzte er sich vor die Türe der Schenke ganz allein, denn er hatte weder das Herz, mit den Zechgästen zu plaudern, noch freute er sich sehr auf das lange Gesicht seines Weibes.
Aber wie er da saß in Gedanken versunken, konnte er doch nicht lassen hin zu hören auf das Gespräch, das drinnen geführt ward. Ein Fremder, der eben aus der Hauptstadt angelangt war, erzählte, dass die schöne Königstochter von einem bösen Zauberer gefangen gesetzt sei und müsse im Kerker bleiben ihr Leben lang, wenn nicht jemand sich fände, der die drei Proben löse, die der Zauberer gesetzt hatte. Fände sich aber einer, so wäre die Prinzess sein und ihr ganzes herrliches Schloss mit all seinen Schätzen.
Das hörte der Meister an, zuerst mit halbem Ohr, dann mit dem ganzen und zuletzt mit allen beiden, denn er dachte: mein Sohn Helmerich ist ein aufgeweckter Kopf, der wohl den Ziegenbock barbieren möchte, so das einer von ihm heischte; was gilt es, er löst die Proben und wird der Gemahl der schönen Prinzess und Herr über Land und Leute. Denn also hatte der König, ihr Vater, verkündigen lassen.
Schleunigst kehrte er nach Haus und vergaß seine Schulden und Kunden über der neuen Mär, die er eilig seiner Frau hinter brachte. Des anderen Morgens schon sprach er zum Helmerich, dass er ihn mit Ross und Wehr ausrüsten wolle zu der Fahrt, und wie schnell machte der sich auf die Reise!
Als er Abschied nahm, versprach er seinen Eltern, er wolle sie samt dem dummen Bruder Hans gleich holen lassen in einem sechsspännigen Wagen; denn er meinte schon, er wäre König. Übermütig wie er dahin zog, ließ er seinen Mutwillen aus an allem, was ihm in den Weg kam.
Die Vögel, die auf den Zweigen saßen und den Herrgott lobten mit Gesang, wie sie es verstanden, scheuchte er mit der Gerte von den Ästen, und kein Getier kam ihm in den Weg, daran er nicht seinen Schabernack ausgelassen hätte.
Und zum ersten begegnete er einem Ameisenhaufen; den ließ er sein Ross zertreten, und die Ameisen, die erzürnt an sein Ross und an ihn selbst krochen und Pferd und Mann bissen, erschlug und erdrückte er alle.
Weiter kam er an einen klaren Teich, in dem schwammen zwölf Enten. Helmerich lockte sie ans Ufer und tötete deren elf, nur die zwölfte entkam. Endlich traf er auch einen schönen Bienenstock; da machte er es den Bienen, wie er es den Ameisen gemacht hatte. Und so war seine Freude, die unschuldige Kreatur nicht sich zum Nutzen, sondern aus bloßer Tücke zu plagen und zu zerstören.
Als Helmerich nun bei sinkender Sonne das prächtige Schloss erreicht hatte, darin die Prinzessin verzaubert war, klopfte er gewaltig an die geschlossene Pforte. Alles war still; immer heftiger pochte der Reiter.
Endlich tat sich ein Schiebefenster auf, und hervor sah ein altes Mütterlein mit spinnewebfarbigem Gesichte, die fragte verdrießlich, was er begehre. "Die Prinzess will ich erlösen", rief Helmerich, "geschwind macht mir auf." "Eile mit Weile, mein Sohn", sprach die Alte, "morgen ist auch ein Tag, um neun Uhr werde ich dich hier erwarten." Damit schloss sie den Schalter.
Am anderen Morgen um neun Uhr, als Helmerich wieder erschien, stand das Mütterchen schon seiner gewärtig mit einem Fässchen voll Leinsamen, den sie ausstreute auf eine schöne Wiese. "Lies die Körner zusammen", sprach sie zu dem Reiter, "in einer Stunde komme ich wieder, da muss die Arbeit getan sein."
Helmerich aber dachte, das sei ein alberner Spaß und es lohne nicht, sich darum zu bücken; er ging derweil spazieren, und als die Alte wiederkam, war das Fässchen so leer wie vorher. "Das ist nicht gut", sagte sie. Darauf nahm sie zwölf goldene Schlüsselchen aus der Tasche und warf sie einzeln in den tiefen, dunklen Schlossteich. "Hole die Schlüssel herauf", sprach sie, "in einer Stunde komme ich wieder, da muss die Arbeit getan sein."
Helmerich lachte und tat wie vorher. Als die Alte wiederkam und auch diese Aufgabe nicht gelöst war, da rief sie zweimal: "Nicht gut! nicht gut!" Doch nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn die Treppe hinauf in den großen Saal des Schlosses; da saßen drei Frauenbilder, alle drei in dichte Schleier verhüllt. "Wähle, mein Sohn", sprach die Alte, "aber sieh dich vor, dass du recht wählst. In einer Stunde komme ich wieder."
Helmerich war nicht klüger, da sie wiederkam, als da sie wegging; übermütig aber rief er aufs Geratewohl: "Die zur Rechten wähl ich." Da warfen alle drei die Schleier zurück; in der Mitte saß die holdselige Prinzess, rechts und links zwei scheußliche Drachen, und der zur Rechten packte den Helmerich in seine Krallen und warf ihn durch das Fenster in den tiefen Abgrund.
Ein Jahr war verflossen, seit Helmerich ausgezogen, die Prinzess zu erlösen, und noch immer war bei den Eltern kein sechsspänniger Wagen angelangt. "Ach!" sprach der Vater, "wäre nur der ungeschickte Hans ausgezogen statt unseres besten Buben, da wäre das Unglück doch geringer."
"Vater", sagte Hans, "lass mich hin ziehen, ich will es auch probieren." Aber der Vater wollte nicht, denn was dem Klugen misslingt, wie führte das der Ungeschickte zu Ende? Da der Vater ihm Ross und Wehr versagte, machte Hans sich heimlich auf und wanderte wohl drei Tage den selben Weg zu Fuß, den der Bruder an einem geritten war.
Aber er fürchtete sich nicht und schlief des Nachts auf dem weichen Moos unter den grünen Zweigen so sanft wie unter dem Dach seiner Eltern; die Vögel des Waldes scheuten sich nicht vor ihm, sondern sangen ihn in den Schlaf mit ihren besten Weisen.
Als er nun an die Ameisen kam, die beschäftigt waren, ihren neuen Bau zu vollenden, störte er sie nicht, sondern wollte ihnen helfen, und die Tierchen, die an ihm hinaufkrochen, las er ab, ohne sie zu töten, wenn sie ihn auch bissen.
Die Enten lockte er auch ans Ufer, aber um sie mit Brosamen zu füttern; den Bienen warf er die frischen Blumen hin, die er am Wege gepflückt hatte. So kam er fröhlich an das Königsschloss und pochte bescheiden am Schalter.
Gleich tat die Türe sich auf, und die Alte fragte nach seinem Begehr. "Wenn ich nicht zu gering bin, möchte ich es auch versuchen, die schöne Prinzess zu erlösen", sagte er. "Versuche es, mein Sohn", sagte die Alte, "aber wenn du die drei Proben nicht bestehst, kostet es dein Leben." "Wohlan, Mütterlein", sprach Hans, "sage, was ich tun soll."
Jetzt gab die Alte ihm die Probe mit dem Leinsamen. Hans war nicht faul, sich zu bücken, doch schon schlug es drei Viertel, und das Fässchen war noch nicht halb voll. Da wollte er schier verzagen; aber auf einmal kamen schwarze Ameisen mehr als genug, und in wenigen Minuten lag kein Körnlein mehr auf der Wiese.
Als die Alte kam, sagte sie: "Das ist gut!" und warf die zwölf Schlüssel in den Teich, die sollte er in einer Stunde heraus holen. Aber Hans brachte keinen Schlüssel aus der Tiefe; so tief er auch tauchte, er kam nicht an den Grund. Verzweifelnd setzte er sich ans Ufer; da kamen die zwölf Entchen heran geschwommen, jede mit einem goldenen Schlüsselchen im Schnabel, die warfen sie ins feuchte Gras.
So war auch diese Probe gelöst, als die Alte wiederkam, um ihn nun in den Saal zu führen, wo die dritte und schwerste Probe seiner harrte. Verzagend sah Hans auf die drei gleichen Schleiergestalten; wer sollte ihm hier helfen? Da kam ein Bienenschwarm durchs offene Fenster geflogen, die kreisten durch den Saal und summten um den Mund der drei Verhüllten.
Aber von rechts und links flogen sie schnell wieder zurück, denn die Drachen rochen nach Pech und Schwefel, wovon sie leben; die Gestalt in der Mitte umkreisten sie alle und surrten und schwirrten leise: "Die Mittlere, die Mittlere." Denn da duftete ihnen der Geruch ihres eigenen Honigs entgegen, den die Königstochter so gern aß.
Also, da die Alte wiederkam nach einer Stunde, sprach Hans ganz getrost: "Ich wähle die Mittlere." Und da fuhren die bösen Drachen zum Fenster hinaus, die schöne Königstochter aber warf ihren Schleier ab und freute sich der Erlösung und ihres schönen Bräutigams.
Und Hans sandte dem Vater der Prinzess den schnellsten Boten und zu seinen Eltern einen goldenen Wagen mit sechs Pferden bespannt, und sie alle lebten herrlich und in Freuden, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch.
FIPPCHEN FÄPPCHEN ...
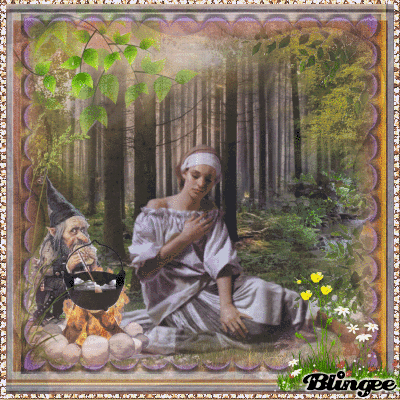
Eine Mutter hatte zwei Töchter, eine rechte Tochter und eine Stieftochter. Die letztere wurde von der Frau sehr schlecht behandelt, so dass sie es nicht aushalten konnte.
Eines Tages nahm sie sich ein Töpfchen, etwas Mehl und einen Löffel in ihr Körbchen und ging davon. Sie kam in einen finsteren Wald, darin lief sie lange herum, bis sie vor Hunger und Müdigkeit nicht weiter gehen konnte.
Hier ruhte sie aus, schürte ein Feuerchen an und kochte sich einen Brei. Als sie im besten Kochen war, kam plötzlich ein kleines, graues Männlein und fragte: "Was kochst du da?" "Einen Brei", sagte sie. "Ach, lass mich deinen Löffel ablecken", bettelte das graue Männlein. Sie sprach freundlich: "Du kannst auch ordentlich mit mir essen."
Da hüpfte das Männlein vor Freude um das Feuer herum, bis der Brei fertig war; darauf aßen die beiden miteinander und ließen es sich gut schmecken. "Weißt du, wie ich heiße?" sprach das Männlein. "Ich heiße Fippchen Fäppchen, und nun gehe mit mir, du sollst es gut bei mir haben!"
Da gingen sie beide zusammen weit, weit fort im Walde und kamen endlich an ein Schloss; die Tore öffneten sich, und beide spazierten hinein. Da war alles prachtvoll ausgeschmückt und war alles zu haben, was man nur wünschen mochte, und es war ein Zauberschloss, das Fippchen Fäppchen gehörte.
Die Stiefmutter des davon gegangenen Mädchens aber hatte sich aufgemacht mit einem tüchtigen Prügel, nach der entflohenen Tochter zu suchen, und wollte sie totschlagen, wenn sie sie fände, oder doch wenigstens windelweich. Und nach einigen Tagen kam sie an die Türe des Zauberschlosses und klopfte an.
Wie erstaunt war die Stieftochter, als sie ihre Mutter kommen sah, und wie erstaunt war die Stiefmutter, ihre von ihr so schlecht behandelte Tochter in so prachtvoller Umgebung und in den schönsten Kleidern wiederzufinden. Vor Schreck fiel ihr der Prügel aus der Hand.
Die Stieftochter nahm ihre Mutter sehr freundlich auf, bewirtete sie gut, und nach einem kurzen Aufenthalt kehrte die Mutter wieder heim und pries zu Hause ihre Stieftochter über die Maßen glücklich.
Das nahm sich die rechte Tochter zu Ohren und zu Herzen, und da die Stiefschwester der Mutter erzählt hatte, wie sie zu dem Glück gekommen war, so lief sie nun auch davon, kam in den selben Wald, ruhte aus und fing an, auch einen Brei zu kochen.
Da kam das graue Männlein auch und fragte: "Was kochst du?" "Einen Brei", sagte sie. Darauf sprach das Männlein: "Lass mich deinen Löffel ablecken." "Nein", sagte das Mädchen trotzig und missmutig, "ich kann ihn selbst ablecken."
Dann setzte sich das Mädchen hin und aß den Brei allein, und das Männlein sah zu, und als das Mädchen fertig war, da nahm das Männlein das Mädchen und zerriss es in tausend Stücke und hing sie an die Bäume.
Nach dem suchte die Mutter ihre rechte Tochter und meinte, der müsse auch ein so großes Glück begegnet sein als ihrer Stieftochter. Als sie in die Nähe kam, wo ihre Tochter in Fetzen hing, dachte sie, die Tochter habe dort Wäsche aufgehangen, wie groß aber waren ihr Schrecken und ihr Jammer, als sie näher kam und sah, was geschehen war. Sie fiel ohnmächtig zur Erde, und ich weiß nicht, ob sie wieder nach Hause gekommen ist.
SIEBENSCHÖN ...
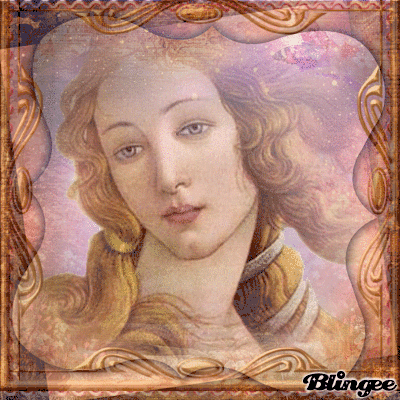
Es waren einmal in einem Dorfe ein paar arme Leute, die hatten ein kleines Häuschen und nur eine einzige Tochter, die war wunderschön und gut über alle Maßen. Sie arbeitete, fegte, wusch, spann und nähte für sieben und war so schön wie sieben zusammen, darum ward sie Siebenschön geheißen.
Aber weil sie ob ihrer Schönheit immer von den Leuten angestaunt wurde, schämte sie sich und nahm Sonntags, wenn sie in die Kirche ging - denn Siebenschön war auch frömmer als sieben andere, und das war ihre größte Schönheit -, einen Schleier vor ihr Gesicht.
So sah sie einstens der Königssohn und hatte seine Freude über ihre edle Gestalt, ihren herrlichen Wuchs, so schlank wie eine junge Tanne, aber es war ihm leid, dass er vor dem Schleier nicht auch ihr Gesicht sah, und fragte seiner Diener einen: "Wie kommt es, dass wir Siebenschöns Gesicht nicht sehen? "
"Das kommt daher" antwortete der Diener, "weil Siebenschön so sittsam ist. "
Darauf sagte der Königssohn: "Ist Siebenschön so sittsam zu ihrer Schönheit, so will ich sie lieben mein Leben lang und will sie heiraten. Gehe du hin und bringe ihr diesen goldenen Ring von mir und sage ihr, ich habe mit ihr zu reden, sie solle abends zu der großen Eiche kommen. "
Der Diener tat, wie ihm befohlen war, und Siebenschön glaubte, der Königssohn wolle ein Stück Arbeit bei ihr bestellen, ging daher zur großen Eiche, und da sagte ihr der Prinz, dass er sie lieb habe um ihrer großen Sittsamkeit und Tugend willen und sie zur Frau nehmen wolle; Siebenschön aber sagte:
"Ich bin ein armes Mädchen, und du bist ein reicher Prinz, dein Vater würde sehr böse werden, wenn du mich wolltest zur Frau nehmen." Der Prinz drang aber noch mehr in sie, und da sagte sie endlich, sie wolle es sich bedenken, er solle ihr ein paar Tage Bedenkzeit gönnen.
Der Königssohn konnte aber unmöglich ein paar Tage warten, er schickte schon am folgenden Tage Siebenschön ein Paar silberne Schuhe und ließ sie bitten, noch einmal unter die große Eiche zu kommen. Da sie nun kam, so fragte er schon, ob sie sich besonnen habe?
Sie aber sagte, sie habe noch keine Zeit gehabt, sich zu besinnen, es gebe im Haushalt gar viel zu tun, und sie sei ja doch ein armes Mädchen und er ein reicher Prinz, und sein Vater werde sehr böse werden, wenn er, der Prinz, sie zur Frau nehmen wolle.
Aber der Prinz bat von neuem und immer mehr, bis Siebenschön versprach, sich gewiss zu bedenken und ihren Eltern zu sagen, was der Prinz im Willen habe. Als der folgende Tag kam, da schickte der Königssohn ihr ein Kleid, das war ganz von Goldstoff, und ließ sie abermals zu der Eiche bitten.
Aber als nun Siebenschön dahin kam und der Prinz wieder fragte, da musste sie wieder sagen und klagen, dass sie abermals gar zu viel und den ganzen Tag zu tun gehabt und keine Zeit zum Bedenken, und dass sie mit ihren Eltern von dieser Sache auch nicht habe reden können, und wiederholte auch noch einmal, was sie dem Prinzen schon zweimal gesagt hatte, dass sie arm, er aber reich sei und dass er seinen Vater nur erzürnen werde.
Aber der Prinz sagte ihr, das alles habe nichts auf sich, sie solle nur seine Frau werden, so werde sie später auch Königin, und da sie sah, wie aufrichtig der Prinz es mit ihr meinte, so sagte sie endlich ja und kam nun jeden Abend zu der Eiche und zu dem Königssohne - auch sollte der König noch nichts davon erfahren.
Aber da war am Hofe eine alte hässliche Hofmeisterin, die lauerte dem Königssohn auf, kam hinter sein Geheimnis und sagte es dem König an. Der König ergrimmte, sandte Diener aus und ließ das Häuschen, worin Siebenschöns Eltern wohnten, in Brand stecken, damit sie darin anbrenne.
Sie tat dies aber nicht, sie sprang, als sie das Feuer merkte, heraus und als bald in einen leeren Brunnen hinein, ihre Eltern aber, die armen alten Leute, verbrannten in dem Häuschen.
Da saß nun Siebenschön drunten im Brunnen und grämte sich und weinte sehr, konnte es aber zuletzt doch nicht auf die Länge drunten im Brunnen aushalten, krabbelte herauf, fand im Schutt des Häuschens noch etwas Brauchbares, machte es zu Geld und kaufte dafür Mannskleider, ging als ein frischer Bub an des Königs Hof und bot sich zu einem Bedienten an.
Der König fragte den jungen Diener nach dem Namen, da erhielt er die Antwort: "Unglück!" und dem König gefiel der junge Diener also wohl, dass er ihn gleich annahm und auch bald vor allen anderen Dienern gut leiden konnte.
Als der Königssohn erfuhr, dass Siebenschöns Häuschen verbrannt war, wurde er sehr traurig, glaubte nicht anders, als Siebenschön sei mit verbrannt, und der König glaubte das auch und wollte haben, dass sein Sohn nun endlich eine Prinzessin heirate, und musste dieser nun eines benachbarten Königs Tochter freien.
Da musste auch der ganze Hof und die ganze Dienerschaft mit zur Hochzeit ziehen, und für Unglück war das am traurigsten, es lag ihm wie ein Stein auf dem Herzen. Er ritt auch mit hinten nach als der Letzte im Zuge und sang wehklagend mit klarer Stimme:
"Siebenschön war ich genannt,
Unglück ist mir jetzt bekannt. "
Das hörte der Prinz von weitem und fiel ihm auf und er hielt und fragte: "Ei, wer singt doch da so schön? " "Es wird wohl mein Bedienter, der Unglück, sein", antwortete der König, "den ich zum Diener angenommen habe." Da hörten sie noch einmal den Gesang:
"Siebenschön war ich genannt,
Unglück ist mir jetzt bekannt. "
Da fragte der Prinz noch einmal, ob das wirklich niemand anders sei als des Königs Diener. Und der König sagte, er wisse es nicht anders. Als nun der Zug ganz nahe an das Schloss der neuen Braut kam, erklang noch einmal die schöne klare Stimme:
"Siebenschön war ich genannt,
Unglück ist mir jetzt bekannt. "
Jetzt wartete der Prinz keinen Augenblick länger, er spornte sein Pferd und ritt wie ein Offizier längs des ganzen Zugs in gestrecktem Galopp hin, bis er an Unglück kam und Siebenschön erkannte. Da nickte er ihr freundlich zu und jagte wieder an die Spitze des Zuges und zog in das Schloss ein.
Da nun alle Gäste und alles Gefolge im großen Saal versammelt waren und die Verlobung vor sich gehen sollte, so sagte der Prinz zu seinem künftigen Schwiegervater: "Herr König, ehe ich mit Eurer Prinzessin Tochter mich feierlich verlobe, wollt mir erst ein kleines Rätsel lösen.
Ich besitze einen schönen Schrank, dazu verlor ich vor einiger Zeit den Schlüssel, kaufte mir also einen neuen; bald darauf fand ich den alten wieder, jetzt sagt mir Herr König, wessen Schlüssel ich mich bedienen soll? "
"Ei, natürlich des alten wieder!" antwortete der König, "das Alte soll man in Ehren halten und es über Neuem nicht hintansetzen. " "Ganz wohl, Herr König", antwortete nun der Prinz, "so zürnt mir nicht, wenn ich Eure Prinzessin Tochter nicht freien kann, sie ist der neue Schlüssel und dort steht der alte."
Und nahm Siebenschön an der Hand und führte sie zu seinem Vater, in dem er sagte: "Siehe Vater, das ist meine Braut. " Aber der alte König rief ganz erstaunt und erschrocken aus: "Ach lieber Sohn, das ist ja Unglück, und mein Diener! "
Und viele Hofleute schrien: "Herr Gott, das ist ja ein Unglück! "
"Nein!" sagte der Königssohn, "hier ist gar kein Unglück, sondern hier ist Siebenschön, meine liebe Braut." Und nahm Urlaub von der Versammlung und führte Siebenschön als Herrin und Frau auf sein schönstes Schloss.
ODA UND DIE SCHLANGE ...

Es war einmal ein Mann, der hatte drei Töchter, von denen hieß die jüngste Oda. Nun wollte der Vater dieser drei einmal zu Markte fahren und fragte seine Töchter, was er ihnen mitbringen sollte. Da bat die Älteste um ein goldnes Spinnrad, die zweite um eine goldne Haspel, Oda aber sagte: "Bringe mir das mit, was unter deinem Wagen wegläuft, wenn du auf dem Rückweg bist."
Da kaufte denn nun der Vater auf dem Markt ein, was sich die älteren Mädchen gewünscht, und fuhr heim, und siehe, da lief eine Schlange unter den Wagen, die fing der Mann und brachte sie Oda mit. Er warf sie unten hin in den Wagen und nachher vor die Haustür, wo er sie liegen ließ.
Wie nun Oda heraus kam, da fing die Schlange an zu sprechen: "Oda! Liebe Oda! Soll ich nicht hinein auf die Diele?" "Was?" sagte Oda. "Mein Vater hat dich bis an unsere Türe mitgenommen, und du willst auch herein auf die Diele?" Aber sie ließ sie doch ein.
Da nun Oda nach ihrer Kammer ging, so rief die Schlage wieder: "Oda, liebe Oda! Soll ich nicht vor deiner Kammertüre liegen?" "Ei, seht doch!" sagte Oda, "mein Vater hat dich bis an die Haustür gebracht, ich habe dich herein gelassen auf die Diele, und nun willst du auch noch vor meiner Kammertür liegen? Doch es mag drum sein!"
Wie nun Oda in ihre Schlafkammer eingehen wollte und die Kammertür öffnete, da rief die Schlange wieder: "Ach, Oda, liebe Oda! Soll ich nicht in deine Kammer?" "Wie?" rief Oda, "hat dich mein Vater nicht bis an die Haustür mitgenommen? Hab ich dich nicht auf die Diele gelassen und vor meine Kammertür? Und nun willst du auch noch mit in die Kammer? Aber, wenn du nun zufrieden sein willst, so komm nur herein, liege aber stille, das sag ich dir!"
Damit ließ Oda die Schlange ein und fing an sich auszukleiden. Wie sie nun ihr Bettchen besteigen wollte, so rief die Schlange doch wieder: "Ach, Oda, liebste Oda! Soll ich denn nicht mit in dein Bette?" "Nun wird es aber zu toll!" rief Oda zornig aus. "Mein Vater hat dich bis an die Haustür mitgenommen; ich habe dich auf die Diele gelassen, nachher vor die Kammertür, nach her herein in die Kammer - und nun willst du gar noch ins Bett zu mir? Aber du bist wohl erfroren? Nun, so komm mit herein und wärme dich, du armer Wurm!"
Und da streckte die gute Oda selbst ihre weiche warme Hand aus und hob die kalte Schlange zu sich herauf in ihr Bett. Da mit einem Male verwandelte sich die Schlange, die eine lange Zeit verzaubert gewesen war und die nur erlöst werden konnte, wenn alles das geschah, was mit ihr sich zugetragen hatte - in einen jungen und schönen Prinzen, der als bald die gute Oda zu seiner Frau nahm.
SCHNEIDER HÄNSCHEN UND DIE WISSENDEN TIERE ...
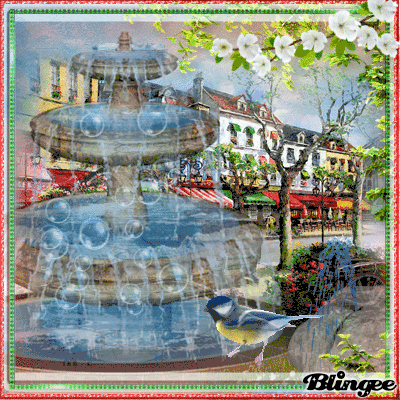
Ein Schuhmacher und ein Schneider sind einmal miteinander auf die Wanderschaft gegangen. Der Schuster hatte Geld, der Schneider aber war ein armer Schwartenhans. Beide hatten ein und das selbe Mädchen lieb, welches Lieschen hieß und jeder gedachte, es zu heiraten, wenn er sich ein gutes Stück Geld verdient habe und Meister geworden sei.
Der Schuster, Peter genannt, war aller Tücke voll und hatte ein schwarzes Herz, das Schneiderlein war gutmütig und leichtfertig, und sein Name war Hänschen. Erst hatte Hänschen nicht mit dem Peter zusammen wandern wollen, weil es kein Geld hatte, aber Peter, der auf eitel Bosheit gegen das Schneiderlein sann, weil jenes Lieschen das Hänschen gern sah und nicht den Peter, sann auf des Schneiderleins Verderben und sprach:
"Komm nur mit mir, ich habe Batzen, ich halte dich frei, auch wenn wir keine Arbeit bekommen. Alle Tage wollen wir uns dreimal tüchtig satt essen und satt trinken. Ist dir das nicht recht? "
"Von satt essen und satt trinken bin ich ja ein Freund!" antwortete Hänschen, und beide schnürten ihre Ränzel und traten ihre Wanderschaft an. Neun Tage lang gingen sie und fanden nirgends Arbeit, zumal Peter keine finden mochte und, wenn auch Hänschen Arbeit hätte haben können, diesen immer verlockte, sie nicht anzunehmen, sondern mit ihm zu wandern.
Nun, nach den neun Tagen sprach Peter: "Hänschen, mein Geld nimmt ab, soll es noch eine Weile reichen, so dürfen wir von jetzt an des Tages nur zweimal essen und trinken." "O weh!" seufzte Hänschen, "wird schon jetzt Schmalhans unser Wandergeselle? Wäre ich doch nicht mit dir gegangen! Hungern konnte ich auch daheim! Dort hatte ich doch was Liebes, was mir den Hunger versüßt hätte! "
Peter, der während des Weitermarsches stets die Speisen kaufte, aß sich heimlich dick satt, denn er hatte Geld genug dazu, aber Hänschen gab er täglich nur zweimal und hatte seine Freude daran, wenn seinem Gefährten der Magen murrte und knurrte und sich, nach dem Sprichwort, die Betteljungen in Hänschens Leibe prügelten.
So gingen abermals neun Tage hin, und noch immer fand sich keine Arbeit, da sprach Peter: "Liebes Hänschen, mit meinem Gelde wird es bald Matthäi am letzten sein - es langt wahrlich nimmer zu vier Mahlzeiten täglich, zwei für dich, zwei für mich. Mein Geldbeutel hat die galoppierende Schwindsucht. Schau her, es ist so dünn wie ein Spulwurm. Wir können von jetzt an uns nur einmal täglich sättigen."
"Ach, ach Peterlein!" klagte Hänschen. "In welches Unglück hast du mich gebracht! Das halt ich ja nicht aus! Sieh mich doch nur an, ich bin ja schon so dünne und durchsichtig, dass ich schier kaum noch einen Schatten werfe. Wo soll denn das zuletzt hinaus?"
"Schnalle einen Schmachtriemen um!" lachte Peter. "Übe dich in der Tugend der Enthaltsamkeit. Tritt in einen Mäßigkeitsverein!"
"Hat sich was einzutreten", jammerte das Schneiderlein. "Ich meint, wir wären schon mitten in der Mäßigkeit!"
Was half aber nun alles, es musste gut tun, wohl oder übel; Hänschen hungerte tapfer, dass er aber nicht zunahm an Leibesfülle, kann sich jeder denken. Er wurde Rassel dürr, und sein Angesicht bekam eine Farbe wie Hauszwirn. Und immer gab es keine Arbeit, und nun zumal erst recht nicht, denn die Meister sprachen: "Reise mit Gott, Bruder Mondschein! Wie kann so ein Kerlchen etwas Dauerbares nähen, dem sein ganzes eigenes Gestelle aus der Naht reißt? Schneider dürfen von Natur dünn sein, aber nur was recht ist - so dann, dass man sie statt Nähgarns einfädeln kann, dürfen sie doch nicht sein!"
Hänslein weinte heiße Tränen, wenn er solche lose Reden zu hören bekam, und der schlechte Peter frohlockte heimlich und innerlich darüber, und als wiederum neun Tage vergangen waren und Hänschen vor Hunger fast am Wege liegen blieb, da sprach der falsche Peter:
"Bruderherz - es tut mir leid und schneidet mir in die Seele, dass ich es sagen muss, aber mein Geldbeutel ist jetzt ganz auf den Hund - mit Essen und Trinken bei Bäcker und Wirt ist es nun ganz und gar vorbei."
"Dass es Gott erbarme!" schrie Hänschen. "Gar nicht mehr essen und trinken? Da steht mir der Verstand stille! Wer kann das aushalten? O wehe, wehe mir! Dass ich dir folgte! Wehe dir, dass du mich so verlockt hast!"
"Mein Himmel, wie du gleich außer dir geraten kannst, Hänschen!" rief Peter. "Als ob es nicht zu trinken vollauf gäbe!" "Wo? Wo?" rief Hänschen mit lechzender Zunge. "Überall! Wasser, Bruderherz! Wasser!" lachte Peter. "Wasser ist sehr gesund, es verdünnt Blut und Säfte, es heilt die meisten Krankheiten, es stärkt die Glieder. Siehst du, ich muss ja auch Wasser trinken."
"Aber Wasser ist kein Essen!" klagte Hänschen. "Von Luft kann ich nicht leben, also schaffe mir zu essen, oder ich muss ins Gras beißen und Erde kauen. Etwas muss ich zu kauen haben."
"Nun, ich will zum Bäcker gehen und für das letzte Geld ein Brötchen kaufen, das will ich redlich mit dir teilen!" sagte der falsche Peter, hieß Hänschen auf einen Stein sitzen und ging zu einem Bäcker, kaufte dort vier Brötchen, aß drei davon gleich auf und trank einen Schnaps dazu - dann kam er wieder zu Hänschen.
"Aber Peter!" sprach das hungrige Schneiderlein: "Du bleibst sehr lange aus. Gib mir zu essen, die Ohnmacht wandelt mich an." "Ich habe erst warten müssen, bis das Brot sich abgekühlt hatte", verteidigte sich Peter, "warmes Brot ist nicht gut in einen leeren Magen. Hier hast du deine Hälfte."
"Peter, du riechst nach Schnaps!" sprach Hänschen. "So?" fragte Peter, "kann schon sein, drinnen trank einer, der stieß an mich und schüttete mir aus Ungeschick ein paar Tropfen auf mein Gewand."
Hänschen verschlang sein halbes Brötchen mit Wolfshunger, stillte mit Wasser seinen Durst und wanderte weiter mit seinem treulosen Gefährten. Beide sprachen fast nichts mehr miteinander.
Als es bald Abend wurde und beide wieder durch ein Dorf kamen, ging Peter wieder zu einem Bäcker, aß sich satt und kam mit einem Brötchen aus dem Laden. Hans dachte, jener werde das Brötchen mit ihm teilen, aber Peter schob es in die Tasche.
Nach einer Weile sprach Hänschen, als sie das Dorf im Rücken hatten und in einen Wald gelangt waren: "Nun, Peter! Rücke heraus mit deinem Brötchen! Mich hungert äußerst." "Mich nicht", antwortete Peter ganz kurz. "Nicht?" schrie Hänschen erschrocken und blieb stehen, und seine Beine zitterten. "Unmensch, der du bist!"
"Vielfrass, der du bist!" höhnte Peter. "Bei dir trifft doch recht zu, was ich immer habe sagen hören: je dürrer ein Kerl ist, eine um so bessere Klinge schlägt er. Das Brötchen, das ich noch bei mir trage, ist, wie du sehr richtig bemerktest, mein Brötchen, und du bekommst nicht eine Krume davon, weil du gesagt hast Unmensch."
"So muss ich ja Hungers sterben!" schrie Hänschen in Verzweiflung. "Stirb in Gottes Namen!" antwortete Peter. "Die Leichenträger werden sich an dir keinen Schaden heben." "Aber ich bitte dich um Gottes willen!" jammerte Hänschen. "Um was?" fragte Peter lauernd. "Um die Hälfte deines Brötchens!" stammelte Hänschen. "Umsonst ist der Tod - es hat mich mein allerletztes Geld gekostet. Wie viel Geld könnte ich noch haben, hätte ich mich nicht mit dir geschleppt und dich gefüttert!" sprach Peter aufs neue.
"Aber du selbst hast mich ja beredet, mit dir zu gehen!" warf Hänschen ein, doch machten Ärger und Hunger ihm schon schwer, die Worte hervor zu würgen. Seine Zunge klebte am Gaumen.
"Gibst du mir, so gebe ich dir", nahm Peter wieder das Wort. "Mir ist mein Brötchen so lieb wie meine Augäpfel, folglich ist es zwei Augäpfel wert. Gib mir einen deiner Augäpfel für die Hälfte." "Gott im Himmel! Wie strafst du mich, dass ich diesem folgte!" wimmerte Hänschen, denn schreien konnte das arme Schneiderlein schon vor Schwäche nicht mehr - doch streckte es die Hand nach dem halben Brötchen aus und sättigte sich, und dann stach ihm Peter den einen Augapfel aus.
Am anderen Tage wiederholte sich alles Traurige des vorigen Tages bei den zwei Wandergesellen. Peter kaufte wieder ein Brötchen und gab Hänschen nichts davon, und wollte das andere Auge Hänschens für dessen Hälfte haben.
"Aber dann bin ich ja stockblind!" jammerte das Schneiderlein. "Dann kann ich ja nicht mehr arbeiten! Ohne ein Auge mindestens kann ich doch nicht einfädeln!"
"Wer blind ist", tröstete der hart- und schwarzherzige Peter mit heimlichem Hohne, "der hat es gut. Er sieht nicht mehr, wie böse, falsch und treulos die Welt ist; er braucht nicht mehr zu arbeiten, denn er hat eine triftige Entschuldigung, und einem armen Blinden gibt auch der Geizigste zur Not noch eine Gabe.
Du kannst noch reich werden als blinder Bettler, während ich mich armselig durch die Welt schleppen muss. Sollte dies eintreten, so werde ich zu dir kommen und du wirst mich noch als deinen besten Wohltäter segnen und deinen Reichtum mit mir teilen, wie ich bisher meine Armut mit dir geteilt habe."
Hänschen vermochte auf diese teuflische Rede gar nichts mehr zu erwidern - er ließ alles mit sich geschehen und gab, um nur nicht Hungers zu sterben, dem treulosen Gefährten auch den zweiten Augapfel preis.
Und als das geschehen war und Hänschen hoffte, dass der Peter ihn nun leiten und führen werde, sprach dieser: "Nun gehabe dich recht wohl, mein gutes dummes Hänschen! Hier habe ich dich haben wollen. Hier ist Bettelmanns Umkehr. Jetzt wandre ich wieder heim und heirate unser Lieschen. Ätsch! Siehe du zu, wohin du kommst!"
Fort ging Peter, und Hänschen schwanden vor Körper und Seelenschmerz eine Zeit lang völlig die Sinne, so dass er umsank und wie tot am Wege lag. Da kamen drei Wanderer des Weges daher, aber keine zweibeinigen, sondern zufällig vierbeinige, das waren ein Bär, ein Wolf und ein Fuchs.
Sie berochen den Ohnmächtigen, und der Bär brummte: "Dieses Manntier ist tot! Mögt ihr ihn? Ich mag ihn nicht!" "Ich habe vor einer Stunde erst ein frisches Schaf verspeist, habe justament jetzt keinen Hunger, auch ist ja der Kerl so dürr und so hart wie ein Baumast!" sprach der Wolf. "Da wäre mir leid um meine Zähne, die ich weiter brauche."
"Dieser Held muss ein Schneider gewesen sein!" spöttelte der Fuchs. "Mir ist eine fette Gans lieber als ein dürrer Schneider. Wäre er ein Kürschner gewesen, so würde ich ihm die Nase abbeißen - so aber liegt er mir gut. Er ist ja blind gewesen, der hat gewiss nie einen Fuchs geschossen."
Das arme Schneiderlein kam wieder zu sich, merkte seine Gesellschaft und hielt den Odem an sich, so gut es ging, während die drei Tiere sich gar nicht weit von ihm behaglich ins Grüne lagerten.
"Blind zu sein, ist ein großes Unglück", sprach der Fuchs, "sowohl für uns edle Tiere als für die schlechten zweibeinigen Gabeltiere, die sich Menschen nennen und sich so klug dünken und so fürchterlich dumm sind, dass sie gar nichts wissen. Wüssten sie, was ich weiß, so gäbe es keine Blinden mehr."
"Oho!" rief der Wolf. "Ich weiß auch, was ich weiß. Wüssten das die Manntiere in der nahen Königsstadt, so litten sie nicht den gebrannten Durst, den sie leiden, und kauften nicht ein Schnapsgläschen voll Wasser um eine Krone."
"Hm hm!" brummte der Bär. "Unsereiner ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Auch mir ist ein Geheimnis kund. Sagt ihr mir das eure, sage ich euch das meine, aber bei Leib und Leben darf keiner von uns den anderen verraten."
"Nein das dürfen und wollen wir nicht tun!" gelobte der Fuchs. "Es muss einer dem anderen feierlich die rechte Pfote darauf geben!" bekräftigte der Wolf. "Topp, es gilt!" sprach Petz, und hielt seine haarige Tatze hin, und wie die anderen einschlugen, so drückte und schüttelte der Bär zum Spaß ihre Pfoten so, dass sie vor Schmerz laut aufheulten, davon dem blinden Schneiderlein Angst und Bange wurde.
"Ich weiß", begann der Fuchs, als der Bär ihn ob seines Zartgefühles ausgelacht und wieder begütigt hatte, "dass heute eine besonders heilige Nacht ist; in dieser fällt Himmelstau auf Gras und Kraut. Wer blind ist, darf nur mit dem Tau seine Augen salben, so wird er wieder sehend, und selbst wenn er keine Augäpfel mehr hat, so bekommt er neue."
"Das ist ein schönes Geheimnis", sprach der Wolf, "meins ist aber auch nicht zu verachten. In der Königsstadt ist das Wasser ausgeblieben, und die Leute dort leben jetzt fast nur vom Geist, wenigstens sagen sie so, wenn es aber noch ein Weilchen so fort geht, so werden sie ihren Geist ganz aufgeben müssen.
Gleichwohl haben sie Wasser die Fülle unter sich und wissen es nur nicht. Auf dem Markte mitten im Pflaster liegt ein Grauwackenstein, wenn der aufgehoben wird, so wird ein Wasserpütz turmhoch aus dem Boden springen. Ach, wie froh würden die Residenzstädter sein, und wie heilsam wäre es ihnen, wenn sie wieder Wasser hätten. Dass aber keiner von euch es ihnen sagt, sonst beiße ich jedem die Zunge im Maule ab!"
"Nichts wird gesagt, Bruder Isegrimm!" sprach Herr Braun und brummelte: "Was ich weiß, ist dieses: Seit sieben Jahren kränkelt des Königs einzige Tochter, und kein Doktor kann ihr helfen, weil keiner weiß, was ihr fehlt, wie wunderklug sich auch alle dünken.
Gar manchen Rat gaben schon insgeheim des Königs Geheimräte, aber es ist nichts Rätliches davon an den Tag gekommen. Die Krankheit der Königstochter ist so gestiegen, dass der König verkündigt hat, sie dem zur Gemahlin zu geben, der ihr hilft, um sie nur beim Leben erhalten zu sehen; es kann aber keiner helfen, der das nicht weiß, was ich weiß."
"Du machst uns neugierig, hochgnädiger Herr König Braun!" sprach der Wolf, und Petz brummte: "Nur Geduld, es kommt schon noch. Werdet doch ein wenig warten gelernt haben?" Darauf schnaubte der Bär erst einmal gehörig aus und fuhr dann fort:
"Die Prinzessin Königstochter sollte in der Kirche ein Goldstück in den Opferstock werfen, sie war aber noch sehr jung und befangen und ängstlich und schämte sich vor den vielen Leuten in der Kirche und warf das Goldstück etwas ungeschickt, dass es daneben und in eine Spalte fiel. Darauf wurde sie von ihrer Krankheit befallen, die nicht früher enden wird, bis man das Goldstück hervor zieht und in die Ritze des Opferstockes einwirft. Solche Kur ist kinderleicht, es dürfte nur einer hingehen und das Goldstück suchen."
Als die Tiere sich einander so ihre Geheimnisse mitgeteilt hatten, erhoben sie sich aus ihrer Ruhe und gingen weiter; Hänschen aber war heilfroh über das, was er gehört hatte. Er bestrich sich eilend mit dem bereits gefallenen Himmelstau die Augen, da wuchsen ihm neue klare Augäpfel, und er sah die goldenen Sterne am Himmel blinken und die dunklen Wipfel der Waldesbäume.
Bald brach der Morgen an, und Hänschen sah nun Weg und Steg und wanderte, neu gestärkt, der Straße entlang. In einigen Dörfern, durch die er kam, erfocht er so viel, dass er seinen neu erwachten Hunger und Durst stillen konnte, und endlich kam er in die Stadt, in welcher der Wassermangel so groß war, dass alle Leute Wein und viele Schnäpse tranken, welche sie Likör nannten.
Hänschen hatte kein Geld für Liköre; er trat zu einer Wirtin und bat, ihm ein großes Glas Wasser zu reichen. Die Wirtin sah ihn dafür sehr groß an und schalt: "Sehe mir einer den Lump! Hat nicht einmal Geld, einen Likör zu bezahlen, und will Wasser zechen! Meint der Mosjö, Herr von Fadenschein, das Wasser quelle nur so für nichts und wieder nichts? Es koste kein Geld?
O weit gefehlt. Wisch Er sich das Maul von wegen dem Wasser; Wein oder Likör kann Er haben, mit Wasser kann ich nicht dienen, zumal in so großer Menge nicht."
"Liegt man hier wirklich so krank an der Wassersucht, wie ich draußen vernommen?" fragte Hänschen. "Ei, wozu habt ihr denn hier Magistrat und Gemeinderat? Ist kein Moses im Stadtrate, der Wasser aus dem Felsen schlüge? Eure Krankheit wollte ich bald kuriert haben; ich bin ein Brunnenarzt."
Diese Worte vernahmen einige junge Ratsherren, welche bei der Wirtin teils auch Liköre, teils Champagnerwein tranken; sie taten dies nur aus Ermangelung des Wassers, sonst würden sie es gewiss nicht getan haben, denn sie nannten den Champagner Gift und Äquinoktialsäure, und ohne die äußerste Not wird sicherlich niemand Gift oder solcherlei Säuren zu sich nehmen.
Diese jungen Herren umringten Hänschen und fragten hastig, wie er es anstellen wolle, dem Mangel abzuhelfen. "Meine hochverehrtesten Herren", sprach Hänschen, "wenn ich solch einen Mangel all hier abstellen soll, so tut nötig sein, dass ich erst angestellt werde.
Soll ich euch geheimen Rat erteilen, so würde eine mir zugeteilte kleine Geheimratsbesoldung - so vier- bis sechstausend Talerchen alljährlich mich zu Dank vergnügt machen. Dann solltet ihr Herren aber auch sehen, dass ich etwas leiste, was sich nicht von allen Geheimräten rühmen lässt."
Die jungen Ratsherren gaben dem Schneiderlein zu verstehen, es möge nicht sticheln und nicht so anzüglich reden, das könne man in der geistreichen Residenz nicht vertragen.
"Nanu!" entgegnete Hänschen. "Wenn ein Kleiderkünstler nicht mehr sticheln und anzüglich reden soll, da hört alles auf." Die Sache wurde nun im Gemeinderate und vom Magistrate reiflich erwogen, und alle Stimmen einigten sich in dem Rufe: "Wasser um jeden Preis - ehe wir im Sande totaliter vertrocknen!"
Der Magistrat stellte hierauf die Not gemeiner Stadt dem Könige vor und auch das Mittel zu deren Abhilfe und bat Seine Majestät, in Gnaden zu geruhen, für den fremden Brunnenarzt ein Geheimratsdekret ausfertigen zu lassen, die Besoldung solle aus städtischen Mitteln gern bestritten werden.
Der König willfahrte mit väterlicher Huld diesem Gesuche und ließ das Dekret ausfertigen, jedoch - durch Erfahrungen gewitzigt - mit dem Vorbehalt, dass selbes nicht eher in Kraft trete, bis hinlängliches Wasser geschafft sei - sonst solle es nichts gelten, da schon so viele Versprechungen von auswärts her gewanderten Fremdlingen zwar zu Wasser geworden seien, aber zu keinem nutzbaren.
Hänschen begab sich nun in Begleitung einer schnell ernannten Wasserkommission auf den Markt, sah schon von weitem den grauen Quader - sprach zu den Technikern der Kommission: diesen Stein lasst ausbrechen, ihr Herren! - und als dies geschah, so rauschte plötzlich der Strahl eines Springbrunnens stark und mächtig und turmhoch in die Luft und quoll so viel Wasser aus, dass auf der Stelle in allen Kaufläden der Residenz die Preise der wasserdichten Zeuge um das Doppelte in die Höhe gingen.
Laut erscholl durch die ganze Königsresidenz das Lob des Wasserdoktors; fast hätte man ihn, wie den Schneider Hans Bockhold von Leiden, zum Propheten gemacht und ihn in Opern voll Pomp und Unsinn verherrlicht.
Noch des selben Tages wurde der neue Herr Geheimrat, der sich in dessen mit Staatskleidern, Staatswagen und Dienerschaft versehen hatte, an den Hof gerufen und fuhr stolz in den Palast.
Der König sagte ihm vieles Freundliche und schenkte ihm in Anerkennung seines Verdienstes um die Haupt- und Residenzstadt einen schönen Orden, am gewasserten Bande zu tragen.
Sehr bald lenkte sich das Gespräch auf die Krankheit der Königstochter, und der König fragte den neuen Geheimrat, ob er als geschickter Wasserdoktor vielleicht für die Prinzessin eine Brunnenkur heilsam finde. "Nein, Euer Majestät", erwiderte der Geheimrat.
"Einmal mit Wasser mich befasst, und nicht wieder. Lasse mich Eure Majestät der Gnade teilhaftig werden, aller höchst dero Prinzessin Tochter zu sehen, so hoffe ich zuversichtlich den Sitz ihrer Krankheit zu ergründen."
Darüber war der König über alle Maßen froh und führte den Doktor selbst zu der kranken Prinzessin. Der fühlte ihr den Puls und sah, dass sie sehr schön war. Dann sprach er: "Großmächtigster König, wenn die aller durchlauchtigste Prinzessin genesen soll, so kann dies nicht durch irdische Medizin geschehen, sondern durch göttliche Hilfe; gestatten Allerhöchst die selben, dass wir die Kranke in die Hofkirche tragen lassen, dort wird sie wohl genesen."
Dieser Vorschlag ward vom Könige als bald gut geheißen, denn er war sehr fromm und freute sich, einen so frommen neuen Geheimrat gewonnen zu haben. In der Kirche ließ sich der Heilkünstler von der Prinzessin den Opferstock zeigen, suchte nach und fand in einer Ritze das Goldstück. Dieses gab er der erleuchten Kranken in die Hand und ersuchte sie, das selbe nun richtig in den Stock zu werfen.
Selbiges tat die Prinzessin, und als bald wurde sie völlig gesund und begann wie eine Rose aufzublühen. So führte sie nun der Geheimrat zu dem Könige. Was da für eine große Freude war, ist gar nicht zu schildern. Aus dem Geheimrat wurde als bald rasch nacheinander ein Reichsrat, ein Standesherr, ein Graf, ein Fürst - und aus diesem ein Bräutigam der genesenen Prinzessin.
Nach der Hochzeit fahren die Neuvermählten auf einer Rundreise durch das Land, da kamen sie auch durch das Dorf, aus welchem der Fürst jüngst als Hänschen gewandert war.
Da stand am Wirtshaus ein Scherenschleifer und schliff, und seine Frau drehte ihm das Rad - und da waren es der Peter und das Lieschen, die den Peter erst durchaus nicht haben wollte, ihn aber am Ende doch nahm, weil er ihr zu schwor, Hänschen werde sie nie wieder sehen.
Hänschen kannte gleich den Peter am falschen Gesicht, rief dem Kutscher zu: "Halt!" und jenem rief er zu: "Peter!" Peter horchte hoch auf - und fragte, was der Herr befehle.
"Nichts befehlen will ich; Peter", sprach Hans, "als dass du das Hänschen in mir wiederkennen sollst, dem du zu so hohem Glücke verholfen hast. Dort im Walde fand ich armer Augenloser, durch dich augenlos, das blinde Glück, wie manche blinde Taube ihre Erbse.
Dort unter einem Baum, an dem ich lag, suchte mich es heim. Hier hast du vieles Geld vom blinden Bettler, der wieder sehend und reich geworden ist! Fahre wohl, und fahr zu, Kutscher!"
Peter stand wie aus den Wolken gefallen, lange starrte er dem Prachtwagen nach, dann gab er seiner Frau das Geld, es aufzuheben, und sagte: "Dort hin muss ich auch - muss auch das blinde Glück finden."
Und als bald rüstete sich Peter und wanderte, so rasch er wandern konnte, an jenen Ort, wo er am armen Hänschen die letzte treulose Tat beging. Ein Fuchs lief lange vor ihm her - an jenem Orte stand der Fuchs. Da kam von weitem ein Wolf entgegen gesprungen.
Rasch wandte Peter sich um, da trabte ein Bär des Weges daher. Voll Entsetzen klomm jetzt Peter am Baum empor, unter dem er Hänschen den letzten Augapfel ausgestochen hatte.
"Verräter! Verräter! Verräter, die ihr seid!" bellte der Fuchs, heulte der Wolf, brummte der Bär, und jeder beschuldigte den anderen, das Geheimnis verplaudert zu haben, auf dessen Behütung sie einander doch alle drei die Pfote gegeben hatten, waren sehr bissig gegeneinander und gaben einander schlechte Titel.
Endlich nahmen Bär und Fuchs gegen den Wolf Partei, der sollte zunächst der Verräter sein und dafür gehenkt werden, und als bald drehte der Fuchs ein Seil und eine Schlinge aus Tannenreisig, der Bär hielt den Wolf fest, der Fuchs warf letzterem die Schlinge um den Hals und zog den Zappelnden in die Höhe.
Der Wolf starrte stieren Auges empor, da sah er Peter im Gezweige des Baumes sitzen und heulte: "O falsche ungerechte Welt! Da droben sitzt er, der unser Geheimnis verraten hat!"
Jetzt sahen die anderen beiden Tiere auch in die Höhe, ließen den Wolf fallen, und der Bär kletterte auf den Baum und holte den Peter herunter. Drunten empfing ihn der Fuchs, der so fuchswild war, dass er ihm gleich beide Augen auskratzte.
Dann würgte ihn der Wolf, und der Bär drückte ihn mausetot, darauf haben sie ihn zu dritt aufgefressen, dass kein Knöchelchen von ihm übrig geblieben ist.
SEELENLOS ...

Es war einmal ein Menschenfresser, der verspeiste nichts lieber als junge Mädchen, und er war so gewaltig und gefürchtet im Lande, dass niemand es wagte, ihn zu bekämpfen und ihm diesen Appetit zu vertreiben, vielmehr musste ihm, sobald er ein Mägdelein verspeist hatte, ein anderes geliefert werden, und um bei der Wahl unparteiisch zu verfahren, mussten alle Mädchen des Landes bis zu einem gewissen Alter (nicht über achtzehn Jahre) das Los ziehen, ohne Unterschied des Ranges und Standes ihrer Eltern; denn Seelenlos, so war der Name jenes Mädchen fressenden Ungeheuers, sagte stets, er liebe nächst dem Mädchenfleisch vor allem die Gleichberechtigung.
Nun geschah es, dass eines Tages abermals das Los gezogen wurde, welches jedes Mal für die arme Jungfrau, die es traf, ein trauriges nicht nur hieß, sondern auch war, und dass solch eines Los die Tochter des Königs traf. Zwar suchte der König durch Anerbieten vieler Schätze das Los, welches ihr drohte, von seiner Tochter abzuwenden, aber Seelenlos sprach:
"Nein! Was einem recht ist, ist dem anderen billig. Mir ist es recht, dass das Los die Königstochter getroffen hat, denn ich habe noch keine Prinzessin gegessen, halte aber dafür, dass ihr Fleisch zart und gut sein müsse, und deshalb muss es der König billig finden, dass ich seiner Schätze ihn nicht berauben, sondern mich ehrlich und redlich nach meinem Grundsatze der Gleichberechtigung mit Fleische von seinem Fleische begnügen will. "
Da in dessen nicht als bald gleich nach gezogenem Lose die Königstochter ausgeliefert zu werden brauchte, so ließ der König bekannt machen, dass, wer seine Tochter von dem schrecklichen ihr drohenden Lose erlöse, diese zur Gemahlin und sein halbes Reich als Mitgift erhalten sollte.
Allein es meldete sich niemand, denn mit Leuten, welche Seelenlos heißen oder sind, ist schlecht umzugehen, und niemand mag sich mit ihnen befassen, sollten sie auch nicht just ausschließlich Menschenfresser sein.
Da hörte ein junger Soldat von des Königs Aufruf und dachte in seinem Sinn: Hm, mir ist in meinem Dienste schon so viel Seelenloses vorgekommen, und mir ist dafür so viele Herzhaftigkeit eingekorporalt worden, dass ich es wohl mit Herrn von Seelenlos aufzunehmen mir getraue.
Er ging also zum Könige und bat sich die Gnade aus, sein Leben gegen Seelenlos für ihn und die Prinzessin in die Schanze schlagen zu dürfen. Darauf gab ihm der König ein schönes Handgeld und schenkte ihm zu dem ein scharfes Vorlegemesser, um, wo möglich, den Mann der Gleichberechtigung damit in Stücke zu zerschneiden.
Der mutige Soldat machte sich auf den Weg und kam über einen Anger, auf selbigem lag ein toter Esel und streckte alle vier Beine von sich, und um den Esel herum saßen ein Löwe, ein Bär und ein Adler, auf der Nase aber saß eine große blaue Schmeißfliege; jedes wollte seinen Teil vom Esel haben, und alle vier konnten, wie das so häufig bei Teilungen der Fall ist, über die Teilung sich nicht einigen und riefen den Soldaten an, als Unparteiischer das Teilungsgeschäft in der Voraussetzung vorzunehmen, dass er nicht etwa selbst am Esel sich beteiligen wolle, denn für diesen Fall würden sie alle vier über ihn herfallen.
"Nein!" sagte der Soldat, "ich will nichts mit lebendigen Eseln zu schaffen haben, geschweige denn mit toten! Aber teilen will ich nach Recht und Überzeugung und nach dem schönen Spruche: Jedem das Seine!" Zog sein Vorlegemesser, strich es hübsch auf seinem Säbelriemen ab, wie ein Barbier mit seinem Schermesser auf dem Streichriemen tut, und fing an, den Esel nach Herzenslust zu zerlegen.
"Dir, dem Löwen", sprach der einsichtsvolle Soldat, "gebührt vor allem der Löwenteil, der Eselskopf, mit dem schönen Gehirn, weil du selbst der Tiere Haupt und König bist, dann die breite, kräftige Eselsbrust, die stets so Sieges stolz und freudig weithin jauchzet und mit ihrem Ruhme die Welt erfüllt, nebst einem Rückenstück und zwei Schinken.
Dir, dem beherzten heißblutigen Adler, dem Könige der Vögel, gebührt des Esels Herz samt allem edlen Eingeweide, absonderlich der starken Lunge, sowie Leber und Nieren und ein Schinken, vom Fleische ebenfalls ein Rückenstück und ein Lendenbraten.
Dir, Meister Petz, kühner Nordlandsrecke, großer Brummer und in nördlichen Gegenden auch ein König der Tiere, gebührt das dritte Rückenstück, der zweite Lendenbraten und der vierte Schinken, und was du sonst magst.
Und dir endlich, blau angelaufene Schmeiße, kleiner Brummer, gebührt des Esels Schwanz, die Beine und alles, was die drei anderen nicht mögen und etwa übrig lassen zu wollen in Gnaden geruhen dürften. Du wirst dich damit um so freudiger bescheiden, da du ja viel zu delikat bist, als schnödes Eselsfleisch zu essen, vielmehr dich vom Tau und Dufte der Blumen sättigst und nur für deine Eier und künftige Larvenbrut ein wenig faulen Fleisches bedarfst."
Die vier Tiere waren mit dieser Teilung außerordentlich zufrieden und zollten dem klugen Soldaten den Tribut ihres Dankes. Die Brummfliege setzte sich ihm auf die Hand, küsste diese mit dem Rüssel und mit dem After zugleich und sprach:
"So oft du diese Stelle mit deinem Finger berührst, kannst du deine unförmliche und ungeschlachte Menschengestalt in eine ebenso schöne, zarte und bewunderungswürdige, auch mit reizendem Musiktalent begabte Brumm-Fliege verwandeln, wie ich eine bin."
Der Adler zog sich mit seinem Schnabel eine Schwungfeder aus dem rechten Flügel, reichte sie dem Soldaten dar und sagte: "Mittels dieser Feder kannst du dich, so oft du sie drehst, in einen Adler verwandeln und als solcher große Dinge tun; auch kannst du sie schneiden, und was du mit ihr unterschreibst und verbriefst oder verbriefen lässt, das hält und dauert drei Tage länger als die aschgraue Ewigkeit."
"Biederer Mensch", sprach der Löwe, "ich muss dir eine Pfote geben, das wird dich stärken und großmächtig machen in der Welt!" Und der Bär sprach: Edelster der Edlen! Komm an mein Herz, ich muss dich umarmen und dir einen Kuss geben!"
Aber der Soldat entgegnete: "Ich dank euch zwei beiden schönstens! Ihr seid gar zu gütig! Ich habe schon genug!" Denn er fürchtete die scharfen Klauennägel der Löwentatze wie des Bären Umarmung und die Nähe von dessen Zähnen an seiner Nase.
Er drehte daher sehr schnell die Feder und wurde zum Adler, als welcher er sich rasch in die Lüfte erhob, von wo aus er nach dem Hause des Herrn Seelenlos umherspähte und das selbe mit seinem Adlerblicke auch sehr bald entdeckte . Das war schon ein großer Gewinn für den braven Soldaten; doch musste er nun auch auf Mittel sinnen, wie dem Seelenlos beizukommen sei, welchem mittlerweile die Königstochter ausgeliefert worden war, doch hielt jener die selbe noch eine Zeit lang gefangen.
Nun verwandelte sich der Soldat erst wieder in einen Menschen, drückte mit dem Finger auf das kleine Denkmal der Fliege auf seiner Hand, verwandelte sich dann in eine solche und schlüpfte durch das Fenster des Gemaches, in welchem die Königstochter gefangen saß, verwandelte sich dort in seine menschliche Gestalt und teilte der Prinzessin die Absicht mit, sie zu erlösen, nur möge sie ihm sagen, auf welche Weise er dies möglich machen könne, indem er es für eine große Kunst und schwere Aufgabe halte, jemanden zu entseelen, der Seelenlos sei und heiße. Jedenfalls müsse Herrn Seelenlos' Seele doch irgendwo sich befinden, und dieses wo müsse ausfindig gemacht werden.
Die Königstochter war sehr erfreut über das Vorhaben des tapferen Soldaten, sie zu befreien, und verhieß ihm, Erkundigungen einzuziehen. Hierauf nahm der Soldat seine Verwandlung vor und entfernte sich; zu der Königstochter aber kam Seelenlos, der Menschenfresser, und brachte ihr treffliche Speisen und Getränke, damit sie sich gut nähre, bis er die Zeit ersehen würde, sie zu verspeisen.
Sie fragte ihn gleich, wo denn seine Seele sei. Er aber antwortete ihr: "Dir das zu sagen, werde ich wohl bleiben lassen, denn wenn schon ich Seelenlos bin, so bin ich doch nicht hirnlos, und es könnte mir, wenn nicht an der Seele, so doch am Leibe schaden, wenn ich mein größtes Geheimnis dir, einem schwatzhaften Weibe, anvertrauen wollte."
Aber die Königstochter ließ mit Bitten nicht nach, bis Seelenlos ihr dennoch sein Geheimnis anvertraute und ihr sagte, seine Seele sei in einer kleinen goldenen Truhe verschlossen, diese Truhe stehe auf einem gläsernen Felsen, und der Felsen stehe mitten im roten Meere. Ein böser Zauberer habe das alles so angerichtet, ihn seelenlos und nächst dem Mädchenfleisch fressend gemacht; er könne nichts dafür; wenn er seine Seele wiederbekomme, so werde er die jungen Mädchen nicht mehr so fresslieb haben, sondern sie mit bescheidenen Augen ansehen.
Das alles sagte die gefangene Königstochter dem Soldaten wieder, als dieser sie abermals besuchte, und als bald verwandelte der selbe sich in einen Adler und flog nach dem Schlosse der vier Winde. Diese selbst waren ausgeflogen, aber ihre Mutter war zu Hause, und er bat letztere um Herberge in ihrem luftigen Palast und erzählte ihr seine Geschichte, worauf die Windmutter gleich bereit war, ihm durch ihre Söhne Beistand zu leisten.
Gegen Abend kamen der Südwind und der Ostwind nach Hause; diesen beiden stellte die Windmutter den tapferen Krieger vor und beschenkte letzteren mit einem Wünschelflughütchen, das ihm die Kraft verlieh, so schnell wie der Wind zu fliegen.
Am anderen Morgen, als die Winde ausgeruht hatten, erhoben sie sich aufs neue, und der Soldat flog in Adlergestalt mit ihnen und ebenso rasch wie sie und kam an die Küste des roten Meeres; unterwegs hatte er den Winden erzählt, was er wünsche, und die Winde fuhren nicht über das Meer, damit es ruhig bleibe.
Dann geboten sie den Fischen, das Kästchen zu suchen, in dem sich die Seele des Herrn Seelenlos befand. Das taten auch die Fische, und sie fanden wohl den gläsernen Felsen, darauf die kleine Truhe stand, konnten aber nicht hinauf. Endlich kam eine krumme Gadde oder Weißling, die schnellte sich in die Höhe und ergatterte das Trühlein mit einem Satze, fasste es in ihr Maul und brachte es dem Adler.
Dieser schlug mächtig mit seinen Schwingen, wackelte mit dem Schwanz und tanzte vor Freude, worüber die Winde sehr lachen mussten, denn sie hatten noch keinen Adler possierliche Sprünge machen sehen, so viel sie auch schon gesehen hatten.
Hierauf drückte der Adler erst den Winden, dann dem Weißling seinen verbindlichsten Dank aus und flog, immer noch das Wünschelflughütlein auf dem Kopfe, nach der Heimat zurück und geradewegs nach dem Schlosse des Herrn Seelenlos, auf welchem er sich wieder in einen Menschen verwandelte.
Er ließ sich sofort anmelden als ein Handelsmann aus dem Morgenlande, der ein Kleinod anzubieten habe. Seelenlos war sehr ungnädig über solchen zudringlichen Besuch und ließ den Angemeldeten nur deshalb eintreten, um ihn mit Grobheiten zu beköstigen, die jedermann anzutun er sich zu jeder Zeit berechtigt glaubte, fuhr ihn auch alsbald trutzig an, denn ein Mensch ohne Seele kann nicht anders sein als ungeschliffen und patzig.
Der Soldat und verstellte Handelsmann kehrte sich in dessen nicht an des Herrn Seelenlos grimmiges Gesicht und an sein Anschnauzen, sondern war um so höflicher, je gröber jener war, der sich nicht anders gebärdete, als wolle er ihn ebenfalls fressen.
"Ich habe einen Schatz, der für Euer Gnaden von unschätzbarem Wert ist", sprach der Fremde, "und biete den selben Ihnen zum Tausche an." "Wird ein rechter Bettel sein, sein Schatz!" murrte Seelenlos. "Was kann so ein Lump mir bieten? Bildet Er sich ein, ich könne Ihn nicht mit barem Gelde bezahlen, dass Er sich erfrecht, vom Tausche zu reden? Was hätte ich, das Ihm ansteht? Gleich will ich es wissen!"
"Eure Gnaden halten gnädigst zu Gnaden!" antwortete der Fremde. "Hoch die selben halten ein Juwel in Verwahrung, das ist die schöne Königstochter, und der Bettel, nach Hoch dero eigener Taxation, den ich gegen dieses Kleinod anzubieten mich unterfangen ist Euer Gnaden - gnädige Seele."
"Meine Seele!" rief Seelenlos mit namenlosem Erstaunen. "Meine Seele hast du? Bei meiner armen, leider verlorenen und mir abhanden gekommenen Seele schwöre ich dir, dass du, wenn ich hundert Königstöchter gefangen hielt, alle hundert bekommen solltest, wenn ich nur meine Seele wieder hätte."
"Ich bescheide mich mit der einen", erwiderte der Handelsmann, "hundert dürften mir zu viele werden. Aber schließen wir den Vertrag schriftlich ab!" Mit diesen Worten zog der Soldat ein beschriebenes Blatt Papier hervor, darauf schon alles kurz und bündig stand, und reichte Seelenlos die Adlerfeder dar, mit ihr zu unterzeichnen, welches Seelenlos auch tat.
Dann ließ er auf der Stelle seine schöne Gefangene herbei führen, die eine große Freude hatte, den Soldaten bei dem Menschenfresser zu finden, welcher bereits den Fremden sich auf das Kanapee hatte niedersetzen lassen, indem schon die Nähe seiner Seele begann, ihn menschlicher zu stimmen.
Die Königstochter aber hatte geglaubt, sie solle in die Küche geführt und dort abgeschlachtet werden, wie eine arme Taube. Jetzt nahm der Soldat das kleine goldene Trühelein aus seiner Tasche, welches mit einer Schraube verschlossen war, und gab es in Seelenlos' Hand.
Dieser öffnete geschwind die Schraube, hielt die Öffnung an seinen Mund und sog mit Wohlgefühl seine Seele in sich ein. Da war mit einem Male der schlimme Zauber gelöst.
Die Königstochter war nicht mehr gefangen, und Seelenlos war nicht mehr seelenlos, sondern vielmehr ganz selig; er umarmte den Soldaten unter einem Strome von Freudentränen und hätte gern auch die Königstochter umarmt, aber eine Ehrfurcht volle Scheu hielt ihn davon zurück, der beste Beweis, dass er wieder eine Seele gewonnen hatte, doch bat er beide um ihre Freundschaft.
Hierauf zog der Soldat mit der Königstochter von hinnen, ward vom Könige, ihrem Vater, in den Prinzenstand erhoben, heiratete als neuer Prinz die junge Prinzessin, und der gewesene Seelenlos verspeiste keine jungen Mädchen mehr, ward vielmehr der artigste Kavalier von der Welt.
STAR UND BADEWÄNNLEIN ...
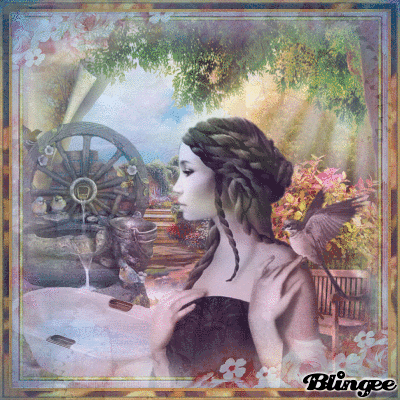
Vor einem Wirtshaus im Walde hielt ein junger stattlicher Reitersmann, da trat eine feine Maid aus der Türe, grüßte ihn züchtig und fragte, was er begehre. Da heischte er einen Becher kühlen Weins, den brachte ihm die Jungfrau.
Der Reitersmann trank aber nicht eher, bis die Maid mit ihren roten Lippen von dem Weine genippt und den Trunk ihm kredenzt hatte. Während er nun trank, trat die Wirtin aus der Türe, ein hässliches Weib von brauner Gesichtsfarbe und widrigem Ansehen. Die fragte der Reitersmann: "Holla, Frau Wirtin! Ihr habt für wahr ein feines Töchterlein! Nicht also? "
"Nein, Herr!" antwortete die Wirtin, "diese Dirne da ist nicht meine Tochter, sie ist nur meine angenommene Magd, hat nicht Eltern und Heimat mehr. Habe sie angenommen aus Barmherzigkeit. "
Der Reitersmann fühlte Liebe zu der schönen Maid, stieg ab vom Ross, begehrte ein Nachtquartier und dass ihm die Magd ein Fußbad rüste, weil er gern mit ihr reden wollte. Die Wirtin gebot der Magd, in den Garten zu gehen und Rosmarin, Thymian und Majoran für das Bad zu pflücken.
Dies tat sie gern und freudig, ging und brach die Kräuter, da flog ein Star auf ein Sträuchelein neben ihr und sang und sprach: "0 weh, du Braut! Du sollst dem Junker die Füße zwagen in dem Badewännelein, darin du hierher getragen worden! Dein Vater ist vor Herzeleid gestorben, und deine Mutter hat sich schier um dich zu Tode gegrämt.
O weh, du Braut, du Findelkind!
Weißt nicht, wer dein Vater und Mutter sind! "
Da erschrak die fromme Maid und grämte sich, rüstete das Bad unter Tränen in dem kleinen Wännelein und trug es hinauf in die Stube, wo der junge Ritter ihrer harrte. Als der sie weinen sah, fragte er: "Warum weinst du, Schönste? Willst du nicht lieber mit mir fröhlich sein? "
"Wie kann ich mit Euch fröhlich sein?" fragte sie weinend zurück. "Ich weine über das, was mir der Star sang, da ich drunten im Garten die Kräuter pflückte in Euer Bad. Der Star, der sang: "O weh, du Braut! Du sollst dem Junker die Füße zwagen in dem Badewännelein, darin du her getragen bist. Dein Vater ist vor Herzeleid gestorben, und deine Mutter hat sich schier um dich zu Tode gegrämt!
O weh, du Braut, du Findelkind!
Weißt nicht, wer dein Vater und Mutter sind! "
Da betrachtete der Herr das Badewännelein und sah daran das Wappen des Königs am Rhein, verwunderte sich über alle Maßen und rief: "Das ist meines Vaters Wappenschild! Wie kommt dies Wännelein in dies schlechte Wirtshaus? "
Da schlug ein Vogel draußen ans Fenster, das war wieder der Star, der sang: "In dem Badewännelein ist sie her getragen!
O weh, du Braut, du Findelkind!
Weißt nicht, wer dein Vater und Mutter sind! "
Jetzt sah der junge Herr am Hals der Maid ein Muttermal und rief freudig aus; "Grüß dich Gott, du Schönste! Du bist meine liebe Schwester! Dein Vater war der König am Rhein! Christine heißt deine Mutter! Konrad heiße ich, dein Zwillingsbruder bin ich. Darum empfand mein Herz nach dir, gleich als ich dich zum ersten sah, solch ein heftiges Verlangen! "
Da fielen sie einander um den Hals und weinten beide, knieten nieder und dankten Gott und sprachen liebreich miteinander die ganze Nacht. Wie nun der Morgen graute, rief die Wirtin vor der Tür mit lauter Stimme und voll Hohn:
"Steh auf, steh auf, du junge Braut, und kehre deiner Frauen die Stube aus! "
Da antwortete aber die Stimme Herrn Konrads: "Weder ist sie eine junge Braut, noch kehrt sie der Wirtin die Stube aus! Bringt uns nur selbst den Morgenwein!"
Als die Wirtin mit dem Morgenwein herein getreten war, fragte sie Herr Konrad: "Von wem und von wannen habt Ihr diese edle Jungfrau? Sie ist eines Königs Tochter und meine Schwester! "
Die Wirtin ward weiß wie eine Wand und fiel zitternd auf ihre Knie, brachte aber kein Wort hervor, des es auch nicht bedurfte, denn der Star war schon wieder am Fenster und verriet der Wirtin böse Tat, indem er sang:
"In einem Lustgarten im grünen Gras saß ein zartes Kind in einem Badewännelein, und wie die Wärterin nur einen Augenblick zur Seite gegangen war, da kam die böse Zigeunerin und trug das Kind samt dem Wännelein von dannen! "
Darüber wurde Herr Konrad so entrüstet, dass er das Schwert zückte und es der Wirtin durch die Ohren spießte, zu einem hinein, zum anderen heraus. Dann küsste er züchtig seine aller schönste Schwester, nahm das Badewännelein, führte sie an ihrer schneeweißen Hand aus dem Hause, hob sie auf den Sattel, und sie musste das Badewännelein vor sich auf dem Schoß tragen.
Auf ihre Schulter setzte sich der Star. So ritten sie vor das Königsschloss am Rhein, darin die Mutter, die Königin, herrschte, und als sie in das Tor ein ritten, kam ihnen die Mutter gerade entgegen gegangen.
Die fragte verwundert: "Ach, mein liebster Sohn! Was für eine Dirne bringst du da herein! Sie führt ja ein Badewännelein mit sich, als ob sie mit einem Kinde ginge!"
"Oh, meine liebste Mutter!" antwortete der junge Königssohn, "sie ist drum keine Dirne, sondern ist eure Tochter Gertraud, die in diesem Wännelein Euch geraubt wurde!"
Und da stieg die Prinzessin aus dem Sattel, die Königin aber fiel vor Freuden in eine Ohnmacht, aus der sie in den Armen ihrer Kinder wieder erwachte.
Der Star sang: "Heut sind es gerade achtzehn Jahre, seit die Königstochter geraubt und in dem Wännelein über den Rhein getragen worden ist!"
Das sang der Star, und auch noch dies:
"Der Zigeunerin tun die Ohren so weh,
Sie wird keine Kinder stehlen mehr! "
Die Prinzessin aber ließ einen Goldschmied rufen, der musste ein goldnes Gitterlein vor das Badewännelein schmieden, da hinein tat sie den Star und pflegte sein, bis an sein Ende.
ASCHENPÜSTER MIT DER WÜNSCHELGERTE ...
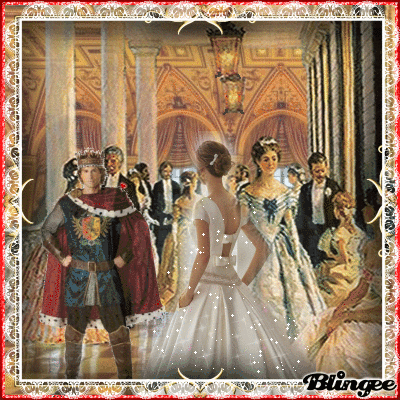
Es war einmal ein reicher Mann, der hatte eine einzige schöne Tochter, welche er über alle Maßen liebte. Seine Frau war gestorben. Die Tochter war außerordentlich schön, und was sie nur immer wünschte, das gab ihr der Vater, weil er kein größeres Glück kannte, als sein Mägdlein zu erfreuen, vielleicht auch, weil sie ein Wünschelfräulein war, dem jeder Wunsch ausging.
»Schenke mir ein Kleid, Vater, das von Silber steht, ich will dir auch einen Kuß dafür geben!« sprach eines Tages die Tochter zum Vater, und sie empfing bald das Kleid, und der Vater empfing seinen Kuß.
»Schenke mir ein Kleid, lieber Vater, das vom Golde steht!« sprach die Tochter bald darauf, »und ich will dir zwei Küsse geben.« Auch diesen Tauschhandel ging der Vater ein. »Schenke mir ein Kleid, das von Diamanten steht, liebster Vater, und ich will dir drei Küsse geben!« bat wiederum die Tochter, und der Vater sagte ihr: »Du sollst es haben, aber du machst mich arm.«
Der Vater schaffte das Kleid, und die Tochter fiel ihm dankend um den Hals, küßte ihn dreimal und rief: »Nun, herzgoldener, herzallerliebster Vater, schenke mir eine Glücksrute und Wünschelgerte, so will ich stets dein Goldkind sein und alles tun, was ich dir an den Augen absehen kann!«
»Mein Kind«, sprach der Vater, »eine solche Gerte habe ich nicht, auch wird sie schwer zu bekommen sein, doch will ich mein Glück versuchen, dich ganz glücklich zu machen.«
Da verreisete der Vater und nahm sein letztes Vermögen mit und forschte nach einer Wünschelgerte, aber kein Kaufmann hatte dergleichen feil. So kam der Mann weit in ein fernes Land, da fand er einen alten Zauberer und hörte, daß dieser eine Wünschelgerte besitze. Diesen Zauberer suchte der nur zu gute Vater auf, trug ihm sein Anliegen vor und fragte, was die Gerte kosten solle.
Der alte Zauberer sprach: »Wenn die Menschen Wünschelgerten mit Gelde kaufen könnten, so würde es auf Erden bald keinen Wald mehr geben, und wenn auch jedes Bäumelein und jedes Zweigelein eine solche Rute wäre. Der eine solche Gerte empfängt, opfert seine Seele und stirbt drei Tage nachher, wenn er sie aus der Hand gegeben, es wäre denn, er gäbe sie jemand, der auch seine Seele dafür zu opfern gelobt und bereit ist. Dann geht die Seele des Besitzers frei aus.«
»Gut«, sprach der Vater jener Tochter. »Meinem Kinde zuliebe scheue ich das verlangte Opfer nicht. Gib mir die Gerte!« Der alte Zauberer ließ den Mann seinen Namen in ein Buch schreiben und erfüllte sein Verlangen. Die weite Reise nach der Gerte zehrte den letzten Rest des Vermögens des reichen Mannes auf, der alles an die Tochter gewendet, aber es war ihm einerlei.
Sie nur durch Erfüllung aller ihrer Wünsche glücklich zu sehen, war sein einziger Wunsch und Gedanke. Es ist gut, dachte er, wenn ich sterbe, denn sie würde doch noch mehr wünschen, und wenn ich ihr nun keinen Wunsch mehr erfüllen könnte, würde ich selbst sehr unglücklich sein.
Mit größter Freude empfing die Tochter aus ihres Vaters Hand, den sie mit Sehnsucht zurück erwartete, die Wünschelgerte und wußte nicht, wie sie ihm danken sollte.
Aber nach drei Tagen hatte die Tochter einen neuen Wunsch. Sie hatte von einem überaus schönen Prinzen gehört, der in einem fernen Lande wohne, sehr reich und aller Liebe würdig sei. Den wollte sie gern zum Gemahl haben.
Der Vater aber sprach: »Meine geliebte Tochter, ich gab dir alles, was ich besitze, und für deine Wünschelgerte gab ich Leib und Leben, ja meine Seele dahin. Ich scheide von dir; schaffe du dir den Prinzen selbst, den du dir wünschst, lebe glücklich und denke mein in Liebe.« Mit diesen Worten neigte der Vater sein Haupt und verschied. Seine Tochter beweinte ihn aufrichtig und schmerzlich und sprach: einen bessere Vater hat es nie gegeben! Und darin hatte sie sehr recht.
Als nun der Vater dieser Tochter zur Erde bestattet war, blieben ihr nicht Verwandte, nicht Geld und Gut. Da tat sie ein Alltagskleid an, das war ein Krähenpelz, nahm ihr Silberkleid, ihr Goldkleid und ihr Diamantkleid und hing alle drei über ihre Schulter, dann nahm sie die Wünschelgerte in die Hand, schwang sie und wünschte sich in die Nähe des Schlosses, darin der gerühmte Prinz wohnte.
Da war es, als ob ein Wind sie sanft erhebe, und sie schwebte, von der Luft getragen, eilend zur Ferne und war bald in einem Parkwalde, in dessen Nähe sie das Prinzenschloß durch die dicken Eichbaumstämme schimmern sah. Sie schlug mit der Gerte an die dickste dieser Eichen und wünschte, daß da drinnen ein Schrein wäre, in dem sie ihre Kleider aufhängen könne, und ein Stübchen, sich darin umzukleiden, und das geschah auch gleich alles.
Sie verstellte nun ihre Gestalt in die eines Knaben und trat, mit dem Krähenpelz angetan, in das Prinzenschloß. Der Geruch feiner Speisen führte sie der Küche zu; dort bot sie dem Koch ihre Dienste an, als ein Eltern- und heimatloser Knabe.
»Wohlan«, sprach der Koch, »du sollst mein Aschenpüster werden, sollst früh die Feuer anschüren und am Tage unterhalten und sorgen, daß keine Asche umher falle, dafür sollst du dich alle Tage satt essen. Mußt aber auch des gnädigsten Herrn Prinzen Röcke ausbürsten und seine Stiefel putzen und glänzend machen.«
Das Mädchen waltete als Knabe ihres Amtes und sah nach einigen Tagen den Prinzen, der von der Jagd kam, den Küchengang entlang schritt und einen Vogel, den er geschossen hatte, in die Küche warf, damit der selbe gebraten werde. Der Prinz war so schön und herrlich von Gestalt und Ansehen, daß Aschenpüster als bald eine heftige Liebe zu ihm fühlte.
Gar zu gerne wäre sie ihm genaht, doch wollte sich das nicht schicken. Da hörte sie, drüben auf einem Nachbarschlosse werde eine fürstliche Hochzeit gehalten, die daure drei Tage lang, und da sei der Prinz der vornehmste Gast und fahre täglich hinüber zum Tanze.
Alles Volk und wer vom Schloßgesinde nur immer konnte, lief hinüber, die Pracht der Festlichkeiten mit anzusehen. Da bat Aschenpüster den Koch, ihr doch auch zu erlauben, hinüber zu gehen und dem Tanze zuzusehen, denn die Küche sei in Ordnung, jedes Feuer gelöscht, jedes Fünklein tot und die Asche wohl verwahrt.
Der Koch erlaubte seinem Diener, sich das erbetene Vergnügen zu gewähren. Aschenpüster eilte nach ihrer Eiche, kleidete sich in das silberne Kleid und verwandelte ihre Knabengestalt in die eigene, dann schlug sie an einen Stein mit ihrer Wünschelgerte, da wurde ein Galawagen daraus, und rührte an ein Paar Roßkäfer, daraus wurden stattliche pechschwarze Rosse, und ein Grasfrosch wurde zum Kutscher und ein grüner Laubfrosch zum Livreejäger.
In den Wagen setzte sich Aschenpüster, und heidi, ging es fort, als flögen wir davon. In den Tanzsaal trat die stattliche Jungfrau, und von ihrer Schönheit war alles geblendet. Der Prinz gewann sie gleich lieb und zog sie zum Tanze; sie tanzte entzückend, und war sehr glücklich, aber nach einigen Reigen schwand sie aus dem Saale, bestieg ihren draußen harrenden Wagen, schwang die Gerte und rief:
»Hinter mir dunkel, und vor mir klar,
Daß niemand sehe, wohin ich fahr!«
Es sah es auch niemand, wohin sie fuhr, aber der Prinz war über das schnelle Verschwinden seiner schönen Tänzerin sehr unruhig, und da auf alle seine Fragen, wer sie gewesen und woher sie sei, niemand Auskunft geben konnte, so verbrachte er die Nacht in großer Unruhe, die sich am Morgen in einen schrecklichen Mißmut und in die üble Stimmung verwandelte, von der selbst Prinzen bisweilen befallen werden können.
Der Koch brachte des Prinzen Stiefel in die Küche und klagte über dessen Mißlaune, in dem er die Stiefel Aschenpüster zum Putzen und Wichsen übergab. Sie übernahm diese Arbeit und wichste die Stiefel so schön, daß der Kater sich mit Wohlgefallen darin spiegelte und seinem Ich im Spiegel einen Kuß gab; davon verschwand an der Stelle, wo der Kater sich geküßt, der Glanz.
Als Aschenpüster nun in ihrer Knabengestalt und im Krähenpelze in des Prinzen Zimmer trat und die Stiefel hineinstellte, sah der Prinz gleich den matten Fleck, nahm den Stiefel, warf ihn ihr an den Kopf und schrie: »Du Bengel von Aschenpüster! Wirst du wohl besser Stiefel putzen lernen?!« Aschenpüster hob den Stiefel auf und machte ihn wieder durchweg glänzend und schwieg.
Abends fuhr der Prinz abermals zum Tanze, und Aschenpüster erbat noch einmal Urlaub. Da Aschenpüster am vorigen Abende bald wieder gekommen und nicht über die Zeit ausgeblieben war, wie manches Dienstgesinde gerne tut, so gewährte der Koch wiederum die Bitte - und nun ging Aschenpüster zu ihrem Schrein und Kämmerlein in der Eiche und tat das goldene Kleid an, schuf sich mit der Wünschelgerte einen neuen Wagen, neue Rosse, neue Bedienung und fuhr zum Schlosse hinüber.
Dort war bereits der Prinz aber verstimmt. Alles fehlte, weil sie fehlte. Da trat sie ein, strahlend wie eine Königin. Er eilte auf sie zu und führte sie zum Tanze - O wie glücklich machte ihn ihr holdes Lächeln, ihr sinniges Gespräch, ihre heitere schelmische Necklust! Viel hatte er heute zu fragen, unter anderem, wo sie her sei. Lachend antwortete Aschenpüster, »Aus Stiefelschmeiß!«
Eine kurze Stunde weilte Aschenpüster beim Tanze - mit einem Male war sie aus dem Saale verschwunden, rasch saß sie wieder in ihrem Wagen und sprach ihr Zauberwort:
»Hinter mir dunkel, und vor mir klar,
Daß niemand sehe, wohin ich fahr!«
Des Prinzen Blick suchte vergebens die geliebte Gestalt. Nach ihr fragend, wandte er sich an diesen und jenen der Hochzeitgäste, niemand kannte sie. Er fragte seinen Geheimen Rat, der mit ihm als sein Begleiter gekommen war: »Sagen Sie mir doch, mein lieber Geheimerat, wo liegt der Ort oder das Schloß Stiefelschmeiß?«
Der Geheimerat machte eine tiefe Verbeugung und antwortete: »Durchlauchtigster Prinz! Höchst die selben geruhen? Stiefelschmeiß - o ja, das liegt - das liegt - in - in - fatal, nun fällt es mir im Augenblicke nicht ein, wo es liegt. Sollte es wirklich ein Ort oder ein Schloß dieses seltsamen Namens geben? Wo sollte selbiges liegen, Eure Durchlaucht?«
Der Prinz drehte dem Sprecher den Rücken zu und murmelte ärgerlich durch die Zähne: »Ich lasse diesem Geheimerat jährlich dreitausend Taler Gehalt auszahlen, und nun weiß er nicht einmal, wo Stiefelschmeiß liegt! Es ist schauderhaft!«
Daraus erklärte sich von selbst, daß, als die Morgenröte des nächsten Tages rosig emporstieg, die Laune des Prinzen dennoch keine rosenfarbene war. Er hatte keine Ruhe, wollte früh schon ausgehen, zog seinen Rock an, den Aschenpüster rein gebürstet hatte, entdeckte darauf einige Stäubchen, rief nach einer Bürste und stampfte mit dem Fuße.
Eilend lief Aschenpüster im Krähenpelze mit der Bürste herbei, der Prinz war aber so schrecklich böse, daß er ihr die Bürste aus der Hand riß, sie ihr an den Kopf warf und ihr zuschrie, sie solle ein anderes Mal gleich besser bürsten.
Am letzten Abende des nachbarlichen Hochzeitfestes lief wieder alles hinüber zum Schlosse, und auch der Prinz fuhr wieder hin. Da bat Aschenpüster zum dritten Mal um Erlaubnis, auch zusehen zu dürfen, darüber schüttelte der Koch sehr den Kopf, daß der Junge so neugierig sei, doch dachte er: Jugend hat nicht Tugend, und sagte: »Es ist heute das letzte Mal, laufe hin!«
Aschenpüster lief geschwinde in den Park in die Eiche, zog das Diamantkleid an, zauberte sich wieder Rosse und Wagen, Kutscher und Lakaien und erschien wie ein lebendiger Schönheitsstrahl beim Feste. Der Prinz tanzte vor allem mit ihr und nur mit ihr und fragte sie zärtlich, wie sie denn heiße. Aschenpüster lächelte schelmisch und antwortete: »Cinerosa Bürstankopf.«
Den Vornamen, der auf Rosa ausging, fand der Prinz, zumal er kein Latein verstand, sehr schön, den Zunamen befremdlich - er hatte diese gewiß reiche und angesehene Familie noch nie nennen hören, doch sprach er, von Liebe bezwungen, in dem er ihr seinen Ring an einen Finger schob:
»Wer du auch sein magst, schönste Cinerosa! Mit diesem Ringe verlobe ich mich dir!« Mit hoher Schamröte auf den Wangen blickte Aschenpüster zur Erde und zitterte. Gleich darauf entfernte sie sich, als der Prinz nur einen Augenblick seine Augen anderswohin wandte.
Schnell saß sie im Wagen, aber der Prinz hatte soeben Befehl gegeben, den seinen dicht hinter dem ihren aufzufahren, damit er ihr folgen könne. Aschenpüster schwang ihre Wünschelgerte und sprach:
»Hinter mir dunkel, und vor mir klar,
Daß niemand sehe, wohin ich fahr!«
Und da rollte sie hin - rasch saß jetzt auch der Prinz in seinem Wagen und rollte ihr nach, aber da war ihr Wagen nicht mehr zu sehen, gleichwohl hörte man dessen Räder rollen, und so folgte der Wagenlenker des Prinzen diesem Schall.
Der Tanz hatte dieses Mal am längsten gedauert, schon zog der frühe Morgen dämmernd heran; die Stunde war bereits da, in der die Küchenarbeit begann, Aschenpüster zauberte schnell ihren Wagen und ihre Bedienung fort und hatte nicht Zeit, sich erst umzukleiden, sie verbarg daher eiligst ihr Diamantkleid unter dem Krähenpelz und eilte in die Küche.
Der Prinz aber, welcher dem Wagen des herrlichen Mädchens nachgefahren war, sah sich mit Verwunderung dicht vor seinem eigenen Schlosse und wußte nicht, wie ihm geschah, war daher wieder sehr mißmutig und dazu sehr ungehalten und übernächtig.
»Unser Prinz ist gar nicht wohl auf!« sagte zu Aschenpüster der Koch. »Er muß ein Kraftsüpplein haben oder eine Schokolade - zünde rasch Feuer an.« Der Morgenimbiß wurde schnell bereitet, Aschenpüster warf des Prinzen Ring hinein, der Koch trug die Tasse auf.
Der Prinz trank und fand am Boden mit Erstaunen seinen Ring und fragte hastig: »Wer war so früh schon in der Küche?« »Euer Durchlaucht, niemand als ich und der Aschenpüster«, antwortete der Koch.
»Schicke mir diesen Burschen gleich einmal herein!« gebot der Prinz, und als Aschenpüster kam, sah ihn der Prinz ganz scharf an, aber der Krähenpelz verhallte alle Schönheit.
»Komme her, tritt näher, Aschenpüster!« gebot der Prinz. »Komm, kämme mich, mein Friseur liegt noch in den Federn!« Aschenpüster gehorchte; sie trat ganz nahe an den Prinzen heran und strählte ihm mit elfenbeinernem Kamm das volle weiche Haar.
Der Prinz befühlte den Krähenpelz; der selbe war an einigen Stellen abgetragen, daher etwas mürb und fadenscheinig, und durch die abgeschabten Fäden blitzte es so funkelklar wie Morgentau, das war der Diamantglanz des Prachtgewandes, das Aschenpüster noch unter ihrem Krähenpelz trug.
»Jetzt kenne ich dich, o Liebe!« rief voll unaussprechlicher Freude der Prinz. »Jetzt bist du mein, jetzt bin ich dein! Auf ewig!« Und schloß die Braut in die Arme und küßte sie.
Kurz vor der Hochzeit bat die schöne Braut sich von ihrem geliebten Bräutigam noch eine Gnade aus. Der gute Koch, der Aschenpüster so wohl wollend aufgenommen und so freundlich und gütig behandelt hatte, empfing von dem Prinzen den Ritterschlag und wurde zum Erbtruchseß erhoben.
Das war ihm recht, da brauchte er das Essen nicht mehr zu kochen, wie sonst, sondern konnte es an der fürstlichen Tafel in aller Ruhe selbst mit verzehren helfen, und als die Hochzeit prachtvoll gefeiert wurde, da trug er im vollen Glanz seiner neuen Würde, geschmückt mit Stern und Orden, dem prinzlichen Paare mit eigener Hand die Speisen auf.
ASCHENBRÖDEL ...
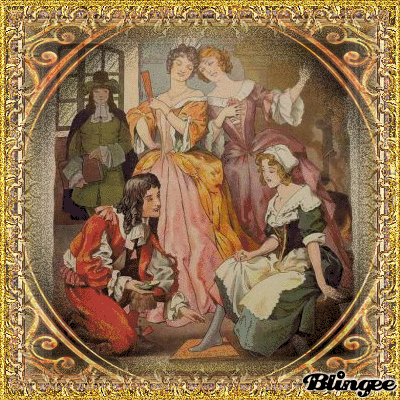
Ein Mann und eine Frau hatten zwei Töchter, und es war auch noch eine Stieftochter da, des Mannes erstes liebes Kind, gar fromm und gut, aber nicht gern gesehen von ihrer Stiefmutter und den Stiefschwestern, deshalb wurde es auch schlecht behandelt.
Es mußte in der Küche den ganzen Tag über wohnen, alle Küchenarbeit tun, früh aufstehen, kochen, waschen und scheuern, und nachts mußte es in der Bodenkammer schlafen. Da kroch es bisweilen lieber in die Asche am Küchenherd und wärmte sich, und da es davon nicht sauber aussehen konnte, so wurde es von der Mutter und den Schwestern noch obendrein Aschenbrödelchen genannt, aus Spott und Bosheit.
Einst war der Vater zur Messe gereist und hatte die Mädchen gefragt, was er ihnen mitbringen solle; da hatte die eine schöne Kleider, die andere Perlen und Edelsteine gewünscht. Aschenbrödel aber wünschte sich nur ein grünes Haselreis. Diese Wünsche hatte der Vater auch erfüllt.
Die Schwestern putzten und schmückten sich, Aschenbrödel aber pflanzte das Reis auf das Grab ihrer Mutter und begoss es alle Tage mit ihren Tränen. Da wuchs das Reis sehr schnell und wurde ein schönes Bäumlein, und wenn Aschenbrödel auf dem Grab ihrer Mutter weinte, so kam allemal ein Vöglein geflogen, das sah sie mitleidig an.
Da begab es sich, daß der König ein Fest anstellte und dazu alle Jungfrauen des Landes einladen ließ, denn sein Sohn sollte sich aus ihnen eine Braut wählen. Und da schmückten sich die Schwestern überaus reizend, und Aschenbrödel mußte ihnen die Haare kämmen und schöne Zöpfe flechten, und daß sie auch gern zum Tanz mitgehen mochte, das fiel gar niemand ein.
Als sie endlich es wagte, um Erlaubnis zu bitten, ward sie schrecklich ausgelacht, daß sie sich einfallen ließe, zum Tanz gehen zu wollen, da sie doch keine schönen Kleider habe und Schuhe. Die böse Stiefmutter nahm geschwind eine Schüssel voll Linsen, warf diese in die Asche und sagte: »So, so, Aschenbrödel, mache dir etwas zu tun, lies erst die Linsen; dann sollst du mitgehen, mußt aber in zwei Stunden fertig sein.«
Das arme Kind ging in den Garten und rief dem Vöglein auf ihrem Haselnußbaum und auch den Täubchen, daß sie lesen sollten die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, und bald wimmelte es von Tauben und anderen Vögeln, da währte es gar nicht lange, so war die Schüssel voll Linsen ganz rein gelesen.
Aber wie das gute Mädchen voller Freude die Linsen brachte, ärgerte sich die Stiefmutter und schüttete jetzt zwei Schüsseln voll Linsen in die Asche, und die sollte es nun auch noch in zwei Stunden lesen.
Aschenbrödel weinte, rief aber die Vöglein wieder, und bald war auch diese Arbeit getan. Es wurde ihr aber dennoch nicht Wort gehalten, sondern sie wurde ausgelacht, denn sie habe ja keine Kleider und keine Schuhe, und wie sie sei, könne sie sich nimmermehr sehen lassen, auch müsse der Königssohn und jeder andre einen schlechten Geschmack haben, der mit ihr tanze, und da gingen jene Stolzen fort und ließen Aschenbrödel tief betrübt zurück.
Die ging zu ihrem Bäumchen und weinte bitterlich, da kam das Vöglein geflogen und rief:
»Mein liebes Kind, O sage mir,
Was du wünschest, schenk ich dir!«
Da rief Aschenbrödel, indem sie das Bäumchen anfaßte:
»O liebes Bäumchen, rüttle dich!
O liebes Bäumchen, schüttle dich!
Wirf schöne Kleider über mich!«
Da flogen ein schönes Kleid herunter und kostbare Strümpfe und Schuhe, das zog Aschenbrödel geschwind an und ging auf den Ball, und das Mädchen war so schön, ach, so schön, daß es gar niemand kannte, auch nicht einmal seine Mutter und seine Schwestern, und der Königssohn tanzte nur mit ihm und mit keiner anderen Jungfrau, und als es abends nach Hause ging, wollte er ihm folgen, es entwich ihm aber, zog geschwind Kleid und Schuhe aus auf dem Grabe, unter dem Bäumchen, und legte sich in seine Asche. Kleider und Schuhe verschwanden augenblicklich.
So ging es noch zweimal, immer kam Aschenbrödel unerkannt und in stets schönern Kleidern zum Tanze, immer tanzte der Königssohn nur mit ihm, und immer folgte dieser, und beim dritten Mal verlor es von ungefähr den einen kleinen goldnen Schuh; der Königssohn hob ihn auf, bewunderte seine Zierlichkeit und sprach es laut, ließ es auch durch die Herolde kundtun, nur die Jungfrau, an deren Fuß der kleine Schuh passe, solle seine Gemahlin werden, und ritt von Haus zu Haus, die Probe zu machen.
Vergebens probierten die beiden Schwestern den kleinen Schuh; es war, als ob ihre Füße ordentlich größer würden, da fragte der Königssohn, ob nicht drei Töchter da wären, und der Mann sagte: »Ja, Herr Prinz! Noch ein kleines Aschenbrödelchen !«
Und die Mutter setzte gleich hinzu: »Die sich nicht sehen lassen kann.«
Der Königssohn wollte sie aber doch sehen; Aschenbrödel wusch sich fein und rein und trat ein, auch in ihrem aschgrauen Kittelchen durch ihre Schönheit die Schwestern überstrahlend. Und wie es den goldnen Schuh anzog, so paßte er prächtig, wie angegossen. Und der Königssohn erkannte sie nun auch gleich wieder und rief: »Das ist meine holde Tänzerin, meine liebe Braut!« nahm sie, führte sie aufs Schloß und befahl, ein stattliches Hochzeitsfest zuzurüsten.
Beim Kirchgang hatte Aschenbrödel ein ganz goldenes Kleid an und ein goldnes Krönlein auf dem Kopf; ihre Schwestern gingen ihr voll Neid zur Rechten und zur Linken. Da kam das Vöglein vom Haselbäumchen und pickte jeder ins Auge, daß dies erblindete.
Als nun die Braut aus der Kirche ging, kam wieder das Vöglein und pickte wieder jeder das andere Auge aus, und so waren sie für ihren Neid und Bosheit mit Blindheit geschlagen ihr Leben lang.
DAS HELLERLEIN ...
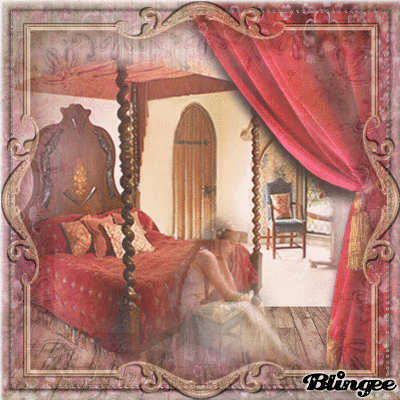
Ein fremder Wandergast trat in ein Bauernhaus und fand allda die Familie, den Vater mit Frau und Kindern, in trüber Stimmung und in Trauerkleidern, denn ihnen war vor wenigen Wochen ein liebes und schönes Kind, ein Mädchen, gestorben.
Die Leute ließen den Fremden, der ihnen jedoch verwandt war, an ihrem Mittagsmahl Anteil nehmen. Man setzte sich nach gesprochenem Gebete zu Tische, da schlug es zwölf Uhr. Und mit dem letzten Schlage der Uhr ging ganz leise die Stubentüre auf, und es trat ein bleiches Kind herein in die Stube, grüßte niemand, sah sich nicht um, sprach kein Wort, sondern ging schwebenden Ganges in die Kammer. Niemand sprach ein Wort, und auch der Fremde fragte nicht, aber es überlief ihn ein Schauer.
Geschäfte hielten den Verwandten noch einen und den anderen Tag im Orte und bei den Leuten, die ihn aufgenommen, fest, sonst wäre er lieber gegangen, denn am zweiten Tage zeigte sich die selbe Erscheinung; das bleiche Kind kam zur Stubentüre herein und ging schweigend in die Kammer - ohne daß die Leute es nur zu gewahren schienen.
Das selbe geschah am dritten Tage, da hielt der Fremde nicht länger an sich, sondern fragte: »Ei, sagt doch, was ist das für ein Kind, das jeden Mittag Glock zwölf so still durch die Stube und in die Kammer geht?« »Ich weiß von keinem solchen Kinde, ich sah noch keins«, antwortete der Vater, die Mutter aber begann zu weinen.
Jetzt ging der Fremde zu der Kammertüre, öffnete sie ein wenig und blickte in die Kammer. Da gewahrte er das Kind. Es saß an der Erde und grub mit den Fingern in einer Ritze zwischen zwei Dielen gar emsig und wühlte und seufzte leise: »Ach, das Hellerlein! Ach, das Hellerlein!« als aber die Kammertüre ein wenig knarrte, fuhr das Kind erschrocken zusammen und verschwand.
Nun sagte der Gast den Leuten an, was er gesehen, und beschrieb des Kindes Gestalt, da rief die Mutter schluchzend aus: »Ach Gott, ach Gott! Das war unser Kind, das wir vor vier Wochen begraben haben! Warum nur hat es keine Ruhe im Grabe?«
Nun gab der Gast den Rat, die Diele aufzubrechen, und als das geschah, so fand sich darunter ein armseliges Hellerlein, das hatte das Kind in der Kirche in den Klingelbeutel legen sollen, hatte es aber behalten, bis es noch eines zweiten habhaft würde, dann hatte es sich wollen Pfennigsemmel kaufen.
Zu Hause aber hatte das Kind das Hellerlein fallen lassen, und es war zwischen den Dielen in die Ritze gefallen. Deshalb hatte das Kind keine Ruhe im Grabe. Am Tage darauf warf des Kindes Mutter das Hellerlein in den Klingelbeutel, und von nun an kam das Kind nicht wieder.
DAS MÄRCHEN VOM MANN IM MONDE ...
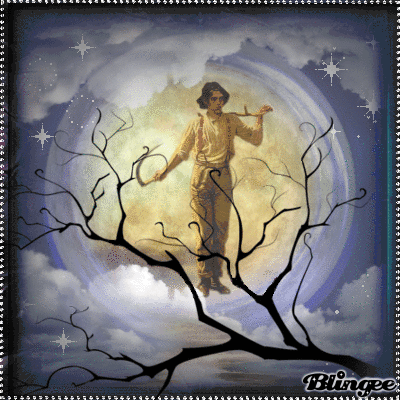
Vor uralten Zeiten ging einmal ein Mann am lieben Sonntagmorgen in den Wald, haute sich Holz ab, eine großmächtige Welle, band sie, steckte einen Staffelstock hinein, huckte die Welle auf und trug sie nach Hause zu.
Da begegnete ihm unterwegs ein hübscher Mann in Sonntagskleidern, der wollte wohl in die Kirche gehen, blieb stehen redete den Wellenträger an und sagte: »Weißt du nicht, daß auf Erden Sonntag ist, an welchem Tage der liebe Gott ruhte, als er die Welt und alle Tiere und Menschen geschaffen? Weißt du nicht, daß geschrieben steht im dritten Gebot, du sollst den Feiertag heiligen?«
Der Fragende aber war der liebe Gott selbst; jener Holzhauer jedoch war ganz verstockt und antwortete: »Sonntag auf Erden oder Mondtag im Himmel, was geht das mich an, und was geht es dich an?«
»So sollst du deine Reisigwelle tragen ewiglich!« sprach der liebe Gott, »und weil der Sonntag auf Erden dir so gar unwert ist, so sollst du fürder ewigen Mondtag haben und im Mond stehen, ein Warnungsbild für die, welche den Sonntag mit Arbeit schänden!«
Von der Zeit an steht im Mond immer noch der Mann mit dem Holzbündel, und er wird wohl auch so stehen bleiben bis in alle Ewigkeit.
DAS NATTERKRÖNLEIN ...
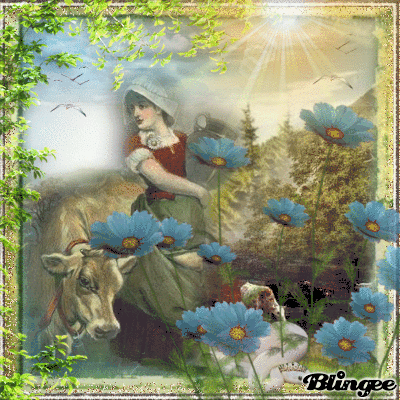
Alte Großväter und Großmütter haben schon oft ihren Enkeln und Urenkeln erzählt von schönen Schlangen, die goldene Krönlein auf ihrem Haupte tragen; diese nannten die Alten mit mancherlei Namen, Otterkönig, Krönleinnatter, Schlangenkönigin und dergleichen, und sie haben gesagt, der Besitz eines solchen Krönleins bringe großes Glück.
Bei einem geizigen Bauern diente eine fromme, mildherzige Magd, und in dessen Kuhstalle wohnte auch eine Krönelnatter, die man zuweilen des Nachts gar wunderschön singen hörte, denn diese Nattern haben die Gabe, schöner zu singen als das beste Vögelein.
Wenn nun die treue Magd in den Stall kam und die Kühe molk oder sie fütterte und ihnen streute, was sie mit großer Sorgfalt tat, denn ihres Herrn Vieh ging ihr über alles, da kroch manchmal das Schlänglein, welches so weiß war wie ein weißes Mäuschen, aus der Mauerspalte, darin es wohnte, und sah mit klugen Augen die geschäftige Magd an, und dieser kam es immer vor, als wolle die Schlange etwas von ihr haben. Und da gewöhnte sie sich, in ein kleines Untertäßchen etwas Euter warme Kuhmilch zu lassen und dem Schlänglein dieses hinzustellen, und das trank die Milch mit gar großem Wohlbehagen, drehte und wendete dabei sein Köpfchen, und da glitzerte das Krönlein wie ein Demant oder ein Karfunkelstein und leuchtete ordentlich in dem dunkeln Stalle.
Das gute Mädchen freute sich über die weiße Schlange gar sehr und nahm auch wahr, daß, seit sie die selbe mit Milch tränkte, ihres Herrn Kühe sichtbarlich gediehen, viel mehr Milch gaben, stets gesund waren und sehr schöne Kälbchen zur Welt brachten, worüber sie die größte Freude hatte.
Da traf es sich einmal, daß der Bauer in den Stall trat, als just die Krönleinnatter ihr Töpfchen Milch schleckte, das ihr das gute Mädchen hingestellt, und weil er geizig und happig über alle Maßen war, so begehrte er gleich so wild auf, als ob die arme Magd die Milch eimerweise weggeschenkt hätte.
»Du miserable, nichts nutze Magd, die du bist!« schrie der böse Bauer. »So gehst du also um mit Hab und Gut deines Herrn? Schämst du dich nicht der Sünde, einen solchen giftigen Wurm, der ohnedies den Kühen zur Nacht die Milch aus den Eutern zieht, auch noch zu füttern und in den Stall zu gewöhnen? Hat man je so etwas erlebt? Schier glaub ich, daß du eine böse Hexe bist und dein Satanswesen treibst mit dem Teufelswurm!«
Das arme Mädchen konnte diesem Strom harter Vorwürfe nur mit reichlich geweinten Tränen begegnen, aber der Bauer kehrte sich nicht im mindesten daran, daß sie weinte, sondern er schrie und zankte sich mehr und mehr in den vollen Zorn hinein, vergaß alle Treue und allen Fleiß der Magd und fuhr fort zu wettern und zu toben: »Aus dem Hause, sag ich, aus dem Hause! Und auf der Stelle! Ich brauche keine Schlangen als Kostgänger!
Ich brauche keine Milchdiebinnen und Hexendirnen! Gleich schnürst du dein Bündel, aber gleich! Und machst, daß du aus dem Dorfe fort kommst, und laß dich nimmer wieder blicken, sonst zeig ich dich an beim Amt, da wirst du eingesteckt und kriegst den Staubbesen, du Malefiz-Wetterdirn!«
Laut weinend entwich die so hart gescholtene Magd aus dem Stalle, ging hinauf in ihre Kammer, packte ihre Kleider zusammen und schnürte ihr Bündlein, und dann trat sie aus dem Hause und ging über den Hof. Da wurde ihr weh ums Herz, im Stalle blökte ihre Lieblingskuh.
Der Bauer war weiter gegangen; sie trat noch einmal in den Stall, um gleichsam im stillen und unter Tränen Abschied von ihrem lieben Vieh zu nehmen, denn frommem Gesinde wird das Vieh seiner Herrschaft so lieb, als wäre es sein eigen, daher pflegt man auch zu sagen, im ersten Dienstjahre spricht die Magd: meines Herrn Kuh, im zweiten: unsere Kuh, und im dritten und in allen folgenden: meine Kuh.
Und da stand nun die Magd im Stalle und weinte sich aus und streichelte noch einmal jede Kuh, und ihr Liebling leckte ihr noch einmal die Hand - und da kam die Schlange mit dem Krönlein auch gekrochen.
»Leb wohl, du armer Wurm, dich wird nun auch niemand mehr füttern.« Da hob sich das Schlänglein empor, als wollte es ihr seinen Kopf in die Hand legen, und plötzlich fiel das Natterkrönlein in des Mädchens Hand, und die Schlange glitt aus dem Stalle, was sie nie getan, das war ein Zeichen, daß auch sie aus dem Hause scheide, wo man ihr fürder nicht mehr ein Tröpflein Milch gönnen wollte.
Jetzt ging das arme Mädchen seines Weges und wußte nicht, wie reich es war. Es kannte des Natterkrönleins große Tugend nicht. Wer es besitzt und bei sich trägt, dem schlägt alles zum Glücke aus, der ist allen Menschen angenehm, dem wird eitel Ehre und Freude.
Draußen vor dem Dorfe begegnete der scheidenden Magd der reiche Schulzensohn, dessen Vater vor kurzem gestorben war, der schönste junge Bursche des Dorfes, dem entbrannte gleich in Liebe das Herz zu der jungen Frau und er grüßte sie und fragte sie: Wohin sie gehe und warum sie aus dem Dienst scheide.
Da sie nun ihm ihr Leid klagte, hieß er sie zu seiner Mutter gehen, und sie solle dieser nur sagen, er sende sie. Wie nun die Magd zu der alten Frau Schulzin kam und ausrichtete, was der Schulzensohn ihr aufgetragen, da faßte die Frau gleich zu ihr ein großes Vertrauen und behielt sie im Hause, und als am Abende die Knechte und die Mägde des reichen Bauern zum Essen kamen, da mußte die neu Aufgenommene das Tischgebet sprechen, und da deuchte allen, als flössen des Gebetes Worte von den Lippen eines heiligen Engels, und wurden alle von einer wundersamen Andacht bewegt und gewannen zu dem Mädchen eine mächtig große Liebe.
Und als abgegessen war und die fromme Magd wieder das Gebet und den Abendsegen gesprochen hatte, und das Gesinde die Stube verlassen hatte, da faßte der reiche Schulzensohn die Hand des ganz armen Mädchens und trat mit ihr vor seine Mutter und sagte: »Frau Mutter, segnet mich und die - denn die nehm ich mir zur Frau oder keine. Sie hat mir es einmal angetan!«
»Sie hat es uns allen angetan«, antwortete die alte Frau Schulzin. »Sie ist so fromm als sie schön ist, und so demütig als sie makellos ist. In Gottes Namen segne ich dich und sie und nehme sie von Herzen gern zur Schwiegertochter.«
So wurde die arme Magd zu des Dorfes reichster Frau und zu einer ganz glücklichen noch dazu.
Mit jenem geizigen Bauern aber, der um die paar Tröpflein Milch sich so erzürnt und die treueste Magd aus dem Hause getrieben, ging es baldigst den Krebsgang. Mit der Krönleinnatter war all sein Glück hinweg.
Er mußte erst sein Vieh verkaufen, dann seine Äcker, und alles kaufte der reiche Schulzensohn, und seine Frau führte die lieben Kühe, die nun ihre eigenen waren, mit grünen Kränzen geschmückt, in ihren Stall und streichelte sie und ließ sich wieder die Hände von ihnen lecken und molk und fütterte sie mit eigener Hand.
Auf einmal sah sie bei diesem Geschäfte die weiße Schlange wieder. Da zog sie schnell das Krönlein hervor und sagte: »Das ist schön von dir, daß du zu mir kommst. Nun sollst du auch alle Tage frische Milch haben, so viel du willst, und da hast du auch dein Krönlein wieder, mit tausend Dank, daß du mir damit so wohl geholfen hast. Ich brauch es nun nicht mehr, denn ich bin reich und glücklich durch Liebe, durch Treue und durch Fleiß.«
Da nahm die weiße Schlange ihr Krönlein wieder und wohnte in dem Stalle der jungen Frau, und auf deren ganzem Gute blieb Friede, Glück und Gottes Segen ruhen.
DAS KLAGENDE LIED ...
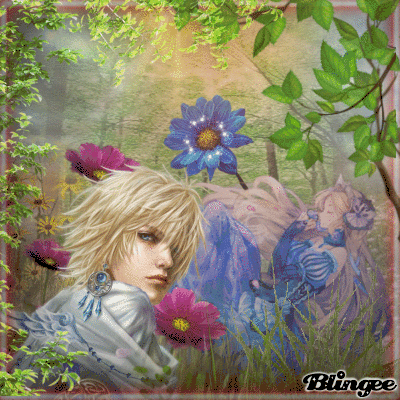
Es war einmal ein König, der starb und hinterließ seine Frau, die Königin, und zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter war aber ein Jahr älter als der Sohn. Und eines Tages stritten die beiden Königskinder miteinander, welches von ihnen beiden König werden sollte, denn der Bruder sagte: »Ich bin ein Prinz, und wenn Prinzen da sind, kommen Prinzessinnen nicht zur Regierung.«
Die Tochter aber sprach dagegen: »Ich bin die erstgeborene und älteste, mir gebührt der Vorrang.« Beides, was die Kinder da sagten, sagten sie in aller Unschuld und hatten die Worte nur so aufgeschnappt von dem Hofgesinde, ohne den Sinn so recht eigentlich zu verstehen.
Da sie nun über ihren Streit nicht einig wurden, so gingen sie miteinander zur Mutter und fragten diese: »Sage, liebe Mutter, welches von uns beiden wird dereinst König werden?«
Diese Frage betrübte die Mutter, denn es blickte der Keim der Herrschsucht durch die selbe, die nicht wurzeln soll im Gemüte eines Kindes, und sie antwortete: »Liebe Kinder! Seht einmal hier das schöne Blümlein recht genau an, und dann geht in den Wald und sucht. Wer von euch beiden dieses Blümchen zuerst findet, der wird dereinst König werden.«
Die Kinder sahen sich voll Aufmerksamkeit das Blümchen an; sein Stengel war gestaltet wie ein Szepterlein und endete in einer halb aufgeschlossenen Lilie . Und die Kinder gingen ganz harmlos zusammen in den Wald und begannen zu suchen, und wie sie so suchten, so kamen sie bald auseinander, daß eins das andere aus den Augen verlor.
Und da fand die kleine Prinzessin zuerst das Blümchen und freute sich darüber und sah sich nach dem Bruder um, der war aber nicht da. Und da dachte das Kind, er wird wohl bald kommen, ich will hier auf ihn warten, und legte sich auf den weichen Rasen und in den kühlen Baumschatten, und es war so still im Walde, Käfer und Bienen summten bloß, und eine nahe Quelle murmelte leise, und der Himmel blickte tiefblau durch die grünen Baumwipfel herab auf den grünen Waldesrasen.
Die kleine Prinzessin hatte ihr Blümchen in die Hand genommen, und weil es so still und sie ein wenig müde war, so entschlummerte sie in Gottes Namen.
Es dauerte nur eine kleine Weile, so kam der Bruder an die Waldstelle, wo seine Schwester schlief; er hatte aber das Blümchen, welches er suchte, nicht gefunden; und da sah er die Schwester am Boden liegen, süß schlummernd, und die hatte das Blümchen in ihrer Hand.
Da stiegen in des Prinzen Seele schwarze Gedanken auf, und Schreckliches kam ihm in den Sinn.
Ich muß König werden, ich! dachte er, und die Schwester soll es nicht werden! Lieber will ich sie töten und will die Blume nehmen und damit heimgehen, und dann werde ich König.
Ach, da hieß es recht: gedacht und getan. Der Prinz ermordete sein unschuldiges Schwesterlein im Schlafe, verscharrte es im Walde und deckte Erde darauf und Rasen auf die Erde, und kein Mensch erfuhr etwas von dieser bösen Tat, denn wie der Prinz nach Hause kam, so sagte er, seine Schwester sei im Walde von ihm hinweg und ihren eigenen Weg gegangen. Wie er die Blume gefunden gehabt, habe er den Rückweg nach Hause angetreten und geglaubt, sie sei auch schon nach Hause.
Und da sind viele Jahre hingegangen, und die alte Königin hat fort und fort getrauert über die verlorene Tochter, die sie im ganzen Walde fruchtlos suchen ließ, und hat sich den Tod gewünscht, weil sie selbst die geliebte Tochter fort geschickt hatte, und als ihr Sohn nun die Jahre seiner Mündigkeit erreicht hatte, so ward er König.
Und nach manchem, manchem Jahre kam ein Hirtenknabe in jenen Wald, der hütete dort seine Herde und stocherte zum Zeitvertreibe und aus Langeweile mit seiner Schippe in dem Rasen herum, wie die Hirten öfter tun, die manches mal Herzen und Namen und Kreuze in den grünen Rasen graben, und da grub er von ungefähr ein Totenbeinlein aus von der getöteten Prinzessin, das war so rein und weiß wie Schnee.
Und der Hirtenknabe machte ein paar Löchlein in das Beinlein, so wurde daraus eine kleine Flöte, und diese setzte der Hirtenknabe an seine Lippen und blies. Da quollen klagende Töne aus dem Totenbeine, ach, so unendlich traurig, und es war ordentlich, als singe in dem selben eine weinende Kindesstimme, daß der Hirtenknabe selbst weinen mußte, und konnte doch nicht aufhören zu blasen. Es lautete aber das klagende Lied so:
»O Hirte mein, o Hirte mein,
Du flötest auf meinem Totenbein!
Mein Bruder erschlug mich im Haine.
Nahm aus meiner Hand
Die Blum, die ich fand,
Und sagte, sie sei die seine.
Er schlug mich im Schlaf, er schlug mich so hart -
Hat ein Grab gewühlt, hat mich hier verscharrt -
Mein Bruder - in jungen Tagen.
Nun durch deinen Mund
Soll es werden kund,
Will es Gott und Menschen klagen.«
Und immer war nur das eine und immer das eine Lied aus der beinernen Flöte zu bringen, und immer blies es der junge Hirte wieder, während ihm jedesmal die hellen Tränen über die Wangen herab rollten.
Wenn das klagende Lied im Walde erklang, da wurden alle Vögelein stumm und traurig, hingen Köpflein und Flügel und schwiegen; auch die Käfer und Bienen summten nicht mehr, und selbst das Murmeln der plätschernden, geschwätzigen Quelle war nicht mehr zu hören - es wurde so recht, was man sagt: totenstill.
Schallte das klagende Lied über eine Trift, so hingen die Tiere der Weide wehmütig die Häupter, und keines gab einen Laut; auch der Hund bellte nicht mehr und sprang nicht, wie sonst, fröhlich umher, vielmehr duckte er sich und winselte ganz leise, denn es war für alle Kreatur etwas Herz zerschneidendes in dem klagenden Liede.
Aber der Hirtenknabe konnte nicht müde werden, dieses Lied zu flöten, bis einst ein Rittersmann am Hang vorüber kam, der hörte auch das Lied und fühlte, daß seine Augen tropften, und hielt und ließ nicht nach, bis der Hirtenknabe ihm, dem Ritter, die kleine Flöte käuflich abtrat. Und nun zog der Ritter im ganzen Lande herum, blies das Lied und brachte mit dem selben alle Welt zu Tränen.
So kam dieser auch an den Hof, wo der junge König auf dem Throne saß, von dem das Lied sang und klagte und die alte Königin Mutter lebte auch noch, und es wurde ihr Kunde gebracht von dem ritterlichen Spielmanne, der ein Lied flöte, von dessen Melodei alle Herzen erzitterten und alle Seelen mit tiefer Trauer erfüllt würden.
Die alte Königin aber, die stets traurig war, sprach: »Was könnte es in der Welt geben, das trauriger wäre als meine Trauer? Ich wüßte nichts, mich wird das klagende Lied des Spielmannes nicht trauriger machen, als ich ohnehin bin. Lasset ihn immerhin kommen.«
Der ritterliche Spielmann kam und blies:
»O Ritter mein, o Ritter mein,
Du flötest auf meinem Totenbein!
Mein Bruder erschlug mich im Haine.«
Kaum hatte die alte Königin diese wenigen Worte vernommen, so schoß schon ein Tränenstrom aus ihren Augen - aber als es weiter tönte:
»Nahm aus meiner Hand
Die Blum, die ich fand,
Und sprach, sie wäre die seine« -
Da stieß die Königin einen gellenden Schrei aus und fiel in eine tiefe Ohnmacht. Der Spielmann erschrak darüber und wollte absetzen, aber das konnte er nicht - das Lied wollte jedesmal, wenn es begonnen war, zu Ende gespielt sein - und als der letzte Ton mit tiefer Klage verzitterte, da erwachte die Königin aus ihrer Ohnmacht und rief: »Mir, mir die Flöte! Um alle meine Schätze - mir diese Flöte!«
Und der ritterliche Spielmann ließ der Königin die beinerne Flöte und sagte, er begehre keine Schätze - und nahm nichts an und zog weiter. Und die Königin schloß sich ganz allein in ihre tiefsten Gemächer und blies das Lied und weinte so lange, bis sie fast keine Tränen mehr hatte.
Der König aber war ein lebenslustiger froher Herr geworden, der hatte seine Freude an Sang und Klang, feierte gern heitere Feste und freute sich seines Lebens. Einst geschah es, daß er auch ein Fest zu feiern beschlossen hatte, und es waren zahlreiche Sänger und Spielleute bestellt und zahlreiche Gäste eingeladen worden.
Der Sitte gemäß hatte der junge König nie unterlassen, seine Mutter auch jedesmal einzuladen zu seinen Festen, aber sie hatte niemals Teil genommen, weil sie, wie sie dem Sohne dankend sagen ließ, zu viele Trauer im Herzen habe. Als aber dieses mal die Einladung wiederum an sie gelangte, da ließ sie sagen, sie werde Teil nehmen. Dies wunderte den König und befremdete ihn, und er wußte nicht, ob er sich darüber freuen sollte.
Da nun alle Gäste in bunter Pracht versammelt waren und alle Sänger und Spielleute bereit und der Hof eintrat in den herrlich geschmückten Königssaal, darin das Fest stattfand, so erregte es fast eine bange Verwunderung, die alte Königin zu sehen in langem schleppenden, schwarzen Trauergewand und im Witwenschleier - der Jubel der Instrumente, der Harfen und Pauken, Flöten und Cymbeln aber brach los, und die Chöre der Sänger begannen in erhabenen Weisen eine Hymne zum Preise des Königs.
Was aber tut die alte Königin? Sie setzt sich nicht, sie steht starr, wie ein Marmorbild. Was hält sie denn für ein seltsames kleines Szepter in der Hand? Das ist ja kein Szepter, das ist ein Totenbein. Und warum hebt sie denn dies Totenbein zum Munde? Warum hält sie es so, wie Spielleute ihre Flöten halten?
Horch! Ein Ton - und es verstummen alle Pauken und Harfen und Cymbeln - noch ein Ton, und jeder Sängermund wird stumm. Dort aber sitzt der König und blickt entsetzt, von ungeheuerem Grauen durchrieselt, auf seine Mutter, und alle, alle blicken auf die alte Königin.
Die alte Königin spielt ein Flötensolo.
»O Mutter mein, o Mutter mein -
Du flötest auf meinem Totenbein!«
Da erbeben, erzittern schon alle Herzen, da bleibt schon kein Auge trocken, Hofstaat und Gäste, Sänger und Spielleute, alle weinen.
»Mein Bruder erschlug mich im Haine.«
Ha!« schreit der König, und das Szepter entsinkt seiner Hand, und er faßt mit beiden Händen nach seiner Krone.
»Nahm aus meiner Hand
Die Blum, die ich fand,
Und sagte, sie sei die seine.«
Da rollte die Krone von des Königes Haupte herab, fiel auf den Marmorboden und zerschellte. Es klang, als ob ein Totenschädel auf dem Marmor rasselte.
»Er schlug mich im Schlaf - er schlug mich so hart -
Hat ein Grab gewühlt, mich im Walde verscharrt -«
Da stürzte der König selbst vom Throne herab und fiel auf sein Angesicht und stöhnte und wimmerte.
»Mein Bruder - in jungen Tagen«.
Der König wand sich in Todeszuckungen und bäumte sich und schrie: »Ende! Mutter - ende!«
Aber die alte Königin konnte nicht von selbst das klagende Lied beendigen, es tönte fort:
»Nun durch deinen Mund
Soll es werden kund,
Will es Gott und Menschen klagen.«
Da flohen, während diese Worte entsetzlich und zermalmend, und doch gar nicht laut, vernommen wurden, alle Gäste, Spielleute, Sänger und Hofdienerschaft zu allen Türen des Saales hinaus - darüber Instrumente und Sessel viele zerbrachen, und die Kerzen löschten aus, bis auf zwei - und als das Lied zu Ende geklungen war, war niemand mehr im weiten Saale als nur die Königin im Trauergewande und ihr sterbender Sohn in seinem bunten Flitterstaate, reich besetzt mit Gold und Perlen.
Und sie kniete neben dem noch immer am Boden liegenden Sohne nieder, hielt sein Haupt in ihren Händen und weinte heiße Tränen darauf. Da löschte langsam die eine der beiden noch brennenden Kerzen aus.
Die alte Königin aber weinte und betete noch bis Mitternacht - dann verlöschte sie selbst die letzte Kerze und zerbrach die Flöte, auf daß niemand mehr das klagende Lied vernehme.
VOM ZORNBRATEN ...
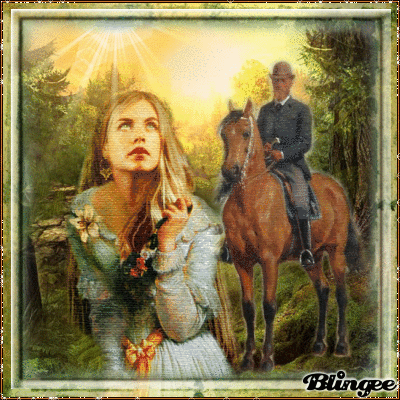
Es war einmal ein Ritter, der hatte neben vielem Geld und Gut ein böses Weib, das wusste er nimmer zu bemeistern, und es war schier auf Erden kein ärger Weib zu finden. Er aber war ehrenhaft und sanften Muts.
Beide hatten eine einzige Tochter, und die erzog die Mutter also in ihren eigenen bösen Sitten und nach ihrem Schlag, dass sie arg und karg, mückisch und tückisch wurde. Gleichwohl hatte Gott das Maidlein zu einer schönen Jungfrau gebildet, dass wer sie schaute, dem deuchte sie ein Bild voll minniglicher Güte, wer aber näher mit ihr bekannt wurde, der nahm bald ihre Argheit wahr und mied sie gänzlich. Nun war die Jungfrau achtzehn Jahre alt und hätte gern einen Mann genommen, aber keiner kam, der ihrer begehrt hätte.
Das bekümmerte den Vater mächtig, und eines Tages sprach er zu ihr: "Tochter, deiner Mutter Sitten und ihr übler Rat machen, dass du ohne Mann bleibst, oder aber, so einer dich nimmt, der nicht Lust hat, wie ich, böse Weibertücken geduldig zu tragen, so wirst du öfter geschlagen, als das Jahr Tage zählt, und wird dich noch bass gereuen, dass du so in allen Stücken deiner Mutter gefolgt bist und gefolgt hast. "
Das hörte die Tochter des frommen Ritters sehr ungern und sprach zornig: "Ei, Herr Vater! Ihr könnt viel reden, ehe mir Eurer Worte auch nur eins gefällt! Ihr habt meiner Mutter auch immer viel zu viel gute Lehren gegeben, die sie Euch nicht dankt. Wisst Ihr was? Tut, was Euch gut dünkt, und lasst mich gewähren. Denn wenn auch schon morgen ein Freier käme, der mein begehrte, so wollte ich doch allezeit in der Ehe das längere Messer tragen. "
"O, meine Tochter!" antwortete der Rittersmann, "das dünkt mich nicht gut, dass du solche Gedanken hast. Du solltest doch darauf denken, besser zu sein als deine arge Mutter, sonst könnte es wohl kommen, dass du einen Mann bekämst, der so bieder und fromm ist, dass er dich bezwingt, und du hernach mit Scham, mit Schimpf und Schande nachgeben musst. "
"Ei, ja, wohl!" antwortete die Tochter. "Eh der Markt aus ist, gibt es noch mehr selben Kofents zu kaufen!" und solche hässliche Spottreden mehr, die sie dem Vater gab, so dass er zornig ausrief: "O du böse Chriemhilt! So du deinem Vater nicht folgen willst, so soll dir dein Rücken satt von Schlägen werden! Wer immer dein begehre, er sei Ritter oder Knecht, der soll dich haben und soll dich ziehen nach seinem Willen!"
"Oder ich ihn nach dem meinen!" erwiderte trotzig die Tochter und andere Reden mehr, bis dieser Wortwechsel endete.
Nun saß etwa drei Meilen weit von der Burg dieses guten Ritters ein anderer Rittersmann, der war reich an Geld und Gut und hatte Freiersgedanken, war auch hübsch vom Angesicht und höflich von Sitten, der vernahm auf Fragen und Sagen, wie schön und wie hässlich zugleich jenes Nachbarn Tochter sei, und dachte: ich wag es frei und wende ihr Gemüt zur Tugend und mache sie gut, wo nicht, so will ich sie doch um ihrer Schöne wohl oder übel nehmen.
Ritt darauf mit seinen Freunden zum Vater der Maid und bat ihn um seine Tochter. Dieser Rittersmann offenbarte dem jungen Werber, wie seine Tochter gesittet sei, und jener sprach: "Ich habe es wohl vernommen, aber gebt Ihr mir sie nur zur Frau! Will Gott, dass wir nur ein Jahr miteinander leben, so sollt Ihr sehen, wie gut sie wird! "
Darauf antwortete der künftige Schwäher: "Gott soll Euch behüten vor ihrem Übelmut! Hütet Euch, denn wenn sie auf ihrer Mutter Spur kommt, so lebt Ihr bei ihr, wie lang sie lebe, nimmer einen guten Tag."
Der Freier beharrte aber auf seinem Entschluss, und es ward ein Übereinkommen getroffen und eine Eheberedung, dass der junge Ritter, sobald er wieder käme, die Maid mit sich nehmen und heimfahren solle.
Die Mutter wusste von dieser Verhandlung weder viel noch wenig, sondern gar nicht, dass die Tochter einem Mann verlobt war, und als sie es nun erfuhr, ward sie überaus zornig, rief die Tochter und sprach: "Tochter, wisse, dass mein Fluch dich trifft, wenn du nicht deinem Manne so widerstehst, wie deinem Vater ich mit Krieg und harter Rede allezeit und an jedem Ort.
Höre, was ich dir ansage: Ich war ein kleines Mägdelein, als ich zu deinem Vater kam, viel geringer als du, denn du bist vollgewachsen. Drei Wochen lang schlug mich alle Tage dein Vater, dass ich krank wurde, und gab mir Wasser zur Labe, und doch hab ich meinen Streit gewonnen und mein Recht bis da immer behauptet! "
"Mutter!" antwortete das feine Töchterlein, "ich sage Euch, und sollt ich tausend Jahre leben, so mache ich meinen Mann zum Affen. "
Inzwischen kam nun der Tag der Heimführung; da kam der Ritter heran auf einem schönen Ross von hohem Preis, führte auch mit sich ein schlankes Windspiel und trug auf der Hand einen wohlgetanen Falken, nahm die Maid in Empfang ohne weiteres und setzte sie hinter sich auf sein Ross, entsandte seine Diener alle, dass ihrer keiner mit den zweien ritt, und nahm gleich Urlaub vom Vater seiner Braut.
Der sprach zum Abschied ein bewegliches Wort: "Gottes Güte sei mit dir, o Tochter! Er gebe dir Ruhe im Glück und ein friedlicheres Herz, als ich an meiner Frau gefunden habe! "
Kaum war diese Rede gesprochen, so schlug die Mutter einen Lärmen auf und schrie der Tochter nach: "Vernimm auch mein Wort! Du sollst alle deine Lebtage deinem Mann untertan sein, so, wie ich dich gelehrt habe!" und die Tochter rief zurück: "Wohl, meine Mutter, so soll es geschehen nach deiner Lehre. "
So ritten nun die beiden ganz allein miteinander hin, aber der Ritter vermied die Straße, um der Braut Argheit willen, und ritt einen unbequemen, steilen und engen Seitenweg, wohl einer Meile lang, doch ritt er rasch, dass er in kurzer Zeit eine halbe Meile zurücklegte auf dem rauen, ungebahnten Steinpfad.
Da kamen sie an einen umbuschten Werder, und der Falke begann nach seiner Art mit den Flügeln zu schlagen und von der Hand zu begehren, weil er auf Reiher stoßen wollte. Sprach der Ritter: "Mit deinem Federschlagen lass es gut sein, oder ich reiße dir den Kopf ab."
Bald darauf sah der Falke eine Krähe fliegen, der wollte er nach; da sprach wiederum der Ritter: "Du bist betrogen, wenn du nach Ungemach strebst und nicht gern in Ruhe dich hältst, und so will ich dir gleich dein Recht tun. Stirb, da du nicht meinen Willen halten willst!" Und er erwürgte den Falken wie ein Huhn.
Die Maid erschrak ob dieser Rede und der tödlichen Tat und begann den Ritter zu fürchten. Nun wurde der Pfad immer enger, steiniger und dorniger, und dem Windspiel schmerzten die Füße, und es vermochte nicht mehr, sich an des Pferdes Seite zu halten.
Der Ritter, der es an einem Riemen führte, musste es immer nachziehen, das war dem Ritter ungelegen, und er schalt das Windspiel: "Du böser Hofwart, hab acht, es kommt dir zum Unheil, dass du mir den Arm so zerziehst!" Der arme Hund vermochte aber nicht zu folgen, und da zog der Ritter sein Schwert und hieb ihn tot.
Die Maid unterdrückte einen Schrei des Unwillens, aber das Herz in der Brust erschrak ihr, es ward ihr weh zumute, und sie dachte: Herr Gott, welch ein Wüterich ist dieser Mann! Brachte mich denn der Teufel zu ihm!
Der Ritter aber behielt das Schwert blank in der Hand und begann nun mit seinem Ross zu schelten: "Was schnaubst du? Warum gehst du nicht Pass oder Trab? Du willst wohl nur auf ebenem Plan gehen? Du musst sterben!" Da nun das arme Ross nicht Pass traben konnte, welcher Gang ihm nie gelehrt worden war, so sprach der Ritter: "Frau, steigt ab! " Sie sprach: "Ich tue, was Ihr mich heißt. "
Darauf stieg der Ritter auch ab und hieb dem Pferd das Haupt vom Rumpfe, sprechend: "Wärst du nach meinem Sinn gegangen, so wäre dir nicht der Tod geworden. Frau, dies ist geschehen, wie Ihr seht. Mir war das Pferd gar unlieb geworden, wie auch Windspiel und Falke. Nun aber ist mir ein ungewohnt und beschwerlich Ding, zu Fuße zu gehen, und ich habe des keine Übung. Ich werde nun Euch reiten!" Und damit begann er, ihr Riemen und Bande anzulegen, und auch den Sattel wollte er ihr aufschnallen.
Sie sprach: "Herr, ich trüge schon genug an Euch, lasst den Sattel und die Seile, viel herzlieber Herr mein, ich trage Euch ja sanfter und besser ohne ihn. " "Ei, Frau, wie stände mir das an, dass ich Euch ritte ohne Sattel und Zeug?" fragte der Ritter heftig. "Ihr habt böse Sitte, dass Ihr gegen meinen Willen zu reden Euch erkühnt!"
Und da ließ sie sich gefallen, dass er zur Stund sie sattelte und aufzäumte, wie ein Ross, und ihr Zaum und Gebiss in den Mund legte, und gab ihr den Steigbügel in die Hände, die stramm zu halten, saß dann auf und ritt sie so eine kleine Weile, etwa dreier Speerlängen weit, bis ihr die Ohnmacht zuging von der schweren Last.
Da stieg der Ritter von ihr ab und sprach: "Frau, schnappt Ihr nach Luft? " "O nein, Herr!" antwortete sie. Weiter sprach er: "Das ist ein schönes Feld, da könnt Ihr nun im Zelt (Schritt) gehen. " Sie sprach, indem sie auf Händen und Füßen weiter kroch: "Ich will es gern tun. Auf meines Vaters Hofe laufen viele Pferde, denen hab ich Zeltgang abgelernt. "
"So wollt Ihr alles tun, was ich will?" fragte der Ritter und sie gegen redete: "Und wenn ich tausend Jahre leben sollte, so wollte ich tun, was Euch lieb ist!" Da hieß er sie aufstehen und nahm sie schön an der Hand und führte sie sittsam heim in sein Schloss, wo seine Freunde versammelt waren, die grüßten sie ehrfurchtsvoll und geleiteten sie in ihr Zimmer.
Das geschah mit großen Freuden, und die Frau war das allerliebste Weib, ehrbar und wohl gezogen, ohne List und Trug, treu, ruhig, mild, keine Tugend fehlte ihr. Ihre Gäste empfing sie freundlich und fröhlich, und ohne Hass und Unwillen erfüllte sie, wie ein biederes Weib tun soll, die Wünsche ihres Eheherrn.
Als nun sechs Wochen vergangen waren, fuhren der jungen Frau Vater und Mutter zu ihrer Tochter hin, zu sehen, wie es ihr ergehe und wie sie sich gehabe. Bald genug erfuhr die Mutter, was geschehen war, und wie ihre Tochter ihrem Manne gehorchte, als sie diese zornig schalt und ihr zurief: "O über dich unseliges Weib! Was ich sehen und hören muss, lässt mich zweifeln, dass du mein Kind bist. Was? Du lässt deinen Mann deinen Meister sein?"
Und dabei schlug die böse Mutter die Tochter ins Gesicht und wo sie sonst hin kam und fiel ihr in die Haare und raufte sie, schlug und schalt und trieb einen schrecklichen Unfug.
Die junge Frau weinte und schrie: "Seid Ihr hergekommen zu schelten, so wartet doch, bis Ihr die Ursache findet! Ich habe den allerbesten Mann, und er ist gut und bieder, wer aber seinen Willen nicht tut, dem geht er in seinem Zorn gleich ans Leben. Darum, Mutter, habt weisen Sinn und hütet Euch, Arges wider ihn zu sprechen, denn er ist so zornmütig, dass er alles, was seinem Willen entgegen ist, im Zorn richtet und vernichtet. "
"Hoho! Morgen ist auch noch ein Tag!" höhnte die Mutter. "Wie schlimm dein Mann sei, das macht mir den geringsten Kummer! Nicht ein Haar stark acht ich seiner! Du alberne Trine! Dir muss der Teufel durchs Hirn fahren, dass du wagst, mir, deiner Mutter, mit deinem Mann zu dräuen! "
"Mutter, ich dräue Euch ja nicht!" verteidigte die Tochter sich. "Ich sage Euch ja nur die Wahrheit; ich darf Euch doch wohl raten, meinen Mann bass zu grüßen, denn wolltet Ihr ihm tun, wie meinem Vater, so zerbläut er Euch den Rücken, und obschon Ihr nicht viel Haares mehr habt, ist es dessen noch genug, dass er es Euch ausreißt! "
"Das wäre ein Hauptwerk!" erwiderte böse die Mutter. "Ich fürchte ihn nicht, und wenn er so groß wie ein Berg wäre; nicht mehr und nicht weniger fürchte ich ihn wie deinen Vater! Was hat der ausgerichtet mit mir nun die zwanzig Jahre? Noch heute gebe ich ihm um kein Haar breit nach! "
Während dieser Schalkrede der älteren Frau standen der Schwäher und der Tochtermann an einer heimlichen Stelle, wo sie jedes Wort hörten, und der Alte sprach leise zu seinem Schwiegersohn: "Ich bin inniglich froh, dass Ihr meiner Tochter starren Sinn bezwungen, und gern hinterlasse ich Euch und ihr mein Hab und Gut, wenn ich dahinfahre."
Der Schwiegersohn bedankte sich für die freundliche Gesinnung des Schwähers, der dann wieder zu ihm sprach: "Ratet mir doch, wie ich Eurer Schwieger tue, die mir allezeit widerstrebt und mir mein Leben so bitterlich vergällt! Wäre es nur zu machen, dass sie etwa ein Jahr vor ihrem Tode wenigstens von ihrer Härte ließe, so hätte ich die sonderste Freude und all mein Leid ein Ende! "
Darauf verhieß der Schwiegersohn, die Schwiegermutter gut zu machen auf seine Weise, wenn der Schwiegervater ihm das nicht wehren wolle. Der sprach: "Ich will Euch nichts verwehren, siedet oder bratet sie, so will ich noch Holz dazu tragen."
Der Ritter nahm als bald heimlich vier flinke starke Knechte, vermaß sich großen Zorns und ging nach der Kemenate, wo noch die Alte saß und immerfort auf ihn und ihre Tochter schalt. Als sie ihn kommen sah, grüßte sie ihn spöttisch: "Seid Gott willkommen, Herr Engelhart! "
"Schönsten Dank, Frau Schlechthart!" klang sein Gegengruß, und dabei trat er fest an sie heran und sprach: "Frau, lasst Eure Unart, das bitte ich Euch, gegen Eueren und meinen Herrn. Er sollte Euch ungezählte Schläge auf Eueren Rücken mit einer eichenen Elle zumessen, bis Euch so weh würde, dass Ihr ein gut Weib würdet. "
"Ei!" sprach sie, "ich höre wohl, dass Ihr viele so erschlagen habt, lieber Herr Guguguk! Ich habe aber doch bisher noch Haut und Haar behalten, hoffe es auch noch länger zu tragen! Was hab ich aber Euch getan? "
"Ihr scheltet täglich meinen Herrn, Euren Mann, und verleidet ihm sein eigenes Haus!" antwortete der junge Ritter; sie war aber gleich mit der Gegenrede zur Hand: "In meinem Hause heiße ich Kratzmaus! Ich kann darin sein Meister sein, wie mein eigener, und es soll ihm Gott, so lang ich lebe, nun keinen einzigen guten Tag mehr geben! "
"Und gibt Gott mir Glück", sprach der Schwiegersohn, "so acht ich, dass Ihr noch, ehe wir voneinander gehen, Eure bösen Ränke und Schwänke lasst. "
"Dass es Euch nur nicht missglücke!" rief sie, "sonst habt Ihr, so mir der große Gott von Schaafhausen, nur Schande und Spott davon! "
"Ich weiß, was Euch so irr und wirr und böse macht", nahm der Ritter wieder das Wort. "Ihr habt zwei Zornbraten hier an jeder Hüfte, davon kommt es, dass Ihr so üble Sitte habt, wenn Euch die jemand ausschnitte, das wäre vortrefflich gut, denn Ihr würdet fröhlicher als jemals eine Frau, und für Euren Mann wäre es nicht minder gut. "
"Ach! Ich freue mich, dass Ihr so ein guter Arzt seid, lehrt doch Eure Kunst meiner Tochter!" war ihre Antwort. "Habt Ihr auch Bertram feil und Nieswurz? Ihr mischt wohl Beifuss zum Tranke? "
"He! Euer Spott ist groß!" rief der Ritter, "aber er wird Euch gleich versalzen werden; sobald wir Eure Zornnieren und Zornbraten haben, so werdet Ihr besser und frommer als ein Kind werden! "
"Genug mit Eurem Klaffen, Klaffer!" schalt die Frau. Da griffen aber die Knechte auf des Ritters Wink sie an, warfen sie nieder, und der Tochtermann wetzte ein großes scharfes Messer, das setzte er ihr an ihre Hüfte und schnitt ihr durch Gewand und Hemde eine lange tiefe Wunde, dass ihr Hohnlachen ihr ganz verging; dann sprach er, indem er ein Stück Fleisch in ein Gefäß warf: "Seht, Frau, Ihr seid manches Jahr ein schlimmes Weib gewesen, daran waren Eure Zornbraten Schuld, die kann ich Euch nicht länger lassen."
Sie aber lag traurig und schreiend: "Das wusst ich an mir selbst nicht, aber ich weiß, welcher Teufel Ihr mich beraten habt! " "Ja, Ihr habt noch einen Zornbraten", sprach der Ritter, "an Eurem anderen Bein, der muss noch heraus! "
"Ach", klagte sie fast weinend: "der ist ganz klein, der schadet mir nicht zu viel! Helfe mir Gott! Der, den Ihr schon ausgeschnitten habt, der war an allem Schaden Schuld. Ich bin alles Zornes ledig und will still sein, lasst nur den anderen ungeschnitten. "
Da sprach die Tochter heiter zu ihrem Gatten: "Bedenket wohl, was Ihr tut; ich fürchte, wenn auch der andere Zornbraten nicht herfür kömmt, so ist die große Arbeit an dem einen verloren, und am Ende bekommt der andere Zornbraten Junge, so Ihr den nicht auch ausschneidet. "
"Nein, nein, liebe Tochter!" rief die Mutter, "sprich ihm doch zu, dass er mich unversehrt lasse, ich will ja gut sein! " "Frau Mutter", antwortete die junge Frau: "Ihr gabt mir den Rat, wider meinen Mann zu streiten, ihm nicht untertan zu sein; darum und dass sie meinem Vater so übel mitgespielt, schneidet nur ihren Zornbraten aus! "
Und da griff der Ritter zum anderen an, jene aber schrie "Nein, nein! Es ist mehr als genug! Tochter, denke, dass ich dich unterm Herzen getragen, und gewinne mir Frieden von deinem Manne! Ich will beschwören, dass ich gütevoll leben will, und der milde und gerechte Gott behüte mich vor Zorn. Den großen Zorn hat mir der Ritter schon genommen, und der kleine ist keines Eis wert zu achten! "
"Wohl", sprach der Ritter, "begehrt sie Friedens, so lasse ich ab von ihr, doch gelobe sie zur Hand, dass, wenn sie den Zorn nicht meidet, sie sich aber will schneiden lassen." Hierauf ward sie aufgehoben und ihre Wunde verbunden.
Und die Frau warf allen Krieg und Hader unter die Füße, wurde ein gut sittig Weib, ließ ab von ihrer bösen Heftigkeit, und als der andere Tag kam, nahm sie Urlaub mit ihrem Mann von dem Schwiegersohn, und er wünschte ihr, dass Gott sie bewahren möge vor allem Übel.
Wenn sie nun nach der Hand dennoch noch manchmal etwa ein Wörtlein oder mehr zu ihrem Manne sprach, das ihm leid und unlieb war, so durfte er nur sagen: "Ich kann mir nicht helfen, ich muss nach unserm Tochtermann senden", so wurde sie rot vor Furcht und sprach:
"Es ist nicht Not darum, sein Kommen wäre mir nicht zum Heile. Ich habe ja Mut und Sinn, zu tun, was Euch lieb ist, und rate auch allen Frauen, dass sie ihren Männern das entbieten, was ich jetzt dem meinen, so sie nämlich in Frieden bestehen wollen. "
Damit hat diese Mär ein Ende, und kann davon eine beliebige Nutzanwendung jeder Mann und jede Frau sich selbst machen. Der alte Dichter aber, der diese Mär erzählt, gibt noch folgenden Rat:
Wenn wer ein übel Weib hat,
Der tu sich ihr'r in Zeit ab,
Empfehl sie dem Ritter,
Und leg sie auf ein'n Schlitten,
Und kauf ihr ein Bästchen,
Und henk sie an ein Ästchen.
Und henk dabei
Zwei Wölf oder drei.
Wer sah dann ein'n Galgen
Mit böseren Balgen?
Es sei denn, dass wer den Teufel fing,
Und ihn auch dazwischen hing.
DER KÖNIG IM BADE ...
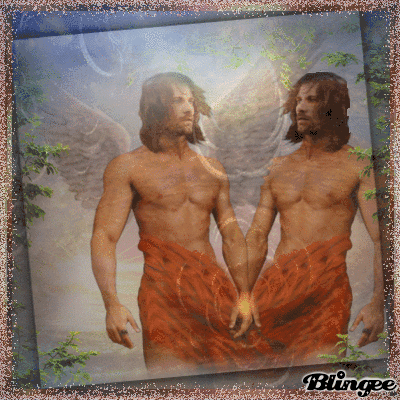
Es war einmal ein König, dem waren viele Lande deutscher und welscher Zunge untertan, darob wurde sein Herz übermütig, und er glaubte, es gäbe in der Welt keinen mächtigen Herrn, außer ihm allein.
Nun geschah es, daß er eines Abends in die Vesper ging und hörte den Priester die Worte lesen: Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Da fragte er, weil er kein Latein verstand, die gelehrten Männer, die um ihn waren, was diese Worte bedeuteten.
Und da wurde ihm die Deutung: Gott der Herr wirft die Mächtigen vom Throne und erhöhet die Niedrigen. Der König erschrak über diesen Spruch und wurde zornig und gab ein Gebot, daß dieser Ausspruch des Evangelisten Lukas fürder nicht mehr solle gelesen werden, auch solle niemand ihn hören und er solle ganz und gar vertilgt werden aus den heiligen Büchern.
Das Gebot trugen des Königs Sendboten in alle Lande und zu allen Geistlichen und in alle Klöster. Die Bücher aber, darin diese Schriftstelle stehen blieb, die sollten verbrannt werden. Also wurden jene Worte vielfach zerstört und ausgetilgt und wurden öffentlich in den Kirchen nicht mehr gelesen oder gesungen.
Nun geschah es zu einer Zeit, daß der König in ein Bad ging; da sandte Gott, auf daß er büße für den Frevel am heiligen Wort des Evangeliums, einen Engel, der nahm des Königs Gestalt an und schlug die Augen aller mit Blindheit, daß sie ihn für den König hielten, den König selbst aber nicht als den, der er war, erkannten.
Als der König aus dem Bade trat, setzte er sich auf eine Bank, auf welcher der Engel schon saß. Da hieß ihn der Bader aufstehen und sich anderswo hinsetzen. »Bist du trunken, Bader?« fragte der König, »daß du so schmachvoll mir redest? Ich bin es, der König, dein Gebieter!«
»Ein Narr mögt Ihr sein!« antwortete der Bader. »Mein Herr, der König sitzt ja hier; wessen König seid Ihr denn? Und wo ist das Reich Eurer Majestät? Wohl Narragonia?«
»Bösewicht!« schrie der König voller Zorn, nahm einen Kübel und warf den an des Baders Kopf, da hörte das Badegesinde den Lärm, eilte herzu und salbte den König mit Faustöl, bis der Engel des König dazwischen trat und ihn aus den Händen des Gesindes befreite.
Dann aber verließ er ihn, trat aus der Badestube, und da legten ihm des Königs Diener, die den Engel für ihren Herrn halten mußten, jenes köstliche Gewand an und geleiteten ihn auf stolzen Rossen in allem Glanze nach der Hofburg.
Den König aber warfen der Bader und seine Gesellen nackt und bloß aus dem Hause, und da stand er vor der Türe und wußte nicht, wie ihm geschehen war. Und das Volk sammelte sich um ihn und spottete über ihn, dazu sein eigenes Gesinde, denn es kannte ihn keiner mehr.
Und er eilte nackend, wie er war, und mit großer Scham von den Leuten hinweg, die ihm aber nachliefen wie einem Toren, zum Hause seines Schenken und viel treuen Rates.
Es war nach der Zeit des Mittagsimbisses, und der Schenk saß und pflegte der Mittagsrast, als der König am Tore schellte und Einlass begehrte. Der Pförtner fragte, wer er sei und was er begehre, und jener sagte: »Ich, der König!«
»Ei, pfui dich!« rief der Pförtner. »So schandbar hab ich noch keinen König gesehen. Du kommst mitnichten herein!« Da schrie und lärmte der König ungetümlich, daß der Schenk es hörte, und fragte, was es gebe.
Der Pförtner sprach: »Herr, es steht ein Mann draußen, der ist nackt und bloß und sagt, er sei dein Herr und König, und das Volk ist hinter ihm und hat seinen Narren an dem Affen.«
»Laßt ihn herein!« sprach mitleidvoll der Schenk, »und reicht ihm ein notdürftig Gewand, auf daß er seine Blöße bedecke.«
Dies geschah, und dann trat der König herein zu dem Schenken, der ihn auch nicht als seinen Herrn zu erkennen vermochte, und sprach: »O mein Freund, du wirst und mußt mich erkennen, daß ich dein König bin, obschon mich heute ein wunderlich Verhängnis heimsucht und von Ehren und Gute mich vertreibt. Denke der Reden, die wir gestern früh vertraulich miteinander pflogen, als ich euch, meinen Räten, einen Befehl gab, den ich erfüllt sehen wollte und ihr mir es ausredetet, als eines Fürsten nicht würdig.«
Und solcher Heimlichkeiten sagte der König zum Schenken noch mehr, der aber begann zu lachen und sprach: »Die Wahrheit sagt Ihr ja, aber Euch muß sie der Teufel ins Ohr geblasen haben!«
Und der König sprach: »Womit ich auch das Unglück verdient, das mich schlägt, mein Herz sagt mir, daß ich ein gerechter und wahrhafter König bin.«
Der Schenke mochte nicht widersprechen, weil das die Narren aufzubringen pflegt und bei Klugen auch nicht für ein Zeichen von guter Lebensart gilt, aber er gebot, dem Fremden Speise aufzutragen, und dachte bei sich: ich will diesen seltenen Fall doch dem König als Neuigkeit hinterbringen.
Er, der Schenke, galt bei Hof so viel durch seine weisen Ratschläge, daß er zu jeder Zeit freien Zutritt hatte, und so machte er sich gleich auf zur Königsburg, trat vor den Engel und verkündete ihm die Mär von seinem wunderlichen Gast.
Der gebot ihm, den König zu Hofe zu führen, und es sammelte sich in einem großen Saale der ganze Hofstaat, und das Gesinde erfüllte alle Treppen und Galerien. Wie nun der Schenk den gedemütigten König brachte, schrie alles spöttisch: »Grüß Gott, Herr König ohne Land!«
Der Engel saß in reicher Pracht neben der schönen Königin auf dem Throne und grüßte seinen Doppelgänger, dessen Herz in Hass aufwallte, als er den vermeinten Feind bei seiner eignen Gemahlin sitzen sah. Der Engel sprach: »Sagt an, ist das wahr, seid Ihr hier König?«
Und der König antwortete: »Wohl sah ich den Tag, da ich hier gewaltig war, wo meine Gemahlin noch mich empfing als ihren König und Herrn, deren gütlichen Gruß ich nun ganz entbehre, der mir doch sonst nie versagt ward, bis heute an diesem Tag meiner Schmach und meines Leides. O wie freundlich schied ich noch heute morgen aus ihren minniglichen Armen!«
Die Königin ward ob dieser Rede ganz schamrot, daß sie sollte den fremden Mann umfangen haben und sprach zum Engel: »Mein königlicher Herr und Gemahl, dieser Mann ist wohl unsinnig!« und ein alter Hofritter rief: »Schweige, Bösewicht! Dich müsse man auf einer Kuhhaut zum Galgen schleifen!« und die jungen Lecker am Hofe wollten schon sich Gunst machen und ihren Heldenmut sehen lassen und griffen nach dem König, hätten ihm auch übel genug mitgespielt, aber der Engel wehrte sie ab und führte den König mit sich hinweg in ein schönes einsames Gemach.
Dort sprach er zu ihm: »Sag an, glaubst du oder glaubst du nicht, daß Gott Gewalt habe über alle Geschöpfe? Siehe, wie seine allmächtige Kraft dich in den Staub tritt! Was hilft dir dein mächtiges Kriegsheer? Wer gehorcht deinem Rufe und Gebote? Noch lebt die Wahrheit: Deposuit potentes de sede, und du und deinesgleichen werdet sie ewig nicht unterdrücken!«
So sprach der Engel zum König, und dieser fragte erbebend: »Mann, wer seid Ihr? Seid Ihr Gott der Allmächtige, von dem Ihr redet, so erbarme sich Eure Gnade über mich armen, betörten Mann!«
»Ich bin nicht Gott!« sprach darauf der Engel: »Aber seiner Boten einer bin ich und des wahren Christus Diener. Der sandte mich, und dir sandte er die Strafe deiner Hoffart. Gott erhöht und erniedrigt, wen er will! Warum verfolgst du diese Wahrheit?«
Da fiel der König hin zu des Engels Füßen und bat um Gottes Huld und Verzeihung. Der Engel hieß ihn aufstehen und sprach: »Du mußt Glauben haben an das Wort der Schrift aus der Priester Munde! Du mußt barmherzig sein gegen die, so dir ihren Kummer klagen! Du mußt gerecht sein gegen die Kleinen, wie gegen den Großen! Willst du das, so sollst du wieder einnehmen den Stuhl deiner Macht und deiner Ehren.«
Da demütigte sich aufs neue der König vor dem Boten des Herrn, neigte sich, kniete nieder und sprach: »Ich folge dir gerne, gewähre mir durch Gott Gnade!« Da bot ihm der Engel seine Hand und reichte ihm die Königsgewande und verlieh ihm die Königsgestalt wieder, und der König legte das dürftige Röcklein ab, das der Schenk ihm geben ließ.
Der Engel aber verschwand vor den Augen des Königs und flog wieder auf gen Himmel, in die Heimat der Seelen, in das Reich des ewigen Vaters.
Der König sprach: »Gelobt sei der süße Christ, der Gewaltige. Was der Engel mir sagte, das ist die rechte Wahrheit.« Und ging hervor aus dem Gemach wie einer, dem nie ein Leid widerfahren.
Da fragten ihn die Dienstmannen ehrfurchtsvoll: »Herr, wo ist der Narr geblieben?« Er aber berief die Königin und alle die Seinen um sich her und erzählte ihnen alles, wie es sich begeben und was er erlitten, seinen Streit mit dem Bader und alles andere und zeigte ihnen das dürftige Röcklein.
Des erschraken die Schranzen und schämten sich, daß sie den Herrn also gekränkt und mißkannt, und meinten ihrer viele, es werde ihnen nunmehr an Leib und Gut gehen. Selbst die Königin bat den Gemahl um Huld und Gnade und versicherte heilig und teuer, daß sie ihn nicht erkannt habe.
Er schloß sanft ihre Hände in seine Hand und sprach: »Frau, schweigt stille! Gott hat es so gewollt! Kannte ich doch zuletzt mich selbst nicht mehr.«
Dann hieß er den Spruch Deposuit wieder in alle Bücher schreiben, wo er ausgelöscht worden, und ließ ihn wieder in den Kirchen lesen und ward gar ein demütiger Herrscher. Und wer diese Mär liest, der demütige sein Herz vor Gott und bitte, daß er ihn vor Hoffart und Übermut gnädiglich bewahren wolle.
DER GARTEN IM BRUNNEN ...
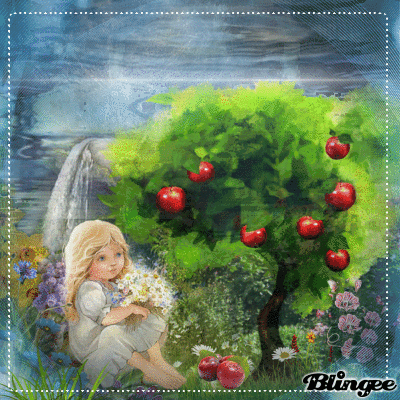
Ein Bauer hatte nach dem Tod seiner ersten Frau, die ihm ein Mädchen und einen Knaben geboren hatte, eine zweite geheiratet und bekam von dieser noch einen Sohn, der hieß Kasperle. Sie war aber gegen jene zwei Kinder eine böse Stiefmutter, behandelte sie übel, ließ sie zerlumpt umhergehen und gab ihnen kaum satt zu essen, während sie Kasperle alles zu Willen tat, ihn in den besten Kleidern einhergehen ließ und ihn in allen Stücken vorzog.
Der Vater durfte darüber nichts sagen, so oft ihm auch die armen Kinder ihr Leid klagten, denn er ward nachgerade kränklich und mußte selbst von seiner Frau alles gebrannte Herzeleid erdulden. Die böse Stiefmutter kam endlich sogar auf den Gedanken, die beiden Kinder aus dem Wege zu räumen und ihrem Sprößling das Erbe allein zuzuwenden.
Sie nahm deshalb einmal die Kinder mit tief hinein in den Wald, um Erdbeeren zu suchen; der Abend kam heran, und als sich die Kinder umsahen, war die Mutter verschwunden. Das Mädchen weinte sehr, denn sie glaubte schon im Walde umkommen zu müssen; aber der Knabe tröstete sie und sprach: »Wir kommen schon nach Hause, denn ich habe an dem Wege Reiser von den Hecken und Bäumen geknickt.«
Und die Kinder kamen wirklich nach Hause zurück, zum Ärger der Stiefmutter. Sie dachte es nun klüger anzufangen und führte sie noch tiefer in den Wald, aber der Knabe hatte Erbsen auf den Weg gestreut, und die Kinder kamen wiederum aus der greulichen finsteren Wildnis.
Die böse Stiefmutter ergrimmte aber über dies Fehlschlagen ihrer Pläne immer mehr, und als der Knabe einst aus dem tiefen Ziehbrunnen im Garten seines Vaters Wasser schöpfte, warf sie ihn hinein. Statt in das Wasser zu fallen, kam der Knabe in einen wunderschönen Garten, der voll Blumen und Bäume stand. Er konnte sich nicht satt sehen und lief immer zu; endlich aber erkannte er, daß er vom Schauen wirklich nicht satt geworden war; denn es hungerte ihn sehr; da sah er ein Bäumchen voll schöner roter Äpfel und sprach voll Sehnsucht:
»Liebes Bäumchen, schüttle dich und rüttle dich
Und wirf deine Äpfel über mich.«
Und das Bäumchen schüttelte sich, und eine Menge der schönen rot farbigen Äpfel lagen im Gras. Der Knabe aß sich satt und ging weiter. Da sah er ein Bäumchen stehen, das hing über und über voll Gold. Das blitzte dem Knaben gar sehr in die Augen, und er sprach:
»Liebes Bäumchen, schüttle dich und rüttle dich
Und wirf Goldblättlein über mich.«
Kaum hatte er ausgesprochen, da flimmerten seine Kleider von dem feinsten Golde. Nun kam aber die Sehnsucht nach dem Vater und der Schwester in sein Herz, und er seufzte: »Ach, wenn ich doch bei meinem Vater wäre!«
Siehe, da stand ein graues Männlein vor ihm, zeigte ihm einen Weg und sprach: »Gehe nur immer gradaus, bis du an die Stelle kommst, wo du hergekommen bist; deine Schwester wird Wasser schöpfen, da hänge dich an den Eimer.«
Der Knabe tat also, und es geschah alles, was das Männchen gesagt hatte.
Die Schwester verwunderte sich sehr, als sie den goldbedeckten Bruder am Eimer hängen sah. Sie freute sich gar sehr darüber und ließ sich von dem Bruder auch in den Brunnen hinab lassen, nachdem er ihr alles erzählt hatte. Dem Mädchen widerfuhr das selbe, und sie wurde ebenso wieder heraus gezogen. Nun gingen die beiden Kinder zum Vater und sagten: »Freue dich, nun haben wir Reichtum genug und wollen glücklich sein!«
Die böse Stiefmutter ärgerte sich gewaltig darüber, tat es sich aber nicht aus, sondern ließ sich alles von den Kindern genau erzählen. Dann unterrichtete sie ihren Sohn Kasperle und warf ihn auch in den Brunnen. Kasperle kam ebenfalls in den schönen Garten. Als ihn hungerte, sah auch er ein Bäumchen voll Äpfel. Da sprach er:
»Liebes Bäumchen, schüttle dich und rüttle dich,
Wirf deine Äpfel über mich!«
Da schüttelte sich das Bäumchen, und die Äpfel fielen dem Kasperle gar hart auf den Kopf! Er griff hastig nach dem ersten und biß hinein, mußte aber den Mund verziehen, so sauer schmeckte der Apfel, und es war ein garstiger Wurm darin. Der Hunger zwang ihn indes, doch davon zu essen. Bald darauf sah er ein Bäumchen, das glänzte wie Gold, und er sagte:
»Liebes Bäumchen, schüttle dich und rüttle dich,
Wirf deine Blütlein über mich!«
Da troff es von dem Bäumchen herab, und er war alsbald mit einer dicken Pechkruste überzogen. Er weinte und schrie und verlangte nach seiner Mutter, damit sie ihn aus der unbequemen Haut erlöse. Und das graue Männchen stand vor ihm und sagte: »Gehe dahin und hänge dich an den Eimer, mit dem deine Mutter Wasser schöpfen wird.«
Die Stiefmutter hatte am Brunnen gewartet und zog hastig vor Begierde den Eimer herauf, als sie eine schwere Last sich dran hängen fühlte. Sie hoffte nichts gewisser, als daß Kasperle mit Gold bedeckt zurück kehren werde. Wie erboste sie sich daher, als sie den armen Jungen in solchem Zustand fand. Sie schalt und schlug sogar nach ihm.
Das Pech ließ sich gar nicht ablösen, und sie kam auf den Gedanken, ihn in den warmen Backofen zu stecken, da sie eben Brot gebacken hatte; da werde das Pech schon abfließen, meinte sie. Sie tat es, vergaß aber den Jungen, und als sie den Ofen endlich öffnete, floß ihr das Pech entgegen, das Kasperle war erstickt und verbrannt.
Die Stiefmutter starb bald darauf vor Ärger und Betrübnis, der Vater aber lebte mit seinen glücklichen Kindern herrlich und in Freuden.
DER HASE UND DER FUCHS ...
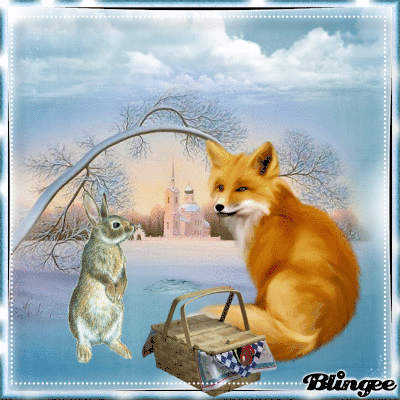
Ein Hase und ein Fuchs reisten beide miteinander. Es war Winterszeit, grünte kein Kraut, und auf dem Felde kroch weder Maus noch Laus. »Das ist ein hungriges Wetter«, sprach der Fuchs zum Hasen, »mir schnurren alle Gedärme zusammen.«
»Jawohl«, antwortete der Hase. »Es ist überall Dürrhof, und ich möchte meine eignen Löffel fressen, wenn ich damit ins Maul langen könnte.«
So hungrig trabten sie miteinander fort. Da sahen sie von weitem ein Bauernmädchen kommen, das trug einen Handkorb, und aus dem Korb kam dem Fuchs und dem Hasen ein angenehmer Geruch entgegen, der Geruch von frischen Semmeln. »Weißt du was!« sprach der Fuchs: »Lege dich hin der Länge lang und stelle dich tot. Das Mädchen wird seinen Korb hinstellen und dich aufheben wollen, um deinen armen Balg zu gewinnen, denn Hasenbälge geben Handschuhe; derweilen erwische ich den Semmelkorb, uns zum Troste.«
Der Hase tat nach des Fuchsen Rat, fiel hin und stellte sich tot, und der Fuchs duckte sich hinter eine Windwehe von Schnee. Das Mädchen kam, sah den frischen Hasen, der alle Viere von sich streckte, stellte richtig den Korb hin und bückte sich nach dem Hasen. Jetzt wischte der Fuchs hervor, erschnappte den Korb und strich damit querfeldein, gleich war der Hase lebendig und folgte eilend seinem Begleiter.
Dieser aber stand gar nicht still und machte keine Miene, die Semmeln zu teilen, sondern ließ merken, daß er sie allein fressen wollte. Das vermerkte der Hase sehr übel. Als sie nun in die Nähe eines Meinen Weihers kamen, sprach der Hase zum Fuchs: »Wie wäre es, wenn wir uns eine Mahlzeit Fische verschafften?
Wir haben dann Fische und Weißbrot, wie die großen Herren! Hänge deinen Schwanz ein wenig ins Wasser, so werden die Fische, die jetzt auch nicht viel zu beißen haben, sich daran hängen. Eile aber, ehe der Weiher zufriert.«
Das leuchtete dem Fuchs ein, er ging hin an den Weiher, der eben zufrieren wollte, und hing seinen Schwanz hinein, und eine kleine Weile, so war der Schwanz des Fuchses fest angefroren.
Da nahm der Hase den Semmelkorb, fraß die Semmeln vor des Fuchses Augen ganz gemächlich, eine nach der anderen und sagte zum Fuchs: »Warte nur, bis es auftaut, warte nur bis ins Frühjahr, warte nur bis es auftaut!« und lief davon, und der Fuchs bellte ihm nach, wie ein böser Hund an der Kette.
DER FUCHS UND DER KREBS ...
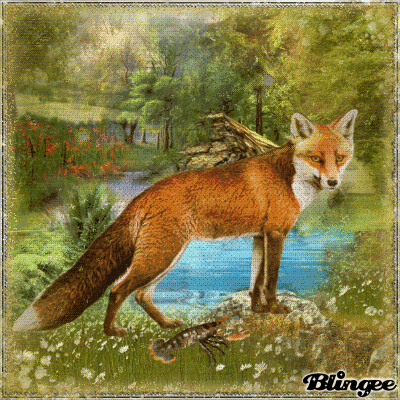
Ein Krebs kroch aus seinem Bache hervor auf das grüne Gras einer Wiese, allda er sich gütlich tat. Da kam ein Fuchs daher, sah den Krebs langsam kriechen und sprach spöttisch zu ihm: »Herr Krebs, wie geht Ihr doch so gemächlich? Wer nahm Euch Eure Schnelligkeit? Oder wann gedenkt Ihr über die Wiese zu kommen? Aus Euerm Gange merke ich wohl, daß Ihr besser hinterrücks als vorwärts gehen könnt!«
Der Krebs war nicht dumm, er antwortete also bald dem Fuchs: »Herr Fuchs, Ihr kennt meine Natur nicht. Ich bin edel und wert, ich bin schneller und leichter und laufe rascher als Ihr und Eure Art, und wer mir das nicht gönnt, den möge der Teufel riffeln. Herr Fuchs, wollt Ihr mit mir eine Wette laufen? Ich setze gleich ein Pfund zum Pfande!«
»Nichts wäre mir lieber«, sprach der Fuchs. »Wollt Ihr von Bern nach Basel laufen oder von Bremen nach Brabant?«
»O nein«, sprach der Krebs, »das Ziel wäre zu fern! Ich dächte, wir liefen eine halbe oder eine ganze Meile miteinander, das wird uns beiden nicht zu viel sein!«
»Eine Meile, eine Meile!« schrie der Fuchs eifrig.
Und der Krebs begann wieder: »Ich gebe Euch auch eine hübsche Vorgabe, ohne daß Ihr die annehmt, mag ich gar nicht laufen. «
»Und wie soll die Vorgabe sein?« fragte der Fuchs.
Der Krebs antwortete: »Gerade eine Fuchslänge soll sie beschaffen sein. Ihr tretet vor mich, und ich trete hinter Euch. daß Eure Hinterfüße an meinen Kopf stoßen, und wenn ich sage: Nun wohl hin! - so heben wir an zu laufen.«
Dem Fuchs gefiel die Rede wohl; er sagte: »Ich gehorche Euch in allen Stücken.«
Und da kehrte er dem Krebs sein Hinterteil zu, mit dem großen und starken haarigen Schwanze, in den schlug der Krebs seine Scheren, ohne daß der Fuchs es merkte, und rief: »Nun wohl hin!«
Und da lief der Fuchs, wie er in seinem Leben noch nicht gelaufen war, daß ihm die Füße schmerzten, und als das Ziel erreicht war, so drehte er sich geschwind herum und schrie: »Wo ist nun der dumme Krebs? Wo seid Ihr? Ihr säumt gar zu lange! «
Der Krebs aber, der dem Ziele jetzt näher stand als der Fuchs, rief hinter ihm: »Herr Fuchs! Was will diese Rede sagen? Warum seid Ihr so langsam? Ich stehe schon eine hübsche Weile hier und warte auf Euch! Warum kommt Ihr so saumselig?«
Der Fuchs erschrak ordentlich und sprach: »Euch muß der Teufel aus der Hölle hergebracht haben!« zahlte seine Wette, zog den Schwanz ein und strich von dannen.
ZWERGENMÜTZCHEN ...

Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne und eine Tochter. Die Tochter hatte er sehr gerne, die Söhne konnte er nicht leiden. Sie konnten ihm nie etwas recht machen, und er war immer unzufrieden mit ihnen. Die Brüder waren deshalb sehr traurig und wünschten oft, sie wären weit weg von zu Hause und von ihrem Vater. Manchmal saßen sie zusammen, klagten und seufzten und wußten nicht, was sie anfangen sollen.
Eines Tages, als sie wieder einmal traurig beisammen saßen, sagte einer von ihnen betrübt: „Ach wenn wir nur ein Zwergenmützchen hätten, dann ginge es uns besser.“ – „Wie meinst du daß?“, fragte einer der beiden anderen Brüder.
„Die Zwerge, die in den grünen Bergen wohnen“, erklärte der Bruder, „haben Mützchen, die man auch Nebelkäppchen nennt. Wenn man sie aufsetzt, wird man unsichtbar. Das ist eine schöne Sache, man kann Leuten , die einem Böses wollen, aus dem Weg gehen und hingehen, wohin man will und kein Mensch sieht es, solange man das Zwergenmützchen auf dem Kopf trägt.“
„Die Zwerge“, antwortete der älteste, „sind ein drolliges und verspieltes Volk. Oft spielen sie auch mit ihren Mützchen. Sie werfen es in die Luft und wupps sind die sichtbar. Nun muß man nur gut aufpassen, wenn ein Zwerg sein Mützchen in die Luft wirft, sich den Zwerg packen und das Mützchen selber fangen. Dann muß er sichtbar bleiben und man wird Herr über die Zwergensippschaft. Man kann dann entweder das Mützchen behalten und auf diese Weise sich selbst unsichtbar machen oder von den Zwergen soviel dafür verlangen, daß man für sein Leben ausgesorgt hat.
Die Zwerge sind nämlich ein reiches Volk. Sie haben Macht über alles Metall in der Erde und kennen alle Geheimnisse und Wunderkräfte der Natur. Durch ihre Lehren können sie aus einem Dummen einen Klugen machen und aus einem faulen Studenten einen hochgelehrten Professor.“ „Das wäre wunderbar“, sagten die Brüder. „Kannst du nicht hingehen“, sagte der ältere Bruder.
Und bald machte er sich auf dem Weg nach den grünen Bergen. Der Weg war weit und der gute Junge kam erst gegen Abend bei den Zwergenbergen an. Dort legte er sich in das grüne Gras an eine Stelle, wo sich noch Spuren der Zwergentänze im Mondlicht zeigten. Und siehe da, nach kurzer Zeit tauchten schon einige Zwerge ganz in seiner Nähe auf, warfen ihre Mützchen in die Luft und hopsten und purzelten durcheinander.
Bald fiel ein Zwergenmützchen ganz in seiner Nähe zu Boden. Er griff schnell danach, aber der Zwerg, dem das Mützchen gehörte, war viel flinker wie er und erhaschte das Mützchen selber. Laut schrie der Zwerg: „Diebe, Räuber“, und bei diesem Ruf stürzten sich alle Zwerge auf den armen Knaben.
Der war gegen diese große Übermacht hilflos und mußte es geschehen lassen, daß diese Zwerge ihn gefangen nahmen und ihn in ihre unterirdische Wohnung schleppten. Die Zeit verging und die beiden jüngeren Brüder sorgten sich, weil der ältere nicht zurück kehrte. Auch ihre Schwester, die sanft und gut war, hatte Angst um den Bruder
Nur der Vater knurrte: „Von mir aus soll der Bursche doch zum Teufel sein, dann haben wir wenigstens einen unnützen Esser weniger, aber er wird wohl wieder auftauchen, Unkraut vergeht nicht.
Aber es verging Tag um Tag, ohne daß der ältere Bruder zurück kehrte. Der Vater wurde gegen die beiden zu Hause gebliebenen Brüder immer gröber und härter. Die Söhne immer trauriger und eines Tages sagte der mittlere: „Weißt du was, Bruder, ich werde mich jetzt selber auf dem Weg zu den grünen Berge machen.
Vielleicht gelingt es mir, ein Zwergenmützchen zu bekommen, ich denke nämlich, daß unser älterer Bruder schon lange so ein Mützchen ergattert hat und in die weite Welt gegangen ist, um sein Glück zu machen. Darüber hat er uns bestimmt vergessen. Ich aber komme ganz bestimmt zurück, wenn ich ein solches Mützchen habe. Wenn ich aber nicht zurückkomme, dann habe ich kein Glück gehabt. In diesem Fall, lebe du wohl.
Traurig trennten sich die beiden Brüder und der mittlere machte sich auf dem Weg zu den grünen Bergen. Aber es erging ihm genau so, wie es seinem ältesten Bruder ergangen war. Er sah die Zwerge mit ihren Mützchen spielen, wollte eine erhaschen, wurde aber vorher entdeckt und von den Zwergen gefesselt und in ihre unterirdische Wohnung geschleppt.
Sehnsüchtig wartete derweil der jüngste Bruder daheim in der Mühle, doch nach einiger Zeit war ihm klar, daß sein Bruder auch kein Glück gehabt hatte. Darüber wurde er sehr traurig. Auch die Schwester war betrübt. Nur der Vater blieb gleichgültig. Hin ist hin brummte er: „Wem es zu Hause nicht gefällt, der soll sich gefälligst aus dem Staub machen. Was macht ihr euch Sorgen um den Kerl, aus den Augen, aus dem Sinn.“
Der jüngste Bruder war untröstlich und er sagte zu seiner Schwester: „Liebe Schwester, auch ich werde jetzt fortgehen, selbst wenn es mir so ergeht wie meinen Brüdern. Ich kann es nicht mehr ertragen, wie der Vater mich behandelt. Lebe wohl und lasse es dir gut gehen.“
Die Schwester wollte ihren jüngsten Bruder erst gar nicht gehen lassen, denn ihn hatte sie besonders gern. Er aber machte sich trotzdem auf den Weg und überlegte wie er es anstellen könnte, ein Zwergenmützchen zu bekommen. Bald kam er in den grünen Bergen an und erkannte an den Spuren im Gras schnell die Wiese, auf der die Zwerge nachts ihre Tänze vollführten. Ruhig legte er sich hin und wartete.
Bald kamen auch die Zwerge und trieben ihre Späße. Ein Mützchen fiel ganz in der Nähe zu Boden, doch der kluge Junge griff noch nicht danach. Erst als ihm ein drittes Mützchen genau in die Hände fiel, hielt er es fest und sprang auf.
„Diebe, Räuber!“, schrie der Zwerg, dem das Mützchen gehörte, mit greller Stimme.
Sofort liefen alle Zwerge herbei, aber sie konnten den Jungen nicht sehen und ihm nichts anhaben, weil er das Mützchen hatte. Die Zwerge heulten, zeterten und jammerten, er solle ihnen doch um alles in der Welt das Käppchen zurückgeben.
„Um alles in der Welt?“, fragte der kluge Knabe. Aus dem Handel könnte etwas werden, nur will ich vorher hören, worin? Wo sind meine Brüder?“ „Die sind unten im Inneren der grünen Berge“, antwortete der Zwerg, dem das Mützchen gehört hatte. „Und was tun sie da?“ „Sie dienen.“ „So, sie dienen. Und ihr dient jetzt mir! Los, schnell zu meinen Brüdern. Ihr Dienst ist nun zu Ende und eurer fängt an.“
Die Zwerge mußten nun gehorchen, ob sie wollten oder nicht, denn gegen den Menschen mit dem Mützchen waren sie machtlos. Die Wirkung des Mützchens war unbeschreiblich. Die bestürzten und bekümmerten Zwerglein führten ihren Gebieter an die Stelle, wo sich die Öffnung zum Inneren der Berge befand.
Rasch traten alle ein und es ging hinunter in die Wohnungen der Zwerge. Welcher Glanz tat sich ihnen auf: riesige Hallen, große und unermäßliche Räume, aber auch kleine Zimmer und Kämmerchen.
Nun verlangte der Knabe seine Brüder zu sehen. Diese wurden herbeigebracht und der jüngste sah, daß sie Dienerkleidung trugen. Wehmütig und traurig riefen sie: „Ach, kommst du auch, unser jüngster Bruder? So sind wir drei in der Gewalt der Zwergen. Nie wieder werden wir das Tageslicht und die grünen Wälder sehen.“
„Liebe Brüder, seid beruhigt, das Blatt hat sich gewendet“, sprach der jüngste und herrschte die Zwerge an. „Bringt Herrenkleider und Prunkgewänder für meine Brüder und mich.“ Dabei hielt er das Mützchen ganz fest in seiner Hand. Mit Hilfe der Diener kleideten sich die Brüder nun fürstlich und ließen dann den Tisch decken mit den erlesensten Speisen und Getränken.
Zum Essen mußten die Musikanten aufspielen und Theaterspieler und Pantomimen auftreten. In diesen Künsten besaßen die Zwerge eine hohe Fertigkeit...
Dann suchten sich die Brüder die besten Gemächer aus, ließen eine gläserne Kutsche mit prächtigen Pferden bespannen und besichtigen das hell erleuchtete Reich. Sie sahen Edelsteingrotten, herrliche Wasserspiele, silberne Lilien, goldene Sonnenblumen, kupferne Rosen und alles strahlte von Glanz, Pracht und Herrlichkeit.
Später begann der jüngste Bruder mit den Zwergen zu verhandeln und nannte seine Bedingungen. Erstens sollten die Zwerge einen Trank aus köstlichen Heilkräutern brauen. Der sollte für das kranke Herz des Vaters sein, damit es sich umkehre und Liebe zu den Söhnen empfindet.
Zweitens mußten viel Gold, Silber und Edelstein her, damit die liebe Schwester mit einem Brautschatz ausgestattet werden konnte, der so reich war, wie der einer Königstochter. Drittens mußte auch für die Brüder ein Wagen mit Edelsteinen und Kunstgeräten, wie sie nur Zwerge so kunstvoll und herrlich anfertigen konnten, beladen werden.
Außerdem noch ein Wagen voll mit Goldmünzen, dazu kam noch ein bequemer Wagen mit Glasfenstern, indem die Brüder selber fahren wollten. Zu allen drei Wagen verlangten sie alles Nötige: Kutscher, Pferde, Geschirr und Riemenzeug. Die Zwerge wanden und krümmten sich, weil sie der Meinung waren, diese Bedingungen seien viel zu hart. Aber es half ihnen nichts.
„Wenn ihr nicht wollt“, so sagte der jüngste Bruder, „so ist es mir auch recht. Dann bleiben wir bei euch. Hier ist es ja ganz nett. Aber dann werde ich jedem sein Mützchen wegnehmen und dann könnt ihr mal sehen, was das gibt. Dann seid ihr nämlich nicht mehr unsichtbar. Die Menschen werden jeden von euch totschlagen, den sie entdecken.
Außerdem werde ich jede Menge Kröten sammeln und sie jedem von euch beim Schlafengehen mit ins Bett geben.“ In dem Moment wo das Wort Kröte ausgesprochen war, sanken alle Zwerge auf die Knie nieder und riefen: „Gnade, Gnade nur das nicht, denn Kröten sind für Zwerge das Abscheulichste, das man sich denken kann.
„Ihr dummen Zwerge“, rief der jüngere Bruder aus, „meine Forderungen sind doch sehr bescheiden. Ich hätte noch viel, viel mehr verlangen können aber ich bin ein guter Mensch. Wenn ich wollte, könnte ich euch alles wegnehmen und das Mützchen dazu behalten. Dann würde ich für immer und ewig über euch herrschen, denn mit dem Mützchen würde ich, wie ihr wisst, nicht sterben. Wollt ihr mir also meine drei kleinen Bedingungen nicht doch lieber erfüllen?“
Da endlich erklärten die Zwerge sich bereit, den Forderungen nachzukommen, weil sie einsahen, daß es das Beste für sie wäre. Sie machten sich daran, alles herbei zu schaffen, was der Herrscher verlangt hatte.
In der Mühle des alten griesgrämigen Müllers ging es zu der Zeit auch recht traurig zu. Als auch der jüngste Sohn auf und davon gegangen war, knurrte der Alte: „Nun ist auch der fort. Soll er bleiben wo er ist. Das hat man davon, wenn man Kinder großzieht. Nun ist nur noch meine Tochter da, mein Augapfel, mein Liebling.“
Aber die Tochter saß dort und weinte bittere Tränen. Glaubst du schon wieder, ich soll wohl denken, du weinst um deine Brüder. Aber ich weiß es besser, du weinst um deinen Liebhaber, der dich heiraten will. Dieser Habenichts besitzt nichts, genau wie du auch. Ich habe nichts, was ich euch geben könnte. Meine Mühle steht still, kein Rad dreht sich und schlechter kann es um eine Mühle nicht stehen. Ich kann nicht mahlen und du kannst nicht heiraten.“
Solche Reden mußte sich das arme Mädchen jeden Tag anhören und sie verging fast vor stillem Leid. Da hielt eines schönen Morgens eine prächtige Kutsche vor der Mühle. Kleine Diener öffneten die Tür und heraus stiegen drei hübsche Herren in kostbaren Gewändern. Die Diener rannten um die Begleitwagen und luden Kisten, Kasten und schwere Truhen aus.
„Guten Morgen Vater! Guten Morgen Schwester! Da sind wir wieder“, riefen die drei Brüder. Diese starrten die Ankömmlinge verwundert an. „Trink mit uns ein Willkommenstrunk, lieber Vater“, rief der Älteste und nahm einem der Diener einen Flasche aus der Hand. Dann schenkte er einen kunstvoll gearbeiteten Goldpokal voll und ließ den Vater trinken.
Dieser trank und gab den Pokal weiter, so daß dieser die Runde machte. Sofort strömte dem Vater Wärme in das kalte Herz und die Wärme wurde zum Feuer, zum Feuer der Liebe. Er weinte vor Rührung und Freude, fiel seinen Söhnen in die Arme, küsste sie und segnete sie.
Da kam auch der Geliebte der Tochter. Auch er durfte trinken und seine zukünftige Frau in die Arme schließen. Vor Freude fingen die Mühlräder, die so lange still gestanden hatten, sich zu drehen und sie drehten sich schneller und schneller und schneller.
VINETA ...

Bei der Insel Usedom ist eine Stelle im Meere, eine halbe Meile von der Stadt gleichen Namens, da ist eine große, reiche und schöne Stadt versunken, die hieß Vineta.
Sie war ihrer Zeit eine der größesten Städte Europas, der Mittelpunkt des Welthandels zwischen den germanischen Völkern des Südens und Westens und den slavischen Völkern des Ostens. Überaus großer Reichtum herrschte allda.
Die Stadttore waren von Erz und reich an kunstvoller Bildnerei, alles gemeine Geschirr war von Silber, alles Tischgeräte von Gold. Endlich aber zerstörte bürgerliche Uneinigkeit und der Einwohner ungezügeltes Leben die Blüte der Stadt Vineta, welche an Pracht und Glanz und der Lage nach das Venedig des Norden war.
Das Meer erhob sich, und die Stadt versank.
Bei Meeresstille sehen die Schiffer tief unten im Grunde noch die Gassen, die Häuser eines Teiles der Stadt in schönster Ordnung, und der Rest Vinetas, der hier sich zeigt, ist immer noch so groß als die Stadt Lübeck.
Die Sage geht, daß Vineta drei Monate, drei Wochen und drei Tage vor seinem Untergang gewafelt habe, da sei es als ein Luftgebilde erschienen mit allen Türmen und Palästen und Mauern, und kundige Alte haben die Einwohner gewarnt, die Stadt zu verlassen, denn wenn Städte, Schiffe oder Menschen wafeln und sich doppelt sehen lassen, so bedeute das vorspukend sicheren Untergang oder das Ende voraus – jene Alten seien aber verlacht worden.
An Sonntagen bei recht stiller See hört man noch über Vineta die Glocken aus der Meerestiefe heraufklingen mit einem trauervoll summenden Ton.
HELA ...
Von Danzig und der Weichselmündung gerade nordwärts liegt auf der äußersten Spitze der Landzunge, die das Putziger Wiek von der Ostsee scheidet, ein kleines Städtchen, das führt den Namen Hela. Selbiges ist ein trauriger und düsterer Name, denn Hela hieß die Todesgöttin in dem skandinavischen Mythus, ein Begriff der Erstarrung, der Kälte und des Reiches unter der Erde, und es wollen manche, daß von diesem Namen sogar das deutsche Wort Hölle abstamme.
Aber da, wo jetzt Hela liegt, und insonderheit einige tausend Schritte hin am äußersten Oststrand, war vorzeiten keine Hölle, sondern eitel irdischer Glanz und Helle, aber das ist freilich schon viele hundert Jahre her, da stand dort eine reiche, große und prächtige Stadt, belebt vom Handel und Wandel, besucht von allen Völkern des Morgen- und Abendlandes, gleich Stavoren und Vineta und Julin; aber wie es in diesen blühenden Städten ging, also ging es auch in Hela, der wachsende Reichtum machte die Menschen gottvergessen.
Aber es steht geschrieben: Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen – und Hela ist untergegangen mitten in seinen Sünden. Es soll dieser Untergang durch die brausende Meeresflut in einer Nacht vom ersten zum zweiten Pfingsttage geschehen sein, weil es dahin gediehen war, daß der Handels- und Betriebsgeist keines Sonn- und Feiertags mehr achtete und Werkeltage aus ihnen machte, wohin auch die Neuzeit wieder steuert, die dem armen arbeitenden Volke seinen Sonntag nimmt – und nur an diesem hohen Festtage kann zuzeiten bei ruhiger See das meerverschlungene Hela erblickt werden.
Und da sieht man in den reichen Straßen die Bewohner geschäftig wandeln in ihrer Prunktracht und Verkehr treiben und kann die Uhren schlagen hören und die Glocken läuten, aber in die Kirchen sieht man niemand gehen, weil das die Leute verlernt hatten über dem Jagen nach dem Mammon.
Wenn der erste Pfingsttag still war und den Hinabblick nach Hela vergönnte, erhebt mit Sonnenuntergang sich der Nordostwind und wühlt das Meer auf, als solle sich der alte Pfingststurm erneuen, und als wolle er gar die ganze Landzunge verschlingen.
Da eilen Schiffer und Fischer, Fahrzeuge und Nachen zu bergen und den sichern Strand zu gewinnen, denn furchtbar toben an diesem nordöstlichen Strande der Ostsee empörte Wogen.
JULIN ...
Da, wo heute Wollin, die Stadt am breiten Dievenowstrome, liegt, der das Große Haff mit der Ostsee verbindet, hat vorzeiten auch gar eine große, Geld- und Volkreiche Stadt gelegen, die hieß Julin.
Sie hob sich absonderlich zur Blüte nach dem Untergange der Stadt Vineta, und aller Handel zog sich nach ihr. Julin führte Kriege auf eigne Hand mit dem Dänenkönig Suen Otto, der mächtig war, und dreimal machten die Krieger Julins diesen König zum Gefangenen.
Das erste Mal mußte er so viel Silber zu seiner Lösung geben, als er schwer war, das Geld gab die königliche Kammer her. Das zweite Mal mußte der König so viel Silbers zur Lösung geben, als er in seiner schweren Rüstung wog. Da hatte die Kammer kein Geld mehr, und es mußten königliche Krongüter verkauft und verpfändet werden.
Da sich aber der König Suen Otto zum dritten Mal unterfing, gegen Julin zu streiten, und zum dritten Mal Gefangener wurde, da verlangten die zu Julin eine schwerere Lösung, nämlich des Königs Schwere in Gold. Da war nun guter Rat teuer, denn die Kammer hatte kein Geld, und die Krongüter lagen in Pfandschaft.
Da haben alle begüterten Frauen Dänemarks ihren reichen Goldschmuck zusammengetan, und er hat hingereicht, den König zu lösen, dafür zum Danke gab König Suen Otto ein Gesetz, daß jede Frau Erbrecht haben solle auf ein Dritteil des Nachlasses ihres Gatten ohne Gefährde, da früher ihnen nur gar ein geringer Teil vergönnt war.
Als die Stadt Julin vom heidnischen Glauben zum christlichen Glauben übertrat, meldeten sich bei dem Bischof Otto auf einmal zweiundzwanzigtausend Einwohner zur Taufe an. Hernachmals aber ist das Volk von Julin wieder gottlos geworden, hat Christum verleugnet und ist in die heidnischen Greuel zurückgefallen, hat einen alten Götzen wieder hervorgesucht und ihm Feste gefeiert.
Da hat Gott der Herr sich erzürnt und Feuer niederregnen lassen, wie auf Sodom und Gomorrha, und Julin von Grund aus verbrannt und nicht gelitten, daß sich durch neuen Bau die Stadt wieder erhole und aufrichte.
Endlich kam auch noch im Jahre 1170 der Dänenkönig Waldemar durch die Dievenow mit einer großen Flotte, plünderte den Rest der Stadt und verbrannte, was von ihr wieder neu gebaut war, abermals. Da ward Julin verlassen, und seine Stätte blieb auf immer öde, und die wenigen Flüchtigen, die dem Verderben entrannen, erbauten die Stadt Wollin in der Nähe des alten Julin, die es nie zu hohem Flor hat bringen können. –
Noch eine blühende Stadt, welche Julins Schicksal ein Jahrhundert früher teilte, war Jomsburg. Es war rund um einen schönen Binnensee gebaut, ganz nahe dem Jaminschen See, jener ist jetzt ein Sumpf und heißt die Müsse.
DIE KORNÄHREN ...
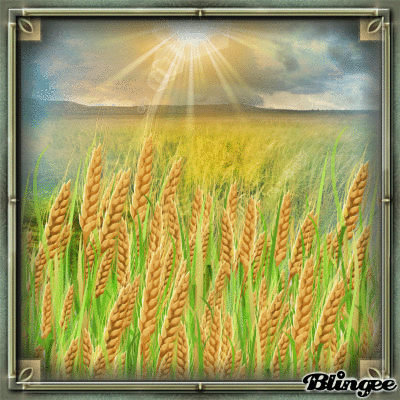
Es war einmal eine Zeit, aber das ist schon undenklich lange her, da trugen alle Kornhalme, und auch die von anderem Getreide, volle goldgelbe Ähren herab bis auf den Boden; da gab es keine Armut und keine Hungersnot, niemals, und das war die goldene Zeit. Da konnten sich alle Menschen mit Wonne sättigen, und auch die Vögel, die gerne Körner fressen, Hühner und Tauben und andere Vögel, fanden Futter vollauf.
Aber da waren unter den Menschen welche, die waren undankbar und gottvergessen und achteten die schöne werte Gottesgabe, das liebe Getreide, für gar nichts. Da gab es Frauen, die nahmen, wenn ihre kleinen Kinder sich verunreinigt hatten, die vollen Ährenbüschel und reinigten damit ihre Kinder und warfen die Ähren auf den Mist; und die Mägde scheuerten mit den vollen Ähren, und die Buben und kleine Mädchen jagten sich durch das liebe Korn, spielten Verstecken darin, wälzten sich darauf herum und zertraten es.
Das jammerte den lieben Gott, der das Getreide den Menschen zur Nahrung gegeben hatte und dem Vieh zum Futter und nicht zum Verderben, und dachte bei sich, wir wollen es anders machen und die goldne Zeit soll ein Ende haben.
Und da schuf der liebe Gott, daß hinfort jeder Halm nur eine einzige Ähre trug, einmal für die Menschen, damit sie das liebe Getreide besser schonen lernten, und einmal für die unschuldigen Tiere, damit sie doch noch ihr Futter haben sollten, wenn auch die Menschen nicht einmal die eine Ähre wert wären.
Von da an ist Hunger und Teuerung und Armut in die Welt gekommen. Nur zuweilen und selten läßt der liebe Gott da oder dort einen Wunderhalm mit vielen, vielen Ähren emporschießen und zeigt so dem Menschen, wie es einst beschaffen war um das Getreide und was Er kann.
Und es geht eine alte Prophezeiung unter dem Volke, daß einmal nach langen Jahren, wenn das Engelwort sich erfüllt haben wird: Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und unter allen Menschen Wohlwollen, Segnung und Liebe, daß dann der Boden auch wieder von Gott erweckt werden solle, solche Halme zu tragen, die bis zur Wurzel voll Ähren sind. Unser keiner aber wird das erleben.
DER KLEINE DÄUMLING ...
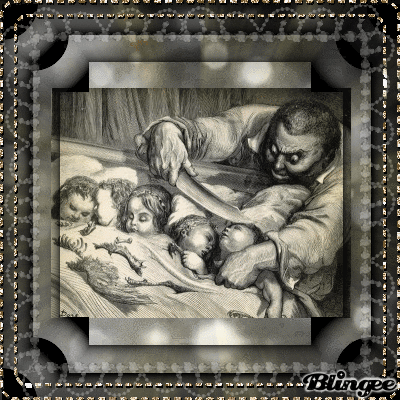
Es war einmal ein armer Korbmacher, der hatte mit seiner Frau sieben Jungen, da war immer einer kleiner als der andere, und der jüngste war bei seiner Geburt nicht viel über Fingers Länge, daher nannte man ihn Däumling. Zwar ist er hernach noch etwas gewachsen, doch nicht gar zu sehr, und den Namen Däumling hat er behalten. Doch war es ein gar kluger und pfiffiger kleiner Knirps, der an Gewandtheit und Schlauheit seine Brüder alle in den Sack steckte.
Den Eltern ging es erst gar übel, denn Korbmachen und Strohflechten ist keine so nahrhafte Profession wie Semmel backen und Kälber schlachten, und als vollends eine teure Zeit kam, wurde dem armen Korbmacher und seiner Frau himmelangst, wie sie ihre sieben Würmer satt machen sollten, die alle mit äußerst gutem Appetit gesegnet waren. Da beratschlagten eines Abends, als die Kinder zu Bette waren, die beiden Eltern miteinander, was sie anfangen wollten, und wurden Rates, die Kinder mit in den Wald zu nehmen, wo die Weiden wachsen, aus denen man Körbe flicht, und sie heimlich zu verlassen.
Das alles hörte der Däumling an, der nicht schlief, wie seine Brüder, und schrieb sich der Eltern üblen Ratschlag hinter die Ohren. Sinnierte auch die ganze Nacht, da er vor Sorge doch kein Auge zutun konnte, wie er es machen sollte, sich und seinen Brüdern zu helfen.
Früh morgens lief der Däumling an den Bach, suchte die kleinen Taschen voll weiße Kiesel und ging wieder heim. Seinen Brüdern sagte er von dem, was er erhorcht hatte, kein Sterbenswörtchen. Nun machten sich die Eltern auf in den Wald, hießen die Kinder folgen, und der Däumling ließ ein Kieselsteinchen nach dem anderen auf den Weg fallen, das sah niemand, weil er, als der jüngste, kleinste und schwächste, stets hintennach trottete. Das wußten die Alten schon nicht anders.
Im Wald machten sich die Alten unbemerkt von den Kindern fort, und auf einmal waren sie weg. Als das die Kinder merkten, erhoben sie allzumal, Däumling ausgenommen, ein Zetergeschrei. Däumling lachte und sprach zu seinen Brüdern: »Heult und schreit nicht so jämmerlich! Wollen den Weg schon allein finden.« Und nun ging Däumling voran und nicht hintendrein und richtete sich genau nach den weißen Kieselsteinchen, fand auch den Weg ohne alle Mühe.
Als die Eltern heimkamen, bescherte ihnen Gott Geld ins Haus; eine alte Schuld, auf die sie nicht mehr gehofft hatten, wurde von einem Nachbarn an sie abbezahlt, und nun wurden Eßwaren gekauft, daß sich der Tisch bog. Aber nun kam auch das Reuelein, daß die Kinder verstoßen worden waren und die Frau begann erbärmlich zu lamentieren: »Ach du lieber, allerlieber Gott! Wenn wir doch die Kinder nicht im Wald gelassen hätten! Ach, jetzt könnten sie sich dick satt essen, und so haben die Wölfe sie vielleicht schon im Magen! Ach, wären nur unsere liebsten Kinder da!«
»Mutter, da sind wir ja!« sprach ganz ruhig der kleine Däumling, der bereits mit seinen Brüdern vor der Türe angelangt war und die Wehklage gehört hatte; öffnete die Türe, und herein trippelten die kleinen Korbmacher - eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ihren guten Appetit hatten sie wieder mitgebracht, und daß der Tisch so reichlich gedeckt war, war ihnen ein gefundenes Essen.
Die Herrlichkeit war groß, daß die Kinder wieder da waren, und es wurde, so lange das Geld reichte, in Freuden gelebt, dies ist armer Handarbeiter Gewohnheit.
Nicht gar lange währte es, so war in des Korbmachers Hütte Schmalhans wieder Küchenmeister, und ein Kellermeister mangelte ohnehin, und es erwachte aufs neue der Vorsatz, die Kinder im Walde ihrem Schicksal zu überlassen. Da der Plan wieder als lautes Abendgespräch zwischen Vater und Mutter verhandelt wurde, so hörte auch der kleine Däumling alles, das ganze Gespräch, Wort für Wort und nahm es sich zu Herzen.
Am anderen Morgen wollte Däumling abermals aus dem Häuschen schlüpfen, Kieselsteine aufzulegen, aber o weh, da war es verriegelt, und Däumling war viel zu klein, als daß er den Riegel hätte erreichen können, da gedachte er sich anders zu helfen. Wie es fort ging zum Walde, steckte Däumling Brot ein und streute davon Krümchen auf den Weg, meinte, ihn dadurch wieder zu finden.
Alles begab sich wie das erste Mal, nur mit dem Unterschied, daß Däumling den Heimweg nicht fand, dieweil die Vögel alle Krümchen rein aufgefressen hatten. Nun war guter Rat teuer, und die Brüder machten ein Geheul in dem Walde, daß es zum Steinerbarmen war. Dabei tappten sie durch den Wald, bis es ganz finster wurde, und fürchteten sich über die Maßen, bis auf Däumling, der schrie nicht und fürchtete sich nicht.
Unter dem schirmenden Laubdach eines Baumes auf weichem Moos schliefen alle sieben Brüder und als es Tag war, stieg Däumling auf einen Baum, die Gegend zu erkunden . Erst sah er nichts als eitel Waldbäume, dann aber entdeckte er das Dach eines kleinen Häuschens, merkte sich die Richtung, rutschte vom Baum herab und ging seinen Brüdern tapfer voran.
Nach manchem Kampf mit Dickicht, Dornen und Disteln sahen alle das Häuschen durch die Büsche blicken und schritten gutes Mutes darauf los, klopften auch ganz bescheiden an der Türe an.
Da trat eine Frau heraus, und Däumling bat gar schon, sie einzulassen, sie hätten sich verirrt und wüßten nicht wohin. Die Frau sagte: »Ach, ihr armen Kinder!« und ließ den Däumling mit seinen Brüdern eintreten, sagte ihnen aber auch gleich, daß sie im Hause des Menschenfressers wären, der besonders gern die kleinen Kinder fräße. Das war eine schöne Zuversicht!
Die Kinder zitterten wie Espenlaub, als sie dieses hörten, hätten gern lieber selbst etwas zu essen gehabt und sollten nun statt dessen gegessen werden. Doch die Frau war gut und mitleidig, verbarg die Kinder und gab ihnen auch etwas zu, essen.
Bald darauf hörte man Tritte, und es klopfte stark an der Türe; das war kein anderer als der heimkehrende Menschenfresser. Dieser setzte sich an den Tisch zur Mahlzeit, ließ Wein auftragen und schnüffelte, als wenn er etwas röche, dann rief er seiner Frau zu: »Ich wittere Menschenfleisch!« Die Frau wollte es ihm ausreden, aber er ging seinem Geruch nach und fand die Kinder.
Die waren ganz hin vor Entsetzen. Schon wetzte er sein langes Messer, die Kinder zu schlachten, und nur allmählich gab er den Bitten seiner Frau nach, sie noch ein wenig am Leben zu lassen und aufzufüttern, weil sie doch gar zu dürr seien, besonders der kleine Däumling.
So ließ der böse Mann und Kinderfresser sich endlich beschwichtigen. Die Kinder wurden zu Bette gebracht, und zwar in der selben Kammer, wo ebenfalls in einem großen Bette Menschenfressers sieben Töchter schliefen, die so alt waren wie die sieben Brüder. Sie waren von Angesicht sehr häßlich, jede hatte aber ein goldenes Krönlein auf dem Haupte.
Das alles war der Däumling gewahr geworden, machte sich ganz still aus dem Bette, nahm seine und seiner Brüder Nachtmützen, setzte diese Menschenfressers Töchtern auf und deren Krönlein sich und seinen Brüdern.
Der Menschenfresser trank viel Wein, und da kam ihn seine böse Lust wieder an, die Kinder zu morden, nahm sein Messer und schlich sich in die Schlafkammer, wo sie schliefen, willens, ihnen die Hälse abzuschneiden. Es war aber stockdunkel in der Kammer, und der Menschenfresser tappte blind umher, bis er an ein Bett stieß, und fühlte nach den Köpfen der darin Schlafenden.
Da fühlte er die Krönchen und sprach: »Halt da! Das sind deine Töchter. Bald hättest du betrunkenes Schaf einen Eselsstreich gemacht!«
Nun tappelte er nach dem anderen Bette, fühlte da die Nachtmützen und schnitt seinen sieben Töchtern die Hälse ab, einer nach der anderen. Dann legte er sich nieder und schlief seinen Rausch aus - Wie der Däumling ihn schnarchen hörte, weckte er seine Brüder, schlich sich mit ihnen aus dem Hause und suchte das Weite. Aber wie sehr sie auch eilten, so wußten sie doch weder Weg noch Steg, und liefen in der Irre herum voll Angst und Sorge, nach wie vor.
Als der Morgen kam, erwachte der Menschenfresser und sprach zu seiner Frau: »Geh und richte die Krabben zu, die gestrigen!« Sie meinte, sie sollte die Kinder nun wecken, und ging voll Angst um sie, hinauf in die Kammer. Welch ein Schrecken für die Frau, als sie nun sah, was geschehen war; sie fiel gleich in Ohnmacht über diesen schrecklichen Anblick, den sie da hatte.
Als sie nun dem Menschenfresser zu lange weg blieb, ging er selbst hinauf, und da sah er, was er angerichtet hatte. Seine Wut, in die er geriet, ist nicht zu beschreiben. Jetzt zog er die Siebenmeilenstiefel an, die er hatte, das waren Stiefel, wenn man damit sieben Schritte tat, so war man eine Meile gegangen, das war nichts kleines.
Nicht lange, so sahen die sieben Brüder ihn von weitem über Berg und Täler schreiten und waren sehr in Sorge, doch Däumling versteckte sich mit ihnen in die Höhlung eines großen Felsens. Als der Menschenfresser an diesen Felsen kam, setzte er sich darauf, um ein wenig zu ruhen, weil er müde geworden war, und bald schlief er ein und schnarchte, daß es war, als brause ein Sturmwind.
Wie der Menschenfresser so schlief und schnarchte, schlich sich Däumling hervor wie ein Mäuschen aus seinem Loch und zog ihm die Meilenstiefel aus und zog sie selber an. Zum Glück hatten diese Stiefel die Eigenschaft, an jeden Fuß zu passen, wie angemessen und angegossen. Nun nahm er an jede Hand einen seiner Brüder, diese faßten wieder einander an den Händen, und so ging es, hast du nicht gesehen, mit Siebenmeilenstiefel-Schritten nach Hause.
Da waren sie alle willkommen, Däumling empfahl seinen Eltern ein sorglich Auge auf die Brüder zu haben, er wolle nun mit Hilfe der Stiefel schon selbst für sein Fortkommen sorgen und als er das kaum gesagt, so tat er einen Schritt, und er war schon weit fort, noch einen, und er stand über eine halbe Stunde auf einem Berg, noch einen, und er war den Eltern und Brüdern aus den Augen.
DAS GRUSELN ...

Es waren einmal zwei Brüder, von denen war der eine, der älteste, nicht auf den Kopf gefallen, vielmehr anstellig und pfiffig über alle Maßen; der jüngere aber hatte, wie man so sagt, ein Brett vor dem Kopf.
Das machte dem Vater große Sorge, ihm aber keine, denn er lebte ganz sorglos und arglos in die Welt hinein, wie die Dummen leben, und er mochte wohl, ohne daß er es wußte, das Sprüchlein im Kopfe haben: Hänschen lerne nicht zu viel, du mußt sonst zu viel tun.
Wenn der Vater etwas verrichtet haben wollte, so mußte er es allemal dem älteren, dem Matthes sagen, denn der andere, das Hänschen, richtete alles verkehrt aus, zerbrach den Ölkrug und die Branntweinflasche, oder blieb eine Ewigkeit aus. Matthes dagegen machte alles gut, nur einen Fehler hatte er, er war furchtsamer Natur, es gruselte ihn gar zu sehr.
Wenn er abends am Kirchhof vorbeiging, so gruselte ihn, und wenn er eine Gespenstergeschichte erzählen hörte, so bekam er vom eitel Gruseln eine Gänsehaut wie ein Reibeisen, und klagte: "Ach, ach, ach, es gruselt mich gar zu sehr." Sein Bruder aber, das dumme Hänschen, lachte ihn oft deshalb aus, und sagte: "Hä, hä, wie kann es einen nur gruseln? Die Kunst möchte ich können, mich gruselt es all mein Lebtage nicht - möchte wahrlich das Gruseln lernen!"
"Du siehst aus, wie einer, der was lernen möchte!" schalt der Vater auf Hänschen. "Zeit wäre es freilich, du wirst ein großer starker Lümmel - aber mit dem Gruseln lernen, du Hans Dampf, da ist es nichts, das ist keine Kunst, damit verdienst du kein Körnlein Salz zum lieben Brote. Und weißt du denn auch, wie man das Gruseln lernt? Was gilt die Wette, daß du auch dazu zu dumm bist?"
Während der Vater und der Bruder noch das dumme Hänschen auslachten, kam der Nachbar Küster und Schulmeister herüber zum Besuch, und hörte noch, wie das Hänschen verlacht wurde, und bekam erzählt, daß der Bube gern das Gruseln lernen wolle. "Das kann er bei mir prächtig lernen!" sprach der Küster.
"Mein Schulhaus ist das aller elendste Nest von einem Hause im ganzen Orte, mich gruselt es den ganzen Tag, daß mir es über dem Kopf zusammenfällt, und einmal die hoffnungsvollen Rangen miteinander erschlägt. Gebt mir das Hänschen herüber, ich muß ja so manchem Dummbart Wissenschaften beibringen, werde ihm doch wohl auch das Gruseln anlehren können!"
Der Vater war den Vorschlag zufrieden und das Hänschen folgte dem Küster hinüber in das alte wackelige Schulhaus. Ihn gruselte das aber mitnichten, es war ihm gerade so einerlei, daß das Haus der Einsturz drohte, wie es dem Schulzen und der ehrsamen Gemeinde einerlei war.
Nun sann der Küster auf ein andres Stücklein, das dem Hänschen auf alle Fälle das Gruseln beibringen sollte. Er hieß ihn die Abendglocke läuten, schlüpfte aber noch vor ihm heimlich hinauf in die Glockenstube, und als Hänschen zur Treppe hinauf war und den Strang zur Abendglocke faßte, hörte er von der Treppe her einen dumpfen stöhnenden Laut.
Wie er sich umsah, stand dort eine große weiße Schleiergestalt starr und unbeweglich. "Wer bist du? Was willst du?" fragte Hänschen, ohne daß ihn nur im mindesten gegruselt hätte. Keine Antwort. "Ich frage dich, wer du bist?" rief Hänschen mit stärkerer Stimme. Keine Antwort. "Hast du kein Maul, Schneemann? noch einmal: was willst du?" Keine Antwort.
Mein Hänschen, nicht faul, springt mit einem Satz auf die Gestalt los, wie der Kasper im Puppenspiel auf den Teufel und rennt sie, die sich solcher Herzhaftigkeit nicht versah, pardauz! über den Haufen, daß sie ein ganz Stück die Stiegen hinunter kollert, und was für Stiegen?
Stiegen von so einziger Art, wie sie nur auf alten Dorfkirchtürmen anzutreffen sind, ausgetreten, verrottet, eng, voll Jahrhundert alten Staubes. Drunten lag das Gespenst und ächzte und krächzte, Hänschen aber läutete zum Abendgebet, und schwang gar wacker den Glockenstrang, als wäre eben nichts vorgefallen; dann kletterte er wohlgemut die Stiege hinab, und ging aus dem Turme, dessen Türe er hinter sich zu schloß.
Die Küsterin wußte gar nicht, wo ihr Mann blieb. "Wo ist denn Er?" fragte sie Hänschen. "Wer?" fragte Hänschen. "Er!" sagte die Küsterin. "Er ist ja vor dir hinüber auf den Turm." "So", sagte Hänschen: "ist er das gewesen? Es stand ein weißer Labutzel an der Treppe, der wollte mir nicht Red und Antwort geben, da hab ich ihn die Treppe hinab gestoßen, er liegt noch drüben und krächzt." -
"Galgenstrick!" schrie die Küsterin, riß Hänschen den Schlüssel aus der Hand, und sprang auf den Turm, da lag ihr Mann in seinem Betttuch, und hatte ein Bein gebrochen.
Jetzt erging es Hänschen gar nicht gut; die Küsterin verklagte ihn bei seinem Vater, und der wurde ganz wild, und schrie: "Ein Taugenichts ist der Junge, aus den Augen soll er mir! Fort marsch! Hier ist Geld - geh, laß dich henken wo du willst - mir kommst du nimmer mehr vor die Augen. Schimpf und Schande und Schaden hat man von dir, du Nichtsnutz!"
"Geh mit Gott, Hänschen!" spottete Matthes; "sorge fein, daß du das Gruseln lernst, das Gruseln soll jetzt Mode sein, und den Menschen draußen in der Welt gruselt es vor allerhand, da wirst du schon vom Gruseln auch deinen Teil bekommen!"
Hänschen ging, er hatte Geld, und wenn einer Geld hat, braucht es ihn erst recht nicht zu gruseln. Unterwegs sprach er öfter vor sich hin: "Wenn mich doch nur gruselte, wenn mich doch nur gruselte!" Das hörte ein Mann, der hinter Hänschen kam, und sprach zu ihm: "Schau dorthin - dort steht der Dreibein, da hängt eine schöne Gesellschaft dran - gerade ihrer sieben, was man so sagt: ein Galgen voll. Dort nimm unter den sieben dein Nachtlager, da lernst du das Gruseln."
"Wenn das wahr wäre", sprach Hänschen, "so wollt ich dir morgen früh all mein Geld geben. Kannst zu mir kommen und es holen, oder du kannst ja auch gleich bei mir bleiben!"
"Daß ich ein Narr wäre und unterm lichten Galgen bei dir bliebe!" antwortete jener. "Nein, mein guter Gesell, das Gruseln lernt sich viel besser, wenn einer allein, als wenn er zu zweien ist. Gute Nacht - auf Wiedersehen morgen in der Frühe!"
Hänschen setzte sich unter den Galgen, machte sich, weil es kalt war, ein Feuerchen an, das schien hübsch hell hinauf zu den Gehenkten, und der scharfe Nachtwind bewegte ihre schlotternden Körper hin und her, hin und her. "Ei, ihr gar armen Teufel!" rief Hänschen hinauf. "Euch friert ja, daß ihr schnappert und klappert. Wartet ich will euch herunter holen, sollt euch wärmen an meinem Feuer."
Und Hänschen, nicht faul, fand eine Galgenleiter, stieg hinauf, knüpfte die Gehenkten los und setzte sie an sein Feuer, das er nun stärker und größer machte. Jene aber schauten gottserbärmlich aus, grün, gelb und jämmerlich, blitzblau, abscheulich, wie das Sprichwort sagt, und regten und rührten sich nicht; das Feuer fraß um sich, und begann die Lumpen und Fetzen anzukohlen, welche um die toten Leichname herum hingen.
"Na?" sagte Hänschen, "laßt ihr ja eure Kleider verbrennen! Da heißt es recht bei euch: gleiche Lumpen, gleiche Lappen! Wartet - ich will euch helfen so unachtsam sein!" Nahm sie, einen nach dem anderen und hing sie wieder hinauf, hüllte sich in seinen Mantel, streckte sich an sein Feuer und schlief ein.
So fand ihn der Mann, mit dem er gestern gegangen, und der heute kam, das Geld zu holen. Da er aber Hänschen so ruhig schlafen sah, wuchs ihm wenig Hoffnung, daß es das Gruseln über Nacht gelernt haben möchte, und als Hänschen nun aufwachte, und ihm erzählte, was er vorgenommen habe, da wandte sich der Mann zum Gehen und sprach: "Dein Geld hab ich das Mal nicht verdient, du lernst das Gruseln nimmermehr."
Wie Hänschen nun auch weiter und seines Weges ging, sprach er vor sich hin: " Es ist doch alleweil schade, daß ich das Gruseln nicht erlernen kann, muß wohl zu dumm dazu sein. Ei, ei - wenn ich doch nur das Gruseln könnte."
Das hörte ein Fuhrmann, der des selben Weges daher schritt, der sprach zu Hänschen: "Ei, kannst du das Gruseln nicht? Da kehre nur dort in dem Wirtshaus am Weg ein, wenn du nämlich Geld hast, der Wirt macht hautschaudrige Zechen, mich hat es noch jedesmal überlaufen, wenn ich hab in dessen Haus einkehren müssen." "Das wollen wir sehen!" sprach Hänschen, dankte dem Fuhrmann und schritt auf das selbige Wirtshaus zu.
"Was schaffens?" fragte der Wirt. "Möchte das Gruseln lernen", antwortete Hänschen. "Die Leute auf der Landstraße sagen, bei Euch wäre es leicht zu lernen. Ihr machtet so gruslige Rechnungen und führt eine so gruslige Kreide!" "Warte Lecker!" dachte der Wirt, "dir will ich wohl was lehren, daß dich das Gruseln ankommt!", und zu Hänschen sprach er:
"Mein lieber Wandergeselle, Ihr seid mit Unwahrheit berichtet worden; in meinem Hause kann man das Gruseln keineswegs lernen, und ich bediene meine Gäste nicht so, wie Euch irgendein Schalksnarr erzählt und vorgelogen hat. Ist es Euch um Gruseln zu tun, so geht dort hinauf auf das alte verwünschte Schloß da droben und seht zu, daß Ihr die Königstochter zur Frau bekommt, die ihr Vater dem versprochen hat, der das Schloß von seinen Poltergeistern befreit; da gibt es was zu gruseln und reich zu werden."
"Ich will so tun, wie Ihr mir ratet", sagte Hänschen, und der Wirt sprach wieder: "Damit, daß Ihr hinauf geht, ist es noch nicht getan. Erst müßt Ihr beim König um Erlaubnis bitten, und müßt drei Nächte lang droben bleiben. Kommt Ihr mit dem Leben davon, so ist die Prinzessin Eure Frau."
"Und wenn ich nicht mit dem Leben davon komme, was dann?" fragte Hänschen - und der Wirt lachte ihm ins Gesicht, und sprach: "Ich merke schon, Ihr seid ein Schlaukopf, Ihr hättet sicher das Pulver erfunden, wenn es noch nicht erfunden wär!"
Und Hänschen ging eilend zu dem König, bat um die Erlaubnis und erhielt sie, auch sprach der König: "Mein Sohn, du darfst dir auch dreierlei mitnehmen, aber nur nichts Lebendiges." Nun hatte Hänschen schon in seiner Jugend immer gar zu gern Feuer angemacht, an der Schnitzelbank gesessen und auch bisweilen an der Drehbank, und verstand mit solchen Dingen umzugehen.
Darum begehrte er weiter nichts mit auf das Schloß zu nehmen, als ein gutes Feuerzeug, eine Schnitzelbank und eine Drehbank, "damit mich nicht friert", sagte er: "und ich mir die Zeit vertreiben kann." Das ward dem Hänschen gern gegeben, und er schlug seinen Sitz in einem hübschen Zimmer mit großem Kamin im alten Schloß auf.
Als es Nacht wurde, machte Hänschen ein helles Feuer an, das wärmte und leuchtete sehr schön. Auf einmal kamen zwei kohlschwarze Katzen, die hatten Augen wie von grünem Feuer, und schrien: "Miau, miau, uns friert!" "Ei wenn euch friert, so wärmt euch doch; hier ist ein Feuer!" sprach Hänschen.
Das taten die Katzen auch, dann sagten sie, "die Zeit wird uns zu lang, wir wollen zu dritt Karten spielen, Dreiblatt oder Pochens." "Meinetwegen Pochens", sagte Hänschen, "wenn ihr Karten mitgebracht habt." Die Katzen hatten wirklich ein Kartenspiel, und zeigten es Hänschen und da sah Hänschen, daß sie fürchterliche Krallen an ihren schwarzen Pfoten hatten, und sagte:
"Mit Verlaub, eure Frau Mutter hat euch die Nägel recht lange nicht geschnitten, schämt euch was, kommt, ich will sie euch putzen!" und packte die Katzen und klemmte ihnen die Pfoten in die Drehbank. Da bissen sie nach ihm und so nahm er sein Schnitzmesser und schnitzte ihnen die Köpfe ab, und warf Katzenköpfe und Leiber aus dem Fenster in den Schloßgraben.
Als er wieder zum Feuer kam, saß ein großer Hund dort und bleckte ihm die Zähne und hatte eine feurige Zunge armslang zum Halse heraushängen. Dies gefiel Hänschen wieder nicht, er nahm abermals sein Schnitzmesser und hieb damit dem Hund gerade zwischen die Zähne in den Rachen, da fiel die Zunge herunter und der obere Kopf nahm Abschied von seinem Unterteil.
Nun meinte Hänschen Ruhe zu haben und wollte sie auch genießen; in der Ecke stand ein Bett, da legte er sich hinein und deckte sich zu. Er war aber noch nicht eingeschlafen, da fing das Bett an zu fahren wie ein Dampfwagen, und fuhr im ganzen Schloß herum, Trepp auf, Trepp ab, durch Säle und Zimmer - aber Hänschen sagte:
"Schau, nun spür ich doch, wie es tut, wenn die großen Herren fahren. Fahre du nur immer zu." Endlich mochte das Bett des Fahrens müde sein, es rollte wieder in Hänschens Zimmer, wo das Feuer noch lustig brannte, da stand es still, und Hänschen schlief ein und schlief wie ein Toter.
Am anderen Morgen stand der König an seinem Bett, und sagte: "Na das heiß ich einen gesunden Schlaf, wenn ich den hätte! So gut schläft kein König. Freut mich daß der Junge noch lebt und schnarcht. Heda! Hänschen!" "Schön guten Morgen Herr König! Schon so frühe?" fragte Hänschen. "Wünsche wohl geruht zu haben!" sprach der König. "Danke, gleichfalls!" sprach Hänschen.
"Kannst auf meine Rechnung drunten beim Wirt frühstücken und zu Mittag essen, aber abends bist du wieder hier oben, magst du?" sprach und fragte der König. "Ei freilich wohl", sagte Hänschen; "drei Nächte müssen es sein."
Wie Hänschen zum Wirt kam, wunderte der sich sehr und fragte: "Nun? noch lebendig? Aber das Gruseln wird man doch gelernt haben in heutiger Nacht?" "Nicht rühr an!" erwiderte Hänschen. Da fing es dem Wirt selber an, vor Hänschen über und über zu gruseln. Hänschen ließ es sich wohl sein auf des Königs Rechnung und sorgte sich nicht um diese, und als es Abend wurde, war er schon wieder oben im Spukschloß, und machte sich sein Feuer an.
Auf einmal prasselte es droben im Schornstein, als breche alles in tausend Trümmer und da kam ein Kerl herunter gefahren, der war aber nur halb. "Na", sagte Hänschen, "was soll denn das sein? Da fehlt ja noch eine Halbschied, anderthalb Mann sind doch noch keine Gesellschaft." Kaum hatte Hänschen das gesagt, bautz! kam die andre Hälfte nach gefallen, mitten in das Feuer.
Hänschen nahm die beiden Hälften, warf sie aus dem Kamin in die Stube, und brachte sein Feuer wieder in Ordnung. Wie er damit zu Stande war und umschaute, war aus den beiden Hälften ein einziger Kerl geworden, aber kein schöner, der saß auf Hänschens Stuhl.
"Platz da!" schrie Hänschen, "hier sitze ich, marsch, oder ich halbiere dich mit dem Schnitzelmesser!"
Auf einmal polterte es wieder im Schornstein, Totenbeine und Schädel prasselten herab, und noch einige Männer vom greulichsten Aussehen. "Guten Abend, meine Herren!" sagte Hänschen; "Sie sind doch ganze Männer, das laß ich mir gefallen. Gehören vielleicht in die Familie Schön? Ach, wie schade, daß kein Spiegel im Zimmer hängt. Womit könnt ich Ihnen denn eigentlich dienen?"
Die Männer sahen Hänschen mit furchtbaren Blicken an, einer nahm die Totenbeine, es waren gerade neun, und stellte sie als Kegel auf, die anderen nahmen die Schädel und rollten sie nach den Kegeln. "Kegelschieben tue ich für mein Leben gern!" sagte Hänschen: "erlauben Sie nicht, daß ich auch mit spiele? Spielen Sie Brettspiel oder Partens? Ums Partiegeld, wie?"
"Hast du Geld?" fragten die Männer grimmig. "Oui!" sagte Hänschen, und fuhr in die Tasche und klimperte. "Nun so schieb an!" schrie einer der Männer, und reichte ihm einen Totenschädel dar. "Mit Verlaub, das ist eine eckige Kugel. Gebt her, da hab ich eine Drehbank stehen, wollen sie hübsch rund drehen, damit wir gut alle neun treffen."
Sprach und setzte sich, und drehte die Schädel rund. Dann ging das Spiel an, Hänschen schob gut, aber die Männer schoben noch besser, Hänschen verlor etwas, und das Spiel fing wieder an, Hänschen schob und rief freudig: "Alle neun!" - "Nein, zwölf!" riefen die Männer mit dumpfen Ton, und verschwanden mit Knochen und Schädeln, und die alte Uhr auf dem Schloßturm schlug zwölf.
"Nun so was!" rief Hänschen. "Ist das auch eine Manier? Erst locken sie mir mein bißchen Geld ab, und nun ich gut schiebe, machen sie sich aus dem Staube." Darauf legte er sich wieder in das Bett, das heute ganz ruhig blieb, und schlief bis an den hellen Morgen.
"Heute wird er wohl nicht mehr am Leben sein", sprach der König, als er auf Hänschens Zimmer zuging, ich höre ihn nicht wie gestern schnarchen, wird wohl aus sein mit ihm." Aber Hänschen ermunterte sich sehr schnell, und sprach: "Wünsche wohl geruht zu haben, Majestät!" - "Gleichfalls, danke schön!" antwortete der König. "Wie ging es diese Nacht?" "Recht hübsch, danke der gütigen Nachfrage, Herr König!" antwortete Hänschen.
"Es war eine Sorte Schlotfeger da, sie kamen zum Schornstein herunter gefahren und wir haben mit Totenbeinen gekegelt." Dem König schauerte die Haut, und er sagte: "Aber das ist ja ganz gruselig!" - "Was denn, Herr König?" fragte Hänschen. "Das - eben!" erwiderte der König. "Nun Glück zu, zur dritten Nacht!"
" Es ist doch recht fatal, daß ich nimmermehr das Gruseln lerne!" sprach Hänschen zu sich selbst, als die dritte Nacht herbei kam.
Auf einmal entstand ein großer Rumor, sechs Männer traten in das Zimmer, die trugen eine Totenlade auf der Bahre, stellten sie vor Hänschen hin und verschwanden. Hänschen dachte: "Wer mag da drinnen liegen?" und öffnete den Sarg. Da lag einer drin, der war steif und eiskalt.
"Ach den friert es, er ist ganz steif vor Frost", sagte Hänschen, "den muß ich wärmen!" hob den Toten aus dem Sarge, und trug ihn an sein Feuer, aber er blieb kalt. "Der muß ins Bett, da wird er schon erwärmen", und nahm ihn und legte ihn ins Bett, und sich dazu. Nach einer Weile wurde der Tote warm und wachte auf, und machte sich breit und sagte:
"Wer hat dir geheißen mich in meiner Ruhe zu stören? Jetzt sollst du sterben!" "Ist das eilig?" fragte Hänschen, packte jenen rasch an, warf ihn in die Totenlade, den Deckel darauf, und schraubte den selben schnell zu. Da kamen gleich die sechs Männer wieder, die hoben den Sargkasten auf und trugen ihn fort.
Bald darauf trat ein greulicher Riese herein, mit großem langem Bart, der schrie: "Wurm, jetzt mußt du sterben! Du mußt mit mir!" "Ich gehe nicht mit dir!" sagte Hänschen. "Es pressiert mir nicht; ich habe noch zu tun, wie du siehst!" und setzte sich an die Drehbank, und trat das Rad, und drehte die Spindel, und hielt den Meißel an das Werkholz.
Der Riese bog sich über das Rad her, und wollte Hänschen fassen. Mit einem Male schrie er aber laut: "Au! au! mein Bart, mein Bart!" Es war das Ende des Bartes zwischen die Darmsaite, die das Rad umschwingen half, gekommen, und hatte sich durch das schnelle Drehen fest gewickelt, und zog nun den ganzen Kopf nach sich, und Hänschen trat frisch darauf los, und sagte; "Kerl, hab Acht, jetzt drehe ich dir deine große Nase ab, und drehe dir die Augen aus, und drehe aus deinem dicken Kopf eine Kegelkugel, so wahr ich Hänschen heiße!"
Da gab der Riese die besten Worte, Hänschen solle ihn gehen lassen, er wolle ihm auch die drei Kisten voll Gold zeigen, eine sei dem König, die zweite sei den Armen bestimmt, die dritte wolle er ihm schenken. "Nun wohl", sagte Hänschen, "gib das Ding her, aber bis ich es habe, bleibst du in den Bock gespannt, und trägst die Drehbank auf den Schultern."
Das war ein sehr unbequemes Tragen, die Bank auf den Schultern, und den Bart ins Rad verflochten, das zog. Der Riese ging nun in ein andres Zimmer voran und zeigte Hänschen die Kisten voll Gold. In dem schlug es Zwölf, und da verschwand er, und die Drehbank stand ohne Träger. Hänschen war es, als ob die Kisten auch Miene machten zu verschwinden, da rief er: "Halt, halt!" und faßte sie und hielt sie fest, und zog sie hinüber in sein Zimmer, worauf er sich schlafen legte, wieder ohne Gruseln.
Am anderen Morgen kam der König, und fragte: "Nun, diese Nacht war dir es doch ganz gewiß recht gruselig?" "Wieso denn, Herr König?" fragte Hänschen. "Ich habe eine Kiste voll Gold geschenkt bekommen, auch eine für Euch, und eine für die Armen. Muß es einem gruselig werden, wenn man Gold geschenkt bekommt?"
"Du hast Großes vollbracht!" sprach der König. "Durch deine Furchtlosigkeit hast du das Schloß von den Poltergeistern befreit, und den verzauberten Schatz an das Licht gezwungen. Du sollst auch deinen Lohn haben, und meine Tochter heiraten!"
"Obligiert, Herr König!" sagte Hänschen, "es ist aber doch schade, daß ich heiraten soll, und bin noch so dumm, daß ich noch nicht das Gruseln gelernt habe." "O mein lieber Sohn und Schwiegersohn!" erwiderte der König. "Heirate du nur, da wird sich alles finden. Es hat schon mancher das auch nicht gekonnt, und hat geheiratet, und da ist er außerordentlich gruselig geworden, und hat die Gänsehaut nicht wieder los werden können."
"Selbige Hoffnung freut mich, Herr König!" rief Hänschen vergnügt aus.
Bald war herrliche Hochzeit, Hänschen war sehr glücklich, sehr reich, und hatte eine wunderschöne Frau, doch sagte er: "Weiß nicht, wie lange es noch dauern soll, bis ich das Gruseln lerne."
Nun warte Hänschen! Dich soll es doch noch gruseln, sprach zu sich selbst die junge Königin, Hänschens Gemahlin, ließ einen Eimer Wasser mit kleinen Gründlingen und Elritzen herbeischaffen, und da Hänschen schlief, nahm sie ihm die Bettdecke weg, und schüttete den Eimer voll Wasser und Fischlein über Hänschen her.
"Brrr!" fuhr er auf und schnapperte vor Kälte. "Mir träumte, ich wäre in den Fischteich gefallen - brrr! Es gruselt mich, es gruselt mich! Hab eine Gänsehaut, wie ein Reibeisen! Siehst du, liebe Frau? Endlich nun - nun kann ich das Gruseln, nun kann ich das Gruseln."
ZITTERINCHEN ...

Es war einmal ein armer Taglöhner, der hatte zwei Kinder, einen Sohn mit Namen Abraham und eine Tochter, die hieß Christinchen. Beide Kinder waren noch sehr jung, als der Vater starb und gute Menschen mußten sich ihrer annehmen, sonst wären sie umgekommen, so arm waren sie.
Das Mädchen wurde eine herrlich aufblühende Schönheit, die nicht ihres Gleichen hatte weit und breit. Abraham ward ein kräftiger Jüngling und kam durch Vermittlung eines Gönners als Bedienter zu einem reichen Grafen. Ehe er aber von seiner Schwester schied, ließ er sich von einem guten Freunde ihr Portrait malen, und nahm es mit sich, denn er hatte sie sehr lieb.
Der Graf war mit Abraham sehr wohl zufrieden, bemerkte jedoch öfters, daß er ein Portrait aus dem Busen zog und küßte; er verwunderte sich darüber, da Abraham still und sittsam war und kaum aus dem Hause kam; er fragte ihn deshalb, ob das Portrait seine Geliebte vorstelle und betrachtete sich es genauer, als Abraham sagte, es sei seine Schwester.
»Ist deine Schwester so schön«, sagte der Graf, »so wäre sie wohl wert, eines Edelmanns Weib zu sein!« - »Sie ist noch weit schöner!« entgegnete Abraham. Der Graf war entzückt und sandte heimlich seine Amme nach dem Orte, wo sich Christinchen befand, um sie nach seinem Schlosse zu holen.
Die Amme fuhr mit einem vierspännigen Wagen vor das Haus von Christinchens Pflegeeltern, grüßte sie von ihrem Bruder und sie solle mit ihr nach dem gräflichen Schloß fahren. Christinchen sehnte sich sehr, ihren Bruder wieder zu sehen und war bereit zu folgen; sie besaß aber ein Hündchen, das sie einst aus dem Wasser gerettet hatte, das hieß Zitterinchen und hegte große Anhänglichkeit an sie.
Das Hündchen sprang mit Christinchen in den Wagen. Die Amme hatte jedoch einen schlimmen Plan gefaßt. Als sie am steilen Ufer eines großen Flusses hinfuhren, machte sie Christinchen auf die Goldfische aufmerksam, die in den blauen Wellen spielten und da Christinchen unbefangen aus dem Kutschenschlag hinaus sah, stürzte sie sie in den Fluß, während der Wagen weiter fuhr.
Die Amme hatte eine Base, die schon eine alte Jungfer war; mit dieser hatte sie bereits verabredet, an einem gewissen Ort zu warten und als der Kutscher seine Pferde tränkte, stieg sie heimlich in den Wagen. Sie trug einen dichten Schleier und die Amme unterwies sie, dem Grafen zu sagen, sie habe ein Gelübde getan, ihren Schleier innerhalb eines halben Jahres nicht zu lüften.
Die verhüllte Dame ward vor den Grafen geführt, der sie inständig bat, den Schleier zurückzuschlagen, sie verweigerte es jedoch standhaft und der Graf ward um so begieriger. Er vertraute der Redlichkeit seines Abraham, der die Schwester ihm noch viel schöner geschildert hatte, als das Portrait war. Er erbot sich daher, sie zu seiner Gemahlin zu erheben.
Der Priester ward gerufen und die Trauung vollzogen. Nach dieser Feierlichkeit weigerte sich die Dame nicht länger, den Schleier zu lüften, doch wie erschrak der Graf, als er statt eines jugendlich frischen, ein abgeblühtes Gesicht sah! Er geriet in den höchsten Zorn und ließ Abraham in ein Gefängnis werfen, trotz seiner Beteuerungen, daß diese Dame seine Schwester nicht sei; das betrügerische Bildnis ließ er in den Rauchfang hängen.
Eines Tages hatte der Bediente, der in des Grafen Vorzimmer schlief, eine seltsame Erscheinung. Eine weiße Gestalt stand vor seinem Bette und rasselte mit Ketten; und sprach in leisem, wehklagenden Ton: »Zitterinchen, Zitterinchen!« Darauf kroch das Hündchen, das bisher im Schlosse geduldet worden war, unter dem Bette hervor, wo es geschlafen, und antwortete:
»Mein allerliebstes Christinchen!« - »Wo ist mein Bruder Abraham?« fragte die Gestalt weiter. »Er liegt gar hart gefangen in Ketten und Banden!« versetzte das Hündchen. »Wo ist mein Bild?« - »Es hängt im Rauch.« - »Wo ist die alte Kammerfrau?« - »Sie liegt in des Grafen Arm.« - »Daß es Gott erbarme! Nun komm ich zweimal noch und werde ich nicht erlöst, so bin ich verloren für dieses Leben.«
Die Gestalt zerfloß darauf wie ein Nebel. Der Bediente glaubte geträumt zu haben und sagte seinem Herrn nichts von der Erscheinung. Aber in der folgenden Nacht ward die selbe Szene vor seinem Bett aufgeführt, doch rasselte die Gestalt mit ihren Ketten mehr als das vorige Mal und sagte, sie werde nun noch einmal kommen.
Diesmal war der Bediente seiner Sache gewiß; er entdeckte den Vorgang seinem Herrn; dieser ward nachdenklich und entschloß sich die Erscheinung zu belauschen. Er stand um die zwölfte Stunde hinter der angelehnten Türe des Schlafzimmers und lauschte.
Endlich sah er die weiße Gestalt plötzlich in dem Dunkel des Vorzimmers auftauchen, hörte sie mit ihren Ketten rasseln und sprechen: »Zitterinchen, Zitterinchen!« und das Hündchen antwortete: »Mein allerliebstes Christinchen!« - »Wo ist mein Bruder Abraham?« - »Er ist gar hart gefangen, und liegt in Ketten und Banden.« - »Wo ist mein Bild?« - »Es hängt im Rauch.« - »Wo ist die alte Kammerfrau?« - »Sie liegt in des Grafen Armen.« - »Daß es Gott erbarme!«
Da öffnete der Graf rasch die Türe, griff nach der Erscheinung und hielt eine schwere Kette in der Hand, die in dem Augenblick sich von der Gestalt abstreifte. Die gespenstische Erscheinung war zu einem holden Frauenbild geworden, das ihn anlächelte und das wohl Ähnlichkeit mit jenem Bilde hatte, aber es an Schönheit noch weit übertraf.
Der Graf war entzückt und bat um Enträtselung des Geheimnisses. Nun erzählte Christinchen, wie die alte Amme sie arglistig ins Wasser gestürzt, die Nixen aber hatten sie mit ihren grünen Schleiern aufgefangen und sie in ihren unterirdischen Palast geführt. Sie habe eine der ihrigen werden sollen, habe sich jedoch geweigert und die Nixen hätten ihr endlich erlaubt, in drei Nächten in des Grafen Vorgemach zu erscheinen. Würden zu diesen dreien Malen ihre Ketten nicht gelöst, so sei sie unwiderruflich verbunden, eine Nixe zu werden.
Der Graf war über diesen Bericht ebenso erfreut, als erstaunt. Abraham wurde seiner Haft entlassen und in die Gunst des Grafen erhoben, in den selben Kerker aber ward die böse Amme geworfen und ihre Base aus dem Schlosse gepeitscht; Christinchens Bild wurde aus dem Rauchfang genommen und der Graf trug es auf seinem Herzen, Christinchen selbst aber ward seine Gemahlin geworden.
Zitterinchen leckte schmeichelnd die Hand der Herrin, als sie ihm aber liebkosend versprach, daß es nun gute Tage bei ihr haben sollte, verwandelte es sich in eine schöne Prinzessin, die dem verwunderten Christinchen ihr Schicksal erzählte. Sie war von einer bösen Zauberfrau verwünscht gewesen und war durch Christinchens Erlösung selbst erlöst worden.
MANN UND FRAU IM ESSIGKRUG ...
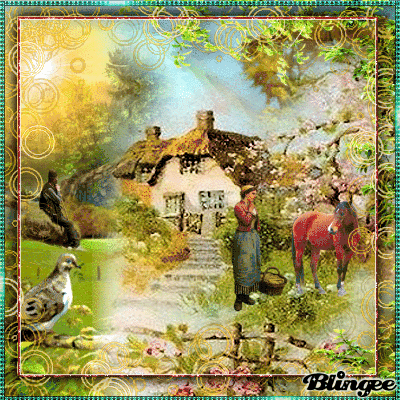
Es war einmal ein Mann und eine Frau, die haben lange lange miteinander in einem Essigkruge gewohnt. Am Ende sind sie es überdrüssig geworden, und der Mann hat zu der Frau gesagt: "Du bist schuld daran, daß wir in dem sauren Essigkrug leben müssen, wären wir nur nicht da!" Die Frau hat aber gesagt: "Nein, du bist schuld daran."
Und da haben sie angefangen, miteinander zu kippeln und zu zanken, und ist eins dem anderen in dem Essigkrug nachgelaufen. Da ist gerade ein goldiges Vögelein an den Essigkrug gekommen, dies hat gesagt: "Was habt ihr denn nur so miteinander?" "Ei", hat die Frau gesagt: "wir sind das Essigkrügel überdrüssig, und möchten auch einmal wohnen wie andere Leute, hernach wollen wir gern zufrieden sein."
Da hat sie das goldene Vögelein aus dem Essigkrug heraus gelassen, hat sie an ein neues Häuschen geführt, wo hinten ein zierliches Gärtchen gewesen ist, und hat zu ihnen gesagt: "Dies ist jetzt euer! Lebt jetzt einig und zufrieden untereinander, und wenn ihr mich braucht, so dürft ihr nur dreimal in die Hände klatschen und rufen:
'Goldvögelein im Sonnenstrahl!
Goldvögelein im Demantsaal!
Goldvögelein überall!'
so bin ich da."
Damit flog das Goldvögelein fort und der Mann und die Frau waren froh, daß sie nicht mehr in dem sauern Essigkrug wohnten, und freuten sich über ihr nettes Häuschen und grünes Gärtchen. Das dauerte aber nur eine Weile, denn wie sie nun ein paar Wochen in dem Häuschen gewohnt hatten, und in der Nachbarschaft herum gekommen waren, da hatten sie die großen stattlichen Bauernhöfe gesehen, mit großen Stallungen, Gärten, Äckern, vielem Gesinde und Vieh.
Und da hat es ihnen schon wieder nicht mehr gefallen in ihrem winzigen Häuslein, und sind es ganz überdrüssig geworden, und an einem schönen Morgen haben sie alle zwei fast zu gleicher Zeit in die Hände geklatscht und haben gerufen:
"Goldvögelein im Sonnenstrahl!
Goldvögelein im Demantsaal!
Goldvögelein überall!"
Witsch, da ist das goldige Vöglein zum Fenster herein geflogen gekommen, und hat sie gefragt, was sie denn schon wieder wollten?
"Ach", haben sie gesagt: "das Häuslein ist doch gar zu klein, wenn wir nur auch so einen großen prächtigen Bauernhof hätten, hernach wollten wir zufrieden sein." Das goldige Vöglein blinzte ein wenig mit seinen Guckäugelein, sagte aber nichts, und führte den Mann und die Frau an einen großen prächtigen Bauernhof, wo viele Äcker daran waren, und Stallungen mit Vieh, und Knechten und Mägden, und hat ihnen alles geschenkt.
Der Mann und die Frau sprangen Decken hoch, und konnten sich vor Freuden gar nicht lassen. Und jetzt sind sie ein ganzes Jahr lang zufrieden und fröhlich gewesen und haben sich gar nichts Besseres denken können. Aber länger hat es auch nicht gedauert, keinen Tag, denn weil sie jetzt manchmal in die Stadt gefahren sind, haben sie die schönen großen Häuser und die schön geputzten Herren und Madamen sehen spazieren gehen, da haben sie gedacht:
Ei, in der Stadt muß es aber herrlich sein, und da braucht man nicht viel zu tun und zu arbeiten; und die Frau hat sich gar nicht können satt sehen an dem Staat und dem Wohlleben und hat zu ihrem Mann gesagt: "Wir wollen auch in die Stadt, ruf du dem goldigen Vöglein! Wir sind nun schon lange genug auf dem Bauernhof." Der Mann hat aber gesagt: "Frau, ruf du ihm!" Endlich hat die Frau dreimal in die Hände geklatscht und hat gerufen:
"Goldvögelein im Sonnenstrahl!
Goldvögelein im Demantsaal!
Goldvögelein überall!"
Da ist das goldige Vöglein wieder zum Fenster herein geflogen, und hat gesagt: "Was wollt ihr nur von mir?" "Ach", hat die Frau gesagt: "wir sind das Bauernleben müde, wir möchten auch gern Stadtleute sein, und schöne Kleider haben, und in so einem großen prächtigen Haus wohnen, hernach wollen wir zufrieden sein."
Das goldene Vöglein hat wieder mit seinen Guckäugelein geblinzt, hat aber nichts gesagt, und hat sie in das schönste Haus in der Stadt geführt, da war alles raritätisch aufgeputzt, und waren Schränke darin und Kommoden, da hingen und lagen Kleider drinnen nach der neuesten Mode.
Jetzt haben der Mann und die Frau gemeint, es gibt auf der Welt nichts Besseres und Schöneres, und waren vor lauter Freude außer sich. Das hat aber leider wieder nicht lange gedauert, so hatten sie es wieder satt, und sprachen zueinander: "Wenn wir es nur so hätten wie die Edelleute! Die wohnen in herrlichen Palästen und Schlössern, und haben Kutschen und Pferde, und Bedienten mit goldbordierten Röcken stehen auf den Kutschen.
Ja das wär erst etwas Rechtes; so ist es doch nur eine armselige Lumperei." Und die Frau hat gesagt: "Jetzt ist es an dir, dem goldigen Vögelein zu rufen." Der Mann hat doch wieder lange nicht gewollt, endlich, wie die Frau gar nicht nachgelassen hat mit Dringen und Drängen, hat er dreimal in die Hände geklatscht und gerufen:
"Goldvögelein im Sonnenstrahl!
Goldvögelein im Demantsaal!
Goldvögelein überall!"
Das ist das goldene Vöglein wieder zum Fenster herein geflogen und hat gefragt: "Was wollt ihr nur von mir?" Da sagte der Mann: "Wir möchten gern Edelleute werden, hernach wollen wir zufrieden sein." Da hat aber das goldene Vöglein gar arg mit den Äuglein geblinzelt, und hat gesagt: "Ihr unzufriedenen Leute! Werdet ihr denn nicht einmal genug haben? Ich will euch auch zu Edelleuten machen, es ist euch aber nichts nutz!" und hat ihnen gleich ein schönes Schloß geschenkt, Kutschen und Pferde und eine zahlreiche Bedienung.
Jetzt sind sie nun Edelleute gewesen, und sind alle Tage spazieren gefahren, und haben an nichts mehr gedacht, als wie sie die Tage herum bringen wollten in Freuden und mit Nichtstun, außer daß sie die Zeitungen gelesen haben.
Einmal sind sie in die Hauptstadt gefahren, ein großes Fest zu sehen. Da sind der König und die Königin in ihrer ganz vergoldeten Kutsche gesessen, in goldgestickten Kleidern, und vorn und hinten und auf beiden Seiten sind Marschälle, Hofleute, Edelknaben und Soldaten geritten, und alle Leute haben die Hüte und Taschentücher geschwenkt, wo der König und die Königin vorbeigefahren sind.
Ach, wie hat da dem Manne und der Frau vor Ungeduld das Herz geklopft! Kaum waren sie wieder nach Hause, so sprachen sie: "Jetzt wollen wir noch König und Königin werden, hernach wollen wir aber einhalten." Und da haben sie wieder alle zwei miteinander in die Hände geklatscht, und haben gerufen, was sie nur rufen konnten:
"Goldvögelein im Sonnenstrahl!
Goldvögelein im Demantsaal!
Goldvögelein überall!"
Da ist das goldne Vöglein wieder zum Fenster herein geflogen, und hat gefragt: "Was wollt ihr nur von mir?" Da haben sie beide geantwortet: "Wir möchten gern König und Königin sein."
Da hat aber das Vöglein ganz schrecklich mit den Augen geblinzelt, hat alle Federchen gesträubt, hat mit den Flügeln geschlagen und hat gesagt: "Ihr wüsten Leute, wann werdet ihr denn einmal genug haben? Ich will euch auch noch zum König und zur Königin machen, aber dabei wird es doch nicht bleiben sollen, denn ihr habt nimmermehr genug!"
Jetzt sind sie nun König und Königin gewesen, und haben übers ganze Land zu gebieten gehabt, haben sich einen großen Hofstaat gehalten und ihre Minister und Hofleute haben müssen auf die Knie niederfallen, wenn sie eines von ihnen ansichtig wurden. Auch haben sie nach und nach alle Beamten im ganzen Lande vor sich kommen lassen, und ihnen vom Thron herab ihre strengsten Befehle erteilt. Und was es nur Teures und Prächtiges in aller Herren Ländern gab, das mußte herbei geschafft werden, daß ein Glanz und ein Reichtum sie umgab, der unbeschreiblich ist.
Und doch sind sie jetzt noch nicht zufrieden gewesen, und sagten immer: "Wir müssen noch etwas mehr werden!" Da sprach die Frau: "Werden wir Kaiser und Kaiserin." "Nein!" sagte der Mann. "Wir wollen Papst werden!" "Hoho! Das ist alles nicht genug!" schrie die Frau in ihrem Eifer. "Wir wollen lieber Herrgott sein!"
Kaum aber hatte sie dies Wort ausgeredet, so ist ein mächtiger Sturmwind gekommen, und ein großer schwarzer Vogel mit funkelnden Augen, die wie Feuerräder rollten, ist zum Fenster herein geflogen, und hat gerufen, daß alles erzitterte: "Daß ihr versauern müßt im Essigkrug!"
Pautz, und da war alle Herrlichkeit zum Kuckuck, und da saßen sie alle beide, der Mann und die Frau, wieder in ihrem engen Essigkrug drin; da sitzen sie noch und können drin bleiben bis an den jüngsten Tag.
Das ist eine Lehre für solche, die nie genug bekommen können.
DES KLEINEN HIRTEN GLÜCKSTRAUM ...
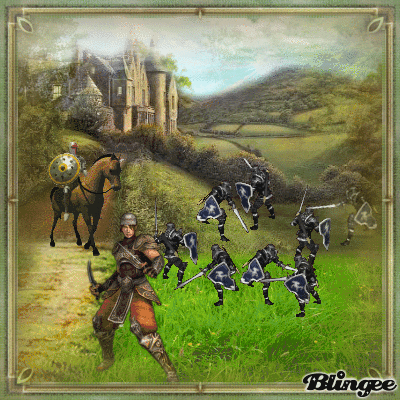
Es war einmal ein sehr armer Bauersmann, der war in einem Dörflein Hirte, und das schon seit vielen Jahren. Seine Familie war klein, er hatte ein Weib und nur ein einziges Kind, einen Knaben. Doch diesen hatte er sehr frühzeitig mit hinaus auf die Weide genommen und ihm die Pflichten eines treuen Hirten eingeprägt, und so konnte er, als nur einigermaßen der Knabe herangewachsen war, sich ganz auf den selben verlassen, konnte ihm die Herde allein anvertrauen, und konnte unterdessen daheim noch einige Dreier mit Körbeflechten verdienen.
Der kleine Hirte trieb seine Herde munter hinaus auf die Triften und Raine; er pfiff oder sang manch helles Liedlein, und ließ dazwischen gar laut seine Hirtenpeitsche knallen; dabei wurde ihm keine Zeit lang. Des Mittags lagerte er sich gemächlich neben seine Herde, aß sein Brot und trank aus der Quelle dazu, und dann schlief er auch wohl ein Weilchen, bis es Zeit war weiter zu treiben.
Eines Tages hatte sich der kleine Hirte unter einen schattigen Baum zur Mittagsruhe gelagert, schlief ein und träumte einen gar wunderlichen Traum: Er reise fort, gar unendlich weit fort - ein lautes Klingen, wie wenn unaufhörlich eine Masse Münzen zu Boden fielen - ein Donnern, wie wenn unaufhörliche Schüsse knallten - eine endlose Schar Soldaten, mit Waffen und in blitzenden Rüstungen - das alles umkreiste, umschwirrte, umtoste ihn.
Dabei wanderte er immerzu und stieg immer bergan, bis er endlich oben auf der Höhe war, wo ein Thron aufgebaut war, darauf er sich setzte, und neben ihm war noch ein Platz, auf dem ein schönes Weib, welches plötzlich erschien, sich niederließ. Nun richtete sich im Traum der kleine Hirte empor, und sprach ganz ernst und feierlich: "Ich bin König von Spanien." Aber in demselben Augenblick wachte er auf.
Nachdenklich über seinen sonderbaren Traum trieb der Kleine seine Herde weiter, und des Abends erzählte er daheim seinen Eltern, die vor der Türe saßen und Weiden schnitzten, und wo er ihnen auch half - seinen wunderlichen Traum, und sprach zum Schluß: "Wahrlich, wenn ich noch einmal träume, so gehe ich fort nach Spanien, und will doch einmal sehen, ob ich nicht König werde!"
"Dummer Junge", murmelte der alte Vater: "dich macht man zum König, laß dich nicht auslachen!" Und seine Mutter kicherte weidlich, und klatschte in die Hände, und wiederholte ganz verwundert: "König von Spanien, König von Spanien!"
Am anderen Tag zu Mittag lag der kleine Hirte zeitig unter jenem Baum, und o Wunder! der selbe Traum umfing wieder seine Sinne. Kaum hielt es ihn bis zum Abend auf der Hut, er wäre gern nach Hause gelaufen, und wäre aufgebrochen zur Reise nach Spanien. Als er endlich heim trieb, verkündete er seinen abermaligen Traum, und sprach: "Wenn mich aber noch einmal so träumt, so gehe ich auf der Stelle fort, gleich auf der Stelle."
Am dritten Tage lagerte er sich denn wieder unter jenen Baum, und ganz der selbe Traum kam zum dritten Male wieder. Der Knabe richtete sich im Traum empor und sprach: "Ich bin König von Spanien", und darüber erwachte er wieder, raffte aber auch sogleich Hut und Peitsche und Brotsäcklein von dem Lager auf, trieb die Herde zusammen und geraden Wegs nach dem Dorfe zu.
Da fingen die Leute an mit ihm zu zanken, daß er so bald und so lange vor der Vesperzeit eintreibe, aber der Knabe war so begeistert, daß er nicht auf das Schelten der Nachbarn und der eignen Eltern hörte, sondern seine wenigen Kleidungsstücke, die er des Sonntags trug, in einen Bündel schnürte, den selben an ein Nußholzstöcklein hing, über die Achsel nahm und so mir nichts dir nichts fort wanderte.
Gar flüchtig war der Knabe auf den Beinen; er lief so rasch, als sollte er noch vor nachts in Spanien eintreffen. Doch erreichte er nur an diesem Tage einen Wald, nirgends war ein Dorf oder ein einzelnes Haus; und er beschloß, in diesem Wald in einem dichten Busch sein Nachtlager zu suchen.
Kaum hatte er aber zur Ruhe sich niedergelegt und war entschlummert, als ein Geräusch ihn wieder erweckte: es zog eine Schar Männer in lautem Gespräch an dem Busch vorüber, in welchen er sich gebettet. Leise machte der Knabe sich hervor und ging den Männern in einer kleinen Entfernung nach, und dachte, vielleicht findest du doch noch eine Herberge; wo diese Männer heute schlafen, kannst du gewiß auch schlafen.
Gar nicht lange waren sie weiter gewandert, als ein ziemlich ansehnliches Haus vor ihnen stand, aber so recht mitten im dunkeln Wald. Die Männer klopften an, es wurde aufgetan und neben den Männern schlüpfte auch der Hirtenknabe mit hinein in das Haus.
Drinnen öffnete sich wieder eine Türe, und alle traten in ein großes, sehr spärlich erhelltes Zimmer, wo auf dem Fußboden umher viele Strohbunde, Betten und Deckbetten lagen, die zum Nachtlager der Männer bereit gehalten schienen. Der kleine Hirtenbub verkroch sich schnell unter einem Strohhaufen, welcher nahe an der Türe aufgeschichtet war, und lauschte nun auf alles, was er nur aus seinem Versteck hören und wahrnehmen konnte.
Bald kam er dahinter, denn er war ohnehin klug und aufgeweckt, daß diese Männerschar eine Räuberbande sei, deren Hauptmann der Herr dieses Hauses war. Dieser bestieg, als die neu angelangten Mitglieder der Bande sich hingelagert hatten, einen etwas erhöhten Sitz und sprach mit tiefer Baßstimme:
"Meine braven Genossen, tut mir Bericht von eurem heutigen Tagewerk, wo ihr eingesprochen seid, und was ihr erbeutet habt!" Da richtete sich zuerst ein langer Mann mit kohlschwarzem Bart empor, und antwortete: "Mein lieber Hauptmann, ich habe heute früh einen reichen Edelmann seiner ledernen Hose beraubt, diese hat zwei Taschen, und so oft man sie unterst oberst kehrt und tüchtig schüttelt, so oft fällt ein Häuflein Dukaten heraus auf den Boden." "Das klingt sehr gut!" sprach der Hauptmann.
Ein anderer der Männer trat auf und berichtete: "Ich habe heute einem General seinen dreieckigen Hut gestohlen; dieser Hut hat die Eigenschaft, wenn man ihn auf dem Kopf dreht, daß unaufhörlich aus den drei Ecken Schüsse knallen." "Das läßt sich hören!" sprach der Hauptmann wieder.
Und ein dritter richtete sich auf und sprach: "Ich habe einen Ritter seines Schwertes beraubt; so man das selbe mit der Spitze in die Erde stößt, ersteht augenblicklich ein Regiment Soldaten." "Eine tapfere Tat!" belobte der Hauptmann.
Ein vierter Räuber erhob sich nun und begann: "Ich habe einem schlafenden Reisenden seine Stiefeln abgezogen, und wenn man diese anzieht, legt man mit jedem Schritt sieben Meilen zurück." - "Rasche Tat lobe ich!" sprach der Hauptmann zufrieden, "hängt eure Beute an die Wand, und dann esst und trinkt und schlaft wohl."
Somit verließ er das Schlafzimmer der Räuber; diese zechten noch weidlich und fielen dann in festen Schlaf. Als alles stille und ruhig war, und die Männer allesamt schliefen, machte sich der kleine Hirte hervor, zog die ledernen Hosen an, setzte den Hut auf, gürtete das Schwert um, fuhr in die Stiefeln und schlich dann leise aus dem Haus. Draußen aber zeigten die Stiefeln zur Freude des Kleinen schon ihre Wunderkraft, und es währte gar nicht lange, so schritt das Bürschchen zur großen Residenzstadt Spaniens hinein; sie heißt Madrid.
Hier fragte er den ersten Besten, der ihm aufstieß, nach dem größten Gasthof, aber er erhielt zur Antwort: "Kleiner Wicht, geh du hin, wo deinesgleichen einkehrt, und nicht wo reiche Herren speisen." Doch ein blankes Goldstück machte jenen gleich höflicher, so daß er nun gerne der Führer des kleinen Hirten wurde, und ihm den besten Gasthof zeigte.
Dort angelangt, mietete der Jüngling sogleich die schönsten Zimmer, und fragte freundlich seinen Wirt: "Nun, wie steht es in eurer Stadt? Was gibt es hier Neues?" Der Wirt zog ein langes Gesicht und antwortete: "Herrlein, Ihr seid hier zu Land wohl fremd? Wie es scheint, habt Ihr noch nicht gehört, daß unser König, Majestät, sich rüstet mit einem Heer von zwanzigtausend Mann? Seht wir haben Feinde; o es ist gar eine schlimme Zeit! Herrlein, wollt Ihr auch etwa unters Militär gehen?" - "Freilich, freilich", sprach der zarte Jüngling, und sein Gesicht glänzte vor Freude.
Als der Wirt sich entfernt hatte, zog er flugs seine ledernen Hosen aus, schüttelte sich ein Häuflein Goldstücke, und kaufte sich kostbare Kleider und Waffen und Schmuck, tat alles an und ließ beim König um eine Audienz bitten. Und wie er in das Schloß kam, und von zwei Kammerherren durch einen großen herrlichen Saal geführt wurde, begegnete ihnen eine wunderliebliche junge Dame, die sich anmutig vor dem schönen Jüngling, der in der Mitte der Herren ging und sie zierlich grüßte, verneigte, und die Herren flüsterten: "Das ist die Prinzessin Tochter des Königs."
Der junge Mann war nicht wenig von der Schönheit der Königstochter entzückt, und seine Entzückung und Begeisterung ließen ihn keck und mutvoll vor dem König reden. Er sprach: "Königliche Majestät! Ich biete hiermit untertänigst meine Dienste als Krieger an. Mein Heer, das ich Euch zuführe, soll Euch den Sieg erfechten, mein Heer soll alles erobern, was mein König zu erobern befiehlt. Aber eine Belohnung bitte ich mir aus, daß ich, wofern ich den Sieg davon trage, Eure holde Tochter als Gemahlin heimführen dürfe. Wollt Ihr das, mein gnädigster König?"
Und der König erstaunte ob der kühnen Rede des Jünglings und sprach: "Wohl, ich gehe in deine Forderung ein; kehrst du heim als Sieger, so will ich dich als meinen Nachfolger einsetzen und dir meine Tochter zur Gemahlin geben."
Jetzt begab sich der ehemalige Hirte ganz allein hinaus auf das freie Feld und begann sein Schwert drauf und drein in die Erde zu stoßen, und in wenigen Minuten standen viele tausende Kampf gerüsteter Streiter auf dem Platz, und der Jüngling saß als Feldherr kostbar bewaffnet und geschmückt auf einem herrlichen Roß, welches mit goldgewirkten Decken behangen war; der Zaum blitzte von Edelsteinen, und der junge Feldherr zog aus, und dem Feind entgegen, da gab es eine große blutige Schlacht; aus dem Hut des Feldherrn donnerten unaufhörlich tödliche Schüsse, und das Schwert des selben rief ein Regiment nach dem anderen aus der Erde hervor, so daß in wenigen Stunden der Feind geschlagen und zerstreut war, und die Siegesfahnen wehten.
Der Sieger aber folgte nach, und nahm dem Feinde auch noch den besten Teil seines Landes hinweg. Siegreich und glorreich kehrte er dann zurück nach Spanien, wo ihn das holdeste Glück noch erwartete. Die schöne Königstochter war nicht minder entzückt von dem schmucken Jüngling gewesen, wie sie ihm im Saale begegnet war, als er von ihr; und der gnädigste König wußte die sehr großen Verdienste des tapferen Jünglings auch gebührend zu schätzen, hielt sein Wort, gab ihm seine Tochter zur Gemahlin und machte ihn zu seinem Nachfolger und Thronerben.
Die Hochzeit wurde prunkvoll und glänzend vollzogen, und der ehemalige Hirte saß ganz im Glück. Bald nach der Hochzeit legte der alte König Krone und Zepter in die Hände seines Schwiegersohns, der saß stolz auf dem Thron und neben ihm seine holde Gemahlin, und es wurde ihm, als dem neuen König, von seinem Volke Huldigung gebracht.
Da gedachte er seines so schön erfüllten Traumes, und gedachte seiner armen Eltern, und sprach, als er wieder allein bei seiner Gemahlin war: "Meine Liebe, sieh, ich habe noch Eltern, aber sie sind sehr arm, mein Vater ist Dorfhirte, weit von hier, und ich selbst habe als Knabe das Vieh gehütet, bis mir durch einen wunderbaren Traum offenbart wurde, daß ich noch König von Spanien werde.
Und das Glück war mir hold, sieh, ich bin nun König, aber meine Eltern möchte ich auch gern noch glücklich sehen, daher ich mit deiner gütigen Zustimmung nach Hause reisen und die Eltern holen will." Die Königin war's gerne zufrieden, und ließ ihren Gemahl ziehen, der sehr schnell zog, weil er die Siebenmeilenstiefeln anhatte.
Unterwegs stellte der junge König die Wunderdinge, die er den Räubern abgenommen, ihren rechtmäßigen Eigentümern wieder zu, bis auf die Stiefeln, holte seine armen Eltern, die vor Freude ganz außer sich waren, und dem Eigentümer der Stiefeln gab er für die selben ein Herzogtum.
Dann lebte er glücklich und würdig als König von Spanien bis an sein Ende.
DER WEISSE WOLF ...
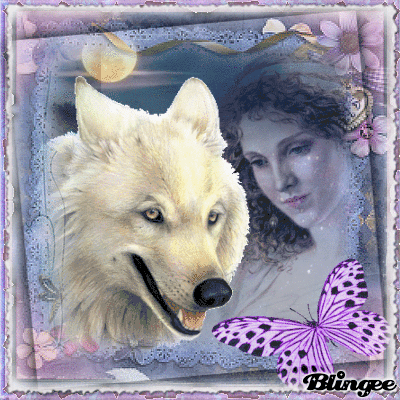
Ein König ritt jagen in einem großen Walde, darinnen er sich verirrte, und er mußte manchen Tag wandern und manche Nacht, fand immer nicht den rechten Weg und mußte Hunger und Durst leiden. Endlich begegnete ihm ein kleines schwarzes Männlein, das fragte der König nach dem rechten Weg. "Ich will dich wohl führen und geleiten", sagte das Männlein, "aber du mußt mir auch etwas dafür geben, du mußt mir das geben, was dir aus deinem Hause zuerst entgegen kommt."
Der König war froh und sprach unterwegs: "Du bist recht brav, Männchen, wahrlich, und wenn mein bester Hund mir entgegenlief, so wollt ich dir ihn doch gern zum Lohne geben". Das Männlein aber erwiderte: "Deinen besten Hund, den mag ich nicht, mir ist was anderes lieb."
Wie sie nun beim Schlosse ankamen, so sah des Königs jüngste Tochter durchs Fenster ihren Vater geritten kommen und sprang ihm fröhlich entgegen. Da sie ihn aber in ihre Arme schloß, sprach er: "Ei, wollt ich doch, daß lieber mein bester Hund mir entgegen gekommen wäre!"
Über diese Rede erschrak die Königstochter gar sehr und weinte und rief: "Wie das, mein Vater? Ist dir dein Hund lieber denn ich, und sollte er dich froher willkommen heißen?" Aber der König tröstete sie und sagte: "O liebe Tochter, so war es ja nicht gemeint!" und erzählte ihr alles. Sie aber blieb ganz standhaft und sagte: "Es ist besser so, als daß mein lieber Vater umgekommen wäre im wilden Walde."
Und das Männchen sagte: "Nach acht Tagen hole ich dich". Und nach acht Tagen richtig, da kam ein weißer Wolf in das Königsschloß, und die Königstochter mußte sich auf seinen Rücken setzen, und heisa, da ging es durch dick und dünn, bergauf und ab, und die Königstochter konnte das Reiten auf dem Wolf nicht aushalten und fragte: "Ist es noch weit?"
"Schweig! Weit, weit ist es noch zum gläsernen Berge - schweigst du nicht, so werfe ich dich herunter!" Nun ging es wieder so fort, bis die arme Königstochter wieder zagte und klagte und fragte, ob es noch weit sei. Und da sagte ihr der Wolf die nämlichen drohenden Worte und rannte immer fort, immer weiter, bis sie zum dritten Male die Frage wagte, da warf er sie auf der Stelle von seinem Rücken herunter und rannte davon.
Nun war die arme Prinzessin ganz allein in dem finsteren Walde und ging und dachte, endlich werde ich doch einmal zu Leuten kommen. Und endlich kam sie an eine Hütte, da brannte ein Feuerchen, und da saß ein altes Waldmütterchen, das hatte ein Töpfchen am Feuer. Und da fragte die Königstochter: "Mütterchen, hast du den weißen Wolf nicht gesehen?"
"Nein, da mußt du den Wind fragen, der fragt überall herum, aber bleibe erst noch ein wenig hier und iß mit mir. Ich koche hier ein Hühnersüppchen." Das tat die Prinzessin, und als sie gegessen hatten, sagte die Alte: "Nimm die Hühnerknöchelchen mit dir, du wirst sie gut gebrauchen können." Dann zeigte ihr die Alte den Weg nach dem Winde.
Als die Königstochter bei dem Winde ankam, fand sie ihn auch am Feuer sitzen und sich eine Hühnersuppe kochen, aber auf ihre Frage nach dem weißen Wolf antwortete er ihr: "Liebes Kind, ich habe ihn nicht gesehen, ich bin heute einmal nicht gegangen und wollte mich einmal hübsch ausruhen. Frage die Sonne, die geht alle Tage auf und unter, aber erst mache es wie ich, ruhe dich aus und iß mit mir, kannst hernach auch alle die Hühnerknöchlein mit dir nehmen, wirst sie wohl gut brauchen können."
Als dies geschehen war, ging die Kleine nach der Sonne zu, und es ging da gerade wieder wie beim Winde, die Sonne kochte sich gerade eine Hühnersuppe an sich selbst, daher es damit sehr geschwind ging, hatte auch den weißen Wolf nicht gesehen und lud die Prinzessin zum Mitessen ein. "Du mußt den Mond fragen, denn wahrscheinlich läuft der weiße Wolf nur des Nachts, und da sieht der Mond alles."
Als nun die Königstochter mit der Sonne gegessen und die Knöchlein aufgesammelt hatte, ging sie weiter und fragte den Mond. Auch er kochte Hühnersuppe und sagte: "Es ist fatal, ich habe letzte Nacht nicht geschienen oder bin zu spät aufgegangen, ich weiß gar nichts von dem weißen Wolf."
Da weinte das Mädchen und rief;: "O Himmel wen soll ich nun fragen?"
"Nun, nur Geduld, mein Kind", sagte der Mond. "Vor Essen wird kein Tanz, setze dich und iß erst die Hühnersuppe mit mir und nimm auch die Knöchelchen mit, du wirst sie wohl brauchen. Etwas Neues weiß ich doch; im gläsernen Berge das schwarze Männchen - das hält heute Hochzeit, der Mann im Mond ist auch dazu eingeladen."
"Ach, der gläserne Berg, der gläserne Berg! Dahin wollte ich ja eben, dahin hat mich ja der weiße Wolf tragen sollen!" rief die Königstochter.
"Nun, bis dorthin kann ich dir schon leuchten und den Weg zeigen", sagte der Mond, "sonst könntest du dich leichtlich verirren, denn ich zum Beispiel bestehe ganz und gar aus lauter gläsernen Bergen. Nimm immer deine Knöchlein hübsch alle mit." Das tat die Prinzessin, aber in der Eile vergaß sie doch ein Knöchlein.
Bald stand sie an dem gläsernen Berge, aber er war ganz glatt und glitschig, da war nicht hinauf zu kommen, aber da nahm die Königstochter alle Hühnerknöchlein von der alten Waldmutter, von den Wind, von der Sonne und von dem Monde und machte sich daraus eine Leiter, die wurde sehr lang, aber o weh, zuletzt fehlte noch eine einzige Sprosse, noch ein Glied.
Da schnitt sich die Prinzessin das oberste Gelenk von ihrem kleinen Finger ab, und so tat es gut, und sie konnte nun rasch zum Gipfel des gläsernen Berges klimmen. Oben war eine große Öffnung, da führte eine schöne Treppe hinunter, und es war alles voll Glanz und Pracht, und da waren ein Saal voll Hochzeitsgästen und viele Musikanten und reich besetzte Tafeln.
Und da saß das schwarze Männlein, und an seiner Seite saß eine Dame, die war seine Braut, das schwarze Männlein aber schien traurig. Und der Königstochter tat es auch so weh, so weh, daß sie nun zu spät kam und daß das schwarze Männlein so traurig war, und sie dachte bei sich, ich will ein Lied vom weißen Wolf singen, vielleicht kennt er mich dann - denn er hatte sie noch gar nicht angesehen, folglich auch nicht wiedererkannt.
Und da stand eine Harfe an der Wand, welche die Prinzessin gut spielte, die nahm sie nun und sang:
"Deinen besten Hund, den mag ich nicht,
Mir ist was andres lieb!
Die jüngste Königstochter.
Der weiße Wolf, der lief davon,
Sie weiß nicht, wo er blieb;
Die jüngste Königstochter."
Da horchte das schwarze Männlein hoch auf, aber die Prinzessin fuhr fort zu spielen und zu singen.
"Sie ist dem Wolfe nachgereist,
schnitt ab ihr Fingerglied,
Die jüngste Königstochter.
Nun ist sie da - du kennst sie nicht,
Traurig singt dir dies Lied
Die jüngste Königstochter."
Da sprang das schwarze Männlein von seinem Sitze auf und war plötzlich ein ganz schöner junger Prinz und eilte auf sie zu und schloß sie in seine Arme.
Alles war Zauber gewesen. Der Prinz war in das alte Männlein und in den weißen Wolf und in den gläsernen Berg hinein verzaubert so lange, bis eine Prinzessin, um zu ihm zu gelangen, sich ein Glied von ihrem kleinen Finger kosten lassen würde, wenn das aber bis zu einer gewissen Zeit nicht geschähe, so müsse er eine andre freien und ein schwarzes Männlein bleiben all sein Leben lang.
Nun war der Zauber gelöst, die andre Braut verschwand, der entzauberte Prinz heiratete die Königstochter, reiste darauf mit ihr zu ihrem Vater, der sich herzlich freute, sie wiederzusehen, und lebten alle glücklich miteinander bis an ihr Ende.
Sollte dieses aber nicht erfolgt sein, so ist es einigermaßen wahrscheinlich, daß sie noch heute leben.
DIE LEBENSGESCHICHTE DER MAUS SAMBAR ...
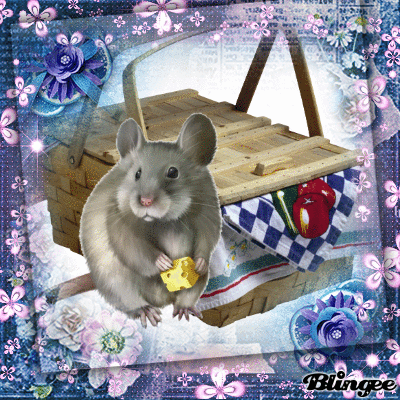
Ich bin geboren in dem Hause eines frommen Einsiedlers; es waren unserer viele Geschwister, und außer meinen lieben verstorbenen Eltern lebten auch deren Geschwister, Vettern und Muhmen und deren Kinder allzumal in diesem Haus.
Es fehlte uns niemals an Nahrungsmitteln aller Art, denn die guttätigen Leute in der Nachbarschaft trugen dem Einsiedler alle Tage Brot, Mehl, Käse, Eier, Butter, Früchte und Gemüse zu, viel mehr als er brauchte, darum, dass er für sie beten solle. Ob er für sie gebetet, und ob das ihnen etwas geholfen hat, weiß ich nicht.
Nun gönnte der Einsiedler mir und meinen Verwandten doch nicht alles und hing deshalb einen Korb mitten in seine Küche, wo wir nicht dazu konnten. Da ich mich aber schon als junges Mäuslein durch Mut, gepaart mit List und Vorsicht, vorteilhaft auszeichnete, so sprang ich von der nahen Wand dennoch in den Korb, aß, soviel mir nur schmeckte und warf das übrige meinen Verwandten herunter, die an jenem Tag einen wahren Festtag feierten.
Als der Einsiedler hereinkam und sah, was geschehen war, traf er Anstalt, den Korb noch höher zu hängen. Da besuchte ihn ein Wallbruder, den bewirtete er nach seinem Vermögen, und als sie miteinander gegessen und getrunken hatten, tat der Einsiedel die Speisereste in den Korb und hing ihn an den neuen Ort und gedachte, Acht zu haben, ob das Mäuslein auch da hineinkommen möchte?
In des begann der Gast zu reden und zu erzählen von seinen Fahrten zu Land und zu Meer und seinen Abenteuern, die er erlebt und bestanden, aber er nahm wahr, dass der Gastfreund immer nur mit halbem Ohr auf ihn hörte und immer dem Korbe mit Leib und Blicken halb zugewendet blieb.
Da ward der Waller unwillig und sprach: "Ich erzähle dir die schönsten Abenteuer, und du achtest nicht darauf und scheinst keine Lust daran zu haben" - "Mitnichten", erwiderte der Einsiedler, "ich höre gar gern deine Reden, aber ich muss Acht haben, ob die Mäuse wieder in den Speisekorb kommen, denn dieses Ungeziefer frisst mir alles weg, dass kaum etwas für mich übrigbleibt, und besonders ist eine, die springt in den Korb für alle anderen."
Damit meinte er mich, die kleine Sambar. Darauf sagte der Wallbruder: "Bei deiner Rede machst du mich der Fabel eingedenk von einer Frau, die zu ihrer Freundin sprach: Diese Frau gibt nicht ohne Ursache den ausgeschwungenen Weizen für den unausgeschwungenen." - "Wieso? Wie war das?" fragte der Einsiedler, und der Waller sagte: "Lass dir erzählen.
Einstmals auf meiner Wanderschaft herbergte ich bei einem ehrenwerten Mann, den hörte ich des Nachts, da ich nebenan schlief, zu seiner Frau sprechen: 'Frau, morgen will ich etliche Freunde zu Gaste laden.' Dem antwortete das Weib: 'Du vermagst nicht alle Tage Gäste zu haben und Wirtschaft zu machen; damit vertust du, was wir haben, und zuletzt bleibt uns im Haus und Hof gar nichts mehr.'
Da sprach der Mann: 'Hausfrau, lass dir das nicht missfallen, was mein Wille ist, besonders in solchen Sachen! Ich sage dir, wer allewege karg ist, und nur immer einnehmen und zusammenscharren, aber niemals wieder ausgeben will, und dessen, was er hat, nicht recht froh wird, der nimmt ein Ende, wie der Wolf.'
'Wie war denn das Ende von dem Wolf?' fragte die Frau, und ihr Mann erzählte: 'Es war einmal, so sagt man, ein Jäger, der ging nach dem Walde mit seinem Schießzeug, Pfeil und Armbrust, da begegnete ihm ein Rehbock, den schoss er und lud sich den selben auf, ihn heim zu tragen.
Darauf aber begegnete ihm ein Bär, der eilte auf ihn zu, und der Jäger, sich seiner zu erwehren, spannte in Eile die Armbrust, legte den Pfeil darauf, aber er vermochte nicht anzulegen, weil ihn der Rehbock hinderte und legte geschwind die Armbrust nieder, zückte sein Weidmesser und begann den Kampf mit dem Bären, und er rannte ihm das Messer durch den Leib in dem Augenblick, wo der Bär ihn umfasste und ihn tot drückte.
Wie der Bär die schwere Wunde fühlte, brüllte er und riss sie aus Wut noch weiter auf, so dass er bald verblutete. Abends ging ein Wolf des Wegs, der fand nun einen toten Rehbock, einen toten Bären und einen toten Jäger. Darüber ward er herzlich froh und sprach in seinem Herzen:
Das alles, was ich hier finde, das soll alles mein bleiben, davon kann ich mich lange nähren. Meine Brüder sollen nichts davon bekommen. Vorrat ist Herr, sagt das Sprichwort. Heute will ich sparen und nichts davon anrühren, dass der Schatz lang dauert, obschon mich sehr hungert. Da liegt aber eine Armbrust, deren Sehne könnte ich abnagen. Und da machte sich der Wolf mit der gespannten Armbrust zu schaffen, die schnappte los, und der ausgelegte Strahl oder Bogenpfeil fuhr ihm mitten durchs Herz!' -
'Siehe, Frau', so fuhr der Mann fort, dem ich zuhörte, sprach der Wallbruder zu dem Einsiedler, von welchem das Mäuslein Sambar ihren Freunden, dem Raben und der Schildkröte erzählte: - 'Siehe, Frau, da hast du ein Beispiel, dass es nicht immer gut sei, zu sammeln, und das Gesammelte treue Freunde nicht mit genießen lassen zu wollen.'
Darauf sprach die Frau: 'Du magst recht haben.' Als nun der Morgen kam, stand sie auf, nahm ausgehülsten Weizen, wusch ihn, breitete den aus, dass er trockne und setzte ihr Kind dazu, ihn zu hüten, und dann ging sie weiter zur Besorgung ihrer übrigen Geschäfte.
Aber das Kind tat, wie Kinder tun, es spielte und hatte nicht acht auf den Weizen, und da kam die Sau, fraß davon und verunreinigte den übrigen Weizen, den sie nicht fraß. Als die Frau hernach kam, und das sah, ekelte ihr vor dem übrigen Weizen, nahm ihn und ging auf den Markt und bot ihn feil gegen ungehüllten zu gleichem Maß.
Da hörte ich eine Nachbarsfrau jener, die gesehen hatte, was vorgegangen war, spöttisch zu einer dritten sagen: 'Schau, wie gibt die Frau so wohlfeil gehüllten Weizen gegen den ungehüllten! Es hat alles seine Ursache.' -
So ist's auch mit der Maus, von der du sagst, sie springe in den Korb für die anderen Mäuse alle zusammen, und das muss wohl seine Ursache haben. Gib mir eine Haue, so will ich dem Mausloch nach graben und die Ursache wohl finden." -
"Diese Rede hörte ich", so erzählte Sambar weiter, "im Löchlein einer meiner Gespielinnen; in meiner Höhle aber lagen tausend Goldgulden verborgen, ohne dass ich, noch der Einsiedler wussten, wer sie hineingelegt, mit denen spielte ich täglich und hatte damit meine Kurzweil.
Der Waller grub und fand bald das Gold, nahm es und sprach: 'Siehe, die Kraft des Goldes hat der Maus solche Stärke verliehen, so keck in den hohen Korb zu springen. Sie wird es nun nicht mehr vermögen.'
Diese Worte vernahm ich mit Bekümmernis, und leider befand ich sie bald wahr. Als es Morgen wurde, kamen die anderen Mäuse alle zu mir, dass ich sie, wie gewohnt, wieder füttere und waren hungriger als je; ich aber vermochte nicht, wie ich sonst gekonnt und getan, in den Korb zu springen, denn die Kraft war von mir gewichen, und als bald sah ich mich von den Mäusen, meinen nächsten Freunden und Verwandten, ganz schnöd behandelt; ja sie besorgten sich, am Ende mir etwas geben und mich ernähren zu müssen, deshalb ging eine jede ihres Wegs, und keine sah mich mehr an, als ob ich sie auf das bitterste beleidigt hätte. "
"Da sprach ich zu mir traurig in meinem Gemüte diese Worte: Gute Freunde in der Not, gehen fünfundzwanzig auf ein Lot; soll es aber ein harter Stand sein, so gehen fünf auf ein Quintlein. Wer keine Habe hat, hat auch keine Brüder; wer keine Brüder hat, hat keine Verwandtschaft; wer keine Verwandtschaft hat, hat auch keine Freundschaft, und wer keine Freundschaft hat, der wird vergessen.
Armut ist ein harter Stand; Armut macht das Leben krank. Keine Wunde brennt so heftig als Armut. Vieles Lob wird dem Reichen, wenn aber der Reiche arm wird, dann wird ihm doppelter und dreifacher Tadel; war er mild und gastfrei, so ist er ein Verschwender gewesen; war er edel und freisinnig, so heißt er nun stolz und streitsüchtig; ist er still und verschlossen, so heißt er tiefsinnig; ist er gesprächig, so heißt er ein Schwätzer.
Tod ist minder hart als Armut. Dem armen Mann ist eher geholfen, wenn er seine Hand in den offenen Rachen einer giftigen Schlange steckt, als wenn er Hilfe begehrt von einem Geizhals. "
"Weiter sah ich nun, dass der Waller und der Einsiedler die gefundenen Goldgulden zu gleichen Hälften unter sich teilten und fröhlich voneinander schieden; und der Einsiedler legte sein Geld unter das Kopfkissen, darauf er schlief.
Ich aber gedachte, mir etwas davon anzueignen, um meine verlorene Kraft wieder zu ersetzen, aber der Einsiedler erwachte von meinem leisen Geräusch und gab mir einen Schlag, dass ich nicht wusste, wo mir der Kopf stand und wie ich in mein Loch kam.
Dennoch hatte ich keine Ruhe vor meiner Gier nach dem Gold und machte einen zweiten Versuch; da traf mich der Einsiedler abermals so hart, dass ich blutete und todwund in meine Höhle entrann. Da hatte ich genug und dachte nur mit Schrecken an Gold und Geld und sagte mir vier Sprüche vor in meinen Schmerzen und in meiner Traurigkeit:
Keine Vernunft ist besser als die, seine eigenen Sachen wohl betrachten und nicht nach fremden streben. Niemand ist edel ohne gute Sitten. Kein besserer Reichtum als Genügsamkeit. Weise ist der, welcher nicht nach dem strebt, was ihm unerreichbar ist.
So beschloss ich, in Armut und edlem Sinn zu beharren, verließ des Einsiedlers Haus und wanderte in die Einöde. Dort richtete ich mir ein wohnlich Wesen ein und lernte die friedsame Taube kennen, die ihre Hilfe bei mir suchte, dadurch auch du, Freund Rabe, dich zu mir gesellt hast, der mir von seiner Freundschaft zu dir, Schildkröte Korax, viel erzählte, so dass ich gern Verlangen trug, dich kennen zu lernen, denn es ist auf der Welt nichts Schöneres, als Gesellschaft treuer Freunde, und kein größeres Betrübnis gibt es, als einsam und freundlos sein. "
Damit endete das kluge Mäuslein Sambar seine Lebensgeschichte, und die Schildkröte nahm das Wort und sprach gar mild und freundlich: "Ich sage dir besten Dank für deine so lehrreiche Geschichte; viel hast du erfahren, und dein Schatz ist Weisheit geworden, die mehr ist als Gold.
Nun vergiss hier bei uns dein Leiden und deinen Verlust und denke, dass das edle Gemüt man ehrt, auch wenn am irdischen Besitz es Mangel hat. Der Löwe, ob er schlafe, ob er wache, bleibt gefürchtet, und seine Stärke geht mit ihm, wohin er geht. Der Weise aber wechselt gern den Aufenthalt, auf dass er kennen lerne fremde Landesart, und zur Begleiterin erwählt er Gold nicht, nein - Vernunft. "
Wie der Rabe diese Worte hörte, freute er sich herzinnig über die Einigung seiner Freundinnen und sprach zu ihnen freundliche Worte; in dem so kam ein Hirsch gelaufen, und als die treuen Tiere ihn hörten, so flohen sie, die Schildkröte in das Wasser, die Maus in ein Löchlein, der Rabe auf einen Baum.
Und wie der Hirsch an das Wasser kam, erhob sich der Rabe in die Luft, zu sehen, ob vielleicht ein Jäger den Hirsch verfolge, da er aber niemand sah, so rief er seinen Freundinnen, und da kamen sie wieder hervor. Die Schildkröte sah den Hirsch am Wasser stehen mit ausgestrecktem Hals, als scheute er sich zu trinken, und rief ihm zu:
"Edler Herr, wenn dich dürstet, so trinke; du hast hier niemand zu fürchten!" Da neigte der Hirsch sein Haupt und grüßte die Schildkröte und näherte sich ihr, und sie fragte, woher er käme?
Er antwortete: "Ich bin lange im wilden Walde gewesen, da habe ich gesehen, dass die Schlangen von einem Ende an das andere wandelten und habe Furcht gefasst, es möchten Jäger den Wald einkreisen und bin hierher gewichen."
Die Schildkröte sprach: "Hierher kam noch nie ein Jäger, darum fürchte dich nicht. Und willst du hier wohnen, so kannst du von unserer Gesellschaft sein; es ist hier rings gute Weide."
Das hörte der Hirsch gern und blieb auch da, und die Tiere erkoren einen Platz unter den Ästen eines schattenreichen Baumes, da kamen sie alle zusammen und erzählten einander von dem Laufe der Welt und auch schöne Märchen.
So kamen eines Tages die treu befreundeten Tiere auch zusammen, der Rabe, die Maus und die Schildkröte, aber der Hirsch blieb aus und fehlte. Da sorgten sie sich, ob ihm etwa von einem Jäger etwas begegnet wäre, und der Rabe wurde ausgesandt, nach ihm zu spähen und Botschaft zu bringen.
Da sah er ihn nach einer Weile im Walde, nicht allzu fern von ihrem Aufenthalt, in einem Netz gefangen liegen, kam wieder und sagte das seinen lieben Gesellen an. Sobald die Maus das vernahm, bat sie den Raben, sie zum Hirsch zu tragen, und dort sprach sie zu ihm:
"Bruder, wer hat dich so überwältigt? Man rühmt doch als der verständigsten Tiere eines dich!" Darauf seufzte der Hirsch und sprach: "O liebe Schwester! Verstand schirmt nicht gegen den Urteilsspruch, der uns von oben kommt. Des Läufers Schnelle und des Starken Kraft zerreißt das Netz nicht, das Verhängnis heißt. "
Wie diese zwei noch redeten, kam die Schildkröte daher, sie war gekrochen, so schnell sie konnte; da wandte der Hirsch sich zu ihr und sprach: "O liebe Schwester, warum kommst du zu uns her? Und welchen Nutzen bringt uns deine Gegenwart?
Die Maus allein vermag mich zu erledigen, und naht der Jäger, so entfliehe ich gar leicht, der Rabe fliegt von dannen, und die Maus entschlüpft. Dir aber, die Natur gemachsam schuf, nicht schnellen Schritts, auch fluchtgewandt nicht, dir droht schmähliche Gefangenschaft."
Darauf antwortete die Schildkröte: "Ein treuer Freund, der auch Vernunft hat, wird sich nicht wert des Lebens dünken, wenn er um seine Freunde kam. Und wenn ihm nicht vergönnt ist, dass er helfe, so mag er trösten doch nach seinen Kräften. Das Herz aus seinem Busen zieht ein treuer Freund und reicht es seinem treuen Freunde dar. "
Als dies die Schildkröte noch sprach, während die Maus bereits das Netz eifrig zernagt hatte, hörten die Tiere den Jäger nahen, da entrann schnell der Hirsch, der Rabe entflog, die Maus entschlüpfte. Der Jäger aber fand sein Netz zernagt, erschrak, sah sich um und fand sonst niemand als die Schildkröte.
Die nahm er, dass es Rabe und Maus mit Bedauern sahen, und band sie fest in einen Fetzen von dem Netz.
Die Maus rief dem Raben zu: "O wehe, weh! Wenn einem Glück kommt, wartet er auf das folgende, und kommt ein Unglück, überfällt auch gleich ein zweites ihn. Trug ich nicht Leids genug an meines Goldes Verlust, und nun bin ich der liebgewordenen Schwester bar, sie, die mein Herz vor allem lieb gewonnen hat. Weh mir, weh meinem Leib, der aus einem Trübsalsnetz ins andere rennt, und dem nichts andres beschert ist als nur Widerwärtigkeit. "
Da sprachen Rabe und Hirsch zur Maus: "O kluge Freundin, klage nicht so sehr, denn Klagen ist nicht, was der Freundin frommt, und deine und unsere Trauer macht sie nicht von Banden frei. Ersinne Listen, wie wir sie befreien! "
Da sann das kluge Mäuslein Sambar eine Weile, dann sprach's: "Ich hab's. Du, Hirsch, gewinne schnell die Straße des Jägers und falle nahe dabei hin, wie halb tot, und du, Rabe, steh auf ihm, als ob du von ihm essest. Wenn das der Jäger sieht, so wird er, was er trägt, aus den Händen legen, dann schleppst du, Freund Hirsch, dich gemachsam etwas tiefer in den Wald, damit er dich verfolgt, indes zernage ich das Netz und mache unsere liebe Schwester frei. "
Dieser Ratschlag ward auch schnell ausgeführt. Der Hirsch und der Rabe eilten nun geschwind auf einem Umweg dem Jäger voraus und taten, wie ihnen die Maus geraten.
Der Jäger war gierig, den Hirsch zu erreichen, und warf alles, was er trug, von sich; der Hirsch kroch ins Dickicht, der Rabe flog nach, und der Jäger lief nach, und die Maus zernagte das Netz der Schildkröte und ging mit ihr nach Hause, dort fanden sie schon den Raben und den Hirsch, die schnell dem Jäger aus den Augen gekommen waren.
Wie dieser nun zurückkehrte an den Ort, wo er seine Sachen hingeworfen hatte, die er noch dazu eine gute Länge suchen musste, so fand er das Netz zernagt, und konnte sich nicht genug wundern. "Das muss der böse Teufel getan haben, und kein guter Geist!" fluchte er, und dachte, dass böse Geister und Zauberer diese Gegend innehaben müssten, welche die Jäger in Tiergestalten äfften, ging furchtsam nach Hause und jagte nie mehr in diesem Wald.
Und da wohnten nun die befreundeten Tiere miteinander in Ruhe, Eintracht und Glückseligkeit, und von Zeit zu Zeit kam auch die Taube in diese schöne Einsamkeit und besuchte die kluge Maus Sambar, ihre liebe Freundin, und brachte Neuigkeiten aus der Welt und allerlei schöne Geschichten, daran alle ihre Freude hatten.
DER HAHN UND DER FUCHS ...
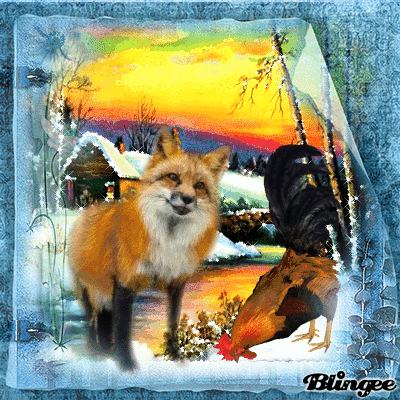
In einer kalten Winternacht kroch ein hungriger Fuchs aus seinem Bau und ging dem Fange nach. Da hörte er auf einem Meierhofe einen Hahn fort und fort krähen, der saß auf einem Kirschbaum und hatte schon die ganze Nacht gekräht.
Jetzt strich der Fuchs hin nach dem Baum und fragte: "Herr Hahn, was singst du in dieser kalten und finstern Nacht?" Der Hahn sprach: "Ich verkünde den Tag, dessen Kommen meine Natur mich erkennen lehrt." Darauf versetzte der Fuchs: "O Hahn, so hast du etwas Göttliches in dir, dass du zukünftig kommende Dinge weißt!"
Und alsbald begann der Fuchs zu tanzen. Jetzt fragte der Hahn: "Herr Fuchs, warum tanzt du?" Ihm antwortete der Fuchs: "So du singst, o weiser Meister, so ist billig, dass ich tanze, denn es ziemt, sich zu freuen mit den Fröhlichen.
O Hahn, du edler Fürst aller Vögel, du bist nicht allein begabt zu fliegen in den Lüften, nein, auch hohe Prophetengaben lieh dir die Natur! O wie bevorzugte sie dich vor allen anderen Tieren! Wie glücklich wäre ich, gönntest du mir deine Gunst! Wie gerne küsste ich dein Weisheit durchdrungenes verehrtes Haupt!
O wie beneidenswert, wenn ich dann künden könnte meinen Freunden: ich war der Glückliche, dem ein Prophet sein Haupt zum Kusse hingeneigt!" Der alberne Hahn glaubte dem Schmeichelwort des arglistigen Fuchses, flog vom Baum und hielt ihm seinen Kopf zum Küssen hin. Mit einem Schnapper war er abgebissen, und lachend sprach der Fuchs: "Ich habe den Propheten ohne alle Vernunft befunden."
Als das Mäuslein diese Fabel geendigt hatte, fuhr es fort, zum Raben zu sprechen: "Ich habe dir dies nicht gesagt, weil ich glaube, dass ich der Hahn sei und du der Fuchs, ich die Speise und du der Fresser, vielmehr will ich glauben, dass deine Worte nicht mit zwei gespaltener Schlangenzunge gesprochen sind."
Und darauf ging die Maus in die Öffnung ihres Türloches. Der Rabe fragte: "Warum stellst du dich unter die Türe? Was macht dich so zaghaft, zu mir herauszugeben? Hegst du immer noch Furcht vor mir?"
Darauf antwortete das Mäuslein: "Ich habe meinen Glauben und mein Vertrauen auf dich gesetzt, denn du gefällst mir, und nicht Furcht vor deiner Unredlichkeit hält mich ab, hervor zu kommen. Aber du hast viele Gesellen deiner Art, doch vielleicht nicht deines Gemütes, und deren Freundschaft ist nicht mit mir, wie deine. Sieht mich einer, so muss ich fürchten, dass er mich frisst."
Dagegen sprach der Rabe: "Zu treuer Genossenschaft gehört doch vor allem, dass einer sei seines Genossen treuer Freund und Feind seines Feindes; sei gewiss, o Freundin Sambar, dass mir kein Freund lebt, der nicht ebenso treuer Freund dir sein soll, wie ich selbst. Auch habe ich Macht und Kraft genug, dich zu schützen und zu schirmen."
Nun endlich ging das Mäuslein Sambar hervor aus seinem Löchlein und verschwor sich mit dem Raben zu einem unverbrüchlichen Freundschaftsbündnis, und als das geschehen war, wohnten sie bei- und nebeneinander friedsam und freundlich und erzählten einander alle Tage schöne Märchen.
Endlich aber zu einer Zeit sprach der Rabe zur Maus: "Höre, meine liebe Freundin Sambar, deine Wohnung ist doch gar laut und zu nahe am Weg; ich besorge, es kommt einmal einer, der dich oder mich schießt oder schädigt, auch fällt es mir schwer, hier meine Nahrung zu finden.
Aber ich weiß einen lustigen und nützlicheren Aufenthalt, da gibt es Wasser und Wiesen, Früchte und Futter, und dort in dem Wasser wohnt auch noch eine alte Freundin von mir, gar eine treue Genossin; ich wünschte, du zögest mit mir an jenen Ort."
"Das will ich dir gern zuliebe tun", sprach die Maus, "denn ich bin hier selbst scheu und halte mich nicht recht sicher, deshalb siehst du auch die vielen Ein- und Ausgänge meiner Wohnung. Glaube nur, lieber Freund, mir sind schon gar mancherlei Fährlichkeiten begegnet, davon ich dir erzählen will, wenn wir an den neuen Aufenthalt kommen."
Darauf nahmen beide Abschied von ihrem alten Wohnort, und der Rabe fasste die Maus am Schwänzlein in seinen Schnabel und flog mit ihr dahin an den Ort, den er meinte. Da guckte ein Tier mit dem Kopf aus dem Wasser, das erschrak vor der Maus, denn es erkannte sie nicht, wie der Rabe sie aus dem Schnabel ließ, und tauchte schnell unter.
Der Rabe flog auf einen Baum und rief "Korax, Korax!" Da kam das Tier aus dem Wasser hervor, das war seine Freundin, eine Schildkröte, die freute sich, den Raben wiederzusehen und fragte ihn, was ihn zu seinem langen Außbleiben bewogen?
Da erzählte ihr der Rabe die Geschichte von der Taube und der Maus und stellte seine Freundinnen einander vor, und die Schildkröte verwunderte sich über die hohe Vernunft der Maus, kroch zu ihr, gab ihr die Hand und freute sich sehr, ihre Bekanntschaft zu machen.
Hernach bat der Rabe die Maus, ihm und seiner alten Freundin doch ihre Lebensgeschichte zu erzählen, und sie ließ sich dazu gern bereit und willig finden und erzählte, wie folgt: Die Lebensgeschichte der Maus Sambar
s.o.
DER MANN UND DIE SCHLANGE ...
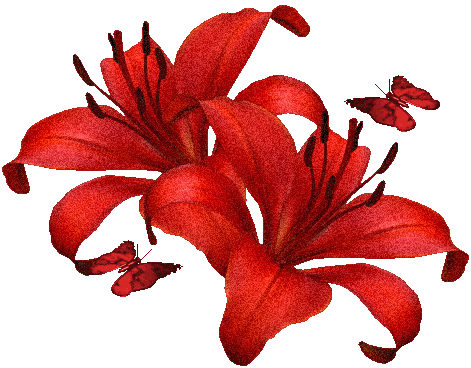
Es war einmal ein Mann, in dessen Haus wohnte eine Schlange, die wurde von dem Weibe dieses Mannes wohl gehalten und bekam täglich ihre Nahrung. Sie hatte ihre Wohnung ganz nahe bei dem Herde, wo es immer hübsch warm war, in einem Mauerloch.
Der Mann und das Weib bildeten sich ein, nach dem herrschenden Aberglauben, dass es Glück bringe, wenn eine Schlange im Hause sei! Nun geschah es an einem Sonntag, dass dem Hausherrn das Haupt schmerzte, deshalb blieb er früh in seinem Bett liegen, und hieß die Frau und das Gesinde in die Kirche gehen.
Da gingen sie alle aus, und es war nun ganz still im Hause; jetzt schlüpfte die Schlange leise aus ihrem Loch und sah sich allenthalben sehr um. Das sah der Mann, dessen Kammer offen stand, und wunderte sich im stillen, dass sich die Schlange, gegen ihre sonstige Gewohnheit so sehr umsah.
Sie durchkroch alle Winkel und kam auch in die Kammer und guckte hinein, sah aber niemand, denn der Hausherr hatte sich verborgen. Und nun kroch sie auf den Herd, wo ein Topf mit der Suppe am Feuer stand, hing ihren Kopf darüber und spie ihr Gift in den Topf, darauf verbarg sie sich wieder in ihrer Höhle.
Der Hausherr stieg als bald auf, nahm den Topf und grub ihn mit Speise und Gift in die Erde. Wie nun die Zeit da war, dass man essen wollte, wo auch die Schlange gewöhnlich hervor zu kommen pflegte, stellte sich der Mann mit einer Axt vor das Loch, willens, sobald sie heraus schlüpfen werde, ihr den Kopf vom Rumpfe zu hauen.
Aber die Schlange steckte ganz vorsichtig ihren Kopf erst nur ein klein wenig aus dem Loch, und wie der Mann zuschlug, fuhr sie blitzschnell zurück und zeigte, dass sie kein gutes Gewissen hatte. Nach einigen Tagen redete die Frau ihrem Manne zu, er solle mit der Schlange Frieden schließen, sie würde wohl nicht wieder so Böses tun; der Hauswirt war gutwillig und rief einen Nachbarn, der sollte Zeuge sein des Friedensbundes mit der Schlange und einen Vertrag mit ihr aufrichten, dass eins sicher sein sollte vor dem anderen.
Hierauf riefen sie der Schlange und machten ihr den Antrag; die Schlange aber sagte: "Nein! - Unsere Gesellschaft kann für der in Treuen nicht mehr bestehen, denn, wenn du daran denkst, was ich dir in deinen Topf getan, und wenn ich bedenke, wie du mir mit scharfer Axt nach meinem Kopf gehauen hast, so möchte wohl keiner von uns dem anderen trauen. Darum gehören wir nicht zusammen; gib du mir frei Geleit, das ist alles, was ich von dir begehre, und lass mich meine Straße ziehen, je weiter von dir, desto besser, und du bleibe ruhig in deinem Hause." Und also geschah es.
Der Rabe, als er diese Erzählung aus dem Mund des Mäusleins Sambar vernommen hatte, nahm wieder das Wort und sprach: "Ich fasse wohl die Lehre, die dein Märlein in sich hält, allein bedenke deine Natur und meine Aufrichtigkeit, sei minder streng, und weigere mir nicht deine Genossenschaft. Es ist ein Unterschied zwischen edel und unedel; der Becher aus Gold hält länger als der aus Glas, und wenn der Glaspokal zerbricht, so ist er hin, leidet aber der Goldpokal, so ist der Wert noch nicht verloren.
Die Freundschaft der bösen und unedlen Gemüter ist gar keine Freundschaft, du aber hast ein edles Gemüt, das hab ich wohl erkannt, und so sehnt sich mein Herz nach deiner Freundschaft und bedarf ihrer, und ich werde nicht weichen vom Eingang deiner Wohnung und nicht eher essen noch trinken, bis du meiner Bitte Gehör gegeben!"
Darauf sprach das kluge Mäuslein Sambar: "Ich nehme jetzt deine Gesellschaft an, denn ich habe noch nie eine billige Bitte ungewährt gelassen. Du magst aber wohl erwägen, dass ich mich nicht zu dir gedrängt, auch dass ich in meiner Wohnung sicher vor dir bin, aber ich begehre nützlich zu sein allen, die meiner Hilfe begehren, darum rühme dich nicht etwa: Haha, ich habe eine unvorsichtige und unvernünftige Maus gefunden! - damit es dir nicht gehe, wie dem Hahn mit dem Fuchs."
"Wie war das?" fragte der Rabe, und da erzählte das Mäuslein ein Gleichnis: Der Hahn und der Fuchs
DAS MÄUSLEIN SAMBAR, ODER DIE FREUNDSCHAFT DER TIERE ...
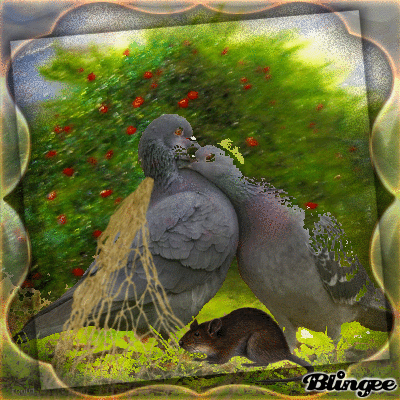
In einem weiten Walde war des Wildes viel, und stand darin ein großer Baum mit vielen Ästen, auf dem hatte ein Rabe sein Nest. Da sah er zu einer Zeit den Vogelsteller kommen und ein Garn unter den Baum spannen, erschrak und bedachte sich und dachte: Spannt dieser Weidmann sein Jagdzeug deinetwegen oder wegen andrer Tiere? Das wollen wir doch sehen!
In dem so streute der Vogelsteller Samen auf die Erde, richtete sein Garn und stellte sich auf die Lauer. Bald darauf kam eine Taube mit einer ganzen Schar anderer Tauben, deren Führerin sie war, und da sie den Samen sahen und des Garns nicht Acht hatten, so fielen sie darauf und das Netz schlug zusammen und bedeckte sie alle.
Des freute sich der Vogler, und die Tauben flatterten unruhig hin und her. Da sprach die Taube, welche die Führerin war, zu den anderen Tauben: "Verlasse sich keine auf sich allein und habe keine sich selbst lieber als die anderen, sondern lasst uns alle zugleich aufschwingen, vielleicht, daß wir das Garn mit in die Höhe nehmen, so erledigt eine jegliche sich selbst und die anderen mit ihr."
Diesem Rate folgten die Tauben, flogen zugleich auf und hoben das Garn mit in die Lüfte. Der Vogelsteller hatte das Nachsehen und das Nachlaufen, um zu gewahren, wo sein Netz wieder herab zur Erde fallen werde; der Rabe aber dachte bei sich: du willst doch auch nachfolgen und sehen, was aus diesem Wunder werden will?
Als die kluge Führerin der Tauben sah, daß der Jäger ihrem Fluge nachlief, sprach sie zu ihren Gefährtinnen: "Seht, der Weidmann folgt uns nach; beharren wir auf der Richtung über dem Wege, so bleiben wir ihm im Gesicht, und werden ihm nicht entgehen, fliegen wir aber über Berge und Täler, so vermag er uns nicht im Auge zu behalten, und muß von seiner Verfolgung abstehen, da er daran verzweifeln wird, uns wieder zu finden. Nicht weit von hier ist eine Schlucht, da wohnt eine Maus, meine Freundin, ich weiß, daß wenn wir zu ihr kommen, sie uns das Netz zernagt und uns erlöst."
Die Tauben folgten dem Rat ihrer Führerin und kamen dem Vogler aus dem Gesicht. Der Rabe aber flog langsam hinter ihnen her, um zu sehen, was aus dieser Geschichte werden würde, und auf welche Weise sich wohl die Tauben von dem Netz erledigen würden, und ob er nicht lernen werde, in eigener Gefahr ihr Rettungsmittel zu gebrauchen?
In dessen erreichten die Tauben jene Schlucht, wo das Mäuschen wohnte, ließen sich nieder und sahen, daß die Maus wohl hundert Löcher und Aus- und Eingänge zu ihrer unterirdischen Wohnung hatte, um an vielen Enden bei drohender Gefahr sich verbergen zu können.
Die Maus hieß Sambar, und die kluge Taube rief nun der Freundin: "Sambar, komm heraus!" Da rief das Mäuslein inwendig: "Wer bist du?" und da rief die Taube; "Ich bin es, die Taube, deine Freundin!" Und da kam das Mäuslein, guckte aus einem der Löcher vorsichtig und fragte: "O liebe Gesellin, wer hat dich so überstrickt?"
Da sprach die Taube: "O liebe Freundin! Weißt du nicht, daß keiner lebt, dem Gott nicht ein widerwärtiges Verhängnis schickt? Und der Betrügerinnen arglistigste ist die Zeit! Sie streute mir süße Weizenkörner, und verbarg meinen Augen das trugvolle Netz, so daß ich mit meinen Freundinnen hinein fiel.
Niemand verwahrt sich der Schickung, die von oben kommt, ja Mond und Sonne leiden auch Verfinsterung, und aus des Sees grundloser Tiefe lockt der Menschen Trug den Fisch, wie er den Vogel aus der Lüfte Meer herab in seine falschen Schlingen zieht."
Als die Taube dies mit vieler Beredsamkeit gesprochen, begann die Maus das Netz zu zernagen, und zwar an dem Ende, wo ihre Gespielin, die Taube, lag, diese aber sprach: "Fange an bei den anderen, meinen Schwestern, und wenn du sie alle erledigt hast, dann erledige auch mich."
Aber die Maus folgte ihr nicht, ob sie gleich wiederholt bat, und wie sie noch einmal die Maus darum ansprach, so fragte diese: "Was sagst du mir dies so oft, als ob du nicht auch wünschtest frei zu sein?"
Darauf antwortete die Taube: "Laß meine Bitte dir nicht mißfallen; diese meine Schwestern haben mir vertraut als ihrer Führerin; sie folgten willig mir und voll Vertrauen und durch meine Unvorsichtigkeit gerieten sie unter das Netz, darum ist es billig, daß ich auf ihre Erlösung eher denke als auf die meinige, zumal es nur durch ihre gemeinsame Hilfe gelang, auch mich zu erheben samt des Voglers Garn. Auch möchtest du ermüden bei den anderen, weißt du aber mich, deine liebste Freundin, noch im Netz, so wirst du mich nicht verlassen."
Darauf sprach das Mäuslein: "O liebe gute Taube, Taubenherz; viele Ehre macht dir diese Gesinnung und muß die Liebe stärken zwischen dir und deinen Gesellinnen." Und sie zernagte das Netz allenthalben, und die Tauben flogen frei und fröhlich ihren Weg, die Maus aber schlüpfte wieder in ihr Löchlein.
Das alles hatte der Rabe, der in der Nähe sich auf einen Baum niedergelassen hatte, gesehen und mit angehört, und hielt hierauf ein Selbstgespräch: "Wer weiß", sprach er, "ob ich nicht auch in gleiche Lage und Gefahr komme, wie diese Tauben? Dann ist es doch gar herrlich, edle Freunde zu haben, die uns aus der Not helfen. Mit dieser Maus möchte mir Freundschaft allewege frommen!"
Und da flog er von seinem Baum und hüpfte zu der Schlucht und rief: "Sambar, komm heraus!" Und drinnen rief das Mäuselein: "Wer bist du?" Da sprach er: "Ich bin der Rabe und habe gesehen, was deiner lieben Freundin, der Taube begegnet ist, und wie Gott sie erledigt hat durch deine Treue, deshalb komme ich, auch deine Freundschaft zu suchen."
Da sprach Sambar, das kluge Mäuslein, ohne daß es hervorkam: "Es kann nicht Freundschaft sein zwischen dir und mir; ein Weiser strebt nur zu erlangen das, was möglich ist, und für unweise gilt, der das Unmögliche erringen will. So führe einer Schiffe übers Land und Karren übers Meer. Wie könnte zwischen uns Gesellschaft sein, da ich dein Fraß bin und der Fresser du?"
Da sprach der Rabe: "Mäuselein, versteh mich wohl, und sinn meiner Rede nach. Was frommte mir, fräße ich dich auf, dein Tod! Dein Leben soll mir hilfreich sein, und deine Freundschaft so beständig wie Ambra, der lieblich duftet, ob man auch verhüllt ihn trägt."
Darauf sprach die Maus: "Wisse, Rabe, der Hass der Begierde ist der größte Hass. Löwe und Elefant hassen einander ihrer Stärke halber, das ist ein edler und gleicher Hass des Mutes und des Streites; aber der eingefleischte Hass des Starken gegen den Schwachen, das ist ein unedler und ungleicher Hass; so hasst der Habicht das Rebhuhn, die Katze die Ratte, der Hund den Hasen, und du - mich.
Erhitze Wasser am Feuer, daß es gleich dem Feuer dicht brennt, es wird darum doch kein Feuer sein, auch nie des Feuers Freund, sondern es wird, in das Feuer geschüttet, dieses dennoch dämpfen.
Die Weisen sagen: Wer seinem Feind anhängt, gleicht dem, der eine giftige Schlange in seine Hand nimmt; er weiß nicht, wann sie ihn beißen wird. Der Kluge traut seinem Feinde niemals, sondern er hält sich fern von ihm, sonst geschieht ihm, wie einst dem Manne mit der Schlange geschah."
Der Rabe fragte: "Wie geschah dem?" und da erzählte ihm die Maus folgendes Märchen: s.o.
DER GASTLICHE KALBSKOPF ...
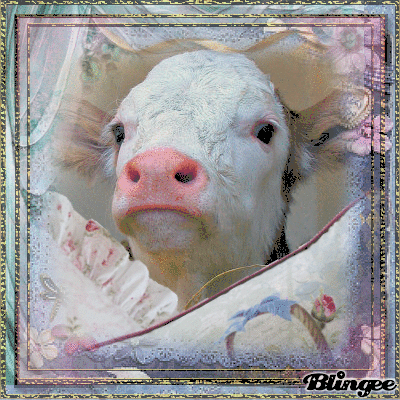
Ein Elternpaar hatte drei Söhne, zwei waren gescheit, oder bildeten sich wenigstens ein, dies zu sein, der dritte, jüngste, Hans, war der dumme, aber der Liebling seiner Mutter, daher auch oft der Gegenstand des Neides seiner Brüder.
Als letztere ziemlich herangewachsen waren, beschlossen sie, gemeinschaftlich die Welt zu sehen und draußen ihr Glück zu machen; sie sprachen daher zu ihrem Vater: »Vater, gib jedem von uns zehn Taler, wir wollen hinaus in die Welt, wollen fremde Städte und Länder sehen, und unser Glück machen.«
Und zur Mutter sprachen sie: »Mutter, gib uns einen Ranzen voll Brot und Speck, wir wollen eine weite Reise tun.«
»Es ist gut, wenn die Jungen fort kommen und sich draußen etwas versuchen, wir wollen sie ziehen lassen!« sprach die Mutter zum Vater, und so wurde der Brüder Wunsch erfüllt.
Wie die Brüder zu ihrer Reise zurüsteten, sah es Hans, und wie er ihren Entschluß vernahm, so sagte er: »Will auch mit! Will auch zehn Taler, will auch einen Ranzen voll Speck und Brot! Auch in die Welt!«
»Du wirst etwas Rechtes draußen sehen und gewinnen, dummer Hans!« grollte der Vater, und die Mutter schrie: »Ach, mein Goldkind! Bleibe daheim und nähre dich redlich!«
Aber der Hans wollte einmal, und da half kein Zureden; er erhielt, was die Brüder erhalten hatten, und wanderte mit ihnen von dannen.
»Dümmeres gibt es gar nicht, als daß der dumme Hans sich uns aufgepackt hat! Der konnte doch wahrlich daheim bleiben! Der wird was Gescheites erleben! Wir wollen tüchtig drauf los schreiten, daß er uns nicht nachkommt, da wird er schon von selbst umkehren«, sprachen die Brüder auf ihrem Wege untereinander, als bereits Hans, der jüngste, ein Stückchen zurück geblieben war, weil er nicht so große Schritte machen konnte, als seine zwei älteren Brüder.
Hans ließ die Brüder noch eine Strecke hinlaufen. Auf einmal schrie er: »Heida! Holla! Was ist das? Was liegt da? Ach der Schatz!«
Die Brüder, als sie den Hans so rufen hörten, blieben stehen, sahen sich um, sahen, wie ihr Bruder sich bückte, und Zeichen der Verwunderung über etwas machte, was dort lag, dann sprachen sie zueinander: »Schau, der Hans hat etwas gefunden, daran wir, ins Gespräch vertieft, vorüber gingen, geschwinde zurück!«
Eilend liefen die älteren Brüder zu ihrem Hans zurück, und sahen nach dem Schatz, den Hans gefunden hatte es lag aber nichts dort, als eine Glasschlacke, die in der Sonne blitzte.
»Einfältiger, dummer Hans!« schalten die getäuschten Brüder. »Mein « sprach Hans: »ist es kein Demant? Tut mir leid!«
Nach einer Weile waren die Brüder dem kleineren und schwächeren Hans wieder eine gute Strecke vor geschritten, und er konnte nicht nachkommen, weil er sich als bequemes Muttersöhnchen im Gehen niemals sonderlich geübt hatte. Da schrie er abermals: »Hei! Holla! Aber das ist was! He! Kommt all daher! Ach, die Pracht! Ach, die Pracht!« und dabei machte er Freudensprünge um einen Punkt.
Die Brüder glaubten, der Hans habe jetzt wirklich etwas gefunden, und liefen zu ihm zurück. Als sie aber die Stelle erreichten, war es ein großer Schwarm Goldkäfer, die zufällig auf einen Punkt zusammengeklumpt da lagen und schalten den Hans noch härter.
Der Hans aber machte sein dümmstes Gesicht, und sagte: »Ich dachte, es wäre ein Haufen Dukaten. Ist's nichts? Tut mir leid.« Er hatte aber beide Male nur gerufen, um wieder bei den Brüdern zu sein, ohne seine Schritte verdoppeln zu müssen, und sie einzuholen.
Leider ließ sich dieses zweimal erprobte Kunststück nicht fortsetzen. Als Hans nach einer Strecke Weges in einem Walde abermals zurück geblieben war, und wieder bei einem vorgeblichen Funde stehen blieb, und schrie, so taten seine Brüder, als hörten sie es nicht und gingen selbst ihres Weges, und waren bald hinter den Waldbäumen, ihrem Bruder aus dem Gesichte.
»Lauft hin!« sprach Hans: »so kann ich desto besser ausruhen!« Und setzte sich auf einen Stein, und öffnete seinen Ranzen, und aß Brot und Speck, trank auch einmal, denn die Mutter hatte ihm vorsorglich eine gefüllte Bulle in den Ranzen geschoben, dann legte er an einer bequemen Stelle den Ranzen unter den Kopf, und machte ein Schläfchen.
Da der Hans Ausgehen nicht gewohnt, und sehr müde geworden war, so dauerte sein Schläfchen etwas lange, und als er endlich daraus erwachte, begann es schon Abend zu werden.
O weh, o weh! dachte Hans. Ist es schon so spät! Wo soll ich nun hin, bei der Nacht und im Walde? Räuber können kommen und mir meine zehn Taler nehmen. Wölfe können kommen, und mir mein übriges Brot samt Speck fressen, und hinterdrein mich dazu. Das wird nicht gut. Hans, Hans! Wärst du doch zu Hause bei der Mutter geblieben!
Es wurde schnell dunkel, und Hans fürchtete sich, weiter zu gehen. Wo ich alleweil bin, ist außer mir niemand sprach er zu sich selbst und ich tue mir nichts. Gehe ich aber weiter, so könnte ich auf jemand stoßen, der mir was tut. Hier steht eine dicke Eiche, da will ich hinauf steigen, und mich oben in das Geäst setzen; da sucht mich kein Räuber, und Wölfe klettern nicht.
Gedacht, getan, Hans kletterte auf den Baum, und sah sich droben ein wenig um. Siehe, da erblickte er ganz nahe ein stattliches Haus, dessen Zimmer von Lichtern erhellt waren.
»O ich dummer Hans!« rief Hans. »Konnte ich nicht noch ein paar Schritte gehen, und in dem schönen Gasthof einkehren? Potz Blitz! Wenn man zehn Taler in der Tasche hat, braucht man da ein Nachtquartier auf Waldbäumen zu suchen?«
Eilend kletterte Hans vom Baum wieder herab, und schritt nach dem Hause zu, dessen Lichter ihm bald entgegen schimmerten. Bald stand er vor dem Hause, es war hell und groß, nur nichts Lebendes ließ sich sehen. Hans fand die Türe offen, alles hell von brennenden Kerzen, auch die Türen einer Reihe von Zimmern standen geöffnet, aber nirgend ein Mensch, auch kein Hund und keine Katze.
In dessen stand in einem der Zimmer ein gedeckter Tisch, darauf standen eine Flasche voll Wein, und Teller voll Weißbrot, Pfannkuchen, kalten Braten, Butter, Käse u. dgl. In einem Zimmer gleich daneben stand eine schöne Wiege, und in der Wiege lag ein K ... nein, kein Kind, sondern ein sehr schöner Kalbskopf, auf seidenen Kissen.
Hans schielte hin, und murmelte: »Ein prächtiger Kalbskopf! Schade, daß selbiger nicht gebraten ist. Zu dem hätte ich just Appetit.« Jetzt öffnete der Kalbskopf seine Augen und Hans erschrak, er hatte nicht gedacht, daß der selbe lebendig sei.
»Schönen guten Abend«, sagte der Kalbskopf und ganz erschrocken stammelte Hans: »Großen Dank!« Er war noch so unbekannt mit der Welt, der gute Hans, hatte noch nie einen Kalbskopf reden gehört.
»Sei schön willkommen!« sprach der Kalbskopf weiter. »Mir wird die Zeit so grässlich lang. Setze dich, iß, trink, mache dir es bequem dort steht ein Himmelbett, da kannst du schlafen, wenn du aber munter bist, da kannst du mir erzählen, wie es draußen in der Welt zugeht.«
Ich? dachte Hans, und erschrak aufs neue. Ich soll von der Welt erzählen? Das werden rührende Geschichten werden. Wenn ich nun nichts weiß da tut mir das Ding am Ende etwas. Ob es wohl ein ganzes Kälbchen ist, oder nur ein Kopf? Ob es wohl aus der Wiege heraus springen kann? Beißen wird es doch nicht, dazu sieht es zu gutmütig aus.
Hans setzte sich und aß und ließ es sich trefflich wohl schmecken, doch quälten ihn über dem Essen, Gedanken was noch nie bei ihm der Fall gewesen war.
Wie fange ich es nur an dachte Hans: daß ich nicht gegen die Höflichkeit verstoße? Wie tituliere ich den Kalbskopf? Ich kann nicht unterscheiden, ob es ein Er ist oder eine Sie? Ob schon verheiratet oder noch ledig? Er scheint noch ziemlich jung zu sein. Soll ich zu ihm oder zu ihr sagen: Euer oder Ihre Gnaden? Ich werde gewiß etwas Dummes machen, so oder so.
Trotz dieser schweren Gedanken ließ es sich Hans doch außerordentlich gut schmecken, und als die Mahlzeit gehalten war, kam es zu keiner Abend Unterhaltung zwischen ihm und dem Kopf, denn Hans war wieder müde und legte sich in das Himmelbett, und schlief bis in den anderen Tag hinein.
Der Kalbskopf nahm das nicht übel; er hatte eine bewunderungswerte Geduld. Am anderen Morgen fand Hans seine Kleider gereinigt, und sein Frühstück neben der Wiege des Kalbskopfes, der ihm freundlich guten Morgen sagte, und seine Ohren mit vieler Anmut bewegte.
Nun aber sollte Hans erzählen, und machte den Versuch, und siehe, es ging besser, als er geglaubt hatte. Er begann zunächst von sich, denn jeder Mensch ist der Mittelpunkt seiner Welt, von seiner Mutter, von dem Vater, den Brüdern, den Muhmen und Vettern und von deren Kindern; von dem Hause seiner Eltern, deren Viehstande, wie viele Ziegen, Enten, Hühner, wie viele Singvögel; dann vom Gärtchen, von dessen Bäumen, Beeten und Blumen.
Hans hatte an dem Kalbskopf den gütigsten Zuhörer. Bisweilen schien es Hans, als glänze eine Träne in dessen großen blassblauen Augen, und als atme er tiefer auf, fast wie wenn ein Mensch seufzt. Ein Wort gab das andere, nie stockte die Unterhaltung.
Hans schilderte bis ins einzelne das Dorf, in dem sein Elternhaus stand, die Häuser, die Kirche, die Schule, den Kirchhof, die Grabsteine, den Pfarrer, den Schulzen, dann die Flur des Dorfes, den Bach, die nächsten Berge.
Hans war über sich selbst verwundert, daß er so vieles wußte. Darüber verging mancher Tag. Dann fielen ihm auch alle Märchen ein, welche ihm die Großmutter, als diese noch lebte, und er noch ein kleiner Junge gewesen war, erzählt hatte, und dann die Mutter von verzauberten Prinzen und Prinzessinnen, von Zauberfrauchen und Hexenmännlein, von verwünschten Schlössern und gläsernen Bergen.
Das alles hörte der Kalbskopf mit großem Wohlgefallen an, besonders schien er sich zu freuen, wenn die Märchen schilderten, wie die verzauberten Prinzen und Prinzessinnen ihre Erlösung gefunden hatten. Und dabei sorgte der Kalbskopf auf das eifrigste dafür, daß es Hans niemals an Trank und Speise mangele, und daß er sich und sein Gedächtnis durch all zu vieles Erzählen ja nicht zu sehr anstrenge.
Immer mehr fiel dem Hans ein; er erzählte von den Gespenstern, die es gebe, von Feuermännern und Irrwischen, vom wilden Jäger und von dem Erdmännlein, von der Nixe im Bache und dem weißen Fräulein am alten Schloßberge in der Nähe seines Dorfes.
Endlich fiel dem Hans ein, daß er ja auch musikalisch sei, und ein Instrument bei sich habe, das er zur Unterhaltung trefflich zu spielen verstehe. Hans packte dieses Musikinstrument, das sehr sorglich verwahrt war, aus.
Es war eine Maultrommel, und als Hans die ersten Töne darauf anschlug, machte der Kalbskopf ganz große Augen, und drückte durch Wedeln mit den blonden Ohren seinen stillen Beifall aus.
Lange Zeit erfreute sich Hans der Gastlichkeit des Kalbskopfes und der stets unsichtbar bleibenden Bedienung des Hauses, und dachte: es ist gut, daß ich nichts von der Dienerschaft sehe, da brauche ich auch kein Trinkgeld zu geben, wenn ich wieder fort gehe, denn der Gedanke an das Fortgehen war dem Hans doch allmählich gekommen.
Er kannte keine andere Welt als die kleine seines Heimatortes; sie füllte seine Seele und den Kreis seiner Ideen aus, und da er täglich nur von ihr sprach, mit allen Gedanken nur in ihr lebte, so war es kein Wunder, daß eine stille Heimat Sehnsucht im Herzen von Hans erwachte.
Der Kalbskopf besaß ungleich mehr seelenkundlichen Scharfblick, als die überklugen Menschen insgemein Kalbsköpfen zutrauen und zugestehen wollen, und nahm daher eines Tages, als Hans wieder vom Daheim erzählte und dabei ein jammeriges Gesicht machte, das verständige Wort:
»Mein guter Gastfreund«, sprach er: »Du sehnst dich heim; ich begreife dieses Gefühl und ehre das selbe. Reise heim ich will dich ausstatten aber kehre wieder. Dort steht ein Stab, schlage mit ihm auf jene Lade, und wähle dir aus den darin liegenden Anzügen den schönsten aus. Dort jene Türe verschließt den Stall. Öffne sie mit dem Stabe, und wähle dir das beste Roß. Dort in jener Kiste liegt Geld und ein Zauberpfeifchen; wenn du verirrt bist, und du pfeifst darauf, so kommen Tiere gesprungen, und laufen dir voran, und zeigen dir den richtigen Weg.«
Hans staunte, und tat, wie ihm geheißen war. Im stattlichsten Jagdjunkerkleide mit goldenen Tressen besetzt, auf stattlichem Schimmel, mit trefflichem Seitengewehr und gezogener Kugelbüchse ritt Hans von dannen, alle Taschen voll Geld, und das Pfeifchen an goldener Schnur um den Hals.
Heilig und teuer versprach Hans dem Kalbskopf, zu ihm zurück zu kommen. Ob Hans dem gastlichen Kalbskopf zum Abschiede einen Kuß gegeben, weiß man nicht so ganz bestimmt.
Wie ging es unterdessen Hans seinen klugen Brüdern? Die waren sehr froh, daß der dumme Hans sie nicht mehr belästigte; sie ließen es sich recht gut schmecken, so lange Brot und Speck in ihren Ranzen vor hielten, und so lange in den Wirtshäusern die zehn Taler eines jeden ausreichten, was wirklich ungefähr acht Tage dauerte.
Dann aber sprachen sie zueinander: »Die Welt ist doch zu groß, als daß wir sie ganz kennen lernen könnten. Wie wär es, wenn wir umkehrten? Es ist doch überall nicht besser, als daheim. Wir haben in diesen acht Tagen eine ziemliche Anzahl fremder Städte und noch mehr Länder gesehen, es sieht fast ein Land aus, wie das andere.
Wir haben zwar kein sonderliches Glück gemacht, aber wir hätten doch vielleicht etwas finden können. Daß uns hier außen nichts vom Glück begegnete, ist ein Beweis der alten Wahrheit, daß nur in der Heimat eines jeglichen der wahre Schatz seines Glückes ruht. Eilen wir, diesen Schatz wieder aufzusuchen.«
Als die Brüder heim kamen, sah sie der Vater finster an, und sagte: »Ihr seid die wahren Helden, ihr Landläufer ihr! Ihr Herrgottstagediebe! Zwanzig Taler habt ihr durchgebracht, und für zehn Taler Kleider und Schuhe zerrissen. Jetzt arbeitet dafür! Nicht einen Groschen geb ich euch, bis ihr mir das an euch zum Fenster hinaus geworfene Geld ersetzt habt!«
Die Mutter aber rief: »Ihr Rangen! Wo habt ihr meinen Hans, mein Goldkind gelassen? Wie könnt ihr euch nur unterstehen, ohne meinen Hans über unsere Schwelle zu schreiten?«
Es hielt den Brüdern sehr schwer, die zürnende Mutter zu bedeuten, daß Hans mit Absicht immer hinter ihnen zurück geblieben sei, ganz sicher, um sich abzusondern. Die Brüder mußten fürchterlich arbeiten, denn dreißig Taler wollen verdient sein.
Nach einiger Zeit entstand gegen Abend im Dorfe ein kleiner Auflauf. Es ritt ein vornehmer Junker hindurch, angetan wie ein Prinz. Die Leute dachten, es wäre der König selbst, und er reise inkognito, ohne alle Bedienung.
Alles lief an die Fenster, vor die Türen, ein heller Haufen lief hinterdrein. Da fielen blanke Guldenstücke auf den Weg. Nun war es der König, und alles schrie vivat! und schlug sich um die Geldstücke. Vor Hans Elternhaus hielt der schmucke junge Reitersmann, und stieg vom Rosse. Eine ganze Schar von Jungen drängte sich herbei, bei dem vermeinten Prinzen Stallmeister- oder Bereiterdienste zu tun.
Hans seine Eltern traten ehrerbietig vor ihr Häuslein. Was konnte bei ihnen der fremde Herr wollen? Die Brüder kamen von der Arbeit, und sahen Mistfinken ähnlicher als Goldammern. Ihre Mäuler blieben offen stehen vor Verwunderung, als der Fremde erst ihrer Mutter, dann ihrem Vater um den Hals fiel, und sie herzte und küßte, und hernach rief: »Na, Michel, na Velten! Patschhand! Ihr kennt am Ende euren Hans alle nicht mehr?« und ihnen die Hände bot.
Es war der Hans und kein Prinz und kein König. »Der dumme Hans ist wieder da, ist reich geworden, und wirft mit Geld um sich, der Hans Narr!« lief die Rede durchs Dorf. Die Alten freuten sich, die Brüder zogen mit scheelem Neide Hans sein schönes Pferd in den Stall, und flüsterten miteinander:
»Wir müssen uns tot schinden, um dem Vater die armseligen dreißig Taler wieder zu verdienen; der Hans, der Glückspilz, der gar nicht mit Geld umzugehen weiß, wirft es auf die Gasse. Wir wollen ihm heute Nacht das Geld weg nehmen, es ist ihm doch nicht nütze. Überhaupt ist nicht recht einzusehen, was so ein Dummer auf der Welt tut?«
In der Nacht kamen die Brüder in die Kammer, wo Hans schlief. Hans war aber nicht so dumm, als seine Brüder dachten. Als die Diebe in die Kammer brachen, schoß er dem einen ein kleines Kügelchen in das dicke Fleisch, und gab dem zweiten mit dem Hirschfänger einen hübschen Zirkumflex.
Darauf wurde Lärm, und der Vater stand auf, und als er sah, was vorgegangen, so nahm er im Zorn seine Peitsche, und hieb auf die verwundeten Buben los, daß sie laut aufheulten und den Himmel für eine Baßgeige ansahen, vor dem Bruder aber sich gar nicht wieder sehen ließen.
Hans lebte und labte sich mit seinen Eltern, außerdem aber gefiel es ihm nicht mehr so recht daheim; er beschenkte seine Eltern reichlich, sattelte sich selbst sein Pferd und ritt von dannen.
Er wollte wieder nach dem Waldhaus, zum gastlichen Kalbskopf, da gab es nicht Neid, nicht Habsucht, nicht Verkennung, nicht Raubsucht, aber zu essen und zu trinken vollauf, und gute Unterhaltung, denn der Kalbskopf wußte auch zu sprechen, und drückte sich noch dazu außerordentlich gewählt aus, woraus Hans schloß, daß der selbe eine sehr gute Erziehung erhalten haben müsse.
Hans ritt ins Blaue hinein, und bald wußte er keinen Weg mehr, aber da half das Pfeifchen trefflich. Ein Pfiff, und es kam ein Hase oder ein Fuchs, oder ein Vogel, liefen und flogen vor dem Pferde her, und als der Wald erreicht war, sprangen muntere Rehe voran, und so wurde das Schloß ohne Gefahr und Abenteuer wieder gewonnen.
Der Kalbskopf rief Hans, als dieser zu ihm eintrat, ein herzliches »Willkommen!« entgegen, und drückte seine Freude aus, Hans wieder zu sehen.
»Du kommst zu rechter Zeit, mein braver Freund!« sprach der Kalbskopf. »Mit großer Sehnsucht erwartete ich dich, denn wenn die gute Stunde, der ich entgegenharre, ungenützt verstrichen wäre, so würdest du mich nicht wieder gefunden haben, und alle meine Hoffnung wäre dann zunichte gewesen.«
Hans horchte hoch auf bei diesen ihm rätselhaften Worten, und der Kalbskopf fuhr fort: »Habe genau Acht auf das, was ich dir sage, denn von diesen Anordnungen hängt mein Glück ab, und vielleicht auch dein Glück.
Gehe jetzt einmal in die Küche, dort steht ein Hackblock, und in der Speisekammer daneben liegt ein scharf geschliffenes Beil. Nimm dieses Beil und lege das selbe auf den Hackblock dann komme wieder zu mir herein.«
Hans befolgte dies Geheiß pünktlich. Wenn ich weiter nichts tun soll, dachte er, so hat es ja gute Wege. Bald hatte er das Gebot erfüllt, und trat wieder in das Zimmer, welches der Kalbskopf bewohnte. »Nicht wahr, mein guter Freund«, rief dieser ihm entgegen: »das war ein sehr leichtes Stück Arbeit? aber nun kommt das schwerere.
Jetzt nimm diese Wiege, in der ich ruhe, und trage sie samt mir in die Küche, und stelle sie neben den Hackblock.«
»Auch das, mit Vergnügen!« sagte Hans, und trug die Wiege in die Küche. Sie war zwar etwas schwerer, als Hans dem Anscheine nach geglaubt hatte, aber Hans hatte Kraft.
»Jetzt aber, bester Freund«, sprach wieder der Kalbskopf: »jetzt kommt das schwerste Stück jetzt erschrick nicht. Jetzt decke mich auf.«
Hans räumte die seidenen Kissen hinweg und o weh, da endete der Hals des Kalbskopfes in einen Arm dicken Schlangenleib, der hing am Kopf, wie ein scheußliches Gewächs, und war blau, wie ein Darm voll Blut.
»Jetzt hebe mich aus der Wiege auf den Block, und haue mir mit dem Beile diesen abscheulichen Wurmzopf ab, der an mir hängt.« Hans schauderte, und stammelte: »So soll ich dich töten, du guter, einziger Kalbskopf? Deinesgleichen lebt zum zweiten Male in der Welt nicht mehr!« »Mache nur frisch zu!« versetzte der Kalbskopf. »Es wird dir gut gelohnt.«
Hans gehorchte, nicht ohne Scheu und Zagen. Er legte den Kopf, er hob das Beil, er zielte gut, er führte den Hieb und siehe, es floß kein Tropfen Blut, der Schlangenleib verschwand, der Kalbskopf verwandelte sich in ein holdes Mädchenantlitz, und aus der Wiege erhob sich, eine Feengestalt von bezaubernder Anmut, und stieg heraus, und fiel Hans um den Hals.
»Du hast mich erlöst, du Guter, Reiner, Treuer! Nun nimm dir was du willst! Das Schloß und die Schätze, und mich dazu, wenn ich dir gefalle.«
Jetzt wimmelte das Schloß von Dienerschaft, alle diese war verzaubert gewesen, alle jubelten über ihr neu geschenktes Dasein.
»Meine gnädigste Prinzessin!« nahm der erstaunte Hans das Wort. »Du bist mir schon als Kalbskopf äußerst appetitlich erschienen, so aber bist du mir noch tausendmal lieber. Ich nehme Dich!«
Hans wurde sehr glücklich. Er begabte seine Eltern, verzieh seinen Brüdern, heiratete die schöne, erlöste Prinzessin, und lebte mit ihr in einer frohen und genussreichen Einsamkeit. Weder er, noch seine Gemahlin, sehnten sich in die so genannte große Welt, und falls sie beide nicht gestorben sein sollten, so dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit zu vermuten sein, daß sie heute noch leben.
DER WANDERGESELLE ...
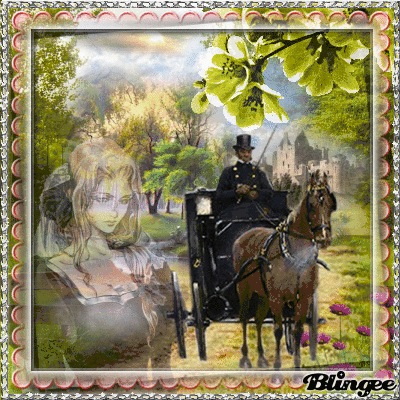
Es lebte einst die Witwe eines Metzgers, die nur einen einzigen Sohn hatte, der bereits begonnen hatte, das Handwerk seines Vaters zu erlernen, als der Vater ihm starb. Die Mutter ließ den Sohn vollends auslernen, und sandte ihn dann in die Fremde, da sollte er drei Jahre lang reisen, sich die Welt besehen, und etwas Tüchtiges draußen lernen. Sie stattete den Sohn aus, so gut sie konnte, und gab ihm ihren besten Hund mit, der hieß Faß'an.
Auf der Wanderschaft kam der junge Metzgergeselle in einen dichten Wald, darinnen Räuber hausten, die ihn anfielen und ihn berauben, oder gar töten wollten. Der junge Geselle aber wehrte sich kräftig, und sein Faß'an stand ihm wacker bei und verwundete die Räuber mit wütenden Bissen, darüber geriet der eine der Räuber so in Zorn, daß er den treuen Faß'an tot schoß.
Der junge Metzger aber entrann den Räubern, und lief immer tiefer in den Wald hinein, der sehr groß war, und verirrte sich völlig, und wußte nicht mehr, wo er war. Endlich erblickte er von fern ein kleines Häuschen mitten in dem Walde, auf welches er zueilte, und in das er, nachdem er angeklopft, eintrat.
Da saß ein altes graues Mütterlein drinnen, das regte sich nicht und bewegte sich nicht, aber der junge Geselle begann frischweg, der Alten zu erzählen, was ihm alles begegnet, und bat, ihm den Weg aus diesem Walde zu zeigen, dabei klagte er sehr um den armen Faß'an, den die Räuber ihm erschossen.
Da sprach das alte Mütterlein: »Hab auch schöne Hunde, kannst dir einen aussuchen und mitnehmen.« Dabei rief sie: »Reißebeiß!«
Auf diesen Ruf trat ein großer Hund in das Häuschen, und das Mütterlein fragte: »Gefällt dir der?«
»Es ist ein schöner Hund«, antwortete der Geselle: »aber der meine war schöner.«
Da rief die Alte abermals: »Sprengalleband!« Und da kam wieder ein noch größerer und noch schönerer Hund herein, und die Alte fragte: »Wie gefällt dir der?«
»Er gefällt mir recht gut«, antwortete der junge Metzger, »aber meiner war mir halt doch noch lieber.«
Da rief die Alte abermals: »Hurtigundgeschwind!« und jetzt sprang ein ganz großer und mutiger, sehr schön gebauter Hund herein da wartete der Geselle gar nicht erst die Frage des Mütterleins ab, ob dieser ihm gefalle? sondern rief als bald: »Den laß ich mir gefallen! Gerade so, wie der, hat mein Hund ausgesehen, und hätten sie den guten Faß'an nicht vor meinen Augen tot geschossen, so schwür ich drauf, der sei es selbst.«
»Ich will dir etwas sagen, mein junger Wandersmann«, sprach die Alte: »ich will dir die braven Hunde alle drei schenken, du mußt aber, wenn du ihnen einst dein Glück dankst, auch an mich arme alte Waldfrau denken, und dich meiner Armut nicht schämen.«
Da der junge Bursche dies versprach, so zog die Alte auch noch ein Pfeifchen hervor und gab ihm dies, und sagte:
»Dieses Pfeifchen verwahre recht gut, denn damit kannst du die drei Hunde zu deiner Hilfe herbeirufen, sie mögen sich befinden, wo sie wollen; dies wird besonders nötig sein, wenn du selbst in Not gerätst.«
Mit vielem Danke schied der Wandergeselle von der guten Alten und von ihrem Häuschen, und ging den Weg, den jene ihn als den richtigen bezeichnet hat, wohlgemut fort, und die drei schönen Hunde sprangen munter bald vor bald hinter ihm, und hetzten sich und spielten miteinander, daran der Geselle eine große Freude hatte.
Als der Abend zu dunkeln begann, erreichte der Reisende mit den drei Hunden ein einsames Wirtshaus, das auch noch in dem großen Walde lag, der gar kein Ende nehmen zu wollen schien. Vor dem Hause fand der Metzger eine junge Magd, welche hölzerne Gefäße scheuerte, und als diese den hübschen jungen Gesellen erblickte, so schien sie zu erschrecken und machte ihm eine abwehrende Gebärde; sie winkte ihm gleichsam, zurück zu gehen und hier nicht einzutreten, ja sie öffnete schon den Mund zu einem warnenden Zuruf, als die Türe aufging, und der Wirt heraustrat, und den späten Wanderer einlud, doch ja bei ihm einzukehren, zumal er, der Wirt, auch ein Metzger sei.
Dem Jüngling kam ein argwöhnisches Gefühl in das Herz, allein er war einmal da, hatte Hunger und Durst, und die Nacht war vor der Türe. Sonach setzte er sich in der Stube nieder, und seine drei Hunde lagerten sich um ihn her, und nun bestellte er sich etwas zu essen. Darauf mußte er gar nicht lange warten, es kam ein großes Stück Fleisch in einer fetten Brühe, und gutes Brot dazu.
Der Wandergeselle aß, und der Wirt hatte sich auf die Ofenbank gesetzt, und sah zu, wie es seinem einzigen Gaste schmeckte, denn es war niemand von Fremden weiter im Hause. Es schmeckte aber dem Gaste nicht, das sah jetzt der Wirt, und sprach: »Gesell, ich vermeine es schmeckt dir nicht! Du bist von daheim wohl eitel Gebratenes gewohnt?«
»Das nicht, Meister«, antwortete der Gast. »Aber ich habe schon Schweinefleisch gegessen, und dieses Fleisch in meiner Schüssel ist keins; ich habe Hammelfleisch gegessen, und dies ist keins; ich habe Rindfleisch und Kalbfleisch gegessen, und das ist keins. Auch weiß ich, wie jede Art von Wildbret schmeckt, und das ist keins. Von irgend einem Vogel ist es auch nicht das dünkt mich ein seltsam Essen!«
Der Wirt lachte, und antwortete: »Mein guter Wanderbursche, du wirst in deinem Leben noch gar vieles hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen, was du doch nie gehört, gesehen, gerochen, geschmeckt und gefühlt hast. In der Welt geht es gar wunderlich her.«
Auf diese empfangene Belehrung aß der Geselle schweigend weiter, obschon es ihm nicht schmeckte, und schöpfte sich auch noch etwas Brühe heraus, da fiel ein Knöchlein aus dem Löffel, und als er das recht ansah, war es ein Finger. Da erschrak der arme Jüngling bis zum Tode, und wurde ihm sehr übel ob sotaner Mahlzeit, und gerade ging die Türe auf, und die Wirtin trat herein, die trug einen Teller, darauf Fettbrote lagen, vielleicht ihr eigen Abendessen, und der Wirt stand auf von der Bank, und sprach leise mit seiner Frau, und da setzte der Geselle geschwinde seinen Teller und seine Fleischschüssel seinen Hunden hin, die leerten sehr rasch alles ab.
»Wünsche guten Appetit gehabt zu haben!« sprach die Wirtin zum Wanderburschen, und dieser antwortete: »Großen Dank, Frau Wirtin, ich hatte welchen« ist mir aber vergangen, setzte er in Gedanken hinzu.
»Nun wollen wir Ihm seine Schlafkammer zeigen!« sprach die Wirtin, und gab ihrem Mann ein Licht in die Hand. »Die Hunde kommen in den Stall.«
»Ich wünsche, daß meine Hunde bei mir bleiben«, versetzte darauf der junge Metzger.
»Das wird sich finden« erwiderte die Frau.
Der Wirt öffnete jetzt ein Nebenzimmer, indem er mit dem Lichte voran ging, und hinter dem Gaste ging die Wirtin und trug immer noch die drei Fettbrote, und zeigte sie heimlich den Hunden des Fremden, und reizte so deren Verlangen nach diesen Broten.
Man trat in ein Zimmer, das hing voller Waffen, Gewehre, Pistolen, Karabiner, Pallasche, Hirschfänger usw., daneben hingen auch Ketten, Stricke, Handschellen und solcher Dinge mehr, womit man die Leute wehrlos macht.
»Das sind ja gar viele Waffen«, sprach verwundert der Gast.
»Ja, man wohnt hier im Walde so einsam«, erinnerte der Wirt: »man muß sich vorsehen; ich habe auch meine Leute, welche mit diesen Waffen gut umgehen können.«
Während dieser Worte öffnete der Wirt eine zweite Türe, und schritt durch die selbe voran, die Wirtin aber warf eins der Fettbrote auf den Boden, Reißebeiß schnappte danach, aber indem der Hund das Brot fraß, warf die Frau die Türe in das Schloß, und Reißebeiß war in der Waffenkammer eingesperrt.
Das zweite Zimmer war herrlich ausgestattet; das eine Licht, welches der Wirt trug, reichte gar nicht aus, dessen Pracht vollständig zu beleuchten; es standen Fässer voll Geld darin, und an den Wänden hingen kostbare Kleider, und in Glasschränken starrte alles von Schmuck, von Gold- und Silbergeräten und edeln Steinen.
So etwas hatte der junge Metzger noch nie gesehen, und konnte sich gar nicht genug darüber verwundern, noch sich zusammen reimen, wie das alles hierher in die einsame Waldherberge komme? Der Wirt erschloß jetzt ein drittes Gemach, und die Wirtin warf das zweite Fettbrot hin, da schnappte Sprengalleband gleich hastig danach, und wie er noch daran kaute, warf die Frau die Türe in das Schloß und Sprengalleband war in der Schatzkammer gefangen.
Der Herr der drei Hunde aber merkte nicht, daß nur noch einer von den dreien bei ihm war. Er folgte, neugierig, noch mehr Wunderbares zu sehen, dem Wirte in das dritte Gemach, aber da sah es ganz abscheulich und schauderhaft aus. Die Wände waren mit Blut bespritzt; mitten im Zimmer stand ein Block, auf dem ein scharfes Metzgerbeil lag, man sah zerstückte Gliedmaßen von Menschen umherliegen, an der Wand hingen aufgeblasene Gedärme, um Wurst einzufüllen, auch standen Wiegemesser und kupferne Fülltrichter, für dieses Geschäft bereit und den Gesellen schauderte, der Wirt aber sprach mit harter Stimme:
»Mein Bursche, hier ist die Werkstätte. Hier wirst du dein Meisterstück machen, und bei mir bleiben, wo nicht, wirst du hier selbst massakriert, daß du es weißt. Entweder du zerhackst hier, und schneidest Griefen und wiegst, oder du wirst selbst zerhackt, zerschnitten und zu Wurst gewiegt.«
Dem armen Gesellen ward in der Seele bange bei dieser ihm gelassenen Wahl, doch faßte er Mut und sprach: »Lieber will ich sterben, als Euer Genosse sein!«
»Wie du willst!« sagte der Wirt. »Folge mir!« Und eröffnete wieder eine Türe, und jetzt warf die Frau das dritte Fettbrot hin, danach sprang hastig und hungrig der Hurtigundgeschwind, und schnapp, war die Türe im Schloß, und der gute Hund in der Blutkammer gefangen, während der Wirt mit dem Gesellen in eine düstere Halle trat, und zu ihm sprach:
»Jetzt sind wir im Schlachthaus, und jetzt schicke dich an, mein Wanderbursche, zur weiten Wanderschaft in die andere Welt.«
Der Geselle erschrak, denn er merkte wohl, daß der Wirt nicht spaße, und sah sich nach seinen drei Hunden um, die waren aber alle drei hinweg, und er war allein und hilflos.
»Willst du stehend oder liegend sterben?« fragte der Wirt, und hob ein blinkendes, schweres Beil. Der Geselle antwortete: »Ich will stehend sterben, vergönne mir nur so viele Zeit, ein Vater unser zu beten.«
»Meinetwegen, so bete!« antwortete gefühllos der schlimme Wirt.
Und der Geselle betete mit rechter Andacht, und da fiel ihm mitten im Beten das Pfeifchen ein, das die gute Alte ihm gegeben, die ihm die drei Hunde geschenkt, und gesagt hatte, er solle, wenn er in Not sei, und die Hunde nicht bei ihm wären, nur darauf pfeifen, bedachte sich daher auch keinen Augenblick, sondern pfiff, zu des Wirtes und der Wirtin großer Verwunderung.
»Heißt das gebetet, Bursche?« schrie der Wirt voller Wut, und hob sein Mordbeil, aber ehe er den tödlichen Streich führte, hatte ihn Hurtigundgeschwind, der wie ein Blitz ins Schlachthaus fuhr, im Nacken und riß ihn nieder und Sprengalleband und Reißebeiß waren nun auch schon da, und alle drei zerrissen den Wirt in tausend Stücken.
Die Wirtin aber fiel auf ihre Kniee, und schrie: »Gott Lob! Gott Lob! Nun bin ich erlöst!«
»Nein Weib!« rief jetzt zornig der Gesell. »Deine Stunde hat auch geschlagen. Helfershelferin des Menschenmetzgers, die meine Hunde heimlich fing, auf daß ich wehrlos in eurer Gewalt sei, ihr Teufelsbraten!«
»O seid barmherzig!« rief flehend die Wirtin. »Ich mußte ja den Willen des Wüterichs tun, der mich auch einst gefangen und hier fortwährend gefangen gehalten hat. O laßt mich leben! Ich will Euch auch eine goldene Dose schenken!«
»Ich danke, ich schnupfe nicht!« versetzte der Geselle.
»Ist auch nicht notwendig« erwiderte die Wirtin. »Aber jeder, der aus dieser Dose schnupft, wenn Ihr den Deckel nach rechts gedreht habt, muß so lange machtlos stehen, liegen oder sitzen bleiben, bis Ihr den Deckel nach links gedreht. Laßt mich leben, guter Geselle, um Gottes und um Eurer selbst willen, denn noch seid Ihr nicht außer aller Gefahr. Ich allein kenne den Aufenthaltsort der Spießgesellen meines Mannes, einer ganzen Bande Räuber, Mörder und Menschenfresser, vor denen Ihr trotz Eurer Hunde nicht sicher wäret.«
»Nun denn, ich will Euch leben lassen, Meisterin«, sprach der Jüngling: »doch hütet Euch wohl, mich hintergehen zu wollen!«
Die Wirtin dachte in der Tat nicht daran, den jungen Gesellen zu täuschen, da sie ihm wirklich ihre Befreiung dankte, sie und ihr Gesinde, das ebenfalls eine große Freude hatte, nicht mehr die entsetzliche Last zu tragen, dem Menschenschlächter untertan zu sein.
Die Frau des Hauses zeigte nun ihrem Befreier den Eingang zu dem verborgenen Schlupfwinkel der Mörderbande, in welchen man durch eine Falltüre gelangte. Diese Falltüre öffnete der junge Metzger und ließ seine drei Hunde hinein, welche unwiderstehlich waren, und der ganzen Raub- und Mordgenossenschaft die Hälse abbissen, daher sie mit sehr blutigen Schnauzen wieder herauskamen.
Der Gesell zeigte sich nun als Herr und betrachtete die Waldherberge als seine Eroberung. Er gab der Dienerschaft, insonderheit der mitleidigen Magd, die ihn gewarnt, von den Schätzen, sandte einen Knecht mit reichem Gute an die alte Waldmutter, welche ihm die drei Hunde geschenkt, eben so viel schickte er nach Hause zu seiner eigenen Mutter, der Wirtin ließ er nehmen, was und so viel sie wollte, die Falltüre zu der Mördergrube ließ er vermauern und die Waldherberge bis auf den Grund niederbrennen; darauf nahm er Abschied von der Frau Wirtin und zog mit seinen drei Hunden seine Straße.
Eigentlich hätte er heimkehren können, denn er hatte genug an Gut und Geld, und die Metzgerei hatte er verredet auf Zeitlebens aber er hatte seiner Mutter versprochen, drei Jahre in der Fremde zu wandern, und wollte nun auch ferner die Welt sehen, und etwas Tüchtiges lernen.
Da nun der gute Geselle mit seinen drei Hunden Reißebeiß, Sprengalleband und Hurtigundgeschwind seiner Straße weiter zog, und ein gutes Stück in die Welt hinein gewandert war, da begegnete ihm eines Tages eine Kutsche, die war ganz mit schwarzem Flor überhangen, und der Kutscher desgleichen und die Pferde ebenso, was sehr traurig aussah.
Und da blieb der Wandergeselle stehen, und sein Herz bewegte sich voll Trauer, und er sann, was das wohl möge zu bedeuten haben, daß ihm ein solches Fuhrwerk begegne? Der Kutscher aber war ein grober Schroll, der rief dem Gesellen zu: »Na Schlingel, was gibt es hier zu gaffen? Wirst du wohl aus dem Wege gehen, wenn eine Prinzessin gefahren kommt?«
Dieser unhöfliche Zuruf verdroß den guten Gesellen, und er rief Hurtigundgeschwind, dem Kutscher einigermaßen Mores (sind gute Sitten), zu lehren. Darauf sprang Hurtigundgeschwind, dem kein Mensch, auch der stärkste nicht, widerstehen konnte, hinauf auf den Bock, kriegte den Kutscher beim Kragen, schüttelte ihn wie einen Karnickel, riß ihn vom Bocke herab, und titschte ihn um und in einer großen Pfütze am Wege, davon er dreckig und triefend wurde, und setzte ihn dann wieder fein säuberlich auf den Kutscherbock.
Davon wurde der Kutscher so geschmeidig, wie ein Ohrwurm, und hätte gern seinen Tressenhut vor dem Gesellen abgezogen, wenn selbiger nicht drunten in der gelben Pfütze liegen geblieben wäre. Der Wanderbursche hielt nun dem Kutscher eine kleine Rede über die Regeln der Höflichkeit, welche Leute seines Gleichen nie aus dem Augen setzen sollten und dürften gegen Personen die zu Fuße gehen, weil möglicherweise eine oder die andere Person solcher Art sich statt eines zehn Kutscher halten könne, und sich für jede Kutschergrobheit eigentlich ein solches Bad in der Pfütze nebst einigen fühlbaren Rippenstößen gebühre.
Als diese Rede, die dem Kutscher gar nicht zusagte, wie viel sagend sie auch war, gehalten worden, sah der Geselle in den florumhangenen Glaswagen, und sah darin eine ganz schwarz gekleidete Prinzessin sitzen, die hatte sehr geweint, und da er sie darum ganz bescheidentlich fragte, so erzählte ihm die Prinzessin ihr Schicksal.
»Ich bin«, begann die ganz schwarz gekleidete Dame: »die Tochter des Königes dieses Landes, über welches der Teufel eine große Teurung und Hungersnot gebracht hat, und als man den selben befragte, ob er beides nicht unter irgendeiner Bedingung wieder von dem Lande nehmen wollte, so machte er die Bedingung, daß ich sein eigen werden solle. Da nun mein Herr Vater sein Land und Volk mehr liebt als mich und sich selbst, so hat er in diese entsetzliche Bedingung gewilligt, und du findest mich Ärmste jetzt auf dem Wege, schnurstracks zum Teufel zu fahren.«
»Aber schöne Prinzessin, warum seid Ihr denn so ganz allein?« fragte der Wandergeselle.
»Ja mein guter Jüngling«, antwortete die Prinzessin: »das kommt daher, daß kein Mensch mit wollte, ob schon meine Dienerschaft mir immerfort Treue bis zum Tod beteuert hat, das sind aber nur leere Redensarten gewesen. Nur der Kutscher war bereit mich zu fahren, weil derselbe schon des Teufels ist.«
»Habe das an seiner Grobheit gemerkt, meine schöne Prinzessin«, sprach der Wanderbursche; »und Euer Herr Vater, erlaubt mir diese Bemerkung, ist nicht so recht gescheit, andere täten so etwas nicht.
Wolltet Ihr mir aber erlauben, Euch Anstandes halber als einen diensttuenden Kammerherrn zu begleiten, so kann ich Euch vielleicht in Wahrheit den besten Dienst tun, und Euch aus den Klauen des Teufels losmachen.«
»Ach, das höre ich sehr gerne!« antwortete die Prinzessin. »Ja, du sollst mein lieber Kammerherr sein, steige nur zu mir herein, es reist sich ohnehin besser zu zweien, als einsam.«
Darauf stieg der Wandergeselle zu der schönen Prinzessin in den schwarzen Wagen, und unterhielt sie gut, und machte, daß sie lachte, und fuhren miteinander ganz lustig zum Teufel. Dieser saß auf einem Holzblock und wartete schon eine geraume Zeit, und war sehr erstaunt, zu sehen, daß die Prinzessin nicht allein kam.
Der Jüngling sagte: »Hochverehrtester Herr Teufel, ich hoffe, Ihr werdet ein vernünftiges Wort mit Euch reden lassen. Mich dauert diese arme und schöne Prinzessin sehr, gebt sie frei, und nehmt dafür meine Seele an.«
Der Teufel schlug einige Male rechts und einige Male links mit seinem Schweife um sich, als wenn er sich die Mücken weg wedeln wollte, und sagte: »Für dieses Mal könnte sich die Sache machen« er dachte aber in seinem Sinne, übers Jahr hole ich mir doch die Prinzessin »also Topp!«
»Topp!« sagte der Geselle. »Und da nichts zu trinken da ist, so schnupfen wir einmal darauf!« Damit zog er seine goldene Dose, drehte den Deckel nach rechts, schnippte mit dem Finger auf den Deckel, öffnete sie und bot sie dem Teufel dar.
»Eigentlich schnupfe ich nicht!« sagte der Teufel.
»Nun so schnupfe einmal uneigentlich! Es ist Doppelmops!« entgegnete der Geselle, und sein Herz lachte innerlich vor Freude, als der Teufel wirklich mit seiner haarigen Kralle in die Dose fuhr und eine tüchtige Prise nahm.
»So mein werter Herr Teufel!« nahm nun wieder der Geselle das Wort, in dem er die Dose wieder mit ihrem Deckel verschloß und in die Tasche schob: »jetzt können wir ein verständiges Wort miteinander reden, denn Ihr seid nun ein vollkommen gesetzter Mann.«
»Wie so gesetzt?« fragte der Teufel.
»Weil Ihr sitzt, und nicht mehr und nicht eher wieder aufstehen könnt, bis es mir beliebt!« erhielt er zur Antwort.
»Weiter fehlte mir nichts! Du Dummkopf!« schrie der Teufel, und wollte auffahren und dem Sprecher an das Genick, aber er konnte nicht, er mußte auf dem Holzblock fest, wie angenagelt, sitzen bleiben.
»Wie lange soll der dumme Spaß dauern?« fragte der Teufel in außerordentlicher Übellaune. »Ich bin das Sitzen schon müde. Mach es kurz das halte der Teufel aus, wenn er es kann!«
»Ich will dir etwas sagen, aber sei stät, hochwohlgeborener Herr Teufel!« spottete der Geselle. »Es kann dir bald geholfen werden. Du gibst diese Prinzessin frei, wie sich von selbst versteht; du gibst auch mich frei, und entsagst dem Anrecht auf meine Seele; du gelobst niemals wieder im Lande des Herrn Vaters dieser schönen Prinzessin Teurung und Hungersnot, Aufruhr oder sonst dergleichen Teufeleien anzustiften und anzuzetteln, und niemals eine Seele als Lösegeld dagegen zu verlangen, vielmehr dich mit den Seelen zu begnügen, die dir von selbst und freiwillig in deinen Höllenrachen gelaufen kommen. Endlich gibst du mir das alles eigenhändig und schriftlich, denn der Teufel traue dem Teufel, und sorgst dafür, daß ich dich niemals wieder zu Gesichte bekomme.«
Der Teufel ächzte und krächzte, schwitzte und krümmte sich, es half ihm aber dieses alles nichts. Immer gewohnt, stets los zu sein, quälte es ihn schrecklich, jetzt einmal nicht los sein zu können, und so bequemte er sich, in die Forderungen des Befreiers der Prinzessin einzuwilligen, worauf dieser nun wieder die goldene Dose hervor zog, den Deckel nach links aufdrehte, und höflich fragte: »Beliebt noch ein Prieschen? Es ist Marokko.«
Der Teufel aber schlug hin, daß aller Schnupftabak in die Luft flog und erhob sich von seinem Holzblock, und brauste wie ein Sturmwind von hinnen.
Darauf stiegen die Prinzessin und ihr Befreier wieder in ihren Wagen, und die Prinzessin war so sehr von Dank erfüllt, daß sie zu dem Gefährten sagte: »Höre du, ich will dich heiraten, weil du mich errettet hast!«
»Ist mir sehr angenehm zu hören«, versetzte der Jüngling: »nur wünschte ich noch ein Weilchen damit zu warten, weil ich erst in die Welt, und draußen etwas Tüchtiges lernen muß. Deshalb entlasst mich jetzt, meine schönste Prinzessin, in Zeit von einigen Jahren komme ich wieder, darauf verlasst Euch.«
Das mußte nun so der Prinzessin recht sein, obwohl es ihr gar nicht recht war, und als der erste Kreuzweg kam, stieg ihr Befreier aus, gab ihr seine Hand und küßte die ihrige, und sagte: »Wir sind verlobt und bleiben es! Traut fest, schöne Prinzessin, auf Euren Bräutigam.«
Der Kutscher, der die Prinzessin fuhr, hatte alles, was er sah, mit Mißmut und Ärger gesehen. Er besaß eine ganz nichtsnutze Seele. Den König hätte er am liebsten tot gesehen, und wäre gern selbst König gewesen; da man aber die Kutscher, und wenn sie die schönsten Staatskutschen noch so schön lenken zu können, sich einbilden, nicht zu Königen macht, so freute sich sein schwarzes Herz darüber, daß wenigstens die unschuldige Königstochter untergehen sollte, und da dies nicht geschehen war, so war er mindestens auf seinen Vorteil bedacht, daher hielt er an, stieg vom Bock, öffnete den Kutschenschlag und sprach hinein zur Prinzessin:
»Mein allergnädigstes Prinzeßchen! Sintemal und alldieweil Höchst-Dieselben nun befreit sind, so hätte ich auch eine kleine Bitte, bitte daher nichts für ungut zu nehmen, wenn ich so mit der Türe ins Haus falle; ich möchte gar zu gerne heiraten!«
»Dagegen habe ich gar nichts einzuwenden, mein lieber Kutscher. Aber will Ihn denn jemand?«
»Die schätzbare Person, welche ich zu heiraten wünsche, sagte mir, sie habe nichts dagegen einzuwenden!« antwortete der Kutscher.
»Nun gut, so nehme Er sie!« versetzte die Prinzessin.
»Nun gut, so nehme ich Sie!« erwiderte der Kutscher.
»Wen denn eigentlich?« fragte die Prinzessin.
»Nun denn Sie! Sie haben es ja gesagt!« entgegnete der Kutscher.
»Ich glaube, Er ist verrückt!« schrie die Prinzessin außer sich vor Entsetzen.
»I Gott bewahre!« versetzte der Kutscher. »Im Gegenteil, Prinzeßchen, ich glaube dies nicht im entferntesten. Wozu viele Worte? Sie sagen zu Hause, daß ich es war, der Sie befreite, und heiraten mich! Wollen Sie das nicht, so fahre ich Sie nicht nach Hause, sondern wieder zum Teufel. Und damit Punktum!«
Da gab die arme Prinzessin klein bei und weinte wieder, und fuhr nach Hause. Da war aber ein Jubel über ihre Heimkunft, der war grenzenlos, und als es nun vollends laut wurde, der Kutscher habe die Prinzessin befreit und werde von ihr zum Danke gefreit werden, da kannte der Jubel keine Grenzen mehr.
Eine so herablassende volkstümliche Prinzessin hatte es noch nie gegeben, weder die alte noch die neue, weder die heilige noch die Profangeschichte lieferten ein Seitenstück zu solchem Bündnis Paläste und Hütten wurden illuminiert, die Vivats nahmen kein Ende, und viele Personen, die in Kutschen fuhren, wurden damals umgeworfen, denn alle Kutscher hatten sich vor Freude betrunken und ihre Köpfe so hell illuminiert, daß sie die Prallsteine für glatte Fahrgleise ansahen.
Nun wurden die Vorbereitungen zur Hochzeit getroffen, welche jedoch die Prinzessin immer von einer Zeit zur anderen hinaus schob. Sie verdarb ihre Brautkleider, sie wurde krank, sie erfüllte fromme Gelübde, sie wartete auf einen Schmuck, der erst vom Morgenlande kommen sollte, und hoffte mit sehnender Seele stärker und stärker auf die Wiederkehr ihres geliebten wahren Bräutigams.
Der Kutscher aber wurde sehr ungeduldig und klatschte viel aus Ungeduld mit seiner Peitsche. Endlich mußte ein Tag der Hochzeit doch festgesetzt werden, und schon kam dessen Vorabend und der Wandergeselle kam nicht. Herzeleid und Wehklagen. Die Prinzessin ließ im Hoftheater das rührende Drama Lenore aufführen, und vergoß viele Tränen bei dem herzbrechenden Liede:
Es flammen am Altare
Die Kerzen wundersam;
Der Brautkranz schmückt die Haare,
Wo bleibt der Bräutigam?
Während aber selbiges herzbrechendes Lied gesungen wurde, war der wahre Bräutigam schon da, und war in Begleitung seiner drei Hunde im Gasthofe ersten Ranges der Residenz abgetreten, freilich aber nicht wie ein Gast ersten Ranges, vielmehr als zerlumpter Bettler und Strolch, und der Wirt hatte nahezu Lust, ihn von seinen Kellnern zur Türe hinaus schmeißen zu lassen, als der anscheinende Bettler einen Dukaten auf den Tisch legte, und dem Wirte zuflüsterte:
»Mein guter Freund, ich bin ein Hochzeitgast! Schafft mir einen Barbuzium und einen Schneider. Morgen am Hochzeittage hoffe ich, so Gott es will, die Ehre zu haben, mit der jungen Königin ein Glas Wein zu trinken.«
Der Wirt maß mit seinen Blicken den Lumpazivagabundus, den er vor sich sah, vom Kopfe bis zur Zehe, und sprach: »Nichts für ungut, guter Freund! Du scheinst mir aus einem Lande zu kommen, wo man keine Hundesteuer zahlt, und wo die Hunde von der Luft leben. Ich unterfange mich nicht, schlechte Witze zu machen, und zu sagen, du seist sehr auf den Hund. Gleichwohl besticht mich dein armseliger Dukaten nicht; Gott mag wissen, auf welcher grünen Wiese du den gefunden hast; in dessen zu einem Abendimbiß für dich und die drei Hunde, und auch noch zu einem Nachtlager reicht er aus. Du wirst aber morgen so wenig Wein mit der königlichen Prinzessin Braut trinken, als ich, ja noch viel weniger, denn ich bin doch der Hofweinlieferant, ich kann daher eher den nämlichen Wein trinken darauf wette ich all mein Hab und Gut, samt Gasthaus- und Schenkgerechtigkeit.«
»Wirt, schwatze nicht zu viel! besorge hübsch meine Befehle! Die Wette steht!« sprach ganz kurz der Gast, forderte Velinpapier und feines Siegellack, schrieb und siegelte rasch einen Brief an die Prinzessin, hielt dem erstaunten Wirte die Aufschrift unter die Augen, schlug den Brief in ein Zeitungsblatt, und gab ihn dem Hurtigundgeschwind ins Maul, der damit fort schoß.
Jetzt kamen der Barbier und der Schneider. Der Fremde ließ sich sauber scheren und zwagen, und vom Schneider in Samt und Seide kleiden, und legte bloß Goldstücke auf den Tisch mit dem stummen Bedeuten, jeder möge sich nehmen, was er glaube, daß ihm gebühre. Der Schneider glaubte, ihm gebühre viel, folglich nahm er viel, der Barbier aber wollte gerne wieder auf das Goldstück herausgeben, er hatte jedoch kein einzelnes, und da winkte der Gast wieder, er möge es nur ungewechselt behalten.
Am anderen Morgen wurde die ganze Residenzstadt voll von der Kunde, daß ein Herr im ersten Gasthof wohne, der viel freigebiger sei, wie der König, wozu im Vertrauen sei dies gesagt nicht viel gehörte.
Wie froh war aber die gute Prinzessin geworden, als sie Hurtigundgeschwind in den Saal springen und ihn einen Brief in ihren Schoß legen sah, während alles vor dem großen und seltsamen Briefpostcourier erschrak, zumeist aber der falsche Bräutigam, der Kutscher.
Er dachte sich: wo der ist, da ist sein Herre auch nicht weit, und verzog sich ganz leise, woran er sehr wohl tat, sonst hätte ihn der Hund zerrissen.
Am anderen Morgen hielt eine königliche Kutsche vor dem Gasthof; ein Hoflakai öffnete den Schlag, ein besternter Kammerherr stieg aus und fragte nach dem fremden Herrn, der gestern gekommen sei, und dem Wirte fiel das Herz in die Kniekehle, denn er hatte sein Hab und Gut, samt der Schenkgerechtigkeit verwettet. Der fremde Herr aber fuhr zur Rechten des Kammerherrn im Wagen sitzend nach Hofe.
Bei Hofe war nun große Freude; der wahre Bräutigam gefiel dem volkstümlichen Könige noch besser, wie der Kutscher, da der selbe sich sehr gut zu benehmen wußte, und sich schon durch die Befreiung der Prinzessin am besten benommen hatte.
Die Hochzeit hatte daher ihren ungestörten Fortgang. Dem Wirte schenkte der glückliche Bräutigam die an ihn verlorene Wette, und den Kutscher, den er durch Reißebeiß, Sprengalleband und Hurtigundgeschwind sehr leicht hätte einfangen und holen lassen können, wobei der selbe sehr übel gefahren wäre, ließ der edle Bräutigam laufen.
Mit abermaliger reicher Gabe aber bedachte er die alte Waldmutter, und seine eigene Mutter ließ er in einer goldenen Kutsche holen und behielt sie bei sich bis an ihr Ende. Als alles zu einem guten Ziele gelangt war, verschwanden die drei Hunde, und niemand wußte, wohin sie gekommen waren, und auch das Pfeifchen war fort, so daß man die Hunde auch nicht wieder herbeirufen konnte, welches auch nicht nötig wurde, da sich kein Teufel mehr um das Land des alten und des jungen Königs bekümmerte.
VOM KNABEN, DER DAS HEXEN LERNEN WOLLTE ...
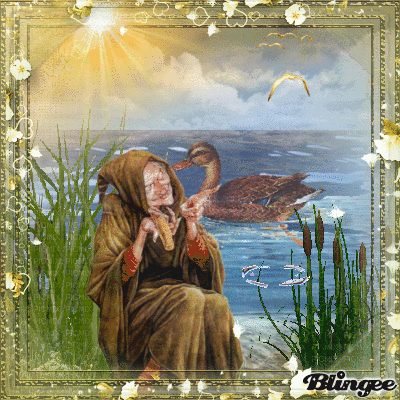
Es war einmal ein Knabe, der hatte vieles gehört von der Hexenkunst, wollte sie auch gern lernen. Wen er aber darum fragte, der sagte, daß er solche Kunst nicht kenne und nicht könne, und auch nichts von ihr wissen wolle. Da ging der Knabe ganz allein in einen dunkeln Wald, und rief mehr denn einmal recht laut: »Wer lehrt mich das Hexen?« und da schallte es wie antwortend an mehreren Stellen des tiefen Waldes: »Hexen! Hexen!«
Und nach einer Weile kam ein uraltes Weiblein durch das Gebüsche gekrochen, das keinen Zahn mehr im Munde und schrecklich rote Augen hatte. Ihr Rücken war gekrümmt, ihr Haar war weiß, und hing ihr wild um den Kopf herum, und wehte im Winde. Ihre Stimme klang wie die Stimme des Vogels Kreideweiß, wenn er ruft: »komm mit!« und geradeso rief auch das alte Weib dem Knaben zu, und winkte ihm zu folgen, sie wolle ihm das Hexen lehren.
Der Knabe folgte ihr und sie führte ihn immer tiefer in den Wald hinein, und zuletzt auf ein sumpfiges Erlenmoor, darauf eine graue, unscheinbare, halb verfallene Waldhütte stand. Die Wände waren von Torfziegeln ausgeführt, und mit Moos austapeziert; das Dach war mit Schilf gedeckt. In der Waldhütte war niemand als ein hübsches junges Mädchen, welche Lieschen hieß; die Alte sagte aber nicht, ob es ihre Tochter oder ihre Enkelin sei; außerdem waren nur noch drei große Kröten vorhanden, und über dem niederen Herde hing ein Kessel, darinnen eine Brühe kochte, wie Gänseschwarz, Hasenpfeffer, oder sonstiges Schwarzsauer mit Fleischknöchlein darin.
Die alte setzte eine Kröte vor die Türschwelle, daß sie Wache halte, die zweite Kröte schickte sie auf den Boden, daß sie dem Knaben eine Lagerstatt bereite, und die dritte Kröte stellte sie auf den Tisch, daß sie leuchte. Diese Kröte tat ihr Bestes im Leuchten, doch wie auch ihre Äugelein im grünlichen Schimmer flammten, so brachte sie es kaum dahin, so hell zu leuchten, wie ein Glühwurm, daher auch der Haß kommt, den die Kröten gegen die Glühwürmer haben.
Nun aßen die Alte und das Lieschen aus dem Kessel ihre Abendmahlzeit, und der Knabe sollte auch essen, aber er graulte sich, denn es kam ihm vor, als ob die Knöchlein Finger und Zehen von Kindern wären. Er klagte, daß er sehr müde sei, und wurde auf sein Strohlager gewiesen, wo er bald mit dem Gedanken einschlief, am anderen Morgen werde nun seine Lehrzeit in der Hexenkunst angehen, und daß es sehr hübsch sein werde, wenn das kleine Lieschen ihm darin Unterricht geben wolle.
Die alte Hexe aber zischelte dem Mädchen zu: »Wieder einen gefangen! Ein hübscher Braten, morgen wecke mich recht früh, ehe die Sonne aufgeht, da wollen wir ihn schlachten und was wir nicht gleich braten, einpökeln.«
Jetzt gingen die beiden auch schlafen, aber Lieschen fand keinen Schlaf, der schöne Knabe dauerte sie gar sehr, daß er auch sterben sollte, und sie stand von ihrem Lager auf und trat an das seine, und sah, wie schön rot seine Wängelein waren, und wie blond sein gelocktes Haar, und daß seine Augen blau waren, wie Vergißmeinnicht, das hatte Lieschen nicht vergessen.
Und es graute ihr vor ihr selbst, daß sie gezwungen war, der alten bösen Hexe zu dienen, die sie schon lange, als sie noch ein ganz kleines Kind war, ihren Eltern geraubt und in den tiefen Wald geschleppt hatte, und hatte das Hexenwerk lernen müssen, wie man pfeilschnell durch die Luft eilt, wie man sich unsichtbar macht, wie man sich in andere Gestalten verwandelt, und als sich nun Lieschens Herz in voller Zuneigung zu dem Knaben bewegte, so beschloß das Mädchen, ihn wo möglich zu erretten.
Sie weckte ihn daher ganz leise, und flüsterte ihm zu: »Lieber Knabe, erhebe dich und folge mir! Hier wartet deiner nur der Tod.« »Soll ich denn hier nicht das Hexen lernen?« fragte der Knabe, welcher Friedel hieß.
»Besser ist dir, wenn du es nimmermehr lernst; außerdem hast du noch Zeit genug dazu«, antwortete Lieschen, »jetzt säume nicht fliehe, und ich will mit dir fliehen.«
»Mit dir gehe ich gerne, liebes Mädchen«, sprach der Knabe: »und bei der häßlichen Alten mit ihren garstigen Kröten möchte ich nicht bleiben.«
»So komm denn!« sprach Lieschen, und öffnete leise das Häuschen, und sah nach, ob die Alte schlief; die schlief noch, denn es war noch halb Nacht, und lange nicht Morgen.
Jetzt trat Lieschen mit Friedel aus dem Häuschen, und Lieschen spuckte auf die Schwelle, worauf sie beide rasch von dannen eilten. Durch das Öffnen und Wiederschließen der Türe war aber doch ein kleines Geräusch entstanden, und weil alte Leute sehr leise schlafen, so erwachte die Hexe, und rief: »Lieschen! Stehe auf! Ich glaube, es wird bald Tag.« Da rief der Speichel auf der Schwelle vermittelst eines Hexenzaubers, den Lieschen verübt: »Ich bin schon auf! Ruhe nur noch, bis ich das Hüttchen gekehrt, und Laub und Holz zum Feuer zusammen gelesen habe.«
Nun blieb die Alte noch ein Weilchen liegen, während die Fliehenden unaufhaltsam von dannen eilten; jene konnte aber nicht wieder einschlafen, und rief abermals: »Lieschen, brennt das Feuer?«
Da antwortete abermals der Speichel auf der Schwelle: »Es brennt noch nicht, das Laub ist feucht das Holz raucht ruhe noch ein Weilchen, bis ich das Feuer angeblasen habe.«
Die Alte ruhte noch eine kurze Zeit, während die Fliehenden immer mehr sich von ihrer Hütte entfernten. Unterdes ging die Sonne auf, da fuhr die Alte, die ein wenig eingenickt war, mit beiden Beinen zugleich aus dem Bette, und schrie: »Satanskind! Die Sonne geht auf, und du hast mich nicht geweckt. Wo steckst du?«
Auf diese Frage bekam die Alte keine Antwort, denn die Sonne hatte den Speichel auf der Schwelle vertrocknet und nun fuhr die Hexe im Hause herum, wie ein Wirbelwind. Der Knabe war fort, und Lieschen war fort, und die Hütte war nicht gefegt, es lag nicht Laub, nicht Holz auf dem Herde. Die Alte war wütend.
Sie ergriff einen Besenstiel, und rannte aus dem Hause. Sie schlug mit dem Besen an die Türe, da ward das Häuschen unsichtbar; sie trat auf einen Bovist, da wallte eine Wolke empor; sie setzte sich auf ihren Besenstiel, und fuhr als Wolke in die Luft. Da sah sie, nach welcher Richtung die Flüchtlinge flohen, und mit Windeseile flog die Wolke ihnen nach.
Lieschen aber sah sich auf der Flucht beständig um, denn sie kannte die Künste der alten Hexe, und sprach jetzt zu Friedel: »Siehst du dort am hohen Himmel die braune Wolke? Das ist die Hexe, die uns nachfährt; wir können nicht weiter fliehen, sie wird uns bald einholen. Jetzt lasse mich meine Kunst brauchen. Ich will ein Dornstrauch werden, und dich als eine Schlehe tragen.«
Plötzlich war Lieschen ein Schlehendorn, der viele Früchte trug, und an einem Raine stand, und die unterste Beere, das war Friedel. Die Hexe bekam auf ihrer Luftfahrt großen Durst, und als sie den Schlehendornstrauch mit den vielen Früchten sah, sprach sie zu sich selbst: die Luft ist trocken und zehrt ich muß mich herablassen und ein paar Schlehen essen.
Dieses tat sie dann, und pflückte eine Beere nach der anderen, und sagte: »Sauer macht lustig.« Jetzt waren die Beeren alle verzehrt, bis auf die letzte, welches der Friedel war, und das wußte die schlimme Alte recht gut, sie krallte mehrmals danach, aber der Dornbusch stach sie tüchtig in ihre langen, dürren Finger aber sie kehrte sich nicht daran, sie gab sich rechte Mühe, die in Dornen ganz versteckte letzte Schlehe zu erhaschen, da fiel die Schlehe ab, und rollte den Rain hinab, und da wurde plötzlich der Dornbusch zu einem Wasser, und die Beere zu einem kleinen Entrich, alles durch Lieschens Zauberkunst, die sie von der Alten gelernt hatte.
Da warf die Alte einen ihrer Pantoffel in die Luft, der wurde als bald ein großer Raubvogel, und stieß auf den Entrich, dieser tauchte schnell unter, und sowie der Raubvogel mit seinem Schnabel das Wasser berührte, schlug dieses eine Welle, die ihn faßte und ersäufte, worauf der Entrich wieder auftauchte.
Wütend schleuderte die Alte ihren zweiten Pantoffel in das Wasser, der wurde ein Krokodil, und schoß nach dem Entrich hin, ihn zu erschnappen, da flog der Entrich in die Luft, und ließ sich an einer anderen Stelle wieder in das Wasser nieder; das Wasser aber, welches dem Krokodil in den Rachen drang, wurde zu Stein, da wurde das Krokodil so schwer, daß es unter sank.
Jetzt legte sich die alte Hexe platt an den Rand des Wassers, um das selbe weg zu trinken, denn ohne das Wasser hatte der verzauberte Entrich keinen Boden mehr. So wie er das Land berührte, mußte dieser Entrich die vorige Gestalt wieder annehmen.
Nicht lange aber hatte die Alte getrunken, da verwandelte sich das Wasser in ihrem Leibe in Feuer, und da tat es einen Knall, als ob die Hölle platze. Die Hexe war zerplatzt, der Entrich war wieder der schöne Knabe, das Feuer wurde zum Lieschen, und dann blieben beide miteinander treu verbunden.
Wie der Knabe das Lieschen fragte, ob es ihm das Hexen lehren wollte lachte Lieschen und sagte: »Du kannst es ja schon, du hast ja mich behext.«
DAS TAPFERE BETTELMÄNNLEIN ...

Es war einmal ein gar armer Schlucker, der stand in nächster Verwandtschaft mit dem all bekannten Herrn von Habenichts, und war ein Gevatter zum Herrn von Tuenichts, und die Arbeit war ihm äußerst verhasst. Alles was er tat, war, daß er gern schöne Märchenbücher las, darinnen so viele Märchen stehen, in denen die Menschen reich werden sonder Mühe, und der Weg beschrieben ist, der zum Schlaraffenlande führt.
Das liebste Märchen aber von allen war dem armen Schlucker doch das »vom tapferen Schneiderlein«. Solch ein Held, meinte er, könnt er auch sein was gälte es wenn sich nur die gute Gelegenheit böte! Und siehe selbige Gelegenheit bot sich. Der junge Bettler ging durchs Hochgebirge, und kam auf eine Alm und bettelte da.
Was konnte der Senn ihm reichen? Da gibt es keine Pfennige und Kreuzer, keine Semmeln und keine Würsteln. Ein Stück Schabzieger (Käse) das war alles, was er bekam, und etwa als Draufgabe noch ein paar liebenswürdige Redensarten von jungem Tagedieb, Taugenichts, Landstreicher und Tunichtgut deren so viele, daß sich der Bettler förmlich schüttelte, als er von der Kaserhütte weg ging.
Als der junge Gergänger von der Alm niederstieg, sagte er: »Da droben ist Dürrhof, da hinauf bringen mich zehn Pferde nicht wieder!« Zog das Stück Schabzieger hervor, legte es neben sich auf einen Stein, ruhte aus, und betrachtete sich die Welt mit weit offenem Maule, als warte er, daß eine gebratene Taube geflogen kommen und stracks hinein fliegen solle.
Selbe Taube blieb aus, aber auf den Schabzieger setzte sich, vom guten Geruch angelockt, eine Menge Fliegen, und da dachte das Bettelmännlein an den Apfel und die Fliegen im Märchen vom tapferen Schneiderlein nahm seinen Hut, schlug drauf und schrie als bald erfreut: »I hub's, i hub's! Sieb'n auf anen Streich!«
Als bald schrieb er auf einen Zettel mit großen Buchstaben in vornehmer, hochdeutscher Schrift, ganz wie das tapfere Schneiderlein getan: »Sieben auf einen Streich!« befestigte selben Zettel am Hut, und stolzierte nun in das erste Dorf hinein.
In diesem Dorfe war große Verlegenheit und Furcht. Im ganz nahen Walde hauste ein greulich großer, starker und wilder Bär, der vielen Schaden tat am Vieh, an Bienenstöcken und den niemand zu fangen oder zu fällen vermochte. Da zog auf einmal der Held durchs Dorf, der an seinem Hut die prahlende Schrift trug: »Sieben auf einen Streich.«
»Was gilt es, der ist unser Mann, Held, Retter und Befreier!« sprachen die tapferen Bäuerlein. »Sieben auf einen Streich? Da kann er auch einen, einen Bären nämlich, auf sieben Streiche fällen, das kann er ganz nach seinem Belieben halten.« Und boten dem Bettelmann ein gutes Stück Geld, so er des Bären mächtig würde, und das Fell sollte auch sein gehören, und vom Bärenbraten sollte er mit essen dürfen.
»Mir schon recht!« sagte das Bettelmandl, »mit dem Viech werde ich kurzen Prozeß machen. Hui! Hui! So ist er tot.«
Die Bäuerlein staunten über die Courage des Helden, und zeigten ihm den Weg nach dem Walde, hüteten sich aber gar wohl, selbst mit hinein zu gehen. Der Held aber schwitzte Angstschweiß, als er so mutterseelenallein im finstern Walde war, und das Herz sank ihm in die Kniekehle, als er von weitem ein Gebrumme hörte, daß gar keinen Zweifel aufkommen ließ, ob es etwa nicht das Gebrumme des Bären sei.
Hilf Himmel, was gibst du, was hast du! Wie zog das hasenherzige Fliegentöterlein aus, durch dick und dünn, in banger, keuchender Flucht, und der Petz zottelte gemütlich hinter ihm her, und begriff gar nicht, warum der Mensch da vor ihm so schrecklich laufe.
Da stand eine Hütte am Wege, in die sprang der Bettler, und drückte sich hart an die Türe, die er aufließ gleich darauf kam der Bär auch hinein, und lief nach der entgegenstehenden Wand schwuppdich! sprang der Bettler bei der Türe wieder heraus, warf die Hüttentüre in das Schloß, zog den Schlüssel ab, sorgte, daß der Bär nicht durch ein Fenster entfliehen konnte, und ging wieder nach dem Dorfe.
Die Bäuerlein, die ihn von weitem stolzierend kommen sahen, sprachen untereinander: »Schaut, gefressen hat ihn der Bär nicht, das ist schon ein gutes Zeichen. Von uns wäre keiner wiedergekommen. Ob er ihn aber erlegt hat? Das ist die große Frage.«
Bald war das Bettelmännlein umringt, und warf sich in die Brust wie ein Volksredner, räusperte sich und sprach: »Freut euch Freunde: Der Sieg ist unser! Ich habe das wilde Ungeheuer gefangen, für den Fall, daß ihr ihm vielleicht wollt Tanzstunde geben, und es dann für Geld sehen lassen, dann werdet ihr mir für das zugesicherte Fell billige Vergütung leisten.«
»Ach was Tanzstunde? Was um Geld sehen lassen? Totgeschlagen wollen wir ihn sehen!« riefen die Bäuerlein, bewaffneten sich, und rückten unter Anführung des tapfern Bettelmännleins nach der Waldhütte, in welcher Bruder Petz gefangen war, und dabei durch sehr starkes Brummen Zeugnis von äußerst übler Laune ablegte, so daß alle Bäuerlein eine Gänsehaut überlief.
Sie kannten und vermochten auch keinen Rat zu ersinnen, was nun anzufangen, denn schlossen sie die Türe auf, und gingen hinein, so biß der Bär sie tot, und gingen sie nicht hinein, so ging der Bär heraus, und die alte Not ging von neuem an.
»Ihr seid halt Helden!« spottete das tapfere Bettelmännlein, ließ sich eine doppelt geladene Flinte reichen, und schoß durchs Fenster den Brummbär tot worauf alle Bäuerlein schrien:
»Vivat! Er lebe! nämlich nicht der Petz, sondern der Held, Retter und Befreier.«
Wie das Bettelmännlein sein Geld und den Bärenpelz hatte, den es gleich wieder an einen reichen Bärenhäuter des Dorfes verkaufte, fiel den Bäuerlein noch etwas ein, und sie sprachen: »Tapferer Held, Retter und Befreier! Uns drückt noch ein Leiden. Droben im Gebirge haust ein wilder Mann, mit einer wilden Fangga, die ist seine Frau. Die plagen uns allewege gar zu sehr, und wir müssen ihnen Zinsen und Zehnten über alle Gebühr, und tun wir es nicht, so werfen sie uns Mühlsteine auf unsere Dächer und schicken uns Schlaglawinen und Wildbäche und Schlammbäche auf den Hals, daß wir noch tausendmal übler daran sind.«
Da schnitt das tapfere Bettelmandl schier ein zorniges Gesicht, und schnauzte die Bäuerlein an, wie ein Landrichter: »Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Sakra! Da hätte ich mich nicht brauchen erst mit dem lumpigen Bären aufzuhalten, den ich, was mir etwas ganz leichtes war, mit den Händen fing, und an seinen Ohren in die Waldhütte zog. So ein Ries, so ein wilder Mann, ha, das ist mir rein gar nichts. Werdet's schauen, wie ich dem heimleuchte mit samt seiner wilden Fangga, dem z'nichten Weibsbild!«
Die Bäuerlein erschraken fast vor der übergroßen Courage des Bettelmännleins; sie zogen ihre Mützen vor ihm ab, und standen voller Ehrfurcht um den Gewaltigen. Sie beratschlagten und sagten, wenn er sie von dem wilden Manne und der wüsten Fangga befreie, so wollten sie ihm aus dem Gemeindevermögen ein Bauerngut kaufen, und wollten ihm das Nachbarrecht schenken, und ihn zum Bürgermeister auf Lebenszeit wählen, und er solle niemals wieder von ihnen weg ziehen. Ob er das zufrieden, und ob es ihm genug sei?
»Ja, selbes bin ich wohl zufrieden, und ist mir genug!« anwortete das Bettelmandl. »Und jetzt drauf! Gott sei dem Riesen gnädig, wenn ich über ihn komme!«
Die Bäuerlein zeigten ihrem Helden den nächsten Fußpfad hinauf ins Gebirge, und er schritt tapfer fürbaß, und war froh, als er allein war, und keiner mehr um ihn. »Kriegt die Kränk mit euern Riesen!« rief er. »Ich hab genug am Geld für den Bärenfang und das Bärenfell. Ich gang übers Gebirg, mich seht ihr nimmermehr!«
Aber der Held ging nicht übers Gebirge, denn auf der Höhe, wo der letzte Wald aufhörte, stieß er auf den wilden Mann. Ach, wie ward ihm da so Angst und Bange, wie war es aus mit Herzhaftigkeit und Heldentum! Flinke Beine das war die einzige Hilfe.
Das Bettelmännlein läuft rasch zurück, der wilde Mann hinter ihm her. Wie der Riese im besten Rennen ist, wendet sich das Mandl um, und kommt dem Riesen, der das gar nicht gewahr wird, zwischen die Beine, da stürzt der Riese hin, so lang er ist, und fällt in eine Klamm (Felsschlucht), und kann nicht wieder heraus.
Da schreit er dem Mandl zu: »Ich will dir nichts tun, aber lauf auf zu meiner Frau, und laß dir einen Keil geben!« »Gleich « sagt das Mandl und läuft zur wilden Fangga, und begehrt den Geldsack; ihr Mann hab es so befohlen. Die Fangga glaubt es nicht, und schreit zur Klamm hinunter: »Soll ich ihn geben?« »Freilich! Nur geschwind!« schreit der Riese, da gibt die Fangga dem Bettelmandl den Geldsack, und der macht sich damit über die Höh.
Der wilde Mann brüllt immer noch die Fangga kommt und befreit ihn, und bekommt viele Keile, daß sie den Geldsack hergegeben, statt eines Keils, darauf rennt der Riese dem Räuber nach. Der ist unterdessen bei Schäfern vorbei gekommen, hat ein Lamm genommen, hat es unters Hemd versteckt, und im Laufen dem Lamm den Bauch aufgeschnitten, und die Gedärme herausgeworfen welches letztere die Schäfer mit Grausen gesehen haben.
Jetzt kommt der wilde Mann und fragt die Hirten, ob sie keinen Mann hätten vorbei laufen sehen? »O ja « sagten diese; »er hat sich ein Messer in den Bauch gestoßen, und seine Gedärme herausgeworfen, damit er desto schneller laufen konnte.«
»Selbes Kunststück hätte ich eher wissen sollen!« brüllte der wilde Mann, zog sein Messer, schnitt sich den Bauch auf, lief, stürzte hin und war tot. Das Männlein stand nicht weit davon und sah ihn stürzen.
Nun ging es zurück zu den Bäuerlein, noch ganz blutig, schwang sein Messer, und rief: »Das war ein schwerer Sieg! Das ging auf Tod und Leben. Droben liegt er! Mit diesem kleinen Messer hab ich ihm den ganzen Leib aufgeschlitzt.«
Da jubelten die Bäuerlein, und schrien ein Vivat übers andere dem Helden, Retter und Befreier.
VOM EDLEN RITTER TANNHÄUSER ...
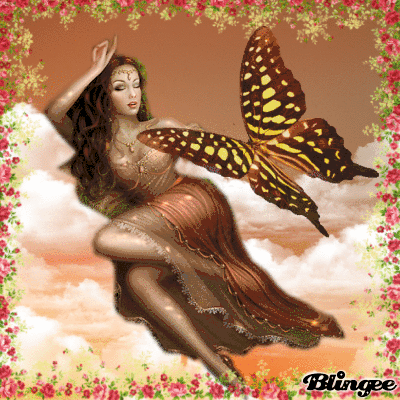
Da Ludwig der Milde, Landgraf von Thüringen, auf einem Kreuzzug im Morgenlande gestorben war, hinterließ er keine Kinder, und das Land fiel an seinen Bruder Hermann.
Zu dessen Zeiten blühte in deutschen Landen der Minnesang und ward geübt und geliebt von Fürsten und Edeln, und Fürst Hermann versammelte viele Sänger zu seinem glänzenden Hofhalt auf der Wartburg. Eine Zeit nach ihm lebte auch ein Minnesänger im Frankenlande, der führte wie die meisten seiner Sanggenossen ein Wanderleben.
Da habe ihn, als er am Hörseelenberge vorüberzog, die Erscheinung eines wunderholden Frauenbildes aufgehalten, das sei niemand anders als eben Frau Venus selbst gewesen, und ihm gewinkt, ihr in den Berg hineinzufolgen, und obschon auch ihn der treue Eckart gewarnt, habe der Ritter doch nicht zu widerstehen vermocht und sei hineingegangen und habe sich von Frau Venus umstricken lassen und habe ein ganzes Jahr im Berge verweilt.
Viele alte Lieder singen und sagen, wie nun die Reue über den Tannhäuser gekommen, daß er sich besonnen und in sich gegangen und habe wieder aus dem Berge heraus begehrt. Als er solches nun äußerte, erinnerte Frau Venus ihn an seinen Eid, den er ihr geschworen hatte, allein Tannhäuser leugnete ihr solches in ihr schönes Gesicht hinein.
Darauf erbot sie sich, ihm eine andere Gespielin statt ihrer zu geben, aber er sprach, so er solches täte, müsse er ewig ob solcher Vielweiberei in der Glut der Hölle brennen. Da lachte Frau Venus hell auf und fragte ihn, was er doch von der Hölle Glut schwatze. Ob er diese je bei ihr empfunden habe? Ob nicht ihr roter Mund zu allen Stunden ihm freundlich zugelacht?
So ging der Streit noch eine Weile fort, bis Tannhäuser in seiner Undankbarkeit für alles Liebe und Gute, was Frau Venus an ihm getan, sie eine Teufelin schimpfte.
Das nahm Frau Venus endlich übel und drohte, es ihm entgelten zu lassen. Da schrie der Tannhäuser die Jungfrau Maria an, ihm von dem Weibe zu helfen, und da sprach Frau Venus mit Stolz: Nun könne er hin gehen, er möge sich nur bei dem Greise beurlauben - er werde dennoch ihr Lob noch preisen.
Nun ging der Tannhäuser reuevoll aus dem Venusberge und wallete gen Rom zum Papst Urban, dem klagte und beichtete er seine Sünden und bekannte, daß er bei einer Frau mit Namen Venus ein Jahr lang gewesen. Der Papst hielt in seiner Hand den hohen Stab mit dem römischen Doppelkreuze und sprach zu dem reuigen Sänger: So wenig der dürre Stab hier grünet, kommst du, der du bei des Teufels Hulde warst, zu Gottes Hulde!
Vergebens flehte der Tannhäuser, ihm eine jahrelange Buße aufzuerlegen, dann zog er wieder aus dem ewigen Rom voll Leid und Jammer und klagte bitterlich, daß des Papstes hartes Wort ihn auf ewig von Maria, der himmlischen Huldin, scheide, daß Gott ihn nicht annehme, und verwünschete sich wieder zu Frau Venus in den Hörseelenberg.
Die stand schon da und lachte hell und spottete ihm entgegen recht teufelisch: Seid gottwillkommen, Tannhäuser, mein lieber Herr, ich hab Euer recht lang entbehrt, mein auserkorener Buhle!, und lachte noch einmal und riß ihn durch die Höhlenpforte mit sich hinab.
Aber am dritten Tage danach, da hub des Papstes Stab an zu grünen, und nun sandte der Papst Boten aus in alle Lande, wo der Tannhäuser hin gekommen wäre - der war aber wieder in dem Berg bei seinem schlimmen Lieb, und deshalb ist der Papst Urban der Vierte auch mit in die ewige Verdammnis gefallen, wie das alte Tannhäuserlied schließt:
Des mußt der vierte Papst Urban
Auch ewiglich sein verloren.
Denn er hatte selbst, bevor er Papst wurde, mit einem Weibe im Bistum Lüttich, genannt Frau Eva in der Klause, die im abergläubischen Müßiggang sich verschlossen hielt, in sonderlicher Freundschaft gestanden und ihr zuliebe das Fronleichnamsfest gestiftet; er hatte drei Jahre lang mit großem Blutdurst die Parteien der Weifen und Ghibellinen aneinander gehetzt, und die Sekte der Bettelbrüder hatte er als ein rechter Heuschrecken König mit den schönsten Freiheiten begabt.
Drei Monate lang leuchtete ein wundergroßer Komet schrecklich durch die Nächte, bis in die Nacht, in welcher Papst Urban IV. 1265 starb, da hörte er auf zu erscheinen.
DIE KNABEN MIT DEN GOLDENEN STERNLEIN ...
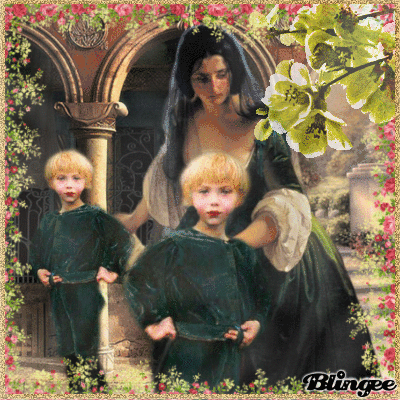
Es war einmal ein junger Graf, der kannte, so schön er auch war, die Liebe nicht und hatte daher den Vorstellungen seiner Mutter und seiner Freunde, sich zu verehelichen, noch nicht Raum gegeben. Er fand aber Vergnügen daran, bei Nacht im Dorfe herum zu schleichen und die jungen Burschen und Mädchen zu belauschen, was sie in ihren Spinnstuben trieben, sangen und sagten.
Einst nun hörte er ein Gespräch, von dem er selbst der Gegenstand war. "O, wenn unser guter Graf ein Weib nehme", sagte das eine der Mädchen, "so wollte ich, wenn ich es würde, ihm die leckersten Speisen kochen." - "Und ich", fiel eine zweite ein, "wollte ihm seine Kinder recht gut warten und pflegen." - "Ich, aber", sprach die Dritte, "wollte ihm zwei Knäblein bringen, wenn er mich zum Weibe nähme, die sollten goldene Sternlein auf der Brust tragen."
Die anderen lachten, der Graf aber hatte allerlei Gedanken und ging auf sein Schloß. Am anderen Tage ließ er die drei Mädchen rufen, und sie mußten ihm alles noch einmal sagen, was sie gestern miteinander über ihn gesprochen, wenn er ein Weib nähme.
Die letzte weigerte sich lange, denn sie schämte sich; als sie aber endlich ihren kühnen Wunsch bekannt, nahm sie der Graf freundlich bei der Hand und sprach: "Du sollst mein Weib sein, wenn du mir zwei Knäblein gebierst, so wie du gesagt hast; wo aber nicht, so will ich dich mit Schmach aus meinem Schlosse jagen."
Das Mädchen willigte ein, denn sie war freudigen Mutes und trug verborgene Liebe zu dem Grafen in ihrem Herzen. Die Hochzeit war demnach begangen, obwohl die alte Gräfin sehr sauer dazu sah. Als nun einige Monde vergangen waren und die junge Gräfin sich guter Hoffnung fühlte, da begab es sich, daß der Graf in ferne Lande ziehen mußte, und er bat seine Mutter, die gegen ihre Schnur alle Freundlichkeit erheuchelte, ihm alsbald zu schreiben, wenn seine Gemahlin geboren haben würde.
Die schwere Zeit rückte heran, und die junge Frau genas zweier holder Knäblein, die trugen goldne Sternlein auf der Brust; sie aber war so erschöpft, daß sie lange in Ohnmacht lag. Als sie nun erwachte und nach den Kindlein fragte, sagte man ihr, sie habe zwei ungestaltene Katzen geboren, die man ersäuft habe.
Darüber jammerte sie sehr, mehr als über das Unglück, das nun folgte. Schmachvoll ward sie aus dem Hause gewiesen, wie eine Bettlerin, und niemand erbarmte sich ihrer, als ein Diener; der vertraute ihr heimlich, daß sie zwei schöne Knäblein mit goldnen Sternlein auf der Brust geboren habe; sie seien in einem Korb mit dem Befehl übergeben worden, sie ins Wasser zu werfen, da es Katzen seien; er aber habe den Korb geöffnet, und da ihn die unschuldigen Würmlein gedauert, habe er sie einer Muhme zur Erziehung übergeben.
Darüber freute sich die Verstoßene in ihrem Schmerze sehr, dankte dem mitleidigen Menschen viel tausendmal, eilte zu ihren Kindern und lebte mehrere Jahre in verborgener Einsamkeit mit ihnen.
Die Knäblein wuchsen heran und wurden immer schöner, die arme Frau dachte wieder an ihren Gemahl, wenn er die Knäblein sähe, würde er alles gut machen, was seine böse Mutter an ihr verschuldet hatte.
Da träumte ihr, sie solle unter einem großen Lindenbaum am Kreuzweg gehen, dort werde sie einen Haufen Leinknotten finden, mit denen solle sie sich die Taschen füllen, aber ja nicht mehr nehmen und dann nach Portugal gehen, wo ihr Gemahl in den Liebesnetzen einer Zauberin oder Fee verstrickt sei.
Die Frau ging an den Baum, fand die Leinknotten und füllte sich die Taschen damit an. In einem Walde wurde sie von Räubern überfallen und ganz ausgeplündert, so daß sie keinen Pfennig behielt; denn sie mußte sich durch Betteln weiter helfen, ihre Füße waren blutig gerissen und noch war ihres Weges kein Ende.
Da tröstete sie abermals ein Traum in ihrem Elend und verhieß ihr endlich Gelingen. Einst bettelte sie an der Pforte eines schönen Schlosses; die Edelfrau sah ihre Knaben und war von ihrer Schönheit aufs Höchste überrascht. Sie bat die arme Frau um einen ihrer Knaben und versprach dafür, ihr jede Bitte zu erfüllen.
Der Armen ging es schwer an, eines ihrer Kinder zu missen, aber sie willigte endlich doch ein und bat dagegen um das goldene Spinnrädchen, das die Edelfrau eben vor sich stehen hatte. Diese wunderte sich über das Verlangen, gab jedoch das Rädchen hin, und einer der beiden Knaben blieb bei ihr zurück.
Die arme Frau war weiter und weiter gegangen und mußte sich endlich auch noch von ihrem zweiten Knaben trennen, für den sie ein goldenes Weiflein erhielt. Diese beiden Kleinodien verwahrte sie sehr sorgfältig und setzte ihre beschwerliche Wanderschaft fort.
Nach unendlichen Mühseligkeiten kam sie denn doch in Portugal an und kam an das Schloß, wo ihr Gemahl wohnte. Die Diener erzählten ihr, ihr Herr sei verheiratet, aber noch niemand habe das Antlitz seiner Gemahlin gesehen, dass sie nur des Nachts im Schlosse sei, und des Tags wisse niemand, wohin sie gekommen.
Als nun die Sonne untergegangen war, schlich sie sich in den Schloßgarten, setzte sich unter das Fenster der Gräfin und drehte ihr Spinnrädlein, daß es wie ein Stern durch die Nacht leuchtete.
Dies aber sah die Zauberin, welche die Gemahlin des Grafen war, und trat zu der Frau und fragte sie nach dem seltsamen Spielzeug. Die Frau bot es ihr als Geschenk an, wenn sie ihr dafür eine Bitte gewähre, sie bitte nämlich, eine Nacht bei ihrem Gemahl bleiben zu dürfen.
Die Frau wunderte sich darüber sehr, willigte jedoch ein; heimlich aber gab sie dem Grafen einen Schlaftrunk, so daß er die ganze Nacht nicht erwachte, und die verzweifelte Frau an seiner Seite den Morgen heranbrechen sah, wo die Zauberin sie abholte.
Den nächsten Abend saß die Frau wieder vor dem Schloß und drehte ihr goldnes Weiflein; die Zauberin kam wieder und mußte ihr die selbe Bitte gewähren. Diesmal hatte sie es versehen und ihrem Mann den Schlaftrunk nicht stark genug gemischt; ehe der Morgen anbrach, erwachte er daher, wunderte sich, die abgemagerte, verkümmerte Frau neben sich zu finden, die nun vor ihm ihr ganzes Herz ausschüttete.
Da ergriff den Grafen eine namenlose Sehnsucht nach seinen Kindern und versprach ihr, sie wieder als Gattin anzuerkennen. Dann stellte er sich schlafend, als die Fee kam und die Frau von dannen führte. Der Fee aber erzählte er, er habe einen sonderbaren Traum gehabt.
Ein Mann habe irrtümlich seine Frau verstoßen und eine andere gefreit; die erste aber habe ihn aufgesucht. Was der Gatte nun tun solle, wenn sie ihn gefunden? "Dann muß er sich von der zweiten scheiden und zu der Treuen zurückkehren!" sprach die Fee. -
"Du hast dein Urteil gesprochen", antwortete der Graf und erzählte ihr alles, was geschehen war. Da trennte die Fee sich schmerzlich von ihm. Der Graf aber kehrte mit der treuen Gattin in die Heimat zurück, nachdem er seine Knäblein ausgelöst hatte.
Die böse Mutter durfte ihm nicht wieder vors Antlitz kommen; die Gattin dagegen hielt er lieb und wert; den mitleidigen Bedienten belohnte er reich. Die Knaben mit den goldenen Sternlein wuchsen heran zu der Eltern Freude und wurden später wackere Kriegshelden, die viele Schlachten schlugen und gewannen.
DER MANN OHNE HERZ ...
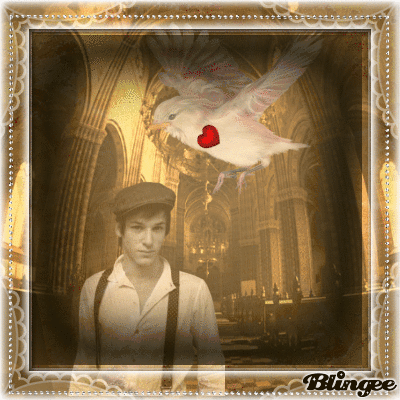
Es sind einmal sieben Brüder gewesen, waren arme Waisen, hatten keine Schwester, mussten alles im Hause selbst tun, das gefiel ihnen nicht, wurden Rates untereinander, sie wollten heiraten.
Nun gab es aber da, wo sie wohnten, keine Bräute für sie, da sagten die älteren, sie wollten in die Fremde ziehen, sich Bräute suchen, und ihr Jüngster sollte das Haus hüten, und dem wollten sie eine recht schöne Braut mitbringen. Das war der Jüngste gar wohl zufrieden, und die Sechse machten sich fröhlich und wohlgemut auf den Weg.
Unterwegs kamen sie an ein kleines Häuschen, das stand ganz einsam in einem Walde, und vor dem Häuschen stand ein alter alter Mann, der rief die Brüder an und fragte: "Heda! Ihr jungen Gieke in die Welt! Wohin denn so lustig und so geschwind? "
"Ei, wir wollen uns jeder eine hübsche Braut holen und unserm jüngsten Bruder daheim auch eine!" antworteten die Brüder.
"O liebe Jungen!" sprach da der Alte, "ich lebe hier so mutterseelenallein, bringt mir doch auch eine Braut mit, aber eine junge, hübsche muss es sein! "
Die Brüder gingen von dannen und dachten: Hm, was will so ein alter, eisgrauer Hozelmann mit einer jungen, hübschen Braut anfangen?
Da nun die Brüder in eine Stadt gekommen waren, so fanden sie dort sieben Schwestern, so jung und so hübsch, als sie sie nur wünschen konnten, die nahmen sie, und die jüngste nahmen sie für ihren Bruder mit. Sie kamen wieder durch den Wald, und der Alte stand wieder vor seinem Häuschen, als wartete er auf sie, und sagte: "Ei, ihr braven Jungen! Das lob ich, dass ihr mir so eine junge, hübsche Braut mitgebracht habt! "
"Nein!" sagten die Brüder, "die ist nicht für dich, die ist für unsern Bruder zu Hause, dem haben wir sie versprochen! "
"So?" sagte der Alte, "versprochen? Ei, dass dich! Ich will euch auch versprechen!" und nahm ein weißes Stäbchen und murmelte ein paar Zauberworte und rührte die Brüder und die Bräute mit dem Stäbchen an - bis auf die jüngste -, da wurden sie alle in graue Steine verwandelt.
Die jüngste aber von den Schwestern führte der Mann in das Haus, und das musste sie nun beschicken und in Ordnung halten, tat das auch gern, aber sie hatte immer Angst, der Alte könne bald sterben, und dann werde sie in dem einsamen Häuschen im wilden, öden Walde auch so mutterseelenallein sein, wie der Alte zuvor gewesen war.
Das sagte sie ihm, und er antwortete: "Hab kein Bangen, fürchte nicht und hoffe nicht, dass ich sterbe. Sieh, ich habe kein Herz in der Brust! Stürbe ich aber dennoch, so findest du über der Türe mein weißes Zauberstäbchen und rührst damit an die grauen Steine, so sind deine Schwestern und ihre Freier befreit, und du hast Gesellschaft genug. "
"Wo aber in aller Welt hast du denn dein Herz, wenn du es nicht in der Brust hast?" fragte die junge Braut.
"Musst du alles wissen?" fragte der Alte. "Nun wenn du es denn wissen musst, in der Bettdecke steckt mein Herz. "
Da nähte und stickte die junge Braut, wenn der Alte fort und seinen Geschäften nachging, in ihrer Einsamkeit gar schöne Blumen auf seine Bettdecke, damit sein Herz eine Freude haben sollte. Der Alte aber lächelte darüber und sagte: "Du gutes Kind, es war ja nur mein Scherz; mein Herz, das steckt -" "Nun, wo steckt es denn, lieber Vater? "
"Das steckt in der - Stubentür! "
Da hat die junge Frau am andern Tage, als der Alte fort war, die Stubentüre gar schön geschmückt mit bunten Federn und frischen Blumen und hat Kränze daran gehangen. Fragte der Alte, als er heimkam, was das bedeuten solle? sagte sie: "Das tat ich, deinem Herzen was zu Liebe zu tun. "
Da lächelte wieder der Alte und sagte: "Gutes Kind, ganz wo anders, als in der Stubentüre, ist mein Herz. "
Da wurde die junge Braut sehr betrübt und sprach: "Ach Vater, so hast du doch ein Herz und kannst sterben, und ich werde dann so allein sein." Da wiederholte der Alte alles, was er ihr schon zweimal gesagt, und sie drang aufs neue in ihn, ihr zu sagen, wo doch eigentlich sein Herz sei.
Da sprach der Alte: "Weit, weit von hier liegt in tiefer Einsamkeit eine große uralte Kirche, die ist fest verwahrt mit eisernen Türen, um sie ist ein tiefer Wallgraben gezogen, über den führt keine Brücke, und in der Kirche da fliegt ein Vogel wohl ab und auf, er isst nicht und trinkt nicht und stirbt nicht, und niemand vermag ihn zu fangen, und so lange der Vogel lebt, so lange lebe auch ich, denn in dem Vogel ist mein Herz. "
Da wurde die Braut traurig, dass sie dem Herzen ihres Alten nichts zu Liebe tun konnte, und die Zeit wurde ihr lang, wenn sie so allein saß, denn der Alte war fast den ganzen Tag auswärts.
Da kam einmal ein junger Wandergesell am Häuschen vorüber, der grüßte sie, und sie grüßte ihn, und sie gefiel ihm, und er kam näher, und sie fragte ihn, wohin er reise, woher er komme. "Ach!" seufzte der junge Gesell. "Ich bin gar traurig. Ich hatte noch sechs Brüder, die sind von dannen gezogen, sich Bräute zu holen, und mir, dem Jüngsten, wollten sie auch eine mitbringen, sind aber nimmer wieder gekommen, und da bin ich nun auch fort vom Hause und will meine Brüder suchen. "
"Ach, lieber Gesell!" rief die Braut, "da brauchst du nicht weiter zu gehen! Erst setze dich und iss und trinke etwas, und dann lass dir erzählen!" Und gab ihm zu essen und zu trinken und erzählte ihm, wie seine Brüder in die Stadt gekommen, und wie sie ihre Schwestern und sie selbst als Bräute mit sich nach Hause hätten führen wollen, und dass sie für ihn, ihren Gast, bestimmt gewesen, und wie der Alte sie bei sich behalten und die anderen in graue Steine verwandelt habe.
Das alles erzählte sie ihm aufrichtig und weinte dazu, und auch, dass der Alte kein Herz in der Brust habe und dass es weit, weit weg sei in einer festen Kirche und in einem unsterblichen Vogel.
Da sagte der Bräutigam: "Ich will fort, ich will den Vogel suchen, vielleicht hilft mir Gott, dass ich ihn fange. "
"Ja, das tue, daran wirst du wohl tun, dann werden deine Brüder und meine Schwestern wieder Menschen werden!" und versteckte den Bräutigam, denn es wurde schon Abend, und als am andern Morgen der Alte wieder fort war, da packte sie dem Wandergesellen viel zu essen und zu trinken ein und gab es ihm mit und wünschte ihm alles Glück und Gottes Segen auf seine Fahrt.
Als nun der Gesell eine tüchtige Strecke gegangen war, deuchte ihm, es sei wohl Zeit zu frühstücken, packte seine Reisetasche aus, freute sich der vielen Gaben und rief: "Holla! Nun wollen wir schmausen! Herbei, wer mein Gast sein will!"
Da rief es hinter dem Gesellen: "Muh!" Wie er sich umsah, stand ein großer, roter Ochse da und sprach: "Du hast eingeladen, ich möchte wohl dein Gast sein! "
"Sei willkommen und lange zu, so gut ich es habe!" Da legte sich der Ochse gemächlich an den Boden und ließ es sich schmecken und leckte sich dann mit der Zunge sein Maul recht schön ab, und als er satt war, sagte er:
"Habe du großen Dank, und wenn du einmal jemand brauchst, dir in Not und Gefahr zu helfen, so rufe nur in Gedanken nach mir, deinem Gast." Und erhob sich und verschwand im Gebüsch.
Der Gesell packte seine Tafelreste zusammen und pilgerte weiter; wieder eine tüchtige Strecke, da deuchte ihm nach dem kurzen Schatten, den er warf, es müsse Mittag sein, und seinem Magen deuchte das nämliche. Da setzte er sich an den Boden hin, breitete sein Tafeltuch aus, setzte seine Speisen und Getränke darauf und rief: "Wohlan! Mittagmahlzeit! Jetzt melde sich, wer mittafeln will! "
Da rauschte es ganz stark in den Büschen, und es brach ein wildes Schwein heraus, das grunzte: "Qui oui oui", und sagte: "Es hat hier jemand zum Essen gerufen! ich weiß nicht, ob du es warst und ob ich gemeint bin? "
"Immerhin, lange nur zu, was da ist!" sprach der Wandersmann, und da aßen sie beide wohlgemut miteinander, und es schmeckte beiden gut.
Darauf erhob sich das wilde Schwein und sagte: "Habe Dank, bedarfst du mein, so rufe dem Schwein!" und damit trollte es in die Büsche.
Nun wanderte der Gesell gar eine lange Strecke und war schon gar weit gewandert, da wurde es gegen Abend, und er fühlte wieder Hunger und hatte auch noch Vorrat, und da dachte er: wie wäre es mit dem Vespern? Zeit wäre es, dächte ich; und breitete wieder sein Tuch aus und legte seine Speisen darauf, hatte auch noch etwas zu trinken und rief: "Wer Lust hat, mit zu essen, der soll eingeladen sein. Es ist nicht, als wenn nichts da wäre! "
Da rauschte über ihm ein schwerer Flügelschlag, und es wurde dunkel auf dem Boden, wie vom Schatten einer Wolke, und es ließ sich ein großer Vogel Greif sehen, der rief: "Ich hörte jemand hier unten zur Tafel einladen! Für mich wird wohl nichts abfallen? "
"Warum denn nicht? Lasse dich nieder und nimm vorlieb, viel wird es nicht mehr sein!" rief der Jüngling, und da ließ sich der Vogel Greif nieder und aß zur Genüge, und dann sagte er:
"Brauchst du mich, so rufe mich!" hob sich in die Lüfte und verschwand. Ei, dachte der Geselle: der hat es recht eilig; er hätte mir wohl den Weg nach der Kirche zeigen können, denn so finde ich sie wohl nimmer, und raffte seine Sachen zusammen und wollte vor dem Schlafengehen noch ein Stückchen wandern.
Und wie er gar nicht lange gegangen war, so sah er mit einem Male die Kirche vor sich liegen und war bald bei ihr, das heißt, am breiten und tiefen Graben, der sie rings ohne Brücke umzog. Da suchte er sich ein hübsches Ruheplätzchen, denn er war müde von dem weiten Weg, und schlief, und am anderen Morgen da wünschte er sich über den Graben und dachte:
Schau, wenn der rote Ochse da wäre und hätte rechten Durst, so könnte er den Graben aussaufen, und ich käme trocken hinüber. Kaum war dieser Wunsch getan, so stand der Ochse schon da und begann den Graben auszusaufen.
Nun stand der Gesell an der Kirchenmauer, die war gar dick und die Türme waren von Eisen, da dachte er so in seinen Gedanken: ach, wer doch einen Mauerbrecher hätte! Das starke wilde Schwein. könnte vielleicht hier eher etwas ausrichten als ich.
Und siehe, gleich kam das wilde Schwein daher gerannt und stieß heftig an die Mauer und wühlte mit seinen Hauern einen Stein los, und wie erst einer los war, so wühlte es immer mehr und immer mehr Steine aus der Mauer, bis ein großes, tiefes Loch gewühlt war, durch das man in die Kirche einsteigen konnte.
Da stieg nun der Jüngling hinein und sah den Vogel darin herumfliegen, vermochte aber nicht ihn zu ergreifen. Da sprach er: "Wenn jetzt der Vogel Greif da wäre, der würde dich schon greifen, dafür ist er ja der Vogel Greif!"
Und gleich war der Greif da, und gleich griff er den Vogel, in dem des alten Mannes Herz war, und der junge Gesell verwahrte selbigen Vogel sehr gut, der Vogel Greif aber flog davon.
Nun eilte der Jüngling, so sehr er konnte, zur jungen Braut, kam noch vor Abends an und erzählte ihr alles, und sie gab ihm wieder zu essen und zu trinken und hieß ihn unter die Bettstelle kriechen mitsamt seinem Vogel, damit ihn der Alte nicht sähe.
Dies tat er alsbald, nachdem er gegessen und getrunken hatte; der Alte kam nach Hause und klagte, dass er sich krank fühle, dass es nicht mehr mit ihm fort wolle - das mache, weil sein Herzvogel gefangen war.
Das hörte der Bräutigam unter dem Bette und dachte, der Alte hat dir zwar nichts Böses getan, aber er hat deine Brüder und ihre Bräute verzaubert, und deine Braut hat er für sich behalten, das ist des Bösen nicht wenig, und da kneipte er den Vogel, und da wimmerte der Alte:
"Ach, es kneipt mich! Ach, der Tod kneipt mich, Kind - ich sterbe!" Und fiel vom Stuhl und war ohnmächtig, und ehe sichs der Jüngling versah, hatte er den Vogel tot gekneipt, und da war es aus mit dem Alten.
Nun kroch er hervor, und die Braut nahm den weißen Stab, wie sie der Alte gelehrt hatte, und schlug damit an die zwölf grauen Steine, siehe, da wurden sie wieder die sechs Brüder und die sechs Schwestern, das war eine Freude und ein Umarmen und Herzen und Küssen, und der alte Mann war tot und blieb tot, konnte ihn keine Meisterwurz wieder lebendig machen, wenn sie ihn auch hätten wieder lebendig haben wollen.
Da zogen sie alle miteinander fort und hielten Hochzeit miteinander und lebten gut und glücklich miteinander lange Jahre.
DIE WEISSEN TAUBEN ...
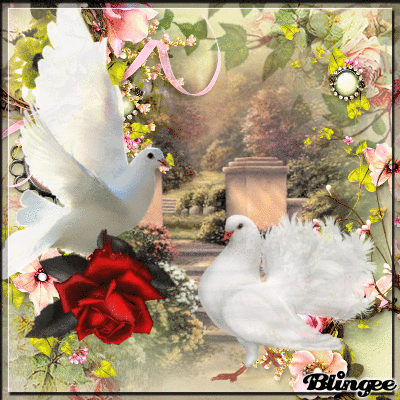
Als der Deutsche Ritterorden im Jahre 1325 nötig fand, die von ihm bis jetzt behaupteten Landstrecken zu schützen und feste Punkte zu haben, wurden im Lande Galindien [Galinden, ehemaliger Gau der Pruzzen] das Schloß Wartenburg (auch an der Alle) und im Bartenlande das Schloß Gerdauen gegründet und erbaut, um welche Schlösser sich hernach Städtlein anbauten.
Da nun der priesterliche Ritterorden diese beiden neuen Schlösser mit feierlichem Hochamt und Messe einweihte, da flog über dem Schlosse Wartenburg eine ganz weiße Haustaube, über Gerdauen aber flogen zwei, und das war das erste Mal, daß in dieser Gegend Haustauben erblickt wurden, denn damals war das meiste Land umher nur noch eine öde weite Wildnis, von düstern Föhrenwaldungen unterbrochen, in denen nur die wilde Taube heimisch war.
DIE DREI HOSTIEN ...

Dem Helfer in Not und Gefahr, dem siegreichen heiligen Ritter Georg, war zu Elbing [Elbląg] eine gar schöne und zierdevolle Kirche erbaut und geweiht worden, aber im Jahre 1400 geschah es, daß diese Kirche in Brand geriet und bis zum Grunde nieder brannte, denn sie war nicht von Stein, sondern nur von Holz.
Alle ihr Geschmuck, Reichtum und ihre Zier war durch die Flamme vernichtet, doch fand sich unversehens im Schutt eine Kapsel völlig unversehrt, und darin waren drei kleine geweihte Hostien enthalten.
Mit großer Feier und Andacht wurde das hochheilige Sakrament erhoben, in einer Kirche verwahrt, und an die Stelle der eingeäscherten Sankt-Georgs-Kirche ließ der Hochmeister durch den Bruder Hellwing Schwang eine neue, steinerne Kirche erbauen, welcher dann die Hostien Kapsel feierlich zugeeignet wurde, und gab ihr den Namen Zum Leichnam Jesu. Viele Wunderwerke sind hernach in dieser Kirche geschehen.
WIE DAS MÄRCHEN GEBOREN WURDE ...
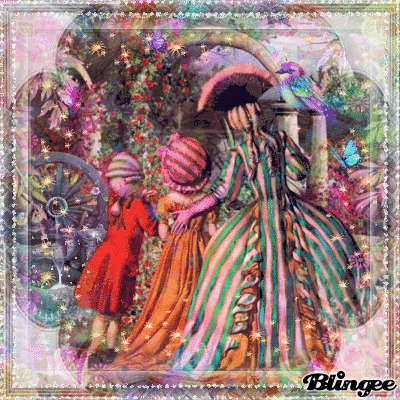
Es war einmal eine Zeit, da es noch keine Märchen gab, und die war betrübend für die Kinder, denn es fehlte in ihrem Jugendparadiese der schönste Schmetterling. Und da waren auch zwei Königskinder, die spielten miteinander in dem prächtigen Garten ihres Vaters. Der Garten war voll herrlicher Blumen, seine Pfade waren mit bunten Steinen und Goldkies bestreut und glänzten wetteifernd mit dem Taugefunkel auf den Blumenbeeten.
Es gab in dem Garten kühle Grotten mit plätschernden Quellen, hoch zum Himmel aufrauschende Fontänen, schöne Marmorbildsäulen, liebliche Ruhebänke. In den Wasserbecken schwammen Gold- und Silberfische; in goldenen großen Vogelhäusern flatterten die schönsten Vögel, und andere Vögel hüpften und flogen frei umher und sangen mit lieblichen Stimmen ihre Lieder.
Die beiden Königskinder aber hatten und sahen das alle Tage, und so waren sie müde des Glanzes der Steine, des Duftes der Blumen, der Springbrunnen und der Fische, welche so stumm waren, und der Vögel, deren Lieder sie nicht verstanden. Die Kinder saßen still beisammen und waren traurig; sie hatten alles, was nur ein Kind sich wünschen mag: gute Eltern, die kostbarsten Spielsachen, die schönsten Kieider, wohlschmeckende Speisen und Getränke, und durften tagtäglich in dem schönen Garten spielen - sie waren traurig, obschon sie nicht wußten, warum, und nicht wußten, was ihnen fehle.
Da trat zu ihnen ihre Mutter, die Königin, eine schöne hohe Frau mit mild freundlichen Zügen, und sie bekümmerte sich darüber, daß ihre Kinder so traurig waren und sie nur wehmütig anlächelten, statt mit Jauchzen ihr entgegen zu fliegen; sie betrübte sich, daß ihre Kinder nicht glücklich waren, wie doch Kinder sein sollen und sein können, weil sie noch keine Sorgen kennen und der Himmel der Jugend meist ein wolkenloser ist.
Die Königin setzte sich zu ihren beiden Kindern, die ein Knabe und ein Mädchen waren, und schlang um jedes derselben einen ihrer vollen weißen Arme, welche goldne Spangen schmückten, und fragte gar mütterlich und liebreich: "Was fehlt euch, meine lieben Kinder?"
"Wir wissen es nicht, teure Mutter!" sprach der Knabe. "Wir sind so taurig!" sprach das Mädchen.
"Es ist so schön hier in diesem Garten, und ihr habt alles, was euch Freude machen kann; macht es euch denn keine Freude?" fragte die Königin, und eine Träne trat in ihr Auge, aus dem eine Seele voll Güte lächelte.
"Nicht genug Freude macht uns, was wir haben", antwortete dieser Frage das Mädchen. "Wir wünschen uns was und wissen nicht, was!" setzte der Knabe hinzu.
Die Mutter schwieg bekümmert und sann nach, was wohl die Kinder wünschen möchten, das sie mehr erfreue als die Pracht des Gartens, der Schmuck der Kleider, die Menge der Spielsachen, der Genuß edler Speisen und Getränke, aber sie fand nicht, was ihre Gedanken suchten.
"O wäre ich nur selbst wieder ein Kind!" sprach die Königin still zu sich, mit einem leisen Seufzer, "dann fiele mir wohl bei, was Kinder froh macht. Um Kindeswünsche zu begreifen, muß man selbst ein Kind sein. Aber ich bin schon zu weit gewandert aus dem Jugendlande, wo die goldnen Vögel durch die Bäume des Paradieses fliegen, jene Vögel, die keine Füße haben, weil die Nimmermüden irdischer Ruhe nicht bedürfen. O käme doch ein solcher Vogel her und brächte meinen teuern Kindern, was sie glücklich macht!"
Siehe, wie die Königin also wünschte, da wiegte sich plötzlich über ihr in den blauen Lüften ein wunderherrlicher Vogel, von dem ein Glanz ausging, wie Goldflammen und Edelsteinblitze, der schwebte tiefer und tiefer, und es sah ihn die Königin, es sahen ihn die Kinder. Diese riefen nur: "Ah! ah!" und Staunen ließ sie keine anderen Worte finden.
Der Vogel war überaus herrlich anzusehen, wie er, immer tiefer schwebend, sich niedersenkte, so schimmernd, so glänzend, im Regenbogenfarbengefunkel, fast das Auge blendend und doch immer wieder das Auge fesselnd. Er war so schön, daß die Königin und die Kinder vor Freude leise schauerten, zumal sie jetzt das Wehen seiner Flügel fühlten. Und ehe sie es ahnten, so hatte sich der Wundervogel niedergelassen in den Schoß der Königin, der Mutter, und sah aus Augen, die wie freundliche Kinderaugen gestaltet waren, die Kinder an, und doch war etwas in diesen Augen, das die Kinder nicht begriffen, etwas Fremdartiges, Schauerhaftes, und sie wagten darum nicht, den Vogel zu berühren, auch sahen sie jetzt, daß der seltsame, überirdisch schöne Vogel unter seinen glänzendbunten Federn auch einige tiefschwarze Federn hatte, die man aber von weitem nicht gewahrte.
Indes blieb den Kindern zu näherer Betrachtung des schönen Wundervogels kaum so lange Zeit, als nötig war, dies zu erwähnen, denn alsbald hob sich der Vogel wieder empor, der Paradiesvogel ohne Füße, schwebte, scnimmerte, flog immer höher, bis er nur eine im Äther schwimmende bunte Feder schien, dann nur noch ein goldener Streif, und dann entschwand - so lange aber, bis das geschah, sahen ihm auch die Königin und die Kinder mit Staunen nach.
Aber O Wunder! Als Mutter und Kinder wieder niederblickten, wie staunten sie da aufs neue! Auf dem Schoße der Mutter lag ein goldnes Ei, das hatte der Vogel gelegt, O und das schimmerte auch so grüngolden und goldblau wie der köstlichste Labradorstein und die schönste Perlenmuschel der Meerestiefen. Und die Königskinder riefen aus einem Munde: "Ei, das schöne Ei!"
Die Mutter aber lächelte selig voll Dankgefühl, das müsse der Edelstein sein, der noch zum Glück ihrer Kinder fehle, das Ei müsse in seiner zauber farbig
schillernden Schale ein Gut enthalten, das den Kindern gewähre, was dem Alter versagt ist, Zufriedenheit, und das ihre Sehnsucht, ihre kindische Trauer stille.
Die Kinder aber konnten sich nicht satt sehen an dem prächtigen Ei und vergaßen bald über dem Ei den Vogel, der es brachte; erst wagten sie nicht, es zu berühren, endlich aber legte das Mägdlein doch eines seiner rosigen Fingerchen daran und rief plötzlich, indem sein unschuldvolles Gesichtchen sich mit Purpur übergoß: "Das Ei ist warm!"
Nun tippte auch der Königsknabe vorsichtig und leise an das Ei, um zu fühlen, ob die Schwester wahr gesprochen. Endlich legte auch die Mutter ihre zarte weiße Hand auf das köstlliche Ei, und siehe, was begab sich da? Die Schale fiel in zwei Hälften auseinander, und aus dem Ei kam ein Wesen hervor, wunderbar anzusehen.
Es hatte Flügel und war nicht Vogel, nicht Schmetterling, Biene nicht und nicht Libelle, und doch von allen diesen etwas, aber nicht zu beschreiben; mit einem Wort, es war das bunt geflügelte, farbenschillernde Kinderglück, selbst ein Kind, nämlich des Wundervogels Phantasie, das Märchen.
Und nun sah die Mutter ihre Kinder nicht mehr traurig, denn das Märchen blieb fortan immer bei den Kindern, und sie wurden seiner nicht müde, solange sie Kinder blieben, und seit sie das Märchen hatten, wurden ihnen Garten und Blumen, Lauben und Grotten, Wälder und Haine erst recht lieb, denn das Märchen belebte alles zur Lust der Kinder; das Märchen lieh selbst den Kindern seine Flügel, da flogen sie weit umher in der unermeßlichen Welt und waren doch immer gleich wieder daheim, sobald sie nur wollten.
Jene Königskinder - das waren die Menschen in ihrem Jugendparadiese, und die Natur war ihre schöne mild freundliche Mutter. Sie wünschte den Wundervogel Phantasie vom Himmel nieder, der so prächtige Goldfedern und auch einige tiefdunkle hat, und er legte in ihren Schoß das goldne Märchenei.
Und wie die Kinder das Märchen innig lieb gewannen, das ihre Kindheitstage verschönte, in tausenderlei Gestaltungen und Verwandlungen sie ergötzte und über alle Häuser und Hütten, über alle Schlösser und Paläste flog, so war des Märchens Art auch diese, daß es selbst den Erwachsenen gefiel und sie sich seiner freuten, wenn sie nur etwas aus dem Garten der Kindheit mit herüber getragen in das reifere Alter, nämlich die Kindlichkeit des Herzens.
Ludwig Bechstein
DIE KUHHIRTEN ...
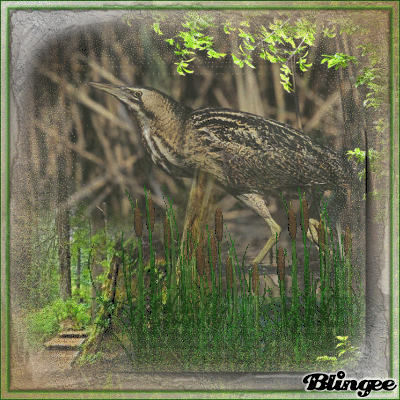
Einst ging ein Wanderer über eine Wiese. Da hörte er von weitem im Geröhrig einen seltsamen dumpfen Ruf, der oft hintereinander ausgestoßen wurde, als ob ein Rind brülle, und konnte sich gar nicht erklären, von wem das Getöne herrühre und was es zu bedeuten habe? Nach einer Weile kam der Wanderer zu zwei alten Kuhhirten, die hüteten nachbarlich ihre Herden auf der weiten Wiese. Diese fragte der Wanderer, was das Tönen bedeute?
Da antwortete der eine alte Kuhhirt: »Ich will es Euch sagen. Was dort im Schilfe so schreit, das ist der Rohrtumb, auch Rohrtrummel genannt.«
»Oh, er hat gar viele Namen«, setzte der andere alte Kuhhirte hinzu. »Er heißt auch Ur-Rind, Moor-Rind, und Mooskuh. Vor Zeiten ist selber Brüller ein Hirtenknecht gewesen, aber ein schrecklich fauler, deshalb ist er in einen Vogel verwandelt worden, und das ärgert ihn so sehr, daß er immerfort brüllt, absonderlich des Nachts, da stößt er seinen Schnabel in das Wasser, und brüllt wie ein Stier, daß man es eine Stunde weit hören kann, damit zeigt er Regen an.«
»Selt ist richtig« nahm wieder der erste Kuhhirte das Wort: »aber mit dem Knecht wird es anders erzählt. Es waren der Kuhhirten zwei, wie unserer auch zwei sind, sie waren aber nicht alle zwei beide beisammen. Der eine hütete seine Kühe auf den grünen fetten Wiesen im Tale, der andere aber auf einem hohen und dürren Berge. Daher wurden die Kühe des ersteren auf den blumigen Wiesen sehr munter und mutig und gaben viele Milch die Kühe des Hirten auf dem Berge aber, wo der Herr zwar Gras wachsen läßt, das aber auch danach ist wie jener Schulmeister in der Kollekte sang und wo der Wind mehr mit dem Sande als mit Blumen spielt, die wurden sehr matt und sehr mager, und gaben wenig und nur himmelblaue Milch, wie sie mehr blauen Himmel, als grünes Gras sahen.
Eines Abends, als beide Kuhhirten nach Hause treiben wollten, da hatten die muntern und mutigen Kühe auf der fetten Wiese keine Lust nach Hause, und war unter ihnen eine bunte Kuh, die lief in entgegengesetzter Richtung davon, und die anderen Kühe alle folgten ihr, da schrie der Kuhhirte, so laut er schreien konnte: ›Bunte h'rum! Bunte h'rum!‹ aber es half ihm all sein Schreien nichts.
Die magern Kühe des Hirten droben auf dem Berge hingegen, die hatten sich vor Hunger und Ermattung hingelegt, und mochten nicht aufstehen, oder vermochten es zuletzt auch nicht, da schrie der Kuhhirte aus Leibeskräften: ›Up! up! up! up!‹ meinte damit, sie sollten aufstehen, standen aber doch nicht auf, die weil sie nicht konnten, und nun schrien die Hirten drunten und droben um die Wette, der eine ›Bunte h'rum, Bunte h'rum‹ der andere ›up! up! upl!‹ und Nacht und Tag und Tag und Nacht, bis ihnen der Odem ausging und die Seele aus dem Halse fuhr, und da sind sie beide zu Vögeln geworden, der Wiesenhirte zum Rohrtumb, und der Berghirte zum Wiedehopf, und schreien nun noch immer so fort.«
So erzählte der Kuhhirte dem Wanderer, und der wußte nun, was das Gebuller im Geröhrig zu bedeuten habe, und wenn er von einem Berge herab den Ruf up! up! up! vernahm, da wußte er auch, was das für ein Vogel war, der also schrie, nämlich der ohnehin verrufene Kuckuckslakai und Kuckucksküster, der Vogel Wiedehopf.
DER SCHMIED IN RUHLA ...

Graf Ludwig, der die Wartburg baute und auch Eisenach, die Stadt, mit Mauern umgab, der Reinhardsbrunn, das Kloster, gründete und in demselben als Mönch büßte, verließ einen Sohn, auch Ludwig geheißen, den machte der Kaiser zum Landgrafen in Thüringen, und der selbe war, da er noch ein Jüngling war, gar gütig und demütig gegen Edle und Unedle und von mildem Wesen; solches ward ihm von seinen Vasallen für Schwäche und Torheit ausgelegt.
Er strafte nicht gern und hörte nicht gerne klagen, hatte zu allen Menschen das beste Vertrauen und wußte nicht, daß die Edeln seine Untertanen schmählich bedrückten und daß Bürger und Bauern von ihnen viel böser Gewalt erleiden mußten, zumal die, so um ihn waren, zu verhindern wußten, daß Beschwerden an den Herrn gelangten.
Da geschah es, daß der junge Landgraf eines Abends auf einem Jagdritt sich im Forste verirrte und in die Nähe des Ortes Ruhla kam, da sah er das helle Feuer einer Waldschmiede durch die Nacht leuchten, ging darauf zu und bat den Schmied um Herberge.
Der Schmied kannte ihn nicht und fragte ihn, wer er sei. - Ich bin Eures Herrn, des Landgrafen, Jäger einer. - Pfui des Landgrafen! rief der Schmied und spuckte aus und wischte sich. Wer ihn nennt, muß sein Maul wischen, daß er es nicht verunreint mit dem Namen. Pfui des übelbarmherzigen Kunzenherrn! Um deines Herrn Willen herberge ich dich wahrhaftig nicht! Geh, ziehe nur dein Pferd in den Schoppen, dann komme her und sitze nieder, iß und trink, was da ist, und ruhe auf dem Heu, denn Bettgewand ist hie nicht vorhanden. -
Der Landgraf, ganz verwundert ob dieser groben Rede, schwieg ganz still, ging und brachte sein Pferd unter Dach und kam wieder in die Schmiede. Der Schmied kümmerte sich so viel als gar nicht um ihn, schürte sein Feuer, zog den Blasebalg, hitzte und hetzte, glühte sein Eisen, löschte es, glühte wieder und hämmerte und rief bei den Schlägen fort und fort: Landgraf Ludwig, werde hart, werde hart! und schlug mit dem gewichtigen Hammer, daß die Funken stoben, und erzählte alles nach der Schnur her, worüber die Untertanen klagten, und schob alle Schuld und alles Unrecht, was im Lande geschah, auf den Landgrafen und verwünschte und verfluchte ihn in die unterste Hölle.
Er sang das alte Lied von den dünkelvollen Räten, die alles besser wissen, sich und ihre Weisheit für unfehlbar halten, die Fürsten glaubend machen, es stehe alles gut im Lande, und hinterdrein ist es Lug und Trug, und der Aufruhr schlägt in hellen Flammen aus, und alles Unglück, das daraus entsteht, wird hernach den Fürsten in die Schuhe geschoben.
Dem Landgrafen erschrak das Herz im Leibe, als er aus dieser harten Stimme des Schmiedes des Volkes Stimmung gegen sich vernahm, und er nahm sich vor, dem Unfug, den seine Edeln verübten, ein Ende mit Schrecken zu machen. Ganz hart geschmiedet verließ er, nachdem er kein Auge zugetan, die Ruhlaer Waldschmiede, und sein milder Sinn war in einen eisernen verkehrt.
Er nahm die Zügel der Regierung in die eigne Hand und zog sie so straff, daß die edeln Rosse schäumten und knirschten und sich bäumten, aber das Volk atmete freier auf, und ward ihm wohler, denn die ritterlichen Vasallen durften es nicht mehr placken und schinden.
VOM INSELBERG ...

Einer der höchsten Berge des Thüringer Waldes ist der Inselberg. Vor alters schrieben manche seinen Namen Heunselberg und wollten ihn von den Heunen, Hünen, ableiten, andere Emsenberg, weil ein Flüßchen, die Emse, nahe seinem Gipfel entspringe; näher kamen die, so ihn Einzelberg nannten, weil sein hohes Haupt über alle seine Nachbarberge vereinzelt emporragt, ja häufig erscheint es wie eine Insel über dem Nebelmeere, das rings um seinen Gipfel flutet, wie sein Haupt sich zuerst über der Flut erhoben, die einst ganz Thüringen bedeckte.
Über ihn dahin zieht die alte Hochstraße, der Rennsteig, Rennsteg, Rennweg, Rinneweg, der über das ganze Thüringer Waldgebirge viele Meilen weit sich erstreckt.
Es geht die Sage, daß jeder Landgraf von Thüringen diesen Weg mit seiner Ritterschaft reiten mußte, sobald er die Regierung Thüringens angetreten hatte.
Nahe dem Inselberg haben in alten Zeiten Bergleute vom Harz den Bergbau begonnen und Orte angebaut, deren Namen eigentümlich fremdländisch klingt: Tabarz, Cabarz, und mögen wohl Einwanderer von weither auch andere Bergorte im Schoß des Waldgebirges begründet haben, die in Sprachlauten und Trachten sich von den eigentlichen Thüringern merklich unterscheiden.
Viele Venetianer sind nachderhand in das Gebirge gekommen, welche die Leute Erzmännerchen und Walen nannten, die haben manch reichen Schatz hinweg getragen, denn im Inselberggraben, im Bärenbruch, im Ungeheuern Grund, an der Schönleite und weiter hin nach der Ruhl zu, in der Ruhl, dem Flüßchen, und sonst, auch im Backsteinsloch, gab es Goldsand, obschon minder viel als in Kalifornien, doch hat er manchen reich gemacht. Seit die Walen dagewesen sind, findet man nichts mehr.
DIE KÖNIGE WIDEWUTO UND BRUTENO ...

Es waren in alten Heiden Zeiten zwei Brüder im Lande Preußen, bevor es noch diesen Namen führte, die herrschten über den kimbrischen Volksstamm und waren auf Flößen an das Ostseegestade gefahren gekommen, hatten das Land eingenommen und sich mit ihrem Volke Wohnsitze gebaut.
König Widewuto erfand den berauschenden Trank des Met zu bereiten, und Bruteno diente den Göttern als oberster Priester, und beide wurden hoch betagt. Da Bruteno einhundertundzweiunddreißig Jahre alt geworden, Widewuto aber einhundertundsechzehn Jahre, so versammelten sie all ihr Volk zu einem großen Opferfesttag und verteilten das Land.
Widewutos ältester Sohn hieß Lithuo, der empfing, in dem er den Göttern Gehorsam gelobte und Andacht und in dem er mit der einen Hand seines Vaters Haupt berührte und mit der anderen die heilige Eiche, das Land vom Briko und Nyemo (Bug und Niemen), den beiden Flüssen, bis an den Wald Thamsoan, und dieses Land wurde dann nach ihm Litauen geheißen.
Hierauf gelobte Widewutos zweiter Sohn, des Namens Samo, und empfing auf gleiche Weise das Land von Krono und Hailibo bis an das Wasser Skara, und das wurde hernachmals Samland genannt. Samo hatte ein Weib, die hieß Pregolla, die ist später in dem Flusse Skara ertrunken, und darauf hat dieser Fluß den Namen Pregel empfangen.
Widewutos übrige Söhne, deren noch zehne waren, empfingen allzumal auch weites Land, darinnen ein jeder Raum hatte zu herrschen. Bruteno, der den Göttern als erster Priester diente, hatte keine Söhne, aber nach seinem Namen wurde Land und Volk genannt, Brutenien und Brutenen, aber die Masovier, der Brutenen Feinde, nannten sie Bruti - darüber entspann sich ein Krieg, und die Brutenen wollten sich nicht Bruti, das ist wilde Bestien, schimpfen lassen; darauf nahmen die Masovier Vernunft an und nannten die Brutener auch prudentes und praescii, das ist die Gescheiten, daraus ist der Name Pruski und Preußen geworden, und diesen Namen haben sie sich eher und besser gefallen lassen und ihn vor anderen lieb gewonnen und beibehalten.

VOGEL HOLGOTT UND VOGEL MOSAM ...
In einen See strömten lustige Bäche, und er war voll Fische und war gelegen in einsamer Gegend, dahin weder Menschen kamen noch Fischreiher und andere Fische fressende Vögel vom Meere her. Diesen See entdeckte ein bejahrter Vogel, der hieß Holgott und war vom Geschlecht der Fischadler, und es gefiel ihm die angenehme Lage, die friedsame Stille rings um den See und die Reichlichkeit der Nahrung.
Da gedachte er bei sich selbst: hierher willst du ziehen mit deinem Weib und allen den Deinen, denn hier finden wir genug an allem, was wir bedürfen, hier ist niemand mir widerwärtig und entgegen, und meine Kinder mögen dies Gebiet, wenn wir tot sind, als ein schönes Erbe innehaben.
Nun hatte Vogel Holgott ein Weib, die saß daheim im Nest auf ihren Eiern, die nahe daran waren ausgebrütet zu sein, und dieses Weibchen hatte einen lieben Freund, auch einen Vogel, der hieß Mosam. Dieser Freund war ihr so lieb, dass ihr nicht Trank und nicht Speise schmeckte, wenn er nicht um sie war, und ohne ihn hatte sie kein Vergnügen oder Kurzweile.
Als nun ihr Mann seinen Ratschlag und Beschluss entdeckte, in jene schöne Gegend zu ziehen, aber ihr hart verbot, dem Freund Mosam davon zu sagen, so war das ihr außerordentlich leid, und sie sann auf Fünde und Ränke, wie sie diesem ihres Mannes Vorhaben heimlich stecken könne, ohne dass dieser es merke.
Und da sagte sie zu ihrem Mann: "Siehe, mein teurer Holgott, nun werden unsere Jungen bald ausschlüpfen, und da ist mir eine Arznei verraten worden, sie für die Jungen zu brauchen, wenn sie auskriechen, dass ihnen ihr Gefieder stark und fest wächst: auch behütet diese Arznei sie lebenslänglich vor bösen Zufällen, diese Arznei nun möchte ich gern holen, so du mir das gestattest und es dir gefällig wäre!"
"Was ist das für ein Arcanum?" fragte Vogel Holgott, und die Frau erwiderte: "Das ist ein Fisch in einem See, der um eine Insel fließt, den niemand weiß als ich und der, welcher es mir verraten. Darum rate und bitte ich dich, setze dich an meiner Statt auf die Eier und brüte, so will ich indes den Fisch holen oder zwei, und wir wollen sie dann mitnehmen in den neuen Aufenthalt, den du uns erwählt hast."
Darauf entgegnete der Mann: "Nicht ziemt es den Vernünftigen, alles zu versuchen, was der erste beste Arzt ihm rät; denn manche raten Dinge uns an, die zu erlangen unmöglich sind. Was frommt das Unschlitt des Löwen wohl dem Kranken oder der Nattern Gift? Soll einer darum den Löwen bestehen und die Nattern in ihrer Höhle besuchen und in die Gefahr selbsteigenen Todes sich wagen, auf eines Arztes Rat?
Lass ab, o Frau, von deinem törichten Vorhaben und lass uns an jenen Ort ziehen, während unsere Jungen hier bleiben; dort findet du Fische mancherlei Art, vielleicht auch jene heilsamen, und die weiß niemand dann, außer uns. Wer an besorglicher gefahrvoller Stätte sein Heilkraut sucht, dem möchte es ergehen, wie es dem alten Affen erging." - "Wie erging es diesem?" fragte das Vogelweibchen, und Vogel Holgott erzählte: Von zwei Affen
VON ZWEI AFFEN ...
"Ein alter Affe lebte an einem fruchtbaren Ort, wo Bäume und Früchte, Wasser und Weiden im Überfluss vorhanden waren. Da er nur immer im Wohlleben war, so bekam er in seinem Alter die Raute und war damit sehr geplagt, wurde mager und kraftlos, so dass er seine Speise nicht mehr erlangen konnte.
Da kam ein anderer Affe zu ihm und fragte ihn verwundert: "Ei, wie kommt es, dass ich dich so krank und abgezehrt sehen muss?"
"Ach!" seufzte der alte Affe, ich weiß keine andere Ursache, als den Willen Gottes, dem niemand zu entfliehen vermag." Drauf sprach jener: "Ich kannte einen Freund, der trug das selbe Siechtum, und es half ihm nichts als das Haupt einer schwarzen Natter. Als er das aß, so genas er, das solltest du auch tun!"
Ihm entgegnete der alte Affe: "Wer gibt mir ein solches Natterhaupt, da ich so schwach bin, kaum eine Frucht von dem Baume zu erlangen?" Darauf versetzte jener: "Vor zwei Tagen sah ich vor einer Höhle in einem Felsen einen Mann stehen, der lauerte auf die schwarze Natter, die in der Höhle lag, und wollte ihr die Zunge herausziehen, weil er einer solchen bedürftig war; da will ich dich hinbringen. Hat der Mann die Natter getötet, so nimmst du das Haupt und isst es."
Der alte Affe sprach: "Ich bin siech und krank, werde ich gesund und stark, so will ich dir gern deinen Dienst vergelten." Da führte jener Affe den alten in die Felsenhöhle, darin er einen Drachen wohnen wusste. Vor der Höhle waren große Fußtritte, wie die eines Menschen, der alte Affe dachte, die habe der Mann zurückgelassen, der die Natter getötet, kroch hinein und suchte das Haupt.
Da zuckte der Drache hervor und erwürgte ihn und fraß ihn. Der junge aber freute sich, dass er seinen Gesellen verlockt und betrogen hatte, und nun im alleinigen Besitz der schönen Fruchtbäume war."
Als Vogel Holgott seinem Weibchen dies erzählt hatte, fügte er noch hinzu: "Dies sage ich der Lehre halber, die darinnen liegt: Es soll kein Vernünftiger sein Leben wagen auf einen törichten und betrüglichen Rat hin."
Aber das Weibchen sprach: "Ich habe dich recht wohl verstanden, allein hier ist es doch ein ganz anderer Fall, denn die Fische, die ich meine, sind ohne Gefahr zu holen und werden unseren Jungen sehr sehr dienlich sein."
Als Vogel Holgott sah, dass verständige Überredung bei seiner Frau nicht anschlage, so gab er nach: "Kannst du es nicht lassen, so hole die Fische; bewahre dich aber, dass du niemanden weder das eine noch das andere Geheimnis vertraust, denn also lehren die Weisen:
Löblich ist jeder Vernunft Übung, aber die größte Vernunft beweist der, der sein Geheimnis begräbt, also dass es keiner zu finden vermag." Darauf flog das Weibchen fort und auf der Stelle zu ihrem lieben Freund Mosam und teilte ihm alles mit, was ihr Mann im Sinn hatte und dass er an einen lustigen Ort ziehen wolle, wo weder von Tieren noch von Menschen etwas zu fürchten sei.
Und sprach: "Möchtest du, o Freund, einen Fund finden, dass auch du dorthin kommen könntest, doch mit Wissen und Willen meines Mannes, denn soll mir etwas Gutes widerfahren, so hab ich keine Freude ohne dich."
Darauf erwiderte der Vogel Mosam: "Warum sollte ich gezwungen sein, nur mit Bewilligung deines Mannes dort zu weilen? Wer gibt ihm solche Gewalt an die Hand über mich und andere? Wer verbietet mir, auch dorthin zu ziehen? Zur Stunde will ich hinfliegen und dort mein Nest bauen, da es so eine genügliche Stätte ist.
Und wird dein Mann kommen und mich vertreiben wollen, so werde ich ihm das wohl zu wehren wissen und ihm sagen, dass weder er noch seine Vorfahren dort sesshaft waren und er also nicht mehr Recht an jener Gegend hat als ich und andere."
Da erwiderte das Weibchen: "Du hast nicht unrecht, aber ich wünschte doch deine Gegenwart dort in der Voraussetzung, dass allewege Friede und Eintracht unter uns sei. Gehst du gegen meines Mannes Willen dorthin, so haben wir üble Nachrede zu gewärtigen, und unsere Freundschaft wird sich in Trauer verkehren.
Mein Rat ist dieser: Du gehst zu meinem Mann, lässt ihn nicht wissen, dass wir uns gesprochen und sagst zu ihm (ehe ich zurück bin), du habst jene sehr schöne Gegend gefunden und dir vorgenommen, dorthin zu ziehen, so wird er dir erwidern, dass er auch zuvor schon diese Stätte entdeckt habe und entschlossen sei, hinzuziehen; dann sprichst du:
"O Freund Holgott, so bist du der erste und jener Stätte würdiger denn ich, aber ich bitte dich, lass mich bei dir wohnen, so will ich dir dort ein treuer Freund und Gefährte sein."
Diesen Rat befolgte Vogel Mosam und flog eiligst zu Vogel Holgott hin, während das Weibchen an den ersten besten Teich flog und zwei Fische fing und heim trug, als seien es die heilsamen Wunderfische, und Vogel Holgott erwiderte auf den Antrag, dass ihm Mosams Gesellschaft wohlgefällig sei.
Das Weibchen aber stellte sich, als wäre ihr ihres Mannes Nachgiebigkeit gegen ihren Freund nicht lieb, damit er ihre Verräterei nicht merke und sagte: "Wir haben doch jene Stätte für uns allein erwählt, und ich besorge, wird Vogel Mosam mit uns ziehen, so folgen seine vielen Freunde auch nach, und zuletzt müssen wir weichen vor ihrer Überzahl."
Darauf entgegnete ihr Mann: "Du hast recht; aber ich vertraue Mosam und hoffe, mit seinem Beistand werden wir uns der Zudringlinge erwehren, darum ist es vielleicht gut, dass dieser Freund bei uns wohne. Niemand vertraue allzuviel der eigenen Kraft und der eigenen Macht. Wir sind zwar mit die stärksten unter den Vögeln, aber Hilfe dient dem Schwachen, zu überwinden den Starken, wie die Katzen den Wolf überwanden."
"Wie war das?" fragte Holgotts Weibchen, und dieser erzählte ihr: Von dem Wolf und den Maushunden
VON DEM WOLF UND DEN MAUSHUNDEN ...
"Am Meeresgestade war eine Schar Wölfe, darunter war einer besonders blutdürstig, der wollte zu einer Zeit sich einen besondern Ruhm unter seinen Gesellen erwerben und ging in ein Gebirge, wo viele und mancherlei Tiere sich aufhielten, da zu jagen.
Aber dieses Gebirge war umfriedet, und die Tiere waren da sicher vor anderen Tieren und wohnten in Eintracht beieinander; darunter war auch eine Schar Maushunde oder Katzen, die hatten einen König.
Nun war der Wolf mit List durch das Gehege gekommen, verbarg sich und fing sich jeden Tag eine Katze und fraß sie. Das war den Katzen sehr leid und sie sammelten sich zur Beratung unter ihrem König, und da waren in sonderheit drei weise, einsichtsvolle Kater, die berief der König in seinen Rat und fragte den ersten um sein Votum gegen den schädlichen Wolf.
Der erste Kater sprach: "Ich weiß keinen Rat gegen dieses große Ungeheuer, als uns in Gottes Gnade zu befehlen, denn wie möchten wir dem Wolf Widerstand tun?" Der König fragte den zweiten Kater, und dieser sprach: "Ich rate, dass wir gemeinschaftlich diesen Ort verlassen und uns eine andere ruhigere Stätte suchen, da wir hier in großer Trübsal, Leibes- und Lebensgefahr verweilen müssen."
Der dritte Kater aber sprach auf des Königs Befragung: "Mein Rat ist, hier zu bleiben und des Wolfs halber nicht auszuwandern. Auch wüsste ich einen Rat, ihn zu überwinden."
"Sage ihn", gebot der König, und der Kater sprach weiter: "Wir müssen acht darauf haben, wenn der Wolf sich neuer Beute bemächtigt hat und wohin er sie trägt und verzehrt, dann musst du, o König, ich und unsere Stärksten ihm nahen, als wollten wir das essen, was er übrig lässt, so wird er sich für ganz sicher halten und von uns sich nichts befürchten.
Dann will ich auf ihn springen und ihm die Augen auskratzen, und dann müssen alle anderen über ihn her fallen, so dass er sich unserer nicht mehr erwehren kann, und es darf uns dabei nicht irren, dass einer oder der andere von uns das Leben einbüßt oder Wunden davon trägt; denn wir erlösen dadurch uns und unsere Kinder von dem Feind, und ein Weiser scheidet nicht feig und furchtsam von seinem Vatererbe; nein, er verteidigt es mit Leibes- und Lebensgefahr."
Diesen Rat hieß der König gut. Darauf geschah es, dass der Wolf einen guten Fang getan hatte, den er auf einen Felsen schleppte, und da führten die Katzen ihre Tat aus, die der tapfere weise Kater angeraten; und der Wolf musste schämlich unter ihren Krallen und zahllosen Bissen sein Leben enden."
"Dieses Beispiel", fuhr Vogel Holgott fort, "sage ich dir, liebes Weib, damit du begreifst, dass treue Freundschaft hilfreich ist, und darum nehme ich gern Vogel Mosam zu meinem Freund und Gefährten mit."
Als dieses das Weibchen hörte, jubilierte sie innerlich, dass ihr Anschlag so unverdächtig und nach ihres Herzens Wunsch ausging. Und da erhoben sich die drei Vögel nach jener lustigen Stätte; heßen im alten Nest die indes ausgebrüteten jungen zurück, bauten dort Nester und wohnten dort friedsam und freundlich bei reichlicher Nahrung eine Zeit miteinander.
Und Vogel Holgott, der alt und schwach wurde, und sein Weib hatten den Vogel Mosam viel lieber in ihren Herzen, als er sie, wie sich gleich zeigen wird.
Es kam eine dürre heiße Zeit, dass alles verdorrte, und der See austrocknete, und die Fische starben; da sprach Vogel Mosam zu sich selbst: "Es ist ein schönes Ding um treue Kameradschaft, und es ist löblich, wenn Freunde zusammen halten. Aber ein jeder ist doch sich selbst der Nächste.
Wer sich selbst nichts nütze ist, wie soll der anderen nützlich sein? Wer künftigen Schaden nicht voraussieht und ihn meidet, der wird ihm nicht entgehen, wenn er da ist. Nun sehe ich voraus, wie mir die Gesellschaft dieser Vögel Schaden und Abbruch tun wird, da von Tag zu Tag die Nahrung sich mindert; und zuletzt werden sie mich verjagen.
Mir aber gefällt es hier wohl, und ich könnte auch allein, ohne jener Gesellschaft hier wohnen; da wäre es wohl gut, wenn ich ihnen zuvor käme, und mich ihrer entledigte, und zwar zuerst des Mannes, denn das Weib vertraut mir ganz, die zwinge ich dann ungleich leichter. Sie kann sogar den Mann töten helfen."
Mit solchen argen und schändlichen Gedanken flog Vogel Mosam zu dem Weibchen und nahte ihr ganz traurig und niedergeschlagen. Die fragte ihn: "Warum sehe ich dich so traurig, mein Freund?" und er antwortete: "Ich trauere über die schwere Zeit und sehe schreckvoll daher schreiten des Hungers Gespenst. Und zumeist deinetwegen trauert mein Herz. Eines nur wüsste ich, das dir frommte, wenn mein Rat nicht unweise dir dünkt."
"Welcher ist das?" fragte das Weibchen, und Mosam sprach: "Bande der Freundschaft sind mehr wert als Bande der Blutsverwandtschaft, denn dies ist oft schädlicher als Gift. Ein Sprichwort sagt: Wer eines Bruders mangelt, der hat einen Feind weniger, und wer keine Verwandten hat, der hat keine Neider.
Ich will dir etwas ansinnen, das dir nützlich sein wird, liebe Freundin, obschon es dir hart ankommen wird, es zu vollbringen, und du wirst es mir als ein Unrecht auslegen, dass ich es dir offenbare, wenn auch es in meinen Augen geringfügig erscheint."
Da sprach das Weibchen: "Deine Rede erschreckt mich, ich kann mir nicht denken, was du meinst, und glaube nicht, dass du mir Übels raten wirst. Doch wäre mir ein leichtes, den Tod zu erleiden um deinetwillen; darum so sprich! Denn wer nicht sein Leben einsetzt für einen treuen Freund, der ist sehr töricht, denn ein Freund ist immer nützlicher wie ein Bruder oder wie Kinder."
Jetzt sprach Mosam mit Arglist: "Mein Rat ist, dass du suchtest, deines alten schwachen Mannes los und ledig zu werden, für den du so mühevoll sorgen musst; da wird dir Glück und Heil zureifen, und mir mit dir!
Und frage nicht nach der Ursache dieses Rates, bis du ihn vollzogen hast, denn hätte ich nicht guten Grund dazu, so glaube mir, würde ich dir solches nicht anraten. Ich schaffe dir schon einen bessern und jüngeren Mann, der dich immer lieben und beschützen wird. Und tust du nicht nach meinem Rat, so wird es dir gehen wie jener Maus, die auch guten Rat verachtete."
Da fragte das Vogelweib: "Wie war das mit jener Maus?" und Mosam erzählte:....
