MÄRCHEN AUS DEUTSCHLAND
Verzeichnis II
"Die Geschichte eines alten Wolfs, in sieben Fabeln"
"Die junge Schwalbe"
"Der Knabe und die Schlange"
"Die List des Fuchses und des Storches"
"Der Esel will den Herrn liebkosen"
"Zeus und das Pferd"
"Der Riese und der Zwerg"
"Die Spinne und die Biene"
"Vom klinkesklanken Lowesblatt"
"Das Märchen von der silbernenen Kugel"
"Pertharit und Ferrandine"
"Neangir und seine Brüder, Argentine und ihre Schwestern"
"Timander und Melissa"
"Nadir und Nadine"
"Der Stein der Weisen"
"Himmelblau und Lupine"
"Der goldene Zweig"
"Der eiserne Armleuchter"
"Der Greif vom Gebirge Kaf"
"Alboflede"
"Adis und Dahy"
"Die Regentrude"
"Vom Handwerksburschen, der mit dreihundert Gulden in den Himmel ritt"
"Die Bernsteinfee"
"Hans ohne Sorgen"
"Hans holt sich eine Frau"
"Hui, in meinen Sack!"
"Schäfer Veit und die drei Riesen"
"König Meerfahrer"
"Fläschlein, tu deine Pflicht!"
"Drei Rosen auf einem Stiel"
"Donner, Blitz und Wetter"
"Die vier kunstreichen Brüder"
"Die teure Metzelsuppe"
"Die gute Gonda"
"Die geraubte Königstochter"
"Die drei Schwäne"
"Die drei Fragen des Kaisers"
"Die Reise zum Vogel Greif"
"Der pfiffige Seilergeselle"
"Der lustige Ferdinand mit dem Goldhirsch"
"Der kranke König und seine drei Söhne"
"Der kluge Martin"
"Der gute schlaue Philipp"
"Der betrogene Teufel"
"Der Meisterlügner"
"Der Kaufmannssohn und die Königstochter"
"Der Köhlerprinz"
"Der Glücksvogel"
"Der Drachentöter"
"Die Zauberei im Herbste"
"Das Märchen von Fanferlieschen Schönefüßchen"
"Der Klabautermann"
"Der Tod und das kleine Mädchen"
"Das andere Ufer"
"Das verlorene Lied"
"Ratzepetz"
"Maimärchen"
"Der Giftpilz"
"Kater Martinchen"
"Prinzessin Svanvithe"
"Die Hand der Jezerte"
"Die Elfen"
"Zottelhaube"
"Goldtöchterchen"
"Das Märchen von der Padde"
"Der Dilldapp"
DER DILLDAPP ...

In einem alten, gut-deutschen Städtchen, das sich friedlich im Wasser eines Flusses spiegelte, lebte ein armes Ehepaar, Michel genannt. Er hatte ein bodenständiges Pech, und wenn sie, eine Schneiderin, es nicht mit der Nadel gehalten hätte, es wäre gar oft arg gegangen. Beide aber hofften auf bessere Zeiten und träumten, wie es in der Not üblich ist, von dem großen Glück, das einst kommen würde. Vorläufig gab es täglich neue Plage.
Ihre größte Plage aber war ihr Sohn, der Dilldapp. Dilldapp war gut, hatte aber statt Verstand nur einen dicken Kopf, so daß er alles überzwerch verstand und verkehrt ausführte. Nichts half. Selbst Naschereien, die Vater und Mutter ihm verabreichten, wie Ohrfeigen, Kopfnüsse oder Nasenstüber konnten es nicht schaffen. "Du Tölpel, Schafskopf, Tollpatsch, Dähmel, Dummerjan", so ging's den ganzen Tag. Unbekümmert dessen vertrieb Dilldapp sich sein Dasein mit Essen, Trinken und Tellerlecken, so daß er dick wurde wie ein Mehlsack, fett wie ein Aal, glänzend wie eine Zwiebel, rot wie ein Trompetermantel und unförmlich wie ein ausgestopfter Mops. Schwer brachte man ihn von der Ofenbank. - "Dilldapp, bring mir Wachs!" Dann brachte der dumme Dilldapp Flachs. - "Bring mir Zwirn!" Dilldapp brachte eine Birn. Er brachte alles verkehrt. Statt Schneiderscher - Schweineschmer; statt Papier - eine Maß Bier; statt Futterzwilch - Buttermilch; statt Stopfnadeln - Topfladen usw. Eines Tages wollte die Mutter bügeln und rief: "Dilldapp hol' mir Rock und Eisen!" Dilldapp ging weg, kam nach Stunden zurück mit einem Bock und zwei Geisen...
Da nahm Frau Michel eine Hechel und schlug sie ihm um den Kopf. Das knallte so heftig, daß Dilldapp erschrak und die Treppe hinunterlief. Er geriet in ein solches Laufen bergab und bergauf, durch Wälder und Felder, Land und Sand, Stock und Stein, Distel und Dorn, daß er nicht eher aufhörte, bis er nichts mehr sah vor lauter Nacht. Die Sonne hatte er schon über den Haufen gelaufen und der Abendröte hatte er die bunten Fensterscheiben eingerannt. Da hingen die Sterne ihre tausend Laternen zum Himmel heraus und der Mond zog als Nachtwächter auf die Wache, um zu sehen, wer so erbärmlich laufe. Dilldapp lief ohne Ende. Gegen Morgen kam er an einen Bach. Die Frösche, die über Dilldapps dummes Aussehen lachten, riefen ihm zu: "Dilldapp, lauf nicht übern Steg; es ist besser, du springst hinüber!"
Dilldapp glaubte, es sei wirklich besser, sprang und fiel ins Wasser. Plumps!! - Das platschte nicht schlecht. Als Dilldapp aus dem Wasser kroch, hüpften die Frösche die kreuz und die quer über ihn hinweg und lachten noch lauter als vordem. Nun war Dilldapp zur Besinnung gekommen, ließ das Laufen sein, blieb im Walde stehen und schaute sich nach allen Seiten um. - "Da bist du schön reingefallen, du Tölpel!" plusterte eine Eule. Ein Rabe rief vom nächsten Baum: "Heda! Dilldapp, Du mußt Hunger haben; greif rechter Hand in das Erdloch, es sind Zuckerbretzeln drin!" Dilldapp glaubte es und griff hastig in das Loch. Es war ein Fuchsbau, und Reinicke, der schon gelauert hatte, biß ihn in die Finger. "Au!" schrie Dilldapp und fiel vor Schreck hintenüber, direkt in einen großen Ameisenhaufen. Sofort hatten ihn die Ameisen vollständig eingehüllt. Ob dieses Spaßes wurde es ringsherum lebendig. Die Käuze und Finken, Spechte und Raken, Libellen und Käfer, die Füchse und Dächse rumorten und lachten; selbst die Blindschleichen, Echsen und Kröten raschelten heftig und hatten weidlich ihr Vergnügen. Ha-ha und Hum-hum und Quackelaquack: "Du Tölpel, Schafskopf, Tollpatsch, Dähmel, Dummerjan!" so ging es unter Lachen in dem Walde.
Dilldapp wühlte sich heraus, wischte sich das krabbelnde Getier aus den Augen und versuchte davonzukommen, stolperte aber und fiel auf einen Felsblock. Dieser vermeintliche Felsblock war ein lagernder Waldesel, der mit Dilldapp auf dem Rücken aufsprang und davoneilte. Als Dilldapp sich einigermaßen aus seiner schwarzen Ameisenhülle befreit hatte, trabte der Esel gerade mit ihm in eine tiefe Felsschlucht hinein. Hier saß in magischer Beleuchtung ein großes dickes Ungeheuer, von einer so außerordentlich ausgedehnten Herzensgüte, daß man sie mit Ellen ausmessen konnte. - "Oh, Mama! wie abscheulich !" - Das Gesicht des Ungeheuers war dick wie ein Pfefferballen; seine Nase so breit wie ein Blasebalg; seine Augen so groß und rund wie die Räder an einem Schiebkarren; sein Mund gähnend breit, wie die Brieftasche eines Postmeisters.
Dilldapp sprang vom Esel und redete sein übliches dummes Zeug, woraus der Popanz erkannte, daß solch närrisches Gerede nur von einem Dilldapp herrühren könne. Er schüttelte sich vor Lachen und auch Dilldapp lachte. - " Wohlan! bleib hier", sagte das Ungeheuer. So trat Dilldapp in seine Dienste. Er hatte nichts weiter zu tun, als dem dicken Popanz den Rücken zu kratzen, weil er es wegen seiner Leibesfülle nicht selber konnte. Aber der war nicht undankbar und kratzte währenddessen den ehrlichen Dilldapp wieder, worüber sie dann gewöhnlich in Gesellschaft einschliefen. - Nach einem Jahr sagte das Ungeheuer zu Dilldapp: "Deine Eltern warten daheim auf dich. Geh zu ihnen zurück. Du hast mir treu gedient, zum Lohne schenke ich dir meinen Waldesel. Jedoch knüpfe ich eine Bedingung an dieses Geschenk; du darfst niemals den Schwanz des Esels erfassen und glauben, es sei der Griff einer Pumpe!" - "Danke", sagte Dilldapp und zog mit dem Esel davon. In der nächsten Waldlichtung blieb Dilldapp stehen. Damit er das Verbot nicht vergäße, wiederholte er die Worte des Popanz: "Du sollst nicht glauben, der Schwanz des Esels sei ein Pumpengriff!"
Während er sich die Worte ins Gedächtnis zurückrief, hatte er beiläufig den Schwanz des Esels erfaßt und pumpte schon. Da fielen aus dem Esel harte, blanke, goldene Taler, eine ganze Menge. Dilldapp war zu dumm, um erstaunt zu sein. Er zog seine Jacke aus, band die Ärmel zusammen und machte aus ihr einen Geldsack, ritt zum ersten besten Wirtshaus, bestellte eine mächtige Schüssel Hirsebrei und hängte seinen schweren Geldsack über sich an die Wand. Dilldapp aß nach Herzenslust und gab auch seinem Esel reichlich. Als der Wirt mit der Rechnung kam, fragte Dilldapp: "Herr Wirt, was sind Sie mir schuldig?" "Alle Ehr' und Respekt," erwiderte der Wirt, "ich bekomme doch etwas von Ihnen." - " Wie viel?" Der Wirt hatte den Dilldapp als solchen erkannt und rechnete ihm die Zeche vor: "Einen zwanzigfachen Hirsebrei, mein Herr, macht 25 Taler, Wein und Bier keines - macht zusammen 50 Taler; Logis keines - 75 Taler, Bund Stroh, Stallung für den werten Esel - 100 Taler, 25 mal die Mütze abgezogen -125 Taler; und 25 mal nach Ihrem Namen gefragt, macht zusammen 150 Taler, - Bitte !" - "Das ist sehr billig", sagte Dilldapp und griff in den Geldsack. - "Ei! was haben Sie da Schweres an der Wand hängen?" meinte der Wirt, "das muß Sie ja bei der Reise stark behindern?" - "Da haben Sie recht, Herr Wirt. Wollen Sie so gut sein und den Sack an sich nehmen? Sie können sich die 150 Taler herausnehmen und das übrige wegwerfen!" -
Darauf bestieg Dilldapp seinen Esel und trabte vergnügt seiner Vaterstadt zu. Als er in die Stadt hineinkam, ritt er zackzack die engen Gassen zu seinen Eltern hinunter, band den Esel vor die Tür und lief schnurstracks ins Haus hinein. Vater Michel und die Mutter hatten ihn kaum erblickt, als sie ihn auch schon umarmten. Dilldapp weinte vor Freude. Auf einmal rief er: "Meine lieben Eltern, ihr braucht euch nicht mehr zu plagen; ich bringe einen Esel mit, der mehr Gold gibt, als ihr euch jemals hättet träumen lassen. - Draußen steht er!" Alle stürzten vor die Tür und sahen in der Tat einen Esel. Dilldapp ergriff den Eselsschwanz, pumpte und schrie: "Gold! Gold! Gold!" - Nun ging es die Brennerzeile hinauf und die Spatzengasse hinunter, es ging durch die ganze Stadt: "Der Dilldapp, der dumme Michel, hat das Glück mit nach Hause gebracht!". Ja - Kinder und Toren haben das Glück bei den Ohren.
Alle Welt lief zusammen und drängte sich um Michels Haus. Die Menschen zeigten ihr wahres Angesicht; sie waren voller Mißgunst und Neid. Berichterstatter und Kundschafter, Steuerbeamte und sonstige Anstalts- und Amtspersonen ließen den Micheln keine Ruhe mehr. Und es wurde immer ärger. Schließlich und zuletzt kam die Kriminal-Polizei, interessierte sich voller Mißtrauen für die Angelegenheit und sagte: Ha! ... Ha! Nun erkannte die Familie Michel, daß das, was sie sich einstmals erträumt hatte, gar nicht das große Glück sei, sondern daß es vielmehr ein friedliches und beschauliches Leben ist, was das sogenannte Glück hier in diesem Dasein ausmacht, daß es aber nie und nimmer das Gold ist. - Nun wünschten sie sich, der Zauberesel möge nicht anders sein, wie jeder gewöhnliche Esel. Eines Morgens nahm der Dilldapp auf Geheiß seines Vaters das Tier am Halfter, um es in den Wald zurückzuführen. Die ganze Stadt lief den beiden hinterdrein. Einige Buben faßten an den Schwanz des Esels und pumpten. Da gab es ein großes Gelächter und alles rief: "Dilldapp, du Dummerjan, das ist doch kein Gold; es ist ja nur ein Eselsdreck!"
Quelle:
(Deutsches Märchen nach Clemens Brentano)
DAS MÄRCHEN VON DER PADDE ...
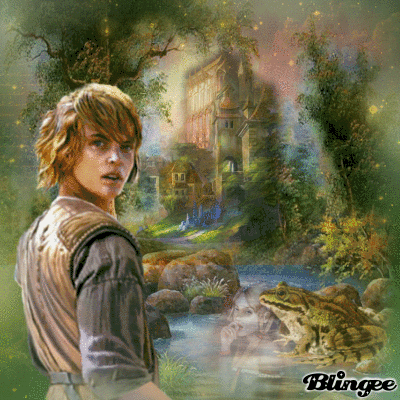
Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Es lebte aber auch damals eine alte Frau, die hatte nur ein Töchterlein, welches Petersilie hieß.
Der König schickte seine Söhne aus, um sich in der Welt umzusehen, seine und fremde Lande kennen zu lernen, um so weise genug zu werden, dereinst ihr Erbteil beherrschen zu können.
Die alte Frau aber lebte stille und eingezogen mit ihrem Töchterlein, das den Namen davon hatte, dass es Petersilie lieber als alle andere Speise aß, ja einen rechten Heißhunger darnach hatte. Die arme Mutter hatte nicht Geld genug, immer und immerfort Petersilie für die Tochter zu kaufen, und es blieb ihr daher nichts übrig, da das Töchterlein gar zu schön war und sie auf keine Weise ihrer Schönheit nachteilig sein wollte, als nächtlich aus dem Garten des gegenüberliegenden Jungfrauenklosters die schönsten Petersilienwurzeln zu entwenden und das Töchterchen damit zu füttern.
Das Gelüst der schönen Petersilie war nicht unbekannt, eben so wenig blieb der Diebstahl verborgen, und die Äbtissin war über ihre schöne Nachbarin nicht wenig erzürnt.
Die drei Prinzen kamen auf ihrer Wanderung auch in das Städtlein, wo Petersilie mit ihrer Mutter wohnte und gingen gerade durch die Straße, als das schöne Mägdlein am Fenster stand und ihre langen, wunderprächtigen Haare kämmte und flocht. Entzündet von Liebe, stieg in einem jeden der Wunsch auf, die Schöne zu besitzen, und kaum war der Wunsch über die Lippen gekommen, als auch ein jeglicher, in blinder Eifersucht, seinen Säbel zog und auf seinen brüderlichen Mitbewerber losging.
Der Kampf ward nicht wenig heftig, auch die Äbtissin trat an die Pforte, und kaum hatte die fromme Frau gehört, dass ihre Nachbarin die Ursache sei, als aller Grimm, früher und späterer, sich in ihr zu der Verwünschung sammelte: sie wünschte, dass Petersilie in einen hässlichen Frosch verwandelt würde und unter einer Brücke am entferntesten Ende der Erde säße. Kaum ausgesprochen, ward Petersilie ein Frosch und war verschwunden. Die Prinzen, die nun keinen Gegenstand des Kampfes hatten, steckten ihre Degen ein, umarmten sich wieder brüderlich und zogen heim zu ihrem Vater.
Der alte Herr merkte indessen, dass er stumpf und schwach in den Regierungsgeschäften ward, und wollte daher das Reich abtreten, aber wem? Dazu konnte sich sein väterliches Herz nicht entschließen, unter den drei Söhnen zu wählen. Das Schicksal sollte es bestimmen und er ließ sie daher vor sich kommen.
»Meine lieben Kinder, - sprach er - ich werde alt und schwach und will meine Regierung niederlegen, kann mich aber nicht entschließen, einen von euch zu wählen, da ich euch alle drei gleich zärtlich liebe und denn doch auch dem Besten und Klügsten von euch mein Volk übergeben wollte. Ihr sollt mir daher drei Aufgaben lösen und wer sie mir löst, der soll mein Erbe sein. Das erste ist: ihr müsst mir ein Stück Leinwand von hundert Ellen bringen, das man durch einen goldnen Ring ziehen kann.« Die Söhne verneigten sich, versprachen ihr möglichstes zu tun und machten sich auf die Reise.
Die beiden ältesten Brüder nahmen viel Gefolge und viele Wagen mit, um alle die schöne Leinwand, die sie finden würden, aufzuladen, der Jüngste ging ganz allein. Bald kamen drei Wege, zwei lustig und trocken, der dritte düster, feucht und schmutzig. Die beiden älteren Brüder nahmen die beiden ersten Wege, der Jüngste nahm Abschied von ihnen und schlenderte den düstern Weg entlang. Wo nur schöne Leinwand war, besahen sie die älteren Brüder und erstanden sie, ihre Wagen krachten unter der Last, und wo nur irgend der Ruf sie hinwies, dahin eilten sie auch und kauften. Sie kehrten reich versehen zurück.
Der Jüngste dagegen ging mehrere Tagereisen auf seinem unwirtlichen Wege fort, nirgends wollte ihm ein Ort erscheinen, in dem er auch nur eine erträglich feine Leinwand gefunden und so reiste er lange und ward immer missmutiger. Einst kam er an eine Brücke, setzte sich an dem Rande nieder und seufzte recht tief über sein böses Schicksal. Da kroch eine missgestaltete Padde aus dem Sumpf hervor, stellte sich vor ihn und fragte, mit nicht ganz übeltönender Stimme: was ihm denn fehle?
Der Prinz, unwillig, antwortete: »Frosch, du wirst mir nicht helfen.« - »Und doch, - erwiderte der Frosch - sagt mir nur eure Leiden.« Nach mehreren Weigerungen erklärte endlich der Prinz die Ursache, warum ihn sein Vater ausgesendet habe. »Dir soll geholfen werden,« sagte die Padde, kroch in ihren Sumpf zurück und zerrte bald ein Läppchen Leinwand, nicht größer als eine Hand und nicht eben zum saubersten aussehend, hervor, das sie vor den Prinzen niederlegte und ihm andeutete, das solle er nur nehmen.
Der Prinz hatte gar keine Lust, ein so übel scheinendes Läppchen anzunehmen, doch lag etwas in den Zuredungen der Padde, das ihn bereitwillig machte und er dachte: etwas ist doch besser, als gar nichts, steckte daher sein Läppchen ein und empfahl sich dem Frosche, der mühsam sich wieder in das Wasser schob.
Je weiter er ging, je mehr merkte er zu seiner Freude, dass ihm die Tasche, in welche er das Läppchen gesteckt hatte, immer schwerer ward und er wanderte daher mutvoll auf den Hof seines Vaters zu, den er auch in kurzem erreichte, als eben auch seine Brüder mit ihren Frachtwagen wieder anlangten.
Der Vater war erfreut, seine drei Kinder wieder zu sehen, zog sogleich seinen Ring vom Finger und die Probe begann. Auf alle den Frachtwagen war auch nicht ein Stück, das nur zum zehnten Teile durch den Ring gegangen wäre, und die beiden älteren Brüder, die erst ziemlich spöttisch auf ihren Bruder, der ganz ohne alle große Vorräte gekommen war, sahen, wurden ziemlich kleinlaut.
Wie ward ihnen zu Mute, als er aus seiner Tasche ein Gespinst zog, das an Zartheit, Feinheit und Weiße alles übertraf, was man je gesehen hatte. Es wallte in glänzenden Lagen und ging nicht allein höchst bequem durch den Ring durch, man hätte wohl noch ein Stück zu gleicher Zeit durch den Ring ziehen können, und dennoch gab das Maas richtige hundert Ellen.
Der Vater umarmte den glücklichen Sohn, befahl die unbrauchbare Leinwand ins Wasser zu werfen, und sagte dann zu seinen Kindern: »nun, ihr lieben Prinzen, müsst ihr die zweite Forderung erfüllen, ihr müsst mir ein Hündlein bringen, das in eine Nuss-Schale passt.« Die Söhne waren über eine so wunderbare Aufgabe nicht wenig erschrocken, aber der Reiz der Krone war zu groß, sie versprachen auch dies zu erfüllen zu suchen, und wanderten nach wenig Tagen Ruhe wieder aus.
Am Scheidewege trennten sie sich; der Jüngste ging seinen feuchten, unscheinbaren Weg, er hatte schon bei weitem mehr Mut. Kaum hatte er einige Zeit an der Brücke gesessen und wieder geseufzt, so kroch auch die Padde wieder hervor, setzte sich ihm, wie das erste Mal, gegenüber, öffnete den weiten Mund und fragte: was ihm denn fehle? Der Prinz setzte diesmal keinen Zweifel in die Macht der Padde, sondern gestand ihr gleich sein Bedürfnis.
»Dir soll geholfen werden,« sagte wiederum die Padde, kroch in den Sumpf und brachte ein Haselnüsslein hervor, legte sie ihm vor die Füße, sagte ihm, er solle sie nur mitnehmen und seinen Herrn Vater bitten, die Nuss sauber aufzuknacken, das andere würde er schon sehen. Der Prinz ging vergnügt fort und die Padde schob sich wieder mühsam in das Wasser hinab.
Daheim waren die Brüder auch schon zu gleicher Zeit angekommen und hatten eine große Menge sehr zierlicher Hündlein mitgebracht. Der alte Vater hatte eine beträchtlich große Wallnussschale bereit und schob jedes Hündlein hinein, aber die hingen bald mit den Vorderfüßen, bald mit dem Kopf, bald mit den Hinterfüßen, bald ganz über die Wallnussschale fort, so dass gar nicht daran zu denken war, dass ein Hündlein hineingepasst hätte.
Als nun kein Hund mehr zu proben übrig war, überreichte der Jüngste mit einer zierlichen Verbeugung dem Vater seine Haselnuss und bat, sie auf das behutsamste aufzuknacken. Kaum hatte der alte König es getan, als aus der Haselnuss ein wunderkleines und niedliches Hündlein sprang, das gleich auf der Hand des Königs umher lief, mit dem Schwänzlein wedelte, ihm schmeichelte und gegen die anderen auf das zierlichste bellte.
Die Freude des Hofes war allgemein, der Vater umarmte wieder den glücklichen Sohn, befahl abermals, die anderen Hunde in das Wasser zu werfen und zu ersäufen, und sagte dann zu seinen Söhnen: »liebe Kinder, die beiden schwierigsten Bedingnisse sind nun erfüllt. Hört nun mein drittes Verlangen: Wer die schönste Frau mir bringt, der soll mein Erbe und Nachfolger sein.« Die Bedingung war zu nahe, der Preis zu reizend, als dass die Prinzen nicht sogleich, jeder auf seinem gewohnten Wege, wieder hätten aufbrechen sollen.
Dem Jüngsten war diesmal gar nicht wohl zu Mute. Er dachte: alles andere hat der alte Frosch wohl erfüllen können, aber nun wird's vorbei sein, wo wird er mir ein schönes Mädchen und noch dazu das schönste herschaffen können? Seine Sümpfe sind fern und breit menschenleer und nur Kröten, Unken und anderes Ungeziefer wohnt dort. Er ging indessen doch fort und seufzte diesmal aus schwerem Herzen, als er wieder an der Brücke saß.
Nicht lange darnach stand die Padde wieder vor ihm und fragte: was ihm fehle? »Ach, Padde, diesmal kannst du mir nicht helfen, das übersteigt deine Kräfte.« - »Und doch - erwiderte der Frosch - sagt mir nur euer Leiden.« Der Prinz entdeckte ihm endlich seine neuen Leiden. »Dir soll geholfen werden - sagte wieder der Frosch - gehe du nur voran, die Schöne wird dir schon folgen, aber du musst über das, was du sehen wirst, nicht lachen.« Darauf sprang er, wider seine Gewohnheit, mit einem herzhaften Sprunge weit in das Wasser hinein und verschwand.
Der Prinz seufzte wiederum recht tief, stand auf und ging fort; denn er erwartete nicht viel von dem Versprechen. Kaum hatte er einige Schritte gemacht, so hörte er hinter sich ein Geräusch; er blickte sich um und sah sechs große Wasserratzen, die, in vollem Trabe, einen Wagen von Kartenpappe gemacht hinter sich herzogen. Auf dem Bocke saß eine übergroße Kröte als Kutscher, hinten auf standen zwei kleinere Kröten als Bediente und zwei bedeutend große Mäuse, mit stattlichen Schnurrbärten, als Heiducken, im Wagen selbst aber saß die ihm wohlbekannte dicke Padde, die, im Vorbeifahren, etwas ungeschickt, aber doch möglichst zierlich, ihm eine Verbeugung machte.
Viel zu sehr in Betrachtungen vertieft von der Nähe seines Glückes, und wie ferne er nun sei, da er die schönste Schöne nicht finden würde, betrachtete der Prinz kaum diesen lächerlichen Aufzug, noch weniger hatte er gar Lust zu lachen. Der Wagen fuhr eine Weile vor ihm her und bog dann um eine Ecke. Wie ward ihm aber, als bald darauf um dieselbe Ecke ein herrlicher Wagen rollte, gezogen von sechs mächtigen, schwarzen Pferden, regiert von einem wohl gekleideten Kutscher und in dem Wagen die schönste Frau, die er je gesehen und in der er sogleich die reizende Petersilie erkannte, für die sein Herz schon früher entbrannt war. Der Wagen hielt bei ihm stille, Bediente und Heiducken, aus der Tiergestalt entzaubert, öffneten ihm den Wagen und er säumte nicht, sich zu der schönen Prinzessin zu setzen.
Bald kam er in der Hauptstadt seines Vaters an, mit ihm seine Brüder, die eine große Menge der schönsten Frauen mit sich führten, aber als sie vor den König traten, erkannte sogleich der ganze Hof der schönen Petersilie den Kranz der Schönheit zu, der entzückte Vater umarmte seinen Sohn, als Nachfolger, und seine neue Schwiegertochter, die anderen Frauen wurden aber alle, wie der Leinwand und den Hündleinen geschehen war, ins Wasser geworfen und ersäuft. Der Prinz heiratete die Prinzessin Petersilie, regierte lange und glücklich mit ihr, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch.
Aus Büsching; Volkssagen, Märchen und Legenden
GOLDTÖCHTERCHEN ...
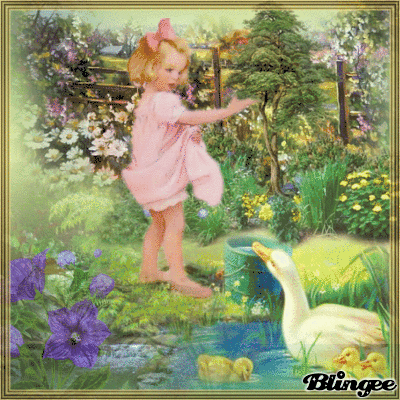
Vor dem Tor, gleich an der Wiese, stand ein Haus, darin wohnten zwei Leute, die hatten nur ein einziges Kind, ein ganz kleines Mädchen. Das nannten sie Goldtöchterchen. Es war ein liebes, kregles kleines Ding, flink wie ein Wiesel.
Eines Morgens geht die Mutter früh in die Küche, Milch zu holen; da steigt das Ding aus dem Bett und stellt sich im Hemdchen in die Haustüre. Nun war ein wunderherrlicher Sommermorgen, und wie es so in der Haustüre steht, denkt es: "Vielleicht regnet's morgen; da ist's besser, du gehst heute spazieren." Wie's so denkt, geht's auch schon; läuft hinters Haus auf die Wiese und von der Wiese bis an den Busch. Wie's an den Busch kommt, wackeln die Haselbüsche ganz ernsthaft mit den Zweigen und rufen:
"Nacktfrosch im Hemde,
Was willst du in der Fremde?
Hat kein' Schuh und hast kein' Hos,
Hast ein einzig Strümpfel bloß;
Wirst du noch den Strumpf verlier'n,
Mußt du dir ein Bein erfrier'n.
Geh nur wieder heime;
Mach dich auf die Beine!"
Aber es hört nicht, sondern läuft in den Busch, und wie es durch den Busch ist, kommt es an den Teich. Da steht die Ente am Ufer mit einer vollen Mandel Junger, alle goldgelb wie die Eidotter, und fängt entsetzlich an zu schnattern; dann läuft sie Goldtöchterchen entgegen, sperrt den Schnabel auf und tut, als wenn sie es fressen wollte. Aber Goldtöcherchen fürchtet sich nicht, geht gerade darauf los und sagt:
"Ente du Schnatterlieschen,
Halt doch den Schnabel und schweig ein bißchen!"
"Ach", sagt die Ente, "du bist's, Goldtöchterchen! Ich hatte dich gar nicht erkannt; nimm's nur nicht übel! Nein, du tust uns nichts. Wie geht es dir denn?Wie geht es denn deinem Herrn Vater und deiner Frau Mutter? Das ist ja recht schön, daß du uns einmal besuchst. Das ist ja eine große Ehre für uns. Da bist du wohl recht früh aufgestanden? Also, du willst dir wohl auch einmal unsern Teich besehen? Eine recht schöne Gegend! Nicht wahr?"
Wie sie ausgeschnattert hat, fragt Goldtöchterchen: "Sag einmal, Ente, wo hast du denn die vielen kleinen Kanarienvögel her?"
"Kanarienvögel?" wiederholt die Ente, "ich bitte dich, es sind ja bloß meine Jungen."
"Aber sie singen ja so fein und haben keine Federn, sondern bloß Haare! Was bekommen denn deine kleinen Kanarienvögel zu essen?"
"Die trinken klares Wasser und essen feinen Sand."
"Davon können sie ja aber unmöglich wachsen."
"Doch, doch", sagt die Ente; "der liebe Gott segnet's ihnen; und dann ist auch zuweilen im Sand ein Würzelchen und im Wasser ein Wurm oder eine Schnecke."
"Habt ihr denn keine Brücke?" fragt dann weiter Goldtöchterchen.
"Nein", sagt die Ente, "eine Brücke haben wir nun allerdings leider nicht. Wenn du aber über den Teich willst, will ich dich gern hinüberfahren."
Darauf geht die Ente ins Wasser, bricht ein großes Wasserrosenblatt ab, setzt Goldtöchterchen darauf, nimmt den langen Stengel in den Schnabel und fährt Goldtöchterchen hinüber. Und die kleinen Entchen schwimmen munter nebenher.
"Schönen Dank, Ente!" sagte Goldtöchterchen, als es drüben angekommen ist.
"Keine Ursache", sagt die Ente. "Wenn du mich mal wieder brauchst, steh ich gern zu Diensten. Empfiehl mich deinen Eltern. Schön adje!"
Auf der anderen Seite des Teiches ist wieder eine große grüne Wiese, auf der geht Gold-töchterchen weiter spazieren. Nicht lange, so sieht es einen Storch, auf den läuft's gerade zu: "Guten Morgen, Storch", sagt's; "was ißt du denn, was so grünscheckig aussieht und dabei quakt?"
"Zappelsalat", antwortet der Storch, "Zappelsalat, Goldtöchterchen!"
"Gib mir auch was, ich bin hungrig!"
"Zappelsalat ist nichts für dich", sagt der Storch; geht an den Bach, taucht mit seinem langen Schnabel tief unter und holt erst einen goldenen Becher mit Milch und dann eine Wecke heraus. Darauf hebt er den rechten Flügel und läßt eine Zuckertüte herunterfallen. Goldtöchterchen läßt sich's nicht zweimal sagen, sondern setzt sich hin und ißt und trinkt. Wie's satt ist, sagt's:
"Ein'n schönen Dank,
Und gute Gesundheit dein Leben lang!"
Darauf läuft's weiter. Darauf läuft's weiter. Nicht lange, so kommt ein kleiner blauer Schmetterling geflogen. "Kleines Blaues", sagt Goldtöchterchen, "wollen wir uns ein wenig haschen?" "Ich bin's zufrieden", antwortet der Schmetterling, "aber du darfst mich nicht angreifen, damit nichts abgeht."
Nun haschten sie sich lustig auf der Wiese herum, bis es Abend wird. Wie es anfängt zu dämmern, setzt sich Goldtöchterchen hin und denkt, jetzt willst du dich ausruhen; dann gehst du nach Hause. Wie's so sitzt, merkt's, daß die Blumen im Grase auch schon alle müde sind und einschlafen wollen. Das Gänseblümchen nickt ganz schläfrig mit dem Kopfe, richtet sich dann auf, sieht sich mit gläsernen Augen um, und dann nickt's noch einmal. Da steht eine weiße Aster daneben (und das war jedenfalls die Mutter) und sagt:
"Gänseblümchen, mein Engelchen,
Fall nicht vom Stengelchen!"
"Geh zu Bett, mein Kind." Und das Gänseblümchen duckt sich hin und schläft ein. Dabei verschiebt sich's das weiße Mützchen, daß ihm die Spitzen gerade übers Gesicht fallen. Darauf schläft die Aster auch ein.
Wie Goldtöchterchen sieht, daß alles schläft, fallen ihm die Augen auch zu. Da liegt es nun auf der Wiese und schläft, und mittlerweile läuft seine Mutter immer noch im ganzen Hause umher und sucht's und weint. Sie geht in alle Kammern und sieht in alle Winkel, unter alle Betten und unter die Treppe. Dann geht sie auf die Wiese bis an den Busch und durch den Busch bis an den Teich. "Über den Teich kann es nicht gekommen sein", denkt sie und geht wieder zurück und durchsucht noch einmal alle Winkel und Ecken und sieht unter alle Betten und unter die Treppe.
Wie sie damit fertig ist, geht sie wieder auf die Wiese und wieder in den Busch und wieder bis an den Teich. Das tut sie den ganzen Tag, und je länger sie es tut, desto mehr weint sie. Der Mann aber läuft unterdes in der ganzen Stadt umher und fragt, ob niemand Goldtöchterchen gesehen hat.
Als es aber ganz dunkel geworden war, kam einer von den zwölf Engeln, die jeden Abend über die ganze Welt hinwegfliegen müssen, um nachzusehen, ob sich nicht irgendwo ein kleines Kind verlaufen hat, und es wieder zu seiner Mutter zu bringen, auch auf die grüne Wiese. Als er Goldtöchterchen hier liegen und schlafen sah, hob er es behutsam auf, ohne es zu wecken, flog bis über die Stadt und sah nach, in welchem Hause noch Licht war.
"Das wird wohl das Haus sein, wo's hingehört", sagte er, als er das Haus von Goldtöchterchens Eltern sah, und das Licht im Wohnzimmer brannte immer noch. Heimlich sah er zum Fenster hinein: Da saßen Vater und Mutter sich an dem kleinen Tische gegenüber und weinten, und unter dem Tisch hielten sie sich die Hände. Da öffnete er ganz leise die Haustüre, legte das Kind unter die Treppe und flog fort.
Und die Eltern saßen immer noch am Tisch. Da stand die Frau auf, zündete noch ein Licht an und leuchtete noch einmal in alle Winkel und Ecken und unter die Betten.
"Frau", sagte der Mann traurig, "du hast ja schon so oft vergeblich in alle Winkel und Ecken und unter die Treppe gesehen. Geh zu Bett. Unser Goldtöchterchen wird wohl in den Teich gefallen und ertrunken sein."
Doch die Frau hörte nicht, sondern ging weiter, und wie sie unter die Treppe leuchtete, lag das Kind da und schlief. Da schrie sie vor Freude so laut auf, daß der Mann eilends die Treppe herabgesprungen kam. Mit dem Kinde auf dem Arm kam sie ihm freudestrahlend entgegen. Es schlief ganz fest, so müde hatte es sich gelaufen.
"Wo war es denn? Wo war es denn?" rief er.
"Unter der Treppe lag's und schlief", erwiderte die Frau, "und ich habe doch heute schon so oft unter die Treppe gesehen."
Da schüttelte der Mann mit dem Kopfe und sagte: "Mit rechten Dingen geht's nicht zu, Mutter; wir wollen nur Gott danken, daß wir unser Goldtöchterchen wieder haben!"
Richard von Volkmann-Leander
ZOTTELHAUBE ...
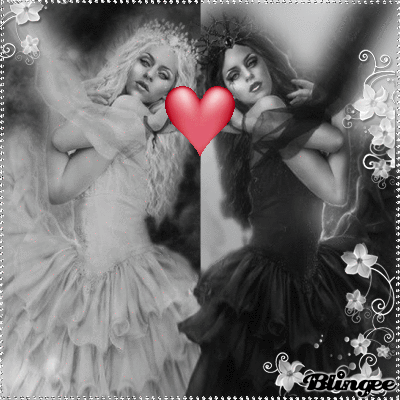
Es waren einmal zwei ungleiche Schwestern. Fast zugleich erblickten sie das Licht der Welt, doch sie konnten nicht verschiedener sein. Einmal glücklich da, hielten sie immer zusammen.
Aber bis die beiden endlich in unseren Kreis treten! Das dauert lange.
'Viel zu lang dauert mir das‘, dachte die Königin. 'Die Zeit verrinnt. Jetzt wird sie allmählich knapp. Der König und ich, wir kriegen und kriegen und kriegen kein Kind. Das Volk hat schon aufgehört, sich zu wundern. Der Hofstaat hat aufgehört, sich in die Ohren zu tuscheln. Der Herr Gemahl hat aufgehört, mich anzusehn. Und dieser ganze weite Spiegelsaal dröhnt mir die Ohren voll. Ach, Schwermut und Stille, das klingt lauter als alles Kindergeschrei‘.
Da riß die Königin rasch ein Fenster auf, schaute ins Weite und dann auf den Platz. Dort unten spielten Kinder Verstecken. Eins hielt sich hinter dem Wachhäuschen verborgen. Eins kauerte unter dem Tisch der Spargelverkäuferin. Ein drittes drückte sich lang und dünn an den Stamm der Kastanie. Ein Kind sollte die anderen suchen, blickte aber just in diesem Augenblick auf, sah die Königin oben an ihrem Fenster und begann heftig zu winken.
Die Königin winkte schweren Herzens zurück.
Nicht lange darauf bestellten Königin und König einen Mann ein. Der erschien und war beflissen und übergab eine Kassette. Der Kasten war mit grünem Leinen überzogen. Darin Bilder von großäugigen Kindern.
"Wähl Du eins."
"Nein, zieh Du eins."
Am Ende schickten die beiden den Mann wieder fort.
Eine gute Frau vom anderen Ende der Hofstraße brachte eins ihrer Mädchen. Das spielte und schlief im Palast und durfte sogar nachmittags dem Teefräulein zur Hand gehen. An einem hellen Sommertag segelte dem Kind eine Papierschwalbe aus dem offenen Fenster. Sie rannte die Treppen hinunter, eilte hinaus auf den Schloßplatz, um den Flieger zu retten. Wie sie wieder hinauf ging, hielt sie den Papierflügler sicher in der einen Hand. Mit der anderen aber zog und zurrte sie ein armseliges Bettlermädchen hinter sich her.
"Wen hast Du da mitgebracht, ach herrje", rief die Königin aus. "Du bist aber ein besonders lumpiges Bettelkind. Bleib vom Teppich, nimm einen Keks. Gruß an die Eltern." "Bist Du die Königin, die keine Kinder bekommt?" So sprach das Bettelmädchen. "Meine Mutter sagt, sie kann Dir welche verschaffen." "Solche wie von Deiner Sorte?", fragte die Königin mißtrauisch. "Das Königshaus dankt." "An Deiner Stelle wäre ich ein wenig mehr interessiert", entgegnete das schmutzige Kind. "Frag nur die Mutter."
"Will sich die auch noch einschleichen? Hier, eine letzte Katzenzunge. Und dann ab." "Frag nur die Mutter. Wirst schon sehen." Und das Schmuddelkind stemmte sich breitbeinig vor die königliche Hoheit, die Hände fest in die Hüften gestützt. Es warf die Schultern zurück und wölbte einen nicht vorhandenen Bauch.
"Jetzt muß ich mich gar im eigenen Palast verspotten lassen", klagte die Königin. "Nun spring los, geh die Mutter holen." "Wein liebt sie. Die Alte nämlich. Roten Wein und süßen Kuchen. Tisch ihr nur starken Wein auf, dann taut sie gleich auf. Gläser nicht notwendig." Das Kind rannte los.
Die schmutzige Alte erschien so schnell unter der Tür, als hätte sie draußen gelauert. Sie delektierte sich am Wein, dann am Kuchen, dann wieder am Wein. Verlangte nach einer zweiten Flasche. "Die gibt es mit auf dem Weg. Jetzt gib Du mir erst mal was", verlangte die Königin. "Ich will und will und will ein Kind. Wie Du sicher schon weißt." "Noch hat der Wein meine Zunge nicht gelöst," meinte die scheußliche Alte. Doch das Bettelmädchen nahm ihr schnell die Flasche vom Tisch und das Weib lenkte ein.
"Zwei Schüsseln mit Wasser laß abends in Deine Waschkammer tragen. Benetz Dein Gesicht mit dem ersten Wasser. Die Hände säubere aber in der zweiten Schale. Ruf den König herein. Schütte alles Waschwasser über seine Füße. Am nächsten Morgen, wenn Du nachsiehst, ist vom Boden alle Feuchtigkeit verschwunden. Doch dafür stehen zwei Blumen, eine schöne und eine häßliche. Die schöne sollst Du brechen, klein schneiden und auf einem Butterbrot verspeisen. Die häßliche laß stehen." "Ich muß mir das alles sauber notieren", seufzte die Königin. "Sonst mach ich am Ende noch etwas falsch."
Die Königin tat, wie geheißen. Zwei große weiße Porzellanschüsseln voll Wasser; Gesicht und Hände benetzt. Den König kommen lassen. Alles über seine Füße gekippt. Den König beschwichtigt. Endlich das Licht ausgelöscht und eingeschlafen.
Zwei Blumen wuchsen am Morgen danach. Soll ich sie beschreiben? Die eine mit fleischigen Blüten, die andere ganz verwelkt. Die eine mit glänzenden Blättern, die andere glanzlos. Grün die eine, schwärzlich die andere. Die Königin hatte ihren Aufschrieb verlegt und schnitt deshalb kurzerhand beide Blumen ab. Sie halbierte ihr Butterbrot, belegte die Hälften mit dem feingehackten Grünzeug und verspeiste die Mahlzeit mit großem Genuß. "Das wird schon nicht schaden. Viel hilft schließlich viel."
Das tat es auch. Der Königliche Bauch schwoll an und füllte sich Tag um Tag mehr. Die Königliche Hoheit lächelte glücklich. Eines Tages aber legte sie sich ins Kindbett. Eine nach der anderen, schlüpften die zwei ungleichen Schwestern heraus. Mit großem Ach und Krach kam die erste. Einen Rührlöffel hielt sie in der Hand! Auf einem Bock kam sie geritten! Was für ein Graus.
"Mama, wir sind da!", krähte das garstige Kind. "Gott helf mir, wenn ich deine Mama sein soll", rief die Mutter. "Keine Sorge. Wir drei schaffen das schon. Da kommt ja noch eine. Siehst, die ist viel hübscher als ich." Da seufzte die Königin und brachte auch noch die andere Schwester zur Welt. Dieses Kind war so schön wie die Ältere häßlich. Der König freute sich über beide. Ob lieblich oder abstoßend, vor Gott und dem König ist jedes Kind gleich.
Die Ältere ritt auf dem Bock, sang, schwang wild den Löffel. Die Jüngere trippelte ihr hinterdrein, mit verklärtem Gesicht. Mutter, Zofen, sie wollten nicht zusehen. Sie trennten die beiden, nahmen die häßliche Schwester weg. Die Zweitgeborene schlüpfte ihnen durch die Beine, schlich hinüber zum Geschwister. Wo immer die eine war, da wollte die andere auch sein.
Auf der Straße klang es:
"Zottelhaube, Distelkind,
bockig wie ein Wirbelwind."
So sangen die Kinder, so schrie lauthals die Ältere. Zottelhaube. Das Wort klebte an ihr wie eine schäbige Mütze. Sie trug es mit Stolz. Der Name blieb haften.
Die Schwestern wuchsen heran, die Jahre vergingen, ein jedes in seinem eigenen Takt. Die Königin blickte zum Fenster heraus. Sah eine wilde Kinderschar. Darunter Zottelhaube auf ihrem Bock, mit dem Löffel die freien Lüfte aufrührend. Die hübsche Schwester im Pulk mit den anderen und ebenso wild.
In einer Julnacht ruckelte es in den Schornsteinen, trippelte es auf den Dächern, klapperte es in den Fluren. Die Trollweiber suchten den Palast heim. Hier wollten sie Weihnachten feiern; das Schloßvolk hielt sich wohlweislich versteckt.
"Die Trollweiber? Auf's Dach will ich sie jagen!" Der Zottelkopf war nicht zu halten. Die Schwester sollte derweil auf die Eltern aufpassen, sollte Sorge tragen, daß alle Türen wohl verschlossen blieben.
Zottelhaube ließ den Rührlöffel wirbeln und hetzte, hoch die Treppen, runter die Treppen, hinter den Trollweibern her. Im sicheren Hort freuten sich alle königlich. Was mußten diese Weiber auch immer zur Weihnachtszeit schwärmen. Auf dem Flur war es bald still. Der König öffnete beherzt die Tür. Unter ihm steckte die Schwester ihren Kopf aus dem Zimmer. Doch das war nicht klug.
"Gott helf mir, mein Kind hat einen Kalbskopf", schrie die Mutter auf. Da fegte die Ältere auf ihrem Bock den langen Flur zurück. "Ein Dummschädel! Bei diesen Eltern auch nicht verwunderlich!", wütete Zottelhaube. Die weinende Schwester fuhr sich wieder und wieder über das Haupt. Zottelkopf überlegte nicht lange. "Das muß sich ändern. So paßt Du mir gar nicht."
Mit der Schwester mußte sie zu den Trollhexen reisen; davon brachte niemand die Bockreiterin ab. "Vater, gebt mir ein Schiff, einen Steuermann, eine Mannschaft. Zwieback, soviel das Schiff trägt. Reisen macht hungrig."
Schließlich lenkte der König ein. Kopfjägerin und kalbsköpfige Schwester brachen bald auf. Wie mit der Feder gezogen segelte das Schiff geradewegs über die See und auf das Land der Trollhexen zu. Das Schiff glitt in den Hafen hinein.
"Das ist kein Geschäft für euch. Wer sich rührt, kriegt eins mit dem Löffel", drohte Zottelhaube Schwester und Reisegefährten. Sie selbst lenkte den Bock aufs Land und trabte den Anweg zur Trollburg hinauf. Da stand schon der schöne Kopf ihrer Schwester, auf einem Fenstersims. Ach, Tränen strömten aus den Augen, flossen die Wangen hinab!
Zottelhaube preschte heran, griff sich das Schwesternhaupt, machte kehrt, stieß dem Bock in die Flanken. Schwirrend und wirbelnd brachen Trollgestalten aus allen Ecken hervor. Zottelhaube aber ließ den Rührlöffel kreisen; der brave Bock selbst keilte und rammte und stieß. Entmutigt ließen die Tollhexen ab. "Haben wir nicht gut mit dem Trollvolk verhandelt?", frohlockte die zottlige Jungfrau.
Die Mannschaft stand im Kreis, als Zottelhaube der schönen Schwester den Kopf wieder aufsetzte und ihn sorgsam zurecht schob. Wohin sollte es jetzt noch gehen? So früh schon in die Heimat zurück? "Ich will und will und will noch was von der Welt sehen", rief Schwester Wiederschön. Zottelhaube studierte die Karte. "Wir sind ziemlich hier. Was man so Welt nennt, befindet sich hauptsächlich dort."
Das Schiff nahm Kurs auf ein fernes Königreich. Dort ankerte es im Hafen. Und wieder befahl Zottelhaube: "Dies ist kein Geschäft für euch. Verhaltet euch still. Wer sich rührt, den mische ich mit dem Breilöffel auf!"
Ein König, ein Witwer wohnte hier, mit seinem einzigen Sohn. Er schickte seine Leute aus, um nach dem seltsamen Schiff zu forschen. Sie erblickten ein häßliches Mädchen mit wirbelnden, zottligen Strähnen. Es ritt auf dem Bock, trieb ihn hart über das Deck.
"Sagt Eurem König, wir sind da!", krähte das garstige Mädchen. "Wer seid ihr?", riefen die Männer zurück. "Zottelhaube mit ihrer bildschönen Schwester."
Zottelhaube, eine Bockreiterin? Mit einer bildschönen Schwester? So ein Unfug! Der König eilte zum Strand. Zwei Schwestern erblickte er in trautem Gespräch. Ach, und er sah nur die Schöne und wollte fortan nichts anderes mehr sehen.
"Aufs Schloß? Dich gleich mir ihr verloben? Nichts da!", schrie Zottelhaube vom Schiff herüber. "Versprich mir erst Deinen Sohn! Der soll mich nehmen, dann heiratet Dich meine Schwester." "Gott helf mir, ich will diesen Wirrkopf nicht haben", klagte der junge Prinz. Vergebens. Für zwei Paare ließ der König die Hochzeit bestellen. Der Sohn war verzweifelt. Solch schweren Kirchgang hatte er noch nie unternommen.
In einer Kutsche fuhren König und des Zottelhaupts schöne Schwester voraus.
Der junge Prinz auf seinem Pferd hintendrein. Neben dem Rappen schnaubte der Bock. Zottelhaube ritt gleichmütig wie immer und schwang den Rührlöffel nach altem Brauch. 'So jung bin ich noch und doch ist mir gar nichts mehr peinlich‘, dachte der Prinz bei sich. 'Sofern ich diesen Gang überhaupt überlebe.‘
"Du bist recht still. Und das an unserem Freudentag", bemerkte der Wildkopf. "Ich trau mich nicht lauter freuen." "Auch fragst Du recht wenig." "Das ist, weil ich mich vor Deinen Antworten fürchte." "Frag doch mal, warum ich auf diesem häßlichen Bock reite", schlug Zottelhaube vor.
Der Prinz seufzte. "Warum reitest Du auf diesem häßlichen Bock? "Ist gar nicht häßlich. Schau doch genau hin." Dies tat der Prinz. Just ebenda war aus dem Bock ein prächtiger Gaul geworden, stärker und höher als der Rappe des Jünglings.
'Na und', dachte der Prinz. 'Ein feuriges Pferd macht eine Braut doch nicht schöner'. Und wieder ritten beide stumm nebeneinander. Zottelhaube lächelnd, der Prinz sorgenvoll und bedrückt.
"Warum manche Prinzen gar nicht neugierig sind", begann das wilde Mädchen aufs Neue.
"Ehrlich gesagt, will ich gar nicht so viel wissen." "Frag doch mal, warum ich diesen blöden Breilöffel schwinge."
Der Prinz seufzte wieder. "Warum schwingst Du diesen blöden Breilöffel?", fragte er schließlich.
"Ist gar nicht blöde. Schau doch genau hin." Und wie er so hinsah, verwandelte sich der stumpfe Kochlöffel in eine lange Reitgerte. Zottelhaube, die vortreffliche Reiterin, hielt sie lässig und sicher.
Und weiter ging es. Der Prinz blieb in sich gekehrt wie ein paar vom Wind verwirbelte Blätter am Wegrand. "Ich weiß, was Du mich eigentlich fragen willst", warb Zottelhaube wieder um ihn. Als Antwort kam nur ein Seufzer. Aus tiefstem Herzen. Doch das ließ der Wildfang, das lassen wir gelten. "Frag doch mal, warum ich diese grauslige Zottelhaube trage."
Ein weiteres Mal wollte der Prinz aufseufzen. Doch er fragte stattdessen: "Warum trägst Du diese grauslige Zottelhaube?" "Ist gar nicht grauslig. Lieber Dummkopf, schau doch genau hin."
Dies tat der Prinz und sah die Verwandlung mit eigenem Auge. Da schwadronierte kein rauhbeiniges Frauenzimmer, da ritt neben ihm auf einmal das beste Mädchen der Welt. Nichts mehr zu sehen vom zottligen, haarigen Filz. Jetzt warf ein Blondkopf das prächtige Haar. " Leider nur mittelblond," lachte die Braut. "Die Farbe von Weizen und Sommer", antwortete der Prinz.
Bevor die beiden Schwestern in die Kirche traten, wandten sie sich noch einmal um, faßten sie sich an der Hand, blickten sie über die See.
„So verschieden", sagte die eine.
„Doch immer dieselbe", sagte die zweite.
Gerhard Winkle
DIE ELFEN ...
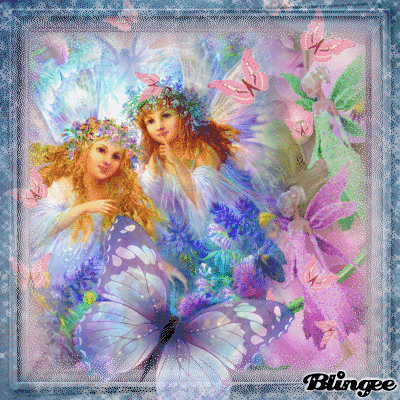
"Wo ist denn die Marie, unser Kind?" fragte der Vater. "Sie spielt draußen auf dem grünen Platze", antwortete die Mutter, "mit dem Sohne unsers Nachbars." "Dass sie sich nicht verlaufen", sagte der Vater besorgt; "sie sind unbesonnen."
Die Mutter sah nach den Kleinen und brachte ihnen ihr Vesperbrot. "Es ist heiß!" sagte der Bursche, und das kleine Mädchen langte begierig nach den roten Kirschen. "Seid nur vorsichtig, Kinder", sprach die Mutter, "lauft nicht zu weit vom Hause, oder in den Wald hinein, ich und der Vater gehen aufs Feld hinaus." Der junge Andres antwortete: "O sei ohne Sorge, denn vor dem Walde fürchten wir uns, wir bleiben hier beim Hause sitzen, wo Menschen in der Nähe sind."
Die Mutter ging und kam bald mit dem Vater wieder heraus. Sie verschlossen ihre Wohnung und wandten sich nach dem Felde, um nach den Knechten und zugleich auf der Wiese nach der Heuernte zu sehen. Ihr Haus lag auf einer kleinen grünen Anhöhe, von einem zierlichen Stakete umgeben, welches auch ihren Frucht- und Blumengarten umschloss; das Dorf zog sich etwas tiefer hinunter, und jenseits erhob sich das gräfliche Schloss.
Martin hatte von der Herrschaft das große Gut gepachtet, und lebte mit seiner Frau und seinem einzigen Kinde vergnügt, denn er legte jährlich zurück, und hatte die Aussicht, durch Tätigkeit ein
vermögender Mann zu werden, da der Boden ergiebig war und der Graf ihn nicht drückte.
Indem er mit seiner Frau nach seinen Feldern ging, schaute er fröhlich um sich, und sagte:
"Wie ist doch die Gegend hier so ganz anders, Brigitte, als diejenige, in der wir sonst wohnten. Hier ist es so grün, das ganze Dorf prangt von dicht gedrängten Obstbäumen, der Boden ist voll schöner Kräuter und Blumen, alle Häuser sind munter und reinlich, die Einwohner wohlhabend, ja mir dünkt, die Wälder hier sind schöner und der Himmel blauer, und so weit nur das Auge reicht, sieht man seine Lust und Freude an der freigebigen Natur."
"So wie man nur", sagte Brigitte, "dort jenseits des Flusses ist, so befindet man sich wie auf einer anderen Erde, alles so traurig und dürr; jeder Reisende behauptet aber auch, dass unser Dorf weit und breit in der Runde das schönste sei."
"Bis auf jenen Tannengrund", erwiderte der Mann; "schau einmal dorthin zurück, wie schwarz und traurig der abgelegene Fleck in der ganzen heiteren Umgebung liegt; hinter den dunkeln Tannenbäumen die rauchige Hütte, die verfallenen Ställe, der schwermütig vorüber fließende Bach."
"Es ist wahr", sagte die Frau, in dem beide still standen, "sooft man sich jenem Platze nur nähert, wird man traurig und beängstigt, man weiß selbst nicht warum. Wer nur die Menschen eigentlich sein mögen, die dort wohnen, und warum sie sich doch nur so von allen in der Gemeinde entfernt halten, als wenn sie kein gutes Gewissen hätten."
"Armes Gesindel", erwiderte der junge Pächter, "dem Anschein nach Zigeunervolk, die in der Ferne rauben und betrügen, und hier vielleicht ihren Schlupfwinkel haben. Mich wundert nur, dass die gnädige Herrschaft sie duldet."
"Es können auch wohl", sagte die Frau weichmütig, "arme Leute sein, die sich ihrer Armut schämen, denn man kann ihnen doch eben nichts Böses nachsagen; nur ist es bedenklich, dass sie sich nicht zur Kirche halten, und man auch eigentlich nicht weiß, wovon sie leben, denn der kleine Garten, der noch dazu ganz wüst zu liegen scheint, kann sie unmöglich ernähren, und Felder haben sie nicht."
"Weiß der liebe Gott", fuhr Martin fort, indem sie weiter gingen, "was sie treiben mögen; kommt doch auch kein Mensch zu ihnen, denn der Ort, wo sie wohnen, ist ja wie verbannt und verhext, so dass sich auch die vorwitzigsten Bursche nicht hin getrauen."
Dieses Gespräch setzten sie fort, in dem sie sich in das Feld wandten. Jene finstere Gegend, von welcher sie sprachen, lag abseits vom Dorfe. In einer Vertiefung, welche Tannen umgaben, zeigte sich eine Hütte und verschiedene fast zertrümmerte Wirtschaftsgebäude, nur selten sah man Rauch dort aufsteigen, noch seltener wurde man Menschen gewahr; je zuweilen hatten Neugierige, die sich etwas näher gewagt, auf der Bank vor der Hütte einige abscheuliche Weiber in zerlumptem Anzuge wahrgenommen, auf deren Schoß ebenso hässliche und schmutzige Kinder sich wälzten; schwarze Hunde liefen vor dem Reviere, in Abendstunden ging wohl ein ungeheurer Mann, den niemand kannte, über den Steg des Baches und verlor sich in die Hütte hinein; dann sah man in der Finsternis sich verschiedene Gestalten, wie Schatten um ein ländliches Feuer bewegen. Dieser Grund, die Tannen und die verfallene Hütte machten wirklich in der heiteren grünen Landschaft, gegen die weißen Häuser des Dorfes und gegen das prächtige neue Schloss, den sonderbarsten Abstich.
Die beiden Kinder hatten jetzt die Früchte verzehrt; sie verfielen darauf, in die Wette zu laufen, und die kleine behände Marie gewann dem langsameren Andres immer den Vorsprung ab. "So ist es keine Kunst!" rief endlich dieser aus, "aber lass es uns einmal in die Weite versuchen, dann wollen wir sehen, wer gewinnt!"
"Wie du willst", sagte die Kleine, "nur nach dem Strome dürfen wir nicht laufen." "Nein", erwiderte Andres, "aber dort auf jenem Hügel steht der große Birnbaum, eine Viertelstunde von hier, ich laufe hier links um den Tannengrund vorbei, du kannst rechts in das Feld hinein rennen, dass wir nicht eher als oben wieder zusammenkommen, so sehen wir dann, wer der Beste ist."
"Gut", sagte Marie, und fing schon an zu laufen, "so hindern wir uns auch nicht auf dem selben Wege, und der Vater sagt ja, es sei zum Hügel hinauf gleich weit, ob man diesseits, ob man jenseits der Zigeunerwohnung geht."
Andres war schon voran gesprungen und Marie, die sich rechts wandte, sah ihn nicht mehr. "Er ist eigentlich dumm", sagte sie zu sich selbst, "denn ich dürfte nur den Mut fassen, über den Steg, bei der Hütte vorbei, und drüben wieder über den Hof hinaus zu laufen, so käme ich gewiss viel früher an." Schon stand sie vor dem Bache und dem Tannenhügel. "Soll ich? Nein, es ist doch zu schrecklich", sagte sie.
Ein kleines weißes Hündchen stand jenseits und bellte aus Leibeskräften. Im Erschrecken kam das Tier ihr wie ein Ungeheuer vor, und sie sprang zurück. "O weh!" sagte sie, "nun ist der Bengel weit voraus, weil ich hier steh und überlege." Das Hündchen bellte immerfort, und da sie es genauer betrachtete, kam es ihr nicht mehr fürchterlich, sondern im Gegenteil ganz allerliebst vor: es hatte ein rotes Halsband um, mit einer glänzenden Schelle, und sowie es den Kopf hob und sich im Bellen schüttelte, erklang die Schelle äußerst lieblich.
"Ei! es will nur gewagt sein!" rief die kleine Marie, "ich renne was ich kann, und bin schnell, schnell jenseits wieder hinaus, sie können mich doch eben nicht gleich von der Erde weg auffressen!" Somit sprang das muntere mutige Kind auf den Steg, rasch an den kleinen Hund vorüber, der still ward und sich an ihr schmeichelte, und nun stand sie im Grunde, und rundumher verdeckten die schwarzen Tannen die Aussicht nach ihrem elterlichen Hause und der übrigen Landschaft.
Aber wie war sie verwundert. Der bunteste, fröhlichste Blumengarten umgab sie, in welchem Tulpen, Rosen und Lilien mit den herrlichsten Farben leuchteten, blaue und goldrote Schmetterlinge wiegten sich in den Blüten, in Käfigen aus glänzendem Draht hingen an den Spalieren vielfarbige Vögel, die herrliche Lieder sangen, und Kinder in weißen kurzen Röckchen, mit gelockten gelben Haaren und hellen Augen, sprangen umher, einige spielten mit kleinen Lämmern, andere fütterten die Vögel, oder sammelten Blumen und schenkten sie einander, andere wieder aßen Kirschen, Weintrauben und rötliche Aprikosen.
Keine Hütte war zu sehen, aber wohl stand ein großes schönes Haus mit eherner Tür und erhabenem Bildwerk leuchtend in der Mitte des Raumes. Marie war vor Erstaunen außer sich und wusste sich nicht zu finden; da sie aber nicht blöde war, ging sie gleich zum ersten Kinde, reichte ihm die Hand und bot ihm guten Tag.
"Kommst du uns auch einmal zu besuchen?" sagte das glänzende Kind; "ich habe dich draußen rennen und springen sehen, aber vor unserem Hündchen hast du dich gefürchtet." - "So seid ihr wohl keine Zigeuner und Spitzbuben", sagte Marie, "wie Andres immer spricht? O freilich ist der nur dumm, und redet viel in den Tag hinein." - "Bleib nur bei uns", sagte die wunderbare Kleine, "es soll dir schon gefallen" - "Aber wir laufen ja in die Wette." - "Zu ihm kommst du noch früh genug zurück. Da nimm, und iss!" - Marie aß, und fand die Früchte so süß, wie sie noch keine geschmeckt hatte, und Andres, der Wettlauf, und das Verbot ihrer Eltern waren gänzlich vergessen.
Eine große Frau in glänzendem Kleide trat herzu, und fragte nach dem fremden Kinde. "Schönste Dame", sagte Marie, "von ungefähr bin ich herein gelaufen, und da wollen sie mich hier behalten." "Du weißt, Zerina", sagte die Schöne, "dass es ihr nur kurze Zeit erlaubt ist, auch hättest du mich erst fragen sollen." "Ich dachte", sagte das glänzende Kind, "weil sie doch schon über die Brücke gelassen war, könnt ich es tun; auch haben wir sie ja oft im Felde laufen sehen, und du hast dich selber über ihr munteres Wesen gefreut; wird sie uns doch früh genug verlassen müssen."
"Nein, ich will hier bleiben", sagte die Fremde, "denn hier ist es schön, auch finde ich hier das beste Spielzeug und dazu Erdbeeren und Kirschen, draußen ist es nicht so herrlich." Die goldbekleidete Frau entfernte sich lächelnd, und viele von den Kindern sprangen jetzt um die fröhliche Marie mit Lachen her, neckten sie und ermunterten sie zu Tänzen, andere brachten ihr Lämmer oder wunderbares Spielgerät, andere machten auf Instrumenten Musik und sangen dazu.
Am liebsten aber hielt sie sich zu der Gespielin, die ihr zuerst entgegen gegangen war, denn sie war die freundlichste und holdseligste von allen. Die kleine Marie rief ein Mal über das andere: "Ich will immer bei euch bleiben und ihr sollt meine Schwestern sein", worüber alle Kinder lachten und sie umarmten. "Jetzt wollen wir ein schönes Spiel machen", sagte Zerina. Sie lief eilig in den Palast und kam mit einem goldenen Schächtelchen zurück, in welchem sich glänzender Samenstaub befand.
Sie fasste mit den kleinen Fingern, und streute einige Körner auf den grünen Boden. Alsbald sah man das Gras wie in Wogen rauschen, und nach wenigen Augenblicken schlugen glänzende Rosenbüsche aus der Erde, wuchsen schnell empor und entfalteten sich plötzlich, in dem der süßeste Wohlgeruch den Raum erfüllte. Auch Maria fasste von dem Staube, und als sie ihn ausgestreut hatte, tauchten weiße Lilien und die buntesten Nelken hervor.
Auf einen Wink Zerinas verschwanden die Blumen wieder und andere erschienen an ihrer Stelle. "Jetzt", sagte Zerina, "mache dich auf etwas Größeres gefasst." Sie legte zwei Pinienkörner in den Boden und stampfte sie heftig mit dem Fuße ein. Zwei grüne Sträucher standen vor ihnen. "Fasse dich fest mit mir", sagte sie, und Maria schlang die Arme um den zarten Leib.
Da fühlte sie sich empor gehoben, denn die Bäume wuchsen unter ihnen mit der größten Schnelligkeit; die hohen Pinien bewegten sich und die beiden Kinder hielten sich hin und wider schwebend in den roten Abendwolken umarmt und küssten sich; die anderen Kleinen kletterten mit behänder Geschicklichkeit an den Stämmen der Bäume auf und nieder, und stießen und neckten sich, wenn sie sich begegneten, unter lautem Gelächter.
Stürzte eins der Kinder im Gedränge hinunter, so flog es durch die Luft und senkte sich langsam und sicher zur Erde hinab. Endlich fürchtete sich Marie; die andere Kleine sang einige laute Töne, und die Bäume versenkten sich wieder ebenso allgemach in den Boden, und setzten sie nieder, als sie sich erst in die Wolken gehoben hatten.
Sie gingen durch die erzene Tür des Palastes. Da saßen viele schöne Frauen umher, ältere und junge, im runden Saal, sie genossen die lieblichsten Früchte, und eine herrliche unsichtbare Musik erklang. In der Wölbung der Decke waren Palmen, Blumen und Laubwerk gemalt, zwischen denen Kinderfiguren in den anmutigsten Stellungen kletterten und schaukelten; nach den Tönen der Musik verwandelten sich die Bildnisse und glühten in den brennendsten Farben; bald war das Grüne und Blaue wie helles Licht funkelnd, dann sank die Farbe erblassend zurück, der Purpur flammte auf und das Gold entzündete sich; dann schienen die nackten Kinder in den Blumengewinden zu leben, und mit den rubinroten Lippen den Atem einzuziehen und auszuhauchen, so dass man wechselnd den Glanz der weißen Zähnchen wahr nahm, so wie das Aufleuchten der himmelblauen Augen.
Aus dem Saale führten eherne Stufen in ein großes unterirdisches Gemach. Hier lag viel Gold und Silber, und Edelsteine von allen Farben funkelten dazwischen. Wundersame Gefäße standen an den Wänden umher, alle schienen mit Kostbarkeiten angefüllt. Das Gold war in mannigfaltigen Gestalten gearbeitet und schimmerte mit der freundlichsten Röte. Viele kleine Zwerge waren beschäftigt, die Stücke auseinanderzusuchen und sie in die Gefäße zu legen; andere, höckrig und krummbeinig, mit langen roten Nasen, trugen schwer und vorn übergebückt Säcke herein, so wie die Müller Getreide, und schütteten die Goldkörner keuchend auf dem Boden aus.
Dann sprangen sie ungeschickt rechts und links, und griffen die rollenden Kugeln, die sich verlaufen wollten, und es geschah nicht selten, dass einer den anderen im Eifer umstieß, so dass sie schwer und tölpisch zur Erde fielen. Sie machten verdrießliche Gesichter und sahen scheel, als Marie über ihre Gebärden und Hässlichkeit lachte. Hinten saß ein alter eingeschrumpfter kleiner Mann, welchen Zerina ehrerbietig grüßte, und der nur mit ernstem Kopfnicken dankte.
Er hielt ein Zepter in der Hand und trug eine Krone auf dem Haupte, alle übrigen Zwerge schienen ihn für ihren Herren anzuerkennen und seinen Winken zu gehorchen. "Was gibt es wieder?" fragte er mürrisch, als die Kinder ihm etwas näher kamen. Marie schwieg furchtsam, aber ihre Gespielin antwortete, dass sie nur gekommen seien, sich in den Kammern umzuschauen.
"Immer die alten Kindereien!" sagte der Alte; "wird der Müßiggang nie aufhören?" Darauf wandte er sich wieder an sein Geschäft und ließ die Goldstücke wiegen und aussuchen; andere Zwerge schickte er fort, manchen schalt er zornig. "Wer ist der Herr?" fragte Marie; "unser Metallfürst", sagte die Kleine, in dem sie weitergingen.
Sie schienen sich wieder im Freien zu befinden, denn sie standen an einem großen Teiche, aber doch schien keine Sonne, und sie sahen keinen Himmel über sich. Ein kleiner Nachen empfing sie, und Zerina ruderte sehr emsig. Die Fahrt ging schnell. Als sie in die Mitte des Teiches gekommen waren, sah Marie, dass tausend Röhren, Kanäle und Bäche sich aus dem kleinen See nach allen Richtungen verbreiteten.
"Diese Wasser rechts", sagte das glänzende Kind, "fließen unter euren Garten hinab, davon blüht dort alles so frisch; von hier kommt man in den großen Strom hinunter." Plötzlich kamen aus allen Kanälen und aus dem See unendlich viele Kinder auftauchend angeschwommen, viele trugen Kränze von Schilf und Wasserlilien, andere hielten rote Korallenzacken, und wieder andere bliesen auf krummen Muscheln; ein verworrenes Getöse schallte lustig von den dunklen Ufern wider; zwischen den Kleinen bewegten sich schwimmend die schönsten Frauen, und oft sprangen viele Kinder zu der einen oder der anderen, und hingen ihnen mit Küssen um Hals und Nacken.
Alle begrüßten die Fremde; zwischen diesem Getümmel hindurch fuhren sie aus dem See in einen kleinen Fluss hinein, der immer enger und enger ward. Endlich stand der Nachen. Man nahm Abschied und Zerina klopfte an den Felsen. Wie eine Tür tat sich dieser voneinander, und eine ganz rote weibliche Gestalt half ihnen aussteigen. "Geht es recht lustig zu?" fragte Zerina. "Sie sind eben in Tätigkeit", antwortete jene, "und so freudig, wie man sie nur sehen kann, aber die Wärme ist auch äußerst angenehm."
Sie stiegen eine Wendeltreppe hinauf, und plötzlich sah sich Marie in dem glänzendsten Saal, so dass beim Eintreten ihre Augen vom hellen Lichte geblendet waren. Feuerrote Tapeten bedeckten mit Purpurglut die Wände, und als sich das Auge etwas gewöhnt hatte, sah sie zu ihrem Erstaunen, wie im Teppich sich Figuren tanzend auf und nieder in der größten Freude bewegten, die so lieblich gebaut und von so schönen Verhältnissen waren, dass man nichts Anmutigeres sehn konnte; ihr Körper war wie von rötlichem Kristall, so dass es schien, als flösse und spielte in ihnen sichtbar das bewegte Blut.
Sie lachten das fremde Kind an, und begrüßten es mit verschiedenen Beugungen; aber als Marie näher gehen wollte, hielt sie Zerina plötzlich mit Gewalt zurück, und rief: "Du verbrennst dich, Mariechen, denn alles ist Feuer!"
Marie fühlte die Hitze. "Warum kommen nur", sagte sie, "die allerliebsten Kreaturen nicht zu uns heraus, und spielen mit uns?" "Wie du in der Luft lebst", sagte jene, "so müssen sie immer im Feuer bleiben, und würden hier draußen verschmachten. Sieh nur, wie ihnen wohl ist, wie sie lachen und kreischen; jene dort unten verbreiten die Feuerflüsse von allen Seiten unter der Erde hin, davon wachsen nun die Blumen, die Früchte und der Wein; die roten Ströme gehen neben den Wasserbächen, und so sind die flammigen Wesen immer tätig und freudig. Aber dir ist es hier zu heiß, wir wollen wieder hinaus in den Garten gehen."
Hier hatte sich die Szene verwandelt. Der Mondschein lag auf allen Blumen, die Vögel waren still und die Kinder schliefen in mannigfaltigen Gruppen in den grünen Lauben. Marie und ihre Freundin fühlten aber keine Müdigkeit, sondern lustwandelten in der warmen Sommernacht unter vielerlei Gesprächen bis zum Morgen.
Als der Tag anbrach, erquickten sie sich an Früchten und Milch, und Marie sagte: "Lass uns doch zur Abwechselung einmal nach den Tannen hinaus gehen, wie es dort aussehen mag." "Gern", sagte Zerina, "so kannst du auch zugleich dorten unsere Schildwachen besuchen, die dir gewiss gefallen werden, sie stehen oben auf dem Walle zwischen den Bäumen."
Sie gingen durch die Blumengärten, durch anmutige Haine voller Nachtigallen, dann stiegen sie über Rebenhügel, und kamen endlich, nachdem sie lange den Windungen eines klaren Baches nachgefolgt waren, zu den Tannen und der Erhöhung, welche das Gebiet begrenzte. "Wie kommt es nur", fragte Marie, "dass wir hier innerhalb so weit zu gehen haben, da doch draußen der Umkreis nur so klein ist?"
"Ich weiß nicht", antwortete die Freundin, "wie es zugeht, aber es ist so." Sie stiegen zu den finsteren Tannen hinauf, und ein kalter Wind wehte ihnen von draußen entgegen; ein Nebel schien weit umher auf der Landschaft zu liegen. Oben standen wunderliche Gestalten, mit mehligen bestäubten Angesichtern, den widerlichen Häuptern der weißen Eulen nicht unähnlich; sie waren in faltigen Mänteln von zottiger Wolle gekleidet, und hielten Regenschirme von seltsamen Häuten ausgespannt über sich; mit Fledermausflügeln, die abenteuerlich neben dem Rockelor hervor starrten, wehten und fächelten sie unablässig.
"Ich möchte lachen und mir graut", sagte Marie. "Diese sind unsere guten fleißigen Wächter", sagte die kleine Gespielin, "sie stehen hier und wehen, damit jeden kalte Angst und wundersames Fürchten befällt, der sich uns nähern will; sie sind aber so bedeckt, weil es jetzt draußen regnet und friert, was sie nicht vertragen können. Hier unten kommt niemals Schnee und Wind, noch kalte Luft her, hier ist ein ewiger Sommer und Frühling, doch wenn die da oben nicht oft abgelöst würden, so vergingen sie gar."
"Aber wer seid ihr denn", fragte Marie, indem sie wieder in die Blumendüfte hinunter stiegen, "oder habt ihr keinen Namen, woran man euch erkennt?" "Wir heißen Elfen", sagte das freundliche Kind, "man spricht auch wohl in der Welt von uns, wie ich gehört habe." Sie hörten auf der Wiese ein großes Getümmel.
"Der schöne Vogel ist angekommen!" riefen ihnen die Kinder entgegen; alles eilte in den Saal. Sie sahen in dem schon, wie jung und alt sich über die Schwelle drängte, alle jauchzten und von innen scholl eine jubilierende Musik heraus. Als sie hinein getreten waren, sahen sie die große Rundung von den mannigfaltigsten Gestalten angefüllt, und alle schauten nach einem großen Vogel hinauf, der in der Kuppel mit glänzendem Gefieder langsam fliegend vielfache Kreise beschrieb.
Die Musik klang fröhlicher als sonst, die Farben und Lichter wechselten schneller. Endlich schwieg die Musik, und der Vogel schwang sich rauschend auf eine glänzende Krone, die unter dem hohen Fenster schwebte, welches von oben die Wölbung erleuchtete. Sein Gefieder war purpurn und grün, durch welches sich die glänzendsten goldenen Streifen zogen, auf seinem Haupte bewegte sich ein Diadem von so hell leuchtenden kleinen Federn, dass sie wie Edelgesteine blitzten. Der Schnabel war rot und die Beine glänzend blau. Wie er sich regte, schimmerten alle Farben durcheinander, und das Auge war entzückt. Seine Größe war die eines Adlers.
Aber jetzt eröffnete er den leuchtenden Schnabel, und so süße Melodie quoll aus seiner bewegten Brust, in schönern Tönen, als die der liebesbrünstigen Nachtigall; mächtiger zog der Gesang und goss sich wie Lichtstrahlen aus, so dass alle, bis auf die kleinsten Kinder selbst, vor Freude und Entzücken weinen mussten. Als er geendigt hatte, neigten sich alle vor ihm, er umflog wieder in Kreisen die Wölbung, schoss dann durch die Tür und schwang sich in den lichten Himmel, wo er oben bald nur noch wie ein roter Punkt erglänzte und sich den Augen dann schnell verlor.
"Warum seid ihr alle so in Freude?" fragte Marie und neigte sich zum schönen Kinde, das ihr kleiner als gestern vorkam. "Der König kommt!" sagte die Kleine, "den haben viele von uns noch gar nicht gesehen, und wo er sich hin wendet ist Glück und Fröhlichkeit; wir haben schon lange auf ihn gehofft, sehnlicher, als ihr nach langem Winter auf den Frühling wartet, und nun hat er durch diesen schönen Botschafter seine Ankunft melden lassen.
Dieser herrliche und verständige Vogel, der im Dienst des Königes gesandt wird, heißt Phönix, er wohnt fern in Arabien auf einem Baum, der nur einmal in der Welt ist, so wie es auch keinen zweiten Phönix gibt. Wenn er sich alt fühlt, trägt er aus Balsam und Weihrauch ein Nest zusammen, zündet es an und verbrennt sich selbst, so stirbt er singend, und aus der duftenden Asche schwingt sich dann der verjüngte Phönix mit neuer Schönheit wieder auf.
Selten nur nimmt er seinen Flug so, dass ihn die Menschen sehen, und geschieht es einmal in Jahrhunderten, so zeichnen sie es in ihre Denkbücher auf, und erwarten wundervolle Begebenheiten. Aber nun, meine Freundin, wirst du auch scheiden müssen, denn der Anblick des Königes ist dir nicht vergönnt."
Da wandelte die goldbekleidete schöne Frau durch das Gedränge, winkte Marien zu sich und ging mit ihr unter einen einsamen Laubengang; "du musst uns verlassen, mein geliebtes Kind", sagte sie; "der König will auf zwanzig Jahr, und vielleicht auf länger, sein Hoflager hier halten, nun wird sich Fruchtbarkeit und Segen weit in die Landschaft verbreiten, am meisten hier in der Nähe; alle Brunnen und Bäche werden ergiebiger, alle Äcker und Gärten reicher, der Wein edler, die Wiese fetter und der Wald frischer und grüner; mildere Luft weht, kein Hagel schadet, keine Überschwemmung droht.
Nimm diesen Ring und gedenke unser, doch hüte dich, irgendwem von uns zu erzählen, sonst müssen wir aus dieser Gegend fliehen, und alle umher, so wie du selbst, entbehren dann das Glück und die Segnung unserer Nähe: noch einmal küsse deine Gespielin und lebe wohl." Sie traten heraus, Zerina weinte, Marie bückte sich, sie zu umarmen, sie trennten sich. Schon stand sie auf der schmalen Brücke, die kalte Luft wehte hinter ihr aus den Tannen, das Hündchen bellte auf das herzhafteste und ließ sein Glöckchen ertönen; sie sah zurück und eilte in das Freie, weil die Dunkelheit der Tannen, die Schwärze der verfallenen Hütten, die dämmernden Schatten sie mit ängstlicher Furcht befielen.
"Wie werden sich meine Eltern meinethalber in dieser Nacht geängstigt haben!" sagte sie zu sich selbst, als sie auf dem Felde stand, "und ich darf ihnen doch nicht erzählen, wo ich gewesen bin und was ich gesehen habe, auch würden sie mir nimmermehr glauben." Zwei Männer gingen an ihr vorüber, die sie grüßten, und sie hörte hinter sich sagen: "Das ist ein schönes Mädchen! Wo mag sie nur her sein?"
Mit eiligeren Schritten näherte sie sich dem elterlichen Hause, aber die Bäume, die gestern voller Früchte hingen, standen heute dürr und ohne Laub, das Haus war anders angestrichen, und eine neue Scheune daneben erbaut. Marie war in Verwunderung, und dachte, sie sei im Traum; in dieser Verwirrung öffnete sie die Tür des Hauses, und hinter dem Tische saß ihr Vater zwischen einer unbekannten Frau und einem fremden Jüngling.
"Mein Gott, Vater!" rief sie aus, "wo ist denn die Mutter?" - "Die Mutter?" sprach die Frau ahndend, und stürzte hervor; "ei, du bist doch wohl nicht - ja freilich, freilich bist du die verlorene, die tot geglaubte, die liebe einzige Marie!" Sie hatte sie gleich an einem kleinen braunen Male unter dem Kinn, an den Augen und der Gestalt erkannt. Alle umarmten sie, alle waren freudig bewegt, und die Eltern vergossen Tränen.
Marie verwunderte sich, dass sie fast zum Vater hinauf reichte, sie begriff nicht, wie die Mutter so verändert und gealtert sein konnte, sie fragte nach dem Namen des jungen Menschen. "Es ist ja unseres Nachbars Andres", sagte Martin, "wie kommst du nur nach sieben langen Jahren so unvermutet wieder? wo bist du gewesen? Warum hast du denn gar nichts von dir hören lassen?" -
"Sieben Jahre?" sagte Marie, und konnte sich in ihren Vorstellungen und Erinnerungen nicht wieder zurechtfinden; "sieben ganze Jahre?" "Ja, ja", sagte Andres lachend, und schüttelte ihr treuherzig die Hand; "ich habe gewonnen, Mariechen, ich bin schon vor sieben Jahren an dem Birnbaum und wieder hierher zurück gewesen, und du Langsame, kommst nun heut erst an!"
Man fragte von neuem, man drang in sie, doch sie, des Verbotes eingedenk, konnte keine Antwort geben. Man legte ihr fast die Erzählung in den Mund, dass sie sich verirrt habe, auf einen vorbeifahrenden Wagen genommen, und an einen fremden Ort geführt sei, wo sie den Leuten den Wohnsitz ihrer Eltern nicht habe bezeichnen können; wie man sie nachher nach einer weit entlegenen Stadt gebracht habe, wo gute Menschen sie erzogen und geliebt; wie diese nun gestorben, und sie sich endlich wieder auf ihre Geburtsgegend besonnen, eine Gelegenheit zur Reise ergriffen habe und so zurückgekehrt sei. "Lasst alles gut sein", rief die Mutter; "genug, dass wir dich nur wiederhaben, mein Töchterchen, du meine Einzige, mein Alles!"
Andres blieb zum Abendbrot, und Marie konnte sich noch in nichts finden. Das Haus dünkte ihr klein und finster, sie verwunderte sich über ihre Tracht, die reinlich und einfach, aber ganz fremd erschien; sie betrachtete den Ring am Finger, dessen Gold wundersam glänzte und einen rot brennenden Stein künstlich einfasste. Auf die Frage des Vaters antwortete sie, dass der Ring ebenfalls ein Geschenk ihrer Wohltäter sei.
Sie freute sich auf die Schlafenszeit, und eilte zur Ruhe. Am anderen Morgen fühlte sie sich besonnener, sie hatte ihre Vorstellungen mehr geordnet, und konnte den Leuten aus dem Dorfe, die alle sie zu begrüßen kamen, besser Red und Antwort geben. Andres war schon mit dem frühesten wieder da, und zeigte sich äußerst geschäftig, erfreut und dienstfertig. Das fünfzehnjährige aufgeblühte Mädchen hatte ihm einen tiefen Eindruck gemacht, und die Nacht war ihm ohne Schlaf vergangen.
Die Herrschaft ließ Marien auf das Schloss fordern, sie musste hier wieder ihre Geschichte erzählen, die ihr nun schon geläufig geworden war; der alte Herr und die gnädige Frau bewunderten ihre gute Erziehung, denn sie war bescheiden, ohne verlegen zu sein, sie antwortete höflich und in guten Redensarten auf alle vorgelegten Fragen; die Furcht vor den vornehmen Menschen und ihrer Umgebung hatte sich bei ihr verloren, denn wenn sie diese Säle und Gestalten mit den Wundern und der hohen Schönheit maß, die sie bei den Elfen im heimlichen Aufenthalt gesehen hatte, so erschien ihr dieser irdische Glanz nur dunkel, die Gegenwart der Menschen fast geringe. Die jungen Herren waren vorzüglich über ihre Schönheit entzückt.
Es war im Februar. Die Bäume belaubten sich früher als je, so zeitig hatte sich die Nachtigall noch niemals eingestellt, der Frühling kam schöner in das Land, als ihn sich die ältesten Greise erinnern konnten. Allerorten taten sich Bächlein hervor und tränkten die Wiesen und Auen; die Hügel schienen zu wachsen, die Rebengeländer erhuben sich höher, die Obstbäume blühten wie niemals, und ein schwellender duftender Segen hing schwer in Blütenwolken über der Landschaft.
Alles gedieh über Erwarten, kein rauer Tag, kein Sturm beschädigte die Frucht; der Wein quoll errötend in ungeheuern Trauben, und die Einwohner des Ortes staunten sich an, und waren wie in einem süßen Traum befangen. Das folgende Jahr war ebenso, aber man war schon an das Wundersame mehr gewöhnt. Im Herbst gab Marie den dringenden Bitten des Andres und ihrer Eltern nach: sie ward seine Braut und im Winter mit ihm verheiratet.
Oft dachte sie mit inniger Sehnsucht an ihren Aufenthalt hinter den Tannenbäumen zurück; sie blieb still und ernst. So schön auch alles war, was sie umgab, so kannte sie doch etwas noch Schöneres, wodurch eine leise Trauer ihr Wesen zu einer sanften Schwermut stimmte. Schmerzhaft traf es sie, wenn der Vater oder ihr Mann von den Zigeunern und Schelmen sprachen, die im finstern Grunde wohnten; oft wollte sie sie verteidigen, die sie als Wohltäter der Gegend kannte, vorzüglich gegen Andres, der eine Lust im eifrigen Schelten zu finden schien, aber sie zwang das Wort jedes Mal in ihre Brust zurück.
So verlebte sie das Jahr, und im folgenden ward sie durch eine junge Tochter erfreut, welche sie Elfriede nannte, indem sie dabei an den Namen der Elfen dachte.
.................................................................................
Die jungen Leute wohnten mit Martin und Brigitte in dem selben Hause, welches geräumig genug war, und halfen den Eltern die ausgebreitete Wirtschaft führen. Die kleine Elfriede zeigte bald besondere Fähigkeiten und Anlagen, denn sie lief sehr früh, und konnte alles sprechen, als sie noch kein Jahr alt war; nach einigen Jahren aber war sie so klug und sinnig, und von so wunderbarer Schönheit, dass alle Menschen sie mit Erstaunen betrachteten, und ihre Mutter sich nicht der Meinung erwehren konnte, sie sehe jenen glänzenden Kindern im Tannengrunde ähnlich.
Elfriede hielt sich nicht gern zu anderen Kindern, sondern vermied bis zur Ängstlichkeit ihre geräuschvollen Spiele, und war am liebsten allein. Dann zog sie sich in eine Ecke des Gartens zurück, und las oder arbeitete eifrig am kleinen Nähzeuge; oft sah man sie auch wie tief in sich versunken sitzen, oder dass sie in Gängen heftig auf und nieder ging und mit sich selber sprach.
Die beiden Eltern ließen sie gern gewähren, weil sie gesund war und gedieh, nur machten sie die seltsamen verständigen Antworten und Bemerkungen oft besorgt. "So kluge Kinder", sagte die Großmutter Brigitte vielmals, "werden nicht alt, sie sind zu gut für diese Welt, auch ist das Kind über die Natur schön, und wird sich auf Erden nicht zurechtfinden können."
Die Kleine hatte die Eigenheit, dass sie sich höchst ungern bedienen ließ, alles wollte sie selber machen. Sie war fast die früheste auf im Hause, und wusch sich sorgfältig und kleidete sich selber an; ebenso sorgsam war sie am Abend, sie achtete sehr darauf, Kleider und Wäsche selbst einzupacken, und durchaus niemand, auch die Mutter nicht, über ihre Sachen kommen zu lassen.
Die Mutter sah ihr in diesem Eigensinne nach, weil sie sich nichts weiter dabei dachte, aber wie erstaunte sie, als sie sie an einem Feiertage, zu einem Besuch auf dem Schlosse, mit Gewalt umkleidete, so sehr sich auch die Kleine mit Geschrei und Tränen dagegen wehrte, und auf ihrer Brust an einem Faden hängend, ein Goldstück von seltsamer Form antraf, welches sie sogleich für eines von jenen erkannte, deren sie so viele in dem unterirdischen Gewölbe gesehen hatte.
Die Kleine war sehr erschrocken, und gestand endlich, sie habe es im Garten gefunden, und da es ihr sehr wohl gefallen, habe sie es so emsig aufbewahrt; sie bat auch so dringend und herzlich, es ihr zu lassen, dass Marie es wieder auf der selben Stelle befestigte und voller Gedanken mit ihr stillschweigend zum Schlosse hinaufging.
Seitwärts vom Hause der Pächterfamilie lagen einige Wirtschaftsgebäude zur Aufbewahrung der Früchte und des Feldgerätes, und hinter diesen befand sich ein Grasplatz mit einer alten Laube, die aber kein Mensch jetzt besuchte, weil sie nach der neuen Einrichtung der Gebäude zu entfernt vom Garten war. In dieser Einsamkeit hielt sich Elfriede am liebsten auf, und es fiel niemanden ein, sie hier zu stören, so dass die Eltern oft in halben Tagen ihrer nicht ansichtig wurden.
An einem Nachmittage befand sich die Mutter in den Gebäuden, um aufzuräumen und eine verlorene Sache wieder zu finden, als sie wahrnahm, dass durch eine Ritze der Mauer ein Lichtstrahl in das Gemach falle. Es kam ihr der Gedanke, hindurchzusehen, um ihr Kind zu beobachten, und es fand sich, dass ein locker gewordener Stein sich von der Seite schieben ließ, wodurch sie den Blick gerade hinein in die Laube gewann.
Elfriede saß drinnen auf einem Bänkchen, und neben ihr die wohlbekannte Zerina, und beide Kinder spielten und ergötzten sich in holdseliger Eintracht. Die Elfe umarmte das schöne Kind und sagte traurig: "Ach, du liebes Wesen, so wie mit dir habe ich schon mit deiner Mutter gespielt, als sie klein war und uns besuchte, aber ihr Menschen wachst zu bald auf und werdet so schnell groß und vernünftig; das ist recht betrübt: bliebest du doch so lange ein Kind, wie ich!"
"Gern tät ich dir den Gefallen", sagte Elfriede, "aber sie meinen ja alle, ich würde bald zu Verstande kommen, und gar nicht mehr spielen, denn ich hätte rechte Anlagen, altklug zu werden. Ach! und dann sehe ich dich auch nicht wieder, du liebes Zerinchen! Ja, es geht wie mit den Baumblüten: wie herrlich der blühende Apfelbaum mit seinen rötlichen aufgequollenen Knospen! der Baum tut so groß und breit, und jedermann, der drunter weg geht, meint auch, es müsse recht was Besonderes werden; dann kommt die Sonne, die Blüte geht so leutselig auf, und da steckt schon der böse Kern drunter, der nachher den bunten Putz verdrängt und hinunter wirft; nun kann er sich geängstigt und aufwachsend nicht mehr helfen, er muss im Herbst zur Frucht werden.
Wohl ist ein Apfel auch lieb und erfreulich, aber doch nichts gegen die Frühlingsblüte: so geht es mit uns Menschen auch; ich kann mich nicht darauf freuen, ein großes Mädchen zu werden. Ach, könnt ich euch doch nur einmal besuchen!"
"Seit der König bei uns wohnt", sagte Zerina, "ist es ganz unmöglich, aber ich komme ja so oft zu dir, Liebchen, und keiner sieht mich, keiner weiß es, weder hier noch dort; ungesehen geh ich durch die Luft, oder fliege als Vogel herüber; o wir wollen noch recht viel beisammen sein, solange du klein bist. Was kann ich dir nur zu Gefallen tun?"
"Recht lieb sollst du mich haben", sagte Elfriede, "so lieb, wie ich dich in meinem Herzen trage; doch lass uns auch einmal wieder eine Rose machen." Zerina nahm das bekannte Schächtelchen aus dem Busen, warf zwei Körner hin, und plötzlich stand ein grünender Busch mit zweien hochroten Rosen vor ihnen, welche sich zueinander neigten, und sich zu küssen schienen. Die Kinder brachen die Rosen lächelnd ab, und das Gebüsch war wieder verschwunden.
"O müsste es nur nicht wieder so schnell sterben", sagte Elfriede, "das rote Kind, das Wunder der Erde." "Gib!" sagte die kleine Elfe, hauchte dreimal die aufknospende Rose an, und küsste sie dreimal; "nun", sprach sie, indem sie die Blume zurück gab, "bleibt sie frisch und blühend bis zum Winter." "Ich will sie wie ein Bild von dir aufheben", sagte Elfriede, "sie in meinem Kämmerchen wohl bewahren, und sie morgens und abends küssen, als wenn du es wärst." "Die Sonne geht schon unter", sagte jene, "ich muss jetzt nach Hause." Sie umarmten sich noch einmal, dann war Zerina verschwunden.
Am Abend nahm Marie ihr Kind mit einem Gefühl von Beängstigung und Ehrfurcht in die Arme; sie ließ dem holden Mädchen nun noch mehr Freiheit als sonst, und beruhigte oft ihren Gatten, wenn er, um das Kind aufzusuchen, kam, was er seit einiger Zeit wohl tat, weil ihm ihre Zurückgezogenheit nicht gefiel, und er fürchtete, sie könne darüber einfältig, oder gar unklug werden.
Die Mutter schlich öfter nach der Spalte der Mauer, und fast immer fand sie die kleine glänzende Elfe neben ihrem Kinde sitzen, mit Spielen beschäftigt, oder in ernsthaften Gesprächen. "Möchtest du fliegen können?" fragte Zerina einmal ihre Freundin. "Wie gerne!" rief Elfriede aus. Sogleich umfasste die Fee die Sterbliche, und schwebte mit ihr vom Boden empor, so dass sie zur Höhe der Laube stiegen.
Die besorgte Mutter vergaß ihre Vorsicht, und lehnte sich erschreckend mit dem Kopfe hinaus, um ihnen nachzusehen; da erhob aus der Luft Zerina den Finger und drohte lächelnd, ließ sich mit dem Kinde wieder nieder, herzte sie, und war verschwunden. Es geschah nachher noch öfter, dass Marie von dem wunderbaren Kinde gesehen wurde, welches jedes Mal mit dem Kopfe schüttelte oder drohte, aber mit freundlicher Gebärde.
Oftmals schon hatte bei vorgefallenem Streite Marie im Eifer zu ihrem Manne gesagt: "Du tust den armen Leuten in der Hütte Unrecht!" Wenn Andres dann in sie drang, ihm zu erklären, warum sie der Meinung aller Leute im Dorfe, ja der Herrschaft selber entgegen sei und es besser wissen wolle, brach sie ab, und schwieg verlegen.
Heftiger als je ward Andres eines Tages nach Tische und behauptete, das Gesindel müsse als landesverderblich durchaus fortgeschafft werden; da rief sie im Unwillen aus: "Schweig, denn sie sind deine und unser aller Wohltäter!" "Wohltäter?" fragte Andres erstaunt; "die Landstreicher?" In ihrem Zorne ließ sie sich verleiten, ihm unter dem Versprechen der tiefsten Verschwiegenheit die Geschichte ihrer Jugend zu erzählen, und da er bei jedem ihrer Worte ungläubiger wurde und verhöhnend den Kopf schüttelte, nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn in das Gemach, von wo er zu seinem Erstaunen die leuchtende Elfe mit seinem Kinde in der Laube spielen, und es liebkosen sah.
Er wusste kein Wort zu sagen; ein Ausruf der Verwunderung entfuhr ihm, und Zerina erhob den Blick. Sie wurde plötzlich bleich und zitterte heftig, nicht freundlich, sondern mit zorniger Miene machte sie die drohende Gebärde, und sagte dann zu Elfriede: "Du kannst nichts dafür, geliebtes Herz, aber sie werden niemals klug, so verständig sie sich auch dünken." Sie umarmte die Kleine mit stürmender Eil, und flog dann als Rabe mit heiserem Geschrei über den Garten hinweg, den Tannenbäumen zu.
Am Abend war die Kleine sehr still und küsste weinend die Rose, Marie war ängstlich zu Sinne, Andres sprach wenig. Es wurde Nacht. Plötzlich rauschten die Bäume, Vögel flogen mit ängstlichem Geschrei umher, man hörte den Donner rollen, die Erde zitterte und Klagetöne winselten in der Luft. Marie und Andres hatten nicht den Mut aufzustehen; sie hüllten sich in die Decken und erwarteten mit Furcht und Zittern den Tag. Gegen Morgen ward es ruhiger, und alles war still, als die Sonne mit ihrem Lichte über den Wald hervor drang.
Andres kleidete sich an, und Marie bemerkte, dass der Stein des Ringes an ihrem Finger verblasst war. Als sie die Tür öffneten, schien ihnen die Sonne klar entgegen, aber die Landschaft umher kannten sie kaum wieder. Die Frische des Waldes war verschwunden, die Hügel hatten sich gesenkt, die Bäche flossen matt mit wenigem Wasser, der Himmel schien grau, und als man den Blick nach den Tannen hinüber wandte, standen sie nicht finsterer oder trauriger da, als die übrigen Bäume; die Hütten hinter ihnen hatten nichts Abschreckendes, und mehrere Einwohner des Dorfes kamen und erzählten von der seltsamen Nacht, und dass sie über den Hof gegangen seien, wo die Zigeuner gewohnt, die wohl fort gegangen sein müssten, weil die Hütten leer ständen, und im Innern ganz gewöhnlich wie die Wohnungen anderer armen Leute aussähen; einiges vom Hausrat wäre zurück geblieben.
Elfriede sagte zu ihrer Mutter heimlich: "Als ich in der Nacht nicht schlafen konnte, und in der Angst bei dem Getümmel von Herzen betete, da öffnete sich plötzlich meine Tür, und herein trat meine Gespielin, um Abschied von mir zu nehmen. Sie hatte eine Reisetasche um, einen Hut auf ihren Kopf, und einen großen Wanderstab in der Hand. Sie war sehr böse auf dich, weil sie deinetwegen nun die größten und schmerzhaftesten Strafen aushalten müsse, da sie dich doch immer so geliebt habe; denn alle, so wie sie sagte, verließen nur sehr ungern diese Gegend."
Marie verbot ihr, davon zu sprechen, und in dem kam auch der Fährmann vom Strome herüber, welcher Wunderdinge erzählte. Mit einbrechender Nacht war ein großer fremder Mann zu ihm gekommen, welcher ihm bis zu Sonnenaufgang die Fähre abgemietet habe, doch mit dem Bedingnis, dass er sich still zu Hause halten und schlafen, wenigstens nicht aus der Tür treten solle.
"Ich fürchtete mich", fuhr der Alte fort, "aber der seltsame Handel ließ mich nicht schlafen. Sacht schlich ich mich ans Fenster und schaute nach dem Strome. Große Wolken trieben unruhig durch den Himmel und die fernen Wälder rauschten bange; es war als wenn meine Hütte bebte und Klagen und Winseln um das Haus schlich. Da sah ich plötzlich ein weißströmendes Licht, das breiter und immer breiter wurde, wie viele tausend niedergefallene Sterne, funkelnd und wogend bewegte es sich von dem finstern Tannengrunde her, zog über das Feld, und verbreitete sich nach dem Flusse hin.
Da hörte ich ein Trappeln, ein Klirren, ein Flüstern und Säuseln näher und näher; es ging nach meiner Fähre hin, hinein stiegen alle, große und kleine leuchtende Gestalten, Männer und Frauen, wie es schien, und Kinder, und der große fremde Mann fuhr sie alle hinüber; im Strome schwammen neben dem Fahrzeuge viel tausend helle Gebilde, in der Luft flatterten Lichter und weiße Nebel, und alles klagte und jammerte, dass sie so weit, weit reisen müssten, aus der geliebten angewöhnten Gegend fort.
Der Ruderschlag und das Wasser rauschten dazwischen, und dann war wieder plötzlich eine Stille. Oft stieß die Fähre an, und kam zurück und ward von neuem beladen, auch viele schwere Gefäße nahmen sie mit, die grässliche kleine Gesellen trugen und rollten; waren es Teufel, waren es Kobolde, ich weiß es nicht. Dann kam im wogenden Glanz ein stattlicher Zug. Ein Greis schien es, auf einem weißen kleinen Rosse, um den sich alles drängte; ich sah aber nur den Kopf des Pferdes, denn es war über und über mit kostbaren glänzenden Decken verhangen; auf dem Haupt trug der Alte eine Krone, so dass ich dachte, als er hinüber gefahren, die Sonne wolle von dorten aufgehen, und das Morgenrot funkle mir entgegen.
So währte es die ganze Nacht; ich schlief endlich in dem Gewirre ein, zum Teil in Freude, zum Teil in Schauder. Am Morgen war alles ruhig, aber der Fluss ist wie weg gelaufen, so dass ich Not haben werde mein Fahrzeug zu regieren."
Noch in dem selben Jahre war ein Mißwachs, die Wälder starben ab, die Quellen vertrockneten, und die selbe Gegend, die sonst die Freude jedes Durchreisenden gewesen war, stand im Herbst verödet, nackt und kahl, und zeigte kaum hie und da noch im Meere von Sand ein Plätzchen, wo Gras mit fahlem Grün empor wuchs. Die Obstbäume gingen alle aus, die Weinberge verdarben, und der Anblick der Landschaft war so traurig, dass der Graf im folgenden Jahre mit seiner Familie das Schloss verließ, welches nachher verfiel und zur Ruine wurde.
Elfriede betrachtete Tag und Nacht mit der größten Sehnsucht ihre Rose und gedachte ihrer Gespielin, und so wie die Blume sich neigte und welkte, so senkte sie auch das Köpfchen, und war schon vor dem Frühlinge verschmachtet. Marie stand oft auf dem Platze vor der Hütte und beweinte das entschwundene Glück. Sie verzehrte sich, wie ihr Kind, und folgte ihm in einigen Jahren. Der alte Martin zog mit seinem Schwiegersohn nach der Gegend, in der er vormals gelebt hatte.
Ludwig Tieck
DIE HAND DER JEZERTE ...
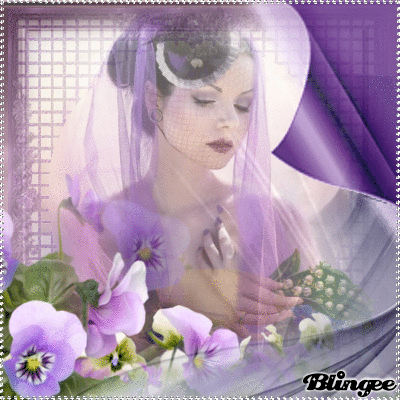
In des Königs Garten, eh das Frühlicht schien, rührte der Myrtenbaum die Blätter, sagend: "Ich spüre Morgenwind in meinen Zweigen; ich trinke schon den süßen Tau: wann wird Jezerte kommen?" Und ihm antwortete die Pinie mit Säuseln: "Am niederen Fenster sehe ich sie, des Gärtners Jüngste, schon durchs zarte Gitter. Bald tritt sie aus dem Haus, steigt nieder die Stufen zum Quell und klärt ihr Angesicht, die Schöne."
Darauf antwortete der Quell: "Nicht Salböl hat mein Kind, nicht Öl der Rose; es tunkt sein Haar in meine lichte Schwärze, mit seinen Händen schöpft es mich. Stille! ich höre das Liebchen."
Da kam des Gärtners Tochter zum Born, wusch sich und kämmte sich und flocht ihre Zöpfe.
Und sieh, es traf sich, dass Athmas, der König, aus dem Palast ging, der Morgenkühle zu genießen, bevor der Tag anbrach; und wandelte den breiten Weg daher auf gelbem Sand und wurde der Dirne
gewahr, trat nahe zu und stand betroffen über ihre Schönheit, begrüßte die Erschrockene und küsste ihr die Stirn.
Seit diesem war sie Athmas lieb und kam nicht mehr von seiner Seite Tag und Nacht; trug köstliche Gewänder von Byssus und Seide, und war geehrt von den Vettern des Königs, weil sie sich hold und demütig erwies gegen Große und Kleine und gab den Armen viel. Übers Jahr aber wurde Jezerte krank, und half ihr nichts, sie starb in ihrer Jugend.
Da ließ der König ihr am Garten des Palasts ein Grabgewölbe bauen, wo der Quell entsprang, darüber einen kleinen Tempel, und ließ ihr Bildnis drin aufstellen aus weißem Marmor, ihre ganze
Gestalt, wie sie lebte, ein Wunderwerk der Kunst. Den Quell aber hielt das Volk heilig.
Alle Monden einmal ging der König dahin, um Jezerte zu weinen. Er redete mit niemand jenen Tag, man durfte nicht Speise noch Trank vor ihn bringen.
Er hatte aber eine andere Buhle, Naïra; die ward ihm gram darob und eiferte im stillen mit der Toten; gedachte, wie sie ihrem Herrn das Andenken an sie verkümmere und ihm das Bild verderbe. Sie beschied insgeheim Jedanja zu sich, einen Jüngling, so dem König diente; der trug eine heimliche Liebe zu ihr, das war ihr nicht verborgen. Sie sprach zu ihm: "Du sollst mir einen Dienst erzeigen, dran ich erkennen will, was ich an dir habe. Vernimm.
Ich höre von Jezerten immerdar, wie schön sie gewesen, so dass ich viel drum gäbe, nur ihr Bildnis zu sehen, und ob ich zwar das nicht vermag, weil mein Herr es verschworen, will ich doch eines von ihr sehen, ihre Hand, davon die Leute rühmen, es sei ihresgleichen nicht mehr zu finden. So sollst du mir nun dieses Wunder schaffen und mir vor Augen bringen, damit ich es glaube."
"Ach, Herrin", sagte er, "ich will dich selbst hinführen, dass du Jezerte beschauest, bei Nacht."
"Mitnichten!" antwortete sie: "Wie könnte ich aus dem Palast gehen? Tu, wie ich sagte, Lieber, und stille mein Gelüst." - Und sie verhieß ihm große Gunst, da versprach es der Knabe. Auf eine
Nacht ersah er die Gelegenheit durch Pforten und Gänge, und kam zum Grabmal unbeschrieen, denn die Wache stand in den Höfen. Er hatte aber einen künstlichen Haken, der öffnete das Schloss, und
wie er eintrat, sah er das Bildnis stehen im Schein der Lampen; die brannten Tag und Nacht.
Er trat herzu, fasste die eine Hand und brach sie ab, hart über dem Gelenke, barg sie in seinen Busen, eilte und zog die Tür hinter sich zu. Wie er nun längs der Mauer hin lief, vernahm er ein Geräusch und deuchte ihm als käme wer. Da nahm er in der Angst die Hand und warf sie über die Mauer hinweg in den Garten und floh. Die Hand fiel aber mitten in ein Veilchenbeet und nahm keinen Schaden.
Alsbald gereute den Jüngling seine Furcht, denn sie war eitel, und schlich in den Garten, die Hand wiederzuholen; er fand sie aber nicht, und suchte bis der Tag anfing zu grauen, und war wie verblendet. So machte er sich fort und kam in seine Kammer. Am anderen Morgen, als die Sonne schien, lustwandelte Athmas unter den Bäumen. Er kam von ungefähr an jenes Beet und sah die weiße Hand in den Veilchen und hob sie auf mit Schrecken, lief hinweg und es entstand ein großer Lärm durch den Palast.
Kamen auch alsbald Knechte des Königs und sagten ihm an: "Wir haben in der Dämmerung Jedanja gesehen durch den Garten hin fliehen und haben seine Fußstapfen verfolgt." - Darauf ward der Jüngling ergriffen und in das Gefängnis geworfen. Naïra mittlerweile bangte nicht, denn sie war keck und sehr verschlagen. Berief in der Stille Maani zu sich, Jedanjas Bruder, und sagte: "Mich jammert dein Bruder, ich möchte ihm wohl heraushelfen, wenn er den Mut hätte, zu tun wie ich ihn heiße, und du mir eine Botschaft an ihn brächtest."
Maani sprach: "Befiehl und nimm mein eigen Leben, dass ich nur den Knaben errette!" Da hieß Naïra ihn schnell einen Pfeil herbeiholen. Sie aber nahm einen Griffel und schrieb der Länge nach auf den Schaft diese Worte: "Verlange vor den König und sprich: Jedanja liebte Jezerten und war von ihr geliebt, und hängt sein Herz noch an der Toten, also dass er im blinden Wahn die Übeltat verübte. So spreche mein Freund und fürchte nicht, dass ihn das Wort verderbe. Die dieses rät, wird alles gutmachen."
Nachdem sie es geschrieben, sagte sie: "Nimm hin und schieße diesen Pfeil zu Nacht durchs Gitter, wo dein Bruder liegt im Turm." Maani ging und richtete es kühnlich aus. Den anderen Tag rief Athmas den Gefangenen vor sich und redete zu ihm: "Du hast das nicht von selbst getan. So bekenne denn, wer dich gedungen!" Der Jüngling sagte: "Herr, niemand."
Und als er Grund und Anlass nennen sollte seines Frevels, verweigerte er es und schwieg, so hart man ihn bedrohte, und mussten ihn die Knechte wieder wegführen. Sie schlugen ihn und quälten ihn im Kerker, drei Tage nacheinander, solchermaßen, dass er nahe daran schien, zu sterben. Dies litt er aber listigerweise, der Absicht, dass er Glauben finden möge, wenn er nunmehr zu reden selbst begehrte. Ließ sich also am vierten Morgen, da die Peiniger aufs neue kamen, zu dem König bringen, fiel zitternd auf sein Angesicht, schien sprachlos, wie vor großer Angst und Reue, bis ihm verheißen ward, das Leben zu behalten, sofern er die Wahrheit bekenne.
Da sagte er: "So wisse, Herr! Bevor des Gärtners Tochter meinem Herrn gefiel, dass er sie für sich selbst erwählte, war sie von Jedanja geliebt, und sie liebte ihn wieder. Hernach floh ich hinweg aus Kummer, und kehrte nicht zur Stadt zurück, bis ich vernahm, Jezerte sei gestorben. Die ganze Zeit aber habe ich nicht aufgehört, das Kind zu lieben. Und da ich jüngst bei Nacht, von Sehnsucht übernommen, wider dein Gebot in das Gewölbe ging und sah das Bild, trieb mich unsinniges Verlangen, den Raub zu begehen."
Der König hatte sich entfärbt bei dieser Rede und stand verworren eine Zeit lang in Gedanken; dann hieß er die Diener Jedanja freilassen, denn er zweifelte nicht mehr, dass dieser wahr gesprochen. Doch befahl er dem Jüngling und allen, die jetzo zugegen gewesen, bei Todesstrafe, nicht zu reden von der Sache. Athmas war aber fortan sehr bekümmert, denn er dachte, Jezerte habe ihm belogen, da sie ihm schwur, sie habe keinen Mann gekannt, bis sie der König gefunden; also dass er nicht wusste, sollte er die Tote ferner lieben oder hassen.
Einstmals, da Naïra sich bei ihm befand wie gewöhnlich, erblickte sie an seinem Sitz ein Kästchen von dunklem Holz, mit Perlen und Steinen geziert. Daran verweilten ihre Augen, bis Athmas es bemerkte und ihr winkte, das Kästchen zu öffnen. Sie lief und hob den Deckel auf, da lag Jezertes Hand darin auf einem Kissen. Sie sah die selbe mit Verwunderung an und pries sie laut mit vielem Wesen vor dem König.
Und er, indem er selber einen Blick hin tat, sprach ohne Arg: "Schaut sie nicht traurig her, gleich einer Taube in der Fremde? Siehe, es war ein weißes Taubenpaar, nun hat der Wind die eine verstürmt von ihrer Hälfte weg. Ich will, dass sie der Grieche wieder mit dem Leib zusammenfüge."
Diese Rede empfand Naïra sehr übel. Sie fing aber an, mit falschen Worten ihren Herrn zu trösten und sagte arglistig dabei, Jezerte möge wohl vor Gram um ihren Knaben krank geworden und gestorben sein. Hiermit empörte sie des Königs Herz und schaffte sich selbst keinen Vorteil, vielmehr ward er misstrauisch gegen sie.
Er ging und sprach bei sich: Sollte es sein, wie dies Weib mir sagt, so will ich doch nimmer das Bildnis vertilgen. Wann jetzt die Zeit der heiligen fünf Nächte kommt, will ich's versenken in das Meer, nicht allzu fern der Stadt. Es sollen sich ergötzen an seiner Schönheit holde Geister in der Tiefe, und der Mond mit täuschendem Schein wird es vom Grund heraufheben. Dann werden die Schiffer dies Trugbild sehen und werden sich des Anblicks freuen.
Nicht lang hernach, da der König vor solchen Gedanken nicht schlief, erhob er sich von seinem Lager und ging nach dem Grabmal, sah das Bild, daran das abgebrochene Glied vom Künstler mit einer goldenen Spange wieder wohl befestigt war, dass niemand einen Mangel hätte finden können, der es nicht wusste. Er kniete nieder, abgewendet von Jezerte, mit dem Gesicht gegen die Wand, und flehte Gott um ein gewisses Zeichen, ob das Kind unschuldig war oder nicht; wo nicht, so wollt er Jezerte vergessen von Stund an.
Er hatte aber kaum gebetet, so ward der ganze Raum von süßem Duft erfüllt, als von Veilchen; als hätte Jezertes Hand von jenem Gartenbeet allen Wohlgeruch an sich genommen und jetzt von sich gelassen mit eins. Da wusste Athmas gewiss, sie sei ohne Tadel, wie er und jedermann sie immerdar gehalten; sprang auf, benetzte ihre Hand mit Tränen und dankte seinem Gott. Zugleich gelobte er ein großes Opfer, und ein zweites mit reichen Gaben an das arme Volk, wenn ihm der Täter geoffenbart würde.
Und sieh, den anderen Morgen erschien Naïra zur gewohnten Stunde nicht in des Königs Gemächern, und ließ ihm sagen, sie sei krank, er möge auch nicht kommen, sie zu besuchen. Sie lag im Bette, weinte sehr vor ihren Frauen und tobte, stieß Verwünschungen aus und sagte nicht, was mit ihr sei; auch schickte sie den Arzt mit Zorn von sich.
Da sie nach einer Weile stiller geworden, rief sie herzu ihre Vertrauteste und wies ihr dar ihre rechte Hand, die war ganz schwarz, wie schwarzes Leder, bis an das Gelenk. Und sprach mit Lachen zu der ganz entsetzten Frau: "Diesmal wenn du nicht weißt zu schmeicheln und ein Bedenken hast, zu sagen, sie ist viel weißer als das Elfenbein, und zarter als ein Lotosblatt, will ich dir nicht feind sein!" -
Dann weinte sie von neuem, besann sich und sagte mit Hast: "Nimm allen meinen Schmuck, Kleider und Gold zusammen, und schaffe, dass wir heute in der Nacht entkommen aus dem Schloss! Ich will aus diesem Lande." Das letzte Wort war ihr noch nicht vom Munde, da tat sich in der Wand dem Bette gegenüber eine Tür auf ohne Geräusch, die war bis diese Stunde für jedermann verborgen, und durch sie trat der König ein in das Gemach.
In ihrem Schrecken hielt Naïra beide Hände vors Gesicht, alsdann fuhr sie zurück und barg sich in die Kissen. Er aber rief: "Bei meinem Haupt, ich wollte, dass meine Augen dieses nicht gesehen hätten!" - So zornig er auch schien, man konnte doch wohl merken, dass es ihm leid tat um das Weib. Er ging indes, wie er gekommen war, und sagte es den Fürsten, seinen Räten, an, alles, wie es gegangen. Diese verwunderten sich höchlich, und einer, Eldad, welcher ihm der nächste Vetter war, fragte ihn:
"Was will mein Herr, dass Naïra geschehe, und was dem Buben, den du losgelassen hattest?" - Der König sagte: "Verbannet sei die Lügnerin an einen wüsten Ort. Ihr Blut begehre ich nicht; sie hat den Tod an der Hand. Jedanja mögt ihr fangen und verwahren."
Es war aber im Meer, zwo Meilen von dem Strand, an dem die Stadt gelegen, eine Insel, von Menschen nicht bewohnt, nur Felsen und Bäume. Dahin beschloss Eldad sie bringen zu lassen; denn beide hatten sich immer gehasst. Als ihr nun das verraten ward, obwohl es noch geheim bleiben sollte, sprach sie sogleich zu ihren Frauen. "Nicht anderes hat er im Sinn, denn dass ich dort umkomme. Ihr werdet Naïra nicht sehen von dieser Insel wiederkehren."
Fortan hielt sie sich still und trachtete auf keine Weise dem zu entgehen, das ihrer wartete. Sie machte sich vielmehr bereit zur Reise auf den anderen Morgen. Denn schon war bestellt, dass ein Fahrzeug drei Stunden vor Tag sie an der hintern Pforte des Palasts empfange. Und als sie in der Frühe völlig fertig war und angetan mit einem langen Schleier, und schaute durchs Fenster herab in die Gärten, da der Mond hell hinein schien, sprach sie auf einmal zu den Frauen:
"Hört, was ich jetzt dachte, indem ich also stand und mir mein ganz Elend vor Augen war. Ich sagte bei mir selbst: du möchtest dies ja wohl erdulden alles, die Schmach, den Bann und den Tod, wenn du nicht müsstest mit dir nehmen das böse Mal an deiner Hand; denn es grauste mir vor mir selbst. In meinem Herzen sprach es da: Wenn du die Hand eintauchtest in Jezertes Quell beim Tempel, mit Bitten, dass sie dir vergebe, da wärest du rein. - Wer ginge nun gleich zu dem Hauptmann der Wache, dass er den Fürsten bitte, mir so viel zu gestatten?"
Und eine der Frauen lief alsbald. Der Hauptmann aber wollte nicht. Naïra sagte: "So gehe du selbst an den Quell, es wird dir niemand wehren, und tauche dieses Tuch hinein und bring es mir." Doch keine traute sich, ihr diesen Liebesdienst zu tun. Naïra rief und sah auf ihre Hand: "O wenn Jezertes Gottheit wollte, ein kleiner Vogel machte sich auf und striche seinen Flügel durch das Wasser und käme ans Fenster, dass ich ihn berühre!" -
Dies aber mochte nicht geschehen; und kamen jetzt die Leute, Naïra abzuholen. Sie fuhr auf einem schlechten Boot, mit zweien Schergen und acht Ruderknechten, schnell dahin; saß auf der mittleren Bank allein, gefesselt; zu ihren Füßen etwas Vorrat an Speisen und Getränk, nicht genug für fünf Tage. Und saß da still, in dichte Schleier eingewickelt, dass die Blicke der Männer sie nicht beleidigten, auch dass sie selbst nicht sehen musste; und war, als schiffte sie schon jetzt unter den Schatten.
Bei jenem Eiland als sie angekommen waren, lösten die Begleiter ihre Bande und halfen ihr aussteigen; setzten drei Krüge und einen Korb mit Brot und Früchten auf den Stein und stießen wieder ab ungesäumt. Die Männer behielten den Ort im Gesicht auf der Heimfahrt, solange sie vermochten, und sahen die Frau verhüllt dort sitzen, im Anfang ganz allein, so wie sie dieselbe verlassen, darnach aber gewahrten sie eine andere Frauengestalt, in weißen Gewändern, sitzend neben ihr.
Da hielten die Ruderer inne mit Rudern, und die Schergen berieten sich untereinander, ob man nicht umkehren solle. Der eine aber sagte: "Es geht nicht natürlich zu, es ist ein Geist. Fahrt immer eilig zu, dass man es dem Fürsten anzeige." - So taten sie und meldeten es Eldad; der aber verlachte und schalt sie sehr.
Jedanja unterdessen, nachdem er zeitig innegeworden, dass möchte seine Unwahrheit an Tag gekommen sein, hatte sich außer den Mauern der Stadt, unter dem Dach einer Tenne, versteckt. Und seine Brüder verkündigten ihm, Naïra sei heut nach dem Felsen gebracht. Alsbald verschwor er sich mit ihnen und etlichen Freunden, sie zu befreien, und wenn es alle den Hals kosten sollte.
Um Mitternacht bestiegen sie ein kleines Segelschiff, sechs rüstige Gesellen, mit Waffen wohl versehen. Sie mussten aber einen großen Umweg nehmen, weil Wächter waren am Strand verteilt und weithin hohes Felsgestade, da kein Schiff an- und abgehen konnte. Dennoch am Abend des zweiten Tags, nach Ankunft der Naïra auf der Insel, erreichten sie die selbige und erkannten bald den rechten Landungsplatz; sahen allda die Krüge und den Korb und fanden alles unberührt.
Es überkam Jedanja große Angst um das Weib, das er liebte. Und suchten lang nach ihr und fanden sie zuletzt auf einem schönen Hügel unter einem Palmbaum liegen, tot; der Schleier über ihr Gesicht mit Fleiß gelegt, die Hände bloß und alle beide weiß wie der Schnee.
Da kamen die Jünglinge bald überein, es sollten ihrer vier auf gradem Weg zur Stadt zurücksteuern, derweil zwei andere bei der Leiche blieben. Jedanja selber wollte sich freiwillig vor den König stellen, ihm alles redlich zu gestehen und zu berichten, denn er kannte ihn für gut und großmütig und wusste wohl, es sei mit seinem Willen nicht also verfahren gegen Naïra.
Auch kam er glücklich vor Athmas zu stehen, obwohl Eldad es verhindern wollte. Wie nun der König alle diese Dinge, teils von dem Jüngling, teils von anderen, aus dem Grund erforscht, auch jetzt erfahren hatte, was die Männer auf dem Boot gesehen, daraus er wohl merkte, Jezerte sei mit Naïra gewesen, da war er auf das äußerste bestürzt und so entrüstet über seinen Vetter, dass er ihn weg für immer jagte von dem Hof.
Zugleich verordnete der König, Naïra auf der Insel mit Ehren zu bestatten, ließ die Wildnis lichten und Gärten anlegen. In deren Mitte auf dem Hügel, erbaute man das Grab, bei dem Palmbaum, wo sie verschieden war.
Eduard Mörike
PRINZESSIN SVANVITHE ...
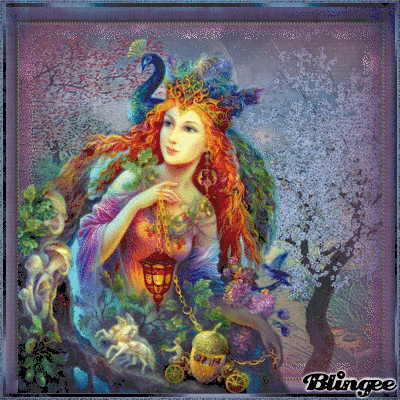
Du hast wohl von der Sage gehört, daß hier bei Garz, wo jetzt der Wall über dem See ist, vor vielen tausend Jahren ein großes und schönes Heidenschloß gewesen ist mit herrlichen Häusern und Kirchen, worin sie ihre Götzen gehabt und angebetet haben.
Dieses Schloß haben vor langer, langer Zeit die Christen eingenommen, alle Helden totgeschlagen und ihre Kirchen umgeworfen und die Götzen, die darin standen, mit Feuer verbrannt; und nun ist nichts mehr übrig von all der großen Herrlichkeit als der alte Wall und einige Leuschen, welche die Leute sich erzählen, besonders von dem Mann mit Helm und Panzer angetan, der auf dem weißen Schimmel oft über die Stadt und den See hinreitet.
Einige, die ihn nächtlich gesehen haben, erzählen, es sei der alte König des Schlosses, und er habe eine güldene Krone auf. Das ist aber alles nichts. Daß es aber um Weihnachten und Johannis in der Nacht aus dem See klingt, als wenn Glocken in den Kirchen geläutet werden, das ist wahr, und viele Leute haben es gehört, und auch mein Vater.
Das ist eine Kirche, die in den See versunken ist, andere sagen, es ist der alte Götzentempel. Das glaube ich aber nicht; denn was sollten die Helden an christlichen Festtagen läuten? Aber das Klingen und Läuten im See ist dir gar nichts gegen das, was im Wall vorgeht, und davon will ich dir eine Geschichte erzählen. Da sitzt eine wunderschöne Prinzessin mit zu Felde geschlagenen Haaren und weinenden Augen und wartet auf den, der sie erlösen soll; und dies ist eine sehr traurige Geschichte.
In jener alten Zeit, als das Garzer Heidenschloß von den Christen belagert ward und die drinnen in großen Nöten waren, weil sie sehr gedrängt wurden, als schon manche Türme niedergeworfen waren und sie auch nicht recht mehr zu leben hatten und die armen Leute in der Stadt hin und wieder schon vor Hunger starben, da war drinnen ein alter, eisgrauer Mann, der Vater des Königs, der auf Rügen regierte.
Dieser alte Mann war so alt, daß er nicht recht mehr hören und sehen konnte; aber es war doch seine Lust, unter dem Golde und unter den Edelsteinen und Diamanten zu kramen, welche er und seine Vorfahren im Reiche gesammelt hatten und welche tief unter der Erde in einem schönen, aus eitel Marmelsteinen und Kristallen gebauten Saale verwahrt wurden. Davon waren dort ganz große Haufen aufgeschüttet, viel größere als die Roggen- und Gerstenhaufen, die auf deines Vaters Kornboden aufgeschüttet sind.
Als nun das Schloß zu Garz von den Christen in der Belagerung so geängstet ward und viele der tapfersten Männer und auch der König, des alten Mannes Sohn, in dem Streite auf den Wällen und vor den Toren der Stadt erschlagen waren, da wich der Alte nicht mehr aus der marmornen Kammer, sondern lag Tag und Nacht darin und hatte die Türen und Treppen, die dahin führten, dicht vermauern lassen; er aber wußte noch einen kleinen heimlichen Gang, der unter der Erde weg lief, viele hundert Stufen tiefer als das Schloß, und jenseits des Sees einen Ausgang hatte, den kein Mensch wußte als er, und wo er hinausschlüpfen und sich draußen bei den Menschen Speise und Trank kaufen konnte.
Als nun das Schloß von den Christen erobert und zerstört ward und die Männer und Frauen im Schlosse getötet und alle Häuser und Kirchen verbrannt wurden, daß kein Stein auf dem anderen blieb, da fielen die Türme und Mauern übereinander, und die Türe der Goldkammer ward gar verschüttet; auch blieb kein Mensch lebendig, der wußte, wo der tote König seine Schätze gehabt hatte.
Der alte König aber saß drunten bei seinen Haufen Goldes und hatte seinen heimlichen Gang offen und hat noch viele hundert Jahre gelebt, nachdem das Schloß zerstört war; denn sie sagen, die Menschen, welche sich zu sehr an Silber und Gold hängen, können vom Leben nicht erlöst werden und sterben nicht, wenn sie Gott auch noch so sehr um den Tod bitten. So lebte der alte, eisgraue Mann noch viele, viele Jahre und mußte sein Gold bewachen, bis er ganz dürr und trocken ward wie ein Totengerippe.
Da ist er denn gestorben und auch zur Strafe verwandelt worden und muß nun als ein schwarzer magerer Hund unter den Goldhaufen liegen und sie bewachen, wenn einer kommt und den Schatz holen will. Des Nachts aber zwischen zwölf und ein Uhr, wann die Gespensterstunde ist, muß er noch immer rundgehen als ein altes graues Männlein mit einer schwarzen Pudelmütze auf dem Kopf und einem weißen Stock in der Hand.
So haben die Leute ihn oft gesehen im Garzer Holze am Wege nach Poseritz; auch geht er zuweilen um den Kirchhof herum. Denn da sollen vor alters Heidengräber gewesen sein, und die Helden haben immer viel Silber und Gold mit sich in die Erde genommen. Das will er holen, darum schleicht er dort, kann es aber nicht kriegen, denn er darf die geweihte Erde nicht berühren. Das ist aber seine Strafe, daß er so rund laufen muß, wann andere Leute in den Betten und Gräbern schlafen, weil er so geizig gewesen ist.
Nun begab es sich lange nach diesen Tagen, daß in Bergen ein König von Rügen wohnte, der hatte eine wunderschöne Tochter, die hieß Svanvithe; und sie war die schönste Prinzessin weit und breit, und es kamen Könige und Fürsten und Prinzen aus allen Landen, die um die schöne Prinzessin warben.
Und der König, ihr Herr Vater, wußte sich kaum zu lassen vor allen den Freiern und hatte zuletzt nicht Häuser genug, daß er die Fremden beherbergte, noch Ställe, wohin sie und ihre Knappen und Staller ihre Pferde zögen; auch gebrach es fast an Hafer im Lande und Raum für alle die Kutscher und Diener, die mit ihnen kamen, und war Rügen so voll von Menschen, als es nie gewesen seit jenen Tagen. Und der König wäre froh gewesen, wenn die Prinzessin sich einen Mann genommen hätte und die übrigen Freier weg gereist wären.
Das läßt sich aber bei den Königen nicht so leicht machen als bei anderen Leuten, und muß da alles mit vieler Zierlichkeit und Langsamkeit hergehen. Die Prinzessin, nachdem sie wohl ein ganzes halbes Jahr in ihrer einsamen Kammer geblieben war und keinen Menschen gesehen, auch kein Sterbenswort gesagt hatte, fand endlich einen Prinzen, der ihr wohl gefiel, und den sie gern zum Mann haben wollte, und der Prinz gefiel auch dem alten Könige, daß er ihn gern als Eidam wollte.
Und sie hatten einander Ringe geschenkt, und war große Freude im ganzen Lande, daß die schöne Svanvithe Hochzeit halten sollte, und hatten alle Schneider und Schuster die Fülle zu tun, die schönen Kleider und Schuhe zu machen, die zur Hochzeit getragen werden sollten. Der verlobte Prinz aber und Svanvithens Bräutigam hieß Herr Peter von Dänemarken und war ein über die Maßen feiner und stattlicher Mann, daß seinesgleichen wenige gesehen wurden.
Da, als alles in lieblicher Hoffnung und Liebe grünte und blühte und die ganze Insel in Freuden stand und nur noch ein paar Tage bis zur Hochzeit waren, kam der Teufel und säte sein Unkraut aus, und die Luft ward in Traurigkeit verwandelt. Es war nämlich all da an des Königs Hofe auch ein Prinz aus Polen, ein hinterlistiger und schlechter Herr, sonst schön und ritterlich an Gestalt und Gebärde. Dieser hatte manches Jahr um die Prinzessin gefreit und sie geplagt Tag und Nacht; sie hatte aber immer nein gesagt, denn sie mochte ihn nicht leiden.
Als dieser polnische Prinz nun sah, daß es wirklich eine Hochzeit werden sollte und daß Herr Peter von Dänemarken zum Treuliebsten der schönen Svanvithe erkoren war, sann er in seinem bösen Herzen auf arge Tücke und wußte es durch seine Künste so zu stellen, daß der König und alle Menschen glaubten, Svanvithe sei keine züchtige Prinzessin und habe manche Nächte bei dem polnischen Prinzen geschlafen.
Das glaubte auch Herr Peter und reiste plötzlich weg; und der polnische Prinz war zuerst weg gereist, und alle Könige und Prinzen reisten weg. Und das Schloß des Königs in Bergen stand wüst und leer da, und alle Freude war mit weg gezogen und alle Geiger und Pfeifer und alles Saitenspiel, die sich auf Turniere und Feste gerüstet hatten. Und die Schande der armen Prinzessin klang über das ganze Land; ja in Schweden und Dänemark und Polen hörten sie es, wie die Hochzeit sich zerschlagen hatte.
Sie aber war gewiß unschuldig und rein wie ein Kind, das aus dem Mutterleibe kommt, und war es nichts als die greuliche Bosheit des verruchten polnischen Prinzen, den sie als Freier verschmäht hatte.
So ging es der armen Svanvithe, und der König, ihr Vater, war einige Tage nach diesen Geschichten wie von Sinnen und wußte nicht von sich, und ihm war so zumute, daß er sich hätte ein Leid antun können von wegen seiner Tochter und von wegen des Schimpfes, den sie auf das ganze königliche Haus gebracht hatte.
Und als er sich besann und wieder zu sich kam und die ganze Schande bedachte, worein er geraten war durch seine Tochter, da ergrimmte er in seinem Herzen, und er ließ die schöne Svanvithe holen und schlug sie hart und zerraufte ihr Haar und stieß sie dann von sich und befahl seinen Dienern, daß sie sie hinaus führten in ein verborgenes Gemach, daß seine Augen sie nimmer wiedersähen. Darauf ließ er in einen mit dichten Mauern eingeschlossenen und mit dunklen Bäumen beschatteten Garten hinter seinem Schlosse einen düstern Turm bauen, wo weder Sonne noch Mond hinein schien, da sperrte er die Prinzessin ein.
Der Turm, den er hatte bauen lassen, war aber fest und dicht und hatte nur ein einziges kleines Loch in der Türe, wodurch ein wenig Licht hinein fiel und wodurch der Prinzessin die Speise gereicht ward. Es war auch weder Bett noch Tisch oder Bank in dem traurigen Gefängnis; auf harter Erde mußte sie liegen, die sonst auf Sammet und Seiden geschlafen hatte, und barfuß mußte sie gehen, die sonst in goldenen Schuhen geprangt hatte. Und Svanvithe hätte sterben müssen vor Jammer, wenn sie nicht gewußt hätte, daß sie unschuldig war, und wenn sie nicht zu Gott hätte beten können.
Sie aber war ein sehr junges Kind, als sie eingesperrt ward, erst sechzehn Jahre alt, schön wie eine Rose und schlank und weiß wie eine Lilie, und die Menschen, die sie lieb hatten, nannten sie nicht anders als des Königs Lilienstengelein. Und dieses süße Lilienstengelein sollte so jämmerlich verwelken in der kalten und einsamen Finsternis.
Und sie hatte wohl drei Jahre so gesessen zwischen den kalten Steinen, und auch der alte König war nicht mehr froh gewesen seit jenem Tage, als der polnische Prinz sie in die große Schande gebracht hatte, sondern sein Kopf war schneeweiß geworden vor Gram wie der Kopf einer Taube; aber vor den Leuten gebärdete er sich stolz und aufgerichtet und tat, als wenn seine Tochter tot und lange begraben wäre.
Sie aber saß von der Welt ungewußt in ihrem Elende und tröstete sich allein Gottes und dachte, daß er ihre Unschuld wohl einmal an den Tag bringen würde. Weil sie aber in ihren einsamen Trauerstunden Zeit genug hatte, hin und her zu denken, so fiel ihr die Sache ein von dem Königsschatze unter dem Garzer Walle, die sie in ihrer Kindheit oft gehört hatte, und sie gedachte damit ihre Unschuld, und daß der polnische Prinz sie unter einem falschen Schein schändlich belogen hatte, sonnenklar zu beweisen.
Und als darauf ihr Wächter kam und ihr die Speise durch das Loch reichte, sprach sie zu ihm: »Lieber Wächter, gehe zu dem Könige, meinem und deinem Herrn, und sage ihm, daß seine arme einzige Tochter ihn nur noch ein einziges Mal zu sehen und zu sprechen wünscht in ihrem Leben und daß er ihr diese letzte Gunst nicht versagen mag.«
Und der Wächter sagte ja und lief und dachte bei sich: »Wenn der alte König ihre Bitte nur erhört!« Denn es jammerte ihn die arme Prinzessin unaussprechlich, und sie jammerte alle Menschen; denn sie war immer freundlich gewesen gegen jedermann, auch hatten die meisten von Anfang an geglaubt, daß sie fälschlich verklagt war und daß der polnische Prinz einen argen Lügenschein auf sie gebracht hatte; denn sie hatte sich immer aller Zucht und Jungfräulichkeit beflissen vor jedermann.
Und als ihr Wächter vor den König trat und ihm die Bitte der Prinzessin anbrachte, da war der alte Herr sehr zornig und schalt ihn und drohte ihm, ihn selbst in den Turm zu werfen, wenn er den Namen der Prinzessin vor ihm je wieder über seine Lippen laufen lasse. Und der erschrockene Wächter ging weg. Der König aber legte sich hin und schlief ein. Da soll er einen wunderbaren Traum gehabt haben, den kein Mensch zu deuten verstanden hat, und er ist früh erwacht und sehr unruhig gewesen und hat viel an seine Tochter denken müssen, bis er zuletzt befohlen hat, daß man sie aus dem Turm herauf brächte und vor ihn führte.
Als Svanvithe nun vor den König trat, war sie bleich und mager, auch waren ihre Kleider und Schuhe schon abgerissen, und sie stand fast nackt und barfuß da und sah einer Bettlertochter ähnlicher als einer Königstochter. Und der alte König ist bei ihrem Anblick blaß geworden vor Jammer wie der Kalk an der Wand, aber sonst hat er sich nichts merken lassen. Und Svanvithe hat sich vor ihm verneigt und also zu ihm gesprochen:
»Mein König und Herr! Ich erscheine nur als eine arme Sünderin vor dir, als eine, die an der göttlichen Gnade und an dem Lichte des Himmels kein Recht mehr haben soll. Also hast du mich von deinem Angesicht verstoßen und von allem Lebendigen weg gesperrt. Ich beteure aber vor dir und vor Gott, daß ich unschuldig leide und daß der polnische Prinz aus eitel Tücke und Arglist all den schlimmen Schein auf mich gebracht hat. Und nun hat Gott, der sich mein erbarmen will, mir einen Gedanken ins Herz gegeben, wodurch ich meine unbefleckte Jungfrauschaft beweisen und dich und mich und dein ganzes Reich zu Reichtum und Ehren bringen kann.
Du weißt, es geht die Sage, unter dem alten Schloßwalle zu Garz, wo unsere heidnischen Ahnen weiland gewohnt haben, liege ein reicher Schatz vergraben. Diese Sage, die mir in meiner Kindheit oft erzählt ist, meldet ferner, dieser Schatz könne nur von einer Prinzessin gehoben werden, die von jenen alten Königen herstamme und noch eine reine Jungfrau sei: wenn nämlich diese den Mut habe, in der Johannisnacht zwischen zwölf und ein Uhr nackt und einsam diesen Wall zu ersteigen und darauf rückwärts so lange hin und her zu treten, bis es ihr gelinge, die Stelle zu treffen, wo die Tore und Treppen verschüttet sind, die zu der Schatzkammer hinabführen.
Sobald sie diese mit ihren Füßen berühre, werde es sich unter ihr öffnen, und sie werde sanft herunter sinken mitten in das Gold und könne sich von den Herrlichkeiten dann auslesen, was sie wolle, und bei Sonnenaufgang wieder heraus gehen. Was sie aber nicht tragen könne, werde der alte Geist, der den Schatz bewacht, nebst seinen Gehilfen nachtragen. Hierauf habe ich nun meine Hoffnung eines neuen Glückes gestellt, ob es mir etwa aufblühen wolle; laß mich denn, Herr König, mit Gott diese Probe machen. Ich bin ja doch einer Toten gleich, und ob ich hier begraben bin oder dort begraben werde, kann dir einerlei sein.«
Sie hatte die Gebärde, als wolle sie noch mehr sagen; aber bei diesen Worten stockte sie und konnte nicht mehr, sondern schluchzete und weinte bitterlich. Der König aber winkte dem Wächter leise zu, der sie hereingeführt hatte, und als bald kamen Frauen und Dienerinnen herbei und trugen sie hinaus von dem Könige weg in ein Seitengemach. Und nicht lange, so ward der Wächter wieder zu dem Könige gerufen, und er brachte ihr Speise und Trank, daß sie sich stärkte und erquickte, und zugleich die Botschaft, daß der König ihr die gebetene mitternächtliche Fahrt erlaube.
Bald trugen Dienerinnen ihr ein Bad herein nebst zierlichen Kleidern, daß sie sich bedecken konnte, denn sie war fast nackend. Und sie lebte nun wieder in Freuden, obgleich sie ganz einsam saß und gegen niemand den Mund auftat - auch den Dienern und Dienerinnen war das Sprechen zu ihr verboten, sie wußten auch nicht, wer sie war, noch wie sie in das Schloß gekommen, denn von denen, die sie kannten, ward niemand zu ihr gelassen denn allein der Wächter, der ihr immer die Speise gebracht hatte im Turme.
Und ihre Schönheit fing wieder an aufzublühen, wie blaß und elend sie auch aus dem Turm gekommen war; und alle, die sie sahen, entsetzten sich über ihre Huld und Lieblichkeit, und sie deuchte ihnen fast einem Engel gleich, der vom Himmel in das Schloß gekommen sei.
Und als vierzig Tage vergangen waren und der Tag vor Johannis da war, da ging sie zu dem König, ihrem Vater, ins Gemach und sagte ihm Lebewohl. Und der alte Herr neigte noch einmal seinen weißen Kopf über sie und weinte sehr, und sie sank vor ihm hin und umfaßte seine Knie und weinte noch mehr. Und darauf ging sie hinaus und verkleidete sich so, daß niemand sie für eine Prinzessin gehalten hätte, und trat ihre Reise an.
Die Reise war aber nicht weit von Bergen nach Garz, und sie ging in der Tracht eines Reiterbuben einher. Und in der Nacht, als es vom Garzer Kirchturm zwölf geschlagen hatte, betrat sie einsam den Wall, tat ihre Kleider von sich, also daß sie da stand, wie Gott sie erschaffen hatte, und nahm eine Johannisrute in die Hand, womit sie hinter sich schlug.
Und so tappte sie stumm und rücklings fort, wie es geschehen mußte. Und nicht lange war sie geschritten, so tat sich die Erde unter ihren Füßen auf, und sie fiel sanft hinunter, und es war ihr, als würde sie in einem Traum hinab gewiegt; und sie fiel hinab in ein gar großes und schönes und von tausend Lichtern und Lampen erleuchtetes Gemach, dessen Wände von Marmor und diamantenen Spiegeln blitzten und dessen Boden ganz mit Gold und Silber und Edelsteinen beschüttet war, daß man kaum darauf gehen konnte.
Sie aber sank so weich auf einen Goldhaufen herab, daß es ihr gar nicht weh tat. Und sie besah sich alle die blitzende Herrlichkeit in dem weiten Saale, wo die Schätze und Kostbarkeiten ihrer Ahnherren von vielen Jahrhunderten gesammelt und aufgehängt waren; und da sah sie in der hintersten Ecke in einem goldenen Lehnstuhl das kleine graue Männchen sitzen, das ihr freundlich zunickte, als wolle es mit der Urenkelin sprechen.
Sie aber sprach kein Wort zu ihm, sondern winkte ihm nur leise mit der Hand. Und auf ihren Wink hob der Geist sich hinweg und verschwand, und statt seiner kam eine lange Schar prächtig gekleideter Diener und Dienerinnen, welche sich in stummer Ehrfurcht hinter sie stellten, als erwarteten sie, was die Herrin befehlen würde.
Svanvithe aber säumte nicht lange, bedenkend, wie kurz die Mittsommersnacht ist, und sie nahm die Fülle der Edelsteine und Diamanten und winkte den Dienern und Dienerinnen hinter ihr, daß sie ebenso täten; auch diese füllten Hände und Taschen und Zipfel und Geren der Kleider mit Gold und edlen Steinen und kostbaren Geschirren.
Und noch ein Wink, und die lange Reihe wandelte, und die Prinzessin schritt voran der Treppe zu, als wenn sie herausgehen wollte; jene aber folgten ihr. Und schon hatte sie viele Stufen vollendet und sah schon das dämmernde Morgenlicht und hörte schon den Lerchengesang und den Hahnenschrei, die den Tag verkündeten - da ward es ihr bange, ob die Diener und Dienerinnen ihr auch nach träten mit den Schätzen.
Und sie sah sich um, und was erblickte sie? Sie sah den kleinen grauen Mann sich plötzlich in einen großen schwarzen Hund verwandeln, der mit, feurigem Rachen und funkelnden Augen gegen sie hinauf sprang. Und sie entsetzte sich sehr und rief: »Oh Herr je!« Und als sie das Wort ausgeschrien hatte, da schlug die Tür über ihr mit lautem Knalle zu, und die Treppe versank, und die Diener und Dienerinnen verschwanden, und alle Lichter des Saales erloschen, und sie war wieder unten am Boden und konnte nicht heraus.
Der alte König aber, da sie nicht wiederkam, grämte sich sehr; denn er dachte, sie sei entweder umgekommen bei dem Hinabsteigen zu dem Schatze durch die Tücke der bösen Geister, die unter der Erde ihre Gewalt haben, oder sie habe sich der Sache überhaupt nicht unterstanden und laufe nun wie eine arme, verlassene Streunerin durch die Welt. Und er lebte nur noch wenige Wochen nach ihrem Verschwinden; dann starb er und ward begraben.
Der Prinzessin Svanvithe war dieses Unglück aber geschehen, weil sie sich umgesehen hatte, als sie weg gehen wollte, und weil sie gesprochen hatte. Denn über die Unterirdischen hat man keine Gewalt, wenn man sich umsieht oder spricht, sondern es gerät dann fast immer unglücklich, wovon man viele Beispiele und Geschichten weiß.
Und es waren viele Jahre vergangen, vielleicht hundert Jahre und mehr, und alle die Menschen waren gestorben und begraben, welche zu der Zeit des alten Königs und der schönen Svanvithe gelebt hatten, und schon ward hie und da von ihnen erzählt wie von einem alten, alten, längst verschollenen Märchen; da hörte man hin und wieder, die Prinzessin lebe noch und sitze unter dem Garzer Wall in der Schatzkammer und müsse nun mit dem alten, grauen Urgroßvater die Schätze hüten helfen.
Und kein Mensch weiß zu sagen, wie dies hier oben bekannt geworden ist. Vielleicht hat der kleine graue Mann, der zur Zeiten rundgeht, es einem verraten, oder es hat es auch einer der hellsichtigen Menschen gesehen, die an hohen Festtagen in besonderen Stunden geboren sind und die das Gras und das Gold in der Erde wachsen sehen und mit ihren Augen durch die dicksten Berge und Mauern dringen können.
Und es war viel erschollen von der Geschichte und von dem wundersamen Versinken der Prinzessin unter die Erde, und daß sie in der dunkeln Kammer sitze und noch lebe und einmal erlöst werden solle. Sie kann aber, sagen sie, erlöst werden, wenn einer es wagt, auf die selbe Weise, wie sie einst in der Johannisnacht getan hat, in die verbotene Schatzkammer hinabzufallen.
Dieser muß sich dann dreimal vor ihr verneigen, ihr einen Kuß geben, sie an die Hand fassen und sie still heraus führen; denn kein Wort darf er beileibe nicht sprechen. Wer sie herausbringt, der wird mit ihr in Herrlichkeit und in Freuden leben und so viele Schätze haben, daß er sich ein Königreich kaufen kann. Darin wird er dann fünfzig Jahre als König auf dem Throne sitzen und sie als seine Königin neben ihm, und werden gar liebliche Kinder zeugen; der kleine graue Spuk wird dann aber auf immer verschwinden, wann sie ihm die Schätze weg gehoben haben.
Nun hat es wohl so kühne und verwegene Prinzen und schöne Knaben gegeben, die mit der Johannisrute in der Hand zu ihr hinab gekommen sind; aber sie haben es immer in etwas versehen, und die Prinzessin ist noch nicht erlöst. Ja, wenn das ein so leichtes Ding wäre, wie viele würden Lust haben, eine so schöne Prinzessin zu freien und Könige zu werden!
Die Leute erzählen aber, der greuliche schwarze Hund ist an allem schuld; keiner hat es mit ihm aushalten können, sondern wenn sie ihn sehen, so müssen sie aufschreien, und dann schlägt die Türe zu, und die Treppe versinkt, und alles ist wieder vorbei.
So sitzt denn die arme Svanvithe da in aller ihrer Unschuld und muß da unten frieren und das kalte Gold hüten, und Gott weiß, wann sie erlöst werden wird. Sie sitzt da über Goldhaufen gebeugt; ihr langes Haar hängt ihr über die Schultern herab, und sie weint unaufhörlich. Schon sitzen sechs junge Gesellen um sie herum, die auch mithüten müssen. Das sind die, denen die Erlösung nicht gelungen ist. Wem es aber gelingt, der heiratet die Prinzessin und bekommt den ganzen Schatz und befreit zugleich die anderen armen Gefangenen.
Sie sagen, der letzte ist vor zwanzig Jahren darin versunken, ein Schuhmachergesell, der Jochim Fritz hieß. Das war ein junges, schönes Blut und ging immer viel auf dem Wall spazieren. Der ist mit einem Male verschwunden, und keiner hat gewußt, wo er gestoben und geflogen war, und seine Eltern und Freunde haben ihn in der ganzen Welt suchen lassen, aber nicht gefunden! Er mag nun auch wohl da sitzen bei den anderen.
Sage von Ernst Moritz Arndt
KATER MARTINCHEN ...
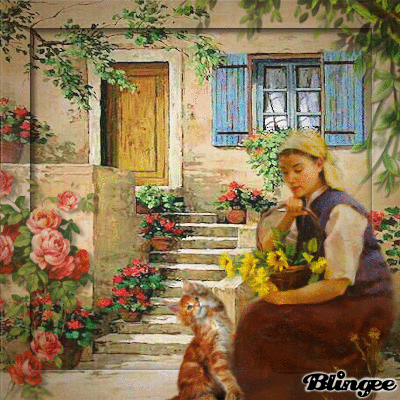
Auf der Halbinsel Wittow auf Rügen ist ein Dorf, das heißt Putgarten, nicht weit von dem berühmten Vorgebirge Arkona, wo der alte heidnische Götze Swantewit weiland seinen Tempel gehabt und sein wüstes Wesen getrieben hat.
In diesem Dorfe Putgarten lebte eine reiche Bäuerin, die hieß Trine Pipers. Sie war jung Witwe geworden und hatte keine Kinder, wollte auch nicht wieder freien, obgleich viele Freier um sie warben, denn sie war ein sehr schönes und frisches Weib. Das konnten die Leute nicht recht begreifen, zumal da sie sonst immer lustig und munter war und bei keinem Tanze und Gelage fehlte.
Denn das mußte man sagen, einen aufgeräumteren Menschen gab es nicht als diese Bäuerin, und kein Haus hatte so viel Lustigkeit als das ihrige. Alle hohen Feste hatte es Tanz und Spiel bei ihr; die Fasten wurden von Anfang bis zu Ende durchgehalten und mit Schmäusen, Spielen und Tänzen gefeiert, Pfingsten und am Johannistage ward unter grünen Lauben getanzt, und am Martinstage setzte keine Bäuerin so viele gebratene Gänse auf, und wenn sie ihr Korn eingebracht, wenn sie Ochsen oder Schweine geschlachtet oder Wurst gemacht hatte, mußte die ganze Nachbarschaft sich mit freuen und mit ihr schmausen.
Kurz, diese Bäuerin lebte so prächtig, daß kaum eine Edelmannsfrau besser leben konnte. In ihrem Hause war alles nett und tüchtig und fast über das Vermögen einer Bäuerin zierlich. Ebenso lustig und tüchtig sah es auf ihrem Hofe und in ihren Ställen aus. Ihre Pferde glänzten immer wie die Aale, und man hätte sie Sommer und Winter als Spiegel gebrauchen können; ihre Kühe waren die schönsten und gedeihlichsten im ganzen Dorfe und hatten immer volle Euter; ihre Hühner legten zweimal des Tages, und von ihren Gänseeiern war nie eines schier, sondern jedes gab ein Junges. Weil ihr Haus lustig und sie freigebig war, so hatte sie auch immer die schönsten und flinksten Knechte und Dirnen auf ganz Wittow.
So lebte Trine manches Jahr, und kein Mensch konnte begreifen, wie sie als Bäuerin das Leben so halten und durchsetzen konnte, und viele hatten schon gesagt: »Nun, die wird auch bald vor den Türen herumschleichen und schnurren gehen.« Aber sie focht und schnurrte nicht herum, sondern blieb die reiche und lustige Trine Pipers nach wie vor.
Andere, die dies lustige Leben so mit ansahen, meinten, es gehe nicht mit natürlichen Dingen zu; sie habe Umgang und Gemeinschaft mit bösen Geistern, und die bringen es ihr alles ins Haus und geben ihrem Vieh und ihren Früchten so wunderbaren Segen und Gedeihen - als wenn Gott nicht der beste und einzige Segenbringer und Segensprecher wäre.
Viele wollten bei nächtlicher Weile einen Drachen gesehen haben, der wie ein langer feuriger Schwanz auf ihr Haus herab geschossen sei; das sei ihr heimlicher Buhler, der hänge ihr den Wiem voll Schinken und Mettwürste, fülle ihr die Kisten und Kasten mit Silber und Gold und stehe mit am Butterfasse und helfe buttern und gehe mit in den Stall und helfe melken.
Andere, noch boshafter, sagten, sie selbst sei eine Hexe und könne sich unsichtbar machen: so schleiche sie den Nachbarn in die Häuser, stehle aus Keller und Speisekammer, nehme den Hühnern die Eier aus den Nestern, melke die Kühe und rupfe den Schafen die Wolle und den Gänsen die Dunen aus. Darum sei sie so glatt und glau und könne so viele Wohlleben ausrichten und ein Leben führen, als wenn es alle Tage Sonntag wäre.
Das bemerkten einige Nachbarsleute noch und schüttelten die Köpfe dabei, daß Trine eine leidige Freundlichkeit habe, womit sie wohl hexen könne, und daß sie Kindern nie in die Augen sehe, wie viel sie auch sonst mit ihnen schmeichle und kose; denn sie habe als Hexe kein Kind in ihren Augen, und es tue ihr sehr wehe, wenn sie den unschuldigen Kindern, die noch nichts verbrochen haben, in ihre reinen Augen schauen müsse.
So lief allerlei Geschwätz unter den Leuten rund, und sie flüsterten und munkelten viel über Trine Pipers; aber sie konnten ihr doch nichts anhaben und beweisen. Sie tat all ihr Werk tüchtig vor den Leuten, war redlich in Handel und Wandel, ging fleißig zur Kirche und gab Priester und Küster willig und freundlich das Ihrige und hatte immer eine offene Tasche und einen offenen Brotkorb für die Armen, wenn sie an ihre Türe kamen. Auch gingen die, welche ihr die Ehre so hinter ihrem Rücken zerwuschen, recht gern zu ihren Festen und Tänzen und schmeichelten und heuchelten ihr.
Trine Pipers hatte auf diese Weise wohl zwanzig Jahre ihre Wirtschaft geführt, und alles war ihr immer nach Wunsch geraten. Da bekam sie einen bunten Kater ins Haus, und bald ging im Dorfe und in der Nachbarschaft das Gerede: der sei es, das sei der Gewaltige, nun sei es endlich zum Vorschein gekommen, und auch ein Kind könne es sehen, der trage ihr all das Glück zu. Denn leider sind die meisten Menschen so, daß sie meinen, es müsse mit einem Menschen was Heimliches oder Ungeheures sein, wenn er die Narrenkappe des Lebens nicht gerade so trägt wie sie, und wenn er die Schellen daran nicht ebenso klingen läßt.
Ein bunter Kater ward in Trines Hause gesehen, und kein Mensch wußte, wo der Kater hergekommen war. Trine lächelte und machte einen Scherz, wenn man sie fragte, und sagte es nicht. Einigen hatte sie wohl gesagt, sie habe einen Bruder, der sei Schiffer in Stockholm, der habe ihr den schönen Kater einmal aus Lissabon mitgebracht; aber das glaubten sie nicht. Der Kater war groß, bunt und schön, grau mit gelben Streifen über dem Rücken und hatte einen weißen Fleck am linken Vorderfuß.
Da schrien die alten Weiber: »Da sehen wir's ja, da haben wir's! Einen dreifarbigen Kater? Wer hat in seinem Leben gesehen oder gehört, daß es Kater mit drei Farben gibt?« Trine liebte den Kater sehr und saß manche Stunde mit ihm allein und spielte mit ihm, der mit wohlgefälligem Brummen seinen Kopf an ihr streichelte und gegen alles, war ihr zu nah kam, ausprustete und aufpfuchsete: die arme Trine ward älter, die arme Trine hatte keine Kinder, sie mußte was zu spielen haben.
So saß sie nun manche Stunde, wo sie sich sonst draußen in ihrer Wirtschaft tummelte, still in der Stube und spielte mit ihrem Martinchen; denn so rief sie den Kater. Martinchen und Mieskater Martinchen klang es in der Stube, Martinchen klang es auf der Flur, Martinchen auf der Treppe und auf dem Boden. Keinen Tritt und Schritt tat sie, Martinchen war immer dabei, und von dem Vorratsboden und aus der Speisekammer brachte er immer seine Bescherung mit im Munde.
Kurz, der bunte Kater Martinchen aus Lissabon war ihre Puppe und ihr Spielzeug; er stand mit ihr auf und ging mit ihr zu Bette, ja sie ging nicht in die Nachbarschaft, daß sie ihr Martinchen nicht unterm Arm trug; Martinchen leckte von ihrem Teller und lappte aus ihrem Napf, er war der Liebling, er durfte alles, keiner durfte ihm was tun: Hunde wurden herausgejagt, die ihn beißen wollten, ein Knecht ward verabschiedet, weil er ihn Murrkater und Brummkater, Speckfresser und Mausedieb genannt hatte.
Dies gab Geschichten und Lügen und Märchen im ganzen Dorfe, bald im ganzen Kirchspiele, dann im ganzen Ländchen: Trine hieß eine Hexe, die einen wundersamen Kater habe, mit dem es nicht richtig sei, und vor dem man sich hüten müsse.
Das sei ein Kater, einen solchen zweiten werde man in der ganzen Welt umsonst suchen; den ganzen Tag tue er nichts als fressen und sich hinstrecken und sonnen oder auf Trines Knien herumwälzen, des Nachts liege er auf ihrem Bette bis an den lichten Morgen, und doch finde der Knecht, wenn er morgens frühe zur ersten Fütterung in den Pferdestall gehe, immer zwei große Haufen toter Ratten und Mäuse vor der Haustüre aufgetürmt. Was möge das wohl für ein Kater sein, der für diesen feisten und glatten Faulenzer die Arbeit tue?
Dies Gerede und Gemunkel hatte sich freilich erst draußen herumgetrieben; dann kam es auch in Trinens Haus und zu Trinens Leuten, und ihnen fing an, bei ihr ungeheuer zu werden. Wenn sie mit schmeichelnder Stimme Mieskaterchen! Mies - Mieskaterchen! Martinchen! Misichen - Martinchen! rief und den knurrenden und spinnenden Kater auf den Schoß nahm und ihm den Rücken streichelte, und er sich dann vor Vergnügen krümmte und an ihr strich und brummte, und ihm die grünen, umnebelten Augen im Kopfe funkelten, dann guckten die Leute die beiden Spieler mit großen Augen an und wären um alles in der Welt mit ihnen nicht lange in der Stube geblieben.
Trine hatte sonst immer die tüchtigsten und schönsten Leute gehabt, aber die konnten es jetzt in ihrem Hause nicht aushalten; sie zogen weg, und sie konnte zuletzt nichts als Hack und Mack in ihren Dienst bekommen, und auch die blieben nicht lange, und fast jeden Monat hatte sie frische Leute.
Alle Welt glaubte nun einmal, Trine sei eine Hexe, und keiner wollte mit ihr zu tun haben. Auch war es mit der alten Gastlichkeit und Fröhlichkeit des Hauses vorbei und mit den Schmäusen und Tänzen, denn keiner wollte kommen; und Trine mußte mit ihrem Mieskater Martinchen einsam sitzen und ihre Bratgänse und Würste allein verzehren.
Aber ach, du arme Trine Pipers, die du sonst so froh und fröhlich gewesen warst und alle gern erfreut hattest, wie ging es dir auf deinen alten Tagen? Nicht allein keine Gesellen und Gesellinnen und Nachbarn und Nachbarinnen kamen mehr, sich des Segens zu freuen, den Gott dir gegeben hatte, und sich mit dir zu erlustigen, sondern in wenigen Jahren verging auch das, wovon du dich hättest erlustigen können.
Die Leute kopfschüttelten und flüsterten zwar, der Kater sei es, der sei bisher der unsichtbare Bringer und Zuträger gewesen und habe Scheunen, Kornböden, Keller, Speisekammern, Milcheimer und Butterfässer und Geldkatzen und Sparbüchsen gefüllt; aber nun war ja dieser Wundertäter und Hexenmeister da, warum ging es denn nicht noch gedeihlicher als vorher? Warum ging vielmehr Trinens Wirtschaft von Tage zu Tage mehr zurück?
Die arme Trine hatte Knechte und Mägde, wie sie kaum ein Bettlerkrug willig beherbergt hätte, recht was man Krücken und Ofenstecken nennt; ihre sonst so glatten Pferde magerten ab und verreckten an Rotz und Wurm; ihre Schweine und Kühe hatten Läuse und gaben keine Milch mehr; ihre Schafe und Gänse wurden Drehköpfe, als hätten sie geheime Wissenschaft studiert; ihre Hühner und Enten legten keine Eier und brüteten nicht mehr; ihr Feld trug Disteln und Dornen für Korn und Weizen.
Kurz, Trine geriet in zwei Jahren in die bitterste Armut: Pferde waren weg, Kühe waren weg, Schweine ausgestorben, Schafe geschlachtet, Tauben und Hühner vom Marder aufgefressen, der Hund an der Kette verhungert - kein Hahn krähte mehr auf ihrer Haustüre, kein Bettler seufzte mehr sein Gebet davor.
Und Trine saß allein und verlassen mit gelben, gefurchten und gerunzelten Wangen und von Tränen und Jammer triefenden Augen und schneeweißen Haaren in der frierenden Ecke ihres leeren Zimmers und hielt ihren mageren und in der Asche verbrannten Kater auf dem Schoße und weinte jämmerlich über den kargen Brocken, die man ihr von fern zuwarf; denn keiner mochte ihr gern nah kommen.
So hat man sie eines Morgens gefunden tot auf dem Boden ihres Stübchens hingestreckt und ihren treuen Mieskater Martinchen tot auf ihr liegend. Die Leute haben mit Grauen davon erzählt. Und die sonst so reiche Trine, die der Kirche und Geistlichkeit immer so gern gab, als sie noch was zu geben hatte, ist begraben, wie man Bettler begräbt, ohne Sang und Klang, ohne Glocken und Gefolge; kein Nachbar hat sie zum Kirchhof begleiten wollen, kein Verwandter ist ihrer Leiche gefolgt, sie hatte ihnen ja nichts nachgelassen.
O kalte Welt, wie kalt wirst du denen im Alter, die dann nichts haben, womit sie sich die Füße zudecken können, und ach, auch die irdischen Mängel, die man mit schärferen Augen an den Alten betrachtet!
Als Trine nun tot war, erzählen die Leute, ist sie immer als Hexe umgegangen und geht bis diesen Tag als Hexe um in der Gestalt einer alten, grauen Katze, die man daran kennt, daß sie Augen hat, die wie brennende Kohlen leuchten, und daß sie ganz entsetzlich laut sprühet und prustet, wenn man sie jagt.
Sie wird noch alle Mitternächte auf der Stelle gesehen, wo ehedem Trinens Haus war, und heult dort erbärmlich; im Winter aber, wann in den Scheunen und auf den Dächern die wütigen Katzenhochzeiten sind, ist sie immer voran auf der höllischen Jagd und führt das ganze Getümmel und miaulet und winselt auf das allerscheußlichste. Diese Stimme verstehen die Leute in Putgarten so wohl, daß alt und jung gleich rufet: »Hört! Da ist wieder die alte Trine!«
So ist es Trine Pipers gegangen, und so geht es vielen Menschen bis diesen Tag. Sie ist eine arme, elendige Bettlerfrau geworden und hat ihren christlichen, guten Namen verloren, weil sie den bunten Kater Martinchen lieber gehabt hat als Menschen. Denn wenn sie auch keine Hexe gewesen ist, so haben die Nachbarn und Nachbarinnen es doch geglaubt, weil sie sich in ihrer unnatürlichen und häßlichen Liebe zu der unverständigen Kreatur so in des Katers Gemüt und Gebärden hineingestohlen und hineinvertieft hatte, daß sie Menschen nicht mehr so suchte und liebte wie sonst.
Sie mag zuletzt auch mit Katzenfreundlichkeit geblinzelt und mit Katzenaugen geschielt und mit allerlei Katzenmännchen sich gekrümmt und gewunden haben, so daß kein Mensch und kein Vieh und also auch kein Glück es länger bei ihr hat aushalten können und sie zuletzt mit ihrem Mieskater Martinchen ganz allein geblieben und so im größten Elende umgekommen ist.
Sage von Ernst Moritz Arndt
DER GIFTPILZ ...
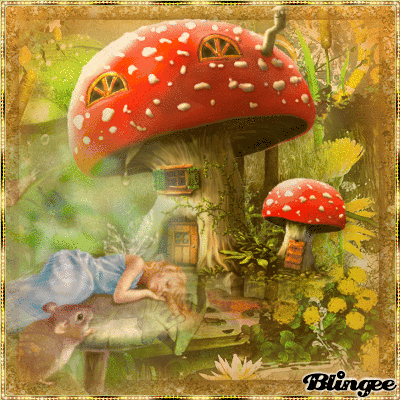
Es hatte mal geregnet und dann hatte es aufgehört; und als es aufgehört hatte, da saß was auf dem grünen Moosboden im Walde - klein und dick und unangenehm - und das war ein Giftpilz. Giftpilze kommen immer so etwas unvermittelt ans Tageslicht; sie sind eben da, und wenn sie da sind, gehen sie nicht mehr weg, ganz gewiss nicht. Sie sitzen im Moos und sehen furchtbar geärgert und giftig aus. Es sind eben Giftpilze!
Der Giftpilz saß auch so da und ärgerte sich und hatte einen roten Hut mit weißen Tupfen und mit einem ganz schrecklich breiten Rande. Was unter dem Rand war, war eigentlich nichts - und das war zu vermieten.
Zuerst zog eine Mausefamilie darunter ein: eine graue Mama und sehr viele kleine schlüpfrige Mausekinder. Wie viele es waren, wusste der Giftpilz nicht. Sie waren stets so lebendig und beweglich, dass er immer eins statt zweien zählte oder zwei statt einem. Aber es waren sehr viele. Und wenn die Mausemutter, wie meistens, nicht zu Hause war und Futter suchte, dann spielten die Kleinen Fangen und sausten auf ihren weichen Pfötchen wie toll um den Giftpilz herum, und das sah eisig niedlich aus.
Aber der Giftpilz ärgerte sich furchtbar darüber, er stand da und ärgerte sich den ganzen Tag und sogar Nachts, wenn die Mausefamilie schlafen ging. Er wurde immer giftiger und schließlich, als er mal ganz giftig wurde und es vor lauter Gift nicht mehr aushalten konnte, da sagte er zur Mausemama: "Ich kündige Ihnen! Sie haben Kinder! Das ist ekelhaft! Sie müssen ausziehen!"
Die Mausemama weinte und barmte und die Kleinen fiepten und rangen die Pfoten, aber der Giftpilz war unerbittlich. Und so zog die arme Mausegesellschaft traurig von dannen, sich eine neue Wohnung zu suchen, der Giftpilz aber nahm sich's ganz giftig vor, nie und nie wieder an eine Familie zu vermieten, höchstens an einen einzelnen Herrn.
Es dauerte auch gar nicht lange, da kam ein junger, alleinstehender Frosch und zog beim Giftpilz ein. Zuerst war er sehr angenehm und still, er schlief nämlich bis zum Abend. Als aber der Mond schien, wachte er auf und ging zum nahen Teich in den Gesangsverein. Das war ja soweit alles ganz gut, aber es wurde spät und später und der Frosch kam nicht wieder. Endlich, gegen Morgen, erschien er, mit grässlich großen Augen und sang sehr laut und tat dabei den Mund so weit auf, dass man bequem einen Tannenzapfen hineinwerfen konnte. Er sang das Leiblied des Gesangvereins:
Immer feucht und immer grün, vom Geschlecht der Quappen,
hupfen wir durchs Leben hin - Füße wie die Lappen!
"Brüllen Sie nicht so!" ,keifte der Giftpilz. "Das ist Ruhestörung ,und zwar nächtliche. Haben Sie gar keine Moral?" - "Füße wie die Lappen!", sang der Frosch noch einmal und dann legte er sich höchst fidel und ungeniert unter den giftigen Giftpilz, schlug die feuchten Beine übereinander dass es klatschte und schlief ein.
Der Giftpilz ärgerte sich furchtbar, er ärgerte sich die ganze Nacht und den ganzen Tag, und als es Abend wurde und der Frosch aufstand, um in den Gesangsverein zu gehen, da wurde ihm gekündigt. "Ich kündige Ihnen! ,sagte der Giftpilz. "Sie gehen in den Gesangsverein! Das ist ekelhaft. Sie müssen ziehen!"
Der Frosch machte Vorstellungen, der Gesangsverein sei durchaus einwandfrei - lauter feine, feuchte Leute - aber es half nichts, der Giftpilz blieb dabei. Da wurde der Frosch böse: "Sie sind ein ekelhafter Kerl!" ,sagte er. "Glauben Sie vielleicht, dass Ihr lächerlicher Hut mit seinen weißen Tupfen die einzige Wohnung ist? Ich miete mir ein Klettenblatt, das ich persönlich kenne, Sie albernes Geschöpf!"
Damit drehte er sich um und ging, die Hände auf dem Rücken, in den Gesangverein. Und nachts schlief er schon unterm Klettenblatt, das er persönlich kannte. Der Giftpilz aber nahm sich vor, von nun ab an niemand mehr zu vermieten.
Eine Weile blieb's auch still, auf einmal aber saß was unter ihm und das war ein Sonnenscheinchen. Ein Sonnenscheinchen ist ein verirrter Sonnenstrahl, der eigentlich in den Himmel gehört, aber auf der Erde geblieben ist - und da ist ein süßes kleines Mädel draus geworden mit goldnen Haaren und Augen, wie lauter Sonnenschein.
Als nun der Giftpilz das Sonnenscheinchen sah, war er sehr unangenehm berührt und sagte giftig: "Ich vermiete nicht mehr!" Das Sonnenscheinchen lachte. "Ich vermiete nicht!" ,schrie der Giftpilz noch einmal. "Machen Sie, dass Sie hinauskommen!"
Das Sonnenscheinchen lachte wieder und streckte sich ganz behaglich unterm Giftpilz aus, so dass ihr Haar in tausend goldnen Fäden übers dunkle Moos husche. Der Giftpilz war eine Zeitlang sprachlos, dann aber raffte er sich auf, nahm all sein Gift zusammen und sagte: "Ich kündige Ihnen! Das ist ekelhaft. Sie müssen ziehen!"
Das Sonnenscheinchen blieb aber sitzen und lachte so sonnenhell und vergnügt, dass der Giftpilz ordentlich zitterte vor Wut. Aber es war nichts zu machen und es ging auch so weiter: der Giftpilz kündigte und schimpfte und das Sonnenscheinchen lachte und blieb.
Endlich, eines Nachts, war der Giftpilz so giftig geworden, dass ihm's selbst unheimlich wurde vor lauter Gift. Und da hat er sich mit einem Ruck auf seine kleinen Füße gestellt und ist vorsichtig und ängstlich weg gewackelt. Das Sonnenscheinchen aber lachte hinter ihm her und streckte behaglich seine feinen Gliederchen, dass ihr Haar in tausend goldnen Fäden übers dunkle Moos huschte.
Der Giftpilz wackelte weiter, halbtot vor Wut - und als er um die Ecke bog, sah er die Mausefamilie in ihrem neuen Heim und es waren schon wieder Junge angekommen! Und die ganze Gesellschaft piepste ihm schadenfroh nach.
Und als er um die nächste Ecke bog, da wanderte der alleinstehende Frosch übern Wiesenhang; er kam vom Gesangverein und ging zum Klettenblatt, das er persönlich kannte. Dazu sang er ganz laut und voller Heiterkeit:
Immer feucht und immer grün, vom Geschlecht der Quappen,
hupfen wir durchs Leben hin - Füße, wie die Lappen!
Da ist der giftige Giftpilz ganz weit fort gegangen und ist niemals wiedergekommen. Und wenn heute noch so viele davon im Walde stehen, so kommt das daher, dass es so sehr viele Giftpilze in der Welt gibt und sehr, sehr wenig Sonnenscheinchen.
Manfred Kyber
MAIMÄRCHEN ...
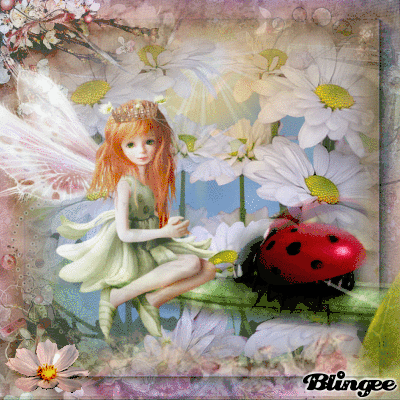
Es war einmal ein Maikäfer, der war wie alle Maikäfer im Mai auf die Welt gekommen - und die Sonne hatte dazu geschienen, so hell und so goldlicht, wie sie nur einmal im Jahre scheint, wenn die Maikäfer auf die Welt kommen. Dem Maikäfer aber war's einerlei. "Das Sonnengold kann man nicht fressen" ,sagte er sich, "also was geht's mich an." Dann zählte er seine Beine, erst links und dann rechts und addierte sie zusammen.
Das schien ihn befriedigt zu haben, und nun überlegte er, ob er einen Versuch machen solle, sich fortzubewegen, oder ob das zu anstrengend wäre. Er dachte drei Stunden darüber nach, dann zählte er noch einmal seine Beine und fing an, sich langsam vorwärts zu schieben, möglichst langsam natürlich, um sich nicht zu überanstrengen. Bequemlichkeit war ihm die Hauptsache!
Da stieß er plötzlich an was Weiches, an etwas, was so weich war, dass er sich's unbedingt ansehen musste. Es lag im Grase und sah aus wie eine schwarze Samtweste, hatte vier kleine Schaufeln und keine Augen. Den Maikäfer, der noch keinen Maulwurf gesehen hatte, interessierte das fabelhaft, er überzählte noch schnell einmal seine Beine und dann ging es mit wütendem Eifer mitten in die schwarze Samtweste hinein.
Der Maulwurf fuhr empört auf. "Sind Sie verrückt?" ,schrie er den Maikäfer an. "So eine Rücksichtslosigkeit!" Der Maikäfer lachte. Es war zu komisch, wie sich die Samtweste aufregte.
"Wissen Sie" ,sagte er vorlaut, "wenn man aus nichts weiter besteht, als aus einer Samtweste und vier kleinen Schaufeln und auch keine Augen hat, soll man lieber ruhig sein." -
"Reden Sie nicht so blödes Zeug" ,kreischte der Maulwurf, atemlos vor Wut. "Sie sind ein ganz verrohtes Subjekt!" Und damit kroch er in die Erde, der Maikäfer aber setzte angenehm angeregt und erheitert seinen Weg fort. Schließlich, als es Abend wurde, kam er an einen Teich, da saß ein großer alter Frosch auf einem Stein, ganz grün und ganz feucht, der las beim Mondlicht die Zeitung, das "Allgemeine Sumpfblatt".
Den frechen Maikäfer reizte der breite Rücken des vertieften Lesers und er kitzelte ihn ganz leise und boshaft mit den Fühlhörnern. Der Frosch fuhr mit seinen langen Fingern herum und kratzte sich, ohne von der Zeitung aufzusehen, denn das "Allgemeine Sumpfblatt" ist sehr lehrreich und sehr schön geschrieben - und dabei lässt man sich nicht gerne stören.
Aber der Maikäfer kitzelte beharrlich weiter, bis der Frosch sich schließlich geärgert umdrehte und den Störenfried vorwurfsvoll betrachtete. Da er aber alle Tage das "Allgemeine Sumpfblatt" las
und also sehr gebildet war, so erkannte er in dem respektlosen Wesen sofort einen Maikäfer.
"Heut ist der erste Mai" ,sagte er ruhig, "es steht in der Zeitung, da kommen diese merkwürdigen Geschöpfe. Dagegen lässt sich nichts machen."
Und dann las er weiter und kratzte sich geduldig, wenn ihn der Käfer kitzelte. Der arme Frosch hätte sich noch lange kratzen müssen, wenn der Maikäfer nicht plötzlich was gehört hätte, was ihm noch übers Kitzeln ging; es klang, als ob es mit vielen feinen Stimmchen singt, und das war ein Elfenreigen: viele kleine Elfchen in weißen Hemdchen und mit goldnen Krönlein im goldnen Haar hatten sich bei den Händen gefasst und schlangen den Ringelreihen und sangen dazu.
Der Frosch sah gar nicht hin, das stand ja alles im "Allgemeinen Sumpfblatt" unter "Lokales", aber der Maikäfer kannte so was nicht und kroch, so schnell er konnte, um sich das Seltsame zu betrachten, was so seltsam mit vielen feinen Stimmchen sang. Die Elfen flohen entsetzt auseinander, nur eine blieb stehen und sah sich den komischen Gesellen an.
"Du hast ja sechs Beine!" ,rief sie, "Du bist gewiss ein verwunschener Prinz - und ich warte schon so lange auf einen, um ihm mein Krönlein zu schenken." Der Maikäfer sah auf seine sechs Beine, bewegte verlegen die Fühlhörner und sagte nichts. "Es ist ganz gewiss ein verwunschener Prinz" ,dachte das Elfchen, "er hat doch sechs Beine und sagt nichts!"
Und dann fragte es ihn: "Willst du mich heiraten?" Der Maikäfer verstand nur, dass er gefragt wurde, ob er was wolle, und da sagte er: "Fressen will ich" ,und legte sich auf den Rücken. "Er muss sehr stark verwunschen sein!" ,dachte das Elfchen und gab ihm zu essen, lauter schöne Sachen, wie man sie nur im Elfenreich hat.
Als er satt war, setzte sich das Elfchen neben ihn und beschloss, geduldig zu warten, bis sich der verwunschene Prinz entpuppt. Und als die Glockenblumen Mitternacht läuteten, da dachte das Elfchen, jetzt müsste es sein, und wollte ihm sein Krönlein schenken. Aber der Maikäfer hörte weder die blauen Glockenblumen noch sah er das goldene Krönlein, er lag auf dem Rücken und schlief.
Das war so schrecklich langweilig - und so ging es alle Tage und Nächte weiter, er fraß grässlich viel; und wenn die Glockenblumen läuteten, schlief er ein. Und das arme Elfchen wartete und wartete.
Da, eines Nachts, geschah etwas Wunderbares: Der Maikäfer rührte sich, streckte seine sechs Beine, bewegte die Fühlhörner und bekam plötzlich Flügel. "Jetzt entpuppt sich der verwunschene Prinz", dachte das Elfchen und freute sich furchtbar. Und grad wie es sich so furchtbar freute - flog der Maikäfer davon und zerbrach noch dabei mit seinen plumpen Beinen das goldene Krönlein, dass es in tausend Scherben ging. Die Elfenkrönlein sind ja so zerbrechlich!
Da saß nun das arme Elfchen und hatte keinen verwunschenen Prinzen bekommen und hatte auch kein Krönlein mehr, es ihm zu schenken. Und so stützte es das Gesichtchen in die Hände und weinte bitterlich. Das klang so traurig, dass der Frosch vom "Allgemeinen Sumpfblatt" aufsah und sich das Elfchen mitleidig betrachtete.
"Ja, ja" ,sagte er seufzend, "heute ist der letzte Mai, es steht in der Zeitung, da gehen diese merkwürdigen Geschöpfe wieder. Dagegen lässt sich nichts machen." Und dann schlug er nachdenklich eine Seite um - das Umblättern ist für einen Frosch sehr leicht, weil er so feuchte Finger hat - und las weiter.
Auch der Maulwurf kam aus der Erde heraus und sagte: "Es war ein ganz verrohtes Subjekt!" In Wirklichkeit aber war der Maikäfer weder ein verrohtes Subjekt, noch ein verwunschener Prinz, sondern eben nur ein ganz gewöhnlicher Maikäfer. Und von dem soll ein Elfenkind keine Märchen erwarten und soll ihm sein Krönlein nicht schenken.
Und was aus dem Elfchen wurde? Das hat der liebe Gott in den Himmel geholt und hat ein Englein draus gemacht mit zwei kleinen Flügeln und hat ihm einen Heiligenschein für das zerbrochene Krönlein gegeben.
Manfed Kyber
RATZEPETZ ...
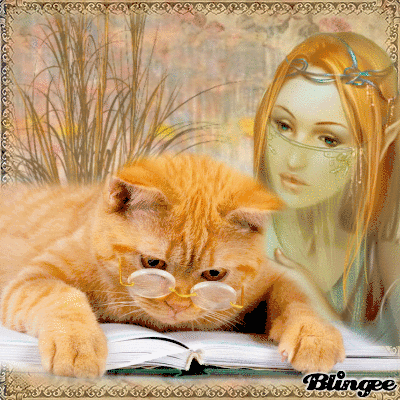
Es war einmal eine kleine Elfe, die tanzte mit ihren Elfenschwestern am Wiesenrain, wo der Holderbaum (Holunderbeerenstrauch) steht, in den die Liebenden ihre Herzen und die Zweige ihre Runenzeichen schneiden. Die Elfen tanzen gerne am Holderbaum, aber es ist bar nicht so ungefährlich da zu tanzen, denn schon manche Elfe hat dabei ihren Schleier verloren.
Der Mond schien dazu und auch die Irrlichter leuchteten, obwohl das gar nicht nötig war, denn wenn der Mond scheint, ist es für einen Elfentanz gerade hell genug. Aber die Irrlichter leuchteten trotzdem mit, sie taten das teils aus Höflichkeit, teils aus Neugier - und dann leuchten sie überhaupt gerne, wenn die Elfen tanzen, obwohl das gar nicht ungefährlich ist. Denn dabei hat schon manche Elfe ihren Schleier verloren.
Als nun der Elfenreigen zu Ende war und die Elfenschwestern ihre Schleier aufnahmen, um nach Hause zu gehen, da sah die kleine Elfe, dass sie ihren Schleier verloren hatte und nun nicht mehr mit den Schwestern gehen konnte. Sie suchte und suchte, aber sie fand ihn nicht mehr. Es war auch dunkel geworden, denn der Mond, der offenbar erkältet war, hielt sich eine Wolke vors Gesicht und nieste und die Irrlichter hatten sich in den Sumpf empfohlen, wo sie eigentlich ja auch zu Hause sind.
Die Schwestern der kleinen Elfe hatten alle noch ihren Schleier. Die brauchten bloß einmal mit den feinen Füßen aufs Gras zu stampfen und die Schleierformel zu sprechen - dann tat der Hügel sich auf und nahm sie in seinen Schoß, als wären sie niemals da gewesen. Nun waren die Elfenschwestern verschwunden und die kleine Elfe war ganz allein im Dunkeln und sie weinte und fürchtete sich. Es ist auch sehr, sehr traurig für eine Elfe, ihren Schleier zu verlieren. Es gilt als eine Schande, sie kann auch nie mehr nach dem Elfenreich zurück und das ist äußerst bedauerlich, wie ein jeder weiß, der einmal im Elfenreich war.
Wie die kleine Elfe nun so da saß und weinte, kam ein Glühwürmchen angekrochen, das von sehr mitleidigem Gemüt war. "Liebe Elfe" ,sagte er, "darf ich Ihnen behilflich sein? Der Mond scheint nicht mehr, aber ich kann ihn vielleicht ersetzen. Sie müssen mich ins Haar nehmen, dann werden Sie Ihren Weg schon finden. Ich bin zwar nicht ganz so hell wie der Mond, aber sehr ähnlich."
Die kleine Elfe dankte, setzte sich das Glühwürmchen ins Haar und ging ihren Schleier zu suchen. Aber ob sie auch rechts oder links ging und überallhin spähte, es war weit und breit nichts zu sehen und auch niemand, der ihr hätte Auskunft oder Rat geben können. Endlich traf sie eine alte dicke Kröte, die am Wegrande saß und wollene Strümpfe strickte. Die Kröte war gar nicht schön, wenigstens nicht nach den Begriffen der Elfen, aber wenn sie lächelte, hatte sie etwas ganz Angenehmes, und so beschloss die kleine Elfe, die alte Kröte um Rat zu fragen.
"Ach bitte" ,sagte die kleine Elfe" , "Sie kennen sich doch hier sicher gut aus. Haben Sie nicht vielleicht meinen Schleier gesehen? Ich habe ihn beim Tanz unter dem Holderbaum verloren."
"Beim Tanz unter dem Holderbaum haben schon viele Elfen ihre Schleier verloren" ,sagte die Kröte und lächelte - aber, wie gesagt, sie lächelte durchaus angenehm. "Leider bin ich da gar nicht
sachverständig. Ich bin eine Kröte und stricke mir wollene Strümpfe, weil ich rheumatisch bin. Wollene Strümpfe aber sind kein Elfenschleier, liebes Kind." -
"Das meinte ich auch nicht" ,sagte die kleine Elfe. "Ich wollte auch nicht um Ihre wollenen Strümpfe bitten für meinen Elfenschleier, aber ich dachte, Sie könnten mir vielleicht einen Rat geben, denn wenn man schon rheumatisch ist und sich wollene Strümpfe strickt, so muss man doch sicher viel Lebenserfahrung haben."
"Der Rheumatismus allein macht es nicht" ,sagte die Kröte und lächelte wieder - aber, wie gesagt, durchaus angenehm. Dabei kratzte sie sich mit der Stricknadel die Warzen auf dem Rücken. "Aber das ist schon wahr, das habe ich oft gesehen: Es hat schon manche Elfe ihren Schleier verloren und wenn sie ihn nicht wiederfand, so ist sie aus dem Märchenland in den Sumpf gegangen, wo immer Alltag ist, und hat Rheumatismus und wollene Strümpfe bekommen." -
"Ich will aber nicht in den Sumpf" ,sagte die kleine Elfe weinerlich, "ich bin ein Märchenkind und will im Märchenlande bleiben." Sie erhob bittend die Hände zum Strickstrumpf der rheumatischen Kröte und das Glühwürmchen in ihrem Haar leuchtete geradezu überzeugend. Man konnte gar nicht anders, als der selben Meinung zu sein, man wurde einfach sozusagen überleuchtet.
Die Kröte zählte die Maschen an ihrem Strickstrumpf und überlegte. "Ich will Ihnen was sagen, liebes Kind" ,meinte sie endlich. "Hier kann Ihnen nur einer helfen und das ist der weise Kater Ratzepetz. So weise ist keiner im ganzen Märchenland." -
"Aber wo wohnt der Kater Ratzepetz?" ,fragte die kleine Elfe.
Der Kater Ratzepetz wohnt im Häuschen an der goldenen Brücke, auf der man ins Sonnenland geht, zusammen mit einem menschenähnlichen Wesen, das ihn sozusagen bedient. Sagen Sie ihm meine schlüpfrigsten Empfehlungen und ich würde ihm zu Weihnachten wollene Strümpfe stricken."
Da bedankte sich die kleine Elfe tausendmal und die Kröte lächelte ihr angenehmstes Lächeln. Das Glühwürmchen aber empfahl sich mit vielen Segenswünschen, es war erschöpft und nun auch nicht mehr nötig. Denn wenn es auch ruhig mit dem Monde wetteifern konnte - die Brücke ins Sonnenland, an welcher der Kater Ratzepetz lebte, die leuchtete so strahlend in alles Dunkel hinein, dass es nicht schwer war, sie zu finden.
Das ist die Brücke, auf der der liebe Gott ins Märchenland wandert, wenn er sich von der Schuld und den Tränen der Menschen erholen muss, und zu den Tieren und Kindern kommt und zu denen, die im Märchenland leben, weil sie die Brüder und Schwestern der Tiere und der Kinder sind.
Als die kleine Elfe an die goldene Brücke kam, da klopfte sie an die Tür des Hauses, in dem der Kater Ratzepetz lebte. Die Tür tat sich auf und ein menschenähnliches Wesen trat heraus. Es war ein Mann, der weiter nicht schön aussah, aber er hatte ein Leuchten in den Augen, weil er das Märchen liebte, die Tiere und die Kinder und weil er dem Kater Ratzepetz diente und sehr, sehr viel von ihm gelernt hatte.
Er war wohl auch ein Mensch gewesen und kannte Schuld und Tränen - aber dann hatte er es so gemacht wie der liebe Gott und war ins Märchenland gegangen zum Kater Ratzepetz. Man muss es eben schon dem lieben Gott abgucken, wenn man ins Märchenland kommen will.
"Wer sind Sie?" ,fragte das menschenähnliche Wesen die Elfe. "Ich bin eine kleine Elfe" ,sagte sie. "Ich habe meinen Schleier verloren und ich will den weisen Kater Ratzepetz sprechen. Die alte Kröte am Wegrand, die Rheumatismus hat, hat mich hergeschickt."
Das menschenähnliche Wesen führte die kleine Elfe ins Haus und nun stand sie vor dem Kater Ratzepetz. Ihr Herz schlug hörbar, denn so gewaltig hatte sie sich den Kater Ratzepetz nicht vorgestellt, so viel sie auch von ihm gehört hatte. Es war eben Ratzepetz - und das Licht von der goldenen Brücke flutete über sein weiches Fell. Er saß vor einem großen Buch, in dem er krallenhaft geblättert hatte.
"Viele schlüpfrige Empfehlungen von der alten Kröte und sie wird Ihnen zu Weihnachten wollene Strümpfe stricken" ,sagte die kleine Elfe. "Ich bin eine kleine Elfe und habe meinen Schleier verloren. Wenn ich meinen Schleier nicht wiederfinde, so muss ich in den Sumpf und kriege Rheumatismus und kann nie wieder zurück ins Elfenreich unter dem grünen Hügel. Es ist sehr traurig."
Der Kater Ratzepetz dachte nach. Er war vor zweitausend Jahren im Katzentempel von Bubastis (altägypt. Stadt und Kultstätte) gewesen und kannte viele Geheimnisse. Das menschenähnliche Wesen hatte auch schon damals mit ihm gelebt und hatte ihn gepflegt und geliebt wie heute. Ägyptens Sonne war noch in beiden - im Kater Ratzepetz und im Mann aus Bubastis. Das war freilich vor zweitausend Jahren und im Tempel gewesen - aber es gibt so viele Geheimnisse - was sind auch zweitausend Jahre und ist nicht das ganze Märchenland auch ein heiliger Tempel?
"Dein Schleier ist gar nicht verloren" ,sagte der Kater Ratzepetz, "die klatschhafte Elster hat ihn dir gestohlen, als du mit deinen Elfenschwestern getanzt hast unter dem Holderbaum. Die Elstern stehlen so gern die Elfenschleier und dann laden sie andere Elstern zum Kaffee ein. Sie zeigen die gestohlenen Schleier und sagen, die Elfen hätten sie verloren. Es gibt freilich sehr viele Elstern, aber ich will schon versuchen, die richtige zu finden. Dann bringe ich dir den Schleier wieder." -
"Ich danke Ihnen tausendmal" ,sagte die kleine Elfe, "und ich will auch jeden Tag kommen, um Sie am Halse zu krabbeln." Der Kater schnurrte, denn er liebte es überaus, so gekrabbelt zu werden. Das war eine Schwäche von ihm und auch große Leute haben ihre Schwächen. "Ich gehe jetzt zur Elster" ,sagte der Kater Ratzepetz zu dem menschenähnlichen Wesen, "setze die kleine Elfe unterdessen unter eine Käseglocke, damit ihr nichts passiert."
Der Kater Ratzepetz ging und das menschenähnliche Wesen setzte die kleine Elfe unter eine Käseglocke. Es war nicht schön drin zu sitzen, aber dazwischen hob das menschenähnliche Wesen die Käseglocke ein bisschen auf und ließ die Elfe hinausgucken und dann erzählte es ihr von den Denkwürdigkeiten des weisen Katers Ratzepetz. Das war so sein Lebensberuf. Der Beruf ist sehr selten.
Der Kater Ratzepetz hatte unterdessen fleißig umhergeschnüffelt und auch bald das richtige Elsternest herausgefunden. Es war hoch auf einem Baum am Rande des Märchenlandes. Denn im eigentlichen Märchenland selbst leben die klatschhaften Elstern nicht. Es wäre ihnen da zu poetisch, sagten sie, und davon bekämen sie Migräne. Es war doch viel netter, in einem warmen Nest zu sitzen, die Elfenschleier aus dem Märchenlande zu stehlen und dann darüber zu klatschen. Das war so ihr Lebensberuf und der Beruf ist sehr häufig.
"Sie haben einen Elfenschleier gestohlen!" ,fauchte der Kater Ratzepetz zum Elsternnest hinauf. "Geben Sie ihn sofort zurück!" - "Wie?!" ,schnatterte die Elster empört, "Ich bin eine ehrbare Frau und stehle niemals. Ich habe höchstens ein Fundbüro und das auch nur aus Gutmütigkeit, weil es mir leid tut, wenn die Leute leichtsinnig sind und was verlieren." -
"Und was befindet sich eben in Ihrem Fundbüro?" -
"Ich will ehrlich sein wie immer und es Ihnen sagen. Ich fand die Gummischuhe eines Frosches, den Regenschirm eines Pilzes, die durchbrochenen Strümpfe einer Bärin und das Klavier einer Eidechse. Weiter kann ich Ihnen nicht dienen und ich habe auch keine Zeit, denn ich gebe heute einen Nestkaffee."
"Meine Gnädige" ,sagte der Kater Ratzepetz, "wenn ich jetzt nach oben komme und selbst nachsehe, dann können Sie ihren Nestkaffee nackt geben, denn ich lasse Ihnen keine Feder am Leibe." Seine Krallen setzten sich fest in den Baumstamm und rupften beängstigend an der Rinde.
Da flog ein Elfenschleier zu Pfoten des Katers Ratzepetz. Die Elster aber sagte den anderen Elstern die kamen, sie habe Migräne und ihr Nestkaffee könne heute nicht stattfinden.
So kam die kleine Elfe wieder zu ihrem Schleier. Und dafür krabbelte sie den Kater Ratzepetz jeden Tag am Halse, so dass er laut und vernehmlich schnurrte. Jeder würde gewiss gerne schnurren, wenn ihn eine Elfe am Hals krabbelte - aber das erlegt nicht ein jeder. Dazu muss man schon so weise werden, wie der weise Kater Ratzepetz.
Manfred Kyber
DAS VERLORENE LIED ...
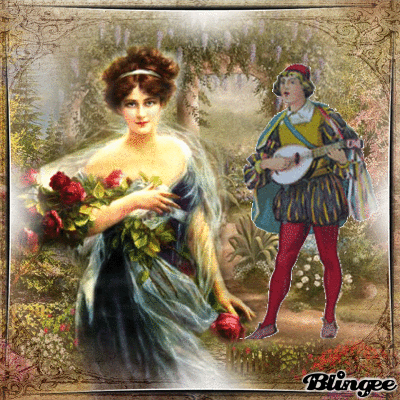
Es war einmal ein armer Hirtenbub, der hütete das Vieh hoch oben im Gebirge. Seine Eltern waren schon lange tot und er hatte nur noch eine Stiefmutter - und die war böse und konnte hexen. Sie war schlecht gegen den armen Hirtenbuben und er wäre schon lange davon gelaufen, wenn er sich nicht so sehr vor ihr gefürchtet hätte.
Denn sie konnte doch hexen - und wenn jemand hexen kann, so ist das nicht angenehm für die anderen Leute und man muss sich gar sehr in Acht nehmen. Darum blieb der kleine Hirtenbub lieber, aber er war sehr traurig und unglücklich und wenn er so allein im Mittagssonnenlicht auf der grünen Wiese lag und die bunten Kühe um ihn herumstanden und recht langweilig aussahen, dann dachte er oft daran, ob es wohl einmal besser werden würde.
Doch die Kühe blieben stehen und sahen langweilig aus und die Wolken zogen vorbei, denn es war ja hoch oben auf den Bergen, und die Sonne ging zur Ruhe und es blieb alles wie es war. Eines Tages aber, als der arme Hirtenbub ganz besonders traurig und unglücklich war und wieder daran dachte, ob es wohl einmal besser werden würde, da wurde er müde und schlief ein. Wie er so da lag und schlief, da sah er plötzlich eine wunderschöne Fee vor sich, die hielt eine Laute aus Rosenholz in den Händen und feine silberne Saiten waren drauf gespannt und das war gar seltsam anzuschauen. Die Fee aber griff in die Saiten der Rosenlaute und sang dazu:
Ich kenne ein Lied von holdem Klang,
das zieht die ganze Erde entlang.
Und ist nichts so lieb und heilig und hold
In der Tiefe und oben im Sternengold,
wie das Lied von dem, wenn zwei sich frein
und wollen einander das Liebste sein.
Da ist nichts so lieb und heilig und hold
In der Tiefe und oben im Sternengold.
Wie das Lied zu Ende war, da lächelte die Fee und nickte dem Hirtenbuben zu und legte ihm die Laute von Rosenholz in den Schoß. Der Bub aber wusste gar nicht, wie ihm geschah, und als er erwachte, meinte er zuerst, das Ganze wäre wohl nur ein Traum gewesen. Doch die Laute von Rosenholz lag wirklich und wahrhaftig in seinem Schoß - und wie er sie in seine Hand nahm und in die feinen silbernen Saiten griff, da erklangen gar wunderbare Weisen und immer neue Lieder fielen ihm ein.
Aber so wie das Lied der Fee waren sie doch alle nicht und er konnte und konnte sich nicht darauf besinnen, so sehr er sich auch mühte und nachdachte. Und da fasste ihn mit einem Male eine so unsagbare Sehnsucht nach jenem Liede, dass er alles vergaß, die Kühe, die so langweilig aussahen, und die Stiefmutter, die hexen konnte, und dass er auf und davon ging, um die seltsame Weise wiederzufinden.
Von der Tiefe war drin die Rede gewesen und vom Sternengold und in den Beiden wollte er suchen, dachte er bei sich. Denn das andere hatte er vergessen oder nicht verstanden. So ging er immer weiter und weiter und wollte in die Tiefe kommen und wusste nur nicht wie. So kam er schließlich an einen großen See, der lag ganz vereinsamt im Walde, nur am Ufer hupften lauter grüne Frösche herum und quakten dazu. Der Hirtenbub meinte, die Frösche müssten doch wohl am besten in der Tiefe Bescheid wissen, und so trat er auf einen Frosch zu, grüßte höflich und fragte:
"Ach bitte, kannst du mir nicht sagen, wie man in die Tiefe kommt?" - "Ja, das ist für dich wohl nicht so leicht" ,sagte der Frosch und schluckte eine Fliege herunter. "Warum willst du überhaupt nach unten? Bleibe doch lieber oben." - "Mir hat eine Fee ein Lied gesungen auf dieser Laute von Rosenholz" ,sagte der Hirtenbub, "aber ich kann mich nicht mehr auf das Lied besinnen und nun will ich es suchen." -
"Das ist ja sehr schlimm" ,meinte der Frosch gedankenvoll, "war es vielleicht so ähnlich, wie wir singen?" - "Nein, es war ganz anders" ,sagte der Hirtenbub. "Dann wird es wohl auch nichts Besonderes gewesen sein" ,sagte der Frosch hochmütig und blies sich dabei auf, so dass er ganz dick wurde. "Aber ich will dir den Gefallen tun und mal den Froschkönig fragen, ob er dich empfängt. Dann kannst du selbst mit ihm darüber sprechen."
Ehe der Hirtenbub sich noch besinnen konnte, war der Frosch ins Wasser gehüpft, dass es nur so klatschte - und fort war er. Es dauerte eine ganze Weile, dann kam er wieder, machte eine Verbeugung und sagte: "Majestät lässt bitten." Da tat sich das Wasser auf und trat zur Seite, so dass der Hirtenbub mitten hindurch gehen konnte, bis tief auf den Grund des Sees und zum Palast des Froschkönigs.
Der Froschkönig war ganz besonders grün und hatte ein kleines goldenes Krönlein auf und saß, die Beine übereinander geschlagen, auf einem großen Wasserrosenblatt. Neben ihm saßen viele alte, dicke Frösche, die alle sehr würdig aussahen, und um ihn herum schwammen kleine Nixen und warfen ihm Kusshändchen zu. Dann lächelte der Froschkönig immer und das sah sehr eigentümlich aus, weil er doch einen so sehr großen Mund hatte. Der Hirtenbub aber verneigte sich tief vor seiner feuchten Majestät und sagte:
"Guten Tag. Ich suche ein Lied, das mir eine Fee gespielt hat auf dieser Laute von Rosenholz. Aber ich kann mich nicht mehr darauf besinnen, wie es war. Es ist auch nicht so, wie die Frösche singen." Da ging der Froschkönig an zu denken und mit ihm alle die alten dicken Frösche, die neben ihm saßen. Endlich sagte er: "Wenn es nicht so ist, wie die Frösche singen, dann kann es nur so sein, wie die Nixlein singen."
Dabei winkte er mit der grünen königlichen Hand den Nixlein, die um ihn herum schwammen und ihm Kusshändchen zuwarfen, und die Nixlein fingen an zu singen und der Froschkönig schlug mit den feuchten Füßen den Takt dazu und es war sehr schön. Aber als es zu Ende war, da sagte der Hirtenbub: "Ich danke dir sehr und es war auch sehr schön, aber es war doch nicht so wie das Lied, das mir die Fee gesungen." -
"Ja, dann tut es mir von Herzen leid, sagte der Froschkönig, "aber dann kann ich dir wirklich nicht helfen." Er reichte dem Hirtenbuben die nasse Hand zum Abschied und war sehr gerührt und höflich und ließ ihn wieder hinauf an das Ufer des Sees geleiten. Der Hirtenbub aber dachte: "Wenn es nicht in der Tiefe ist, so muss es wohl in der Höhe sein, oben im Sternengold." Denn das andere hatte er ja vergessen oder nicht verstanden.
So ging er hoch hinauf auf einen Berg, wo die Wolken an ihm vorbeizogen, und als eine Wolke gerade recht nahe und bequem vorbeikam, da sagte er: "Ach bitte, nimm mich doch mit!" - "Steige nur auf meinen Rücken" ,sagte die Wolke, "aber beeile dich, denn ich habe keine Zeit und muss zum Wolkenkönig." Der Hirtenbub sprang auf den Rücken der Wolke und im Nu ging es fort durch die weite Luft über Meere und Länder. Und ehe sich's der Hirtenbub versah, war er am Schloss des Wolkenkönigs angekommen und der Wolkenkönig stand auf der Treppe und bestimmte gerade, wo es heute regnen sollte.
"Ja, wer ist denn das?" ,sagte er erstaunt, als er den Hirtenbuben sah, "du willst wohl Sternenputzer werden?" - "Nein, Sternenputzer möchte ich nicht werden" ,sagte der Hirtenbub, "aber mir hat eine Fee ein Lied gespielt auf einer Laute von Rosenholz und das Lied habe ich vergessen und ich wollte nur einmal fragen, ob es nicht vielleicht hier oben zu finden wäre." - "So, so" ,sagte der Wolkenkönig, "ich werde mal nachsehen" - und holte ein großes Buch hervor, wo alle die Lieder drin standen, die die kleinen Sternlein sangen, wenn sie nachts spazieren gehen. Aber es war nichts darunter, was so gewesen wäre, wie das Lied der Fee auf der Laute von Rosenholz.
Da wurde der Hirtenbub sehr traurig und ging wieder auf die Erde zurück auf einer Treppe, die ihm der Wolkenkönig gezeigt hatte. Und wie er wieder auf der Erde war, da zog er überall umher in allen Landen und sang den Leuten seine Lieder und spielte dazu auf seiner Laute von Rosenholz. Die Leute waren alle froh und wollten nur immer und immer wieder die wunderbaren Weisen hören und baten ihn, doch immer bei ihnen zu bleiben, und boten ihm Geld und Gut und hohe Ehren.
Er aber hatte nirgends Ruhe und war sehr traurig, denn er dachte, er würde das verlorene Lied nun nie und nimmer wiederfinden. So wanderte er jahrein, jahraus und endlich kam er vor ein herrliches Königsschloss, in dem lebte eine wunderschöne junge Königin. Die hatte etwas vergessen - und da sie selbst nicht wusste, was sie eigentlich vergessen hatte, so konnte ihr auch niemand helfen, sich darauf zu besinnen, und es war große Trauer in den Königshallen und im ganzen Lande.
Der Hirtenbub aber fragte, ob er vor der traurigen jungen Königin seine Lieder singen dürfe. Es wurde ihm erlaubt und er wurde in den Königssaal geführt, wo die traurige junge Königin auf dem Throne saß. Die Minister standen um sie herum in goldstrotzenden herrlichen Kleidern und hatten große Taschentücher in der Hand, weil sie doch immer so viel weinen mussten um die traurigen junge Königin. Denn mehr als weinen konnten sie nicht, weil die Königin ja selbst nicht wusste, was sie vergessen hatte, und ihr also auch niemand helfen konnte.
Wie der Hirtenbub aber die Königin sah, da ward ihm ganz wunderbar zu Mute und er hatte sie von ganzen Herzen lieb. Und als er nun vor ihr singen sollte, da fiel ihm mit einem Male das Lied ein, das ihm die Fee gesungen und es war ihm, als könne er gar kein anderes mehr singen. So nahm er die Laute von Rosenholz zur Hand, griff in die feinen silbernen Saiten und sang dazu:
Ich kenne ein Lied von holdem Klang,
das zieht die ganze Erde entlang.
Und ist nichts so lieb und heilig und hold
In der Tiefe und oben im Sternengold,
wie das Lied von dem, wenn zwei sich frein
und wollen einander das Liebste sein.
Da ist nichts so lieb und heilig und hold
In der Tiefe und oben im Sternengold!
Und wie er das Lied gesungen, da stieg die Königin von ihrem Thron herunter und hatte ganz und gar vergessen, dass sie etwas vergessen hatte, und trat auf den Hirtenbuben zu und küsste ihn und sagte: "Ich habe dich lieb und will deine Frau sein." Da jubelte alles und freute sich und die Minister steckten die Taschentücher wieder ein und es wurde eine herrliche Hochzeit hergerichtet.
Wie es aber gerade losgehen sollte mit den Hochzeitsfeierlichkeiten, da meldete de Oberhofmeister drei große Frösche, die vom Froschkönig zum Gratulieren geschickt waren. Sie wurden herein gebeten und gratulierten und waren sehr grün und hießen: Herr Schlupferich, Herr Hupferich und Herr Tupferich.
Der Wolkenkönig aber hatte ein kleines Sternchen geschickt, das knickste und leuchtete und gratulierte dazu. Und es war eine ganz herrliche Hochzeit. Es wurde gegessen, getrunken und getanzt und Herr Schlupferich, Herr Hupferich und Herr Tupferich tanzten auch mit und benahmen sich dabei sehr manierlich, so wie sich das für feine und vornehme Frösche gehört. Etwas nasse Füße hatten sie freilich, aber das schadete nichts.
So war alles sehr schön, nur das kleine Sternlein war unvorsichtig und hatte sich, um besser sehen zu können, dem Minister für außerordentliche Angelegenheiten auf den Kopf gesetzt, so dass hochdero Perücke zu brennen anfing. Aber das Feuer wurde bald gelöscht, wie das bei einem Minister für außerordentliche Angelegenheiten gar nicht anders zu erwarten ist - und das Sternlein wurde ermahnt, daran zu denken, dass doch nicht jeder Kopf solch ein Feuer verträgt.
Und als die ganze Hochzeit zu Ende war und der junge König und die junge Königin allein waren, da küssten sie sich auf den Mund und sangen das verlorene Lied dazu, das einst die Fee gespielt hatte auf der Laute von Rosenholz.
Manfred Kyber
DAS ANDERE UFER ...

Es war einmal ein Sammler, der sammelte allerlei Seltsamkeiten aus fernen Ländern. Er sammelte auch alltägliche Dinge, aber dann hatten sie einen besonderen Sinn und ihre besondere Geschichte. Diese Geschichte der Dinge verstand der Sammler zu lesen wie wenige es verstehen, denn es ist keine leichte Kunst. So saß der Tage und Nächte unter all seinen Seltsamkeiten und las ihre Schicksale und er wusste, dass es Menschenschicksale waren, die daran hingen. Wie ein breiter Fluss flutete das arme verworrene Menschenleben um ihn herum, er stand an seinem Ufer und schaute mit erkenntnisreichen Augen, wie Welle um Welle an ihm vorüberzog.
Aber er wusste auch, dass ihm noch etwas fehlte: Er wusste, dass das menschliche Leben, in dem er so viel gelesen hatte, nicht nur das eine Ufer haben konnte, auf dem er stand und es betrachtete. Er wusste, dass es auch ein anderes Ufer haben musste, und das andere Ufer suchte er - wie lange schon! Aber er hatte es nicht gefunden. Einmal aber hoffte er es bestimmt zu finden. Er suchte in allen Läden der Städte, ob er nicht ein Ding finden würde, das ihm etwas vom anderen Ufer erzählen könne. Er war ja sein Leben lang ein Sammler und Sucher gewesen und hatte viel Geduld gelernt.
So kam er einmal in einer fernen Stadt im Süden in einen sehr merkwürdigen Laden. Der Laden war ein richtiger Kramladen des Lebens, denn es waren wohl alle Dinge darin vertreten, die man sich im menschlichen Leben nur denken konnte, von den seltensten Kostbarkeiten herab bis zu den geringsten Alltäglichkeiten. Und alle Dinge hatten, so wie es sich gehört, ihre eigene Geschichte.
Der Sammler besah sich alle die vielen Dinge mit großer Sachkenntnis. Manches gefiel ihm sehr und manches hätte er gerne gekauft, aber irgendwie erinnerte es ihn doch an etwas, was er schon einmal erworben hatte. "Dies ist wohl die seltsamste Sammlung der Dinge vom menschlichen Leben, die ich je gesehen habe" ,sagte der Sammler, und da der Händler ihm kein gewöhnlicher Händler zu sein schien - denn er hatte etwas Stilles und Feierliches in seinem Wesen - so fragte er ihn, ob er nicht etwas habe, was ihm vom anderen Ufer erzählen könne.
Der Händler war auch wirklich kein gewöhnlicher Händler. Er wusste zu gut, wie viel Leid und Tränen manche Dinge, die die Menschen bei ihm um teuren Preis erstanden, denen bringen mussten, die sie mit einer Inbrunst erwarben, als hinge ihr ganzes Leben davon ab. Es kam nicht oft vor, dass einer den richtigen Gegenstand bei ihm verlangte. Als nun der fremde Sammler den Händler nach dem anderen Ufer fragte, da lächelte der Händler und reichte ihm eine kleine Lampe von unscheinbarer Form, doch von sehr sorgfältiger Arbeit. Die Lampe aber brannte schon mit einer schönen bläulichen Flamme und brauchte nicht erst entzündet zu werden.
"Diese Lampe stellt man nirgends aus" ,sagte der Händler, "man gibt sie nur denen, die nach dem anderen Ufer fragen." - "Erzählt mir denn diese Lampe etwas vom anderen Ufer?", fragte der Sammler und betrachtete die Lampe mit aufmerksamen und erstaunten Blicken, denn er hatte so etwas noch nicht in seiner Sammlung und er hatte es bisher auch nirgends gesehen. "Vom anderen Ufer darf dir die Lampe nichts erzählen" ,sagte der Händler, "zum anderen Ufer musst du selber wandern, aber die Lampe wird dir leuchten und dir den Weg zum anderen Ufer weisen."
Da dankte der Sammler dem Händler und fragte ihn, was er ihm für die Lampe zu zahlen habe. "Ich habe viele Gegenstände in meinem Laden, die man um billigen Preis erstehen kann" ,sagte der Händler, "ich habe auch manche darunter, die um ein Königreich nicht zu haben sind. Aber die kleine Lampe, die du in der Hand hast, kostet nichts für den, der nach dem anderen Ufer fragte. Es ist deine eigene Lampe und es ist eine ewige Lampe - und sie wird dir den Weg zum anderen Ufer weisen."
Da wurde der Sammler ein Wanderer. Er ließ alle die vielen seltsamen Dinge, die er bisher gesammelt hatte, hinter sich und wanderte dem Licht seiner ewigen Lampe nach, das andere Ufer zu suchen. Er sah viel Schönes auf seinem Wege, das er früher nicht gesehen hatte. Er sah, wie die Steine sich regten und formten, er schaute in die Träume der Blumen und er verstand die Sprache der Tiere. Allmählich aber wurde der Weg des Wanderers immer einsamer und verlassener, er stand allein in einer Einöde und vor sich erblickte er sieben steile, felsige Berge.
Die Lampe warf ihren Lichtschein auf seinen Weg und sie zeigte ihm an, dass er alle die sieben Berge besteigen müsse. So bestieg er alle sieben Berge und von jedem Berge hoffte er das andere Ufer zu sehen, aber er sah es nicht. Ein eisiger Neuschnee lag auf allen sieben Gipfeln. Mitten aber im Schnee blühte eine rote Rose, leuchtend wie ein Rubin. Die pflückte der Wanderer und nahm sie mit sich auf den Weg.
Als er nun alle sieben Berge bestiegen hatte und sich ihre sieben Rosen zum Kranz geholt hatte aus dem eisigen Neuschnee der Gipfel, da stand er vor einem dunklen Tor. Der Torhüter trat auf ihn
zu und fragte ihn, was er wolle.
"Ich suche das andere Ufer" ,sagte der Wanderer. "Was führst du mit dir auf deinem Weg?" ,fragte der Torhüter. "Sieben rote Rosen und meine ewige Lampe" ,sagte der Wanderer. Da ließ ihn der
Torhüter in das dunkle Tor eintreten.
"Es ist ein langes und dunkles Tor" ,sagte der Torhüter, "du musst bis an sein Ende gehen, dann kommst du an das Meer der Unendlichkeit." - "Ich will nicht an das Meer der Unendlichkeit" ,sagte der Wanderer, "ich suche das andere Ufer. Das Meer der Unendlichkeit aber ist uferlos." - "Du musst warten, bis die Sonne aufgeht, dann wirst du das andere Ufer sehen" ,sagte der Torhüter.
Da ging der Wanderer durch das lange dunkle Tor hindurch und setzte sich am Meer der Unendlichkeit nieder, denn er war sehr müde geworden von seiner Wanderung. Das Meer der Unendlichkeit brandete zu seinen Füßen und über seinen wilden Wellen und dem einsamen Wanderer an seinem Gestade stand die gestirnte Nacht. Der Wanderer aber wartete und wachte bei seiner ewigen Lampe die ganze Nacht und es war eine so lange Nacht, dass er dachte, sie wolle gar kein Ende nehmen.
Endlich verblassten die Sterne, die brandenden Wellen wurden still und klar und über ihnen ging die Sonne auf. Im Licht der aufgehenden Sonne aber tauchte eine leuchtende Insel mitten aus dem Meer der Unendlichkeit empor. Da erkannte der Wanderer, dass es das andere Ufer war, das er gesucht hatte. Über das dunkle Tor kam eine Taube geflogen und zeigte dem Wanderer den Weg zur Insel und er schritt über das Meer der Unendlichkeit so sicher wie auf klarem Kristall hinüber zum anderen Ufer.
Vom anderen Ufer aber darf ich euch nichts weiter erzählen, so wenig als es die Lampe getan hat. Zum anderen Ufer muss ein jeder selber wandern im Licht seiner eigenen ewigen Lampe. Denn das Märchen vom anderen Ufer ist ein Märchen der Wanderer.
Manfred Kyber
DER TOD UND DAS KLEINE MÄDCHEN ...
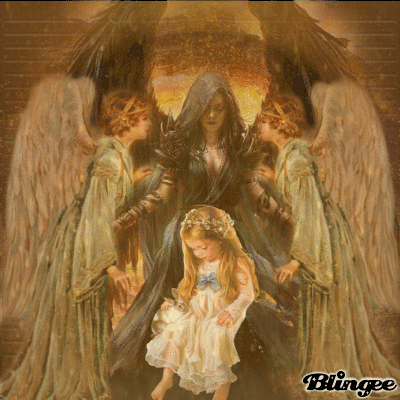
Es war einmal ein kleines Mädchen, das war immer sehr einsam. Es sei ein sonderbares Kind, sagten die Großen und es sei dumm und es vertrage keinen Lärm, sagten die Kleinen - und darum spielte niemand mit ihm. Ihr werdet nun gewiss denken, dass das sehr langweilig und sehr traurig für das kleine Mädchen war.
Ein bisschen traurig war es manchmal schon, aber langweilig war es gar nicht, denn das kleine Mädchen langweilte sich niemals. Es kamen immer so viele Gedanken zu ihm zu Besuch und diese Gedanken sah es auch alle und sprach mit ihnen, als ob sie leibhaftig vor ihm stünden. Es war eine Sprache ohne Worte und diese Sprache kennen alle, zu denen die Gedanken zum Besuch kommen.
Die Gedanken, die zu dem kleinen Mädchen kamen, waren alle sehr verschieden und sie waren auch ganz verschieden angezogen, wenn man das von einem Gedanken überhaupt sagen kann. Es waren traurige Darunter in grauen Kleidern, frohe in rosenfarbenen mit goldenen Sternen darauf, rote und lustige, die Fratzen machten, und blaue, die von Märchenländern erzählten und deren Augen immer irgendwo hinaus in eine weite Ferne sahen.
Es muss sehr still um einen herum sein, wenn so viele Gedanken zu einem zum Besuch kommen. Darum ging das kleine Mädchen am liebsten ganz allein auf den Dorffriedhof und setzte sich zwischen alle die Gräber unter den hohen Bäumen. Das kleine Mädchen kannte alle die Gräber mit Namen und es war wirklich merkwürdig zu beobachten, welche Gedanken an den verschiedenen Gräbern zum Besuch kamen und an welchen Gräbern die Gedanken fort blieben. Es war, als ob es ihnen da nicht recht gefiele.
Lehrreich und unterhaltend war es auch, was die Gedanken an dem einen oder anderen Grabe sagten, wenn sie zum Besuch kamen. Was sie sagten, war nicht immer schmeichelhaft für die Toten in den Gräbern. Aber das kleine Mädchen konnte daraus sehen, an welchen Gräbern man am besten sitzen und sich mit seinen Gedanken unterhalten konnte.
Als nun das kleine Mädchen wieder einmal auf dem Friedhof saß und sich von seinen bunten Gedanken besuchen ließ, da kam eine Gestalt im schwarzen Gewande durch alle die Grabhügel geschritten und ging gerade auf das kleine Mädchen zu. "Bist du auch ein Gedanke?" ,fragte das kleine Mädchen. "Aber du bist so sehr viel größer als die Gedanken, die mich sonst besuchen, und du bist so schön, wie keiner von meinen vielen Gedanken es jemals war." Die schöne Gestalt im schwarzen Gewand setzte sich neben das kleine Mädchen.
"Du fragst ein bisschen viel auf einmal. Ich bin wohl ein Gedanke - und doch wieder auch etwas mehr. Es ist für mich gar nicht so leicht, dir das zu erklären. Sonst täte ich es gewiss gerne." - "Bemühe dich nicht meinetwegen" ,sagte das kleine Mädchen, "ich brauche dich gar nicht zu verstehen. Es ist auch sehr schön, dich bloß anzusehen. Aber ich möchte gerne wissen, wie du heißt. Meine Gedanken sagen mir immer alle, wie sie heißen, und das ist sehr lustig."
"Ich bin der Tod" ,sagte die schöne Gestalt und sah das kleine Mädchen sehr freundlich an. Man musste Vertrauen zum Tod haben, wenn man ihm in die Augen sah, denn es waren schöne und gute Augen, die der Tod hatte. Solche Augen hatte das kleine Mädchen noch nicht gesehen. Das kleine Mädchen erschrak auch gar nicht. Es war nur sehr erstaunt und überrascht und fast freute es sich, dass es so ruhig neben dem Tod sitzen konnte.
"Weißt du" ,sagte es, "es ist so komisch, dass alle Menschen Angst haben, wenn sie von dir sprechen, wo du so nett bist. Ich möchte gerne mit dir spielen. Es spielt sonst niemand mit mir." Da spielte der Tod mit dem kleinen Mädchen - wie zwei Kinder miteinander spielen, mitten unter den Gräbern auf dem Friedhof. "Wir wollen Himmel und Erde bauen" ,sagte das kleine Mädchen, "hoffentlich verstehst du es auch. Wir machen den Himmel aus den hellen Kieseln und die erde aus den dunklen. Du musst aber fleißig Steine suchen."
Der Tod suchte kleine Steine zusammen und er gab sich viele Mühe, um das kleine Mädchen zufriedenzustellen. "Jetzt haben wir genug" ,sagte das kleine Mädchen. "Ich finde, dass du sehr schön spielen kannst. Willst du nun den Himmel bauen und ich die Erde oder umgekehrt? Mir ist es einerlei. Du kannst dir aussuchen, was dir mehr Spaß macht. Ich erlaube es dir." -
"Ich danke dir sehr" ,sagte der Tod, "aber siehst du, ich bin kein Kind mehr und verstehe nicht mehr so zu bauen, wie man das als Kind versteht. Du bist ja noch ein Kind und ich denke, du baust dir deinen Himmel und deine Erde selber. Aber ich will dir bei beidem helfen."
"Das ist nett von dir" ,sagte das kleine Mädchen und baute sich seinen Himmel und seine Erde aus den bunten Kieselsteinen. Der Tod sah zu und half dem kleinen Mädchen dabei. "Jetzt pass auf" ,sagte das kleine Mädchen, "hier ist der Himmel und drin wohnt der liebe Gott und hier ist die Erde und da wohne ich. Nun musst du auch noch eine Wohnung haben. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wo du wohnst?"
"Ich wohne zwischen Himmel und Erde" ,sagte der Tod, "denn ich muss ja die Menschenseelen von der Erde zum Himmel führen." - "Richtig" ,sagte das kleine Mädchen, "dann kriegst du eine Wohnung aus hellen und dunklen Steinen zusammen. Es soll eine feine Wohnung werden, du wirst schon sehen." Der Tod freute sich und sah zu, wie das kleine Mädchen ihm seine Wohnung baute.
"Höre mal" ,sagte das kleine Mädchen, "du hast doch eben gesagt, dass du die Menschenseelen von der Erde zum Himmel führst. Erzähle mir mal ein bisschen davon, wie du das machst - und warum müssen wir überhaupt sterben? Kann man denn nicht einfach in den Himmel 'rüberlaufen?" Als das kleine Mädchen das fragte, läuteten die Glocken Feierabend.
"Hörst du die Glocken läuten?" ,fragte der Tod. "Siehst du, mit den Menschenseelen ist das ganz ähnlich wie mit den Glocken. Jede Menschenseele ist eine Glocke und du hörst sie läuten, wenn du ordentlich aufpasst, in frohen und in traurigen Stunden. Bei manchen läutet sie nur noch ganz schwach und das ist dann wirklich sehr schlimm. Wenn ich nun zu einem Menschen komme, dann läutet seine Glockenseele Feierabend - und ich hänge die Glocke dann in den Himmel. Dort läutet sie weiter."
"Läuten sie denn da alle durcheinander?" ,fragte das kleine Mädchen. "Das muss gar nicht schön klingen, denn jede läutet doch sicher ganz anders. Es ist gewiss nicht angenehm für den lieben Gott, sich das immer anhören zu müssen." - "Das ist schon wahr" ,sagte der Tod, "aber siehst du, die Glockenseelen kommen so oft auf die Erde zurück und werden so lange umgegossen, bis sie alle ihr eigenes richtiges Geläute haben und alle zusammenklingen. So lange aber muss ich die Menschen von der Erde zum Himmel tragen."
"Das tut mir sehr leid für dich", sagte das kleine Mädchen, "es ist gewiss eine sehr mühsame Arbeit. Aber pass nur auf, es wird schon mal besser werden und dann hast du gar nichts mehr zu tun und wir beide spielen immer so nett zusammen wie heute." Der Tod nickte und seine Augen sahen in eine sehr, sehr weite Ferne.
"Deine Wohnung ist jetzt fertig" ,sagte das kleine Mädchen, "ist sie nicht sehr hübsch geworden?" - "Sie ist sehr hübsch" ,sagte der Tod, "ich danke dir auch. Aber es ist spät und du musst jetzt nach Hause gehen. Es war schön, mit dir zu spielen." Und der Tod reichte dem kleinen Mädchen die Hand. "Guten Abend" ,sagte das kleine Mädchen und knickste, "kommst du nicht auch einmal mich besuchen? Ich bin so viel allein." - "Ja" ,sagte der Tod freundlich, "ich werde dich sehr bald besuchen, weil du so allein bist."
Bald darauf wurde das kleine Mädchen sehr krank und die Leute meinten alle, dass es wohl sterben müsse. Die Leute waren traurig, denn es erschien ihnen immer traurig, wenn einer starb - und besonders wenn es ein Kind war, das das Leben noch vor sich hatte, wie sie sagten. Aber es war ja ein sonderbares Kind, das die Großen nicht verstanden und mit dem die Kleinen nicht spielen mochten. Am Ende war es so auch besser.
Als die Glocken Feierabend läuteten, da trat der Tod zu dem kleinen Mädchen ins Zimmer. "Das ist nett von dir, dass du mich besuchen kommst" ,sagte das kleine Mädchen. "Es ist Feierabend" ,sagte der Tod und setzte sich zu dem kleinen Mädchen aufs Bett. "Ach ja" ,sagte das kleine Mädchen, "davon hast du mir damals so schön erzählt, als wir zusammen Himmel und Erde bauten. Dann kommst du gewiss, um meine Glockenseele zu holen. Hoffentlich klingt sie aber auch hübsch, so dass sich der liebe Gott nicht ärgert."
"Sie sehnen sich im Himmel nach einer reinen Glocke" ,sagte der Tod, "darum haben sie mich gebeten, zu dir zu kommen." - "Muss ich dann sterben?" ,fragte das kleine Mädchen. "Das brauchst du gar nicht so zu nennen" ,sagte der Tod. "Siehst du, es ist ganz einfach: An deiner Tür stehen zwei Engel und die führen dich dann zum lieben Gott in den Himmel." - "Ich kann aber die Engel nicht sehen" ,sagte das kleine Mädchen. "Ich werde dich mal auf den Arm nehmen" ,sagte der Tod, "dann wirst du die Engel gleich sehen."
Da nahm der Tod das kleine Mädchen auf die Arme - und als er es auf die Arme genommen hatte, da sah es zwei strahlende Engel in weißen Kleidern mit schimmernden Flügeln und die Engel führten es zum lieben Gott in den Himmel. Die Glockenseele des kleinen Mädchens aber läutete und es war lange her, dass eine so reine Glocke oben ihren Feierabend geläutet hatte.
Im Himmel war es sehr schön und da war das kleine Mädchen kein sonderbares Kind mehr, denn die großen Engel verstanden es und die kleinen Engel spielten mit ihm. Auch der liebe Gott war zufrieden und freute sich, dass er eine so reine Glocke bekommen hatte. Das kleine Mädchen fand es nur sehr traurig, dass der Tod unten auf der Erde bleiben musste. Es sah ihn auf dem Friedhof stehen, wenn es mal herunterguckte und dann nickte es ihm zu.
"Kannst du hören, wenn ich von oben 'runterrufe?" ,fragte das kleine Mädchen. "Ja", sagte der Tod, "du brauchst auch nicht so laut zu rufen, denn für mich sind Himmel und Erde so nahe beieinander, wie wir sie einmal zusammen aus Kieselsteinen gebaut haben." - "Das freut mich" ,sagte das kleine Mädchen, "es ist bloß sehr schade, dass ich nicht mehr mit dir spielen kann. Jetzt spielt niemand mehr mit dir. Sei bloß nicht zu traurig darüber. Hörst du?"
"Es war schön, dass du mit mir gespielt hast", sagte der Tod, "und wenn ich einmal traurig werde, dann höre ich oben deine Glockenseele läuten und freue mich darüber, dass einmal ein Kind mit mir gespielt hat." - "Ja, tue das" ,sagte das kleine Mädchen, "und ich will dir auch etwas Wunderhübsches sagen, was mir die großen Engel erzählt haben. Die großen Engel sagen, dass einmal eine Zeit kommen wird, wo alle Glockenseelen zusammenklingen und alle Menschen mit dem Tod wie die Kinder spielen werden."
Manfred Kyber
DER KLABAUTERMANN ...
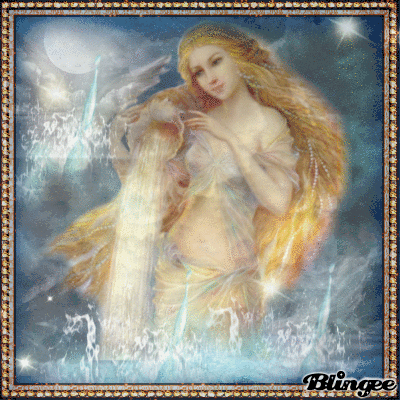
Dort, wo die blauen Wogen der Ostsee die schneeweißen Kreideklippen der Insel Rügen umspülen, lag vor langer Zeit, zwischen Felsen eingezwängt, ein einsames, winziges Fischerhaus. Gleich dem Neste der Seeschwalbe war es hoch über dem Meeresspiegel erbaut. Keine noch so hohe Flut vermochte das Bauwerk zu erreichen, und darum konnten seine Bewohner ohne Sorge auf die entfesselten Wogen blicken, wenn der Sturm sie brandend gegen die Felsen schlenderte. Mochten sie sich noch so gierig recken und dehnen, so hoch reichte ihre Macht nicht.
Lachend betrachtete Jan Classen, der Fischer, die vergeblichen Anstrengungen des Meeres, sein Heim zu vernichten, und die Wut, mit welcher die Wogen unverrichteter Sache schäumend und brausend wieder zurückstürzten. Ja, solch ein Unwetter vom sicheren Ort aus zu beobachten und der Gewalt der Fluten zu spotten, das war Jans größtes Vergnügen. Dann stand er vor seiner Hütte auf dem Felsenvorsprung, drückte die Lederkappe fest auf den Kopf und stemmte die harten braunen Hände in die Seiten. Sein sonst so gleichgültiges Gesicht schien Leben zu bekommen. In den festen Zügen mit den unzähligen Falten und Runzeln zuckte es wie Wetterleuchten, und seine Augen funkelten vor heimlicher Lust.
"Ja, brülle nur, tobe nur", schrie er in das Donnern des Meeres hinein, "mich sollst du nicht verschlingen! Mein Häuschen steht hoch, mein Kahn ist fest, und meine Hand hat Kraft genug, mein Fahrzeug zu zwingen!"
"Rede doch nicht so, Mann", mahnte eine tiefe Frauenstimme. In der Tür der Hütte erschien eine hochgewachsene, kräftige Frau; auch ihr Äußeres zeigte, daß ihr harte Arbeit und Kampf mit Wind und Wetter zur Gewohnheit geworden waren. Aus ihren Gesichtszügen sprach ruhiger Ernst. Große blaue Augen blickten treuherzig-freundlich, die gerade, scharfgeschnittene Nase, der fest geschlossene Mund und das starke Kinn deuteten auf Willensstärke, indessen sich über das gebräunte Antlitz ein Ausdruck von Gutmütigkeit verbreitete.
Gekleidet war sie in die dunkle Tracht, welche bei den Frauen Rügens üblich war. Zeugte der Anzug auch von großer Armut, so doch auch wiederum von peinlicher Ordnung und Sauberkeit.
Sie war einst ein hübsches Mädchen gewesen, die Helge, und viele junge Männer hatten sich um sie beworben, auch wohlhabendere als Jan Classen. Sie hätte nur zuzugreifen brauchen, und sie wäre des
reichsten Bauern Weib geworden und hätte heute in teuren Kleidern mit goldenen Knöpfen einhergehen können.
Ihre Mutter hatte ihr vergebens zugeredet, ihr Glück nicht von sich zu stoßen, und hatte die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen, als sie erfuhr, daß Helge den wilden, unbändigen, jähzornigen Jan heiraten wollte. Dieser besaß nichts als einen Fischerkahn, und ein Häuschen wollte er sich erst von seinen Ersparnissen bauen, die er als Steuermann eines Kauffahrers erworben hatte. Und doch wurde es so.
Allgemein bedauerte man, daß die brave Helge eine solche Wahl getroffen hatte, und die Mutter sagte ärgerlich: "Meinetwegen denn, wenn du dir einmal einbildest, daß du den wilden Menschen zähmen
willst. Komme mir aber später nicht mit Klagen!" Helge kam nicht mit Klagen, obgleich sie viel unter ihres Mannes Ungestüm und rohem Sinn zu leiden hatte.
Aber sie hatte ihn eben lieb und er sie auch.
Das Häuschen, welches Jan sich weitab von allen anderen erbaut hatte, war wohl klein, doch nett und wohnlich. Helge wußte der sehr bescheidenen Einrichtung eine solche Behaglichkeit zu geben, daß es jedem wohl tat, der in die kleine Stube trat. Aber nicht nur ihr kleines Hauswesen hielt sie in Ordnung; sie half ihrem Mann auch tüchtig bei der Arbeit. Sie fuhr mit hinaus zum Fischfang, trocknete und räucherte die Fische, strickte, flickte und wusch die Netze, kurz: Sie war eine richtige und echte Gefährtin ihres Mannes.
Ja, und wenn er es auch nicht laut sagte, er empfand ihren Wert gut und ehrte und liebte sie in seiner barschen Weise. Er gab viel auf ihren Rat und ihre verständige Rede, wenn er ihr auch scheinbar niemals recht gab. Vielleicht hätte sich seine Rauheit noch gemildert, wenn die bunte Wiege, die ihnen als Hochzeitsgabe verehrt worden war, nicht leer geblieben wäre. Doch Jahr um Jahr ging dahin, und das Paar blieb allein. Kein helles Kinderlachen unterbrach die Stille der Hütte, kein Kindesauge strahlte Jan und Helge an. Und sie hätten sich beide unendlich gefreut, wenn ihnen solches Glück beschert worden wäre.
So schön das Häuschen gelegen war, es gewährte einen prächtigen Ausblick auf das weite Meer, so gab es dabei doch einen Punkt, über den Helge mit ihrem Manne nie einig wurde, und das war die Nachbarschaft einer wunderbaren QueIle. Unweit der Hütte quoll klares, reines Wasser aus dem Felsen. Es war von einer merkwürdig blaugrünen Farbe, genau wie Seewasser, jedoch von süßem Geschmack. Als munteres Bächlein stürzte es sich über die Felsen hinab in das Meer, mit dem es sich sofort verband. Jan hatte sein Haus mit gutem Bedacht in die Nähe dieser Quelle gebaut, da Trinkwasser sonst nur aus großer Entfernung zu beschaffen war. Es gab zwar den Herthasee in der Nähe; aber daraus mochte niemand Wasser für den Haushalt schöpfen.
Kurze Zeit, nachdem Helge als junge Frau in ihr neues Heim gezogen war, fiel es ihr auf, daß sich in der Quelle jedesmal ein sonderbares Brausen und Rauschen bemerkbar machte, wenn sie ihre Eimer
dort füllte. Einigemale war es ihr vorgekommen, als ob ein wunderliches Gesicht sie aus dem klaren Wasserspiegel drohend angeblickt hätte, so daß sie erschrocken zurückfuhr.
Eines Tages wollte sie eben wieder zur Quelle gehen, da begegnete ihr der greise Knut, der Ziegenhirt, der wohl mehr als hundert Jahre alt sein mochte.
Als er sah, daß die Frau in der Felsenquelle Wasser schöpfen wollte, fiel er ihr entsetzt in den Arm und rief: "Was beginnst du, törichtes Weib, willst du mit aller Gewalt Unheil über dich und deinen Mann bringen? Weißt du nicht, daß diese QueIle der Eingang zur Wohnung des Klabautermanns ist?"
"Was sagst du", stammelte Helge erschrocken, "hier wohnt der boshafte Wassergeist, der seine Freude daran hat, wenn die Schiffe ins Verderben stürzen?"
"Jaja." Der Alte nickte.
"Dein Mann weiß es recht gut; aber in seinem wilden Frevelmut hat er sich fern von allen Menschen trotzig hier angebaut."Helge überlief es eiskalt. Sie überlegte, daß sie ja, ihren ganzen Bedarf
an Wasser von jeher aus dieser Quelle geschöpft hatte und daß ihr auch in Zukunft nichts anderes zu tun übrig blieb.
Wie, wenn dies nun den Zorn dieses unheimlichen Wasserzwerges erregte, der von den Seeleuten so gefürchtet war? Hatte sie nicht oft erzählen hören, wie der Klabautermann, lachend seine Laterne schwenkend, auf dem Kiel des Schiffes hockte oder in den Rahen umherkletterte, wenn des Wetters Ungestüm das Schiff, das dem Untergang geweiht war, in seinen Fugen erbeben ließ? Wenn der Blitz den Mast zerschmetterte, wenn die wilden Wogen das Steuer entrissen, wenn das unglückselige Wrack dem Untergang nahe war und die Besatzung dem Wellentod entgegensah, dann jauchzte der Klabautermann, und bis zum letzten Augenblick verweilte er auf dem untergehenden Fahrzeug.
Versank es endlich in den tosenden Fluten, so war der letzte Ton, der an die Ohren der Ertrinkenden schlug das gellende Gelächter des Klabautermanns. Und aus seinem Bereich war Helge gezwungen, Wasser zu holen! Natürlich hatte sie diese Tatsache sofort ihrem Manne mitgeteilt und ihn inständig gebeten, sich doch bei all den anderen Menschen im Dorf ein neues Häuschen zu bauen. Gern wollte sie alle ihre Ersparnisse hingeben, um nur dieser gefährlichen, unheimlichen Nachbarschaft zu entgehen.
Aber da war sie schön angekommen! Jan wollte über Helges Entsetzen schier platzen vor Lachen und rief: "Närrisches Weib, denkst du, ich weiß nicht, wer unser Nachbar ist? Das ist es ja eben, was mir Spaß macht, daß uns der wunderliche Kauz Trinkwasser geben muß, er mag wollen oder nicht. Sei nicht so dumm, dich zu fürchten! Der Klabautermann ist kein so schlimmer Gesell, wie du glaubst. Ich habe Beispiele genug gehört, daß er Schiffer und Fischer sogar beschützt hat."
"Um so weniger hättest du seinen Unwillen herausfordern sollen", entgegnete die Frau ernst. "Man muß die Bosheit nie herausfordern und die Gutmütigkeit nicht mißbrauchen. Warum störst du den
Wassergeist in der Stille seiner Wohnung? Ich glaube nicht, daß es ihm gefällt, wenn ich den Eimer in die Quelle hinab lasse."
"Ach, Weibergeschwätz", brummte der Fischer. "Wenn ihm meine Nachbarschaft nicht gefällt, mag er fortziehen!"
Helge seufzte. Sie wußte leider schon längst, daß ihr Mann niemals auf vernünftige Vorstellungen hörte, sondern nur seinem Eigenwillen folgte. Seit der Zeit ging sie mit Zagen und Widerwillen nach der Quelle. Viel lieber wäre sie drei Stunden nach dem Herthasee gegangen. Allein dessen Wasser war am Ufer oft trüb und schlammig. Sie schöpfte von nun an mit der größten Vorsicht und vergaß niemals, vorher hinabzurufen: "Bitte erlaube mir, ein wenig Wasser hier zu schöpfen." Alsdann war es ihr, als ob aus dem Wasserspiegel ein runzliges Antlitz zustimmend nickte.
Es war an einem sonnigen Sommernachmittag. Das Meer glitzerte ,und glänzte im Sonnenschein und murmelte leise wie ein Waldbächlein. Über ihm wölbte sich tiefblau die Himmelsdecke. Am Horizont flossen Himmel und Meer so innig zusammen, als ob man dort aus einem ins andere schreiten könnte. Helge war zur Quelle gegangen, hatte aber ihre Eimer hingestellt und saß nun, die Hände über dem Knie verschränkt, nachdenklich auf einem Felsenvorsprung. GedankenvoIl blickte sie in die Ferne.
Dort draußen die weißen Punkte waren wohl die Fischerboote, bei denen sich auch Jan befand. Sie fühlte sich heute wieder einmal recht einsam. Die schwüle Stille wirkte niederschlagend auf ihr Gemüt. Es war so leer, so öde um sie. Warum war ihr nur das Glück nicht beschieden, ein Kindlein zu besitzen? Unwillkürlich hatte sie ihren Gedanken Worte verliehen; da, plötzlich ein Schrei, ein Platsch -- und als sie sich erschrocken umsah, bemerkte sie, daß von dem steilen Abhang ein kleines Kind in die Quelle gefallen war. Diese war tief.
Rasch und entschlossen beugte sich Helge über den Brunnenrand. In dem selben Augenblick tauchte das Kind wieder empor. Sie erfaßte es, und mit einem kräftigen Ruck hob sie es hoch. Es war ein Knabe von vielleicht drei Jahren. Weder der Fall noch das Bad schienen ihm geschadet zu haben; denn er blickte seine Retterin mit hellen Augen an und lachte. Schön war er nicht, das mußte man sagen.
Auf einem kleinen, schmächtigen, aber starkknochigen Körper saß ein großer, dicker Kopf, bedeckt mit lang strähnigem schwarzem Haar, das zottig in die breite, niedere Stirn hinein hing. Die gelbe Haut war straff über die hervorstehenden Backenknochen gezogen. Ein breiter Mund mit wulstigen Lippen ließ zwei Reihen mächtiger Zähne erkennen. Eine kleine, plumpe Nase gereichte dem Gesicht durchaus nicht zur Zierde, und nur die beweglichen grauen Augen verschönten das selbe einigermaßen. Im Grunde bot der Junge den Anblick eines recht häßlichen, kleinen Ungetüms. Er schien überdies auch keineswegs von reicher Herkunft zu sein; denn das einzige Kleidungsstück, das er trug, war ein grob wollener, brauner Kittel. Seine krummen Beinchen waren unbedeckt.
Was fragt denn aber ein Frauenherz nach Schönheit, wenn sein Mitgefühl für ein hilfsbedürftiges Wesen erweckt wird! Frau Helge trocknete den armen Schelm mit ihrer Schürze ab und fragte ihn besorgt, ob er sich weh getan habe. Da riß der Kleine den Mund weit auf und schrie: "Nein, Purzelbaum macht, bums, platsch!" Dabei bezeichnete er den Vorgang so komisch mit Händen und Beinen, daß die Frau mitlachen mußte. Endlich fragte sie den Knaben, der es sich auf ihrem Schoß bequem gemacht hatte: "Wie heißt du denn, mein Söhnchen? Wer sind deine Eltern, und wo wohnst du?"
Der Knabe schien aber gar nicht zu verstehen, was die Frau wissen wollte, sondern rief nur, vergnügt mit den Beinen strampelnd: "Bautzmann, Bautzmann!"
"Du kannst doch nicht Bautzmann heißen", erwiderte verwundert Helge. Aber: "Oja, oja!" beteuerte der Kleine lachend und zappelnd. Helge überlegte, was sie wohl mit dem Kind anfangen sollte. Es
hatte etwas so Fremdartiges an sich und schien durchaus keine Auskunft über seine Angehörigen oder seine Heimat geben zu können. "Willst du mit mir kommen?" fragte sie von neuem, und "ei ja, ei
ja! Hunger, essen!" antwortete der Kleine.
Das ließ sich die Frau gesagt sein. Rasch füllte sie ihre Eimer, hob den einen auf die Schulter und hieß den Kleinen sich an der Hand festhalten, mit welcher sie den anderen Eimer trug.
Hei, wie der Junge mit den krummen Beinchen rennen konnte! Im Häuschen angekommen, holte Helge Ziegenmilch und Brot herzu, um den Hunger ihres Findlings zu stillen. Dieser war auf die Bank
geklettert und stemmte die Ärmchen auf den Tisch, als ob er von jeher hier daheim gewesen wäre. In unglaublich kurzer Zeit hatte er die Speisen verzehrt; doch war er nicht so unbescheiden, noch
mehr zu fordern, obgleich sich Helge erbot, ihm noch Milch und Brot zu holen.
Er machte es sich bald bequem, streckte sich auf die Bank, legte den Kopf auf den Arm und schlief ein. Kopfschüttelnd betrachtete die Frau den kleinen Schläfer. Er war doch ein gar zu wunderliches Geschöpf. Was würde wohl ihr Mann zu dem kleinen Gast sagen? Es wurde Abend. Helge war mit dem Zubereiten des Abendbrotes fertig und trat hinaus, um nach Jan auszuschauen. Da nahten die Boote schon. Flink lief sie zum Ufer hinab, um beim Landen zur Hand zu sein. Ihr Mann winkte ihr schon von weitem fröhlich zu und rief herüber: "Solchen Fang wie heute habe ich noch nie gemacht. Schau her, Weib, das Boot faßt die Fische kaum!"
HeIge schlug die Hände vor Erstaunen zusammen. Da galt es, sich zu rühren, um das Glück richtig zu nützen, damit die schöne Beute nicht verderbe. Vorläufig wurden die Fische in Fässer getan und für die Nacht an einen kühlen Ort gestellt. Morgen in aller Frühe sollte es an das Einsalzen oder Trocknen gehen. Die Sonne war bereits untergegangen, als Jan und Helge in die Stube traten, um sich das wohlverdiente Abendbrot schmecken zu lassen. Erst jetzt fiel es der Frau ein, daß sie ganz vergessen hatte, ihrem Mann von dem kleinen Ankömmling etwas zu sagen.
Im Halbdunkel kollerte den Eintretenden ein sonderbares Etwas entgegen. Es war der kleine Junge, welcher ausgeschlafen hatte und nun zum Zeitvertreib Purzelbäume in der Stube schlug. Verwundert prallte Jan zurück; doch Helge erzählte kurz und bündig, während sie die Tranlampe anzündete, wie sie zu dem Kinde gekommen sei. Prüfend betrachtete der Fischer den wilden Knaben. Dann packte er ihn mit raschem Griffe beim Genick, stellte ihn auf die Beine und sagte: "Na, mal still, Knirps, muß doch sehen, was du eigentlich für ein Kerlchen bist."
Der guckte ihn von unten herauf mit einer so komisch ernsthaften Miene an, daß Jan in lautes Lachen ausbrach und rief: "Gelt, Weib, gerade so hätte unser Söhnchen nicht ausschauen sollen. Ich werde morgen nach der Arbeit Umfrage halten, wohin der kleine Schelm gehört. Sollte sich jedoch niemand zu ihm finden, nun, so mag er eben bei uns bleiben." Ein listiger Blick schoß aus des Knaben Augen nach Jan und Helge. Diese jedoch bemerkten es nicht. Helge hob ihn auf die Bank, damit er an der abendlichen Mahlzeit teilnehme.
Jans Nachforschungen nach des Kleinen Eltern und Heimat blieben erfolglos, obgleich er sie beharrlich wochenlang fortsetzte. Bautzmännchen zeigte auch gar kein Verlangen, wieder fortzukommen, sondern fühlte sich in Classens Hause ganz heimisch. Helge war dies recht. Sie hatte den Wildfang lieb gewonnen. "Er sieht auch gar nicht so häßlich aus, wie es mir anfangs vorkam", sagte sie zu ihrem Mann. Doch dieser schlug ihr lachend auf die Schulter und fügte hinzu: "Weil du dich bereits an den Kleinen gewöhnt hast!"
Wochen und Monate gingen dahin. Der Knabe, den man Klaus genannt hatte, weil Bautzmann doch gar zu sonderbar klang, brachte Leben in das eintönige Dasein Jans und Helges. Er tummelte sich auch sorglos außerhalb des Häuschens, kletterte mit den beiden Ziegen um die Wette oder bat den Fischer so lange, bis er ihn mit auf den Fischfang nahm. Dann hockte er auf der Spitze des Kieles, und wenn das Boot auf bewegten Wellen auf und nieder tanzte, schrie er lustig: "Hoioho, hoioho!"
Anfänglich war Jan ängstlich gewesen, das Kerlchen könne am Ende ins Meer fallen. Aber diese Sorge schwand bald; denn Klaus klebte wie eine Klette an dem Kahn. Und als er eines Morgens doch ins Wasser purzelte, sah Jan zu seinem höchsten Erstaunen, daß er schwimmen konnte wie eine Wassermaus. Das schien ihm doch nicht mit rechten Dingen zuzugehen, und bedenklich sah er den Jungen von der Seite an, als er wieder im Boot stand und wie ein nasser Pudel das Wasser abschüttelte. Bald aber beruhigte er sich. Er dachte: Der Klaus ist jedenfalls älter, als wir gemeint haben. Er ist nur so klein, und bei seinem häßlichen Gesicht läßt sich das Alter schwer bestimmen. Es ist schade, daß er darüber keine Auskunft geben kann.
Einige Tage später begleitete Klaus seine Pflegemutter, die eine Bütte voll Fische nach dem Markte trug. Unterwegs begegnete ihnen der alte Knut, der Ziegenhirt. Kaum hatte er den Knaben an Helges Seite erblickt, so fuhr er zusammen, als ob ihn eine Natter gestochen hätte. Starr sah er ihn an und hob warnend die Hand in die Höhe. "Woher habt Ihr denn den Jungen, Helge Classen?" rief er aus. "Schafft ihn schleunigst wieder hin, wo Ihr ihn gefunden habt. Denkt an meinen Rat!"
Klaus war hinter die Frau getreten und schnitt dem Hirten eine fürchterliche Fratze, wobei er drohend die kleine Faust ballte. Doch dieser ließ sich nicht irremachen, sondern sagte mit erhobener Stimme: "Er scheint aus Holland zu stammen, man hört es an der Sprache. Jaja, dort gibt es Leute, die haben Wohnungen wie die Dachse und Füchse. Nur daß sie mit Wasser gefüllt sind und ihre Ausgänge an den Ufern aller Meere haben, damit sie bei der Hand sind, wenn Sturm und Wetter die Schiffe in Not bringen!"
Hätte jetzt Frau Helge Obacht auf ihren Schützling gehabt, so würde sie mit Entsetzen die Veränderung bemerkt haben, die mit ihm vorging. Die Füße schienen vor Wut den Erdboden zerstampfen zu wollen. Die Gesichtszüge waren verzerrt. Aus dem Munde fletschten die Zähne wie bei einem Raubtier, und die Augen schienen Flammen zu sprühen. Von alledem nahm die gute Frau jedoch nichts wahr. Sanft antwortete sie: "Wir haben das hilflose Kind aufgenommen, weil niemand es haben mochte, und bis jetzt haben wir keine Ursache, den armen Schelm wieder fortzujagen. Uns ist endlich ein Kind geschenkt worden, das wir liebhaben können. Nicht wahr, Klaus, du hast uns auch lieb?"
Bei den freundlichen Worten Helges hatten sich die Mienen des Knaben wieder aufgehellt, und jetzt antwortete er freundlich, nicht ohne einen Seitenblick auf Knut, der mit vorgestrecktem Kopf
aufhorchte: "Ja, habe euch lieb; Bautzmann will bei euch bIeiben!"
Bei dem Namen Bautzmann zuckte Knut zusammen, fuchtelte nochmals warnend mit seinem Stock in der Luft herum, sagte aber nichts mehr, sondern hinkte davon.
So war der Spätherbst gekommen. Das Wetter wurde von Tag zu Tag stürmischer und für die Fischer gefährlicher. Mit Sorge sah Helge oftmals ihren Mann hinausfahren auf die stürmische See. Sein alter Trotz und Übermut, die eine Zeit lang geruht hatten, brachen plötzlich mit Gewalt wieder hervor, und er achtete weder auf Bitten noch auf Warnungen. Seine Lust an der Gefahr überwog alle vernünftigen Vorstellungen.
Auch den kleinen Klaus befiel eine merkwürdige Unruhe. Er kam oft den ganzen Tag nicht heim, und Helge lebte in fortwährender Angst, daß ihm ein Unglück widerfahren sei. Seit die schlimme Witterung eingetreten war, durfte er Jan nicht mehr beim Fischfang begleiten. Seine Bitten wurden rauh zurück gewiesen: "Das fehlte mir noch, auf einen unnützen Bengel aufpassen zu müssen, wenn man alle Hände voll zu tun hat, um mit Wind und Wasser fertig zu werden. Warte, bis du groß bist, dann kannst du mir helfen!"
Eines Tages rüstete sich Jan wieder zum Fischfang. Der Sturm heulte um die Hütte, als ob alle bösen Geister los gelassen wären. Dichte Nebel verhüllten das Meer. Die Sonne glich einem schwefelgelben Ball, der sich mühsam im Firmament fortwälzte. Als Jan das Boot klar machte, war ihm Helge gefolgt. Sie war zum Mitfahren fest entschlossen, damit ihr Mann wenigstens jemanden in der Nähe habe, der ihm beistehen könne. Aber barsch und ungestüm hatte dieser ihre Hilfe zurückgewiesen.
"Ich bin Manns genug", schrie er ihr zu, "und ich brauche keinen Weiberbeistand. Du willst mich wohl gar retten, wenn es an Hals und Kragen geht? He? Da müßte ich mich ja schämen und auslachen lassen! Nein, du bleibst daheim. Punktum!"
Als Jans Boot in den wallenden Nebelmassen verschwunden war, kehrte Helge tiefbetrübt ins Häuschen zurück. Eben schlüpfte Klaus mit einem listigen Lächeln zur Hintertür hinaus, als die Frau in die Stube trat und sich nach dem Knaben umsah. Es war ihr gar nicht lieb, daß auch er sich bei dem bösen Wetter umhertrieb. Wollte er es ihrem Manne nachtun? Der Tag schlich dahin. Gegen Abend hellte sich der Himmel etwas auf. Heute war Vollmond. In Helges geängstigtem Herzen stieg die Hoffnung auf, daß ihr Mann beim Mondenschein zurückkehren werde, wenn nur das Meer sich erst etwas beruhigte.
Auch Klaus war den ganzen Tag nicht heimgekommen. Wo trieb sich nur der Bub umher? Die Frau trat vor die Tür, um nach ihm auszuschauen. Siehe, da nahte der alte Knut. Er winkte und machte schon von weitem allerhand Zeichen, daß Frau Helge mit ihm kommen solle. Ein Schrecken durchfuhr sie. War ein Unglück geschehen? Knut ging eilenden Schrittes den steilen Weg hinab, der in das Tal führte, wo der Herthasee lag. Immer winkend, rief er Helge halblaut zu: "Geschwind, geschwind, daß wir unten sind, wenn der Mond aufgeht. Da werdet Ihr sehen, was Ihr mir nicht glauben wolltet!"
Der Frau klopfte das Herz. Was sollte sie nur erfahren? Jetzt waren sie angekommen. Knut faßte sie bei der Hand und zog sie hinter einen Felsvorsprung von dem aus man ungesehen das Tal beobachten konnte. Alles lag still. In wunderlichen Formen und Gestalten wallten die Nebelschleier durcheinander. Ein fahles Licht ließ alles noch unheimlicher erscheinen. Aus dem sumpfigen Boden am Rande des Sees tauchten zahllose Irrlichter auf. Leuchtende Dünste durchzogen die Luft.
Es war ein Leben und Treiben, das unheimlich aussah. Plötzlich erschien den Mond über den Hügeln, und sofort veränderte sich das Bild. Den Abhang herab schritt Hertha, eine große weißgekleidete Frau. Weithin wallte ihr goldblondes Haar gleich einem mächtigen Schleier. Ihre großen blauen Augen strahlten in mildem Glanz; doch über ihrer ganzen Erscheinung lag der Ausdruck tiefer Trauer. Als sie am See angekommen war, umringten sie zahllose weibliche Wesen, die aus den Nebeln entstanden waren.
Sie brachten einen goldenen Wagen herbei, den sie vorher im See gewaschen hatten. Aber siehe, er war morsch, und die Speichen seiner Räder waren zerbrochen. Im wogenden Reigen zogen sie den Wagen hinweg, und nun umtanzten Kobolde und Erdgeister die betrübte Frau, die teilnahmslos am Seeufer saß und nach dem stillen Monde blickte. Da veränderte sich das Bild. Mitten auf dem See kam ein sonderbares Wesen in einem Muschelwagen gefahren.
Beinahe hätte Helge laut aufgeschrien und "Klaus!" gerufen, wenn ihr nicht zu rechter Zeit Knut die Hand auf den Mund gelegt hätte. Das Männchen sah aber durchaus nicht kindlich aus, sondern trug einen langen, dunklen Bart, auf dem Kopf eine Lederkappe und war nach Art der holländischen Schiffer gekleidet. In der Hand hielt es eine weithin leuchtende Laterne, weIche es lustig im Kreise schwang. Vor der weiß gekleideten Frau machte es halt, verneigte sich und schien ihr leise etwas mitzuteilen, wobei es mehrmals nach der Richtung deutete, in der Classens Hütte lag.
Ein Schimmer von Heiterkeit überflog Herthas Gesicht, als sie den Kleinen Abschied nehmend freundlich grüßte. Dieser lenkte alsbald seine Muschel nach der Mitte des Sees, wo er versank. In diesem Augenblick kamen düstere Wolken und verhüllten den Mond. Im Nu verschwanden auch die übrigen Gestalten auf dem Herthasee sowie Hertha selbst. In der Luft ertönte ein dumpfes, entsetzliches Brausen, und mit doppelter Gewalt brach das Unwetter wieder los. Helge war regungslos. Ihr wirbelte der Kopf von dem Gesehenen. Der Schrecken nahm ihr den Atem und ließ sie keinen Gedanken fassen.
Da packte Knut sie am Arm und rief: "Wißt Ihr nun, wen Ihr bei Euch aufgenommen habt? Habt Ihr den Klabautermann erkannt?" HeIge konnte nicht antworten. Sie nickte nur stumm und ließ sich willenlos von dem Hirten hinweg ziehen. Es war schwer, das Häuschen zu erreichen; denn die Naturgewalten schienen sich verschworen zu haben, den entsetzlichsten Reigen aufzuführen. Das Meer brüllte und schleuderte Wogenberge brandend gegen die Felsen, als ob es das Eiland vernichten wollte. Jammernd rang Helge die Hände; denn aus diesem Aufruhr der Natur kehrte wohl ihr Mann nimmer zurück.
Voll Trotz und sehr befriedigt, sein Weib zurückgewiesen zu haben, segelte Jan hinaus auf die See. Obgleich Wind und Nebel für den Fischer keine Verbündeten sind, senkte er doch die Netze ins Meer. Er hatte aber heute entschieden Unglück. Zuerst geriet das Netz an eine Klippe, und es war noch gut, daß es völlig zerriß; denn beinahe wäre durch die Gewalt des Rucks das Boot gekentert. Während Jan damit beschäftigt war, das Netz aus dem Wasser zu ziehen, legte sich der Wind in das Segel, und von neuem kam das Schiff in Gefahr umzuschlagen. Jan arbeitete aus Leibeskräften, um das Segel zu reffen; denn der Sturm erhob sich immer mehr.
Nur mit äußerster Anstrengung gelang es ihm endlich. Dichter und kälter umgaben die Nebelmassen den einsamen Fischer. Kaum konnte er die blendend weißen Schaumkämme der heranstürzenden Wogen erkennen. Doch der wetterharte Mann verzagte nicht. Mit eiserner Faust hielt er das Steuer und lugte scharf aus, daß er vor dem Winde blieb. Allerdings sagte er sich, daß er auf diese Weise keine Aussicht hätte, wieder in die Nähe der Heimatinsel zu gelangen, sondern vielmehr auf das weite Meer hinaus trieb. Mittag war vorbei, als sich der Wind einigermaßen legte und hier und da ein Riß in der Nebelwand entstand. Eiligst hißte Jan das Segel auf, und durch Kreuzundquerfahrt hoffte er, die Rückkehr noch vor dem Dunkelwerden bewerkstelligen zu können. Es sollte ihm nicht gelingen.
Der Sturm schien nur Atem geholt zu haben; denn als der Abend nahte, erhob er sich mit erneuter Gewalt. Gleichzeitig brach eine dichte Finsternis herein, und der unglückliche Fischer sah sich rettungslos dem empörten Meere preisgegeben. Vergebens kämpfte er mit Aufbietung seiner letzten Kräfte in Todesangst um sein Leben. Längst waren ihm das Spotten und das Trotzen vergangen. Noch einmal durchbrach der Vollmond die Wolken und den Nebel; dann wurde es wieder tiefe Nacht. Stumpf und starr, nur noch krampfhaft das Steuer umklammernd, hockte Jan in seinem Boot.
Da, plötzlich, was war das? Welch sonderbarer Lichtschein? Was kauerte denn da vorn auf dem Kiel? Dem Fischer lief es eiskalt über den Rücken, als er erkannte, daß es ein zwerghaftes Männchen mit
einem langen Bart war, welches eine Laterne im Kreise schwang und gellend dazu lachte. "Der Klabautermann!" murmelte der erblassende Jan.
"Ja, der Klabautermann!" kreischte der Kleine. "Erkennst du mich nicht?"
"Klaus, Bautzmann!" rief entsetzt der Fischer.
"So ist es", entgegnete der. "Ich bin Helges und dein Pflegesohn. Euch zu prüfen, kam ich in euer Haus. Jetzt siehst du nun, eigenwilliger, hochmütiger Mensch, wohin dich dein wilder Trotz
geführt hat."
Jan vermochte nicht zu antworten. Seine Zähne schlugen klappernd gegeneinander, und die helle Verzweiflung malte sich auf seinen Zügen. Seine schlotternden Beine trugen ihn nicht mehr. Kraftlos sank er in sich zusammen, und seinen Händen entglitt das Steuer. Hei, wie das befreite Schifflein nun auf den turmhohen Wogen tanzte; ein lustiges Spiel, wenn es nur nicht so verderblich gewesen wäre! Des Fischers Übermut war gebrochen. Er ergab sich in sein Schicksal und erwartete den Tod, den er selbst heraufbeschworen hatte. "Klaus", bat er mit leiser, demütiger Stimme, "ich habe mein Los verdient. Wenn es aber noch eine Gnade für mich gibt, so bitte ich dich: Grüße mein armes Weib, tröste sie und verlasse sie nicht!"
Der Kleine hob seine Laterne empor und leuchtete dem Mann ins Gesicht. Nachdem er ihn durchdringend angesehen hatte, rief er. "Will sehen, was sich für dich tun läßt." Und für sich setzte er
hinzu: "Diese Lehre wird er nicht vergessen!" In dem selben Augenblick raste eine Riesenwelle heran, und -- verschwunden war das kleine Fahrzeug mit seinen Insassen.
Am andern Morgen ging die Sonne fröhlich und heiter auf, gerade als ob niemals ein Unwetter sie verdunkelt hätte. Das Meer murrte noch ein wenig, die Wellen schlugen noch unruhig gegen den
Strand; aber die unendliche Wasserfläche machte einen friedlichen Eindruck.
In Classens Hütte war es still. Helge saß vor dem großen Bett, dessen bunt geblümte Vorhänge zurückgeschlagen waren, und blickte besorgt auf ihren Mann, der mit verbundenem Kopf in den Kissen lag und im Fieber irre redete. Sie beachtete die eigene Erschöpfung nicht. Hatte sie doch die ganze Nacht in Sturm und Graus am Ufer gestanden und in Angst auf ihren Mann gewartet. Beim Morgengrauen hatte sie auf einmal ein kreischendes "Hoioho" vernommen. Gleich darauf spülte eine Welle mit dumpfem Krach ein Boot ans Ufer, in dem sich, mit einem Seil an die Ruderbank festgeschnürt, Jan befand.
Voll Schreck und doch voll Jubel hatte Helge ihren Mann losgeknüpft. Freilich gab er nur schwache Lebenszeichen von sich und blutete aus einer Kopfwunde; aber die brave Helge hob ihn auf und trug ihn in die Hütte. So befand sich nun der Fischer in treuer Pflege, und nach wenigen Tagen hatte das gute Weib die Freude, ihren Mann genesen zu sehen. War dies aber noch ihr wilder Jan? Er war wie ausgewechselt.
Ernst und sanft, ruhig in seinem ganzen Benehmen, konnte sie ihn kaum wiedererkennen. Er bemerkte das freudige Erstaunen seiner Frau und benützte die erste Gelegenheit, als sie abends bei der Lampe behaglich beisammen saßen, ihr die Erlebnisse seiner letzten Schreckensfahrt zu erzählen. Am Schluss reichte er ihr die Hand und sagte: "Von nun an will ich ein anderer werden. Nie wieder werde ich mich mutwillig in Gefahr begeben. Wir wollen uns im Dorf bei all den anderen Menschen anbauen, dann werden wir auch den Klabautermann in Zukunft nicht mehr belästigen." Wie froh war Helge über diesen Entschluß! Sie erzählte, was sie mit Knut gesehen hatte, und Jan hörte ihr voll Staunen zu.
Im nächsten Frühjahr wurde im Dorf ein neues Häuschen erbaut. Es gehörte Jan Classen. Schon im Spätsommer konnte das glückliche Ehepaar einziehen. Hier sollte ihnen auch eine Freude zuteil
werden, die ihnen bisher versagt geblieben war; denn im Herbst lag ein prächtiger Junge in der bunten Wiege. Von nun an wurde ihr Glück durch nichts gestört.
Den Klabautermann sahen sie nie wieder. Sein Andenken aber hielten sie in Ehren und litten nicht, daß man ihn einen boshaften Wassergeist schalt.
Sage von der Ostsee
DAS MÄRCHEN VON FANFERLIESCHEN SCHÖNEFÜSSCHEN ...

Es war einmal ein König, der hieß Jerum, und sein Land hieß Skandalia, und er regierte in der Stadt Besserdich. Dieser Jerum war gar nicht viel wert, er quälte seine armen Untertanen bis aufs Blut, so dass sie Jahraus, Jahrein schrien. "O Jerum, o Jerum, sieh auf Skandalia und besser dich!" Er wirtschaftete aber immer drauf los und war ganz das Gegenteil seines verstorbenen Vaters, dessen Sterbetag die Bürger von Besserdich jährlich mit großer Traurigkeit feierten.
Vor diesem Tage ritt der böse Jerum immer mit seinem ganzen Hofstaat nach einem fernen Jagdschloss Munkelwust, um nicht die Liebe seiner Untertanen zu seinem seligen Vater zu sehen. Als er nun
einstens mit unanständigem Hörnergeblase und Peitschengeknall am Tag vor dem Trauerfest der Stadt hinaus zog, sah er nah an dem Tore vor einem kleinen Hause eine alte Frau ihre Ziege kämmen. Da
nahm er seinen Bogen und legte einen Pfeil auf und verwundete der alten Frau die Ziege. Die Alte ergrimmte sehr und schrie ihm nach:
"O Jerum, o Jerum,
meine Ziege geschossen.
O Jerum, o Jerum,
dir selbst zum Possen;
sie ist ein armes Waiselein,
wird Königin im Lande sein."
Jerum bekümmerte sich nicht um das Geschrei der Alten und sprengte im Galopp zur Stadt hinaus. Die Alte hieß Fanferlieschen und war eine außerordentlich kluge Hexe; bei dem verstorbenen Vater des
König Jerum hatte sie sehr viel gegolten; sie hatte damals große Macht in Händen und dem Lande viel Gutes getan. Wenn der alte König einen Minister oder General oder Gelehrten haben wollte, so
ging er nur zu Fanferlieschen, die damals sehr schön war, und sprach nur:
"Fanferlieschen
hat schöne Füßchen,
nicht zu lang, nicht zu kurz;
schüttle mir aus deinem Schurz
einen guten Staatsminister!"
"Herr, da ist er!" sprach sie dann und schüttelte ihn aus der Schürze. So hatte sie dem König viele geschickte Leute verschafft.
Aber als der Jerum an die Regierung kam, wurde Fanferlieschen vertrieben, ja er ließ ihr ein großes Loch von seinen Jagdhunden in die Schürze reißen und misshandelte sie auf alle Weise. Da zog Fanferlieschen in ein kleines Haus in der Vorstadt und mästete Vieh und Geflügel, und man wunderte sich über gar nichts, als dass sie niemals einen Ochsen oder Esel oder ein Pferd oder einen Puthahn oder sonst etwas verkaufte.
Aber oft hörte man sie in der Nacht, wenn alles ganz still war, sehr ernsthafte Staatsgespräche mit ihrem Vieh halten, und lautete es nicht anders, als wenn die größten Professoren bei ihr versammelt wären, so dass es ordentlich in der ganzen Stadt ein Sprichwort war, wenn einer von den Hofleuten des König Jerum einen üblen oder dummen Streich machte, zu sagen: "Dieses Rindvieh hat nicht bei dem Fanferlieschen studiert!"
Als ihr der Jerum nun die Ziege verwundet hatte, geriet Fanferlieschen in den höchsten Zorn gegen ihn und entschloss sich, Rache an dem König zu nehmen. Sie legte die geliebte Ziege in ein schönes Bett und verband ihr die Wunde mit Kräutern und Wein.
In der Stadt machte man schon alle Anstalten, das Andenken des verstorbenen guten Königs Laudamus zu feiern. Alle Häuser waren mit schwarzem Tuch behängt, auf allen Türmen und Rauchfängen wehten schwarze Fahnen. Alle Glocken, die geläutet wurden, hatten Schwarze Flöre an den Schwengeln. Alle Bürger zogen schwarze Wäsche und Kleider an, alle Perückenmacher puderten schwarz, alle Schimmel waren Rappen, man aß nichts als Schwarzwildbret und Schwarzwurzeln und Schwarzsauer.
In solcher entsetzlichen Schwärze waren bereits alle Einwohner in der großen Kirche der heiligen Nigritia um das Grab des Königs Laudamus versammelt, auf welchem viele tausend schwarze Fackeln brannten, und warteten nur noch auf das Fräulein Fanferlieschen, um ihre Trauergesänge anzufangen. Denn Fanferlieschen pflegte alle Jahre dieses Trauerfest mit einem großen Leichenzug zu verherrlichen.
Sie kam immer an der Spitze ihres sämtlichen schwarzen Horn- und Federviehs durch die Stadt in die Kirche gezogen, und es war den guten Bürgern nichts so rührend, als alle die schwarzen Pferde, Esel, Stiere, Kühe, Böcke, Ziegen, Schafe, Schweine, Hunde, Katzen, Puthähne, Pfauen, Haushähne, Hühner, Schwanen, Gänse und Enten usw. die bittersten Tränen vergießen zu sehen. Ein großer Teil in der Mitte der Kirche war für sie und ihren Zug frei gelassen.
Die Bürger harrten; da kam der Kirchendiener und zeigte an, dass der Zug der Fanferlieschen sich nähere; die Tore wurden aufgetan, und man sah Fanferlieschen in schwarzem Samt gekleidet mit einer Krone von schwarzen Brillanten neben einer schwarzen Portechaise hergehen, die von zwei schwarzen Eseln getragen wurde. Vor ihr her ging ein schwarzer Pudel auf den Hinterbeinen, der trug Fanferlieschens Schürze, welche dem Lande so viel Gutes getan und von den Jagdhunden des Jerums zerrissen worden war, an einer Stange als Trauerfahne, und hinter der Trauer-Portechaise folgten viele schwarze Böcke und Ziegen mit Trauerflören und Zitronen auf den Hörnern.
Dann kam alles übrige schwarze Horn- und Wollen- und Federvieh, alle mit Zypressenzweigen und Kränzen geziert. Kurzum, die ganze Herde des Trauerviehs war auf die rührendste und anständigste Art geschmückt und bezeugte ein tiefes Leidwesen. Als jedermann und jedes Vieh seinen Platz eingenommen, wurde eine kohlrabenschwarze Melodie gesungen, und dann stieg Fanferlieschen auf das Grab des König Laudamus und erzählte den Bürgern alle seine guten Eigenschaften, worüber sie alle gallenbittere Tränen weinten, so schwarz wie Tinte.
Zuletzt kam sie auf die Bosheit des Königs Jerum zu sprechen und sagte: "Endlich ist es Zeit, dass wir ihm das Tor vor der Nase zumachen, seine Bosheit ist auf das höchste gestiegen: Als er gestern mit seinem gottlosen Hofstaat dem Tore hinaus ritt, stand ich vor meiner Türe und kämmte der Fräulein Ziegesar die schwarzen Locken zu dem heutigen Feste; da verwundete er mir diese geliebte Waise mit einem mutwilligen Pfeilschuss."
Bei diesen Worten Fanferlieschens entstand ein gewaltiges Murren in der Kirche, und alle Fackeln auf dem Grabe des König Laudamus knisterten und flackerten und tröpfelten schwarze Wachstränen herab. Der älteste Bürger der Stadt, der sich seine weißen Haare und seinen weißen Bart heute ganz schwarz gepudert hatte, trat zu Fanferlieschen und sprach:
"O Fanferlieschen, deine große Freundschaft mit dem seligen Laudamus, der Anblick deiner zerrissenen Schürzenfahne, aus der uns einst so viel würdige Staatsmänner geschüttelt wurden, dein stilles Leben, deine edlen Bemühungen zur Erziehung und Bildung unvernünftigen Viehs, ach! alles, was wir von dir wissen, lehrt uns, dass keine Lüge aus deinem Munde kommt; aber sage uns, wen verstehst du unter dem Fräulein Ziegesar?" -
"Wen soll ich darunter verstehen", sagte Fanferlieschen, "als jenes liebenswürdige Töchterlein des verstorbenen Fürsten von Buxtehude, dessen Land von seinem Freunde, dem verstorbenen Laudamus, verwaltet wurde, bis das liebe Fräulein herangewachsen sei, welches hier nebst vielen anderen vornehmen Waisenkindern unter meiner Aufsicht in dem Fräuleinstift und der Ritterakademie erzogen wurde.
Ach, der gute Laudamus dachte einst, den Jerum mit ihr zu vermählen; aber ihr wisst, als Jerum nach des Vaters Tod König ward, nahm er alle die Länder der Waisenkinder, deren Pflegevater er sein sollte, in Besitz und befahl seinem Kammerherrn, dem Herrn von Neuntöter, alle die armen Kinder im Fräuleinstift und in der Ritterakademie mit einem Reisbrei zu vergiften, den sie jährlich am Pfingstfeste auf der Eselswiese unter Tanzen und Springen zu verzehren pflegten.
Mich hätte er auch gern umgebracht, aber er weiß nicht, wie mein Ende ist. Als das Fest auf der Eselswiese bestellt war, zogen die unschuldigen Kinder mit Blumen geschmückt hinaus auf die Wiese.
Der Reisbrei stand in einer silbernen Schüssel, welche Laudamus dazu gestiftet hatte, brotzelnd unter der großen Linde. Ich ließ die guten Kinder in einem großen Kreise niederknien und
singen:
'Te regem laudamus,
qui nobis dedit Hirsenmus."
Da kam der Herr von Neuntöter und brachte Zucker und Zimt vom Jerum, welches der König immer sonst selbst drauf zu streuen pflegte. Aber es war dieses Mal Rattengift. Als der Neuntöter sich dem Musbecken nahte, sah ich auf einmal den Geist des verstorbenen Laudamus ihm entgegentreten; er sagte:
'Wenn der Jerum nicht selbst den Kindern Zucker und Zimt bringen will, so will ich es tun. Fliege hin, du Neuntöter!' Damit schlug er dem Kammerherrn erst die Zuckertüte und dann die Zimttüte um
die Ohren, und sieh da, er flog in einen Neuntöter verwandelt davon. Nun kam der König Laudamus zu mir und sprach:
'Fanferlieschen
Schönefüßchen,
pfleg und zieh die Kinderlein,
bis sie wieder Menschen sein.'
Nun streute er selbst Zucker und Zimt auf das Mus und verschwand. Die Kinder hatten alle das gesehen und sangen wieder.
'Te regem laudamus,
qui nobis dedit Hirsenmus.'
Und nun fuhr jedes mit seinem silbernen Löffel in das Hirsenmus. Kaum aber hatten sie einen Löffel voll gegessen, als sie sich alle in Tiere verwandelten. Die Ziegesar in Ziegen, die Ochsenstierna in Ochsen, die Rindsmaul in Rinder, die Schimmelpennink in Schimmel, die Rabenhorst in Raben, die Boxberg in Böcke, die Putlitz in Puthähne, die Hühnerbein in Hühner, die Rothenhahn in Hähne und so ein jedes Kind nach dem Familiennamen in ein Tier dieses Namens.
Ich führte nun diese ganze Herde in den nahe gelegenen Wald in eine große Höhle und ging wieder in die Stadt. Da hörte ich, wie der König Jerum glaubte, der Kammerherr von Neuntöter sei mit den Kindern, statt sie umzubringen, in die weite Welt gelaufen, und dass Jerum Boten ausgesendet habe, ihn aufzusuchen.
Als er mich nach den Kindern fragte, sagte ich ihm: 'Der liebe Gott wird sich ihrer erbarmen.' Weiter sagte ich ihm nichts. Er ward sehr zornig auf mich, und weil er mir das Leben nicht nehmen konnte, so nahm er mir doch alles, was mir Laudamus geschenkt hatte, so dass mir nichts blieb als das Haus und der Hof und Garten meiner Eltern am Tore. Nachts führte ich nun die ganze verwandelte Herde aus dem Wald in mein Haus und habe sie bis jetzt immer in allen standesmäßigen Wissenschaften unterrichtet. Sie sind bereits alle erwachsen, und jeder wird seiner Familie Ehre machen.
Ach, Fräulein Ziegesar war vor allen ein Engel, sie tanzt alles vom Blatt weg und singt wie der größte Tanzmeister, sie webt und stickt wie eine perfekte Köchin und kocht und backt wie die größte Stickerin, sie macht Gedichte wie ein Sprachmeister und spricht alle Sprachen wie ein Dichter, kurz, sie ist eine der vollkommensten Fräulein der Welt; und diese hat mir der grausame Jerum mit einem Pfeile durch das linke Ohrläppchen geschossen.
Nein, länger wollen wir diese Schmach nicht mehr erdulden, übergebt einem anderen die Krone, denn Jerum denkt doch nur an seine Laster und niemals an Besserdich." So hatte Fanferlieschen gesprochen. Alles hatte mit der größten Spannung zugehört, und der älteste Bürger sagte: "Du erzählst uns sehr merkwürdige Geschichten, aber, wenn wir auch einen anderen König wählen, wo kriegen wir dann gleich alle die nötigen Minister und Hofkavaliere her, welche alle mit Jerum ausgereist sind? Deine Schürze, aus welcher du sie sonst schütteltest, hat ein Loch, und wird jeder durchfallen."
Nun sprach Fanferlieschen zu dem Pudel, der die Schürze trug:
"Herr von Pudelbeißmichnit,
schwenk die Fahn,
vivat Laudamus!
Es ist getan."
Da schwenkte der Pudel die Fahne und verwandelte sich zugleich in den schönsten Fahnenjunker, und alles anwesende Horn-, Wollen- und Federvieh verwandelte sich in die hoffnungsvollsten Ritter und
Fräulein, und sie öffnete die Portechaise, und die Prinzessin Ziegesar mit dem verwundeten Ohrläppchen trat heraus und umarmte Fanferlieschen, und alle die verwandelten Ritter und Fräulein
schrien laut:
"Oramus Laudamus!
Fanferlieschen
Schönefüßchen
soll regieren und florieren."
Da rief die ganze Versammlung das selbe, und sie nahmen Fanferlieschen und setzten sie in die Portechaise und trugen sie in das Schloss, und alles war richtig, sie musste Königin sein. Fanferlieschen aber machte nun aus allen ihren Zöglingen vornehme Leute; der Herr von Ochsenstierna wurde Minister des Ackerbaus, der Herr von Rindsmaul wurde Erz-Heumarschall, der Herr von Riedesel Generalobermühlenrat, der Herr von Rothenhahn wurde Direktor der Feuersbrunst und Hofwetterminister, und so hatte ein jeder seine Stelle nach seinen Qualitäten.
Die Prinzessin Ziegesar ward allgemein verehrt, und allgemein bekannt gemacht, wer ihr Gemahl werden würde, der sollte nicht nur ihr Fürstentum Buxtehude, sondern auch einstens das ganze Königreich Skandalia mit ihr erhalten. So ging nun alles herrlich in der Stadt, aber der König Jerum kriegte einen großen Schrecken, als die Fanferlieschen ihm einen Brief nach dem Jagdschloss Munkelwust schickte, worin drin stand, dass er abgesetzt sei und sich nicht mehr dürfe in der Stadt sehen lassen, sonst wolle man ihm den Kopf zwischen die Ohren stecken.
Wenn er aber sein Leben ändern, Witwen und Waisen das Ihrige zurückgeben und de- und wehmütig in die Stadt Besserdich zurückkehren wolle, so solle er vor allem eine fromme Gemahlin nehmen; die frömmste wäre die Prinzessin Ziegesar von Buxtehude. Hernach wolle man sehen, ob man ihn wieder zum König aufnehmen könne. Diesen Brief schickte ihm Fanferlieschen durch den Hofschäfer Mopsus, und Jerum wurde so zornig darüber, dass er dem armen Mopsus die Ohren abschneiden ließ und ihm die Nase breit schlug; und zu dessen Andenken tragen sich bis jetzt alle Mopse so.
Der König Jerum, der nun zu Munkelwust lebte, wurde jetzt ganz wie rasend, er verwüstete alles Land umher und beging tausend Grausamkeiten. Aber es ging ihm bald übel, seine Hofleute verließen ihn, und sein Geld wurde alle. Er hatte nichts mehr als das Ländchen Bärwalde, welches eigentlich der Fräulein Ursula gehörte und das er ihr noch immer zurückhielt.
Die armen Leute aus dem Ländchen mussten alles hergeben, dass er sein wildes Leben fort fahren konnte. Er hatte nur noch wenige Diener, und sein Ratgeber war ein großer hölzerner Götze, der bei Munkelwust unter einem dürren Baum stand und Pumpelirio hieß und, wenn man einen Menschen vor ihm schlachtete und ihn mit dem Blut bespritzte, auf alles antwortete, was man ihn fragte.
Jerum machte nun bekannt, er wolle sich bessern und eine fromme Frau nehmen. Da ließ er die Töchter seiner Untertanen zusammen kommen und heiratete eine. Aber in der Nacht schleppte er sie vor
den Götzen Pumpelirio und brachte sie um und fragte ihn:
"Pumpelirio Holzebock!
Sag mir doch,
wann die Jungfer Fanferlieschen
Schönefüßchen
sterben wird?
Wann ich komme
nach Besserdich?"
Da fing der Pumpelirio an zu knacken wie nasses Holz im Ofen und sprach mit schnurrender Stimme:
"Fanferlieschen blind,
Ursulus das Kind
geschwind wie der Wind
Besserdich gewinnt."
Jerum wusste nicht, was das heißen sollte, er bat sich eine Erklärung aus, aber Pumpelirio sprach:
"Für einen Mord
nur ein Wort;
morgen ist auch ein Tag
zu Mord und Totschlag."
Am nächsten Morgen sagte Jerum, er habe seine Braut nach Haus geschickt, weil sie nicht fromm genug gewesen sei, und suchte sich eine andere Jungfrau und heiratete sie wieder und brachte sie wieder um vor dem Pumpelirio Holzebock und fragte ihn wieder. Der sagte aber immer dasselbe, und Jerum brachte immer mehr Fräulein um, bis sie endlich seine Grausamkeit merkten und entflohen.
Als die guten Leute in Bärwalde hörten, dass ihr Fräulein Ursula bei der Fanferlieschen lebe, gingen viele nach Besserdich, um die liebe Tochter ihres verstorbenen Fürsten zu sehen. Sie küssten ihr die Hände und Füße und klagten ihr das Elend, in dem sie durch den Jerum lebten, und wünschten nichts mehr, als dass Ursula bei ihnen sein und sie regieren möge.
Ursula weinte sehr über das Unglück ihrer Untertanen und versprach ihnen, mit Fanferlieschen zu überlegen, was zu tun sei; da zogen die guten Leute wieder ab. Als Fräulein Ursula eben mit Fanferlieschen hierüber sprach, kam ein Bote vom König Jerum zu ihr und sagte, wenn Fräulein Ursula seine Gemahlin werden wolle, so wolle er sich bessern.
Ursula willigte ein, um nur ihre armen Untertanen trösten zu können, und Fanferlieschen sagte mit bitteren Tränen zu ihr: "Ich kann dich nicht abhalten, gib dir alle Mühe, den Jerum gut zu
machen; wenn du es verlangst, soll er seine Krone von mir wiedererhalten. Gehe hin, meine liebste Ursula, tue allem, was da lebt, Gutes, so wirst du in der Not nicht verderben!
Ursula, Ursula, große Not!
Wein dir nur die Äuglein rot;
Ursulus, Ursulus, gutes Kind,
macht das Fanferlieschen blind;
Ursulus, Ursula, Ursulum,
bin ich blind, so komm ich um.
Schau dich um, ich bitt dich drum."
Dann umarmten sie sich und weinten miteinander bitterlich, und Ursula zog mit dem Boten zum Tor hinaus zu dem König Jerum. Fanferlieschen aber stand auf dem Schlossturm und sah ihre liebe Ursula
in ihrem weißen Hochzeitskleid fort über die grünen Wiesen ziehen; und so oft Ursula sich nach Besserdich umsah und mit ihrem weißen Tüchlein winkte und sich die Augen trocknete, musste der
Fahnenjunker Pudelbeißmichnit die schwarze zerrissene Schürzenfahne auf dem Turm schwenken, wozu Fanferlieschen immer sang:
"Ursula, Ursula, große Not!
Wein dir nur die Äuglein rot;
Ursulus, Ursulus, gutes Kind,
macht das Fanferlieschen blind;
Ursulus, Ursula, Ursulum,
bin ich blind, so komm ich um.
Schau dich um, ich bitt dich drum."
Dazu bliesen die Türmer eine sehr betrübte Melodie auf den Posaunen, und dies währte so lange, bis ein Wald die Ursula und den Boten des Jerum verbarg. Ursula ging traurig neben dem Boten durch den Wald und dachte immer nach, was doch der wunderbare Gesang Fanferlieschens bedeuten möge; aber sie konnte ihn auf keine Art begreifen. Da hörte sie auf einmal einen Vogel ganz jämmerlich schreien und sah, wie er ängstlich um einen Baum herum flatterte.
Da schaute sie recht hin und erblickte einen großen Marder, der am Baum herunter geschlichen kam und sich dem Neste des Vogels nahte, um ihm seine Jungen zu fressen. Da nahm Ursula einen Stein und warf ihn so geschickt nach dem Marder, dass er tot von dem Baum herunter purzelte. Oh, wie froh war nun der Vogel: Er flog erst zu seinen Jungen, und da er sah, dass sie noch alle gesund waren, flog er immer um Ursulas Haupt und vor ihr her von Baum zu Baum und machte die rührendsten Bewegungen, als wolle er ihr Dank sagen, und sang auf allerlei Weise, bis er sie am Abend verließ, wo sie ihm noch ein Stückchen von dem Kuchen, den ihr Fanferlieschen mit auf die Reise gebacken hatte, für seine Jungen mitgab.
Nun ward der Weg immer trauriger und öder. Verbrannte Hütten und zerstörte Gärten waren am Weg; sie hörte in der Ferne einen traurigen Gesang, und das Herz ward ihr entsetzlich schwer. In der Ferne ging die Sonne ganz rot unter, und man sah in eine wilde schwarze Bergschlucht voll Dampf und Qualm. Hie und da am Weg stand ein dürrer Baum, von dem die Eulen herunter schrien: "Hu, hu, o weh! Hu, hu, o weh!"
Ach, das Herz ward Ursula immer schwerer, und sie fragte den Boten, der bis jetzt immer stumm neben ihr her gegangen war:
"Ach, mein Herz bricht in der Brust.
Sind wir bald in Munkelwust?"
Da sagte der Bote:
"In der Schlucht liegt Munkelwust,
hier am Baum du warten musst
bei dem Pumpelirio;
Jerum macht es immer so.
Setz dich an die Felsenstufen,
ich will dir den Bräutigam rufen." Und da verließ er die Ursula unter einem großen dürren Baum, wo der böse Pumpelirio Holzebock auf einem Felsen stand, und lief nach dem Tal hinunter.
Ursula war in der entsetzlichsten Angst; die Nacht brach an, die Eulen schrien auf dem dürren Baum; der Mond ging blutrot hinter dem Pumpelirio Holzebock auf. Ursula war sehr müde und setzte sich ins Gras und begann bitterlich zu weinen. Da hörte sie wieder den traurigen Gesang, und es kam immer näher und näher durch den Nebel, und sie sah eine Reihe von weißen Jungfrauen auf den Platz ziehen.
Sie hatten Brautkränze auf und waren alle ganz bleich, und in der Brust hatte jede ein Messer stecken, dass das Blut über ihre weißen Röcklein nieder floss. Sie zogen über die Grasspitzen weg,
als wären sie von Luft, und sangen mit feiner Stimme:
"Willkommen, willkommen, du Jerum Braut!
Ein Messer ins Herz, das heißt getraut.
Ach, ohne Kreuz und Segen
liegen im Schnee und Regen
bald hier deine Beinelein
im Sonnen- und im Mondenschein.
Im Baum da schreien die Raben.
Ach, wäre ich doch ehrlich begraben!"
Ursula war in der fürchterlichsten Angst und riss vor Bangigkeit das Gras aus der Erde; da schrie auf einmal eine der weißen Jungfrauen sie an:
"O weh! o weh!
Was raufst du meinen Kranz,
morgen musst du auch an den Tanz!"
Da sprang Ursula auf und wollte fliehen, aber sie fiel über einen Hügel; da schrie eine andere sie an:
"O weh! o weh! Was trittst du auf mein Herz,
morgen leidest du denselben Schmerz."
So ging das immerfort; sie mochte fliehen nach welcher Seite sie wollte, immer trat ihr eine jener Jungfrauen in den Weg und schrie bald:
"O weh mein Arm, o weh mein Bein, o weh mein Leib", usw. Da stand Ursula endlich still und fragte: "Oh, ihr armen Jungfrauen, wer seid ihr und was wollt ihr von mir?" Da sangen sie:
"Jerums Frauen von gestern
sind wir, Messerschwestern,
Jerums Weib von heute:
Morgen gehst du uns zur Seite.
Bete fleißig, denn gar oft
kömmt das Messer unverhofft.
Im Baume schreien die Raben;
ach, wären wir ehrlich begraben.
Fort von hier, von hierio
weit vom Pumpelirio,
weit vom Holzebocke
hübsch mit Kreuz und Glocke;
mit Gesang und Posaunenspiel,
gibt uns Ruh und kost' nicht viel."
Da antwortete ihnen Ursula: "Ach, wenn es mir möglich ist, sollt ihr gewiss begraben werden:
Unter zarten Blumenrasen,
in dem Schatten grüner Linden,
wo die frommen Lämmer grasen,
sollt ihr euer Bettlein finden.
Und ein kühler Marmorbronnen
soll da bei der Linde springen,
an jed' Bettlein hingeronnen
kühlen Born wohl jeder bringen,
dass ihr könnt die heißen Schmerzen
eurer schreienden Wunden kühlen,
und das Blut zerrissner Herzen
von dem weißen Schleier spülen.
Ach! Wenn Gott euch wird erwecken,
sollt ihr für den Mörder bitten!
Ringsum blühen Rosenhecken,
und ein Kreuz steht in der Mitten.
Will der Herr mein Blut auch haben,
soll man zu des Kreuzes Füßen,
euch zur Seite mich begraben,
bis uns all die Englein grüßen."
Während Ursula diese Worte recht von Herzen sprach, sahen die Jungfrauen sie mit rechter Liebe an, und jede zog ihr Ringlein vom Finger, und sie flochten sie ineinander wie eine Kette und zogen
Blumen durch, dass es eine Krone ward; die setzten sie der Ursula auf das Haupt und sangen:
"So viel Ringe, so viel Bräute;
so viel Bräute, so viel Messer;
so viel Messer, so viel Herzen;
so viel Herzen, so viel Wunden;
ach, du arme Braut von heute!
Ach, dir geht es auch nicht besser;
ach, du hast die bittern Schmerzen
alle bald wie wir empfunden."
Da krähte aber der Hahn, und sie schwebten über die Wiese weg. Ursula fühlte sich ruhiger, sie sah an dem blauen Himmel die Sterne an, und da glänzte das Gestirn, das man den großen Bär nennt, ihr besonders tröstlich in das Herz. Da gedachte sie recht innigst an ihre verstorbenen Eltern, den Fürsten Ursus und die Fürstin Ursa von Bärwalde, welche sie nie gesehen hatte, und sprach:
"Ach, mein geliebter Vater und meine liebe teure Mutter, ich habe euch nie gekannt, aber ich liebe euch doch wie ein frommes Kind; oh, verlasst mich nicht in meiner tiefen Angst; schaut auf euer armes Töchterlein; ich will ja alles ruhig ertragen, was über mich bestimmt ist." Als sie diese Worte recht von Herzen gesprochen hatte, sieh, da war es, als wenn die zwei Sterne am Himmel zusammenstießen und als wenn einer davon in den Schoß der guten Ursula herab fiele. Aber sie fand nichts.
Ihr Herz war aber sehr gestärkt und ihre Seele ganz voll frischem freiem Mut. Schon stand der Mond tief über der dunkeln Waldschlucht, worin Munkelwust lag, als sie auf einmal ein wildes Horngetön erklingen hörte und aus dem Waldgrund herauf Pferdegetrapp tönte. Sie richtete sich auf und trat auf einen Felsen; da sah sie einen Reiterzug mit brennenden Fackeln heran sprengen, dass die Funken und die brennenden Pechtropfen rings in das dürre Laub fielen und die Flammen prasselnd durch die Büsche herum zischten.
Sie sprengten im Galopp heran, an ihrer Spitze saß Jerum im roten Mantel auf einem getigerten Rosse. Auf seinem Helm war das Bild eines Drachen, seine langen schwarzen Haare wehten wie die Mähne
seines Rosses im Wind, und an seinem Gürtel hatte er eine breite Scheide hängen, worin viele Messer staken. Sie sangen ein wildes Lied, welches also lautete:
"Juch! juch! Über die Heide!
Fünfzig Messer in einer Scheide
reitet Jerum auf die Freite:
Schürz dich, Braut! zur Hochzeitreite."
So schrecklich das auch klang, konnte Ursula doch nicht mehr erschrecken; sie stand in wunderbarer Schönheit auf dem Felsen, gerade dem hässlichen Pumpelirio Holzebock gegenüber, und als der König Jerum heran sprengte, wehte sie ihm mit ihrem Tüchlein entgegen.
Und da die Reiter mit den Fackeln um sie her standen und Jerum von ihrer wunderbaren Schönheit und ihrer schönen Hochzeitskrone, die ihr die Geisterfräulein geflochten hatten, ganz geblendet zu
ihr hin ritt, streckte sie die Hand gegen ihn aus und sprach:
"O Jerum, Jerum, sei willkomm!
Nimm deine Braut und werde fromm!
Im Baum, da schreien die Raben;
ach, wären wir ehrlich begraben!
Drum sollst du mir erst versprechen -
willst du mich auch erstechen -
begrab mich und die Mägdelein
in einem kühlen Lindenhain,
unter den grünen Rasen,
wo fromme Lämmer grasen,
wo ein klarer Bronnen
kömmt an das Herz geronnen,
ein Kreuz steh in der Mitten:
Da will ich ruhn zu Füßen
und für den Mörder bitten
wenn mich die Englein grüßen,
dass ihn in Zorn und Schrecken
der Herr nicht mög erwecken."
Als sie diese lieb seligen Worte sprach, schüttelte sie ihr Haupt, und die Ringlein klingelten in der Krone, und in der Luft hörte man singen:
"Fort von hier, von hierio,
weit vom Pumpelirio,
weit vom Holzebocke.
Hübsch mit Kreuz und Glocke,
Chorgesang und Posaunenspiel,
gibt uns Ruh und kost' nicht viel!"
Dem Jerum ging das durch Mark und Bein; er zitterte, dass ihm die Messer in der Scheide tanzten, und schrie mit verzweifelter Stimme gegen Ursula:
"Was sein soll, das muss geschehen,
nichts kann dem Geschick entgehen.
Ach, ich möchte nicht und muss!
Oh, ich armer Jerumius!"
Da knackte auf einmal der Pumpelirio Holzebock so gewaltig, als wolle er in der Mitte auseinander platzen, und Jerum riss die arme Ursula vom Felsen und
fasste sie in der Mitten
und schwang sie auf sein Ros,
hei, wie sind sie geritten
nach Munkelwust ins Schloss.
Mehrere Wochen war Ursula schon die Gemahlin des bösen Jerum, und sie war so gütig und so fromm und so schön und so mild, dass er ganz tiefsinnig wurde und über sein böses Leben nachdachte. Ach, seine Stadt Besserdich lag ihm immer im Sinn. Ursula sprach immer von Besserdich, aber er schämte sich, gedemütigt an den Ort zurückzukehren, wo er immer ein übermütiger Herr gewesen war, und wurde dann oft plötzlich von Zorn und Wut überfallen und ritt im Land herum und tat viel Böses.
'Ach', dachte dann Ursula, 'wenn mir Gott ein liebes Kind schenkte, das ihm freundlich wäre, vielleicht würde sein wildes Herz gerührt werden, wann es ihn freundlich anblickte und ihm seine kleinen Hände entgegenstreckte.' Sie betete darum immer sehr fleißig zu Gott, und wenn sie abends allein am Fenster saß und den wilden Jerum von seinen Streifereien zurück erwartete, so blickte sie immer nach dem Gestirn des großen Bären und dachte ihrer verstorbenen Eltern, und streckte die Hände gen Himmel: 'Ach, wenn ich nur ein Kind hätte!'
Den einzigen Trost hatte sie in ihrem elenden Leben, dass die armen Leute aus Bärwalde die Bedrückung des Jerum leichter zu ertragen schienen, seit die liebe Tochter ihres ehemaligen Fürsten bei ihnen war. Auch tat sie, wo sie konnte, ihnen Gutes und redete ihnen freundlich zu. Das traurigste aber war ihr, dass Jerum niemals erlaubte, dass sie an Fanferlieschen schreibe, und dass er schon einige Boten dieser ihrer einzigen Freundin hatte ermorden lassen.
Als sie nun einstens Abends einsam und traurig am Fenster saß und auf Jerum wartete, der seit mehreren Tagen nicht mehr heimgekehrt war, war der Himmel ganz trüb und ihr liebes Gestirn nicht zu
sehen. Und wie sie so an den wilden Bergwänden hinauf blickte, hörte sie wieder jenen traurigen Gesang, und die weißen Jungfrauen zogen ums Schloss herum und sangen sehr traurig:
"Im Baume schreien die Raben;
ach, wären wir ehrlich begraben!
Fort von hier, von hierio,
weit vom Pumpelirio,
weit vom Holzebocke.
Hübsch mit Kreuz und Glocke,
Chorgesang, Posaunenspiel,
gibt uns Ruh und kost' nicht viel."
Worauf sie verschwanden. Da nahm sich Ursula fest vor, nicht zu ruhen noch zu rasten, bis die Fräulein begraben wären. Bald darauf hörte sie wilden Hörnerklang und sah die Fackeln durch den Wald
reiten und hörte den wilden Gesang von Jerums Zug:
"Juch! juch! Über die Heide!
Fünfzig Messer in einer Scheide."
Sie eilte hinab an das Tor, ihren Gemahl zu empfangen, aber er sprengte so wild herein, dass sie das Pferd gegen die Treppe schleuderte. Als Jerum absteigen wollte, raffte sie sich auf und hielt ihm den Steigbügel. Er redete aber nicht freundlich mit ihr und bat sie nicht um Vergebung. Finster stieg er die Treppe hinauf, und die arme Ursula folgte ihm nach.
Er setzte sich auf seinen Stuhl und redete kein Wort; sie konnte es vor Jammer nicht mehr aushalten und warf sich vor ihm auf die Knie und weinte und sprach: "Ach, mein Gemahl, was hab ich dir
zuleide getan?" Er antwortete nicht. "O ich Unglückliche", rief sie, "ich hatte mich so auf deine Heimkehr gefreut, ich hatte dich recht innig bitten wollen:
Du möchtest begraben die Mägdelein
in einem kühlen Lindenhain - - -
"Weiter konnte sie vor Tränen nicht sprechen; sie legte ihr Haupt in seinen Schoß, und als die Ringe in ihrer Krone so rasselten, zitterte Jerum am ganzen Leibe. Plötzlich fasste er mit seiner
Hand an ihr Ohr und schrie wie erschreckt:
"O wahr, wahr, wahrlich, wahr!
du musst auch zu der Schar,
Bärin Ursula, der Schuss! -
O ich armer Jerumius.
" Was fehlt dir, lieber Jerum", sagte Ursula, "dass du so traurig redest?" Da erwiderte er: "Nichts, mein Weib; aber stehe auf, wir wollen gleich dahin gehen, wo die Mägdelein sollen begraben
werden; ich habe den Lindenhain gefunden, ich will dir ihn zeigen." Das sagte er so kalt, dass Ursula zitterte und sprach:
"Ach Jerum, hast du mich ein bisschen lieb:
Jetzt nicht, jetzt nicht, der Himmel ist trüb."
Er aber sprach:
"Nur fort! Nur fort! Der Himmel grau,
der ist so recht zur Totenschau."
Da zog er sie zum Schloss hinaus und zog mit ihr den Weg hinauf nach dem Pumpelirio Holzebock. Da sprach sie:
"Ach Jerum! Ach! kein Lindenhain
wird auf dem Weg zu finden sein."
Er aber sprach:
"Nur fort! Und ist's kein Lindenhain,
so finden wir doch Totenbein."
Da weinte Ursula sehr und klammerte sich an ihn und sprach:
"Ach Jerum! Ich flehte zum Himmelsthron,
dass Gott uns schenk' einen kleinen Sohn."
Er aber zerrte sie weiter den Berg hinauf und sprach:
"Nur fort! Nur fort! Es heult der Wind,
er wiegt der Bärin ihr schwarzes Kind."
Da sie aber oben waren, ging der Mond ganz blutig auf, und Ursula sprach:
"Ach Jerum! Der Mond ist blutig rot.
Ach Jerum! Stich mich heut nicht tot."
Er aber sprach:
"Nur fort! Das ist der Abendschein,
er scheinet in den Lindenhain."
Da kamen sie den Berg hinauf auf die öde Heide, und Ursula sprach:
"O Jerum! Wie die Wolken fliehen,
wie sie so wild vor dem Monde ziehen."
Er aber sprach:
"Nur fort, das sind die Lämmer klein,
sie ziehen nach dem Kirchhof dein."
Und immer riss er sie weiter fort, ach! dass die Dornen ihr Röcklein zerrissen, und Ursula sprach:
"O Jerum! Die Dornen zerreißen mich,
kehre um, ich bitte dich!"
Er aber sprach:
"Nur fort, es ist der Rosenhain,
er schließet rings den Kirchhof ein."
Und nun kamen sie an den dürren Baum, wo der Pumpelirio Holzebock stand, und Ursula sprach:
"Ach Jerum! Das ist der dürre Baum,
das ist der wüste, öde Raum,
das ist der Pumpelirio Holzebocke,
ach! hörst du, wie die Raben schreien?"
Er aber sprach:
"Hier ist der kühle Lindenhain,
hier läutet deine Glocke,
hörst du, wie der Neuntöter schreit?
Du musst sterben, halt dich bereit!"
Da sank sie auf die Knie und sprach:
"Ach Jerum! Sag mir doch, warum
bringst du deine arme Ursula um?"
Da sprach er:
"Weil du nur eine Bärin bist,
die mich betrog mit böser List.
Bei Besserdich gleich an dem Tor
schoss ich den Pfeil dir durch das Ohr.
Die Narbe habe ich gefühlt,
als ich mit deinen Locken spielt'.
Und jetzo muss ich dich erstechen,
um Fanferlieschens Schwur zu brechen.
Mach fort! Mach fort! Der Neuntöter schreit,
sterben musst du, halt dich bereit!"
Ursula kniete nieder, um zu beten, und Jerum suchte eins von seinen fünfzig Messern heraus und fing es an zu wetzen. Wie Ursula die Hände gegen Himmel hob und betete, sah sie plötzlich das
Gestirn des großen Bären erscheinen, und es zuckte wieder wie damals, als sie zuerst hier betete, und es fiel wieder wie ein Stern in ihren Schoß nieder. Da war sie auf einmal wunderbar getröstet
und stand auf und sprach:
"Herr, ist dies der Lindenhain,
wo ich soll begraben sein?
Sag, wo ist der kühle Bronnen,
der zum Grabe kömmt geronnen?"
Jerum sprach da:
"Aus der Brust soll er dir springen,
wenn ich werd das Messer schwingen."
Da griff er nach dem Messer, das er geschliffen und neben sich gelegt hatte, aber fort war es; er konnte es nicht mehr finden. Da sagte er zu Ursula: "Bete nur noch ein wenig." Sie kniete nieder
und betete fort. Er nahm ein anderes Messer und wetzte es und legte es wieder hin und rief:
"Mach fort! Mach fort! Der Neuntöter schreit,
sterben musst du, halt dich bereit!"
Ursula nahte sich still und sprach wieder:
"Herr, ist dies der Lindenhain,
wo ich soll begraben sein?
Sag, wo ist der kühle Bronnen,
der zum Grabe kömmt geronnen?"
Da sprach er wieder:
"Aus der Brust soll er dir springen,
wenn ich werd das Messer schwingen."
Aber das Messer war wieder fort. Er konnte das nicht begreifen und ließ sie wieder beten und wetzte wieder. Und sie kniete hin und betete für den Jerum recht von Herzen. Er rief wieder:
"Der Neuntöter schreit,
halt dich bereit!"
Sie nahte wieder mit den selben Worten, das Messer war wieder fort, und so ging das, bis neunundvierzig Messer fort waren. Da hielt Jerum das fünfzigste Messer fest in der Hand und schwang den Arm und wollte es ihr in das Herz stoßen; aber auf einmal hielt er ein und tat einen lauten Schrei und ließ den Arm sinken, denn es flog ein Messer vom Himmel herunter auf seinen Arm und stach ihm die Hand durch und durch, und wo er hin floh, fielen Messer auf ihn und verwundeten ihn hier und dort.
Ursula lief auf ihn zu und umarmte ihn und bedeckte ihn mit ihren Armen; aber die Messer fielen überall auf ihn, bis sie alle herunter gefallen waren. Da hörte man die Hörner von Jerums Gefolge,
da leuchteten die Fackeln heran. Sie zogen aus, ihren Herrn zu suchen, und fanden ihn mit Wunden bedeckt, und Ursula, die ohnmächtig bei ihm lag. Seine Diener waren sehr erschrocken, sie zogen
ihm die Messer aus den Wunden, verbanden ihn, so gut sie konnten, und brachen Äste von dem dürren Baum, auf welche sie ihn und Ursula legten und nach Haus brachten. Dabei sangen sie:
"Juch! juch! Über die Heide!
Fünfzig Messer in einer Scheide,
fünfzig Messer in Mannes Leib,
durch Ursula, das böse Weib."
Über ihnen aber flog der Neuntöter und schrie sehr heftig, und neben dem Zug schwebten die weißen Jungfräulein über die Erde hin und sangen:
"Fünfzig Messer in Mörders Leib,
ihr könnt nicht retten sein treues Weib."
Das alles war sehr betrübt.
Als sie sich Munkelwust nahten, sahen sie das ganze Schloss erleuchtet. Da ließ der Führer den Zug halten, nahte sich dem Jerum, der sich etwas erholt hatte, und redete mit ihm heimlich, worauf
sich der Zug trennte. Die mit den Fackeln zogen mit Jerum in das Schloss. Der Führer aber und sein Sohn blieben mit der armen Ursula zurück.
Als der Zug schon in das Schloss herein war, trugen sie die Ursula in einen alten, hohen Turm des Schlosses, in welchem gar kein Fenster war. Da legten sie die selbe an die Erde, gingen weg und mauerten die Türe zu und warfen eine Menge Disteln und Dornen davor.
Die arme Ursula mochte wohl ein paar Stunden in dem dunkeln Turm gelegen haben, als sie etwas Kühles an den Augen und Wangen spürte und erwachte. Das erste Wort, das sie aussprach, war: "Ach, mein teurer Herr und Gemahl, lebst du noch? Oh, wenn Gott nur deine Diener herführte, dich mit deinen vielen Wunden aus der dunkeln Nacht nach Hause zu bringen. Ich will dich so treulich pflegen und heilen, dass du mich gewiss lieb gewinnen sollst. O mein Gemahl, antworte mir! Wehe mir, haben dich die fallenden Messer getötet, konnte ich keines, mit meinem Leibe dich bedeckend, von dir abwenden?"
Da die arme Ursula, welche glaubte, sie sei noch an dem schrecklichen Orte bei dem bösen Pumpelirio Holzebock, keine Antwort erhielt, richtete sie sich auf und suchte herum, den Leichnam ihres
Gemahls zu suchen; aber wie erschrak sie, da sie sich rings von kalten Mauern umschlossen fühlte. "Oh! allmächtiger Gott!" rief sie aus. "Wo bin ich, was ist aus mir geworden?
Weh, weh, ganz allein!
Erd und Himmel sind von Stein!
Ach, kein Mond, kein Sternenschein,
und kein Lüftlein grüßt herein,
und es singt kein Vögelein;
weh, weh, ganz allein!"
Da sprach eine Stimme zu ihr mit freundlichem Tone: "Erschrick nicht, liebe Ursula, ich bin da; erinnerst du dich wohl des Vogels, dessen Junge du von dem Marder durch einen Steinwurf befreitest und mit dem du deinen Kuchen teiltest, da du durch den Wald nach Munkelwust reistest?"
"O ja", sprach Ursula, "aber was soll dieser Vogel? Wer bist du? Sage mir um Gottes willen, wo ist Jerum, mein armer Gemahl, und wie komme ich an diesen Ort?"
"Ich bin dieser Vogel", antwortete die Stimme, "setze dich wieder an die Erde und erlaube mir, auf deine Hand zu sitzen, so will ich dir alles erzählen, was du mich gefragt, und noch viel, viel
mehr. Aber fasse Mut und vertraue auf Gott, du bist sehr unglücklich.
Aber keiner ist so allein,
und wäre Erd und Himmel von Stein
und schiene kein Mond, kein Sternenschein,
und grüßte ihn kein Lüftlein,
und sänge ihm kein Vögelein:
Wird doch in seinem Herzen rein
der liebe Gott stets bei ihm sein."
Da setzte sich Ursula an die Erde und legte ihren Kopf gegen die harte Steinwand und streckte die Hand aus und sprach: "Komm, lieber Vogel, setze dich auf meine Hand; ach, du bist fromm, und ich will Gott vertrauen, und wäre mein Elend noch so groß." Da flog der Vogel auf ihre Hand, sie zog sie an sich und drückte ihn an ihre Wangen, die er sanft mit den Flügeln streichelte.
"Deine Flügel sind ja nass", sprach Ursula. "Ja, liebe Ursula", sagte der Vogel, "ich habe sie in kühles Quellwasser getaucht und habe flatternd dein Gesicht hiermit gesprengt, damit du aus der Ohnmacht erwachst." -
"Oh, wie gut bist du", erwiderte Ursula, "was bist du denn für ein Vogel?" - "Frage nicht", sagte der Vogel, "ich habe einen hässlichen Namen." Da erwiderte Ursula: "Sage ihn mir nur, du hast dich so gut gegen mich gezeigt, ich will dich lieben, und wärst du auch ein Neuntöter." -
"Der bin ich", sagte der Vogel, "und höre nun alles still an, denn ich habe noch viele Geschäfte für dich." - "Erzähle", sagte Ursula, "ich unterbreche dich nicht wieder!" Da sprach der Neuntöter also: "Du weißt, nach dem Tode von Jerums Vater, dem guten König Laudamus, führte Fanferlieschen wie gewöhnlich ihre Waisenkinder zu dem Hirsenmusfest auf die Eselswiese.
Der böse Jerum wollte den Kindern, statt ihnen wie sein verstorbener Vater Zucker und Zimt auf den Brei zu streuen, Gift drauf streuen lassen, damit sie alle sterben müssten, weil er wusste, dass die Erbin von Bärwalde dabei sei, welches Ländchen er gern gehabt hätte. Ich Unglücklicher war der Kammerherr von Neuntöter und sollte das Gift auf das Mus streuen; da erschien der Geist des verstorbenen Laudamus und verwandelte mich zur Strafe in einen Neuntöter, und als ein solcher Vogel habe ich bis jetzt im Walde gelebt.
Du kannst dir denken, wie es mich rührte, dass du, die ich dich doch auch mit den anderen vergiften wollte, mir so große Wohltaten erwiesest; und seit dieser Zeit habe ich nie wieder von anderen lebendigen kleinen Vögeln gelebt, was sonst die Art der Neuntöter ist, sondern ich habe mir große Gewalt angetan und habe nur schädliche Fliegen und Würmer und Samen von Unkraut gefressen. Immer habe ich mich gesehnt, dir für deine Wohltaten dankbar werden zu können, und endlich habe ich die Gelegenheit gefunden.
Ich flog oft um das Schloss Munkelwust und belauerte alles. Da habe ich denn auch gehört, wie Jerum zu seinem alten Diener sprach, als er das letzte Mal nach Hause ritt: 'Rüste alles zum Empfange der Königin Würgipumpa im Schlosse zu. Morgen kömmt sie hier an, ich bin schon mit ihr vermählt. Heute nacht steche ich die Ursula bei dem Pumpelirio Holzebock tot."
"Ach Gott, ach Gott, ist das wahr, Neuntöter?" rief da Ursula aus. "Ist das wahr?" "Ja, es ist wahr", sagte der Vogel, "die neue Königin ist da." "Ach, lieber Gott", sagte Ursula, "ich bitte dich, mache, dass Würgipumpa recht gut und fromm sei, dass sie ihm noch mehr Liebe erweise als ich, dass sie ihn recht pflege in seiner Krankheit. Gott segne ihn, dass sie ihn auf gute Wege und wieder in seine Stadt Besserdich führe. Nun erzähle weiter, lieber Neuntöter."
"Oh, wie bist du gütig, Ursula, du betest für deinen Mörder!" sagte der Vogel. "Rede nicht so hart von dem unglücklichen Jerum, Gott der Herr möge uns allen verzeihen", versetzte Ursula. - "Ach ja", seufzte der Vogel und sprach fort: "Als ich gehört hatte, dass du sterben solltest, flog ich auf den dürren Baum bei dem hässlichen Pumpelirio und wartete auf dich, und als Jerum sein Messer wetzte und du knietest und für ihn betetest, musste ich vor unendlichem Grimm laut schreien.
So oft er nun eines von seinen fünfzig Messern geschliffen hatte und neben sich legte, flog ich von der Nacht versteckt herzu und nahm das Messer weg und trug es auf den Baum. Das letzte aber hielt er fest in der Hand; ach! da zitterte ich für dein Leben, und mein Zorn ward so groß, dass ich eines seiner früheren Messer auf seine Hand herab fallen ließ, mit welcher er so eben dein liebes, treues Herz durchbohren wollte.
Meine Kinder und Freunde, welche still auf dem Baum gesessen, wurden nun auch so ergrimmt als ich, denn ich hatte ihnen erzählt, dass du von ihnen einst den Marder abgehalten, und da ergriffen sie alle die anderen Messer und ließen sie auf den bösen Jerum fallen. Ach, in welcher Angst war ich, da du ihn mit deinem Leibe vor den fallenden Klingen schützen wolltest, du möchtest verletzt werden, aber ich konnte ihren Zorn nicht abwehren; doch der hebe Gott hat dich beschützt."
"Was du erzählst, ist schrecklich und traurig", unterbrach Ursula den Vogel, "aber sage mir um Gottes willen, ist Jerum noch am Leben? Wird er wohl wieder gesund werden? Und wo bin ich denn? Werde ich je wieder aus diesen dunklen Mauern kommen?"
Da erwiderte der Vogel: "Jerum ist schwer krank, aber ich zweifle nicht, er wird genesen. Gott wird ihn doch nicht sterben lassen, ehe er sein schweres Unrecht eingesehen und bereut hat; denn als man ihn mit dir nach Munkelwust zurück brachte, machten seine Diener in der Nähe des Schlosses, welches wegen der Ankunft der neuen Königin schon prächtig erleuchtet war, halt und fragten ihn, was sie mit dir anfangen sollten.
Da sagte er, sie sollten dich umbringen und begraben. Aber dein Anblick rührte sie, und da haben sie dich in den alten Turm des Schlosses gelegt und haben ihn vermauert. Gott hat es gefügt, dass ich, um dir nahe zu sein, in den letzten Tagen mein Nest da oben in dem Dache gebaut, und so denke ich denn, dass Gott es mir auch künftig vergönnen wird, an dir das Böse, das ich als Mensch getan, wieder gut zu machen."
"Gott, sei gelobt und gepriesen", sagte Ursula, "ach, wenn ich nur den lieben Sternhimmel sehen könnte, das würde mich recht stärken und trösten!" "Das sollst du, liebe Ursula!" erwiderte der Vogel. "Überhaupt fasse Mut: Alles, was ich nur auf Erden vermag, soll dazu dienen, dir dein Leben erträglich zu machen. Das Dach des Turmes ist ziemlich lose, ich will mit meinen Freunden Löcher hinein machen, dass du den Himmel sehen kannst, und wenn es regnet, wollen wir es mit Strohhalmen und Moos decken.
Ach, liebe arme Ursula, lasse mich nur sorgen, ich habe den Kopf voller Gedanken, dir Freude zu machen: Wenn mir nur die Hälfte gelingt, sollst du in vielen Stunden glücklicher als manche Prinzessin sein, wenigstens glücklicher, als du es auf dem Schlosse Munkelwust warst. Lebe wohl, jetzt sorge ich dir vor allem für ein Lager und für Licht und für einige Erquickung."
Nach diesen Worten flog der gute Vogel in die Höhe des Turms, und Ursula rief ihm nach:
"Dank und Ehre und Preis sei Gott im Himmel, der dich guten Vogel bewogen hat, mich zu erhalten, damit ich fromm sei und beten kann." Kaum war der Neuntöter oben auf dem Turm angekommen, als er
mit seinen anderen Gehilfen an einigen alten Ziegeln mit dem Schnabel den Kalk los hackte, und nach einigen Minuten hörte man die losen Steine über das Dach herunter rasseln und draußen an die
Erde fallen.
Ach, da sah der liebe blaue Sternenhimmel hinunter in den Turm, in die Augen, in das liebe treue Herz der frommen Ursula, wie in einen tiefen Brunnen voll Schmerz und Bitterkeit. Aber sein milder Schein brachte Friede und fromme Ergebung herein. Ursula lehnte ihr Haupt gegen die Mauer und sah ruhig hinauf. Da erkannte sie das Gestirn des großen Bären, das sie an ihre Eltern erinnerte, mit viel Freude und betete recht fromm zu Gott für ihre Eltern und den grausamen Jerum und für Fanferlieschen und fiel dann in einen sanften Schlummer.
Gegen Morgen wurde sie von angenehmem Gesange erweckt. Da sah sie an den offenen Stellen des Daches mehrere Rotkehlchen und Distelfinken und Schwalben sitzen, die immer herab guckten und außerordentlich schön sangen; und da sie sich aufrichtete, kam der Neuntöter herab geflogen und brachte in seinen Klauen einen Zweig voll der schönsten Kirschen, der so groß war, dass er ihn kaum tragen konnte.
Er flog auf die Hand der Ursula und gab ihr den Zweig und sprach: "Da hast du vorerst eine kleine Erquickung, bald soll mehr kommen. Jetzt lasse uns vorerst sehen, wie Boden und Wände hier beschaffen sind." Ursula dankte und aß die süßen Kirschen, und dann besahen sie den ganzen Raum.
Der Turm war so geräumig als eine kleine Stube, die Wände aber waren raue Steine, und da Ursula daran herumfühlte, fand sie ihn an der einen Seite sehr warm. Da sagte der Vogel: "Ja, ja, ich weiß schon, gleich daneben ist die Schlossküche, und der Feuerherd steht dicht hier an der Wand." - "Du hast recht", sagte Ursula, "jetzt erinnere ich mich; aber da fällt mir etwas ein: Durch die Küche läuft ja ein fließendes Bächlein gerade unter dem Herd weg. Sollte das nicht auch unter dem Turm weg laufen?"
Da legte sie sich an die Erde und horchte und hörte es murmeln und rief voll Freude: "Ach, da ist lebendiges Wasser." - "Das muss geöffnet werden", sagte der Vogel, "damit du dich waschen und trinken und auch ein bisschen kochen kannst. Lass mich nur sorgen. Erst wollen wir den Boden fegen, damit du dein Bettlein machen kannst."
Nun pfiff er in der Vogelsprache in die Höhe, und viele Vögel schwebten sanft herab und pickten alle Steinchen und Späne auf, die am Boden lagen, und trugen alles so sorgsam zum Dach hinaus und fegten dann mit ihren Flügeln so rein, dass der Boden wie eine Tenne sauber wurde. Nun flogen sie weg und brachten eine Menge trockenes Moos und Wolle, welche die Schafe an den Dornen hatten hängen lassen, und fuhren so lange damit fort, bis so viel beisammen war, dass Ursula sich ein recht weiches Lager daraus bereiten konnte.
Als dies fertig war, kam der Neuntöter wieder und brachte einen großen Maulwurf, den setzte er an die Erde und sprach: "Da habe ich einen Bergknappen gebracht, der soll uns nach dem Brunnen wühlen." Der Maulwurf scharrte gleich munter drauflos; da er aber bald an das Wasser kam, so hörte er auf und ließ sich wieder hinweg tragen.
Ursula räumte mit einem Stein nun die Erde hübsch auf und hatte nun ein schönes Bächlein durch ihren Turm laufen, dessen Rand sie mit Steinen auslegte und dessen Grund sie mit bunten Kieseln belegte, die ihr die Vögel brachten. Von der aufgewühlten Erde machte sie sich einen kleinen Herd und eine Bank. Mit diesen Arbeiten ward es Mittag, die Sonne schien gerade vom Himmel in den Turm herein, und Ursula konnte durch die Wand den Bratenwender in der Küche schnurren hören.
Da kam auf einmal der Vogel geschwinde, geschwinde den Turm herab geflogen und trug ein gebratenes Rebhuhn in seinen Klauen und sprach: "Nimm, liebe Ursula; das hatte sich der Koch bei Seite gelegt, ich bin durch den Rauchfang in die Küche und habe es für dich geholt." Dann brachte er ihr auch Brot, und während sie aß, sprach er: "Denk dir, wie gerecht der Lohn des Himmels ist:
Die zwei bösen Diener Jerums, welche dich hier herein vermauert, sind von den Ziegelsteinen, die ich von dem Dach los machte, damit du den Himmel sehen solltest, tot geschlagen worden. Jetzt weiß niemand, dass du hier bist, und ich kann mit niemand reden als mit dir; nun wirst du wohl lange hier bleiben müssen." - "Wie Gott will", sagte Ursula und bat den Vogel, er möge ihr nur recht viele Wolle verschaffen und eine Spindel, damit sie spinnen könne, und ein paar feine Stäbchen, damit sie stricken könne.
Das brachte ihr der Vogel alles und brachte ihr täglich zu essen. Da spann sie und strickte und betete und entschlief Nachts, nach den Sternen sehend. An einem Morgen, als der Vogel ihr keine Kirschen, aber Weintrauben brachte, fragte ihn Ursula recht ängstlich, was Jerum mache. "Oh, er ist recht wohlauf", sagte der Vogel, "die neue Frau Königin ist recht strenge gegen ihn; wenn er heftig will werden, so zeigt sie ihm nur ihren Pantoffel, da wird er stille." -
"So", sagte Ursula, "möge es zu seinem Besten sein; aber, liebster Vogel, ich bitte dich, kannst du mir nicht recht zarte Flaumfedern schaffen?" - "Soviel du willst", erwiderte der Neuntöter, "alle Vögel sollen sich die zartesten ausrupfen; sie tun mir jetzt alles zulieb, weil ich ihre Jungen nicht mehr fresse." Da flog er fort, und bald waren viele Vögel da, die saßen auf Ursulas Schoß und rupften sich die Flaumfedern auf ihre Schürze aus. Als es genug war, dankte Ursula, und sie flogen weg.
Am anderen Tag sagte Ursula: "Kannst du mir wohl einige Leinentüchlein bringen?" - "O ja", sagte der Vogel, "sie bleichen Wäsche am Schlosse; heute Nacht bringe ich dir soviel du willst." In der Nacht brachte er ihr sechs Windeln, und sie nähte zwei zusammen und stopfte die Flaumfedern hinein und machte ein Kissen daraus, und suchte hervor, was sie alles gestrickt hatte, von Wolle, und legte es alles fein und ordentlich zurecht.
"Ei", sagte der Vogel, "liebe Ursula, ist es doch, als wenn du dir ein Nestchen bautest, so wirtschaftest du herum und stopfst Bettchen und legst allerlei schöne Kleidchen und Mützchen zurecht." - "Ach lieber Vogel", sagte Ursula, "ich habe heute Nacht, als ich so an den Himmel hinauf zu meinem Stern sah, einen recht innerlichen Trost empfunden, als sollte ich nun bald nicht mehr so allein sein." -
"Welche Gesellschaft hättest du dann am liebsten?" fragte der Vogel, und Ursula erwiderte: "Ach, so mir Gott ein liebes schönes Kindlein bescheren wollte, oh, ich wäre so glücklich, so glücklich!" - "Das glaube ich", sagte der Vogel, "aber lebe wohl, ich muss heute auch noch an meinem Nestchen bauen." Da flog er fort.
So lebte Ursula ruhig fort, von den guten Vögeln bedient und ernährt. Ihr Wohnort verschönerte sich täglich, die rauen Wände waren mit gestickten wollenen Decken behängt, der Fußboden war mit Strohmatten belegt, das durchfließende Bächlein war mit bunten Steinen ausgelegt, Bogen, Kränze, Sterne und Sonne von roten Beeren hingen an den Wänden umher; allerlei Körbe und Geräte von Weidenruten, welche ihr die Vögel brachten, hatte Ursula geflochten und auch eine recht schöne Wiege.
Als diese fertig war, legte sie die Bettchen hinein, und es ward Nacht. Der Sternenhimmel war gar hell, Ursula sah ihren lieben Stern, den großen Bären, recht ernsthaft an und dachte an ihre Eltern und betete recht fromm zu Gott. Da schlief sie ein, und es war ihr im Traum, als zuckten die Sterne zusammen und als falle einer herunter in ihre Wiege. Da fühlte sie eine so heftige Freude, einen so süßen Schmerz, als flöge alles irdische Glück wie ein goldner Pfeil durch ihr Herz und als fange sie ihn mit ihren Händen, und als wäre es ein wunderschöner bunter Vogel, der sich an ihre Brust schmiege und von ihren Lippen äße und tränke wie von roten Kirschen.
Ach, da war es ihr wie ein Blitz durch das innerste Leben, und sie erwachte. Und wer kann ihre Seligkeit aussprechen? Ein schöner kleiner Knabe schlummerte an ihrer Brust. Sie weinte und betete und nährte ihr Kindlein, und die gute fromme Mutter gefiel dem lieben Gott. Am anderen Morgen sangen die Vögel so süß und lieblich wie nie. Der Neuntöter und alle seine Freunde kamen, das Kindlein zu sehen, und streuten Blumen auf seine Wiege und brachten ihr die besten Speisen aus der Küche, und immer blieb ein wohl singendes Vöglein auf der Wiege sitzen und sang das Kindlein in Schlaf.
Nach drei Tagen, in einer Nacht, da die Sterne so hell schienen, als wollten sie zu Gevatter stehen in ihrem schönen Glanz, betete die gute Ursula recht herzlich und dankte Gott für das liebe Kind und versprach, es in Gottesfurcht aufzuziehen, und sprach: "Ach du lieber Gott, ich habe hier kein Kirchlein und keinen frommen Priester, der mein Kind taufen könnte, so nimm meinen guten Willen für den Priester und meine Not für ein Kirchlein an."
Und nun schöpfte sie Wasser mit der hohlen Hand aus dem Bächlein des Turmes und taufte ihr Kind im Namen Gottes und rief hinauf: "Sagt, liebe Sterne, bei welchen ich immer an meinen seligen Vater Ursus und meine Mutter Ursa denke, sagt, wie soll euer Patchen heißen?" Da bewegten sich die Sterne und es flüsterte in die Ohren der Mutter: "Ursulus." Und sie taufte den Knaben Ursulus.
Am folgenden Morgen kamen die Vöglein alle und wollten das liebe Kind sehen, und sie brachten der Mutter die besten Bissen aus der Schlossküche, und ein Vöglein blieb immer auf der Wiege sitzen und sang den kleinen Ursulus in den Schlaf. So lebte die arme Mutter sieben Jahre mit Ursulus in dem Turm und erzog ihn auf das beste. Aber er bekam eine gewaltige Begierde, wenn er die Vögel oben auf dem Turm im Sonnenschein sitzen und singen sah und wenn die Wolken so vorüberzogen, auch einmal da oben zu sein und sich umzuschauen, wie die Welt aussähe.
Das sagte er seiner Mutter, und da dachten sie nach, wie es zu machen sei. Da kam der gute Neuntöter zu ihnen und hörte ihren Wunsch. "Das soll bald in Ordnung sein", sprach er und flog weg. Er kam mit vielen Vögeln wieder, und alle brachten Hanf im Schnabel, daraus mussten nun Ursula und Ursulus Stricke drehen und mussten eine Strickleiter draus machen. Dann kam ein Adler, der trug die Strickleiter im Turm in die Höhe und hängte sie oben an einen Haken fest.
Ursulus wollte gleich hinauf klettern, aber seine Mutter erlaubte es nicht, weil es noch Tag war und man ihn da oben hätte sehen können. Als es Abend wurde, stieg er voraus und Ursula hinter ihm auf der Strickleiter in die Höhe. Ach, sie hatte seit sieben Jahren Berg und Tal nicht mehr gesehen, und er noch nie.
Als sie oben an dem Turmrand hinaus sahen, umklammerte sie ihren Sohn mit beiden Armen, denn er war wie betrunken von der Luft und dem Abendrot und von Berg und Tal. Ach! sie musste ihn sehr festhalten, dass er nicht herunter stürzte; denn wenn er die Vögel fliegen sah, so zuckte er die Arme hinaus und wollte auch fliegen. Sie stieg bald wieder mit ihm hinab, und nun musste sie ihm bis spät in der Nacht erzählen und erklären, was er gesehen hatte.
Bald musste sie es bereuen, dass sie ihm die Herrlichkeit der Welt gezeigt hatte, denn Ursulus ward täglich unruhiger, und sein einziger Gedanke war, über diese Hügel und Berge zu schweifen, die er gesehen. Er fragte seine Mutter über alles aus; er hörte, Jerum würde sie umbringen, wenn er wisse, dass sie noch lebe; auch erzählte sie ihm von dem bösen Pumpelirio Holzebock und von den armen Jungfrauen, welche gern möchten begraben sein.
Das tat dem kleinen Ursulus so leid, so leid; er konnte nicht mehr ruhen und rasten, und als sein Mütterlein einst in der Nacht schlief, schlich er an ihr Bett und küsste sie und weinte und
flüsterte: "Leb wohl, leb wohl, Herzmutter mein!" Und nun stieg er die Strickleiter hinauf, und als er oben war, zog er die Leiter nach sich und warf Blumen, die oben wuchsen, in den Turm hinab,
die fielen auf das Bett der Mutter, dass sie erwachte und ausrief:
"Wer warf das Blümlein, das mich traf?
Wer weckt sein Mütterlein aus dem Schlaf?
Bist du es, lieber Ursulus?
Komm, gib der Mutter einen Kuss!"
Da rief Ursulus hernieder:
"Leb wohl, leb wohl, lieb Mütterlein!
Der blanke Mond, der Sternenschein,
und Berg und Tal und Wies und Fluss,
die ziehen mich fort, ich muss, ich muss."
Da sah die Mutter ihn mit Schrecken oben auf dem Turm. Sie sprang auf und wollte die Leiter hinauf zu ihm, aber sie fand sie nicht, denn er hatte sie zu sich hinauf gezogen. Da war Ursula gar betrübt und bat ihn, er möge die Strickleiter wieder herab lassen, sie wolle ihn noch einmal an ihr Herz drücken. Er aber sagte: "Mutter, ich fühle, dann könnte ich Euch nicht verlassen; der Vogel soll Euch oft von mir Nachricht bringen, und so Gott will, sehn wir uns in Freuden wieder." -
"Aber wie willst du dann hinunter kommen?" rief die Mutter hinauf. "Ich habe mir alles ausgedacht", antwortete er, "daneben am Turm kommt der Rauchfang aus der Küche herauf, da hänge ich die Strickleiter hinein und werde Küchenjunge. Da bin ich immer in deiner Nähe; und wenn ich an der Mauer anpoche, dann lasse mir einen Faden auf dem Bächlein, das durch den Turm in die Küche fließt, herüber schwimmen, da werde ich dir etwas dran binden, das kannst du zu dir ziehen. Leb wohl, Herzensmutter; es muss, es wird alles besser werden." -
"O Gott, o Gott, mein Kind!" rief die Mutter und sank auf die Knie und weinte. Ursulus aber stieg durch den Rauchfang hinab in die Schlossküche. Die Mutter lauschte an der Wand, und sie konnte ihn klettern hören. Da pochte er mit der Feuerzange siebenmal, und sie nahm geschwind einen Faden, band einen Holzspan dran und ließ ihn hinüber schwimmen.
Als Ursulus den Span fühlte, band er einen Blumenstrauß dran, den der Koch am Fenster stehen hatte, worüber sich die Mutter sehr erfreute. Als Ursulus den Tag grauen sah, versteckte er sich hinter das Holz bei der Küchentüre, und als der Koch in der Küche zu wirtschaften anfing, trat er hervor, als sei er zur Tür herein gekommen, und grüßte den Koch sehr freundlich.
Dieser fragte ihn, wer er sei und wo er her komme. Ursulus sagte, dass seine Mutter im Walde von Räubern sei umgebracht worden und dass er als ein armes verlassenes Kind Dienst suche. Dem Koch gefiel der freundliche schöne Knabe, und er nahm ihn zu sich als Küchenjunge. Wenn nun der Koch nicht da war, klopfte er immer der lieben Mutter, und wenn dann der Faden angeschwommen kam, band er ihr etwas Gutes zu essen dran und immer schöne Blumen dazu.
Als aber der Hofmarschall einmal in die Küche kam und den wunderschönen Ursulus sah, gewann er ihn sehr lieb und sprach: "Morgen früh halte dich bereit, ich will dich zum König Jerum bringen; du sollst Edelknabe bei ihm werden." Da dankte ihm Ursulus höflich. Am Abend aber war er voller Sorge, wie er seiner Mutter nur sagen solle, dass er aus der Küche heraus in das Schloss komme.
Da ging er in den Küchengarten und suchte Blumen und band einen Strauß Vergissmeinnicht, und da kam der Neuntöter zu ihm und dem gab er den Strauß für seine Mutter und sprach zu ihm: "Lieber Vogel, sage meiner Mutter, dass ich Edelknabe werde, und besuche mich manchmal und erzähle mir von ihr." Der Vogel sagte leise: "Gott helfe dir, ich bleibe dein Freund" und nahm den Strauß und flog in den Turm.
Am folgenden Morgen ward Ursulus zu dem König Jerum gebracht. Als dieser ihn sah, ward er recht innerlich in seinem Herzen bewegt, denn Ursulus glich seiner Mutter sehr, und da gedachte der Jerum an sie und an seine Grausamkeit. Er fragte ihn: "Wie heißt du?" Da sagte Ursulus: "Kommtzeitkommtrat." Der Name machte den Jerum recht nachdenklich, aber er nahm ihn gleich zu sich und erzeugte ihm sehr viele Liebe und ließ ihn alles lehren, was nur auf der Welt zu lernen war.
Jerum hatte keine Kinder, und Ursulus war ihm so lieb, so lieb; er wusste nicht, warum. Deswegen konnten ihn aber die meisten anderen Diener nicht leiden, und vor allem die böse Königin Würgipumpa hatte immer einen inneren Zorn, wenn sie ihn sah. Ursulus aber wurde von den Untertanen Jerums sehr geliebt, denn Jerum war lange nicht mehr so wild, seit der Knabe bei ihm war, und er besserte sich alle Tage.
Wenn nun Ursulus allein war in der Nacht, so kam immer der Neuntöter und pickte am Fenster; da machte Ursulus auf, und der Vogel setzte sich auf sein Bett und erzählte ihm, was die Mutter im Turm mache, und Ursulus erzählte ihm wieder, wie es ihm gehe und wie Jerum viel besser sei als sonst, und schickte ihr immer viel gute Sachen und allerlei Bildchen und Ringe, die ihm der König schenkte.
Ach, da ward die arme Ursula recht froh in ihrer Einsamkeit und weinte vor Freuden und betete zu Gott. So lebte er eine Zeit lang fort und hatte sein größtes Vergnügen dran, in seinen Freistunden durch die ganze Gegend herumzuschweifen. Einstens aber kam er in einen Wald zu einem eisgrauen Schäfer; der saß an einem Brunnen unter grünen Linden, und seine Lämmer weideten um ihn her.
Er setzte sich zu ihm; es war so still und kühl, und die Sonne schien so freundlich durch die Bäume. Der Schäfer war traurig, und Ursulus sagte zu ihm: "Lieber Schäfer, dieses Plätzchen hier wäre recht schön, um die Gebeine der armen Fräulein hin zu begraben, die jetzt bei dem bösen Pumpelirio Holzebocke herumliegen."
Der Schäfer sagte: "Was sind das für Fräulein?" Da erzählte ihm Ursulus alles, was ihm die Mutter gesagt, und der Schäfer sagte: "Ach Gott, da war mein Töchterlein auch dabei!" und war sehr betrübt. "Ach", sagte Ursulus, "wenn du hier recht schöne Gruben machen wolltest, alle recht schön in einer Reihe, und wolltest Blumen hinein streuen, und wolltest um den Platz herum einen Zaun von Rosen machen, so wollte ich dir treulich helfen, und wollten wir die armen Fräulein hier zur Ruhe bringen."
Der alte Schäfer war alles zufrieden, und sie fingen gleich an zu hacken und zu graben, bis Ursulus wieder nach Hause musste. Aber er kehrte oft wieder, und der alte Schäfer war recht fleißig, so dass alles bald in Ordnung war. Eines Abends kam der gute Vogel zu Ursulus und fand ihn sehr nachdenklich. "Lieber Vogel", sprach er, "ich habe etwas Großes unternommen und weiß nun nicht, wie ich es ausführen soll. Ich habe einen stillen freundlichen Ort, um die Gebeine der armen Jungfrauen hin zu begraben; alles ist fertig und bereit, jetzt hilf mir das Begräbnis anstellen."
Da sprach der Vogel: "Ich will alles tun, was ich kann, sorge nur für Kreuz und Glocke und für Posaunenspiel und Chorgesang; bringe das morgen Nacht mit zum Pumpelirio Holzebock, so soll alles gut gehen." Ursulus sagte: "Gut, das will ich; nun grüße die Mutter und erzähle ihr alles." Da flog der Vogel fort.
Am anderen Morgen, als bei Hof noch alles schlief, sang ein Rotkehlchen am Fenster des Ursulus, und es war ihm, als höre er die Worte: "Lieber Schläfer, weck den Schäfer!" Da sprang er vom Lager und eilte zu dem Schäfer, und sie redeten alles miteinander ab. In der nächsten Nacht schlich sich Ursulus aus dem Schloss.
Der König Jerum konnte nicht ruhen, er hatte eine große Angst im Herzen; er stand allein auf, wickelte sich in seinen Mantel und ging dem Schloss hinaus. Er wollte zu dem Pumpelirio Holzebocke gehen und ihn fragen, ob er bald wieder seine Stadt Besserdich erhalten würde, denn er hatte ein rechtes Heimweh.
Er war seit jener schrecklichen Nacht, da die Messer auf ihn regneten, nicht mehr hingegangen. Als er an dem Ort vorüber kam, wo er den zwei Dienern befohlen hatte, die Ursula umzubringen, konnte er vor Bangigkeit nicht weiter; er lehnte an einen Baum und wünschte, nie geboren zu sein; da hörte er auf einmal ein wunderbares Tönen sich nahen und sah eine Reihe von Lichtern über das Feld herziehen.
Der Anblick war so wunderbar, dass er sich an den Baum andrückte. Jetzt war es ganz nah, er sah den kleinen Ursulus voraus gehen mit einem Kreuz von Rosen; dann flogen eine ungeheure Menge Vögel,
welche allerlei Gebeine trugen; dann kam der alte Schäfer und blies eine sehr bewegliche Weise auf der Schalmei und weinte bitterlich; hinter ihm schwebten alle die Gestalten der armen Mägdelein,
die Jerum umgebracht hatte, und sangen:
"Endlich, endlich schweigen die Raben,
endlich werden wir ehrlich begraben
weit von hier, von hierio,
weit vom Pumpelirio,
weit vom Holzebocke,
hübsch mit Kreuz und Glocke,
mit Chorgesang, Posaunenspiel,
gibt uns Ruh und kost' nicht viel."
Und nun schlossen die Schäflein des alten Hirten den Zug; sie gingen still und paarweise hatten alle Glöcklein anhängen, und nur dann und wann blökten sie gar traurig; an beiden Seiten des Zugs aber zogen zwei Reihen von großen Irrlichtern, welche leuchteten. Als der Zug vor Jerum vorüber ging, war alles ganz still, und das betrübte ihn noch weit mehr.
Da der Zug aber ganz in der Ferne war, nahm Jerum seine Streitaxt und rannte mit großem Zorn nach dem Orte, wo der Pumpelirio Holzebock stand, und sprach zornig zu ihm: "Du böser gottloser Pumpelirio! du hast mich zu allen meinen großen Verbrechen beredet; um deinetwillen habe ich alle die lieben Jungfrauen ermordet; nun sollst du auch nicht länger leben."
Da holte Jerum weit mit seiner Axt aus und, paff! hieb er den Pumpelirio mitten voneinander. Aber es fuhr ein schwarzer Rauch aus den Trümmern, und aus dem Rauch ward ein ungeheurer scheußlicher Bock, der sah den Jerum mit schrecklichen Augen an, meckerte abscheulich die Worte heraus: "Den Pumpelirio konntest du zerschlagen, aber den Holzebock nie." Dann ging er einige Schritte zurück, beugte den Kopf nieder, rannte gewaltig gegen Jerum, fasste ihn auf die Hörner und warf ihn weit, weit in das Feld hinaus, wo er wie tot nieder fiel.
Er hatte schon zwei Stunden so da gelegen, als Ursulus von dem Begräbnis zurück nach Hause ging und auf einmal über den König Jerum stolperte. Der Knabe fühlte bald an der Krone, dass es Jerum sei. Er rüttelte und schüttelte ihn und benetzte ihn mit seinen Tränen. Da wachte der König Jerum wieder auf; aber er konnte nicht gehen, er hatte sich ein Bein gebrochen.
Da lief Ursulus ins Schloss und holte die Diener; die trugen ihn nach seinem königlichen Bett, und der Doktor verband ihn, und die Königin sprach: "Das kommt davon, wenn man zu nachtschlafender Zeit herum rennt." Ursulus aber verließ das Lager des Königs nie, und dieser gewann ihn immer lieber.
Einstens nahm der Jerum die Hand des Ursulus und sagte: "Lieber Junge, erzähle mir, wo habt ihr dann die Gebeine der armen Fräulein begraben?" Da erzählte ihm Ursulus von dem kühlen Lindenhain und dem Brunnen und dem alten Hirten und seinen Schafen und sagte: "Herr König, es wäre sehr schön, wenn Ihr ein Kirchlein dort bauen ließet." -
"Ja", sagte der König, "aber wenn es die Königin erfährt, so bin ich verloren; ich habe ihr zuschwören müssen, nie eine Kirche zu bauen. Wenn du es recht heimlich zustande kriegst, so bin ich es zufrieden und will dir gerne Geld dazu geben; und baue auch ein kleines Häuslein dabei, worin ein armer Mann wohnen kann."
Ursulus dankte dem Jerum herzlich für seine Erlaubnis und setzte sich nun hin und zeichnete allerlei Gestalten von Kirchen, um sich eine auszusuchen; auch redete er oft mit Maurern und Steinmetzen. Die böse Königin Würgipumpa, welche immer einen heimlichen Hass auf den Ursulus hatte, wurde täglich grimmiger gegen ihn und nahm sich fest vor, ihn auf eine oder die andere Art ins Unglück zu bringen.
Wenn sie nun bei Ursulus vorüber ging und ihn fragte: "Was hast du denn zu bauen vor, du naseweiser Bursche, dass du immer mit Zirkel und Lineal herumziehst?", so antwortete Ursulus gewöhnlich: "Schlösser in die Luft, Ihre Majestät!" Als er ihr dies öfter gesagt hatte, ward sie über die Maßen zornig und sprach zu ihm: "Ich werde dich bei dem Wort halten."
Sie ging zum König und kniete vor ihm nieder und bat ihn um eine Gnade. Jerum war eine solche Demut von ihr gar nicht gewohnt und sagte ihr alles zu, was sie verlange. Da sprach sie: "Jerum, ich verlange, dass jeder deiner Diener, der mich belügt und der nicht das tut, was er mir sagt, dass er tue, des Todes sterbe."
Jerum gab ihr sein königliches Wort und seine Hand drauf, und an dem selben Tage noch ward das Gesetz in ganz Munkelwust bekannt gemacht: "Wer lügt, der stirbt!" Als die Königin das unterschriebene Gesetz in der Hand haltend von dem König weg ging, sah sie den Ursulus im Vorzimmer wieder allerlei Linien ziehen und allerlei Zirkel schlagen. Da fragte sie ihn gleich. "Ursulus, was willst du bauen?"
Er antwortete wieder: "Schlösser in die Luft, Ihre Majestät!" Da erwiderte aber Würgipumpa sehr heftig, indem sie ihm das königliche Gesetz vorhielt: "Wer lügt, der stirbt!" Sie lief gleich zum König zurück und verklagte den Ursulus. Der König ließ diesen rufen und sprach mit Tränen zu ihm: "Ursulus, du musst ein Schloss in die Luft bauen oder sterben."
Da ging Ursulus in seine Kammer und war sehr betrübt und weinte sich schier die Augen aus, weil er gar nicht wusste, wie er ein Schloss in die Luft bauen solle. In solchen Sorgen saß er, als der Neuntöter am Fenster pickte; Ursulus machte ihm auf, und der Vogel sprach: "Ursulus, was weinst du?" Und nun erzählte ihm der Knabe seine Not, dass er eine Kirche in die Luft bauen müsse oder sterben.
"Gräme dich nicht", sagte ihm der Vogel, "mache dir von Karten und Papier die ganze Kirche, wie du sie dir auf dem Kirchhof erdacht hast, fertig, und wenn du sie ganz vollendet hast aus einzelnen Stücken, dass man sie schön zusammen setzen kann, so lege alles bei offenem Fenster hierher; dann lade den König und die Königin auf den Altan des Schlosses und läute nur mit einem Glöckchen und befehle mir und den anderen Bauleuten, welche kommen werden, so sollst du deine Kirche bald in der Luft entstehen sehen.
Ich werde sie auch dann deiner Mutter im Turm zeigen, die wird sich sehr drüber freuen, und alles wird gut gehen; denn ich trage dann das Kirchlein in den kühlen Lindenhain, und die Arbeitsleute werden die Kirche dort nach dem Muster viel besser zustande bringen als nach der bloßen Zeichnung." -
"Tausend Dank, lieber Vogel", sagte Ursulus, "aber was hast du denn für Kräuter da in den Klauen mitgebracht?" - "Das sind Kräuter, mit welchen du das Bein des Königs Jerum in wenigen Tagen heilen kannst, wenn du sie ihm auf die Wunde legst", sprach der Vogel, "ich habe es von einem Reh gelernt, das neulich im Walde vom Felsen fiel; ich will dir alle Tage frische bringen. Aber du musst dir auch eine recht ordentliche Gnade dafür ausbitten!" -
"Gut", sagte Ursulus, "es fällt mir schon etwas Herrliches ein, was ich begehren will; nun lebe wohl und grüße mir die liebe Mutter viel tausendmal." Da flog der Vogel fort, und Ursulus träumte die ganze Nacht von schönen wunderbaren Kirchen.
Am anderen Morgen kam er ganz fröhlich zum König, wo auch die Königin zugegen war, und sagte: "Ihre Majestät, ich will sterben, wenn ich in acht Tagen das Gebäude nicht in die Luft baue; und so Ihre Majestät mir versprechen, das selbe Gebäude auf die Erde zu bauen, so will ich bis dahin Euer zerbrochenes Bein so gut heilen, dass Sie selbst auf den Altan gehen können, mein Luftgebäude bauen zu sehen." - "Ich verspreche es", sagte der König. "Und ich verspreche es noch dazu", sagte die Würgipumpa.
Das ließ sich Ursulus schriftlich geben, legte dann dem Jerum die Kräuter auf das Bein und begab sich auf seine Kammer und baute von Karten und Papier eine ganz erstaunlich schöne Kirche zusammen und machte alles so fein und ordentlich, dass man die ganze Kirche auseinanderlegen und wieder zusammenbauen konnte. Als er fertig war, war auch der Fuß des Königs, dem er alle Tage frische Kräuter aufgelegt hatte, gesund, und er forderte den Jerum und die Würgipumpa auf, morgen früh auf den Altan zu treten, weil er vor ihnen sein Schloss bauen wolle.
Die Königin sagte: "Ja, wir werden kommen; so du aber dein Gebäude nicht in die Luft baust, will ich dir eines in die Luft bauen, in dem du sterben sollst, nämlich einen Galgen." Ursulus
verbeugte sich und ging weg. Am anderen Morgen fand er den König und die Würgipumpa schon auf dem Altan, als er mit einer kleinen Glocke in der Hand kam. "Was soll die Glocke?" sprach die
Königin. Da sprach Ursulus:
"Ich muss jetzt von allen Seiten
meine Baumeister zusammenläuten."
Da fing er an zu klingeln, klingeling, klingeling, und es kamen eine Menge große Vögel herbei geflogen: Adler und Geier und Falken, und auch mancherlei kleinere: Tauben und Finken und Amseln und
Stare, kurz, alle möglichen Vögel; worüber sich der König und die Königin sehr verwunderten. Da sprach Ursulus:
"Willkommen, ihr Meister und Gesellen,
ich will einen Bau in die Lüfte stellen,
nun schafft einen schönen Grund herbei,
worauf mein Werk zu richten sei!"
Da flogen die Adler weg und brachten auf einmal eine große starke Pappe getragen, auf welcher von Moos eine schöne Wiese ausgelegt war, aus der allerlei grüne Zweige als Bäume hervorragten. Nun
sprach Ursulus:
"Eine schöne Kirche bauet mir,
ein hoher Turm sei ihre Zier."
Da flogen wieder viele Vögel fort und brachten allerlei einzelne Stücke von einer sehr schönen papiernen Kirche und einem hohen Turm und setzten alles das auf der Mooswiese zusammen, so dass es wunderlieblich anzuschauen war. Als aber alles fertig war, brachte auch der Kreuzschnabel einen kleinen Altar und ein Kreuz hinein getragen, und der Dompfaff trug eine kleine Kanzel hinein, und eine Amsel, wie ein schwarzer Kantor, brachte eine kleine Orgel hinein.
Dann flogen ein paar Nachtigallen als Sängerinnen hinein und eine Menge Finken und Grasmücken als Choristen. Da begannen allerlei Glöckchen im Turm zu läuten, und in der Kirche fingen die Vögel so lieblich an zu singen und zu klingen, als wenn der feierlichste Gottesdienst drin gehalten würde.
Darüber ward der König Jerum, ganz gerührt und umarmte den Ursulus mit den Worten: "Kommtzeitkommtrat, wie schön hast du dein Gebäude erbaut." Würgipumpa aber hatte alles mit dem entsetzlichsten Zorn angesehen und geriet in eine solche Wut, dass sie einen Stein von dem Altan nahm und nach der Kirche warf; aber auf einen Wink des Ursulus flogen die Vögel mit dem schönen Bau über ihrem Haupt hinweg, und da bei dieser Gelegenheit einiger Schmutz auf die Königin herab fiel, wollte sie erzürnt den kleinen Ursulus schlagen; aber der König nahm ihn in seine Arme und sprach: "Würgipumpa, wer nach den Bauleuten mit Steinen wirft, dem antworten sie mit Kalk."
Da ging die Königin erzürnt nach ihrer Kammer. Der König Jerum aber hatte den Ursulus noch viel lieber als vorher und ließ in dem Lindenhain, wo die Jungfräulein begraben waren, eine Kirche bauen, ganz nach der Gestalt der Kirche, die Ursulus in die Luft gebaut und welche die Vögel zu dem Schäfer im Lindenhain getragen. Alles das erzählte Ursulus dem Neuntöter, und der Neuntöter der Ursula, so dass diese sehr erfreut wurde, dass Jerum so gut werde, und herzlich in ihrer Einsamkeit dem lieben Gott dafür dankte.
Die Königin Würgipumpa aber sah nun ein, dass sie mit ihrem Zorn gegen Ursulus gar nichts mehr ausrichtete, weil der König ihn zu sehr liebte, und fing deswegen an, ihm auf alle mögliche Weise zu
schmeicheln und schön zu tun. Heimlich aber dachte sie immer auf eine Gelegenheit, ihn in Lebensgefahr zu bringen. Sie wusste, dass der Pumpelirio Holzebock dem Jerum, als er ihn fragte, wann er
seine Stadt Besserdich wieder erhalten werde, sprechend:
"Pumpelirio Holzebock,
sag mir doch,
wann wird Jungfer Fanferlieschen
Schönefüßchen
länger nicht vertreiben mich?
Wann kehr ich nach Besserdich?"
geantwortet hatte:
"Fanferlieschen blind,
ein unschuldig Kind
Besserdich gewinnt."
Das ging der Würgipumpa immer im Kopf herum, und sie dachte hin und her, wie sie den Kommtzeitkommtrat brauchen wolle, um Jungfer Fanferlieschen blind zu machen. Weil sich aber Jerum so sehr verändert hatte, getraute sie sich nicht, ihm ihr Vorhaben grad heraus zu sagen, und sprach einstens zu ihm: "Lieber Jerum, ich glaube, du könntest doch einmal bei Jungfer Fanferlieschen fragen lassen, ob sie dir deine Stadt nicht wiedergeben will; du bist jetzt so fromm und gut, dass sie es dir gewiss nicht abschlagen wird."
"Ach", sagte Jerum, "so gut werde ich niemals, dass ich wieder verdiene, auf dem Throne meines frommen seligen Vaters zu sitzen." - "Ja", erwiderte Würgipumpa, "darüber magst du nun denken, wie du willst; aber du bist es der Stadt schuldig, denn Jungfer Fanferlieschen kann der Regierung nicht länger vorstehen: Soeben habe ich die Nachricht erhalten, dass sie blind geworden."
Hier sah Jerum die Königin erschrocken an und sprach zu ihr: "Würgipumpa, lasse mich allein; ich muss über das, was du mir gesagt, nachdenken." Die Königin ging, und Jerum fiel in tiefe Gedanken.
Der Spruch des Pumpelirio:
"Fanferlieschen blind,
ein unschuldig Kind
Besserdich gewinnt" fiel ihm ein, und er war in der größten Unruhe, ob er nicht nach Besserdich hinziehen sollte.
Als er aber dachte, wie der böse Holzebock ihm allzeit zum Bösen geraten hatte, entschloss er sich anders. Er ließ den Ursulus zu sich kommen und die Königin und sprach: "Da ich gehört, wie die weise und fromme Jungfer Fanferlieschen blind ist, so ist mein sehnlicher Wunsch, dass sie wieder sehend werde, damit sie die guten Leute in Besserdich noch länger so treu regiere, als sie es bis jetzt getan. Ich begehre eueren Rat, wie dies zu machen sei." Ursulus fing an zu weinen, als er das Unglück der Jungfer Fanferlieschen hörte, von welcher seine Mutter ihm so viel Gutes erzählt hatte.
Würgipumpa aber sprach: "Ich habe immer gehört, dass nichts so gut für die Augen sei als Schwalbenkot: Wenn es möglich wäre, dass Jungfer Fanferlieschen diesen in die Augen brächte, so würde sie gleich geheilt sein. Kommtzeitkommtrat ist ja mit den Vögeln so gut Freund, mit seinen Baumeistern, dass er ihr ein wenig von dem Kalke könnte ins Auge fallen lassen, der neulich bei dem Luftbau auf mich nieder fiel. Ich muss sagen, dass ich meine Augen seit jener Zeit sehr gestärkt finde." -
"Ach", erwiderte Ursulus, "wenn das möglich wäre, ich wollte die guten Vögel sehr darum bitten." - "Wohlan, mein Geliebter", sprach der König, "wenn es dir gelingt, sollst du begehren von mir, was du willst, ich will es dir halten." Nach diesen Worten gingen sie auseinander. Die böse Würgipumpa wusste wohl, dass man von Schwalbenkot blind werde, und sie dachte: 'In jedem Falle werde ich den verhassten Knaben los; denn wenn Fanferlieschen ihn erwischt, so lässt sie ihn umbringen, und sie erwischt ihn gewiss, weil sie wohl weiß, dass sie sterben muss, wenn sie blind wird, denn es steht im Zauberkalender; so lässt sie sich immer streng bewachen.'
Ursulus saß in seiner Kammer und lauerte auf den Neuntöter. Pick, pick, pick, da war er am Fenster. Ursulus öffnete und erzählte seinem Freund alles, was er von dem König und der Königin gehört. Der Neuntöter ward sehr nachdenklich darüber und bauschte seine Federn am Kopf einige Mal auf, als ob er sehr zornig sei. "Was machst du für wunderliche Gesichter?" fragte Ursulus.
"Nichts, nichts", sagte der Vogel, sich beruhigend, um zu überlegen. "Gut, ja, ja, morgen früh will ich dir sagen, was du zu tun hast", und fort flog er. Am anderen Morgen war er richtig wieder da und sprach: "Auf, auf, Ursulus! Mache dich auf die Reise; du hast einen weiten Weg nach Besserdich." Da sprang Ursulus aus dem Bett, zog seine Reisekleider an und machte sich auf den Weg. Der Vogel aber flog immer vor ihm her, um ihm den Weg zu zeigen.
Als sie in den Wald kamen um Mittag, machte der Vogel bei einem Eichbaum halt und sagte: "Hier musst du ausruhen, essen und trinken. Hier in dem Baume wohne ich; hier, lieber Ursulus, hat deine arme Mutter, als sie aus Besserdich ging, meinen Jungen das Leben gerettet durch einen Stein, den sie nach dem Marder warf; hier hat sie ihren Kuchen mit mir geteilt. Hier esse du auch, was ich dir aus der Hofküche hierher getragen."
Ursulus setzte sich auf das Moos am Fuße der Eiche und dachte mit vieler Liebe an seine liebe Mutter im Turm und musste recht weinen, als er gedachte, wie sie einst hier so unschuldig in das Elend ging. Da brachte der Neuntöter die Frau Neuntöter und die jungen Herren und das junge Fräulein Neuntöter, und diese hießen den Ursulus bei sich sehr willkommen mit Kopfnicken und Flügelschlagen und Sichverneigen, denn sie kannten die Menschensprache nicht. Der Neuntöter aber übersetzte dem Ursulus alles, was sie sagten.
Da gefielen ihm die Reden des Fräulein besonders wohl, denn sie sprach: "Ach, liebster Ursulus, ich wollte gern ewig ein Vogel bleiben, wenn ich dir nur recht viele Liebe erweisen könnte für alles das Gute, was deine Mutter meinem Vater und meiner Mutter und uns erwiesen hat." Das ging dem Ursulus recht durchs Herz.
Der Neuntöter brachte nun dem Ursulus einen Kaninchenbraten, den er schon am Abend vorher aus der Munkelwuster Hofküche hierher gebracht, und da Ursulus Brot in seiner Reisetasche bei sich hatte, schmeckte es ihm recht gut; denn er trank aus einer hellen Quelle, die ihm Fräulein Neuntöter zeigte, Wasser dazu. Auch rief sie ihre Spielgesellinnen, eine Amsel und eine Nachtigall, herbei, welche dem Ursulus die schönste Tafelmusik machten, während sie Erdbeeren und Brombeeren und Heidelbeeren und Haselnüsse pflückte und auf die Schultern des Ursulus fliegend sie mit ihrem blanken Schnabel zu den Lippen des Freundes reichte, der sie freundlich dafür streichelte.
Während diesem Mittagmahl rief der Neuntöter viele Schwalben herbei und fragte sie, welche es wohl unternehmen wolle, ihren Kot ins Aug der Fanferlieschen zu spritzen, und er versprach dafür so viel Fliegen und Mücken und Würmchen, als sie nur wollten. Da fand sich eine dazu bereit und flog gleich von dannen. Das Fräulein Neuntöter hatte alles das gehört und ihre eigenen Gedanken darüber; und da nun Ursulus mit dem alten Neuntöter sich wieder auf die Reise machte und für die freundliche Bewirtung dankte, war das Fräulein Neuntöter weg geflogen und nicht zugegen. Das war ihm leid; er ließ ihr recht schöne Grüße zurück, und sie machten sich auf den Weg.
Abends kamen sie in Besserdich an. Der Vogel führte den Ursulus in den Schlossgarten, da fand er eine Laube, einen gedeckten Tisch und ein Ruhebett. Er aß und schlief ein. Als er morgens erwachte, stand die Sonne schon am Himmel, und er sah auf dem Altan des Schlosses die Jungfer Fanferlieschen auf einem Ruhebett liegen, und neben ihr standen ein paar Pfauen, welche ihr mit ihren Schweifen wie mit Sonnenfächern die Fliegen abwehrten.
Die Jungfer Fanferlieschen war sehr alt, hatte aber wunderschöne lange weiße Locken, welche ihr ein schönes Ansehen gaben; und durch das goldne Gegitter des Altans sah Ursulus ihre schönen kleinen Füße in rotsamtenen Pantoffeln herabhängen. 'Ach', dachte Ursulus, 'was ist das für ein liebes gutes altes Jüngferchen, das Fanferlieschen Schönefüßchen, und wie wird sie sich freuen, wenn ihr der Sohn ihrer lieben Ursula wieder zu ihren gesunden Augen helfen wird.'
Da sah er auch, wie sich die Schwalbe grade über dem Kopf der Jungfer Fanferlieschen auf den Vorsprung der Türe setzte, und konnte vor Begierde, ihr zu helfen, sich nicht mehr halten; er winkte
mit dem Schnupftuch, und die Schwalbe ließ den Kot der guten Fanferlieschen ins Aug fallen, welche erwachte, mit den Füßen, schüttelte und aufschrieb
"Der, den mein Pantoffel trifft,
nahm mir meiner Augen Licht."
Ursulus wollte grade zu ihr hinauf laufen und ihr Glück wünschen; aber ein niederfallender Pantoffel schlug ihm so auf die Nase, dass er betäubt nieder sank. Als er erwachte, lag er in Ketten und
Banden in dem aller dunkelsten Kerker. Er wusste nicht, wie ihm geschehen, er tappte an den Wänden herum, er rief, er klagte, er weinte; ach! da erinnerte er sich der Worte, die er vor dem
Pantoffelfall gehört:
"Der, den mein Pantoffel trifft,
nahm mir meiner Augen Licht."
Das fuhr ihm recht durch Mark und Bein. "Ach" sagte er, "die Würgipumpa hat mich betrogen; statt Fanferlieschen zu helfen, habe ich sie blind gemacht; o ich unglücklicher Ursulus." Als er so in Jammer und Klagen saß, sprang auf einmal ein eiserner Fensterladen auf, und das gute Fräulein Neuntöter flog zu ihm. Sie ließ ein kleines Büchlein auf seinen Schoß fallen und hatte eine Wurzel im Schnabel, die legte sie zu seinen Füßen, und saß auf seiner Schulter und streichelte ihn mit ihren Flügeln und tat sehr mitleidig.
Ursulus dankte ihr und klagte seinen Jammer. Da blätterte sie mit dem Schnabel in dem Büchlein herum und winkte ihm, zu lesen. Das tat Ursulus und fand, dass es die Geschichte des frommen Tobias war, und als er las, dass der auch durch eine Schwalbe blind geworden, ward er seines Unglücks gewiss und weinte noch mehr. Aber Fräulein Neuntöter blätterte noch mehr im Buche, und da las er weiter, dass der Sohn des Tobias seinen Vater wieder mit der Galle eines Fisches geheilt habe.
"Ach Gott im. Himmel", sagte er, "hätte ich einen Tropfen dieser Galle, wie selig wollte ich sein, wenn ich die gute Jungfer Fanferlieschen wieder heilen könnte." Da hielt ihm der Vogel die Wurzel an die Schlösser seiner Fesseln, und siehe da, sie fielen ihm ab, und hielt sie an das Schloss der Kerkertür, und sie sprang auf. Da machte Ursulus die Türe wieder zu, weil es noch Tag war, und wartete bis zur Nacht.
Dann nahm er Abschied von dem lieben Vogel, sagte ihm tausend Dank, und durch die Berührung der Wurzel sprangen alle Türen und Tore auf, und so ging er traurig zur Stadt hinaus in lauter Angst und Trauer, wie er nur die Galle von dem Fische finden sollte; und so lief er immer in den wilden Wald hinein, und kein Mensch wusste damals, wo er hingekommen war.
In Munkelwust wartete der König Jerum mit großer Ungeduld auf die Rückkehr des Ursulus, und da er nicht kam, sprach Würgipumpa: "Wie wäre es, wenn wir miteinander nach Besserdich reisten, um der Fanferlieschen zu ihrer Genesung Glück zu wünschen, sie hält den Kommtzeitkommtrat gewiss mit Liebkosungen zurück. Wenn du auch nicht wieder König dort sein willst, so kannst du doch gute Freundschaft mit Jungfer Fanferlieschen halten."
Das war der König zufrieden, und sie zogen mit einem großen Gefolge nach Besserdich. Jerum war sehr traurig auf der Reise, Würgipumpa aber sehr lustig. Auf halbem Wege kamen ihm einige schwarz gekleidete Reiter entgegen. Jeder trug in der einen Hand eine Zitrone, in der anderen Hand einen Ölzweig, und von ihren Hüten schleppten lange Trauerflöre bis an die Erde hinab. Sie machten halt bei dem König, und er erkannte bald mehrere alte Bürger von Besserdich.
Der eine sprach zu ihm: "König Jerum! So du dich wirklich gebessert hast, komme wieder zu uns in die Stadt und sei unser guter König, dieses hat uns Fanferlieschen dir zu sagen befohlen." Bei diesen Worten weinten sie. Jerum sprach: "Ich habe mich bestrebt, besser zu werden, aber ich fühle doch, dass ich noch nicht verdiene, über andre zu herrschen. Sagt das der Fanferlieschen, und bittet sie um Erlaubnis, dass ich sie sehen darf." -
"Ach", sagten sie, "diese Freude kann sie nicht mehr haben, denn vor einigen Tagen ist sie durch eine Schwalbe blind geworden." Da zitterte der König vor Schrecken und zog sein Schwert und wollte die Würgipumpa erstechen und schrie: "Verräterin, das hast du mir getan!" Würgipumpa warf sich vor ihm nieder und sprach: "Mein Gemahl, ermorde mich Unschuldige; mein Bruder hat es mich gelehrt, ich wusste nichts davon, dass dies den Augen schädlich sei."
Da steckte der König sein Schwert wieder ein und sprach zu den Herren: "Seht, wie soll ich über andre herrschen, da ich mich selbst nicht beherrschen kann." Die Herren redeten ihm aber so lange zu, bis er mit ihnen nach Besserdich ritt. Als er wieder in seinem Schloss war, fragte er nach Fanferlieschen und nach Ursulus, aber man erzählte ihm, dass Ursulus aus dem Kerker entkommen sei, niemand wisse wie, und dass die blinde Jungfer Fanferlieschen, als sie sich den Tag nach ihrem Unglück habe in den Garten führen lassen, ein anderes Unglück gehabt habe.
Sie habe sich auf eine Rasenbank gesetzt, und die habe sich unter ihr auf einmal in einen ungeheuren schwarzen Bock verwandelt und sei wie ein Pfeil mit ihr durch die Lüfte fort gefahren. Da rief der König mit Schrecken aus: "Ach, der böse Pumpelirio Holzebocke!" Er gab nun Befehl, überall nach dem Holzebock und Fanferlieschen und Ursulus zu suchen, und ritt selbst oft ganze Tage lang nach ihnen aus.
Als er nun einstens abends nach Hause kam und traurig in seine Stube ging, welche Freude! Ursulus kam ihm entgegen. Der Jüngling fiel ihm zu Füßen, der König umarmte ihn und weinte. "Ach", sagte da Ursulus, "wo ist Jungfer Fanferlieschen, dass ich sie wieder sehend mache. Seht, hier in dem Schneckenhaus habe ich von der Fischgalle, womit der blinde Tobias von seinem Sohne geheilt wurde; ach, wo ist sie, dass ich ihr helfe!" -
"Ach und o weh", sprach Jerum, "sie ist fort, niemand weiß, wohin; der Holzebock hat sie davon geführt." Da ward Ursulus noch viel trauriger. Der König fragte ihn, wo er die Fischgalle her habe. Da erzählte Ursulus alles, wie es ihm gegangen mit dem guten Vogel, und zeigte ihm das Tobiasbüchlein und die Wurzel. "Und als ich", sprach er, "in die Wildnis gelaufen, hat mich der Vogel an einen Fluss gebracht und hat da sehr lange mit einem alten Fischreiher gesprochen; der hat immer mit dem Kopf geschüttelt, als wisse er nicht, was für ein Fisch es sein müsse, weil im Büchlein stehe, ein Fisch, und es gar viele Fische gebe.
Endlich habe der alte Fischreiher in Gottes Namen einen Fisch nach dem anderen gefangen, und da ich mir die Augen ganz blind geweint hatte, so haben wir die Galle an meinen Augen versucht. Da haben wir endlich einen gefangen, dessen Galle meine Augen gleich wieder herstellte, und da habe ich mir das Schneckenhaus voll genommen und komme nun leider zu spät hierher." Jerum ließ gleich die Probe an einem alten blinden Manne machen, und er ward gleich wieder sehend und dankte dem König sehr.
Als Würgipumpa alles dies hörte, nahte sie sich dem König mit Tränen und sprach: "Ich muss alles tun, das Unrecht wieder gut zu machen, das ich unschuldig veranlasste. Ich habe nun durch meine Nachforschungen erfahren, dass der Holzebocke sich hier im Walde in einer Höhle aufhält; wie wäre es, wenn Kommtzeitkommtrat, der alles kann, was er unternimmt, den Holzebock zu bekämpfen suchte? Er ist jetzt schon ein schöner junger Ritter, und wenn er das Ungeheuer erlegt hätte, so würde er Fanferlieschen, die er in seiner Höhle gefangen hat, heilen und befreien können."
König Jerum sprach erzürnt: "Wie? Soll mein einziger Trost auf Erden, dieser gute Jüngling, noch einmal in Todesgefahr? Nein, das kann ich nimmer mehr zugeben." Ursulus hatte es aber kaum gehört, als er vor dem König niederkniete und zu ihm sagte: "Lieber König, gebt mir Waffen, es mag mir gehen, wie es will, so kann ich doch nicht eher ruhen, bis ich Fanferlieschen geheilt habe. Lasst mich ausziehen gegen den Holzebocke."
Jerum war sehr betrübt, aber Ursulus ließ mit Bitten nicht nach. "Wohlan", sagte der König, "so will ich mit meinem Hofstaat und dir nach Munkelwust ziehen, weil der böse Holzebocke dort in der Gegend wohnt, und in unserer neuen Kirche will ich dich zum Ritter schlagen, und ich will beten dort, bis du wiederkommst."
Da zog Jerum und seine Gemahlin und der Hofstaat und Ursulus nach Munkelwust, und der König ging mit Ursulus in die Kirche, die fertig war, und der alte Schäfer hatte den Altar mit wunderschönen Blumen geschmückt. Da schlug der König den Ursulus zum Ritter und gab ihm einen goldnen Harnisch von Kopf bis zu Fuß und ein herrliches Schwert, das war wie eine Säge. Und auf seinem Schild war abgebildet ein Kreuz und vier Nägel und ein Schwamm und eine Geißel und ein Speer und eine Dornkrone.
Den Knopf des Schwertes konnte man aufschrauben, da hinein legte Ursulus das Schneckenhaus mit der Fischgalle. Und nun nahm er eine große Lanze in die Hand, und ein schneeweißer Schimmel mit himmelblauem Geschirr ward vorgeführt; der König hielt ihm selbst den Bügel, und Ursulus schwang sich in den Sattel, dass es rasselte. Da kam der alte Neuntöter geflogen und zog immer vor ihm her. Die Frau Neuntöterin aber flog auf den Kopf seines Pferdes, und der Junker Neuntöter setzte sich auf die Spitze seiner Lanze. Das Fräulein Neuntöter aber setzte sich auf seinen Helm, und so sprengte er in den Wald hinein.
Der König sah ihm lange nach und warf sich dann in der Kirche betend auf sein Angesicht und der alte Schäfer auch, und alle Lämmer auch, und es war, als wenn die Blumen auch auf den Gräbern der Jungfrauen beteten. Auch Ursula, welcher der Neuntöter alles gesagt hatte, betete in ihrem einsamen Turme in heißen Tränen: "Ach Gott im Himmel, erhalte mir meinen Ursulus."
Die Königin Würgipumpa aber betete nicht, sie hatte sich krank gestellt und war im Schlosse geblieben, denn sie war falsch und verlogen und glaubte ganz gewiss, dass der Holzebocke den Ursulus
umbringen werde; deswegen hatte sie den bösen Rat gegeben. Als Ursulus mitten in der Wildnis angekommen war, hielt er sein Pferd an, schlug mit dem Schwert gegen sein Schild und schrie:
"Pumpelirio Holzebocke,
hörst du deine Totenglocke?"
Da trat auf einmal sein Freund, der alte Schäfer, hinter einem Baum hervor und nahte seinem Pferd und sprach: "O lieber Ursulus, tue doch dem Pumpelirio Holzebocke nichts, wenn du den Pumpelirio
umbringst, so muss ich sterben, denn wir sind in einer Stunde geboren." Da rief Ursulus:
"In einer Stunde geboren,
in einer Stunde verloren;
der Holzebock muss sterben,
sonst muss Fanferlieschen verderben.
Tritt aus dem Weg zur Seiten,
sonst muss ich dich überreiten"
Der Schäfer aber wollte nicht aus dem Weg, da machte Ursulus die Augen zu und ritt den Schäfer über den Haufen. Da flog der Vogel zu Ursulus und sagte ihm: "Gott segne dich, das war der
Pumpelirio selber." Da ritt er weiter, hielt wieder an und rief wieder, an das Schild schlagend:
"Pumpelirio Holzebocke,
hörst du deine Totenglocke?"
Da stürzte auf einmal der König Jerum ihm in den Weg und hielt ihm den Zügel des Pferdes und sprach wie der Schäfer: "Tue dem Pumpelirio nichts, sonst muss ich sterben." Aber Ursulus schrie
wieder:
"Tritt aus dem Weg zur Seiten,
sonst muss ich dich überreiten"
und machte die Augen wieder zu und ritt den König über den Haufen. Da kam der Vogel wieder zu Ursulus und lobte ihn sehr, dass er sich nicht irre machen ließ. Denn dieser Jerum war wieder nur der verstellte Holzebocke. Als Ursulus zum dritten Male auf das Schild schlug und den Pumpelirio rief, ach! welche Gestalt trat ihm da in den Weg, wer kniete vor seinem Pferd?
Niemand anders war es als seine Mutter Ursula. Sie rang die Hände und rief aus: "Mein Sohn, mein Sohn! Wenn du dem Pumpelirio etwas tust, so muss ich sterben." Ach, bei diesem Anblick brach dem
Ursulus das Herz, und schon wollte er umwenden, da stieß der Vogel das Pferd mit seinem Schnabel in die Seite, und das rannte auch diese Gestalt des Pumpelirio über den Haufen, welcher ganz
zornig, dass es ihm nicht gelungen war, den Ursulus zu betrügen, nun in Gestalt eines ungeheuren schwarzen Bocks auf ihn zukam und ihn fragte
"Ei, was willst du, Ursulus?"
Da sagte dieser:
"Fanferlieschen
Schönefüßchen,
die ich wieder heilen muss."
Da sagte der Bock wieder:
"Pumpelirio biet dir Trutz,
Holzebocke machet Stutz."
Und nun rannte der Bock auf ihn zu und stieß seinen weißen Schimmel über den Haufen, dass er tot nieder sank, und die Lanze, mit welcher Ursulus nach dem Bock gestochen, zerbrach. Die guten Vögel aber hatten alle die neunundvierzig Messer, welche sie schon einmal auf den Jerum geworfen hatten, schon auf einem Baum zurecht gelegt und ließen sie eins nach dem anderen auf den Holzebock fallen.
Er machte sich nichts draus, denn sie blieben alle in ihm stecken, und jedes ward ein Horn, so dass er endlich wie ein Stachelschwein aussah. Ursulus hatte sich vom Pferde geschwungen und schlug mit seinem Schwerte auf den Holzebock, aber das zerbrach, und Ursulus ward über den Haufen gerannt.
Da bedeckte er sich mit seinem Schild, und der Bock trampelte mit Füßen auf ihm herum. Das tat dem Fräulein Neuntöter so leid, dass sie dem Bock zwischen die Hörner flog und ihm die Augen aushackte, worüber er erschrecklich zu meckern anfing. Nun griff Ursulus unter dem Schild hervor und fasste den Bock beim Bart und zog das Messer hervor, das ihm seine Mutter gegeben, und stach es dem Holzebock ins Herz. Da machte er noch einen Seitensprung und fiel tot nieder.
"Gott sei Dank!" rief Ursulus und raffte sich von der Erde auf: "Ach, wo ist nun Fanferlieschen Schönefüßchen, die ich nun gleich heilen muss?" Da sagte ihm der Neuntöter, dass sie gleich hier in einer Höhle liege und schlafe. Ursulus lief in die Höhle, da lag Fanferlieschen tot auf einer steinernen Bank. Ursulus glaubte, sie schlafe, aber sie war nicht zu wecken, da klagte er Jammer und Not. Überdem kam der Vogel und sagte: "Ursulus, das Blut vom Holzebock ist auf dein Pferd gespritzt, da ist es wieder lebendig geworden."
Da nahm Ursulus gleich von dem Blut und bestrich die Fanferlieschen damit. Da wurde sie wieder lebendig, und nun bestrich er ihr die Augen mit der Fischgalle, da ward sie wieder sehend. Ach, wie glücklich war da Ursulus, auch sie weinte vor Freuden und drückte ihn an ihr Herz. "Geschwind wollen wir nun zu Jerum", rief sie, "denn der ist in großer Angst."
Da setzte sie der Ursulus hinter sich auf sein Pferd und ritt mit ihr nach der Kirche. Da war große Not und Kummer, denn es war die Nachricht gekommen, dass die Königin Würgipumpa tot mit einem Stich im Herzen auf ihrer Stube gefunden worden sei und dass ihr die Augen aus dem Kopf gesprungen seien. Der König aber vergaß bald seine Betrübnis, da Ursulus und Fanferlieschen angeritten kamen.
Er küsste der Fanferlieschen das schöne Füßchen und hob sie vom Pferd und küsste den Ursulus viel tausendmal. Da sagte Fanferlieschen: "Es ist mir lieb, Jerum, dass du dich gebessert hast; aber wo ist Ursula, meine Pflegetochter, zeige mir sie, dass ich sie umarme." Bei diesen Worten riss sich der König die Haare aus und schrie: "Weh, weh! Ich Elender, ich bin ein Mörder und bleib ein Mörder." -
"Ja", sagte Fanferlieschen, "das bist du, und deswegen sollst du lebendig in den Turm vermauert werden, in welchen du die gute Ursula hast mauern lassen." - "Von Herzen gern", sagte Jerum, "will ich sterben, wo sie gestorben ist, bringt mich hin." Da brachte man ihn an den Turm und gab ihm eine Hacke. Alle standen traurig um ihn her und sahen, wie der arme Jerum für sich selbst den Turm aufbrechen musste.
Er tat allen Abbitte, die er beleidigt hatte, er bat Fanferlieschen tausendmal um Verzeihung und bat sie, mit Ursulus sein Land zu regieren. Ach, und als er diesen ansah, wollte ihm das Herz
zerreißen. Er umarmte ihn und sprach:
"Du brachtest mich zum rechten Pfad
Kommtzeitkommtrat,
dass ich dich nie mehr wiederseh,
das tut mir weh, o weh, o weh!"
Ursulus aber sprach:
"Kommtzeitkommtrat, dein Diener, spricht:
Meinen Herrn und König verlass ich nicht.
Ich geh mit dir ins Grab hinein,
ich denk, es wird uns wohl drin sein."
Da nahm er auch eine Hacke, und sie arbeiteten zusammen, und der König Jerum sagte, so oft ein Stein herausgebrochen war:
"Lieb Ursula so still und fromm,
o freue dich, ich komm, ich komm."
Und dann hielt er immer wieder ein und umarmte den Ursulus und bat ihn, zurückzubleiben. Ursulus aber sagte beständig:
"Ich geh mit dir ins Grab hinein,
ich denk, es wird uns wohl drin sein."
Und da arbeiteten sie immer drauflos, und sie waren schon bis an die wollene Decke gekommen, welche Ursula rings im Turme herum gespannt hatte, da ließ Jerum die Hacke sinken und sprach:
"Lieb Ursula so still und fromm,
o freue dich, ich komm, ich komm."
Und alle, die umher standen, weinten bitterlich. Aber auf einmal hörte man eine Stimme hinter der wollenen Decke, welche sprach: "Ihre königliche Majestät Jerum werden alleruntertänigst ersucht, noch einige Augenblicke zu verziehen zu geruhen, da Ihre Majestät die Königin Ursula noch mit ihrem Anzug beschäftigt sind." -
"Allmächtiger Gott, was ist das?" rief Jerum. "Himmel und Erde mögen zusammenfallen, sie lebt! Sie lebt! Oh, ich muss, ich muss sie sehen." Da wollte er die Decke niederreißen, aber Fanferlieschen und Ursulus hielten ihn zurück. "O lasst mich! Lasst mich ihre Füße mit meinen Tränen benetzen und sterben", rief Jerum.
Da steckte Ursula ein wunderschönes Füßchen zu der Decke heraus und sprach mit süßer Stimme:
"Da, mein lieber Jerumius,
hast du deiner Ursula Fuß."
Und Jerum sank zur Erde und küsste ihren Fuß und legte sein Haupt nieder und setzte den Fuß Ursulas auf sein Haupt und sprach:
"Der Unschuld Fuß auf Schlangenhaupt,
selig, wer da liebt und glaubt."
Da streckte Ursula ihre schöne Hand hervor und sprach:
"Da, Jerum, hast du meine Hand,
leg deine drein zum Liebespfand."
Da sprang Jerum auf und küsste die Hand und benetzte sie mit Tränen und sprach:
"O Engelshand, o segne mich,
nie mehr, nie mehr, beleidig ich dich!"
Da steckte Ursula den Kopf durch die Decke und rief:
"O Jerum, küsse meinen Mund,
da sind wir alle beide gesund."
Ach, da riss Jerum die Decke nieder und sank an das Herz der Ursula, und Ursulus auch und Fanferlieschen auch, und alle Schmerzen waren vergessen, und alles Böse war verziehen. Der Himmel war blau und heiter, die Zuschauer aber sanken auf die Knie und beteten. Als sie sich ein wenig erholt hatten, sagte Ursula zu Jerum: "Sieh, das ist dein Sohn Ursulus!"
Oh, da war Jerums Freude von neuem groß. Neben der Ursula aber stand der Vogel Neuntöter wieder in den Kammerherrn von Neuntöter verwandelt, und seine Gattin war wieder die Hofdame von Neuntöter, und der Junker war ein Edelknabe, und das Fräulein Neuntöter stand so schön, so blond und schlank mit niedergeschlagenen Augen vor Ursulus, dass er vor sie hin trat und sprach:
"Oh, mein schönes Fräulein! Ihnen verdanke ich die Befreiung aus dem Kerker durch die Springwurzel und das Tobias Büchlein und die Fischgalle, und Sie haben dem Holzebocke die Augen ausgehackt, wie lohne ich Ihnen?" Als Jerum und Ursula und Fanferlieschen dieses hörten, legten sie die Hände der beiden zusammen und sagten: "Ihr sollt Mann und Frau sein." Darüber waren beide glücklich.
Alle aber zogen nun nach der Kirche und dankten Gott, und Fanferlieschen sagte. "Gott sei Dank, Jerum, dass der Holzebock und Würgipumpa tot sind. Sie waren Geschwister und meine größten Feinde, aber sie wussten nicht, dass eines mit dem anderen sterben musste. Jetzt lasst uns alle nach Besserdich ziehen und in Tugend und Ehren das Land regieren."
Jerum aber sprach: "Ich bin das Glück nicht wert, nur die Unschuld soll regieren, die Schuld aber soll Buße tun. Ich bleibe hier bei dem alten Schäfer und büße ewiglich." Da setzte er seine Krone auf das Haupt des Ursulus, und Ursula setzte ihre Krone auf das Haupt der Fräulein Neuntöter, welche auch Ursula hieß, und sprach: "Auch ich will hier bleiben und beten."
Darüber ward das Herz des armen Jerums so gerührt, dass es mitten entzwei sprang und Jerum starb. Oh, da war Weinen und Wehklagen. Und sie begruben ihn zu Füßen eines Kreuzes bei dem Brunnen, und Ursula sang, und aus allen Gräbern der Jungfräulein sang es mit.
Ursula blieb nun da bei dem alten Schäfer wohnen und nahm viele Witwen und Waisen zu sich, und sie arbeiteten für die Armut und beteten und sangen. Fanferlieschen segnete sie, und Ursulus und seine Frau trennten sich weinend von ihr und zogen nach der Stadt Besserdich. Der Herr von Neuntöter und seine Frau und sein Sohn aber regierten das Ländchen Bärwalde für Ursula.
Als Fanferlieschen weg ritt, ging sie auf den alten Schäfer zu und sprach zu ihm: "Damon, kennst du mich noch? Wir sind beide alt geworden." - "Ja", sagte der Schäfer, "ich kenne dich noch; als
du die Lämmer hütetest neben mir, da liebte ich dich und sagte dir es. Da sprachst du:
'Lieber guter Schäfer mein,
schön wär's wohl, doch kann's nicht sein.
Ich bin nur ein guter Geist,
der so durch das Leben reist.
Liebe Gott, das ist gescheiter',
also sprachst du, und zogst weiter."
"Richtig", sagte Fanferlieschen, "so war es, und du hast meinem Rat gefolgt, drum werd ich dich im Himmel wiedersehen." Da sank der Schäfer tot an die Erde, und Fanferlieschen flog durch die Lüfte davon und ließ ihre Pantoffeln nieder fallen. Die fing die Gemahlin des Ursulus auf und war gleich so schön und lieb und klug als Fanferlieschen. Sie kamen nach Besserdich und regieren gut bis dato.
Clemens von Brentano
DIE ZAUBEREI IM HERBSTE ...
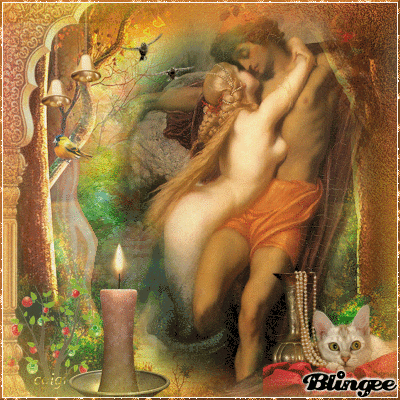
Ritter Ubaldo war an einem heiteren Herbstabend auf der Jagd weit von den Seinigen abgekommen und ritt eben zwischen einsamen Waldbergen hin, als er von dem einen der selben einen Mann in seltsamer, bunter Kleidung herabsteigen sah. Der Fremde bemerkte ihn nicht, bis er dicht vor ihm stand. Ubaldo sah nun mit Verwunderung, daß der selbe einen sehr zierlichen und prächtig geschmückten Wams trug, der aber durch die Zeit altmodisch und unscheinlich geworden war. Sein Gesicht war schön, aber bleich und wild mit Bart verwachsen.
Beide begrüßten einander erstaunt, und Ubaldo erzählte, daß er so unglücklich gewesen, sich hier zu verirren. Die Sonne war schon hinter den Bergen versunken, dieser Ort weit entfernt von allen Wohnungen der Menschen. Der Unbekannte trug daher dem Ritter an, heute bei ihm zu übernachten; morgen mit dem frühesten wolle er ihm den einzigen Pfad weisen, der aus diesen Bergen heraus führe. Ubaldo willigte gern ein und folgte nun seinem Führer durch die öden Waldesschluchten.
Sie kamen bald an einen hohen Fels, in dessen Fuß eine geräumige Höhle ausgehauen war. Ein großer Stein lag in der Mitte der selben, auf dem Stein stand ein hölzernes Kruzifix. Ein Lager von trockenem Laub füllte den Hintergrund der Klause. Ubaldo band sein Pferd am Eingang an, während sein Wirt stillschweigend Wein und Brot brachte. Sie setzten sich miteinander hin, und der Ritter, dem die Kleidung des Unbekannten für einen Einsiedler wenig passend schien, konnte sich nicht enthalten, ihn um seine früheren Schicksale zu befragen. -
«Forsche nur nicht, wer ich bin», antwortete der Klausner streng, und sein Gesicht wurde dabei finster und unfreundlich. - Dagegen bemerkte Ubaldo, daß der selbe hoch aufhorchte und dann in ein tiefes Nachsinnen versank, als er selber nun anfing, mancher Fahrten und rühmlicher Taten zu erwähnen, die er in seiner Jugend bestanden. Ermüdet endlich streckte sich Ubaldo auf das ihm angebotene Laub hin und schlummerte bald ein, während sein Wirt sich am Eingang der Höhle nieder setzte.
Mitten in der Nacht fuhr der Ritter, von unruhigen Träumen geschreckt, auf. Er richtete sich mit halbem Leibe empor. Draußen beschien der Mond sehr hell den stillen Kreis der Berge. Auf dem Platz vor der Höhle sah er seinen Wirt unruhig unter den hohen, schwankenden Bäumen auf und ab wandeln. Er sang dabei mit hohler Stimme ein Lied, wovon Ubaldo nur abgebrochen ungefähr folgende Worte vernehmen konnte:
Aus der Kluft treibt mich das Bangen,
Alte Klänge nach mir langen -
Süße Sünde, laß mich los!
Oder wirf mich ganz darnieder,
Vor dem Zauber dieser Lieder
Bergend in der Erde Schoß!
Gott! Inbrünstig möcht ich beten,
Doch der Erde Bilder treten
Immer zwischen dich und mich,
Und ringsum der Wälder Sausen
Füllt die Seele mir mit Grausen,
Strenger Gott! ich fürchte dich.
Ach! So brich auch meine Ketten!
Alle Menschen zu erretten,
Gingst du ja in bittern Tod.
Irrend an der Hölle Toren,
Ach, wie bald bin ich verloren!
Jesus, hilf in meiner Not!
Der Sänger schwieg wieder, setzte sich auf einen Stein und schien einige unvernehmliche Gebete herzumurmeln, die aber vielmehr wie verwirrte Zauberformeln klangen. Das Rauschen der Bäche von den nahen Bergen und das leise Sausen der Tannen sang seltsam mit darein, und Ubaldo sank, vom Schlafe überwältigt, wieder auf sein Lager zurück.
Kaum blitzten die ersten Morgenstrahlen durch die Wipfel, als auch der Einsiedler schon vor dem Ritter stand, um ihm den Weg aus den Schluchten zu weisen. Wohlgemut schwang sich Ubaldo auf sein Pferd, und sein sonderbarer Führer schritt schweigend neben ihm her. Sie hatten bald den Gipfel des letzten Berges erreicht, da lag plötzlich die blitzende Tiefe mit Strömen, Städten und Schlössern im schönsten Morgenglanz zu ihren Füßen.
Der Einsiedler schien selber überrascht. «Ach, wie schön ist die Welt!» rief er bestürzt aus, bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen und eilte so in die Wälder zurück. - Kopfschüttelnd schlug Ubaldo nun den wohl bekannten Weg nach seinem Schlosse ein. Die Neugierde trieb ihn indessen gar bald von neuem nach der Einöde, und er fand mit einiger Mühe die Höhle wieder, wo ihn der Klausner diesmal weniger finster und verschlossen empfing.
Daß der selbe schwere Sünden redlich abbüßen wolle, hatte Ubaldo wohl schon aus jenem Nächtlichen Gesang entnommen, aber es kam ihm vor, als ob dieses Gemüt fruchtlos mit dem Feinde ringe; denn in seinem Wandel war nichts von der heiteren Zuversicht einer wahrhaft Gott ergebenen Seele, und gar oft, wenn sie im Gespräch beieinander saßen, brach eine schwer unterdrückte irdische Sehnsucht mit einer fast furchtbaren Gewalt aus den irre flammenden Augen des Mannes, wobei alle seine Mienen sonderbar zu verwildern und sich gänzlich zu verwandeln schienen.
Dies bewog den frommen Ritter, seine Besuche öfter zu wiederholen, um den Schwindelnden mit der ganzen, vollen Kraft eines ungetrübten, schuldlosen Gemüts zu umfassen und zu erhalten. Seinen Namen und früheren Wandel verschwieg der Einsiedler indes fortdauernd, es schien ihm vor der Vergangenheit zu schaudern. Doch wurde er mit jedem Besuche sichtbar ruhiger und zutraulicher. Ja, es gelang dem guten Ritter endlich sogar, ihn einmal zu bewegen, ihm nach seinem Schlosse zu folgen.
Es war schon Abend geworden, als sie auf der Burg anlangten. Der Ritter ließ daher ein wärmendes Kaminfeuer anlegen und brachte von dem besten Wein, den er hatte. Der Einsiedler schien sich hier zum ersten Male ziemlich behaglich zu fühlen. Er betrachtete sehr aufmerksam ein Schwert und andere Waffenstücke, die im Widerscheine des Kaminfeuers funkelnd dort an der Wand hingen, und sah dann wieder den Ritter lange schweigend an.
«Ihr seid glücklich», sagte er, «und ich betrachte Eure feste, freudige, männliche Gestalt mit wahrer Scheu und Ehrfurcht, wie Ihr Euch, unbekümmert durch Leid und Freud, bewegt und das Leben ruhig regiert, während Ihr Euch dem selben ganz hinzugeben scheint, gleich einem Schiffer, der bestimmt weiß, wo er hinsteuern soll, und sich von dem wunderbaren Liede der Sirenen unterwegs nicht irre machen läßt. Ich bin mir in Eurer Nähe schon oft vorgekommen wie ein feiger Tor oder wie ein Wahnsinniger. - Es gibt vom Leben Berauschte - ach, wie schrecklich ist es, dann auf einmal wieder nüchtern zu werden!»
Der Ritter, welcher diese ungewöhnliche Bewegung seines Gastes nicht unbenutzt vorbeigehen lassen wollte, drang mit gutmütigem Eifer in den selben, ihm nun endlich einmal seine Lebensgeschichte zu vertrauen. Der Klausner wurde nachdenkend. «Wenn ihr mir versprecht», sagte er endlich, «ewig zu verschweigen, was ich Euch erzähle, und mir erlaubt, alle Namen wegzulassen, so will ich es tun.» Der Ritter reichte ihm die Hand und versprach ihm freudig, was er forderte, rief seine Hausfrau, deren Verschwiegenheit er verbürgte, herein, um auch sie an der von beiden lange ersehnten Erzählung teilnehmen zu lassen.
Sie erschien, ein Kind auf dem Arme, das andere an der Hand führend. Es war eine hohe, schöne Gestalt in verblühender Jugend, still und mild wie die untergehende Sonne, noch einmal in den lieblichen Kindern die eigene versinkende Schönheit abspiegelnd. Der Fremde wurde bei ihrem Anblick ganz verwirrt. Er riß das Fenster auf und schaute einige Augenblicke über den nächtlichen Waldgrund hinaus, um sich zu sammeln. Ruhiger trat er darauf wieder zu ihnen; sie rückten alle dichter um den lodernden Kamin, und er begann folgendermaßen:
«Die Herbstsonne stieg lieblich wärmend über die farbigen Nebel, welche die Täler um mein Schloß bedeckten. Die Musik schwieg, das Fest war zu Ende, und die lustigen Gäste zogen nach allen Seiten davon. Es war ein Abschiedsfest, das ich meinem liebsten Jugendgesellen gab, welcher heute mit seinem Häuflein dem heiligen Kreuze zuzog, um dem großen christlichen Heere das gelobte Land erobern zu helfen.
Seit unserer frühesten Jugend war dieser Zug der einzige Gegenstand unserer beiderseitigen Wünsche, Hoffnungen und Pläne, und ich versenke mich noch jetzt oft mit einer unbeschreiblichen Wehmut in jene stille, morgenschöne Zeit, wo wir unter den hohen Linden auf dem Felsenabhang meines Burgplatzes zusammen saßen und in Gedanken den segelnden Wolken nach jenem gebenedeiten Wunderland folgten, wo Gottfried und die anderen Helden in lichtem Glanze des Ruhmes lebten und stritten. - Aber wie bald verwandelte sich alles in mir!
Ein Fräulein, die Blume aller Schönheit, die ich nur einigemale gesehen und zu welcher ich, ohne daß sie davon wußte, gleich von Anfang eine unbezwingliche Liebe gefaßt hatte, hielt mich in dem stillen Zwinger dieser Berge gebannt. Jetzt, da ich stark genug war, mitzukämpfen, konnte ich nicht scheiden und ließ meinen Freund allein ziehen.
Auch sie war bei dem Fest zugegen, und ich schwelgte vor übergroßer Seligkeit in dem Widerglanz ihrer Schönheit. Nur erst, als sie des Morgens fort ziehen wollte und ich ihr auf das Pferd half, wagte ich, es ihr zu entdecken, daß ich nur ihretwillen den Zug unterlassen. Sie sagte nichts darauf, aber blickte mich groß und, wie es schien, erschrocken an und ritt dann schnell davon.» -
Bei diesen Worten sahen der Ritter und seine Frau einander mit sichtbarem Erstaunen an. Der Fremde bemerkte es aber nicht und fuhr weiter fort:
«Alles war nun fort gezogen. Die Sonne schien durch die hohen Bogenfenster in die leeren Gemächer, wo jetzt nur noch meine einsamen Fußtritte widerhallten. Ich lehnte mich lange zum Erker hinaus; aus den stillen Wäldern unten schallte der Schlag einzelner Holzhauer herauf. Eine unbeschreiblich sehnsüchtige Bewegung bemächtigte sich in dieser Einsamkeit meiner. Ich konnte es nicht länger aushalten, ich schwang mich auf mein Roß und ritt auf die Jagd, um dem gepreßten Herzen Luft zu machen.
Lange war ich umhergeirrt und befand mich endlich zu meiner Verwunderung in einer mir bis jetzt noch ganz unbekannt gebliebenen Gegend des Gebirges. Ich ritt gedankenvoll, meinen Falken auf der Hand, über eine wunderschöne Heide, über welche die Strahlen der untergehenden Sonne schräg blitzend hinfuhren; die herbstlichen Gespinste flogen wie Schleier durch die heitere blaue Luft; hoch über die Berge weg wehten die Abschiedslieder der fortziehenden Vögel.
Da hörte ich plötzlich mehrere Waldhörner, die in einiger Entfernung von den Bergen einander Antwort zu geben schienen. Einige Stimmen begleiteten sie mit Gesang. Nie noch vorher hatte mich Musik mit solcher wunderbaren Sehnsucht erfüllt als diese Töne, und noch heute sind mir mehrere Strophen des Gesanges erinnerlich, wie sie der Wind zwischen den Klängen herüberwehte:
Über gelb und rote Streifen
Ziehen hoch die Vögel fort.
Trostlos die Gedanken schweifen,
Ach! sie finden keinen Port,
Und der Hörner dunkle Klagen
Einsam nur ans Herz dir schlagen.
Siehst du blauer Berge Runde
Ferne überm Walde stehn,
Bäche in dem stillen Grunde
Rauschend nach der Ferne gehn?
Wolken, Bäche, Vögel munter,
Alles ziehet mit hinunter.
Golden meine Locken wallen,
Süß mein junger Leib noch blüht -
Bald ist Schönheit auch verfallen,
Wie des Sommers Glanz verglüht,
Jugend muß die Blüten neigen,
Rings die Hörner alle schweigen.
Schlanke Arme zu umarmen,
Roten Mund zum süßen Kuß,
Weiße Brust, dran zu erwarmen,
Reichen, vollen Liebesgruß
Bietet dir der Hörner Schallen,
Süßer! komm, eh sie verhallen!
Ich war wie verwirrt bei diesen Tönen, die das ganze Herz durchdrangen. Mein Falke, sobald sich die ersten Klänge erhoben, wurde scheu, schwang sich wild kreischend auf, hoch in den Lüften verschwindend, und kam nicht wieder. Ich aber konnte nicht widerstehen und folgte dem verlockenden Waldhorn Lied immerfort, das Sinnen verwirrend bald wie aus der Ferne klang, bald wieder mit dem Winde näher schwellte.
So kam ich endlich aus dem Walde heraus und erblickte ein blankes Schloß, das auf einem Berge vor mir lag. Rings um das Schloß, vom Gipfel bis zum Walde hinab, lachte ein wunderschöner Garten in den buntesten Farben, der das Schloß wie ein Zauberring umgab. Alle Bäume und Sträucher in dem selben, vom Herbst viel kräftiger gefärbt als anderswo, waren purpurrot, goldgelb und feuerfarben; hohe Astern, diese letzten Gestirne des versinkenden Sommers, brannten dort im mannigfaltigsten Schimmer. Die untergehende Sonne warf gerade ihre Strahlen auf die liebliche Anhöhe, auf die Springbrunnen und die Fenster des Schlosses, die blendend blitzten.
Ich bemerkte nun, daß die Waldhornklänge, die ich vorhin gehört, aus diesem Garten kamen, und mitten in dem Glanze unter wilden Weinlaubranken sah ich, innerlichst erschrocken - das Fräulein, das alle meine Gedanken meinten, zwischen den Klängen, selber singend, herumwandeln. Sie schwieg, als sie mich erblickte, aber die Hörner klangen fort. Schöne Knaben in seidenen Kleidern eilten herab und nahmen mir das Pferd ab.
Ich flog durch das zierlich übergoldete Gittertor auf die Terrasse des Gartens, wo meine Geliebte stand, und sank, von so viel Schönheit überwältigt, zu ihren Füßen nieder. Sie trug ein dunkelrotes Gewand; lange Schleier, durchsichtig wie die Sommerfäden des Herbstes, umflatterten die goldgelben Locken, von einer prächtigen Aster aus funkelnden Edelsteinen über der Stirn zusammengehalten.
Liebreich hob sie mich auf, und mit einer rührenden, wie vor Liebe und Schmerz gebrochenen Stimme sagte sie: ‹Schöner, unglücklicher Jüngling, wie lieb ich dich! Schon lange liebte ich dich, und wenn der Herbst seine geheimnisvolle Feier beginnt, erwacht mit jedem Jahr mein Verlangen mit neuer, unwiderstehlicher Gewalt. Unglücklicher! Wie bist du in den Kreis meiner Klänge gekommen? Laß mich und fliehe!›
Mich schauderte bei diesen Worten, und ich beschwor sie, weiter zu reden und sich näher zu erklären. Aber sie antwortete nicht, und wir gingen stillschweigend nebeneinander durch den Garten. Es war indes dunkel geworden. Da verbreitete sich eine ernste Hoheit über ihre ganze Gestalt.
‹So wisse denn›, sagte sie, ‹dein Jugendfreund, der heute von dir geschieden ist, ist ein Verräter. Ich bin gezwungen seine verlobte Braut. Aus wilder Eifersucht verhehlte er dir seine Liebe. Er ist nicht nach Palästina, sondern kommt morgen, um mich abzuholen und in einem abgelegenen Schlosse vor allen menschlichen Augen auf ewig zu verbergen. - Ich muß nun scheiden. Wir sehen uns nie wieder, wenn er nicht stirbt.›
Bei diesen Worten drückte sie einen Kuß auf meine Lippen und verschwand in den dunklen Gängen. Ein Stein aus ihrer Aster funkelte im Weggehen kühlblitzend über meinen beiden Augen; ihr Kuß flammte mit fast schauerlicher Wollust durch alle meine Adern. Ich überdachte nun mit Entsetzen die fürchterlichen Worte, die sie beim Abschied wie Gift in mein gesundes Blut geworfen hatte, und irrte, lange nachsinnend, in den einsamen Gängen umher. Ermüdet warf ich mich endlich auf die steinernen Staffeln vor dem Schloßtor; die Waldhörner hallten noch fort, und ich schlummerte unter seltsamen Gedanken ein.
Als ich die Augen aufschlug, war es heller Morgen. Alle Türen und Fenster des Schlosses waren fest verschlossen, der Garten und die ganze Gegend still. In dieser Einsamkeit erwachte das Bild der Geliebten und die ganze Zauberei des gestrigen Abends mit neuen morgenschönen Farben in meinem Herzen, und ich fühlte die volle Seligkeit, wiedergeliebt zu werden. Manchmal wohl, wenn mir jene furchtbaren Worte wieder einfielen, wandelte mich ein Trieb an, weit von hier zu fliehen; aber der Kuß brannte noch auf meinen Lippen, und ich konnte nicht fort.
Es wehte eine warme, fast schwüle Luft, als wollte der Sommer noch einmal wiederkehren. Ich schweifte daher träumend in den nahen Wald hinaus, um mich mit der Jagd zu zerstreuen. Da erblickt ich in dem Wipfel eines Baumes einen Vogel von so wunderschönem Gefieder, wie ich noch nie vorher gesehen. Als ich den Bogen spannte, um ihn zu schießen, flog er schnell auf einen anderen Baum. Ich folgte ihm begierig; aber der schöne Vogel flatterte immerfort von Wipfel zu Wipfel vor mir her, wobei seine hell goldenen Schwingen reizend im Sonnenschein glänzten.
So war ich in ein enges Tal gekommen, das rings von hohen Felsen eingeschlossen war. Kein rauhes Lüftchen wehte hier herein; alles war hier noch grün und blühend wie im Sommer. Ein Gesang schwoll wunderlieblich aus der Mitte dieses Tales. Erstaunt bog ich die Zweige des dichten Gesträuches, an dem ich stand, auseinander - und meine Augen senkten sich trunken und geblendet vor dem Zauber, der sich mir da eröffnete.
Ein stiller Weiher lag im Kreise der hohen Felsen, an denen Efeu und seltsame Schilfblumen üppig emporrankten. Viele Mädchen tauchten ihre schönen Glieder singend in der lauen Flut auf und nieder. Über allen erhoben stand das Fräulein prächtig und ohne Hülle und schaute, während die anderen sangen, schweigend um die wollüstig um ihre Knöchel spielenden Wellen wie verzaubert und versunken in das Bild der eigenen Schönheit, das der trunkene Wasserspiegel widerstrahlte. Eingewurzelt stand ich lange in flammendem Schauer, da bewegte sich die schöne Schar ans Land, und ich eilte schnell davon, um nicht entdeckt zu werden.
Ich stürzte mich in den dicksten Wald, um die Flammen zu kühlen, die mein Inneres durchtobten. Aber je weiter ich floh, desto lebendiger gaukelten jene Bilder vor meinen Augen, desto verzehrender langte der Schimmer jener jugendlichen Glieder mir nach. So traf mich die einbrechende Nacht noch im Walde. Der ganze Himmel hatte sich unterdes verwandelt und war dunkel geworden; ein wilder Sturm ging über die Berge. ‹Wir sehen uns nie wieder, wenn er nicht stirbt!› rief ich immerfort in mich selbst hinein und rannte, als würde ich von Gespenstern gejagt.
Es kam mir manchmal dabei vor, als vernähme ich seitwärts Getös von Rosseshufen im Walde; aber ich scheute jedes menschliche Angesicht und floh vor dem Geräusch, so oft es näher zu kommen schien. Das Schloß meiner Geliebten sah ich oft, wenn ich auf eine Höhe kam, in der Ferne stehen; die Waldhörner sangen wieder wie gestern Abend; der Glanz der Kerzen drang wie ein milder Mondenschein durch alle Fenster und beleuchtete rings umher magisch den Kreis der nächsten Bäume und Blumen, während draußen die ganze Gegend in Sturm und Finsternis wild durcheinander rang.
Meiner Sinne kaum mehr mächtig, bestieg ich endlich einen hohen Felsen, an dem unten ein brausender Waldstrom vorüber stürzte. Als ich auf der Spitze ankam, erblickte ich dort eine dunkle Gestalt, die auf einem Steine saß, still und unbeweglich, als wäre sie selber von Stein. Die Wolken jagten so eben zerrissen über den Himmel. Der Mond trat blutrot auf einen Augenblick hervor - und ich erkannte meinen Freund, den Bräutigam meiner Geliebten.
Er richtete sich, sobald er mich erblickte, schnell und hoch auf, daß ich innerlichst zusammen schauderte, und griff nach seinem Schwert. Wütend fiel ich ihn an und umfaßte ihn mit beiden Armen. So rangen wir einige Zeit miteinander, bis ich ihn zuletzt über die Felsenwand in den Abgrund hinab schleuderte. Da wurde es auf einmal still in der Tiefe und ringsumher, nur der Strom unten rauschte stärker, als wäre mein ganzes voriges Leben unter diesen wirbelnden Wogen begraben und alles auf ewig vorbei.
Eilig stürzte ich nun fort von diesem grausigen Orte. Da kam es mir vor, als hörte ich ein lautes, widriges Lachen wie aus dem Wipfel der Bäume hinter mir drein schallen; zugleich glaubte ich in der Verwirrung meiner Sinne den Vogel, den ich vorhin verfolgte, in den Zweigen über mir wiederzusehen. - So gejagt, geängstigt und halb sinnlos, rannte ich durch die Wildnis über die Gartenmauer hinweg zu dem Schlosse des Fräuleins. Mit allen Kräften riß ich dort an den Angeln des verschlossenen Tores. ‹Mach auf›, schrie ich außer mir, ‹mach auf, ich habe meinen Herzensbruder erschlagen! Du bist nun mein auf Erden und in der Hölle!›
Da taten sich die Torflügel schnell auf, und das Fräulein, schöner als ich sie jemals gesehen, sank ganz hingegeben in flammenden Küssen an meine von Stürmen durchwühlte, zerrissene Brust. Laßt mich nun schweigen von der Pracht der Gemächer, dem Duft ausländischer Blumen und Bäume, zwischen denen schöne Frauen singend hervor sahen, von den Wogen von Licht und Musik, von der wilden, namenlosen Lust, die ich in den Armen des Fräuleins -»
Hier fuhr der Fremde plötzlich auf. Denn draußen hörte man einen seltsamen Gesang an den Fenstern der Burg vorüber fliegen. Es waren nur einzelne Sätze, die zuweilen wie eine menschliche Stimme, dann wieder wie die höchsten Töne einer Klarinette klangen, wenn sie der Wind über ferne Berge herüberweht, das ganze Herz ergreifend und schnell dahin fahrend. -
«Beruhigt Euch», sagte der Ritter, «wir sind das lange gewohnt. Zauberei soll in den nahen Wäldern wohnen, und oft zur Herbstzeit streifen solche Töne in der Nacht bis an unser Schloß. Es vergeht ebenso schnell, als es kommt, und wir bekümmern uns weiter nicht darum.» - Eine große Bewegung schien jedoch in der Brust des Ritters zu arbeiten, die er nur mit Mühe unterdrückte. -
Die Töne draußen waren schon wieder verklungen. Der Fremde saß, wie im Geiste abwesend, in tiefes Nachsinnen verloren. Nach einer langen Pause erst sammelte er sich wieder und fuhr, obgleich nicht mehr so ruhig wie vorher, in seiner Erzählung weiter fort:
«Ich bemerkte, daß das Fräulein mitten im Glanze manchmal von einer unwillkürlichen Wehmut befallen wurde, wenn sie aus dem Schlosse sah, wie nun endlich der Herbst von allen Fluren Abschied nehmen wollte. Aber ein gesunder, fester Schlaf machte durch eine Nacht alles wieder gut, und ihr wunderschönes Antlitz, der Garten und die ganze Gegend ringsumher blickte mich am Morgen immer wieder erquickt, frischer und wie neugeboren an.
Nur einmal, da ich eben mit ihr am Fenster stand, war sie stiller und trauriger als jemals. Draußen im Garten spielte der Wintersturm mit den herabfallenden Blättern. Ich merkte, daß sie oft heimlich schauderte, als sie in die ganz verbleichte Gegend hinausschaute. Alle ihre Frauen hatten uns verlassen; die Lieder der Waldhörner klangen heute nur aus weiter Ferne, bis sie endlich gar verhallten.
Die Augen meiner Geliebten hatten allen ihren Glanz verloren und schienen wie verlöschend. Jenseits der Berge ging eben die Sonne unter und erfüllte den Garten und die Täler ringsum mit ihrem verbleichenden Glanz. Da umschlang das Fräulein mich mit beiden Armen und begann ein seltsames Lied zu singen, das ich vorher noch nie von ihr gehört und das mit unendlich wehmütigem Akkorde das ganze Haus durchdrang. Ich lauschte entzückt, es war, als zögen mich diese Töne mit dem versinkenden Abendrot langsam hinab, die Augen fielen mir wider Willen zu, und ich schlummerte in Träumen ein.
Als ich erwachte, war es Nacht geworden und alles still im Schlosse. Der Mond schien sehr hell. Meine Geliebte lag auf seidenem Lager schlafend neben mir hingestreckt. Ich betrachtete sie mit Erstaunen; denn sie war bleich wie eine Leiche, ihre Locken hingen verwirrt und wie vom Winde zerzaust um Angesicht und Busen herum. Alles andere lag und stand noch unberührt umher, wie es bei meinem Entschlummern gelegen; es war mir, als wäre das schon sehr lange her. -
Ich trat an das offene Fenster. Die Gegend draußen schien mir verwandelt und ganz anders, als ich sie sonst gesehen. Die Bäume sausten wunderlich. Da sah ich unten an der Mauer des Schlosses zwei Männer stehen, die dunkel murmelnd und sich besprechend, sich immerfort gleichförmig beugend und neigend gegeneinander hin- und her bewegten, als ob sie ein Gespinste weben wollten.
Ich konnte nichts verstehen, nur hörte ich sie öfters meinen Namen nennen. - Ich blickte noch einmal zurück nach der Gestalt des Fräuleins, welche eben vom Monde klar beschienen wurde. Es kam mir vor, als sähe ich ein steinernes Bild, schön, aber totenkalt und unbeweglich. Ein Stein blitzte wie Basiliskenaugen vor ihrer starren Brust, ihr Mund schien mir seltsam verzerrt.
Ein Grausen, wie ich es noch in meinem Leben nicht gefühlt, befiel mich da auf einmal. Ich ließ alles liegen und eilte durch die leeren, öden Hallen, wo aller Glanz verloschen war, fort. Als ich aus dem Schlosse trat, sah ich in einiger Entfernung die zwei ganz fremden Männer plötzlich in ihrem Geschäfte erstarren und wie Statuen still stehen. Seitwärts, weit unter dem Berge, erblickt ich an einem einsamen Weiher mehrere Mädchen in schneeweißen Gewändern, welche, wunderbar singend, beschäftigt schienen, seltsame Gespinste auf der Wiese auszubreiten und am Mondschein zu bleichen.
Dieser Anblick und dieser Gesang vermehrte noch mein Grausen, und ich schwang mich nur desto rascher über die Gartenmauer weg. Die Wolken flogen schnell über den Himmel, die Bäume sausten hinter mir drein, ich eilte atemlos immer fort. Stiller und wärmer wurde allmählich die Nacht, Nachtigallen schlugen in den Gebüschen. Draußen, tief unter den Bergen, hörte ich Stimmen gehen, und alte, lang vergessene Erinnerungen kehrten halb dämmernd wieder in das ausgebrannte Herz zurück, während vor mir die schönste Frühlingsmorgen Dämmerung sich über dem Gebirge erhob. -
‹Was ist das? Wo bin ich denn?› rief ich erstaunt und wußte nicht, wie mir geschehen. ‹Herbst und Winter sind vergangen, Frühling ist es wieder auf der Welt. Mein Gott! wo bin ich so lange gewesen?› So langte ich endlich auf dem Gipfel des letzten Berges an. Da ging die Sonne prächtig auf. Ein wonniges Erschüttern flog über die Erde, Ströme und Schlösser blitzten, die Menschen, ach! ruhig und fröhlich kreisten in ihren täglichen Verrichtungen wie ehedem, unzählige Lerchen jubilierten hoch in der Luft. Ich stürzte auf die Knie und weinte bitterlich um mein verlorenes Leben.
Ich begriff und begreife noch jetzt nicht, wie das alles zugegangen; aber hinabstürzen mocht ich noch nicht in die heitere, schuldlose Welt mit dieser Brust voll Sünde und zügelloser Lust. In die tiefste Einöde vergraben, wollte ich den Himmel um Vergebung bitten und die Wohnungen der Menschen nicht eher wiedersehen, bis ich alle meine Fehler, das einzige, dessen ich mir aus der Vergangenheit nur zu klar und deutlich bewußt war, mit Tränen heißer Reue abgewaschen hätte.
Ein Jahr lang lebt ich so, als Ihr mich damals an der Höhle traft. Inbrünstige Gebete entstiegen gar oft meiner geängstigten Brust, und ich wähnte manchmal, es sei überstanden und ich hätte Gnade gefunden vor Gott; aber das war nur selige Täuschung seltener Augenblicke und schnell alles wieder vorbei. Und als nun der Herbst wieder sein wunderlich farbiges Netz über Berg und Tal ausbreitete, da schweiften von neuem einzelne wohlbekannte Töne aus dem Walde in meine Einsamkeit, und dunkle Stimmen in mir klangen sie wider und gaben ihnen Antwort, und im Innersten erschreckten mich noch immer die Glockenklänge des fernen Doms, wenn sie am klaren Sonntagmorgen über die Berge zu mir herüberlangten, als suchten sie das alte, stille Gottesreich der Kindheit in meiner Brust, das nicht mehr in ihr war. -
Seht, es ist ein wunderbares, dunkles Reich von Gedanken in des Menschen Brust, da blitzen Kristall und Rubin und alle die versteinerten Blumen der Tiefe mit schauerlichem Liebesblick herauf, zauberische Klänge wehen dazwischen, du weißt nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen, die Schönheit des irdischen Lebens schimmert von draußen dämmernd herein, die unsichtbaren Quellen rauschen, wehmütig lockend, in einem fort, und es zieht dich ewig hinunter - hinunter!»
«Armer Raimund!» rief da der Ritter, der den in seiner Erzählung träumerisch verlorenen Fremden lange mit tiefer Rührung betrachtet hatte.
«Wer seid ihr um Gottes willen, daß ihr meinen Namen wißt!» rief der Fremde und sprang wie vom Blitze gerührt von seinem Sitze auf. «Mein Gott!» erwiderte der Ritter und schloß den Zitternden mit herzlicher Liebe in seine Arme, «kennst du uns denn gar nicht mehr? Ich bin ja dein alter, treuer Waffenbruder Ubaldo, und da ist deine Berta, die du heimlich liebtest, die du nach jenem Abschiedsfeste auf deiner Burg auf das Pferd hobst.
Gar sehr hat die Zeit und ein viel bewegtes Leben seit dem unsere frischen Jugendbilder verwischt, und ich erkannte dich erst wieder, als du deine Geschichte zu erzählen anfingst. Ich bin nie in einer Gegend gewesen, die du da beschrieben hast, und habe nie mit dir auf dem Felsen gerungen. Ich zog gleich nach jenem Fest gen Palästina, wo ich mehrere Jahre mit focht, und die schöne Berta dort wurde nach meiner Heimkehr mein Weib.
Auch Berta hatte dich nach dem Abschiedsfest niemals wiedergesehen, und alles, was du da erzähltest, ist eitel Phantasie. - Ein böser Zauber, jeden Herbst neu erwachend und dann wieder samt dir versinkend, mein armer Raimund, hielt dich viele Jahre lang mit lügenhaften Spielen umstrickt. Du hast unbemerkt Monate wie einzelne Tage verlebt. Niemand wußte, als ich aus dem gelobten Lande zurückkam, wohin du gekommen, und wir glaubten dich längst verloren.»
Ubaldo merkte vor Freude nicht, daß sein Freund bei jedem Worte immer heftiger zitterte. Mit hohlen, starr offenen Augen sah er die beiden abwechselnd an und erkannte nun auf einmal den Freund und die Jugendgeliebte, über deren lang verblühte, rührende Gestalt die Flamme des Kamins spielend die zuckenden Scheine warf.
«Verloren, alles verloren!» rief er aus tiefer Brust, riß sich aus den Armen Ubaldos und flog pfeilschnell aus dem Schlosse in die Nacht und den Wald hinaus. «Ja, verloren, und meine Liebe und mein ganzes Leben eine lange Täuschung!» sagte er immerfort für sich selbst und lief, bis alle Lichter in Ubaldos Schlosse hinter ihm versunken waren. Er nahm fast unwillkürlich die Richtung nach seiner eigenen Burg und langte da selbst an, als eben die Sonne aufging.
Es war wieder ein heiterer Herbstmorgen wie damals, als er vor vielen Jahren das Schloß verlassen hatte, und die Erinnerung an jene Zeit und der Schmerz über den verlorenen Glanz und Ruhm seiner Jugend befiel da auf einmal seine ganze Seele. Die hohen Linden auf dem steinernen Burghofe rauschten noch immerfort; aber der Platz und das ganze Schloß war leer und öde, und der Wind strich überall durch die verfallenen Fensterbogen.
Er trat in den Garten hinaus. Der lag auch wüst und zerstört, nur einzelne Spätblumen schimmerten noch hin und her aus dem falben Grase. Auf einer hohen Blume saß ein Vogel und sang ein wunderbares Lied, das die Brust mit unendlicher Sehnsucht erfüllte. Es waren die selben Töne, die er gestern Abend während seiner Erzählung auf Ubaldos Burg vorüber schweifen hörte. Mit Schrecken erkannte er nun auch den schönen goldgelben Vogel aus dem Zauberwalde wieder. -
Hinter ihm aber, hoch aus einem Bogenfenster des Schlosses schaute während des Gesanges ein langer Mann über die Gegend hinaus, still, bleich und mit Blut bespritzt. Es war leibhaftig Ubaldos Gestalt. Entsetzt wandte Raimund das Gesicht von dem furchtbar stillen Bilde und sah in den klaren Morgen vor sich hinab. Da sprengte plötzlich unten auf einem schlanken Rosse das schöne Zauberfräulein, lächelnd, in üppiger Jugendblüte, vorüber. Silberne Sommerfäden flogen hinter ihr drein, die Aster von ihrer Stirne warf lange, grünlichgoldene Scheine über die Heide.
In allen Sinnen verwirrt, stürzte Raimund aus dem Garten, dem holden Bilde nach.
Die seltsamen Lieder des Vogels zogen, wie er ging, immer vor ihm her. Allmählich, je weiter er kam, verwandelten sich diese Töne sonderbar in das alte Waldhornlied, das ihn damals verlockte.
«Golden meine Locken wallen,
Süß mein junger Leib noch blüht -»
hörte er einzeln und abgebrochen aus der Ferne wieder herüberschallen.
«Bäche in dem stillen Grunde
Rauschend nach der Ferne gehen.» -
Sein Schloß, die Berge und die ganze Welt versank dämmernd hinter ihm.
«Reichen, vollen Liebesgruß
Bietet dir der Hörner Schallen.
Komm, ach komm! eh sie verhallen!»
hallte es wider - und, im Wahnsinn verloren, ging der arme Raimund den Klängen nach in den Wald hinein und ward niemals mehr wiedergesehen.
Josef Freiherr von Eichendorff
DER DRACHENTÖTER ...

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Als sie erwachsen waren, ließ er ihnen kostbare Gewänder anfertigen, gab jedem einen schön verzierten Gürteldolch und ein gutes Schwert in die Hand und sprach: "Nun reist hinaus in die Welt, seht euch überall wohl um und versucht euer Glück!" Dazu waren die drei Brüder gleich bereit, nahmen Abschied von ihrem alten Vater und zogen zum Tor hinaus.
Als sie ein gutes Stück gewandert waren, kamen sie zu einer großen Tanne; da beschlossen sie, sich zu trennen. "Wir wollen unsere Dolche in diese Tanne stecken", sagte der älteste. "Kommt einer von uns zu irgendeiner Zeit wieder einmal hier vorbei, so mag er an ihnen erkennen, ob wir noch am Leben oder ob wir gestorben sind, und dies wird das Zeichen sein: wessen Dolch einen Rostfleck zeigt, der ist tot und wird die Heimat seiner Väter nie mehr wiedersehen." -
Sie stießen also die blanken Klingen tief in den Baum; dann ging der eine zur Rechten, der andere zur Linken, der jüngste aber zog geradeaus und kam bald in einen großen, finsteren Wald. Wie er nun so allein zwischen den dunklen Tannen dahin ging, kam ihm mit einem Mal ein Bär entgegen. Ohne langes Besinnen griff er nach seinem Schwert und wollte ihm auf den Pelz rücken.
Der Bär aber rief: "Töte mich nicht, es wird dein Glück sein!" trottete freundlich und zutraulich heran und begleitete den Königssohn durch den Wald. Als er wieder eine Strecke gewandert war, kam plötzlich ein großer, wilder Wolf daher gesprungen. "Im nächsten Augenblick schon schwang der Prinz sein Schwert, stellte sich ihm in den Weg und wollte ihn erschlagen. Der Wolf aber rief: "Töte mich nicht, es wird dein Glück sein!" - Da ließ er auch ihn am Leben, und nun zog der Wolf mit dem Bären hinter ihm her.
Es dauerte nicht lange, da stand, wie aus der Erde gewachsen, ein mächtiger Löwe vor ihm und fletschte die Zähne. Dem Königssohn fuhr geschwind der Schreck in die Glieder; dann aber zog er blitzschnell sein Schwert, um es ihm in den Rachen zu stoßen. Weil aber der Löwe sagte: "Töte mich nicht, es wird dein Glück sein!", schenkte er auch ihm das Leben. Nun zog auch der Löwe mit dem Wolf und dem Bären hinter ihm her, und alle drei Tiere wichen nicht mehr von ihm.
Lange Zeit wanderte der Prinz mit seinen Begleitern durch den Wald, ohne einem Menschen zu begegnen. Endlich sah er in der Ferne eine Stadt. Da schritt er munter voran und zog bald darauf mit seinen Tieren durch das Tor ein. Doch seltsam: Alle Häuser waren mit schwarzem Flor behangen, und die Menschen gingen stumm und traurig durch die Straßen. Da fragte der Prinz, was denn der Stadt widerfahren sei.
"Ach !" erzählten ihm da die Leute, "auf dem Berg dort, wo die Kapelle steht, haust ein siebenköpfiger Drache. Dem muß man jeden Tag ein unschuldiges Mädchen zum Fressen bringen sonst ist vor ihm niemand seines Lebens sicher. Nun aber soll ihm morgen die einzige Tochter des Königs ausgeliefert werden, und darum ist die Stadt in so tiefer Trauer." - "Das verstehe ich wohl", meinte der Prinz, "aber - ist denn gar keine Rettung möglich?" -
"Ja, das fragen wir auch, lieber Herr", sagten sie. "Der König hat wohl schon lange im ganzen Lande bekanntmachen lassen, daß er dem Drachentöter die schöne Prinzessin zur Frau geben wolle; doch bis heute hat sich keiner gefunden, der den Kampf mit dem Ungeheuer wagen will." - Der Prinz hörte sich alles genau an und dachte: "Wenn du den Drachen erlegen und die schöne Königstochter gewinnen könntest! Vielleicht würden die drei Tiere dir helfen?" Und er nahm sich vor, den Kampf gegen den Drachen zu versuchen.
Am anderen Morgen, als die Sonne aufging, gürtete er sich sein Schwert um und stieg auf den Drachenberg, von seinen treuen Tieren begleitet. Als er zu der Kapelle kam, ging die Prinzessin gerade hinein, um zu beten. Sie war so jung und schön, daß er wie gebannt stehenblieb und ihr nachschaute. Da wurde er plötzlich durch ein fürchterliches Brüllen und Fauchen aufgeschreckt, und aus der Felsschlucht hervor stürzte der siebenköpfige Drache ungestüm auf ihn ein.
Der Bär, der Wolf und der Löwe warfen sich wütend auf das Untier und jeder riß und biß ihm zwei Köpfe ab. Der siebente Kopf aber, der schrecklichste und gefährlichste von allen, fiel unter dem scharfen, Schwert des Prinzen in den Sand. Lang ausgestreckt lag der tote Drache in seinem Blute. Da trat die Prinzessin aus der Kapelle, ihrem Retter zu danken. Sie nahm die goldene Kette, die sie bisher selber, getragen, zerteilte sie und legte jedem der Tiere ein Stück davon um den Hals.
Zu dem Prinzen aber sagte sie: "Ich danke dir von Herzen, du tapferer Mann! Du hast mich vom Tode errettet, und dafür will ich dir für mein ganzes Leben als deine liebe und treue Frau gehören! Nun aber komm mit zu meinem Vater. "Es kann noch nicht sein, liebe Prinzessin", sagte er; "ich muß mich zuerst noch eine Weile in der Welt umsehen. Heute übers Jahr aber komme ich wieder und dann wollen wir Hochzeit halten!"
Darauf schnitt er aus den sieben Drachenköpfen die Zungen heraus, wickelte sie in ein seidenes Tuch und steckte sie in die Tasche. Dann nahm er Abschied von seiner Braut und zog mit seinen getreuen Tieren auf gut Glück in die weite Welt hinaus.
Als der Prinz ihren Blicken in der Ferne entschwunden war, stieg die Prinzessin in die Kutsche, die am Fuße des Berges wartete, um sich nach Hause fahren zu lassen. Der Kutscher fuhr aber erst ab, nachdem er die sieben Drachenköpfe zu sich auf den Wagen geladen hatte. Und wie sie unterwegs durch einen dunkeln Wald kamen, hielt er plötzlich die Pferde an und sagte zu der Prinzessin: "So, nun sind wir allein und keiner ist da, der dir helfen könnte! Sage zum König, ich hätte den Drachen getötet! Versprich es mir, oder du mußt auf der Stelle sterben!"
Was konnte da die Prinzessin anderes tun, als zustimmen, wenn ihr das Leben lieb war? Als sie im Schloß ankamen, wies der Kutscher dem König die sieben Drachenköpfe vor, verlangte die Prinzessin zur Frau und wollte, daß die Hochzeit gleich am anderen Tage stattfinden sollte. Der König, der sein Wort halten wollte, war damit einig; die Prinzessin aber brachte es unter allerlei Vorwänden fertig, daß die Hochzeit immer wieder aufgeschoben wurde.
Ein ganzes Jahr lang trieb sie es so; dann aber mußte sie dem Drängen des Kutschers doch nachgeben. Sie tat es auch scheinbar willig, weil sie hoffte, daß der rechte Bräutigam sich nun bald einfinden werde, so wie er es ihr versprochen hatte.
Und richtig, als das Jahr bald um war, hatte der Prinz sich genug in der Welt umgesehen und die Heimreise angetreten. Als gerade noch ein einziger Tag an dem Jahr fehlte, kam er in der Stadt an und war erstaunt darüber, wie lustig und lebendig es überall zuging. Er kehrte in einem Wirtshaus ein, fragte den Wirt, ob er hier übernachten könne und fügte so beiläufig hinzu: "Was geht denn hier vor? Vor einem Jahr war die Stadt mit Trauerflor behangen und die Leute gingen stumm und traurig umher; heute dagegen sehe ich überall fröhliche Gesichter und die Stadt ist wie zu einem Fest geschmückt!" -
"lhr habt es erraten", antwortete der Wirt und erzählte ihm, daß morgen die Königstochter Hochzeit halte mit dem Kutscher, der sie vor einem Jahr aus den Klauen des Drachen errettet habe. "So so", sagte der Prinz, trank sein Glas leer und begab sich in seine Schlafkammer hinauf.
Am anderen Tag, während droben im Schloß das Hochzeitsmahl im Gange war, saß der Prinz, als Jäger gekleidet, mit dem Wirt in der Schankstube. Sie sprachen von der schönen Prinzessin und dem Drachentöter und dem prachtvollen Fest, und dabei sagte der Prinz: "Herr Wirt, holt mir doch auch einen Krug von dem Wein, den die Braut im Schlosse trinkt!" - "Das kann ich nicht, Herr!" antwortete der Wirt.
"Dann muß ich halt meinen Wolf hinschicken!" meinte der Prinz; rief den Wolf zu sich und sagte: "Geh zu der Prinzessin ins Schloß und sage, dein Herr lasse um einen Krug von dem Wein bitten den sie selbst trinke!" Es dauerte nicht lange, und der Wolf kam mit dem Krug angesprungen. Da konnte der Wirt sich nicht genug wundern", saß nur da und sah den Fremden an und schüttelte den Kopf.
"So, jetzt will ich auch von dem Braten haben, den die Braut ißt!" sprach der Prinz und schickte den Bären aufs Schloß, und der brachte wahrhaftig nach einer Weile ein Stück vom allerbesten Braten. "Nun fehlt bloß noch ein Stück von dem Brot, das die Prinzessin ißt!" sagte der Prinz, und schickte den Löwen hin. Der kam nach kurzer Zeit mit einem großen Stück Brot im Maul angetrottet.
Die Prinzessin aber, die an der Hochzeitstafel saß, hatte die Tiere erkannt und wußte wohl, wer ihr Herr war. Darum gab sie ihnen auch alles, was sie forderten, von Herzen gerne. Der König hatte die sonderbaren Besucher mit Staunen beobachtet, nahm endlich seine Tochter bei Seite und sprach: "Nun sage mir doch einmal, meine liebe Tochter: Was hast du eigentlich mit diesen wilden Tieren im Sinn?"
Da erzählte die Prinzessin ihrem Vater alles, so wie es sich zugetragen hatte, und gestand ihm zuletzt, daß der wahre Drachentöter nun da sei und daß sie den und keinen anderen heiraten werde. Der König schickte sogleich einen Boten in das Wirtshaus und ließ den Herrn, dem die drei wilden Tiere gehörten, zur Tafel laden.
Als die Hochzeitsgäste nun alle genug gegessen und getrunken hatten und noch eine Weile so recht vergnügt beisammen saßen, sagte der König: "Wir wollen uns zur Unterhaltung ein wenig erzählen. Und wer wird mehr erzählen können als der Drachentöter und unser lieber Gast, der Jäger, der heute erst von einer weiten Reise zurückkehrte? Beginne also, Freund Drachentöter!"
Da ließ der falsche Drachentöter die sieben Drachenköpfe auf den Tisch legen und berichtete mit vielen aufgeblähten Worten, wie er sie damals im Kampf dem Untier abgeschlagen habe. Und alle, die von dem bösen Betrug nichts wußten und den Kutscher für den Drachentöter hielten, bewunderten ihn und spendeten ihm Lob über Lob. Der König aber verzog keine Miene und sagte nur: "Nun denn, Herr Jäger, erzählt Ihr einmal von Euren Abenteuern!"
Der erhob sich, verbeugte sich höflich und gestand zum ersten, daß er kein Jäger, sondern ein Prinz sei. Dann schilderte er getreulich, auf welch eigentümliche Weise er zu den treuen Tieren gekommen sei und wie sie geholfen hätten, einen siebenköpfigen Drachen zu überwinden und eine Königstochter vom sicheren Tode zu erretten. "Und welch ein Zufall", sagte er, "gerade heute vor einem Jahr und nahe bei dieser Stadt hat sich all das zugetragen.
Auch die Drachenköpfe hier kommen mir so bekannt vor, als ob ich sie schon einmal gesehen hätte. Nur, will mir scheinen, haben sie keine Zunge im Maul, was doch sonst gewiß bei allen Tieren der Fall ist." Da erhob sich der König und rief: "Diener! Öffnet die Drachenmäuler!" Und richtig, - in keinem von allen sieben war eine Zunge zu entdecken. "Wo sind die Zungen, Kutscher?!" stellte der König den falschen Mann zur Rede.
"Da müßt Ihr nicht den da, sondern, mich fragen, Herr König", entgegnete der Prinz. "Hier sind sie!" - und dabei wickelte er die sieben Zungen aus dem seidenen Tuch. Und siehe, sie paßten genau auf die abgeschnittenen Enden in den Rachen der Drachenköpfe. "Und nun, edle Prinzessin", wandte sich der Prinz an die Königstochter, "kennt Ihr vielleicht die goldene Kette am Hals meiner Tiere?" -
"O gewiß!" sagte sie, "die kenne ich gut! Ich selbst habe sie ja deinen Tieren umgehängt, weil sie dir so treu und tapfer im Kampf gegen den Drachen beigestanden haben." Nun wußte der König gewiß, daß der Prinz der wahre Drachentöter, der Kutscher aber ein arglistiger Betrüger war. In der gleichen Stunde noch wurde der Falsche dem Henker übergeben. Der Prinz und die Prinzessin aber hielten Hochzeit und lebten nach des alten Königs Tod noch lange Jahre in Glück und Freude als König und Königin.
Was aus den beiden Brüdern des Königs geworden ist? Niemand weiß, ob sie heimgekehrt sind oder heute noch in der Welt umherwandern. Wenn ich aber an die große Tanne komme, will ich doch nachsehen, ob sie noch am Leben sind oder ob die blanken Klingen Rostflecke bekommen haben.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER GLÜCKSVOGEL ...
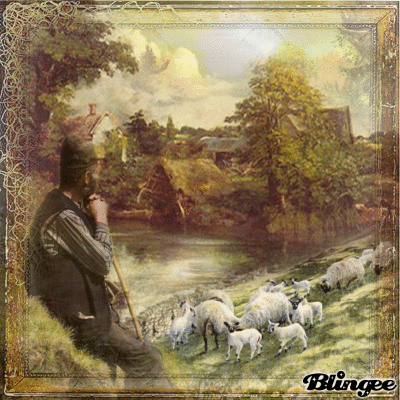
In einem Dorf lebte einmal ein Bäuerlein, das hatte nur ein paar magere Äcker und Wiesen und eine einzige Kuh im Stalle. Ihm und seinem Weib war aber das wenige, das sie besaßen, genug. Sie waren zufrieden, lebten glücklich miteinander und zeigten den Leuten stets ein freundliches Gesicht. Sie schafften fleißig vom Morgen bis zum Abend, waren sparsam und vorsorglich und brauchten darum nie jemand um Hilfe anzugehen. So schien das Bäuerlein mit seinem Wenigen wahrhaftig wohlhabender zu sein als die viel größeren und reicheren Bauern der Nachbarschaft.
Gerade darum aber waren ihm seine Nachbarn spinnefeind. Sie suchten ihm Schaden zuzufügen, wo sie nur konnten, und zuletzt trieb einige von ihnen der Neidteufel so weit, daß sie Nachts in den Stall des Bäuerleins einbrachen und die einzige Kuh tot schlugen. Der arme Mann war traurig, dachte aber, daß die Kuh wohl an einer plötzlichen, schlimmen Krankheit gestorben sei. Er schaffte sie am Abend in den Wald, zog ihr das Fell ab und vergrub sie.
Wie er nun, die Kuhhaut wie einen Mantel über sich geworfen, durch den Wald nach Hause ging, stieß er unversehens auf drei Räuber; die hockten auf einem Baumstumpf und zählten ihr gestohlenes Geld. Als die Spießgesellen die sonderbare Gestalt daher kommen sahen, kam ihnen das Grausen. Sie nahmen die Beine unter den Arm und liefen davon; denn sie hielten den, der da auf sie zukam, für den leibhaftigen Gottseibeiuns.
Das Bäuerlein aber steckte gemütlich die dahinten gelassenen Goldstücke in die Tasche und ging Heim. Die Nachbarn wunderten sich nicht wenig über das viele Geld und fragten ihn, wie er dazu gekommen sei. Da erzählte er ihnen wahrheitsgetreu, wie alles zugegangen war.
Da schlugen die neidischen Bauern des Dorfes alle ihre Kühe tot und vergruben sie im Wald. Dann warfen sie sich auch die Häute über den Rücken und schlichen auf den großen Baumstumpf zu, um den drei Räubern das gestohlene Geld abzujagen. Doch - wer sich nicht blicken ließ, waren die Räuber. Darüber ergrimmten die Bauern sehr. "Daran ist nur sein Weib schuld, die Hexe!" sagten sie untereinander, gingen in ihrem Zorn hin und erschlugen die Nachbarsfrau.
Da stand nun das arme Bäuerlein vor seiner toten Frau, wußte nicht was tun und dachte schließlich: "Ich will sie mit in die Stadt nehmen."
In seinem Garten waren gerade die Äpfel reif geworden. Er schüttelte sie, lud einen Wagen voll auf, setzte sein totes Weib oben drauf und fuhr los. In der Stadt stellte er den Wagen auf den Markt, so, als ob sein Weib die Äpfel zu verkaufen habe, und setzte sich dann nahe dazu zwischen abgeladene Säcke. Kaum war eine Weile vergangen, kam ein vornehmer Herr mit einem Stock daher, blieb vor dem Wagen stehen und fragte die Bäuerin, die da saß und sich nicht rührte, wie teuer sie ihre Äpfel verkaufe.
Die aber sagte nichts und blieb stumm. Er fragte noch einmal und erhielt wieder keine Antwort. Als sie ihn zum dritten mal ohne Antwort ließ, wurde er ungehalten und stach sie mit der Spitze seines Stockes in die Seite. Da fiel das Weib vom Wagen, blieb am Boden liegen und rührte sich nicht mehr. Im Augenblick war der Bauer herbei gesprungen, ,packte den Mann von hinten und schrie: "So! So! Ihr habt mein Weib tot geschlagen! Das sollt Ihr teuer bezahlen!" Da mußte der vornehme Herr wohl oder übel ein Häuflein Goldfüchse aus seinem Beutel tun, um den Bauern loszuwerden.
Als nun die Nachbarn daheim erfuhren, auf welche Weise er schon wieder zu so viel Geld gekommen, trieb sie der Neidteufel noch ärger. Sie schlugen ihre Weiber tot, setzten sie auf die Wagen und fuhren mit ihnen im Galopp auf den Markt in die Stadt. Wer aber vergebens auf den Herrn mit dem Stock wartete, waren die dummen und habsüchtigen Nachbarn des Bäuerleins.
Nun waren sie nicht nur voller Ärger, weil sie nicht auch reich geworden waren, sondern schoben auch ihrem Nachbarn die Schuld daran zu, daß sie keine Weiber mehr hatten. Darum beschlossen sie untereinander, ihn aus der Welt zu schaffen. Sie griffen ihn, steckten ihn in einen Sack und trugen ihn hinaus, um ihn im Dorfteich zu ersäufen. Weil aber gerade ein Schäfer mit seiner Herde die Landstraße daher kam, lehnten sie den Sack derweil an einen Baum und gingen wieder Dorf einwärts.
Als der Schäfer vorüberging, rief der Bauer im Sack: "Oh, wie glücklich bin ich! Oh, wie glücklich bin ich und kann es doch nicht brauchen!" Verwundert hielt der Schäfer an und fragte den im Sack drin um Bescheid, was seine Rede bedeute. "Ei", sagte das Bäuerlein, "die Leute im Ort wollen mich mit Gewalt zu ihrem Schulzen machen, und weil ich nicht will, haben sie mich in diesen Sack gesperrt, bis ich mürb werde und ja sage." -
"So?" sagte der Schäfer, "da wäre ich schon anders. Ich würde für mein Leben gern Schulze werden." - "Das könnt Ihr", versetzte das pfiffige Bäuerlein; "dann müßt halt Ihr in den Sack schlüpfen; und wenn sie wiederkommen und Euch fragen: ,Willst du noch nicht Schulze werden?', dann könnt ja Ihr an meiner Stelle antworten: ,Ja, ich will euer Schulze sein."
Der Schäfer war mit diesem Anerbieten gleich einig und kroch in den Sack. Das Bäuerlein aber versteckte sich hinter einem Weidenbusch. Da kamen auch schon die Bauern daher. Sie dachten, der Schäfer sei für einen Augenblick weg gegangen, so daß sie inzwischen ihr Vorhaben am besten ausführen könnten, und warfen den Sack ins Wasser. Wer aber über eine kleine Weile mit einer Schafherde zum Dorf herein fuhr, das war unser Glücksvogel.
Jetzt rissen die Nachbarn ihre Augen sperrangelweit auf vor Erstaunen, drängten herzu und fragten, wie er denn dazu gekommen sei; da gehöre doch mehr Glück dazu, als wenn einem gar der Holzschlegel auf dem Speicher kälbere. "Wir haben dich doch in den Teich geworfen, und dazuhin in einem zugebundenen Sack. Und jetzt kommst du mit einer Schafherde ins Dorf gezogen. Soll das vielleicht mit rechten Dingen zugehen?" sagten sie. -
"Ja", entgegnete der Schlaukopf, "hört zu, wie das ging", und erzählte: Wie er auf dem Grund des Teiches angekommen sei, habe ein kleines Seemännlein den Sack aufgebunden und ihn heraus gelassen. Da sei er tief unter dem Wasser mitten in einem wunderschönen Land gestanden. Vieh- und Schafherden in Menge seien dort auf der Weide gegangen. Das Männlein habe freundlich zu ihm gesagt, er solle sich doch eine Herde auslesen, wenn er Gefallen dran habe. "Da habe ich mir die Schafherde hier ausgesucht und bin heimgefahren."
Da wollten die neidischen Nachbarn auch so schöne Schafherden haben und liefen so schnell sie konnten an den Dorfweiher hinaus. Sie drängten und schoben und stritten sich, denn jeder wollte zuerst ins Wasser. "Halt!" rief da der Schulze. "Mir als der Obrigkeit gebührt der Vortritt, und das von Rechts wegen! Ich springe zuerst in den Teich und ihr folgt mir, wenn ich rufe: ,Kommet!"'
Was tat es da für einen gewaltigen Plumps, als der dicke Schulze ins Wasser fiel! Die Bauern, die mit gespitzten Ohren standen und auf den Befehl ihres Schulzen warteten, meinten, als sie den lauten Plumps hörten, es habe "kommet!" gerufen und plumpsten alle kopfüber in den Teich wie Frösche. Herausgekommen aber ist keiner mehr. Das arme Bäuerlein aber war nun reich und alleiniger Herr im Dorf, und wenn unser
Glücksvogel nicht gestorben ist, lebt er heute noch.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER KÖHLERPRINZ ...
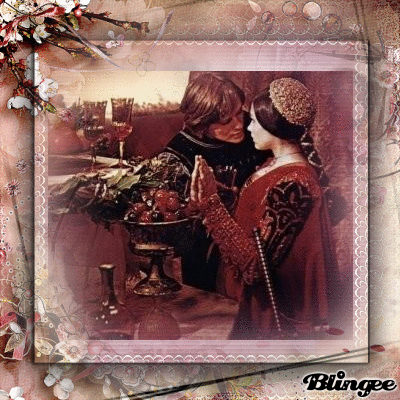
Tief im Böhmerwald lag einmal ein kleines Dorf; das wurde Schwarzdorf geheißen, weil nur Kohlenbrenner darin wohnten. In einer der armseligen Hütten lebte ein alter Köhler mit seiner Frau und seinem Sohne. Der war wohl ein sauberer und stattlicher, aber leider auch ein fauler und nichtsnutziger Bursche. Er lief, wann es ihm gerade paßte, von den Kohlenfeuern weg ins Wirtshaus und zechte mit seinen Kumpanen die ganze Nacht hindurch, und wenn der Vater morgens in den Wald hinaus kam, waren die Meiler ausgebrannt und nur noch ein Haufen Asche übrig. Weil aber alles Mahnen und gute Zureden nichts half, tat der alte Köhler die Arbeit lieber selber und saß manchmal tage- und nächtelang draußen und hütete die Feuer.
Eines Abends aber kam er so müde nach Hause, daß er seinen Sohn gerade noch bitten konnte in den Wald hinauszugehen und diese Nacht bei den Kohlenmeilern zu wachen; dann sank er auf sein Lager und schlief ein. Die Mutter traute erst ihren Augen nicht, als der Sohn den Vespersack über den Rücken warf und sich auf den Weg machte. "Vielleicht wird er doch vernünftiger und gibt sein wildes Leben auf", dachte sie; "es wäre wahrhaftig an der Zeit, und der Vater könnte auf seine alten Tage eine tüchtige Stütze recht wohl brauchen."
All dies überlegte sich der Sohn auch, während er dem Walde zuschritt und nahm sich fest vor, ein anderer Kerl zu werden. Noch keine Stunde aber war vergangen, da fiel ihm plötzlich ein, daß ja heute Abend in der Dorfschenke drunten Tanz sei. Da vergaß er alle guten Vorsätze wieder, ließ die Arbeit Arbeit sein und eilte dem Wirtshaus zu. Dort ging es hoch her, und mit Trinken und Singen und Tanzen verging die Zeit wie im Fluge.
Die Hähne krähten schon, als der leichtsinnige Köhlerssohn endlich zu seinen Meilern zurückkehrte. Aber all das schöne Holz war zu Asche verbrannt; keine Handvoll Kohle blieb übrig. Da überfiel den Burschen plötzlich die Angst vor dem väterlichen Zorne der maßen, daß er auf und davon lief, immer tiefer in den stockdunklen Wald hinein. Stundenlang lief er wie ein gehetztes Wild, verstrickte sich in spitzdorniges Buschwerk und fand zuletzt weder Weg noch Steg mehr. Hungrig und sterbensmüde sank er unter einer Tanne ins Moos nieder und schlief ein.
Dort fand ihn am nächsten Morgen der König des Landes, der gerade eine Jagd abhielt; er hatte Mitleid mit ihm, und weil ihm auch der stattliche Bursche und sein gutes Benehmen wohl gefiel, fragte er ihn, ob er Stallknecht bei ihm werden wolle. O ja, das will ich wohl!" antwortete der Köhlerssohn und trat sogleich seinen Dienst an. Das Leben und Treiben am königlichen Hofe gefiel ihm sehr, und er hielt sich so gut, daß der König bald seine Freude an ihm hatte und ihn zu seinem Kammerdiener machte.
Nun hatte aber der König in der Hauptstadt des Landes noch ein zweites, großes Schloß. Darin lebte seine jüngere Schwester, eine sehr schöne, aber stolze und lieblose Prinzessin, die immer noch unverheiratet war, weil ihr kein Mann gut genug schien. Manch schmucker und reicher Freier hatte schon um ihre Hand angehalten, an jedem aber hatte sie etwas auszusetzen gehabt und einen nach dem anderen abgewiesen. Der König mochte ihr freundlich zusprechen oder ihr im Ärger Vorwürfe machen, soviel er wollte, sie lachte nur und sagte schnippisch : "Was geht es dich an?"
Als nun die Prinzessin wieder einen Bewerber, einen reichen Grafen, abgewiesen hatte, dachte der König bei sich. "Warte nur, ich will dich schon dran kriegen! Ist dir ein Graf zu schlecht, so ist dir mein Kammerdiener wohl recht." Er ließ ihn sogleich zu sich kommen und weihte ihn in seinen Plan ein, und der Bursche war wohl damit zufrieden.
Am nächsten Sonntag hieß der König dem Burschen fürstliche Kleider anlegen, gab ihm ein Dutzend Diener zur Begleitung, ließ seine besten Rappen vor die Staatskutsche spannen und schickte ihn zur Stadt in die Schloßkirche. Dort war die Prinzessin und der ganze Hofstaat schon versammelt, und man sang gerade das erste Lied, als das Portal noch einmal aufging und der fremde Prinz in prächtigem Gewande und mit stattlichem Gefolge in die Halle trat.
Alle Blicke wandten sich nach ihnen um, und auch die Prinzessin bewunderte den schönen Prinzen. Sie wandte kein Auge von ihm und hatte nur den einen Wunsch, daß er einmal zu ihr herübersehen und sie mit einem freundlichen Blick grüßen möge. Doch der Prinz beachtete sie gar nicht und verschwand noch ehe der Gottesdienst zu Ende ging, so rasch wie er gekommen war.
Am nächsten Sonntag, als der Köhlerprinz mit noch herrlicheren Gewändern und einem noch zahlreicheren Gefolge die Kirche betrat, sah die Prinzessin sich wiederum fast die Augen aus. Einmal seufzte sie sogar vor Sehnsucht laut auf. Doch der Prinz tat, als sehe und höre er überhaupt nicht und schritt wieder aus der Kirche, bevor der Pfarrer das Amen gesagt hatte.
Beim Heimgang sagte die Prinzessin zu ihrer ersten Hofdame: "Hast du den schönen fremden Prinzen gesehen, der heute schon zum zweiten Male in der Kirche war. Er gefällt mir und ich liebe ihn, er und kein anderer soll mein Gemahl werden! Lade ihn am nächsten Sonntag in meinem Namen zu Tisch aufs Schloß. Und daß du mir es ja nicht an Aufmerksamkeiten und Ehren fehlen läßt!"
Die Prinzessin konnte den nächsten Sonntag kaum erwarten, und das Schloß glich die ganze Woche hindurch einem riesigen Bienenkorbe, so krabbelte und summte es drin und drum herum: Da ging es an ein Putzen und Wischen und Scheuern, Mägde und Knechte und Pagen rannten, und Koch und Kellermeister hatten alle Hände voll zu tun.
Nun war es Sonntag. Der ganze Hof war in der Kirche versammelt, und zum dritten Male tat sich die hohe Pforte auf, durch die der Köhlerprinz mit seinem prunkvollen Gefolge einzog. Als er sich aber wieder vorzeitig entfernen wollte, trat die erste Hofdame zierlich vor ihn, entbot ihm den Gruß der Prinzessin und lud ihn zur Mittagstafel aufs Schloß ein. "Wen darf ich meiner hohen Herrin melden?" fragte die Hofdame.
"Den Prinzen von Schwarzdorf", gab der Kohlenbrenner zur Antwort. Die Prinzessin empfing ihn freundlich und ließ sich von ihm zu Tische führen. Die allerfeinsten Speisen wurden aufgetragen und die teuersten Weine eingeschenkt. So etwas hatte der Köhlerssohn in seinem Leben noch nie gegessen und getrunken! Und als ihn gar nach dem Essen die schöne Prinzessin in den Garten führte und ihn fragte, ob er ihr Gemahl werden wolle, da wäre er wohl der dümmste Kerl im ganzen Böhmerland gewesen, wenn er nicht von Herzen ja gesagt hätte. Da fand noch am gleichen Tage die Verlobung statt, und am dritten wurde die Hochzeit mit aller Pracht und Herrlichkeit gefeiert.
Ein ganzes Jahr lang lebte er nun schon als Prinz von Böhmen mit seiner Gemahlin im königlichen Schlosse, da erinnerte er sich in seinem Glück endlich auch einmal wieder an seine armen Eltern. Er sagte darum zu seiner Frau, er müsse seinen kranken Vater besuchen, ließ die Reisekutsche mit Geld und Kostbarkeiten vollpacken und fuhr seiner Wäldlerheimat zu. Als er aber mitten in dem riesengroßen Walde war, überfielen ihn Räuber, nahmen Pferd und Wagen und all sein Geld und Gut an sich und führten ihn in ihre Höhle.
Dort lag der Hauptmann schwer krank auf dem Bärenfell und dachte an kein Gesundwerden mehr. So war er milde und mitleidig gestimmt und schenkte dem Prinzen das Leben. Seine schönen Kleider aber ließ er ihm abnehmen, warf ihm dafür ein paar alte Lumpen hin und trieb ihn dann wieder in den finstern Wald hinaus.
Da stand er nun, der Prinzgemahl, und war wieder so arm wie früher. ja, wenn er seine zerrissenen Schuhe und die Fetzen an seinem Leibe ansah, schämte er sich in den Boden hinein; denn, dachte er: "Wenn ich so zu Hause anklopfe, werden mich Vater und Mutter gewiß für einen Bettler halten, und abweisen." Und als er sich nach langem Überlegen endlich doch nach Schwarzdorf aufmachte und in sein Vaterhaus eintrat, da erging es ihm beinahe so, wie er vermutet hatte.
Als er erzählte, daß er Prinz von Böhmen geworden sei und daß er ihnen einen Wagen voll Silber und Gold habe mitbringen wollen, im dunklen Wald aber von Räubern überfallen und ausgeplündert worden sei bis auf die paar Fetzen, die er anhabe - da sagte der Vater verächtlich: "Du bist mir der rechte Prinz! Man braucht dich ja nur anzusehen! Ein Lump und Lügner und Landstreicher bist du! - Wir kennen dich noch von früher her!" ja, der Alte glaubte sogar, sein Sohn müsse wohl durch sein unordentliches Leben den Verstand verloren haben. Deshalb band er ihn mit einer Eisenkette in der Ecke hinter dem großen Kachelofen fest. Da saß er nun hinterm Ofen, der Köhlerprinz, und konnte über sich und der Welt Lauf nachdenken.
Zur selben Zeit lag die junge Prinzessin im Königsschlosse an einer eigentümlichen Krankheit darnieder. Sie aß und trank nicht mehr, sprach mit keinem Menschen auch nur ein einziges Wort, sondern sah traurig vor sich hin oder weinte sich die Augen wund. Der Kummer um ihren spurlos verschwundenen Prinzen hatte ihr Gemüt krank gemacht.
Der König ließ alle berühmten Ärzte kommen, damit sie der Kranken helfen und Tag und Nacht an ihrem Bette wachen sollten. Die Prinzessin aber wollte von keinem Arzt und keiner Arznei etwas wissen; sie sann und grübelte immerzu nur dem einen Gedanken nach: wie sie am besten unerkannt aus dem Schlosse gelangen und ihren Mann suchen könnte. Und endlich hatte sie auch einen Plan ausgedacht:
Eines Abends, als wieder einer ihrer Ärzte ins Zimmer trat, um die Nacht bei ihr zu wachen, bot sie ihm zur Stärkung ein Glas Wein an, in das sie zuvor ein Schlafpulver geschüttet hatte. Über eine kleine Weile war er fest eingeschlafen. Da zog die Prinzessin rasch den schwarzen Gelehrtenmantel an und drückte sich den großen Doktorhut ins Haar. Dann packte sie ihr Hochzeitskleid in die Reisetasche, füllte sie vollends bis obenan mit Goldstücken und ritt auf ihrem Pferde im Galopp davon, in die Nacht hinein, Schwarzdorf zu.
Als sie aber mitten im finstern Böhmerwalde war, brachen plötzlich die Räuber aus ihrem Versteck hervor, nahmen sie gefangen und führten auch sie in die Höhle. Dort fiel ihr erster Blick auf die kostbaren Kleider, die da in einer Ecke an der Wand hingen. Sie erkannte sofort, daß es die Gewänder des Prinzen waren, ließ sich aber ihre Überraschung und ihren Schrecken nicht anmerken.
Der Hauptmann lag noch immer todkrank darnieder, und wie er sah, daß seine Kumpane einen Arzt in die Höhle brachten, bat er den sogleich um Hilfe. Da trat die Prinzessin an sein Lager, fühlte ihm den Puls und sprach mit verstellter Stimme: "Dir kann noch geholfen werden! Ich habe zufällig meine Lebensarznei in der Tasche. Wer davon einen Schluck trinkt, ist Zeit seines Lebens gegen alle Krankheiten gefeit und wird hundert Jahre alt."
Sie setzte dem Kranken die Flasche an den Mund, und der nahm einen tiefen Schluck daraus. Weil aber die anderen Räuber auch hundert Jahre alt werden wollten, rissen sie ihrem Hauptmann die Arzneiflasche vom Mund und tranken einer nach dem anderen, bis kein Tropfen mehr drin war. Im Augenblick aber lagen alle auf dem Boden der Höhle durcheinander und schnarchten um die Wette - denn sie hatten keine Lebensarznei, sondern -einen schweren Schlaftrunk eingenommen.
Nun schnürte die Prinzessin die Kleider ihres Gemahls in ein Bündel zusammen, versteckte sie unter ihrem weiten Doktormantel und ritt so schnell sie nur konnte nach Schwarzdorf. Dort war aber Kirchweih und das Wirtshaus so überfüllt von Gästen aus nah und fern, daß von der Scheune bis zum Speicher kein leeres Eckchen mehr zu finden war. -"Es tut mir leid, hochgelehrter Herr, daß ich Euch nicht beherbergen kann", sprach der dicke Wirt; "aber ich will mit meinem Nachbarn, dem alten Köhler, sprechen; er wird Euch gewiß für eine Nacht aufnehmen können."
Der Nachbar sagte auch zu, begrüßte den gelehrten Herrn freundlich und lud ihn ein, am Mahle teilzunehmen. Während sie aßen, seufzte auf einmal jemand in der dunkeln Ecke hinter dem Ofen. Als sich der Doktor umwandte, sagte der Kohlenbrenner: "Seid unbesorgt. Das ist nur mein Sohn, dem spukt es im Kopf, und darum habe ich ihn dort hinterm Ofen angebunden. Denkt Euch nur, er erzählt, er habe die schöne Prinzessin geheiratet und sei Prinz von Böhmen geworden! Daran seht Ihr schon, daß ihm ein Vögelchen unterm Schopfe pfeift." -
"So, so! Dies ist also mein Prinz von Schwarzdorf!" dachte die Prinzessin im stillen, gab den Köhlersleuten einen Gulden und sprach: "Geht noch ein bißchen auf die Kirchweih und trinkt einen Krug Bier auf meine Gesundheit. Ich muß morgen früh aus den Federn und will darum zeitig zu Bett gehen." Die beiden alten Leutchen wußten vor Freude nicht, wie sie sich bedanken sollten und trollten sich glücklich zur Tür hinaus.
Sobald die Köhlersleute aus dem Hause waren, zog die Prinzessin ihr Brautkleid an, nahm ein Licht zur Hand und leuchtete in die dunkle Ofenecke. "Schönen guten Abend, mein lieber Prinz von Schwarzdorf!" sprach sie. "So muß ich dich wiederfinden? Das hätte ich mir nie und nimmer träumen lassen!" Als der Köhlerssohn seine Frau erkannte, fing er bitterlich zu weinen an und verbarg vor Scham sein Gesicht in den Händen.
Da strich sie ihm liebevoll übers Haar, küßte ihn und sagte: "Ei, so weine doch nicht! Du bist und bleibst doch mein lieber Mann!" Dann machte sie ihn von seinen Ketten los, wusch ihm Gesicht und Hände und half ihm in seine fürstlichen Kleider, die sie aus der Räuberhöhle mitgebracht hatte. "So", sagte sie, "nun sind wir wieder Prinz und Prinzessin, gehen miteinander auf die Kirchweih und feiern unser Wiedersehen!" -
Da nahm der Prinz seine liebe Frau an den Arm, führte sie in den Tanzsaal und zu seinen Eltern und sprach: "Seht ihr nun, daß die schöne Prinzessin meine Frau ist und daß ich Prinz von Böhmen geworden bin?" Da reichte ihm der Vater die Hand zur Versöhnung, und die alte Mutter weinte vor Glück und Freude. Dann aber griff er in die Geldtasche und warf Hände voll Gold unter die Kirchweihgäste.
"Es lebe der Prinz! Es lebe die schöne Prinzessin!" riefen jung und alt durcheinander und hoben die vollen Gläser, um auf ihre Gesundheit anzustoßen. Als aber die Prinzessin erzählte, wie sie im finstern Wald von Räubern überfallen worden sei und wie sie die Bande mit einem Schlaftrunk unschädlich gemacht habe, da beschlossen die Dorfleute, den Kerlen das Handwerk zu legen sprangen von den Bänken hoch, spannten einen Leiterwagen ein und fuhren im Galopp in den Wald hinaus zur Räuberhöhle.
Da lagen noch die Kerle und schnarchten, als wollten sie den ganzen Böhmerwald zu Meilerholz klein sägen. Im Handumdrehen waren die Spießgesellen aufgeladen und nach Schwarzdorf geschafft. Dort luden die Köhlerburschen die Fracht ab, aber nicht vor dem Wirtshaus, sondern vor dem Diebesturm, aus dem sie nie wieder ans Tageslicht kamen. -
Der Köhlerprinz aber beschenkte seine Eltern reichlich, nahm Abschied von ihnen und fuhr mit seiner Gemahlin fröhlich durch den grünen Böhmerwald in die Stadt und vors Schloß. Dort wurden sie vom König herzlich empfangen, lebten bei ihm, bis er starb und wurden zuletzt noch König und Königin des schönen Böhmerlandes.
Schwäbisches Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER KAUFMANNSSOHN UND DIE KÖNIGSTOCHTER ...
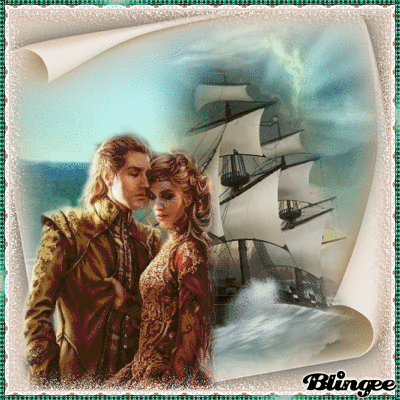
Es war einmal ein reicher Kaufmann, der hatte einen einzigen Sohn, der schon als Knabe keinen größeren Wunsch kannte, als einmal eine Reise nach Indien machen zu dürfen. Weil er aber noch so jung war und weil sein Vater fürchtete, es könnte ihm auf einer so großen Seereise ein Unglück zustoßen, erlaubte er ihm nicht, die weite Fahrt anzutreten. So mußte er voll Sehnen und Ungeduld warten, bis er zwanzig Jahre alt geworden war.
Da kam eines Tages zu dem Kaufmann ein Bote mit der Nachricht, daß sein Schiff, das vielerlei kostbare Waren aus dem fernen Osten bringen sollte, untergegangen sei. Der Kaufmann war über den schweren Verlust so betrübt, daß er drei Nächte lang nicht schlafen konnte und sich gar nicht mehr zu fassen wußte. Da trat der Sohn zu ihm und sprach:
"Lieber Vater, ich habe auch lange über die schlimme Botschaft nachgedacht - und glaube sie nicht. Es ist schon mancher um ein Schiff betrogen worden, indem man ihm fälschlich berichtet hat, es sei in einen Sturm geraten oder auf eine Klippe gelaufen und gesunken. Laß mich nach Indien reisen, um mich an Ort und Stelle nach dem Schicksal unseres Schiffes zu erkundigen. So können wir am ehesten erfahren, ob ein Betrug geschehen ist." Der Vater billigte den Rat, und der Sohn trat die Reise an.
Viele Tage schon war das Schiff unterwegs, als es endlich in einer großen, fremden Hafenstadt anlegte. "Das muß die Hauptstadt von Indien sein, in der auch der König sein Schloß hat, denn eine herrlichere Stadt kann es kaum geben!" dachte der Kaufmannssohn. Er fragte einen der Seeleute, und es zeigte sich, daß er richtig vermutet hatte. Also stieg er vom Schiffe und mietete sich im schönsten Gasthof ein Zimmer.
Es lag hoch über dem Markt und den vier Hauptstraßen der Stadt, und er stand oft am Fenster und sah auf das bunte Gewimmel da drunten. Eines Tages drang plötzlich ein gewaltiger Lärm an sein Ohr. Er öffnete das Fenster und sah hinaus. Scharen von Männern, Weibern und Kindern drängten sich zu beiden Seiten der Straße, durch die ein Eselsgespann eine zusammengerollte Kuhhaut schleifte. "Was soll das bedeuten?" fragte der Kaufmannssohn den Wirt.
"Das will ich Euch erklären", sagte der. "Ein Kaufmann unserer Stadt hat gewuchert und gepraßt und riesige Schulden gemacht, um die er dann seine Gläubiger betrogen hat. Ein solch übler Betrüger aber wird nach unserem Gesetz aufgehängt; seine Leiche wird in eine Kuhhaut genäht, durch die Stadt geschleift und dann den Vögeln zum Fraße vorgeworfen. Nur wenn einer bereit ist, den dritten Teil der Schulden des Verurteilten zu bezahlen, gibt das Gericht den Leichnam frei und läßt ihn begraben." -
"Gut, so will ich mich für die arme Seele einsetzen", sprach der Kaufmannssohn, ging zum Richter, bezahlte das Drittel der Schuld und sorgte dafür, daß die Leiche dem Brauche gemäß in die Erde gelegt wurde.
Nun aber ging der Kaufmannssohn endlich daran, sich nach dem Schiff seines Vaters zu erkundigen. Tagelang reiste er von Hafen zu Hafen und fragte alle Handelsherren und Seeleute, die ihm begegneten, ob sie nichts Näheres über das Schicksal des Schiffes wüßten. Alle seine Bemühungen aber blieben vergebens, und so schiffte er sich wieder ein und fuhr in seine Heimat zurück.
Als sie sieben Tage unterwegs waren, ging das Schiff in einem kleinen Hafen vor Anker, und der Kaufmannssohn suchte ein Wirtshaus auf, um dort bis zur Weiterfahrt Herberge zu nehmen. Als er zu Nacht gegessen hatte, traten zwei wild und verwegen aussehende Burschen mit einem schönen Mädchen in die Schankstube und setzten sich zu ihm an den Tisch. Sie gerieten bald ins Gespräch und fragten einander auch nach dem Woher und Wohin.
"Wollen wir uns nicht die Zeit ein wenig mit Würfelspiel vertreiben?" fragten die Burschen. "Mir kann es gleich sein", antwortete der Kaufmannssohn, spielte mit und hatte so großes Glück, daß er den beiden ihr ganzes Geld ab gewann. Da baten sie ihn: "Kauf uns das Mädchen da ab, daß wir wenigstens das Geld haben, um weiterreisen zu können!" Da merkte der Kaufmannssohn, daß sie das Mädchen geraubt hatten, zählte fünfzig Golddukaten auf den Tisch und nahm die schöne Fremde mit auf sein Schiff. Er fragte sie nach ihrer Heimat und erklärte sich gerne bereit, sie auf dem nächsten Wege dorthin zu bringen.
Doch sie verriet ihm weder ihren Namen, noch woher sie war, sondern bat ihn herzlich, sie mit in seine Heimat zu nehmen; sie würde gewiß gerne zu ihrem Vater zurück kehren, doch es sei ein anderes, was sie an eine Heimkehr nicht denken lasse: Ein alter, häßlicher und gewalttätiger Edelmann wolle sie heiraten und habe sie sicher durch die beiden Seeräuber entführen und mit Gewalt in sein Haus schaffen lassen wollen. Lieber aber möchte sie sterben, als diesem bösen Manne angehören. "Das begreife ich wohl, liebes Mädchen", sagte darauf der Kaufmannssohn. "So komm nur mit mir; ich will dich beschützen, und du sollst es immer gut bei mir haben."
Der Vater aber machte ein bitterböses Gesicht, als er den Sohn mit dem fremden Mädchen ankommen sah, und verlangte, daß er es sogleich wieder aus dem Hause schaffe oder selber gehe. Da verließ der Sohn das väterliche Haus, kaufte sich in einer abgelegenen Gasse einen kleinen Laden und richtete ein eigenes Handelsgeschäft ein. Das Mädchen führte ihm den Haushalt und half auch fleißig im Laden mit, und war so sparsam und sorgte so gut für ihren Herren, daß er schon nach kurzer Zeit seine Schulden bezahlen konnte.
Als der Vater dies erfuhr und hörte, wie sehr jedermann das Mädchen lobte, beschloß er, sich selbst davon zu überzeugen. Damit ihn niemand erkenne, verkleidete er sich und ging eines Morgens, als sein Sohn gerade abwesend war, in den Laden, um ein Stück Tuch zu kaufen. Die schöne Verkäuferin legte ihm allerlei Muster vor. "Sie gefallen mir wohl, aber sie sind mir zu teuer", sagte er und versuchte den Preis herunterzuhandeln.
Aber sie ließ nicht einen Groschen nach und sagte, sie dürfe ohne den Willen ihres Herrn das Tuch nicht billiger hergeben. Da ging der Vater wieder aus dem Laden, ohne etwas gekauft zu haben. Für sich aber dachte er: "Das ist doch ein ordentliches Mädchen. Es ist freundlich und ehrlich und dazu auf den Vorteil meines Sohnes bedacht." Darum versöhnte er sich wieder mit den beiden und war auch damit einverstanden, daß sein Sohn das fremde Mädchen zur Frau nahm.
Zwei Jahre waren sie nun schon verheiratet, da brachte ein Schiff, das von fernen Ländern kam, die Kunde, daß der König von Indien seine Tochter suche, die von Seeräubern entführt worden sei. Wer sie ihm lebendig zurückbringe, solle sie zur Frau bekommen und König von Indien werden. Als die junge Frau dies hörte, dachte sie: "Es wäre doch besser, Königin von Indien zu sein, als bloß die Frau eines einfachen Kaufmanns."
Und als ihr Mann nach Hause kam, erzählte sie ihm, wer sie eigentlich sei und bat ihn, Hab und Gut zu verkaufen, sie zu ihrem Vater nach Indien zurückzubringen und dort König zu werden. "Den Wunsch erfülle ich dir von Herzen gerne!" sagte er, verkaufte sein Haus, nahm Abschied vom Vater und fuhr mit ihr übers weite Meer nach Indien.
Nach vielen Tagen sahen sie endlich eine Küste, die ihnen recht bekannt vorkam, und wahrhaftig: nach einiger Zeit landeten sie in dem selben Hafen, wo einst der Kaufmannssohn den beiden Seeräubern die Prinzessin abgekauft hatte. Sie sprachen eben miteinander von jener Zeit, als ein großes Segelschiff in den Hafen einfuhr und dicht neben ihrem eigenen Schiffe die Anker auswarf. Der Herr des Schiffes war aber kein anderer als jener Edelmann, der die Prinzessin mit Gewalt zu seiner Frau machen wollte.
Er war wirklich so alt und häßlich, wie die Prinzessin ihn geschildert hatte, und man sah es ihm an, daß er ein hartes und finsteres Herz in sich trug. Auf seinen Befehl ergriffen die Matrosen den Kaufmann, fesselten ihn an ein Balkenstück und warfen ihn ins Meer, wo ihn die Wellen auf die hohe See hinaus trieben.
Dann ließ er die Prinzessin auf sein Schiff bringen, trat in ihre Kammer, die er hinter sich abschloß, und sprach: "Wenn Euch Euer Leben lieb ist, so schwört mir hier, daß Ihr Eurem Vater berichten werdet, ich hätte Euch aus den Händen der Seeräuber befreit! Wagt es ja nicht, auch nur ein einziges Wort von jenem Menschen zu erzählen, von dem Ihr sagtet, daß er Euer Mann sei! Es könnte Euch sonst übel ergehen !"
Was konnte die arme, hilflose Prinzessin anders tun, als Ja sagen und sich in ihr Schicksal ergeben? - Das Schiff lichtete die Anker, fuhr auf das offene Meer hinaus und landete nach sieben Tagen im Hafen der indischen Hauptstadt. Als der König seine verloren geglaubte Tochter wiedersah, kannte er sich fast nicht mehr vor Freude und Glück und ließ sogleich alles vorbereiten, um sie mit dem reichen Edelmann zu vermählen und ihm das Reich zu übergeben.
Wie war es unterdessen dem Kaufmannssohn ergangen? Drei Tage und drei Nächte wurde er von den Wellen hin und her geworfen, und war nahe daran, zu sterben. Da kam mit einemmal ein riesiger Vogel herbei geflogen, ließ sich bis dicht über die Wellen herab und trieb mit seinem Flügelschlag den Balken auf eine Sandbank am Meeresufer.
Dann hackte er mit dem Schnabel die Stricke entzwei und sprach: "Ich bin der Geist des Kaufmanns, den du einst hast begraben lassen. Zum Dank dafür will ich dir nun in deiner Not helfen. Geh in die Hauptstadt und melde dich im königlichen Schloß. Der König sucht einen Maler, der im Laufe von drei Tagen den großen Saal des Schlosses mit Bildern auszuschmücken vermag, und er will dem, der die Aufgabe löst, hunderttausend blanke Goldstücke bezahlen und ihn zu seinem Hofmaler machen. Nimm diese Arbeit an; sie wird dir gelingen! Du mußt nur dafür sorgen, daß niemand in den Saal gelangen kann! Verschließe die Tür und öffne ein Fenster. Für alles Weitere laß mich sorgen." Als der Vogel dies gesagt hatte, flog er fort und verschwand in den Wolken.
Als der Kaufmannssohn in die Königsstadt eintrat, herrschte darin lauter Jubel und große Fröhlichkeit, und alle Straßen waren festlich geschmückt; denn in drei Tagen sollte die Hochzeit der Prinzessin stattfinden. Der König führte ihn in den Saal und fragte ihn, ob er Meister genug sei, Decke und Wände binnen drei Tagen zu bemalen, und versprach ihm auch, daß niemand ihn bei der Arbeit stören solle.
Als er gegangen war, verriegelte der Kaufmannssohn die Tür und öffnete eines der Fenster. Da kam auch schon der Vogel mit einem Schwert im Schnabel angeflogen und sagte: "Nimm das Schwert und hau mir den Kopf ab." - "Nein, das kann ich nicht! Du hast mir nur Gutes getan", sagte erschrocken der Kaufmannssohn. "Tust du es nicht, so kann ich dir auch nicht helfen", sprach der Vogel. Da nahm er das Schwert, schlug zu und sank sogleich ohnmächtig zu Boden.
Am Morgen des dritten Tages erwachte er und sah, daß der ganze Saal ohne sein Zutun fertig bemalt war. An der Decke waren Himmel, Sonne, Mond und Sterne dargestellt, an den Wänden aber erkannte er zu seinem Erstaunen seinen eigenen Lebenslauf, von seiner ersten Reise nach Indien bis heute.
Während er noch die Bilder betrachtete, suchte ihn der König voller Erwartung auf. Seine Tochter, die ihn begleitete, erkannte auf den ersten Blick ihren Mann, den sie so lange vermißt hatte. Voller Freude fanden sich die beiden wieder und erzählten dem König alles, was ihnen begegnet war. Dieser beschloß, den falschen Edelmann auf die Probe zu stellen und ließ ihn am nächsten Tage zur Hochzeit kommen, als ob nichts vorgefallen sei.
Als alle Gäste erschienen waren, führte er sie und den Edelmann in den Saal mit den bemalten Wänden und sprach: "Wer mir erklären kann, was diese Bilder bedeuten, der soll meine Tochter zur Frau bekommen und König von Indien werden." Nun gab es ein großes Raten, denn mancher der Gäste hätte sich gerne den schönen Preis verdient. Auch der Edelmann wollte auf die Prinzessin nicht so leichthin verzichten; doch so sehr er sich auch anstrengte, er konnte nicht herausfinden, was die Bilder bedeuteten.
Da gab endlich der Kaufmannssohn die richtige Deutung des Rätsels und wies nach, wie ein jedes der Bilder einen Augenblick seines eigenen Schicksals zum Gegenstand hatte. Da erkannten alle, wie schmählich der Edelmann den König betrogen hatte und daß der Kaufmannssohn der rechtmäßige Gemahl der Prinzessin war.
Zur selben Stunde noch wurde der Edelmann auf Befehl des Königs ins Gefängnis geworfen und zum Tode verurteilt. Der Kaufmannssohn aber feierte zum zweiten mal Hochzeit mit der Königstochter und wurde bald darauf König von Indien.
Schwäbisches Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER MEISTERLÜGNER ...
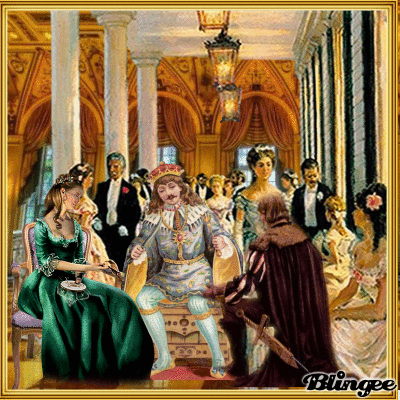
Da war auch einmal im Land Ichweißnichtwo ein König, dem konnte einer das Blaue vom Himmel herunter in die Ohren lügen; er konnte lügen, daß sich die eichene Balken im Thronsaale bogen - der König hielt alles für wahr; es gab nichts, was ihm zu Ohren kam, das er am Ende nicht doch für möglich gehalten hätte.
Viele Jahre war er nun schon König, und mindestens einmal an jedem Tag war es vorgekommen, daß einer seiner Hofleute oder Minister über irgendeine neue Kunde gesagt hatte: "Das ist eine Lüge!" oder: "Das ist Faustdick gelogen!" oder: "Das glaubt ja kein Sterblicher!" Da ärgerte sich der König über sich selbst, weil er immer alles für wahr halten mußte und noch kein einziges Mal in seinem Leben einem ins Gesicht hatte sagen können: "Du großmauliger Schelm, das lügst du!"
Ein mal wollte er es aber doch sagen können, ehe er starb, und sollte er gleich sein liebstes Kleinod dafür hingeben müssen. Darum ließ er in seinem Reich durch einen Herold verkünden: wer eine so große Lüge tun könne, daß selbst der König sie nicht glaube, der solle seine einzige Tochter, die schöne Prinzessin, zur Frau bekommen.
Viele edle und unedle Lügenbeutel hatten nun schon versucht, sich mit ihrer Schelmenkunst das Königstöchterlein zu erlügen; doch es war ihnen nicht gelungen. Sie hatten für ihre Dreistigkeit auf sieben Jahre in den dunklen Turm wandern müssen. Da hörte auch ein wandernder Handwerksgeselle in einer fernen Stadt den Herold die königliche Botschaft ausrufen.
Der Geselle hielt sich für einen Erzlügner, dem nicht so leicht einer das Wasser reichen konnte. Zudem dachte er, eines Königs schönes Töchterlein sei ein Preis, um den man schon ein paar saftige Lügen wagen könne, und machte sich also auf den Weg zum Schlosse.
Als der junge, schmucke Bursche durch das Tor trat und den Torhütern und Dienern Bescheid gab, was er da wolle, rieten ihm alle, keinen Schritt mehr weiter zu gehen. Doch der Handwerksbursche ließ sich nicht einschüchtern und verlangte, vor den König geführt zu werden.
Der König saß auf seinem goldenen Throne, ihm zur Seite seine Tochter. Sie war so schön, daß der Bursche die Augen schließen mußte, als er sie nur mit einem einzigen Blick gestreift hatte. Der König aber sprach: Drei Lügen will ich dir gestatten. Wenn ich sie aber alle für wahr halte und dich nicht wenigstens einmal einen Lügner heiße, so ist der köstliche Preis hier zu meiner Linken verscherzt, und du siehst für sieben Jahre das Licht der Sonne nicht mehr!"
Wie der König aber von dem köstlichen Preis zu seiner Linken sprach, wagte der Bursche noch einmal einen Blick zu der schönen Prinzessin hinüber, und - O Wunder! - die lächelte ihm so freundlich und lieb zu, daß er alles Bangen von sich warf und nicht mehr daran zweifelte, daß er sie noch heute in seine Arme schließen werde.
"Zum ersten also!" begann der König. Er wies mit seiner ringfunkelnden Hand auf den Boden des Thronsaales, der mit lauter Goldplatten belegt war, und fragte den Handwerksburschen: "Gelt, Junge, so einen kostbaren Boden hast du noch nirgends gesehen?" - "Ei, warum nicht", antwortete der. "Wo?" fragte der König. "In meinem Heimatdorf, das gleich hinter dem gläsernen Wald rechts unterm Mond liegt und Lügmireins heißt." -
"Und bei wem hast du einen solchen goldenen Boden gesehen?" - "Na, wo auch? Daheim, bei meinem Vater." - "Wer ist denn dein Vater?" - "Ei, wer sollte er auch sein: der Sauhirt in unserem Dorf." - "Wie viel Säue hat er zu hüten?" - "An die fünftausend." - "Wie lange schon treibt dein Vater auf die Weide?" - "Jetzt geht es gerade ins hundertneunundneunzigste Jahr. "
Der König räusperte sich und sagte: "Daß dein Vater in so viel Jahren mit so viel Säuen, so viel Geld erspart hat, daß er am Ende in seine Stube einen goldenen Boden hat legen lassen können, das glaube ich gerne; denn Sauhirt sein ist verdienstlich."
Der König schmunzelte spöttisch, weil die erste Lüge für ihn nicht groß genug gewesen war. Doch der Bursche ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. "Zum anderen denn!" fuhr darauf der König fort, wies mit der Hand nach dem Fenster und sprach: "Geh dort hin und schau in den Garten hinab! Hast du deiner Lebtage schon einmal so große Rüben gesehen?" -
"O jemine!" versetzte der kecke Geselle, "da sind die Euren vertrocknete Setzlinge gegenüber denen, die ich heut vor neunundneunzig Jahren weit hinterm Nirgendsmeer im Land Eckumeck gesehen habe. Selbige sind so groß gewesen, daß unter ihrem Krautwerk sechzehntausend Soldaten beim größten Wolkenbruch unterstehen konnten, und ist keiner auch nur einen Tropfen naß geworden."
Der König räusperte sich zweimal und sagte: "Nun ja, kann sich ein Schweinehirt einen goldenen Fußboden in seiner Stube leisten, so können auch im Land Eckumeck hinterm Nirgendsmeer so große Rüben wachsen. Was ist nicht alles möglich unter der Sonne!?"
Der König lächelte noch spöttischer als beim ersten Male. Und sogleich hob er wieder seine Hand und wies nach dem Fenster auf der anderen Seite des Saales. Dann sagte er: "Zum dritten also! Geh dort hinüber und sieh dir die Tanne in meinem Park an. Hast du je einmal auf deinen Wanderfahrten eine so hohe Tanne angetroffen?"
Der lustige Geselle, der voller Lügen steckte, besann sich rasch auf eine, die so grausam erlogen war, daß es gewiß auf der ganzen Welt keinen Menschen gab, der sie glaubte, und begann tapfer und mit prahlerischer Stimme zu erzählen: "O du meine Güte! Das hier? Das ist ja nur ein Besenreis gegen das, was ich im Himmeleieieigebirge einmal an Tannen gesehen habe! Ich habe wundershalber probiert, wie hoch die höchste wohl sein möge.
Habe mir also zweiundzwanzigtausend Sparrennägel gekauft und sie einen nach dem anderen in den Stamm geschlagen und bin drauf Gipfel wärts geklettert. Denkt Euch! Da bin ich bis in den siebten Himmel hinauf gekommen, und die Tannenwipfel waren immer noch nicht zu sehen. Weil ich nun doch schon einmal da war, dachte ich, ich könnte mir auch den Himmel ein bißchen ansehen. Fand viele alte Bekannte aus Lügmireins und aus dem Lande Eckumeck vor und erzählte ihnen, daß ich, ehe ein Jahr vergangen, des Königs schönes Töchterlein im Land Ichweißnichtwo als Gemahlin heimführen werde.
Und sie glaubten mir alle bei ihrer Seele Seligkeit und wünschten mir von Herzen Glück dazu. Sie hätten mich gar zu gerne zum Nachtessen eingeladen, aber ich war drauf bedacht, vor dem Dunkelwerden wieder in die Welt hinabzurutschen, und empfahl mich. Ich habe aber ums Leben nicht mehr die Tanne gefunden, auf der ich herauf gestiegen bin, und hatte drum im Sinn, im Himmel ein verstecktes Plätzchen zum Nachtlager zu suchen.
Wie ich da nun so herumstolperte, stieß ich von ungefähr an ein Bollenfaß. Sah hinein und bemerkte, daß es ein gut Stück über den Rand hinaus voll war mit Weizenkleie. Holla! habe ich gedacht, du kommst mir gerade recht! Habe aus der Kleie ein Seil geflochten, es mit einem Dutzend übrig gebliebenen Nägeln am Himmelfenster festgenagelt und mich an dem Kleieseil allmählich auf die Welt herabgelassen.
Wie ich aber noch weit über den aller obersten Wolken gewesen bin, ist das Trumm ausgegangen. Jetzt was tun? Nun, ich habe halt keine andere Wahl gehabt, als das Seil oben abzuschneiden und unten an den Rest wieder anzuknüpfen. Bis ich aber endlich auf festem Boden und geradeswegs vor dem Tor zu Eurem königlichen Palast angekommen bin, hat das Seil - Ihr mögt es mir glauben oder nicht! - nur noch aus lauter Knöpfen bestanden."
Da fuhr der König aus seinem Thronsessel auf und rief: "Das ist ja eine Lüge so groß wie das Seil, das du mir da vom Himmel herunter gelogen!" - "Gut", erwiderte freudestrahlend der Handwerksbursche, "und also bin ich Euer Tochtermann!", nahm die schöne Prinzessin, die ihn gar liebreich anlachte, bei der Hand und gab ihr den Verlobungskuß.
Dann trat das glückliche Paar vor den König, und der legte ihre Hände ineinander, nahm die Krone von seinem grauen Haupt und drückte sie dem wackeren Gesellen in die Locken. Und so ist der Meisterlügner König im Lande Ichweißnichtwo geworden.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER BETROGENE TEUFEL ...

Es war einmal ein junger Bursche, Berthold hieß er; dem waren Vater und Mutter gestorben und hatten ihm nichts hinterlassen, weder Geld noch Gut, und so stand er eines Tages arm und allein und ohne einen Freund auf der Welt. Jemand hätte er zwar schon gehabt, das war Gertrud, eine reiche Bauerntochter, die er heimlich liebte und die auch ihn gern hatte, denn er war ein sauberer und starker Bursche.
Weil er aber so gar nichts hatte als seinen kärglichen Lohn und mit knapper Not ein ordentliches Werktags- und Sonntagsgewand, wollte es der Bauer nicht leiden, daß seine Tochter den armen Taglöhner heirate. Darüber war Berthold sehr traurig, saß oft an einem einsamen Platz im Walde und sann und sann und mußte immer nur das eine denken: "Ja, wenn ich reich wäre, dann würde ich die schöne und reiche Gertrud ganz gewiß zur Frau bekommen. Wie aber soll aus mir armem Kerl ein wohlhabender Mann werden? Das wird im Leben nicht so weit kommen, und was tue ich also eigentlich auf dieser ungerechten Welt. Am besten wär es, ich würde einschlafen und nicht mehr aufwachen."
Wie er nun wieder einmal so in düsteren Gedanken da saß, stand plötzlich ein großer, fremder Jäger vor ihm - das war aber niemand als der Teufel - und sagte: "Ei, nur keinen solch trübseligen Gedanken nachspinnen, Bursche! Was drückt dich denn? Wo fehlt es?" - "Am Geld fehlt es mir. Reich sollte ich sein!" antwortete Berthold bitter. "Wenn es weiter nichts ist", sprach der Teufel, "dazu kann ich dir leicht verhelfen. Du brauchst mir nur deine Seele dafür verschreiben." - "Die sollst du nach meinem Tod gerne haben; ich fange ja dann doch nichts mehr mit ihr an", sagte Berthold; "aber jetzt will ich mich freuen mit ihr, wenn ich reich bin und das Mädchen, das ich schon lange gerne möchte, zur Frau bekommen habe."
So ging also der arme Berthold in seiner Not den Pakt mit dem Teufel ein, bekam gleich einen Stumpen Gold ausgehändigt und war vom Tage an der reichste Mann im Lande. Es dauerte auch gar nicht lange, da gab ihm der Bauer seine Tochter und ließ die Hochzeit zurichten. Als aber die Feier gerade am schönsten war und das junge Brautpaar bei Flöten- und Geigenspiel den ersten Tanz miteinander tanzte, da ging plötzlich die Tür auf und der Teufel trat herein, um den versprochenen Lohn abzuholen.
"Du siehst doch, ich halte gerade Hochzeit; da kann ich dir doch meine Seele nicht geben. Jetzt will ich erst recht anfangen zu leben! Komm in fünfzig Jahren wieder vorbei und frage nach", sagte Berthold und wollte wieder in den Saal zurück und zum Tanz gehen. So ließ sich aber der Teufel nicht abfertigen und bedachte, wie er sich heute noch des Burschen Seele mit List verschaffen könnte.
"Höre!" sagte er drum zu Berthold, "ich will dich fortan ungeschoren lassen und auf deine ärmliche Menschenseele verzichten, wenn du mich mit irgendeiner Arbeit einen ganzen Tag lang beschäftigen kannst." - "Das müßte eine Kunst sein, dir für einen Tag Arbeit zu verschaffen", dachte der Bursche und war mit diesem Vorschlag gleich einverstanden.
Er führte den Teufel vor das Dorf hinaus auf einen großen, abgemähten Fruchtacker und sagte: "So, diesen Acker sollst du umhacken!" Dazu brauchte ein einzelner Mann sonst drei volle Tage; der Teufel aber war schon nach einer Viertelstunde damit fertig und forderte weitere Arbeit. Da nahm Berthold ein Simri Kleesamen, säte den auf dem Felde aus und sagte: "Lies den Samen wieder in das Simrimaß zurück! Es darf aber kein Körnlein liegen bleiben!"
Doch auch das war dem Teufel eine Kleinigkeit; er war in einer halben Stunde fix und fertig und verlangte neue Arbeit. Nun wurde aber dem Berthold allmählich doch Höllenangst, und er kam jedesmal bleicher und aufgeregter in den Saal zurück. Die Braut merkte, daß da etwas nicht stimmte und fragte ängstlich und besorgt ihren Mann: "Warum bist du denn so blaß? Was hast du denn, daß du immer aus- und eingehst?"
Da gestand er seiner Frau alles und klagte ihr die Not und Gefahr, in der er schwebte. Als sie ihn angehört hatte, fing sie aber nicht etwa zu weinen und zu jammern an, sondern lachte und sprach: "Oh, hättest du mir das doch gleich zu Anfang gesagt! Ich kann dir helfen, mein lieber Berthold!" Dabei zupfte sie sich eins ihrer kurzen, krausen Haare aus, gab es ihm und sagte: So, nun bring das dem Teufel und verlange von ihm, daß er es gerade machen solle." -
"Was habe ich doch für eine kluge Frau!" sagte Berthold, gab seiner Braut einen Kuß und eilte so schnell er konnte auf den Hof hinaus. Als der Teufel das Haar nur sah, schnitt er schon ein Gesicht wie neun Tage Regenwetter, zupfte und zog und bog voll Wut an dem Härchen herum und legte es zuletzt sogar auf den Amboß, um es mit dem schweren Schmiedehammer grad zu klopfen. Doch es war alles umsonst; er konnte diese Arbeit an einem Tage nicht zustande bringen. Das Haar blieb kraus, und der Teufel war um seinen Lohn betrogen.
Voller Freude kehrte Berthold zu seiner Braut zurück, tanzte und feierte mit ihr bis in den frühen Morgen hinein und lebte nun mit seiner Frau in Glück und Wohlstand bis an sein Ende.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER GUTE SCHLAUE PHILIPP ...

Zu den Zeiten, als der Herr noch mit seinen Jüngern in schlichtem Gewand und unerkannt auf Erden wandelte, kam er auch einmal mit den Zwölfen in ein kleines Bauerndorf im Allgäu und bat dort bei den reichen Bauern um Nachtherberge. Von allen aber wurden die Bittenden mit allerhand Ausreden und groben Worten abgewiesen. Der Bauer im letzten Hause rief ihnen noch durchs Fenster nach: draußen vor dem Ort in der kleinsten Hütte wohne ein alter Wittiber, der Philipp; der pflege solcherlei Leute, wie sie seien, übernachten zu lassen; den sollten sie einmal fragen.
Der alte Philipp kochte gerade für sich das Nachtessen, als die dreizehn vor seiner Hütte ankamen und um ein Nachtquartier fragten. Der Alte lächelte und sagte: "No ja! Das wäre alles schon recht, wenn, ich nur so viel Platz hätte, um euch alle beherbergen zu können. Für sechs Mann könnte es am Ende reichen." Sie wollten aber alle gerne hier bleiben. "No ja! So schauet in Gottes Namen, wie ihr es mit dem Liegen macht", meinte Philipp; "ich will mal im Ort drin Stroh betteln, damit ihr es euch auf meinem Stubenboden bequem machen könnt. Will mich auch nach Pferdedecken umschauen, damit ihr was zum Zudecken habt."
Am anderen Morgen stand der gute Philipp früh auf und kochte für seine dreizehn Gäste, soweit sein kleiner Vorrat reichte. Als sie gegessen hatten, wollten sie sich für die freundliche Bewirtung auch erkenntlich zeigen, und also sagte Petrus als ihr Wortführer: "Höre, Philipp! Du darfst drei Wünsche tun; die werden dir in Erfüllung gehen." - No ja, dachte Philipp bei sich, was soll ich mir jetzt geschwind wünschen?
Er hüstelte ein paarmal verlegen und sagte dann: "No ja! So wünsche ich fürs erste, daß ich noch fünfhundert Jahre lang so bleibe, wie ich jetzt gerade bin; fürs zweite, daß mein Birnbaum vor dem Haus allzeit Birnen trägt und daß jeder, der auf ihn steigt, nicht wieder herunter kann, ehe ich es ihn heiße, und zum dritten, daß der, der ohne meinen Willen in meinen Altvatersessel dort am Ofen sitzt, sich nicht mehr daraus erheben kann." - "Soll geschehen!" sagte der Herr und wanderte mit seinen Zwölfen weiter.
Als die fünfhundert Jahre um waren, kam der Tod zu Philipp. Es war Herbst und Philipp wollte eben die Birnen schütteln. Der Tod sagte: "Höre, Philipp! Die fünfhundert Jahre sind jetzt um und nun heißt es für dich: mit mir gehen!" - "No ja! Ei, ei! Schon?" erwiderte Philipp aufgeräumt. "Ich sollte doch noch vorher meine Birnen schütteln." -"Gut!" sagte der Tod. "Aber du machst mir zu langsam, alter Freund! Ich will für dich auf den Baum steigen und die Birnen schütteln, damit wir schneller fertig werden."
Der Philipp ließ es zu. Stieg also der Tod auf den Birnbaum und schüttelte nach Kräften; und Philipp las die Birnen auf und trug sie ins Haus. Hernach wollte der Knochenmann wieder vom Baum herunter steigen; er brachte es aber nicht fertig, so sehr er sich auch abmühte. Da bat er den Philipp um Hilfe. Philipp aber sagte seelenruhig: "No ja ... Ich hab dich nicht hinauf klimmen heißen. Also bleib, wo du bist!" Der Tod bettelte und flehte, er möge ihn doch wieder herabsteigen lassen.
Endlich sagte Philipp: "No ja! Gut, ich will es tun, wenn du dich nicht eher bei mir blicken läßt, als bis wieder fünfhundert Jahre vergangen sind!" Was konnte der Tod auf dem Birnbaum anders tun, als ja sagen? Er mußte dem Philipp sein Wort geben und weiter ziehen. Der alte Philipp aber lebte weiterhin glücklich und zufrieden in seiner kleinen Hütte und begnügte sich mit den Birnen, die ihm der Baum in seinem Garten trug.
Auch die zweiten fünfhundert Jahre gingen herum. Da stellte sich eines Morgens der Tod wieder ein und sprach: "So, Philipp, diesmal erwischst du mich nicht! Mach dich bereit!" -"No ja, wird nicht so pressieren, Meister Tod", meinte er. "Laß mich noch den Bart schaben, dann wollen wir gehen." Der Tod sagte: "Meinetwegen", und setzte sich aus Langeweile in den Ohrenstuhl am Ofen.
Weil ihm aber der Philipp gar zu lang brauchte, wollte er ihn ohne viel Federlesen am Arm packen und mitnehmen. Doch, o weh! - Er vermochte sich nicht aus dem Sessel zu erheben, und wenn er sich auch noch so sehr anstrengte. Er flehte den Philipp an, er solle ihn doch aus dem Sessel befreien. Der aber sagte: "No ja! Das will ich tun, wenn du dich abermals nicht eher bei mir blicken läßt, als bis fünfhundert Jahre vergangen sind." Und der Tod mußte noch einmal fünfhundert Jahre drein geben!
Als aber die um waren, half dem schlauen Philipp keine List mehr, und er ging willig mit dem Tod in die Ewigkeit. "No ja, führe mich zuerst in die Hölle", sagte er; "Will doch auch sehen, wie es da zugeht." Als sie vor dem Höllentor ankamen, schrien die Teufel: "Heio! Tod! Was bringst du uns denn da für einen Kerl?" - "Ei", entgegnete der unwirsch, "fragt ihn doch selber; er ist alt genug zum Schwätzen!"
Da fragten die Teufel den Philipp, wer er sei. "No ja, wer ich bin?" sagte der Philipp. "Ein Spieler und Säufer." Da stimmten die Teufel ein gewaltiges Gelächter an, und ihr Oberster fragte ihn: "Hör, Alter, hast du keine Würfel bei dir? " - "O ja!" sagte Philipp, "was gilt es?" - "Eine arme Seele", lachte der Teufelober, rüttelte den Knöchelbecher und warf. Philipp warf nach und hatte ein Auge mehr. "No ja! Das wär mal eine Seele!" schmunzelte Philipp, ging in die Höllenküche hinein und suchte sich eine Seele aus.
Wie staunte er aber, als er mitten drin im größten Haufen sein Weib erblickte! "Du Geizteufel du!" rief er ärgerlich. "Hab ich es nicht immer gesagt, du werdest einmal da herein kommen? Aber da du nun schon einmal mein Weib bist, will ich mich deiner annehmen." Faßte sie bei der Hand und nahm sie mit sich. Als Philipp wieder zu den Teufeln hinaus kam, fing ihr Oberster aufs neue mit ihm zu würfeln an und verlor nacheinander zwölf Seelen. Da wurde er fuchsteufelswild und schrie: ..So, du Kerle! Meinst du, du dürfest mir die ganze Hölle ausräubern?!", sprang in die Hölle und schlug das Tor zu.
Nun ging der Tod mit Philipp und seinen zwölf gewonnenen Seelen weiter, dem Himmel zu. Dort klopfte Meister Philipp an. Petrus öffnete ein wenig die Tür, schaute heraus und fragte nach seinem Begehr. "No ja! Ich wollte nur gern mit meinen Reisegesellen in den Himmel", antwortete Philipp. Petrus schaute den stattlichen Zug, der da hinter dem Philipp vor der Himmelstür draußen stand, gar verwundert an und sprach: "Sapperlott! Das sind halt viel auf einmal!" -
"No ja", sagte Philipp, "weißt du nicht mehr, daß ihr auch so viel gewesen seid, als ihr damals zu mir kamt? Hab euch seinerzeit auch in mein Haus gelassen und hat viel weniger Platz gehabt als der Himmel da oben." -"Potz Kuckuck!" rief da Petrus voller Freude, "so, Ihr seid es, alter Philipp? Nur alle hereinspaziert!" Und so sind der Philipp und seine Zwölfe allesamt in den Himmel gekommen.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER KLUGE MARTIN ...

Es war einmal ein armer Tagelöhner, der besaß drei Söhne. Jeder hatte ein Handwerk erlernen dürfen, und so war der eine Weber, der andere Schneider und der dritte Schuster geworden. Der Schuster war der jüngste, aber auch der gescheiteste, und darum wurde er von allen nur "der kluge Martin" genannt.
Als die Lehrzeit um war, schickte der Vater sie auf die Wanderschaft. Weil er aber so arm war, konnte er ihnen außer seinem Segen nichts mitgeben als Messer, Gabel und Löffel, die in einem einfachen Ledertäschchen beisammen steckten. Doch die drei Brüder waren mit diesem wenigen zufrieden und zogen frohgemut in die weite Welt hinaus.
Am Abend nach ihrem ersten Reisetage kehrten sie in einem Dorfwirtshaus ein. Ehe sie aber am anderen Morgen weiterwanderten, beschlossen sie: "Wir wollen nun ein jeder einen anderen Weg einschlagen, heute über fünf Jahre aber hier an diesem Tische wieder zusammentreffen." Dann wünschten sie sich gegenseitig viel Glück und nahmen herzlich Abschied voneinander.
Als der kluge Martin eine Weile gewandert war, kam er an eine steinerne Brücke, und wie er gerade den Fuß auf sie setzen wollte, trat ihm ein Mann in den Weg und fragte mit finsterem Gesicht: "Was suchst du hier und wo willst du hin?" Sprach der kluge Martin: "Ich bin ein Schuhmacher, bin auf Wanderschaft und suche Arbeit." - "Soso", brummte der Fremde. - "Ja", nickte Martin; "aber nun sag mir auch, wer du bist und was du hier treibst." -
Da grinste der andere ganz unheimlich unter seinem breitrandigen Schlapphut hervor und antwortete: "Ich? - Ich bin ein Räuber." - "So", sagte der kluge Martin; "ein seltsames Handwerk. Ist es auch einträglich?" - "Das will ich meinen! Mehr als das deine!" - "Ei, was!" rief da der kluge Martin verwundert aus. "Meinst du, daß ich es auch erlernen könnte?" - "Das kommt ganz darauf an, wie du dich anläßt", meinte der Räuber. -
"Weißt du was? - Behalte mich hier. Ich will auch ein Räuber werden!" sagte Martin. - "Gut. Ich will dich einstweilen da behalten. In die Schar der Kumpanen aufnehmen kann dich aber nur mein Meister, und der ist gerade nicht zu Hause." Da wartete der kluge Martin drei Tage lang, bis der Räuberhauptmann zurückkehrte und er ihm seinen Wunsch vorbringen konnte.
Der Hauptmann hörte den Burschen an und sagte dann: "Gut, ich will dich aufnehmen. Du mußt aber erst eine Probe ablegen und deine Geschicklichkeit zeigen." - "Daran soll es nicht fehlen! In ein paar Stunden bin ich wieder hier; dann sollst du sehen, daß ich wohl zu brauchen bin", sagte der kluge Martin und schritt über die Brücke davon, dem Walde zu.
Wie er nun in den Wald hinein kam, sah er einen Metzger des Weges ziehen, der führte ein Kalb mit sich. Der kluge Martin schlich seitwärts durchs Unterholz und gewann so ungesehen auf einem Fußpfad einen Vorsprung. Dann bog er wieder auf die Straße ein, die der Metzger mit dem Kalb daher kommen mußte, nahm Messer, Gabel und Löffel aus dem Ledertäschchen und warf die leere Hülle mitten auf den Weg.
Nachdem er eine Strecke gegangen war, ließ er die Gabel fallen. Und wieder nach einer Weile den Löffel und das Messer zusammen. Drauf versteckte er sich in der Nähe und wartete, bis der Metzger mit seinem Kalbe zwischen den Bäumen auftauchte. Jetzt war er bei dem Ledertäschchen angekommen, hob es auf und besah es sich genau. Er dachte aber wohl: "Was kannst du mit diesem nichtsigen Lederzeug anfangen? Ist ja des Aufhebens nicht wert", - warf es wieder auf den Weg und zog weiter.
Nun kam er an die Stelle, wo die Gabel lag. Er sah sie nur von oben her an und ging weiter, ohne sich nach ihr zu bücken. Als er aber danach den Löffel und das Messer fand, hob er beide auf und steckte sie in die Tasche. "Jetzt wäre es doch gut, wenn ich das ganze Besteck beisammen hätte!" überlegte sich der Metzger, band das Kalb an einen Baum und lief zurück, um die Gabel und die Lederhülle zu holen.
Inzwischen sprang der kluge Martin aus seinem Versteck hervor, band das Tier los und trieb es in den Wald hinein. Dabei blökte er beständig wie ein Kalb. Als der Metzger wieder an die Stelle kam, wo er das Vieh angebunden hatte und es nicht mehr vorfand, dachte er: "Es wird sich losgerissen und verlaufen haben" und ging dem Blöken nach, das er aus dem Walde hörte.
Der kluge Martin aber war inzwischen an einen Teich gekommen, hatte dort schnell das Kalb geschlachtet und den abgeschnittenen Kopf ins Wasser geworfen. Dann hatte er sich im Gebüsch versteckt und blökte erbärmlich. Als der Metzger aus dem Walde heraus und ans Ufer trat, glaubte er nicht anders, als daß sein Kalb ins Wasser gelaufen sei und nur noch den Kopf herausstrecke. Deshalb zog er sich flink aus und sprang in den Teich, um es herauszuziehen.
Während er aber im Wasser patschte, sprang der kluge Martin aus dem Versteck hervor, nahm die Kleider des Metzgers, samt allem was darin war, unter den Arm und machte sich wie der Wind davon. Dann brachte er alles dem Räuberhauptmann und erzählte ihm, wie er dazu gekommen war. Da war der Hauptmann mit dem Probestück des klugen Martin wohl zufrieden und nahm ihn unter seine Gesellen auf und es dauerte nicht lange, da war Martin der geschickteste und kühnste Räuber weit und breit.
Als die fünf Jahre um waren, dachte er an die Verabredung, die er mit seinen Brüdern getroffen hatte. Er zog vornehme Kleider an, bekam von seinem Hauptmann Kutsche und Pferde geliehen und fuhr vor das Wirtshaus. Da saßen seine zwei Brüder schon am Tische, erkannten ihn aber nicht wieder, bis er sich ihnen zuletzt zu erkennen gab. War das eine Wiedersehensfreude! Martin ließ Braten und Wein auftragen, und sie waren miteinander vergnügt bis in die späte Nacht hinein.
Gerade in dieser Nacht aber geschah es, daß der Räuberhauptmann mit seiner ganzen Bande gefangen genommen wurde. Der kluge Martin war der einzige, den die Schergen nicht erwischten. Da ließ der König durch einen Herold bekannt machen, daß derjenige, der den klugen Martin lebendig oder tot herbei schaffe, tausend Gulden zum Lohn erhalten solle. Das hörte der kluge Martin selbst ausrufen, als er am anderen Morgen mit seinen Brüdern in der Wirtsstube saß.
"Habt ihr es gehört: Tausend Goldgulden ist dem König mein Kopf wert! Die soll kein anderer einstecken als ich selber, verlaßt euch drauf!" sagte er, verkaufte die Kutsche samt den schönen Pferden davor und kaufte sich dafür einen alten Krämerwagen. Darauf lud er ein Faß voll Branntwein, zog die lumpigsten Kleider an, die er auftreiben konnte, und fuhr so zum Tor hinaus, ohne daß ihn jemand erkannte.
Froh und guter Dinge fuhr er dahin. Wie er aber in die Nähe der Brücke kam, war diese von fünfundzwanzig Husaren umstellt, die ihn auf Befehl des Königs gefangen nehmen sollten. Martin besann sich nicht lange. Er tat, als wäre er betrunken, sang und schrie und taumelte hinter dem Wagen drein von einer Straßenseite zur anderen. Gerade vor der Brücke aber trieb er das Pferd so heftig auf die eine Seite, daß ein Rad in den tiefen Graben geriet und der Wagen umfiel.
"Ach, ich armer Mann! Ach, ich armer Mann!" jammerte er und versuchte den Wagen wieder aufzurichten. "Oh, jetzt ist alles hin! Alles und der gute teure Schnaps dazu! Helft mir doch, Soldaten! Soll mir auf ein paar Schoppen nicht ankommen!". Da legten die Husaren wacker Hand an, und der kluge Martin schenkte zum Dank jedem ein großes Glas Branntwein ein und füllte nach, bis die Husaren so betrunken waren, daß keiner mehr lallen konnte und einer nach dem anderen wie ein Sack in den Graben fiel.
Da holte der kluge Martin aus seiner Höhle fünfundzwanzig Kapuzinerkutten, zog sie den Husaren an und fuhr die Kerle dann in der Nacht zur königlichen Schloßwache. Ihr könnt euch denken, was der König am anderen Morgen für Augen machte, als er die Kapuziner in der Wachstube antraf! Er fragte alle Diener und Knechte und Hofleute, ob sie in der Nacht nichts Verdächtiges gesehen oder gehört hätten.
Niemand konnte ihm eine Auskunft geben; jedoch die junge Königstochter sprach: "Das hat niemand anders als der kluge Martin getan!" - "Daß ich daran nicht gedacht habe!" sagte der König und schlug sich mit der Hand vor die Stirn. "Du bist klug, mein Kind. Rate mir: Wie, meinst du, kann man wohl den klugen Martin am besten fangen?" -
"Mir dünkt, das dürfte nicht so gar schwer sein, lieber Vater", antwortete die Prinzessin. "Laßt einmal einen öffentlichen Tanz im Schloß ausrufen und bald da, bald dort Goldstücke auf den Boden des Saales legen. Der kluge Martin wird bei dem Fest gewiß nicht fehlen, und wenn er das Gold sieht, so kann er es nicht liegen lassen, sondern wird es aufheben und in die Tasche stecken. Daran werdet Ihr ihn leicht erkennen und ihn dann festnehmen können."
Der Rat der Tochter gefiel dem König, und er ließ darum sogleich landauf, landab durch einen Herold den Tanzabend ausrufen. Ehe aber die ersten Gäste eintrafen, streute er eine Tasche voll Goldstücke im Saale aus, so wie die Prinzessin es ihm geraten hatte. Wahrhaftig, die Pforten des Schlosses waren kaum eine Weile geöffnet, so erschien der kluge Martin im Saale, mit dem allerfeinsten Gewand angetan und von einem Diener begleitet. Niemand aber wußte, wer dieser fremde Herr war.
Wie er nun da die Goldstücke am Boden zerstreut liegen sah, dachte er bei sich: "Die lägen in meiner Tasche viel weicher und besser als hier auf den harten Dielen." Und er überlegte sich, wie er die Goldvögel am besten einfangen könne, ohne dabei ertappt zu werden. Als der erste Tanz zu Ende war, ging er hinaus zu seinem Diener und befahl ihm, eilends Pech zu holen. Dann machte er das Pech warm, strich es auf seine Schuhsohlen, ging wieder in den Saal zurück und tanzte, daß es eine Art hatte; einige Male sogar mit der schönen Prinzessin selber.
Sooft aber ein Tanz zu Ende war, verließ er den Saal und hieß draußen seinen Diener die Goldstücke abnehmen, die an den Pechsohlen hängen geblieben waren. Ein dutzendmal, wenn nicht mehr, trieb er es so und trug manches blanke Goldstück hinaus, ohne daß die geheimen Späher des Königs ihn als Dieb hätten entlarven können. Im Gegenteil, der kluge Martin hatte noch einen viel kostbareren Fang als die paar Dutzend Goldvögelein gemacht.
Die Prinzessin nämlich hatte ihn wohl erkannt und der stattliche, kühne Bursche hatte ihr so gut gefallen, daß sie den ganzen Abend mit keinem anderen tanzen wollte. Als das Fest zu Ende ging, nahm sie ihn heimlich auf die Seite und sagte: "Nimm dich in acht, Martin; mein Vater will dir ans Leben. Aber sei ohne Sorge, ich werde alles schon zum rechten Ende bringen."
Nun war also der Tanzabend aus, und der kluge Martin war weder erkannt noch gefangen genommen worden. "Es fehlen mehr als dreißig Goldstücke!" sagte der König am anderen Tage zu seiner Tochter. "Also ist er da gewesen! Mir ist das ein Rätsel. Wenn ich nur wüßte, wie ich den Kerl in die Hand bekommen könnte! Kannst du mir nicht noch einen Vorschlag machen?"
Da besann sich die Prinzessin eine Weile und sagte: "Laßt ein Turnier ausschreiben und versprecht mich dem Sieger als Preis. Der kluge Martin wird bestimmt an dem Kampf teilnehmen und ihn gewinnen. So erkennt Ihr ihn sicher und könnt ihn inmitten Eurer Ritter und Hofleute leicht gefangen nehmen lassen." "Ja, so will ich`s machen!" sagte der König, rief seinen Schreiber, hieß ihn ein großes Turnier ausschreiben und darin versprechen, daß er dem Sieger im Kampfe seine einzige Tochter zur Frau geben wolle.
Da zogen aus allen vier Enden der Welt Fürsten und Grafen und Ritter und Edelleute herbei, ritten in die Schranken und turnierten tapfer und hätten ein jeder gerne die schöne junge Königstochter gewonnen. Wer aber über alle den Sieg davontrug, das war der kluge Martin. Anstatt ihn aber mit seiner Tochter zu verloben, wollte der König ihn vor den versammelten Gästen binden und in den Kerker werfen lassen.
Da aber schritt die Prinzessin auf den tapferen klugen Martin zu, küßte ihn und sprach: "Den will ich zum Manne haben und keinen anderen! Das müßt Ihr wissen, Vater! Ich liebe ihn und Ihr haltet Euer königliches Wort!" - "So sei es!" riefen alle, kamen herbei und drückten dem glücklichen Paare die Hand. Nun trat auch der König freudig herzu und gab den beiden seinen Segen.
Bald danach wurde die Hochzeit gefeiert; und der kluge Martin bekam also, der einst ein armer Schustergeselle war, eine Prinzessin zur Frau und wurde am Ende König in einem großen Reiche.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER KRANKE KÖNIG UND SEINE DREI SÖHNE ...
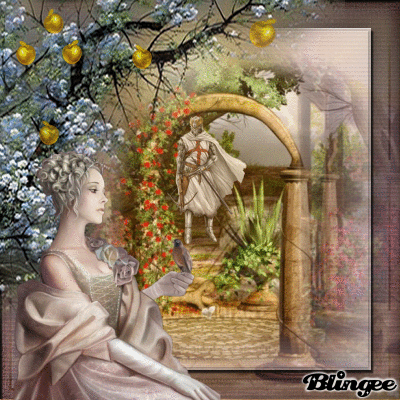
Es war einmal ein König, der litt schon jahrelang an einer so schweren und unheimlichen Krankheit, daß nicht einmal die berühmtesten Ärzte im Reiche ihm helfen konnten. Er aß und trank fast nichts mehr und hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, seine Gesundheit je einmal wieder zu erlangen.
Da hatte er eines Nachts einen sonderbaren Traum: Er sah in einem fremden Land einen großen und herrlichen Garten. In dessen Mitte stand ein Apfelbaum, der über und über mit goldenen Früchten behangen war. Da gelüstete ihn so sehr nach einem der Äpfel, daß er die Hand hob, um sich einen von den Zweigen zu brechen und zu essen. Denn ihm war augenblicks gewiß, daß er durch den Genuß eines solchen Wunderapfels wieder völlig gesund werden würde.
Doch wie er eben verlangend seine Hand nach der Frucht ausstreckte, klopfte der Diener an die Türe und der König erwachte. "Du hast mich im schönsten Traume gestört!" sagte der König. "Aber ich hoffe, daß du mich dadurch zum Leben erweckt hast. Geh und rufe meine drei Söhne!" Als sie kamen, erzählte er ihnen ausführlich seinen Traum und bat sie, jenes Traumland aufzusuchen und ihm aus dem Garten einen der goldenen Äpfel mitzubringen.
Mit Freuden waren alle drei bereit dazu. Nach dem Wunsche des Königs trat zunächst der älteste die Reise an. "Wenn ich heute übers Jahr noch nicht zurück bin, werdet ihr mich wohl nimmer wiedersehen", sagte er und nahm Abschied von seinem kranken Vater und den Brüdern.
Nach einiger Zeit kam er in einen großen Wald. Da begegnete ihm ein alter Mann und bat ihn um eine kleine Gabe. "Ich bin schon drei Tage ohne Essen und habe kein Geld, um mir etwas zu kaufen. Wollt Euch meiner erbarmen, lieber Herr!" bat er. Der Prinz aber wies ihn mit barschen Worten von sich und ritt weiter, immer tiefer in den dunklen Tannenforst hinein. Am Abend traf er plötzlich mitten im Wald ein großes Gasthaus an. Müde und hungrig kehrte er ein, stärkte sich und ging dann früh zu Bett.
Als er aber am anderen Morgen weiter reisen wollte, traten zwei wunderschöne Mädchen zu ihm ins Zimmer und baten ihn mit schönen Blicken und Schmeichelworten, doch noch eine Weile hier zu bleiben und zum Zeitvertreib ein Kartenspiel mit ihnen zu machen. Da vergaß er seinen kranken Vater und die wichtige Reise ganz, blieb bei den Mädchen und spielte und spielte Karten, bis er zuletzt all sein Geld verloren hatte.
Weil er aber einmal wieder zu gewinnen hoffte, gab er seine Sache nicht verloren, sondern machte beim Wirt Schulden. Doch er verspielte auch das entliehene Geld und hatte nun nichts mehr bei sich was er zum Pfande geben konnte. Als ihn aber der Wirt nach Namen und Herkunft fragte, gab er keine Auskunft und verschwieg auch, daß er einer der drei Königssöhne war.
Da ließ ihn der Wirt gefangen nehmen und in den Kerker werfen und sagte: "Zwei Jahre gebe ich dir Frist; wenn du bis dahin deinen Namen nicht genannt und deine Schuld bezahlt hast, so bringe ich dich an den Galgen!"
Nun war ein Jahr um, und der älteste Prinz war nicht zurückgekehrt. Da machte sich der zweite auf den Weg. Auch er kam in den großen dunklen Wald und begegnete dem alten Mann. Als der ihn aber um ein Almosen bat, machte er es wie sein Bruder und wies den Bettler mit unfreundlichen Worten ab. Dann ritt er weiter, bis er an das einsame Waldwirtshaus kam.
Dort stieg auch er ab, übernachtete in der selben Kammer, in der vor einem Jahr sein Bruder geschlafen hatte, und wollte in der Frühe wieder weiter reisen. Als er aber die zwei schönen Mädchen zu Gesicht bekam, dachte er mit keinem Gedanken mehr an seinen kranken Vater und den Liebesdienst, den er ihm erweisen sollte. Er blieb im Wirtshaus sitzen, spielte Tag und Nacht Karten mit den Mädchen, verlor sein ganzes Geld und machte noch viele Schulden dazu.
Da ging es ihm genau so wie seinem Bruder. Er wurde eingesperrt und ins Gefängnis geworfen. Als wieder ein Jahr vergangen und auch der zweite Prinz nicht zurückgekehrt war, wollte der jüngste die Reise in das ferne Land antreten, um dem kranken Vater einen Apfel aus dem Traumgarten zu holen.
Doch seinen jüngsten und liebsten Sohn wollte der König nicht ziehen lassen. Er befürchtete, es möchte ihm ein Unglück zustoßen wie seinen Brüdern; denn er dachte nicht anders, als daß sie ums Leben gekommen seien. Weil ihm aber der Prinz gar keine Ruhe ließ und Tag für Tag seine Bitte wiederholte, so gab der König endlich nach und ließ auch seinen letzten Sohn die weite Reise antreten.
Er schlug die gleiche Straße wie seine beiden älteren Brüder ein, gelangte bald in den großen Wald und traf den alten Bettler zerlumpt und todesmatt unter einer Eiche sitzend an. Als er ihm seine Not klagte und ihn um ein Almosen bat, griff er sogleich voller Mitleid in die Tasche und drückte dem Greis ein Goldstück in die Hand. Darauf unterhielt er sich noch eine Weile freundlich mit ihm, erzählte auch von dem kranken Vater und seinem Traum von den Lebensäpfeln, und daß er, der jüngste Sohn, nun unterwegs sei, den wunderbaren Garten zu suchen.
Der Alte hörte sich alles ruhig an und sagte dann: "Fahre mit Glück! Nur hüte dich, Galgenfleisch zu kaufen!" Der Prinz wußte zwar nicht, was der Greis mit seiner Rede meinte, bedankte sich aber von Herzen und ritt weiter, bis er an das Wirtshaus im Walde kam. Da stand der Wirt unter der Türe und lockte ihn mit schönen Worten, bei ihm und seinen zwei jungen Töchtern einzukehren. Doch er ließ sich nicht dazu verleiten und setzte unbekümmert seinen Weg fort.
Nach langer, langer Zeit kam der Prinz endlich in ein Land, in dem er weder Menschen, noch Dörfer, noch Städte antraf, nur unzählige Vögel und alle Arten Tiere aus Wald, Wiese und Feld umdrängten ihn zutraulich und begleiteten ihn in langem Zuge zu ihrem König - einem uralten weißen Raben, der mitten im Walde auf einer Eiche wohnte. Wie wunderte sich der Prinz, als er den mächtigen Bau betrat und der Rabe ihn mit menschlicher Stimme begrüßte und ihn fragte, wer er sei und was ihn hier her in sein Reich führe.
Da erzählte der Prinz den Traum seines Vaters und fragte, ob dies das Land sei, in dem der Garten mit dem wunderbaren Apfelbaum liege. - "ja", sagte der Rabe, "dies ist das Land mit dem Garten des Lebens. Alles aber, was in ihm lebt, ist verwunschen, und du bist der Glücksprinz, der es aus seiner Verzauberung befreien kann. Brich auch für mich einen Apfel von dem Baume, so wird nicht nur dein kranker Vater wieder gesund werden, sondern auch ich und alle Tiere des Landes werden ihre menschliche Gestalt wieder erhalten." -
"Oh, wie gerne will ich deinen Wunsch erfüllen!" rief da der Prinz voller Freude aus. "Sage mir nur, wie ich dabei zu Werke gehen soll!" - "Geh ohne Furcht in den Garten, der jenseits der goldenen Brücke liegt; schrecke auch nicht davor zurück, das Schloß zu betreten; versäume nur nicht, den Garten zur rechten Stunde wieder zu verlassen!" sprach der Rabe und flog in den höchsten Wipfel der Eiche hinauf.
Der Prinz machte sich sogleich auf den Weg, und die Tiere begleiteten ihn durch den Wald zu dem Garten. Als sie bei der goldenen Brücke angelangt waren, blieben sie zurück und ließen ihn allein weiter gehen. Obwohl zu beiden Seiten der Brücke ein grimmig großer Löwe auf Wache lag, schritt der Prinz ohne Furcht hindurch und betrat den Garten. Was war da für eine Pracht an seltenen Blumen und Blüten aller Art zu schauen!
Doch der Prinz beachtete sie kaum; er ging geradeaus auf den Wunderbaum zu, pflückte zwei der, goldenen Äpfel und barg sie sorgsam in seiner Reisetasche. Als er sich umwandte, stand mit einem Male ein marmelweißes Schloß inmitten des Gartens. Um die Torsäulen ringelten sich aber zwei riesige Schlangen, die mit bösen Blicken und wildem Zischen dem Prinzen den Eintritt wehren wollten.
Er aber trat ohne Bangen in das Schloß und traf in dem großen, goldenen Saal ein Mädchen an, das so hold und schön war, wie ihm in seinem Leben noch keines begegnet war. "O mein Prinz! Mein Erretter!' 'sprach es überglücklich vor Freude. "Wie lange schon warte ich hier auf dich; nun bist du endlich gekommen und wirst mich arme Königstochter und alle, die mit mir verwunschen sind, befreien!"
Und der Prinz, der die schöne Prinzessin auf den ersten Blick lieb gewonnen hatte, küßte sie, steckte ihr seinen Ring an die Hand und verlobte sich mit ihr in der selben Stunde. Plötzlich aber brüllten die beiden Löwen, die die goldene Brücke bewachten, laut auf und die Prinzessin sprach: "Dies ist das Zeichen! Nun mußt du mich und den Garten verlassen.
Beeile dich! Aber sei ohne Sorge, wir werden uns wiedersehen, wenn die Zeit gekommen ist." Da verließ der Prinz das Schloß und den Garten, und kaum war er draußen im Walde angelangt, da wurde die goldene Brücke hoch gezogen und all die Herrlichkeit war wie ein Traum verschwunden.
Die Tiere aber, die ihm den Weg zum Garten mit dem Lebensbaum gewiesen, hatten geduldig auf ihn gewartet und begleiteten ihn nun wieder zu dem Baum des weißen Raben. Der empfing den Prinzen voller Freude und aß sogleich den Apfel, den ihm dieser mitgebracht hatte. Kaum aber war dies geschehen, da war der Rabe in einen König verwandelt, und auch alle die hundert und aber hundert Tiere waren wieder zu Menschen geworden.
Auch die Städte und Dörfer, die versunken waren, stiegen aus der Erde empor, und Straßen und Gärten und alles war wieder so, wie es einst gewesen. Aus allen Fenstern wehten bunte Fahnen, und die Freude und der Jubel wollte kein Ende nehmen. Jeder wünschte den Prinzen zu sehen, um sich bei ihm für die wunderbare Befreiung zu bedanken. Der König hätte ihm gern sein ganzes Königreich gegeben, aber der Prinz hatte nur den einen Wunsch, seinen Vater bald wiederzusehen und ihm mit dem goldenen Lebensapfel seine Gesundheit wieder zu schenken. Deshalb nahm er mit herzlichen Worten Abschied und trat die Heimreise an.
Als er ohne Unterbrechung einen Tag und eine Nacht geritten war, kam er in eine große Stadt. Da sah er zwei schwarze Fahnen vom Turme wehen und fragte einen Mann, was das denn zu bedeuten habe. - "Das kann ich Euch erzählen", antwortete der Mann. "Es ist nun etwas mehr als zwei Jahre her, da haben in einem nahen Wirtshaus zwei fremde Prinzen beim Kartenspiel große Schulden gemacht, die sie bis heute noch nicht bezahlen konnten. Weil sie aber auch in böser Verstocktheit verschweigen, wie sie heißen und woher sie stammen, sollen sie morgen vor Sonnenaufgang gehängt werden." -
"Kann denn niemand sie retten?" fragte der Prinz. - "O doch", entgegnete der Mann; "wenn sich einer findet, der für sie die zweitausend Taler Schulden bezahlt, wird man sie schon frei lassen." Der Prinz hatte gleich geahnt, wer die beiden Gefangenen waren, begab sich auf das Gericht und kaufte seine Brüder los. Ohne ihn aber erkannt zu haben, zogen sie auf seine Bitte mit ihm weiter, der Heimat zu.
Als sie aber eine Weile miteinander gewandert waren, gab sich der Prinz seinen Brüdern zu erkennen und erzählte ihnen, wie er ferne von hier den Garten mit dem wunderbaren Baum gefunden habe, und zeigte ihnen auch den Apfel, den er dem kranken Vater bringen wolle. Das hörten die beiden Brüder mit heimlichem Neid an und faßten böse Gedanken in ihren Herzen. Und als, sie bald darauf an einer tiefen Schlucht vorüberkamen, warfen sie sich hinterrücks auf den Bruder und stießen ihn über den Felsen hinunter. Dann töteten sie sein Pferd, nahmen den Apfel an sich und zogen weiter aufs Schloß ihres Vaters.
Der König freute sich, daß er seine beiden ältesten Söhne wieder hatte, aß den Apfel und war von Stund an gesund. Sie aber belogen ihn, daß sie das Pferd ihres jüngsten Bruders in fremdem Land tot am Wegrand aufgefunden hätten und daß er wohl nicht mehr am Leben sein werde.
Ja, das hätten die beiden Übeltäter gerne wahr gehabt! Aber ihre böse Absicht war vereitelt worden. Der junge Prinz war, als sie ihn über die Felswand gestoßen hatten, im Geäst einer Esche hängen geblieben. Nachdem er sich aber einen Tag lang vergeblich abgemüht hatte, aus dem abgründigen Geklüfte empor zu steigen, hörte er eine Stimme von oben rufen: "Prinz! Seid Ihr es, der da zwischen Leben und Tod über dem Abgrund schwebt?" -
"Ja, ich bin es. Zum Dank dafür, daß ich sie vom Henkerstode los gekauft habe, stießen mich meine neidischen Brüder in die Schlucht. Sagt, wer seid Ihr? Helft mir! Helft!" - "lch bin der Bettler, dem Ihr einst das Goldstück geschenkt habt. Habe ich Euch nicht gesagt, Ihr sollt kein Galgenfleisch kaufen? Weil Ihr es seid, will ich Euch noch einmal helfen." - So wurde der Prinz aus höchster Not gerettet, dankte dem Bettler und beschenkte ihn reichlich; dann wanderte er auf beschwerlichen und schier endlosen Wegen dem väterlichen Schlosse zu.
Inzwischen war fast ein Jahr vergangen, seit er den Apfel aus dem Lebensgarten geholt und die verwunschene Prinzessin im Marmelschlosse geküßt und zu seiner Braut gemacht hatte. Nun hatte sie einen schönen Knaben geboren und sich mit ihm in Begleitung von tausend Rittern auf gemacht, das ferne Königreich und den jungen Prinzen zu suchen.
Drei Monde war sie unterwegs, da leuchteten in der Ferne die Zinnen der Königsburg in der Morgensonne auf. Die Prinzessin befahl, das Heerlager aufzuschlagen; ließ den Weg, der zum Schloß hinauf führte, mit einem kostbaren scharlachroten Teppich belegen und sandte einen Boten zum König mit der Aufforderung, ihr seinen jüngsten Sohn entgegen zu senden, andernfalls werde sie die Burg stürmen und in Schutt und Asche legen lassen.
Was sollte da der alte König in seiner Not tun? - "Woher soll die fremde Prinzessin wissen, welcher der Jüngste von uns ist?" sagte der älteste Sohn. "Laß mich ihr entgegen reiten, Vater!" Was blieb dem König anderes übrig, als ihn ziehen zu lassen? Wie nun aber der Prinz den kostbaren Scharlachteppich liegen sah, wagte er es nicht, das Pferd darauf zu lenken, sondern ritt daneben her. Daran erkannte die Prinzessin, daß es der falsche war, hieß ihn schnellstens umkehren und den richtigen Prinzen zu schicken.
Nun sandte der König ihr seinen zweiten Sohn entgegen. Auch der wagte nicht, auf dem kostbaren Teppich zu reiten, sondern lenkte sein Pferd vorsichtig daran vorbei. Da wurde die Prinzessin zornig und befahl ihm zurück zu reiten und den zu schicken, den sie zu ihrem Empfange gewünscht habe. Erscheine er binnen drei Tagen nicht vor ihr, so werde geschehen, was sie angekündigt habe.
"Was nun tun?" fragte der König verzweifelt. "Mein jüngster Sohn ist tot, und niemand kann ihn mir wiederbringen! Wäre ich doch an seiner Statt gestorben, so müßte ich nun nicht auch noch das Ende meines Hauses erleben". Zwei Tage und zwei Nächte saß er grübelnd und ohne Schlaf zu finden in seinem Stuhle und glaubte an keine Rettung mehr. Am Morgen des dritten Tages war aber auf geheimen Waldpfad der jüngste Prinz auf die väterliche Burg zurück gekehrt.
Obwohl er von seiner langen Reise so müde und matt war, daß seine Füße ihn kaum mehr trugen, zog er doch gleich seine schönsten Kleider an und ritt der Prinzessin entgegen. Und er ritt aufrecht und stolz, so wie es einem echten Königssohne gebührt, mitten auf dem herrlichen Scharlachteppich. .,Er ist es!" rief die Prinzessin aus und eilte ihm entgegen, den Knaben auf dem Arm und wie eine Braut geschmückt. Sie umarmten und küßten sich und weinten vor Glück und Freude.
Er küßte auch den Knaben, strich ihm und dann der Mutter lächelnd übers Haar und sprach: "Nun bist du ja schon meine liebe Frau." Dann traten sie vor den greisen König und der gab ihnen seinen väterlichen Segen. Sie wollten aber nicht mit den Brüdern zusammen im selben Hause leben und kehrten darum in die Heimat der Prinzessin zurück. Sie zogen in das Marmorschloß ein, das mitten im Garten des Lebens stand, bekamen viele gesunde und schöne Kinder und waren glücklich bis an ihr Ende.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER LUSTIGE FERDINAND MIT DEM GOLDHIRSCH ...
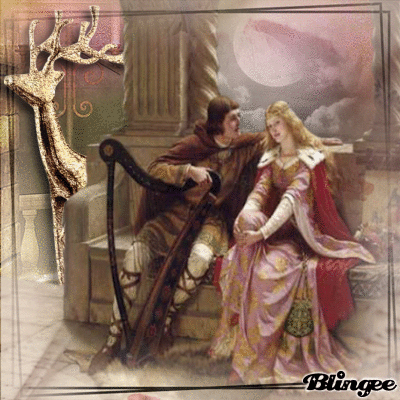
Es war einmal ein Soldat, der war immer lustig und guter Dinge, obwohl er nur wenig zu beißen hatte. Die Groschen und Kreuzer wollten nie lange in seiner Tasche bleiben, so daß oft Schmalhans Koch bei ihm war. Doch ließ er sich das nicht verdrießen und blieb trotzdem immer lustig und frohen Mutes. Darum nannten ihn auch seine Kameraden den lustigen Ferdinand.
Als er nun eines Tages vor der Tür des Königs die Wache hatte, betrachtete er sich einmal so recht das schöne Schloß mit seinen vielen Kostbarkeiten. Und wie er dazuhin noch alle die vornehmen Herren sah, die da aus- und eingingen und dem König zu Diensten waren, da dachte er: "So ein König hat es doch gut! Der hat Geld genug, und für Geld kann man ja alles in der Welt haben. Ach, hätt' ich nur Geld; ich wüßte wohl, was ich täte!" Wie nun dem lustigen Ferdinand diese Gedanken so im Kopf herum gingen, gerade aber niemand da war, dem er sie hätte mitteilen können, nahm er ein Stück Kreide und schrieb an die Tür, die zum Zimmer des Königs führte:
Das Geld bezwingt die ganze Welt.
Als der König später ausging und die Türe abschloß, las er diese Worte und ließ eine strenge Untersuchung anstellen, wer das geschrieben habe. Da gestand es der lustige Ferdinand sogleich ein. Der König ließ ihn zu sich kommen und stellte ihn darüber zur Rede. Der lustige Ferdinand sagte ganz treuherzig: "Das habe ich nur so hingeschrieben, weil ich auf Posten nicht habe sprechen dürfen und doch den Gedanken nicht loswerden konnte."
Weil der König ein guter und gnädiger Herr war, verzieh er ihm; wollte ihm dann aber beweisen, daß er mit seinen Gedanken vom Geld eben doch auf dem Holzweg sei. Doch der lustige Ferdinand wußte den König immer zu widerlegen und sagte endlich sogar: "Herr König, wenn ich nur Geld genug hätte, so wollte ich alles erreichen, es möchte sein, was es auch wollte! Sogar Eure Tochter wollte ich zur Frau bekommen und selbst noch König werden!"
Diese Rede eines gemeinen Soldaten verdroß zwar den König, doch ließ er sich's nicht anmerken und sagte: "Um dich zu widerlegen, will ich eine Wette mit dir eingehen: Du sollst ein ganzes Jahr lang so viel Geld haben, wie du verlangst. Kannst du während dieser Zeit die Liebe meiner Tochter gewinnen - gut, so sollst du sie haben. Will sie dich dann aber nicht, so kostet es dich den Kopf! Jetzt besinne dich wohl!"
Der lustige Ferdinand besann sich aber nicht lange und ging die Wette mit dem König ein. Darauf erhielt er vom König den Schlüssel zur Schatzkammer, ging hin und nahm sich fürs erste so viel Geld, als er nur heimtragen konnte. Nun aß und trank er jeden Tag das Feinste, das überhaupt aufzutreiben war, lud seine Kameraden zu sich ein, fuhr in der Kutsche aus, ging auf Reisen und sah und genoß für das viele Geld alles, was das Herz begehrte. Um die schöne Prinzessin aber kümmerte er sich gar nicht.
Die war unterdessen nicht so vergnügt wie der lustige Ferdinand. Um sie nämlich vor allen unliebsamen Bewerbern zu schützen, hatte der König sie auf eine kleine Insel in der Nähe des Schlosses bringen lassen und den Wächtern streng geboten, ja keinen Mann zu Besuch bei ihr einzulassen. So lebte nun die Prinzessin auf der Insel wie in einem Gefängnis und hatte oft Langeweile.
Eines Tages kam der lustige Ferdinand wieder in die königliche Schatzkammer und füllte seine leeren Taschen mit Gold. Da fragte ihn der König, wie es ihm gehe. "Gut! Recht gut, Herr König!" antwortete er. "Das freut mich", sagte der König. "Vergiß aber die Wette nicht, die du mit mir abgeschlossen hast! Nur noch ein halbes Jahr hast du übrig, um das Herz meiner Tochter zu gewinnen; gelingt dir dies nicht, so kostet es dich unfehlbar das Leben!"
Ferdinand blieb guten Muts, dachte aber bei sich: "Es ist wahr, du mußt dich jetzt wohl nach der Prinzessin umsehen." Er suchte einen Goldschmied auf, der so geschickt war, wie kein anderer Meister auf der ganzen Welt, und sagte zu ihm: "Hört, Meister! Ihr müßt mir einen goldenen Hirsch schmieden! Er muß so groß sein wie ein echter Hirsch, mit großem, zackigem Geweih, im Innern aber muß er hohl sein, so daß sich ein Mann darin verbergen kann!" Das Gold dazu holte Ferdinand aus der Schatzkammer des Königs.
Es dauerte gar nicht lange, da war der Hirsch fertig, und er war so überaus schön geworden, daß man wohl nirgends etwas Herrlicheres sehen konnte. Durch eine geheime Tür, die niemand fand, der sie nicht wußte, kroch der lustige Ferdinand in den Bauch des goldenen Hirsches und nahm zugleich seine Zither mit, die er sehr schön zu spielen verstand. Er hatte dem Goldschmied die Geschichte mit der Wette erzählt und ihm alles entdeckt, was er im Sinne hatte; hatte ihn auch für viel Geld dazu bewogen, daß er den Goldhirsch aufs Schloß brachte und ihn dem König zeigte.
Der konnte sich nicht genug darüber wundern. Und als erst der Goldschmied ein bestimmtes Zeichen gab und darauf im Bauche des Hirsches eine Zither anfing zu spielen, da wußte der König nicht, was er vor Staunen und Entzücken sagen sollte. Auch die Königin war ganz außer sieh vor Freude und bat ihren Gemahl, er solle doch den Hirsch kaufen und ihn der Tochter auf die Insel schicken, daß sie sich damit unterhalten könne.
Der König sagte: "Ja, das' will ich gerne tun", kaufte den Goldhirsch und ließ ihn sogleich der Prinzessin bringen. Die freute sich sehr über das Geschenk, ließ den Hirsch immer und immer wieder die Zither schlagen und konnte sich nicht genug satt hören an seinem Spiel, bis sie endlich müde wurde und einschlief.
Da öffnete der lustige Ferdinand leise die geheime Tür und schlüpfte heraus und besah sich die Prinzessin, die in ihrem Bette lag und ruhig schlief. Sie war so wunderschön, daß er seine Augen nicht von ihr wegzuwenden vermochte und es endlich nicht lassen konnte, ihr einen Kuß auf die Lippen zu drücken. Davon erwachte die Prinzessin und erschrak bis ins Herz hinein, als sie einen Mann vor ihrem Bett stehen sah.
Ferdinand aber sagte ihr sogleich, wer er sei und bat sie inständig, ihn doch nicht zu verraten. Er wolle ihr auch alle Tage vorspielen, so viel und so lange sie es nur zu hören wünsche. Die schöne Prinzessin versprach es ihm endlich, wenn er immer hübsch still in seinem Versteck bleibe. Das wolle er gerne tun, sagte er und verkroch sich alsbald wieder in den Bauch des Hirsches.
Am anderen Morgen konnte die Prinzessin es fast nicht erwarten, bis sie den goldenen Hirsch wieder spielen hörte. Auch der König kam, hörte zu und freute sich, weil seine Tochter so vergnügt war. Ja, sie sagte zu ihrem Vater, sie glaube, daß sie nun gewiß keine Langeweile mehr auf der einsamen Insel haben werde.
Am Abend, als die Prinzessin wieder ganz allein war und zu Nacht aß, machte der lustige Ferdinand leise die Tür auf und fragte: "Prinzessin, ach liebe Prinzessin, darf ich nicht ein wenig herauskommen? Ich habe solchen Hunger! Seit gestern habe ich nichts mehr gegessen und heute habe ich so viel spielen müssen." Da erlaubte ihm die Prinzessin herauszusteigen und mit ihr zu essen.
Und wie sie ihn nun genauer betrachtete und sich mit ihm unterhielt, da gefiel er ihr recht gut und immer besser, so daß sie es gern geschehen ließ, als er sie zuletzt in den Arm nahm und küßte. Inzwischen war es spät geworden und die Prinzessin ging zu Bett. Da klagte ihr der lustige Ferdinand, wie sehr ihn sein Rücken schmerze, weil er im Bauche des Goldhirsches immer krumm liegen müsse und wie erbärmlich er in der letzten Nacht gefroren habe. Da ließ die Prinzessin ihn mit unter ihre Decke schlüpfen, und beide hatten sich dann recht herzlich lieb und versprachen sich, daß sie nie mehr voneinander lassen und immer beisammen bleiben wollten.
Fünf Monate waren nun schon dahin gegangen. Den lustigen Ferdinand sah man nirgends mehr, und der König meinte, er werde wohl wieder auf Reisen sein. Da wurde die Prinzessin krank und von Tag zu Tag blasser und kränker, so daß der König ihr seinen Leibarzt schickte, damit er sie untersuchen und ihr ein Mittel verschreiben solle. Der Doktor aber schüttelte den Kopf, ging zum König und sprach: "Der Prinzessin kann ich nicht helfen. Die wird in ein paar Monaten, wenn sie ein kleines Kind bekommen hat, schon von selbst wieder gesund werden."
Darüber wurde der König so böse, daß er den Arzt ins Gefängnis werfen ließ. Dann schickte er einen anderen Doktor zu der Prinzessin. Der sagte das gleiche wie der erste und wurde ebenfalls dafür eingesperrt. Und so ging es noch einigen anderen, bis endlich der König selbst seine Tochter besuchte und sie fragte, ob sie denn heiraten und bald Hochzeit halten wolle. Die Prinzessin sagte: "Ich habe schon Hochzeit gehalten, lieber Vater. "
Und als der König fragte, wer denn ihr Gemahl sei, antwortete sie: "Der lustige Ferdinand, den du mir ja selbst in dem goldenen Hirsch geschenkt hast." Bei diesen Worten öffnete sie die geheime Tür und ließ ihn heraus steigen. Da ärgerte sich zwar der König zuerst, konnte aber doch sein Wort nicht brechen, weil die Prinzessin erklärte, daß sie nie einen anderen Mann lieben und heiraten möge. Und so hat der lustige Ferdinand, noch ehe das Jahr um war, seine Wette gewonnen; er hielt Hochzeit mit der Prinzessin und ist nach dem Tode ihres Vaters auch noch König geworden.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DER PFIFFIGE SEILERGESELLE ...
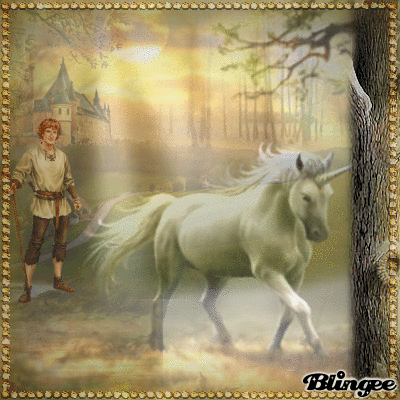
Es war einmal ein Seilergeselle, der ging, wie jeder seines Handwerks, alle Tage den Krebsgang, war aber doch ein ganz gewichstes Bürschlein, das nicht wenig Witz und Gritz unter seinem Kappenschild sitzen hatte. Eines Tages gefiel es ihm bei seinem alten Meister nicht mehr, also schnürte er sein Bündel und machte sich auf in die Fremde.
Als er, ein krummes Hahnenfederchen hinterm Ohr und den Wanderstecken in der Hand, aus der Werkstatt trat, sah er da ein Trumm Hanffaden und einen abgebrochenen Hechelzahn liegen, hob beides auf und steckte es in die Tasche. "Man kann nie wissen, wofür so ein Ding einmal gut sein könnte", dachte er und zog vergnügt in die weite Welt hinaus.
Eines schönen Tages kam er in eine große Stadt, und weil er rechtschaffen müde war, setzte er sich beim Tor auf einen Prellstein in die Sonne, um von der langen Wanderschaft ein wenig auszuruhen. Gerade war er am Einschlafen, da ertönte ein Trompetenstoß, und ein Herold verkündete mit lauter Stimme: "Der König tut allen kund und zu wissen: So einer den Mut aufbringt, das Einhorn und den Riesen zu besiegen, die schon seit langem das Land unsicher machen, der soll meine einzige Tochter zur Frau bekommen und nach meinem Tode König werden !" -
"Ja ja . . wäre gar nicht übel ... so einer den Mut hat", sirmelte der Geselle vor sich hin und war eben wieder daran, in der wohlig warmen Mittagssonne einzunicken. Da surrte ihm ein Mückenschwarm so lästig und frech um die Ohren, daß er auffuhr und im Ärger so tüchtig drein schlug, daß gleich sieben Mücken auf einmal liegen blieben. "Hahaha!" lachte er und schrieb auf seinen Kappenschild:
"Schlag' sieben z'Tod
von hint' und vorn,
auf einen Streich
wohl ohne Zorn!"
Das las der Herold, der eben wieder vorbei geritten kam, und rief: "He du! Du bist der rechte Mann, das Einhorn und den Riesen zu erlegen!", nahm den Seilergesellen hinter sich aufs Pferd und ritt mit ihm davon, dem Königsschlosse zu. Während sie so über Stock und Stein dahin trabten, wollte es dem Gesellen fast ein wenig bange werden. Je näher sie aber dem Schloß kamen und je mehr er an die schöne Prinzessin dachte, desto leichter wurde ihm zumut.
"Sei doch kein Hasenfuß!" sagte er zu sich. "Wer nichts wagt, gewinnt nichts! Habe ich sieben Mücken auf einen Schlag getötet, so werde ich doch auch mit sieben Schlägen ein Einhorn zur Strecke bringen können! Und - der Dümmste ist ja meiner Mutter Sohn auch nie gewesen." Mittlerweile waren sie im Schloßhof angelangt. Der König ließ den Burschen sogleich zu sich rufen, befahl ihm, daß er zuerst gegen das böse Einhorn angehen müsse, und fragte, wann er mit der Arbeit beginnen wolle.
"Auf der Stelle! Bei mir wird nicht lange gefackelt!" antwortete der Seilergeselle und machte sich auf in den Wald, in dem das Ungeheuer hauste. Als er nahe bei dem Ort war, schlug er einen schmalen Seitenpfad ein, um das Einhorn vorsichtig anzuschleichen. Plötzlich aber stürzte es aus dem Dickicht hervor und geradewegs auf ihn zu. Er konnte sich gerade noch hinter eine große Zwittertanne flüchten, und darauf schoß nun das Untier in so gewaltigem Ansturm los, daß es sein langes Horn in die Tannengabel verrannte.
Schnell steckte der Geselle den spitzen stählernen Hechelzahn durch das Horn, so daß das Tier nicht vor- und rückwärts konnte und gefangen war. Fröhlich pfeifend wanderte er darauf in die Stadt zurück, ging ins Schloß und sagte: "Draußen im Wald bei der großen Zwittertanne könnt ihr euer Einhorn abholen!" Da machten alle große Augen, verwunderten sich sehr und sagten untereinander: "Das ist ein Heidenkerl, der ist recht für den Riesen!" Und darum trug ihm der König auch auf, alsbald gegen den Unhold ins Feld zu ziehen.
"Mach es gut!" sagte der König. - "Nur keine Bange! Ich werde diesen großmauligen Tropf schon kleinkriegen!" erwiderte der Geselle und zog dem Riesen entgegen. Als er in den zerklüfteten Eichenwald kam, in dem der Riese seine Höhle hatte, lief er dem Unhold geradewegs in die Hände. Der Riese lag rücklings im Gras, über eine ganze Waldwiese hin. Er hatte geschlafen und war durch das raschelnde Laub aufgeweckt worden. Aber er stand des verächtlichen Seilerleins wegen, das blaß und zitternd an einem Baume lehnte, nicht einmal vom Boden auf.
"Du elendes Wichtlein", sagte er, "fällt dir das Herz schon in die Hosen, he? Du willst es wohl mit mir aufnehmen? Komm her, ich will dich zwischen Daumen und Zeiger zerdrücken wie eine Schnake!" Unterdessen hatte aber unser Geselle sich schnell überlegt, wie er den Unhold am besten unschädlich machen könnte; und was war ihm da für ein guter Einfall gekommen! Er zog das Stück Hanffaden aus der Tasche, hielt es dem Riesen hin und sagte: "Tu nur nicht so großspurig mit deiner Kraft! Was gilt es, du vermagst den Schneller da nicht zu zerreißen!"
Der Riese hatte sich inzwischen sitzlings aufgerichtet und lachte, daß der Wald widerhallte: "Hahaha! Ich dieses elende Flachstricklein da nicht zerreißen können? Gib her!" Der Seilergeselle war aber ein verteufelt pfiffiger Kerl und sagte: "Wart mal, ich will dir erst zeigen, wie man einen Schneller in die Hand nehmen muß, um ihn zerreißen zu können - ich bin nämlich ein Seiler, mußt du wissen."
Er hieß den Riesen im Gras sitzen bleiben und die Knie anziehen, so hoch, bis er fast das Kinn drauflegen könne; nun den Schneller um die Hände wickeln, so, und jetzt die Arme beugen und die Fäuste rechts und links an den Knien außen anstemmen. "Gut so!" sagte der Geselle. "jetzt zieh!" Wie aber der Riese gerade so recht anfangen wollte zu ziehen, steckte ihm der Seiler seinen hagebuchenen Wanderstecken zwischen Ellbogen und Kniekehlen durch und - eh er sich's versah, war der Riese ins Bocksfutter gespannt und lag hilflos am Boden.
"Viel Vergnügen derweil!" rief lachend der Geselle, wanderte seelenruhig in die Stadt und zum Schloß hinauf und sagte: "Holt euch den Lümmel! Er liegt draußen auf der großen Wiese im Wald; ich hab' ihn ins Bocksfutter gespannt."
Die Leute im Schloß und in der Stadt sprachen den ganzen Tag von niemand anderem als dem mutigen Gesellen, der das Land von den beiden Ungeheuern befreit hatte, und manche wünschten ihm auch schon Glück zu der schönen Prinzessin, die er nun bald heiraten werde. Doch sie alle, samt dem Seilergesellen, freuten sich zu früh. Der König nämlich wollte ihm seine Tochter nicht zur Frau geben, weil er nur ein einfacher Seilergeselle und niederen Standes war.
Darum besann er sich hin und her, wie er seinem Versprechen entgehen könnte, und dachte sich zuletzt eine neue schwere Aufgabe aus, von der er glaubte, daß sie der Geselle nicht lösen könne. Er befahl ihm also: "Spanne einem Bauern einen Ochsen, der keinen Schwanz hat, vom Pfluge, ohne daß es der Bauer merkt! Bringst du das zuwege, dann darfst du wiederkommen und wegen der Heirat fragen." Der Geselle besann sich eine Weile, dann war ihm schon ein guter Einfall gekommen. "Ei, das mag ein großes Kunststück sein, Herr König!" sagte er und ging aus dem Schloß und zur Stadt hinaus.
Als er ein Stück weit in den Feldern draußen war, sah er einen Bauern mit einem Ochsengespann am Waldrand ackern. Er schlich sich unbemerkt näher und rief: "O Wunder über Wunder! O Wunder über Wunder!" In währendem Rufen zog er sich aber immer tiefer in den Wald zurück. Der Bauer hinterm Pfluge stutzte bei den Worten, die er da rufen hörte, und dachte bei sich: "Der da drin hat gewiß einen Schatz gefunden! Will doch mal hingehen und sehen!" - und lief der Stimme nach ins Holz.
Derweil sprang der Geselle schnell aus dem Dickicht hervor, spannte einen Ochsen vom Pflug, schnitt ihm den Schwanz ab, steckte ihn dem anderen ins Maul, so daß nur noch das Haarbüschel am Ende heraus sah, und machte sich mit dem schwanzlosen Ochsen davon. Als der Bauer lange genug und umsonst den Wald durchsucht hatte, kam er zurück und sah, was geschehen war. "Oh, oh!" rief er verzweifelt aus. "jetzt hab' ich Wunder über Wunder! Nun hat derweil ein, Ochs den anderen gefressen!"
Als aber der Geselle auch diese dritte Aufgabe gelöst hatte, konnte der König nicht mehr anders, als sein gegebenes Wort halten. Er gab dem Burschen seine schöne, junge Tochter zur Frau und ließ eine Hochzeit zurichten, so prunkvoll, wie man im ganzen Lande noch keine gesehen hatte. Und als er bald darauf starb, wurde der Seilergeselle König, und das ist er heute noch, wenn er nicht gestorben ist.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE REISE ZUM VOGEL GREIF ...
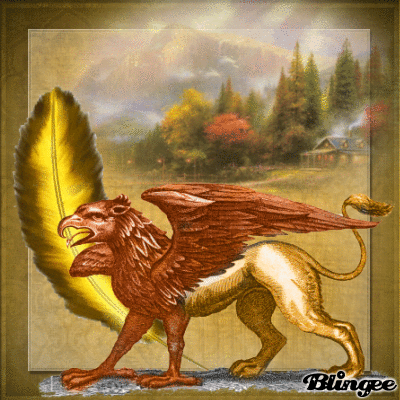
Es war einmal ein reicher Graf, der reiste um sein Leben gerne in der Welt umher. Dabei mußte ihn stets sein Lieblingsdiener begleiten, der ihm schon sieben Jahre treu und fleißig Dienste tat, und den er darum auch von Herzen gern hatte. Einmal aber, als sie wieder fern der Heimat auf Abenteuer aus waren, ließ sich der Diener ein Versehen zuschulden kommen. Darüber geriet der Graf in einen solchen Zorn, daß er den Burschen nicht mehr sehen konnte.
Er schickte ihn heim und gab ihm einen Brief an seine Frau mit. Darin stand, sie solle den Diener, sobald er auf der Burg eintreffe, in den Turm sperren und ihm den Kopf abschlagen lassen. Obwohl der Bursche nicht wußte, was in dem Briefe stand, war ihm doch sehr traurig zumute, weil der Graf plötzlich so böse und ungnädig zu ihm war und ihn nun allein nach Hause schickte. Dies aber dachte er auch bei sich, daß in dem Brief wohl auch nicht viel Gutes stehen werde.
Als er nur noch eine Tagereise vom Schloß des Grafen entfernt war, blieb er in einem Wirtshaus über Nacht. Weil er nun nach dem Abendessen so schweigsam und niedergeschlagen da saß, fragte ihn der Wirt, ob er denn auf einer unlieben Reise unterwegs sei, oder was sonst ihn bedrücke. Da erzählte er ihm die ganze Geschichte, wie sie sich zugetragen, und zeigte ihm auch den Brief des Grafen.
Der Wirt aber war ein pfiffiger Mann und. sagte: "Wenn ich in deinen Schuhen stecken würde, ich gäbe den Brief nicht ab, bevor ich nicht wüßte, was darin steht." Der Bursche, der immer ein treuer Diener gewesen war, wollte anfangs nichts davon hören; zuletzt aber brachte ihn der Wirt doch so weit, daß er alle Bedenken vergaß, den Brief aufbrach und las. Todesblaß ließ er ihn aus der zitternden Hand auf den Tisch fallen.
Da nahm ihn der Wirt und las ihn Wort für Wort. "Hab' ich doch gleich richtig geahnt!" sagte er. "Einen Kopf kürzer will er dich also machen lassen? Wär doch bigott schade um dich! Sei nur ohne Sorge. Hat der Graf so Übles gegen dich im Sinn, so wollen wir ihm auch einen Streich spielen! Laß du jetzt nur mich machen." Darauf holte er Federkiel, Tinte und Papier, ahmte die Handschrift des Grafen aufs Tüpfelchen genau nach und schrieb an die Gräfin, sie solle den treuen Diener am selben Tage noch, an dem er den Brief abgebe, mit ihrer Tochter verheiraten.
Dem Diener schien dieser Plan zwar gefährlich; doch da ihm sein Herr nun schon einmal nach dem Leben trachtete, wollte er ihm auch erst einen rechten Anlaß dazu geben. Wenn es aber gelang, warum sollte er sich dann nicht mit der schönen jungen Gräfin verheiraten? Je mehr er an sie dachte, desto vergnügter wurde er, und am anderen Morgen konnte er nicht früh genug aufbrechen, um zu ihr zu kommen.
Die Gräfin las den Brief und tat sogleich, wie ihr Mann befohlen hatte; denn sie wußte, er war ein strenger Herr und konnte keine Widerrede leiden. Andernfalls hätte sie ihm schon einen ernsten Vorhalt gemacht, daß er doch nicht ihre einzige Tochter einem Diener zur Frau geben dürfe. Die junge Gräfin aber, die den Burschen schon immer gern gemocht hatte, war mit ihres Vaters Wunsch wohl zufrieden und wurde also noch am gleichen Tage des Dieners Frau.
Nach einiger Zeit kam der Graf zurück und erfuhr, was seine Frau angerichtet hatte. Vor Ärger und Zorn hätte er sich am liebsten alle Haare ausgerissen und sein Weib aus dem Hause gejagt oder in den Turm geworfen. Doch die Schrift, die er da in Händen hielt, war so genau nachgeahmt, daß er gestehen mußte: "Fürwahr, die Buchstaben sind so ähnlich, daß sogar ich selber den Brief für echt hätte halten können!" Darum war er milde gegen seine Frau.
Auf den Diener aber, der nun sein Schwiegersohn war, warf er von Stund an einen noch viel größeren Haß und suchte ihn auf irgendeine andere Art aus dem Weg zu räumen. Vor den Leuten und besonders vor seiner Tochter, die sich sehr glücklich fühlte, tat er zwar, als ob er mit der Heirat einverstanden sei; zu seinem Schwiegersohn aber sagte er: "Ich will mit eurer Ehe einverstanden sein, wenn du mir nachträglich noch eine Feder aus dem Schwanz des Vogels Greif verschaffst." -
"Und für mich", sagte die Gräfin, "frage den Vogel Greif, wo mein Trauring geblieben sei; ich finde ihn nicht mehr." Das wolle er gerne tun, antwortete der Schwiegersohn, nahm Abschied von seiner jungen Frau und machte sich auf den Weg. Der Graf sah ihm vom Turmfenster aus nach und freute sich schon im stillen; denn er dachte nicht anders, als der Vogel Greif werde seinen Schwiegersohn zerreißen und auffressen.
Der war nun schon eine gute Wegstrecke gewandert und kam eines Tages auch durch ein Dorf. Die Leute fragten, wohin er wolle, und als er es ihnen sagte, baten sie ihn: "Oh, frage doch auch den Vogel Greif, warum unser Dorfbrunnen gar nicht mehr läuft." - "Das will ich ihn gerne fragen", sagte er und ging weiter. Nachdem er wieder eine weite, weite Strecke gewandert war, kam er an einen breiten Fluß. Über den führte keine Brücke; am Ufer aber stand ein Mann, der mußte seit undenklichen Zeiten jeden, der des Weges kam, hinüber tragen.
Er nahm auch sogleich den Burschen auf die Schulter, trug ihn über den Fluß und fragte ihn dann, wohin er reise. "Zum Vogel Greif!" antwortete er. "Oh, so vergiß doch auch nicht zu fragen, wie lange ich noch hier die Menschen ans andere Ufer tragen muß, und wann ich endlich abgelöst werde." - "Ich will nicht vergessen zu fragen", sagte er und ging weiter.
Unser Wandersmann war schon durch mancher Herren Länder gezogen, als er endlich an eine Hütte kam, in dem ein uraltes Mütterchen wohnte. Das fragte er, ob hier nicht der Vogel Greif wohne. "Ja, der wohnt hier", sagte es. "Er ist aber ausgeflogen, und das ist dein Glück, denn sonst würde er dich gleich in Stücke reißen und auffressen. Darum mach nur, daß du so schnell wie möglich wieder von hier fort kommst!"
Der Bursche ließ sich aber nicht so rasch einschüchtern und erzählte, was er den Vogel Greif alles fragen müsse; berichtete auch, daß der Graf eine von den schönen Schwanzfedern haben wolle und er also nicht unverrichteter Dinge von hier fortgehen dürfe. Da versprach das Mütterchen, ihm beizustehen und ihm zu helfen, versteckte ihn unter dem Bett und sagte: "So, nun rühr dicht nicht und halte die Ohren steif!"
Bald darauf kam der Vogel Greif nach Hause. Kaum hatte er das Zimmer betreten, so rief er: "Ich wittere Menschenfleisch! Belüg mich nicht!" - "Nur gemach!" sagte das Mütterchen. "Es ist freilich ein Mensch hier gewesen; der hätte allerlei zu fragen gehabt, was du ihm aber doch nicht hättest beantworten können." - "Haha! Das wäre!" sagte der Vogel Greif. "Was wollte er denn wissen?" -
"Ach", antwortete das Mütterchen, "eine Frau Gräfin läßt dich fragen, wo ihr Brautring geblieben sei. Sie kann ihn um alle Welt nicht finden und meint, du wüßtest es." - "Da hat sie recht", sagte der Vogel Greif; "ich weiß es auch. Die dumme Frau dürfte nur die Türschwelle aufbrechen lassen, so würde sie den Ring finden! Was hat er sonst noch wissen wollen?" -
"Ja: warum der Dorfbrunnen schon so lange nicht mehr laufe? Aber wie sollst denn du das wissen?" - "Freilich weiß ich es!" sagte der Vogel Greif, "die einfältigen Leute dürften nur den Frosch fangen, der die Quelle verstopft, dann würde der Brunnen gleich wieder laufen." - "Was du nicht alles weißt!" sagte erstaunt das Mütterchen. "Aber das hättest du ihm doch gewiß nicht sagen können, warum der Mann beständig die Leute übers Wasser tragen muß, und wann ihn endlich einmal einer ablösen wird?" -
"Oh, der Narr!" sagte der Vogel Greif. "Er soll doch den ersten besten, den er hinübertragen muß, ins Wasser werfen und sagen: ,Jetzt nimm du meinen Platz ein !" so ist er frei. Hat es weiter nichts gewollt, das Erdenwürmchen?" - "O doch'", sagte das Mütterchen, der Bursche wollte für den Grafen etwas von dir geschenkt haben; aber das war gar zu dumm, ich mag es nicht einmal sagen." -
"Sag es nur!" rief der Vogel Greif; "ich möchte alles wissen." - "Gibst du mir es, wenn ich es dir sage?" fragte das Mütterchen. "Ei, warum nicht? Heraus mit der Sprache!" "Denk dir nur, er wollte eine von deinen Schwanzfedern!" sagte das Mütterchen. Da machte der Vogel Greif zwar ein grimmiges Gesicht; weil er es aber versprochen hatte, so riß er sich eine Feder aus und gab sie dem Mütterchen. Darauf legte er sich nieder und schlief ein.
Am anderen Morgen, sobald der Vogel Greif ausgeflogen war, holte das alte Mütterchen den Burschen unter dem Bett hervor und fragte ihn, ob er alles verstanden, was der Vogel Greif ihr verraten habe? "Natürlich, liebes Mütterchen!" sagte er. "Kein Wort ist mir entgangen!" - "Dann ist es ja gut", sagte das Mütterchen und gab ihm zum Abschied die Feder, die sich der Vogel Greif ausgerupft hatte. Da bedankte sich der Bursche vielmals und trat vergnügt die Rückreise an.
Als er an den Fluß kam, fragte ihn der Mann, was der Vogel Greif gesagt habe. "Trag mich nur erst hinüber", antwortete der Bursche, "dann will ich es dir sagen." Als er am anderen Ufer stand, sagte er: "Den nächsten, den du tragen mußt, den wirf ins Wasser und sprich: ,Jetzt nimm du meinen Platz ein!', dann bist du frei und für alle Zeiten abgelöst." - "Das hätte ich eher wissen sollen", brummte der Alte und tappte wieder durch das Wasser zurück.
Der Bursche aber ging tapfer weiter und kam bald in das Dorf, wo die Bauern schon auf ihn warteten. Er verriet ihnen, was er vom Vogel Greif erfahren und siehe, als sie den Frosch aus dem Brunnen geholt hatten, sprudelte das Wasser wieder so reichlich wie vor dem. Da waren die Leute froh und schenkten ihm dreihundert Gulden für seine Mühe.
Nach vielen Wochen kam er endlich wieder auf der Burg an. "Wo ist mein Trauring?" fragte die Gräfin, die ihm voll Erwartung bis zum Tor entgegen gegangen war. "Unter der Schwelle hier", gab er zur Antwort. Da mußte so gleich ein Zimmermann kommen und die Schwelle aufbrechen; und wahrhaftig - da lag der Ring.
Zum Grafen aber sagte der Bursche: "Der Vogel Greif läßt Euch freundlich grüßen und schickt Euch da eine seiner goldenen Federn. Kämt Ihr selbst aber einmal zu ihm, so wolle er Euch so viele Schätze schenken, daß kein zweiter mehr auf Erden sein solle, der reicher sei als Ihr. " Als der Graf diese Kunde vernommen hatte, wollte er mit seinem Besuch beim Vogel Greif keine einzige Stunde verlieren und trat sogleich die Reise an.
Er kam glücklich bis an das Wasser, über das keine Brücke führte, und der Mann am Ufer fragte ihn, ob er ihn hinübertragen solle. "Ja, das ist mir recht", sagte der Graf "ich habe es eilig, denn ich gehe meinem Glück entgegen, mußt du wissen! Wenn ich wiederkomme, wirst du mich nicht mehr zu tragen brauchen!" -
"Das will ich glauben!" sagte der Mann, nahm den Grafen auf den Rücken, trug ihn bis in die Mitte und - plumps! warf er ihn ins Wasser und sagte: "Jetzt nimm du meinen Platz ein!" Dann machte er, daß er fort kam. Da mußte der Graf nun da bleiben und die Leute durch den Fluß tragen; und wenn ihn keiner abgelöst hat, so tut er es heute noch.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE DREI FRAGEN DES KAISERS ...
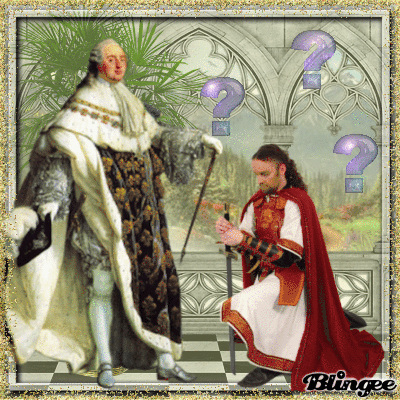
Da lebte einmal vor siebenhundert und mehr Jahren an der Grenze des Reiches ein Markgraf, Wulf geheißen. Wahrhaftig, der machte seinem Namen alle Ehre! Er war ein tückischer und reißender Wolf und darum von seinen Untertanen, den armen Bauern, Hirten und Holzhauern, ebenso sehr gehaßt wie gefürchtet. Wie der die Leute schindete und plagte, das war nicht an den Himmel zu malen.
Er trieb den Zehnten mit der Reitpeitsche ein und zwang auch noch die ältesten Greise ihm beim Wall- und Burgenbau zu fronen. Am meisten Elend geschah aber den Bauern durch die Hirsche und Wildsauen, die der Graf in den weiten und tiefen Wäldern hegte und auf die er dann mit seinem wilden Gefolge gerade in der Erntezeit wochenlang Jagden und Hatzen veranstaltete.
"Was gehen mich die Bauern und ihre Kornfelder an!" sagte er verächtlich. "Hussa! Mir nach!", gab seinem Roß die Sporen und jagte mit der kläffenden Meute quer durch die reifen Ährenfelder. "Beschweren wollt ihr euch, ihr Mistbuben? Paßt auf, ich werd' euch beschweren, aber mit Quadersteinen und Maltersäcken! Klage führen wollt ihr vor dem Kaiser? Was geht mich der Kaiser an! Ich bin euer Herr, niemand sonst!"
Nun war dies nicht das erste Mal, daß das Volk so laut und vernehmlich gegen den Markgrafen sich stellte, daß das Murren bis zu den Ohren des Kaisers hinauf drang. Er hatte lange dazu geschwiegen. Nun ihm aber außerdem noch berichtet worden war, daß der Graf seine Gebote mißachte und seinen Namen mit wenig Ehrfurcht im Munde führe, gedachte er ihm eine Lehre zu geben.
Er sandte einen Boten in die Grenzmark und lud mit einem freundlichen Schreiben den Grafen auf heute über drei Tage zu sich aufs Schloß. Der Markgraf kam zur vorgeschriebenen Zeit an und wurde so gleich in das kaiserliche Gemach geführt. "Wie geht es Euch, Graf?" hub der Kaiser zu sprechen an. - "Gut, recht gut!" antwortete der. - "Ihr habt also gar keine Sorgen und Beschwerden?" fragte der Kaiser weiter. - "Ich weiß nicht, worüber ich klagen sollte, habe aber auch nichts zu wünschen übrig", entgegnete der Graf, und aus dem Ton seiner Stimme war der Ärger über diese sonderliche Fragerei des Kaisers herauszuhören.
"Aber Eure Bauern wissen, worüber sie zu klagen haben und ich, Graf Wulf, habe zu wünschen übrig!" sprach da der Kaiser strenge, und seine Augen funkelten. "Ich will Buch Sorgen und Beschwerden verschaffen, mehr als Euch lieb ist! Dessen seid gewiß! - Ich lege Euch drei Fragen vor. Hört gut zu.
Erstlich: Was ist der Kaiser wert? Zum anderen: Was ist der Bauer wert? Zum dritten: Wie weit sind Glück und Unglück voneinander? Gebt Ihr mir heute über einen Monat auf meine drei Fragen nicht die richtige Antwort, so seid Ihr Eurer Grafschaft und Eures ritterlichen Namens verlustig und könnt gehen!"
Das war der langsamste und traurigste Ritt, den der Markgraf je in seinem Leben getan hatte. Er brauchte die doppelte Zeit zu diesem Heimweg und sah und hörte doch nichts von dem sonnigen, bunten Herbsttage mit all seinem jubilieren und Vogelsingen. Er ritt tief in grauen Gedanken, und als er endlich heimkam, saß er die ganze Nacht bis an den Morgen und sann und zerbrach sich den Kopf darüber, welches wohl die richtigen Antworten auf die drei Fragen des Kaisers wären.
Doch er fand sie nicht und fand sie auch nicht am zweiten oder am dritten Tage; er hatte sie auch noch nicht gefunden, als der Mond am Himmel schon über das zweite Viertel hinaus gewachsen war. - Wie dumm und vorschnell hatte er doch dem Kaiser geantwortet! Nun wußte er, worüber klagen, und hatte Tage und Wochen hindurch nur den einen Wunsch übrig, daß er doch die Antworten auf die drei Fragen finden möge; denn von ihnen hing sein ganzes ferneres Leben ab.
Er studierte dicke und gelehrte Bücher, doch sie konnten ihm die Rätsel nicht lösen. Er fragte seine Freunde und Bekannte, Doktoren, Gelehrte und Professoren; aber sie wußten alle keinen Rat. Die Bauern und einfachen Leute seines Landes, die er so oft hart geplagt und in größter Bedrängnis ohne Hilfe gelassen hatte, die gönnten ihm nun seine eigene Not und sahen ihn mit Freuden Trübsal blasen.
Allmählich nahte der Tag, an dem er vor dem Kaiser erscheinen mußte, und dem Grafen wurde bange. Nach einer schlaflosen Nacht verließ er am letzten Morgen verzweifelt die Burg und machte sich auf den Weg in die Kaiserstadt.
Da traf er auf den Feldern vor dem Ort draußen einen Schafhirten mit seiner Herde. Der merkte an dem finsteren Gesicht des Grafen, daß seinem Herrn nicht wohl zumute sei und fragte ihn nach der Ursache. - "Ach, mein lieber Stöffel", sagte der Graf traurig, "ich bin die längste Zeit dein gräflicher Herr gewesen." Der Markgraf schilderte dem Schäfer seine Not und legte ihm die drei Fragen des Kaisers vor: Was ist der Kaiser wert? Was ist der Bauer wert? Wie weit sind Glück und Unglück voneinander?
"Mhm" - nickte der Stöffel, runzelte die Stirne und besann sich eine Weile. Dann sagte er - denn er war ein pfiffiger Kerl -: "Ich glaub', ich hab's, gnädiger Herr! Leiht mir Euer gräfliches Gewand und hütet derweil in meinem Mantel meine Schafe. Wann es anfängt zu dunkeln will ich für Euch zum Kaiser gehen und ihm die drei Fragen aufs beste beantworten." Damit war der Graf sogleich einverstanden. Sie wechselten ihre Kleider, und der Schäfer machte sich auf den Weg.
Zur fest gesetzten Stunde trat der Schafhirt, als Graf verkleidet, vor den Kaiser. Der saß in seinem goldenen Thronsessel und sprach: "Nun, habt Ihr die richtigen Antworten auf meine drei Fragen gefunden?" - "jawohl, allergnädigster Kaiser und Herr", antwortete der Schäfer. "Ei, so schießt los!" -
"Zum ersten", begann der Schäfer, "ist der Kaiser wert, daß man seine Gebote halte und ihm in Ehrfurcht und Treue diene. Zum anderen ist der Bauer wert, daß man seine Arbeit achte und den Segen seiner Felder dankbar schaue, hüte und schone. Und zum dritten sind Glück und Unglück nur einen Tag voneinander." -
"Wahr habt Ihr gesprochen, was die beiden ersten Fragen betrifft; wie aber kommt Ihr zu Eurer dritten Antwort?" fragte der Kaiser. - "Meine dritte Antwort, hoch edler Herr und Kaiser, darum: Gestern noch bin ich ein Schafhirt gewesen, heute aber ein Graf." - Der Kaiser verstand diese Worte gleich richtig zu deuten, erhob sich von seinem Thron und sah mit einem festen Blick dem Schäfer in die Augen.
"So sei denn und bleibe ein Graf!" sprach der Kaiser, legte ihm sein Schwert auf die Schulter und machte ihn zum Herrn über die Grafschaft, in der er bis zu diesem Tage einer der Geringsten gewesen war.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE DREI SCHWÄNE ...
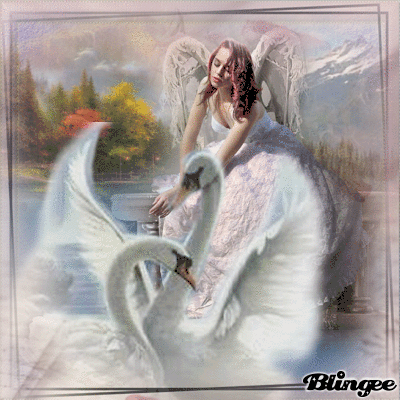
Einem Jäger war ein Jahr nach der Hochzeit seine junge Frau gestorben, und darüber war er nun sehr betrübt. Wenn er so einsam durch Stube, Kammer und Küche ging, meinte er immer, daß ihm seine liebe Frau begegnen müßte, und weil er sie auf diese Weise Tag und Nacht nicht mehr aus seinen Gedanken verlor, hielt er es im Hause nicht mehr aus und streifte oft tagelang draußen im Walde umher. Er wußte wohl, daß er nicht allein bleiben konnte, sondern wieder heiraten mußte; aber er sorgte sich ab und zweifelte daran, ob er noch einmal eine Frau finden werde, die er ebenso lieb haben könne wie seine erste.
Als er eines Tages wieder so in Gedanken dahin ging und immer tiefer in den dunklen Wald hinein geriet, kam er endlich zu einer kleinen, Stroh gedeckten Hütte. Er trat ein und fand darin einen alten Mann, der über ein Buch gebeugt am Tische saß und las. Der Alte begrüßte ihn freundlich und fragte, was ihn hierher in seine Waldhütte führe. Da klagte ihm der Jäger sein Leid: daß er seine Frau verloren habe und nun so einsam lebe und nicht wisse, ob er noch einmal glücklich sein werde.
"Aus dieser Not wird dir wohl zu helfen sein", sagte der Greis. "Über eine kleine Weile werden drei weiße Schwäne geflogen kommen und sich in der Nähe der Hütte niederlassen. Betrachte sie dir genau! Sie werden dann zum Weiher fliegen und, ehe sie ins Wasser gehen, ihre Federkleider ausziehen und ans Ufer legen. Sobald sie draußen auf dem See schwimmen, mußt du dich heimlich heran machen und unbemerkt eines der Schwanenkleider nehmen und damit hierher kommen.
Kaum hatte der Alte dies gesagt, kamen drei schneeweiße Schwäne daher gerauscht, ruhten eine Weile aus und flogen dann weiter zu dem benachbarten Weiher. Als sie aber ihre Federkleider abgelegt hatten, waren sie in drei wunderschöne Jungfrauen verwandelt, stiegen ins Wasser und schwammen weit hinaus in den See. Da schlich der Jäger hin, nahm heimlich das Kleid des einen Schwans und brachte es dem Alten in die Hütte.
Unterdessen waren die drei Schwanenjungfrauen wieder ans Ufer gestiegen. Aber nur noch zwei fanden ihre Federgewänder und konnten sich wieder in Schwäne zurück verwandeln; die dritte aber mußte zur Waldhütte und dem Jäger, der ihr Kleid an sich genommen hatte, in sein Haus folgen. Dort gefiel es ihr recht wohl, sie blieb bei ihm und wurde bald seine liebe Frau.
Ehe der Jäger aber damals von dem alten Mann in der Waldhütte Abschied nahm, hatte der ihn gemahnt, das Schwanenkleid gut zu verstecken. "Das wird mein erstes sein, wenn wir nach Hause kommen, und ich will es so gut verwahren, daß keines Menschen Auge es entdecken wird!" hatte der Jäger geantwortet.
Nun lebte er schon viele Jahre lang froh und glücklich mit seiner Frau und den drei Kindern, die sie ihm schenkte. Eines Morgens aber, als er wie immer in den Wald ging, hatte er unbedachterweise den Schlüssel in der Truhe stecken lassen, darin das Schwanenkleid verborgen lag. Dort fand es sein Weib, das schon oft danach gesucht hatte, gedachte der Zeit mit den Schwestern, zog das Gefieder an und flog als Schwan davon, weit fort über den großen Wald.
Als der Mann am Abend heimkam, war seine Frau verschwunden. Er mochte suchen und rufen, solange er wollte, sie war nirgends aufzufinden, und auch die Kinder wußten nicht, wohin ihre Mutter gegangen war.
Da begab sich der Jäger wieder in den fernen Wald zu dem alten Mann und klagte ihm sein Unglück. "Du hast das Schwanenkleid nicht gut verwahrt", sagte der Greis; "sie hat es gefunden und ist damit fort geflogen." "Ach!" fragte der Jäger traurig, "ist es denn gar nicht mehr möglich, daß ich sie wieder bekomme?" - "Möglich ist es wohl", sprach da der Alte, "aber jetzt ist es gefährlich, sie zu erlangen; es kann dir leicht das Leben kosten!" - "Was gilt mir mein Leben ohne meine liebe Frau!" sagte der Jäger. -
"Gut", sprach darauf der Greis, "so will ich dir meine Hilfe nicht versagen: du mußt zuerst versuchen, in das Schloß zu gelangen, in dem deine Frau jetzt wohnt. Das wird am besten so gehen: Sie hat im Stalle ein paar Esel, die jeden Tag in der Mühle im Tal drunten Mehl holen. Geh also zu dem Müller und bitte ihn, dich in einen Mehlsack zu stecken und den dann einem der Esel aufzuladen. Bist du einmal im Schloß, so ist das Gröbste gewonnen; das Weitere wirst du dann schon von deiner Frau erfahren."
Der Jäger dankte dem alten Mann von Herzen und begab sich darauf in die Mühle. Für ein gutes Trinkgeld steckte ihn der Müller gern in einen Mehlsack und so gelangte er nun auf dem Rücken eines Esels wohl behalten in den Burghof hinauf. Dort stellte der Knecht den Sack in eine Ecke nahe beim Eingang zum Schloßgebäude. Als es dämmerte und im Hof immer ruhiger wurde, dachte der Jäger, er werde nun unbemerkt aus dem Sack schlüpfen können.
Kroch also leise und vorsichtig daraus hervor und - seiner Frau geradeswegs vor die Füße. Sie hatte den großen Sack von ihrem Fenster aus gesehen und wollte eben nachschauen, was Besonderes darin war. Wie freute sie sich da, als sie so unerwartet ihren Mann wiedersah! Und auch der Jäger war überglücklich, schloß sie in die Arme und küßte sie. "Liebe Frau", bat er, "komm wieder zurück zu mir und deinen Kindern!" -
"Wie gerne wollte ich das!" sagte sie. "Aber es wird nicht leicht sein. Ehe wir glücklich miteinander leben können, mußt du die drei Drachen dieses Schlosses besiegen. Drei Tage hintereinander werden sie dir in immer wieder anderen Gestalten entgegentreten und dich quälen und bedrohen. Sprichst du nur ein einziges Wort, so werden sie dich umbringen! Wenn du aber aushältst ohne einen Laut von dir zu geben, so können sie dir nichts anhaben, und ich werde frei und ganz dein eigen sein." -
"Sei ohne Sorge, liebe Frau!" sagte da der Jäger voller Freude und Zuversicht, "die Liebe zu dir wird mich so stark machen, daß mir selbst die bösen Drachen nichts anhaben können!"
Am ersten Tag krochen drei große Schlangen auf den Jäger zu und wanden sich ihm um Beine und Leib, so daß er sich nicht mehr rühren konnte. Sie zischten ihn mit böse funkelnden Augen an und drohten ihn mit ihren giftigen Zähnen zu beißen. Weil er sich aber nicht fürchtete und alles, ohne einen Laut von sich zu geben, ertrug, hatten sie keine Macht über ihn, ließen von ihm ab und verschwanden.
Am anderen Tag hüpften drei riesige Kröten gegen ihn an und bespien ihn mit feurigen Kugeln. Obwohl diese Pein schier nicht zum Aushalten war, nahm er doch seine Kraft bis aufs letzte zusammen und verbiß schweigend alle Schmerzen. Da mußten endlich auch die Kröten aufhören, ihn zu quälen, und machten sich davon.
Am dritten Tag aber stürzten sich drei ungeheure, beflügelte Drachen auf den Jäger und nahmen ihn frei in ihre weit aufgesperrten Rachen. Da wurde ihm heiß und bang, und er meinte, das Grausen und Quälen nicht länger ertragen zu können und laut hinausschreien zu müssen. Doch aus Liebe zu seiner Frau ertrug er es doch. Und als die dritte Probezeit um war, standen plötzlich an Stelle der drei Drachen drei schöne Frauen vor ihm.
Das waren die drei verwunschenen Schwanenjungfrauen, die er jetzt alle miteinander befreit hatte. Nun war der Jäger froh, daß er seine Frau wieder hatte, und auch sie war glücklich und weinte vor Freude, als sie ihre drei lieben Kinder wieder sah. Sie blieben nun auf dem Schloß, behielten auch die beiden Schwestern bei sich und lebten in Frieden und Freude bis an ihr Ende.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE GERAUBTE KÖNIGSTOCHTER ...
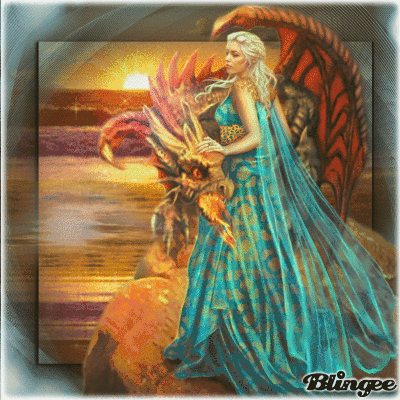
Es war einmal ein reicher und mächtiger König. Der hatte eine einzige Tochter und die war so schön, daß selbst die zarteste Rose, der weiße Schnee und der blaue Himmel vor ihrer Schönheit verblaßten. Wenn sie aus dem Schlosse in den Garten heraus trat, dufteten alle Blumen lieblicher, und die Vögel sangen ihr zu Ehren wie aus goldenen Kehlen. Eines Tages aber, als die Prinzessin bei der Quelle im Park saß und mit ihrem goldenen Balle spielte, brach plötzlich ein Drache aus dem Walde hervor, faßte die Jungfrau mit seinen Krallen und entführte sie weit übers Meer in seine Höhle.
Nun hielt er sie schon fünf Jahre dort gefangen, und hundertmal schon hatte er sie gefragt, ob sie seine Frau werden wolle. Doch ihr graute davor, wie sehr er sie auch bat und sich um sie bemühte. Neben vielen anderen Kostbarkeiten, mit denen er ihr Herz zu gewinnen suchte, schenkte er ihr auch drei prachtvolle Kleider - die herrlichsten, die es auf der Welt gab: auf dem einen war die Sonne abgebildet, auf dem anderen der Mond, auf dem dritten die Sterne. Aber auch damit ließ sie sich nicht verlocken, das Weib des Drachen zu werden.
Eines Tages, es waren gerade sieben Jahre um, verirrte sich ein wandernder Schneidergeselle in diese Gegend und war sehr erstaunt, als er die schöne Frau ganz allein in der Drachenhöhle antraf. Er fragte, ob sie sich auch verirrt habe wie er. Da schüttelte sie traurig den Kopf und erzählte ihm, wer sie sei und wie sie hierher in diese einsame, düstere Felsenwildnis gekommen sei. - "O wär' ich doch aus den Klauen des bösen Drachen und wieder daheim auf dem väterlichen Schlosse!" klagte die Prinzessin. -
"Wir wollen miteinander fliehen und deine Heimat suchen, und ich will dich beschützen bei Tag und bei Nacht gegen alle Not und Gefahr, die dich bedrohen könnte", sagte der Schneidergeselle. Darüber war die Königstochter voller Freude und versprach ihm, seine Frau zu werden wenn er sie glücklich wieder in ihres Vaters Schloß zurückbringe. Nun paßten sie auf, zu welcher Zeit der Drache am längsten ausblieb, und als sie das herausgefunden hatten, flohen sie eines Abends miteinander in aller Heimlichkeit.
Der Schneider hatte die drei schönen Kleider der Prinzessin in seinen Ranzen gesteckt, und so wanderten sie nun eilig dahin, bis sie sicher waren, daß der Drache sie nicht mehr einholen werde. Jetzt endlich gönnten sie sich Ruhe, legten sich im Walde nieder und schliefen ein. Ihre Müdigkeit war so groß, daß sie erst am Morgen des übernächsten Tages wieder erwachten; nun aber schritten sie rüstig aus und gelangten bald darauf an den Strand des Meeres. Dort lag gerade ein kleines Schiff vor Anker; das hatte allerhand Waren geladen, die es nach jenem Lande bringen wollte, in dem der Vater der Prinzessin König war.
Aber als das Schiff eine Tagereise weit draußen auf dem Meere schwamm, erhob sich ein so gewaltiger Sturm, daß es gegen eine Felseninsel getrieben wurde und zerschellte. Nur wenige Menschen, darunter auch die Prinzessin, konnten in einem Boot gerettet werden, und als am anderen Morgen ein fremdes Schiff vorüber fuhr, nahm es die Verunglückten auf und brachte sie wohl behalten in den sicheren Hafen. Die Königstochter konnte sich aber über ihre Rettung doch nicht freuen, war vielmehr betrübt und traurig in ihrem Herzen; denn sie dachte nicht anders, als daß der gute Geselle im Meer ertrunken sei.
Doch auch er war mit knapper Not mit dem Leben davon gekommen. Er hatte sich an den Balkentrümmern des gekenterten Schiffes fest gehalten, war tagelang von den wilden Wogen umher getrieben und endlich völlig ermattet an ein fremdes Ufer gespült worden. Ein alter Fischer nahm ihn in seiner Hütte auf, gab ihm zu essen und beherbergte ihn eine Woche lang. Dann wies er ihm den Weg in die große Stadt, die eine Tagesreise entfernt am Strome lag.
Wie er nun dort so durch die Straßen ging, sah er vor einem Hause das Zunftschild eines Schneiders hangen. Da bekam er plötzlich wieder Lust zu seinem Handwerk, fragte bei dem Meister um Arbeit nach und wurde gleich als Geselle eingestellt. Kaum war er ein paar Wochen hier, da hörte er eines Feierabends einen Herold in den Straßen ausrufen, daß der König demjenigen zehntausend Gulden bezahlen werde, der seiner Tochter binnen drei Monaten drei Kleider zu liefern vermöge, auf denen Sonne, Mond und Sterne sich spiegelten.
Da fiel dem Schneidergesellen ein, daß er ja noch die drei Kleider der Prinzessin in seinem Ranzen habe und mit ihnen den Beutel voll Gold werde verdienen können. - "Doch ach", dachte er im stillen bei sich, "nun wird eine andere die drei kostbaren Kleider tragen. Mag sie gleich auch eine Königstochter sein, so ist sie doch nicht die aller Schönste und liebste, die nun schon lange auf dem kühlen Meeresgrunde ruht."
Ging aber doch zu seinem Meister und sagte, er könne die drei Kleider für die Tochter des Königs machen. Darüber war der Meister sehr erfreut, meldete dem königlichen Kanzler, daß er mit seinem Gesellen die Kleider anfertigen wolle und erhielt gleich tausend Gulden im voraus. Die gab er dem Gesellen, damit er sich alles kaufen könne, was er nötig habe. "Ja", sagte der, "Geld ist dazu schon nötig und nicht wenig!" und nahm die tausend Gulden mit Dank an.
Weil ja aber die Kleider schon fertig waren, konnte er die Goldvögel fliegen lassen, wie und wohin es ihn beliebte, ging also ins Wirtshaus, aß und trank mit seinen Freunden nach Herzenslust und fuhr zu jeder Tages- und Nachtzeit in einer vornehmen Kutsche in der Gegend umher. Als der erste Monat beinahe vergangen und weit und breit noch nichts von einem Kleide zu sehen war, wurde dem Meister Angst und bange. Er stellte darum den Gesellen zur Rede und sagte:
"Übermorgen soll das erste Kleid fertig sein, und du hast noch keine Nadel eingefädelt! Weißt du, daß es uns den Kopf kostet, wenn das Kleid nicht rechtzeitig abgeliefert wird?" - Der aber gab zur Antwort: "Ich kann nur bei Nacht, wenn ich Wein getrunken habe, an dem Kleid arbeiten, und darum muß ich den Tag über ins Wirtshaus gehen. Und in der Kutsche fahre ich nicht zum Vergnügen, sondern um Sonne, Mond und Sterne zu betrachten, damit ich sie schön und Naturgetreu widergeben kann. So ist das, Meister! - und dreinreden lasse ich mir nicht! Basta !"
Am anderen Morgen aber übergab er dem Meister das erste Kleid, auf dem die Sonne dargestellt war. Der bewunderte und lobte die schöne Arbeit und trug sie eigenhändig ins Schloß hinauf. Als die Prinzessin das Gewand sah, erkannte sie im Augenblick das Kleid, das der Drache ihr einst geschenkt hatte, und bat den Meister, ihr auch das zweite bald abzuliefern. - Darauf erhielt er vom Schatzkanzler wieder tausend Gulden ausbezahlt, als Vorschuß für das zweite Kleid. Der Meister gab das Geld dem Gesellen und der machte es kein Haar anders als das erstemal, - er verjubelte es bis auf den letzten Groschen.
Der Monat war wieder gerade zu Ende, als er endlich dem Meister das zweite Kleid übergab, das wie der Mond schimmerte. Diesmal freute sich die Prinzessin noch mehr, nahm den Meister bei Seite und fragte ihn: "Habt Ihr selber dieses Kleid gearbeitet?" Da wurde er unsicher, wich ihrem Blick aus, setzte zum Sprechen an und konnte doch die richtigen Worte nicht finden. - "Redet die Wahrheit, Meister! Denn sie wird mir, der Tochter des Königs, doch nicht verborgen bleiben!" fuhr sie fort.
Und da gestand er ihr, daß er vor einem Vierteljahr einen wandernden Gesellen bei sich aufgenommen habe; der habe die beiden Kleider angefertigt, ganz allein und ohne daß er ihm dabei hätte zusehen können. Da ließ die Prinzessin ihm zweitausend Gulden ausbezahlen, tausend für ihn und tausend für den Gesellen, und verlangte, daß das letzte Kleid der Geselle selber aufs Schloß bringen solle.
Der Monat ging wieder dahin mit Trinkgelagen, Festen und Spazierfahrten, und am letzten Tag machte sich der Schneidergeselle auf den Weg zum Schloß und überbrachte der Königstochter das Sternenkleid. Kaum hatte er einen Schritt über die Schwelle ihres Gemachs getan, so hatte die Prinzessin ihn auch schon erkannt, fiel ihm um den Hals und küßte ihn und weinte vor Glück und Wiedersehensfreude.
Sie führte ihn zu ihrem greisen Vater, erzählte ihm, wie er sie einst aus der Höhle des Drachen befreit und wie sie einander auf dem wilden Meere verloren und längst für tot gehalten hätten. Nun aber hatten sie sich wiedergefunden, hielten Hochzeit und wurden nach dem Tode des alten Vaters König und Königin über das ganze, große Reich.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE GUTE GONDA ...

Es war einmal eine Witfrau, die hatte drei Söhne, Kasper, Melcher und Baltes mit Namen. Die Mutter war froh, als ihre Burschen nacheinander aus der Schule gekommen waren und nun bald anfangen konnten, etwas zu verdienen. Weil aber der Vater oftmals gesagt hatte, daß Handwerk einen goldenen Boden habe, so sollte jeder der drei Söhne ein nützliches Handwerk lernen und danach auf Wanderschaft gehen. Da wurde der älteste ein Weber, der zweite ein Schuhmacher, der dritte ein Sattler.
Bald war es so weit, daß Kasper als Handwerksgeselle seine Reise in die Welt hinaus antreten konnte. Die besorgte Mutter packte ihm in sein Felleisen alles, was er nötig brauchte: Handwerkszeug, Hemden und Strümpfe, dazu noch eine Joppe und ein Paar Schuhe für den Sonntag. Den übrigen Platz füllte sie ihm mit selbst gebackenen Küchlein aus, denn so war es damals in dem Ort Sitte. - "Und nun leb' wohl, mein Junge", sagte sie, "bleibe fleißig und ehrlich, habe Anstand gegen jedermann, und wenn dir ein Armer begegnet, so teile mit ihm die Küchlein, die ich dir ins Felleisen gesteckt habe." - Darauf nahm der älteste von der Mutter Abschied.
Nachdem er einige Tage gewandert war, kam er in einen großen Wald. Da begegnete ihm eine alte Frau und bat ihn um etwas zu essen. Er aber sagte unwillig: " Scher dich fort! Was ich habe, das brauche ich selber!" und wollte seines Weges gehen. Doch er konnte keinen Schritt mehr weiter vorwärts tun; er mochte sich anstrengen, so sehr er wollte. Ratlos sah er sich nach der Frau um; aber die war verschwunden. Es war die Waldfrau gewesen, die da dem Webergesellen auf seinem Weg ins Glück erschienen war und ihn für seine unfreundlichen Worte mit ihrem Zauber gebannt hatte, so daß er sofort nach Hause umkehren mußte.
Rascher als man dachte, kam die Zeit heran, da der zweite Sohn ausgelernt hatte und seine Wanderschaft antreten sollte. Die Mutter packte auch ihm alles Nötige in sein Felleisen, stopfte den übrigen Platz mit Küchlein aus und sprach: "Nun, Melcher, will ich doch sehen, wie weit du kommen wirst. Sei ein rechter Kerl und zu allen Leuten gefällig und vergiß nicht, von deinen Küchlein ,herzugeben, wenn dich einer um etwas zu essen bittet. " Da nahm der zweite Abschied und wanderte dieselbe Straße, die das Jahr zuvor sein älterer Bruder gezogen war.
Nach einigen Tagen kam auch er in den riesengroßen Wald und begegnete der Waldfrau. In der Gestalt des alten Weibleins trat es zitternd und am Stocke humpelnd zu ihm heran und bat ihn um ein Stück Brot. Er aber gab hart und finster zur Antwort: "Ich habe kein Brot! Ich habe nur Küchlein und die esse ich selber gern!", und wollte weitergehen. Im nächsten Augenblick traf auch ihn der Zauberspruch der Waldfrau, so daß er keinen Schritt mehr vorwärts tun konnte und zu seiner Mutter zurückkehren mußte. Weder Kasper noch Meicher hatten aber zu Hause ein Wort darüber fallen lassen, warum sie schon nach wenigen Tagen so mißmutig und gedrückt heimgekommen waren.
Als wieder ein Jahr um war und die Mutter auch ihren jüngsten Sohn auf Wanderschaft gehen lassen sollte, da weinte sie und sagte: "Ach, mein lieber, kleiner Baltes, ich lasse dich mit einer großen Sorge im Herzen ziehen. Wenn es dir nur nicht ebenso geht wie deinen Brüdern! Ich habe dir alles, was du in der Fremde brauchst, in dein Felleisen geschnürt; achte immer gut darauf. Auch von den Küchlein, die du so magst, habe ich dir zugesteckt. Bleibe treu und gut und laß keinen, der in Not ist, dich vergebens um eine Gabe bitten." Darauf trat der Jüngste wohlgemut seine Wanderschaft an.
Nach etlichen Tagen kam er in den Wald, wo ihm die alte Frau, müde und schwach auf ihren Wurzelstock gebeugt, über den Weg humpelte und ihn um etwas zu essen bat. Sogleich nahm er sein Felleisen vom Rücken, machte es auf und schüttete ihr alle Küchlein, die er noch hatte, in den Schoß. Da sah ihn die' Waldfrau' freundlich an und sagte: "Weil du so gut gegen mich warst, so soll es dir auch gut gehen. Ich will dir eine Ente schenken, die hat goldene ,Federn und heißt ,Gute Gonda'. Falls einmal einer sie dir stehlen oder ihr eine Feder ausreißen will, so brauchst du nur sagen: ,Gute Gonda! Es bleibe an dir hangen, was bei dir ist!' - alsbald gibt es für jenen kein Entkommen mehr; er muß mit, wohin die Ente geht."
Baltes bedankte sich, nahm die Ente in Empfang und zog weiter durch den Wald. Während er so dahinging, sagte er sich in Gedanken ein um das andere Mal den Namen und das Sprüchlein vor, damit sie ihm ja nicht am Ende entfielen. So war es allmählich Abend geworden, als er vor einem Wirtshaus ankam, wo er übernachten und sein Abendbrot verzehren wollte. Als die Speisen aufgetragen waren, durfte auch die Ente mitessen.
Sie saß neben Baltes auf dem Tisch und fischte sich die besten Fleischbrocken aus dem Teller heraus. Was da der Wirt und die Gäste für Augen machten! Und besonders die drei vornehmen Fräulein, die auch in dem Wirtshaus übernachten wollten. "Was für ein schönes Tierchen!" sagten sie bewundernd und baten und baten den Baltes, er solle ihnen doch eine Feder von seiner goldenen Ente schenken. Er schlug ihnen aber ihren Wunsch ab, denn er mochte seiner Ente die kostbaren Federn nicht ausrupfen. Da baten die drei Fräulein den Wirt, er solle sie heute Nacht in dem Zimmer neben dem Fremden schlafen lassen, und er sagte es ihnen zu.
Um Mitternacht, als die Mädchen dachten, der Baltes schlafe fest, stiegen sie leise aus ihren Betten und schlichen in sein Zimmer. Der Mond schien zum Fenster herein, gerade auf die goldene Ente, die neben ihres Herrn Bett auf dem Stuhle hockte den Kopf unter den Flügel gesteckt. Gerade wollten ihr die drei Mädchen einige Federn ausrupfen, da schrie die Ente: "Quaak, quaak!" so laut sie nur konnte. Sogleich wachte Baltes auf und sprach: "Gute Gonda! Es bleibe an dir hangen, was bei dir ist!"
Da mußten die drei Mädchen im Hemde die ganze Nacht bei der Ente stehen bleiben. Und als der Baltes am anderen Morgen drunten frühstücken wollte und seiner Ente rief: "Gute Gonda, komm herunter und was bei dir ist!", da mußten die Mädchen auch in die Wirtsstube herab und im Hemd frühstücken. Und als der Baltes darauf seines Weges weiterging, hatten sie keine andere Wahl als ihm und seiner Ente hintendrein zu laufen, mochte es auch gehen wohin es wollte.
Nach einiger Zeit kam Baltes in ein Dorf. Da schaute gerade der Pfarrer zum Fenster heraus, sah den Baltes mit der Ente und den drei Mädchen und rief: "Ei! Ei! Bedenkt doch, ihr großen Mädchen! Schämt ihr euch denn nicht, auf offener Straße im Hemd zu gehen?", kam aus dem Haus gelaufen, faßte die letzte bei der Hand und wollte sie samt den beiden anderen mit sich nehmen. Der Baltes aber sagte nur: "Gute Gonda, es bleibe an dir hangen, was bei dir ist!", und da mußte der dicke Pfarrer ebenfalls mit, so sehr er sich auch wehrte und um Hilfe schrie.
Darauf zogen sie durch einen andern Ort, wo sieben Maurer an einem neuen Hause arbeiteten. Wie die den Zug sahen, liefen sie mit ihren Maurerkellen herbei und wollten die Mädchen befreien helfen. Der Baltes aber rief wieder seiner Ente zu: "Gute Gonda, es bleibe an dir hangen, was bei dir ist!" Da konnten die sieben Maurer nicht mehr weg und mußten auch mitziehen.
Als sie so eine Weile gegangen waren, kamen sie in eine Stadt, in der eine große Bäckerei war. Die Bäckergesellen sahen den wunderlichen Zug daherkommen, und als sie die drei Mädchen im Hemd erblickten, wollten sie ihnen beistehen. Sogleich kamen alle fünfunddreißig Gesellen mit ihren Backschaufeln aus dem Hause gesprungen und faßten zu. Baltes aber sprach nur: "Gute Gonda, es bleibe an dir hangen, was bei dir ist!", und da mußten sich auch die fünfunddreißig Bäckergesellen dem Zug anschließen.
Am Abend kehrte Baltes mit seiner goldenen Ente und ihrem lustigen Anhang in einem Wirtshaus ein, um zu übernachten. Er ließ sich ein Nachtessen richten und unterhielt sich hernach beim Wein noch eine Zeit lang mit ein paar vornehmen Gästen aus der Stadt. Dabei vernahm er eine gar sonderbare Kunde; Der König habe eine Tochter, so erzählte einer, die sei so ernst, daß sie in ihrem Leben noch nie gelacht habe. Darum habe der König beschlossen, daß derjenige die Prinzessin zur Frau bekommen solle, der sie zum Lachen bringen könne.
"Ei, das wäre was für mich!" dachte da der Baltes bei sich. "Eine Königstochter zur Frau haben, würde mir nicht übel passen!" Ging also am andern Morgen ins Schloß, meldete sich beim König und sagte, er, der Baltes, getraue sich wohl, die Prinzessin zum Lachen zu bringen. Darüber war der König sehr erfreut und hieß ihn am andern Tag um zehn Uhr mit seinen Leuten vors Schloß kommen.
Es war ein herrlicher Sommermorgen. Die Sonne strahlte hell und warm, und in den Parkbäumen sangen die Vögel um die Wette. Die schöne Königstochter stand mit ihren Hoffräulein auf dem Altan und sah von dort herab den seltsamen Zug in den Schloßhof einziehen: die goldene Ente, die drei Jungfern im Hemd, den dicken Pfarrer, die sieben Maurer mit ihren Kellen und die fünfunddreißig Bäckergesellen mit ihren Schaufeln; alle aneinanderhängend wie bunte Perlen an einer Schnur.
"Ei,so was! Ei, so was!" jauchzte die Prinzessin und mußte sich vor Lachen wahrhaftig an ihrer Kammerjungfer festhalten. Sie lachte, daß ihr die Tränen nur so über die Backen herunter kugelten. Als dies der König sah, war er froh und sprach: "Wie bin ich nun auf meine alten Tage glücklich, daß mein liebes Töchterchen das Lachen gelernt hat." Dann ging er selber in den Schloßhof hinunter, bedankte sich beim Baltes, ließ ihn schöne und kostbare Kleider anlegen und führte ihn der Prinzessin entgegen.
Wurde das eine herrliche und fröhliche Hochzeit! Die Prinzessinbraut lachte und strahlte wie die aufgehende Sonne, und sie lachte von nun an viel und von Herzen gerne; besonders als sie übers Jahr ein Kind auf ihren Armen wiegte. Als der alte König starb, wurde Baltes sein Nachfolger und regierte an der Seite seiner lieben Königin viele Jahre in Glück und Frieden.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE TEURE METZELSUPPE ...

Vor langer Zeit war einmal in einem Dorf ein Pfarrer, den hatten die Bauern wegen seiner kurzen Predigten so gern, daß sie ihm bei jedem Schweine Schlachten einen ordentlichen Happen von der Metzelsuppe schickten. Nun hatte aber der Pfarrer selber auch ein Schwein ein getan und gemästet, und es wog wohl an die vier Zentner, als es geschlachtet werden sollte.
Der Metzger war eben daran, das Tier abzubrühen und die Schwarte von den Borsten zu reinigen; da fiel dem Pfarrer ein, daß er nun den Bauern, die ihm sonst etwas von ihrer Metzget zukommen ließen, auch ein Stück Fleisch und ein paar Würste ins Haus schicken müßte. "Gerechter Gott, wenn ich da jedem abgebe, bleibt mir selber nichts mehr übrig!" dachte er, ließ den Messner zu sich kommen und fragte ihn um Rat, wie er es machen solle, damit er den Bauern keine Metzelsuppe zu geben brauche.
"Das ist ganz einfach", sagte der Messner, "laßt das Schwein den ganzen Tag über am Rechen vor dem Hause hängen, so daß es die Bauern sehen und wissen, daß Ihr geschlachtet habt. Sobald aber die Nacht hereingebrochen ist, laßt Ihr es in aller Heimlichkeit bei Seite schaffen und erzählt jedem, der Euch begegnet, Euer Schwein sei in der Nacht von einem Spitzbuben gestohlen worden. So wird niemand eine Metzelsuppe von Euch erwarten und Euch in Eurem Unglück höchstens noch bedauern."
Dieser Rat gefiel dem Pfarrer gut, und er gedachte ihn zu befolgen. "Ihr dürft aber keinem Menschen ein Sterbenswörtchen davon verraten!" bat der Pfarrer. - "Keine Silbe, Herr Pfarrer; darauf könnt Ihr Euch verlassen!" erwiderte der Messner und ging nach Hause; schlich sich aber um Mitternacht, als das ganze Dorf in tiefem Schlafe lag, vors Pfarrhaus, nahm das Schwein auf die Schulter und trug es in seinen Keller, wo er es in einem großen Krautfaß versteckte.
Früh am Morgen schon erschien der Pfarrer wieder: " Messner, ich kann's fast nicht glauben "jammerte er, "man hat mir heute Nacht mein Schwein gestohlen !" - "Ja, Herr Pfarrer, so ist's recht! So müßt Ihr sagen und gerade so jämmerbarwie jetzt, - dann glauben's die Leute!" "Ich bitt' Euch, Messner' macht keine Späße; 's ist mir nämlich nicht danach! Man hat mir wirklich in der Nacht das Schwein gestohlen", sagte da der Pfarrer. -
"Recht so; so müßt Ihr sprechen, Herr Pfarrer! Und seid versichert: ich will schon mithelfen und dafür sorgen, daß es unter die Leute kommt. 's ist ja Samstag heut, wo sich ohnehin die Weiber in Metzig und Laden und die Männer im Wirtshaus treffen." - Als aber der Pfarrer gar nicht nachgab, zu versichern, daß das Schwein wirklich gestohlen sei, lächelte der Messner nur verschmitzt und sagte: "Macht nur keine Flausen! Ich weiß doch alles; hab' Euch ja selbst diesen Rat gegeben; bei mir bedarf's keiner Verstellung!"
Da ging der Pfarrer unwillig nach Hause. Weil ihm aber das Betragen des Messners verdächtig vorkam und er zuletzt in ihm den Dieb vermutete, sann er unterwegs darüber nach, auf welche Weise er sich am schnellsten Gewißheit verschaffen könne. Er hatte sich auch bald einen Plan zurecht gezimmert: Seine Schwiegermutter sollte horchen und ausspüren, ob der Messner in Wahrheit der Schweine Dieb sei.
Er steckte sie darum in eine Kiste, ließ diese in die Messnerwohnung schaffen und bat den Messner, die Kiste über den Sonntag in seiner Stube aufzubewahren. Er bekomme Besuch und könne sie daher während der Zeit nicht im Hause brauchen. Öffnen dürfe er aber die Kiste nicht; es könnte sonst leicht ein Unglück geschehen. Der Messner erfüllte des Pfarrers Wunsch gerne.
Am Sonntag kochte die Messnersfrau Sauerkraut und setzte ein gutes Stück von dem fetten Schweinefleisch zu. Wie nun die Familie am Tisch saß und aß, sagte die Tochter: "Ah! Wie schmeckt doch dem Herrn Pfarrer sein Fleisch so gut!" Das hörte die alte Frau in der Kiste und konnte das Lachen nicht mehr verhalten, so daß der Messner es bemerkte. Er zündete eine Schwefelschnitte an und steckte sie durch eine Ritze in die Kiste.
Er dachte, der drinnen säße, würde nach einer Weile um Hilfe rufen, und er könnte ihn ja dann heraus lassen. Als sich aber kein Laut mehr vernehmen ließ, brach er die Kiste auf und - sah zu seinem Schrecken des Pfarrers Schwiegermutter darin liegen. Die aber war im Schwefeldampf erstickt und mausetot. Neben ihr lag ein halber Laib Brot und ein Happen Rauchfleisch, von dem sie gegessen hatte. Da schnitt der Messner schnell ein Stück von dem Fleisch ab, steckte es ihr in den Hals und nagelte die Kiste wieder zu.
Als nun der Pfarrer am anderen Tag die Kiste zurückholen ließ und öffnete, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen und rief: "Ach Gott, ach Gott! Die alte Frau ist an dem zähen Fleisch erstickt! Was fange ich nur an, ich armer, geschlagener Mann!" In seiner Not ließ er den Messner kommen und gestand ihm hinter verschlossenen Türen:
"Denkt Euch nur, Messner, meine Schwiegermutter ist in der Nacht an einem Bissen Fleisch erstickt. Weil ich aber in meiner Einfalt und Aufregung keinen Arzt zu Hilfe gerufen habe, fürchte ich, daß man mir Vorwürfe macht und mir gar die Schuld an ihrem Tode zu schiebt. Drum bitt' ich Euch, begrabt sie heimlich im Garten. Ich will Euch einen Scheffel Korn, den Ihr selbst einfassen dürft, zum Lohne geben." -
Der Messner war damit einverstanden, nahm die Tote und trug sie auf des Pfarrers Kornboden, wo er sich gleich einen gehäuften Scheffel Frucht einmaß. Als er damit fertig war, stellte er die tote Schwiegermutter bis über die Knie in den Kornhaufen und ging nach Hause.
Am andern Morgen kehrte die Pfarrmagd die Treppen und kam dabei auch auf den Speicher. Kaum aber hatte sie die Tür zur Fruchtkammer aufgemacht, stieß sie einen Schrei aus, rannte die Treppe hinab und in des Pfarrers Studierstube und erzählte außer Atem: "Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! . . . droben . . . in der Fruchtkammer ... steht Eure Schwiegermutter mitten im Kornhaufen ... und ..." -
"Wie? Was erzählst du mir da?" sagte der Pfarrer. "Geh schnell zum Messner hinüber; er soll gleich kommen!" - Der Messner kam. - "Habt Ihr denn meine Schwiegermutter nicht begraben?" fragte der Pfarrer. - "Freilich habe ich sie begraben", erwiderte der Messner. - "Aber sie steht droben auf der Kornbühne mitten im Fruchthaufen." - "Dann ist sie eine Hexe, Herr Pfarrer; sonst wäre sie nicht wiedergekommen!" -
Sollte der Pfarrer aufkommen lassen, daß seine Schwiegermutter eine Hexe sei? Er bat den Messner, sie noch einmal zu begraben. - "Das tue ich nur, wenn Ihr mir hundert Gulden auf die Hand legt. Andernfalls könnt Ihr sie selber einscharren!" - So schwer's ihm fiel, der Pfarrer mußte in den Beutel greifen und dem Messner die hundert blanken Gulden auf die Hand zählen. Der steckte sie in die Tasche, nahm dann die Leiche und trug sie in den Wald hinaus.
Er war noch nicht lange gegangen, da sah er unter einer Eiche einen Krämer sitzen. Der war eingeschlafen und hatte einen großmächtigen Koffer neben sich stehen; er schlief so tief, daß er nicht einmal merkte, wie der Messner den Koffer öffnete, alle Waren heraus nahm und davon trug und in einem hohlen Baum versteckte. Dann legte er die tote Frau hinein, drückte ihr einen der silbernen Löffel in die Hand, die der Krämer zum Verkaufe bei sich hatte, und schloß darauf den Koffer wieder vorsichtig ab.
Danach ließ er sich ein Stück weit entfernt im Schatten eines Baumes nieder und wartete, bis der Krämer erwachte, den schweren Koffer auf die Schulter nahm und sich zum Weiterwandern anschickte. Nun trat der Messner hinter dem Baum hervor, tat, als ob er ganz zufällig hier vorüber käme, grüßte den Fremden und sagte: "So, seid Ihr auch unterwegs? Werd' wohl nicht fehl gehen, wenn ich annehme, daß Ihr ein Handelsmann seid."
"Das bin ich", gab darauf der Krämer zur Antwort, "aber man macht schlechte Geschäfte heutzutage. Die Leute haben weder Lust noch Geld, etwas zu kaufen." "Da habt Ihr recht", sagte der Messner. "Aber manchmal muß auch einer etwas kaufen, ob er Lust hat oder nicht. Seid Ihr beim Pfarrer gewesen?" Der Krämer schüttelte den Kopf und sagte: "O je, den kenn' ich! Der ist zu knauserig, um unsereinen was verdienen zu lassen."
"Da habt Ihr wiederum recht. Aber diesmal ist's eine andere Sache. Geht nur gleich hin und klopft bei ihm an; er hat Trauerkleider nötig, weil seine Schwiegermutter gestorben ist." Da bedankte sich der Krämer bei dem Messner für den guten Rat und machte sich auf den Weg ins Pfarrhaus.
Der Pfarrer ließ ihn gar nicht erst bis in sein Studierzimmer gelangen, sondern kam in den Gang heraus und brummte mißgelaunt, er brauche nichts, er sei mit allem versehen. "So gestattet wenigstens, daß ich Euch meine Waren zeige", sagte der Händler und machte den Koffer auf. Da fiel das tote Weib heraus.
"Um Gottes willen!" rief der Pfarrer. "Das ist ja meine Schwiegermutter! Wie kommt die in Euren Koffer hinein?" Doch der Krämer konnte keine Antwort geben; er war vor Schrecken in Ohnmacht gefallen. Da ließ der Pfarrer den Messner holen und fragte ihn, ob er denn seine Schwiegermutter nicht begraben habe.
"Ei, freilich habe ich sie begraben! Schon zweimal; und diesmal habe ich sie sogar in den Wald hinaus getragen. Eben daran aber, Herr Pfarrer, daß sie immer wieder kommt, kann man deutlich sehen, daß sie eine Hexe gewesen sein muß!" - "So begrabt sie zum dritten Mal und sorgt dafür, daß sie nicht wieder ans Tageslicht kommt !"
Der Messner versprach es zu tun, wenn er ihm dreihundert Gulden gebe. Das kam den geizigen Pfarrer hart an; aber er hatte keine andere Wahl, wenn er die Sache geheim halten wollte, als den vollen Beutel aufzutun. Und diesmal ging der Messner wirklich in den Garten hinaus und begrub die Schwiegermutter unter einem alten Apfelbaum.
Inzwischen war der Krämer aus seiner Ohnmacht wieder erwacht und verlangte von dem Pfarrer, daß er ihm die Waren, die vor dem im Koffer gewesen, bezahlen solle. Der aber sagte, das gehe doch ihn nichts an; er habe die Sachen ja nicht gestohlen. "Aber Eure Schwiegermutter hat sie gestohlen! Sie hatte doch noch einen von meinen silbernen Löffeln in der Hand! Der Tand war wohl seine hundert Gulden wert, und wenn Ihr mir die nicht auf Heller und Pfennig bezahlt, dann verklage ich Euch samt Eurer Schwiegermutter!"
So blieb dem Pfarrer am Ende nichts übrig, als auch diese hundert Gulden dran zu geben, wenn er nicht in das böse Gerede der Leute kommen oder vom ganzen Dorf verhöhnt und ausgelacht werden wollte.
Das ist die Geschichte von der teuren Metzelsuppe, die der Pfarrer ganz allein zu verzehren gedachte. Meine Großmutter hat sie mir einst zwischen Tag und Dunkel erzählt, und also muß sie auch wahr sein, so gewiß als der Pfarrer Amen sagt.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE VIER KUNSTREICHEN BRÜDER ...
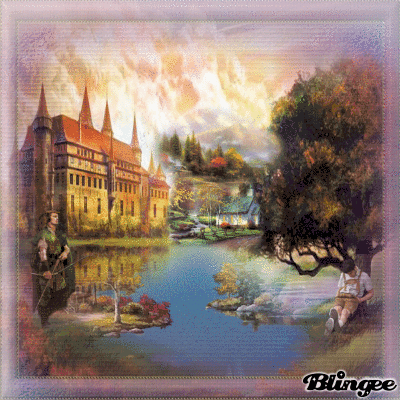
Es waren einmal vier Brüder, die hießen Hans, Jörg, Jockel und Michel. Der erste war ein Scharfschütze, der zweite ein Windbläser, der dritte ein Schnellläufer und der vierte, der Michel, war so stark, daß er die dicksten Eichen wie Grashalme aus der Erde rupfen konnte. Eines Tages gingen sie miteinander auf Wanderschaft in die weite Welt hinaus.
Da traf einmal ein Forstmann den Hans, der gerade sein Gewehr zum Schuß angelegt hatte, und es sah aus, als wolle er in die blaue Luft hineinschießen. »Wonach zielst du denn?« fragte der Förster. »Wonach ich ziele?« sagte Hans. »Hundert Stund von hier, auf einer Kirchturmspitze, sitzt ein Spatz, den will ich herunterschießen.« Er drückte ab, sah hinter der Kugel drein und sagte dann nach einer Weile: »So, da liegt er!«
Der Forstmann aber schüttelte ungläubig den Kopf und sagte: »Das machst du mir nicht weis! Auf eine so große Entfernung trifft kein Mensch!« Da rief der Hans seinen Bruder Jockel, den Schnellläufer, herbei und sagte zu ihm: »Hole doch geschwind den Spatzen, den ich hundert Stund weit von hier vom Kirchturm geschossen habe!« Jockel machte sich sogleich auf den Weg, war nach zwei Stunden wieder da und brachte richtig den toten Spatzen mit; aber in zwei Stücken; denn er war so gut getroffen, daß der Kopf rechts, der Leib links von dem Kirchturm herabgefallen war.
Der Förster ging weiter und traf nach einiger Zeit den Jörg. Der stand bei den sieben Windmühlen, schien müßig in den blauen Himmel hinaufzugucken und hielt dabei beständig ein Rohr vor den Mund. »Ei, Kamerad, was machst du denn da?« fragte der Forstmann. »Ich? Ich blase die Windmühlen an, daß sie nicht still stehen, weil doch heute der Wind nicht weht«, antwortete der Jörg.
Nicht weit davon traf der Förster auch den Michel an. Der hatte ein langes, armdickes Seil um drei Morgen Wald gespannt und machte eben den Knopf dran. Der Förster sah ihm von weitem eine Weile zu und dachte bei sich: »Sag mir bloß einer, was der Kerl im Sinn hat?« Endlich trat er näher heran und fragte: »Was willst du denn mit dem Seil anfangen, das du da um den Wald gelegt hast?« -
»Ach«, sagte der Michel, »ich wollte nur ein Büschel Holz holen, damit ich mir auch ein bißchen einbrennen kann, wenn's etwa im Winter recht kalt wird.« Sprach's und riß mit einem Ruck den ganzen Wald um, daß es nur so krachte, lud ihn auf die Schulter und trug ihn fort. Da brachte der Förster den Mund nicht mehr zu vor Staunen, wagte dem starken Michel kein böses Wort zu sagen und machte, daß er nach Hause kam. Die vier Brüder aber wanderten ihres Weges weiter, bis sie endlich in der Hauptstadt anlangten.
Dort war gerade im königlichen Schloß große Sorge und Not. Der König war schwer erkrankt, und sein Leibarzt erklärte, er müsse sterben, wenn nicht binnen sieben Stunden das Kraut des Lebens herbeigeschafft werde, das auf dem höchsten Berge fern an der Grenze des Landes wachse. Da ließ der König sogleich in allen Städten und Dörfern ausrufen: Wer ihm innerhalb sieben Stunden das Kraut des Lebens bringe, der bekomme zum Lohn einen Sack voll Geld, so schwer als er ihn tragen könne.
»Das wäre was für uns!« sagten die vier Brüder untereinander, und der Schnellläufer eilte spornstreichs aufs Schloß und meldete sich. »Ich will es aber schriftlich haben, Herr König, daß ich einen Sack voll Geld bekomme, wenn ich Euch das heilsame Kraut verschaffe«, sagte Jockel, und der König sicherte ihm den Lohn mit Unterschrift und Siegel zu.
Als er das Schriftstück in der Tasche hatte, sprang Jockel davon, so schnell ihn seine Füße trugen und kam schon nach zwei Stunden auf dem Berge an. Er fand auch gleich das Kraut des Lebens und machte sich auf den Heimweg. Als er aber eine Weile gelaufen war, dachte er, er habe ja noch Zeit genug und könne also gut ein wenig ausruhen. Er legte sich unter eine Eiche und schlief ein.
Inzwischen warteten die Brüder und warteten, und die Zeit verstrich. Da hielt endlich der Scharfschütze nach ihm Ausschau und sah ihn wahrhaftig fest eingeschlafen unter der Eiche liegen. Flink nahm er sein Gewehr, zielte und schoß dem Bruder eine Kugel durch den Rockzipfel. Davon erwachte der Jockel und sah schnell nach seiner Uhr. O Wetter! Es war höchste Zeit!
Er sprang auf und lief, springst nicht, so gilt's nicht, über Stock und Stein, und kam gerade noch zur rechten Zeit im Schlosse an. Sogleich bereitete der Leibarzt aus dem Kraut eine Arznei, gab sie dem Kranken zu trinken - und nach wenigen Stunden schon war der König wieder gesund. Darüber war er sehr froh und ließ dem Schnellläufer sagen, er solle am anderen Tag ins Schloß kommen und seinen Lohn abholen.
Der schlaue Jockel aber ließ sich vorher einen Sack machen, der war so groß, daß der Schneider hundert Ellen Zwilch dazu brauchte. Mit diesem Sack ging er zu seinem Bruder, dem starken Michel, und sagte: »Du mußt mit mir als mein Diener und den Sack tragen; da bist du gerade der rechte Mann dazu! Denn der König hat mir so viel Geld versprochen, als einer auf seinen Schultern tragen könne.« -
»Machen wir, Brüderchen!« sagte Michel und ging gleich mit ihm. Als sie zum König kamen, führte er sie in eine seiner Schatzkammern und sagte: »Hier nehmt euch, so viel einer tragen kann!« - »Pack ein, Michel!« sagte der Jockel. Da nahm der Michel eine Tonne Gold nach der anderen wie einen Spielball in die Hand und schüttete sie in den großen Zwilchsack. Als aber alles Gold drin war, war der Sack noch lange nicht voll, und der Michel konnte noch viel mehr tragen.
Deshalb gingen sie in die zweite Schatzkammer und steckten auch dort alles Geld in den Sack. Ja, sie gingen auch noch in die dritte Kammer und fingen an einzupacken. Da wurde der König böse und gab heimlich den Befehl, daß zwei Regimenter Fußsoldaten und zwei Regimenter zu Pferd vor das Schloß rücken und die beiden Burschen ja nicht entkommen lassen sollten. Bis die aber ankamen, dauerte es zwei Stunden, und unterdessen hatte der Michel längst den Geldsack über die Schulter geworfen und war hinter seinem Bruder Schnellläufer drein davon gegangen.
Weil der Sack aber so dick und breit war, konnte er damit nicht ganz ungehindert aus dem Schloßtor kommen, sondern mußte ein wenig Gewalt anwenden. Da ging der Sack zwar hindurch; aber auch die ganze Schloßtür samt acht Säulen blieben daran hängen. Der Michel ging ruhig weiter, als ob nichts geschehen wäre, bis er ans eiserne Hoftor kam. Da war der Durchgang wieder zu eng. Aber er tat einen herzhaften Ruck, hob das ganze Tor aus den Angeln und trug's samt den acht Säulen und der Schloßtür und den vielen Tonnen Goldes auf seinen Schultern davon.
Als er mit dieser Last eine Weile gewandert war, kam er an einen See. Da sprach er bei sich: »Hier will ich ein Viertelstündchen ausruhen, bis der Hans und der Jockel und der Jörg kommen; auch drückt mich das dumme Säcklein ein wenig auf der Schulter.« Wie staunte er da, als er den Sack ablegte und sah, was sonst noch alles drum und dran hing! Und da die drei Brüder auch gerade dazu kamen, mußten sie über den starken Michel recht herzlich lachen.
Plötzlich dröhnte der Boden von Pferdegetrappel und die vier Regimenter Soldaten brachen aus dem Walde hervor und wollten dem Michel den Sack wieder abnehmen. Doch eh' sie's gedacht, hatte der Jörg sein Windrohr an den Mund genommen und blies alle, Roß und Mann, in den tiefen See, daß sie jämmerlich ertranken. Drauf zogen die vier Brüder fröhlich weiter, teilten unter sich das Geld und lebten als reiche Leute glücklich und vergnügt bis an ihr Ende.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DONNER, BLITZ UND WETTER ...
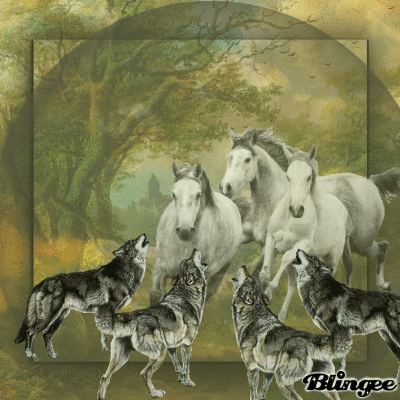
Es war einmal ein alter König, der hatte einen Sohn und drei Töchter. Eines Tages wurde er schwer krank, ließ den Prinzen zu sich rufen und sprach: "Lieber Sohn, ich fühle, daß ich sterben muß. Höre meinen letzten Willen: Meine drei Töchter, deine Schwestern, sollen nicht eher heiraten, als bis nach meinem Tode sechs Jahre dahin gegangen sind. Versprich mir, dafür zu sorgen, daß dieser letzte Wunsch, den ich an euch und an das Leben habe, Erfüllung findet.'' Der Sohn versprach es dem Vater in die Hand, und bald darauf schloß der König seine Augen.
In der Folgezeit warben viele edle und reiche Prinzen um die schönen Prinzessinnen doch der junge König ließ es nicht zu, daß seine Schwestern heirateten, und sagte, sie müßten warten, bis die sechs Jahre herum seien. So waren nun schon drei Jahre vergangen, und gar mancher Freier war abgewiesen worden.
Da erschienen eines Tages drei vornehme Brüder und warben um die Schwestern des Königs; der eine hieß Donner, der andere Blitz und der dritte Wetter. Doch auch ihnen wurde die gleiche Antwort zuteil wie allen anderen. In einem aber unterschieden sich die drei Brüder von den früheren Freiern: sie ritten nicht schon am selben Tage wieder nach Hause, sondern nahmen in der Nähe des Schlosses Quartier, damit sie die schönen Prinzessinnen so oft wie möglich sehen konnten.
Als nun aber eines Tages der König verreiste, drangen sie ins Schloß ein, hoben die Prinzessinnen zu sich auf die wartenden Pferde und jagten mit ihrer holden Beute davon, über Wiesen und Felder fort in den dunkeln Wald. Als der König zurückkam und seine Schwestern nicht mehr vorfand, war er untröstlich. Er machte sich sogleich auf den Weg, sie zu suchen, und sollte er gehen müssen bis ans Ende der Welt.
Nachdem er lange Zeit vergeblich gewandert war, kam er in einen großen Wald. Er ging immer tiefer in ihn hinein, rief und suchte nach seinen Schwestern, konnte aber nirgends eine Spur von ihnen entdecken. Mit einem mal erblickte er auf einer Lichtung ein schönes Schloß. Und wie er ans Tor trat, rief ihm aus einem Fenster eine Stimme zu: "O Bruder, zu einer unglücklichen Stunde bist du ausgezogen und hierher gekommen! Kehre eilends um! Hier wohnt der Blitz und der ist mein Mann; wenn er heimkommt und dich findet, bringt er dich um!'' -
"Ist mir diese Stimme nicht bekannt?'', dachte der König, schritt näher an das Schloß heran und erkannte seine älteste Schwester. Da freute er sich sehr über das Wiedersehen und blieb trotz allem Mahnen bei ihr. Während sie nun so miteinander sprachen und sich erzählten, wie es ihnen seit der Trennung ergangen war, kam der Blitz nach Hause. Der aber zeigte sich über den fremden Besuch gar nicht böse, sondern begrüßte den König freundlich und lud ihn ein, sein Gast zu sein, solange es ihm gefalle. Dazu sagte der König gerne "ja'', denn nun konnte er wenigstens für eine kurze Zeit bei seiner lieben Schwester bleiben.
Schwager Blitz unterhielt sich jeden Tag mit dem König und suchte ihm mit allerlei Spielen die Zeit zu vertreiben. Meistens schossen sie mit Pfeil und Bogen. Das Ziel aber, denkt euch nur! war eine ganze Stunde weit entfernt, und der Pfeil hatte die merkwürdige Eigenschaft, daß er immer wieder von selbst zurückkam, und dazu brauchte er jedesmal zwei volle Stunden.
Der König konnte sich nicht genug darüber wundern, zumal Blitz so zu schießen verstand, daß der Pfeil weit über das Ziel hinausging, am Ende des Tales mit feurigem Zucken tief in einen Felsen eindrang und dennoch immer wieder zurückkehrte. Acht Tage lang blieb der König bei Blitz zu Gast, dann reiste er weiter, um seine beiden anderen Schwestern aufzusuchen.
Er wanderte fort und fort durch den großen, dunkeln Wald und stand mit einem mal wieder am Rande einer Wiese vor einem herrlichen Schloß. Da rief ihm aus einem Fenster eine Stimme zu: "O Bruder, zu einer unglücklichen Stunde bist du ausgezogen und hierher gekommen! Kehre eilends um! Hier wohnt der Donner und der ist mein Mann; wenn er dich da fände, würde er dich ohne Gnade umbringen!''
Der König freute sich, daß er auch seine zweite Schwester gefunden hatte, ließ sich nicht bange machen und blieb da. Als der Donner aber heimkam und den Bruder seiner Frau sah, begrüßte er ihn freundlich und bat ihn, doch einige Tage hierzubleiben, damit sie sich zusammen die Zeit vertreiben könnten. Der König nahm die Einladung gerne an, und Schwager Donner führte ihn gleich zu seiner Kegelbahn.
Die war, denkt euch nur! zwei Stunden lang, und die geworfene Kugel kam nach jedem Wurf von selbst wieder zurück. Am Ende der Bahn, die in einer abgründigen, finstern Schlucht lag, drang sie mit Krachen und Dröhnen tief in eine Felswand ein, rollte zurück und brauchte zu diesem Weg jedesmal vier volle Stunden.
Nachdem der König acht Tage lang bei seinem Schwager Donner sich aufgehalten hatte, zog er wieder weiter, um seine dritte Schwester zu suchen. Nach einigen Tagereisen kam er zu einem dritten Schloß, das grau und verwittert mitten in einem wilden Tannenforste lag. Aus dem Turmfenster rief ihm eine Stimme zu: "O Bruder, zu einer unglücklichen Stunde bist du ausgezogen und hierher gekommen! Rette dich, so gut du kannst! Dieses Schloß gehört meinem Mann, dem bösen Wetter; wenn er dich hier fände, würde er dich auf der Stelle umbringen!''
Der König aber beruhigte seine Schwester und blieb bei ihr, bis ihr Mann zurückkehrte. Wetter sah zuerst finster drein, wie er da den Fremden bei seiner Frau erblickte. Als sie ihm aber sagte, daß es ihr Bruder sei, der sie vor einer Stunde mit seinem Besuch überrascht habe, zeigte auch Wetter sein freundlichstes Gesicht und bat den Schwager, für ein paar Tage sein Gast zu sein. Und weil er mit Leib und Seele Jäger war, lud er den König ein, ihn auf die Jagd zu begleiten. Da sagte der König mit Freuden zu.
Als sie nun eines Tages im Walde jagten, erblickte der König plötzlich einen Hirsch; der war so stattlich und schön, wie er in seinem Leben noch keinen gesehen hatte. "Den muß ich erlegen! Koste es, was es wolle!'' dachte er und nahm sofort die Verfolgung auf. Doch der Hirsch schien ihn necken zu wollen; er ließ ihn immer ganz nahe herankommen, zielen und abdrücken, - im selben Augenblick aber, in dem der Pfeil von der Sehne schwirrte, war er verschwunden und setzte irgendwo zwischen fernen Bäumen gesund und munter davon.
Das ging mehrere Stunden lang so fort, und der König merkte nicht, daß er seinen Jagdgefährten schon längst verloren hatte. Er befand sich mitten im dunkelen, fremden Wald und wußte nicht aus und nicht ein. Endlich kam er auf einen freien Wiesengrund und traf dort einen alten Schäfer mit seiner Herde an. Bei dem erkundigte er sich nach dem Weg und hörte nun, wie weit er sich vom Schlosse weg verirrt hatte.
Er ließ sich mit dem freundlichen Schäfer in ein Gespräch ein, erzählte, wie er hierher gekommen, und auch das sonderbare Erlebnis, das er bei der Jagd mit dem Hirsch gehabt hatte. Da schüttelte der Alte lächelnd den Kopf und sagte: "Das war kein gewöhnlicher Hirsch, sondern Wetter, Euer Schwager! Er hat sich in den Hirsch verwandelt, um Euch zu täuschen und irrezuführen.'' -
"Glaubt Ihr?'' fragte der König. - "Das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich gewiß'', antwortete der Schäfer. Da wollte der König sogleich heimkehren, ein großes Kriegsheer sammeln und seine Schwestern aus der Gewalt der drei zaubermächtigen Brüder befreien. Der Schäfer aber sagte: "Nein! Hört mich an und tut, wie ich Euch sage:
Seht den großen Wald dort drüben; er ist des Wolfskönigs Reich. Durch ihn müßt Ihr hindurch, wenn Ihr den Zauberbann brechen wollt. Tretet Ihr aber unwissend in ihn ein, so werdet Ihr unversehens von wilden Tieren zerrissen. Darum nehmt dies Schaf aus meiner Herde, geht mit ihm bis an den Waldrand und ruft: ,Wolfskönig, hier bringe ich dir ein Schaf!` - und Euch wird kein Leid zustoßen.'' -
Der König tat, wie ihn der alte Schäfer geheißen, und der Wolfskönig trat heraus, bedankte sich freundlich und sprach: "Nun gehe ohne Furcht durch den Wald, und solltest du einmal Hilfe brauchen, so denke nur an mich; ich werde dir gerne zu Diensten sein.'' - "Ich danke dir auch und werde dein Anerbieten nicht vergessen'', sagte der König, verabschiedete sich und zog wohlgemut durch den Wald weiter.
Als er eine Weile gewandert war, kam er an einen See. Da lag ein schöner roter Fisch am trockenen Ufer und schlug verzweifelt mit dem Schwanze. "Du armer Kerl!'' sagte der König, hob ihn voll Mitleid auf und setzte ihn wieder ins Wasser. Der Fisch schwamm aber nicht gleich davon, sondern sprach: "Ich danke dir und will dir`s lohnen. Wenn du einmal in Not bist, so denke nur an den Fischkönig; dann werde ich dir zu Hilfe kommen.'' - "Vielen Dank!'' antwortete der König und setzte seine Reise fort.
Als er am anderen Tag so gemütlich den Weg dahin ging, sah er eine Hornisse vor seinen Füßen liegen. Sie lag auf dem Rücken und konnte sich nicht wieder von allein in die Luft erheben. Andere hätten wohl das Tier zertreten; der König aber, der ein gutes Herz für alle Geschöpfe hatte, hob es auf und ließ es fliegen. Doch ehe die Hornisse weiter flog, bedankte sie sich und sprach: "Ich bin der Hornissenkönig. Wenn du je einmal in Not gerätst, so denke an mich; ich werde dir sogleich zu Hilfe eilen.''
Nach mehreren Tagen erreichte der König das Ende des Waldes. Er kam auf eine Wiese und fand dort eine Hütte und darin ein altes Mütterchen. Das nahm ihn freundlich auf. Und weil er müde und hungrig war, blieb er da, um sich ein wenig zu erholen. Die alte Waldfrau aber war eine weise Zauberin und die Mutter der drei Brüder Donner, Blitz und Wetter.
Als die Nacht hereingebrochen war, kamen die drei zu ihrer Mutter in die Hütte. Wie erstaunt waren sie da, als sie ihren Schwager, den König, in dem großen Gastbett neben dem Ofen liegen und schlafen sahen. Besonders Wetter machte große Augen und sagte: "Wie kommt denn der hierher? Ich dachte, er findet nie mehr aus meinem Walde heraus, in dessen finsterste Gründe ich ihn auf einer Hirschjägd verlockt habe !'' -
"Er muß geheime und mächtige Gehilfen haben!'' entgegnete die Zauberin. "Es gibt nur eine Rettung für uns: Wir müssen ihm eine Aufgabe stellen, die so schwer ist, daß er sie nicht erfüllen kann. Andernfalls ist es um uns und unsere Herrschaft geschehen!'' - "Weißt du eine solche Aufgabe, Mutter?'' fragten die drei Söhne.
"Ja, hört zu. Ihr sollt euch in den kommenden Nächten in Pferde verwandeln, und die will ich ihn dann hüten lassen. Versteckt euch aber ja gut im Wolfswalde, daß weder er noch sonst jemand euch finden kann! Denn sonst ist es aus mit uns!'' -
"Ja, so wollen wir es machen!'' sagten die Brüder; "er wird zum letzten mal so gut geschlafen haben, wie er es gerade tut!'' Wenn aber nur wahr gewesen wäre, was die Zauberin und ihre drei Söhne glaubten! Doch der König schlief nicht, hatte alles wohl verstanden, was sie da miteinander besprochen hatten, und merkte es sich gut.
Am anderen Morgen sagte die alte Zauberin zum König: "Dafür, daß ich dir Essen und Nachtquartier gebe, mußt du drei Nächte lang auf der Weide draußen meine Pferde hüten.'' - "Das will ich gerne tun'', antwortete der König. Als es nun Abend geworden war, nahm sie ihn mit hinaus vor die Hütte, wo drei prächtige Pferde im Sande scharrten und sagte: "Führe sie auf die Weide. Sieh aber wohl zu, daß dir keines verlorengeht!''
Der König versprach, gut auf sie achtzugeben, und trieb sie in die Koppel. Sie weideten auch einige Stunden lang ganz ruhig, und der König ließ sie nicht aus den Augen. Auf einmal aber waren alle drei spurlos verschwunden. "Wie wird es dir ergehen?'' dachte besorgt der König und suchte die Pferde überall, bis der Tag anbrach. Doch alles Suchen war vergebens. Da überfiel ihn eine große Angst vor der Strafe der Zauberin, und er seufzte: "Wenn jetzt nur der Wolfskönig da wäre und mir helfen könnte.''
Kaum hatte er dies vor sich hin gesagt, stand auch schon der Wolfskönig vor ihm und fragte, was er wünsche. Da klagte ihm der König seine Not; der Wolfskönig beruhigte ihn aber, ging fort und sandte alle seine Knechte aus, die den ganzen Wolfswald nach den drei Pferden durchsuchten. Es dauerte nicht lange, da fanden sie, tief in einer Felsenhöhle versteckt, die drei Pferde und führten sie vor den König.
Die Alte staunte nicht wenig, als der König ihr die Pferde wiederbrachte. "Nun bin ich aber müde und möchte mich ein wenig ausruhen'', sagte er, zog Rock und Stiefel aus und legte sich auf sein Lager. Da hörte er, wie die Frau in der Stube draußen zu ihren Söhnen sagte: "Versteckt euch heute nacht auf dem Grund des Sees; dort können die Boten des Wolfskönigs nicht hinkommen.''
Am Abend bekam der König wieder die drei Pferde zu hüten, führte sie hinaus auf die Koppel und gab wohl acht auf sie. Ein paar Stunden lang weideten sie fromm wie Lämmer vor seinen Augen; dann aber waren sie ganz plötzlich wieder verschwunden. Diesmal aber blieb der König ganz ruhig und sagte: - "Nun könntest du mir helfen, lieber Fischkönig.'' Kaum hatte er diese Worte vor sich hin gesprochen, stand auch schon der Fischkönig da und fragte ihn, was er wünsche.
Da erzählte der König, wie es ihm seither ergangen war und in welch großer Not er sich nun befinde. "Sei ohne Sorge!'' sagte der Fischkönig und gab sogleich allen Fischen den Befehl, den großen See bis in die letzten Schlupfwinkel hinein zu durchsuchen. Und richtig! - sie fanden die drei Pferde tief auf dem Grunde unter einem gewaltigen Stein verborgen und brachten sie dem König. Der dankte dem Fischkönig von Herzen für seine Hilfe und führte sie dann wohlgemut vor die Hütte der alten Zauberin.
Die konnte vor Staunen gar keine Worte finden; der König aber begab sich in seine Kammer und legte sich nieder, um auszuruhen. Da hörte er, wie die Mutter ihre drei Söhne wieder schalt, weil sie sich nicht besser verborgen hatten. Sie aber entgegneten: "Hätte der Fischkönig ihm nicht geholfen, so hätte uns in alle Ewigkeit niemand finden können!'' -
"So versteckt euch heute nacht hoch in den Wolken; dahin kann euch weder der Fischkönig noch der Wolfskönig folgen!'' sagte die Mutter. "Das eine aber laßt euch gesagt sein: Findet euch der König zum dritten Male, dann hat meine und eure Macht über die Menschen für immer ein Ende!''
Der König hatte jedes Wort der Unterhaltung wohl verstanden und merkte sie sich gut. Am Abend trieb er die drei Pferde wieder auf die Wiese und sah ihnen mehrere Stunden lang beim Weiden zu. Auf einmal waren sie wieder spurlos verschwunden. "Habt keine Sorge'', sagte der König lächelnd, "ich weiß schon, wo ihr zu finden seid! Diesmal wird der Hornissenkönig mir aushelfen können.'' Kaum hatte er dies gesagt, kam auch schon der Hornissenkönig angeflogen und fragte, auf welche Weise er ihm dienen könne.
Als der König ihm Bescheid gegeben hatte, befahl der Hornissenkönig seinen hunderttausend Hornissen, den ganzen Himmel zu durchstreifen und alle Wolken zu durchsuchen, solange, bis sie die drei Pferde fänden. Da brausten die Hornissen wie der Wind davon. Lange, lange suchten sie vergebens. Endlich aber fanden sie hoch oben in einer schwarzen Wolke die drei Rosse und führten sie ihrem Herrn und Meister zu.
Der übergab sie sogleich dem König, und als der sie der Zauberin zum dritten Male zurückbrachte, wurde sie sehr traurig und sprach: "Du hast die Aufgabe, die ich dir stellte, besser gelöst, als ich dachte. Nimm dafür ein anderes, merkwürdiges Pferd zum Geschenk an. Es bringt dir Glück und trägt dich sicher nach Hause.''
Wie aber staunte der König, als er dieses Pferd sah! -- denn es war aus Holz und hatte vier Köpfe. Und während er das seltsame, schreckliche Wesen betrachtete, hörte er eine dunkle Stimme sprechen: "Nimm dein Schwert und haue damit dem Tier seine vier Köpfe ab, so werden deine Schwestern aus der bösen Zaubermacht der Alten und ihrer drei Söhne befreit sein!''
Der König gehorchte der Stimme, und alsbald stand ein schönes, gesatteltes Pferd vor ihm. Er ritt zu den drei Schlössern im Walde, befreite seine Schwestern und nahm so viel Gold und Edelsteine aus den verborgenen Schatzkammern mit sich, daß er dadurch zum reichsten König der Welt wurde. Dann ritt er auf seine heimatliche Burg, nahm die drei Schwestern zu sich und lebte mit ihnen froh und glücklich bis an sein Ende.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DREI ROSEN AUF EINEM STIEL ...
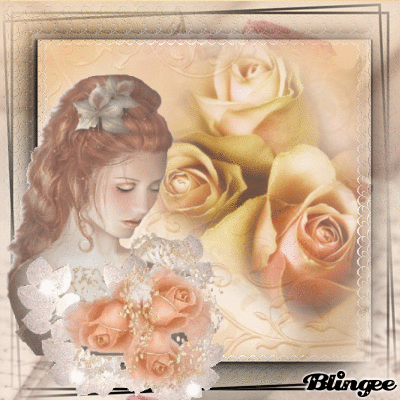
Auf einem abgelegenen Hof, nahe bei einem großen Tannenwalde, lebte einmal ein Bauer, dem seine Frau schon vor Jahren gestorben war. Zum Glück hatte er aber zwei erwachsene Töchter, die eine blond und die andere schwarz; die führten ihm nun den Haushalt, versahen den Stall und das Hühnervolk und halfen auch draußen auf dem Felde mit, so gut sie konnten.
Meist richteten sie es aber so ein, daß die eine dem Vater bei den bäuerlichen Arbeiten half, während die andere zu Hause blieb und dort nach dem Rechten sah. Denn es war nun einmal so, und niemand wußte eigentlich zu sagen warum, daß die zwei Schwestern sich nicht vertrugen, sondern sich wegen jeder Kleinigkeit zankten oder tagelang, ohne sich ein Wort zu gönnen, aneinander vorübergingen.
Dem Vater aber waren beide gleich lieb; er bemühte sich redlich, keine der anderen gegenüber zu bevorzugen, und erfreute sie häufig durch Geschenke, die sie sich immer selber wählen durften. Als er darum eines Tages wieder einmal auf den Markt ging, rief er sie zu sich in die Stube und fragte: "Ihr wißt ja, heut ist Markt im Dorf drunten; was soll ich euch mitbringen?"
"Ich möchte ein schönes Sonntagskleid haben", sagte die eine. "Und ich wünsche mir drei Rosen auf einem Stiel", entgegnete die andere. "Drei Rosen auf einem Stiel? . . . Wenn ich die nur bekommen kann", sagte der Vater und machte sich auf den Weg.
Als er seinen Handel abgeschlossen und im Wirtshaus zu Mittag gegessen hatte, kaufte er der einen Tochter ein schönes neues Kleid; obgleich er aber den ganzen Markt zweimal auf und ab ging und sich auch auf dem Heimweg lange und angestrengt umsah, konnte er doch nirgends drei Rosen erblicken, die auf einem Stiele wuchsen.
Endlich, als er schon ein gutes Stück vor dem Dorf draußen war, sah er in einem Garten einen blühenden Rosenstrauch stehen. Er betrachtete ihn näher, und wahrhaftig - an ihm wuchsen drei Rosen auf einem Stiel beisammen, so wie die zweite Tochter es sich gewünscht hatte. Ohne sich lange zu besinnen, trat er in den Garten ein, faßte das Zweiglein mit den drei Rosen und wollte es gerade abbrechen.
Da stand mit einem Male ein braun zottiger Bär vor ihm und sagte: "Was suchst du da in meinem Garten?" Als er sich von seinem Schrecken erholt hatte, erzählte der Bauer, daß seine eine Tochter gewünscht habe, er solle ihr drei Rosen auf einem Stiel als Marktgeschenk mitbringen. Lange habe er vergeblich gesucht; hier an diesem Strauch habe er endlich einen solch wundersamen Zweig gefunden. Ob er ihn nicht brechen und mit nach Hause nehmen dürfe.
"Du kannst die drei Rosen mitnehmen", sagte der Bär; "doch nur unter der Bedingung, daß du morgen um die selbe Stunde wieder hieher kommst und deine Tochter mitbringst. Es soll ihr Schaden nicht sein. Tust du aber nicht, was ich dir geboten, so mußt du sterben!" Der Bauer versprach wiederzukommen, bedankte sich für die drei Rosen und machte sich auf den Heimweg.
Als er auf dem Hofe ankam, warteten seine Töchter schon auf ihn. Die Schwarzhaarige begrüßte ihn am Brunnen, wo sie gerade Wasser für das Vieh schöpfte; die Blonde trat ihm freudig aus der Küche entgegen. Als sie das Zweiglein mit den drei Rosen in des Vaters Hand sah, strahlten ihre ,Augen vor Glück; sie bewunderte es lange und stellte es dann sorgsam in ein Glas ans Fenster.
Die Schwarzhaarige aber, die ihr Kleid gleich einmal zur Probe angelegt hatte, lächelte nur verächtlich, als sie die drei Rosen sah, und wie sie erst vernahm, daß die Schwester morgen den wilden Bären besuchen sollte, meinte sie: "Du wirst deine drei Rosen teuer bezahlen müssen und nicht wieder zurückkehren!" Die Blonde aber sagte: "Was der Vater dem Bären versprochen hat, das will ich halten."
Am anderen Tag begab sich der Bauer mit seiner Tochter zu dem Garten des Bären. Als sie eintraten, kam auch schon der Bär angetrottet und fragte: "Ist das die Tochter, die sich die drei Rosen gewünscht hat?" - "Ja", erwiderte der Vater. "Laß sie bis zum Sonnenuntergang bei mir", sprach der Bär. "Es soll ihr kein Leid geschehen und wird sie nicht gereuen."
Dem Bauern fiel es schwer, die Tochter so mutterseelenallein bei dem wilden Tier zu lassen, und er dachte den ganzen Tag über voll Sorge an sie. Doch er hätte sich nicht mit solchen Gedanken zu quälen brauchen. Denn als der Bär mit dem Mädchen allein war, nahm er es behutsam bei der Hand und führte es in ein herrliches Lustschloß, das zwischen Bäumen und blühenden Sträuchern versteckt mitten in dem Garten lag.
Er zeigte ihm alle die prunkvollen bemalten Räume und auch die Schmuckschränke, in denen es nur so gleißte und funkelte von Gold, Silber, Perlen und Edelsteinen. So etwas hatte die einfache Bauerntochter noch nie gesehen, und sie konnte ihre Augen fast nicht mehr abwenden von all den Herrlichkeiten. "Wähle für dich aus, was dir am besten gefällt", sprach der Bär. "Ich will es dir schenken, wenn du morgen noch einmal allein zu mir in den Garten kommst."
Das Mädchen versprach es, suchte sich eine Halskette und einen Ring aus und kehrte am Abend vergnügt nach Hause zurück. Als die Schwarzhaarige den kostbaren Schmuck sah, wurde sie blaß vor Neid. Und weil sie vermutete, daß die Schwester beim nächsten Besuche womöglich noch reicher beschenkt werden könnte, suchte sie ihr wiederum Furcht vor dem Bären einzureden und sie so weit zu bringen, ihr Versprechen nicht einzuhalten und lieber daheim zu bleiben.
Aber all ihr Zureden und Einflüstern war umsonst. Da stand sie in der Nacht heimlich auf, raffte die Kleider und Schuhe der Schwester zusammen und versteckte sie in der Scheune unter dem Heu. Wohl eine Stunde lang suchte die Blonde am anderen Morgen nach ihren Kleidern und ahnte bald, daß die neidische Schwester ihre Hände im Spiel hatte. Doch sie ließ sich in ihrem Entschluß, dem Bären ihr Wort zu halten, nicht beirren, zog ihre alte zerwaschene und geflickte Küchenschürze an und ging barfuß vom Hofe.
Weil sie sich aber beim Suchen zu lange aufgehalten hatte, kam sie verspätet im Garten an. Da stand der Rosenstrauch mit traurig leblosen Zweigen, und die Rosen hingen blaß und halb verwelkt zwischen den Blättern. "Es ist auch so totenstill überall", dachte sie und rief mit banger Stimme nach dem Bären. Niemand gab Antwort. Weinend irrte sie von einem Ende des Gartens zum anderen und lockte und rief: "Komm, komm mein Bär! Wo bist du denn, mein liebes Tier?" Da hörte sie endlich aus dem Rosenstrauch hervor etwas wimmern und winseln, lief drauf zu und sah den Bären wie tot auf dem Moose liegen.
Als sie aber mit ihren Händen die Zweige und Blüten berührte, um dem Tier den Weg freizumachen, richteten sich die welken Ranken und Blätter wieder auf, die Rosen dufteten und leuchteten, und der Bär schlug die Augen auf, kroch aus dem Dickicht hervor, streifte daran seinen zottigen Pelz ab und stand als ein schöner, junger Prinz vor dem Mädchen. "Nun bin ich unglücklicher, verwunschener Königssohn endlich befreit!" sprach er.
"Deiner Liebe und Treue, liebes Mädchen, habe ich mein neues Leben zu danken, und darum will ich dich zu meiner Frau und Königin machen!" Unter dem Rosenstrauch gab er ihr den Verlobungskuß, und bald darauf hielten sie Hochzeit und lebten glücklich miteinander bis an ihr Ende.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
FLÄSCHLEIN, TU DEINE PFLICHT! ...
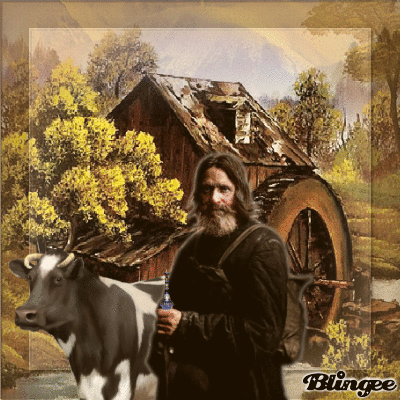
Es war einmal ein Müller, der konnte auf seiner Mühle nicht vorwärts kommen, er mochte arbeiten und sich anstrengen, so sehr er wollte. Das war wohl sonderbar, aber es brauchte einen nicht wundernehmen; denn erstens gehörte die Mühle nicht ihm, sondern dem Grafen, dem er hohen Pachtzins dafür zahlen mußte, und zum anderen brachte der Mühlbach oft so wenig Wasser, daß das Rad still stand und also auch die Mahlpfennige recht dünn und spärlich flossen. Dadurch war der Müller allmählich so arm geworden, daß er schon seit mehreren Jahren nicht imstande war, das Pachtgeld zu bezahlen.
Der Graf aber drängte immer unwilliger und drohte zuletzt, ihn aus der Mühle zu vertreiben, wenn er binnen drei Tagen nicht seine Schuld beglichen habe. Da nahm der Müller in der Not seine einzige Kuh und führte sie in die Stadt, um sie auf dem Markt zu verkaufen.
Wie er nun so bekümmert mit der Kuh durch den Wald zog, kam auf einmal ein Männlein mit grauem Runzelgesicht daher und fragte, was ihm denn fehle, daß er so traurig sei. Der Müller, der ohnehin ein freundlicher und leutseliger Mann war, faßte gleich Zutrauen zu dem Männchen und erzählte ihm alles, was ihn bedrückte. Da sprach das Männlein: "Ich will dir die Kuh abkaufen. Ich gebe dir dieses Fläschlein dafür. Wenn du das auf den Tisch stellst und sprichst: ,Fläschlein, tu deine Pflicht!', so wird es dir gewiß an nichts mehr mangeln."
Der Müller wollte aber nicht recht, war ängstlich und meinte: "Ach, was wird meine Frau sagen, wenn ich statt Geld dieses Fläschlein heimbringe." - "Ei", versetzte drauf das Männlein in ärgerlichem Tone, "wie magst du dich noch lang besinnen! Geld möchtest du heimbringen? Weißt du denn überhaupt, ob du deine Kuh da lebendig auf den Markt bringst?"
Da fürchtete sich der Müller, weil er die Worte für eine Drohung hielt und gab dem Männlein die Kuh für das Fläschchen. Kaum war der Tausch geschehen, versank das Männlein mit der Kuh in die Erde und war nicht mehr zu sehen. Der Müller stapfte eilends nach Hause, stellte das Fläschlein auf den Tisch und sprach: "Fläschlein, tu deine Pflicht ! Da war auch schon im Augenblick der Tisch mit goldenen Schüsseln voll herrlichster Speisen gedeckt.
Voller Freude rief er seine Frau herbei, und die schlug vor Verwunderung die Hände über dem Kopf zusammen. "Ja, Mann! Ja, Mann!" rief sie ein übers andere Mal und vergaß beinahe, sich an den gedeckten Tisch zu setzen und sich's schmecken zu lassen. Am anderen Morgen machte der Müller sich auf den Weg in die Stadt, verkaufte die goldenen Schüsseln und erhielt soviel Geld dafür, daß er mit einem mal ein reicher Mann war.
Gleich ging er aufs Schloß und bezahlte seine Schulden. Der Graf wunderte sich sehr darüber, daß der Müller so schnell den Pachtzins beisammen hatte. Er sah ihn mißtrauisch an und sagte: "Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen! Wie kommst du auf einmal zu dem vielen Geld?" Der Müller wollte es lange nicht sagen, mußte aber zuletzt doch die ganze Geschichte erzählen; wie ungern er's auch tat. "Verkaufe mir das Fläschlein", sagte da der Graf; "ich gebe dir einen Beutel voll Dukaten dafür."
Doch der Müller wollte und wollte es nicht hergeben. Als ihm aber der Graf zuletzt nicht nur die Mühle, sondern auch sein schönes Schloß für das Fläschlein bot, konnte er nicht mehr länger widerstehen und gab es ihm. Sobald aber der Graf das Fläschchen in der Hand hatte, sagte er: "Laß dir nur nicht träumen, daß du das Schloß bekommst! Hahaha! Das Schloß bleibt mein! Du hast an der Mühle genug; die kannst du meinetwegen behalten!" So also war der gute, leichtgläubige Müller betrogen worden.
Nun hatte er zwar von dem Erlös für die goldenen Schüsseln noch ein gutes Sümmchen übrig; weil aber die Mühle wieder einmal ohne Wasser war und ihm darum nichts eintrug, war das Geld bald verbraucht, und er geriet wieder in bittere Armut. In dieser Not wollte er eines Tages einen Freund besuchen und ihn bitten, ihm doch etliche Taler zu leihen. Als er so betrübt und allein im Wald dahinwanderte, stand plötzlich wieder das Männlein vor ihm und fragte, was er auf dem Herzen habe.
Da erzählte er, wie es ihm ergangen war und wie der Graf ihn betrogen und ins Elend gebracht habe. Darauf gab ihm das Männlein ein zweites Fläschchen und sprach: "Da, nimm dies Fläschlein; es wird dir zu jenem ersten wieder verhelfen. Sobald du sprichst: ,Fläschlein, tu deine Pflicht!', kommen drei Kerle daraus hervor und zerschlagen alles, was ihnen in den Weg kommt, und hören nicht eher auf, als bis du sagst: ,Fläschlein, du hast deine Pflicht getan!"'
Der Müller bedankte sich und machte sich spornstreichs auf den Weg zum Schloß. "Herr Graf! Ich habe wieder ein solches Fläschchen, und seine Zauberkraft ist noch größer!" So verkündete er voller Freude und schwang das Fläschlein mit erhobener Hand. Da strahlten die tückischen Augen des Grafen, und er lud den Müller freundlich zum Dableiben ein. Dann ließ er die Diener Essen und Trinken auftragen und bewirtete ihn aufs beste; denn er gedachte ihm auch das zweite Fläschlein abzulocken.
Als sie gegessen und getrunken hatten und der Graf wieder von dem Fläschlein zu reden anfing, fragte der Müller: "Soll ich es zur Probe einmal seine Pflicht tun lassen?" - "Ja, zeig mal, was der kleine Flaschenkobold kann!" rief der Graf. - "Gerne zu Diensten, Herr Graf!" sagte der Müller und schmunzelte dabei. "Also, mein Fläschlein, tu deine Pflicht!"
Im Augenblick hüpften drei wilde Kerle daraus hervor und schlugen so wetterlich auf den Grafen los, daß er weh und ach schrie und den Müller um Gottes willen bat, ihn doch zu verschonen. "Hast meiner auch nicht geschont und mich dazu hin noch um das Fläschlein betrogen!" entgegnete der Müller und ließ die drei Gesellen lustig auf des Grafen Rücken weitertrommeln.
Da zeigte ihm der Graf den Schrank, in dem das Fläschlein versteckt war, und der Müller schob es in die Tasche und entfernte sich. Die drei Kerle aber ließ er so lange weiter zuschlagen, bis der Graf keinen Schnaufer mehr tat und das ganze Schloß nur noch ein Trümmerhaufen war. Dann sprach er: "Fläschlein, du hast deine Pflicht getan!", und sogleich wurden die drei Spießgesellen ganz klein und Krochen wieder in das Fläschlein zurück.
Nun war der Müller froh, daß er das erste Zauberfläschchen wieder hatte und sprach jeden Tag zu ihm: "Fläschlein, tu deine Pflicht!" Sogleich stand dann der Tisch voll goldener Schüsseln, die mit den köstlichsten Speisen gefüllt waren. Die ließ er sich munden, verkaufte dann die Schüsseln an einen Goldschmied in der Stadt und wurde in kurzer Zeit ein steinreicher Mann.
Darauf baute er sich ein schönes Schloß, und weil er dachte, daß er nun Schätze genug habe, mauerte er das Fläschlein in den Grundstock ein. Das zweite Fläschchen aber, in dem die drei wackeren Gesellen verborgen waren, trug er immer bei sich, damit es ihm jederzeit aus aller Not und Gefahr helfen konnte.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
KÖNIG MEERFAHRER ...
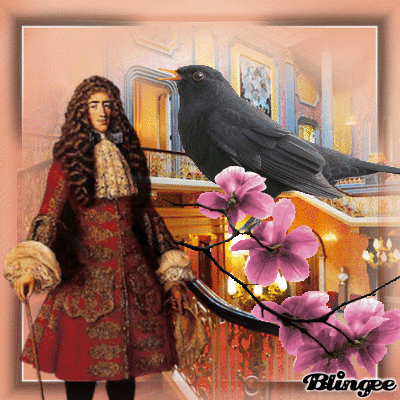
Es war einmal ein König, der wurde überall nur "König Meerfahrer" genannt, weil er ein halbes Leben lang auf allen Meeren gefahren war. Nun war er in sein Land zurückgekehrt und trug sich mit dem Gedanken zu heiraten. Da träumte ihm drei Nächte hintereinander, er solle ein armes Mädchen, das keinen Kreuzer Geld besitze, zur Frau nehmen.
Als er am Morgen nach dem ersten Traum erwachte, schüttelte er den Kopf und lachte darüber. "Was für unmögliches Zeug doch einer träumen kann!" sagte er vor sich hin und ging an seine Regierungsgeschäfte. Wie aber der Traum sich dreimal wiederholte, nahm er ihn für ein Zeichen und sann lange darüber nach. Endlich dachte er bei sich: "Wenn ich auch ein König bin so könnte ich doch mit einer armen Frau glücklich werden; wenn sie sonst nur lieb und brav ist." Am anderen Tage schon begab er sich auf die Reise, um sich in der Welt umzusehen und die richtige Frau für sich auszusuchen.
Er war schon eine gute Weile unterwegs, da kam er eines Abends in ein fremdes Dorf. Weil aber im Wirtshaus kein Platz mehr war, mußte er bei einem armen Schuster übernachten. Wie er da so in der niedrigen Stube saß, rief der Meister seine Tochter herein, dem vornehmen Gast das Nachtessen und hernach das Bett zu richten. Das Mädchen war jung und hübsch und gab auch dem König auf alle Fragen so gute und verständige Antworten; daß es ihm von Herzen wohl gefiel.
Und so geschah es, daß er noch am selben Abend den Schuster bat, er möge ihm seine Tochter zur Frau geben. Der arme Schuster glaubte, der König wolle ihn zum besten haben; darum sagte er: "Herr König, Ihr solltet über meine Armut nicht spotten! Mein Kind ist zwar brav und gut, aber ich weiß recht wohl, daß ihm alles fehlt, was die Frau eines Königs besitzen muß." Aber der König blieb mit allem Ernst dabei: Keine andere als seine Tochter müsse seine Gemahlin werden.
Da sagte der Schuster: "Nun, so will ich nichts dagegen haben. Das Weitere müßt Ihr mit meiner Tochter selbst ausmachen. Am anderen Morgen traf der König die Schusterstochter allein im Garten an, gestand ihr seine Liebe und versprach ihr, sie sein Leben lang in Treuen lieb zu haben Sie errötete und senkte den Blick zu Boden, und konnte es fast nicht glauben, daß der König ein so armes Mädchen wie sie zu seiner Frau machen wolle.
Als sie aber merkte, wie ernst es ihm mit seiner Bitte war, sagte sie von Herzen "ja". Bald darauf wurde die Hochzeit gefeiert, und die beiden waren glücklich miteinander, obwohl im Schlosse auch noch die alte Mutter des Königs wohnte, die eine unleidige und finstere Frau war.
Sie waren aber noch kein halbes Jahr verheiratet, da brach ein Krieg aus, und der König mußte an der Spitze seines Heeres gegen die Feinde ziehen, weit, bis an die Grenzen seines Landes. Mehrere Monate war er nun, schon von zu Hause fort; da gebar eines Tages seine Frau drei wunderschöne Kinder, zwei Buben und ein Mädchen, und jedes hatte ein kleines goldenes Kreuz als Mal auf der Schulter.
Die Mutter des Königs aber, die böse, hochmütige Frau, konnte die junge Königin nicht leiden, weil sie so arm und von so niederer Herkunft war. Deshalb nahm sie ihr gleich nach der Geburt die drei Kinder weg und schrieb dem König in einem Brief, seine Frau müsse eine Hexe sein, denn sie habe drei Hunde geboren.
Darüber wurde der König sehr zornig, und schrieb seiner Mutter zurück, sie solle die drei Hunde ins Wasser werfen und seine Frau so lange in den tiefen Turm einsperren lassen, bis er aus dem Krieg zurückkomme. Diesen Auftrag führte die Alte mit Freuden aus. Die Königin wurde in den Kerker geworfen und bekam jeden Tag nur Wasser und Brot. Die drei Kinder aber ließ das böse Weib in ein Faß einschließen und so in den nahen Fluß werfen.
Das Faß sank jedoch nicht unter, sondern schwamm auf der Strömung fort und wurde zuletzt an das Wehr einer Mühle getrieben. Der Müller holte es heraus und öffnete es. Wie wunderte er sich da, als er die drei schönen, zarten Kinder darin fand! Er brachte sie gleich seiner Frau, und die sorgte für sie mit Liebe und zog sie auf wie ihre eigenen fünf Kinder.
So waren beinahe fünfzehn Jahre vergangen. Der König mußte andauernd Krieg führen; seine Frau aber blieb in dem Turm eingesperrt und seine drei Kinder wurden fern in der Mühle großgezogen. Nun konnten sich aber die Kinder des Müllers mit den Königskindern nur schlecht vertragen. Sie schlossen sie bei ihren Spielen aus und neckten sie oft damit, daß sie keinen Namen und keine Heimat hätten und bloß Findelkinder seien.
Das verdroß die Königskinder endlich so sehr, daß sie eines Tages die Mühle heimlich verließen und fortwanderten, tief in den Wald hinein. Da begegnete ihnen eine alte Frau, die war eine Zauberin. Als sie sich nach dem Weg erkundigten, sagte die Alte: "Bleibt nur bei mir. Ich will euch verraten, wie ihr euer Glück machen könnt." - "Das möchten wir gar gern", sagten die drei Königskinder. "Sag uns, wie das geschehen kann."
Da erzählte ihnen die Zauberin, im Walde stehe ein verwunschenes Schloß, das könnten sie aus seinem Zauberschlaf befreien. Das war eine Aufgabe, so recht nach dem Sinne der Königssöhne! Darum antworteten sie auch wie aus einem Munde: "Das wollen wir gerne tun! Sag uns nur, wie wir es anfangen sollen!" -
Da flüsterte die Alte geheimnisvoll: "Ihr braucht bloß den goldenen Käfig mit der schwarzen Amsel drin aus dem Schlosse zu holen. Aber ihr dürft euch durch nichts aufhalten lassen und müßt euch beeilen; denn nur des Mittags beim zwölften Glockenschlag tut sich das Schloß für eine Stunde auf und kann die Befreiung gelingen. Wer mir den goldenen Käfig bringt, der bekommt das Schloß und alle Schätze, die es in seinen hundert Zimmern birgt." -
"Wir wollen das Los darüber entscheiden lassen, welcher von uns beiden das Schloß gewinnen soll", sagten die Brüder, und der, den es traf, machte sich sogleich auf den Weg in den dunkeln Wald. Er kam auch richtig schon nach kurzer Zeit vor das Schloßtor, und weil es gerade Mittag vom Turm schlug, konnte er mit dem zwölften Schlag ungehindert eintreten.
Er konnte nicht genug staunen über das prächtige Schloß und wollte sich erst einmal alle Räume genau ansehen. Seltsamerweise ließ sich kein menschliches Wesen blicken, wohl aber allerlei Getier des Waldes: Rehe, Hasen, Füchse und Vögel, die ihn alle zutraulich umdrängten. Während er mit den Tieren spielte, hörte er auf einmal eine so wunderschöne Musik, wie er in seinem Leben noch keine vernommen hatte. Er blieb stehen und lauschte und vergaß alle Zeit.
Plötzlich aber erdröhnte ein so mächtiger Schlag, daß er vor Schreck erbleichte und meinte, das Schloß stürze in sich zusammen. Zugleich aber fielen alle Türen ins Schloß und blieben verschlossen und er konnte nicht mehr ins Freie gelangen. Als er am folgenden Tage nicht zurückkam, sagte die Zauberin zu dem zweiten Prinzen:
"Nun kannst du dich auf den Weg machen und dein Glück probieren. Dein Bruder hat die rechte Stunde versäumt und das Schloß nicht aus seinem Zauber befreien können. Geh nun; du darfst dich aber ja nicht zu lange darin aufhalten!" - "Nein, das will ich nicht tun", sagte der Prinz und machte sich auf den Weg. Er kam auch bald und zur rechten Zeit zu dem Schloß und trat ein. Wie mußte er da staunen! Er ging von Zimmer zu Zimmer, spielte mit den Tieren und vernahm die wunderschöne Musik und konnte sich gar nicht satt daran hören. Da ging es ihm wie seine Bruder: er vergaß die Zeit, war plötzlich eingesperrt und konnte nicht mehr aus dem Schlosse kommen.
Am anderen Tag sagte die alte Zauberin zu der Prinzessin: "jetzt, mein Kind.. ist die Reihe an dir. Nun kannst du wieder gut machen, was deine Brüder versäumt haben, und kannst zugleich auch sie beide aus dem verzauberten Schloß befreien. Denke an die richtige Stunde und halte dich ja nicht zu lange darin auf!" Die Königstochter versprach, alles wohl zu beachten und ging ohne Furcht in den großen, dunkeln Wald hinein.
Als sie beim zwölften Stundenschlag durch das Tor trat, kamen ihr sogleich ihre Brüder entgegen und erzählten von dem Unglück, das ihnen widerfahren war. Doch sie gab ihnen kein Gehör und keine Antwort und eilte, ohne auf die schöne Musik zu hören, von einem Zimmer ins andere, bis sie endlich im allerletzten den goldenen Käfig mit der schwarzen Amsel fand. Schnell ergriff sie ihn und eilte damit zum Schloß hinaus.
Kaum aber war sie draußen, da geschah ein furchtbares Donnern und Dröhnen und viele Stimmen riefen durcheinander: "O Glück! - O Freude! Endlich ist die Stunde der Befreiung gekommen!" Alle die Tiere hatten ihre menschliche Gestalt wieder erlangt, kamen aus dem Schloß gegangen und bedankten sich von Herzen bei der Prinzessin. Ihre Brüder aber blieben bei ihr in dem Schloß, und sie waren nun alle drei überglücklich.
Von diesem Schlosse aber wurde in der ganzen Welt viel gesprochen; besonders von der Amsel in dem goldenen Käfig. Denn die konnte sprechen wie ein Mensch und wußte alles, was seit hundert Jahren geschehen war und in den nächsten hundert Jahren geschehen werde. Darum kamen oftmals Leute aus aller Herren Ländern, um die kluge Amsel zu befragen.
Auch König Meerfahrer, der noch immer im Kriege war, hörte von dem wunderbaren Vogel und gedachte ihn aufzusuchen, um aus seinem Munde die Wahrheit über das Vergangene zu erfahren, denn er hatte oft mit Trauer und Sehnsucht an seine geliebte Frau gedacht, die nun schon jahrelang - und, wer weiß, vielleicht unschuldig - auf seinen Befehl im Gefängnis schmachtete. Als er darum endlich Frieden schließen konnte, zog er auf seiner Heimfahrt durch den großen Wald und kehrte in dem Schlosse ein.
Da wurde er von seinen drei Kindern freundlich empfangen, ohne daß sie einander erkannten. Nachdem er sich an Brot und Wein gestärkt hatte, erkundigte er sich auch nach der Amsel und wünschte sie zu sehen und zu befragen. Da begleiteten ihn die Geschwister, in das Zimmer, in dem der goldene Käfig hing.
Kaum war der König eingetreten, so begrüßte ihn die Amsel mit, den Worten: "Willkommen, König Meerfahrer!" Der König blieb verwundert stehen und sagte: "Du kennst mich bei meinem Namen und Stand?" - "Ja, König Meerfahrer", antwortete die Amsel, "und ich kenne auch Euer Geschick und weiß Dinge, die Euren Augen verborgen sind." - "Oh, es sind schlimme und schreckliche Dinge, ich ahne es!" sagte der König und barg das Gesicht in seiner Rechten.
"Ihr Seid betrogen worden, damals, als Eure Mutter Euch den Brief ins Heerlager schrieb." - "Als meine Frau die drei ... ?" "ja, mein König, als Eure liebe und getreue Frau Euch die drei Kinder gebar. Keine Hunde waren es, wie die böse, alte Königin schrieb, sondern drei liebliche Kinder zwei Söhne und eine Tochter. Warum glaubtet Ihr Eurer Mutter, die die junge Königin nur haßte, weil sie arm und niederer Herkunft war?"
"Ach, ich Unglücklicher!" klagte der König. "Wie man berichtet wird, so richtet man! Falsch und böse wurde mir berichtet und falsch und böse habe ich darum auch gerichtet!" - "Es kann noch alles gut werden, König Meerfahrer", tröstete die Amsel. "Eure Frau ist ja noch am Leben." - "Und was ist aus meinen Kindern geworden?" fragte der König.
Da erzählte ihm die Amsel alles, so wie es geschehen war: wie der Müller die ausgesetzten Kinder gefunden und aufgezogen, wie sie mit fünfzehn Jahren heimlich davon gegangen seien und wie sie endlich hier im Walde das verwunschene Schloß und auch sie selber aus der Verwünschung befreit hätten. "Eure Tochter und Eure beiden Söhne aber, - sie stehen in diesem Augenblick vor Euch."
Da hättet ihr die Freude des Königs sehen sollen, als er seine Kinder in die Arme schloß und küßte, und wie die Kinder sich freuten, als sie zum ersten Male ihren Vater liebhaben durften! Der König bedankte sich von Herzen bei der Amsel, und die Tochter brachte sie nun im goldenen Käfig der alten Zauberin in den Wald hinaus. Wie aber erstaunte da die Prinzessin, als die Frau das Türchen des Käfigs öffnete und die Amsel heraushüpfte und sich in einen herrlichen jungen Königssohn verwandelte! Sie hatten einander lieb auf den ersten Blick, küßten sich und wanderten fröhlich zu dem Schloß zurück, in dem der Vater mit seinen Söhnen wartete.
Nun ritten sie alle so schnell sie konnten auf die heimatliche Burg. Des Königs erster Gang war ins Gefängnis. Mit eigener Hand schloß er die eiserne Tür auf, holte seine arme, unschuldige Frau aus dem dunkeln Verlies hervor und bat sie tausendmal um Verzeihung. Es war gut, daß die alte böse Königin gestorben war; denn nun konnte das Königspaar mit seinen Kindern von Herzen glücklich sein. Die Prinzessin aber hielt Hochzeit mit dem erlösten Königssohn und war durch das Schloß und die vielen Schätze, die darin angesammelt waren, die reichste Königin auf der ganzen Welt geworden.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
SCHÄFER VEIT UND DIE DREI RIESEN ...
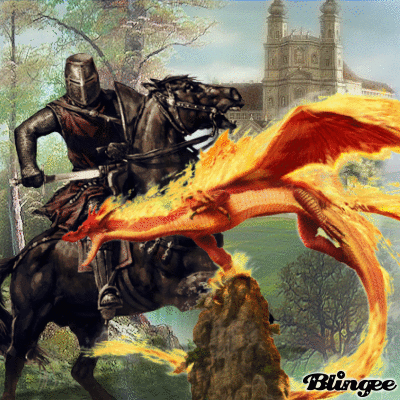
Es war einmal ein schönes, grünes Land, "das Land mit den drei Tälern" geheißen. Darin herrschte ein König, der wohnte in einem herrlichen Schloß, besaß eine große, große Schafherde und war reich an Gold und Schätzen aller Art. Und doch war er nicht glücklich; denn von Ahnenzeiten her lastete ein Fluch über dem königlichen Haus und seinem Besitztume: In den drei Tälern hausten drei Riesen, die wie wilde Wölfe die Schafe rissen, und am Tage, an dem die Königstochter achtzehn Jahre alt würde, sollte sie dem Teufel ausgeliefert werden.
So war der König schon jahrelang in großer Sorge, und die Zeit ging dahin, und er sah keine Rettung. Wenn nur erst einmal die drei Riesen unschädlich gemacht wären, vielleicht hätte dann zugleich auch der Teufel seine tückische Gewalt eingebüßt. Doch es sah noch gar nicht danach aus. So oft ein Schäfer die Herde in eines der drei Täler trieb, erschien ein Riese, zerriß die Tiere und brachte den Hirten um.
Zu jedem neuen Hirten, den er einstellte, sagte der König: "Du darfst überall hüten, nur nicht in den drei Tälern! Treibst du die Herde dort hin, so wird es dir schlecht gehen!" Alle Schäfer versprachen zwar, das Verbot zu beachten, konnten aber ihr Wort nie halten. "Einmal wenigstens will ich's versuchen und sehen, was Geheimnisvolles dahinter steckt!" dachte jeder, trieb in eines der drei Täler hinein und kam niemals wieder heraus.
So hatte der König auch wieder einmal alle seine Schafe mitsamt dem Schäfer verloren. Er kaufte sich aber gleich wieder eine Herde und suchte einen Hirten für sie. Schon am anderen Tag meldete sich ein junger, hübscher Bursche, Veit mit Namen. Er gefiel dem König gut, und so vertraute er ihm die Herde an. Der König erzählte dem Schäfer, wie es schon einigen seiner Vorgänger ergangen sei und warnte ihn, in eines der drei Täler zu gehen, wenn ihm sein Leben lieb sei.
Veit versprach, die Herde nicht dahin zu treiben, hütete auch eine Zeit lang die Schafe in einer anderen Gegend, und es geschah ihm kein Leid. Im stillen aber war er mit seinen Gedanken immer in den drei Tälern und dachte: "Ich möchte doch sehen, wer mir da etwas tun könnte! Ich wollte es niemand raten! Es sollt' ihm übel bekommen!"
Also zog er eines Tages mit seiner Herde in das eine Tal. Was wuchs da für ein fettes, saftig grünes Gras! Die Schafe taten sich gütlich und weideten bis gegen Abend, ohne daß ihnen etwas zugestoßen wäre. Mit einem mal aber kam aus der Felsschlucht ein gewaltiger Riese auf den Schäfer zu und rief: "Was suchst du hier mit deinen Grasmücken?" -
"Das geht dich nichts an!" sagte Veit. - "Das wollen wir gleich sehen!" brummte der Riese und griff nach seinem Schwert, um ihn zu erschlagen. Doch der Bursche war rascher bei der Hand, schlug ihm seine spitze Schippe auf den Kopf, daß er betäubt umfiel, sprang flink herzu und schlug so lange auf den Riesen ein, bis er tot liegen blieb. Hierauf nahm er ihm sein Schwert und seine Kleider ab und warf ihn ins dichte Gebüsch.
Wie nun aber der Schäfer nach seiner Herde Umschau hielt, sah er in dem Tale plötzlich ein schönes Schloß stehen. Verwundert ging er hinein und kam in ein prächtiges Zimmer. Auf einem gedeckten Tisch stand ein Krug voll Wein, und daneben lag ein Zettel, auf den die Worte geschrieben waren:
Wer diesen Krug austrinkt
und dieses Schwert regiert,
der zwingt den Teufel.
Das las der Schäfer, dachte sich nichts weiter dabei und ließ den Wein stehen. Er legte das Schwert und die Kleider des Riesen auf einen Stuhl im Zimmer und wanderte dann durch Gänge und Hallen, um all das Wunderbare zu betrachten. Im Stalle unten stand ein prächtiger Schimmel. Er ließ aber auch ihn da, wo er stand, verließ das seltsame Schloß und zog mit seinen Schafen heim.
Am anderen Morgen trieb Veit die Herde in das zweite Tal. Um sich besser wehren zu können, nahm er einen langen Spieß mit. Ein paar Stunden hatte er hier gehütet, da kam abermals ein Riese daher. Der war noch größer als der erste und rief: "Was suchst du hier mit deinen Grasmücken?" -
"Was geht's dich an?" antwortete Veit. - "Das will ich dir gleich zeigen!" sagte der Riese und zog sein Schwert. Der Schäfer war aber auf der Hut, nahm seinen Spieß und rannte gegen den Riesen an. Er traf ihn aber beim Stoß auf eine Rippe, so daß die Spitze nicht tief eindrang und dem Riesen nur wenig schadete. Schon schwang der Unhold sein Schwert, um dem Schäfer den Kopf abzuschlagen; da zog der Bursche blitzschnell seinen Spieß heraus und sprang zurück, so daß der Riese den Hieb in die Luft tat und zu Boden stürzte.
Im Augenblick sprang der Schäfer herzu und bohrte ihm den Spieß mitten ins Herz. Dann zog er ihm die Kleider aus, nahm sein Schwert an sich und warf ihn in das Gebüsch. Als sich Veit umwandte und zu seiner Herde zurück wollte, sah er mitten im Tal ein schönes Schloß vor sich stehen. Er ging hinein und kam in ein großes Zimmer. Auf einem Tisch stand ein Krug Wein und daneben lag ein Zettel mit den Worten:
Wer diesen Krug austrinkt
und dieses Schwert regiert,
der zwingt den Teufel.
Er las den Zettel, ließ den Wein unbeachtet stehen, legte die Kleider und das Schwert des Riesen auf einen Stuhl und besah sich das Schloß. Im Stalle unten stand wieder ein prächtiges Pferd; nur war es diesmal ein Fuchs, der sich hell wiehernd umwandte, als Veit die Stalltüre schloß, um zu seiner Herde zurückzukehren.
Am anderen Morgen zog er wieder hinaus. Da dachte er unterwegs: "Ei, ich möchte doch auch wissen, wie's in dem dritten Tal aussieht!" und schlug sogleich den Weg dorthin ein. Kaum hatte er das Tal betreten kam ihm ein ungeheurer Riese entgegen. Der hatte eine Haut so grob wie Eichenrinde und langes Moos wuchs in seinem Gesicht. Da wäre es dem Schäfer schier angst geworden; denn er hatte seine Waffen mitzunehmen vergessen.
Als aber der Riese brüllte: "Was willst du hier?!" besann er sich nicht lange, sagte: "Das sollst du gleich sehen!" und griff sich geschwind vom Wege drei spitze Steine zusammen. Die pfiffen dem Riesen pfeilschnell entgegen. Der erste traf ihn mitten auf die Brust, der zweite an den Hals, aus dem sogleich ein dicker Blutstrahl schoß; der dritte aber traf die linke Schläfe so gut, daß der Riese zusammenbrach und mausetot war.
Im gleichen Augenblick stand wieder ein prächtiges Schloß im Tale. In das trug der Schäfer das Schwert und die Kleider, die er dem Riesen abgenommen hatte, fand in einem Zimmer den Tisch mit dem Weinkrug und den Zettel mit dem Spruch daneben:
Wer diesen Krug austrinkt
und dieses Schwert regiert,
der zwingt den Teufel.
Doch er ließ alles stehen, rührte den Wein nicht an und sah bloß nach, ob im Stall drunten auch wieder ein Pferd stehe. Richtig, es stand wieder eines drin! Diesmal aber war es ein glänzender Rappe. Vergnügt zog der Schäfer nach Hause.
Nach einiger Zeit fragte der König den Schäfer: "Bist du auch schon in den drei Tälern gewesen?" - "Jawohl, ich bin dort gewesen!" antwortete Veit und wollte schon zu erzählen anfangen. Jedoch der König ließ ihn gar nicht zu Wort kommen; so böse war er darüber, daß der Schäfer sein Verbot nicht eingehalten hatte. Er wollte den Burschen auf der Stelle fortjagen.
Der aber bettelte und flehte, man solle ihn doch hier behalten, bis der König endlich nachgab und sprach: "Nun, so magst du bleiben und dem Gärtner helfen, Mist und Wasser zu tragen. Die Schafe kann ich dir aber nicht länger anvertrauen." So war nun also Veit Gärtnergehilfe geworden, und wenn er auch viel lieber die Schafe in den drei Tälern gehütet hätte, war er doch froh, daß er wenigstens am königlichen Hofe bleiben durfte.
Ein Jahr war unterdessen vergangen und der Tag herangekommen, an dem der König seine Tochter dem Teufel übergeben sollte. Darüber entstand große Trauer im Schlosse. Der König hatte vor Sorgen Tag und Nacht keine Ruhe mehr, fragte alle seine Minister und Hofherren um Rat, aber keiner wußte einen Ausweg. Zuletzt klagte er auch noch dem Gärtner seine Not; aber der wußte auch keinen Rat und erzählte die Geschichte seinem Gehilfen.
"Denke dir nur, Veit", erzählte er, "morgen muß der König die junge Prinzessin dem Teufel ausliefern. Wer da helfen könnte der hätte sein Glück gemacht." - "Wie war das?' fragte Veit und ließ sich die ganze Geschichte noch einmal erzählen. Da fielen ihm die drei Schlösser ein, und er dachte an den Spruch, den er in jedem auf dem Zettel gelesen hatte. Er hatte Mitleid mit der schönen Königstochter und nahm sich vor, sie um jeden Preis zu befreien.
Am nächsten Morgen ging er hinaus in das erste Tal begab sich ins Schloß und in das Zimmer und trank den Krug voll Wein aus. Dann hing er sich das Wams des Riesen um, obwohl es ihm viel zu weit und zu lang war und wie ein Mantel auf die Erde hing. Zuletzt nahm er das Schwert, bestieg den Schimmel und ritt auf den Berg, auf dem der Teufel die Jungfrau abholen wollte.
Als er dort ankam, war der König mit der Prinzessin schon da und meinte zuerst, es sei der Teufel, der da angeritten komme. Der aber erschien in der Gestalt einer Schlange und fuhr wild zischend auf den Reiter los. Veit zog das Riesenschwert, schwang es mit Wucht und schlug ihr den Kopf ab. Ohne ein Wort zu sprechen und ohne daß ihn jemand erkannt hatte, ritt er wieder fort nach dem Schloß im Tal, führte den Schimmel in den Stall, legte das Schwert und die Kleider des Riesen in das Zimmer und begab sich in den Garten an seine Arbeit.
Der König meinte, nun sei sein Kind erlöst und kehrte fröhlich mit ihm heim. Jedoch nach kurzer Zeit erschien der Teufel wieder und sagte: "Du mußt mit deiner Tochter morgen noch einmal auf den Berg kommen!" Nun war wieder großer Jammer im Schloß, und durch den Gärtner hörte auch der Gehilfe davon, daß der Teufel noch keine Ruhe gebe, obwohl er von einem fremden Reiter überwunden worden sei. Veit sagte nur: "So, so . . .," und tat weiter seine Arbeit.
Anderntags in aller Frühe begab sich Veit in das Schloß, das im zweiten Tale stand. Er trank den Krug aus, der auf dem Tisch stand, hing sich das Kleid und das Schwert des Riesen um, schwang sich auf den Fuchs und ritt wieder nach dem Berge. Diesmal erschien der Teufel als feuerspeiender Drache. Der Reiter kämpfte lange und erbittert mit ihm und spaltete ihm endlich mit dem scharfen Schwert den Kopf.
Darauf wandte er sogleich sein Roß, um in das Riesenschloß zurückzukehren. Da hörte er aus der Erde herauf eine Stimme dem König zurufen: "Morgen um die gleiche Zeit mußt du noch einmal mit deiner Tochter hierher kommen! Sonst wehe dir und deinem ganzen Geschlechte!" - "Schon ~echt! Ich werde aber auch dabei sein!" dachte Veit und ritt in das Schloß im Tal zurück, ohne daß ihn der König erkannt hatte.
Am anderen Morgen ging er in das dritte Schloß und trank den Wein, der dort auf dem gedeckten Tische stand. Dann bewaffnete er sich mit dem Wams und dem Schwert des Riesen, bestieg den Rappen und ritt dem Berge zu. Der König aber dachte: "Zweimal ist deine Tochter erlöst worden; doch wer weiß, was beim dritten Male geschehen könnte!", und wollte sich darum nicht mehr auf den Berg begeben.
Bald befiel ihn aber eine solche Angst und Unruhe, daß er nicht länger in seinem Schloß zu bleiben wagte und nun auch zum dritten Male die Prinzessin dem Teufel entgegenführte. Der kam diesmal als ein feuriger Greif durch die Luft gefahren und schoß wild auf den Reiter nieder. Nach langem Kampfe war endlich auch der grausige Greif besiegt. In dem Augenblick aber, in dem der Reiter dem Untier den Todesstoß gab, schlug ihm dieses mit einer Flügelspitze eine tiefe Wunde in die Hand.
Der König sprang eilends herzu, um zu helfen; doch ehe er noch Hand anlegen konnte, gab der Reiter seinem Pferd die Sporen und ritt davon. Als er im Schloß ankam, brachte er den Rappen in den Stall, legte das Kleid und das Schwert ins Zimmer und kehrte an den königlichen Hof zurück, als ob nichts vorgefallen wäre.
Am anderen Tag ging er in der Frühe in den Garten und an seine Arbeit. Nach einer Weile schmerzte ihn aber die Hand so sehr, daß er den Verband löste, um nach der Wunde zu sehen. Dabei überraschte ihn der König und fragte, woher er die Wunde habe. Da gestand ihm Veit alles: wie er die drei Riesen erlegt, in den drei Schlössern die Zettel und die Pferde angetroffen und durch den Wein und die Riesenschwerter den Teufel bezwungen habe.
Da dankte ihm der König tausendmal und sprach: "Weil du meine Tochter und mein Land von den Riesen befreit hast, so sollst du auch beide zum Lohne bekommen!" Nach sieben Tagen fand die Hochzeit statt. Vor allen Gästen drückte der alte König dem jungen Paare die goldenen Königskronen ins Haar, und die beiden regierten bis an ihr Ende glücklich und in Frieden im Land mit den drei Tälern.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
HUI, IN MEINEN SACK! ...
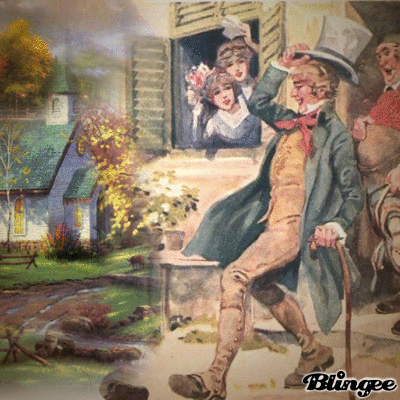
Ein armer Handwerksgeselle war schon lange auf der Wanderschaft und hatte nur noch drei Kreuzer in der Tasche. Während er so dahin schritt, vertrieb er sich ein wenig die Zeit, indem er die Kupfervögel gegeneinander klimpern ließ und im Takt dazu ein Liedlein pfiff. Dabei dachte er: "Was soll ich wohl mit ihnen anfangen? Große Sprünge kann ich nicht mit ihnen tun. Ich will mir dafür im nächsten Ort ein Päckchen Tabak kaufen, das ist das Beste; denn Rauchen vertreibt die Langeweile und den Hunger. " -
Er konnte in der Ferne schon die ersten roten Dächer zwischen den Obstbäumen leuchten sehen, da begegnete ihm ein anderer Handwerksbursche und bat ihn um eine kleine Gabe. "Du hast Glück, Kamerad", sagte er und gab ihm einen Kreuzer. Über eine kleine Weile kam ein zweiter daher und sprach ihn auch um eine Gabe an. - "Du hast mehr als Glück, Bruder", sagte er und drückte ihm den zweiten Kreuzer in die Hand. Es dauerte aber nicht lange, da begegnete ihm noch ein dritter und bat ihn um einen Zehrpfennig.
Da holte der arme Handwerksbursche den letzten Kreuzer aus seiner Tasche, ließ ihn in der offenen Hand blinken und sagte: "Du bist wahrhaftig ein Sonntagskind! Sieh her, das ist alles, was ich noch habe. Aber sei's drum; da hast du ihn." - Dieser dritte Bettler war aber niemand anders als Gott selbst, und er sagte zu dem freigebigen Handwerksburschen: "Zum Dank für deine Gabe will ich dir drei Wünsche gewähren; sag, was du wünschest und überlege es dir gut."
Da dachte der Handwerksbursche eine Weile nach und sagte: "So wünsch' ich zum ersten, daß mir der Tabak nie aus geht und gleich von selbst brennt, sobald ich die Pfeife in den Mund nehme. Zum anderen wünsche ich, daß alles in meinen Sack fahren muß, wenn ich rufe: ,Hui, in meinen Sack!' Mein dritter Wunsch aber ist ein hohes und geruhsames Alter." - "Es soll dir alles gewährt werden", sagte Gott, verabschiedete sich und ging weiter.
Der Handwerksbursche nahm gleich sein Haselholzpfeifchen aus der Tasche, steckte es in den Mund und fing an zu ziehen. Da glühte und dampfte es, daß es eine Lust war, und wie oft und wie lange er auch rauchte, der Tabak ging ihm nie aus. Am Abend kam er in eine Stadt, suchte ein gutes Wirtshaus und aß und trank, was ihm schmeckte. Am Nebentisch saßen reiche Kaufleute. Als sie ihre Zeche bezahlten und so verlockend blanke Goldstücke wechseln ließen, dachte der Handwerksbursche: "Du solltest doch einmal deinen Sack probieren!" und sprach leise vor sich hin: Hui, in meinen Sack!"
Im selben Augenblick spürte er auch schon, daß sein Sack schwerer geworden war. "Jetzt ist's gut! Jetzt bist du ein gemachter Mann!" dachte er und pfiff sich eins. Die Kaufleute. aber merkten nicht, was geschehen war. Auf diese Weise verschaffte sich der Handwerksbursche Geld, sooft es ihm ausging, und zog mit seiner qualmenden Tabakspfeife im Mund vergnügt durch die Welt.
Eines Tages, als er sich rechtschaffen müde gelaufen hatte, kam er noch spät in ein kleines Dorf und wollte im einzigen Wirtshaus übernachten. Doch alle Zimmer waren schon von Fremden besetzt. "Ach, ich bin so todmüde. Seid so gut, Herr Wirt, und beherbergt mich diese Nacht; ich will es Euch gut lohnen", bat der Handwerksbursche. Der Wirt aber sagte: "Es ist unmöglich. Ich wüßte im ganzen Haus kein Plätzchen, wo ich Euch hinlegen sollte. Einen Platz, ja, den hätte ich noch für Euch, drüben in dem alten Schloß, das ich vom Grafen gekauft habe; aber darin kann niemand übernachten." -
"Warum nicht?" fragte der Handwerksbursche. - "Weil keiner, der es am Abend betritt, am anderen Morgen wieder daraus hervor kommt!" - "Oh", sagte da lächelnd der Bursche, "laßt mich nur hinein; mir wird nichts geschehen." - "Wenn Ihr meint; ich halt' Euch nicht und wünsch' Euch für die Nacht alles Gute", sagte der Wirt und gab ihm den Schlüssel zum Schloß.
Der Bursche trat ohne Furcht ein, suchte sich das beste Zimmer aus, riegelte die Türe zu, legte sich ins Bett und schlief ein. Plötzlich, die Uhr schlug gerade Mitternacht, erwachte er: Ganz deutlich pochte es an die Tür. "Wer da?" fragte er; aber er bekam keine Antwort. Es klopfte nur um so heftiger draußen. Endlich sprang die Tür krachend auf und ein schreckliches Gespenst trat herein, kam mit gefletschten Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zerreißen.
Doch der Handwerksbursche war schnell besonnen, rief nur: "Hui, in meinen Sack!" - und schon saß das Gespenst mucksmäuschenstill in dem Sack und konnte nicht mehr heraus. Nun legte er sich wieder aufs Ohr und schlief ruhig bis zum anderen Morgen. Sobald er aber wach war und sich angezogen hatte, nahm er seinen Knotenstock und schlug damit so lange auf den Sack los, bis sich nichts mehr darin rührte.
"So, magst du meinethalben gewesen sein, wer du willst, - genug hast du auf jeden Fall!" sagte der Bursche und warf den Sack mitten hinein in den Schloßteich. Seit dieser Nacht hat sich das Gespenst in dem alten Schloß nicht wieder sehen lassen. Zum Dank dafür durfte der Handwerksbursche bei dem Wirt bleiben und hatte es sein Leben lang vollends gut bei ihm, und so ist ihm also auch sein dritter Wunsch in Erfüllung gegangen.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
HANS HOLT SICH EINE FRAU ...
Es waren einmal drei Brüder. Die zwei älteren waren ordentliche und kluge Burschen und hatten beide ein Handwerk erlernt; der jüngste aber, der Hans, war so dumm wie Bohnenstroh und zu nichts zu gebrauchen. Er lümmelte vom Morgen bis zum Abend nur im Hause herum und aß rein aus Langeweile jeden Tag einen Brotlaib auf, ganz zu schweigen von den vollen Tellern, die er zu Mittag verschlang. Aber man ließ den Hans ohne viel Aufhebens eben machen; denn er war doch ein gutmütiger Kerl.
Als nun die beiden älteren ihre Gesellenzeit hinter sich hatten und Meister geworden waren, wollten sie heiraten und sich in der Fremde eine Frau suchen. Da sagte die Mutter: "Nehmt nur auch gleich den Hans mit, denn allein kommt der doch nie zu einem Weib." Die Brüder hatten aber keine Lust, den dummen Hans auf die Reise mitzunehmen. Weil's die Mutter aber unbedingt haben wollte, ließen sie ihn endlich doch mitgehen. Sie verlangten aber, daß er ihnen überall und immer folgen müsse. Ja, das wolle er ganz gewiß tun, versprach Hans.
Nachdem sie eine Zeitlang gewandert waren, kamen sie in ein Dorf und wollten dort im Wirtshaus einkehren, weil sie wußten, daß der Wirt eine hübsche heiratsfähige Tochter hatte. Ehe sie eintraten, sagte darum der Älteste zu Hans: "Mach uns da drin ja keine Schande! Und iß nicht so viel wie zu Hause! Wenn ich an den Tischfuß klopfe, so ist dies das Zeichen, daß du aufhören sollst! Verstanden?" - "Ja", sagte Hans, "ich will gut achtgeben und mich danach richten."
Als sie nun in der Wirtsstube beim Essen saßen und Hans die Linsensuppe sich schmecken ließ, schlug der Hund, der unter den Tisch gekrochen war, mit dem Schwanz an einen der Tischfüße. Da meinte Hans, sein Bruder habe ihm das verabredete Zeichen gegeben, legte den Löffel weg und aß keinen Schub mehr, so sehr auch die Wirtin und ihre Tochter ihn dazu nötigten. Auch seine Brüder forderten ihn auf, er solle doch noch mehr essen. Aber Hans meinte, sie sagten nur so, damit die Wirtin nichts von dem geheimen Zeichen merken solle.
Er hatte aber wahrhaftig so wenig gegessen, daß ihm der Magen wie ein zorniger Hund knurrte. Und das wurde von Stunde zu Stunde schlimmer. Seine Brüder schwatzten und schäkerten mit dem Mädchen, und ihm wurde allmählich ganz schummerig vor den Augen. Als sie endlich gute Nacht gesagt hatten und in ihre Schlafkammer hinauf stiegen, sagte Hans: "Brüder, ich halte es nicht mehr aus vor Hunger; ich muß noch etwas zu essen haben." Da lachten sie und verspotteten ihn dazu noch, weil er sich von dem Hund hatte täuschen lassen.
Wenn er's aber gar nicht mehr aushalten könne vor Hunger, sagten sie, so solle er in die Küche gehen, dort stehe noch eine ganze Schüssel voll Linsen. Da ging Hans in die Küche hinunter, fand auch richtig die Linsenschüssel und aß sie mit der Hand rein aus. Dann kam er zu seinen Brüdern zurück und wollte sich am Bettuch die Hände und den Mund abwischen. "Du Igel! Was fällt dir denn ein? Geh erst an den Brunnen und wasche dich!" sagten sie.
Da ging Hans in den Hof und fand am Brunnen einen Krug, der mit Wasser gefüllt war. Er steckte eine Hand hinein und spülte sie darin ab. Weil er sie aber zur Faust geballt hatte, konnte er sie nicht mehr herausbringen; kam deshalb mitsamt dem Krug zu den Brüdern gelaufen und klagte seine Not. "O du ewige Einfalt!" sagten sie; "so zerschlag ihn doch am Brunnen, dann wirst du deine Hand schon wieder herausbringen!"
Hans tat, wie sie ihm befohlen; ging abermals zum Brunnen und schlug den Krug an den Steintrog, daß die Scherben klirrten. Da kam die schöne Wirtstochter aus dem Hause gelaufen, um zu sehen, was geschehen war. Hans aber nicht faul, faßte sie mit seinen starken Armen und trug sie schnell fort, zum Dorf hinaus, sie mochte schreien und sich wehren so sehr sie auch wollte.
Als er zu Hause ankam, trat er in die Stube und sagte: "Mutter, da hab' ich eine Frau!" Da konnte sich die Mutter über ihren Hans und seine schöne Braut nicht genug wundern. Dann stieg Hans zu seiner Schlafkammer hinauf, und das Mädchen mußte mit ihm gehen und sich neben ihn legen. Er schnarchte aber so schrecklich, daß der Armen angst und bange wurde, und sie dachte: "Ach, wär' ich nur schon wieder aus dem Haus und bei meiner Mutter! Wie mach' ich's nur, daß ich von hier fortkomme?"
Endlich, als auch die alte Mutter fest schlief, stand sie leise auf und schlich sich aus der Kammer. Sie suchte durch die Scheune und den Stall aus dem Hause zu kommen. Erst aber band sie die Ziege los, führte sie in die Kammer und legte sie neben den schnarchenden Hans ins Bett. Dann machte sie, daß sie fort kam.
Als die Mutter früh am andern Morgen aufwachte, rief sie: "Hans! Lieber Hans! Bist du schon wach?" Hans rieb sich die verschlafenen Augen und sagte: "Jaaa, Mutter." - "Hast du auch deine Frau noch?" -"Ich will mal fühlen!" sagte er und langte zur Seite. "ja, Mutter, ich hab' sie noch! Da liegt sie neben mir. Aber ... aber sie ist voller rauher Haare!" - "Ach, du Narr!", rief die Mutter, "das kommt dir nur so vor!" - "Nein, Mutter", sagte Hans, "ich habe noch einmal gefühlt; sie ist über und über voller Zotteln!" - "Ach, Hans, du bist nicht recht gescheit! Fühl' nur auch recht!" entgegnete die Mutter.
Da fühlte Hans noch einmal und sagte: "Ach, liebe Mutter, sie hat auch ein Horn!" - "Um Gottes willen!" rief da die Mutter. "Es wird doch nicht der Teufel sein!" -"Ach, Mutter, sie hat sogar zwei Hörner!" jammerte Hans und war ganz ratlos und verzweifelt. Da stand die Mutter auf, zündete ein Licht an und ging zu Hans in die Kammer. Da sah sie, daß es die Ziege war, die neben Hans im Bett lag, nahm sie am Halsband und führte sie wieder in den Stall hinunter. Hans aber sagte, er wolle sich's zur Warnung dienen lassen und es kein zweites Mal versuchen, sich eine Frau zu holen, wenn ihm schon die erste gleich wieder davon gelaufen sei.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
HANS OHNE SORGEN ...
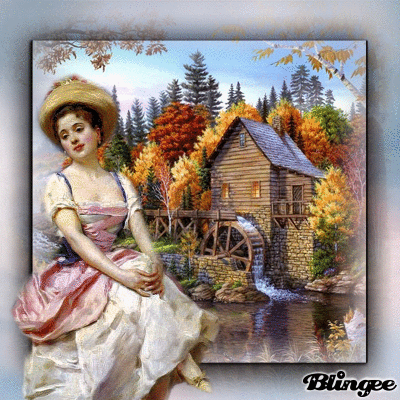
Vor langer Zeit lebte in Schwaben ein fröhlicher Müller. Der hatte über seine Haustüre die Worte geschrieben "Hans ohne Sorgen". Da ritt einmal der Herzog an seiner Mühle vorbei, las die Überschrift und dachte: "Wart, wenn du keine Sorgen hast, so will ich schon dafür tun!"
Er ließ den Müller zu sich rufen und sprach: "Auch du sollst erfahren, was Sorgen sind. Ich will dir ein Rätsel aufgeben. Kannst du das lösen, so ist's gut; kannst du es aber nicht, so sollst du nicht länger Herr auf deiner Mühle bleiben, sondern sie mir abtreten. Das Rätsel, das du lösen sollst, ist dies: Du mußt mich besuchen, nicht bei Tag und nicht bei Nacht, nicht nackt und nicht bekleidet, nicht zu Fuß und nicht zu Pferd." So sprach der Herzog und ritt weiter.
Der Müller zerbrach sich den Kopf bei Tag und bei Nacht, dachte hin und her und konnte das Rätsel nicht lösen, und je länger es ging, um so mehr war er in Sorge um seine Mühle. In seiner Not wandte er sich endlich an den Mahlknecht und sagte: "Kannst du mir das Rätsel lösen, so sollst du meine Tochter zur Frau bekommen und nach mir die Mühle erben!"
Dem Knecht schien das Rätsel nicht schwer. Kaum hatte er sich eine Weile besonnen, sagte er zu seinem Herrn: "Ei, so geht doch am Mittwoch zum Herzog! Denn der Mittwoch ist kein Tag, weil das Wörtchen ,Tag' in seinem Namen nicht vorkommt, und eine Nacht ist er ja auch nicht. Und wenn Ihr nicht nackt und nicht bekleidet sein sollt, ei, so hängt doch ein Fischernetz um! Sollt Ihr aber nicht zu Fuß und nicht zu Pferd kommen, ei, so reitet auf einem Esel hin!"
Da war der Müller wieder fröhlich und guter Dinge. Am nächsten Mittwoch hüllte er sich in ein Fischernetz und ritt auf einem Esel vors Schloß. Der Herzog war mit der Auflösung des Rätsels zufrieden und entließ Hans ohne Sorgen freundlich und mit den besten Wünschen. Als der Müller heimkam, verlobte er seine einzige Tochter mit dem Mahlknecht, und nicht lange hernach gab es eine fröhliche Hochzeit.
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE BERNSTEINFEE ...
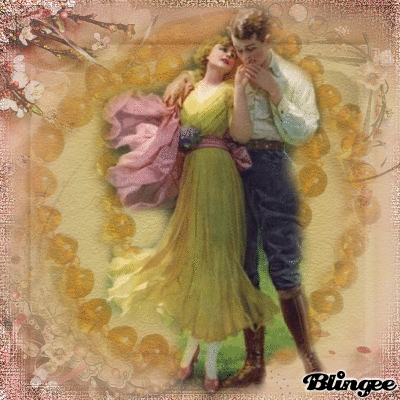
Ein großes Schiff verließ mit geblähten Segeln den Hafen an der Ostsee. Zum Abschied winkend, standen am Ufer die Seemannsfrauen mit ihren Kindern. Unter ihnen war ein junges, blondes Mädchen, Marie, die Tochter des Lotsen. Sie schwenkte ein Tuch in der Hand, denn ihre Abschiedsgrüße galten dem jungen Steuermann, dessen Braut sie seit einer Woche war. Guter Wind führte das Schiff bald auf die offene, weite See, bis es, immer kleiner werdend, verschwand.
Da erst kamen dem jungen Mädchen die Tränen, und es lief vom Weg ab in die Dünen, um allein zu sein. Das Abschiedsweh um ihren Bräutigam überkam sie so sehr, wie sie es vorher kaum vermutet hätte. In der einen Woche waren die beiden so recht von Herzen glücklich gewesen. Jetzt aber erfüllten das Mädchen Angst und Zweifel, ob sie ihn jemals wiedersehen werde, und das Geschwätz der Leute, daß ihr Verlobter wohl ein stattlicher, aber leichtfertiger junger Seemann sei, bedrückte sie.
Wie lange Marie dort so allein in den Dünen gesessen, wußte sie nicht, sie hatte sich wohl wie ein Kind in leichten Schlaf geweint. Sie erwachte erst, als am nachtdunklen Himmel schon Sterne funkelten. Leise fuhr der Wind durchs Dünengras.
Plötzlich wird Marie hellwach, eine Hand hat ihre Schulter berührt, und eine schöne Frauengestalt neigt sich zu ihr nieder. Ihr silbernes Kleid ist wie aus Mondstrahlen gewebt. Auf dem blonden Haar trägt sie eine Krone aus den goldenen Steinen des Meeres, die man Bernstein nennt. Von ihrem Hals löst sie eine Kette mit schönsten Perlen des golden schimmernden Bernsteins und reicht sie dem Mädchen mit den Worten:
»Weine nicht mehr, du junges Menschenkind, aus tiefem Herzeleid wird dir am Ende doch dein Lebensglück erblühen. Nimm diese Kette aus meinen Händen und wisse, ich bin die Bernsteinfee.«
Marie glaubte zu träumen, aber sie fühlte die Kette in ihren Händen, und innige Freude stieg in ihr auf, als sie die wunderbaren Perlen durch ihre Finger gleiten ließ. Als sie danken wollte, war die schöne Fee verschwunden. Das Mädchen stand auf und ging, ruhiger geworden, nach Hause. Ihre Eltern atmeten auf, als sie Marie endlich in die Stube treten sahen, denn sie hatten sie schon bei den Nachbarn gesucht.
Der junge Steuermann nahm den Abschied nicht schwer. Manchmal kam ein Brief von ihm, aber er schrieb immer vergnügt, und nie stand auch nur ein Wort von Sehnsucht nach seiner Braut darin. Dann verging ein Monat nach dem anderen, ohne daß Marie eine Nachricht von ihm erhielt. Von heimkehrenden Seeleuten hörte der Lotse eines Tages, der junge Steuermann sei in einem Hafen bei einem Vergnügen uns Leben gekommen. Er hatte mit den Eingeborenen Streit angefangen, den er mit dem Leben büßte. Marie betrauerte ihren Verlobten aufrichtig. Still tat sie jeden Tag ihre Arbeit im Hause ihrer Eltern.
Einmal kam ein neuer Lotse in das Haus, zur Unterstützung ihres Vaters. Er war jung und stark, und wenn es galt, Menschenleben aus Sturmesnot zu retten, setzte er sich mutig ein. Die jungen Mädchen putzten sich sonntags ordentlich heraus, um ihm zu gefallen, wenn es zum Tanze ging. Nur Marie blieb immer daheim. Ihr Vater schätzte aber seinen jungen, tüchtigen Kameraden sehr, so wie diesen hatte er sich immer einen Sohn gewünscht.
Der Winter hatte viel Eis und Schnee gebracht, und nun meldete sich der Frühling an mit Eisgang und mit Sturm. In diesem Jahre schien es schlimm zu werden. In mancher dunklen Nacht erscholl das Horn des Strandwächters und trieb die Menschen heraus. Eines Nachts stieg die Flut so weit, daß sie die Fischerkaten, nahe am Strande unterspülte. Die meisten Häuser standen höher, aber auch bis dahin stieg die Flut unter fortwährendem Heulen des Sturmes.
Marie war mit der Magd ständig draußen, um den Männern zu helfen, wenn sie mit Booten Frauen und Kinder, auch Hausrat und Vieh in Sicherheit brachten. Aber plötzlich merkten sie, daß das Wasser noch immer stieg und sie selbst nun auch gefährdet waren. Im Schein von Fackeln und Laternen versuchten sie, mit dem Nötigsten bis zur Kirche zu gelangen. Diese bot noch Schutz, weil sie am höchsten gelegen war und starke Mauern hatte.
In der Kirche suchte Marie nach der Mutter und der Großmutter, denn sie glaubte die beiden Frauen dort geborgen. Da hieß es auf einmal, vom Hause des Lotsen höre man noch Hilferufe von Frauen. Marie war wie gelähmt vor Entsetzen. Die ganze Nacht hatte sie den anderen mit allen Kräften geholfen. Wer hilft mir nun? dachte sie verzweifelt. Aber alle Menschen waren ermüdet und zermürbt und glaubten, das Rettungswerk sei vollendet.
Maries Vater wollte allein noch einmal das Boot ins dunkle, wogende Wasser bringen. Doch die anderen hielten ihn wortlos zurück, indem sie auf ein Boot wiesen, das mitten auf der Flut bereits seinem Hause zufuhr. Ohne ein Wort zu verlieren, hatte Knut, der junge Lotse, auf den Hilferuf der Frauen sein Boot sofort zu Wasser gebracht. Gewaltig schwankten die beiden Sturmlaternen auf und nieder, aber in letzter Minute gelang ihm die Rettung.
Kaum hatte er die beiden Frauen im Boot, da riß das tosende Wasser Türen und Treppen ein und spülte alles fort. So schlimm wie in diesem Jahr hatte die grausige Sturmflut lange nicht am Strande der Ostsee gewütet. Groß waren Schaden und Not. Aber sobald sich die Fluten verlaufen hatten, begannen die Menschen wieder aufzubauen.
Übers Jahr zu Pfingsten, als sich die Natur mit frischem Grün geschmückt hatte, sah das Fischerdorf ein junges, glückliches Paar, Knut und Marie. Der schönste Schmuck der Braut war eine Bernsteinkette aus herrlich glänzenden Perlen, das Geschenk der Bernsteinfee. Am Abend führte Marie ihren Mann zu der Stelle in den Dünen, wo ihr die Fee erschienen war. Wieder war ihr, als hörte sie es im hohen Dünengras leise rauschen und flüstern:
»Wer ihn trägt, des Meeres goldnen Stein,
wird nimmermehr vom Glück verlassen sein.«
Der Wunsch der Bernsteinfee war in Erfüllung gegangen, aus Not und tiefem Herzeleid war doch noch ihr Lebensglück erblüht.
eine Sage vom Ostseestrand
VOM HANDWERKSBURSCHEN, DER MIT DREIHUNDERT GULDEN IN DEN HIMMEL RITT ...

Es war einmal eine Wirtin, der war ihr erster Mann gestorben; weil sie aber nicht ihr Lebtag vollends allein bleiben wollte, hatte sie wieder geheiratet. Als sie das erste Mittagessen für ihren zweiten Mann zurichtete, fragte sie ihn: "Was soll ich kochen?" -
"Koch meinethalben Apfelschnitz und Speck!" erwiderte er. Sie tat nach seinem Willen, und weil sie meinte, das sei seine Leibspeise, so kochte sie tagaus, tagein nichts anderes als Apfelschnitz und Speck. Das ewige Einerlei wurde aber dem Mann allmählich doch zu dumm und darum sagte er eines Tages: "Nun koch auch einmal etwas anderes und heb die Schnitz auf, bis der lange Frühling kommt!", ließ die dampfende Schüssel stehen und ging verärgert aus dem Hause.
Während er aber zur Hintertür hinausging, trat vorn ein Fremder in die Wirtsstube. Der war lang und dürr wie eine Hopfenstange und begehrte rasch etwas zu essen, weil er von seiner langen und beschwerlichen Wanderschaft einen Riesenhunger im Bauche habe. - "Seid Ihr am Ende der lange Frühling, für den ich Schnitz und Speck aufbewahren soll?" fragte die Wirtin. -
"Freilich bin ich der!" antwortete der fahrende Handwerksgeselle. "Tragt nur gleich auf; ich will mir beides wohl schmecken lassen!" Da stellte die Wirtin die volle Schüssel vor ihn auf den Tisch und gab ihm, als er satt war, auch noch den ganzen Vorrat an Speck und Apfelschnitz mit auf den Weg. "Vielen Dank auch, gute Frau Wirtin!" sagte der Geselle, warf sein Felleisen über die Schulter und trat auf die Straße hinaus.
"Die hat die Gescheitheit auch nicht mit Löffel gefressen! Mit Witz und Schläue wäre von der gewiß noch mancherlei zu ergattern, was ich gut brauchen könnte!" dachte der pfiffige Bursche bei sich und sann im Handumdrehen einen Streich aus: Er ging noch einige Schritte den Weg entlang, blieb dann plötzlich stehen und sah senkrecht über sich in die Höhe, und starrte und starrte immer auf einen Punkt, als wolle er ein Loch in den Himmel gucken.
Und wahrhaftig! - es dauerte gar nicht lange, da kam die Wirtin voller Neugier zu ihm auf die Straße heraus und fragte: "Was guckt Ihr denn so angestrengt in die Luft?" - "Psst ... !" machte der Handwerksbursche und legte den Finger auf den Mund. "Ich soll ja zu keinem Menschen davon sprechen; aber Euch, Frau Wirtin, will ich's sagen: Ich kam, ehe ich in Eure Wirtsstube trat, geradeswegs vom Himmel herunter und will mir nun die Stelle genau merken, wo ich herabgestiegen bin, damit ich später den Weg hinauf wiederfinde." -
"Was?" sagte da die Wirtin und ließ vor Staunen den Mund offen stehen - "Was habt Ihr gesagt: vom Himmel herunter?" - "-Ei freilich!" entgegnete der Schalk. -"Habt Ihr da am Ende auch meinen seligen ersten Mann-, den Hansjörg, gesehen?" - "Ha, das versteht sich, daß ich den gesehen habe. Den kenn' ich sogar sehr gut; wir sind gute Freunde, der Hansjörg und ich." -
"O du mein! jetzt sag' ich aber gar nichts mehr! Ja, wie geht's ihm denn?" -"Ach, soso lala ... Nicht gerade am besten", entgegnete er mit ernster Miene. -'"Ach Gott, ist er gar wohl krank?" fragte die Wirtin besorgt. -
"Krank? Nein, krank ist er nicht. Aber er hat's schwer droben. Er muß viel schaffen; der Lohn ist schlecht, und so hat er die meiste Zeit kein Geld, um sich neues Zeug zu kaufen. Als ich ihn das letztemal sah, hatte er ein arg zerrissenes Hemd am Leibe. Der Himmelswind kam gerade vom kalten Osten hergebraust, und so. zitterte er - wahrhaftig und wahr - vor Frost wie Espenlaub." -
"Oh, daß Gott sich erbarm! So übel dran ist er also, mein lieber, guter Hansjörg selig! Wie gern wollt' ich ihm was zukommen lassen in seinem Himmel droben; aber wie machen?" - "Ei, liebe Frau Wirtin", meinte drauf der Geselle, "da ist leicht Rat schaffen: Ich gehe nächstens wieder zurück und kann ihm schon dieses und jenes mitnehmen, das Ihr ihm schicken wollt. " -
"Wie dank' ich Euch für Eure Freundlichkeit, lieber Herr! Ihr dürft's gewißlich nicht umsonst,tun!" sagte die Frau und packte in einen Schnappsack einen guten Anzug, sechs Hemden, Schuhe und Strümpfe und dazu einen mächtigen Schinken von der letzten Metzelsuppe.
"So, und in diesem Lederbeutel sind dreihundert Gulden für meinen Hansjörg, daß er sich dafür das Notwendigste kaufen und am Sonntag auch einkehren und einen Schoppen trinken kann. Diese fünfzig Gulden da sind für Euch, lieber Herr; verbraucht sie gesund." -"Das will ich, gute Frau!" sagte lachend der Handwerksgeselle und zog fröhlich weiter.
Als der Wirt nach Hause kam -und von seiner Frau erfuhr, was vorgefallen war, schimpfte er sie tüchtig aus und nannte sie eine dumme Kätter. "Einem hergelaufenen Lüdrian einen Packen Zeugs in den Himmel mitgeben und gar noch dreihundert Gulden schönes Geld, - hat man so etwas schon gehört! Das Geld muß wieder her, und wenn ich dem Bruder bis ans Himmelstor nachlaufen müßte!" Er wollte ihn aber lieber schon nach einer Stunde einfangen, und darum sattelte er sein bestes Pferd und jagte im Galopp den Weg entlang, den der Geselle eingeschlagen hatte.
Der saß gerade am Waldrand im Schatten, um sich ein wenig zu verschnaufen. Als er den Reiter daher sprengen sah, ahnte ihm gleich nichts Gutes. "Das ist sicher der Wirt, der mir den vollen Schnappsack wieder abjagen will!" dachte er und sann gleich einen neuen Streich aus: Er riß den dürren, stachligen Kopf einer Distel ab, warf ihn ins Gras, stülpte seinen Hut darüber und tat so, als ob irgend etwas Seltsames und Kostbares darunter verborgen sei, das er sorgsam bewachen müsse.
Inzwischen kam der Wirt angeritten und fragte ihn, ob er der Mann sei, der in den Himmel reise. "ja, der bin ich!" antwortete der Geselle. "Habt Ihr vielleicht auch was an jemand mitzugeben?" - "O nein; das könnte Euch so gefallen! Im Gegenteil: gebt mir ja auf der Stelle die dreihundert Gulden heraus, die mein Weib Euch für ihren ersten Mann mitgegeben hat!" -
"Wie Ihr wollt", sagte der Geselle; "mir kann es einerlei sein, ob der Hansjörg die dreihundert Gulden bekommt oder nicht. Wollt Ihr sie wieder zurück haben, gut, so brauch' ich sie schon nicht zu tragen. Nur müßt Ihr ein wenig warten. Ich habe da nämlich vorhin unter meinem Hut einen seltenen und teuren Vogel gefangen - er ist unter Brüdern gut seine fünfhundert Gulden wert!" -
"Was Ihr nicht sagt!" unterbrach ihn da der Wirt; "einen Vogel, der fünfhundert Gulden wert ist? ja gibt es denn hierzulande so was?" - "ja, das gibt's. Und man muß schon Glück haben, einen solchen Vogel zu fangen! Daß er mir aber nicht mehr entwischt, habe ich meinen Freund in die Stadt geschickt, einen schönen Käfig zu kaufen. Damit ich nun nachher nicht so viel zu schleppen brauche, habe ich ihm die dreihundert Gulden gleich mitgegeben; er solle sie einstweilen einem Wechsler zum Aufbewahren bringen.
Wenn es Euch aber zu lange dauern sollte, bis er wieder aus der Stadt zurück ist, so wüßt ich Euch einen Vorschlag zu machen." - "Und der wäre?"- "Ihr paßt an meiner Stelle auf den Hut auf und leiht mir Euer Pferd, damit ich meinem Freund schnell nachreiten und Euch das Geld zurückholen kann." -
"Ihr scheint mir ein kluger Kopf zu sein", sagte der Wirt. "Ich bin mit Eurem Vorschlag gern einverstanden." Setzte sich also als Wächter neben den Hut und ließ den Gesellen das Pferd besteigen und davon reiten. Und der ritt schon, daß die Funken stoben; - könnt's euch ja wohl denken!
Da hockte er nun, der dicke dumme Wirt, eine Stunde und noch eine, und hockte auch noch, als die Sonne schon hinter den Bergen unter ging. Er wartete, bis die Nacht hereinbrach - und immer noch ließ sich kein Reiter sehen. "Ich will heimgehen und morgen in der Frühe wiederkommen. Den Vogel aber will ich als Pfand mitnehmen", dachte er; hob vorsichtig den Hut, griff mit der Hand darunter und -- fuhr mit einem lauten Schmerzensschrei zurück, denn er hatte tüchtig in die Stacheln der Distel gegriffen.
Da merkte er endlich, daß er selber dem Lüdrian auf den Leim gegangen war, und kehrte recht betrübt und kleinlaut nach Hause zurück. Als seine Frau wissen wollte, ob er das Geld wieder bekommen und wo er denn das Pferd gelassen habe, sagte er nur: "Frag mich nicht danach! Heute nicht und morgen nicht und meiner Lebtag nie! Du bist dumm, aber ich bin noch dümmer! Der einzige Gescheite ist der, der mit deinem vollen Schnappsack und deinen dreihundert Gulden auf meinem Pferd in den Himmel reitet. Wir zwei sind durch Schaden klug, er aber ist durch unsere Dummheit reich geworden."
Schwäbische Volksmärchen - Franz Georg Brustgi
DIE REGENTRUDE ...
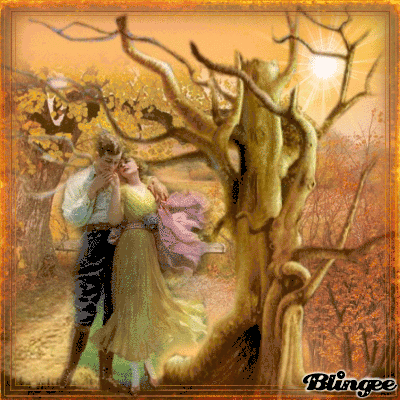
Einen so heißen Sommer, wie nun vor hundert Jahren, hat es seitdem nicht wieder gegeben. Kein Grün fast war zu sehen; zahmes und wildes Getier lag verschmachtet auf den Feldern.
Es war an einem Vormittag. Die Dorfstraßen standen leer; wer nur konnte, war ins Innerste der Häuser geflüchtet; selbst die Dorfkläffer hatten sich verkrochen.
Nur der dicke Wiesenbauer stand breitspurig in der Torfahrt seines stattlichen Hauses und rauchte im Schweiße seines Angesichts aus seinem großen Meerschaumkopfe. Dabei schaute er schmunzelnd einem mächtigen Fuder Heu entgegen, das eben von seinen Knechten in die Diele gefahren wurde. –
Er hatte vor Jahren eine bedeutende Fläche sumpfigen Wiesenlandes um einen geringen Preis erworben, und die letzten dürren Jahre, welche auf den Feldern seiner Nachbarn das Gras versengten, hatten ihm die Scheuern mit duftendem Heu und den Kasten mit blanken Krontalern gefüllt.
So stand er auch jetzt und rechnete, was bei den immer steigenden Preisen der Überschuß der Ernte für ihn einbringen könne. »Sie kriegen alles nichts«, murmelte er, in dem er die Augen mit der Hand beschattete und zwischen den Nachbarsgehöften hindurch in die flimmernde Ferne schaute; »es gibt gar keinen Regen mehr in der Welt.« Dann ging er an den Wagen, der eben abgeladen wurde; er zupfte eine Handvoll Heu heraus, führte es an seine breite Nase und lächelte so verschmitzt, als wenn er aus dem kräftigen Duft noch einige Krontaler mehr heraus riechen könne.
In dem selben Augenblicke war eine etwa fünfzigjährige Frau ins Haus getreten. Sie sah blaß und leidend aus, und bei dem schwarz seidenen Tuche, das sie um den Hals gesteckt trug, trat der bekümmerte Ausdruck ihres Gesichtes nur noch mehr hervor. »Guten Tag, Nachbar«, sagte sie, in dem sie dem Wiesenbauer die Hand reichte, »ist das eine Glut; die Haare brennen einem auf dem Kopfe!«
»Laß brennen, Mutter Stine, laß brennen«, erwiderte er, »seht nur das Fuder Heu an! Mir kann es nicht zu schlimm werden!« »Ja, ja, Wiesenbauer, Ihr könnt schon lachen; aber was soll aus uns anderen werden, wenn das so fortgeht!« Der Bauer drückte mit dem Daumen die Asche in seinen Pfeifenkopf und stieß ein paar mächtige Dampfwolken in die Luft. »Seht Ihr«, sagte er, »das kommt von der Überklugheit. Ich hab es ihm immer gesagt; aber Euer Seliger hat es allweg besser verstehen wollen. Warum mußte er all sein Tiefland vertauschen! Nun sitzt Ihr da mit den hohen Feldern, wo Eure Saat verdorrt und Euer Vieh verschmachtet.«
Die Frau seufzte. Der dicke Mann wurde plötzlich herablassend. »Aber, Mutter Stine«, sagte er, »ich merke schon, Ihr seid nicht von ungefähr her gekommen; schießt nur immer los, was Ihr auf dem Herzen habt!« Die Witwe blickte zu Boden. »Ihr wißt wohl«, sagte sie, »die fünfzig Taler, die Ihr mir geliehen, ich soll sie auf Johanni zurückzahlen, und der Termin ist vor der Tür.«
Der Bauer legte seine fleischige Hand auf ihre Schulter. »Nun macht Euch keine Sorge, Frau! Ich brauche das Geld nicht; ich bin nicht der Mann, der aus der Hand in den Mund lebt. Ihr könnt mir Eure Grundstücke dafür zum Pfand einsetzen; sie sind zwar nicht von den besten, aber mir sollen sie diesmal gut genug sein. Auf den Sonnabend könnt Ihr mit mir zum Gerichtshalter fahren.«
Die bekümmerte Frau atmete auf. »Es macht zwar wieder Kosten«, sagte sie, »aber ich danke Euch doch dafür.« Der Wiesenbauer hatte seine kleinen klugen Augen nicht von ihr gelassen. »Und«, fuhr er fort, »weil wir hier einmal beisammen sind, so will ich Euch auch sagen, der Andrees, Euer Junge, geht nach meiner Tochter!«
»Du lieber Gott, Nachbar, die Kinder sind ja miteinander aufgewachsen!« »Das mag sein, Frau; wenn aber der Bursche meint, er könne sich hier in die volle Wirtschaft ein freien, so hat er seine Rechnung ohne mich gemacht!« Die schwache Frau richtete sich ein wenig auf und sah ihn mit fast zürnenden Augen an. »Was habt Ihr denn an meinem Andrees auszusetzen?« fragte sie.
»Ich an Eurem Andrees, Frau Stine? – Auf der Welt gar nichts! Aber« – und er strich sich mit der Hand über die silbernen Knöpfe seiner roten Weste – »meine Tochter ist eben meine Tochter, und des Wiesenbauers Tochter kann es besser belaufen.« »Trotzt nicht zu sehr, Wiesenbauer«, sagte die Frau milde, »ehe die heißen Jahre kamen –!«
»Aber sie sind gekommen und sind noch immer da, und auch für dies Jahr ist keine Aussicht, daß Ihr eine Ernte in die Scheuer bekommt. Und so geht es mit Eurer Wirtschaft immer weiter rückwärts.« Die Frau war in tiefes Sinnen versunken; sie schien die letzten Worte kaum gehört zu haben. »Ja«, sagte sie, »Ihr mögt leider recht behalten, die Regentrude muß eingeschlafen sein; aber – sie kann geweckt werden!«
»Die Regentrude?« wiederholte der Bauer hart. »Glaubt Ihr auch an das Gefasel?« »Kein Gefasel, Nachbar!« erwiderte sie geheimnisvoll. »Meine Urahne, da sie jung gewesen, hat sie selber einmal aufgeweckt. Sie wußte auch das Sprüchlein noch und hat es mir öfters vorgesagt, aber ich habe es seither längst vergessen.«
Der dicke Mann lachte, daß ihm die silbernen Knöpfe auf seinem Bauche tanzten. »Nun, Mutter Stine, so setzt Euch hin und besinnt Euch auf Euer Sprüchlein. Ich verlasse mich auf mein Wetterglas, und das steht seit acht Wochen auf beständig Schön!« »Das Wetterglas ist ein totes Ding, Nachbar; das kann doch nicht das Wetter machen!« »Und Eure Regentrude ist ein Spukeding, ein Hirngespinst, ein Garnichts!« »Nun, Wiesenbauer«, sagte die Frau schüchtern, »Ihr seit einmal einer von den Neugläubigen!«
Aber der Mann wurde immer eifriger. »Neu- oder altgläubig!« rief er, »geht hin und sucht Eure Regenfrau und sprecht Euer Sprüchlein, wenn Ihr es noch beisammen kriegt! Und wenn Ihr binnen heut und vierundzwanzig Stunden Regen schafft, dann –!« Er hielt inne und paffte ein paar dicke Rauchwolken vor sich hin. »Was dann, Nachbar?« fragte die Frau. »Dann – – dann – zum Teufel, ja, dann soll Euer Andrees meine Maren freien!«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Wohnzimmers, und ein schönes schlankes Mädchen mit rehbraunen Augen trat zu ihm auf die Durchfahrt hinaus. »Topp, Vater«, rief sie aus, »das soll gelten!« Und zu einem ältlichen Manne gewandt, der eben von der Straße her ins Haus trat, fügte sie hinzu: »Ihr habt es gehört, Vetter Schulze!«
»Nun, nun, Maren«, sagte der Wiesenbauer, »du brauchst keine Zeugen gegen deinen Vater aufzurufen; von meinem Wort da beißt dir keine Maus auch nur ein Titelchen ab.« Der Schulze schaute indes, auf seinen langen Stock gestützt, eine Weile in den freien Tag hinaus; und hatte nun sein schärferes Auge in der Tiefe des glühenden Himmels ein weißes Pünktchen schwimmen sehen, oder wünschte er es nur und glaubte es deshalb gesehen zu haben, aber er lächelte hinterhältig und sagte: »Mög es Euch bekommen, Vetter Wiesenbauer, der Andrees ist allewege ein tüchtiger Bursch!«
Bald darauf, während der Wiesenbauer und der Schulze in dem Wohnzimmer des erstern über allerlei Rechnungen beisammen saßen, trat Maren an der anderen Seite der Dorfstraße mit Mutter Stine in deren Stübchen. »Aber Kind«, sagte die Witwe, in dem sie ihr Spinnrad aus der Ecke holte, »weißt du denn das Sprüchlein für die Regenfrau?«
»Ich?« fragte das Mädchen, in dem sie erstaunt den Kopf zurück warf. »Nun, ich dachte nur, weil du so keck dem Vater vor die Füße tratst.« »Nicht doch, Mutter Stine, mir war nur so ums Herz, und ich dachte auch, Ihr selber würdet es wohl noch beisammen bekommen. Räumt nur ein bissel auf in Eurem Kopfe; es muß ja noch irgendwo verkramt liegen!«
Frau Stine schüttelte den Kopf. »Die Urahn ist mir früh gestorben. Das aber weiß ich wohl noch, wenn wir damals große Dürre hatten, wie eben jetzt, und uns dabei mit der Saat oder dem Viehzeug Unheil zuschlug, dann pflegte sie wohl ganz heimlich zu sagen: ›Das tut der Feuermann uns zum Schabernack, weil ich einmal die Regenfrau geweckt habe!«
»Der Feuermann?« fragte das Mädchen, »wer ist denn das nun wieder?« Aber ehe sie noch eine Antwort erhalten konnte, war sie schon ans Fenster gesprungen und rief: »Um Gott, Mutter, da kommt der Andrees; seht nur, wie verstürzt er aussieht!« Die Witwe erhob sich von ihrem Spinnrad: »Freilich, Kind«, sagte sie niedergeschlagen, »siehst du denn nicht, was er auf dem Rücken trägt? Da ist schon wieder eins von den Schafen verdurstet.«
Bald darauf trat der junge Bauer ins Zimmer und legte das tote Tier vor den Frauen auf den Estrich. »Da habt ihr es!« sagte er finster, indem er sich mit der Hand den Schweiß von der heißen Stirn strich. Die Frauen sahen mehr in sein Gesicht als auf die tote Kreatur. »Nimm dir es nicht so zu Herzen, Andrees!« sagte Maren. »Wir wollen die Regenfrau wecken, und dann wird alles wieder gut werden.«
»Die Regenfrau!« wiederholte er tonlos. »Ja, Maren, wer die wecken könnte! – Es ist aber auch nicht wegen dem allein; es ist mir etwas widerfahren draußen.« – Die Mutter faßte zärtlich seine Hand. »So sag es von dir«, ermahnte sie, »damit es dich nicht siech machte!« »So hört denn!« erwiderte er. –
»Ich wollte nach unseren Schafen sehen und ob das Wasser, das ich gestern Abend für sie hinauf getragen, noch nicht verdunstet sei. Als ich aber auf den Weideplatz kam, sah ich so gleich, daß es dort nicht seine Richtigkeit habe; der Wasserzuber war nicht mehr, wo ich ihn hingestellt, und auch die Schafe waren nicht zu sehen. Um sie zu suchen, ging ich den Rain hinab bis an den Riesenhügel.
Als ich auf die andere Seite kam, da sah ich sie alle liegen, keuchend, die Hälse lang auf die Erde gestreckt; die arme Kreatur hier war schon krepiert. Daneben lag der Zuber umgestürzt und schon gänzlich ausgetrocknet. Die Tiere konnten das nicht getan haben; hier mußte eine böswillige Hand im Spiele sein.«
»Kind, Kind«, unterbrach ihn die Mutter, »wer sollte einer armen Witwe Leides zufügen!«
»Hört nur zu, Mutter, es kommt noch weiter. Ich stieg auf den Hügel und sah nach allen Seiten über die Ebene hin; aber kein Mensch war zu sehen, die sengende Glut lag wie alle Tage lautlos über
den Feldern. Nur neben mir auf einem der großen Steine, zwischen denen das Zwergenloch in den Hügeln hinabgeht, saß ein dicker Molch und der sonnte seinen häßlichen Leib.
Als ich noch so halb ratlos, halb ingrimmig um mich her starrte, hörte ich auf einmal hinter mir von der anderen Seite des Hügels her ein Gemurmel, wie wenn einer eifrig mit sich selber redet, und als ich mich umwende, sehe ich ein knorpsiges Männlein im feuerroten Rock und roter Zipfelmütze unten zwischen dem Heidekraut auf und ab stapfen. – Ich erschrak mich, denn wo war es plötzlich hergekommen! –
Auch sah es gar so arg und mißgeschaffen aus. Die großen braunroten Hände hatte es auf dem Rücken gefaltet, und dabei spielten die krummen Finger wie Spinnenbeine in der Luft. Ich war hinter den Dornbusch getreten, der neben den Steinen aus dem Hügel wächst, und konnte von hier aus alles sehen, ohne selbst bemerkt zu werden.
Das Unding drunten war noch immer in Bewegung; es bückte sich und riß ein Bündel versengten Grases aus dem Boden, daß ich glaubte, es müsse mit seinem Kürbiskopf vornüber schießen; aber es stand schon wieder auf seinen Spindelbeinen, und in dem es das dürre Kraut zwischen seinen großen Fäusten zu Pulver rieb, begann es so entsetzlich zu lachen, daß auf der anderen Seite des Hügels die halbtoten Schafe aufsprangen und in wilder Flucht an dem Rain hinunterjagten.
Das Männlein aber lachte noch gellender, und dabei begann es von einem Bein auf das andere zu springen, daß ich fürchtete, die dünnen Stäbchen müßten unter seinem klumpigen Leibe zusammenbrechen. Es war grauenvoll anzusehen, denn es funkelte ihm dabei ordentlich aus seinem kleinen schwarzen Augen.«
Die Witwe hatte leise des Mädchens Hand gefaßt. »Weißt du nun, wer der Feuermann ist?« sagte sie. Maren nickte. »Das aller grausenhafteste aber«, fuhr Andrees fort, »war seine Stimme. ›Wenn sie es wüßten, wenn sie es wüßten!‹ schrie er, ›die Flegel, die Bauerntölpel!‹ Und dann sang er mit seiner schnarrenden, quäkenden Stimme ein seltsames Sprüchlein; immer von vorn nach hinten, als könne er sich gar daran nicht ersättigen. Wartet nur, ich bekomm es wohl noch beisammen!«
Und nach einigen Augenblicken fuhr er fort:
»Dunst ist die Welle,
Staub ist die Quelle!«
Die Mutter ließ plötzlich ihr Spinnrad stehen, das sie während der Erzählung eifrig gedreht hatte, und sah ihren Sohn mit gespannten Augen an. Der aber schwieg wieder und schien sich zu
besinnen. »Weiter!« sagte sie leise. »Ich weiß nicht weiter, Mutter; es ist fort, und ich hab es mir unterwegs doch wohl hundertmal vorgesagt.« Als aber Frau Stine mit unsicherer
Stimme selbst fortfuhr:
»Stumm sind die Wälder,
Feuermann tanzet über die Felder!«
da setzte er rasch hinzu:
Nimm dich in acht!
Eh du erwacht,
Holt dich die Mutter
Heim in die Nacht!«
»Das ist das Sprüchlein der Regentrude!« rief Frau Stine; »und nun rasch noch einmal! Und du, Maren, merk wohl auf, damit es nicht wiederum verloren geht!« Und nun sprachen Mutter und Sohn noch einmal zusammen und ohne Anstoß:
Dunst ist die Welle,
Staub ist die Quelle!
Stumm sind die Wälder,
Feuermann tanzet über die Felder!
Nimm dich in acht!
Eh du erwacht,
Holt dich die Mutter
Heim in die Nacht!«
»Nun hat alle Not ein Ende!« rief Maren; »nun wecken wir die Regentrude; morgen sind alle Felder wieder grün, und übermorgen gibt es Hochzeit!« Und mit fliegenden Worten und glänzenden Augen erzählte sie dem Andrees, welches Versprechen sie dem Vater abgewonnen habe. »Kind«, sagte die Witwe wieder, »weißt du denn auch den Weg zur Regentrude?« »Nein, Mutter Stine; wißt Ihr denn auch den Weg nicht mehr?«
»Aber, Maren, es war ja die Urahne, die bei der Regentrude war; von dem Wege hat sie mir niemals was erzählt.« »Nun, Andrees«, sagte Maren und faßte den Arm des jungen Bauern, der während dessen mit gerunzelter Stirn vor sich hin gestarrt hatte, »so sprich du! Du weißt ja sonst doch immer Rat!« »Vielleicht weiß ich auch jetzt wieder einen«, entgegnete er bedächtig.
»Ich muß heute mittag den Schafen noch Wasser hinauf tragen. Vielleicht, daß ich den Feuermann noch einmal hinter dem Dornbusch belauschen kann! Hat er das Sprüchlein verraten, wird er auch noch den Weg verraten; denn sein dicker Kopf scheint überzulaufen von diesen Dingen.« Und bei diesem Entschluß blieb es. Soviel sie auch hin und wieder redeten, sie wußten keinen bessern aufzufinden.
Bald darauf befand sich Andrees mit seiner Wassertracht droben auf dem Weideplatze. Als er in die Nähe des Riesenhügels kam, sah er den Kobold schon von weitem auf einem der Steine am Zwergenloch sitzen. Er strählte sich mit seinen fünf ausgespreizten Fingern den roten Bart; und jedesmal, wenn er die Hand heraus zog, löste sich ein Häufchen feuriger Flocken ab und schwebte in dem grellen Sonnenschein über die Felder dahin.
Da bist du zu spät gekommen, dachte Andrees, heute wirst du nichts erfahren, und wollte seitwärts, als habe er gar nichts gesehen, nach der Stelle abbiegen, wo noch immer der umgestürzte Zuber lag. Aber er wurde angerufen. »Ich dachte, du hättest mit mir zu reden!« hörte er die Quäkstimme des Kobolds hinter sich.
Andrees kehrte sich um und trat ein paar Schritte zurück. »Was hätte ich mit Euch zu reden«, erwiderte er; ich kenne Euch ja nicht.« »Aber du möchtest den Weg zur Regentrude wissen?«
»Wer hat Euch denn das gesagt?« »Mein kleiner Finger, und der ist klüger als mancher großer Kerl.«
Andrees nahm all seinen Mut zusammen und trat noch ein paar Schritte näher zu dem Unding an den Hügel hinauf. »Euer kleiner Finger mag schon klug sein«, sagte er, »aber den Weg zur Regentrude wird er doch nicht wissen, denn den wissen auch die aller klügsten Menschen nicht.«
Der Kobold blähte sich wie eine Kröte und fuhr ein paarmal mit seiner Klaue durch den Feuerbart, daß Andrees vor der heraus strömenden Glut einen Schritt zurück taumelte. Plötzlich aber sah er den jungen Bauer mit dem Ausdrucke eines überlegenen Hohns an. Aus seinen bösen kleinen Augen anstarrend, schnarrte er ihn an: »Du bist zu einfältig, Andrees; wenn ich dir auch sagte, daß die Regentrude hinter dem großen Walde wohnt, wo würdest du doch nicht wissen, daß hinter dem Walde eine hohle Weide steht.«
Hier gilt es, den Dummen spielen, dachte Andrees; denn obschon er sonst ein ehrlicher Bauer war, so hatte er doch auch seine gute Portion Bauernschlauheit mit auf die Welt bekommen. »Da habt Ihr
recht«, sagte er und riß den Mund auf, »das würde ich freilich nicht wissen!«
»Und«, fuhr der Kobold fort, »wenn ich dir auch sagte, daß hinter dem Wald die hohle Weide steht, so würdest du doch nicht wissen, daß in dem Baum eine Treppe zum Garten der Regenfrau hinab
führt.«
»Wie man sich doch verrechnen kann!« rief Andrees. »Ich dachte, man könnte nur so geradeswegs hinein spazieren.« »Und wenn du auch geradeswegs hinein spazieren könntest«, sagte der Kobold, »so würdest du immer noch nicht wissen, daß die Regentrude nur von einer reinen Jungfrau geweckt werden kann.« »Nun freilich«, meinte Andrees, »da hilft es mir nichts; da will ich mich nur gleich wieder auf den Heimweg machen.«
Ein arglistiges Lächeln verzog den breiten Mund des Kobolds. »Willst du nicht erst dein Wasser in den Zuber gießen?« fragte er; »das schöne Viehzeug ist ja schier verschmachtet.« »Da habt Ihr zum vierten Male recht!« erwiderte der Bursche und ging mit seinen Eimern um den Hügel herum. Als er aber das Wasser in den heißen Zuber goß, schlug es zischend empor und verprasselte in weißen Dampfwolken in der Luft. Auch gut, dachte er, meine Schafe treibe ich mit mir heim, und morgen mit dem frühesten geleite ich Maren zu der Regentrude. Die soll sie schon erwecken!
Auf der anderen Seite des Hügels aber war der Kobold von seinen Steinen aufgesprungen. Er warf seine rote Mütze in die Luft und kollerte sich mit wieherndem Gelächter den Berg hinab. Dann sprang
er wieder auf seine dürren Spindelbeine, tanzte wie toll umher und schrie dabei mit seiner Quäkstimme einmal übers andere: »Der Kindskopf, der Bauernlümmel! dachte mich zu übertölpeln und weiß
noch nicht, daß die Trude sich nur durch das rechte Sprüchlein wecken läßt. Und das Sprüchlein weiß keiner als Eckeneckepenn, und Eckeneckepenn, das bin ich!« –
Der böse Kobold wußte nicht, daß er am Vormittag das Sprüchlein selbst verraten hatte.
Auf die Sonnenblumen, die vor Marens Kammer im Garten standen, fiel eben der erste Morgenstrahl, als sie schon das Fenster aufstieß und ihren Kopf in die frische Luft hinaus streckte. Der Wiesenbauer, welcher nebenan im Alkoven des Wohnzimmers schlief, mußte davon erwacht sein; denn sein Schnarchen, das noch eben durch alle Wände drang, hatte plötzlich aufgehört. »Was treibst du, Maren?« rief er mit schläfriger Stimme. »Fehlt es dir denn wo?«
Das Mädchen fuhr sich mit dem Finger an die Lippen; denn sie wußte wohl, daß der Vater, wenn er ihr Vorhaben erführe, sie nicht aus dem Hause lassen würde. Aber sie faßte sich schnell. »Ich habe nicht schlafen können, Vater«, rief sie zurück, »ich will mit den Leuten auf die Wiese; es ist so hübsch frisch heute morgen.«
»Hast das nicht nötig, Maren«, erwiderte der Bauer, »meine Tochter ist kein Dienstbote.« Und nach einer Weile fügte er hinzu: »Na, wenn es dir Pläsier macht! Aber sei zur rechten Zeit wieder heim, eh die große Hitze kommt. Und vergiß mein Warmbier nicht!« Damit warf er sich auf die andere Seite, daß die Bettstelle krachte, und gleich darauf hörte auch das Mädchen wieder das wohl bekannte abgemessene Schnarchen.
Behutsam drückte sie ihre Kammertür auf. Als sie durch die Torfahrt ins Freie ging, hörte sie eben den Knecht die beiden Mägde wecken. Es ist doch schnöd, dachte sie, daß du so hast lügen müssen, aber – und sie seufzte dabei ein wenig – was tut man nicht um seinen Schatz! Drüben in seinem Sonntagsstaat stand schon Andrees ihrer wartend. »Weißt du dein Sprüchlein noch?« rief er ihr entgegen.
»Ja, Andrees! Und weißt du noch den Weg?« Er nickte nur. »So laß uns gehen!« Aber eben kam noch Mutter Stine aus dem Hause und steckte ihrem Sohne ein mit Met gefülltes Fläschchen in die Tasche. »Der ist noch von der Urahne«, sagte sie, »sie tat allezeit sehr geheim und kostbar damit, der wird euch gut tun in der Hitze!«
Dann gingen sie im Morgenschein die stille Dorfstraße hinab, und die Witwe stand noch lange und schaute nach der Richtung, wo die jungen kräftigen Gestalten verschwunden waren. Der Weg der beiden führte hinter der Dorfmark über eine weite Heide. Danach kamen sie in den großen Wald. Aber die Blätter des Waldes lagen meist verdorrt am Boden, so daß die Sonne überall hindurch blitzte; sie wurden fast geblendet von den wechselnden Lichtern. –
Als sie eine geraume Zeit zwischen den hohen Stämmen der Eichen und Buchen fort geschritten waren, faßte das Mädchen die Hand des jungen Mannes. »Was hast du, Maren?« fragte er. »Ich hörte unsere Dorfuhr schlagen, Andrees.« »Ja, mir war es auch so.« »Es muß sechs Uhr sein!« sagte sie wieder. »Wer kocht denn dem Vater nur sein Warmbier? Die Mägde sind alle auf dem Felde.« »Ich weiß nicht, Maren, aber das hilft nun doch weiter nicht!« »Nein«, sagte sie, »das hilft nun weiter nicht. Aber weißt du denn auch noch unser Sprüchlein?« »Freilich, Maren!
Dunst ist die Welle,
Staub ist die Quelle!«
Und als er einen Augenblick zögerte, sagte sie rasch:
»Stumm sind die Wälder,
Feuermann tanzet über die Felder!«
»Oh«, rief sie, »wie brannte die Sonne!«
»Ja«, sagte Andrees und rieb sich die Wange, »es hat auch mir ordentlich einen Stich gegeben.«
Endlich kamen sie aus dem Walde, und dort, ein paar Schritte vor ihnen, stand auch schon der alte Weidenbaum. Der mächtige Stamm war ganz gehöhlt, und das Dunkel, das darin herrschte, schien tief in den Abgrund der Erde zu führen. Andrees stieg zuerst allein hinab, während Maren sich auf die Höhlung des Baumes lehnte und ihm nachzublicken suchte. Aber bald sah sie nichts mehr von ihm, nur das Geräusch des Hinabsteigens schlug noch an ihr Ohr.
Ihr begann angst zu werden, oben um sie her war es so einsam, und von unten hörte sie endlich auch keinen Laut mehr. Sie steckte den Kopf tief in die Höhlung und rief: »Andrees, Andrees!« Aber es blieb alles still, und noch einmal rief sie: »Andrees!« – Da nach einiger Zeit war es ihr, als höre sie es von unten wieder herauf kommen, und allmählich erkannte sie auch die Stimme des jungen Mannes, der ihren Namen rief, und faßte seine Hand, die er ihr entgegenstreckte.
»Es führt eine Treppe hinab«, sagte er, »aber sie ist steil und ausgebröckelt, und wer weiß, wie tief nach unten zu der Abgrund ist!« Maren erschrak. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »ich trage dich; ich habe einen sicheren Fuß.« Dann hob er das schlanke Mädchen auf seine breite Schulter; und als sie die Arme fest um seinen Hals gelegt hatte, stieg er behutsam mit ihr in die Tiefe.
Dichte Finsternis umgab sie; aber Maren atmete doch auf, während sie so Stufe um Stufe wie in einem gewundenen Schneckengange hinab getragen wurde; denn es war kühl hier im Innern der Erde. Kein Laut von oben drang zu ihnen herab; nur einmal hörten sie dumpf aus der Ferne die unterirdischen Wasser brausen, die vergeblich zum Lichte empor arbeiteten.
»Was war das?« flüsterte das Mädchen. »Ich weiß nicht, Maren.« »Aber hat es denn noch kein Ende?« »Es scheint fast nicht.« »Wenn dich der Kobold nur nicht betrogen hat!« »Ich denke nicht, Maren.« So stiegen sie tiefer und tiefer. Endlich spürten sie wieder den Schimmer des Sonnenlichts unter sich, das mit jedem Tritt leuchtender wurde; zugleich aber drang auch eine erstickende Hitze zu ihnen herauf.
Als sie von der untersten Stufe ins Freie traten, sahen sie eine gänzlich unbekannte Gegend vor sich. Maren sah befremdet umher. »Die Sonne scheint aber doch die selbe zu sein!« sagte sie endlich. »Kälter ist sie wenigstens nicht«, meinte Andrees, in dem er das Mädchen zur Erde hob. Von dem Platze, wo sie sich befanden, auf einem breiten Steindamm, lief eine Allee von alten Weiden in die Ferne hinaus.
Sie bedachten sich nicht lange, sondern gingen, als sei ihnen der Weg gewiesen, zwischen den Reihen der Bäume entlang. Wenn sie nach der einen oder anderen Seite blickten, so sahen sie in ein ödes, unabsehbares Tiefland, das so von aller Art von Rinnen und Vertiefungen zerrissen war, als bestehe es nur aus einem endlosen Gewirre verlassener See- und Strombetten.
Dies schien auch dadurch bestätigt zu werden, daß ein beklemmender Dunst, wie von vertrocknetem Schilf, die Luft erfüllte. Dabei lagerte zwischen den Schatten der einzeln stehenden Bäume eine solche Glut, daß es den beiden Wanderern war, als sähen sie kleine weiße Flammen über den staubigen Weg dahinfliegen.
Andrees mußte an die Flocken aus dem Feuerbart des Kobolds denken. Einmal war es ihm sogar, als sähe er zwei dunkle Augenringe in dem grellen Sonnenschein; dann wieder glaubte er deutlich neben sich das tolle Springen der kleinen Spindelbeine zu hören. Bald war es links, bald rechts an seiner Seite. Wenn er sich aber wandte, vermochte er nichts zu sehen; nur die glutheiße Luft zitterte flirrend und blendend vor seinen Augen. Ja, dachte er, indem er des Mädchens Hand erfaßte und beide mühsam vorwärts schritten, sauer machst du es uns, aber recht behältst du heute nicht!
Weiter und weiter gingen sie, der eine nur auf das immer schwerere Atmen des anderen hörend. Der einförmige Weg schien kein Ende zu nehmen; neben ihnen unaufhörlich die grauen, halb entblätterten Weiden, seitwärts hüben und drüben unter ihnen die unheimlich dunstende Niederung.
Plötzlich blieb Maren stehen und lehnte sich mit geschlossenen Augen an den Stamm einer Weide. »Ich kann nicht weiter«, murmelte sie; »die Luft ist lauter Feuer.« Da gedachte Andrees des Metfläschchens, das sie bis dahin unberührt gelassen hatten. – Als er den Stöpsel abgezogen, verbreitete sich ein Duft, als seien die Tausende von Blumen noch einmal zur Blüte auferstanden, aus deren Kelchen vor vielleicht mehr als hundert Jahren die Bienen den Honig zu diesem Tranke zusammengetragen hatten.
Kaum hatten die Lippen des Mädchens den Rand der Flasche berührt, so schlug sie schon die Augen auf. »Oh«, rief sie, »auf welcher schönen Wiese sind wir denn?« »Auf keiner Wiese, Maren; aber trink nur, es wird dich stärken!« Als sie getrunken hatte, richtete sie sich auf und schaute mit hellen Augen um sich her. »Trink auch einmal, Andrees«, sagte sie; »ein Frauenzimmer ist doch nur ein elendiglich Geschöpf!«
»Aber das ist ein echter Tropfen!« rief Andrees, nachdem er auch gekostet hatte. »Mag der Himmel wissen, woraus die Uhrahne den gebraut hat!« Dann gingen sie gestärkt und lustig plaudernd weiter. Nach einer Weile aber blieb das Mädchen wieder stehen. »Was hast du, Maren?« fragte Andrees. »Oh, nichts, ich dachte nur –« »Was denn, Maren?« »Siehst du, Andrees! Mein Vater hat noch sein halbes Heu draußen auf den Wiesen; und ich gehe da aus und will Regen machen!«
»Dein Vater ist ein reicher Mann, Maren; aber wir anderen haben unser Fetzchen Heu schon längst in der Scheuer und unsere Frucht noch alle auf den dürren Halmen.« »Ja, ja, Andrees, du hast wohl recht; man muß auch an die anderen denken!« Im stillen bei sich selber aber setzte sie später hinzu: Maren, Maren, mach dir keine Flausen vor; du tust ja doch alles nur von wegen deinem Schatz!
So waren sie wieder eine Zeit lang fort gegangen, als das Mädchen plötzlich rief: »Was ist denn das? Wo sind wir denn? Das ist ja ein großer, ungeheurer Garten!« Und wirklich waren sie, ohne zu wissen wie, aus der einförmigen Weidenallee in einen großen Park gelangt. Aus der weiten, jetzt freilich versengten Rasenfläche erhoben sich überall Gruppen hoher prachtvoller Bäume.
Zwar war ihr Laub zum Teil abgefallen oder hing dürr und schlaff an den Zweigen, aber der kühne Bau ihrer Äste strebte noch in den Himmel, und die mächtigen Wurzeln griffen noch weit über die Erde hinaus. Eine Fülle von Blumen, wie die beiden sie nie zuvor gesehen, bedeckte hie und da den Boden; aber alle diese Blumen waren welk und duftlos und schienen mitten in der höchsten Blüte von der tödlichen Glut getroffen zu sein.
»Wir sind am rechten Orte, denk ich!« sagte Andrees. Maren nickte. »Du mußt nun hier zurück bleiben, bis ich wiederkomme.« »Freilich«, erwiderte er, in dem er sich in dem Schatten einer großen Eiche ausstreckte. »Das übrige ist nun deine Sach! Halt nur das Sprüchlein fest und verred dich nicht dabei!« –
So ging sie denn allein über den weiten Rasen und unter den himmelhohen Bäumen dahin, und bald sah der Zurückbleibende nichts mehr von ihr. Sie aber schritt weiter und weiter durch die Einsamkeit. Bald hörten die Baumgruppen auf, und der Boden senkte sich. Sie erkannte wohl, daß sie in dem ausgetrockneten Bette eines Gewässers ging; weißer Sand und Kiesel bedeckten den Boden, dazwischen lagen tote Fische und blinkten mit ihren Silberschuppen in der Sonne.
In der Mitte des Beckens sah sie einen grauen fremdartigen Vogel stehen; er schien ihr einem Reiher ähnlich zu sein, doch war er von solcher Größe, daß sein Kopf, wenn er ihn aufrichtete, über den eines Menschen hinweg ragen mußte; jetzt hatte er den langen Hals zwischen den Flügel zurückgelegt und schien zu schlafen. Maren fürchtete sich. Außer dem regungslosen unheimlichen Vogel war kein lebendes Wesen sichtbar, nicht einmal das Schwirren einer Fliege unterbrach hier die Stille; wie ein Entsetzen lag das Schweigen über diesem Orte.
Einen Augenblick trieb sie die Angst, nach ihrem Geliebten zu rufen, aber sie wagte es wiederum nicht; denn den Laut ihrer eignen Stimme in dieser Öde zu hören, dünkte sie noch schauerlicher als alles andre. So richtete sie denn ihre Augen fest in die Ferne, so sich wieder dichte Baumgruppen über den Boden zu erheben schienen, und schritt weiter, ohne rechts oder links zu sehen. Der große Vogel rührte sich nicht, als sie mit leisem Tritt an ihm vorüberging, nur für einen Augenblick blitzte es schwarz unter der weißen Augenhaut hervor. – Sie atmete auf. –
Nachdem sie noch eine weite Strecke hin geschritten, verengte sich das Seebett zu der Rinne eines mäßigen Baches, der unter einer breiten Lindengruppe durchführte. Das Geäst dieser mächtigen Bäume war so dicht, daß ungeachtet des mangelhaften Laubes kein Sonnenstrahl hindurch drang. Maren ging in dieser Rinne weiter; die plötzliche Kühle um sie her, das hohe dunkle Gewölk der Wipfel über ihr; es schien ihr fast, als gehe sie durch eine Kirche. Plötzlich aber wurden ihre Augen von einem blenden Licht getroffen; die Bäume hörten auf, und vor ihr erhob sich ein graues Gestein, auf das die grellste Sonne niederbrannte.
Maren selbst stand in einem leeren sandigen Becken, in welches sonst ein Wasserfall über die Felsen hinabgestürzt sein mochte, der dann unterhalb durch die Rinne seinen Abfluß in den jetzt verdunsteten See gehabt hatte. Sie suchte mit den Augen, wo wohl der Weg zwischen den Klippen hinaufführte. Plötzlich aber schrak sie zusammen. Denn das dort auf der halben Höhe des Absturzes konnte nicht zum Gestein gehören; wenn es auch ebenso grau war und starr wie dieses in der regungslosen Luft lag, so erkannte sie doch bald, daß es ein Gewand sei, welches in Falten eine ruhende Gestalt bedeckte. –
Mit verhaltenem Atem stieg sie näher. Da sah sie es deutlich; es war eine schöne mächtige Frauengestalt. Der Kopf lag tief aufs Gestein zurück gesunken; die blonden Haare, die bis zur Hüfte hinab flossen, waren voll Staub und dürren Laubes. Maren betrachtete sie aufmerksam. Sie muß sehr schön gewesen sein, dachte sie, ehe diese Wangen so schlaff und diese Augen so eingesunken waren. Ach, und wie bleich ihre Lippen sind! Ob es denn wohl die Regentrude sein mag? –
Aber die da schläft nicht; das ist eine Tote! Oh, es ist entsetzlich einsam hier! Das kräftige Mädchen hatte sich indessen bald gefaßt. Sie trat ganz dicht herzu, und niederkniend und zu ihr hinabgebeugt, legte sie ihre frischen Lippen an das marmorblasse Ohr der Ruhenden. Dann, all ihren Mut zusammennehmend, sprach sie laut und deutlich:
»Dunst ist die Welle,
Staub ist die Quelle!
Stumm sind die Wälder,
Feuermann tanzt über die Felder!«
Da rang sich ein tiefer klagender Laut aus dem bleichen Munde hervor; doch das Mädchen sprach immer stärker und eindringlicher:
»Nimm dich in acht!
Eh du erwacht,
Holt dich die Mutter
Heim in der Nacht!«
Da rauschte es sanft durch die Wipfel der Bäume, und in der Ferne donnerte es leise wie von einem Gewitter. Zugleich aber und, wie es schien, von jenseits des Gesteins kommend, durchschnitt ein greller Ton die Luft, wie der Wutschrei eines bösen Tieres. Als Maren empor sah, stand die Gestalt der Trude hoch aufgerichtet vor ihr. »Was willst du?« fragte sie. »Ach, Frau Trude«, antwortete das Mädchen noch immer kniend. »Ihr habt so grausam lang geschlafen, daß alles Laub und alle Kreatur verschmachten will!«
Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als mühe sie sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie mit tonloser Stimme: »Stürzt denn der Quell nicht mehr?« »Nein, Frau Trude«, erwiderte Maren. »Kreist denn mein Vogel nicht mehr über dem See?« »Er steht in der heißen Sonne und schläft.« »Weh!« wimmerte die Regenfrau. »So ist es hohe Zeit. Steh auf und folge mir, aber vergiß nicht den Krug, der dort zu deinen Füßen liegt!«
Maren tat, wie ihr geheißen, und beide stiegen nun an der Seite des Gesteins hinauf. – Noch mächtigere Baumgruppen, noch wunderbarere Blumen waren hier der Erde entsprossen, aber auch hier war alles welk und duftlos. – Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran, nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Maren, es bleibe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten, und wenn die grauen Gewänder über das dürre Gras schleppten, da rauschte es so eigen, daß sie immer darauf hinhören mußte.
»Regnet es denn schon, Frau Trude?« fragte sie. »Ach nein, Kind, erst mußt du den Brunnen aufschließen!« »Den Brunnen? Wo ist denn der?« Sie waren eben aus einer Gruppe von Bäumen heraus getreten. »Dort!« sagte die Trude, und einige tausend Schritte vor ihnen sah Maren einen ungeheuren Bau emporsteigen.
Er schien von grauem Gestein zackig und unregelmäßig aufgetürmt; bis in den Himmel, meinte Maren, denn nach oben hinauf war alles wie in Duft und Sonnenglanz zerflossen. Am Boden aber wurde die in riesenhaften Erkern vorspringende Front überall von hohen spitzbogigen Tor- und Fensterhöhlen durchbrochen, ohne daß jedoch von Fenstern oder Torflügeln selbst etwas zu sehen gewesen wäre.
Eine Weile schritten sie gerade darauf zu, bis sie durch den Uferabsturz eines Stromes aufgehalten wurden, der den Bau rings zu umgeben schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der Mitte floß, verdunstet; ein Nachen lag zerborsten auf der trockenen Schlammdecke des Strombettes. »Schreite hindurch!« sagte die Trude. »Über dich hat er keine Gewalt. Aber vergiß nicht, von dem Wasser zu schöpfen; du wirst es bald gebrauchen!«
Als Maren, dem Befehl gehorchend, von dem Ufer herab trat, hätte sie fast den Fuß zurück gezogen, denn der Boden war hier so heiß, daß sie die Glut durch ihre Schuhe fühlte. Ei was, mögen die Schuhe verbrennen! dachte sie und schritt rüstig mit ihrem Krug weiter. Plötzlich aber blieb sie stehen; der Ausdruck des tiefsten Entsetzens trat in ihre Augen. Denn neben ihr zerriß die trockene Schlammdecke, und eine große braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr daraus hervor und griff nach ihr.
»Mut!« hörte sie die Stimme der Trude hinter sich vom Ufer her. Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus, und der Spuk verschwand. »Schließe die Augen!« hörte sie wiederum die Trude rufen. – Da ging sie mit geschlossenen Augen weiter; als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihre Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf.
Bald hatte sie das Schloß erreicht und trat mit klopfendem Herzen durch eines der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingang stehen. Das ganze Innere schien nur ein einziger unermeßlicher Raum zu sein. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in beinahe unabsehbarer Höhe eine seltsame Decke; fast meinte Maren, es seien nichts als graue riesenhafte Spinngewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säulen herab hingen.
Noch immer stand sie wie verloren an der selben Stelle und blickte bald vor sich hin, bald nach einer und der anderen Seite, aber diese ungeheuren Räume schienen außer nach der Front zu, durch welche Maren eingetreten war, ganz ohne Grenzen zu sein; Säule hinter Säule erhob sich, und wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nirgends ein Ende absehen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften. Und siehe! Dort, unweit von ihr, war der Brunnen; auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Falltür liegen.
Während sie darauf zuging, bemerkte sie, daß der Fußboden nicht etwa, wie sie es in ihrer Dorfkirche gesehen, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrockneten Schilf- und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber es nahm sie jetzt schon nichts mehr wunder. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen; da zog sie rasch die Hand zurück. Denn deutlich hatte sie es erkannt, der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen herein fallenden Sonnenstrahl entgegen leuchtete, war von Glut und nicht von Gold rot.
Ohne Zaudern goß sie ihren Krug darüber aus, daß das Zischen des verdampfenden Wassers in den weiten Räumen widerhallte. Dann schloß sie rasch den Brunnen auf. Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Falltür zurück geschlagen hatte, und erfüllte bald alles mit einem feinen feuchten Staube, der wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg.
Sinnend und in der frischen Kühle aufatmend, ging Maren umher. Da begann zu ihren Füßen ein neues Wunder. Wie ein Hauch rieselte ein lichtes Grün über die verdorrte Pflanzendecke, die Halme richteten sich auf, und bald wandelte das Mädchen durch eine Fülle sprießender Blätter und Blumen. Am Fuße der Säulen wurde es blau von Vergißmeinnicht; dazwischen blühten gelbe und braun violette Iris auf und verhauchten ihren zarten Duft.
An den Spitzen der Blätter klommen Libellen empor, prüften ihre Flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den Blumenkelchen, während der frische Duft, der fortwährend aus dem Brunnen stieg, immer mehr die Luft erfüllte und wie Silberfunken in den herein fallenden Sonnenstrahlen tanzte.
In dessen Maren noch des Entzückens und Bestaunens kein Ende finden konnte, hörte sie hinter sich ein behagliches Stöhnen wie von einer süßen Frauenstimme. Und wirklich, als sie ihre Augen nach der Vertiefung des Brunnens wandte, sah sie auf dem grünen Moosrand, der dort emporgekeimt war, die ruhende Gestalt einer wunderbar schön blühenden Frau. Sie hatte ihren Kopf auf den nackten glänzenden Arm gestützt, über den das blonde Haar wie in seidenen Wellen herab fiel, und ließ ihre Augen oben zwischen den Säulen an der Decke wandern.
Auch Maren blickte unwillkürlich hinauf. Da sah sie nun wohl, daß das, was sie für große Spinngewebe gehalten, nichts anderes war als die zarten Florgewebe der Regenwolken, die durch den aus dem Brunnen aufsteigenden Duft gefüllt und schwer und schwerer wurden.
Eben hatte sich ein solches Gewölk in der Mitte der Decke abgelöst und sank leise schwebend herab, so daß Maren das Gesicht der schönen Frau am Brunnen nur noch wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände, und sogleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floß durch die selbe ins Freie hinaus.
»Nun!« rief die schöne Frau. »Wie gefällt dir das?« Dabei lächelte ihr roter Mund, und ihre weißen Zähne blitzten. Dann winkte sie Maren zu sich, und diese mußte sich neben ihr ins Moos setzen; und als eben wieder ein Duftgewebe von der Decke nieder sank, sagte sie: »Nun klatsch in deine Hände!« Und als Maren das getan und auch diese Wolke, wie die erste, ins Freie hinaus gezogen war, rief sie: »Siehst du wohl, wie leicht das ist! Du kannst es besser noch als ich!«
Maren betrachtete verwundert die schöne übermütige Frau. »Aber«, fragte sie, »wer seid Ihr denn so eigentlich?« »Wer ich bin? Nun, Kind, du bist aber einfältig!« Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissen Augen an; endlich sagte sie zögernd: »Ihr seid doch nicht gar die Regentrude?« »Und wer sollte ich denn anders sein?« »Aber verzeiht! Ihr seid ja so schön und lustig jetzt!«
Da wurde die Trude plötzlich ganz still. »Ja«, rief sie, »ich muß dir dankbar sein. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre der Feuermann Meister geworden, und ich hätte wieder hinab müssen zu der Mutter unter die Erde.« Und indem sie ein wenig wie vor innerem Grauen die weißen Schultern zusammenzog, setzte sie hinzu: »Und es ist ja doch so schön und grün hier oben!«
Dann mußte Maren erzählen, wie sie hierher gekommen, und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr empor sproßten, und steckte sie sich oder dem Mädchen ins Haar. Als Maren von dem mühseligen Gange auf dem Weidendamm berichtete, seufzte die Trude und sagte:
»Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden; aber es ist schon lange, lange her! Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen damals öfters zu mir, ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreiden, und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten. Wie sie meiner nicht vergaßen, so vergaß ich ihrer nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit langem aber sind die Menschen mir entfremdet, es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich denn vor Hitze und lauter Langeweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg erhalten.«
Maren hatte sich während dessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Moos zurück gelegt, es taute so sanft um sie her, und die Stimme der schönen Trude klang so süß und traulich. »Nur einmal«, fuhr diese fort, »aber das ist auch schon lange her, ist noch ein Mädchen gekommen, sie sah fast aus wie du und trug fast eben solche Gewänder. Ich schenkte ihr von meinem Wiesenhonig, und das war die letzte Gabe, die ein Mensch aus meiner Hand empfangen hat.«
»Seht nur«, sagte Maren, »das hat sich gut getroffen! Jenes Mädchen muß die Urahne von meinem Schatz gewesen sein, und der Trank, der mich heute so gestärkt hat, war gewiß von Eurem Wiesenhonig!« Die Regenfrau dachte wohl noch an ihre junge Freundin von damals; denn sie fragte: »Hat sie denn noch so schöne braune Löckchen an der Stirn?« »Wer denn, Frau Trude?« »Nun, die Urahne, wie du sie nennst!« »O nein, Frau Trude«, erwiderte Maren, und sie fühlte sich in diesem Augenblick ihrer mächtigen Freundin fast ein wenig überlegen –, »die Urahne ist ja ganz steinalt geworden!«
»Alt?« fragte die schöne Frau. Sie verstand das nicht, denn sie kannte nicht das Alter. Maren hatte große Mühe, ihr es zu erklären. »Merkt nur«, sagte sie endlich, »graues Haar und rote Augen und häßlich, verdrießlich sein! Seht, Frau Trude, das nennen wir alt!« »Freilich«, erwiderte diese, »ich entsinne mich nun; es waren auch solche unter den Frauen der Menschen; aber die Urahne soll zu mir kommen, ich mache sie wieder froh und schön.«
Maren schüttelte den Kopf. »Das geht ja nicht, Frau Trude«, sagte sie, »die Urahne ist ja längst unter der Erde.« Die Trude seufzte. »Arme Urahne.« Hierauf schwiegen beide, während sie noch immer behaglich ausgestreckt im weichen Moose lagen. »Aber Kind!« rief plötzlich die Trude, »da haben wir über all dem Geplauder ja ganz das Regenmachen vergessen. Schlag doch nur die Augen auf! Wir sind ja unter lauter Wolken ganz begraben; ich sehe dich schon gar nicht mehr!«
»Ei, da wird man ja naß wie eine Katze!« rief Maren, als sie die Augen aufgeschlagen hatte.
Die Trude lachte. »Klatsch nur ein wenig in die Hände, aber nimm dich in acht, daß du die Wolke nicht zerreißt!« So begannen beide leise in die Hände zu klopfen; und als bald entstand ein
Gewoge und Geschiebe, die Nebelgebilde drängten sich nach den Öffnungen und schwammen, eins nach dem anderen, ins Freie hinaus.
Nach kurzer Zeit sah Maren schon wieder den Brunnen vor sich und den grünen Boden mit den gelben und violetten Irisblüten. Dann wurden auch die Fensterhöhlen frei, und sie sah weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen. Allmählich verschwand die Sonne. Noch ein paar Augenblicke, und sie hörte es draußen wie einen Schauer durch die Bäume und Gebüsche wehen, und dann rauschte es hernieder, mächtig und unablässig.
Maren saß aufgerichtet mit gefaltenen Händen. »Frau Trude, es regnet«, sagte sie leise. Diese nickte kaum merklich mit ihrem schönen blonden Kopfe; sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Prasseln und Heulen, und als Maren erschrocken hinaus blickte, sah sie aus dem Bette des Umgebungsstromes, den sie kurz vorher überschritten hatte, sich ungeheure weiße Dampfwolken stoßweise in die Luft erheben. In dem selben Augenblick fühlte sie sich auch von den Armen der schönen Regenfrau umfangen, die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte.
»Nun gießen sie den Feuermann aus«, flüsterte sie, »horch nur, wie er sich wehrt! Aber es hilft ihm doch nichts mehr.« Eine Weile hielten sie sich so umschlossen; da wurde es stille draußen, und es war nun nichts zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. – Da standen sie auf, und die Trude ließ die Falltür des Brunnens herab und verschloß sie. Maren küßte ihre weiße Hand und sagte: »Ich danke Euch, liebe Frau Trude, für mich und alle Leute in unserm Dorfe! Und« – setzte sie ein wenig zögernd hinzu – »nun möchte ich wieder heimgehen!«
»Schon gehen?« fragte die Trude. »Ihr wißt es ja, mein Schatz wartet auf mich; er mag schon wacker naß geworden sein.« Die Trude erhob den Finger. »Wirst du ihn auch später niemals warten lassen?« »Gewiß nicht, Frau Trude!« »So gehe, mein Kind; und wenn du heimkommst, so erzähle den anderen Menschen von mir, daß sie meiner fürder nicht vergessen. – Und nun komm! Ich werde dich geleiten.«
Draußen unter dem frischen Himmelstau war schon überall das Grün des Rasens und an Baum und Büschen das Laub hervor gesprossen. – Als sie an den Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bett wieder ausgefüllt, und als erwartete er sie, ruhte der Kahn, wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd an dem üppigen Grase des Uferrandes. Sie stiegen ein, und leise glitten sie hinüber, während die Tropfen spielend und klingend in die Flut fielen.
Da, als sie eben an das andre Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem Dunkel des Gebüsches. »Oh«, sagte die Trude und atmete so recht aus Herzensgrunde, »es ist noch Nachtigallenzeit, es ist noch nicht zu spät!«
Da gingen sie an dem Bach entlang, der zu dem Wasserfall führte. Der stürzte sich schon wieder tosend über die Felsen und floß dann strömend in der breiten Rinne unter den dunklen Linden fort. Sie mußten, als sie hinab gestiegen waren, an der Seite unter den Bäumen hingehen. Als sie wieder ins Freie traten, sah Maren den fremden Vogel in großen Kreisen über einem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte.
Bald gingen sie unten längs dem Ufer hin, fortwährend die süßesten Düfte atmend und auf das Anrauschen der Wellen horchend, die über glänzende Kiesel an dem Strande hinauf strömten. Tausende von Blumen blühten überall, auch Veilchen und Maililien bemerkte Maren, und andere Blumen, deren Zeit eigentlich längst vorüber war, die aber wegen der bösen Glut nicht hatten zur Entfaltung kommen können. »Die wollen auch nicht zurück bleiben«, sagte die Trude, »das blüht nun alles durcheinander hin.«
Mitunter schüttelte sie ihr blondes Haar, daß die Tropfen wie Funken um sie her sprühten, oder sie schränkte ihre Hände zusammen, daß von ihren vollen weißen Armen das Wasser wie in eine Muschel hinab floß. Dann wieder riß sie die Hände auseinander, und wo die hingesprühten Tropfen die Erde berührten, da stiegen neue Düfte auf, und ein Farbenspiel von frischen, nie gesehenen Blumen drängte sich leuchtend aus dem Rasen.
Als sie um den See herum waren, blickte Maren noch einmal auf die weite, bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück; es schauerte sie fast bei dem Gedanken, daß sie am Morgen trockenen Fußes durch die Tiefe gegangen sei. Bald mußten sie dem Platze nahe sein, wo sie ihren Andrees zurück gelassen hatte. Und richtig! Dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestütztem Arm; er schien zu schlafen.
Als aber Maren auf die schöne Trude blickte, wie sie mit dem roten lächelnden Munde so stolz neben ihr über den Rasen schritt, erschien sie sich plötzlich in ihren bäuerischen Kleidern so plump und häßlich, daß sie dachte: Ei, das tut nicht gut, die braucht der Andrees nicht zu sehen! Laut aber sprach sie: »Habt Dank für Euer Geleite, Frau Trude, ich finde mich nun schon selber!«
»Aber ich muß doch deinen Schatz noch sehen!« »Bemüht Euch nicht, Frau Trude«, erwiderte Maren, »es ist eben ein Bursch wie die anderen auch und just gut genug für ein Mädel vom
Dorf.« Die Trude sah sie mit durchdringenden Augen an. »Schön bist du, Närrchen!« sagte sie und erhob drohend ihren Finger: »Bist du denn aber auch in deinem Dorf die Allerschönste?«
Da stieg dem hübschen Mädchen das Blut ins Gesicht, daß ihr die Augen überliefen.
Die Trude aber lächelte schon wieder. »So merk denn auf!« sagte sie; »weil nun doch alle Quellen wieder springen, so könnt ihr einen kürzeren Weg haben. Gleich unten links am Weidendamm liegt ein Nachen. Steigt getrost hinein; er wird euch rasch und sicher in eure Heimat bringen! – Und nun leb wohl!« rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küßte sie.
»Oh, wie süß frisch schmeckt doch solch ein Menschenmund!« Dann wandte sie sich und ging unter den fallenden Tropfen über den Rasen dahin. Dabei hub sie an zu singen; das klang süß und eintönig; und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wußte Maren nicht, hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang, oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens.
Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen; dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus. »Lebt wohl, schöne, liebe Regentrude, lebt wohl!« rief sie. – Aber keine Antwort kam zurück; sie erkannte es nun deutlich, es war nur noch der Regen, der hernieder rauschte. Als sie hierauf langsam dem Eingang des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauer hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen. »Wonach schaust du denn so?« fragte sie, als sie näher gekommen war.
»Alle Tausend, Maren!« rief Andrees, »was war denn das für ein sauber Weibsbild?« Das Mädchen aber ergriff den Arm des Burschen und drehte ihn mit einem derben Ruck herum. »Guck dir nur nicht die Augen aus!« sagte sie, »das ist keine für dich; das war die Regentrude!«
Andrees lachte. »Nun, Maren«, erwiderte er, »daß du sie richtig aufgeweckt hast, das habe ich hier schon merken können; denn so naß, mein ich, ist der Regen noch nimmer gewesen, und so etwas von Grünwerden habe ich auch all mein Lebtag noch nicht gesehen! – Aber nun komm! Wir wollen heim, und dein Vater soll uns sein gegebenes Wort einlösen.«
Unten am Weidendamm fanden sie den Nachen und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet, auf dem Wasser und in der Luft lebte es von aller Art Gevögel; die schlanken Seeschwalben schossen schreiend über ihnen hin und tauchten die Spitzen ihrer Flügel in die Flut, während die Silbermöwe majestätisch neben ihrem fort schießenden Kahn dahin schwamm; auf dem grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorbeikamen, sahen sie die Bruushähne mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele halten.
So glitten sie rasch dahin. Noch immer fiel der Regen, sanft, doch unablässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser, und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andrees hatte schon eine Zeit lang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt. »Sieh doch, Maren«, rief er, »ist das nicht meine Roggenkoppel?« »Freilich, Andrees; und prächtig grün ist sie geworden! Aber siehst du denn nicht, daß es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren?«
»Richtig, Maren; aber was ist denn das dort? Das ist ja alles überflutet!« »Ach, du lieber Gott!« rief Maren, »das sind ja meines Vaters Wiesen! Sieh nur, das schöne Heu, es schwimmt ja alles.« Andrees drückte dem Mädchen die Hand. »Laß nur, Maren!« sagte er, »der Preis ist, denk ich, nicht zu hoch, und meine Felder tragen ja nun um desto besser.«
Bei der Dorflinde legte der Nachen an. Sie traten ans Ufer, und bald gingen sie Hand in Hand die Straße hinab. Da wurde ihnen von allen Seiten freundlich zugenickt; denn Mutter Stine mochte in ihrer Abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben. »Es regnet!« riefen die Kinder, die unter den Tropfen durch über die Straße liefen. »Es regnet!« sagte der Vetter Schulze, der behaglich aus seinem offenen Fenster schaute und den beiden mit kräftigem Drucke die Hand schüttelte.
»Ja, ja, es regnet!« sagte auch der Wiesenbauer, der wieder mit der Meerschaumpfeife in der Torfahrt seines stattlichen Hauses stand. »Und du, Maren, hast mich heute morgen wacker angelogen. Aber kommt nur herein, ihr beiden! Der Andrees, wie der Vetter Schulze sagt, ist allewege ein guter Bursch, seine Ernte wird heuer auch noch gut, und wenn es etwa wieder in drei Jahren Regen geben sollte, so ist es am Ende doch so übel nicht, wenn Höhen und Tiefen beieinander kommen. Drum geht hinüber zu Mutter Stine, da wollen wir die Sache all fort in Richtigkeit bringen!«
Mehrere Wochen waren seit dem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört, und die letzten schweren Erntewagen waren mit Kränzen und flatternden Bändern in die Scheuern eingefahren; da schritt im schönsten Sonnenschein ein großer Hochzeitszug der Kirche zu. Maren und Andrees waren die Brautleute; hinter ihnen gingen Hand in Hand Mutter Stine und der Wiesenbauer.
Als sie fast bei der Kirchentür angelangt waren, daß sie schon den Choral vernahmen, den drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, zog plötzlich ein weißes Wölkchen über
ihnen am blauen Himmel auf, und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut in ihren Kranz. – »Das bedeutet Glück!« riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen. »Das war die Regentrude!«
flüsterten Braut und Bräutigam und drückten sich die Hände.
Dann trat der Zug in die Kirche; die Sonne schien wieder, die Orgel aber schwieg, und der Priester verrichtete sein Werk.
Theodor Storm
ADIS UND DAHY ...
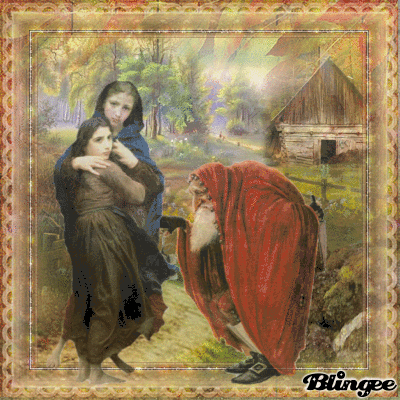
In der Gegend von Masulipatnam, einer Stadt des Königreichs Golkonde, wohnte eine gute Frau, die ihr verstorbener Mann, mit zwei sehr artigen Töchtern auf dem Halse, in geringen Umständen hinterlassen hatte. Die älteste, namens Fatime, hatte siebzehn Jahre, und Kadidsche, die jüngste, kaum zwölfe. Sie wohnten in einer einsamen abgelegenen Hütte und nährten sich bloß von der Arbeit ihrer Hände.
Ein Bach, der nicht weit von ihrer Hütte entsprang, lieh ihnen sein Wasser, um das Leinengerät einiger Personen in Masulipatnam zu waschen, die schon von langem her ihre Kundsleute waren. Sobald die gute Bäurin und ihre Töchter ein Stück Wäsche recht schön gewaschen und getrocknet hatten, pflegten sie es mit Blumen zu überstreuen, damit es wohl riechend würde.
Eines Tages, da die Mutter in dieser Absicht Blumen auf der Wiese pflückte, kneipte sie, ohne es gewahr zu werden, eine Natter, die unter einer Hyazinthe verborgen lag, in den Schwanz. Der giftige Wurm rächte sich auf der Stelle und biß die arme Frau so heftig in den Finger, daß sie laut aufschreien mußte. Ihre Töchter liefen erschrocken herbei und fanden den Finger schon gewaltig aufgeschwollen; in weniger als einer Viertelstunde war das Gift schon in die edleren Teile eingedrungen, und es griff so schnell um sich, daß keine Rettung war.
Da die unglückliche Frau sich ihrem Ende so nahe sah, wollte sie noch die letzte Pflicht einer guten Mutter erfüllen und sprach zu ihren Töchtern: «Liebe Kinder, mir ist leid, daß ich zu einer Zeit, wo ihr meiner noch so nötig hättet, von euch scheiden muß: aber meine Stunde ist gekommen; ich sehe den Todesengel sich nähern, und wir müssen uns trennen. Was mich tröstet, ist, daß ich mir wegen eurer Erziehung keinen Vorwurf zu machen habe und daß ich euch, Dank sei dem lieben Gott, als gutartige fromme Kinder hinterlasse.
Bleibt immer auf dem guten Wege, auf den ich euch geführt, und habt die Gebote unseres großen Propheten immer vor Augen. Nährt euch von eurer kleinen Arbeit, wie wir bisher getan haben; der liebe Gott wird euch nicht verlassen. Besonders empfehle ich euch, im Frieden beisammen zu leben und, wo möglich, euch nie voneinander zu trennen; denn euer ganzes Glück beruht auf eurer Einigkeit. Du, liebe Kadidsche, bist noch ein Kind; gehorche deiner Schwester Fatime; sie wird dir niemals einen schlimmen Rat geben.»
Nach dieser Vermahnung fühlte die gute Frau, daß die Kräfte sie verließen; sie umarmte ihre Kinder zum letzten Mal und starb in ihren Armen. Der Schmerz ist über allen Ausdruck, der die armen Mädchen überfiel, da sie ihre Mutter ohne Leben vor sich liegen sahen; sie zerflossen in Tränen und erfüllten die ganze Gegend mit ihrem Jammergeschrei.
Endlich, da sie sich die Augen schier ausgeweint hatten, sanken sie in eine Art von Betäubung, woraus sie durch die Notwendigkeit erweckt wurden, dem Leichnam ihrer Mutter die letzte Ehre anzutun. Sie nahmen jede ein Grabscheit, dessen sie sich sonst bedienten, ein kleines Gemüsegärtchen an ihrer Hütte zu bauen; gruben, etwa fünfzig Schritte weit davon, ein Grab; trugen mit vieler Mühe den Leichnam hinein und bedeckten ihn mit Erde und Blumen.
Hierauf kehrten sie in ihre Hütte zurück, wo der Schlaf, den ihnen die Abmattung von dieser traurigen Arbeit verschaffte, sie auf einige Stunden in ein erquickendes Vergessen ihres Kummers senkte.
Des folgenden Tages stellte Fatime, als die Verständigere, ihrer Schwester vor, daß sie nun wieder an ihre Arbeit gehen müßten, und hieß sie zwei Körbe mit der Wäsche füllen, welche sie den Tag vor ihrem Unglück gewaschen hatten; hierauf setzten sie die Körbe auf den Kopf und traten den Weg nach Masulipatnam miteinander an.
Sie hatten kaum hundert Schritte zurück gelegt, so begegnete ihnen ein kleiner, sehr häßlicher, kahlköpfiger und buckliger alter Mann, der aber ziemlich reich gekleidet war und sie mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. Er schien nahe an hundert Jahre alt zu sein und stützte sich auf einen Stab, mit dessen Hilfe er gleich wohl, für sein hohes Alter, noch stattlich genug einher stapfte.
Der Greis fand die beiden Schwestern nach seinem Geschmack. «Wo hinaus, ihr schönen Kinder», redete er sie mit einem Ton an, den er so sanft und gefällig, als ihm möglich war, zu machen suchte. «Wir gehen nach Masulipatnam», sagte die Älteste. «Darf ich euch, ohne allzu große Zudringlichkeit, fragen», versetzte er, «was eure Lebensart ist und ob man euch nicht irgend einige Dienste leisten könnte?»
«Ach, guter Herr», erwiderte Fatime, «wir sind nur einfältige Bauernmädchen und arme Waisen, wir haben erst gestern durch den unglücklichsten Zufall unsere Mutter verloren.» Und darauf erzählte sie ihm die Geschichte mit allen Umständen, nicht ohne von neuem viele Tränen zu vergießen.
«Oh, wie leid tut es mir», sagte der Greis, «daß ich eure Mutter nicht vor ihrem Tode noch gesehen habe! Ich hätte ihr ein Geheimnis gegen alle giftige Wunden geben können, das sie in zwei Tagen wieder gesund gemacht haben sollte. Meine lieben Kinder», fuhr er fort, «euer Kummer geht mir zu Herzen, und ich erbiete mich, Vaterstelle bei euch zu vertreten, wenn ihr so viel Vertrauen zu mir fassen könnt, die Sorge für euer Schicksal meiner Erfahrenheit und meinem guten Willen zu überlassen.
Ich gestehe euch», fügte er hinzu, in dem er einen Blick auf die junge Kadidsche warf, «daß ich eine starke Zuneigung zu diesem liebenswürdigen Mädchen in mir finde. Ihr erster Anblick hat Empfindungen in mir erregt, die ich noch nie gefühlt habe. Wenn ihr beide mit mir kommen wollt, so will ich euch in eine Lage setzen, die weit über eurem Stand ist; und ihr sollt Ursache finden, den Tag, da ihr mir begegnet seid, auf ewig glücklich zu preisen.»
Hier hielt der kleine bucklige Greis mit Reden ein und wartete mit sichtbarer Unruhe auf die Antwort, die man ihm geben würde. Er hatte freilich alle Ursache, unruhig zu sein. Sein Alter und seine Figur waren nicht so beschaffen, daß sie diesen jungen Personen Lust machen konnten, seinem Vorschlag Gehör zu geben. In dessen hatte doch Fatime schon Verstand genug, um einzusehen, daß es, in Umständen wie die ihrige, eben nicht die schlimmste Partie wäre.
Der Alte bemerkte ihre Unschlüssigkeit mit Betrübnis. «Mein schönes Kind», sagte er ihr, «wenn ihr die Gefahr, in einer so abgelegenen Gegend so allein zu wohnen, gehörig überlegt hättet, so würdet ihr euch nicht lange bedenken, mein Anerbieten anzunehmen. So ohne allen Schutz, wie ihr seid, glaubt ihr den Fallstricken entgehen zu können, welche man eurer Unschuld legen wird?
Wenn ihr auch Tugend genug habt, um zu lasterhaften Anträgen eure Einwilligung zu verweigern, so wird es euch doch an Macht fehlen, gewaltsame Anfälle abzuhalten. Bei mir habt ihr nichts dergleichen zu fürchten. Mein Alter sichert euch vor Anfechtungen von mir selbst, und meine Erfahrenheit soll euch gegen die von anderen Leuten sicher stellen.
Gebt eine mühselige Arbeit auf, die euch kaum den notdürftigsten Unterhalt verschaffen kann: ihr sollt bei mir alles finden, was ihr zur Notdurft und zur Annehmlichkeit des Lebens verlangen könnt; und ich will euch Dinge sagen, die euch begreiflich machen werden, daß der Vorschlag, den ich euch tue, euer und mein Glück sein wird. Kommt, liebe Mädchen, ihr könnt nichts Bessers tun. Wenn eure Mutter noch lebte, würde sie gewiß meinen Gründen nachgeben und euch unter meinem Schutze sicherer glauben als in der Hütte, die ihr bewohnt.»
Kurz, der kleine alte Mann sprach so gut, daß Fatime anfing, sich überreden zu lassen. «Guter Herr», sagte sie, «ich glaube Euch zum Teil zu verstehen und bin ganz geneigt, von Eurer Güte für mich und meine Schwester Gebrauch zu machen; aber da Euer Antrag, nach dem Geständnis Eurer besondern Neigung zu ihr, hauptsächlich sie angeht, so muß ich doch vorher ihre Gesinnung wissen, ehe ich Euch eine genaue Antwort geben kann.
Rede also, Kadidsche: fühlst du dich geneigt, dem Antrag dieses Herrn Gehör zu geben und ihn zum Gemahl anzunehmen? Denn ich halte ihn für zu rechtschaffen, als daß er ein paar unschuldige Waisen, die ihm ihre Ehre anvertrauen, könnte hintergehen wollen.» - «Nein, Schwester», antwortete Kadidsche errötend, «er ist gar zu alt und gar zu häßlich.»
Die kindische Offenherzigkeit dieses jungen Mädchens setzte Fatimen in einige Verlegenheit. «Liebe Schwester», sprach sie, «man sieht wohl, daß du noch in einem Alter bist, wo man wenig Überlegungen macht, weil du die Ehre, die dir dieser Herr erweisen will, so schlecht erkennst. Anstatt ihm solche Unhöflichkeiten zu sagen, solltest du es für ein Glück ansehen, daß du ihm gefallen hast.» -
«Ja, wahrhaftig», erwiderte Kadidsche weinend, «das ist auch eine Sache, worüber eins sich viel zu freuen hat! Ich weiß nicht, ob es eine Ehre für mich ist; aber das weiß ich recht gut, daß es ein schlechtes Vergnügen ist, einen Mann, wie dieser da, immer vor Augen zu haben.» -
«Du mußt nicht so reden», sagte ihre Schwester. «ich kann nicht anders reden», antwortete die Jüngere; «wenn es ein so großes Glück ist, ihm zu gefallen, warum macht er sich nicht an dich, da du doch schöner und verständiger bist als ich? Ich möchte wohl sehen, wenn er dich liebte, ob du ihn wiederlieben würdest.»
Der kleine bucklige Greis spielte keine angenehme Rolle während diesem Wortwechsel. «Wie unglücklich doch mein Schicksal ist», rief er mit Betrübnis aus; «ich habe die berühmtesten Schönheiten aller Morgenländer gesehen und lebe nun bis auf das Alter, worin ihr mich seht, ohne daß ich jemals mein Herz hätte überraschen lassen; und nun muß ich in diesem Augenblick in die stärkste Leidenschaft für eine Person fallen, die mit einem unüberwindlichen Widerwillen gegen mich eingenommen ist!
Ich sehe, welch ein schreckliches Los ich mir selbst zubereite, und gleichwohl nötigt mich mein Verhängnis, einer Neigung zu folgen, die mich wider Willen fortzieht.» Die Augen stunden dem Alten voll Wassers, indem er dies sagte, und er schien so bewegt, daß Fatime, die von Natur sehr weichherzig war, Mitleid mit ihm haben mußte.
«Lieber Herr», sagte sie, «hört auf, Euch so zu betrüben! Laßt Euch die ersten Reden eines Kindes nicht beunruhigen, das noch nicht weiß, was ihm gut ist; ihr Verstand wird mit den Jahren reifer werden. Ihr habt freilich die Annehmlichkeiten der Jugend nicht mehr, aber ich halte Euch für einen wackeren Herrn. Eure Liebe und Eure Gefälligkeiten werden sie gewiß noch gewinnen. Wir wollen inzwischen mit Euch gehen, und ich verspreche Euch, daß ich mein Bestes bei ihr tun will.» -
«Gut, Schwester», fiel ihr die Kleine verdrießlich ins Wort; «aber wenn er mich quält und haben will, daß ich ihn liebe, so bin ich euch nicht gut dafür, daß ich nicht davonlaufe.» - «Nein, schöne Kadidsche», sagte der Greis, «du sollst nicht gequält werden; ich schwöre es bei allem, was heilig in der Welt ist! Ich will dir nicht den geringsten Zwang auflegen.
Du sollst unbeschränkte Gebieterin über alles, was ich habe, sein. Hättest du gern ein reiches Kleid oder irgendeinen anderen Putz, so sollst du es auf der Stelle haben; ich werde mir eine Pflicht daraus machen, allen deinen Wünschen entgegen zu kommen. Noch mehr, wenn ich merken werde, daß dir mein Anblick lästig sein wird, so will ich dich damit verschonen, wie schwer es mich immer ankommen mag.»
Fatime nahm nun wieder das Wort und sagte zum Alten: «Weil denn meine Schwester nicht abgeneigt scheint, auf die versprochnen Bedingungen mit Euch zu gehen, so erlaubet nur, daß wir vorher diese Wäsche zu den Personen tragen, denen sie zugehört; wir wollen bald wieder bei Euch sein.» -
«Ach! ich bitte Euch inständig», rief der Alte, «wenn Ihr mir nicht das Leben nehmen wollt, so nehmt mir Eure holdselige Schwester nicht! Es sei nun Vorsichtigkeit oder Ahndung, genug, ich fürchte, euch nie wiederzusehen, wenn ihr mich beide verlaßt, und darüber würde ich mich zu Tode kränken. Ihr wollt bald wiederkommen? Nun, so laßt sie bei mir, bis Ihr wiederkommt! Was habt Ihr zu besorgen? Könntet Ihr ein Mißtrauen...»
«Nein, nein», fiel Kadidsche hastig ein, «ich gehe mit meiner Schwester, ich bleibe nicht allein bei ihm.» - «Und warum denn nicht?» sagte Fatime, die dem Alten eine Probe ihrer versprochenen guten Dienste geben wollte, «warum wolltest du nicht bei ihm bleiben? Ich werde in einem Augenblick wieder hier sein. Ich bitte dich, Schwester, bleibe und warte hier auf mich. Du bist dem Herrn diesen Beweis deines Zutrauens schuldig, um ihn über die unangenehmen Dinge zu trösten, die du ihm gesagt hast.»
Kadidsche, so hart es sie ankam, allein bei ihm zu bleiben, wagte es doch nicht, sich dem Willen ihrer ältern Schwester zu widersetzen, die sie als eine zweite Mutter betrachtete. Fatime nahm also beide Körbe und machte sich auf den Weg, nachdem sie dem Alten wohl empfohlen hatte, mit dem Eigensinn der kleinen Person, die sie bei ihm zurückließ, behutsam zu verfahren.
Allein, anstatt bald wiederzukommen, wie sie versprochen hatte, kam sie den ganzen Tag nicht wieder. Kadidschens Unruhe war mit nichts zu vergleichen; und wie sie endlich gar die Nacht einbrechen sah, verlor sie alle Geduld und überschüttete den armen Alten mit Vorwürfen.
«Ihr allein bringt uns Unglück», sagte sie; «ohne Eure leidige Bekanntschaft wär' ich jetzt bei meiner Schwester. Was für ein Unfall ihr auch zugestoßen sein mag, so wollte ich ihn lieber mit ihr teilen als hier bei Euch sein.»
Diese Reden machten dem Alten große Unlust. Er wußte nicht, was er antworten sollte, so sehr scheute er sich, die junge Person noch mehr aufzubringen, die, wie er sich wohl bewußt war, nur zu viel Ursache hatte, wider ihn eingenommen zu sein. Indessen tat er sein äußerstes, sie zu beruhigen; aber alles, was er vornahm, vermehrte nur ihre Unruhe und ihren gegen ihn gefaßten Widerwillen.
Sie sagte ihm, er sollte schweigen, und sie wollte nach Masulipatnam gehen, trotz der Finsternis der Nacht und einem großen Regen, der inzwischen eingefallen war. Im Grunde war es noch mehr, um nicht die Nacht bei dem Alten zubringen zu müssen, als aus Verlangen, von ihrer Schwester Nachricht einzuziehen, wie groß dieses auch immer sein mochte.
In dessen brachte er sie doch endlich davon ab, indem er ihr vorstellte: Aller Wahrscheinlichkeit nach werde Fatime, da sie das Gewitter im Anzug gesehen, bei einer ihrer Bekanntschaften zurückgeblieben sein und morgen früh unfehlbar wiederkommen. Kurz, er vermochte endlich, ungeachtet ihres Widerwillens und Eigensinns, so viel über sie, daß sie ihm nach ihrer Hütte folgte, wo sie, über einer leichten Mahlzeit von trocknen Datteln und Brunnenwasser, von nichts als den unglücklichen Zufällen dieses Tages reden konnten.
Das junge Mädchen tat die ganze Nacht nichts als weinen und jammern; man kann sich vorstellen, wie ihrem alten Liebhaber dabei zumute war. Sobald der Tag anbrach, verließen sie die Hütte und gingen zusammen nach Masulipatnam. Sie erkundigten sich allerorten nach Fatimen, wo Kadidsche wußte, daß sie Wäsche hin getragen hatte; aber niemand konnte ihr sagen, was aus ihr geworden sei.
Sie begnügten sich nicht hieran. Sie suchten sie von Gasse zu Gasse und fragten in allen Häusern nach ihr; aber ihr Nachforschen war vergeblich. Diese Dunkelheit über Fatimens Schicksal setzte sie in den äußersten Kummer. Sie konnten nicht zweifeln, daß dem armen Mädchen etwas Außerordentliches begegnet sein müsse. Ihre junge Schwester blieb ganz untröstbar und sagte dem Alten die härtesten Dinge von der Welt, so oft er es versuchen wollte, sie zu beruhigen.
Sie brachten die sieben oder acht folgenden Tage damit zu, die ganze benachbarte Gegend zu durchlaufen. Es war kein Schloß, kein Haus und keine Hütte auf vier Meilen in die Runde, wo sie nicht nachgesucht hätten, aber immer mit gleich schlechtem Erfolge. Endlich, da sie sich nicht anders zu helfen wußten, kehrten sie ganz niedergeschlagen in die Hütte zurück.
Wie nun der kleine Greis sah, daß Kadidsche sich ohne Maß über den Verlust ihrer Schwester grämte, beschwor er sie mit tränenden Augen, einen Ort, wo alles ihren Schmerz nährte und wo er sie überdies nicht hätte schützen können, zu verlassen und ihm in die Stadt, wo er sich gewöhnlich aufhielt, zu folgen.
Er legte ihr alle nur möglichen Beweggründe vor; und da sie ihm keine Antwort gab, fing er wieder von vorne an und drang so lange und so inständig in sie, bis sie endlich mehr aus Verzweiflung als gutwillig sich erklärte, er möchte sie hinführen, wohin es ihm beliebte.
Sie machten sich also auf den Weg; aber ehe sie sich entfernten, schrieb der Alte mit einer Kohle über die Tür, wohin er Kadidschen führe, damit Fatime, wenn sie etwa wieder käme, Nachricht von ihnen hätte. Hierauf schlossen sie die Tür zu und steckten den Schlüssel in einen benachbarten hohlen Baum, wie sie es sonst immer zu tun gewohnt waren.
Die Stadt, wohin der kleine bucklige Greis Kadidschen zu führen gedachte, war nur drei Tagesreisen von Masulipatnam entfernt; aber ein Mann von hundert Jahren und ein Mädchen von zwölf können keine lange Tagesreisen machen. Sie brachten sieben Tage damit zu und waren gleichwohl beide von Müdigkeit und Hunger ganz erschöpft, als sie anlangten.
Das erste, was Dahy tat (so nannte sich der Alte), war, daß er in die Stadt schickte und in größter Eile das Beste, was man auftreiben konnte, holen ließ, um seine junge Freundin und sich selbst zu erfrischen. Nachdem der Hunger gestillt war, führte er sie in ein ziemlich feines Gemach, das er für sie bestimmt hatte, und er selbst ging, in einem anderen Zimmer auszuruhen.
Des folgenden Tages ging er in die Kaufläden und kaufte eine Menge schönes Zeug zu Kleidern für Kadidsche und zu ihrer Aufwartung eine alte Sklavin, die man ihm als eine große Meisterin in der Kunst, Damen zu coiffieren, anpries. Kadidsche konnte sich über die Veränderung ihrer Umstände nicht genug verwundern.
Sie merkte zwar wohl, was für Gesinnungen der Alte für sie hatte; aber sie begriff nicht, wie sie zu einer so unumschränkten Herrschaft über ihn gekommen sei. Zuweilen, wenn sie dachte, daß sie ihm gleichwohl alle die Vorteile, in deren Besitz sie war, schuldig sei, erhob sich eine Bewegung von Dankbarkeit in ihrem Herzen; indessen konnte doch, was sie auch sich selbst hierüber sagte, die Zärtlichkeit eines so abgelebten Liebhabers ihren Abscheu vor seiner Figur nicht vermindern.
Was ihr indessen noch am besten an ihm gefiel, war die große Ehrerbietung, womit er ihr begegnete; und daß er, seines Versprechens eingedenk, sie so viel, als ihm nur immer möglich war, mit seiner unangenehmen Gegenwart verschonte.
Verschiedene Wochen waren schon verflossen, ehe Kadidsche nur einigermaßen sich wieder zu fassen schien. Das Andenken an ihre Schwester verbitterte alles, was ihr ihre gegenwärtige Lage hätte angenehm machen können, und immer fielen ihr die letzten Worte ihrer sterbenden Mutter ein, die ihr so ernstlich anbefohlen hatte, sich nie von ihrer Schwester zu trennen.
In dessen wurde doch das Gefühl ihres Schmerzes nach und nach ein wenig stumpfer, und wahrscheinlich trugen die angenehmen Zerstreuungen, die ihr Dahy zu verschaffen suchte, nicht weniger dazu bei als die Zeit und die Lebhaftigkeit der Jugend.
Eines Tages, da sie sich durch Spazieren gehen ermüdet hatte, legte sie sich früher als gewöhnlich nieder. Sie fiel in einen tiefen Schlaf, und gegen Morgen, wenn die Bilder, die sich der Seele darstellen, am reinsten und lebendigsten sind, hatte sie einen Traum, der einen sehr starken Eindruck auf sie machte.
Ihr träumte, es erscheine ihr ein Jüngling von außerordentlicher Schönheit, dessen Miene und lockiges blondes Haar sie bezauberte. In dem sie ihn mit großer Aufmerksamkeit betrachtete, sprach er zu ihr: «Wo denkst du hin, Kadidsche? Hast du deine Fatime so bald vergessen können? Glaubst du, die schönen Kleider, die dir Dahy verehrt hat, überheben dich der Pflicht, sie aufzusuchen?
Nein, gewiß nicht; und ich sage dir, daß du nicht anders glücklich werden kannst, als wenn du gehst und sie in der Insel Sumatra suchst. Betrachte mich wohl, denn du siehst denjenigen, den dir das Schicksal zum Gemahl bestimmt hat.» Mit diesem Worte verschwand der schöne Jüngling, und Kadidsche erwachte; aber sie konnte es sich kaum ausreden, daß es eine Erscheinung und kein Traum gewesen sei, so tief hatte sich das reizende Bild in ihre Seele eingedrückt.
Sie glaubte den schönen Jüngling mit seinem krauslockigen blonden Haare noch vor sich zu sehen, und seine Stimme tönte noch wie Musik in ihren Ohren nach. Sie konnte zwar nicht glauben, daß es in der ganzen Welt einen Sterblichen von solcher Schönheit geben könnte; aber dem ungeachtet war ihr Glaube an ihren Traum so stark, daß sie ihn sogleich dem alten Dahy erzählte und ihm sogar zumutete, noch an selbigem Tage Anstalt zur Reise nach Sumatra zu machen.
Auch er, es sei nun aus wirklicher Überzeugung oder aus Gefälligkeit gegen die kleine Schwärmerin, schien ihr Traumgesicht für etwas mehr als ein bloßes Spiel der Phantasie zu halten, und wie wohl er alle Ursache hatte, sich vor dem schönen Nebenbuhler, den es ihm gegeben, zu fürchten: so erklärte er sich doch, daß er keinen anderen Wunsch habe, als die ihrigen zu befriedigen, und daß er bereit sei, mit ihr nach der Insel Sumatra abzugehen.
Kadidsche betrieb die Abreise mit solcher Ungeduld, daß sie ihm kaum Zeit ließ, die nötigen Anstalten zu machen. Jedoch wollten sie, ehe sie zu Schiffe gingen, vorher eine Reise nach der Hütte machen, um zu sehen, ob sie keine Spur finden würden, daß Fatime in dessen zurück gekommen sei.
Aber sie fanden alles, wie sie es gelassen hatten, und da sie dieser Umstand in der Entschließung, dem Befehle des Traumes zu gehorchen, bestärkte, so gingen sie nach Masulipatnam zurück, wo Dahy auf einem Schiffe von Achem, welches im Begriffe stand, mit einer reichen Ladung unter Segel zu gehen, eine kleine Kammer mietete und sie mit allen Bequemlichkeiten versah, die das Beschwerliche einer langen Seereise erleichtern können.
Die kleine Kadidsche machte sehr große Augen, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben nichts als Himmel und Wasser sah; aber das Verlangen nach ihrer Schwester unterstützte ihren Mut; eine gewisse aus Neugier und Liebe zusammengesetzte Empfindung für den schönen Jüngling, der ihr im Traum erschienen war, trug wohl auch das ihrige dazu bei.
Sie wollte sich zwar nicht gestehen, daß sie Hoffnungen in ihrem kleinen Herzen brütete, die ihr zuweilen selbst lächerlich vorkamen; aber sie war doch neugierig, wie sich das alles enden würde, und sie fragte den Alten alle Augenblicke, wie lange sie noch bis nach Sumatra zu fahren hätten.
Um ihre Ungeduld soviel möglich zu täuschen und ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu ziehen, suchte er alles hervor, was ihm seine Kenntnisse und die großen Reisen, die er gemacht hatte, zu ihrer Unterhaltung an die Hand gaben; und da die Gewohnheit ihr das Unangehme seiner Gestalt und seines hohen Alters ziemlich erträglich gemacht hatte, so hörte sie ihm gerne zu und fand immer mehr Belieben an seinem Umgang, je mehr ihr eigener Verstand sich dadurch bildete und je heller es darin wurde.
Die neue Verbindlichkeit, die sie ihm dafür schuldig wurde, nahm mit dem neuen Werte zu, den sie in ihren eigenen Augen erhielt; und die Achtung und Bewunderung, die ihr die Vorzüge seines Geistes einflößten, stiegen in eben dem Verhältnisse wie ihre Fähigkeit, sie gewahr zu werden.
Rechnet man nun noch das Vertrauen hinzu, das ihr sein immer gütiges und von dem feinsten Gefühle geleitetes Betragen gegen sie einflößen mußte, und ein gewisses Wohlwollen, das man sich nicht entbrechen kann, zu einer jeden Person zu tragen, von welcher man außerordentlich geliebt wird, wie abgeneigt wir uns auch immer fühlen mögen, ihre Liebe zu erwidern.
So wird man begreiflich finden, wie aus diesem allem unvermerkt eine Art von Freundschaft wurde, die sich bei Gelegenheit auf eine so zärtliche Art ausdrückte, daß der gute Alte beinahe zu entschuldigen war, wenn er sich zuweilen mit der ausschweifenden Hoffnung täuschte, es könnte doch wohl am Ende noch Liebe daraus werden - eine Hoffnung, die er in seiner besonderen Lage, trotz aller ihrer Unwahrscheinlichkeit, sich um so mehr verzeihen konnte, da sie das einzige war, was ihm sein Dasein erträglich machte.
In diesem süßen Wahne überredete er sich, daß es nun Zeit sei, sie nicht länger unwissend zu lassen, wer er sei, was für ein seltsames Schicksal ihn zu ihrem Liebhaber gemacht habe und wie sehr er ihr Mitleid verdiene. «Wäre es denn das erste Mal», sagte er zu sich selbst, «daß Mitleid in dem Herzen eines Mädchens zu Liebe geworden wäre?» Der gute Dahy vergaß, wie man sieht, in diesem Augenblicke seine kleine bucklige Figur, seine Triefaugen, seinen Glatzkopf und seine hundert Jahre!
«Liebe Kadidsche», sprach er eines Tages zu ihr, da sie an einem schönen Abend bei dem heitersten Wetter ihre Augen an der untergehenden Sonne, die zur See ein gar herrliches Schauspiel macht, geweidet und sie sich hierauf in ihr Kämmerchen zurückgezogen hatten, «so abgelebt und baufällig ich dir auch in dieser Gestalt vorkommen muß, so wirst du dich doch nicht wenig wundern, wenn ich dir sage, daß ich unsterblich bin.» -
«Unsterblich?» sagte Kadidsche, in dem sie ihn sehr aufmerksam betrachtete, mit einem Ton und mit einer Miene, worin Erstaunen und Unglauben zu ziemlich gleichen Teilen miteinander vermischt waren; «wenn Ihr es nicht wärt, der es mir sagte», fuhr sie fort und hielt auf einmal inne... «Nichts ist gewisser», versetzte Dahy und schwieg abermals um zu bemerken, was in der Seele des jungen Mädchens bei einem so unerwarteten Geständnis vorging.
«So beklage ich Euch von Herzen», erwiderte sie traurig; «es würde grausam sein, Euch in solchen Umständen zu einem Vorzug Glück zu wünschen, den Ihr selbst unmöglich als ein Gut betrachten könnt.» - «Auch würde er», fuhr Dahy fort, «die unerträglichste Last für mich sein, wenn ich das wirklich wäre, was ich scheine; aber du wirst noch mehr erstaunen, schönste Kadidsche, wenn ich dir sage, daß du mich unter einer fremden Gestalt siehst.
Meine eigene ist, ohne Ruhm zu melden, geschickter, deinem Geschlechte Liebe als Abscheu einzuflößen, und ist um so gewisser, immer zu gefallen, weil sie den Vorteil einer ewigen Jugend hat. Lilien und Rosen blühen auf meinen Wangen, und - mit einem Worte: alles, was man schön und liebreizend nennt, ist über mein Gesicht und über meine ganze Person ausgegossen.» -
«Lieber Himmel», rief das Mädchen (der in diesem Nu der wunderschöne Jüngling aus ihrem Traum wieder vor die Stirn kam), «wie könnt Ihr nur einen Augenblick zaudern, eine so vorteilhafte Gestalt wieder anzunehmen?» - «Leider steht dies nicht in meiner Macht», antwortete Dahy mit einem tiefen Seufzer; «darin besteht eben mein Unglück; aber ich habe es nie so schmerzlich gefühlt, liebe Kadidsche, als seit dem es mich dir in einer so widrigen Verkleidung vor die Augen gebracht hat.» -
«Und es wird nie aufhören, dieses Unglück?» sagte sie. «Das liegt bloß an dir», erwiderte er. «An mir?» versetzte Kadidsche mit neuem Erstaunen; «wie soll ich das verstehen? Was kann ich tun, um ein so unbegreifliches Wunder zu wirken?» - «Nichts, als mich lieben», erwiderte Dahy, indem er sie mit einem Ausdruck von Zärtlichkeit ansah, der in einem Gesichte wie das seinige zur abscheulichsten Grimasse wurde und also gerade die umgekehrte Wirkung tat.
«Wenn das ist», sagte sie, «so besorge ich sehr, Ihr werdet ewig bleiben, wie Ihr seid. Aber, mein guter Herr, wie wollt Ihr, daß ich so unbegreiflichen Dingen Glauben beimesse?» «Wenn du mich nur anhören willst, meine Königin, so wirst du nicht länger an der Wahrheit meiner Reden zweifeln.
Ich habe dir schon genug gesagt, um zu merken, daß ich zu der Klasse von Wesen gehöre, die ihr Genien nennt. Ich habe einen Bruder, der von Natur ebenso schön und ebenso mächtig ist als ich. Wir sind Zwillinge; sein Name ist Adis, der meinige Dahy. Vermöge unseres angebornen Standes sind uns alle Dinge diesseits des Mondes unterworfen; aber dies konnte nicht hindern, daß wir selbst nicht der Willkür eines gewissen Brahminen von Wisapur untertan wären, der sich durch seine Wissenschaft eine unumschränkte Herrschaft über unsere Gattung erworben hat.
Zu unserem Unglücke warf er eine besondere Zuneigung auf mich und meinen Bruder; und zum Beweis seines Vertrauens bestellte er uns zu Hütern eines Frauenzimmers, die er heftig liebte, deren Treue aber ihm etwas unsicher schien. Vielleicht hätte er besser getan, ihr ohne Wächter zu trauen oder ihr wenigstens keine von unserer Figur zuzugeben.
In dessen ging eine Zeit lang alles sehr gut: wir versahen unseren Dienst auf das pünktlichste, die Dame hatte immer einen von uns beiden zur Seite, und wir bemerkten nicht das geringste, weder in ihren Neigungen noch in ihrem Betragen, das uns ihre Treue gegen den Brahminen verdächtig machen konnte.
Aber unvermerkt fiel sie in eine Art von Schwermut, die sich bald in ein sanft trauriges Schmachten verwandelte. Sie seufzte mitten unter den Lustbarkeiten, die der Brahmine ihr zulieb anstellte; und zuweilen sah sie uns, mich und meinen Bruder, an, als ob sie uns um Mitleid mit einem geheimen Gram, der sie verzehrte, bitten wollte.
Wir waren beide so weit entfernt, Arges zu denken, daß wir einander um die Ursache dieser Veränderung, unter welcher ihre Schönheit bereits merklich zu leiden anfing, befragten und mit allem unseren Genienverstande uns eher alles andere einbildeten, als daß wir selbst die unschuldige Ursache ihrer verborgenen Krankheit sein könnten.
Und gleich wohl war es nicht anders: die arme Dame, die uns tagtäglich vor Augen haben mußte, hatte sich endlich, vielleicht bloß aus Langeweile, nicht erwehren können, auf unsere Gestalt aufmerksam zu werden, und diese Aufmerksamkeit wurde ihr Unglück. Sie mochte sich selbst darüber sagen, was sie wollte, sie konnte sich (wie sie uns in der Folge selbst gestand) die schönen blonden Haare, die uns in großen natürlich krausen Locken auf die Schultern fielen und am Rücken hinunter wallten, gar nicht aus dem Sinne bringen.»
Die junge Kadidsche, die sich bei diesem Zug ihres Traumes erinnerte, betrachtete das alte Männchen mit großen Augen und fühlte, daß seine Erzählung sie zu interessieren anfing.
«Kurz», fuhr der Alte fort, «die Dame verliebte sich in uns, ohne daß wir etwas davon merkten, und die Zeit, von welcher man immer das Beste hofft, tat so wenig zu Linderung ihres Übels, daß es vielmehr alle Tage schlimmer mit ihr wurde. Es wäre unbegreiflich, wie Kansu (so nannte sich der Brahmine) mit aller seiner großen Wissenschaft nicht klarer in den Angelegenheiten seiner Geliebten sah, wenn man nicht wüßte, daß gerade die größten Geister die Leute sind, die nie sehen, was vor ihren Füßen liegt.
Genug, der Brahmine merkte so wenig davon als wir und machte sich auf eine Reise nach den Grenzen der großen Tartarei, wo er in einer Versammlung von weisen Meistern präsidieren mußte, ohne sich wegen seiner geliebten Farsana die geringste Unruhe zu machen. Wir beschlossen, Adis und ich, uns seine Abwesenheit zunutze zu machen, um, was es auch kosten möchte, hinter ihr Geheimnis zu kommen.
Der kürzeste Weg schien uns, wenn wir sie dahin bringen könnten, uns ihr Herz selber aufzuschließen. Wir redeten sie also deswegen an; wir baten sie aufs inständigste, uns nicht länger ein Geheimnis ans ihrem Übel zu machen, und erboten uns in den stärksten Ausdrücken zu allem, was nur immer in unserem Vermögen sein könnte, um die Ruhe ihres Gemütes wiederherzustellen.
Die Anrede des Adis, der in unser beider Namen das Wort geführt hatte, schien sie in große Verlegenheit zu setzen; allein, da sie dadurch einen Anlaß, sich uns zu entdecken, erhielt, den sie schon lange gesucht hatte, so faßte sie sich auf der Stelle und beschloß, die gute Gelegenheit nicht ungenutzt aus den Händen zu lassen.
‹Ihr seid gar zu großmütig, liebenswürdiger Adis›, antwortete sie ihm, ‹Euch um eine Unglückliche zu beunruhigen, die sich dieser Ehre unwürdig fühlt. Lasst mir, ich bitte Euch, den armseligen Trost, ein Übel, dem nicht zu helfen ist, im verborgenen zu beweinen.› ‹Was sagt Ihr, schöne Dame›, rief ich ganz erstaunt; ‹Eurem Übel sollte nicht zu helfen sein? So begreife ich wahrlich nicht, was für ein Übel das sein kann, denn ich kenne kein unheilbares.› -
‹Das meinige›, erwiderte sie, ‹ist von einer so besondern Art, daß, sofern es ja durch etwas in der Welt gelindert werden könnte, Euer Mitleid das einzige wäre, wovon ich diese Wirkung hoffen dürfte.› - ‹Oh, wenn es nur an unserm Mitleid liegt›, rief ich ein wenig zu voreilig, ‹auf das könnt Ihr rechnen! Aber wozu könnte Euch unser bloßes Mitleid helfen?
Wir werden uns nicht eher zufriedengeben, bis dieser tiefen Schwermut geholfen ist, die Euch allmählich aufreibt. Ist irgendein verborgenes körperliches Übel die Ursache, so wißt Ihr, daß uns die geheimsten Heilkräfte der Natur zu Gebote stehen; oder sollte das Betragen des Brahminen nicht so beschaffen sein, wie es Euer Wert und Eure Liebe um ihn verdienen: so ist Euch ebenfalls nicht unbekannt, wie viel wir über ihn vermögen.
Redet also, liebenswürdige Gebieterin; setzt uns in den Stand, Euch unseren Diensteifer tätig zu beweisen und uns dadurch zugleich um den Brahminen, unseren Gebieter, und um eine Person, die ihm so lieb ist, verdient zu machen.›
Farsana erseufzte bei diesen Worten. ‹Meine Gesundheit ist nicht angegriffen›, erwiderte sie, ‹und Kansu hat mir keine Ursache gegeben, mich über ihn zu beklagen. Gleichwohl leide ich auf die grausamste Weise, und ich weiß nicht, mein lieber Dahy, ob Ihr mit allem dem Diensteifer, dessen Ihr mich versichert, so geneigt wärt, meinem Leiden abzuhelfen, wenn Ihr es kennt.› -
‹Ah, meine Gebieterin›, rief mein Bruder, ‹Ihr tut uns das größte Unrecht. Stellt uns auf die Probe, so werdet Ihr bald vorteilhafter von uns denken!› - ‹Und wenn ich Euch nun sagte›, antwortete sie errötend, ‹daß ihr beide ganz allein Ursache des Übels seid, das ihr heilen wollt.› - ‹Wer? Wir?› riefen wir beide zu gleicher Zeit voll Erstaunen, aber durch die seltsamste Verblendung noch immer weit entfernt, zu verstehen.
‹Wie sollte das möglich sein›, setzte ich hinzu, ‹daß wir Urheber einer Wirkung sein könnten, die so gänzlich unserer Absicht entgegen wäre?› - ‹Eine solche Frage, nach dem, was ich euch schon gesagt habe, sollte mir zwar den Mund auf ewig schließen›, versetzte die Dame; ‹aber ich habe mich schon zu weit heraus gelassen, um mein Geständnis nicht zu vollenden.
Wisset also, weil ihr es doch wissen wollt, allzu liebenswürdige Brüder, daß ich nicht stark genug gewesen bin, gegen den Eindruck eurer Reize auszuhalten. Ich habe vergebens allen meinen Kräften aufgeboten, ihren täglich zunehmenden Wirkungen Einhalt zu tun, und dieser Widerstand hat mich endlich dahin gebracht, wo ihr mich seht.›
Sie begleitete diese Worte mit einem Strom von Tränen, der das Feuer ihrer Augen nur desto stärker anzufachen schien. Unsere Bestürzung bei einem so unerwarteten Geständnis ist unbeschreiblich; aber wir erholten uns bald genug, um sie zu überzeugen, daß sie sich keine Hoffnung machen dürfe, uns zu Teilnahme an ihrem Vergehen gegen den Brahminen, unseren Gebieter, verleiten zu können.
Wir beeiferten uns in die Wette, sie zur gehörigen Empfindung ihres Unrechts gegen Kansu und zur Überlegung der schrecklichen Folgen zu bringen, die ihre Leidenschaft für sie und uns haben würde. Aber es war schon zu weit mit ihr gekommen. Sie hörte uns zwar mit Gelassenheit an, weil das Geständnis, so sie uns getan, ihr Herz von einer drückenden Last erleichtert hatte, aber unsere Vorstellungen machten nicht den geringsten Eindruck auf ihr Gemüt.
Sie schmeichelte sich eine Zeit lang mit der Hoffnung, durch ihre Beharrlichkeit und durch immer wiederholte Angriffe endlich den Sieg über uns zu erhalten; aber da sie sich von einem Tage zum anderen in ihrer Erwartung betrogen sah, so verfiel sie wieder in ihren vorigen Zustand. Unglücklicherweise verpflichtete uns der ausdrückliche Befehl des Brahminen, sie nicht aus den Augen zu lassen.
Ihre Begierden erhielten dadurch immer neue Nahrung, und wir befanden uns täglich und stündlich ihren Klagen und Vorwürfen ausgesetzt. Das Seltsamste bei dem allem war, daß ihre Leidenschaft nicht auf einen von uns, sondern mit gleicher Heftigkeit auf beide gerichtet war. Auch hierüber, wie anstößig es uns immer sein mußte, half keine Vorstellung bei ihr.
Sie warf die Schuld auf ihr Verhängnis und auf die Unmöglichkeit, einen von uns dem anderen vorzuziehen. Sie könnte und würde nie ruhig werden, sagte sie, sofern wir nicht beide ihre grenzenlose Liebe zu uns teilten. Bei der innigen Freundschaft, die uns gleichsam nur zu einer Person machte, könnte ja keine Eifersucht zwischen uns stattfinden. Kurz, es helfe hier kein Widerstand, und wenn wir grausam genug sein könnten, sie noch länger ohne Hilfe schmachten zu lassen, so bliebe ihr kein anderer Trost, als daß wir bald genug das Ende ihres elenden Lebens sehen würden.
Es war keine leichte Sache, liebe Kadidsche, gegen die vereinigte Wirkung der Reizungen der schönen Farsana, des Mitleids, das uns der Anblick ihres Leidens einflößte, und der unaufhörlichen Stürme, so sie täglich auf unsere Standhaftigkeit tat, auszuhalten; und gleichwohl blieb ich immer unbeweglich, wie wohl ich die Verblendung und den Starrsinn der armen Unglücklichen von ganzem Herzen beklagte. Aber wer könnte sich vermessen, daß er, in einer solchen Lage, unter solchen Versuchungen, immer Herr über seine Sinne bleiben werde?
Eines Abends, da ich allein bei ihr war und sie noch mehr als gewöhnlich niedergeschlagen sah, fragte ich, was für eine neue Ursache sie wohl haben könnte, sich so zu grämen. ‹Grausamer Dahy›, antwortete sie mir, ‹kannst du eine solche Frage an mich tun? Brauche ich eine andere Ursache, um aufs äußerste gebracht zu sein, als die unerbittliche Strenge, die du gegen mich beweist? Oh, warum, da ihr Brüder einander sonst in allem so ähnlich seid, kannst du hierin allein deinem Bruder so unähnlich sein?› -
‹Meinem Bruder unähnlich?› fragte ich erstaunt; ‹wie soll ich das verstehen?› - ‹Er hat alles für mich getan, was ich von ihm erwartete›, versetzte sie mit schmachtender Stimme. Ich glaubte falsch gehört zu haben. ‹Wie?› rief ich, ‹mein Bruder Adis? Er hätte Eure Wünsche befriedigt?› -
‹Ja›, versetzte sie ganz kalt; ‹und was ist denn daran, das dich in solches Erstaunen setzen kann? Meinst du, jedermann müsse so hartherzig sein wie du? Er hat sich durch meine Tränen erweichen lassen; er hat sein Herz der Liebe geöffnet, er ist glücklich und bedauert jetzt nur, daß er so viel Zeit verloren hat, wo er es hätte sein können.› -
‹Und Ihr seid noch nicht zufrieden?› rief ich mit Heftigkeit; ‹Ihr habt nicht an einem Schlachtopfer genug und hofft auch mich zu verführen, wie Ihr den allzu nachgiebigen Adis verführt habt?› - ‹Ja, mein liebster Dahy›, antwortete sie, indem sie einen Blick auf mich schoß, worin alle Pfeile der feurigsten Leidenschaft zusammen gedrängt waren; ‹ja, dein Herz allein mangelt mir noch, um glücklich zu sein. Weh mir! Haben alle Leiden, die ich schon so lange um deinetwillen erdulde, mir nicht endlich einiges Mitleiden von dir verdienen können?› -
‹O Farsana›, erwiderte ich, ‹was Ihr mir sagt, überzeugt mich, daß Ihr meinen Bruder nicht liebt; unmöglich, wenn Ihr ihn liebtet, könntet Ihr auch noch für einen anderen seufzen?› - ‹Ich bete ihn an›, versetzte sie. ‹Hundertmal wollte ich mein Leben hingeben, um ihm meine Liebe zu beweisen; aber eben diese grenzenlose Liebe, die ich für ihn fühle, hat die ganze Stärke derjenigen, die ich zu dir trage, wieder angefacht.
Wie oft habe ich es dir schon gesagt: ich kann keinen von euch weniger lieben als den anderen. Alles, was Adis für mich empfindet, so teuer es meinem Herzen ist, kann mich nicht glücklich machen, wenn ich dir nicht die nämlichen Empfindungen einzuflößen vermag. Mit einem Worte, liebenswürdiger Dahy: ich sterbe, wenn du dich nicht erbitten lässt. Kannst du gefühlloser sein als dein Bruder oder dich schämen, seinem Beispiele zu folgen? Oh, höre einmal auf zu widerstehen, wenn du nicht willst, daß ich mir vor deinen Augen einen Dolch ins Herz stoßen soll!›
Bei diesen Worten warf sie sich mit einem Strom von Tränen zu meinen Füßen und überhäufte mich mit so lebhaften Beweisen der heißesten Inbrunst, daß ich fürchten mußte, sie würde ihre Drohung wahr machen, wenn ich mich ihren Wünschen länger widersetzte. Ich bekenne es, ich wurde überwältigt; ich verlor die Kraft, länger zu widerstehen; kurz, ich wurde so schwach wie mein Bruder, zu dessen Verführung sich die listige Farsana (wie er mir hernach gestand) des nämlichen Kunstgriffs bedient hatte.
Eine natürliche Folge ihres über uns erhaltenen Sieges war, daß sich ihre Gesundheit in kurzer Zeit wiederherstellte; sie bekam ihre ganze Munterkeit wieder, wurde schöner als jemals und würde uns durch einen Reichtum von Liebe, der für beide groß genug war, vielleicht beide glücklich gemacht haben, wenn sie die Vorwürfe, womit unser Herz unsere Treulosigkeit an dem Brahminen bestrafte, zum Schweigen hätte bringen können. Bei allem dem führten wir einige Tage ein ganz angenehmes Leben, als unsere Sorglosigkeit uns auf einmal in das Unglück stürzte, dessen Folgen ich bis auf diese Stunde tragen muß.
Unter den Bedienten des Brahminen war ein sehr häßlicher schwarzer Sklave namens Torgut, dessen gewöhnliche Verrichtung war, eine tartarische Stute zu striegeln, welche Farsana zu reiten pflegte, wenn sie sich Bewegung im Freien machen wollte. Diesen häßlichen Unhold kam die Verwegenheit an, seine Augen bis zu seiner Gebieterin zu erheben und ihr eine Liebeserklärung zu tun.
So übel gebaut er am Leibe war, so hatte ihn die Natur dafür mit einem sehr kurzweiligen Geiste begabt; und wenn er so neben seiner zu Pferde sitzende Gebieterin einherging, pflegte er sie mit allerlei drolligsten Geschichtchen zu unterhalten, an welchen Farsana großes Belieben fand.
Einsmals fiel ihm ein, ihr von verschiedenen Mädchen vorzuschwatzen, von welchen er Gunst Bezeugungen genossen zu haben vorgab. ‹Wie, Torgut›, sagte die Dame mit Lachen, ‹eine Figur wie du kann sich seines Glückes bei den Damen rühmen?› - ‹Warum das nicht›, antwortete der Schwarze; ‹bin ich etwa nicht so gut als ein anderer? Oh, wahrhaftig, wenn das wäre, so hätte ich meine Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn ich habe mir in den Kopf gesetzt, schöne Dame, die Liste meiner Eroberungen auch mit Eurem Namen zu vermehren.›
Bei diesen Worten des Negers brach Farsana in ein noch größeres Gelächter aus; denn sie dachte nichts anderes, als er sage es bloß, um ihr Spaß zu machen. ‹Du hast Absichten auf mich?› sagte sie. ‹Es ist mir lieb, daß ich es weiß; ich werde mich vor einem so gefährlichen Menschen, wie du bist, in acht nehmen zu wissen.›
Torgut antwortete im nämlichen Tone, und so kam es mit lauter Scherzen endlich so weit, daß der rohe Kerl aus Scherz Ernst machte und sich so benahm, daß Farsana sich genötigt sah, ihn nicht nur sehr ernsthaft und mit der Verachtung, die ihm gebührte, abzuweisen, sondern, weil er unverschämt genug war, ihren Unwillen noch immer für Scherz zu nehmen, ihm sogar zu drohen, daß sie sich bei dem Brahminen über seine Verwegenheit beklagen würde.
Der Neger wurde über eine Begegnung, die seinen vermeinten Verdiensten so schlecht entsprach, boshaft. Die gute Meinung, die er von sich selber hatte, ließ ihn nicht begreifen, daß ihm Farsana hätte widerstehen können, wenn ihr Herz nicht schon für einen anderen begünstigten Liebhaber eingenommen gewesen wäre. Er nahm sich vor, sie genau zu beobachten, und es glückte ihm so gut, daß unser heimliches Verständnis mit ihr gar bald kein Geheimnis mehr für ihn war.
Aus Neid und Rachgier entdeckte er es dem Brahminen, dem die Sache so unglaublich vorkam, daß er sie nur dem Zeugnis seiner eignen Augen glauben wollte. Um uns sicher zu machen, schützte er abermal eine Reise vor; aber er kam unzeitig genug wieder, um uns, mich und meinen Bruder Adis, mit Farsanen im Bade zu überraschen. Die Vorkehrungen, die wir gemacht hatten, um von niemand entdeckt werden zu können, halfen nichts gegen die Wissenschaft des Brahminen.
Alle Türen öffneten sich ihm; der magische Nebel, der uns einhüllte, zerrann, und auf einmal stand Kansu als der furchtbarste Richter vor uns da. ‹Nichtswürdige›, sprach er, indem er einen Blick auf mich und meinen Bruder warf, der schon ein Anfang seiner Rache war, ‹die grausamsten Martern wären eine zu leichte Strafe für euer Verbrechen; aber ich will euch in einen so elenden Zustand herabstürzen, daß ihr das Vorrecht der Wesen eurer Art, nicht sterben zu können, als das äußerste Unglück beweinen sollt!›
Und so gleich, ohne ein Wort zu unsrer Entschuldigung anhören zu wollen, fing er seine Beschwörungen an. In einem Augenblick erfüllte das Gemach, wo wir waren, die dickste Finsternis. Wir hörten den Donner mit schrecklichem Getöse über unsere Scheitel rollen, die Erde zitterte unter unseren Füßen, und fürchterlich brüllende Wirbelwinde schienen den Untergang der Natur anzukünden.
Wir blieben zwei ganze Stunden in dieser entsetzlichen Finsternis und in bebender Erwartung der Strafe, die uns zubereitet würde. Endlich wurde es wieder so heiter als zuvor; aber wie groß war unser Erstaunen, als wir beide, ich und mein Bruder, uns, anstatt in einem prächtigen Palast und in dem herrlichsten Bade, mitten auf einer dürren Heide befanden, beide mit Lumpen bedeckt und in Gestalt zweier kleiner mißgestalteter Greise, so wie ich, schöne Kadidsche, in diesem Augenblick vor dir erscheine.
‹Undankbare›, sagte Kansu, ‹von diesem Augenblicke an seid ihr aller Vorrechte eurer Natur beraubt und zum Stande gewöhnlicher Menschen, wie ihr zu sein scheint, herabgesetzt. Ihr werdet nicht mehr wissen, nicht mehr vermögen als sie, und den Tod allein ausgenommen, werdet ihr allen Zufällen und allem Ungemach der Sterblichen unterworfen sein.› Nachdem der Brahmine dieses Urteil über uns ausgesprochen hatte, verlangte er nun auch die Umstände unseres an ihm begangenen Hochverrats zu wissen.
Wir erzählten ihm alles, von Anfang an, mit der größten Aufrichtigkeit: in welche Bestürzung uns Farsanens Erklärung gesetzt; welche Mühe wir uns gegeben, sie auf andere Gedanken zu bringen; wie lange und ernstlich wir uns gegen sie und gegen unsere eigene Neigung gewehrt; was für eine List die Dame gebraucht, um uns zu verführen; und wie schmerzlich uns der Gedanke sei, seinem Vertrauen so übel entsprochen zu haben.
Dieser Bericht und die Aufrichtigkeit unsrer Reue stimmte den Brahminen zu milderen Gesinnungen gegen uns herab. Er schien sich selbst zu tadeln, daß er unsere Treue einer so gefährlichen Prüfung ausgesetzt hätte; und da wir ihm immer sehr lieb gewesen waren, so konnte er sich nicht entbrechen, uns mit Mitleid anzusehen.
‹Meine Kinder›, sprach er, ‹es ist nicht mehr in meiner Gewalt, euch eure vorige Gestalt ohne Bedingung wiederzugeben; aber ich will euch, soviel ich kann, die Strenge eures Schicksals erträglich zu machen suchen; und ihr werdet eure natürliche Figur mit allen ihren Vorrechten wieder bekommen, sobald jeder von euch ein Mädchen unter zwanzig Jahren, die ihn liebt, gefunden haben wird.›
Mutlos schlugen wir bei diesen Worten die Augen nieder, denn es brauchte nur einen Blick auf uns Selbst, um uns alle Hoffnung, unter einer solchen Bedingung, auf ewig zu verbieten. Kansu erriet unsere Gedanken. ‹Wie unwahrscheinlich es auch immer sein mag›, sagte er, ‹daß ihr unter dieser Gestalt Liebe einflößen könntet, so ist es doch nicht unmöglich. Lebt in dieser Hoffnung und seid versichert, daß ihr unter keiner anderen Bedingung wieder in euren vorigen Stand gelangen könnt! Geht nun, Kinder, und erfüllt euer Schicksal!
Ihr müßt euch trennen, damit jeder auf seiner Seite suchen könne, was er von Nöten hat.› Hierauf wies er jedem von uns einen gewissen Ort, ungefähr sechzig Meilen voneinander, zum gewöhnlichen Aufenthalt an, ließ uns anständige Kleider geben und jedem an Gold und Juwelen den Wert von fünfzigtausend Zechinen aus seinem Schatze auszahlen, damit wir während unserer Verbannung gemächlich leben könnten. Hierauf umarmte er uns und wünschte uns ein baldiges Ende unseres unglücklichen Zustandes.
Aber gegen die arme Farsana blieb er unerbittlich. Er verwandelte sie in einen Frosch und verbannte sie in einen Sumpf, wo er ihr den Sklaven Torgut zum Unglücksgefährten gab, nachdem er durch seine Kunst entdeckt hatte, daß dieser aus bloßer Rachgier zum Verräter an seiner Gebieterin worden war. Solchergestalt wurde der Ankläger und die Verklagte, beide in Frösche verwandelt, dazu verurteilt, ihr übriges Leben in dem nämlichen Sumpfe zuzubringen, wo die Hoffnung, einander zu quälen, allenfalls noch der einzige elende Trost war, der ihnen übrig blieb.
Ohne dich, liebste Kadidsche, mit Beschreibung des traurigen Abschieds aufzuhalten, den wir Brüder mit so wenig Hoffnung, uns im nächsten Jahrtausend wiederzusehen, voneinander nahmen, will ich die Fortsetzung meiner Geschichte sogleich von der Stadt anfangen, die mir Kansu zum Hauptaufenthalt angewiesen hatte.
Meine erste Sorge war, meine fünfzigtausend Zechinen (als das Kapital, von welchem ich vielleicht länger, als ich wünschte, leben sollte) in der Handlung geltend zu machen; worin es mir dann so gut gelang, daß ich in weniger als drei bis vier Jahren imstande war, ohne Nachteil meines Hauptstammes einen ganz artigen Aufwand zu machen.
Wenn die Weissagung des Brahminen in Erfüllung gehen sollte, mußte ich also eine junge Person finden, die von so sonderbarem Geschmack wäre, eine zärtliche Neigung für mich zu fassen. Glücklicherweise war das schöne Geschlecht in unsrer Stadt nicht so eingesperrt wie in den meisten Morgenländern, sondern lebte in einer anständigen Freiheit.
Ich hatte also alle Tage Gelegenheit, Damen zu sehen. Ich machte ihnen artige kleine Geschenke, stellte ihnen zu Ehren kleine Lustpartien an und war bei allen öffentlichen Ergötzungen; kurz, ich tat mein möglichstes, um den Einfluß des Unglückssterns, der mich verfolgte, von mir abzuleiten. Auf diesem Wege machte ich mich in kurzem bei jedermann beliebt.
‹Die gute ehrliche Haut!› sagte man; ‹er ist aus lauter Fröhlichkeit und guter Laune zusammengesetzt. Was muß er erst in seiner Jugend gewesen sein, da er mit einem Fuß im Grabe noch so ein großer Liebhaber vom Vergnügen ist?› Vor allem erhoben mich die Weiber himmelhoch und stellten mich ihren Männern zum Muster vor. Die Sauertöpfe unter den Männern waren die einzigen, die über mein Betragen Glossen machten.
‹Was doch der Mensch für ein Narr sein muß›, sagten sie, ‹daß er noch immer nach Vergnügungen läuft, die er in seinem Alter nicht mehr genießen kann!› Ich, meines Ortes, der am besten wußte, wie und warum, ließ die Leute reden, was sie wollten, und ging meinen Gang fort. In dessen, wie ich es auch anstellte und wie viele Mühe ich mir gab, mit dem Liebe einflößen wollte mir es gar nicht vonstatten gehen.
Ich schränkte mich nicht auf die Stadt ein, wo ich wohnte, wie wohl es da nicht an jungen Mädchen fehlte; ich machte Reisen auf mehr als fünfzig Meilen in die Runde; aber alles, was ich dabei gewann, war die Überzeugung, daß ich nicht gefallen könne - ein Gedanke, der mich beinahe unsinnig machte, ohne gleichwohl meine Geduld zu überwältigen.
Mehr als zweihundert Jahre sind schon über diesem vergeblichen Suchen hingegangen. Man wußte endlich nicht mehr, was man von mir denken sollte. Ich hatte die Welt schon viermal wieder jung gesehen und alle diejenigen begraben, die mich in ihrer Kindheit just so alt und abgelebt gesehen hatten als ihre Urenkel. Alle Leute sagten sich in die Ohren: ‹Was für eine Art von Mensch ist das? Man sieht gar keine Veränderung an ihm.›
Die ältesten Greise zeigten mich ihren Kindeskindern mit dem Finger: ‹Seht da den guten alten Dahy›, sagten sie. ‹Bildet euch nicht ein, daß ich ihn jemals jung gekannt habe. Er war bei meinem Denken immer so alt und gebrechlich, wie ihr ihn jetzt seht, und ich hörte in meiner Jugend meinen Großvater sagen, er habe ihn nie anders gesehen.›
Du kannst dir leicht vorstellen, meine Liebe, daß ich wenig Freude daran hatte, ein solches Wunder in den Augen der Leute zu sein. Die Hoffnung, welche mir Kansu gelassen hatte, wurde in dessen immer stärker, je länger sie mich schon getäuscht hatte; ich machte immer neue, wie wohl immer fruchtlose Reisen; und so geschah es endlich, da ich eben im Begriff war, von Masulipatnam wieder nach Hause zu kehren, daß ich dir und deiner Schwester in den Weg kam. Was ich euch damals sagte, holde Kadidsche, zeigte dir deutlich genug, wie sehr mich dein Anblick bezauberte; aber leider! sah ich zugleich nur gar zu wohl, wie unangenehm dir der meinige war.»
Die Stimme brach dem guten alten Manne bei dieser Vorstellung; er hörte auf zu reden, und Kadidsche, die von seinem Unglück wirklich gerührt war, hätte ihm gerne was Tröstliches gesagt, und sagte ihm wirklich alles, was ihm ihr mitleidiges und erkenntliches Herz beweisen konnte, nur nicht das einzige, wovon sein Glück abhing; und dies war es doch allein, was er zu hören wünschte. Sie gerieten öfters in kleine Wortwechsel darüber, wobei beider Geduld mehr als einmal zu reißen drohte.
Dahy beklagte sich über ihre Härte und Kadidsche über seine Unbilligkeit; und immer endete ihr Streit damit, daß beide über sich selbst ungehalten waren; er, daß er ihr das Unmögliche zumuten wollte, sie, daß es ihr unmöglich war, einen Mann zu lieben, dem sie doch so herzlich gerne hätte geholfen sehen mögen. Übrigens, wenn das holde Mädchen seufzte (welches ihr oft genug begegnete), so geschah es nicht immer aus Mitleid mit dem armen Dahy.
Ihr kleines Herz hatte ganz in geheim seine eigenen Beklemmungen. Es war ihr unmöglich, sich den schönen Jüngling mit den dichtgelockten gelben Haaren aus dem Sinne zu bringen; sein Bild stahl ihr manche Stunde von ihrem Schlaf. Seine Ähnlichkeit mit der Beschreibung, welche der alte Dahy von dem, was er vor seiner Verwandlung gewesen sei, gemacht hatte, und die Worte: «Betrachte mich wohl, denn du siehst denjenigen, den dir das Schicksal zum Gemahle bestimmt hat», erweckten ihr Gedanken, aus welchen sie sich nicht herauszuhelfen wußte. «Sollte wohl», dachte sie zuweilen, «Dahy selbst dieser Gemahl sein, der mir bestimmt ist?»
Wie liebenswürdig fand sie ihn unter der Gestalt, worin er ihr im Traum erschienen war! Aber dann brauchte es nur einen einzigen Blick auf den Dahy, der wirklich vor ihr stand, um zu fühlen, daß es ihr immer unmöglich sein werde, die Bedingung zu erfüllen, unter welcher sie ihm seine ursprüngliche Gestalt und ewige Jugend wiedergeben könnte. Und doch war ihr ein Jüngling von dieser Gestalt zum Gemahl bestimmt! Und Kansu hatte den unglücklichen Brüdern Hoffnung gemacht, daß sie endlich die Mädchen finden würden, die ihrer Bezauberung ein Ende machen sollten!
Inzwischen hatte das Schiff, worauf sie sich befanden, in vierzehn Tagen mehr als fünfhundert Seemeilen zurück gelegt, und sie konnten, nach Dahys Rechnung, nicht weit mehr von der Küste, wohin ihr Lauf gerichtet war, entfernt sein: als der Wind sich auf einmal umlegte und ein heftiger Sturm sie mit solcher Gewalt in die weite See hinein trieb, daß es ihnen unmöglich war, länger einen gewissen Lauf zu halten. Sie wurden etliche Tage lang hin und her getrieben und endlich an eine Insel geworfen, die weder dem Schiffshauptmann noch einem von seinen Leuten bekannt war.
Sie erblickten eine große Stadt, die in Gestalt eines halben Mondes sich über das Ufer erhob und einen geräumigen und bequemen Hafen bildete. Kaum waren sie in den selben eingelaufen, so sahen sie sich von allen Seiten mit einer Menge kleiner Boote umringt, aus welchen eine unendliche Menge menschenähnlicher Dinge hervorwimmelte, die mit unglaublicher Behändigkeit an ihrem Schiffe hinaufkletterten.
In ihrem Leben hatten unsere Reisenden keine so seltsame Geschöpfe gesehen. Sie waren alle klein, häßlich und übel gebaut und hatten etwas so lächerlich Verzerrtes in ihrer Gesichtsbildung, eine so groteske Lebhaftigkeit in ihren Bewegungen und Gebärden, mit einem Worte: etwas so Affenmäßiges in ihrem ganzen Wesen, daß, wenn sie nicht eine Sprache, die unseren Reisenden bekannt war, gesprochen hätten, man sie eher für eine Art von Waldteufeln als für Menschen hätte halten sollen.
Ihre Kleidung war ebenso seltsam als ihre Figur und ihre Manieren. Sie hatten hohe dreieckige Hüte von buntem Kartenpapier auf dem Kopfe und trugen lange Röcke von baumwollenem Zeuge, die über und über mit gelben, blauen und grünen Klecksen und grotesken Figuren bemalt waren und das abgeschmackte Aussehen dieser sonderbaren Insulaner nicht wenig vermehrten.
In wenig Augenblicken war das ganze Schiff dermaßen mit ihnen angefüllt, daß die Leute im Schiff sich kaum regen konnten und, weil Widerstand hier zu nichts geholfen hätte, alles mit sich anfangen lassen mußten, was ihnen beliebte. Es zeigte sich gar bald, daß sie, vermöge der Gesetze ihrer Insel, alles, was auf dem Schiffe war, als ein ihnen zugefallenes Eigentum behandelten.
Diesem zufolge war ihr erstes, daß sie alle Personen vom Equipage in eine lange Reihe stellten, eine nach der anderen von vorn und hinten besahen, die Haare und Zähne sehr aufmerksam untersuchten und vornehmlich die Runzeln, wenn sie deren in einem Gesichte antrafen, mit vieler Genauigkeit abzählten. Die Leute hätten sich über die Grimassen, die sie dazu machten, tot lachen müssen, wenn das Erstaunen und die Ungewißheit, was in den Händen solcher Unholden aus ihnen werden würde, sie nicht wider Willen ernsthaft gemacht hätte.
Sie fingen schon an, einige alte Matrosen auszusondern, und schienen sie mit besonderer Achtung zu unterscheiden, als sie Dahy, Kadidsche und die alte Sklavin erscheinen sahen, die sich bisher noch in der Kajüte verborgen hatten und also nicht mit in den Reihen gekommen waren. Bei diesem Anblick kam der Befehlshaber, der eine ansehnliche Stelle am Hofe der Königin dieser Insel bekleidete, vor Entzücken ganz außer sich.
Besonders verweilten seine Augen auf der alten Sklavin, die er auf den ersten Blick so liebenswürdig fand, daß er sich auf der Stelle entschloß, sie an die Spitze seines Harems zu setzen. Er warf sich ihr zu Füßen, erklärte ihr seine Leidenschaft in den feurigsten Ausdrücken und beschwor sie, das Opfer seines Herzens günstig aufzunehmen. Da es vergebens gewesen wäre, hier die Spröde machen zu wollen, so ergab sich die alte Sklavin mit guter Art und machte ihn dadurch, wie es schien, zum glücklichsten aller Menschen.
Er übergab sie unverzüglich dem vertrautesten unter seinen Dienern, sagte ihm, daß er mit seinem Kopfe für sie stehen würde, und empfahl ihm über alles, ja auf seiner Hut zu sein, daß sich niemand die geringste Freiheit bei ihr herausnehmen könnte. Der weise Dahy wußte nicht, wie er sich einen so verkehrten Geschmack erklären sollte. «Die Weiber müssen was sehr Rares in dieser Insel sein », sprach er bei sich selbst, «weil sogar ein altes Hausratsstück wie diese Sklavin fähig ist, einen so starken Eindruck zu machen.»
Dieser Gedanke setzte ihn Kadidschens wegen in große Unruhe, deren Reizungen unfehlbar schreckliche Folgen für ihn haben würden; aber es zeigte sich bald, daß er sich vergebliche Sorge gemacht hatte. Seine junge Geliebte hatte nichts, das ihr in den Augen dieser Insulaner einen Wert gab; und wofern sie bei ihnen einige Gefahr lief, so war es wenigstens nicht diejenige, die er befürchtete. Der Befehlshaber hatte kaum die alte Sklavin in seinen Harem abführen lassen, als er von ungefehr einen Blick auf die junge Person fallen ließ.
Erstaunt, sie so reich gekleidet zu sehen, sagte er in einem rauhen Tone zu ihr: «Für ein so häßliches Tierchen bist du gut genug angezogen, kleines Mädchen!» Und so gleich befahl er einem seiner Bedienten, das garstige Ding in seine Gesindewohnung abzuführen und sie zu den niedrigsten Verrichtungen anzuhalten. Eine so unwürdige Behandlung war mehr, als das gute Mädchen, die immer der zärtlichsten Begegnung gewohnt gewesen war, ertragen konnte. Sie brach in einen Strom von Tränen aus und bat ihren alten unvermögenden Beschützer mit aufgehobenen Händen, sich ihrer anzunehmen.
Die Bewegung, die er in diesem Augenblick gegen sie machte, und sein ängstliches Geschrei, da er sie mit Gewalt weg schleppen sah, zog auf einmal die Aufmerksamkeit der Insulaner auf ihn. Seine kleine zusammen gekrümmte Figur, seine kurzen auswärts gebogenen Beine, seine Runzeln und Triefaugen, seine grüngelbe verschrumpfte Haut, die behaarten Warzen, die sein Gesicht bedeckten - kurz, alles, was Kadidschen widerlich und ekelhaft an seiner Person war -, wurde der Gegenstand der Bewunderung dieses widersinnigen Volkes.
Ihr Erstaunen war so groß, daß es eine Weile stumm blieb; aber auf einmal brach es in Ausdrücke der lebhaftesten und unmäßigsten Freude aus, und man hörte von allen Seiten nichts als ein verwirrtes Getöse von Lobeserhebungen und Jubelgeschrei. Der Befehlshaber selbst vergaß auf einen Augenblick den Wohlstand seiner Würde und ließ sich von der allgemeinen Schwärmerei hinreißen. Aber er faßte sich sogleich wieder, warf sich dem bewunderten Greise zu Füßen, stieß mit seinem spitzigen Hut von Pappe gegen den Boden und bat ihn in den ehrerbietigsten Ausdrücken um Vergebung, daß man ihm die gebührende Ehre nicht eher erwiesen habe.
«Ich, meines Orts, bekenne», fuhr er fort, «daß ich von dem Glanze der schönen Dame aus Eurem Gefolge, die nun in meinem Harem ist, zu stark geblendet war, um meiner selbst mächtig zu bleiben. In dessen, wie sehr ich auch für sie eingenommen bin, muß ich gestehen, daß Eure Schönheit alles übertrifft, was auf dieser Insel jemals gesehen worden. Erlaubt, daß man Euch in den Palast unserer Königin Scheherbanu führe. Ich bin gewiß, diese große Fürstin wird von Eurem Anblick bezaubert werden und Euch alle Ehrenbezeugungen, wozu Ihr berechtigt seid, erweisen lassen.»
Der Befehlshaber wollte fort fahren, ihm das Glück anzupreisen, das ihn erwartete, als ihm Dahy, dem die Geduld ausging, in die Rede fiel und sagte: «Anstatt mir solch abgeschmacktes Zeug vorzuschwatzen, gebt mir die junge Person wieder, die Ihr mir weg genommen habt!» - «Wen?» antwortete der Befehlshaber; «den kleinen Wechselbalg? Ah, schöner Greis, fasst Gesinnungen, die Eurer würdiger sind, und denkt jetzt nur darauf, wie Ihr unserer großen Königin gefallen wollt, vor welche wir Euch zu führen im Begriff sind.» Mit diesen Worten packte er und sein Lieutenant den guten Alten unter den Armen, und führten ihn, wie sehr er sich auch sträubte, nach dem Palaste der Königin ab.
Dahy, der diese Gewalt, die man gegen ihn brauchte, als eine leichtfertige Verspottung seiner Figur und seines Alters ansah, stellte darüber schmerzliche Betrachtungen an. «Welch ein unseliges Schicksal!» sprach er zu sich selbst, in dem man ihn fort schleppte. «Wer dächte, daß ein Genie zu diesem Grade von Unmacht und Unvollkommenheit erniedrigt werden könnte? Es ist wahrlich keine der erträglichsten Folgen meines Unglücks, daß ich mir gefallen lassen muß, den Kindern Adams zum Spielwerke zu dienen.»
So natürlich dieser Gedanke auf seiner Seite war, so fehlte doch sehr viel, daß er den Insulanern dadurch ihr Recht angetan hätte. Denn in der Tat war es ihnen mit allem, was sie ihm sagten, völliger Ernst. Die Königin selbst, sobald sie ihn erblickte, konnte sich nicht enthalten, ihn zu bewundern und ihm die Leidenschaft, die sie für ihn zu empfinden anfing, in den schmeichelhaftesten Ausdrücken zu erkennen zu geben.
Sie pries den Tag glücklich, an welchem ihrem Reiche das Heil widerfahren sei, von einer so wundervollen Person besucht zu werden; und wie wohl sie sich Gewalt antat, ihm nicht sogleich den ganzen Umfang der Zärtlichkeit zu zeigen, die er ihr einflößte, so sagte sie doch genug, um die Hofleute über das, was in ihrem Herzen vorging, nicht in Ungewißheit zu lassen; und diese verstanden ihr Handwerk zu gut, als daß sie nicht auf den ersten Wink in die Gesinnungen der Königin eingegangen wären.
Der alte Dahy wurde diesem nach mit den ausschweifendsten Ehrenbezeugungen überhäuft und, nachdem alle Großen des Reichs ihm, mit gebogenen Knien und abgenommenen Mützen, gehuldigt hatten, auf Befehl der Königin in ein nach Landesart prächtiges, mit bunten Strohmatten möbliertes Gemach begleitet, welches sie ihm, ganz nahe an ihrem eigenen, zur Wohnung angewiesen hatte.
Die gute Königin konnte nicht länger warten, als bis die Hofleute sich wieder entfernt hatten, ihrem bezaubernden Gast einen geheimen Besuch zu geben und ihm, kraft ihres königlichen Vorrechts, einen Liebesantrag zu tun, den der Alte, wie empfindlich ihm auch die vermeinte Verspottung war, doch anfangs, als einen gnädigen Scherz, mit aller Ehrerbietung, die er einer Dame von ihrem Rang schuldig war, beantwortete.
Da er aber aus ihren Antworten sah, daß es wirklich Ernst war und Ihre Majestät immer feuriger und dringender wurde, je mehr er sich zurück zog, so überlief ihm endlich die Galle, und er konnte sich nicht länger halten, ihr, mit Hintansetzung alles Respekts, Dinge zu sagen, die noch keiner Königin gesagt worden sind und die keine Königin, wie sehr sie auch für den Redner eingenommen sein möchte, mit Gelassenheit anhören kann.
Gleichwohl hielt sie ihren Unwillen zurück und machte noch verschiedene Versuche, ihn mit Sanftmut auf bessere Gedanken zu bringen. Da aber alles nichts verfangen wollte und Dahy vielmehr immer beleidigender in seinen Ausdrücken wurde, so ließ sie den Hauptmann ihrer Wache rufen. «Führt mir», sagte sie zu ihm, «diesen Alten in den schwarzen Turm, wo er dem anderen Gesellschaft leisten mag, der die Zärtlichkeit meiner Schwester Mulkara verschmäht hat. Sie werden dort Gelegenheit finden, es sich gereuen zu lassen, daß sie die Grausamen mit uns haben spielen wollen.» Nach diesen Worten entfernte sich Ihre Majestät mit gebührendem Stolze, und ihr Befehl wurde stracks vollzogen.
Dahy ließ sich ganz willig nach dem schwarzen Turme abführen und stellte es sich als keinen geringen Trost in seinem Unglücke vor, daß er einen anderen ebenso unglücklichen Alten da selbst zum Gesellschafter haben würde. Aber wie groß war sein Erstaunen, da er beim ersten Blick in dem Gefährten seiner Trübsale seinen Bruder Adis erkannte! Sie gingen mit offenen Armen aufeinander zu und hielten sich mit tränenvollen Augen eine lange Zeit umarmt, ohne ein Wort hervorbringen zu können.
In dessen fanden sie doch zuletzt die Sprache wieder, und man kann sich leicht vorstellen, wie viel zwei Brüder, die sich so zärtlich liebten, sich seit mehr als zweihundert Jahren nicht gesehen hatten und nun wieder durch die alte Gleichförmigkeit ihres Schicksals zu einerlei Leiden vereinigt waren, einander zu sagen haben mußten. Natürlicherweise gab ihr gegenwärtiger Zustand und der widersinnige Geschmack der Einwohner dieser Insel, wovon er die Folge war, den ersten Stoff zu ihren Gesprächen.
«Begreifst du was davon?» sagte Dahy zu seinem Bruder. «Es ist freilich ein albernes Gesindel um diese Adamskinder. Ich kenne wohl Völker, bei denen eine platte Nase, kleine Schweinsaugen, ein spitzer Kopf und ein Hängebauch für Schönheiten gelten. Aber wie man über Figuren wie die unsrige in Entzückung geraten kann, davon habe ich keinen Begriff.» -
«Ich will dir das Rätsel mit zwei Worten auflösen», versetzte Adis. «Diese Insulaner haben einen großen häßlichen Affen zum Gott, und dieser Gott hat Priester. Wenn du die Sache nun nicht begreifst, so kann ich dir nicht helfen. Wo ein Affe das Urbild der Vollkommenheit ist und Tempel und Priester hat, da geht es ganz natürlich zu, wenn seine Anbeter nach und nach zu Affen werden. Ein jedes Volk bildet sich unvermerkt nach seinem Gotte.»
Dahy hatte nichts gegen diese Auflösung einzuwenden, als - daß ihr Schicksal dadurch nicht besser wurde. Sie fingen hierauf an, einander zu fragen, wie es jedem in der langen Zeit ihrer Trennung ergangen sei, und Dahy ermangelte nicht, seinem Bruder die ganze Geschichte seiner Bekanntschaft mit Kadidschen zu erzählen und alles, was ihm seit der selben begegnet war, ohne den geringsten Umstand auszulassen.
Sobald er damit fertig war, sagte Adis: «Was du mir da erzählt hast, läßt mir keinen Zweifel übrig, daß unser Unglück bald ein Ende nehmen wird. Ja, mein lieber Bruder, wir sind dem Augenblick nahe, der uns unsere eigene Gestalt und mit ihr die Rechte unserer Gattung wiedergeben wird, deren wir schon so lange beraubt sind. Du wirst ebenso wenig daran zweifeln als ich, wenn du gehört haben wirst, was ich dir erzählen will.
Ich hatte mir in dem Lande, welches mir der Brahmine Kansu angewiesen, bereits über zweihundert Jahre lang vergebens alle Mühe von der Welt gegeben, eine junge Schöne zu finden, die sich in meine abscheuliche Figur verlieben könnte, als mir einsmals eine junge Bäurin von siebzehn bis achtzehn Jahren im Traum erschien, die mir sagte:
‹Du hoffst umsonst, das Ende deiner Verbannung in dieser Stadt zu finden. Wenn du dieses Wunder erleben willst, so schiffe dich nach der Insel Sumatra ein. Betrachte mich wohl, denn du siehst in mir diejenige, die dir das Schicksal zur Gemahlin bestimmt hat.› Das Mädchen war von ungemeiner Schönheit. Ich fühlte mein Herz bei ihrem Anblick in Liebe entbrennen; ich wollte es ihr sagen, aber sie verschwand, und ich erwachte.
Dieser Traum schien mir mehr als ein gewöhnlicher Traum zu sein. Ich betrachtete ihn als einen geheimen Fingerzeig, schiffte mich nach Sumatra ein und wurde, wie du, durch einen Sturm, den ich nicht für natürlich halte, auf diese Insel geworfen. Hier begegnete mir mit der Prinzessin Mulkara, welche damals in Abwesenheit ihrer Schwester regierte, alles, was dir mit der Königin Scheherbanu begegnet ist.
Sie erklärte mir ihre Liebe; ich glaubte, sie treibe ihren Scherz mit mir; sie überzeugte mich vom Gegenteil und erhielt die Antwort, die du dir vorstellen kannst. Sie wurde dringend, ich wurde ungeduldig; wir erhitzten uns endlich beide, und das Ende davon war, daß ich in diesen Turm geworfen wurde, wo ich so lange büßen soll, bis ich mich geneigt finden werde, zu den Füßen meiner Prinzessin die ihren Reizungen zugefügte Beleidigung wieder gut zu machen.
Unter dieser Bedingung könnte ich wohl ewig in diesem Turme schmachten müssen; aber daß wir uns so unverhofft hier zusammen finden und die Mittel, die uns zusammen gebracht haben, und die wunderbare Ähnlichkeit meines Traumes mit dem Traum deiner Geliebten und die Ähnlichkeit der jungen Bäurin, deren Bild seitdem nicht aus meiner Seele gekommen ist, mit ihrer Schwester Fatime: das alles überredet mich, daß eine verborgene Hand im Spiele ist, und daß wir...»
Ehe Adis seine Rede vollenden konnte, öffnete sich die Tür ihres Kerkers, und der Hauptmann der Leibwache trat herein. Er stieß aber mal mit seiner spitzen Mütze gegen den Fußboden und redete die beiden Brüder also an: «Glorwürdigste unter allen Greisen, ich komme im Namen unsrer erlauchten und mildherzigen Fürstinnen, euch anzukünden, daß sie alles, was ihnen an eurem Betragen hätte mißfällig sein können, in den Abgrund der Vergessenheit versenkt haben.
Zu dessen Beweis und aus Überzeugung, daß eine so übermenschliche Schönheit wie die eurige nur das Anteil der Familie des großen Affen sein kann, haben sie mit Beistimmung der ehrwürdigen Priesterschaft beschlossen, daß sein Tempel von nun an eure Wohnung sein und daß euch da selbst alle die Ehre widerfahren soll, wozu ihr als nahe Verwandte des selben berechtigt seid.»
Die beiden Brüder waren über diesen neuen Ausbruch der seltsamen Torheit dieses abenteuerlichen Volkes nicht wenig betroffen und hatten schlechte Lust, die Hauptpersonen des neuen Possenspiels zu sein, das man mit ihnen spielen wollte. In dessen, weil doch, Kerker gegen Kerker, ein Tempel immer besser war als der schwarze Turm und weil sie entschlossen waren, ihrem Schicksal in allen Dingen nachzugeben, so folgten sie dem Hauptmann gutwillig nach der Pagode, wo sie von dem Oberpriester und den übrigen Dienern des Tempels an der Pforte mit großer Feierlichkeit empfangen wurden.
Die Königin, ihre Schwester, der Hof und die ganze Stadt waren bereits zugegen; es wurden Hymnen den beiden Vettern des großen Affen zu Ehren angestimmt; und nachdem man sie, unter einer Menge possierlicher Zeremonien und Kniebeugungen, wohl besungen und beräuchert hatte, ließ man sie auf ein großes, sieben Fuß hohes Gerüste steigen, wo zwei prächtige Throne von bunten Strohmatten für sie bereitet waren.
Die beiden Brüder nahmen geduldig ihren Platz; und während die Priester die Zurüstungen zu dem Opfer machten, das ihnen auf dem Altar, hinter welchem das Gerüste aufgerichtet war, dargebracht werden sollte, tanzte ein Chor junger Mädchen singend um den Altar, und die Augen aller Anwesenden waren in schwärmerischer Entzückung auf die neuen Götter gerichtet, die in den Talaren von buntem Stroh, womit man sie behangen hatte, eine sehr komische Figur machten und so aussahen, als ob sie an allem diesem Unsinn kein sonderliches Belieben fänden.
Aber plötzlich wurde Gesang und Tanz und Opfer durch eine Begebenheit unterbrochen, die der Freude und Andacht der Anwesenden auf einmal ein schreckliches Ende machten. Adis und Dahy verloren die Gestalt abgelebter Greise und glänzten wieder in ihrer eigenen. Auf ihren Stirnen und Wangen blühte wieder die Blume der ewigen Jugend auf, dichtes blondes Haar wallte in großen Locken um ihren milchweißen Nacken; kurz, sie wurden auf einmal wieder, was sie waren, als Farsana zu ihrem Unglück ein zu zärtliches Auge auf sie warf.
Welch eine fürchterliche Verwandlung in den Augen der Insulaner! Ein allgemeiner gräßlicher Schrei verkündigte die allgemeine Bestürzung. Die Priester, die eine so unnatürliche Verwandlung für ein Wunder von böser Vorbedeutung hielten, rannten in größter Verwirrung davon; die Mädchen, die um den Altar tanzten, wandten voller Schrecken um und flohen; die Königin und die Prinzessin, ihre Schwester, deren Zärtlichkeit sich auf einmal in Abscheu verwandelte, eilten in ihren Palast zurück.
In einem Augenblicke war die ganze Pagode leer, und die beiden Genien blieben allein und staunten einander an. Da sie aber mit ihrer Gestalt auch ihre übrigen Vorzüge wiedererhalten hatten, so erkannten sie sogleich, daß ihre Bezauberung durch zwei junge Personen aufgelöst worden war, die sich während der Zeremonien in ihre Greisengestalt verliebt hatten und aus Ekel vor ihrer jetzigen mit den übrigen davon gelaufen waren.
Sie bezeugten einander noch ihre Freude über diese glückliche Überraschung, als sie den Brahminen Kansu mit Fatimen an der Hand in die Pagode treten sahen. Auf den ersten Blick erkannte Adis das reizende Bauernmädchen seines Traumes. «Ah!» rief er mit Entzücken, «das ist sie, das holde Mädchen, dessen Bild so fest in meinem Herzen sitzt!» - «Ja, Adis, da ist sie», sagte der Brahmine; «Um Euer Glück vollständig zu machen, habe ich sie mitgebracht. Sie war, seitdem sie von ihrer Schwester getrennt wurde, in meinem Schutze.
Endlich, meine Kinder», fuhr er fort, «habe ich die Freude, euch wieder aus dem traurigen Zustand gezogen zu haben, in welchen mein zu rascher Zorn euch versetzte. Es war mir schmerzlich, euch so lange darin zu sehen; aber es war unmöglich, das, was ich für euch getan habe, früher zu tun. Denn ich bin es, Dahy, der dich die beiden Schwestern finden ließ, die dazu bestimmt sind, euch alle eure Leiden durch ihre Liebe zu vergüten.
Ich bin der Urheber der Träume, die den Gedanken, nach Sumatra zu reisen, in euch erweckten; und ich habe euch durch von mir erregte Stürme an diese Insel geworfen, weil ich wußte, was da geschehen würde. Ja, ich leugne nicht, daß ich, zu Beförderung meiner Absicht, der gewöhnlichen Narrheit dieser äffischen Insulaner durch meine Kunst ein wenig nachgeholfen habe. Nun fehlt uns nur noch eine Person. Dahy, geh, hole Kadidschen, und mach ihr das Vergnügen, ihre Schwester und den schönen Jüngling ihres Traumes wiederzusehen.»
Dahy flog wie ein Blitz in die Küche des Hauptmanns von der Leibwache und brachte Kadidschen in die Pagode. Die Umarmungen der beiden Schwestern, das Entzücken der beiden Brüder und die Freude des alten Brahminen über das Glück dieses doppelten Paares, welches sein Werk war, machten eine Szene, die über alle Beschreibung geht.
Ihr Glück vollkommen zu machen, gab Kansu den beiden Genien auch ihre Freiheit wieder und erlaubte ihnen, mit ihren Geliebten zu leben, wo es ihnen beliebte. Er verschwand hierauf aus ihren Augen, und die beiden Brüder flogen mit den schönen Schwestern auf eine Insel von Dschinnistan, die, von ihnen bewohnt und bevölkert, ein Nachbild des irdischen Paradieses wurde.
Christoph Martin Wieland - Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
ALBOFLEDE ...
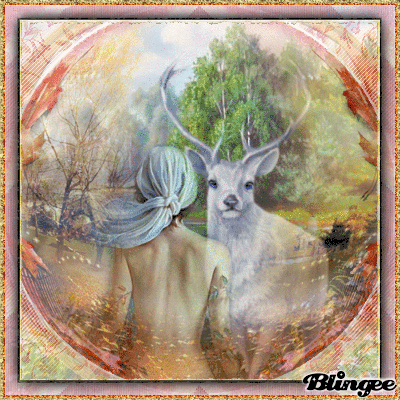
Mehr als hundert Jahre vor dem Einfall der Franken in Gallien lebte auf einer einsamen kleinen Insel, welche die Seine eine Meile oberhalb der Stadt Troyes macht, eine außerordentliche Frau namens Alboflede. Das, was dem ersten Anblick am meisten auffiel, war ihr Alter und ihre Häßlichkeit. Beides übertraf alles, was man sich davon einbilden kann; die eisgrauen Parzen hätten jung und die häßlichste der Gorgonen reizend neben ihr geschienen; das mag genug davon sein, denn ich male nicht gerne, was niemand ansehen mag.
Man erzählte Wunderdinge von ihrer Macht und von dem Umfang ihrer geheimen Wissenschaften; das Volk hielt sie für eine gewaltige Hexe; wäre sie so schön gewesen, als sie abscheulich war, so würde man sie für eine Fee gehalten haben. Indessen stand sie doch im ganzen Lande in Ansehen; die gemeinen Leute fürchteten sie; die vornehmen hingegen bewarben sich um ihre Gunst, in Hoffnung, von ihren Zauberkünsten und von ihrer Gabe, das Künftige vorherzusehen, bei Gelegenheit guten Gebrauch zu machen.
Sie wohnte am Ufer des Flusses in einem kleinen Palaste, der auf einer Galerie von marmornen Pfeilern ziemlich weit über das Wasser hinragte; und die dazugehörigen Gärten nahmen den ganzen Rest der kleinen Insel ein. Sie waren mit den seltensten Pflanzen und Gewächsen des ganzen Erdbodens angefüllt und immer in dem schönsten Stande unterhalten, ungeachtet man keine Hände sah, die ihrer warteten.
Wer Albofleden besuchen wollte, fand am jenseitigen Ufer eine vergoldete Gondel, die von selbst ging und diejenigen, deren Besuch ihr angenehm war, in wenig Augenblicken hinüberbrachte: jedem anderen wäre es unmöglich gewesen, sie von der Stelle zu bewegen. Wer den Zutritt erhielt, wurde sehr wohl aufgenommen; man konnte nicht herrlicher bewirtet werden, wie wohl im ganzen Hause weder männliche noch weibliche Bediente zum Vorschein kamen.
Es begab sich eines Tages, daß die Gondel ein Paar junge Liebende hinüberführte, die von einer heftigen Begierde geplagt wurden, das Schicksal ihrer wechselseitigen Leidenschaft zu erfahren. Alboflede nahm sie gütig auf, und nachdem sie ihnen einige Erfrischungen vorgesetzt (denn sie schienen von den Beschwerden eines langen Weges erschöpft zu sein), erkundigte sie sich nach dem Bewegungsgrunde ihres Besuches.
«Wir kommen», antwortete der Jüngling, «dich, der nichts Zukünftiges verborgen ist, um das Glück unserer Liebe zu befragen. Ich liebe die schöne Selma, seit dem ich sie kenne; und daß sie sich erbitten ließ, mich hierher zu begleiten, verrät dir schon genug von dem Geheimnis unserer Herzen, um sie eines förmlichem Geständnisses zu überheben. Aber mächtige Hindernisse stehen unserem Glück entgegen. Wir fürchten, durch die Hartherzigkeit der Unsrigen auf ewig getrennt zu werden. Rate uns, weise Frau, was wir tun sollen!»
«Wieder nach Hause gehen und ruhig erwarten, was das Schicksal und die Liebe über euch beschlossen haben», antwortete Alboflede.
Das Mädchen seufzte. «Das ist unmöglich», rief der Jüngling; «habe Mitleid mit uns, gütige Fee! Schlage das Blatt im Buche der Schicksale auf, worauf das unsrige geschrieben ist, und entdeck uns, wie wir dem Elend entgehen können, zu einer hoffnunglosen Liebe verdammt zu sein, wie wir die Hindernisse überwinden können, die uns mit ewiger Trennung bedrohen!»
«Laßt euch Besseres raten», sagte Alboflede, «und unterdrückt einen Vorwitz, dessen Befriedigung euer Schicksal nicht ändern, aber wohl verschlimmern könnte. Eine wohltätige Hand hat den dichten Vorhang gewebt, der die Zukunft vor den Augen der Sterblichen verbirgt; aber unerbittlich bestraft sie diejenigen, die ihn aufzuheben und mit unbescheidenem Blick in das Verbotene einzudringen wagen.
Ich selbst, meine Kinder, bin ohne mein Verschulden ein unglückliches Beispiel dieser Wahrheit; und damit fremde Erfahrung euch die Qualen einer zu späten Reue erspare, will ich euch, wenn ihr Lust zu hören habt, meine Geschichte erzählen.»
Die jungen Leute dankten ihr für die Gefälligkeit, so sie ihnen dadurch erweisen wollte. Sie folgten ihr in den Garten; und indem sie durch ein mit Blumen besetztes Parterre hingingen, pflanzte sich auf einmal der schönste Blumenstrauß vor den Busen der jungen Selma, ohne daß man sah, wie es damit zuging.
Alboflede lächelte über das angenehme Erschrecken des Mädchens, tat aber nicht, als ob sie es bemerkt hätte. Bald darauf ließ sie ihre beiden Gäste unter einem hoch aufgeschossenen, voll blühenden Rosengebüsch Platz nehmen und begann ihre Erzählung folgendermaßen:
«Mein Vater, ein Druide dieses Landes, dem ich in seinem Alter geboren wurde, war der Astrologie mit solcher Leidenschaft ergeben, daß er über der Betrachtung des Himmels und der Sterne sich unvermerkt angewöhnte, alles Irdische, als seiner Aufmerksamkeit unwürdig, mit Geringschätzung anzusehen.
Er bekümmerte sich wenig um meine Erziehung; aber da er in dem Augenblick meiner Geburt mein Horoskop gestellt und gefunden hatte, daß ich alle Weiber meiner Zeit an Schönheit und Leichtigkeit übertreffen würde, so stiegen ihm über die Verbindung zweier so gefährlicher Eigenschaften von Zeit zu Zeit Gedanken in den Kopf, die ihn, nach dem Maße, daß ich heranwuchs, beunruhigten.
Der erste Teil meines Horoskops - wie unglaublich es euch, meine Kinder, in diesem Augenblick auch immer vorkommen mag - war auf eine so vollkommene Art in Erfüllung gegangen, daß mein Vater um so weniger zweifelte, auch den anderen Teil, mehr als ihm lieb war, realisiert zu sehen.
Zu meinem Unglück hatte er die Leichtigkeit des Körpers, die mir die Sterne weissagten, für Leichtigkeit des Sinnes genommen; und diese Vorstellung setzte sich so fest in seinem Kopfe, daß er mich, von meiner frühen Jugend an, als ein Mädchen ansah, das die größte Gefahr liefe, ein Schandfleck seines Namens und ihres Geschlechtes zu werden.
Indessen schien meine Schönheit mit jedem Tage neuen Zuwachs zu erhalten; wer mich sah, wurde in meine Figur vernarrt; aber niemand war es mehr als ich selbst. Mein Vater betrachtete dies als die erste Wirkung meiner unglücklichen Anlage zur Koketterie, die er in den Sternen entdeckt hatte; und in der guten Absicht, aus dieser meiner Schwachheit selbst ein Mittel zur Erhaltung meiner Ehre zu ziehen, nahm er mich einsmals auf die Seite und entdeckte mir mit großem Ernst als ein Geheimnis von der äußersten Wichtigkeit für das Glück meines Lebens.
Die Reizungen, auf die ich einen so großen Wert legte, hingen lediglich von meiner Unerbittlichkeit ab, und der erste Sieg, den eine Mannsperson über mich erhielte, würde mich zur häßlichsten Person auf dem ganzen Erdboden machen. ‹Ich beklage dich, meine Tochter›, setzte er hinzu; ‹aber es steht nicht in meiner Macht, was in den Sternen von dir geschrieben ist, auszulöschen.
Alles, was ich tun kann, ist, daß ich dich von deinem Schicksale benachrichtige und dir rate, wenn dir anders daran gelegen ist, so zu bleiben, wie du bist, den Mannspersonen aus dem Wege zu gehen. Sie so nahe kommen zu lassen, daß sie dich anreden könnten, oder gar stehen zu bleiben und sie anzuhören, würde schon zu gefährlich sein.
Das Sicherste ist, davonzulaufen, ehe es soweit kommt; ein Mädchen, das die Unvorsichtigkeit hat, auf die Stimme dieser Lockvögel zu horchen, ist immer in Gefahr, auf der Leimstange hängen zu bleiben; und ich habe dir gesagt, was bei dir die Folge davon sein würde.›
Mein guter Vater hätte die Hälfte seiner Warnungen ersparen können, wenn er einen Begriff davon gehabt hätte, in welchem Grad ich in mich selbst oder, was mir damals gleich viel galt, in meine Figur verliebt war. Indessen, da ich in die Wahrheit seiner Worte nicht den geringsten Zweifel setzte und alles im buchstäblichen Sinne nahm, konnte doch alle Gleichgültigkeit, womit ich meine bisherigen Liebhaber anzusehen gewohnt war, mich nicht verhindern, von der fürchterlichen Gefahr, womit mich mein Vater bedrohet hatte, von Zeit zu Zeit in große Beängstigung gesetzt zu werden.
Natürlicherweise mußten es meine armen Anbeter entgelten, deren Anzahl mit jedem Tage zunahm, und dies um so mehr, da keiner unter ihnen sich des kleinsten Vorzugs bei mir rühmen konnte. Vergebens trugen sie mir in der einzigen Sprache, die ihnen erlaubt war, in Blicken und Seufzern, ihr Anliegen vor; vergebens ermüdeten sie die arme Echo Tag und Nacht mit Wiederholung meines Namens.
Umsonst kratzten sie ihn in alle Bäume der Gegend: der bloße Gedanke, diese schönen Augen, deren mörderischen Glanz die Herren in tausend Oden und Elegien verwünschten, einem von ihnen zu gefallen, verlöschen zu sehen, machte, daß ich sie lieber alle mit einem Blick hätte versteinern mögen. Dieses Betragen entfernte nach und nach alle ehrerbietigen Liebhaber von mir.
Aber es fanden sich mitunter auch Verwegene, die sich nicht abweisen lassen wollten und die mir so viele Gelegenheit gaben, meine Schnellfüßigkeit zu zeigen, daß ich es in diesem Stücke gar bald mit allen Atalanten und Camillen der Dichter hätte aufnehmen können. Diese Gelegenheiten kamen endlich gar zu oft; ich wurde es überdrüssig, immer zu laufen, ohne Lust dazu zu haben, und mich von den verhaßten Nebenbuhlern meiner eignen Schönheit in der süßen Beschäftigung stören zu lassen, in irgendeinem kristallnen Bache mich an meinem eigenen Anschauen zu ergötzen.
Ich zog mich, um dieses reinen Vergnügens desto ruhiger zu genießen, in eine Einöde zurück; aber gerade in dieser Einöde war es, wo der erzürnte Liebesgott das Mittel fand, eine grausame Rache an seiner unbesonnenen Verächterin auszuüben.
Von allen den Reizungen, womit die Natur mich zu meinem Unglück so verschwenderisch beschenkt hatte, waren meine Haare vielleicht die geringste; indessen hatten sie die schönste Farbe von der Welt und waren so lang und dicht, daß ich sie nur aufzulösen brauchte, um bis auf die Füße über und über von ihnen bedeckt zu werden.
Eines Tages, da ich an dem Rande eines Flusses, worin ich mich gebadet hatte, im Begriff war, meine Haare auszukämmen, und ganz allein zu sein glaubte, kam auf einmal ein schneeweißer, von Jägern verfolgter Hirsch angesprengt, stürzte sich ins Wasser, schwamm an das diesseitige Ufer herüber und legte sich, äußerst abgemattet und mit Blicken, die um meinen Schutz zu bitten schienen, zu meinen Füßen nieder, während daß seine Verfolger am gegenseitigen Ufer in lärmender Verwirrung eine Stelle suchten, wo sie ohne Gefahr über den Fluß setzen könnten.
Niemals in meinem Leben hatte ich für irgendeine Kreatur soviel Anmutung gefühlt als für dieses schöne Tier, das auf eine so rührende Art mein Mitleid zu erregen wußte. Ich legte meine Hand auf seinen Rücken und fing an, es sanft zu streicheln und zu liebkosen; aber kaum hatte ich es berührt, als es sich in einen wunderschönen jungen Menschen verwandelte, der sich berechtigt hielt, diese Liebkosungen zu erwidern und seine Liebeserklärung damit anzufangen, womit man sie gewöhnlich zu endigen pflegt.
Ich gestehe, daß mein Schrecken über ein so unvermutetes Wunder im ersten Anblick mit ich weiß nicht was für einem Gefühl, das mehr Angenehmes als Widriges hatte, vermischt war; aber mein zur anderen Natur gewordener Abscheu vor allem, was einem Manne gleich sah, bekam sogleich wieder die Oberhand. Zudem hatte mich der wundervolle Unbekannte in einem Zustande überfallen, der von dem gewöhnlichen Negligé der Grazien wenig verschieden war.
Ich machte mich also eilends auf die Füße, und da die Scham meiner natürlichen Leichtigkeit einen neuen Grad von Geschwindigkeit gab, so schien ich mehr zu fliegen als zu laufen. Aber mein neuer Liebhaber, den das, was mich beschämte, desto verwegener machte, schien nicht nur seine vorige Hirschnatur behalten, sondern noch zum Überfluß die Flügel der Liebe an seine Fersen bekommen zu haben; denn ein Vorsprung von fünf bis sechs Schritten war alles, was ich mit der höchsten Anstrengung meiner Kräfte über ihn gewinnen konnte.
In währendem Lauf wehte der Wind die langen dichten Haare, die mir sonst eine zulängliche Bedeckung gegeben hätten, dergestalt auseinander, daß sie zu Verrätern an mir wurden und den Augen meines Verfolgers einen Vorteil über mich gaben, gegen welchen alle meine Geschwindigkeit zu kurz kommen mußte. Dieser Umstand brachte meine Vernunft in eine solche Unordnung, daß ich mich unbesonnenerweise in das erste beste Gebüsche warf, aber eben dadurch den Unfall, dem ich entfliehen wollte, beschleunigte.
Um es kurz zu machen, Kinder - ich verfing mich mit meinen langen Haaren in einem Busch; der schöne Unbekannte holte mich ein, und wie wohl ich einen Teil meiner verhaßten Locken aufopferte, mich von ihm loszureißen, so blieb es mir unmöglich, meinem Schicksal zu entrinnen.
Ich gestehe, daß der Übermut, womit der Unbekannte sich seines Vorteils über mich bediente, nicht vermögend war, das sympathetische Gefühl gänzlich auszulöschen, das mich beim ersten Anblick für ihn eingenommen hatte; und mein Unglück würde mir vielleicht weniger unerträglich, als es an sich selbst war, vorgekommen sein, wenn der Gedanke, daß es mich meine ganze Schönheit koste, es nicht zum Grausamsten, was mir begegnen konnte, gemacht hätte.
Die Flucht meines Liebhabers, den vielleicht nur mein entsetzliches Geschrei und die Furcht, entdeckt zu werden, vertrieben hatte, schien mir die erste Bekräftigung zu sein, daß die Vorhersagung meines Vaters in Erfüllung an mir gegangen sei. Mein Schmerz, meine Verzweiflung war unaussprechlich. Ich hatte das Herz nicht, mich selbst anzusehen.
Das Tageslicht wurde mir verhaßt; ich floh in die ödesten Wildnisse, verbarg mich in die dunkelsten Felsenklüfte und hörte nicht auf, ein Unglück zu beweinen, das gleichwohl bloß in meiner Einbildung bestand. Ein einziger Blick in einen der Bäche oder Brunnen, worin ich mich sonst mit so innigem Wohlgefallen zu spiegeln pflegte, würde mir meinen fatalen Irrtum benommen haben; aber ein Spiegel war jetzt in meiner Einbildung das schrecklichste aller schrecklichen Dinge, und die Furcht vor meinem eignen Anblick machte, daß ich einem Bach auf tausend Schritte auswich.
Zu meinem Unglück mischten sich endlich, aus Bosheit oder Mitleid, auch die Feen in meine Angelegenheiten. In einer unseligen Stunde, da meine Verzweiflung eben aufs höchste gestiegen war, kam mir eine der selben in den Weg und versprach mir, in der guten Meinung, mich zu trösten, mir jede Gabe zu bewilligen, um die ich sie bitten würde.
‹Oh›, rief ich, ohne mich einen Augenblick zu besinnen, ‹wenn du das willst, mitleidige Fee, so verwandle meine Gestalt augenblicklich in das Gegenteil dessen, was sie jetzt ist; mache mich mir selbst so unähnlich als möglich, dies ist die höchste Wohltat, die du mir erweisen kannst.› Die Fee betrachtete mich einige Augenblicke mit Erstaunen; aber sie hatte nun einmal ihr Wort gegeben, und ein Feenwort ist, wie ihr wißt, unwiderruflich.
Meine Bitte wurde mir gewährt; was zuvor nur eine Einbildung gewesen war, die mir ein wohlgemeinter Betrug meines Vaters in den Kopf gesetzt hatte, wurde nun Wirklichkeit; und aus dem schönsten Mädchen in der Welt ward ich auf der Stelle in ein so abscheuliches Geschöpf verwandelt, daß die Fee selbst meinen Anblick nicht aushalten konnte und sich eilends davon machte.
Allein, vor Freude über die vermeinte Wiederherstellung meiner Schönheit wurde ich den Ausdruck des Abscheues in ihrem Gesichte nicht gewahr und bildete mir ein, daß sie bloß nach Feenart wieder verschwunden sei, um mir den Dank für die unschätzbare Gabe, so ich von ihr empfangen zu haben glaubte, zu ersparen.
Bald darauf begegnete mir eine andere Fee, da ich eben im Begriff war, einen Bach zu suchen, worin ich mich beschauen könnte. Auch sie bot mir eine Gabe an, und ich besann mich noch weniger als das erste Mal. ‹Gib mir›, rief ich in der Freude meines Herzens, ‹gib mir die Gabe, mit allen den Reizungen, die ich jetzt besitze, soviel Jahre zu leben, als ich Haare auf meinem Kopfe habe!›
Die kleine Fee sah mich mit dem Erstaunen an, womit man eine Person, die man für klug hielt, Wahnsinn sprechen hört; sie zuckte die Achseln und schien einen Augenblick unschlüssig, ob sie mir ein so unbegreifliches Begehren bewilligen sollte: allein, da sie ihr Wort gegeben hatte, so konnte sie sich, ebenso wenig als die erste, nicht entbrechen, es zu halten.
Die Fee verschwand, und ich Unglückliche glaubte mich kaum im Besitz einer Schönheit, deren Dauer ich, nach der ungeheuren Menge von Haaren, die ich wiederbekommen zu haben vermeinte, für unermeßlich hielt, als ich einem Brunnen zu lief, um mich, nach einer so langen Trennung von mir selbst, wieder mit vollen Zügen an meinem Anschauen zu erlaben.
Aber stellt euch die ganze Unaussprechlichkeit meines Entsetzens vor, da ich nichts als das Ideal der Häßlichkeit, eine Karikatur von allem, was Alter und Ungestaltheit Widerliches und Grausenhaftes hat, kurz, eben die Figur darin erblickte, die ihr vor euch seht!
Unmöglich konnte ich glauben, daß ich dieses Scheusal sei; ich sah mich überall nach dem Gegenstande des verhaßten Bildes um, das mir das meinige verdecke; aber da ich es alle die Bewegungen machen sah, die ich selbst machte, fand ich mich endlich gezwungen, der abscheulichen Wahrheit Platz zu geben, und erkannte nun zu spät, in welchem Grade ich ein Spiel mißgünstiger Sterne und ein Opfer des frommen Betruges meines Vaters und meiner eigenen Leichtgläubigkeit, Eigenliebe und raschen Übereilungen gewesen war.
Es würde Unbarmherzigkeit sein, meine Kinder, wenn ich euch mit einer Beschreibung des Zustandes, in den mich diese Entdeckung stürzte, quälen wollte. Tausendmal trieb mich die Verzweiflung, meinem Leben ein Ende zu machen; aber immer hielt mich ein unsichtbarer Arm mit stärkerer Gewalt zurück.
Die Zeit, deren abstumpfende Würkung auf unsere Sinne uns zuletzt das Angenehmste gleichgültig und das Widrigste erträglich macht, vermochte endlich soviel, daß ich mich meinem Schicksal mit einiger Gelassenheit unterwarf; aber was am meisten dazu beitrug, war die Gewißheit, daß mein Elend nicht länger als drei Jahre dauern würde, welches gerade soviel Jahre waren, als mir die Feen Haare auf meinem kahlen Kopfe gelassen hatten.
Meine angenehmste Beschäftigung war jetzt, die Stunden und Augenblicke zu überrechnen, die mich dem letzten Ziele meiner Wünsche näher brachten; und in dem ich auf diese Art mein verhaßtes Dasein in den dunkelsten Wäldern und einsamsten Wildnissen hin schleppte, hatte ich den zwölften Monat meines letzten Jahres erreicht, als ich in einer finsteren Nacht, worin ich lange zwischen Felsen und Abgründen herum geirrt war, bei eben dieser Insel anlangte, wo ich seitdem meine Wohnung aufgeschlagen habe.
Ich glaubte da selbst, durch die Gebüsche, die ihre Ufer bekränzten, ein Feuer zu erblicken, das über alle umliegende Gegenstände eine so große Klarheit verbreitete, als ob es heller Tag wäre. Ungeachtet mir nach meiner eigenen Figur nichts verhaßter war als das Licht, so bemächtigte sich doch meiner in diesem Augenblick eine Neubegierde, der ich nicht widerstehen konnte.
Ich watete durch eine seichte Stelle des Flusses, die ich bei diesem Lichtglanze gewahr wurde, und erstaunte nicht wenig, als ich in dem Gebüsche, wo mir das schöne Feuer zu brennen schien, einen kleinen Neger schlafend fand und entdeckte, daß ein Halsband von Karfunkeln, das er um seinen schwarzen Hals hatte, die einzige Ursache des hellen und beinahe blendenden Glanzes war, der einen Teil der Insel so herrlich erleuchtete.
Ich konnte eine gute Weile nicht Herz genug fassen, mich ihm zu nähern, denn er kam mir noch häßlicher und abscheulicher vor als ich selbst. Aber plötzlich wandelte mich eine so heftige Begierde an, die Besitzerin dieses wundervollen Schmuckes zu sein, daß ich mich stark genug fühlte, es dem dreiköpfigen Cerberus selbst aus dem Rachen zu reißen.
Diese Begierde war desto unsinniger, da ich nur noch wenige Tage zu leben hatte und das Halsband, wie unschätzbar es auch an sich selbst sein mochte, mir zu nichts helfen konnte, als meine Häßlichkeit in ein auffallenderes Licht zu setzen: aber sie war stärker als meine Vernunft und meine Eigenliebe zusammen genommen; und so kam ich, mit furchtsamen Schritten, dem kleinen Ungeheuer, vor dessen Anblick ich alle Augenblicke hätte ohnmächtig werden mögen, endlich nahe genug, um zu bemerken, daß das Halsband nur mit einem schwachen seidenen Faden umgebunden war.
Ich bemächtigte mich des selben ohne Mühe und war im Begriff, mich mit meiner kostbaren Beute davonzumachen, als der Neger erwachte und mich bei einem Zipfel meines Rocks zurück hielt. ‹Wohin so eilig, schöne Alboflede›, rief er mir zu, indem er einen Rüssel aussperrte, vor dessen Anblick ich hätte umsinken mögen.
Ihm entfliehen zu wollen war keine Möglichkeit, da ich mit meiner Gestalt auch die Geschwindigkeit, die mich retten konnte, verloren hatte. Meine Verlegenheit und Verwirrung schien den Unhold in gute Laune zu setzen. ‹Wenn du erst den ganzen Wert des Kleinodes kennst, das du mir entwenden wolltest›, sprach er lachend und unbekümmert, daß ihn das Lachen noch zehnmal häßlicher machte, als wenn er sauer sah; ‹aber sei guten Mutes, schöne Alboflede!
Ich bin darum nicht böse auf dich, und wenn du dich nur zu einer kleinen Gefälligkeit bequemen kannst, so soll es mir auf das Halsband nicht ankommen, da es mir ohnehin zu nichts nütze ist, als die Lichter des Nachts dabei zu ersparen.› - ‹Und worin soll die kleine Gefälligkeit bestehen?› fragte ich ihn mit weg gewandtem Gesicht, indem ich ein paar Schritte zurücktrat, um von seinem Atem nicht erreicht zu werden.
‹In weiter nichts›, erwiderte er mit einem abscheulich freundlichen Zähnefletschen, ‹als mich zu lieben und die Meinige zu werden.› Alle Knochen an meinem ganzen Leibe klapperten zusammen bei diesem Antrag und bei der Vorstellung, die meine Einbildungskraft damit verband, indem sie mich wider Willen an den schneeweißen Hirsch erinnerte.
‹Nicht um die ganze Welt, und wenn sie aus lauter Karfunkeln zusammen gesetzt wäre›, schrie ich, indem ich ihm sein Halsband mit Abscheu vor die Füße warf. ‹Ich lasse mir Gerechtigkeit widerfahren›, versetzte der grinsende Wechselbalg, indem er das Halsband mit großer Gelassenheit von der Erde aufhob; ‹ich bin freilich nicht der Liebenswürdigste, und ich kann es einer jungen Dame von so außerordentlicher Schönheit, wie du bist, nicht verargen, wenn sie bei einem Antrage wie der meinige ein wenig zusammenfährt.› -
‹Dieser unmenschliche Spott›, rief ich, vor Zorn außer mir, ‹beweist mir, daß deine Seele noch abscheulicher ist als deine Außenseite.› - ‹Er beweist nichts, schöne Alboflede›, sagte der Neger, indem er mir, meines Sträubens ungeachtet, das funkelnde Kleinod um den dürren schwarzgelben Hals herum schlang; ‹ich sage nichts, als was dir dieser Spiegel auch sagen wird!›
Mit diesen Worten hielt er mir einen großen Spiegel vors Gesicht, und - wie soll ich euch mein Erstaunen, meine Bestürzung und mein Entzücken ausdrücken? - ich erblickte mich wieder in meiner ehemaligen Gestalt, im vollen Glanze der Schönheit und Jugend, kurz, so vollkommen alles, was ich gewesen war, daß ich weder dem Spiegel noch meinen Augen zu glauben mir getraute.
‹Ist's möglich?› rief ich in stammelnder Wonnetrunkenheit, indem ich, aus Furcht, der Spiegel könnte bezaubert sein, wie eine Närrin mitten in den Fluß hinein lief, um mich in seiner unverdächtigen Flut zu bespiegeln. Der Neger, der sich einbilden mochte, daß ich ihm entlaufen wolle, rannte mir so eilig nach, daß er mich auf einen Sprung einholte.
Aber wie er mich so ruhig und über eine dunkle Stelle des Wassers hingebückt in meinem eignen Anschauen vergeistert stehen sah, begnügte er sich, mir ganz sachte von hinten zu das Halsband wieder abzulösen und dadurch meiner ganzen Wonne auf einmal ein Ende zu machen. Denn in dem Augenblicke, da das Halsband wieder in seinen Händen war, stand ich wieder so alt und häßlich, wie ihr mich seht, da und suchte mit meinen zusammen gerunzelten und ausgelöschten kleinen Schweinsaugen vergebens, wo mein so innig geliebtes Ich auf einmal hingekommen wäre.
Man müßte selbst in einer solchen Lage gewesen sein, um sich eine wahre Vorstellung davon zu machen. Der verwünschte Neger ging mit seinem Halsband in den Klauen ganz kaltblütig wieder zurück, und ich, als ob ich ihm meine geraubte Schönheit wieder abjagen wollte, lief ihm nach und würde ihm, solange er sie in seinen Händen hatte, trotz meinem Abscheu vor seinem widerlichen Mohrengesichte bis ans Ende der Welt nachgelaufen sein.
Er schien Mitleid mit meiner gewaltsamen Lage zu tragen, und sein Ton wurde immer höflicher und zärtlicher, ohne daß ich seine Figur darum erträglicher fand. Er führte mich in seinen kleinen Palast, zeigte mir alle seine Seltenheiten und Schätze und entdeckte mir im Vertrauen, daß er der Sohn einer Fee und, vermöge der Kenntnisse, womit er von seiner Mutter begabt worden, sehr außerordentliche Dinge zu tun imstande sei. Aber mit allem dem stehe es nicht in seiner Macht, mir das Halsband anders als auf die gemeldete Bedingung wiederzugeben.
‹Verlangen, daß du mich so, wie ich bin, wirklich lieben solltest›, setzte er hinzu, ‹hieße vielleicht etwas Unmögliches von dir fordern; aber so unbillig bin ich nicht; ich will zufrieden sein, wenn du, sobald du mit dem Halsband deine Schönheit wieder von mir erhalten, dich nur ebenso gegen mich beträgst, als ob du mich liebtest; und damit dir deine Gefälligkeit weniger koste, so wisse, daß sie das einzige Mittel ist, den schneeweißen Hirsch, der dir vielleicht nicht gleichgültig ist, wiederzusehen.›
Ich würde bei diesen Worten rot geworden sein, wenn eine so pergamentartige Haut wie die meinige hätte erröten können; es war mir unbegreiflich, woher der kleine Neger soviel von meiner Geschichte wissen könne, und meine Verlegenheit nahm mit der Begierde nach dem Halsband sichtbar zu. Was soll ich euch sagen? Im Grunde konnte kein Preis für das Gut, dessen Erwerbung in meine Willkür gestellt war, zu groß sein.
Wenigstens dachte ich damals so, und jede andre würde vielleicht an meinem Platze ebenso gedacht haben. Genug, ich erhielt das Halsband mit aller meiner Schönheit wieder, und der abscheuliche kleine Mohr verwandelte sich, sobald ich ihm meine Dankbarkeit zu beweisen anfing, zu meinem großen Erstaunen in den wunderschönen Jüngling, der in Gestalt eines schneeweißen Hirsches mein Herz gewonnen hatte und dessen Ungezogenheit die Quelle aller meiner Abenteuer gewesen war.
Ich erfuhr nun von ihm selbst, daß eine Intrige mit einer ebenso mächtigen als eifersüchtigen Fee an seiner Verwandlung Ursache gewesen. Er konnte seine eigentümliche Gestalt unter keiner anderen Bedingung wieder erhalten, als wenn er in seiner häßlichen Negermaske die schönste Person in der Welt dahin bringen könnte, die Seinige zu werden; und von wem konnte er dies jemals zu erhalten hoffen als von einer Person, über die er sich den Vorteil zu verschaffen gewußt hatte, daß es von ihm abhing, ob sie die schönste oder die häßlichste ihres Geschlechtes sein sollte?
Alquif (so nannte sich mein neuer Gemahl) war ein großer Zauberer; aber das Halsband, wie wohl es für ein Meisterstück der magischen Kunst gelten konnte, vermochte doch nicht das Werk der Feen gänzlich zu vernichten. Die Kraft dieses mächtigen Talismans erstreckte sich bloß auf die Stunden der Nacht; sobald der Tag anbrach, verschwand meine Schönheit zugleich mit dem wundervollen Glanz des Halsbandes, und ich erhielt alle die Häßlichkeit wieder, womit mich die erste Fee begabet hatte.
Alquif hatte, sobald er mich wieder in diesem Zustande sah, nichts Angelegneres, als das einzige graue Haar, das ich noch auf meinem Kopfe hatte, durch die stärksten Zaubermittel so fest und dauerhaft zu machen, daß es die ganze Anzahl von Jahren aushalten könnte, für welche mir die außerordentliche Fülle meiner Haare im Stande meiner Schönheit Gewähr leistete; und da der Tag die Zeit war, wo meine Gesellschaft einem jungen Manne, der das Vergnügen liebte, eben nicht die angenehmste sein konnte, so wandte er ihn in den ersten Wochen unserer Verbindung dazu an, mich in die Mysterien der Kunst, worin er einer der größten Meister war, einzufahren.
Aber kaum sah er mich, durch den schnellen Fortgang, den ich darin machte, in den Stand gesetzt, seines Beistandes entbehren zu können, so überließ er sich seinem natürlichen Unbestand und entfernte sich von dieser Insel, ohne daß wir uns seitdem wiedergesehen haben.
Ich habe euch diese Geschichten erzählt, meine Kinder», fuhr Alboflede fort, «um euch zu überzeugen, daß das Vorherwissen unserer Schicksale uns nicht nur ganz unnütz dazu ist, ihnen auszuweichen, sondern daß es sogar das Mittel wird, uns unangenehme Schicksale zu machen, in welche wir, ohne jenen Vorwitz und eine unzeitige Geschäftigkeit und Einmischung in das Werk der höhern Mächte, die unser Verhängnis leiten, nie geraten wären.
Hätte der Druide, mein Vater, sich nicht einfallen lassen, mir die Nativität zu stellen, so wäre ich aller der unsäglichen Leiden und Kränkungen überhoben geblieben, die er mir bloß durch das Mittel zuzog, wodurch er mein vermeintliches Unglück verhüten wollte. Lasst euch also durch Albofledens Erfahrung warnen: hütet euch, euerem Schicksal eigenmächtig vorgreifen zu wollen; lasst die Götter walten und erwartet in Geduld, was sie über eure Liebe und euer Glück beschlossen haben!»
Während daß die alte Zauberin ihre jungen Gäste solchergestalt unterhielt und ihre wunderreiche Erzählung (die diese für ein ausgemachtes Märchen hielten) mit so weisen Lehren bekrönte, war unvermerkt die Nacht eingebrochen; und Alboflede hatte kaum den dreifachen Kragen, womit sie bei Tage ihren Hals zu verhüllen pflegte, abgelegt, als das funkelnde Halsband auf hundert Schritte im Durchmesser einen neuen Tag verbreitete und die Alte vor den erstaunten Augen der beiden Liebenden in einem Glanz von Schönheit und Jugend dastand, der sie beinahe zu Boden warf.
«Ihr seht», sagte sie zu ihnen, «daß ich euch kein Märchen erzählt habe, wie ihr euch vermutlich einbilden mochtet.» Die jungen Leute erröteten; und da sie nicht Philosophen genug waren, um das Wunderbare, was sie mit Augen sahen, für ein Märchen ihrer eigenen Einbildungskraft zu halten, so ließen sie es dabei bewenden und begnügten sich, Albofleden, oder vielmehr die Göttin der Schönheit, die so unverhofft ihren Platz eingenommen hatte, mit großen Augen anzustarren.
Auf einmal trat ein Adonis von sechzehn Jahren, dem Ansehen nach so schön wie der schönste Engel, den Guido Reni jemals gemalt hat, zwischen sie hin und bediente die kleine Gesellschaft aus goldnen Schalen mit den köstlichsten Erfrischungen. Alboflede sagte ihnen, daß es ein Sylphe und dieser Sylphe das einzige Wesen sei, mit welchem sie das Vergnügen der Einsamkeit in ihrer kleinen Insel teile.
Die junge Selma gestand sich selbst, daß sie, nach dem schönen Arbogast, ihrem Liebhaber, nie etwas gesehen habe, das mit diesem Sylphen zu vergleichen sei. Aber das Wahre von der Sache war, daß sie ihren schönen Arbogast mit Augen der Liebe, das ist mit blinden oder wenigstens verblendeten Augen, ansah; denn in der Tat mußte man so eingenommen sein, als sie es war, um eine Vergleichung zwischen beiden nicht lächerlich zu finden.
Kaum hatte sich der wirkliche oder vorgebliche Sylphe (denn wir getrauen uns nicht zu entscheiden, ob er das eine oder andere war) wieder entfernt, so erneuerten die beiden Liebenden ihre erste Bitte mit so vieler Zudringlichkeit, daß Alboflede alle Mühe, die sie sich gegeben hatte, verloren sah, «Ihr seid also», sagte sie lächelnd, «wie alle jungen Leute; die Lehren und Warnungen der Weisheit glitschen, wie Töne ohne Sinn und Bedeutung, von euern Ohren ab. Ihr wollt alles selbst erfahren und auf eure eigene Unkosten klüger werden.
Nun, wohlan dann! Tretet in diesen Kreis», fuhr sie fort, indem sie mit einem elfenbeinernen Stab einen Kreis um sie her zog; «ich will das Buch des Schicksals für euch aufschlagen, und ihr sollt den Ausgang eurer Liebe vernehmen.» Sogleich trat der schöne Sylphe wieder auf, indem er seiner Gebieterin in der einen Hand ein goldnes Rauchfaß und in der anderen ein großes Buch, das mit goldnen Buckeln beschlagen und reich mit Edelsteinen besetzt war, darreichte.
Sie nahm das Buch aus seiner Hand, und als sie aus einer diamantenen Büchse einige Körner in das Rauchfaß geworfen hatte, stieg ein lieblicher, sanft betäubender Dampf daraus in die Höhe und erfüllte in einem Augenblick die ganze Gegend. «Hört nun euer Schicksal», sagte sie zu den Liebenden, die, in eine Wolke von Wohlgeruch eingehüllt, zitternd vor ihr standen. Sie schlug das Buch auf und las mit lauter Stimme: «Ihr werdet getrennt werden!»
Die armen Seelen, denen bei allen diesen Zeremonien vorhin schon wenig Gutes ahndete, mußten sich aneinander anhalten, um vor Schmerz aber diese schreckliche Weissagung nicht umzusinken. «Doch nicht auf lange? Nicht auf ewig?» fragte Selma mit erstickter Stimme. «Was können wir tun, um wieder vereinigst zu werden?» fragte Arbogast.
«Indem ihr einander auf entgegengesetzten Wegen sucht, werdet ihr euch unverhofft wiederfinden», las Alboflede von einem anderen Blatte herab. Sie schloß hierauf das Buch wieder zu und gab es dem Sylphen zurück, der damit verschwand.
Die Liebenden fielen der schönen Zauberin zu Füßen und dankten ihr für die Gewährung ihrer Bitte. «Wir unterwerfen uns unserm Schicksale», sagten sie; «wie groß auch die uns erwartenden Leiden sein mögen, welche Wollust ist in dem Gedanken, für das, was man liebt, zu leiden!»
«Das werdet ihr erfahren», sagte Alboflede. «Aber wir werden uns wiederfinden», riefen die Liebenden. «Welche Wonne! wir werden uns wiederfinden und glücklich sein!» - «Das wollen wir hoffen», sagte Alboflede. «Wir müssen uns trennen, so will es unser unerbittliches Schicksal», riefen die Liebenden, einander in die Arme sinkend; «jeder Augenblick, den wir länger säumen, verzögert die selige Stunde des Wiedersehens.» -
«Romanhafte Seelen!» sagte Alboflede mit einem gütig bedauernden Blicke; «so tretet denn eure Wanderung an, du ostwärts da hinaus, du westwärts dort hinaus; und verlasst euch darauf, daß Alboflede mit euch sein wird!»
Sie erlaubte ihnen hierauf, einander noch einmal und aber mal zu umarmen; mit einem Strome von Tränen rissen sie sich endlich voneinander los, und nachdem sie sich von Albofleden beurlaubt hatten, traten sie mit wankenden Schritten ihren Leidensweg an; ostwärts er, westwärts sie, nicht ohne sich, solange sie konnten, umzusehen und einander von ferne Küsse zuzuwerfen.
Aber kaum waren sie, jedes auf seinem eigenen Schlangenwege, ein paar hundert Schritte im Walde, der Albofledens Gärten auf der mitternächtlichen Seite umfaßte, fort gegangen, als jedes, von einer angenehmen Betäubung überwältigt, auf eine Moosbank hinfiel, um durch Veranstaltung der wohltätigen Zauberin in einem magischen Traum alle die Abenteuer zu durchlaufen, die eine Folge ihrer törichten Entschließung gewesen sein würden, wenn Alboflede nicht Mittel gefunden hätte, sie zu vereiteln.
Arbogast und Selma träumten beide einerlei Traum; er fing mit dem Augenblick ihres Abschiedes von Albofleden an und führte sie durch verworrene und größtenteils unangenehme Begebenheiten, nach einer zehnjährigen Trennung (wie es ihnen däuchte), beide in eine große Stadt, wo Selma die unverhoffte Freude hatte, ihren geliebten Arbogast - in den Armen einer anderen wiederzufinden.
Die Zauberin hatte es so veranstaltet, daß die beiden Liebenden, wie wohl sie sich voneinander zu entfernen glaubten, in den Schlangengängen ihres Lustwaldes wieder so nahe zusammen kamen, daß sie in dem Augenblicke, da sie von der Betäubung des magischen Schlummers überwältigt wurden, nur durch eine leichte Wand von Myrten und Rosen getrennt waren.
Auf ihren Wink mußte der Sylphe den schlafenden Arbogast auf die nämliche Moosbank tragen, wo Selma eingeschlummert war. Der zehnjährige Traum, in welchem sie eine unendliche Menge romanhafter Abenteuer bestanden zu haben glaubten, währte in der Tat nicht länger als eine einzige Stunde.
Alboflede, welche während dieser Zeit der träumenden Selma immer gegenüber gesessen, war die erste Person, die ihr in die Augen fiel, als sie, vor Schrecken und Unwillen, ihren Liebhaber nach so langer Trennung in fremden Armen zu finden, erwachte und, ohne zu merken, daß sie das alles nur geträumt hatte, in die bittersten Klagen und Vorwürfe über ihren Treulosen ausbrach.
In eben diesem Augenblick erwachte auch Arbogast, nicht ohne große Verwirrung, Selma und die Zauberin zu Zeugen des Verbrechens zu haben, dessen er sich schuldig glaubte, aber fest entschlossen, sich dadurch nicht aus dem Vorteil werfen zu lassen, den er über seine Geliebte zu haben versichert war.
«Räche mich an diesem Ungetreuen, große Fee», rief die ergrimmte Selma, indem sie sich Albofleden zu Füßen warf «Welche Unverschämtheit!» rief Arbogast, von Selmas Hitze ebenfalls in Feuer gesetzt. «Du unterstehst dich, mir meine Untreue vorzuwerfen, du?» -
«Habe ich dich», schrie Selma, «nicht in den verhaßten Armen einer...» - «Und war ich nicht, ohne daß du etwas von mir wissen wolltest, Galeerensklave auf der nämlichen Brigantine, wo ich mit diesen meinen Augen sah, wie du dich, ohne Widerstand, von dem Hauptmann der Seeräuber in seine Kajüte führen ließest?» schrie Arbogast.
«Wie, meine Kinder?» rief Alboflede mit lächelnder Verwunderung, «in dem Augenblicke, da ich euch nach einer so langen und schmerzlichen Trennung wieder zusammenbringe, in dem seligen Augenblicke des Wiedersehens, da meine einzige Furcht war, daß ihr vor Liebe und Entzücken einander in den Armen sterben würdet, sind die bittersten Vorwürfe euer Willkommen?» -
«Oh, wenn du erst alles wüßtest, große Fee», riefen beide wie aus einem Munde. «Ich weiß mehr, als ihr euch einbildet», antwortete Alboflede; «und ihr könnt euch nur bei mir bedanken, daß euch das alles nur geträumt hat. Es würde euch wirklich und im ganzen Ernste begegnet sein, wenn ich nicht klüger gewesen wäre als ihr und euch die romanhafte Reise, die ihr zu unternehmen im Begriff wart, nicht innerhalb eines Bezirkes von zweihundert Schritten und binnen einer einzigen Stunde hätte vollenden lassen.
Noch einmal, meine Kinder, ihr habt nur geträumt und seid nicht aus diesem Garten gekommen; gebt einander die Hände und verzeiht einander, was ihr nicht getan habt, aber getan haben würdet, wenn ich, weniger gütig, euch den Folgen eures Vorwitzes und eurer Übereilung preisgegeben hätte. Kehrt nun ungesäumt wieder zu den Eurigen!
Euer Traum wird in kurzem nur schwache Spuren in eurer Seele zurück lassen. Aber hütet euch, solang ihr lebt, vor der törichten Ungeduld, die Früchte eures Schicksals pflücken zu wollen, bevor sie reif sind; liebt euch, seid standhaft und getreu, leidet geduldig, was ihr nicht ändern könnt, ohne euch größeren Übeln auszusetzen, und hofft immer das Beste von den unsichtbaren Mächten, in deren Schoße die Zukunft liegt.»
Mit diesen Worten ließ Alboflede die beiden Liebenden von sich. Sie dankten ihr für ihre Güte und versprachen Gehorsam. Bald nach ihrer Zurückkunft wurden sie wirklich getrennt; aber sie erinnerten sich der Worte Albofledens und ihres Traumes und erwarteten, so geduldig als ihnen möglich war, was die Götter über sie beschlossen hätten.
In kurzem verschwanden die Hindernisse, die sie für unübersteiglich gehalten hatten: sie wurden wieder vereinigt, liebten einander und waren glücklich.
Christoph Martin Wieland - Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
DER GREIF VOM GEBIRGE KAF ...

Als Sultan Soliman, der Sohn Daads, den Thron der Welt bestieg, erklärte er den Greif vom Gebirge Kaf zum König aller befiederten Scharen. Ungeachtet dieser Würde, die diesen Wundervogel zum Befehlshaber über siebzehnhundert verschiedene Gattungen von Vögeln machte, fuhr er fort, ein Diener des großen Fürsten zu bleiben, und kam alle Morgen, ihm seine Aufwartung zu machen.
Es begab sich eines Tages, daß der Greif bei einer Versammlung der Weisen, die vor Soliman gehalten wurde, zugegen war. Einer von ihnen sagte, es sei unmöglich, etwas gegen die Ratschlüsse des Königs der Geister auszuführen. «Und ich», fiel ihm der Greif ins Wort, «ich behaupte, daß ich imstande bin, etwas zu verhindern, das im Divan der Geister beschlossen worden ist.»
Die Weisen stellten ihm vergebens die Ungereimtheit eines solchen Vermessens vor; er blieb bei seiner Rede, und Geoncha, der sie gehört hatte, beschloß, ihn beim Worte zunehmen. «Ihr habt gehört», sagte er zu den Geistern, die seinen Thron im Dschinnistan umgaben, «wessen sich der Greif vermessen hat. Wohlan! Er soll uns eine Probe seiner Kunst sehen lassen.
Ich will, daß der Sohn des Königs vom Morgen die Tochter des Königs vom Abend zum Weibe nehme. Gehe, Edris, eröffne dem Soliman meine Entschließung; wir wollen doch sehen, wie es der Greif anfangen will, sie zu hinter treiben.» Soliman eröffnete dem Greif, was ihm Edris zu wissen getan hatte, und machte ihm nochmals Vorstellungen über die Unvernunft seines Unternehmens; aber er beharrte zuversichtlich auf seiner Rede und behauptete, er wolle schon Mittel finden, diese Heirat zu verhindern.
«Ich will dir nicht verhalten», sagte der Sultan, «daß die Königin vom Abend in diesem Augenblick von einer Tochter entbunden worden ist, die man dem Sohn des Königs vom Morgen zum Weibe bestimmt.» Statt der Antwort spannte der Greif seine ungeheuren Flügel aus und erhob sich in die Lüfte, ohne daß sich unter allen Vögeln nur einer gefunden hätte, der seiner Meinung gewesen wäre; das einzige Käuzlein ausgenommen, welches versicherte, daß es dem Greif gelingen würde.
Dieser durchschnitt die Lüfte mit unglaublicher Geschwindigkeit, langte in kurzem am Hof des Königs vom Abend an und entdeckte, nachdem er sich eine Weile umgesehen hatte, die neugeborne Prinzessin in ihrer Wiege, mitten unter ihren Ammen und Wärterinnen. Er stürzte aus der Höhe auf sie herab, die Weiber liefen vor Schrecken davon, und er packte die Wiege mit seinem krummen Schnabel und trug sie in sein Nest auf dem Berge Kaf.
Der Greif, welcher eigentlich zu reden eine Greifin war, nahm die Verrichtungen einer Amme bei der kleinen Prinzessin auf sich selbst; und da seine Milch von der besten Art war, so gedieh das Kind so wohl, daß es bald entwöhnt werden konnte. Kurz, die Prinzessin wuchs heran, genoß der vollkommensten Gesundheit und wurde so groß und schön, als sie am Hofe ihres Vaters schwerlich geworden wäre.
Der Greif sparte keine Mühe, ihr eine gute Erziehung zu geben; er lehrte sie lesen und schreiben und ließ sich mit ihr in Unterredung über das, was sie auf sein Geheiß gelesen hatte, ein. Die Prinzessin, die keine andere Mutter zu haben glaubte, gehorchte ihrer vermeintlichen Mutter in allem und beschäftigte sich den ganzen Tag allein im Neste, während der Greif alle Morgen wie gewöhnlich am Hofe des Sultans Soliman erschien und die Dienste, die er ihm auftrug, ausrichtete.
Aber er vergaß nie, des Abends zurückzukommen, seinem lieben Mädchen zu essen zu bringen und sich mit ihr von tausend Dingen zu unterhalten. Endlich erreichte die Prinzessin das Alter der Mannbarkeit, und um eben diese Zeit starb der König der Abendländer, und sein Sohn, ein Prinz von sechzehn Jahren, bestieg den Thron, den jener erledigt hatte.
Der junge Fürst war ein so großer Liebhaber der Jagd, daß kein Tag verging, wo er dieser Lustbarkeit nicht nachgehangen hätte. Endlich wurde er es überdrüssig, immer in den selben Gegenden und die nämlichen Tiere zu jagen. «Gehen wir zu Schiffe», sagte er zu seinen Wesiren, «und jagen in Gegenden, wo wir noch nie gewesen sind; während unserer Abwesenheit wird das Wild in diesen Revieren Zeit gewinnen, sich wieder zu vermehren.»
Da die Wesire des jungen Königs keine Leute waren, die gegen eine so weise Entschließung etwas einzuwenden gehabt hätten, so wurden unverzüglich die nötigen Anstalten gemacht. Sie ließen eine Menge kleiner Fahrzeuge bauen, um überall desto leichter landen zu können; der junge König und seine Wesire und Höflinge stiegen ein und segelten mit gutem Winde davon.
Nachdem sie auf verschiedenen Inseln, wo sie landeten, gejagt hatten, überfiel sie einst mitten auf dem Meer ein so entsetzlicher Sturm, daß alle Schiffe, die zu ihrer Flotte gehörten, versenkt oder zerstreut wurden; nur das einzige, worauf der König sich befand, blieb unbeschädigt und langte am Fuß des Berges Kaf an.
Einige von seinen Leuten stiegen an Land, gerieten aber in große Bestürzung, es ganz unbewohnt zu finden und sich überall von lauter wilden, himmelhohen und unbersteigbaren Felsen umgeben zu sehen. Gleichwohl bestand der Prinz darauf, in diesen unwirtbaren Gegenden zu jagen, und da er von Natur etwas unvorsichtig war, verlor er sich unvermerkt von seiner Gesellschaft und ging oder kletterte eine Zeit lang ganz allein auf Geratewohl herum.
Endlich erblickte er einen Baum, wie er in seinem Leben noch keinen gesehen hatte; er war so dick, daß ihn vierhundert Männer nicht hätten umspannen können; die Höhe war einer so ungeheuren Dicke gemäß, und was den Prinzen nicht weniger in Erstaunen setzte, war, ein Nest auf diesem wunderbaren Baum zu sehen, das die größten Paläste an Größe übertraf.
Es hatte mehrere Stockwerke übereinander und war aus großen Balken von Zedern, Sandelholz und anderen aromatischen Hölzern zusammengefügt. Der junge König stand schon eine gute Weile in Betrachtung dieser seltsamen Wunder der Natur und Kunst vertieft, als er durch eine Öffnung des Gebälks eine junge Person erblickte, die ihm ein noch viel größeres Wunder schien.
Nicht lange, so wurde sie ihn ebenfalls gewahr. Nachdem sie sich eine geraume Weile mit wechselseitigem Erstaunen und Vergnügen angesehen hatten, entwickelte sich (als die erste Wirkung der wechselseitigen Sympathie, mit der sie geboren waren) bei dem Prinzen der Gedanke, sich zu dem schönen Mädchen hinauf zu wünschen, und bei ihr, daß er diesen Gedanken haben möchte.
«Diese junge Person», dachte die Prinzessin, «ist, dem Ansehen nach, ein Wesen meiner Gattung! Oh, wie gerne möchte ich sie bei mir haben können! Meine Mutter ist eine sehr gute Person, aber es fehlt viel daran, daß sie so schön wäre wie diese. Freilich hat sie die Flügel vor uns voraus.» - «Leider! Hätte ich Flügel, oh, wie bald wollte ich an deiner Seite sein, um mich nie wieder von dir zu trennen!»
In der Tat wären Flügel dem Prinzen oder ihr hier sehr nötig gewesen, denn der Schaft des Baums war bis zu seinen untersten Zweigen so hoch und glatt, daß es schlechterdings eine Unmöglichkeit war, hinauf- oder herabzusteigen. Beide schienen diese Unmöglichkeit mit gleich großem Schmerz zu fühlen; aber die Liebe, die sich des Prinzen beim ersten Anblick der jungen Person bemächtigt hatte und die eines der mächtigsten Triebräder ist, wodurch der Himmel seine Absichten bewerkstelligt, findet Mittel, das Unmögliche selbst möglich zu machen.
Sie fing damit an, daß sie die Einbildungskraft und den Scharfsinn des Prinzen erhöhte. «Wie dieses junge Mädchen auch in dieses Nest gekommen sein mag», dachte er, «wo ein Nest ist, muß ein Vogel sein, der es gebaut hat, und ein so ungeheures Nest kann nur das Werk eines ungeheuren Vogels sein.»
Auf einmal erinnerte er sich, daß ihm seine Amme große Wunderdinge von dem Vogel Greif, der auf einem hohen Berge am Ende der Welt wohne, erzählt hatte, und so gleich war es etwas Ausgemachtes bei ihm, daß dieses Nest die Wohnung des Vogels Greif sein müsse, daß er die junge Person entführt habe und - wie einem Liebhaber zuweilen auch die widersinnigsten Einfälle zu Kopfe steigen - daß er vielleicht in sie verliebt sei oder sie aus irgendeiner anderen geheimen Absicht in diesem unzugangbaren Zauberturm gefangen halte.
Dieses alles vorausgesetzt, fing er an, hin und her zu sinnen, ob er nicht ein Mittel ausdenken könnte, den Greif selbst, wenn er wieder zurück käme, zum Werkzeuge seiner Zusammenkunft mit dem holden Mädchen zu machen, das seine schönen Arme so wehmütig bald zum Himmel emporstreckte, bald zu ihm herunter faltete, und dadurch sein Verlangen, bei ihr zu sein, zur heftigsten Leidenschaft entflammte.
In diesem Augenblick wurde er eines toten Kamels gewahr, das nicht weit von ihm im Grase lag und erst vor kurzem das Leben verloren zu haben schien. So gleich fiel es wie ein Blitz in seine Seele, was er tun müßte, um diesen Zufall zu Befriedigung seines brennenden Verlangens zu benutzen. Er zog sein Weidmesser heraus, weidete das Kamel aus, ließ es in der Sonnenhitze austrocknen und füllte es mit allerlei wohlriechenden Kräutern an, die in Menge auf dieser Höhe des Gebürges zu finden waren.
Die junge Prinzessin beobachtete dies alles mit großer Aufmerksamkeit, und der Prinz gab sich viele Mühe, ihr durch Zeichen zu verstehen zu geben, was seine Absicht bei diesem Unternehmen sei. Als endlich die Sonne unterging, hörte er ein gewaltiges Rauschen, wie das Tosen eines Sturmwindes, in der Luft; er schloß daraus, daß der Greif im Anzug sei, und eilte, in den ausgeweideten Leib des Kamels zu kriechen, wo er Mittel fand, sich so gut einzuschließen, daß ihn niemand darin gesucht hätte.
Der Greif kam indessen bei seiner Pflegtochter an, besorgte ihre Abendmahlzeit und unterhielt sie mit allerlei Neuigkeiten, die er an Solimans Hofe gehört hatte. Am folgenden Morgen, da er sich mit Anbruch des Tages wieder zu seiner gewöhnlichen Abreise anschickte, machte ihn die junge Prinzessin das Kamel bemerken und bezeugte ein großes Verlangen, dieses seltsame Tier in der Nähe zu sehen.
Der Greif, der es für etwas sehr Unbedeutendes hielt, diese kindische Neugier zu befriedigen, und gewohnt war, ihr in allen ihren unschuldigen Wünschen zu willfahren, besann sich keinen Augenblick; er holte das Kamel herauf und flog davon.
Man kann sich leicht vorstellen, was nun erfolgte, da der junge Prinz einmal im Neste war. Die Prinzessin überließ sich in ihrer unwissenden Unschuld dem süßen Hang der Sympathie, und der Prinz, der nicht ganz so unwissend war, seiner Leidenschaft.
Die Freude, die sie aneinander hatten, war unbeschreiblich. Sie konnten zwar nicht miteinander reden, aber die Liebe lehrte sie gar bald eine Sprache, die eine ganz andere Deutlichkeit und Wärme hat als die schönste aller anderen Sprachen und in der sie nicht müde wurden, einander ihre gegenseitigen Empfindungen aufs lebhafteste auszudrücken.
Die Energie dieser ihnen beiden ganz neuen Sprache war so groß, daß die Prinzessin, noch ehe der Greif wieder von Solimans Hofe zurückkam, bereits in Umständen war, die alle Maßregeln dieses vermessenen Vogels vernichteten. Sobald dieser durch das Getöse seiner Flügel seine Annäherung verkündigte, kroch der Prinz in sein Kamel zurück, welches der Greif als ein Spielzeug seiner kleinen Pflegetochter betrachtete und keiner weitern Aufmerksamkeit würdigte.
Die Speisen, der er ihr alle Abend aus Solimans Küche zutrug, reichten überflüssig zu, ein Paar junge Liebende zu sättigen, die beinahe schon von ihrer bloßen Liebe hätten leben können; und da sie alle Zeit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang für sich allein hatten, so vergingen ihnen die neun ersten Monate ihres Beisammenseins wie einzelne Tage.
Inzwischen rückte die Stunde heran, wo die Torheit des Greifs vom Berge Kaf durch den Augenschein gehämt werden sollte, und Edris wurde abermals abgeschickt, den Sultan von dem, was vorgegangen war, zu unterrichten. Soliman ließ den Greif zu sich rufen und fragte ihn, ob er die Verbindung der Tochter des Königs vom Abend mit dem Sohne des Königs vom Morgen verhindert habe.
«Das habe ich», antwortete der Greif; «die Prinzessin ist von ihrer Geburt an in meiner Gewalt gewesen, und den Prinzen möchte ich sehen, der sich rühmen könnte, ihr nahe gekommen zu sein! Kurz, sie ist in meinem Nest auf dem Berge Kaf; das ist genug gesagt, Herr, um dich zu überzeugen, daß sie in ihrem Leben niemand als mich gesehen hat.» -
«Geh», sagte der Sultan, «und bringe sie mir auf der Stelle her; ich will mit meinen eigenen Augen sehen, ob du mir die Wahrheit sagst.» Der Greif ließ sich diesen Befehl mit Freuden gefallen, und Soliman berief in dessen alle Weisen und Schriftgelehrten und seinen ganzen Hof zusammen, um Zeugen dessen, was erfolgen würde, abzugeben.
Die junge Prinzessin erschrak nicht wenig, da sie ihre Pflegemutter zu einer so ungewöhnlichen Stunde wiederkommen sah, und hatte kaum noch Zeit genug, den Prinzen, mit dem sie in Freiheit zu sein geglaubt hatte, wieder unbemerkt in sein Kamel zu verbergen. «Meine Tochter», sagte der Greif, «du mußt unverzüglich mit abreisen; Soliman verlangt dich zu sehen, und ich komme deswegen, um dich an seinen Hof zu tragen.»
Die Prinzessin erschrak über diese Nachricht noch heftiger, denn wie hätte sie sich entschließen können, ihren Geliebten im Neste des Greifs vom Berge Kaf allein zurückzulassen? Aber so jung und unerfahren sie war, der schlaueste aller Ratgeber, die Liebe, ließ sie in dieser Not nicht unberaten. «Wie willst du mich hinbringen?» fragte sie. «Auf meinem Rücken», antwortete der Greif.
Die Prinzessin bezeugte eine große Angst vor einer so ungewohnten Art zu reisen. «Wir haben», sagte sie, «so viel Länder und Meere zu passieren; der Anblick so vieler neuen Gegenstände und die Höhe und Geschwindigkeit deines Flügels wird mich schwindlig machen; ich werde ganz unfehlbar herabfallen, mein Tod ist gewiß; ich kann mich unmöglich zu einer solchen Art zu reisen entschließen. Wenn es aber ja sein muß, liebe Mutter, so erlaube mir wenigstens, daß ich mich in dieses Kamel einschließe; ich werde dann nichts sehen, und so wirst du mich ohne alle Gefahr tragen können.»
Der Greif fand den Einfall vortrefflich und hatte über diese Probe des Verstandes und der Besonnenheit seiner Pflegetochter eine große Freude. Die Prinzessin schloß sich zu ihrem lieben Prinzen in das Kamel ein, ohne daß der Greif den geringsten Verdacht schöpfte; und so eilte dieser in triumphierender Ungeduld mit seiner schönen Last davon, ohne zu merken, daß die Prinzessin unterwegs, vermutlich unter dem unsichtbaren Beistand irgendeiner guten Fee, von einem wunderschönen Knäblein entbunden wurde.
Als sie nun bei Soliman angelangt waren, der sie mitten unter seinen Weisen und Hofleuten erwartete, befahl der Sultan dem Greif, das Kamel zu öffnen; und nun denke man sich das allgemeine Erstaunen, als der Prinz und die Prinzessin mit dem Knäblein im Arme zum Vorschein kamen. «Wie?» sagte Soliman zu dem bestürzten Greif, «so verhinderst du die Ausführung dessen, was Geoncha beschlossen hat?»
Die Beschämung, der Verdruß und das allgemeine unmäßige Gelächter aller Anwesenden machten den Greif auf eine fürchterliche Art an allen Gliedern und Federn seines ungeheuren Körpers zittern; er flog davon und verschloß sich von diesem Tage an in sein Nest auf dem Berge Kaf, den er nie wieder verlassen hat.
«Wo ist das Käuzlein», fragte Soliman, «das der Vermessenheit des Greifs seinen Beifall gab?» Aber das Käuzlein war so klug gewesen, sich zu Zeiten zu entfernen; und seitdem hält es sich immer an einsamen Orten auf und fliegt nur bei Nacht aus.
Christoph Martin Wieland - Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen - Ein morgenländisches Märchen
DER EISERNE ARMLEUCHTER ...
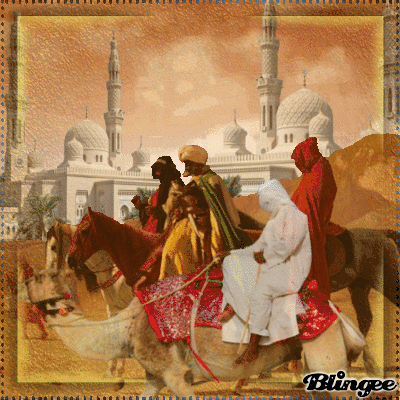
Ein reisender Derwisch wurde zu Bassora von einer Krankheit überfallen. Er nahm seine Zuflucht in die Hütte einer guten armen Witwe, die sich in einer der Vorstädte mit ihrem einzigen Sohne Nardan, einem Knaben von sechzehn Jahren, von ihrer Handarbeit und einem kleinen Garten, der ihr ganzer Reichtum war, notdürftig nährte. Das gute Mütterchen wartete und pflegte den Kranken mit so großer Sorgfalt, daß er nach Verfluß einiger Wochen sich wieder völlig hergestellt befand.
Da er während dieser Zeit Gelegenheit genug gehabt hatte, wahrzunehmen, daß ihr der junge Nardan mehr zur Last als zum Troste gereichte und daß sie für die Zukunft seinetwegen nicht wenig verlegen war, so tat er ihr, zum Beweise seiner Dankbarkeit, den Vorschlag, ihr alle weitere Sorge für ihren Sohn abzunehmen und ihn, falls sie in eine Trennung von ihm einwilligen wollte, wie sein eignes Kind zu halten.
Der Stand, das Alter, die Miene und das Betragen des Derwisch flößten Ehrfurcht und Vertrauen ein; die Witwe nahm sein Anerbieten an, und in wenigen Tagen machte er sich mit dem jungen Nardan auf den Weg, nachdem er ihnen eröffnet hatte, daß er eine Reise von zwei bis drei Jahren zu tun gedächte, ehe er nach Magrebi, dem Orte seines gewöhnlichen Aufenthalts, zurückkehren würde.
Während dieser langen Zeit, in welcher der Derwisch mit seinem jungen Gefährten alle Länder, die dem Gesetze des Propheten folgen, durchwanderte, schien er nichts Angelegneres zu haben, als sich durch alle nur ersinnliche Beweise einer väterlichen Zärtlichkeit das Zutrauen und die Liebe dieses Jünglings zu erwerben.
Er ließ es ihm an nichts fehlen, er bemühte sich, ihm die Lehren der Weisheit ins Gemüte zu prägen und ihm Mäßigung der Begierden und Geringschätzung aller ungewissen und vergänglichen Güter einzuflößen; er teilte ihm eine Menge nützlicher und angenehmer Kenntnisse mit, zeigte ihm überall, wo sie hin kamen, alles, was der Aufmerksamkeit eines Reisenden würdig war, pflegte seiner in einer tödlichen Krankheit und stellte ihn wieder her; kurz, er tat alles an ihm, was der beste Vater für seinen einzigen Sohn zu tun fähig sein kann.
Der junge Nardan schien von so vieler Güte nicht wenig gerührt zu sein und bezeugte seinem Wohltäter die Dankbarkeit seines Herzens tausendmal in den stärksten Ausdrücken; aber der Derwisch antwortete ihm allemal: «Mein Sohn, ein dankbares Herz spricht durch Taten; wir wollen sehen, wenn Zeit und Gelegenheit kommt.»
Sie hatten nun über drei Jahre mit dieser Wanderschaft zugebracht, als sie sich eines Tages in einer ganz abgelegenen Gegend unvermerkt von hohen Bergen und schroff überhängenden Felsen ringsum eingeschlossen sahen. Das Grauen, das den jungen Nardan bei diesem Anblick befiel, verdoppelte sich, als der Derwisch auf einmal still hielt, ihn bei der Hand ergriff und sagte:
«Endlich, mein Sohn, sind wir am Ziel unserer Reise angekommen; in wenig Augenblicken wirst du die Gelegenheit finden, mir für alles, was ich an dir getan habe, deine Erkenntlichkeit zu beweisen. Sei aufmerksam, schweige und gehorche!»
Der Jüngling erblaßte bei diesen Worten, in dem er einen furchtsamen Blick auf den Derwisch warf, als ob er den Sinn dieser geheimnisvollen Anrede und sein Schicksal in den Augen des Alten ausspähen wollte; da er aber nichts als die gewöhnliche Heiterkeit und Güte darin zu sehen glaubte, faßte er sogleich wieder ein Herz und schwur ihm zu, daß er sich, was es auch antreffen möchte, auf seine Treue und auf seinen Gehorsam verlassen könne.
Der Derwisch hieß ihn hierauf einige dürre Reiser und Baumblätter zusammen legen, und nachdem er sie vermittelst eines Brennglases angezündet hatte, warf er etliche Weihrauchkörner aus einer kleinen Büchse, die er bei sich trug, in die Flamme und murmelte eine Art von Gebet dazu her, wovon Nardan nichts verstehen konnte.
Auf einmal tat sich die Erde vor ihnen auf, es zeigten sich einige Stufen von weißem Marmor, und der Derwisch sagte zu seinem Pflegesohn: «Noch einmal, mein Sohn, es steht jetzt bei dir, mir einen großen Dienst zu erweisen; du findest vielleicht in deinem ganzen Leben keine so gute Gelegenheit, mir zu zeigen, daß du kein undankbares Herz hast.
Steige getrost in diese Höhle hinab; du wirst sie mit unermeßlichen Reichtümern angefüllt finden; aber laß dich durch ihren Schimmer nicht verblenden, rühre nichts davon an und denke an nichts anderes, als dich eines eisernen Leuchters mit zwölf Armen zu bemächtigen, dessen ich benötige und um dessentwillen ich diese weite Reise hierher unternommen habe. Du wirst ihn neben der Tür eines offenen Kabinetts ohne Mühe gewahr werden. Geh, mein lieber Nardan, und hol ihn mir unverzüglich herauf»
Nardan versprach, allem, was ihm der Alte befohlen hatte, getreulich nachzuleben, und stieg herzhaft in die Höhle hinab. Als er etwa zwanzig Stufen zurück gelegt hatte, sah er sich in einem großen Saale, der auf dicken Pfeilern von Jaspis ruhte und zur Rechten und Linken in verschiedene offene Gemächer führte.
Das Ganze war von einer großen Menge hell brennender Lampen erleuchtet, bei deren Licht seine Augen von dem Funkeln und Flimmern eines unermeßlichen Schatzes von Edelsteinen und gemünztem Golde geblendet wurden, welche haufenweise in den Gemächern aufgeschüttet lagen. Dieser Anblick, wie wohl ihn der Derwisch darauf vorbereitet hatte, brachte die ganze Seele des jungen Menschen in Unordnung; er vergaß, was ihm sein Wohltäter so ernstlich befohlen hatte, und anstatt den verbotenen Schatz nicht anzurühren, hätte er lieber tausend Arme und Hände haben mögen, um alles auf einmal fort tragen zu können.
Aber während er alle seine Taschen und sogar die Falten seines Turbans mit den schönsten Diamanten, Rubinen, Smaragden und Saphiren vollstopfte, schloß sich mit einem donnernden Getöse die Öffnung der Höhle zu, und die Lampen loschen eine nach der anderen aus.
Mitten in der Angst, die ihn bei diesem fürchterlichen Zufall überfiel, behielt Nardan doch noch so viel Besonnenheit, daß er sich eilends des eisernen Leuchters bemächtigte. «Es muß», dachte er, «ein Talisman von außerordentlicher Tugend sein, sonst würde ihn gewiß der Derwisch nicht allen Reichtümern dieses großen Schatzes vorgezogen haben.»
Wie schrecklich auch seine Lage in diesem Augenblick war, so trieb ihn doch der Instinkt der Selbsterhaltung an, statt sich der Verzweiflung zu überlassen, mit dem Leuchter in der Hand zu versuchen, ob er nicht irgendeinen verborgenen Ausweg finden könne. Unter den bittersten Vorwürfen, die er sich selbst über seinen Ungehorsam gegen den Derwisch machte, und unter manchem angstvollen Stoßgebet zum Himmel entdeckte er, eben als die letzte Lampe verlosch, einen schmalen Gang, durch dessen Krümmungen er sich mit unsäglicher Mühe aus diesem unterirdischen Kerker emporarbeitete.
Es währte eine ziemliche Weile, bis er eine mit Dornen dicht überwachsene Öffnung gewahr wurde, durch die er, nicht ohne einen guten Teil seiner Kleidung und seiner Haut zurückzulassen, endlich wieder an das Tageslicht hervor gekrochen kam.
Mit der Freude eines Menschen, der soeben aus dem fürchterlichsten Traum erwacht und sich überzeugt, daß es nur ein Traum war, sah er sich nach dem Derwisch um, in der Absicht, ihm den Leuchter auszuhändigen und sich dadurch seiner Verbindlichkeiten auf eine Art zu entledigen, die ihn um so weniger Überwindung kostete, weil ein eiserner Leuchter, dessen allenfallsige talismanische Tugend er nicht kannte, ihm am Ende doch zu nichts helfen konnte.
Zu gleicher Zeit dachte er darauf, wie er sich mit guter Art von dem Alten los machen wollte, als dessen Unterstützung er nun nicht mehr bedurfte und der ihn nur verhindert hätte, seines in der Höhle erbeuteten Schatzes froh zu werden. Aber er hätte sich diese Mühe ersparen können: denn so weit seine Augen und seine Stimme reichten, war kein Derwisch zu sehen noch zu hören.
Und erst nachdem er lange hin und her gelaufen und sich ganz außer Atem geschrien hatte, wurde er gewahr, daß er sich in einer ganz unbekannten Gegend befinde und daß es nicht mehr die selbe sei, wo sich die unterirdische Höhle aufgetan hatte.
Ohne zu begreifen, wie es damit zuging, schlenderte er eine Zeit lang auf dem ersten besten Fußpfade fort, machte aber sehr große Augen, als er sich auf einmal vor der Haustür seiner Mutter sah, von welcher er wenigstens ein paar hundert Meilen weit entfernt zu sein geglaubt hatte.
Er erzählte ihr alles offenherzig, was sich mit ihm zugetragen, und setzte die Wahrheit seiner Geschichte außer allen Zweifel, in dem er ganze Hände voll Edelsteine von unermeßlichem Wert aus seinen Taschen hervor zog, über deren Anblick die gute Frau beinahe selbst zum Steine geworden wäre. Sie verstand sich zwar nicht sonderlich auf Juwelen; doch wußte sie so viel davon, daß der zehnte Teil dessen, was ihr in die Augen blitzte, mehr als hinlänglich war, ihr und ihrem Sohne auf ihre ganze Lebenszeit alle weitere Nahrungssorgen zu ersparen.
Sie glaubte aus allem, was ihr Nardan berichtete, schließen zu können, der heilige Mann habe sie für das Gute, so sie an ihm getan, auf eine großmütige Art belohnen und übrigens bloß eine Probe machen wollen, ob Nardan auch Mut und Besonnenheit genug haben werde, sich aus der Gefahr, womit er ihn sein Glück erkaufen ließ, herauszuziehen.
Beide überließen sich nun der Freude, auf einmal so reich zu sein; sie konnten gar nicht aufhören, ihre Augen an dem funkelnden Schatz zu weiden, und fingen schon an, über den Gebrauch, den sie davon machen wollten, uneinig zu werden, als alles plötzlich vor ihren Augen verschwand.
Mit einem lauten Schrei griffen sie beide in die Luft, als ob sie den verschwindenden Schatz zurück halten wollten; sie rieben sich die Augen, tappten hundertmal auf dem leeren Tisch herum, durchsuchten ebenso oft alle Winkel ihrer kleinen Stube; aber alles vergebens: der Schatz war weg und kam nicht wieder.
Nun fing Nardan wieder an, sich selbst wegen seines Ungehorsams und seiner Undankbarkeit Vorwürfe zu machen, zumal wie er sah, daß ihm der eiserne Leuchter geblieben war. «Es geschieht mir recht», rief er; «ich habe wieder verloren, was ich mir verstohlener Weise zueignen wollte, und das einzige, was ich dem Derwisch zu überliefern gesonnen war, ist mir geblieben.
Aber wo bleibt er selbst, und warum ist er nun auf einmal so gleichgültig gegen etwas, woran ihm diesen Morgen noch so viel gelegen war?» - «Er wird vermutlich wiederkommen», sagte die Mutter, «und wer weiß, ob er nicht so gütig ist, uns für den Leuchter, den du ihm doch mit Gefahr deines Lebens geholt hast, wenigstens so viel zu geben, daß wir uns über den Verlust der funkelnden Steine trösten können, die uns nicht bestimmt waren und uns am Ende doch nur zur Last gewesen wären.»
Als es Nacht wurde, steckte Nardan ohne eine andere Ursache, als weil es ihm just am bequemsten war, das einzige Licht, so sie anzuzünden pflegten, in den eisernen Leuchter. Sogleich erschien ein Derwisch, der, nachdem er sich eine ganze Stunde lang mit immer zunehmender Geschwindigkeit um den Leuchter herumgedreht hatte, ihnen einen Asper (ungefehr soviel als ein Kreuzer oder drei gute Pfennige) zuwarf und verschwand.
Man kann sich vorstellen, wie eine so seltsame Erscheinung auf solche Köpfe würken mußte; der erste aller Philosophen würde seinen Schlaf darüber verloren haben. Nardan und seine Mutter konnten die ganze Nacht kein Auge zutun, sie hörten nicht auf, über diese wunderbare Begebenheit miteinander zu plaudern, und Nardan geriet endlich auf den Einfall, was wohl daraus werden möchte, wenn in jeden Arm des Leuchters ein Licht gesteckt würde.
Der Versuch wurde nicht länger als bis zur nächsten Nacht aufgeschoben. Der Leuchter hatte, wie wir wissen, zwölf Arme. Nardan steckte in jeden ein Licht, und augenblicklich sprangen zwölf Derwische hervor, drehten sich eine Stunde lang um den Leuchter herum, warfen ihnen so dann jeder einen Asper zu und verschwanden.
Dieser Erfolg gefiel ihnen so gut, daß sie es in der nämlichen Nacht noch einmal mit zwölf neuen Lichten versuchten; aber die Derwische wollten nicht wiederkommen, und die Erfahrung belehrte sie eine lange Reihe von Nächten durch, daß der wunderbare Armleuchter seine Kraft in vierundzwanzig Stunden nur einmal äußerte.
Wie mäßig nun auch das Einkommen war, welches er ihnen auf diese Weise verschaffte, so war es doch hinlänglich, sie einige Tage lang sehr glücklich zu machen. Zwölf Asper des Tages war in der Tat mehr als alles, worauf sie in ihrer gewöhnlichen Lage jemals hatten rechnen können; es reichte zu ihren notwendigsten Bedürfnissen zu, und noch vor kurzem würden sie sich mit einer solchen Einnahme reich geachtet haben, aber der würkliche Besitz brachte gar bald andere Gedanken hervor.
Was sie hatten, däuchte ihnen wenig, und sie fühlten nun täglich lebhafter, wie viel ihnen mangelte. «Mit zwölf Asper des Tags ist man doch nur ein armer Teufel», sagte Nardan seufzend; «was ist das gegen die königlichen Schätze, die ich aus der unterirdischen Gruft mitbrachte?»
Diese Erinnerung und die Vergleichung seines gegenwärtigen Zustandes mit den glänzenden Aussichten, die ihm sein vermeinter Reichtum gegeben hatte, wurde für den unglücklichen jungen Menschen eine Quelle von Mißvergnügen, Unzufriedenheit und unaufhörlichen Träumereien und Projekten, wovon immer eines das andere zerstörte. Das letzte, woran er sich festhielt, war, eine Reise zu seinem alten Wohltäter zu tun und ihm mit dem Leuchter ein Geschenke zu machen.
In den ersten Tagen, nachdem er die talismanische Tugend des Leuchters entdeckt hatte, kam ihm nichts weniger in den Sinn, als sich seines dem Derwisch gegebenen Wortes zu entledigen; aber nun, da er die Erfüllung des selben als eine gute Spekulation betrachtete, die ihn bei seinem alten Freunde wieder in Gunst und vielleicht in den Besitz seines verschwundenen Schatzes setzen könnte, nun beschloß er auf einmal, ehrlich und sogar großmütig genug zu sein, um - wie das Sprichwort sagt - eine Wurst nach einer Speckseite zu werfen.
Seine Mutter wollte sich anfangs nicht dazu verstehen: «Ein Sperling in der Hand, mein Sohn», sagte sie, «ist besser als eine Goldammer auf dem Dache»; aber Nardan gab sich nicht zufrieden, bis er halb in Gutem, halb mit Unwillen ihre Einwilligung erhielt; und so machte er sich des nächsten Tages früh mit seinem eisernen Armleuchter auf den Weg.
Nach einigen Tagesreisen langte er auch glücklich zu Magrebi an und erkundigte sich sogleich im Tore nach dem Derwisch Abunadar, der in dieser kleinen Stadt so bekannt war, daß ihm jedes Kind seine Wohnung zeigen konnte.
Nardan hatte sich, nach dem Stande des Derwischen, eine kleine Hütte oder eine Zelle in einem armen Klösterchen vorgestellt; aber wie groß war sein Erstaunen, als man ihn vor die Pforte eines Palastes führte, den er eher für die Wohnung eines großen Fürsten angesehen hätte.
Die Menge der Bedienten, wovon der Vorhof und die Vorsäle wimmelten, der Reichtum ihrer Kleidung und die Pracht, die ihm von allen Seiten entgegen schimmerte, vermehrten sein Erstaunen mit jedem Augenblick. «Unmöglich», dachte er, «kann ich in dem rechten Hause sein; die Leute haben mich nicht verstanden oder wollen mich zum besten haben, daß sie mich, anstatt in die Hütte eines Derwisch, in den Palast ihres Königs führten.»
In dieser Verlegenheit blieb er eine gute Weile in einem Winkel stehen und war eben im Begriff, sich ein Herz zu nehmen und einen von den vornehmen Herren im Vorsaale zu fragen, wo er wäre, als ein Bedienter aus dem innern Teile des Hauses herauskam und zu ihm sagte: «Willkommen, Nardan! Der Derwisch, mein Gebieter, der dich schon lange erwartet, wird dich mit Vergnügen sehen.»
Mit diesen Worten führte ihn der Bediente durch verschiedene Zimmer in einen herrlichen Saal, wo er den Derwisch auf einem mit Gold und Perlen gestickten Sofa sitzen fand. Nardan, vom Anblick aller dieser unerwarteten Umstände geblendet, wollte sich vor ihm niederwerfen, wenn es Abunadar nicht verhindert hätte.
Aber als er sich, wie wohl mit vielem Stottern, in weitläufige Versicherungen seiner Treue und Dankbarkeit verwickelte und sich ein Verdienst daraus machen wollte, daß er eine so weite Reise unternommen habe, um seinem hohen Wohltäter den eisernen Leuchter zuzustellen, den er mit Gefahr seines Lebens für ihn erworben habe, fiel ihm der Alte in die Rede.
«Du bist ein undankbarer Mensch», sagte er; «bildest du dir ein, mir Schwarz für Weiß vormachen zu können? Ich lese in deiner Seele und weiß deine geheimsten Gedanken; nimmer mehr würdest du mir den Armleuchter gebracht haben, wenn du seine Tugend gekannt hättest.» -
«Ich kenne sie sehr wohl», rief Nardati, «und eben dies war die Ursache.» - «Du weißt nichts», unterbrach ihn der Derwisch abermal, «aber du sollst sie sogleich kennen lernen!»
Mit diesen Worten befahl er einem Sklaven, zwölf Wachslichter zu holen, und sobald sie wieder allein waren, steckte er sie in die zwölf Arme des Leuchters und zündete sie an. Sogleich erschienen die zwölf Derwische und begannen ihren gewöhnlichen Tanz. Als sie sich eine Weile herum gedreht hatten, gab Abunadar jedem einen Schlag mit einem Stocke, und augenblicklich verwandelten sie sich in zwölf Haufen Goldstücke, Diamanten und Rubinen.
«Siehst du nun», sagte Abunadar, «Wie man es anstellen muß, um sich den Besitz dieses wundervollen Leuchters zunutze zu machen? Übrigens muß ich dir sagen, daß ich mir diesen Talisman aus keinem anderen Grunde gewünscht habe, als weil er das Werk eines Weisen ist, den ich ehre, und weil es mir Vergnügen machen wird, ihn den Fremden, die mich besuchen, als eine Seltenheit zeigen zu können.
Um dich davon zu überzeugen, will ich dir den Schlüssel zu meinen Vorratskammern anvertrauen. Geh, schließe sie auf, sieh dich darin um und urteile dann selbst, ob ich reich genug bin, den Leuchter entbehren zu können!»
Nardan gehorchte. Er durchlief zwölf große Gewölbekammern, die so mannigfaltige und unermeßliche Reichtümer enthielten, daß er zweifelhaft war, ob er wache oder träume, und seinen eigenen Sinnen kaum glaubte, wie wohl er alles mit seinen Augen sah und mit seinen Händen betastete.
Er fand hier ganze Magazine voll reicher Gold- und Silberstoffe und aller Arten kostbarer Waren, die in Persien, Indien und China gearbeitet worden; gemünztes und ungemünztes Gold lag in pyramidenförmigen Haufen aufgeschüttet, und eine Menge großer Schränke von Sandelholze waren mit Perlen, Edelsteinen, kostbaren Gefäßen und allerlei künstlichen Werken angefüllt, woran der Reichtum der Materie gegen die Kunst der Arbeit für nichts zu achten war.
Dieser Anblick war mehr, als die Weisheit des armen Nardans aushalten konnte: Neid und Lüsternheit nach allem, was er sah, preßten ihm, mitten im Bewundern und Anstaunen, die herbesten Seufzer aus; und nun hätte er sich selbst prügeln mögen, daß er wider Wissen und Willen die Reichtümer des alten Derwisch durch einen Schatz vermehrt hatte, der allein mehr wert war als alles übrige zusammengenommen.
«Oh, wenn ich das hätte wissen können, was ich nun weiß! » rief er einmal über das andere aus; und da er es in der Kunst, die Bewegungen seiner Seele zu verbergen, trotz aller seiner Bemühung noch nicht weit gebracht hatte, so war es bei seiner Zurückkunft dem weisen Abunadar ein leichtes, alles zu sehen, was in seinem Inwendigen vorging.
Aber ohne sich etwas davon merken zu lassen, überhäufte er den jungen Menschen mit Freundlichkeit, behielt ihn etliche Tage in seinem Hause und befahl, daß ihm ebenso gut aufgewartet werden mußte als ihm selbst.
Endlich, als der Abend vor dem Tage, an welchem Nardan wieder abreisen wollte, gekommen war, sagte er zu ihm: «Mein Sohn Nardan, ich zweifle nicht, du werdest durch das, was dir begegnet ist, von deiner Undankbarkeit geheilt worden sein, und damit hättest du schon viel gewonnen; indessen bin ich dir eine Erkenntlichkeit dafür schuldig, daß du eine so weite Reise unternommen hast, um mir etwas zu bringen, wovon du wußtest, daß es mir Vergnügen machen würde.
Ich will dich nicht aufhalten. Reise glücklich! Du wirst morgen vor der Pforte ein Pferd gesattelt finden, das dich nach deiner Heimat tragen wird, und einen Sklaven mit zwei Kamelen, die du mit so viel Gold, als sie tragen können, und mit so viel Edelsteinen, als du dir selbst in meinen Schatzkammern aussuchen willst, beladen kannst.» Mit diesen Worten überreichte er ihm nochmals den Schlüssel zu seinem Schatze und wünschte ihm eine gute Nacht, ohne die Danksagungen, in die sich der entzückte Nardan ergoß, abzuwarten.
Es gehört vermutlich unter die unmöglichen Dinge, einem habsüchtigen Menschen so viel zu geben, bis er genug hat. Nardan brachte die ganze Nacht in einer Bewegung zu, die ihn keinen Augenblick ruhen ließ; nicht etwa vor Freuden über die Freigebigkeit des Derwisch, der ihn doch, über alles, was er billigerweise erwarten konnte, beschenkt und aus einem Burschen von zwölf Asper des Tags zu einem der reichsten Leute in der Welt gemacht hatte, sondern aus Verdruß, daß er den Leuchter zurücklassen sollte, der ihm, seitdem er das Geheimnis des selben wußte, mehr wert zu sein schien als zehn Königreiche mit allen ihren Schatzkammern.
«Er war mein», sagte er, in dem er sich mit der Faust vor die Stirne schlug; «niemals wäre Abunadar ohne mich zum Besitze des selben gekommen. Und warum ist nun er der Herr dieses Schatzes aller Schätze? Weil ich ein so guter Narr gewesen bin und ihn damit beschenkt habe. Es ist gar nicht schön von ihm, der ein alter Mann und ohnehin so reich ist, daß er sich auf Unkosten eines armen jungen Menschen, an dem er wie ein Vater zu handeln versprach, noch mehr und auf eine so ungeheure Art bereichern will. Meint er etwa, sich seiner Schuld durch das armselige Geschenk, womit ich mich abfinden lassen soll, zu entledigen?
Was sind zwei mit Gold und Edelsteinen beladene Kamele gegen den Leuchter, der mir täglich zwölfmal soviel verschaffen würde? Oh, wahrhaftig, Abunadar ist ein Geizhals, ein unersättlicher Mann und ein Undankbarer obendrein; er verdient nicht, der Besitzer eines solchen Schatzes zu sein; ich kann mich nicht an ihm versündigen, wenn ich ihm den Leuchter wieder nehme, dessen er gar nicht bedarf und wovon er keinen bessern Gebrauch machen will, als groß damit zu tun!»
Alle diese Betrachtungen, die der undankbare Nardan mit sich selbst anstellte, endigten sich mit dem festen Vorsatz, das Vertrauen, das der Derwisch durch Übergebung des Schlüssels in seine Redlichkeit setzte, sich zunutze zu machen und den Leuchter heimlich wieder mitzunehmen. «Ich nehme ja nur, was ohnehin von Rechts wegen mein ist», dachte er; «und sollte ich auch eine kleine Sünde daran tun, so kann ich ja mit dem zehnten Teile dessen, was ich in einer einzigen Nacht durch den Leuchter gewinne, eine herrliche Moschee bauen und ein großes Kloster für zweihundert Derwische stiften, die Tag und Nacht für mich beten und den Engel Arsail schon bewegen werden, diese Kleinigkeit in meinem Schuldregister auszustreichen.»
Mit diesen frommen Gedanken bewaffnet, begab sich Nardan, sobald der Tag angebrochen war, mit etlichen großen Säcken in die Schatzkammer des alten Derwisch, suchte sich aus, was ihm gefiel, und vergaß nicht, vor allen Dingen den Leuchter in einen der Säcke zu stecken, die er, der Erlaubnis seines Wohltäters zufolge, mit Gold und Edelsteinen bis obenan vollstopfte. Er belud damit die zwei Kamele, die vor der Pforte auf ihn warteten, stellte dem Derwisch seinen Schlüssel wieder zu, nahm unter tausend Danksagungen und Wünschen für sein langes Leben Abschied, trabte nun auf seinem schönen arabischen Pferde mit seinen zwei Kamelen vergnügt und wohlgemut davon und langte mit allen seinen Reichtümern glücklich wieder zu Bassora an.
Seine Mutter bezeugte große Freude über seine Zurückkunft, zumal da sie aus seinem Aufzug und den zwei beladenen Kamelen schloß, daß er von dem alten Derwisch wohl aufgenommen worden. Aber Nardan nahm sich kaum Zeit, sie zu grüßen, so groß war seine Ungeduld, sich von der Fortdauer der neu entdeckten Tugend seines Talismans zu überzeugen.
Er eilte, die Ladung seiner Kamele in eine Kammer mitten im Hause zu schaffen, schloß sich ein, zog den eisernen Leuchter aus dem Sacke hervor, steckte zwölf Lichter auf und zündete sie an, nachdem er sich zuvor mit einem tüchtigen Haselstock versehen hatte.
Sogleich erschienen die zwölf Derwische und begannen ihren alten Ringeltanz; Nardan gab jedem einen derben Schlag mit seinem Stecken, aber unglücklicherweise hatte er nicht in Acht genommen, daß der alte Abunadar diese Operation mit der linken Hand verrichtete.
Nardan bediente sich der rechten, mit der er alles zu tun gewohnt war, und die zwölf Derwische hatten kaum ihren Schlag empfangen, so zogen sie, statt sich in Haufen Gold und Edelsteine zu verwandeln, jeder einen entsetzlichen Knüttel unter seinem langen Rock hervor und schlugen damit unbarmherzig auf den armen Nardan zu, bis er zu Boden fiel.
Sie verschwanden hierauf, in dem sie alles, was er aus Abunadars Palaste mitgebracht - das Pferd, die Kamele samt ihrer Ladung, den Sklaven und den Leuchter -, mit sich nahmen, und ließen den unglücklichen Nardan halb tot auf der Erde liegen, um, solang er noch lebte, seine Habsucht, Undankbarkeit und - Unachtsamkeit zu beweinen.
Christoph Martin Wieland - Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen - Ein türkisches Märchen
DER GOLDENE ZWEIG ...
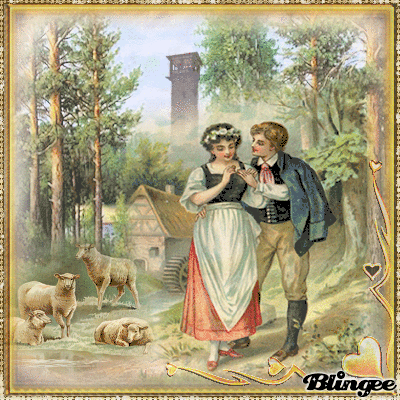
In einem Lande, das an das Reich der Feen grenzt, war einmal ein König, dessen finstere und übel launige Sinnesart alle Herzen von ihm abwendig machte. Er war gewalttätig, argwöhnisch und grausam, gab alle Tage neue Gesetze, damit er nur immer viel zu strafen hätte, ärgerte sich, wenn er die Leute fröhlich sah, und tat sein möglichstes, alle Freuden aus seinem Reiche zu verbannen.
Weil er immer die Stirne runzelte, so nannte man ihn den König Runzelwig. Dieser König hatte einen Sohn, der von allem diesem gerade das Gegenteil war. Er war offen, leutselig, großmütig und tapfer, hatte einen durchdringenden Verstand und fand großes Belieben an Künsten und Wissenschaften; kurz, er wäre der liebenswürdigste Prinz von der Welt gewesen, wenn die Ungestaltheit seines Körpers nicht alles wieder verdorben hätte. Von dieser Seite hätte ihm die Natur unmöglich ärger mitspielen können.
Er hatte krumme Beine, einen Höcker wie ein Kamel, schiefe Augen, einen Mund, der von einem Ohr zum anderen reichte, und eine Nase, die einem Schweinsrüssel ähnlich sah; mit einem Worte: er war ein zweiter Äsop, und man konnte ihn nicht ansehen, ohne sich zu ärgern, daß eine so schöne Seele in einem so häßlichen Gehäuse stecken sollte.
Der arme Prinz durfte es sich mit einer solchen Figur nicht verdrießen lassen, daß man ihn «Krummbuckel» nannte, wie wohl sein wahrer Name Alazin war; aber trotz seinem Spottnamen und seiner Gestalt hatte er die Gabe, sich beliebt zu machen; und sein Verstand und seine angenehme Gemütsart erwarben ihm gar bald die Herzen wieder, die sein erster Anblick zurück schreckte.
Der König Runzelwig, dem seine Vergrößerungsprojekte näher am Herzen lagen als das Glück seines Sohnes, warf seine Augen auf ein benachbartes Königreich, das er schon lange gern mit guter Art seinen Staaten einverleibt hätte; denn er war ein großer Liebhaber von dem, was man in der politischen Kunstsprache arrondieren nennt.
Ein Heiratstraktat zwischen seinem Sohne und der Erbin dieses Landes schien ihm hiezu das schicklichste Mittel zu sein; und er war, ohne den ersten zu fragen, schon so weit damit gekommen, daß nichts mehr daran fehlte als die Hochzeit. Die Partie schien ihm um so schicklicher, weil man schwerlich in allen fünf Weltteilen eine Prinzessin hätte finden können, welcher es weniger geziemt hätte, sich über die Mißgestalt des Prinzen Krummbuckels aufzuhalten, als diese.
Denn, um ihr Bild mit einem Zuge zu machen, sie war an Seele und Leib das wahre Seitenstück des Prinzen: ebenso abscheulich von außen und ebenso liebenswürdig von innen. Sie war so zusammen gewachsen, daß man, ohne etwas, das einem Kopfe (wie wohl eher von einem Affen als von einem Menschen) ähnlich sah, gar nicht gewußt hätte, was man aus ihrer Figur machen sollte. Dafür aber hatte sie Verstand wie ein Engel, und wenn es erlaubt gewesen wäre, sich die Augen verbinden zu lassen, wenn man Audienz bei ihr hatte oder in ihrer Gesellschaft war, so würde man ganz bezaubert von ihr weg gegangen sein.
Sobald der König Runzelwig das Bildnis der Prinzessin Marmotte (denn so nannte man sie, wie wohl ihr wahrer Name Klaremonde war) für seinen Sohn erhalten und es unter den Thronhimmel in seinem Audienzsaal aufgestellt hatte, ließ er den Prinzen rufen und sagte ihm in einem gebieterischen Tone, er müßte nun seine Augen daran gewöhnen, in diesem Bildnisse die Prinzessin zu sehen, die ihm zur Gemahlin bestimmt sei.
Krummbuckel warf einen Blick auf das Bildnis (welches der Maler gleich wohl, wie man sich vorstellen kann, so viel möglich zu verschönern gesucht hatte) und fand es so abscheulich, daß er sogleich die Augen davon weg wandte. «Sie gefällt dir also nicht?» sagte der König. «Nein, Herr Vater», antwortete der Prinz, «und ich will nicht hoffen, daß Sie mir zumuten werden, einen Wechselbalg zu heiraten.» -
«Wahrhaftig», rief Runzelwig, in dem er Stirne und Nase zugleich rümpfte, «dir steht es auch wohl an, eine Prinzessin, die ich selbst für dich ausgesucht habe, nicht schön genug zu finden, da du doch selbst ein kleines Scheusal bist, wovor man davonlaufen möchte!» -
«Eben darum will ich mich mit keinem anderen Scheusale vermählen», sagte Krummbuckel; «ich habe genug zu tun, mich selbst zu ertragen; wie ginge es mir erst, wenn ich noch eine solche Gesellschafterin hätte?» - «Ich verstehe», erwiderte der König in einem beleidigenden Tone; «du besorgst, eine neue Zucht Affen in die Welt zu setzen? Aber sei darum unbekümmert! Du sollst sie heiraten; gern oder ungern, gilt mir gleich; genug, daß ich es so haben will!» Der Prinz antwortete nichts, machte eine tiefe Verbeugung und begab sich weg.
Runzelwig, der nie den geringsten Widerstand hatte leiden können, ward über die Widerspenstigkeit seines Sohnes so aufgebracht, daß er ihn als bald in einen Turm einsperren ließ, der vor alters für rebellische Prinzen erbaut worden war. Weil sich seit ein paar hundert Jahren keine der gleichen gefunden hatten, so war alles darin in ziemlich schlechtem Stande.
Zimmer und Möbeln schienen von undenklichen Zeiten her zu sein. Der Prinz verlangte zu seiner Unterhaltung Bücher: man erlaubte ihm, deren so viel er wollte aus der Bibliothek des Turms zu nehmen; aber da er sie lesen wollte, fand er die Sprache so alt, daß er nichts davon verstehen konnte. Er ließ sie liegen, nahm sie über eine Weile wieder vor, und da er nicht nachließ, bis er endlich hier und da einen Sinn heraus brachte, so halfen sie ihm wenigstens die Zeit in seiner Einsamkeit zu kürzen.
Inzwischen hatte der König Runzelwig durch Abgesandte bei seinem Nachbar förmlich um Marmotten anhalten lassen. Das Bildnis des Prinzen Krummbuckel wurde in einer prächtigen Galerie aufgestellt und die Prinzessin herbei geholt, um ihren künftigen Gemahl in Augenschein zu nehmen. Da sie den feinsten Geschmack und eine nicht gemeine Zärtlichkeit der Empfindung besaß, so kann man sich einbilden, wie ihr dabei zumute ward.
Die arme Prinzessin fühlte auf den ersten Blick die ganze Grausamkeit ihres Schicksals; sie schlug die Augen nieder und weinte bitterlich. Der König, ihr Vater, ungehalten über ein solches Betragen, das nach seiner Vorstellungsart äußerst albern und unschicklich war, nahm einen Spiegel, hielt ihn seiner Tochter vor die Nase und sagte in einem unfreundlichen Tone:
«Da ist auch wohl noch viel zu weinen! Schau einmal hier her und bekenne, daß du dich nicht zu beklagen hast!» «Wenn es mir so not um einen Mann wäre, gnädiger Herr», antwortete sie, «so hätte ich vielleicht unrecht, so delikat zu sein; aber ich wünsche und verlange ja nichts anders, als mein Schicksal allein zu tragen, ohne den Verdruß, mich zu sehen, mit jemand teilen zu wollen. Man lasse mich doch die unglückliche Prinzessin Marmotte bleiben, so will ich wohl zufrieden sein oder mich doch wenigstens über nichts beklagen!»
Die arme Prinzessin hatte keine Mutter mehr, die sich ihrer hätte annehmen können; der König, ihr Vater, dessen Fehler die Weichherzigkeit nie gewesen war, blieb bei ihren Vorstellungen und Tränen ungerührt, und sie mußte mit den Gesandten des Königs Runzelwig abreisen.
Während nun alles dies vorging, hatte Prinz Krummbuckel schlimme Zeit in seinem Turm. Kein Mensch durfte ein Wort mit ihm reden; er hatte außer seinen alten Büchern nicht den geringsten Zeitvertreib; man gab ihm schlecht zu essen, und seine Hüter hatten Befehl, ihn durch alle Arten von übler Begegnung mürbe zu machen. König Runzelwig war ein Mann, der sich Gehorsam zu verschaffen wußte; aber gleich wohl hatten die Leute den Prinzen so lieb, daß die Befehle seines hartherzigen Vaters eben nicht aufs strengste vollzogen wurden.
Eines Tages, da er in einer großen Galerie auf und ab ging und den Gedanken über sein trauriges Schicksal nach hing, das ihn so häßlich und mißgeschaffen hatte geboren werden lassen und ihm nun mit aller Gewalt auch noch ein Scheusal von einer Gemahlin aufdringen wollte, warf er die Augen von ungefähr auf die Fensterscheiben, die er mit Gemälden von trefflicher Zeichnung und von den lebhaftesten Farben bemalt sah.
Weil er ein großer Liebhaber der Kunst war, so verweilte er sich mit desto mehr Vergnügen bei dieser Glasmalerei; aber was die darauf vorgestellten Historien bedeuten sollten, konnte er nicht heraus bringen. Seine Verwunderung nahm nicht wenig zu, da er auf einem dieser Gemälde einen Menschen erblickte, der ihm so ähnlich sah, als ob es sein Bildnis gewesen wäre. Dieser Mensch befand sich in dem obersten Geschosse des Turmes und suchte in der Mauer, wo er einen goldenen Kugelzieher fand, mit welchem er ein Kabinett aufschloß.
Es war noch viel anderes, das ihm sonderbar vorkam; aber das aller sonderbarste däuchte ihm doch, daß er beinahe auf allen Scheiben sein Bildnis antraf. Unter anderem sah er auch eine wunderschöne junge Dame von so feiner und geistreicher Gesichtsbildung, daß er sich gar nicht satt an ihr sehen konnte. Sein Herz schien ihm etwas bei diesem Bilde zu sagen, das es ihm noch nie gesagt hatte, und er verweilte sich so lange dabei, bis die Nacht einbrach und er nichts mehr unterscheiden konnte.
Wie er wieder in sein Zimmer zurück kam, nahm er das erste alte Manuskript vor, das ihm in die Hände fiel. Die Blätter waren von Pergament mit zierlich bemalten Rändern, und die Deckel, in die es geheftet war, von Gold, mit verschlungenen Namensbuchstaben von blauem Schmelz. Aber wie groß war sein Erstaunen, da er es aufschlug und die nämlichen Personen und Geschichten darin gemalt fand, die er auf den Fensterscheiben gesehen hatte!
Es war auch etwas darunter geschrieben; aber er konnte, mit aller Mühe, die er sich gab, nicht heraus bringen, was es bedeutete. Indem er so herumblätterte, fand er ein Blatt, worauf ein Chor Musikanten gemalt war, die sich sogleich zu beleben schienen und zu musizieren anfingen. Er kehrte das Blatt um und fand ein anderes, wo Ball gegeben wurde; die Damen waren alle sehr schön und prächtig geputzt, und alles fing zu tanzen und zu springen an.
Er kehrte noch ein Blatt um, und ihm kam der Geruch eines herrlichen Gastmahls entgegen: eine Menge kleiner Figuren saßen um eine lange Tafel und ließen es sich schmecken. Eine davon wandte sich an ihn. «Auf deine Gesundheit, Prinz Krummbuckel», sagte sie; «laß es dir angelegen sein, uns unsere Königin wiederzugeben; wenn du es tust, so wird es dein Schade nicht sein; tust du es nicht, so wird es dir übel bekommen.»
Bei diesen Worten überfiel den Prinzen, wie natürlich, eine solche Furcht, daß er das Buch aus der Hand fallen ließ und mit einem Schrei in Ohnmacht sank. Seine Hüter liefen herbei und ließen nicht nach, bis sie ihn wieder zu sich selbst brachten. Wie er wieder reden konnte, fragten sie ihn, was ihm denn begegnet wäre. Er antwortete ihnen:
Man gebe ihm so schlecht und wenig zu essen, daß er ganz schwach davon würde und tausend seltsame Einbildungen ihm durch den Kopf liefen; und so wäre es ihm vorgekommen, er sehe und höre in diesem Buche so erstaunliche Dinge, daß er vor Entsetzen die Besinnung verloren habe. Seine Hüter betrübten sich darüber und brachten ihm sogleich was Besseres zu essen, wie wohl es ihnen scharf verboten war. Als er gegessen hatte, nahm er das Buch in ihrer Gegenwart wieder vor, und da er von allem dem, was er vorhin gesehen zu haben glaubte, nichts mehr fand, so zweifelte er nicht mehr, daß es bloße Einbildungen gewesen sein müßten.
Am folgenden Tage ging er wieder in die Galerie und sah alles wieder, was er gestern auf den gemalten Fensterscheiben gesehen hatte; auch sah er die schöne junge Person wieder, die einen Abdruck ihres Bildes in seinem Herzen zurück gelassen hatte. Überall fand er sich selbst, in einer eben solchen Kleidung wie die seinige; und immer stieg diese Figur in das oberste Geschoß des Turmes und fand einen goldenen Kugelzieher in der Mauer.
«Dahinter muß ein sonderbares Geheimnis stecken», sprach er zu sich selbst; «diesmal habe ich gut gegessen; es kann keine Einbildung sein. Vielleicht finde ich im obersten Geschoß etwas, das mir Licht in der Sache gibt.» Er stieg hinauf, schlug mit einem Hammer gegen die Mauer, glaubte, eine Stelle, welche hohl schallte, zu bemerken, schlug ein Loch hinein und fand einen zierlich gearbeiteten goldenen Kugelzieher.
In dem er sich bedachte, wozu er ihn wohl gebrauchen könnte, ward er in einem Winkel eines alten Schrankes von schlechtem Holze gewahr. Er sah sich überall daran nach einem Schlosse um, aber vergebens; er konnte nirgends finden, wie er aufzumachen wäre. Endlich bemerkte er ein kleines Loch; und da ihm sogleich einfiel, daß ihm sein Kugelzieher hier dienlich sein könnte, so steckte er ihn hinein, zog hierauf mit aller Gewalt, und der Schrank ging auf.
Nun fand es sich, daß er von innen so schön war, als er von außen alt und schlecht geschienen hatte. Alle Schubladen waren von zierlich ausgestochenem Ambra oder Bergkristall; und wenn man eine herauszog, fand man oben, unten und zu beiden Seiten wieder kleinere, die mit Deckeln von Perlenmutter voneinander abgesondert und mit einer unendlichen Menge seltener und kostbarer Sachen angefüllt waren.
Der Prinz fand darin die schönsten Waffen von der Welt, reiche Kronen, schöne Bildnisse, herrliche Juwelen und andere Dinge, die ihm großes Vergnügen machten. Er zog immer heraus, ohne müde zu werden und ohne daß es ein Ende nehmen wollte. Endlich fand er auch einen kleinen Schlüssel, der aus einem einzigen Smaragd geschnitten war und womit er eine kleine Türe am Boden des Schrankes aufmachte.
Als sie aufging, wurde er von dem Glanz eines Karfunkels ganz verblendet, der den Deckel einer aus dem nämlichen kostbaren Steine gearbeiteten großen Schale ausmachte. Er hob ihn ab; aber wie wurde ihm zumute, als er sie mit Blut angefüllt und eine abgehauene Manneshand darin sah, die ein reich besetztes Bildnis zwischen den Fingern hielt!
Er fuhr bei diesem Anblick zusammen, seine Haare richteten sich empor, seine Knie schlugen gegeneinander, und er konnte sich kaum auf seinen Füßen halten. Er setzte sich auf den Boden und hielt die Schale immer noch mit weg gewandten Augen in der Hand, unschlüssig, ob er sie wieder hinlegen, wo er sie gefunden, oder was er mit ihr anfangen sollte. Daß irgendein großes Geheimnis unter allem dem, was ihm in diesem Turme begegnet war, verborgen sein müsse, schien ihm nicht zweifelhaft.
Die Worte, welche die kleine Figur in dem wundervollen Buche zu ihm gesprochen hatte, kamen ihm wieder in den Sinn. Sein Glück oder Unglück konnte davon abhangen, wie er sich in diesem Augenblicke benehmen würde; und diese außerordentlichen Dinge schienen ihn auch zu außerordentlicher Entschlossenheit aufzufordern.
Kurz, er rief allen seinen Mut zusammen, tat sich Gewalt an, die Augen auf diese in Blute badende Hand zu heften, und: «O du unglückliche Hand», sprach er, «wenn du mich durch irgendein Zeichen von deinem Schicksal benachrichtigen kannst und ich fähig bin, dir zu dienen, so sei gewiß, daß ich ein Herz habe, alles für dich zu tun.»
Bei diesen Worten schien die Hand sich auf einmal zu beleben, sie bewegte ihre Finger und sprach mit ihm durch Zeichen, die er, weil er diese Art von Sprache ehmals gelernt hatte und viele Fertigkeit darin besaß, so gut verstand, als ob jemand in seiner Muttersprache mit ihm gesprochen hätte. «Wisse», sagte sie ihm, «daß du alles für denjenigen tun kannst, von welchem die Wut eines Eifersüchtigen mich abgesondert hat.
Du siehst in diesem Bilde die Anbetenswürdige, die meines Unglücks Ursache ist. Gehe unverzüglich in die Galerie und gib acht auf die Stelle, die von den einfallenden Sonnenstrahlen am stärksten vergoldet wird; dort suche, und du wirst meinen Schatz finden.» Hier hörte die Hand auf zu reden, wie wohl der Prinz noch verschiedene Fragen an sie tat.
Endlich fragte er, wo er sie hin tun sollte, und sie antwortete ihm wieder durch Zeichen, er sollte sie wieder in den Schrank legen. Er gehorchte, schloß alles wieder zu, verbarg den Kugelzieher in der Mauer, wo er ihn gefunden hatte, und stieg, voll Ungeduld nach dem weitern Erfolg, wieder in die Galerie hinab.
Bei seinem Eintritt fingen die Fensterscheiben außerordentlich an zu zittern und zu klirren; er sah umher, um zu bemerken, wohin die Sonnenstrahlen fielen, und sah, daß es auf das Bildnis eines jungen Menschen war, dessen Schönheit und große Miene ihn ganz bezauberte. Er rückte dieses Gemälde weg und fand nichts als ein Getäfel von Ebenholz mit goldenen Leisten wie an den übrigen Wänden der Galerie; aber da er seine Fensterscheiben zu Rate zog, sah er, daß es sich aufschieben ließ.
Er schob es also auf und befand sich nun am Eingang eines Vorsaals von Porphyr, der mit schönen Bildsäulen geziert war und zu einer breiten Treppe aus Achat führte, deren Seitenlehnen mit Gold eingelegt waren. Er stieg hinauf, kam in einen Saal, wo die Wände mit Spiegel hellen Lasur überzogen waren, und aus diesem in eine lange Reihe herrlicher Zimmer, deren immer eines das andere an Pracht und Glanz und Schönheit der Malereien und Kostbarkeit der Möblierung übertraf, bis er sich endlich in einem Kabinett befand, wo er auf einem prächtigen Ruhebett eine Dame von außerordentlicher Schönheit erblickte, die zu schlafen schien.
In dem er so leise als möglich hinzu trat, glaubte er zu sehen, daß sie vollkommen dem Bildnis gleiche, welches ihm die abgehauene Hand gezeigt hatte. Ihr Schlummer schien unruhig zu sein, und ihr reizendes Gesicht schien etwas Schmachtendes und die Spuren eines langwierigen Grams zu verraten.
Der Prinz betrachtete sie noch mit großer Aufmerksamkeit und Rührung, in dem er, aus Furcht, sie aufzuwecken, den Atem zurück hielt, als sie im Schlafe zu sprechen anfing und in diese von Seufzern halb erstickte Worte ausbrach: «Denkst du, Treuloser, daß ich dich jemals lieben könne, nachdem du mich von meinem Alzindor entfernt hast? Du, der vor meinen Augen sich unterstand, eine so liebe Hand von einem Arme zu trennen, der dir ewig furchtbar bleiben muß!
Denkst du mir auf solche Art deine Ehrerbietung und Zärtlichkeit zu beweisen? O Alzindor, mein Geliebter! soll ich dich denn niemals wiedersehen?» Der Prinz sah mit äußerster Bewegung, wie die Tränen bei diesen Worten unter ihren geschloßenen Augenlidern hervor zu dringen suchten und über ihre blassen Wangen, wie die Tränen der Aurora an sinkenden Lilien, herunterrollten.
Er stund noch am Fuße des Ruhebettes, ungewiß, ob er sie wecken oder noch länger in einem so traurigen Schlummer lassen sollte, als ihn auf einmal eine liebliche Musik, wie von einer Menge zusammen stimmender Nachtigallen und Distelfinken, stutzen machte; und gleich darauf kam ein Adler von ungewöhnlicher Größe heran gezogen, der einen goldenen Zweig voller Kirschen förmigen Rubinen in seinen Klauen hielt.
Er heftete seine Augen unverwandt auf die schlafende Schöne, als ob er in die Sonne sähe; dann entfaltete er plötzlich seine Flügel, um mit einer brünstigen Sehnsucht, die in allen seinen Federn und Schwingen zitterte, auf sie zuzufliegen; aber eine unsichtbare Gewalt schien einen magischen Kreis um sie gezogen zu haben, den er nicht durch dringen konnte.
Jetzt betrachtete er den Prinzen mit großer Aufmerksamkeit, näherte sich ihm und gab ihm den goldenen Zweig. In diesem Augenblick erhoben die Vögel, die ihn begleiteten, ein melodisches, aber so durchdringendes Getöne, daß es in allen Gewölben des Palastes widerhallte.
Der Prinz, dessen Verstand nicht müßig war, alle diese Ereignisse miteinander zu vergleichen, schloß daraus, daß diese Dame ohne Zweifel bezaubert und die Ehre, sie zu befreien, ihm vorbehalten sei. Er näherte sich ihr, setzte ein Knie auf den Boden und berührte sie mit dem goldnen Zweige.
Als bald erwachte die schöne Dame, erblickte den entziehenden Adler und rief ihm mit ausgebreiteten Armen nach: «Bleibe, mein Geliebter, bleibe!» Aber der königliche Vogel stieß einen traurigen und durchdringenden Laut aus und flog mit allen seinen befiederten Sängern aus ihrem Gesichte.
Die Dame wandte sich sogleich gegen den Prinzen: «Verzeihe», sprach sie, «daß eine Empfindung, welche stärker ist als ich, der Dankbarkeit zuvor gekommen ist. Ich weiß, was ich dir schuldig bin: du hast mich an das Licht zurückgerufen, das ich seit zweihundert Jahren nicht gesehen habe; du allein konntest es; und der Zauberer, dessen verhaßte Liebe die Ursache alles meines Unglückes ist, vermochte nicht zu verhindern, was das Schicksal durch dich zu bewirken beschlossen hatte.
Es steht in meiner Macht, dir meine Dankbarkeit zu beweisen, und ich brenne vor Verlangen, sie auszuüben. Sage mir, was du wünschst: ich bin eine Fee und will meine ganze Macht anwenden, dich glücklich zu machen.» - «Große Frau», antwortete Krummbuckel, «wenn Eure Wissenschaft bis ins Innere der Herzen eindringen kann, so müßt Ihr sehen, daß ich mit allem, was ich mein Unglück nennen muß, weniger zu beklagen bin als jemand anders.» -
«Dies ist eine Wirkung deines guten Verstandes», versetzte die Fee; «aber gleichwohl kann ich den Gedanken nicht ertragen, deine Schuldnerin zu bleiben. Was wünschst du? Rede!» - «Ich wünsche, Euch den schönen Alzindor wiederzugeben», sagte der Prinz.
Die Fee heftete einen Blick auf ihn, worin Bewunderung und Freundschaft sich auf eine Art ausdrückten, die über alle Worte ist. «Ich fühle den Wert dieser Großmut», sprach sie; «aber was du wünschst, muß durch eine andere Person zustande gebracht werden, die dir nicht gleichgültig ist. Dies ist alles, was ich davon sagen kann. Laß mich also nicht länger vergebens bitten! Verlange etwas, das dich selbst angeht!» -
«Schöne Fee», antwortete der Prinz, «ihr seht, wie mich die Natur mißhandelt hat; zum Spotte nennt man mich Krummbuckel. Ich verlange kein Adonis zu sein, aber wenn ich nur nicht lächerlich aussähe.» - «Du verdienst mehr als dies», sagte die Fee, in dem sie ihn dreimal mit dem goldnen Zweige berührte; «gehe und sei so schön von außen, als du es von ihnen bist!»
Mit diesen Worten verschwand die Fee aus seinen Augen; der Palast und alle die Wunderdinge, die der Prinz darin gesehen hatte, verschwanden mit ihr, und er befand sich in einem dicken Wald, mehr als hundert Meilen von dem Turm, wo rein ihn der König Runzelwig hatte setzen lassen.
Während sich dieses mit dem Prinzen zutrug, gerieten seine Wächter in die entsetzlichste Verlegenheit, wie sie ihn um die Zeit des Abendessens nicht in seinem Zimmer fanden. Sie suchten ihn überall im ganzen Turm und fielen schier in Verzweiflung, da nirgends die geringste Spur, was aus ihm geworden sein könnte, zu sehen war.
Dem König die Wahrheit von der Sache zu hinterbringen, war keine Möglichkeit: er würde ihnen nicht geglaubt, sie für Mitschuldige an der Flucht seines Sohnes gehalten und sie dafür aufs grausamste bestraft haben. Nach langem Beratschlagen fanden sie keine bessere Auskunft, als den kleinsten aus ihrem Mittel mit einem großen Buckel auszustaffieren, ihn, als ob es der Prinz wäre, bei gezogenen Vorhängen in Krummbuckels Bette zu legen und dem Könige die Nachricht zu bringen, daß sein Sohn sehr unpäßlich sei.
Dieser Anschlag wurde ungesäumt ins Werk gesetzt. Runzelwig, der sich einbildete, der Prinz stelle sich nur krank, um ihn zu erweichen und seine Freiheit wiederzuerhalten, würdigte die Nachricht von seiner vorgegebenen Krankheit keiner Aufmerksamkeit; je gefährlicher sie die Sache machten, je gleichgültiger zeigte sich der König dabei, und dies war es eben, was die Hüter gehofft hatten.
Immittelst war die Prinzessin Marmotte, in eine Sänfte bestmöglich eingepackt, am Hofe Königs Runzelwigs glücklich angelangt. Der König ging ihr entgegen; aber wie man sie, nicht ohne viele Mühe, aus ihrer Maschine heraus gehoben hatte und er sie so verwachsen, krüppelhaft und mißgeschaffen fand, daß sie kaum einer menschlichen Figur ähnlich sah, konnte er sich nicht entbrechen, ihr ein Kompliment zu machen, das für eine Schwiegertochter und zum Willkomm eben nicht sehr verbindlich war.
«Ei, zum Henker, Prinzessin Marmotte», sagte er, «es steht Ihnen auch wohl an, meinen Krummbuckel zu verachten! Ich läugne es nicht, er ist ein häßliches Tier; aber, wahrhaftig, er ist es noch bei weitem nicht so sehr als Sie.» «Gnädiger Herr», antwortete die Prinzessin, «ich gefalle mir selbst nicht wohl genug, um über die Unhöflichkeiten, so Sie mir sagen, empfindlich zu werden; in dessen weiß ich nicht, ob Sie es für ein Mittel halten, mich desto eher zur Liebe Ihres reizenden Krummbuckels zu verführen.
Aber dieses erkläre ich hiermit, daß ich ihn, ungeachtet meiner armseligen Gestalt, nicht heiraten werde und lieber ewig die Prinzessin Marmotte als die Königin Krummbuckel heißen will.» Der König Runzelwig entrüstete sich nicht wenig über diese Antwort. «Sie irren sich stark», versetzte er, «wenn Sie damit los zu kommen denken. Da ich mich einmal in die Sache eingelassen habe, so muß sie zustande kommen, das können Sie versichert sein.
Ich mute Ihnen nicht zu, daß Sie meinen Sohn lieben sollen; aber, bei Gott! Sie sollen ihn heiraten, Prinzessin, und wenn Sie an ihm ersticken müßten! Ihr Herr Vater, der über Sie zu befehlen hat, hat mir sein Recht abgetreten, indem er Sie in meine Hände geliefert hat, und ich werde es geltend zu machen wissen.» -
«Es gibt Fälle», erwiderte die Prinzessin, «wo uns das Recht zu wählen zusteht. Man hat mich wider meinen Willen hierher gebracht, und ich werde Sie als meinen tödlichen Feind ansehen, wenn Sie Gewalt gegen mich gebrauchen.» Der König, den diese Rede noch mehr aufbrachte, entfernte sich, ohne ihr weiter zu antworten, ließ sie in die Zimmer des Palastes bringen, die er für sie hatte zurechte machen lassen, und gab ihr einige Hofdamen, die den Auftrag hatten, alles zu versuchen, um sie auf andere Gedanken zu bringen.
Diese Damen taten ihr möglichstes, sich bei ihr in Gunst zu setzen. Sie fanden bald Ursache genug, die Prinzessin wegen der Vorzüge ihres Geistes zu bewundern, und ihre ungemeine Leutseligkeit kam ihnen, in dem sie sich um ihr Vertrauen bewarben, auf halbem Wege entgegen; aber sobald sie die Saite, deren Ton der Prinzessin so zuwider war, berühren wollten, hörte ihre Gefälligkeit auf, und sie mußten alle Hoffnung aufgeben, über diesen Punkt etwas bei ihr auszurichten.
Bald hernach kamen die Hüter des Prinzen, welchen bange ward, daß der König ihre List und die Flucht seines Sohnes auf die eine oder andere Art entdecken möchte, und kündigten ihm in großer Bestürzung an, daß er gestorben sei. Runzelwig, so hartherzig er vorher gewesen war, kam bei dieser Nachricht schier von Sinnen; er heulte und tobte wechselweise; und weil er sonst niemand fand, über den er seine Wut mit einigem Schein rechtens hätte auslassen können, so mußte es die Prinzessin Marmotte entgelten, und er ließ sie unverzüglich statt des Verstorbenen in den Turm einsperren.
Die arme Prinzessin wußte nicht, wie ihr geschah, da sie sich auf einmal so übel behandelt sehen mußte; und da es ihr nicht an Herz fehlte, so sprach sie, wie es ihr zustand, gegen ein so ungebührliches Verfahren. Sie glaubte, man würde es dem König hinterbringen, aber es unterstand sich niemand, ihm davon zu sprechen.
Sie schrieb auch an ihren Vater, wie übel man mit ihr umginge, und lebte immer in der Hoffnung, daß er bald Mittel finden würde, sie wieder in Freiheit zu setzen. Aber sie hoffte vergebens: alle ihre Briefe wurden aufgefangen und dem König gebracht.
Inzwischen suchte sie sich ihre Gefangenschaft so gut sie konnte zu erleichtern und ging alle Tage in die Galerie, um die Gemälde auf den Fensterscheiben zu betrachten. Nichts kam ihr sonderbarer vor als die Menge außerordentlicher Dinge, die sie darauf vorgestellt sah, und daß sie überall sich selbst vorgestellt fand.
«Es muß», dachte sie, «seit ich in diesem Lande bin, die Maler eine seltsame Krankheit überfallen haben, daß sie so viel Vergnügen daran finden, mich zu malen, als ob es sonst keine lächerlichen Figuren gäbe als die meinige. Oder ist ihre Absicht nur, die Schönheit dieser reizenden jungen Schäferin durch den Kontrast noch mehr zu erheben?»
Gleich darauf fiel ihr auch ein junger Schäfer in die Augen, dessen ungemeine Schönheit sie nicht gleichgültig betrachtete. «Wie sehr ist man zu bedauern», sagte sie, «wenn man von der Natur so unmütterlich behandelt worden ist wie ich! Wie glücklich müssen sich diese schönen Leute fühlen!» Bei diesen Worten traten ihr die Tränen in die Augen.
Sie warf einen Blick in einen Spiegel und fand sich so abscheulich, daß sie sich nicht schnell genug wieder umdrehen konnte. In dem sah sie, nicht ohne Entsetzen, ein kleines altes Weibchen vor sich stehen, die noch weit häßlicher war als sie selbst; ihre Gestalt und schlechte Kleidung, welche völlig so waren, wie man in den Märchen die Feen zuweilen erscheinen sieht, und diese plötzliche Art, auf einmal da zu sein, brachte die Prinzessin sogleich auf die Vermutung, daß sie eines dieser wundervollen Wesen sein müsse.
«Prinzessin», sprach das alte Mütterchen zu ihr, «wie du mich hier siehst, bin ich mächtig genug, dir das zu geben, dessen Ermangelung dir so schmerzlich ist. Wähle zwischen Schönheit und Tugend! Willst du schön sein, du sollst es werden; aber sobald du schön bist, wirst du eitel, eingebildet, kokett und - noch etwas Ärgers werden; willst du bleiben, wie du bist, so wirst du gut, verständig und bescheiden bleiben. Wähle!»
«Da ist nichts zu wählen», antwortete Marmotte, indem sie der Fee in die Augen sah; «aber ist denn die Schönheit mit der Tugend so unverträglich?» - «Nicht schlechterdings», antwortete die Alte; «aber wenn sie nun gerade bei dir unverträglich sind?» - «Nun», rief die Prinzessin in entschloßenem Tone, «so will ich ewig häßlich bleiben!»
«Bedenke dich wohl, Marmotte», sprach die Fee; «ich will dir nichts Unangenehmes sagen, aber es ist doch was Seltsames, daß jemand lieber Grausen erwecken als gefallen wollen kann.» - «Lieber alles Unglück in der Welt», erwiderte die Prinzessin, «als einen Augenblick aufhören, edel und gut zu sein.» -
«Ich hatte bloß für dich meinen weiß und gelben Muff mitgebracht», fuhr die Alte fort; «hättest du am gelben Ende hinein geblasen, so würdest du auf der Stelle so schön geworden sein wie diese Schäferin, die du so sehr bewundert hast, und du würdest den schönen Hirten, dessen Bild deine Augen mehr als einmal auf sich zog, zum Liebhaber bekommen haben.
Hauchst du hingegen am weißen Ende hinein, so wirst du bleiben, wie du bist, aber immer fester auf dem Wege der Tugend fortschreiten, den du schon so mutig betreten hast.» - «O mein liebes Mütterchen», rief die Prinzessin, «versagt mir diese Wohltat nicht; sie wird hinlänglich sein, um mich über die Verachtung der Welt hinwegsetzen zu können.» Die Fee gab ihr den Muff, und Marmotte vergriff sich nicht: sie hauchte in das weiße Ende, und die Fee nahm ihren Muff wieder und verschwand.
Wir müssen aufrichtig sein: es gab Augenblicke, wo die gute Prinzessin - nicht ihre Wahl bereute, aber wo sie doch sehr lebhaft den Wert des Opfers fühlte, das sie der Tugend gebracht hatte. In dessen fehlte es ihr, auch in solchen Augenblicken, nicht an guten Gedanken, die sie nicht nur bald wieder mit sich selbst zufrieden machten, sondern ihre Seele noch mit einem Licht und einem Wonnegefühl erfüllten, das nur das innige Bewußtsein unseres inneren Wertes und daß wir gedacht und gehandelt haben, wie wir sollen, gewähren kann.
Inzwischen hoffte sie noch immer, daß ihre Briefe an ihren Vater nicht ohne Wirkung bleiben und daß er, wenn Runzelwig in Güte nicht zu bewegen wäre, an der Spitze eines Kriegsheeres kommen würde, seine einzige Tochter zu befreien. Sie erwartete diesen Augenblick mit Schmerzen und hätte gar zu gern in das oberste Geschoß des Turmes hinauf steigen mögen; aber mit einer Figur wie die ihrige schien es eine völlige Unmöglichkeit.
Doch was ist dem Entschloßenen und Geduldigen unmöglich? Genug, sie versuchte es, und wie wohl sie mehr als zwanzigmal absetzen und ausruhen mußte und beinahe einen halben Tag darüber zubrachte, so erkroch sie doch endlich mit unsäglicher Mühe die oberste Stufe. Ihr erstes war, durchs Fenster ins Feld hinauszusehen.
Da sie aber immer nichts kommen sah, entfernte sie sich vom Fenster, um ein wenig auszuruhen; und indem sie sich an die Mauer anlehnte, welche Prinz Krummbuckel aufgerissen und ziemlich schlecht wieder zugeflickt hatte, ging ein Stückchen Pflaster los, und der goldene Kugelzieher fiel klingelnd auf den Boden vor sie hin.
Sie hob ihn auf und bedachte sich, wozu er wohl dienen könnte; und da sie an dem Schranke kein Schloß, sondern nur eine Öffnung sah, in welche der Kugelzieher paßte, so fiel ihr sogleich ein, zu versuchen, ob sich der Schrank nicht mit Hilfe des selben öffnen lassen würde. Es gelang ihr auch, wie wohl mit vieler Mühe, und sie war nicht weniger als der Prinz über alle die schönen und seltenen Sachen entzückt, womit die unzähligen Schubladen angefüllt waren.
Endlich fand sie auch das goldene Türchen, die Schale von Karfunkel und die im Blut schwimmende Hand. Sie fuhr über ihrem Anblick zusammen und würde das Gefäß vor Entsetzen haben fallen lassen, wenn eine unsichtbare Gewalt sie nicht gehalten hätte. In dem hörte sie eine liebliche Stimme, die zu ihr sagte: «Fasse Mut, Prinzessin, deine Glückseligkeit hängt an diesem Abenteuer.» -
«Ach Gott!» sprach sie zitternd, «was vermag ich zu tun?» - «Du mußt», sprach die Stimme, «diese Hand mit dir in dein Zimmer nehmen und sie unter deinem Hauptpfühle verbergen; und wenn du einen Adler an dein Fenster kommen siehst, so öffne ihm das Fenster und gib sie ihm.»
Es sind wohl wenig Dinge, vor denen die weibliche Natur mit solchem Grauen zurück schaudert wie vor dem, was die Stimme der Prinzessin zumutete. Das Herz kehrte sich ihr bei dem bloßen Gedanken im Leibe um. Aber auf der anderen Seite war es augenscheinlich, daß höhere Mächte hier im Spiele waren, und sie fühlte sich aufgefordert, in einer so außerordentlichen Gelegenheit auch außerordentlichen Mut zu äußern, denn ohne Zweifel hing irgendeine große Entwicklung von ihrer Entschließung in diesem Augenblicke ab.
Sie nahm also alle ihre Herzhaftigkeit zusammen, ergriff schaudernd die abgehauene Hand, die einem Körper von großer Schönheit und Stärke angehört zu haben schien, und erstaunte nicht wenig, sie, sobald sie aus dem Gefäße heraus genommen war, so rein zu sehen, als ob sie aus dem weißesten Wachse gebildet wäre.
Sie hüllte sie in ein reines Tuch, das sie bei sich hatte, und verbarg sie in ihrem Rocke, schob hierauf alle Schubladen wieder hinein, schloß den Schrank zu und verbarg den goldenen Kugelzieher, so gut sie konnte, wo sie ihn gefunden hatte. Bald darauf kamen ihre Aufwärterinnen, die über ihr ungewöhnliches Verschwinden in große Unruhe geraten waren und sie überall im ganzen Turme gesucht hatten, bis es ihnen endlich einfiel, sie unter dem Dache zu suchen.
Sie konnten nicht begreifen, wie Marmotte ohne ein Wunderwerk habe herauf kommen können, und trugen sie wieder herunter, ohne daß sie ihnen etwas von den außerordentlichen Dingen, die ihr begegnet waren, verraten hätte.
Es vergingen zwei Tage, ohne daß sich etwas Ungewöhnliches sehen ließ; aber in der dritten Nacht hörte sie ein Geräusche an ihren Fenstern. Sie zog ihren Vorhang und erblickte beim Mondschein einen großen Adler, der mit seinen Flügeln an das Fenster schlug. Sie kroch, so gut sie konnte, aus ihrem Bette heraus, rutschte ans Fenster und öffnete es, um den Adler hereinzulassen, der durch das Getöse, so er mit seinen Flügeln machte, ihr seine Freude und Dankbarkeit bezeugen zu wollen schien.
Sie säumte nicht, ihm die Hand dar zu reichen. Er nahm sie in seine Klauen und verschwand; und wenig Augenblicke darauf sah sie den schönsten Jüngling vor sich stehen, den sie jemals gesehen hatte. Er war von mehr als gewöhnlicher Größe; seine Gesichtsbildung hatte etwas unbeschreiblich Edles und Anmutsvolles; ein reiches Diadem funkelte um seine Stirne, und in seinem ganzen Ansehen war etwas Blendendes, das ein Wesen von höherer Ordnung anzukünden schien.
«Prinzessin», sagte er, «eine höhere Macht waltet über mein Schicksal wie über das deinige; sie bediente sich deiner, um mich in meinen natürlichen Stand wiederherzustellen; du hast ein Recht an meine wärmste Dankbarkeit.» Bei diesen Worten berührte er die Prinzessin mit dem Bilde der Fee, das er in der Hand hatte, und verschwand.
In dem nehmlichen Augenblicke sank die Prinzessin wie in eine angenehme Ohnmacht. Sie kam aber bald wieder zu sich selbst und war nicht wenig erstaunt, sich, ohne zu wissen, wie es zugegangen, am Ufer eines Bachs, der von hohen Gebüschen überschattet war, in der anmutigsten Gegend von der Welt zu finden.
Aber wie groß war erst ihr Erstaunen, da sie die Veränderung, welche während ihrer kurzen Ohnmacht mit ihrer Person vorgegangen, inne wurde und bei einem Blick in das ruhige Spiegel helle Wasser erkannte, daß sie eben diese Schäferin war, deren Bild auf den Fensterscheiben der Galerie ihr so bezaubernd geschienen hatte.
Sie mußte aller ihrer Vernunft aufbieten, und kaum reichte sie zu, um sich zu überreden, daß ihr Selbst noch das nämliche sei. Bald besorgte sie, den Verstand verloren zu haben, bald, daß alles nur Täuschung sei und daß sie unversehens wieder in die vorige Marmotte zusammen sinken würde. In der Tat hätte die Veränderung, wiewohl sie nur das Äußerliche betraf, nicht wohl größer sein können, denn aus der elendsten und grauenhaftesten Menschenfigur, die jemals gewesen war, sah sie sich in die schönste liebreizendste Person verwandelt.
Ihr Wuchs hätte zu einer Diane oder Aurore und ihre Gesichtsbildung und jugendliche Blüte zu einer Hebe oder Psyche das Modell abgeben können. Sie trug (wie die Schäferin, von welcher sie nun das Original war) einen weißen, mit den feinsten Spitzen garnierten Anzug; ein Gürtel von kleinen Rosen und Jasminen, die feinste Schmelzarbeit hielt ihr Gewand um die schmalen Weichen zusammen.
Ihre schönen halb aufgebundenen Haare waren mit frischen Blumen durchwunden, und zierliche Halbstiefel von weißem Leder bekleideten den schönsten Fuß, der jemals den Samt eines kurz bewachsenen Grasbodens betreten hatte.
Sie fand einen vergoldeten Schäferstab und einen mit Bändern und Blumen gezierten Hut neben sich im Grase, nebst einer Herde Schafe, die längs dem Ufer weideten und auf ihre Stimme ebenso folgsam hörten als der neben ihnen wachende Hund, der sie zu kennen schien und sie liebkoste.
Welch eine wundervolle Verwandlung! und wie viele Betrachtungen hatte sie darüber anzustellen! Vorher war sie das häßlichste aller Geschöpfe gewesen, aber eine Prinzessin; jetzt das schönste Mädchen, das die Sonne jemals beschienen hatte, aber dafür auch nichts als eine Schäferin. Hatte sie beim Tausche gewonnen oder verloren?
«Gewonnen, ohne allen Zweifel», wenigstens sagte sie es sich selbst mit der lebhaftesten Freude; aber es gab doch auch Augenblicke, wo ihr der Verlust ihres hohen Rangs nicht ganz gleichgültig war. Da die Sonne noch sehr hoch stand und nur schwache Lüftchen, die unter dem Laubgewölbe, wo sie sich befand, zu wohnen schienen, die Hitze des Tages milderten, so schlummerte sie unter diesen Betrachtungen unvermerkt ein - und wir benutzen diese Gelegenheit, um zu sehen, was in dessen aus dem Prinzen Alazin (wie wir ihn künftig nennen wollen) geworden ist.
Wir verließen ihn, beim Verschwinden der Fee und des Zauberpalastes, wo ihm so wunderbare Dinge begegnet waren, hundert Meilen von seinem Turm, in einem ihm unbekannten Wald, wo er, so bald er zu sich selbst kommen konnte, über die Verwandlung, die mit ihm vorgegangen war, nicht weniger als die Prinzessin Marmotte über die ihrige, in die angenehmste Bestürzung geriet.
Die Veränderung, welche das Berühren mit dem goldnen Zweig in seiner Figur hervor gebracht hatte, war so groß, daß Alazin den vormaligen Krummbuckel gar nicht mehr erkannte. Es brauchte einige Zeit, bis er das fortdauernde Gefühl, daß er die nämliche Person sei, die er kaum gewesen war, mit seiner jetzigen Gestalt, die ein ganz neues Wesen aus ihm zu machen schien, in den gehörigen Einklang stimmen konnte.
Er kam inzwischen unvermerkt an einen von hohen Erlen beschatteten Teich, wo sein Erstaunen aufs höchste stieg, in dem er die Entdeckung machte, daß er Zug um Zug dem schönen Schäfer glich, den er so vielmals, nicht ohne eine schmerzliche Vergleichung mit seiner damaligen Mißgestalt, auf den bemalten Fensterscheiben betrachtet hatte.
Die Ähnlichkeit erstreckte sich bis auf die Kleidung; auch fand sich, damit ihm nichts zu einem Schäfer nach der Weise der Asträa oder der Hirten des Geßnerischen Arkadiens abginge, unvermerkt eine Herde schöner Schafe bei ihm ein, die ihn für ihren Herrn und Führer erkannte.
Sogar für eine Hütte hatte die dankbare Fee gesorgt: Alazin fand sie, mit allem Zubehör einer schäferischen Haushaltung, am Ende des Waldes in einem anmutigen Tal, durch welches sich ein Bach schlängelte, an dessen Ufern zu beiden Seiten hier und da verschiedene Schäferwohnungen zwischen fruchtbaren Bäumen oder aus halb verdeckenden Gebüschen hervorragten.
Das süße Gefühl der Freiheit und das Vergnügen, eines verhaßten Namens mit einer noch verhaßteren Gestalt los zu sein, ließen ihn eine gute Weile nicht daran denken, daß er mit dieser Figur und diesem Rahmen auch sein Königreich verloren hatte und daß der Sohn und Erbe eines Königs sich nun gefallen lassen mußte, seinem Szepter nichts als eine Herde Schafe und einen getreuen Hylas untertan zu sehen.
Aber endlich dachte er doch daran; und seine Betrachtungen darüber würden vielleicht nicht die angenehmsten gewesen sein, wenn sein guter Verstand ihn nicht fähig gemacht hätte, sich seinem Schicksale mit guter Art zu unterwerfen; zumal, da er aus allem, was ihm begegnet war, augenscheinlich erkennen mußte, daß es von einer wohltätigen Macht geleitet werde.
Alazin hatte schon einige Zeit in diesem Hirtenlande gelebt, wo ihm seine Gestalt und sein gefälliges Betragen in wenig Tagen die Herzen der rohen, aber gutartigen Einwohner gewonnen hatte, als ihn ein geheimer Zug, den er für Zufall hielt, an den Ort führte, wo die schöne Schäferin schlummerte.
Kaum war er nahe genug hinzu getreten, um sie genau zu betrachten, Himmel! wie wurde ihm zumute, da er das Original eben dieser reizenden Schäferin in ihr erkannte, die er auf den Fensterscheiben der Galerie so vielmals abgebildet gefunden und niemals ohne die zärtlichste Regung hatte ansehen können!
Er würde, sofern er sich nicht gleich an einen Baum angehalten hätte, von der heftigen Wirkung, die diese Überraschung auf sein ganzes Wesen machte, der Länge nach hingestürzt sein. Aber er erholte sich bald wieder, um sie aufs neue anzuschauen, oder vielmehr, das unbeschreibliche Vergnügen, das er beim Anschauen eines so vollkommenen Gegenstandes - einer Schönheit, die er bloß für den glücklichen Traum eines gefühlvollen Künstlers gehalten hätte - empfand, war die beste Stärkung seiner vom ersten Anblick betäubten Sinnen.
Er ließ sich vor ihr auf die Knie nieder; sein Auge, sein Herz, sein ganzes Wesen schien in eine einzige von ihr ausgefüllte Empfindung zusammen gezogen, und er würde bis in die Nacht in diesem wonnevollen Anschauen unverwandt beharrt haben, wenn sie nicht von selbst erwacht wäre.
Klaremonde (denn wir werden ihr nun, wie billig, ihren eigenen Namen wiedergeben) hatte kaum die Augen aufgeschlagen, als sie in dem schönen Schäfer, den sie in der ehrerbietigsten Stellung vor sich knien sah, eben denjenigen erkannte, dessen Bild ihr in der Galerie öfters vorgekommen war.
Dieser Umstand, der ihn gewissermaßen zu einer alten Bekanntschaft machte, milderte bei ihr die Verlegenheit, in welcher sie sich befunden hätte, wenn er ihr ganz fremde gewesen wäre. Ihre Augen waren schon mit seiner Schönheit bekannt, und ihr Herz, an eine gewisse zärtliche Regung bei seinem Anblick ebenso gewöhnt, war bereits zu sehr dazu gestimmt, gut von ihm zu denken, als daß es ihr hätte einfallen können, einiges Mißtrauen in ihn zu setzen.
Zwei so vollkommene Personen, wie sie beide waren und deren Inneres so schön und rein zusammen gestimmt ist, können einander nicht ansehen, ohne daß jedes das andere seiner würdig finde; sie verstehen einander in der ersten Minute besser als gemeine Menschen nach einem jahrelangen Umgang.
Das erste, was sie für einander fühlen, ist Wohlwollen, und dieses Wohlwollen ist Freundschaft, und diese Freundschaft ist, bei einem jungen Schäfer und einer jungen Schäferin, Liebe. Hierzu kommt noch, daß Klaremonde, mit ihrer Verwandlung aus einem mißgeschaffenen Murmeltiere in das schönste aller Mädchen, zugleich aus einer Prinzessin in eine Schäferin verwandelt worden war.
Zwar nicht so, daß sie die Erinnerung an ihre Geburt und an die Vorrechte ihres vorigen Standes ganz darüber verloren hätte; aber bei einer Person von ihrem Geiste und Herzen mußten diese Vorrechte in ihrem neuen Stande viel von ihrem anscheinenden Werte verlieren. Der Rang einer Prinzessin hat seine Ungemächlichkeiten, der niedrige Stand einer Schäferin seine Vorteile.
Überdies, was für Ursache hätte die Schäferin Klaremonde haben können, ihren ehemaligen Stand noch immer geltend machen zu wollen? Was für Hoffnung konnte sie sich machen, sofern sie auch den Weg in die Staaten ihres Vaters gefunden hätte, jemals für die Prinzessin Marmotte erkannt zu werden? Sie hätte die Geschichte ihrer Umgestaltung noch so lebhaft erzählen mögen, wer würde sie geglaubt haben?
Mit dem schönen Alazin hatte es vollkommen die nehmliche Bewandtnis. Wir können also versichern, daß alles, was die Geschichtschreiberin der Begebenheiten dieses wundervollen Paares, die Gräfin d'Aulnoy, von dem strengen Betragen der Prinzessin Brillante (wie sie ihre verwandelte Marmotte nennen läßt) gegen den schönen Schäfer erzählt, aus verfälschten Urkunden gezogen sein muß; daß der Schäfer und die Schäferin kein Wort von allem, was diese Dame sie sprechen läßt, miteinander gesprochen haben; und daß beide viel zuviel Verstand und Geschmack besaßen, um die Verse gemacht zu haben, die sie ihnen in den Mund legt.
Da wir berechtigt sind, unsere Nachrichten für die zuverlässigeren zu halten, so fahren wir fort, ihnen in unserer Erzählung zu folgen, und sagen demnach, daß Klaremonde und Alazin, bei aller der Verwunderung, womit sie einander in der ersten Überraschung ansahen, ein Zutrauen gegen einander zeigten, welches uns zu beweisen scheint, daß ihre Herzen schon einverstanden waren, ehe sie Zeit hatten, sich gegen einander zu erklären.
«Ist es möglich?» rief Alazin, «Sie sind es selbst?» - «Eben diese Frage schwebt auch auf meinen Lippen», sagte Klaremonde. «Es sind nur wenige Wochen, seit ich Ihr Bild auf den gemalten Glasscheiben eines alten Turmes gesehen habe, worin ich gefangen gehalten wurde», sagte der schöne Schäfer.
«Es sind nur wenige Stunden, seit mir eben das mit dem Ihrigen geschehen ist», sprach die schöne Schäferin. «Meine Geschichte ist seltsam: Sie würden sie unglaublich finden, wenn ich sie Ihnen erzählte», sagte der Schäfer. «Eben das würde Ihnen mit der meinigen begegnen», sagte die Schäferin.
«Ich wurde von meinem Vater in einen alten Turm gesperrt, weil ich eine gewisse Prinzessin nicht heiraten wollte, die selbst in ihrem Bildnisse, wie wohl ihr der Maler unfehlbar geschmeichelt hatte, so häßlich aussah, daß es keine Möglichkeit war, sie zu heiraten.» -
«Und ich wurde von meinem Schwiegervater eingesperrt, weil ich nicht die Gemahlin seines Sohnes werden wollte, den ich zwar selbst nie gesehen habe, aber vor dessen bloßem Bildnis das Herz sich mir im Leibe umkehrte.» «Ich war damals nicht, was ich jetzt bin», fuhr der Schäfer fort; «und wie häßlich auch derjenige sein mochte, den man Ihnen zum Gemahl aufdringen wollte, so konnte er es doch gewiß nicht mehr sein als ich.» -
«Ich war damals auch nicht, was ich jetzt scheinen mag», versetzte die Schäferin; «aufrichtig zu reden: meine Figur war so krüppelhaft, daß mich niemand ohne Jammer ansehen konnte, und doch so lächerlich dabei, daß man sich in die Lippen beißen mußte, um mir nicht ins Gesicht zu lachen.» -
«Man nannte mich aus Verspottung Krummbuckel», sagte der Schäfer. «Und mich aus eben der Ursache Marmotte», sagte die Schäferin. «Himmel!» riefen beide zu gleicher Zeit, «so sind wir ja eben die, die man zwingen wollte, einander zu heiraten! Wie unglücklich», fuhr der schöne Schäfer fort, «daß die wundertätigen Mächte, deren Werk unsere Verwandlung ist, es nicht einige Wochen früher vorgenommen haben!» -
«Oder daß sie uns nicht ließen, wo sie uns fanden!» setzte die schöne Schäferin hinzu. «Doch nein, nicht unglücklich», sagte jener, «wenn meine liebenswürdige Schäferin von den Empfindungen gerührt werden könnte, die mir ihr Bildnis beim ersten Anblick einflößte.» Klaremonde errötete und schlug die Augen nieder, und Alazin war so bescheiden, auf keine deutlichere Antwort zu dringen.
Sie erzählten einander darauf ihre Begebenheiten mit allen Umständen; und wie wohl der schöne Schäfer ein zu zartes Gefühl hatte, um die schon einmal berührte Saite so bald wieder anzuschlagen, so schienen doch beide in dem Gedanken, was sie einander sein könnten, überflüssige Ursache zu finden, mit ihrem Schicksale zufrieden zu sein.
Wie es gegen Abend ging, ersuchte Klaremonde ihren neuen Freund, der in dieser Gegend schon wohl bekannt war, sie zu einer anständigen Person ihres Geschlechtes zu führen, unter deren Aufsicht sie leben könnte, da es für eine junge Person in ihrer Lage doch nicht wohl schicklich wäre, unter einem unbekannten Volke ganz allein zu wohnen.
Er führte sie in eine der geräumigsten und reinlichsten Hütten dieses Tales, wo sie, auf seine Empfehlung (wie wohl ihr bloßes Ansehen schon Empfehlung genug war), von einem guten alten Mütterchen aufs freundlichste empfangen und bewirtet wurde. Sie brauchte nur sehr wenig Zeit, um das ganze Herz der Alten zu gewinnen, die sich nicht wenig darauf zu gut tat, eine so liebenswürdige Pflegetochter zu bekommen.
Daß der Prinz-Schäfer und die Prinzessin-Schäferin von dieser Zeit an, die Nacht ausgenommen, sich selten lange voneinander trennten, ist leicht zu erraten. Verschiedene Wochen kamen ihnen auf diese Weise wie einzelne Tage vorüber. Aber da sie einander auch alle Tage lieber wurden, so gerieten sie zuletzt ganz natürlich auf die Frage, was das Schicksal wohl über sie beschlossen haben möchte, und diese Frage schien sich aus dem Wege, den es mit ihnen gegangen, von selbst auf eine sehr entscheidende Art zu beantworten.
Der Rückweg in ihren angeborenen Stand schien ihnen auf immer abgeschnitten zu sein, und ihr neuer, niedriger, der Welt verborgener, aber glücklicher Zustand bekam alle Tage neuen Reiz für sie. Ohne Zweifel hatte das Schicksal ihre Vereinigung beschlossen, die in ihren vormaligen Umständen unmöglich gewesen war oder, wenn sie endlich auch erzwungen worden wäre, ihr beiderseitiges Elend nur vergrößert hätte.
Kurz, sie mochten sich als Königskinder oder als Hirten betrachten, so stand dem, was nun der einzige Wunsch ihrer Herzen war, nichts im Wege. Sie vereinigten sich also, und der Tag ihrer Vermählung war ein Fest für dieses ganze Hirtenland.
Alazin hatte sich, da er noch der Prinz Krummbuckel hieß, mit besonderen Fleiße auf verschiedene Teile der Naturwissenschaft gelegt. In seinem Hirtenstande machte er die Zucht der eßbaren und heilsamen Pflanzen und der fruchtbaren Bäume zu seiner Hauptbeschäftigung, und er wurde dem Hirtenvolke dadurch auf mehr als eine Art nützlich.
Die schöne Klaremonde lehrte die jungen Schäferinnen die Pflege der Seidenwürmer und die Zubereitung ihres kostbaren Gespinstes. Beide trugen nicht wenig dazu bei, das Leben dieser gutartigen Naturmenschen zu verschönern und ihren Wohlstand zu vermehren, ohne die Unschuld ihrer Sitten zu verderben.
Eine Reihe schöner Kinder, wie sie von solchen Eltern kommen mußten, vervielfältigten die Arbeit und die süßen Sorgen ihres häuslichen Standes, in dem sie ihre Glückseligkeit vollkommen machten. Die Fee und der Genie Alzindor waren mit ihrem Werke zufrieden.
Die Frau d'Aulnoy versichert uns zwar, sie wären unserem glücklichen Paare wieder erschienen und hätten es mit einem Palast von Diamanten und mit einem Garten beschenkt, worin alle Bäume von Golde, alle Blätter von Smaragd und alle Blumen und Früchte von gewachsenen Rubinen, Saphiren, Türkisen, Amethysten und Chrysolithen gewesen seien.
Aber wir können versichern, daß kein wahres Wort daran ist. Um was hätte ein solches Haus und ein solcher Garten die Glücklichen glücklicher machen können?
Christoph Martin Wieland Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
HIMMELBLAU UND LUPINE ...
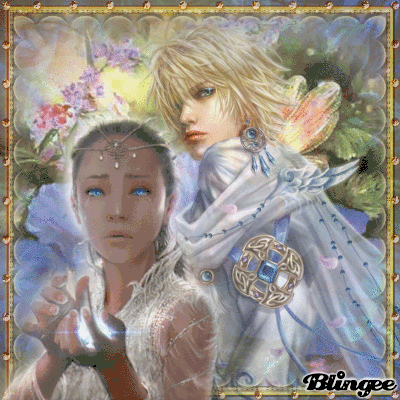
Die Fee Lupine hatte das Unglück, fünf Tage in jeder Woche eine außerordentlich häßliche kleine Person zu sein; in den beiden übrigen hätte sie das Modell zu einer Liebesgöttin abgeben können. Es ist noch immer etwas, wöchentlich zwei schöne Tage zu haben, sofern man sie benutzen kann.
Aber für Lupinen ging dieser Vorteil durch einen anderen Umstand verloren, und das war, daß sie, so wie sich ihre Figur änderte, auch eine andere Denkart und andere Gesinnungen bekam. In ihren fünf häßlichen Tagen war sie sanft, zärtlich, gutherzig, gefühlvoll, mit einem Worte: liebenswürdig, wenn man es mit einer widerlichen und zurückstoßenden Außenseite sein könnte.
Sie war in dieser Zeit die gefälligste, die verbindlichste Person von der Welt und tat ihr möglichstes, um irgendeinen Genie, Zauberer oder auch nur einen bloßen Sterblichen aufzutreiben, der edel genug wäre, sich von wahren und soliden Verdiensten, von Vollkommenheiten des Geistes und Herzens, ohne einen Zusatz von körperlichen Reizungen, einnehmen zu lassen; aber leider! wo findet man solche Männer in der Welt?
Bei allem dem muß man sich nicht einbilden, als ob die gute kleine Fee darum eine Kokette gewesen wäre; sie tat es bloß, weil es nun einmal geschrieben stand, daß sie ihre ursprüngliche Gestalt, welche sehr liebreizend gewesen war, nicht eher wiederbekommen würde, bis sie einen Mann fände, dem sie in ihrer Häßlichkeit eine wahre Liebe einzuflößen vermochte. So stand es in dem Buche des Schicksals geschrieben, einem Buche, das jedermann kennt, wie wohl kein Mensch jemals darin gelesen hat.
Wie die gute Lupine zu diesem Unglück gekommen, wird wohl niemand erst fragen, der ein wenig in der Feerei bewandert ist. Natürlicherweise hatte sie es sich durch eine hartnäckige Sprödigkeit gegen irgendeinen häßlichen, boshaften, abscheulichen Zauberer zugezogen, welcher mächtiger als sie.
So etwas versteht sich von selbst; und gleichwohl gibt es Leute, denen man alles sagen muß und die gleich ungehalten über euch werden, wenn ihr ihnen das Vergnügen machen wollt, etwas zu erraten, das sich von selbst versteht.
Lupine hatte, wie gesagt, auch zwei Tage in der Woche, wo sie zum Entzücken schön war. Sie besaß in dieser kurzen Zeit alle Reizungen und Annehmlichkeiten, womit Schönheit und Jugend die Sinne bezaubern können; und wäre es in ihrer Gewalt gestanden, die nämlichen Gesinnungen und das nämliche Betragen, womit sie in den Tagen ihrer Häßlichkeit so wenig ausrichtete, beizubehalten: welches Herz hätte gegen sie aushalten können?
Aber sobald sie schön wurde, wurde sie auch albern, eitel, übermütig und, mit einem Worte: unausstehlich; ihr hochmütiges Wesen, ihre Kälte, ihr Eigensinn, ihre Geringschätzung anderer, ihr Mangel an Geschmack und Empfindung, kurz, alle ihre Manieren, stießen einen jeden wieder zurück, den ihre Figur angezogen hatte; und man brauchte sie nur reden zu hören oder sich mit ihr einzulassen, um in wenig Augenblicken die gute Meinung von ihr zu verlieren, die man gewöhnlich von einer schönen Person hat und worin man sich so ungern betrogen findet.
Es war eine von den Bedingungen, von welchen ihre Wiederherstellung in den vorigen Stand abhing, daß es ihr nicht erlaubt war, weder denen, die sie anbeteten, wenn sie schön war, noch denen, deren Herz sie als häßlich gerne gewonnen hätte, zu entdecken, daß sie unter beiderlei Gestalt die nämliche Person sei.
Man glaubte bei Hofe (die Rede ist vom Hofe der Feenkönigin), es seien zwei Lupinen, eine schöne und eine häßliche. Dieser Hof ist ein Land, wo man zuweilen alles und noch mehr sieht, als zu sehen ist, dafür aber auch zuweilen die auffallendsten Dinge übersieht, so daß viele Zeit verstrich, ohne daß man die Bemerkung machte, daß die beiden Lupinen sich nie zugleich sehen ließen.
Inzwischen hatte die kleine Fee fünf Tage in jeder Woche hintereinander den Verdruß, sich von eben den Liebhabern verachtet und verspottet zu sehen, die in den beiden übrigen Tagen alles in der Welt darum gegeben hätten, sie ebenso liebenswürdig und gefällig zu finden, als sie schön und reizend war.
Diese Lage ist traurig genug; auch war es Lupine nicht wenig, und sogar noch mehr in den Tagen, wann sie schön, als in denen, wann sie häßlich war: woraus sich schließen läßt, daß es noch besser ist, mit Verstand und Empfindung häßlich, als mit aller möglichen Schönheit eine Gans zu sein.
So stand es indessen mit der guten Fee, als das Schicksal sie mit einer Mannsperson zusammen brachte, die aus einerlei Ursache ebenso übel behandelt worden war. Es war ein junger Prinz (wie man leicht denken konnte), aber was man so leicht nicht erraten hätte, ist, daß er sich «Himmelblau» nennen ließ: teils, weil seine Augen von dieser Farbe waren, teils, weil er sich den ganzen Sommer durch in himmelblauen Schielertaft zu kleiden pflegte und diese Art von Zeug eine Zeitlang zur Mode gemacht hatte.
Er war ursprünglich einer von den Adonissen gewesen, die das Vorrecht haben, den Weibern den Kopf zu verrücken, ohne daß sie recht sagen könnten, warum. Sobald sich einer von diesen privilegierten Herren sehen läßt, so sind die alten Feen gemeiniglich nicht die letzten, welche Jagd auf sie machen; wie wohl mit so schlechtem Erfolge, daß sie längst von dieser kleinen Schwachheit geheilt sein sollten, wenn man sich von einer Schwachheit, die man gerne hat, heilen ließe.
Die erste Fee, die sich über Himmelblaus Grausamkeit zu beklagen hatte, nahm ihre Rache auf der Stelle. Sie tat ihm, wie der Zauberer Lupinen getan hatte: der ganze Unterschied war, daß Himmelblau nur für zwei Tage in der Woche mit der vollständigsten Häßlichkeit begabt war, in den fünf anderen aber seine angeborene Schönheit behielt.
Im übrigen war es mit ihm wie mit Lupinen: häßlich hatte er alle nur ersinnliche Vorzüge des Geistes und Herzens; aber sobald er wieder schön wurde: weg war Seele, Witz, Geschmack und Empfindung; er wurde so kalt und gleichgültig wie eine Bildsäule, sah ohne Gefühl, sprach ohne zu denken, kurz, wurde so albern und abgeschmackt, daß er mit aller seiner Schönheit kaum erträglich war.
Die beiden Tage, wo Himmelblau unter dem Namen Magotin häßlich und gefühlvoll war, waren gerade die selben, wo Lupine verurteilt war, schön und gleichgültig zu sein; die fünf Tage hingegen, wo sie häßlich und geistvoll war, waren diejenigen, an welchen sich der Prinz im Besitz aller Reizungen und aller Kälte einer schönen Statue befand.
In diesem letzteren Stande mußte er Liebe einflößen, um jemals daraus befreit zu werden; und was für ihn das mißligste war, es mußte wahre Liebe und die Liebhaberin eine Dame von Verstand und vortrefflichem Charakter sein. In diesem Stücke war er wirklich schlimmer daran als die Fee. Eine häßliche Person kann durch die Schönheit ihrer Seele gefallen; aber daß ein verständiges Frauenzimmer einen gefühllosen Gecken bloß um seiner Figur willen lieb gewinne, scheint beinahe eine Unmöglichkeit.
Die Übereinstimmung in Himmelblaus und Lupinens Schicksalen brachte noch eine andere hervor, die man leicht voraussehen konnte. Der Prinz wurde in den zwei Tagen, wo er Magotin war, sterblich in Lupinen verliebt, die dann just ihre zwei schönen Tage hatte; und sie begegnete ihm so unartig und verächtlich, als man es von einem Charakter wie der ihrige erwarten kann.
Aber dafür kam auch, sobald die zwei Tage vorbei waren, die Reihe an den Prinzen. Lupine wurde dann wieder auf fünf Tage das häßlichste Geschöpf von der Welt; und der schöne Himmelblau nahm mit seiner Gestalt und seinem Namen auch seine Eiskälte und sein verächtliches Bezeugen wieder an. Die arme Fee gab alle ihre Blicke und Seufzer umsonst bei ihm aus; sie schien nur desto häßlicher zu werden, je zärtlicher sie aussah und je mehr sie zu gefallen suchte.
Bei allem dem sah sich der schöne Himmelblau bald genug von dem Gedränge verlassen, das seine Figur anfangs um ihn her gemacht hatte. Koketten und Prüden, die davon geblendet worden waren und sich viel von ihm versprochen hatten, wurden seiner Kälte und unhöflichen Gleichgültigkeit überdrüssig; die einzige Lupine, die keine Wahl hatte, hielt bei ihm aus.
Sie hatte dann doch wenigstens das Vergnügen, allein bei dem, was sie liebte, zu sein und keine Nebenbuhlerin zum Zeugen der Gleichgültigkeit, womit ihr begegnet wurde, zu haben; und das ist kein geringer Trost. Wenn diese Gleichgültigkeit nicht abnahm, so schien sie doch auch nicht zuzunehmen; und auch das ist ein Trost: die Liebe nährt sich von dem leichtesten Anschein von Hoffnung; und Hoffnung ist vielleicht der größte Zauber der Liebe.
Auch in diesem Stücke hatte es Himmelblau schlimmer, wenn die Reihe an ihn kam, häßlich zu sein. Lupine, so wenig Unterhaltung auch ihre Liebhaber bei ihr fanden, behielt doch immer einen kleinen Hof von Anbetern um sich. Die Eigenliebe der Mannsleute scheint von einer zäheren und hartnäckigeren Natur zu sein als der Damen ihre, und es braucht eine weit längere Zeit, bis ein Liebhaber, der das Unglück hat zu mißfallen, es sich gesagt sein läßt.
Und wenn denn auch einem die Geduld ausging, so stellten sich immer wieder zwei neue dafür ein, die ihren eignen Verdiensten und Gaben mehr zutrauten und desto hitziger wurden, das Abenteuer zu versuchen, je mehr Vorgänger dabei verunglückt waren. Himmelblau-Magotin hatte also immer die Demütigung auszustehen, daß ihm unter allen seinen Nebenbuhlern am schlimmsten mitgespielt wurde. Freilich besaß er, zu seinem Glücke, so viel Verstand, daß er noch immer besser als ein anderer davon kam; aber litt er darum weniger?
Ein so stürmischer Hof, wie Lupinens, hatte oft genug lauter neue Gesichter aufzuweisen: der einzige Magotin hielt sie alle aus; keine Mißhandlung konnte ihn ermüden, geschweige zum Abzug bewegen. Anfangs gab niemand darauf acht; aber da es lange genug gewährt hatte, bemerkte man es endlich.
Man zog ihn darüber auf, er hielt fest. Seine Beständigkeit schien ein Wunder; die Damen stellten ihre Betrachtungen darüber an: man beschloß Mitleid mit ihm zu haben und, wo möglich, seine Figur zu vergessen, wenn man ihm auch mit geschlossenen Augen Audienz geben müßte.
Man begriff, es müßte was Außerordentliches hinter ihm stecken; kurz, er wurde Mode; und ehe man eine Hand umkehrte, war keine Dame von einer gewissen Gattung, die sich nicht eine sehr ernsthafte Angelegenheit daraus gemacht hätte, diesen Liebhaber der schönen Unerträglichen zu entführen. Denn unter diesem Namen war Lupine in ihren zwei schönen Tagen bekannter als unter ihrem eigenen.
Die Geschichte sagt nicht, ob Magotin alle die Gütigkeit, womit man ihn auf einmal überhäufen wollte, so wie man es von ihm erwartete, beantwortet habe. Lupine, die ihn abscheulich gefunden hatte, da er ihr so unablässig aufwartete, fand ihn nun ebenso abscheulich wegen seiner Abwesenheiten und strafte ihn mit gleicher Strenge für beides; jeder Vorwand war ihr recht, wenn sie ihn nur quälen konnte.
Man will bemerkt haben, daß ein Fratzengesicht, wenn es einmal in die Mode gekommen ist, das Talent hat, sich länger darin zu erhalten als ein anderes; der Geschmack, den die Damen all ihm finden, wird, ehe man es sich versieht, eine ordentliche Wut.
Eine gewisse Fee, die man Confidante hieß, war die einzige am ganzen Hofe, die noch keine besondern Konversationen mit dem Prinzen Magotin gehabt hatte. Diese Fee Confidante war zum wenigsten ebenso schön als Lupine, aber sie war noch unempfindlicher; und in Rücksicht dieser allgemein bekannten Tugend verziehen ihr die übrigen Feen ihre Schönheit.
Wie wohl diese letztere eben keine gute Eigenschaft an einer Confidante ist, so setzte man dem ungeachtet ein großes Vertrauen in sie. Niemand hatte sich noch übel dabei befunden; es war die beste, gefälligste, harmloseste Seele von einer Fee am ganzen Hofe. Man konnte ihr in einem ganzen Tage nicht mehr als zwei oder drei unbesonnene Streiche und ebenso viel grillenhafte Einfälle vorwerfen.
Ein so gleichförmiger Charakter ist was Seltenes; auch machte sie der ihrige bei allen ihren Gespielen außerordentlich beliebt. Sie erfuhr also alles, was die übrigen von Magotins Verdiensten wußten; und sie erfuhr so viel davon, daß die Neugier, die Tochter und Mutter aller Übel unterm Monde, ihr endlich den bösen Gedanken eingab, den Prinzen allen seinen Beschützerinnen zu entführen.
Unter allen den kleinen Tyrannen, die sich anmaßen, den Kopf einer Schönen zu regieren, ist Neugier oder Vorwitz (wie man es lieber nennen will) der aller unbeschränkteste, wie wohl es sonst noch einige sehr mächtige gibt; aber so bald er spricht, schweigen so gleich alle anderen und stehen seinen Winken zu Gebot.
Die Fee Confidante hatte alle Augenblick Gelegenheit, mit Magotin zu sprechen, denn sie war immer mit tausend kleinen unbedeutenden Aufträgen von ihren Freundinnen an ihn beladen. Bisher hatte sie immer in fremdem Namen mit ihm gesprochen; aber nun, da ihre Partie genommen war, sprach sie für ihre eigene Rechnung und nicht so undeutlich, daß der Prinz, der seit kurzem große Aufschlüsse über das Geheimnis des weiblichen Herzens bekommen hatte, nicht sehr gut erraten hätte, was er erraten sollte. Er erriet sogar noch mehr; und das bewies eben, daß er sich aufs Raten verstand.
Confidante war nur vorwitzig; aber sie war es auf eine so passionierte Art, daß ihr Vorwitz wie Liebe aussah. Die Freundinnen, deren Vertraute sie gewesen war, blieben nicht lange im Irrtum und empfanden ihre Treulosigkeit, wie man es sich vorstellen kann. Die Beleidigung war gemeinschaftlich, die Rache mußte es nicht minder sein.
Kurz, man trat in eine ordentliche Verbindung zusammen, ihr ihren Magotin wieder abzusagen; und man trieb die Sache mit solchem Eifer, daß Confidante, die sich aus bloßem Vorwitz vielleicht kaum vierundzwanzig Stunden mit dem kleinen Scheusal abgegeben hätte, nun einen Ehrenpunkt daraus machte, ihn zu behaupten, sobald sie sah, daß man sie mit Gewalt aus dem Besitze werfen wolle.
Lupine wurde in diesen Umständen als die geschickteste Person betrachtet, die zusammen verschworenen Feen an Confidanten zu rächen: die Leidenschaft des Prinzen für sie war bekannt, und es kostete sie nur einen Blick, um ihn auf immer von ihrer Rivalin abzuziehen. Aber die Schwierigkeit war, ihr den Willen dazu zu machen.
Von Liebe oder Vorwitz war hier nicht die Rede, die schöne Lupine hatte für diesen sowenig Empfänglichkeit als für jene; man bemühte sich also, ihr wenigstens Eifersucht über ihre Nebenbuhlerin beizubringen.
Man würde sich sehr betrügen, wenn man sich einbildete, daß die Eifersucht einer Schönen immer Liebe voraussetze. Sie kann ebenso wohl aus bloßer Abneigung gegen eine Rivalin, aus Eitelkeit, Stolz und Begierde nach einem Vorzug entstehen, wovon man zwar keinen Gebrauch für sich selbst machen will, aber sich doch auch nicht entschließen kann, ihn einer anderen zu überlassen.
Diese Art von Eifersucht war es, was die Feen Lupinen in den Busen hauchten; und die erste Frucht davon war, daß sie Confidanten so herzlich zu verabscheuen anfing, als man nur wünschen konnte. Noch liebte sie den Magotin nicht; aber sie hatte eine ganz sonderbare Lust, beide recht unglücklich zu sehen.
Sie machte sich eine Freude und ein Geschäft daraus, ihnen heimliche Streiche zu spielen, ihre Unterredungen zu stören und ihre Zusammenkünfte rückgängig zu machen. Bald affektierte sie ein schmachtendes und zärtliches Wesen, auf eine Art, die den Prinzen hoffen ließ, daß es ihm gelten könnte, bald setzte sie ihn wieder in Unruhe und Verzweiflung; aber beides immer auf den Moment, wo es für ihre Rivalin nicht ungelegener kommen konnte.
In den Augenblicken, wo Magotin Confidanten hätte sehen können, hielt sie ihn auf, hatte zwanzig Fragen an ihn zu tun, hörte ihm mit anscheinender Teilnahme zu und schien etwas auf dem Herzen zu haben, das er für einen Anfang von Liebe halten mußte; in anderen hingegen, wo sie von Confidanten nichts zu besorgen hatte und wo Magotin die Belohnung für die Opfer, die man von ihm gefordert hatte, zu erhalten hoffte, begegnete sie ihm wieder mit einer Härte, die ihn zur Unsinnigkeit hätte treiben mögen.
Bei allem dem sah sie ihn öfter und länger als ehedem, war mehr allein mit ihm, und das Ende von dieser ganzen Komödie war, daß es die nämliche Wirkung bei ihr hervorbrachte, die der Vorwitz bei Confidanten gehabt hatte: sie spielte die Eifersüchtige und die Verliebte so lange, bis sie es im Ernste wurde. Und so hat Amor seine Kurzweile mit unseren Anschlägen; so enden alle seine Spiele!
Sobald Lupine ihres Übels gewahr wurde, gab sie sich alle Mühe, es zu verheimlichen; eine Mühe, die man sich, in ihrem Falle, ebenso wohl ersparen könnte; denn sie dient zu nichts, als das, was man verbergen will, desto sichtbarer zu machen.
Diese Veränderung zog gar bald eine andere nach sich: so wie Magotin geliebt zu werden anfing, verminderte sich seine Häßlichkeit. Es ging so langsam mit dieser Verwandlung zu, daß sie für andere Leute beinahe unmerklich war; aber in Lupinens Herzen und in ihren Augen ging es desto schneller. Mit jedem Male, wo sie ihn wiedersah, fand sie ihn liebenswürdiger; und das war gerade, was er brauchte, um es immer mehr zu werden.
Diese angehende Liebe konnte den übrigen Feen nicht lange verborgen bleiben; sie sahen sich dadurch an Confidanten gerochen; und in Rücksicht auf Lupinens Charakter zweifelten sie nicht, sich bald genug auch an Magotin gerochen zu sehen. Sie vergaßen, daß die Liebe, die so viel Wunder zu tun vermag, auch Seelen umgestalten und neue Sinnesarten machen kann. Während alles dies mit Lupinen der Schönen und Himmelblau dem Häßlichen vorging, kam ein glücklicher Zufall auch Lupinen der Häßlichen zu statten.
Es trug sich nämlich zu, daß der Schöne Himmelblau, da er einsmals seine Gleichgültigkeit und seine Reizungen in einem benachbarten Gehölze spazieren führte, von einer Räuberbande angefallen wurde; er setzte sich, wie man leicht erachtet, mit großer Tapferkeit zur Wehr, verwundete verschiedene und verjagte die übrigen; aber er kam mit einer Wunde zurück, die er durch einen Pfeilschuß an der linken Hand bekommen hatte.
Die Verwundung war an sich sehr unbedeutend; aber unglücklicherweise war der Pfeil vergiftet, und der Wundarzt gab mit aller in solchen Fällen gebräuchlichen Behutsamkeit zu verstehen: das einzige Mittel, den Prinzen zu retten, sei, je bälder, je lieber eine Person zu finden, die sich entschließen könne, das Gift aus der Wunde zu saugen.
Der Wundarzt hatte kaum ausgeredet, als Lupine, in Tränen zerfließend, sich der Hand ihres Geliebten bemächtigte und, wie sehr er sich auch dagegen sträubte, sie nicht eher wieder fahren ließ, bis sie alles Gift, das bereits in das Blut eingedrungen sein konnte, ausgezogen hatte. Welcher Unempfindliche hätte nicht in einem solchen Augenblicke eine Seele bekommen?
Der Prinz, der von dieser edelmütigen Liebesprobe mehr als von seiner eigenen Gefahr gerührt wurde, betrachtete Lupinen mit Tränen in den Augen, ohne daß er ein Wort heraus bringen konnte. Aber wie groß war sein Erstaunen, sie auf einmal so schön zu finden, als sie ihm wenige Augenblicke zuvor häßlich vorgekommen war!
War es die Schönheit dieser Handlung oder das Auge der Liebe, womit er sie ansah, oder nicht vielmehr beides zugleich, was sie so schön machte? Genug: Hochachtung, Mitleid und Dankbarkeit bemeisterten sich seines Herzens auf ewig. Von dem Augenblick, da er Lupinen mit diesen Empfindungen ansah, war sie nicht mehr die vorige.
Ihre Häßlichkeit verschwand, sie erhielt ihre ursprünglichen Reizungen wieder, seine Zärtlichkeit wurde Liebe; in einem Nu war sie die schönste aller Feen und er der gefühlvollste aller Liebhaber. Die schöne Lupine hörte auf, unempfindlich, die gefühlvolle Lupine hörte auf, häßlich zu sein.
Himmelblau war nicht mehr Magotin, und Magotin war der liebenswürdigste aller Prinzen. Sie erkannten sich nun für diejenige, die einander unter jener zweifachen Gestalt so viel Leid verursacht hatten. Die Sache wurde bald auch allen übrigen bekannt, und jedermann wollte es schon lange gemerkt haben, wie wohl kein Mensch vorher daran gedacht hatte.
Die Königin der Feen, die sich zuvor nicht in ihre Angelegenheiten gemischt hatte, tat es nun bloß, um die Wünsche der Liebenden zu krönen und sie auf ewig miteinander zu vereinigen. Lupine teilte Himmelblau ihre Unsterblichkeit mit, und noch jetzt sind sie so glücklich, als ob jeder Tag ihres Lebens der erste ihrer Liebe wäre.
Christoph Martin Wieland - Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
DER STEIN DER WEISEN ...
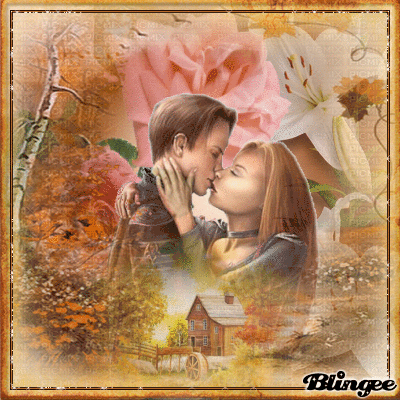
In den Zeiten, da Cornwall noch seine eigenen Fürsten hatte, regierte auf dieser kleinen Halbinsel des großen Britanniens ein junger König namens Mark, ein Enkel desjenigen, der durch seine Gemahlin, die schöne Yselde, auch Yseult die Blonde genannt, und ihre Liebesgeschichte mit dem edeln und unglücklichen Tristan von Leonnois so berühmt geworden ist.
Dieser König Mark hatte viel von seinem Großvater: er war hoffärtig ohne Ehrgeiz, wollüstig ohne Geschmack und geizig, ohne ein guter Wirt zu sein. Sobald er zur Regierung kam, welches sehr früh geschah, fing er damit an, sich seinen Leidenschaften und Launen zu überlassen und auf einem Fuß zu leben, der ein weit größeres und reicheres Land als das seinige hätte zugrunde richten müssen. Als seine gewöhnlichen Einkünfte nicht mehr zu reichen wollten, drückte er seine Untertanen mit neuen Auflagen; und als sie nichts mehr zu geben hatten, machte er sie selbst zu Gelde und verkaufte sie an seine Nachbarn.
Bei allem dem hielt König Mark einen glänzenden Hof und wirtschaftete, als ob er eine unerschöpfliche Goldquelle gefunden hätte. Nun hatte er sie zwar noch nicht gefunden, aber er suchte sie wenigstens sehr eifrig; und sobald dies ruchtbar wurde, stellten sich allerlei sonderbare Leute an seinem Hofe ein, die ihm suchen helfen wollten. Schatzgräber, Geisterbeschwörer, Alchimisten und Beutelschneider, die sich Schüler des dreimal großen Hermes nannten, kamen von allen Enden herzu und wurden mit offnen Armen aufgenommen; denn der arme Mark hatte zu allen seinen übrigen Untugenden auch noch die, daß er der leichtgläubigste Mensch von der Welt war und daß der erste beste Landstreicher, der mit geheimen Wissenschaften prahlte, alles aus ihm machen konnte, was er wollte. Es wimmelte also an seinem Hofe von solchem Gesindel.
Der eine gab vor, er hätte eine natürliche Gabe, alle Schätze zu wittern, die unter der Erde vergraben lägen; ein anderer wußte sie mit Hilfe der Wünschelrute zu entdecken; ein dritter versicherte, daß das eine und das andere vergeblich sei; wenn man nicht das Geheimnis besitze, die Geister, die in Gestalt der Greifen, oder unter anderen noch fürchterlicheren Larven, die unterirdischen Schätze bewachten, einzuschläfern, zu gewinnen oder sich unterwürfig zu machen; und er ließ sich's auf eine bescheidene Art anmerken, daß er im Besitze dieser Geheimnisse sei.
Noch andere sahen auf alle magischen Künste mit Verachtung herab: bei ihnen ging alles natürlich zu. Sie verwarfen alle Talismane, Zauberworte, Kreise, Charaktere, und was in diese Rubrik gehört, als eitel Betrügerei und Blendwerk. Was jene durch übernatürliche Kräfte zu leisten vorgaben, das leisteten sie, wenn man ihnen glaubte, durch die bloßen Kräfte der Natur.
Wer in das innerste Heiligtum der selben eingedrungen ist, sagten sie; wer in dieser ihrer geheimen Werkstätte die wahren Elemente der Dinge, ihre Verwandtschaften, Sympathien und Antipathien kennengelernt hat; wer den allgestaltigen Naturgeist mit dem allauflösenden Natursalze zu vermählen weiß und durch Hülfe des alldurchdringenden Astralfeuers diesen Proteus festhalten und in seiner eigenen Urgestalt zu erscheinen zwingen kann: der allein ist der wahre Weise.
Er allein verdient den hohen Namen eines Adepten. Ihm ist nichts unmöglich, denn er gebietet der Natur, welcher alles möglich ist. Er kann die geringeren Metalle in höhere verwandeln; er besitzt das allgemeine Mittel gegen alle Krankheiten; er kann, wenn es ihm und den Göttern gefällt, Tote ins Leben zurückrufen, und es steht in seiner Macht, selbst so lange zu leben, bis es ihm angenehmer ist, in eine andere Welt überzugehen.
König Mark fand dies alles sehr nach seinem Geschmack; aber weil er sich doch nicht entschließen konnte, nur einen von seinen Wundermännern beizubehalten und die übrigen fortzuschicken, so behielt er sie alle und versuchte es mit einem nach dem anderen. Der Tag wurde mit Laborieren, die Nacht mit Geisterbannen und Schatzgraben zugebracht; und wie die Betrüger sahen, daß er kein Freund von Monopolien war, so vertrugen sie sich, zu seiner großen Freude, gar bald so gut zusammen, als ob alles in einen Beutel ginge.
Verschiedene Jahre verstrichen auf diese Weise, ohne daß König Mark dem Ziele seiner Wünsche um einen Schritt näher kam. Er hatte die Hälfte seines kleinen Königreichs aufgraben lassen und keinen Schatz gefunden; und über die Hoffnung, alles Kupfer und Zinn seiner Bergwerke in Gold zu verwandeln, war alles Gold, das seine Vorfahren daraus gezogen hatten, zum Schornstein hinaus geflogen.
Einem anderen wären nach so vielen verunglückten Versuchen die Augen aufgegangen; aber Mark, dessen Augen immer trüber wurden, wurde desto hitziger auf den Stein der Weisen, je mehr er sich vor ihm zu verbergen schien. Seine Hoffnung, den allgestaltigen Proteus endlich einmal festzuhalten, stieg in eben dem Verhältnisse, wie die Schale seines Verlustes sank: er glaubte, daß er nur noch nicht an den rechten Mann geraten sei; und in dem er zehn Betrüger fort jagte, war ihm der elfte neu angelangte willkommen.
Endlich ließ sich ein ägyptischer Adept aus der echten und geheimen Schule des großen Hermes bei ihm anmelden. Er nannte sich Misfragmutosiris, trug einen Bart, der ihm bis an den Gürtel reichte, eine pyramidenförmige Mütze, auf deren Spitze ein goldner Sphinx befestigt war, einen langen, mit Hieroglyphen gestickten Rock und einen Gürtel von vergoldetem Blech, in welchen die zwölf Zeichen des Tierkreises gegraben waren.
König Mark schätzte sich für den glücklichsten aller Menschen, einen Weisen von so viel versprechendem Ansehen an seinem Hofe ankommen zu sehen; und wie wohl der Ägypter sehr zurückhaltend tat, so wurden sie doch in kurzem ziemlich gute Freunde. Alles an ihm, Gestalt, Kleidung, Sprache, Manieren und Lebensart, kündigte einen außerordentlichen Mann an. Er aß immer allein, und nichts, was andere Menschen essen; er hatte einige große Schlangen und ein ausgestopftes Krokodil bei sich in seinem Zimmer, denen er mit großer Achtung begegnete und mit welchen er von Zeit zu Zeit geheime Unterredungen zu halten schien.
Er sprach die wunderbarsten und rätselhaftesten Dinge mit einer Offenheit und Gleichgültigkeit, als ob es die gemeinsten und bekanntesten Dinge von der Welt wären; aber auf Fragen antwortete er entweder gar nicht, oder wenn er es tat, so geschah es in einem Tone, als ob nun weiter nichts zu fragen übrig wäre, wie wohl der Fragende jetzt noch weniger wußte als zuvor.
Von Personen, die vor vielen hundert Jahren gelebt hatten, sprach er, als ob er sie sehr genau gekannt habe; und überhaupt mußte man aus seinen Reden schließen, daß er wenigstens ein Zeitgenosse des Königs Amasis gewesen sei, wie wohl er sich nie deutlich darüber erklärte. Was ihm bei Mark den meisten Kredit gab, war, daß er viel Gold und eine Menge seltener Sachen bei sich hatte und von sehr großen Summen als von einer Kleinigkeit sprach.
Alle diese Umstände schraubten nach und nach die Neugier des leichtgläubigen Königs von Cornwall so hoch hinauf, daß er es nicht länger aushalten konnte; und, wie er es nun auch angefangen haben mochte, genug, der weise Misfragmutosiris ließ sich endlich erbitten, oder sein Herz erlaubte ihm nicht länger undankbar gegen die Ehrenbezeigungen und Geschenke zu sein, womit ihn der König überhäufte; und so entdeckte er ihm endlich - doch nicht eher, als bis er ihn mittelst verschiedener Initiationen durch einige höhere Grade des Hermetischen Ordens geführt hatte - das ganze Geheimnis seiner Person.
«Die Götter», sagte Misfragmutosiris, «geben ihre kostbarsten Gaben, wem sie wollen. Ich war nichts weiter als ein Mensch wie andere, noch jung, doch nicht ganz unerfahren in den Mysterien der ägyptischen Philosophie, als mich die Neugier anwandelte, in das Innere der großen Pyramide zu Memphis, deren Alter den Ägyptern selbst ein Geheimnis ist, einzudringen.
Eine gewisse hieroglyphische Aufschrift, die ich schon zuvor über dem Eingang des ersten Saales entdeckt und abgeschrieben hatte, brachte mich, nach vieler Mühe ihren Sinn zu erraten, auf die Vermutung, daß diese Pyramide das Grabmal des großen Hermes sei. Ich beschloß, mich in einer Stunde hinein zu wagen, worin gewiß noch kein Sterblicher sich dessen unterfangen hat; und noch jetzt wäre mir meine Verwegenheit unbegreiflich, wenn ich nicht überzeugt wäre, daß dieser Gedanke, dessen meine eigene Seele nicht fähig war, von einer höheren Macht in mir erschaffen wurde.
Genug, ich stieg um Mitternacht, ohne Licht und mit gänzlicher Ergebung in die Führung desjenigen, der mir ein so kühnes Unternehmen eingegeben, in die Pyramide hinab. Ich war auf einem sanften Abhang eine Zeit lang abwärts- und dann wieder ebenso unvermerkt empor gestiegen, als ich auf einmal ein helles Licht erblickte, das wie eine Kugel vom reinsten gediegenen Feuer vor mir her schwebte.» Hier hielt Misfragmutosiris einige Augenblicke ein.
«Und Ihr hattet den Mut, diesem Licht zu folgen?» fragte König Mark, der in der Stellung eines versteinerten Horchers, den Leib vorwärts gebogen, mit straff zurückgezogenen Füßen, beide Hände auf die Knie gestützt, ihm gegenüber saß und, furchtsam, nur eine Silbe von der Erzählung zu verlieren, wie wohl unter beständigem Schaudern vor dem, was kommen würde, mit zurück gehaltenem Atem und weit offenen Augen zuhörte.
«Ich folgte dem Licht», fuhr der Ägypter fort, «und kam durch einen immer niedriger und enger werdenden Gang in einen viereckigen Saal von poliertem Marmor, dessen Ausgang mich in einen anderen Gang leitete. Als ich ungefähr fünfzig Schritte fort gekrochen war, fand ich zwei Wege vor mir. Der eine schien ziemlich steil in die Höhe zu führen, der andere, linker Hand, lief gerade fort. Ich folgte der Lichtkugel auf diesem letztern, bis ich an den Rand eines tiefen Brunnens gelangte.
Bei dem sehr lebhaften Licht, das die Kugel umher streute, wurde ich gewahr, daß eine Anzahl kurzer eiserner Stangen, eine ungefähr zwei Spannen weit von der anderen, von oben bis unten aus der Mauer hervor ragten; eine gefährliche Art von Treppe, auf welcher man zur Not in den Brunnen hinab steigen konnte. Ohne mich lange zu bedenken, schickte ich mich an, diese schwindlige Fahrt anzutreten, und war schon drei oder vier Stufen hinab gestiegen, als die Lichtkugel plötzlich verschwand und mich in der schrecklichsten Dunkelheit zurückließ.
Ich begreife nicht, wie ich in diesem entsetzlichen Augenblick nicht vor Schrecken in den Abgrund hinunter stürzte. Genug, ich faßte mich und fuhr mit verdoppelter Behutsamkeit fort, hinab zu klettern, in dem ich mich mit einer Hand an einer Stange über mir fest hielt, während ich eine andere unter mir mit den Füßen suchte. Endlich merkte ich, daß keine Stangen mehr folgten; ich hörte das Wasser unter mir rauschen; aber zugleich ward ich an der Seite, woran ich herunter gestiegen, einer Öffnung gewahr, aus welcher mir ein dämmernder Schein entgegenkam.
Ich sprang in diese Öffnung hinein und gelangte auf einem abschüssigen Weg in eine ungeheure Höhle von glimmerndem Granit, die durch einen mitten aus der gewölbten Decke herabhängenden großen Karfunkel erleuchtet war. Wie groß war meine Bestürzung, als ich mich auf einmal an dem Rande eines reißenden Stromes sah, der sich mit entsetzlichem Geräusch aus einer Öffnung dieser Höhle über schroffe Felsenstücke herabstürzte!
Indessen bedachte ich mich nur einen Augenblick, was ich zu tun hätte. Ich war schon zu weit gegangen, um wieder zurückzugehen, und ein Genius schien mir zuzuflüstern, daß mir alle diese Schwierigkeiten nur um meinen Mut zu prüfen entgegen gestellt würden. Ich zog alle meine Kleider aus, band sie in einen Bündel über meinem Kopfe zusammen und stürzte mich in den Strom. In wenigen Augenblicken wurde ich von der Gewalt des selben durch ein dunkles Gewölbe fortgerissen.
Nun merkte ich, daß das Wasser unter mir seicht wurde; bald darauf verlor es sich gänzlich und ließ mich in einer großen Höhle auf einem moosigen Grund sitzen. Eine ungewöhnliche Hitze, die ich hier verspürte, trocknete mich so schnell, daß ich mich so gleich wieder anzog, um zu sehen, wohin mich eine ziemlich enge Öffnung führen würde, aus welcher ein lebhafter Schein in die Höhle eindrang.
So wie ich der Öffnung näher kam, hörte ich ein zischendes Geprassel, wie von einem lodernden Feuer. Ich kroch hinein, die Öffnung erweiterte sich allmählich, und ich befand mich am Eingang eines weiten gewölbten Raumes, wo mein Fortschritt durch ein neues Hindernis gehemmt wurde, das noch viel fürchterlicher als alle vorigen war.
Ich sah einen feurigen Abgrund vor mir, der beinahe den ganzen Raum erfüllte und dessen wallende Flammen, wie aus einem Feuersee, über die Ufer von Granitfelsen, womit es ringsum eingefaßt war, empor loderten und bis an meine Füße herauf zu zücken schienen. Statt einer Brücke war eine Art von Rost, aus vierfach nebeneinander liegenden schmalen Kupferblechen zusammengefügt, hinüber gelegt, der von einem Ufer zum anderen reichte, aber kaum drei Palmen breit war.
Ich gestehe aufrichtig, ungeachtet der großen Hitze dieses schrecklichen Ortes lief mir's eiskalt durchs Rückenmark auf und nieder; aber was war hier anderes zu tun, als auch dieses Abenteuer zu wagen, ohne mich lange über die Möglichkeit zu bedenken? Wie ich hinüber gekommen, weiß ich selbst nicht; genug, ich kam hinüber; und ehe ich Zeit hatte, wieder zu mir selbst zu kommen, fühlte ich mich von einem Wirbelwind ergriffen und mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit durch die grauenvollste Finsternis fort gezogen.
Ich verlor alle Besinnung, kam aber bald wieder zu mir selbst, indem ich mich etwas unsanft gegen eine Pforte geworfen fühlte. Sie sprang auf, und ich befand mich, auf meinen Füßen stehend, in einem herrlich erleuchteten Saale, dessen gewölbte, mit Azur überzogene Decke die Halbkugel des Himmels vorstellte und mit einer unendlichen Menge von Karfunkeln, als ebenso viel Sternbildern, eingelegt war. Sie ruhte auf zwei Reihen massiv goldener Säulen, an welchen unzählige Hieroglyphen aus Edelsteinen von allen möglichen Farben schimmerten. Ich stand etliche Minuten ganz verblendet und entzückt von der Herrlichkeit dieses Ortes.»
«Das glaub' ich», rief König Mark, «und nach solchen ausgestandenen Gefährlichkeiten! Ich möchte da wohl an Eurem Platze gewesen sein!»
«Als ich mich wieder in etwas gefaßt hatte», fuhr Misfragmutosiris in seiner Erzählung fort, ohne auf die lebhafte Teilnehmung des Königs achtzugeben, «fiel mir eine hohe Pforte von Ebenholz in die Augen, vor welcher zwei Sphinxe von kolossalischer Größe einander gegenüber lagen. Sie waren aus Elfenbein geschnitzt und von wunderbarer Schönheit; aber zu meinem großen Bedauern lagen sie so dicht an der Pforte und so nahe beisammen, daß es schlechterdings für mich unmöglich schien, sie zu öffnen und die Begierde zu befriedigen, welche mich in ein so gefahrvolles Abenteuer verwickelt hatte.
Indem ich nun, der verbotenen Pforte gegenüberstehend, vergebens auf ein Mittel sann, diese Schwierigkeit zu überwinden, erblickte ich über der Tür, in diamantnen Charakteren der heiligen Priesterschrift, die mir nicht unbekannt war, den Namen Hermes Trismegistos. Ich las ihn mit lauter Stimme; und kaum hatte ich ihn ausgesprochen, so öffnete sich die Pforte von selbst, die beiden Sphinxe belebten sich, sahen mich mit funkelnden Augen an und wichen so weit zurück, daß ich zwischen ihnen durchgehen konnte.
Sobald ich über die Schwelle der Pforte von Ebenholz geschritten war, schlossen sich ihre Flügel, wie von einem inwohnenden Geist bewegt, von sich selbst wieder zu, und ich befand mich in einem runden Dom von schwarzem Jaspis, dessen furchtbares Dunkel nur von Zeit zu Zeit, in Pausen von zehn bis zwölf Sekunden, durch eine Art von plötzlichem Wetterleuchten erhellt wurde, das an den schwarzen glatt geschliffenen Wänden herum zitterte und ebenso schnell verschwand als entstand.
Bei dieser majestätischen geheimnisvollen Art von Beleuchtung erblickte ich in der Mitte des Doms ein großes Prachtbett von unbeschreiblichem Reichtum, worauf ein langer ehrwürdiger Greis, mit kahlem Haupt und einem schlohweißen Bart, die Hände auf die Brust gelegt, sanft zu schlummern schien.
Zu seinen Haupt lagen zwei Drachen von so seltsamer und schrecklicher Gestalt, daß ich sie noch jetzt, nach so viel Jahrhunderten, vor mir zu sehen glaube. Sie hatten einen flachen Kopf mit langen herabhängenden Ohren, runde gläserne Augen, die weit aus ihren Kreisen hervorragten, einen Rachen gleich dem Krokodil, einen langen, äußerst dünnen Schwanenhals und ungeheure lederne Flügel wie die Fledermäuse; der vordere Teil des Leibes war mit starren spiegelnden Schuppen bedeckt und mit Adlerfüßen bewaffnet, und der Hinterleib endigte sich in eine dicke, siebenmal um sich selbst gewundene Schlange.
Ich bemerkte bald, daß das Wetterleuchten, das diesen Dom alle zehn Sekunden auf einen Augenblick erhellte, aus den Nasenlöchern dieser Drachen kam und daß dies ihre Art zu atmen war. Wie schauderhaft auch der Anblick dieser gräßlichen Ungeheuer war, so schienen sie doch nichts Feindseliges gegen mich im Sinne zu haben, sondern erlaubten mir, den majestätischen Greis, der hier den langen Schlaf des Todes schlief, bei dem flüchtigen Licht, das sie von sich gaben, so lange ich wollte zu betrachten.
Ich bemerkte eine dicke Rolle von ägyptischem Papier, die zu den Füßen des Greises lag und mit Hieroglyphen und Charakteren beschrieben schien. Eine unsägliche Begierde, der Besitzer dieser Handschrift zu sein, bemächtigte sich meiner bei diesem Anblick; denn ich zweifelte nicht, daß sie die verborgensten Geheimnisse des großen Hermes enthalte. Zehnmal streckte ich die Hand nach ihr aus, und zehnmal zog ich sie wieder mit Schaudern zurück.
Endlich wurde die Begierde Meister, und meine Hand berührte schon den heiligen Schatz, gegen welchen ich alle Schätze über und unter der Erde verachtete, als mich ein Blitz aus dem Munde eines der beiden Drachen plötzlich zu Boden warf und alle meine Glieder dergestalt lähmte, daß ich unfähig war, wieder aufzustehen.
Sogleich fuhr eine kleine geflügelte und gekrönte Schlange, die den hellsten Sonnenglanz von sich warf, aus der Kuppel des Doms herab und hauchte mich an: ich fühlte die Kraft dieses Anhauchs gleich einer lieblich scharfen, geistigen Flamme alle meine Nerven dergestalt durchdringen, daß ich etliche Augenblicke wie betäubt davon war.
Als ich mich aber wieder aufraffte, sah ich einen Knaben vor mir, der auf einem Lotusblatt saß und, indem er den Zeigefinger der rechten Hand auf den Mund drückte, mir mit der linken die Rolle darreichte, die ich zu den Füßen des schlafenden Greises gesehen hatte. Ich erkannte den Gott des heiligen Stillschweigens und warf mich vor ihm zur Erde: aber er war wieder verschwunden; und nun wurde ich erst gewahr, daß ich mich, ohne zu begreifen, wie es damit zugegangen, anstatt in der großen Pyramide bei Memphis, in meinem Bett befand.»
«Wunderbar! Seltsam, bei meiner Ehre!» rief König Mark mit allen Zeichen des Erstaunens und der Überraschung auf dem gläubigsten Gesichte von der Welt.
«So kam es mir auch vor», erwiderte Misfragmutosiris; «und ich würde mich sicher selbst beredet haben, daß mir alle diese wunderbaren Dinge bloß geträumt hätten, wenn die geheimnisvolle Rolle in meiner Hand mich nicht von der Wirklichkeit der selben hätte überzeugen müssen.
Ich betrachtete sie nun mit unbeschreiblichem Entzücken, ich betastete und beroch sie auf allen Seiten und konnte es gleichwohl kaum meinen eignen Sinnen glauben, daß ein so unbedeutender Mensch als ich der Besitzer eines Schatzes sei, um welchen Könige ihre Kronen gegeben hätten. Das Papier war von der schönsten Purpurfarbe, die Hieroglyphen gemalt und die Charaktere von dünn geschlagenem Golde.»
«Das muß ein schönes Buch sein», sprach König Mark; «ich weiß nicht, was ich nicht darum gäbe, es nur eine Minute lang in meiner Hand zu haben. Dürfte ich bitten?»
«Von Herzen gern, wenn es noch in meinen Händen wäre.»
«Wie? Es ist nicht mehr in Euern Händen?» rief Mark mit kläglicher Stimme.
«Ich besaß es nur sieben Tage. Am achten erschien mir der Knabe auf dem Lotusblatte wieder, nahm die Rolle aus meiner Hand und verschwand damit auf ewig. Aber diese sieben Tage waren für mich hinreichend, mich zum Meister von sieben Geheimnissen zu machen, deren geringstes von unschätzbarem Wert in meinen Augen ist. Seit dieser merkwürdigen Nacht sind nun über tausend Jahre verstrichen.»
«Über tausend Jahre?» unterbrach ihn König Mark abermals «Ist es möglich? Über tausend Jahre?»
«Alles ist möglich», antwortete der tausendjährige Schüler des großen Hermes mit seinem gewöhnlichen Kaltsinne; «dies ist es kraft des siebenten Geheimnisses. Seitdem ich im Besitze des selben bin, ist der ganze Erdboden mein Vaterland, und ich sehe Königreiche und Geschlechter der Menschen um mich her fallen wie die Blätter von den Bäumen.
Ich wohne bald hier, bald da, bald in diesem, bald in jenem Teile der Welt; ich rede alle Sprachen der Menschen, kenne alle ihre Angelegenheiten und habe bei keiner zu gewinnen noch zu verlieren. Ich verlange über niemand zu herrschen und bin niemanden untertan; aber wenn ich, was mir selten begegnet, einen guten König antreffe, so habe ich mein Vergnügen daran, sein Vermögen, Gutes zu tun, zu vermehren.»
König Mark versicherte, er wünsche und hoffe, einer von den guten Königen zu sein, wenigstens habe er immer seine Lust daran gehabt, Gutes zu tun; und bloß, um unendlich viel Gutes tun zu können, habe er sich immer gewünscht, den Stein der Weisen in seine Gewalt zu bekommen.
Misfragmutosiris gab ihm zu verstehen, dazu könne wohl noch Rat werden; er schien die Sache als eine Kleinigkeit zu betrachten, wollte sich aber diesmal nicht näher darüber erklären.
König Mark, der einen Mann, dem nichts unmöglich war, zum Freunde hatte, glaubte den Stein der Weisen schon in seiner Tasche zu fühlen und gab, auf Abschlag der Goldberge, in welche er seine Kupferberge bald zu verwandeln hoffte, alle Tage glänzendere Feste; denn der Wundermann mit dem goldnen Sphinx auf der Mütze, der schon tausend Jahre alt war, alle Krankheiten heilen konnte und einen Krokodil zum spiritus familiaris hatte, war bereits im ganzen Land erschollen, und mit der hohen Meinung, die das Volk von ihm gefaßt hatte, war auch der gesunkene Kredit des Königs wieder höher gestiegen.
Die Königin Mabillje mit ihren Damen und Jungfrauen trug nicht wenig bei, diese Hoflustbarkeiten lebhafter und schimmernder zu machen. Es war schon lange, daß König Mark, der die Veränderung liebte, seiner Gemahlin einige Ursachen gab, sich von ihm für vernachlässiget zu halten; und die Eifersucht, womit sie ihm ihre Zärtlichkeit zu beweisen sich verbunden hielt, war ihm so beschwerlich gefallen, daß ihm zuweilen der Wunsch entfahren war, daß sie (ihrer Tugend unbeschadet) irgendein anderes Mittel, sich die Langeweile zu vertreiben, ausfindig machen möchte, als das Vergnügen, das sie daran zu finden schien, wenn sie ihm seine kleinen Zeit kürzungen verkümmern konnte.
Er schien es daher entweder nicht zu bemerken oder (wie einige Hofleute wissen wollten) es heimlich ganz gern zu sehen, daß ein schöner junger Ritter, der seit kurzem unter dem Namen Floribell von Nikomedien an seinem Hoflager erschienen war, sich auf eine sehr in die Augen fallende Art um die Gunst der Königin bewarb und alle Tage größere Fortschritte in der selben machte.
In der Tat war es schon so weit gekommen, daß Mabillje ihre Parteilichkeit für den schönen Floribell sich selbst nicht länger leugnen konnte; da sie aber fest entschlossen war, einen tapferen Widerstand zu tun, so nahmen ihr die Angelegenheiten ihres eigenen Herzens so viel Zeit weg, daß sie keine hatte, den König in den seinigen zu beunruhigen.
Wie lebhaft auch König Mark seine Geschäfte auf dieser Seite treiben mochte, so verlor er doch das Ziel seiner Hauptleidenschaft keinen Augenblick aus dem Gesichte. Es waren nun bereits einige Monate verstrichen, seit der Erbe des großen Trismegistos an seinem Hofe wie ein König bewirtet wurde, und Mark glaubte sich einiges Recht an seine Freundschaft erworben zu haben.
Misfragmutosiris hatte sich zwar bei aller Gelegenheit gegen Belohnungen und große Geschenke erklärt; aber kleine Geschenke, pflegte er zu sagen, die ihren Wert bloß von der Freundschaft erhalten, deren Symbole sie sind, kann sich kein Freund weigern, von dem anderen anzunehmen. Weil aber die Begriffe von Klein und Groß relativ sind und unser Adept von Sachen, die nach der gemeinen Schätzung einen großen Wert haben, als von sehr unbedeutenden Dingen sprach: so hatten die kleinen Geschenke, die er nach und nach von seinem Freund Mark anzunehmen die Güte gehabt hatte, die Schatzkammer des armen Königs ziemlich erschöpft, und es war hohe Zeit, ihr durch neue und ergiebige Zuflüsse wieder aufzuhelfen.
Der Ägypter schien die Billigkeit hiervon selbst zu fühlen; und bei der ersten Anregung, welche der König von den sieben Geheimnissen tat, trug er kein Bedenken mehr, ihm zu gestehen, daß das erste und geringste der selben die Kunst, den Stein der Weisen zu bereiten, sei. Mark beteuerte, daß er mit diesem geringsten gern fürliebnehmen wolle, und der Adept machte sich ein Vergnügen daraus, ihm ein Geheimnis zu entdecken, worauf er selbst zwar keinen großen Wert legte, das aber gleichwohl, wie er weislich sagte, um des Mißbrauchs willen allen Profanen ewig verborgen bleiben müsse.
«Der wahre Hermetische Stein der Weisen», sagte er, «kann aus keiner andern Materie als aus den feinsten Edelsteinen, Diamanten, Smaragden, Rubinen, Saphiren und Opalen gezogen werden. Die Zubereitung des selben, vermittelst Beimischung eines großen Teils Zinnober und einiger Tropfen von einem aus verdickten Sonnenstrahlen gezogenen flüchtigen Öle, ist weniger kostbar oder verwickelt als mühsam und erfordert beinahe nichts als einen ungewöhnlichen Grad von Aufmerksamkeit und Geduld; und dies ist die Ursache, warum es der Mühe nicht wert wäre, einen Versuch im Kleinen zu machen.
Das Resultat der Operation, welche unter meinen Händen nicht länger als dreimal sieben Tage dauert, ist eine Art von purpurroter Masse, die sehr schwer ins Gewicht fällt und sich zu einem feinen Mehle schaben läßt, wovon eines halben Gerstenkorns schwer hinreichend ist, zwei Pfund Blei zu ebenso viel Gold zu veredeln; und dies ist, was man den Stein der Weisen zu nennen pflegt.»
König Mark brannte vor Begierde, sobald nur immer möglich einige Pfund dieser herrlichen Komposition zu seinen Diensten zu haben. Er fragte also, ein wenig furchtsam, ob wohl eine sehr große Quantität Edelsteine vonnöten wäre, um ein Pfund des philosophischen Steines zu gewinnen.
«Oh», sagte Misfragmutosiris, «ich merke, wo die Schwierigkeit liegt. An Edelsteinen soll es uns nicht fehlen; denn ich besitze auch das Geheimnis, die feinsten und echtesten Edelsteine zu machen. Ich muß gestehen, die Operation ist etwas langweilig; sie erfordert gerade soviel Monate als der Stein der Weisen Tage; aber...»
«Nein», fiel ihm Mark in die Rede, «so lange kann ich unmöglich warten! Lieber will ich meine Kronen und mein ganzes übriges Geschmeide dazu hergeben! Einundzwanzig Monate sind eine Ewigkeit! Wenn wir nur erst den Stein aller Steine haben, so soll es uns an den übrigen nicht fehlen. Für Gold ist alles zu bekommen; und allenfalls habe ich nichts dagegen, wenn Ihr bei guter Muße auch Edelsteine machen wollt.»
«Wie es beliebig ist», sagte der Adept. «Von zwei Unzen Diamanten und zweimal soviel Rubinen, Smaragden und dergleichen erhalten wir genau einen Stein von zwölftausend Gran an Gewicht, und damit läßt sich schon was machen. Ich für meinen Teil brauche in hundert Jahren nicht so viel.»
«Kleinigkeit», rief König Mark; «ich wette, an meiner schlechtesten Hauskrone müssen mehr Steine sein, als Ihr verlangt; aber wenn wir einmal an die Arbeit gehen, so muß es auch der Mühe wert sein. Laßt mich dafür sorgen! Wir müssen einen Stein von vierundzwanzigtausend Gran bekommen, oder ich heiße nicht König Mark!»
«Das beste ist», sagte der Adept, «daß ich mit dem Sonnenöle schon versehen bin, welches von allen Ingredienzen das kostbarste ist und dessen Zubereitung einundzwanzig Jahre dauert. Ich bin immer besorgt, einige Violen davon vorrätig zu haben; denn außerdem, daß es bei Verfertigung des Steins die Hauptsache ist, so ist es auch die Materie, woraus, vermittelst einer Konzentration, welche dreimal einundzwanzig Jahre erfordert, das Hermetische Öl der Unsterblichkeit bereitet wird, von dessen wunderbaren Kräften ich dir künftig so viel entdecken werde, als mir erlaubt sein wird.»
König Mark war vor Freude außer sich, einen Freund zu besitzen, der solche Entdeckungen zu machen hatte, und eilte, was er konnte, alles Nötige zu dem großen Werke veranstalten zu helfen. An Öfen und allen Arten chemischer Werkzeuge konnte es an einem Hofe, wo schon so lange laboriert wurde, nicht fehlen; aber Misfragmutosiris erklärte sich, daß er, außer einem kleinen Herd, den er in einem kleinen Kabinett seines Zimmers bauen ließ, und einem Sack voll Kohlen, nichts von Nöten habe, weil er alles, was zur Operation erforderlich sei, bei sich führe.
Als man mit den Zurüstungen fertig war, zog er die Gestirne zu Rate und setzte den Anfang der geheimen Arbeiten auf einen gewissen Tag um die erste Stunde nach Mitternacht fest. Vorher aber initiierte er den König in einem neuen Grade der Hermetischen Mysterien, welcher ihn fähig machte, ein Augenzeuge aller zu dem großen Werke gehörigen Arbeiten zu sein.
Eine einzige höchst geheimnisvolle war hier von ausgenommen, bei welcher der Geist des dreimal großen Hermes selbst erscheinen mußte, um zu dem vorhabenden Werk seinen Beifall zu geben. Die Gegenwart dieses Geistes ertragen zu können, war ein Vorrecht der Eingeweihten des höchsten Grades; und Misfragmutosiris gab dem Könige zu verstehen, daß er selbst unter allen Lebendigen der einzige, der sich dieses Vorrechtes rühmen könne, und kraft des selben das unsichtbare Oberhaupt des ganzen Hermetischen Ordens sei.
Endlich, als die sehnlich erwartete Mitternacht heran nahte, übergab König Mark dem Adepten eigenhändig ein goldenes Kästchen, mit Dicksteinen, Smaragden, Rubinen, Saphiren und morgenländischen Opalen angefüllt, die er aus zwei oder drei von seinen Vorfahren geerbten Kronen hatte ausbrechen lassen. Bei dieser Gelegenheit wurde er zum ersten Male in das geheime Kabinett eingelassen, welches bisher, außer dem Adepten, kein sterblicher Fuß hatte betreten dürfen.
Es war um und um mit ägyptischen Götterbildern und Hieroglyphen ausgeziert und nur von einer einzigen Lampe, die von der Decke herab hing, beleuchtet; in der Mitte stand ein kleiner runder Herd von schwarzem Marmor, in Form eines Altars, auf welchem das große Werk zustande kommen sollte. Misfragmutosiris, in der Kleidung eines alten, ägyptischen Oberpriesters, fing die Zeremonie damit an, daß er den König mit einem angenehm betäubenden Rauchwerk beräucherte.
Er zog hierauf einen großen hermetisch-magischen Kreis um den Altar, und in den selben einen kleineren, den er mit sieben, wie jenen mit neun, hieroglyphischen Charakteren bezeichnete. Er befahl dem Könige, in dem äußeren Kreis stehen zu bleiben; er selbst aber trat in den inneren Kreis vor den Altar, warf etliche Körner Weihrauch in die Glutpfanne und murmelte einige dem König unverständliche Worte.
Sowie der Rauch in die Höhe stieg, erschien über dem Altar ein langohriger Knabe, auf einem Lotusblatt sitzend, den Zeigefinger der rechten Hand an den Mund gelegt und in der linken eine brennende Fackel tragend. Mark wurde bei dieser Erscheinung leichenblaß und konnte sich kaum auf den Beinen halten; aber der Adept näherte seinen Mund dem rechten Ohre des Knaben und flüsterte ihm etwas zu, worauf dieser mit einem bejahenden Kopfnicken antwortete und verschwand.
Misfragmutosiris hieß den König guten Mutes sein, gab ihm, um seine Lebensgeister wieder zu stärken, einen Löffel voll von einem Elixier, von großer Tugend und empfahl ihm, morgen in der siebenten Stunde sich wieder einzufinden, in dessen aber sich zur Ruhe zu begeben, während er selbst wachen werde, um der Erscheinung des großen Hermes, welche ihm angekündigt worden, abzuwarten und die Mysterien zu vollziehen, womit das große Werk angefangen werden müsse, wenn man sich eines glücklichen Ausgangs versichern wolle.
König Mark begab sich voll Glauben und Erwartung in sein eigenes Gemach; und weil das, was ihm der Adept gegeben hatte, ein Schlaftrunk gewesen war, so schlief er hart und ununterbrochen zwei Stunden länger als die Zeit, auf welche er bestellt war. Endlich erwachte er, warf sich in seine Kleider und eilte dem geheimen Zimmer zu. Er fand alles in eben dem Stande, wie er es verlassen hatte: nur der weise Misfragmutosiris und das goldne Kästchen mit den Edelsteinen waren unsichtbar geworden.
Es gibt keine Worte, um die Bestürzung des Königs zu schildern, wie er seine sanguinischen Hoffnungen und sein grenzenloses Vertrauen auf das Haupt des Hermetischen Ordens so grausam betrogen sah. Auf die erste Betäubung des Erstaunens folgte Unwillen über sich selbst, und dieser brach endlich in Verwünschungen und wütende Drohungen gegen den Betrüger aus, der in einer sichern Freistätte seiner Leichtgläubigkeit spottete.
Er war im Begriff, in die Halle herunter zu steigen und alle seine Reisigen und Knechte aufsitzen zu lassen, um dem Flüchtling auf allen Seiten nachzusetzen, als auf einmal ein wunderschöner Jüngling in einem hell glänzenden Gewand, mit einer goldnen Krone auf dem Haupt und einem Lilienstengel in der Hand, vor ihm stand und ihn anredete.
«Ich kenne den Unfall», sprach der Jüngling, «der dich beunruhigt, und bringe dir Entschädigung. Du suchst den Stein der Weisen. Nimm diesen Stein, bestreiche dreimal mit ihm deine Stirne und deine Brust hin und wieder, und du wirst die Erfüllung deines Wunsches sehen.» Mit diesen Worten gab ihm der Jüngling einen purpurroten Stein in die Hand und verschwand.
König Mark sank aus einer Bestürzung in die andre. Er betrachtete den Stein, den er auf eine so wunderbare und unverhoffte Art empfangen hatte, von allen Seiten; und wie wohl er nicht begriff, wie die Erfüllung seiner Wünsche und das Bestreichen seiner Stirne und seiner Brust mit diesem Steine zusammenhänge, so war er doch zu sehr gewohnt, Dinge, von denen er nichts begriff, zu glauben und zu tun, als daß er hätte Anstand nehmen sollen, dem Befehle des Genius Folge zu leisten. Er bestrich sich also Stirne und Brust dreimal mit dem magischen Steine hin und wieder und stand beim dritten Mal - in einen Esel verwandelt da.
Während daß dieses mit dem König vorging, erhob sich auf einem anderen Flügel des Schlosses, wo die Königin wohnte, auf einmal ein entsetzlicher Lärm. Der schöne junge Ritter Floribell (der, wie wir nicht leugnen können, in Verdacht stand, die Nacht im Schlafzimmer der Königin zugebracht zu haben) hatte sich mit dem besten Teil ihrer Juwelen diesen Morgen unsichtbar gemacht.
Mabillje war die erste Person am Hofe, die es gewahr wurde. Sie war im Begriff, vor Scham und Ärger sich ihre schönen Haare aus dem Kopf zu raufen, als eine Dame von unbeschreiblicher Schönheit, in rosenfarbnem Gewand und mit einer Krone von Rosen auf dem Haupt, vor ihr stand und zu ihr sagte: «Ich kenne dein Anliegen, schöne Königin, und komme dir zu helfen. Nimm diese Rose und stecke sie an deine Brust, so wirst du glücklicher werden, als du jemals gewesen bist.»
Mit diesen Worten reichte sie ihr eine Rose aus ihrer Krone und verschwand. Die Königin wußte nichts Besseres zu tun als zu gehorchen; sie steckte die Rose an ihren Busen und sah sich in dem nämlichen Augenblick in eine rosenfarbne Ziege verwandelt und in eine unbekannt wilde Einöde versetzt.
Als die Kammerfrauen des Morgens um die gewöhnliche Stunde herein kamen und weder die Königin noch ihre Juwelen, noch den schönen Floribell fanden, war die Bestürzung und der Lärm so arg, als man es sich vorstellen kann. Man konnte nicht zweifeln, daß sie sich von dem jungen Ritter habe entführen lassen, und man ging, es dem König anzuzeigen.
Aber wie groß ward erst der Schrecken und die Verwirrung, da auch der König und sein neuer Günstling, der Mann mit dem großen weißen Bart, nirgends zu finden waren! Sich vorzustellen, daß König Mark sich von dem alten Graubart habe entführen lassen, war keine Möglichkeit. Man stellte sich also gar nichts vor, wie wohl acht Tage lang in ganz Cornwall von nichts anderem gesprochen wurde.
Die Ritter und Knappen setzten sich alle zu Pferde und suchten den König und die Königin vier Monate lang in allen Winkeln von Britannien. Aber alles Suchen war umsonst. Sie kamen wieder so klug nach Hause, wie sie ausgezogen waren; und das einzige, womit sich das Volk tröstete, war die Überzeugung, daß es ihnen leicht sein werde, wieder einen König zu finden, wenn sie keinen weiseren haben wollten als König Mark,
Der königliche Esel hatte sich in dessen mit vieler Behutsamkeit, um nicht entdeckt zu werden, aus seiner Burg ins Freie hinaus gemacht und war, mißmutig und mit gesenkten Ohren, schon einige Stunden lang durch Wälder und Felder daher getrabt, als er in einem Hohlweg eine junge, mit einem Quersack beladene Bäuerin antraf, deren Wohlgestalt, frische Farbe und schönen blonden Haare ihm beim ersten Anblick etwas einflößten, das sich besser für seinen vorigen als gegenwärtigen Zustand schickte.
Er blieb stehen, um das junge Weib anzugaffen, die sich ganz außer Atem gelaufen hatte und vor Müdigkeit nicht weiter konnte. Die Teilnehmung, die sie diesem allem Ansehen nach herrenlosen Tiere einzuflößen schien, erregte ihre Aufmerksamkeit: sie näherte sich ihm, streichelte ihn mit einer sehr weißen atlasweichen Hand; und da er ganz ruhig still hielt und (zum Zeichen, daß es ihm wohl behage, von einer so weichen Hand gekrabbelt zu werden) die Zähne bleckte und beide Ohren ellenlang vorstreckte, so bekam sie auf einmal Lust, ihn in ihre Dienste zu nehmen, und schwang sich auf seinen Rücken.
Der Esel bequemte sich zu dem ungewohnten Dienste mit einer Gefälligkeit, von deren geheimem Beweggrunde die schöne Bäuerin sich wenig träumen ließ; er schien stolz auf die angenehme Bürde zu sein und trabte so munter mit ihr davon wie der beste Maulesel aus Andalusien.
Wie wohl sie nichts hatte, womit sie ihn lenken konnte, als seine kurze Mähne, schien er doch die Bewegungen ihrer Hände, ja sogar den Sinn ihrer Worte zu verstehen; und so brachte er sie, durch eine Menge Abwege, die sie ihm andeutete, gegen Einbruch der Nacht in eine wilde Gegend an der Seeküste, die von Felsen und Gehölz eingeschlossen und nur gegen die benachbarte See ein wenig offen war.
Sie hielten vor einer mit Kiefern und wildem Gebüsch umwachsenen Höhle still, wo die junge Bäuerin kaum mit etwas heller Stimme zwei- oder dreimal «Kasilde» rief, als ein feiner wohl gewachsener Mann von dreißig bis vierzig Jahren, in Matrosenkleidung, aus der Höhle hervor eilte und, mit großer Freude über ihre Ankunft, ihr von dem lastbaren Tier herunter half.
«Dank sei dem Himmel», rief er, sie umarmend, «daß du da bist, liebe Kasilde; mir war schon herzlich bang, es möchte dir ein Unfall zugestoßen sein.» - «Sage lieber Dank diesem guten Esel», versetzte die Bäuerin lachend; «denn ohne ihn würdest du mich schwerlich so bald, vielleicht gar nicht wiedergesehen haben.» -
«Dafür soll er nun auch ausrasten und so viel Gras oder Disteln fressen, als er in dieser hungrigen Gegend finden kann», sagte jener; «ich bin unendlich in seiner Schuld, daß er dich, und, wie ich sehe, auch den lieben Quersack, so glücklich in meine Arme geliefert hat.»
Der König-Esel stutzte mächtig, da er eine Stimme hörte, die ihm nur gar zu wohl bekannt war. Er betrachtete die beiden Personen (denen er unvermerkt in die Höhle gefolgt war) beim Schein einer Lampe, die aus dem Felsen herab hing, und es kam ihm vor, als ob ihm die Züge des Matrosen und der jungen Bäuerin nicht ganz fremde wären.
Er schaute dem ersten schärfer ins Gesicht: die Ähnlichkeit schien immer größer zu werden; und wie er von ungefähr nach einer Art von steinernem Tische sah, der aus einer von den Felsenwänden hervor ragte, fiel ihm ein langer weißer Bart in die Augen, der auf einmal ein verhaßtes Licht in seinen dumpfen Schädel warf.
«Ha, ha», rief die Bäuerin lachend; «da ist ja auch der Hermetische Bart!» - «Ich weiß wahrlich nicht», sagte der Mann im nämlichen Tone, «warum ich ihn nicht unterwegs in eine Hecke geworfen habe: er hat nun seine Dienste getan, und wir werden ihn schwerlich wieder nötig haben.» «Dafür ist gesorgt», versetzte jene, indem sie auf den Quersack klopfte. «Sieh einmal, und sage, ob ich nicht würdig bin, die Geliebte eines Zeitgenossen des Königs Amasis zu sein.»
«O gewiß», rief der weise Misfragmutosiris, «und des dreimal großen Hermes selbst, wenn du willst. Aber», fuhr er fort, indem er den Sack ausleerte, «wo hast du deine schimmernde Hofritter-Kleidung gelassen, Kasilde?» - «Wie du siehst, habe ich sie mit der ersten hübschen Bäuerin, die ich nach der Stadt zu Markte gehen sah, vertauscht.» -
«Der Schade ist zu verschmerzen», sagte das unsichtbare Haupt des Hermetischen Ordens, indem er den kostbaren Inhalt des Quersackes durchmusterte; «aber damit du mir nicht gar zu stolz auf deine Talente wirst, Mädchen - sieh einmal her, ob ich mir die Abenteuer in der großen Pyramide zu Memphis und den Schrecken, den mir die wetterleuchtenden Drachen am Prachtbett des großen Hermes eingejagt, nicht teuer genug habe bezahlen lassen.»
Man stelle sich vor, wie des armen Esels Majestät dabei zumute war, da er alle die Geschenke, die der schelmische Adept nach und nach von ihm erhalten hatte, mit den gesamten Edelsteinen seiner Kronen und dem größten Teil des Schmuckes der Königin, in funkelnder Pracht auf dem steinernen Tisch ausgebreitet sah. Wäre ihm nicht die unbegrenzte Duldsamkeit zustatten gekommen, die als eine charakteristische Tugend der Gattung, zu welcher er seit kurzem gehörte, von jeher gepriesen worden ist, er würde sich unmöglich haben halten können, die Wut, die in seinem Busen kochte, auf die fürchterlichste Art ausbrechen zu lassen.
«Oh, warum mußte ich nun auch gerade in einen Esel verwandelt werden?» dachte er. «Wäre ich ein Leopard, ein Tiger, ein Nashorn, wie wollte ich! Aber wozu kann das helfen? Mit einem Esel würden sie bald fertig werden.» So sprach der arme König Mark zu sich selbst und lag in seinem Winkel so still und in einen so kleinen Raum zusammen geschmiegt, als ihm nur immer möglich war, um wenigstens seine Neugier zu befriedigen, indem er dem vertraulichen Gespräch dieser zu seinem Unglück verschworenen Schlauköpfe zuhörte.
Nachdem sie ihre Augen an der kostbaren Beute satt geweidet hatten, regte sich ein Bedürfnis von einer dringenderen Art; denn sie hatten beide den ganzen Tag nichts gegessen. Der Adept, der immer an alles dachte, hatte, da ihm in der Burg noch alles zu Gebote stand, sich aus der königlichen Küche mit Vorrat auf etliche Tage reichlich versehen lassen.
Er zog einen Teil davon nebst einer Flasche köstlichen Weins aus seinem Sack, und während sie es sich trefflich schmecken ließen, vergaßen sie nicht, sich durch tausend leichtfertige Einfälle über die Leichtgläubigkeit des Königs von Cornwall und die Schwachheit seiner tugendreichen Gemahlin lustig zu machen.
«Nun muß ich dir doch erzählen, lieber Gablitone», sagte die schöne Spitzbübin, «wie ich es anfing, um die Tugend der guten Königin so kirre zu machen, daß ich Gelegenheit bekam, unseren Anschlag auszuführen.»
«Wie du das anfingst, Kasilde? So wie du in deiner Hofritterkleidung aussahst, und bei allen deinen übrigen Gaben - welche Königin in der Welt hätte sich nicht von dir fangen lassen?»
«Schmeichler! Die meinige zappelte noch im Garne so heftig, daß sie es beinahe zerrissen hätte. Meinen Verführungskünsten würde sie vielleicht widerstanden haben: aber die Eifersucht über die Buhlereien des Königs, die Langeweile, die Gelegenheit, eine gereizte Einbildungskraft und unbefriedigte Sinne kämpften für mich, und sie wurde endlich überwältigt, indem sie sich bis auf den letzten Augenblick wehrte.
Das Fest, das der König am Tage vor unsrer Entweichung gab, beförderte mein Glück nicht wenig. Ich verdoppelte die Lebhaftigkeit meiner Anfälle auf ihr Herz; Tanz und griechische Weine hatten ihr Blut erhitzt; eine gewisse Fröhlichkeit, der sie sich überließ, machte sie sorglos und zuversichtlich; sie tat, was sie noch nie getan hatte, sie machte sich ein Spiel aus meiner Leidenschaft und verwickelte sich unvermerkt immer stärker, je weniger sie Gefahr zu sehen schien.
Endlich wirkte das Opiat, das ich zu gehöriger Zeit in ihren Wein hinein praktiziert hatte. Eine angenehme Mattigkeit überfiel ihre Sinne, ihre Augen funkelten lebhafter, aber ihre Knie erschlafften; sie schrieb es der Müdigkeit vom Tanze zu und begab sich in ihr Schlafgemach. Sobald ihre Jungfrauen sie zu Bette gebracht hatten, kamen sie in den Tanzsaal zurück, und ich schlich mich davon.
Mabillje erschrak nicht wenig, da sie, schon halb eingeschlummert, mich vor ihrem Bette sah. Gleichwohl merkte ich, daß ich nicht ganz unerwartet kam und daß ein anderer an meinem Platze klüger getan hätte, etwas später zu kommen. Genug, die Delikatesse, womit ich, vermöge der Vorteile meines Geschlechts, meine vorgebliche Leidenschaft in diesen kritischen Augenblicken zu mäßigen wußte, ohne darum weniger zärtlich und feurig zu scheinen, gewann unvermerkt so viel über die gute Dame, daß ich mich, wenn der Schlaftrunk nicht so wirksam gewesen wäre, in keiner geringen Verlegenheit befunden haben würde.
Aber er überwältigte sie gar bald unter so zärtlichen Liebkosungen, daß sie beim Erwachen sich vermutlich für viel strafbarer halten wird, als ich sie machen konnte; und dieses Kästchen von Ambra mit dem besten Teil ihres Geschmeides ist der Beweis, daß ich meine Zeit nicht mit Betrachtung ihrer schlummernden Reize verlor, wie vielleicht der weise Misfragmutosiris selbst an meinem Platze getan haben möchte.»
«Spitzbübin», sagte Gablitone, indem er sie auf die Schulter klopfte; «jedes von uns war auf seinem gehörigen Posten. Du hast deine Rolle wie eine Meisterin gespielt; und weniger konnte ich auch nicht von dir erwarten, als ich dich beredete, das Theater zu Alexandria zu verlassen und mir den Plan ausführen zu helfen, der uns so glücklich gelungen ist.
Wir haben nun genug, um künftig bloß unsere eigenen Personen zu spielen. Morgen soll uns ein Fischerboot nach Kleinbritannien hinüber bringen, und von dort wird es uns nicht an Gelegenheit fehlen, in unser Vaterland zurückzukehren. Inzwischen, schöne Kasilde, laß uns dem guten Beispiel unseres Esels folgen, der dort im Winkel eingeschlafen ist. Wir sind hier vor allen Nachsetzern sicher und bedürfen der Ruhe.»
Der königliche Esel war nichts weniger als eingeschlafen, wie wohl er sich so gestellt hatte. Der Verdruß, sich so schändlich hintergangen zu sehen, ein Augen- und Ohrenzeuge der Ränke und des glücklichen Erfolges der Betrüger und (was noch das ärgste war) aus einem König in einen Esel verwandelt zu sein, seine Feinde vor Augen zu sehen und sich nicht an ihnen rächen zu können, ja in seiner Eselsgestalt noch sogar selbst ein Werkzeug ihres Glückes gewesen zu sein, alles das schnürte ihm die Kehle so zusammen, daß er kaum noch atmen konnte.
Aber eine andere Szene, die in alle Leidenschaften, welche in seinem Busen kochten, noch das Furiengift des Neides goß, setzte ihn auf einmal in solche Wut, daß er nicht länger von seinen Bewegungen Meister war. Er sprang mit einem gräßlichen Geschrei von seinem Lager auf und über die beiden Glücklichen her, die sich einer solchen Ungezogenheit von ihrem Esel so wenig versehen hatten, daß sie etliche tüchtige Hufschläge davon trugen, ehe sie sich seiner erwehren konnten.
Aber der Handel fiel doch zuletzt, wie natürlich, zum Nachteil des unglücklichen Königs aus; denn der ergrimmte Adept fand bald einen Knüttel, womit er einen so dichten Hagel von Schlägen auf den Kopf und Rücken des langohrigen Geschöpfes regnen ließ, daß es halb tot zu Boden fiel und zuletzt, nachdem jener auf inständiges Bitten der mitleidigen Kasilde seiner Rache endlich Grenzen setzte, in einem höchst kläglichen Zustand zur Höhle hinaus geschleppt wurde.
Der arme Mark war nunmehr auf einen Grad von Elend gebracht, wo der Tod das einzige zu sein scheint, was einem, der ein Mensch und ein König gewesen war, in einer solchen Lage noch zu wünschen übrig ist. Aber der mächtige Trieb der Selbsterhaltung ringt in jedem lebenden Wesen dem Tode bis zum letzten Hauch entgegen.
Der gemißhandelte Esel kroch, so weit er konnte, von der verhaßten Höhle ins Gebüsch, und ein paar Stunden Ruhe, die freie Luft und etwas frische Weide, die er auf einem offenen Platze des Waldes fand, brachten ihn so weit, daß er mit Anbruch des Tages seine Beine wieder ziemlich munter heben konnte. Er lief den ganzen Tag in der Wildnis herum, ohne einen anderen Zweck, als sich von den Wohnungen der Menschen zu entfernen, in deren Dienstbarkeit zu geraten er nun für das einzige Unglück hielt, das ihm noch begegnen konnte; denn von Wölfen und anderen reißenden Tieren war das Land ziemlich gereinigt.
So trabte er den ganzen Tag auf ungebahnten Pfaden daher, stillte seinen Hunger, so gut er konnte, trank, wenn er Durst hatte, aus einer Quelle oder Pfütze und schlief des Nachts in irgendeinem dicken Gebüsch, wie wohl ihn die Erinnerung an seinen vorigen Zustand wenig schlafen ließ. Das Seltsamste bei dem allen war, daß er die unselige Grille, die ihm so teuer zu stehen kam, das Verlangen nach dem Besitze des Steins der Weisen, auch in seinem Eselsstand nicht aus dem Kopf kriegen konnte. Den Tag über dachte er an nichts andres, und des Nachts träumte ihm von nichts anderem.
Der wohltätige Genius, der den Entschluß gefaßt hatte, ihn von dieser Torheit zu heilen, machte sich diese Disposition seines Gehirnes zunutze und wirkte durch einen Traum, was vielleicht die Vorstellungen und Gründe aller Weisen des Erdbodens wachend nicht bei ihm bewirkt haben würden.
Ihm träumte, er sei noch König von Cornwall, wie ehemals, und stehe voll Unmut über einen mißlungenen Versuch an seinem chemischen Herde. Auf einmal sah er den schönen Jüngling wieder vor sich stehen, von welchem er den purpurroten Stein empfangen zu haben sich sehr wohl erinnerte.
«König Mark», sprach der Genius mit einer Stirn voll Ernstes zu ihm, «ich sehe, daß das Mittel, wodurch ich dich von deinem Wahnsinne zu heilen hoffte, nicht angeschlagen hat. Du verdienst, durch die Gewährung deiner Wünsche bestraft zu werden. Vergeblich würdest du bis ans Ende der Tage den Stein der Weisen suchen, denn es gibt keinen solchen Stein; aber nimm diese Lilie, und alles, was du mit ihr berührst, wird zu Golde werden.» Mit diesen Worten reichte ihm der Jüngling die Lilie dar und verschwand.
König Mark stand einen Augenblick zweifelhaft, ob er dem Geschenke trauen sollte; aber seine Neugier und sein Durst nach Gold überwogen bald alle Bedenklichkeiten: er berührte einen Klumpen Blei, der vor ihm lag, mit der Lilie, und das Blei wurde zum feinsten Gold. Er wiederholte den Versuch an allem Blei und Kupfer, womit das Gewölbe angefüllt war, und immer mit dem nämlichen Erfolg.
Er berührte endlich einen großen Haufen Kohlen: auch dieser wurde in einen ebenso großen Haufen Gold verwandelt. Die Wonne Trunkenheit des betörten Königs war unaussprechlich. Er ließ unverzüglich zwölf neue Münzhäuser errichten, wo man Tag und Nacht genug zu tun hatte, alles Gold, das er mit seiner Lilie machte, in Münzen aller Arten auszuprägen.
Da in Träumen alles sehr schnell vonstatten geht, so befanden sich in kurzem alle Gewölbe seiner Burg mit mehr barem Gelde angefüllt, als jemals auf dem ganzen Erdboden im Umlauf gewesen ist. «Nun», dachte Mark, «ist die Welt mein.» Er fragte sich selbst, was ihn gelüstete, und sein Gold verschaffte es ihm, es mochte noch so kostbar oder ausschweifend sein.
Mit der Willkür, über eine unerschöpfliche Goldquelle zu gebieten, geriet er sehr natürlicherweise in den Wahn, daß er alles vermöge; er wollte also auch seine Wünsche ebenso schleunig ausgeführt wissen, als sie in ihm entstanden, und was er gebot, sollte auf den Sturz da stehen. Seine Untertanen zogen daher wenig Vorteil von dem unermeßlichen Aufwand, den er machte; denn er ließ ihnen keine Zeit, weder die zu seinen Unternehmungen nötigen Materialien herbeizuschaffen noch sie zu verarbeiten.
Zudem fehlte es auch in seinem Lande an Künstlern; und zu warten, bis er durch seine Unterstützung welche erzogen hätte, konnte ihm gar nicht einfallen. Wozu hätte er das auch nötig gehabt? Es fanden sich Künstler und Arbeiter aus allen Enden der Welt bei ihm ein, und alle nur ersinnliche Produkte und Waren wurden ihm aus Italien, Griechenland und Ägypten in unendlichem Überfluß zugeführt.
Er ließ Berge abtragen, Täler ausfüllen, Seen austrocknen, schiffbare Kanäle graben; er führte herrliche Paläste auf, legte zauberische Gärten an, erfüllt diese und jene mit allen Reichtümern der Natur, mit allen Wundern der Künste, und das alles, sozusagen, wie man eine Hand umwendet.
Die schönsten Weiber, die vollkommensten Virtuosen, die sinnreichsten Erfinder neuer Wollüste, alles, was jede seiner Leidenschaften, Gelüste und Launen reizen und befriedigen konnte, stand zu seinem Gebot. Er gab Turniere, Schauspiele und Gastmähler, wie man noch keine gesehen hatte, und verschwendete oft in einem Tage mehr Gold, als die reichsten Könige im ganzen Jahre einzunehmen hatten.
Bei allem diesem zog die ungeheure Menge Gold, die er auf einmal in die Welt ergoß, einige sehr beträchtliche Unbequemlichkeiten nach sich. Die erste war, daß die Fremden, die aus allen Ländern der Welt herbei strömten, ihm ihre Waren, ihre Köpfe, Hände oder Füße anzubieten, sobald sie von der Unerschöpflichkeit seiner Goldquelle benachrichtigt waren, ihre Preise in kurzer Zeit erst um hundert, dann um tausend, zuletzt um zehntausend Prozent steigerten.
Alle Produkte des Kunstfleißes wurden so teuer, das Gold hingegen wegen seines Überflusses so wohlfeil, daß er endlich ganz unfähig ward, als ein Zeichen des Wertes der Dinge im Handel und Wandel gebraucht zu werden. Aber bevor er soweit kam, zeigte sich eine noch weit schlimmere Folge der magischen Lilie, die in den Händen des Königs die Stelle des Steins der Weisen vertrat.
Denn während seine grenzenlose Hoffart, Üppigkeit und Verschwendung die halbe Welt mit Gold überschwemmte, verhungerte der größte Teil seiner eigenen Untertanen, weil ihnen beinahe alle Gelegenheit, etwas zu verdienen, abgeschnitten war.
Ackerbau und Gewerbe lagen darnieder; denn wer hätte sich im Lande noch damit abgeben sollen, da man alle Notwendigkeiten und Überflüssigkeiten des Lebens in allen Häfen des Königreiches zu allen Zeiten in größter Güte und Vollkommenheit haben konnte und da überdies alle hübschen jungen Leute vom Lande nur nach der Hauptstadt zu gehen brauchten, um tausend Gelegenheiten zu finden, durch Müßiggehen dort ein ganz anderes Glück zu machen, als sie an ihrem Orte durch Arbeit und Wirtschaft zu machen hoffen konnten?
König Mark, sobald er von der Not des Volkes Bericht erhielt, glaubte ein unfehlbares Mittel dagegen zu besitzen und säumte nicht, in allen Städten, Flecken und Dörfern des Landes so viel Gold austeilen zu lassen, daß sich der ärmste Tagelöhner auf einmal reicher sah, als es vormals sein Edelmann gewesen war.
Mark glaubte dadurch dem Übel abgeholfen zu haben: aber er hatte aus Übel Ärger gemacht. Denn nun hörte vollends aller Fleiß und alle häusliche Tugend auf. Jedermann wollte sich nur gute Tage machen, und in kurzem waren alle diese Reichtümer, die so wenig gekostet hatten, in Saus und Braus und unter den zügellosesten Ausschweifungen durchgebracht.
Der König konnte nicht Gold genug machen; und wie es endlich seinen Wert gänzlich verlor, so stellte sich wieder der vorige Mangel ein, der aber nun durch die Erinnerung der goldnen Tage des Wohllebens desto unerträglicher fiel und unter einem Volke, das alles sittliche Gefühl und alle Scheu vor den Gesetzen verloren hatte, ein allgemeines Signal zu Raub, Mord und Aufruhr wurde.
Der König, der sich und sein Volk vor lauter Reichtum in Bettler verwandelt sah, wußte sich nicht zu helfen; aber er hatte noch nicht alle Früchte seines wahnsinnigen Wunsches gekostet. Sie blieben nicht lange aus. Sein von allen Arten der Schwelgerei erschöpfter und zerrütteter Körper erlag endlich den übermäßigen Anstrengungen der Lüste; sein Magen hörte auf zu verdauen, seine Kräfte waren dahin, seine abgenutzten Sinne taub für jeden Reiz des Vergnügens; scheußliche Krankheiten, von den empfindlichsten Schmerzen begleitet, rächten die gemißbrauchte Natur und ließen ihn in den besten Jahren seines Lebens alle Qualen einer langsamen Vernichtung fühlen.
In diesem Zustand merkte König Mark, daß es noch ein elenderes Geschöpf abgebe als einen halb tot geprügelten Esel und daß dieses elendste aller Geschöpfe ein König sei, dem irgendein feindseliger Dämon die Gabe, Gold zu machen, gegeben und der unsinnig genug habe sein können, ein so verderbliches Geschenk anzunehmen.
Aber wie unbeschreiblich war dafür auch seine Freude, da er mitten in diesem peinvollen Zustand erwachte und im nämlichen Augenblick fühlte, daß alles nur ein Traum und er selbst glücklicherweise der nämliche Esel sei, wie zuvor! Er stellte jetzt, in der lebhaften Spannung, die dieser Traum seinem Gehirne gegeben hatte, Betrachtungen an, wie sie vermutlich noch kein Geschöpf seiner Gattung vor ihm angestellt hat; und das Resultat davon war, daß er aus voller Überzeugung bei sich selbst festsetzte, lieber ewig ein Esel zu bleiben, als ein König ohne Kopf und ein Mensch ohne Herz zu sein.
Während der Nutzanwendung, welche der königliche Esel aus seinem Traum zog, war der Morgen angebrochen; und wie er sich aufmachte, um die Gegend, in die er geraten war, ein wenig auszukundschaften, ward er am Fuß eines mit Tannen und Kiefern bewachsenen Felsens eine Art von Einsiedelei gewahr, um welche einige Ziegen herumkletterten und hier und da, wo sich zwischen den Spalten oder auf den flachren Teilen des Felsens etwas Erde angesetzt hatte, ihre Nahrung suchten.
Vor der Einsiedelei zog sich ein schmaler, sanft an den Felsen angelegter Hügel hin, wovon der Fleiß des Menschen, der auch die wildeste Gegend zu bezähmen weiß, einen Teil zu einem Küchengarten angebaut und den anderen mit allerlei Arten von Obstbäumen bepflanzt hatte, die unter dem Schirm der benachbarten Berge sehr wohl zu gedeihen schienen und das romantische Ansehen dieser Wildnis vermehrten.
Indem der gute Mark ziemlich nahe, aber von einem dünnen Gesträuch bedeckt, alles dies mit einigem Vergnügen betrachtete, sah er eine Magd mit einem großen Krug auf dem Kopf aus der Hütte hervor gehen, um an einer Quelle, welche fünfzig Schritte davon aus dem Felsen hervor sprudelte, Wasser zu holen.
Sie schien eine Person von vierundzwanzig Jahren zu sein, wohlgebildet, schlank, etwas bräunlich, aber dem Ansehen nach von blühender Gesundheit und munterem gut launigem Wesen, wie Mark, der jetzt seine Menschheit wieder fühlte, aus ihrem leichten Gang und seinem Liedchen, das sie vor sich her trällerte, zu erkennen glaubte.
Sie ging in einem leichten, aber reinlichen bäurischen Anzug daher, ohne Halstuch, die Haare in einen Wulst zusammen gebunden, und indem sie sich im Vorbeigehen bückte, um eine frisch aufgeblühte Rose zu brechen und vorzustecken, hatte er einen Augenblick Gelegenheit, eine Bemerkung zu machen, die den Hofbusen, an die er gewöhnt war, wenig schmeichelte.
Das wenige, was ihn ein nicht allzu langer Rock von ihrem Fuße sehen ließ, bestärkte ihn vollends in der günstigen Meinung, die er nach diesem Muster von den Töchtern der kunstlosen Natur zu fassen anfing. Aber mit allen diesen Bemerkungen ward auch der Verdruß über seine gegenwärtige Gestalt wieder so lebhaft, daß er Kopf und Ohren voll Verzweiflung sinken ließ und (was noch nie ein Esel getan hat noch jemals tun wird) mit dem Gedanken umging, sich von einem der benachbarten Felsen in die Schlucht herabzustürzen.
Er entfernte sich mit einem schweren Seufzer von dem Ort, wo er ein so schmerzliches Gefühl seiner zur Hälfte verlorenen Menschheit bekommen hatte, und war im Begriff, den Gedanken der Verzweiflung auszuführen, als ihm unversehens eine aus dem Gras empor prangende Lilie in die Augen fiel.
Ihn schauderte vor ihrem Anblick; aber zu gleicher Zeit wandelte ihn eine so starke Begierde an, diese Lilie aufzuessen, daß er sich dessen nicht enthalten konnte.
Kaum hatte er sie mit Blume und Stengel hinab geschlungen, o Wunder! so verschwand seine verhaßte Eselsgestalt, und er fand sich in einen wohl gewachsenen, nervigen, von Kraft und Gesundheit strotzenden Bauernkerl von dreißig Jahren verwandelt, der (außer dem, was in der menschlichen Bildung allen gemein ist) mit dem, was er sich erinnerte, vor seiner ersten Verwandlung gewesen zu sein, wenig Ähnliches hatte.
Das Sonderbarste dabei war, daß er mit dem völligsten Bewußtsein, noch vor wenig Tagen Mark, König von Cornwall, gewesen zu sein, und mit deutlicher Erinnerung aller Torheiten, die er in dieser Periode seines Lebens begangen, eine ganz andere Vorstellungsart in seinem Gehirn eingerichtet fand, eine ganz andere Art von Herz in seinem Busen schlagen fühlte und an Leib und Seele bei diesem Tausche stark gewonnen zu haben glaubte.
Man kann sich einbilden, wie groß seine Freude über eine so unverhoffte Veränderung war. Er dachte mit Schaudern daran, was sein Schicksal hätte sein können, wenn er wieder König Mark geworden wäre; und so lebhaft war der Eindruck, den er von seinem Traum noch in seiner Seele fand, daß ihn däuchte, wenn er wählen müßte, er wollte lieber wieder zum Esel als zum König Mark von Cornwall werden.
Unter diesen Gedanken befand er sich unvermerkt wieder vor der Hütte, aus welcher er die Frauensperson mit dem Krug auf dem Kopfe hatte hervor gehen sehen. Ihm war, als ob ihn eine unsichtbare Gewalt nach der Hütte hinzöge. Er ging hinein und fand einen steinalten Mann mit einem eisgrauen Bart in einem Lehnstuhl und gegenüber ein zusammengeschrumpftes Mütterchen an einem Spinnrocken sitzen.
Beim Anblick des eisgrauen Bartes wandelte ihn eine Erinnerung an, die ihn einen Schritt zurück warf; aber alles übrige in dem Gesichte des alten Mannes paßte so gut zu diesem ehrwürdigen Barte und flößte zugleich so viel Ehrfurcht und Liebe ein, daß er sich augenblicklich wieder faßte und die ehrwürdigen Bewohner dieser einsamen Hütte um Vergebung bat, daß er ohne Erlaubnis sich bei ihnen eingedrungen habe.
«Ich irre», sprach er, «durch einen Zufall, der mich aus meinem Wege warf, schon zwei Tage in dieser wilden Gegend herum, und meine Freude, endlich eine Spur von Menschen darin anzutreffen, war so groß, daß es mir unmöglich gewesen wäre, vorbei zu gehen, ohne die Bewohner dieser Hütte zu grüßen, wenn mich auch kein anderes Bedürfnis dazu getrieben hätte.»
Die beiden alten Leutchen hießen ihn freundlich willkommen, und da die Magd inzwischen ihr Frühstück herein gebracht hatte, nötigten sie ihn, sich zu ihnen zu setzen und mitzuessen. In kurzem wurden sie so gute Freunde, daß Mark, der sich den Namen Sylvester gab, sich aufgemuntert fühlte, ihnen seine Dienste anzubieten.
«Ich bin», sprach er, «ein rüstiger junger Mann, wie ihr seht; ihr seid alt, und die junge Frauensperson hier mag doch wohl einen Gehilfen zu Beschickung dessen, was das Haus erfordert, nötig haben, wie wohl sie flink und von gutem Willen scheint. Ich habe Lust und Kräfte zum Arbeiten; wenn ihr mich annehmen wollt, so will ich alle Arbeit, die einen männlichen Arm erfordert, übernehmen und euch in Ehren halten wie meine leiblichen Eltern.»
Die Magd, die inzwischen ab- und zugegangen war und den Fremden seitwärts, wenn sie nicht bemerkt zu werden glaubte, mit Aufmerksamkeit betrachtet hatte, errötete bei dieser Erklärung, schien aber vergnügt darüber zu sein, wie wohl sie tat, als ob sie nicht zugehört hätte, und ungesäumt wieder an ihre Arbeit ging.
Die Alten nahmen das Erbieten des jungen Mannes mit Vergnügen an, und Sylvester, der unter einer Schuppe neben der Wohnung das nötige Feld- und Gartengeräte fand, installierte sich noch an dem selben Tage in seinem neuen Amte, indem er rings um die Wohnung alle noch unbepflanzten Plätze auszustocken und umzugraben anfing, um sie teils zu Kohl- und Rübenland, teils zum Anbau des nötigen Getreides zuzurichten.
Diese Arbeit beschäftigte ihn mehrere Wochen; und wie er damit fertig war, fing er an, einen Keller in den Felsen zu hauen, und brachte alle Zeit damit zu, die ihm die Garten- und Feldarbeit übrig ließ. Das alte Paar gewann ihn so lieb, als ob er ihr leiblicher Sohn gewesen wäre, und er fühlte sich alle Tage glücklicher bei einer Lebensart, die ihm so leicht und bekannt vorkam, als ob er dazu geboren und erzogen gewesen wäre.
Nie hatte ihm als König Essen und Trinken so gut geschmeckt, denn ihn hatte nie gehungert noch gedürstet; nie hatte er so wohl geschlafen, denn er hatte sich nie müde gearbeitet, noch sich mit so ruhigem Herzen niedergelegt; nie war er zu den Lustbarkeiten des Tages so fröhlich aufgestanden als jetzt zu mühsamer Arbeit; nie hatte er das angenehme Gefühl, nützlich zu sein, gekannt.
Kurz, nie hatte er solche Freude an seinem Dasein, solche Ruhe in seinem Gemüt und so viel Wohlwollen und Teilnehmung an den Menschen, mit denen er lebte, empfunden; denn nun war er selbst ein Mensch, und nichts als ein Mensch; und wie hätte er das sein können, als er König, und was noch ärger ist, ein törichter und lasterhafter König war?
Mittlerweile hatten Sylvester und die junge Frauensperson, die sich Rosine nannte, täglich so manche Gelegenheit, sich zu sehen, daß es in ihrer Lage ein gewaltiger Bruch in die Naturgesetze gewesen wäre, wenn die Sympathie, welche sich schon in der ersten Stunde bei ihnen zu regen anfing, nicht zu einer gegenseitigem Freundschaft hätte werden sollen, die in kurzem alle Kennzeichen der Liebe hatte und, ungeachtet sie einander noch kein Wort davon gesagt, sich auf so vielfältige Art verriet, daß das Einverständnis ihrer Herzen und Sinne keinem von beiden ein Geheimnis war.
Endlich kam es an einem schönen Sommerabend zur Sprache, da sie im Walde - er, bei der Beschäftigung, dürres Reisholz zusammenzubinden, sie, indem sie junges Laub für ihre Ziegen abstreifte - wie von ungefähr zusammenkamen. Anfangs war der Kreis, innerhalb dessen sie in der Entfernung eines ganzen Durchmessers arbeiteten, ziemlich groß; aber er wurde unvermerkt immer kleiner und kleiner; und so geschah es zuletzt, daß sie, ohne daß es eben ihre Absicht zu sein schien, sich nahe genug beisammen fanden, um während der Arbeit ein freundliches Wort zusammen zu schwatzen.
Die Wärme des Tages und die Bewegung hatte Rosinens bräunlichen Wangen eine so lebhafte Röte, und ich weiß nicht was anderes, das ihren Busen aus seinen Windeln zu drängen schien, ihren Augen einen so lieblichen Glanz gegeben, daß Sylvester sich nicht erwehren konnte, vor ihr stehen zu bleiben und sie mit einer Sehnsucht zu betrachten, die den beredtesten Liebesantrag wert war.
Rosine war vierundzwanzig Jahr alt und eine unverfälschte Tochter der Natur. Sie stellte sich nicht, als ob sie nicht merke, was in ihm vorging, noch fiel es ihr ein, ihm verbergen zu wollen, daß sie ebenso gerührt war wie er. Sie sah ihm freundlich ins Gesicht, errötete, schlug die Augen nieder und seufzte.
«Liebe Rosine!» sagte Sylvester, indem er sie bei der Hand nahm, und konnte kein Wort weiter herausbringen, so voll war ihm das Herz. «Ich merke schon lange», sagte Rosine, nach einer ziemlichen Pause, mit leiserer Stimme, «daß du mir gut bist, Sylvester.»
«Daß ich dir gut bin, Rosine? Was in der Welt wollte ich nicht für dich tun und für dich leiden, um dir zu zeigen, wie gut ich dir bin!» rief Sylvester und drückte ihr die Hand stark genug an sein Herz, daß sie sein Schlagen fühlen konnte. «So ist mir es auch», versetzte Rosine, «aber...»
«Aber was? Warum dies Aber, wenn ich dir nicht zuwider bin, wie du sagst?» «Ich weiß nicht, was ich dir antworten soll, Sylvester: ich bin dir herzlich gut; ich wollte lieber dein sein, als die vornehmste Frau in der Welt heißen - aber mir ist, es werde nicht angehen können.»
«Und warum sollte es nicht angehen können, da wir uns beide gut sind?» «Weil es - eine gar besondere Sache mit mir ist», sagte Rosine stockend. «Wieso, Rosine?» fragte Sylvester, indem er ihre Hand erschrocken fahren ließ. «Du wirst mir es nicht glauben, wenn ich dir es sage.» «Ich will dir alles glauben, liebe Rosine, rede nur!»
«Ich bin nur zwei Tage, ehe ich dich zum ersten Male sah, eine - rosenfarbene Ziege gewesen.» «Eine rosenfarbene Ziege? Doch wenn es nichts weiter ist als dies, so haben wir einander nichts vorzuwerfen, liebes Mädchen; denn um eben die selbe Zeit war ich, mit Respekt, ein Esel.»
«Ein Esel?» rief Rosine ebenso erstaunt wie er; «das ist sonderbar! Aber wie ging es zu, daß du es wurdest und daß du nun wieder Mensch bist?» «Mir erschien in einem Augenblicke, da ich mir aus Verzweiflung das Leben nehmen wollte, ein wunderschöner Jüngling mit einer Lilie in der Hand, gab mir einen Stein, mit welchem ich mich bestreichen sollte, und sagte mir, dies würde mich glücklich machen. Ich bestrich mich mit dem Stein und wurde zum Esel.»
«Erstaunlich!» sprach Rosine. «Mir erschien, da ich mir eben vor Herzeleid alle Haare aus dem Kopfe raufen wollte, eine wunderschöne Dame mit einer Rosenkrone auf der Stirn. Sie gab mir eine von diesen Rosen. ‹Stecke sie vor den Busen›, sagte sie, ‹so wirst du glücklicher werden, als du jemals gewesen bist.› Ich gehorchte ihr und wurde stracks in eine rosenfarbene Ziege verwandelt.»
«Wunderbar! Aber wie kam es, daß du wieder Rosine wurdest?» «Ich irrte beinahe einen ganzen Tag in Wäldern und Gebirgen herum, bis ich von ungefähr in diese Wildnis und an die Hütte der beiden Alten kam. Nicht weit davon, am Fußsteig, der nach der Quelle führt, erblickte ich einen großen Rosenbusch. Da wandelte mich eine unwiderstehliche Begierde an, von diesen Rosen zu essen; und kaum hatte ich das erste Blatt hinab geschluckt, so war ich, wie du mich hier siehst, aber nicht, was ich zuvor gewesen war.»
«Mit mir ging es gerade ebenso», erwiderte Sylvester. «Ich fand eine Lilie dort im Walde; mich kam eine unwiderstehliche Begierde an, sie zu verschlingen; und da ward ich, was du siehst und was ich vorher nicht gewesen war. Es ist eine wunderbare Ähnlichkeit in unsrer Geschichte, liebe Rosine. Aber was warst du denn vorher, ehe du in eine Ziege verwandelt wurdest?»
«Die unglücklichste Person von der Welt. Ein Betrüger, der sich durch die feinste Verstellung in meine Gunst eingeschlichen hatte, fand, ich weiß nicht wie, ein Mittel, sich in mein Schlafzimmer zu schleichen, und machte sich mit allen meinen Juwelen aus dem Staube.»
«Immer wunderbarer! » rief Sylvester. «ein andrer Betrüger spielte ungefähr die nämliche Geschichte mit mir. Er machte mir weiß, er besitze ein Geheimnis, mich zum reichsten Mann in der Welt zu machen; aber es war ein Mittel, mich um den Wert einiger Tonnen Goldes zu prellen und damit unsichtbar zu werden. Aber diesem nach müssen wir, wie es scheint, alle beide sehr vornehme Leute gewesen sein?»
«Du magst mir's glauben oder nicht, aber ich war wirklich eine Königin.» «Desto besser, liebste Rosine!» rief Sylvester, «so kannst du mich ohne Bedenken heiraten: denn ich selbst war auch nichts Geringers als ein König.» «Seltsam, wenn es dein Ernst ist! - Aber...»
«Wie, Rosine, schon wieder ein Aber, da ich es mir am wenigsten versehen hätte?» «Du kannst mich nicht heiraten, denn mein Gemahl ist noch am Leben.» «Die Wahrheit zu sagen, ich fürchte, dies ist auch bei mir der Fall.» «Du liebtest also deine Gemahlin nicht?»
«Sie war eine ganz hübsche Frau, wie wohl bei weitem nicht so hübsch wie du. Aber was willst du? Ich war ein König, und in der Tat keiner von den besten. Ich liebte die Veränderung; meine Gemahlin war mir zu einförmig, zu zärtlich, zu tugendhaft und zu eifersüchtig. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sie mir mit allen diesen Eigenschaften zur Last war.»
«So warst du ja um kein Haar besser als der König, dessen Gemahlin ich war, als ich noch die Königin Mabillje hieß.» «Wie, Rosine, dein Gemahl war der König Mark von Cornwall?» «Nicht anderes.» «Und der schöne junge Ritter, der sich in dein Schlafzimmer schlich und dir deine Juwelen stahl, nannte sich Floribell von Nikomedien?» «Himmel!» rief Rosine bestürzt, «wie kannst du das alles wissen, wenn du nicht...»
«Mein Mann selber bist?» fiel ihr Sylvester ins Wort, indem er ihr zugleich um den Hals fiel. «Das bin ich, liebste Rosine, oder Mabillje, wenn du dich lieber so nennen hörst; und wenn du mir als Sylvester nur halb so gut sein kannst, wie ich dir als Rosine bin, so haben der Jüngling mit dem Lilienstengel und die Dame mit der Rosenkrone ihr Wort treulich gehalten.»
«Oh, wie gern wollte ich nichts als Rosine für dich sein! Aber, armer Sylvester», sprach sie weinend, indem sie sich aus seinen Armen wand, «ich fürchte, ich bin deiner nicht mehr wert. Zwar, mit meinem Willen geschah es nicht, aber der Bösewicht muß Zauberei gebraucht haben. Denn es überfiel mich ein übernatürlicher Schlaf, leider! gerade da ich aller meine Kräfte am nötigsten hatte, um mich von ihm loszumachen; und was kann ich besorgen, als daß er sich...»
«Über diesen Punkt kannst du ruhig sein», sagte Sylvester lachend; «dein Bösewicht war ein verkleidetes Mädchen, eine Tänzerin von Alexandrien, die sich mit dem Goldmacher Misfragmutosiris heimlich verbunden hatte, uns in Gesellschaft zu bestehlen. Ein glücklicher Zufall brachte mich, da ich noch ein Esel war, in die Höhle, wohin sie sich mit ihrer Beute flüchteten, und ich hörte alles aus ihrem eigenen Munde.»
«Wenn dies ist», sprach Rosine, indem sie sich in seine Arme warf, «so bin ich das glücklichste Geschöpf, solange du Sylvester bleibst...» «Und ich der glücklichste aller Männer, wenn du nie aufhörst, Rosine zu sein.»
«Seid ihr das?» hörten sie zwei bekannte Stimmen sagen; und als sie sich umsahen, wie erschraken sie, den Greis mit dem eisgrauen Bart und das gute alte Mütterchen vor sich zu sehen!
Sylvester wollte eben eine Entschuldigung vorbringen; aber bevor er noch zu Worte kommen konnte, verwandelte sich der Greis in den Jüngling mit dem Lilienstengel und das Mütterchen in die Dame mit der Rosenkrone.
«Ihr seht», sprach der schöne Jüngling, «diejenigen wieder, die es auf sich nahmen, euch glücklich zu machen, als ihr euch für die unglücklichsten aller Wesen hieltet, und ihr seht uns zum letzten Male. Noch steht es in eurer Willkür, ob ihr wieder werden wollt, was ihr vor eurer Verwandlung wart, oder ob ihr Sylvester und Rosine bleiben wollt. Wählt!»
«Laßt uns bleiben, was wir sind», riefen sie aus einem Munde, indem sie sich den himmlischen Wesen zu Füßen warfen; «der Himmel bewahre uns, einen anderen Wunsch zu haben!»
«So haben wir unser Wort gehalten», sprach die Dame, «und ihr habt in dieser Wildnis den Stein der Weisen gefunden!»
Mit diesen Worten verschwanden die beiden Geister, und Sylvester und Rosine eilten beim lieblichen Scheine des Mondes Arm in Arm nach ihrer Hütte zurück.
Christoph Martin Wieland - Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
NADIR UND NADINE ...
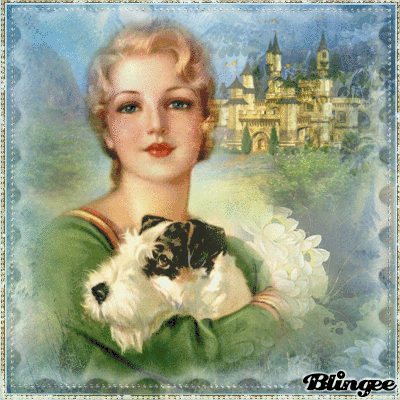
Zwischen unersteiglichen Felsen, die sich nur auf einer Seite auftun, wo das Meer einen kleinen Busen in das Land hinein macht, zieht sich ein langes, fruchtbares, der Welt unbekanntes Tal, das die Einwohner in ihrer Sprache «die ruhige Aue» nennen.
Es wird seit undenklichen Zeiten von einer gutherzigen Art von Hirten bewohnt, die so glücklich sind, keinen anderen Gesetzgeber zu kennen als die Natur. Sie haben kein gemeinschaftliches Oberhaupt, weil sie keinen Anführer gegen ihre Feinde und keinen Richter nötig haben, der ihre Händel entscheide oder ihre Verbrechen bestrafe; denn sie haben keinen Feind, fangen keine Händel an und begehen keine Verbrechen: sie sind alle gleich und leben zusammen wie gutartige Geschwister.
Ihre Herden geben ihnen Nahrung und Kleidung, sie sind ihr vornehmster Reichtum; und wiewohl jede Familie ihre eigene hat, so werden sie doch von den benachbarten Bergen, die bis auf einen gewissen Grad von Höhe fruchtbar sind, so reichlich mit Weide und Futter versehen, daß nie ein Streit deswegen unter ihnen entstehen kann.
Diese guten Leute stehen, man weiß nicht warum, unter dem Schutze eines Zauberers, der in ihrer Nachbarschaft auf einem hohen Felsen wohnt und dem sie es zuschreiben, daß ihre Täler vor allen Arten von Raubtieren und ihre Herden vor ansteckenden Krankheiten gesichert sind.
Indessen muß man gestehen, daß er sie diesen Schutz teuer genug bezahlen läßt, denn alle vier Jahre müssen ihm, vermöge eines Rechtes oder Herkommens, dessen Ursprung und Gültigkeit niemals untersucht worden ist, alle junge Mädchen von vierzehn Jahren vorgeführt werden; er nimmt sie in Augenschein, wählt sich aus, welche ihm am besten gefällt, und fährt sie in seinem Wagen davon, ohne daß man weiter etwas von ihr zu hören bekommt.
Weil nun im Tale der Ruhe alle Eltern ihre Kinder sehr zärtlich lieben und jedes Mädchen von vierzehn Jahren, unter den Knaben von sechzehn oder siebzehn, irgendeinen guten Freund hat, der im Notfall seine beiden Augen um sie gäbe, so ist dieser Tribut den guten Hirten überaus lästig; und die Angst, in der sie alle vier Jahre leben, wenn die Zeit des Besuchs von ihrem Beschützer heran naht, verbittert das Glück, dessen sie sonst genössen, nicht wenig.
Indessen, da sie es nicht ändern können, begnügen sie sich, darüber zu seufzen, und suchen sich mit dem Gedanken zu trösten, daß der Zauberer noch immer gütig genug sei, sich alle vier Jahre an einem Mädchen zu begnügen; denn, sagen sie, was wollten wir machen, wenn er ihrer zwei oder drei mit sich nähme? Er würde es immer so anzugehen wissen, daß er am Ende recht behielte.
Einer von den guten Hirten dieses kleinen Arkadiens, namens Sadik, hatte eine Tochter, die der Liebling aller ihrer Gespielinnen war, wie wohl sie einhellig für das schönste Mädchen im Lande gehalten wurde. Sadik hatte auch noch einen Pflegesohn, den er, um die Zeit, da ihm sein Weib die besagte Tochter geboren, am Ufer des Meeres in einem Korbe gefunden und aus Mitleid wie sein eigen Kind erzogen hatte.
Die Erziehung ist, wie man leicht denken kann, in diesem kleinen Hirtenlande etwas sehr Einfaches; was die Kinder zu lernen haben, ist wenig; aber dafür brauchen sie, wenn sie zu Verstande gekommen sind, sich keine Mühe zu geben, wieder zu vergessen, was sie als Kinder gelernt haben. Ihre Spiele sind Übungen, die den Körper entwickeln, ihn stärken, geschmeidig machen und gesund erhalten; außerdem lernen sie, sich an wenigem genügen zu lassen, den Alten zu gehorchen, ihre Geschwister und Gespielen zu lieben und immer die Wahrheit zu sagen.
Auch erzählen ihnen die Alten nach und nach, wie es die Gelegenheit gibt, was sie selbst in ihrer Jugend von ihren Alten gehört haben, lehren sie alles, was sie selbst können, und üben ihren Verstand durch Fragen, worauf die Kinder die Antwort aus ihrem eigenen Kopfe finden müssen. Und so kommt es dann, daß die jungen Leute in diesem Lande ganz verständige und gutartige Geschöpfe werden, ohne daß eines von ihnen sagen könnte, wie es damit zugegangen sei.
Wie Nadine und Nadir (so nannte man die Tochter und den Pflegesohn des guten Sadiks) ihr sechzehntes Jahr erreicht hatten, war nichts Liebenswürdigeres im ganzen Lande als Nadir und Nadine; jedermann fand sie so, und so hatte auch jedes von ihnen beiden das andere gefunden. Sie hatten sich geliebt, ehe sie wissen konnten, was Liebe war; es war ihnen nie eingefallen, ihr Herz deswegen zur Rechenschaft zu ziehen.
Ihre Liebe war ihnen immer ebenso natürlich gewesen wie das Atem holen, und nun fand sich's, daß sie ihnen auch ebenso unentbehrlich war. Sadik, der in ihren Herzen wie in seinem eigenen las, hatte immer seine Freude daran gehabt, dem Wachstum ihrer gegenseitigen Neigung zuzusehen: sie erfüllte seinen liebsten Wunsch; und da er keinen Begriff von einem glücklicheren Leben hatte, als man in diesen Tälern lebte, so fiel ihm auch nicht ein, daß er etwas Bessers für Nadirn tun könnte, als ihn mit Nadinen zu vereinigen, wie wohl er vielleicht zu einem glänzenderen Glücke geboren sein möchte.
Ihre Verbindung war also eine beschlossene Sache, die ganze Gegend nahm Anteil daran; aber noch stand ihr ein Hindernis im Wege, das ihnen zuweilen bange Gedanken machte. Astramond (so hieß der Zauberer) hatte Nadinen noch nicht gesehen, seitdem sie das vierzehnte Jahr zurück gelegt. Die Zeit der Musterung rückte immer näher; endlich war sie so nahe, daß man schon die Anstalten dazu machte und von nichts anderem sprach, als wer wohl die Unglückliche sein möchte, auf die seine Wahl fallen werde.
Nadine war nicht sehr unruhig, denn ihr däuchte, die meisten von ihren Gespielinnen seien schöner als sie und müßten den Vorzug vor ihr erhalten; aber Nadir dachte anders. Er fand es ganz unmöglich, daß der Zauberer, wenn er Augen hätte, eine andre wählen könnte als Nadinen. Die junge Schäferin hatte eine geheime Freude an Nadirs Unruhe, weil sie ihr ein Beweis seiner Liebe war; aber da die letzten Tage vor der Musterung herbei kamen, fing auch sie zu fürchten an; und der Gedanke, es sei gleichwohl nicht unmöglich, daß sie von ihrem Geliebten getrennt werden könnte, machte sie am ganzen Leibe zittern.
Sie schwur ihm tausendmal zu, daß sie lieber sterben als eines anderen Eigentum werden wollte, und dies war freilich einiger Trost für Nadirn; aber weil es ihm unmöglich war, sein Unglück nicht für etwas ganz Gewisses anzusehen, so brachte er die letzten vierzehn Nächte hin, ohne ein Auge zuschließen zu können.
Nadinen erging es nicht besser, und ehe diese Zeit noch vorüber war, sahen beide so elend aus, daß sie nicht mehr kenntlich waren. Sadik wurde unruhig darüber und sprach mit seiner Tochter davon. «Seid ohne Kummer, lieber Vater», antwortete sie, «ich kann nicht zuviel von dem verlieren, was mir die Wahl des Zauberers zuziehen könnte; fällt sie auf eine andere, und bin ich so glücklich, mit demjenigen zu leben, den ihr zu meinem Gatten bestimmt habt, so werde ich bald wieder so wohl auf sein, als Ihr es wünscht; hat hingegen der Himmel mein Unglück beschlossen, wozu helfe mir dann ein Leben, das ich ferne von meinem Vater und von Nadirn hinschmachten müßte?»
Am letzten Morgen vor dem gefürchteten Tage ging Nadir mit Anbruch der Morgenröte zu Nadinen und sagte zu ihr: «Liebe Nadine, ich habe dir einen Vorschlag zu tun. Der Zauberer wird sich in dich verlieben, sobald er dich sieht, das ist ausgemacht; wir können gar nicht hoffen, daß er eine andere wähle als dich; aber vielleicht ist er kein ganz hartherziger Mann: er weiß nichts von unserer Liebe, er weiß nicht, daß seine Wahl das Todesurteil eines Menschen ist, der ihn nie beleidigt hat.
Ich will ihm entgegen gehen, will ihm zu Füßen fallen, will ihn mit weinenden Augen um die einzige Gnade bitten, dich nicht zu sehen und zu erlauben, daß du von der Musterung weg bleibst. Entweder sterbe ich zu seinen Füßen, oder ich erweiche ihn. Kurz, liebste Nadine, wir haben keinen anderen Ausweg; sieht er dich, so bist du für mich verloren!»
Während Nadir so redete, brach seine Geliebte in einen Strom von Tränen aus; Tränen der Zärtlichkeit, die ihrem Herzen eine wollüstig schmerzliche Erleichterung verschafften und in das seinige den Trost, geliebt zu sein, wie einen heilenden Balsam träufelten. Der Gedanke ihres Geliebten kam Nadinen ganz vernünftig vor; sie begriff nicht, wie man Nadirn etwas abschlagen könnte; aber der alte Sadik, ohne dessen Einwilligung sie gleichwohl nichts tun wollten, mißbilligte dieses Vorhaben gänzlich.
«Ihr bildet euch ein, alle Herzen seien wie das eurige», sagte er. «Hier, in diesen Tälern, meine Kinder, ist es wohl so; aber weiter hinaus ist alles ganz anders als bei uns. Wir kennen nichts als die unverdorbene Natur; die übrige Welt hat ihr einziges Geschäft daraus gemacht, sie zu ersticken oder zu verfälschen. Der Schritt, den ihr tun wollt, würde keine andre Wirkung auf Astramond haben, als ihn desto neugieriger zu machen.
Erwartet euer Schicksal in Geduld, meine Kinder, und hofft das Beste von den unsichtbaren Mächten, die den guten Menschen hold sind.» Die armen Kinder, denen mit ihrem Anschlage der letzte Strahl von Hoffnung verschwand, fühlten, wie wenig dieser Trost in einem Falle wie der ihrige vermag, und brachten den Rest des Tages und die Nacht in unaussprechlicher Beängstigung zu.
Endlich erschien der Morgen, der ihnen und allen Liebenden der ruhigen Aue so schrecklich war. Alle Mädchen über vierzehn Jahren wurden in einem großen Saal von grünen Zweigen, der mitten auf der Aue errichtet war, in Reihen gestellt. Der Zauberer selbst hatte es so angeordnet, daß der Saal kein ander Licht empfing als von oben herab, damit es sich auf alle Gesichter gleich verteilte.
Außen um den Saal standen alle diejenigen Hirten, deren Mädchen in dem selben eingeschlossen waren. Die Angst, ihre Geliebten zu verlieren, war auf allen Gesichtern und in allen ihren Bewegungen sichtbar. Man hörte überall nichts als ein dumpfes Gemurmel, und sie zitterten und schwankten wie junge Bäumchen, die vom Sturm geschüttelt werden.
Mitten unter ihnen unterschied sich Nadir durch seine Totenblässe und seinen fast wahnsinnigen Blick, die einzigen Merkmale, woran man ihn erkennen konnte, so sehr hatte die Furcht, Nadinen zu verlieren, sein schönes Gesicht entstellt. Der Zauberer wurde mit Ungeduld erwartet; endlich erschien er und trat in den Saal.
Seine Gesichtszüge kündigten Güte und sein ganzes Betragen Ruhe an; ein Ausdruck von sanfter Traurigkeit war über seine ganze Person verbreitet; er zeigte wenig Lust, eine Wahl zu treffen, und seine Augen schweiften ziemlich kaltsinnig über eine so reizende Versammlung hin. Diese Gemütsfassung des Zauberers, welche von keiner anwesenden Person unbemerkt blieb, beruhigte die zärtliche Nadine und gab ihr den Mut, eine Bewegung zu machen, wodurch sie Gefahr lief, bemerkt zu werden.
Wir haben vergessen, einer kleinen schwarz - weißen Hündin zu erwähnen, welche der alte Sadik ehmals bei dem Korbe, worin Nadir als ein kaum gebornes Kind ans Ufer getrieben worden war, gefunden hatte. Dieses kleine Tier hatte sowohl damals, da es neben dem Korbe her schwamm und alle seine Kräfte anstrengte, ihn unbeschädigt an den Strand zu bringen, als in der Folge bei allen Gelegenheiten so viel Verstand und Geschicklichkeit gezeigt, daß Nadir, dem es auf eine außerordentliche Art ergeben war, sich nicht aus dem Kopfe bringen ließ, es müßte mehr als ein gewöhnlicher Hund und vielleicht eine Fee sein, die, aus welcher Ursache es auch geschehen möchte, sich in dieser Gestalt zu seinem Dienste gewidmet hätte.
Es war nichts, das er seiner kleinen Hündin nicht zutraute. Er war also darauf bestanden, daß Nadine das Hündchen mit sich in den grünen Saal nehmen sollte, in Hoffnung, es werde seine Geliebte vor der Gefahr, die sie liefe, zu schützen wissen. Das kleine Tier hatte sich auch bisher ganz ruhig gehalten; aber sobald es den Zauberer hereintreten sah, fing es an, am ganzen Leibe zu zittern, und schien entfliehen zu wollen.
Nadine, von welcher es sich schon einige Schritte entfernt hatte, besorgte, es zu verlieren, und verließ ihren Platz, um es auf ihren Arm zu nehmen. Diese Bewegung machte den Zauberer aufmerksam; er näherte sich und stand Nadinen gegenüber, eben da sie sich wieder aufgerichtet und das Hündchen auf den Arm genommen hatte.
Man bemerkte, daß Astramond plötzlich in Bewegung geriet; er wurde feuerrot, und niemand zweifelte, daß eine für Nadinen gefaßte heftige Leidenschaft die Ursache davon sei. In der Tat berührte er sie mit seinem Stabe, und in einem Augenblicke befand sie sich an Astramonds Seite in einem Wagen, der sogleich von einer Wolke den Augen der Zuschauer entrückt wurde.
Alle übrigen Schäferinnen kamen haufenweise aus dem Saal hervor, und ihre entzückten Liebhaber, die von Astramond nun nichts mehr zu befürchten hatten, stürzten sich in ihre Arme. Aber in diesem Lande unverderbter Menschen machte die Liebe der Freundschaft nicht vergessen. In wenigen Augenblicken drängten sich alle diese Glücklichen um Nadir her, der auf die Nachricht von der Wahl des Zauberers in Ohnmacht gefallen war und nach Hause getragen wurde, ehe man ihn wieder zur Besinnung bringen konnte.
Die ersten Lebenszeichen, die er von sich gab, waren Ausbrüche von Verzweiflung: alle seine Bewegungen waren wütend und seine Reden ohne Zusammenhang. Der tiefe Schmerz, worin er Nadinens Eltern versunken sah, brachte ihn allmählich zu sich selbst; sein Schmerz wurde gelassen; es kam endlich dazu, daß er sich beklagen, daß er weinen konnte; und zuletzt vermochte das flehentliche Bitten seiner Pflegeltern so viel über ihn, daß er einen schwachen Funken von Hoffnung zu nähren anfing und sein Leben zu erhalten beschloß, weil er es für möglich zu halten anfing, seine geliebte Nadine wiederzufinden und den Zauberer zu erbitten.
In wenigen Tagen wirkte dieser Gedanke schon so gewaltig auf seine Einbildung, daß er dem alten Sadik seinen Entschluß entdeckte, sie so lange zu suchen, bis er sie gefunden hätte. Keine Vorstellungen, keine Bitten, keine Gefahren konnten ihn zurückhalten; man mochte ihn noch so sehr versichern, daß Astramonds Aufenthalt unzugangbar, daß er sogar den Augen eines Sterblichen unerreichbar sei, es half alles nichts.
Er machte sich auf den Weg und ließ das ganze Hirtental in allgemeiner Betrübnis über seinen Verlust und sein Unglück. Sadik und seine Gattin wollten ihn begleiten; aber er erlaubte ihnen nicht, weiter mitzugehen als bis an die Berge, wo er den zärtlichsten Abschied von ihnen nahm, um sich, auf Geratewohl, in einen Labyrinth pfadloser Felsen zu wagen, welche vor ihm kein Menschenfuß betreten hatte und wo der Tod das einzige war, was er zu finden gewiß sein konnte.
Hier war es, wo er zum ersten Male gewahr wurde, daß er mit Nadinen auch sein Hündchen verloren hatte, dessen Treue und wunderbare Gaben ihm in seiner gegenwärtigen Lage so wohl zustatten gekommen sein würden. Dieser Umstand vermehrte seinen Kummer, ohne seine Entschließung wankend zu machen.
Er stieg und kletterte zwei Tage und zwei Nächte an einem fort, ohne zu wissen, wo er hin kam, und beinahe, ohne sich aufzuhalten. Waldströme löschten seinen Durst, einige wilde Früchte waren seine Nahrung, und wenn die Finsternis der Nacht und die Ermattung ihn nötigten, still zu halten, so warf er sich unter einer hohen Klippe auf den harten Stein, um etliche Stunden schlaflos oder in ängstlichen Träumen hinzubringen.
Der unglückliche Jüngling merkte nicht, daß er in diesen schrecklichen Felsen immer nur im Kreise ging; sein Kopf war zu verwirrt, um auf seinen Weg achtzugeben, und nach einem achttägigen, beinahe ununterbrochnen Marsch ward er endlich mit Schrecken gewahr, daß er sich kaum hundert Schritte von dem Orte befand, wo er von Sadik Abschied genommen hatte.
Der Schmerz, der ihn bei dieser Entdeckung befiel, und der Gedanke, so viel Zeit gänzlich für seinen Zweck verloren zu haben, hätte ihn zu einem verzweifelten Entschluß bringen können, wenn er noch so viel Kräfte übrig gehabt hätte, ihn auszuführen; aber so abgemattet und erschöpft, als er war, blieb ihm einige Augenblicke nichts als das Gefühl seines Elendes. Bald überwältigte ihn auch dieses: er sank zu Boden, seine Sinne verließen ihn, und aller Wahrscheinlichkeit nach hätte der arme Unglückliche in dieser Ohnmacht das Ende seines Lebens finden sollen.
Gleichwohl kam er wieder zu sich selbst, und seine erste Bewegung war, über sich zu zürnen, daß er sich in einer viel ruhigern Fassung fühlte; aber wie groß war sein Erstaunen, da er nun gewahr wurde, daß er in einem prächtigen Gemach auf einem schönen Bette lag, zu dessen Füßen er sein schwarz - weißes Hündchen und zur Seite eine weiße Taube von außerordentlicher Schönheit erblickte.
Bei diesem Anblick fühlte er sich von der innigsten Freude durchdrungen; er küßte das Hündchen tausendmal mit Entzücken und fragte es, ob es ihm keine Nachricht von seiner lieben Nadine geben könne. Bei diesem Namen schlug die Taube mit den Flügeln, und das Hündchen schien durch seine Bewegungen lauter fröhliche Nachrichten anzukündigen.
Diese stumme Unterhaltung dauerte eine gute Weile. Nadir konnte es nicht müde werden, diesen Tieren Liebkosungen zu machen, und fühlte mit jedem Augenblicke Ruhe und Hoffnung in seinem Gemüte wieder aufleben, als auf einmal ein Mann von majestätischem Ansehen in das Zimmer trat. «Du siehst», sagte er zu Nadirn, in dem er sich dem Bette näherte, «denjenigen vor dir, der dir das Leben gerettet; aber es ist eben der, der dir Nadinen und dein Hündchen entrissen hat.»
Bei diesen Worten sprang Nadir in einer Bewegung, worin Zorn und Ehrfurcht einander bekämpften, vom Bette auf, und eine zweite Bewegung warf ihn dem Zauberer zu Füßen. Er überströmte sie mit Tränen, ohne daß er vermögend war, ein Wort herauszubringen; die kleine Hündin und die Taube weinten mit, und sogar dem Zauberer fielen einige Tränen aus den Augen. Aber er nahm sich zusammen, hob Nadirn freundlich auf und redete ihn folgendermaßen an:
«Du betrachtest mich als einen strengen Richter, von dem dein Leben oder Tod abhängt; und du selbst bist gleichwohl so notwendig zu meinem Glücke als ich zu dem deinigen. Liebe immerhin Nadinen, wie sie dich liebt; ich werde euch nicht entgegen sein; aber besitzen kannst du sie nie, wofern du mir nicht den Ring der Gewalt überlieferst, der im Palaste des Geisterkönigs Geoncha verwahrt wird. Gehe, und wenn du sieben Tage lang gegen Mittag gegangen bist, wirst du vor diesem Palaste anlangen.
Nimm daselbst den Ring in Empfang, den man dir nicht verweigern wird; und sei gewiß, wenn du mir ihn eingehändigt haben wirst, sollst du Nadinen dagegen erhalten, um nie wieder von ihr getrennt zu werden. Noch kann ich dir weder dein Hündchen noch die Taube verabfolgen lassen; aber ich bewahre dir beide getreulich auf. Gehe, und sei nochmals versichert, daß ihr Glück und das meinige, ebenso wohl als das deinige, davon abhängt, daß deine Unternehmung wohl vonstatten gehe.»
Diese Rede des Zauberers gab Nadirn großen Mut; er dankte ihm für seinen guten Willen und machte sich mit Freuden anheischig, ihm den wundervollen Ring zu verschaffen, und wenn er ihn auch aus dem Mittelpunkt der Erde holen müßte, wofern Nadine die Belohnung sein sollte. Er bezeugte freilich große Lust, das Hündchen und die Taube, für die er eine sonderbare Zuneigung gefaßt hatte, mitzunehmen, aber der Zauberer fand nicht für gut, sich ihrer zu entäußern, und Nadir mußte sich gefallen lassen, allein abzureisen.
Astramond hatte ihm einen Beweggrund zur Eilfertigkeit gegeben, der ihn Tag und Nacht anspornte. Er machte so große Schritte, daß er schon am Morgen des siebenten Tages den Palast des Geisterkönigs erblickte, der, wegen des Funkelns der Edelsteine, woraus er erbaut ist, in großer Ferne schon zu sehen war. Dieser Anblick verdoppelte seine Ungeduld, aber seine Kräfte versagten ihm auf einmal, da er sie aufs neue anstrengen wollte; er fühlte sich ganz erschöpft und war genötigt, sich unter einen Palmbaum hinzulegen.
Er schlief ein, und beim Erwachen fand er sich zu seiner Verwunderung unter einem Zelt von goldnem Stoffe auf einem reichen Sofa, an dessen einem Ende ein Mann von einer etwas düsteren, aber majestätischen Miene saß, dessen Züge einige Ähnlichkeit mit Astramonds hatten und der ihn in einem einnehmenden Ton also anredete:
«Du siehst ein unglückliches Opfer der Bosheit Astramonds vor dir. Dieser Grausame ist mein Bruder; aber die Gefühle der Natur sind ihm etwas Unbekanntes, und er verfolgt mich seit dem Augenblicke meiner Geburt. Wir sind einander an Macht gleich; er hat mich der meinigen nicht berauben können, aber er hat mir was noch Schlimmeres zugefügt: er hat mir meine Geliebte geraubt.
Du seufzest?» fuhr er fort, da er den Eindruck sah, den dieses Wort auf Nadirn machte. «Laß uns unsere Tränen und unsre Rache vereinigen! Er hält die Fee, die ich liebe, unter der Gestalt einer schwarz - weißen Hündin und deine Nadine in Gestalt einer weißen Taube gefangen; aber der Ring der Gewalt kann uns beiden helfen. Weder er noch ich können Besitzer des selben sein; dir allein, liebenswürdiger und unglücklicher Nadir, ist er aufbehalten.
Bediene dich seiner zu unserem Glücke und zu unserer Rache. Sobald du im Besitze des Ringes bist, brauchst du nur zu wünschen, in meinem Palaste zu sein, so wirst du im Nu dahin versetzt werden. Du wirst mir den Ring anvertrauen, und in einem Augenblicke soll der grausame Feind unserer Liebe gestraft und Nadine in deinen Armen sein.
Du hast dann nichts mehr von Astramond zu befürchten: der Ring macht dich zu seinem Herrn; und da man ihn nie anders als mit gutem Willen des Besitzers erhalten kann, so würde jeder Versuch, ihn dir mit Gewalt abzunehmen, fruchtlos sein. Lebe wohl, lieber Nadir! Ich könnte dir noch mehr sagen, könnte dich mit einem Namen nennen, der dir Liebe und Ehrerbietung einflößen würde; aber ich will alles bloß deiner Dankbarkeit und deinem Mitleid schuldig sein.
Verliere nun keine Zeit, und wenn du den Dienst erkennst, den ich dir leiste, indem ich dich mit den Ursachen deines Unglücks und den Mitteln, dir zu helfen, bekannt mache, so vergiß nicht, mich an deinem Glücke teilnehmen zu lassen! Ich erwarte dich morgen in meinem Palaste.»
Mit diesen Worten verschwand der Unbekannte, ohne Nadirn zu einer Antwort Zeit zu lassen, der sich in keiner kleinen Unruhe befand, indem er sich bemühte, alles, was er gehört hatte, wieder vor seine Stirne zu rufen. Sein gutes Herz, dem Argwohn so fremde war als Betrug, neigte sich schon auf die Seite dieses Unbekannten, bloß weil er unglücklich war; überdies schien ihn sein eigener Vorteil mit dem selben zu verbinden; und wie zurückhaltend er sich auch am Schlusse seiner Rede ausgedrückt hatte, so glaubte Nadir doch zu merken, daß er am Ende wohl gar sein Vater sei.
Diese Vermutung schien sehr gut zu der Erzählung zu stimmen, die ihm Sadik von den Umständen gemacht hatte, worin er ihn gefunden, und wie er von der kleinen schwarz - weißen Hündin ans Gestade gebracht worden, welche ohne Zweifel seine Mutter und von Astramond, wie der Unbekannte sagte, so verwandelt worden war.
Alles dies gab Nadirn so viel zu denken, daß er seinen Weg ziemlich langsam fortsetzte und daher erst mit Einbruch der Nacht in dem Palaste ankam, wo der Geisterkönig seinen Hof hält und alle Begebenheiten in der Welt nach seinem Belieben lenkt, weil die unsichtbaren Mächte, welche die Hand im Spiele haben, von seinen Winken abhangen.
Nadir wurde auf seinen Befehl wohl aufgenommen und, als es Schlafenszeit war, in das Traum Gemach geführt; etwas, das nur denen widerfuhr, die der Geisterkönig vorzüglich begünstigte. Den Menschen ihr künftiges Schicksal ganz aufzudecken, ist ihren unsichtbaren Beschützern nicht erlaubt; aber sie dürfen denen, welche sie dessen würdig achten, einen Fingerzeig geben, der sie aufmerksam macht, ohne sie gänzlich zu belehren; und sie tun dies gemeiniglich durch Träume.
Nadir, der von der Reise müde war, legte sich an der Hinterwand des Zimmers auf eine mit Samt beschlagene Estrade und entschlief. Gegen das Ende der Nacht, wenn die Träume den lebhaftesten Eindruck zu machen pflegen, däuchtete ihm, er befinde sich wieder in der nämlichen Ebene, wo er Tages zuvor den Unbekannten unter dem goldbrokatnen Zelte angetroffen hatte.
Er war nicht allein. Zu seiner Linken stund der Zauberer Astramond, der ihn bei der Hand hielt, zur Linken Astramonds ein ehrwürdiger Greis und neben diesem ein Mann, den er sogleich für eben den erkannte, den er gestern unter dem Zelte angetroffen und für seinen Vater hielt. Ihnen gegenüber sah er einen Mann, der, ungeachtet seiner menschlichen Gestalt, etwas so Großes und Übermenschliches in seinem ganzen Ansehen hatte, daß Nadir von seinem Anblick ebenso geblendet wurde, als ob er in die Sonne gesehen hätte.
Dieser Mann empfing aus der Hand des Greises einen Ring mit einem geschnittenen Türkis, den er Nadirn überreichte. Kaum hatte dieser den Ring am Finger, so verschwand dieser Mann, der Greis und Astramond, und Nadir blieb einen Augenblick allein. Aber ehe er sich aus seiner Verwunderung erholen konnte, sah er den Unbekannten, der Nadinen an der Hand hatte und sie ihm mit freundlichem Blicke zuzuführen schien. Er flog ihnen mit Entzückung entgegen; aber kaum hatte er sie berührt, so verwandelte sich Nadine in eine andere Person, und der Unbekannte versank in die Erde.
Die Bestürzung über einen so unerwarteten Ausgang weckte Nadirn aus seinem Traum; aber alle Erscheinungen des selben standen noch so lebendig vor seiner Seele da, daß es ihm beinahe unmöglich war, sie für einen bloßen Traum zu halten. Er fiel darüber in ein tiefes Nachdenken; und da er einen geheimen Unterricht darin zu finden glaubte, so bemühte er sich, seinen Traum mit der Rede des Unbekannten, der selbst darin aufgetreten war, zu vereinigen; aber er fand es schwer, aus allen diesen Ideen ein Ganzes zu machen, und arbeitete noch vergebens daran, als ihm gemeldet wurde, vor dem Geisterkönige zu erscheinen.
Beim ersten Blicke erkannte Nadir den Mann in ihm, den er in seinem Traum den Türkis aus der Hand des Greises empfangen gesehen; und wie er damals schon von seinem Anblick wie geblendet worden war, so würde er jetzt, da er den mächtigsten der Geister (wie wohl in einer menschlichen Hülle) würklich vor sich sah, seine Gegenwart kaum ausgehalten haben, wenn Geoncha ihm nicht mit einem Blick voll Milde und Huld entgegengekommen wäre.
«Ich kenne dich, Jüngling», sprach er zu ihm, «und liebe dich, weil du edel bist und gut. Sei auch weise und hüte dich für den Fallstricken, die dir gelegt sind. Vergiß niemals empfangene Wohltaten, wenn du gleich von der selben Hand Unrecht erlitten hättest. Du bist im Begriffe, der Besitzer eines Schatzes zu werden, der dir zugehört und der dich mächtiger machen wird als die größten Könige der Erde.
Sei immer eingedenk, daß Macht ohne Gerechtigkeit weder ihrem Besitzer noch anderen wohltätig ist und daß Gerechtigkeit eine genaue Kenntnis der Wahrheit voraussetzt. Nimm meine Warnungen wohl zu Herzen, lieber Nadir! Traue nie dem äußeren Schein; siehe alles selbst und tue alles selbst, soviel es nur immer möglich ist: nur dadurch wirst du bald dich selbst und alles, was ein Recht an deine Liebe hat, glücklich machen.»
Mit diesen Worten überreichte er ihm den Talisman hin; aber wie groß war die Verwirrung, in welche Nadir geriet, da er den Türkis mit den eingegrabenen magischen Zeichen für eben den erkannte, den er im Traum empfangen hatte! «Nimm ihn hin, Nadir», fuhr Geoncha fort, wie er den Jüngling mit nieder gesenktem Blicke zaudern sah, «nimm, was dein ist, und denke an nichts, als wie du ihn wohl gebrauchen wollest! Erinnere dich deines Traumes und meiner Warnungen! Ich weiß, wohin du gehst. Säume dich nicht, dein Schicksal wird sich dort entwickeln.»
Nadir empfing jetzt den Ring mit Ehrfurcht aus der Hand des Geisterkönigs, und da er sich in den Palast des unbekannten Zauberers wünschte, wurde er auf einmal gewahr, daß er würklich darin sei. Dieser Palast wich an Pracht und Schönheit keinem anderen Zauberschlosse in der Welt und war mit einer Menge sehr schöner Personen beiderlei Geschlechtes angefüllt, in deren Mitte der Zauberer Nadirn entgegen kam.
Dieser ganze Hof hatte mit allem seinem Glanz ein so trauriges Aussehen, daß es Nadirn, wie unerfahren er auch war, hätte auffallen müssen, wenn ihm der Herr des Palastes Zeit dazu gelassen hätte. Aber dieser bemächtigte sich seiner sogleich mit der verbindlichsten Freundlichkeit; und nachdem er ihm alle Herrlichkeiten seines Palastes, die von keiner geringen Macht zeugten, gewiesen hatte, führte er ihn in einen prächtigen Garten.
Er setzte sich mit ihm unter eine einsame Laube und fing damit an, daß er ihm zu dem Schatze, der ihm zuteil worden, in Ausdrücken, die eine mehr als gewöhnliche Teilnehmung und Zärtlichkeit zu verraten schienen, Glück wünschte, aber ihn zugleich zu überreden suchte, das, was nun weiter zu tun sei, um Nadinen in Freiheit zu setzen und den Verräter Astramond zu bestrafen, ihm, dem Unbekannten, zu überlassen und ihm zu diesem Behuf den magischen Ring anzuvertrauen.
Wie groß auch immer die Gewalt sei, die dieser Ring seinem Besitzer mitteile, so würde sie ihm doch, sagte er, gegen Astramond wenig helfen, weil er sich ihrer nicht zu bedienen wisse; man müsse hierzu in den Geheimnissen der Magie eingeweiht sein, und ohne diese Kunst seien die mächtigsten Talismane nichts. Nadir habe sich nicht das geringste Bedenken zu machen, ihm dieses Vertrauen zu schenken, da er solches unmöglich mißbrauchen könnte, wenn er es auch zu wollen fähig wäre, indem keine Macht in der Welt ihm den Ring wider seinen Willen rauben oder vorenthalten könne.
Sie hätten gleiches Interesse, gleiche Hoffnungen, und natürlicherweise müßte auch ihre Rache gemeinschaftlich sein. Er selbst besitze alle die Kenntnisse und Erfahrenheit, die ihr Vorhaben erfordere; und sofern ihm Nadir seinen Talisman sogleich anvertrauen wolle, so sollte er noch vor Sonnenuntergang ihren gemeinschaftlichen Feind zu seinen Füßen und Nadinen in seinen Armen sehen.
Der Zauberer sah nach dieser Rede dem Jüngling sehr scharf in die Augen und erwartete stillschweigend seine Antwort, mit welcher aber Nadir sich nicht übereilen wollte. Er erinnerte sich seines Traumes und der Warnungen des Geisterkönigs, der ihm so ernstlich empfohlen hatte, dem Scheine nicht zu trauen und alles, was er könnte, selbst zu tun.
Überdies glaubte er in den Reden und dem Betragen des Unbekannten Dunkelheiten zu finden, die ihm eine geheime Absicht zu verraten schienen. Er begriff nicht, warum dieser Mann sich nicht geradezu für seinen Vater erkläre, wie er es schon bei ihrer ersten Unterredung und jetzt abermal zu verstehen gegeben hatte.
Kurz, Nadir faßte, nachdem er alles wohl überlegt hatte, die Entschließung, seinen Ring nicht von seiner Hand zu geben und seinen und Nadinens Trübsalen mit Hilfe des selben selbst ein Ende zu machen. Der Zauberer schien mit dieser Entschließung sehr übel zu frieden zu sein: seine Stirne zog sich einen Augenblick zusammen; aber er brauchte auch nicht mehr als diesen Augenblick, um seinem Gesichte wieder die vorige Heiterkeit zu geben.
Er nahm das Wort wieder mit der treuherzigsten Miene von der Welt, und ohne sich über Nadirs Eigensinn zu beschweren, begnügte er sich, ihm zu sagen, daß der Weg, den er einschlagen wolle, der längste und unsicherste sei. «Das Schwerste ist nicht, Nadinen wieder zu bekommen», fuhr er fort; «das getraue ich mir wohl allein durch meine Kunst zu bewerkstelligen; aber was kann uns das helfen, wenn wir Astramonden nicht außerstand setzen, sie noch einmal zu entführen?
Der Ring, dessen Besitzer du bist, dieser Ring allein ist stärker als alle Beschwörungen Astramonds; aber dir fehlt es an der Wissenschaft, den gehörigen Gebrauch davon zu machen; dein Mißtrauen hilft also zu nichts, als dein Glück und das meinige aufzuziehen. Indessen soll dies meinen Eifer, dir zu dienen, nicht erkälten, und ich hoffe, bevor die Sonne wieder aufgegangen sein wird, dir Nadinen wiederzugeben.
Vielleicht wird mir diese neue Probe meiner Liebe deine Freundschaft verdienen, und du wirst dann nicht länger glauben, gegen die Klugheit zu handeln, wenn du mir diesen mächtigen Ring anvertraust, dessen sehr schwerer Gebrauch allein mein Glück machen und das deinige befestigen kann.»
Nach diesen Worten klatschte der Zauberer in die Hand, und sogleich eilte sein ganzer Hof herbei, seine Befehle zu vernehmen. «Meine Freunde», sagte er zu ihnen, «ich empfehle euch meinen liebenswürdigen Gast; wendet in meiner Abwesenheit alles an, seine Schwermut zu zerstreuen und ihm soviel Vergnügen zu machen, als nur immer in eurem Vermögen ist.»
Er forderte hierauf seinen Wagen, bestieg ihn und erhob sich in die Lüfte, wo man ihn bald aus den Augen verlor. Nadir kehrte in den Palast zurück; aber das Nachsinnen über alle die Wunderdinge, die ihm begegnet waren, und die Ungewißheit, was er davon denken und wozu er sich entschließen sollte, ließ ihn wenig Anteil an den Vergnügungen nehmen, die man ihm zu machen suchte.
Man zeigte ihm alle die schönen und seltenen Dinge, womit der Palast angefüllt war; man gab ihm ein Schauspiel und führte ihn endlich in einen herrlich beleuchteten Saal, wo eine köstliche Tafel für ihn gedeckt war, bei welcher die Höflinge des Zauberers ihn bedienten und alle die schönen Personen, die in diesem bezauberten Orte beisammen waren, sich in die Wette bestrebten, ihn mit Musik und Tänzen zu unterhalten.
Aber das alles machte nur einen schwachen Eindruck auf seine Sinne. Hingegen fiel ihm der Zwang und die Traurigkeit, die er auf allen Gesichtern ausgedrückt sah, desto stärker auf, je mehr er mit der Beeiferung, ihm Vergnügen zu machen, kontrastierte; und sobald er es nur mit Anständigkeit tun konnte, stund er von der Tafel auf, bedankte sich sehr höflich gegen die Personen, die sich so viele Mühe mit ihm gegeben hatten, und ließ sich in das für ihn bereitete Schlafgemach führen.
Kaum glaubte er allein zu sein und sich seinen Gedanken ungestört überlassen zu können, so öffnete sich die Tür, und man stelle sich sein Entzücken vor, als er Nadinen an der Hand des Zauberers hereintreten sah. In diesem Augenblicke verlor sich alle seine Unruhe, die reinste Freude durchdrang alle seine Sinne, er flog seiner geliebten Schäferin entgegen, umfaßte mit Tränen der Liebe im Auge ihre Knie und konnte nur Töne des Entzückens und abgebrochene Worte hervor stammeln, so sehr war er vor Zärtlichkeit und Freude außer sich.
Nadine hob ihn auf, indem sie ihm ihre Hand zu küssen erlaubte, und sprach zu ihm mit einem Gesichtsausdruck, der mehr Sanftheit und Sittsamkeit als Freude zeigte: «Nadir, wenn du in meiner Seele liest, so wirst du sehen, wie gerührt ich bin und wie sehr die Empfindungen, die ich bei dir errege, auch die meinigen sind. Aber in diesem Augenblicke sei unsere erste Sorge, die Pflichten der Freundschaft zu befriedigen.
Oder wollte Nadir undankbar gegen denjenigen sein, der ihn seine Nadine sehen läßt? Laß uns ihm zu Füßen fallen und seine Wohltaten mit der Erkenntlichkeit annehmen, die wir ihm dafür schuldig sind.» «Nein», unterbrach sie der Zauberer, «du bist mir nichts schuldig, Nadir; ich habe für mich selbst getan, was ich für dich tat, vielleicht wirst du mir nun dein Vertrauen schenken. Aber es ist Zeit, daß ich euch allein lasse; nach einer so langen Trennung müsst ihr euch, denke ich, sehr viel zu sagen haben.» Mit diesen Worten entfernte er sich, ehe Nadir, noch ganz von seinem Glücke betäubt, ein Wort herauszubringen vermochte.
Sobald sich dieser mit seiner Geliebten allein sah, brach sein Entzücken mit verdoppelter Stärke aus; er näherte sich ihr mit einer Inbrunst, die der Trunkenheit ähnlich war, aber sie stieß ihn sanft zurück, setzte sich in einiger Entfernung von ihm auf den Sofa und brach in einen Strom von Tränen aus. «Was fehlt dir, liebste Nadine», rief Nadir bestürzt; «du durchbohrst mir das Herz.» -
«Nadir», sagte sie, «berührt mich mit Eurem Ringe und wünscht mich zu sehen, wie ich bin: der Zauberer ist ein Verräter, und ich bin nicht Nadine.» Nadir fühlte bei diesen Worten einen Todesschauer durch seine Adern rinnen. Bestürzt, verwirrt und unschlüssig, sich einer so süßen Täuschung zu berauben - wie wohl er im nämlichen Augenblick über sich selbst zürnte, daß er sich durch einen Betrug hatte täuschen lassen, den sein Herz, wie er glaubte, hätte ahnen sollen -, stand er unbeweglich und ohne die Dame auf dem Sofa zu hören, die ihn zu beruhigen suchte.
Aals auf einmal der Zauberer, der durch seine Kunst erfahren hatte, daß seine List entdeckt sei, mit Grimm im Auge und mit aufgehobenem Stabe hereintrat, um die Verräterei der untergeschobenen Nadine (weil Nadirn sein Talisman gegen alle Zaubergewalt schützte) wenigstens an dieser Unglücklichen zu rächen, die er gezwungen hatte, sich zu einem Werkzeuge seines schwarzen Betruges mißbrauchen zu lassen.
Diese, sobald sie ihn erblickte, fuhr erschrocken vom Sofa auf und verbarg sich hinter Nadirn, indem sie ihn flehentlich um Rettung bat. Zu ihrem Glück erholte sich Nadir aus seiner Bestürzung, ging auf den Zauberer los und berührte ihn, da er eben im Begriff war, die falsche Nadine mit seinem Zauberstabe zu schlagen, mit seinem Ringe, indem er zugleich, auf eine instinktmäßige Weise, wünschte, daß der Zauberer dadurch außerstand gesetzt werden möchte, Schaden zu tun; und alsbald schien dieser in der Stellung, worin er war, sich zu versteinern und blieb unbeweglich und starr wie eine Bildsäule vor ihm stehen.
Es bedurfte einer guten Weile, bis Nadir sich an den Gedanken der außerordentlichen Gewalt, womit er sich bekleidet sah, gewöhnen konnte. Er betrachtete den unbeweglichen Zauberer eine Zeitlang mit Erstaunen, das nicht gänzlich ohne Furcht war. «Unglücklicher», rief er ihm endlich zu, «deine Verräterei ist, wie du siehst, entdeckt; du wolltest mich um diesen wundervollen Ring betrügen, und vielleicht um Nadinen auch? Sage mir, was aus ihr geworden ist! Sprich die Wahrheit, ich befehle dir es.»
Bei diesen letzten Worten schien der Zauberer auf einmal wieder zu sich selbst zu kommen, seine Zauberrute fiel ihm aus der Hand, und er fing unfreiwillig also an zu reden: «Die stärkere Gewalt, welche die meinige vor dir vernichtet, nötigt mich auch, dir gern oder ungern die Wahrheit zu sagen. Sei für Nadinen unbesorgt, sie ist nicht in meiner Gewalt; aber vernimm, wie sehr ich strafbar und deines ganzen Grimms würdig bin.
Meine Absicht war nicht bloß, dir Nadinen zu rauben und mich an Astramond zu rächen; ich hatte sogar deinen Untergang beschlossen. Du erstaunst, weil du nicht begreifen kannst, wie du mir in einem solchen Grade hast verhaßt werden können; aber du wirst aufhören, dich zu wundern, wenn du hörst, wer ich bin.»
Geschichte des Zauberers
«Ich habe dich nicht betrogen, da ich dir sagte, daß ich Astramonds Bruder sei. Mein Name ist Neraor, und wir sind beide die Söhne eines berühmten Weisen, dem unter allen, welche die magische Kunst über die Sterblichen erhebt, keiner den ersten Platz streitig machte. Er arbeitete viele Jahre lang an dem geheimnisvollen und alles vermögenden Talisman, dessen Besitzer du bist.
Ich war ungefähr fünfzehn Jahre alt, als dieses bewundernswürdige Werk der Magie zustande kam, und mein Bruder hatte nur ein Jahr mehr; aber da wir von Kindheit an zu den geheimen Wissenschaften erzogen worden waren, so begriffen wir beide, unserer Jugend ungeachtet, die Wichtigkeit des Schatzes sehr wohl, den unser Vater besaß.
Er stand bereits in einem hohen Alter, und da sein Tod in unseren Gedanken nicht mehr ferne sein konnte (denn das Geheimnis der Unsterblichkeit haben die Götter sich selbst vorbehalten), so fingen wir an, jeder in dem anderen einen Mitwerber um den Ring zu sehen, dessen Besitz das Ziel unserer ungeduldigsten Wünsche war. Ich hatte meinen Bruder nie sonderlich geliebt; aber diese Rivalität setzte meine Antipathie gegen ihn in ihre volle Wirksamkeit, und es verging kein Tag, wo sie nicht in Zänkereien und Händel ausbrach, die unseren Vater endlich beunruhigten.
Er hatte sich schon lange vergebens Mühe gegeben, eine dauerhafte Einigkeit unter uns zu stiften; Vernunft, Zärtlichkeit und väterliches Ansehen blieben ohne Wirkung. Er merkte endlich, daß das Verlangen, den Ring zu besitzen, die wahre Quelle unsrer Zwietracht war, und in der Absicht, das Übel von Grund aus zu heben, ließ er uns eines Tages vor sich kommen.
‹Undankbare und unnatürliche Söhne›, so ließ er uns mit zürnender Stimme an, ‹ihr seufzt nach dem Augenblick, wo ich nicht mehr sein werde, und streitet euch schon um das Kostbarste, was ich besitze; aber eure Strafe soll sein, daß es keinem von beiden zuteil werden soll.› Mit diesem Worte zog er den Ring vom Finger und warf ihn in ein Gefäß, das mit Wasser und wohlriechenden Kräutern angefüllt war; und kaum hatte er einige geheime Worte ausgesprochen, so fing das Wasser an aufzubrausen, und ein Adler, der den wundervollen Ring im Schnabel trug, stieg aus der Tiefe des Gefäßes und erhob sich in die Luft.
‹Eile›, sagte er zu ihm, ‹und trage diesen Talisman in den Palast des Geisterkönigs; dort werde er aufbehalten, bis die Schlüsse des Schicksals erfüllt sein werden!› Hierauf wandte er sich wieder zu uns: ‹Ihr habt ihn verloren und werdet nie zu seinem Besitze gelangen; er ist einem Sohne von einem unter euch bestimmt.
Der erste von euch beiden, der sich der aufrichtigen Gegenliebe einer geliebten Person würdig machen, sich mit ihr vermählen und einen Sohn von ihr haben wird, dieser wird der Vater des mächtigsten Sterblichen sein. Keine menschliche noch übermenschliche Gewalt oder List kann den Ring aus dem Palaste des Geisterkönigs entführen; aber dieser glückliche Sohn wird ihn ohne Mühe erhalten. Geht nun, und möchtet ihr künftig in besserer Eintracht leben, da der Zunder eures Hasses aus dem Wege geräumt ist!›
Mein Vater verfehlte seine Absicht. Hatte ich Astramonden vorher als einen Mitwerber gehaßt, so betrachtete ich ihn jetzt als einen Feind, der mir den Gegenstand meiner feurigsten Wünsche geraubt hatte. Indessen blieb mir (wie wohl der Gedanke, der Vater desjenigen zu werden, dem er aufgehoben war, wenig Reiz für mich hatte) doch ein Mittel, meinen Groll gegen meinen Bruder zu befriedigen: wir durchliefen beide die Welt; er, um eine Gemahlin zu suchen, wie unser Vater sie verlangte; ich, um ihm, sobald sein Herz eine Wahl getroffen haben würde, in den Weg zu treten und, wo möglich, sein Glück zu vereiteln.
Der König der unbekannten Insel hatte eine Tochter, von deren Schönheit so viel gerühmt wurde, daß mein Bruder Lust bekommen hatte, sich um sie zu bewerben. Kaum erhielt ich Nachricht davon, so erschien ich gleichfalls am Hofe dieses Königs. Ich fand die Prinzessin bei ihrem Vater und meinen Bruder bei der Prinzessin. Meine Augen wurden von ihrem Anblick geblendet, und die Leidenschaft, die sich in meinem Busen entzündete, brannte desto ungestümer, da ich Zeichen eines geheimen Verständnisses in den Blicken meines Bruders und der Prinzessin wahrzunehmen glaubte.
Der stolze Ton, worin ich meine Bewerbung anbrachte, und die sichtbare Gewalt, die ich mir antun mußte, um meine Wut über Astramond zurückzuhalten, setzte den König in Verlegenheit: er kannte unsere Macht, er wollte sich weder meine noch Astramonds Feindschaft auf den Hals laden; und um uns eine völlige Unparteilichkeit zu zeigen, tat er uns einen Vorschlag, den beide, wie er glaubte, billig finden müßten.
‹Prinzen›, sagte er zu uns; ‹ich liebe mein Volk, und seine Glückseligkeit ist immer der erste meiner Wünsche gewesen. Ich kann keinen von euch beiden zum Eidam erwählen, ohne gegen den anderen ungerecht zu sein; ich will also gar nicht wählen, sondern derjenige von euch, der vermittelst seiner Macht meinen Untertanen das wünschenswürdigste Gut verschafft, soll der Gemahl meiner Tochter sein; die Stimme des Volkes soll den Ausspruch tun!›
Wir ließen uns den Vorschlag des Königs gefallen; er gab uns acht Tage Zeit, um unsre Anstalten zu machen, und ich wandte sie dazu an, der Prinzessin überall wie ihr Schatten zu folgen und sie mit den Äußerungen einer Leidenschaft zu verfolgen, welche sie wenigstens auf keine zu merkliche Art abzuweisen wagen durfte.
Mein Haß gegen Astramond wuchs indessen täglich, je mehr ich aus tausend geheimen Zeichen merken konnte, daß er der Prinzessin nicht gleichgültig war; und ich genoß wenigstens das boshafte Vergnügen, zu sehen, wie lästig ihnen meine Gegenwart war.
Inzwischen dachte ich ernstlich auf ein Mittel, den aufgesetzten Preis zu gewinnen; und da ich immer gefunden hatte, daß die Menschen nichts ärger scheuen und ungeduldiger ertragen als die Armut, so hielt ich mich überzeugt, die Untertanen des Königs der unsichtbaren Insel nicht glücklicher machen zu können, als indem ich sie mit Reichtum überhäufte.
Ich war so gewiß, daß es mir auf diesem Wege nicht fehlen könne, daß ich keine andere Furcht hatte, als mein Bruder, dem dieser Gedanke natürlicherweise auch gekommen sein müßte, möchte mir in der Ausführung zuvorkommen.
Ich erklärte mich also in Gegenwart der Prinzessin, ich würde es nie zugeben, wenn Astramond, unter dem Vorwand des Rechts der Erstgeburt, sich anmaßen wollte, der erste zu sein, der seine Macht sehen ließe; ich verlangte, daß wir entweder beide zugleich agieren oder das Los entscheiden lassen sollten, wer den Anfang zu machen hätte.
Astramond versicherte, mit einem Lächeln, das mich desto mehr erbitterte, da es mir von böser Vorbedeutung schien, er glaube nicht nötig zu haben, sein Recht bei dieser Gelegenheit geltend zu machen, und sei es sehr wohl zufrieden, mir einen Rang zu lassen, der ihm keinen Nachteil bringen könne. Die Prinzessin mußte ihr ganzes Ansehen anwenden, um den Ausbruch der Wut zu verhindern, in welche mich diese verächtliche Antwort setzte; und wenn ich mich aus Gehorsam gegen sie zu besänftigen schien, so geschah es bloß, weil ich meine Rache bis nach dem entscheidenden Tage verschob.
Dieser mit allgemeiner Ungeduld erwartete Tag war endlich gekommen. Ich erhob mich nach dem großen Platze der Stadt, wo das ganze Volk schon versammelt war. ‹Lieben Leute›, sprach ich, ‹ich werde euch alle reich machen›; und indem ich das letzte Wort aussprach, schlug ich die Erde mit meiner Zauberrute.
Sie eröffnete sich, und man sah allmählich einen großen Berg von lauter Gold und Silbermünzen sich erheben. Auf einmal stieg ein allgemeines Freudengeschrei in die Luft, welches aber bald durch das Jammergeschrei derjenigen unterbrochen ward, die im Gedränge des auf den Berg einstürmenden Volkes zerdrückt und zertreten wurden.
Die Geldgier der Leute tat eine ebenso schnelle Wirkung als meine Kunst, und der Berg verschwand beinahe in ebenso kurzer Zeit, als er zu seiner Entstehung gebraucht hatte. Ich glaubte des Sieges gewiß zu sein, als, sobald der erste Tumult sich gelegt hatte, Astramond nun auch auf den Platz kam, ohne daß das Volk, das mit Zählen seines erbeuteten Goldes und Silbers beschäftigt war, die mindeste Acht auf ihn gab.
Inzwischen zog er mit seinem Stabe einen Kreis in die Luft, murmelte einige Worte und rief dann dem Volke mit lauter Stimme zu: ‹Bürger, morgen sollt ihr entscheiden, wem der Preis gebührt; ich habe ein Recht an eure Dankbarkeit, denn ich werde euch glücklich machen.› Seine Rede machte wenig Eindruck; der Tag ward in lauter Lustbarkeit zugebracht; man erhob meine Freigebigkeit bis in die Wolken; von Astramond war nur die Rede nicht, ohne daß er sich im mindesten darum zu bekümmern schien.
Diese Sicherheit fing an, mir Unruhe zu machen; ich konnte mir gar nicht vorstellen, was er denn so Großes getan haben könnte. Während daß ich mir den Kopf darüber zerbrach, wurde ich mit Erstaunen gewahr, daß eben diese Leute - welche kaum einen so unersättlichen Durst nach Golde gezeigt hatten, daß ein unermeßlicher Schatz kaum hin reichte, sie zu befriedigen - nun auf einmal sich wenig aus den Reichtümern, womit ich sie überschüttet hatte, zu machen schienen und sie vielmehr selbst aneinander verschwendeten.
Jedermann schien etwas sehr Angelegenes auf dem Herzen zu haben: man suchte sich, man sprach vertraulich zusammen, man umarmte sich und teilte Hab und Gut miteinander; einige gaben alles weg, was sie hatten, andere schlugen alles aus, was man ihnen anbot; und überall zeigte sich eine Herzinnigkeit, wovon ich nie einen Begriff gehabt hatte.
Bestürzt über ein so unerwartetes Schauspiel, machte ich mich unsichtbar und folgte ihnen in ihre Häuser. Hier sah ich Ehegatten, Eltern und Kinder einander umarmen und mit den zärtlichsten Liebesproben überhäufen; die reinste Freude glänzte in allen Augen, und alle Herzen schlossen sich einander auf. Alle Augenblicke wurde das Haus von Gästen voll; bald waren es Freunde, die einander ewige Treue schworen, bald Feinde, die sich schämten, einander gehasst zu haben, oder Undankbare, die es nicht mehr waren und um Verzeihung baten, es gewesen zu sein.
Nie hatten die Weiber ihre Männer so liebenswürdig, nie die Männer ihre Weiber so schön gefunden; mit einem Worte: ich merkte, daß Astramond den Geist der Liebe über die Einwohner der Stadt ausgegossen hatte; und was brauchte es mehr, um ihn des Sieges gewiß zu machen?
Die Prinzessin wurde ihm einhellig zuerkannt; und ich, halb unsinnig vor Wut und Rachgier, schloß mich ein und sann auf Mittel, das Glück der neu Verbundenen zu vernichten. Mit Gewalt war nichts gegen Astramond auszurichten; ich nahm also meine Zuflucht zum Betrug. Ich verbarg meine inneren Bewegungen unter eine Larve von Großmut und Gelassenheit; ich söhnte mich mit meinem Bruder aus, bat ihn und seine Gemahlin um ihre Freundschaft und um Vergebung, daß ich den Wünschen ihres Herzens im Wege gestanden.
Ich nahm Anteil an allen Lustbarkeiten, die den Neuvermählten zu Ehren angestellt wurden; kurz, ich betrug mich so künstlich, daß mein Bruder, dessen schöne Seele ohnehin zum Argwohn ungeneigt war, dadurch hintergangen und gänzlich überredet wurde, daß ich der Hoffnung, den magischen Ring zu erhalten, und mit ihr auch allem Groll gegen ihn selbst auf ewig entsagt hätte.
Seine gutherzige Sicherheit erleichterte die Ausführung meines geheimen Anschlages, die Prinzessin auf einer großen Jagd, die der König einige Tage nach der Vermählung anstellte, zu entführen. Meine Anstalten waren so gut getroffen, daß der Anschlag nach Wunsche gelang; kurz (um dich nicht mit überflüssiger Weitläufigkeit aufzuhalten), ich brachte die Prinzessin in meine Gewalt, eilte mit ihr dem Ufer zu, ging unter Segel und war in wenig Stunden weit genug entfernt, um vor dem Einholen sicher zu sein.
Rachbegierde, nicht Liebe war es, was mir diesen Anschlag eingegeben hatte; ich labte mich an den Tränen und Klagen der Prinzessin, und die Vorstellung der Verzweiflung, worin sich mein Bruder jetzt befinden würde, hatte etwas Entzückendes für mich. Indessen tat gleichwohl die Schönheit meiner Gefangenen, die von ihrer Traurigkeit neue Reize erhielt, ihre Wirkung auf meine Sinne; und da mir die Abscheu gegen mich keine Hoffnung ließ, sie durch Güte zu gewinnen, so blieb mir zu meiner Befriedigung nur ein Mittel übrig, nämlich, zu den Täuschungen meiner Kunst Zuflucht zu nehmen.
Wir landeten nach einigen Tagen in dieser Gegend an, wo ich den Palast aufführte, den du hier siehst, und wo ich, um die untröstliche Prinzessin zu zerstreuen, alle nur ersinnliche Ergötzlichkeiten vergebens zusammenhäufte. Ich kam nie von ihrer Seite; aber an dem Tage, den ich zu Ausführung meines Anschlages erwählt hatte, belebte ich ein Phantom, dem ich meiner Gestalt gegeben hatte, und schickte es an meiner Statt zu ihr.
Gegen Mitternacht hörte sie ein schreckliches Getöse vor der Pforte des Palastes; bald darauf erschien ich unter der Gestalt Astramonds, drang auf das Phantom an ihrer Seite ein und bekämpfte es so lange, bis es, von verschiedenen Wunden durchbohrt, zu Boden fiel und seine Seele in Strömen von Blut auszusprudeln schien. ‹Liebste Gemahlin›, sagte ich zur Prinzessin, ‹sehen Sie Ihren Astramond wieder vor sich; der Schändliche, der uns trennte, hat sein Verbrechen mit seinem Leben gebüßt.
Dieser schöne Palast, der zu lange die Szene Ihres Kummers gewesen ist, soll hinfür der Schauplatz unserer Glückseligkeit sein; nichts steht ihr mehr entgegen, wenn Sie mich lieben, wie ich Sie anbete.› Mit diesen Worten flog ich in ihre Arme; aber das Entsetzen über das blutige Schauspiel, dessen Zeugin sie eben gewesen war, machte sie unfähig, meine Liebkosungen zu erwidern, wie wohl sie nicht zweifeln konnte, daß ich der wahre Astramond wäre.
Ich ließ ihr einige Zeit, wieder zu sich selbst zu kommen, führte sie in ein anderes Gemach, und nachdem ich alles angewandt hatte, den Abscheu vor einem Brudermörder durch die Liebe zu Astramond in ihrem Herzen auszulöschen, ließ ich sie unter den Händen der Nymphen, die ich ihr zur Bedienung gegeben hatte. Nach einer Weile wurde ich benachrichtigst, daß sie ausgekleidet wäre; ich fand sie in einem herrlich erleuchteten und von den köstlichsten Wohlgerüchen durchdufteten Zimmer bereits zu Bette gebracht.
Aber in dem Augenblicke, da ich im Begriff war, es mit ihr zu teilen, fühlte ich, daß mich eine unsichtbare Gewalt zurückzog, welcher ich vergebens entgegen kämpfte und gegen welche alle meine Zauberkünste ohne Wirkung blieben. Mit der äußersten Anstrengung wagte ich endlich einen letzten Versuch, den Zauber, der mich fesselte, zu zerreißen, als ich die Stimme meines vor kurzem verstorbenen Vaters hörte.
‹Zurück, Unseliger›, rief sie mir schrecklich zu, ‹zurück!› Ich schauderte zurück, und in dem nämlichen Augenblicke fuhr die Prinzessin mit äußerstem Entsetzen aus dem Bette. ‹Götter, es ist Neraor!› rief sie und rettete sich eilends in ein anderes Gemach. Ich sah nun, daß meine Bezauberung vernichtet war und daß ich meinen Anschlag aufgeben müsse.
Bald darauf stieg meine Verzweiflung aufs höchste, da mir von den Nymphen, die der Prinzessin aufwarteten, die Nachricht gegeben wurde, daß sie unzweideutige Zeichen von Schwangerschaft an ihr bemerkten. Dieser Umstand verdoppelte meine Wut gegen meinen Bruder und sie selbst; der vollständigste und unersättlichste Haß war von nun an die einzige Leidenschaft, die mich beseelte, und sie zu quälen und unglücklich zu machen meine einzige Sorge.
Ich ließ sie in ein unterirdisches Gewölbe einsperren, wohin die Sonne nie geschienen hatte und wo tausend ekelhafte Arten von Ungeziefer ihre einzige Gesellschaft waren; und da, vermöge der noch immer fortdauernden Bezauberung meines Vaters, weder ich noch meine Diener ihr nahe genug kommen konnten, um an ihrer eigenen Person Gewalttätigkeiten auszuüben, so machte ich Veranstaltungen, daß sie alle Tage, beim fürchterlichen Schein brennender Pechfackeln, mit dem Anblick der ausgesuchtesten Torturen gequält wurde, womit ich eine Menge belebt scheinender Phantomen, die sie für wahre Menschen hielt, vor ihren Augen martern ließ.
Sieben ganzer Monate hatte sie bereits in diesem schrecklichen Zustande geschmachtet, als mir in der Stille der Nacht mein Vater erschien, in eben der ehrwürdigen Gestalt, die er hatte, da er noch unter den Menschen lebte; ein strahlendes Schwert blitzte in seiner Hand, und der zürnende Blick seiner Augen warf mich vor ihm zu Boden.
‹Unwürdiger, mein Sohn zu sein›, sprach er, ‹wirst du nicht endlich müde werden, deine Macht bloß zum Böses tun zu mißbrauchen? Gehorche den Befehlen, die ich dir geben werde, oder du bist des Todes. Verlaß diesen Ort, besteige ein Schiff und durchlaufe alle Meere; nimm deines Bruders Weib mit dir, aber höre auf, sie unglücklich zu machen; auf diese Weise wird sich dein Schicksal erfüllen, und du wirst noch glücklich werden, weil du tugendhaft werden wirst.›
So sprach er und verschwand, indem er mir mit einer drohenden Gebärde das Schwert in seiner Zeit zeigte, dessen Griff aus einem einzigen Rubin geschnitten war. Ich wagte es nicht, den Befehlen meines Vaters ungehorsam zu sein; ich ließ unverzüglich ein Schiff ausrüsten und bestieg es mit der Prinzessin und meinem Gefolge.
Wir irrten einen Monat lang auf dem Meere herum, ohne daß uns etwas Merkwürdiges begegnet wäre; nach Verlauf dieser Zeit gebar die Prinzessin einen Sohn, und du, Nadir, bist diese Frucht von Astramonds Liebe. Bald darauf ließ sich ein Schiff sehen, das mit vollen Segeln auf uns zukam; als wir nahe genug waren, wie groß war mein Erstaunen, da ich sahe, daß es von Astramond geführt wurde! Der Augenblick, da wir uns erkannten, war auch das Zeichen zum Angriff.
Ich suchte meinen Bruder, um den Streit durch einen einzigen Streich zu entscheiden; ich fand ihn bald; aber wie wohl ich von Natur nicht leicht erschrecke, so erstarrte doch alles Blut in meinen Adern, und meine Haare drehten ihre Spitzen empor, da ich das nämliche Schwert in seiner Hand blitzen sah, das ich in meines Vaters Hand gesehen hatte.
Ich konnte diesen Anblick nicht aushalten, ich wandte mich plötzlich um; mein Beispiel machte meine Leute mutlos, und in wenig Augenblicken wurden wir übermannt und in Ketten geschlagen. Astramond ließ mich vor sich führen, und zu gleicher Zeit wurde die Prinzessin mit ihrem neugebornen Kinde herbei gebracht.
Mein Bruder, welcher nicht zweifelte, die Prinzessin habe sich mit gutem Willen von mir entführen lassen, geriet bei diesem Anblick in Wut, und in der ersten Bewegung seines Grimms verwandelte er sie in eine kleine schwarz - weiße Hündin und ließ dich, in der Wiege von Bambusrohr, worin du lagst, samt ihr ins Meer werfen. Zugleich befahl er, mir die Fesseln abzunehmen.
‹Du bist nicht wert, von meiner Hand zu sterben›, sagte er zu mir; ‹lebe, um von ewiger Reue gefoltert zu werden und (wenn du anders so viel Gefühl hast) den Verlust des unwürdigen Gegenstandes deiner Liebe zu betrauern.› Hierauf befahl er, mich in ein Boot zu setzen, und überließ mich der Willkür der Wellen. Nach zweien Tagen erreichte ich das Land und begab mich wieder in diesen Palast.
Meines Vaters Weissagung schwebte mir noch lebhaft vor; aber ich begriff nicht, was er damit gemeint haben konnte, da ich so wenig Anscheinung zu ihrer Erfüllung sah. Um mich von den traurigen Gedanken, die mich peinigten, zu zerstreuen, brachte ich durch verschiedene Zauberkünste alle die Schönen hieher, die das Unglück hatten, in meine Netze einzugehen; aber Rache an Astramond war die einzige Wollust, die einen Reiz für meine Seele hatte, und das Unvermögen, ihm weder durch Gewalt noch List beizukommen, verbitterte mir alle andern Ergötzungen.
Mein einziger Trost war noch, zu wissen, daß er nicht glücklicher war als ich. Keine von allen den Schäferinnen der ruhigen Aue hatte ihm die Prinzessin aus dem Sinne bringen können, deren Andenken ihn peinigte und unfähig machte, etwas anderes zu lieben. Endlich erfuhr ich vor einigen Tagen, daß er sie unter der Gestalt einer kleinen schwarz - weißen Hündin wiedergefunden und daß sie sich erboten habe, ihm ihre Unschuld dadurch zu beweisen, wenn er ihren Sohn nach dem Ringe der Gewalt schicken wollte.
Alle meine Leidenschaften erwachten wieder mit Ungestüm bei dieser Zeitung; der Gedanke, daß Astramond wieder glücklich werden und durch seinen Sohn zum Besitze des Ringes der Gewalt gelangen sollte, war mir unerträglich. Um mich durch mich selbst von allen Umständen zu unterrichten und desto sicherer einen Plan zu Vereitlung seines Glückes anlegen zu können, versetzte ich mich unsichtbarerweise in Astramonds Palast; aber eine neue Leidenschaft bemächtigte sich meiner Sinne beim Anblick der unvergleichlichen Nadine.
Ich verliebte mich bis zum Wahnsinn in sie, und vielleicht wäre ich noch bei Astramond, um mich im verborgenen in ihrem Anschauen zu berauschen, wenn er sie nicht, um deine Reise nach dem Palast des Feenköniges zu beschleunigen, in eine weiße Taube verwandelt hätte. Doch wozu verlängere ich meine Erzählung? Das übrige ist dir schon bekannt.
Mein Anschlag war, Astramonden, die Prinzessin und dich selbst, die Frucht einer verhaßten Liebe, der ich alles Unglück meines Lebens zuschreibe, zu vertilgen. Ich hoffte Nadinen und den Ring der Gewalt zu besitzen; und kein Mittel, das mir zu einem so großen Gute verhelfen konnte, war in meinen Augen unerlaubt. Alle diese Anschläge sind zu Wasser worden; alle meine Wünsche haben mir fehl geschlagen. Was säumst du? Räche dich! Vertilge den, der dich vertilgen wollte!»
«Ich spare dich zu einer anderen Rache auf», sagte Nadir. In diesem Augenblick wünschte er, daß Astramond, die Prinzessin und Nadine erscheinen möchten; und kaum hatte er den Wunsch getan, so sah er sie in einem von weißen Tauben gezogenen Wagen anlangen; und weil die sechzehn Jahre, welche die Prinzessin unter der Gestalt einer Hündin hingebracht, an ihrem Alter nicht gerechnet wurden, so schien sie nicht älter als Nadine zu sein.
Nadir warf sich zu ihren und Astramonds Füßen. «Hier», sagte er zu ihnen, «ist der Ring der Gewalt; behaltet ihn, ich verlange nichts als Nadinen.» Astramond und seine Gemahlin umarmten ihren Sohn, aber sein Geschenk wollten sie nicht annehmen. «Nur auf einen Augenblick», sagte Astramond; «gib mir den Ring, damit ich diesen Verräter bestrafen könne.» - «Nein», antwortete Nadir, «vergönnt mir, daß ich um Gnade für ihn bitte, er soll ihrer würdig werden.»
Bei diesem Worte berührte er die Stirne des Zauberers mit seinem Ring. «Werde tugendhaft!» sagte er zu ihm; und so gleich wurde es Neraorn, als ob ein dichter Nebel, der sein Gehirn bisher umzogen hätte, sich auf einmal zerstreue; seine ganze Vorstellungsart wurde das Gegenteil dessen, was sie gewesen war; aber Neraor war darum nicht glücklicher. Die Reue über das Vergangene peinigte ihn nun ebenso arg und noch ärger als vormals die Wut seiner Leidenschaften.
Nadir wurde es kaum gewahr, so berührte er seine Stirne zum zweiten Male, indem er ihm befahl, alles Vergangene zu vergessen. Nun erheiterten sich seine Augen, sein Gesicht wurde ruhiger, seine Physiognomie mild und offen; er warf sich seinem Bruder in die Arme und wurde liebreich von ihm empfangen. Nadir schenkte allen den Prinzen und Fräulein, welche Neraor in seinen Palast gezaubert hatte, die Freiheit wieder.
Diejenige, die unter Nadinens Gestalt so viel zu dieser glücklichen Entwicklung beigetragen, ließ sich bewegen, Neraorn ihre Hand zu geben, der nun fähig zu lieben und würdig, geliebt zu sein, worden war.
Das dreifache glückliche Paar erwählte die ruhige Aue zu seinem beständigen Aufenthalt; und Nadir bediente sich des Ringes der Gewalt nur, um die Bewohner des selben, wo möglich, noch glücklicher zu machen, als sie es schon durch ihre Einfalt und Unschuld waren.
Christoph Martin Wieland Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
TIMANDER UND MELISSA ...
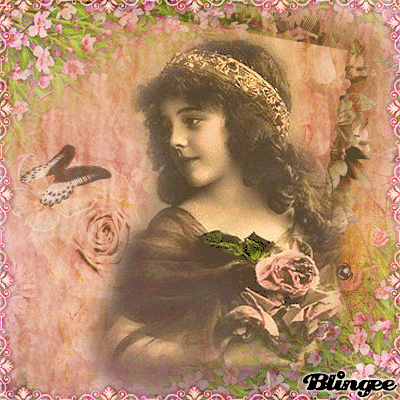
In den Zeiten, da die Königreiche noch ziemlich klein waren, regierte in einer Gegend des schönen Thessalien ein König namens Siopas; ein Name, den er bekommen hatte, weil er ein Mann von sehr wenig Worten war und auf das, was man ihm sagte - es mochten Vorschläge, Einwendungen oder Bitten sein -, gewöhnlich mit Stillschweigen zu antworten pflegte.
Er war übrigens eine gute Art von König; er hatte eine Menge negativer Tugenden, war nicht grausam, nicht ungerecht, nicht treulos, nicht ehrsüchtig, nicht unruhig, nicht unbeständig, nicht launisch, quälte seine Untertanen nicht mit unnötigen Verordnungen, wollte nicht alles besser wissen, war kein Verschwender, betrank sich nicht, hielt keine Mätressen, und so weiter; er hatte sogar seine Augenblicke, wo er mitleidig und freigebig war; und doch, weil er bei allen diesen guten Eigenschaften (oder wie man's nennen will) immer finster und mürrisch aussah, wenig sprach, an nichts besondere Lust hatte, also auch anderen Leuten keine Freude machte, und weder die Pracht noch den Krieg liebte, noch sonst etwas tat, womit er Aufsehen in der Welt gemacht hätte: so war er von seinem Volke mehr gehaßt und verachtet, als wenn er der ärgste Tyrann gewesen wäre; und es kam endlich so weit, daß einer seiner entfernten Verwandten, ein ehrgeiziger unternehmender Mann, eine Verschwörung gegen ihn anstiftete, die ihm Thron und Leben zugleich kosten sollte.
An dem Morgen vor der Nacht, in welcher der mörderische Anschlag ausgeführt werden sollte, sah er auf einmal ein kleines altes Weibchen vor ihm stehen, die ihn folgendermaßen anredete, «König Siopas», sprach sie, «ich bin immer eine gute Freundin deines Hauses gewesen; du kannst es mir um so eher glauben, weil ich nichts von dir verlange, wie wohl du ein König bist. Hier, nimm diesen Ring von mir: du wirst, wenn du ihn an dem kleinen Finger der rechten Hand trägst und die Hand auf die linke Brust legst, die Gabe erhalten, in den Herzen der Menschen zu lesen, die dich umgeben. Wenn die Zeit kommt, wo du seiner nicht mehr von Nöten hast, so stelle dich mit dem Gesichte gegen Mitternacht, sprich mit lauter Stimme die heiligen Worte: ‹Aski, Kataski, Tetrax›, und wirf ihn in die Luft!»
In Thessalien, wo Feerei und Zauberkünste von uralten Zeiten her zu Hause waren, befremdete so etwas weniger als in einem Lande, wo man sich von jeher auf die Naturwissenschaft gelegt hätte. Der König empfing den Ring (der aus einem unbekannten Metall gemacht und mit magischen Charakteren bezeichnet war) aus der runzlichten Hand des alten Weibchens, und in dem Augenblicke, da er ihn besah und an den kleinen Finger steckte, war die Alte wieder verschwunden.
Der Ring hätte nicht zu gelegenerer Zeit kommen können. Denn bald darauf, wie sich die Hofleute einstellten, um dem Könige nach Gewohnheit ihre Aufwartung zu machen, entdeckte er in dem Busen einiger Anwesenden den Anschlag, der in dieser Nacht gegen sein Leben hätte ausgeführt werden sollen. Er ließ sie sogleich in Haft nehmen; sie gestanden ihr Verbrechen und empfingen ihre Strafe.
Siopas erkannte nun den unendlichen Wert des Kleinodes, das ihm die unbekannte Fee anvertraut hatte, und machte so fleißig Gebrauch davon, daß ihm sein Hof in kurzer Zeit ein unerträglicher Aufenthalt wurde. Entweder log der Ring oder sein ganzes Hofgesinde war ein Pack falscher, ränkevoller, undankbarer, kriechender, raubgieriger Schmeichler und Verräter, deren einziges Dichten war, einander zu überlisten, ihn zu betrügen und zu mißbrauchen und sich selbst auf seine Unkosten zu bereichern, wie wohl sie bei allem dem ihren Schalk unter einem glatten Balg und einer schönen Larve zu verbergen wußten.
Seine übrigen Untertanen waren nicht um ein Haar besser. Die armen und geringeren schmälten auf die vornehmeren und reicheren und gaben sich das Ansehen, als ob sie an ihrem Platze viel bessere Leute sein wollten; aber wer, wie König Siopas, in ihren Herzen lesen konnte, sah wohl, daß sie entweder andere belügen wollten oder sich selbst belogen.
Der gute Siopas konnte es nicht länger ertragen, über ein so garstiges Menschengeschmeiß König zu sein. Er entschloß sich, die Krone dem besten Manne zu übergeben, den er im Lande finden könnte, und sich in ein Landgut zurückzuziehen, welches er, nicht weit vom Parnaß, an den Ufern des Flusses besaß, den die Verwandlung der Daphne in einen Lorbeerbaum so berühmt gemacht hat. Weil er sich ohne Erben sah (denn seine einzige Tochter war in ihrer Kindheit, da die Amme mit ihr spazieren ging, von einer ungeheuren Bärin geraubt und vermutlich gefressen worden), so hatte sein Vorhaben keine andere Schwierigkeit, als wo er den besten Mann im Lande finden sollte.
Er besann sich lange hin und her, bis ihm endlich eine seiner ältesten Bekanntschaften, ein gewisser Euthyfron, einfiel, der im Ruf eines sehr verständigen Mannes stand und den er seit mehr als zwanzig Jahren nicht an seinem Hofe gesehen hatte. «Ein gutes Zeichen!» dachte Siopas und ließ den Mann von seinem Gute, wo er der Landwirtschaft oblag und seinem eigenen Hause vorstand, zu sich berufen.
Der König hatte kaum seine rechte Hand in den Busen geschoben, so zeigte sich's, daß seine Vermutung richtig gewesen war. Er fand in diesem Euthyfron einen Mann voll gesunder Vernunft, Tätigkeit und Klugheit, der Fleiß und Ordnung liebte und Freude daran hatte, wenn alles um ihn her wohl stand. Siopas entdeckte ihm seine Entschließung, und Euthyfron, wie er sah, daß es Ernst war, dachte: Wer sein eignes Haus zu regieren verstünde, könnte auch wohl ein kleines Königreich regieren. Er willigte also, da das Volk seine Wahl bekräftigte, wie wohl mit etwas schwerem Herzen ein, sein glückliches Privatleben mit der Sorge für das Glück eines undankbaren und lasterhaften Völkchens zu vertauschen.
Der neue König wurde gekrönt, und der gute Siopas, dem in diesem Augenblick eine schwere Last von den Schultern fiel, eilte, was er konnte, nach seinem Gute an den Ufern des Peneus, wo es ihm, beim ersten Blick in das blühende, von waldichten Bergen umfangene und von der weißen Felsenstirne des Pindus beherrschte Tal und beim ersten vollen Zuge reiner Luft, den er mit freier Brust ein- und wieder ausatmete, nicht anders zumute war, als ob er neu erschaffen aus dem Kräuterkessel der Medea heraus gestiegen wäre.
Die Hirten und Landleute in diesem Tale schienen ein guter unschuldiger Schlag von Menschen zu sein; und Siopas, der keine Lust hatte, zu sehen, ob der Schein auch hier betrüge, und es lieber nicht so genau nehmen, als des Trostes, unter guten Menschen zu leben, entbehren wollte, stellte sich gegen Mitternacht, rief, so laut er konnte: «Aski, Kataski, Tetrax», und warf seinen Ring in die Luft.
König Euthyfron ließ sich's inzwischen eifrig angelegen sein, das kleine Reich, das ihm Siopas in ziemlich schlechtem Stand übergeben hatte, in einen besseren zu setzen. «Wenn nur erst die Menschen besser wären», dachte er, «das übrige sollte sich wohl von selbst finden.» Und so war seine erste Sorge, wie er seine Untertanen zu bessern Menschen machen könnte. «Als ich noch ein Landwirt war», sagte er zu sich selbst, «hatte ich immer gutes Hausgesinde; sie mußten tüchtig arbeiten, aber dafür nährte ich sie gut, sorgte für sie, wenn sie krank waren, und machte ihnen zuweilen einen frohen Tag. Ich wette, hätt' ich sie müßig gehen und hungern lassen, sie wären bald so schlecht worden als die Untertanen des Königs Siopas.»
Dieser Theorie zufolge wandte Euthyfron alle möglichen Mittel an, Fleiß und Wohlstand in seinem Lande zu befördern. Er munterte alle Nahrungszweige auf, schützte den Landmann vor Unterdrückung, beschäftigte die Handwerker und Künste und ließ der Handelschaft ihren freien Lauf. Er bestrafte den Müßiggang als das ärgste aller Laster, weil er der Vater aller übrigen ist. Er machte wenig Polizeiverordnungen, aber die er machte, waren zweckmäßig, und er hielt scharf darüber.
Er hatte selbst die Augen überall, und wo er einen geschickten und emsigen Mann, einen guten Hausvater, einen Mann, der durch Fleiß und Sparsamkeit empor zu kommen anfing, sah, der konnte sich auf seine Unterstützung verlassen. Kurz, König Euthyfron regierte sein Volk als ein verständiger Landesvater, gerade so, wie er ehemals sein Haus als ein kluger Hausvater regiert hatte; und wie wohl sein Volk eine hart Häutige ungeschlachte Art von Menschen war, so zeigte sich doch in wenigen Jahren, daß sie unter seiner Regierung besser, sittlicher und wohlhabender zu werden anfingen.
Euthyfron hatte einen Sohn namens Timander, dem bei einem Wettstreit um den Vorzug der Schönheit niemand in ganz Thessalien den Preis hätte streitig machen können. Er war seines Vaters nicht unwürdig; in dessen liebte er, wie alle jungen Leute, die Vergnügungen. Bisher waren starke Leibesübungen, vornehmlich die Jagd, beinahe das einzige gewesen, wozu er einen entschiedenen Hang gezeigt hatte; aber endlich fing er doch an zu fühlen, daß ein Leeres in seinem Herzen war, welches diese Dinge nicht ausfallen konnten.
Die Schönen am Hofe seiner Mutter, die er bisher mit Gleichgültigkeit angesehen hatte, setzten ihn jetzt in eine halb angenehme, halb unbehagliche Art von Unruhe; er wünschte einen Gegenstand zu finden, der seine ganze Einbildungskraft ausfüllen und ihn in den Genuß aller der Entzückungen setzen möchte, die er ahnte, ohne die Person zu sehen, welche sie ihm verschaffen könnte.
Eines Tages, da er, um seine Gedanken zu zerstreuen, sich dem Vergnügen der Jagd ziemlich unmäßig überlassen hatte und darüber von allen seinen Leuten abgekommen und in ein ungepfadetes Gebirge verirrt war, wurde er durch ein Schauspiel, das gleich beim ersten Anblick dem Anfang irgendeines schönen Abenteuers ähnlich sah, nicht wenig in Erstaunen gesetzt.
Eine unzählbare Menge schneeweißer Tauben trugen eine Art von Thron, der aus lauter Rosen von allen Farben zusammengesetzt war, durch die Luft daher und setzten ihn vor seine Füße auf die Erde. Er hatte kaum Zeit genug, diese seltsame Erscheinung, die er für eine Wirkung seiner Phantasie zu halten versucht war, etwas genauer zu betrachten, als eine dieser Tauben, deren Hals und Schwingfedern in der schönsten Purpurfarbe glühten, ihm in ihrem Schnabel ein Rosenblatt überreichte, worauf mit goldnen Buchstaben eine Einladung, sich in diesen wunderbaren Rosenthron zu setzen, geschrieben war.
Timander besann sich einige Augenblicke; aber Neugier und eine Art von Ahnung und gutem Zutrauen zu einem Abenteuer, das so artig begann, überwogen bald alle Bedenklichkeiten. Man nimmt es der unerfahrenen Jugend übel, daß sie sich, durch einen natürlichen Instinkt zum Erfahren hingerissen, so gern in unbekannte und mißliche Dinge einläßt, gleich als ob man durch etwas anderes als Erfahrungen zur Erfahrenheit kommen könnte.
Wie dem auch sei, der junge Prinz entschloß sich, zu sehen, was das Ende dieser seltsamen Begebenheit sein würde, und setzte sich in den Rosenthron. In diesem Augenblick stimmten eine Menge bunt durcheinander flimmernder Kanarienvögel, die mit den Tauben gekommen waren, einen so lauten und durchdringenden Jubelgesang an, daß der Prinz bei minder starken Nerven sein Gehör darüber hätte verlieren können; und ehe man die Hand umkehren konnte, war der Thron wieder aufgehoben und schwebte so schnell wie ein Luftballon unter leichten Rosenwölkchen daher.
Es würde dem Prinzen schwer gewesen sein, zu sagen, wie viele Zeit er mit dieser Reise zugebracht habe; genug, sie schien ihm die kurzweiligste, die er in seinem Leben gemacht; und nur die unendliche Menge von Städten, Dörfern, Landhäusern, Flüssen, Seen, Bergen, Tälern und Ebnen, die in der angenehmsten Mannigfaltigkeit unter ihm weg flogen, hieß ihn schließen, daß er einige tausend Meilen zurückgelegt haben müsse: als die Tauben ihn mitten auf einer höchst anmutigen Insel, in einem Duftkreise der süßesten Wohlgerüche, wieder niedersetzten.
Dieser Ort machte die lieblichsten Träume seiner Kindheit und Jugend alle auf einmal in ihm rege. Es war ein Garten oder ein Lustwald, wie sich die Phantasie eines Verliebten denjenigen einbilden kann, worin die Göttin der Liebe ihren Adonis vor den neidischen Blicken der Götter und der Sterblichen verbarg. Ein ewiger Sommer teilte sich mit Zephyrn und Floren in die Herrschaft über diese Zaubergefilde; nie verloren die Bäume ihr Laub, nie die Fluren ihre Blumen; jede sterbende wurde von einer neuen ersetzt, die an ihrer Stelle hervor sprießte.
Stürme, Regen und Ungewitter waren auf ewig aus dieser glücklichen Insel verbannt; die Auen und Haine wurden nur von tausend schlängelnden Silberbächen und die Blumen allein von den süßen Tränen der Aurora angefeuchtet. Tausend Vögel, die durch die Anmut ihres Gesanges oder die Schönheit ihres Gefieders dieses Ortes würdig waren, Nachtigallen und schimmernde Kolibris, kleine Papageien von den buntesten und lebhaftesten Farben, Goldfasanen und cayennische Feuerhähne, belebten die Pomeranzenwäldchen und die immerblühenden Gebüsche, und unzählige Schmetterlinge, deren Farben die schönsten aus Surinam auslöschten, gaukelten, gleich eben so viel lebendigen Blumen, zwischen den Gesträuchen im Sonnenstrahl.
Alles atmete Eintracht und Liebe in diesem irdischen Elysium. Da war keine Pflanze, die mit ihrem Gift hauchenden Schatten die Blumen um sie her entfärbte, kein Raubvogel, der die friedsamen Kinder der Lüfte in ihren Liebesgeschäften und häuslichen Freuden störte; kein reißendes Tier, keine Schlangen, keine beschwerlichen Insekten entweihten den Wohnsitz der Freuden und der wollüstigen Ruhe. Nur schneeweiße Hündinnen und muntere Rehe mit diamantenen Halsbändern durchstrichen unverfolgt und ohne Furcht die luftigen Gehölze und sprangen, von einer schönen Nymphe gerufen, folgsam herbei, um Blumen aus ihrer weißen Hand zu fressen.
Timander konnte es nicht satt werden, seine Augen an allem dem Reichtum der schönen Natur zu weiden, der hier auf einem Raume von wenigen Stunden, in einer so reizenden Unordnung, daß sie das Werk der sinnreichsten Kunst schien, zusammengehäuft war. Ungeachtet der üppigsten Fülle und der reichsten Mannigfaltigkeit drängte keines das andere: alles schien sich von selbst zusammen gefunden und einander gleichsam das Wort gegeben zu haben, um dieses bezauberte Eiland zur Wohnung irgendeiner Göttin zu machen.
So dachte Timander und sah sich halb betroffen, halb ungeduldig nach den Bewohnern des selben um, als er durch einen der breiten Lustgänge des Gartens einen leichten muschelförmigen Wagen, mit zwei Hirschen bespannt, vorüber eilen sah. Der Wagen war von Elfenbein, das Geweihe der Hirsche von Golde, und in der Muschel saß eine junge Person, so schön, als man sich die junge Hebe denken kann, da sie dem vergötterten Herkules die erste Nektarschale reichte.
Der Prinz, von ihrem Anblick bezaubert, hätte sich gern in ihren Weg gestellt; aber die Hirsche eilten zu schnell vorüber, um sie einholen zu können. In wenig Augenblicken folgten mehr als zwanzig andere Wagen, die mit weißen Einhörnern bespannt und mit einer Menge junger Nymphen angefüllt waren, wovon immer eine schöner als die andere schien. Sie flogen ebenso schnell vorüber als die erste und ließen den Prinzen vor Erstaunen unbeweglich.
Da er in dessen aus der wunderbaren Art, wie er hierher gekommen, nichts anders schließen konnte, als daß er keine unerwartete Person sei, so folgte er diesen Wagen durch verschiedene krumme Gänge eines Lustwäldchens von Myrten- und Rosenbüschen, die hier zu einer ungewöhnlichen Höhe aufgeschossen waren und in voller Blüte standen, bis er endlich, auf einem sanften, kaum merklichen Abhang, zu einem mit Akazien und Silberpappeln umschlossenen Platz gelangte, der, anstatt des Sandes, mit lauter kleinen Perlen dicht bestreut war und ein großes porphyrnes Wasserbecken umgab, worin verschiedene Schwäne stolz und langsam daher schwammen, und mit wollüstig gebogenen Hälsen sich selbst in der dunkel hellen Flut bespiegelten, ohne auf das entzückende Schauspiel Acht zu geben, dessen plötzlicher Anblick Timandern in Stein verwandelte.
Man stelle sich hundert junge Nymphen von der blühendsten Schönheit in allen ihren mannigfaltigen Formen und Reizen vor, die eine junge Göttin von achtzehn Jahren bloß darum zu umringen schienen, um von ihrer vollkommenem Schönheit wie die Sterne von dem vollen Monde verdunkelt zu werden. Diese hundert Nymphen schienen in vier Ordnungen abgeteilt, deren jede sich durch eine andere Farbe der Kleidung von den übrigen unterschied. Sie trugen alle die Arme bloß und den Busen nur leicht verdeckt; und weil sie überdies zum Tanzen aufgeschürzt waren, so würde es einem Künstler hier nicht an Gelegenheit, die Natur zu studieren, gefehlt haben.
Ihre Gebieterin allein war in ein langes rosenfarbenes Gewand gekleidet, welches sie auf eine sehr wohl anständige Art bedeckte, ohne gleich wohl, je nachdem sie ihre Lage und Stellung veränderte, eine ihrer schönen Formen unangedeutet zu lassen. Sobald Timander nahe genug war, um von der Beherrscherin dieses Ortes bemerkt zu werden, kam ihm die eine Hälfte der Nymphen tanzend entgegen, während die andere, die einen halben Mond um ihre Königin zog, die anmutigste Musik aus den elfenbeinernen Zithern und Pandoren, die an silbernen Bändern um ihre milchweißen Schultern hingen, hervor zauberte.
Die Tänzerinnen umwanden ihn mit Kränzen von Rosen und Jasmin und führten ihn gleichsam im Triumphe zu den Füßen ihrer schönen Gebieterin, die unter einem Thronhimmel von Rosen die Huldigung seines Herzens zu erwarten schien. Er ließ sich auf ein Knie vor ihr nieder; aber sie bückte sich mit unbeschreiblicher Anmut zu ihm herab, hieß ihn willkommen und befahl ihm, neben ihr auf ihrem Rosenthron Platz zu nehmen.
Die Nymphen fingen jetzt neue Tänze an, die von Zeit zu Zeit durch entzückende Wechsel- und Chorgesänge unterbrochen wurden, worin sie die Freuden der Liebe besangen, die aus ihren Augen zu strahlen und aus allen ihren Bewegungen zu atmen schienen. Timander, berauscht von allem, was er sah und hörte, glaubte einer der seligen Götter zu sein. Er vergaß auf einmal aller seiner Verhältnisse, seiner Eltern, seines Vaterlandes, seiner Freunde und der Würde, für die er geboren war: vergaß sie so gänzlich, wie man die Gegenstände vergißt, die unserer ersten Kindheit Freude oder Schmerz gemacht haben.
Ein unbekannter, aber unaussprechlich angenehmer Zauber hatte sich aller seiner Sinne bemächtigt; und er schien sich selbst sein neues Wesen bloß dazu empfangen zu haben, um es in Seufzer der Liebe wieder auszuatmen. Die Göttin oder Fee, unter deren süßer Gewalt sein Herz erlag, las in seinen Augen alles, was er in Worte auszuströmen zu bescheiden war, und kam seiner Schüchternheit zu Hilfe, in dem sie ihm sagte, wer sie sei und was für Absichten sie auf ihn habe.
«Mein Name ist Pasithea», sprach sie mit einer Stimme, deren Klang sein Herz in Liebe schmerzte; «ich bin eine Tochter der Feenkönigin, und diese Insel erkennt keine andere Macht als die meinige. Man nennt sie die Roseninsel, denn sie ist unter den Inseln, was die Rose unter den Blumen. Vergnügen und Ruhe, Scherze und Freuden haben sie, unter meiner Herrschaft, auf ewig in Besitz genommen.
Aber was ist Ruhe und Vergnügen, was sind Scherze und Freuden ohne Liebe?» Ein kaum hörbarer Seufzer, so leise wie das Fächeln eines Sommervogels um eine neu aufgequollene Rose, unterbrach ihre Rede einen Augenblick. «Ich sah dich diesen Morgen», fuhr sie fort, «in dem ich, von dir unbemerkt, über der Gegend, wo dich die Jagd beschäftigte, vorüber schwebte. Ich glaubte in deinen Zügen das süße Bedürfnis der Liebe zu lesen, und du scheinst mir würdig, durch sie glücklich zu sein. Frage nun dein Herz - ich will ihm Zeit lassen - und sage mir...»
Hier konnte sie der liebes trunkene Timander nicht länger fort reden lassen. Er unterbrach sie, um ihr bei allen Göttern der Liebe zu bezeugen, daß er keine Zeit brauche, mit einer Gewißheit, die dem Gefühle seines Daseins gleich sei, sie für die unumschränkte Beherrscherin seines Herzens zu erklären. Er schwur ihr - was allen jungen Liebhabern im ersten Feuer der unbefriedigten Leidenschaft so leicht zu beschwören und so leicht zu halten scheint, und doch, wenn der Taumel vorüber ist, so leicht vergessen wird! - ewige Liebe, ewige Treue. Er konnte nicht aufhören, ihr die feurigsten Versicherungen von der Wahrheit dieser Erklärung zu geben, und die zärtliche Fee schien nicht müde zu werden, ihm zuzuhören, wie wohl er im Grunde immer das nämliche sagte.
In dessen hörten die Nymphen zu tanzen auf, und die Schönheit des Abends diente Pasitheen zum Vorwand, seine Sinne mit einem anderen Schauspiel zu ergötzen. Die Gärten, wo sie sich befanden, waren in verschiedene große Terrassen abgeteilt, deren unterste von den Wellen des Meeres, wenn es hoch ging, angespült wurde. Eine Menge zierlich geschnitzter und vergoldeter Barken lagen hier in einer kleinen Bucht bereit, die Fee mit ihrem Hofe einzunehmen.
Sie bestieg an Timanders Hand die größte der selben, die, in Gestalt einer Muschel gebaut und mit Perlenmutter überzogen, dem Wagen nicht ungleich sah, in welchem Dichter und Maler die Göttin des Ozeans auf den vor ihr her gebannten Wellen daher schwimmen lassen. Ein leichtes Segel von Purpur, an einem vergoldeten Maste befestigt, blähte sich vom sanften Hauch eines gelinden Abendlüftchens, und auf jeder Seite schienen drei Knaben, schön wie Liebesgötter und wie Liebesgötter gekleidet, mit ihren versilberten Rudern mehr zu spielen als zu arbeiten.
Pasithea und Timander saßen auf einer erhöhten Estrade, die mit reichen Tapeten belegt und mit goldnem Gitterwerk umgeben war, unter einem Bogen von Rosen und Orangenblüten. Zu beiden Seiten wimmelten eine Menge kleinerer Fahrzeuge voll Nymphen und Amoretten um sie her, die durch allerlei mutwillige Scherze ihre Augen auf sich zu ziehen suchten.
Aber der Prinz hatte keine Augen als für seine reizende Fee, deren kleinste Bewegung seine Aufmerksamkeit um so mehr beschäftigte, weil ein dichter Schleier, den sie alles seines Bittens ungeachtet nicht ablegen wollte, ihm noch immer die Reize ihres Gesichtes entzog, welche ohne allen Zweifel der ausnehmenden Schönheit ihrer übrigen Person würdig waren. Die Fee bestand darauf, daß sie ihm diese Gunst nicht eher erweisen könne, bis sie von der Stärke und Beständigkeit seiner Liebe überzeugt sei.
«Aufrichtig zu reden», sagte sie zu ihm, «ich würde nicht wahrhaft geliebt zu sein glauben, wenn ich dein Herz nicht ohne Hilfe meines Gesichtes gewinnen könnte. Ich wünsche dir mehr durch meinen Charakter als durch meine Schönheit zu gefallen. Ein schönes Gesicht ist wie eine schöne Blume; beide entzücken das Auge in ihrer frischen Blüte; aber es braucht nur einen einzigen zu brennenden Sonnenstrahl, um beide welk zu machen.
Gesetzt auch, ein reizendes Gesicht wüßte sich vor allen Zufällen zu verwahren, die ihm schaden könnten: so kann es doch den Wirkungen der Jahre nicht entgehen. Und wenn bei einer Person meiner Art auch diese nicht zu befürchten wären: so ist die bloße Gewohnheit hinlänglich, das Auge des wärmsten Liebhabers kalt und stumpf zu machen.
Laß dich indessen diese kleine Grille, wenn es eine ist, nicht betrüben! Ich werde diesen Schleier, der dir so verhaßt ist, nicht immer tragen. Er soll nur deine Treue auf die Probe stellen; und sobald ich mich der selben gänzlich versichert halten werde, will ich dich zum Besitzer und Herrn meiner Person machen, wie du es schon von meinem Herzen bist.»
Timander hatte gegen diese schöne Rede vieles einzuwenden; aber am Ende war doch nichts zu tun, als Geduld zu haben. In der Tat konnte er dies um so leichter, da das, was sie seinen Blicken freigab, sie zur vollkommensten Person der Welt in seinen Augen machte.
Sie war groß, schlank und in allen Teilen nach dem feinsten Ebenmaße gebaut; ihr Busen, ihre Arme und Hände waren von der höchsten Schönheit, und über ihr ganzes Wesen, wie über ihre kleinsten Bewegungen, war eine Anmut ausgegossen, die von dem unsichtbaren Teile ihrer Person die angenehmsten Ahnungen erweckte und der man um so weniger widerstehen konnte, weil sie durch Witz, Gefühl und Lebhaftigkeit, unterstützt von den Grazien ihres Geistes, alle Augenblicke neuen Reiz entlehnte. Der Schleier selbst - wie viel man auch durch ihn verlieren mochte - kleidete sie so gut, daß er ausdrücklich für sie erfunden schien und alle ihre übrigen Reizungen um desto rührender machte.
Die Lustpartie auf dem Wasser wurde bis in die Nacht verlängert, um der magischen Wirkungen zu genießen, die der Vollmond hervor brachte, in dem sie auf den breiten Kanälen daher fuhren, die den Garten von verschiedenen Seiten durchschnitten und in ebenso viel kleine Inseln abteilten, zwischen welchen das Auge wie in einer Zauberwelt zweifelhafter Schattenwesen und lieblich verworrener Umrisse umher schwamm.
Sie landeten endlich an den marmornen Stufen eines prächtig erleuchteten Pavillons an, der nicht schöner, als er war, hätte sein können, wenn er auch, wie die Gräfin d'Aulnoy versichert, aus Quaderstücken von Diamant erbaut gewesen wäre. Alle Säle dieses Palastes wimmelten von schönen Personen, die zum Hofe der Fee gehörten; alles schimmerte und funkelte und war dazu gemacht, um die Größe und Liebenswürdigkeit der Gebieterin zu erheben, die mitten in dieser Welt voll Pracht und Schönheit und Reichtum doch immer in Timanders Augen das einzige blieb, was seine Aufmerksamkeit fesselte.
Man setzte sich zur Tafel, während welcher sich eine bezaubernde Musik hören ließ; und so oft diese eine Pause machte, unterhielt die Fee ihren Gast mit so munteren und witzigen Einfällen und gab ihm so viele Gelegenheit, seinen eigenen Witz zu zeigen, daß er sie, wenn sie dessen auch selbst weit weniger gehabt hätte, gleich wohl für die unterhaltendste Gesellschafterin in der Welt erklärt haben würde.
Als die Tafel aufgehoben war, brachte man ihr eine Laute; und nachdem sie eine Weile mit ebenso viel Geschmack als Fertigkeit präludiert hatte, ließ sie den halb vergeisterten Prinzen eine Stimme hören, die allein mehr als hinlänglich gewesen wäre, ihn zum verliebtesten aller Menschen zu machen. Endlich vollendete ein großer Ball die Lustbarkeiten dieses Tages und den Triumph der schönen Pasithea.
Eine unzählbare Menge schöner Nymphen und Hirten versammelten sich in einem Saale, den die Kunst und eine verschwenderische Beleuchtung in einen bezauberten Garten verwandelt hatte. Alle tanzten unverbesserlich; aber die Fee allein tanzte so schön, daß die Grazien selbst darüber neidisch worden wären, wenn die Grazien neidisch werden könnten.
Timander, dessen Trunkenheit mit jeder Stunde zugenommen hatte, verlor in dieser alles, was ihm noch von seiner Vernunft übrig geblieben war. Er warf sich im Taumel seines Entzückens der Fee zu Füßen und schwur ihr von neuem, in Ausdrücken, die einem Dithyrambendichter Ehre gemacht hätten, daß alle Reize aller Göttinnen des Himmels und der Erde, die eine einzige zusammen gedrängt, nicht vermögend sein sollten, die Treue, die er ihr von neuem auf ewig gelobte, nur einen Augenblick wanken zu machen.
Die verlobte Gräfin versichert, Timander hätte auf diese Weise sechs ganzer Monate bei der schönen Pasithea zugebracht, ohne daß ihm zur Vollständigkeit seines Glückes etwas anderes als ihr Besitz gemangelt habe. Die gute Dame hat sich entweder verschrieben und Monate anstatt Tage aus der Feder schlüpfen lassen, oder sie dachte nicht, was sie sagte.
Unsere Nachrichten geben, daß er es in dem halb wahnsinnigen Zustand, wozu ihn die Fee brachte, in dem sie seinem Herzen mit allen ihren Reizen und Talenten auf einmal so heftig zusetzte, nicht länger als sechs bis acht Tage habe aushalten können; und wir glauben, daß alle Leute, welche wissen, was möglich ist, sich für unsere Lesart erklären werden.
Der Prinz, dem man übrigens seine wenige Geduld auf Rechnung seiner großen Jugend schreiben muß, wurde binnen dieser kurzen Zeit, die ihm sehr lang vorkam, so dringend, daß die schöne Fee sich nicht länger weigern konnte, seine Probezeit abzukürzen und in einem Tempel des Hymen, den sie auf dem anmutigsten Platze ihrer Gärten aufführen ließ, mit ihm zusammen zu kommen.
Da ihr die schönsten Gebäude und die herrlichsten Feste nur ein Wort kosteten, so kann man sich diesen Tempel und das Fest, womit sie den schönsten Tag ihres Lebens feierte, so schön und herrlich einbilden, als man nur immer will. Timandern würde eine alte schwarz geräucherte Kapelle bei dieser Gelegenheit so schön vorgekommen sein als ein Tempel von Porphyr, mit azurnen Säulen und einer goldnen Kuppel; und von allen Szenen der Freude, die einander an diesem Tage drängten und die er sehr langweilig fand, war die Prozession, welche die verschleierte Braut unter Anstimmung des hochzeitlichen Gesanges in den Hymens Tempel führte, die einzige, die nach seinem Geschmacke war.
Dieser Tempel verwandelte sich, sobald die Fee seine Schwelle betrat, in das herrlichste Brautgemach; aber kaum war sie von ihren Nymphen zu Bette gebracht worden, so befahl sie, die Karfunkeln weg zu nehmen, die zu beiden Seiten des selben von zwei goldnen Liebesgöttern empor gehalten wurden und einen Schein von sich warfen, der das ganze Zimmer erleuchtete.
Wie unangenehm auch dieser Befehl dem Prinzen war, so wagte er es doch nicht, sich ihm zu widersetzen. Er glaubte der zarten jungfräulichen Empfindung dieses letzte Opfer schuldig zu sein; über dies kam ihm die Nacht, nach der Versicherung der Dame d'Aulnoy, so erstaunlich kurz vor, daß er den Tag um so leichter erwarten konnte, der ihm das so sehnlich verlangte Glück endlich gewähren würde.
Da ihn seine Ungeduld keinen Augenblick schlafen ließ, so benutzte er den ersten Morgenstrahl dazu, sich diese Wonne zu verschaffen. Er zog ganz leise den Vorhang und blickte mit gierigen Augen nach der Fee, die in dessen fest eingeschlafen war. Himmel! wie groß war seine Bestürzung: diese Abgöttin seines Herzens, die er so inbrünstig liebte, die, seinem Wahne nach, alles, was schön und vollkommen ist, in ihrer Person vereinigte, hatte ein kleines Affengesicht, das wirklich ziemlich drolligste Grimassen im Schlafe machte, aber dem betrogenen Prinzen in diesem Augenblick so abscheulich vorkam, daß er zusammenfuhr und sich nicht halten konnte, sein Entsetzen durch einen lauten Schrei und einige sehr starke Redensarten kund werden zu lassen.
Die Fee, die davon erwachte, war vor Erstaunen außer sich, in ihrem zärtlich geliebten und kaum noch so entzückten Gemahle auf einmal einen Undankbaren zu finden, der sie mit den bittersten Vorwürfen überschüttete und ihr sogar zum Verbrechen machte, was ihn auf ewig hätte an sie fesseln sollen. Sie konnte sich in eine so unnatürliche Veränderung seiner Gesinnungen gar nicht finden; denn die gute Dame war so weit entfernt, sich über ihr kleines Affengesicht, an das sie längst gewöhnt war, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, daß sie sich vielmehr, dessen ungeachtet, mit allen ihren übrigen Reizungen und Gaben für die liebenswürdigste Person in der Welt hielt.
Es ist wahr, der Schleier, hinter den sie sich verbarg, bewies einiges Mißtrauen in die Wirkung des ersten Anblicks: aber nachdem der Prinz von den Reizen ihrer Person und ihres Geistes so bezaubert geschienen, nachdem er ihr unbegrenzte Liebe und Treue geschworen und nachdem sie ihn so glücklich gemacht hatte, als es ein Sterblicher sein kann, konnte sie doch wohl erwarten, daß er ein Gesicht, das zwar nicht das regelmäßigste war, dem es aber bei allem dem (wie sie glaubte) nicht an einer gewissen Grazie fehlte, mit Augen der Liebe betrachten würde.
Überhaupt (sagt die mehr belobte französische Gräfin) wollen alle Damen, daß man ihnen schmeichle, und die Wahrheit gefällt ihnen nur insofern, als sie der guten Meinung, die sie von ihrer Schönheit haben, keinen Abbruch tut. In der Tat hatte Pasithea von ihren Höflingen immer nichts als Komplimente über die ihrige gehört; und sogar die Spiegel in ihrem Schlosse waren so gefällig gewesen, ihr nie was anders zu sagen.
Stolz und Liebe waren also bei ihr in gleichem Grade durch das unartige Betragen des Prinzen beleidigt; und da er, anstatt sich zu besinnen und zu ihren Füßen Gnade zu suchen, es vielmehr immer ärger machte, so geriet sie endlich in eine Wut, wodurch ihr Gesicht in der Tat nicht liebenswürdiger wurde. Aber zu stolz, in Gegenvorwürfe auszubrechen, die vielleicht durch ihre Tränen würden erstickt worden sein, berührte sie ihren Ungetreuen bloß mit ihrem Stäbchen und verwandelte ihn, weil sie im höchsten Zorne nicht grausam sein konnte, in einen Schmetterling.
Der arme Timander sank, von Schrecken betäubt, zu Boden; aber die Sonnenstrahlen, die auf ihn fielen, und der Morgenduft, der ihm durch ein offnes Fenster entgegen kam, riefen ihn bald wieder ins Leben: er entfaltete seine Flügel und flatterte so geschickt, als ob er den besten Schmetterling zum Lehrmeister gehabt hätte, zum Fenster hinaus.
Wie ihm zumute war, da ihm die Fee das Bewußtsein seines vorigen Wesens und Standes gelassen hatte (als ohne welches seine Verwandlung keine Strafe gewesen wäre), kann man sich leicht vorstellen. Timander als Schmetterling gefiel sich in seinem neuen Stande ganz gut; aber der Schmetterling als Timander war der unglücklichste Prinz von der Welt. In dessen, wie sich der Mensch endlich in alles schicken lernt, so fügte sich Timander endlich auch in seinen Schmetterlings Stand; und wenn die leidige Furcht vor den Elstern, Staren und ihresgleichen nicht gewesen wäre, wovon ein gemeiner Schmetterling nichts weiß, so würde ihm das freie, sorglose, vagabunde Leben seiner neuen Kameraden ganz wohl gefallen haben.
Seine Abscheu vor der Fee hatte ihn so weit von der Roseninsel weg geführt, daß er nach einigen Tagen wieder in dem Lande anlangte, woraus ihn die jugendliche Begierde nach Abenteuern zu seinem Unglück entfernt hatte. Er erkannte es und stellte traurige Betrachtungen über das an, was er hier sein sollte und was er war oder zu sein schien. Welche Möglichkeit, sich für den Prinzen Timander zu erkennen zu geben? Und wenn er es auch könnte, wozu würde es ihm helfen? Welches Volk in der Welt würde einen Schmetterling zum Fürsten haben wollen?
Unter diesen Gedanken geriet er von ungefähr in ein Gebüsch, wo ein junges Mädchen sich ins Gras hin gestreckt hatte, um nach einem Bade in einem vorüberrieselnden Bache auszuruhen. Ein weißes leinen Gewand und einige blaue Kornblumen in ihrem braunen Haar machten ihren ganzen Putz aus. Weil der Tag sehr warm war und sie hier ganz allein zu sein glaubte, war sie beinahe entkleidet, ihr Busen offen, ihre Arme und Füße bloß, ihr Haar halb aufgelöst und ihr Gewand nur nachlässig um den Leib geworfen.
Das holde unbesorgte Mädchen war eingeschlummert, und es möchte gefährlich für sie gewesen sein, von einem anderen als einem Schmetterling in diesem Zustand überrascht zu werden. Bei dem Schmetterling hatte es nichts zu bedeuten; er mochte sie für einen Haufen Lilien und Rosen ansehen und würde sich vermutlich begnügt haben, etliche Mal um sie her zu flattern, sie mit feinen Fühlhörnern hie und da zu beschnüffeln und dann wieder davon zu fliegen, wenn Timander aus dem, was ihm seine Schmetterlingssinnen entdeckten, vermittelst des feinern Menschensinnes, der ihm geblieben war, nicht durch Verbindung alles dessen, was er bei öfterem Umflattern und leiser Berührung dieses anziehenden Gegenstandes bemerkte, heraus gebracht hätte, daß es ein artiges junges Mädchen von sechzehn Jahren sein müßte.
Mehr brauchte es nicht, seine Einbildungskraft und sein Herz mit ins Spiel zu ziehen. Jene bildete sie ihm als eine zweite Pasithea vor; aber eine Pasithea mit dem schönsten Kopfe von der Welt, mit den Augen der Venus, den Wangen der Hebe, den Lippen der Suada und dem Lächeln der Grazien; dieses verliebte sich auf der Stelle in das zauberische Traumbild - und fühlte, anstatt seine Schmetterlingsfigur zu verwünschen, ein unbeschreibliches Vergnügen in dem Gedanken, die holde Schöne ohne alle eigennützige Begierden bloß um ihrer selbst willen zu lieben und sich an dem reinen Anschauen ihrer Vollkommenheiten zu weiden, ohne sie, wie ein gemeiner Liebhaber, durch seine eigennützige Liebe zu zerstören.
Unter allen Wesen ist vielleicht keines, das sich besser zu einem würdigen Schüler der berühmten Platonischen Diotima schickt, als ein denkender und empfindsamer Schmetterling. Timander flatterte in dieser Eigenschaft so lange und so unvorsichtig bald um die Lippen, bald um den Busen, bald um das runde wächserne Knie der jungen Schläferin herum, bis sie erwachte und bei Eröffnung ihrer schönen Augen einen neuen himmlischen Tag, wie ihn däuchte, aufgehen ließ.
Der Schmetterling konnte dem Mädchen nicht lange unbemerkt bleiben. Seine Größe und die seltene Schönheit seiner Farben würden ihre Augen auf ihn gezogen haben, wenn er auch nicht so ungewöhnlich zahm gewesen wäre und ein so sonderbares Belieben, um sie zu sein, gezeigt hätte. Sie bemerkte dies mit Verwunderung; und ungeachtet ihr nichts weniger in den Sinn kam, als daß ein Jüngling und ein Königssohn unter diesem Tierchen verborgen sein könnte, so war doch das erste, was sie tat, daß sie ihr allzu loses Gewand zusammenzog und in gehörige Ordnung brachte.
Sie bemühte sich hierauf, den schönen Sommervogel zu haschen; aber anstatt sich fangen zu lassen, setzte er sich von freien Stücken bald auf ihren Kopf, bald auf ihre Schultern und flatterte nicht eher fort, bis sie die Finger nach ihm spitzte, entfloh aber jedesmal bloß, um von selbst wiederzukommen. Sie wurde endlich des Spiels müde, pflückte einen großen Strauß frischer Rosen im Gebüsche und ging einer nicht weit entlegenen Hütte zu.
Timander setzte sich sogleich auf den Strauß, den sie in der Hand trug, und wich und wankte nicht, auch wenn sie tat, als ob sie ihn abschütteln wollte. Sie wunderte sich dessen immer mehr, weil sie sich nicht begreiflich machen konnte, wie ein so wildes und flattriges kleines Ding so zahm und standhaft sein könne.
Das junge Mädchen trat in eine ländliche Wohnung, worin alles sehr hübsch und reinlich aussah. Sie war von einem großen Obst- und Küchengarten umgeben, durch den man in eine Wiese hinaus sah, wo einige Kühe im Grase gingen; ein Bach, der an beiden Ufern mit Weiden besetzt war, schlängelte sich in verschiedenen Krümmungen durch sie hin; und das alles zusammen genommen machte ein angenehmes kleines Gütchen aus, das einer guten alten Frau namens Sofronia zugehörte, welche die Mutter des jungen Mädchens war oder zu sein schien.
«Meine liebe Melissa», sagte die Alte, an ihrem Spinnrocken sitzend, zu dem Mädchen, als sie mit ihrem Strauß in der Hand in die Stube trat, «Wie froh bin ich, dich wiederzusehen! Dein langes Ausbleiben hat mir große Unruhe gemacht. Tu es mir zulieb, mein Kind, und entferne dich künftig nicht mehr so lange von mir. Mädchen in deinem Alter und Aussehen laufen gar zu leicht Gefahr, daß ihnen was Widriges zustoßen kann, wenn sie nicht unter den Augen der Mutter sind.»
Das junge Mädchen nahm diese Erinnerung des alten Mütterchens sehr wohl auf und versprach, künftig ihrem Rate zu folgen. «In dessen», sagte sie, «ist mir nichts bei meinem Spaziergang aufgestoßen als dieser schöne Schmetterling»; und sie erzählte darauf, wo sie ihn angetroffen und wie außerordentlich artig und zahm er gewesen, wie er sich von freien Stücken auf ihren Strauß gesetzt und sie nach Hause begleitet habe, und wie sie sich vorgenommen habe, Sorge zu dem artigen Tierchen zu tragen und es ihm, solang es bei ihr bleiben wolle, nie an frischen Blumen fehlen zu lassen.
Die Alte schien dies als eine schuldlose Kinderei des Mädchens anzusehen und wenig darauf zu achten; aber Prinz Schmetterling hörte mit großem Vergnügen, daß er der schönen Melissa so wichtig sei, und suchte ihr seine Dankbarkeit durch tausend kleine Liebkosungen, Neckereien und Scherze, die ihm sein Schmetterlingsinstinkt eingab, zu erkennen zu geben.
Unvermerkt entspann sich ein so gutes Verständnis zwischen ihnen, daß die junge Melissa keine Bedenken mehr trug, ihn wie eine vertraute Gespielin ihres eigenen Geschlechtes zu behandeln. Er hatte sogar die Erlaubnis, sie alle Morgen im Bette zu besuchen; und es sei nun, daß eine geheime, ihr selbst unbekannte Ahnung sich ins Spiel mischte oder daß auch dem unschuldigsten jungen Mädchen, in Ermanglung eines schicklicheren Gegenstandes, selbst die Zärtlichkeit eines Schmetterlings nicht gleichgültig sein kann.
Genug, sie fand so viel Vergnügen an der Gesellschaft ihres kleinen geflügelten Liebhabers, daß sie ganze Stunden mit ihm spielen konnte, ohne es überdrüssig zu werden. Wir getrauen uns eben nicht zu behaupten, daß Timander bei diesen Gelegenheiten große Fortschritte in der platonischen Liebe gemacht habe: im Gegenteil ist nicht zu läugnen, daß die Schmetterling Natur von Tag zu Tag mehr über die menschliche gewann und daß in manchen Augenblicken die Gefühle des Schmetterlings mit den Imaginationen des Prinzen Timander dergestalt zusammenflossen und durch die letztern auf eine so seltsame Art erhöht wurden, daß der gute Prinz auf einmal wieder er selbst zu sein wähnte, und wenn er (wie es nicht fehlen konnte) bald genug erinnert wurde, daß er doch nur ein Schmetterling sei, in eine lächerliche Art von Verzweiflung darüber geriet, die desto quälender für ihn war, je mehr die Ausbrüche der selben die junge und unwissende Melissa zu belustigen schienen.
Unter diesen Freuden und Leiden waren bereits mehrere Tage hin gegangen, als einsmals, da die schöne Melissa (nach der Sitte des griechischen Mädchen) an ihrem Webstuhle saß und von der guten Alten beim Spinnrocken mit allerlei anmutigen und lehrreichen Geschichten unterhalten wurde, der unruhig herumflatternde Schmetterling ein kleines Fläschchen vom Gesimse herunter warf, das zufälligerweise zu weit hervor gestanden hatte.
Das Fläschchen zerbrach, und ein himmelblaues Wasser, das darin gewesen war, floß auf den Boden. Die Alte geriet darüber in große Betrübnis. «Der leidige Schmetterling!» rief sie; «war mir doch immer, als ob er uns noch Unglück bringen würde, wenn ich dich so viel mit ihm schäkern und kurzweilen sah!» -
«Verzeiht ihm!» sagte Melissa mit bittender Stimme; «er hat es gewiß nicht mit Fleiß getan; aber ist es denn etwas so Kostbares um dieses Fläschchen, daß Ihr Euch so darum betrübt?» - «Nicht um das Fläschchen», antwortete Sofronia, «aber um das, was darin war. Mein gutes Kind, ein einziger Tropfen von diesem blauen Wasser, das nun hier leider! auf den Boden fließt, ist hinlänglich, die stärkste Bezauberung aufzulösen. Ich bekam es von einer Dame, die ich für eine große Fee halte und von der ich dir noch viel erzählen könnte, wenn sie mir nicht...»
Hier wurde das gute Mütterchen von einer Begebenheit unterbrochen, die uns freilich nicht so unerwartet kommt als ihr. Der Schmetterling nämlich hatte in einem Winkel, wohin er sich nach vollbrachter Tat geflüchtet, alle Worte der Alten mit angehört und, sobald er die Tugend des verschütteten Wassers vernommen, sich keinen Augenblick besonnen, die Probe davon zu machen.
Er war also hinzu gezogen, und kaum hatte er den Ort, der noch naß davon war, berührt, so stieg eine dichte und lieblich duftende Rauchsäule vom Boden auf, und als sie vergangen war, siehe! da stand Prinz Timander, in seiner eigenen Gestalt und in dem nämlichen Jagdkleid, worin ihn die Tauben der schönen Pasithea nach der Roseninsel abholten, leibhaftig vor den beiden Frauenspersonen da, die vor Erstaunen über ein so unverhofftes Wunder die Sprache und beinahe die Sinnen verloren hatten.
Ungeachtet er viel zu schön aussah, um ein junges Mädchen sehr zu erschrecken, so würde doch Melissa, sobald sie die Füße wieder heben konnte, davon gelaufen sein, wenn er sie nicht mit ebenso viel Ehrerbietung als Zärtlichkeit zurück gehalten hätte. Er bat sie und ihre gute Mutter, sich nicht vor ihm zu fürchten, sagte ihnen, wer er sei und welche seltsame Zufälle ihm das Glück verschafft hätten, auf eine so ungewöhnliche Art an ihre Bekanntschaft zu kommen.
Er schlüpfte, wie billig, sehr leicht über die Ursache hin, die ihm den Zorn der Fee Pasithea und seine Verwandlung in einen Schmetterling zugezogen; hingegen breitete er sich mit desto vollerem Herzen über die tugendhafte Liebe aus, welche ihm die holdselige Melissa schon in seinem Schmetterlingsstande eingeflößt habe, und erklärte ihnen, daß ohne sie kein Glück für ihn sei und daß er nicht zweifle, die Einwilligung seines Vaters zu erhalten, wenn er hoffen dürfe, ihr eigenes Herz und den Beifall ihrer Mutter auf seiner Seite zu haben.
Man kann sich vorstellen, wie erstaunt die beiden Frauenzimmer waren, den Schmetterling in einen so liebenswürdigen Prinzen verwandelt zu sehen. Melissa, wie wohl sie dadurch ein Spielding verlor, das ihr kurz zu vor um keinen Preis feil gewesen wäre, war doch im Herzen über den Verlust des selben nicht unzufrieden; aber die Erinnerung an die kleinen Freiheiten, welche sie, zwar unschuldigerweise, dem Prinzen als Schmetterling gestattet hatte, nahmen ihr alle Fassung.
Sie errötete, schlug die Augen nieder und schwieg. Die alte und weise Sofronia merkte ihre Verlegenheit und sagte dem Prinzen, sie könnte seine Gesinnungen für ihre Tochter weder mißbilligen noch aufmuntern; aber sie müßte ihn bitten, sich ohne Verzug wieder an den Hof seines Vaters zu begeben, der nur wenige Stunden von ihrem Orte entlegen sei.
Könnte er die Einwilligung des selben erhalten, so zweifle sie nicht, daß Melissa, die ihm als Schmetterling so gut gewesen sei, seine Umgestaltung für keine Ursache ansehen werde, ihre Gesinnungen gegen ihn zu ändern; widrigenfalls aber traue sie einem Prinzen, dessen Äußerliches so viel Gutes verspreche, Klugheit und Tugend genug zu, daß er, auch ohne ihre Erinnerung, die Notwendigkeit einsehen werde, diese Gegenden zu vermeiden und, was dem Schmetterling allenfalls zu verzeihen sein möchte, als Prinz Timander nicht zu einer strafbaren Sache zu machen.
«Seid ohne Sorge, gute Mutter», sagte der Prinz; «mein Herz weissagt mir den glücklichsten Ausgang; entweder ich komme als der Gemahl der schönen Melissa zurück - oder Thessalien hat mich zum letzten Mal gesehen.» Mit diesen Worten ergriff er die sanft sich sträubende Hand des erröteten Mädchens, drückte sie an sein Herz und eilte davon.
Inzwischen geschah es an eben dem Morgen, da sich diese Dinge in der Hütte der guten Sofronia zutrugen, daß der gewesene König Siopas, in dem er, der Morgenluft zu genießen, an den schattenreichen Ufern des Peneus lustwandelte, auf einmal wieder das kleine alte Weibchen vor sich stehen sah, deren Vermittlung er die Erhaltung seines Lebens und seine gegenwärtige Ruhe zu verdanken hatte.
«Kennst du mich noch, König Siopas?» sagte sie lächelnd zu ihm, in dem sie ihm den Ring wieder an den Finger steckte, den er vor einigen Jahren von ihr empfangen und, nach ihrer Anweisung, wieder in die Luft geworfen hatte. Der König war im Begriff, ihr zu antworten, aber er blieb vor Erstaunen sprachlos; denn das alte Weibchen war verschwunden, und an ihrer Statt sah er eine große Frau von majestätischer Schönheit, in einem langen himmelblauen Talar, mit langen fliegenden Haaren, mit einer kleinen goldnen Krone auf dem Haupte und einem Stäbchen von Elfenbein in der Hand, vor sich stehen.
«Ich bin die Königin der Feen», sprach sie, «und komme zu vollenden, was ich bisher zu deines Volkes Glück, und zum deinigen, getan habe. Du hattest eine Tochter, Siopas, und hast sie noch. Du glaubtest, eine Bärin habe sie geraubt und gefressen. Diese Bärin war ich. Ich sah vorher, daß die junge Melissa an deinem Hofe schlecht erzogen werden würde. Ich nahm sie weg und übergab sie einer verständigen guten Frau, welche sie, ohne ihren Stand zu wissen, wie ihr eigenes Kind auf dem Lande erzog.
Deine Tochter ist, durch diese Veranstaltung, gegenwärtig ein gutes, gefühlvolles und unschuldiges Mädchen, bescheiden, sanft, mitleidig, wohltätig, jeder edelen Gesinnung fähig und jeder Menschenfreude offen; ihr Blut ist so rein wie ihr Herz, sie ist gesund und munter wie ein junges Reh und wird euch alle glücklich machen, weil sie es selbst sein wird.
Sie war schon als zweijähriges Kind, da du sie verlorst, das leibhafte Ebenbild ihrer Mutter, sie ist es noch, und die Figur einer Biene, die sie unter dem linken Arme mit auf die Welt brachte, wird sie dir, wenn du sie wieder siehst, vollends kenntlich machen. Vermähle sie mit dem Sohne deines Freundes Euthyfron, und ihr werdet alle glücklich sein.»
Kaum hatte die Feenkönigin das letzte Wort gesprochen, so stiegen Sofronia und Melissa aus einem Wagen, von Schwänen gezogen, worin sie von einer der Sylphiden, die der Königin dienten, abgeholt worden waren. Sofronia erkannte die Dame, die ihr Melissen übergeben hatte, und warf sich ihr zu Füßen, in dem sie auf das holde Mädchen wies und ihr für die Freude dankte, die ihr die Erziehung eines so gutartigen Kindes gemacht hatte.
Die Fee hob sie auf und umarmte sie; darauf nahm sie Melissen bei der Hand und stellte sie dem Siopas als seine Tochter dar. «So wäre sie freilich bei Hofe nicht geworden», sagte Siopas, in dem er sie umarmte und küßte. Melissa, die zu dieser Szene nicht vorbereitet war, betrachtete ihn mit einer aus Furcht, Liebe und Erstaunen vermischten Miene, die ihrem schönen Gesichte einen wundervollen Reiz gab; aber sie faßte sich so gleich, kniete vor ihm hin und küßte seine Hand.
Er hob sie auf, drückte sie an sein Herz und sah die Feenkönigin mit Augen an, die in dankbaren Tränen schwammen. «Aber sie bleibt doch meine Mutter?» sagte Melissa, in dem sie auf Sofronia wies. «Das soll sie», antwortete Siopas, «und wenn sie will, soll sie hier so glücklich sein, als ich es selbst bin.»
«Kommt», sprach die Feenkönigin, «unsere Freude vollkommen zu machen.» Sie stiegen alle in ihren Wagen ein und langten in wenigen Minuten bei dem Könige Euthyfron an. «Mein Bruder», sprach Siopas zu ihm, «ich bringe dir eine Braut für deinen Sohn: hier ist meine wiedergefundene Tochter!» Melissa wurde bei diesen Worten so blaß wie eine sterbende Lilie; sie dachte an ihren geliebten Schmetterling und fühlte, daß sie kein Herz mehr zu verschenken hätte.
«Ach!» antwortete der König mit einem tiefen Seufzer, «es sind nun vierzehn Tage, seit sich mein Sohn auf der Jagd verloren hat und in ganz Thessalien nicht zu finden ist.» Melissa lebte wieder auf. In diesem Augenblicke stürzte ein Diener mit der Nachricht herein, der Prinz Timander sei im Vorhofe angekommen. Der König eilte ihm entgegen.
Der Prinz umarmte seine Knie, erzählte ihm seine Abenteuer und endigte damit, ihn in den stärksten Ausdrücken zu bitten, daß er seine Liebe zu Melissen billigen möchte. «Zu einem gemeinen Landmädchen?» sagte der König. «Nein, mein Sohn, ich habe dir eine Königstochter ausersehen, die dich gewiß ebenso glücklich machen wird: alles ist schon ins reine gebracht.»
«Wie, mein Vater», versetzte der Prinz, «ohne mich?» - «Ich rechnete auf deinen Gehorsam.» «In allem, mein Vater, nur in diesem einzigen nicht. Ich liebe Melissen, sie hat mein Herz, sie soll meine Hand haben; und bei Jupiter und Apollo, ich verschmähe gegen dieses Landmädchen alle Königstöchter, und wenn sie mir so viele Kronen zu brächten, als sie Haare auf dem Kopfe haben!»
«Du wirst unartig, mein Sohn», sprach der König; «aber ich verzeihe dir, wenn du kommen und wenigstens nur sehen willst, was du verschmähst.» Mit diesen Worten zog ihn der König in den Saal, wo Melissa, Siopas, Sofronia und die Feenkönigin seiner warteten. Denkt selbst, wie unbeschreiblich sein Entzücken war, als ihm die gefürchtete Prinzessin - in Melissen dar gestellt wurde.
Die Feenkönigin legte ihre besten Gaben auf sie, in dem sie ihre Hände vereinigte. «Mein Werk ist vollendet», sagte sie. «Selbst das einzige, was euer Glück stören konnte, habe ich schon verhütet. Meine Tochter Pasithea darf euch nicht mehr furchtbar sein. Sie hat dir vergeben, Timander. Ich habe einen anderen Liebhaber für sie erzogen, der sie für deinen Verlust tröstet; und damit sie keines Schleiers bei ihm bedürfe, hab' ich ihn von seiner Kindheit an unter so häßlichen Affen erziehen lassen, daß Pasithea mit ihrem kleinen Meerkatzengesicht eine Venus in seinen Augen ist.
Ihr bedürft nun ferner meines Beistandes nicht. Ihr seid glücklich und werdet es so lange bleiben, als ihr einander liebet und Freude daran findet, Gutes zu tun.» Mit diesen Worten zog die Feenkönigin mit ihrem Stab einen Kreis um sie und verschwand.
Christoph Martin Wieland Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
NEANGIR UND SEINE BRÜDER, ARGENTINE UND IHRE SCHWESTERN ...
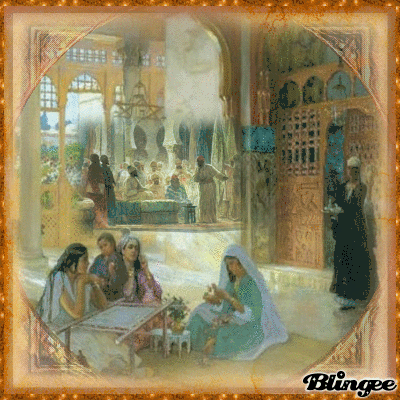
Der junge Neangir hatte die Jahre, worin man sich selbst zu erkennen anfängt, in einem Dorfe ungefähr zwanzig Meilen von Konstantinopel hingebracht. Ein alter Musulmann namens Muhammed, der mit seiner Gattin Zinebi von einem kleinen Gütchen lebte, hatte sich seiner während dieser Zeit angenommen, und Neangir wurde für seinen Sohn gehalten. Er hatte nun sein achtzehntes Jahr erreicht, und seine Gestalt so wohl als seine Sinnesart versprach weit mehr, als man von dem Stande, worin er aufgenommen war, erwarten konnte.
Eines Tages nahmen ihn Muhammed und Zinebi bei Seite, umarmten ihn mit Zärtlichkeit und kündigten ihm an, sie hätten sich entschlossen, ihn nach Konstantinopel zu schicken, damit er sein Glück in der Welt versuchen könnte. «Du würdest zu nichts kommen, mein lieber Sohn», sagte ihm der alte Muhammed, «wenn du länger bei uns bliebest: wir haben dich so weit gebracht, daß du dir nun selbst forthelfen kannst; du weißt deinen Koran so gut als auswendig, und es kann dir nicht fehlen, entweder bei der Armee oder im Zivildienst unterzukommen.
Laß uns wissen, wie es dir geht: wir wollen dich nicht im Stiche lassen. Nach diesem Bescheide gaben sie ihm acht Zechinen in die Hand, gesellten ihn zu einer nach Konstantinopel gehenden Karawane, bezahlten das Kost- und Reisegeld für ihn, umarmten ihn noch einmal und ließen ihn ziehen.
Nach einer Reise von etlichen Tagen langte Neangir in Konstantinopel an. Man kann sich leicht einbilden, wie ihm zumute war, sich auf einmal in einer so großen Stadt zu sehen, wo er weder Straßen noch Menschen kannte und ihm folglich alles so neu und fremd vorkam, als ob er unmittelbar aus dem Monde herab gestiegen wäre. Je mehr man Verstand hat, je verlegener fühlt man sich unter lauter Gegenständen, die man noch nie gesehen und wovon man nie reden gehört hat.
Der gute Neangir dachte eben nach, wie er sich helfen wollte, als ein Mann von sehr gutem Ansehen mit höflicher Art zu ihm trat, den oberen Teil seines Turbans befühlte und, nachdem er ihn einige Augenblicke scharf betrachtet hatte, ihm den Antrag tat, mit ihm zu gehen und, bis er etwa einen bessern Platz gefunden hätte, seinen Tisch und seine Wohnung anzunehmen. Neangir, der nichts Bessers zu tun sah, nahm den Antrag willig an und ging mit.
Der Unbekannte führte ihn in ein ganz artiges Gemach, wo sie ein schönes junges Mädchen von ungefehr zwölf Jahren im Begriff fanden, den Tisch für drei Personen zu decken, gleich als ob sie vorausgesehen hätte, daß der Unbekannte Gesellschaft mitbringen würde. «Zelide», sprach er zu ihr, «sagte ich nicht, ich würde dir einen Gast mitbringen und er würde mir keinen Korb geben?» -
«Ihr sagt immer wahr, lieber Vater», versetzte das Mädchen, «Ihr habt Euch selbst noch nie betrogen und betrügt keinen anderen Menschen.» Eine alte Sklavin, die in diesem Augenblick aus der Stadt ankam, trug etliche Schüsseln mit Pilau von verschiedenen Farben auf, setzte drei Becher mit Scherbet auf den Tisch und entfernte sich.
Während der Mahlzeit unterhielt der Herr des Hauses seinen Gast mit allerlei Dingen, die ihm viel Vergnügen machten; aber was ihn am meisten bezauberte, war die kleine Zelide. Er lieh dem Unbekannten wohl die Ohren, aber die Augen konnte er von dem holden Mädchen nicht verwenden. Sie war aber auch unbeschreiblich schön und lieblich; ihre pechschwarzen, mit dem sanftesten Feuer erfüllten Augen schienen so groß als ihr Mund, dessen Röte den Glanz des Rubins übertraf. Ihre Haare fielen in schönen Locken auf einen Busen, der nur eben aufzuquellen anfing; ihre Figur war lauter Ebenmaß, ihre Bewegungen lauter Anmut, und eine Kleidung von grünem Goldstoff trug auch das ihrige bei, alle diese Reize in ein vorteilhaftes Licht zu setzen.
«Lieber Vater», sagte Zelide ein wenig stockend, «der junge Mensch sieht mich unaufhörlich an; wenn Hassan es erfährt, wird er eifersüchtig werden.» - «Nein, nein», versetzte der Vater, «du bist nicht für diesen jungen Menschen; hab' ich dir nicht schon gesagt, daß er deiner Schwester Argentine bestimmt ist? Ich will die Sache sogleich richtig machen.» Mit diesem Worte stand der Unbekannte auf, öffnete einen Schrank und holte etliche Körbchen mit Früchten und eine Flasche mit Likör heraus. Außerdem zog er noch eine kleine Dose von Perlenmutter, in Silber gefaßt, daraus hervor und setzte sie auf den Tisch.
Nachdem er wieder Platz genommen, sprach er zu dem jungen Menschen: «Kosten wir einmal von diesem Elixier!», und sogleich schenkte er ihm davon in sein Glas ein. «Gebt mir auch ein paar Tropfen», sagte Zelide. «Nein, nein», erwiderte der Unbekannte; «du hast deinen Teil schon davon bekommen, und Hassan auch.» - «So trinkt doch Ihr davon», sagte sie; «der junge Mensch wird sonst denken, wir geben ihm Gift.» - «Das will ich», versetzte der Unbekannte; «in meinem Alter ist dies Elixier nicht so gefährlich wie in dem deinigen.»
Der Unbekannte, sobald er selbst davon gekostet und Neangir sein Glas ausgetrunken, öffnete die Dose, die er auf den Tisch gelegt hatte, und bot sie dem Jüngling dar. Neangir erblickte mit Entzücken das Bildnis einer jungen Person, welche höchstens vierzehn Jahre alt schien und ihm noch zehnmal liebreizender als Zelide vorkam. Er geriet ganz außer sich bei diesem Anblick, und sein Herz, das noch nie erfahren hatte, was Liebe war, wurde von tausend unbekannten Regungen in die angenehmste Beklemmung gesetzt. Der Unbekannte schien Neangirs Gemütszustand mit Vergnügen zu bemerken, und Zelide sprach zu ihrem Vater, indem sie ihre Hand auf die seinige legte: «Lieber Vater, wir werden sie wiedersehen!»
«Aber so erklärt mir doch alle diese Rätsel», sagte Neangir. «Warum habt Ihr mich hieher geführt? - wie wohl ich mich darüber nicht beklage, da Ihr mir wie einem Sohn begegnet. Warum habt ihr mich von diesem gefährlichen Trank, der mich wie in lauter Feuer setzt, trinken lassen? Und warum zeigt Ihr mir ein Bildnis, das mich des Verstandes beraubt?» -
«Ich will einen Teil deiner Fragen beantworten», versetzte der Unbekannte; «alles ist mir nicht erlaubt zu sagen. Ich nehme den Himmel und meine liebe Zelide zu Zeugen, das einzige Gut, so mir mein Unglück übrig gelassen hat, daß ich dich nicht hintergehe. Das Bildnis, so du in Händen hast und womit ich dir ein Geschenk mache, stellt eine Schwester Zelidens vor: du liebst sie und wirst beständig in deiner Liebe sein. Wende alles mögliche an, sie zu finden; findest du sie, so wirst du auch dich selbst wiederfinden.»
«Aber um Himmels Willen, wo soll ich sie suchen?» rief Neangir, indem er das reizende Bildnis küßte, das ihm der Unbekannte gegeben hatte; «Ihr macht mich auf einmal zum glücklichsten und zum unglücklichsten Menschen auf der Welt.» «Ich kann Euch nichts weiter sagen», antwortete der Unbekannte. «So will ich's tun», sprach Zelide. «Morgen, sobald es Tag ist, geht in den Bazar der Juden und kauft Euch in der zweiten Bude rechter Hand eine silberne Uhr, und sobald es nahe um Mitternacht ist...»
Zelide konnte nicht ausreden, denn ihr Vater hielt ihr die Hand vor den Mund und sagte: «So schweig doch, Kleine! Willst du durch deine Unbesonnenheit auch dir das Schicksal deiner Schwester zuziehen?» Durch die Bewegung, die der Unbekannte machte, um Zeliden den Mund zu schließen, stieß er die Flasche mit dem Elixier um, wovon Neangir getrunken hatte; auf einmal erhob sich ein dicker Rauch, der die Lichter auslöschte; die alte Sklavin stürzte mit einem lauten Schrei herein, und Neangir, voller Schrecken über dieses Abenteuer, schlich im Dunkeln davon.
Er brachte die Nacht auf den Stufen einer Moschee zu; aber die seltsamen Dinge, die ihm begegnet waren, und seine Liebe zu dem schönen Geschöpfe, dessen Bild sich unauslöschlich in seine Seele eingedrückt hatte, ließen ihm keinen Augenblick Ruhe. So bald der Tag anbrach, verbarg er das ihm so kostbar gewordene Bildnis in seinen Turban und erkundigte sich ungesäumt nach dem Bazar und der Bude, wovon Zelide gesprochen hatte.
Der Jude, bei welchem er eine silberne Uhr besprach, empfing ihn sehr freundlich und suchte ihm selbst eine aus, die er für die beste gab und wofür er sechs Zechinen verlangte. Neangir gab sie ihm, ohne lange zu handeln; aber der Kaufmann wollte ihm die Uhr nicht aushändigen, bis er ihm seine Wohnung gesagt hätte. «Die weiß ich selbst nicht», erwiderte Neangir; «ich bin erst seit gestern hier, und ich würde das Haus, wo ich bei meiner Ankunft aufgenommen wurde, schwerlich wiederfinden können.» -
«Gut», versetzte der Kaufmann, «so will ich Euch zu einem wackeren Musulmann führen, wo Ihr Euch um einen sehr leidlichen Preis für Kost und Wohnung herrlich wohl befinden sollt; kommt nur mit.» Neangir folgte dem Kaufmann durch verschiedene Gassen und trat endlich in einem Hause ab, wo er auf Empfehlung des Juden aufgenommen wurde und seine zwei noch übrigen Zechinen voraus bezahlte.
Nach dem Mittagessen schloß er sich in sein Kämmerchen ein, um das reizende Bildnis wieder zu betrachten, das ihm beständig im Sinne lag. Aber indem er es aus seinem Turban hervor langte, zog er einen versiegelten Brief mit heraus, worauf er sogleich die Hand der Zinebi erkannte. Er erbrach ihn mit Ungeduld und las darin, wie folgt:
Mein lieber Sohn!
Ich schreibe Euch diesen Brief, den ich mit Vorwissen meines Mannes in Euern Turban gesteckt habe, um Euch zu berichten, daß Ihr nicht mein Sohn seid: wir vermuten, Euer Vater sei ein großer Herr, der aber weit von uns entfernt ist; aus der Beilage könnt Ihr sehen, wie er uns bedroht, sofern wir Euch nicht zurück geben. Schreibt nicht an uns und sucht uns nicht auf; beides würde vergebens sein, weil wir nicht mehr zu finden sind. Ihr werdet uns immer lieb bleiben - lebt wohl!
Die Beilage lautete folgendermaßen:
Nichtswürdige, Ihr seid ohne Zweifel mit den Kabbalisten in Verständnis, die dem unglücklichen Siroco seine Töchter geraubt und ihre Talismane entwendet haben. Ihr haltet mir meinen Sohn zurück; aber ich habe Euern Schlupfwinkel entdeckt, und Euer Verbrechen soll nicht lange ungestraft bleiben. Ich schwör' es bei dem Propheten! Die Schneide meines Säbels soll Euch schneller vertilgen, als der Blitz die Wolke zerreißt.
Neangir schöpfte ebensowenig Trost als Licht aus diesen Briefen. Sie schienen ihm zwar zu sagen, daß er der Sohn des vornehmen Mannes sei, der diesen Brief an Muhammed und sein Weib geschrieben hatte; aber was half ihm diese Nachricht? Er wußte nicht, wo er ihn aufsuchen sollte, und hatte keine Hoffnung mehr, diejenigen zu finden, die man bisher für seine Eltern gehalten hatte. «Wie unvorsichtig war es doch von meinem Vater», rief er traurig aus, «meine Pflegeeltern durch solche Drohungen zu erschrecken! Er hätte kommen sollen, mich bei ihnen abholen, anstatt ihnen eine solche Angst einzujagen, daß sie mich so allein und hilflos von sich schickten, ohne daß ich weiß, was nun aus mir werden soll.»
Die Gedanken, die alles dies in ihm erweckte, waren so niederschlagend, daß er, um ihrer loszuwerden, aus dem Hause ging und nicht wieder zurück kam, als bis es gänzlich Nacht war. Er war eben im Begriff, wieder in das Haus hineinzugehen, als er im Mondschein etwas Glänzendes auf der Türschwelle liegen sah; er hob es auf und fand, daß es eine goldene, mit Edelsteinen reich besetzte Uhr war. Er sah sich auf allen Seiten um, ob jemand vorhanden wäre, dem sie zugehörte; und da er sich ganz allein sah, steckte er sie in seinen Busen zu der silbernen, die er diesen Morgen gekauft hatte.
Er betrachtete sie als ein Geschenke, das ihm das Glück mache, um ihn aus der Verlegenheit seiner gegenwärtigen Umstände zu ziehen. «Ich werde», dacht' er, «mehr als tausend Zechinen für diese Steine bekommen und wenigstens was zu leben haben, bis ich meine Eltern wiederfinde.» Es war etwas so Tröstliches in diesem Gedanken, daß er sich ganz ruhig schlafen legte, nachdem er seine beiden Uhren auf die Estrade neben sich hingelegt hatte.
Da er zufälligerweise mitten in der Nacht erwachte, hörte er eine kleine Stimme, aber so rein wie ein Silberglöckchen, die aus einer von den beiden Uhren zu kommen schien und sagte: «Liebe Schwester Aurore, bist du um Mitternacht aufgezogen worden?» - «Nein, meine beste Argentine», antwortete eine andre Stimme, «und du?» - «Ich?» versetzte die erste, «man hat Mich auch vergessen.» - «Wie unglücklich!» erwiderte die andere; «es ist schon über eins, und wir müssen nun noch einen ganzen Tag warten, bis wir unserer Gefangenschaft entledigt werden können.» - «Ja», sagte die erste, «wenn man uns nicht wieder vergißt wie heute.» - «Für jetzt haben wir hier nichts mehr zu tun», sprach Aurore, «wir müssen fort, wohin uns unsere Bestimmung nötigt - komm!»
In diesem Augenblicke sah Neangir, der, ganz bestürzt über ein so seltsames Wunderding, sich mit halbem Leibe aufgerichtet hatte, beim Mondscheine die beiden Uhren auf den Fußboden herab hüpfen und durch das Katzenloch in der Türe aus seiner Kammer weg rollen. Er sprang eilends auf, öffnete die Tür und lief der Treppe zu, um sie einzuholen; aber er kam zu spät, und sie waren schon unter der Pforte, die auf die Gasse ging, weg geschlüpft.
Er versuchte sie zu öffnen, aber sie war abgeschlossen; und aus der Behendigkeit, womit sich die beiden Uhren davon gemacht hatten, urteilte er sehr richtig, daß, wenn er auch Lärm machen und sich die Türe aufschließen lassen wollte, er sie doch nimmer einholen würde. Er kehrte also wieder um und legte sich nieder; aber sein Unglück und der Gedanke, sich ohne Eltern, ohne Freunde, ohne Geld, und nun auch auf eine so seltsame Weise seiner beiden Uhren wieder beraubt zu sehen, beschäftigte seine Einbildung auf eine sehr unangenehme Art.
Sobald es Tag war, steckte er seinen Dolch in den Gürtel und eilte in voller Wut, den Juden aufzusuchen, der ihm die silberne Uhr verkauft hatte. Er fand ihn nicht in dem Bazar und in der Bude, wo er ihn anzutreffen hoffte; aber dafür fand er einen andern darin sitzen, der einem wackeren Manne gleichsah und ihn sehr freundlich empfing. «Die Person, die Ihr sucht, ist mein Bruder», sagte er zu Neangir, «und wir pflegen es so zu halten, daß immer einer von uns hier ist, während der andere unsere Geschäfte in der Stadt besorgt.» -
«Saubere Geschäfte», schrie Neangir; «Ihr seid der Bruder eines Betrügers, der mir gestern eine Uhr verkaufte, die mir diese Nacht wieder davon gelaufen ist; aber ich will ihn wiederfinden, oder Ihr sollt mir für ihn gut stehen, da Ihr sein Bruder seid.» «Was sagt Ihr da», versetzte der Jude in Beisein einer Menge Volkes, das um die Bude herumstand; «eine Uhr, die davon läuft! Wenn von einem Faß Öl oder Wein die Rede wäre, da könntet Ihr recht haben; aber daß eine Uhr weg laufe, ist unmöglich.» -
«Das wollen wir vor dem Kadi sehen», antwortete Neangir; und da er in dem nehmlichen Augenblicke seinen Kaufmann gewahr wurde, packte er ihn flugs beim Arme und schleppte ihn, so sehr er sich sträubte (denn der Pöbel half dem jungen Menschen Hand anlegen), mit sich vor die Wohnung des Kadi. Während dem Lärmen, den diese Szene verursachte, näherte sich derjenige, den Neangir in der Bude angetroffen hatte, seinem Bruder und sagte leise, doch daß Neangir es hören konnte, zu ihm: «Ich bitte dich, Bruder, gestehe nichts, oder wir sind beide verloren.»
Sobald man bei dem Richter angelangt und das herzudrängende Volk mit Prügeln (nach türkischer Manier) auf die Seite geschafft war, hörte der Kadi vor allem die Klage des Neangir an, die ihm sehr außerordentlich vorkam. Er befragte hierauf den Juden, der aber, anstatt zu antworten, die Augen gen Himmel erhob und in Ohnmacht fiel. Der Richter, der noch mehr Geschäfte auszumachen hatte, sagte ganz gelassen zu Neangirn: Seine Klage sei ohne alle Wahrscheinlichkeit und er würde sogleich den Kaufmann wieder nach Hause bringen lassen.
Dies brachte Neangirn aus aller Fassung: «Er soll mir», schrie er, «sogleich wieder zu sich selbst kommen und die Wahrheit gestehen!» Und damit zog er seinen Dolch und gab dem Juden einen tüchtigen Stoß in das Dickbein. Der Jude schrie laut auf. «Ihr seht», sprach er zum Kadi, «daß dieser junge Mensch rasend ist und seinen Verstand verloren hat; ich verzeihe ihm die Wunde, die er mir beigebracht; aber, um Gottes willen, gnädiger Herr, befreit mich aus seinen Händen.»
In diesem Augenblicke ritt der Bassa vom Meere vor dem Hause des Kadi vorbei, und da er einen so großen Lärm hörte, stieg er ab, um sich nach der Ursache zu erkundigen. Nachdem man ihm berichtet hatte, was vorgegangen war, betrachtete er Neangirn sehr aufmerksam und fragte ihn freundlich, wie das alles möglich sein könne.
«Gnädiger Herr», versetzte Neangirn, «ich schwöre Euch zu, daß alles wahr ist, und es wird Euch nicht mehr so seltsam vorkommen, wenn Ihr hört, daß ich selbst ein Opfer der kabbalistischen Künste dieser Art von Leuten gewesen bin; ich selbst war drei Jahre lang in einen kupfernen Tiegel mit drei Füßen verwandelt und bin nicht eher wieder Mensch geworden, bis man einen Turban auf meinen Deckel setzte.»
Kaum hatte Neangir die letzten Worte ausgesprochen, so fiel ihm der Bassa um den Hals und rief mit Entzückung aus: «O mein Sohn, mein lieber Sohn! Ist's möglich, daß ich dich wiederfinde? Kommst du nicht aus dem Hause von Muhammed und Zinebi?» - «Ja, mein gebietender Herr», antwortete Neangir; «sie sind es, die sich meiner in meinem Unglück angenommen und mich durch ihre guten Lehren und Beispiele dahin gebracht haben, eines solchen Vaters weniger unwürdig zu sein.» -
«Gelobet sei der große Prophet», versetzte der Bassa, «der mir in dem Augenblick, wo ich's am wenigsten hoffte, einen von meinen Söhnen wiedergibt! Ihr wißt», fuhr er gegen den Kadi fort, «daß ich in den drei ersten Jahren meiner Ehe mit der schönen Zambak, mit welcher nur die unsterblichen Jungfrauen des Paradieses zu vergleichen sind, drei Söhne von ihr bekam. Als sie das dritte Jahr zurück gelegt hatten, schenkte ein weiser Derwisch von meiner Bekanntschaft dem Ältesten einen Tesbusch von überaus schönen Korallen und sagte dabei:
‹Mein Sohn, trage große Sorge zu diesem Kleinod und sei dem Propheten getreu, so wirst du glücklich sein.› Dem zweiten, den Ihr hier seht, gab er ein Stück Kupferblech, worauf der Name des Gesandten Gottes in sieben verschiedenen Sprachen eingegraben war, und sagte: ‹Der Name des Freundes des Allerhöchsten beschirme dein Haupt, und der Turban, das Zeichen der Rechtgläubigen, begleite ihn allezeit, so wird dein Glück vollkommen sein!›
Endlich gab er auch meinem dritten Sohn ein Armband, das er ihm mit eigener Hand um den rechten Arm befestigte, und sprach: ‹Rein sei deine rechte Hand und deine Linke unbefleckt! Bewahre dieses Kleinod, das in der heiligen Stadt Medina gewebt wurde, und nichts wird deine Glückseligkeit stören können!› Mein ältester Sohn hat die Lehre des weisen Derwisch nicht wohl beachtet, und oh! wie unglücklich ist er dadurch geworden! Sein Schicksal ist so beklagenswürdig als der Zustand meines jüngsten. Um denjenigen, den Ihr hier seht, vor einem ähnlichen Unglück zu verwahren, hatte ich ihn unter der Aufsicht eines getreuen Sklaven namens Guluku an einem abgelegenen Orte erziehen lassen, während daß ich gegen die Feinde unseres Gesetzes zu Felde zog.
Bei meiner Zurückkunft fand ich weder Guluku noch meinen Sohn wieder. Urteilt selbst, wie groß seit dieser Zeit meine Verzweiflung war. Erst seit etlichen Monden habe ich erfahren, daß dieser mir so liebe Sohn sich bei einem gewissen Muhammed und seinem Weibe Zinebi aufhalte. Ich muß gestehen, daß ich ihnen seine Entführung Schuld gab. Melde mir doch, mein Sohn, wie du in ihre Hände geraten bist.»
«Mein gebietender Herr», antwortete ihm der junge Mensch, «ich erinnere mich der ersten Jahre meines Lebens nicht mehr; dies weiß ich nur, daß ich mit einem alten Schwarzen, dessen Namen Ihr mir eben jetzt wieder ins Gedächtnis gebracht habt, in einem Schlosse am Ufer des Meeres lebte. Ich war ungefähr zwölf Jahre alt, als wir einsmals, da er mich auf einen Spaziergang herausführte, einen Menschen, der genau wie dieser Jude aussah, antrafen, der sich mit Tanzen und Springen an uns machte und uns durch seine Gaukeleien sehr belustigte.
Was darauf weiter erfolgte, davon kann ich nichts sagen, als daß mich auf einmal eine Betäubung überfiel, wovon mir der Kopf ganz schwindlig wurde: wie ich meine Hände dahin bringen wollte, um zu fühlen, was mit mir vorgehe, verwandelten sie sich in Henkel; kurz, ich wurde in einen kupfernen Kochtiegel umgestaltet. Ich weiß nicht, wie mein Aufseher sich bei dieser Begebenheit benahm; aber das weiß ich noch recht wohl, daß ich vor Erstaunen ganz außer mir war.
Doch fühlte ich, daß man mich aufhub und in großer Eilfertigkeit mit mir davon lief. Einige Tage darauf, so viel ich erkennen konnte, setzte mich derjenige, der mich davon getragen hatte, bei einer Hecke auf die Erde, und bald darauf hörte ich ihn an meiner Seite schnarchen. Sogleich entschloß ich mich, ihm zu entfliehen. Ich schlüpfte, so gut ich konnte, durch die Hecke durch und lief wohl eine Stunde lang. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, mein gebietender Herr, wie unbequem es ist, auf drei Füßen zu gehen und dazu noch mit so steifen Beinen, als ich damals hatte.
Bei jedem Schritte blieb mein vorderster Fuß im Sande stecken, und wenn ich den hintersten heben wollte, war ich in Gefahr umzukippen. Nach einer sehr mühsamen Wanderschaft merkte ich endlich, daß ich in einem Küchengarten angelangt war, und versteckte mich in einem Kohlfeld, wo ich eine ziemlich ruhige Nacht zubrachte. Am folgenden Morgen wurde ich gewahr, daß jemand neben mir ging; ich fühlte, daß man mich aufhob und von allen Seiten betrachtete.
Endlich hörte ich die Stimme eines herzukommenden Mannes, der seinem Weibe mit dem Namen Zinebi rief ‹O mein lieber Muhammed›, antwortete sie, indem sie mich forttrug, ‹da finde ich in unserm Garten den schönsten Kochtiegel in der ganzen Welt.› Muhammed, der, wie ich merkte, ihr Mann war, nahm mich in die Hände und schien viel Gefallen an mir zu haben. Kurz, ich wurde nun ein Teil ihres Küchengerätes, und Zinebi trug große Sorge für mich.
Sie war noch ziemlich jung, und da ich sie mir, nach dem Klang ihrer Stimme und der Sanftheit ihrer Hände, sehr liebenswürdig einbildete, so war es kein kleines Vergnügen für mich, alle Morgen von einer so hübschen Frau ausgescheuert zu werden. Es ist wahr, meine Lebensart hatte außerdem wenig Unterhaltendes: ich arbeitete nicht, ich dachte nichts Sonderliches; aber wie viele wackere Leute gibt es in der Welt, die in ihrem ganzen Leben nichts mehreres tun und doch sehr wohl mit sich selbst zufrieden sind.
Ich will damit nicht gesagt haben, daß der Stand eines Kochtiegels etwas sehr Beneidenswürdiges sei; indessen ist gewiß, daß ich in diesem Stande drei ganze Jahre recht vergnügt bei diesen guten Leuten zubrachte. Nach dieser Zeit trug sich's zu, daß Zinebi, da sie mich eines Morgens mit einer Hammelbrust angefüllt, das gehörige Gewürze dazugetan und mich auf ein gelindes Feuer gesetzt hatte, aus Besorgnis, ihr Ragout möchte verdunsten - vermutlich, weil mein Deckel nicht genau mehr einpaßte -, etwas suchte, womit sie ihn bedecken könnte. Weil sie in der Eile nichts anders finden konnte als einen alten Turban von ihrem Manne, so bediente sie sich dessen, deckte mich damit zu und ging davon.
Kaum war sie fort, so fühlte ich, daß das Feuer, von welchem ich bisher keine Ungelegenheit verspürt hatte, mich an die Fußsohlen zu brennen anfing; ich sprang eilends zurück und erstaunte, wie Ihr denken könnt, nicht wenig, da ich mich auf einmal wieder in einen Menschen verwandelt sah. Um die Zeit, da das dritte Gebet gesprochen wird, kamen Muhammed und Zinebi zurück. Aber wie groß war ihre Bestürzung, da sie ihren Kochtiegel nicht mehr fanden, hingegen an seiner Statt einen jungen Menschen, der ihnen ganz unbekannt war.
Ich erzählte ihnen die Geschichte meiner Verwandlung, welcher sie anfangs keinen Glauben beimessen wollten; endlich schien doch meine Jugend und die unschuldige Treuherzigkeit, womit ich sie der Wahrheit meiner Erzählung versicherte, ihr gutes Herz zu überwältigen; und nachdem sie sich heimlich miteinander besprochen hatten, umarmte mich Muhammed, gab mir den Namen Neangir und erklärte mich für seinen Sohn.
In der Tat hätte er mich in den zwei Jahren, die ich noch in seinem Hause lebte, nicht besser halten können, wenn ich es wirklich gewesen wäre. Was mir seit dem begegnet ist, gnädige Herren, habt ihr bereits von mir vernommen; und hier sind noch die zwei Briefe, die ich in meinem Turban fand und woraus ihr euch von der Wahrheit meiner Reden vielleicht noch besser überzeugen werdet.»
Während Neangir seine Geschichte erzählte, hatte man mit Erstaunen wahr genommen, daß die Wunde des Juden auf einmal von selbst zu bluten aufhörte, und in diesem Augenblicke zeigte sich an der Pforte des Gerichtssaals eine junge Person, die man an ihrer Kleidung für eine Jüdin erkannte. Sie schien ungefähr zweiundzwanzig Jahre alt zu sein und war, ungeachtet der Unordnung ihres Anzugs, äußerst reizend. Ihr Kopfputz sah ganz zerstört aus, und die Haare fielen ihr in großen Locken auf die Schultern und auf den halb entblößten Busen; sie hatte, um desto schneller laufen zu können, eine Seite ihres langen Kleides aufgebunden, und ihr Gesicht sah so erhitzt aus wie bei einer Person, die in der äußersten Unruhe ist.
Sie hatte zwei Krücken von weißem Holze in der Hand, und hinter ihr drein kamen zwei Männer, deren einen Neangir sogleich für den Bruder des von ihm Verwundeten erkannte; der andere schien ihm demjenigen völlig gleich zu sein, den er in dem Augenblicke seiner Verwandlung gesehen hatte. Beide hatten den rechten Schenkel mit einer breiten Wundbinde von Leinwand umwickelt und stützten sich jeder auf ein paar eben solche Krücken, wie die junge Frauensperson in der Hand trug.
Die schöne Jüdin näherte sich demjenigen, welchen Neangir verwundet hatte; sie legte die Krücken neben ihn, betrachtete ihn mit großer Gemütsbewegung und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. «Unglückseliger Izuf», rief sie endlich aus, «muß dich denn deine gefährliche Neigung in so verderbliche Händel verwickeln? Siehe nun, in was für einen Zustand du dich selbst und deine beiden Brüder gesetzt hast!» Während sie ihm diese Vorwürfe machte, waren die beiden Mannspersonen, wie durch eine verborgene Gewalt genötigt, herein gekommen und hatten sich auf den Fußteppich neben den verwundeten Juden nieder gelassen.
Der Bassa, der Kadi und Neangir, ebenso verwundert über diese Begebenheit als betroffen über die außerordentliche Schönheit der Jüdin, verlangten von ihr, daß sie ihnen ein so seltsames Geheimnis erklären möchte. «Gnädige Herren», antwortete sie ihnen, «Sie sehen ein unglückliches Mädchen vor sich, die durch die stärkste Leidenschaft wider ihren Willen an einen von diesen drei Männern gefesselt ist. Mein Name ist Sumi, und ich bin die Tochter des Moyses, eines unsrer berühmtesten Rabbinern.
Der Mann, den ich liebe, ist Izaf», setzte sie hinzu, indem sie auf denjenigen zeigte der zuletzt herein getreten war, «und trotz seiner Undankbarkeit kann ich nie aufhören, ihn zu lieben. Grausamer Feind der Unglücklichen, die dich anbetet, und deiner selbst», fuhr sie fort, sich an Izaf wendend, «rede du selbst an meiner Statt und suche durch deine Aufrichtigkeit und Reue von deinen Richtern Gnade für dich und deine beiden Brüder zu erhalten!»
Während daß Sumi dieses sagte, schlugen die Juden die Augen nieder und beobachteten ein tiefes Stillschweigen. Aber der Kadi hieß die schöne Jüdin sich auf den Sofa nieder setzen, und nachdem er dem Izaf ihr zu gehorchen befohlen, fing dieser seine Geschichte, die zugleich die Geschichte seiner beiden Brüder war, folgendermaßen zu erzählen an.
Neangir und seine Brüder, Argentine und ihre Schwestern - Gechichte der drei Juden
Geschichte der drei Juden
«Wir sind drei Zwillingsbrüder, die Söhne des berühmten Nathan Ben Sadi und der weisen Dizara; unser Vater nannte den ältesten von uns dreien Izif, den zweiten Izuf, und mich, den jüngsten, Izaf. Er unterwies uns von unserer zartesten Jugend an in den verborgensten Geheimnissen der Kabbala, und unsere Fähigkeit betrog seine Erwartungen nicht.
Da wir unter der nämlichen Konstellation geboren sind, so findet sich auch in unserem Genie und in unseren Neigungen die vollkommenste Gleichheit; aber die Natur hat überdies noch eine ganz sonderbare Gleichförmigkeit in uns gelegt, und es waltet eine so außerordentliche Sympathie zwischen uns, daß, was einem von uns widerfährt, zu gleicher Zeit auch den beiden anderen begegnet: stößt ihm ein Glück auf, so verbreitet es sich sogleich auch auf die übrigen; trifft ihn ein Unfall, so leiden seine Brüder das nämliche; wird einer von uns zum Beispiel verwundet, so werden es, wie ihr seht, die anderen auch, zur nämlichen Zeit und auf die nämliche Art, wenn wir gleich tausend Meilen voneinander entfernt wären.»
«Also und dergestalt», fiel der Kadi ein, «daß, wenn einer von euch beiden gehenkt oder verbrannt würde, die beiden anderen das nämliche Schicksal hätten, ohne daß es darum mehr Holz oder Stricke kostete?» - «Gnädiger Herr», antwortete ihm Izaf, «wir haben zwar das Experiment noch nicht gemacht; ich bin aber fest überzeugt, daß es nicht fehlen würde.» - «Mir ist lieb, daß ich das weiß», versetzte der Kadi; «fahre nur in deiner Erzählung fort!»
«Wir hatten unsere Mutter in unserer Kindheit schon verloren», fuhr Izaf fort; «und als wir das fünfzehnte Jahr erreicht hatten, wurde unser Vater von einer Krankheit überfallen, gegen welche weder die gewöhnlichen Mittel noch die Geheimnisse seiner Kunst anschlagen wollten. Da er sich dem Tode nahe fühlte, rief er uns zu sich.
‹Meine Kinder›, sprach er, ‹ich werde euch keine großen Schätze hinterlassen; mein Reichtum bestand in den Geheimnissen, die ich euch bereits mitgeteilt habe; ihr besitzt verschiedene Talismane und versteht die Kunst, andere, noch mächtigere zu verfertigen; aber was euch mangelt, sind die drei Ringe der Töchter des Siroco; trachtet ihrer habhaft zu werden, nur hütet euch, wenn ihr dieser schönen Kinder ansichtig werdet, daß die Liebe euer Herz nicht überwältige!
Sie sind einem anderen Glauben zugetan als der eurige; sie sind den drei Söhnen des Bassa vom Meere bestimmt; sie können niemals die eurigen werden: wenn sie euch Liebe einflößen, so würdet ihr die unglücklichsten aller Menschen werden. Was euch vor dem Unglücke, das euch bedroht, verwahren kann, ist das Buch der Geheimnisse, das die Tochter des Rabbi Moyses von ihrem Vater geerbt hat; ihr wisst, daß Izaf von ihr geliebt wird; ihre Macht ist größer als die eurige; versäumt ja nicht, ihre Freundschaft zu unterhalten, und sucht ihren Beistand, wenn ihr in Not geratet.›
Kaum hatte Nathan Ben Sadi diese Worte ausgesprochen, so verschied er und ließ uns in einer tödlichen Ungeduld, die drei Talismane der Töchter Sirocos zu besitzen. Wir erkundigten uns bei Sumi nach seinem Aufenthalt und erfuhren, daß man ihn zwar nach dem Treffen bei Lepante tot gesagt habe, daß er aber Mittel gefunden, sich zu retten, und daß er sich in einem abgelegenen Hause verborgen halte, aus Furcht, das Unglück, das der Seemacht des Großherrn zugestoßen, mit seinem Kopfe zu bezahlen. Wir erfuhren zugleich, daß seine drei Töchter Wunder von Schönheit seien und daß sich die älteste Aurore, die zweite Argentine und die dritte Zelide nenne.»
Der Bassa und sein Sohn machten eine Bewegung des Erstaunens, da sie diese Namen hörten, hielten aber an sich, um die Erzählung nicht zu unterbrechen,
«Wir beschlossen», fuhr Izaf fort, «uns in fremde Kaufleute zu verkleiden, um uns den Zutritt zu diesen jungen Personen zu verschaffen. Wir nahmen die schönsten und kostbarsten Juwelen auf Kredit auf und wurden, unter dem Vorwand, ihnen etwas davon zu verkaufen, von einer Sklavin eingeführt, die wir uns durch ein ansehnliches Geschenk günstig gemacht hatten.
Bei ihrem Anblick konnten wir die Klippe nicht vermeiden, vor welcher uns Nathan Ben Sadi gewarnt hatte. Aber wer hätte auch den Reizungen widerstehen können, die sich unseren Augen dar stellten? Die drei Schwestern saßen beisammen auf einem Sofa, und es schien, als ob eine der anderen ihre Reize noch zu ihren eigenen leihe, um ihre Wirkung desto unwiderstehlicher zu machen. Die schöne Aurore war in einen Kaftan von goldnem Mohr, Argentine, welche blond war, in Silberstoff, und Zelide, die ungeachtet ihres noch zarten Alters den tiefsten Eindruck auf mich machte, in den niedlichsten persischen Zitz gekleidet. Wenn auch keine Sympathie zwischen mir und meinen Brüdern gewesen wäre, so würden wir doch alle drei nicht weniger auf einmal in voller Flamme gestanden sein.
Unter den Seltenheiten, die ich bei mir hatte, war auch ein Fläschchen, mit einem Elixier angefüllt, welches die Eigenschaft hatte, die vollkommenste Liebe zwischen einer Mannsperson und einem Frauenzimmer hervorzubringen, sobald sie einander darin zu getrunken hatten. Es war ein Geschenk der schönen Sumi, wovon sie selbst zu meinen Gunsten Gebrauch gemacht, wie wohl ich mich immer geweigert hatte, für sie das nämliche zu tun.
Ich zeigte dieses Elixier den drei Schwestern, die sich aus unseren Kostbarkeiten auswählten, was ihnen gefiel; und ich hatte eben eine kristallene Tasse genommen, um ihnen davon einzuschenken und sie zu bereden, mit uns davon zu trinken, als Zelide, der ich das Fläschchen in die Hand gegeben, die Augen auf ein Stück Papier warf, womit es umwickelt war, und plötzlich ausrief.
‹Ah, ihr Bösewichter! Was lese ich hier? 'Kostet nicht von diesem Tranke außer mit dem, der Euch zum Gemahl bestimmt ist; jeder andere sucht Euch bloß zu verführen.'› Ich warf einen Blick auf das Papier und erkannte die Handschrift der Sumi. Inzwischen hatten meine beiden Brüder bereits die Ringe, welche Aurore und Argentine an ihren Fingern trugen und die das vornehmste Ziel unserer Wünsche waren, gegen einige ihrer Juwelen eingetauscht; aber wie groß war unser Erstaunen, da wir, sobald die beiden Schwestern ihre Ringe von sich gegeben hatten, eine goldne Uhr und eine silberne, die schönsten, die man sehen konnte, an ihrer Stelle sahen!
In eben dem Augenblicke kam die alte Sklavin, die uns aufgeführt, mit einem schwarzen Verschnittenen herein gelaufen, um uns Zelidens Vater anzukündigen. Wir zitterten vor Angst. Meine Brüder steckten die beiden Uhren in ihren Busen; die alte Sklavin, voller Bestürzung, zwei von ihren Gebieterinnen nicht mehr zu finden, riß Zeliden, die in Ohnmacht gefallen war, das Fläschchen aus der Hand; und während daß der Verschnittene und die Sklavin nicht wußten, was sie anfangen sollten, machten wir uns so eilfertig, als wir konnten, davon.
Da wir uns nicht in unsre gewöhnliche Wohnung zurückzukehren getrauten, so flüchteten wir uns zu Sumi, die wir in Tränen fanden, weil sie besorgte, uns nicht wiederzusehen. ‹Was habt ihr getan, Unglückliche›, rief sie uns entgegen, ‹ist dies euer Gehorsam gegen die letzten Befehle eines sterbenden Vaters? Eine sonderbare Ahnung bewog mich diesen Morgen, das Buch der Geheimnisse nachzuschlagen, und da sah ich, daß ihr euer Herz in diesem Augenblick einer Leidenschaft überließet, die euer Verderben sein wird.
Glaubt nicht, daß ich es dulden werde. Ich bin es, die das Papier in Zelidens Hände gespielt hat, das sie verhinderte, von dem Elixier der vollkommenen Liebe mit dir zu trinken. Und ihr›, setzte sie hinzu, indem sie sich an meine Brüder wandte, ‹lernt aus diesem Buche den Wert des Schatzes kennen, dessen ihr euch mit den beiden Uhren bemächtigt habt; aber bildet euch nicht ein, jemals eures Raubes zu genießen; was ihr davon erfahren werdet, wird bloß dazu dienen, euch unglücklicher zu machen.›
Mit diesen Worten hielt uns Sumi das Buch des weisen Moyses vor, und wir lasen darin folgendes: ‹Wenn die beiden Uhren mit dem goldnen und mit dem silbernen Schlüssel um Mitternacht aufgezogen werden, so werden sie während der ganzen ersten Stunde des Tages ihre wahre Gestalt wiedererhalten. Sie werden immer in der Verwahrung eines Frauenzimmers sein und immer zu ihr zurück kehren: die Tochter des Moyses ist bestimmt, sie in Verwahrung zu haben.›
Meine beiden Brüder waren über diese Entdeckung äußerst aufgebracht. ‹Weil wir es doch nicht verhindern können›, sagten sie zu der Tochter Moyses, indem sie ihr die beiden Uhren hin gaben, ‹so magst du dann im Besitze des Schatzes bleiben, der uns zugehört; wenigstens sollst du doch die Talismane nicht zu sehen kriegen, die wir ihnen abgenommen haben.› Mit diesen Worten begaben sie sich voller Unmut hinweg; ich, meines Orts, blieb bei Sumi, und wir erwarteten die Nacht mit Ungeduld, um den Verfolg dieses Abenteuers zu sehen.
Gegen Mitternacht zog Sumi die beiden Uhren, jede mit ihrem eigenen Schlüssel, auf, und im Nu sahen wir die schöne Aurore und ihre Schwester zum Vorschein kommen. Sumi wurde von ihrer Schönheit fast verblendet. Die beiden jungen Personen schienen aus einem sanften Schlafe zu erwachen. Sie waren erstaunt und unruhig darüber, daß sie sich an einem ganz unbekannten Orte sahen; und als Sumi ihnen das schreckliche Geheimnis ihres Schicksals eröffnet hatte, sanken sie ihr mit einem Strom von Tränen in die Arme. Die schöne Sumi suchte sie zu trösten, mit dem Versprechen, daß sie auf ihren Beistand rechnen könnten und daß auf dieses ihr Unglück die vollkommenste Glückseligkeit folgen werde. Sobald die erste Stunde vorbei war, wurden sie wieder Uhren.
Ich brachte den Rest der Nacht bei der Tochter Moyses zu, und als der Tag anbrach, fühlte ich ganz außerordentliche Bewegung in mir. Meine Seele wurde wechselweise mit Wut und Schrecken angefüllt; eine unsichtbare Gewalt riß mich wider Willen fort und trennte mich von Sumi. ‹Ach!› rief ich, ‹ich fühle, daß einer von meinen Brüdern ins Gefängnis geführt wird. Lebe wohl! allzu liebenswürdige Sumi, ich muß ihm folgen.›
Ich eilte wirklich aus ihrem Hause, und indem ich, ohne zu wissen wohin, durch die Straße lief, stieß ich auf Izif, der mir sagte, daß er die nämliche Beängstigung fühle und daß Izuf ohne Zweifel für einen von den Männern, die im Hause des Siroco gewesen, erkannt worden sein müsse. Sogleich fiel mir ein Mittel ein, meinen Bruder zu befreien. Ich sagte zu Izif, daß er ihm nachlaufen und ihm einen Säbel, um sich wehren zu können, in die Hand zu spielen suchen sollte. Ich selbst aber ging in das nächste Bagno, das in meinem Wege lag, wo verschiedene Häscher täglich zusammen zu kommen pflegten, um Wein zu trinken.
Da es mir nicht an Geld fehlte, so tat ich neun oder zehn von diesen Gesellen den Antrag, jedem von ihnen zwei Zechinen zu geben, wenn sie sich, solange mir's beliebte, von mir durchwalken lassen wollten. Diese Kerls, die für Geld alles zu leiden und zu unternehmen bereit sind, nahmen meinen Antrag mit Vergnügen an. Kaum hatten sie das Geld voraus empfangen, so stürmte ich mit einem Säbel, den ich von dem Herrn des Bagno geborgt hatte, auf sie ein; und indessen, daß ich auf diese Leute, die dafür bezahlt waren, Hiebe regnen ließ, begegnete meinen Brüdern das nämliche mit denen, die nichts dafür bekommen hatten.
Ich kam siegreich aus den Händen der Häscher, die ich in die Flucht trieb, und traf unterwegs meine beiden Brüder an, die durch Sympathie das nämliche Glück mit denen, welche sie ins Gefängnis führen wollten, gehabt hatten. Indessen hielten wir nicht für ratsam, länger in Konstantinopel zu verweilen, und wir machten uns aus dem Staube, ohne von der schönen Sumi Abschied zu nehmen.
Des folgenden Tages erfuhren wir, daß man unser Haus nieder gerissen und alles, was wir besaßen, geplündert habe. So verdrießlich uns diese Nachricht war, so könnt ihr doch leicht denken, gnädige Herren, daß wir uns nicht einfallen ließen, Klage darüber bei der Obrigkeit anzustellen. Wir hatten nichts mehr, als was uns von den Juwelen und anderen Waren übrig geblieben war, und die beiden Ringe der Töchter des Siroco. Um nicht so leicht erkannt zu werden, beschlossen wir, uns zu trennen und ein irrendes Leben zu führen.
Nach einigen Tagen befand ich mich am Ufer des Meeres; ich sah einen alten Kämmerling vor der Pforte eines einsamen Schlosses sitzen und näherte mich ihm. Er wollte mir anfangs aus dem Wege gehen; aber mit etlichen Kleinigkeiten, die ich ihm zum Geschenk anbot, machte ich ihn so zahm, daß er mir neben ihm Platz zu nehmen erlaubte und sich von freien Stücken mit mir in ein Gespräch einließ.
Er sagte mir, er wäre bei einem jungen Herrn von Stande, einem Sohne des Bassa vom Meere, der schon eine lange Zeit wegen des Krieges, den man damals mit den Christen führte, abwesend sei. Er sprach mir von einem Talisman, den sein Zögling besitze und dessen Tugend mir nicht unbekannt war. Endlich berichtete er mir auch, dieser junge Herr sei, nebst zweien Brüdern, die er habe, von seiner Kindheit an bestimmt, die Töchter des Siroco zu heiraten, deren Abenteuer er mir erzählte, ohne sich beigehen zu lassen, daß ich es besser wisse als er.
Während er so schwatzte, loderte alle die Liebe, die Zelidens erster Anblick in mir entzündet hatte, wieder in meinem Busen auf und erfüllte mich mit Eifersucht. ‹Wie?› sprach ich zu mir selbst, ‹vielleicht ist es dieser Knabe, dem sie zugedacht ist, vielleicht ist er's, mit dem sie von dem Elixier der vollkommenen Liebe trinken soll? Nein! das kann und will ich nicht geschehen lassen!›
Ich beschloß sogleich, den Sohn des Bassa zu entführen, und um desto leichter zu meinem Zwecke zu kommen, geriet ich auf den Einfall, mich wahnwitzig zu stellen, und fing an, zu singen und zu tanzen, was das Zeug hielt. Der alte Kämmerling, der seinen jungen Herrn auch an diesem Spaß Anteil nehmen lassen wollte, holte ihn herbei, und ich tanzte von neuem wie ein Mensch, der nicht klug ist. Der junge Herr hatte große Lust an meinen Bockssprüngen, und der alte Kämmerling wollte sich zu Tode lachen.
Endlich tat ich ihnen den Antrag, daß ich sie die Künste, die ich machte, lehren wollte, und sie ließen sich's gefallen. Der Alte war gar bald so außer Atem, daß er's aufgeben mußte, und der junge Mensch zerfloß in Wasser. Ich bat den Kämmerling, er möchte etwas zu trinken holen; und während er hinein ging, sah ich meinen Vorteil und riet dem jungen Menschen, die Leinwand von seinem Turban abzulegen, weil er ihm gar zu warm mache.
Er folgte meinem Rate; aber in dem nämlichen Augenblicke wurde er in einen dreifüßigen Kochtiegel verwandelt, dessen ich mich sogleich bemächtigte und so behend mit ihm davonlief, daß der Alte, wie wohl er sogleich wieder herauskam, mich nicht einholen konnte. Ich sah von ferne, daß er, aus Verzweiflung, seinen Zögling nicht mehr vorzufinden, sich ins Meer stürzte; aber es kam mich keine Lust an, ihn wieder heraus zu fischen.»
Hier unterbrach der Bassa den Juden, indem er ausrief. «O du weiser Derwisch, wohl hattest du recht! Sobald das kupferne Blech nicht mehr von dem Zeichen der Rechtgläubigen bedeckt war, war mein Sohn nicht mehr! Aber du, Unglücklicher», sagte er zu Izaf, «sieh diesen Jüngling recht an: ist es nicht derjenige, den deine Bosheit unglücklich gemacht hat?» - «Ich glaube, ihn zu erkennen», versetzte Izaf; «allein, da er seine erste Gestalt wieder erlangt hat, so bin ich nicht mehr so schuldig, als ich es befürchtete.»
«Aber, in meiner Erzählung fort zu fahren, so lief ich mit meiner Beute etliche Tage lang, in dem ich mich immer weiter von Konstantinopel entfernte, als ich mich eines Abends auf einmal so matt fühlte, daß ich nicht mehr konnte, wie wohl ich an selbigem Tage keinen großen Weg gemacht hatte; und ich war am ganzen Leibe so zerbleut, als ob ich eine Menge Schläge bekommen hätte. Ich legte mich neben einem Garten ins Gras nieder, setzte meinen Tiegel neben mich und schlief ein. Mein Schlaf wurde durch tausend unruhige Bewegungen unterbrochen. Bald schwamm ich in lauter Fröhlichkeit, bald schnürte mir die Furcht die Kehle zu, bald verging ich schier vor Traurigkeit.
Endlich, da ich wieder erwachte, sah ich, daß mein Kochtiegel weg war; ich befand mich in bloßen Schlafhosen und erkannte meine beiden Brüder, die im nämlichen Aufzug mir zur Seite schliefen. Als sie aufwachten, fragte ich sie zitternd, ob sie wüßten, warum wir uns alle drei in solchen Umständen befänden. ‹Leider ja!› antwortete Izuf, nachdem er uns beide eine Weile betrachtet und endlich einen Blick auf sich selbst fallen lassen, ‹ich seh' es nur zu wohl, daß wir gänzlich zugrunde gerichtet sind! Was für ein unseliges Abenteuer!› Ich lag ihm an, mir zu entdecken, was ihnen denn zugestoßen sei.
‹Diese verwichnen Tage›, sagte er, ‹waren wir, mein Bruder und ich, ungewöhnlich vergnügt; vermutlich mußte dir irgend etwas Glückliches begegnet sein, worüber wir die Freude aus Sympathie, wie gewöhnlich, mit dir teilten.› - ‹Dem ist wirklich also›, versetzte ich; ‹es sind nur etliche Tage, seit ich den Sohn des Bassa vom Meere entführte, den ich in einen Kochtiegel verwandelt hatte.› - ‹Nun, dann›, fuhr mein Bruder fort, ‹in dem wir so wohlgemut einher zogen, kamen wir bei einem Karawanserei vorbei, wo wir hörten, daß lustige Lieder gesungen wurden, daß man aus vollem Halse lachte; kurz, daß man alle mögliche Zeichen der Fröhlichkeit von sich gab.
Dies lockte uns hinein. Wir fanden einige Türken, welche zirkassische Tänzerinnen von ungemeiner Schönheit bei sich hatten. Unter diesen stachen uns gar bald ein Paar in die Augen, deren feine Gesichtszüge und außerordentlicher Reiz alle übrigen auslöschte. Wir wurden freundlich aufgenommen und an einen Tisch gesetzt, um Wein zu trinken, der in Überfluß vorhanden war und reichlich eingeschenkt wurde. Man hatte uns zu den beiden schönsten Zirkasserinnen gesetzt, die uns durch ihr einnehmendes Wesen ganz bezauberten.
Die Männer, die bei ihnen waren, bezeugten nicht die mindeste Eifersucht darüber. Nachdem wir uns einige Zeit auf diese Weise erlustigt hatten, sagte eine von den beiden schönen Zirkasserinnen zur anderen: 'Ihr Bruder hat getanzt, sie müssen auch tanzen.' Diese Worte waren ein Rätsel für uns...› ‹Für mich nicht›, unterbrach ich meinen Bruder, ‹ich tanzte, als ich den Sohn des Bassa entführen wollte.› - ‹Vermutlich wollten sie das damit sagen›, fuhr Izuf fort; ‹und damit nahmen die beiden Mädchen uns bei der Hand und machten uns mit einer unmäßigen Lebhaftigkeit tanzen.
Eine Weile darauf, da wir uns wieder zu Tische setzten und von neuem zu trinken anfingen, stieg uns der Wein, der viel stärker als der erste war, zu Kopfe; die Männer, in deren Gesellschaft wir die Zirkasserinnen gefunden hatten, zogen ihre Säbel und drohten uns nieder zu metzeln. Der Wein und die Ermüdung hatte uns so entkräftet, daß wir uns nicht wehren konnten; wir fielen in Ohnmacht und schliefen ein; und diesen Morgen finden wir uns neben dir in dem Zustande, worin du uns siehst. Man hat uns völlig ausgeplündert; aber was wir am meisten zu beklagen Ursache haben, ist der Verlust der beiden Talismane der Töchter Sirocos, die wir, um sie besser zu verbergen, als Siegelringe hatten fassen lassen und bei uns trugen.›
Nachdem wir unser Unglück eine Weile bejammert hatten, fanden wir keinen bessern Rat, als nach Konstantinopel zurück zu kehren, wo man uns vermutlich nicht mehr suchen würde, und unsere Zuflucht zu der guten Sumi zu nehmen. Wir machten uns auf den Weg und langten, nach überstandenem vielem Ungemach, endlich bei diesem liebenswürdigen Mädchen an. Der Anblick unseres Elends rührte sie, aber sie hatte es schon lange in dem Buche der Geheimnisse gelesen.
Da sie nicht reich genug war, uns auf andere Art wieder auf zu helfen, so schlugen wir ihr vor, alle Tage die silberne Uhr zu verkaufen, in welche Argentine verwandelt worden war. ‹Du weißt›, sagten wir ihr, ‹daß sie täglich wieder zu dir zurück kommen muß; es wäre denn, daß der silberne Schlüssel sie um Mitternacht aufzöge; und du läufst also keine Gefahr, sie zu verlieren.› Sumi willigte endlich ein, doch mit der Bedingung, daß wir uns allemal nach der Wohnung des Käufers erkundigen sollten, damit sie auch die goldne Uhr dahin tragen könne und Argentine sich also nicht allein befinde, falls man sich's etwa von ungefähr einfallen ließe, sie zur gesetzten Zeit aufzuziehen.
Seit dieser Zeit treiben wir diesen Uhrenhandel, der uns alle Tage jedem zwei Zechinen einträgt, und die beiden Töchter des Siroco sind noch allemal zu ihrer Hüterin zurück gekommen. Gestern verkaufte Izuf die silberne Uhr an diesen jungen Menschen und legte auf Sumis Befehl auch die goldne auf seine Türschwelle. Vermutlich, junger Herr, habt Ihr vergessen, sie aufzuziehen, denn diesen Morgen in aller Frühe waren sie schon wieder da.»
«Ich möchte verzweifeln», rief Neangir. «Hätte ich mehr Verstand gehabt, so hätte ich die anbetenswürdige Argentine gesehen, deren bloßes Bild mich schon bezauberte!» - «Das war nicht Eure Schuld», sagte der Kadi, «Ihr seid kein Hexenmeister. Wer könnte auch erraten, daß er seine Uhr gerade um Mitternacht aufziehen müsse? Aber dem soll bald geholfen werden: ich werde diesen Kaufmann anhalten, sie Euch wieder zu geben, und diese Nacht werdet Ihr sie nicht vergessen.»
«Heute», sprach Izuf, «ist es uns unmöglich, sie wiederzugeben; sie war schon verkauft, ehe dieser junge Herr uns aufsuchte.» - «Nun gut », sagte der Kadi, «so sollt Ihr ihm wenigstens sein Geld zurück geben! Waren's nicht sechs Zechinen, die er Euch für die Uhr bezahlte?» Der Jude, sehr vergnügt, so leicht davon zu kommen, griff schon in seine Tasche, als Neangir, voll Unwillen über die Entscheidung des Kadi, ausrief:
«Es ist auch wohl die Rede hier von meinem Geld! Die unvergleichliche Argentine will ich haben; ohne sie kann mir alles übrige nichts helfen.» - «Mein lieber Kadi», sagte der Bassa, «seht Ihr nicht, daß Ihr Unrecht habt und daß ein Schatz wie der, den mein Sohn verloren hat, mit keinem Geld zu vergüten ist?» Gnädiger Herr», antwortete der Richter, «Ihr habt mehr Verstand und Ansehen als ich; tut selbst den Ausspruch in diesem Handel; ich, meines Ortes, bekenne, daß ich mich nicht darein finden kann.» «Ich lasse mir's gefallen», sagte der Bassa; «komm du mit mir, mein Sohn, komm in meinen Palast; Ihr, schöne Sumi, bleibt bei uns, und man führe auch die drei Brüder dahin: ich hoffe, in kurzem sollen wir alle zufrieden sein.» -
«Nur bitte ich», versetzte der Kadi, «wohl Sorge zu tragen, daß uns keiner von diesen drei Schelmen entwische; er könnte gehen und irgend einem Bassa oder Kadi Geld geben, um sich eine Tracht Schläge geben zu lassen, und dann käme heraus, daß wir von seinen beiden Brüdern, vermöge der sauberen Sympathie, die sie unter sich haben, zu Tode geprügelt würden.» - «Gnädiger Herr», antwortete Izuf, «Ihr habt nichts der gleichen zu besorgen; wenn die Kadis Geld annehmen, so geschieht es gewiß nie, um sich Schläge dafür geben zu lassen.» -
«Verlaßt Euch auf mich», sagte der Bassa; «es liegt niemanden mehr daran, das Ende dieses Abenteuers zu sehen, als mir.» Mit diesen Worten stand er auf und ließ den Kadi Händel von geringerer Schwierigkeit ausmachen. Neangir und die schöne Sumi mußten sich auf ein paar Handpferde setzen, er selbst ritt zwischen ihnen, und die drei Juden folgten, unter Begleitung einiger Sklaven des Bassa, auf ihren Krücken langsam hinterher.
Wie der Zug vor dem Palaste des Bassa anlangte, sah man auf einer steinernen Bank im Vorhofe zwei verschleierte Frauenspersonen sitzen, die ihrer Gestalt und übrigem Ansehen nach ungemein jung zu sein schienen. Sie waren aufs zierlichste gekleidet; ihr Kaftan und ihre Beinkleider waren von hellblauem Atlas mit Silber gestickt; und ihre Pantoffeln, vom feinsten weißen Leder, dessinierten die niedlichsten Füßchen, die man sehen konnte. Eine von ihnen hatte einen ziemlich großen Sack von rosenfarbenem Taft auf den Knien liegen, in welchem etwas steckte, das sich zu bewegen schien.
Die beiden jungen Frauenzimmer standen auf, wie sie den Bassa heran kommen sahen, um ihm entgegen zu sehen, und diejenige, die den Sack trug, sprach zu ihm: «Mein guter Herr, habt Ihr nicht Lust, uns unseren Sack, mit dem, was drin ist, unbesehen abzukaufen?» - «Wie teuer wollt Ihr ihn geben?» sagte der Bassa. «Um dreihundert Zechinen», antwortete die Unbekannte. Der Bassa lachte über eine so ausschweifende Forderung und ritt fort, ohne sie einer Antwort zu würdigen.
«Der Kauf wird Euch nicht gereuen», rief ihm die Unbekannte nach; «wir kommen vielleicht morgen wieder, und dann bezahlt Ihr vierhundert Zechinen dafür - denn, das sag' ich Euch, der Sack wird mit jedem Tage um hundert Zechinen teurer.» «Komm, komm», sagte die andere, indem sie ihre Gefährtin beim Ärmel zog, «wir wollen uns nicht aufhalten; es könnte schreien, und vielleicht wäre dann unser Geheimnis auf einmal verraten.» Mit diesen Worten entfernten sich die beiden jungen Frauenzimmer, und man verlor sie bald aus dem Gesichte.
Neangir, welchem Dinge begegnet waren, die keinem Menschen begegnen, würde vermutlich diese Begebenheit mehr als andere zu Herzen genommen haben, wenn seine Gedanken nicht alle bei seiner geliebten Argentine gewesen wären; die übrigen waren gleich damit fertig, die beiden Weibspersonen für Närrinnen zu erklären, und gingen in den Palast hinein, ohne weiter an die Sache zu denken.
Man ließ die drei Juden, von einigen Sklaven bewacht, in einem Saale des Vorhofes; Neangir aber mit der Jüdin folgte seinem Vater in das Innere des Harems, dessen Pracht seine ungewohnten Augen ganz verblendete. In allen Zimmern war das Gold an Decken und Wänden verschwendet; die Fußböden waren mit kostbaren Tapeten belegt und aufs herrlichste möbliert; in einem prachtvollen Saale saßen eine Anzahl schöner Sklavinnen von verschiedenen Nationen auf dem Sofa im Kreise herum, und eine große Menge von Kämmerlingen, stehend und mit über die Brust gelegten Armen, erwarteten in tiefster Stille die Befehle ihres Gebieters, bereit, sie augenblicklich mit unumschränktem Gehorsam zu vollziehen.
In der Vertiefung des Saales erblickte man auf einer mit reichen Teppichen bedeckten Estrade eine Frau von ungefehr fünfunddreißig Jahren, welche ungeachtet der tiefen Schwermut, worin sie versunken schien, eine Person von außerordentlicher Schönheit war; sie lag unter einem Thronhimmel auf übereinander geschichteten Polstern, mit dem Gesicht auf dem Inwendigen ihrer rechten Hand.
Sobald der Bassa herein trat, standen die Frauenspersonen allesamt aus Ehrfurcht auf; er ging mit Neangirn an der Hand auf diejenige zu, die auf der Estrade stand, und sprach zu ihr: «Schöne Zambak, holdes Licht meiner Augen, freue dich mit mir; hier ist dein Sohn wieder, der dich so viele Tränen gekostet hat und den ich endlich wiedergefunden.» Die schöne Zambak fuhr vor Freude zusammen.
«O mein gebietender Herr und Gemahl», sagte sie zum Bassa, «mögen alle Feinde unseres unüberwindlichen Sultans zu Eueren Füßen gelegt werden, und wenn einst der Engel des Todes Eure Augen schließt, möge Euch für dies Geschenk, so Ihr mir macht, die schönste Jungfrau des Paradieses durch ihre Liebe belohnen!»
Neangir, der hieraus erkannte, daß Zambak seine Mutter sei, warf sich ihr zu Füßen. Die schöne Zambak nahm sein Haupt in ihre beide Hände und küßte ihn auf die Stirne. «Das ganze Haus nehme Anteil an meiner Freude», sprach der Bassa; «man rufe meinen Söhnen Ibrahim und Hassan, daß sie kommen und ihren Bruder umarmen!» - «Ach, mein gebietender Herr», sagte Zambak, «erinnert Ihr Euch nicht, daß es ihre Stunde ist: Hassan weint auf seine Hand und Ibrahim sucht.» -
«Gelobt sei der Prophet ewiglich!» rief der Bassa; «wenn das ist, so muß man sie machen lassen.» - «Mein Sohn Neangir, wir werden sie diesen Abend sehen.» «Verzeiht meiner Neugier, gnädiger Herr», sagte die schöne Sumi, «wenn ich Euch bitte, mir dieses Rätsel zu erklären; vielleicht kann ich Euch dienen. Das Buch der Geheimnisse, so ich besitze, enthält deren vermutlich, die Euch nicht gleichgültig sind.» - «Reizende Sumi », erwiderte der Bassa, «Wieviel würde ich Euch dafür schuldig sein! Folgt mir in ihr Zimmer: der Anblick meiner unglücklichen Söhne wird Euch besser unterrichten, als es meine bloße Erzählung tun könnte.»
Sumi und Neangir folgten dem Bassa in ein großes Gemach, wo sie zwei junge Leute von der liebenswürdigsten Gestalt antrafen; der eine schien kaum neunzehn Jahre und der andere etwa siebzehn alt. Der jüngere saß neben einem Tische, über den er sich herbückte, indem seine Tränen auf seine rechte Hand, die er vor die Augen hielt, tröpfelten. Er blickte einen Augenblick auf, aber wie erschraken Neangir und die schöne Jüdin, da sie sahen, daß die Hand, die er mit Tränen badete, von Ebenholz war!
Die Traurigkeit des Jünglings schien sich bei ihrem Anblick zu verdoppeln; er legte die Hand wieder auf seine Augen, holte einen tiefen Seufzer und fing von neuem an, bitterlich zu weinen. Der andere junge Mensch war inzwischen beschäftigt, mit großer Eilfertigkeit eine Menge von Korallen Kügelchen auszulesen, die unter den Tischen und Möbeln im Saale herum rollten; er legte eines nach dem anderen auf den nämlichen Tisch, auf den der andere Jüngling sich stützte. Neangir und Sumi bemerkten, daß er ihrer bereits achtundneunzig beisammen hatte; aber indem er sich eben darüber zu erfreuen schien, rollte alles wieder den Tisch herab und im ganzen Saale herum, und so ging die Arbeit des armen Jünglings wieder von vorne an.
«Ihr seht nun», sagte der Bassa, «das Schicksal meiner unglücklichen Söhne: der eine sucht alle Tage drei Stunden lang die Korallen, die ihr da herumrollen seht; und der andere, dessen Hand schwarz worden ist, weint eine ebenso lange Zeit darüber, ohne daß ich erfahren kann, was die Ursache dieses seltsamen Unglücks ist.»
«Bleiben wir nicht länger hier», sagte Sumi; «unsere Gegenwart scheint ihre Betrübnis zu vermehren. Erlaubt mir, das Buch der Geheimnisse zu holen, welches uns ohne Zweifel die Ursache ihres Unglücks und vielleicht auch das Mittel dagegen lehren wird.» Der Bassa ließ sich den Vorschlag der schönen Jüdin wohl gefallen; aber Neangir konnte sich nicht entschließen, die Person von sich zu lassen, von welcher es abhing, ihm in dieser Nacht den Anblick seiner geliebten Argentine zu verschaffen, und versicherte, daß es sein Tod sein würde, wenn er noch eine Nacht mehr auf diesen Trost warten müßte.
«Beruhiget Euch», sagte Sumi; «ich werde vor Nacht wieder hier sein; wie könnt Ihr fürchten, daß ich Euch verlassen möchte, da ich Euch meinen geliebten Izaf als Geisel hinterlasse?» Da Neangir nichts hier gegen einzuwenden hatte, so führte er sie bis an die äußerste Pforte des Palasts, nachdem sie noch einen Augenblick die drei Juden besucht und einen Befehl durch ihn ausgewirkt hatte, daß man es ihnen an nichts fehlen lassen sollte.
Kaum hatte sich Sumi von Neangirn entfernt, der noch in dem Vorsaale bei den drei Juden verweilte, als er eine alte Sklavin mit einem Manne herein kommen sah, den er nicht gleich für den nämlichen erkannte, der ihn vor zwei Tagen so freundlich bewirtet hatte, weil er jetzt in einem ganz anderen Aufzug erschien; denn er war in einen prächtigen, mit Zobel gefütterten Kaftan gekleidet und trug einen Busch von Reigerfedern (das Zeichen der Feldherrnwürde) auf seinem Turban und einen reich mit Edelsteinen besetzten Säbel an seinem Gürtel.
Aber die alte Sklavin erkannte er so gleich für die nämliche, die er bei dem Unbekannten gesehen hatte. «Mein gebietender Herr», sagte die Sklavin zu dem Feldherrn, «ich habe mich nicht geirrt, da ich ihnen von dem Hause des Kadi bis zu diesem Palaste nachging; es sind die nämlichen; Ihr könnt Eure Rache sicher an ihnen nehmen.»
Als bald entflammte sich das Angesicht des Unbekannten; er zog seinen Säbel und war im Begriff, auf die drei Juden einzuhauen, wenn ihn Neangir und die Bedienten des Bassa nicht zurück gehalten hätten. «Was habt Ihr vor, mein Herr», rief ihm Neangir zu; «wollt Ihr Leute anfallen, denen der Bassa in seinem Hause Zuflucht gegeben hat?» «O mein Sohn», antwortete der Feldherr, der ihn augenblicklich erkannte, «wenn dies ist, so kennt der Bassa weder die Leute, denen er Zuflucht gibt, noch Euch selbst.» - «Herr», erwiderte Neangir, «er kennt sie und weiß, daß ich sein Sohn bin; erlaubt, daß ich Euch zu ihm führe; er wird Eueren Unwillen am besten besänftigen können.»
Der Unbekannte und die alte Sklavin folgten Neangirn in das Innere des Palastes; aber wie groß war das Erstaunen des jungen Menschen, da er seinen Vater den Feldherrn mit allen Zeichen der lebhaftesten Freude umarmen sah! «Wie», rief der Bassa, «seid Ihr's, mein liebster Siroco? Ihr, der, nach der allgemeinen Sage in jenem unglücklichen Treffen, wo die Feinde des Glaubens obsiegten, umgekommen war? Aber warum sehe ich Euer Gesicht von eben dem Feuer glühen, wovon es flammte, da wir gegen die Feinde unseres all gebietenden Sultans stritten? Stillt Euren Grimm und überlaßt Euch den frohesten Hoffnungen; daß ich meinen Sohn wiedergefunden habe, den Ihr hier seht, ist mir ein sicherer Vorbote unseres gemeinschaftlichen Glückes.»
«Ich zweifelte nicht», sagte Siroco, nach dem sie sich gesetzt hatten, «Ihr würdet bald die Freude haben, einen so geliebten Sohn wiederzusehen; es sind erst drei Tage, seitdem mir der Prophet im Traum erschien und mir befahl, daß ich um die Stunde des Sonnenuntergangs nach dem Tore von Galata gehen sollte. ‹Du wirst›, sagte er zu mir, ‹einen jungen Menschen da selbst finden, den du in deine Wohnung führen sollst; er ist der zweite Sohn deines alten Freundes, des Bassa vom Meere; und damit du nicht irren kannst, so greife ihm oben an seinen Turban; du wirst das kupferne Blech fühlen, worein mein Name in sieben Sprachen gegraben ist.›
Ich gehorchte dem Befehle des Propheten», fuhr Siroco fort, «und ich fand diesen jungen Menschen; er gefiel mir, und mit dem größten Vergnügen habe ich ihn in Argentinen, deren Bildnis ich ihm gab, verliebt gemacht; aber während daß ich dem Vergnügen nach hing, meiner Tochter einen so liebenswürdigen Gatten zu versichern und Euch Euren Sohn wiederzugeben, wurden durch einen Zufall etliche Tropfen von dem Elixier der vollkommenen Liebe auf den Tisch verschüttet, und in dem dicken Rauche, der dadurch verursacht wurde, verlor ich Euren Sohn. Diesen Morgen berichtete mir die Sklavin, die Ihr hier seht, sie habe die Verräter entdeckt, die mir meine beiden Töchter geraubt haben; ich flog zur Rache, aber wenn sie, wie Ihr mich versichert, zu nichts helfen würde, so will ich mich Eurer Leitung und meinem Schicksal unterwerfen.»
«Ich hoffe, es wird uns günstig sein», versetzte der Bassa; «wenigstens sind wir so gut als gewiß, daß wir diese Nacht die goldene und die silberne Uhr haben werden. Schickt sogleich nach der jungen Zelide; laßt sie in Zambaks Arme kommen, um das Vergnügen, zwei so zärtlich geliebte Schwestern wiederzusehen, mit ihr teilen zu können.» Siroco winkte der alten Sklavin seinen Befehl zu, und sie ging ab.
In diesem Augenblicke traten Ibrahim und Hassan, deren Buße für heute vorüber war, herein und umarmten Neangirn, welchen der Bassa ihnen als ihren Bruder dar stellte. Es schien, als ob sie in diesem Augenblick alle ihren Kummer vergessen hätten; und auf die Nachricht, die man ihnen von dem Versprechen der Tochter Moyses gab, öffneten sich ihre Seelen den tröstlichen Hoffnungen.
Gegen Abend stellte sich die schöne Jüdin mit ihrem Buche ein. Sie öffnete es und rief den Hassan auf, zu kommen und sein Schicksal darin zu lesen. Wirklich fand man in hebräischer Sprache diese Worte auf einem eigenen Blatte: «Die rechte Hand ist schwarz und zu Ebenholz geworden, weil sie das Fett eines unreinen Tieres angerührt, da die christliche Sklavin ihren Kuchen knetete; und sie wird so lange Ebenholz bleiben, bis das letzte von der Rasse des unreinen Tieres im Meer ersäuft worden sein wird.»
«Leider!» sagte Hassan, «erinnere ich mich dessen nur zu wohl; ich sah eine christliche Sklavin einen Kuchen zubereiten; sie warnte mich, ihn nicht anzurühren, weil er mit Schweinefett gemacht sei; ich tastete ihn aber dem ungeachtet an, und plötzlich wurde meine Hand so, wie Ihr sie seht.»- «O weiser Derwisch», rief der Bassa aus, «du hattest wohl recht: so bald mein Sohn der Lehre ungehorsam ward, die du ihm gabst, als du ihm das Armband schenktest, so wurde er nach der Strenge dafür bestraft.
Aber, gute Sumi, wo werden wir das letzte von der Rasse des unreinen Tieres finden, das zum Unglück meines Sohnes den Anlaß gab?» - «Lest», antwortete Sumi, nachdem sie ein paar Blätter umgeschlagen hatte; und der Bassa fand diese Worte: «Das schwarze Ferkel ist in dem Sacke von rosenfarbenen Taft, den die zwei zirkassischen Tänzerinnen tragen.»
Bei diesen Worten stürzte der Bassa voll Verzweiflung auf das Sofa hin. «Oh, ganz gewiß», rief er, «ist der Sack, den mir diesen Morgen zwei unbekannte Weibspersonen um dreihundert Zechinen verkaufen wollten; und allem Ansehen nach sind sie es eben die Zirkasserinnen, welche die beiden Brüder der schönen Sumi tanzen machten und ihnen die Talismane der Töchter Sirocos entwendeten. Wehe mir, daß ich sie davongehen ließ! Sie hätten aller unsrer Not ein Ende machen können. Man eile, sie aufzusuchen, sie wieder zu bringen; ich bin bereit, ihnen die Hälfte meiner Schätze zu geben.»
Während daß der Bassa seinen Unmut so ausließ, hatte Ibrahim das Buch der Geheimnisse ebenfalls aufgeschlagen und mit Beschämung diese Worte darin gefunden: «Der Tesbusch wurde abgereiht, um Gerad oder Ungerad zu spielen: der Eigentümer des selben wollte betrügen und ein Kügelchen heimlich auf die Seite schaffen; der Unredliche mag so lange suchen, bis er die fehlende Koralle findet.» -
«O Himmel», rief lbrahim, «jetzt besinne ich mich der unseligen Geschichte wieder; ich hatte den Faden der Betschnur abgeschnitten, um mit der schönen Aurore zu spielen; ich hatte alle neunundneunzig Korallen in der Hand, und sie riet ungerade; um zu gewinnen, ließ ich eine fallen; es war nun gerade, und sie verlor; aber wie wohl ich täglich drei ganzer Stunden suchen muß, hab' ich doch mit allem meinem Suchen das Kügelchen, das ich fallen ließ, nicht wiederfinden können.» -
«O du weiser Derwisch», sagte der Bassa, «wohl behältst du recht! Sobald der Tesbusch, den du meinem Sohne schenktest, nicht mehr vollzählig war, mußte er schwer dafür büßen! Aber sollte uns das Buch des Moyses kein Mittel zeigen, wie der arme Ibrahim seiner täglichen Marter wieder los werden könnte?» - «Hört», sagte Sumi, «was ich hier lese: ‹Die Koralle ist in die fünfte Falte der Robe von goldnem Mohr gefallen.›» - «Wie glücklich», rief der Bassa; «wir werden die schöne Aurore nun bald zu sehen bekommen; vergiß ja nicht, mein Sohn, in der fünften Falte ihrer Robe zu suchen: denn gewiß meint das Buch der Geheimnisse keine andere.»
Kaum hatte die schöne Jüdin das Buch wieder zugemacht, so erschien die alte Sklavin mit der jüngsten Tochter des Siroco, unter der Bedeckung verschiedener Kämmerlinge. Die Freude, ihren geliebten Hassan zu sehen, hatte das holde Kind noch reizender gemacht, als Neangir an dem Abend, da er mit ihr zu Nacht speiste, sie gefunden hatte. Hassan war vor Entzücken außer sich; und Zambak, welche Zelide noch nie gesehen hatte, konnte nicht müde werden, sie mit Liebkosungen zu überschütten, so sehr war sie von ihrer Anmut und Artigkeit bezaubert. Die beiden anderen Brüder hätten sich kaum erwehren können, Hassans Glück mit neidischen Augen anzusehen, wenn die Hoffnung, womit Sumi sie bei guter Laune zu erhalten suchte, ihrer Erfüllung nicht mit jeder Stunde näher gekommen wäre.
Indessen war es Abend geworden, und die Gesellschaft stieg in die Gärten des Bassa herab, um der frischen Luft zu genießen, die den Wohlgeruch unzähliger Gattungen von Blumen und blühenden Büschen überall umher streute. Was die größte Schönheit dieser Gärten ausmachte, waren verschiedene große Terrassen, von denen man nach und nach wie auf Stufen bis zum Meerufer herab stieg. Die schöne Zambak erwählte die unterste dieser Terrassen, um da selbst unter einer großen Laube von Jasminen, die am äußersten Ende stand, mit der ganzen Gesellschaft auszuruhen.
Sie hatten sich kaum nieder gelassen, als sie durch ein Getöse überrascht wurden und, in dem sie aufmerksam gegen die Mauer, woher es kam, hin horchten, mit großer Heftigkeit reden hörten. «Undankbare», sagte eine männliche Stimme, «können fünf Jahre, seit ich Euch mit der feurigsten Leidenschaft liebe, mir keine bessere Begegnung von Euch verschaffen? Seht selbst, was für eine unerträgliche Beleidigung Ihr mir da wieder zugefügt habt! Ich muß mich nun gänzlich aus der Welt verbannen, und diese Höhle selbst ist noch nicht finster genug, mich vor den Augen aller Menschen zu verbergen.»
Diese Rede erregte eine allgemeine Aufmerksamkeit; aber man hörte statt der Antwort nichts als ein Gelächter, das kein Ende nehmen wollte. «Ah, ihr treulosen Geschöpfe», fuhr die nämliche Stimme fort, «hätte ich mich nach den großen Wohltaten, die ich euch erwiesen, einer solchen Begegnung zu euch versehen sollen? Ist's das, was ihr mir versprachet, als ich euch die Talismane der Schönheit in die Hände spielte? Leider seid ihr dadurch nur angereizt worden, mich treuloserweise zu verlassen; und da ich euch endlich wiedergefunden, so macht ihr euch kein Bedenken, mir den empfindlichsten Schimpf anzutun! Ist das der Dank dafür, daß ich euch das kleine schwarze Ferkel geschenkt habe, womit ihr das größte Glück machen könnt?»
Bei diesen Worten stieg die Verwunderung und die Begierde, noch mehr zu wissen, bei den Zuhörern auf den höchsten Grad. Der Bassa ließ sogleich alle seine Leute zusammen rufen und befahl ihnen, die Mauer einzureißen, die ihn von den Unsichtbaren trennte, deren Stimme man gehört hatte. Sein Befehl war in wenig Augenblicken ins Werk gesetzt; aber man fand den Mann, der gesprochen hatte, nicht mehr.
Man sah bloß zwei junge Personen von außerordentlicher Schönheit, die, ohne die mindeste Unruhe über diesen Vorgang blicken zu lassen, mit leichten tanzenden Schritten der Gesellschaft auf der Terrasse sich näherten. Ein alter Schwarzer kam hinter ihnen drein, den der Bassa für eben den Guluku erkannte, dem er Neangirn anvertraut hatte, ehe er in einen kupfernen Kochtiegel verwandelt wurde.
Sobald der Sklave den Bassa ansichtig wurde, warf er sich mit dem Angesicht auf die Erde vor ihm hin und sprach sich selbst sein Urteil. «Ich verdiene den Tod», sprach er, «weil ich Euren Sohn verloren gehen ließ; aber mein Verbrechen war unvorsetzlich und verdient keine grausame Bestrafung.» - «Stehe auf, Guluku», sagte der Bassa; «ich habe meinen Sohn wieder gefunden; dein Versehen soll dir verziehen sein, zumal da du dich, wie man mir sagte, selbst bestrafen wolltest und dich ins Meer stürztest, als mein Sohn verschwunden war.
Aber sage mir, wie es zuging, daß ich dich noch am Leben finde? Und vor allem sage, wer sind diese beiden schönen Mädchen, und was bedeuten die Reden, die so eben in dieser Höhle geführt wurden?» - «Mein gebietender Herr», antwortete Guluku, «aus Verzweiflung über den Verlust meines jungen Herrn hatte ich mich zwar ins Meer gestürzt; aber sobald ich im Wasser war, behielt die Liebe zum Leben die Oberhand. Ich schwamm, so lang ich konnte, und erreichte endlich mit vieler Mühe das Ufer.
Dort fand ich einen guten Derwisch, der mich das eingeschluckte Wasser wieder von mir geben ließ und Sorge zu mir hatte. Ich erzählte ihm das Unglück, das mir zugestoßen, und er schien alles für bekannt anzunehmen. ‹Ich weiß, was aus deinem jungen Herrn geworden ist›, sagte er; ‹er wird sich wiederfinden; aber inzwischen wirst du wohl tun, wenn du deinem Herren aus dem Wege gehst. Ich will dich als Bedienten zu einem Paar junger Frauenzimmer bringen; du sollst sie heute noch zu einer großen Lustbarkeit begleiten und in allem zu ihrem Befehle sein.›
Ich folgte also dem Derwisch, und so stellte er mich diesen beiden jungen Damen vor, die ich seit diesem immer als ihr getreuer Sklave begleitet habe; aber was ihren Stand und ihre Geschichte betrifft, darüber werden sie Euch selbst die beste Auskunft geben können.» - «Vor allem sagt mir», fuhr der Bassa etwas rasch heraus, «wo ist das schwarze Ferkel, dessen ich erwähnen hörte?» -
«Herr», antwortete so gleich eine von den beiden Mädchen, wie wohl die Frage nicht an sie gerichtet war, «sobald der Alte, bei dem wir waren, die Mauer einreißen hörte, entfloh er durch eine Öffnung, die ins Feld hinaus geht, und da hat er den Sack samt dem Ferkel mitgenommen.» «Man laufe ihm eilends nach», rief der Bassa, «und ergreife ihn!» - «Ihr könnt ganz ruhig sein, mein Herr», sagte das andere Mädchen; «der Mann ist ein Derwisch, er ist in uns verliebt, und er kommt ganz gewiß wieder; gebt nur Befehl, daß man den Eingang bewache, um ihm, sobald er wieder drin ist, den Ausgang zu versperren.»
Weil der Tag beinahe gesunken war, kehrte die ganze Gesellschaft in den Palast zurück. Der Bassa und Siroco schienen sehr von den Reizungen der beiden Unbekannten eingenommen und erwiesen ihnen große Achtung; aber was ihnen eigentlich am Herzen lag, war doch, je bälder, je lieber herauszubringen, ob sie nicht diejenigen seien, die im Besitz der zwei Talismane waren, welche Izif und Izuf Auroren und Argentinen entwendet hatten.
Man trat in einer prächtigen Galerie ab, die den Harem von dem vorderen Teile des Palastes absonderte. Sie war durch eine große Anzahl kristallner Kronleuchter mit silbernen Lampen beleuchtet. Sobald man Platz genommen hatte, wurde die Gesellschaft mit Kaffee, Sorbet, trocknen und eingemachten Früchten und einer Menge anderer Erfrischungen bedient. Der Bassa, dem seine Zweifel lästig zu werden anfingen, befahl die drei Juden herbei zu holen, um zu sehen, ob sie die beiden jungen Personen für diejenigen erkennen würden, die ihnen in dem Karawanserei ihre Kostbarkeiten abgenommen; aber man brachte ihm die Nachricht:
Während daß die Sklaven gegangen seien, die Mauer einzureißen, hätten sich die drei Juden aus dem Staube gemacht. Die schöne Sumi erblaßte bei dieser Zeitung, beruhigte sich aber bald wieder, nach dem sie, ohne bemerkt zu werden, ihr Buch hervor gezogen und einen Blick da rein getan hatte. Sie steckte es geschwind wieder ein und sagte halblaut: «Sie werden den Derwisch erwischen, man braucht ihretwegen in keiner Unruhe zu sein.»
Indessen konnte sich Hassan doch nicht enthalten, seinen Unmut laut werden zu lassen. «Wir sind doch sehr unglücklich», rief er aus; «wenn uns das Glück auf der einen Seite in die Hände läuft, so geschieht es immer nur, um uns auf der anderen wieder zu entwischen.»
Ein Leibpasche des Bassa, der alles bei ihm galt, konnte sich über diesen Gedanken des Lachens nicht enthalten. «Gnädiger Herr», sagte er zu Hassan, «was kümmern Euch die drei Juden? Ich würde mich an Eurer Stelle an diesen beiden jungen Personen erholen, die ich nicht gegen alle Juden in der Welt vertauschen wollte. Dies Glück kam uns tanzend, jenes lief auf Krücken davon; es wird nicht sehr weit laufen.»
Der Bassa, dem diese Freiheit seines Paschen in der bösen Laune, worin er sich eben befand, anstößig war, befahl ihm, sich sogleich zu entfernen und ihm nicht wieder vor die Augen zu kommen. «Ich gehorche, mein Gebieter», sagte der Pasche; «aber es soll nicht lange anstehen, so will ich in so guter Gesellschaft wieder kommen, daß Ihr mich mit Vergnügen sehen sollt.» Und damit verschwand er, ohne daß man begriff, was er sagen wollte.
Die Ungeduld, zu wissen, ob die beiden schönen Unbekannten die Talismane der Töchter Sirocos in ihrer Gewalt hätten oder nicht, wurde inzwischen immer dringender; und Neangir konnte sich endlich nicht länger halten. «Ihr seht hier», sagte er zu ihnen, «drei junge Leute, die von der heftigsten Leidenschaft eingenommen sind. Nichts ist liebenswürdiger als die Gegenstände unserer Sehnsucht; aber zwei von ihnen leiden großes Ungemach und sind aller ihrer Vorzüge beraubt. Wenn es nur bei Euch stände, wolltet Ihr ihnen nicht ihre Reize und ihre Freiheit wieder geben?»
Bei diesen Worten schienen die beiden Unbekannten vor Zorn feuerrot zu werden. «Was?» sagte eine von ihnen mit einer Heftigkeit, die ans Komische grenzte. «Wir? Wir sollten den Leiden irgendeines Liebenden abhelfen? Nein, macht Euch keine Hoffnung dazu! Wir sind Eure Sklavinnen nicht, und Ihr könnt uns nicht dazu zwingen. Nachdem das Schicksal so grausam gegen uns gewesen ist, uns unserer Geliebten auf ewig zu berauben, möchte doch die ganze Welt ebenso unglücklich sein als wir.
Ja, meine liebe Schwester», setzte sie hinzu, sich zu ihrer Gefährtin wendend, «wie wohl mein Kopf leicht geworden ist, so werde ich doch unsrer Schwüre nie vergessen; und sofern es in unsrer Macht steht, soll niemand, den die Liebe begünstigen will, unseres Unglücks durch seine Freude spotten!»
Diese Reden setzten alle Anwesenden in große Verwunderung, und man ersuchte die Unbekannte, sich zu erklären, was es mit ihrem Unglück für eine Bewandtnis habe und durch was für einen Zufall ihr Kopf leicht geworden sei. Sie bezeugte sich dazu nicht abgeneigt, und nachdem sie einen Blick auf ihre Gesellin geworfen, als ob sie sich ihre Einwilligung ausbäte, begann sie ihre Erzählung folgendermaßen:
«Mein Name ist Dely, und meine Schwester hier nennt sich Tezile. Wir sind in Zirkassien geboren und wurden von unseren Eltern, die sich große Hoffnungen von unserer Gestalt machten, von früher Kindheit an für den Harem des Großherrn bestimmt; eine Spekulation, womit Leute von geringem Stande und Vermögen in unserm Lande sehr gewöhnlich ihre Glücksumstände zu verbessern pflegen.
Zu diesem Zwecke wurden wir frühzeitig in allen Künsten geübt, die den natürlichen Reiz der Jugend und Schönheit erhöhen; und ich darf sagen, daß wir schon als sehr junge Mädchen auf allen Arten von Instrumenten, im Singen und vornehmlich im Tanzen wenige unser gleichen hatten. So hart es auch unsere Eltern anzukommen schien, sich von uns zu trennen, so vergnügt waren sie doch, als diejenigen, welche sich damit abgeben, Odalisken für den Harem des Großherrn aufzukaufen, nachdem sie uns in Augenschein genommen hatten, uns würdig fanden, dem obersten Beherrscher der Gläubigen dar gestellt zu werden.
Der Tag, an welchem wir nach Konstantinopel abgehen sollten, war nun bestimmt, als wir des Abends zuvor zwei junge Unbekannte von der einnehmendsten Gestalt in unsre Wohnung treten sahen. Der eine schien zwanzig Jahre alt; seine Haare waren rabenschwarz, seine Augen voll Feuer, und sein Gesicht glühte in der lebhaftesten Farbe der Gesundheit; der andere, der kaum fünfzehn zu haben schien, war blond, hatte himmelblaue Augen, eine blendend weiße Haut, die das frischeste Rosenrot durchschimmern ließ, und überhaupt so feine Züge und eine so zarte Bildung, daß er für das schönste Mädchen hätte verkauft werden können.
Sie redeten uns mit einem furchtsamen Anstand an und gaben vor, daß sie sich verirrt und wegen einbrechender Nacht genötigt gesehen hätten, eine Zuflucht bei uns zu suchen. Unsere Mutter, wie wohl nicht ohne Angst vor unseren Käufern, denen ein solcher Besuch nicht anständig hätte sein mögen, konnte es doch nicht über ihr Herz bringen, sie abzuweisen, und erlaubte ihnen also, die Nacht in unserer Hütte zuzubringen.
Wenn diese beiden jungen Fremdlinge auf unsere Eltern selbst Eindruck gemacht hatten, so war es wohl kein Wunder, daß wir junge Mädchen, die außer unserem Vater noch keinen Mann gesehen hatten, ganz von ihrem Anblick bezaubert wurden. Vorher hatten wir uns auf unsere Abreise gefreut, in der kindischen Hoffnung, daß es uns nicht fehlen werde, große Damen im Harem des Sultans zu werden; nun stellten wir uns unser Schicksal als das fürchterlichste Elend vor: wir seufzten wider Willen bei jedem Atemzuge, und kurz, die heftigste Leidenschaft hatte sich in einem Augenblick unserer kleinen Herzen bemeistert.
Inzwischen ward es Nacht. Ich lag neben Tezilen; aber beide ganz mit dem Bilde der jungen Fremdlinge beschäftigt, hatte keine von uns den Schlaf finden können. Endlich hörte ich dicht an meinem Ohre flüstern; ich war im Begriff, laut aufzuschreien, aber zum Glücke ließ mich der erste anbrechende Tagesschimmer sehen, daß es der jüngste der beiden Fremden war, der neben mir saß, in des sein Gefährte sich auf der anderen Seite mit Tezilen unterhielt.
‹Ruhig, schöne Dely›, flüsterte er mir zu, in dem er mich bei der Hand nahm, ‹höre einen Prinzen an, den im ersten Augenblick, da er dich sah, die Liebe zu deinem Sklaven gemacht hat.› Ich war außer mir, zitterte und verstummte und hatte nicht so viel Kraft, meine Hand zurück zu ziehen, die er mit der zärtlichsten Inbrunst küßte.
Er sagte mir hierauf, er nenne sich Alidor, sei der Sohn des Königs der schwarzen Marmorinsel; sein Gefährte sei zwar kein Königssohn, aber er besitze Geheimnisse, die ihn den größten Königen gleich machten; er selbst sei von dem Hofe seines Vaters heimlich entflohen, weil man ihn mit der Prinzessin Okimpare, einer Nichte des Königs, habe vermählen wollen, die zwar ein Wunder von Verstand und Schönheit sei, aber das rechte Auge ein wenig größer habe als das linke.
Meine kleine Eitelkeit fand sich von einer so glänzenden Eroberung unendlich geschmeichelt, und ich kehrte ihm mit einem schmachtenden Blicke beide Augen zu, um ihm zu zeigen, daß die meinigen einander vollkommen gleich seien, aber dieser Blick hätte ihm beinahe den Verstand gekostet; ich sah, daß er die Augen verdrehte und in Gefahr war, unmächtig hin zu sinken. Ich hatte nichts um mich, als die Haut eines Tigers, den mein Vater auf der Jagd erlegt und womit er mir ein Geschenk gemacht hatte; ich konnte also unmöglich aufstehen, aber Tezile, die meine Verlegenheit merkte, warf einen Rock um und kam ihm mit Thelamir zu Hilfe.
Als Alidor wieder zu sich selbst kam, fand er sich in einer Lage, die ihm mehr als die stärkste Liebeserklärung von meiner Seite Wert sein mußte, denn ich hatte mich mit dem halben Leibe aufgerichtet, um seinen Kopf zu unterstützen, der, anstatt auf den Boden (wie ich gefürchtet hatte), an meinen Busen gesunken war. Meine Schwester, die vor Angst zitterte, daß man uns in diesem Zustande überraschen möchte, mußte alle ihre Stärke anwenden, ihn von mir weg zu reißen.
Einen Augenblick darauf hörten wir ein Getöse, und unsere jungen Liebhaber hatten kaum noch Zeit, uns die Hand zu küssen und sich unsichtbar zu machen. Es waren unsere Führer, die uns abholen kamen. In der Verwirrung, worin wir uns befanden, mußten wir alles mit uns machen lassen, was man wollte. Wir sahen eine Karawane von mehreren Kamelen, deren jedes zwei große hölzerne Kasten trug. Unsere Eltern umarmten uns zum letzten Male, und man packte uns, mich und meine Schwester, in eines dieser Gehäuse ein, das oben durch ein Fenster Licht empfing und worin wir ganz bequem sitzen und liegen konnten.
Wir reisten auf diese Weise etliche Tage lang in großer Unruhe, was aus unseren Liebhabern geworden sei, die in dessen Tag und Nacht der Inhalt unserer Gespräche und Träume waren. Endlich erblickte ich eines Morgens durch das Fenster, das über meinem Kasten war, eine junge Person in einer Kleidung wie die unsrige, die mich bei meinem Namen rief.
Ich sprang in Entzückung auf und erkannte den Prinzen Alidor, der mir sagte, Thelamir habe ihn auf diese Art verkleidet, in dem er sich für einen Sklavenhändler ausgegeben, der dem Sultan eine wunderschöne Sklavin zum Geschenke bringen wollte. Diesem zufolge habe er einen Kasten auf eben dem Kamele, wo der unsrige war, gemietet und ihn als die vergebliche Sklavin da rein verschlossen; und durch Thelamirs Beihilfe habe er Mittel gefunden, den Deckel seines Kastens aufzuheben und über den Saumsattel des Kamels bis an unser Fenster zu steigen.
Wir waren außer uns vor Freude über diese schlaue Erfindung, die uns, verschiedene Tage durch, das Vergnügen verschaffte, einander zu sprechen oder wenigstens zu sehen; denn um nicht entdeckt zu werden, mußten wir bescheidner sein, als uns lieb war. Aber inzwischen näherten wir uns täglich dem fürchterlichen Orte unserer Bestimmung, und die Frage war, wie wir es anstellen wollten, um uns in Freiheit zu setzen.
Endlich meldete uns Alidor, Thelamir habe unterwegs einen guten Derwisch gefunden, dem er weisgemacht, wir wären seine Schwestern, die ihm wider seinen Willen entführt würden; er habe ihn um eine Zuflucht gebeten, auf den Fall, daß er uns den Händen unserer Räuber entreißen könnte; der Derwisch habe sich erbitten lassen, und es käme also nur darauf an, in der nächsten Nacht, wenn unsere Führer schliefen, durch die obere Öffnung unserer Gehäuse heraus zu steigen und mit ihm davon zu gehen.
Die Sache kam mit Hilfe unserer Liebhaber glücklich zustande; wir stiegen heraus, ließen das Kamel stehen, und unsere Führer langten ohne Zweifel des folgenden Tages mit den leeren Kästen bei guter Zeit in Konstantinopel an.
Thelamir war inzwischen unser Wegweiser; wir gingen wieder zurück, und nach dem wir eine Zeit lang durch Pfade, die sonst keinem Menschen bekannt waren, fort gekrochen waren, langten wir an die Einsiedelei des Derwischen an, der uns erwartete. Wir fanden bei ihm eine gute Mahlzeit bereitet, wozu ihm Thelamir Geld gegeben hatte, und entschädigten uns nun für die auf unserem Kamele ausgestandene Langeweile durch das Vergnügen, an einem Orte, der der ganzen Welt verborgen war, in Freiheit und beisammen zu sein.
Thelamir und Tezile, die einander seit vielen Tagen nicht gesehen hatten, schienen über dem Vergnügen ihrer Wiedervereinigung alles andere zu vergessen; ich hingegen überließ mich meiner natürlichen Fröhlichkeit. Da ich bemerkte, daß der gute Derwisch mich und meine Schwester nicht gleichgültig ansehen konnte, so verführte ich ihn, mehr Wein zu trinken, als seiner Weisheit zuträglich war, um ihn noch mehr zu entzünden und mit seiner lächerlichen Leidenschaft unser Spiel zu treiben.
Tezile sang ein paar Liedchen, die ihn ganz aus seiner Fassung brachten; und ich selbst machte ihm, boshafterweise, so viele Liebkosungen, daß mein geliebter Alidor beinahe eifersüchtig darüber geworden wäre. So brachten wir die Nacht sehr kurzweilig hin. Des folgenden Tages schenkte uns der Derwisch einen schwarzen Sklaven zu unsrer Bedienung und sagte, es läge nur an uns, so wollte er uns zu den schönsten Personen in der ganzen Welt machen.
‹Folgt mir alle›, sprach er, ‹in eine Karawanserei, die nicht weit von hier liegt; ihr werdet dort zwei Juden finden, die im Besitze unschätzbarer Kleinode sind, so sie gestohlen haben: trachtet sie in eure Gewalt zu bekommen.›
Thelamir riet uns, von dieser Nachricht Gebrauch zu machen; wir folgten dem Derwisch in die Karawanserei, wo wir von einigen Kaufleuten wohl empfangen wurden und uns mit ihnen zu Tische setzten. Es währte nicht lange, so sahen wir die beiden Juden anlangen, die uns der Derwisch beschrieben hatte. Wir setzten sie zwischen uns; und da uns der Derwisch (ohne daß wir begriffen, was er damit sagen wollte) ins Ohr raunte, ihr Bruder habe getanzt, so mußten sie auch mit uns tanzen.
Sie können sich rühmen, einen sehr vergnügten Abend mit uns zugebracht zu haben. Wir setzten sie in einen solchen Zustand, daß wir ihnen ohne Mühe alles, was sie hatten, abnahmen, und so überließen wir sie ihrem Schicksal. Wir hatten sie kaum verlassen, so kam es dem Prinzen und Thelamir und mir selber vor, als ob Tezile hundertmal schöner geworden sei, als sie zuvor war; und das nämliche sagten sie auch von mir. Thelamir, der selbst eine Menge Geheimnisse besaß, wünschte uns zu dem Schatze, den wir besäßen, Glück, sagte aber nicht, was es wäre.»
Siroco und der Bassa sahen einander hier mit einer Miene an, welche zu erkennen gab, daß sie einerlei Gedanken hatten: sie wollten aber die schöne Dely in ihrer Erzählung nicht unterbrechen.
«Wie wohl Alidor mehr als jemals von mir bezaubert schien, so mißbilligte er doch unsere Unternehmung und wollte schlechterdings nicht, daß wir zu dem gefährlichen Derwisch zurück kehren sollten. Wir schifften uns also, weil es doch nirgends sicherer für uns war, nach der schwarzen Marmorinsel ein und langten ohne einen widrigen Zufall in einem Schlosse an, das mitten in einem großen Walde lag und dem Thelamir gehörte.
Wir erfuhren hier, daß des Prinzen Vater über seine heimliche Entweichung sehr aufgebracht sei, daß er noch immer auf seiner Vermählung mit der Prinzessin Okimpare bestehe und es also nicht ratsam für den Prinzen wäre, ihm unter die Augen zu kommen. Ich gestehe, wie wohl ich eben nicht ehrgeizig bin und meinen Prinzen bloß um seiner selbst willen liebte, so würde es mir doch unendlich geschmeichelt haben, an einem Hofe zu schimmern und alles dort unter mir zu sehen.
Da es aber unter solchen Umständen nicht sein konnte, so überredeten wir einander ohne Mühe, daß wir, um glücklicher als Könige zu sein, nichts als unsere Liebe nötig hätten, zumal da unsere Liebe noch so jung war und uns in Thelamirs Schlosse nichts abging, was wir zu unserm Vergnügen wünschen konnten. Es glich einem wahren Zauberpalaste und war aus einem so glatt polierten Marmor erbaut, daß sich die Gärten, wovon es umgeben war, mit allen ihren Bäumen, Springbrunnen, Lauben, Teichen und Gebüschen darin wie in einem Spiegel abbildeten.
Es war von einem ungeheuren Umfang und inwendig aufs prächtigste, bequemste und zierlichste eingerichtet. Besonders war da ein kleines, mit blaß gelbem Taft und Silber möbliertes Appartement, das ich für mich auswählte, weil es zu meinen pechschwarzen Haaren einen ganz entzückenden Effekt machte. Meine Schwester und ich wurden wie ein Paar kleine Königinnen gehalten. Wir hatten eine Menge bildschöner Sklavinnen zu unserer Bedienung und alle Tage andere Kleider anzuziehen; kurz, wir waren über alle Maßen glücklich; und leider! fehlte nichts als daß es nicht länger dauerte.
Doch eines hätte ich bald vergessen, wie wohl es in der Tat mehr dazu diente, unsere Glückseligkeit zu erhöhen als zu unterbrechen. Meine Schwester, die von Natur reicher an Zärtlichkeit ist als ich, befand sich in einem solchen Überflusse, daß ihr, nach allem, was sie davon an Thelamir verschwendete, noch etwas für den Prinzen übrig blieb und wirklich (mit ihrer Erlaubnis) mehr als nötig war, um den armen Thelamir in die heftigste Eifersucht zu setzen. Dies brachte von Zeit zu Zeit kleine Stürme hervor, die aber durch Tezilens Tränen und meine gefällige Vermittlung sich immer wieder zu ihrem Vorteile legten und Aussöhnungen veranlaßte, wobei wir alle gewannen.
Mitten in diesem wonnevollen Leben kam uns die Nachricht zu, daß der König gefährlich krank liege. Ich riet dem Prinzen, nach Hofe zu gehen, um selbst zu sehen, wie es stünde, und sich den Großen des Reichs zu zeigen. Er konnte sich lange nicht entschließen, sich von uns zu trennen; aber endlich redete ihm Tezile an einem Morgen in Thelamirs Gegenwart so stark zu, daß er ihr nicht widerstehen konnte. Aber da ihm seine Liebe zu mir näher am Herzen lag als die Krone, so versprach er uns, daß er noch vor Nacht wieder bei uns sein wollte.
In dessen brach die Nacht herein, ohne daß wir ihn wieder kommen sahen. Tezile, die an seiner Abreise schuld war, ließ eine Unruhe darüber blicken, in welcher Thelamir gar zu viel Zärtlichkeit zu sehen glaubte. Ich, meines Ortes, befand mich in einer unbeschreiblichen Bewegung. Ich stand mitten in der Nacht auf und machte mich, in der Hoffnung, ihm zu begegnen, ganz allein auf den Weg, den ich ihn durch den Wald hatte nehmen sehen.
Mein Vorgefühl hatte mich nicht betrogen; ich hörte ein Geräusch: es war mein geliebter Prinz; er stieg vom Pferde, so bald er mich erkannte, und wir setzten uns zusammen ins Gras, um uns unserer beiderseitigen Empfindungen zu erleichtern. Wir hatten keine Zeit, von seiner Reise zu sprechen; das Vergnügen, wieder beisammen zu sein, beschäftigte uns ganz allein.
‹Liebster Prinz›, sagte ich zu ihm, ‹möchte ich Euch doch meine ganze Liebe zeigen können. O gewiß, meine Schwester, mit aller ihrer Zärtlichkeit, kann nicht lieben wie ich!› Mein geliebter Alidor war außer sich vor Vergnügen; und sein Gesicht auf das meinige gedrückt, antwortete er mir: ‹O gewiß, wie feurig auch Thelamir lieben mag, seine Liebe wird die meinige nie erreichen!› Kaum hatte Alidor diese Worte ausgesprochen, so hörte ich ein Geräusch hinter uns; wir hatten nicht Zeit, uns umzusehen, von einem einzigen Säbelzug flogen unsere beiden Köpfe und rollten etliche Schritte von uns im Grase.»
«Beim Mahomed», rief Siroco, «es geschah euch recht: wer wird sich auch so abgenutzter Wendungen bedienen, um seine Liebe auszudrücken? Und was soll das heißen: ‹Ich liebe dich so viel und so viel› - oder: ‹Andre Leute lieben nicht wie ich!› Das nenn' ich Plattheiten und klaren Unsinn. Hättet ihr einander was Gescheiteres oder lieber gar nichts gesagt, so würde euch diese Verdrießlichkeit nicht begegnet sein.» -
«Oh, was das betrifft», fiel Tezile ein, um sich ihrer Schwester anzunehmen; «wenn das Herz recht voll ist, so hat der Kopf keine Zeit, auf Ausdrücke zu studieren.» - «Ihr seid auch gar zu streng, mein Herr», sagte Dely; «es wäre kein Bleiben mehr in der Welt, wenn man allen Leuten, die ohne Sinn reden, die Köpfe abschlagen wollte.
Aber, um meine Erzählung zu Ende zu bringen, in eben dem Augenblicke, da unsere Köpfe herunter flogen, hörte ich die Stimme Thelamirs, der in äußerstem Grimme zu uns sagte: ‹Treulose, antwortet mir, ich gebe euch auf etliche Augenblicke die Macht dazu: ungetreue Tezile, falscher Alidor, es ist heute nicht zum ersten Male, daß ich euer Einverständnis entdecke; was für Ursache habe ich euch gegeben, mir so mitzuspielen?›
Nun ich erst, daß mich Thelamir für meine Schwester gehalten hatte. ‹Ich bin nicht Tezile›, antwortete ihm mein Kopf mit schwacher Stimme; ‹ich bin die arme Dely, die Ihr mit Eurem Freund unschuldig ums Leben bringt.› - ‹Wenn das so ist›, versetzte Thelamir, in dem er sich augenblicklich wieder faßte, ‹so seid ohne Kummer, ich kann euch das Leben wieder geben.›
So gleich suchte er auch den Kopf des Prinzen, schob einem jeden von uns eine magische Pastille in den Mund und setzte uns unsere Köpfe wieder auf, die denn auch, durch die Wunderkraft der magischen Zeltchen, im Nu wieder so gut einpaßten und so fest saßen, daß nicht die mindeste Narbe daran zu sehen war; aber weil es Nacht und Thelamir in Eile war, hatte er sich vergriffen und meinen Kopf auf Alidors Hals und des Prinzen seinen auf den meinigen gesetzt.
Wir wunderten uns nicht wenig über die ungewohnten Vorstellungen, die aus unserm Herzen in unseren Kopf aufstiegen. Wir langten mit den Händen an unsere Stirn; des Prinzen seine waren ebenso wenig gewohnt, einen weiblichen Kopfputz, als die meinigen, einen Turban da zu finden; wir konnten gar nicht begreifen, was mit uns vorgegangen sein müsse. Aber bei unserer Zurückkunft in den Palast, wo uns meine Schwester mit Lichtern entgegenkam, wie groß war mein Erstaunen, da ich meinen Kopf auf einem anderen Rumpf als auf dem meinigen stehen sah!
Meine Schwester glaubte anfangs, daß ich die Kleider mit dem Prinzen verwechselt hätte; aber da sie ihren Irrtum gewahr wurde, so war ihr Erstaunen nicht kleiner als das unsrige; und weil es unmöglich war, ihr die Geschichte dieser seltsamen Versetzung unserer Köpfe zu verbergen, so hatte Thelamir, der bei diesem allem die schlimmste Rolle spielte, nicht wenig zu tun, wegen eines so übel angebrachten Beweises seiner Liebe zu ihr, Verzeihung zu erhalten.
Um seinen Fehler wieder gut zu machen, sagte er uns: Er habe noch ein paar Zeltchen von gleicher Kraft und Tugend, und wenn es uns gefällig wäre, wollte er die Operation wiederholen und jedem das seinige wiedergeben. Aber wir konnten uns nicht entschließen, die Probe noch einmal an uns machen zu lassen, und begnügten uns, die magischen Pastillen anzunehmen, die er uns anbot, um davon Gebrauch zu machen, falls wir jemals in den Fall kommen sollten, unsere Köpfe zu verlieren.
Inzwischen hatte der Irrtum des Thelamir natürlicherweise eine Menge Folgen, die uns alle Augenblicke in kleine Verlegenheiten setzten. Mein Kopf führte den Prinzen, ohne daran zu denken, in mein gelbes Zimmer, wo ihm aber meine Sklavinnen die Türe vor der Nase zuschlossen, mit der Versicherung, es wäre nichts darin, das ich brauchen könnte; und man führte mich in die Zimmer des Prinzen. Aber da man mich auskleiden wollte, hätte ich gleich vor Beschämung sterben mögen, so viele Mannsgestalten um mich herum zu sehen.
Am allermeisten setzte mich meine eigene Person in Befremdung: ich war wie schlaftrunken und konnte mich gar nicht daran gewöhnen, Alidor zu sein, da ich doch in meinen Gedanken Dely war. Ich stellte mir vor, daß es dem Kopfe des Prinzen, der in diesem Augenblick auf meinem Körper in meinem Zimmer war, nicht besser ergehen würde, und ich hätte gar zu gerne sehen mögen, wie er sich dabei benähme; aber mit allen diesen Gedanken war mein Schlaf nicht der ruhigste.
In dessen brauchte es doch nur wenige Tage, um uns selbst und alle Personen im Schlosse an diese Metamorphose zu gewöhnen. Ich wurde mit Alidors Kopf die schönste Blondine von der Welt; Alidor wurde mit dem meinigen, so wie ihr ihn hier vor euch seht (denn ich bekam ihn in der Folge wieder), ein Brünett, der die Miene hatte, einiges Unheil unter den Weibern anzurichten.
Bald darauf erhielten wir Nachricht, daß der König gestorben sei. Alidor, der mit meinem Kopfe eine Menge Ambition bekommen hatte, war voller Ungeduld, sich nach der Hauptstadt zu erheben und zum König ausrufen zu lassen. Aber nun wurden wir erst der schlimmsten Folge unseres Kopfwechsels gewahr, denn welches von uns beiden sollte den neuen König vorstellen?
Die Person, die des Prinzen Gesichtszüge hatte, war ein Mädchen; der Prinz war unkennbar mit einem anderen Gesichte als dem, so er immer geführt hatte; und den Großen des Reichs unsere Geschichte zu erzählen, hätte zu nichts helfen können, denn man würde sie nicht geglaubt haben. Es wäre schwer gewesen, uns durch einen vernünftigen Ausweg aus dieser Verlegenheit zu finden; aber mein Kopf ersparte uns diese Mühe: er tat, was er wollte, und so gingen wir, mein Liebhaber und ich, uns den Ständen darzustellen.
Allein, wir fanden unsere Sache bereits in einer sehr schlimmen Lage. Der König, da er seinen Tod vor Augen sah, hatte seinen Sohn noch vorher enterbt und die Prinzessin Okimpare auf den Thron gesetzt. Die Großen des Reichs hatten eine Antwort für uns bereit, gegen welche gar nichts einzuwenden war. Sie würden, sagten sie, dem Sohne des verstorbenen Königs ohne Bedenken den Vorzug vor der Prinzessin gegeben haben; aber sie könnten ihn weder in Alidor noch in mir erkennen. Wir wurden also für Betrüger erklärt, man machte uns den Prozeß, und man verurteilte uns, noch zu allem Glücke, den Kopf zu verlieren.
Unter anderen Umständen würde uns diese Entwicklung unserer Geschichte nicht die angenehmste gewesen sein, aber jetzt trösteten wir uns mit dem Gedanken, daß dies eine Gelegenheit sei, unsere eigne Köpfe wieder zu bekommen und vielleicht dadurch den Sachen eine andere Wendung zu geben. Wir verließen uns auf den Beistand Thelamirs und Tezilens, welche Mittel gefunden hatten, auf das Schafott gelassen zu werden.
Alles ging nach Wunsche vonstatten. Sobald unsere Köpfe herunter waren, steckte uns Thelamir die Pastillen, die er noch übrig hatte, in den Mund, setzte uns die Köpfe wieder auf und stellte nun, zu allgemeinem Erstaunen, dem versammelten Volke in Alidor den Sohn des Königs und den rechtmäßigen Thronfolger dar, welcher auch augenblicklich von jedermann dafür erkannt wurde. Okimpare, die auf einem Balkon des königlichen Palastes zusah, fiel in Ohnmacht und wurde weg getragen.
Ich lief in Entzückung auf meinen geliebten Prinzen zu, um ihn in meine Arme zu schließen; aber wie groß war mein Entsetzen, da ich sah, daß sein Gesicht leichenblaß wurde, seine Augen allen Glanz verloren und da er mit schwacher Stimme zu mir sagte: ‹Ich sterbe, meine liebe Dely, aber ich sterbe als König und getreu.› Jetzt sah ich, daß eine Pulsader seines Halses nicht recht eingepaßt war und das Blut meines lieben Prinzen unter seinem Rocke herab floß. Kurz, der arme Alidor konnte sich nicht länger auf seinen Füßen halten; er sank in unsere Arme und atmete seine Seele aus.
In diesem Augenblicke machte mich die Verzweiflung wütend. Ich ergriff das Schwert, das auf den Boden des Schafotts gefallen war. Thelamir wollte mir in die Hand fallen, weil er glaubte, daß ich mich selbst durchbohren wolle; aber ich bestrafte ihn dafür, daß er den Kopf meines geliebten Prinzen nicht besser aufgesetzt hatte, und stieß ihn mitten durchs Herz; er fiel tot zu den Füßen meines Liebhabers hin.»
Jedermann hörte mit größter Aufmerksamkeit einer so wundervollen Geschichte zu, als man gewahr wurde, daß Dely auf einmal totblaß wurde und daß Tezile auf die Polster, worauf sie saß, hin gesunken war; so sehr hatte die Erinnerung an diese unglückliche Szene beide Schwestern angegriffen. Zambak befahl ihren Sklavinnen, alles anzuwenden, um sie wieder zurecht zu bringen, und ließ sie in ein Zimmer nahe an dem ihrigen tragen.
Inzwischen, und während daß man über die Geschichte, welche Dely erzählt hatte, allerlei Betrachtungen anstellte, rückte die Mitternacht herbei. Neangir, der neben der schönen Jüdin saß, zeigte ihr das Bildnis der reizenden Argentine und hörte mit großem Vergnügen von ihr, daß sie noch schöner sei, als sie da gemalt war.
Die ganze Gesellschaft wartete nun mit Ungeduld auf die beiden Uhren, welche zu Sumi zurück kehren sollten, und der Bassa hatte deswegen befohlen, alle Türen im Palast offen stehen zu lassen; aber man war zugleich in großer Angst, derjenige, der sie diesen Morgen gekauft hatte, möchte sie von ungefähr aufgezogen haben und sie möchten also diese Nacht nicht wieder kommen, als man den jungen Paschen herein treten sah, den der Bassa diesen Abend aus seiner Gegenwart verbannt hatte.
Der Bassa warf einen zürnenden Blick auf ihn. «Asemi», sprach er zu ihm, «ist das der Gehorsam, den du meinen Befehlen leistest? Habe ich dir nicht verboten, mir vor die Augen zu kommen?» - «Mein gebietender Herr», antwortete Asemi mit Demut, «ich stand im Vorsaal bei der Türe und hörte der Erzählung dieser schönen Tänzerinnen zu. Ihr seid ein Liebhaber von Historien: ich weiß eine, die gar nicht lang ist, die Euch aber sehr interessieren wird; habt die Gnade, sie anzuhören, und wenn sie Euch nicht gefällt, so laßt mich nach der Strenge züchtigen.»
«Es sei darum», sagte der Bassa; «gib wohl acht, was du sagen wirst.» «Mein gnädigster Gebieter, ich lustwandelte diesen Morgen in der Stadt herum. Von ungefähr komme ich neben einem Manne zu gehen, dem ein Sklave von gutem Aussehen mit einem großen Korb folgte. Der Mann geht vor einen Bäckerladen, läßt sich vom besten Brot geben und beladet den Sklaven damit. Hierauf geht er zu einem Obsthändler, kauft von seinen schönsten Früchten ein und übergibt sie dem Sklaven. Von da gehen wir auf den Markt, wo er das beste Wildbret und alle Arten Gewürz zur Zubereitung einkauft und es ebenfalls dem besagten Sklaven gibt.»
«Nun - bei meinem Leben», sagte Siroco, «Asemi wird unter zweihundert Prügeln auf die Fußsohlen nicht davon kommen; seine Erzählung ist nichts weniger als interessant.» «Ich bin aber auch noch nicht damit zu Ende», sagte der Pasche; «das Interessante wird schon kommen, wenn man mich nur fort fahren läßt.
Der Unbekannte sagte hierauf zu seinem Sklaven: ‹Trage nun das alles nach Hause und sorge dafür, daß das Essen bis Mitternacht auf den Punkt fertig ist; ich werde Gesellschaft haben, aber wir können nicht länger als eine Stunde bei Tische sein.› Der Sklave trabte mit diesem Befehle fort, und ich folgte meinem Unbekannten noch immer in einiger Entfernung.
Da sah ich, daß er eine Uhr kaufte, sie in seinen Busen steckte und davon ging. Einige Schritte vorwärts sah ich, daß er sich bückte, um eine goldne Uhr aufzuheben, die er vor seinen Füßen fand. Ich lief eilends hinzu, um meinen Anteil zu fordern, weil ich die Uhr zu gleicher Zeit gesehen hätte. ‹Das ist billig›, sagte er, führte mich in seine Wohnung, gab mir vierhundert Zechinen für die Hälfte der Kostbarkeit, die er in meiner Gegenwart gefunden hatte, und ließ mich damit gehen.
Ich eilte nach Hause, um meinen Dienst zu tun, und begleitete Euch, gnädiger Herr, da Ihr bei dem Kadi abstieget. Hier hörte ich aus der Geschichte der drei Juden, was die beiden Uhren auf sich hätten; ich lief so gleich nach der Wohnung meines Unbekannten; aber ich traf niemand an als den Sklaven, der mich kurz zuvor bei ihm gesehen hatte und mich für einen seiner Freund halten mochte.
Da ich vorgab, ich hätte seinem Herrn etwas Wichtiges zu sagen, so ließ er mich hinein gehen, um zu warten, bis sein Herr zurück käme. Ich sah die beiden Uhren auf einem Tische liegen, steckte sie zu mir, legte statt der goldnen die vierhundert Zechinen und sechse statt der silbernen auf den Tisch und ging davon. Ich vergaß nicht, die Uhren zur gehörigen Zeit aufzuziehen, und in diesem nämlichen Augenblicke sind Aurore und Argentine unter einem doppelten Schloß in meiner Kammer.»
Bei diesen Worten fiel Siroco, vor Freude außer sich, dem Paschen um den Hals, und alle übrigen liefen hinzu und erstickten ihn beinahe mit Umarmungen. Neangir und seine Brüder sprangen wie unsinnig herum, indessen Asemi auf einmal unsichtbar wurde, aber einen Augenblick darauf mit Auroren an der einen und Argentinen an der andern Hand in den Saal zurückkam.
Die Szene, die nun folgte, läßt sich besser denken als beschreiben. Zelide flog in die Arme ihrer so lange beweinten Schwestern; Siroco weinte vor Freuden, daß er seine Kinder wieder hatte; Zambak ließ sie neben sich auf den Sofa sitzen und konnte sich nicht satt an ihnen sehen; die drei Jünglinge standen und verschlangen sie mit ihren Augen; und Neangir fand seine geliebte Argentine tausendmal reizender, als er sie in ihrem Bilde gefunden hatte.
Inzwischen nahte sich Ibrahim der schönen Aurore, warf sich zu ihren Füßen und suchte und fand in der fünften Falte ihres Kleides die Koralle, die er verloren hatte. Voller Freude reihte er sie geschwinde mit den achtundneunzig übrigen an einen Faden und rief entzückt: «Der Tesbusch ist wieder vollständig, ich werde nicht länger suchen!» -
«Aber ich Armer», rief Hassan, «ich werde noch immer weinen müssen und bin nun allein unglücklich. Es war doch wenigstens eine Art von Trost für mich, mein lieber Bruder, wenn ich dich in unserem Zimmer so herum rennen sah, während ich, in der tiefsten Traurigkeit versunken, auf meine schwarze Hand herab weinte!» Man tröstete den armen Hassan so gut als möglich, in dem man ihm vorstellte, daß der Derwisch mit dem rosenfarbigen Taftsack ganz unfehlbar würde eingeholt werden.
Neangir, dem vor dem bloßen Gedanken schauderte, daß seine geliebte Argentine in Gefahr gewesen war, von einem Unbekannten aufgezogen zu werden, erkundigte sich bei ihr, ob sie nicht wisse, wer dieser Mann sei und wie er hinter ihr Geheimnis habe kommen können. «Alles, was ich davon weiß», sagte sie, «ist, daß es der nämliche Musulmann war, bei dem ihr gestern euer Nachtlager hattet; und daß ich, während ihr eure Tür aufschlosset, um uns auf der Treppe einzuholen, jemand sagen hörte:
‹Geht nur, ihr artigen Kinder, morgen will ich euch kaufen und nicht so nachlässig sein wie er.› Neangir fiel dem Paschen von neuem um den Hals und konnte nicht Worte genug finden, ihm seine Dankbarkeit auszudrücken. Inzwischen wurde eine Kollation für die beiden Schwestern aufgetragen, und nachdem Siroco das Fläschchen mit dem Elixier der vollkommenen Liebe hatte holen lassen, brachten es Neangir und Ibrahim jeder seiner Geliebten zu.
Sobald sie davon getrunken hatten, blitzten ihre Augen von einem noch schönern Feuer, und sie wurden nicht müde, einander ewige Zärtlichkeit zuzuschwören. Die Freude war so groß, daß man ganz vergessen hatte, daß sie nur eine Stunde dauern würde. Diese glückliche Stunde war nur zu bald vorbei; auf den Schlag eins verschwanden die Töchter Sirocos und wurden wieder Uhren.
Allgemeine Traurigkeit folgte nun auf die allgemeine Freude; aber Asemi versprach bei Verlust seines Kopfes, der Bezauberung binnen vierundzwanzig Stunden ein Ende zu machen, wenn man ihm die Uhren anvertrauen wollte. Seine Bitte wurde ihm zugestanden, und der Bassa, um ihm desto mehr Lust zur Sache zu machen und ihn für die Zechinen, die er dem Unbekannten wieder gegeben, zu entschädigen, warf ihm einen Beutel mit tausend Dukaten zu.
Sobald es tagte, stieg Asemi (den die Freude über seinen Reichtum und sein Versprechen, die Töchter Sirocos zu entzaubern, die ganze Nacht durch wach erhalten hatte) in die Gärten herab. Nachdem er einige einsame Gänge durchlaufen, machte ihn eine schöne Stimme aufmerksam, die aus einem nicht weit entfernten Gebüsche zu kommen und sich mit den erwachenden Vögeln, deren anmutig wildes Wirbeln und Gluchzen die Luft erfüllte, wie in die Wette hören zu lassen schien.
Der junge Mensch folgte der Stimme, schlich unbemerkt hinzu und erkannte die beiden Zirkasserinnen. Die Sängerin (es war Dely) saß auf dem Rasen und hatte eine Menge Blumen in ihrem Schoße, womit Tezile die Haare ihrer Schwester zu durchflechten beschäftigt war; und da sie ohne Zeugen zu sein glaubten, so dachten sie auch an keine Zurückhaltung.
Delys Haare wallten, größtenteils noch aufgelöst, um ihre bloßen Schultern und um ihren Busen; und Tezile, welche die weiten Ärmel ihres Kaftans zurück geschlagen hatte, ließ Arme von unbeschreiblicher Schönheit sehen. Asemi, der selbst äußerst wohlgebildet und noch in der ersten Jugend war, konnte bei einem so reizenden Schauspiel keinen gleichgültigen Zuschauer abgeben; und beinahe hätte er, über den Regungen, die er fühlte, das Interesse seiner Gebieter und der Töchter Sirocos vergessen.
Nachdem er seinen Augen eine Zeit lang gütlich getan, wollte er sich den lieblichen Schwestern nähern. Diese waren, beim ersten Geräusch, das sie hörten, im Begriff davon zu laufen, als er die schöne Dely zurück hielt. «Warum vor mir fliehen», sagte er; «was könnt ihr in den Gärten dieses Palastes fürchten?» -
«Was wir fürchten?» versetzte Tezile lächelnd; «nichts, als daß Ihr eine von uns mehr lieben möchtet als die andere und also eine unglücklich sein müßte. Ihr seid nicht der alte Derwisch, der nur die unglücklich macht, der er den Vorzug gibt.» - «Der Derwisch liegt euch sehr am Herzen, wie ich sehe» erwiderte Asemi; «aber erlaubt mir, mich hier neben euch zu setzen, und erzählt mir, wenn ich bitten darf, wie es euch, nach dem unglücklichen Schicksal eurer Liebhaber, in der schwarzen Marmorinsel erging und wie ihr dem alten Derwisch wieder in die Hände geraten seid.»
«Von Herzen gerne», sagte Tezile. «Sobald ich meinen geliebten Thelamir fallen sah...» «Oh», fiel ihr der Pasche ein,«ich bitte gar schön, laßt Dely erzählen; nicht, als ob Ihr nicht Verstand wie ein Engel hättet, aber sie hat so einen gewissen Ton der Stimme, daß man Musik zu hören glaubt, wenn sie spricht.» - «Gut», sagte Dely, «damit Ihr seht, daß wir die gefälligsten Mädchen von der Welt sind, so will ich erzählen, weil Ihr's so haben wollt.
Sobald also der arme Prinz und Thelamir das Leben verloren hatten, ließ uns die Königin Okimpare in ihrem Palast abholen; und um sich zu rächen, daß ich ihre Nebenbuhlerin gewesen war, legte sie uns die Strafe auf, noch am nämlichen Tage in einem großen öffentlichen Schauspiel zu singen und zu tanzen. Es war sehr natürlich, wie Ihr seht, daß mein Kopf, während er zweimal von einem Leibe auf einen anderen versetzt wurde, sich ein wenig auslüftete. Wirklich war er dadurch so leicht geworden, daß ich nicht merkte, wie übel es sich schicke, an dem nämlichen Tage zu tanzen, da ich einen Liebhaber wie Alidor verloren hatte: ich bezauberte alle Menschen durch meine Leichtigkeit.
Was meine Schwester betrifft, die immer ein weiseres Mädchen gewesen ist als ich, die sang so zärtliche und schmachtende Arien, daß man vor Langeweile dabei seufzte; und die Worte, die sie dazu wählte, waren so albern, daß sie alle Sängerinnen der Welt hätten um den Kopf bringen sollen. In dessen, weil man sich immer wieder am Ballett erholte, so fehlte es unseren Schauspielen nicht an Zuspruch. Um diese Zeit war es, daß meine Schwester mich endlich dahin brachte, den Schwur mit ihr zu tun, daß wir alle Liebhaber so unglücklich machen wollten, als wir es selbst gewesen wären.
Sobald wir ein paar Herzen einverstanden sahen, boten wir allen unseren Verführungskünsten auf, um den Liebhaber in unser Garn zu ziehen; die Geliebte wußten wir durch die boshaftesten Afterreden gegen ihn einzunehmen; kurz, es war keine Möglichkeit, dem Gifte zu widerstehen, das wir über alle diejenigen ausspritzten, welche durch Herz, Geschmack oder Konvenienz miteinander verbunden waren.
Die Damen machten endlich gemeine Sache gegen uns und bestürmten die Königin mit so bitteren Klagen, daß sie uns auf ewig von ihrer Insel verbannte. Man brachte uns mit unserem Sklaven Guluku auf ein Schiff und setzte uns in der Gegend von Konstantinopel ans Land, ohne sich weiter um unser Schicksal zu bekümmern. Am Ufer der See sahen wir einen Alten in einer Beschäftigung, die uns sonderbar vorkam.
Er vertrieb sich die Zeit damit, kleine schwarze Schweinchen, eines nach dem anderen, im Meere zu ersäufen, und sprach während dieser Operation mit ihnen, als ob sie ihn hätten verstehen können. ‹Eure unselige Rasse›, sprach er zu ihnen, ‹hat den jungen Menschen unglücklich gemacht, dem ich das Armband von Medina schenkte: dafür sollt ihr mir auch alle sterben!›
Wir näherten uns ihm aus Vorwitz und erkannten in ihm den nämlichen Derwisch, der uns bei sich aufgenommen hatte, als wir den Kaufleuten, die uns ins Serail führten, entflohen waren. Sobald der Derwisch auch uns erkannte, gab er seine Arbeit auf und lief mit unbeschreiblicher Freude auf uns zu. Wir wollten von ihm wissen, was das zu bedeuten hätte, was wir soeben gehört und gesehen hatten.
Aber ohne sich in eine Erklärung einzulassen, führte er uns in eine Höhle, die er bewohnte, und machte uns mit dem einzigen Schweinchen, das noch lebte, ein Geschenk. Der Bassa vom Meere, sagte er, würde uns soviel dafür geben, als wir nur verlangen wollten. Da sein Geschenk von solcher Wichtigkeit war, so leerte ich meinen Arbeitssack aus und steckte das Schweinchen hinein. Diesen Morgen wollten wir es dem Bassa anbieten, aber er wies uns spöttisch ab.
Wir beschlossen, uns an dem Derwisch, der uns zum besten gehabt hatte, zu rächen; und da wir ihn bei unserer Zurückkunft schlafend fanden, schnitten wir ihm den ganzen Bart bis auf die Stoppeln ab, so daß er sich vor keinem Menschen mehr sehen lassen darf. Das war es, was uns so großen Spaß machte, als man die Mauer der Höhle einschlug, worin wir uns mit ihm befanden.»
Asemi, dem es nicht an Lebhaftigkeit fehlte, scherzte mit Dely über diese neue Probe der Leichtigkeit ihres Kopfes, und von Scherz zu Scherz kam er endlich so weit, daß er den beiden Schwestern, im ganzen Ernste, wie es schien, die zärtlichsten Sachen von der Welt vorsagte. Die Zirkasserinnen schienen, aus Koketterie oder zur Kurzweil, Gefallen daran zu finden; und wie wohl sie sich die Miene gaben, als ob sie einen hohen Wert auf ihre kleinsten Gnadenbezeugungen legten, so schienen sie doch nicht abgeneigt, zugunsten des schönen Paschen eine Ausnahme von ihrem Gelübde zu machen, wofern er Mittel finden könnte, sie von der Aufrichtigkeit seiner Liebe zu überzeugen.
Asemi erbot sich zu jeder Bedingung und Probe. «Die sichersten Mittel, euch zu gefallen, meine reizenden Gebieterinnen», sagte er, «werden diejenigen sein, die ihr mich selbst lehren werdet. Sagt mir nur, was ich tun soll und wie ihr mich haben wollt.» - «Das ist so schwer nicht», versetzte Dely, «wer gefallen will, muß angenehm, aufmerksam und verschwiegen sein, muß der geliebten Person immer tausend kleine Dienste erweisen, ihr immer etwas Verbindliches zu sagen haben.»
- «Oh», fiel Tezile ein, «wir haben von unseren Gespielinnen auf der Marmorinsel noch ein weit hübscheres Geheimnis gelernt.» - «Und was ist das?» fragte Asemi mit Lebhaftigkeit. «Freigebig sein», antwortete Tezile lachend; «nichts gewinnt die Herzen so schnell als das!» - «Gut, daß ihr mich erinnert», versetzte der kleine Schalk, der seine geheimen Absichten hatte; «darf ich bitten, schöne Dely, diese Uhr von mir anzunehmen, die Euch, ehe ich hier her kam, schon zugedacht war?» (Mit diesen Worten gab er ihr die goldne Uhr in die Hand, und Dely nahm sie mit Bewunderung an.)
«Und weil Ihr eine Liebhaberin von kleinen Diensten seid, so erlaubt mir, Euren Kopfputz zu vollenden.» - «Ich bin's zufrieden», sagte die junge Zirkasserin; «wir wollen sehen, wie Ihr Euch dazu anschicken werdet.» Asemi kniete vor sie hin und schien vor Vergnügen außer sich, ihre langen rabenschwarzen Haare, die ihr bis unter den Gürtel reichten, zu streicheln und auszumessen; er machte sich nun darüber her, sie aufzuwenden und mit Blumen zu durchflechten, aber alle Augenblicke ließ er eine Blume auf ihren Nacken oder in ihren Busen fallen, wo er sich die kleine Freiheit nahm, sie wieder hervor zu holen.
Die junge Zirkasserin lachte über diese Kinderei oder bestrafte sie wenigstens nicht sehr strenge. «Aber, wenn man es sagen darf, Tezile», sprach er zu dieser, «Ihr habt eben nicht die schönsten Blumen in diesem Garten ausgesucht; wenn Ihr so gut sein wolltet, andere aus dem Blumenstücke dort zu wählen, so wollte ich Euch mit Vergnügen diese silberne Uhr geben; seht nur, sie ist nicht zu verachten, wie wohl sie nur von Silber ist.»
Tezile, die schon darüber eifersüchtig war, daß Asemi ihrer Schwester deutlich genug den Vorzug über sie gab, lachte über das Präsent aus voller Kehle. «Eine wahre Paschen-Galanterie!» rief sie aus; «wann ist jemals erhört worden, Frauenzimmern von unserer Gattung silberne Uhren anzubieten?» - «Ihr seid etwas schwer zu befriedigen, sehe ich», erwiderte Asemi; «in dessen wollte ich darauf wetten, daß eine von euch einen silbernen Siegelring hat, der vollkommen zu dem Geschenke, das ich der schönen Tezile mache, passen sollte.» -
«Das ist wahr», sagte Dely; «Schwester, hänge einmal deinen silbernen Siegelring an diese Uhr: ich habe einen goldenen, wie du weißt, ich will ihn sogleich an die meinige hängen.» Die beiden Zirkasserinnen hängten also, gleichsam zum Scherz, den Uhren die Talismane an, die sie den Gebrüdern Izif und Izaf im Karawanserei abgenommen hatten; aber in dem nämlichen Augenblicke schlüpften ihnen die Uhren aus der Hand, und Aurore und Argentine standen leibhaftig vor ihnen da, jede mit ihrem Talisman der Schönheit am Finger.
Die beiden Töchter Sirocos schienen anfangs ganz verblüfft, da sie sich selbst so unverhofft wieder fanden; das Sonnenlicht schien sie zu verblenden, so lange war's, daß sie den Tag nicht gesehen hatten; es war ihnen, als ob alles um sie her wie durch den Schlag einer Zauberrute ans nichts hervor springe. Endlich, da sie die Talismane an ihren Händen wieder erkannten und daraus abnahmen, daß ihre Bezauberung nun gänzlich aufgehört habe, brach ein Schimmer von Entzücken aus ihrem Gesichte hervor; sie fielen einander um den Hals und bezeugten sich in den lebhaftesten Ausdrücken ihre Freude über eine so glückliche Veränderung.
Man kann sich vorstellen, wie groß das Erstaunen der beiden Zirkasserinnen war, da sie auf einmal zwei so liebreizende und ihnen völlig unbekannte Personen vor ihren Augen entstehen sahen; aber wie sie gewahr wurden, daß ihre Talismane dies Wunder gewirkt und daß diese nun für sie verloren seien, fingen sie bitterlich zu weinen an. Asemi, der aus Ehrfurcht für die Töchter des Bassa von Alexandrien auf die Seite getreten war, näherte sich jetzt der schönen Dely mit schüchterner Gebärde und bemühte sich, ihren Schmerz zu besänftigen; aber sie wollte ihn nicht anhören, sondern stieß ihn, das Gesicht von ihm wendend, mit der Hand zurück.
Aurore und Argentine, welche nun klar in der Sache zu sehen anfingen, bemühten sich, ihnen auf das freundlichste Trost zuzusprechen. Sie machten ihnen begreiflich, daß sie mit diesen Talismanen nichts verloren hätten, als was ihre angeborenen Reizungen ihnen sehr entbehrlich machten, dahin gegen sie dasjenige wiedergefunden, woran das Glück oder Unglück ihres Lebens geheftet sei. Überdies versprachen sie ihnen, daß ihr Vater nicht ermangeln würde, sie für ihren Verlust auf eine andere Weise reichlich zu entschädigen.
Inzwischen war Asemi nach dem Palaste geflogen und hatte die Nachricht von der Entzauberung der beiden Uhren überall verbreitet. Zambak, Zelide und Sumi eilten in den Garten; in wenig Augenblicken folgten auch Siroco und der Bassa mit seinen beiden Söhnen, denn Hassan, der damals just auf seine Hand von Ebenholz weinen mußte, konnte nicht mit ihnen kommen. Die Freude war allgemein und unbeschreiblich.
Die einzige Zelide konnte sich nicht enthalten, über die Abwesenheit ihres geliebten Hassan zu seufzen und die Dauer seines unglücklichen Schicksals, woran das ihrige hing, zu beklagen, als man plötzlich die Sklaven, welchen der Bassa die Bewachung der Höhle des Derwischen anbefohlen hatte, wieder kommen sah, und Hassan in ihrer Mitte, der schon von ferne in die Hände klopfte und Zeichen der lebhaftesten Freude von sich gab. Er eilte in vollem Sprung herbei, um zu zeigen, daß seine Buße ein Ende habe und seine Hand wieder geworden sei, wie sie gewesen, ehe er den Speckkuchen der christlichen Sklavin angerührt hatte.
Wie es damit zugegangen, konnte er nicht sagen; man zweifelte aber nicht, das schwarze Ferkel müsse ersäuft worden sein, wie wohl man nicht wußte, bei wem man sich dafür zu bedanken habe. Alles, was die Sklaven berichten konnten, war, sie hätten diesen Morgen drei Männer gesehen, die einem vierten nachgelaufen und gewaltig auf ihn zugeschlagen hätten; dieser habe sich endlich in die Höhle geflüchtet, die drei Männer wären ihm gefolgt, und sogleich hätten sie (ihrem obhabenden Befehle gemäß) die Öffnung der Höhle mit großen Felsenstücken zugestopft.
Kaum hatten die Sklaven ihren Bericht geendigt, so hörte man ein großes Geschrei auf der Terrasse, und man sah einen Mann angelaufen kommen, den die Zirkasserinnen sogleich für ihren alten Derwisch erkannten, wie wohl er beide Hände vors Gesicht hielt, um seinen abgestutzten Bart zu verbergen. Zu gleicher Zeit erkannte man auch die drei Juden, die ihn, ohne Krücken, so behend und hitzig verfolgten, als ob sie nie am Schenkel verwundet gewesen wären.
So bald der alte Derwisch einer so zahlreichen Gesellschaft gewahr wurde, so suchte er auf einer anderen Seite zu entfliehen; aber weil ihm die Sklaven des Bassa in die Flanke fielen, so blieb ihm nichts übrig, als sich gutwillig zu ergeben. Wie groß war jetzt das Erstaunen des Bassa, in dem er in diesem Derwisch denjenigen erkannte, der seinen drei Söhnen ehemals den Tesbusch, das kupferne Blech und das Armband gegeben hatte!
Da er (wie man bereits hat bemerken können) der weichherzigste Bassa von der Welt war, so konnte er sich nicht enthalten, mit offenen Armen auf ihn zu zu gehen. «Seid ohne Furcht, mein ehrwürdiger Vater», sprach er zu ihm; «Ihr seid in dem Hause eines echten Musulmanns, der Euren Habit verehrt, und wehe dem, der Euch beleidigen wollte! Aber sagt mir, wer durfte sich erfrechen, Euch des ehrwürdigen Zeichens Euren Standes zu berauben? Nennt mir ihn: es soll ein schreckliches Exempel an ihm statuiert werden!»
Die beiden Zirkasserinnen brachen bei dieser Drohung in ein lautes Gelächter aus. «Gnädiger Herr», sagten sie, «das ist ein Stück von unserer Arbeit; aber es widerfuhr ihm nicht mehr, als er verdient hat.» Und darauf erzählten sie der ganzen Gesellschaft, daß es eben der Derwisch sei, der ihnen ehemals aus ihrem Käfig geholfen und sich in sie verliebt habe, und alles übrige, was sie dem Asemi bereits erzählt hatten.
Der arme Mann, der schon durch seine niedergeschlagenen Augen und sein Stillschweigen alles eingestanden, was die leichtfertigen Mädchen von ihm sagten, hatte nun nichts Bessers zu tun als sich - wie ein Derwisch aus der Sache zu ziehen.
«Ich gestehe meine Verblendung mit Schamröte», sagte er; «wie konnte ich von den leichtsinnigen Geschöpfen, von denen mein Herz sich hatte überraschen lassen, jemals eine bessere Begegnung erwarten? Aber selbst die weisesten Menschen sind nicht vor einem unglücklichen Augenblick sicher, worin sie sich vergessen können, und sind um so mehr zu beklagen, da die Weiber, die über ihre Tugend siegen, gemeiniglich nicht zur Klasse derjenigen gehören, die nach Grundsätzen leben.
Die Tugend dieser Letztern unterstützt die unsrige: nur an Leichtsinn und Torheit scheitert die Vernunft. Glücklich ist es in dessen, daß es auch um so viel leichter ist, von einer solchen Leidenschaft geheilt zu werden. Meine Augen sind nun wieder offen, und der Zauber, den diese jungen Dirnen auf mich geworfen, ist aufgelöst.
Um euch aber, gnädige Herren, nichts zu verschweigen, was mich meine törichte Leidenschaft gekostet hat, so will ich euch sagen, daß ich, wie die Mauer, welche die Rückenwand meiner Höhle ausmachte, eingerissen wurde, aus Scham, in diesem Zustand bei diesen zwei jungen Personen gefunden zu werden, so schnell ich konnte mit dem Sacke von rosenfarbenen Taft davonlief.
Ich brachte diese Nacht auf dem Felde zu. Diese drei Männer hier kamen und setzten sich neben mich. Sie sagten mir, sie wären so eben einer großen Gefahr entgangen, und sie wären, da einer von ihnen eine Wunde bekommen, alle drei auf die nämliche Weise verwundet worden. Ich konnte ihnen dies unmöglich glauben; aber um die Probe zu machen, pflückte ich einige Wundkräuter, deren Kräfte mir bekannt sind; und sobald ich sie einem von ihnen auf seine Wunde gelegt hatte, fand sich nach einigen Stunden, daß alle drei geheilt waren, wie wohl ich den beiden anderen nichts aufgelegt hatte.
Wir brachten nun den Rest der Nacht ganz ruhig zu; aber wie der Tag anbrach, betrachtete mich einer von ihnen mit Aufmerksamkeit. ‹Ah›, rief er seinen Gefährten zu, ‹das ist der nämliche, der die Tänzerinnen begleitete, die uns in der Karawanserei ausplünderten!› Diese Rede machte mich bestürzt. Ich sah nun auch ihnen schärfer ins Gesichte und erkannte die beiden Männer, denen die jungen Zirkasserinnen die Talismane der Töchter Sirocos und alle Waren, so sie bei sich trugen, genommen hatten.
Nun wurde mir Angst; ich wollte mich davon machen, aber sie fielen grimmig über mich her, und wie schnell ich ihnen zu entlaufen suchte, so fielen doch nicht alle ihre Schläge auf die Erde. Instinktmäßig lief ich meiner Höhle zu, und sie verfolgten mich bis auf die Terrasse dieses Gartens.
Im Laufen bemächtigte sich einer von ihnen meines Sackes, und vermutlich aus Unwillen, nichts als das kleine schwarze Schweinchen darin zu finden, warf er ihn samt dem unreinen Tier ins Meer, wie ich selbst schon lange getan haben würde, wenn die beiden Undankbaren, die ich liebte, meine Vernunft nicht benebelt hätten.
Ich weiß, gnädiger Herr», setzte der Derwisch hinzu, in dem er sich gegen den Bassa wandte, «daß das Glück eines Eurer Söhne von diesem Umstand abhing; diese drei Juden sind die Werkzeuge, die ihn von seiner schweren Buße befreit haben; und anstatt einiger Bestrafung haben sie vielmehr die größte Belohnung um Euch verdient. Alles, was ich noch wünsche, ist, daß der Prophet, um sie der selben würdig zu machen, ihnen die Gnade verleihe, unseren allein wahren Glauben anzunehmen.»
Der Derwisch, wie man sieht, sprach und wünschte, wie es einem Derwisch zukommt. Während seiner Rede hatten die Gebrüder Izif und Izuf ihre Augen auf die reizenden Zirkasserinnen geheftet, und die Zauberkraft der selben, die sie bereits erfahren, als sie ihnen in der Karawanserei in die Hände fielen, wirkte neuerdings so sichtbar auf sie, daß alle Anwesenden den frommen Wunsch des ehrwürdigen Derwisch für erfüllt ansahen, sobald diese holden Verführerinnen sich ihre Bekehrung zu Herzen nehmen wollten.
Der Bassa und sein Freund Siroco fanden, nach dem alles auf so gutem Wege war, daß nun nichts weiter übrig sei, als mit Hilfe des Kadi (welchen man hatte einladen lassen, um an der Wonne einer so glücklichen Entwicklung Teil zu nehmen) so viel Paare aus den Personen des Dramas zu machen, als nur immer herauszubringen waren.
Die drei Töchter Sirocos wurden den drei Söhnen des Bassa vom Meere zuteil, mit denen sie bereits das Elixier der vollkommenen Liebe gekostet hatten; die schöne Sumi nahm es auf sich, ihren geliebten Izaf glücklich zu machen; und die beiden Zirkasserinnen ließen sich ohne Mühe bereden, den Brüdern Izif und Izuf die Hand zu geben unter der Bedingung, daß sie sich gefallen ließen, das Gesetz des Propheten anzunehmen; eine Sache, die dem alten Derwisch so große Freude machte, daß er sich durch die Zeremonie, ihnen den Turban aufzusetzen, für den Verlust seines Bartes reichlich entschädigt hielt.
Um die Einigkeit unter diesen Neuvermählten desto fester zu gründen, präsentierte man nun auch der schönen Dely und ihrer Schwester das Elixier der vollkommnen Liebe, wovon sie allein noch nicht gekostet hatten; sie tranken alles aus, was noch in der Flasche war, und ließen keinen Tropfen für alle Tänzerinnen übrig, die nach ihnen gekommen sind.
Christoph Martin Wieland Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
PERTHARIT UND FERRANDINE ...
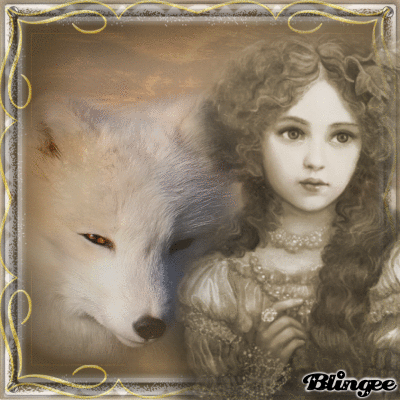
Es war einmal ein König in der Lombardei, der der häßlichste Mann in seinem ganzen Lande war; seine Gemahlin hingegen wurde für die schönste Frau in Italien gehalten; dafür aber war er der beste Mann von der Welt und sie die wunderlichste und unerträglichste aller Weiber.
Der gute König durfte sich kaum unterfangen, sie anzusehen; ihr so nahe zu kommen, daß ihre Nasen einander hätten berühren können, daran war gar nicht zu gedenken; und gleichwohl machte sie ihm immer Vorwürfe, daß sie keine Kinder hatte.
Er, seines Orts, hätte sich darüber trösten können; denn er hatte aus seiner ersten Ehe einen Sohn und eine Tochter, die von seinem Volke bis zum Anbeten geliebt, aber desto mehr von ihrer Stiefmutter gehaßt und verfolgt wurden, welches dann dem armen Manne alle Freude, die er sonst an seinen Kindern hätte haben können, verbitterte.
Die Königin besaß zwar nichts weniger, als was man ein zärtliches Herz nennt, aber sie war eifersüchtig auf ihre Schönheit; und wenn etwa zufälligerweise in ihrer Gegenwart die Rede von einer jungen Person war, die sich durch ihre Reize auszeichnete, so konnte man darauf rechnen, daß sie in kurzem verschwinden würde; denn die Königin ließ sie sogleich entführen und in aller Stille so weit weg schaffen, daß man nichts wieder von ihr zu sehen noch zu hören bekam. Dafür hätte man aber auch ihre Hofdamen für Geld sehen lassen können, so ausgesucht vollkommen waren sie in der häßlichen Gattung.
Der König hingegen, wie übel er selbst von der Natur in seinem Äußerlichen verwahrlost worden war, hatte recht seine Freude daran, die schönsten und wohl gemachtesten Mannspersonen, die nur zu finden waren, an seinem Hofe zu sehen; aber es brauchte alle mögliche Mühe, sie da zu behalten, so widrig war ihnen der tägliche Anblick der Fratzengesichter, die den Hof der Königin ausmachten.
Der König indessen, ungeachtet der Beweise von Verachtung und Abscheu, die er tagtäglich von seiner Gemahlin empfing, war so jämmerlich in sie verliebt, daß er sie alles machen ließ, was sie wollte. Sie war unumschränkter Herr über seine Einkünfte und über seine Untertanen; und diese ungerechte Gewalt erstreckte sich sogar bis auf seine Kinder.
Die Prinzessin mußte es teuer büßen, daß sie ebenso schön war als ihre eifersüchtige Stiefmutter; sie wurde in eine Mansarde unterm Dache des Palastes eingesperrt, wo sich kein Mensch unterstehen durfte, ihr die Cour zu machen. Die Königin hatte ihr eine alte mißgeschaffene Furie zur Hofmeisterin zugegeben, die, wenn sie die arme Prinzessin den ganzen Tag ausgescholten hatte, sie auch noch mitten in der Nacht aus dem Schlafe weckte, um ihr Grobheiten zu sagen, und die sich alle mögliche Mühe gab, ihr durch übel gemachte Kleider die Taille zu verderben und sie um ihre schöne Gesichtsfarbe zu bringen.
Die Prinzessin war die sanftmütigste Person von der Welt, und Tränen waren also das einzige, was ihr in ihrem Leiden einige Erleichterung verschaffte. Dem Prinzen wurde von den Hofleuten, die zu seiner Bedienung angestellt waren, nicht viel besser begegnet; denn die Königin hatte sie ausgewählt, und sie hingen gänzlich von ihren Winken ab; aber es fehlte viel, daß der Prinz ihre Mißhandlungen so geduldig ertragen hätte wie seine Schwester.
Der König hatte einen Vetter, welcher Erzherzog von Plazenz war. Dieser Prinz hatte das Unglück gehabt, seinen Verstand zu verlieren, weil er eine einzige Nacht in einem gewissen Schlosse geschlafen, wohin er sich auf der Jagd verirrt hatte. Es spukte in diesem Schlosse; und seinem Sagen nach hatte er so außerordentliche Dinge darin gesehen, daß sie ihn aus seinen fünf Sinnen hinausgeschreckt hatten.
Dieser Erzherzog hatte ebenfalls einen Sohn und eine Tochter, die er über alles liebte, und das mit Rechte; denn es waren die zwei vollkommensten Geschöpfe, die jemals geatmet hatten. Der Prinz nannte sich Pertharit, die Prinzessin Ferrandine.
Der Zustand, worin sie ihren armen Vater sahen, brachte sie beinahe selbst um den Verstand. Sie ließen sich bei einer berühmten Zauberin Rat einholen, die nicht weit vom See Avernes wohnte und so alt, aber dabei so munter und kräftig aussah, daß man sie für die cumäische Sibylle hielt: man nannte sie nur die alte Messerscheiden-Mutter, weil die Grotte, worin sie sich aufhielt, mit lauter Messerscheiden tapeziert war.
Jedermann, der sie um Rat fragte, mußte ihr ein Messer zum Geschenke mitbringen, welches sie, bevor sie die Antwort gab, in eine von den Scheiden steckte. Der ganze Trost, den die Kinder des wahnsinnigen Erzherzogs von ihr erhielten, war, sie möchten den Verstand ihres Vaters nur an eben dem Orte suchen, wo er ihn verloren hätte.
Der Prinz und die Prinzessin waren sogleich dazu entschlossen; aber die Minister und die sämtlichen Räte widersetzten sich. Es wäre genug, sagten sie, daß ihr gnädigster Herr närrisch geworden sei; es sei gar nicht nötig, daß der Rest der Familie sich in Gefahr setze, es ebenfalls zu werden. Aber wie sehr sie sich sperrten, Pertharit beharrte dabei, daß er allein für sie beide gehen wolle.
Allein, das wollte seine Schwester nicht zugeben; und so war dann, nach vielen vergeblichen Bemühungen, sie davon abzuhalten, das Ende vom Liede, daß der schöne Pertharit und die liebreizende Ferrandine miteinander gingen.
Der ganze Hof begleitete sie bis vor die Pforte des bezauberten Schlosses. Sie gingen ganz allein hinein. Die Hofleute warteten vierzehn Tage lang im Walde auf ihre Zurückkunft; aber sie hätten sich zu Tode warten können, der Prinz und die Prinzessin kamen nicht wieder. Ganz Plazenz wollte in Verzweiflung darüber geraten.
Anfangs schrie alles, man sollte gehen und die alte Scheiden-Mutter mit ihrer ganzen Bude lebendig verbrennen; aber das fanden sie denn doch, bei näherer Überlegung, nicht für ratsam; denn die Hexen der damaligen Zeit ließen sich nicht so geduldig verbrennen wie die armen Hexen unseres Jahrhunderts. Der Geheimeratspräsident, ein kluger und anschlägiger Mann, riet, man sollte vielmehr eine Deputation von den angesehensten Personen im Lande, jede mit einem goldnen und mit Edelsteinen besetzten Messer in der Hand, zu ihr schicken und sie um ihren Beistand bitten lassen. Dieser Rat wurde befolgt.
Die Schönheit des Geschenkes schien einen günstigen Eindruck auf die Fee zu machen; und nachdem sie die Messer jedes in seine gehörige Scheide gesteckt, öffnete sie einen alten Schrank und zog aus einem Schubfach einen Kamm und ein Halsband hervor. Der Kamm stak in einem Futteral, und das Halsband war von hell poliertem Stahl und mit einem kleinen goldnen Vorlegschloß zugemacht.
«Hier», sagte die Zauberin, «geht mit diesen zwei Dingen von einem Hofe zum anderen, so lange, bis ihr eine Dame gefunden habt, die schön genug ist, um dieses Halsband aufzuschließen, und einen so vollkommenen Mann, daß er imstande ist, diesen Kamm aus seinem Futteral herauszuziehen; sobald ihr sie gefunden haben werdet, könnt ihr nur wieder nach Hause gehen. Dies ist alles, was ich zum Besten eurer Herrschaft tun kann.» Die Deputierten hatten mit ihrem Kamm und Halsband bereits ganz Italien vergebens durchzogen, als sie bei dem König der Lombardei, zu Mirandola, wo er damals seinen Hof hielt, anlangten.
Das Unglück des Erzherzogs, seines Vetters, und seiner beiden Kinder war ihm vorhin schon bekannt. Er zweifelte nicht, daß seine Gemahlin überflüssig schön sei, um das Halsband aufzuschließen, und daß sich unter den auserlesenen Jünglingen, die er an seinem Hofe beisammen hatte, unfehlbar einer finden würde, der den Kamm aus seinem Futteral zu ziehen würdig wäre; aber was er nicht begriff, war, was seinem Verwandten zu Plazenz damit gedient sein könne.
Indessen ließ er, sobald die Deputierten ihre baldige Ankunft hatten wissen lassen, alle Anstalten zu ihrem Empfang machen. Die Königin hatte nun Tag und Nacht nichts zu tun, als sich zu baden und sich frisieren und herausputzen zu lassen; und doch, mit allem Vertrauen, das sie in ihre Schönheit setzen konnte, konnte sie nicht verhindern, über den Gedanken, daß sie bei dieser Gelegenheit mit der Prinzessin in eine gefährliche Konkurrenz kommen würde, in große Unruhe zu geraten, wiewohl man alles mögliche getan hatte, um die Schönheit der selben zugrunde zu richten.
Die Hofmeisterin, als eine getreue Dienerin der boshaften Gesinnungen der eifersüchtigen Königin, lief sogar in der ganzen Stadt herum, um irgendeinen dienstfertigen Arzt aufzutreiben, der ihr in der Geschwindigkeit die Pocken geben könnte. Da sich keiner finden wollte, so geriet sie in große Versuchung, ihr ein Auge auszuschlagen und vorzugeben, daß sie durch einen Zufall darum gekommen sei.
Inzwischen ließ der Prinz, der den Gesandten entgegen reiten wollte, allen jungen Herren vom Hofe sagen, sie möchten sich bereit halten, ihn zu begleiten; aber wie wohl er unendlich geliebt wurde, so getraute sich doch aus Furcht vor der Königin keiner, dem Prinzen bei dieser Gelegenheit aufzuwarten. Es verdroß ihn, wie man denken kann, nicht wenig; aber er verbiß seinen Unwillen aus Achtung gegen den König, seinen Vater, dem er aufs zärtlichste ergeben war.
Er beschloß also, ohne Gefolge hinauszureiten; aber da er eben das Pferd, das man ihm vor geritten hatte, besteigen wollte, näherte sich ihm einer der edelen Jünglinge und beschwor ihn, dieses Pferd nicht zu reiten, weil es das wildeste und bösartigste Tier von der Welt sei; der Oberstallmeister der Königin, sein Vater, habe es auf ausdrücklichen Befehl der Königin aussuchen müssen, damit dem Prinzen ein Unglück begegnen sollte.
Der Prinz raunte ihm ins Ohr, er möchte sich ja nichts merken lassen, und bestieg das Pferd ohne die geringste Furcht. Er war ein sehr guter Reiter und überhaupt in allen Stücken der vollkommenste junge Mann, den man sehen konnte, den schönen Pertharit allein ausgenommen; und wohl ihm, daß er das war! denn der verwünschte Gaul roch kaum die freie Luft, so fing er so unbändig an, zu wiehern und sich zu bäumen und von vorn und hinten auszuschlagen, als ob ihm alle böse Geister in den Leib gefahren wären.
Der Prinz, der ihn ganz blutrünstig gepeitscht hatte, schwamm selbst im Wasser, so sehr hatte er sich angestrengt, den unartigen Gaul zur Räson zu bringen; er glaubte auch wirklich, daß es ihm gelungen sei, indem er ganz ruhig mitten unter den Abgesandten einher schritt; aber kaum waren sie auf der großen Brücke, über welche man in die Stadt passieren mußte, so fing das unartige Tier wieder an, sich zu bäumen, setzte mit einem Sprung über das Brustgeländer weg und stürzte sich mit dem Prinzen in den Fluß.
Das Pferd ersoff, wie billig; der Prinz hingegen, der ein sehr geschickter Schwimmer war, kam mit leichter Mühe wieder ans Land und retirierte sich, ohne die mindeste Empfindlichkeit zu zeigen, in seine Zimmer, um sich anders anzuziehen.
Der König und die Königin befanden sich mit ihrem ganzen Hofe auf einer Bühne, die an dem größten Platze der Stadt aufgerichtet war, und erwarteten da selbst die Ankunft der Abgesandten, um die Probe, worauf es ankam, vorzunehmen. Der Prinz, der sich von dem unangenehmen Vorfall wieder vollkommen erholt hatte, fand sich ebenfalls ein, schön wie ein Apollo, und wurde mit allgemeinem Zujauchzen des Volkes empfangen.
Die Abgesandten erschienen gleich nach dem Prinzen. Die Königin, anstatt auf ihr Kompliment Acht zu geben, sagte zum Prinzen, es wäre eine sonderbare Grille von ihm gewesen, sich so zur Unzeit zu baden, und fragte ihn in einem spöttischen Tone, ob ihm das Bad wohl zugeschlagen habe. Die sämtlichen Meerkatzen ihres Hofes fanden den Einfall äußerst witzig und rissen ihre garstigen Mäuler auf, um überlaut zu lachen.
Sie lachten noch, als man die Prinzessin ankommen sah, bei deren Anblick sogleich ein dumpfes Gemurmel unter allen Anwesenden entstand. Vielen traten vor Schmerz und Mitleid die Tränen in die Augen; die Hofleute knirschten vor Unwillen, wie wohl sie es zu verbergen suchten, und die Abgesandten wußten nicht, was sie bei Erblickung dieser Prinzessin denken sollten, die sie mehrmals mit der unvergleichlichen Ferrandine hatten vergleichen hören.
Sie war schlecht angezogen und noch schlechter coiffiert; denn man hatte ihr die Haare auf einer Seite ganz weggeschnitten, und um sie noch lächerlicher aussehen zu machen, hatten sie ihr das Gesicht mit gelber Farbe bepinselt. Sie war so beschämt, sich in einem solchen Aufzug sehen zu lassen, daß sie alle Augenblicke stehen blieb und sich nicht erwehren konnte, vor Scham und Verdruß die hellen Tränen zu vergießen; aber ihre Hofmeisterin schubste sie von hinten zu, auf eine sehr grobe Art vorwärts und nötigte sie, neben der Königin Platz zu nehmen, die in dem höchsten Glanz ihrer Schönheit parodierte und ganz mit Diamanten bedeckt war.
Man hätte denken sollen, sie könnte mit diesem Triumphe zufrieden sein; aber ihre Hofdamen schlugen, um ihn noch vollständiger zu machen, ein kicherndes Gelächter auf, wie die gedemütigte Prinzessin gezwungen wurde, sich neben ihr hinzusetzen.
Der König saß mit nieder geschlagenen Augen da und hätte vor Beschämung und Mitleid in die Erde sinken mögen; und weil er sich nicht stark genug fühlte, weder der Königin seinen gerechten Unwillen zu zeigen noch diesen Anblick auszuhalten, so sagte er zu den Abgesandten: Da er für seine Person keinen Anspruch an die Ehre, dieses Abenteuer zu bestehen, machen könne, so wolle er seinen Platz hiermit seinem Sohne überlassen haben - und damit begab er sich weg.
Der Prinz, der nun die Person des Königs vorstellte, ließ unverzüglich zum Werke schreiten, und das Halsband wurde auf seinen Befehl zuerst der Hofmeisterin der Prinzessin überreicht. Da sie wenigstens ebenso häßlich als boshaft war, so war ans Aufmachen gar nicht zu gedenken. Der Prinz (nicht halb so streng als Hamilton, der Gewährsmann dieser Geschichte) begnügte sich, ihr, statt aller Strafe, die sie verdient hatte, zu befehlen, sich sogleich mit der Prinzessin, seiner Schwester, wegzubegeben und sie so anzukleiden und auszuschmücken, wie es ihrem Rang und Alter zukomme, mit dem Bedeuten, daß sie ihm mit ihrem Kopfe dafür stehen würde!
Die Königin, die ihn niemals aus diesem Tone hatte reden hören, war ganz verblüfft darüber; aber was konnte sie machen? Der Befehl des Prinzen, dem alles Volk den lautesten Beifall zugeklatscht hatte, litt keine Einwendung; er wurde vollzogen, und die Prinzessin kam so schön und glänzend zurück, daß man nicht merkte, daß ihr die Hälfte ihrer Haare abgeschnitten worden waren.
Die Proben hatten indessen ihren Anfang genommen; alle Mannspersonen verloren ihre Mühe, da sie, einer nach dem anderen, versuchten, den Kamm aus seinem Futteral zu ziehen; und es war eine rechte Lust zu sehen, was für ein unaufhörliches Gelächter das Volk aufschlug, wie das Halsband bei den Damen der Königin herumging. Endlich nahm sie es selbst, und nach einiger Mühe gelang ihr es, es aufzumachen; aber es schnappte sogleich wieder mit einem so entsetzlichen Knalle zu, daß die Königin davon zu Boden fiel und für tot weg getragen wurde.
Der Prinz und seine Schwester waren nun allein noch übrig, und die armen Abgesandten fingen an zu besorgen, daß sie auch von diesem Hofe unverrichteter Dingen würden abziehen müssen; aber der Prinz berührte kaum das Futteral, so ging der Kamm von sich selbst heraus, und das Halsband öffnete sich in der Hand der Prinzessin, ohne sich wieder zuzuschließen.
Ein lautes Jubelgeschrei stieg von allen Seiten zu der Bühne, wo sie standen, empor; aber es wurde sogleich auf eine schrecken volle Art unterbrochen. Denn die Erde fing zu erbeben an, und es folgte ein Sturm mit Blitzen und Schloßen darauf, der die ganze Versammlung in wenig Augenblicken auseinander trieb. Man suchte den Prinzen und die Prinzessin, aber vergebens; sie waren verschwunden, und niemand konnte sagen noch begreifen, was aus ihnen geworden sei.
Die Zeitung von dieser Begebenheit setzte das ganze Reich in die äußerste Bestürzung; der König konnte sich gar nicht darüber trösten, und die Hofleute, nachdem sie die tiefe Trauer angelegt, zerstreuten sich, um die Verlorenen auf dem ganzen Erdboden zu suchen. Aber das Seltsamste von diesem ganzen Abenteuer war, daß die Betrübnis und Verzweiflung der Königin über alles ging.
Ihr Haß gegen die Kinder ihres Gemahls hatte sich, wunderbarerweise, auf einmal in die zärtlichste Liebe verwandelt, und zugleich in eine so heftige Liebe, daß sie sich die Haare aus dem Kopfe riß, wie sie hörte, daß sie nirgends zu finden seien. Sie schickte zum Könige und ließ ihn bitten, zu ihr zu kommen, damit sie ihn um Vergebung bitten könnte; denn anstatt der Verachtung und des Abscheues, womit sie ihm sonst begegnet war, liebte sie ihn jetzt bis zur Anbetung und stellte sich ihn in ihrer Einbildung als den liebenswürdigsten aller Menschen vor.
Aber der König, der es sich nicht aus dem Kopfe bringen konnte, daß sie seine Kinder durch irgendeinen heimlichen Anschlag aus dem Wege geräumt habe, wie wohl er noch immer schwach genug war, sie zu lieben, und nicht daran denken konnte, sie zu bestrafen, wollte sich doch selbst für diese Schwachheit bestrafen und tat ein Gelübde, sie in seinem ganzen Leben nicht wiederzusehen.
Der Sturm, der, vorerzählter maßen, am Tage der Proben alle Anwesenden auseinander stöberte, hatte sich in zwei Wirbel geteilt, deren einer den Prinzen und der andere die Prinzessin aufhob und durch die Lüfte davon führte, um sie ziemlich weit von Hause wieder niederzusetzen.
Die Prinzessin, sobald sie wieder zu sich selbst gekommen war, sah sich mitten in einem sehr öden und ihr ganz unbekannten Wald; allein, hilflos und in einer Lage, die durch die Vorstellungen ihrer Einbildungskraft mit jedem Augenblicke schrecklicher wurde. Wohin sie ihre Augen drehte, sah sie nichts als Felsen und Abgründe, und niemand als der Widerhall antwortete ihr, wenn sie ihren Bruder bei seinem Namen um Hilfe rief.
Indem sie nun auf Geratewohl in verworrenen und unwegsamen Felsenpfaden herum kletterte, wurde sie zwei große Wölfe gewahr, die auf Raub ausgingen und, sobald sie sie erblickten, mit offenem Rachen auf sie losgingen. Sie hielt sich für verloren; aber indem sie, um wenigstens das Entsetzliche einer solchen Todesart nicht zu sehen, die Hand vor die Augen hielt, taten die Wölfe einen Satz zurück und fingen nicht anders an zu laufen, als ob hundert Hunde hinter ihnen her wären.
Eben das selbe begegnete ihr mit verschiedenen anderen Raubtieren, die in dieser Wildnis zu Hause waren und alle mit ebenso schüchterner Eilfertigkeit wie die beiden Wölfe vor ihr flohen, sobald sie das Halsband gewahr wurden. Mittlerweile war sie in einen Weg geraten, der durch den ganzen Wald ging und sie unvermerkt in eine minder raue Gegend des selben führte, wo sie auf einige Schäfer stieß, die ihre Herden hüteten.
Sie verdoppelte ihre Schritte, um zu den Schäfern zu kommen und Hilfe bei ihnen zu suchen; aber wie sie den Mund zum Reden auftat, erblickten die Schafe das Halsband, gerieten in Angst und zerstreuten sich durch den ganzen Wald. Die Schäfer liefen ihnen, was sie konnten, nach; und nun fing die Prinzessin zum ersten Mal an, die geheime Kraft ihres Halsbandes zu bemerken, und es war ihr sehr leid, die Entdeckung nicht früher gemacht zu haben; jedoch fühlte sie sich dadurch nicht wenig beruhigt.
Sie begab sich wieder tiefer in den Wald hinein, in Hoffnung, einen von den Schäfern wieder aufzutreiben; aber sie mochte laufen und rufen, soviel sie wollte, die Leute waren einmal erschreckt, und keiner wollte ihr standhalten. Die gute Prinzessin war von dem beständigen Laufen in einer so rauen Gegend so abgemattet, daß ihre Kräfte eben zu sinken anfingen, wie ihr zu gutem Glück in einiger Entfernung ein altes Schloß in die Augen fiel.
Dieser Anblick gab ihr neue Kräfte, und sie richtete ihren Lauf mit verdoppelten Schritten dahin. Wie sie dem Schlosse ziemlich nahe war, lief ein schneeweißer Fuchs quer über den Weg, kehrte aber gleich wieder um, blieb etliche Schritte weit von ihr stehen und betrachtete sie mit der größten Aufmerksamkeit. Die Prinzessin ihrerseits tat desgleichen; denn es war unmöglich, ihn anzusehen und nicht von ihm bezaubert zu werden.
Aus Furcht, ihn ebenfalls zu verscheuchen, verbarg sie ihr Halsband, so schnell sie konnte; sie hätte ihn um alles in der Welt nicht wieder aus dem Gesichte verlieren mögen, denn außer einem gewissen Ausdruck von Feinheit und Verstand, den alle Füchse in ihrer Physiognomie haben, hatte er noch eine ihm ganz eigene Grazie und etwas Vornehmes in seinem Blicke. Sie näherte sich ihm, um zu sehen, ob er sich von ihr anrühren lassen oder ihr wenigstens in das Schloß folgen würde; aber er wollte weder das eine noch das andere, sondern fing an, auf eine andere Seite zu laufen, doch nicht so schnell, daß er ihr aus den Augen kam.
Endlich, nachdem sie den ganzen Rest des Tages damit zugebracht hatte, ihm mit einer über ihre Kräfte gehenden Standhaftigkeit zu folgen, fehlte nur noch wenig, daß sie vor Mattigkeit umgefallen wäre, als sie den weißen Fuchs in eine Art von kleinem Palast, der in der anmutigsten Gegend von der Welt am Ufer eines Baches stand, hinein gehen sah. Sie blieb einen Augenblick, ungewiß, was sie tun sollte, stehen; aber das Verlangen, ihrem liebenswürdigen Füchschen zu folgen, überwand alle Bedenklichkeiten. Sie ging also hinein.
Der weiße Fuchs, der die Höflichkeit selbst war, empfing sie an der Pforte, nahm die Schleppe ihres Rockes zwischen die Zähne und trug sie ihr, wie sehr sie sich auch dagegen setzte, so lange nach, bis sie durch den Schloßhof einen Saal des Palasts erreichte, den sie mit allen Bequemlichkeiten versehen fand.
Sie warf sich sogleich auf ein Kanapee hin, und wie sie ihren lieben weißen Fuchs zu ihren Füßen sah, der die zärtlichsten Blicke zu ihr emporschickte, vergaß sie auf einmal nicht nur alles bereits ausgestandenen Ungemachs, sondern würde auch, so däuchte ihr es, sich der ganzen übrigen Welt gern entschlagen haben, wenn sie nur immer in dieser Lage hätte bleiben können.
Wir wollen sie also auf einige Augenblicke lassen, wo sie ist, um zu sehen, was in dessen aus dem Prinzen, ihrem Bruder, geworden war. Während der eine Wirbelwind die Prinzessin aufgehoben und mitten in einem Walde wieder abgesetzt hatte, wurde der Prinz von dem anderen bis ans Ufer des Meeres fortgeführt.
Er ging da mit großen Schritten hin und wider, seinem seltsamen Abenteuer und allem, was ihm an diesen Tag, am Hofe seines Vaters begegnet war, nachdenkend. Da er dort nichts als hassens- oder vergessenswürdige Gegenstände gesehen hatte, so erinnerte er sich bloß seiner Schwester und daß sie von einem allzu schwachen Vater den grausamen Behandlungen einer Stiefmutter preisgegeben sei, die jetzt, wegen dessen, was vorgegangen, mehr als jemals gegen sie erbittert sein würde.
Diese traurigen Gedanken führten ihn unvermerkt an den Fuß eines Felsen, der sich ziemlich sanft vom Ufer erhob und bis ins Meer hineinragte. Er bestieg den Felsen, um sich besser umsehen zu können, und erblickte hinter ihm nichts als eine öde unangebaute Wildnis, aber vorwärts in einiger Entfernung eine Insel, die ihm der lieblichste Ort in der ganzen Welt zu sein däuchte.
Er ward es nicht müde, nach ihr hinzusehen, und es fiel ihm sogleich ein, die Prinzessin, seine Schwester, könnte gar wohl auf dieser Insel sein. Wie oft er sich auch sagte, daß es eine bloße leere Einbildung sei, der Gedanke stieg ihm immer wieder auf.
Der Gipfel des Felsen war mit Moos und kurzem dichten Grase bedeckt; er streckte sich in das Gras, lehnte den Kopf an einen bemoosten Stein, und in dem er, auf den rechten Arm gestützt, mit traurigen Blicken nach der Insel hin sah, sank er in eine Art von Traum, woraus er von Zeit zu Zeit wieder erwachte, um die Insel zu betrachten, die mit dem frischesten Grün tapeziert und mit tausend blühenden Bäumen besetzt war, welche von ferne die anmutigste Landschaft bildeten.
Er verwandte die Augen nicht von diesem Gegenstande, bis es anfing, so dunkel zu werden, daß er ihn nicht mehr erkennen konnte. Er stieg nun wieder von dem Felsen herab, begab sich tiefer ins Land hinein, und da sich nirgends eine Spur von Bewohnern zeigen wollte, verbrachte er die Nacht, so gut er konnte, in einer Felsenhöhle zu.
Sobald der Tag wieder angebrochen, war sein erster Gedanke, einen Weg zu suchen, der ihn wieder an den Hof seines Vaters führen könnte, wo seine Schwester ohne Zweifel seiner sehr nötigt hätte; aber er konnte sich die Einbildung nicht aus dem Kopfe bringen, daß sie auf der Insel sei. Wie lächerlich ihm diese Grille vorkam, so brachte sie ihn doch unvermerkt wieder an den Strand des Meeres.
Er wollte die Felsenspitze wieder besteigen, um seine bezaubernde Insel desto besser sehen zu können, aber es war ihm unmöglich, den gestrigen Fußpfad wiederzufinden. Er ging um den Felsen herum, um einen anderen zu suchen, als sich von der entgegen stehenden Seite die schönste Stimme von der Welt hören ließ. Er urteilte sogleich, daß es eine weibliche sei, und setzte sich mehr als einmal in den Fall, den Hals zu brechen oder ins Meer zu fallen, in dem er den Ort zu erreichen suchte, wo er das Singen hörte.
Endlich wurde der Boden ebener, und es däuchte ihm, er könne kaum zehn Schritt von der Sängerin entfernt sein; gleichwohl sah er noch immer nichts, vermutete aber, daß sie hinter einer anderen Ecke des Felsens verborgen sein müsse. Er schlich sich so leise, als ihm möglich war, hinzu, als ihm neben dem Orte, wohin er wollte, die frisch im Sande ausgebreitete Haut eines großen Seefisches in die Augen fiel.
Er entsetzte sich vor diesem Anblick; die Bewegung, die er machte, in dem er ihm ausweichen wollte, verursachte einiges Getöse, und in dem nehmlichen Augenblicke hörte er etwas ins Meer springen. Er kehrte zurück, und die Fischhaut war nicht mehr da. Nun näherte er sich dem Orte, woher die singende Stimme gekommen war; er fand niemand, aber seine Verwunderung war unbeschreiblich, da er in einer Grotte, die in den Felsen gehauen war, das schönste Bad von der Welt antraf.
Diese Grotte war etwas mehr als ein bloßes Werk der Natur, denn sie war überall mit Marmor bekleidet, und die Badekufen waren von Ebenholz und mit goldnen Platten gefüttert. Er wußte nicht, was er von dem allem denken sollte, wie wohl er bis in die Nacht darüber nachdachte. Er brachte sie, wie die vorige und noch zwei oder drei andere, in einem Gehölze zu, wo er auf der Erde schlief und wenigstens von seinen Mahlzeiten nicht an der Ruhe verhindert wurde; denn einige wilde Früchte, die er bei Tage zusammensuchte, waren alles, was ihm diese öde Gegend, sein Leben zu fristen, reichen konnte.
Für einen Prinzen war dies eben keine sehr wollüstige Lebensart, aber das war seine geringste Anfechtung; er hatte andere, die ihm näher zu Herzen gingen. Zwei- oder dreimal war er mit jedem Morgen an den Strand gekommen, ohne etwas zu hören noch zu sehen. Endlich fiel ihm der Fußpfad wieder ins Gesicht, der ihn das erste Mal auf die Felsenspitze geleitet hatte. Er bestieg sie mit Ungeduld, um sich am Anblick seiner schönen Insel wieder zu ergötzen.
Nicht lange, so hörte er die nehmliche Stimme wieder singen, die ihn das erste Mal so sehr bezaubert hatte. Er stieg eilends herab, und wie er nur noch drei Schritte von der Grotte entfernt war, lag die blutige Fischhaut wieder da. Er entsetzte sich vor ihr wie das erste Mal, er machte das nehmliche Getöse und sah einen Augenblick darauf einen ungeheuren Fisch ins Meer springen, und die Haut war fort.
Er fand die Grotte im vorigen Stande, außer daß Wasser in der Kufe war; und da er merkte, daß es noch lau war, so zweifelte er nicht, man müsse sich so eben darin gebadet haben; aber er konnte sich nicht vorstellen, daß es dieser Fisch sei, der sich alle Morgen die Haut abziehen lasse, um zu baden, und noch weniger, daß ein solches Ungeheuer so anmutig singen könnte. Er ging an den Ort, wo er den Fisch ins Meer hatte springen sehen, und bemerkte noch eine Art von Furche, die sich auf der Oberfläche des Wassers nach der Insel hin zog.
Des folgenden Morgens legte er sich hinter ein großes Felsenstück, das am Eingang der Grotte lag, in Hinterhalt und hatte die Augen unverwandt auf die Insel geheftet, von wannen, seiner Einbildung nach, der Fisch her kam, als er etwas Weißes aus der selben hervor stechen sah, das in der Ferne einem Rachen mit einem Segel glich; aber sobald es nahe genug war, daß er alles deutlich genug erkennen konnte, sah er die schönste Kreatur der Welt, die auf einer großen Seemuschel stand und, in dem sie mit der einen Hand das Ende eines großen weißen Segels empor hielt, das mit dem anderen Ende an diesen wundervollen Wagen befestigt war, ihn mit Hilfe der Zephyrn nach ihrem Gefallen lenkte.
Der Prinz warf sich so gleich auf die Knie nieder, in der festen Meinung, daß es nichts Geringeres als die Göttin Thetis oder eine ihrer Schwestern sei; denn wirklich konnte nichts dieser Göttin, so wie sie gewöhnlich von den Malern und Dichtern vorgestellt wird, ähnlicher sehen, ausgenommen, daß sie weder so blond noch so nackend war.
Sie richtete ihren Lauf gerade nach dem Orte, wo der Prinz noch immer auf seinen Knien lag und sich zehntausend Augen wünschte, um sie genug ansehen zu können; seine Aufmerksamkeit schien sie so wenig zu befremden, daß sie vielmehr, ihm gegenüber, ganz nahe am Ufer still hielt und ihn mit gleichem Interesse zu betrachten schien.
Was den armen Prinzen betrifft, so war es, von dem Augenblick an, da er diese allzu reizende Nymphe erblickt hatte, um seine Freiheit geschehen. Bewunderung und Liebe bemächtigten sich seiner mit solcher Gewalt, daß er ganz außer sich war und daß ihm der Schweiß in großen Tropfen auf der Stirne stand. Er zog sein Schnupftuch hervor, um sich abzuwischen, und im herausziehen fiel ihm der Kamm mit seinem Futteral aus der Tasche.
Die schöne Nymphe wurde den selben kaum gewahr, so entfuhr ihr ein lauter Schrei, und sie näherte sich dem Ufer, um ans Land zu steigen; aber der Prinz, ganz beschämt, daß vor den Augen seiner Göttin eine sich so wenig für einen Helden schickende Sache aus seiner Tasche gekommen sein sollte, fiel augenblicklich über den verwünschten Kamm her und steckte ihn eilfertig und ungehalten wieder ein.
Die Nymphe tat hierüber einen noch lauteren und schmerzlicheren Schrei, kehrte ihm unmittelbar den Rücken zu, fuhr nach der Insel zurück und verschwand aus seinen Augen. Der Prinz geriet darüber in unbeschreibliche Traurigkeit; alle seine Begierden und Wünsche zogen ihn unwiderstehlich nach dieser Insel; und da er kein Fahrzeug fand, das ihn hätte hinüber bringen können, so war er eben im Begriff, das Abenteuer des Leander zu wagen, und hatte zu diesem Ende schon angefangen, sich auszukleiden, als er von der Spitze des Felsens her eine Art von Gewinsel hörte, wie die Hunde zu machen pflegen, wenn sie Mitleid erregen wollen.
Er schaute empor und erblickte den weißen Fuchs, der, auf seine Hinterfüße aufgerichtet, noch immer fortwinselte und mit seinen Vorderfüßen allerlei pantomimische Gebärden gegen die Insel machte. Der Prinz betrachtete ihn mit großer Aufmerksamkeit, während daß ein kleines Fahrzeug, welches auf das Schreien und Zeichen geben des weißen Fuchses von der Insel abgestoßen war, mit vollem Segel gegen das Gestade zusteuerte.
Der Fuchs stieg herab, tat bei Erblickung des Prinzen vor Freuden zwei oder drei große Sätze und wollte nicht aufhören, ihm die Hände zu küssen und die Füße zu lecken, wie wohl der Prinz, der gleich auf den ersten Blick die zärtlichste Hochachtung für ihn gefaßt hatte, es auf keine Weise zulassen wollte. Während dieser beiderseitigen Höflichkeitsbezeugungen war der Nachen ans Land gekommen. Der weiße Fuchs gab dem Prinzen durch Zeichen zu verstehen, er möchte sich wieder vollends ankleiden und mit ihm in den Nachen steigen.
Das war es eben, was der Prinz so sehnlich wünschte; aber ehe er einstieg, um an einen Ort überzufahren, wo er seine Göttin wiederzusehen hoffte, fiel ihm die Beschämung ein, die ihm sein Kamm zugezogen hatte; zornig zog er ihn aus der Tasche und war im Begriff, ihn ins Meer zu werfen, als ihm der weiße Fuchs mit einem kläglichen Schrei an den Ärmel sprang, ihm den Arm mit aller Gewalt zurück hielt und schlechterdings nicht von ihm ablassen wollte, bis er den Kamm mit dem Futteral wieder in seine Tasche gesteckt hatte.
Das Fahrzeug fing, sobald sie eingestiegen waren, von selbst zu gehen an; es hatte sich aber noch nicht zwanzig Schritte vom Ufer entfernt, als man ein Getrampel von Pferden hörte und einen Augenblick darauf sich ein Mann zu Pferde am Ufer sehen ließ, der von verschiedenen anderen verfolgt zu werden schien. Dieser Reiter erblickte nicht so bald den weißen Fuchs, als er seinen Bogen spannte, einen Pfeil auflegte und den Fuchs damit durch den Leib schoß, der mit einem großen Seufzer seine Augen traurig nach dem Prinzen kehrte und sie dann schloß, als ob er sie nie wieder öffnen würde.
Der Prinz hätte nicht betrübter über diesen Unfall sein können, wenn der Pfeil ihn selbst getroffen hätte; Schmerz und Wut verdrängten in diesem Augenblick alle andere Empfindungen in seiner Brust, und er stürzte sich ins Meer, um hinüberzuschwimmen und den Tod des armen Fuchses zu rächen. Aber wie er wieder am Lande war, fand er niemand mehr und verlor in kurzem die Hoffnung der Rache mit den Spuren des Mörders, den die Felsen, womit die ganze Küste umgeben war, seinem Nachsetzen entzogen.
Er kehrte also ans Gestade zurück, um zu versuchen, ob er das Fahrzeug noch erreichen könnte und ob dem weißen Fuchse vielleicht noch zu helfen sei; aber alles war wieder verschwunden, auf dem Meere wie auf der Erde. Nie in seinem ganzen Leben hatte er den Kopf so voll verschiedener durch- und gegeneinander laufender Bewegungen und das Herz so voll Zärtlichkeit und Schmerz gehabt als jetzt.
Er konnte sich nicht entschließen, einen Ort zu verlassen, wo er ein Zeuge so vieler außerordentlicher Begebenheiten gewesen war; der Fuchs, die Nymphe und der Fisch beschäftigten seine Gedanken wechselweise, ohne daß er begreifen konnte, was sie wären noch was aus ihnen geworden sei; aber das wußte er gewiß, daß er niemals eine Liebe, einen Abscheu und eine Freundschaft in sich gefühlt hatte, die mit seiner Liebe für die Nymphe, mit seinem Abscheu vor der Fischhaut und mit seiner Freundschaft für den armen unglücklichen weißen Fuchs zu vergleichen gewesen wäre.
Die einbrechende Nacht und einige Blitze, die ein nahes Gewitter verkündigten, unterbrachen ihn endlich in seiner Träumerei und nötigten ihn, sich nach einem Orte, wo er Schirm haben könnte, umzusehen. Die Grotte mit dem Bade fiel ihm zuerst ein; er ging auf sie zu und war nicht wenig betroffen, da er sie sehr stark erleuchtet sah und, wie er näher kam, die nehmliche Stimme hörte, die er schon zweimal gehört hatte.
Er schlich sich, so leise als er konnte, bis zum Eingang der Grotte und hielt den Atem zurück, um ja nichts von dem Gesang der schönsten Stimme, die sein Ohr jemals getroffen hatte, zu verlieren. Er war so nahe dabei und horchte so aufmerksam auf die Worte ihres Gesanges, daß er keine Silbe davon verlor. Sie lauteten folgendermaßen:
O Prinz, auf ewig dieses Herzens König!
Wofern dir nicht vor meinem Anblick graut,
so kämme mich in diesem Bad ein wenig,
und dann verbrenne meine Haut!
Wie geheimnisvoll und unbegreiflich auch der Sinn dieser Worte war, so schmeichelten sie doch seinem Herzen und einer so süßen Hoffnung, daß er sich nicht länger zurückhalten konnte. Sobald er in die Grotte hinein trat, hörte der Gesang auf; sie war mit einer unendlichen Menge von Wachskerzen erleuchtet, die in lauter Scheiden von Ebenholz mit Gold garniert staken, und alle Kerzen hatten die Form eines Messers, das halb aus seiner Scheide gezogen ist.
Diese sonderbare Illumination überraschte ihn ungemein; aber wie wurde ihm erst zumute, da er die Badekufe ringsum mit einem Zelte von weißem Atlas, der mit einem Rande von lauter in Gold gestickten Messerscheiden eingefaßt war, umgeben sah und, ehe er Zeit hatte, sich von seinem Erstaunen zu erholen, mit einem sehr zärtlichen Seufzer diese Worte aus dem Zelt hervorkommen hörte:
«Prinz, ich bin diejenige, die du liebst: tue alles, was ich dich heißen werde, wie widersinnig es dir auch immer vorkommen mag, und erschreck nicht über das, was du sehen wirst, sobald sich mein Zelt öffnen wird; denn durch die geringste Furcht, die du blicken ließest, würdest du mich auf ewig verlieren.»
In diesem Augenblick öffnete sich das Zelt, und der Prinz erblickte etwas, worüber der herzhafteste Mann in Ohnmacht hätte sinken mögen: ein scheußlicher Krokodilskopf kam mit offenem Rachen aus dem Bad hervor und schien ihm ganz nahe auf den Leib rücken zu wollen. Er bebte nicht zurück, aber er schwitzte Todesschweiß, und sein Herz pochte wie ein Hammer, in dem er sich Gewalt antat, dem Ungeheuer mit starren Augen in den Rachen zu sehen.
Immittelst schloß sich dieser gräßliche Rachen wieder und schob sich zurück, um ihm unter dem selben das schönste und lieblichste Engelsgesicht sehen zu lassen, das er so gleich für das Gesicht seiner angebeteten Nymphe erkannte. Aber dieser Krokodilskopf, der sich an den Kopf der Nymphe anschmiegte, stellte gleichwohl eine ziemlich häßliche Coiffure vor, indem er sich so knapp an ihre Stirne und Backen anpaßte, daß man nicht ein einziges von ihren Haaren sehen konnte.
Dem ungeachtet verlor sich das Entsetzen des Prinzen beim ersten Blick, den die schönen Augen seiner Nymphe auf ihn hefteten; er warf sich auf seine Knie und öffnete schon den Mund, um ihr, weiß der Himmel was für zärtlichen Unsinn vorzusagen, als sie ihm in die Rede fiel:
«Was wollen Sie, lieber Prinz», sagte sie; «die Zeit ist edel; warum kämmen Sie mich nicht?» - «Kämmen?» sprach er bei sich selbst; «und wie soll ich das anfangen?» Die Nymphe schien über sein Zaudern ungehalten zu werden; er nahm also seinen Kamm und wollte ihn geschwind aus dem Futteral herausziehen, erschrak aber nicht wenig, da er merkte, daß der Kamm nur allmählich und nicht anders als durch die äußerste Gewalt, die er anwenden mußte, herausging.
Aber so, wie er auch hervorkam, trat der Krokodilskopf zurück und deckte endlich die schönsten Haare auf, die man je gesehen hatte. Wie der Kamm bald heraus war, verschwand der Krokodilskopf gänzlich, und der Prinz erblickte nun seine geliebte Nymphe in ihrer ganzen Schönheit. Vor Freude und Liebe außer sich, bemühte er sich sehr eifrig, den Kamm vollends herauszuziehen, indem er leicht glauben konnte, daß eine Dame, die einen so scheußlichen Überkopf getragen hatte, des Kämmens wohl von Nöten habe; und so, wie die andere Hälfte des Kamms nach und nach aus dem Futteral heraus ging, kam auch der übrige Teil der Nymphe aus dem Bade hervor.
Lilien, Alabaster und neu gefallener Schnee hätten gegen das, was er jetzt sah, gelb ausgesehen; und doch war diese verblendende Weiße nichts in Vergleichung mit den Grazien, die alle diese Schönheiten belebten. Die Nymphe ragte nun mit den Schultern und bis an die Hälfte der Arme aus dem Wasser hervor, und man hätte sehen sollen, wie sehr der Prinz arbeitete, um seinen Kamm vollends heraus zu Druchsen.
Aber die Nymphe unterbrach ihn in der Arbeit, in dem sie ihm sagte, es wäre nun genug; er solle den Kamm lassen, wo er sei, und dafür eilends ihre Haut verbrennen. «Ich?» rief er, «ich, eine solche Haut verbrennen? Eher soll meine eigene mit meiner ganzen Person und mit der ganzen Natur zu Asche werden, ehe ich fähig wäre, einer so liebenswürdigen Haut nur mit einer Nadelritze wehe zu tun.»
«Ich zweifle nicht an Ihrer Liebe», versetzte die Nymphe; «aber jetzt ist die Rede bloß davon, mir zu gehorchen; kommt Ihnen ein anderer zuvor, so verlieren Sie mich auf ewig; denn es ist nun einmal geschrieben, daß ich nur demjenigen zuteil werden kann, der meine Haut verbrannt hat.»
Der Prinz konnte sich unmöglich zu einer so grausamen Tat entschließen, und während daß Mitleid, Liebe und Gehorsam in seinem Herzen stritten, sagte ihm die Nymphe Lebewohl, das Zelt schloß sich wieder über ihr zu, und alle Lichter verloschen. Jetzt, aber zu spät, kam den guten Prinzen eine gewaltige Reue an, daß er nicht wenigstens so viel Herz gefaßt und ihre schöne Haut an irgendeinem kleinen Fleckchen verbrannt habe, da sie es doch selbst verlangte und er so viel damit zu gewinnen oder zu verlieren hatte.
Er nahm sich fest vor, seinen Fehler bei der ersten Gelegenheit wieder gut zu machen, und damit ihm niemand zuvorkommen könnte, legte er sich neben den Eingang der Grotte nieder, um den Tag da selbst zu erwarten. Einen Augenblick drauf flimmerte ihm ein neuer Schein in die Augen; er glaubte, es käme aus der Grotte, die wieder erleuchtet worden wäre; aber es war ein Feuer, welches unter den vordersten Bäumen des Waldes, der sich gegen das Gestade hinzog, angezündet worden war.
In dem er ein paar Schritte weiter vorwärts ging, um zu sehen, was dort vorgehe, erblickte er die abscheuliche Fischhaut, die vor ihm auf der Erde lag. Voller Unwillen, diesen grauenhaften Gegenstand abermals vor Augen sehen zu müssen, ergriff er sie. «Verwünschte Haut», rief er, «du verdienst, anstatt derjenigen verbrannt zu werden, der du so wenig ähnlich bist!» - und so lief er aus allen seinen Kräften mit ihr dem Feuer zu.
Wie er hin kam, sah er eine Dame neben dem selben sitzen, die, sobald sie ihn mit einer so scheußlichen Last beladen auf sie zukommen sah, mit einem großen Schrei auffuhr und sich in den dunkelsten Teil des Waldes stürzte. Der Prinz warf die Haut ins Feuer, und kaum fing die Flamme sie zu ergreifen an, so war es nicht anders, als ob eine Mine mit hunderttausend Zentner Pulver in die Luft flöge.
Er bemächtigte sich eines Brandes und lief, was er konnte, nach der Grotte zurück; aber sein Brand war ihm unnütz; er fand alle Lichter wieder angezündet und die Kufe noch voll Wassers, die Nymphe hingegen und das Zelt waren verschwunden. Der arme Prinz geriet darüber beinahe in Verzweiflung, denn er nahm es für gewiß, daß irgendein anderer, weniger zärtlicher Liebhaber, nachdem er sie tüchtig gekämmt und gesengt, sie zur Belohnung für seine Mühe davon geführt haben werde.
Er stürzte wie wahnsinnig aus der Grotte, um ihnen nachzurennen, ohne zu wissen, wo hinaus, und durchlief den ganzen Wald, traf aber keinen Menschen an. Mit Anbruch des Tages befand er sich wieder an der Stelle, wo das Feuer gebrannt hatte; er wollte sehen, ob noch etwas von der scheußlichen Haut übrig wäre; er fand aber nichts als Asche. Allein, wie groß war sein Erstaunen und seine Freude, da er wenige Schritte davon das Halsband im Grase liegen sah!
Er zweifelte nun nicht, daß seine Schwester die Frau gewesen sei, die sich in den Wald geflüchtet hatte. Das Verlangen, sie wiederzufinden, verdrängte jetzt auf einen Augenblick alle anderen Gedanken aus seiner Seele; allem Anschein nach konnte sie nicht weit entfernt sein; und wirklich hatte er kaum angefangen, sie zu suchen, als sie ihm von selbst in die Hände lief, indem sie mit großem Eifer nach dem Halsband umher suchte, dessen Verlust sie erst bei wiederkommendem Tage gewahr worden war.
Man kann sich leicht vorstellen, wie lebhaft ihr Entzücken sein mußte, einander nach einer so wunderbaren Trennung so unverhofft wiederzufinden, und mit welcher Ungeduld sich jedes nach dem, was dem anderen zugestoßen war, erkundigte. Die Prinzessin berichtete ihrem Bruder alles, was wir bereits von dem Abenteuer mit dem weißen Fuchse wissen, ohne daß der Prinz sich gleich merken ließ, daß er von seiner Bekanntschaft sei, und fuhr sodann in ihrer Erzählung folgendermaßen fort:
«O mein liebster Bruder», sagte sie, «wenn du ihn gekannt hättest, es wäre dir so unmöglich gewesen als mir, nicht in ihn verliebt zu werden! Seine zärtliche Aufmerksamkeit für mich hatte etwas Übernatürliches; er schien meine Gedanken zu erraten, so geschickt wußte er allen meinen Wünschen zuvorzukommen. In der Tat hatte ich keinen anderen, als nie wieder von ihm getrennt zu werden; und meine erste Sorge war deswegen, mein Halsband vor ihm zu verstecken, weil es alle Tiere davon laufen machte.
Der kleine Palast, wo wir wohnten, war mit anmutigen Gärten versehen, worin mich der Fuchs spazieren führte, wenn er glaubte, daß ich Lust habe, der frischen Luft zu genießen. Wie wohl ihm die Sprache fehlte, so schien er doch alles, was ich ihm sagte, zu verstehen und wußte auch mir zu erkennen zu geben, daß er von meinem guten Willen zu ihm entzückt sei; in dessen schien er mich doch durch seine Blicke und Gebärden immer um etwas zu bitten, und ich hätte oft vor Schmerz vergehen mögen, daß ich mehr erraten konnte, was er wollte.
Endlich erfuhr ich es zu meinem Unglück. Ich hatte das Halsband in einem Busche am Ende des Gartens versteckt; der weiße Fuchs wurde es auf einem unserer Spaziergänge gewahr, und anstatt wie andre davor zu fliehen, ließ er mich stehen und fiel auf einen Sprung über das Halsband her; aber er hatte es kaum berührt, so schnappte es mit eben dem Getöse zu, wie es in den Händen der Königin getan hatte. Bei diesem Getöse machte der arme Fuchs einen Sprung zurück, und mit einem anderen setzte er über die Gartenmauer weg, so daß ich ihn seit dem nie wieder gesehen habe.
Ich steckte das verhaßte Halsband wieder zu mir, weil es mir in dieser Wildnis gegen die Raubtiere unentbehrlich war; und ich hatte es kaum in der Hand, so öffnete es sich wieder. Ich verließ den kleinen Palast, der mir ohne meinen Gesellschafter unerträglich war, und irre seit dieser Zeit mit unendlichem Ungemach in Wäldern, Felsen und Klüften herum; aber von allem, was ich ausgestanden, ist die Trennung von meinem getreuen und geliebten weißen Fuchs das einzige, was mir unerträglich ist.
Gestern überfiel mich die Nacht an dem Orte, wo ich das Feuer angezündet hatte, bei welchem du mich mit der abscheulichen Haut erschrecktest; und sobald ich mich von meinem Entsetzen über den fürchterlichen Knall, den ich im Fliehen hörte, wieder erholt hatte, kam ich zurück, um das Halsband zu suchen, das ich vor Schrecken vermutlich hatte fallen lassen.»
Nach Endigung dieser Erzählung bat die Prinzessin ihren Bruder, sie an diesen Ort hinzuführen; aber alles Suchens ungeachtet, fand sich das Halsband nicht wieder. Ihre Betrübnis über diesen Verlust war nicht so groß, als sie gewesen sein würde, wenn sie den Prinzen nicht wieder angetroffen hätte. Seine Gegenwart beruhigte sie über alle Gefahren, vor welchen die talismanische Tugend des Halsbandes sie beschützt hatte; und ihr Vertrauen auf seine Gefälligkeit und Freundschaft ging so weit, daß sie noch weit mehr von ihm erwartete.
«Lieber Bruder», sprach sie, indem sie ihm die Hände drückte und in Tränen ausbrach, «ich muß dir meine ganze Schwachheit gestehen! Ich kann nicht mehr ohne den weißen Fuchs leben; und wenn du nicht die Güte hast, ihn mir auf dem ganzen Erdboden suchen zu helfen, so wirst du mich vor Gram und Schmerzen sterben sehen.»
Dem guten Prinzen traten die Tränen in die Augen, in dem er sich die Verzweiflung seiner Schwester vorstellte, wenn sie das Schicksal ihres armen Lieblings erfahren würde; und da er es unmöglich über sein Herz bringen konnte, ihr diesen tödlichen Schlag zu geben, so verschwieg er ihr, was er wußte, und versprach ihr alles, was sie wollte, wofern sie ihm nur erlaubte, den Rest dieses Tages das Ufer des Meeres zu durchstreichen.
Es kostete der Prinzessin viel Überwindung, ihm hierin nachzugeben, so groß war ihre Ungeduld, dem weißen Fuchs nachzujagen. Sie teilten die Gegend, die sie durchsuchen wollten, unter sich; und die Grotte mit dem Bade war der Ort, wo sie, ihrer Abrede gemäß, wieder zusammen trafen, nachdem sie ein paar Stunden vergebens das ganze Gestade durchkrochen hatten. Die Prinzessin erstaunte nicht wenig über die wunderbaren Dinge, die sie in der Grotte sah.
Während sie sich mit Betrachtung der selben aufhielt, bestieg der Prinz den höchsten Gipfel des Felsens, wo er seine Augen, so weit sie reichen konnten, über Land und Meer hin schweifen ließ, ohne daß sich ihnen weder auf dem Lande noch dem Meere etwas von demjenigen zeigte, was er so ängstlich suchte.
Bei dem Nachdenken, worein er hier verfiel, kam ihm auch der Krokodilskopf und die Fischhaut wieder in den Sinn, und zum ersten Mal stieg der Gedanke in ihm auf, ob am Ende die Haut der Nymphe, die er hätte verbrennen sollen, diese nehmliche Fischhaut sei, die er in seinem Unwillen ins Feuer geworfen hatte. Je mehr er alle Umstände verglich, je wahrscheinlicher kam ihm diese Vermutung vor, und je weniger konnte er sich selbst verzeihen, daß sie ihm nicht eher eingefallen war.
«Ich hätte also», sagte er bei sich selbst, «die eine Hälfte dessen, was die Nymphe von mir verlangte, bereits bewerkstelligt, ohne zu wissen, was ich tat; aber warum entzieht sie mir die Gelegenheit, auch das übrige zu tun? Möchte sie doch hier sein», rief er aus, indem er seinen Kamm mit der größten Leichtigkeit aus dem Futteral zog, «ich wollte sie so gut kämmen, als sie in ihrem Leben nie gekämmt worden ist!»
Er hatte diese Worte kaum ausgesprochen, als ihn ein Geschrei, das aus dem Walde zu kommen schien, stutzig machte; er wandte sich um und erblickte eine Frau, die mit fliegenden Haaren und in größter Unordnung zwischen den Bäumen hin rannte, um vor einem Reiter, der hinter ihr her jagte, zu entfliehen. Der Entfernung ungeachtet wurde er gewahr, daß dieser Mann einen Bogen in der Hand hatte; und da er nicht zweifelte, daß es kein anderer als der Mörder des weißen Fuchses sei und daß die von ihm verfolgte Person eines schleunigen Beistandes bedürfe, rannte er dem Walde zu.
Er hatte sie zwar aus den Augen verloren, aber ihr Schreien diente ihm zum Wegweiser. Die Dame hatte im Laufen einen Fall getan. Der Reiter war abgestiegen, hatte sich ihrer bemächtigt und war eben im Begriff, sie auf sein Pferd zu setzen, als der Prinz anlangte. Die Schönheit dieser Person blendete ihn beim ersten Anblick; aber wie erstaunte er, da er sie für die Königin, seine Stiefmutter, erkannte!
Da er von der Veränderung ihrer Gesinnungen noch nichts wußte und sich nur ihrer Grausamkeiten gegen ihn und seine Schwester erinnerte, so hätte er es sich schier reuen lassen, so früh angekommen zu sein. Dem ungeachtet war er großmütig genug, sie von ihrem Räuber loszumachen, und eben wollte er mit dem Degen in der Faust die ihr zugefügte Beleidigung und den Tod des weißen Fuchses rächen, als ihm die Königin den Arm zurückhielt und ihm sagte, daß es der Erzherzog von Plazenz sei.
Der Prinz zweifelte keinen Augenblick daran, sobald er ihn genauer ins Auge gefaßt hatte; denn es konnte schwerlich noch ein andrer Erzherzog in der Welt sein, der den Schildhaltern des dänischen Wappens so ähnlich gesehen hätte. Er hatte einen zottigen Bart, seine Haare standen wie Borsten in die Höhe, seine Blicke waren wild und grimmig und seine Kleider in so schlimmen Umständen, daß ein Schurz von Eichenlaub ihm bessere Dienste getan haben würde.
Die Königin warf sich dem Prinzen zu Füßen, umfaßte seine Knie, bat ihm alles Unrecht ab, so sie ihm und seiner Schwester getan hatte, und beschwor ihn, dem König, ihrem Gemahl und seinem Vater, mit ihr zu Hilfe zu eilen, den dieser verwünschte Erzherzog so eben mit einem Pfeile verwundet habe.
Der Prinz geriet über diese Nachricht in solche Wut, daß er sich umwandte, um den Erzherzog, seines Wahnsinns ungeachtet, zu töten; aber glücklicherweise hatte sich dieser, während die Königin redete, wieder auf sein Pferd geschwungen und war ohne Zweifel auf irgendein neues Abenteuer ausgezogen.
In dessen die Königin und der Prinz mit großen Schritten dem Orte zueilten, wo der verwundete König lag, erzählte sie dem Prinzen, wie ihr Herz auf einmal gegen die ganze königliche Familie umgekehrt worden sei; wie der König, der sie nicht mehr sehen wollen, den Hof verlassen habe, um seine Kinder aufzusuchen; wie sie, voller Verzweiflung über die Abreise ihres Gemahls, ihm ohne Begleitung und Equipage nachgefolgt sei und, da sie ihn binnen drei Monaten nirgends finden können, sich endlich bei der Messerscheiden-Mutter Rats erholt habe.
Diese habe sie nach der Scheiden-Insel führen lassen, wo sie mit der schönsten Prinzessin in der Welt bekannt worden, aber auch mit der unglücklichsten, in dem sie durch Bezauberung gezwungen sei, einen Tag um den anderen die Gestalt eines Meerungeheuers anzunehmen.
Sobald dieser Tag komme, stelle sich ihr eine große Fischhaut dar, der sie unmöglich widerstehen könne; der Abscheu, den sie vor der selben habe, sei so entsetzlich, daß sie lieber tausendmal den Tod leiden wollte, und dennoch sei sie genötigt, sich in die selbe einzuwickeln und sich ins Meer zu stürzen.
Der Prinz, voller Freuden über das Licht, das ihm diese Erzählung gab, konnte sich nicht enthalten, die Königin bei dieser Stelle zu umarmen und sie zu versichern, daß diejenige, von welcher sie rede, von dieser abscheulichen Haut nicht wieder werde geängstigt werden; er warf sich nun der Königin ebenfalls zu Füßen und beschwor sie, ihn unverzüglich auf die Insel zu führen, wo diese anbetungswürdige Prinzessin sich aufhalte.
«Dies war eben die Sache, lieber Prinz, warum ich Sie aufsuchte», sagte die Königin; «aber wie wohl ich so glücklich gewesen bin, Sie zu treffen, so kann es uns doch nichts helfen, wenn wir nicht auch die Prinzessin, Ihre Schwester, finden; denn von euer beider Gegenwart hängt das kostbarste Leben in der Welt ab.» - «Wessen Leben?» rief der Prinz in großer Unruhe. «Des weißen Fuchses», versetzte die Königin, «den wir vielleicht nicht mehr lebendig antreffen, wenn wir noch lange verziehen.»
Die Königin konnte ihre Tränen bei diesem Gedanken nicht zurückhalten. «O Gott!» rief sie, «der arme Fuchs kam von Zeit zu Zeit, uns zu besuchen, und gewann uns durch seine Liebenswürdigkeit das Herz ab. Gestern gab er uns ein Zeichen, daß man ihm die Schaluppe von der Insel schicken sollte. Ich befand mich am Ufer, um ihn zu erwarten; die schöne Bezauberte war bei mir; aber sie konnte nicht bleiben, bis er ankam: sie ging beiseite, als ob sie allein ihren Gedanken nachhängen wollte; bald darauf hörte ich sie laut aufschreien und sah, wie sie sich in Gestalt des abscheulichsten Ungeheuers ins Meer stürzte.
Ich beklagte ihr Schicksal, aber ich bekam bald noch größere Ursache, mich zu betrüben, als die Schaluppe ankam und ich den armen weißen Fuchs in seinem Blute schwimmend und aufs äußerste gebracht erblickte. Ich nahm ihn eilends in meine Arme und trug ihn so sanft, als ich konnte, in den Scheiden-Palast, wo er so gut bedient wird, als ob er der einzige Sohn des größten Königs wäre.
Die Wundärzte erklärten seine Wunde für tödlich; aber die Gouvernantin der Insel, die seine große Freundin ist, tat der Fee der Orakel einen Fußfall und erhielt die Antwort von ihr: Wenn ich den Prinzen und die Prinzessin der Lombardei binnen vierundzwanzig Stunden nach der Insel bringen könnte, so würde der weiße Fuchs gerettet sein; ich hätte zu diesem Ende weiter nichts zu tun, als mich in die Schaluppe zu setzen, denn sie würde mich von selbst an dies Ufer überführen, wo ich Nachricht von ihnen erhalten würde.
Ich landete gestern beim Eintritt der Nacht an; ich durchlief den Wald, um Euch aufzusuchen, und wurde auf die angenehmste Art überrascht, da ich wider alles Hoffen den König antraf. Er wollte mir anfangs entfliehen; aber ich fiel ihm zu Füßen und überzeugte ihn mit solcher Wahrheit von meiner Reue und von der Veränderung meiner Sinnesart, daß er der Zärtlichkeit, die er immer zu mir getragen, nicht länger widerstehen konnte; indessen sagte er mir, er könne nicht bleiben, bis er seine Kinder gefunden habe.
Ich meldete ihm, daß ich ebenfalls im Begriff sei, Euch aufzusuchen, und erzählte ihm alles übrige, was Ihr schon gehört habt. Er berichtete mich hinwieder, daß der Erzherzog, sein Vetter, der seit etlichen Tagen Mittel gefunden, seinen Wächtern zu entwischen, in dieser Gegend herum irre und nach allem, was ihm in den Weg komme, mit Pfeilen schieße... Diesen nehmlichen Morgen machten wir selbst eine traurige Erfahrung hievon.
Wie wir anfangen wollten, den Wald zu durchsuchen, kam uns der Erzherzog unvermerkt auf die Spur und schoß den König mit einem Pfeil in die Schulter; er hatte schon einen anderen aufgelegt, um auch nach mir zu schießen, aber auf einmal hielt er sich zurück, und nachdem er mich einige Augenblicke betrachtet hatte, sprang er vom Pferde und kam auf mich zu, um sich meiner zu bemächtigen und mich auf sein Pferd zu setzen.
Die Angst gab mir so viel Stärke und Leichtigkeit, daß er mich bald aus den Augen verlor; allein, da er sehr wohl beritten war, holte er mich bald wieder ein, und ohne Ihre Hilfe, mein lieber Prinz, würde ich unfehlbar seine Beute geworden sein.» Diese Erzählung ging eben zu Ende, da sie an den Ort kamen, wo der König verwundet worden war; aber sie fanden ihn nicht mehr dort, und dies warf sie beide in neue Verlegenheit.
Aus Mitleid und Pflicht hätten sie ihn gerne aufgesucht, aber die Gefahr des armen weißen Fuchses war noch dringender. Sie empfahlen also den König, wo er auch sein möchte, seinem guten Engel und eilten, was sie konnten, der Grotte des Bades zu, um die Prinzessin abzuholen und mit ihr nach der Scheiden-Insel hinüberzufahren.
Wie sie in die Grotte hinein kamen, fanden sie die Prinzessin in trostlosem Schmerz auf dem Rande des Bades sitzen; sie hielt den Kopf des Königs, ihres Vaters, auf ihrem Schoß und überströmte ihn mit ihren Tränen, weil sie ihn für tot hielt; aber es war eine bloße Ohnmacht, die ihm der Eifer, womit er dem Räuber seiner Gemahlin nachsetzte, und ein starker Blutverlust zugezogen, da er kaum noch so viel Kräfte behalten hatte, die Grotte, wo er Hilfe zu finden hoffte, zu erreichen.
Glücklicherweise wurde er durch das gewöhnliche Mittel in solchen Fällen, nehmlich einen tüchtigen Kübel voll frischen Wassers, womit sie ihn begossen, bald wieder zu sich selbst gebracht. Die Damen stillten das Blut durch Bäusche von Gaze, die sie sich von ihren Kleidern rissen, darauf nahmen ihn seine Gemahlin und sein Sohn unter die Arme und brachten ihn in die Schaluppe, die so gefällig war, sich so nahe bei der Grotte als möglich ans Ufer anzulegen.
Während daß die Schaluppe mit ihnen davon ruderte, erfuhr die Prinzessin aus dem Munde der Königin das traurige Abenteuer ihres geliebten weißen Fuchses. Sie geriet darüber in solche Verzweiflung, daß sie sich ins Meer stürzen wollte und bloß durch die Versicherung zurück gehalten werden konnte, daß ihre Gegenwart das einzige Rettungsmittel seines Lebens sei.
Es ist nichts Süßeres für ein verliebtes Herz als der Gedanke, dem Geliebten das Leben wiedergeben zu können. Die Ungeduld der Prinzessin war jetzt so groß, daß ihr das Fahrzeug unbeweglich vorkam, wie wohl es so schnell als ein Pfeil ging; sie langten in wenig Minuten an und flogen dem Palast zu.
Der weiße Fuchs, auf ein kleines Bett neben einem guten Kaminfeuer ausgestreckt, war seinem Ende nahe; seine Augen waren geschlossen und sein ganzer Leib ohne Bewegung, aber auf den ersten Schrei der Prinzessin öffnete er die Augen, blickte sie, wie wohl sterbend, mit unbeschreiblicher Zärtlichkeit an und wedelte ein wenig, aber äußerst schwach, mit dem Schwanz.
Sie warf sich der Länge nach vor ihm auf den Boden hin, aber die Statthalterin der Insel zog sie beim Arm und sagte, in dem sie sie aufhob: «Wo denken Sie hin? Es kommt hier darauf an, den Fuchs ins Leben zurückzubringen, nicht ihn zu bejammern.» Der König der Lombardei war, seiner eigenen Schwachheit ungeachtet, mit der nehmlichen Torheit angesteckt worden, die alle Leute beim Anblick dieses liebenswürdigen Tiers ergriff, und während die Statthalterin sprach, hörte er nicht auf, zu jammern und dem Kranken an den Puls zu fühlen.
Sie befahl, daß man ihn in ein anderes Zimmer bringen sollte, und in dessen daß er von den Wundärzten verbunden wurde, sagte die Statthalterin zu der Prinzessin: «Nun, was zaudern Sie? Das Leben des weißen Fuchses ist in Ihren Händen. Sobald Sie ihm das Halsband angetan haben, wird er sich wieder so wohl befinden, als er in seinem Leben nie gewesen ist; aber ich muß Ihnen sagen, Sie haben, um ihn zu retten, nur noch wenig Augenblicke übrig.»
Dies fehlte der armen Prinzessin noch, um sie völlig zur Verzweiflung zu bringen: zu wissen, daß ein Leben, wofür sie tausendmal das ihrige gegeben hätte, von dem Halsband abhing, das sie - verloren hatte. Sobald es herauskam, erhob sich ein allgemeines Jammergeschrei. Alle Anwesenden schrien: «O weh! Das Halsband ist verloren!», und tausend Stimmen brachen auf einmal aus ebenso viel Messerscheiden, womit das Zimmer ausgeziert war, hervor, fielen in tausendfachen kläglichen Tönen in das Jammergeschrei ein und riefen: «O weh! Das Halsband ist verloren!»
Der König der Lombardei, der sich eben unter den Händen der Wundärzte befand, fragte sie, was der abscheuliche Lärm, der ihm zu Ohren drang, bedeute. Einer von ihnen lief hin, um sich zu erkundigen, und kam mit der Nachricht zurück, warum es zu tun sei. «Wahrlich, viel Lärms um ein Halsband!» sagte der König; «hier ist eines, das ich diesen Morgen im Walde gefunden habe; ich wünsche, daß es das rechte sein möge, denn hoffentlich wird es dann dem abscheulichen Geheul ein Ende machen, das mir unerträglich ist.»
Die Sonde mußte dem guten König vermutlich sehr weh getan haben, daß er das Halsband diesem nehmlichen Fuchse, der ihm noch kaum so lieb gewesen war, auf eine so verdrießliche Art zu Hilfe schickte. Wie der Wundarzt mit dem Halsband erschien, lag der arme Kranke schon in den letzten Zügen, und die Prinzessin, die sich das Leben nehmen wollte, hätte rasend werden mögen, so viele Scheiden zu sehen und nicht ein einziges Messer darin zu finden.
Sie riß dem Wundarzt das Halsband mit Ungestüm aus der Hand und legte es ihrem sterbenden Liebling um den Hals. Augenblicklich dehnte er sich aus, und anstatt des weißen Fuchses lag der schönste Jüngling, den man mit den Augen sehen konnte, vor ihr da, so frisch und gesund, als ob ihm nie das mindeste gefehlt hätte.
Diese Verwandlung schien die Prinzessin im ersten Augenblick vor Erstaunen und Freude in ein steinernes Bild verwandelt zu haben; aber den Augenblick darauf setzte sie die Erinnerung an alle die unschuldigen Liebkosungen, womit sie den weißen Fuchs ohne Bedenken und Zurückhaltung überhäuft hatte, in die äußerste Verlegenheit.
Beschämt und mit gesenkten Augen eilte sie aus dem Zimmer, eben da man dem schönen Pertharit Kleider brachte; denn daß er und der weiße Fuchs nur eine Person gewesen, hat der scharfsinnige Leser vermutlich schon lange gemerkt, wiewohl wir beflissen gewesen sind, ihm das Vergnügen, es selbst zu erraten, nicht durch die geringste Anleitung zu verkümmern.
Sobald der schöne Pertharit angekleidet war, eilte er, seine geliebte Prinzessin aufzusuchen. Ihre beiderseitige Entzückung, und alles, was sie einander sagten, und die Freude der Prinzessin, da sie hörte, wer er sei und mit welcher Inbrunst sie, vom ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an, von ihm angebetet worden: alle diese Dinge lassen sich besser einbilden als beschreiben. Sie wurden aber bald durch das Zudringen aller derjenigen unterbrochen, die an seinem Unglück teilgenommen hatten und ihm nun über die glückliche Verwandlung seines Schicksals ihre Freude bezeugten; und darauf gingen sie alle zusammen, dem Könige der Lombardei ihre Aufwartung zu machen.
Der Prinz war die einzige Person, die von dieser erfreulichen Begebenheit nichts wußte. Er hatte den Palast so gleich wieder verlassen, da er seine schöne Nymphe nicht darin erblickte; er hatte die ganze Insel vergebens durchstrichen und kam eben traurig und mutlos wieder zurück, als der schöne Pertharit aus dem Palast herausging, um ihn aufzusuchen.
Sie flogen einander mit offenen Armen entgegen, und es brauchte nur wenig Augenblicke, um dem Prinzen über alles, was er noch nicht wußte, Licht zu geben. Pertharit wandte sich hierauf an die Statthalterin, welche herbei gekommen war, und beschwor sie, mit den Leiden der schönen Ferrandine Mitleid zu haben. «Ach», rief der Prinz, «vergessen Sie einen Augenblick den Anteil, den Sie an Ferrandine nehmen, um auf Mittel zu denken, die schöne bezauberte Nymphe von den entsetzlichen Qualen, die sie leidet, zu befreien!»
«Sie sind größer, diese Qualen, als Sie sich einbilden», antwortete die Statthalterin; «in dessen kann ihr bald geholfen werden, wenn Sie noch im Besitz Ihres Kammes sind.» Der Prinz zog ihn sogleich aus der Tasche. «Wohlan», sagte die Statthalterin, «Sie müssen die Nymphe kämmen, deren Erlösung Ihnen so nahe am Herzen liegt.
Wollen Sie mir schwören, daß Sie es tun wollen?» - «Ob ich es schwören will?» rief der Prinz. «O gewiß schwöre ich es; man führe mich nur auf der Stelle zu ihr!» «Nur sachte», versetzte die Statthalterin; «und wenn nun diese Nymphe, nachdem sie durch Ihren Beistand in den Besitz aller ihrer Reizungen und ihrer vormaligen Ruhe wieder eingesetzt worden, wenn sie Ihnen dann selbst zumuten würde, die schöne Ferrandine, Pertharits Schwester, zu heiraten, würden Sie einwilligen?» -
«Nein», rief der Prinz mit der größten Lebhaftigkeit, «eher wollte ich den Tod leiden!» - «Aber wenn die Ruhe der Nymphe um keinen anderen Preis zu erhalten ist, was wollen Sie tun?» - «Eilen und sie befreien», sagte er; «wenn sie nur die Ruhe ihres Lebens durch mich erhält, mag ich sie doch mit dem meinigen bezahlen müssen!» - «So kommen Sie dann», antwortete die Statthalterin, «und kämmen sie, wenn Sie das Herz haben!»
Mit diesen Worten nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn, in Begleitung aller übrigen, vor die Pforte eines Saales, die sich so gleich auftat, wie er sich ihr näherte. Aber wie groß war sein Entsetzen, als er mitten in diesem Saale die unglückliche Nymphe in einem Lehnstuhl sitzen sah, der ganz in Feuer zu stehen schien.
Ihr Busen und ihre Arme waren halb entblößt, und an diesem allein erkannte er sie; denn ihre Haut war statt der Haare von lauter Flammen umgeben, ihr Gesicht ganz aufgedunsen und die Augen so weit heraus getrieben, als ob sie ihr aus dem Kopfe fallen wollten.
«Sehen Sie, Prinz», sagte die Statthalterin, «in was für einen Zustand Sie ihre angebetete Nymphe gesetzt haben, um sie von dem Krokodilskopf und von ihrer Haut zu befreien! Gehen Sie nun und kämmen Sie!» Er ließ es sich nicht zweimal sagen, wie wohl das Abenteuer keines von den leichtesten war.
Er zog seinen Kamm hervor und warf sich damit mitten in den Saal. Aber kaum war er mit der Hand, worin er den Kamm hielt, durch die Flammen, die wie dichtes aufgelöstes Haar um ihren Kopf und Nacken herwallten, hindurch gefahren, als sie plötzlich verschwanden und die Nymphe, frischer als Aurora und glänzender als die Sonne, aufstand und ihm ihre Hand darbot, die er auf seinen Knien küßte.
Der schöne Pertharit und die Nymphe fielen nun einander um den Hals und umarmten sich mit Zeichen der äußersten Zärtlichkeit. Der Prinz wurde in den ersten Bewegungen von Eifersucht, die dieser Anblick in seinem Busen erregte, durch die Namen von Bruder und Schwester unterbrochen, die ihn zu seiner unbeschreiblichen Freude belehrten, daß seine geliebte Nymphe die unvergleichliche Ferrandine sei, deren Hand er unwissend ausgeschlagen und die er nun bald zu besitzen hoffte.
Sein Glück kam ihm wie ein Traum vor, aus dem er alle Augenblicke zu erwachen fürchtete, und er konnte sich nicht aus seinem Erstaunen erholen, wenn er bedachte, daß diese himmlische Schönheit, die er unter so mancherlei Gestalten angebetet hatte, die weltberühmte Ferrandine und der schöne Pertharit der nehmliche weiße Fuchs sei, den seine Schwester so heftig geliebt hatte.
Diese vier Liebenden, die vollkommensten und glücklichsten, die vermutlich damals auf dem ganzen Erdenrunde zu finden waren, begaben sich nun miteinander in das Zimmer des Königs der Lombardei, wo sie die Königin antrafen, die durch die zärtlichste Aufmerksamkeit sich beeiferte, ihm die Aufrichtigkeit ihrer Zuneigung zu beweisen.
Da seine Wunde an der Schulter nicht viel zu bedeuten hatte, so brauchte es nur wenig Zeit, um ihn völlig wieder herzustellen. Inzwischen erzählte der schöne Pertharit, um ihm die Zeit zu vertreiben, wie es mit seiner und seiner Schwester Verwandlung zugegangen war.
«Sobald wir», sagte er, «in das unbewohnte Schloß im Walde hinein getreten waren, um den verlorenen Verstand des Erzherzogs, unseres Vaters, darin zu suchen, wurden wir sogleich von einer unendlichen Menge Gespenster und fürchterlicher Schreckbilder überfallen, die uns die ganze Nacht durch ängstigten. Mit Anbruch des Tages stand auf einmal eine Frau vor uns, die, ungeachtet ihres hohen Alters und ihrer mit lauter Messerscheiden garnierten Kleidung, ein ziemlich ehrwürdiges Ansehen hatte und in der einen Hand einen Kamm, in der anderen ein Halsband trug.
‹Hier, Pertharit›, sagte sie zu mir, ‹lege dieses Halsband an, und du, Ferrandine›, fuhr sie fort, sich an meine Schwester wendend, ‹kämme dich mit diesem Kamm, wenn ihr wollt, daß euer Vater seinen Verstand wieder bekommt; und um euch in den Unfällen, die euch zustoßen möchten, zu trösten, wisst, daß, so bald man dir, Pertharit, dies Halsband angelegt, und dich, Ferrandine, mit diesem Kamm gekämmt und deine Haut verbrannt haben wird, alle euere Leiden aufhören und euch alles zuteile werden wird, was euer Herz wünscht.›
Mit diesen Worten verschwand die alte Frau wieder und ließ uns, wie man sich vorstellen kann, in keiner geringen Verlegenheit über den geheimnisvollen Sinn ihrer Rede. In dessen, um je bälder, je lieber aus dem verwünschten Schlosse zu kommen und meinen Vater wieder herzustellen, eilte ich, mir das Halsband anzulegen. Aber kaum hatte ich es an, so sah ich mich in einen schneeweißen Fuchs verwandelt.
Meine Schwester tat einen entsetzlichen Schrei, wie sie das Unglück sah, das mir begegnet war. Da mich meine Vernunft bei dieser kläglichen Verwandlung nicht verlassen hatte, so fühlte ich es in seinem ganzen Umfang; und um meine arme Schwester vor dem Fallstrick, den uns die Scheiden-Mutter gelegt hatte, zu warnen, suchte ich ihr, in Ermanglung der Sprache, durch Zeichen zu erkennen zu geben, daß sie sich ja nicht kämmen möchte.
Aber meine Gebärden betrogen sie; sie nahm sie gerade im gegenteiligen Sinne, und in Hoffnung, daß der Kamm vielleicht die Wirkung des Halsbandes wieder aufheben würde, fing sie an, sich damit zu kämmen. Aber kaum berührte der Kamm ihre Haare, so sah ich sie, auf eben die Art, wie ihr sie alle gesehen habt, in lauter Flammen verwandelt.
In voller Angst warf sie den Kamm von sich, lief zum Schlosse hinaus und dem Walde zu und hörte nicht auf zu laufen, bis sie das Ufer, dieser Insel gegenüber, erreicht hatte. Ich folgte ihr, nachdem ich mein Halsband ebenfalls abgeworfen, auf dem Fuße nach und sah, daß sie, sobald sie in der Badegrotte bei der Kufe voll Wassers angelangt war, sich auskleidete, um hinein zu springen.
Aber unglücklicherweise fiel ihr die abscheuliche Fischhaut in die Augen, und wie wohl sie sich mit ängstlichem Geschrei von ihr zu entfernen suchte, so fühlte sie sich doch durch eine unsichtbare Gewalt genötigt, sich in diese Haut einzuwickeln und ins Meer zu stürzen. Von dieser Zeit an kam ich alle Tage zu der Grotte zurück, um ihr Unglück zu beweinen und sie, wo möglich, wiederzusehen.
Als ich nun eines Tages auf die Spitze des Felsens hinauf geklettert war und nach dem Schlosse dieser Insel hin winselte, in der Meinung, daß Ferrandine sich dahin geflüchtet haben könnte, sah ich eine Schaluppe zu mir herüber kommen. Ich sprang hinein, und sie setzte mich an der Insel ab, wo ich, zu meinem unbeschreiblichen Trost, meine Schwester an einem ihrer guten Tage fand.
Sie erzählte mir, wie gütig sie von der Statthalterin aufgenommen worden und wie freundlich ihr in diesem Schlosse begegnet werde; aber sie preßte mir Tränen aus, indem sie mir sagte, daß sie, einen Tag um den anderen, sowie die Fischhaut sich ihren Augen darstelle, genötigt sei, sich da rein zu wickeln, ins Meer zu springen und nach der Badegrotte hinüberzuschwimmen, wo die Haut sie wieder verlasse, während sie sich in dieser prächtigen Kufe bade.
Die Statthalterin, die an unserem Unglück vielen Anteil zu nehmen schien, erlaubte mir, Ferrandinen von Zeit zu Zeit zu besuchen, und wir redeten die Zeichen miteinander ab, die ich ihnen von der Spitze des Felsens geben wollte. Ich kehrte in den Wald zurück, um die Ursache unseres Unfalls, den Kamm und das Halsband, zu suchen, die nun das einzige Mittel, uns wieder herauszuhelfen, sein sollten.
Und das Glück, oder vielmehr die Zaubereien der Scheiden-Mutter, führten mich in den kleinen Palast, den ich seit dem immer bewohnt habe und wo mir mit der schönen Prinzessin der Lombardei alles das begegnet ist, was sie euch schon selbst berichtet hat.»
Sobald der schöne Pertharit mit seiner Erzählung fertig war, nahm die Statthalterin das Wort. «Billig ist es nun an mir», sagte sie, «den erleuchten Personen, die in diese wundervolle Geschichte verflochten sind, einiges Licht darüber zu geben, wer diese sogenannte Scheiden-Mutter ist, die in diesem allem die Hauptrolle gespielt hat, und was sie dazu gebracht, dem Erzherzog und seiner liebenswürdigen Familie so übel mitzuspielen, und was alle die Messerscheiden bedeuten, die überall das Symbol ihrer Gegenwart und ihres Einflusses sind.»
Da die sämtlichen Anwesenden sich sehr neugierig bezeugten, die Geschichte einer so merkwürdigen Person zu hören, erledigte sich die Statthalterin ihres Versprechens folgendermaßen:
«Philoklea - denn dies ist der wahre Name derjenigen, die seit ungefehr einem Jahrhundert unter dem seltsamen Namen der Messerscheiden-Mutter bekannt ist - war die Tochter eines Königs von Armorika. Sie brachte die Anlage zu einer Schönheit mit auf die Welt, die in der Folge so vollkommen wurde, daß sie Wunder tat.
Glücklicherweise hatte das Gestirn, das sie mit diesem beneideten Vorzug begabte, sie zu gleicher Zeit mit einem Geist ausgerüstet, dessen Vollkommenheiten den Glanz ihrer Schönheit beinahe verdunkelten und wenigstens verhinderten, daß sie nicht selbst davon verblendet wurde. Die Anbeter ihrer Reizungen konnten sich nur insofern Hoffnung machen, ihrem Herzen beizukommen, als sie fähig waren, durch Geist und Wissenschaft ihre Achtung zu erlangen.
Da es lange währte, bis sich Liebhaber einstellten, die ihrer Aufmerksamkeit würdig schienen, so war die Einsamkeit und das Studieren ihr einziges Vergnügen. Der König, ihr Vater, der prächtigste und zugleich der unwissendste Fürst seiner Zeit - ungeachtet er in seinem Leben in keinem Buche las -, hatte doch, um sich auch in dieser Art von Aufwand hervor zu tun, mit großen Kosten eine Sammlung der seltensten und kuriosesten Bücher, die in der ganzen Welt aufzutreiben waren, zusammengebracht.
Diese Bibliothek war Philokleens gewöhnlichsten Aufenthalt, und hier schöpfte sie die Anfangsgründe der wunderbaren Kenntnisse, durch welche sie in der Folge so berühmt wurde. Eine unermüdete Anstrengung schloß ihr in kurzem die Bedeutung der unbekanntesten Schriftzeichen und den Sinn der dunkelsten Bücher auf, womit diese Sammlung angefüllt war.
Bei allem dem blieb ihr doch das kostbarste dieser Bücher lange Zeit unverständlich. Es enthielt eine unendliche Menge ausgemalter Abbildungen von Pflanzen, Blumen und Tieren, die bald untereinander gemischt, bald in einer gewissen Ordnung zusammen gestellt und öfters durch die Zeichen der Planeten und Sternbilder unterbrochen waren.
Wie rätselhaft und geheimnisvoll auch diese hieroglyphische Sprache war, so wußte sie doch durch unablässiges Forschen und Vergleichen, sich auch von dieser endlich Meister zu machen, und fand sich für alle Mühe, die es sie gekostet hatte, reichlich durch die großen Geheimnisse belohnt, die ihr dieses Buch offenbarte.
Ihr Vater, der ihre allzu große Liebe zum Studieren für ihren einzigen Fehler ansah, drohte ihr öfters, daß er die ganze Bibliothek in Brand stecken lassen wollte. Einsmals kam er, um sie mitten aus ihren Büchern heraus und auf die Jagd mitzuschleppen. Sie stieg zu Pferde, und in einem schimmernden Jagdkleid, mitten unter einem glänzenden Gefolge von beiderlei Geschlechte, löschte sie alle übrigen Damen aus und bezauberte alle Männerherzen, ohne die mindeste Kenntnis davon zu nehmen.
Die Jagd war kaum angegangen, als Philokleens Pferd, von dem Geschrei der Jäger und Hunde erschreckt, mit ihr durchzugehen anfing. Ein großer Fluß setzte sich endlich seinem Lauf entgegen; aber es stürzte sich hinein, schwamm hindurch und hielt nicht eher still als mitten in einem großen Walde.
Philoklea stieg ab, band ihr Pferd an einen Baum und lustwandelte einige Zeit unter den Bäumen hin und her, sehr vergnügt, durch diesen Zufall von einem ihr unangenehmen Gedränge von Menschen entfernt worden zu sein. Endlich setzte sie sich auf eine Art von Moosbank am Fuße einer alten Eiche nieder und überließ sich ihren Gedanken, die sie so weit führten, daß sich der Tag schon zu neigen anfing, als sie durch einen ziemlich lauten Schrei aus ihrer Träumerei erweckt wurde.
Sie schaute auf und sah einen großen Uhu, der von Ast zu Ast herunterfiel und sich endlich durch eine unendliche Menge von Lappen und Fetzen, die an seinen Füßen herab hingen, in einem der untersten Äste verwickelte. Da sie keine Person war, die sich vor einem Uhu fürchtete, so machte sie sich ein Vergnügen daraus, ihn loszuwickeln und in Freiheit zu setzen; allein, anstatt davon zu fliegen, setzte er sich ein paar Schritte weit von Philokleen auf die Erde und fing an, ihr mit großer Aufmerksamkeit in die Augen zu sehen, denn die zunehmende Dunkelheit hatte ihm den Gebrauch seiner eigenen wiedergegeben.
Die Prinzessin erwartete, daß er anfangen würde zu sprechen, da sie so lange von ihm begafft worden war; aber er tat bloß einen kleinen Schrei, schlug mit den Flügeln, flog davon, setzte sich wieder auf eine andere Eiche und ließ abermals einen kleinen Schrei hören.
Philoklea, die etwas Geheimnisvolles in dem Betragen dieser Eule zu finden glaubte, näherte sich ihr: aber die Eule verschwand, und aus dem Ort, wo sie gesessen hatte, schoß ein Lichtstrahl hervor; aber ehe die Prinzessin Zeit hatte zu untersuchen, was es sein könnte, zeigten sich eine große Menge Fackeln in dem Walde, und sie wurde von den Personen, welche sie zu suchen ausgeschickt worden waren, nach dem Hofe ihres Vaters zurückgebracht.
Seit diesem Tage wurde Philokleen die Bibliothek verboten; alles, was sie erhalten konnte, war, daß man ihr das Buch der Hieroglyphen ließ, weil ihr Vater es für ein bloßes Bilderbuch ansah, mit dessen Durchblättern sie sich die Zeit vertreiben wolle.
Sie nahm es gemeiniglich mit sich, wenn sie in dem Walde, wo sie den Uhu angetroffen hatte, einsam spazieren ging. Einsmals kam ihr die Lust an, zu sehen, was aus ihm geworden sei; sie ging ziemlich tief in den Wald hinein und guckte mit großer Emsigkeit an allen Bäumen hinauf, in Hoffnung, ihn endlich gewahr zu werden oder wenigstens den Baum zu entdecken, aus dem sie den Lichtstrahl hatte hervor brechen sehen; aber vergebens.
Sie wurde endlich vom Suchen so müde, daß sie sich ins Gras hinlegte und in einen tiefen Schlaf versank, aus welchem sie plötzlich auf eine sehr unangenehme Art erweckt wurde, indem sie sich von einer Art von Waldmenschen angepackt fühlte, der am ganzen Leibe mit Haaren bewachsen war und (die Hörner und Bocksfüße ausgenommen) genauso aussah, wie man die Satyrn abzubilden pflegt.
Ihr Geschrei und ihr Bestreben, sich aus den gewaltsamen Armen dieses Unholdes loszuwinden, würde, da er eine unmenschliche Stärke hatte, vergebens gewesen sein, wenn nicht auf einmal der Uhu, mit etwas Glänzendem in seinen Klauen, auf das Ungeheuer herab geschossen wäre und es tot zu ihren Füßen hingestreckt hätte.
Sie glaubte, daß ihn ein Donnerkeil erschlagen hätte; aber da sie ihn genauer betrachtete, erblickte sie das Heft eines Messers, dessen Klinge in seinem Herzen stak. Kaum hatte sie es heraus gezogen, als alle Stellen der Klinge, die nicht mit Blute befleckt waren, ihre Augen durch einen Glanz verblendeten, der im Dunkeln immer heller wurde.
Sie ging zu einer Quelle hin, die nicht weit davon aus einem Felsen sprang, um das Blut von der Klinge weg zu waschen; aber ihre Mühe war vergeblich, das Wasser machte die Farbe des Blutes nur desto lebhafter. Ihr Erstaunen über dieses Wunder machte bald einem noch größern Platz.
Sie kam auf den Einfall, die Klinge an dem Felsen zu reiben, um zu versuchen, ob sich die Flecken nicht wegschleifen ließen; aber kaum hatte die Spitze der Klinge den Felsen berührt, so war es, als ob das Messer lebendig werde, und indem sie seiner Bewegung nachgab, ohne es aus der Hand zu lassen, fing es an, gewöhnliche Buchstaben zu schreiben, aber in einer Sprache, wozu der Schlüssel nirgends als in dem mehr erwähnten Buche zu finden war.
Der Uhu, der sich eben so wenig von Philokleen als von dem Messer zu trennen Lust hatte, saß nicht weit davon auf dem Felsen und schien auf das, was vorging, sehr aufmerksam zu sein. Als das Messer zu schreiben aufhörte, las die Prinzessin folgende Worte:
Schöne Prinzessin mit dem goldnen Messer,
rupfe den Uhu damit, so wird ihm besser!
Philoklea, die von der Wichtigkeit dieses Messers hohe Begriffe zu fassen anfing, hielt sich verbunden, alles, was es schreiben würde, mit dem Gehorsam, den man einem Orakel schuldig ist, zu vollziehen. Sie ergriff also den Uhu, der sich willig seinem Schicksal unterwarf, und fing an, ihn zu berupfen, nicht ohne innerliche Vorwürfe, daß sie ihm für den wichtigen Dienst, den er ihr geleistet, so übel mitspielen sollte.
Aber, siehe da! ehe sie noch mit der Arbeit fertig war, wurde der häßlichste aller Uhus unter ihren Fingern zum schönsten aller Menschen! Vor Bestürzung ließ sie das Messer aus der Hand fallen; aber der schöne Jüngling hob es sogleich wieder auf, und in dem er es der Prinzessin auf seinen Knien dar reichte, sagte er ihr so witzige und verbindlichste Sachen, daß sie sich nicht enthalten konnte, ihm mit einer Gefälligkeit zuzuhören, womit noch keine Mannsperson von ihr begünstigt worden war.
Vermutlich», fuhr die Statthalterin fort, in dem sie sich an den König und die übrigen Anwesenden wandte, «werdet ihr nicht viel weniger neugierig sein, als es Philoklea damals war, zu erfahren, was es mit dem gewesenen Uhu für eine Bewandtnis hatte; ich will also die Erzählung, die er ihr davon machte, ins Kurze zusammen ziehen, wie wohl wir unsere Hauptperson eine kleine Weile darüber aus den Augen verlieren werden.
Es lebte einst in Armorika ein berühmter Druide, der sich Kaspar der Alleswisser nannte, denn er hatte in einer von ihm selbst erfundenen Sprache ein Buch verfaßt, worin alle Wissenschaft der Weisen vor und nach Adam enthalten war. Dieses Buch war nach seinem Tode in die Bibliothek des Königs gekommen und war das nehmliche, woraus Philoklea ihre größten Geheimnisse gelernt hatte.
Dieser Kaspar der Alleswisser hatte einen Sohn, der so schön war, daß er in sich selbst verliebt wurde und kein größeres Vergnügen in der Welt kannte, als den ganzen langen Tag vor einem Bach oder Brunnen zu stehen und sein eigenes Bild darin anzuschauen. Dies war die Ursache, warum ihn sein Vater Narzissus nannte; in dessen machte ihm diese Narrheit seines Sohnes so viel Unlust, daß er ihn eines Tages in sein Laboratorium kommen ließ und, nachdem er ihm wegen seiner abgeschmackten Selbstgefälligkeit einen derben Verweis gegeben, hinzusetzte:
‹Mein Sohn, ich sehe wohl, daß du nimmermehr zu nichts gut sein wirst, solang ich dich bei mir behalte; ich will dir also einen Auftrag geben, wodurch du Gelegenheit bekommen wirst, die Welt zu sehen, aber unter der Bedingung, daß du dich nie wieder in einem Bache beschaust; denn das sage ich dir, das erste Mal, da du diesem Verbot ungehorsam bist, wirst du so häßlich werden, daß du vor deiner eigenen Gestalt erschrecken wirst; und wofern du jemals in diesen Fall kommst, so wird niemand als eine Dame, die mein Buch lesen und verstehen kann, dir diese Schönheit wiedergeben können, die dir den Kopf verrückt hat und die du als dann verachten wirst.
Noch mehr: mit deiner ersten Gestalt wird dir als dann auch alle meine Wissenschaft mitgeteilt werden, ebenso wie derjenigen, in deren Hände mein Buch geraten wird, sofern sie den Schlüssel zu einer von mir erfundenen und mir allein bekannten Sprache zu finden weiß. Merke wohl auf das, was ich dir sagen will! Es ist irgendwo in der Welt ein Wald, und in diesem Wald ein Baum, der nicht leicht zu finden ist, und in diesem Baum eine goldene Messerscheide, aber von einem Golde, das nicht zerschmelzt, wie jedes andere Gold tun wird, wenn es von dem Messer berührt wird, das ich dir geben will.
Diese Scheide ist es, mein Sohn, die du suchen und, wenn du sie gefunden hast, mir überbringen sollst.› Mit diesen Worten gab er ihm das Messer, umarmte ihn und schickte ihn fort.
Narzissus durchsuchte alle Wälder, die er auf seiner Wanderschaft vor sich fand, mit einer solchen Emsigkeit, daß er in drei Jahren nicht mehr als zwanzig Meilen zurück legte. Endlich kam er an den Hof des Königs, dessen Tochter Philoklea ist; da es ihm aber bloß darum zu tun war, die Scheide zu suchen, und er diese an keinem Hofe, sondern in einem Walde finden sollte, so eilte er sogleich wieder fort, ohne sich gezeigt zu haben, und geriet in ein sehr anmutiges Gehölz, das größtenteils von einem Flusse umgeben war, dessen Wasser den Kristall an Klarheit übertraf.
Um tiefer in den Wald hinein zu kommen, mußte er über den Fluß; und in dem er hinüber ging, wandelte ihn die Neugier an, zu sehen, ob die Beschwerden der Reise seiner Schönheit keinen Abbruch getan hätten. Er vergaß der väterlichen Warnung und bückte sich über das Wasser herab; aber wie groß war sein Entsetzen, da ihm, statt der Züge des schönen Narzissus, ein großer Uhu entgegensah!
Der Schrei, den er vor Schrecken tat, verdoppelte seine Bestürzung, denn es war der Schrei einer Eule, und ehe er den zweiten tun konnte, sah er sich von Kopf bis Fuß in eine Horneule von der ersten Größe verwandelt. Er behielt zwar noch seine Vernunft; aber er hatte so wenig, daß es nicht der Mühe wert war, sie ihm zu nehmen.
Voller Verzweiflung eilte er nun den dunkelsten Gegenden des Waldes zu, wo er sein trauriges Leben damit zubrachte, sich den Tag über in einem hohlen Baum zu verbergen und des Nachts Waldratten oder Fledermäuse zu seiner Nahrung zu fangen und die Scheide des Messers zu suchen, welches er sorgfältig aufbewahrt hatte.
Er suchte so lange, bis der Glanz, den diese wundervolle Scheide im Dunkeln von sich warf, ihn den Baum, worin sie steckte, finden ließ; aber wie viele Mühe er sich auch deswegen gab, so konnte er es doch nie dahin bringen, weder die Scheide herauszuziehen noch sein Messer hineinzustecken.
Alles, was er tun konnte, war, das Messer auf eben diesem Baume nahe bei der Scheide zu verbergen und sich immer in der Nähe des selben aufzuhalten. Endlich fügte es ein glücklicher Zufall, daß die Prinzessin Philoklea sich in diese Gegend des Waldes verirrte und von der Nacht überfallen wurde. Der Uhu verliebte sich sterblich in sie, sobald es dunkel genug war, daß er sie sehen konnte; aber sein Zustand würde durch seine Liebe, wovon er sich so wenig zu versprechen hatte, eher verschlimmert als gebessert worden sein, wenn ihm nicht eine geheime Stimme innerlich zugeflüstert hätte, daß dies vielleicht die Dame sei, die ihm seine vorige Gestalt wiedergeben könne.
Bald darauf war er glücklich genug, sie vermittelst seines Messers aus den zottigen Armen des wilden Mannes zu retten, der sie, wie ich bereits gemeldet, im Schlaf überfallen hatte; und da er, durch eine Folge dieses Abenteuers, mit seiner ursprünglichen Schönheit auch noch allen Verstand und alle Wissenschaften seines Vaters, Kaspar des Alleswissers, erhielt: so war die Gegenliebe der schönen Philoklea das einzige, was er noch zu wünschen hatte, um der glücklichste aller Menschen zu sein.
Und wie hätte die Prinzessin ihm diese versagen können, da er nun, nachdem der Geist seines Vaters in ihn übergegangen war, unter allen Sterblichen der einzige war, den sie ihrer Liebe würdig halten konnte? Um es kurz zu machen, sie überließen sich der Sympathie, welche natürlicherweise zwischen zwei Personen vorwalten mußte, die vergebens eine dritte ihresgleichen in der Welt gesucht hätten: sie liebten sich und teilten einander alle ihre Wissenschaften und Geheimnisse mit.
Er beschenkte sie mit der Gabe, sich unsichtbar zu machen und niemals alt zu werden; und sie mußte ihm schwören, das wundervolle Messer niemals zu veräußern, an dessen Besitz ihre gemeinschaftliche Glückseligkeit gebunden war, und niemanden weder ihr Abenteuer noch ihre Verbindung mit ihm zu entdecken.
Vermittelst des Geheimnisses, sich unsichtbar zu machen, welches der glückliche Narziß besaß, führten sie viele Jahre das beneidenswürdigste Leben, ohne daß man etwas davon gewahr wurde. In dessen fehlte ihnen gleichwohl noch die goldene Scheide, die sie mit aller ihrer Wissenschaft nicht aus dem Baume herauszuziehen vermochten. Dieses Abenteuer war einem anderen aufbehalten, aber unglücklicherweise blieb der Besitz des Messers immer unsicher, solange man nicht zugleich im Besitz der Scheide war.
Die schöne Philoklea hielt sich, diese Zeit über, noch immer am Hofe ihres Vaters auf, wo die Mühe, alle die Anträge und Bewerbungen, die ihre Schönheit ihr zuzog, von sich abzuhalten, das einzige war, was ihre geheime Glückseligkeit verbitterte, wie wohl im Grunde sie nur desto reizender machte. Sie allein erhielt sich immer im Glanz einer unverwelklichen Jugend, während alles um sie her unvermerkt alterte; aber eben dieses Umstandes wegen wurde sie endlich eines Aufenthaltes überdrüssig, wo sie selbst, ihrer ewigen Jugend ungeachtet, zuletzt etwas Altes zu werden anfing.
Sie verließ also ihr Vaterland, um in Begleitung ihres unsichtbaren Liebhabers in fremden Ländern neue Entdeckungen zu machen. Sie besuchte Ägypten, Afrika, Persien und Indien und brachte verschiedene Jahrhunderte mit diesen Reisen zu, die an einer Menge merkwürdiger Zufälle und Abenteuer fruchtbar waren.
Als sie endlich nach Europa zurück kam, fand sie es überall von dem Ruhm des weisen Merlins erfüllt. Die Neugier, durch sich selbst zu erkunden, ob die Wunder, die man von seiner Wissenschaft erzählte, eines so großen Ruhmes würdig seien, bewogen sie, nach Britannien überzugehen und, unter einer unkenntlichen Gestalt, am Hofe des Königs Artus zu erscheinen, wo Merlin sich aufzuhalten pflegte.
Wie gut sie sich auch verborgen zu haben glaubte, so konnte sie doch nicht verhindern, daß der schlaue Zauberer Verdacht bekam. Er bot allen seinen Künsten auf, sich bei ihr einzuschmeicheln; aber sie war zu scharfsichtig, um nicht bald zu merken, daß seine Freundschaft die Maske geheimer Absichten war und daß er auf nichts Geringeres ausging, als sie des Messers zu berauben, von dessen Scheide er sich durch ein Geheimnis, das ihm allein bekannt war, zum Besitzer gemacht hatte.
Sie erhielt die Bestätigung dieser Vermutung von dem Messer selbst, von welchem sie, sobald sie es mit der Spitze auf einen dichten Körper setzte, über alles, was sie zu wissen verlangte oder nötig hatte, ein immer zuverläßliges Orakel erhielt. Da sie sich mit aller ihrer Wissenschaft vor den Kunstgriffen eines so geschmeidigen und viel gestaltigen Menschen nicht sicher hielt, so verließ sie Britannien wieder und zog sich an den Fuß des Apenninischen Gebürges zurück, wo sie, um desto weniger entdeckt werden zu können, die Gestalt annahm, unter welcher sie euch bekannt ist.
Aber alle ihre Vorsicht war vergebens. Eines Tages, da ihr der Zauberer Merlin, und was sie von ihm zu befürchten hatte, ganz wieder aus dem Sinne gekommen war, sah sie, auf einem ihrer Spaziergänge, einen glänzenden Wagen von dem Gipfel des Berges herab steigen. Aus diesem Wagen stieg ein Zauberer von so ehrwürdigem Ansehen, daß es unmöglich gewesen wäre, ihm etwas Arges zuzutrauen.
‹Schon lange›, sagte er, indem er ihr die Scheide ihres Messers darbot, ‹suche ich die ehrwürdige Besitzerin des Messers, für welches diese wundervolle Scheide gemacht ist, um ihr einen Schatz einzuhändigen, der ihr angehört und mir unnütz ist, wie wohl ich der einzige Sterbliche bin, der das Messer in die Scheide stecken kann.›
Die Freude der Prinzessin beim Anblick eines Kleinods, dessen so lange schon gewünschter Besitz das einzige war, was ihre Glückseligkeit unzerstörbar machen konnte, war so groß, daß sie auf einen Augenblick ihre Klugheit überwog. Sie reichte dem Unbekannten ihr Messer hin, um es in die goldne Scheide zu stecken; aber er hatte es kaum in der Hand, als er damit aus ihren Augen verschwand.
Ihre Verzweiflung über diesen Verlust und über die Art, wie sie sich um das Kostbarste, was sie besaß, hatte bringen lassen, ist mit keinen Worten auszudrücken; aber sie fühlte erst die ganze Größe ihres Verlustes, da sie bei ihrer Zurückkunft ihren geliebten Narzissus nicht mehr fand. Vergebens suchte sie ihn viele Jahre lang auf dem ganzen Erdboden. Endlich kehrte sie wieder an den Ort zurück, wo sie alles, was ihr das Liebste war, verloren hatte.
Das Verlangen, das nun ihre einzige Leidenschaft ist, ihr verlorenes Messer, wenn auch Jahrhunderte darüber hingehen sollten, wieder zu bekommen, brachte sie auf den seltsamen Einfall, überall, wo sie sich sehen läßt, eine Art von Buden zu errichten, die mit Scheiden angefüllt sind, und von allen, die etwas bei ihr zu suchen haben, das Geschenk eines Messers zu verlangen: in Hoffnung, daß unter so vielen Messern endlich einmal das rechte in eine von diesen Scheiden werde gesteckt werden.
Das Schlimmste war in dessen, daß der Verlust des Messers, ohne welches sie keine Hoffnung hat, mit ihrem geliebten Narzissus wieder vereinigt zu werden, ihre sonst äußerst sanfte und wohltätige Sinnesart so vergällte, daß sie, um die Menschen in den Fall zu setzen, ihrer Hilfe recht oft von Nöten zu haben, sich ein ordentliches Geschäft daraus machte, unerhörte und abenteuerliche Zufälle und Schicksale zu erfinden, in welche sie die Leute verwickelte.
Vornehmlich war sie ebenso sinnreich als unbarmherzig, diejenigen zu quälen, die eine gegenseitige Sympathie dazu bestimmt hat, nur durch ihre gegenseitige Liebe glücklich sein zu können. Sie schien in den Qualen, so sie diesen Unglücklichen zubereitete, eine Erleichterung ihrer eigenen zu finden; und wie wohl sie zu gutherzig war, sie am Ende nicht dafür zu belohnen: so können doch Pertharit und Ferrandine mit ihren Geliebten bezeugen, daß sie ihnen das Glück, womit ihre Liebe endlich gekrönt wird, teuer genug verkauft hat.»
Hier endigte die Statthalterin ihre Erzählung, mit der Versicherung, daß sie die Scheiden-Mutter von nun an um so gewisser als ihre Freundin betrachten könnten, da sie große Hoffnung habe, in kurzem wieder zu ihrem Messer und seiner Scheide, und mit beiden zum Besitz ihres Geliebten und ihrer vormaligen Zufriedenheit, zu gelangen.
Dieser Versicherung zufolge endigten sich nun die Abenteuer des ganzen königlichen Hauses so glücklich, daß sie versucht waren, sowohl ihre vormaligen Leiden als ihr jetziges Glück für ein Märchen zu halten. Der König wurde geheilt; der Erzherzog fand seinen Verstand wieder, und mehr als er jemals gehabt hatte; der schöne Pertharit und seine Prinzessin erhielten die bezauberte Insel, die Badegrotte und das ganze Land umher zum Hochzeitsgeschenke; und die schöne Ferrandine machte den Prinzen der Lombardei zum glücklichsten aller Longobarden seiner Zeit.
Christoph Martin Wieland Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen
DAS MÄRCHEN VON DER SILBERNEN KUGEL ...
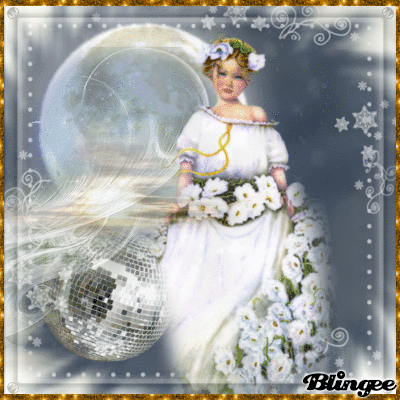
Silberner Mondschein lag auf der Waldwiese hinter dem Hegehause. Schwül und berauschend dufteten Heckenrosen und Nachtviolen, und tausend und abertausend Diamanten gleich, funkelten die Tautropfen aus den schwankenden Gräsern. Es war eine Nacht, wie geschaffen für Elfenspuk und Märchenzauber.
In dem niedrigen Zimmer der Waldhütte stand ein zwölf jähriger Knabe vor einer krank aussehenden Frau und sagte liebevoll:
"Eben schlägt es zwölf Uhr, Mutterle, und der Mond scheint so hell, wie seit langer Zeit nicht mehr. Jetzt ist die rechte Zeit gekommen, um all die guten Heilkräuter zu sammeln, die du zu deiner
Genesung brauchst. Haben keine Angst um mich. Ich fürchte mich nicht. Was können mir Elfen und Waldgeister tun, wenn Gottes Segen mit mir ist."
Die bleiche Frau auf ihrem Schmerzenslager nickte dem jugendfrischen Sohn hoffnungsvollen Blickes zu: " Geh mit Gott, mein Hannes! Nein, dir geschieht nichts Böses, denn meine Gebete begleiten dich. Und zu einem Vorhaben, das mit einem liebevollen Herzen beginnt, gibt der Allmächtige seinen Segen! -
Sollte dir etwas Unheimliches begegnen, dann bete und sprich laut: "Alle guten Geister loben Gott, den Herrn, - und jeder Spuk wird weichen. Hannes nickte fröhlich.
"Mir soll nur was kommen! Ich brauche weder gute noch böse Kobolde zu fürchten, wenn ich auf rechtem Wege gehe. Nun lebe wohl, und versuche ein wenig zu schlafen. In einer Stunde bin ich wieder da." Noch einmal winkte der Knabe der Mutter freundlich zu, dann eilte er schnellen Fußes in die Mondnacht hinaus.
Mit liebevollem Blicken schaute die Kranke dem Sohne nach. "Du gutes Kind! Was fange ich an, wenn ich dich nicht hätte! Aber nun will ich deiner Bitte nachkommen und schlafen." Damit drehte sie sich nach der Wand, und bald verkündeten ihre regelmäßigen Atemzüge, daß sie die ersehnte Ruhe gefunden hatte.
Unterdessen schritt Hannes mit erwartungsvollem Herzen der Waldwiese zu. Er kannte sie alle ganz genau die zwölf heilkräftigen Kräuter. Aber es durfte keines fehlen, wenn die wundertätige Wirkung erzielt werden sollte. Das hatte ihm die alte Dore, die weise Frau des Dorfes, die schon so vielen geholfen hatte, oft eingeschärft.
So begann er eilig zu suchen, indem er die Namen der bewußten Pflanzen sich immer laut vorsagte. Und siehe da! Er hatte Glück! Binnen einer Viertelstunde lagen elf der gepriesenen Wurzeln in seinem Korbe. "Nun fehlt nur noch das Johanniskraut," murmelte er freudestrahlend. Dann sind sie alle zwölf zusammen, und ich kann meinem Mutterle den Lebenstrank brauen.
Eine gute halbe Stunde habe ich noch, ehe es ein Uhr schlägt, und in dieser Zeit werde ich doch das Kraut finden, das hier wie Unkraut wächst, so lange ich denken kann. Sonderbar, ich dachte immer, das Johanniskraut würde ich zuallererst im Korbe haben! -
Und wie müde ich auf einmal bin! Nun, einen Augenblick lang, darf ich mich schon auf den Baumstamm setzen. Einschlafen werde ich gewiss nicht. Nein, Nein! Wie war doch gleich Mutters Spruch? Ach
ja, nun weiß ich es wieder:
Breit aus die Flügel beide,
O Jesu meine Freude.
Und nimm dein Küchlein ein.
Will Satan mich verschlingen,
So laß die Englein singen:
Dies Kind soll unverletztet sein!
Schon im Einschlafen begriffen und halb unterbewußt, sagte Hannes das Lied. Und siehe da, wie mit einem Schlage war alle Müdigkeit von ihm gewichen, und mit hellen Augen blickte er in die taufrische Mondnacht.
"Nein, aber so was! Da wäre ich wohl beinah eingeschlafen! Das hätte schön werden können! Nun aber schnell an das Suchen des Johanniskrautes. Potz,Blitz!
Was blinkt und gleißt den da im Grase? Da hat wohl ein Stadtherr seine Uhr verloren. Das gäbe einen netten Finderlohn, und ich könnte meinem Mutterle endlich eine Freude machen."
Mit beiden Füßen zugleich sprang der Knabe von dem Baumstumpf in die Höhe und eilte auf die Stelle zu, wo die vermeintliche Uhr liegen sollte. Mit festem Griff faßte er nach dem blinkenden Ding. Aber wie ein lebendes Wesen entwischte der begehrte Gegenstand seiner Hand.
Silbern schimmernd und wie ein Mondlicht leuchtend, rollte eine zauberhaft glänzende Kugel den Abhang der Waldwiese hinunter. Einen Augenblick stand Hannes wie erstarrt. Dann raffte er sich auf und eilte behend dem wunderbaren Kleinod nach.
"Mein, mein, mußt du werden! und mit dir halte ich das Glück!" murmelte er atemlos und griff nach der silbernen Kugel. Schon wollte er einen Jubelstoß ausstoßen und das glitzernde Ding ergreifen, da hörte er plötzlich hinter sich Hilferufe und das klägliche Weinen eines Kindes.
Erschrocken drehte er sich um. "Nanu! Was ist denn das? Wie kommt denn solch kleines Ding jetzt bei nachtschlafender Zeit auf die Waldwiese? Da ist sicher irgend etwas nicht in Ordnung, und ich muß sehen, daß ich helfen kann."
Ohne weiter an die sehnlichst begehrte silberne Kugel zu denken, folgte er seinem guten Herzen und lief nach dem Gebüsche, aus dem der Hilferuf noch immer, wenn auch schon leiser und hoffnungsloser, erklang. Er kannte die Waldwiese und deren Umgebung wie seine Tasche, und er wußte, daß sich an der Westseite, wo das Unterholz begann, eine Höhle befand, die der Volksmund "das Zwergenloch" nannte.
Vielleicht war dort ein Kind beim Beeren suchen verunglückt. Eilig lief er also nach jener Stelle und teilte mit beiden Armen das Dickicht. "Ich komme schon. Wer ist es, der Hilfe braucht?" Suchend blickte er um sich. Noch waren seine Augen von dem hellen Mondlicht so geblendet, daß er nicht gleich erkennen konnte, was da vor ihm geschah.
Erst als eine krächzende und vor Wut heisere Stimme schrie: "Was willst du hier? Das ist mein Reich. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann mache dich schleunigst von dannen", merkte er, daß er zwei ungleiche Wesen, die augenscheinlich im Kampfe miteinander begriffen waren, vor sich hatte.
"Gott helfe uns! Ein Schwarzelf!" rief er entsetzt und blickte auf den unheim-
lichen, mißgestalteten Zwerg, der mit beiden Händen ein zartes, weiß gekleidetes
Mädchen in einen unterirdischen Gang zu zerren suchte.
Das bedrohte Kind war anscheinend schon halb ohnmächtig, denn es wehrte sich nur noch schwach gegen den Feind, wobei es leise, klagende Laute aus stieß, die Hannes jetzt wie das Klingen eines Glöckchens vorkamen. Auf welcher Seite das Recht war, wußte er sofort; und ohne sich an die Verwünschungen und Drohugen des tückischen Schwarzelfen zu kehren, faßte er nach der Hand der Kleinen und rief laut und furchtlos:
"Alle guten Geister loben Gott, den Herrn!" Der gräuliche Kobold stieß ein kreischendes Geschrei der höchsten Wut aus. Das schöne Kind aber neigte sich anbetend und sprach ehrfurchtsvoll: "Dank sei dem lieben Gott, dem Schöpfer und Regierer aller Welten, von nun an bis in Ewigkeit!"
Hannes war von dem wunderbaren Abenteuer viel zu erregt, um auf diesen merkwürdigen Ausruf eines so jungen Mädchens - die Kleine konnte höchstens zehn Jahre alt sein - zu achten. Auch daß sein Schützling von ganz eigenartiger, ja überirdischer Schönheit war, merkte er vorläufig nicht.
"Komm, komm, "drängte er und faßte die Rechte des Kindes. "Ich bringe dich zu meiner Mutter. Der da," - er wies auf den in ohnmächtiger Wut fauchenden Schwarzelf, darf uns nichts tun. Wir stehen unter Gottes Schutz." Der Zwerg aber schrie erbost:
"Du dummer, dummer Junge! Hättest du lieber die silberne Kugel erwischt! Das wäre dein Glück gewesen. Reichtum und Ehre hättest du erlangt. Was kann dir an dem unnützen Mädchen liegen? Überlasse es mir, und ich verschaffe dir das unschätzbare Kleinode, daß dir die Türe zu irdischem Wohlleben öffnet."
Angstvoll schaute die arme Kleine auf ihren jugendlichen Beschützer. " Glaube ihm nicht! Er betrügt dich! Glück durch anderer Leid erkauft, bringt auf Dauer keinen Segen! Die Treue erhält am Ende stets ihren Lohn; und Gott wird dir seine Barmherzigkeit gegen mich reichlich vergelten."
Treuherzig blickte Hannes auf den Findling: "Habe nur keine Angst, ich weiß schon, was ich tun muß. Der Schwarze kann mich nicht verführen. Meiner Seele Seligkeit ist mir um Gold und Ehren nicht feil! Und die silberne Kugel, von der er immer spricht, wird wohl auch nicht alles Erdenglück enthalten! Komm, Kleine, ich bringe dich jetzt zu meiner Mutter. Da bist du wohl aufgehoben und geborgen, bis dich die Deinen wieder holen."
Das fremde Kind senkte die Augen und jammerte leise: "Mutter Luana! Mutter Luana! - Meine Kugel! Ach meine Kugel! Hannes achtete kaum auf die sonderbaren Reden. Er hatte genug zu tun, sich den unheimlichen Zwerg vom Leibe zu halten, und außerdem dachte er an das fehlende Johanniskraut und schaute danach aus.
"Komm, schnell, Kleine. Gleich wird es ein Uhr schlagen, ich muß vorher noch eine Pflanze suchen, die meiner kranken Mutter zur Genesung verhelfen soll."
" Deine Mutter wird auch ohne Kraut gesunden," sagte das Kind ernst. " Wo Luana hinkommt, schwindet alle Krankheit."
Jetzt wurde Hannes doch aufmerksam und schaute sich seinen Schützling näher an. Und nun erschrak er fast vor der lichten und zauberhaften Schönheit der Kleinen; duftige, schneeweiße Gewänder umgaben ein zartes, elfenhaftes Körperchen. Lockiges, silberglänzendes Haar fiel auf die Schultern herab und aus dem lieblichen, sanftem Gesichtchen blickten zwei Augen, so tief blau, wie der Himmel der Sommernacht.
"Wer bist du ?" stotterte der eben noch so kecke Knabe ganz verwirrt. "Ich heiße Luana," erwiderte die Fremde leise und traurig. Meine Heimat dort auf dem Monde. -
Nein, fürchte dich nicht," fuhr sie fort, als Hannes erschrocken zurückwich. "Wir Mondleute sind allen guten Menschen wohl gesinnt. Dein Gott ist auch unser Gott; und wir dienen ihm allzeit in Ehrfurcht und Anbetung. Mein Unglück wird dein Glück werden; und der böse Schwarzelf kann trotz seiner schrecklichen Drohungen nie Macht über dich gewinnen, so lange du in des Höchsten Wegen wandelst."
Der tückische Kobold hinter den beiden Kindern kreischte höhnisch und wütend: "Dummer Junge, dummer Junge! Um solch Mädel läßt er sich die silberne Kugel entgehen! Da war einst der Peter Hele in Nürnberg klüger! Als der das wundersame Kleinod fand, gab er es nicht mehr her. Er bildete danach die Taschenuhren, die Nürnberger Eierlein, und wurde ein berühmter Mann.
Um das Mondmädchen, das seine silberne Kugel verloren hatte, kümmerte er sich nicht. Laß dir raten und folge ihm. Es soll dein Schaden nicht sein. Aber Johannes antwortete dem listigen Versucher nicht. In ehrfurchtsvoller Scheu ergriff er aufs neue die Hand des fremden Kindes und führte es aus dem Dickicht auf die von silbernem Mondlicht überstrahlte Waldwiese hinaus.
Als Luana das herrlich glänzende Gestirn erblickte, stieß sie abermals einen klagenden Schrei aus: "Ach, meine silberne Kugel! Ach, Mutter Luna, nun bin ich von dir getrennt! Wie konnte ich auch so nachlässig und ungehorsam sein!"
Hannes verstand diese rätselhafte Rede freilich nicht, aber er sagte mitleidig:
"Sei nur still und gräme dich nicht. Meine Mutter wird schon Rat wissen; und auf mich kannst du alle Zeit bauen." Die kleine Fremde sah ihn dankbar an. "Ja, du bist gut, aber ob du mir weiter
helfen kannst, weiß ich nicht."
"Kommt Zeit, kommt Rat!" rief jetzt Johannes fröhlich und gar nicht mehr scheu.
"Erzähle nur Mutter ausführlich deine Geschichte. Du sollst sehen, es kommt alles wieder in Ordnung. Mit Geduld, Ausdauer und Treue kann man die größten Schwierigkeiten überwinden. Und nun wollen
wir eilen, damit Mutter sich nicht unnütz ängstigt." Das schöne Kind nickte einverstanden, wenn auch mit trauriger Miene.
"Ja, laß uns zu deiner Mutter gehen. Vielleicht weiß sie Rat, wie Luana wieder zu ihrer silbernen Kugel gelangen kann, denn dieses Kleinod ist meine Seele, mein Leben , mein Glück! Ohne die Kugel sehe ich die Meinen in der Mondheimat niemals wieder, sondern muß auf der Erde zugrunde gehen!"
Johannes sah seinen Schützling mitleidig an. "Ich werde dir suchen helfen. Du wirst schon noch zu den Deinen kommen. Gott, der mich schickte, dich aus den Händen des Schwarzelfen zu befreien,
weiß um deine Not und wird dir zur rechten Zeit Hilfe senden. Horch nur, wie der Kobold hinter uns tobt und lästert!
Hu, ich möchte nicht in seiner Gewalt sein! -
Und jetzt sind wir zuhause. Was wird Mutter für Augen machen über mein Mitbringsel!" Eilig stieß er den hölzernen Riegel an der Tür zurück und zog Luana über die Schwelle in das Zimmer hinein. Immer noch ruhte die Kranke in süßem Schlummer auf dem ärmlichen Lager. Aber Johannes wollte es so vorkommen, als ob sie lange nicht mehr so bleich und elend aussähe wie sonst.
"Mutterle!" rief er leise, in freudiger Erwartung. "Mutterle, sieh doch, was ich gefunden habe! Nun wirst du ganz gesund werden und nie mehr hungern und frieren müssen! Luana bringt das Glück in unser Haus!" Mit einem freundlichen Lächeln schlug die Angerufene die Augen auf: Johannes, mein Sohn, du bist schon zurück? O wie schön habe ich geträumt; und so wohl, wie jetzt, fühlte ich mich noch nie in meinem Leben! -
Aber was ist das denn für Licht und Glanz in unserer armen Hütte? Hannes, Hannes, ich träume wohl immer noch, denn ich sehe neben dir ein holdes, strahlendes Engelchen, und das ganze Zimmer ist mit überirdischem Scheine überfüllt! Kind, Kind, sag mir doch, was soll ich von dem Wunder halten? Nicht wahr, ich träume nur?"
Aber da fiel der schon der beglückte Junge der geliebten Mutter um den Hals:
"Nein, nein! Du träumst nicht! Es ist alles Wahrheit und Wirklichkeit! Gott hat unser Elend angesehen und Hilfe geschickt! Luana bringt die Liebe und Gesundheit! Mutterle, liebes Mutterle, ich
weiß nicht, wo ich anfangen soll, zu erzählen!"
Lächelnd, aber immer noch erstaunt, blickte Frau Reinald, die Witwe des einstigen Waldhegers, auf ihren erregten Sohn. Doch allgemach, als sie munterer wurde, begann sie zu begreifen. Sie war immer eine Wundergläubige gewesen, und so glaubte sie auch freudig das holde Wunder, das da vor ihr stand.
"Johannes, rief sie atemlos, "ist es denn menschenmöglich? Du hast ein Mondelfchen gefunden! O welch großes Glück! Gott sei gelobt und gepriesen, nun kann uns kein Unglück mehr treffen!" Ehrfurchtsvoll verneigte sich das fremde Kind, aber es seufzte dabei kläglich, und in den schönen blauen Augen standen große Tränen.
"Nein, nein, weine nicht," sagte Johannes vertraulich und mitleidsvoll. "Was für unser Glück ist, darf gewiß nicht dein Verderben werden. Viel lieber wollte ich, wie sonst, weder hungern noch frieren." Dankbar sah Luana ihren Tröster und Erretter an. "Du Guter!"
Unterdessen hatte sich Frau Reinald flink und rüstig, wie einst in gesunden Tagen, von ihrem Lager erhoben und wirtschaftete glückstrahlend am Herde herum. "Hannes, Hannes, ich bin ja ganz gesund! Und nun koche ich dir und deinem Findling rasch eine Milchsuppe."
Der Knabe nickte vergnügt: " Ja, ich bin rechtschaffen hungrig, und Luana kann auch eine Stärkung gebrauchen. Ich weiß nur nicht, ob ihr unsere irdische Kost behagen wird." Das Mondmädchen schüttelte den Kopf. "Habt Dank, aber ich brauche eure Speise nicht. Die ersten vierundzwanzig Stunden auf Erden darf ich nichts genießen, damit ich, falls sich während dieser Zeit meine Kugel wieder findet, unbeschwert durch Irdisches, zur Heimat aufsteigen kann."
Die Witwe und ihr Sohn sahen mitleidig auf den armen, kleinen Gast. "So will ich dir ein Ruhelager bereiten," sagte Frau Anna freundlich. Du wirst müde und erschöpft sein, und schon manchmal wurde im Traume der Weg zur Hilfe gezeigt." Doch abermals wehrte Luana.
„Wenn der Mond scheint, kann und darf ich nicht schlafen. Ich muss in seinem Strahle weilen, so lange er zu sehen ist. Darum lasst mich hier am Fenster sitzen und hört meine Geschichte.“
„Du sprichst wie eine Erwachsene und siehst doch aus wie ein achtjähriges Kind“, rief die Witwe staunend. Das Mondmädchen lächelte traurig. „Wir haben eine andere Zeitrechnung als ihr. Wenn ihr beide längst alles Erdenleid hinter euch haben werdet, werde ich noch immer ein Kind sein.
Ich lebte schon, als die erste Christnacht anbrach. Ich sah die Hirten auf Judäas Fluren und hörte der Engel Jubelchören bei der Geburt des Kindes in der Krippe. Ich schaute in den Stall von Bethlehem; und der holdselige Anblick wird mir ewig unvergesslich bleiben.
Dann sah ich ihn wieder, den Welterlöser, in der Nacht, da er verraten ward! Ich sah ihn am Ölberge zittern und zagen, und beneidete die Menschen, um derent-willen er so unsägliches Leid erduldete.“ Luana schwieg; atemlos und ehrfurchtsvoll blickten Frau Reinald und Johannes auf das wundersame Kind.
Das so eben Gehörte überwältigte Mutter und Sohn. War es dann möglich,
dass in ihrer armseligen Wohnung ein Wesen weilte, das all die heiligen, welterschütternden Ereignisse miterlebt hatte! War es nicht doch vielleicht nur ein Traum?
Aber das holde Wunder vor ihnen verschwand nicht, als sie wiederholt Gott anriefen, sie vor trügerischen Zauberspuk zu bewahren. Strahlender Vollmondschein umwob Luanas liebliche Gestalt mit überirdischem Lichte, und das dürftige Zimmer war so hell erleuchtet, wie an einem Sommertag.
Da konnten Mutter und Sohn an der Wahrheit und Wirklichkeit nicht länger zweifeln. Aber sie blickten mit fast heiliger Scheu auf den kleinen Gast, und nur zögernd sagte Frau Reinald: " Habe Dank für deine Rede. Sie hat mich tief ergriffen. Aber willst du uns jetzt nicht erzählen wie du auf die Waldwiese gekommen bist?“
Das Kind nickte traurig:“ Ihr sollt alles erfahren, denn nur dadurch, dass ich meine große Schuld offen und ohne Beschönigung eingestehe, bleibt mir die Hoffnung, mein Kleinod mit eurer Hilfe zu erlangen.
Ich habe euch schon oft gesagt, daß meine Heimat der schöne, glänzende Mond dort oben am Himmel ist. Seit der Erschaffung der Welt leben die Meinen dort, und weder Ungehorsam, noch gar Auflehnung, brachte sie jemals mit den Gesetzen des Allschöpfers in Unfrieden.
Ganz anderen Bedingungen, als euch Menschen, ist unser Tun und Treiben unterworfen. Wir haben eine andere Zeitrechnung – Wir haben nicht das Bedürfnis nach Speise und Trank; aber Allezeit preisen wir mit euch die Herrlichkeit und Allmacht des Höchsten. –
Elend und Krankheit gibt es meiner Heimat nicht. Nahrungssorgen, Jagd nach Reichtum und Ehren sind uns unbekannt. – Auch der Tod hat für uns keine Schrecken. Wenn unsere Zeit gekommen ist, verwandelt uns der gütige Schöpfer und macht uns zu Schutzengeln seiner neugeborenen Erdenkinder. –
Unsere Eltern sind unsere Vorbilder in allen Tugenden; und unser Dasein verläuft harmonisch und schattenlos bis auf einen Punkt.“ Hier schwieg Luana voll Trauer und blickte sehnsuchtsvoll nach dem Monde. Frau Reinald und ihr Sohn schauten mitleidig und aufs höchste gespannt auf den kleinen, fremden Gast. Immer noch war ihnen wie Träumenden zumute, aber das liebliche Kind hatte längst ihre herzen gefangen genommen.
„Sei nicht betrübt, Luana,“ sagte Hannes freundlich. „Es wird alles wieder gut werden; und was in meinen Kräften steht, will ich tun, um dir deine Kugel suchen zu helfen.“ „Ja, er wird dir beistehen,“ beteuerte auch die Witwe. „Er geht auf Gottes Wegen, und darum wird es ihm nicht fehlen.“
Dankbar schaute Luana auf ihre Beschützer. „Dass ich nach meinem Fehltritt in eure Hände geriet, werde ich Gott niemals genug danken können! Meinen armen Schwestern ist es nicht so gut gegangen, und der böse Schwarzelf hatte recht, wenn er höhnend sagte, andere Menschen hätten sich nur um die kostbare, silberne Kugel und niemals um das Schicksal ihrer Beschützer gekümmert.
Ach, wie viel Leid und Trauer gab es damals in meiner Mondheimat! Denn, wenn die Kugel ihrem ursprünglichen Besitzer nicht mehr zugestellt wird, muß er auf der Erde sterben und verderben! Die Kugel ist unsere Seele, unser Leben, unser Glück, unser alles! Ohne die silberne Kugel sind wir macht – und – rechtlos, und jeder Kobold kann uns zugrunde richten.
Ohne dein Dazwischenkommen, Johannes Reinald, wäre ich jetzt für immer dem Bösen verfallen; - und darum danke ich dir! Aber es soll dein Schade nicht sein, dass du dich der Hilflosen angenommen hast. Und selbst, wenn ich meine Kugel nicht wiederfinden würde und immer bei euch bleiben müsste.
Meine Gegenwart in eurer Hütte hält Not und Jammer fern! Aber nun hört. Was es mit meinem verlorenem Kleinode für eine Bewandtnis hat. Wenn wir Mondkinder zum Leben erwachen, haben wir sofort Gewalt über Geist und Körper. Wir sind nicht hilflos, wie ihr, und unsere Eltern haben keine Not, sondern Freude an uns.
Gleich bei unserer Geburt erhalten wir die silberne Kugel. Das ist ein Kleinod, so köstlich, wie ich es gar nicht beschreiben kann! Es ist, wie ich schon einmal sagte, unsere Seele, unser Glück, unser Leben! Aufs genaueste gibt dieses Wunder außerdem die Stunden – Zeit – und Jahresrechnung an.
Kunstvoll ist der Lauf der Gestirne eingegraben und eine kleine Spiegelfläche zeigt uns alle Ereignisse, die in der Welt vorgehen. Denn die Kugel ist kein totes, mechanisches Instrument wie etwa eure Uhren; nein, sie lebt! Und von einer unsichtbaren Gewalt getrieben, bewegen sich auf ihr die Abbilder von Sonne, Mond und Sternen.
Wollen wir etwas wissen, so brauchen wir nur auf die Kugel zu schauen, und es wird uns sofort geantwortet. Ach, ich kann euch unmöglich alle Vorzüge und Herrlichkeiten unseres Kleinodes schildern! - Nur noch eines muß ich zum Verständnis meines Unglücks mitteilen.
Wenn wir die Kugel erhalten, wird sie mit einer feinen silbernen Kette an unserem Hals befestigt, und wir müssen geloben, sie nie von diesem Bande zu lösen. Für gewöhnlich, in unserer Heimat, tritt diese Versuchung auch niemals an uns heran.
Nun haben wir Mondkinder aber eine unbeschreibliche Liebe zu der Erde und ihrer Farbenpracht; denn bei uns auf dem Monde ist alles silberweiß! Berge, Häuser, Bäume, Blumen, Früchte, alles, alles schimmert silbern. So oft es also möglich ist, gleiten wir an den Mondstrahlen zur Erde hinab und ergötzen uns an dem Grün der Wiesen und Wälder und an den duftenden, bunten Blumen, die überall blühen.
Die Kugel, die uns, auf unseren Wunsch unsichtbar bleibt, ermöglicht es uns ungesehen und ungestört von allen irdischen Wesen nach Herzenslust herumzutummeln und zu spielen. Solange wir das Kleinod nicht von der Kette lösen, droht uns nirgends Gefahr; darum erlauben uns unsere Eltern gern dies Vergnügen und den Spaziergang auf der Erde.
Oft, oft bin ich schon in eurem Reiche gewesen und freute mich an den lieblichen, bunten Blumen. Alle eure Weltteile lernte ich auf diese Weise kennen; bald war ich hier, bald dort: in Europa, Asien, Afrika, Amerika, Australien, für uns ist es ein und das selbe!
Gestern tummelte ich mich am Strande der Nordsee, wo am Tag flachsköpfige, blauäugige Kinder mit Dünensand und Muscheln spielten – heute spazierte ich im Negerland, wo es seltsame Tiere und hohe Palmen gibt. Herrlich, ach herrlich ist unser Leben!“
Hier schwieg Luana einen Augenblick und seufzte traurig, währen Frau Reinald und Johannes wie die Träumenden saßen und lauschten. Mitleidig ruhten ihre Augen auf dem schönen, fremden Kinde. Endlich sagte der Knabe leise: „Wie geht es zu, Luana, dass du unsere Sprache verstehst? Du bist bald hier, bald dort gewesen, und es scheint, als ob du dich mit allen Erdenbewohnern verständigen könntest.“
Das Mondmädchen lächelte freundlich: „Ich verstehe alle Sprachen, die es auf Erden gibt und ein jeder spricht meine Sprache. Das heißt: Wir Mondleute sprechen die ursprüngliche, vom Allschöpfer beim Anbeginn der Welt eingesetzte Sprache, die auch alle Menschen sprachen, bis beim Turmbau von Babel die Sprachverwirrung eintrat.
Wir sind von dieser Strafe nicht getroffen worden; denn wir haben gegen die Gesetze des Allmächtigen nicht gesündigt, darum verstehen wir die Reden aller Menschenkinder, und sie hinwiederum verstehen auch uns. Aber nun lasst mich erzählen, wie ich heute in diese große Not geriet. Denn je eher ich offen meine Schuld bekenne, desto eher darf ich auf Erlösung hoffen.
Als ich am Abend von meiner lieben Mutter Luna Abschied nahm, da warnte sie mich eindringlich: "Luana, du bist oft sehr dreist und unbesonnen. Laß nie die silberne Kugel von dir! Ich gönne dir von Herzen deine Spiele und Vergnügen auf der Erde, aber halte stets dabei die Kugel fest und löse sie um keinen Preis von der Kette. Schrecklich ist die Strafe, die die ungehorsamen Mondkinder trifft!“
Ach, Mutter Luna, Mutter Luna, hätte ich doch deinem Rat gefolgt! Hier weinte Luana schmerzlich, und ihre Tränen fielen gleich silbernen Tautropfen zur Erde. Als sie sich wieder gefasst hatte, fuhr sie leise und klagend fort:
"Das taufrische, grüne Gras schimmerte im Mondenscheine gar so verlockend; und da dachte ich, es müsse zauberhaft aussehen, wenn meine silberne Kugel den Abhang der Wiese hinunterrollt. Ehe ich es noch wollte, hatte ich mein Kleinod von der Kette gelöst und ergötzte mich, wie es glitzernd und gleißend über den Samt grünen Teppich glitt.
Ich durfte ja nur rufen, dann kam es wieder in meine Hand zurück. Leider vergaß ich, dass mir Mutter Luna einst von bösen Schwarzelfen erzählt hatte, die nichts Höheres kennen, als ein Mondkind in ihre Gewalt zu bekommen. So geschah das Unglück und mein Ungehorsam wurde aufs grausamste bestraft!
Der Schwarzelf, aus dessen Händen du mich befreitest, Johannes, hatte schon seit langem danach getrachtet wieder ein Mondmädchen zur Dienerin zu bekommen.
Meine arme Schwester, die ihre Kugel im Jahre 1510 an Peter Hele in Nürnberg verlor, war inzwischen verdorben und gestorben; und er hatte nun niemand, der ihm seine Wünsche erfüllen musste.
Sobald wir nämlich in der Gewalt dieser tückischen Kobolde sind, müssen wir bedingungslos jeden ihrer Befehle ausführen, und sie selber können herrlich in Freuden leben. Was ich empfand, als ich während meines schönsten Spieles plötzlich das teuflisch grinsende Gesicht meines größten Feindes neben mir sah, kann ich unmöglich beschreiben!
Mein Ungehorsam! Weiter vermochte ich nichts zu denken. Aber das andere weißt du ja, Johannes! Nie, nie kann ich dir deine Furchtlosigkeit und Treue genugsam danken! Selbst wenn die silberne Kugel für mich verloren sein sollte, bei euch, ihr guten Menschen, werde ich mein Elend leichter tragen. Euch aber wird meine Gegenwart zum Segen gereichen!
Und nun geht zur Ruhe, ich bleibe im Strahle des Mondlichtes, bis der Morgen dämmert.“ Luana schwieg, und Frau Reinald und Johannes wagten keine Gegenrede. Bald sanken sie in festen Schlummer, während die arme, kleine Fremde trauernd und weinend am Mond beglänzten Fenster saß.
Als Hannes einmal aus seinen süßen Träumen erwachte und schlaftrunken die Augen aufschlug, bot sich ihm ein wundersames Bild: Lachend und weinend stand Luana inmitten des glänzenden Mondlichtes, und draußen, vor dem geöffneten Fenster, schwebte eine wunderschöne Frau in silberweißen Gewändern. Klagend rang sie die durchsichtigen Hände:
„Luana, Liebling, warum hast du meine Lehren und Mahnungen nicht beherzigt! Nun sind wir auf lange Zeit, wenn nicht gar für immer getrennt! Die Boten haben nichts über den Verbleib deiner silbernen Kugel erfahren können. Sie sahen nur deinen Kampf mit unseren Feind und das Hinzutreten des braven Knaben, als dir gerade das schrecklichste Ende drohte. Der Allgütige sei gepriesen, dass dir das Fürchterlichste erspart blieb, und wir wenigstens die Hoffnung haben, dich in absehbarer Zeit wieder zu gewinnen.“
Das kleine Mädchen weinte schmerzlich: „Mutter Luna, vergib, ach vergib! Ich bereue meinen Ungehorsam von Herzensgrund! O, sage doch allen unseren Boten, dass sie ausschauen sollen, wo meine Kugel geblieben ist! Der gute Knabe dort wird mir dann helfen, sie wieder zu erlangen.“ Die schöne Fee lächelte ihrem traurigen Kind tröstend zu.
„Was in unserer Macht steht, dir zu helfen, soll geschehen, Aber du bist jetzt aus unserem Bereich in den Bann und Zauberkreis der Erde gelangt. Nur selbstlose Menschenliebe kann dich erlösen und dir wieder den Weg zur Heimat öffnen. Diene darum den guten Menschen, die dir Schutz gewährten, mit allen Kräften, vielleicht gelingt es ihnen, dein Kleinod zu erwerben.
Und nun muß ich scheiden, Liebling. Wenn der nächste Vollmond dies Waldtal beleuchtet, hoffe ich dich wiederzusehen. Die schöne Frau schwebte davon; und unter schmerzlichem Weinen schaute Luana ihr nach. „Mutter Luna, Mutter Luna, ach, daß ich doch bald wieder bei dir wäre!“
Johannes hatte kaum zu atmen gewagt. Mutter und Kind taten ihm gar zu sehr leid, und innig wünschte er sich, Luanas Kugel finden zu dürfen. Dann schlief er wieder ein. Als am anderen Morgen die Witwe und ihr Sohn erwachten, fanden sie den fremden kleinen Gast in sanftem Schlummer auf der Fensterbank liegen; und abermals konnte Frau Reinald und Hannes nicht genugsam die überirdische Schönheit bewundern.
Solange die Sonne am Himmel stand, schlief Luana tief und fest, und erst als der abnehmende Mond aufging, erwachte sie. Freundlich begrüßte sie ihre Wirte, als diese sich ihr abermals mit Speise und Trank näherten. „Ja, jetzt muß ich eure Güte annehmen. Die Erdenluft zehrt, und ich bin gezwungen, irdische Speise zu genießen, so lange ich unter euch weile.“
Frau Reinald und Johannes freuten sich herzlich, als sie sich darauf Milch und Honig und etwas Weißbrot schmecken ließ. „Ich habe mich inzwischen nach deiner silbernen Kugel umgesehen“, sagte der Knabe bekümmert. Die ganze Waldwiese habe ich abgesucht, ohne auch nur eine Spur von dem Kleinod zu finden.“ –
„ Ich wusste es“, entgegnete Luana traurig. „Wenn die Mondstrahlen, unseren Boten nichts ausrichten können, dann ist Menschenmacht meist auch vergeblich das Verborgene zu entdecken. Ich kann jetzt nichts anderes tun, als geduldig die Strafe für meinen Ungehorsam zu tragen. Laßt mich, nun teilnehmen an eurem Leben und eurer Arbeit, und behandelt mich, als sei ich eine euresgleichen, ihr guten Menschen.“
Frau Reinald nickte freundlich und schlang mütterlich ihre Arme um den kleinen Findling. „ Du bist unser Töchterchen. Nenne mich Mutter Anna“, und vertraue in allen Dingen Johannes und mir. Ich hatte vor Jahren auch einmal solch liebes, kleines Mädchen, wie du bist. Jetzt ist unser Hannchen im Himmel, aber ich kann es nimmer vergessen, und ich freue mich, dass du nun bei mir bist.“-
Zutraulich lehnte sich Luana an die gute Frau. „Mutter Anna, ich will alles tun, was du sagst.“ Johannes klatschte fröhlich in die Hände: „So habe ich denn wieder ein Schwesterchen!“ Wie schön das ist! Aber gelt, Mutterle, nun zieht Luana auch Hannchens rotes Röckchen an. In dem feinen Spitzenkleidchen kann sie doch nicht bei uns herumgehen. Da würden sich alle Menschen wundern, und wir hätten vor neugierigen Fragen keine Ruhe mehr.“
„Ja, mein Sohn, da hast du recht,“ rief die Witwe. „ Hannchens Sachen werden dem Kinde gerade passen. Und wenn dann jemand wissen will, wo wir den kleinen Besuch her haben, dann ist es eine Verwandte die von ferne kam, um sich in unsrem Walde zu erholen.“ –
Geschäftig kramte Frau Reinald im Schrank und Kasten; und kurze Zeit darauf war das Elfenkind in ein allerliebstes Bauern Dirnlein verwandelt. Wie hübsch standen Röckchen und Mieder dem zarten Mondmädchen. Selbst das durchsichtige blasse Gesicht erhielt einen leisen Hauch von Farbe. Johannes tanzte lustig um das neue Schwesterchen herum und hielt ihm dann einen Spiegel vor.
„Schau, Luana, gefällst du dir?“ Das Mondmädchen lächelte. „ Es ist gut so. Aber nicht wahr, Johannes, du vergisst meine Kugel nicht. Ich kann ja doch nicht eher froh werden, bis ich sie wieder habe.“ „Verlasse dich darauf. Ich tue, was in meinen Kräften steht,“ sagte der Knabe ernsthaft.
„Und nun komm mit mir in den Garten. Ich werde dir meine Blumen zeigen, und mein zahmes Reh, und meine Vögel und die Kaninchen.“ Willig folgte Luana ihrem freundlichen Führer ins Freie hinaus. Einen Augenblick lang breitete sie dem Monde sehnsüchtig die Arme entgegen.
„Mutter Luna! Mutter Luna, ach, wenn ich doch erst wieder bei euch wäre!“
Mitleidig und tröstend redete ihr der Knabe zu; und endlich vergaß sie ihren Kummer und freute sich an den Tieren und Blumen ihres Gefährten. Es war gar seltsam, das gegen Fremde sonst so scheue
Reh folgte ihr auf Schritt und Tritt, und die Vögel flogen ihr zutraulich auf Kopf und Schultern.
Befriedigt schaute Frau Reinald dem Treiben der beiden Kinder zu und faltete dann dankend die Hände. Mit Luana war das Glück in ihr Haus gekommen!“ Sie, die Witwe, die seit Jahren krank gewesen war, fühlte sich nun wieder jung und gesund, und auch die Not schien von ihrer Schwelle gewichen zu sein. Es fehlte ihr niemals mehr an Notwendigen!
Wider Erwarten schnell hatte sich Luana im Waldhause eingelebt. Mit Johannes war sie ein Herz und eine Seele, freundlich und dienstwillig ging sie ihrer „lieben Mutter Anna“ zur Hand. Gar oft ertappte sich Frau Reinald auf dem Gedanken, wie herrlich es doch wäre, wenn sie dies liebe Wesen für immer bei sich behalten dürfte.
Wenn sie dann aber am Abend sah, wie des fremden Kindes Augen voll unendlicher Sehnsucht nach der Heimat blickten, dann schämte sie sich ihrer Selbstsucht und wünschte von Herzensgrund das Auffinden der Kugel herbei.
Auch Johannes war jetzt so froh, wie noch nie in seinem Leben. „Gelt, Mutterle, so schön war es niemals bei uns!“ rief er oft mit leuchtenden Blicken, wenn sie abends traulich beisammen saßen und Luana von ihrer Heimat erzählte. Immer wieder mußte sie ihm von der Herrlichkeit der silberglänzenden Städte und Landschaften berichten: und niemals wurde er müde, von allen sonstigen Einrichtungen auf dem Monde zu hören.
Könnte ich doch auch einmal alles sehen,“ Sag Luana, gibt es keine Möglichkeit, meinen Wunsch zu erfüllen?“ Das Mondmädchen lächelte wehmütig. „Nein, Johannes. Euch Menschen ist meine Heimat verschlossen, denn ihr seid ganz anderen Naturgesetzen unterworfen, als wir.
Wenn ich meine Kugel habe, kann ich in wenigen Minuten von der Erde zum Mond emporsteigen. Du aber würdest viele Jahre brauchen, ehe du das himmlische Gestirn erreichen würdest. Und wenn du dann bei uns wärst, könntest du doch nicht leben, denn die Speise, dir nötig ist, fehlt. Freue dich darum an deiner Erde, denn es ist ja so schön bei euch, und ihr habt unendlich viel vor uns voraus.“ Der Knabe nickte staunend. „ Du hast recht, Luana, und ich will mich bescheiden.
Über ein Jahr weilte das Elfenkind nun schon in der Waldhütte, aber trotz alles Forschens und Suchens, hatte Johannes bis jetzt nichts über den Verbleib der silbernen Kugel erfahren können. Jedesmal, wenn er von einem erfolglosen Gang heimkehrte, war Luana stundenlang still und traurig.
So wohl sie sich auch bei ihren gütigen Beschützern fühlte, die Sehnsucht nach der Heimat überwog doch immer wieder. Äußerlich zwar hatte sie sich der Erde mehr und mehr angepasst. Die irdische Speise hatte ihrem Gesichtchen Farbe verliehen und ihr Wesen menschenähnlicher gemacht.
Sie schlief nicht mehr den ganzen Tag über, und floh auch nicht, wie zuerst, jeden Sonnenstrahl. Trotzdem sie nur Milch, Honig und Weißbrot genoß, gedieh sie sichtlich, und Frau Reinald und Johannes hatten ihre Herzensfreude an ihr. Oft vergaßen beide ganz und gar, dass das holde Wesen nicht zu ihnen gehörte und über kurz und lang, wieder von ihnen scheiden mußte.
Nur in den Vollmondnächten wurde ihnen die seltsame Begebenheit stets ins Gedächtnis gerufen. Dann besuchte Frau Luna ihren verlorenen Liebling. Klagend schwebte die Mutter vor dem Fenster und sehnsuchtsvoll streckte das Kind die Arme nach ihr aus. Dann trauerten Frau Reinald und ihr Sohn mit den Ärmsten und wünschten von Herzensgrund die silberne Kugel herbei.
Es war am Morgen eines trüben Novembertages. Frau Reinald und Luana schliefen noch, als Johannes leise aufstand, um die Ziegen und sein zahmes Reh zu füttern. Aber nicht wie sonst antworteten die Tiere auf seinen Zuruf, wie Meckern und ungeduldigen Bewegungen. Nur klägliches, wimmerndes Stöhnen tönte ihm entgegen.
„Da ist etwas nicht in Ordnung,“ rief er erschrocken und hob die Stallaterne, um besser sehen zu können. „Ach, wer hat mir das getan!“ schrie er gleich darauf und glitt weinend zu seinem Reh nieder, das mit einer großen Schlinge erwürgt vor ihm lag. Von den Ziegen war nichts zu sehen. Dagegen krümmte sich auf deren Lagerstätte eine alte hässliche Frau.
Der Knabe erschrak und wandte sich mit Widerwillen ab. Das war die böse Muhme, die größte Feindin seiner Mutter! So lange er denken konnte, hatte dieses schlechte Weib ihnen alles mögliche Ungemach angetan; und in jedem Abendgebet bat die Witwe den Allmächtigen, sie vor den Nachstellungen dieser boshaften Alten zu schützen.
Die Feindschaft stammte schon von den Voreltern her; und kein Bitten und Flehen der sanften Frau Reinald hatte die Muhme bis jetzt zur Nachgiebigkeit gestimmt. Bei jeder Gelegenheit kränkte sie die schutzlose Witwe und tat ihr alles denkbar Böse an.
Jetzt lag die Schlimme stöhnend und bewusstlos vor dem entsetzten Johannes, und dieser wusste gut genug, woher ihr Unheil gekommen war. Sein liebes Reh hatte sie erwürgt und die Ziegen davon gejagt; und zur Strafe war sie denn ausgeglitten und hingefallen und hatte sich bei ihrem Alter verletzt sie zählte achtzig Jahre. -
So sehr der gute Junge um sein Reh und die verlorenen Ziegen jammerte und der alten Feindin zürnte, er brachte es nicht über sich, sie hilflos in ihren Schmerzen liegen zu lassen. Eilends lief er ins Haus. „Mutterle, Mutterle, komm und hilf! Die alte Muhme ist in unserem Stalle gefallen und ist bewusstlos. Ich glaube, sie stirbt. Komm schnell!
So rasch sie konnte, sprang Frau Anna von ihrem Lager auf, der Alten bei. In selbstloser Menschenliebe trugen gleich darauf Mutter und Sohn die todkranke Greisin ins Haus. In diesem Augenblick erwachte Luana, die bis dahin friedlich geschlummert hatte.
„Meine Kugel!“ rief sie aufgeregt. Meine silberne Kugel muß in der Nähe sein! O, sagt, was ist geschehen.“ Aber Frau Reinald und Hannes achteten diesmal kaum auf das sonderbare Wesen ihres Schützlings, da sie vollauf mit der allem Anschein nach sterbenden Muhme beschäftigt waren.
Die gebrochenen Glieder und die Nacht auf dem kalten Stallboden hatten der bösen alten Frau den Rest gegeben. Trotzdem versuchte Frau Anna alle Mittel.
„Hannes, du musst zum Doktor laufen.“ Aber ehe es noch dazu kam, geschah etwas Wunderbares.
Als Frau Reinald die bewusstlose Greisin entkleidete, rollte plötzlich ein glitzerndes, rundes Ding unter den Hüllen hervor und sprang mit melodischem Klingen auf die Erde. Im selben Augenblick wurde die niedere Stube mit überirdischem Lichte erfüllt.
Mit einem Jubelschrei sprang Luana empor und haschte nach dem Kleinod. „Meine Kugel! Ich habe meine silberne Kugel wiedergefunden. Gott sei Lob und Dank!“ Mit beiden Händen hielt das glückstrahlende Kind den wiedergefundenen Schatz in die Höhe: „Mutter Luna! Mutter Luna! Noch heut darf ich bei dir sein!
Aber auch die bewusstlose Alte schlug bei dem strahlenden Scheine der Mondkugel wider Erwarten die Augen auf. „ Meine Kugel! Ihr habt mir meine Kugel genommen!“ kreischte sie mit schriller Stimme, und versuchte umsonst aufzustehen und das Kleinod zu ergreifen.
"Gebt mir meine Kugel wieder! Ich habe zu Haus viel, viel Geld versteckt, das soll dann euer sein! In der Johannisnacht, vor Jahr und Tag, habe ich das wunderbare Ding auf der Waldwiese gefunden; und seitdem gingen Gold und Silber in meiner Hütte nicht mehr aus. Gebt mir die Kugel wieder! Gebt mir meine silberne Kugel wieder!“
„Nein,“ sagte hier plötzlich die sonst so sanfte und stille Luana ernst. „Nein, diese Kugel gehört nicht dir! Sie ist mein Eigentum! Gefundenes Gut, gestohlenes Gut!
Gib es ab, ehe es dir Schaden tut! Nur dem rechtmäßigen Eigentümer und seinen Freunden bringt die Kugel wahres Glück.“
Entsetzt und scheu sah die Alte auf das schöne Kind. „Wer bist du?“ „Ich bin Luana, das Mondmädchen, und mir gehört die Kugel, die du gefunden hast. Du hast viel Böses getan, aber es sei dir verziehen, wenn du jetzt dein Unrecht einsiehst und bereust.“
Die sterbende Greisin zitterte am ganzen Körper: „Ja, ja, ich bin schlecht gewesen! Trotzdem Johannes Reinald und seine Mutter mir immer nur Gutes erwiesen haben, suchte ich sie doch auf alle Weise sie zu kränken. Heute Nacht drang ich in ihren Stall ein und wollte alle ihre Tiere vernichten, denn ich wusste, wie lieb sie ihnen waren. Dabei trat ich fehl und kam zu Fall, und mußte die ganze Nacht hilflos am Boden liegen.“
„Das ist des Sünders Lohn!“ sagte Luana wieder ernst. „Aber der Allmächtige wird auch dich in Gnaden annehmen, wenn dir deine Sünde leid tut! Bedenke deine letzte Stunde ist da!“
„Ja, ja! Ich bereue alles Unrecht von Herzensgrund,“wimmerte die Alte kläglich. „Anna Reinald und Johannes vergebt mir.“ „Wir tragen dir nichts nach, Muhme. Du kannst in Frieden heimfahren.“ Die arme Alte tat einen tiefen Atemzug und legte sich befriedigt zurück. „Das lohne euch Gott in Zeit und Ewigkeit!“ Eine Stunde später war sie verschieden.
Als der Abend kam und die Zeit des Mondaufganges nicht mehr fern war, fasste Luana Frau Reinalds Hände: „ Mutter Anna, die Scheidestunde naht. Wenn der Vollmond am Himmel steht, muß ich von euch gehen. Habt Dank für alle Liebe und vergesst mich nicht.“
Johannes traten die Tränen in die Augen und die Witwe drückte das Pflegetöchterchen zärtlich an sich. „Ach, mein Liebling, wenn du doch bei uns bleiben könntest!“ Luana sah ihre beiden Beschützer herzlich an: „ Ich bin sehr gerne bei euch gewesen, aber ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich nun zu den Meinen heimkehren darf. Habt Dank!
Wärt ihr dem natürlichem Rachebedürfnis gefolgt und hättet ihr die Feindin hilflos liegen lassen, so hätte ich niemals mein Kleinod wiedererlangt! Und nun kommt mit mir hinaus auf die Waldwiese. Wenn die Mondstrahlen, unsere Boten, meine wiedergefundene Kugel sehen, dann herrscht große Freude in meiner Heimat; und Mutter Luna kommt und holt mich heim ins Vaterhaus. Seid nicht traurig, ihr Guten, sondern freut euch mit mir, dass mein Leid in Freude verwandelt ist. Wenn ich kann, sehe ich euch von Zeit zu Zeit wieder.“
Während sie also sprach, hatte Luana das rote Röckchen und Käppchen abgestreift und stand nun, wie einst, in überirdischer Schönheit leuchtend, vor ihren Freunden. "Kommt, kommt, es ist Zeit.“ Betrübt und doch froh, folgten ihr Frau Reinald und Johannes auf die Waldwiese hinaus. So lieb sie den kleinen, fremden Gast gewonnen hatten, so freuten sie sich doch von Herzen, dass er nun wieder in die ersehnte Heimat zurückkehren durfte.
Inzwischen war der Vollmond aufgegangen. Da hob Luana mit beiden Händen die silberne Kugel zu ihm empor, und die Mondstrahlen glänzten über alle Maßen herrlich auf dem wiedergefunden Kleinode. Gleich darauf glitt es wie eine Sternschnuppe vom Himmel herunter.
"Mutter Luna, Mutter Luna! Jubelte das schöne Kind und breitete die Arme der überirdischen Frauengestalt entgegen. „Nun darf ich heimgehen! Dank, Dank, ihr Lieben! Einen Augenblick später schwebten Mutter und Kind Hand in Hand dem leuchtenden Mond zu; und melodisches, wundersames Klingen zog durch die stille Nacht.
Weinend schlang Johannes die Arme um Frau Reinalds Hals. „ Ach, Mutterle, wie einsam wird es uns sein! Aber trotzdem freue ich mich, dass wir die silberne Kugel gefunden haben, und Luana nun wieder bei den Ihren ist!“ „So ist es recht, mein Sohn,“ sagte Frau Anna ernst. Man muß nie an sich selbst, sondern immer an das Wohl der anderen denken. Nun komm heim und laß uns in treuer Arbeit unser Leben fortsetzen.“
Viele, viele Jahre waren seitdem vergangen. Längst schlummerte Mutter Anna im Schatten der Kirchhoflinden; und der frische, fröhliche Johannes von einst war nun ein angesehener, tüchtiger Mann und schon Großvater. Nimmer aber konnte er sein wundersames Jugenderlebnis vergessen; und mit Freude und Sehnsucht dachte er an Luana.
Unermüdlich erzählte er den lauschenden Enkelkindern von der silbernen Kugel und dem lieblichen Mondmädchen; und atemlos hörten die blondhaarigen Knaben und Mädchen zu. Ein blauäugiges Dirnlein besonders, zu Ehren der lieben Verlorenen „Luana“ genannt, konnte nie genug bekommen.
"Ach, Großvater, wenn dich das liebe Mondkind nur ein einzig mal sehen könnte!“ Der Greis nickte, in wehmütige Erinnerungen verloren. „Ja, Liebling, ich würde mich auch freuen, und versprochen hat es mir damals Luana. Aber sie muß wohl keine Erlaubnis mehr bekommen haben, die Erde zu besuchen.“
Acht Tage nach diesem Gespräch trat Johannes Reinald nach seiner Gewohnheit abends noch einmal an die Betten der Enkelkinder. Da stutzte er plötzlich. Hell schien der Vollmond ins Zimmer, und an seinen silbernen Strahlen glitt soeben Luana, das Mondmädchen, zu ihrer irdischen Namensschwester herab.
Freundlich sprach und spielte sie mit dem entzückenden Kinde, und der Greis konnte sich an dem lieblichen Bilde gar nicht satt sehen.“ Luana!“ rief er endlich leise und sehnsüchtig. Da wandte sich die Kleine und sah den einstigen Retter und Gespielen liebreich an.
„Gott segne dich, Johannes Reinald! Ich bin sehr glücklich, und das habe ich dir zu danken. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehen durfte. Du bist inzwischen ein alter Mann geworden, und ich bin noch immer ein Kind. Aber uns beide eint dankbares Gedenken an unser wundersames Erlebnis.“
Als Johannes aufsah, war Luana verschwunden. Er sah sie auf dieser Erde nicht wieder, aber er vergaß Luana nicht und gedachte stets mit Freude und Rührung des lieblichen, fremden Gastes.
Helene Berthold 1925, das dreizehnte Bändchen
VOM KLINKESKLANKEN LOWESBLATT ...
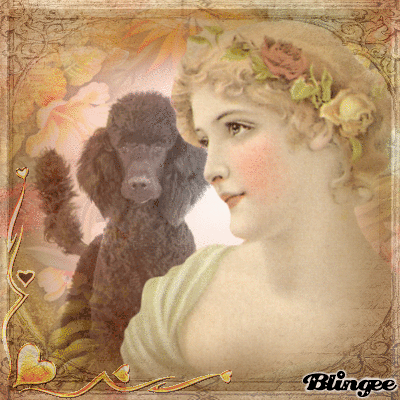
Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, und die jüngste war sein Herzblatt. Einst wollte er nach dem Jahrmarkt, um etwas einzukaufen, und er fragte die drei Töchter, was er ihnen mitbringen solle. Die erste wünschte sich ein goldenes Spinnrad, die zweite einen goldenen Haspel, die dritte ein klinkesklankes Lowesblatt. Der König versprach es und reiste weg.
Als er auf den Markt kam, kaufte er das goldene Spinnrad und den goldenen Haspel; aber das klinkesklanke Lowesblatt war nirgends feil, und so viel Mühe er sich auch gab, er konnte es nicht finden. Da wurde er sehr traurig; denn die jüngste Tochter war ihm lieb wie seine Seele, und er hätte ihr so gern eine Freude gemacht.
Als er so missmutig Heim ritt, kam er an einen großen, großen Wald und in dem Walde an einen großen Birkenbaum, und unter dem Birkenbaume lag ein großer schwarzer Pudelhund. Als der den König so traurig sah, fragte er ihn, was ihm fehle. »Ach«, versetzte der König, »ich sollte meiner jüngsten Tochter, die mir die allerliebste ist, ein klinkesklankes Lowesblatt mitbringen und kann es nirgends kriegen; deshalb bin ich traurig.«
»Da kann ich dir helfen«, sagte der Pudel; »hier in diesem Baume wächst das klinkesklanke Lowesblatt, und wenn du mir nach Jahr und Tag das gibst, was dir heute aus deinem Hause am ersten entgegen kommt, so sollst du es haben.« Erst wollte der König nicht und besann sich lange; endlich aber dachte er: »Ei, was wird denn das anderes sein, als unser Hund; versprich es nur«, und er versprach es.
Da wedelte der Pudel, kletterte in die Birke, brach das Blatt mit seiner krausen Pfote und gab es dem König, indem er sagte: »Halte aber ja Wort; denn sonst geht es dir nicht gut!« Der König wiederholte seine Zusage, nahm das Blatt und ritt fröhlich von dannen.
Als er nicht mehr fern vom Hause war, siehe, da sprang ihm seine jüngste Tochter freudig entgegen; und der König entsetzte sich, ihm wurde so weh ums Herz, und er stieß die Tochter von sich. Da weinte sie und dachte: »Was soll das heißen, daß der Vater mich von sich stößt?« und ging hinauf und klagte es der Mutter.
Bald kam auch der König herein, gab der ältesten das goldene Spinnrad, der mittleren den goldenen Haspel und der jüngsten das klinkesklanke Lowesblatt und war still und traurig. Da fragte ihn die Königin, was ihm fehle, und warum er die jüngste Tochter von sich gestoßen habe; er aber ließ sich nichts von der Geschichte aus.
Und er war das ganze Jahr betrübt und härmte sich und grämte sich und wurde blaß und mager, so griff es ihn an; wenn aber die Königin ihn fragte, schüttelte er mit dem Kopfe oder ging weg. Endlich, als das Jahr bald um war, konnte er es nicht mehr aushalten und erzählte das Unglück und meinte, seine Gemahlin würde sterben vor Schreck.
Sie verjagte sich auch, faßte sich aber gleich wieder und sagte: »Ihr Männer denkt doch an nichts! Haben wir nicht noch das Gänsehirtenmädchen? Das wollen wir ausschmücken und dem Pudel geben; was weiß so ein dummer Pudel davon?« Und als der Tag kam, zogen sie dem Gänsehirtenmädchen die Kleider ihrer jüngsten Tochter an, daß es war wie aus der Beilade genommen; und sie waren noch kaum damit fertig, als es draußen bellte und an der Pforte kratzte.
Sie sahen hinaus, und richtig! er war es, der große schwarze Pudelhund. Wer mochte dem nur das Rechnen gelehrt haben? Denn ein Jahr hat doch über dreihundert Tage, und da verzählt sich auch wohl ein Mensch, geschweige denn ein Pudel! Er hatte sich aber nicht verrechnet; er war da, um die Königstochter abzuholen.
Freundlich traten ihm der König und die Königin entgegen und führten ihm das Gänsehirtenmädchen heraus; da wedelte und kratzte er, legte sich strecklangs auf den Bauch und sprach:
»Sett dick up min Swänschen,
Ick will dick hentildenschen!«
und als sie sich auf ihn gesetzt hatte, ging es fort und davon, daß die Heide wackelte. Bald kamen sie an den großen, großen Wald, und als sie bei der großen Birke waren, stand der Pudel still, um sich erst ein wenig auszuruhen; denn es war heiß, und hier gab es kühlen Schatten.
Rings umher streckten aber viele Gänseblumen ihre weißen Köpfchen aus schönem Grase hervor, und das Mädchen dachte an seine Eltern und seufzte so für sich hin: »Ach, wenn hier doch mein Vater wäre, hier könnte er die Gänse leicht hüten; denn hier ist schöne fette Weide!«
Da stand der Pudel auf, schüttelte sich und sagte: »Was bist du denn für eine?« Sie antwortete: »Ich bin ein Gänsehirtenmädchen, und mein Vater hütet die Gänse« und hätte gern gesagt, wie ihr die Königin befohlen hatte; aber unter diesem Baume konnte kein Mensch lügen, das ging nicht und ging nicht. Da sprang er unwirsch vor sie hin und war gräulich anzusehen und sagte:
»Sett dick up min Swänschen,
Ick will dick hentildenschen!
du bist die Rechte nicht, dich kann ich nicht brauchen.«
Als sie aber nicht fern mehr vom Königshause waren, sah sie die Königin und merkte, was da für Wind wehe; deshalb nahm sie flugs das Besenbindermädchen, zog ihm noch schönere Kleider an, und als nun der Pudel kam und gewaltig böse tat, führte sie ihm das Besenbindermädchen heraus und sagte: »Dieß ist nun aber die Rechte!«
»Das wollen wir einmal sehen«, erwiderte der Pudelhund, daß der Königin ganz grausig wurde, und dem Könige die Kehle fast zugeschnürt ward; der Pudel aber wedelte und kratzte, legte sich strecklangs auf den Bauch und sprach:
»Sett dick up min Swänschen,
Ick will dick hentildenschen!«
und als das Besenbindermädchen sich auf ihn gesetzt hatte, ging es fort und davon, daß die Heide wackelte. Bald kamen sie wieder an den großen Wald und an die große Birke, und als sie da so saßen und sich ausruhten, dachte das Mädchen an seine Eltern und seufzte so für sich hin:
»Ach, wenn hier mein Vater wäre, hier könnte er leicht Besen binden; denn hier gibt es schlanke Reiser die Menge!« Da stand der Pudel auf, schüttelte sich und sagte: »Was bist du denn für eine?« Sie hätte gern gelogen, denn die Königin hatte es befohlen, und das war eine strenge Herrin; aber sie konnte es nicht, weil sie unter diesem Baume war, und antwortete:
»Ich bin ein Besenbindermädchen, und mein Vater bindet Besen.« Da sprang er wie toll vor sie hin und war über alle Maßen gräulich anzusehen und sagte:
»Sett dick up min Swänschen,
Ick will dick hentildenschen!
du bist die Rechte nicht, dich kann ich nicht brauchen.«
Als sie nun wieder an das Königshaus kamen, und der König und die Königin, die immer aus dem Fenster geschaut hatten, sie sahen, da weinten und jammerten sie, besonders aber der König, denn die jüngste Tochter war sein Augapfel; und die Hofleute heulten und schluchzten auch, und war eitel Wehklagen überall.
Es half aber alles nicht; der Pudel kam an und sagte: »Nun gebt mir aber die Rechte, sonst geht es nicht gut!« und sprach das mit so fürchterlicher Stimme und machte dabei so wütige Gebärden, daß allen das Herz still stand und die Haut schauderte. Und als sie die jüngste Tochter heraus führten, in weißen Kleidern und bleich wie Schnee, daß es aussah, als wäre der Mond aus düsteren Wolken hervor getreten; da merkte der Pudel, daß dies die Rechte sei, und sagte mit liebkosender Stimme:
»Sett dick up min Swänschen,
Ick will dick hentildenschen!«
und lief viel sanfter, hielt auch in dem großen Walde nicht wieder unter der Birke still, sondern eilte immer tiefer in den Wald hinein, bis sie da endlich bei dunkler Nacht an ein kleines Haus kamen, wo er die Königstochter, die eingeschlafen war, leise, lose auf ein weiches Bette setzte.
Und sie schlummerte weiter und träumte von ihren Eltern und von dem seltsamen Ritt und lachte und weinte im Schlafe; der Pudel aber legte sich in seine Hütte und bewachte das Häuschen und die Königstochter.
Als diese am anderen Morgen erwachte und sich Mutterseelen allein fand, da weinte sie und jammerte sehr und wollte fliehen; aber sie konnte es nicht, denn die Hütte war verwünscht und ließ wohl jemanden ein, aber niemanden wieder aus. Eßen und Trinken stand da genug, und wie es eine Königstochter nur wünschen mag; aber sie mochte nicht und rührte keinen Bißen an.
Auch der Pudel war nirgends zu hören und zu sehen; doch sangen die Vögel wundersüß, ringsum weideten muntere Rehe und sahen die Königstochter groß an, und der Morgenwind kam und ringelte ihre goldenen Locken und goß frische Farbe über ihr Antlitz. Und die Königstochter seufzte und sprach: »Ach, wäre doch nur ein einzig menschlich Wesen hier, und wär es auch die elendeste und schmutzigste Bettlerin; ich wollte sie küssen und drücken und lieb und wert halten!«
»Wolltest du das wirklich?« krächzte dicht hinter ihr eine grelle Stimme, daß die Königstochter zusammenfuhr, so erschrak sie; und als sie sich umsah, stand ein steinaltes Mütterchen da mit Triefaugen, die glotzte sie an und sprach: »Eine Bettlerin hast du gerufen, eine Bettlerin ist da; verachte künftig keine Bettlerin und höre zu!
Der Pudelhund ist ein verwünschter Königssohn, diese Hütte ein verwünschtes Schloß, der Wald eine verwünschte Stadt, und alle Tiere sind verwünschte Menschen; wenn du nun eine echte Königstochter bist und auch die Armen lieb hast, so kannst du alles erlösen und reich und glücklich werden. Jeden Morgen läuft der Pudel fort, weil er muß, jeden Abend kehrt er heim, weil er will; und um die Mitternachtsstunde streift er sein raues Fell ab und ist ein ordentlicher Mensch.
Wenn er dann an deine Kammer klopft, laß ihn nicht ein, so viel er auch bittet und bettelt, die erste Nacht nicht, die zweite Nacht nicht und die dritte Nacht erst recht nicht; in der dritten Nacht aber, wenn er sich müde gesprochen hat und eingeschlafen ist, nimm das Fell, mach ein lustig Feuer an und verbrenne es; verschließ aber ja zuvor die Kammertür fest, daß er nicht herein kann, und öffne nicht, so lieb dir dein Leben ist, wenn er an der Tür kratzt; und wenn du Hochzeit hast, so sag dreimal, vergiß es aber ja nicht, hörst du? so sag dreimal:
›Alte Zungen,
Alte Lungen!‹
so sprechen wir uns wieder.« Die Königstochter merkte sich alles ganz genau, und weg war die Alte.
Die erste Nacht bat der Königssohn und schmeichelte, sie möchte doch öffnen; sie antwortete: »Das tue ich nicht« und tat es auch nicht. Die zweite Nacht bat er noch viel süßer; sie antwortete gar nicht, duckte den Kopf ins Kissen und öffnete nicht. Die dritte Nacht bat er so rührend und sang dazwischen so wundersüße Weisen, daß sie eben aufspringen und öffnen wollte, als ihr zum Glück die alte Frau einfiel und Vater und Mutter; da zog sie flugs das Deckbett über den Kopf und öffnete nicht.
Klagend zog der Königssohn sich zurück, aber sie hörte es nicht, und als er schlief, brachte sie rasch das Feuer in Schwung, schlich auf den Zehen hinaus, holte das raue Fell aus der Ecke, wohin der Pudel es immer legte, verriegelte die Kammertür und warf es in die Flamme.
Heulend sprang der Pudel auf, nagte und kratzte an der Tür, drohte, bat, knurrte, heulte wieder; aber sie öffnete nicht, und er konnte es auch nicht, so wütend er dagegen sprang. Jetzt zum letzten mal loderte das Feuer hell auf: da geschah ein ungeheurer Knall, als ob der Himmel berste und die Hölle dazu; und vor ihr stand der schönste Königssohn von der Welt, und die Hütte war ein herrliches Schloß, der Wald eine große Stadt voll Paläste, die Tiere aber waren allerhand Menschen.
Und als die Hochzeit gefeiert wurde, und der Königssohn und die Königstochter bei Tische saßen, und der alte König und die alte Königin auch samt den beiden Schwestern und vielen reichen und vornehmen Leuten; da rief die Braut dreimal:
»Alte Zungen,
Alte Lungen!«
und herein kam das zerlumpte Mütterchen.
Die alte Königin schalt, und die beiden Königstöchter schalten mit und wollten sie hinaus jagen; die junge Königin aber stand auf, ließ die Alte sich auf ihren Platz setzen, aus ihrem Teller essen und aus ihrem Becher trinken; und als das Mütterchen satt war, sahe sie die Königin und die bösen Töchter an, daß sie krumm und lahm wurden, die junge Königin aber segnete sie, daß sie noch siebenmal schöner wurde, und niemand hat je wieder was von ihr gehört oder gesehen.
Märchen aus der Sammlung von Carl und TheodorColshorn: Märchen und Sagen aus Niedersachsen.
DIE SPINNE UND DIE BIENE ...
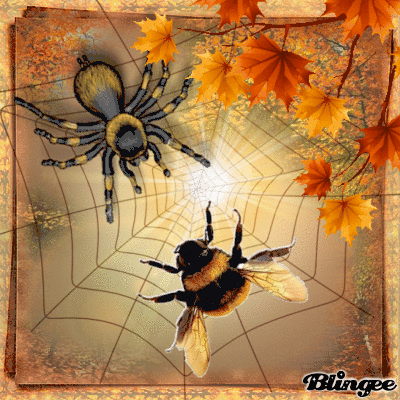
Eine Biene flog umher, ihre Arbeit zu vollbringen und ihre Nahrung zu suchen. Da ist sie zu einer Spinnen gekommen, die ein Netzlein ihrer Kunst webte und spann. Da sprach die Spinn zu der Biene: „Du brummender, unruhiger Vogel, wo rennst du den ganzen Tag hin?“
Antwortete ihr die Biene: „Ich flieg umher zu den süßen Blümlein und schaff mit meiner Arbeit die Nahrung des Honigs.“Sprach die Spinn: „Es ist eine Torheit, daß du um ein Tröpflein Honig also weit umher läufst.“
Antwortete die Biene: „Wahrlich ist es eine Torheit, daß du verurteilst, wovon du nichts verstehst, Ich verliere nichts von dem Meinen und arbeite für sicheren Gewinn. Du aber wartest den ganzen Tag, mergelst dich selber aus um ungewissen Vorteil. Wenn nichts in dein ausgespanntes Garn fällt, so hast du dein Gut verloren.
“Jeder, wie er es ansieht.
Johannes Pauli
DER RIESE UND DER ZWERG ...
Einen Zwerg, der sich am Wege niedergesetzt hatte, belästigten die Fliegen sehr. Sie saßen auf einmal auf seinem Knie, da schlug er zu und schlug sie alle sieben tot.
Voll Freude darüber schrieb er an seine Mütze: >>Ich bin ein Herr von großer Macht, ich habe sieben geschlagen mit einem Schlag.<<
Er blieb noch länger da sitzen uns schlief endlich ein. Nun kam ein Riese daher gegangen, der trug eine große eiserne Stange in der Hand. Als er den Zwerg erblickte, dachte er bei sich :>> Den will ich verschlucken.<< Wie er aber näher kam und las, was an der Mütze stand, machte er daß er fort kam.
Er tat einen gewaltigen Sprung, stürzte dabei und brach sich ein Bein. Von dem Krachen, welches durch seinen Fall enstand, war der Zwerg aufgewacht. Der Riese aber fing an zu schreien und um Hilfe zu rufen: >>Bitte, hilf, << rief er dem Zwerg zu, >>du sollst auch mein bester Bruder sein.<<
Da ging der Zwerg hin und holte Hilfe. Sieben Zwerge trugen den Riesen zur Stadt, wo sein Bein geheilt wurde.
Märchen aus Niedersachsen
ZEUS UND DAS PFERD ...
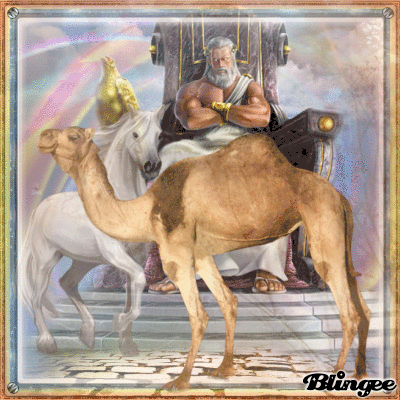
Vater der Tiere und Menschen, so sprach das Pferd und nahte sich dem Throne des Zeus, man will, ich sei eines der schönsten Geschöpfe, womit die Welt gezieret, und meine Eigenliebe heißt mich es glauben. Aber sollte gleichwohl nicht noch verschiedenes an mir zu bessern sein?
Und was meinst du denn, daß an dir zu bessern sei? Rede, ich nehme Lehre an: sprach der gute Gott, und lächelte.
Vielleicht, sprach das Pferd weiter, würde ich flüchtiger sein, wenn meine Beine höher und schmächtiger wären; ein langer Schwanenhals würde mich nicht verstellen: eine breitere Brust würde meine Stärke vermehren; und da du mich doch einmal bestimmt hast, deinen Liebling, den Menschen zu tragen, so könnte mir ja wohl der Sattel anerschaffen sein, den mir der wohltätige Reiter auflegt.
Gut, versicherte Zeus; gedulde dich einen Augenblick! Zeus mit ernstem Gesichte, sprach das Wort der Schöpfung. Da quoll Leben in den Staub, da verband sich organisierter Stoff; und plötzlich stand vor dem Throne - das häßliche Kamel.
Das Pferd sah, schauderte und zitterte vor entsetzendem Abscheu. Hier sind höhere und schmächtigere Beine, sprach Zeus; hier ist ein langer Schwanenhals; hier ist eine breitere Brust; hier ist der anerschaffene Sattel! Willst du Pferd, daß ich dich so umbilden soll?
Das Pferd zitterte noch. Geh, fuhr Zeus fort; dieses mal sei belehrt, ohne bestraft zu werden. Dich deiner Vermessenheit aber dann und wann reuend zu erinnern, so daure du fort, neues Geschöpf - Zeus warf einen so erhaltenden Blick auf das Kamel - und das Pferd erblicke dich nie, ohne zu schaudern.
Gotthold Ephraim Lessing
DER ESEL WILL DEN HERRN LIEBKOSEN ...
Es war einst ein gewisser König, der kleine Hunde über alles liebte, und ob sie gleich Tag und Nacht tüchtig bellten, sie jedoch in seinem Schloß schliefen ließ und gab ihnen dort auch zu essen. Nun gewöhnten sich die Hündchen aber so daran, an des Königs Busen zu schlummern und mit ihm zu speisen, daß sie nirgends anders mehr sein mochten; und manchmal legten sie sogar ihre Pfoten um seinen Hals, und so hatte denn der König seinen großen Spaß und seine Zerstreuung mit ihnen.
Nun gab es da selbst auch einen Esel. - "Wenn ich nun sänge", dachte er, wie er das alles mit ansah, - "und vor dem König herumtanzte und legte auch seine Beine um seinen Hals, so würde er gewiß auch mir zu fressen geben, was mein mein Herz nur nur begehrte, und meinen Kopf, den lege ich dann auch in seinen Schoß, um dort zu ruhen.
Sogleich sprang er aus dem Stall heraus, kam in die Hofhalle hereingetrabt und begann zu singen. Dann sprang er auf den König los, um seinen Nacken mit seinen Beinen zu umschlingen, wie er es bei den Hündchen gesehen hatte. Aber ebenso schnell rannten die Diener hinzu, die nichts anderes glauben konnten, als daß der Esel toll geworden sei, rissen ihn zurück, verabreichten ihm eine gehörige Tracht Prügel und jagten ihn in seinen Stall zurück.
Gesta Romanorum
DIE LIST DES FUCHSES UND DES STORCHES ...

Zu einem Storch kam ein Fuchs. Einer klagte dem anderen seinen merklichen Mangel und Hunger: "Denn die Frösche", sprach der Storch - "tunken sich unter Wasser und fliehen unter die Stöcke am Ufer, sobald sie meine Ankunft bemerken. "Eben also auch", klagte der Fuchs - "ist mir es nicht wohl möglich, die Mäuse aus ihren Höhlen zu locken."
Nach mehreren Ratschlägen entschlossen sie sich die Sache folgendermaßen anzugehen. Der Fuchs ging zum Gestade eines Sees, darin viel Frösche ihre Wohnung hatten. Er sagte zu ihrem König, daß er eilends käme, ihm anzuzeigen, daß die Mäuse vor hätten, die Frösche heimlich und meuchlings zu überfallen. Sie sollten es aber frisch mit den Mäusen wagen, denn er, der Fuchs, wollte ihnen seinen Beistand treulich zusichern. Diesen Worten glaubten die Frösche und versprachen, den Kampf aufzunehmen.
Andernteils tat auch der Storch vor der Festung der Mäuse sagen, wie die Frösche aus großer Hoffart und Vertröstung auf ihre Stärkung vor hätten, die Mäuse zur gemeinsamer Feldschlacht zu fordern, und dies gar bald und eilends. Die Frösche hätten auch schon einen Platz da ausgemacht. Darum würde es schimpflich und ihnen übel nachzusagen sein, solches abzuschlagen. Es sollte ihnen jedoch an seinem Beistand und gutem Rate nicht fehlen.
Siehe, also wurden diese beiden Teile zum Kriege angehetzt und mit Zorn über und wider einander erhitzt, so daß jeder darauf bedacht war, als erster und Bestgerüsteter auf der Kampfstatt zu erscheinen. Der Fuchs brachte andere Füchse mit, auch der Storch mehrere Störche; Füchse umgaben die Mäuse, Störche die Frösche, hielten also mit ihnen Haus, daß ihrer wenig die Haut davon brachten.
Kehr dich nicht an loses Geschwätz, das dich zur Raserei aufhetzt, und späte Reue dir bringt zuletzt.
Hans Wilhelm Kirchhof
DER KNABE UND DIE SCHLANGE ...

Ein Knabe spielt mit einer zahmen Schlange. Mein liebes Tierchen, sagte der Knabe, ich würde mich mit dir so gemein nicht machen, wenn dir das Gift nicht benommen wäre. Ihr Schlangen seid die boshaftesten, undankbarsten Geschöpfe! Ich habe es wohl gelesen, wie es einem armen Landmann ging, der eine, vielleicht von deinen Ureltern, die er halb erfroren unter einer Decke fand, mitleidig aufhob, und sie in seinen erwärmenden Busen steckte. Kaum fühlte sich die Böse wieder, als sie ihren Wohltäter biß; und der gute freundliche Mann mußte sterben.
Ich erstaune, sagte die Schlange. Wie parteiisch eure Geschichtsschreiber sein müssen! Die unsrigen erzählen diese Historie ganz anders. Dein freundlicher Mann glaubte, die Schlange sei wirklich erfroren, und weil es eine von den bunten Schlangen war, steckte er sie zu sich, ihr zu Hause die schöne Haut abzustreifen. War das recht?
Ach, schweig nur; erwiderte der Knabe. Welcher Undankbare hätte sich nicht zu entschuldigen gewusst?
Recht, mein Sohn; fiel der Vater ein, der diese Unterredung zugehört hatte, dem Knaben ins Wort. Aber gleichwohl, wenn du einmal von einem außerordentlichen Undank hören solltest, so untersuche alle Umstände genau, bevor du einen Menschen mit so einem abscheulichen Schandfleck brandmarken lässt. Wahre Wohltäter haben selten Undankbare verpflichtet; ja, ich will zur Ehre der Menschheit hoffen - niemals. Aber die Wohltäter mit kleinen eigennützigen Absichten, die sind es wert, mein Sohn, daß sie Undank anstatt Erkenntlichkeit einwuchern.
Gotthold Ephraim Lessing
DIE JUNGE SCHWALBE ...

"Was macht ihr da?" fragte eine Schwalbe, die geschäftigen Ameisen. "Wir sammeln Vorrat auf den Winter;" war die geschwinde Antwort. "Das ist klug, sagte die Schwalbe; das will ich auch tun." Und sogleich fing sie an, eine Menge toter Spinnen und Fliegen in ihr Nest zu tragen.
"Aber was soll das?" fragte endlich ihre Mutter. "Wozu? Vorrat auf den bösen Winter; liebe Mutter sammle doch auch! Die Ameisen haben mich diese Vorsicht gelehrt."
"O laß den irdischen Ameisen diese kleine Klugheit", versetzte die Alte; "was sich für sie schickt, schickt sich nicht für bessere Schwalben. Uns hat die gütige Natur ein holderes Schicksal bestimmt. Wenn der reiche Sommer sich endet, ziehen wir von hinnen; auf dieser Reise entschlafen wir allgemach, und da empfangen uns warme Sümpfe, wo wir ohne Bedürfnisse rasten, bis uns ein neuer Frühling zu einem neuen Leben erwecket."
Gotthold Ephraim Lessing
DIE GESCHICHTE EINES ALTEN WOLFS, IN SIEBEN FABELN ...

Der böse Wolf war zu Jahren gekommen und fasste den gleißenden Entschluß, mit den Schäfern auf einem gütlichen Fuß zu leben. Er machte sich also auf und kam zu dem Schäfer, dessen Horden seiner Höhle am nächsten waren.
Schäfer, sprach er, du nennst mich den blutgierigen Räuber, der ich doch wirklich nicht bin. Freilich muß ich mich an deine Schafe halten, wenn mich hungert; denn Hunger tut weh. Schütze
mich nur vor dem Hunger; mache mich nur satt,
und du sollst mit mir recht zufrieden sein. Denn ich bin wirklich das zahmste, sanftmütigste Tier, wenn ich satt bin.
Wenn du satt bist? Das kann wohl sein: versetzte der Schäfer. Aber wann bist du denn satt? Du und der Geiz werden es nie. Geh deinen Weg! Der abgewiesene Wolf kam zu einem zweiten Schäfer.
Du weißt Schäfer, war seine Anrede, daß ich dir, das Jahr durch, manches Schaf würgen könnte. Willst du mir überhaupt jedes Jahr sechs Schafe geben; so bin ich zufrieden. Du kannst als denn sicher schlafen und die Hunde ohne Bedenken abschaffen.
Sechs Schafe? sprach der Schäfer. Das ist ja eine ganze Herde. Nun weil du es bist, so will ich mich mit fünfen begnügen: sagte der Wolf. Du scherzt fünf Schafe! - Mehr als fünf Schafe
opfre ich kaum im ganzen Jahr dem Pan. Auch nicht viere? fragte der Wolf weiter; und der Schäfer schüttelte spöttisch den Kopf.
Drei? - Zwei? - Nicht ein einziges; fiel endlich der Bescheid.
Denn es wäre ja wohl töricht, wenn ich mich einem Feinde zinsbar machte, vor welchem ich mich durch meine Wachsamkeit sichern kann.
Aller guten Dinge sind drei; dachte der Wolf und kam zu einem dritten Schäfer.
Es geht mir recht nahe, sprach er, daß unter euch Schäfern als das grausamste, gewissenloseste Tier verschrien bin. Dir Montan, will ich jetzt beweisen, wie unrecht man mir tut. Gib mir jährlich
ein Schaf, so soll deine Herde in jenem Wald, den niemand unsicher macht als ich, frei und unbeschädigt weiden dürfen.
Ein Schaf! Welche Kleinigkeit! Könnte ich großmütiger, könnte ich uneigennütziger handeln? - Du lachst Schäfer? Worüber lachst du denn?
O über nichts! Aber wie alt bist du, guter Freund? sprach der Schäfer. Was geht dich mein Alter an? Immer noch alt genug, dir deine liebsten Lämmer zu würgen.
Erzürne dich nicht, alter Isegrim! Es tut mir leid, daß du mit deinem Vorschlag einige Jahre zu spät kommst. Deine ausgebissenen Zähne verraten dich. - Du spielst den Uneigennützigen, bloß um dich desto gemächlicher, mit desto weniger Gefahr nähren zu können.
Der Wolf ward ärgerlich, fasste sich aber doch und ging auch zu dem vierten Schäfer. Diesem war eben sein treuer Hund gestorben, und der Wolf machte sich den Umstand zu Nutze.
Schäfer, sprach er, ich habe mich mit meinen Brüdern in dem Wald veruneinigt, und so, daß ich mich in Ewigkeit nicht wieder mit ihnen aussöhnen werde. Du weißt, wie viel du von ihnen zu fürchten hast! Wenn du mich aber, anstatt deines verstorbenen Hundes, in Dienste nehmen willst, so stehe ich dir dafür, daß sie keines deiner Schafe auch nur scheel ansehen sollen.
Du willst sie also, versetzte der Schäfer, gegen deine Brüder im Wald beschützen? - Was meinte ich denn sonst? Freilich! Das wäre nicht übel! Aber, wenn ich dich nun in meine Horden ein nähme, sage mir doch, wer sollte als denn meine armen Schafe gegen dich beschützen! Einen Dieb ins Haus nehmen, um vor den Dieben außer dem Hause sicher zu sein, das halten wir Menschen.
Ich höre schon: sagte der Wolf; du fängst an zu moralisieren. Lebe wohl!
Wäre ich nicht so alt! knirschte der Wolf. Aber ich muß mich, leider, in die Zeit schicken. Und so kam er zu dem fünften Schäfer. Kennst du mich, Schäfer? fragte der Wolf. Deinesgleichen wenigstens kenne ich, versetzte der Schäfer.
Meinesgleichen? - Daran zweifle ich sehr. Ich bin ein so sonderbarer Wolf, daß ich deiner und aller Schäfer Freundschaft wohl wert bin! Und wie sonderbar bist du denn? - Ich könnte kein lebendiges Schaf würgen und fressen, und wenn es mir das Leben kosten sollte. Ich nähre mich bloß mit toten Schafen. Ist das nicht löblich! Erlaube mir also immer, daß ich mich dann und wann bei deiner Herde einfinden und nachfragen darf, ob dir nicht.....
Spare der Worte! sagte der Schäfer. Du müsstest gar keine Schafe fressen, auch nicht einmal tote, wenn ich dein Feind nicht sein sollte. Ein Tier, das mir schon tote Schafe frisst, lernt leicht aus Hunger kranke Schafe für tot und gesunde für krank ansehen. Mache auf meine Freundschaft also keine Rechnung und geh!
Ich muß nun schon mein Liebstes daran wenden, um zu meinem Zwecke zu gelangen! dachte der Wolf und kam zu dem sechsten Schäfer. Schäfer, wie gefällt dir mein Pelz? fragte der Wolf. Dein Pelz? sagte der Schäfer. Laß sehen! Er ist schön; die Hunde müssen dich nicht unter ihnen gehabt haben.
Nun höre, Schäfer; ich bin alt und werde so lange nicht mehr treiben. Füttere mich zu Tode, und ich vermache dir meinen Pelz. Ei sieh doch! sagte der Schäfer. Kommst du auch hinter die Schliche der alten Geizhälse? Nein, nein; dein Pelz würde mich am Ende siebenmal mehr kosten, als er wert wäre. Ist es dir aber ein Ernst, mir ein Geschenk zu machen, so gib ihn mir jetzt. - Hiermit griff der Schäfer nach der Keule, und der Wolf floh.
O die Unbarmherzigen! schrie der Wolf und geriet in die äußerste Wut. So will ich auch als ihr Feind sterben, ehe mich der Hunger tötet; denn sie wollen es nicht besser! Er lief, brach in die Wohnungen der Schäfer ein, riß ihre Kinder nieder und ward nicht ohne große Mühe von den Schäfern erschlagen.
Da sprach der Weiseste unter ihnen: Wir taten doch wohl Unrecht, daß wir den alten Räuber auf das Äußerste brachten und ihm alle Mittel der Besserung, so spät und erzwungen sie auch war, benahmen.
Gotthold Ephraim Lessing.
