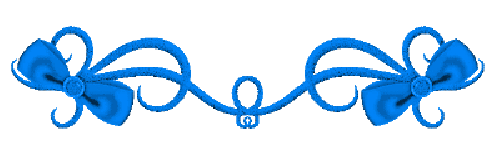MÄRCHEN AUS POLEN
VERZEICHNIS
„Strafe der Unzucht in Kehl“
„Vom Knecht, der eine Hexe ausspürte“
„Die kluge Kasia“
„Hexensabbat“
„Der verlorene Hammer“
„Kachna und Magda“
„Geizbauch“
„Vom Mäusepelzchen“
„Die Feindschaft zwischen Hund und Katze“
„Die Kuhhaut“
„Die Geschichte vom Zauberer“
„Der Igel“
„Das Märchen vom Königssohn“
„Die Rose“
„Vom armen Mädchen, das Königin wurde“
"Vom armen Fischersohn“
„Die Geschichte vom Königssohn Argelus“
„Der Teufel als Liebhaber“
„Vom Zauberstein“
„Ein Ofenhocker wird Prinz“
„Das Märchen vom Lämmchen“
„Die böse Stiefmutter“
„Wie aus dem Knecht ein Herr wurde“
„Die Tiere im Waldhaus und die beiden Schwestern“
„Schwester und Braut“
„Die Prinzessin und die zertanzten Schuhe“
„Die Macht des Büchleins“
„Das Madejlager (Schmerzlager)“
„Der Taugenichts“
„Die Farnblüte“
„Die vergessene Braut“
„Der gute Hirte“
„Die Lebensbäume“
„Das Märchen vom Wolf und dem Hund“
„Belohnte Mildtätigkeit“„Rübezahl und die Mutter“
„Die Räuberpredigt“
„Rätselmärchen“
„Die Krügerin zu Eichmedien“
„Die einäugige Not“
„Hans“
„Stachelsöhnchen“
„Von einem Grafen, der die Not nicht kannte“
„Die Froschprinzessin“
„Die Hochzeit der Wichtelmännchen“
„Das Schneiderlein Nadelfein“
„Der Geisterzug“
„Vom Werwolf“ 3 Geschichten
„Das Hasenherz“
„Der tapfere Soldat und der Geist“
„Der Schmied vor dem Höllentor“
„Bergestürzer und Eichenreisser“
„Vom Hexenmeister“
„Der Vogel Cäsarius“
„Titelituri“
„Nikolaj“
„Der Drache von Wawel“
„Der letzte Kampf der Stoleme“
„Der Schatz Kaschubiens“
„Die Pest“
„Twardowski“
„Der böse Blick“
„Die Grotten im schwarzen Berge“
"Der Windreiter“
„Madey“
„Boruta“
„Der Teufelstanz“
„Die Kröte“
„Knüppel raus“
„Die Flucht“
„Der arme Student“
„Die Pestjungfrau“
„Die Krähe“
„Herr und Diener“
„Goldbeutel, Tabakspfeife und Wunschsack“
„Der kleine Bzdzionek“
„Der Ritt in das vierte Stockwerk“
„Die Prophezeiung der Lerche“
„Das wunderbare Pfeifchen“
„Der Hexenmeister und sein Lehrling“
„Das Märchen vom Schlangenkönig“
„Die goldenen Tauben“
„Der goldene Apfel“
„Vom Pflaumenbaum der Goldstücke trug“
„Der Glasberg“
„Dobrodzieniak“
„Von Alibaba“
„Die drei Brüder“
„Die Monate“
DIE MONATE ...

Ein Mann, ein Witwer, hatte eine Tochter. Er heiratete ein zweites Mal, eine Witwe, die auch eine Tochter hatte. Während ihr Mann zur Arbeit ging, bereitete sie, die Mutter, ihrer eigenen Tochter viele Annehmlichkeiten; gab ihr stets besser zu essen und putzte sie besser heraus. Aber ihrer, Stieftochter, die Tochter ihres Mannes, gab sie schlechteres Essen, kleidete sie scheußlich und schlug sie mitunter sogar. Obwohl sie ihre eigene Tochter so bevorzugte, fand sich für diese kein einziger Freier, aber seine Tochter hatte mehrere Verehrer. Wenn sie in die Schenke gingen, so tanzte seine Tochter ständig, aber ihre Tochter stand immer nur an der Tür. Da beklagte sich diese Tochter bei ihrer Mutter, daß sie, die doch so hübsch gekleidet sei, nicht zum Tanze geholt würde, während die andere, die in so häßlichen Kleidern steckte, dauernd tanze. Darauf sagte ihre Mutter zu ihr: „Wenn wir ihr nur etwas antun könnten, damit sie stirbt!“ „Wir schicken sie einfach in den Wald“, entgegnete ihre Tochter.
Derzeit herrschte strenger Frost, und es lag viel Schnee. Da sagte ihre Tochter zu seiner Tochter: „Gehe in den Wald und bringe mir einen Strauß Veilchen!“ Des Vaters Tochter, Kasia, ging und sagte weinend:„Jetzt ist da draußen doch so starker Frost, und überall liegt viel Schnee, Veilchen wird es nirgendwo im Walde geben!“ Der Mutter der Tochter, Magda, antwortete: „Du wirst gehen, und wenn du erfrierst!“
Kasia ging also in den Wald und sah etwas weiter entfernt ein Feuer lodern. Sie schritt geradeswegs auf dieses Feuer zu. Als sie näher herangekommen war, sah sie rings um das Feuer zwölf Männer sitzen. Die Männer riefen sie heran und fragten: „Wohin gehst du, Mädchen?“ „Mich haben meine Stiefmutter und deren Tochter hinaus getrieben“, entgegnete sie, „ich soll Veilchen suchen. Mein Gott, wo soll ich bei diesem Frost Veilchen finden?“ Aber die Männer beruhigten sie und sagten: „Setz dich erst mal, Mädchen, und wärme dich!“ Dann ergriff einer von ihnen das Wort: „Zwölf Monate gibt es doch im Jahr. Welcher von diesen zwölf Monaten ist wohl der klügste und der beste?“
Nach kurzem Besinnen erwiderte Kasia: „Sie sind alle gleich, denn alle wurden von demselben Herrgott geschaffen.“ Da forderte der März den April, der April, aber dann den Mai auf, den Wanderstab zu nehmen, ihn in den Boden zu stoßen, damit an dieser Stelle warmer Frühling würde und Veilchen erblühen könnten. Bald konnte sie sich einen ganzen Strauß Veilchen pflücken, bedankte sich und ging damit nach Hause.
Dort angekommen, wunderten sich Magda und die Stiefmutter mächtig darüber, wo wohl Kasia diese Veilchen hätte pflücken können. Der Stiefmutter kam jetzt das Gelüst nach Äpfeln. Also forderte sie Kasia auf: „Da du Veilchen hast bringen können, wirst du jetzt schnell in den Wald laufen und Äpfel bringen!“ Und Kasia ging wieder, klagend und weinend: „Wo soll ich nur bei diesem starken Frost Äpfel finden? Wo finde ich sie?“
Sie ging in den Wald und stieß wieder auf dieses hell flackernde Feuer; sie schritt auf das Feuer zu, und da saßen wieder die zwölf Männer und fragten sie: „Wohin gehst du, Mädchen?“ „Meine Stiefmutter und deren Tochter haben mich hinaus getrieben“, entgegnete sie, „ich soll Äpfel bringen!“ Da sagten die zwölf: „Setze dich und wärme dich!“ Sie setzte sich. Einer der Männer fragte: „Zwölf Monate gibt es im Jahr, sage uns, welcher von den zwölf der klügste oder des beste ist?“ Und sie erwiderte darauf: „Alle zwölf sind sich gleich, denn alle wurden von dem gleichen Herrgott geschaffen!“
So befahl der Juli dem August, einen Stab zu nehmen und mit ihm an den Apfelbaum zu schlagen, damit an dieser Stelle Sommer würde und ein Apfelbaum erblühte, dann trug der August dem September auf, die Äpfel reifen zu lassen. So konnte sich das Mädchen eine Anzahl Früchte pflücken und ging mit ihnen nach Hause. Die Stiefmutter und deren Tochter waren über alle Maßen verwundert, wo sie diese Äpfel herbekommen hatte.
Schließlich sagte Magda zu ihrer Mutter: „Mutter, ich werde jetzt selbst nach Äpfeln gehen!“ „Gehe, meine Tochter, gehe“, sagte die Mutter. So machte sich Magda auf den Weg. Sie gelangte in den Wald und sah ebenfalls das Feuer lodern. Da ging sie auf das Feuer zu und sah, daß rings um das Feuer zwölf Männer saßen, die sie, als sie herangekommen war, fragten: „Wohin gehst du, Mädchen?“ Und sie antwortete: „Ich will Äpfel holen!“
„Gut!“ sagten sie, „Setz und wärme dich; aber sag uns, welcher von den zwölf Monaten des Jahres wohl der klügste oder der beste ist?“ „Keiner von ihnen ist gut. Der Februar bringt Kälte, der April, macht was er will, der Mai frisst dem Vieh das letzte Heu.“ Die Tochter der Stiefmutter hatte ein loses Mundwerk und antwortete unfreundlich, bis die zwölf sie bestraften. So schlug der Frost zu, der Schnee schüttete, so daß Magda im Schnee versank, der Schnee wehte sie zu, und sie erfror.
Ihre Mutter wurde ganz unruhig, weil die Tochter so lange ausblieb, und immer noch nicht wiederkam. Sie ging, um sie zu suchen. Aber auch die Mutter wurde vom Schnee zugeweht und erfror wie ihre Tochter.
Doch die gute Kasia wurde eine Herrin, denn ein reicher Herr kam und heiratete sie.
Quelle: Kolberg,
DIE DREI BRÜDER ...
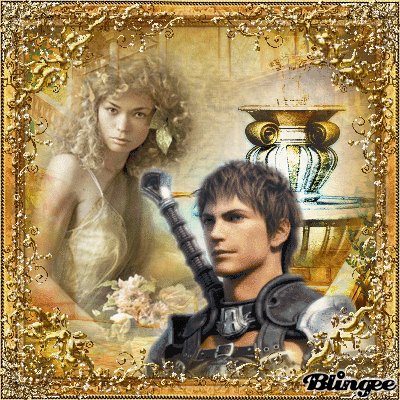
Eine Hexe in Gestalt eines großen Falken schlug immer die Fensterscheiben der Dorfkirche entzwei. In dem Dorfe wohnten drei Brüder, die wollten den schädlichen Falken töten. Doch vergebens lauerten die beiden älteren mit ihren Flinten: so oft der Vogel herabkam, schloß ihnen der Schlaf die Augen, und sie erwachten erst, wenn schon die Fenster des Gotteshauses klirrten.
Auch der jüngste stellte sich nun auf die Lauer. Um nicht einzuschlafen, steckte er sich Dornen unter das Kinn: die sollten ihn stechen und munter machen, wenn er etwa in Gefahr kam, einzunicken. Der Mond schien; es war beinah so hell wie am Tage. Da hörte der junge Mann ein Sausen in der Luft. Die Hexe sah ihn und schickte die Schlummersucht auf ihn hinab. Seine Augen machten sich zu, sein Kopf neigte sich, - aber da stachen ihn die Dornen bis aufs Blut, und er wurde munter. Er griff nach der Flinte, zielte auf den Falken und schoß. Der Falke fiel neben einem großen Steine nieder, sein rechter Flügel war zerschmettert.
Der Bursche lief hin und sah, daß ein ungeheurer Abgrund sich unter dem Steine öffnete. Er sagte dies seinen Brüdern und schleppte mit ihrer Hilfe ein langes Seil und eine Menge Kienspäne herbei. Das Seil mit dem angebrannten Kien ließen sie bis auf den Boden des Abgrundes hinunter. Dann ließ sich der Jüngling selbst am Seile hinab. Unten blühten schöne Blumen und immergrüne Bäume.
Mitten in dieser wundervollen Umgebung stand ein großes, fest gemauertes Schloß. Das eiserne Tor war weit geöffnet, und in einem goldenen Zimmer saß eine Jungfrau, die kämmte ihr goldenes Haar. Sowie ein Haar zu Boden fiel, klang es wie reines Metall. Er sah sich die Jungfrau näher an: sie war glatt und weiß, hatte blitzende Augen und lockiges Haar. Von Liebe entbrannt, kniete er vor ihr nieder und bat sie, seine Frau zu werden. Sie willigte freundlich ein, aber sie sagte noch: »Ich darf erst dann auf die Erde kommen, wenn die alte Hexe nicht mehr lebt; sie ist aber nur mit einem alten Schwerte umzubringen, das hier im zweiten Zimmer hängt. Dieses Schwert ist so groß und schwer, daß Du es gewiß nicht heben kannst.«
Der Jüngling ging nun in das zweite Zimmer. Hier war alles aus Silber, und wieder saß da eine Jungfrau, die Schwester seiner Braut. Sie kämmte ihr silbernes Haar, und wenn eins auf die Erde fiel, klang es wie eine Saite. Die Jungfrau reichte ihm das Schwert, aber er konnte es nicht heben. Da kam die dritte Schwester hinzu und gab ihm Tropfen, die den Menschen stärker machen. Er trank einen Tropfen, aber noch hob er das Schwert nicht. Er trank noch einen, und schon rührte es sich etwas, als er es anfaßte. Nach dem dritten Tropfen konnte er das Schwert heben und hin und her schwenken.
Nun wartete er auf die alte Hexe. Sie kam als Falke und nahm dann menschliche Gestalt an. Der junge Bursche schwang sein Schwert kräftig in der Luft und schlug ihr das Haupt ab. Jetzt packte er alle Schätze zusammen und ließ sie von den Brüdern hinaufziehen ans Tageslicht, hernach auch die drei Schwestern, - nur er allein war noch unten. Da beschlich ihn ein Mißtrauen gegen seine Brüder; er band einen Stein an das Seil und ließ ihn hochziehen. Die beiden Brüder oben zogen kräftig, als aber der Stein in der Mitte war, ließen sie los, - und der Stein sauste hinab und zerschmetterte.
»So wären meine Knochen zerschmettert, hätte ich meinen Brüdern getraut«, sagte der Jüngling und fing an bitterlich zu weinen, - aber nicht wegen der Schätze, sondern wegen seiner Braut mit dem Schwanenhals und dem goldgelockten Haar. Betrübt irrte er in dem schönen unterirdischen Lande umher.
Da traf ihn ein Zauberer und fragte nach der Ursache seiner Tränen. Als er alles erfahren hatte, sagte er zu dem Jüngling: »Sei ruhig, junger Mann; ich will Dich auf die Erde hinaufbringen. Aber Du mußt vorher meine Kinder retten, die auf dem Apfelbaume verborgen sind und die ein anderer Zauberer verfolgt und auffrißt. Vergebens hab ich sie in der Erde verborgen, vergebens im fest gemauerten Schlosse. Jetzt hab ich sie auf dem Apfelbaume versteckt. Verbirg Dich dort, um Mitternacht kommt der Bösewicht an.«
Der Jüngling bewaffnete sich mit dem Schwerte, kletterte auf den Apfelbaum und verschmauste die herrlichen Äpfel als köstliches Abendessen. Um Mitternacht sauste der Wind. Ein großer, langer Wurm kam heran geschossen, - gerade auf den Baum zu. Er wickelte sich um den Stamm und kroch immer höher. Er streckte seinen Hals aus und suchte mit gierigen Augen nach dem Neste der kleinen Kinder. Da schwang der Jüngling sein Schwert und hieb den mächtigen Kopf des Drachen mit einem Streich herunter.
Da war der Vater der kleinen Kinder froh über den Tod seines Feindes, und zum Dank nahm er den Jüngling huckepack auf den Rücken und trug ihn hinauf auf die Erde. Der Jüngling eilte zu dem weißen Hofe seiner Brüder, aber niemand wußte, wer er war. Nur seine Braut, die bei ihren Schwestern als Küchenmädchen dienen mußte, erkannte sogleich den Geliebten.
Seine Brüder hatten ihn schon für tot ausgegeben. Sie gaben ihm alle seine Schätze zurück und flohen erschreckt in die Wälder. Er aber ließ sie zurückrufen, teilte alles mit ihnen, baute ein großes Schloß mit goldenen Fenstern und lebte dort mit seiner goldgelockten Gattin glücklich bis an den Tod.
Polen: K.W. Woycicki: Volkssagen und Märchen aus Polen
VON ALIBABA ...

Es waren einmal zwei Brüder, der eine war arm, der andere reich. Der Arme hieß Alibaba und wußte von einem Gewölbe im Wald, wo Räuber ihre Beute aufbewahrten. Alle paar Tage schlich er sich zu diesem Gewölbe, nahm ein paar Goldstücke, und wenn sie ihm ausgegangen waren, ging er wieder hin. Aber er war es überdrüssig, immer nur so wenig mit zu nehmen, und so fuhr er eines Tages mit einem Wagen in den Wald, nahm ein paar Säcke mit Geld und brachte sie in seine Hütte. Er wollte nun aber unbedingt erfahren, wie viel er hatte, und so schickte er seine Frau zu dem reichen Bruder nach einem Viertelmaß, mit dem er das Geld messen könnte.
Der reiche Bauer lieh ihm das Maß; weil er aber neugierig war, was Alibaba zu messen hatte, bestrich er den Boden mit Pech. Alibabas Frau nahm das Maß und brachte es in die Hütte zu ihrem Mann. Der maß das Geld und sandte dem Bruder den Scheffel zurück. Der Reiche blickte auf den Boden und fand am Teer ein Goldstück; sogleich vermutete er, daß sein Bruder zu Reichtum gekommen war, und ging zu Alibaba, um zu erfahren, woher ihn hatte.
Alibaba sperrte sich nicht, er erzählte ihm alles: wo dieses Gewölbe sich befand und daß man, damit die Tür sich öffnete, sagen mußte: „Sesam, öffne dich!“ Der Reiche war hocherfreut, spannte das Pferd vor den Wagen und fuhr in den Wald. Er fand das Gewölbe und sagte, genau wie ihn Alibaba angewiesen hatte: „Sesam, öffne dich!“ Die Tür des Kellers tat sich auf, der Reiche kroch hinein und befahl der Tür, sich zu schließen; danach füllte er alle Säcke und Fässer, die er bei sich hatte, mit Gold.
Als er nichts mehr zum Einpacken hatte, ging er zur Tür und wollte, daß sie sich öffnete, aber er hatte vergessen, wie sie anzurufen war, und sagte: „Gerste, öffne dich!“, weil er glaubte, daß es so hieß. Die Tür aber rührte sich nicht. Wieder schrie der Reiche: „Weizen, öffne dich!“ Die Tür blieb geschlossen. Der Bauer rief die Tür mit jeglichen Getreidenamen an, aber es half alles nichts, denn sie wollte, sich nicht öffnen.
In diesem Augenblick kamen die Räuber, die dort hausten, zur Höhle und sagten: „Sesam, öffne dich!“ Die Tür ging auf, sie krochen in das Gewölbe, der Bauer aber, der zu entkommen suchte, lief ihnen genau vor die Füße, da griffen sie ihn und sagten: „Du bist das also, der uns das Gold gestohlen hat! Warte nur, wir werden es dir heimzahlen.“ Sie vierteilten den Bauern und hängten die Säcke an der Tür auf.
Am folgenden Tag kam der Arme zur Höhle, um Gold zu holen und sagte: „Sesam, öffne dich!“ Die Tür ging auf. Alibaba blickte auf die Tür, da war sein Bruder daran aufgehängt. Er grämte sich, denn es war ihm leid um ihn. Er nahm ein paar Goldstücke, lud den zerstückelten Leichnam auf den Wagen und fuhr nach Hause. Unterwegs dachte er: „Man muß die Stücke zusammennähen und ihn heimlich begraben.“
Er fuhr in die Stadt, in der die beiden Brüder wohnten, ging auf den Markt und holte einen Schuster. Dieser flickte die Stücke mit Pechfäden zusammen, und Alibaba beerdigte sie in einer Grube. Als die Räuber anderntags ihre Höhle aufsuchten, öffnete sich die Tür vor ihnen, und alle sahen, daß die Leiche nicht mehr da war und auch vom Gold etwas fehlte.
Zwei der Räuber gingen zum Ältesten und sprachen: „Wir gehen beide in die Stadt, um zu erfahren, wer das Geld nimmt. Und wir wollen des Todes sein, wenn wir es nicht herausfinden.“ Der Räuberhauptmann und die übrigen der Kumpanei erwiderten: „Gut, geht, aber wenn ihr nichts herauskriegt, dann werden wir euch wirklich töten.“ Die beiden Räuber eilten sogleich in die Stadt.
Die Straßen waren noch menschenleer, nur jenen Schuster erblickten sie auf dem Markt, der den zerstückelten Bruder zusammengenäht hatte, und sie fragten ihn: „Warum seid Ihr heute so früh aufgestanden?“ Der Schuster sagte: „Ich bin heute um Mitternacht aufgestanden, weil ich bis zum Morgen einen Körper zusammengenäht habe.“ Die Räuber dachten bei sich, daß es bestimmt jene Teile waren, die er zusammengeflickt hatte, und sie sagten zum Schuster: „Sag uns, in welcher Hütte Ihr den Leib zusammengenäht habt, wir wollen Euch dafür auch gut bezahlen.“ Der Schuster war einverstanden. Sie gaben ihm etwas Geld, und er zeigte ihnen das Haus Alibabas.
Da die Räuber nun Bescheid wußten, machten sie am Tor mit Rötel ein Zeichen, um es in der Nacht wiederzuerkennen, und kehrten zugleich wieder in den tiefen Wald zurück.
Alibaba hatte eine Dienerin, die hieß Maryjanna. Diese Maryjanna ging morgens vor das Haus und erblickte am Tor ein rotes Zeichen. Sie ahnte, daß jemand ihrem Herrn etwas Böses antun wollte, kaufte sofort Rötel und machte das gleiche Zeichen auch an drei andere Haustore. Am Abend kamen alle Räuber in die Stadt und befahlen den beiden, sie zu dem Haus zu führen, das sie gekennzeichnet hatten. Der Räuberhauptmann fragte sie: „Wo ist das Haus, in dem dieser Mensch wohnt?“
„Wir haben sein Haus mit Rötel bezeichnet“, antworteten die beiden Räuber. Schließlich kamen sie an den Platz, wo Alibabas Haus stand, das Zeichen aber war an vier Toren. Da kehrten die Räuber zornig in ihre Höhle zurück; die beiden aber mußten sterben. Nachdem sie die beiden erschlagen hatten, blieben noch achtzehn Räuber.
Der Räuberhauptmann steckte die siebzehn anderen in Fässer, lud sie auf einen Wagen und fuhr in die Stadt. Aufs Geratewohl fuhr er auf Alibabas Hof und fragte ihn, ob er ihn mitsamt der Naphtfässern beherbergen könne, weil er sich fürchte, in der Nacht weiterzufahren. Alibaba stimmte zu, die Räuber aber hatten sich im Wald verabredet, daß der Anführer sie um Mitternacht aus den Fässern holen sollte und sie gemeinsam den töten wollten, der ihnen das Nachtquartier gegeben hatte.
Die Dienerin aber, als sie den Worten des Räubers entnommen hatte, daß er Naphta mitührte, dachte bei sich: „Wenn du, Freundchen, siebzehn Fässer Naptha fährst, dann kann ich ein bißchen für die Lampe nehmen, das wenige wird dich nicht arm machen.“ Sie nahm die Lampe und ging Naphta abzapfen. Sie stöpselte ein Fass auf und sah darin einen Räuber; sie entkorkte das zweite – wieder ein Räuber; sie blickte reihum in alle Fässer und fand in jedem ein Räuber.
Da ging sie ein paar Kessel Wasser abkochen, um mit diesem Sud die Räuber in den Fässern zu übergießen. Am Abend saß der Räuberhauptmann mit Alibaba zu Tisch, und unter seinem Bauernrock guckte ein scharfes Schustermesser hervor, das ihm zum Töten diente. Als Maryjanna dieses Messer sah, näherte sie sich heimlich und zog es ihm heraus, ohne daß er dessen gewahr wurde.
Dann packte sie es mit beiden Händen und bohrte es ihm in die Brust. Als sie Alibaba von den Räubern in den Fässern erzählte, machten sie auch denen gemeinsam den Garaus. Alibaba aber fuhr am folgenden Tag zu jener Räuberhöhle, nahm alles Gold und Geld, kaufte sich ein Stück Land und bewirtschaftete es bis zu seinem Tode.
Quelle: Chelchowski, Przasnysz
DOBRODZIENIAK ...
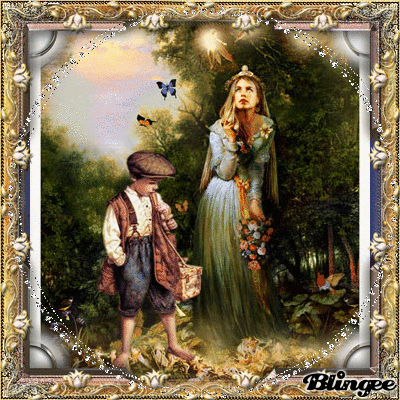
In alten Zeiten, als man noch die Waren aus Wroclaw über Krakow nach Brody fuhr, gab es in Dobrodzien viele Fuhrleute, die für diese Fahrten mehr als vierzig Pferde hielten. Einer dieser Fuhrleute, der in jungen Jahren Witwer geworden war und eine Tochter hatte, verheiratete sich erneut. Gleich nach der Hochzeit fuhr er für ein ganzes Jahr in die Welt.
Auf dem Rückweg, als er dem Hause schon nahe war, kündigte er sich, wie er es gewohnt war, mit Peitschenknallen an, damit seine Frau zur Begrüßung heraus käme. Als sie sich aber nicht blicken ließ, wendete er noch einmal und knallte wieder, aber die Frau kam nicht. Er fuhr noch einmal vor, da trat seine Tochter heraus und erzählte dem Vater, dass die Stiefmutter sich schlecht aufführe, es mit Buhlen treibe und die Heimkehr des Ehemannes nicht erwartet habe.
Voller Zorn betrat der Fuhrmann die Stube, schrie die Frau an und tadelte sie streng, die Frau aber leugnete nicht nur alles ab, sondern sagte zu ihm: „Du wirst schon noch sehen, was für eine Tochter du hast; wenn du das nächstemal heimkehrst, findest du sie mit einem Kind auf dem Arm.“ Nach einer gewissen Zeit begab sich der Fuhrmann wieder auf eine weite Reise, erst nach einem Jahr erwartete man seine Rückkehr.
Inzwischen ging die Stiefmutter zu ihrer Tante, einer Hexe, ließ sich einen Zaubertrank für die Stieftochter bereiten, damit diese in der Tat vor der Heimkehr des Vaters einen Knaben gebäre. Nach einem Jahr kam der Vater zurück und knallte, als er sich dem Haus näherte, mit der Peitsche, und auf dieses Zeichen hin lief die Frau sofort aus dem Haus und erzählte ihm, die Tochter habe vor Stunden einen Sohn geboren.
Der Fuhrmann betrat also mit großem Zorn die Kammer, schalt die Tochter und wies sie aus dem Hause. Die Tochter verlegte sich aufs Bitten; da sie aber den Zorn des Vaters nicht zu besänftigen vermochte, hüpfte der neugeborene Knabe aus dem Bett, hieß den Alten willkommen und sagte: „Wie ist es Euch ergangen, Alterchen? Begrüßt uns und ärgert Euch nicht über mich und meine Mutter!“
Danach hüpfte der Knabe durch die Kammer, über die Bänke, den Tisch, der Alte aber blickte nicht auf, er befahl der Tochter, sich ohne Verzug aus dem Hause zu scheren und ihm nie mehr unter die Augen zu treten. Die Tochter musste sich schließlich aus dem Wochenbett erheben und ihre Sachen packen, der Knabe aber tröstete sie und wies sie an, zwei Bündel zu schnüren, und er sagte, dass er das seine selbst tragen würde. Der Junge nahm ein Päckchen, die Mutter das andere, und so verließen sie die Stadt.
Alsbald wurde die Mutter jedoch von solcher Schwäche übermannt, dass der Sohn auch das zweite Bündel tragen musste. So führte er die Mutter bis nach Wien, wo der österreichische Kaiser regierte. Zu eben dieser Zeit war aber der böse Feind ins Land eingefallen, und dem Kaiser fehlte ein Befehlshaber für die Armee; der junge Wandersmann aber ließ in der Stadt verlauten, dass er, wenn sie ihn nun zum Befehlshaber machten, den Feind schon aus dem Land treiben würde.
Also ließ ihn der Kaiser zu sich rufen und übertrug ihm den Befehl über sein ganzes Heer. Der Wanderer hielt, was er versprochen hatte, und in kurzer Zeit besiegte er den Feind und jagte ihn aus dem Lande. Seit dieser Zeit standen er und seine Mutter in Wohlstand und großer Gnaden bei Hofe. Der Kaiser aber hatte einen Sohn, mit dem sich Dobrodzieniak – so wurde der junge Mann geheißen – für eine Wanderschaft verabredete. Sie hatten bereits so manches Land bereist, und schließlich wollte der junge Prinz nach Sibirien gehen, aber sein Gefährte riet ihm davon ab und erzählte ihm, dass man dort die Menschen vor den Pflug spanne und sie noch schlimmer behandele als das Vieh. Weil der Prinz aber auf sein Vorhaben bestand, zogen sie schließlich in dieses Land.
Dort erging es ihnen jedoch schlecht, denn sie wurden gefangen genommen und mussten schwer arbeiten. Außer ihnen befanden sich dort mehr als zweihundert Gefangene aus verschiedenen Ländern, die man zur Nacht in einen großen Pferdestall brachte.
Einst als alle Wächter schliefen, sagte Dobrodzieniak zu den Gefangenen, dass keiner von ihnen am Morgen aufstehen sollte und dass er dafür einstehen wollte, dass ihnen nichts Böses geschähe. Als die Zeit zum Aufstehen gekommen war und der Wächter den Stall betrat, um sie zu wecken, rührte sich keiner der Gefangenen. Der Wächter kam zum ersten -, zum zweiten – und zum drittenmal – immer vergeblich.
Da ging er und meldete den Vorfall dem Zaren, der ließ Soldaten aufmarschieren, um die Häftlinge zur Strafe mit Ruten auszupeitschen. Die Soldaten führten die Gefangenen hinaus, und Dobrodzieniak wurde nach vorn gebracht, aber kein zaristischer Soldat vermochte sich zu rühren, und die Gefangenen blieben unangefochten, was dem Zaren solche Furcht einflößte, dass er schließlich dem Fremden versprach, alle Gefangenen frei zu lassen, wenn er nur seine Soldaten wiederbeleben würde. Dieser erklärte sich einverstanden, erweckte die Soldaten und begab sich selbst mit den freigelassenen Gefangenen auf die Reise.
Der erzürnte Zar schickte zu ihrer Verfolgung noch mehr Soldaten aus, weil er sie aufhalten wollte. Der Jüngling aber besorgte es ihnen auf gleiche Weise, so dass alle auf der Stelle erstarrten. Der Zar, aufs neue sehr bestürzt, sicherte Dobrodzieniak zu, was immer er verlangte, wenn er nur die Soldaten ins Leben zurück riefe. Dobrodzieniak erbat sich also zwei Schiffe voll Gold, Silber und kostbarer Steine, die ihm der Zar bereitwillig gab.
Weil er jedoch nach wie vor grübelte, auf welche Weise er den Fremdling und seine Gefährten aufhalten könnte, ließ Dobrodzieniak, der des Zaren Absicht durchschaute, alle Bewohner des Landes zu Stein werden und den Boden auf Ewige Zeiten erstarren. So segelten die Gefangenen, angeführt von Dobrodzieniak und dem jungen Prinzen, auf den beiden Schiffen unbeschadet über das Meer und gelangten mit ungeheurem Reichtum nach Hause.
Als sie in der Mitte des Ozeans waren, dankte der junge Fürst dem Gefährten für seine Befreiung. Doch der verlangte dafür, dass der junge Prinz seine Mutter zur Frau nahm, die alle Schätze, die er mit sich führte, als Mitgift bekommen sollte; wenn er sich jedoch dem widersetzte, wollte er ihn ins tiefe Meer werfen. Der Fürst musste wohl oder übel auf die Forderungen des Weggefährten eingehen, und als sie nach Wien zurückkehrten, eröffnete er dem Vater, welche Verpflichtungen ihm Dobrodzieniak für seine Errettung auferlegt hatte, worauf der alte Kaiser auch bereitwillig die Zustimmung gab, und man richtete eine üppige Hochzeitsfeier für den Prinzen und die Mutter von Dobrodzieniak aus, die sowohl jung als auch sehr schön war.
Nach der Hochzeit erbat sich Dobrodzieniak vom alten Kaiser aus, dass er mit der Mutter und dem neuen Vater nach Dobrodzien fahren dürfe. Als sie nach Skrzydlowice kamen, eine Meile vom heimatlichen Dorf entfernt, befahl Dobrodzieniak, ihn in eine Truhe einzuschließen und so in das Haus des Großvaters zu bringen; dort angekommen, sollten sie die Truhe an den Platz stellen, wo er zur Welt gekommen war.
Als sie nun zu dem alten Fuhrmann kamen und um seine Gastfreundschaft baten, nahm er sie gerne auf und hielt es für eine große Ehre, dass so hohe Herrschaften bei ihm einkehrten. Da fragte ihn der Prinz, ob er Kinder habe. Darauf bekannte der alte Fuhrmann mit Trauer, dass er eine Tochter habe, die er im Zorn von sich gestoßen hätte, und dass er nicht wüsste, wo sie abgeblieben sei.
Schließlich gab sich ihm die verlorene Tochter in Gestalt der edlen Prinzgemahlin zu erkennen, und die ganze Familie war sehr glücklich, nur die Stiefmutter fehlte, die gerade in dieser Zeit zu ihrer Tante, der Hexe, gefahren war. Man schickte nach ihr, und als sie kam und auch die Tante mitbrachte, sprang aus der Truhe Dobrodzieniak in kindlicher Gestalt, als ob er gerade erst geboren wäre. Und er hüpfte und sprang wie ehedem und begrüßte den Alten, bis er plötzlich die Stiefmutter und deren Tante ergriff und durch die Stubendecke mit ihnen davon flog.
Alle waren aus tiefster Seele erschrocken und vermochten sich nicht gleich zu fassen, erst nach einer Weile erholten sie sich von dem Schreck, bekreuzigten sich und beredeten im Flüsterton die merkwürdige Erscheinung, dass der böse Geist, mit dem die Hexe ihn heimgesucht hatte, der unschuldigen Familie nichts Böses hatte tun können und nur die Bösewichte selber, durch die den ehrlichen Leuten soviel Unbill zugefügt wurde, in die Hölle entführt hatte.
Von jener Zeit an lebte die Tochter des Fuhrmanns glücklich mit ihrem fürstlichen Ehegespons. Und dem Vater wurde für alle Kümmernisse seines Lebens hundertfältige Freude zuteil.
Quelle: Berwinski Dobrodzien, Slask
DER GLASBERG ...

Auf einem hohen Glasberg stand einst ein Schloß aus puren Gold und vor dem Schlosse ein Apfelbaum mit goldenen Äpfeln. Wer einen Apfel pflückte, der kam in das Schloß hinein, und dort saß eine verzauberte Prinzessin von wunderbarer Schönheit inmitten ungeheurer Schätze und Reichtümer.
Schon viele Ritter hatten versucht, auf den Berg hinauf zu kommen. Auf scharf beschlagenem Pferde kletterte mancher hinan, aber auf halbem Wege stürzte er von dem glatten und steilen Berge hinunter. Einer brach sich den Arm, der andere das Bein, mancher gar das Genick.
Die schöne Prinzessin sah von ihrem Fenster aus, wie die herrlichen Ritter vergebens in die Höhe zu kommen suchten, und schon sieben Jahre wartete sie auf ihren Retter.
Rund um den Berg lagen viele Leichen - Ritter und Pferde. Die ganze Gegend sah aus wie ein Kirchhof.
Es fehlten bloß noch drei Tage zu den sieben Jahren, als ein Ritter in goldener Rüstung auf mutigem Rosse zum Glasberge ritt. Mit mächtigem Anlauf kam er bis zur halben Höhe und kehrte glücklich zurück.
Nach dieser glücklichen Probe machte er am nächsten Tage einen zweiten Versuch. Das Roß stampfte auf dem harten Glase, daß die Funken sprühten. Schon war der Ritter oben bei dem Apfelbaume. Da erhob sich ein großer Falke, rauschte mit seinen breiten Flügeln und traf damit die Augen des Pferdes. Das Pferd wird scheu, bäumt sich hoch empor, seine Hinterfüße glitschen aus, - es fällt mitsamt dem Ritter den steilen Berg hinunter. Von beiden blieben bloß die Knochen übrig, und die klapperten in der zusammengestoßenen Rüstung wie Erbsen in einer Blase.
Jetzt fehlte nur noch ein Tag bis zum Schlusse des siebenten Jahres. Da kam ein flotter Student heran, ein schmucker, kräftiger und großer Jüngling. Er hatte schon zu Hause bei seinen Eltern von der Prinzessin gehört und deshalb im Walde einen Luchs getötet. Jetzt machte er sich dessen Krallen an Händen und Füßen fest, und so kam er glücklich bis zur halben Höhe. Die Sonne war schon am Untergehen. Er konnte kaum atmen vor Müdigkeit, der Mund war ihm ganz trocken vor Durst. Eine schwarze Wolke flog vorüber, doch vergebens bat und flehte er, sie möchte wenigstens einen Tropfen fallen lassen; vergebens öffnet' er den Mund, - die Wolke fliegt vorüber, kein Tröpflein Tau feuchtet seine trockenen Lippen.
Seine Füße sind ganz blutig; er hält sich nur noch mit den Händen. Die Sonne ist verschwunden, - und er blickt nach oben, um noch des Berges Gipfel zu erschauen. Dabei muß er den Kopf so heben, daß ihm die schöne Mütze herunterfällt. Dann blickt er nach unten: - Himmel, was für ein Abgrund, und was für ein schrecklicher Geruch kommt von den Leichen herauf!
Es wird ganz finster. Die Sterne beleuchten blaß den gläsernen Berg. Der kühne Student hängt wie angeschmiedet an seinen Händen. Seine Kraft ist zu Ende, und er erwartet den Tod. Da schließt ihm der Schlaf die Augen. Er vergißt seine gefährliche Lage und schlummert süß ein. Die scharfen Krallen sind aber so fest in das Glas gehackt, daß er bis Mitternacht ganz ruhig schläft und nicht hinunterfällt.
Der Falke, der den Apfelbaum verteidigte und den Ritter mit dem Pferde hinab geworfen hatte, flog jede Nacht als wachsamer Wächter um den Berg. Als nun der Mond aufgegangen war, kreiste er wieder in der Luft, erblickte den Jüngling und ließ sich bei ihm nieder, denn er glaubte, es gebe da eine frische Leiche zu fressen. Aber der Bursche schlief nicht mehr; er sah den Vogel und dachte nach, wie er sich mit dessen Hilfe retten könnte.
Der Falke schlug seine scharfen Krallen in das Fleisch des Jünglings. Da packte dieser plötzlich die Beine des Vogels und ließ sich von ihm empor tragen in die Luft. Das Schloß auf dem Berge glänzte im bleichen Mondlichte wie eine trübe Lampe. Jetzt war der goldene Apfelbaum in der Nähe. Der Bursche zog ein Messer aus dem Gürtel und schnitt dem Falken beide Füße ab. Der Vogel stieg vor Schmerz bis zu den Wolken hinauf, der Jüngling aber fiel in die breiten Äste des Apfelbaums.
Da zog er die Falkenfüße, die noch mit den Krallen in seinem Fleische steckten, heraus, legte die Schale eines goldenen Apfels auf die Wunde, - und gleich war sie geheilt.
Dann pflückte er sich die Taschen voll solch goldener Äpfel und ging dreist ins Schloß hinein. Der Hofplatz war voll Blumen und schöner Bäume, und auf dem Balkon saß die verzauberte Prinzessin mit ihrem Gefolge. Sie ging dem Jüngling entgegen und begrüßte ihn als ihren Herrn und Gemahl. Sie überlieferte ihm alle Schätze, und der junge Bursche wurde ein reicher, mächtiger Herr. Auf die Erde kehrte er nicht mehr zurück.
Einmal ging er mit seiner Gemahlin im Garten spazieren. Da sahen sie unten am Berge eine große Menschenmenge. Sie riefen die Schwalbe herbei, die im Schlosse als Botin diente, und sagten zu dem kleinen Vogel: "Flieg hin und frage, was es da Neues gibt!"
Die Schwalbe flatterte eilig fort, kam bald zurück und sagte: "Das Falkenblut hat die Leichen da unten wieder lebendig gemacht. Alle erwachen heute wie aus einem Schlafe, setzen sich auf die rüstigen Rosse, und alles Volk schaut auf das unerhörte Wunder."
Quelle: Kasimir Wladislaw Woycicki, Polnische Volkssagen und Märchen
VOM PFLAUMENBAUM DER GOLDSTÜCKE TRUG ...
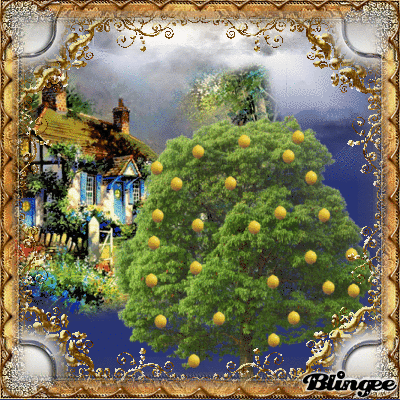
Es lebte vor Jahren in Schlesien ein verarmter Herr. Einmal, als er sich seine Mahlzeit aus dem Dorfweiher holte, hing ihm ein kleiner weißer Fisch an der Angel, der schrie: „ Mach mich los, mach mich los, du kannst dir auch was wünschen!“
Da überlegte der Mann nicht lange, denn ein Fisch, der spricht, kann auch noch andere Dinge, Und so war’s. Er war der Sohn des Zauberers und lernte gerade bei den Fischen, wie man im Wasser lebt. Er konnte schon durch die Kiemen atmen und sich mit den Flossen fortbewegen. Aber die Fische können ja noch viel mehr.
„Wenn ich dich freilassen soll, mußt du auf meinem Pflaumenbaum Goldstücke wachsen lassen“, sagte der Gutsherr.
„ Das kann ich nicht“, antwortete der Fisch, „ da mußt du meinen Vater, den Erzzauberer bitten. Nimm heute vor Mitternacht ein Boot und fahre in die Schilfstraße ein. Dort, wo sie sich gabelt, wähle die rechte Schneise und rudere bis zum Schilfsrohr mit den fünf goldenen Kolben. Dahinter führt ein Kanal, so eng wie ein Nadelöhr, zu unserem Wasserschloß. Der Kanal öffnet sich dir, wenn du sprichst:
„Vogel und Fisch, Mensch oder Baum –
Alles was lebt, einigt im Traum.“
Der Baron tat, wie ihm geheißen. Als sein Kahn zu dem Schilfrohr mit den fünf goldenen Kolben kam, sagte er den Spruch. Da öffnete sich der Kanal, so eng wie ein Nadelöhr, und sein Fahrzeug glitt glatt hindurch. Dann kam er zu dem Wasserschloß. Zwischen schimmernden Gärten saß, umgeben von sieben Töchtern und zwölf Söhnen, der Erzzauberer in seinem Schiff mit Segeln aus Fledermausflügeln. Er sprach mit dem Atem des Windes und der Stimme der Wogen:
„Du hast Mut, dich vor mein Angesicht zu wagen“, sagte er. „Wenn ich wollte, könnte ich dich in ein Sandkorn verwandeln und in die Wüste blasen.“ „Das könnt ihr nicht, Herr“, widersprach der Baron, „denn euer Sohn hat mir versprochen, dass ihr mir einen Wunsch erfüllt. Wenn ihr das Wort nicht haltet, verliert Ihr eure Zauberkraft.“ „Nenne deinen Wunsch und mach dich davon!“, befahl der Erzzauberer. Er war in Eile, denn er hatte eine Verabredung auf dem höchsten Berg der Welt. „So wünsch ich mir, dass auf meinem Pflaumenbaum Goldstücke wachsen“, sagte der Gutsherr. „Wenn’s weiter nichts ist!“ brummte der Zauberer. „Ihr Menschen denkt immer nur an Geld. Geh nach Hause und warte den Herbst ab, dann kannst du die Münzen vom Baum schütteln.“
Da bedankte sich der Mann, wendete seinen Kahn und fuhr durch den Kanal so eng wie ein Nadelöhr, wieder zurück. Gleich ging er zu seinem Pflaumenbaum und schaute nach, ob nicht vielleicht schon ein kleines Goldstück heranwuchs. Aber er sah nur linsengroße, grüne Stummelchen. Es war ja noch zweieinhalb Monate bis zur Ernte. Der arme Baron, den seine Schulden wie Mühlsteine drückten, lief jetzt jeden Morgen aus dem Haus, um nach seinen Goldmünzen zu sehen. Es blieben aber Pflaumen bis in den September hinein.
Eines Nachts, als schon der Herbstwind die Baumkronen schüttelte, hörte er es klingen und klirren, als ob ein Sack Dukaten ausgeschüttet würde. Und als er in den Garten stürzte, hing der Pflaumenbaum voller Goldstücke mit dem Bild des Kaisers. Da tanzte er vor eitel Glück dreimal um den Baum herum, und dann schüttelte er ihn, dass ihm die Dukaten auf den Kopf regneten. In ein paar Säcken sammelte er sie ein, und es hingen immer noch welche hoch oben. Sein Nachbar aber, der nicht schlafen konnte, weil ihn das Zahnweh plagte, hörte das Klirren und Klingeln und kam herbei, denn er meinte, bei dem Baron zersprängen die Fensterscheiben. Als er sah, was sich tat, drohte er dem anderen mit Gericht. Wegen Hexerei wollte er ihn anzeigen, doch dann gab er sich mit der Hälfte der Erntesegens zufrieden.
Der Zauber war aber solche Art, dass von nun an die Hälfte der Golddukaten auf dem Pflaumenbaum des Barons und die andere Hälfte auf dem seines Nachbarn wuchsen. Als das nächste Jahr herankam, schlichen der eine wie der andere wohl ein dutzend Mal am Tag in den Garten, um ihre Pflaumen zu zählen, aus denen bald Goldmünzen werden sollten. Die Frau des Nachbarn, die nicht wusste, warum er immer fortlief, lag ihm deshalb so lange in den Ohren, bis er ihr es eingestand. Dann wußten es bald alle Weiber in Schlesien, und zum Schluß wuchs zwischen Troppau und Freiwaldau nur noch ein Goldstück auf jedem Pflaumenbaum. Auch der Baron erntete nur noch ein einziges Goldstück.
Eines Tages, als er sich einen Braten vom Himmel herunterholen wollte, schoß er eine Wildente flügellahm. Er wollte gerade den Hund nach ihr schicken, da hörte er eine Stimme, die kläglich rief: „Verschone mich, verschone mich, du kannst dir dafür was wünschen!“ Da der Baron den Ton schon kannte, pfiff er den Hund zurück, hob die Wildente aus dem Wasser und verband ihr die Flügel.
„Es tut mir leid, dass ich euch getroffen habe“, sagte der Baron, „ aber wie konnte ich wissen, dass ihr jetzt in der Luft herumgeistert?“ „Ich lerne gerade die Kunst des fliegenden Getiers“, sagte der Sohn des Erzzauberers. Mein Vater hat mich gestern in eine Wildente verwandelt, da bin ich noch ein wenig unerfahren, sonst wäre ich dir nie in die Hände gefallen.“ „Das mag sein, wie es will, aber jetzt musst du mir einen Wunsch erfüllen“, sagte der Baron. „ Ich wünsche mir, dass auf meinem Birnbaum Goldbirnen wachsen.“ – „ So weit bin ich noch nicht“, antwortete der Sohn des Zauberers, „da musst Du meinen Vater bitten.“
Noch in der selben Nacht fuhr der Baron mit seinem Kahn über den Teich. Dort, wo sich die Schilfstraße gabelt, bog er nach rechts ab und hielt vor dem Rohr mit den fünf Kolben. Dann sagte er seinen Spruch und glitt durch den Kanal, so eng wie ein Nadelöhr, zu dem Wasserschloß des Erzzauberers. Der saß mit seinen sieben Töchtern und zwölf Söhnen in einem Schiff und gab gerade Zauberunterricht. In diesem Augenblick bemerkte der den Baron, der in seinem Kahn heran gerudert war.
„Was willst du schon wieder hier?“ fuhr er ihn an. „Weißt du nicht, dass ich dich in einen Wassertropfen verwandeln und ins Meer fallen lassen kann?“
„Das könnt ihr nicht“, widersprach der Baron, „ihr müsst mir vielmehr einen Wunsch erfüllen, weil ich die Wildente, Euren jüngsten Sohn, gerettet habe.“
„Weiß schon, weiß schon“, knurrte der Zauberer unwillig. „Geh heim, warte die Erntezeit ab und schüttle deinen Birnbaum leer, dann hast du mehr Gold, als du je verbrauchen kannst.“
Das wäre auch so gewesen, wenn nicht der Nachbar es wieder entdeckt hätte. Diesmal plagte ihn seine Gicht, sein schmerzendes Knie ließ ihn nicht schlafen. Da hörte er es im Garten nebenan „ plums, plumpumps und plumpumpums“ – das waren des Barons dicke Goldbirnen, die fielen polternd ins Gras. Da lief er hin und verlangte die Hälfte, sonst wollte er ihn anzeigen wegen Hexerei. Und darauf stand damals der Tod auf dem Scheiterhaufen. Was blieb dem Baron übrig?
Er mußte das Geheimnis mit seinem Nachbarn teilen, und gleich war nur noch die Hälfte seiner Birnen aus Gold, die andere Hälfte bloß gut für Zunge, Gaumen und Magen. Und dann plauderte die Frau des Nachbarn das Wunder weiter, sie meinte, sie müsse ersticken, wenn sie es für sich behielte. Da wuchs zuletzt nur noch eine Goldbirne auf jedem Birnbaum zwischen Troppau und Freiwaldau, und endlich waren es nur noch goldene Stengel und Kerne, und dann blieben auch die aus.
„Das nächste Mal muß ich’s klüger anfangen“, sagte der Baron. „ Immer wenn er fischte, hoffte er, dass ihm der jüngste Sohn des Zauberers an der Angel hinge, und wenn er auf die Jagd ging, sah er ihn in jedem Hasen und Schnepfe. Aber sei es, dass der andere nun die Zauberkunst besser verstand oder sie anderswo ausübte – der Baron angelte nur gewöhnliche Barsche und Weißfische und stöberte nur wilde Kaninchen und Wachteln auf.
So verging manches Jahr. Dann kam eine große Dürre über das Land, und wo man früher doppelt und dreifach geerntet hatte, gab es jetzt nur noch ein Viertel oder weniger. Da rückten dem Baron die Gläubiger auf den Hals und wollten ihm das Gut versteigern. Traurig nahm er seine Axt und ging in den Wald, um einen Baum zu fällen, denn er hatte nicht einmal mehr Holz für seinen Kamin. Sowie er aber den ersten Schlag tat, ertönte eine Stimme:
„Laß mich leben, du darfst dir dafür auch was wünschen!“ „Seid Ihr jetzt ein Baum?“ fragte der Baron, der die Stimme wohl kannte. Da sagte der Sohn des Zauberers, dass er gerade lerne, wie die Bäume wachsen und Nahrung aus der Tiefe der Erde ziehen und mit Ast und Zweig gegen den Himmel streben. Bald würde er alles wissen, dann könne er jede Gestalt annehmen und nach Gefallen leben wie Mensch, Tier, Pflanze oder Stein.
„Aber zuerst musst du auf meinem Apfelbaum goldene Äpfel wachsen lassen“, sagte der Baron. „Das kann ich wohl“, antwortete der Sohn des Zauberers, „denn mein Vater hat mich jetzt alles gelehrt. Denke aber daran, wie dir’s mit den goldenen Pflaumen und den Goldbirnen erging, und wünsch dir was anderes!“ Da wünschte sich der Baron, dass Goldstücke aus seinen Fingern sprängen, immer wenn er sie knacken ließ, und das wurde ihm gewährt.
Von jetzt an konnte der Nachbar, von Zahnschmerzen, Gicht oder Magendrücken geplagt, noch so angestrengt aus dem Fenster lauschen, er hörte kein Klirren mehr, kein Plumpsen und kein Hoppla – pardauz. Der Baron aber zahlte seine Schulden und hinterließ seinen Erben die ganze Kornkammer voll Gold. So oft hatte er seine Finger knacken lassen.
Quelle: Die schönsten Märchen von Roderich Menzel
DER GOLDENE APFEL ...
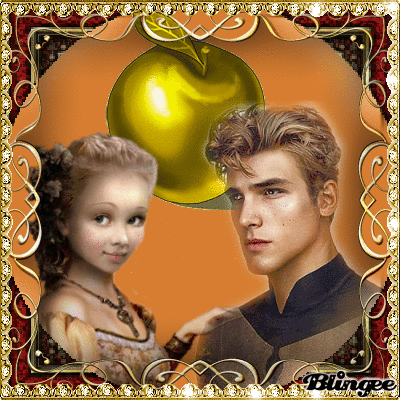
Es war einmal ein Wirt, der hatte drei Söhne, zwei kluge und einen dummen. Auch hatte er einen goldenen Apfelbaum, von dem aber jede Nacht ein Apfel verschwand. Da sagte der Vater zu dem ältesten seiner Söhne, er sollte in der nächsten Nacht Wache halten neben dem Baum und sehen, wer der Dieb sei. Der ging auch hin, als es aber Abend wurde, schlief er ein, und morgens war wieder ein Apfel fort. Da sagte der zweite Sohn: Nun werde ich wachen gehen. Er machte es aber ebenso, wie sein Bruder, schlief ein, und - des Morgens fehlte wieder ein Apfel. Da sagte der Jüngste, der Dumme: Nun werde ich Wache halten gehen, ich werde den Dieb schon fangen.
Er ging hin, setzte sich unter den Baum und blieb auch wirklich wach und munter. Um zwölf Uhr in der Mitternacht kommt ein schwarzes Schwein mit zwei Hörnern, das war der Teufel. Der Jüngste aber springt zu und schlägt es tot. Seine Brüder jedoch standen auf der Lauer und wollten doch sehen, wie es ihm ergehen würde. Als sie nun sahen, daß er das Schwein getötet hatte, fielen sie über ihn her, töteten ihn und vergruben den Leichnam in einem Bruch.
Auf der Stelle, wo der Leichnam vergraben war, wuchs ein Rohr. Ein alter Hirte, welcher dort seine Schafe weidete, schnitt sich das Schilfrohr ab und machte sich daraus eine Flöte. Die Flöte aber spielte folgenden Vers: »Spiele, liebe Flöte, ich habe einen Stein auf meinem Herzen, der älteste Bruder hat mich erschlagen, der zweite hat ihm dazu geraten, und ich habe dem Vater ein Schwein getötet.«
Da verbrannte der Hirte die Flöte, und auf dieser Stelle wuchs ein Apfelbaum mit goldenen Äpfeln. Die Äpfel konnte Niemand anders erreichen als der Hirte: denn wenn ein anderer sie pflücken wollte, wuchs der Baum gleich so hoch, daß er sie nicht berühren konnte. Nun kam einmal eine kleine Katze angelaufen, die sagte zu dem Hirten, er möchte den größten und schönsten der Äpfel abpflücken und verwahren. Das tat der Hirte, und als er den Apfel abgepflückt hatte, fing der Apfel auch an zu singen und sang dasselbe Liedchen.
Er legte den Apfel in einen Kasten, die Katze setzte sich auf diesen und wollte auch nicht mehr fortgehen. Sie sagte zu dem Hirten, er solle die schönste Prinzessin holen, die es gebe, die solle den Apfel aufessen. Da fuhr er denn hin zum König und holte die schönste Prinzessin, und die mußte den Apfel aufessen. Und als sie den Stengel fortschmiß, da geschah ein Knall und der Dumme von den drei Brüdern stand vor ihr. Die Beiden heirateten einander.
Auf der Hochzeit bin ich auch gewesen und habe da Bierchen getrunken; das lief aber alles aufs Kinn, im Mund ist nichts geblieben.
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren, aus Klein-Jerutten
DIE GOLDENEN TAUBEN ...

Es war einmal ein Bauer, der hatte drei Söhne, zwei kluge und einen, den sie den Dummen nannten. Der selbe Bauer hatte auch eine goldene Wiese. Jeden Morgen, wenn der Bauer auf die Wiese kam, sah er, daß da getanzt war, denn das Gras war im Kreise zertreten. Er schickte daher seinen ältesten Sohn, die Nacht über auf der Wiese zu wachen. Der aber bemerkte nichts, vermutlich weil er eingeschlafen war. Danach wachte der zweite, aber es erging ihm nicht besser. Da sagte der Dumme: Vater, laß mich nur wachen, ich werde schon etwas herausfinden.
Und richtig, als er wachte, um 12 Uhr Nachts kamen drei goldene Tauben geflogen, die verwandelten sich in eine Prinzessin und zwei Dienerinnen, legten ihre Flügel in das Gebüsch und fingen an zu tanzen, so daß immer eine sang und die beiden anderen tanzten. Da schlich der Dumme in das Gebüsch, nahm ihnen die Flügel und sagte, als sie die Flügel zurück verlangten: Ich gebe euch eure Flügel nicht eher zurück, als bis jede von euch mir etwas geschenkt hat.
Da schenkte ihm die Prinzessin einen goldenen Ring, eine der Dienerinnen einen goldenen Apfel, die andere Dienerin ... (Was diese schenkte, hatte die Mährchenerzählerin vergessen). Er fragte die Prinzessin, ob sie ihn heiraten möchte; sie ging darauf ein. So fuhren sie also zu seinen Eltern und machten Hochzeit. Als sie nun nach ihrem Schloß zurück wollte, schickte er sich an, sie zu begleiten, sie bat ihn aber, noch ein Jahr bei seinen Eltern zu bleiben, sie wollte mit ihren Mädchen voraus fliegen. Er fragte sie, wo ihr Schloß liege, sie antwortete ihm darauf: mein Schloß liegt da, wo die Sonne untergeht, und wo immer Winter ist. Darauf flog sie davon, er aber blieb noch ein Jahr bei seinen Eltern. Als das Jahr um war, machte er sich auf den Weg nach dem goldenen Schloß.
Er hatte weit zu gehen über Berg und Tal, durch Feld und Wald; endlich erreichte er eine Wiese, auf der sich zwei Riesen um einen Stiefel prügelten. Er fragte sie: »Warum prügelt ihr euch«. Da sagte der eine der Riesen: »Wir haben von unserem Vater einen Stiefel geerbt, der mit jedem Schritt hundert Meilen macht; wir wissen aber nicht, wer von uns beiden ihn haben soll«. Da machte der Dumme ihnen kurzweg den Vorschlag und sagte: »Wißt ihr was?« Dann gebt ihn mir.« Die Riesen gaben ihm auch wirklich den Stiefel, und er zog ihn an, und machte nun mit jedem Schritte hundert Meilen.
Darauf kam er wieder nach einer Wiese, auf der sich wieder zwei Riesen prügelten, und zwar um einen Mantel. Er fragte sie: »Weshalb prügelt ihr euch, und was hat denn der Mantel zu bedeuten?« Da sagte der eine der Riesen: »Wir haben den Mantel geerbt, und er besitzt die Kraft, den jenigen, der ihn um nimmt, unsichtbar zu machen.« Da sagte der Dumme: »Gebt den Mantel mir, dann habt ihr Frieden.« Richtig, er bekam auch den Mantel und nahm ihn sich um.
Darauf wanderte er weiter und kam wieder an eine Wiese, wo sich zwei Riesen um einen Säbel prügelten. Auf seine Frage, was der Säbel für eine Kraft habe, sagte ihm einer der Riesen: »Der Säbel hat die Kraft, was man mit dem selben berührt, das wird lebendig.« Er bekommt den Säbel auf die selbe Weise, wie vorher den Stiefel und den Mantel, und geht weiter und kommt an ein Häuschen im Walde, in dem eine alte Hexe wohnte.
Er bittet um Nachtquartier, und sie nimmt ihn auch auf. Auch fragt er sie nach dem Wege zum goldenen Schloß, worauf sie ihm sagt: »Das goldene Schloß liegt da, wo die Sonne untergeht, und wo nie Sommer ist.« Sie hatte aber Macht über die Tiere im Walde und blies in ein Horn. Da kam ein Löwe, und sie sagte ihm, er möchte den Fremden im Walde beschützen und nicht zu Schaden kommen lassen.
Richtig, er kommt auch ganz gut durch den großen Wald und wieder an ein Häuschen, wo wieder eine alte Hexe wohnt. Die nimmt ihn sehr gut auf und sagt ihm, sie habe Macht über alle Vögel. Sie bläst in ein Horn, da kommt der Zaunkönig geflogen. Dem sagt sie, er solle den Fremden auf den Rücken nehmen und mit ihm nach dem goldenen Schloß fliegen, dieser aber mußte dabei, um unsichtbar zu sein, den Mantel um nehmen.
Der Zaunkönig fliegt mit ihm über Meere, Wälder, Seen und Städte und fragt ihn alle Augenblick: »Was siehst du da?« Er antwortet: »Ich sehe die Wolken da in der Ferne.« Der Vogel aber erwiederte: »Nein, das ist das goldene Schloß, wo die Prinzessin wohnt.« So kommen sie denn nach langer Reise bei dem Schlosse an, aber die Türen sind zugeschlossen, und auf dem Hofe ist Alles tot, Tiere und Pflanzen sind wie verzaubert.
Er bullert an die Tür und denkt: »Ich kann mich hier zerbullern, es wird doch nicht gehört!« Endlich ruft er: » Ewa, Ewa, mach' die Türe auf!« Da schickt sie ihr Dienstmädchen hinaus, und er sagt dieser, er sei der Mann von der Prinzessin, das Jahr sei verflossen, und so komme er denn zu ihr. Das Mädchen verlangt von ihm ein Zeichen, daß er es sei; da kollert er den Apfel in das Schloß. Darauf geht das Mädchen zur Prinzessin und zeigt ihr an, daß ihr Mann da sei.
Die Prinzessin lacht und sagt: »Das ist doch nicht möglich, daß der hierher gefunden hat, es wird ein anderer sein!« Das Mädchen zeigt ihr aber den goldenen Apfel, und so glaubte sie und ließ ihn ein. Als er eingetreten war, sagte sie ihm: »Du kannst hier nicht eher Ruhe haben, als bis du die zweimal zwölf Teufel hier im Hause bestanden hast; im ersten Zimmer sind ihrer zwölf, elf haben einen Kopf, der zwölfte hat zwölf Köpfe; wenn du diesem einen seiner zwölf Köpfe abhaust, wachsen an der Stelle des selben immer gleich zwölf neue, wenn du ihn aber besiegst, dann verschwinden auch die übrigen zwölf. Im zweiten Zimmer sind wieder zwölf Teufel, von denen der eine vierundzwanzig Köpfe hat, und da mußt du, was sie dich auch fragen, nicht darauf hören und nichts antworten.«
Er kommt in das erste Zimmer und besiegt die zwölf Teufel. Dann kommt er in das zweite Zimmer; da kommt ihm einer der Teufel entgegen und fragt ihn, was er da zu suchen habe? Er ist aber ganz stumm und sagt nichts; da kommt ein zweiter und sagt: »Warum hast du nicht geantwortet, wenn du gefragt wirst?« Er sagt aber wieder kein Wort und bleibt stumm, was sie ihn auch fragen. So besiegt er auch diese. Nun kommt er in das dritte Zimmer, da liegt der König und die Königin tot. Er berührt sie mit dem Schwerte, da bekommt das ganze Schloß mit Allem, was darinnen ist, einen Ruck, auch er selbst, daß die Gedärme im Leibe sich ihm umdrehten, der König und die Königin wurden lebendig, ebenso alle Tiere und Pflanzen. Er führte den König und die Königin zu seiner Frau und lebte mit der selben sehr glücklich. Sie mögen heute noch leben.
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren, aus Klein Jerutten
DAS MÄRCHEN VOM SCHLANGENKÖNIG ...

Es lebte einmal eine alte Frau. Sie hatte einen einzigen Sohn, der hieß Jas (Hans). Beide waren sehr arm und wohnten in einer sehr alten Hütte, die mitten in Wäldern lag, weit gegen Norden, fern von menschlichen Wohnstätten. Sie lebten von Pilzen und Waldbeeren. Manchmal gelang es Jas, ein wildes Tier zu fangen oder eine Ente und so konnten sie sich ziemlich ernähren. Sie besaßen auch genügend Acker, aber die Mutter war schon zu alt und zu schwach und Jas seiner seits zu jung, um den Acker genügend zu bearbeiten. Deshalb hatten sie von dem Acker nicht viel Ertrag. Trotzdem waren sie sehr gastfreundlich. Jeden Wanderer sahen sie in ihrem Hause gern und teilten mit ihm alles, was sie hatten, auch wenn sie sich selbst etwas entziehen sollten.
Einmal ging Jas auf die Straße hinaus. Da vernahm er ein merkwürdiges Gewinsel. Es kam immer näher, und Jas erblickte einen kleinen Hund, den ein unbarmherziger Mensch aus dem Hause trieb. Jas gab ihm ein Stück Brot. Der Hund fraß es mit großem Appetit. Dann nahm ihn Jas auf die Arme, trug ihn nach Hause und sprach zur Mutter: "Mutter, ich habe auf dem Wege diesen Hund gefunden; erlaube mir, daß ich ihn behalte!" Die Mutter aber, welche arm war und selbst nichts zu essen hatte, sagte: "Ich hätte nichts dagegen, aber womit sollen wir ihn füttern ?" "Ich werde ihm von meinem Teil etwas geben, es wird schon gehen!" Und so blieb das Hündchen. Es bewachte seinen Herrn und war ihm in allem gehorsam. Als es groß geworden war, half es Jas bei der Jagd auf Enten und Hasen, und es ging ihnen gut.
Eines Tages geht Jas über eine Wiese und erblickt dabei eine Schlange, die auf dem Wege liegt und kaum noch lebendig ist, Jas erbarmt sich der Schlange, versteckt sie unter dem Arm und bringt sie nach Hause. Hier gibt er ihr Milch von seinem Frühstück und die Schlange kommt wieder zum Leben. Sie legt sich aufs Fenster und beschaut sich alles sorgfältig. Aber die Mutter sagt: "Das ist doch schon zu viel, den Hund füttern, den Kater füttern, die Schlange füttern und noch dazu mit Milch, woher soll ich das alles nehmen ?" Doch Jas entgegnet: "Ich werde schon immer mit ihr mein Frühstück teilen, sie ist so schön, so lieb, daß ich sie um nichts aus dem Hause geben würde."
Es blieb also die Schlange beim Jas, und es ging ihr gut. Da sie dankbar war, behütete sie die Hütte vor Dieben. Es kam oft vor, daß alle das Haus verließen. Da legte sich die Schlange vor die Tür, rollte sich in einen Kreis zusammen und wärmte sich in der Sonne. Sobald sich ein Dieb näherte, begann sie so sehr zu lärmen, zu schreien und zu zischen, daß der Hund und der Kater aus der Hütte herausstürzten und der erschrockene Dieb weglaufen mußte. Dafür liebte auch Jas die Schlange sehr und nahm sie oft mit sich ins Bett.
Die Schlange jedoch war immer über irgend etwas sehr traurig. Da fragte sie einmal Jas: "Warum bist du traurig, mein Liebchen?" Und die Schlange antwortete: "Mein lieber Jas, ich weiß, daß du mir nur Gutes wünschest; deshalb will ich dir sagen; wer ich bin. - Ich bin der Sohn eines Königs. Ich war der einzige Sohn und es ging mir bei meinem Vater gut. Alle Schlangen von Polen und Rußland müssen meinem Vater gehorchen. Er trägt auf dem Haupte eine kostbare Krone von lauter Brillanten; sie scheint heller wie die Sonne, daher man ihn von weitem erkennen kann. Wer diese Krone besitzt, kann alles erhalten, was er sich wünscht. Mein Vater wohnt in den großen Wäldern und Sümpfen von Pinczuk, und es ist schwer, zu ihm zu gelangen.
Zwar kenne ich den Weg nach Hause, habe aber nicht die Kraft so weit zu gehen." "Auf welche Weise bist du hieher gekommen?" fragt sie Jas. "Einmal bin ich hinaus geschlichen, um mit meinen Kameraden auf der Wiese zu spielen; da kam ein Storch herbei geflogen, alle meine Kameraden stoben in großer Furcht auseinander, der Storch ergriff mich und brachte mich hieher weit nach Süden. Ich glitt ihm aus und fiel ins Schilf. Vergebens suchte mich der Storch bis zum Abend. So saß ich dort einige Tage, ohne etwas zu essen, und wenn du nicht gekommen wärest, wäre ich vor Hunger gestorben.
Ich bitte dich, lieber Jas, - ich sehe, daß du arm bist und möchte dir ein wenig helfen - trage mich zum Vater und fordere von ihm die Krone, die er auf dem Haupte trägt. Mein Vater wird sie dir sicherlich geben und du wirst von nun an glücklich sein."
Ohne sich lange zu bedenken, machte sich Jas auf den Weg. Er wanderte einige Tage, immer nach Norden. Da gelangte er in solche Sümpfe und Wälder, daß es ihm schier unmöglich schien, wieder heraus zu kommen. Aber die Schlange steckte ihr Köpfchen hervor und zeigte ihm den Weg. Auf einmal sah sich Jas von Tausenden von Schlangen umgeben, die sich grimmig auf ihn stürzen wollten, um ihn zu zerreißen, weil er es wagte, ihren Frieden zu stören und die Grenzen ihres Aufenthaltsortes zu überschreiten.
Aber die Schlange des Jas streckte ihr Köpfchen hervor und zischte ihnen etwas zu. Alle Schlangen schlichen mit Hochachtung auseinander und zeigten Jas den Weg bis zum Palast des Königs. Der Palast war aus Brillanten. Der König lag auf dem Gange und wärmte sich in der Sonne. Leicht war er zu erkennen, denn seine Krone leuchtete wie die Sonne.
Verwundert bei dem Anblick eines Unbekannten, fragte der König: ,,Was will hier dieser Mensch?" Jas antwortete: "Ich bringe dir einen Sohn, den ich vom Tode errettet habe; ich übergebe dir ihn, wenn du mir deine Krone schenkst!" Der König war sehr erfreut, als er seinen einzigen Sohn unter dem Arme des Jas erblickte. Er sprach jedoch zu Jas: "Fordere, was du willst, Gold, Schätze, nur nicht die Krone !" "Nein, ich will nur die Krone, oder ich kehre nach Hause zurück und nehme deinen Sohn mit." "Hat dir dieser Milchbart mit der Krone schon den Kopf verdreht ? - Ich schenke sie dir, aber sie bringt dir keinen Nutzen und kein Glück.
Du wirst alles besitzen, was du dir wünschest, alles wird dir gelingen, aber das Glück wirst du nicht finden und über kurz oder lang bringst du mir die Krone zurück." Er schüttelte das Köpfchen, die Krone fiel hinunter. Jas küßte den Königssohn und ließ ihn frei, nahm dann die Krone und steckte sie in die Tasche. Sie war ganz klein, ungefähr so groß wie ein Knopf. Auf dem Rückwege bemerkte Jas, daß sich der Weg selbst vor ihm bahne; die Sümpfe und Wälder teilen sich vor ihm, damit er einen trockenen und sicheren Weg gehen kann. So gelangte er wieder nach Hause.
Hier fand er großes Elend; die Mutter ganz abgemattet vor Hunger, der Kater und der Hund so mager, daß sie nur Haut und Knochen waren. Jas nahm die Krone in die Hand und sagte laut: "Ich wünsche etwas gutes zu essen!" Sofort wurden, man weiß nicht woher, die besten Speisen aufgetragen. Sie hatten nun zu essen, zu trinken, sich zu kleiden, eine schöne Wohnung, so wie ein Herr. Die Mutter kam zu Kräften, der Hund und der Kater erkannten erst jetzt, was es bedeutet, Jas zu dienen.
Und alle glaubten glücklich zu sein. Nur Jas fühlte sich nicht glücklich. Alles war ihm zu wenig, mit nichts war er zufrieden. Er war bereits ein Jüngling und es kam ihm in den Sinn, zu heiraten. Aber mit wem ? Wohl kannte er nicht nur eine Jungfrau im Dorfe. Er brauchte nur dem Finger zu bewegen, nur ein Wörtchen zu sagen und hundert Jungfrauen hätte er zur Auswahl und wäre glücklich; aber das paßte ihm nicht. Er blickte nicht einmal einer Jungfrau vom Hofe nach, vielmehr nahm er sich vor, sich im Königspalast eine Gemahlin zu suchen.
So erschien er denn in prächtiger Kleidung, bestehend aus Gold und Diamanten und auf einem herrlichen Pferde vor dem König. Nicht einmal der König hatte ein solches Pferd. Jas brachte dem König reiche Geschenke und Kleinodien mit, wie sie der König in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Da der König seinen Untertan in diesem Reichtum sah, führte er ihn in seine Gemächer und zeigte ihm seine Tochter. Jas gab auch ihr schöne Geschenke; die Königstochter nahm sie an, erkannte aber sofort, daß Jas ein einfacher Mann sei, denn er hatte seine teuren und schönen Stiefel mit Birkenharz eingeschmiert. Der arme Jas glaubte, daß das Birkenharz der Königstochter das größte Wohlgefallen bereiten würde; aber was Wunder? Er war ja im Walde aufgewachsen, wußte nicht, daß die Königstochter von Jugend an nur die ausgesuchtesten Speisen aß und darum besser duftete als ein Veilchen ?!
Ungefähr nach einem Monat, als sich Jas in dem königlichen Hofe schon mehr heimisch fühlte, bat er den König um die Hand seiner Tochter. Der König, verwundert über diesen Wunsch, antwortete: "Meine Tochter ist schon mit dem Fürsten der Letten verlobt, ich kann mein Wort nicht mehr zurücknehmen." Als aber Jas dringender bat, sagte zu ihm der König, indem er sich über ihn lustig machte: "Sieh, drei Meilen von hier steht ein großer Berg, und soweit man mit dem Blick reichen kann, gibt es nur Sümpfe. Trage den Berg zur Hälfte ab, schütte mit der Erde die Sümpfe zu, damit hier Menschen wohnen können, errichte auf dem Berge eine starke Festung und ein so festes Schloß, daß kein Feind es nehmen kann!" Mit diesen Worten wollte ihm der König zu verstehen geben, daß es ihm ebenso unmöglich sei als einfacher Mann eine Königstochter zu heiraten, wie es ihm unmöglich ist, die Arbeit auszuführen.
Jas entfernte sich, nahm die Krone aus der Tasche und sagte laut, er wünsche den Berg abzutragen, die Sümpfe zuzuschütten, das Schloß aufzubauen. Kaum hatte er den Wunsch geäußert, siehe, da begann sich der Berg zu schieben, die Erde fiel auf die Sümpfe und schüttete sie zu. Auf dem Berge begannen sich Mauern zu erheben, es erstand ein Schloß und ein prächtiger und fester Königspalast, wie es im ganzen Reiche keinen gab. Und das alles geschah in einer Nacht.
Als der König am folgenden Morgen aufstand, erblickte er das prächtige Schloß. Nicht einmal der Fürst der Letten besaß ein solches. Am meisten aber verwunderte sich der König über die Schnelligkeit, mit der das Schloß aufgebaut wurde. Eine Menge Volkes kam zum König und bat ihn um Land, und der König gab jedem, solange der Vorrat reichte.
Jas erschien zum zweiten Male vor dem König und bat um die Hand seiner Tochter. Dem Könige war es jetzt unmöglich, die Bitte abzuschlagen. Sogar die Königstochter, bewegt durch die Wunder, willigte in das Verlöbnis mit Jas ein. Aber sie fürchtete ihn, liebte ihn nicht und sang weinend in russischer Sprache:
"Wer mein Geliebter ist, das weiß ich wohl,
Weiß aber nicht, mit wem ich leben soll."
Es Wurde eine Hochzeit gefeiert, wie sie die Welt weder sah noch kannte. Der Fürst der Letten war Brautwerber. Während der Hochzeitsfeier hatte dieser der Königstochter andauernd etwas ins Ohr gesagt und umgekehrt die Königstochter ihm. Jas sah das zwar, dachte aber, daß es so sein muß, daß es so die königliche Sitte fordert. Der arme Jas freute sich und wußte nicht warum, wahrscheinlich deswegen, weil sich andere freuten. Da er selber sehr ehrbar war, glaubte er, daß es auch alle sind. Der König aber befahl seiner Tochter, mit ihrem Gemahl zu wohnen, und bat den Fürsten abzureisen.
Beim Abschied weinte der Fürst und die Königstochter, wogegen man nichts tun konnte. Obwohl Jas sehr gut und rechtschaffen war, selbst die Königstochter gab das zu, so hatte er doch kein königliches Blut. Er konnte nicht befehlen, sondern nur gut handeln, er konnte nicht fein tanzen und wenn er den Säbel in die Hand nahm, so meinte er, es sei ein Dreschflegel. Mit der Zeit jedoch gewöhnte er sich an alles. Seine Gemahlin begann ihm aus eigenem Interesse zu schmeicheln, ja sogar ihn zu küssen und Jas verlor dadurch vollends die Besinnung und glaubte, daß er sehr glücklich sei.
Ungefähr nach zwei Monaten fragte ihn seine Gemahlin, auf welche Weise er das prächtige Schloß erbaut habe. Jas offenbarte ihr alles, erzählte ihr auch von der Schlangenkrone und zeigte sie ihr sogar. Das gerade wünschte sich die Königstochter. Noch an demselben Abend lud sie Gäste ein, womit Jas einverstanden war. Alle wurden mit den besten Speisen bewirtet, und der Wein floß nur so allen über das Kinn. Die Königstochter schenkte Jas in einem fort Wein ein; Jas berauschte sich zum ersten Male in seinem Leben und lag wie leblos auf seinem Bett.
Das "liebe Frauchen" machte sich - ripps, rapps - an seine Taschen und fand die brillantene Krone. Darauf blickte sie auf den berauschten Jas und sagte: "Ach! ach! wenn ich doch einmal diesen Jas los würde und meinen geliebten Fürsten besitzen könnte!" Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, war Jas auch schon weg und an seiner Stelle der feine Fürst, ihr alter Geliebter. Die Königstochter war sehr erfreut; sie versteckte die Krone in das geheimste Versteck und wenn sie schlief, nahm sie dieselbe in den Mund und verbarg sie unter der Zunge.
Jas kam unterdessen allmählich wieder zu sich; er schaut und sieht sich in seiner Hütte, in seinem Heimatdorf, der Hund und der Kater schmiegen sich an ihn, - nur die Mutter fehlt - denn sie ist gestorben. Er wußte nicht sofort, was das bedeuten sollte. Als er jedoch seine Taschen durchsuchte und die Krone nicht fand, merkte er sogleich, daß ihn die Königstochter in schändlicher Weise hintergangen hatte. Da vergoß Jas bittere Tränen. Der Hund und der Kater erbarmten sich seiner und fragten ihn, warum er so weine. Jas erzählte ihnen sein Unglück. "Ha, so gehen wir die Krone suchen und bringen sie dir," sprachen die guten Tiere. Es begaben sich nun alle auf den Weg.
Sie gehen und gehen - doch es geht sich nicht so schnell, wie man spricht - verschiedene Unglücksfälle erlebten sie auf der Reise, bis sie endlich das berühmte Schloß des Jas erblickten. Jas blieb im Walde zurück und wartete. Hund und Kater begaben sich zum Schloß. Sie mußten über einen Fluß. Der Kater stieg auf den Hund und sie schwammen hinüber. Als sie bei der Schloßmauer angelangt waren, wollte der Kater hinaufklettern, aber die Mauer war so glatt, daß ihm seine Krallen nichts nützten. Sie überlegten nun, wie sie in das Schloß kommen könnten. Während sie so nachsannen, hörten sie Musik; irgend ein Marsch wurde gespielt. "Was ist das ?" fragte der Hund und verbarg sich hinter einem Strauch. Der Kater duckte sich hinter ihm nieder.
Da kriechen aus einem Loch Mäuse hervor, es war ein Mäusehochzeitszug. Voran gehen die Musikanten mit Bässen, Geigen und einer Pauke, dann die Brautwerber und Brautwerberinnen, weiter die Hochzeitsburschen mit ihren Frauen, hinter diesen das Brautpaar, der Bräutigam schön gekleidet, die Braut die schönste von allen Mäusen, hinter dem Brautpaar die Ehrenpersonen und die Gäste. Alles ging zur Trauung. Des Katers Augen funkelten, o, er war hungrig, hungrig! Doch der Hund sagt zu ihm: "Kater, mach keine Dummheiten, ergreif die Braut, erwürge sie aber nicht, im übrigen verlaß dich auf mich." - Hops --sprang der Kater und ergriff die Braut. Ihr hättet das Geschrei, die Verwirrung und die Angst der Mäuse hören und sehen sollen, als ihnen dieses schreckliche Unglück zustieß.
Sie stoben nach allen Seiten auseinander. Nur der Bräutigam streckte seinen Kopf aus dem Loch hervor um zu sehen, was mit seiner Braut geschieht. Und der Hund sprach: "Höre, Schwarzer, wir geben dir deine Braut zurück und tun ihr nichts, du mußt aber zu der Königstochter gehen und uns die Schlangenkrone bringen; du kennst ja hier alle Verstecke." "Wohl kenne ich sie", antwortete der Bräutigam, "im Strumpf der Königstochter hat mich meine Mutter aufgezogen, aber zu der Krone kann ich nicht gelangen, denn die Königin trägt sie bei sich und versteckt sie während des Schlafes im Munde." "Was geht mich das an", schrie ihn der Hund zornig an, "bringe die Krone oder leb wohl und verabschiede dich mit deiner Braut für immer!"
Der Bräutigam zog das Schwänzchen ein und eilte davon. Er kriecht in das Schlafzimmer der Königstochter. Siehe, da liegen zwei im Bette: der Fürst und die Königin; sie schlafen und schnarchen, daß einem das Herz lacht. Der Bräutigam sah der Königstochter zwischen die Zähne. Es war nicht möglich, die Krone herauszunehmen. Doch wozu hatte er den Verstand ? Er steckte ihr das Schwänzchen in den Mund, begann damit zu wackeln, die Königstochter wachte auf und weil sie so was Rundes im Munde fühlte, spukte sie aus und die Krone fiel - hopp - auf die Erde. Die Königstochter sprang auf; doch ehe sie die Kerze angezündet hatte, war der Bräutigam mit der Krone davon und hatte sie dem Kater übergeben. Dieser ließ das arme Mäuschen, welches aus Angst mit den Zähnen klapperte, los. Alle Mäuse eilen aus den Löchern. Ei! wie sie den Mazur aufspielen: pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi ! Das war eine Freude! Sogar dem Hund und dem Kater brachte man Käse, Wurst und Honig, damit sie sich freuten.
Nachdem sich Hund und Kater gesättigt hatten, verweilten sie nicht länger, sondern begaben sich auf den Weg. Als sie wiederum zu dem Flusse kamen, nahm der Kater die Krone zwischen die Zähne, stieg auf den Rücken des Hundes und sie begannen zu schwimmen. Auf einmal erblickte der Kater einen Fisch. Das habsüchtige Katerungetüm wollte ihn fangen - die Krone fiel ihm aus dem Munde. "0 - Hilfe, Hilfe!" schrie er. Der Hund wollte ihn im ersten Augenblick vor Ärger ertränken; bald aber mäßigte er sich und versetzte ihm erst am Ufer einen Rippentriller. Dann befahl er ihm, den Schwanz ins Wasser zu tauchen und ihn so zu halten.
Ein Hecht kam heran geschwommen und da er glaubte, daß es etwas zu essen ist, schnappte er nach dem Schwänze. Der Kater miaute vor Schmerz, aber der Hund faßte den Hecht sofort beim Halse und zog ihn ans Ufer. Hier trennte er ihn sofort auf und fand in seinem Innern die Krone. Er gab sie nicht mehr dem Kater, weil dieser zwar rechtschaffen, aber dumm war. So kamen sie zu Jas und übergaben ihm die Krone. Jas dankte ihnen aufs herzlichste für den Dienst und begab sich sofort zum König.
Der König wußte von nichts und da beklagt sich Jas vor ihm über die Königstochter! "Das kann nicht sein, es steht sie nicht an zu schonen!" "Nun gut", sagte Jas, nahm die Krone in die Hand und sprach: "Man soll die Königstochter mitsamt dem Bette herbringen !" Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, so öffnet sich die Tür, das Bett kommt herein und in ihm liegen der Fürst und die Königstochter. Ei, wie ergreift da der alte König das Kerbholz, wie beginnt er beide zu prügeln, daß sie vor Schmerz und vor Scham seufzten! Schließlich trat Jas für sie ein und nahm dem Könige den Stock weg.
Doch was war zu tun ? Jas sah ein, daß die Königstochter nicht für ihn bestimmt war. Er wollte sie nicht zur Liebe zwingen, obwohl er das Recht dazu hatte. Ein solches Leben mit der Königstochter wäre ja dem Tode gleich gewesen. Was tat er nun ? Er stand auf und sprach folgendermaßen zu ihnen: "Ich könnte euch töten, verbrennen, vernichten, doch was hätte ich davon ? Lebt ihr lieber im Glück, ich gehe in die Welt!" Weg war er und kehrte nie wieder zurück.
Jas begab sich mit der Krone zum Schlangenkönig und gab sie ihm zurück. Zugleich erzählte er ihm sein Unglück. Die Schlange sprach zu ihm: "Ich sagte dir doch, daß du niemals auf der Welt wahres Glück finden wirst. Gut und Ruhm wirst du besitzen, die Leute aber werden es dir mißgönnen, denn sie wissen nicht, daß der einfache Mann oft hundertmal glücklicher ist als der mächtigste König."
Es lebte nun Jas zusammen mit dem Hunde und dem Kater im Palaste des Schlangenkönigs bis an sein Lebensende.
DER HEXENMEISTER UND SEIN LEHRLING ...

Ein armes Weib ging einst durch einen dunklen Wald und führte ihr kleines Söhnlein an der Hand. Sie weinte, indem sie so ging, denn sie hatte nicht Geld genug, um ihre vielen Kinder ordentlich zu ernähren und zu erziehen. Da erhob sich plötzlich ein Mann, der unter einer Eiche gesessen hatte, und als er die Tränen des armen Weibes sah, fragte er sie nach der Ursache. Sie erzählte ihm nun ihren Kummer. Der Unbekannte tröstete sie und sagte, er sei ein Schneider. Das war aber eine Lüge, denn er war ein Hexenmeister.
Er nahm den Knaben bei der Hand, führte ihn in seine Höhle und versprach der Mutter, ihn schon nach drei Jahren loszusprechen. Erfreut ging nun das Weib nach Hause, der kleine Hans aber fing an die schwarze Kunst zu lernen, und bald konnte er mehr als sein Meister.
Als drei Jahre um waren, lief er heimlich aus der Höhle des Zaubrers fort und traf seine Mutter auf der grünen Wiese. Die gute Mutter weinte Freudentränen, als sie sah, wie ihr Sohn so groß und stark geworden war. Der Bursche aber sprach zu ihr: "Nun habe ich drei Jahre gelernt, jetzt müßt Ihr zum Meister kommen und fordern, daß er mich losspricht. Er wird Euch eine ganze Menge Tauben zeigen, das sind die verzauberten jungen Burschen, die er in die Lehre genommen hat. Wenn er dann den Tauben Erbsen vorstreut, müßt Ihr darauf achtgeben, welche unter ihnen gar nicht frißt, sondern immer vor Freuden mit den Flügeln schlägt: das wird Euer Söhnchen sein."
Die Mutter ging zum Hexenmeister und verlangte ihren Sohn zurück. Der Alte nahm eine kupferne Trompete und blies nach allen vier Weltgegenden hin. Sogleich kamen viele Tauben herbei. Alle fraßen von den hingestreuten Erbsen, und die Mutter sollte ihren Sohn aus der Schar herausfinden. Sie zeigte auf die eine, die nur immer freudig umher sprang und mit den Flügeln schlug. Das war richtig ihr Sohn, und sie nahm ihn mit nach Hause.
Der Vater des Burschen war ein Schuhflicker und lebte mit seiner zahlreichen Familie in größtem Elend. Zu ihm sprach Hans: "Ich will Euch schon reich machen, aber auf einmal geht das nicht. Ich verwandle mich in eine Kuh, in einen Ochsen und in ein Schaf; Ihr verkauft mich auf dem Markte und bekommt ein hübsches Stück Geld für mich. Nur in ein Pferd dürft Ihr mich nicht verwünschen, denn sonst gibt es ein Unglück."
Der Schuhflicker verwünschte also seinen Sohn zuerst in einen Ochsen, dann in eine Kuh, dann in ein Schaf, - und immer macht' er einen guten Handel. Er konnte sich ein neues Häuschen bauen und brauchte keinen Hunger mehr zu leiden. Doch ließ er sich von seiner Habsucht verführen, den Sohn auch in ein Pferd zu verwünschen. Auf dem Markte wartete schon der Hexenmeister und kaufte das Pferd. Nun war der arme Hans wieder in der Gewalt des Zauberers.
Er führte ihn in seinen Stall, band ihn an eine Kette, ließ ihn hungern und schlug ihn jämmerlich mit der Peische. Da erbarmte sich seiner die Magd und machte ihn von der Kette los. Hans verwandelte sich in seine natürliche Gestalt, dankte dem Mädchen herzlich und flog aus Furcht vor seinem Meister als Sperling auf das Dach.
Der Zaubrer bemerkte die Flucht und erkannte den Burschen in der Sperlingsgestalt. Er verwandelte sich also sofort in eine schwarze Krähe und verfolgte das arme Vögelchen. Es fiel endlich erschöpft im königlichen Garten nieder, über ihm flatterte schon die wütende Krähe mit geöffnetem Schnabel. Hans verwandelte sich in einen Zaunkönig, - und der Hexenmeister sogleich in einen Sperling. Die Jagd aber dauerte fort mit derselben Erbitterung.
Zu derselben Zeit ging die Prinzessin im Garten spazieren, und da sie diesen Kampf bemerkte, dachte sie bei sich selbst: "Du lieber Gott, was ist doch unter diesen kleinen Tierchen für eine Feindschaft! Alles führt doch Krieg auf dieser Welt!"
Da nun Hans schon ganz müde war und vor dem wütenden Feinde nicht mehr fliehen konnte, verwandelte er sich in einen schönen Ring und sprang auf den Finger der Prinzessin. Kaum war die Prinzessin in ihr Zimmer gekommen, so erblickte sie voll Verwunderung den schönen Ring, und siehe da, in demselben Augenblick verwandelte sich dieser in den schmucken Hans. Er erzählte ihr sein Leid und warnte sie vor dem Zauberer, der gewiß bald kommen und den Ring verlangen werde.
Am folgenden Tage kam der Hexenmeister, als Prinz verkleidet. Als man ihn der Prinzessin vorstellte, bat er sie sogleich, ihm den Ring zu zeigen. Die Prinzessin aber hatte den Hans lieb gewonnen und wollte dem Hexenmeister nicht einmal die Hand mit dem Ringe zum Kusse reichen. Als er sie aber immer dringender bat, ließ sie den Ring auf die Erde fallen. Nun entstand aus dem Ringe eine Menge von Erbsen.
Der Zauberer blies auf seiner kupfernen Trompete nach allen vier Weltgegenden hin, und ein ganzer Schwarm Tauben flog herbei, um die Erbsen aufzupicken. Nur ein Erbsenkorn schob sich in die weiße Hand der Prinzessin. Sie warf es auf die Erde, und aus der Erbse wurde eine ganze Menge kleiner Mohnkörner. Da blies der Zauberer wieder mit seiner Trompete nach allen vier Weltgegenden hin, und es kam eine große Menge Sperlinge zusammen geflogen, und damit der Mohn schneller aufgefressen werde, verwandelte sich der Zauberer selbst in einen solchen Vogel.
Darauf hatte Hans nur gewartet. Sogleich machte er sich zur Krähe, biß den bösen Hexenmeister tot, und seinen Körper trug er stückweise nach allen vier Weltgegenden hin, damit er nie wieder zusammenwachse.
Die Prinzessin wählte sich den schmucken Hans zum Gatten. Man hielt ein prächtiges Hochzeitsmahl. Dort wurde gegessen und gezecht bis in die späte Nacht. Auch ich war da und aß und trank soviel, daß mir's am Kinn heruntertröpfelte. Aber - seht her! - jetzt ist der Mund ganz leer.
Quelle: Kasimir Wladislaw Woycicki, Polnische Volkssagen und Märchen
DAS WUNDERBARE PFEIFCHEN ...
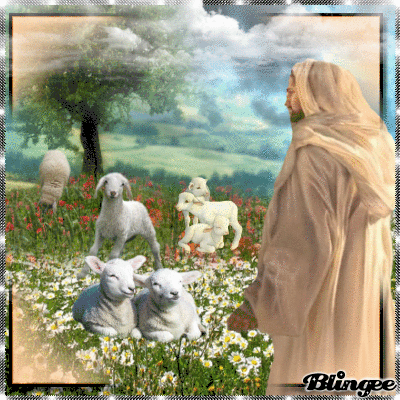
Ein Knecht diente in der Hölle und tat seinem Herrn, dem Teufel, so gute Dienste, daß dieser sagte: »Wenn Du aus meinem Dienste gehst, dann kannst Du Dir von mir erbitten, was Du willst, ich werde es Dir mitgeben«. Der Knecht mußte in einem großen Kessel die Seelen der bösen Menschen kochen. Da baten ihn die Seelen, er möchte nichts weiter verlangen als nur den Schaum aus dem Kessel.
Als er nun zwei Jahre gedient hatte, so sagte er zu dem Teufel: »Ich will jetzt aus dem Dienste abgehen, und als Lohn erbitte ich mir den Schaum aus dem Kessel«. Der Teufel kratzte sich hinter dem Ohr; es war ihm eine recht unangenehme Forderung, aber er kann doch nicht anders und muß Wort halten. Da nimmt sich denn der Knecht ein volles Säckchen Schaum und geht.
So kommt er auf eine Wiese und ruht etwas aus. Da will er denn auch sehen, was aus dem Schaum geworden ist und schüttet ihn auf das Gras, und es entstehen aus demselben lauter Schäfchen. Da kommt der Herr Jesus gegangen und fragt ihn, ob er ihm die Schäfchen nicht verkaufen könnte. »O ja!« sagt der Knecht. »Aber ich kann Dir dafür weiter nichts geben, als eine Flöte; willst Du sie dafür nehmen?« »Meinetwegen«, sagte der Knecht, und sie wurden handelseinig.
Das Pfeifchen hatte die Eigenschaft, daß, wenn man darauf blies, alle, die es hörten, tanzen mußten. Der Knecht bläst auf seinem Pfeifchen, da kommt ein Jude mit Porzellan gegangen; als er das Blasen hörte, mußte er tanzen und springen, daß all sein Porzellan zerschlagen wurde. Der Jude verklagt den Knecht bei Gericht, und der Knecht wird verurteilt und soll gehängt werden.
Wie er nun schon am Galgen steht, so bittet er noch um die Gunst, noch einmal auf seiner lieben Flöte blasen zu dürfen. Der Jude, der auch auf dem Platze ist, bittet, es ihm nicht zu erlauben; als die Erlaubniß dennoch erteilt wird, so schreit er: »bindet mich, bindet mich, sonst muß ich wieder tanzen.« Der Knecht aber nahm seine Flöte vor und blies, und alle Anwesenden, Richter und Zuschauer, faßten einander an und tanzten, daß sie beinahe ohnmächtig wurden. Endlich erließen ihm die Richter die Strafe, und er ging seiner Wege.
Polen: M. Toeppen, Aberglauben aus Masuren
DIE PROPHEZEIUNG DER LERCHE ...
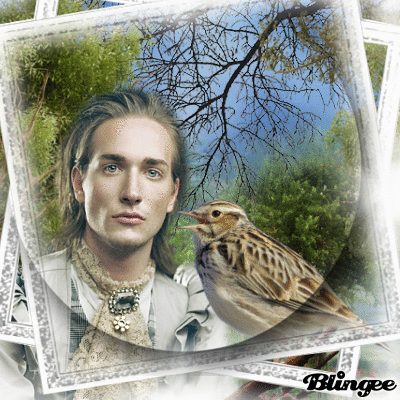
Es war einmal ein Kaufmann, der hatte einen einzigen Sohn, und die Eltern wußten gar nicht, was sie ihn lernen lassen sollten; denn sie wollten ihn gern so recht gut erziehen, und er hatte auch einen guten Kopf. Kaufmann, - das gefiel ihnen nicht; und Pfarrer, - das schien ihnen auch nicht recht. Da hörten sie von einem Manne, der die Vogelsprache verstände, und sie beschlossen, ihn zu dem in die Lehre zu geben.
Das geschah, und als er zwei Jahre bei ihm gelernt und den Eltern viel Geld gekostet hatte, kam er zurück mit einer Flöte, durch die er alle Vögel anlocken und sich mit ihnen unterhalten konnte. Die Eltern freuten sich sehr darüber und waren recht stolz auf ihn.
Nun wollte er aber auch wandern, und die Eltern hatten es ihm auch schon erlaubt, da steht er einmal in der Haustüre und spricht mit einer Lerche, und sein Vater tritt leise hinter ihn und hört, ohne daß der Sohn es weiß, der Unterredung zu. Er hörte den Sohn die Worte sprechen: »Na Lerche, wenn das wahr würde, was Du da sagst, das wäre doch sehr schlimm und traurig«. Nun wollte der Vater durchaus wissen, was die Lerche gesagt hätte, aber der Sohn wollte nicht mit der Sprache heraus, sondern sagte nur immer: »Sie hat ja nichts gesagt«.
Da ging der Vater zur Mutter und sagte: »Frau, frage Du doch den Sohn, was die Lerche gesagt hat, denn ich hörte gerade, als der Sohn zu ihr sagte: Na Lerche, wenn das wahr würde, was Du da sagst, das wäre doch sehr schlimm und traurig. Vielleicht sagt er es Dir eher«. Die Mutter schmeichelte dem Sohn auch so lange, bis er es richtig sagte. »Wenn ich es denn sagen soll und muß«, erwiederte der Sohn, »so wisset, die Lerche hat gesagt: Wenn Du von Deiner Wanderschaft zurückkommst, dann wirst Du sehr reich sein, aber Dein Vater wird ganz verarmt sein, daß er Deiner Hilfe sehr bedürfen wird; Deine Mutter wird Dir die Füße waschen und Dein Vater wird das Wasser austrinken.«
Als das die Eltern hörten, wurden sie wirklich sehr böse auf den Sohn und verabredeten sich, ihn umzubringen. Der Vater lockte ihn auf einen Speicher und schlug mit einer eisernen Stange auf ihn zu, traf ihn aber nur in die Hüfte, wo er ihm eine große Beule beibrachte, aber töten konnte er ihn nicht.
Da kam zu ihm ein Kaufmann aus England, um von ihm Waren zu kaufen, und fragte nach den Preisen. Der hartherzige Vater antwortete ihm: »Ich will Dir die Waren umsonst überlassen, wenn Du mir den Dienst erweisest, meinen Sohn zu töten, und um Zeichen seine Augen und seinen kleinen Finger brächtest«, und erzählte ihm die ganze Geschichte.
Der englische Kaufmann war dazu bereit und sagte: »Gebt mir den Sohn nur gleich mit, ich werde ihn, wenn wir auf dem Wasser sind, ermorden.« So wurde denn dem Sohne gesagt, er solle mit dem fremden Kaufmann mitreisen. Der Sohn freute sich darüber sehr, sie bestiegen das Schiff und fuhren ab.
Der Kaufmann behandelte ihn am Anfang sehr schlecht und gab ihm nichts zu essen; da nahm er seine Flöte und blies darauf, da kamen sogleich drei Tauben geflogen, von welchen er sich zwei fing und kochte. Als sie ein Paar Tage gefahren waren, gedachte der Kaufmann seines Versprechens, aber der junge Mensch gefiel ihm sehr. Er war so klug und immer so gehorsam, betete auch jeden Morgen und jeden Abend, so daß es dem Kaufmann leid tat, ihn umzubringen. Er nahm ihn also auf die Seite, erzählte ihm alles und sagte endlich: »Von jetzt ab aber sollst Du wie ein Sohn gehalten werden, ich nehme Dich als meinen Sohn an«. Da freute sich der junge Mensch und er nannte den Kaufmann fortan seinen Vater.
Nun näherten sie sich einer schönen Stadt, in welcher ein König wohnte. Schon von ferne sahen sie eine Kirche, auf der sehr viele Krähen und Raben saßen. Der Sohn bemerkte dies und befragte deshalb seinen Pflegevater. »Ja«, sagte dieser, »diese Kirche war einstmals sehr schön, sie hatte auch ein goldenes Dach, aber es kamen unreine Geister und nahmen von ihr Besitz, so daß jetzt Niemand sich hineinwagt. Die Krähen und Raben sind die unsauberen Geister. Der König hat demjenigen eine große Summe Geldes geboten, der sie ihm reinigen möchte, aber Niemand versteht es«. »O«, sagte der Pflegesohn, »ich möchte mir das wohl übernehmen«.
Der Kaufmann suchte ihm das auszureden, aber er blieb dabei, und so wie sie die Stadt erreicht hatten, ging er sogleich zum Könige, meldete sich bei ihm und sagte: »Herr König, ich habe von der Kirche gehört, daß sie von den bösen Geistern eingenommen ist, und ich möchte sie davon reinigen«. »Wenn Du das tätest«, sagte der König, »so wollte ich Dich reichlich belohnen«.
Der junge Mann ging in die Kirche und blieb da drei Tage ohne Essen und Trinken, hat sich nur immer mit den Geistern herum gestritten, so lange bis er sie besiegte, und die Glocken von selbst anfingen zu läuten, und die Altarlichter sich von selbst anzündeten. Als das der König hörte, war er sehr erfreut, ließ den jungen Mann rufen und sagte ihm: »Nun sage, was Du zur Belohnung haben willst, es soll Dir gewährt sein; auch habe ich eine Tochter, die will ich Dir zur Frau geben, und Du sollst mein Nachfolger in der Herrschaft sein«.
Er aber dankte für alles, auch für die Tochter, weil er noch zu jung zum Heiraten war, und fuhr mit seinem Pflegevater weiter, und sie kamen nach England in des Kaufmanns Haus. Den König von England hatte ein großes Unglück getroffen. Er hatte einen Sohn und eine Tochter, und als die beiden einen Sonntag aus der Kirche kamen, so wurden sie ganz voll Schorf und konnten von keinem Arzt geheilt werden. Auch der junge Kaufmannssohn hörte davon. »O«, sagte er, »ich würde sie schon heilen«.
Der Pflegevater hielt das für leeren Eigendünkel und schalt ihn wegen solcher Reden; er aber ließ sich nicht abhalten, ging zum Könige und sagte: »Herr König, ich will eure Kinder heilen, denn ich weiß, wovon sie diesen Schorf haben. Sie haben beim heiligen Abendmahl das Brot nicht aufgegessen, sondern auf die Erde geworfen; da kam eine große schorfige Kröte und fraß das Brot auf, und davon haben sie nun solchen Schorf, wie die Kröte. Der Herr König muß mir nur erlauben, den Altar aufzureißen, denn da sitzt die Kröte, und sie ist der Teufel.«
Der König erlaubte es ihm, er ging hin, riß den Altar auf und fand dort die Kröte sitzen. Da nahm er sie, stellte sie mit zwölf Stof Wasser aufs Feuer und ließ sie zu einem Halben einkochen, so daß eine Salbe davon wurde. Nun nahm er die Salbe und die beiden Kinder in eine Stube, die er von innen verschloß, und kurierte sie in drei Tagen. Den dritten Tag war der Schorf schon so los, daß er ihn mit einem Messer abschaben konnte, und die Kinder sahen so schön, wie neu geboren, aus.
Der Vater, der König, hatte zuletzt schon keine Ruhe mehr und ging, um zu erforschen, was in dem Zimmer vorginge, an das Schlüsselloch; als er die Kinder sah und lachen hörte, wurde er vor Freuden ohnmächtig und fiel auf die Erde. Sobald er sich ermuntert hatte, und die wiederhergestellten Kinder ihm zugeführt waren, bot er dem jungen Menschen die Tochter und das Königreich an. Diesmal nahm er beides an, und bald war denn auch die Hochzeit.
Als nun aber die anderen Könige, die auch um diese Prinzessin gefreit hatten, hörten, daß ein so armer Kaufmannssohn ihr Mann und König geworden war, da wurden sie neidisch und kündigten ihm, ihrer zwölf, Krieg an. Da sagte er denn: Mit allen auf einmal Krieg zu führen, dazu ist mein Reich zu klein, aber mit jedem einzelnen will ich es aufnehmen. Das geschah auch, und er besiegte sie alle.
Nun lebte er in Glück und Frieden, aber dennoch war er oft sehr traurig. Da fragte ihn seine junge Frau, was ihm denn fehle; es ginge ihm doch so gut, und er könne ja lustig sein. »Ja,« sagte er, »ich habe nun alles, was ich mir wünschen kann, aber etwas macht mir doch Sorgen,« und nun erzählte er ihr, was die Lerche ihm prophezeit hätte, und sagte auch, die Furcht verlasse ihn nicht, daß die Prophezeiung in Erfüllung gegangen sei. »Nun wir können ja hinfahren und uns überzeugen,« sagte sie, und so geschah es auch.
Er nahm Soldaten mit und reiste hin. Am Tor fragte er die Leute nach dem Kaufmann, seinem Vater. »Ach,« sagten die Leute, »der ist jetzt ganz arm und hütet die Schweine, und seine Frau kocht für Herrschaften.« Da ging er denn in das Hüttchen, wo er nur die Mutter einheimisch fand, gab sich aber nicht zu erkennen, sondern verlangte bei ihr Quartier. Sie war sehr verlegen und sagte, daß sie so arm sei, und daß sie einen König unmöglich aufnehmen könne. Er aber beruhigte sie wegen ihrer Armut, sagte, das schade nichts, er habe alles mit, und gab ihr gleich einen Dukaten. Sie war nun über die Ehre so erfreut, daß sie gleich für den Dukaten allerhand Weine und wohlriechende Wasser kaufte und dem Könige darin die Füße wusch.
Nachher kam auch ihr Mann nach Hause, der die Schweine gehütet hatte, und sie erzählte ihm von ihrem hohen Gaste. Er aber sagte: »Ach, es ist auch heute so heiß gewesen, hast du nicht einen kühlenden Trunk?« »Nein,« sagte sie, »als das mit Wein gemischte Wasser, in dem ich dem Könige die Füße gewaschen habe.« »Gib es nur her,« sagte er, »er hat ja wohl reine Füße gehabt.« »Ach ja,« sagte sie, »wie von Weizenmehl.« Sie gab ihm das Wasser, und er trank es aus.
Der Sohn war sehr traurig und fragte sie, ob sie keinen Sohn gehabt hätten? »Ja,« sagten sie, »das war aber ein Taugenichts, und er lebt schon lange nicht mehr.« »Vielleicht,« sagte er, »lebt er doch noch, und ihr habt ihm Unrecht getan?« Da gab er sich ihnen zu erkennen, ließ sie reinigen und gut ankleiden und nahm sie mit sich in sein Königreich, und vielleicht leben sie da noch, wenn sie nicht gestorben sind.
Polen: M. Toeppen, Aberglauben aus Masuren, aus Klein-Jerutten
DER RITT IN DAS VIERTE STOCKWERK ...
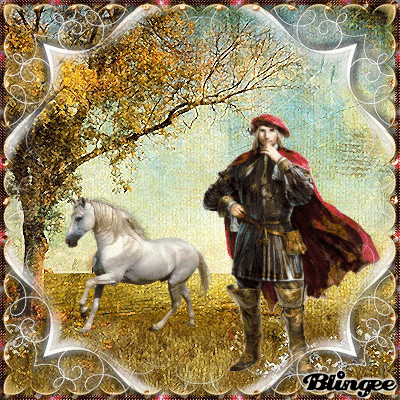
Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne, von denen zwei für klug galten, der dritte für dumm. Als er im Sterben lag, sagte er zu seinen Söhnen: »Wachet an meinem Grabe, wenn ich bestattet bin, jeder eine Nacht.« Sie versprachen es; doch als die erste Nacht kam und der Älteste zuerst die Wache halten sollte, befiel ihn Angst und er wollte nicht. Da sagte der Jüngste: »So will ich für Dich hingehen und wachen«. Das geschah.
Um Mitternacht öffnete sich das Grab, der Vater stand auf und gab dem Sohne drei Ruten, welche dieser wohl bewahrte. Den Brüdern aber erzählte er davon nichts. Als die nächste Nacht herankam, und nun der zweite Bruder wachen sollte, machte dieser es ebenso wie der älteste, mochte nicht hingehen und ließ statt seiner wieder den jüngsten wachen. Als dieser nun am Grabe stand, öffnete sich das Grab abermals, der Vater stand auf und gab ihm ein Knäuel Garn, welches er wohl bewahrte.
Nun war in derselben Stadt ein König, der hatte eine Tochter, und diese wohnte im Schlosse im vierten Stock und ließ bekannt machen, daß nur derjenige ihr Mann werden könne, der zu Pferde zwei Mal die vier Stock hoch in ihr Zimmer kommen werde; zum Zeichen, daß er es getan, werde sie ihm das erste Mal ihr Taschentuch und das zweite Mal ihren Ring geben. Viele Prinzen und Edelleute hatten es bereits versucht, an der Mauer hinaufzukommen, aber noch war es keinem gelungen.
Nachdem nun der jüngste der drei genannten Brüder schon zwei Nächte für die älteren Brüder am Grabe des Vaters gewacht hatte, kam die Reihe an ihn selbst, und so müde er war, begab er sich nach dem Kirchhof, um des Vaters Auftrag zu erfüllen. Das Grab öffnete sich abermals, der Vater stand auf, belobte den Sohn wegen seiner Treue und sagte: »Du weißt doch von der Prinzessin, die keinen andern Mann haben will, als denjenigen, der zu Pferde die vier Stock hoch zu ihr hinauf reitet. Nimm die drei Ruten, geh an den Eichenbaum im Garten, schlage mit den Ruten auf seinen Stamm, und Du wirst dann schon sehen, was Du weiter zu tun hast«.
Den andern Tag, als die Brüder zusammen waren, sprachen sie auch von der Prinzessin, und die beiden Ältesten kamen auf den Gedanken, es mit dem Reiten zu versuchen. Sie kauften sich schöne Pferde und prächtige Anzüge und sagten ganz verächtlich zu dem Jüngsten: »Du bleibe nur zu Hause und füttere die Schweine und heize den Ofen.«
Als aber die Brüder weg waren, nahm er die drei Ruten, ging an den Eichenbaum, klopfte dreimal auf den Stamm und sagte dazu: »Eichenbaum, öffne dich!« Sogleich öffnete sich der Baum, und es waren darin die prächtigsten Kleider; auch stand da ein gesatteltes goldenes Pferd. Der junge Mann zog nun sogleich seine Kleider aus, legte die schöneren an, setzte sich auf den goldenen Schimmel und ritt an das Königshaus. Es waren dort zu demselben Zwecke viele Prinzen anwesend, er aber war der schönste, hatte auch das prächtigste Pferd, und als er den Versuch wagen wollte, die vier Stock hinauf zu reiten, traten alle zurück und ließen ihn vor.
Es gelang ihm auch hinaufzukommen, er gelangte in das Zimmer der Prinzessin und bat sich das Taschentuch aus. Sie gab es ihm auch gern, voller Freude, daß es ein so hübscher schmucker Jüngling war. So ritt er denn freudigen Mutes zurück, wechselte in dem Eichenbaum seine Kleider, ließ auch das Pferd und das Taschentuch dort und ging an seine gewöhnliche Arbeit, damit die Brüder, wenn sie nach Hause kämen, nichts merken sollten. Als die Brüder zurück kamen, spotteten sie seiner wieder und sagten: »Wenn Du wüßtest, was für einen schönen Prinzen wir gesehen haben!« Darauf gab er zur Antwort: »Die Klugen sehen es bloß, aber die Dummen besitzen es«. »Was? Du denkst wohl, der Prinz war auch so ein Dummer wie Du?« sagten sie und verspotteten ihn noch mehr.
Den andern Tag ritten die Brüder wieder zu dem Schlosse, und als sie weg waren, ging der jüngste an den Eichenbaum, zog sich wieder die schönen Kleider an, bestieg den goldenen Schimmel und ritt nach dem Schlosse. Der Ritt an den Mauern hinauf gelang ihm, wie am Tage zuvor, und er erhielt von der Prinzessin den Ring. Auf dem Rückwege schoß Jemand auf ihn und verwundete ihn am Fuße. Als er nach Hause kam, verwahrte er Roß und Kleider, Taschentuch und Ring wieder in dem Eichenbaum und tat, als wenn nichts vorgefallen wäre.
Nun wollte die Prinzessin gerne den Namen des Prinzen wissen, der sie erobert hatte, und da sie gehört hatte, daß er verwundet sei, ließ sie im ganzen Lande nach allen Lahmen forschen, jeder Lahme sollte zu ihr gebracht werden. So hoffte sie ihn sicher zu erkennen. Die Abgesandten kamen auch in das Haus der drei Brüder, wo ihnen die beiden Ältesten sagten, ihr Bruder sei zwar lahm, der werde es ja aber auf keinen Fall sein. Die Abgesandten nahmen ihn jedoch mit und brachten ihn zu der Prinzessin.
Diesmal sah ihn die Prinzessin in seinem gewöhnlichen, sehr schmutzigen Anzug, da er aber der Wunde nach der rechte war, so weinte die Prinzessin, daß sie einen so häßlichen Mann haben sollte. Da ging er an den Eichenbaum, zog die prächtigen Kleider an, bestieg den goldenen Schimmel und schickte sich an, zu der Prinzessin zurückzureiten. Da kam noch ein Knecht mit sechs goldenen Schimmeln und zwölf silbernen Stuten mit zwölf silbernen Füllen, die ihm von nun an auch gehörten.
Als ihn die Prinzessin jetzt sah, er auch das Taschentuch und den Ring vorzeigte, freute sie sich sehr, und es wurde gleich Hochzeit gemacht, und ich war auch auf der Hochzeit und habe Bierchen getrunken.
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren, aus Klein-Jerutten
DER KLEINE BZDZIONEK ...
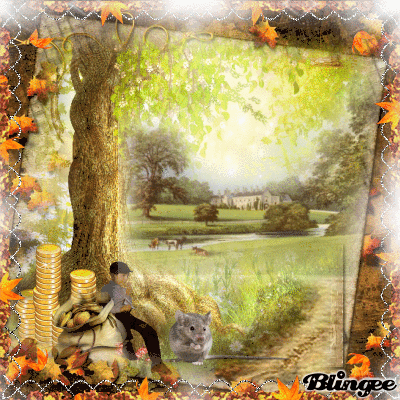
Ein Vater hatte einen einzigen Sohn, der war aber ein Bzdzionek, ein Däumling, denn er war nur so groß wie eine Bremse. Der Junge bereitete seinen Eltern manchen Ärger, weil er überall mitgenommen sein wollte. Der Vater war ein Ochsenknecht und den ganzen Tag nicht zu Hause, und so musste er den kleinen Kerl immerfort auf dem Felde bei sich haben. Er setzte ihn dann dem einen Ochsen ins Ohr, und hier schrie er den ganzen Tag: »Hü, hott!«
Eines Tages fuhr ein reicher Mann des Weges, und als er das Geschrei hörte, blieb er verwundert stehen und fragte den Ochsenknecht, wer denn da immer schreie. Da zog dieser seinen Sohn dem Ochsen aus dem Ohr und zeigte ihn dem Manne. Und der Mann fand Gefallen an dem kleinen Bzdzionek und bot dem Vater hundert Taler für denselben. Da spitzte der Ochsenknecht die Ohren und war erstaunt, dass man ihm so viel Geld für den kleinen Taugenichts geben wolle. »Halt,« dachte er, »will mir dieser Mann schon hundert Taler geben, dann muss mein Sohn noch etwas mehr wert sein.«
Daher verkaufte er ihn dem Manne nicht, sondern trug ihn am nächsten Tage zu dem Gutsbesitzer. Dieser freute sich ebenfalls über den Kleinen; er versprach dem Vater dreihundert Taler und erhielt ihn auch. Da er aber sehr geizig war, hätte der Ochsenknecht die Summe nicht bekommen, wenn der kleine Bzdzionek ihm nicht dazu verholfen hätte. Und das geschah in folgender Weise:
Der Gutsbesitzer trug den Kleinen immer bei sich in der Tasche. Eines Tages, als er ausgefahren war, fand er auf dem Wege einen Sack mit Geld liegen, den hob er auf und legte ihn zu sich auf den Wagen. Der Kleine hatte das gemerkt, und nun kroch er leise aus des Herrn Tasche heraus und machte sich über den Geldsack her. Er warf ein Goldstück nach dem andern durch einen Spalt im Wagen heraus; dann liess er sich selbst durch den Spalt auf die Erde fallen, sammelte die Goldstücke zusammen und verwahrte sie in einem Mauseloch, bis der Vater des Weges kam. Diesem übergab er den Haufen Gold und machte ihn so zu einem reichen Manne.
Der Vater aber nahm jetzt den kleinen Bzdzionek wieder zu sich und bekam nie mehr Lust, ihn zu verkaufen.
Polen: Otto Knoop: Sagen aus Kujawien
GOLDBEUTEL, TABAKSPFEIFE UND WUNSCHSACK ...
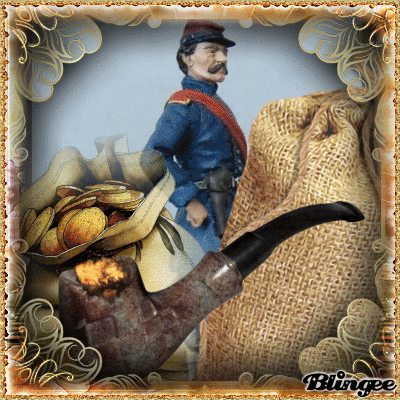
Es war einmal ein Soldat, der hatte seinem Könige treu gedient und sich manche Ehrenzeichen erworben; die schmückten seine Brust gerade so wie die Narben seiner Stirn. Als nun Friede im Lande wurde und er Urlaub bekam, machte er sich auf die Wanderschaft, den Tschako auf dem Kopfe, ein Stück Brot im Tornister, einen Schluck Wasser in der Feldflasche. Sein Beutel war leer, sein Herz aber voll Hoffnung und Glauben.
Eines Morgens kam er auf seinem Wege in den Wald, und als er durch das Dickicht ein Rauschen hörte, das eine nahe Quelle verriet, beeilte er sich, um dort zu rasten und sich zu laben. Da begegnete ihm ein armer Alter und bat: 'Erbarm dich meiner, Soldat, und schenke mir ein Stückchen Brot, ich bin so erschöpft vom Hunger, daß ich mich nicht mehr aufrecht halten kann!'
Der Soldat langte in den Tornister und gab dem Alten sein letztes Stück Brot, obgleich er selber hungrig war. Als er dann an die Quelle kam, dachte er: 'Ein Schluck klares Wasser muß diesmal für Hunger und Durst gelten!', labte sich, füllte seine Flasche von neuem und marschierte weiter. Die Sonne fing an heiß nieder zu brennen, und während er um Mittagszeit über die offene Heide ging, wurde er recht müde, beschleunigte aber doch seinen Schritt, da er vor sich ein paar Bäume erblickte, unter deren Schatten er sich mit frischem Trunk erquicken wollte.
Da begegnete ihm abermals ein Greis und bat: 'Erbarme dich und gib mir zu trinken, ich komme um vor Durst!' Da reichte ihm der Soldat seine Feldflasche, der Alte trank sie leer bis auf den letzten Tropfen, dankte und ging weiter. Hunger und Durst quälten den Soldaten nicht wenig, und weit und breit war weder Dorf noch Herberge zu sehen, kein Mensch auf den Feldern, die er durchwanderte. Auf einmal sah er am Saume der Landstraße einen armseligen Krüppel liegen, der nur mit wenig Lumpen bekleidet auf dem sonnenheißen Boden lag und stöhnte. Dies Elend erbarmte den Soldaten, er schnallte seinen Mantel vom Tornister los, breitete ihn über den Armen und ging weiter.
Gegen Abend wurde er aber so hungrig und durstig, daß er sich ganz erschöpft fühlte; er riß einige Ähren aus dem Weizenfelde, rieb sie zwischen den Händen und aß die Körner, während er sich unter einem am Wege aufgerichteten Kreuze niederließ.
Plötzlich standen dieselben drei Greise vor ihm, denen er im Laufe des Tages begegnet war. 'Du hast den Hungrigen gespeist,' sprach der erste, 'fordere dafür einen Lohn von der unerschöpflichen Gnade Gottes!' 'Ei,' antwortete der Soldat, 'wenn's erlaubt ist, so wünsche ich mir einen Beutel voll Gold, der nie leer würde, wenn ich auch noch so viel für die Dürftigen und für mich selbst heraus nähme!' Da reichte ihm der Greis einen gefüllten Beutel und verschwand.
Nun sprach der zweite: 'Du hast den Durstigen mit deinem letzten Tropfen getränkt, fordere deinen Lohn dafür!' 'Ja, weißt du, Alterchen, am liebsten wäre mir eine Pfeife von Gottes Gnaden, die immer voll Tabak bleibt, wenn ich auch noch so oft rauche oder sie anderen zum Rauchen borge.' Der Greis reichte ihm eine kurze Pfeife und verschwand.
'Du hast den Nackten bekleidet,' sprach nun der dritte, 'sprich, was du dir dafür wünschest!' Der Soldat besann sich ein Weilchen, denn er wußte wahrhaftig nicht, was man sich noch auf der Welt wünschen könnte, wenn man immer Geld im Beutel und Tabak in der Pfeife hat. 'Na,' sagte er zuletzt, 'will mir der liebe Gott durchaus noch etwas schenken, so gefiele mir wohl ein Sack, in den man alles einfangen und stecken lassen könnte, was man möchte.' 'Hier ist, was du begehrst,' sprach der dritte Greis, und reichte dem Soldaten einen Sack. 'Willst du ihn benützen, dann sprich so:
Wenn dich öffnet meine Hand,
Wundersäckchen fein,
Jeder, den ich dir genannt,
Schlüpf in dich hinein!'
Als der Greis diese Worte gesprochen hatte, verschwand auch er. Der Soldat bekreuzigte sich, kniete nieder und betete ein andächtiges Vaterunser. Dann steckte er vergnügt den goldspendenden Beutel ein, zündete sich die Pfeife an, hängte den Sack über den linken Arm und wanderte singend weiter; Hunger, Durst und Müdigkeit waren vergessen.
Noch ehe es Nacht geworden war, langte er in der Hauptstadt des Landes an, und das Tor, zu dem er einging, führte durch das Judenviertel, in dessen Straßen Laden an Laden grenzte. Sobald die Verkäufer den Fremdling erblickten, stürzten sie aus ihren Buden, umringten ihn und fingen an, ihre Waren mit lautem Geschrei anzupreisen, ihn an den Kleidern zu zerren, weil jeder ihn zu seinem Laden nötigen wollte, und sich so zudringlich um ihn zu streiten, daß sich der Soldat ihrer gar nicht mehr erwehren konnte. Ärgerlich zog er die Schnur seines Sackes auseinander und rief:
'Wenn dich öffnet meine Hand,
Wundersäckchen fein,
Jeder, den ich dir genannt,
Schlüpf in dich hinein,
Juden, alle hinein!'
Da öffnete sich der Sack ganz weit, und alle, die sich um den Soldaten her gedrängt hatten, Händler, Weiber und Kinder fuhren Hals über Kopf hinein, wie Wasser durch die Schleusen, worauf die Schnur sich von selbst wieder zuzog. Der Soldat schüttelte den Sack, warf ihn auf den Rücken und wanderte singend weiter. Die Juden fingen an zu schreien und zu lärmen, sie wimmerten und flehten um Freiheit. 'Sobald ich euch herauslasse, werdet ihr wieder anfangen, die Vorübergehenden zu belästigen!' sagte der Soldat. 'Nein, nein, das tun wir gewiß nicht mehr,' schrien sie. Da band der Soldat den Sack los, schüttelte alle heraus und ging weiter, um sich in der großen Hauptstadt um zu sehen.
Der König erfuhr noch an dem selben Abend diesen Vorfall, er ließ den Soldaten zu sich rufen und sagte: 'Du bist ja ein wackerer Soldat, hast den ganzen Haufen Juden allein bezwungen! Möchtest du dich nicht auch mit Teufeln messen, die sich in der Königsburg meines Vaters so sehr eingenistet haben, daß ich ihnen weichen und den neuen Palast beziehen mußte? Gelingt es dir, sie zu verscheuchen, so gebe ich dir Gold in Fülle und ernenne dich zum Herzog.'
'Ich weiß nicht, ob es glücken wird, mein König, doch will ich es gerne versuchen', antwortete der Soldat und ging auf der Stelle in die Burg, die ganz leer stand, um dort zu übernachten. Er brachte eine Laterne mit, setzte sich im großen Saale auf einen eisernen Sessel, stellte seine Leuchte auf den Tisch, zündete die Pfeife an und wartete ab, was es jetzt geben würde.
Als es Mitternacht schlug, ertönte ein schrecklicher Lärm, die Türen flogen von selbst auf, und auf der Schwelle erschien ein gehörnter Teufel, der mit seinem langen Schweife auf dem Boden Takt schlug. 'Wie kannst du so keck sein, dich hierher zu wagen?' sagte er grimmig. 'Antworte, oder ich drehe dir den Hals um.' 'Ich bin ein Soldat auf der Wanderschaft,' sagte dieser, indem er ruhig weiter rauchte. 'Wenn du mir den Hals umdrehen willst, so warte damit, bis meine Pfeife ausgeraucht ist.' 'Das verspreche ich dir,' sagte der Teufel, setzte sich hin und wartete. Auf einmal rief er ärgerlich: 'Das dauert mir zu lang! Her mit der Pfeife, ich will sie selbst ausrauchen. Bei dem Herren der Hölle, das tue ich!'
Der Soldat nahm die Pfeife aus dem Munde, reichte sie dem Teufel, und dieser fing nun an, den Rauch mit voller Kraft in sich zu ziehen, um ihn dann durch seine große Habichtsnase wieder ausströmen zu lassen. Gewaltige Dampfsäulen stiegen aus seinen Nasenlöchern und verbreiteten sich wie dunkles Gewölk im ganzen Saale, aber die Pfeife blieb voll Tabak wie zuvor.
Da erscholl ein wildes Getöse in allen Gängen des Schlosses, die Türen flogen auf, und Tausende von Teufeln stürzten herein, umringten den Soldaten und schrien: 'Wo kommst du her, wo willst du hin?' Als sie von ihm erfuhren, daß ihr Oberster versprochen hätte, ihn leben zu lassen, bis die Pfeife ausgeraucht sei, und sahen, daß dieser damit nicht zustande kam, nahm einer nach dem anderen die Pfeife, paffte und dampfte, bis ihm fast der Atem ausging und zuletzt der Rauch zu allen Fenstern und Türen hinausströmte wie Gewitterwolken. Der letzte Teufel steckte sich das Pfeifenrohr bis zur Mitte in den Rachen, aber alles half nichts, der Tabak glimmte immer fort und wurde nicht weniger.
Mittlerweile entstand Lärm in der Hauptstadt, man sah die Rauchwolken aus dem Schlosse strömen, die Feuerglocke wurde geläutet, und die Feuerwehr zog aus, um zu löschen, damit der Brand nicht die Stadt ergreifen möge. Den Teufeln wurde es unheimlich, als sie sahen, daß diese Pfeife nie auszurauchen sei, und sie sprachen zum Soldaten: 'Gib das Wort zurück, welches unser Oberster dir gegeben hat, wir lassen dich lebendig fortziehen.' 'Lebendig bleibe ich auch schon ohne euere Gnade; wenn ihr das Wort zurückhaben wollt, müßt ihr versprechen, diese Burg zu verlassen, und zwar auf immer!'
'Das können wir nicht!' riefen die Teufel. 'Der verstorbene König hat in den unterirdischen Gewölben viel unrechtmäßiges Gut aufgehäuft, das nun dort insgeheim vergraben liegt und keinem Nutzen bringt; deshalb ist er dazu verdammt, jede Nacht aus seinem Grabe in diese Keller zu kommen, wo wir ihn so lange quälen, bis jemand die Schätze entdeckt und an die Armen verteilt.' Nachdem die Teufel so gesprochen, öffnete der Soldat seinen Sack und rief:
'Wenn dich öffnet meine Hand,
Wundersäckchen fein,
Jeder, den ich dir genannt,
Schlüpf in dich hinein,
Teufel, alle hinein!'
Im nächsten Augenblick befand sich der Soldat ganz allein im Saale, sämtliche Teufel waren im Sack und baten jammernd, wieder heraus zu dürfen, der Soldat aber schlug mit dem Sack gegen die Wand und sagte: 'Ich lasse euch nicht eher heraus, bis ihr mir das Wort gebt, sogleich alle verwünschten Schätze herauf in diesen Saal zu schaffen und dann die Burg für immer zu verlassen!' 'Laß uns heraus. Wir geben dir unser Wort.'
Da stach der Soldat mit einer Stecknadel in den Sack, und zu diesem kleinen Loch schoß ein Teufelchen heraus wie ein Stein aus der Schleuder. Schnell stopfte der Soldat die Öffnung wieder zu und gebot dem Teufel, der sich unaufhörlich vor ihm verneigte: 'Gehe jetzt und tue, was ich gefordert! Sobald es geschehen ist, lasse ich auch die anderen heraus.'
Da ließ sich das Teufelchen durch eine Ritze im Fußboden in die unterirdischen Gewölbe hinab, und nach Verlauf einer Stunde war der halbe Saal mit Silber und Gold überschüttet. Nun öffnete der Soldat den Sack, und ein ganzer Schwarm Fledermäuse flatterte winselnd heraus und verschwand durch die offenen Fenster.
Der Soldat streckte sich nun aus, um bis an den Morgen zu schlafen, ging dann zum Könige und berichtete ihm alles. Das Gold, das ihm zum Lohn versprochen war, bat er, statt seiner den Armen zu geben; auch für den Herzogstitel bedankte er sich schönstens und zog vor, wieder in die Welt hinaus zu wandern, nachdem er gesehen, daß der König in seines Vaters Burg eingezogen war und alle dort aufgehäuften Schätze unter die Dürftigen verteilt hatte.
Der Soldat ging und ging, rauchte mit Behagen seine Pfeife, und wenn er etwas nötig hatte oder armen Leuten begegnete, so machte er auch zuweilen Gebrauch von dem goldspendenden Beutel, der immer voll Dukaten blieb. Nach einiger Zeit gelangte er in eine andere Hauptstadt und begann dort wieder ganz soldatisch zu leben. Der Feind hatte sich nämlich in großer Menge in dieses Land geworfen, das Heer, das ihm entgegengesandt worden, besiegt und belagerte jetzt die Hauptstadt. Als der Soldat dort ankam, hatte der Feind die Stadt eben zur Übergabe aufgefordert und mit Feuer und Schwert bedroht. Der König des Landes, der sich gegen die Überzahl nicht zu helfen wußte, ließ öffentlich ankündigen, daß er dem, der die Belagerer verjage, seine einzige Tochter und sein halbes Reich zum Lohn geben wollte.
Als der Soldat dies erfuhr, eilte er auf den Wall, nahm seinen Goldbeutel und fing an, Gold auszuschütten. Er schüttete und schüttete ohne Aufhören, und als dies im feindlichen Heerlager bemerkt wurde, kam ein Trupp nach dem anderen herbei gelaufen, die Goldstücke aufzulesen. Sobald aber allesamt auf einem Haufen versammelt waren, öffnete er seinen Sack, sagte seinen Spruch und rief: Soldaten, alle hinein! Da donnerte und blitzte es, und das ganze feindliche Heer fuhr in den Sack.
Das erfreute Volk der Hauptstadt stürmte nun nach dem verlassenen Lager und machte große Beute an Lebensmitteln, reich gezäumten Pferden, Gewehren und anderen Waffen. Der Soldat hatte sich inzwischen zum Könige begeben und schüttete dort im Schloßhofe nach und nach das ganze Heer aus dem Sack, das alsbald von dem Gefolge des Königs in Haft gebracht wurde. Der König selbst führte dem Soldaten seine Tochter zu, eine wunderschöne junge Prinzessin und sprach: 'Hier, mein Erretter, nimm die Hand meiner Tochter zum Lohne; heute noch verschreibe ich dir die Hälfte meines Reiches.'
Der Soldat lächelte die schöne Prinzessin freundlich an. Als er aber bedachte, daß er als ihr Mann am Königshofe bleiben müßte, gefiel ihm das nicht, denn sein soldatisches Herz liebte die Freiheit über alles, und ohne zu wandern, mochte er nicht leben. Deshalb schlüpfte er unter die Volksmenge und machte sich mir nichts, dir nichts auf und davon. Die Pfeife im Munde, wanderte er fort und fort, gar weit in der Welt herum, und zuletzt ward er alt und grau.
Da erkrankte er eines Tags und sah den Tod zu seinem Haupt stehen. Zu sterben gefiel ihm aber gar nicht; er meinte: in einer Welt, wo es Pfeifen gibt, die sich nie ausrauchen, und Beutel, die immer voll Dukaten sind, ließe sich's ganz angenehm leben. Als nun der Tod den Arm nach ihm ausstreckte, machte er eiligst seinen Sack auf und rief:
'Wenn dich öffnet meine Hand,
Wundersäckchen fein,
Jeder, den ich dir genannt,
Schlüpf in dich hinein,
Tod, marsch hinein!'
Der Tod stöhnte und ächzte im Sack; seit vielen Jahrhunderten war er allerwärts hingekommen, wo er nur immer wollte; zu diesem Sack konnte er aber nicht hinaus. Lange bat und flehte er jämmerlich, zuletzt wurde er still. Der Soldat genas, steckte seine Pfeife an und wanderte weiter von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Er wurde immer älter und älter, doch weder er noch sonst jemand in der Welt starb, seit er den Tod gefangen hielt.
Es fing an schlimm in der Welt auszusehen. Der Bruder verfolgte den Bruder, Kinder griffen ihre Eltern an, jeder suchte dem anderen den letzten Bissen zu entreißen, und blutige Kämpfe, welche die schrecklichsten Wunden hinterließen, fanden täglich statt, weil es zu viele Menschen gab. Selbst an den schlimmsten Verletzungen starb niemand. Zuletzt entstand solche Unordnung, daß dem Soldaten das Leben verleidet ward, und eines Tages öffnete er den Sack, um den Tod frei zu lassen. Ganz ermattet und klapperdürr sprang der Tod heraus und stürzte sich in die Welt hinein.
Nun fingen die Leute wieder an zu sterben, und auf der Welt ging es in der gewöhnlichen Ordnung zu, nach kurzer Zeit war alles wie ehemals. Nur der Soldat war und blieb unglücklich. Da er schon 200 Jahre gelebt hatte, langweilte er sich auf Erden und wünschte zu sterben.
Aber der Tod hatte Angst vor ihm, und wenn er den Soldaten nur von weitem sah, entfloh er meilenweit. 'Ja, was ist da zu machen?' dachte der Soldat. 'Wenn mich der Tod flieht, bleibt mir nichts übrig, als mich selbst auf die Wanderschaft nach der anderen Welt zu begeben.' Er zündete seine Pfeife an und ging, ging einen Monat und noch einen Monat, ein Jahr oder gar zweie immer nach Westen zu, bis er endlich das Tor der Hölle erreicht hatte. Dort klopfte er an.
'Wer ist draußen?' rief der Pförtner-Teufel.
'Ich bin's, der wandernde Soldat.'
'Du bist nicht in die Liste der Verdammten eingeschrieben, geh anderswohin.'
'Laß mich doch hinein, ich bitte dich, die Welt ist mir so zuwider, daß ich mich wirklich noch lieber in der Hölle aufhalte.'
'Nein, ich lasse dich durchaus nicht herein, wir kennen dich und deinen Sack zu gut!' Der Soldat klopfte und klopfte, es half ihm nichts. Da zündete er seine Pfeife frisch an, steckte den Beutel tiefer in seine Tasche, warf den Sack über den Arm und wanderte in die entgegengesetzte Richtung gen Osten.
Er ging lange, lange, viele Tage und Nächte durch, bis er endlich an das Himmelstor kam und dort schüchtern anklopfte.
'Wer ist draußen?' fragte Sankt Petrus und klapperte mit den Schlüsseln.
'Ich bin's, Sankt Peter, der wandernde Soldat, ein treuer Diener Gottes.'
'Du kommst zu früh, der Tod hat dich noch nicht von der Erbsünde gereinigt.'
'Ja, was kann ich dafür! Der Tod flieht mich, die Teufel fürchten sich vor mir, wo soll ich denn bleiben?'
Sankt Petrus schwieg, und der Soldat fing wieder an zu klopfen. Plötzlich ging die Himmelstüre auf, strahlendes Licht strömte heraus, und Sankt Petrus steckte den Kopf durch die Spalte und rief grimmig: 'Fort, Plagegeist!'Da ward der Soldat aufgebracht, er öffnete seinen Sack, sprach seinen Spruch und wollte mit den Worten schließen: 'Sankt Peter, gleich hinein!'
Noch hatte er diese Worte aber nicht ausgesprochen, als es plötzlich donnerte und blitzte und alles ringsum erzitterte. Der Soldat erschrak und stand wie versteinert. Vor ihm war Gott selbst im Sonnengewande seiner Majestät erschienen. Der Soldat wußte sich vor Schreck nicht zu helfen, er ließ seine Pfeife fallen, und sie fiel geradeswegs auf den Vesuv hinunter; auch den goldspendenden Beutel verlor er, denn er glitt ihm aus der Tasche und fiel auf das Gebirge von Akush.
Da sprach Gott zu ihm: 'Du hast nach meinem Gebot die Hungrigen gespeist, die Nackten bekleidet, die Durstigen getränkt, deshalb bin ich dir unter dem Kreuze erschienen und habe dir drei Wünsche freigegeben. Unter dem, was du verlangt hast, war kein Wunsch auf den Himmel gerichtet. Und jetzt willst du mit Gewalt in die Säle des ewigen Lichtes eindringen? Tapferkeit ist gut, Frechheit muß aber Strafe haben. Marsch, in den Sack hinein!' Der Sack tat sich weit auf, verschlang den Soldaten, und auf Gottes Befehl blieb er gerade über dem Himmelstor in der Luft hängen.
Noch heutigen Tages raucht die Pfeife des Soldaten aus dem Vesuv heraus, das Gebirge von Akush ist voll Gold, und in hellen Nächten kann man den Sack in Gestalt eines weißen Wölkchens sehen; darin muß der Soldat bleiben, bis die Zeit seiner Sühne zu Ende ist.
Polen: Oskar Dähnhardt, Naturgeschichtliche Märchen
HERR UND DIENER ...
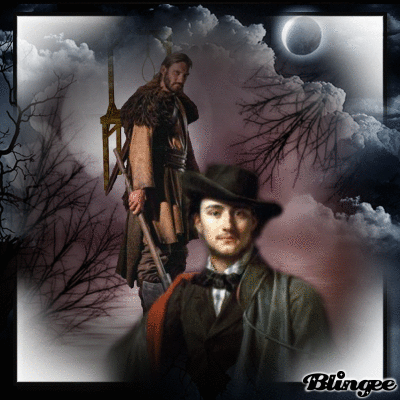
Es war einmal ein Herr, der war sehr geizig; es war ihm lieber, Jemanden zu betrügen, als ihm etwas zu geben. Kein Dienstbote konnte bei ihm zu Ende dienen, da er ihm entweder zu viel aß und zu wenig verrichtete oder zu viel schlief und zu viel Lohn verlangte. Deshalb hüteten sich die Leute, bei ihm in Dienst zu treten, wodurch er in große Not kam.
Um diese Zeit aber fand sich bei ihm ein solcher Knecht ein, der sehr die Unreinlichkeit hegte, sich weder putzte, noch wusch, noch kämmte, noch seine Nase wischte. In solchem Aufzuge und dazu noch in einem zerrissenen Rock fand er sich bei jenem Herrn ein und erbot sich, in seinen Dienst zu treten. Dabei fragte ihn der Herr: Wie viel Lohn verlangst du auf ein Jahr?
Darauf antwortete ihm der Knecht: Ich will Euch 7 Jahre lang dienen und will dafür nichts weiter, als nur ein Pferd mit seinem Sattel, und daß Ihr mir einen Tag dient. Als der Herr das hörte, freute er sich sehr darüber, daß er so wohlfeil für eine so lange Zeit einen Diener bekomme, in dem er dachte, daß es ihm schon leicht sein würde, diesen einen Tag für dessen sieben Dienstjahre auszuhalten, und daß sein Diener diese Zeit nicht aushalten würde.
Aber siehe da! Dieser Knecht erfüllte sein Versprechen; als er zum Dienst, zu seinem Herrn gekommen war, diente er ihm aufrichtig, wie wohl es ihm kühl und hungrig wurde; obwohl er aussah, wie ein Wilder oder ein Affe, so arbeitete er doch früh und spät. Und als die sieben Jahre zu Ende gingen, kam er des Abends in die Stube seines Herrn, setzte sich hinter den Tisch und rief zu ihm: Mein Dienst ist heute zu Ende, jetzt bin ich Dein Herr und Du mein Diener, wie Dir bekannt ist. Sogleich sattle mir und Dir ein Pferd und führe es mir vor die Türe und nimm mit Dir einen Sack.
Wenn auch dem, der bis dahin Herr war, diese Worte wunderlich ins Ohr klangen, dennoch mußte er, sich dabei den Kopf kratzend, dieses ausführen. Jetzt wurde der, der bis dahin Diener war und in seinem zerrissenen Rocke wie ein Unmensch aussah, Herr, und der frühere Herr im prächtigen Kleide und schönem Aussehen, Diener.
Nachdem sie Nachts sich auf die Pferde gesetzt hatten, rief der jetzige Herr zu seinem Diener scharf: Reite hinter mir! und sagte nicht wohin?, auch nicht wozu?, was den Diener mit großer Sorge und Furcht erfüllte. Und nachdem sie in fremden Gegenden über Berg und Tal, Feld und Wald geritten waren, trafen sie in der Finsternis einen Galgen an, an dem ein Toter hing, der schon sehr stank.
Hier hielt der Herr sein Pferd an und rief seinem Diener schroff zu: Krieche sogleich vom Pferde, schneide den Hängenden ab, stecke ihn in den Sack und nimm ihn mit Dir; selbstverständlich ging es ihm übel und schwer an, diesen hoch Hängenden abzuschneiden; aber dennoch mußte es geschehen. Als er darauf mit ihm weiter ritt, kamen sie weit in eine Haide.
Endlich erblickten sie in ihr ein Licht in der Nacht, zu dem sie hin eilten. Als sie dasselbe erreichten, sahen sie, daß es in einem Hause war. Hier machte der Herr Halt, indem er seinem Diener sagte: Gehe hier in die Stube, und erkundige dich bei den Leuten, ob sie mich nicht auf die Nacht behalten wollten, damit ich mein Abendbrot bereiten kann.
Der Diener gehorchte, ging in die Stube hinein und fand dort 24 Mann, hinter einem Tisch sitzend, essen und trinken, und er wußte nicht, daß dies alles Mörder waren. Als sie diesen Kutscher sahen, sagten sie zu sich: »Wenn ein Herrschaftskutscher einen so schönen Anzug hat, dann muß sein Herr von Silber und Gold starren«, und sie erlaubten ihm, bei ihnen zu nächtigen.
Aber als nun der Herr in die Stube trat, wurden sie alle starr und steif vor Staunen, da noch keiner von ihnen in seinem Leben eine solche Gestalt gesehen hatte, und sie sahen ihn nicht als einen Menschen an. Er ging erst hin und her von dem Tische zur Schwelle und sprach eine ganze Weile kein Wort.
Darauf ertönte sehr barsch sein erstes Wort zum Kutscher: Bring sogleich den Sack hierher in die Stube und brate mir im Kamin zum Abendbrot, was in dem selben ist. Der arme Unglückssohn fing an seine Nase zu krausen, aber dennoch tat er es und schüttete den Toten auf die Diele und ein großer Gestank verbreitete sich im Zimmer.
Nun nahm er all seine Kraft zusammen und warf ihn in den Kamin ins Feuer und briet ihn. Als es ihm aber übel wurde, fing er an gewaltig zu schreien: Herr, es stinkt, mir wird schlimm, ich falle um! Aber der Herr erwiderte ihm darauf: Ich sage dir: Backe. Die Mörder, die hinter dem Tisch saßen, wurden schwarz, als sie das sahen. Als der Diener zum dritten Male dieselben Worte ausstieß, da schrie ihm der Herr ganz fürchterlich zu: Wirf ihn auf die Erde und schiebe einen von denen hinter dem Tisch hinein.
Da meinten die am Tisch, der wäre der Leibhaftige, und entflohen alle durch das Fenster in die Haide. Nun suchte jener Herr in ihrem Hause ihre großen Schätze auf und nahm sie nach Hause. Aus Freude, daß er dadurch ein reicher Mann geworden war, beschenkte er auch seinen Diener und entließ ihn nach der Heimat.
Polen: M. Toeppen, Aberglauben aus Masuren
DIE KRÄHE ...
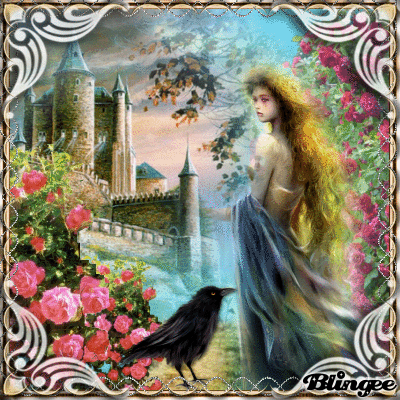
In einem königlichen Schlosse lebten drei Schwestern. Alle drei waren hübsch und jung, die jüngste war aber von allen die gutherzigste.
Nicht weit, etwa eine halbe Meile entfernt, stand ein zweites, schon zerfallenes Schloß, und dabei war ein köstlicher Garten. Hier ging die jüngste Prinzessin gern spazieren.
Einmal ging sie die Lindenallee auf und ab, da hüpfte aus einem Rosengesträuch eine schwarze Krähe hervor. Sie war ganz zerfetzt und blutig, sodaß die gute Prinzessin Mitleid mit ihr hatte. Kaum sah das die Krähe, als sie in diese Worte ausbrach:
»Ich bin keine Krähe, ich bin ein verzauberter Prinz und muß meine jungen Jahre so im Elend zubringen. Wenn Du es wolltest, o Prinzessin, Du könntest mich wohl retten. Sei für immer meine Gefährtin, trenne Dich von Deinen Lieben und komme zu mir in dieses Schloß. Ein Zimmer ist noch wohnlich, drin steht ein goldenes Bett. Einsam wirst Du hier leben. Doch vergiß nicht: was Du in der Nacht auch siehst und hörst, - nie darfst Du ein Angstgeschrei erheben; denn wenn Du nur ein einziges Mal schreist, sind meine Qualen verdoppelt.«
Die gütige Prinzessin verließ Vater und Mutter und bewohnte in dem einsamen Schlosse das Zimmer mit dem goldenen Bett. Am ersten Abend konnte sie nicht einschlafen. Um Mitternacht hörte sie, daß etwas geschlichen kam. Die Tür öffnete sich sperrweit, und ein Heer böser Geister stürmte herein. Die Teufel zündeten auf dem Herde ein großes Feuer an, darauf kochten sie Wasser in einem großen Kessel. Dann kamen sie mit Lärm und Geschrei zum Bette, rissen das zitternde Mädchen heraus und schleppten es zum Kessel.
Sie starb beinah vor Furcht, doch gab sie keinen Laut von sich. Da krähte plötzlich der Hahn, und alles verschwand. Und da erschien die Krähe und hüpfte vor Freude im Zimmer umher. Sie dankte der Prinzessin für ihren Mut, denn schon waren die Qualen des armen Tierchens bedeutend vermindert.
Die eine der älteren Schwestern hatte das alles erfahren, und aus Neugier kam sie die jüngste besuchen. Hier drang sie solange mit Bitten in sie, bis das gute Kind ihr endlich erlaubte, eine Nacht mit ihr im goldenen Bette zuzubringen. Als aber um Mitternacht die bösen Geister erschienen, schrie die Ältere laut vor Angst, und sogleich ertönte ein schmerzliches Gezwitscher. Von nun ab nahm die Jüngste keine ihrer Schwestern mehr zu Gaste.
Sie lebte einsam und litt die schrecklichste Angst vor den Geistern der Nacht. Aber plötzlich kam die Krähe, dankte ihr für ihre Ausdauer und sagte, ihre Leiden seien schon bedeutend vermindert.
So waren zwei Jahre vergangen, da sprach die Krähe zur Prinzessin: »In einem Jahre ist meine Strafzeit vorbei. Ehe ich jedoch meine wahre Gestalt wieder erlange, mußt Du in die weite Welt und als Magd dienen.«
Die junge Prinzessin diente nun ein ganzes Jahr lang, und obgleich sie jung und hübsch war, entging sie doch den Nachstellungen der Bösewichte. Eines Abends spann sie Flachs und war schon ganz müde. Da vernahm sie frohes Rufen, und herein trat ein schöner Jüngling, kniete nieder vor ihr und küßte ihre arbeitsmüden weißen Händchen.
»Ich bin es,« rief er aus, »ich bin der Prinz, den Du durch Deine Güte von furchtbaren Qualen befreit hast, als ich noch in Gestalt einer schwarzen Krähe umherwandelte. Komm nun mit auf mein Schloß. Wie glücklich wollen wir da miteinander leben!«
Und sie zog mit nach dem Schlosse, wo sie solchen Schrecken erlebt hatte. Hundert Jahre lebt' sie drinnen, hundert freudenvolle Jahre.
Polen: K.W. Woycicki, Volkssagen und Märchen aus Polen
DIE PESTJUNGFRAU ...

Einmal war die Pest im Lande. Da standen alle Dörfer öde, und alle Hähne waren heiser, kein einziger konnte krähen. Die Hunde konnten nicht mehr bellen wie früher; aber sie rochen und sahen das Gespenst von weitem. Sie knurrten und suchten es zu packen, und die Pestjungfrau neckte und reizte sie mit wahrer Schadenfreude.
Ein Bursche schlief auf einem hohen Heuschober, und neben ihm stand eine Leiter. Die Nacht war still und mondhell. Plötzlich entsteht in der Ferne ein mächtiges Brausen, wütiges Geknurre und Geheul der Hunde schallt herüber. Der Bursche steht auf und sieht zu seinem Schrecken, wie eine hohe weibliche Gestalt in weißem Gewande und mit fliegenden Haaren auf ihn zujagt. Ein langer hoher Zaun ist auf dem Wege: das Weibsbild springt mit einem Satz hinüber und klettert die Leiter hinauf. Hier, auf diesem sichern Platze, hält sie neckend ihren Fuß den Hunden hin. So reizt sie die wütende Meute und ruft beständig: »Huß, huß - den Fuß! Huß, huß - den Fuß!«
Der Knecht erkannte sogleich die furchtbare Jungfrau. Drum ging er leise zu der Leiter hin und stieß das obere Ende mit aller Gewalt ab. Das Weibsbild fiel hinunter, die Hunde packten sie: da drohte sie noch mit ihrer Rache und verschwand.
Der junge Bursche starb zwar nicht, aber sein Lebenlang hielt er den einen Fuß vor und konnte nichts anderes sagen, als die Worte der Jungfrau: »Huß, huß - den Fuß! Huß, huß - den Fuß!«
Polen: K.W. Woycicki, Volkssagen und Märchen aus Polen

DER ARME STUDENT ...

Ein armer Student ging auf der Straße nach der Stadt. Da sah er an den Mauern des Tores einen unbekannten Leichnam liegen, der von den vorübergehenden Leuten mit den Füßen gestoßen wurde. Er hatte nicht viel Geld im Sack, aber gern gab er seine paar Groschen zu einem christlichen Begräbnis her, damit die Leiche nicht weiter umher geworfen würde. Dann betete er auf dem frischen Grabe und ging rüstig in die Welt hinein.
Er kam in einen Eichenwald und schlief ermüdet unter einem Baume ein. Als er erwachte, merkte er mit Staunen, daß alle seine Taschen mit Gold angefüllt waren. Er dankte dem unbekannten Wohltäter und kam an einen Fluß, bei dem er nicht weiter konnte. Zwei Fährleute aber, die seine goldgefüllten Taschen sahen, nahmen ihn in ihr Boot, und mitten auf dem Wasser raubten sie ihm das Gold und warfen ihn in den Fluß.
Hilflos trieb er in den Wellen und glaubte sich schon verloren, doch da kam ihm zufällig ein Brett zu geschwommen. Er klammerte sich daran und gelangte glücklich ans Ufer. Aber das war eigentlich kein Brett, sondern der Geist des beerdigten Leichnams, und er sprach zu ihm: »Du hast meinen Leichnam beerdigen lassen, ich danke Dir herzlich dafür! Und als Dank sollst Du von mir lernen, wie man sich in eine Krähe verwandelt.« Darauf lehrte er ihn die Worte der Verzauberung. »Und nun«, fuhr er fort, »gebe ich Dir einen Brief an meinen leiblichen Bruder; der wird Dich lehren, wie man sich in einen Hasen und in ein Reh verwandelt.« -
Nachdem der Student alle diese Künste gelernt hatte, konnte er sich nach Belieben in eine Krähe, in einen Hasen oder in ein Reh verwandeln. Er kam zu einem mächtigen Könige und wurde dessen Hofjäger. Der König hatte eine reizende Tochter, die wohnte auf einer einsamen Insel, die von allen Seiten vom Meere umflossen war. Ihr Schloß auf der Insel war ganz von Kupfer, und ein Schwert war darin, so groß und stark, daß man damit ein ganzes Heer besiegen konnte. Gerade zu dieser Zeit waren die Feinde des Königs an der Grenze des Landes, er brauchte daher notwendig das siegreiche Schwert, aber wer sollte es holen? Er machte also bekannt: »Wer das Schwert herbeischafft, soll meine Tochter zur Frau bekommen und nach meinem Tode den Thron besteigen.«
Der Hofjäger erklärte sich bereit, das Schwert zu holen, und der König gab ihm einen Brief an die Tochter mit. Der Bursche ging in den Wald, bemerkte aber nicht, daß ein anderer Jäger ihm nachging. Zuerst verwandelte er sich in einen Hasen, dann in ein Reh, und so lief er mit voller Kraft bis ans Ufer des Meeres. Hier verwandelte er sich in eine Krähe und flog über das große Wasser hinüber auf die Insel.
Er trat in das kupferne Schloß und überreichte der Prinzessin den Brief des Vaters, und sie fand auf den ersten Blick Gefallen an dem schmucken Jäger. Sie fragte ihn, wie er denn über das Wasser gekommen sei. Da erzählte der Jäger, er kenne geheime Zaubersprüche und könne sich in eine Krähe, in einen Hasen und in ein Reh verwandeln. Die schöne Prinzessin bat ihn, doch sogleich vor ihren Augen eine solche Verwandlung vorzunehmen. Er machte sich zu einem Reh, hüpfte herum und leckte die Hände der Jungfrau, und sie schnitt ihm heimlich ein Stückchen Fell heraus. Als er sich dann zum Hasen machte und mit aufgestellten Ohren umher sprang, schnitt sie ihm wieder ein Stückchen Fell aus dem Rücken. Dann flatterte er als schwarze Krähe im Zimmer umher, und die Prinzessin riß ihm heimlich einige Federn aus dem Flügel heraus. Dann schrieb sie einen Brief an ihren Vater und übergab den Brief sowie das Schwert dem Jäger.
Wie er gekommen war, so eilte er nun zurück zum König. Als er in Hasengestalt durch den Wald lief, lauerte dort der verräterische Jäger, der die Verwandlung beobachtet hatte. Er spannte seinen Bogen, - und der Pfeil ging dem Hasen ins Herz. Nun brachte dieser andre Jäger Brief und Schwert dem König und erinnerte ihn an sein Versprechen. Der hocherfreute König sagte ihm die Hand der Prinzessin zu, setzte sich auf sein Pferd und ritt mit dem guten Schwert kühn in den Krieg.
Als er die Feinde von weitem erblickte, schwenkte er sein Schwert nach allen vier Weltgegenden. Sogleich fielen ganze Reihen der Feinde zu Boden, und die andern liefen davon wie die furchtsamen Hasen. Froh kehrte der König heim und brachte seine Tochter mit, um sie dem Jäger anzutrauen. Ein herrliches Fest wurde gefeiert; die Spielleute machten köstliche Musik, und das ganze Schloß glänzte von Lichtern. Aber traurig saß die Braut an der Seite des falschen Jägers. Sie hatte sogleich bemerkt, daß es nicht der sei, den sie im Schlosse gesehen hatte; aber sie wagte nicht, den Vater nach dem andern Jäger zu fragen. Sie weinte nur heimlich, denn ihr Herz schlug dem andern entgegen.
Und jener arme Jäger lag in seinem Hasenfelle ein ganzes Jahr lang tot unter der Erde. Da fühlte er sich mitten in der Nacht aus seinem tiefen Schlaf erweckt. Siehe da! Vor ihm stand der wohlbekannte Geist des Leichnams, den er hatte beerdigen lassen. Er erzählte ihm von dem Verrat des Jägers und sagte dann mit froher Stimme: »Morgen soll die Hochzeit sein. Geh schnell ins Schloß, die Prinzessin wird Dich gleich erkennen, und der falsche Jäger auch.« Schnell sprang der Jüngling auf und ging mit klopfendem Herzen ins Schloß des Königs. Eine große Gesellschaft war da, alle Gäste aßen und tranken nach Herzenslust. Die schöne Prinzessin erkannte ihn sofort: vor Freude schrie sie laut auf und sank in Ohnmacht. Aber der böse Jäger wurde vor Schrecken blaß und grün.
Da erzählte der arme Jüngling, wie er verraten und ermordet worden war, und um vor allen ein Zeugnis für die Wahrheit des Gesagten abzulegen, verwandelte er sich in ein schlankes Reh und fing an, die Prinzessin zu liebkosen. Sie aber legte den Streifen Fell, den sie ihm herausgeschnitten hatte, auf den Rücken, und der Streifen wuchs sogleich daran fest. Dann verwandelte er sich in einen Hasen, und die Prinzessin legte ihm wieder den herausgeschnittenen Streifen Fell auf den Rücken; er paßte genau hin. Alle waren darüber erstaunt, - noch mehr aber, als sich der Jüngling gar zur Krähe machte. Die Prinzessin zog die Federn hervor, die sie ihm in ihrem Kupferschlosse herausgerissen hatte, und sogleich wuchsen die Federn zusammen.
Da befahl der König, den schändlichen Jäger hinzurichten. Der getreue Jüngling erhielt die Hand der Prinzessin, und diese weinte nicht mehr, denn der Wunsch ihres Herzens war nun erfüllt.
Polen: K.W. Woycicki, Volkssagen und Märchen aus Polen
DIE FLUCHT ...
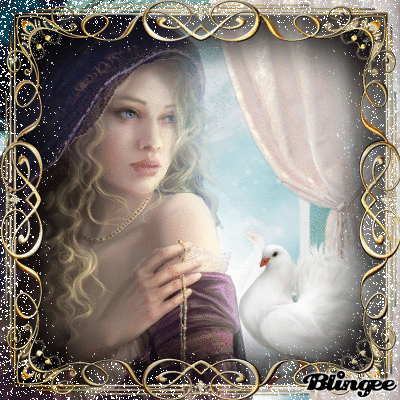
Eine verzauberte Prinzessin saß in einem hohen Bergschlosse und wurde hier von einer bösen Hexe bewacht. Der junge Prinz, mit dem die Prinzessin verlobt war, ging vergebens um den Berg herum und guckte in die Fenster des Schlosses, wo seine Braut in Sehnsucht schmachtete. Oft weinte er dann heiße Tränen, bis sich endlich eine Wahrsagerin seiner erbarmte und versprach, die verzauberte Prinzessin zu befreien.
In Gestalt einer Taube flog sie auf das Fenster der Gefangenen und sprach zu ihr: »Da hast Du einen Kamm, eine Bürste, einen Apfel und ein Bettlaken. Fliehe mit diesen Dingen aus dem Schlosse. Wenn Dich die Hexe verfolgt, so wirf zuerst den Kamm hin, sieh Dich um und fliehe weiter. Läuft sie Dir dann noch nach, so wirf die Bürste und dann den Apfel zur Erde. Und hört sie immer noch nicht auf, Dich zu verfolgen, so wirf das Laken hin, und Du wirst das Schloß Deines lieben Vaters erreichen«.
Die Prinzessin dankte dem guten Täubchen aufs herzlichste und wartete mit der Ausführung ihres Planes bis zum nächsten Donnerstag. An diesem Tage, da es eben Neumond war, setzte sich die Hexe auf eine Schaufel und ritt mit lautem Geschrei auf den Kahlenberg. Diese Gelegenheit benutze die Prinzessin, und früh mit Tagesanbruch lief sie fort. Sie lief, so schnell sie konnte, doch als sie sich umblickte, sah sie zu ihrem Schrecken die Hexe, die auf einem Hahne schon ganz dicht hinter ihr her geritten kam.
Voll Angst wirft die Prinzessin den Kamm hinter sich, so wie das Täubchen ihr geheißen hat. Der Kamm dehnt sich aus, eine Meile in die Länge, eine Meile in die Weite, und wird zum mächtigen Flusse. Die aufgehende Sonne beleuchtet das blaue Wasser: herdenweise plätschern wilde Gänse und Enten darauf herum, und die Schwalben netzen im schnellen Fluge die schwarzen Flügel in den glänzenden Wellen. Die Hexe wird durch den Fluß aufgehalten. Sie zittert und schäumt vor Wut, denn auf dem andern Ufer entfernt sich die Prinzessin immer weiter. Die Hexe besteigt also von neuem den Hahn, wirft sich ins Wasser und schwimmt durch den Fluß.
Die Prinzessin wird blaß vor Schrecken und wirft die Bürste hinter sich. Dann guckt sie sich um, und o Wunder: aus jeder Borste wird ein ungeheurer Baum; es entsteht ein großer Wald, ganz finster und dicht. Scharen von Wölfen heulen darin, und die Hexe muß sich einen ganzen Tag lang durch Gebüsch und Dickicht hindurchzerren. Aber auch die Prinzessin war nun schon müde und konnte nicht mehr so schnell vorwärts wie am Anfang. Deshalb konnte auch die Hexe, nachdem sie aus dem Walde heraus war, schnell nachkommen.
Die arme Prinzessin war kaum imstande, sich weiterzuschleppen, und warf den Apfel hinter sich. Der Apfel wurde zum hohen, steilen Berge. Die Zauberin schäumte schon wieder vor Wut, aber alles half nichts: sie mußte den Berg hinan, und vom Gipfel erblickte sie die Prinzessin, die unten mit mattem Schritt kaum vorwärts kam. Die Hexe bestieg wieder ihren Hahn und flog pfeilschnell vom Berge hinunter. Beinah konnte sie die Prinzessin am Rocke fassen: da wirft diese das Bettlaken zur Erde - und ein breites Meer legt sich zwischen sie und die Verfolgerin. Der Wind bewegt die Wellen. Die Hexe sieht von weitem aus wie Schnee, so ist sie bespritzt von dem glänzenden Schaume der Wellen; aber hindurch schwimmen kann sie nicht auf ihrem Hahne.
Die Prinzessin kam glücklich in das Schloß des Vaters. Dort wartete auch schon der Prinz auf sie, der traute Verlobte. Der König gab nun ein herrliches Gastmahl, und man feierte sogleich die Hochzeit. Das Schloß erglänzte von Lichtern, und draußen auf dem Meere ritt die schändliche Hexe immer noch auf dem ertrunkenen Hahne umher. Sie sah das glänzende Schloß und hörte die lustigen Geiger und das freudige Jauchzen der Gäste. Sie fluchte lange voll Wut, aber zuletzt mußte sie auch elend ertrinken.
Sogleich verschwand das große Meer, aber der Leichnam der Hexe blieb auf dem Felde liegen. Man wollte sie begraben, aber die Erde warf die schmutzige Leiche immer wieder herauf. In einer Nacht trug endlich der Sturmwind den ekelhaften Körper hinauf zu dem Schlosse, wo die Hexe die Prinzessin gefangen gehalten hatte.
Polen: K.W. Woycicki, Volkssagen und Märchen aus Polen
KNÜPPEL, RAUS! ...
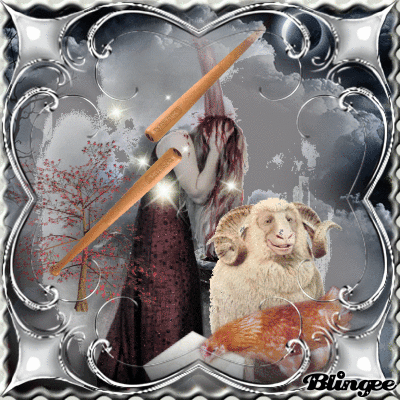
Ein armer Knecht hackte im Walde Holz. Da hörte er jemanden um Hilfe rufen. Er lief hin und sah, daß ein Mann mit Wagen und Pferden im Sumpfe stecken geblieben war. Er half ihm heraus, und der Mann sagte zu dem Burschen: »Was Du nur willst, ich geb Dir alles!« - Er war ein großer Hexenmeister.
Der Bursche kratzte sich hinter dem Ohr und wußte nicht, was er sich wünschen sollte. Der Zauberer gab ihm einen Widder und sprach: »So oft Du sein Fell schüttelst, fallen lauter Goldstücke heraus.« Der Bursche dankte höflich und nahm den Widder mit in seine elende Hütte. Hier fing er an ihn stark zu schütteln, und sieh! ein großer Haufen Goldes fiel aus des Widders Fell heraus.
Im selben Dorfe wohnte eine Hexe, die hörte von des Burschen Widder, gab ihm viel süßen Met zu trinken, nahm ihm den Widder fort und stellte ein gewöhnliches Schaf an seine Stelle. Als der Bursche wieder Geld brauchte, schüttelte er vergebens das arme Tier, es blökte nur, aber kein Pfennig kam heraus. Traurig ging er an den Sumpf und traf dort wieder den alten Zauberer.
Der wußte schon von der ganzen Geschichte und gab ihm eine Henne, zu der sollte er sagen: »Mein Hühnchen hold, leg mir ein Ei von Gold!« Dann legte die Henne wirklich ein goldenes Ei. Als aber der dumme Bursche nach Hause kam, machte ihn die Hexe wieder mit süßem Met betrunken und vertauschte seine Henne mit einer ganz gewöhnlichen. Vergebens wartete der Knecht auf ein goldenes Ei.
Betrübt ging er wieder aus, und der gute Zauberer gab ihm ein Tischtuch. Wenn man zu dem sagte »Tischlein, deck dich!« so schlug es sich gleich auseinander, und was man sich nur zu essen und zu trinken wünschte, das stand schon darauf. Der neugierige Bursche befahl dem Tischtuch gleich im Walde, sich aufzudecken; da aß und trank er sich gehörig satt. Doch die böse Hexe lauerte schon auf ihn und vertauschte sein Tischtuch mit einem gewöhnlichen.
Da erkannte der Mann den Betrug des Weibes, ging hin und verlangte vom Zaubrer etwas, womit er das Weib tüchtig durchprügeln könnte. Der Hexenmeister gab ihm einen Korb, wenn man dem zurief: »Knüppel, raus aus eurem Haus!« so flogen zwei mächtige Knüppel hervor und prügelten die bezeichnete Person mit der größten Wut.
Der Bursche nahm erfreut den Korb auf die Schulter, dankte dem Zaubrer und sagte, er werde ihm nun nicht mehr weiter zur Last fallen. Dann ging er geradewegs zu der Hexe, und als sie ihm wieder mit Met zusetzte, rief er voll Zorn: »Knüppel, raus aus eurem Haus!«
Dabei zeigte er mit den Fingern auf das Weib, und die Knüppel fingen an, unbarmherzig auf die Hexe loszuschlagen. Da versprach sie, ihm alle seine Sachen zurückzugeben, und gab ihm auch wirklich zuerst den Widder, dann die Henne und zuletzt das Tischtuch heraus.
Aber der Bursche befahl den Knüppeln, sie sollten das Weib nur totschlagen, denn es tat den Menschen viel Böses. Als nun die Hexe ihr Leben ausgehaucht hatte, rief er: »Knüppel, hinein ins Körbelein!« Da kehrten die Knüppel zurück in den Korb.
Der Bursche aber zog mit seinen Wundersachen in die weite Welt, an den Hof eines Königs, und als dieser mit seinen Feinden Krieg führte, schlug er das feindliche Heer, heiratete die Prinzessin und wurde später selber König.
Polen: K.W. Woycicki: Volkssagen und Märchen aus Polen
DIE KRÖTE ...
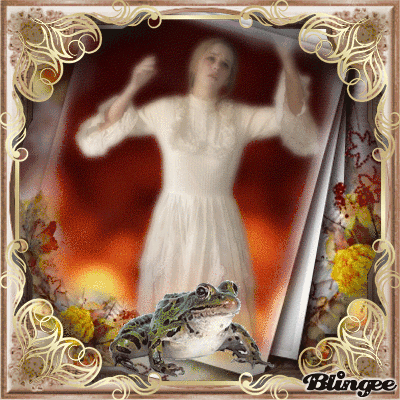
Ein reicher Fürst hatte drei Söhne. Zwei waren klug und der dritte dumm. Als sie groß geworden waren, wünschte der Vater, daß sie sich verheiraten möchten. Er gab ihnen also Bogen und Pfeile und redete sie folgendermaßen an:
»Ihr seid nun groß und stark geworden; bald wird es Zeit, Ihr guten Burschen, an schmucke Weibchen auch zu denken, die Euch durch ihren holden Reiz erheitern, damit ich noch vor meinem Tode die lieben Enkelchen mag schaukeln. Hier habt Ihr jeder einen Bogen. Schießt weit hinweg die schnellen Pfeile, und wo der Pfeil hinfällt, da suchet Euch die holde Gattin.«
Der Älteste spannte seinen Bogen, und zischend flog der Pfeil von dannen. Erst hinterm Walde fiel er nieder, auf dem Balkon des Marmorhauses. Da stand die goldgelockte Jungfrau, spann ihren Flachs mit weißen Händen. Die Jungfrau war des Ritters Tochter, dem viele Schlösser zugehörten. Der Ritter wählte ihn zum Eidam (zum Schwiegersohn). Voll Freude war der alte Fürst nun, daß sich sein Sohn ein Weib gewählt.
Der Jüngere spannte seinen Bogen, und zischend flog der Pfeil von dannen. Erst hinterm Bach fiel er nieder, im Schatten einer großen Linde. Dort saß die schwarzgelockte Jungfrau und sammelt' Honig in die Töpfe. Die Jungfrau war des Landmanns Tochter. Zwei große Häuser hatte der Landmann: das eine Haus von Fichtenholz, das andere von festen Steinen. Der Landmann wählte ihn zum Eidam. Voll Freude war der alte Fürst nun bei seines zweiten Sohnes Hochzeit.
Der Jüngste ging noch immer weiter mit dem schönen Bogen. Als die Reihe nun an ihn kam, - schwirrend flog der Pfeil von dannen, fiel dann in den schlammigen Teich. Der Jüngling fuhr im Kahn hin, suchte den Pfeil und fand neben ihm - eine häßliche Kröte.
Und weil es sein Vater so haben wollte, nahm er sich die Kröte zur Frau. Im Grunde aber war das keine Kröte, sondern eine verzauberte Prinzessin. Er brachte sie nach Hause, setzte sie auf sein Bett und befahl seinen Leuten, ihr zu dienen. Der alte Fürst aber war sehr traurig darüber, daß sein Sohn eine Kröte heiraten mußte.
Da kam der Namenstag der alten Fürstin-Mutter heran. Die Schwiegertöchter buken eifrig Brot, und das Brot wurde köstlich, groß und weiß wie Milch. Der Jüngste weinte heiße Tränen, daß seine Frau nicht auch der Mutter ein Brot backen konnte. Die gute Kröte sah ihn weinen und sprach zu ihm mit diesen Worten: »Sei nicht traurig, mein liebes Männchen; auch ich versteh ein Brot zu backen.«
Sogleich erschienen sieben Mägde und buken viel mehr Brot zusammen als die beiden Schwiegertöchter. Der junge Fürst, voller Freude, schickte es seiner Mutter - als Geschenk von seiner Frau. Und alle wunderten sich über das schöne Brot.
Die beiden Schwägerinnen wurden neidisch und fingen an, Gürtel zu sticken, der alten Fürstin zum Geschenk. Sie stickten sie mit Gold, mit Silber, und alle waren entzückt über die herrliche Arbeit. Der junge Fürst weinte bittere Tränen, daß seine Frau nicht auch so sticken konnte. Die Kröte sah ihn weinen und sprach zu ihm mit diesen Worten: »Sei nicht traurig, mein liebes Männchen; auch ich stick einen schönen Gürtel, den bringst Du als Geschenk der Mutter.«
Und es erschienen sieben Mägde und stickten einen Gürtel aus Gold, Silber, Perlen und blitzenden Diamanten. Der junge Fürst brachte das Geschenk zur Mutter, und alle waren erstaunt, daß eine Kröte einen so schönen Gürtel sticken konnte.
Der Namenstag der alten Fürstin war da. Die beiden Schwiegertöchter saßen schön ausgeputzt neben ihr. Der junge Fürst war traurig, daß er nicht auch bei dem Feste sein konnte. »Wir werden auch hingehen,« sagte die Kröte. »Geh Du voran, und wenn es regnet, so sag, daß Deine Frau sich badet; wenn es blitzt, so sag, daß sie sich putzt, und wenn es donnert, daß sie schon angefahren kommt.«
Voll Freude geht er hin und wünscht der Mutter Glück und Segen. Man stellt die Tische auf, das Festmahl soll beginnen. Da fängt es ganz leise an zu regnen. Der junge Fürst sieht zum Fenster hinaus und sagt laut: »Jetzt badet sich mein liebes Weibchen!« Alle sehen hin und denken: »Was spricht der Dummkopf doch für Unsinn!« Es blitzt am Himmel; - er spricht wieder: »Jetzt zieht sich mein liebes Weibchen an!« Es donnert, - da ruft er mit Jauchzen: »Jetzt kommt mein Weibchen angefahren!«
Voll Neugier blickt man nach der Tür. Aber es kommt keine Kröte herein, sondern eine holde, wunderschöne Frau. Die Eltern sind entzückt, und ebenso der junge Fürst. Schnell läuft er nach Hause, niemand weiß, warum. An der Tafel geht es lustig zu. Die junge Fürstin strahlt von Schönheit, und die beiden Schwägerinnen sind wütend vor Neid.
Da kommt eilig der junge Fürst zurück und ruft seiner Frau zu: »Die häßliche Krötenhaut, die Deine Schönheit verdeckte, ich habe sie zu Hause gefunden und verbrannt!« In demselben Augenblick war die junge Frau ganz in Flammen eingehüllt. »Leb wohl!« rief sie; »bald sollte ich erlöst werden, als Mensch unter Menschen leben. Nun bin ich für lange Zeit aufs neue verzaubert.«
Sie schwand dahin wie im Nebel, und man sah sie niemals wieder.
Polen: K.W. Woycicki: Volkssagen und Märchen aus Polen
DER TEUFELSTANZ ...
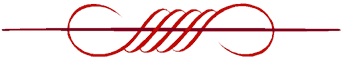
Wenn der Sturmwind sich im Kreise dreht und den trockenen Sand herumfegt, so ist das ein Tanz des bösen Geistes. Dann mach alle Fenster zu, denn der Böse kann Dir in die Knochen fahren. Hast Du aber Mut und willst Du Deine Seele hingeben für Gold und Reichtum, so nimm ein neues scharfes Messer und wirf es mitten in den Ringeltanz.
Es war einmal ein junger Bauer, dem hatte der Teufel in Gestalt eines Wirbelsturms das Dach von der Scheune herunter gerissen. Der Bursche nahm ein glänzendes Messer und warf es mitten in den Sturm. Sogleich erschien der höllische Geist, demütig gebückt, und fragte nach seinem Befehl.
"Zuerst bessere mir die Scheuer wieder aus," rief der junge Bauer, rot vor Wut; "und dann fülle mir die Kartoffelgrube bis zum Rande mit Gold; bring mir auch ein Fäßchen Schnaps ins Haus und frischen Speck, drei große Schwarten."
"Ganz wie Du willst soll es geschehen. Nur zieh mir vorher das Messer heraus, denn es schmerzt mich abscheulich." "Nein," rief der Bauer, "erst tu, was ich Dir gesagt habe." Und der Teufel tat alles.
Der Bauer aber wurde bald nachher zum Sterben krank. Die andern Bauern gingen zu ihm, ihn besuchen. Da sahen sie neben dem Bette, zum Haupt des Kranken, den Teufel stehen und auf die arme Seele lauern. Alle betrauerten den Kranken, und der alte Gevatter sagte leise:
"Er hätte kein Gold verlangen sollen. Er hätte lieber mit einem silbernen Rockknopfe auf den Teufel schießen sollen. Dann konnte er noch lange und ehrlich leben und seine Seligkeit behalten."
Quelle: Polnische Volkssagen und Märchen
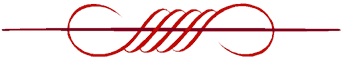
BORUTA ...

Boruta ist ein berüchtigter Teufel, der noch bis auf den heutigen Tag unter den Trümmern des Schlosses von Lenczyca in Masowien haust. Er ist schon alt, denn schon seit Jahrhunderten kennt man ihn. Doch ist er jetzt wahrscheinlich schon ein bißchen gesetzter geworden, da man in neuester Zeit nicht mehr viel von ihm zu hören bekommt. Früher aber war sein Name weit und breit gefürchtet, und wer mit seinem Nachbar in Feindschaft lebte, der führte wohl den Fluch im Munde: »Mag ihn Boruta erdrosseln oder ihm das Genick brechen!« - Und der Teufel war immer willig, solche Wünsche zu erfüllen.
Nicht weit vom Schlosse von Lenczyca wohnte ein Edelmann von ungeheurer Körperstärke. Niemand wagte es, sich im Zweikampf mit ihm zu messen, denn gleich beim ersten Zusammenstoß schlug er dem Gegner mit einem kräftigen Hieb den Säbel aus der Hand. Hatte er einmal mit dem Rücken an der Mauer des Hauses Stellung genommen, so konnte die ganze Nachbarschaft nichts gegen ihn ausrichten.
Deshalb wurde dieser Edelmann ebenfalls Boruta genannt. Man glaubte, daß ihm der Teufel Boruta beistehe, weil niemand seiner Stärke widerstehen konnte. Zum Unterschied von dem wirklichen Teufel jedoch, und weil er eine graue Kappe zu tragen pflegte, wurde er Grau-Boruta genannt. Niemand wagte ihn zu reizen, jeder ging ihm von weitem aus dem Wege. Sogar im Weinhause - wenn da die betrunkenen Edelleute in wildem Streite schon nach den Säbeln griffen und zufällig Grau-Borutas Stimme hörten, gingen sie entweder in den Hausflur oder auf den Hof und färbten sich dort ihre kahlen Köpfe blutig.
Das machte den Edelmann stolz, und in kühnem Selbstlob drohte er häufig, er wolle dem wirklichen Boruta, sobald er ihn treffe, den Hals umdrehen und ihm seine Reichtümer entreißen. Dann erschallte oft, wie man bald bemerkte, im Ofen oder hinter dem Ofen ein höhnisches Gelächter. Grau-Boruta trank nicht übel: der beste masurische Edelmann konnte ihn nicht zu Boden trinken; und wenn er trank, pflegte er den ersten Humpen auf das Wohl seines Namensvetters, des Teufels Boruta, zu leeren; und sogleich hörte man eine tiefe gedehnte Stimme »Danke, Herr Bruder!« vernehmlich aussprechen.
Grau-Boruta hatte viel Geld, aber bald war alles in wüstem Leben verpraßt. Er beschloß daher, von seinem geliebten Herrn Bruder (so nannte er den Teufel) einige Säcke Gold auf unbestimmte Zeit zu borgen. Um Mitternacht zündete er seine Laterne an und ging mit gezogenem Säbel in die tiefen Kellergewölbe des Schlosses. Zwei ganze Stunden irrte er in den Gängen umher. Endlich entdeckte er eine verborgene Tür. Mit einem Schlage machte sie sich auf, und vor den Augen des Edelmannes erschienen glänzende Schätze, und im Winkel, auf einem mächtigen Klumpen Goldes, saß der Teufel in Gestalt einer Eule mit feurig blitzenden Augen. Der Edelmann erblaßte und zitterte, der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn; doch faßte er sich bald, verbeugte sich demütig und sagte: »Meines geliebten Bruders ergebenster Diener!«
Die Eule nickte mit dem Kopfe, und das gab unserem Grau-Boruta wieder einigen Mut. Er verbeugte sich nochmals, und dann begann er seine Taschen und Säcke mit Gold und Silber zu füllen. Das ward ihm bald so schwer, daß er sich kaum noch von einer Seite auf die andere drehen konnte. Schon fing es an zu tagen, und immer noch langte der Edelmann mit gierigen Händen nach den goldenen Schätzen. Endlich waren alle seine Taschen gefüllt, und er fing an, sich den Mund vollzustopfen; und da dieser eben nicht klein war, so bekam er noch ein ordentlich Teil hinein. Dann verbeugte er sich wieder vor dem Geiste und verließ das Gewölbe.
Kaum war er jedoch auf der Schwelle, da fiel die Tür von selbst mit Gewalt ins Schloß und zerhackte seine rechte Ferse in zwei Stücke. Hinkend und blutend brachte der Edelmann die Schätze in seine Wohnung. Jetzt hatte er viel Geld, aber seine Gesundheit war dahin. Sein ganzes Leben war nur noch ein Siechtum. Einmal geriet er wegen eines Feldrains mit einem Nachbar in Streit und forderte ihn zum Zweikampf. Früher hätte ihn Grau-Boruta mit seinem kleinen Finger umgeworfen; jetzt aber konnte der Nachbar leicht fertig werden mit dem reichen Geizhals und schlug ihn tot.
Sein Haus blieb nun für immer unbewohnt. Man erzählt sich, daß der Geist Boruta oft auf einem Weidenbaume saß, der auf dem Hofe wuchs. Und manchmal wurde der Teufel auch gesehen, wie er durch die verfallenen Gänge und Zimmer lief.
Polen: K.W. Woycicki: Volkssagen und Märchen aus Polen
MADEY ...
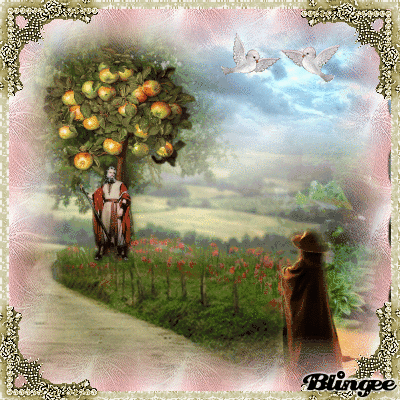
Es war einmal ein Kaufmann, der fuhr durch einen Wald. Da war es schwarz und dunkel. Er irrte lange umher, und als es ganz Nacht geworden war, blieb er im Sumpfe stecken. Er wurde ganz traurig und fing an zu weinen, als ihm plötzlich der Böse in Menschengestalt erschien.
»Sei munter, Mensch!« sprach er zum Kaufmann, »ich will Dich aus dem Sumpfe ziehen und Dir den Weg nach Hause zeigen, - aber unter der Bedingung, daß etwas, was in Deinem Hause ist, ohne daß Du es weißt, mir gehören soll.« Der Kaufmann dachte ein wenig nach und war gern mit der Bedingung zufrieden, denn er wußte nicht, daß ihm seine Frau während seiner langen Reise ein hübsches Söhnchen geboren hatte. Der Teufel zog ihn aus dem Sumpfe, brachte ihn auf die rechte Straße und nötigte ihn, sein Versprechen mit Namensunterschrift auf ein Pergament zu setzen. Dann verschwand er plötzlich.
Der Kaufmann freute sich sehr, als er seine liebe Frau nach so langer Abwesenheit wieder umarmen konnte; aber er war sehr betrübt, als er das kleine Knäblein sah, das er schon dem bösen Geiste verschrieben hatte. Der ehrliche Mann weinte oft im stillen und verbarg seine Tränen vor Weib und Kind. Indessen wuchs das Kind heran. Es war still, ruhig und lernbegierig. Im fünften Jahre las und schrieb es schon wie sein Lehrer, und das betrübte den armen Vater noch mehr, daß er sich von einem so lieben Kinde bald trennen und es dem Teufel opfern sollte.
Als der Junge sieben Jahre alt geworden war, bemerkte er des Vaters Kummer und Tränen; er bat deshalb so sehr und drang so lange in ihn, bis ihm der Kaufmann alles erzählte. »Betrübe Dich nicht, mein Vater; Gott wird mir helfen: ich will in die Hölle gehen und Deine Handschrift herausholen.« Die Mutter weinte und der Vater weinte auch, als sie dem Knaben zu einer so weiten Reise den Segen gaben. Doch dieser packte zusammen, was er nötig hatte, und schritt dann ruhig zum Hause hinaus.
Er ging einen weiten, weiten Weg, bis er in einen finstern, schrecklichen Wald kam, wo in einer verborgenen Höhle der grausame Räuber Madey wohnte. Dieser hatte seinen eigenen Vater ermordet und nur seine Mutter bei sich behalten, damit sie ihm das Essen koche. Wer in seine Hände kam, den schlug er ohne Erbarmen tot. Seine Mutter versteckte wohl die Verirrten in der Höhle; aber Madey hatte einen so feinen Geruch, daß er Menschenfleisch sofort roch.
In diese Räuberhöhle geriet zufällig unser Bürschlein, als es sich vor einem Sturme schützen wollte. Die alte Mutter erbarmte sich des Kleinen und versteckte ihn in einem Winkel der Höhle; als aber Madey später hereinkam, roch er gleich einen frischen Menschen. Schon hatte der arme Junge seinen Kopf unter die Keule des Räubers gebückt, da hörte dieser, wohin eigentlich seine Reise ging. Er schenkte dem Knaben das Leben, und dafür sollte sich der Kleine in der Hölle erkundigen, welche Qualen dort den Räuber erwarteten.
Der kleine Bursche verließ mit Tagesanbruch die Höhle und kam bald an die Pforte der Hölle. Mit geweihtem Wasser und mit kleinen Heiligenbildern, die er da anklebte, öffnete er leicht das Tor. Luzifer vertrat ihm den Weg und fragte barsch nach seinem Begehr. »Ich will die Handschrift, welche Dir mein Vater auf meine Seele ausgestellt hat.«
Da der König der Hölle ihn so schnell wie möglich loszuwerden wünschte, so befahl er, dem Kleinen die Handschrift herauszugeben. Aber der lahme Twardowski hielt ihn fest, denn da ihn ein Tropfen des geweihten Wassers brannte, so wollte er aus Rache die Schrift nicht hergeben. Da rief Luzifer zornig aus: »Legt ihn auf Madeys Bett!« Aus Furcht vor dieser schrecklichen Strafe gab nun Twardowski die Handschrift schnell zurück.
Der Knabe war neugierig geworden und wollte sich das Bett ansehen. Es war aus eisernen Stangen gemacht, auf diesen waren scharfe Messer, Nadeln und Spitzen angebracht; unten brannte ein beständiges Feuer, und von oben tropfte glühender Schwefel herunter.
Der Knabe ging nun zurück in die Räuberhöhle, wo Madey ganz traurig auf ihn wartete. Er erzählte ihm alles, was er gesehen hatte. Da wurde der Räuber starr vor Schrecken; er wollte sogleich anfangen für seine Sünden Buße zu tun. Sie gingen also zusammen zur Höhle hinaus. Madey kniete im Walde nieder, steckte seine Mörderkeule in die Erde, und da er wußte, daß der Knabe ein Priester werden wollte, so sagte er: »Hier an diesem Orte will ich warten, bis Du ein Bischof sein wirst.«
Es waren wohl dreißig Jahre vergangen, da war der Knabe herangewachsen und Bischof geworden. Einmal reiste er durch einen dunklen Wald, den er mit den Augen gar nicht ausmessen konnte, und da spürt' er einen lieblichen Apfelgeruch. Er befahl also seiner Dienerschaft, hinzugehen und die Früchte aufzusuchen. Die Fortgeschickten kamen bald zurück und erzählten, in der Nähe sei zwar ein schöner Apfelbaum, aber kein einziger Apfel lasse sich pflücken, und neben dem Baum kniee ein eisgrauer Mann.
Der Bischof ging hin und erkannte zu seinem Erstaunen den Räuber Madey: in schneeweißem Haar und mit einem ungeheuren Barte kniete er noch immer an derselben Stelle. Er bat den Bischof himmelhoch, ihm die Beichte abzuhören und die Lossprechung zu geben. Der Bischof erfüllte seine Bitte. Seine Diener sahen mit Verwunderung, daß sich während der Beichte ein Apfel nach dem andern in eine weiße Taube verwandelte und in die Luft flog. Das waren die Seelen der Gemordeten. Nur ein Apfel blieb noch übrig, - es war dies die Seele des ermordeten Vaters, denn Madey hatte diese schwerste Sünde verschwiegen. Doch als er zuletzt auch diese Schuld bekannte, da flog der letzte Apfel, in eine graue Taube verwandelt, den übrigen nach.
Der Bischof betete heiß für den reuigen Sünder, und als er ihm die Lossprechung gegeben hatte, zerfiel der Leib des Räubers in lauter Staub.
Polen: K.W. Woycicki: Volkssagen und Märchen aus Polen
DER WINDREITER ...

Ein Zauberer zürnte einem jungen Knechte. Voll Wut ging er in des Knechts Hütte und steckte ein neues, scharfes Messer in die Schwelle. Dabei sprach er die Zauberworte: "Sieben Jahre soll der Bursche auf dem schnellen Sturmwind reiten, durch die weite Welt getragen."
Der Bursche geht auf die Wiese, legt das frische Heu in Haufen. Da erhebt sich plötzlich ein Sturmwind, reißt die Haufen auseinander, reißt mit sich fort den Burschen. Der sucht vergebens sich zu halten, packt vergebens mit den Händen bald den Zaun und bald die Bäume. Vorwärts treibt ihn eine unsichtbare Macht.
Auf den Flügeln des Windes fliegt er wie eine Taube, seine Füße berühren nicht mehr die heimische Erde. Die Sonne geht schon unter. Der Knecht blickt mit Heißhunger hinunter auf sein Dorf, wo duftender Rauch aus den Schornsteinen aufsteigt. Er kann sie beinah mit den Füßen berühren; doch vergebens schreit und ruft er, und vergebens klagt und weint er. Niemand sieht ihn, niemand hört ihn.
Und so reitet er zwölf Wochen, ewig Durst und Hunger leidend, trocken wie ein Fichtenapfel. Manches Land hat er durchflogen, immer aber trägt der Wind ihn zu dem Dorf hin, wo er wohnte. Traurig sieht er seine Hütte. Gerade kommt sein Liebchen aus der Haustür, Mittagbrot trägt sie im Korbe. Und er streckt die dürren Hände flehend aus nach der Geliebten. Ruft vergebens ihren Namen; matt verhallt die schwache Stimme, und das Mädchen blickt nicht mal nach oben.
Er fliegt weiter: steht der Zauberer vor der Tür seiner Hütte, blickt hinauf und ruft voll Spott: "Sieben Jahre wirst Du reiten, über diesem Dorfe fliegen, wirst Du leiden und nicht sterben." "O mein Vater, alter Falke! Wenn ich jemals Dich erzürnte, so vergib mir! Schau, die Lippen sind mir schon ganz hart geworden. Mein Gesicht, meine Hände, - sieh her: lauter Knochen. O hab Erbarmen mit meiner Qual!" Und der Zauberer flüstert leise.
Hört der Bursche auf zu fliegen; bleibt an einem Orte stehen, doch berührt er nicht die Erde. Sprach der Zauberer: "Gut, daß Du mich reuig anflehst. Doch was willst Du mir wohl geben, wenn ich Dir die Qual erlasse?" "Alles, was Du nur verlangst," antwortete der Bursche, und er faltete die Hände, kniete nieder in den Lüften. "Überlasse mir Dein Mädchen, denn zur Frau will ich sie haben. Wenn Du sie gutwillig abgibst, kommst Du wieder auf die Erde."
Der Knecht verstummte. Endlich dacht' er bei sich selber: wenn ich erst wieder auf der Erde bin, werd' ich mir schon zu helfen wissen. Er sagte also zu dem Zaubrer: "Führwahr, Ihr verlangt ein großes Opfer von mir; aber weil's denn nicht anders sein kann, so sei's!"
Fing der Zauberer an zu blasen, und der Knecht kam herunter auf die Erde. Wer war glücklicher als er, als er den festen Grund unter seinen Füßen fühlte und nicht mehr in der Gewalt des Windes war!
So schnell wie möglich lief er nach seiner Hütte. An der Schwelle begegnete er der Geliebten. Sie schrie laut auf vor Erstaunen, als sie den verschwundenen Knecht erblickte, den sie schon so lange beweint und betrauert hatte. Der Knecht stieß sie kräftig mit den dürren Händen zurück und trat eilig in das Wohnzimmer. Hier saß auf seinem Stuhle der Bauer, bei dem der Bursche gedient hatte, und halb in Tränen redete er ihn an: "Ich werde nicht mehr bei Euch dienen, und Eure Tochter kann ich auch nicht heiraten. Zwar lieb ich sie noch immer und habe sie wohl noch mehr lieb als meine eigenen Augen, aber heiraten werd ich sie doch nicht."
Der Bauer sah ihn verwundert an, und da er auf seinem bleichen und abgemagerten Gesichte die Spur von Leiden erblickte, so fragte er, weshalb er denn die Tochter jetzt nicht wolle. Da erzählte ihm der Bursche alles. Der Bauer aber sagte zu ihm, er solle nur keine Angst haben, steckte sich einen vollen Geldbeutel ein und ging zur Wahrsagerin. Abends kehrte er munter zurück. Er nahm den Burschen beiseite und tröstete ihn: "Morgen früh, sobald es Tag wird, geh zur Wahrsagerin. Du wirst sehen, es wird noch alles gut."
Der Knecht schlief zum ersten Male seit zwölf Wochen wieder auf dem gewohnten Lager. Dennoch erwachte er noch vor der Morgenröte und ging sogleich zur Wahrsagerin. Er traf sie am Herde, damit beschäftigt, verschiedene Kräuter ins Feuer zu werfen. Auf ihren Befehl mußte er im Winkel stehen bleiben, bis plötzlich sich ein heftiger Sturm erhob, daß das ganze Haus zitterte.
Da führte ihn die Wahrsagerin in den Hof und sagte, er möchte in die Höhe sehen. Er erhob seine Augen und sah - o Wunder! - den bösen Zauberer, der hatte nur ein Hemde an und drehte sich immerfort im Kreise. "Das ist Dein Feind," sagte die Frau. "Wenn Du willst, daß er Deine Hochzeit mit ansehen soll, so tue, was ich Dir gesagt habe; und er wird die selben Leiden erdulden, die er Dir zugefügt hat."
Voll Freude lief der Knecht nach Hause, und einen Monat darauf hielt er schon fröhliche Hochzeit. Als die Gäste tanzten, ging er hinaus in den Hof, blickte in die Höhe, - und siehe, über der Hütte drehte sich wieder der böse Zauberer im Kreise. Da nahm er ein neues Messer, zielte lange und schleuderte es mit voller Kraft gerade in seinen Fuß.
Der Zauberer fiel herab, denn das Messer heftete ihn an die Erde. Die ganze Nacht stand er vor dem Fenster und mußte die Freude des Brautpaares und der Gäste mit ansehn.
Am folgenden Morgen war der Zauberer verschwunden, aber einige Leute sahen ihn noch über den See fliegen. Vor ihm und hinter ihm schwärmte eine Schar von Krähen und Raben; diese schwarzen Vögel begleiten den endlosen Ritt des Zauberes mit ihrem abscheulichen Geschrei.
Quelle: Polnische Volkssagen und Märchen
DIE GROTTEN IM SCHWARZEN BERGE ...

Der Schwarze Berg in Galizien hat viele geheimnisvolle Löcher und Grotten. Ein schmaler Fußweg geht durch Unkraut und dickes Gebüsch. Wenn die Dämmerung anfängt, ist hier kein Mensch mehr zu sehen. Denn gleich nach Sonnenuntergang hört man im Innern des Berges unheimliches Brausen und Kettengeklirre, und mitten in der Nacht erblickt man im Scheine des Mondlichtes die Geister erschlagener Räuber, die früher hier gehaust und in den umliegenden Dörfern Tod und Schrecken verbreitet haben. Schweigend tritt alsdann ein Zug von zwölf riesenhaften weißen Gestalten aus dem Berge hervor. Einen offenen Sarg tragen sie auf ihren Schultern. Sie steigen damit auf den Gipfel des Berges und verschwinden im Nebel. Dann beginnen auch die Schädel der Gemordeten, die unter den Steinen umherliegen, einen fürchterlichen Totentanz.
In den Grotten des Berges liegen noch heute unermeßliche Reichtümer, - die Schätze, die die Räuber den Wanderern geraubt oder aus Kirchen und Häusern fortgeschleppt haben. Doch nur selten ist die Tür zu den Grotten zu finden, obwohl manchmal Gespenster in Pilgergestalt im Eingang verschwinden. -
Einmal sah ein junger Bauer, der am Steinbruch eine Buche fällen wollte, wie ein Pilger langsamen Schrittes durch den Wald daher kam. Der Bauer versteckte sich hinter einen dicken Baum, und der Pilger ging achtlos an ihm vorbei ins Innere des Berges. Leise folgte ihm der pfiffige Bursche, und da sah er, daß der Pilger an einer kleinen Tür stehen blieb, die noch niemand aus dem Dorfe bemerkt hatte.
Der Pilger klopfte an und sprach mit leiser Stimme: "Türlein, tu dich auf!" Sogleich öffnete sich die Tür. Dann sprach er wieder: "Türlein, tu dich zu!" und die Türe schloß sich. Der Bauer zitterte vor Angst, doch vergaß er nicht, die Stelle mit abgerissenen Zweigen zu bezeichnen. Von nun an konnte er weder essen noch schlafen. Etwas Geheimnisvolles zog ihn immer fort; er wollte erfahren, was in den Grotten sei.
Am Sonnabend fastete er den ganzen Tag, und am Sonntag ging er zeitig früh mit einem kleinen Kreuze in der Hand zu dem bezeichneten Orte. Er klapperte vor Angst mit den Zähnen; trat an die Tür und horchte lange; doch drinnen war alles still. Endlich klopfte er stark an und rief, halb ohne Besinnung: "Türlein, tu dich auf!" Die Tür sprang auf, und er trat in ein finsteres Gewölbe. Fast willenlos sprach er nun: "Türlein, tu dich zu!" und die Tür sprang wieder ins Schloß. Er ging weiter und kam in einen großen hellen Saal.
Im Saale standen ungeheure Fässer mit weißen Silbertalern und roten Goldgulden angefüllt. Dann standen auch mächtige Kisten da mit echten Perlen und Edelsteinen. Auf silbernen Tischen lagen große Haufen von goldenen Kreuzen und schönen Heiligenbildern. Der Bauer bekreuzte sich vor all den Herrlichkeiten, doch konnte er sich nicht enthalten, etwas davon einzustecken, denn er dachte an seine Frau und an seine kleinen Kinder, die schon beinahe nackt gingen.
Er ließ also die Angst fahren, langte in ein Faß und nahm sich etwas von dem Silbergelde. Schnell griff er dann an seinen Kopf und war beruhigt, als dieser noch an seinem Platze stand. Nun nahm er noch eine Handvoll kleinen Silbergeldes; dann schob er sich zitternd zur Tür. "Komm wieder!" rief eine Stimme aus dem Innern des Berges. Dem Armen wurde schwindlig, alles kreiste rund um ihn her, und kaum vermochte er noch zu sagen "Türlein, tu dich auf!" Sogleich öffnete sich die Tür, und mit erleichtertem Herzen eilte der Bauer hinaus.
Zu Hause erzählte er nichts von seinen Schätzen. Doch ging er in die Kirche und gab einen Teil für die Armen. Am nächsten Tage ging er in die Stadt und kaufte Lebensmittel und Kleider für Frau und Kinder, und er erzählte ihnen dann, er habe unter den Wurzeln der gefällten Buche einen alten Taler und einige Gulden gefunden. Am Sonntag darauf ging er schon mit weniger Furcht in die Grotte und nahm schon etwas mehr Geld aus dem Fasse. "Komm wieder!" rief ihm die Stimme nach, und er kam am nächsten Sonntag wieder und füllte nun seine Taschen bis zum Rande.
Jetzt war er schon ein reicher Bauer. Aber was sollte er machen mit dem vielen Gelde? Zwei Zehntel von seinem ganzen Vermögen opferte er für die Kirche und für die Armen, und was dann übrig blieb, wollte er im Keller vergraben, als Notpfennig für die Zeit einer Mißernte. Zuvor jedoch wünschte er sein Geld zu messen, denn zählen konnte er nicht. Er ging also zu seinem Nachbar, einem schwerreichen Manne, um von ihm einen Scheffel zu borgen. Dieser Nachbar war ein Geizhals. Bei all seinem Reichtum litt er Hunger, mit dem Korn trieb er abscheulichen Wucher, seine Arbeiter betrog er um den Tagelohn, und seinen Dienstboten behielt er den Lohn zurück. Dabei hatte er weder Frau noch Kinder.
In jenem Scheffel waren große Ritzen, durch die der Geizhalz, wenn er den armen Tagelöhnern ihren Roggen zumaß, den größten Teil des Korns wieder auf seinen Haufen zurückfallen ließ. In diesen Ritzen nun blieben einige kleine Silberstücke stecken, die das Falkenauge des geizigen Nachbars bald entdeckte. Er suchte den Bauer im Walde auf und fragte ihn, was er denn mit dem Scheffel gemessen habe. "Haselnüsse!" antwortete stotternd der Gefragte. Da schüttelte der Geizhals den Kopf, zeigte ihm die Silberstücke und drohte mit dem Richter und mit dem Henker. Nach und nach entlockte er dem andern das Geheimnis von den Schätzen in der Grotte.
Die ganze Woche dachte der Geizhals darüber nach, wie er den ganzen Schatz auf einmal herausholen könnte. Dann wollte er Felder und Wälder, Dörfer und Schlösser zusammenkaufen und endlich gar Graf oder Fürst werden. Dem jungen Bauern war es nicht ganz recht, daß sein neidischer Nachbar die Grotten besuchte; aber schließlich versprach er, bis zur Tür mitzugehen; - dort sollte er die von dem Wucherer gefüllten Säcke in Empfang nehmen. Nachher wollten sie das ganze Geld teilen, ein Zehntel der Kirche schenken und allen Armen im Dorfe neue Kleider kaufen. So war ihre Verabredung.
Im Grunde des Herzens aber beschloß der Geizhals, den Bauern, wenn er ihn nicht mehr nötig habe, in den tiefsten Abgrund hinab zu stoßen, die Kirche bloß mit einigen Silberlingen zu bedenken und sich um die Armen gar nicht zu kümmern. Als der erwartete Sonntag gekommen war, machten sich die beiden auf den Weg zu den Grotten. Der Geizhals schleppte eine Schaufel, ein mächtiges Beil und einen großen Sack, und in diesem Sacke steckten wieder hundert kleinere Säcke. Der Bauer warnte ihn immer wieder vor einer solchen Habgier, - aber der Wucherer ging fluchend und zähneknirschend weiter. Nun waren sie an der Tür. Der junge Bauer blieb hier stehen, doch wurde ihm schon ganz übel vor Furcht.
"Türlein, tu dich auf!" rief der Geizige mit tiefer, kräftiger Stimme. Die Tür öffnete sich. "Türlein tu dich zu!" rief er wieder, und die Tür klappte zu. Kaum war er drinnen, da erblickte er die Fässer und Kisten mit Geld und Edelsteinen. In aller Geschwindigkeit schätzte er diese Kostbarkeiten ab, und dann begann er mit zitternder Hand die Säcke zu füllen. Da kam aus dem Innern der Höhle ein großer schwarzer Hund mit feurigen Augen langsamen Schrittes heran. Der erschrockene Wucherer bekam einen heftigen Schwindel und ließ die Säcke fallen. Der Hund fletschte ihm seine Zähne entgegen und heulte gräßlich: "Was willst Du hier, Du Wucherer?"
Von Schauder ergriffen fiel der Geizhals zu Boden und kroch auf allen Vieren nach der Tür. Aber in seiner Angst vergaß er das richtige Wort und schrie immer nur: "Türlein, tu dich zu!" und die Tür blieb geschlossen. Der junge Bauer draußen wartete mit klopfendem Herzen. Er horchte an der Tür, - da hörte er ein dumpfes Geschrei und Gestöhn, vermischt mit Hundegeheul. Bald darauf war's wieder ganz still. Eben fingen die Glocken an zum Gottesdienst zu läuten. Er betete also ein Vaterunser, bekreuzte sich und klopfte leise an die Tür, indem er die bekannten Worte aussprach. Die Tür sprang auf. Er trat in die Grotte - und schauderte zurück vor dem gräßlichen Anblick: der mit Blut bespritzte Leichnam des Wucherers lag auf den Säcken ausgestreckt, und die Fässer und Kisten mit Gold, Silber und Edelgestein sanken langsam hinab in die Tiefen der Erde.
Quelle: Polnische Volkssagen und Märchen
DER BÖSE BLICK ...

Es wohnte einmal ein reicher Edelmann in einem schön gemauerten Hause nicht weit vom Ufer des Weichselstromes. Alle Fenster des Hauses, das die Leute den weißen Hof nannten, gingen nach dem Wasser hin, nicht ein einziges zeigte die Landstraße oder die geräumigen Scheunen. Eine lange Lindenallee, die nach dem Edelhofe führte, war mit Gras und Unkraut bewachsen; daran konnte man leicht erkennen, daß die Nachbarn nur selten diesen einsamen Wohnsitz besuchten.
Der Herr des Hauses war erst vor sieben Jahren aus ferner Gegend hergezogen. Die Bauern kannten ihn fast gar nicht und gingen ihm voll Angst aus dem Wege, denn man erzählte über ihn allerlei schreckliche Dinge.
Der Herr war an den Ufern des San von reichen Eltern geboren; aber das Unglück verfolgte ihn von der Wiege an. Er hatte den bösen Blick, der allen Menschen Krankheit und Tod brachte. Wenn er zur bösen Stunde seine Herde ansah, so starb das arme Vieh vor seinen Augen; wenn er etwas lobte, so verdarb es sogleich. Die beiden Eltern waren vor Kummer über des Sohnes Schicksal gestorben. Der Sohn, in der ganzen Gegend nur der verzauberte Herr genannt, verkaufte seine großen Güter und zog hierher an die Weichsel, wo er das schön gemauerte Haus bewohnte. Er litt keinen Menschen um sich und behielt nur einen alten Diener, der ihn als Kind auf den Armen getragen hatte und dem allein der böse Blick seines Herrn keinen Schaden tat.
Der verzauberte Herr verließ selten das Haus, denn seine Augen verbreiteten Unglück, Krankheit und Tod. Darum saß auch immer im Wagen neben ihm der alte Diener, und der sagte ihm, wenn irgendwo ein Mensch, ein Dorf, eine Stadt zu sehen war. Dann legte der Herr die Hände auf seine unglücklichen Augen, oder auch er blickte starr auf ein Erbsenbüschel, das stets zu seinen Füßen lag. Ein verderbliches Auge konnte nämlich niemandem schaden, wenn man damit ein verwelktes Erbsenbüschel ansah; nur wurde davon das Erbsenbüschel noch dürrer.
Absichtlich hatte der Herr alle Fenster des schön gemauerten Hauses nach der Weichsel hin machen lassen: denn schon zweimal waren seine Scheuern in Brand geraten, da er zur bösen Stunde auf sie blickte. Trotzdem verwünschten ihn auch noch die Schiffer und zeigten mit Furcht auf die Fenster des schön gemauerten Hauses, von wo aus ihnen der böse Blick schon manche Krankheit gebracht hatte, und der Sturm beschädigte fast immer die Fahrzeuge, wenn sie am Landungsplatze gegenüber vom weißen Hofe anlegten.
Einmal faßte sich ein Schiffer ein Herz: er ruderte auf seinem Schiffchen zum weißen Hofe und verlangte den verzauberten Herrn zu sprechen. Der alte Diener führte den Schiffer in den Speisesaal. Der Herr saß eben bei Tische, und ungehalten darüber, daß ihn ein Fremder beim Essen störte, blickte er streng auf den Eintretenden. Sogleich bekam der Schiffer ein heftiges Fieber, und lautlos fiel er bei der Tür zu Boden.
Der alte Diener brachte den Mann auf Befehl seines Herrn auf das Schiffchen, fuhr mit ihm ans andre Ufer und gab ihm eine Menge Goldstücke. Der Schiffer war noch lange krank. Da er später die ganze Geschichte erzählte und dabei den weißen Hof und den verzauberten Herrn recht schrecklich ausmalte, jagte dies den andern Schiffern noch größere Furcht ein. Von der Zeit an wendete jeder Schiffer, wenn er an dem weißen Hause vorbeikam, die Augen ab und betete zu allen Heiligen und zitterte vor Angst, wenn jemand vom bösen Blick des verzauberten Herrn zu sprechen anfing. -
Zehn Jahre waren seither verflossen. Der weiße Hof war noch immer der Schrecken der Nachbarn und der vorbeifahrenden Schiffer. Niemand besuchte den verzauberten Herrn, und der Unglückliche verlebte einsam alle Stunden des Tages.
Ein harter Winter kam. Scharenweise heulten die Wölfe mit furchtbarer Stimme rund um den weißen Hof. Der Herr saß traurig am Kamin, auf dem ein großes Feuer brannte, und trübsinnig blätterte er in einem mächtigen Buche.
Der alte Diener hatte schon alle Türen des Hauses geschlossen, setzte sich auch ans Feuer, wärmte seine alten erstarrten Knochen und besserte dann und wann an seinem Fischernetze.
"Stanislaw", sagte der Herr, "hast Du schon viele Fische gefangen?"
"Noch nicht viele, lieber Herr; aber für uns beide wird es genug sein."
"Das ist wahr", erwiderte der unglückliche Herr. "Wir beide, - wie viele Jahre sind wir schon allein! O unglückliche Stunde, in der ich geboren bin! Immer bin ich einsam, die Menschen fliehen mich wie ein Ungeheuer." Er trocknete die Tränen, die seine unglücklichen Augen benetzt hatten.
Plötzlich hörten sie draußen eine menschliche Stimme, die um Hilfe rief. Der Herr des Hauses erzitterte, denn er hatte schon lange keine fremde Stimme gehört. Der alte Diener eilte hinaus, und der Herr folgte ihm mit der Lampe in der Hand.
Vor dem Torwege stand ein verdeckter Schlitten, neben dem Schlitten stand ein alter Mann. Als er die beiden aus dem Hause kommen sah, hob er seine ohnmächtige Frau herab; der alte Diener half dann der Tochter, einer schönen Jungfrau, beim Aussteigen.
Man legte frisches Holz auf den Kamin, brachte die ohnmächtige Mutter an das wärmende Feuer, und der Hausherr ließ in geschäftiger Freude den alten Ungarwein aus dem Keller heraufholen und setzte dem Gaste mächtige Humpen vor. Der Diener lächelte heimlich, da er das frohe Gesicht seines Herrn bemerkte. Der Fremde war ein Edelmann. Er erzählte, wie sie sich verirrt hatten, dann von Wölfen angefallen wurden, und wie die flinken Pferde sie kaum hatten nach dem weißen Hofe hinziehen können.
Nach dem Abendessen wurde alles vom Schlitten heruntergeholt. Der Herr führte die müden Reisenden in ein warmes und bequemes Schlafzimmer. Bald war es still im weißen Hofe, und das Feuer auf dem Kamin flackerte bloß noch in schwachen Flammen. -
Es war nach Mitternacht. Der alte Stanislaw schlief am Herde. Da knarrte die Tür, und der Hausherr trat herein. Der Diener rieb sich verwundert den Schlaf aus den Augen und brummte: "Wie, schläft der arme Herr noch nicht?"
"Still, alter Freund," erwiderte der Herr mit froher Miene, "ich kann nicht einschlafen und möchte niemals einschlafen, wenn ich immer so glücklich wäre wie heute!" Und er setzte sich in den großen Lehnstuhl am Herde und lächelte in sich hinein und fing an zu weinen.
"Weine, armer Herr, weine nur!" dachte der alte Stanislaw bei sich selber; "mit den Tränen fließt Dir vielleicht der böse Blick davon."
"Wenn mir der liebe Gott doch das geben wollte, woran ich jetzt denke," sagte der verzauberte Herr, "ich wollte weiter nichts von dieser Welt verlangen. Dreißig Jahre schon lebe ich wie ein Einsiedler, wie ein Verbrecher. Und doch habe ich nie etwas Böses begangen, meine Seele ist rein vom Laster. Nur meine Augen, - - o meine Augen!"
Tiefe Trauer beschattete sein Antlitz, das eben noch so freudig gewesen war; doch bald erschien wieder das Lächeln auf seinen Wangen, und man konnte erkennen, wie wieder ein Hoffnungsstrahl in sein Herz leuchtete.
"Alter Freund," sprach er, und Stanislaw schaute fröhlich drein, "ich werde vielleicht heiraten."
"Das gebe Gott!" rief der Diener aus. "Aber wo ist denn Eure Zukünftige?"
Der Herr stand auf, zeigte mit der Hand nach der Seite, wo das Schlafzimmer der drei Gäste war, und sagte leise: "Dort!"
Stanislaw nickte mit dem Kopfe, als sei er sehr zufrieden mit der Wahl seines Herrn, und geschäftig warf er eine Handvoll Holz auf den Herd. Der Herr kehrte sinnend in sein Schlafgemach zurück. Der alte Diener brummte in seinen Bart: "Gott geb es, Gott geb es!" Und allmählich schlief er wieder ein. -
Am folgenden Morgen erwachte der fremde Edelmann neugestärkt und erfrischt, doch war an Abreise noch nicht zu denken, denn die Frau lag in heftigem Fieber. Wie froh war der Herr, als er erfuhr, die Gäste würden einige Zeit in seinem Hause zubringen! Der fremde Edelmann war nicht gerade reich, aber er lebte als ehrlicher Mensch und nährte sich redlich. Der freundliche Wirt gefiel ihm recht gut, und eines Tages sprach er zu seiner Frau, mit der es schon viel besser geworden war:
"Hör mal, Gretchen, mir scheint, der Herr macht unserer kleinen Marie gewaltig den Hof, und wie ich sehe, ist sie ihm auch nicht abgeneigt. Nun, mir könnte das nur gefallen."
"I, das scheint Dir wohl bloß so!" erwiderte die Frau; aber im Grunde war es ihr lieb, daß ihr Mann dasselbe sagte, was sie sich im stillen auch schon gedacht.
"Der Mann ist nicht arm, er ist kein Springinsfeld, es fehlt ihm überhaupt an nichts," fuhr der fremde Edelmann fort, indem er in der Stube auf und ab ging, "und unsere Kleine ist auch nicht bucklig und zum Heiraten eben alt genug."
Nach dem Abendbrot trank der Gast wieder den alten Ungarwein, strich mit Wohlgefallen den grauen Knebelbart und hörte mit sichtlicher Freude, wie der Herr des Hauses ihn um seine Tochter bat.
"Ihr habt mir gut gefallen, Herr Bruder," erwiderte er nach einer Pause, "und da Ihr nicht erst nach der Aussteuer fragt und an Eurem eigenen Brot genug habt, so mag sie denn meinetwegen Euer Weibchen werden."
Ein Vierteljahr darauf führte der verzauberte Herr die Braut heim. Unkraut und Gras verschwanden von der langen Lindenallee, denn viele Wagen rollten da ohne Unterlaß hin und her, Verwandte und Freunde der schönen Braut kamen scharenweise zur Hochzeit nach dem weißen Hofe. Einige Tage später war es wieder still wie vorher, und auf der langen Lindenallee wuchs wieder Gras und garstiges Unkraut. -
Der Winter kam wieder. Obgleich das Schloß nun eine Herrin hatte, war es hier so einsam wie früher. Die Dienerschaft, die der Herr angenommen hatte, lief davon, als sie hörte, daß ihr Gebieter den bösen Blick habe. Einige, die geblieben waren, wurden bald von schweren Krankheiten darnieder geworfen. Die schöne junge Frau lag in Schmerzen auf ihrem reichen Lager. Der liebende Gatte saß bei ihr, und mit abgewandtem Gesichte drückte er ihre kalten Hände.
Das arme Weib wußte recht wohl von dem bösen Blick ihres Mannes, und ihre Leiden wurden dadurch noch größer. Trotzdem bat sie den Gatten in aufrichtiger Liebe, er möchte ihr doch einmal sein Gesicht wieder zuwenden.
"Meine Maria!" rief der Unglückliche mit tiefem Seufzer aus, "ich kann mit Dir nicht glücklich sein, solange ich diese Augen habe. O reiß sie mir aus! Hier ist ein scharfes Messer, - von Deiner Hand wird's nicht schmerzen!"
Die arme Frau schauderte bei diesem schrecklichen Verlangen. Der verzauberte Herr fing an bitterlich zu weinen: "Für andre Menschen sind die Augen ein Glück, meine Augen bringen Trauer und Unheil. Aber das sage ich Dir: unser Kind soll meine Augen nimmer erblicken, - ihm sollen sie nicht schaden, und es wird dem Andenken seines Vaters nicht fluchen müssen!"
Ein leises Stöhnen war die Antwort der kranken Frau. -
Bald darauf wurde dem Schloßherrn eine Tochter geboren. In demselben Augenblicke, als das Kind mit lautem Schrei das Licht der Sonne begrüßte, da hörte man auch im Saale, wo das Kaminfeuer brannte, das herzerschütternde Geschrei eines Mannes: der Vater des Kindes hatte auf ewig vom Tageslichte den furchtbaren Abschied genommen. Zwei Augen, wie glänzende Kristallkugeln, fielen zugleich mit dem blutigen Messer zur Erde.
Sechs Jahre später gab eine Reihe glänzender Fenster wieder die Aussicht ins Dorf und auf die gefüllten Scheuern. Die Schiffer hatten am Fuße des weißen Hofes einen herrlichen Landungsplatz. Die Herrin des Hauses war gesund und munter, und ihre größte Freude war ein engelschönes Töchterlein, das manchmal den blinden Vater auf der Straße führte.
Die Landleute, die früher den verzauberten Herrn ängstlich gemieden hatten, gingen nun freundlich hinzu, wenn sie den Blinden mit dem kleinen Mädchen auf dem Spaziergang erblickten. Allenthalben verschwand die Grabesstille, denn zahlreiche Dienerschaft erfüllte die einst so einsamen Hallen des weißen Hofes.
Der alte Stanislaw hatte gleich an jenem traurigen Tage die verderblichen Augen tief neben der Gartenmauer vergraben. Einmal ergriff ihn die Neugierde: er wollte sehen, was aus den Augen geworden sei. Er fing an zu graben, - da glänzten ihm die Augen wie zwei Lichter entgegen. Doch kaum hatte ihr Glanz sein Angesicht getroffen, da befiel ihn ein heftiges Zittern; er sank um und starb.
So hatten die verderblichen Augen des verzauberten Herrn dem alten Diener zum ersten und zum letzten Male geschadet. Einige Leute aber wollten wissen, sie hätten ihm früher deswegen keinen Schaden getan, weil ihn der Herr so sehr geliebt: das Herz nahm dem Blicke die Gewalt. Nun aber hatten die Augen in der Erde neue Kraft bekommen und den alten Diener getötet!
Der blinde Herr betrauerte ihn von ganzer Seele. Auf seinem Grabe ließ er ein schönes Kreuz errichten, und davor pflegten die Schiffer zu beten wenn sie am weißen Hofe landeten.
TWARDOWSKI ...

Twardowski war von Vater- und Mutterseite her ein vollwertiger Edelmann. Er glaubte klüger zu sein als die andern Leute und bemühte sich, eine Arznei gegen den Tod zu finden: denn er hatte keine Lust zu sterben.
Er las einmal in einem alten Buche, wie man den Teufel rauf beschwören kann. Um die Mitternachtsstunde verläßt er heimlich die Stadt Krakau, wo er als Doktor sehr bekannt war, und begibt sich auf die nahen Berge. Er ruft den Teufel, und der Teufel erscheint. Beide machen, wie es damals Brauch war, einen Vertrag miteinander. Der Böse lehnt sich an eine Felswand, legt ein Pergament auf sein Knie und schreibt den Vertrag, und Twardowski schreibt mit seinem eignen Blute seinen Namen darunter.
Einer von den Punkten des Vertrages besagt, der Teufel habe erst dann einen Anspruch auf Twardowkis Leib und Seele, wenn er ihn in Rom antreffen würde.
Nun war der Teufel der Diener des Doktors Twardowski. Und Twardowski befahl ihm sogleich, alles Silber aus ganz Polen an einem Orte aufzuhäufen und mit Sand zuzuschütten. Der Teufel gehorchte, und so entstanden die Silbergruben von Olkusz. (Das ist eine Stadt, die früher durch ihre Silbergruben berühmt war, jetzt aber ganz in Trümmer gefallen ist.)
So geschah alles, was Twardowski nur wünschte. Bald ritt er auf einem gemalten Pferde, bald flog er ohne Flügel um her, bald setzte er sich rittlings auf einen Hahn und jagte so durch die Luft, bald fuhr er mit seinem Mädchen in einem Boote ohne Ruder und Segel den Strom hinauf, bald nahm er ein Brennglas in die Hand und zündete damit hundert Meilen entfernte Häuser und Dörfer an.
Einmal verliebte er sich in ein schönes Fräulein. Aber das Fräulein hatte ein Tier in einem Fläschchen und wollte bloß den heiraten, der den Namen des Tieres erraten konnte. Twardowski verkleidete sich als Bettler und ging zu dem schönen Fräulein. Sie hielt ihm von weitem das Fläschchen hin und fragte:
"Wurm oder Schlange? Was für ein Tier?"
"Wer das errät, der vermählt sich mit mir."
Twardowski erwiederte: "Das ist eine Biene, gnädiges Fräulein!" Und so war es wirklich, und schon am nächsten Tage wurde die Hochzeit gefeiert.
Frau Twardowski baute sich auf dem Markte zu Krakau ein kleines Häuschen aus Lehm und verkaufte dort Schüsseln und Töpfe. Ihr Mann fuhr manchmal als reicher Herr verkleidet an ihrer Bude vorbei, und bei dieser Gelegenheit mußten seine Diener rasch alle Schüsseln und Töpfe zerschlagen. Wenn dann die Frau in die ärgste Wut geriet und die ganze Welt verfluchte, dann beugte sich Twardowski aus dem schönen Wagen hinaus und lachte aus vollem Halse.
Gold hatte er wie Sand am Meere, denn der Teufel mußte ihm bringen, soviel er haben wollte. Einmal kam er in einen dunklen Wald. Da stand plötzlich der Böse vor ihm und verlangte, er solle sich sofort nach Rom begeben. Aber Twardowski sagte einen kräftigen Spruch und vertrieb damit den Teufel. Dieser riß voll Wut einen großen Fichtenbaum aus der Erde, schleuderte ihn auf den Doktor und zerschmetterte ihm das rechte Bein. Von da an war Twardowski lahm, und die Leute nannten ihn daher "Hinkebein."
Der Teufel hatte es nun aber satt, ihm täglich und stündlich zu dienen. Um ihn in seine Gewalt zu kriegen, versuchte er eine List. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und kam zu Twardowski gelaufen und bat ihn, daß er, der berühmte Arzt, zu seinem Herrn kommen und ihm in seiner schweren Krankheit helfen möchte. Der Zauberer ging mit dem Knechte in das nahe Dorf, wo das Gasthaus den Namen "Zur Stadt Rom" führte.
Kaum war er in das Gasthaus eingetreten, da flog eine große Schar von Eulen und Raben auf das Dach und erfüllten die Luft mit unheimlichem Schreien. Twardowski erkannte die Gefahr: schnell nahm er ein neugetauftes Kind aus der Wiege und ging mit ihm in der Stube auf und ab.
Plötzlich stürzte der Teufel herein. Er war sehr schön angezogen: hatte einen dreieckigen Hut auf, einen deutschen Frack, eine lange, bis über den Bauch reichende Weste, kurze enge Hosen, Schuhe mit silbernen Schnallen und seidenen Bändern. Aber trotz dieser vornehmen Kleidung erkannten ihn doch alle, denn unter dem Hute guckten Hörner hervor, die Schuhe konnten die dicken Klauen nicht ganz verdecken, und hinten kam ein haariger Schwanz zum Vorschein.
Schon wollte der Teufel den gefangenen Doktor mit fortreißen, als sich ihm ein großes Hindernis entgegenstellte: das kleine, unschuldige Kind, auf das der Teufel kein Recht hat. Nach langem Nachdenken trat er ruhig auf Twardowski zu und sagte: "Was denkst Du, Herr Twardowski? Kennst Du unsern Vertrag nicht? Ein Edelmann muß doch sein Wort halten!"
Twardowski begriff recht wohl, daß er sein adeliges Wort nicht brechen durfte. Er legte also das Kind in die Wiege und fuhr sogleich mit seinem Gefährten durch den Schornstein hinaus. Die Eulen und Raben erhoben ein lautes Freudengeschrei. Indes fliegen die beiden immer höher. Die Dörfer unten sehen aus wie kleine Mücken, die Städte wie Fliegen, Krakau nicht größer als zwei Spinnen.
Noch immer höher hinauf geht die Reise, - da endlich nimmt Twardowski die letzte Kraft zusammen, und er fängt an ein frommes Lied zu singen. Es war dies eines von den Liedern, die er in seiner Jugend, als er noch keine Zauberkünste kannte und seine Seele rein und unschuldig war, der Mutter Gottes zu Ehren gedichtet und täglich gesungen hatte.
Seine Stimme zerfließt in der Luft. Die Berghirten, die unter ihm die Herden hüten, blicken verwundert hinauf in die Wolken und zerbrechen sich den Kopf, woher denn die heiligen Töne kommen. Twardowski singt das Lied zu Ende: da sieht er mit Staunen, daß er sich nicht mehr fortbewegt, sondern mitten in der Luft wie angenagelt stehen geblieben ist. Eine laute Stimme von oben ruft ihm zu:
"So wirst Du zwischen Himmel und Erde hängen bleiben bis zum jüngsten Tage!"
Und so hängt er wirklich noch bis auf den heutigen Tag. Das Wort im Munde ist ihm erstorben, niemand hört mehr seine Stimme. Aber vor wenigen Jahren noch zeigten die alten Leute, wenn der Vollmond schien, ein dunkles Fleckchen am Himmel, und sie schworen, das sei der Zauberer Twardowski.
Quelle: Kasimir Wladislaw Woycicki, Polnische Volkssagen und Märchen
DIE PEST ...
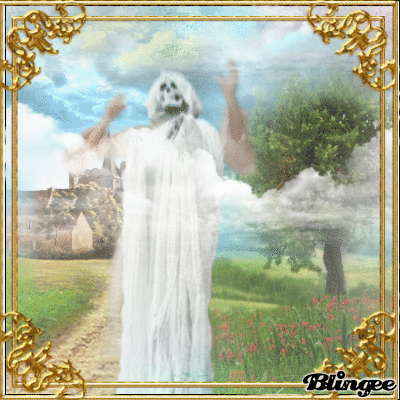
Es saß einmal ein Bauer draußen auf dem freien Felde. Die Sonne glühte wie Feuer. Sieht er von weitem, daß etwas herankommt; sieht nochmal hin - und es ist ein Weibsbild! Es war ganz in ein weißes Gewand gehüllt und schritt wie auf langen Stelzen einher. Der Mann erschrak und wollte fliehen; aber das Gespenst hielt ihn mit seinen dürren Armen auf.
"Kennst Du die Pest? Ich bin's! Nimm mich denn auf Deine Schultern und trage mich durch's Land; und laß kein Dorf und keine Stadt mir aus; denn überall will ich hin. Du selbst aber befürchte nichts: Du bleibst gesund inmitten all der Toten."
Und es schlingt seine langen Arme um den Hals des furchtsamen Knechtes. Der Mann geht nun vorwärts, doch blickt er verwundert bald hinter sich, weil er gar keine Last spürt: und immer noch sitzt das Gespenst auf seinem Rücken.
Kam zuerst nach einem Städtchen. Freude war auf allen Gassen, Tanz und Lustigkeit und Frohsinn. Blieb kaum auf dem Markte stehen, weht das Weibsbild mit dem Tuche; gleich ist's vorbei mit Tanz und Freude, und der Frohsinn flieht von dannen. Wo er hinschaut, sieht er bebend: Särge trägt man, Glocken läuten, voll von Menschen ist der Kirchhof; ist kein Platz mehr zum Begraben!
Auf dem Markte liegen haufenweise die Leichen der Menschen nackt und unbeerdigt!
Dann ging er weiter. Wo er durch ein Dorf kam, da wurden die Häuser öde und leer, und die Menschen flohen mit blassen Wangen, zitternd vor Furcht; und auf den Landstraßen, in den Wäldern und auf freiem Felde hörte man herzzerreißendes Geschrei der Sterbenden.
Auf hohem Berge stand ein Dorf; hier wohnte der arme Bursche, auf dessen Rücken die Pest sich gehängt hatte; dort waren sein Weib und seine Kinder und seine alten Eltern. Fängt das Herz ihm an zu bluten. Drum umgehet er sein Dorf, hält mit kräft'ger Hand das Weibsbild, daß es ihm nicht springt herunter.
Und er schaut vor sich hin, und vor ihm fließt der blaue Pruth, hinter ihm erheben sich immer höhere, grün belaubte Berge, weiterhin schwarze, und die höchsten sind mit Schnee bedeckt.
Läuft nun geradehin zum Flusse; springt hinein und taucht sich unter, will das Weibsbild auch ertränken, um sein Land vor Unglück und Pestluft zu bewahren!
Er selbst ertrank; doch die Pest, welche federleicht war und die er auch auf seinen Schultern nicht gefühlt hatte, konnte nicht untersinken und floh, durch diesen Mut erschreckt, in die Wälder auf dem Gebirge. - So hat der Mann sein Dorf gerettet und seine Eltern, seine Frau und seine kleinen Kinder.
DER SCHATZ KASCHUBIENS ...

Nachdem der Herrgott die Welt geschaffen hatte, setze er sich in seinen himmlischen Thron, rief alle Engel zu sich und sagte:
„Schaut hin, meine Lieben, wie wunderschön ist all das, was ich geschaffen habe.“
Die Engel schauten sich alles an, klatschten in die Hände und sagten:
„Vater, alles ist bezaubernd, uns gefällt es einfach.“
Nur ein Engel stand sehr traurig an der Seite.
Der Herrgott fragte ihn: „Wieso freust du dich nicht?“
Der Engel sagte: „Herr, schau doch auf das arme kaschubische Land. Nur unfruchtbarer Sand ist dort zu finden. Vielleicht findet Euere Gnade etwas, um es zu verschönern?“
Der Herrgott sagte: „Hast Recht. Ich schau’ mal nach.“
Der Herrgott stand auf und sagte schließlich: „Ein bisschen blieb mir übrig, sei beruhigt“.
Der Schöpfer sagte das allmächtige Wort, und es geschah ein Wunder. Innerhalb des sandigen Kaschubien entstanden Berge, die mit rauschenden Bäumen verdeckt waren, und zwischen den Bergen schimmerten blaue Augen – das waren wunderschöne Seen, voll mit gut schmeckenden Fischen. Unzählige Vögel und Tiere bewegten sich am Ufer und in den Büschen.
Der Engel sah es und sagte: „Dieses Land ist jetzt schöner als alle anderen“.
Der Herr Gott erhob seine Hand. In diesem Moment rauschte es in der Luft. Vom Norden kam ein Greif, der einen Riesen-Bernstein, der in den Sonnenstrahlen glänzte, trug. Diesen warf er in einen der Karthauser Seen, so dass das Wasser bis zum Himmel spritzte.
Der Herrgott sprach: „Dieser Klumpen ist soviel wert wie ganz Kaschubien.“
Darauf fiel der Engel vor Gott auf die Knie und küsste seine gütige Hand. Der Schöpfer gebot den Engel aufzustehen und sagte: „Und du wirst ab jetzt der treue Beschützer dieses wunderschönen Teils der Erde sein.“
Da flog der erfreute Engel hinunter und schützt unser Pommern, damit uns nichts Böses passiert. Seitdem kann der Smatk (ein böser Geist) nichts ausrichten. In schlechten Zeiten wird sich dieser Bernstein zeigen, und sein Wert wird unser Land vor der Vernichtung retten.
Quelle: Polen - Kaschuben
DER LETZTE KAMPF DER STOLEME (RIESEN) ...

Ein Stolem (Riese), der zur Ostsee ging, traf einen anderen. Beide setzten sich hin, der eine auf der Oxhöfter Kampe und der andere auf den Steinberg, und fingen an, sich Geschichten von früher und heute zu erzählen. Schließlich sagte der eine: „Es sieht nicht gut für uns aus, die kleinen Kreaturen – die Menschen – werden uns wohl alle verjagen.“ Ermüdet nach so einem langen Gespräch, legten sich beide hin und schliefen ein.
Das sah ein Fischer. Er stopfte sich seine Hosentaschen voll mit Steinen und kletterte auf den größten Baum hinauf. Von da oben warf er einen Stein direkt auf die Stirn eines der Stoleme. Der wachte auf und sagte zu seinem Kameraden: „Lass mich in Ruhe!“ Der, weil er von nichts wusste, entgegnete ihm nur, das er dumm sei, und nach einem kurzen Streit legten sich beide wieder hin und schliefen wieder ein. Darauf warf der Fischer nochmals einen Stein, diesmal auf den Kopf des anderen.
Der Riese stand auf, schubste seinen Kameraden und sagte: „Lass mich in Ruhe!“
Da antwortete der: „Jetzt bist du wohl dumm geworden!“
Sie stritten sich wieder eine Zeit lang, zum Schluss schliefen beide jedoch ein.
Dann nahm der Fischer einen größeren Stein aus der Hosentasche und warf ihn auf die Nase der ersten Riesen. Das war dem dann zu viel des Guten, er stand auf und forderte seinen Gegner zum Kampf heraus. Die schlugen sich erst in die Gesichter - was sich wie ein Donner anhörte. Danach gingen beide aus einander, fingen an, Bäume herauszureißen und wirbelten diese um die Köpfe.
Der Fischer bekam jetzt große Angst und bereute seinen Leichtsinn. Zum Glück trafen die Riesen den Baum, auf dem er saß, nicht. Aber der entstandene Wind war so riesig, dass der Fischer sich mit all' seiner Kraft an einem Ast festhalten musste, um nicht herunterzufallen.
Die Gegner gingen noch mehr aufeinander los und bewarfen sich mit riesigen Felsblöcken. Das war der schrecklichste Kampf, den man sich vorstellen kann. Andere Riesen, die in Europa lebten, schauten zuerst nur zu, angelehnt an ihre Berge, mit der Zeit haben die sich aber auch an dem Kampf beteiligt.
Das war der letzte Kampf der Stoleme, danach starben fast alle aus. Die von den Bergen abgerissenen Gesteine sind heutzutage in vielen Ländern zu sehen. In Pommern und Pomerellen gibt es auch 'ne ganze Menge davon.
Quelle: Polen - Kaschuben
DER DRACHE VON WAWEL ...
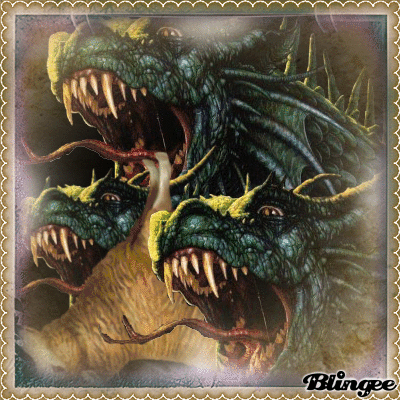
Vor vielen, vielen Jahren, als Krakau noch die Hauptstadt Polens war, lebten in der Burg auf dem Wawel-Berg oberhalb der Weichsel der König Krak mit seiner Tochter Wanda. Alle Bürger von Krakau liebten ihren gutherzigen König und die liebevolle Wanda. Jahrelang lebten alle in Frieden und sorgten um das Wohlhaben ihrer Stadt. Unter ihnen lebte auch in der Familie des Schuhmachers ein tüchtiger und fleißiger Lehrling namens Dratewka.
Eines Tages passierte folgendes: In einer Höhle unter dem Wawel-Berg hatte sich ein böser Drache niedergesetzt. Er hatte drei Köpfe, und sein ganzer Körper war mit Schuppen bedeckt. Wenn er wütend war, tobte er so stark, dass der ganze Berg bebte, aus seinem Maul spie Feuer und Rauch. Er versetzte die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Um ihn zu besänftigen, haben die Bewohner täglich ein Schaf vor seine Höhle gelegt. Es war für ihn aber noch nicht genug. Einmal im Jahr musste sogar ein junges Mädchen geopfert werden.
Viele Bürger versuchten gegen den Drachen anzukämpfen. Niemand konnte ihn jedoch bewältigen. Der Ältestenrat verbrachte Tage und Nächte, um eine Lösung zu finden, fand aber keine. Letztendlich war in Krakau kein Mädchen mehr da. Nur die Prinzessin Wanda verblieb. Der Drache wurde immer ungeduldiger. Da nun kein anderes Mädchen mehr zu finden war, stand fest, dass die Königstochter an der Reihe war. In ganz Krakau herrschte große Trauer.
Der König verkündete im ganzen Land, dass er einen tapferen Ritter suche, der den Drachen besiegen würde. Es kamen viele mutige Ritter und kämpften erfolglos gegen den Drachen. Die meisten wurden im Kampf vom Drachen getötet. Als keine Hoffnung mehr bestand, erschien der Schuhmacherlehrling Dratewka vor dem König. Er bat um Erlaubnis, gegen den Drachen anzutreten. Der König hörte und stimmte seinem Vorhaben zu.
Sofort begann der Junge mit seinem Plan. Vom Metzger holte er sich Schafsfell. Von allen Bürgern sammelte er Schwefel, Salz, Pfeffer und Pech. Er füllte das Fell damit voll und nähte es dicht zu, dass es wie ein echtes Schaf aussah. Nachts warf er das "Schaf" vor den Höhleneingang. Am nächsten Morgen kam der hungrige Drache aus der Höhle und fraß sofort das Schaf. Kurz darauf verspürte er ein fürchterliches Brennen im ganzen Körper. Er versuchte es durch Trinken von riesigen Wassermassen zu löschen. Er trank so viel, dass man den Boden der Weichsel sehen konnte. Er trank weiter, so lange, bis er endlich mit einem riesigen Knall platzte.
Es herrschte große Freude in ganz Krakau. Dratewka heiratete Wanda, und sie lebten noch lange Zeit glücklich und zufrieden.
NIKOLAJ ...

Ein Man ging durch den Wald und verirrte sich. Er ging von einer Ecke in die andere und kam nicht raus. Da stand auf einmal ein Fremder neben ihm und fragte: „Was machst du denn hier?“
Der Mann antworte: „Ich habe mich verirrt, und kann den richtigen Weg nicht finden.“
„Na ja, ich könnte dich hinausführen, aber nicht umsonst.“
„Ich bezahl alles, was du verlangst.“
„Gut, nur für Geld tue ich nichts, davon habe ich genug, weil ich der Teufel bin. Und aus diesem Wald kommst du ohne meine Hilfe nie heraus.“
„Was verlangst du denn dafür?“ fragte der Mensch.
„Du wirst drei Mal meinen Namen raten, wenn du ihn errätst, führe ich dich aus dem Wald heraus. Falls du es innerhalb von fünf Tagen nicht schaffen solltest, dann musst du mir deine Seele verschreiben.“
Der Man wusste, dass er alleine aus dem Wald nie herauskommen würde und wurde sehr traurig. Mit dem Teufel wollte er sich jedoch nicht verbrüdern. Er ging, sehr sauer auf sich selbst, wie ein Irrer durch den Wald – woher sollte er auch den Namen des Teufels kennen?
Dann traf er eine bettelnde Frau. Die sah, wie besorgt er war, und sagte:
„Was fehlt dir denn, dass du so nachdenklich wirkst?“
„Mir kann sowieso keiner helfen“ – sagte er und erzähle ihr alles, was ihm zugestoßen war.
„Humpelte er?“ – fragte sie.
„Ja, das tat er.“
„Na also! Ich kann dir helfen. Als ich durch den Wald ging, sah ich wie einer von einem Fuß auf den anderen sprang und schrie: „Keiner weiß es, dass ich Nikolaj heiß'!“
Am fünftem Tag kam der Teufel auf die besprochenen Stelle. Als der Man dort ankam, wartete er schon ungeduldig auf ihn.
„Die Zeit ist gekommen, jetzt sage mir meinen Namen!“
Der Man dachte kurz nach und sagte:
„Du bist Purtk! “
„Nein!“ – schrie der erfreute Teufel .- „Jetzt hast du nur noch zwei Versuche!“
Da sagte der Man: „ Smatk bist du!“
„Nein! Nur noch ein Versuch. Bald gehörst du mir.“
Der Man erschreckte sich und sagte ängstlich: „Dein Name lautet: Nikolaj!“
„Das muss dir der Teufel selbst gesagt haben oder die alte Frau mit dem Sack auf dem Rücken, die vor ein Paar Tagen hier entlang ging.“
So war der Mann seine Sorgen los und der Teufel musste ihn aus dem Wald herausführen.
Quelle: Polen - Kaschuben

TITELITURI ...

Es war einmal ein Prinz, der wollte gern heiraten, fand aber gar keine Prinzessin, die ihm gefiel. Wie er nun so im Lande umher reiste, so stand auch im Walde ein kleines Hüttchen. Da wohnte eine alte Frau mit ihrer Tochter. Die Tochter war sehr schön, wollte aber gar nichts arbeiten, so daß ihre Mutter sie zur Strafe mit ihrem Spinnrocken auf das Dach setzte; da mußte sie spinnen.
Kommt der Prinz gefahren, und da sitzt sie gerade auf dem Dach, und sie gefällt ihm gleich sehr. Geht also in das Haus und fragt die Alte, ob sie ihm ihre Tochter nicht zur Frau geben möchte. Die war damit einverstanden und sagte: Ja, sie täte es recht gerne, und lobte noch ihre Tochter, daß sie aus Stroh Gold spinnen könne.
So wird denn gleich Hochzeit gemacht, und der Prinz nimmt seine junge Frau mit sich auf sein Schloß. Da werden alle Kammermädchen zusammengerufen mit ihren Spinnrocken, und der Prinz verlangt von seiner jungen Frau, daß sie ihnen mit ihrem Beispiel voran gehen solle. Nun ist sie denn so traurig, wie das werden sollte, da sie doch nicht Gold spinnen konnte.
Wie sie so da sitzt und sich deshalb grämt, kommt unter dem Kamin hervor ein Koboldchen, wie ein kleines Menschchen. Er fragt sie, was ihr fehlt, und sie klagt ihm ihre Not. Da sagte er: Ach, ich kann dir helfen; ich gebe dir solche Handschuhe, wenn du die anziehst, so kannst du Gold spinnen; du mußt mir aber dafür morgen, wenn ich wiederkomme, sagen, wie ich heiße, oder du mußt mit mir Hochzeit machen.
Nun setzt sie sich hin, zieht die Handschuhe an und kann richtig Gold spinnen und spinnt so viele, viele Spulen von Gold. Aber bald sitzt sie wieder in Sorgen, wie der Kleine doch heißen mag! Ihr Mann, der Prinz, war unterdessen auf die Jagd gegangen, der Kobold aber hatte sich in einen Vogel verwandelt und war auch in den Wald geflogen.
Da setzte er sich auf einen Baum und sang und sang immer von Neuem: »Morgen hab' ich Hochzeit, meine Braut spinnt Gold; sie weiß nicht wie ich heiße, ich heiße Titelituri.« Der Prinz hörte, was der Vogel sang, und erzählte, als er nach Hause kam, alles seiner Frau. Die merkt nun gleich, daß der Vogel von ihr gesungen hat, und freut sich, daß sie nun seinen Namen weiß, und sitzt und wiederholt den Namen, um ihn nicht zu vergessen, in einem fort den ganzen Tag.
Den andern Tag, wie das Koboldchen wieder unter dem Kamin hervorkommt, ruft sie ihm seinen Namen zu: Titelituri heißt du! Da fährt er auf in die Luft, reißt das Dach des Hauses mit sich und verschwindet für immer. Der Prinz und seine Frau aber lebten glücklich und in Freuden.
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren, aus Klein Jerutten
DER VOGEL CÄSARIUS ...
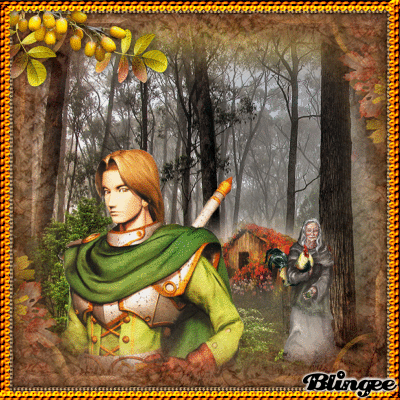
Es war einmal ein König, der war blind. Alle Ärzte und Weisen konnten ihm nicht seine Sehkraft verschaffen. Da fand sich nach vielen Jahren ein weiser Mann ein, der sprach zum König: Es gibt in einem fernen Lande einen Vogel mit Namen »Cäsarius«; wenn du dessen Gesang, o König, hören würdest, wärest du sogleich sehend.
Dieser König hatte drei Söhne; zwei waren klug, und der dritte war dumm. Da rief der König die klugen Söhne und bat sie, ihm den Vogel »Cäsarius« zu bringen. Der älteste Sohn rüstete sich nun zu der großen Reise, bestieg ein schönes Roß und versicherte seinem Vater, er solle den Vogel haben.
Aufs Geratewohl ritt er nun den ganzen Tag, bis er die folgende Nacht in einer vereinsamten Herberge im Walde übernachten mußte. Dort fand er eine Gesellschaft Kartenspieler, die ihn bald nötigten, mit ihnen zu spielen. Im Spiele verlor er nicht nur all sein Geld, sondern auch sein Roß und seine Kleider und wurde fast nackend in einen Keller geworfen. Als nach Verlauf einer geraumen Zeit nichts von ihm zu hören war, ritt der andere Sohn aus, um seinen Bruder und den Vogel zu suchen; er traf auf dieselbe Herberge und es erging ihm gerade so wie seinem Bruder. -
Als auch vom zweiten nichts zu hören war, schickte sich der dumme Prinz Ludwig zur Reise an; aber der König wollte ihn nicht ziehen lassen aus Furcht, den Letzten zu verlieren, und weil es unmöglich schien, daß er ausführe, wobei schon zwei Söhne untergegangen waren.
Aber Ludwig bat so lange, bis man ihn ließ. Auf seiner Reise traf auch er jene Gesellschaft Kartenspieler; aber als er von ihnen eingeladen wurde, sagte er: Jetzt habe ich wegen eines wichtigen Geschäftes keine Zeit um Kartenspiel; in kurzem aber komme ich zurück, und dann werde ich mit euch spielen,« und nachdem er sich gestärkt hatte, ritt er aufs Geratewohl weiter.
Die folgende Nacht brachte ihn in einen großen Wald; da traf er aber eine kleine Frau; ein sehr altes Weib ging aus ihrem Haus heraus und rief zu ihm: »Prinz Ludwig! Was suchst du hier? Spring herab von deinem Pferde, iß und trink, was ich habe, und dann lege dich nieder, daß du ausruhst; denn morgen hast du einen weiten Weg. Du brauchst mir nichts zu erzählen, ich weiß alles und werde dir Rat geben!«
Jenes Weib war eine weise Frau. Tags darauf sagte sie: »Setze dich auf mein Pferd und reite dahin, wohin es gehen wird, bis zu meiner anderen Schwester, die wird dir das Weitere sagen.« Nachdem er noch gefrühstückt hatte, bestieg er dies Pferd, das so schnell lief wie der Wind.
Abends kam er in einen anderen Wald und zu der anderen weisen Frau, die hundert Meilen von der ersten entfernt war, und bei der er es ebenso wie bei der zweiten hatte. Nachdem er ein Nachtlager, Essen und Trinken und ein anderes Pferd erhalten hatte, eilte er den anderen Tag hundert Meilen weit zu der dritten Schwester.
Diese nahm ihn ebenso auf und gab ihm am folgenden Tage eine gewisse Lehre: »Prinz Ludwig, reite jetzt auf meinem Pferde; dies wird dich weiter als hundert Meilen zu der Stelle hin bringen, wo du den Vogel Cäsarius finden wirst. Wenn es stehen bleibt, dann steige von ihm herunter, gehe geradezu in den Eingang des Schlosses, das vor deinen Augen stehen wird. In der dritten Stube wird unter anderen Vögeln der Cäsarius sein, den du so und so erkennen wirst. Ergreife ihn und gehe so schnell als möglich fort, damit du nicht umkommst, und sobald du nur den Fuß auf das Pferd legst, wirst du entkommen.«
Nachdem er wie der Wind an Ort und Stelle gekommen war, erblickte er ein schönes und wunderbar herrliches Königschloß, das verschlossen war.
Als er in das erste Zimmer trat, fand er soviel Schönheiten daß er vor Staunen erstarrte, und eine Fülle von Singvögeln, die in verschiedenen Tönen sangen; in dem zweiten Zimmer waren noch mehr Schönheiten und Vögel und in dem dritten am allermeisten. Als er nach der einen Seite sah, erblickte er eine auf goldenem Lager schlafend liegende, sehr schöne aber schwarze Prinzessin.
Ohne sich bezwingen zu können, warf er sich auf sie und verrichtete mit ihr das Werk der Liebe, und nachdem er ein Stück Papier ergriffen hatte, schrieb er darauf, daß Prinz Ludwig von da und da hier nach einem Vogel aus gewesen wäre und dies getan hätte. Dieses Blatt steckte er hinter einen Balken in eine Spalte. Kaum geriet er den Vogel zu ergreifen, da erhoben sich große Hunde und Löwen in dem Schlosse, die ihn verschlingen wollten; aber er geriet durch Schnelligkeit, seinen Fuß auf das Pferd zu legen, und war wie der Wind bei der weisen Frau.
Die sandte ihn fort zurück zu ihrer Schwester und gab ihm ein Stück Brot, indem sie sagte: Nimm das mit dir; so oft du auch von dem selben abbrechen wirst, wird es doch unversehrt bleiben; die andere sandte ihn zu der ersten, nachdem sie ihm ein Stück Seife gegeben hatte, mit den Worten: Wenn du auch wie ein Wald verwachsen wärst, wasche dich nur damit, und wie ein Engel wirst du schön und glatt werden. Von der anderen ritt er zur ersten; die gab ihm ihr Pferd und die Lehre auf den Weg: Deine Brüder sitzen im Keller der Herberge; du würdest aber am besten tun, wenn du dahin gar nicht hinein gehen möchtest; du kannst das ein andermal verrichten.
Nachdem er zu der genannten Herberge heran geritten war, hielt er es nicht für gut, vorbei zu reiten; sondern er bezahlte die Schulden seiner Brüder und löste sie aus und ihre Sachen, und sie alle ritten nach Hause. Auf der Reise kamen die beiden Brüder zu dem Beschluß, daß es ihnen unmöglich sei, nach so schlechtem Verlauf ihrer Aussendung unter die Augen des Vaters zu treten und dem Dummen den ganzen Ruhm zu überlassen; sie müßten den Bruder Ludwig töten und ihn für verschollen angeben und sich selbst als die Helden vorstellen.
Da sie aber ohne Mördermut waren, und indem sie an einem Meere einen Haufen Fischer sahen, gaben sie ihnen Geld und ihren Bruder, damit sie ihn töteten. Diese schworen den Brüdern, daß jener niemals nach Hause zurückkehren würde, und so ritten jene mit dem Vogel nach Hause. Auch Ludwig gab den Fischern Geld und bat sie, ihn nicht zu töten, auch nicht zu ertränken, und legte einen Eid ab, daß, wenn sie ihn auf die einsame Insel, die dort war, aussetzten, er sich von ihr nicht rühren würde nach der Heimat.
Und so geschah es; er lebte sieben Jahre lang auf der Insel und lebte wild wie ein Tier, zusammen mit den Meerbewohnern und mit den Seetieren, die er mit dem immer vollständigen Brot nährte und große Zuneigung von diesen erfuhr. In der Heimat war zwar wegen der beiden Söhne große Freude, aber Trauer um den Verlorenen und die Blindheit der Augen; denn der Vogel war immer traurig und gab keinen Ton von sich.
Um diese Zeit geschahen große Dinge in dem verwünschten Schlosse, denn die Prinzessin hatte nach dem Besuch des Prinzen Ludwig empfangen, und sie, die selbst schön war, bekam innerhalb eines Jahres einen unaussprechlich schönen Sohn. Doch wußte sie nicht sieben Jahre lang, von wem sie den Sohn hatte.
Als einmal der kleine Sohn, mit Verschiedenem spielend, eine lange Rute nahm und mit derselben in allen Winkeln und Spalten stichelte, kratzte er mit einem Male in dem Saale den Zettel des Prinzen Ludwig auf und lief mit demselben zu Mutter. Da erst erfuhr die Mutter, wie und wer sich ihr genaht hatte, versammelte ein großes Heer und zog zum Krieg wider das Land, aus dem Prinz Ludwig war.
Nachdem sie die Grenzen der Hauptstadt umstellt hatte, sandte sie einen Herold zum König mit dem Befehl, der König solle ihr sofort den Sohn herausgeben, der den Vogel Cäsarius aus ihrem Schlosse gebracht hätte; sonst würde sie das Land und das königliche Haus verwüsten. Der Vater rief voll Furcht den ältesten Sohn zu sich und fragte ihn, ob er es wäre. Und als der Sohn antwortete, es verhielte sich so, bat ihn der Vater, er solle so schnell als möglich sich in das feindliche Lager begeben und vor den Augen der mächtigen Königin Gnade suchen.
Der Prinz schmückte sich so schön als möglich, bestieg ein Roß und ritt ab. Hinter der Stadt fand er die Heerstraße zur Königin wie mit Gold ausgeschlagen und wagte es nicht, auf der selben, sondern nur neben der selben, zu reiten. Die Königin erwartet ihn mit ihrem Sohne, der sie fragt, ob der sein Vater wäre, der da heranreite.
Nein! mein Sohn, ruft sie; der hat nicht die Courage deines Vaters. Bald ward der Prinz auch abgefertigt und mit ihm wieder der Herold gesandt, er solle den herschicken, der den Vogel gebracht hätte; der jetzt gewesen wäre, sei es nicht. Der König ruft den zweiten Sohn, dem es eben so ergeht, wie dem ersten. Der besorgte Vater befahl seinen Söhnen, den Prinzen Ludwig aufzusuchen und zu befragen.
Als diese nun sahen, daß es bitterer Ernst werde, ritten sie so schnell als möglich zu dem Meere, um die Fischer zu fragen, und erfuhren, daß ihr Bruder auf der Insel lebe. Sofort fuhren sie in Schiffen mit den Fischern dort hin und fanden ihn. Er wollte nicht gehen, auch wollten ihn nicht die Meerbewohner und die Seefische fahren lassen. Auf langes Bitten seiner Brüder und der Fischer fuhr er mit ihnen; aber er war verwachsen und schwarz wie ein Wald. Nachdem er aber seine Seife angewandt hatte, wurde er schöner als alle. Zu Hause war große Freude über ihn, und auch der Vogel, als er seine Stimme hörte, sang und der Vater wurde sogleich sehend.
Nachdem er sich ausgerüstet hatte ritt er zur Königin, und als er den goldenen Weg fand, rief er: Das ist ein Weg, gerade wie für mich und trabte gerade auf ihm zu. »Jetzt reitet zu uns dein Vater,« rief die Mutter zum Sohne. In Kurzem fand die Begrüßung, Erkennung, volles Freudenfest statt; sie besuchten seinen Vater, und eine Hochzeit wurde ihnen ausgerichtet.
Der Vater wollte aus Dankbarkeit seinem Sohne Ludwig das ganze Königreich geben; aber die Königin rief: »Nicht so; ich habe ein ganz anderes Königreich, wo mein Mann herrschen wird.« Und nachdem sie sich ausgerüstet hatten, reisten sie fort zu ihrem Vaterlande, wo sie lange und glücklich lebten und regierten.
Und jene beiden Söhne empfingen Verachtung als Belohnung für ihre Bosheit und Falschheit.
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren, aus dem Angerburger Kreise
VOM HEXENMEISTER ...
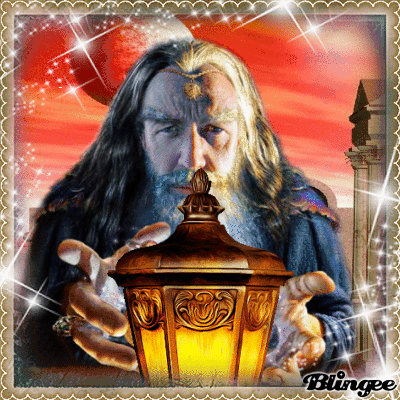
Eine arme Frau hatte einen Sohn. Eines Tages kaufte ein Zauberer ihr den Sohn ab und gab ihr ein Säckchen Geld dafür. Er nahm ihn zu sich nach Hause und sagte zu ihm: „Paß gut auf! Dieser Dachboden dort wird sich um Mitternacht öffnen. Wenn er sich geöffnet hat, dann steigst du auf diesen Boden. Dort liegt eine Menge Gold, und dort liegen auch viele Diamanten, aber von all dem darfst du nichts nehmen. An einem Balken hängt auch eine Lampe, wenn sich diese Lampe bewegt, nimm sie ab und bringe sie mir.“
Der Jüngling stieg auf den Dachboden und klaubte sich die allerschönsten Diamanten heraus. Währenddessen schloß sich der Dachboden. Der Jüngling sah sich erschrocken um, erblickte die am Balken hängende Lampe und bewegte sie. Da öffnete sich der Dachboden wieder; und da kam irgendein anderer Zauberer und fragte ihn: „Was willst du, durchlauchtester Prinz?“
Der Jüngling sagte, er solle ihm einen Diamanten groß wie ein Kopf bringen. Der Zauberer brachte ihm das Gewünschte. Der Jüngling ging mit der Lampe und mit dem Diamanten zum Kaiser, denn dieser hatte eine wunderschöne Tochter, die der Jüngling gern heiraten wollte. Und der Kaiser sagte zu ihm: „Wenn du mir etwas Wertvolles zu geben vermagst, dann kannst du sie heiraten.“ „Und was möchte der Kaiser haben?“ Der Kaiser wünschte sich den kopfgroßen Diamanten und außerdem für die Fahrt zur Kirche eine goldene Karosse und Rappen mit weißem oberem Zaumzeug, das beidseitig mit goldenen Nägeln beschlagen sein sollte.
Der Jüngling ging, bewegte seine Lampe, und schon kam der Zauberer. „Was möchtest du, erlauchtetester Prinz?“ Der Jüngling befahl ihm, alles zu bringen, was sich der Kaiser gewünscht hatte. Der Zauberer gab ihm alles. Als der Kaiser mit seinem Gefolge vom Gebet zurückkam, wollte er ihm seine Tochter trotzdem nicht zur Frau geben. Da sagte der Jüngling: „Dann gib mir den großen Diamanten zurück, den ich dir gab!“
Aber den Diamanten wollte der Kaiser gern behalten; so sagte er, er wolle ihm seine Tochter nur zur Frau geben, wenn dieser ihm bis zum Hochzeitstag eine Straße baue, die mit Silber, Gold und Diamanten gepflastert sei. Außerdem sollen zu beiden Seiten der Straße Bäume wachsen, und jeder Baum sollte anders vergoldet sein und in jedem Baum ein anderer Vogel singen.
Der Jüngling bewegte wieder die Lampe, und schon erschien der Zauberer und ließ das Gewünschte entstehen. Als sie tags darauf zur Trauung fahren sollte, schickte er einen Boten zum Kaiser, um ihn zu fragen, was er für Karossen und Pferde er wünsche. Der Kaiser ließ ihm sagen, daß es eine diamantene sein solle, dazu Grauschimmel mit schwarzer Passe über der Brust und mit weißen Schwänzen.
Der Jüngling bewegte die Lampe, da erschien auch schon der Zauberer und gab ihm sofort das Verlangte. Nach der Trauung fuhr der Jüngling spazieren. Unterdessen kam zu seiner jungen Frau der erste Zauberer, der nämlich, der den Jüngling seiner Mutter abgekauft hatte, und nahm ihr die Lampe fort. Er bewegte die Lampe, und da erschien noch ein anderer Schwarzkünstler. diesen wurden nun befohlen, den kleinen Palast des Jünglings mitsamt seiner Frau hinter das Rote Meer zu versetzen.
Als der junge Mann von seiner Spazierfahrt zurückkehrte, war alles verschwunden. Da verkaufte er Pferde und Karossen und schritt weinend die Landstraße entlang. Unterwegs traf er einen Greis, dem er einen Groschen zusteckte. „Weshalb weinst du?“ fragte ihn der Greis.
Und so erzählte ihm der Jüngling, seine ganze Geschichte. Da gab ihm der Greis den Groschen zurück und riet ihm, ans Rote Meer zu reisen. Dort am Ufer würde eine Eiche stehen, in dieser befände sich Schilfrohr; dieses Schilfrohr sollte er nehmen und damit über das Meer ein Kreuzzeichen schlagen. Er tat, wie ihm der Greis geraten hatte, und sofort trat das Wasser zurück, und ein Weg lag vor ihm.
Der Jüngling lehnte das Schilfrohr wieder an die Eiche und schritt auf diesem Weg über das Rote Meer, aber hinter ihm stürzten die Wasser wieder zusammen. Am Ende des Pfades, am anderen Ufer, stand sein Palast, er erkannte seine Frau, und seine Frau erkannte auch ihn.
Zu dieser Zeit war der Zauberer gerade im Walde. Als aber die Zeit heranrückte, daß er zurückkommen sollte, schloß die Frau ihren Mann in einen Kleiderschrank ein. Da erschien der Zauberer schnupperte mehrfach und sagte, daß es streng nach einer Seele rieche. Doch sie antwortete: „Mann, das kommt dir nur so vor, hier riecht nichts, die Gerüche kommen aus dem Walde.“
Aber er spuckte aus und sagte, daß es doch streng nach einer Seele stinke. Sie setzte sich hin, indessen hieß er sie, ihn zu lausen, und er schlief dabei ein. Sobald er fest eingeschlafen war, reichte sie ihrem Gatten ein Schwert. Dieser öffnete den Schrank, einen Spalt; im Schrank stand jene Lampe, und diese nahm er unverzüglich an sich.
Dann bewegte er die Lampe, und wie von tausend Nadeln gestochen, sprang der Zauberer mit beiden Beinen zugleich auf und fragte: „Was willst du, durchlauchter Prinz?“ Der Prinz befahl ihm, seinen Palast wieder dorthin zu bringen, wo er zuvor gestanden hatte. Der Zauberer rief die Hexenmeister aus der ganzen Welt zusammen, und sie alle brachten gemeinsam den Palast an die alte Stelle zurück.
Der Zauberer verschwand mit allen den anderen Schwarzkünstlern; von da an lebten der junge Mann und seine Frau glücklich miteinander.
Quelle: Saloni, A. Lud wiejski w okolicy Przeworska
BERGESTÜRZER UND EICHENREISSER ...

Eines Jägers Frau im Walde hatte zwei kleine Knaben, ein Zwillingspaar. Die Kinder waren erst wenige Tage alt, da starb die Mutter.
Kein Mensch kümmerte sich um die beiden Waisen, aber sie wurden von einer Wölfin und einer Bärin gesäugt. Sie wuchsen heran und wurden riesenstarke Jünglinge. Der eine konnte Berge umwerfen, als wären es Sandhaufen; er bekam den Namen Bergestürzer. Der andere riß die stärksten Eichen aus der Erde, als wären es Grashalme; er bekam den Namen Eichenreißer.
Die beiden Brüder liebten sich von Herzen und gingen zusammen auf Reisen, um die weite Welt zu sehen. Sie gehen durch eine Heide, einen Tag und noch einen. Am dritten Tage bleiben sie stehen, denn ein Berg versperrt die Straße, und der Berg war hoch und felsig.
"Was fangen wir nun an!" ruft der Eichenreißer traurig.
"Sorge dich nicht, geliebter Bruder; ich will diesen Berg schon stürzen, daß die Straße nicht gesperrt bleibt!"
Er stemmt sich unter mit den Schultern: krachend fällt sogleich der Berg um; schiebt ihn fort noch eine Meile.
Sie gehen weiter. Eine Eiche stehet mitten auf dem Wege und versperrt die ganze Straße. Eichenreißer läuft geschwinde, packt die Eiche mit den Händen, reißt sie aus samt ihrer Wurzel, wirft sie in das nahe Wasser. - Aber ob sie gleich so stark sind, fühlen sie doch auch Ermattung; ruhen also aus im Walde. Noch sind sie nicht eingeschlafen, sieh, da kommt ein kleines Männchen auf sie zu, doch so geschwinde, daß kein Tier und auch kein Vogel es vermöchte einzuholen.
Sie erheben sich verwundert, als das Männchen nun im Fluge gerade vor den beiden Halt macht.
"Ei, wie geht es Euch, Ihr Burschen?" fragt das Männchen freundlich lächelnd; "seid ermüdet, wie ich sehe. Wenn Ihr wollt, will ich geschwinde Euch hintragen, wo Ihr wünschet."
Einen Teppich zeigt er ihnen: "Setzt Euch mit mir auf den Teppich!" Und die beiden Brüder setzen sich bequem drauf nebst dem Männchen; dieses klatscht, - und der Teppich fährt wie'n Adler durch die Lüfte.
"Sicher habt Ihr Euch gewundert," sagt das kleine Männchen wieder, "über meinen Lauf vorhin: seht mal her! Hier sind zwei Schuhe, die ein Zauberer mir geschenkt hat. Mit den Schuhen kann ich laufen: jeder Schritt ist eine Meile; zweie mach ich, wenn ich springe."
Beide Brüder bitten dringend, daß das Männchen ihnen doch die Wunderschuhe schenken möchte; denn obgleich sie riesenstark sind, werden sie doch auch bald müde.
Das Männchen konnte den Bitten nicht wiederstehen und schenkte ihnen die Schuhe. - Noch immer flogen sie in der Luft. Vor einer großen Stadt ließ sich der Teppich nieder. In dieser Stadt war ein ungeheurer Drache, der täglich viele Menschen fraß. Der König hatte bekanntgemacht: Demjenigen, der den Drachen tötet, geb ich eine von meinen Töchtern zur Frau, und nach meinem Tode soll er König sein.
Die beiden Brüder nehmen sich vor, den Drachen zu töten, und machen sich auf den Weg zu des Drachen Höhle. Unterwegs treffen sie wieder das kleine Männchen.
"Ei, wie geht es Euch, Ihr Burschen? Weiß schon gut, wohin Ihr eilet! Aber höret meinen Rat noch: ziehet jeder einen Schuh an; denn sobald der Drache rausspringt, läßt er Euch nicht Zeit zum Töten."
Sie gehorchen diesem Rate. Eichenreißer bewaffnet sich mit einem mächtigen Eichenstamme, um dem Drachen damit den Kopf zu zerschmettern. Bergestürzer schüttelt an den Felsenwänden der Drachenhöhle, als wäre es ein Bündel Roggen.
Aus der Höhle springt der Drache, und erschreckt denkt Eichenreißer nicht mehr an den großen Baumstamm, den er kräftig in der Hand hält. Nur ein Glück, daß er den Schuh hat, denn er springt zwei Meilen seitwärts. - Da der Drache ihm nicht nach kann, wirft er sich auf Bergstürzer. Dieser nimmt ein mächt'ges Felsstück, wirft es hin mit allen Kräften; krachend fällt der Block zu Boden, grade auf den Schwanz des Drachen. Und nun springt auch Bergestürzer seitwärts fort, schnell und behende, - und erblickt da seinen Bruder.
"Laß uns wieder hin, mein Bruder, denn das Tier kann nicht vom Platze: Du hau los mit deinem Eichstamm, und ich stürze einen Berg drauf!"
Dreister gehen sie nun vorwärts. Eine Eiche schwingt der eine, und der andre trägt ein Felsstück. Gräßlich heult und faucht der Drache, da nun beide Gegner kommen. Wütend will er auf sie stürzen, doch den Schweif drückt jenes Felsstück. Eichenreißer haut nun kräftig und zerschmettert ihm das Gehirn; und der Bruder wirft den Berg drauf und bedeckt das ganze Untier.
Ungeduldig harrt der König. Groß ist jetzo seine Freude: jedem gibt er eine Tochter. Bald darauf, nach seinem Tode, teilten beide sich das Reich. Sie lebten glücklich und zufrieden.
Quelle: Kasimir Wladislaw Woycicki, Polnische Volkssagen und Märchen
DER SCHMIED VOR DEM HÖLLENTOR ...
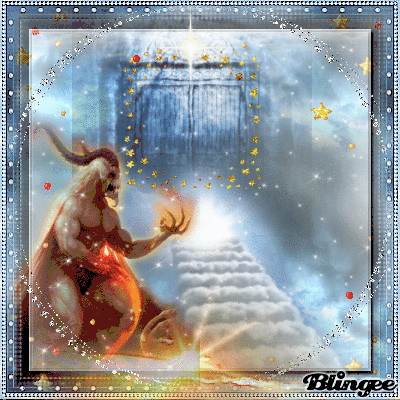
Es war einmal ein Schmied, der lebte lustig in den Tag hinein und scherte sich weder um Gott noch den Teufel. Als er aber merkte, dass er bald sterben musste, sagte er zu seinem Lehrjungen: "Wenn ich sterbe, dann gib mir einen Hammer und ein paar lange, scharfe Nägel mit in den Sarg.“ Der Lehrling tat, was ihm sein Meister aufgetragen hatte, und so wurde der Schmied begraben.
Er kam an das Himmelstor und bat, in den Himmel eingelassen zu werden. Der heilige Petrus aber sagte: „Ich kann dich in den Himmel nicht einlassen, du warst auf Erden ein zu großer Sünder. Geh weiter!“ Der Schmied wanderte weiter und gelangte vor die Hölle. Dort am Höllentor stand aber niemand, und es war verschlossen. Da nahm der Schmied seinen Hammer und pochte kräftig ans Höllentor.
Das hörten die Teufel, und sie schickten einen von ihnen, der nachsehen sollte, was das für ein Lärm war. Aber als der Teufel die Tür eine Spaltbreite geöffnet hatte und hinausguckte, fasste ihn der Schmied beim Ohr und nagelte ihn daran fest. Das tat dem Teufel schrecklich weh, und er schrie deshalb fürchterlich. Da schickten die Teufel noch einen Teufel aus, um zu ergründen, weshalb der erste so ein Geschrei machte.
Aber als dieser seinen Kopf hinausstreckte, fasste ihn der Schmied auch am Ohr und nagelte ihn auf der anderen Seite fest. Nun schrien die beiden Teufel so laut, dass der allerhöchste Teufel sagte: "Da muss ich wohl selbst nachsehen, was dort vorgeht!“ Als er hinter der Tür hervor sah, wollte der Schmied ihn ebenfalls greifen und festnageln, aber der Teufel sprang rasch zurück und schlug die Tür zu.
Dann eilte er zur Hinterpforte der Hölle, floh zum Herrgott und sagte: "Vor meiner Tür steht ein Schmied, der hat schon zwei meiner Teufel an den Ohren ans Höllentor genagelt, und es fehlte nicht viel, und er hätte auch mich festgenagelt. Den musst du in den Himmel nehmen, denn wenn ich ihn bei mir aufnehme, bin ich nicht mehr Herr der Hölle!“ Der Herrgott wollte den Schmied aber nicht in den Himmel nehmen, da sagte der Teufel: "Ich bleibe solange hier, bis du ihn zu dir in den Himmel nimmst!“
So musste der Herrgott den Schmied in den Himmel aufnehmen, denn er konnte ja den Teufel nicht gut bei sich lassen.......
Quelle: Stopka A, Sabala – Bojan (Weijherowo
DER TAPFERE SOLDAT UND DER GEIST ...
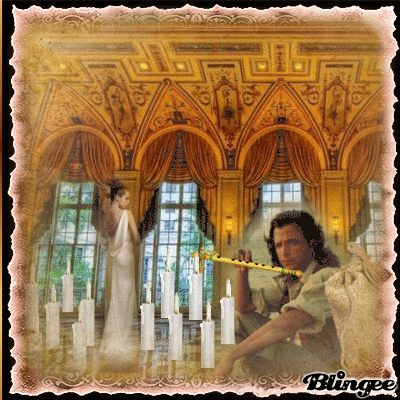
Nachdem ein großer Krieg aus war, wurden die Soldaten nach Hause geschickt. Nicht jeder von denen fand sofort eine Arbeit. Einer dieser Soldaten, der sehr tapfer und mutig war (er bekam auch viele Orden dafür), kaufte sich eine Flöte. Er wanderte von Dorf zu Dorf, spielte fröhliche Töne und verdiente damit sein Geld.
Eines Abends trat er in eine Schenke ein, und weil es schon spät war, wollte er dort übernachten. Der Schenkwirt sagte jedoch, dass es kein freies Bett mehr gäbe, aber ganz in der Nähe fände der Soldat ein halb im Sand versunkenes Schloss, wo er übernachten könne. Er sollte nur daran denken, dass es dort spukt.
Der tapfere Soldat machte sich nichts draus, hat sein Abendbrot aufgegessen und machte sich auf den Weg. Unterwegs kaufte er von dem Kirchendiener 12 Kerzen, wobei er eine zwölfmal weihen ließ. Er besorgte sich auch einen Sack. Nach dem es dunkel wurde, ging er mit all seinen Sachen zum Schloss. Als er ankam, gingen alle Tore auf - das hat ihm aber keine Angst gemacht.
Der Soldat ginge sofort in den größten Saal, wo er auf dem dort stehenden Tisch seine zwölf Kerzen angezündet hinstellte. Dann setzte er sich bequem hin und spielte in Ruhe ihm bekannte Lieder. Als die Kirchenuhr Mitternacht schlug, ging die Decke über ihm auf und ein halber menschlicher Körper fiel auf den Tisch. Der Soldat spielte jedoch weiter und ließe sich nicht erschrecken. Nach einer Weile ging erneut die Decke auf, und dann fiel die andere Hälfte des Körpers herunter. Der Soldat spielte jedoch weiter, ohne Angst zu haben.
Einige Minuten später vereinten sich die beiden Körperhälften, woraus die Erscheinung einer wunderschönen Frau entstand. Die fing dann an zu tanzen, pustete nach und nach die Kerzen aus und sagte: "Komm doch mit mir!"
Der wackere Soldat spielte jedoch die Flöte weiter. Es blieb nur noch eine einzige Kerze an (die er hatte weihen lassen), welche die Erscheinung jedoch, trotz aller Mühe, nicht auspusten konnte. Sie tanzte und tanzte weiter, und der Soldat hörte nicht auf zu spielen. Plötzlich stand er schnell auf, fing die Erscheinung und steckte sie in den Sack Mit dem ging er zum Dorfschmied, weckte ihn auf und sagte: "Schlage kräftig eine halbe Stunde lang auf den Sack, und du bekommst das, was du verlangst."
Der Geist erschrak und sagte: "Bitte, tue es nicht, ich werde nie wieder jemanden erschrecken. Als ich am Leben war, war ich ein reicher Herr, meine Geldgier ist mir jedoch zum Verhängnis geworden. Ich habe drei Fässer voll mit Gold gesammelt, auf die ich seit meinem Tode aufpassen muss. Nimm die bitte, sie befinden sich unter dem großen Saal. Das eine Fass spende der Kirche, das zweite an die Armen und das dritte behalte, es ist deine Belohnung für deine Tapferkeit und meine Erlösung."
Nachdem der Geist es sagte, verschwand er auch. Der Soldat tat alles das, was der Geist ihm sagte. Bald wurde er sehr reich und wohnte in dem verzauberten Schloss.
Quelle: Polen - Kaschuben
DAS HASENHERZ ...

Auf einer Insel mitten in der Weichsel stand vor Jahren ein großes Schloß, von Mauern rund umgeben, und viele Fähnlein wehten darauf im Winde. Dort wohnte ein Ritter, ein tapferer und berühmter Krieger, der in vielen Kämpfen Ruhm und Ehre erworben hatte.
In unterirdischen Kerkern waren die Gefangenen eingesperrt. Täglich mußten sie zur Arbeit: die Mauern ausbessern, den Garten bestellen. Ein altes Weib war unter ihnen, eine alte Hexe. Der Mann von dieser Hexe war auch gefangen und gefesselt. Die Hexe nahm sich vor, den Mann zu rächen.
Einmal war der Ritter allein im Garten. Müde setzte er sich auf den grünen Rasen und schlief ein.
Heimlich lauert dort die Hexe, schüttet Mohn auf seine Augen, daß er nicht so früh erwache, und mit einem Fichtenzweig stößt sie an die offene Brust ihn, wo das Herz des Menschen klopft.
Und die Brust tut sich auf. Man sieht das rote Herz, wie's beständig schlägt und zittert. Teuflisch lächelt da die Hexe, streckt die magre Arme aus, und mit ihren langen Fingern greift sie leise nach dem Herzen; zieht es aus der Brust so leise, daß der Ritter nicht erwacht.
Nimmt das Herz dann eines Hasen, das sie schon bereit gehalten, legt es in die Brust des Ritters und verschließt die Öffnung wieder. Geht dann selber auf die Seite, legt sich hin im dichten Busch, will des Zaubers Folgen sehen.
Noch war der Ritter nicht erwacht, doch schon fühlte er das Hasenherz. Er, der früher keine Furcht gekannt, er zitterte nun ängstlich und warf sich von einer Seite auf die andre. Er erwachte. Seine Rüstung schien ihm so schwer. Kaum hatte er sich erhoben, so hörte er das Bellen der Hunde.
Wenn früher die muntre Meute das Wild im Walde verfolgte, so hüpfte das Herz ihm vor Wonne. Jetzt aber flieht er erschrocken, - er flieht wie ein furchtsamer Hase! Kaum ist er in seinem Zimmer, so erschreckt ihn die eigene Rüstung, das Geklirr der silbernen Sporen. Daher wirft er die Rüstung zu Boden und sinkt ermattet auf sein Lager.
Früher träumte er im Schlafe nur von Kampf und Siegesbeute, jetzt stöhnt und ächzt er traurig; jedes Bellen seiner Hunde, jeder Anruf seiner Wache, die am Feuer auf dem Walle sorglich schützt vor einem Anfall, schreckt den Armen auf dem Lager. Wie ein Kind drückt er das Antlitz tief hinein ins weiche Kissen.
Mächtige Scharen wilder Heiden umringten das Schloß. Die Ritter und Soldaten erwarteten ihren Herrn, der sie immer zu Kampf und Sieg geführt hatte. Aber sie warteten diesmal vergebens. Als der einst so tapfere Ritter das Geklirr der Waffen und das Geschrei der Krieger und das Wiehern der Rosse vernahm, lief er fort aufs Dach des Schlosses und erblickte von dort aus das große Heer der Heiden.
Da gedachte er seiner alten Kriegsfahrten, seines Ruhms und seiner Siege. Da meinte er bitterlich, seufzte tief und sprach:
"O Gott, gib mir doch meinen Mut wieder, die alte Kraft und die alte Kühnheit! Dort auf dem Schlachtfeld wehen meine Fahnen, und ich stehe da wie ein furchtsames Mädchen. Gib mir mein Herz wieder, daß es nicht zittre, - gib mir die Kraft wieder, daß ich meine Rüstung ertrage, belebe mich mit frischem Jugendmut und schenk mir den Sieg!"
Die Erinnerung weckt ihn gleichsam aus dem Schlafe: schnell kehrt er zurück in sein Zimmer, legt die Rüstung an, besteigt das Roß und reitet zum Tore hinaus. Der Torwächter begrüßt freudig seinen Herrn und gibt den Kriegern ein Zeichen durch den Schall der Trompete.
Indessen reitet der Herr davon. Aber noch beherrscht die Furcht seine Gedanken, und wie sich seine Ritter voll kühnen Mutes auf die Feinde stürzen, da wendet der Schloßherr in tödlicher Angst den schnellfüßigen Renner und flieht zurück in die feste Burg.
Atemlos kommt er im Schlosse an. Doch auch hinter den mächtigen Mauern verläßt ihn die heimliche Furcht nicht. Eilig wirft er sich vom Pferde, läuft in eine Kammer, die durch feste Eisentüren gesichert ist, und kraftlos erwartet er den ruhmlosen Tod.
Seine Ritter haben den Feind geschlagen. Der Wächter verkündet vom hohen Turme die Rückkehr der siegreichen Fahnen. Voll Verwunderung suchen alle den Herrn des Schlosses. Endlich finden sie ihn halb tot in der eisernen Kammer.
Er lebte nicht mehr lange. Den ganzen Winter hindurch wärmte er den zitternden Leib am Kaminfeuer im Schlafgemach. Als der Frühling gekommen war, öffnete er einmal ein Fenster, um frische Mailuft einzuschlürfen. Da flog eine Schwalbe vorbei, und im Fluge streifte sie mit ihrem dunklen Flügel das Gesicht des Ritters. Erschrocken und wie vom Blitz getroffen sank er nieder und war tot.
Alle betrauerten den guten Herrn, doch keiner wußte, was ihn so verwandelt hatte. Ein Jahr darauf aber verbrannte man alle Hexen, weil sie den Regen zu lange aufgehalten hatten. Da bekannte jene alte Hexe, daß sie das Herz des Ritters mit einem Hasenherzen vertauscht hatte.
So erfuhren alle Menschen, weshalb der einst so kühne Ritter so furchtsam geworden war. Sie betrauerten ihn jetzt noch mehr, und auf seinem Grabe verbrannten sie die böse Hexe bei lebendigem Leibe.
Quelle: Polnische Volkssagen und Märchen
VOM WERWOLF ...
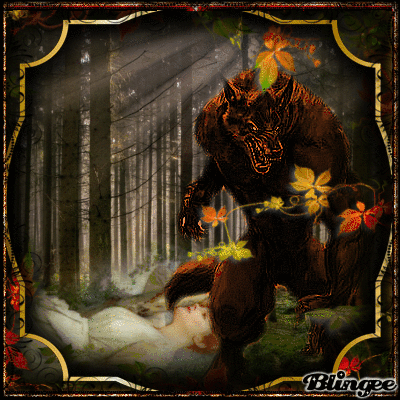
1. Geschichte
Man feierte das Erntefest. Auf einem blumigen Hügel am Ufer der Weichsel tanzte das junge Volk. Fässer mit Bier und Schnaps standen da, denn auch die Alten wollten fröhlich sein. Mitten im lautesten Jubel brachte plötzlich ein lauter Schrei die Musik und die fröhlichen Lieder zum verstummen. Man hörte auf zu tanzen. Alle drängten dahin, woher der Lärm zu kommen schien. Und sie mußten etwas Schreckliches sehen: ein Werwolf hatte das schönste Mädchen des Dorfes gefaßt und schleppte es im Rachen fort.
Die jungen Männer eilten ihm nach, und bald war das Untier eingeholt. Aber dieses ließ seine Beute auf die Erde fallen, stellte sich voll Wut davor und erwartete den Angriff. Die armen Burschen wußten sich nicht zu helfen; einige liefen nach Hause um ihre Flinten zu holen, andere traten furchtsam ganz zurück. Als der Werwolf das sah, hob er schnell das Mädchen wieder auf und rannte in vollem Lauf dem Walde zu.
Fünfzig Jahre später war auf demselben Hügel die Jugend des Dorfes wieder zu fröhlichem Spiel versammelt. Da sahen sie einen eisgrauen Alten herankommen und baten ihn, an ihrer Fröhlichkeit teilzunehmen. Er aber setzte sich schweigend nieder und leerte traurig das Glas mit Schnaps, welches man ihm reichte. Einer der Bauern, der fast ebenso alt war, ging zu dem Fremden hin und fing an mit ihm zu reden.
Jener sah ihm lange ins Gesicht, endlich rief er mit Tränen: »Was, Du bist es, mein lieber Stephan?« Und sogleich erkannte der Bauer seinen älteren Bruder, der vor fünfzig Jahren auf rätselhafte Weise verschwunden war. Erstaunt umringten ihn alle, und nun erfuhren sie, wie eine böse Hexe ihn in einen Werwolf verwandelt und er dann das Mädchen beim Erntefest geraubt habe, wie es aber ein Jahr darauf vor Kummer im Walde gestorben sei.
»Von da an,« fuhr er fort, »warf ich mich mit Heißhunger auf alle Menschen. Wen ich nur packen konnte, den fraß ich auf, und die Blutspuren hab ich noch immer nicht verwischen können.« Hierbei zeigte er seine Hände, - sie waren ganz mit Blut bespritzt. Und er sprach weiter: »Vier Jahre irre ich nun wieder in Menschengestalt umher. Ach, ich wollte Euch noch einmal sehen, Euch und das Dorf, wo ich geboren bin. Dann, - o meine lieben Freunde! - dann flieht vor mir, denn ich werd' wieder ein Werwolf, wie vorher!«
Kaum hat er das gesagt, so springt er plötzlich, in einen Wolf verwandelt, auf schnellen Beinen davon, heulte gräßlich und verschwand für immer im Walde.
2. Geschichte
Eine Hexe verliebte sich einmal in einen jungen Burschen, doch es gelang ihr nicht, seine Gegenliebe zu erwecken. Endlich schwur das böse Weib, an ihm furchtbare Rache zu nehmen.
Bald darauf traf sie den hübschen Knecht und sagte spottend: »O warte nur! Sobald Du in den Wald gehst, verwandelst Du Dich beim ersten Schlag Deiner Axt in einen grausamen Werwolf!«
Aber der leichtsinnige Bursche achtete der Drohung nur wenig, spannte seine Ochsen vor den Wagen und fuhr ins Holz. Kaum hatte er die Axt zum ersten Schlage erhoben, als sie seiner kraftlosen Hand entfiel. Ganz erschrocken besieht er sich, - seine Hände haben sich schon in Wolfsklauen verwandelt. Besinnungslos rennt er im Walde umher. Er kommt zu einer Quelle und sieht nun mit Grausen: er ist von Kopf zu Fuß ein wirklicher Wolf geworden. Nur paar Lappen seiner Kleider hängen ihm noch am Leibe.
Er eilt zu seinen Ochsen hin; aber diese geraten bei seinem Anblick in Furcht und laufen fort. Noch eins will er versuchen: seine bekannte Stimme soll ihnen freundlich Stillstand gebieten. Doch ach! statt eines menschlichen Wortes kommt rauhes Wolfsgeheul aus seiner Kehle. Nun muß er einsehen, daß der Hexe Drohungswort an ihm erfüllt sei.
Doch auch in der Wolfsgestalt war es ihm unmöglich, sich von seinem heimatlichen Dorfe ganz zu trennen; er blieb immer in der Gegend. Nie konnt' er sich an rohes Fleisch gewöhnen, und der Gedanke nur an Menschenfleisch erregte Grausen in ihm. Deshalb begann er die Hirten und Schnitter zu schrecken und sie von der Arbeit zu verjagen; dann fraß er ihnen gierig Milch und Brot und ihre andern Speisen auf.
Nachdem der arme Wolf schon viele Jahre auf diese Weise zugebracht hatte, empfand er einmal einen mächtigen Drang zum Schlafen. Er warf sich also auf eine Wiese und schlief ein. Wie groß war seine Verwunderung, als er sich beim Erwachen wieder in einen Menschen verwandelt sah!
In seiner Freude dachte er nicht daran, daß er ganz unbekleidet war, und so schnell wie möglich lief er nach seiner lieben Hütte. Aber kein Glück ist dauerhaft, sagt das Sprichwort. Das mußte auch unser Knecht erfahren: seine Eltern waren gestorben, Katharina, seine Geliebte, hatte sich einen andern genommen, und schon vier Kinder balgten sich vor ihrer Hütte. Seine Freunde waren entweder gestorben oder in fremde Länder gezogen.
Der arme Bauer trug alle diese Nachrichten mit festem Mute, aber ihm blutete das Herz dabei. Im Schweiße seines Angesichts bearbeitete er sein kleines Feld, und wenn er am Sonntag mit den andern Männern im Gasthause saß, so erzählte er ihnen sein Leiden und sein Unglück, in das ihn die Rache der verschmähten Zauberin gestürzt hatte.
3. Geschichte
Ein Bauer war sieben ganze Jahre Werwolf gewesen. Als nun seine Zeit um war, wurde er wieder in einen Menschen verwandelt. Nackt und hungrig lief er den ganzen Tag seinem Hause zu. Dort wohnte seine Frau mit seinen Kindern. Am späten Abend endlich kam er an und klopfte an die verschlossene Tür.
»Wer da?« so rief es aus der Hütte, und der Bauer erkannte die Stimme seiner Frau.
»Ich bin's! Dein Mann! Dein lieber Mann! Geschwind mach auf!«
»Alle guten Geister loben den Herrn! Um Gottes willen, Mann, steh auf!« rief das erschrockene Weib; und der Bauer sah seinen alten Knecht herauskommen, der unterdessen seine Frau geheiratet hatte und Herr vom Hause geworden war.
Der Knecht hielt eine große Mistgabel in der Hand und wollte den rechtmäßigen Besitzer damit vertreiben. Erzürnt über die Treulosigkeit seiner Frau, rief der Bauer schmerzlich aus: »O, warum bin ich kein Werwolf mehr, wie würd' ich gleich das böse Weib bestrafen!«
Kaum hat er so gesprochen, so wird der frevelhafte Wunsch erfüllt. Von neuem ist er in einen Wolf verwandelt, und wütend stürzt er sich auf seine Frau und wirft sie um mitsamt dem Kinde, das aus der zweiten Ehe war und an der Mutter Brust lag. Das Kindlein fraß er auf, und auch die Frau zerbiß er tödlich.
Auf der Unglücklichen Geschrei liefen bald die Nachbarn zusammen und warfen sich vereint auf das reißende Tier. Es vermochte sich nicht lange zu widersetzen. Die Bauern erhoben ein Freudengeschrei. Als sie aber beim Lichte eines Kienholzes das Untier näher beschauten, da erkannten sie zu ihrem Schrecken, daß der Landmann getötet da lag, der vor sieben Jahren spurlos verschwunden war und von dem wohl mancher erzählt hatte, er sei in einen Werwolf verwandelt.
Nun war menschliche Hilfe für ihn zu spät, und auch die Bäuerin starb bald darauf an ihren Wunden.
Polen: K.W. Woycicki: Volkssagen und Märchen aus Polen
DER GEISTERZUG ...

Einem Knechte waren Frau und Kinder an der Pest gestorben. Da lief er aus der verödeten Hütte fort in den Wald. Den ganzen Tag irrte er umher. Am Abend machte er sich aus Ästen eine Bude, brannte daneben ein Feuer an und schlief ermüdet ein. Es war schon nach Mitternacht, als ihn ein starker Lärm aufweckte. Er sprang auf und horchte: da schallten ihm von weitem wunderliche Lieder entgegen, begleitet von Trommel- und Pfeifenklang. Er wunderte sich, daß die Freude hier so laut war, während rundherum der Tod herrschte.
Immer näher kam die Musik, und der erschrockene Mann mußte nun sehen, wie auf dem breiten Wege der Geisterzug daherkam. Es waren wunderliche Gespenster, die umkreisten einen Wagen. Der Wagen war schwarz und mächtig groß, und oben saß die Pestjungfrau. Mit jedem Schritte vergrößerte sich die Schar der Geister, denn alles, was in ihrer Nähe war, verwandelte sich in ein Gespenst.
Das Feuer bei der Holzbude glimmte nur noch schwach, ein Holzbrand rauchte noch ein wenig. Wie jetzt der Geisterzug vorüber kam, richtete sich der Holzbrand auf, streckte zwei Arme aus, und zwei Knorren glänzten wie zwei feurige Augen. Das neu entstandene Gespenst sprang zu den andern und begann ebenso wunderlich zu singen.
Der Bauer ist ganz verblüfft: in stummer Angst packt er sein Beil und schlägt auf das Gespenst los, das ihm am nächsten ist. Aber das Beil fliegt ihm aus der Hand, verwandelt sich in ein hohes Weibsbild mit rabenschwarzem Haar und saust singend an ihm vorüber. Der Geisterzug ging weiter, und der Knecht sah, wie Bäume und Sträucher, Eulen und Krähen, in ungeheure Gespenster verwandelt, den Geisterzug vergrößerten, den furchtbaren Verkünder eines schrecklichen Todes.
Halbtot vor Schreck sank der arme Knecht nieder. Als am folgenden Morgen der warme Strahl der Sonne ihn weckte, war das mitgebrachte Hausgerät zerbrochen, Speise und Trank verdorben, seine Kleidung zerrissen. Da dankte er Gott, daß er noch mit dem Leben davongekommen war, und ging weiter, sich Wohnung und Nahrung zu suchen.
Quelle: Kasimir Wladislaw Woycicki, Polnische Volkssagen und Märchen
DAS SCHNEIDERLEIN NADELFEIN ...
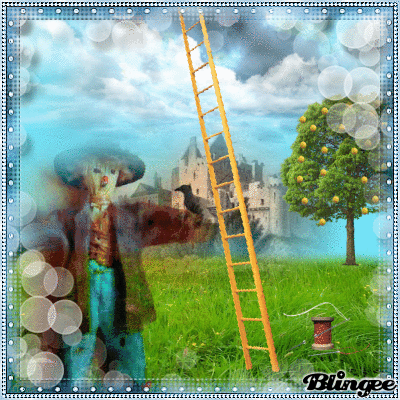
Es war einmal ein Schneider, den alle, weil er die hübschesten und zierlichsten Kleider weit und breit nähte, Schneiderlein Nadelfein nannten. Eines Nachts träumte der Schneider, daß er durch die Welt wanderte und ihn die Leute fragten, ob er ihr König werden will. Als der Schneider erwachte, lachte er über seinen Traum. Aber der Traum kam auch in den folgenden Nächten immer wieder. Da dachte das Schneiderlein, daß er in die weite Welt wandern und sein Glück suchen solle.
Er zog seinen besten Rock und seine beste Hose an, nahm hundert Nadeln, hundert Zwirnrollen, drei Scheren, Fingerhut und Bügeleisen und machte sich auf den Weg. Er wanderte und wanderte und kam zu einer Wiese. Dort bat er den Wind: "Wind, Wind, trage mich fort an einen fernen Ort."
Der Wind faßte den Schneider und trug ihn mit sich fort. Es war herrlich so zu fliegen. Als der Wind müde wurde, setzte er das Schneiderlein sanft an einem Feldrand ab.
"Wer ist da zu mir ins Gras gepurzelt?" knarrte eine Stimme hinter dem Schneider. Der Schneider sah sich um und entdeckte eine wunderliche Gestalt.
"Ich bin eine Vogelscheuche und bewache die Felder und Wälder. Und wer bist du?"
"Ich bin Schneiderlein Nadelfein. Der Wind hat mich hergeweht. Ich bin auf dem Weg nach Irgendwo, um dort König zu werden."
"Laß mich mit dir ziehen, hier ist es so einsam", bat die Vogelscheuche. Der Schneider dachte, ja zu zweit ist es lustiger und willigte ein.
"Kannst du mir nicht meine Jacke, Hose und Hut flicken? Wenn du König wirst, will ich auch schick aussehen."
"Gern", antwortete Nadelfein. Er flickte sorgfältig alle Löcher, reparierte auch die Hutfeder und dann wanderten sie los.
Endlich kamen sie in ein Land, das aussah, wie das, von dem der Schneider geträumt hatte. Mitten in dem Land war auch eine Stadt, die der in seinem Traum glich. Seltsamerweise aber regnete es über der Stadt, während ringsherum die Sonne schien. Und es regnete nicht nur, es goß wie aus Eimern.
"Ach Nadelfein, ich mag nicht in die Stadt gehen, dort werden meine schönen Kleider naß", sagte die Vogelscheuche.
"Und ich will lieber überhaupt nicht König sein, als König in einer so nassen Stadt.", entgegnete Nadelfein. Sie wollten weiterwandern, aber da kamen die Bewohner der Stadt schon durch das Tor gelaufen und riefen: "Rettet uns. Rettet uns bevor wir im Regen umkommen!"
"Warum regnet es bei euch, während ringsherum die Sonne scheint?", fragte Nadelfein.
"Das wissen wir nicht. Unser guter König starb und seine Tochter weinte drei Wochen lang. In der vierten Woche lachte sie wieder und da haben wir vor Freude alle Kanonen abgeschossen. Seitdem regnet es ununterbrochen"; antworteten die Leute. Sie führten die Gäste in die Stadt. Überall quoll das Wasser hervor. Die Bewohner hatten alle Schnupfen. Ihre Nasen trieften. Es gab längst nicht mehr genug Taschentücher. Die Kinder mußten in den Häusern bleiben, damit das Wasser sie nicht weg trug. Die Vogelscheuche wollte schnell weg.
Doch Nadelfein überlegte laut: "Ihr habt bestimmt mit den Kanonen ein Loch in den Himmel geschossen. Ich weiß, was man da tun muß!" Er bat die Leute, alle Leitern, die sie finden können, zu bringen. Dann stellten sie die Leitern auf. Eine über die andere. Nadelfein nahm seine hundert Nadeln, den Zwirn, die Scheren, den Fingerhut und das Bügeleisen und kletterte hoch und immer höher, bis hinauf zum Himmel. Er fädelte eine Nadel ein und begann zu nähen.
Er verbrauchte hundert Nadeln und die hundert Zwirnrollen und als die letzte aufgebraucht war, war der Himmel kunstvoll geflickt. Er nahm das Bügeleisen und glättete den Himmel, dann stieg er hinab. Das Wasser fing an zu versickern, die Kinder begannen in den Pfützen zu spielen und lachten.
Die Prinzessin kam und fragte: "Schneiderlein Nadelfein, willst du mein Gemahl sein?" Sie küßte ihn und Nadelfein wurde König. Die Vogelscheuche aber blieb als bester Freund bei ihm und wachte über die Spatzen im Land.
DIE HOCHZEIT DER WICHTELMÄNNCHEN ...

Auf einem Gut lebte einst ein Herr. Zu ihm kam eines Abends ein Erdmännchen, das aus dem Kamin gekrochen war, und fragte diesen Herrn, ob die Erdmännchen bei ihm ein Fest veranstalten dürften. Der Herr gestattete es ihnen, und so kamen viele Wichtelmänner auf kleinen Pferden angeritten; alle waren sie bunt gekleidet, mit roten Hosen und grünen Wämsern. Unter ihnen waren Männer, Frauen und ein junges Paar. Sie tanzten und vergnügten sich, doch als sie genug getanzt hatten, verneigten sie sich alle vor dem Herrn und verschwanden im Kamin. Als Geschenk hatten sie dem Herrn eine Perle hinterlassen.
Als sie sich ein zweites Mal dort vergnügen wollten, machte die Hausherrin ein Loch in die Wand und sah ihnen zu. Sobald die Wichtelmänner dies merkten, verschwanden sie auf Nimmerwiedersehen.
Quelle: Kowerska "Wisla"

DIE FROSCHPRINZESSIN ...

Ein Wirt hatte drei Söhne, zwei kluge und einen dummen; die klugen Söhne wurden gut gekleidet und gut behandelt, der dumme, welcher Hans hieß, mußte nur immer das Vieh hüten.
Als nun die Söhne erwachsen waren, sagten die beiden klugen zu den Eltern: »Liebe Eltern, ihr müßt uns in die Welt schicken, denn wir lernen hier zu Hause doch nichts und möchten doch gerne etwas rechtes werden.« Der eine wollte die Müllerei und der andere das Fleischerhandwerk lernen. »Ja ja,« sagten die Eltern, »das sollt ihr, lieben Söhne,« und fingen auch gleich mit der Ausrüstung an.
Als der Dumme davon hörte, sagte er: »Wie ihr in die Welt geht, so gehe ich auch, ich will auch was lernen.« Das wurde aber von den Anderen gar nicht beachtet, auch wurde zu seiner Ausstattung nichts besorgt. So sammelte er sich denn selbst alle Brodüberreste, die er nicht aufaß, in einen Sack, und als die beiden Brüder ihre Wanderschaft antraten, ging er mit.
Im nächsten Walde kamen sie an einen Kreuzweg, die klugen Brüder gingen nach der einen Seite, der Dumme nach der anderen. Nun ging er denn in denWald und ging immer weiter, ohne hinaus zu kommen, sein Vorrat an Brod ging ihm aus, daß er sich Beeren lesen mußte, aber das reichte nicht hin, seinen Hunger zu stillen, und er fing schon an, vor Hunger und Beschwerden zu weinen, da sieht er in der Ferne ein Lichtchen schimmern, nimmt noch die letzte Kraft zusammen und erreicht das Hüttchen, aus dem der Lichtschein kam.
Er geht hinein und sagt seinen Gruß, so wie er es von anderen Leuten gehört hat. Es war aber Niemand darin als ein Frosch, der ihm denn auf seinen Gruß dankte und ihn fragte, was er haben wollte. »Ach,« sagt er, »meine Brüder sind in die Welt gegangen, etwas zu lernen und ihr Glück zu machen, sie hofften auch, reiche Bräute zu gewinnen, und versprachen, der Mutter von denselben schöne Geschenke mitzubringen; da bin ich denn auch gegangen und wollte sehen, ob es mir nicht auch so gelingen möchte.«
»Wenn du willst,« sagt der Frosch, »so kannst du auch bei mir dienen du sollst ein gutes Leben und leichte Arbeit haben; ich verlange von dir nichts weiter, als daß du mich nur immer auf einem weißen Atlaskissen herumträgst.« Das gefiel dem Dummen und er dachte: »Warum sollt ich nicht bleiben?«
So blieb er denn und trug den Frosch immer ganz sanft auf dem Kissen herum und hatte immer gutes Essen und Trinken. Als er nun zwei Jahre dort gewesen war, wurde er still und traurig, und der Frosch fragte ihn: »Dummes Hänschen, was fehlt dir?« »Ja,« sagte er, »nun kommen meine Brüder wahrscheinlich aus der Welt zurück und bringen der Mutter von ihren Bräuten schöne Geschenke mit, und ich habe keine Braut, und habe gar nichts, kann auch gar nicht nach Hause.«
»Dafür kann ja Rat geschafft werden,« sagte der Frosch, »gehe nur heute noch ruhig schlafen, morgen wird sich alles finden.« Das tut denn Hänschen auch, und am Morgen gibt ihm der Frosch eine Rute und sagt: »Geh' nur an den Pferdestall und schlage mit der Rute dreimal auf die Tür, da wird dann ein schönes Pferd herausstürzen, auf das du steigen und nach Hause reiten kannst. Aber an deines Vaters Grenze mußt du absteigen und zu Fuß gehen.« Auch gab ihm der Frosch ein Packetchen mit, das sollte das Geschenk von seiner Braut sein.
Der dumme Hans nahm die Rute, klopfte drei Mal auf die Tür des Pferdestalles, und ein sehr schönes Pferd kam heraus und blieb vor ihm stehen. Er bestieg es sogleich, ritt nach Hause, vergaß auch nicht, an der Grenze des Vaters abzusteigen. Da sah er, daß auch seine Brüder gerade ankamen, fein gekleidet und mit stolzem Gang.
Die Eltern freuten sich sehr, daß ihre Söhne wieder da waren. Die klugen Söhne sind richtig, der eine Müllergeselle, der andere Fleischergeselle, haben auch schöne reiche Bräute und haben von denselben für die Mutter auch schöne Geschenke mitgebracht. »Nun, liebe Mutter,« sagte der Dumme, »nimm auch das Geschenk von meiner Braut.« Da lachten ihn die andern aus und sagten: »Du wirst da was Schönes mitgebracht haben! Du hast gewiß auch nichts gelernt, sondern nur irgendwo gehütet, denn du bist ja noch in denselben Kleidern, in denen du von hier fortgingst!«
Als aber die Mutter das Paket öffnete, fand sie darin ein sehr schönes Kleid, mit Gold gestickt und mit Diamantenknöpfen besetzt. Anstatt sich nun darüber zu freuen, wird sie und der Vater sehr böse auf ihn, und sie schelten ihn aus: »Das ist nicht möglich, daß du das Kleid auf ehrliche Weise erworben hast; gewiß hast du eine Prinzessin erschlagen und es ihr weggenommen.«
Nach ein Paar Wochen, als sie sich mit ihren Eltern befreut hatten, sagten die klugen Söhne: »Nun müssen wir wieder zurück zu unsern Meistern; übers Jahr kommen wir wieder und bringen auch unsere Bräute mit. Sie reisten dann ab, und der Dumme ging auch zu seinem Frosch. An der Grenze stand schon das Pferd und erwartete ihn und er bestieg dasselbe und war sehr bald an Ort und Stelle.
Der Frosch fragte ihn, wie es ihm gegangen sei, und er erzählte alles, auch daß die Brüder übers Jahr mit ihren Bräuten nach Hause kommen wollten, »und ich«, sagte er, »mit wem soll ich nach Hause fahren? Ich habe ja Niemand als dich, und du bist ein Frosch!« »Na sei nur ruhig«, antwortete der Frosch, »das wird sich alles finden.« Nach einem Jahre sagte der Frosch: »Nun kannst du auch mit deiner Braut nach Hause fahren.« »Ja, wo ist sie?« fragte der Dumme. »Geh' nur wieder mit dieser Rute nach dem Pferdestalle und klopfe dreimal auf die Thür, da wird ein Wagen herauskommen, in den steige ein, dann wird auch die Braut zu dir kommen.«
Er gehorcht dem Befehle, und es kommt eine sehr schöne Kutsche, mit vier Pferden bespannt vorgefahren. Wie er eingestiegen ist, sieht er auch ein sehr schönes Fräulein neben sich sitzen, und das war seine Braut. Er ist nun sehr vergnügt, und sie sagt ihm, daß sie Niemand anders wäre, als der Frosch. »Du mußt aber,« sagte sie, »wenn wir an deines Vaters Grenze kommen, absteigen und zu Fuß nach Hause gehen und so tun, als wenn du von mir nichts weißt, und wenn ihr mich dann ankommen seht, dann komm heraus und schlage mir die Fenster im Wagen ein; und nachher, wenn ich in deiner Eltern Hause bin und mich zum Essen hinsetze, so laß du mich nichts in den Mund bringen, sondern schlage mir immer in den Löffel.«
Das geschah denn auch alles. Die Brüder waren gerade mit ihren Bräuten angekommen, da sahen sie den schönen Wagen vorfahren. »Wer wird das wohl sein?« fragten sie, »gewiß ein reicher Herr.« Da lief der Dumme an den Wagen und schlug mit einem Stocke alle Fensterscheiben ein. Die schöne Prinzessin steigt aus und fragt, ob sie hier wohl bleiben könne. »Wir sind ja aber so arm, Prinzessin, wie können wir Sie anständig aufnehmen?« »Es wird für mich alles gut sein«, antwortet sie, »was ihr esset, das wird auch mir schmecken.«
So wurde denn gleich Mittag besorgt, und Alle setzten sich um den Tisch; und der Dumme wurde nicht heran gerufen; der saß auf seinem gewöhnlichen Plätzchen hinter dem Ofen. Aber die Prinzessin litt das nicht, sondern verlangte, daß er auch an den Tisch kommen und mitessen sollte. »Ach«, sagte der Vater, das ist ja so ein dummer Tölpel, lassen Sie den doch dort hinter dem Ofen sitzen, er hat Ihnen ohnehin schon Schaden getan.«
Aber sie ließ nicht nach, sondern sagte: »Das schadet nichts, komm nur her, dummes Hänschen.« Er kam auch und setzte sich neben die Prinzessin welche ein weißes Atlaskleid anhatte und so wie sie einen Löffel voll Blaubeerensuppe an den Mund bringen wollte, so stieß er sie an den Arm, daß die Blaubeeren auf Kleid und Tischtuch verschüttet wurden. Die Eltern schalten ihn und entschuldigten ihn bei der Prinzessin, aber es half alles nicht, die Prinzessin konnte nichts essen.
Da ging sie denn in das Oberzimmer und nahm den Dummen auch mit. Dort sprach sie nur ein Paar Worte, so waren Diener da, welche den Dummen wuschen und reinigten, und ihm königliche Kleider, mit Orden geschmückt, anzogen; auch stand eine gedeckte Tafel mit schönen Speisen da, und Beide setzten sich daran und aßen.
Inzwischen sagte einer von den klugen Söhnen, ich will doch gehen und sehen, was die da oben machen, und als er herunterkam, erzählte er, was er gesehen hatte, die Prinzessin sitze da mit einem schönen Könige an einer Tafel, der Dumme aber sei nicht da. »Na«, sagte der Vater, »dich hielt ich doch für klug, aber du bist ebenso dumm als der Hans. Wie kann das sein? Dann hätten wir doch auch etwas von der Ankunft des Königs und der Zurichtung der Tafel sehen müssen.«
Indem kommt der König mit der Prinzessin herunter, und sie stellt ihn als den dummen Hans vor und sagte: »Ihr haltet ihn alle für dumm, aber er ist ebenso klug, wie ihr alle, und hat das meiste Glück.« Nun fuhren denn die Söhne mit ihren Bräuten wieder weg, und der dumme Hans auch mit seiner schönen Braut. Als sie in dem Waldhäuschen angelangt sind, und er einen Augenblick sich entfernt hat, da ist die schöne Prinzessin wieder verschwunden, und an ihrer Stelle ist wieder der Frosch da.
Wie er um sie weint und klagt, sagt der Frosch: »Dummes Hänschen, denkst du denn so ganz ohne Sorgen zu einer Frau zu kommen? Du mußt noch einige Proben bestehen, dann bekommst du deine schöne Prinzessin auf immer. Ich werde dir jetzt für drei Tage verschwinden, und über dich werden Versuchungen kommen, daß du sprechen sollst, sprich aber kein Wort, sonst kommen wir beide um.
In der ersten Nacht wird eine Musik ertönen und schöne Fräuleins werden zu dir kommen und mit dir tanzen und sich unterhalten wollen, aber sprich du kein Wort. Die zweite Nacht werden Grafen und Prinzen kommen und dich zum Könige machen wollen, aber sei klug und achte nicht darauf. In der dritten Nacht werden Henker kommen und dich töten wollen, sie werden dir auch schon die Füße abhauen, auch eine Hand, und immer sagen, wenn du ein Wort sprichst, so solle alles wieder gut sein, aber halte dich standhaft und sprich kein einziges Wort, sonst sind wir verloren.«
Den andern Tag war der Frosch richtig verschwunden. Die Nacht darauf kamen die Damen und wollten mit ihm tanzen und sprechen, er aber hielt aus, sagte kein Wort, und als die Uhr zwölf schlug, war alles vorbei und die Gefahr vorüber, und er bemerkte den anderen Tag einen hellen Streifen durch das ganze Haus. Die zweite Nacht kamen die Grafen und Prinzen und wollten ihn zum König machen, aber er hielt aus und sprach kein Wort. Den Tag darauf war der helle Streifen schon viel größer. Die dritte Nacht erging es ebenso. Die Henker kamen und wollten ihn köpfen, dafür, daß er die Nacht zuvor sich geweigert hatte, König zu werden, hieben ihm auch schon beide Füße und eine Hand ab, aber er hielt bis Mitternacht aus, wo Alles verschwand.
Da schlief er ruhig ein und schlief bis an den Morgen. Wie er erwacht, sieht er Menschen so geschäftig und auf den Zehen hin und herlaufen; er denkt erst, es seien noch die Henker, die ihm jetzt den Kopf abhauen wollen, aber er fühlt, daß er die Hand noch hat, auch einen, auch den anderen Fuß und richtet sich im Bette auf. Da kommt sogleich ein Diener und zieht ihm prächtige Kleider an; der Kaffee dampft schon auf dem Tische; er sieht zum Fenster hinaus, da sieht er, ist aus dem Walde ein schönes Land mit vielen Städten und Dörfern geworden, und das Hüttchen ist in ein prächtiges Schloß verwandelt.
Da kommt denn auch die Prinzessin in ihrer vorigen Gestalt herein und sagt: »Na, Hänschen, nun hast du mich erlöst, und nun bin ich dafür deine Frau, und dir gehört das ganze Königreich.« Von der Zeit an lebten sie sehr glücklich bis an ihr Ende.
Aus Klein-Jerutten
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren
VON EINEM GRAFEN, DER DIE NOT NICHT KANNTE ...
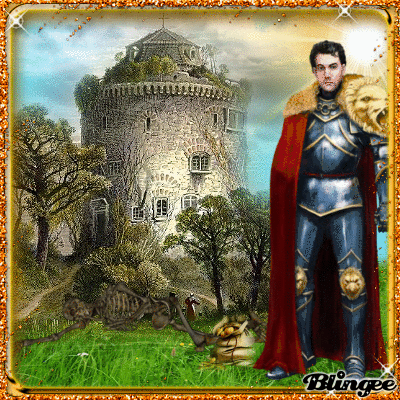
Es lebte einmal ein Graf; der wußte nicht, was Not ist. Wenn ein Armer zu ihm kam oder ein Wanderer, so fragte er ihn, was es in der Welt zu hören gibt. Jeder antwortete ihm, man höre von nichts anderem als nur von großer Not.
Eines Tages spricht der Graf zu seinen Dienern: "Ich muß einmal in die Welt hinausgehen und sehen, wie eigentlich die Not aussieht." - Wie gesagt, so getan. Er nahm sich einen Beutel mit Geld und ein Pferd mit und ritt in die Welt hinaus. Weit fuhr er in ein fremdes Land. Kaum betrat, er das erste Städtchen, so sah er einen Toten vor der Kirche in der Sonne liegen. Der Graf fragte die Leute, was das zu bedeuten habe, daß der Tote so da liegt und sich in der Sonne brät. Man antwortete ihm, es sei hier so Brauch. Wenn jemand stirbt und Schulden hinterläßt, so muß er solange in der Sonne liegen, bis sich seiner jemand erbarmt und ihm die Schulden bezahlt.
Da spricht der Graf zu den Leuten: "Saget mir wieviel er schuldig ist, ich -will für ihn bezahlen." Sie sagten ihm die Summe, die so groß war, daß er sie nur mit Mühe mit dem mitgenommenen Gelde bezahlen konnte. Der Tote wurde begraben, und der Graf ritt weiter.
Er gelangte in eine zweite Stadt. Der Hunger quälte ihn. Was sollte er tun? Es gab keinen anderen Rat, als das Pferd zu verkaufen. - Dann ging er weiter, immer weiter, solange, bis er alles Geld wieder ausgegeben hatte. Hungrig war er, konnte aber niemanden um etwas bitten. Da kam er in einen Wald. Hier strömt ihm der Duft von Äpfeln entgegen. Der Graf geht weiter und sucht. Bald erblickt er einen runden, ebenen Platz; in der Mitte steht ein Apfelbaum, und auf dem Apfelbaum hängen wunderschöne Äpfel.
Der Graf wollte sich einige abpflücken, - da spricht plötzlich etwas zu ihm: "Rühr sie nicht an, denn du hast sie nicht gepflanzt l" - Der Graf erschrickt, fängt an zu beten, steht dann auf und will wieder die Hand nach den Äpfeln ausstrecken. Von neuem vernimmt er die Worte: "Rühr sie nicht an, denn du hast sie nicht gepflanzt l" - Der Graf wollte nun weitergehen; doch sein Hunger war riesengroß und er dachte bei sich: "Ich will's noch einmal probieren!" Er kniete nieder, betete lange, erhob sich dann und griff wieder nach den Äpfeln. Jetzt hörte er keine Stimme mehr.
Er pflückte sich so viel Äpfel ab wie er wollte, aß sich satt und ging dann weiter. Hinter dem Walde begegnet er einem alten Manne, der auf dem Wege kniet. Der Alte spricht zum Grafen: "Was tust du hier, was suchst du, Graf?" Der Graf antwortet: "Ich wußte nicht, was Not ist und bin deshalb in die Welt gegangen, um sie zu suchen; und wirklich hab ich sie gefunden ! O, wahr ist es, die Not ist furchtbar! Ich weiß mir keinen Rat mit ihr!" Darauf sagt der Alte: "Ich könnte dir einen guten Rat geben, doch weiß ich nicht, ob du mit ihm einverstanden sein wirst." - "In alles willige ich ein, denn in meine Heimat kann ich doch nicht zurückkehren, und die Not setzt mir schon fürchterlich zu." -
Da sagt zu ihm der Alte: "In dieser Stadt wohnt ein König; der hat drei verzauberte Töchter. Er würde, ich weiß nicht was dafür geben, wenn sich ein kühner Mensch fände, der seine Töchter befreien könnte. Alle drei verlassen um Mitternacht den Palast, nehmen eine Menge Schuhe mit und kehren erst mit der Morgenröte zurück. Könnte sie jemand behüten und beobachten, was sie in der Nacht tun, dann würde er ihr Erlöser sein. Gehe zu dem König, einige dich mit ihm und komm dann zu mir; ich will dir raten, was du tun sollst." -
Der Graf begab sich zum König und erklärte ihm, er sei bereit, seine Töchter zu behüten und zu beobachten. Der König sprach darauf: "Gut! wenn du sie erhütest, dann sollst du die jenige Königstochter erhalten, die dir am meisten gefällt, und mit ihr die Hälfte des Königreiches; kannst du es aber nicht, dann verlierst du den Kopf. Jetzt geh und richte dich für die Nacht." Der Graf ging zu dem alten Manne. Dieser belehrte ihn, was er tun soll. Er gab dem Grafen auch Schuhe und einen Mantel mit und sagte ihm, es würde ihm das in der Nacht von Nutzen sein.
Am Abend führte man den Grafen in die Gemächer der Königstöchter und ließ ihn dort allein. Er legte sich auf ein Bett nieder und begann bald an zu schnarchen. Die Königstöchter erschienen vor ihm mit guten Speisen und mit Wein, begannen ihn zu bewirten, dann forderten sie ihn zum Tanz auf und gaben sich alle mögliche Mühe, ihn zum Aufstehen zu verlocken. Doch er stellte sich so, als ob er ganz fest schliefe und drehte sich nicht einmal auf die andere Seite. Es wurde 11 Uhr, die Königstöchter begannen sich vorzubereiten. Der Graf schielte ein wenig durch die Augenlider hindurch und hätte sich beinahe verraten.
Alle drei Königstöchter waren so schön wie Hirschkühe, die schönste von ihnen war aber die jüngste. Es schlägt zwölf. Die Königstöchter schleichen tup, tup an dem Bett vorüber, jede mit einem Bündel Schuhe auf dem Rücken. Sobald sie draußen waren, zog der Graf seine Schuhe an, mit denen man bei jedem Schritt eine Meile zurücklegt, warf sich den Mantel um, der ihn vor jedem Menschen unsichtbar machte, und setzte ihnen nach. Die Königstöchter fahren so schnell, was nur die Pferde laufen können und der Graf folgt ihnen Schritt für Schritt. Fahren sie schneller, so schreitet auch er schneller aus.
Sie gelangten zu einem gläsernen Palast. Aus den Fenstern strahlt Licht, Musik spielt, Rufe und Gesänge erschallen. Eigentümlich zugestutzte Kavaliere führen die Königstöchter am Arm in den Palast hinauf. Der Graf folgt ihnen Schritt für Schritt nach. Er blickt sich in dem Saale um und sieht an Stelle von Lampen ringsherum Totenköpfe stehen mit funkelnden Augen. Der Fußboden ist ganz mit scharfen Rasiermessern gepflastert. Der Graf erschrickt zuerst furchtbar, beruhigt sich aber und wartet ab, was weiter geschieht.
Da fangen die Königstöchter auf den Rasiermessern zu tanzen und mit den Füßen zu stampfen an, so daß es einem in den Augen schwirrte. Jedesmal, wenn sie um den Saal herumgetanzt hatten, zogen sie ihre Schuhe aus und warfen sie zum Fenster hinaus. Dem Grafen gelang es, unsichtbar gemacht durch den Mantel, wieder hinauszukommen, denn er hatte von dem Anblicke genug. Draußen hob er sich ein Paar von den Schuhen der Königstöchter auf und ging in den Garten. Dort hingen an jedem Baume goldene Äpfel, Birnen und Pflaumen.
Der Graf pflückte sich von jeder Sorte eine Frucht ab. Als das Vergnügen in dem Palaste sich seinem Ende näherte, kehrte er schnell in das Königsschloß zurück und legte sich wieder in sein Bett. Die Königstöchter erscheinen auch bald und sehen ihn auf dem Bette liegen. Sie beginnen ihn auszulachen und freuen sich, daß sie ihn angeführt haben. Der Graf jedoch lachte sie im stillen noch mehr aus.
In der Frühe ließ der König den Grafen zu sich führen und fragte ihn, ob er die Töchter erhütet hätte. - "Ja, ich habe sie erhütet !" - "Nun, dann gib mir irgend welche Zeichen!" - Der Graf zog einen goldenen Apfel, eine goldene Birne und Pflaume und ein Paar zerschnittene Schuhe hervor. Die Königstöchter erbleichten und die erste von ihnen sagt: "Ich will bis zu den Knien zu Stein werden, wenn das wahr ist." Und sie wurde bis zu den Knien zu Stein. - Darauf sagt die zweite: "Ich will bis zum Gürtel zu Stein werden, wenn das wahr ist!" Und sie wurde bis zum Gürtel zu Stein. - Die dritte sagt: "Ich will ganz zu Stein werden, wenn das wahr ist !" Und sie wurde ganz zu Stein. - Man brauchte drei Särge und legte die Königstöchter hinein. Der König spricht darauf zum Grafen: "Da du sie zu ihren Lebzeiten bewachen konntest, so mußt du sie auch jetzt nach dem Tode drei Tage lang in der Kirche bewachen. Gelingt es dir, so erhältst du die Hälfte meines Königreiches, gelingt es dir aber nicht, so ist dein Kopf verloren."
Kummervoll begab sich der Graf zu dem Alten und erzählte ihm alles. Der Alte sagt zu ihm: "Fürchte nichts! Laß um den Sarg der ältesten Königstochter zwei Reifen schmieden, die ungefähr zwei Zoll stark sind. Gegen Abend geh dann auf das Kirchenchor, laß dich dort zuschließen und nimm dir einen Stock mit." - Der Graf ging in die Kirche und tat wie ihm der Alte befohlen. Gegen Abend stieg er aufs Chor und ließ sich zuschließen. Es schlägt 11 Uhr, die Reifen platzen, der Sargdeckel springt auf, es erhebt sich die älteste Königstochter und sucht jemanden in der Kirche. Nach langem Suchen schaut sie zum Chor empor und ruft: "Aha! dort bist du, mein Vögelchen!" Sie ergreift eine Bank nach der anderen, schichtet sie übereinander und erreicht das Chor. Als sie schon fast oben war, stößt der Graf mit dem Stocke die Bänke um und sie fällt hinunter. In demselben Augenblick schlägt es zwölf. Die Königstochter muß in ihren Sarg zurück.
Am folgenden Morgen begab sich der Graf wiederum zu dem Alten, um ihn zu fragen, Was er weiter tun soll. Der Alte spricht zu ihm: "Laß um den Sarg der mittleren Königstochter drei Reifen schmieden und versteck dich in der Sakristei. Dort ist eine Vertiefung, die mit Knochen gefüllt ist. Laß die Knochen herausnehmen, krieche dann in die Vertiefung mit dem Kopf nach unten und laß dich mit den Knochen zudecken."
Der Graf tat, wie ihm der Alte befohlen. Er kroch in die Vertiefung hinein und wurde mit den Knochen zugedeckt. Es schlägt elf, die Reifen platzen, der Sargdeckel springt auf, die mittlere Königstochter erhebt sich, sucht ihn. in der ganzen Kirche, kann ihn aber nirgends finden. Dann kommt sie in die Sakristei, beginnt die Knochen auseinander zu werfen und findet seine Füße. Sie will ihn herausziehen, beißt ihn aber nur in die Ferse, denn sie hat keine Zeit mehr. Die Uhr schlägt zwölf, sie muß in ihren Sarg zurück.
Am folgenden Morgen ging der Graf wiederum zu dem Alten. Der sprach zu ihm: "Laß dir ein Sieb machen, das sofort zu brennen anfängt, wenn du es fort wirfst. Den Sarg der jüngsten Königstochter laß auf einen hohen Katafalk aufstellen, nimm das Sieb in die Hände, geh vor den Altar und bete. Sobald sie aufsteht, wird sie sich auf dich stürzen. Wirf dann schnell das Sieb gegen sie, und wenn es auf ihr verbrennt, so nimm sie bei der Hand und bete bis zum Morgen. Dann erhältst du die Königstochter und die Hälfte des Reiches." Der Graf Wußte nicht, auf welche Weise er sich dem guten Alten für die Hilfe dankbar erzeigen könnte. Doch der Alte sagte zu ihm: "Du hast für mich die Schuld bezahlt, als ich mich in der Sonne briet, ich mußte es dir vergelten. Jetzt sind wir quitt." Mit diesen Worten verschwand er.
Der Graf verwunderte sich sehr darüber, ging dann in die Kirche, nahm sich das Sieb und wartete kniend vor dem Altar. Es schlägt elf, der Sarg knarrt, der Deckel springt auf, die jüngste Königstochter erhebt sich und stürzt sich auf den Grafen. Er wirft das Sieb gegen sie, es verbrennt vollständig auf ihr, dann nimmt er sie bei der Hand und führt sie zum Altar. Früh morgens will der Organist die Kirche aufschließen; es gelingt ihm nicht. Da holt er den König. Dieser kommt, macht die Tür zur Hälfte auf - siehe, da verlassen viele Menschen die Kirche, die, sobald sie draußen ankommen, verlöschen.
Zuletzt kommt der Graf mit der jüngsten Königstochter, gefolgt von den beiden älteren. Der König War darüber sehr erfreut und führte sie in den Palast. Dort veranstaltete er eine große Hochzeitsfeier, verheiratete den Grafen mit der jüngsten Tochter und schenkte ihm die Hälfte seines Reiches. Der Graf lebte glücklich mit der erlösten Königstochter und wurde nie mehr von der Not heimgesucht.
STACHELSÖHNCHEN ...
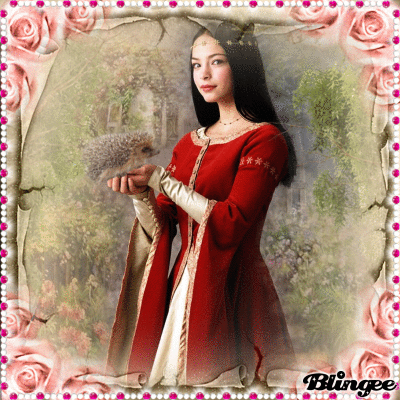
Es waren einmal ein Bauer und seine Frau. Zum ganz großen Glück fehlte beiden nur noch ein Kind. Jeden Morgen, wenn die Bäuerin erwachte, war ihr erster Gedanke: Ach hätte ich doch nur ein Kind. Jeden Abend schlief sie mit dem gleichen Wunsch wieder ein.
Als sie eines Tages im Gras vor ihrem Haus einen Igel sah, dachte sie: "Ach, hätte ich doch ein Kindchen und wäre es nur ein Igel." Nicht lange danach bekam die Bäuerin ein Kind, das so ganz anders aussah als alle andren Kinder. Es war über und über mit Stacheln versehen und hatte ein schwarzes Schnäuzchen. Nach einem Jahr konnte Stachelsöhnchen schon sprechen wie ein Erwachsener und half der Mutter im Haushalt, brachte dem Vater Essen aufs Feld. Am liebsten aber hütete er die Schweine im Wald, er legte sich unter einen Baum und hörte den Vögeln zu.
Einmal geschah es, daß sich ein König im Wald verirrte und dann auf Stachelsöhnchen und die Schweine traf. "Was suchst Du, König?", fragte der Igel. "Ich habe mich verlaufen", antwortete der König, "kannst du mir nicht den Weg aus dem Wald zeigen?" "Das kann ich. Du mußt mir aber eine deine Töchter zur Frau geben."
Der König sah den Igel an und dachte: "Der wird ohnehin nie in mein Schloß kommen." "Wenn das dein Wunsch ist", antwortete also der König, "will ich ihn dir gerne erfüllen." Kaum hatte Stachelsöhnchen den König aus dem Wald geführt, vergaß dieser sein Versprechen.
Wieder zu Hause bat Stachelsöhnchen am nächsten Morgen seinen Vater, ihm den Hahn zu satteln, damit er in die Welt ziehen und sein Glück suchen kann. Stachelsöhnchen ritt schnurstracks zum Schloß des Königs. Dieser speiste gerade mit seinen sieben Töchtern und war sehr erschrocken als er den Igel sah. Stachelsöhnchen stieg aus dem Sattel, verbeugte sich artig und sagte zum König: "Ich bin gekommen, mir das zu holen, was du mir versprochen hast!"
Der König gestand die Wahrheit ein und seine Töchter fingen an zu lachen und den Igel zu verspotten. Nur die siebente Tochter schaute den Igel nachdenklich an und meinte: "Vater, ein Versprechen ist ein Versprechen, auch wenn man es nur einem Igel gegeben hat. Er hat dir dein Leben gerettet. Ich will ihn zum Manne nehmen."
Als die Königstochter den Igel nach dessen dritten Bitten endlich küßte, stand nicht mehr ein Igel, sondern ein schöner junger Mann vor ihr. Den Schwestern verging das Lachen, gab es doch weit und breit keinen so schönen Mann wie ihn.
Stachelsöhnchen und die Königstochter bekamen viele Kinder und besuchten jeden Tag die Bäuerin und den Bauern. Und niemand war glücklicher als die beiden.
HANS ...
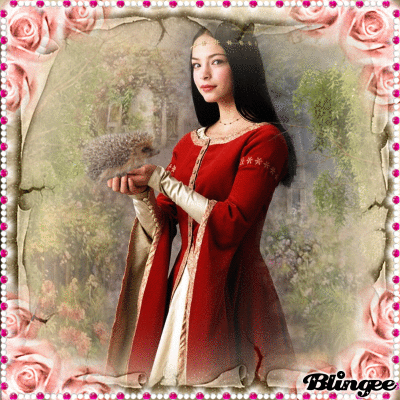
Hans war ein junger Knecht. Einmal fuhr er mit seinem Ochsengespann durch den Wald. Da sprach eine unsichtbare Stimme zu ihm:
"Hans, höre, wie Du glücklich und reich werden kannst! Suche die Weide auf der Wiese, die grüne Weide, die noch niemals das Krähen des Hahnes und das Gemurmel der Quelle gehört hat. Schneide einen Zweig von der Weide ab und mach Dir eine Pfeife daraus. Wenn Du auf der Pfeife spielst, müssen alle Leute, die es hören, die Beine rühren und tanzen, und die Toten kommen neu belebt aus dem Grabe heraus. Du mußt aber die richtige Weide finden, denn das Krähen des Hahnes vertreibt alle Geister und Gespenster, und wenn die Weide schon das Murmeln der Quelle gehört hat, zwingt sie die Füße nicht mehr zum Tanzen.
Und willst Du, daß Dich jedes Mädchen liebe, so nimm in der Mitternacht das Gerippe einer Fledermaus; Du findest drin eine Gabel und ein Häkchen. Mit dem Häkchen zieh das Mädchen an Dich, und sie wird Deine Geliebte. Zieh einen Burschen mit dem Häkchen an Dich, und er wird Dein Freund. Bist Du dann des Mädchens überdrüssig, so stoße sie mit der Gabel ab, und sie wird Dich nicht mehr ansehen. Und ist der Bursche Deiner Freundschaft nicht wert, so stoß ihn mit der Gabel ab, und sicherlich kehrt er nie mehr zu Dir zurück. Die Pfeife also umgibt Dich mit Lust und Tanz, das Gerippe der Fledermaus umgibt Dich mit Freundschaft und mit Liebe.
Willst Du gern die Zukunft wissen? Möchtest Du reich werden? So höre meinen letzten Rat:
Am Johannis-Abend, grad um Mitternacht, blüht das Farnkraut im Walde auf. Aber es ist schwer, die Blume zu bekommen: Du wirst von Angst und Schrecken befallen, eisige Schauer gehen Dir durch die Glieder, furchtbare Donner erschüttern die Erde. Die Haare werden Dir zu Berge stehen, und selbst der grause Wind kann sie nicht niederlegen. Wenn Du aber fest bleibst und die Blume holst, so zeigt sie Dir die Zukunft wie in einem Spiegel und macht Dich steinreich."
So sprach die unsichtbare Stimme im Walde zu Hans. Hans ließ seinen Wagen mit den Ochsen stehen. Voll Hoffnung auf nahes Glück lief er durch Busch und Wald, und auf einer trockenen Wiese fand er die richtige Weide. Er hieb einen schönen Zweig ab, zog die Rinde herunter, und die Pfeife war fertig.
Er fing an zu blasen. Es war zwar keiner da, der es hören konnte. Er selbst aber wurde von Lustigkeit ergriffen, tanzte und sprang auf der Wiese umher, bis die Dämmerung hereinbrach. Doch da fiel ihm mit Schrecken ein, daß der Ton der Pfeife auch Tote lebendig machen könne. Angstschweiß trat auf seine Stirn; schnell versteckte er die Pfeife und machte sich auf den Weg zum Wagen.
Er kam auf einen schönen Hügel. Rund umher waren uralte Gräber, aber ein Stückchen weiter, an dem Kreuzwege, war ein neueres Grab mit einem Holzkreuze. "Ha," sprach Hans bei sich selber, "das wollen wir lieber gleich versuchen; es ist noch ein gutes Stück Weg nach dem Kirchhof; will doch wenigstens einen sehen, der auf den Ton der Pfeife seine Bretter heben kann."
Er fing an, auf der Pfeife zu blasen, - da stürzte das Kreuz um, das Grab machte sich auf, und ein alter Bettler kam hervor, der vor dreißig Jahren hier totgeschlagen worden war. Furchtsam wandte sich der Bursche ab, weil er das elende Gesicht des Gespenstes nicht ansehen konnte. Aber noch immer spielte er weiter, und da öffneten sich nach und nach auch die anderen Gräber, und er hörte Waffengeklirr und Pferdegetrappel.
Wie er hinsieht, - o Schrecken! Bewaffnete Ritter zu Fuß und zu Pferde eilen durcheinander. Hatte er schon vor dem Alten Furcht gehabt, so war's nun noch ärger, als die gerüsteten Riesen vor seinen Augen umherzogen. Er, der doch der größte Mann des Dorfes war, reichte ihnen kaum an die Knie. Er hörte auf zu pfeifen, denn vor Angst konnte er den Mund nicht mehr zumachen. Alsbald kehrten die Geister in ihre Gräber zurück, und nur noch der kalte Wind bewegte die Grashalme auf dem Hügel. -
Um Mitternacht suchte Hans die Gabel und das Häkchen aus dem Fledermausgerippe heraus, denn ihn gelüstete nach Liebe und Freundschaft. Schon lange hatte er der schwarzäugigen Marie, der Tochter des Nachbarn, sein Herz zugewandt, aber die Kleine achtete nicht auf sein Liebesfeuer. Vergeblich sang er Tag und Nacht:
Mein Mariechen hat
Äuglein wie zwei Blitze,
Mündchen frisch wie Sahne,
Hallari heida!
Mariechen lachte bloß über Hans und seinen Gesang.
Sie breitete gerade Flachs aus im Garten, da kam Hans hinzu und zog sie mit dem kleinen Knochenhäkchen an sich. Gleich blickte ihn die Schöne freundlicher an, und Hans war glücklich. Es fehlte ihm jetzt noch ein Freund, und da ihm der junge Ziemba immer schon gefallen hatte, war er bald mit ihm vertraut. Mariechen kannte ihn auch recht gut, und wenn die beiden Freunde gemeinsam zu ihr kamen, grüßte sie immer mit freundlichem Lächeln.
Hans überlegte schon, wann er Hochzeit machen könnte, und setzte sich einmal nachdenklich neben einen Heuschober. Da hörte er auf der andern Seite ein Geräusch. Voll Neugier horcht er, - und was hört er? Daß Ziemba und Mariechen von ihrer Verlobung reden. Ganz ärgerlich zerbrach er sein Häkchen, und er wollte nichts mehr von Freundschaft und Liebe wissen.
"Was nützt mir die Pfeife, was nützt mir das Häkchen," rief er weinend aus. "Die Pfeife hat mich ermüdet, denn ich mußte wider Willen tanzen, und dann hat sie mir große Furcht eingejagt. Mit dem Häkchen hab ich Mariechen umsonst herangezogen, denn alles ist zum Teufel gegangen. Besser wird es sein, nach Geld zu gehen und dann zu hören, was aus mir werden wird."
Nicht lange darauf war der Johannis-Abend. Hans ging fort und kam die ganze Nacht nicht nach Hause, und seine Mutter war schon außer sich vor Angst. Es war nicht mehr weit von Mittag, als Hans zitternd, bleich und mit Schweiß bedeckt nach Hause zurückkehrte. Seine Mutter setzte ihm sorgsam eine Schüssel mit Klößen und Speck vor, aber Hans wollte nicht essen. Die Mutter betete, und Hans seufzte. Manchmal nur kam ein Lächeln auf seinen Mund, denn er klimperte mit dem Golde in der Tasche.
Als Mariechen Hochzeit hatte, war Hans der erste Brautführer. Er hatte den schönsten Anzug und gab den Musikanten das meiste Geld. Nun hatte er im Gasthause immer den Vorrang, weil er das ganze Dorf freihielt. An Sonn- und Feiertagen zahlte er den Musikanten wie ein vornehmer Herr. Manchmal blies er auch selbst auf seiner Zauberpfeife, und dann mußte alles, was da lebte, fröhlich tanzen vom Abend bis zum Morgen.
Aber unser Hans war damit noch nicht zufrieden; er wollte auch seine Zukunft wissen. Zog also die Farnkraut-Blüte hervor und fragte: "Was wird denn aus mir werden?" Und eine unterirdische Stimme antwortete: "Du wirst hängen, und der Wind wird Deine Beine hin und her bewegen!" "Pfui Teufel," rief Hans zornig aus, "wofür sollt' ich wohl hängen?" Dann fing er an zu lachen, aber er konnte abends doch nicht einschlafen, obwohl er absichtlich paar Gläschen über den Durst getrunken hatte.
Im Grunde hatte er schon zu lange wie ein großer Herr gelebt, ehe es ihm eingefallen war, an seine Zukunft zu denken. Seine Taschen waren leer, und eine Farnkrautblüte zu finden gelingt, wie jeder weiß, nur ein einziges Mal. Das machte ihn denn sehr unruhig. Die Osterfeiertage kamen heran. Das ganze Dorf bat Hans, er möchte wieder die Musikanten kommen lassen. Aber Hans hatte keinen Groschen. Das machte ihm Kummer, und er wälzte sich schlaflos auf seinem Lager. Da fällt ihm ein: die Farnkraut-Blüte könnte mir wohl einen Platz zeigen, wo Geld vergraben ist. Sofort befragt er die Blüte, und richtig, - im Garten des Edelmanns, unter einem Apfelbaum, erblickt er einen großen Geldkasten, mit Messing beschlagen.
Hans springt eiligst vom Lager auf, läuft in den Garten und fängt an zu graben. Schon liegt der schwere Kasten oben auf der Erde, und gerade will Hans ihn über den Zaun werfen, - da erwacht der Edelmann, der ein Klappern gehört hat, eilt hinaus und hält den Räuber fest. Doch dieser, nach dem schönen Golde begierig, nimmt die Schaufel und schlägt den Edelmann tot.
Auf all den Lärm kommen Leute herbei, fangen den Mörder und bringen ihn zum Richter. Ein halbes Jahr darauf hing der arme Hans auf dem Marktplatze des nahen Städtchens. Das war die Strafe für seine Habsucht und für seine Neugier, die Zukunft kennen zu lernen.
Heftig wehte der Wind, und nun waren es nicht mehr die Töne der Zauberpfeife, die die kalten und starren Beine des Hans zu lustigem Tanze bewegten.
Quelle: Polnische Volkssagen und Märchen
DIE EINÄUGIGE NOT ...

Es lebten einst drei Brüder: einer war Kürschner, einer Schneider, einer Schmied. Im Dorfe herrschte Not, man hatte nichts zu essen. Doch die drei Brüder hatten immer genug zu essen, und um sich zu kleiden. - "Ei, die Leute reden, daß hier Not herrscht. Hm! Wie sieht die Not eigentlich aus? Wir wissen nicht, was das ist - Not." - So sprachen die drei Brüder und machten sich auf, die Not zu suchen.
Sie gingen, gingen und kamen in einen Wald. Dort sahen sie eine kleine Hütte. Sie traten ein. Eine alte Frau mit einem Auge saß am Ofen und briet Kartoffeln. Das Zimmer und die Werkstatt war voll von Widdern. - "Wozu seid ihr hier her gekommen?" - "O, wir gingen, um die Not zu suchen!" - "Dann habt ihr sie schon gefunden, denn ich bin die Not." - Die Brüder erschraken.
Der Kürschner sagte zu der Frau:
"Liebe, liebe Not,
Bring mir nicht den Tod,
Ich mach dir einen Pelz."
"Was soll ich mit einem Pelz ?" entgegnete die Frau, packte ihn an der Kehle und erwürgte ihn. Der Schneider flehte sie ebenfalls um Schonung an und versprach ihr einen Leinenkittel. Aber auch ihn erwürgte die Not.
Der Schmied blieb allein übrig. Er sang sich ein Liedchen:
"Liebe, liebe Not,
Bring mir nicht den Tod,
Bestatten mußt mich dann,
Wenn mich der Tod gewann."
Die Not lachte nur dazu und sagte: .,Nun, singe noch etwas." - Aber dem Schmied war die Lust zum Singen vergangen. Obwohl er sehr stark war, fürchtete er sich dennoch, da er sah, wie sie seine beiden Brüder erwürgt hatte. Darum versuchte er es mit Versprechungen. "Ei, liebe Not! ich würde dir gern ein zweites Auge machen, denn wenn du so mit einem Auge auf der Stirn herumläufst, siehst du gar nicht hübsch aus. Du wirst dann zwei Augen haben so wie ich." - "Willst du es wirklich machen ?"- "O, warum denn nicht?" - "Nun, so mach es!" -
Der Schmied nahm den Schürhaken, mit dem sie die Kartoffeln aus dem Feuer holte, machte ihn glühend und brannte Frau Not das Auge aus. Nun sah sie gar nichts mehr.
Daher kommt es auch, daß heute auch solche Leute Not leiden müssen, die wie die Pferde arbeiten, während es Faulenzern oft gut geht. Die Not weiß nämlich nicht zu wem sie sich begeben soll, denn sie ist blind. -
Die Not geriet in Wut, sie wollte sich auf den Schmied stürzen, dieser entkam, lief in die Werkstatt, die Not seufzte, wandelte zwischen den Widdern und suchte, aber der Schmied entwischte ihr immer wieder.
Sie setzte sie auf die Türschwelle, rief die Widder zu sich, betastete jeden und ließ sie nach einander hinaus. Der Schmied sah das, ergriff schnell ein Widderfell, das er liegen sah, warf es sich um und zog seinen Leinenkittel einem Widder an. Dann kroch er auf allen vieren heran, blökte, die Not befühlte ihn und ließ ihn hinaus.
Als letzter kam der Widder in dem Leinenkittel. Die Not betastete ihn: "Oho, das ist der Schmied!" - schlug ihn gegen die Erde, daß er sofort tot war - und der Schmied lachte auf dem Hofe: ,,Ha! Ha! Ha!" - Frau Not wurde fast toll vor Wut, aber was sollte sie tun? "Schmied!" - rief sie. "Weißt du was? Ich kann dir nichts mehr anhaben. Aber es hängt ein goldener Schlüssel im Wald, gehe diesen Weg, so findest du ihn; nimm dir ihn, denn er wird dir nützen, weil du ein Schmied bist; gern gebe ich ihn dir, denn du bist furchtlos!" -
Der Schmied ging und ging, schaute in die Baumkronen hinauf und sah den Schlüssel dort hängen. "Aha!" - er kletterte auf den Baum, wollte den Schlüssel nehmen, - oho! seine Hand wuchs am Baum an. Er blickte hinunter, - Frau Not kam gelaufen. Was sollte er nun tun ? Er hatte ein starkes Messer bei sich, zog es heraus und schnitt sich mit einem Hieb den Arm bis zum Ellenbogen ab.
Die Not kam herbei und nam den Schlüssel, an welchem der Arm hing. - "Siehst du nun, Schmied ? Du suchtest die Not, jetzt hast du sie, denn ohne den Arm kannst du dir nichts verdienen." - So fanden alle drei Brüder die Not.
Quelle: Polnisches Volksmärchen
DIE KRÜGERIN ZU EICHMEDIEN ...
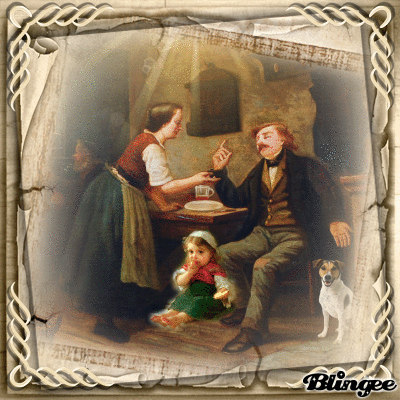
Eine Krügerin (Bierwirtin) zu Eichmedien (zwischen Rhein und Rastenburg) war so gottlos, den Bauern öfters zwei Stof Bier statt eines anzuschreiben. Die Bauern aber merkten das, und als es nun zur Bezahlung kam, hielten sie ihr den Betrug vor und sprachen zu ihr: Wollt ihr zu Gott kommen, so müßt ihr recht tun. Andere sprachen: Sie hat zu Gott nicht Lust, sondern zum Teufel.
Die Krügerin aber fing darauf an sich zu verfluchen, daß sie der Teufel mit Leib und Seele vor ihren Augen wegnehmen sollte, wo sie ihnen auf einen Stof Unrecht getan hätte. Der Teufel aber hat nicht gesäumt, ist stracks in die Stube gekommen und hat sie vor ihren Augen angefaßt. Dabei ist ein schreckliches Sausen und Brausen in der Stube geschehen, und die Anwesenden haben sich so erschrocken, daß sie für tot zu Boden fielen.
Der Teufel aber hat sie zum schwarzen Gaul gemacht und ist auf ihr denselben Abend nach Schwarzstein vor die Schmiede geritten, da hat er den Schmied geweckt und von ihm verlangt, er sollte ihm seinen Klepper beschlagen. Der Schmied wollte nicht, da das Feuer schon ausgelöscht, und auch sein Gesinde zur Ruhe gegangen war. Aber der Teufel hat nicht nachgelassen, sondern hat gesagt: Ich habe Briefe, die muß ich noch diese Nacht zur Stelle bringen; wo du nicht wirst aufstehen und mir meinen Klepper beschlagen, so will ich dich vor meinem gnädigsten Herrn verklagen. Da erschrak der Schmied, stand auf und fertigte die beiden Hufeisen.
Wie er nun aber die Eisen dem Pferde auf den Fuß gelegt hat, fing das Pferd an zu reden und sagte: Nur sacht, Gevatter, denn ich bin die Krügerin aus Eichmedien. Der Schmied erschrak, daß ihm die Zange sammt dem Eisen aus den Händen fiel. Der Teufel hat ihn immer angetrieben, sich zu fördern, denn er müßte noch die Nacht mit den Briefen zur Stelle sein. Aber der Schmied, halbtot vor Entsetzen, kam mit der Arbeit nicht vorwärts und endlich krähte der Hahn. Da ist das Pferd wieder zum Menschen geworden. Der Teufel hat die Krügerin dreimal aufs Maul geschlagen, daß ihre Lebtage seine Finger und Klauen in den Backen zu erkennen waren, »sind also wie Teer geronnen gewesen«, und ist verschwunden.
Die Krügerin hat hernach noch ein halbes Jahr gelebt, aber sie ist umhergelaufen wie »ein unsinniger Mensch« und konnte weder eingesperrt noch angebunden werden; auch die Sprache hatte sie verloren. Die Hufeisen wurden zu Schwarzstein in die Kirche gehängt, wo sie noch der Bischof Paul Speratus bei einer Kirchenvisitation im Jahre 1562 gesehen hat. Diese Begebenheit soll sich im Jahre 1473 ereignet haben.
Quelle: Aberglauben aus Masuren Danzig
RÄTSELMÄRCHEN ...

Eine Prinzessin wollte keinen andern Mann, als einen solchen, der ihr ein Rätsel aufgeben würde, das sie nicht auflösen könnte. Jeder durfte ihr sein Rätsel aufgeben, wenn sie es aber riet, so hatte er sein Leben verloren. Das hörte auch ein junger Schäfer, und obwohl ihn seine Eltern mahnten, von dem gefährlichen Versuche abzustehen, so vermochten sie doch nicht, ihn zurück zu halten. Er machte sich auf den Weg, kam zur Prinzessin und gab ihr folgendes Rätsel auf:
Vom Verstande Feuer gewonnen,
Von der Lust sich erwärmt;
Schoß in das, was er gesehen,
Und tötete das, was er nicht gesehen,
Hat gebraten und aufgegessen,
Nahm hinter sich weg, legte vor sich hin
Und kam zum Könige zu Mittag.
Die Prinzessin befragte die Weisen und schlug in allen ihren Rätselbüchern nach, aber sie konnte das Rätsel nicht lösen, und so wurde der Schäfer zum Schwiegersohn des Königs aufgenommen. Der König und die Prinzessin verlangten nach der Hochzeit die Auflösung zu hören, und er erzählte nun Folgendes:
Als ich hierher gehen wollte, nahm ich meine Violine und ein Terzerol mit und ging, doch verirrte ich mich im Walde, und die Nacht brach ein, und ich mußte im Walde übernachten. Es war kalt und naß, ich wollte mir Feuer machen, aber es war nichts Trockenes bei der Hand; da riß ich das Futter aus meiner Mütze und machte Feuer. Es war finster, und ich hatte kein Holz bei der Hand, so zerbrach ich meine Violine und legte sie aufs Feuer.
Beim Lichte des selben konnte ich auch Holz sehen und nehmen. Da hörte ich ein Geräusch, eine Rehkuh lief vorbei, ich griff nach meiner Pistole und schoß darnach. Die Rehkuh ist aber fortgelaufen; ich sah und es lag etwas, als ich näher kam, war es ein junges Rehchen, das ich nicht gesehen hatte, weil es hinter der Mutter verborgen war. Dieses Rehchen machte ich mir zurecht, habe es gebraten und aufgegessen.
Den andern Tag ging ich weiter und fragte, wie weit es bis um Könige sei. Es wurde mir gesagt, rund herum eine Meile und gerade zu zwei (do kola mila, a na prost dwie). Da waren aber Brettschneider, und ich kaufte zwei Schwarten. Der gerade Weg führte nämlich über einen Sumpf. Auf einer Schwarte ging ich und die andere legte ich vor mich hin, und so wechselte ich mit den Schwarten. So kam ich glücklich durch und bin nun hier zu rechter Zeit angekommen.
Aus Lindenwalde
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren
DIE RÄUBERPREDIGT ...
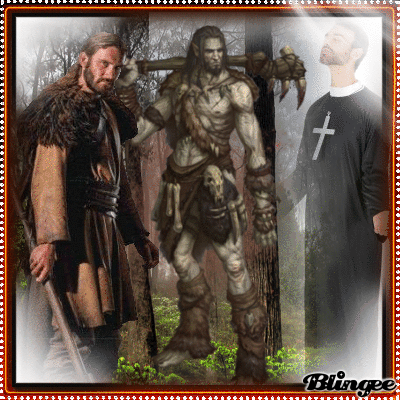
Es war einmal ein Priester, der ging über die Grenze – und begegnete dort einigen Räubern.
Sie umringten ihn, der Anführer aber sagte zu ihm: „Sprich uns ein Gebet vor, das wir aufsagen können, wenn es ans Sterben geht!“
Der Priester erschauerte vor Angst, dachte aber für sich: „Wenn ich’s nicht tue, werden sie mich töten.“ Er betete leise zum heiligen Bartholomäus, dem Schutzpatron der Räuber, dann stellte er sich auf einen Baumstumpf wie auf eine Kanzel, die Räuber aber nahmen die Hüte ab und hörten ihm zu.
Der Priester bekreuzigte sich und begann: „Euer Leben ist dem Leben des Herrn Jesus sehr ähnlich.“
„Und warum?“ fragten erneut die Räuber.
„Warum?“ antwortete der Priester, „nun darum, weil Jesus arm geboren wurde und auch ihr nicht reich seid. Als Jesus ein Knabe war, half er dem heiligen Joseph Bretter zu hobeln, und auch ihr habt bestimmt nicht auf der faulen Haut gelegen, sonst hätte euer Vater euch wohl das Fell gegerbt.“ Als Jesus erwachsen war, begab er sich auf die Wanderschaft, und auch ihr zieht von Ort zu Ort. Jesus haben sie gefangen genommen – und auch euch werden sie gefangen nehmen. Jesus ist gegeißelt worden – und auch ihr werdet ausgepeitscht werden. Jesus wurde gekreuzigt – und auf euch wartet der Galgen. Jesus fuhr nieder zur Hölle – und auch ihr werdet gewiß dort einfahren...Und das weitere wißt ihr ja!“
„Nun ja, das wissen wir“, sagten die Räuber, und der Anführer gab ihm freudig eine Handvoll Gold.
Der Priester ging ein Stück und drehte sich erst dann zu den Räubern um und rief: „Das eine muß ich euch noch sagen: ihr wißt, der Herr Jesus ist nach drei Tagen in den Himmel aufgefahren, Euch wird er für immer verschlossen sein.“
Quelle: Rozne gadki z Podgorza. Kalendarz Siewca Krakow 1897 Podhale
RÜBEZAHL UND DIE MUTTER ...
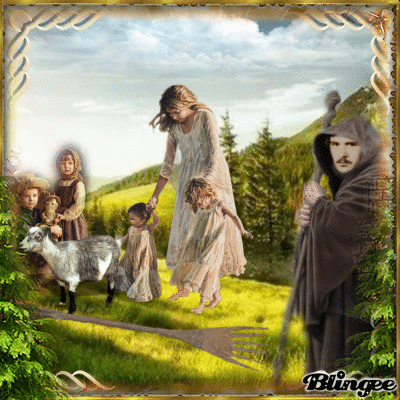
Einst begegnete dem Geiste eine Frau, die seine Aufmerksamkeit erregte. Sie hatte ein Kind auf dem Arme, eins auf dem Rücken und ein drittes leitete sie an ihrer Hand. Ein etwas größerer Knabe trug einen Korb und einen Rechen, denn sie wollte Laub für ihr Vieh sammeln. „Eine Mutter“, sagte Rübezahl zu sich selber, „ist doch ein gutes Geschöpf, schleppt sich da mit vier Kindern und tut ihren Beruf ohne Murren!“ Diese Betrachtung setzte ihn in gute Laune, und er fühlte sich geneigt, sich in eine Unterhaltung einzulassen.
Die Frau hatte indes ihre Kleinen auf den Rasen gesetzt und streifte nun das Laub von den Bäumen. Die Kinder störten sie jedoch oft genug bei ihrer Arbeit. Sie fingen an, ungeduldig zu werden, zu schreien und zu weinen und die Frau hatte genug zu tun, sie zu beruhigen. Sie spielte und tändelte mit ihnen, nahm sie auf den Arm und wiegte sie in den Schlaf oder suchte Erdbeeren und Himbeeren für sie in den Büschen. Der Schreier, der vorher auf der Mutter Rücken geritten war, wollte aber nicht stille werden.
Da riß der Mutter die Geduld endlich, und sie rief: „Komm, Rübezahl, und friß mir den Schreihals!“ Alsbald stand Rübezahl in der Gestalt eines rußigen Köhlers vor ihm und sprach: „Hier bin ich.“ Die Frau zitterte vor Schrecken, doch sagte sie: „Ich bedarf deiner nicht mehr, die Kinder sind jetzt ruhig.“ Rübezahl antwortete: „Weiß du nicht, daß man mich nicht ungestraft ruft? Gleich gib mir den Schreier, daß ich ihn fresse!“ Damit streckte er die Hand nach dem Jungen aus – aber wie eine Gluckhenne, die ihre Jungen verteidigt, stürzte sich die Frau auf Rübezahl und faßte ihn beim Barte. „Das Herz“, rief sie, "mußt du mir aus dem Leibe reißen, ehe du mir mein Kind raubst!“
Rübezahl lächelte unter dem kühnen Angriff und sprach: „Nun, nun, beruhige dich, ich bin kein Menschenfresser. Laß mir aber den Knaben; ich will ihn halten, wie einen Junker und einen tüchtigen Kerl aus ihm ziehen. Fordere tausend Dukaten, und ich zahle sie dir!“ Die Frau lachte: „Nicht um alle Schätze in der Welt sind mir meine Kinder feil.“ „Törin“, versetzte Rübezahl, „hast du nicht noch drei, die dir Last genug machen? Mußt du dich nicht mit ihnen placken und kümmerlich ernähren?“ – „Wohl war“, antwortete die Frau, „aber ich muß tun, was meines Berufes ist. Kinder machen Last, aber auch Freude.“
Als Rübezahl sah, daß sein Drängen vergeblich sei, fragte er die Frau weiter aus, hörte, daß ihr Mann Steffen ein Glashändler sei, der eben Glas aus Böhmen hole und in seinem Korb über die Berge bringe; er sei ein guter Mensch, der sie aber nicht immer gut behandle, und gewaltig geizig. Damit tat die Frau ihr Laub in den Korb und ging davon. Je weiter sie aber kam, umso schwerer ward der Korb. Sie meinte, Rübezahl habe ihr einen Possen gespielt. Sie untersuchte den Korb, fand aber nur Laub. Die Hälfte mußte sie nun ausschütten, weil sie den Korb nicht weiterschleppen konnte. Zu Hause warf sie das Laub den Ziegen vor und ging fröhlich schlafen.
Wie groß aber war ihr Schrecken und ihr Schmerz, als sie am andern Morgen die Ziegen melken wollte und sie tot im Stalle fand. Trostlos saß sie da und weinte. Da sah sie plötzlich ein Blättlein das wie Gold schimmerte; und als sie nachsah, fand sich, daß alles Laub zu Gold geworden war. Und als sie die Ziegen schlachtete, fanden sich in deren Magen große Goldklumpen.
Rübezahl hatte sich indessen vorgenommen, dem Manne, weil er so geizig war, einen Streich zu spielen. Er ging ihm entgegen und traf ihn auf der Höhe, als er sich gerade niedergesetzt und seinen Glaskorb neben sich auf einen Baumstumpf gestellt hatte. Da erhob Rübezahl plötzlich einen argen Wirbelwind und warf den Korb um, daß alles Glas in Scherben am Boden lag. Als ein geschlagener Mann machte er sich nun auf den Heimweg. Was sollte er anfangen, um seinen Handel wieder in Gang zu bringen. Da fielen ihm die Ziegen ein, aus deren Verkauf war ein Stück Geld zu lösen. Würde ihm sein Weib aber erlauben, sie zu verhandeln, die sie zur Ernährung ihrer Kinder brauchte?
„Ach was“, sagte Steffen zu sich, „sie mögen Wasser trinken. Ich will die Ziegen in der Nacht stehlen, dann kann die Frau nicht schelten und sich widersetzen, und ich kann ihr noch Vorwürfe machen, daß sie das Vieh nicht besser gehütet hat.“ Gesagt, getan. Er wartete, bis es Nacht war, kletterte über den Zaun und fand den Stall offen, drinnen aber zu seinem Schrecken alles öde und leer. Er wagte es nicht, seine Frau aus dem Schlafe zu wecken, und legte sich in dumpfer Trauer auf die Streu im Stalle.
Am Morgen trat er kleinmütig in die Stube, ein Bild des Jammers. Als die Frau hörte, was ihm widerfahren, lächelte sie über den Schabernack, den ihm Rübezahl angetan. Lange konnte sie aber seinen Kummer nicht mit ansehen, sondern entdeckte ihm bald, wie sie durch den Berggeist zu wohlhabenden Menschen geworden seien.
Schlesische Volkssage
BELOHNTE MILDTÄTIGKEIT ...

Es war einmal ein Schuhmacher, und der war sehr unfreundlich und böse und zankte immer mit seiner Frau und schalt auf alle, die in sein Haus kamen. In derselben Stadt war auch ein König, dessen Frau ebenso böse war; alle, mit denen sie zusammentraf, den König selbst, seine Dienerschaft und alle, die nach dem Schlosse kamen, schrie sie an und keinem gab sie ein gutes Wort.
Einst kam auch ein Handwerksbursche, der durch die Welt wanderte, in das Schloß und bat die Königin um eine Gabe. Die Königin aber, statt ihm etwas zu geben, schrie ihn heftig an und schmähte ihn und drohte ihm, wenn er nicht gleich sich packte, würde sie ihn hinauswerfen lassen. Da ging der Handwerksbursche weiter und kam zu dem Schuhmacher, und der Schuhmacher war nicht zu Hause, nur seine gute Frau.
Er bat sie um eine Gabe, und sie erwiderte ihm: »Ja, ich werde dir einen Groschen geben, es ist zwar mein letztes Gröschchen, und ich werde dafür von meinem Mann wahrscheinlich Prügel bekommen, aber das schadet nichts; nimm das letzte Gröschchen.« Der Handwerksbursche war aber ein Schwarzkünstler, ein Zauberer, der durch seine Kunst auch zu bewirken wußte, daß die Menschen verwechselt wurden. Da machte er denn, daß die Frau des Schuhmachers Königin wurde und die Königin Schuhmacherfrau, und das geschah in der Nacht.
Als die Königin erwachte, wälzte sie sich auf ihrem Lager hin und her und fluchte und wetterte über das Lager, denn es war ihr alles zu hart, und das Stroh stach und kratzte sie, daß sie nicht schlafen konnte. Der Schuhmacher hörte das auch, konnte aber nichts davon verstehen, weil sie deutsch sprach; und schrie sie ärgerlich an, sie sollte das Maul halten und ruhig schlafen.
Des Morgens stand der Schuhmacher auf und fuhr mit Schimpfreden über sie her, weil sie noch liegen blieb. »Ei, du sollst den Pechdraht machen!« rief er, »da liegt sie bis acht Uhr und denkt wohl gar, ich werde ihr den Pechdraht machen!« und prügelte sie zum Bette hinaus. Die Schuhmacherfrau, welche indeß im Schlosse genächtigt hatte, war beim Erwachen nicht wenig verwundert; da war alles so mäuschenstill, nur die Uhren tickten; das Bett war so weich, daß sie dachte, sie schwebe in der Luft; wie sie die Augen aufschlug, sah sie, daß eine Lampe die ganze Nacht gebrannt hatte, und alles war so schön in der Stube! Sie war ganz still, rührte sich nicht einmal und schlief wieder ein.
Des Morgens kam das Stubenmädchen, ganz leise, ohne Schuhe nur auf Strümpfen (denn sie dachte nicht anders, als daß die böse Königin im Bett liege), trat an das Bett und fragte: »Majestät, welche Kleider soll ich heute bringen?« Die Schuhmacherfrau war in der größten Verlegenheit, was sie sagen solle, weil sie doch nichts von den Kleidern der Königin wußte, und antwortete, um sich keine Blöße zu geben: »Bringe mir die selben Kleider, die ich gestern an hatte.«
Die Schuhmacherfrau war aber von dem Pechdrahtmachen ganz schwarz im Gesicht. Das Stubenmädchen, welches das bemerkt hatte, sagte daher, als sie die Kleider holen ging, zu den andern Dienstmädchen: »Meine Lieben, unsere Königin haben sie heute Nacht in der Hölle gehabt, denn sie ist noch mit dem Teer beschmutzt; es hat ihr aber geholfen, sie ist viel sanfter geworden.«
Die Königin stand dann nun auf, putzte sich aus und ging verwundert in den Stuben umher. Da kam auch der König und sagte ihr ängstlich, wie er es gewöhnt war: »Guten Morgen«; sie erwiderte den Gruß so freundlich, daß er ganz erstaunt war und sie aus Freude über ihr verändertes Wesen, was lange nicht geschehen war, küßte. Nachher kam auch die Köchin und fragte, was sie zu Mittag kochen solle? Die Königin besann sich und besann sich; da ihr aber gar nichts einfiel, dachte sie - Grütze oder Kartoffeln, das kann ich doch nicht sagen - so sagte sie zuletzt: »Koche das selbe, was du gestern gekocht hast!« Alle wunderten sich und freuten sich über die Sanftmut und Güte der Königin. Da ging sie in die Speisekammer und fand dort so viele Speisen, die sie nicht kannte, und sie kostete von Allem.
Dann fuhren sie spazieren und der König ließ die schönsten Pferde vor den schönsten Wagen anspannen. Sie fuhren durch die ganze Stadt und kamen auch an dem Haus des Schuhmachers vorbei. Da stürzte die eigentliche Königin aus dem Hause und schrie, sie sollten anhalten, sie sei die Königin, der König solle sie auf dem Wagen mitnehmen. Da ließ der König den Schuhmacher an den Wagen treten und sagte zu ihm: »Wenn du eine verrückte Frau hast, so lasse sie nicht aus der Stube, Menschen anzufallen, - oder gieb sie in ein Irrenhaus«, und fuhr nach Hause, und gab vor Freude, daß seine Frau so gut geworden ist, einen großen Ball.
Aus Klein-Jerutten
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren
DAS MÄRCHEN VOM WOLF UND DEM HUND ...

Ein Bauer hatte einen sehr alten Hund. Und er sprach zu ihm: „Du bist zu nichts mehr nütze, für nichts und wieder nichts gebe ich dir Futter.“
Eines Tages ging der Bauer aufs Feld um Roggen zu säen, und er nahm sein Kind mit. Der Hund aber lag tief bekümmert am Feldrain. Da kam ein Wolf zu ihm und sagte: „Ich will dich fressen!“
Der Hund aber entgegnete: „Was hast du schon von mir, so abgemagert wie ich bin?“
Darauf der Wolf: „ Na, dein Fell!“
„Und was ist an dem Fell?“ fragte der Hund.
Der Wolf aber sagte: "Soll dran sein, was will, dann werde ich eben deine Knochen zerbeißen.“ ...
"Weißt du was, älterer Bruder“, sagte da der Hund, „verschaff du mir Brot, denn mein Bauer gibt mir nichts mehr zu fressen, und wenn ich mich aufgepäppelt habe, dann friß mich.“....
“Was soll ich denn tun“, fragte der Wolf, „wie kann ich dir Brot verschaffen?“
„Sieh! Dort sitzt das Kind des Bauern“, sagte der Hund, „das greifst du dir, und ich nehme es dir wieder ab.“
Als der Wolf das Kind losgelassen hatte, nahm der Bauer den Hund wieder zu sich ins Haus, er gab ihm zu fressen, soviel er nur wollte.
Danach, ein paar Wochen später, fand bei diesem Bauer eine Hochzeit statt. Da lud der Hund den Wolf auf die Hochzeit. Der Wolf kam auch, und sie beschlossen zusammen in die Vorratskammer einzudringen. Da sagte der Hund zum Wolf:
"Wenn wir in diese Kammer kriechen, dann bist du mein Bruder und ich der deinige. Ich buddele ein Loch zur Kammer, und wenn wir ausrücken müssen, dann fliehst du durch das Loch, das ich gegraben habe, ich aber durch das deinige.“
Sie krochen in die Vorratskammer und tranken vom Schnaps. Aber der Wolf bekam große Lust zu singen; er riss seinen Rachen auf und sang. Das hörte der Bauer: "Was ist dort los?“
Die Hofleute liefen herbei und schlugen den Wolf tot, denn er sollte durch das winzige Loch flüchten, das der Hund gegraben hatte, wie es mit dem Hund abgesprochen war.
Quelle: Dabrowska S., Przypowiastki i bajki z Zabna
DIE LEBENSBÄUME ...
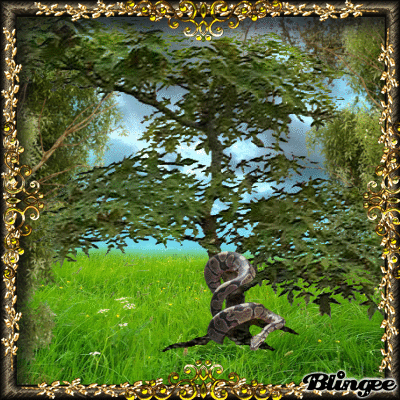
Der Vater sagte zu seinem jüngsten Kind, das der Liebling aller war, die Mutter sei todkrank und werde den Abend nicht erleben, wenn kein Wunder geschehe.
Das Kind ging trostlos herum und fragte die Leute, die ihm begegneten, was ein Wunder sei. Da kam eine bleiche Frau einher, die der Mutter so ähnlich sah, als wäre sie ihre Schwester. Die nahm das Kind bei der Hand und sprach: „ Ich weiß, wo eure Lebensbäume stehen und will dich hin führen, du musst dir aber die Augen verbinden lassen und nie mehr den Weg finden, sonst ist es dein früher Tod. Du darfst auch zu Haus nicht sagen, wo du warst.“
Als sie am Ort angelangt waren, zeigte die Frau mit dem Finger auf einen Baum: „Das ist der Lebensbaum deiner Mutter; siehst du die Schlange an der Wurzel herum kriechen? Nimm einen Stein und zertrümmere ihr den Kopf, dann wird die Mutter genesen.“
Das Kind tat es, und zu Hause angekommen fand es die Mutter frisch und froh und großen Jubel bei dem Vater und den Geschwistern.
Als wieder ein Jahr um war, legte sich auch der Vater schwer danieder. Das Kind konnte es nicht lassen, es suchte lange nach den Lebensbäumen und fand sie endlich auch. Auch den Lebensbaum des Vaters, an welchem eine Schlange herum kroch. Es erschlug sie und sank dann selbst tot nieder. Da kam ein Engel Gottes und trug das Kind in den Himmel.
Der Vater war erschöpft eingeschlafen, aber als das böse Fieber vergangen war, da hatte er einen Traum, in dem er alles sah was geschehen war. Er erzählte es beim Erwachen der Mutter, die in bitteres Weinen ausbrach. Dann aber lächelte sie unter ihren Tränen. Nun hatte das Haus einen Schutzgeist, wie es so leicht keinen wieder gibt.
Ostpreußisches Märchen
DER GUTE HIRTE ...
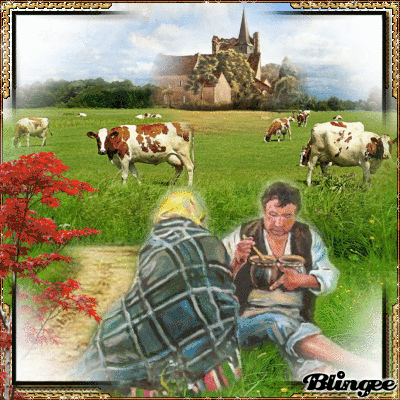
Es war einmal ein König, der hatte sieben Söhne und eine Tochter. Die Söhne waren aber alle verwünscht und waren Kühe. Sie lebten bei dem Könige, fraßen aber kein Gras und Heu, und waren sehr schwer zu hüten; denn jedem Hirten liefen sie fort und kamen dann erst nach Verlauf einiger Zeit von selbst wieder.
Nun hatte der König bekannt gemacht, daß derjenige, welcher ihm die Kühe gut hüten und ihm auch sagen könnte, was sie fräßen und wovon sie lebten, seine Tochter zur Frau erhalten sollte. Die war sehr schön. Da war denn auch ein Mann, welcher drei Söhne hatte, zwei kluge und einen dummen. Der führte zuerst den ältesten Sohn zum Könige und sagte: »Allergnädigster König, mein Sohn versteht das Hüten, er wird die Kühe hüten, daß sie fett werden, und wird auch sagen können, wovon sie leben.
Der König nahm ihn als Hirten an, aber gleich am ersten Tage, als dieser die Kühe aufs Feld trieb, liefen diese ihm weg, und als er ihnen nachlaufen wollte, saß am Kreuzwege eine alte Frau, welche in einer Schüssel Suppe und in einer andern noch ein Gericht hatte. Die rief den Hirten an und sagte: »Komm, iß von diesen Gerichten, die Kühe werden schon wieder kommen.« Das gefiel dem Hirten besser als da den Kühen, wer weiß wie weit, nachzulaufen. Er setzte sich zu der Frau, aß und sprach mit ihr. Abends kamen die Kühe richtig von selbst wieder, und die Alte sagte: »Siehst du? ich hatte Recht; jetzt nimm den Rest der Speisen, die du übrig gelassen hast und sage dem Könige, daß die Kühe von denselben leben.«
Das tat der Hirte auch, er nahm den Rest der Speisen mit, trieb die Kühe nach Hause und sagte um Könige: »Ich weiß, wovon die Kühe leben, hier sind ihre Speisen!« und zeigte die Speisen von der alten Hexe. »Du Taugenichts, erwiderte der König, »das ist nicht wahr, das haben mir alle Hirten, die ich bis dahin gehabt habe, vorgelogen, davon leben sie aber nicht«, und jagte ihn weg. Da dieser nun nach Hause kam, seine Sache also nicht gut gemacht hatte, so brachte der Vater den zweiten Sohn zum Könige.
Dem ging es aber ganz ebenso, wie dem ersten, er ließ sich von der alten Hexe betören und wurde fortgejagt. Da sagte der dritte Sohn: »Nun laßt mich gehen!« Der Vater und die Brüder wollten es gar nicht zulassen; sie meinten: »Was wir beide nicht verstanden haben, das solltest du verstehen?« Aber er ging doch. Als er nun die Kühe auf die Weide trieb, liefen sie auch ihm gleich am ersten Tage weg, er aber lief ihnen nach, ließ sich auch von der alten Hexe, die ihn wieder verlocken wollte, nicht zurückhalten, sondern lief immer weiter. Die Kühe aber liefen sehr, sehr weit und kamen endlich an einen großen Fluß. »Nun werden sie«, dachte er schon »hinüber schwimmen, und ich kann nicht hinüber, und sie werden mir dann natürlich fortkommen;« da besann er sich noch zu rechter Zeit, sprang auf eine der Kühe und ließ sich so über den Fluß mit hinübertragen.
An dem andern Ufer stand eine prachtvolle Kirche, um welche rings herum sich der Kirchhof ausbreitete. Als die sieben Kühe auf dem Kirchhofe ankamen, da wurden aus ihnen sieben wunderschöne Prinzen, die alle in die Kirche gingen. Der Hirte ging ihnen nach und sah, wie sie alle kommunizierten. Dann schlich er auch an den Altar, nahm etwas Brot und Wein und steckte es zu sich. Als die Prinzen das Abendmahl genommen hatten, verließen sie die Kirche und gingen über den Kirchhof heimwärts. In dem Augenblick, als sie den letzten Schritt vom Kirchhofe setzten, verwandelten sie sich wieder in Kühe und liefen nun nach Hause; der Hirte ihnen immer nach.
Der König sah ihnen mit Ungeduld entgegen; als sie endlich anlangten, fragte er den Hirten, ob er nun wisse, wovon die Kühe lebten. »Ja, allergnädigster König, hier von dieser Speise leben sie«, sagte dieser und erzählte dem Könige alles, was er gesehen hatte. Darüber war der König nun sehr erfreut und sagte: »Nun kannst du auch meine Tochter, die schöne Prinzessin, heiraten.« Die Hochzeit wurde veranstaltet, und als das junge Paar eben im Begriffe stand nach der Kirche abzufahren, und er zu diesem Zwecke von Allen Abschied genommen hatte, ging er zuvor noch in den Stall zu seinen lieben Kühen. Als er in den Stall trat, wurden die Kühe wieder Prinzen, und er hatte sie erlöst, und es war große Freude im Hause, und er lebte mit der schönen Prinzessin als König noch viele Jahre.
Aus Klein-Jerutten
Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren
DIE VERGESSENE BRAUT ...
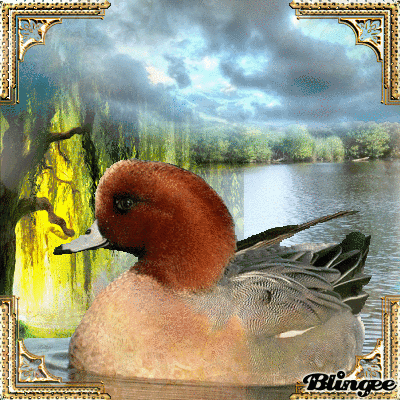
Ein Müller hatte einen einzigen Sohn. Als dieser herangewachsen war, trug ihm der Vater auf, in die Welt hinauszuziehen und sich eine reiche Frau zu suchen. Der Jüngling machte sich auf den Weg. Nach längerer Wanderung kam er in die Nähe eines Glasberges, bei welchem ein Bach vorbeifloss, und hier beschloss er, sich einige Tage auszuruhen.
Auf dem Berge wohnte eine Frau mit ihren drei Töchtern. Die Jungfrauen kamen täglich vom Berge herabgeflogen und badeten sich in dem Bache, nachdem sie ihre Flügel abgelegt hatten, und der Jüngling hatte einige Male Gelegenheit, sie dabei zu beobachten. Die schönste von ihnen aber war die jüngste. Als nun die Mädchen eines Tages wieder im Wasser waren, da eilte der Müllerssohn hinzu und nahm der Jüngsten die Flügel fort. So konnte sie nicht mehr auf den Berg zurückkehren, und der Jüngling führte sie nun als seine Braut mit sich in seine Hütte. -
Die Mutter der Jungfrau wollte zwar in eine Ehe einwilligen, doch nur dann, wenn er die Arbeiten ausführen würde, die sie ihm geben würde. Und nun brachte sie ihm am nächsten Tage gläsernes Handwerkszeug und trug ihm auf, eine gläserne Kapelle zu bauen. Aber der Jüngling zerschlug alles. Da legte er sich auf die Erde und weinte. Am Mittag brachte ihm seine Braut das Mittagessen, und als sie ihn weinen sah, fragte sie ihn nach der Ursache seines Weinens. Der Jüngling sagte es ihr. Da befahl sie ihm, sich hinzulegen und zu schlafen; dann werde schon alles gut werden. Der Jüngling tat, wie ihm geheissen wurde, und als er erwachte, da war die Kapelle aufgebaut.
Als zweite Arbeit wurde ihm aufgetragen, er solle um den ganzen Glasberg einen drei Ellen breiten Graben ziehen. Die Frau gab ihm dazu einen gläsernen Spaten. Aber kaum hatte er sich an die Arbeit gemacht, da zerbrach der Spaten, Ratlos und hilflos stand er da und begann an zu weinen. Als es Mittag geworden war, brachte ihm seine Braut wieder das Mittagessen, und er klagte ihr wieder sein Leid. Auch jetzt riet ihm die Jungfrau, sich hinzulegen und auszuschlafen; und als er wieder erwachte, da war der Graben fertig.
Nun eilten die beiden fort. Aber als die Mutter das bemerkte, schickte sie ihre älteste Tochter hinter den Fliehenden her. Als die beiden diese herankommen sahen, sagte die Braut: 'Ich werde mich jetzt in einen Dornbusch verwandeln, und du wirst zur Blume werden.' Kaum waren sie verwandelt, da kam die Schwester heran und wollte die Blume pflücken, aber vor lauter Dornen konnte sie nicht an die Blume herankommen. Sie kehrte deshalb um, und nun schickte die Mutter die zweite Tochter den Fliehenden hinterher. Da verwandelte sich die Braut in eine Kapelle und den Müllerssohn in einen Priester. Wie nun die zweite Schwester in die Kapelle hineingehen wollte, da schlug der Priester drei Kreuze vor ihr, und sie musste umkehren.
Jetzt machte sich die Mutter selbst auf den Weg. Die Braut verwandelte sich nun zu einem Teiche und ihren Bräutigam zu einem Enterich, der auf dem Wasser herum schwamm. Wie nun die Mutter zu dem Teiche kam, da rief sie nach ihrer Tochter; aber vergeblich, denn die Tochter kam nicht; und so kehrte auch sie um, nachdem sie noch drei Kleider am Rande des Teiches niedergelegt hatte. Nachdem die Braut sich und den Müllerssohn wieder in Menschen verwandelt hatte, nahm sie die Kleider, und die beiden wanderten nun unbehelligt weiter und kamen zu der Heimatstadt des Bräutigams. Hier liess der Müllerssohn die Jungfrau zurück und begab sich zu seinen Eltern in die Mühle.
Dort hatte er seine junge Braut bald vergessen und sich ein anderes Mädchen ausgesucht, das er als Gattin heim zu führen gedachte. Seine frühere Braut aber trat bei einem Müller in die Dienste. Einmal kam der junge Mann zu dem Müller zu Besuch, als sie gerade mit der Wäsche beschäftigt war. Er trat zu ihr und fragte sie, ob sie sich nicht etwas mit ihm unterhalten möchte, denn er hatte sie nicht erkannt. Sie sagte: ja, wenn er ihr waschen helfen wolle. Da nahm er ein Schnupftuch und spülte es aus. Aber nun konnte er nicht wieder loskommen, und er musste bis zum nächsten Morgen am Waschtrog stehen. Ein anderes Mal traf er das Mädchen beim Melken. Er wollte ihr helfen und fasste eine Kuh beim Schwanze. Da konnte er den Schwanz nicht wieder loslassen und musste die ganze Nacht so stehen bleiben. Doch auch jetzt hatte er seine frühere Braut nicht wiedererkannt.
Jetzt nahte der Tag der Hochzeit heran. Die Magd wurde als Brautführerin eingeladen. Sie nahm das hässlichste von den drei Kleidern, die ihr die Mutter einst am Teich zurückgelassen hatte, und ging zur Hochzeit. Wie nun der Müllerssohn die schöne Brautführerin erblickte und sah, dass ihr Kleid viel schöner war als das seiner Braut, da bat er sie, das Kleid seiner Braut zu schenken. Sie tat es, eilte aber nach Hause und zog das zweite Kleid an, das sie von ihrer Mutter erhalten hatte.
Wieder war es viel schöner als das der Braut, und wieder bat der Bräutigam sie, das Kleid seiner Braut zu schenken. Sie tat es auch diesmal und zog nun das dritte Kleid an, das noch viel schöner war als die beiden ersten. So erschien sie wieder auf der Hochzeit. Jetzt fiel es dem Bräutigam wie Schuppen von den Augen; er erkannte seine Braut wieder, die er treulos in der Stadt zurück gelassen hatte. Daraufhin heiratete er die erste Braut; die andere Braut aber wurde zurück nach Hause geschickt.
Polen: Otto Knoop: Sagen aus Kujawien
DIE FARNBLÜTE ...

Am Vorabend des Johannistages schritt ein Bauer durch den Wald. Plötzlich sah er unter einer Eiche etwas aufblitzen gleich einem Häufchen Sterne. Er lief hin und fand blanke, neue Dukaten. Ihm wurde aber etwas unheimlich zumute. Wieder blickte er um sich, da war die ganze Welt unter ihm wie Glas, und als er genauer hinsah, nahm er allenthalben bald Silber, bald Gold wahr, hier in Kesseln, dort in Truhen, anderwärts in Töpfen; und wenn auch manche Geldstücke mit Asche bestäubt waren, so hing diese Asche doch nur wie Rauch darüber, und auf dem Grunde blinkte gleich einem Feuer das Gold. Während der Landmann auf all diesem Reichtum starrte und starrte, zog sich dieser auf einer Stelle zusammen, zum Greifen nahe, dass er alles mit der Hand hätte fassen können. Doch dann plötzlich stupste ihn jemand von hinten.
Er drehte sich um und erblickte einen Geistlichen, wie’s schien, einen Bernhardinermönch, dessen linkes Bein aber nackt war. Der Priester redete alsbald zu ihm: „Weißt du, verkauf mir einen von deinen Schuhen, den linken“, (wohlgemerkt, er bot ihm kein „Gelobt sei Jesus Christus) „Mir ist“, fuhr er dann fort, „ein Unglück widerfahren. Ich schlief in einer Scheune in einem Dorf, und in der Nacht brach ein Gewitter los, und es begann zu wetterleuchten, die Donner grollten, und der Blitz schlug in die Scheune ein. Obwohl die Leute gleich daher gelaufen, rettete doch niemand etwas, denn jeder hielt es für die Strafe Gottes. Ich fuhr schnell aus dem Schlaf auf, aber im Schreck konnte ich nur einen Schuh fassen, hatte auch keine Zeit, an den zweiten zu denken, sondern dankte dem Herrgott, daß er mich vor dem plötzlichen Tode gerettet hatte.“
Freilich überlegte der Bauer, „das, was der Herr Jesus selbst angezündet hat, darf man nicht löschen, das ist Wahrheit, und die Güte Gottes hat Hochwürden vor dem Tode bewahrt; ich hab’s nicht weit von hier nach Hause und werde auch ohne den einen Schuh gesund nach dorthin gelangen.“ Darauf wiederum der Geistliche, als ob es ihm recht dringlich wäre: „Ich bezahle dich dafür gut, mein lieber Bauer, denn siehst du, ich bin’s nicht gewohnt, des Nachts barfüßig durch den Wald zu gehen, und mir schmerzen bereits die Füße.“
Und kaum, daß der Bauer sich niedergelegt hatte, zog ihm der Priester schon den Schuh ab und warf ihm einige Münzen zu; in dem Augenblick, hörte der Bauer einen Hahn um Mitternacht krähen. Da lachte der Geistlich fürchterlich auf, und warf ihm den Schuh ins Gesicht; sogleich erscholl im ganzen Wald ein so schreckliches Pfeifen und Knallen, daß die Eichen barsten und all die Reichtümer wie von der Erde verschluckt verschwanden.
Dem Bauern war eben eine Farnblüte hinter den Stiefelschaft geflogen, und diese Blume „Unheil“ bringt jeden in die Hölle. Weil der Mann aber nicht wissentlich, sondern durch Zufall in ihren Besitz gekommen war, hatte der Teufel keine Macht über ihn, sondern mußte eine List ersinnen, um ihm die Blüte abzunehmen. Als der Bauer aber zu Hause ankam und sich das Geld besah, daß er von dem Geistlichen erhalten hatte, mußte er feststellen, daß es sich in Pferdedreck verwandelt hatte.
Quelle: Kolberg Krakow 1884 Piaski /Lublin
DER TAUGENICHTS ...
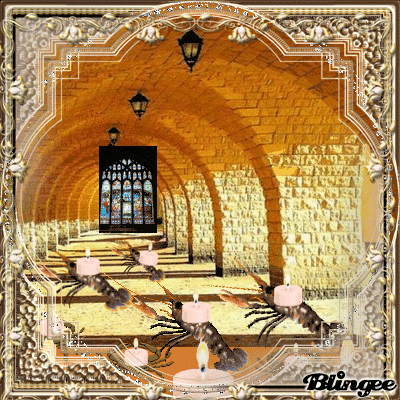
Es war einmal ein Herr, der hatte einen Knecht, einen Taugenichts sondergleichen. Eines Tages sagte sein Herr zu ihm: »Wenn du meiner Frau den Ring von dem Finger nimmst, bekommst du 100 Taler.«
In der folgenden Nacht holte der Knecht einen Toten vom Kirchhof, stellte ihn in das Fenster des Herrn und rief: »Den Ring will ich haben!« Der Herr nahm die Pistole, schoss nach der Gestalt und traf sie, so dass sie hinfiel. Darauf ging er hinaus, um zu sehen, wer das wäre. Während dessen schlich sich der Knecht in die Stube hinein und rief der im Bette liegenden Frau seines Herrn zu: »Gib mir den Ring in Verwahrung; es könnte sonst ein zweiter kommen und ihn dir nehmen.« Die Frau gab ihm den Ring, und der Knecht schlich sich wieder heraus. Am nächsten Tage musste ihm der Herr die 100 Taler geben.
Davon erfuhr aber der Geistliche des Dorfes und hielt dem Knecht eine derbe Strafpredigt wegen des Toten. Der Knecht beschloss, sich dafür zu rächen. Er ging an den Fluss und fing einen Sack voll Krebse. Diese trug er in die Kirche, klebte jedem der Krebse eine Kerze auf den Rücken, zündete die selbe an und ließ dann das Tier laufen. Darauf zog er ein langes weißes Hemd über und stellte sich beim Altar auf. Bald war die Kirche von den vielen Lichtern erhellt. Als das dem Geistlichen hinterbracht wurde, ging er in die Kirche, fand die vielen Flämmchen und sah am Altar die weiße Gestalt stehen. Diese fing an zu reden und sagte, sie wäre der heilige Michael und sei gekommen, um den Geistlichen mit in den Himmel zu nehmen. Nun musste der Geistliche in einen Sack kriechen. Der Knecht band ihn fest zu, fasste ihn beim Zipfel und schleppte ihn hinter sich her.
Es war aber ein hartes und spitzes Pflaster, und der Geistliche wurde jeden Augenblick an einen Stein geschleudert, worüber er den heiligen Michael jedesmal zur Rede stellte. Dieser suchte ihn zu beruhigen und sagte ihm, dass dies Pflaster die Busse für seine Sünden sei. Er solle jetzt nur still sein, denn nun ginge die Fahrt nach oben. Damit hängte er den Sack mit dem Geistlichen an einem Baum auf und ging davon. Der Geistliche wartete vergebens auf die Ankunft im Himmel. Die Fahrt kam ihm etwas lang vor, aber doch hielt er geduldig aus. Als es Tag geworden war, trieb ein Schweinehirt seine Herde des Weges. Als der Geistliche das Grunzen der Schweine vernahm, glaubte er nicht nach dem Himmel, sondern nach der Hölle zu steigen, da es ja im Himmel keine unreinen Tiere geben könne. Er fing deshalb laut zu schreien an und wurde nun von dem Schweinehirten von seiner luftigen Fahrt befreit. Der Knecht aber war längst über alle Berge.
Polen: Otto Knoop: Sagen aus Kujawien
DAS MADEJLAGER ... (Schmerzlager)

An einem düstern Tag im Herbst gelangte ein von einer weiten Reise heimkehrenden Kaufmann mit seinem Wagen, der mit Waren aus einer fremden Stadt schwer beladen war, um die Abendstunde in einen dichten Wald.
Nun hatte ihm sein Kutscher, obwohl es noch wenig früh war, geraten, sein Nachtlager in dem vorm Walde gelegenen Dörfchen aufzuschlagen, denn er wußte, daß sich der Wald über drei Meilen ausdehnte, überdies war Regen gefallen und der Weg, ohnehin nicht der beste, schwierig zu befahren, so daß man nicht früher als gegen Mitternacht beim nächsten Quartier ankommen würde. Jedoch der ungeduldige Kaufmann, der nach mehrmonatiger Abwesenheit so schnell wie möglich das eigene Haus erreichen und vor allen Dingen seine geliebte Frau wiedersehen wollte, mochte nicht soviel kostbare Zeit vergeuden; er beschloß also, doch bis zur Schenke hinterm Walde zu fahren, um schon am nächsten Tag den heimischen Flecken zu erreichen. Zu seinem Unglück wurde der Weg immer schlechter, auch erschwerte die undurchdringliche nächtliche Finsternis das Vorwärtskommen des überladenen Wagens, so daß der Kaufherr sehr bald ehrlich bedauerte, dem klugen Rat seines Dieners nicht gefolgt zu sein. Es blieb nun nichts anderes mehr übrig, als der göttlichen Fügung zu vertrauen und weiterzufahren. So hatten sie schon mit großer Mühsal die Hälfte des Waldes durchquert, als das Fuhrwerk plötzlich im Schlamm steckenblieb und auf keiner Weise von der Stelle zu bringen war. Umsonst hieb der eifrige Kutscher unter kräftig ermunterndem „Hüh! Hüh!“ angestrengt mit der Peitsche auf die ermüdeten Pferde ein; die armen Tiere wühlten sich immer tiefer in den bodenlosen Morast und versanken schließlich so im Schlamm, daß man sie nicht ohne fremde Hilfe von der Stelle bewegen konnte.
Was tun? Das Dorf war viel zu weit entfernt, um von dort Hilfe heranzuholen. Der arme Kaufmann befand sich in einer wahrlich bedauernswerten Lage. Müde, außer Atem von den angespannten Bemühungen, überdies durchnässt von dem zeitweilig tröpfelnden Regen, warf er sich am Ende verzweifelt auf den Boden, verfluchte den Weg und seinen unglückseligen Starrsinn, der ihn um diese Stunde in den Wald geführt hatte. Plötzlich erblickte er beim blassen schein des Mondes, der hinter den Wolken hervorsah, neben sich eine Gestalt. Im ersten Augenblick hielt er die Person mit dem kurzen, grünen Gewand für den Jäger des Forsts; das lodernde Gesicht, die scharfen Augen, die dürren, in Hühnerkrallen endenden Beine, auf denen er gleichsam schwebte, verrieten jedoch den Abgesandten der Hölle. Um sich noch besser vom Charakter des Ankömmlings zu überzeugen, bekreuzigte er sich unmerklich. Und obwohl der Höllenjäger ziemlich entfernt von ihm stand, zischte er vor Schmerz und wand sich in Krämpfen, während er dem Kaufmann zurief: „Laß diese dummen Flausen! Ich bin gekommen, dich zu retten: wenn du meine Hilfe nicht annehmen und in diesem Moor versinken willst, ist das deine Sache, du wirst nicht der erste sein, der an dieser stelle zu Tode gekommen ist.“
Als ihm der Kaufmann darauf nicht antwortete, setzte der Teufel, sein Schweigen als Einverständnis nehmend, hinzu: „Nun, ich sehe, Brüderchen, daß du Verstand hast und nicht warten willst, bis den Pferden der Schlamm überm Kopf zusammenschlägt, du möchtest lieber etwas verlieren als alles. Du weißt selbst sehr genau, daß nichts auf der Welt umsonst ist: ich bin gar nicht so habgierig, gib mir nur das, was du zu Hause hast, ohne davon zu wissen, und ich hole dich aus diesem Moor heraus.“ Der Kaufmann, darauf vertrauend, daß er sein ganzes Vermögen aufs Tüpfelchen genau aufzählen könnte, dachte bei sich: „Das muß noch ein Anfänger sein, ich sehe, daß er die Welt nicht kennt; er weiß nicht, daß die Leute heutzutage, und besonders die Kaufleute, ausgezeichnet rechnen können: ich werde aus seiner Dummheit den Nutzen ziehen.“ Als der Teufel seine Bereitwilligkeit sah, fügte er in boshaften, unterdrückte Freude verratendem Ton hinzu: „Trau, schau, wem; besser, wenn du mir einen kleinen Schuldschein ausstellst, weißt du doch selbst, daß man sich aufs nackte Wort nicht verlassen kann; und ich möchte die Sache bei Gericht nicht verlieren, wenn’s zum Prozeß kommt.“ Im Nu holte er aus dem Hemd einen Fetzen Ochsenhaut hervor, und nachdem er mit einem spitzen Taschenmesser dem Kaufmann etwas Blut aus dem Ringfinger gezapft hatte, stellte er das fragliche Dokument in optima forma aus. Er machte vor Freude einen Luftsprung, dann zog er auf geheimnisvoller Weise das Fuhrwerk aus dem Sumpf und führte es auf einen trockenen Platz.
Plötzlich peitschte ein heftiger Sturm durch die Zweige des dichten Waldes: das Teufelgesicht verschwand, nur ein fahler Schein, einem Irrlicht gleich, blinkte im Dickicht, in der Ferne aber ließ sich ein schrilles Pfeifen und ein höllisches Echo vernehmen: Ha, ha, ha! Unheilschwanger krächzten und schrien die aufgeschreckten Eulen, Käuzchen und Raben über dem Kopf des verängstigten Kaufmanns, ihnen antwortete das fürchterliche Geheul der Wölfe. Die Haare standen unseren Reisenden zu Berge, und sogar die armen ausgepeitschten Pferde nahmen ihre letzten Kräfte zusammen und bemühten sich mit gesträubten Mähnen, schnaubend und röchelnd, dem schrecklichen Ort zu entrinnen. Nach einer gewissen Zeit gelangten sie auf offenes Feld, dort erst erlaubte er den armen Tieren, Atem zu schöpfen, und erholte sich selbst von seinem Schrecken. Aber bald vermischte der sonnige und freundliche Morgen die Erinnerung an das nächtliche Grauen, und als die wohlbekannten Türme der heimatlichen Stadt am Horizont auftauchten, zog das nahe Heim seine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Als das beladene Fuhrwerk schon vor dem Haus stand, nahm die erfreute Ehefrau, die mit Sehnsucht nach dem heimkehrenden Mann ausgeschaut hatte, ihren Sohn auf den Arm, das ersehnte Pfand der Liebe, mit dem die Gunst des Himmels sie während der langen Abwesenheit des Mannes beschenkt hatte.
Mit dem Gefühl der lebhaftesten Freude eilte sie diesem Wiedersehen entgegen. Gerührt drückte der Vater die Mutter und den langersehnten Sohn an seine Brust und weinte Freudentränen; plötzlich jedoch, wie vom Blitzschlag getroffen, erinnerte er sich an den unglückseligen Teufelspakt: „Ach, wehe mir Unglücklichem, wehe mir Unglücklichem, wehe! Welch Unheil habe ich angerichtet! Du armes, unschuldiges Wesen!“ Danach warf er sich, das Gesicht in beide Hände gepresst, auf die Bank und weinte und schluchzte in größter Verzweiflung. Die über das unbegreifliche Verhalten des Mannes verwunderte Kaufmannsfrau stellte ihm tausenderlei Fragen, um den Grund für den Gram und die Traurigkeit des Mannes herauszufinden; sei es, daß er der empfindsamen Ehefrau diesen großen Harm ersparen wollte, sie vermochte nichts aus ihm herauszubringen. Nachdem der Tränenstrom versiegt war, verspürte der unglückselige Kaufmann ein wenig Erleichterung, wurde jedoch von nun an ohne Unterlaß von innerem Kummer geplagt; niemals stand nach diesem furchtbaren Abenteuer ein Lächeln auf seinen Lippen, lediglich geschäftliche oder häusliche Verrichtungen brachten ein wenig Vergessen und linderten seine inneren Qualen. Das geradezu engelhafte Lächeln des geliebten Kindes schien seine grausame Pein noch zu verdoppeln.
Inzwischen wuchs das kleine Kind heran und entwickelte vorzügliche körperliche und sittliche Talente. Die fürsorgliche Mutter, die sich ganz der Erziehung des einzigen Kindes widmete, pflanzte ihm frühzeitig den Keim der Tugend und Gottesfurcht ein; und auch der Vater liebte es, als sich seine Trauer ein wenig besänftigt hatte, am meisten mit dem Kind über die wunderbaren Erkenntnisse der Religion zu sprechen, um beizeiten seine Aufmerksamkeit auf die Erlösung der Seele zu richten. Er wunderte sich nicht, daß sich der Sohn, als er wesentliche Fortschritte in den Wissenschaften gemacht hatte, sich in Übereinstimmung mit dem elterlichen Wunsch für den geistlichen Stand entschied. Im Priesterseminar galt er nicht nur durch Fleiß und gründliches Studium, sondern auch seines vorzüglichen Verhaltens wegen bald als Vorbild. Er besaß die Liebe seiner Mitschüler, die Gunst der Vorgesetzten und war vollkommen glücklich; nur ein Umstand quälte ihn: wann immer er auch in den Ferien nach Hause fuhr, gewann er, statt im Gesicht des geliebten Vaters Freude zu gewahren, den Eindruck, daß jeder seiner Erfolge diesen nur mit tieferer Trauer erfüllte.
Schließlich, als er schon Diakon war und bald die Kaplanweihe empfangen sollte, paßte er während der letzten Ferien im Elternhaus den entsprechenden Moment ab und bat den Vater herzlich, ihm den Grund seines ständigen Kummers zu entdecken. Da konnte dieser nicht länger an sich halten, zumal er selbst schon bei sich beschlossen hatte, dem Sohn den verhängnisvollen Teufelshandel um seine Seele zu verraten. Der beherzte Klerikus fiel, nachdem er sich die ganze Angelegenheit ruhig angehört hatte, keineswegs in Furcht vor der ihm drohenden Gefahr. Er wollte sich vielmehr sofort auf den Weg in die Residenz des Teufels begeben, um der Hölle die Verschreibung seiner Seele zu entreißen. Zwar riet ihm der Vater von diesem kühnen Unternehmen ab, da er aber des Sohnes unerschütterlichen Willen sah und glaubte, daß der mit geistlichen Eigenschaften ausgestattete sich schneller gegen den Teufel Rat wüßte, gab er endlich seine Einwilligung. Der Klerikus geschützt durch die wirksamsten Reliquien, die ihn gegen die Angriffe des Satans verteidigen sollten, nahm als Waffen einen Weihwedel und einen geweihten Kessel mit sich.
Als er am dritten Tag seiner einsamen Wanderung einen dichten Wald erreichte, schritt er schneller aus, denn er wollte so schnell wie möglich dieses düstere Dickicht hinter sich lassen, aber vergeblich: je weiter er fort schritt, um so wilder und finsterer umgab ihn da Gestrüpp. Die Sonne neigte sich bereits gen Westen, schon fiel die große Dämmerung herein, und es begann stark zu regnen. Die Lage des Wanderers war tatsächlich bedauernswert, da erblickte er plötzlich von weitem zwischen dichtem Gesträuch ein schwaches Licht. Erfreut beschleunigte er seine Schritte und sah dicht vor sich im Dickicht eine dürftig zusammengeschlagene Lehmhütte. Wenn die entlegene und versteckte Behausung auch an eine Räuberhöhle erinnerte, in der Asyl zu suchen ihm nicht geraten schien, so überwogen doch Hunger, Not und Erschöpfung. Nach mehrmaligem Klopfen öffnete endlich eine hinfällige Greisin die Tür. Sie ließ den Wandersmann in die Kammer ein, die von einem glühenden Kaminfeuer erleuchtet wurde. Als sie ihn nun besser sehen konnte, erbarmte sie sich seiner Jugend und wohl auch des geistlichen Gewandes. Sie rief: „Mein liebes Kind, entfliehe auf schnellstem Wege, denn hier erwartet dich der unvermeidliche Tod.Mein Sohn ist ein Bandit, ich erwarte ihn jeden Augenblick, und wenn er dich hier vorfindet, bezahlst du deine Kühnheit mit dem Leben; um Gottes willen, entflieh! Er hat noch niemanden lebend aus seiner Hand gelassen.“ Aber der übermüdete Klerikus lechzte nach einer Stärkung und war bis auf den letzten Faden durchnässt, daß er lieber in der warmen Hütte bleiben wollte, als sich den Gefahren des Waldes auszusetzen. Er flehte die Alte an, daß sie ihn stärke und an einem sicheren Ort verberge. Kaum hatte er ein paar Brocken der mageren Kost zu sich genommen, als plötzlich gewaltig an die Tür geschlagen wurde.
Die verängstigte Frau versteckte ihn mit Mühe hinter den Ofen unter den Kienspänen und ging, die Tür zu öffnen. Der ungeduldige Räuber trat mit heftigen Schritten in die Kammer, brummte drohend vor sich hin, daß sie ihn so lange hatte draußen stehen lassen, danach aber ließ er seine Habichtsblicke durch den Raum schießen und witterte wie ein Spürhund, der die Fährte eines Wildes aufnimmt. „He, Mutter“, sagte er, ich rieche einen frischen Menschenleib; wo ist er? Oder willst du, daß ich dir mit meiner Keule den Kopf zertrümmere?“ Bevor das verängstigte Weiblein sich vom Fleck rühren konnte, sprang der mutige Klerikus, ohne das Äußerste abzuwarten, hinter dem Ofen hervor, hielt es doch für besser, selbst der schlimmsten Gefahr ins Auge zu blicken. Er nährte die Hoffnung, daß seine Diakonwürde, wenn schon nicht seine Jugend, das harte Räuberherz erweichen würde. Und so flehte er in demütiger Haltung um Mitleid. „Was Mitleid?“ donnerte mit furchtbarer Stimme der wutschnaubende Räuber. „Mitleid! Dieses Wort kenne ich nicht, wenn unter den Schlägen meines Knüppels dein Hirn zerspritzt, wird das mein Mitleid sein. Aber warte, ich werde dir eine Gnade erweisen: knie nieder und bereite dich auf den Tod vor; aber kurz, denn ich liebe keine langen Zeremonien.“
Als der unglückselige Jüngling sich plötzlich vor den Toren der Ewigkeit sah, ohne daß er zuvor aus dem Höllenrachen seine Seelenverschreibung zurückerlangt hatte, sprach er mit so eindringlicher, herzzereißender Stimme von der doppelten, der körperlichen und der seelischen Gefahr, die ihm drohte, daß der rasende Räuber die erhobene Keule sinken ließ und nachdenklich nach den näheren Gründen der Höllenwanderung fragte. Der redegewandte, Klerikus erzählte ausführlich die ganze Geschichte, und er wiederholte die Bitte, seine Seele nicht aufs Spiel zu setzen und unrettbar den teuflischen Mächten auszuliefern; er könnte ausgestattet mit wirksamen Mitteln, um den teuflischen Angriffen standzuhalten, lebendig schneller die satanischen Kräfte überwältigen.
Der Räuber verblüfft von diesem doppelten Anschlag auf Körper und Seele, stand lange gedankenverloren da, endlich ließ er sich mir düsterer Stimme vernehmen: „Du bist der erste, der meinen Händen heil entschlüpft; ich lasse dich frei, aber nur unter der Bedingung, daß du auf dem Rückweg zu mir kommst und mir erzählst, was du in der Hölle gesehen und gehört hast; ich habe wichtige Gründe dafür, die du leicht erraten kannst.“ Der Diakon gab sein feierliches Versprechen erfreut, daß ihm gelungen war, sein Leben zu retten und das Herz des harten Räubers zu erweichen. Nachdem sie dieses Geschäft, wie es sie dünkte, zur beiderseitigen Zufriedenheit erledigt hatten, nahmen sie schweigend das bereitete Abendessen ein, danach legten sie sich zu Bett, und am nächsten Tag im Morgengrauen begab sich der Diakon, ein frommes Morgenlied summend, auf die weitere Reise. Er ging über Felder und Berge, durch Wälder und Wiesen und sah sich plötzlich vor den Toren der Hölle.
Feuerschlünde, aus denen zwei dicke Rauchwolken brachen, zeigten den Hauptsitz der teuflischen Macht an. Das Rauschen lodernder Wogen, das durch dringende Pfeifen der Winde, das furchtbare Gepolter, das an den Lärm sich drehender Mühlräder erinnerte, das Zischen von Ottern, das furchtbare Gebrüll Gefolterter – all das schuf ein entsetzliches, wahrhaft höllisches Chaos des Schreckens und des Grauens. Doch der beherzte Jüngling vertraute der Kraft seiner heiligen Talismane, vor allem aber der Reinheit seines Gewissens, und war zum Kampf mit der Hölle bereit. Er zog die geweihte Kreide der Heiligen Drei Könige, die Skapuliere und heilige Reliquien heraus, tauchte dreimal den Weihwedel in geweihtes Wasser, stimmte danach das Lied: „Wer sich in den Schutz des Herrn begibt“ an und tauchte mutigen Schritts ein in den Höllenkrater.
Was sein Auge dort erblickte, sein Ohr dort vernahm, das vermag keine menschliche Hand nachzuzeichnen: hier rollte sich ein schreckliches Ungeheuer mit zischender Zunge zu einem Knäuel zusammen und ließ gräuliche Schwaden aufsteigen; dort sperrte ein anderes seinen schwarzen Rachen auf, schnalzte mit der Zungenspitze und spie Flammen; hier brauste eine brennende Woge heran, dort öffnete sich der schwarze Schlund eines bodenlosen Abgrunds; wieder woanders glaubte man sich in eine Eisenhütte versetzt, wo gewaltige Öfen und Feuergluten ausatmeten, bei denen flinke Teufel die armen Seelen mit Zangen rösteten und danach mit gewaltigem Hammer auf glühendem Amboß schmiedeten. Seufzer, Jammer, Verzweiflung und wütendes Zähneknirschen, das drohende Schimpfen der Teufel und ihr höhnisches Gelächter; das Poltern, Rumpeln und Rattern der Marterinstrumente waren derart fürchterlich, daß man viel Mut und ein so wichtiges Anliegen haben mußte wie der Klerikus, um die angsterfüllten Schritte nicht rückwärts zu lenken. Gleichsam unerschütterlich in seinem Entschluß, schritt er kühn voran, schwenkte flink den Weihwedel und stürmte, auf diese Weise sich Platz schaffend, geradewegs zu Luzifer, dem obersten Höllenfürsten.
Als er vor ihm stand, sagte er ihm geradeheraus, daß er wegen dem Dokument gekommen sei, welches einer der Teufel auf so unredliche Art seinem Vater abgelistet hatte. Da aber Luzifer nicht allzu viel Lust zeigte, auf diese gerechte Forderung einzugehen, begann er, um seinen Worten von vornherein das rechte Gewicht zu verleihen, bereitete er ihm mit seinen Weihwedeln ein so heißes Bad, daß der arme Teufel vor Schmerzen brüllte, sich wie rasend hin und her warf und um ein Haar die Kette zerrissen hätte, mit der er an seinen Höllenthron geschmiedet war. In dieser Lage blieb Luzifer nichts anderes übrig, als dem Gesuch des hartnäckigen Bittstellers zu entsprechen; er ließ also den Besitzer des Seelenwechsels kommen und befahl ihm, das Dokument augenblicks ohne Gegenwert auszuhändigen. Es war dies der berühmte spindeldürre Seelenfänger Asmodeus, der auf einem Bein hinkte und über die Maßen ungefällig und knauserig war, wenn er einen Groschen, der schon seine Schatulle füllte, wieder herausgeben sollte. Verbissen wehrte er sich also dagegen, das strittige Schriftstück herauszugeben.
Dieser Verstoß gegen die Subordination zog eine Ordnungsstrafe nach sich: man spannte Asmodeus um ihn zur Auslieferung des Schuldscheins zu zwingen, auf die Folter; dieser hartgesottene Bösewicht ertrug jedoch die schrecklichsten Plagen, mit denen ihn der Höllenhenker quälte, mit solchem Ingrimm und Eigensinn, daß sich jegliche Hoffnung auf einen günstigen Ausgang zu verflüchtigen schien. Bei all dem verlor der Diakon, für den die Angelegenheit so ungemein wichtig war, nicht die Zuversicht. Mit doppeltem Ingrimm ging er auf Luzifer los, erst mit dem Weihwedel, dann mit dem Skapulier, und schließlich, als das Weihwasser schon alle war, schwenkte er den geweihten Kessel und bedrängte den Höllenfürsten derart, daß dieser unter den schrecklichsten Schmerzen aufheulte: „Legt ihn auf das Madejelager“ (Schmerzenslager). Als Amodeus diese Worte vernahm, warf er dem Klerikus in größter Wut das Dokument vor die Füße. Das war nämlich die schrecklichste Höllenfolter; ausgerüstet mit den besten englischen Rasiermessern, schnitt es den Körper......
Nachdem der Klerikus seine Angelegenheit in der Hölle erledigt hatte, überlegte er sich den Rückzug; der gelang ihm ebenso großartig wie einem Heerführer, der im ersten Ansturm den Feind in die Enge treiben konnte. Obwohl er beherzten Sinnes diesen Feldzug angetreten hatte, stieß er doch, als er endlich das Höllenreich verließ und die Strahlen der Sonne erblickte, unter tiefem Seufzer: „Gelobt sei Gott“ aus, und er fiel auf die Knie und sandte dem Himmel heißen Dank für seinen mächtigen Schutz, danach kehrte er zufrieden auf dem gleichen Wege zurück. Als er durch jenen Wald kam, erinnerte er sich des gegebenen Wortes; er machte also den Umweg über die Hütte des Räubers, dem er alles aufs genaueste erzählte und hinzufügte, das erst die Androhung des Madejlagers den Teufel gezwungen hätte, das Schriftstück herauszugeben. Bei diesen Worten erblasste der kaltblütige Mörder, dann aber rang er in größter Verzweiflung die Hände und rief: „Ich bin jener Madej, für mich sind diese Qualen vorbereitet: wehe mir, ach, wehe! Das Maß meiner Verbrechen ist so groß, daß es für mich keine Hoffnung mehr gibt.“
Nach diesen Worten wälzte er sich auf der Erde im Staub, zerkratzte sich das Gesicht mit den Nägeln und kam fast von Sinnen. Der von tiefem Schmerz gerührte Diakon sagte, um ihn zu trösten, die Barmherzigkeit Gottes sei grenzenlos und keine Sünde so groß, daß Gott sie nicht vergeben könne – wenn sich der Sünder nur mit wahrer Bußfertigkeit an ihn wende. Diese Erklärungen beruhigten den Übeltäter ein wenig und hatten eine heilsame Wirkung: er legte augenblicklich einen feierlichen Eid ab, daß er sein grausames Handwerk verwerfen und die ihm noch verbleibende Lebenszeit in der allerhärtesten Buße verbringen werde. Mehr noch, er fiel dem Klerikus zu Füßen, bat und beschwor ihm unter Tränen, daß er ihm helfen möge, sich vor Gott zu rechtfertigen. Vergeblich berief sich dieser darauf, daß er keine Beichte abnehmen durfte; der fanatische Büßer erfleht so eindringlich diese einzige Gnade, bereitete mit soviel Empfindsamkeit sein reuiges Herz vor ihm aus, daß jener es ihm nicht versagen konnte, um so mehr, als der Räuber einzig in ihm, der in der besonderen Gnade Gottes stand, seine ganze Hoffnung.
Er nahm also seinen Stab, steckte ihn in die Erde und hörte, nachdem er Madej geheißen hatte, daneben niederzuknien, dessen lange furchtbare Beichte an, danach sprach er zu ihm: „Sündige Seele, ich kann dich nicht freisprechen, selbst wenn deine Schuld geringer wäre, weil ich noch nicht zum Kaplan geweiht wurde: aber verzweifle nicht, hab Vertrauen zu Gott, bereue von ganzem Herzen, benetze diese Erde mit deinen Tränen, dann wird der Himmel deine Bitte erhören und dir einen Kaplan senden, der die Absolution erteilt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich zu dir kommen, sobald ich nur Macht zur Sündenvergebung erlangt habe.“ Nachdem er das gesagt hatte, empfahl er ihn mit heißen Gebet der Barmherzigkeit Gottes und begab sich auf den Weg, denn er konnte den bedauernswerten Anblick nicht länger ertragen. Wenig später überschritt er mit großer Freude die Schwelle des elterlichen Hauses.
Das Glück über seine Ankunft war um so größer, als er den Vater von seiner Pein entbinden konnte. Die Eltern überschütteten ihn mit Zärtlichkeiten und vergossen Tränen der Freude, daß ihnen der Himmel solch ein Kind geschenkt hatte. Wenig später erhielt der junge Diakon, der immer und überall in Wissen und Tugend allen voranging, aus den Händen des Bischofs die Priesterweihe: er wurde Kaplan, und wegen seines großen Wissens und um seines edlen Herzens willen stieg er mit größter Gewissenhaftigkeit, so daß er sich durch seine Hingabe für das Wohl der Menschheit allgemeine Achtung erwarb und nach dem Tode des Bischofs dessen Nachfolger wurde.
Nun traf es sich, daß er einmal in Angelegenheiten auf einer ziemlich langen Reise war und durch einen dichten Wald kam, wo ihn der Wohlgeruch von Äpfeln anlockte, die ihn von einem in der Nähe stehenden Apfelbaum in Scharlachrot und Gold anzulächeln schienen. Er bat also seinen Kutscher, anzuhalten und ihm einige dieser schönen Äpfel zu pflücken; als jener sich aber dem Baum näherte und die Hand eifrig nach den Früchten ausstreckte, vernahm er die Worte: „Nur der, der mich gepflanzt hat, darf mich pflücken.“ Der verängstigte Diener lief zu seinem Herrn und berichtete ihm von der merkwürdigen Begebenheit. Diese unverständlichen Worte riefen ihm die Erinnerung an das frühere Erleben wach: Ihm fiel das einst gegebene Versprechen der Sündenvergebung ein, das er über seinen wichtigen Pflichten vergessen hatte, also legte er das Kaplangewand an und ging eilends zu dem Apfelbaum.
Hier unter dem Baum sah er einen knienden, zur Erde gebeugten Alten, dessen weißer Bart bis zu den Knien niederwallte. In ihm erkannte er den Büßer. Nachdem er seine Seele Gott überantwortet hatte, machte er über ihm das Zeichen des heiligen Kreuzes und gab ihm die Absolution. Jedoch als er ihn mit dem Finger berührte, verfiel der Leib zu staub, die goldenen Äpfel aber flogen als erlöste Seelen zu Himmel.
Quelle: Berwinski, R., Madejowe loze, 1835 Poznan
DIE MACHT DES BÜCHLEINS ...
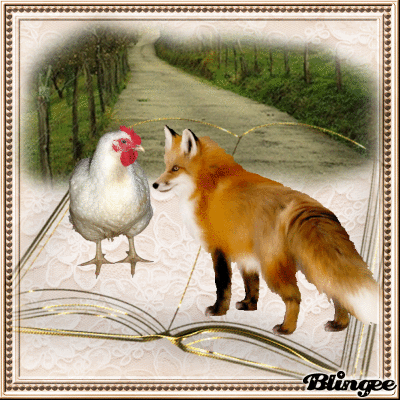
Es war einmal ein Vater, der ein einziges Kind – einen Jungen – hatte. Bei denen zu Hause herrschte riesige Armut. Der Sohn musste also fort in die weite Welt, um Arbeit zu suchen. Die fand er auch bei einem reichen Bauern, der sehr viele Bücher besaß. „Du kannst lesen, was du willst, nur das kleine Büchlein fasse nicht an“, befahl der wohlhabende Gutsbesitzer dem Jungen.
Drei Jahre lang war der Junge bei dem Herrn und hatte alle dort stehende Bücher schon gelesen mit der Ausnahme des einen. Eines Tages fuhr der Bauer fort, und sein Diener blieb in dem Herrenhaus alleine. „Was kann denn darin stehen, dachte er, dass ich es nicht lesen darf?“ Seine Neugier war so groß, dass er, ohne auf das Verbot seines Herren zu achten, das Büchlein durchlas. In dem Moment, als er mit der letzten Seite fertig war, stellte sich heraus, dass er zaubern konnte.
Der Junge wünschte sich den Vater zu sehen, da kam eine Wolke, die ihn einhüllte und zum Haus seiner Familie brachte. „Wundert euch nicht, dass ich hier bin. Ich kann zaubern“ sagte der Sohn zum Vater. „Unsere Armut hat ab jetzt ein Ende, ab jetzt bekommen wir all' das, was wir uns wünschen.“ Dann schlug er vor: „Vater, ich verwandele mich in ein Pferd, und du wirst mich zum Markt führen und dort für 300 Taler verkaufen. Gleich nach dem Verkauf nimm mir bitte die Zügel ab, sonst bleibe ich bis zu meinem Lebensende ein Pferd.“
In der Zwischenzeit kehrte der reicher Bauer zurück und stellte fest, dass sein Büchlein sowie der Diener fort waren. Schnellstens begab er sich zum Markt und sah sofort ein Pferd, in dem er seinen Diener erkannte. Er fragte den Vater, was er dafür verlange. Als Antwort bekam er "300 Taler" zu hören. Er bezahlte diese Summe, und in dem Moment, als der Vater die Zügel runternehmen wollte, sagte er: „Nein, die bleiben beim Pferd.“ Im Pferdestall bat das Pferd einen Knecht, ihn von den Zügeln zu lösen. Der wunderte sich zwar, dass das Pferd reden konnte, half ihm aber. Das Pferd verwandelte sich sofort in eine Taube und flog fort.
Der Herr sah es, verwandelte sich in einen Habicht und nahm die Verfolgung auf. Er meinte, ihn schon zu haben, da wurde aus der Taube ein Haferkorn, das auf die Erde fiel. Der Habicht verwandelte sich sofort in eine Henne, die das Korn aufessen wollte, aus dem Korn wurde jedoch ein Fuchs, der die Henne am Kopf packte und erdrosselte.
So verlor der böse Herr sein Leben, und der Vater mit dem Sohn lebten seitdem im Frieden.
Quelle: Polen - Kaschuben
DIE PRINZESSIN UND DIE ZERTANZTEN SCHUHE ...
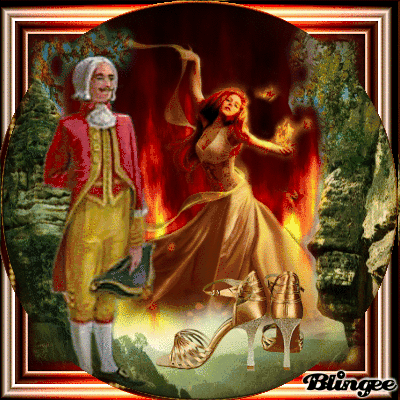
Ein großer König hatte eine Frau, der er jeden Tag fünfzehn Paar Schuhe kaufen musste. Und er hatte einen alten Soldaten als Diener. Jede Nacht um die zwölfte Stunde verschwand die Frau, und niemand vermochte herausfinden, wohin sie ging. Da fragte der König seinen alten Soldaten, ob er nicht auf sie Acht geben könnte. Der Soldat passte auf.
Als aber die zwölfte Stunde heranrückte, übermannte ihn der Schlaf und er hatte nichts gesehen. Nicht anders erging es ihm in der zweiten Nacht, doch für die dritte Nacht zerhackte er Schlehdornzweige und schichtete sie rings um sich auf. Als ihn der Schlaf anwandelte, fiel er von seinem Sitz mitten in die Schlehdornzweige und stach sich, so dass er nicht einschlafen konnte.
Das ging so lange, bis mit einem Mal eine Karosse angefahren kam; die Prinzessin stand mit ihren Tanzschuhen schon bereit und stieg ein. Und der Soldat – der schwang sich hinten auf den Kutschkasten, ohne dass sie es bemerkte. Und sie fuhren und fuhren, direkt in die Hölle. Und eine Musik war dort! Sie tanzte in einer Weise, dass sie alle Schuhe zertanzte.
Der Soldat stand an der Tür, und die Lust zu tanzen überkam auch ihn. Er tanzte und tanzte und wetzte seine Stiefel durch, so dass er mit nackten Füßen da stand. Die Prinzessin aber zog ihr letztes Paar Schuhe an, setzte sich in die Karosse und fuhr nach Hause. Zu Hause angekommen, schilderte der alte Soldat seinem König den Höllentanz und berichtete, dass die Gnädige, dort beim Tanzen fünfzehn Paar Schuhe durchgewetzt hätte.
Danach rief der König alle Priester zusammen, und diese nahmen die Prinzessin in ihre Mitte. Als am nächsten Abend wieder die zwölfte Stunde heranrückte, sandten die Teufel die Kalesche nach ihr aus. Da versuchte sie sich loszureißen, aber jene gaben sie nicht frei; und sie hauchte in ihren Armen das Leben aus. Man begrub sie in der Kirche unter dem Altar. Aber Nacht für Nacht machte sie dort einen gewaltigen Lärm.
Der Soldat ging für eine Nacht in die Kirche. Als die zwölfte Stunde herankam, erhob sich die Prinzessin aus dem Sarg und jagte durch die Kirche, der Soldat aber legte sich in ihren Sarg. Und als die Zeit abgelaufen war, kehrte sie zum Sarg zurück. Dort jedoch lag der Soldat. Sie zerrte ihn am Arm, und sie schrie ihn an, er solle sie hineinlassen; da er aber nicht wollte, musste sie bis zum hellen Morgen draußen bleiben.
In der Frühe, als die anderen kamen, saß sie in der Kirchenbank, und sie lebte. Da halfen ihr die Pfarrer, sich von den Teufeln loszusagen, und endlich ließen die sie in Frieden. Und fortan war sie so, wie es sich gehört.
Quelle: Sage aus Polen Saloni, A. Lud
SCHWESTER UND BRAUT ...
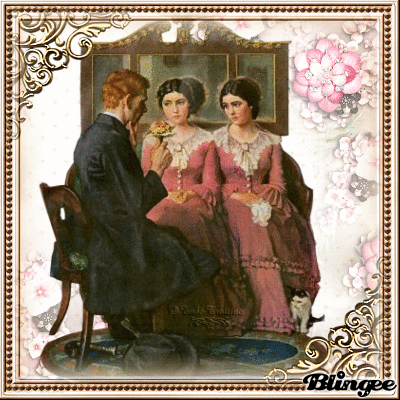
Ein junger König hatte eine schöne Schwester und wollte auch gerne heiraten, konnte aber keine Prinzessin finden, die so schön gewesen wäre wie seine Schwester. Da bot sich diese an, für ihn eine schöne Braut zu suchen, und reiste zu diesem Zweck im Lande umher. Als sie nun schon lange unterwegs gewesen war und auch viele andere Länder durchreist hatte, kam sie in einem Wald an ein kleines Hüttchen, in welchem am Fenster ein sehr schönes Mädchen saß und webte. Dies fiel ihr auf, und sie merkte sogleich, daß dieses Mädchen und kein anderes ihrem Bruder zur Frau bestimmt sei.
Sie ging in die Hütte hinein und machte mit dem Mädchen Bekanntschaft, und beide gewannen einander sehr lieb. Die Prinzessin erzählte dem fremden Mädchen auch, zu welchem Zwecke sie umherreise, und sagte ihr dann, daß sie jetzt die Braut für ihren Bruder gefunden habe, nämlich sie selbst, und sie müßte nun auch gleich zu ihrem Bruder sie begleiten. Das junge Mädchen war darüber sehr erfreut und sagte: »Ja, ich will sehr gerne die Frau deines Bruders werden, aber erstens muß ich zuvor noch die Leinwand ausweben, die auf dem Webstuhl ist, und das wird einige Zeit dauern, und zweitens ist meine Mutter eine Hexe und wird mich nicht gehen lassen wollen, da werden wir viel aushalten müssen. Jetzt ist sie nicht zu Hause, aber ich merke, daß sie nur noch dreißig Meilen von hier entfernt ist, und wenn sie dich hier findet, so bringt sie dich um. Ich will dich daher in eine Kohle verwandeln, dann findet sie dich nicht«. Das tat sie denn auch und legte sie unter die anderen Kohlen in den Ofen.
Als nun die Mutter ankam, roch sie gleich, daß sich ein Mensch in ihrem Hause befände, aber die Tochter versicherte, daß dies nicht der Fall sei; auch sei es ja unmöglich, daß in diese Wildniss je ein Mensch kommen könne; und so beruhigte sie sich. Als sie den andern Tag wieder das Haus verließ, ihren Geschäften nachzugehen, verwandelte ihre Tochter die Kohle wieder in die Prinzessin und sie webten fleißig, um bald fertig zu werden. Als aber die Hexe dem Hause sich wieder näherte, und die Tochter dieses merkte verwandelte sie die Prinzessin in eine Erbse und legte dieselbe unter die anderen Erbsen in ein Gefäß.
Die Alte kam und fragte wieder: »Es riecht mir hier nach Menschenfleisch«, wogegen die Tochter versicherte, daß dies nicht möglich sei. »Hast Du für mich nicht etwas zu essen?« fragte die Alte. »Nichts weiter als jene rohen Erbsen«, antwortete die Tochter. Nun setzt sich die Hexe an die Erbsen und fraß fast alle auf, nur drei bleiben übrig, aber darunter auch die Prinzessin. Den dritten Tag, als die Alte wieder weggegangen war, entzauberte das Mädchen die Prinzessin wieder, sie arbeiteten eifrig fort und webten die Leinwand zu Ende, und machten sich auf den Weg in die Heimat der Prinzessin.
Die Tochter der Hexe nahm aber zur Vorsicht einen Kamm, eine Bürste und ein Ei mit. Die alte Hexe kam mittlerweile nach Hause, und als sie die Tochter nicht zu Hause fand, merkte sie gleich, was geschehen war, rüstete sich aus und setzte ihnen nach. Die beiden jungen Mädchen sehen sich, weil sie das fürchten mußten, alle Augenblicke ängstlich um und erkennen zu ihrem Schrecken, daß sie ihnen wirklich nachfolgt und sich ihnen immer mehr und mehr nähert. Als sie ihnen schon ganz nahe ist, wirft die Tochter die Bürste hinter sich, und es entsteht ein dichter, wild verwachsener Wald, in den Niemand eindringen kann. Nun kann die Alte nicht weiter und muß erst zurück und von zu Hause eine Axt holen, um sich einen Weg durchzuhauen. Wie sie damit fertig ist, will sie die Axt unter einen Strauch legen, da hört sie aber einen Vogel, wie der singt: »Ich werde aufpassen, wo die Axt hingelegt wird, da werde ich sie mir dann holen!« »Oho, das sollst du nicht«, antwortet die Alte und läuft wieder zurück, um die Axt zu Hause zu verwahren.
Nun läuft sie wieder den Mädchen nach, und da sie viel größere Schritte nehmen kann, als irgend ein Mensch, so ist sie ihnen bald so nahe, daß sie fürchten müssen, jeden Augenblick von ihr ergriffen zu werden. In ihrer Angst wirft die Tochter der Hexe den Kamm hinter sich, und es entstehen Schluchten und Berge und Felsen, daß kein Mensch im Stande ist, hinüber zu kommen. Nun muß die Alte wieder nach Hause, einen Spaten zu holen. Als sie sich endlich einen schmalen Weg geebnet hat, will sie, um nun schnell weiter zu kommen, den Spaten nur unter einem Strauch verstecken, da singt derselbe Vogel wieder: »Ich werde aufpassen, wo der Spaten hingelegt wird, da werde ich ihn mir dann holen!« Die Hexe muß also wieder nach Hause, um den Spaten dort zu verwahren.
Als sie darauf den Mädchen zum dritten Male schon ganz nahe gekommen war, wirft ihre Tochter das Ei hinter sich, und es entsteht ein großer zugefrorener See, und das Eis darauf ist spiegelglatt. Wie die Alte hinüber will, fällt sie hin und bricht sich Hals und Bein. Nun können die Mädchen ruhig weiter ziehen. Als sie in das Land gekommen waren, wo die Prinzessin zu Hause war, und sich schon dem Schlosse näherten, wo der Bruder der Prinzessin wohnte, da verwandelte die Tochter der Hexe sich und die Prinzessin in zwei Tauben, und sie nährten sich in dieser Gestalt einige Tage lang in des Königs Hirsefeld.
Eines Tags geht nun der Diener des Königs durch das Feld und hört, wie eine Taube singt: »Ich bin die Schwester des Königs, habe Länder durchreist, um ihm eine Braut zu suchen, und hier ist dieselbe auch.« Das erzählte der Diener sogleich dem Könige, der schickte einen andern Diener in das Feld, zu erforschen, ob es auch wahr wäre, was jener erzählt hatte, und als dieser es bestätigte, ging er selbst hin, um sich selbst zu überzeugen. Er hört dieselben Worte der Taube und ist sehr betrübt darüber, daß die Mädchen Vögel geworden sind, beschließt aber doch, sie zu fangen. Dies gelang endlich nach vieler Mühe, und in demselben Augenblick wurden die Tauben wieder zu Mädchen.
Aber die beiden Mädchen waren einander in allen Stücken so vollständig gleich, daß der König nicht erkennen konnte, welches die Schwester, und welches die Braut sei, und so konnte denn auch aus der Heirat vorerst noch nichts werden. Der König war hierüber sehr traurig. Als er eines Tages so recht betrübt durch die Straßen der Stadt ging, begegnete ihm eine Fleischerfrau und fragte ihn, warum er so betrübt sei. Er klagte ihr seine ganze Not, und daß er nun nach so langem Warten, da die Braut in seinem Schlosse wäre, Schwester und Braut nicht unterscheiden könne.
»O, dafür weiß ich Rat«, sagte die Frau; »nehmen Sie nur von uns Blut in einer Schweinsblase und befestigen Sie sich diese irgendwie auf der Brust; dann stellen Sie sich so recht traurig und verzagt, nehmen ein Messer aus der Tasche und tun so, als wenn Sie sich erstechen; wenn dann die Mädchen das Blut sehen werden, dann werden sie zu Ihnen hinstürzen, und die Schwester wird zu Kopfende und die Braut zu Fußende sein.« Der König befolgte den Rat, und als nun die Braut zu seinen Füßen um ihn beschäftigt war, da stand er auf und hielt sie fest und sagte ihnen, warum er sie so erschreckt hätte.
Die Mädchen aber nahmen fortan, jede ihre wirkliche Gestalt an, da waren sie einander wohl sehr ähnlich, aber doch von einander zu unterscheiden. Nun feierte der König die Hochzeit mit seiner Braut, und sie lebten mit einander glücklich viele Jahre.
Aus Klein-Jerutten, Polen: M. Toeppen: Märchen aus Masuren
DIE TIERE IM WALDHAUS UND DIE BEIDEN SCHWESTERN ...

Ein Witwer, der eine Tochter hatte, heiratete eine Witwe, die ebenfalls eine Tochter besaß. Die Frau konnte aber ihre Stieftochter nicht leiden. Deshalb buk sie ihr eines Tages einen Aschenkuchen, führte sie tief in den Wald hinein und ließ sie dort allein. Das junge Mädchen irrte lange im Walde umher; endlich kam sie zu einem Hause, in dem ein Hahn, ein Hund und eine Katze sassen. Sie teilte ihren Aschenkuchen mit den Tieren und blieb dann bei ihnen.
Da klopfte es einmal an die Tür. Das Mädchen fragte die Tiere, ob sie die Tür öffnen solle. 'Nein', lautete die Antwort; 'verlange erst, dass man dir einen Stall aufbaut!' Das Mädchen tat es. Als der Stall dastand, klopfte es wieder. 'Soll ich öffnen?' fragte das Mädchen. 'Mach nicht auf', sagten die Tiere, 'bis man dir den Stall mit Kühen gefüllt hat!' und das Mädchen forderte von dem Klopfenden, dass er den Stall mit Kühen fülle. Als das geschehen war, klopfte es zum dritten Mal. Da forderte das Mädchen Kutsche, Pferde und Diener, und als sie das alles erhalten hatte, setzte sie sich in die Kutsche und fuhr zu ihren Eltern. Diesen erzählte sie, was sie im Walde bei den Tieren erlebt hatte.
Da buk die Frau ihrer Tochter einen Kuchen von Weizenmehl und schickte sie in den Wald. Sie kam ebenfalls zu dem Hause, in dem die Tiere wohnten, aber sie aß ihren Kuchen allein auf und gab den Tieren nichts. Da klopfte es wieder an die Tür, und das Mädchen fragte die Tiere, ob sie öffnen solle. Doch die Tiere wollten ihr keinen Rat geben, und so verlangte sie dasselbe, was vorher ihre Stiefschwester verlangt hatte. Dasselbe geschah zum zweiten und dritten Male. Wie sie nun in die Kutsche steigen wollte, da wurde ihr der Kopf abgerissen, und ihre Haut wurde an die Tür des Waldhauses gehängt.
Lange wartete nun die Mutter auf ihre Tochter, und da diese immer noch nicht kam, sagte sie: 'Unsere Tochter ist reich geworden und denkt nicht mehr an uns; wir müssen zu ihr hin.' Als sie zu dem Waldhaus kam, sah sie die Haut ihrer Tochter an der Tür hängen; aber sie dachte, es wären Vorhänge. Da aber schrie der Hahn: 'Kukuruku, twoja córka wisi tu!' (Kukuruku, deine Tochter hängt hier). Jetzt erst erkannte sie, dass die Haut ihrer Tochter an der Tür hing.
Oberschlesische Märchen, Polen: Otto Knoop: Sagen aus Kujawien
WIE AUS DEM KNECHT EIN HERR WURDE ...
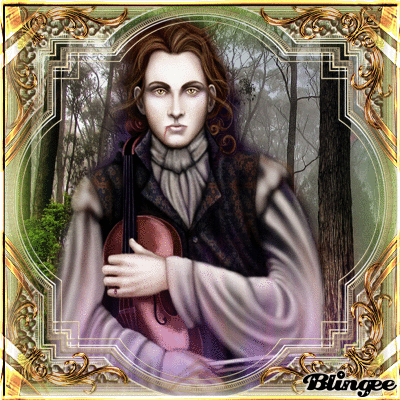
In einem Dorf lebte ein sehr armer Mann, er hieß Maciej. Auf dem Gut diente er als Knecht; arbeitete, ohne zu murren, vom Sonnenaufgang bis lange nach Sonnenuntergang wie ein Ochse, aber er konnte sich nichts erarbeiten. Eines Tages, als er gerade Holz spaltete, ging ein sehr schönes Fräulein an ihm vorbei und sprach: „Viel Glück bei der Arbeit!“ „Gott vergelt’s“, antwortete der Knecht. Das Fräulein blieb stehen und sah ihm interessiert zu, sie betrachtete den Knecht sehr aufmerksam und sagte schließlich: „Möchtest du nicht mein Mann werden?“
Der Knecht wunderte sich und dachte: „Wieso will dieses Fräulein mich zum Manne haben, einen zerlumpten Menschen, einen armen Schlucker?“ „Nun, denkt mal darüber nach, Maciej, und sagt mir, habt Ihr nicht Lust, mich zur Frau zu nehmen?“ Der Knecht kratzte sich hinterm Ohr, sah das Fräulein von der Seite an und sprach: „Wenn sich das Fräulein mit einem armen Schlucker nicht bloß einen Scherz erlauben will, so wäre ich wohl nicht dagegen.“ „Einverstanden, Maciej, von heute an sind wir verlobt.“
Das Fräulein ging ins Dorf, nahm sich eine Wohnung, kaufte verschiedene Gerätschaften und Hausrat ein. Mit einem Wort, sie stattete die ganze Wirtschaft aus. Maciej kam, um sie zu besuchen. Er betrachtete sie; ein Mädchen, schön wie ein Bild, und ihn überkam großes Verlangen, sie zu besitzen, sich so schnell wie möglich mit ihr zu vermählen, doch zu allem Unglück besaß er nicht nur das notwendige Geld für das Aufgebot, sondern auch für anständige Kleidung, die er nicht kaufen sollte. Dann bat sie ihn, alle Leute aus dem Dorf zu ihrer Hochzeit zu bitten, nur den Gutsherrn sollte er um nichts in der Welt einladen. „Lade den Gutsherrn nicht zur Hochzeit ein“, ermahnte sie ihn, „denn sonst wirst du sehen, daß dir ein Unglück zustößt.“
Sie kauften alles, was erforderlich war, in großen Mengen ein, brieten und buken, stellten die Tische bereit und fuhren dann zur Trauung. Nach der Trauung ging Maciej mit seiner hübschen Frau von Bauernkate zu Bauernkate, und sie luden die Leute zur Hochzeit ein. Sie luden alle ein, nur den Gutsherrn ließen sie aus, Maciej küßte seiner Frau die Hand und bat sie, doch den Gutsherrn auch zu ihrer Hochzeit einzuladen. „Wir haben doch von allem ausreichend da, was schadet es da schon, wenn wir auch den Herrn einladen.“ „Wenn du diesen Herrn durchaus einladen willst. so lade ihn eben ein“, antwortete sie, „aber ich sag dir nochmals, daß dir dies Unglück bringen wird.“
So luden sie also auch den Gutsherrn ein. Sie platzierten ihn in einem besonderen Zimmer und bewirteten ihn mit den besten Speisen und Getränken, die sie nur zu bieten hatten. Als der Gutsherr Maciejs Frau erblickte, hörte er auf zu essen, sah bloß immerzu zu ihr hin und verschlang sie förmlich mit seinen Augen. Das merkte auch Maciej und sagte darauf zu seiner Frau: „Der Herr sieht dich immerfort so eigen an!“ „Ich habe dir nicht gesagt, lade diesen Herrn nicht ein, weil dir sonst Böses widerfahren wird?“
Nach der Hochzeitsfeier rief der Gutsherr seinen Verwalter zu sich und beriet mit ihm, wie man Maciej wohl am besten loswerden könnte, um an dessen Frau zu gelangen. Da riet der Verwalter dem Gutsherrn: „Man könnte ihm doch befehlen, das große Feld an einem Tag zu pflügen.“ Der Herr ließ Maciej auf den Gutshof rufen und sagte: „Höre, Maciej, du wirst mit das große Feld an einem einzigen Tag umpflügen, schaffst du es aber nicht, dann kostet’s dich dein Leben!“ Maciej war sehr bekümmert und vergoß bittere Tränen. Weinend trat er vor seiner Frau, die ihn fragte: „Weshalb weinst du denn, Maciej?“ „Wie soll ich nicht weinen, da mir der Herr befahl, das große Feld an einem einzigen Tag umzupflügen, und mir mit dem Tode drohte, wenn ich es nicht schaffe.“
„Da hast du es! Habe ich dir nicht gesagt, lade diesen Herrn nicht ein, weil sonst das Unglück über dich kommt? Du hast auf mich nicht hören wollen. Aber sorge dich nicht so sehr, es wird noch alles gut werden. Nimm den Pflug und gehe aufs Feld, aber pflüge nur eine Furche am Feldrain entlang rings um das ganze Feld.“ Maciej tat, was seine Frau ihm gesagt hatte. Er pflügte eine Furche am Feldrain rings um das Feld. Aber plötzlich war das ganze Feld umgepflügt mitsamt den Hügeln, Wiesen und Gruben; alles war eben wie eine große Tischplatte, so daß es eine wahre Freude wahr, über den Acker zu blicken.
Noch bevor es Abend wurde, kehrte Maciej singend und pfeifend vom Felde zurück, Der Verwalter wunderte sich. „Zum Teufel, hat der Maciej denn nicht gepflügt?“ Er ritt aufs Feld, um nachzuschauen, aber das Feld war glatt wie ein Tisch, so sauber war es umgepflügt. Das meldete er dem Gutsherrn, der so wütend wurde, daß er sich die Haare raufte.
„Da habt Ihr mir was Schönes angeraten. Jetzt habe ich nicht mal eine Wiese, um meine Schafe weiden zu lassen!“ „Ihr sollt Euch nicht beunruhigen, Herr, lasst doch den Maciej das Waldstück an einem Tage schlagen!“ „Ruft mir den Maciej!“ Maciej erschien vor dem Gutsherrn, und dieser fuhr ihn sofort an: „Höre, du Narr, du wirst mir alle Bäume in dem Waldstück an einem Tage fällen, doch wenn du es nicht schaffst, lasse ich dich zu Tode prügeln!“ Darüber war Maciej sehr bekümmert und ging weinend nach Hause.
„Weshalb weinst du, Maciej?“ „Wie soll ich nicht weinen, da mir der Herr befohlen hat, den Wald an einem Tag zu fällen, und wenn ich das nicht schaffe, will er mich tot prügeln lassen.“ „Siehst du, du hättest auf mich hören und ihn nicht zur Hochzeit laden sollen. Ich hatte dir gesagt, daß damit Unglück über dich käme. Verzage aber nicht, wir werden auch hier Rat schaffen. Nimm die Axt, gehe in den Wald, gehe aber nicht in die Mitte des Waldes, sondern versetze nur den Waldrand stehenden Bäumen mit dem Axtrücken einen Schlag.“ Maciej ging in den Wald und tat, wie ihm seine Frau geraten hatte. Sobald er einem Baum mit dem Axtrücken einen Schlag versetzte, da fiel, bums, der Baum um. Die Sonne stand noch hoch am Himmel, als alle Bäume in Reih und Glied auf dem Boden lagen. Maciej kehrte zurück und ging pfeifend über den Gutshof.
Das sah der Verwalter und wunderte sich, daß Maciej so zeitig von der Arbeit zurückgekehrt war. Er begab sich unverzüglich zum Wald und sah, daß alle Bäume gefällt auf der Erde lagen. Dann ging er zum Gutsherrn und berichtete es ihm. Der Gutsherr raufte sich die Haare und machte seinem Verwalter die bittersten Vorwürfe wegen seines dummen Rates. „Herr, werdet nicht ungeduldig, wir werden ihn schon zum Teufel jagen. Vor dem Herrenhof befindet sich doch der Teich, das Wasser aus diesem Teich soll Maciej fortbringen, wohin er es nur will, nur sollte der Teich zu guter letzt ohne Wasser sein.“
Maciej kam, und der Gutsherr befahl ihm. „Du wirst heute noch den Teich vom Herrenhof trocken legen. Das Wasser kannst du wegbringen, wohin du willst. Wenn du es aber nicht schaffst, werde ich dich ins Jenseits befördern!“ Maciej senkte den Kopf und ging weinend nach Hause. Seine Frau sah dies und fragte: „Weshalb weinst du schon wieder, Maciej?“ „Wie soll ich nicht weinen, wenn mir der Herr befohlen hat, noch heute den Teich vor dem Herrenhaus trocken zu legen. Wenn ich das nicht schaffe, drohte er, mich töten zu lassen. „Hättest du diesen Herrn nicht zu unserer Hochzeit eingeladen, dann hättest du nicht diese dauernden Plagen. Aber sei nicht traurig, irgendwie wird sich auch das machen lassen. Gehe du jetzt an das Wasser, lege dich dort ausgestreckt hin und horche nur, aber erhebe dich nicht, wenn jemand an dir zerrt oder dich gar schlägt.“
Marciej ging an den Teich und befolgte alles, was ihm seine Frau empfohlen hatte. Da hörte er plötzlich, wie das Wasser zu rauschen begann, aber er sah nicht, wohin das Wasser verschwand. Das sah auch der Verwalter, er lief zu Maciej, rief ihn, versetzte ihm Fußtritte, aber Maciej rührte sich nicht von der Stelle. Dann kam der Gutsherr selbst. Er sah, daß das Wasser im Teich alle Augenblicke weniger wurde, nicht mehr lange, und dann würde es dort kein Wasser mehr geben. Er begann Maciej zu bitten, versuchte ihn zu überreden, versprach ihm goldene Berge, daß er nur aufstehen sollte, doch Maciej rührte sich nicht von der Stelle, er blieb liegen, als hätte er nie etwas gehört. Derweil war das Wasser auf geheimnisvolle Weise aus dem Teich verschwunden, der Boden war völlig trocken, und der Gutsherr wurde auf seinen Verwalter ungemein wütend, weil er durch dessen Ratschläge nun schon viele Verluste hatte hinnehmen müssen, dabei aber Maciej von seiner Frau nicht hatte trennen können.
Da gab der Verwalter seinem Gutsherrn einen letzten Rat: „Veranstaltet einen großen Ball, Herr, und ladet dazu viele Gäste ein, dem Maciej aber befehlt, auf diesem Ball aufzuspielen. Maciej ist ein einfacher Bauer, war noch nie auf einem großen Ball und spielen kann er ganz und gar nicht, er ist nicht einmal imstande, eine Geige zu halten.“ „So ruf ihn mir!“ Maciej wurde zum Herrenhof gerufen, und der Gutsherr sprach: „Ich werde einen Ball veranstalten, und du wirst auf diesem Ball zum Tanze aufspielen, aber wenn du das nicht fertig bringst, dann werde ich dich töten lassen!“
Maciej war sehr besorgt, denn er hatte Zeit seines Lebens noch keine Geige in den Händen gehalten. Er verließ den Herrenhof und ging weinend nach Hause. Seine Frau sah seinen Kummer und fragte ihn: „Was ist dir, warum weinst du?“ „Bah, da soll ich nicht weinen, auf seinem Ball soll ich aufspielen, aber ich kann gar nicht spielen! Er drohte mir, mich töten zu lassen, wenn ich nicht ordentlich spiele.“ Ich habe dich gewarnt, Maciej, diesen Herrn zu unserer Hochzeit einzuladen. Jetzt ist alles so eingetroffen, wie ich vorausgesagt habe. Guter Rat ist nun teuer, aber auch hier werde ich eine Lösung finden. Gehe in den Wald und tritt auf die Kiefer, die du als erste gefällt hast; springe solange auf dieser Kiefer herum, bis auf dich eine Geige herabfällt. Diese Geige mußt du ganz hurtig auffangen und so lange darauf spielen, bis du ganz erschöpft bist.“
Maciej begab sich in den Wald und befolgte peinlichst genau alle Ratschläge seiner Frau. Ach, er sprang, sprang solange auf der Kiefer herum, bis eine Geige zur Erde fiel. Rasch ergriff Maciej diese Geige und begann darauf zu spielen; und er spielte so schön, daß die Leute im Dorf ihre Arbeit unterbrachen und dem Geigenspiel zuhörten; einige stiegen sogar auf die Dächer. Noch bevor es Abend wurde, kehrte Maciej ins Haus zurück.
Am nächsten Tag beorderte man Maciej zum Herrenhof, damit er dort zum Tanze aufspielte. Und Maciej begann zu spielen und spielte wie ein studierter, alt erprobter Musikus, und die Herren tanzten. Er spielte ohne Unterlaß, so daß die Herren schon ganz und gar erschöpft waren und ihn baten, er möchte aufhören zu spielen. Aber er wollte nicht und sagte: „Man muß dem Herrn den Frondienst ehrlich ableisten!“ Den Herren lief der Schweiß schon in Strömen herab, und sie baten und bedrängten ihn, er sollte doch das Spiel beenden. Doch Maciej wollte nicht aufhören.
Die Herren hätten gern eine Pause, doch sie konnten nicht solange Maciej spielte. Zu guter Letzt waren die Herren so erschöpft, daß sie fast taumelten, gar nicht mehr sprechen konnten, sondern nur mit Kopfschütteln bedeuteten, daß er aufhören möge. Doch Maciej tat nicht der gleichen, sondern spielte unverdrossen weiter. Der Herr versprach ihm eine Bauernkate zu geben, er hörte nicht. Der Herr versprach ihm eine Hufe Ackerland, Maciej lehnte ab. Schließlich bot ihm der Gutsherr die Hälfte seines Gutes an, aber auch das wollte Maciej nicht. „Ich gebe dir mein ganzes Gut, nur höre auf zu spielen!“ „Gut, aber Ihr müßt es mir unterschreiben!“
Er gab ihm Papier. Der Herr tanzte und schrieb. Dann hatte er das Schreiben fertig, und die Zeugen unterschrieben es. Als Maciej die Überschreibung in den Händen hatte, hörte er auf zu spielen. Nach dem Ball wurde Maciej der Herr, der Herr aber ging am Bettelstab.
Quelle: Petrow A. Lud ziem dobrzyskiej 1877
DIE BÖSE STIEFMUTTER ...
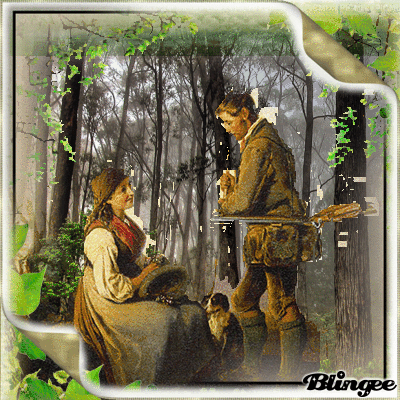
Es war ein Mädchen, das hatte eine Stiefmutter. Die Stiefmutter aber war böse und konnte ihre Stieftochter nicht ausstehen. Deshalb führte sie die Kleine eines Tages in den Wald und ließ sie dort allein. Sie kam zu einem Räuberhaus und kehrte in dem selben ein. Die Räuber nahmen das Mädchen freundlich auf, und bald gewannen sie es lieb; deshalb behielten sie es bei sich, und es musste ihnen das Essen kochen und die Zimmer in Ordnung halten.
Die Stiefmutter hatte gedacht, dass die Tochter im Walde umkommen würde. Als sie aber erfuhr, dass es ihr im Walde gut ging, verkleidete sie sich und ging zum Räuberhaus. Sie traf ihre Stieftochter allein. Beim Weggehen gab sie dem Mädchen ein Kleid. Als diese das Kleid angezogen hatte, da fiel sie um und war tot.
Bald darauf kamen die Räuber zurück, und als sie ihren Liebling tot fanden, da weinten sie sehr. Sie zogen ihr nun das Kleid aus, aber siehe da, kaum hatten sie das Kleid abgezogen, da wurde das Mädchen wieder lebendig. Bald darauf kam die Stiefmutter, die das gehört hatte, wieder und gab dem Mädchen einen verhexten Ring. Als diese den Ring an den Finger gesteckt hatte, da fiel sie wieder tot zu Boden.
Die Räuber kleideten sie wieder aus, in der Hoffnung, dass sie dann zum Leben zurückkehre; allein diesmal half alles nichts, das Mädchen blieb tot. Da nahmen sich die Räuber aus Verzweiflung alle das Leben. Einige Zeit später kam ein Förster an dem Hause vorbei. Er schaute hinein und sah das tote Mädchen liegen. Er trat an sie heran und betrachtete sie. Da sah er den schönen Ring an dem Finger der Toten, und er machte sich daran, den Ring abzuziehen, um ihn mitzunehmen. Kaum aber hatte er ihn abgezogen, da erwachte das Mädchen wieder. Sie ging nun mit dem Förster mit und wurde seine Frau.
Polen: Otto Knoop, Sagen aus Kujawien
DAS MÄRCHEN VOM LÄMMCHEN ...

Es lebte einst ein Bauer, dem die Frau gestorben war. Doch er hatte zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen, so heiratete er ein zweites Mal. Die Stiefmutter konnte diese beiden Kinder nicht leiden, und so redete sie ständig auf ihren Mann ein, dass er ihr die Kinder vom Halse schaffen sollte, doch wusste er nicht, was da zu tun war. Da sagte seine Frau: "Wir lassen den Kindern etwas zu essen und zu trinken zurück, und gehen beide einfach fort.“ Damit war der Bauer einverstanden.
Nun schickte die Stiefmutter beide in den Wald, um Beeren zu sammeln. Danach stellte sie Grütze und Kartoffel in der Kate auf den Tisch und ging mit ihrem Mann fort. Als die Kinder aus dem Wald zurückkehrten, sahen sie sich im Hause um, doch sie fanden niemanden vor. Sie warteten und warteten, aber niemand kam, da aßen sie die Grütze und die Kartoffeln, die auf dem Tisch standen, und gingen selbst in die Welt hinaus.
Sie wanderten eine lange Zeit und gelangten schließlich an ein sehr großes Wasser, an dem einige Pferde standen und tranken. Da sagte der Junge: "Ich habe großen Durst, lass mich gehen und von dem Wasser trinken.“ Aber das erlaubte ihm seine Schwester nicht. So wanderten sie weiter und immer weiter, bis sie wieder ein großes Wasser erblickten. An diesem Wasser standen aber Ochsen und tranken. Der Junge wollte nun unbedingt ans Wasser, um zu trinken, doch seine Schwester ließ das nicht zu. Nachdem sie nun weitergewandert waren, kamen sie an ein drittes großes Wasser, hier waren es Schafe, die von dem Wasser tranken. Und ehe sich das Mädchen versah, war ihr Bruder an den See geeilt und hatte von dem Wasser getrunken.
Sogleich verwandelte er sich in ein goldenes Lämmchen, und gleichzeitig verwandelte sich das Haar des Mädchens in Goldhaar. Die Waise fing schrecklich zu weinen an, als sie sah, dass sich ihr Bruder in ein Lämmchen verwandelt hatte. Aber sie nahm ihn auf ihre Arme, ging auf eine Wiese und setzte sich mit ihm in einen Heuschober.
Kurz darauf kam ein Prinz von einer Jagd daher geritten. Seine Jagdhunde begannen etwas zu wittern; sie witterten und liefen zu dem Heuschober, wo die beiden Waisen saßen. Als die Hunde zu bellen anfingen, dachte der Prinz, er würde in dem Heu irgendein Tier zu sehen bekommen. Er ritt an den Heuschober heran, aber da saß im Heu ein junges Mädchen mit Goldhaar, und hielt ein goldenes Lämmchen auf seinem Schoß.
Da begann er sie auszufragen, wer sie sei, und sie erzählte ihm, wie sich alles zugetragen hatte. Sie sagte, dass dieses Lämmchen ihr Bruder sei und er sich nur, weil er nicht auf sie hören wollte, in ein Lamm verwandelt hatte. Das Mädchen gefiel dem Prinzen so sehr, dass er sie zusammen mit dem Lämmchen zu sich nahm und sie heiratete.
Dort gab es noch ein anderes Fräulein, das den Prinzen heiraten wollte. Diese Frau überlegte unablässig, was sie tun müsse, um die Frau des Prinzen aus der Welt zu schaffen. Eines Tages musste der Prinz in einen Krieg ziehen und war genötigt, seine Frau mit seinem kleinen Sohn zu Hause zu lassen. Da kam jenes Fräulein zu der Prinzessin und bat sie, mit ihr in den Schlossgarten zu gehen.
Als beide am Schlossteich angelangt waren, sagte das Fräulein zu der Prinzessin, sie solle doch einmal schauen, was für herrliche Fische im Wasser schwimmen. Während sich die Prinzessin über das Wasser neigte, versetzte ihr die andere einen Schlag in den Nacken, so dass die Prinzessin ins Wasser fiel und sogleich ertrank.Das alles beobachtete das Lämmchen. Am nächsten Tag nahm das Lämmchen den Sohn aus der Wiege und ging mit ihm an den Schlossteich und begann zu rufen:
„Komm hervor geschwommen, goldenes Entlein, hier weint dein kleines Kindlein!“ Nachdem er dies gerufen hatte, tauchte ein goldenes Entlein aus dem Wasser hervor und verwandelte sich augenblicklich in die Frau des Prinzen; sie stillte ihr Kind, sprang danach wieder ins Wasser und verschwand.
Einige Tage später kehrte der Prinz aus dem Kriege zurück, das Edelfräulein aber tat so, als wäre sie des Prinzen Frau; und damit der Prinz nicht gleich wieder gehen sollte, dass sie keine goldenen Haare hatte, umwand sie ihren Kopf mit einem Tuch, legte sich ins Bett und sagte, sie sei krank; sie tat aber nur so, damit der Prinz sie nicht erkennen sollte.
Eines Tages ging der Prinz im Schlossgarten spazieren, und kurz darauf kam auch das Lämmchen mit seinem Sohn auf dem Rücken. Darüber wunderte sich der Prinz gar sehr, doch er sagte nichts, sondern versteckte sich hinter einem Baum und beobachtete wie sich das Lämmchen an das Wasser stellte und zu rufen begann:
„Komm hervor geschwommen, goldenes Entlein , hier weint dein kleines Kindlein!“ Und wieder entstieg eine schöne Frau dem Wasser, und sogleich erkannte der Prinz, dass dies seine Frau war. Er sprang hinter dem Baum hervor und umschlang sie mit seinen beiden Armen, dass sie nicht mehr ins Wasser zurückkehren konnte.
Sie erzählte ihm alles, was geschehen war, danach kehrten sie alle gemeinsam in ihr Schloss zurück. Das böse Edelfräulein aber ließ der Prinz unverzüglich von wilden Pferden zerreißen.
Quelle: Sarnowska H. Dwie bajki z Lowicza Wisla
EIN OFENHOCKER WIRD PRINZ ...

Ein Schäfer hatte einen Sohn, der zwanzig Jahre lang nichts tat als hinter dem Ofen zu hocken. Darum nannten ihn alle „Ofenhocker“. Seine Mutter war schon gestorben, und sein Vater, der Schäfer, hatte eine zweite Frau geheiratet. Der gefiel das gar nicht. Immer öfter schimpfte sie: „So ein großer Bursche, tut nichts, als den ganzen Tag hinter dem Ofen zu hocken, und arbeitet überhaupt nichts. Das muss anders werden! Schick ihn in die Welt hinaus, Mann. Er soll auf Wanderschaft gehen und sein Brot selbst verdienen!“ Und sie bedrängte den Schäfer solange, bis er einverstanden war.
Eines Tages rief er den Sohn zu sich. „Komm, Ofenhocker, wir wollen zusammen zur Kirchweih gehen!“ Sie gingen gemeinsam fort, und bald kamen sie durch einen großen, dichten Wald. Dort blieb der Vater stehen. „Ofenhocker, bleib du hier und warte ein Weilchen, ich will mir nur mal einen Wanderstab schneiden.“ Der Vater verschwand und der Sohn blieb allein. Er wartete – eine Stunde lang, und noch eine, und noch eine, aber der Vater kam nicht zurück. Es wurde Abend. Da kletterte Ofenhocker auf einen Baum und verbrachte dort die Nacht.
Am anderen Morgen wollte er aus dem Wald heraus und wieder nach Hause, aber er verirrte sich. Er konnte den Weg nicht finden. Doch er ging weiter, wohin seine Augen ihn führten. Da sah er auf einmal eine große Spinne, die gerade eine Ameise fressen wollte. Die Ameise hatte sich im Spinnennetz verfangen. Sie zappelte und rief: „Ofenhocker, rette mich!“ Der Ofenhocker vertrieb die Spinne und befreite die Ameise. „Danke, du hast mich gerettet. Wenn du einmal in Not bist, rufe mich, und ich werde dir helfen.“ Dann zeigte die Ameise ihm noch den Weg, der aus dem Wald hinausführte, und verschwand. Ofenhocker wanderte weiter.
Nach einer Weile begegnete er einem Fischer, der hatte einen Goldfisch gefangen. Der Fisch zappelte im Netz und rief: „Ofenhocker, rette mich!“ Ofenhocker kaufte dem Fischer den Goldfisch ab und setzte ihn zurück ins Wasser. „Danke, Ofenhocker, du hast mich gerettet. Ruf mich, wenn du mich brauchst, und ich werde dir helfen.“ Ofenhocker wanderte weiter.
Da sah er, wie zwei Knechte ein altes Hexenweiblein im Fluss ertränken wollten. Sie hatten es an Händen und Füßen gebunden. Das Hexenweiblein bat und flehte: „So lasst mich doch frei, ich habe doch nichts Böses getan!“ Doch die Knechte hörten nicht darauf und waren unerbittlich. „Ofenhocker, rette du mich!“ Da vertrieb Ofenhocker die beiden Knechte. Er jagte sie davon und befreite das Hexenweiblein. „Dank dir, Ofenhocker, du hast mich gerettet! Ruf mich, wenn ich dir einmal helfen soll!“ Ofenhocker wanderte weiter und weiter.
Schließlich stieß er am Wegesrand auf einen toten Menschen, der erschlagen und unbestattet da lag. Er kniete nieder und sprach eine Gebet für die arme Seele. Da wurde er plötzlich am Genick gepackt. Es war ein Gendarm. „Ha, da haben wir ja den Mörder!“ „Nein, ich habe den Menschen nicht umgebracht. Er war schon tot.“ Doch der Gendarm glaubte ihm nicht. Er schleppte ihn zur Wache und dann zum König. Ofenhocker beschwor seine Unschuld und flehte: „Bitte, lasst mich frei! Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nur für die arme Seele gebetet.“ Der König sah ihn lange an. Dann ließ er sich einen Scheffel Mohn und einen Scheffel Sand bringen und vermischte beides miteinander. „Das sollst du, Ofenhocker, an einem Tag auseinander sortieren. Wenn du das schaffst, lasse ich dich frei.“
Da saß Ofenhocker nun in seinem Verließ und wusste nicht, wie er das schaffen sollte. Nein, das war nicht zu schaffen! Da fiel ihm die Ameise ein. „Ameise, komm, hilf mir! Rette du mich jetzt, sonst bin ich verloren.“ Da kamen aus allen Ecken und Ritzen Scharen von Ameisen in sein Gefängnis gekrabbelt, und es dauerte nicht lange, da hatten die Ameisen den Mohn und den Sand auseinander sortiert – hier ein Scheffel Mohn und dort ein Scheffel Sand. Ofenhocker rief die Wachen: „Meldet dem König, ich bin fertig!. Der Mohn ist vom Sand befreit.“ Der König konnte es nicht glauben und kam selbst ins Gefängnis, um dieses Wunder mit eigenen Augen zu sehen. Und er sah es. Der Ofenhocker wurde sofort freigelassen und der König machte ihn zu seinem Schweinehirten.
Der König hatte eine Tochter. Die Königstochter liebte es, über die Felder spazieren zu gehen. Da begegnete sie dem Ofenhocker, der dort seine Schweine hütete. Die beiden lernten sich kennen, und sie verliebten sich ineinander. Auch der König fand Gefallen am Ofenhocker, und bald erhob er ihn zum Kammerdiener. Nun hatte er noch mehr Gelegenheit, die Königstochter zu treffen, doch sie mussten ihre Liebe geheim halten, denn an eine Heirat war nicht zu denken.
Einmal geschah es nun, dass der König auf Reisen war, und gerade, als er sich über die Weichsel übersetzen ließ, da fiel ihm seine Königskrone herab und fiel ins Wasser, mitten im Fluss. Da ließ der König im ganzen Land bekannt machen: „Wer mir die Krone aus der Weichsel herausholt, der soll meine Tochter zur Frau bekommen.“ Viele vornehme und reiche Herren versuchten ihr Glück, aber keiner konnte die Krone finden. Da meldete sich der Ofenhocker. „Herr König, bekomme auch ich Eure Tochter zur Frau, wenn ich die Krone wiederbringe?“ „Ja gewiss, wenn ich nur bald meine Krone wieder hätte!“ Der Ofenhocker ging zur Weichsel. Dort rief er den Goldfisch, den er dem Fischer abgekauft und wieder ins Wasser gesetzt hatte. Nicht lange, da kam der Goldfisch geschwommen, und er brachte die Königskrone mit. Der Ofenhocker übergab sie dem König. Der hielt sein Wort und die Hochzeit wurde festgesetzt und vorbereitet.
Doch plötzlich wurde die Königstochter krank. Sie war so schwach, dass sie gar nicht mehr aufstehen konnte. Der König rief alle berühmten Ärzte herbei, aber keiner konnte ihr helfen. Da erinnerte sich der Ofenhocker an das Hexenweiblein, das er vor den Knechten gerettet hatte. Vielleicht konnte die helfen. Das Hexenweiblein kam sofort und wusste auch Rat. Es war nämlich so: Da war ein Prinz, der hatte schon lange ein Auge auf die Prinzessin geworfen, und er wollte durchaus nicht, dass sie einen anderen heiratet. Darum hatte er sie mit einem Blatt von einer Pflanze aus seinem Garten vergiftet. Es gab in seinem Garten aber auch ein Kräutlein, das der Königstochter helfen konnte. Das sollte Ofenhocker holen, einen Sud daraus kochen und der Kranken zu trinken geben. „Aber pass auf, dass du das Kräutlein mit der Wurzel ausgräbst! Und zwar dann, wenn der Prinz eingeschlafen ist, weil er sonst das Kräutlein streng bewacht.“
Der Ofenhocker begab sich zum Garten des Prinzen. Er wartete, bis sich der Prinz zum Schlafen niedergelegt hatte. Rasch grub er nun das Kräutlein aus und eilte zurück in das königliche Schloss. Er bereitete die Arznei und gab sie der Kranken. Kaum hatte die Königstochter die ersten Schlucke getan, richtete sie sich auf, und als sie die ganze Medizin getrunken hatte, erhob sie sich aus dem Bett und war völlig gesund. Der König freute sich und richtete den beiden eine üppige und prachtvolle Hochzeit aus, so prachtvoll, dass man heute noch davon erzählt.
VOM ZAUBERSTEIN ...
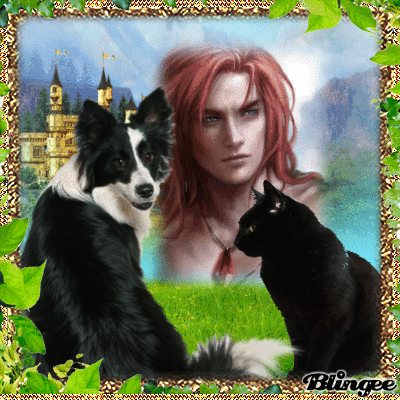
Es war einmal ein König, der eine einzige Tochter hatte und einen Hirten, dessen Sohn Schweine hütete. Der Hirtensohn und die Königstochter trafen sich oft, verliebten sich ineinander, und es kam so weit, daß sie erklärten, ohne einander nicht mehr leben zu können. Da ließ der König den Hirtenvater zu sich kommen und gebot ihm, seinen Sohn fortzuschicken. Der Vater kam sehr bedrückt nach Hause. Sein Sohn sah dies und fragte ihn nach dem Warum. „Ich bin traurig, weil ich dich fortschicken soll!“ „Väterchen“, sagte da der Sohn, „seid nicht traurig, so gehe ich eben auf Wanderschaft!“ Da umarmte ihn der Vater sehr herzlich und ließ ihn ziehen. Er verabschiedete sich auch von der Königstochter recht herzlich, die ihm versprach, auf ihn zu warten.
So machte er sich auf und kam in einen Wald. Dort stieß er auf einen Mann, der einen Hund an der Leine führte. Er bat diesen Mann, ihm doch den Hund zu verkaufen. Doch jener wollte ihm das Tier nicht verkaufen, sondern schenken, aber schließlich nahm er doch ein Entgelt, und der Jüngling führte das Tier an der Leine mit sich fort. Er wanderte weiter und traf wieder einen Mann, der einen großen, kräftigen Kater bei sich hatte. Und auch diesen Mann bat er, ihm doch den Kater zu verkaufen, aber der wollte ihm das Tier durchaus schenken. Schließlich nahm er aber doch ein Entgelt. Der Jüngling nahm seine beiden Tierchen, den Hund und den Kater, an die Leine und wanderte mit ihnen weiter. Auf seinem Wege stieß er auf eine Insel, die sehr dicht mit Gras bewachsen war. Am Rande der Insel waren Bauern damit beschäftigt, das Gras abzumähen, doch sie ließen die Inselmitte aus. Er fragte sie, weshalb sie nur den Rand abmähten und nicht auch das Gras in der Mitte. Sie antworteten ihm, daß sich dies nicht getrauten, weil dort in der mitte ein großes Reptil säße, das ihnen Unglück bringen könne. Da sagte er zu ihnen, sie sollen ihm das Reptil verkaufen. Das kam ihnen so gelegen, daß sie schnellstens einen Boten zum Amtmann schickten, um ihm kundzutun, daß ihnen der Herrgott einen Menschen zugeführt hatte, der das Reptil kaufen wollte. Als der Bote zum Amtmann kam, war dieser eben damit beschäftigt, sein Mittagsmahl einzunehmen.
Sobald er von dem Boten den Grund seines Kommens erfragt und dieser ihm alles berichtet hatte, begab sich der Amtmann schnellstens zu seinen Leuten. Dort angekommen, fragte er den Schweinehirten, was er dafür verlange, wenn er ihnen das Reptil vom Halse schaffe. Dieser antwortete aber, daß er die Schlange nicht umsonst haben wolle, sondern daß er sie kaufen möchte. Schließlich einigten sich beide, und der Amtmann sagte: „Gib meinen Leuten, was du denkst!“ So gab er den Leuten etwas für einen Umtrunk und für Brot. Danach schritt er in die Mitte der Insel und rief: „Schlange, komm heraus, denn du gehörst mir!“ Da sprang die Schlange aus ihrem Loch hervor und wand sich um seinen Hals. Nachdem dies geschehen war, ging er mit seinen Tieren weiter; er hatte nun einen Hund, einen Kater und eine Schlange. Sie wanderten tief in den Wald hinein, wo sie zu nächtigen gedachten. Bevor er und seine Tiere sich schlafen legten, ordnete er an, daß jedes eine Stunde wachen müsse, damit niemand die Schlange stehle.
Der Hund wachte zuerst; da war aber nichts Böses geschehen. Dann kam die zweite Stunde, der Kater hielt Wache, aber bei seiner Wache nickte er ein wenig ein. Und schon war die Schlange weg. Der Kater wachte auf, merkte, daß sein Herr keine Schlange mehr um den Hals hatte und sprach zu dem Hund: „Bruderherz, ein großes Unglück ist geschehen, man hat unseren Herrn bestohlen, was werden wir jetzt tun, uns erwartet große Strafe!“ Sie liefen im Wald umher, suchten die Schlange, krochen auf die Bäume, der Hund scharrte, der Kater kroch ins Dickicht, aber die Schlange konnten sie nicht finden. Da wurde ihr Herr wach: „Was habt ihr getan?“ klagte er. „Ihr habt eure Arbeit schlecht gemacht, habt euch die Schlange stehlen lassen!“ Sie brachen alle drei auf, um die Schlange zu suchen. Bei ihrer Suche stießen sie auf eine Einsiedelei und baten um ein Nachtlager und obendrein ein Abendbrot. Der Einsiedler wollte es zunächst verweigern, fragte sie aus, wer sie wohl seien, und ließ sich erst nach herzlichem Bitten erweichen. Er gab dann dem Schweinehirten und den beiden Tieren ein Nachtlager und obendrein ein Abendbrot. Als sie sich zum Schlafen bereit machten, sagte der Hund zu dem Kater: „Lieber Bruder, hier werden wir suchen, hier ist unsere Schlange!“
Hierauf begab sich der Hund auf den Hof, der Kater blieb am Fenster. Als der Hund den Kater von draußen anbellte, öffnete der Schweinehirt das Fenster und ließ den Kater auf den Hof. Hund und Kater schlichen nun um die Einsiedelei und kamen an ein Kellerfenster, hinter dem sich die Schlange befand. Dies meldeten sie ihrem Herrn. Der sagte zu dem Einsiedler: „Einsiedler, gib uns die Schlange zurück!“ Der Einsiedler widersprach nicht, sagte nur zu dem Schweinehirten: „Sie sei dein. Fordere keinerlei Geld von der Schlange, Herr, fordere nur den Stein, welchen die Schlange an einer weißen Schnur am Körper trägt.“ Da ging der Mann in den Keller und rief: „Schlange, du gehörst wieder mir!“ Die Schlange hatte aber inzwischen ihre Schlangenhaut abgeworfen; im Keller saß eine wunderschöne Prinzessin, die sehr traurig aussah. Sie folgte ihm in die Stube und fragte ihn: „Herr, was verlangst du dafür, daß du mich aus der Schlangenhaut befreit hast? Wie viel Geld soll ich dir geben?“ Der Herr wollte aber keinerlei Geld, sondern nur das Ringlein, daß sie an der weißen Schnur am Halse trug.
Dieses Steinchen wollte sie ihm aber nicht geben. Da sagte er zu ihr: „Wenn du mir das Steinchen nicht gibst, mußt du wieder in die Haut schlüpfen, in der du bislang gesteckt hast!“ Da erschrak die Prinzessin sehr und gab ihm das Steinchen. „Hier hast du es, Herr, als Erinnerung daß du mich aus dieser Schlangenhaut befreit hast.“ Der Herr und die Prinzessin schieden in herzlicher Freundschaft voneinander. Zum Schluß sagte die Prinzessin zu ihm, daß er alles, was er sich wünsche und ersinne, ja die schönsten Gewänder, sofort bekommen werde, wenn er das Steinchen in die Hand nehme; alles Gewünschte würde sich dann schnellstens einfinden.
Dann ging der Schweinehirt mit seinen beiden Tieren in Richtung Sonnenaufgang aus dem Walde heraus. Dabei nahm er das Steinchen in die Hand und dachte: „Ach, wäre ich doch schon bei meinen Eltern!“ Kaum hatte er dies gedacht, befand er sich auch schon bei seinem Vater. Sein Vater und seine Mutter waren vor Überraschung fast erstarrt. Er hatte stets in Liebe seiner Eltern gedacht, so hatte ihn der Herrgott auch erhört, und er sagte zu seinem Vater: „Vater, geh so schnell wie möglich zu unserem durchlauchten König und grüße ihn und die Königin recht artig von mir, aber auch die Prinzessin!“
Als sein Vater mit diesem Anliegen vor dem König erschien, ärgerte sich dieser sehr, daß der Hirtensohn zurückgekommen war. Er sagte zum König: „König, sei nicht böse, morgen wird mein Sohn kommen, um die Prinzessin zu besuchen.“ Der Prinzessin war es sehr angenehm, dies zu hören, aber der König sagte zu dem Hirten: „Mach, daß du nach Hause kommst, und sag deinem Sohn, er solle mir eine Straße von fünf Viertel Meilen bauen, auf der ich zu meinem Palast fahren kann; wenn er das nicht schafft, wird er durch mein Schwert den Tod finden, schafft er es aber, dann wird er mein Schwiegersohn.“ Sehr traurig und bekümmert ging der Hirt nach Hause; er war noch etliche Schritte vom Sohn entfernt, da lief ihm dieser schon erfreut entgegen und fragte: „Vater, warum bist du so betrübt?“ Hierauf entgegnete sein Vater: „Mein Sohn, ich bringe dir keine gute Nachricht!“ „Vater, sei unbesorgt, alles wird gut werden!“ Kaum hatte der Vater von des Königs Begehr berichtet, war alles, was der Jüngling wünschte, schon fix und fertig. „Vater, begib dich so schnell wie möglich zum König, denn morgen fahre ich zur Hochzeit.“
Der König staunte nicht schlecht, daß er, der einfache Hirtenjunge so große Wunder für seinen König vollbracht hatte. Der alte Vater ging erneut in das Königsschloß, und da sagte der König zu ihm: „Da dein Sohn für mich das getan hat, steht ihm auch mein Schloß jederzeit offen.“ Erfreut kehrte der Vater heim. Sein Sohn zog sich die Hirtenkleidung an und fuhr gleich bei Sonnenaufgang zum König. Der König, die Königin und die Prinzessin sahen aus dem Fenster, und alle drei freuten sich, als sie den Hirtensohn kommen sahen. Für ihn lagen vornehme Gewänder schon bereit, aber er wollte davon nichts anziehen. Im Königssaal gab es ein großes Festmahl, dort waren auch schon einige andere Könige versammelt, auch König Arcyus aus der Stadt Eno. Er war noch unvermählt, war aber ein Heide, denn er hatte einen anderen Glauben. Er hatte sich in aller letzter Zeit oft mit der Prinzessin getroffen, so daß es ihn sehr kränkte, daß sie jetzt den Sohn eines Hirten heiratete.
Das junge Paar lebte nun schon ein Jahr und fünf Monate zusammen. Eines Tages mußte aber der junge König August Cinius durch das Land fahren und war dreieinhalb Monate nicht zu Hause. Gerade zu dieser Zeit kam König Arcyus zu der Königin, der Frau des Königs August, zu Besuch. Zu dem Zeitpunkt hatte die Königin an ihrem Herrn Gemahl August keinen Gefallen mehr. Der zu Besuch weilende König Arcyus sagte zu der Königin, sie solle doch ihren Herrn fragen, was für ein Mittel er wohl habe, daß er alles, was er wolle, ja, was er nur denke, so rasch erhielte.
Als König August nach Hause zurückkehrte, war seine Gemahlin schwer erkrankt, und kein Arzt konnte sie heilen. Der König fragte sie liebevoll, was ihr fehle. Hierauf antwortete sie: „Ach, mein König, mir träumte in der Nacht, daß mir sofort besser würde, wenn du mir dein Wundermittel verraten würdest.“ „Liebe Königin, hättest du mich danach schon früher gefragt, dann würde es dir längst besser gehen.“
König Arcyus saß indessen verborgen im Keller. König August und seine Frau nachtmahlten gemeinsam an ihrer Tafel, da sagte er zu ihr: „Ich trage ein Steinchen an einer weißen Schnur am Körper, aber wenn ich ihn verliere, werde ich sehr unglücklich werden.“ Da bewirtete die Königin ihren Gemahl August mit gutem Wein, bis er einschlief. Sie zog sein Messer aus der Scheide, schnitt das Steinchen von der Schnur ab und ließ König Arcyus aus dem Keller, so daß sie nun zusammen waren, dann nahm sie das Steinchen und dachte: „Aus diesem Palast, aus diesem Königreich sollen große Felsen, riesige Wälder und Heideflächen werden.“ Danach entfloh sie mit König Arcyus über das Meer.
König August wachte auf und war, wie auch der Vater der Königin, sein Schwiegervater, sehr verwundert, daß sie plötzlich mitten im Wald zwischen Felsen lagen. Der alte König war sehr verärgert: „Du Unglücksmensch, was muß ich deinetwegen erleben! Wir hatten prunkvolle Gemächer, ausgezeichnete Keller und jetzt muß ich deinetwegen im Wald zwischen Felsen liegen!“ Der alte König ließ auf dem Felde Mauern errichten und ordnete an, seinen Schwiegersohn darin einzumauern. Nur ein kleines Fensterchen ließ er ihm, groß genug, daß gerade der Kater oder der Hund dort hindurchschlüpfen konnten. Der Eingemauerte war in seinem Verließ sehr traurig. Da sagten der Hund und der Kater zu ihm: „Sei nicht traurig, Herr, wir werden dein Steinchen suchen gehen, aber zuvor müssen wir für drei Jahre den Lebensunterhalt für dich beschaffen, damit du essen und zu trinken hast.“ Nachdem sie ihm Speisen und Getränke herbeigeschafft haben, zogen sie in die Welt.
Zu guter Letzt kamen sie zum König Arcyus, der ihrem Herrn so übel mitgespielt hatte. Der Hund ging zu dem Koch in die Küche, und der Kater meldete sich beim Beschließer im Marstall, denn dort gab es unzählige Ratten. Der Hund diente dem Koch so gut, daß dieser außerordentlich zufrieden mit ihm war. Er ging zu dem Beschließer und sagte: „Beschließer, ich will dir eine Neuigkeit berichten: mir ist da ein Hund zugelaufen, der so scharf ist, daß er niemanden gestattet, auch nur etwas anzurühren.“ Hierauf sagte der Beschließer zum Koch: „Und mir ist ein großer Kater zugelaufen, der mir eine Vielzahl von Ratten weg fängt.“
Bereits drei Tage und drei Nächte weilten die beiden Tiere bei König Arcyus. Am dritten Tag in der achten Abendstunde trafen sich Kater und Hund und sprachen miteinander: „Bruder, hier befindet sich unser Steinchen!“ sagt der Hund zum Kater. „Was können wir tun, um den Stein zu bekommen!“ Da entgegnete der Kater: „Ich werde Ratten fangen, bis ich auf den Rattenkönig stoße!“ Der Kater räumte also unter den Ratten derart auf, daß Schlossherr und Beschließer höchst zufrieden waren. Er hatte schon dreitausend Ratten getötet, doch auf den Rattenkönig war er noch nicht gestoßen; er hatte weitere dreitausend gefangen, aber wieder hatte er den Rattenkönig dabei nicht erwischt; schließlich tötete er nochmals dreitausend von ihnen und begegnete dabei dem Rattenkönig, der zu dem Kater sagte: „Halte ein, Kater, sage mir lieber, was du willst, und morde nicht so viele meiner Soldaten!“ Der Kater fragte ihn nach dem Steinchen.
Der Rattenkönig stieß einen Pfiff aus, da kamen viermal einhunderttausend Raten zusammen, aber keine von ihnen hatte das Steinchen. Darüber war der Kater sehr verärgert, und wenn er zuvor schon sehr viele Ratten getötet hatte, so töte er jetzt noch viel mehr von ihnen. Wieder sagte der Rattenkönig zum Kater: „Halte ein, Ritterkönig, töte mir nicht so viele meiner Soldaten, denn du bekommst deinen Gegenstand!“ Und erneut pfiff der Rattenkönig, da kamen ihrer sechsmal einhunderttausend und zum Schluß kam noch eine lahme Ratte angelaufen, die hatte das Steinchen. Der Kater war sehr erfreut, daß er endlich das Steinchen bekommen hatte, und meldete es so gleich dem Hund, wobei er zu dem Hund sagte: „Was wollen wir nun mit dem Steinchen tun?“ Hierauf entgegnete der Hund: „Morgen wird bei König Arcyus ein großes Fest sein, dazu muß der Koch die verschiedenartigsten Speisen bereiten, diese Speisen werden im Fenster stehen, und ich werde sie sorgsam bewachen müssen, aber du wirst auf den Hof gehen und an diesem Fenster kratzen, ich werde dich dann mächtig anknurren.“
Abends um die zehnte Stunde geschah es dann so, wie der Hund dem Kater gesagt hatte, der Kater hatte die Weisung des Hundes befolgt; er nahm jetzt das Steinchen an der weißen Schnur und band es dem Hund um den Hals, dann ermahnte er ihn: „Bruderherz, gib gut acht auf das Steinchen an der Schnur!“ Als die Zeit herangerückt war, kam der Kater an das Fenster und kratzte mächtig daran. Der Hund saß an der anderen Seite des Fensters in der Küche und knurrte. Der Koch wunderte sich sehr, daß der Hund den Kater so böse anknurrte, wurde schließlich darüber wütend, öffnete das Fenster und rief: „Jag ihn davon, diesen dreckigen Kater!“ Und auf diese Weise entflohen beide von König Arcyus Hof und beide waren heilfroh. Auf ihrer Flucht kamen sie an einen großen See. Sie mußten zusehen, wie sie an das andere Ufer gelangten.
Da sie aber seht hungrig waren, schlich der Kater in eine Bauernkate, kroch in die Kammer und nahm sich von dort genügend Essbares mit. Sie stillten ihren Hunger, dann liefen sie zurück zum See und sagten zu einander: „Bruder, wir müssen nun tüchtig auf unsere Sachen achten!“ Der Kater war schon glücklich bis in die Mitte des Sees geschwommen, da fiel dem Hund der Stein ins Wasser und versank.
Als sie am anderen Ufer angekommen waren, fragten sie sich gegenseitig: „Bruder, was werden wir nun tun?“ So liefen sie ständig am Ufer entlang und fingen immerfort Frösche, denn sie wollten dabei auf den Froschkönig stoßen. Als sie ihn schließlich erwischten, sprach dieser zu ihnen: „Haltet ein, ihr Könige, tötet mir nicht so viele von meinen Soldaten, sagt mir lieber, was ihr von mir wollt!“ Sie sagten es ihm. Der Froschkönig pfiff, und schon kamen hunderttausend Frösche angeschwommen, aber keiner von ihnen hatte das Steinchen.
Der Froschkönig pfiff erneut, da schwammen weitere hunderttausend Frösche ans Ufer. Schließlich pfiff er ein drittes Mal, doch da kamen gleich zweimal hunderttausend und ein einzelner Frosch ans Ufer, und dieser letzte Frosch hatte den Stein. Da waren Kater und Hund hoch erfreut, daß sie ihre Sachen wieder hatten. Der Kater nahm das Steinchen, band es dem Hund um den Hals, und beide liefen nun mit großer Freude zu ihrem Herrn. Als sie bei ihm eintrafen, hatte der Ärmste gerade den letzten Bissen gegessen und den letzten Schluck getrunken. Da gaben ihm seine Tiere den wiedererlangten Stein zurück, und sogleich dachte er: „Diese Mauer hier soll zu Staub werden. Ich aber möchte an der stelle sein, an der ich geheiratet habe, und das Königsschloß, wenn es zuvor schon prachtvoll war, soll jetzt noch prachtvoller sein.“ Alles was er gedacht hatte, geschah dann augenblicklich.
Sein Schwiegervater und seine Schwiegermutter waren hoch erfreut, daß aus dieser Waldeinöde und aus den Felsen ein so prächtiges Königreich entstanden war, prächtiger als je zuvor. Der Schwiegervater wußte gar nicht, was er ihm Gutes antun sollte, und fragte seinen Schwiegersohn, was dieser sich wünsche. Aber der Schwiegersohn antwortete: „Mein Vater, wir werden zunächst ein großes Fest, ein Gastmahl ausrichten!“ So richteten sie also für die neunte Abendstunde ein Gastmahl aus. Hierzu versammelten sich alle Herren und Könige aus den eigenen und angrenzenden Landen. Er aber, der junge König August, ging mit seinen Tieren, mit dem Kater und dem Hund, in den Schloßgarten, nahm das Steinchen in die Hand und dachte: „In fünf Minuten soll meine Frau, die ich als erster geheiratet habe, hier erscheinen!“ Er war kaum aus dem Schloßgarten zurückgekehrt, da saß seine Frau bereits mit dem König Arcyus an der Festtafel.
Als der König August den Festsaal betrat, erkannte sie ihn nicht, doch er erkannte sie sogleich. Seine Gäste gaben sich gegenseitig Rätsel auf, alle rätselten mit. Eine Dame aus dieser Gesellschaft, die eine gute Freundin von König August war, fragte die Runde: „Was verdient wohl eine Frau, die ihren eigenen Mann beraubte, ihn ins Unglück stürzte und mit einem anderen davon lief?“ Da sagte die Königin, die ungetreue Frau von König August: „Eine solche Frau ist nichts anderes wert, als daß man einen großen Holzstoß errichtet, diesen anbrennt und die Ungetreue auf den lodernden Scheiterhaufen wirft.“ Da sagte König August: „Den Tod, den du dir selbst erwählt hast, den sollst du auch erleiden.“ Und man errichtete auf dem Felde einen großen Scheiterhaufen und ließ sie darauf werfen und das war ihr Ende.
Nachdem König August regierender König geworden war, kamen der Kater und der Hund zu ihm, hüpften auf seinen Tisch und sagten zu ihrem Herrn: „Herr nimm dein Schwert und schlage uns beiden die Köpfe ab!“ König August weinte sehr um seine Tiere und sprach zu ihnen: „Ich würde mir lieber selbst den Kopf abschlagen, als euch beiden!“ Aber als beide darauf bestanden und er einsah, daß er es tun müsse, zog er sein Schwert und schlug den beiden die Köpfe ab. Da flatterten zwei Tauben aus ihren Körpern empor und setzten sich auf seine Schulter. Sie dankten ihm, flogen auf und flogen schnurstracks zum Himmel empor.
König August regierte fortan allein, und wenn er lebt, dann regiert er noch, wenn aber nicht, dann beißt er die Erde, genauso wie wir.
Malinowski L.; Lancut/Koziels
DER TEUFEL ALS LIEBHABER ...
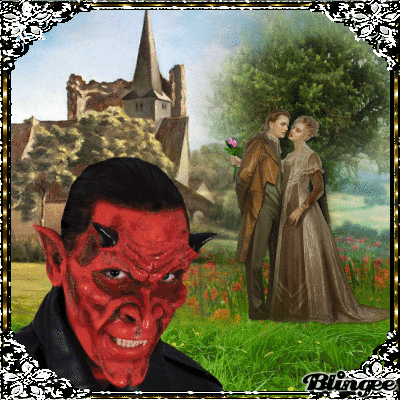
Ein Elternpaar hatte eine Tochter, zu der kam tagtäglich ein Galan. Als er eines Abends wieder bei ihr weilte, bat er sie, ihn hinauszubegleiten, sie aber wollte nicht. Doch ihre Mutter hieß sie, ihn hinauszubegleiten, aber nur bis in den Hausflur.
Sie ging jedoch weiter. In jenem Dorf befand sich eine Kirche; und wie sie so mit ihm ging, standen sie unversehens an der Schwelle dieser Kirche. Hier nun mußte sie sehen, daß er von einem Altar zum anderen raste, hier die Kerzen zerbrach, dort alles hinunterfegte; sie aber ging danach in ihre Kammer und legte sich schlafen, ohne ihrer Mutter ein Sterbenswörtchen davon zu sagen.
Ihr Verehrer (es war ein verruchter Teufel) kam am nächsten Abend wieder zu ihr und bat sie, alles zu erzählen, was sie am Abend zuvor gesehen hatte, als sie ihn begleitete. Sie sagte aber, sie habe weder etwas gesehen noch gehört. Da fragte er sie: „Was ist dir lieber, willst du sagen, was du gesehen hast, als du mit mir gegangen bist, oder willst du, daß dein Vater stirbt?“ „Wenn es Gott gefällt, daß mein Vater sterben soll, so wird er sterben, aber ich habe nichts gesehen und nichts gehört!“ Und der Vater starb.
Am dritten Tag erschien er aber wieder und sprach zu ihr: „Hättest du mir gesagt, was du gesehen hast, als du mit mir gegangen bist, dann hättest du deinen Vater noch. Was willst du jetzt, sagen, was du gesehen hast, oder willst du, daß dir auch deine Mutter noch weg stirbt?“ Darauf sie: „Ich habe werder etwas gesehen noch etwas gehört, und wenn Gott will, daß meine Mutter sterben soll, dann muß sie sterben!“ Und die Mutter starb ebenfalls.
Ihr Galan kam auch am vierten Tag. „Siehst du, hättest du gesagt, was du gesehen hast, so hättest du deine Mutter noch!“ Da sagte sie: „Sie starben, da der Herrgott nicht gewollt hat, daß sie länger leben, nun sind sie tot; ich aber habe nichts gesehen.“ Hierauf sagte er: „Was willst du, wirst du sagen, was du gesehen hast, nachdem du mich hinausbegleitet hattest, oder willst du selbst sterben?“ Sie entgegnete: „Ich habe nichts gesehen!“
Und sie ging unverzüglich zu der Gutsherrin und berichtete ihr, daß sie am nächsten Tag sterben müsse, und bat sie, daß man sie, wenn sie stürbe, im Zimmer nicht längs, sondern quer aufbahrte, mit den Füßen zum Fenster, nicht zur Tür, und daß man sie durch das Fenster und nicht durch die Tür hinaus trüge und sie nicht auf dem Friedhof begrübe, sondern in einem Graben neben dem Friedhof.
Und wie sie es gewünscht hatte, so wurde sie begraben – und es wuchs eine Lilie aus ihr hervor. Da fuhr ein Herr an dieser Lilie vorbei und sagte zu seinem Diener, er solle aussteigen und ihm diese Blume brechen. Der Diener ging hin und wollte sie pflücken. Die Blume aber sprach: „Brich mich nicht! Der mich haben möchte, soll selbst kommen, um mich zu pflücken.“ Und der Herr brach sie und steckte sie sich an den Hut. Dann fuhren sie zu einer Herberge, in der sie nächtigen wollten, und der Herr befahl seinem Koch, das Abendessen zu richten. Sie nahmen das Essen ein. Hernach bereitete der Lakai seinem Herrn das Nachtlager, und dieser legte sich schlafen. Der Lakai saß am Tisch und las, und der Hut seines Herrn lag auf dem Tisch.
Es schlug die zehnte Stunde, dann die elfte; als es aber zwölf geschlagen hatte, trat ein Fräulein hinter dem Hut hervor und sprach: Oh, die Herren haben wohl keinen Gast erwartet, da sie nichts auf den Tellern gelassen haben.“ Kaum hatte das Fräulein dies ausgesprochen, war es verschwunden. Da legte sich auch der Lakai zum Schlafen nieder.
Anderntags erzählte er seinem Herrn, was sich in der Nacht zugetragen hatte, und obwohl sie gleich weiter reisen wollten, blieben sie deswegen noch an diesem Ort. Der Herr befahl seinem Koch ein Abendmahl zu richten und ein Gedeck für einen Gast auflegen. Der Lakai ging schlafen, der Herr aber setzte sich an den gedeckten Tisch und las beim Kerzenschein.
Es schlug die zehnte, die elfte und schließlich die zwölfte Stunde. Hinter dem Hut trat das Fräulein hervor und sprach: „Nun, heute waren die Herren höflich, sie haben einen Gast erwartet und den Tisch gut gedeckt.“ Indem sprang der Herr auf, ergriff das Fräulein an den Haaren und hielt es am Zopf fest. Sie bat, ihn, dass er sie freilassen möge, denn ihre Zeit wäre gekommen. Aber er ließ sie nicht los, sondern nahm sie mit zu sich nach Hause. Zu Hause wollte er sich mit ihr vermählen, und tat es auch. Zur Hochzeit lud er viele Herren ein.
Sie fuhren zur Kirche, sie schritten durch die Kirche – in dem Augenblick eilte der Teufel herbei und fragte sie, was ihr lieber wäre, zu sagen, was sie gesehen hatte, als sie ihn begleitete, oder ein zweites Mal zu sterben. Da umringten sie alle diese Herren und redeten auf sie ein, daß sie sagen sollte, was sie gesehen hatte, als sie jenen begleitete.
Und sie erzählte vor dem Pfarrer und allen diesen Herren, daß seinetwegen Vater und Mutter sterben mußten und schließlich sie selbst und daß sie ihn nicht nur bis zur Schwelle ihres Flures hinausbegleitet hatte, sondern bis an die Kirchenschwelle mit ihm gegangen war, und er sei dort über die Altäre gefahren, habe die Kandelaber umgeworfen und die Kerzen zerbrochen, sie aber sei, nachdem er alle Kerzen zerbrochen hatte, in ihre Kammer gegangen und habe sich schlafen gelegt und ihren Eltern von alledem nichts erzählt.
Danach zerfloß der Teufel in der Kirche zu einer Pechlache, sie aber wurde getraut. Ich war auch auf der Hochzeit, aber ich hatte eine trockene Zunge, und unter meinen Füßen knirschte der Sand.
Quelle: Kolberg, O. Lud.ser.XIV. Krakow 1881
DIE GESCHICHTE VOM KÖNIGSSOHN ARGELUS ...

Es war einmal ein König, der hatte zwei Söhne. Der älteste von ihnen, Argelus geheißen, war von so wunderbarer Schönheit, dass sein Vater ein abgesondertes Schloss als Aufenthalt für ihn bestimmte und ihm nicht gestattete, dieses Schloss zu verlassen, damit kein schlechter Windhauch ihn treffen und ihm schaden konnte. Der Prinz hatte alle Bequemlichkeiten, und alle waren ihm zu Diensten. Obwohl der König ihn oftmals aufsuchte und sich mit ihm unterhielt, langweilte ihn ein solches Leben sehr, und er sehnte sich nach der Freiheit.
Eines Tages erwuchs im königlichen Garten ein wunderschöner Apfelbaum, der morgens goldene Blüten, gegen Abend aber goldene Früchte trug. Der König der sich im Garten erging, freute sich sehr über diesen Apfelbaum und gedachte, die vornehmsten Fürsten seines Reiches zusammen zu rufen, um diese wundersame Früchte zu zeigen.
Die Früchte aber verschwanden in der Nacht, aber man wusste nicht, auf welche Weise, die goldenen Äpfel in der Nacht verschwanden; am Morgen dann zeigten sich wieder goldene Blüten und gegen Abend goldene Äpfel. In der nächsten Nacht ließ der König eine doppelte Wache aufstellen, aber dennoch verschwanden die Äpfel. Ebenso in der dritten Nacht. Da er nicht wusste, was das alles zu bedeuten hätte, ließ er einen Zauberkünstler rufen. Dieser sagte: „Ich würde es dir sagen, durchlauchtigster König, aber ich fürchte um mein Leben.“ Der König drang so heftig in ihn, es doch kund zu tun, dass der Zauberer am Ende sagte: „Nur Argelus, dein Sohn, könnte diese Früchte so behüten, dass sie nicht verloren gehen.“
Der König erzürnte sich sehr darüber und sagte: „Halunke, du willst, dass mein Sohn sein Leben verliert, aber vorher wirst du umkommen!“ Und der König befahl, den Zauberer hinrichten zu lassen. Der jüngere Königssohn hatte einen etwas wirren Geist, weshalb der König ihn auch nicht liebte. Da bat nun dieser Sohn, die Früchte bewachen zu dürfen, und der König erlaubte es ihm. Da die Früchte aber auch während seiner Wache verschwanden, offenbarte er alles seinem Bruder Argelus. Als der König seinen ältesten Sohn wieder besuchte, schien ihm dieser sehr traurig.
Da fragte ihn der König nach der Ursache, und sein Sohn antwortete: „Mir träumte von einem Baum mit Wunderäpfeln, der in unserem Garten wächst, und davon, dass nur ich seine Früchte bewachen kann.“ Als dann bat er seinen Vater um die Erlaubnis, dies zu gestatten, doch sein Vater wollte nichts davon hören, und als Argelus damit drohte, dass er sich umbringen würde, gab er, wenn auch widerwillig, sein Einverständnis.
Argelus ließ Bett und Tisch samt Lampen unter dem Wunderbaum aufstellen und nahm einen seiner Diener mit. Er legte sich ins Bett, um aber nicht einzuschlafen, las er in verschiedenen Büchern. Gegen Mitternacht kamen sieben Schwäne angeflogen und ließen sich auf dem Apfelbaum nieder. Argelus sah dies, streckte sofort den Arm, soweit er reichte, in den Apfelbaum und ergriff einen der Schwäne, der sich sogleich in eine bildschöne Jungfrau verwandelte; die übrigen sechs Schwäne flogen auf die Erde herab und verwandelten sich ebenfalls in schöne Jungfrauen. Die erste, die der Prinz festgehalten hatte, war eine verzauberte Prinzessin, die anderen sechs ihre Hofdamen.
Argelus freute sich über alle Maßen; die Prinzessin unterhielt sich lieb mit ihm und bat ihn sehr, auch die nächsten drei Nächte auf gleiche Weise zu verbringen, denn nur so könnte er sie von dem Zauberbann befreien, doch gemahnte sie ihn, nicht einzuschlafen.
Kaum hatten die ersten Sonnenstrahlen die Dämmerung verscheucht, da verwandelten sich die Jungfrauen wieder in Schwäne und flogen davon, in dieser Nacht aber blieben die goldenen Äpfel am Baum hängen. Der König freute sich darüber und verbot, die Früchte abzupflücken. Aber von den Jungfrauen sagte Argelus seinem Vater kein Sterbenswörtchen, und er befahl auch seinem Diener, den er als seinen treuesten betrachtete, darüber tiefstes Schweigen zu bewahren.
Der Diener aber warb um die Tochter einer Alten, die eine Hexe war, und erzählte seiner Liebsten im Vertrauen von den Ereignissen der vergangenen Nacht. Diese trug das Gehörte, ebenfalls unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit, ihrer Mutter an. Die Mutter gebot ihm zu schweigen, gab ihm einen Lederbeutel und sprach: „Wenn sich dein Herr unter dem Apfelbaum, hinlegt, dann öffne du diesen Beutel ein wenig, und er wird sogleich einschlafen. Wenn die Schwäne wieder fortgeflogen sind, dann bestreich ihm mit der Salbe aus diesem Döschen die Augen, und sodann wird er hellwach werden.“
Argelus wachte in der nächsten Nacht sehr gespannt, aber sobald der ungetreue Diener hinter ihm den Beutel ein wenig geöffnet hatte, schlief der Arme wie ein Toter ein. Da kamen die Schwäne herbeigeflogen und verwandelten sich in schöne Jungfrauen. Die Prinzessin rüttelte den Schlafenden und befahl über dies dem Diener, seinen Herrn zu wecken, aber alles war umsonst, denn der Diener wollte seinen Herrn nicht wecken.
Als die Morgendämmerung anbrach, sagte die Prinzessin mit großem Bedauern zu dem Diener, er solle seinem Herrn ausrichten, dass dieser am nächsten Abend wachsamer sein möge. Darauf wurden alle Jungfrauen wieder zu Schwänen und flogen davon. Nun erst bestrich der Diener die Augen seines Herrn mit Salbe. Sobald der Prinz aufgewacht war, erzählte er ihm von den Jungfrauen und auch, was die eine ihm zu sagen aufgetragen hatte.
Der Prinz war sehr bekümmert, und er befahl seinem Diener noch strenger, über alles Gesehene und Gehörte Stillschweigen zu wahren. Aber der Diener vertraute sich erneut der Hexe an, die ihm riet, in der kommenden Nacht das gleiche zu tun wie in der Nacht zuvor. In der nächsten Nacht, gab sich Argelus alle erdenkliche Mühe, nicht einzuschlafen, aber der ungetreue Diener ließ wieder etwas Wind aus dem Lederbeutel entweichen, und sogleich verlor sein Herr seine Besinnung.
Aber da flogen auch schon die Schwäne heran und verwandelten sich in Jungfrauen; sie versuchten den Prinzen wach zu rütteln, hoben ihn sogar aus dem Bett und führten ihn umher, aber das half nichts. Erneut trug die Prinzessin dem Diener auf, sein Herr solle, wenn er sie aus seinem Bann erlösen wolle, wenigstens in der kommenden Nacht nicht schlafen. Der Diener berichtete alles seinem Herrn, nachdem er ihm die Augen mit der Salbe bestrichen hatte; die Hexe und den Lederbeutel erwähnte er aber mit keinem Sterbenswörtchen.
Argelus zwang sich den ganzen Tag über zum Schlafen, damit er in der Nacht wachen könnte, aber auch das war umsonst. Er schlief ein, und da ihn die Jungfrauen auf keine Weise wachrütteln konnten, sagten sie zu dem Diener, dass sein Herr von nun an nicht mehr wachen brauchte, weil sie sich zur weiteren Buße in sehr entlegenene Lande begeben müssten. Wenn Argelus aber die Gründe wissen wolle, so möge er das Schwert, dass im Schloss über seinem Bett hinge, vom ersten auf den zweiten Pflock umhängen, und dann würde er alles erfahren. Wollte er sie aber suchen, so sollte er wissen, dass sie östlich der Sonne in der Schwarzen Stadt ihren Bußgang beenden müssten.
Der arme Argelus begab sich in sein Schloss. Da ihm aber der Diener alles wortwörtlich berichtet hatte, was die Jungfrauen gesagt hatten, hängte er sein Schwert von dem ersten Pflock auf den anderen. Sogleich begann sich das Schwert zu heben und schwenkte zu dem ungetreuen Diener hin. Als Argelus dies sah, ergriff er das Schwert und schlug dem treulosen Diener den Kopf ab.
Als dann berichtete er seinem Vater über den Verrat und bat ihn, ihm zu gestatten, seine Geliebte zu suchen. Sein Vater wollte ihm dies nicht erlauben, doch als er sah, dass sein Sohn von Gram gepeinigt, immer mehr dahinwelkte, stattete er ihn für eine Reise aus, gab ihm Diener, Fahrzeuge und reichlich Geld, dass er sich alle Wünsche erfüllen konnte. Argelus begab sich ungesäumt auf die Reise.
Er durchzog viele ferne Länder, dass es ihm am Ende doch an Geld mangelte. Da verkaufte er kurzerhand Pferde und Fahrzeuge und schickte die Dienerschaft nach Hause, er selbst aber wanderte zu Fuß weiter. Der Hunger setzte ihm bereits mächtig zu, als er einen Wald erreichte und dort auf drei Männer stieß, die sich prügelten. Er trat an sie heran und befragte sie, nachdem er ihnen seine königliche Abstammung offenbart hatte, nach den Gründen des Streites.
Da sagten die Jünglinge: „Wir sind drei Brüder, unser Vater hat uns nur das hinterlassen was du hier siehst: den kleinen Tisch, eine Peitsche, einen Sattel und ein Pferd. Wir vermögen uns aber über die Aufteilung der Sachen nicht einigen. Denn alle diese Dinge können nur einem von uns dienlich sein. Wer nämlich dem Pferd den Sattel auflegt, als dann aufsitzt, mit der Peitsche knallt und sagt: „An dem oder jenem Ort will ich sein!“ der ist im selben Augenblick dort. Wer hingegen auf den Tisch schlägt, zu dem kehrt das Pferd mit dem Sattel und der Peitsche unverzüglich zurück. Weißt du was? Entscheide du, was zu geschehen hat.“
Der Prinz begleitete sie eine Zeitlang und sagte schließlich: „Ja, so könnte man es machen“, und er fuhr fort, „seht ihr dort jene drei Berge in der Ferne, die alle gleich weit entfernt sind? Lauft dorthin; wer von euch als erster auf dem Gipfel anlangt und wieder zu mir zurückkommt, der erbt den gesamten Nachlass!“ Die Brüder willigten ein und liefen zu den Bergen. Aber Argelus wartete nicht auf sie, sondern schwang sich auf das Pferd und sprach: „Ich will in der Schwarzen Stadt sein!“ und er verschwand.
Das Pferd hatte ihn bereits auf einige hundert Meilen an die Schwarze Stadt herangebracht, als die drei Brüder zurückkehrten und seiner List gewahr wurden. Einer von ihnen schlug mit der Faust auf den Tisch und rief: „Das Pferd soll sofort hierher zurückkehren!“ Da ließ das Pferd den armen Argelus in einen großen Sumpf herabfallen, aus dem konnte er sich nur mit großer Mühe herausarbeiten, und er erreichte völlig ausgehungert ein Haus.
Der dortige Hausvater antwortete ihm auf seine Fragen: „Ich habe von einer solchen Stadt wohl schon gehört, aber wie weit es bis zu dieser Stadt ist, vermag ich nicht zu sagen, Aber bleibe einige Tage bei mir, denn hier werden Handelskarawanen und Kompanien zur Kirchweih durchkommen, von denen wirst du vielleicht etwas erfahren können.“
Es kam die erste Kompanie, eine zweite und eine dritte folgten, aber niemand wusste etwas über die Schwarze Stadt. Am Ende fand sich doch ein Mensch, der sagte, dass es von dem Ort aus bis zur Schwarzen Stadt noch gute einhundertfünfzig Meilen seien. Argelus besaß noch einen wertvollen Ring, den versprach er diesem Mann, wenn er ihn zur Schwarzen Stadt führte. Der aber bekannte, dass er einst als Missetäter aus dieser Stadt entflohen sei, weshalb er ihn nur bis in die Nähe der Stadt geleiten könnte.
Danach gelangte Argelus aber doch noch glücklich an sein Ziel. Nun eilte er durch die ganze Stadt und grübelte, was zu tun sei und er etwas über seine Liebste erfahren könnte. Die Prinzessin und deren Jungfrauen waren zu jener Zeit bereits erlöst und die Prinzessin sollte sich in einigen Tagen mit einem vornehmen Fürsten vermählen. Sie hatte gerade eine ihrer Hofdamen in die Stadt geschickt, um für sie Kleider zu einzukaufen. Doch diese Dame kehrte, als sie Argelus in der Stadt erblickt hatte, geschwind wieder zurück, um es der Prinzessin wieder zu berichten.
Doch die Prinzessin glaubte ihr nicht, und sie sagte: „Das ist ganz und gar unmöglich!“ Sie schickte dann eine zweite und eine dritte ihrer Damen aus, aber beide kehrten nach kurzer Zeit mit der gleichen Neuigkeit zurück und beschworen, dass es der gleiche Prinz sei, den sie gut kannten, weil sie ihn seinerzeit unter dem Apfelbaum genau betrachtet hatten. Schließlich begab sich die Prinzessin selbst in die Stadt, um ihn zu sehen.
Sie beobachtete ihn aufmerksam, erkannte ihn sogleich, begrüßte ihn herzlich und feierte einige Tage später im Schloss mit ihm eine große Hochzeit, und ich war auch dabei. Danach begaben sie sich auf die weite Reise zum König, und ich bin mit ihnen gefahren, und so bin ich hierher gekommen.
Quelle: Ein Märchen v .Malinowski, L. Slask Opolski
VOM ARMEN FISCHER SOHN ...

Es lebte einst ein sehr armer Fischer, der hatte sieben Kinder. Er ging täglich zum Fischfang, aber nie fing er mehr Fische als immer nur neun, so daß jeder einen Fisch hatte, er aber keinen verkaufen konnte. Da grämte er sich furchtbar über seine Armut. Und so sprach er eines Tages, als er zu Bett ging: „O Gott, mein Gott! Könntest du doch eines meiner Kinder zu dir nehmen, damit ich wenigstens einen Fisch täglich verkaufen kann!“ Und der Herr erhörte ihn, eines seiner Kinder starb.
Er ging fischen – und fing einen Fisch weniger. Darüber war er zutiefst bekümmert und sprach, wie schon einmal, den Wunsch aus, daß der Herrgott eins seiner Kinder zu sich nehmen möge. Und der Herr nahm das zweite Kind zu sich. Aber wieder fing er beim Fischen einen Fisch weniger als zuvor.
Einmal ging er des Nachts auf Fischfang und fischte lange. Er warf sein Netz einmal ins Wasser und zog es leer heraus, er warf es ein zweites Mal und zog es leer heraus, da dachte er: „Morgen wird es wohl nichts zu essen geben!“ Zum dritten Mal warf er das Netz aus und holte es ein: es war furchtbar schwer! So furchtbar schwer, daß er es kaum einholen konnte, und er sprach: „Wenigstens einmal! Wenn ich diesen Fisch verkaufe, das wird eine Freude.“
Er zog das Netz heraus, und da hing ein riesiger Fisch im Netz, der hatte einen Menschenkopf mit wunderschönen langen blonden Haaren! Er erschrak fürchterlich, der Fisch aber sagte zu ihm: „Schick morgen deinen ältesten Sohn zu mir, er kann mir helfen! Inzwischen gebe ich dir sechzig Dukaten, da brauchst du nicht mehr auf Fischfang zu gehen.“ Der Fischer freute sich sehr, er ging nach Hause und erzählte alles seiner Frau. Gleich am nächsten Tag schickte er seinen ältesten Sohn zum Fluß.
Dort zeigte sich ihm derselbe Fisch, der mit seinem Vater gesprochen hatte, und sagte: „Hinter der Stadt erhebt sich ein riesiger Felsen, auf diesem Felsen steht mein Schloß! Ich gebe dir aber den Rat, gib, wenn du drei Nächte hindurch dort sitzt, kein Sterbenswörtchen von dir!“ Er antwortete, er wolle es so halten. Dann ging er zur Kirche, legte die Beichte ab, nahm einen Weihwedel, geweihtes Wasser, geweihte Kreide und begab sich in jenes Schloß.
Als er das Schloß erreichte, stand er vor einem gewaltigen eisernen Tor, er klopfte an, und es öffnete sich von selbst. Er betrat das Schloß und stieg zum ersten Stockwerk empor. Dort war in einem schön eingerichteten Esszimmer ein Frühstück für ihn angerichtet, und es war so köstlich, daß er selbst nicht wußte, wie er alles essen sollte. Er wußte auch nicht, wie man sich in den Sessel zu setzen hatte.
Er aß also, ging danach in den Salon und versteckte sich unter einem Kanapee. Da saß er nun, sagte den Rosenkranz her, sprach die Gebete, sang die Psalmen und dabei rückte die Nacht heran. Über alldem wurde er schrecklich müde und sank in tiefen Schlaf. Er schlief. Da hörte er aber im Schlaf, in der Nacht – wohl um Mitternacht – dicht neben sich einen inferalischen Tanz.
Er erwachte, und zog mit der geweihten Kreide einen Kreis um sich. Dann lauschte er, was weiter geschah. Er schaute und sah den Fußboden schwarz von Teufeln, die es sich dort bequem gemacht hatten, unter das Kanapee linsten und ihm zuriefen: „Jakob! Komm und tanz mit uns!“ Er aber regte sich nicht. Da sagte ein anderer Teufel: „He! Laß den in Ruhe! Er schläft ja!“ „Gewiß! Und wie er schläft! Bei solcher Musik, solchem Gelage da, da wird er wohl schlafen können!“
Da kam ein dritter Teufel zu ihm: „Nun, was ist, Jakob?! Feierst du mit uns? Oder nicht? Wenn ich für dich an die Glocke schlage, wird dein Herz gleich hüpfen!“ Er aber gab keinen Mucks von sich. Da wandte sich ein vierter Teufel an ihn, ein hinkender: „Jakob! Ich weiß, daß du mit keinem anderen gehen willst, nur mit mir, Du hinkst“ (aber Jakob war kein Hinkerfuß) und ich hinke, wir werden hübsch langsam tanzen.“ Er schwieg beharrlich, denn hätte er etwas entgegnet, dann hätte er vortreten und tanzen müssen.
Doch dann wäre es um seinen Kopf geschehen gewesen. Als sich die Teufel nun über ihn erzürnten, warfen sie alles, was Im Zimmer stand, nach ihm, nach dem Kanapee. Dann begannen sie so wild zu tanzen, daß es klang, als ob das ganze Schloß zusammenstürzte.
Und diese Teufel waren hundert an der Zahl. Doch Jakob unter dem Kanapee machte sich nichts daraus. Die Teufel lärmten, bis die zwölfte Stunde herangerückt war. Um Mitternacht wurde es überall still, doch Jakob kroch erst um halb zwei Uhr unter dem Kanapee hervor, denn er hatte Angst.
Er trat zum Schrank und trank etwas Wein, denn morgens hatte ihm ein Lakai gesagt, daß darin Wein für ihn stünde. Dieser Lakai war ebenfalls ein Teufel, denn dieses Schloß war nur von Teufeln bewohnt, am Tag jedoch besaßen sie keinerlei Macht. Er trat also zu dem Schrank, trank den Wein, reckte die Glieder und setzte sich; da vernahm er plötzlich im Nebenzimmer leichte Schritte und das Rascheln eines Seidenkleides.
Eine schöne junge Frau trat ins Zimmer. Sie trug ein schwarzes Kleid und darüber eine weiße Tunika. Und sie sagte zu ihm: „Du hast dich gut gehalten, mein Söhnchen! Aber sieh dich vor, denn in der zweiten Nacht werden es zweihundert sein!“ Und er antwortete, er habe auch davor keine Angst. Sie verabschiedete sich und verschwand.
Er legte sich in das Bett, das die Frau ihm hatte richten lassen, und schlief bis in die zehnte Stunde in der Frühe. Da kam sein Vater, der äußerst besorgt war, daß er den Sohn nicht mehr lebend vorfände. Er kam und freute sich sehr, als er Jakob bei einem köstlichen Frühstück antraf, an dem auch er sich ein wenig laben konnte. Dann verabschiedete sich der Vater, er aber ging im Schloßgarten spazieren, wo herrliche Äpfel und wunderschöne Blumen wuchsen. Er hätte gern welche gepflückt, doch fürchtete er, daß auch sie Teufelswerk waren.
So vertrieb er sich den ganzen Tag, teils frohgemut, teils traurig; traurig, weil er sich langweilte, und frohgemut, weil ihm die Dame das schöne Schloß und sich selbst versprochen hatte, wenn er sie erlösen würde. In der nächsten Nacht kroch er hinter einen Schrank, zog um sein Versteck einen Kreis mit geweihter Kreide........., und sank dann erschöpft in den Schlaf.
Da hörte er, wie alle Türen aufgingen, ein Gewirr heiserer Stimmen drang herein, und der Gestank von Pech breitete sich im ganzen Zimmer aus. Nun wurde er hellwach und wartete, was sich weiter begab. Endlich kamen alle Teufel in das Zimmer, in dem er sich befand, und sie sprachen: „Pfui! Pfui! Es stinkt nach einer Menschenseele!“ Da ließ sich der Hinkefuß vernehmen: „Sei doch still! Schimpf hier nicht herum! Wenn du Jakob verärgerst, wird er nicht mit uns tanzen wollen!“ „Suchen wir mal, wo er steckt!“ sagte einer der Teufel, und sie guckten unter das Kanapee. „Heute hat er sich woanders verkrochen, hier ist er nicht!“ „Aber er muß hier sein! Sein Duft ist doch in der Luft.“
Sie suchten ihn überall und riefen tanz mit uns! Wie bist du doch dumm, hier spielt die Musik, und du sitzt da wie eine Eule!“ Er aber antwortete nicht darauf. „Jakob, komm tanzen! Tut dir der Fuß weh? Oder bist du gar krank? Komm, komm, wir werden langsam tanzen!“ Um ihn versammelten sich alle Teufel, so daß es drückend heiß wurde, weil sie einen fürchterlichen Pechgestank verbreiteten. Als er den Sprengwedel ins Weihwasser tauchte und die Teufel damit besprengte, stobten sie je auseinander.
Aber sie kamen wieder, und zwar schrecklich wütend, riefen ihm alle erdenkliche Schimpfwörter zu und riefen alle möglichen Sünden auf ihn herab. Mit glühenden Schüreisen stießen sie nach ihm und mit Gabeln, und Jakob entgegnete nichts, er besprengte sich nur dauernd mit Weihwasser. Schließlich sagte einer der Teufel: „Wartet nur! Wenn ich ihm aufspiele, muß er aus seinem Versteck hervor kriechen!“
Als dieser Teufel wunderschön und feurig spielte, kam auch Jakob hinter seinem Schrank die Tanzlust an, aber er trat nicht hervor, sondern tanzte nur für sich allein hinter dem Schrank, und alle Teufel lachten ihn aus. „Haha! wie schlau er doch ist! Plagt sich allein mit dem Tanz ab, dabei würde er besser daran tun, mit uns gemeinsam zu tanzen!“ Jakob blieb aber still, er gab keine Antwort.
Immerzu sprangen die Teufel um ihn herum und schleuderten heißes Pech nach ihm. Wenn er sie aber mit Weihwasser besprengte, sagten sie: „Unser Pech brennt doch fürchterlich, aber ihm tut es nichts! Was hat er nur für Zeug, das uns so arg verbrennt?“ Und einer der Teufel entgegnete: „Weiß du, er ist ein Heiliger! Diese Heiligtümer hat er mitgebracht! Er wird uns aber doch in die Hände fallen, und wir werden ihn hinter diesem Schrank hervorzerren, wenn morgen noch mehr von uns da sein werden.“
Doch sie kamen mit ihren Flüchen und Drohungen nicht weiter, denn ihre Stunde war abgelaufen. Sie sammelten sich alle und verschwanden – und es wurde ganz still. Jakob war sehr erschöpft und schlief hinter dem Schrank ein. Und er sah und hörte nicht, wie jene Dame das Zimmer betrat, sie kam zu ihm hinter den Schrank, weckte ihn und sprach: „Weshalb schläfst du hinter diesem Schrank? Ich hatte doch befohlen, dir ein bequemes Bett zu richten! Weshalb schläfst du also hinter dem Schrank?“ Da entgegnete er: „Ach, ich war so müde, daß ich mich nicht einmal ins Bett legen wollte!“ Und sie antwortete: „Siehst du, wenn du auch morgen so tapfer bist, dann bin ich übermorgen deine Frau. Dann hast du es nicht mehr nötig, dich zu quälen und nicht zu schlafen!“ Sie war glücklich und entwich nicht so schnell wie gestern.
Sie verplauderten fast zwei Stunden mit ihm, bevor sie sich verabschiedete und verschwand. Er legte sich noch für ein Weilchen hin und schlief, aber nicht lange, denn der Morgen graute bereits. Voll Erwartung kam auch sein Vater, doch weniger, um ihn zu ,sehen, als – wie am Vortag – das prachtvolle Frühstück zu genießen. Sie aßen gemeinsam, danach nahmen sie Abschied voneinander, und Jakob lief mehrmals durch den Schloßgarten, nahm sein Mittagessen ein, schlief eine Zeitlang und suchte sich wieder ein anderes Versteck.
In der Nähe hörte er: etwas Gewaltiges stürzte über ihm zusammen. Schuttmassen, Ziegel, Steine fielen in riesigen Mengen herab, daß es ihm schien, er könnte nicht mehr darunter hervorkommen. Schließlich warf er einen Blick aus dem Versteck und sah, daß alle Kerzen in den Räumen brannten, auch alle Lampen, und unzählige Herren umher liefen, so daß alle Zimmer im ersten Stock brechend voll waren.
Sie speisten furchterregend, lange und viel. Danach tanzten sie miteinander und begannen sich entsetzlich zu streiten und zu schlagen, aber er konnte von all diesem Gezänk nichts verstehen, nur so viel, daß es um eine Frau ging. Einer fiel über den anderen her: „Du bist schuld!“ „Nein, du!“ Ein dritter sagte: „Das ist nicht wahr! Der da ist schuld!“Es war ein fürchterliches Gezänk im Gange, und alle ballten sich zu einem einzigen Haufen.
Noch am Tage hatte Jakob seine geweihte Kreide auf eine lange Stange gespießt; als er nun all die Streitenden auf einem Haufen zusammengedrängt sah, beugte er sich aus seinem Versteck und zog um den ganzen Schwarm einen Kreis, so daß sie nicht mehr auseinander gehen konnten, nur der hinkende Teufel befand sich nicht in diesem Haufen.
Da verließ Jakob sein Versteck, nahm das Weihwasser und begann, diesen Teufelsschwarm tüchtig zu besprengen, daß sie ihn händeringend baten, sie nicht dauernd zu verbrennen, weil es furchtbar weh täte. Der hinkende Teufel hatte sich versteckt, weil er fürchtete, gleichfalls besprengt zu werden. Da fragte Jakob die übrigen Teufel: „Und wo ist der Hinkefuß?“ Keiner der Teufel wollte preisgeben, wo sich der Hinkefuß befand.
Da sagte Jakob, daß er sie nicht nur besprengen, sondern sogar begießen würde, wenn sie es ihm nicht verrieten. Nun, da sagten sie es ihm. Jakob ging zu ihm, doch der Hinkende bat hastig, Jakob möge ihn verschonen. Darauf forderte dieser: „Dann komm, und führ mich überall herum!“ Der Teufel nahm die Schlüssel zu den Hofgebäuden, wo sich ein großer Speicher befand.
Dort angekommen, sagte er zu Jakob:
„Schließe du auf!“ Aber Jakob entgegnete: „Nein, du wirst öffnen!“ „Nein, du wirst öffnen!“ Der Teufel wollte anfangs nicht öffnen, als aber Jakob den Weihwedel hob, blieb ihm nichts anderes übrig. So betraten sie den ersten Raum.
Dort war lauter Gold angehäuft, und der Teufel sprach: „Das wird dir gehören!“ Dann betraten sie den zweiten Raum; hier war alles von Silber. „Das ist für die Kirche!“ Danach gingen sie in den dritten Raum; dort war alles von Kupfer. „Das ist für die Armen!“ Schließlich betraten sie den vierten Raum; da waren viele teure Edelsteine.
„Die werden dir gehören!“ Der Teufel schloß danach den fünften Raum auf; dort hingen die aller schönsten Kleider, wie sie sich für ein königliches Haus schickten. „Das alles ist für deine Frau bestimmt!“ Im sechsten Raum waren Schüsseln, Pokale und anderes Geschirr gelagert, alles aus Silber und Gold und mit wertvollen Edelsteinen besetzt.
„Das wird ebenfalls dein Eigentum sein!“ Den Rest konnte ihm der Teufel nicht mehr zeigen; er hatte nicht einmal die Zeit, alle offenen Kammern wieder zu verschließen. Kaum war er nämlich durch die Tür des Speichers getreten, da zerfloß er zu einer klebrigen, übelriechenden Masse, denn seine Stunde war gekommen.
Jakob kehrte wieder nach oben zurück und fand im Salon einen ungeheuren Kothaufen, das Haus aber voll von Dienerschaft, von echten Menschen, die Jakob von ihrem Zauber erlöst hatte. Und er fand auch (wie es ihm versprochen hatte) seine künftige Frau, so frei und glücklich, daß sie kaum Worte finden konnte, ihm für seinen Mut und seine Ausdauer zu danken. Sogleich ließ sie seine Eltern herbeirufen, um ihnen ein besseres Obdach zu geben, als sie es bisher hatten, und sie verkündete Jakobs Vater, sie wolle seinen Sohn zum Manne nehmen.
Sie heirateten also und waren beide sehr glücklich – aber nur für kurze Zeit.
Eines Morgens betrat Jakob das Zimmer seiner Frau und fand dort nicht sie, sondern nur ein Kärtchen auf ihrem Frisiertisch, auf dem geschrieben stand: „Gräm dich nicht, mein lieber Mann! Mich hat der Hexenmeister vom Glasberg entführt. Deine dich liebende Frau!“
Sogleich nahm er Abschied von seinen Eltern und sagte, daß er seine Frau suchen wollte, bis er sie fände. Dann machte er sich auf den Weg. Und er wanderte sehr weit, mehr als einhundert Meilen. Endlich stieß er auf eine kleine Hütte im Walde, er sah durch das Fenster; drinnen saß ein grauhaariger Greis am Tisch, ein sehr alter Mann, denn er zählte schon einhundertzehn Jahre, und nahm mit seiner Frau das Abendbrot ein.
Jakob pochte an die Tür; man öffnete ihm, und der Alte begrüßte ihn ganz väterlich und sprach: „Oh! Nun wohne ich schon so lange hier, von Jugend an, aber noch nie hat mich jemand besucht! Von wo, mein Sohn, hast du dich hierher verirrt?“ Es war aber der König aller Tiere. Und Jakob antwortete ihm, daß er auf der Suche nach seiner Frau sei, die ihm der Hexenmeister vom Glasberg gestohlen habe.
„Wißt Ihr vielleicht, Alterchen, wo sich dieser Glasberg befinden könnte?“
„O nein, mein Sohn! Ich weiß es nicht! Ich lebe schon über einhundert Jahre, aber von einem Glasberg habe ich noch nie etwas gehört, doch vielleicht wissen meine Tiere etwas darüber. So Gott uns den morgigen Tag erleben läßt, rufe ich sie alle zusammen und befrage sie. Inzwischen aber“ wandte er sich an seine Frau, „richte doch unserem Gast ein bequemes Lager, denn er ist müde!“
Der Alte setzte dem Wanderer ein Abendmahl vor, das dieser mit großem Appetit zu sich nahm, denn er war ungemein hungrig. Danach wünschte er seinen alten Gastgebern eine gute Nacht und legte sich schlafen. Er schlief so köstlich und ruhig ein, daß er sogar seine geliebte Frau vergaß, um die er sich so sehr sorgte. Am nächsten Morgen erwachte er und bekam ein so gutes Frühstück vorgesetzt, wie er das in der Hütte dieses armen Alten nie erwartet hätte.
Später trat der Alte aus der Hütte und pfiff auf zwei Fingern. Da kamen alle Tiere herbei, die es auf der Welt nur gab. Und der Alte sagte: „Wißt ihr wohl zufällig, wo der Glasberg zu finden ist?! Sie zuckten alle die Achseln: „Nein!...Nein!“ und jedes entfernte sich in seine Richtung. Da sagte der Alte: „Nun, da kann ich Euch nicht helfen, Herr, aber ich gebe Euch einen Brief an meinen älteren Bruder mit, der wohnt hundert Meilen von hier. Er hat die Macht über alle Vögel, und am besten werden bei ihm wohl die Adler Bescheid wissen.“
So verabschiedete sich Jakob von den beiden Alten und wanderte weiter. Er mußte sehr weit gehen, furchtbar weit, und kam schließlich in einen Wald. Dort sah er, wie ein Wolf, ein Bär, und ein Löwe miteinander um einen Hirsch kämpfen. Er ging näher heran und fragte die drei: „Worum geht es euch denn?“ Da gab der Löwe zurück: „Uns geht es darum, daß wir niemanden haben, der den Hirsch aufteilen könnte, damit jeder von uns einen gleichgroßen Anteil bekommt!“ Jakob zog seinen Säbel aus der Scheide, zerteilte den Hirsch in drei Stücke und sprach:
„Hier, Freunde, habt ihr eure Anteile, schlagt euch nicht länger!“ Da packte jeder der drei sein Stück und verspeiste es. Nachdem sie sich gesättigt hatten, fragten sie: „Was können wir dir dafür geben, daß du Frieden zwischen uns gestiftet hast?“ Er aber sagte: „Was könntet ihr mir denn geben?“
Der Wolf sagte: „Ich gebe dir ein Paar Stiefel!“ Der Bär: „Von mir bekommst du einen Hut!“ Der Löwe: „Und ich gebe dir einen Mantel!“ „Wenn du die Stiefel anziehst, wirst du mit einem einzigen Schritt hundert Meilen zurücklegen.“ „Wenn du den Hut aufsetzt, kann dich niemand erkennen, wohin du auch gehst.“ „Wenn du aber den Mantel umlegst, muß selbst der bösartigste Mensch, wenn er dir begegnet, erbeben, denn er wird denken, du bist der Tod.“
So setzte er seinen Weg fort. Er tat einen Schritt und war sogleich hundert Meilen weiter beim älteren Bruder des Alten, dem Beherrscher der Vögel. Er sah zum Fenster hinein und erblickte in der Hütte einen Greis, einen alten Mann, wie er sein Leben lang noch keinen mit eigenen Augen gesehen hatte. Er klopfte an die Tür – öffnete ihm ein ebenso altes Mütterchen, sie war so alt, daß sie vor Schwäche zitterte.
Sie begrüßten ihn überaus herzlich, denn sie sehnten sich nach einem Gast, weil sie gewöhnlich niemand besuchen kam. Die beiden fragten ihn also, woher er denn käme und wieso er sich in eine Gegend verirrt habe, wo sich sonst nur Füchse gute Nacht sagten. Sie setzten ihm sein Abendbrot vor, und während des Essens erzählte Jakob sein ganzes Abenteuer.
Darauf sagte der Alte: „Von einem Glasberg, habe ich, solange ich lebe, noch nicht gehört, aber meine Adler werden vielleicht etwas darüber wissen. Anderntags bekam Jakob sein Frühstück; danach trat der Alte vor die Hütte und pfiff seine Vögel herbei. Und sie kamen in Scharen hergeflogen, nur die Adler waren nicht dabei: „Wißt ihr nicht, meine Vögelchen, wo der Glasberg ist?“ Alle antworteten, daß sie es nicht wüßten.
Er pfiff nach den Adlern. Und schon kamen die riesigen Adler herbei. Der Alte fragte sie, ob sie wüßten, wo der Glasberg sei. Die Adler antworteten: „Und ob wir das wissen! Wir sitzen schon den ganzen Tag auf der Lauer, denn am Abend findet dort eine Hochzeit statt, da fällt sicher auch für uns etwas ab!“ „Wenn ihr es also wißt, dann führt diesen Herrn dort hin.“ „Nun gut!“ Jakob schwang sich auf einen Adler, und der trug ihn im Handumdrehen auf den Glasberg.
Dieser Berg war ganz und gar aus Glas, und auf dem Gipfel stand ein Schloß. Der Adler trug ihn also auf den Glasberg hinauf und ließ ihn dort absteigen. Jakob nahm seinen Hut und wollte gehen, da schrie ihn der Adler fürchterlich an, er solle ihm dafür, daß er ihn bis auf den Glasberg getragen hatte, einen halben Ochsen geben.
Aber Jakob entgegnete:
„Du weißt, daß ich keinen Ochsen bei mir habe; wenn du wartest, werfe ich dir einen ganzen Kalbsbraten aus dem Fenster!“
Jakob dachte dabei an den Hexenmeister, den er fangen und aus dem Fenster werfen wollte. Dagegen hatte der Adler nichts einzuwenden.
Unsichtbar betrat er nun das Schloß, denn er trug jenen Hut; er ging in den Salon, wo die Hochzeitsgäste sich bereits vergnügten, stellte sich neben seine Frau und flüsterte ihr zu: „Was hast du mir da Schönes eingebrockt?“ Und sie entgegnete sogleich: „Gut, daß du gekommen bist, denn du wirst mich ganz gewiß aus den Fängen dieses schrecklichen Menschen befreien!“ Sie schloß ihn in ihrem Zimmer ein, ging selbst in den Salon zurück und begann zu schreien und zu weinen.
Alle Gäste fragten, was ihr geschehen sei, sie antwortete, daß der Schlüssel zu ihrem Toilettentisch verloren gegangen sei. Die Anwesenden versuchten, sie zu beschwichtigen, zu trösten, man könnte ja einen neuen Schlüssel kaufen. Sie entgegnete aber, daß ein zweiter niemals so sei wie der erste. Alle pflichteten ihr bei, daß stets das erste das beste sei.
Da sagte sie: „Seht selbst! Ich habe einen ersten Mann, der so gut ist, daß ein zweiter Mann gar nicht so gut sein kann. Gebt mich also frei aus der Gefangenschaft, damit ich zu meinem ersten Mann zurückkehre!“ Danach ging sie in ihr Zimmer, in dem sie ihren Mann zurückgelassen hatte. Er versteckte sie unter seinem Mantel und entfloh mit ihr, von niemanden gesehen, denn er hatte ja den Wunderhut auf dem Kopf. Und so brachte er sie in seinen Palast, wo sie bis zu ihrem Tode glücklich lebten.
VOM ARMEN MÄDCHEN, DAS KÖNIGIN WURDE ...

Eine Mutter hatte eine eigene Tochter und eine Stieftochter; ihre eigene Tochter schonte sie sehr, aber die Stieftochter trieb sie dauernd mit dem Vieh hinaus auf die Weide, gab ihr nichts zu essen und ließ sie ständig hungern. Doch die Stieftochter hatte unter dem Vieh, das sie hütete, einen jungen Stier, und wenn sie Hunger bekam, so rief sie nur:
„Komm, Hörnerstierchen, Eichbaum erblühe, Goldfäden ziehe!“
Und sofort kam der junge Stier angelaufen, begann mit seinen Hörnern gegen die Eiche zu stoßen, und das Mädchen hatte sogleich Essen, Trinken und alles, was es auf der Welt gibt. Das spielte sich jeden Tag so ab, doch die Stiefmutter war neugierig geworden, wovon das Mädchen wohl lebte, und so befahl sie eines Tages ihrer eigenen Tochter, das Vieh auf die Weide zu treiben, um zu sehen, ob ihre Tochter auch ohne Essen auskäme.
Diese hatte einmal gehört, wie die Stiefschwester den jungen Stier gerufen hatte. Als sie also das Vieh auf die Weide getrieben hatte, versuchte sie, den Stier ebenso zu rufen. Der Stier kam angelaufen, aber statt seiner Hörner in die Eiche zu stoßen, begann er, sie selbst mit seinen Hörnern zu stoßen. Abends trieb die Tochter das Vieh nach Hause und beklagte sich mächtig. Die Mutter wurde wütend, dass der junge Stier ihre Tochter so zugerichtet hatte, und verkaufte ihn den Juden zum Schlachten.
Die Juden kauften den Stier. Als die Stieftochter davon erfuhr, begann sie bitterlich zu weinen und zu klagen und brachte ihm, bevor er geschlachtet wurde, in einem Bottich etwas Molke. Als der junge Stier sah, dass das Mädchen so großes Mitleid mit ihm hatte, bat er sie, nicht um ihn zu weinen, und sagte: „Wenn mich die Juden geschlachtet haben, so bitte sie um meine Därme. Wenn du sie ausspülst, wirst du darin etwas finden.“
Nachdem die Juden den Stier geschlachtet hatten, gaben sie ihr die Därme. Sie ging damit ans Wasser, spülte sie und fand in ihnen einen goldenen Apfel; sie steckte ihn in ihren Busenausschnitt und ging nach Hause. Doch unterwegs musste sie erst über einen, dann über einen zweiten und schließlich über einen dritten Zaun steigen. Als sie sich über den letzten Zaun beugte, rollte ihr der Apfel aus dem Busenausschnitt und fiel ins Gras. Sie begann ihn zu suchen, suchte und suchte, konnte ihn aber nicht finden und kehrte weinend nach Hause zurück.
Am nächsten Tag ging sie an die gleiche Stelle, an der sie den Apfel verloren hatte, und stellte staunend fest, dass dort über Nacht ein ganz herrlicher Apfelbaum gewachsen war, an dem so viele Äpfel hingen, dass sich seine Zweige bogen. Sie pflückte sich so viele Äpfel, wie sie wollte, aß sich daran satt und tat es jeden Tag. So ernährte sie sich nur von Äpfeln.
Eines Tages fuhr ein Prinz vorüber. Da ihm ein so herrlicher Duft von Äpfeln entgegenkam, ließ er seinen Vorreiter halten und befahl dem Lakai, ihm einige Äpfel zu pflücken. Der Lakai ging zu dem Apfelbaum und erblickte die schönen Äpfel, die ihn geradezu anlachten, und wollte anfangen zu pflücken. Doch da erhob sich der Apfelbaum mitsamt den Äpfeln in die Höhe. Der Lakai stutzte, ging zum Prinzen und erzählte ihm, was geschehen war. Der Prinz wollte ihm nicht glauben und sagte: „Das kann doch nicht sein!“ „Möge sich der erlauchteste Prinz selbst überzeugen“, empfahl der Lakai.
Der Prinz ging also zum Apfelbaum und sah, dass der Lakai die Wahrheit gesagt hatte, denn auch er konnte keinen Apfel pflücken. Unweit von diesem Apfelbaum stand die Bauernkate, in der jene Mutter mit Tochter und Stieftochter wohnte. Der Prinz befahl also, jemanden aus der Kate zu holen, damit man ihm die Äpfel pflückte.
Sobald dies die Mutter hörte, freute sie sich sehr, putzte ihre Tochter heraus, wie sie nur konnte, und schickte sie zum Apfelbaum, doch als sie dicht an ihn herangekommen war, hob sich der Apfelbaum sogleich in die Höhe. Dann kam die Mutter selbst, und es geschah das gleiche. Da fragte der Prinz: „Gibt es niemanden mehr in der Kate?“ „Nein, niemanden mehr, nur eine ist noch da, die läuft in einem Schweinepelz herum.“ „Ruft auch diese Person“, sagte der Prinz, „auch sie soll versuchen, die Äpfel zu pflücken!“
Das arme Mädchen kam also zu dem Apfelbaum, und schon bogen sich die Zweige ihr entgegen. Sie pflückte einige Äpfel und brachte sie in einem Tüchlein dem Prinzen. Der Prinz nahm die Äpfel von ihr an, fasste das Mädchen an der Hand, setzte sie neben sich in die Karosse und fuhr davon. Aber der Apfelbaum schwebte bis zur Tür der Karosse, blieb davor und wanderte ständig mit.
Danach heiratete der Prinz dieses Mädchen, und sie hatten ein Kind miteinander.
Eines Tages fuhr der Prinz zur Jagd. Die Prinzessin bat ihn daher um Erlaubnis, ihre Stiefmutter zu besuchen. Er erlaubte ihr dies, und sie fuhr hin. Als ihre Stiefmutter sie sah, fing sie sogleich an, sie auszufragen: welches Zimmer sie bewohne, welche Diener und welche Kleider sie hätte, in was für einer Wiege das Kind läge. Nachdem sie alles Wissenswerte von ihr erfahren hatte, erschlug sie die Stieftochter, streifte dann ihrer eigenen Tochter die Gewänder über und schickte sie zu dem Prinzen. An der Stelle, an der die Stiefmutter ihre Stieftochter begraben hatte, blieb der Apfelbaum stehen und vertrocknete.
Nicht lange danach klopfte es Nachts an die Fenster des Schlosses, und jemand begann zu singen: „Küchenmeister, Küchenmeister! öffne mir das Fensterchen, dann stille ich mein Kindchen. Und schlafen die Hunde unter der Küchenbank, und schläft mein Herr mit dieser Magd?“
Der Küchenmeister antwortete, die Hunde schliefen, der Herr aber schlafe nicht mit seiner Dienstmagd. Er öffnete das Fenster, sah, dass eine Gestalt hineinschlüpfte, das in der Wiege liegende Kind stillte und dann wieder verschwand. In der nächsten Nacht wiederholte sich alles wie in der Nacht zuvor. Der Koch war darüber sehr verwundert und berichtete alles dem Prinzen.
In der dritten Nacht legte sich der Prinz nicht schlafen, sondern setzte sich in einen Sessel und sagte zu dem Koch: „Lege dich unter den Sessel, und wenn du öffnest und sie kommt herein, so ergreife sie rasch am Haarzopf und wickle ihn dir um die Hand.“ Der Koch befolgte die Weisungen. Als die Gestalt hereinkam, fasste er sie von hinten am Zopf und begann, während er ihn sich um sein Handgelenk wickelte, zu reden: „Werde wieder das, was du warst! Werde wieder das, was du warst!“
Sie versuchte sich loszureißen, sich zu entwinden, verwandelte sich in verschiedene Reptilien, Vögel, Tiere, Kühe, Hunde und alles, was es sonst auf der Welt gibt, doch schließlich verwandelte sie sich in die Prinzessin, in die Stieftochter jener Stiefmutter, bekleidet nur mit einem Hemd, so wie sie von ihrer Mutter erschlagen worden war.
Nun kam alles ans Tageslicht; zu dem Prinzen, er war inzwischen König geworden, kamen viele Ratgeber und diese schickten nach der Stiefmutter und fragten sie, welches Urteil sie über ein Weib sprechen würde, das dies und das begangen habe. Da antwortete sie, dass man ein solches Weib mit eisernen Eggen auf dem Feld auseinander reißen sollte, der Tochter aber sollte man nur eine Hand abschlagen.
So geschah es dann auch, und die getötete Prinzessin wurde alsbald so lebendig wie zuvor, ja, und war nun auch eine richtige Königin.
Quelle: Märchen aus Polen - Chelchowski
DIE ROSE
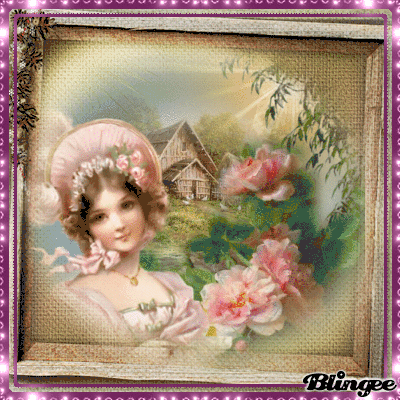
Ein Kaufmann hatte drei Töchter, von denen er besonders die jüngste sehr liebte. Als er sich einst zur Reise über das Meer, in ein fernes Land rüstete, fragte er beim Abschiede die Töchter, was er ihnen aus dem fremden Lande mitbringen solle. »Mir, lieber Vater,« sagte die älteste, »bringe ein Sonnenkleid mit,« »mir,« bat die zweite, »eine goldene Mütze,« »und ich bitte,« rief die jüngste, »um eine Rose, ich möchte gerne sehen, wie die Rosen im fremden Lande blühen.« Der Vater versprach, ihnen ihre Wünsche zu erfüllen, und fuhr mit günstigem Winde ab.
Als er in dem fernen Lande seine Einkäufe besorgt und sich auf die Rückreise begeben hatte, entstand aber gleich am ersten Tage ein heftiger Sturm; das Schiff wurde auf einen Felsen getrieben, zerschellte, und alle Schätze und Waaren sanken unter. Der Kaufmann, welcher sich an ein losgerissenes Brett klammerte, wurde allein an das Land getrieben und entging so dem Tode.
Er ging an dem Ufer hin und her und beklagte den Verlust seiner Habseligkeiten, aber am meisten tat es ihm um die Geschenke leid, die er für die Töchter mitgenommen hatte, und daß er ihnen nun keine Freude machen könnte; da erblickte er nicht weit von dem Orte, an dem er sich befand, ein kleines Häuschen und daneben einen Rosenstrauch mit wunderschönen Rosen. »Da sehe ich ja Rosen,« dachte er bei sich selbst, »und kann wenigstens meiner liebsten Tochter eine Freude machen«, und ging hin, um eine abzupflücken.
Als er schon ganz nahe daran war, kam aus dem Häuschen ein häßliches Tier, nicht recht Wolf und nicht recht Bär, das aber sprechen konnte und ihn auch gleich fragte, wer er sei, und was er wolle. Der Kaufmann erzählte ihm, wie es ihm ergangen sei, und wie er nichts so bedaure, als den Verlust der drei Geschenke für seine drei Töchter, und wie er sich eine Rose von dem Rosenstocke abschneiden wollte für seine jüngste und geliebteste Tochter.
Das Tier, so abschreckend es auch aussah, war in seinem Wesen recht liebenswürdig, lud den Kaufmann ein, in seiner Hütte einige Tage auszuruhen, und versprach ihm auch eine Rose mitzugeben. Das nahm der Kaufmann alles dankbar an, und als er nach ein Paar Tagen Verlangen zeigte, nach Hause zu reisen, sagte das Tier: »Hier hast du die Rose, reise glücklich, aber nach einer gewissen Zeit (die ihm das Tier bezeichnete) muß deine jüngste Tochter hier sein, sonst ist es um mein und euer Aller Leben geschehen.« Das mußte der Kaufmann nun schon versprechen.
Als er darauf zum Ufer ging, um Anstalten zur Abreise zu treffen, da war auch gleich ein Schiff zur Hand, das nur für ihn bestimmt zu sein schien, und das er dann auch gleich bestieg. Er kam sehr bald glücklich nach Hause und erzählte daselbst seine Abenteuer. Mit betrübtem Herzen fügte er auch hinzu, was das Tier von seiner jüngsten Tochter verlangt hätte. Alle waren darüber sehr traurig, nur die jüngste Tochter selbst tröstete sie und sagte: »Grämt euch nicht, es ist ja besser, daß ich allein umkomme, als daß euch alle das Unglück trifft, und vielleicht wird mir auch nichts Schlimmes widerfahren.«
Als die von dem Tiere bezeichnete Zeit herankam, nahm sie Abschied von den Ihrigen und begab sich an das Ufer. Dort wartete ihrer auch schon dasselbe Schiff, welches den Vater zurückgebracht hatte, und der Capitain rief ihr entgegen: »Sputen sie sich, Fräulein, es ist die höchste Zeit.« Nach einer sehr schnellen und glücklichen Fahrt kam sie nach dem Hüttchen an. Am Ufer empfingen sie drei schöne schwarzgekleidete Fräuleins, die aber bald verschwanden und sie ganz allein ließen.
Da ging sie denn allein auf die Hütte zu und als sie in den Garten kam und das Tier ihr entgegentrat, erschrak sie so sehr, daß sie ohnmächtig wurde. Das Tier war sehr besorgt um sie, und holte Wasser, um sie wieder ins Leben zu rufen, was ihm auch gelang. Auch redete es ihr freundlich zu, sich nicht zu ängstigen, es werde ihr nichts geschehen, auch solle es ihr an nichts fehlen. Sie beruhigte sich wirklich, und da sie im übrigen hatte, was sie bedurfte, gut Essen und Trinken, gute Kleidung u.s.w., und da sie sich mit dem Tiere auch unterhalten konnte, so fühlte sie sich allmählich auch zufrieden.
Nach einigen Monaten fing sie sich aber doch an zu bangen. Das Tier bemerkte es und tröstete sie, daß zu Hause alles gesund und vergnügt sei, und gab ihr auch einen Spiegel, in welchem sie die Ihrigen sehen konnte. Sie sah, wie die Ihrigen sangen und sprangen und vergnügt waren. Das verstimmte sie doch. »Sie kümmern sich,« sagte sie zu sich selbst, »auch gar nicht um dich und wissen doch nicht einmal, ob du noch lebst.« Nun wollte sie sich auch nicht mehr nach ihnen bangen, aber nach ein Paar Tagen überkam sie doch wieder die Schwermut.
Da sagte das Tier: »Ich werde dich zum Besuche nach Hause schicken, aber nach ein Paar Tagen mußt du wieder zurückkommen, sonst muß ich und ihr Alle mit mir sterben.« Das tat es denn auch, sie bestieg das Schiff und war in einer Minute zu Hause. Ihr Vater und ihre Schwestern waren freudig überrascht und sehr glücklich, als sie sie wieder hatten, und wollten sie gar nicht mehr wieder fortlassen, aber sie ließ sich nicht bewegen, zu Hause zu bleiben, da ja dann Alle sterben müßten.
Als die bestimmten Tage verflossen waren, begab sie sich wieder an das Ufer, wo das Schiff schon bereit stand, und der Capitain ihrer mit Ungeduld wartete. Er meinte, als sie anlangte, daß es eigentlich schon etwas zu spät sei. Sie stieg aber ein, und in einer Minute war sie wieder bei dem wunderbaren Tiere.
Es hatte mit großer Unruhe auf sie gewartet und war, als die rechte Zeit verstrichen war, in Ohnmacht gefallen, und so fand es das Mädchen auf der Erde liegend. Das tat ihr sehr leid, sie kniete an ihm nieder und küßte es - da fiel die zottige Haut von seinem Leibe und vor ihr stand ein schöner Prinz und aus dem Hüttchen war ein Schloß in mitten eines prächtigen Parks geworden, und im Schlosse lebte Alles wieder auf, was bis dahin sich nicht geregt hatte, die Eltern und Geschwister des Prinzen und alles Gesinde.
Der Prinz umarmte das Mädchen und erzählte ihr, daß er verwünscht gewesen sei, und nur ein Kuß eines reinen unschuldigen Mädchens bei seiner abschreckenden Gestalt hätte ihn erlösen können. Jetzt heiratete er das Mädchen, und das glückliche Paar lebt bis auf den heutigen Tag.
Aus Klein-Jerutten
[Polen: M. Toeppen: Aberglauben aus Masuren]
DAS MÄRCHEN VOM KÖNIGSSOHN ...
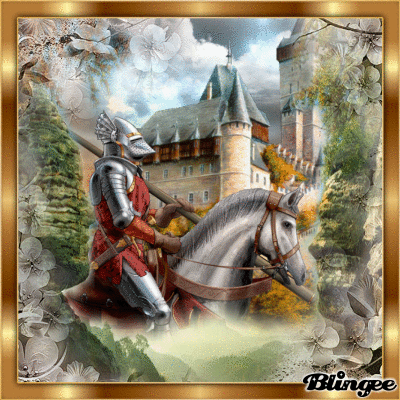
Ein König mußte einmal Krieg führen, es fehlte ihm dazu aber an Geld. Also nahm er bei einen Juden namens Milojardyn eine Anleihe auf und zog in den Krieg. Dieser Jude hatte eine Tochter, die sah so aus wie des Königs Frau; und die Tochter fragte ihren Vater, weshalb der König nicht sie zur Frau genommen habe. Da sagte der Jude: „Wenn du des Königs Frau sein willst, dann komm!“
Er ging mit ihr in den Königspalast, verwandelte die Königin in eine Stute und setzte seine Tochter an ihre Stelle, denn sie glich ihr aufs Haar. Der König hatte einen Sohn, der zur Schule ging. Nachdem der König aus dem Krieg zurückgekehrt war und sie sich zum Mittagsmahl setzten, klagte die Frau, daß ihr der Sohn sehr viel Kummer bereite. Da sagte der König: „So schaff ihn dir irgendwie vom Halse!“
Als der Sohn darauf nach Hause kam, nahm er eine Zuckertüte und Wecken, ging in den Stall und gab sie der Stute, doch diese versetzte ihm einen Tritt. Da sagte er: „Ach, du Undankbare, ich gebe dir Futter, und du trittst nach mir.“ Da gab die Stute zurück: „Deine Mama wird dir heute zum Mittagsmahl Süßigkeiten und Fleischbrühe vorsetzen. Iß nichts von dem, was sie dir bringen, sondern nimm es und sage, daß du es gleich essen wirst, denn wenn du dies zu dir nähmest, würdest du dich vergiften. Nimm die Speisen also, wickle sie in Papier und wirf sie dem Hund vor.“ Er ging in sein Zimmer und begann zu lernen.
Die Mutter brachte ihm sein Mittagessen, er bat sie etwas später essen zu dürfen, da er viel zu lernen habe. Die Mutter stellte ihm alles hin und ging hinaus, er aber wickelte das Essen in ein Stück Papier und gab es dem Hund. Sowie es der Hund gefressen hatte, verendete er. Als er am nächsten Tag aus der Schule kam, nahm er wieder Zuckerstücke und Wecken, ging zur Stute und gab ihr alles, was er hatte, aber wieder gab sie ihm einen Tritt. Und er sagte: „Ach, du Undankbare, ich gebe dir zu fressen, und du trittst mich!“ Sie aber sprach: „Heute bekommst du abermals Süßspeise und Fleischbrühe. Iß die Brühe und das Fleisch, die Süßspeise aber wirf einem Hund vor. Wenn sie dir die Speisen bringen, übe deine Aufgaben und sage, dass du fleißig lernen mußt!“
Die Mutter brachte ihm die Gerichte. Er aß die Fleischbrühe auf, doch die Süßspeise versteckte er in einer Tasche. Als er zur Schule ging, warf er sie einem Hund vor, und der Hund verendete, nachdem er sie gefressen hatte. Da sagte die Königin zu ihrem Manne, daß dem Sohn nicht beizukommen sei.
Der König ließ nun für seinen Sohn einen Überrock anfertigen mit Knöpfen, die ihn, wenn er sie andrückte, auseinander reißen sollten. Als er aus der Schule kam, nahm er Zucker und Wecken und gab wieder alles der Stute, und diese trat in erneut, und er sagte: „Du Undankbare, ich gebe dir etwas, du aber trittst mich!“ Und sie erwiderte: „Dein Vater ließ dir einen Überrock mit Knöpfen machen, die dich in Stücke reißen werden, wenn du sie andrückst. Nimm Geld, geh zum Schneider, laß dir einen gleichen Überrock nähen wie jenen und versteck ihn, wenn der Schneider ihn bringt, in einen kleinen Koffer. Wenn dir die Mutter den Überrock bringt, dann lern wieder fleißig und bitte sie, den Rock später anprobieren zu dürfen, weil du lernen müßtest.“
So machte er es auch. Sobald sich die Mutter entfernt hatte, legte er den todbringenden Rock in den Koffer, holte seinen eigenen hervor und legte diesen auf den Koffer. Später kam die Königin wieder und ließ ihn den Rock anziehen; er zog den Rock an, doch ihm geschah nichts. Da sagte der König zur Königin, daß es kein Mittel gegen diesen Sohn gäbe.
Einst fuhr der König durch sein Reich, und die Königin zerraufte sich die Haare und zerkratzte sich das Gesicht und sagte zum König, als er zurückkehrte: „Dein Sohn hat mich so zugerichtet!“ Da sagte der König zu seinem Sohn, daß er ihn am nächsten Tag hinrichten lasse. Dieser nahm wieder Zucker und Wecken und brachte alles der Stute. Diese trat ihn und sprach: „Bevor sie dich hängen, bitte deinen Vater, er möge dir als letzten Wunsch gestatten, zweimal um den Palast zu reiten.“
Am nächsten Tag kamen viele Würdenträger angefahren, denn der Königssohn sollte um elf Uhr gehängt werden. Um halb elf kam der Sohn und bat seinen Vater, daß er ein letztes Mal auf seiner geliebten Stute reiten dürfte, und sein Vater erlaubte ihm dies. Aber die Stute erhob sich mit dem Königssohn in die Lüfte und trug ihn fort, in den Garten eines anderen Königs, dann gab sie ihm ihr Zaumzeug und sprach: „Bitte die Gärtner, daß sie dir Arbeit geben, wenn du aber in Not bist, schüttle das Zaumzeug.“
Der Königssohn hatte aber goldene Haare und einen Stern auf der Brust. Er kaufte sich eine Maske für den Kopf und sah damit aus, als hätte er den Grind. Der Gärtner stellte ihn ein und trug ihm auf, die Blumen zu pflegen.
Eines Tages ergingen sich die Töchter dieses Königs im Garten; alle Gärtner banden Blumensträuße für die Königstöchter, und auch er band einen, aber nur für die jüngste der Töchter. Diese zog einen Ring vom Finger, band ihn in ein Tüchlein und warf es ihm zu. Zwei der Königstöchter heirateten bald, und auch zu der Jüngsten kamen viele vornehme Prinzen, doch sie wollte keinen von ihnen, nur diesen Gärtnerburschen, und der König gab sein Einverständnis. Der Gärtnerbursche schüttelte nur einmal das Zaumzeug, schon stand die Stute vor ihm. Er saß auf, zog seine Maske ab und ritt in den Königspalast. Die Königstochter sah ihn und erkannte ihn.
Sie dachte nun, daß er zur Tarnung so gekleidet käme, er aber fuhr wie gewöhnlich mit seiner Maske zur Trauung, wie ein Grindiger. Nun wollte sich die Prinzessin nicht mit ihm trauen lassen, aber der König befahl es ihr. Nach der Trauung erklärten die Prinzen dem König den Krieg, weil die Königstochter keinen von ihnen zum Mann genommen hatte, und der König verlor alle Schlachten. Da sagte die Königstochter zu ihrem Manne:
„Du Grindiger, alles rührt nur daher, daß ich dich zum Manne genommen habe!“ Und er antwortete: „Ich werde auch in den Krieg ziehen!“ und er zog los.
Er bestieg ein Pferd, das Gesicht dem Hinterteil des Pferdes zugewandt, ritt hinaus aufs Feld, tötete das Pferd, schüttelte sein Zaumzeug, und die Stute kam angeflogen. Er schwang sich in den Sattel und ritt dorthin, wo der Kampf tobte. Er gebot, ihm Platz zu machen, und man machte ihm Platz. Als er zu kämpfen begann und alle auseinandertrieb, ertönte dort ein einziges: „Pardon!“ Der Vater seiner Frau ordnete an, ihm nachzuspüren, um zu erfahren, wer er sei.
Doch während ihn die Minister bewachten, erhob sich die Stute plötzlich mit ihm in die Lüfte und trug ihn dorthin, wo er das Pferd getötet hatte. Er erlegte ein paar Raben, brachte sie seiner Frau und sagte: „Ich komme vom Krieg!“ Aber sie war wütend auf ihn und erwiderte kein einziges Wort. Es vergingen einige Monate, und der König selbst erklärte einem anderen König den Krieg. Die Königstochter aber sprach: „Du Grindiger, bist daran schuld, daß meinem Vater der Krieg erklärt wird.“ Und er antwortete: „Dann ziehe ich auch in den Krieg!“
Er bestieg ein Pferd und ritt in eine Schlucht. Dort tötete er das Pferd, schüttelte das Zaumzeug und die Stute kam angeflogen. Da schwang er sich in den Sattel und ritt auf der Stute zum Kampfplatz. Er befahl, ihm Platz zu machen, und begann heftig drein zu schlagen – und der gegnerische König rief: Pardon! er wolle sich nicht mehr schlagen, bis in die siebente Generation.
Der König befahl, auf diesen kühnen Ritter gut aufzupassen und, sobald sich die Stute mit ihm in die Lüfte erhebe, auf sie zu schießen. Sie ritten, und die Stute erhob sich plötzlich in die Lüfte. Einer der Bewacher schoß, er traf den Ritter ins Bein. Als sie weiter ritten, erhob sich die Stute erneut in die Lüfte und trug ihn dorthin, wo er das Pferd erschossen hatte. Dort erlegte er ein paar Raben und brachte sie seiner Frau. Als er heimkam, gab er ihr die Raben und sagte, daß er schon aus dem Krieg zurück sei, aber sie war wütend.
Unterdessen kam ein Bote und sprach: Kommt auf den Ball!“ Seine Frau ging, er aber nicht. Da kam der Bote abermals und sagte: „Komm, denn der König ruft dich!“ Und er darauf: „Der König hat den gleichen Weg zu mir wie ich zum König!“ Da kam der König selbst zu ihm, fand die Tür versperrt, trat zum Fenster, sah einen Schal am Bein des Schwiegersohnes und sagte: „Er ist es also, der uns befreit hat!“
Jener nahm die Maske vom Kopf und trat hinaus. Er schüttelte sein Zaumzeug, und die Stute kam herbei. Schon wollte er aufsitzen, da wurde die Stute wieder zur Königin, und sie sprach: „Ich bin deine Mutter!“ Auch der König, der sein Vater war, kam angereist; als bald ließ man die Königin, die nicht seine Mutter war, in Stücke reißen. Und der Jüngling wurde König von zwei Königreichen.
DER IGEL ...
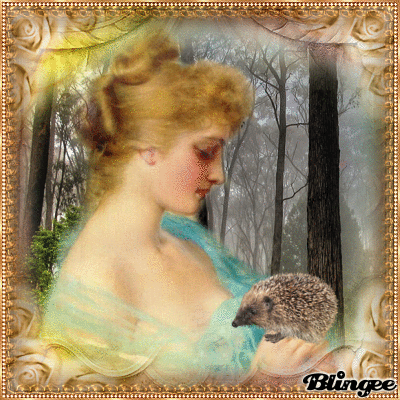
Es waren einmal drei Schwestern. Obwohl sie vermögend und annehmend hübsch waren, ließ sich kein Freier bei ihnen blicken. Als sie eines Tages in den Wald gingen, sahen sie einen Igel. Da sprach die Jüngste: „Das wird mein Bräutigam!“ In der nächsten Nacht kam der Igel unter das Fenster, klopfte und rief: „Ans Fensterchen poch, poch, Herzliebchen, öffne doch!“
Die jüngste Schwester öffnete und der Igel sprang sogleich aufs Fensterbrett, und sie gelobten einander ewige Treue. Dem Verlöbnis folgte das Aufgebot: einige Leute lachten darüber, andere wiederum dachten, der Bräutigam hieße nur „Igel“. Schließlich kam der Hochzeitstag. Die Braut stieg auf den Wagen und wickelte den Igel in ihre Schürze.
Als sie vor der Kirche eintrafen, setzte sie ihn in den Glockenturm, aber er sprach zu ihr: „Erlaub mir, dich zu küssen, mein Liebchen!“ Die Braut beugte sich willig zu ihm hinab, beim Küssen aber stach er sie in die Nase. Das Blut floß in Strömen und benetzte den Igel, da verwandelte der sich plötzlich in einen stattlichen Jüngling.
Die Menschen drängten herbei, das Wunder zu sehen, die Weiber aber nahmen seinen Stachelpelz und verwahrten ihn zum Andenken in der Vorhalle der Kirche. Groß war die Freude der Braut, der Eltern und Verwandten auf dieser prächtigen Hochzeit, und die Jungvermählten lebten sehr glücklich miteinander.
Weil aber die älteste und die mittlere Schwester dem jungen Paar das Glück neideten, töteten sie die verheiratete Schwester, begruben sie unter der Mauer und fügten die Dielenbretter wieder so ein, als wäre nichts geschehen.
Nach einiger Zeit kam ein Schafhirt des Weges und erblickte an der Mauer eine herrlich gewachsene Lilie; er pflückte sie und schnitzte aus dem Stengel eine Flöte. Immer aber, wenn er auf ihr blies, erklang eine Stimme daraus und sang folgende Worte:
„Schafhirte mein,
spiel zart und fein,
die Schwestern haben mich erschlagen,
unterm Balken eingegraben,
Schafhirte mein!“
Der Schafhirte wunderte sich sehr, noch mehr aber der Mann der Seligen, der gerade im Garten war und diese Worte hörte; er hatte sich inzwischen mit der mittleren Tochter der Verstorbenen vermählt.
Er ging also zum Schafhirten und fragte ihn, wie er zu dieser Flöte gekommen sei. Der Hirte bekannte die Wahrheit und übergab ihm die Flöte. Kaum hatte der Herr sie an die Lippen gesetzt, begann sie schon wehmütig zu summen:
„Ehegespons mein,
spiel zart und fein,
die Schwestern haben mich erschlagen,
unterm Balken eingegraben,
Ehegespons mein!“
Von Trauer erfaßt, lief der Herr eilig zum Haus, offenherzig erzählte er seiner Frau, wie er die Flöte erworben und welche Worte er vernommen hatte, worauf die frevlerische Schwester erblasste, und so zu zittern begann, daß sie um ein Harr das Kind aus ihren Armen fallen ließ.
Um sich entgültig von der furchtbaren Untat zu überzeugen, befahl ihr der Mann, die Flöte zu nehmen und darauf zu blasen. Obwohl die Frau sich lange wehrte, mußte sie ihm doch zu Willen sein, und kaum hatte sie das Mundstück angehaucht, erklangen schon die schrecklichen Töne:
„Spiel, Schwester mein,
spiel zart und fein,
ihr habt, Schwerstern, mich erschlagen,
unterm Balken eingegraben!“
Die erschrockene Missetäterin wollte die furchtbaren Worte nicht weiter hören und schlug im Zorn die Flöte gegen den Tisch – da fuhr der Geist der Verstorbenen aus der Flöte.
Der Mann aber rächte sich an den verbrecherischen Schwestern, indem er sie lebendigen Leibes von Pferden zerreißen ließ.
Quelle: Lompa J. Klechdy ludu polskiego w Slasku 1844
DIE GESCHICHTE VOM ZAUBERER ...
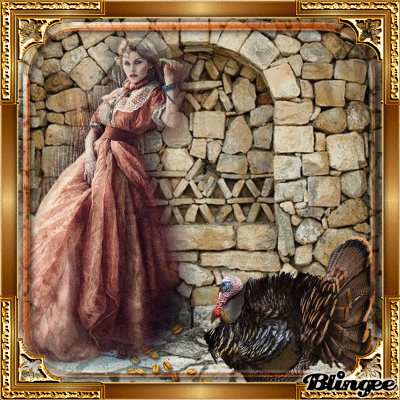
Es war einmal ein Knabe, der war sehr arm. Er hatte nur seinen Vater. Oft saß er im Sand und zeichnete mit dem Finger Buchstaben.
Er setzte sie zusammen und lernte so das Lesen. Eines Tages kam ein Zauberer vorüber und fragte ihn: „Möchtest du nicht für vier Jahre in meine Dienste treten?“
„Ich möchte wohl“, antwortete der Junge.
„Kannst du lesen?“ fragte ihn der Zauberer.
„Ja, das kann ich....!“ „Dann kann ich dich nicht gebrauchen“, sagte der Zauberer und ging weiter. Der Junge wechselte an eine andere Stelle des Sandbodens über. Da kam derselbe Zauberer und fragte ihn: „Kannst du lesen?“ „Ich kann nicht lesen“, antwortete der Junge. „Willst du für vier Jahre zu mir in den Dienst kommen?“ „Ja, ich komme.
Der Zauberer nahm ihn in sein Haus, gab ihm einen Hund und eine Katze zur Zerstreuung, damit er mit diesen spielen konnte, wenn er Langweile hatte. Danach gab er ihm die Schlüssel zu allen Räumen und hieß ihn in alle Zimmer gehen, nur in eins hieß er ihn nicht zu gehen. Der Junge machte in den Zimmern Ordnung, und ein ganzes Jahr lang betrat er das eine nicht. Als das erste Jahr abgelaufen war, fragte ihn der Zauberer, ob er ein weiteres Jahr bei ihm dienen wolle, und der Junge antwortete, daß er bliebe. Gegen Ende des zweiten Dienstjahres betrat er das verbotene Zimmer. Dort stand nur ein kleiner Tisch, und darauf lag ein Buch. Er nahm dieses Buch und schlug es auf, aber als eine Seite darin gelesen hatte, verwandelte er sich in einen Ochsen. Er blätterte die zweit Seite um, da wurde er wieder zum Mensch. Als sein zweites Dienstjahr beendet war, fragte ihn der Zauberer, ob er ein drittes Jahr bei ihm bleiben wolle, doch der Junge sagte, er wolle nach Hause gehen.
Der Zauberer entließ ihn, und der Junge kehrte zu seinem Vater zurück und sagte zu ihm: „Ihr müßt einen Strick drehen, Vater! Ich werde mich in ein großes Schwein verwandeln. Ihr treibt mich zum Jahrmarkt und fordert für mich einhundert Gulden. Den Strick aber nehme mir ab, wenn Ihr mich verkauft habt!“
Der Vater führte alles aus. Die Leute fragten ihn, wieviel er für dieses Schwein haben wolle; als er sagte, daß er einhundert Gulden verlange, zogen sie sich zurück. Dann kam der Zauberkünstler und zahlte die einhundert Gulden dafür. Der Mann löste den Strick und ließ das Schwein frei. Der Zauberer trieb es nach Hause in den Stall und sperrte es ein. Nach einer Stunde kam er, um nachzusehen, aber das Schwein war nicht mehr da.
Kurz darauf sagte der Junge zu seinem Vater, er solle ein Zaumzeug kaufen, weil er sich in ein Pferd verwandeln würde, und er solle ihn zum Markt treiben und dem Zauberkünstler für zweihundert Gulden verkaufen. Der Vater führte alles aus. Aber er vergaß, ihm nach dem Verkauf das Zaumzeug abzunehmen. Sogleich nach dem Kauf führte der Zauberer das Pferd zum Schmied, um es beschlagen zu lassen. Unterdessen erinnerte sich der Vater des Jungen, daß er vergessen hatte, das Zaumzeug zu lösen. Er ging daher zum Schmied und bat den Lehrjungen, das Zaumzeug abzunehmen. Der Lehrjunge nahm das Zaumzeug ab, und das Pferd verwandelte sich in eine Taube, die davon flog.
Da sagte der Lehrjunge zu dem Zauberer: „Herr, Herr! das Pferd ist entflohen!“ Der Zauberer verwandelte sich in einen Habicht und verfolgte die Taube. Sie flogen in einen Wald, dort verwandelte sich die Taube in einen Fuchs, der Habicht aber in einen Wolf, und der Wolf setzte dem Fuchs nach, bis sie in ein Gehölz kamen, da wurde der Fuchs zur Lerche, der Wolf dagegen zur Taube, und diese jagte die Lerche.
Schließlich flog die Lerche in den Garten des Grafen. Dort war die Tochter des Grafen. Und die Lerche sang so wunderschön, daß die Grafentochter ihre Hand nach ihr ausstreckte und sprach: „Liebe kleine Lerche!“ Da verwandelte sich die Lerche in ein Ringlein und schob sich auf ihren Finger. Sie ging zu ihrem Vater und zeigte ihm diesen Ring. Als ihr Vater den Ring betrachtete, erkrankte er plötzlich. Kein Arzt konnte diese Schwäche heilen.
Da kam der Zauberer und erklärte, daß er ihren Vater heilen könnte, wenn sie ihm den Ring gäbe. Sie wollte ihm den Ring aber nicht geben, und er kehrte nach Hause zurück. Er kam aber ein zweites Mal, und wieder wollte sie ihm den Ring nicht geben, sondern bat ihn, am Freitag wiederzukommen. Ihr Vater empfahl ihr, den Ring dem Zauberer nicht in die Hand zu geben, sondern ihn auf die Erde zu werfen.
Als der Zauberer wieder erschien, warf sie ihm den Ring vor die Füße, da wurde er zu Hirsekörnern. Flugs verwandelte sich der Zauberer in einen Truthahn und begann die Hirsekörner aufzupicken. Als der Zauberer das letzte Körnchen von der Erde aufgepickt hatte, verwandelte er sich in einen Fuchs; er packte den Grafen am Schlafittchen und führte ihn durchs Zimmer; dann ließ er ihn los, und der Graf war augenblicklich wieder gesund. Der Zauberer verschwand.
Aber das eine Hirsekörnchen, aus dem Schuh der Grafentochter, verwandelte sich in den Jungen, der nun zu seinem Vater zurück kehrte.
Quelle: Saloni A. Lud rzeszowski Przeworsk 1898
DIE KUHHAUT ...
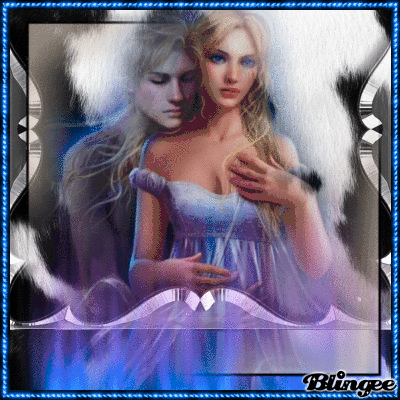
In einem Dorf lebte einmal ein Mann mit seiner Frau und seinen drei Töchtern. Der Mann war sehr krank.
Hinter dem Dorf, in dem sie wohnten, befand sich ein Brunnen, in dem es gewaltig spukte. Der Mann wollte gerne Wasser aus dem Brunnen haben und sagte: „Wenn ich aus diesem Brunnen Wasser zu trinken bekäme, würde ich mich gleich wohler fühlen und gesund werden.“
Da sagte seine älteste Tochter: „Vater, ich werde gehen und dir dieses Wasser holen!“ Sie ging also zu dem Brunnen und wollte Wasser schöpfen, aber aus dem Brunnen ertönte eine Stimme: „Von diesem Wasser werde ich dir erst geben, wenn du mir gelobst, die Meine zu werden!“ Darauf entgegnete sie: „Das kann nicht sein, da ich nichts von dir sehe!“ So bekam sie kein Wasser und sie ging wieder nach Hause. „Vater“, sagte sie „aus dem Brunnen kann man kein Tröpfchen Wasser bekommen.“
Da kam die zweite Tochter: „Da du nichts bekommen hast, werde ich gehen!“ Doch es erging ihr wie der ersten, auch sie bekam kein Wasser. Schließlich ging die dritte Tochter, die jüngste. Als sie an den Brunnen kam und Wasser schöpfen wollte, hörte auch sie die Stimme: „Wenn du mir feierlich gelobst, die Meine zu werden, kannst du Wasser schöpfen!“ Und sie entgegnete: „Ich gelobe dir, daß ich die Deine werde!“
Am Abend dann, als es dunkel war, schlich sich jemand in einer Kuhhaut heran, machte am Haus halt und klopfte an die Tür. Die Jüngste mußte gehen, um zu öffnen; als sie die Tür öffnete, erschrak sie furchtbar und bekreuzigte sich mit Weihwasser.
Da fing dieser Jemand in der Kuhhaut an zu singen:
„Halte ein, was du mir gelobt,
als du Wasser bei mir geholt,
mein Liebchen zu sein,
komm, lasse mich ein.“
Das Mädchen lie´ihn rein und alle andren mußten das Zimmer verlassen, und sie blieb mit ihm alleine zurück.
Er aber sprach:
„Halte ein, was du mir gelobt,
als du Wasser bei mir geholt,
mein Liebchen zu sein,
so liege bei mir fein.“
Dann streifte er die Kuhhaut ab und stand vor ihr als bildschöner junger Mann, wie es kaum einen zweiten auf Erden gab. Als aber die Uhr zwölfmal schlug, warf er sich sogleich die Kuhhaut wieder über und kehrte spornstreichs wieder in das Wasser zurück. Am nächsten Abend kam er abermals und klopfte an die Tür. Wieder ging das Mädchen, um zu öffnen, aber schon etwas freudiger gestimmt, denn sie war ihm sehr zugetan. Wieder mußten alle das Zimmer verlassen. Er aber sprach zu ihr:
„Halte ein, was du mir gelobt,
als du Wasser bei mir geholt,
mein Liebchen zu sein,
so liege bei mir fein.“
Der junge Mann erzählte ihr, daß er in der zwölften Nacht erst die Kuhhaut für immer abwerfen dürfe und dann für immer bei ihr bleiben würde. Er bat sie jedoch, niemanden etwas davon zu sagen, bis sie ihn vollkommen erlöst habe. Aber das Mädchen hatte sich eilends ihrer Mutter anvertraut und ihr erzählt, was für ein schöner Bräutigam er sei, sobald er die Kuhhaut von sich streifte und sie unter das Bett legte. So hatte die Mutter in der dritten Nacht rasch den großen Backofen angeheizt sich leise ins Zimmer geschlichen, die Kuhhaut ergriffen und sie in den Backofen geworfen.
Da wachte der Bräutigam auf und wollte hurtig in die Kuhhaut schlüpfen, doch diese war nicht mehr da. Beide, schrien verzweifelt: „Wo ist die Kuhhaut?“ Die Mutter hörte das Geschrei, kam zu ihnen gelaufen und sagte, daß sie die Kuhhaut in den Backofen geworfen habe, wo sie sicher ganz geschrumpft sei. Nun versuchten Beide die Haut zu dehnen, damit er sich wieder darin einhüllen konnte, doch die Kuhhaut war schon so geschrumpft, daß ihre Enden nicht mehr zusammenstießen. Sie trennten sich in großem Leid, und der Bräutigam sagte zu seiner Braut, daß er jetzt zur Buße ins Rote Meer gehen müsse.
Kurz darauf ließ sich das Mädchen einen eisernen Wanderstab, eiserne Schuhe sowie ein eisernes Kesselchen machen und ging, um ihren Bräutigam zu suchen. Sie weinte um ihn Tag und Nacht, und ihre Tränen flossen in das Kesselchen. Irgendwann gelangte sie in einen weit weg entfernten Wald, in dem eine Hütte stand. Sie klopfte an die Tür.
Ein altes Weiblein trat aus der Hütte: „Mädchen, was willst du hier?“ Sie bat um ein Nachtlager. Da sagte die Alte: „Mein Kind, ich kann dich zur Nacht nicht hier behalten, denn mein Gemahl ist der Mond, und der leuchtet alles aus, sogar die allerkleinste Ecke hinter dem Ofen.“ Doch schließlich nahm die Alte das Mädchen auf.
Wenig später kam der Gemahl Mond. „Pfui Teufel! Hier riecht es nach Menschenseele. Sage Weib, wen du bei dir hast!“ „Nun, ich habe nur ein Mädchen hier, das ihren Liebsten sucht. Hast du vielleicht gesehen, wo er ist?“ Der Mond antwortete: „Ich habe nichts gesehen. Geh aber zu meiner Schwester, der Sonne, die leuchtet überall hinein, vielleicht kann Sie dir helfen. Der Weg zu Ihr ist hundert Meilen weiter!“ Der Mond führte das Mädchen aus dem Wald und gab ihr zum Abschied eine Nuß.
Das Mädchen wanderte weiter und sie weinte immerfort und ließ ihre Tränen in den Kessel fließen. Schließlich gelangte sie wieder in einen großen Wald, und sie erblickte weit weg ein Licht, das aus einer Hütte leuchtete. Sie ging zu der Hütte und klopfte an die Tür. Ein alter Mann öffnete:
"Wer pocht denn hier?“ „Ich, Alterchen, ich bin unterwegs, meinen Liebsten zu suchen.“ „Aber woher kommst du? Hierher kommt sonst kein Vogel geflogen, auch der Mond scheint hier nicht, der Wind bläst hier nicht, du aber bist von ganz weit hergekommen!“ Das Mädchen erzählte ihm alles.
„Ich habe mich unterwegs auf den eisernen Wanderstab gestützt, habe einen Kessel Tränen vollgeweint, aber meinen Liebsten kann ich nicht finden.“
Als die zwölfte Nachtstunde gekommen war, erschien dem Alten seine Frau – es war die Sonne. Sie leuchtete hinter dem Ofen und sagte: „Pfui Teufel, hier riecht es nach einer Seele nicht aus dieser Welt, sage mir Alter, wen du bei dir hast!“ Da erzählte ihr der Alte alles. „Nein, ich habe niemanden gesehen, sagte die Sonne, "aber gehe zu meinem Bruder, dem Wind, der bläst alles aus dem allerkleinsten Loch heraus. Doch bis zu ihm sind es noch hundert Meilen weiter." Sie verabschiedete das Mädchen und auch sie gab ihr zum Abschied eine Nuß.
Also ging das Mädchen weiter auf die Suche und weinte ohne Unterlass. Schließlich gelangte sie wieder in einen großen Wald, und sah Licht aus einer Hütte leuchten. Sie schritt auf die Hütte zu und klopfte an die Tür. Eine alte Frau kam und öffnete ihr: „Wer klopft denn hier? Weshalb bist du hergekommen? Hier scheinen weder Mond noch Sonne, hier läuft auch kein Hase vorbei, du aber hast den Weg hierher gefunden!“ „Ich bin unterwegs und suche meinen Liebsten", sagte das Mädchen. "Ich war schon beim Mond und bei der Sonne, und die Sonne schickte mich zu ihrem Bruder, dem Wind, damit er mir hilft, meinen Liebsten zu finden.“ Dann bat sie um ein Nachtlager, und wenn es auch nur ein kleines Eckchen hinter dem Ofen wäre.
In der Nacht gegen zwölf kam der Wind und sprach: „Pfui Teufel! Hier riecht es nach einer Seele nicht aus dieser Welt. Sage, wen du bei dir beherbergst!“ Da antwortete die Alte: „Eine Jungfrau ist hier, die ihren Liebsten sucht. Hast du ihn irgendwo gesehen?“ „Bislang habe ich nichts gesehen, aber morgen in der Frühe werde ich einen großen Sturm entfesseln, vielleicht wird der ihn irgendwo finden.“
Hernach rief er das Mädchen zum Abendmahl. Sie aßen ein Huhn. „Sammle diese Hühnerknochen auf und bewahre sie gut!“ Dann gab auch er ihr eine Nuß und entfernte sich mit dem großen Sturm, den er entfesselt hatte. Der Sturm fegte überall hin und hatte den Liebsten des Mädchens gefunden. Der Wind kam zurück und sagte zu dem Mädchen: „Vor dem Meer steht ein Hund und am anderem Ufer findest du deinen Liebsten“. „Gehe dort hin, aber dein Liebster ist schon verheiratet. Wenn du über das Meer willst, so lege diese Knochen aus, und du wirst auf ihnen hinüber gehen können.“
Das Mädchen machte sich auf und irgendwann sah sie den Hund. Sie warf ihm rasch einen Knochen zu, aber dieser Knochen fehlte ihr dann, um das andere Ufer zu erreichen. So schnitt sie sich den kleinen Finger von einer Hand ab und legte ihn aus, damit sie das Ufer erreichen konnte. Nach einer Weile erreichte sie das Schloß, in dem ihr Liebster wohnte, der jedoch schon mit einer andren verheiratet war. Sie wurde im Schloß vorstellig und bat, um eine Anstellung, und sei es nur als Gänsemagd.
Man nahm sie.
Als sie die Gänse zur Weide trieb, öffnete sie eine Nuß, und siehe da, in der Nuß befand sich ein silbernes Kleid. Der Schlossherrin, die es gesehen hatte, gefiel das Kleid so sehr, daß sie die Gänsemagd bat, ihr doch dieses zu verkaufen, aber das Mädchen entgegnete: „Ich schenke Euch das Kleid, wenn Ihr mir erlaubt, eine Nacht bei Eurem Gemahl zu schlafen.“ Die Schlossherrin erlaubte es, gab aber ihrem Ehegemahl zuvor einen Schlaftrunk und ließ ihn, erst, als er fest eingeschlafen war, zur Gänsemagd ins Bett bringen. In der Nacht bat das Mädchen, rief und weinte: „Mein Allerliebster, mein goldener Geliebter, der du mein Gemahl sein solltest, weißt du noch, wie wir die Kuhhaut zu dehnen versuchten, damit du dich in sie hüllen konntest?“ Meine eisernen Schuhe habe ich zerschlissen, meinen eisernen Wanderstab abgewetzt und einen Kessel Tränen vollgeweint.“
Unter dem Fenster stand ein Wächter, der alles hörte, worüber sie klagte, und der sich wunderte, was das bedeuten solle. Bis zum anbrechenden Morgen konnte sie bei ihrem Liebsten nichts ausrichten, kein einziges Wort ihm entlocken. Hernach meldete der Wächter seinem Herrn, daß dieser mit der Gänsemagd geschlafen und sie zu ihm solches gesagt habe: „Mein Allerliebster, mein goldener Geliebter, der du mein Gemahl sein solltest, weißt du noch, wie wir die Kuhhaut zu dehnen versuchten, damit du dich in sie hüllen konntest?“ Damit erfuhr der Schlossherr, daß es seine erste Frau war, die ihn erlöst hatte. Anderntags trieb die Gänsemagd ihre Gänse wieder auf die Weide und brach dort die zweite Nuß auf, in der sich ein goldenes Kleid befand. Und auch die zweite Nacht mit ihm verlief ebenso, wie die erste.
Das Mädchen beklagte sich sehr, als man ihn zu ihr ins Bett gelegt hatte, und wiederholte immerfort: "Mein Allerliebster, mein goldener Geliebter, der du mein Gemahl sein solltest, weißt du noch, wie wir die Kuhhaut zu dehnen versuchten, damit du dich in sie hüllen konntest?“ Und wieder hatte der Wachmann das Klagen gehört und anderntags früh es seinem Herrn erzählt.
Als man dem Herrn für die dritte Nacht wieder einen Schlaftrunk zu trinken gab, spie er ihn heimlich aus. Man hielt ihm glühende Kohlen an die Fußsohlen, um zu sehen, ob er noch wach sei, aber er hielt aus und stellte sich schlafend. Danach brachte man ihn zur Gänsemagd ins Bett, die ihn sogleich umarmte, küßte und bat, nicht einzuschlafen, indem sie sagte: „Mein Allerliebster, mein goldener Geliebter, der du mein Gemahl sein solltest, weißt du noch, wie wir die Kuhhaut zu dehnen versuchten, damit du dich in sie hüllen konntest?“ Ich habe mir einen eisernen Wanderstab, eiserne Schuhe und einen eisernen Kessel machen lassen; die Schuhe sind zerschlissen, der eiserne Wanderstab ist abgewetzt und der Kessel voller Tränen, aber dich konnte ich nicht finden, und jetzt, da ich dich endlich gefunden habe, kann ich kein einziges Wort von dir hören, meine allerliebste Kuhhaut.“
Da umschlang er sie, küßte sie immer wieder und sprach: „Von heute an, meine Herrin, wird dir der ganze Hof dienen!“ Morgens rief die Schloßherrin: „Stehe auf, Gänsemagd, und treibe die Gänse zur Weide!“ Da entgegnete der Herr: „Nein, die Herrin bleibt bei mir liegen, diejenige aber, die bisher Herrin war, wird von nun an die Gänsemagd sein!“
Und so lebten sie glücklich miteinander bis zu ihrem Tod – und leben vielleicht noch heute, wenn sie nicht gestorben sind. Wenn aber doch, dann beißen sie bereits die Erde.
DIE FEINDSCHAFT ZWISCHEN HUND UND KATZE ...
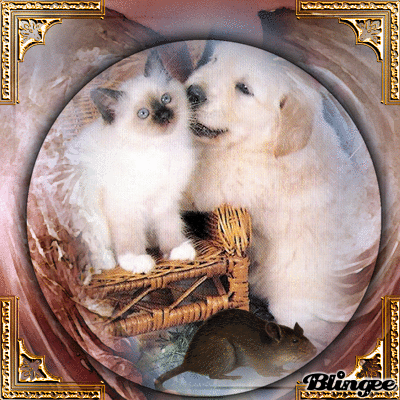
Einmal, so wahr ich hier sitze, ließ der Herr Jesus Kerbstöcke verschicken, damit alle Heiligen, die einen erhalten hatten, sich zu seinem Rat versammelten – hai.
Sei’s wie es sei, sie beratschlagten und beratschlagten, bis sie beschlossen, dem Menschen Verstand zu geben, denn darum war es – bitte schön – früher nicht so gut bestellt, nur so, wie bei den Tieren auch – hai. Danach, so wahr ich hier sitze, schrieben die Engel die Briefe, und der Herr Jesus hielt das Petschaft über das Öllämpchen, und wenn ein Brief geschrieben war, drückte er schnell sein Siegel drauf – hai.
Da beeilte sich der Hund und sagte, er wolle das Schreiben den Menschen überbringen, weil er den Menschen – bitte schön – immer sehr gern sähe. Schließlich sagte der Herr Jesus zu ihm: „Lauf, lauf geschwind, daß ich sehe, ob du bald anlangen wirst.“ Der Hund rannte über das Feld. Erst als er ein gehöriges Stück gelaufen war, gab ihm der Herr Jesus das Schreiben und sprach: „Nimm das, aber schnell, und bringe es den Menschen.
Paß aber gut auf, daß du es nicht verlierst!“
Der Hund rannte und rannte, die Füße taten ihm schon weh, denn es ist doch ein langer Weg vom Himmel zu uns – hai. Er sauste zur Erde und wollte gerade die Botschaft übergeben, da traf er eine Katze, die er gut kannte, und sie begannen zu reden.
Der Hund war ein schlechter Anwalt, er ließ die Tasche mit den Schriften auf die Erde fallen und begann mit der Katze zu schmusen – hai. Er hatte ganz vergessen, was der Herr Jesus ihm aufgetragen hatte – hai.
Bis ihn ein großer Kater erblickte. Der schnappte sich geschwind die Tasche und eilte damit ins Haus, wo er sie unter den Dielen versteckte, damit der Hund sie nicht fand.
Doch dann kamen die Mäuse und fraßen den Ratschluß auf, schleckten die Buchstaben – hai – nur ein paar blieben übrig. Und sei’s, wie es sei, als der Hund in den Himmel zurückkehrte, fragt ihn der Herr Jesus: „Weshalb hast du nicht allen Menschen die Briefe überbracht, wie ich es dir aufgetragen hatte?“
Da antwortete der Hund: „Wie konnte ich denn alle verteilen, wenn mir die Katze die Briefe gestohlen und schlecht verwahrt hat, so daß die Mäuse sie gefressen und die Buchstaben abgeschleckt haben. Weshalb haben die süßen Engel, auch mit süßer Tinte geschrieben – he?“ Da ließ der Herr Jesus Menschen und Mäuse zusammenrufen und sprach: „Es ist nicht meine Schuld, daß ihr nicht alle Verstand bekommen habt, sondern die des Hundes, mit ihm müßt ihr rechten – hai.“
Seitdem – bitte schön – ist der Mensch böse und dumm und wirft mit Steinen nach dem Hund – hai – oder prügelt ihn mit einem Knüppel. Der Hund dagegen jagt die Katze, wo immer es sie sieht, um sich für den Diebstahl zu rächen. Die Katze aber fängt die Mäuse und frisst sie, denn sie sind überhaupt an allem schuld, weil sie die Briefe gefressen und die Schrift aufgeschleckt haben – hai.
Ich meine aber, daß der Hund an allem schuld ist. Hätte er sich nicht in die Katze verliebt, dann hätte er auch die Tasche nicht vergessen – hai. Aber ein Weib ist eben ein Weib.
Immer machen sie dem Mann etwas vor, hängen ihm Unglück an, und du, Mann, hast es auszubaden – hai. Würde der Mann sie – bitte schön – nicht lieben und ihnen nicht glauben, dann wäre es etwas anderes, aber wie sollte man den Weibern nicht glauben – hai.
Quelle: Stopka A. Sabala Krakow 1897
Zakopane
VOM MÄUSEPELZCHEN ...
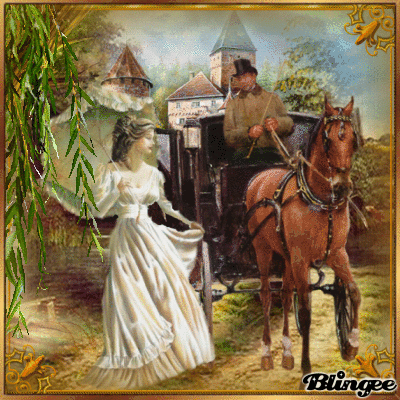
Es lebten einst ein Mann und eine Frau, die nur eine einzige Tochter hatten. Die Frau war sehr, sehr krank und sollte bald sterben. Sie forderte von ihrem Mann, daß er nach ihrem Tode keine andere heiraten dürfte, es sei denn, er fände eine, die aussähe wie ihre Tochter. „Aber wenn ich eine solche Frau nicht finden kann, was wird dann?“
„Wenn du eine, wie sie ist, nicht findest, so wirst du dich mit ihr (mit der Tochter) verheiraten.“ Also gut, die Frau starb, man beerdigte sie. Seither war eine ganze Anzahl von Wochen ins Land gegangen. Der Vater machte sich reisefertig, fuhr im Lande umher, suchte eine Frau, doch umsonst. Er kehrte wieder nach Hause zurück und sagte zu seiner Tochter: „Nun werde ich mich mit dir verheiraten!“ Aber sie begann zu weinen: „Wie kann es wohl sein, daß ich meinen Vater heiraten soll ?"
Der Vater befahl ihr, zur Mutter auf den Friedhof zu gehen und sich mit ihr zu beraten. sie folgte seinem Rat, ging auf den Friedhof, trat an das Grab ihrer Mutter und weinte herzergreifend, Ihre Mutter hörte das: weshalb weinst du, mein Kind?“ „Der Vater will sich mit mir verheiraten!“ „Gehe zu ihm und sage ihm, er soll dir zuvor ein Kleid wie die Nacht machen lassen, erst dann wirst du ihn heiraten.“ Die Tochter kehrte zu ihrem Vater zurück und berichtete, was die Mutter geheißen hatte. Also gut. Der Vater reiste im Ausland herum, aber er konnte einen wie die Nacht schwarzen Stoff nirgendwo erwerben. Er reiste weiter und immer weiter umher und erwischte mit Mühe etwas. Schließlich brachte er den Stoff und ließ für die Tochter ein Kleid schneidern.
„Hier, hast du das gewünschte Kleid, jetzt werde ich dich aber heiraten.“
„Nein, ich muß mich nochmals mit meiner Mutter beraten!“ Sie ging zum Grab der Mutter, die ihr gebot, nicht zu heiraten, bevor ihr der Vater nicht ein Kleid anfertigen ließe, das wie der Tag war. Als sie dann dieses Kleid besaß, verlangte sie, daß der Vater ihr noch ein Kleid wie die Sonne und eins wie der Mond schneidern ließ. Und zum Schluß sollte er ihr einen kurzen Pelz aus Mäusefellen beschaffen. Er befahl also, in allen Pferde– und Kuhställen und in allen Vorwerken Mäusefallen aufzustellen. Man fing die Mäuse, und der Vater ließ aus ihnen einen Mäusepelz nähen. Die Tochter lief ein letztes Mal zum Grab ihrer Mutter. Die Mutter gab ihr einen Knäuel Seide:
„Nimm dieses Knäuel“, sagte sie, „fasse das eine Fadenende und laß das Knäuel rollen. Gehe dorthin, wo sich dieses Knäuel hinbewegen wird. Es wird zu einer mächtigen Eiche rollen. In dieser Eiche wirst du ungewöhnlich schöne Zimmer vorfinden. Du wirst dort alles haben, und dein Vater wird nicht wissen, wo er dich suchen soll.“
Die Tochter nahm also dieses Knäuel und ließ es rollen. Das Knäuel rollte und rollte und stieß schließlich an eine Eiche, die sich sogleich öffnete. Dort fand sie ein Schloß mit vielen Nebengelassen, fand auch die Kleider, die ihr der Vater beschafft hatte, fand alles.
Sie hatte zu trinken, sie hatte zu essen, sie konnte schlafen. Dort verbrachte sie drei ganze Tage. Dann erschien ihr aber die Mutter und sprach: „Was sitzt du hier so untätig in dieser Eiche? Du mußt unbedingt hinausgehen. Gehe durch diesen Wald ein kleines Stück weiter, du kommst dann an den Waldrand, gleich hinter dem Wald liegt ein Herrenhof. Gehe auf diesen Herrenhof und bitte, daß man dich dort in den Dienst nimmt. Zieh dir deinen Mäusepelz an und nichts anderes. Sollte es dort keine Stellung für dich geben, so bitte die Herrschaft, daß sie dich umsonst und nur fürs Essen nimmt. Auf diesem Gutshof leben drei erwachsene junge Herren, drei Kavaliere, und einer von ihnen wird dich heiraten.“
Also gut, sie zog sich ihren kurzen Mäusepelz an und ging. Sie verdingte sich auf diesem Herrenhof als Küchenmagd. Sie wurde dem Koch beigegeben, daß sie ihm zur Hand ging.
Man lachte über sie, aber sie blieb und bat sich nur aus, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen.
Am ersten Sonntag befahl ihr der Herr, ihm Wasser für die Waschschüssel zu bringen.
Sie brachte das Wasser, verschüttete aber etwas auf dem Fußboden. Dafür schlug sie der Herr mit seinem Handtuch. „Ach du! Tolpatsch, hast mir meinen Fußboden besudelt! Geh schon, geh in die Kirche!“ Der Koch lachte sie nur aus: „Ach du! Schmutzfink, worin willst du denn in die Kirche gehen? Hast doch nichts anderes als deinen häßlichen Mäusepelz!“
Aber sie bat, unbedingt in die Kirche gehen zu dürfen, also erlaubte er es ihr, doch er trug den anderen Mädchen auf, aufzupassen, wo sie sich hinstellen und was sie tun würde. Sie aber lief zur Eiche.
Dort stand eine Wanne mit Badewasser bereit. Sie wusch sich gründlich und zog dann das Kleid „wie die Nacht“ an. Danach kam eine Kutsche, um sie abzuholen. Sie stieg ein und fuhr zur Kirche. Dort kniete sie am größten Kirchenportal nieder. Viele Herrschaften fanden sich in der Kirche ein, und alle blickten zu ihr hin. Was ist das denn für eine? Sie hatten sie noch nie gesehen. Sie fragten den Kutscher, woher sie käme, und der antwortete, sie wäre aus Handtuchwalde hierher verschlagen worden. Wieder ging das Mädchen die ganze Woche lang in dem Mäusepelzchen umher, heizte die Küchenherde und war immer verschmutzt und verdreckt. Am Sonntag sollte sie wieder Wasser für die Waschschüssel bringen und verschüttete es wieder auf den Fußboden.
Da versetzte ihr der Herr einen Schlag mit der Waschschüssel. Vom Koch bekam sie aber die Erlaubnis, in die Kirche zu gehen. Sie eilte zur Eiche, zog sich das Kleid „wie die Sonne“ an und fuhr zur Kirche. Die Leute wunderten sich, wer sie wohl sei, denn in der ganzen Gegend hatte noch niemand von ihnen eine solche Dame zu sehen bekommen!
Sie fragten den Kutscher, und der antwortete, sie sei aus Schüsselheim hierher verschlagen.
Nach dem Gottesdienst stieg sie in die Kutsche und fuhr davon. Die Herren wunderten sich, daß über sie nichts zu erfahren war. Sie gefiel ihnen über die Maßen.
Am dritten Sonntag befahl ihr der Herr, ihm beim Stiefel ausziehen zu helfen, aber sie schaffte es nicht, ihm die Stiefel von den Füßen zu ziehen, sondern fiel dabei mit einem Schwung zu Boden; da versetzte er ihr einen Tritt mit dem Stiefel. Hernach ging sie in die Kirche in dem Kleid „wie der Mond". Die Herren fragten erneut, woher sie käme, und der Kutscher antwortete, die wäre aus Stiefelhausen hierher verschlagen. Da berieten sich die Herren, was zu tun sei, um einen der feinen Schnabelschuhe von ihrem Fuß zu bekommen, damit sie ein Zeichen von ihr in ihren Händen hätten. Sie nahmen daher eine Kanne mit Pech und gossen dieses an einer Stelle aus, die sie unausweichlich überschreiten mußte. Als sie, ohne das Pech zu bemerken, über diese Stelle schritt, blieb einer ihrer Schnabelschuhe am Pech kleben.
Sich danach zu bücken, schämte sie sich, sie stieg in die Kutsche und fuhr davon.
Die jungen Herren aus dem Herrenhof nahmen diesen Schuh aber an sich, fragten und prüften überall, wem dieser Schuh passte. Doch alle ihre Bemühungen waren vergeblich, kein Damenfuß aus der Umgegend wollte in diesen Schuh passen. Sie versuchten es weiter, riefen alle Mädchen zusammen und ließen ihnen unter viel Gekicher den Schuh anprobieren.
Doch auch dies führte zu nichts. Letztendlich riefen sie die Küchenmagd:
„Vielleicht gehört der Schuh ihr!“ Sie lachten bei diesem Gedanken. Da kam sie, die Küchenmagd, beschmutzt in ihrem Mäusepelzchen, und sie lachte: Eh, das ist doch nicht für meinen Fuß!“
Aber es half ihr nichts, sie mußte den Schuh anprobieren, und siehe da, der Schuh paßte genau auf ihren Fuß. Da gestand sie alles. Der älteste der jungen Herren wollte sie heiraten. Sie führte ihn zu der Eiche, zog sich sehr hübsch an, und dann fuhren sie beide zur Trauung, danach aber nach Hause zu ihrem Vater – und damit ist das Märchen aus.
Quelle: Kowerska. Z. A., O mysim kozuszku
„Wisla“ 1898 Jozwow/ Lublin
GEIZBAUCH ...

Als der Hochmeister Friedrich von Sachsen aus dem Lande gezogen war, da saß ein Pfleger zu Passenheim, den die Untertanen seines Schindens wegen den Geizbauch nannten. Der verbot den Fischern, welche das Recht hatten zu ihres Tisches Notdurft in den herrschaftlichen Seen zu fischen, dem Gewerbe nachzugehen.
Die Bauern beriefen sich auf ihre Gerechtigkeit, aber vergebens, und fischten trotz des Verbotes. Der Pfleger wollte sie pfänden lassen, sie aber setzten sich zur Wehr und erschlugen einen der Amtsdiener. Da nahm der Pfleger ihnen die besten Pferde und Ochsen, womit sie den Hals löseten, und nun mußten sie sich der Fischerei enthalten. Aber von diesem Tage an vermochte der Pfleger mit seinem Garn nicht einen Fisch zu fangen. Er hielt das nicht für Gottes Strafe, sondern für Waideley (Zauberei), gab den Weibern die Schuld, die ihm Garn und Fische bezaubert hätten, setzte sie ein und ließ sie durch den Henker befragen (foltern), fand aber doch nichts an ihnen.
Ein tüchtiger Taucher, der drei Stunden unter dem Wasser bleiben konnte, mußte, während die Garne des Pflegers gezogen wurden, in den See springen und versicherte dem Pfleger, daß viele Fische im See wären, sich aber meisterlich vor dem Garn zu hüten wüßten; der Pfleger meinte, er wäre von den Bauern bestochen. Darnach wandte er sich an eine Waidlerin (Zauberin), von der er erfuhr, sie könnte benehmen, was Andere bezaubert hätten. Sie aber sagte ihm, daß es von Gott herkomme, der ihn um seiner Ungerechtigkeit willen strafe, und daß es nicht gebüßet und gebessert werden könne, er stürbe denn zuvor mit allen Fischen im See; dann würde der See auch wieder werden. Aber der Pfleger meinte, sie wäre auch überkauft und ritt mit Flüchen davon.
Nicht lange darnach wollte der Pfleger jagen. Er stößt plötzlich auf einen grausamen Bären, der sich gegen ihn aufrichtet. Sein Pferd erschrickt und geht durch. Der Pfleger will es zügeln, aber der Zaum zerreißt, und das Pferd jagt unaufhaltsam vorwärts in den bezeichneten See, darinnen Pferd und Mann ertrank. Am andern Tage fand man die Fische in dem See auch tot und auf dem Wasser schwimmend. In demselben Jahre war kein Fisch in dem See, hernach aber waren Fische genug darin, wie zuvor.
Simon Grunau, welcher am Anfang des sechzehnten Jahrhunderts die Sage zuerst erzählte, nannte den See nicht mit Namen, aber es wird von den Passenheimern erzählt, dass es sich um den Lelesken- See handeln solle.
Quelle:
Aberglauben aus Masuren Danzig
KACHNA UND MAGDA ...
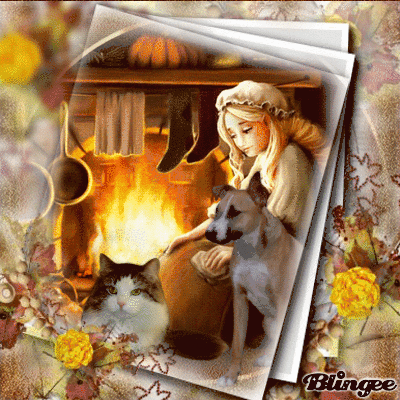
Einem leichtsinnigen Bauern starb die Frau, doch er war nicht traurig darüber, denn er hatte sie schon zu ihren Lebzeiten verhöhnt. Die Frau hinterließ als Waise ein Töchterchen, das der Vater unbarmherzig behandelte. Als er erneut heiratete, nahm er sich eine Witwe zur Frau, die eine Tochter hatte, die genau so alt war wie die seine. Das erste Mädchen hieß Kachna, das zweite Magda.
Die boshafte Stiefmutter quälte ihre Stieftochter, wo sie nur konnte, hetzte den Vater gegen sie auf, so daß das arme Mädchen vielerlei Plagen und Kümmernisse geduldig ertragen mußte. Schließlich besprach sich die Stiefmutter mit dem hartherzigen Vater, Kachna ganz und gar aus dem Haus zu treiben. Damit dem Scheine nach keine Schuld auf sie fiel, vereinbarten sie, das Mädchen nach Beeren in den Wald zu schicken, wo es sich verirren und nicht mehr zurückfinden würde. Ihr Vater ging zuerst in den Wald, aber bevor er ging, sagte er zu seiner Tochter: „Du kommst mir nach zu der Stelle, wohin du schon öfter Essen gebracht hast. Ich werde dort Holz schlagen, und du kannst inzwischen Beeren sammeln!“ Und Kachna ging ihrem Vater nach in den Wald mit einem durchlöcherten Topf, den ihr die Stiefmutter absichtlich gegeben hatte.
Im Wald traf sie den Vater aber nicht an; sie begann zu rufen, doch vergeblich. Dann begann sie Beeren zu sammeln, nur konnte sie ihren Topf nicht füllen, er hatte ja Löcher. Schließlich bekam sie große Angst, verlor den Weg und irrte lange, lange im Wald umher. Ermüdet und hungrig geriet sie auf einen Pfad, wo sie einem alten Weiblein begegnete. Diese Alte befragte sie, woher sie komme, und Kachna erzählte ihr weinend ihre Not. Da sagte das Weiblein: „Möchtest du nicht zu mir in den Dienst kommen?“ „Wehalb nicht“, antwortete das Mädchen.
Nachdem die Alte das Mädchen in ihr Haus geführt hatte, beschrieb sie ihr, welche Arbeiten sie verrichten müsse. Sie trug ihr auf, jeden Morgen die Stube zu fegen und den Kehricht in eine Truhe zu schütten, die in der Kammer stand. Für das erste Mittagsmahl gab die Alte ihr eine Erbse, ein Hirsekorn und ein Körnchen Buchweizengrütze und beauftragte sie, dies während ihrer Abwesenheit zu kochen. Kachna tat, wie ihr die Wirtin aufgetragen hatte, und staunte nicht wenig, als sie sah, daß die Töpfe plötzlich voller Speisen waren. Sie aß sich selber satt und gab noch dem Hund und der Katze davon.
Als das erste Dienstjahr sich seinem Ende neigte, sagte das Weiblein zu ihr: „Liebes Kind, wenn du willst, kannst du jetzt nach Hause zurückkehren! Nimm die Truhe, in der du immer den Kehricht geschüttet hast, setzte sie auf das Wägelchen und spanne den Hund und die Katze davor. Da du die beiden immer gut versorgt hast, werden sie dich dafür auch nach Hause fahren.“ Kachna tat, was ihr die Alte aufgetragen hatte. Als sie sich ihrem Elternhaus näherte, riefen der Hund und die Katze: „Vor ihr klirrt es, hinter ihr klirrt es. Kachna bringt nur Gutes!“
Auf diesen Ruf hin kam die Stiefmutter wuterfüllt angelaufen, schlug auf das Gespann ein und rief dabei: „Nicht so sollt ihr rufen, sondern so: Vor ihr klirrt es, hinter ihr klirrt es, Kachna bringt nur Schlechtes!“ Der Hund und die Katze achteten darauf aber nicht, sondern riefen weiterhin wie zuvor. Doch als man die Truhe vom Wägelchen nahm und hineinsah, was erblickte man da! Lauter Schmuck, teure Gerätschaften, golddurchwirkte Kleider. Die Freude war im ganzen Hause groß; der Hund und die Katze kehrten aber zur Herrin, dem alten Weiblein zurück.
Vom unbeschreiblichen Neid gebeutelt, sagte die Stiefmutter zu ihrem Mann: „Weißt du, wir werden auch Magda in diesen Dienst schicken, damit sie ähnliche Reichtümer erwerben kann.“ Und sie machten es mit Magda ebenso wie seinerzeit mit Kachna. Auch Magda traf das alte Weiblein, das sie – ebenso wie seinerzeit Kachna – zu sich nahm und ihr die gleichen Aufgaben übertrug. Aber kaum war die Alte fort, sagte sich Mada: „Wie soll ich wohl etwas aus einem einzigen Körnchen kochen?“ Sie nahm aber eine ganze Schüssel Erbsen, Hirse und Graupen und kochte alles in großen Töpfen, die alsbald barsten und zersprangen. Hernach, als sie aß, schwänzelten der Hund und die Katze um sie herum, aber sie trieb beiden mit einem großen Holzlöffel davon und gab ihnen nichts. Den Kehricht schüttete sie in die Truhe, nahm aber stets einen Messstock, um recht viel Kehricht anzusammeln.
Nachdem ein Jahr vergangen war, sagte die Alte, daß sie der Hund und die Katze, wenn sie wolle, nach Hause fahren werden. Magda freute sich schon auf die erhofften Schätze, und als sie wählen sollte, welche Truhe sie mitnehmen wollte, nahm sie nicht die alte Truhe, in der sie den Kehricht geschüttet hatte, sondern wählte eine neue, hübsch bemalte Truhe. Als sie auf ihrem Heimweg nicht mehr weit vom Elternhaus entfernt war, riefen der Hund und die Katze:
„Vor ihr klirrt es, hinter ihr klirrt es. Magda bringt nur Schlechtes.“ Die Mutter, die ihr entgegengelaufen war, schlug auf das Gespann ein und sagte: „Ihr sollt nicht so rufen, sondern so: Vor ihr klirrt es, hinter ihr klirrt es. Magda bringt nur Gutes!“
Der Hund und die Katze kümmerten sich aber nicht darum, sondern wiederholten ihre Mitteilung. Eilends trug man die Truhe in die Stube, und nachdem sich das Gespann entfernt hatte, öffnete man erwartungsvoll die Truhe, doch sie enthielt lauter Reptilien, Frösche, Kröten und Schlangen, Blindschleichen, die rasch aus der Truhe schlüpften, den Vater, die Stiefmutter und Magda zu Tode bissen und dann irgendwohin verschwanden. Nur Kachna hatten sie nicht angerührt. Sie blieb zurück mit ihren Reichtümern, bekam einen guten Mann und lebte mit ihm glücklich viele, viele Jahre.
Quelle: Lompa, J., 1843 Slask Opolski
DER VERLORENE HAMMER ...

Einmal des Morgens in der Frühe ging ein junger Bursche durch den Wald. All’ sein Hab’ und gut auf dieser Welt trug er in einem schmalen Ränzlein auf dem Rücken; in seiner Brust aber trug er Freudigkeit, denn er ging in die Fremde, sein Glück zu versuchen als rühriger Gesell, der sein Handwerk aus dem Grunde verstand.
Wie nun aber der Weg gar kein Ende nehmen wollte und die Sonne immer höher stieg, da mußte sich der gute Geselle nach einem schattenkühlen und moosreichen Orte umtun, zu rasten eine Stunde oder zwei. An einer Felsenwand traf er, was er nur wünschen mochte. Aus dem Stein sprudelte klares Wasser nieder, und daneben war eine schwellende Moosbank von blühendem Flieder umwölbt.
Der Bursche trank von dem Quell, streckte sich auf die Moosbank und war bald eingeschlafen. Nicht lange, da trat aus dem Felsen ein Mann hervor. Sein düster, trauriges Ansehen konnte der Jugend und Schönheit seiner Gestalt doch nicht Herr werden. Er klopfte dem Burschen auf die Schulter und winkte ihm zu folgen. Der Gesellte raffte sich auf und ging immer hinter dem schweigenden Mann drein, denn es war, als könnte er nicht anders.
Auf den langen Weg, den sie durchwandelten, fiel kein Sonnenstrahl, aber doch war es nicht dunkel. Endlich kamen sie in ein weites, hohes Gemach, und droben war’s als hing ein Kronleuchter herab, aus dessen blitzendem Gestein Kerzenflammen viel tausendfarbige Strahlen hervorlockten. Unter dem Kronleuchter aber lag eine Jungfrau von so wunderbarer Schönheit, daß der junge Geselle kaum hinzublicken wagte.
Nun aber trat der ernste Mann auf ihn zu, faßte seine Hand, zog in ein anderes Gemach und sprach: “Hier mach’ ein Ruhebett für die Jungfrau dort. Was Du nötig hast, findest Du.“ Der Geselle war fast erschrocken; er konnte sich erst gar nicht zurechtfinden. Er hatte gemeint, die Jungfrau schlafe nur, und nun war sie doch wohl tot, und doch so schön, fügt er dann endlich die schweren Bretter mit schwerem Herzen zusammen, und als er den letzten Schlag getan, ging auch die Tür auf.
Der ernste Mann trat herein, beide trugen sie das Ruhebett in das große Gemach und füllten es mit weichem Moos. Der Mann hob die Jungfrau hinein, breitete einen Schleier über sie hin, nahm dann den Hammer und beide traten hinaus in den Wald. Der Mann schlug an den Fels mit dem Hammer, gab diesen dem Gesellen in die Hand und sprach: „Das ist Dein Lohn! Brauche ihn recht, das wird Dir auf allen Wegen gut sein.“ Darauf ging der Mann davon und war bald unter den Bäumen verschwunden. Der junge Geselle aber stand noch lange mit dem Hammer in der Hand und wußte nicht, wie ihm geschehen war.
Durch denselben Wald schritt einmal ein rüstiger Mann. Er hatte kaum die Felswand erblickt, als er zu sich selber sprach: „Da ist ja ein alter Bekannter! Da sprudelt noch das Wasser hervor; da ist noch die Moosbank und darüber hin der blühende Flieder.“ Er setzte sich auf die Moosbank, zog einen Hammer aus der Tasche hervor und sprach wieder: „Der hat mir viel Glück gebracht, sogar in dem wüsten Kriegslärm. Ich habe nun so viel erworben, daß ich der Heimat zuwandern und da ein gutes Leben führen kann. Das ist aber auch der Hammer, wie keiner sonst! Schlägt wie eine Wünschelrute!“
Damit hatte er zwei kräftige Schläge auf die Steinwand fallen lassen, als er heftig erschrak, denn die Schläge rollten wie Donner durch den Wald. Und auf hohem Roß sprengte durch den Wald ein Reiter daher, der drohte mit blinkendem Schwerte nach dem Klopfen herüber. Dieser sah, daß er dem Reiter nicht entrinnen konnte; die Angst um sein Leben läßt ihn noch einen Schlag auf die Felswand tun, - Aber da stand schon der Reiter vor ihm, und der Klopfer meinte nicht anders, als das Schwert solle nun seine Brust durchbohren und der Hammer fiel ihm aus der Hand. Da ließ der Reitersmann sein Schwert sinken, reichte dem Wanderer die Hand und sprach: „Ich dachte nicht, daß Du wieder kämest; nun aber geht alles Leid zu Ende. Komm’!“
Es war ein langer Weg, auf den kein Sonnenstrahl fiel, aber doch war es nicht dunkel. Endlich traten sie in ein weites, hohes Gemach, und droben war’s als hing ein Kronleuchter herab, aus dessen blitzendem Gestein Kerzenflammen viel tausendfarbige Strahlen hervorlockten. Unter dem Kronleuchter aber lag auf einem Ruhebett eine Jungfrau von wunderbarer Schönheit. Der Wanderer sah immer noch ganz verwundert umher. Es war ihm, als hätte er das alles schon einmal gesehen, wie in einem Traume damals, als er draußen am Felsen auf der Moosbank unter den Flieder eingeschlafen war. Jetzt aber hatte er nicht geschlafen und nicht geträumt, und in dem Reiter erkannte er den Mann wieder, der ihn in den Felsen geführt, nur sah er heute nicht mehr düster und traurig aus, und die Jungfrau war so blühend, als schlafe sie nur. Da reckte der Mann seine Hand aus nach der Hand der Jungfrau. Sie schlug die Augen auf, und über ihr Antlitz blühte so ein holdseliges Lächeln dahin, als hätte ein Engel eine Blume des Paradieses ihr auf die Stirn gelegt.
Der Wandersmann wußte nicht, wie ihm geschah und wie es gekommen war, daß die Jungfrau nun mit einem Male da stand wie eine Königin im weißen Schimmer eines Seidengewandes und ihr Lockenhaar hing ihr fast bis zur Erde nieder. Sie neigte das Haupt an die Brust des Ritters und fragte: „Ist nun alles gut?“ Er antwortete: „Der böse Nachbar ist geschlagen und sein Schloß zerstört.“ Da sprach sie wieder: „So laß uns gehen!“ Und als sie hinaus traten in den Wald, waren da viele Diener in glänzenden Kleider, die führten einen weißen Zelter herbei, dessen Sattel war von rotem Sammet und der Zaum glänzte von goldenen Sternen. Als aber die Jungfrau auf dem Zelter saß, schwang auch der Rittersmann sich auf sein Roß und sprach zu dem Wanderer: „Besseres als der Hammer da, weiß ich Dir nicht zu geben zum Lohn. Wenn Dein Haupthaar weiß geworden, magst Du Deinen Kindern erzählen, was Du gesehen und getan.“ Darauf ritten sie alle davon.
Der Wandersmann war alt geworden und sein Haar silberweiß. Es war ihm alles nach Wunsch gegangen. Er hatte Haus und Hof und drin ein wackeres Weib und gesunde Kinder. Im Hofe stand eine Linde, da saßen die Alten Feierabends gern darunter und erzählten manchmal den Kindern Geschichten. Einmal des Abends saß der Alte hier auch, zu seinen Füßen spielte ein rotwangiges Knäblein mit einem Hammer. Da lachte der Alte und sprach: „Das Bübchen hat all’ unser Glück in der Hand und weiß nichts davon!“ Über die Worte machte der Sohn ein verwundert Gesicht. Als er aber den Hammer sah in der Hand seines Knaben, sprach er mit Lachen: „Der alte Hammer da?“ „Lache nur darob!“ sagte der Alte und erzählte darauf, wie er zu dem Hammer gekommen, weit da drüben im Walde, wo vom Fels ein klares Wasser niedersprudelnd und daneben unter blühendem Flieder eine Moosbank ist, und wie es ihm ergangen war.
Der Sohn stand mit unter geschlagenen Armen und sah mit traurigem Gesicht und doch ungläubig auf den Alten nieder. Er meinte, der Alte sei nun auch schwach im Kopfe geworden, nahm den Hammer aus der Hand des Knaben, der ihn nicht lassen wollte, besah ihn dann von allen Seiten und sprach: „Von der Geschichte habt Ihr ja niemals ein Wort gesagt, und der Hammer hier, - nun ja! Das ist so ein Hammer, wie jeder andere. Nun aber ist er so alt und abgeschlagen, daß ihm nicht mehr geholfen werden mag. Weg damit!“ Er schleuderte den Hammer fort, und als er darauf nach dem Alten nieder sah, erschrak er: der Vater war tot und an seinen Knien hatte der Knabe sich aufgerichtet. Der Sohn ging in alle Winkel des Hofes, suchte nach dem Hammer und konnte ihn nicht wiederfinden. Es ging ihm kümmerlich sein lebenlang. Jeden Morgen suchte er nach dem alten Hammer und konnte ihn doch nicht wieder finden, bis er endlich darüber hin gestorben ist.
Der Knabe, der an den Knien des Großvaters gestanden, ging als junger Gesell in die weite Welt, und nun, wo er die Geschichte seines Großvaters und vom verlorenen Hammer erzählt, ist er auch schon ein alter Mann, und es mag sein, daß keiner ihm glaubt, denn das ist ja so der Lauf der Welt.
Sage aus Ostpreußen
HEXENSABBAT ...

aus der Chronik des Johann Jakob Wick
Eine Gutsbesitzerin und Dame von Stand hatte eine Wirtschafterin, die sich um das Vieh und alle Arbeiten auf dem Vorwerk kümmerte.
Diese aber war eine Hexe, wovon niemand etwas wußte. Jeden Donnerstag um Mitternacht salbte sie Hände und Arme mit Machandelöl, bestieg den Schürhaken und ritt damit wie auf einem Pferd zum Kahlen Berg zur Teufelsorgie. Am anderen Tag kehrte sie zurück, als wäre nichts geschehen, tat ihre Arbeit und wartete fleißig das Vieh. Die Herrin war überaus zufrieden mit diesem Frauenzimmer, denn die Milchkühe gediehen unter ihrer Aussicht, und es konnten viele Kälber aufgezogen werden.
Nun gab es aber unter dem Gesinde einen Knecht, dem sie gewogen war, so dass er auskundschaften konnte, was sie tat. Er wunderte sich, wohin sie verschwand und wo sie herkam. Also ging er zu ihr, wie er’s zu tun pflegte, denn sie waren sich inzwischen schon einig geworden, und gab vor zu schlafen. Sie hingegen, als sie glaubte, daß er schlief – er war gerade die erste Neumondnacht angebrochen -, klopfte dreimal an den Ofen und sagte ihr Sprüchlein.
Zum Vorschein kam ein Döschen mit Salbe, sie bestrich sich Hände und Arme, nahm den Feuerhaken und flatterte durch das Fenster von dannen. Es war gerade Mitternacht. Der Knecht, der sich alles gut gemerkt hatte, sagte also die gleichen Worte, wobei er dreimal an den Ofen klopfte. Als das Döschen herauskam, salbte er sich auf die selbe Weise, ergriff den Stampfer und flog ihr durch das Fenster hinterher. Er gelangte auf den Kahlen Berg, wo ein großes Fest im Gange war.
Die Hexen tanzten mit den Teufeln und führten sich auf wie feine, aufgeputzte Damen und Herren. Das Geschirr auf den Tischen war von Silber und Gold; Essen und Trinken gab es in Hülle und Fülle. Die Teufel schenkten ihm ein, und die Hexen prassten mit ihm, und er aß, was das Zeug hielt. Schließlich war es soweit, daß er und die Wirtschafterin zurückkehren mußten. Ihre Pferde standen an der Krippe und fraßen. Da kam Luzifer, der älteste der Teufel, gab jedem der Gäste eine rote Kappe und sagte, wer immer jene rote Kappe aufsetzte, sei sofort unsichtbar für die Welt und im Handumdrehen an seinem Ort.
Die Pferde aber wurden wieder zu Feuerhaken, Ofenbesen und Stößeln. Der Knecht und die Wirtschafterin gelangten gut nach Hause und verrichteten am anderen Tag wie gewohnt ihre Arbeit. Der Knecht aber vermochte das Geheimnis nicht zu wahren und rühmte sich vor den anderen, wo er gewesen sei, was er gesehen und gehört habe. Am meisten aber lobte er alles, was sie dort gegessen und getrunken hatten. Die anderen Knechte lachten ihn aus und glaubten ihm nicht.
Am nächsten Donnerstag fuhren er und die Verwalterin erneut zu dem teuflischen Fest und schwelgten dort wie zuvor, Der Knecht dachte bei sich: „Wenn ich schon hier bin, sollte ich mich nicht nur satt essen und trinken, sondern auch etwas mitgehen lassen.“
Also füllte er sich die Taschen mit goldenen Bechern, silbernen Löffel und stahl, was er nur fassen konnte. Nachdem sie heimgekehrt waren, ging der Knecht anderentags zu dem übrigen Gesinde und plauderte noch mehr aus als zuvor, prahlte vom Essen und Trinken und wollte als Beweis die gestohlenen Dinge zeigen. Doch statt Silber und Gold, zog er nur Hufe, Klauen und Bockshörner aus der Tasche. Als seine Gefährten vor Lachen fast erstickten, stülpte sich ihm der Magen um, und die Speisen, die ihm aus dem Hals drangen, rochen nach Unrat und waren abscheulich anzusehen. Da lief er zur Verwalterin und beschimpfte sie; sie aber gab ihm eins aufs Maul und sagte: „Was schwätzt du da, du Esel, wir essen und trinken nie etwas anderes, sondern immer dasselbe.“
Er fiel über das Weib her, das Weib über ihn, genug, sie zerstritten und entzweiten sich so, daß der Knecht zum Priester ging, um das Frauenzimmer anzuklagen. Die Wirtschafterin aber ging, nachdem sie die Angelegenheit bedacht hatte, ebenfalls zum Geistlichen und verlangte, wie um sich von ihrem Vergehen reinzuwaschen, die Beichte. Er hörte sie an und erfuhr von allem. Der Pfarrer dieser Probstei war noch jung und neugierig auf alles Weltliche; er bat also das Weib: „Gib auch mir von dieser Salbe, ich möchte mit dir fahren.“
„Gut“, sagte sie, „wenn es so ist, Hochwürden, dann haltet Euch bereit, und wenn ein Pferdefuhrwerk vorfährt, steigt ein.“
Die Frau brachte dem Priester die Salbe, und am nächsten Donnerstag um Mitternacht hielt ein Pferdegespann vor dem Pfarrhaus. Der Pfarrer stieg ein, fuhr los, und das Weib folgte ihm auf dem Feuerhaken. Dem Geistlichen behagte die schon geschilderte Völlerei, und so fuhr er nicht nur einmal, sondern dutzendmal zum Kahlen Berg, von wo er immer unerkannt heimkehrte, weil er unterwegs auf Geheiß der Verwalterin die rote Kappe trug.
Einmal, als er von jenem teuflischen Gastmahl zurückkehrte, überfiel ihn die Lust, das Käppchen auf seinem Kopf genauer zu besehen. Doch als er es abnahm, purzelte er plötzlich aus dem Gefährt und befand sich gleich darauf, nackt, wie in Gott geschaffen hatte, in Frankreich, wo Pfeffer und Weine wuchsen, im Keller eines Kaufmanns zwischen den Fässern liegend. Er schämte sich furchtbar, denn es gingen Leute im Keller umher, deshalb blieb er still hinter einem Faß sitzen, und als sie hinausgingen, vertilgte er mit großem Hunger alles, was ihm in die quere kam – Mandeln, Rosinen, Feigen - und spülte es fein mit Wein hinunter, denn den hatte er ja reichlich.
Zum Glück kamen ein paar Tage später einige Mönche in den Keller, um vom Kaufmann Wein zu kaufen. Nun ist es so, daß ein Priester gegenüber einem Amtsbruder mehr Mut hat als vor einem anderen; unserem Unglücksraben ging es ebenso, daher kroch er denn hinter dem Faß hervor und rief seinen Brüdern zu: „Fratres, zu Hilfe!“ und wieder: „Fratres zu Hilfe, rettet mich!“ Und so kamen sie miteinander ins Gespräch. Er erfuhr von ihnen, daß er dreihundert Meilen von seiner Probstei entfernt war; da begann er zu lamentieren, sich zu bedauern und zu bemitleiden. Die Mönche gaben ihm an Kleidern, was er benötigte, und nahmen ihn in ihr Kloster.
Nachdem sie ihn überdies noch mit Wegegeld versorgt hatten, sagten sie ihm Lebewohl. Beruhigt begab er sich nach dreimonatiger Abwesenheit auf den Weg nach Hause. Dort angekommen, schickte er augenblicklich nach jenem Weib. Er ließ einen großen Holzstoß aufrichten und befahl, diese Hexe auf das Holz zu legen. Als man sie auf den Scheiterhaufen gepackt hatte, rief sie laut: „Rokia, rette mich!“ Da riß der Teufel sie aus dem Feuer. So geschah es dreimal hintereinander; erst danach kam es dem Pfarrer in den Sinn, den Holzstoß mit geweihtem Wasser zu besprengen und das heilige Kreuz darüber zu schlagen. Nun konnte dem Weib selbst der Teufel nicht mehr helfen, es ist verbrannt, so wahr mir Gott helfe.
Quelle: Kolberg, O. Czersk (Warszawa)

DIE KLUGE KASIA
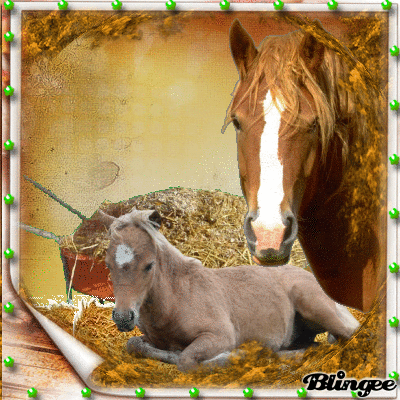
Es gingen zwei Bauern des Weges, ein Gevatter mit dem anderen, sagte der eine: „Na, was hört man bei Euch?“ Antwortete der:„Die Sorge hat Einzug gehalten, meine Tochter ist erwachsen, und ich wäre glücklich, wenn sie sich verheiraten würde, aber es findet sich niemand.“ Der zweite antwortete: „Grämt Euch deswegen nicht, ein Eidam findet sich immer.“ Und schon begann er zu berichten, was sich – wie sein Großvater erzählte – einst im Dorf zugetragen hatte.
Es lebte nämlich in diesem Dorf ein sehr kluger und begüterter Herr, der aber schon im gesetzten Alter war und wohl schon über vierzig Jahre zählte. Er fuhr durch die Städte und übers Land, aber nirgendwo gefiel ihm eine so, daß er sich mit ihr hätte vermählen wollen, denn er suchte keine Frau mit Vermögen, sondern eine mit Verstand.
Nun lebte aber auf seinem Hof ein Viehhirt, Szymon mit Namen, und dieser Szymon hatte eine Tochter namens Kasia. Die aber sagte zu ihrem Vater: „weißt du, Väterchen, wenn der Herr keine Frau finden kann, dann sag es ihm doch, daß ich ihn nehmen würde.“ Der Vater aber antwortete: „Bist du von Sinnen? Eher wirst du ohne Atem pfeifen, als daß der Herr sich mit dir vermählt. Er fährt durch alle Städte und Dörfer und kann keine finden, da sollte er dich nehmen?“ Da entgegnete sie: „Darüber zerbrich dir nicht den Kopf Väterchen, sag es nur dem Herrn.“
So bedrängte sie den Vater am ersten Tag, auch am zweiten und dritten, daß er dem Herrn das Anliegen vortrage, wenn aber nicht, so würde sie selbst zum Herrn gehen und es ihm sagen. Und schließlich als der Herr eines Morgens nach den Kühen sah, ging Szymon zu ihm und sagte: „Herr, Ihr könnt nirgendwo eine Frau finden, doch wenn Ihr wollt, würde meine Tochter Euch heiraten.“
Als der Herr diese Worte vernahm, trieb es ihm die Schamröte ins Gesicht, und er ging wütend in sein Haus. Nach einem Augenblick kam er aber wieder zu Szymon heraus, brachte ein paar gekochte Eier und sprach: „Gib sie deiner Tochter und sag ihr, sie soll sie der Henne unterlegen, auf daß sie bis zur Hochzeit Küken ausbrüte.“ Szymon faßte sich an den Kopf, nahm die Eier, ging zur Tochter und sprach zu ihr: „Siehst du, das sind so Herrenpossen, aus gekochten Eiern soll die Glucke Küken ausbrüten. Er befahl, daß du ihr diese Eier unterlegst, damit sie Küken ausbrütet.“ Da sagte Kasia: „Sorge dich nicht darum, Väterchen, merk dir nur immer gut, was der Herr sagt.“ Danach holte sie einen Topf mit gekochter Grütze, scharrte die Reste heraus, gab sie dem Vater und sprach: „Gib sie dem Herrn, Väterchen, er soll diese Grütze aussäen, damit daraus Korn für die Küken wachse, und wenn es reift, dann wird es auch aus gekochten Eiern Küken geben.“ Szymom nahm alles, um es dem Herrn zu überbringen, der Herr nahm die Grütze, sagte aber nichts.
Am übernächsten Tag sah der Herr wieder nach den Kühen. Als ihm Szymon begegnete, riß er ihm einige Dutzend Haare aus und sagte dann: „Hier bring sie deiner Tochter, sie soll daraus Linnen für ein Hochzeitshemd weben.“ Szymon brachte sie der Tochter und sagte: „Hier hast du den Ärger, der Herr hat befohlen, daß du aus diesen Haaren Linnen für ein Hochzeitshemd webst.“ Sie aber antwortete wieder: „Sorge dich nicht, Väterchen, wenn du nur gut aufpasst, was der Herr sagt, wird alles gut.“ Dann brach sie einige Ruten vom Besen und sagte: „Nimm das und bring es dem Herrn, er soll daraus einen Webstuhl arbeiten lassen, dann bekommt er auch sein Linnen.“ Szymon ging, übergab die Reiser, der Herr nahm sie und entgegnete nichts.
Am dritten Tag sah der Herr wiederum nach den Kühen, und da sagte er zum Knecht: „Szymon, ich gebe deiner Tochter ein Rätsel auf, sie soll mir antworten auf die Frage: „Was ist am schnellsten, was ist am fettesten und was ist am schönsten?“ Szymon ging, kratzte sich am Kopf und dachte bei sich: „Das sind so Herrenpossen.“ Dann sagte er zu seiner Tochter: „Der Herr hat dir ein Rätsel aufgegeben; du sollst ihm sagen, was am schnellsten sei, was am fettesten und was am schönsten. Wir haben hier ein Kalb, das schon einige Monate alt ist, und es kann wahrhaftig schnell laufen, aber das wird es wohl nicht sein. Wir haben ein Schwein, das schon ein Jahr gemästet wird und ziemlich fett ist, doch wer weiß, ob das gemeint ist. Aber etwas Schöneres als dich, Kasia, kenne ich nicht.“ Kasia aber entgegnete: „Sorge dich nicht, Väterchen, sondern geh zum Herrn und sag: am schnellsten ist das Auge, am fettesten die Erde, am schönsten das Schlafen.“ Dem Herrn gefiel die Antwort, aber er erwiderte nichts darauf, sondern ging in sein Haus.
Am vierten Tag sah er wieder in den Stall und sprach zu Szymon: „Wenn deine Tochter erfüllt, was ich verlange, dann heirate ich sie! Sag ihr dieses: sie soll morgen kommen, früh und nicht früh, weder am Tag noch in der Nacht, fahrend und nicht fahrend, bekleidet und unbekleidet, mit Geschenk und ohne Geschenk.“ Szymon ging zur Tochter, erzählte ihr alles, was der Herr aufgetragen hatte, aber es war ihm gar nicht wohl dabei, weil er nicht verstand, was das alles heißen sollte. Kasia aber sprach zu ihm: „Sorg dich nicht, Väterchen, ich weiß damit schon etwas anzufangen.“ Dann griff sie sich einen Ziegenbock, wickelte sich nackt in ein Fischnetz, nahm ein Kaninchen, denn der Herr hatte alle Hunde auf dem Hof losgelassen, des weiteren tat sie eine Taube in einen Korb, und als der Morgen dämmerte, setzte sie sich auf den Ziegenbock und ritt zum Gehöft.
Und sie lief auf ihren Beinen und saß doch auf dem Bock und näherte sich dem Hof noch nicht im Tageslicht und nicht mehr in der Nacht, sie war bekleidet und trug doch kein Kleid. Als die Hunde sie erblickten, liefen sie neugierig heraus, da aber ließ sie das Kaninchen frei, und alle Hunde rannten hinter diesem her, sie aber ritt auf dem Ziegenbock in den Hof.
Der Herr sah sie, daß sie wahrhaftig nicht ging und nicht ritt, nicht am Tag und nicht in der Nacht kam, angekleidet und unbekleidet war.Da lief er ihr entgegen, sie aber nahm die Taube aus ihrem Korb und reichte sie ihm.Er streckte die Hand aus und wollte sie ergreifen, sie aber ließ sie fliegen und sprach: „Hier habt Ihr, Herr, ein Geschenk und doch kein Geschenk.“ Da nahm der Herr sie in sein Haus, hüllte sie in reiche Gewänder, setzte den Tag der Hochzeit fest und lud die Gäste ein. Doch bevor sie zum Altar schritten, mußte sie ihm geloben, sich nicht in seine Entscheidungen einzumischen, denn anders würde es sogleich zur Trennung kommen. Sie feierten Hochzeit, die dauerte einen Tag, dann noch einen und schließlich die ganze Woche.
Damals herrschte ein solches Gesetz, daß jeder Herr auf seinem Hofe Gericht abhielt. Und es begab sich, daß ein Bauer zu seinem Sohn fuhr und zur Nacht in einem Gasthof einkehrte. Er hatte eine trächtige Stute, die fohlte in der Nacht. Am Morgen ging der Schankwirt, das Pferd aus dem Stall herauszulassen, und als er das Fohlen auf der Schubkarre sah, sagte er: „Oho, meine Schubkarre hat gefohlt.“ Der Bauer versicherte, daß es sein Fohlen sei, denn seine Stute habe in der Nacht geworfen, der Schankwirt aber wollte das Fohlen nicht herausgeben. So stritten sie und brachten den Fall vor den Herrn. Der Schankwirt sagte: „Als ich morgens in den Stall ging, um das Pferd für die Weiterfahrt herauszulassen, da fand ich auf der Schubkarre das Fohlen. Die Karre gehört mir, also ist auch das Fohlen mein.
Der Herr sagte: „Du hast recht, wem die Karre gehört, dem muß auch das gehören, was darauf liegt.“ Und er sprach dem Schankwirt das Fohlen zu. Kasia war bei der Verhandlung zugegen, und es verdroß sie sehr, daß dem Bauern Unrecht geschah.
Da rief sie den Bauern heimlich zu sich und sprach zu ihm: „Morgen gegen Nachmittag werden wir an dem höchsten Berg vorbeifahren; holt ein Netz und legt es auf dem Berg aus. Wenn wir vorbeifahren, dann tut so, als ob Ihr Fische fangen wolltet auf dem Sand.“ Der Bauer tat, was ihn Kasia geheißen hatte. Als am folgenden Tage die Herrschaften vorbei fuhren, fragte der Herr den Bauern: „Was tut ihr dort mit den Netzen?“ Er antwortete: „Ich fange Fische.“ Der Herr sagte: „Habt Ihr den Verstand verloren, auf diesem Berg, noch dazu ohne Wasser, Fische fangen zu wollen?“ Darauf antwortete der Bauer: „Und Ihr, Herr, habt Ihr nicht ebenfalls den Verstand verloren, wenn Ihr meint, daß eine Schubkarre fohlen kann?“
Da erkannte der Herr, daß er den Fall schlecht gerichtet hatte, und befahl sogleich, dem Bauern das Fohlen zu geben. Gleichwohl wußte er, daß es Kasia gewesen war, die dem Bauern geraten hatte, was er tun sollte.
Das wurmte ihn sehr, und er befahl, sofort nach allen Gästen auszusenden, die auf der Hochzeit gewesen waren, damit er vor ihnen die Scheidung des Bundes, der bei der Trauung geschlossen wurde, vollziehen könnte. Als sich alle versammelt hatten, verkündete ihnen der Herr, daß er nicht mehr der Ehemann der Kasia sei und sie nicht mehr sein Eheweib, und sie bestätigten, daß sie gerade gegen das verstoßen hatte, was sie vor der Trauung gelobt hatte. Danach sagte der Herr zu ihr: „Du kannst zu deinem Vater zurückkehren, aber ich verwehre dir nicht das mit zu nehmen, was dir das liebste, das teuerste und das kostbarste ist.“ Dann richtete er noch das Scheidungsmahl, sie aber verleitete alle Herren, daß jeder ihm zu trank, soviel er nur vermochte, weil sie wollte, daß er sich berauschte. Sie traten mit großer Freude zum Gutsherrn und er mußte mit diesem ein Glas, mit jenem ein Kelch leeren. Da betrank sich der Herr so gewaltig, daß er von dieser Welt nichts mehr wußte. Kasia aber befahl, die Pferde anzuspannen und den Herrn auf den Wagen zu legen. Kasia setzte sich neben ihn und fuhr mit ihm zusammen zu ihrem Vater.
Hier trugen sie ihn aus dem Gefährt in die Kammer und legten ihn auf ein Lager aus einfachem Stroh, der Herr aber wußte nicht, was mit ihm geschah, so fest schlief er.
Als er wieder zu sich kam, blickte er sich um und sah niemanden, nur seine Kasia.
Da fragte er: „Was bedeutet das? Wo befinde ich mich?“ Sie umarmte ihn und sagte: „Bei meinem Vater. Du hast mich geheißen, das Liebste, Teuerste und Kostbarste mitzunehmen, und so habe ich dich mitgenommen, weil ich nichts habe, was mir lieber, teurer und kostbarer wäre als du! Da erkannte der Herr, wie klug seine Kasia war und sah, daß sie sich immer zu helfen wußte. Eilig schickte er zu seinem Gut nach den Pferden, danach saßen sie auf und ritten zum Hof. Als sie ankamen, waren die Gäste noch da. Der Herr verkündete allen, daß er Kasia für immer zum Weib nähme, gab ihr die Schlüssel in die Hände und erlaubte ihr, alles nach seinem Gutdünken zu verwalten. Da wurde Kasia eine große Herrin, Szymon aber brauchte nicht mehr das Vieh zu weiden, und damit endet die Geschichte.
Quelle: S.Ulanowska, Lukowiec / Garwolin 1844
VOM KNECHT DER EINE HEXE AUSSPÜRTE ...

Ein Landwirt hatte eine Frau, aber er wußte nicht, daß sie eine Hexe war und oft auf ihrem Feuerhaken durch den Kamin flog. In ihrer Stube standen drei Betten: in einem schlief der Bauer, in dem andern die Hausherrin und im dritten der Knecht.
Einmal erwachte der Knecht mitten in der Nacht und konnte nicht wieder einschlafen, dadurch wurde er gewahr, daß seine Herrin etwas aus dem Tiegel nahm, sich den Bauch einschmierte, rittlings den Feuerhaken bestieg und durch den Kamin flog. Da wunderte sich der Knecht, und er erkannte, daß sie eine Hexe war.
Weil ihn aber die Neugier packte, was es wohl mit diesem Tiegel auf sich habe, stand er auf, schnallte den Säbel um, bestrich sich ebenfalls mit der Salbe, setzte sich auf einen Feuerhaken und flog ebenso wie die Frau durch den Kamin davon. Ehe er sich’s versah, was geschah und wohin die Reise ging, landete er auch schon an einem Ort voller aufgeputzter Gäste. Es fand ein Ball statt, man vergnügte sich, aß Gebäck und andere Speisen und bewirtete auch ihn mit Gebackenem. Er aß sich satt und füllte obendrein die ganze Tasche mit dem Backwerk, das dort gereicht wurde.
Wenig später begannen sich alle Versammelten um irgendetwas zu zanken und auszuschelten, packten einander bei den Köpfen und schlugen aufeinander ein. Unter ihnen erkannte er auch seine Herrin. Da mischte er sich unter die Raufenden und fuchtelte solange mit dem Säbel herum, bis er seiner Bäuerin die Hand abgeschlagen hatte.
Über ein Weilchen wurde es ganz dunkel, alle stoben auseinander und machten sich auf den Heimweg, nur der Knecht, der keine Salbe zum Einschmieren mitgenommen hatte, blieb allein an diesem Ort zurück. „Was fange ich hier an?“ dachte er bei sich, „nun ist guter Rat teuer, ich muß wohl oder übel nach Hause wandern.“
Da machte er sich also auf die Strümpfe und lief und lief. Hatte er zuvor, als er auf dem Feuerhaken geflogen kam, im Handumdrehen den Weg zurückgelegt, so mußte er nun ein ganzes Jahr wandern, bis er endlich zu Hause anlangte. Als er eintraf, fragte ihn der Bauer: „Wo hast du dich so lange herumgetrieben?“ „Ach seht, Herr, ich war hier und dort, und darum bin ich so lange unterwegs gewesen“, log er. „Wartet, Bauer, ich hab Euch Backwerk mitgebracht, seht nur, wie gut es ist!“
Er langte in die Tasche, als er aber hineinschaute, da war alles voller Pferdeäpfel. Er warf sie fort und spuckte aus, weil er auch von diesem Unrat gegessen hatte. Dann aber sah er nach der Hausfrau, die krank im Bett danieder lag. „Was ist Euch?“, fragte der Knecht. „Ich bin krank“, antwortete sie. „Aber was fehlt Euch?“ „Was geht’s dich an, ich bin eben krank!“ Aber der Knecht sah, daß sie unter dem Federbett den Arm verbarg, an dem die Hand fehlte.
Da ging er zum Herrn und erzählte ihm alles, was er in jener Nacht erlebt und gesehen hatte. Es bekümmerte den Hausherrn sehr, daß er eine Hexe zur Frau hatte. Heimlich tötete er sie, trug sie in die Nacht hinaus und verscharrte sie in einer Grube, so daß niemand wußte, wo sie geblieben war.
Quelle: Kozlowski, K., a.a. O.,Czersk/Warszawa
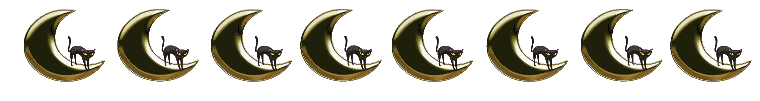
STRAFE DER UNZUCHT IN KEHL ...
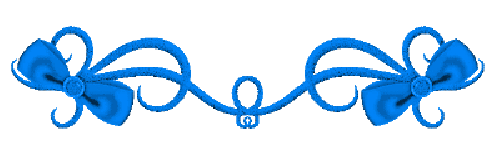
Zu Kehl, einem Dorfe am Mauersee, etwa eine halbe Meile von Angerburg gelegen, hat sich der Teufel im Jahre 1564 gar schrecklich bewiesen.
Vier Personen, die schon vorher in verdächtigem Umgange mit einander gelebt hatten, begaben sich am Tage der unschuldigen Kindlein (28. Dezember) von Branntwein berauscht in ein kleines nach polnischer Weise aus Holz erbautes Häuschen und verschlossen sich in demselben von Innen, um in dem selben ihre Unzucht zu treiben. Aber der Teufel hat nicht lange auf sich warten lassen; er ist plötzlich unter ihnen gewesen und hat erstlich dem einen Paar, Paul und Gertrud geheißen, die Hälse ab- und umgedreht. Als die andern, Rosa und Benedikt, solches gesehen, wollte Benedikt zur Thür hinaus, aber der Teufel hat ihn zurückgerissen daß die Haut von seiner Hand an dem Thürschloß kleben blieb, und auch ihm »den Hals entzwei gebrochen«. Der Rosa hat er nicht bloß den Hals entzwei gebrochen, sondern ihr auch den ganzen Leib von den Beinen bis zur Brust verbrannt, daß von Fleisch und Eingeweiden nichts übrig blieb; »das Fett von ihr (denn sie eine völlige Magd gewesen) ist in die Erde geflossen, daß man, da man doch knietief gegraben, gleichwohl das Ende vom Fetten noch nicht hat finden können; hat so grausam gestunken, daß nicht davon zu sagen ist.« Man wußte mehrere Tage nicht, wo die vier Personen geblieben waren, wiewohl die Menge und das Geschrei der Raben und Krähen bei dem Häuschen allerlei Vermuthungen rege machten.
Den Sonntag darauf Donnerstag war das Unglück geschehen) wollten die Brüder der beiden Mägde von dem Bier trinken, welches in dem Häuschen aufbewahrt wurde, und brachen es, nachdem sie den Schlüssel lange vergeblich gesucht, endlich gewaltsam auf. Da sahen sie die vier in jämmerlicher Gestalt vor sich liegen. Ein heftiges Grauen kam sie an, und mit Furcht und Zittern liefen sie davon. Der Teufel warf ihnen mit einer Paudel nach, traf aber keinen von ihnen; sondern über ihnen hinweg den Zaun. Später wurden die Körper nach einem Gebrüche geschleppt und da vergraben. Es kamen aber seitdem viele Fremde dorthin, den Ort zu besehen. Das verdroß die Bauern, und sie versuchten das Häuschen hinweg zu bringen, indem sie es unten los machten und große Bäume unterlegten, aber sie konnten es durchaus nicht bewegen, und es kam eine solche Furcht über sie, daß sie die Bäume liegen ließen und davon gingen. So sah das Häuschen mit den untergelegten Bäumen noch der gelehrte Hennenberger im Jahre 1573. Später wurde da selbst ein Monument aus Mauerwerk mit einer das Ereigniß berichtenden und vor der Sünde warnenden Inschrift in lateinischer, deutscher, litauischer und polnischer Sprache errichtet.
Quelle:
Aberglauben aus Masuren Danzig