MÄRCHEN AUS ITALIEN ...
"Der Verschwender"
"Vom Spadónia"
"Von dem mutigen Mädchen"
"Vom Schlaf"
"Die Alte"
"Von dem Seminaristen, der die Königstochter erlöste"
"Von der Fata Morgana"
"Das Rosmarinsträuchlein"
"Von Joseph dem Gerechten"
"Von Pezze e fogghi"
"Vom sprechenden Bauche"
"Von der jungen Gräfin"
"Das Teufelsweib"
"Der Albanese"
" Der geraubte Schleier"
"Der genarrte Tod"
"Von den zwölf Räubern"
"Die Alte vom Garten"
"Vom Einsiedler"
"Von Tobià und Tobiòla"
"Vom klugen Peppe"
"Vom Principe Scursuni"
"Der König Stieglitz (Cardiddu)"
"Der Kupferschmied"
"Von Giuseppinu"
"Die Strafe der Hexe"
"Von dem Kaufmannssohne Peppino"
"Von San Japicu alla Lizia"
"Von Sorfarina"
"Die jüngste, kluge Kaufmannstochter"
"Fortuna"
"Der Teufel heiratet drei Schwestern"
"Vom Ohimè"
"Die Stieftochter"
"Die kluge Kathrin"
"Meine drei schönen Kronen!"
"Die schöne Fiorita"
"Gewonnen"
"Die Prinzessin im Sarg und die Schildwache"
"Es war einmal"
"Die zwölf Ochsen"
"Maria, die böse Stiefmutter und die sieben Räuber"
"Von den drei guten Ratschlägen"
"Don Giovanni di la Fortuna"
"O das Veilchen!"
"Ein italienischer Eulenspiegel"
"Die Tochter des Schlangenkönigs"
"Fiorindo und Chiara Stella"
"Oraggio und Bianchinetta"
"Micco"
"Geppone"
"Granadoro"
"Giufá"
"Meerblume"
"Das kluge Mädchen"
"Schuhflicker im Glücke"
"Pappelröschen"
"Vom Conte Piro"
"Die drei Schwestern"
"Vom Abte Sorgenlos"
"Vom Crivòliu"
"Vom goldnen Löwen"
"Vom grünen Vogel"
"Vom klugen Bauer"
"Die zwei Reiter"
"Der Blinde"
"Cattarinetta"
"Vom Sciauranciovi"
"Der Stöpselwirth"
"Die zwei Schwestern"
"Fanta Ghiro Siebenschön"
"Der König der sieben Schleier"
"Die kranke Prinzessin"
"Vom Räuber, der einen Hexenkopf hatte"
"Von Armaiinu"
"Der Zauberbrunnen"
"Die drei Gänse"
"Das Ziegengesicht"
"Cric und Croc"
"Die beiden Buckligen"
"Vom tapferen Schuster"
"Massafadiga"
"Der Herrgott, St. Peter und der Schmied"
"Der Prinz mit der Schweinshaut"
"Der arme Fischerknabe"
"Vom verschwenderischen Giovanninu"
"Der Drachentöter"
"Königin Angelica"
"Das schlaue Dreizehnterle"
"Margheritina"
"Die Insel der Glückseligkeit"
"Der Florentiner"
"Vom Re Porco"
"Vom singenden Dudelsack"
"Die Granatäpfel"
DIE GRANATÄPFEL ...
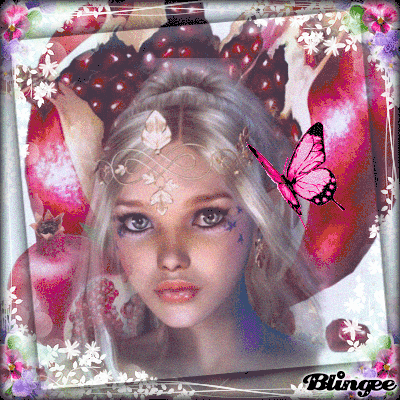
Es war einmal ein König, dessen Sohn war schwermütig. Er lachte nie, und es gab keine Vergnügungen und Zerstreuungen, die ihn zum Lachen gebracht hätten. Einmal fiel es dem Vater ein, der nicht wußte, wie er es anfangen sollte, ihn zu erheitern, auf dem Platz vor dem Schlosse drei Brunnen springen zu lassen, einen mit Wein, einen mit Öl, einen mit Essig.
Alle gingen hin, sich davon zu holen, und stießen und schlugen sich, und eine Menge spaßhafter Szenen fielen vor, aber umsonst! Der Prinz sah aus einem Fenster des Schlosses, aber es kam nicht dazu, daß er lachte. Wein und Essig waren zu Ende, das Öl tröpfelte nur noch, als ein altes Weibchen mit einem Fläschchen kam und anfing es zu füllen, Tropfen für Tropfen, und lange stehen mußte, bis sie ungeduldig wurde.
Dem Prinzen, der am Fenster stand, machte es Spaß, ihr zuzusehen, und um sie zu peinigen, nimmt er, als sie ihr Fläschchen beinahe gefüllt hatte, einen Stein und wirft ihn so geschickt, daß das Glas zerbricht. Dann lacht er aus vollem Halse.
Die Alte, ganz wütend, wendet sich um. »Ha, du lachst? Bravo! lache nur. Aber du wirst dich nie wohl befinden, wenn du nicht ein Mädchen aus Milch und Blut findest!« –
Diese Worte ließen ihn wieder schwermütig werden mehr als zuvor, und er sagte zum Vater, er wolle fort, das Mädchen von Milch und Blut zu finden, von dem die Alte ihm gesagt hatte. Er steckte Geld ein und ging, und ging eine Weile und sah viele Städte und verschiedene Länder, aber ein solches Mädchen fand er nicht.
Eines Morgens kam er in einen Wald und geht und geht und wird durstig, findet aber kein Wasser zum trinken, noch ein Haus, dort eins zu bekommen. Da setzt er sich auf die Erde, denn er konnte wirklich nicht weiter, und als er sich etwas ausgeruht hatte, hebt er den Kopf und sieht einen Baum mit drei Granatäpfeln. Schau, sagt er, ich will mir einen pflücken, um nur ein wenig den Durst zu stillen.
– Er bricht einen ab, macht ihn auf, und herausspringt ein schönes Mädchen weiß und rot und aus Milch und Blut gemacht. Der Prinz sagt ihr: »Willst du kommen und bei mir bleiben?« – »Hast du zu essen und zu trinken?« – »Nein.« – »Dann bleibe ich nicht bei dir.« – Und sie kehrt in den Granatapfel zurück und hängt sich wieder an.
Der Prinz pflückt einen anderen Granatapfel ab, bricht ihn auf, und ein anderes Mädchen kommt heraus. Auch die fragt ihn, ob er zu essen und zu trinken habe, und er verneint es. Da verläßt auch diese ihn und will nicht bei dem Prinzen bleiben. Da pflückt er die dritte Frucht, wieder kommt ein Mädchen aus Milch und Blut heraus, diesmal aber beantwortet er ihre Frage mit Ja. –
»Also werde ich bei dir bleiben.« – Sie sagte ihm, eine Fee habe sie so verzaubert und halte sie in den Granatäpfeln eingeschlossen. Sie hätten eine Zaubergerte, eine Haselnuß, eine Mandel und eine Nuß, die ihnen die Fee aufzuheben gegeben habe; das alles nahm das Mädchen mit.
Sie schlägt die Gerte: »Ich will einen Wagen mit den Pferden« – und sofort erscheint ein schöner Wagen mit den Pferden. Beide setzten sich hinein und fuhren fort.
Die Fee, die eine alte Frau war, kehrt zurück, läßt die Mädchen aus den Granatäpfeln herauskommen und sieht nur zwei. »O, wohin ist Caterina gekommen?« Die beiden anderen erzählten alles, was sich zugetragen hatte, und die Alte macht sich eilig auf, Caterina zu verfolgen.
Die aber gab acht, da sie sie erwartete, und kaum sah sie sie von weitem kommen, warf sie die Nuß weg und sogleich stand eine Kapelle da, sie selbst war in einen Priester verwandelt und er in einen Kleriker.
Die Alte tritt in die Kapelle ein. »Habt Ihr nicht ein Mädchen mit einem jungen Mann vorbei kommen sehen?« – »Was wollt Ihr?« antwortete der Kleriker. »Wollt Ihr Messe hören? Eben läutet es.« – »Aber nein! Ich frage, ob Ihr ein Mädchen mit einem jungen Menschen gesehen habt.« – »Ah! vielleicht wollt Ihr den Segen.« –
Und sie machten sie so verwirrt, daß sie umkehrte. Sie aber stiegen wieder in den Wagen und fuhren fort. Die Alte aber ging wieder zu den Mädchen. – »Heilige Maria! Hat die Caterina auch die Nuß mitgenommen?« – »Freilich.« – Und wieder eilt die Alte hinter der Caterina her und erreicht sie.
Die Caterina aber, kaum erblickt sie sie, wirft die Haselnuß weg, und sogleich erscheint ein schöner Garten, sie aber hat sich in eine Gärtnerin verwandelt, der Prinz in einen Gärtner. –
»Hättet ihr vielleicht ein Mädchen gesehen mit einem jungen Menschen?« – »Was wünschen Sie?« sagt die Gärtnerin, »wollen Sie einen Strauß von Rosen? Ich werde ihn gleich pflücken.« – »Ach was, Rosen! Ich will« – »Ich verstehe. Sie wollen einen Strauß Akazienblüten. Ich hole ihn sofort.« – Kurz, sie machten ihr den Kopf so wirr, daß sie umkehrte.
Und die beiden setzten ihren Weg fort. Die Alte aber fragt die beiden Mädchen: »Sagt doch einmal, hat die Caterina auch die Mandel mitgenommen?« – »Jawohl, alles hat sie fort gebracht, auch die Zaubergerte.« – »Oh, ich Ärmste! Was soll ich tun?«
Und sie fängt wieder an zu laufen und läuft und läuft und geschwinde, weil sie eine Fee war, und holt sie als bald ein. Aber Caterina, so bald sie sie erblickt, wirft die Mandel weg und sogleich erscheint ein reißender Fluß, der Wasser zu enthalten schien, wie alle anderen Flüsse, aber wenn jemand hineinstieg, schnitt er ihn, als wären es geschliffene Klingen. So konnte die Alte nicht durch.
Endlich aber entschloß sie sich doch, hinein zu steigen, um hindurch zu schwimmen; aber kaum war sie drin, so schnitt sie das Wasser in Stücke, und sie starb. Da verschwand der Fluß und alle Bezauberungen der Fee. Der Prinz und Caterina kehrten zurück, um die beiden anderen Mädchen zu holen, und alle gingen nach dem Palast.
Der Prinz heiratete Caterina, die die kleinste war, und vermählte die beiden anderen mit zwei anderen Prinzen. Und so wurde der schwermütige Prinz heiter und wußte nun nichts mehr von Melancholie.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Pisa
VOM SINGENDEN DUDELSACK ...

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten drei schöne Söhne. Nun begab es sich eines Tages, daß der König und die Königin Beide von einer schweren Augenkrankheit befallen wurden und kein Arzt ihnen helfen konnte und kein Mittel anschlagen wollte.
Als nun einst die Königin spazieren ging, begegnete sie einem alten Mütterchen, das bat um eine Gabe. Da schenkte ihm die Königin ein Almosen und das alte Mütterchen sprach: »Königliche Majestät, ihr habt kranke Augen und kein Arzt kann euch helfen. Ich weiß aber ein Mittel, das ist unfehlbar ist. Wenn ihr drei Federn von dem Vogel Pfau hättet, und damit eure Augen bestrichet, so würdet ihr von eurem Leiden genesen.«
»Wie soll ich mir aber die drei Federn verschaffen?« frug die Königin. »Ihr habt ja drei kräftige Söhne,« antwortete die Alte, »lasst sie ausziehen, euch die Federn zu suchen.« Da berief die Königin ihre drei Söhne und sprach: »Meine lieben Kinder, eine alte Frau hat mir gesagt, meine Augen und die eures Vaters könnten wieder gesund werden, wenn unsere Augen mit drei Federn von dem Vogel Pfau bestrichen würden. So zieht denn aus und sucht die drei Federn, daß wir wieder gesund werden.«
Da sprach auch der König: »Und wer mir die drei Federn bringt, soll nach mir König sein.« Da segneten sie ihre drei Söhne, und sie wanderten fort, immer gerade aus.
Als sie nun eine lange Zeit gewandert waren, begegneten sie einer alten Frau, das war die selbe, die ihrer Mutter den Rat wegen der drei Federn gegeben hatte. »Wo geht ihr hin, schöne Jünglinge,« frug die Alte. »Wir sind ausgezogen, unseren Eltern drei Federn von dem Vogel Pfau zu suchen, damit ihre Augen wieder gesund werden,« antworteten die Brüder,
»Ach, ihr armen Kinder,« rief die Alte, »da müßt ihr noch lange gehen, bis ihr die findet. Erst müßt ihr ein Jahr, einen Monat und einen Tag lang wandern.« »Wenn es denn nicht anders ist, so werden wir eben wandern, bis wir die drei Federn gefunden haben,« antworteten die Königssöhne.
Als sie nun wieder eine lange Zeit gewandert waren, begegneten sie der selben alten Frau. Die frug sie: »Wohin geht ihr, schöne Jünglinge?« Da erzählten sie ihr, wie sie ausgezogen wären, die drei Federn zu suchen. »Wohl,« sprach sie, »wenn nun ein Jahr, ein Monat und ein Tag vergangen sind, so werdet ihr an eine tiefe Cisterne kommen, da muß einer von euch sich hinunterlassen, und wieder ein Jahr, einen Monat und einen Tag drin zubringen, so kann er dem Vogel Pfau die drei Federn ausreißen.«
Da wanderten die Brüder wieder weiter und als ein Jahr, ein Monat und ein Tag vergangen waren, kamen sie an die tiefe Cisterne. Da ließ sich der älteste Bruder an einem Strick fest binden und in die tiefe Cisterne hinunter, und nahm ein Glöckchen mit, wenn er das läutete, so sollten ihn seine Brüder wieder hinauf ziehen. Er kam aber nicht weit, denn es war in der Cisterne so dunkel, daß er bald den Mut verlor, und mit dem Glöckchen das Zeichen gab, seine Brüder sollten ihn hinauf ziehen.
»Versuche du es einmal,« sprach er zum zweiten Bruder. Dem ging es aber auch nicht besser; er verlor in der dunkeln Cisterne den Mut und schellte, zum Zeichen, daß seine Brüder ihn hinauf ziehen sollten. Nun ließ sich der Jüngste fest binden und sprach: »Wartet hier oben auf mich ein Jahr, einen Monat und einen Tag; wenn ich dann noch kein Zeichen gebe, dann bin ich wohl tot.«
Also ließ sich der jüngste Königssohn in die Cisterne hinunter, und ob es gleich dunkel war, so verlor er doch nicht den Mut, sondern ging tapfer weiter, bis er auf den Grund kam. Als er sich nun umsah, befand er sich in einem großen Gewölbe und auf der einen Seite sah er eine Tür. Als er die aufmachte kam er in einen hellen Saal, darin weilte der Vogel Pfau.
Da blieb er bei dem Vogel ein Jahr, einen Monat und einen Tag und diente ihm, und nach dieser langen Zeit gelang es ihm endlich, dem Vogel drei Federn auszureißen. Sobald er aber die drei Federn hatte, kehrte er in die Cisterne zurück und ließ sein Glöckchen erschallen.
Seine Brüder waren schon im Begriff, weg zu gehen, denn sie dachten: »Der arme Junge ist gewiss schon lange tot.« Als sie aber das Glöckchen hörten, waren sie sehr erfreut und zogen ihn schnell aus der Cisterne heraus. Da zeigte er ihnen die drei Federn und sie machten sich auf den Weg nach Haus.
Der älteste Bruder aber war neidisch, daß der Jüngste König werden sollte und sprach: »Wir haben doch Alle drei gearbeitet, so wollen wir Jeder eine Feder unseren Eltern überbringen.« Der jüngste Bruder war es zufrieden, zog seine Federn heraus und gab dem Ältesten die schlechteste, weil er am kürzesten in der Cisterne geblieben war, dem zweiten Bruder die zweitbeste und für sich behielt er die schönste. Da entbrannte das Herz seines ältesten Bruders vor Neid, und er beschloss, ihn zu töten.
Also sprach er zum zweiten Bruder: »Warum hat unser jüngster Bruder das getan und hat mir die schlechteste Feder gegeben, da ich doch der Älteste bin? Dafür will ich ihn töten.« »Ach, tue das nicht,« antwortete der zweite Königssohn, »er hat ja am meisten gearbeitet, also gebührt ihm auch die beste Feder, was willst du ihn umbringen?«
»Nein,« rief der Andere, »er muß sterben, und wenn du mir nicht einen heiligen Eid schwörst, daß du zu Hause Nichts davon sagen willst, so reiße ich dir auch den Kopf ab.« Da schwur ihm der zweite Bruder einen heiligen Eid, er wolle nichts verraten, und der Älteste erschlug den jüngsten Bruder und verscharrte ihn im Sand.
Es war aber an den Ufern des Jordan Flusses. Die Feder hatte er ihm fort genommen, und so wanderten die beiden Brüder weiter. Der Jüngere aber weinte immer und sprach: »Was sollen wir nun unseren Eltern sagen, wenn sie uns fragen, wo unser armer Bruder geblieben ist?« »Wir sagen, er sei im Jordan ertrunken,« antwortete der Andere.
So kamen sie endlich nach Haus und sprachen zum König und zur Königin: »Liebe Eltern, hier sind die drei Federn von dem Vogel Pfau.« Da bestrichen sie die Augen ihrer Eltern damit, also daß sie wieder sehend wurden. »Wo ist denn euer jüngster Bruder?« frug die Mutter. »Er ist im Jordan ertrunken,« antwortete der Älteste. Da war die Mutter sehr betrübt und weinte um ihren verlorenen Sohn. Der König aber sprach: »Mein ältester Sohn hat mir zwei Federn mitgebracht und sein Bruder nur eine, so soll also der Älteste nach mir König sein.«
Ein Schäfer aber hatte gesehen, wie die Beiden ihren Bruder im Sand verscharrten und dachte: »Ich will ihn wieder heraus scharren und aus seinen Knochen und der Haut einen Dudelsack machen.« Er hatte aber einen Hund mit sich, dem zeigte er den frischen Sandhügel, und der Hund scharrte so lange, bis er den toten Jüngling heraus gescharrt hatte.
Da ließ der Schäfer ihn an der Sonne trocknen, und nahm die Knochen und die Haut und machte einen Dudelsack daraus. Weil aber der Jüngling vor der Zeit eines gewaltsamen Tode gestorben war, so war sein Geist noch nicht zu seiner Ruhe eingegangen, sondern weilte in dem toten Körper. Als nun der Schäfer anfing zu spielen, ließ der Dudelsack ein schönes Lied ertönen, das lautete also:
»Spiele mich, spiele mich, o mein Bauer,
Spiele nur immer munter fort;
Für drei Federn eines Pfauen
Ward ich getötet am Jordan dort,
Von meinem Bruder, dem Verräter.
Der Zweite hat keine Schuld zu tragen,
Dem Großen aber geht es an den Kragen.«
So oft nun der Schäfer auf dem Dudelsack spielte, ertönte dieses Lied, das war so schön, daß alle die es hörten davon gerührt wurden. Da zog der Schäfer durch alle Länder und ließ überall sein Lied hören, und die Leute gaben ihm gern viel Geld dafür.
So kam er auch endlich in die Stadt wo der König herrschte, und da sich das Gerücht verbreitet hatte, er spiele ein so wunderschönes Lied, so ließ ihn der König aufs Schloß kommen, damit er vor ihm und der Königin und den beiden Söhnen spielen solle. Da nun der Schäfer das Lied spielte, fing die Königin an bitterlich zu weinen und der König sprach: »Laß mich auch einmal darauf spielen.« Als er nun anfing zu spielen, sang der Dudelsack:
»Spiele mich, spiele mich, o mein Vater,
Spiele nur immer munter fort;
Für drei Federn eines Pfauen
Ward ich getötet am Jordan dort,
Von meinem Bruder, dem Verräter.
Der Zweite hat keine Schuld zu tragen,
Dem Großen aber geht es an den Kragen.«
Als nun der König zu Ende gespielt hatte, gab er den Dudelsack der Königin und sprach: »Spiele du auch einmal.« Da nahm die Königin den Dudelsack, der sang:
»Spiele mich, spiele mich, o meine Mutter,
Spiele nur immer munter fort;
Für drei Federn eines Pfauen
Ward ich getötet am Jordan dort,
Von meinem Bruder, dem Verräter.
Der Zweite hat keine Schuld zu tragen,
Dem Großen aber geht es an den Kragen.«
Nach der Königin spielte auch der jüngere Bruder und der Dudelsack sang:
»Spiele mich, spiele mich, o mein Bruder,
Spiele nur immer munter fort;
Für drei Federn eines Pfauen
Ward ich getötet am Jordan dort,
Von meinem Bruder, dem Verräter.
Du hast keine Schuld zu tragen,
Dem Großen aber geht es an den Kragen.«
Als der König das hörte, rief er: »Nun soll der Älteste auch einmal darauf spielen.« Der wollte nicht, aber der König zwang ihn zu spielen, und nun klang das Lied:
»Spiele mich, spiele mich, Verräter,
Spiele nur immer munter fort;
Für drei Federn eines Pfauen
Hast du mich getötet am Jordan dort.
Der Zweite hat keine Schuld zu tragen,
Du bist es, dir geht es an den Kragen.«
Da merkten alle, daß der falsche Bruder seinen jüngsten Bruder ermordet hatte, und der König ließ einen Galgen errichten und ihn daran aufhängen. Dem Schäfer aber gab er große Schätze, damit er ihm den Dudelsack lasse.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
VOM RE PORCO ...
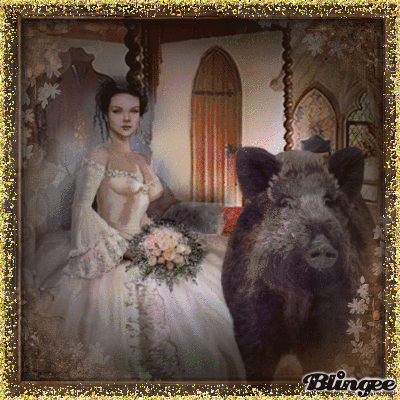
Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten kein Kind und hätten doch so gern eins gehabt. Eines Tages ging die Königin spazieren, und da lief ihr eine Sau mit ihren Ferkelchen über den Weg. Da sprach die Königin: »O Gott, so ein unvernünftiges Tier hat so viele Kleine, und mir habt ihr auch nicht eines geschenkt, trotz meiner Gebete. Ach, hätte ich doch ein Kind, und wenn es nur ein Schweinchen wäre!«
Nicht lange, so hatte die Königin Aussicht, ein Kind zu bekommen, und bald kam auch ihre Stunde. Sie gebar aber ein kleines Schweinchen. Da war große Verwunderung und Trauer im Schloß und im ganzen Land. Die Königin aber sagte: »Dieses Schweinchen ist nun einmal mein Kind, und ich habe es eben so lieb, als wenn ich einen schönen Knaben zur Welt gebracht hätte.« Also säugte sie das Schweinchen, und hatte es von ganzem Herzen lieb; das Schweinchen aber gedieh, und wuchs einen Tag für zwei.
Als es nun größer geworden war, fing es an, im Schlosse herumzugehen und zu grunzen: »Ich will eine Frau haben! ich will eine Frau haben!« Die Königin aber sprach zum König: »Was sollen wir tun? Eine Königstochter können wir unserm Sohn nicht geben, es würde ihn ja keine nehmen; so wollen wir mit der Waschfrau sprechen, die hat drei schöne Töchter, vielleicht gibt sie uns eine davon zur Frau für unsern Sohn.«
Der König war es zufrieden, und die Königin ließ die Waschfrau zu sich kommen. »Höre einmal,« sprach sie zu ihr, »du mußt mir einen Gefallen tun. Mein Sohn will sich gern verheiraten, und du mußt mir deine älteste Tochter zur Frau für ihn geben.« »Ach, Frau Königin,« antwortete die Waschfrau, »soll ich mein Kind einem Schwein geben?« Die Königin aber sprach: »Ach, tue es doch. Sieh, deine Tochter soll wie eine Königin gehalten werden, und ich gebe dir, was du willst.«
Die Waschfrau war ein armes Weib, und ließ sich bereden, den Willen der Königin zu tun; sie ging also zu ihrer ältesten Tochter, und sprach zu ihr: »Denke dir nur, meine Tochter, der Sohn des Königs will dich heiraten, und du sollst nun gehalten werden wie eine Königin.« Die Tochter wollte zwar nicht gerne ein Schwein heiraten, sie dachte aber, sie würde dann schöne Kleider haben und Geld die Hülle und Fülle, und sagte ja.
Nun wurde ein glänzendes Hochzeitsfest gefeiert, drei Tage lang, und die Tochter der Waschfrau wurde in kostbare Gewänder gekleidet. Da sie nun in einem schönen Kleide ganz breit da saß, kam das Schwein herein gelaufen, hatte sich im Schlamm gewälzt, und wollte sich an ihrem schönen Kleide abreiben. Sie aber stieß ihn unsanft von sich, und rief: »O du abscheuliches Tier, geh weg, du beschmutzt mir ja mein schönes Kleid,« und so oft er in ihre Nähe kam, trieb sie ihn mit unfreundlichen Worten weg.
Am Abend des dritten Tages nun, nach dem die Trauung vollzogen war, wurde sie in die Brautkammer geführt, und legte sich nieder; er aber wartete, bis sie eingeschlafen war, dann trat er in die Brautkammer, verriegelte die Türe, streifte seine Schweinshaut ab, und wurde ein schöner, edler Jüngling. Da zog er sein Schwert, und hieb seiner Frau den Kopf ab, und als der Morgen kam, schlüpfte er wieder in seine Schweinshaut, lief im Schloß umher, und grunzte: »Ich will eine Frau haben! ich will eine Frau haben!«
Die Königin aber hatte keine Ruh, denn sie dachte: »Wenn er sie nur nicht umgebracht hat.« Als sie nun in das Zimmer trat, und die tote Braut im Bette fand, ward sie tief betrübt und sprach: »Was soll ich nun ihrer armen Mutter sagen?« Das Schwein aber rannte immer im Haus umher und verlangte eine Frau. Da ließ die Königin die Waschfrau rufen, und erzählte ihr mit vielen Tränen das unglückliche Schicksal ihrer Tochter.
»Nun mußt du mir aber den Gefallen tun, und mir deine zweite Tochter herbringen, daß sie die Frau meines Sohnes werde,« sprach sie. Die Waschfrau jammerte laut: »Wie soll ich mein armes Kind in den Tod schicken?« Die Königin aber antwortete: »Du mußt es tun. Bedenke doch, wenn es gelingt, so ist deine Tochter nach mir die Erste im ganzen Reich.« Da willigte die Waschfrau ein, und brachte ihre zweite Tochter ins Schloß, und die Hochzeit wurde mit großer Pracht gefeiert, drei Tage lang.
Die Braut wurde schön gekleidet, und als sie in ihrem schönen Kleide da saß, kam das Schwein herein gelaufen, hatte sich im Schlamm gewälzt, und wollte ihr auf den Schoß steigen. Sie aber rief: »O du abscheuliches Tier, geh weg, du beschmutzest mir ja mein schönes Kleid.« Am Abende des dritten Tages wurde sie in die Brautkammer geführt, es ging ihr aber nicht besser, als der älteren Schwester. Als sie fest schlief, kam ihr Mann herein, streifte die Schweinshaut ab, daß er zu einem schönen Jüngling wurde, und schnitt ihr den Kopf ab.
Am Morgen kam die Königin ins Zimmer, und fand die tote Braut im Bette, ihr Sohn aber lief in seiner Schweinshaut im ganzen Haus umher, und grunzte: »Ich will eine Frau haben! ich will eine Frau haben!« Was war zu machen? Die Königin mußte wieder die Waschfrau kommen lassen, ihr das traurige Schicksal der Tochter mitteilen, und sie bitten, ihr nun das Jüngste zu schicken. Da fing die arme Mutter an zu weinen und sprach: »Soll ich alle meine Kinder verlieren?« und wollte ihre Tochter nicht hergeben.
Die Königin aber bat sie, und stellte ihr vor, die jüngste Tochter sei ja viel klüger als ihre Schwestern, vielleicht möchte es ihr gelingen. Da ließ die Waschfrau sich überreden, und brachte auch ihre jüngste Tochter in das Schloß, die war sehr klug, und schöner als die Sonne und der Mond. Gleich kam ihr das Schwein entgegen gelaufen, und sie bückte sich, und nannte es: »mein hübsches Tierchen.« Da wurde ein glänzendes Hochzeitsfest gefeiert, drei Tage lang, und die Braut bekam die schönsten Kleider.
Als sie nun schön geschmückt da saß, kam das Schwein herein, hatte sich im Schlamm gewälzt, und wollte sich an ihrem Kleide abreiben. Da sprach sie: »Komm nur auf meinen Schoß, du liebes Tierchen, und wenn das Kleid auch schmutzig wird, es tut nichts, ich ziehe später ein andres an.« So oft sie sich nun schön geschmückt hatte, kam das Schwein, und beschmutzte ihr ihre Kleider, sie aber ließ es geschehen, und verlor nie die Geduld.
Am Abende des dritten Tages wurde sie in die Brautkammer geführt, und als sie fest schlief, kam ihr Mann herein, streifte seine Schweinshaut ab, und legte sich auch nieder. Ehe sie aber aufgewacht war, schlüpfte er wieder in die Schweinshaut, also daß sie nicht wußte, welch schönen Jüngling sie zum Manne habe.
Als nun am Morgen die Königin mit schwerem Herzen ins Zimmer trat, fand sie die Braut munter und vergnügt, und dankte Gott, daß alles gut abgelaufen war.
So vergingen einige Tage, eines Abends aber schlief die junge Frau nicht, als ihr Mann die Schweinshaut abstreifte und sah ihn nun in seiner wahren Gestalt. Da gewann sie ihn von Herzen lieb, und sprach: »Warum hast du mich nicht erkennen lassen, wie schön du bist?«
Er aber antwortete: »Sage ja keinem Menschen, wie ich aussehe, denn wenn du es erzählst, so muß ich fort, und du mußt sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage wandern, und mußt sieben Paar eiserne Schuhe durchlaufen, ehe du mich erlösen kannst.« Da versprach sie ihm, verschwiegen zu sein, und keinem Menschen davon zu sagen, und hielt ihr Versprechen einige Tage lang.
Eines Tages aber konnte sie dem Verlangen nicht widerstehen, es der Königin mit zu teilen, und sprach: »Ach, liebe Mutter, wenn ihr wüßtet, wie schön mein Mann ist, wenn er Abends seine Schweinshaut abstreift!« In dem selben Augenblick war der Königssohn verschwunden, und so viel man auch nach ihm suchen mochte, er war nirgends zu finden.
Da fing die junge Frau an zu weinen, und sprach: »Ich bin Schuld an diesem Unglück; er hatte es mir ja gesagt. So will ich denn nun wandern sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage lang, bis ich ihn wieder gefunden habe.« Also ließ sie sich sieben Paar eiserne Schuhe machen, und ob auch der König und die Königin sie nicht ziehen lassen wollten, so blieb sie dennoch standhaft und wanderte fort, viele, viele Tage lang, bis sie eines Abends an ein Häuschen kam. Darin wohnte eine gute, alte Frau.
»Ach,« bat die junge Frau, »laßt mich diese Nacht bei euch ruhen, sonst muß ich verschmachten.« Da nahm die Alte sie freundlich auf, und als sie hörte, warum die junge Frau ausgezogen sei, sprach sie: »Ach, du armes Kind, du mußt nun unter der Erde weiter wandern, bis du vier Paar Schuhe durchgelaufen hast.«
Da gab sie ihr ein Lämpchen, und zeigte ihr den unterirdischen Gang, durch den sie wandern mußte, und die arme junge Frau fing an zu wandern, und wanderte vier Jahre, vier Monate und vier Tage unter der Erde, bis die vier Paar Schuhe verbraucht waren. Nach dieser langen Zeit kam sie wieder ans Tageslicht, und wanderte nun auf der Erde weiter.
Da kam sie in einen dichten Wald, und konnte keinen Ausweg finden. Endlich sah sie in der Ferne ein Licht, und als sie näher hin zu ging, sah sie ein Häuschen und klopfte an. Ein ganz alter Mann öffnete ihr die Tür, der war ein Einsiedler, und frug sie, was sie wolle. »Ach, Vater,« antwortete sie, »ich bin ein armes Mädchen, und bin ausgegangen, meinen Gemahl zu suchen,« und erzählte ihm die ganze Geschichte.
Da sprach der Einsiedler: »Ach, du armes Kind, da mußt du noch weit wandern, und ich kann dir nicht helfen. Aber eine Tagesreise weiter im Wald wohnt mein älterer Bruder, der kann dir vielleicht raten. Ruhe diese Nacht hier aus, morgen früh will ich dich wecken.« Am Morgen weckte sie der Einsiedler, wies ihr den Weg, und gab ihr beim Abschied eine Haselnuß. »Verwahre sie wohl, sie wird dir nützen,« sprach er, segnete sie und ließ sie ziehen.
Da wanderte sie den ganzen Tag, und als es Abend wurde, kam sie zum zweiten Einsiedler, bei dem brachte sie die Nacht zu, und klagte ihm ihr Leid. »Du armes Kind,« antwortete er, »ich kann dir nicht helfen, aber eine Tagesreise tiefer im Wald wohnt mein älterer Bruder, der kann dir vielleicht raten.« Zum Abschied gab der Einsiedler ihr eine Kastanie, und sprach: »Verwahre sie wohl, sie wird dir nützen.«
Da wanderte sie wieder einen ganzen Tag im finstern Wald, und kam am Abend zum dritten Einsiedler, bei dem brachte sie die Nacht zu, und klagte ihm ihr Leid. Er konnte ihr aber auch nicht helfen, sondern wies sie an seinen ältesten Bruder, der wohnte noch tiefer im Wald. Zum Abschied schenkte er ihr eine Nuß, und sprach: »Verwahre sie wohl, sie wird dir nützen.«
Am Abend des vierten Tages kam sie endlich zum ältesten Einsiedler, der war so steinalt, daß sie fast vor ihm erschrak. Als sie ihm nun erzählt hatte, warum sie so allein herumziehe, sprach er: »Du armes Kind, du mußt noch weiter wandern, bis die sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage um sind. Dann wirst du in die Stadt kommen, wo der Königssohn weilt. Nimm diese Zaubergerte, gehe in der Nacht vor das königliche Schloß, und schlage damit auf den Boden, so wird sich ein wunderschöner Palast erheben, in dem kannst du wohnen.« Dann segnete er sie und ließ sie ziehen.
So wanderte sie immer weiter, bis die sieben Paar Schuh aufgebraucht, und die sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage verflossen waren, und kam endlich eines Abends in eine Stadt, wo der König Porco weilte. Er hatte zwar seine menschliche Gestalt, denn der Zauber war von ihm gewichen, aber er hatte sein treues Weib vergessen, und eine schöne Königin hielt ihn gefangen, und in einigen Tagen sollte die Hochzeit sein.
Als die arme junge Frau das hörte, ward sie von Herzen betrübt, sie tat aber, wie der Einsiedler ihr geheißen, ging in der Nacht vor das königliche Schloß, und schlug mit der Zaubergerte auf den Boden. Als bald erhob sich ein prachtvoller Palast, mit großen Sälen und zahlreicher Dienerschaft, und sie ging hinein, und wohnte darin.
Als nun am Morgen der König Porco ans Fenster trat, sah er den schönen Palast, und verwunderte sich sehr, und rief die Königin, damit sie ihn auch sehen sollte. Unterdes aber hatte die junge Frau die Haselnuß zerknackt, die der Einsiedler ihr gegeben, und siehe da, es kam eine schöne goldne Henne heraus mit vielen goldnen Küchlein, die waren gar niedlich anzusehen.
Sie aber nahm die Henne samt den Küchlein, und stellte sie auf den Balkon, wo der König und die Königin sie sehen konnten. Als nun die Königin die Tiere sah, regte sich in ihr der Wunsch, sie zu besitzen. Also rief sie ihre vertraute Kammerfrau, und sprach: »Gehe hinüber zu der Dame, und fragte sie, ob sie mir die Henne und die Küchlein verkaufen wolle. Ich wolle ihr dafür geben, was sie verlange.«
Da ging die Kammerfrau hinüber, und richtete den Auftrag der Königin aus, die junge Frau aber antwortete: »Sagt eurer Herrin, die Henne und die Küchlein seien mir nicht feil; ich werde sie ihr aber mit Freuden schenken, wenn sie mir erlaubt, eine Nacht in dem Zimmer ihres Bräutigams zuzubringen.« Als die Kammerfrau der Königin diesen Bescheid brachte, meinte die Königin: »Nein, das kann nicht geschehen, das ist unmöglich!«
Die Kammerfrau aber sprach: »Warum nicht, Frau Königin? Wir geben dem Könige heute Abend einen Schlaftrunk, so wird er nichts davon merken.« So willigte die Königin denn ein, und die junge Frau mußte die goldnen Tierlein hergeben, und wurde am Abend in die Kammer des Königs geführt.
Da fing sie an zu weinen und zu klagen: »Hast du mich denn ganz vergessen? Sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage bin ich gewandert, bei Sturm und Regen, und bei der glühenden Sonnenhitze, und habe sieben Paar eiserne Schuhe verbraucht, um dich zu erlösen, und nun willst du mir untreu werden?« So jammerte sie die ganze Nacht, weil aber der König den Schlaftrunk genommen hatte, konnte er sie nicht hören, und sie mußte am Morgen früh die Kammer verlassen, ohne ihn geweckt zu haben.
Unter der Kammer des Königs aber war das Gefängnis, und die Gefangenen hatten alles gehört, was die arme Frau geklagt hatte, und verwunderten sich sehr darüber. Sie aber ging nach Hause, biss die Kastanie auf, und fand darin eine kleine Lehrerin ganz von Gold, mit ihren kleinen Schülerinnen, die stickten und nähten, daß es gar hübsch anzusehen war, und alle waren von Gold.
Da nahm sie das Spielzeug und stellte es auch auf den Balkon, und als die Königin es sah, bekam sie Lust es zu haben, und schickte ihre Kammerfrau hinüber, um zu fragen, ob es feil sei. Die junge Frau aber antwortete: »Sagt eurer Herrin, ich werde ihr mit Freuden das Spielzeug schenken, wenn sie mir erlaubt, eine Nacht in der Kammer ihres Bräutigams zuzubringen.«
Die Königin wollte nicht, die Kammerfrau aber sagte: »Warum denn nicht? Wir geben dem König wieder einen Schlaftrunk, daß er nichts merke.« Als es nun Abend wurde, und der König zu Tische saß, mischte ihm die Königin einen Schlaftrunk in den Wein, also daß er fest einschlief, und als seine rechte Frau kam, konnte er nicht hören, wie sie die ganze Nacht durch weinte und jammerte.
Die Gefangenen aber hörten es, und als der König erwachte, ließen sie ihn bitten, doch einen Augenblick zu ihnen zu kommen, sie hätten ihm ein Wort zu sagen. Da kam der König, und die Gefangenen sprachen: »Königliche Majestät, schon seit zwei Nächten hören wir in eurer Kammer ein Klagen und Jammern von einer Frauenstimme.« »Wie ist es denn möglich, daß ich nichts davon gehört habe?« sprach der König. »Heute Abend will ich keinen Wein trinken.«
Die arme Frau aber war traurig nach Haus gegangen, und zerknackte auch noch die Nuß, darin fand sie einen wunderschönen, goldnen Adler, der glänzte in der Sonne, daß es eine Pracht war. Da nahm sie ihn, und stellte ihn ebenfalls auf den Balkon, und kaum hatte ihn die Königin erblickt, so wünschte sie auch schon ihn zu haben, und schickte die Kammerfrau hinüber, um ihn um jeden Preis zu kaufen.
Die junge Frau aber gab immer die selbe Antwort: »Sagt eurer Herrin, ich werde ihr mit Vergnügen den Adler schenken, wenn sie mir erlaubt, eine Nacht in der Kammer ihres Bräutigams zuzubringen.« »Nun gut,« dachte die Königin, »ich werde dem König wieder einen Schlaftrunk geben.« Als es aber Abend ward, und der Königin zu Tische saß, hütete er sich wohl, den Wein zu trinken, den die Königin ihm bot, sondern goß ihn unter den Tisch. Er tat aber dennoch, als ob der Schlaf ihn übermanne ließ sich zu Bette bringen, und fing an zu schnarchen, als ob er ganz fest schliefe.
Da ging die Türe auf und seine rechte Frau kam herein, setzte sich auf das Bett und fing an zu jammern: »Hast du mich denn ganz vergessen? Sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage bin ich gewandert, bei Sturm und Regen, und bei glühender Sonnenhitze, und habe sieben Paar eiserne Schuhe verbraucht, um dich zu erlösen, und nun willst du mir untreu werden?«
Als der König das hörte, erinnerte er sich wieder seines treuen Weibes, sprang auf, umarmte und küßte sie, und sprach: »Ja, du bist meine liebe Frau; sei unbesorgt, wir wollen morgen entfliehen.«
Am Morgen aber, als seine Frau ihn verlassen hatte, stand er auf, befreite alle die Gefangenen zum Dank für ihre Warnung, und rüstete dann heimlich ein Schiff aus, ohne daß die Königin es merkte. In der Nacht aber bestieg er mit seiner Frau das Schiff, und fuhr zu seinen Eltern zurück.
Ihr könnt euch denken, wie sich die gefreut haben werden, als sie ihren Sohn und ihre liebe Schwiegertochter wieder sahen! Da wurde ein schönes Fest gefeiert, und sie blieben reich und getröstet, und wir sind hier sitzen geblieben.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DER FLORENTINER ...
Es war einmal ein Florentiner, der jeden Abend in Gesellschaft ging und Leute hörte, die gereist waren und viele schöne Dinge gesehen hatten. Er war immer in Florenz geblieben, hatte nichts zu erzählen und hielt sich für einen Dummkopf. Er bekam eine große Lust zu reisen. Geld hatte er, und eines schönen Tages entschloß er sich, packte seinen Koffer und reiste ab.
Er geht und geht, und als es Nacht wird, findet er sich beim Hause eines Pfarrers. Er klopft und bittet um Herberge für die Nacht. Im Gespräch mit dem Pfarrer beim Abendessen erzählte er, warum er auf die Reise gegangen war. Der Pfarrer, als er das gehört hatte, sagte: »Auch ich möchte gern ein Stück Welt sehen und etwas erzählen können. Wenn es euch recht ist, gehen wir zusammen.« –
Der Florentiner war hocherfreut, Gesellschaft gefunden zu haben. So gingen sie zu Bette und brachen am anderen Morgen zusammen auf. Bei Dunkelwerden kamen sie zu einem Landsitz und baten den Verwalter um Aufnahme. Und auch dieser, als er hörte, weshalb sie reisten, bekam Reiselust und sagte, er wolle anderen Tags mit ihnen gehen.
Wirklich machten sie sich tags darauf alle drei auf den Weg. Als sie eine Weile gewandert waren, vertieften sie sich in einen Wald und fanden darin eine prachtvolle Straße, auf der sie lange fortgingen. Sie führte sie endlich zu einem herrlichen Palast. Da klopften sie an, und der Riese, der darin wohnte, öffnete ihnen in Person, und da sie um Nachtquartier baten, ließ er sie eintreten.
Er fragte, wohin sie gingen, und sie sagten: »Wir wollen etwas herumschweifen.« – »Gut,« sagte der Riese zum Florentiner. »Wenn ihr aber bei mir bleiben wollt, in meiner Pfarre fehlt ein Pfarrer, in der Faktorei ein Faktor, und auch für den dritten wird sich eine Stelle finden.« –
Alle drei nahmen an und blieben bei dem Riesen, der jedem eine Kammer gab und ihnen sagte: »Morgen werde ich jedem seine Stelle anweisen.« Am Tage darauf kommt der Riese, holt den Pfarrer und nimmt ihn mit sich in ein Zimmer.
Der Florentiner, sachte, sachte, geht ihnen aus Neugier nach, hält das Auge ans Schlüsselloch und sieht, daß der Riese dem Pfarrer ein paar Blätter zeigt und, während der sie betrachtet, plötzlich einen Säbel nimmt, ihm den Kopf abhaut und ihn in einen Steinkasten wirft, der in dem Zimmer steht.
Das haben wir gut gemacht, daß wir hieher gekommen sind! sagte der Florentiner. Als sie zu Mittag aßen, sagte der Riese: »Den Pfarrer habe ich an seine Stelle gebracht. Jetzt werde ich dem Faktor zu seiner verhelfen.« –
Nach Tische nimmt er den Faktor und führt ihn in das selbe Zimmer, und der Florentiner hinter drein. Durch das Schlüsselloch sieht er, daß der Riese den Schreibtisch öffnet, ein paar Blätter herausnimmt und sie dem Faktor zeigt, dann, während der sie durchsieht, ihm einen Hieb mit dem Säbel gibt, ihm den Kopf abhaut und ihn auch in den steinernen Kasten wirft. Jetzt kommt die Reihe an mich! sagt der Florentiner.
Beim Nachtessen sagt der Riese zu ihm, daß er auch den Faktor an seine Stelle gebracht habe, und daß er bald auch für ihn etwas finden würde. Der Florentiner aber, der dahin, wohin die anderen gegangen waren, nicht auch gehen wollte, zerbrach sich den Kopf, wie er entwischen könnte, und verfiel auf etwas.
Der Riese hatte nur ein Auge, auf dem er schlecht sah. »Schade!« sagt zu ihm der Florentiner. »Sie sind so schön, aber dies Auge ... sehen Sie, ich weiß eine Medizin, mit der könnte ich Sie heilen. Es ist ein Kraut, das ich hier auf der Wiese gesehen habe.« – »Wirklich?« sagte der Riese, »es findet sich hier auf der Wiese? Dann wollen wir gehen und es pflücken.« –
So führte er ihn zu der Wiese, der Florentiner aber besah sich im Hinausgehen genau, wie die Schlösser an der Tür waren, um entwischen zu können. Als sie auf der Wiese waren, pflückte er irgend ein Kraut, sie kehrten dann ins Haus zurück, und er warf das Kraut in eine Pfanne voll Öl, um es zu kochen.
Als es dann gekocht war, sagte er zum Riesen: »Ich mache Euch darauf aufmerksam, daß der Schmerz heftig sein wird. Doch müßt Ihr Euch nicht rühren, und es würde gut sein, ich bände Euch auf diesen Marmortisch, sonst könnte die Operation mißglücken.« –
Der Riese, dem sehr daran lag, sich das Auge in Ordnung bringen zu lassen, sagte dem Florentiner, er möge ihn nur anbinden. Das tat der denn auch gründlich, nahm dann das siedende Öl und schüttete es ihm in die Augen. »Du hast mich blind gemacht!« heulte der Riese.
Der Florentiner aber, ganz leise, flüchtet die Stiegen hinunter, öffnet die Tür und hinaus. Der Riese aber, der jetzt alle beide Augen verloren hatte, erhebt sich und zog sich mit der Kraft, die er hatte, den Marmortisch nach und beginnt mit der Tafel auf dem Rücken dem Florentiner nachzusetzen.
»Komm her!« ruft er ihm nach; »komm her! Habe keine Angst! Wenigstens nimm noch ein Andenken mit.« – Und er wirft ihm einen Ring nach. Der Florentiner hebt ihn auf und steckt ihn an den Finger. Der Finger aber wird ihm augenblicklich zu Stein, und er selbst konnte sich nicht mehr von der Stelle bewegen.
Er sucht sich den Ring vom Finger zu ziehen, es glückt ihm aber nicht, und der Riese war ihm schon nahe. In Verzweiflung nimmt er ein Messer, das er in der Tasche hatte und schneidet sich den Finger ab, da konnte er sich wieder bewegen und entfloh eilig, denn der Riese, schwer wie er war und mit dem Tisch auf dem Nacken, war nicht imstande ihn einzuholen.
So kam er nach Florenz, ganz außer Atem und hatte genug. Die Neigung, die Welt zu durchschweifen und von seinen Reisen zu erzählen, kam ihm nicht wieder.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Pisa
DIE INSEL DER GLÜCKSELIGKEIT ...
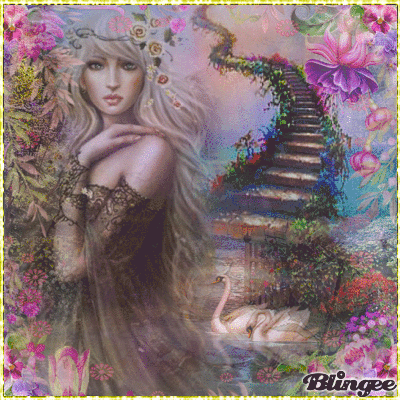
Es war einmal eine arme Witwe mit einem Knaben, die wohnten in einer abgelegenen Hütte und waren fast an den Bettelstab gebracht. Als der Knabe 18 oder 20 Jahre alt geworden war, sagte er zu seiner Mutter: »Ich will fort gehen, Mutter, Glück zu suchen, und fort bleiben, bis ich es gefunden habe, und wenn ich es finde, soll es auch Euch zugute kommen.« – Damit machte er sich auf, die Welt zu durchstreifen.
Er streift und streift umher, ein Jahr war schon vergangen, das Glück hatte er noch nicht gefunden. Da kam er einmal in einen Wald und fand ein Häuschen, und es wurde schon Nacht. Er klopfte an die Tür, und ein alter Mann kam heraus, der für diese Nacht ihn aufnahm. Am anderen Morgen fragte er ihn, was er in dieser Gegend suche, und der Jüngling sagte es ihm.
»Mein lieber Junge,« sagte ihm der Alte, »das Glück kommt einmal alle hundert Jahre, und wenn man es dann nicht fängt, fängt man es nie wieder. Aber sieh einmal: gerade von heute auf morgen enden die hundert Jahre, und das Glück muß kommen. Du mußt gut aufpassen, Punkt Mitternacht. Stelle dich sachte, sacht hinter den Wald am Ufer des Baches. Dahin werden drei wunderschöne Mädchen kommen, die sich auskleiden werden, um zu baden. Warte, bis sie ganz nackt sind, dann nimm die Kleider von der, die in der Mitte steht, und trage sie fort, und wenn sie sie wieder haben will, nimm das Befehlbuch aus ihrer Tasche, und du hast sicher erreicht, was du willst.«
Der Jüngling versprach es; als aber die Nacht kam, schlief er, der nicht gewohnt war, zu wachen, ein und fing in der ersten Nacht nichts. Am Morgen geht er zu dem Alten und berichtet ihm, daß er nichts gesehen hat. – »Warst du denn wach?« – »Nein.« – »Dann bist du ein Tölpel, und dir ist recht geschehen.« – Die zweite Nacht ging es ebenso. In der dritten gab ihm der Alte einen Kamm von Hanf und sagte ihm: »Wenn dir Schlaf kommt, reibe dir das Rückgrat mit dem Kamm, und du wirst wach bleiben.«
So kam es, weil das Reiben stärker war als der Schlaf. Und als die drei Mädchen kamen, paßte der Jüngling auf, und kaum hatten sie sich entkleidet, trug er die Kleider von der, die in der Mitte stand, fort. Die beiden anderen zogen sich an und gingen weg; die dritte aber mußte dem Jüngling nachlaufen, um die Kleider wieder zu bekommen. Die gab er ihr, behielt aber das Befehlbuch zurück und tat mit ihm alles, was er wollte. Und da er Lust bekam, die Fortuna zu heiraten, mußte sie sich drein ergeben.
Nun geschah es einmal, daß er eine Reise machen mußte. Er verschloß das Buch in einen Kasten und sagte zu seiner Mutter: »Wenn meine Frau etwas verlangt, gebt ihr nichts, bis ich zurück gekehrt bin.« – Kaum war er fort, sagte die Fortuna zu ihrer Schwiegermutter, sie wolle in die Messe gehen und brauche dazu das Buch in dem Kasten.
Die Schwiegermutter aber wollte ihr es um keinen Preis geben. Da bat und bettelte sie so lange, bis endlich die arme Frau einen Schlosser kommen und den Kasten aufbrechen ließ, worauf sie ihr das Buch, das sie haben wollte, gab. Dann sagte sie zu ihrer Schwiegermutter: »Ade, ade! Ich gehe fort. Wenn euer Sohn mich suchen will oder Kunde von mir haben, soll er nach der Insel der Glückseligkeit kommen. Dort stirbt man nicht, befindet sich immer wohl, und die Jahre scheinen Augenblicke.«
Der Sohn kommt nach Hause, und die Mutter sagt ihm: »Deine Frau ist nach der Insel der Glückseligkeit gegangen. Wenn du sie finden willst, mußt du dorthin gehen.« – Der Sohn geriet außer sich und rief: »O ich Ärmster! Ich werde sie nie wiedersehen!« – Dann aber besann er sich und sagte: »Komme was wolle, ich will sie suchen gehen.« –
Er geht und geht und kommt an einen Ort, wo sich drei Diebe befanden, die hatten ein Tischtuch, das, wenn sie es ausbreiteten, ihnen Gerichte von jeder Art bereitete, ein Paar Schuhe, wenn man die anzog, konnte man hundert Meilen in einer Minute machen, und einen Mantel, wer den trug, der wurde unsichtbar.
Die drei sagten zu dem Manne: »Schau, wir streiten uns, wem jedes dieser drei Stücke zufallen soll. Entscheide du!« – Darauf antwortete er: »Erst muß ich selbst sehen, wie die drei Stücke beschaffen sind, dann will ich entscheiden.« – Damit breitete er das Tischtuch aus, und plötzlich kamen die Gerichte, und da er gerade Hunger hatte, aß er davon. Dann warf er sich den Mantel um und zog die Schuhe an und fragte die Diebe: »Seht ihr mich noch?« – »Nein.« – »Also auf Wiedersehn am Nimmerlestag.« –
Und fort mit jenen Schuhen, bis er an den Felsen des Donners kam, von dem Felsen und Steine mit einem Höllenlärm herab zu fallen schienen. Er aber sagte: »O, lieber Herr, ich habe hier ein Tischtuch, um die Tafel zu bereiten, haltet ein wenig ein und kommt und eßt!« – Der Donner hielt ein und aß. Darauf sagte der Jüngling: »Wißt Ihr vielleicht, wo die Insel der Glückseligkeit ist?« – »Nein, aber ich habe einen Bruder, den Sonnenstrahl, der 500 000 Meilen von hier entfernt wohnt. Wenn du dorthin kommen kannst, wird er es dir sagen.« –
Und er in zwei, drei Tagen kommt hin, und der Sonnenstrahl machte eine Helle, wie der Tag. Da fragte ihn der Jüngling, ob er wisse, wo die Insel der Glückseligkeit sei. Aber auch er wußte es nicht und schickte ihn weiter zu seinem Bruder, dem Blitz. Zu dem kommt endlich nach vielem Umherschweifen der Mann, als er Kirchtürme, Türme, Bäume und Berggipfel umstürzte. Er aber bat ihn einzuhalten und fragte ihn nach dem, was er wissen wollte.
Der Blitz antwortete, er hätte sieben seiner Vettern danach gefragt, den Südwest, den Nord, den Seewind, den Schirokko, den West- und Nordostwind und den Zephir, keiner aber wußte es, außer dem Schirokko, der überall herumkommt. Der sagte denn auch dem Jüngling nicht nur, wo die Insel der Glückseligkeit lag, sondern gab ihm auch mit seinem Hauch einen Stoß, um ihn vorwärts zu treiben.
Als jener nun in das Haus der Fortuna kam, das auf dieser Insel stand, tat er seinen Mantel um und kam so, ohne gesehen zu werden, durchs Fenster in ein Zimmer, in dem die drei Schwestern waren. Und die, die seine Frau gewesen war, sagte: »Wenn ich nicht Furcht gehabt hätte, dort zu bleiben, wo man stirbt, und meinen Gatten hätte mitnehmen können, wäre ich sehr froh.« –
Da zeigte er sich und sagte: »Da bin ich.« – Sie freute sich sehr und sagte: »Nun sollst du immer bei mir bleiben!« Eine Weile blieb er auch. Dann aber sagte er: »Ich will jetzt ein bißchen nach meiner Mutter sehen.« – »Was willst du dort tun? Zu dieser Stunde ist dort nicht einmal ihre Asche.« – »Wie? Erst vor zwei Monaten bin ich ja gekommen.« – »Es sind mehr als zweihundert Jahre. Doch wenn du hin willst, werden dein Mantel und deine Schuhe dir nichts mehr helfen. Ich werde dir ein Pferd geben, das mit jedem Schritt ein Jahr zurücklegt, und ich werde dich immer begleiten.«
Als er dann mit der Fortuna reiste, begegnete er einem Karren, auf dem saß eine magere Frau, die eine ganze Karrenlast Schuhe verbraucht hatte bei ihrem langen Wandern. Diese Frau stellte sich, als fiele sie auf die Erde nieder, um zu sehen, ob er sie aufheben würde, und wenn er sie berührte, hätte er sicher sterben müssen. Die Fortuna aber, die bei ihm war, rief ihm zu: »Nimm dich in Acht! Es ist der Tod!« – Da ließ er die Frau und ging seines Weges weiter.
Dann begegnete er einem Teufel zu Pferd in Gestalt eines großen Herren, und das Pferd hatte sich durch den langen Lauf die Beine beschädigt. Auch der fiel vom Pferde, der Jüngling lief schon hin, ihm zu helfen, aber die Fortuna rief ihm wieder zu: »Hüte dich!« – So ging er ohne weiteres nach seiner Heimat. Dort aber erkannte ihn niemand; und seine Mutter – selbst unter den Ältesten war keiner, der sich ihrer erinnerte.
Als er das sah, merkte er, daß man in der Welt alt wird und stirbt, stieg wieder zu Pferde und reiste ab mit seiner Fortuna und kehrte nach der Insel der Glückseligkeit zurück. Dort aber starb er nie und befindet sich noch heute da selbst.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Monferrato
MARGHERITINA ...
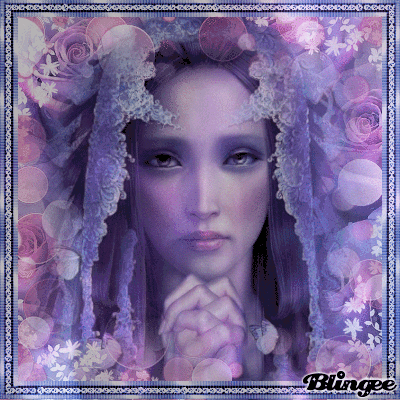
Es war einmal ein Mann, der hatte einen Birnbaum, von dem er jedes Jahr vier Körbe voll Birnen erntete. Nun geschah es in einem Jahre, daß er nur dreieinhalb Körbe voll trug, und der Mann, der dem Könige immer vier zu bringen pflegte, wußte nicht, wie er es anfangen sollte, sie alle vier zu füllen. Er füllte also drei und den vierten nur halb, dann steckte er die kleinste von seinen Töchtern hinein und tat soviel Blätter darüber, bis er voll war wie die anderen. Als er ihn dann in der Vorratskammer des Königs ausleerte, brachte er zugleich mit den Birnen auch dies sein Kind heraus, das sich zwischen den Strohmatten versteckte, und da es nichts zu essen hatte, aß es von den Birnen.
Eine Zeit lang hatten die Diener des Königs es nicht gemerkt, dann aber sagten sie: »Es muß irgend ein Tier sein, das die Birnen ißt. Wollen doch einmal nachsuchen« – und suchten hier und dort und fanden das Mädchen unter den Matten. »Was machst du hier?« fragten sie. »Komm mit uns und diene in der königlichen Küche.« –
Und das Mädchen war so gescheit, daß sie in kurzer Zeit den Dienst besser tat, als die Dienerinnen des Königs, und war so anmutig, daß alle sie gern hatten. Ein Weilchen waren die Dienerinnen des Königs still, dann aber, neidisch wie sie waren, suchten sie auf alle Weise dem armen Mädchen Böses anzutun. Sie fingen damit an, dem König zu sagen, Margheritina habe geprahlt, sie könne in einem Tage die ganze Wäsche des königlichen Hauses waschen und trocknen.
Eines Tages ruft sie der König und sagt ihr: »Ist es wahr, daß du dich erboten hast, in einem Tage alle Wäsche in meinem Hause zu waschen und zu trocknen?« – »Nein,« sagte sie, »es ist nicht wahr. Das habe ich nicht gesagt.« – Der König aber antwortete: »Du hast es gesagt, und was du dem König versprochen hast, mußt du halten.«
Das arme Mädchen geht in seine Kammer und fängt zu weinen an. Der Sohn des Königs, der in sie verliebt war, sagt ihr: »Warum weinst du, Margheritina?« – Da erzählt sie ihm alles, und er sagt: »Weine nicht, ich will dir alles machen. Sage dem König, daß er dir all sein Zeug in ein einziges Zimmer bringen lassen solle.«–
Sie tat es, und der Sohn des Königs erhob eine Rute, die er unter den Kleidern hatte, und machte, daß alles Zeug in einem Augenblick gewaschen und getrocknet war, Leintücher, Strümpfe, Handtücher, alles von selbst. Am Morgen geht der König, um nachzusehen, und findet alles in so schöner Ordnung, daß selbst er nicht wußte, was er sagen sollte.
Zwei oder drei Monate sagten die Mädchen nichts mehr, dann aber sagten sie dem König, Margheritina habe sich gerühmt, sie könne den Hexen den Schatz abnehmen. Der König hörte es, ließ sie kommen und sagte ihr: »Ist es wahr, daß du dich gerühmt hast, du kannst den Hexen ihren Schatz abnehmen?« – Sie leugnete es, der König aber bestand darauf, mit jenem Wort habe es seine Richtigkeit, und sagte: »Wenn du es versprochen hast, mußt du es halten.« –
Da ging sie in ihre Kammer und weinte noch heftiger als zuvor. Der Sohn des Königs hörte sie, und weil er wußte, weshalb sie weinte, sagte er ihr: »Nun wohl, sage nur ja, und der König solle dir drei Pfund Schmier, drei Pfund Brot und drei Pfund Kehrbesen geben lassen.« – Das sagte sie dem König, und der König tat es.
Darauf geht sie fort, geht und geht weit, weit fort. Sie kommt zu einem Ort, wo ein Backofen war, und dabei waren drei Weiber, die sich die Haare ausrissen und mit ihnen den Ofen fegten. Mit denen fühlte sie Mitleid und gab ihnen die drei Pfund Besen, und sie fegten nicht mehr den Ofen mit ihren Haaren.
Dann geht und geht sie und kommt zu einem Ort, den sie nicht passieren konnte, denn da waren drei Hunde, die bellten und an ihr hinauf sprangen wie Wölfe. Da nahm sie die drei Pfund Brot und gab sie ihnen, und sie ließen sie passieren. Dann immer weiter, weiter, bis sie zu einem Flusse kam, dessen Wasser so rot wie Blut war; da wußte sie nicht, was sie tun sollte.
Aber der Königssohn hatte ihr gesagt, sie sollte sprechen: »Wässerlein, schön Wässerlein, hätte ich nicht Eile, tränke ich vom Wasser dein!« – Bei diesen Worten zog sich das Wasser von rechts und links zurück und ließ sie durchgehen.
Als sie am anderen Ufer war, sieht sie einen Palast, der schöner und größer war, als irgend einer in der Welt. Er hatte eine Türe, die sich so geschwind öffnete und schloß, daß niemand hinein konnte. Da nahm sie die drei Pfund Schmier, schmierte die Türe damit und trat nun in das Haus der Hexen ein. Das Kästchen mit dem Schatz, der auf einem Tischchen stand, nahm sie; das aber war verzaubert.
Als sie es in der Tasche hatte, hörte sie es sagen: »Türe, töte sie! Türe, töte sie!« – Die Türe aber antwortet: »Nein, ich will sie nicht töten. Ich bin so lange nicht geschmiert worden, sie aber hat mich geschmiert.« – Darauf geht sie zu dem Fluss, und das Kästchen sagt: »Ertränke sie, ertränke sie!« – Der Fluß aber antwortet: »Nein, ich will sie nicht ertränken, weil sie zu mir gesagt hat: Wässerlein! schön Wässerlein!« –
Als sie dann zu den Hunden kommt, sagt das Kästchen: »Frisst sie, frisst sie!« – Sie aber: »Nein, wir wollen sie nicht fressen, weil sie uns Brot gegeben hat.« – Bei dem Backofen der Hexen hörte sie das Kästchen sagen: »Verbrenne sie! verbrenne sie!« – Die aber: »Nein, wir wollen sie nicht verbrennen, weil sie uns drei Pfund Besen gegeben hat, unsere Haare zu schonen.«
Endlich war sie beinahe wieder nach Hause gekommen, aber weil die Frauen neugierig sind, wollte sie sehen, was in dem Kästchen wäre, öffnete es, und heraus flog eine Henne mit goldenen Küchlein, und sie konnte sie nicht wieder fangen. Der Königssohn sah es und ließ mit seiner Zauberrute die Henne mit den Küchlein in das Kästchen zurück kehren.
Dann sagte er zu dem Mädchen: »Du siehst, daß ich dir das Leben gerettet habe. Also mußt du mich lieben und mich heiraten, und meinem Vater mußt du sagen, daß du zur Belohnung jene große Kiste voll Kohlen ganz hinten im Schlosse haben willst, in der aber werde ich stecken.«
Als Margheritina nach Hause kam, gingen ihr die Dienerinnen entgegen und der König und alle Hofleute, und sie gab dem König die Henne mit den goldenen Küchlein. Der König aber sagte ihr: »Verlange, was du willst, ich werde dir es geben.« – Da verlangte sie die Kohlenkiste hinten im Schlosse. Man ging zu sehen, was drin war, da fand man den Königssohn. Der König war es zufrieden, daß Margheritina seinen Sohn heiratete, und sie hielten ein schönes Hochzeitsmahl, mich aber ließen sie hinter der Türe.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Monferrato
DAS SCHLAUE DREIZEHNTERLE ...
Es war einmal eine Witwe, die hatte dreizehn Söhne, aber sie lebte in solcher Armut, dass sie sie kaum ernähren konnte. So wie die Knaben nur ein wenig heran gewachsen waren, rief sie alle zu sich und sagte:" Meine lieben Söhne, ich kann euch nicht weiter ernähren, ihr müsst jetzt selbst für euch sorgen. Ihr seht ja, wie alt ich nun bin."
Die Jungen sahen das ein, jeder warf sich einen Ranzen über die Schulter, und so zogen sie hinaus in die Welt. Nach einiger Zeit kamen sie zum Schloss des Königs. Sie klopften an das Tor und baten um ein Almosen. Aber als der König sah, wie viele sie waren, sagte er: "Wie kann ich euch ein Almosen geben, da ihr so viele seid? Es sei denn, einer von euch wäre beherzt genug, dem bösen Wolf im nahen Walde die Bettdecke zu stehlen. Dafür würde ich euch dann alle reichlich belohnen!"
Die Burschen schauten einander an und wussten nicht, was sie sagen sollten. Da aber trat der Jüngste von ihnen vor, ein Bürschchen, klein, doch schlau wie zehn Füchse. Weil er der dreizehnte war, nannten sie ihn Dreizehnterle. Er sagte: "Die Bettdecke des Wolfes bringe ich dir, Herr König, gib mir nur eine Nadel, die ein Klafter lang ist."
Und er bekam eine klafterlange Nadel und begab sich kühn in den Wald zur Hütte des Wolfes. Als er dort angelangt war, wartete er, bis der Wolf fort ging, dann kletterte er leise auf das Dach, ließ sich durch den Kamin in die Stube hinab und versteckte sich unterm Bett.
Als es Nacht geworden war und der Wolf in seinem Bett zu schnarchen begann, kroch Dreizehnterle aus seinem Versteck hervor und stach ihn mit seiner langen Nadel hier hin und dort hin, wohin er gerade traf. Der Wolf warf sich im Bett herum, nach links und rechts und rechts und links, und darauf eben hatte Dreizehnterle gewartet. Er packte die Bettdecke, und im Handumdrehen war er fort.
Aber der Wolf hatte einen ungemein gelehrten Papagei, der konnte nicht nur sagen, wie viel Uhr es ist, er wusste überhaupt alles auf der Welt. Kaum wachte der Wolf am Morgen auf, fragte er ihn: "Papagei, wie viel Uhr ist es?" "Fünf", antwortete der Papagei, "und die Bettdecke hat dir Dreizehnterle davon getragen." "Wer ist denn das?" fragte der Wolf. "Dreizehnterle ist ein Junge, winzig klein, aber schlau wie zehn Füchse." "Oh, wenn ich diesen Kerl fange, verschlucke ich ihn wie eine Himbeere!"
Aber Dreizehnterle stand inzwischen mit der Bettdecke des Wolfes schon vor dem König. Der König wunderte sich sehr und sprach. "Hör einmal, Dreizehnterle, wenn du willst, dass ihr, du und deine Brüder, wirklich reiche Leute werdet, dann geh noch einmal zum Wolf und bringe mir auch sein Kissen mit den vielen Glöckchen." "Schön, Herr König, bringe ich", antwortete Dreizehnterle, "gib mir nur etwas Werg und Zwirn."
Und als er alles bekommen hatte, begab er sich aufs neue in den Wald zur Hütte des Wolfes. Wie das erste Mal kletterte er auf das Dach, ließ sich durch den Kamin in die Stube hinab, versteckte sich unterm Bett und wartete, bis es Nacht wurde.
Als der Wolf eingeschlafen war, kroch Dreizehnterle aus seinem Versteck hervor. Leise, leise wickelte er ein Glöckchen nach dem anderen in Werg ein und band dann alles mit dem Zwirn fest. Nun konnten die Glöckchen nicht mehr läuten, und er trug in aller Ruhe das Kissen davon.
Der Wolf wachte bei Tagesgrauen auf und fragte: "Papagei, wie viel Uhr ist es?" "Vier", antwortete der Papagei, "und das Kissen hat dir Dreizehnterle davon getragen." "Oh, das wird er mir bezahlen! Wenn er mir unter die Hände kommt, verschlucke ich ihn wie eine Himbeere!"
Aber dem lieben Herrn König genügte auch das Kissen mit den Glöckchen nicht. Eines Tages ließ er Dreizehnterle zu sich rufen und sprach: "Hör einmal, Dreizehnterle, du bist der König der Diebe, und ich mache dich, meiner Treu, zu einem reichen Mann, wenn du mir noch einen letzten Gefallen tust. Ich will, dass du mir den Wolf selber bringst. Wenn nicht, ergeht es dir übel!"
Ihr könnt euch denken, wie dem armen Dreizehnterle zumute war, als er den Befehl und die Drohung des Königs vernahm. Glaubte er doch, dass es mit ihm aus und vorbei sei, und weinte die ganze Nacht. Aber gegen Morgen schlief er doch ein und hatte lauter schöne Träume. Als er erwachte, rieb er sich zufrieden die Hände und sagte: "Ha, ich hab es schon! Ich weiß, wie ich es mit dem Wolf anstellen muss!"
Schnell kleidete er sich an, zog einen Handwagen aus dem Schuppen, warf ein paar Bretter und Nägel darauf und fuhr damit in den Wald. Als er an der Hütte des Wolfes vorbei kam, fing er laut zu rufen an: "Dreizehnterle ist gestorben! Ach, ach, ach, Dreizehnterle ist gestorben! Wer hilft mir, einen Sarg für ihn zu machen?" Und er schlug auf die Bretter.
"Ich, ich", rief der Wolf vergnügt, "ich helfe dir mit Freuden. Wenn du wüsstest, lieber Junge, was dieser Schuft, dieser Dreizehnterle, mir alles angetan hat!" Dreizehnterle nagelte nun die Bretter zu einem Sarg zusammen und der Wolf half ihm fleißig.
Es dauerte auch nicht lange, und sie waren fertig. "Jetzt solltest du den Sarg einmal ausprobieren", sagte der Junge zum Wolf, "denn Dreizehnterle ist etwa so groß wie du. Damit ich sehe, ob wir ihn groß genug gemacht haben, ich möchte nicht gerne noch einmal von vorn anfangen müssen."
Der Wolf ahnte nichts Böses. Ohne Zögern legte er sich in den Sarg. Da aber sprang Dreizehnterle wie der Blitz herbei, schlug den Deckel zu und vernagelte ihn flink. Der Wolf im Sarge schrie: "He, du, was tust du denn? Mach schnell auf, ich ersticke ja!" Aber Dreizehnterle scherte sich nicht um sein Geschrei. "Nur Ruhe, Gevatter Wolf! Dieser Dreizehnterle, der bin nämlich ich! Und jetzt lauf mir davon, wenn du kannst!"
Dann lud er den Sarg mit dem Wolf auf den Wagen, nahm den Käfig mit dem gelehrten Papagei in die Hand und fuhr zum König. Als sich alle durch die Bretter Ritzen an dem Wolf satt gesehen hatten, machten sie ein großes Feuer und verbrannten den Sarg mitsamt dem Wolf zu Asche.
Dann erst nahm der König einen großen Beutel voll Goldstücke und gab ihn dem tapferen Dreizehnterle. Der ließ sich nicht nötigen, steckte den Beutel an den Gürtel, hängte sich den Käfig mit dem Papagei über die Schulter, nahm vom König Abschied und kehrte mit seinen Brüdern zu seiner Mutter zurück.
Quelle: italienisches Märchen
KÖNIGIN ANGELICA ...
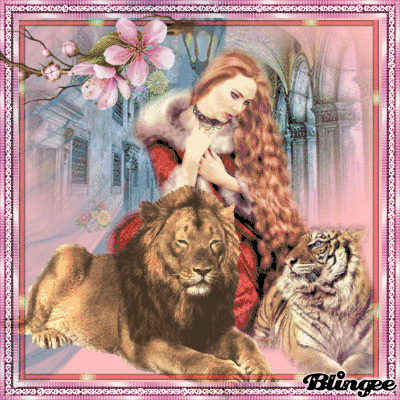
Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Dieser König war blind und befragte alle Ärzte, die in dieses Land kamen, aber keiner hatte ihn heilen können.
Eines Tages sagte ein Arzt: »Hier hilft kein anderes Mittel, als das Wasser der Königin Angelica. Wenn man es finden kann, wird der König sicher geheilt werden.« –
»Ich will gehen, es zu suchen,« sagte der älteste Sohn, und wirklich bat er den Vater um seinen Segen, versah sich mit Geld und einem Diener und reiste ab.
Er geht und geht, sucht, fragt, – wo das Wasser der Königin Angelica zu finden sei, weiß ihm niemand zu sagen. Und doch muß ich es finden, sagt er bei sich selbst und schickt den Diener zurück, um zu sagen, wenn man ihn nicht binnen einem Jahr und drei Tagen zurück kehren sähe, sollte man nun annehmen, daß er gestorben sei. –
Damit ging er weiter und kam in einen Wald. Es war Nacht und es regnete stark. Er bleibt stehen, sieht sich um, und ihm ist, als sähe er in der Ferne zwischen den Bäumen ein kleines Licht. Er geht nach dieser Richtung und findet wirklich ein Haus, und müde, wie er war, tritt er ein, um eine Unterkunft zu finden. In diesem Hause waren drei schöne Mädchen, und als sie diesen Herrn ganz durchnässt sahen, nahmen sie ihn mit den anmutigsten Gebärden auf, ließen ihn sich am Feuer trocknen und gaben ihm Erfrischungen.
Nachdem er gegessen hatte, erzählte er den Mädchen seine Geschichte und weshalb er sich in dieser Gegend befände. Die Mädchen hörten ihn an, als er aber sagte, morgen früh wolle er seinen Weg fortsetzen, baten sie so lange, bis er zu bleiben versprach. Und so blieb er und verliebte sich, und an den blinden Vater und die Königin Angelica dachte man nicht weiter.
Indessen verstrich das Jahr und die drei Tage; nach Hause sah man ihn nicht kommen und hielt ihn für tot. – Nun, dann will ich es versuchen, sagte der zweite Bruder. Auch er bittet den Vater um seinen Segen, nimmt Geld zu sich und einen Diener und reist ab. Aber das Wasser der Königin Angelica fand auch er nicht, schickt ebenfalls den Diener zurück mit der selben Botschaft und setzt dann seinen Weg fort.
Auch er kommt in den Wald, sieht das Lichtchen, tritt in das Haus, und ihr könnt euch seine Freude vorstellen, als er seinen Bruder vor sich sieht, den er tot geglaubt hatte. Auch ihm lagen die Mädchen an, daß er bleiben solle, und auch der Bruder ruhte nicht, bis er blieb, und blieb solange, daß auch er sich verliebte und wie sein Bruder den blinden Vater und die Königin Angelica vergaß.
Als nun wieder ein Jahr und drei Tage vergangen waren und man zu Hause auch ihn nicht zurück kehren sah, sagte der jüngste Bruder: Jetzt ist die Reihe an mir, und ging fort, wie die beiden anderen und kam auch zu dem Hause der drei Mädchen. Diese, im Einverständnis mit den beiden älteren Brüdern, boten alles auf, ihn zurück zu halten, es war aber nicht möglich. Ich will fort, ich will fort und will das Wasser der Königin Angelica finden. –
Er macht sich wieder auf den Weg, bei einem Hundewetter, wo es in Strömen regnete, und in diesen Wäldern wusste er nirgends unterzukommen. Endlich entdeckt er ein Haus und findet darin eine Frau, die ihn aufnimmt, dann aber sagt: »Nimm dich in acht! Dies ist das Haus des Menschenfressers, und ich bin seine Frau. Versteck dich; denn wenn er kommt und dich hier findet, frisst er dich auf.« – Und verbarg ihn.
Nach einer Weile kommt der Menschenfresser nach Hause und wittert, wittert. »Hier riecht es nach Christenfleisch!« sagt er zu seinem Weibe. Die leugnete zuerst, dann erzählt sie ihm alles und sagt ihm, er habe ihr Geld gegeben, und bittet ihn solange, ihm kein Leid anzutun, bis der Menschenfresser versprach, gut zu sein.
Da kam der Jüngling hervor und erzählte dem Menschenfresser die ganze Geschichte seiner Reise. »Du gefällst mir,« sagte jener, »und ich will dir helfen. Siehst du den Berg dort? Da oben steht ein Palast, und in diesem Palast wohnt die Königin Angelica. Am Eingang wirst du zwei Löwen und zwei Tiger finden; hier aber hast du vier Brote, vier Stück Fleisch und vier Karten. Das alles gib den Löwen und den Tigern, und sie werden einschlafen.
Im Palast wirst du die Königin finden, schlafend auf einem Bett. Nimm einen Schlüssel, den du unter ihrem Kopfkissen finden wirst, öffne damit den Schrank in ihrem Zimmer, und dort wirst du das Wasser finden, das du suchst. Nimm es zu dir, geh fort und komm wieder hier vorbei.«
Er ging und tat pünktlich alles, wie es der Menschenfresser ihm angegeben hatte. Die Königin Angelica fand er schlafend, mit sieben Schleiern zugedeckt. Aus Neugier hob er diese Schleier auf und fand sie so schön, aber so schön, daß er sich nicht enthalten konnte und gab ihr einen Kuß. Dann nahm er einen Schleier und steckte ihn in die Tasche. Als er sich umdrehte, sah er am Boden ein Paar goldene Pantoffeln und steckte auch von diesen einen in die Tasche. Dann fand er den Schlüssel, öffnete den Schrank, nahm die Flasche voll Wasser und entfernte sich.
Als er nun zum Menschenfresser zurück kam, nahm der die Flasche, nähte sie ihm in sein Kleid, damit keiner sie finden könnte, und sagte: »Nimm dich in acht, ziehe die Flasche nicht hervor, ehe du in dem Zimmer deines Vaters bist. Hier hast du eine andere Flasche, die kannst du den anderen zeigen statt der echten. Hast du mich verstanden?«
Der Jüngling dankte dem Menschenfresser, machte ihm ein schönes Geschenk an Geld und ging, den Weg nach Hause einschlagend. So kommt er in eine Stadt, hört die Totenglocke läuten und erfährt auf seine Frage, zwei Missetäter gingen zum Tode. Als er hin kommt, sieht er – – daß es seine Brüder sind. Er gibt sich zu erkennen und erreicht es als Sohn des Königs, daß die Hinrichtung aufgeschoben wird.
Er erfuhr, daß jene drei Mädchen drei Hexen waren, welche die Brüder zu dem schlechten Leben von Dieben und Mördern verleitet hatten, und soviel Böses hatten sie begangen, daß sie endlich gefangen und zum Tode verurteilt worden waren. Da bemühte sich jener gute Sohn auf alle Weise, sie zu retten, und brachte es mit Bitten und Geld dahin, daß er sie befreite. Er nahm sie mit sich, kleidete sie neu und erzählte ihnen die ganze Geschichte vom Menschenfresser und der Königin Angelica.
Dann schlug er vor, sie sollten alle zusammen zum Vater zurück kehren.
Jene beiden, die schon von Herzen böse waren, waren eifersüchtig auf ihn wegen der Figur, die er vor dem Vater machen würde, und dachten ihn zu töten. Sie brachen alle drei auf, und unterwegs fingen sie schon an, den Bruder zu misshandeln und bedrohten ihn, bis er ihnen die Flasche mit Wasser übergab.
Dann trennte er sich von ihnen in einer Stadt, wo er sich aufhielt. Die beiden anderen kamen zum Vater, zeigten ihm die Flasche und erzählten ihm alles umgekehrt, als ob sie sie gefunden hätten, vom Bruder aber sagten sie alles Böse, wie wenn er getan hätte, was sie getan hatten. Der Vater segnete sie, und wegen des anderen Bruders gab er Befehl, sobald er sich an den Toren der Stadt zeigte, sollte man ihn verhaften und in einen gewissen Kerker einsperren, der voller Wasser und Gestank war, daß man nach 24 Stunden darin starb.
Wirklich kam wenige Tage später der dritte Bruder und wurde sofort in jenem Gefängnis eingeschlossen. Doch durch die magische Kraft des Pantoffels, des Schleiers und des Wassers, das er bei sich trug, war das Gefängnis für ihn weder feucht noch lebensgefährlich, und er fand immer Essen für sich bereit und es fehlte ihm an nichts. Der König indessen hatte das Wasser probiert, das ihm die anderen beiden Söhne gebracht hatten, und es hatte keine Wirkung gehabt.
Schon wollte er dem Thron entsagen und die beiden krönen lassen, da kommt die Königin Angelica. Die Verzauberung, die sie so schlafend gehalten hatte, war gebrochen worden, sie war mit einem großen Trupp Soldaten aufgebrochen und näherte sich unter Kanonaden der Stadt jenes Königs.
Durch einen Botschafter ließ dieser sie fragen, was sie wolle, und lud sie in seinen Palast ein. Als sie dort angekommen war, fragte sie den König: »Wie viel Söhne habt ihr?« – »Zwei.« – »Nicht mehr?« – »Ich hatte noch einen, der muß aber gestorben sein« – und nun erzählte er ihr die Geschichte jenes anderen Sohnes und sagte ihm alles Böse nach, während er die beiden anderen rühmte.
Die Königin wollte, man sollte nachsehen, ob jener dritte noch lebe. Das sei unmöglich, sagte der König, doch ihr zu Gefallen schickte er hin und wirklich fand man ihn lebend und frisch wie eine Rose. Man führte ihn vor die Königin, die ihn sehen wollte, und sie sagte zu ihm: »Kennst du mich?« – »Ob ich Sie kenne!« – »Und wer bin ich?« – »Die Königin Angelica.« –
»Bist du in meiner Kammer gewesen?« – »Ja, gnädige Frau.« – »Also,« sagten die Brüder, »seht ihr, daß er wirklich ein Dieb ist.« – »Und der Pantoffel?« fragte die Königin. – »Ich nahm Euch auch den Pantoffel,« antwortete er, und wieder nannten ihn die Brüder einen Dieb. – »Und tatest du mir nichts?« – »Ich gab Euch einen Kuß.« – Und wirklich hat die Königin noch ein Merkmal von jenem Kuss.
Zuletzt fragte sie ihn auch nach dem Wasser. – »Das Wasser nahm ich und habe es noch bei mir« – und damit zog er den Schleier und den Pantoffel hervor, trennte seinen Rock auf und zog die Flasche mit dem Wasser heraus. Sofort öffnete die Königin die Flasche, wusch mit dem Wasser die Augen des Königs, und augenblicklich erhielt der König die Sehkraft wieder.
Die beiden schlimmen Brüder wußten nicht wohin sie sich verstecken sollten. Der Jüngste erzählte alles, wie es sich zugetragen hatte, und der Vater blieb ganz bestürzt und wußte nicht, was er tun sollte, jene beiden Schurken zu bestrafen, wie sie es verdienten. – »Wenn Sie damit einverstanden sind,« sagte die Königin, »werde ich die Strafe bestimmen.« –
Der König sagte, er überlasse es ihr. Da rief die Königin: »He, Tiger! zerreiße diesen! He, Löwe! zerreiße den anderen!« und es kam ein Tiger und ein Löwe, und jene beiden wurden zerrissen. Dann krönte der König seinen Sohn, der die Königin Angelica heiratete, und sie lebten glücklich und zufrieden, und hiermit ist das Märchen zu Ende.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Pisa
DER DRACHENTÖTER ...
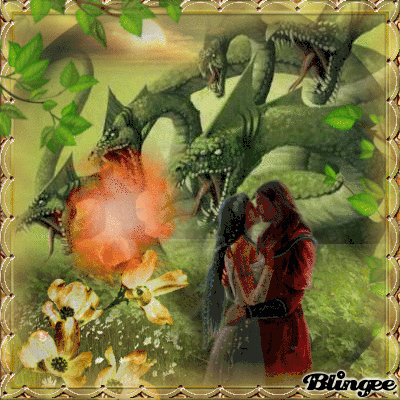
Einst war in einem Königreiche große Not und Trauer. Seit einigen Jahren kam nämlich alle Jahr ein Drache, dem jedesmal eine reine Jungfrau geopfert werden musste. Dieses Jahr hatte das Los die einzige Tochter des Königs getroffen. Vergebens hatte dieser nicht bloß die Hand des Mädchens, sondern alle seine Schätze dem geboten, der das Land und seine Familie von solchem Unglück zu befreien im Stande wäre; aber es fand sich keiner unter den Rittern seines Hofes und den Offizieren seiner Armee, der den Kampf mit dem scheußlichen Ungetüm aufzunehmen wagte.
Da kam zufällig ein junger Jäger aus dem Gebirge in die Stadt, dem die allgemeine Trauer auffiel und dem man auf sein Befragen den Grund erklärte.
Zum Kuckuck, dachte er sich, ich bin jung, stark und gewandt, habe ein Gewehr, das an Sicherheit und Kraft des Triebes im Königreiche so wenig seines Gleichen hat als meine Hunde, Forte (Stark), Potente (Mächtig) und Ingegnoso (Schlau, Findig); arm und allein steh ich auch auf der Welt, was kann ich viel verlieren? Ich wag es.
Nachdem er sich genau die Gegend ausgekundschaftet hatte, wo die arme Prinzessin in einen hölzernen Thurm gesperrt das Ungeheuer weinend erwartete, legte er sich in einen Busch in Hinterhalt. Plötzlich hörte er ein unheimliches Rauschen hoch in der Luft, das sich stets mehr und mehr näherte, und da sah er denn den fürchterlichen Drachen, der mit flammendem Schweif und die Rachen seiner sieben Köpfe weit aufgesperrt auf die Prinzessin los flog.
Kaltblütig wartete der Jäger, bis ihm der Drache ganz schussgerecht über dem Kopfe stand; da drückte er los und mit ungeheurem Gebrüll sank die Bestie unweit des Turmes tot zu Boden. Wer vermag den Jubel der geretteten Prinzessin zu beschreiben, der um so aufrichtiger und grösser war, als sie in ihrem Retter auch einen sehr hübschen und gut gebauten Burschen erblickte. Vom Flecke weg hätte sie ihn geheiratet, aber er erklärte ihr, dass ihn ein Gelübde binde und dass er erst nach einem Jahr, einem Monat und einem Tage in die Stadt kommen werde, sie abzuholen und zu ehelichen.
Nachdem er sich von ihr das Versprechen hatte geben lassen, so lange auf ihn zu warten, schnitt er mit seinem Waidmesser dem Drachen die Zungen aus den Köpfen, steckte sie zu sich und verabschiedete sich von der Prinzessin. Bald nach ihm kam ein Köhler, sah was hier vorgefallen war, ließ sich den Rest von der Prinzessin erzählen und fasste hierauf folgenden Entschluss. Wem das Glück, so wie mir jetzt, entgegen kommt und er fasst es nicht beim Schopf, der ist ein dummer Kerl; das will ich mir nicht nachsagen lassen.
Hierauf schnitt er dem Drachen die Köpfe ab und packte sie in einen Sack, zur Prinzessin aber sagte er: »Euch bleibt jetzt nur die Wahl, mich in meinem Plan zu unterstützen und mich für euren Retter auszugeben oder von meiner Hand zu sterben. Wer weiß, ob und wann der Dummkopf wieder kommt, der euch hier so allein gelassen hat, und kommt er auch, so werde ich schon mit ihm fertig werden; ihr aber kennt das Sprichwort: besser ein Spatz an dem Spieße, als eine Taube in der Luft.«
Als sie notgedrungen eingewilligt hatte, befreite er sie aus dem Turm, setzte sie auf sein Maultier und führte sie zu ihrem Vater, der sie schon als tot beweinte, da er von der Ankunft des Drachen gehört hatte. Voll Freude wollte der König, dass gleich am nächsten Tag Hochzeit sein sollte, worin ihn der Köhler eifrigst bestärkte. Da trat aber die Prinzess entschieden auf. »Vater!«, sagte sie, »ich habe in der Freude über meine Rettung das Gelübde gemacht, keinem Mann vor Ablauf eines Jahres, eines Monats und zweier Tage meine Hand zu geben, und dieses Gelübde will ich halten.«
Schon war ein Jahr und ein Monat vergangen, als der König zur Vorfeier der Hochzeit seiner Tochter ein großes Mahl gab. Jubel und Freude herrschte in der ganzen Stadt und drang somit auch zu den Ohren unseres Jägers, der eben mit seinen Hunden angelangt war und sich daher um die Ursache dieser Freude erkundigte.
Als er diese vernommen hatte, verlangte er in den Palast gehen zu dürfen, was ihm verweigert wurde und bedeutet, dass dessen Tore geschlossen seien. Da sagte er zu seinem Hunde Forte: »Gehe und sprenge die Tore des Palastes!« und der Hund tat wie ihm geheißen. Da sprach er zu seinem Hunde Ingegnoso: »Gehe und hole die Schüssel, die vor der Prinzessin steht!« und der Hund gehorchte dem Befehle seines Herrn. Da sagte er zum dritten Hunde: »Gehe und bringe mir auch die andere Schüssel, die vor der Prinzessin steht!« und siehe, auch das geschah.
Unterdessen hatte dieses Vorgehen der Hunde die Aufmerksamkeit des Königs sowie der anderen Gäste in hohem Masse erregt; auf sein Geheiß war ein Höfling dem Hunde gefolgt, und als er dessen Herrn noch an der früheren Schüssel zechend fand, so fragte er ihn: »Wer bist du und was treibt dich des Königs Freude zu stören und der Prinzessin die Beleidigung anzutun?« »Beim Himmel!« rief der Jäger, wie erschrocken aufspringend, »weder das Eine noch das Andere war meine Absicht, und um euch zu beweisen, wie leid mir das Geschehene tut, erlaubt, dass ich euch begleite und dem König sowie der Prinzessin vor allen Gästen Abbitte leiste.«
Darauf trat er mit dem Höfling in den Speisesaal, in welchem sein Erscheinen die grösste Veränderung hervorrief; denn schon trat ihm der König mit Zorn funkelnden Augen entgegen, als seine Tochter plötzlich voll Freude ausrief: »Vater! Vater! das ist mein wirklicher Erretter, der andere ist ein Schurke, der mich durch Todesdrohungen gezwungen hatte, seine Lügen zu bekräftigen, darum habe ich die Heirat so lange verzögert, weil ich gewiss war, dass er am heutigen Tage erscheinen werde.«
Da wandte sich der Grimm des Königs gegen den Köhler, der augenblicklich getötet wurde, während er den Jäger, der die Drachenzungen vorwies, an dessen Platz zur Seite seiner Tochter führte. Schon den folgenden Tag fand die Hochzeit statt und der Jäger wurde ein glücklicher Gatte, der sich die Liebe seiner Gattin sowie seiner künftigen Untertanen zu verdienen und zu erhalten verstand.
Nur einmal wurde das Glück dieser Gatten, und zwar auf sehr gefährliche Art gestört. Einst hatte ihn nämlich die alte Neigung zum Waidwerk in einen benachbarten verzauberten Park geführt. Es war ein kühler Tag und gern nahm er daher das Anerbieten eines alten Mütterchens an, sich am Kaminfeuer ihrer Hütte ein wenig zu wärmen; doch kaum fühlte er die Wirkung des Feuers, als er auch schon zur steinernen Statue zu werden begann.
Während der Zeit hatte sein Bruder von seinem Glücke gehört und sich aufgemacht, ihn zu besuchen; aber wie erstaunte er nicht, als ihn bei seiner Ankunft die Prinzessin mit der grössten Zärtlichkeit als Gemahl empfing und ihm Vorwürfe über sein langes Ausbleiben machte.
Die Verwechslung der Person ahnend und zu edel, von der selben Vorteil zum Schaden seines Bruders zu ziehen, ließ er die selbe zwar im Irrtum, wusste sie aber durch Vorspiegelung eines Gelübdes sich vom Leibe zu halten und trachtete der unerklärlichen Abwesenheit seines Bruders auf die Spur zu kommen.
Da hörte er einst, wie ein junges Mädchen in der Stadt zu einem anderen sagte: »Du lieber Gott! fast für jedes Übel gibt es ein Mittel, es nur die Leute wüssten. Wie viele Freudentränen würden fließen, wenn die Verwandten der in unserm Parke versteinerten sechzig Menschen wüssten, dass es bloß des Blutes meiner Großmutter bedarf, um sie alle wieder zu entzaubern; die abscheuliche böse Alte lebte schon längst nicht mehr.«
Ha, dachte er, könnte da nicht auch mein Bruder darunter sein? Augenblicklich ließ er das Mädchen nicht mehr aus dem Auge, sondern schlich ihr nach und kam so in den Park. Kaum dass ihn die Alte erblickte, so machte sie auch ihm das freundliche Anerbieten, sich zu wärmen. »Herzlich gern«, antwortete er, »aber gebt mir einen Stuhl, denn ich fühle mehr Müdigkeit als Kälte.«
Während sie aber einen Stuhl vom Staube mit der Schürze reinigte, zog er sein Schwert und hieb ihr den Kopf vom Rumpf, stürzte mit dem blutenden Kopfe in den Park und bestrich sämtliche Statuen mit dem Blute. Wer beschreibt die Freude, als der gerettete Bruder an die Brust seines Retters stürzte, wer die Freude der Prinzessin, als sie nach einigem Zweifel, welcher der wahre Gemahl sei, ihren schon betrauerten Mann wieder in die Arme schloss und ihm das edle Benehmen seines Bruders erzählte, der sich nie mehr von beiden trennte.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
VOM VERSCHWENDERISCHEN GIOVANNINU...

Es war einmal ein reicher Jüngling, der hieß Giovanninu. Er hatte große Schätze, und viele Reichtümer. Er wollte aber nicht arbeiten und keine Geschäfte machen, sondern lebte nur immer herrlich und in Freuden, ging überall hin, wo eine Festlichkeit war, und verspielte und vertrank sein Geld.
Sein treuer Diener Peppe sagte oft zu ihm: »Ach, Patron, nehmt euch in Acht! Das kann ja so nicht fortgehen. Wenn ihr nur immer ausgebt, ohne je etwas zu erwerben, so muß ja das Geld zuletzt ein Ende nehmen.«
Giovanninu aber antwortete immer: »Meine Reichtümer nehmen noch lange kein Ende, lasse mich nur selbst dafür sorgen.« So lebte er den einen Tag wie den anderen, ging zu jeder Festlichkeit, und verspielte sein Geld. »Patron, nehmt euch doch in Acht,« warnte ihn der treue Peppe. Er aber ließ sich nicht warnen, bis eines Tages alle Schätze verbraucht waren, und er nicht einmal so viel mehr hatte, daß Peppe die Einkäufe für das Mittagessen hätte besorgen können.
Da fing Giovanninu an all sein Silberzeug zu verkaufen und alle seine schönen Möbel, und führte mit dem Gelde sein altes Leben fort. So trieb er es, bis er alles verkauft hatte, und ganz arm und bloß blieb. »Ach, Patron, ich habe euch ja gewarnt,« sprach der arme Peppe und weinte bitterlich.
»Du hast recht,« antwortete Giovanninu, »es bleibt uns nun nichts übrig, als unser Glück zu suchen. Wandre du auf die eine Seite hinaus, und ich will auf die andere Seite gehen, so wollen wir sehen, ob wir unser Glück finden.« Also trennten sie sich, und Giovanninu wanderte fort und mußte betteln.
Als er nun eine lange Zeit gewandert war, kam er eines Tages in eine ganz fremde Gegend. Vor ihm stand ein herrlicher Palast, und weil die Sonne so schön schien, setzte er sich auf die Schwelle, um sich ein wenig zu wärmen. Wie er so da saß, kam ein wunderhübsches weißes Schäfchen aus dem Palast heraus, lagerte sich neben ihn und ließ sich von ihm streicheln.
Er aber freute sich über das niedliche Tierchen. Auf einmal tat das Schäfchen seinen Mund auf und sprach: »Willst du mit mir hinauf gehen, schöner Jüngling? Sieh, ich bin eine verzauberte Königstochter, und wenn du alles tust, was ich dir sagen werde, so kannst du mich erlösen.« »Sage mir, was ich tun soll,« sprach Giovanninu, »so will ich dich von deinem Zauber erlösen.«
»Komm nur mit hinauf,« antwortete das Schäfchen, »da wirst du gutes Essen und Trinken finden und schöne Kleider. Auch ein gutes Bett ist für dich bereit. Wenn du nun jede Nacht alles erträgst, was mit dir geschehen wird, ohne einen Laut aus zu stoßen, so kannst du mich erlösen.«
Da versprach Giovanninu noch einmal, er wolle sie erlösen, und die verzauberte Königstochter führte ihn in den Palast, wo er aß und trank, was sein Herz begehrte, und sich dann zu Bette legte. Er schlief bald ein, und hielt ganz ruhig seinen ersten Schlaf. Als es aber Mitternacht schlug, erwachte er von einem großen Lärm; die Tür sprang auf, und herein trat ein langer Zug von Gestalten, von denen jede eine brennende Kerze in der Hand hielt.
»Steh auf, und geh mit uns,« sprachen sie zu Giovanninu; er aber antwortete ihnen nicht, und blieb ruhig liegen. Da rissen sie ihn aus seinem Bett, und schleppten ihn mitten in die Stube, bildeten einen Kreis und tanzten um ihn herum. Dabei stießen und schlugen sie ihn, und misshandelten ihn arg, er aber ertrug alles, ohne einen Laut von sich zu geben.
Als der Morgen graute, ließen sie ihn halb tot liegen und verschwanden. Da kam das weiße Schäfchen herein, und verband ihm seine Wunden, und brachte ihm Speise und Trank, daß er sich wieder erholte. So ging es jede Nacht, wohl zwei Wochen lang.
Eines Morgens aber kam statt des weißen Schäfchens ein Mädchen herein, das war so schön, als ob Gott es geschaffen hätte, und sprach: »Ich bin das weiße Schäfchen, und du hast mich von meinem Zauber erlöst. Ich gehe nun fort, und kehre zu meinen Eltern zurück.
Dich kann ich noch nicht mitnehmen, aber in acht Tagen komme ich wieder, und komme drei Tage nacheinander, jedesmal um Mittag. Dann mußt du vor dem Tor des Palastes auf mich warten, aber wehe dir, wenn ich dich schlafend finde.« Giovanninu versprach gute Wache zu halten, und die schöne Königstochter fuhr weg.
Als sie nun nach Hause kam, waren ihre Eltern sehr erfreut, ihre liebe Tochter wiederzusehen, die sie vor vielen Jahren verloren hatten. Sie aber sprach: »Giovanninu hat mich erlöst, und er soll nun mein Gemahl sein.« Als nun die acht Tage um waren, bestieg sie ein wunderschönes Pferd, und nahm ein großes Gefolge mit, und ritt nach dem Palast.
Giovanninu hatte sich auf die Schwelle gesetzt, und wartete auf sie. In dem Palast aber waren noch viele andre verzauberte Mädchen, die waren von Neid gegen die schöne Königstochter erfüllt, weil sie zuerst erlöst worden war. Deshalb warfen sie einen Zauber auf den armen Giovanninu, und in dem Augenblick, wo die Königstochter in der Ferne erschien, kam ein tiefer Schlaf über ihn, und er schlief ein.
Da nun die Königstochter heran geritten kam, und ihn schlafend fand, ward sie sehr betrübt, und stieg vom Pferd und rief ihn: »Giovanninu! Giovanninu! wache auf!« Er aber hörte nicht, denn es war eben ein Zauberschlaf. Als sie nun sah, daß sie ihn nicht wecken konnte, nahm sie einen Zettel und schrieb darauf: »Nimm dich in Acht, es bleiben dir nur noch zwei Tage.« Diesen Zettel steckte sie ihm in die Tasche und ritt fort.
Als er nun aufwachte, und sah, daß sich die Sonne schon neigte, erschrak er sehr, und dachte »Weh mir! Die Königstochter ist gewiss gekommen und hat mich schlafend gefunden.« Da er aber von ungefähr in die Tasche fuhr, und den Zettel fand, ward er noch viel trauriger, und jammerte: »Ach, ich Unglücklicher, wie konnte ich nur einschlafen.«
Den nächsten Tag setzte er sich wieder zu rechter Zeit auf die Schwelle und dachte: »Heute will ich gewiss wach bleiben.« Es ging ihm aber nicht besser, als das erste Mal; in dem Augenblick, als die Königstochter in der Ferne erschien, überfiel ihn ein tiefer Schlaf.
Da sie ihn nun zum zweiten Mal schlafend fand, ward sie noch mehr betrübt, und stieg vom Pferde, und rief: »Giovanninu! Giovanninu! wache auf!« Als er aber nicht aufwachte, nahm sie einen Zettel und schrieb darauf: »Jetzt komme ich nur einmal noch; wehe dir, wenn du auch morgen schläfst.« Diesen Zettel steckte sie ihm in die Tasche, bestieg ihr Pferd und ritt davon.
Als aber Giovanninu aufwachte, und den Zettel fand, jammerte er laut und sprach: »Wie ist denn das möglich? Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, daß ich so jeden Mittag einschlafe.«
Am dritten Tage setzte er sich nun gar nicht hin, sondern ging immer vor dem Palast auf und ab. Aber es half ihm nichts. So wie die Königstochter von ferne erschien, überfiel ihn wieder der Zauberschlaf, also daß er sich hinsetzte und fest einschlief.
Als die Königstochter ihn nun wieder schlafend fand, rief sie aus: »Er hat sein Glück nicht gewollt, so soll er denn auch keines haben.« Dann nahm sie einen Zettel, und schrieb darauf: »Du hast dein Glück nicht gewollt, so sollst du denn auch keines haben. Wenn du mich nun noch wieder erlangen willst, so mußt du wandern, bis du mich gefunden hast.« Diesen Zettel steckte sie ihm in die Tasche, bestieg ihr Pferd und ritt davon.
Denkt euch den Kummer des armen Giovanninu als er aufwachte, und den Zettel fand. »Ich Unglücklicher, wo soll ich sie nun finden!« jammerte er. Es blieb ihm aber nichts übrig, als seinen Stab von Neuem zu ergreifen und in die weite Welt zu wandern, und weil er gar nichts hatte, so mußte er betteln.
So wanderte er eine lange, lange Zeit, daß ihm seine Kleider in Lumpen vom Leibe fielen, aber die schöne Königstochter fand er nicht. Da er nun eines Tages ganz matt und erschöpft am Wege lag und nicht mehr weiter konnte, flog ein Adler vorbei, der frug ihn:
»Schöner Bursche, was liegst du so traurig da?« »Ach,« antwortete Giovanninu, »ich bin so matt, daß ich nicht weiter kann.« »Setze dich auf meinen Rücken,« sprach der Adler, »so will ich dich eine gute Strecke weit tragen.« Da setzte er sich auf den Rücken des Adlers, und der Adler stieg mit ihm in die Luft, und flog wie der Wind.
Als sie aber eine Weile geflogen waren, rief der Adler auf einmal: »Fleisch!« »Was soll ich nun tun?« dachte Giovanninu. »Wenn ich ihm kein Fleisch gebe, so wirft er mich herunter.« Weil er nun nichts hatte, so schnitt er sich die linke Hand ab und gab sie dem Adler.
Wieder nach einer Weile schrie der Adler: »Fleisch!« Da schnitt sich Giovanninu den linken Arm ab, und gab ihn dem Adler, und weil das Tier immer mehr verlangte, so mußte er sich auch den linken Fuß und das linke Bein abschneiden. Endlich aber senkte sich der Adler mit ihm hinab, und sprach: »Steige von meinem Rücken, und setze deinen Weg fort.«
»Wie kann ich in diesem Zustande weiter wandern!« klagte Giovanninu. Da ihn nun der Adler so verstümmelt sah, frug er: »Warum hast du das getan?« »Ihr verlangtet ja immer Fleisch, und ich hatte kein andres Fleisch, euch zu geben.« Da wurde der Adler gerührt, und sprach: »Mache dir keine Sorgen, ich will dich schon heilen.«
Damit brach er die Glieder des armen Giovanninu wieder aus, setzte sie ihm an und sprach: »Ich weiß, daß du ausgewandert bist, die schöne Königstochter zu suchen. So höre denn meinen Rat. Wenn du noch zwei Tagereisen weiter wanderst, so wirst du an ein kleines Häuschen kommen, darin wohnt eine alte weise Frau, die wird dir helfen.«
Also machte sich Giovanninu wieder auf, und wanderte zwei Tage lang, und am Abend des zweiten Tages kam er an ein Häuschen, wie der Adler gesagt hatte. Da klopfte er an, und eine steinalte Frau kam und frug ihn, was er wolle. »Ich bin ein armer Jüngling,« erwiderte Giovanninu, »erweist mir die Barmherzigkeit und laßt mich diese Nacht hier ruhen.«
»Komm herein, mein Sohn,« sprach die Alte, machte ihm die Türe auf, und gab ihm zu essen und zu trinken. Dann frug sie ihn: »Was führt dich denn in diese einsame Gegend?« Da erzählte er ihr alles, was vorgefallen war, und sprach: »Das und Das ist mir begegnet, nun ratet mir, wie ich die schöne Königstochter wiederfinden soll.«
»Schlafe für jetzt,« erwiderte die Alte, »morgen früh will ich dir sagen, was du tun sollst.« Da legte sich Giovanninu hin und schlief ruhig bis zum Morgen, und als er aufwachte, gab ihm die Alte noch etwas zu essen, und sprach: »Die Königstochter wohnt in der und der Stadt, wandre so lange bis du hin kommst.
Hier gebe ich dir auch eine Zaubergerte. Wenn du nun in der Stadt sein wirst, so laß dir den Palast des Königs weisen, und in der Nacht befiehl der Gerte, so wird ein Palast entstehen, viel schöner als der des Königs, und dem königlichen grade gegenüber. Was du aber um die Königstochter ausgestanden hast, das lasse du sie nun auch entgelten.« Damit gab ihm die Alte die Zaubergerte, und Giovanninu bedankte sich vielmals, und wanderte wieder weiter.
Als er nun noch einige Zeit gewandert war, kam er endlich in die Stadt, wo die Königstochter wohnte, und ließ sich gleich vor den königlichen Palast führen, und merkte sich genau wo er stand. In der Nacht aber schlich er mit seiner Zaubergerte hin und sprach: »Ich befehle!« »Was befiehlst du?« frug die Gerte.
Da wünschte er sich einen Palast, mit Allem ausgestattet. Dazu Wagen und Pferde und alle Dienerschaft; und sogleich stand ein wunderschöner Palast da, wie er nicht schöner sein konnte. Die Diener kamen herbei, und wuschen den Giovanninu, und legten ihm kostbare Kleider an, und da wurde er ein so schöner Jüngling, daß ihn kein Mensch erkennen konnte.
Als nun am nächsten Morgen die Königstochter den wunderschönen Palast sah, war sie sehr erstaunt und sprach: »Sind es denn meine Augen, oder ist wirklich über Nacht ein so schöner Palast entstanden?« Wie sie noch so dachte, erschien Giovanninu am Fenster, sie aber erkannte ihn nicht. Weil er jedoch ein so schöner Jüngling war, so entbrannte sie in heftiger Liebe zu ihm und sprach: »Dieser soll mein Gemahl sein und kein anderer.«
Also versuchte sie, ihn zu grüßen und mit ihm Bekanntschaft zu schließen, er aber tat, als sehe er sie nicht. Je gleichgültiger er sich aber zeigte, desto heftiger liebte sie ihn. Da nähte sie zwölf Hemden von der allerfeinsten Leinwand, und legte sie auf einen silbernen Präsentierteller, und bedeckte sie mit einem wunderschönen gestickten Tuch, rief ihren Diener, und schickte ihn damit zu Giovanninu und ließ ihm sagen: »Die Königstochter hier gegenüber läßt euch grüßen, und läßt euch bitten, diese Hemden ihr zu Liebe zu verbrauchen.«
Als nun der Diener Giovanninu diese Botschaft brachte, antwortete dieser: »Schön, ich wollte heute eben Wischtücher in die Küche kaufen; bringt diese in die Küche. Und sagt eurer Herrin, ich ließe ihr vielmals danken.«
Der Diener kam ganz verstört zur Königstochter und sprach: »Ach, königliche Hoheit, dieser Herr muß viel reicher sein als ihr. Denkt euch nur, die schönen Hemden hat er in die Küche bringen lassen, um die Kessel damit auszuwischen.«
Da wurde die Königstochter sehr traurig, und nahm einen goldnen Armleuchter, der war so schön, daß man nichts schöneres sehen konnte. Diesen Armleuchter schickte sie dem schönen Giovanninu, und ließ ihm sagen: »Die Königstochter schickt euch viele Grüße; ihr möchtet diesen Leuchter ihr zu Liebe neben eurem Bette brennen lassen.«
Als aber der Diener zu Giovanninu kam, und ihm die Botschaft brachte, antwortete dieser wieder: »Schön, der Leuchter kommt mir eben recht; ich wollte ja heute eine Küchenlampe kaufen. Bringt den Leuchter in die Küche, eurer Herrin aber sagt, ich ließe ihr vielmals danken.«
Der Diener kam zurück, und brachte seiner Herrin die Antwort; und die Königstochter wurde immer trauriger. Da rief sie ihren vertrautesten Diener, und schickte ihn zu Giovanninu und ließ ihm sagen: »Die Königstochter ist in heftiger Liebe zu euch entbrannt, und läßt euch fragen, ob sie nicht die Ehre haben kann, euch zu ihrem Gemahl zu erwählen.«
Da das Giovanninu hörte, antwortete er: »Wenn die Königstochter meine Gemahlin werden will, so muß sie sich in einem Sarge, wie eine Tote, mit Priestern und Musik, durch die ganze Stadt tragen lassen, und endlich vor meinem Fenster vorbeikommen.«
Als die Königstochter das hörte, ließ sie sich in einen Sarg legen, und durch die ganze Stadt tragen, und die Priester begleiteten sie mit brennenden Kerzen, und alles Volk lief mit. Wie sie aber unter dem Fenster vorbei kam, wo Giovanninu stand, spuckte dieser vor ihr aus, und rief mit lauter Stimme: »Um eines Mannes willen erträgst du solche Schmach? Nun wird dir vergolten für alles, was ich deinetwegen habe leiden müssen!«
Da erkannte sie ihn, und stürzte sich vom Sarg herunter, lief zu ihm und fiel vor ihm nieder und sprach: »Giovanninu, mein lieber Giovanninu, vergib mir! Ach, wie viel hast du mich leiden lassen!« »So viel habe ich für dich gelitten,« antwortete Giovanninu, »darum wollte ich, du solltest auch meinetwegen leiden.«
Da umarmten sie sich, und es war große Freude im ganzen Land, und sie hielten drei Tage Festlichkeiten, und heirateten sich. Als aber der alte König starb, ward Giovanninu König. Und so lebten sie glücklich und zufrieden, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DER ARME FISCHERKNABE ...
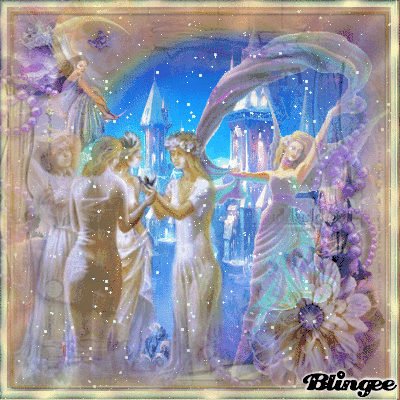
Einst war ein Fischer, den der Himmel in seinem Zorn mit sehr viel Kindern und mit noch mehr Unheil bedacht hatte. So sass er wieder einmal am Strande und wartete auf die Fische, die in sein Netz gehen sollten; weil aber nicht ein einziger so gefällig war, so überließ er sich ganz seiner Verzweiflung.
Da kam ein vornehmer Herr und fragte ihn herablassend, wie es ihm denn gehe. »Herr!« antwortete er, »mir geht es schlecht, ganz miserabel; ich weiß nicht mehr, was anfangen.« – »Nun«, sagte der Herr, »ich kann dich leicht reich machen. Du hast einen hübschen kleinen Knaben, der Almerich (Almerigo) heißt, bringe ihn morgen früh zu mir in den Garten und führe ihn zur großen Zypresse auf der Wiese vor dem Hause. Neben dem Baum wirst du ein Kistchen voll Gold finden, das nimm du und trage es heim, den Knaben aber lasse beim Baum, für den wird gesorgt werden.«
Gar schön bedankte sich der Fischer bei dem Herrn, und tat am anderen Morgen ganz genau, wie ihm geheißen worden war. Zu der selben Zeit befand sich im nahen Sieben-Sterngebirge das Haus einer mächtigen Zauberin, Namens Sabina, unter deren Herrschaft eine Menge der schönsten Mädchen waren, die sie aber alle an Schönheit weit übertraf.
Am nämlichen Tage, als der Fischer sein Kind in den Garten führte, unternahm Sabina einen kleinen Morgenspaziergang durch die Luft und sah den kleinen Knaben weinend bei der Zypresse stehen, denn er hatte nicht bloß Zeit lang, sondern auch Hunger. Armes Kind, sagte sie für sich, in dem sie den kleinen Krauskopf mit Wohlgefallen betrachtete, für eine Hand voll Goldes hat dich dein Rabenvater an einen Höllengeist verkauft, der dich verderben wird. Nein, das soll nicht geschehen, ich will dich retten.
Sie nahm den Knaben zu sich in den Wagen und führte ihn in ihr Haus, wo er eine vortreffliche Erziehung erhielt. Als ihr Zögling zweiundzwanzig Jahre alt und ein sehr schöner Mann geworden war, wusste er noch immer nichts von seiner Abkunft und glaubte zur Familie zu gehören, bis ihn einst ein Feenmädchen scherzend fragte, wo es ihm besser gegangen sei, zu Hause oder hier.
Auf seine verwunderte Gegenfrage erzählte sie ihm dann die Art, wie er in die Feenwohnung gekommen war, dass er das Kind eines Fischers sei, seine Eltern jetzt in London und durch das für ihn erhaltene Geld reiche Leute geworden seien, und dass er sie nur mit Sabinen's Erlaubnis werde wiedersehen können. Jung und freudig, wie unser Feenzögling war, beschäftigte der Wunsch, seine Eltern kennen zu lernen und die Welt zu sehen, jetzt seine ganze Seele, und er wandte sich also gleich an Sabina und bat um ihre Einwilligung.
»Nein«, sagte diese, »du darfst mich nicht verlassen; denn einmal weg von hier, kehrst du schwerlich jemals wieder.« Erstaunt, sich in so vielen Jahren die allererste Bitte abgeschlagen zu sehen, aber doch die einmal gefasste Idee nicht aufgebend, stiftete er die Mädchen an, bei Sabinen für ihn ein Vorwort einzulegen, und das geschah gerne, denn alle hatten ihn lieb; aber auch ihre Verwendung blieb lange fruchtlos, bis Sabina endlich nachgab.
»Wohlan«, sprach sie, »so mag er ziehen, aber unter der Bedingung, nie und nirgends meiner, meines Hauses oder meiner Angehörigen Erwähnung zu tun; aber wehe euch allen, wenn er nimmer wiederkehrt, denn ihr habt mich zu dieser unklugen Nachgiebigkeit beredet.« Alle verstummten anfangs, dann aber liefen sie zur Wette, ihm die freudige Kunde zu bringen. Voll Freude eilte Almerich zu Sabinen, ihr zu danken, und nachdem er die Bedingung zu halten versprochen, nahm er zärtlichen Abschied von ihr.
Eilends nahm er aus ihrem Stall vier Pferde, drei Bediente, und fort ging es mit Windes Schnelle durch die Luft nach London, wo er in der Locanda reale, gegenüber dem königlichen Palast, abstieg. Am nächsten Morgen öffnete er die Läden seines Zimmers und wusch sich. Da bemerkte ihn eine der königlichen Töchter, lief schnell zu ihrer Mutter und erzählte ihr, welch schöner Fremdling, ohne Zweifel ein Prinz, in dem Wirtshaus gegenüber wohne.
Die Königin, nicht minder neugierig als ihre Töchter, schickte also gleich einen Diener in den Gasthof, Erkundigung einzuziehen, und als diese ziemlich befriedigend lautete, ließ sie den schönen Fremdling zu Tische bitten, welche Ehre natürlich höflichst angenommen wurde. Während er nun mit der Königin und ihren Töchtern zu Tische sass, geschah es, dass die ältere Prinzessin sich in ihn verliebte.
Die Königin Mutter, der die entstehende Leidenschaft ihrer schon ziemlich reifen Tochter nicht entgangen war, begann hierauf die Tugenden und Schönheit der selben der Gestalt übertrieben vor ihrem Gast heraus zu streichen, dass der selbe, ganz unbekannt mit dem Hofton und seit Jugend an in dem Feenhaus an Aufrichtigkeit gewöhnt, mit der Bemerkung herausplatzte, sie möchte doch mit der Schönheit der Prinzessin nicht so viel Aufhebens machen, denn das hässlichste der Mädchen vom Hofe, wo er her komme, sei viel schöner als sie.
Über diese Äußerung fuhren Mutter und Töchter zornig von der Tafel empor, unser Reisender aber wanderte mit Ketten belastet und unter starker Begleitung von Wachen in einen tiefen Kerker. Glücklicherweise sah fast gleichzeitig Sabina in ihren Zauberspiegel (batte il quaderno), und als sie ihren Liebling in Ketten erblickte, zauberte sie sich also gleich eine große Armee, mit der sie in der Luft bis zu den Toren von London vorrückte.
Unterdessen hatte die Königin ihren großen Rat versammelt, um über Almerich zu Gerichte zu sitzen. Da sprach ein alter, weiser Ratsherr: »O Königin! gebt acht, was ihr tut, wer weiß, wer der Gefangene ist? Kann es nicht ein mächtiger Prinz sein, dessen Vater uns dann die Schwere seines Zorns bitter fühlen lässt?« – Aber die Königin gab nicht nach.
Da kamen am anderen Morgen zwölf Wägen, reich vergoldet und von prachtvollen Pferden gezogen, vor den königlichen Palast, aus denen vierundzwanzig Prinzessinnen von wunderbarer Schönheit abstiegen und die Königin zu sprechen begehrten; diese aber ließ ihnen sagen, sie sei nicht gewohnt, sich wegen irgend Jemand zu inkommodieren, worauf die Prinzessinnen wieder die Wägen bestiegen und sich entfernten und vor die Stadt hinausfuhren.
Da rückte Sabina mit ihrem Heer vor und umzingelte die Stadt. Mit Schrecken sieht der Feldherr der Königin vom Turm des Palastes die drohende Gefahr, die Königin selbst eilt auf den Turm und sieht den sturmbereiten Feind. Schnell sendet sie ins feindliche Lager und begehrt den feindlichen Anführer zu sprechen. Da erschienen abermals die zwölf Wagen mit den vierundzwanzig Jungfrauen, ließen sich aber jetzt die Königin auf den Platz herab holen.
»Gebt den Gefangenen los«, riefen sie ihr entgegen, »wo nicht, so ist in vierundzwanzig Stunden London vernichtet.« »Er hat meine Krone und meine Tochter beleidigt, dafür muss er bestraft werden«, antwortete die Königin. Da sagten die Prinzessinnen: »Wenn er eure Tochter beleidigt hat, so hat eure Krone gar nichts damit zu schaffen und zu ersterem wird er seinen Grund gehabt haben.«
Aber die Königin gab nicht nach. Vergebens sprach ihr der große Rat und der ganze Hof zu, sie möchte doch um Himmelswillen wegen der verletzten Eitelkeit ihrer Tochter nicht ihr armes Volk der Rache des Feindes preisgeben. Als die ihr gegebene Stunde Bedenkzeit fruchtlos verstrichen war, begann der Angriff gegen die Stadt mit einem fürchterlichen Bombardement und binnen einer Stunde war halb London in Flammen. Da ließ die Königin voll Angst den Gefangenen frei und schickte ihn ins Lager, den Frieden zu unterhandeln. Als er mit dem Gesandten vor Sabina erschien, machte diese ihm schwere Vorwürfe.
»Habe ich es dir nicht gesagt, dass deine Abreise nur dir und mir Verdruss bereiten wird? Eine lumpige Königin hat es gewagt, dich einzusperren, und ich, die ich die Macht habe, eine Welt zu vernichten, muss mich jetzt deinetwegen herablassen, mit ihr zu unterhandeln!« Zu dem Londoner aber sagte sie: »Ihr habt das Üble, das ich euch getan, nicht verdient, aber eurer Königin sollte man den Palast verbrennen; fünfunddreißig Millionen Kriegskosten muss sie mir zahlen und dann sich in ihrem eigenen Palast überzeugen, dass das letzte meiner Hoffräuleins viel schöner ist als ihre Töchter.«
Und ganz genau so geschah es. Die Königin fiel dabei vor Zorn in Ohnmacht, erholte sich, wollte den Kampf von neuem beginnen, aber da sie Große und Kleine mutlos und bloß gegen sich gewendet sah, so stieß sie sich einen Dolch ins Herz und starb. Als die Königin von England tot und der Friede wieder hergestellt war, suchte sich Almerich mit Sabinen zu versöhnen, aber so geneigt sie auch innerlich dazu war, so verstieß sie ihn dennoch.
»Du hast meinen Befehl, deinen Schwur gebrochen, du hast meiner Familie Erwähnung getan«, rief sie. Von Sabinen verlassen suchte er möglichst bald aus der Nähe von London zu kommen; denn war gleich die Königin tot, so lebte doch ihre von ihm schwer beleidigte Tochter noch; er floh daher ins Gebirge und hielt sich schon für verloren, so hatte er mit Not und Hunger zu kämpfen.
Da traf er auf einmal drei Männer, die sich zankten, denn sie hatten drei sonderbare Dinge unter sich zu verteilen, nämlich: einen Mantel, der unsichtbar machte, wenn man ihn um hing; einen Geldbeutel, der sich stets füllte, wenn man ihn ausleerte; ein paar Schuhe, die, wenn man sie anhatte, wie der Gedanke liefen. Als sie seiner ansichtig wurden, sagten sie: »Du kommst uns wie gerufen, sei so gut und entscheide du unsern Streit.«
»Vor allem, liebe Leute«, antwortete er, »überzeugt mich, dass ihr mich nicht zum Besten habt.« »Gerne«, riefen alle drei, und man begann damit, dass man ihm den Mantel um hing. »Seht ihr mich?« fragte er. »Nein«, antworteten die drei. »Ich glaube euch nicht«, erwiderte er, »aber probieren wir den Beutel.« Da leerte er ihn oftmals aus. »Siehe da«, sagte er, »mit dem habt ihr doch recht.« Da legte er die Schuhe an. »Wollt ihr mitkommen?« rief er den drei Verblüfften zu und war auch schon verschwunden.
Da sah die besorgte Sabina in den Zauberspiegel, um zu erfahren, wie es dem so heißgeliebten Sträfling ergehe, aber der Spiegel zeigte gar nichts, denn er war unterdessen mächtiger geworden als sie selbst. Da verfluchte sie die Stunde ihrer früheren Nachgiebigkeit und späteren Strenge, denn sie fürchtete, ihn für immer verloren zu haben.
Aber auch ihn zog die gleiche Sehnsucht zu ihr. Sein erster Gedanke war, Sabinen zu besuchen, und der Gedanke und die Ausführung waren bei dem Besitzer dieser Schuhe ohne dem das Werk eines Augenblicks. Da fand er vor ihr im Palast drei Pferde, eines von Blei, eines von Bronze und eines von Eisen. Das bleierne Pferd fragte, das bronzene antwortete und das eiserne brachte die Antwort zu.
Als er an das Tor des Feenpalastes klopfte, fragte das Pferd von Blei: »Wer klopft?« Das von Bronze antwortete: »Unser mächtiger Almerich«, und das von Eisen brachte die Antwort Sabinen. Da vergaß sie ihren Zorn und Würde und lief voll Freude herbei; er aber sprach mit verstelltem Ernst: »Wisse, o Grausame! dass ich jetzt dreimal mächtiger bin als du und dass ich eigens gekommen bin, dich zu züchtigen.«
Da fragte das bleierne Pferd: »Ist das wahr?« »Ja wohl«, antwortete das bronzene, das eiserne aber begann beiden zu zusprechen, sie möchten sich versöhnen. »Wohlan«, sprach Almerich zum eisernen Pferde, »werde du ein Löwe«, und zu Sabinen: »Du aber werde eine Löwin.« Da machte die neue Löwin so ein trauriges Gesicht, dass er schnell rief: »Nein, nein Sabina! werde wieder, was du warst, komm in meine Arme und liebe mich so, wie ich dich.«
Natürlich, heirateten sie sich und lebten unendlich glücklich, und leben wahrscheinlich noch so, denn derlei Leute sind unsterblich, und wenn sie auch alt werden, so sehen sie doch immer jung aus, weil sie sich die Runzeln und grauen Haare wegzaubern können.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
DER PRINZ MIT DER SCHWEINSHAUT ...
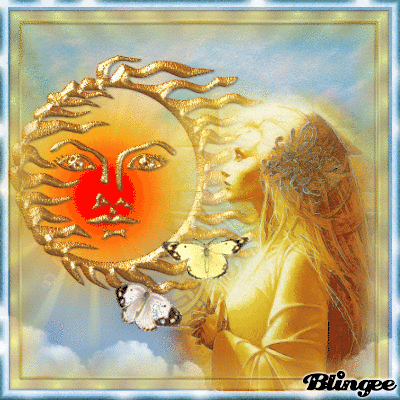
Ein mächtiger König und Zauberer heiratete einst eine Prinzessin, die nur ein gewöhnliches Menschenkind war. Eine benachbarte Zauberin, die in ihn verliebt war und ihn selbst gerne geheiratet hätte, ärgerte sich gewaltig darüber und schwur ihm einen schmerzlichen Possen zu spielen. Die neue Königin brachte nach einem Jahre ein Söhnlein zur Welt. Das Kind war schön und wohl gebaut, aber von oben bis unten mit einer Schweinshaut bedeckt.
Als dieser Prinz einundzwanzig Jahre erreicht hatte und, die Haut ausgenommen, ein gar stattlicher junger Mann geworden war, verliebte er sich in ein armes Mädchen, die Älteste von drei Schwestern, und hielt um ihre Hand bei ihrem Vater an. »Ich habe nichts dagegen«, sagte der Vater, »jedoch will ich früher meine Tochter befragen, ob sie es zufrieden ist.«
Als der Vater seine Tochter fragte, antwortete diese ihm: »Um Königin zu werden, würde ich einen noch viel hässlicheren Mann heiraten.« Die Sache war bald abgemacht und der Tag der Hochzeit festgesetzt. Als die Vermählung vorüber war und die Hochzeitstafel im fröhlichsten Gange, da sprang der Bräutigam plötzlich vom Tische auf, lief in den Hof und legte sich in eine dort befindliche Pfütze.
Nachdem er sich dort weidlich herumgewälzt hatte, kehrte er in den Saal zurück, setzte sich zu seiner Braut und begann sich mit ihrem schönen Kleide abzutrocknen. »Aber geh«, sagte die zu ihm, »du bist doch ein wahres Schwein.«
Als die Brautnacht vorüber war, fand man die junge Frau im Bette erdrückt.
Drei Monate nach ihrem Begräbniss hält der Prinz um ihre jüngere Schwester an, und auch diese nimmt ihn, um Königin zu werden, aber während des Hochzeitschmauses wälzt sich der Prinz wieder im Kot und trocknet sich mit ihrem Brautkleid. Auch diese wird ärgerlich und heißt ihn ein Schwein, und am anderen Morgen findet man auch sie im Bette tot.
Da hält der Prinz nach anderen drei Monaten um die jüngste Schwester an, aber der Vater wollte nicht einwilligen und machte auch seiner Tochter Vorstellungen dagegen. »Lieber Vater«, erwiderte diese, »Königin zu werden ist doch eine gar zu schöne Sache, um derentwillen man schon etwas wagen kann. Wenn meine beiden Schwestern Gänschen waren, so bin ich es nicht. Lass mich also nur machen, denn ich weiß recht gut, was ich tue.«
Mit schwerem Herzen willigte der Vater ein. Als aber der Prinz während des Hochzeitschmauses sich wieder im Kote wälzte und an ihrem Kleide zu trocknen begann, da half sie ihm und sagte ganz freundlich: »Putze dich nur fein sauber ab, mein Schatz, was liegt an einem Kleide, ich habe deren noch genug.« Da entbrannte der Prinz erst recht in Liebe zu ihr, und als sie Nachts miteinander allein im Brautgemach waren, fiel die Schweinshaut von ihm ab, und sie sah mit Erstaunen und Entzücken, dass ihr Gemahl einer der schönsten Männer war.
»Meine Teure!« sagte er, »was du jetzt gesehen hast, darfst du gar Niemand sagen, denn verrätst du das Geheimnis, so gehe ich fort, und ehe du mich wiederfindest, wirst du ein paar Schuhsohlen von Eisen abreißen müssen.« Und sie gelobte ihm unverbrüchliches Schweigen. Da sagte er zu ihr: »Morgen und die nächsten Tage ist am benachbarten Hofe großes Turnier um eine Prinzessin, wir wollen auch hinreiten und uns recht gut unterhalten.«
Als sie wirklich am anderen Morgen zum Turniere ritten, wurden sie von seiner Mutter gesehen, die in dem hübschen Manne ihren Sohn nicht erkannte und nicht wenig erstaunte, ihre Schwiegertochter gleich nach der Brautnacht ganz allein mit einem Anderen einen Morgenritt machen zu sehen.
Als sie wieder nach Hause gekommen waren und der Prinz seine Frau verlassen hatte, um die Schweinshaut wieder umzunehmen, da kam ihre Schwiegermutter ganz erbost zu ihr und machte ihr über ein solches Betragen die heftigsten Vorwürfe, denen sie nichts entgegnen konnte, als dass sie zu schweigen gelobt hatte.
Am nächsten Morgen ritten sie wieder zum Turnier und nach der Rückkehr gab es eine neue und noch heftigere Szene mit der Schwiegermutter. Da ritten sie zum dritten Male zum Turnier, aber dieses Mal erschien nach der Rückkehr die Schwiegermutter mit einem Schwerte. »Bekenne«, rief sie im höchsten Zorne, »bekenne, schändliches Weib, mit wem du meinen Sohn, deinen Mann verraten hast, sonst verlässt du nicht lebend dieses Zimmer.«
Da gestand sie in der Todesangst alles. »Wo ist die Schweinshaut?« rief die Schwiegermutter noch immer zweifelnd. »Dort in der Aschenkammer«, entgegnete zitternd die Prinzessin. Wütend stürzte die Königin auf die Kammer los, zerriss die Haut in Fetzen und verbrannte sie.
Als der Prinz die Haut umnehmen wollte und sie nicht mehr fand, ritt er augenblicklich fort, ohne dass Jemand erfuhr wohin. Lange überließ sich die Prinzessin dem trostlosesten Schmerz über den Verlust ihres geliebten Gatten, aber endlich raffte sie sich auf und beschloss ihn aufzusuchen, koste es was es wolle.
Da ging sie denn zu allererst ins Gebirge zum Abendstern (stella d'oro) und fragte ihn, ob er nicht wisse, wo ihr Mann sei. »Ich weiß es nicht«, antwortete der Stern, »ich gehe ja nie weiter, aber geht zur Sonne, die stets wandelt. Bevor ihr aber abreist, will ich euch ein Geschenk machen. Da nehmt diese Haselnuss, solltet ihr in Bedrängnis kommen, so brecht sie auf.«
Schönstens bedankte sich die Prinzessin für das Geschenk und den guten Rat und ging fort zur Sonne. »Wo euer Mann ist, weiß ich nicht«, sagte die Sonne, »fragt den Wind, der kommt überall hin. Ich bin selbst gerade in Verlegenheit; ich soll eine Wäsche trocknen und weiß nicht wo, und muss daher selbst den Gevatter Wind fragen. Nehmt übrigens als Angedenken an mich diese Nuss mit euch, vielleicht wird sie euch frommen.«
Da reiste die Prinzessin zum Wind, der aber war nicht zu Hause, sondern seine Mutter. »Unglückliche!« rief diese, »wie könnt ihr wagen, hierher zu kommen? Trifft euch mein Sohn, so zerreißt er euch.« Da erzählte ihr die Prinzessin ihr Anliegen und die alte Frau sagte gerührt: »Wohlan, ich werde euch helfen; versteckt euch da im Kasten und gebt wohl Acht auf das, was ihr hören werdet.«
Da hörte man schon von weitem in der Luft ein fürchterliches Brausen; es war der Wind, der ankam. »Wer ist hier«, brüllte er, »ich rieche Menschenfleisch.« »Gar Niemand«, sagte die Mutter, »beruhige dich nur, mein Sohn, und gib mir Antwort auf meine Frage. Weißt du nicht, wo der Prinz mit der Schweinshaut ist?«
»Gerade recht, Mutter, dass du mich an den erinnerst. Ich muss morgen mit der Sonne zu ihm, seine Wäsche zu trocknen; der wohnt dort hinterm Berge, im Tal in dem schönen Haus. Ich muss jetzt gehen, der Sonne den Weg zu zeigen.« Hierauf verschwand der Wind, seine Mutter aber ließ die Prinzessin aus dem Kasten heraus und beschenkte sie mit einer guten Kastanie.
Da begab sich die Prinzessin in das bezeichnete Tal, wo sie auf einer Wiese vor dem Haus eine große Menge Wäsche ausgebreitet fand. Dieses Haus gehörte ihrem Manne, der sich unterdessen wieder verheiratet hatte und Vater von zwei Mädchen geworden war. Da ging sie in das Haus und bat, in den Dienst genommen zu werden, und ihr Mann, der sie nicht erkannte, weil sie von der Reise ganz hergenommen und abgerissen war, gab ihr die Stelle als Gänsehüterin.
So trieb sie denn am nächsten Tag die Gänse vor das Haus auf die Wiese, bevor sie aber Abends mit ihnen heimkehrte, brach sie die Haselnuss auf, aus der ein wunderschönes Kleid in der Farbe des Abendsterns hervor stieg. Als sie dieses anlegte, erhoben die Gänse ein so großes Geschnatter und Geschrei, dass die Kinder zum Fenster liefen, und als sie die Gänsehüterin in dem schönen Kleid sahen, auch die Mutter herbei riefen.
Da rief die Hausfrau die Gänsehüterin zu sich und sagte: »Das Kleid musst du mir verkaufen, ich zahle es dir sehr gut.« »Verkaufen kann ich es nicht«, antwortete diese, »aber umsonst könntet ihr es haben, denn habt ihr eine so große Sehnsucht nach meinem Kleide, so habe ich eine nicht geringere nach eurem Bette. Lasst mich eine Nacht bei eurem Manne schlafen, und das Kleid ist euer.«
Die Frau fand dieses Begehren unverschämt, willigte aber doch ein mit dem festen Vorsatz, die Magd zu betrügen und dann auszulachen. Sie gab ihrem Mann einen Schlaftrunk, und als er fest schlief, führte sie die vermeinte Gänsehüterin zu ihm ins Bett. Vergebens entdeckte sich ihm diese als seine erste Gemahlin und erzählte ihre Leiden, denn er hörte wohl ein Gemurmel, konnte aber zu keiner deutlichen Vorstellung gelangen, und traurig trieb diese wieder am Morgen ihre Gänse auf die Weide.
Als es Abend zu werden begann und somit Zeit wurde, die Gänse nach Hause zu führen, öffnete sie die Nuss, und siehe ein noch prachtvolleres Kleid, das die Farbe der Sonne hatte, stieg aus ihr. Und als sie es angezogen hatte, so schrien und schnatterten wieder die Gänse, und die Kinder liefen zum Fenster und riefen die Mutter, und diese handelte wieder mit der Magd um das Kleid, und betrog sie neuerdings, in dem sie ihrem Manne vor dem Schlafengehen eine tüchtige Portion Opium bei zu bringen wusste.
Da fielen denn doch dem Prinzen die schweren Träume, die er schon durch zwei Nächte gehabt, sowie der wüste Kopf des Morgens auf, und er erinnerte sich dunkel an das unverständliche Gemurmel, das er gehört hatte. Dahinter steckt ein Geheimnis, das ich ergründen will, dachte er.
Am dritten Tag erbrach die arme Gänsehüterin die Kastanie und fand ein Kleid, das die frühern noch weit an Schönheit übertraf. Da schnatterten wieder die Gänse und die Frau suchte wieder die Magd um das Kleid zu betrügen. Schon war der Schlaftrunk für den Prinzen wieder bereitet, der aber stellte sich krank, aß nichts und trank nichts, sondern legte sich zeitlich zu Bett.
Als er fest zu schlafen schien, überließ die Frau wieder der Gänsehüterin ihren Platz im Bett ihres Gemahls und diese begann ihre Klagen. Aber dieses Mal vernahm sie der Prinz, erhob sich, und als er gehört, dass sie von seiner eigenen Mutter zum Geständnisse gezwungen worden war, was und wie lange sie gelitten hatte, wie sie ein paar eiserne Sohlen um ihn durch gelaufen, während die zweite Frau ihn um ein paar Kleider verkauft, da verstieß er seine zweite Frau und sperrte sie in eine Burg, während er mit der ersten fort an glücklich lebte.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
DER HERRGOTT, ST. PETER UND DER SCHMIED ...
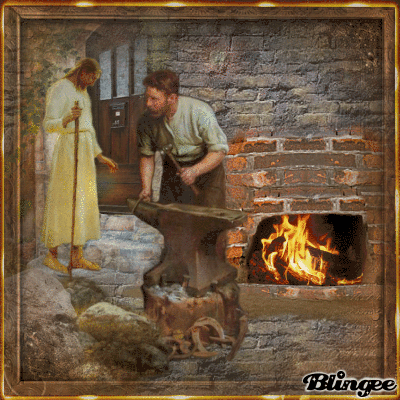
In einer kleinen Stadt von der Grösse wie Schio oder Thiene lebte einst ein Schmiedemeister, ein braver, fleißiger und geschickter Mann, der sich aber auf seine Kunst so viel einbildete, dass er jedem, der ihn nicht Herr Professor titulierte, gar keiner Antwort würdigte. Dieser Stolz bei diesem sonst wie gesagt tadellosen Manne missfiel allgemein.
Da erschien einst in seiner Schmiede unser Herrgott mit dem heiligen Peter, den er immer auf solchen Ausflügen mitzunehmen pflegte. »Herr Professor!« redete unser Herrgott den Schmiedemeister an, »würdet ihr wohl so gütig sein, mir zu erlauben, eine kleine Arbeit an eurer Esse da zu verrichten?«
»Warum denn nicht! bedient mich«, erwiderte der geschmeichelte Schmied, »was wollt ihr machen?« Das werdet ihr gleich sehen, sagte unser Herrgott, ergriff eine Zange, packte damit den heiligen Petrus und hielt ihn in die Esse, bis er ganz rotglühend war. Hierauf zog er ihn heraus und hämmerte ihn von allen Seiten, und in weniger als zehn Minuten stand der alte Apostel mit seiner Glatze in einen wunderschönen Jüngling mit schönem Haarputz umgeschmiedet da.
Sprachlos vor Erstaunen stand der Schmied da, während unser Herrgott und St. Peter sich schönstens bedankten und höflichst empfahlen. Da endlich ermannte sich der Meister und lief schnurstracks in den ersten Stock, wo sein alter, kranker Vater im Bette lag.
»Vater!« schrie er, »kommt schnell mit mir, so eben habe ich das Geheimnis erlernt, aus euch einen jungen, kräftigen Mann zu machen.« »Sohn! bist du närrisch geworden?« fragte halb erschrocken der alte Mann. »Nein, glaubt mir doch, ich habe es so eben selbst gesehen.«
Als nun der Alte durchaus gegen diesen Versuch protestierte, packte ihn der Sohn mit Gewalt, trug ihn in die Schmiede und steckte ihn trotz allem Bitten und Schreien in die Feueresse, brachte aber nichts heraus, als ein Stück verkohltes Bein, das beim ersten Hammerschlag zerfiel.
Da erfassten ihn Schmerz und Gewissensbisse. Schnell lief er, die zwei Männer zu suchen und fand sie noch glücklich auf dem Marktplatz. »Herr«, rief er, »was habt ihr getan! Ihr habt mich verleitet; ich wollte eure Kunst nachahmen und habe dabei meinen leiblichen Vater verbrannt. Kommt schnell mit mir und helft mir, wenn ihr noch könnt.«
Da lächelte unser Herrgott gnädig und sprach: »Geht getröstet nach Hause, ihr werdet euren Vater gesund und lebend, aber wieder als alten Mann finden.« Und so fand er ihn auch zu seiner grössten Herzensfreude. Seit der Zeit war sein Hochmuth verschwunden, und betitelte ihn ja noch jemand als Herr Professor, so rief er: »Ach was da, Dummheit! die Herrn (i Signori) sind in Venedig, die Professoren sind in Padua, ich aber bin ein Pfuscher.«
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
MASSAFADIGA ...
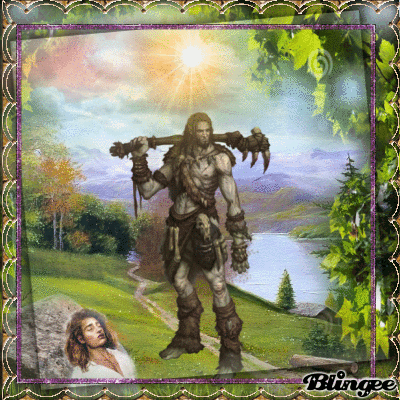
Einst hatte ein Bauer einen grossen, starken Sohn, der aber unendlich faul war und daher von den andern Burschen des Dorfes den Spitznamen »Massafadiga« (Faulhans) erhalten hatte.
»Höre«, sagte ihm einst sein Vater, »ich werde alt und schwach und kann nicht mehr so viel verdienen, um außer mir noch so einen großen, gefräßigen Tölpel zu erhalten; du musst aus dem Hause und in Arbeit gehen.« Der Sohn, der wusste, dass sein Vater nicht gern zweimal sprach, packte, wenn auch ungern, den nächsten Morgen seine sieben Sachen zusammen, und da eben ein Riese im nahen Gebirge einen Knecht suchte, so trat er in dessen Dienste, jedoch fest entschlossen, eben so wenig zu arbeiten, wie zu Hause.
»Komm mit mir zum Brunnen und hilf mir Wasser tragen«, sagte einst der Riese, nahm das krumme Tragholz mit zwei großen kupfernen Kesseln über die Achsel und ging. Massafadiga folgte ihm mit einer kleinen Erdhaue. Beim Brunnen angelangt merkte der Riese erst, dass Massafadiga die Haue statt der Kessel bei sich hatte und fragte ihn: »Was willst du mit der Haue machen?«
»Wozu«, antwortete ihm Massafadiga, »die tägliche Plackerei mit dem Wassertragen? Ich will lieber gleich den ganzen Brunnen hinauf zum Hause tragen.« »Was?« rief der erschrockene Riese aus, »ich bin doch ein Riese, aber das wäre ich nicht im Stande.« – »Hm«, meinte Massafadiga, »ich bin kein Riese, aber das ist für mich bloß Kleinigkeit.«
Beschämt und ärgerlich schwieg sein Herr, aber kaum zu Hause angelangt, hielt er Rat mit seinem Weib. »Wenn ich nur den Knecht wieder aus dem Hause hätte«, sagte er, »der Kerl bringt mich in der ganzen Nachbarschaft um meinen Ruf. Mit Bösem geht es nicht, denn er ist im Stande und erschlägt uns beide, also was zu machen?«
»Weißt du was«, sagte die Riesin, »seine Schlafstube ist gerade unter der Felsenwand. Nachts, wenn er schläft, werfen wir einige Felsblöcke herunter, die zerschmettern das Dach und alles, was darunter ist.«
Massafadiga, der die Eheleute behorcht hatte, legte sich aber nicht ins Bett, sondern vor die Türe, und als Nachts die Felstrümmer brechend das Dach durch schlugen, rief er wie ganz erzürnt: »Herr, schafft doch die kleinen Buben weg, die mit Steinchen herab werfen, man kann ja nicht ordentlich schlafen!«
Das Dach war zerschlagen, die Bettstätte zerschmettert, aber den gefürchteten Knecht war der Riese nicht los. Da beschloss er, ihn mit auf die Jagd zu nehmen. Oben im Hochwalde hatte der Riese in einer Schlucht eine alte Hütte, in welcher er das Gerät für Jagd und Vogelfang aufbewahrte.
Dort stellte er den unbewaffneten Knecht auf, während er selbst ein paar große Bären auf die Hütte zu trieb. Der Knecht aber war auf das Dach gekrochen, und als die Bären in blinder Flucht sich in die höhlenartige Hütte verrannten, sprang er flugs herab und verriegelte von außen die Tür.
Gleich darauf kam auch der Riese in der Hoffnung, den Knecht von den Bären zerrissen zu finden. Ganz erstaunt fragte er ihn: Hast du hier keine Bären laufen gesehen?« »Ja wohl«, antwortete Massafadiga ganz unbefangen, »ich habe sie bei den Ohren gepackt und einstweilen in die Hütte gesperrt.«
»Sei doch so gut«, sagte der Riese, »gehe hinein und schlage sie tot.« »Das wäre doch zu viel«, meinte Massafadiga, »ich habe sie euch gefangen, nun töten und sie nach Hause tragen mögt ihr selbst, wenn ihr ein Riese seid.« Der Riese trat hierauf ans Fenster, erschoss die Bären und schleppte sie keuchend nach Hause.
Da aber hielten die Eheleute wieder Rat und es ward beschlossen, einen ungeheuren Nussbaum zu fällen, den der Riese beim Sturz so wenden sollte, dass er den Knecht zerschmettere.
Als sie beim Baum angelangt waren, begehrte der Riese die Hacke, und da Massafadiga sie nicht mit hatte, so schmähte er ihn. »Herr!« sagte dieser, »die Hacke hat die Frau in der Küche, aber ich werde sie gleich holen.« Und da lief er zur Riesin und sagte: »Frau, ihr sollt mir die Schlüssel zum Geld geben.«
Die Riesin aber traute ihm nicht, sondern trat auf einen Vorsprung vor dem Hause und rief zu ihrem Manne auf die Wiese hinab: »Du, Mann! soll ich sie ihm geben?« »Nun ja«, rief der Riese in der Meinung zurück, der Knecht habe die Hacke verlangt; worauf ihm die Riesin die Schlüssel gab. Er steckte das Geld zu sich und lief mit möglichster Eile in den Wald.
Lange war er schon gelaufen, da traf er einen Hirten, diesem kaufte er für ein Goldstück das schlechteste der Schafe ab, tötete es und warf die Eingeweide auf den Weg. »Hier habt ihr«, sagte er zum Hirten, »Haut und Fleisch von dem Schafe und noch ein Goldstück, aber tut mir den Gefallen: Wenn ein Riese gelaufen kommt und nach mir fragt, so zeigt ihm die Eingeweide auf dem Wege und sagt zu ihm: O Herr! den könnt ihr schwerlich mehr einholen, der hat sich mit meinem Messer den Bauch aufgeschnitten und seine Eingeweide weg geworfen, um schneller laufen zu können.«
Als dem Riesen das Warten beim Nussbaum zu lange geworden war, ging er selbst ins Haus hinauf und erfuhr, was vor gefallen war. So geschwind er konnte, eilte er dem Flüchtigen nach. Da stieß er zu seinem Unglück auf den nämlichen Hirten, und als er dessen Erzählung vernommen und die weg geworfenen Eingeweide sah, entschloss er sich zur nämlichen Operation, fand sich aber im Laufen nicht erleichtert. Er stürzte bald zu Boden und gab den Geist auf.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
VOM TAPFEREN SCHUSTER ...

Es war einmal ein Schuster, der arbeitete den ganzen Tag, und konnte doch nicht genug verdienen um sorgenfrei zu leben. Eines Tages nun hatte er vier Grani verdient; da kam Einer vorbei und rief: »Was ich für schöne Ricotta habe! Schöne, süße Ricotta!« »Ei,« dachte Meister Joseph, »ich könnte mir wohl für drei Grani Ricotta kaufen. Wenn ich dann noch einen Grani verdiene, so kaufe ich mir für zwei Grani Brot, und halte ein herrliches Mittagessen.« Also kaufte er für drei Grani Ricotta, und legte sie vor sich auf den Tisch, während er weiter arbeitete.
Es war aber ein sehr heißer Tag, und die Fliegen setzten sich in Scharen auf die weiße Ricotta. Da nahm Meister Joseph ein Stück Leder, schlug mit aller Macht auf die Ricotta und erschlug eine Menge Fliegen. »Ei,« dachte er, »ich bin doch ein tapferer Schuster; nun will ich in die weite Welt ziehen, und mein Glück versuchen.«
Nun nahm er einige Zettel Papier und schrieb darauf: »Fünfhundert Tote und dreihundert Verwundete,« steckte diese Zettel zu sich, nahm auch die Ricotta mit, und wanderte fort. Wenn er nun in eine Stadt kam, so klebte er seine Zettel an den Straßenecken fest, und alle Leute verwunderten sich über den tapferen Schuster.
Nun begab es sich, daß es auch dem König zu Ohren kam, der dachte: »Ein so tapferer Mann könnte dir wohl nützen,« und ließ ihn vor sich kommen. »Bist du derjenige, der Fünfhundert getötet und Dreihundert verwundet hat?« frug er ihn. »Ja wohl, königliche Majestät,« sprach der Schuster.
»Wenn du denn so tapfer bist, so mußt du mir einen Dienst erweisen,« sagte der König. »Sieh, in jenem Walde haust ein furchtbarer, wilder Riese, dem müssen wir jedes Jahr einen Menschen Opfern, daß er ihn fressen kann, sonst kommt er in die Städte, und ermordet uns alle. Geh hin und töte den Riesen, sonst lasse ich dir den Kopf abhauen.«
»Ach, ich armer Mann,« dachte Meister Joseph, »jetzt bin ich gewiß verloren. Entweder frißt mich der Riese, oder der König läßt mir den Kopf abhauen.« Weil er aber schlau und listig war, so verlor er dennoch nicht den Mut, sondern kaufte etwas Gips, und machte sich auf den Weg in den Wald. Unterwegs aber knetete er sich Kugeln aus Gips und Ricotta, und steckte die Kugeln in die Tasche.
Als er nun ein gutes Stück weit in den Wald hinein gewandert war, hörte er auf einmal einen großen Lärm, als ob jemand starke Äste abbreche. »Aha,« dachte er, »da ist wohl der Riese,« und kletterte schnell auf einen Baum. Nicht lange, so kam der Riese heran, der war furchtbar anzusehen, und brummte nur immer: »Ich rieche Menschenfleisch, ich rieche Menschenfleisch!«
Als er nun die Augen aufhob, und Meister Joseph auf dem Baum sitzen sah, sprach er: »So, du bist es; komm doch herunter, ich habe dir etwas zu sagen.« »Geh fort,« rief der Schuster, »denn wenn du mich nicht in Ruhe lässt, so drehe ich dir den Hals um.« »Du kleiner Wicht,« rief der Riese und lachte, »du Zwerg, wie willst du das anfangen?« »O,« sprach Meister Joseph, »du weißt gar nicht, wie stark ich bin. Sieh einmal diese Marmorkugeln, die zerdrücke ich mit meinen Fingern zu Mehl.«
Damit nahm er seine Gipskugeln, zerdrückte sie mit seinen Fingern, und streute das Mehl auf den Boden. Der Riese aber glaubte wirklich, es seien Marmorkugeln, und war über die Kraft des kleinen Menschen ganz entsetzt. »Komm herunter, Gevatter,« sprach er, »und bleibe bei mir. Wenn zwei so starke Menschen, wie wir beide sind, sich vereinigen, dann kann ihnen ja nichts widerstehen.«
Als nun der Schuster hörte, daß ihn der Riese Gevatter nannte, kletterte er ganz vergnügt herunter, und sprach: »Gut, wir wollen bei einander bleiben; führe mich in deine Hütte.« Da führte ihn der Riese in seine Hütte und sagte: »Jetzt wollen wir uns in die Haushaltungsgeschäfte teilen. Geh du an den Brunnen und hole Wasser, so will ich unterdessen Feuer anmachen. Dort steht der Krug.«
Da zeigte er ihm einen Krug, den der kleine Meister Joseph nicht einmal aufheben konnte. »Ach was,« sprach der listige Schuster, »gib mir lieber einen recht starken, langen Strick, so bringe ich dir gleich den ganzen Brunnen mit; sonst muß ich ja jeden Tag zum Brunnen laufen.«
Als der Riese das hörte, erschrak er noch mehr, und dachte: »Nein, was ist das für ein starker Mann! Nun, laß es nur gut sein,« sprach er dann, »ich will lieber selbst mit dem Krug gehen.« Also nahm er den Krug und ging zum Brunnen, und unterdessen saß Meister Joseph behaglich in der Hütte, und ließ es sich wohl sein.
Als nun der Riese mit dem Wasser kam, sprach er: »Du könntest aber doch wenigstens im Wald etwas Holz suchen, sonst langt es nicht; dort ist die Axt.« Das war aber eine so große schwere Axt, daß Meister Joseph sie gar nicht vom Fleck bringen konnte.
»Ach was,« sprach er, »gib mir doch lieber einen starken, langen Strick, so binde ich gleich einen ganzen Baum an, und schleppe ihn hierher, so haben wir auf lange Zeit genug.« »Nein, was ist der Mann stark,« dachte der Riese, und ging lieber selbst, das Holz zu suchen; denn er fürchtete sich vor dem starken Schuster. Meister Joseph aber blieb vergnügt sitzen, und ruhte aus. Als der Riese nun mit dem Holz nach Hause kam, setzte er einen großen Kessel aufs Feuer, und kochte sein Abendessen.
Nachdem sie nun gegessen hatten, holte er eine große, dicke, eiserne Stange hervor, und sprach: »Wir wollen jetzt noch ein Spielchen machen. Wir wollen einmal sehen, wer diese Stange am längsten herum tragen kann.« »Gut,« sprach der Schuster, »zu erst aber mußt du das dicke Ende recht tüchtig umwickeln, denn wenn ich mit der Stange ein Rad schlage, so geht das so schnell, daß ich nicht sehen kann, wohin ich treffe, und ich könnte dir dann mit der Stange den Schädel einschlagen.«
Da bekam der Riese einen solchen Schrecken, daß er sprach: »Nein, dann wollen wir lieber nicht spielen; komm, wir wollen zu Bette gehen.« »Wo soll ich denn schlafen?« frug der Schuster. »Komm nur,« sprach der Riese, »in meinem Bett ist für uns Beide Platz.« Da legten sich Beide in des Riesen Bett, und bald schnarchte der Riese, daß es eine Art hatte.
Der Schuster aber hatte noch immer Angst vor dem Riesen, also kroch er leise aus dem Bette, und legte einen großen Kürbis an die Stelle, wo sein Kopf gewesen war; sich selbst aber versteckte er unters Bett.
Nicht lange, so wachte der Riese auf, und weil er sich vor dem starken Schuster fürchtete, so dachte er: »Jetzt schläft der kleine Mensch; jetzt ist der Augenblick, ihn zu töten. Wer weiß, er bringt mich sonst noch vielleicht um.« Also stand er auf, nahm die schwere, eiserne Stange, und weil er den Kürbis für den Kopf des Schusters hielt, so schlug er mit aller Macht darauf, daß der Kürbis ganz zerquetscht wurde.
In dem selben Augenblick aber seufzte Meister Joseph unter dem Bett laut auf. »Was ist dir?« frug der Riese ganz erschrocken. »Ach, es hat mich eben ein Floh tüchtig ins Ohr gebissen!« antwortete Meister Joseph. Nun erschrak der Riese noch viel mehr, und legte sich ganz stille zu Bett.
Meister Joseph aber kroch unter dem Bett hervor, warf den zerquetschten Kürbis unters Bett, und legte sich selbst leise nieder. Er sann aber fortwährend nach, auf welche Weise er den Riesen ums Leben bringen könne, denn er dachte: »Ich kann doch nicht immer hier bleiben, und wenn ich unverrichteter Sache heimkehre, so läßt mir der König den Kopf abhauen.« Hört also, was er tat.
Am nächsten Morgen sprach er zum Riesen: »Heute wollen wir uns einmal an Maccaroni gütlich tun; koche deshalb einen großen Kessel voll. Wenn wir dann fertig sind mit Essen, so schneide ich mir zuerst den Bauch auf, damit du siehst, daß ich meine Maccaroni essen kann, ohne sie zu zerkauen, und nachher mußt du dir auch den Bauch aufschneiden, damit ich sehen kann, wie deine Maccaroni aussehen.«
Der Riese war es zufrieden, denn er war eben sehr dumm, und setzte einen mächtigen Kessel mit Wasser auf, um eine ganz große Schüssel Maccaroni zu kochen. Unterdessen aber ging der Schuster ein wenig abseits in den Wald, und band sich unter dem Hals einen großen Sack fest, der ihm bis an den Bauch reichte. Als er nun wieder kam, sprach der Riese: »Die Maccaroni sind fertig; nun wollen mir auch sehen, wer am meisten davon ißt.« »Gut, das wollen wir,« sprach der Schuster, und sie machten sich Beide daran.
Der Riese aß sehr schnell, Meister Joseph aber warf seine Maccaroni alle in den Sack hinein, und sagte dabei immer: »Mach doch zu, siehst du nicht, daß ich viel schneller esse als du?« Endlich waren die Maccaroni alle aufgegessen, da sprach Meister Joseph: »So, jetzt gib mir ein Messer, jetzt wollen wir einmal nach sehen, wie die Maccaroni aussehen, und ich will den Anfang machen.«
Da gab ihm der Riese ein großes Messer, und Meister Joseph schnitt mit einem kräftigen Schnitte den Sack auf, daß die Maccaroni alle auf den Boden fielen. »Siehst du, ich esse meine Maccaroni ohne sie zu kauen; jetzt ist die Reihe an dir,« sprach er, und reichte dem Riesen das Messer.
Der setzte kräftig an, und schnitt sich den Bauch auf, daß die Eingeweide heraus fielen, und er brüllend zu Boden sank. »So recht,« sprach der tapfere Schuster, »jetzt hast du mir die Mühe erspart, dich umzubringen.« Da nun der Riese gestorben war, trat Meister Joseph hinzu, und schnitt ihm in aller Ruhe den Kopf ab. Den brachte er dem König, und sprach: »Königliche Majestät, hier ist des Riesen Kopf. Es ist ein heißer Kampf gewesen, aber endlich ist es mir doch gelungen, ihn zu besiegen.«
Da wurde der König hoch erfreut, und da er eine sehr schöne Tochter hatte, so gab er sie dem Schuster zur Frau, und Meister Joseph führte nun ein herrliches Leben, und als der König starb, wurde er König, und lebte glücklich und zufrieden, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DIE BEIDEN BUCKLIGEN ...

Es waren einmal zwei Bucklige, zwei gute Kameraden, aber einer buckliger als der andere. Arm und elend waren sie, ohne einen Heller. Einer von ihnen sagte: »Ich will ein wenig herumstreifen, denn hier gibt es nichts zu essen, man stirbt des Hungers. Ich will sehen, ob ich mein Glück machen kann.« – »Geh nur immer! Wenn du dein Glück machst und zurück kommst, will auch ich sehen, ob ich es machen kann.« –
Dieser Bucklige also macht sich auf den Weg und geht fort. Als er ein großes Stück Wegs zurückgelegt hat, findet er einen Platz, wo ein Markt war, wo alles, von allen Sorten verkauft wurde. Einer verkaufte da Käse. Er sagte: »Essen Sie den Parmigianino«. –
Der Bucklige, der aus Parma war, glaubte, es gelte ihm und er, der Parmesaner, sollte gegessen werden. Er flüchtet und verbirgt sich in einem Hof. Als er eine Stunde dort geblieben war, hört er ein Kettengerassel, ein grauliches, und den Ruf: »Samstag und Sonntag!« – Drei oder viermal.
Der arme Bucklige fügt hinzu: »Und Montag.« »O Gott,« sagen die Stimmen, »wer ist der, der unseren Chor gestimmt hat?« – Sie suchen und finden den armen Buckligen in seinem Versteck. – »O, ihr Herren,« sagt er, »ich bin hierher gekommen nicht um etwas böses zu tun, wissen Sie!« – »O, und wir sind gekommen, Dich zu belohnen. Du hast unseren Chor in Ordnung gebracht. Komm mit uns!«
Sie setzen ihn auf einen Tisch und nehmen ihm den Buckel ab. Dann behandeln sie ihn, heilen die Wunde und geben ihm zwei Säcke voll Geld. »Jetzt,« sagen sie, »kannst du gehen.« – Er bedankt sich und geht, ohne den Buckel.
Als er nach Parma kommt, wo er her ist, schau, da kommt der andere Bucklige. »Ist das nicht mein Freund? Aber wie? Der hatte ja keinen Buckel. Höre mal, du bist nicht mein alter Kamerad, so und so!« – »Ja,« sagt jener, »ich bin es.« – »Sage mal, warst du nicht bucklig?« – »Ja, aber sie haben mir den Buckel abgenommen und mir zwei Säcke voll Geld gegeben. Nun will ich dir erzählen, warum.
Ich«, sagt er, »kam an jenen Ort« – (er sagt ihm, wo es war, mir hat er es nicht gesagt, und so weiß ich es nicht) »und hörte ausrufen: Essen Sie den Parmigianer, essen Sie den Parmigianer! – Ich kriegte große Angst und versteckte mich« (er sagte ihm auch, wo) »in einem Hof, so und so. Und,« sagt er, »nach einer gewissen Zeit höre ich ein Kettengeklirre und den Ruf: Samstag und Sonntag! von einem Chor. Nach zwei oder drei Wiederholungen sagte ich: Und Montag! Da kamen sie und suchten und fanden mich und sagten, ich hätte ihren Chor in Ordnung gebracht und sie wollten mich belohnen. Sie holten mich, nahmen mir den Buckel ab und gaben mir zwei Säcke voll Geld.« – »O Gott!« sagte der andere Bucklige, »da will ich auch gehen, weißt du.« – »Geh nur, armer Kerl, geh, geh, geh! Addio, Addio!«
Der andere Bucklige macht sich auf den Weg und geht und kommt auch an den Ort, und wo sein Kamerad gesagt hat, versteckt er sich, genau an die selbe Stelle. Nach einer gewissen Zeit hört er plötzlich Kettengeklirr. Samstag und Sonntag! – singt ein ganzer Chor, und ein anderer: Und Montag! Der Bucklige, nachdem sie das drei oder viermal gesungen hatten, ruft: »Und Dienstag!« – »Wo ist der,« sagen sie, »der unseren Chor verdorben hat? Wenn wir ihn finden, reißen wir ihn in Stücke.« –
Nun denkt, dieser arme Bucklige, sie schlagen und hauen auf ihn ein, was sie nur können, dann setzen sie ihn auf den selben Tisch wie seinen Gefährten. – »Nehmt diesen Buckel,« sagen sie, »und setzt ihn ihm vorn hin!« – Sie nehmen den Buckel des anderen und heften ihn an die Brust des Ärmsten, dann jagen sie ihn mit Schlägen fort.
Er kehrt nach Hause zurück und findet den Freund. »Um Gotteswillen!« ruft der, »ist das nicht mein Freund? Ei was! er ist es nicht, denn er hat auch vorn einen Höcker. Aber gib mir Bescheid,« sagt er: »Bist du nicht mein Freund?« – »Freilich,« antwortet der weinerlich. »Ich wollte meinen Buckel nicht und muß nun meinen und deinen tragen, und bin noch dazu elend verprügelt worden, siehst du es nicht?« –
»Komm nur!« sagte der Freund, »komm nach Hause, wir wollen einen Bissen essen, und beruhige dich!« – Und so ging er jeden Tag und aß einen Bissen bei dem Freund, und endlich, denke ich, werden sie gestorben sein.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
CRIC UND CROC ...
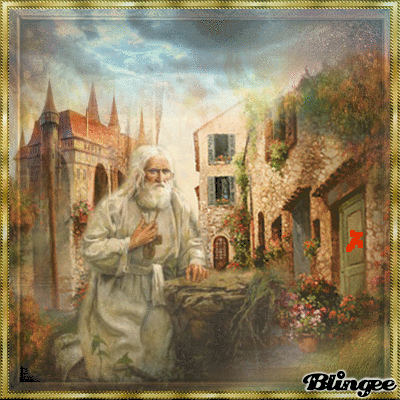
In einem fernen Lande war einmal ein berühmter Dieb, den man Cric nannte und nie hatte fangen können. Dieser Dieb wünschte die Bekanntschaft eines anderen Diebes zu machen, der Croc genannt wurde und ebenso berühmt war, wie er; denn er wollte sich mit ihm verbünden.
Nun geschah es, daß, ohne es zu wissen, Cric und Croc sich in dem selben Gasthaus trafen, und während des Essens stahl Cric dem Croc seine Uhr. Als dieser nun sehen wollte, wie viel es an der Zeit war, und merkte, daß seine Uhr ihm fehlte, sagte er: Das muß also Cric sein, denn ich habe nichts gemerkt. –
Und er stahl dem Cric die Geldbörse. Als dieser dann zahlen wollte und fand, daß sein Geld fehlte, sagte er zu seinem Gefährten: »Du mußt Croc sein,« und der andere: »Ich bin es.« – »Gut! so wollen wir zusammen stehlen.«
Als sie nun in eine Stadt gekommen waren, bestahlen sie den Schatz des Königs. Der König merkte, daß an seinem Schatz etwas fehlte und wußte nicht, was er denken sollte, weil das Haus, wo er ihn aufbewahrte, voller Wachen war. Er ging zu einem, der wegen Diebstahl im Gefängnis war – er hieß Portacalce – und sagte ihm: »Wenn du mir sagen kannst, wer den Schatz gestohlen hat, lasse ich dich frei und mache dich zum Marchese.« –
Der Mann antwortete: »Es muß Cric und Croc gewesen sein, denn es gibt keinen berühmteren Dieb als die zwei. Ich aber entdecke sie. Lassen Sie den Preis des Fleisches auf hundert Lire das Pfund setzen, und an das Haus, wo man mir als Almosen Fleisch geben wird, mache ich ein rotes Zeichen, und Eure Majestät wird wissen, wer den Schatz gestohlen hat.«
Genau so tat der König. Jene beiden Diebe kauften Fleisch für hundert Lire das Pfund, und eines Tages, als Portacalce, als Bettler verkleidet, zu ihnen kam, um ein Almosen bittend, gaben sie ihm ein Stück davon. Er aber machte sogleich ein rotes Zeichen an die Tür. Der schlaue Cric, als er es sah, ging und machte das gleiche an allen Türen der Stadt, so daß der König nicht erfahren konnte, wer ihn bestohlen hatte.
Portacalce aber sagte zu ihm: »Habe ich Ihnen nicht gesagt, wenn ich schlau bin, so sind sie schlauer als ich! Machen Sie es nun so: Lassen Sie am Fuß der Treppe des Schatzhauses eine Kufe mit heißem Öl stellen. Der Dieb, der zu stehlen kommt, wird hinein fallen, und wir werden ihn sehen.« –
Cric und Croc waren mit ihrem Geld zu Ende. Sie gingen, neues zu stehlen, und Croc, der voran gegangen war, fiel in die Kufe und starb. Cric wartet und wartet, sieht ihn aber nicht zurück kommen, geht also nach, und da er sieht, daß er tot ist, schneidet er ihm den Kopf ab und trägt ihn fort, damit man nicht erkennen könnte, wer gestohlen hatte.
Tags darauf gehen die anderen, um nachzuschauen, und alle sagten: »Diesmal ist er drin, o gewiß!« – Er war aber ohne Kopf. Da sagte Portacalce zum König, er solle den Toten von zwei Pferden durch die ganze Stadt schleifen lassen, und wo man weinen hören wird, da sei es, wo der Dieb gewohnt habe. Und so taten sie.
Als man also bei dem Hause der beiden Diebe vorbei kam, fängt Crocs Weib an zu weinen: Oh, mein armer Mann! Oh, mein armer Gatte! – Cric aber, als er sah, daß sie auf diese Art entdeckt waren, macht sich daran, alle Teller und Schüsseln zu zerbrechen und die Frau zu schlagen. Die Diener des Königs gehen herzu und sehen, daß die Frau weinte, da der Mann sie schlug, weil sie alles Geschirr zerbrochen hatte, und so konnten sie den Dieb nicht finden.
Portacalce aber sagte zum König: »Nun, Majestät, geben Sie einen Ball, und wer mit Ihrer Tochter tanzen wird, wird der sein, der gestohlen hat, sie aber soll, um ihn wieder zu erkennen, ihm ein Stück von seinem Kleide abschneiden.« – So geschah es. Aber Cric, der es gemerkt hatte, schnitt auch allen anderen, die dort waren, ein Stück von ihrem Kleide ab.
Da ließ der König eine Verordnung anschlagen: Er verzeihe dem Dieb, der den Schatz bestohlen habe, wenn dieser imstande sei, ihm das Leintuch im Bett unterm Leibe zu stehlen.
Nun also kleidet sich der König am Abend aus und legt eine Flinte neben das Bett und wartet auf den Dieb. Cric stieg auf das Dach des Palastes, machte einen Mann aus Stroh, gekleidet wie er selbst, und läßt ihn um Mitternacht herunter vor dem Fenster des Königs. Wie der die Puppe sieht, hält er sie für Cric und feuert einen Schuß auf sie ab, und die Puppe fällt hinunter. Der König läuft geschwinde hinaus, den Toten zu sehen.
In dessen schleicht sich Cric in das Zimmer, nimmt das Leintuch und entfernt sich, ohne gehört zu werden, da die Königin ihn für den König gehalten hatte. Am anderen Morgen brachte er dem König das Leintuch, und der König war verpflichtet, ihm zu verzeihen, da er sein Wort nicht brechen konnte, und damit er ihn nicht wieder bestehle, gab er ihm seine Tochter, und Cric heiratete sie und wurde königlicher Prinz.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen, Monferrato
DAS ZIEGENGESICHT ...
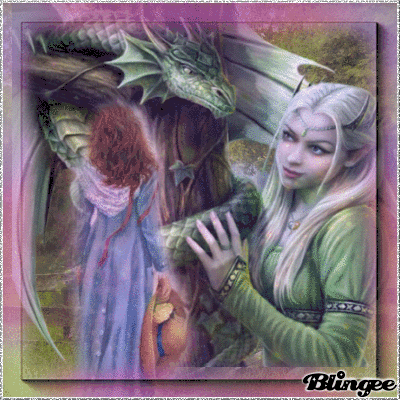
Ein Bauer hatte zwölf Töchter, keine war einen Kopf höher als die andere; denn jedes Jahr schenkte die gute Frau Ceccuzza ihrem Manne ein Töchterlein, so dass der arme Schelm, um sie ehrlich durch zu bringen, jeden Morgen hin ging und den ganzen Tag hindurch grub, so dass man nicht füglich sagen könnte, ob ihm mehr Schweiß von der Stirn rann, oder er mehr in die Hand spie. - Kurz, er bewahrte seine kleine Herde durch den Ertrag dieser Arbeit vor dem Hungertode.
Er grub eines Tages am Fuß eines Berges, der der Luginsland der anderen Berge war, so hoch streckte er sein Haupt in die Wolken, um zu sehen, was im Himmel vorging, und zwar nahe bei einer Höhle in diesem Berge, die so dunkel war, dass die Sonne sich fürchtete hineinzugehen. Aus dieser Höhle kam eine grüne Eidechse, so dick wie ein Krokodil und der arme Bauer erschrak so sehr, das er nicht die Kraft hatte, vom Flecke zu gehen, indem er fürchtete, von dem hässlichen Tiere verschlungen zu werden.
Aber die Eidechse richtete sich auf und sagte. "Fürchte dich nicht, guter Mann, denn ich will Dir nichts zu Leide sondern etwas zu Gute tun." Als Masaniello, so hieß der Bauer, das hörte, fiel er auf die Knie und sagte: "Madam Ungenannt, ich bin gänzlich in ihrer Macht; handeln sie wie eine vortreffliche Person, und haben sie Mitleid mit diesem Stamm, der zwölf Äste zu erhalten hat." -
"Eben deswegen, sagte die Eidechse, bin ich geneigt Euch zu helfen, darum bringt mir Morgen früh Eure jüngste Tochter, ich will sie erziehen wie mein eigenes Kind und so lieb haben, wie mein Leben."
Als der arme Vater diese hörte, wurde er bestürzter als ein Dieb, bei dem man das gestohlene Gut findet. Denn da die Eidechse nach einer von seinen Töchtern und zwar nach der jüngsten und zartesten fragte, so schloss er, dass auf dem Kleide keine Wolle sei, und dass sie wohl nur einen Mund voll haben wolle, um ihren Appetit zu beschwichtigen, er sagte daher zu sich selbst:
"Gebe ich ihr meine Tochter, so gebe ich ihr meine Seele; schlage ich sie ihr ab, so nimmt sie meinen eignen Körper; überlasse ich sie ihr, so verliere ich meine eignen Eingeweide; weigere ich mich, so saugt sie mir das Blut aus; willige ich ein, so gebe ich ihr einen Teil von mir; tue ich es nicht, so nimmt sie das Ganze. - Was soll ich tun? Welchen Plan fassen? Welchen Weg einschlagen? Das war ein schlechtes Tagewerk! Welches Unglück ist vom Himmel auf mich herab gefallen!
Während er so sprach, sagte die Eidechse zu ihm: "Entschließe Dich schnell, und tue was ich Dir gesagt habe, oder Du wirst deine Gebeine hier lassen, so will ich es haben, und so soll es sein." - Als Masaniello dies Urteil hörte und nirgends zu appellieren wusste, so ging er ganz melancholisch nach Hause und so gelb im Gesicht als wenn er die Gelbsucht hätte.
Als Ceccuzza ihn so bleich, verfallen und elend sah, fragte sie ihn: "Was ist Dir widerfahren, Mann? Hast Du mit Jemanden Streit gehabt? Ist eine Pfändung im Werke gegen Dich? Oder ist der Esel gestorben?" "Nichts von dem Allen, erwiderte Masaniello, aber eine gehörnte Eidechse hat mir solchen Schreck eingejagt; denn sie hat mir gedroht, dass sie mir den Gar ausmachen würde, wenn ich ihr nicht meine jüngste Tochter brächte.
Mein Kopf dreht sich wie ein Kreisel. Ich weiß nicht, welchen Fisch ich nehmen soll, auf der einen Seite treibt mich die Liebe, auf der anderen Seite die Sorge für die Meinigen. Ich habe Renzolla sehr lieb, aber mein eigens Leben auch. Gebe ich ihr nicht die Frucht meiner Lenden, so nimmt sie die ganze Masse dieses unglücklichen Körpers. Darum rate mir, teure Ceccuzza, oder ich bin verloren." -
Als die Frau das hörte, sagte sie: "Wer weiß, diese Eidechse macht vielleicht allem unseren Unglück ein Ende. Sieh doch, wie oft wir uns die Axt vor die Füße legen, und wenn wir Falkenaugen haben sollten, um das Gute zu sehen, das uns in die Arme läuft, so haben wir Schuppen auf den Augen. - Wir haben jetzt den Haken in der Hand, um das Glück fest zu halten, darum geh hin und bringe sie ihr, denn meine Ahnung sagt mir, es werde zum Besten der armen Kleinen sein."
Masaniello billigte ihre Rede, und am nächsten Morgen, als die Sonne mit ihrer Strahlenbürste anfing, den Himmel zu scheuern, den die Schatten der Nacht beschmutzt hatten, nahm er das kleine Mädchen bei der Hand und führte es nach der Höhle. Die Eidechse, welche auf ihn wartete, kam sogleich auf ihn zu, gab ihm einen Beutel mit Patacken und sagte, das Kind nehmend: "Geh nur, und verheirate Deine anderen Töchter mit diesem Gelde und lebe glücklich, denn Renzolla hat Vater und Mutter gefunden; wohl ihr, dass ihr ein solches Glück begegnet!"
Masaniello, hoch erfreut, dankte sehr, kehrte zu seiner Frau zurück und zeigte ihr das Geld, mit dem er alle seine anderen Töchter ausstatten und doch noch genug Essig übrig behielt, um die Mühen seines ganzen übrigen Lebens damit hinunter zu spülen.
Sobald die Eidechse Renzolla bekommen hatte, ließ sie einen prächtigen Palast erscheinen, brachte das Kind hinein und erzog es in solchem Glanz und Herrlichkeit, dass es selbst die Augen einer Königin geblendet haben würde. Ihr könnt sicher sein, dass es ihr nicht an Ameisenmilch fehlte. Ihre Nahrung passte für einen Grafen und ihre Kleidung für einen Prinzen. Sie hatte hundert Mädchen zu ihrer Bedienung und wurde durch die gute Behandlung in vier Sekunden so rund wie ein Ring.
Es trug sich zu, dass der König, als er zufällig in dieser Gegend jagte, von der Nacht überrascht wurde und nicht wissend, wohin er sein Haupt legen solle, in dem Palast Licht sah; deshalb sandte er einen seiner Diener ab, um den Eigentümer um ein Nachtquartier zu bitten.
Als der Diener zu der Eidechse kam, die wie eine schöne Dame erschien, und sein Anliegen vorbrachte, so sagte sie, dass der König tausend Mal willkommen wäre, und es weder an Brot noch an einem Messer fehlen solle. - Der König begab sich, als er diese Antwort vernahm, dahin, und wurde wie ein Ritter empfangen.
Hundert Pagen gingen ihm mit brennenden Fackeln entgegen, und sahen aus wie die Dienerschaft eines vornehmen Mannes. Hundert andere Pagen deckten den Tisch, und waren anzuschauen wie eben so viele Apotheken Burschen, wie sie den Kranken Herzstärkung bringen. Hundert andere machten ein gewaltiges Geräusch mit Musik, über alles aber war Renzolla, die den König bediente, und ihm mit so vieler Liebenswürdigkeit zu trinken reichte, dass er mehr Liebe als Wein einschlürfte. -
Als das Mahl geendet war und die Tische abgedeckt, ging der König zu Bett und Renzolla zog ihm selbst die Strümpfe von den Füßen und das Herz aus der Brust, so gewaltig, dass er fühlte, wie das Gift der Liebe, so bald er von ihren schönen Händen berührt wurde, aus den Füßen in die Höhe stieg und seine Seele erfüllte. Um daher dem Tode zu vor zu kommen, beschloss er, das Gegengift für diese Schönheiten zu versuchen und es sich zu verschaffen, und die Fee, welche Sorge für ihre Erziehung trug, rufend, verlangte er von ihr Renzolla zur Gattin. Da jene nur auf ihres Pflegekindes Glück bedacht war, so willigte sie nicht allein mit Freuden ein, sondern steuerte das selbe auch noch mit sieben Beuteln Goldes aus.
Der König, hoch erfreut über dieses Glück, reiste mit Renzolla ab, die, ungezogen und undankbar nach so vielen ihr erzeigten Wohltaten, bei dem Abschied der Fee kein freundliches Wörtchen sagte. - Diese, entrüstet über ihr Betragen, verfluchte sie und wünschte, dass sie ein Gesicht wie eine Ziege bekäme. Kaum hatte sie dies geäußert, als auch schon ein, einen halben Fuß langer Bart an Renzolla's Kinn ansetzte; ihre Kinnbacken verlängerten sich, ihr Gesicht schrumpfte ein, aus ihren schönen Locken wurden ein Paar Hörner, kurz Renzolla hatte ein Ziegengesicht.
Als der arme König das sah, war er wie vom Donner gerührt, da er nicht begreifen konnte, wie es zuginge, dass eine Schönheit mit zwei Sonnen plötzlich so verändert werden könnte. - Seufzend und weinend rief er aus: "Wo sind die Locken, die mich fesselten? Wo ist der Mund, die Falle meiner Seele, die Angel meines Gemütes, der Branntwein meines Herzens? Soll ich denn der Gatte einer Ziege sein und Bock heißen? Nein, nein mein Herz soll nicht brechen um einer Ziege willen, die mich stößt und meine Hemden schmutzig macht. -
Dies sagend, schickte er, sobald er in seinem Palast angekommen war, Renzolla in die Küche mit einem Dienstmädchen und gab jeder von ihnen ein Bund Flachs mit dem Befehl, es am Ende der Woche gesponnen zu haben. Das Mädchen, dem König gehorsam, fing an den Flachs zu hecheln, bereitete ihn, tat ihn auf die Spindel und arbeitete frisch, so dass sie am Sonnabend Abend fertig war.
Renzolla, die aber glaubte, sie sei noch immer die selbe, die sie im Hause der Fee gewesen war, weil sie nicht in den Spiegel gesehen hatte, warf den Flachs aus dem Fenster und sagte: "Das ist wahrhaftig recht hübsch vom König, mir eine solche Beschäftigung zu geben! Wenn er Hemden braucht, so kann er sich welche kaufen, und mich nicht für ihn arbeiten lassen wollen. Er sollte sich erinnern, dass ich ihm sieben Beutel Goldes mitgebracht habe, und dass ich seine Frau und nicht seine Magd bin; er ist ein rechter Esel, mich so behandeln zu wollen.
Als nun der Sonntag heran kam und sie sah, dass die Magd allen ihren Flachs gesponnen habe, fürchtete sie sich doch etwas gehechelt zu werden, und ging daher nach dem Palast der Fee, um dieser ihr Schicksal zu erzählen. Die Fee umarmte sie herzlich und schenkte ihr einen großen Beutel voll gesponnenen Flachs, um ihn dem König zu geben um ihm zu zeigen, dass sie eine gute Hausfrau sei.
Renzolla nahm den Sack und ging, ohne sich bei ihr zu bedanken, nach dem Palast des Königs zurück, so dass die Fee nichts als Steine von dem Boden des undankbaren Mädchens erntete.
Als der König den Flachs in Empfang genommen hatte, gab er ihnen zwei Hunde, einen ihr, den anderen dem Mädchen, mit dem Befehl, die Tiere zu füttern und aufzuziehen. Das Mädchen tat das rechtschaffen und behandelte ihren Hund wie ein Kind. Aber Renzolla sagte: "Mein Page gab mir den Rat, wenn man Türken bekommt, so soll man sie hinauswerfen. Bin ich denn dazu da, Hunde zu kämmen und zu dressieren?" Bei diesen Worten warf sie den Hund aus dem Fenster, was ein ganz anderes Ding war, als wäre er in den Schoß gesprungen.
Nach einigen Monaten fragte der König nach den Hunden. Renzolla roch Unrat, und eilte wieder zu der Fee. Am Schloßtor aber fand sie einen alten Mann, der der Pförtner war und zu ihr sagte: "Wer bist Du und was willst Du?" Als sie sich so kurz anreden hörte, erwiderte sie. "Kennst Du mich nicht, Du Ziegenbart?" -
"Reichst Du mir das Messer, versetzte der Alte. Da folgt ja der Dieb dem Büttel. Lass ab, sagte der Topf, Du machst mich schmutzig. Wirf Dich hin, oder Du wirst fallen. - "Ich ein Ziegenbart! Du bist anderthalb Mal selbst ein Ziegenbart; denn Du verdienst das und noch mehr für Deine Unverschämtheit. Warte ein Weilchen, und ich will es Dir klar machen; Du wirst sehen, wohin Dein vornehmes Tun und Deine Schamlosigkeit Dich gebracht haben."
Bei diesen Worten lief er in ein kleines Zimmer, holte einen Spiegel und hielt ihn Renzolla vor das Gesicht, so dass diese, als sie ihr hässliches haariges Antlitz darin erblickte, beinahe vor Schrecken gestorben wäre. Rinaldos Grausen, als er sich in dem bezauberten Schilde erblickte, war nichts gegen ihre Verzweiflung, da sie sich so entstellt sah.
Der alte Mann sagte darauf zu ihr: "Du solltest dich erinnern, Renzolla, dass Du die Tochter eines Bauern bist und die Fee Dich zum Range einer Königin erhoben hat; aber rohes, ungesittetes, undankbares Ding, hast ihr nicht die mindeste Erkenntlichkeit oder Zuneigung dafür bewiesen. Deshalb nimm und siehe, gehe damit fort und komm des Übrigen wegen zurück. Gute Sitten trittst Du mit Füßen, jetzt weißt Du, was Du dafür bekommen hast; denn durch die Verwünschung der Fee hast Du nicht allein ein anderes Gesicht, sondern auch einen anderen Stand bekommen. -
Willst Du aber handeln, wie es sich für einen solchen weißen Bart geziemt, so wirf Dich der Fee zu Füßen, zerraufe Deinen Bart, zerkratze das Gesicht, zerschlage die Brust und bitte sie um Verzeihung für Dein schlechtes Betragen; sie ist gutherzig und wird Mitleid mit Deinem Unglück haben."
Renzolla, welche einsah, dass er den rechten Schlüssel berührt und den Nagel auf den Kopf getroffen habe, befolgte seinen Rat. Die Fee umarmte und küsste sie und gab ihr ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Sie zog ihr darauf ein mit Gold reich besetztes Kleid an und brachte sie in einer prächtigen Kutsche, von einer großen Dienerschaft begleitet, wieder zu dem Könige zurück, der, als er sie so schön und so geschmückt sah, sich mehr als je in sie verliebte, sich wegen der Leiden, die sie hatte tragen müssen, aber auch zugleich mit dem hässlichsten Ziegengesicht, das die Ursache gewesen war, entschuldigte.
So lebte nun Renzolla glücklich, liebte ihren Gatten, ehrte die Fee, und bezeigte sich dankbar gegen den alten Mann, nachdem sie auf ihre Kosten gelernt hatte, dass:
Es immer gut sei, artig zu sein!
Neapolitanisches Märchen
DIE DREI GÄNSE ...
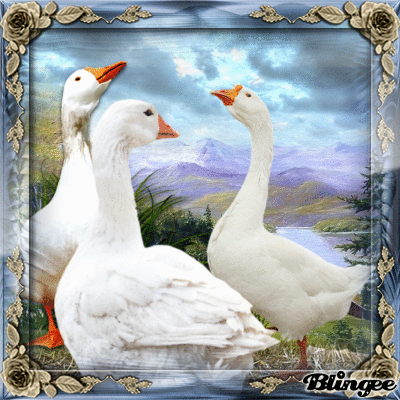
Drei Gänse waren auf einem Jahrmarkt gewesen und kehrten mit den eingekauften Sachen nach Hause zurück. Aber sie mußten durch einen Wald gehen, und auf dem Wege überraschte sie die Nacht. Sie berieten, was zu tun sei.
«Wir armen Gänse können heute unsere Wohnung nicht mehr erreichen. – Was fangen wir nur an, um uns vor dem Wolfe zu schützen?» Sie beschlossen, sich Häuser zu bauen. Jede baute sich ein besonderes Haus, die erste aus Stroh, die zweite aus Holz, die dritte aus Eisen.
In der Nacht kam der Wolf und ging zuerst vor das Häuschen aus Stroh. «Liebe Gans», rief er, «mach mir auf, sonst blase ich dein Haus über den Haufen!» Die Gans öffnete nicht, der Wolf blies ihr Haus um und verschluckte sie.
Dann ging er vor das Haus der zweiten Gans und sagte: «Liebe Gans, mach mir auf, sonst werfe ich dein Haus um!» Als die Gans nicht aufmachte, warf er ihr Haus um und verschlang sie.
Dann ging er vor das Haus der dritten Gans, welches von Eisen war, und sagte: «Liebe Gans, mach mir auf, sonst schlag ich dein Haus zusammen!» Die Gans aber öffnete nicht. Da ward der Wolf zornig und schlug auf das Haus los.
Das Haus brach nicht, aber der Wolf schlug sich einen Fuß ab. Nun hinkte er auf drei Beinen zum Schlosser und ließ sich einen eisernen Fuß ansetzen. Dann ging er wieder zum Hause der Gans zurück und bat sie um Einlaß. Aber die Gans lachte nur und tat nicht auf. Da versuchte es der Wolf mit einer List. «Ei, liebe Gans, laß mich nur auf einen Augenblick herein, ich möchte mir eine Suppe kochen, ich habe großen Hunger.»
Weil er gar so flehentlich bat, sagte die Gans endlich: «Aufmachen kann ich dir nicht, lieber Wolf, aber ein gutes warmes Süppchen will ich dir kochen, sollst deine Freude daran haben!»
Sie ging, schürte ein Feuer an und hing einen Kessel voll Wasser darüber, bis es siedend heiß war. Dann trat sie zum Fenster und rief hinab: «Nun, lieber Wolf, sperre den Rachen recht weit auf, das Süppchen ist fertig, ich gieße es dir hinab.»
Der Wolf sperrte den Rachen weit auf, und die Gans schüttete das siedend heiße Wasser hinab, gerade in den Rachen des Wolfes. Es verbrühte ihn, und er mußte jämmerlich verenden. Die Gans aber ging hinaus und riss ihm den Leib auf. Da sprangen ihre beiden Schwestern fröhlich heraus. Und sie setzten ihren Weg fort und kamen alle drei wohlbehalten nach Hause.
Fabel aus Italien
DER ZAUBERBRUNNEN ...
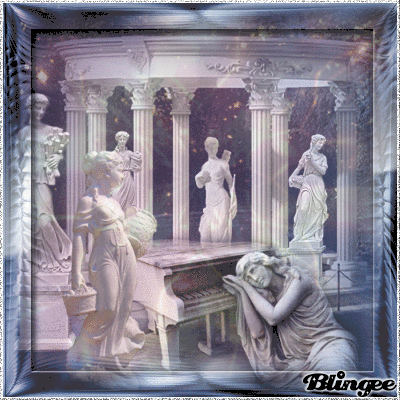
Ein König hatte drei Töchter, die er zärtlich liebte. Er war daran gewöhnt, einen großen Teil des Tages bei seinen Büchern zu verbringen, und eines Tages fiel ihm ein Buch in die Hand, in dem er folgendes las: «O König, habe ein Auge auf deine Töchter, und laß sie sich niemals dem Brunnen in deinem Garten nähern, denn sonst würdest du sie für immer verlieren.»
Beim Lesen dieser Mahnung erschrak der gute Vater sehr. Nun gab es an seinem Hofe drei Brüder, die in die drei Prinzessinnen ganz und gar verliebt waren, aber es natürlich nicht wagten, um deren Hand anzuhalten. Der König ließ nun die drei Burschen rufen und gab ihnen den Auftrag, sie sollten auf seine drei Töchter aufpassen und verhindern, daß sie sich je dem Brunnen im Garten näherten. Die Burschen waren nur zu gern bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.
Aber eines Tages, als sie mit den Mädchen im Garten Spazieren gingen und hier hin und dort hin kamen, sahen sie mit einem Male die Prinzessinnen nicht mehr. Sie suchten sie hier – sie suchten sie dort, aber alles war vergeblich, sie fanden sie nicht. Was sollten sie jetzt tun? Was konnten sie schon dem König sagen?
Der Jüngste von ihnen, der – wie wir sehen werden – auch der Gescheiteste war, sagte: «Verliert nicht den Mut, liebe Brüder! Wir werden es so machen: wir werden dem König erklären, daß wir bereit sind, einer nach dem anderen in die Welt zu ziehen, um die Mädchen zu suchen. Wenn nach einem Jahr der erste nicht heimkehrt, dann soll das heißen, daß er tot ist oder an der Heimkehr verhindert; und dann soll der zweite los ziehen und nach einem Jahr der dritte.» – «Uns gefällt dein Plan», sagten die Brüder und nahmen ihn an.
Als der König von dem Verschwinden seiner drei Töchter gehört hatte, glaubte er, vor Schmerz sterben zu müssen. Und als er den Plan der drei Brüder hörte, nahm er ihren Vorschlag gerne an.
So reiste denn der Älteste ab, und nachdem er lange durch Wälder und Gebirge geritten war, kam er endlich zu einem Wirtshaus, das einsam in der Wildnis lag. Er stieg ab, klopfte an die Türe, und es erschien eine Alte am Fenster und fragte: «Was willst du?» – «Was ich will? Mich und dieses Pferd hier unter Dach bringen, denn das Pferd ist halb tot vor Hunger und Müdigkeit.» –
«Höre einmal, für dich – glaube ich – wird sich ein Platz finden lassen, aber für das Pferd nicht, denn hier gibt es keinen Stall.» – «Sei es, wie es wolle, mach mir nur gleich auf!» Da wurde ihm aufgesperrt und er ging hinein. Er fragte die Alte, ob er ein Zimmer haben könne, um sich auszuruhen.
Sie führte ihn in eine Kammer, wo drei Männer beim Kartenspiel saßen. Der Bursche war so unvorsichtig, sich von ihnen zum Spielen verleiten zu lassen. Und da er beim Spiel kein Glück hatte, verspielte er erst sein Geld, dann seine Kleider, sein Pferd und schließlich sich selbst. Dann nahmen ihn die drei Männer, banden ihn und sperrten ihn in einen Stall.
Unterdessen verging ein Jahr, und als der Älteste nicht zurückkehrte, sagte der Mittlere zum Jüngsten: «Jetzt versuche ich mein Glück.» Er nahm Geld und ein gutes Pferd und machte sich auf den Weg. Er ritt durch Wälder und Gebirge, und schließlich führte ihn sein Schicksal dort hin, wo sein Bruder gefangen lag. Auch er ließ sich zum Kartenspielen verführen, auch er verlor Geld, Kleider, Pferd und Freiheit.
Als wiederum ein Jahr vorüber war und auch der Mittlere nicht heimkehrte, reiste der Jüngste ab. Und nach einiger Zeit gelangte er zu der gleichen Wirtschaft, wo seine beiden Brüder gefangen waren. Auch er ließ sich zwar zum Kartenspielen verleiten, aber das Glück war ihm freundlicher gesinnt als seinen beiden Brüdern. Er gewann den Spielern alles ab und tötete sie schließlich zusammen mit der häßlichen Alten. Dann befreite er seine beiden Brüder.
Am nächsten Tag sagte der Jüngste zum Ältesten: «Du wirst hier bleiben und das Essen kochen, während wir zwei auf die Jagd gehen. Schau, daß alles fertig ist, bis wir heimkommen.»
Der Älteste, der in der Wirtschaft geblieben war, machte sich also so gleich daran, das Essen zu kochen, damit alles fertig sei, wenn die Brüder Heim kämen. Aber nach kurzer Zeit, als es im Kochtopf schon brutzelte, hörte er einen Lärm im Kamin, und als er hinauf schaute, erblickte er ein scheußliches Vieh, das durch den Kamin herunter stieg. Der Schreck ließ ihn so sehr erstarren, daß er weder daran dachte, sich zu verteidigen noch um Hilfe zu rufen, sondern wie verhext einschlief.
Als die beiden anderen nach einer guten Jagd heimkamen, fanden sie den Ältesten wie betrunken und – was noch schlimmer war – das Feuer ausgelöscht und das Essen verdorben. Sie fragten den Bruder, was da vorgefallen sei, und der Älteste erzählte ihnen von dem scheußlichen Vieh, das er gesehen habe, und wie ihn gleich der Schlaf überfallen habe.
«Morgen werde ich daheim bleiben», sagte der Mittlere, «und ihr geht auf die Jagd. Laßt mich nur machen!»
Aber ihm erging es ganz genauso und nicht besser und nicht schlechter als dem ältesten Bruder. So kam denn die Reihe an den Jüngsten, daheim zu bleiben und für das Essen zu sorgen. Der nun, der überhaupt der Klügste und Geschickteste war, ließ sich nicht erschrecken, als er das Untier den Kamin herunter klettern hörte. Er stellte sich viel mehr so gleich schlafend, und kaum daß die Bestie herunten war und anfing, das Feuer zu löschen und das Essen zu verwüsten, sprang er auf die Füße, zog sein Schwert und schlug ihr den Kopf ab.
Und als die beiden größeren Brüder von der Jagd heimkamen, sahen sie mit Staunen, was der Jüngste mit dem Vieh gemacht hatte. Aber es gefiel ihnen nun in dieser Spelunke nicht mehr. Sie gingen hinaus, und im Hof sahen sie einen tiefen, tiefen Brunnen.
Der Jüngste sagte zu den anderen beiden: «Holt einmal einen Strick, dann wollen wir nachschauen, was in dem Brunnen ist. Laßt mich in die Tiefe hinab, und ich werde mich darum kümmern, in welche Abenteuer ich da komme.»
Sie machten es so und ließen den Jüngsten hinunter, und als er auf dem Grund des Brunnens ankam, sah er sich in einem großen Saal, in dem an den Wänden ringsum eine Reihe von Statuen stand, und in einer Ecke des Saales saß ein Alter, der, der Wächter zu sein schien.
Der Alte schlief, und da näherte sich ihm der Jüngste, zog sein gutes Schwert und schlug ihm mit einem Streich den Kopf ab. Aber welch ein Wunder: aus dem abgeschlagenen Haupt fiel ein Schlüssel heraus.
Der Jüngste hob den Schlüssel auf und öffnete mit ihm einen Schrank, der dort stand. Und als er den Schrank geöffnet hatte, fand er dort ein Schriftzeichen, das besagte: «O du, der du so tapfer warst, hier herunter zu steigen, öffne die letzte Schublade dieses Schrankes! Du wirst darin ein Gefäß mit Öl finden, und damit kannst du von den Statuen salben, wen du willst. Und die Statuen, die du salbst, werden ins Leben zurück kehren, mit Haut und Bein, Männer und Frauen.»
Kaum hatte der Bursche diese Schrift gelesen, da öffnete er die bezeichnete Schublade und fand darin das Gefäß mit dem Öl. Er nahm das Gefäß heraus und ging damit im Saal herum. Und da fand er in einer anderen Ecke die drei Prinzessinnen, in Statuen verwandelt, die sie gesucht hatten.
Er salbte mit dem Öl diese drei Statuen, und sofort wurden sie lebendig, sprangen herum und umarmten unter Dank ihren Erlöser. Er gab sich aber damit nicht zufrieden, sondern er fuhr fort, Statuen zu salben, so lange ihm das Öl reichte. Und so sah er sich schließlich von einer Menge hübscher junger Mädchen und eleganter junger Burschen umgeben.
Er führte sie alle dort hin, wo der Strick hing, und er ließ einen nach dem anderen hinauf ziehen. Als er selber aber an die Reihe gekommen wäre, merkte er zu seinem Erstaunen, daß seine Brüder den Strick nicht mehr herunter ließen. Er schrie laut, aber niemand antwortete ihm. Da er nicht wußte, wo er sich den Kopf einrennen sollte, begann er verzweifelt zu pfeifen in der Hoffnung, daß ihn vielleicht am Ende doch noch jemand hören würde.
In der Tat hatte er noch nicht lange gepfiffen, als ein Schwarm kleiner Teufel erschien und ihn umtanzte. Sie schrien dabei im Chor: «Was willst du, Herr? Was willst du, Herr?»
«Ach, was ich will? Ich will hier heraus und sonst nichts», antwortete der Bursche, der sich durch nichts erschrecken ließ. Er hatte es kaum gesagt, da fand er sich schon aus dem Brunnen befreit. Nun verlor er keine Zeit, sondern verfolgte die Spuren seiner Brüder, bis er zum Hof des Königs gelangte, von dem er vor einigen Monaten ausgezogen war.
Er fand dort alles auf einem großen Fest zur Feier der Befreiung der drei Prinzessinnen. Die beiden verräterischen Brüder, die allen zu verstehen gegeben hatten, daß sie selbst die Prinzessinnen befreit hätten, fühlten sich nicht recht gut, als sie ihren Bruder kommen sahen. Der zeigte sich dem König und erzählte Punkt für Punkt, was sich zugetragen hatte.
Der König war sehr bewegt, umarmte den Burschen und gab ihm eine seiner drei Töchter zur Frau. Dann wandte er sich den beiden Übeltätern zu und wollte sie töten lassen. Aber der Jüngste, der so klug und tapfer gewesen war, war außerdem auch sehr gutherzig und großmütig. Er bat für seine Brüder um Verzeihung, und der König begnadigte sie.
Dann aber feierte man die glänzendste Hochzeit, die es je gegeben hat.
Märchen aus Italien
VON ARMAIINU ...
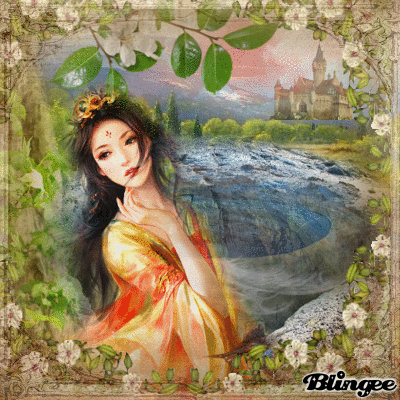
Es war einmal ein König, der hatte drei schöne Töchter. Als nun eines Tages die Prinzessinnen sich im Garten belustigten, brachen drei furchtbare Riesen in den Garten ein, und raubten die Prinzessinnen. Da ließ der König im ganzen Reich verkündigen, wer ihm die Töchter wieder bringe, solle sich eine von ihnen zur Gemahlin wählen, und nach ihm König sein. Es kamen viele und zogen aus, die Prinzessinnen zu finden, aber keiner von ihnen kehrte jemals zurück.
Nun kamen eines Tages auch drei Prinzen, die waren Brüder. Sie ließen sich vor den König führen und sprachen: »Königliche Majestät, wir sind gekommen, die Prinzessinnen zu erlösen.« »Ach,« antwortete der König, »es sind schon so viele ausgezogen und noch keiner ist wieder gekommen; hoffen wir zu dem Herrn, daß es euch besser glücken wird.«
Da wanderten die drei Prinzen fort, immer zu, ein Jahr, einen Monat und einen Tag, bis sie an ein schönes großes Schloss kamen, das mitten in einem großen Gute lag. Da verloren sie den Mut noch weiter zu wandern, und dachten: »Hier wollen wir bleiben, bis wir etwas Genaueres erfahren, wo die Prinzessinnen zu finden sind. Das Gut ist schön, und Wild gibt es im Überfluss, daß wir uns davon ernähren können.« Also blieben sie da, gingen auf die Jagd, und führten in dem schönen Schlosse ein herrliches Leben.
Unterdessen wartete der König immer fort auf seine Töchter und ihre Befreier, und da immer niemand kam, dachte er endlich: »Sie werden verschollen sein, wie die anderen auch,« und war sehr traurig. Er hatte aber einen alten treuen Türhüter, der war früher Soldat gewesen, und weil er im Kriege einen Arm und ein Bein verloren hatte, und nicht arbeiten konnte, so war er des Königs Türhüter geworden, und hieß Armaiinu.
Der kam zum König und sprach: »Königliche Majestät, ich will ausziehen, und die drei Prinzessinnen und die drei Prinzen suchen und sie euch wieder bringen.« Der König lachte und sprach: »O Armaiinu, wenn so viele starke, junge Leute dabei zu Grunde gegangen sind, wie wolltest du es unternehmen?« Armaiinu aber ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen, also daß ihm der König endlich den erbetenen Urlaub geben mußte.
Da zog Armaiinu fort zu Fuß, und trug nur ein kleines kurzes Schwert, über das alle Leute lachten. Es war aber ein Zauberschwert, und wer das hatte, dem konnte nichts widerstehen. Armaiinu wanderte und wanderte, und weil er alt und lahm war, so brauchte er zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage, bis er zu dem Schloss kam, wo die drei Prinzen weilten.
Endlich erreichte er es, trat herein, grüßte sie, und sprach: »Ich bin gekommen, nach euch zu sehen, edle Prinzen, und euch zu helfen, die Prinzessinnen wieder zu erlangen.« Die Prinzen lachten, aber sie hießen ihn doch willkommen. Da sprach Armaiinu: »Nun wollen wir noch einige Tage hier bleiben, und jeder von uns soll der Reihe nach im Schloss bleiben und kochen, derweil die anderen auf die Jagd gehen.«
Die Prinzen waren es zufrieden, und am ersten Tag blieb der Älteste da. Als er nun eben daran war, eine wilde Ente zu rupfen, trat ein gewaltiger Riese herein, der frug ihn mit drohender Stimme: »Wer hat dir erlaubt, in meinem Schlosse zu wohnen?« »Wir wohnen ja schon seit zwei Jahren hier,« antwortete der Prinz, »und erst jetzt fällt es euch ein, danach zu sehen.«
»Antwortest du mir so?« rief der Riese, erhob seinen großen Stock, und prügelte den Prinzen durch, bis er halb tot liegen blieb. Als die anderen wieder kamen, war die Ente erst halb gerupft, und der Prinz lag am Boden und stöhnte: »Ich habe auf einmal solches Leibweh bekommen,« sagte er, »und konnte deshalb meine Arbeit nicht fortsetzen.«
Am zweiten Tag blieb der zweite Prinz da, es erging ihm aber nicht besser; während er eine wilde Ente rupfte, erschien der Riese und frug ihn, wer ihm erlaubt habe, im Schlosse zu wohnen, und da er die selbe Antwort gab wie sein Bruder, so prügelte ihn der Riese durch, und ließ ihn halb tot liegen. Als die anderen kamen, fanden sie die Ente nur halb gerupft, und den Prinzen am Boden, der stöhnte: »Ach, ich habe auf einmal solches Kopfweh bekommen, daß ich in meiner Arbeit nicht fort fahren konnte.«
Also mußten sie wieder hungrig zu Bette gehen. Der Älteste aber sprach leise zum Zweiten: »Du, hat dich der Riese vielleicht auch durchgeprügelt?« »Ja,« antwortete der Andere, »wir wollen den beiden dort nichts sagen. Haben wir unsre Prügel bekommen, so können sie auch welche kriegen.«
Am nächsten Morgen blieb der jüngste Prinz zu Hause, es erging ihm aber nicht besser als seinen Brüdern; als die anderen Abends heimkamen, war die Ente kaum zur Hälfte gerupft, und der Prinz lag am Boden und stöhnte: »Ach, es ist mir so unwohl geworden, darum konnte ich nichts machen.«
»Nun, das ist nett,« sprach Armaiinu, »ihr seid drei kräftige junge Leute, und nun müssen wir dreimal nach einander hungrig zu Bett gehen, weil der eine Leibweh bekommt, und der andre Kopfweh, und es dem dritten unwohl wird. Ich sehe schon, morgen muß der arme Armaiinu zu Hause bleiben und für alle arbeiten.« »Ja,« dachten die drei Brüder, »bleibe du nur zu Hause, und koste die Prügel, die wir haben schmecken müssen.«
Am vierten Tag also blieb Armaiinu zu Hause, und als er eben eine Ente rupfte, erschien der Riese und sprach mit drohender Stimme: »Seid ihr noch immer da? Warte nur, heute bringe ich dich um.« Armaiinu aber zog sein Zauberschwert, ging auf den Riesen los und hieb ihm den Kopf ab. Dann briet er das Wild, und als die Anderen kamen, stand er ganz vergnügt unter der Tür und rief ihnen zu: »Ihr kommt zu guter Stunde, denn das Essen ist fertig.«
Da verwunderten sie sich sehr und frugen ihn, ob niemand gekommen wäre. »O ja,« sprach Armaiinu, »es kam so ein unhöflicher Kerl, dem habe ich den Kopf abgeschnitten.« Da erschraken die Prinzen und dachten: »Das geht nicht mit rechten Dingen zu.«
Am anderen Morgen sprach Armaiinu: »Nun wollen wir aber auch gehen, die Prinzessinnen erlösen; hinter dem Hause ist eine große Cisterne, da muß sich einer von uns hinunter lassen, denn da unten sind die armen Mädchen gefangen.« »Gut,« antwortete der älteste Prinz, »ich will es versuchen.« Da nahmen sie einen großen Korb und banden ihn an einen Strick, und der Prinz stellte sich in den Korb und nahm auch ein Glöckchen mit; wenn er das läutete, sollten ihn die Anderen wieder hinauf ziehen.
Wer aber auf den Grund der Cisterne gelangen wollte, mußte durch einen großen Wind, durch ein großes Wasser und durch ein großes Feuer hindurch. Als nun der Prinz zum großen Wind kam, ward ihm so bange, daß er sein Glöckchen läutete und sich hinauf ziehen ließ.
Nun wollte der zweite Prinz sein Glück versuchen und hielt auch mutig aus, bis er durch den großen Wind gekommen war. Als er aber das Wasser an seinen Füßen spürte, verlor er den Mut, läutete und ließ sich hinaufziehen. Nun war die Reihe an dem Jüngsten. Der ging mutig durch den Wind und durch das Wasser hin durch; als er aber das Feuer spürte, mochte er nicht weiter und ließ sich hinauf ziehen.
»Nun muß wohl der arme Armaiinu sein Glück versuchen,« sprach der Alte, stieg in den Korb und ließ sich in die Cisterne hinunter. Er ging mutig durch den Wind, das Wasser und das Feuer und kam glücklich unten an. Da stieg er aus dem Korb und wanderte ein wenig in einem dunklen Raum, bis er eine Türe sah, unter der schien das Licht hindurch. Als er aber aufmachte, sah er einen schönen Saal, darin saß die älteste Prinzessin vor einem wunderschönen Spiegel, und vor ihr lag der eine Riese und ruhte mit seinem Kopf in ihrem Schoss.
Da zog Armaiinu sein Zauberschwert und hieb dem Riesen den Kopf ab, ohne daß er auch nur erwachte. Die Prinzessin aber wies mit der Hand auf eine Türe, und als er diese öffnete und durch ging, kam er in einen zweiten Saal, darin saß die zweite Prinzessin wie ihre Schwester vor einem wunderschönen Spiegel und vor ihr lag der zweite Riese und ruhte mit seinem Kopf auf ihrem Schoss.
Armaiinu aber schlug ihm den Kopf ab und ging dann durch eine Türe in den dritten Saal, wo die jüngste Prinzessin saß wie ihre Schwester vor einem Spiegel und des dritten Riesen Kopf in ihrem Schoss haltend. Da schlug Armaiinu auch diesem Riesen den Kopf ab und befreite so die Prinzessinnen. Nun führte er sie alle drei an den Ort, wo noch der Korb hing, setzte die älteste Prinzessin hinein und läutete das Glöckchen.
Die Prinzen zogen die Prinzessin hinauf und ließen dann den Korb wieder hinunter. Da setzte Armaiinu auch die zweite Prinzessin in den Korb und zuletzt auch die Jüngste. Als aber die drei Prinzen die Töchter des Königs heraus gezogen hatten, sprachen sie untereinander: »Wir wollen den alten Türhüter unten sitzen lassen, so wird uns allein der Lohn für die Befreiung der Prinzessinnen.«
Da drohten sie den Mädchen, sie zu ermorden, wenn sie nicht einen heiligen Eid schwören würden nichts zu verraten, und eilten davon. Als sie nun an des Königs Hof kamen, sagten sie: »Königliche Majestät, nach langem Kampf und großer Mühe ist es uns gelungen, eure Töchter zu befreien und die Riesen umzubringen.« Da war der König hoch erfreut und ließ eine glänzende Hochzeit veranstalten und jeder Prinz heiratete eine Prinzessin.
Unterdessen hatte Armaiinu lange in der Cisterne gewartet und mit seinem Glöckchen geläutet, aber der Korb wurde nicht wieder herunter gelassen und er merkte endlich, daß die Prinzen ihn verraten hatten. Da ging er zurück in die schönen Säle und sah alle die herrlichen Schätze, die dort gesammelt waren. Aber er empfand nur Zorn darüber, denn er dachte, daß alle die Schätze ihm nichts helfen könnten, so lange er in der Cisterne gefangen saß.
Wie er nun vor dem Spiegel stand, vor dem die älteste Prinzessin gesessen hatte, übermannte ihn der Zorn, daß er einen großen Stein gegen den Spiegel warf und ihn in tausend Stücke zerbrach. Aus dem Spiegel aber fiel ein prachtvoller Kaisermantel und eine Kaiserkrone heraus. »Was hilft mir der schöne Mantel und die Krone, wenn ich nicht aus der Cisterne hinaus kann?« rief er, und zerriß ihn in tausend Stücke.
Dann ging er in den zweiten Saal und zerbrach auch den anderen Spiegel. Da fielen ein Kaisermantel und eine Kaiserkrone heraus, die waren noch viel prächtiger als die ersten. Armaiinu wollte diesen Mantel auch zerreißen, da er aber sah, wie prächtig gestickt er war, so wollte er ihn doch nicht verderben, und ging hin und zerbrach auch den dritten Spiegel.
Da fiel ein kleines Pfeifchen heraus, und als er es an den Mund setzte und hinein blies, rief eine Stimme: »Befiehl.« »So wünsche ich mir, ein junger schöner Mann zu sein,« rief Armaiinu. Da wurde er in einen jungen wunderschönen Mann verwandelt, legte den prächtigen Kaisermantel an und setzte die Krone auf, und war nun anzuschauen wie ein mächtiger Kaiser.
Da pfiff er wieder und wünschte sich aus der Cisterne hinaus und in dem selben Augenblick stand er an der freien Luft. Da wünschte er sich noch ein großes Gefolge und einen sechsspännigen Wagen und fuhr dann nach den Hof des Königs.
Als aber der König hörte, der Kaiser der ganzen Welt zöge in sein Reich ein, eilte er ihm entgegen und fiel ihm zu Füßen. Armaiinu aber hob ihn freundlich auf und sagte, er wolle heute bei ihm zu Tische sein. Also wurde ein glänzendes Mahl gehalten, und nach dem Essen sollte ein jeder eine Geschichte erzählen.
Da sprach Armaiinu: »Ich will euch die Geschichte eines armen Türhüters erzählen, und hub an, und erzählte seine eigene Geschichte.« Die drei Prinzen aber, die nebst ihren Frauen mit zu Tische saßen, erschraken sehr, als sie diese Geschichte hörten, und Armaiinu rief: »Ja, königliche Majestät, und ich bin der arme Armaiinu, und diese drei Prinzen sind die Verräter, die mich im Stich gelassen haben, und wenn es noch eines Beweises bedarf, so seht doch nur, wie sie alle drei so blaß und entstellt aussehen.«
Da ließ der König die drei Prinzen hinaus führen und erhängen, und sprach zu Armaiinu: »Wähle dir nun eine meiner Töchter aus, und wenn ich sterbe, so sollst du König sein.« Armaiinu aber sprach: »Nein, königliche Majestät, euren Töchtern gebührt es, drei Königssöhne zu heiraten; ich aber wünsche mir nichts anderes, als in eurem Dienst als euer treuer Armaiinu zu sterben.«
Da wünschte er sich in seine frühere Gestalt zurück und wurde wieder der lahme einarmige Armaiinu, der er früher gewesen war, und blieb des Königs Türhüter, bis er starb. Die drei Prinzessinnen aber heirateten mit der Zeit drei edle Königssöhne, und blieben glücklich und zufrieden, und wir sind leer ausgegangen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
VOM RÄUBER, DER EINEN HEXENKOPF HATTE ...
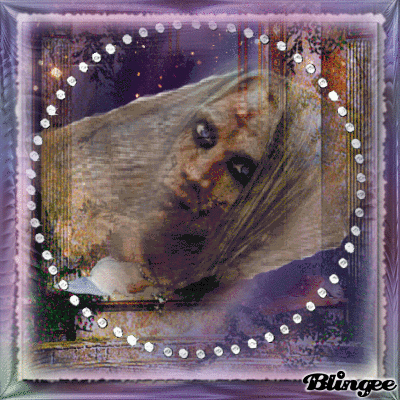
Es war einmal ein König, der hatte drei schöne Töchter, die Jüngste aber war die Schönste und Klügste. Eines Tages rief er sie und sprach zu ihr: »Komm mein Kind und lause mich ein wenig.« Das tat die jüngste Tochter und fand eine Laus. Da setzte der König die Laus in einen großen Topf mit Fett und ließ sie viele Jahre darinnen.
Als er aber eines Tages den Topf zerschlagen ließ, war die Laus zu einem solchen Ungetüm angewachsen, daß alle Leute davor erschraken und der König sie umbringen ließ. Dann ließ er ihr die Haut abziehen, nagelte sie über die Tür fest und sprach: »Derjenige, der erraten kann, von welchem Tier dieses Fell ist, der soll meine älteste Tochter zur Frau bekommen. Wer es aber nicht errät, der muß seinen Kopf dabei verlieren.«
Da kamen von nah und fern Prinzen und vornehme Herren und wollten die schöne Königstochter freien, aber keiner konnte das Rätsel erraten, und so mußten sie jämmerlich sterben.
Nun war auch ein Räuber, der lebte in einer wilden Gegend ganz allein. Der hatte einen Hexenkopf in einem kleinen Körbchen, bei dem holte er sich immer guten Rat, wenn er irgend etwas unternehmen wollte. Dieser Räuber hörte nun davon, wie so viele Freier das Leben ließen und keiner das schwere Rätsel heraus bringen konnte.
Da trat er vor seinen Hexenkopf und frug: »Sage mir, Kopf, von welchem Tier ist das Fell, das der König über seiner Tür angenagelt hat?« »Von einer Laus,« antwortete der Kopf. Nun war der Räuber guter Dinge und machte sich auf den Weg nach der Stadt. Unterwegs fragten ihn die Leute, wo er hin ginge. »Ich gehe nach der Stadt und will die älteste Königstochter freien,« antwortete er. »So geht ihr eurem gewissen Tode entgegen,« meinten die Leute.
Als er nun in die Stadt kam, ließ er sich bei dem König melden, er hätte auch Lust, das Rätsel zu erraten. Da ließ ihn der König herein kommen, zeigte ihm die Haut und frug: »Kannst du mir sagen, von welchem Tier dieses Fell ist?« »Von einem Hasen?« sagte der Räuber. - »Falsch!« - »Vielleicht von einem Hund?« »Falsch!« »Ist es vielleicht das Fell einer Laus?« Da hatte er es erraten und der König gab ihm seine älteste Tochter zur Frau.
Als nun die Hochzeitsfeierlichkeiten vorbei waren, sprach er zum König: »Ich will nun mit meiner Frau nach Haus zurück kehren.« Da umarmte die Königstochter ihren Vater und ihre Schwestern, und ging mit ihrem Manne fort. Nachdem sie lange, lange Zeit gewandert waren, kamen sie in eine wilde, einsame Gegend. »Ach,« sprach die Königstochter, »wohin führst du mich denn? Wie häßlich es hier ist!« »Komm du nur mit!« antwortete der Räuber.
Da kamen sie endlich an sein Haus, das war so finster und häßlich, daß die Königstochter wieder sagte: »Wohnst du denn hier? Ach, wie unfreundlich es hier ist!« »Komm nur herein,« antwortete der Räuber. Nun mußte die arme Königstochter in der Wildnis wohnen und hart arbeiten.
Am zweiten Morgen sprach der Räuber: »Ich muß nun meinen Geschäften nach gehen, besorge unterdessen das Haus.« Zu seinem Hexenkopf aber sprach er ganz leise: »Gib Acht, was sie über mich sagt.« Als nun der Räuber weg war, konnte es die Königstochter nicht mehr aushalten, und fing an über ihren Mann zu schimpfen, denn sie hätte ihn nicht gern geheiratet und konnte ihn nun vollends nicht leiden.
»Dieser Bösewicht!« sagte sie, »ich wollte doch, er bräche sich den Hals! Möge das Unglück ihn verfolgen!« und dergleichen mehr. Der Hexenkopf aber hörte alles mit an und erzählte es dem Räuber, als er nach Hause kam. Da ergriff der Räuber die Königstochter, schnitt ihr den Kopf ab und warf sie in ein Kämmerlein. Da drin waren noch viele andere Leichen von Mädchen, die er auf die selbe Weise umgebracht hatte.
Den nächsten Tag aber wanderte er wieder an den Hof des Königs. Als er nun zum König kam, frug ihn dieser: »Wie geht es meiner Tochter?« »Meine Frau ist wohl und munter,« antwortete der Räuber, »sie langweilt sich aber und möchte ihre zweite Schwester zur Gesellschaft haben.« Da gab ihm der König die zweite Tochter mit und er führte sie in jene wilde Gegend.
»Ach, Schwager,« sprach sie, »wie unheimlich ist diese Gegend! Wohin führt ihr mich denn?« »Komm du nur mit,« antwortete der Räuber. Als sie nun an das Haus des Räubers kamen, frug die Königstochter wieder: »Ach, Schwager, ist das eure Wohnung? dieses häßliche Haus?« »Komm nur herein,« sprach der Räuber. »Wo ist denn meine Schwester?« frug sie. »Um deine Schwester brauchst du dich nicht zu bekümmern, tue nur deine Arbeit.«
Also mußte die Königstochter harte Arbeit tun und ihr Herz ward immer mehr von Zorn und Haß gegen ihren Schwager erfüllt. Eines Tages nun sprach er zu ihr: »Ich muß meinen Geschäften nach gehen und komme erst heute Abend zurück.« Dann ging er auch zum Hexenkopf und sprach: »Gib Acht, was sie über mich sagt.« Damit ging er.
Die Königstochter aber machte ihrem Hass Luft, schimpfte über ihn, und nannte ihn einen Bösewicht und wünschte ihm alles Unglück. Als nun der Räuber nach Hause kam, sagte es ihm der Hexenkopf und der armen Königstochter erging es nicht besser als ihrer Schwester.
Nun wanderte der Räuber wieder zum König, der frug ihn, wie es seinen zwei Töchtern gehe. »O sehr gut,« antwortete der Räuber, »sie hätten aber gern ihre jüngste Schwester, um bei einander zu sein.« Da gab ihm der König auch die Jüngste mit. Die war aber sehr klug, und als sie in die Wildnis kamen, sprach sie: »Nein, Schwager, wie schön ist diese Gegend! Wohnt ihr hier?« Und als sie an das Haus kamen, sprach sie wieder: »Ei, was ist das Haus so schön!«
Als sie aber hinein gingen, hütete sie sich wohl, nach ihren Schwestern zu fragen, sondern ging fröhlich an ihre Arbeit. Nun ging der Räuber wieder seinen Geschäften nach und der Hexenkopf mußte auf alles achten, was die Königstochter sagen würde.
Als sie nun ihre Arbeit fertig hatte, kniete sie nieder und betete laut für den Räuber, dem sie alles Gute wünschte, in ihrem Herzen aber wünschte sie, es möchte ihm ein Unglück begegnen. Am Abend kam der Räuber und frug gleich den Hexenkopf: »Nun, was hat sie von mir gesagt?« Da antwortete der Kopf: »Ach, so Eine haben wir noch nicht hier gehabt! Sie hat den ganzen Tag gebetet und fromme Wünsche für dich getan!«
Da war der Räuber sehr erfreut und sprach zur Königstochter: »Weil du vernünftiger gewesen bist, als deine Schwestern, so sollst du es gut bei mir haben und ich will dir auch zeigen, wo deine Schwestern sind.« Da führte er sie in das Kämmerlein und zeigte ihr die toten Schwestern. »Ihr habt wohl daran getan, sie zu töten, Schwager, wenn sie euch nicht geehrt haben,« sprach die kluge Königstochter. Nun hatte sie es gut bei dem Räuber und war Herrin im Haus.
Eines Tages aber, da der Räuber wieder einmal auf mehrere Tage fort gegangen war, kam sie von ungefähr in sein Zimmer, und als sie die Augen aufhob, erblickte sie den Hexenkopf. Der war in seinem Körbchen oberhalb des Fensters angenagelt. Weil sie aber so klug war, so rief sie dem Kopf zu: »Was machst du da oben? Komm doch herunter zu mir, hier kannst du es viel besser haben.« »Nein,« antwortete der Kopf, »ich befinde mich hier oben ganz gut, und habe keine Lust, hinunter zu gehen.«
Die Königstochter aber schmeichelte dem Hexenkopf, also daß er sich betören ließ und endlich herunter stieg. »Was hast du für struppiges Haar,« sprach die Königstochter, »komm mit mir, ich will dich fein machen.« Da folgte ihr der Hexenkopf in die Küche, und die Königstochter nahm einen Kamm und begann den Kopf zu kämmen.
Sie hatte aber gerade den Ofen geheizt, um das Brot zu backen. Während sie nun das Haar kämmte, wand sie sich leise den langen Zopf um den Arm, und mit einem Male schleuderte sie den Kopf in den Ofen, machte die Ofentür zu und ließ ihn ruhig verbrennen. An den Kopf aber knüpfte sich das Leben des Räubers und während er nun verbrannte, fühlte der Räuber auch seine Gesundheit und sein Leben schwinden und starb.
Die Königstochter aber war an dem Fenster hinauf gestiegen, wo noch das Körbchen hing, in welchem der Kopf gehaust hatte. Dort fand sie ein kleines Töpfchen mit Salbe und als sie damit ihre Schwestern bestrich, wurden sie wieder lebendig. Da bestrich sie auch alle die anderen Mädchen und jede nahm sich von den Schätzen des Räubers, so viel sie tragen konnte; dann kehrten sie alle zu ihren Eltern zurück.
Die drei Schwestern aber kamen zu ihrem Vater und lebten mit ihm glücklich und zufrieden, bis sie drei schöne Prinzen heirateten.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DIE KRANKE PRINZESSIN ...
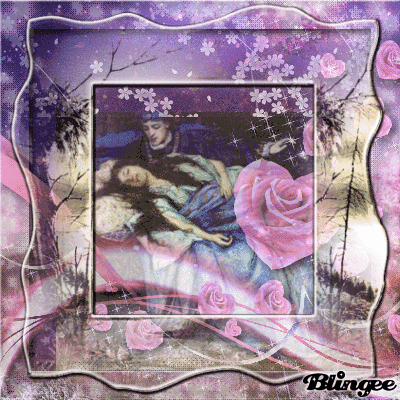
In der Hauptstadt eines großen Reiches herrschte tiefe Trauer. Kam ein Fremder und fragte nach der Ursache, so gaben ihm gleich zehn für Einen zur Antwort, die schöne und einzige Tochter ihres geliebten Königs liege schwer krank darnieder, sie rühre sich nicht mehr und esse und trinke nichts, so dass man nur aus dem schwachen Atem entnehmen könne, sie sei noch am Leben. Die Ärzte seien schon zu Hunderten gerufen worden und hätten Tausende von Mitteln versucht, aber alles umsonst.
Und auch wenn der Fremde dies gehört hatte, so brauchte er nur noch an den Straßenecken stehen zu bleiben und zu lesen: da stand überall gedruckt, der König wolle seine Tochter demjenigen zur Frau geben, der sie retten würde und damit niemand an der Richtigkeit dieses Versprechens zweifle, hatte der König selbst seine Unterschrift beigefügt.
Fern von der Hauptstadt wanderte ein Jüngling seiner Wege. Er war gar sittsam und schön gewachsen mit frisch roten Wangen und fröhlichem Sinne, obwohl er elternlos in der Welt allein stand und am Gelde, das er hatte, nicht schwer trug. Aber ganz ohne Sorge um seine Zukunft war er doch nicht und so kam es, dass er unversehens in einen Wald geriet, sich verirrte und keinen Ausweg mehr fand.
So lief er den ganzen Tag, stieg über manchen nieder gebrochenen Baum und wand sich durch manches dichte Gebüsche, bis er beim dämmernden Zwielicht des Abends neben einem großen Baum eine Einsiedler Klause sah. Er ging darauf zu und bat den alten weißbärtigen Einsiedler um Nachtherberge.
Dieser erwiderte: »Recht gerne; allein ich habe ober meiner Klause nur einen Dachboden mit weichem Moos Lager, wo ich dich hinlegen kann. Da magst du wohl weich schlafen, aber ich will dir auch sagen, dass da schon Mancher abends auf der Leiter hinauf gestiegen und morgens nicht wieder zurück gekommen ist.« »Ich fürchte mich nicht«, sagte der Jüngling, »ich habe ein rein Gewissen und mag es daher wohl versuchen.«
Der Einsiedler teilte mit dem Gast den kärglichen Abendimbiss mit einem Krug schlechten lauen Regenwassers; dann führte er ihn zur Leiter, der Jüngling stieg hinauf und schlief, müde wie er war, bald ein.
Um Mitternacht erwachte er, es war ihm, als habe er im Traum flüstern und kichern gehört. Und richtig, als er auf den großen Baum hinüber sah, den er am Abend neben der Klause bemerkt hatte, erblickte er dort viele Hexen, die sassen auf den Ästen und hatten sich gar viel zu erzählen. »Aber wo bleibt denn heute unser Pantoffel (la nostra ciabatta)?« fragten mehrere.
Und sogleich erschien auch die gerufene gar kleine und hässliche Hexe und erzählte mit boshafter Schadenfreude, wie sie in dieser und dieser Stadt die Tochter des Königs so behext habe, dass sie wohl bald sterben müsse. Der König habe bereits alle Ärzte im Lande gerufen, aber keiner wisse da zu helfen. »Und wäre denn gar kein Mittel mehr?« fragten die Anderen.
»O ja«, erwiederte die Kleine. »Man dürfte nur diesen Baum hier neben der Klause ausgraben und eine Wurzel davon in dem Wasser der Quelle sieden, die unter dem Baum fließt. Gäbe man dieses Wasser dann der Prinzessin zu trinken, so würde sie noch in der selben Stunde gesund sein. »Aber«, fügte sie höhnisch lachend hinzu, »wer hat wohl in der großen Stadt eine Ahnung davon? Die schöne Prinzessin muss ihr junges Leben lassen.«
Sie sprachen noch vieles, bis im Osten der Tag graute. Dann flogen sie schwirrend davon, wie ein Schwarm Vögel, welche der nahende Jäger aufschreckt. Der Jüngling hatte sich alles wohl gemerkt. Der Einsiedler war erstaunt ihn am Morgen so frisch und gesund wiederkehren zu sehen und erzählte ihm, wie er schon lange Jahre in dieser Wüstenei lebe und ihm nichts fehle, als eine Quelle frischen Wassers.
Das kam dem Jünglinge gelegen und er verhieß dem Einsiedler eine reiche Quelle, wenn er ihm erlaube, jenen Baum aus zu graben. Der Alte wollte anfangs davon nichts hören; endlich aber gab er den Bitten des Jünglings nach, holte Schaufel und Hacke und beide machten sich daran den Baum aus zu graben. Es war ein schweres Stück Arbeit und es dauerte lange; endlich aber neigte sich der Baum immer mehr und fiel bald ganz um.
Während der Baum noch fiel, sprang auch schon eine volle reiche Quelle des reinsten und besten Trinkwassers empor. Der Einsiedler wusste sich vor Freude fast gar nicht zu fassen; der Jüngling aber schnitt so gleich einige Wurzelenden ab, ließ sich vom Einsiedler ein Fläschchen geben und füllte es mit Wasser. Beides barg er sorgfältig an seinem Leibe und machte sich dann unverweilt auf den Weg, nach dem er zuvor noch den Einsiedler, der ihm gar nicht genug danken konnte, um die Lage jener Stadt und die Richtung des Weges dahin befragt hatte.
Er wanderte unermüdlich weiter und weiter und als am Morgen des dritten Tages die Sonne aufging, stand er schon an der breiten und hohen Treppe, welche in die Königsburg hinaufführte. Sogleich kamen die Diener und fragten ihn, was er wolle. Dann berichteten sie dem König, es sei ein junger Mann da, der mache sich erbötig, die Prinzessin unverzüglich zu heilen. Der König ließ ihn vor und da ihm das einnehmende sittige Wesen des Jünglings gefiel, gestattete er ihm den Heilungsversuch zu machen.
Der Jüngling ließ sich in die Küche führen, entfernte die Dienerschaft und tat, was er zu tun hatte. Hierauf trat er in das Zimmer der Kranken und flösste ihr einige Tropfen des Wunderwassers in den Mund. Sogleich schlug sie die Augen auf und es dauerte nur wenige Stunden, so hatte sie auch schon frisch und gesund ihr Schmerzenslager verlassen.
Der König hielt sein Versprechen um so lieber, je mehr der Jüngling auch der Prinzessin gefiel und bald wurde eine so lustige Hochzeit gehalten, wie im ganzen weiten Reiche nie eine war und auch in tausend Jahren keine mehr sein wird. Das neu vermählte Paar lebte glücklich und zufrieden und wenn der Leser noch mehr wissen will, braucht er bloß in alten Chroniken nachzublättern; denn da wird geschrieben stehen, dass der glückliche Arzt seiner Zeit auch König geworden ist und das Land gerecht, weise und milde regiert und von manchen alten Schäden geheilt hat.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DER KÖNIG DER SIEBEN SCHLEIER ...
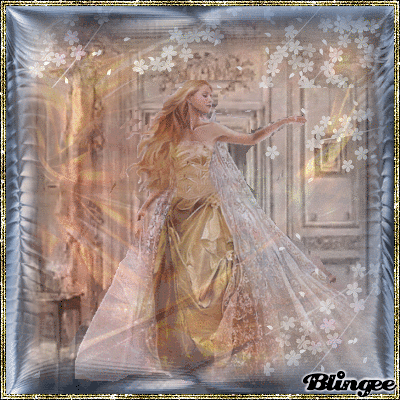
Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten alles, was sie sich nur denken konnten, nur eines fehlte ihnen zu ihrem Glück - sie hatten keine Kinder. Und sie härmten sich darob viele Jahre lang, und es bekümmerte sie so, daß sie sich vielleicht zu Tode gegrämt hätten, wenn ihnen nicht zu guter Letzt doch noch ein Kind geboren worden wäre, ein Mädchen, schön wie eine Rosenknospe.
Ihr könnt euch vorstellen, wie sie sich freuten! Aber in ihre Freude war ein Blättchen Bitterkraut gemischt. Kaum war nämlich die Prinzessin zur Welt gekommen, weissagte der Hofsterndeuter, es erwarte sie das Schicksal, sich in den ersten Mann zu verlieben, dem sie begegne, und das werde ihr zum Verderben gereichen.
Der König und die Königin erschraken. Einen Kummer hatten sie glücklich hinter sich, und schon sollte ein neuer folgen? Um ihn zu verhüten, ließen sie für ihr Töchterlein einen schönen Palast erbauen und von einer hohen Mauer umgeben. Den Garten hinter dieser Mauer durfte bei Todesstrafe kein Mann betreten. Nur Ammen und Dienstmägde durften hinein, und denen war es strengstens verboten, vor der Prinzessin von Männern zu sprechen. Der einzige Mann, den das Mädchen bis zu seinem siebzehnten Geburtstage kannte, war ihr Vater, der König.
Aber je mehr sie die Welt vor ihrer Tochter verbargen, desto neugieriger wurde die Prinzessin. Wo sie nur konnte, lief sie ihrer Amme davon, irrte allein im Hause umher, als suchte sie einen Weg hinaus, und eines Tages gelangte sie in eine verlassene Dachkammer und erblickte hoch oben, fast an der Decke, ein halboffenes Dachfenster. Das Mädchen zog ein Tischchen unter das Dachfenster, stellte einen Schemel darauf, kletterte hinauf und schaute hinaus.
Draußen schneite es, und auf dem Wege längs der hohen Mauer gingen zwei dicht vermummte Gestalten. Sie sprachen miteinander, und ihre Stimmen schollen hinauf zu der Prinzessin. "Siehst du das Blut und den Schnee?" sagte die erste. "Wenn jemand einen so roten Mund und eine so weiße Haut hätte, wäre das eine Schönheit, die ihresgleichen nicht hätte. Aber solch einen Menschen gibt es nicht." "O doch", antwortete die zweite. "Den König der sieben Schleier, der ist der schönste Mann der Welt!" Und dann verschwanden die Gestalten im Schneetreiben.
Die Prinzessin mußte immer wieder an dieses Gespräch denken. Der König der sieben Schleier ging ihr nicht aus dem Sinn. Seinetwegen konnte sie nicht mehr essen, seinetwegen konnte sie nicht mehr schlafen, müde und matt wankte sie in ihrem Palast umher, die Amme dachte schon, sie sei krank. Auch ihrem Vater fiel ihr verstörtes Wesen auf, als er sie einige Tage später besuchen kam.
Er fragte: "Was hast du denn, Töchterchen?" "Nichts, Vater", antwortete die Prinzessin, "ich habe mich bloß in den König der sieben Schleier verliebt."
Wie da der König erschrak! "Was fällt dir denn ein, Tochter! Der König der sieben Schleier ist doch der schönste Mann der Welt! Der kann nur ein Mädchen zur Frau nehmen, das noch schöner ist als er selbst." Aber die Prinzessin kehrte sich nicht an seine Worte. "Wie er auch sein mag, wenn ich ihn nicht zum Mann bekomme, muß ich sterben."
Der König sah, daß es schlimm um seine Tochter stand, die Weissagung des Hofsterndeuters schien sich zu erfüllen. Betrübt nahm er von ihr Abschied, aber die Prinzessin hielt ihn am Mantel fest und wollte ihn nicht fort lassen, er solle sie mitnehmen und ihr versprechen, mit dem König der sieben Schleier zu reden. Was konnte der König da tun? Das Unglück war geschehen, er brauchte die Prinzessin nicht mehr von der Welt abzuschließen. Er nahm sie also mit, brachte sie in sein Schloß zurück und übergab sie der Obhut ihrer Mutter, er selbst aber begab sich mit seinem Gefolge in das Land des Königs der sieben Schleier.
Der Weg war weit, und als er endlich dort anlangte, ließ er sich so gleich beim König der sieben Schleier melden. Als er vor ihm stand, sprach er zu ihm: "Edler Herr, ich bin gekommen, dich um Rat und Hilfe zu bitten. Ich habe eine Tochter, und dieser Tochter war es bestimmt, sich in dich zu verlieben. Ich habe mich bemüht, es ihr auszureden, aber vergebens. Ich weiß, daß du kein Mädchen heiraten kannst, das nicht noch schöner ist als du. Aber was soll ich tun? Meine Tochter sagt, ohne dich müsse sie sterben. Rate einem unglücklichen Vater!"
Der König der sieben Schleier hörte dem König aufmerksam zu, dann lächelte er und nahm die sieben Schleier, die sein Gesicht verhüllten, einen nach dem anderen ab. Der alte König erblickte ein so unbeschreiblich schönes Antlitz, daß er den Anblick fast nicht ertragen konnte. Der König der sieben Schleier aber fragte: "Edler Herr, antworte mir, ist deine Tochter schöner?" Der arme alte König senkte den Kopf und seufzte: "Nein!"
Da sprach der König der sieben Schleier: "Dann bleibt ihr nichts übrig als zu sterben! Hier schicke ich ihr drei Geschenke: diesen Ring, an den Finger zu stecken, dieses Tüchlein, ihre Tränen damit zu trocknen, und diesen Dolch, sich das Herz damit zu durchbohren."
Und so kehrte der alte König trauriger nach Hause zurück, als er ausgezogen war. Er erzählte seiner Tochter, was der König der sieben Schleier ihm gesagt, und gab ihr auch die drei Geschenke. Die Prinzessin dankte ihrem Vater, dann sprach sie: "Wenn ich schon sterben soll, will ich es auf meine Weise tun. Laß mir einen Sarg aus Kristall machen und drei Kleider, ein Mondkleid, ein Sonnenkleid und ein Sternenkleid. Mit diesen Kleidern und den Geschenken des Königs der sieben Schleier will ich mich in den Sarg einschließen, und ihr laßt mich dann hinab ins Meer. Mögen mich die Wellen meinem Schicksal entgegentragen. Vielleicht wird es mir gnädiger sein als bisher."
Der alte König wollte zuerst davon nichts hören. Als er aber sah, wie die Prinzessin vor seinen Augen dahin siechte, willigte er ein und tat alles, was sie gewollt hatte. Er ließ ihr ein Mond-, ein Sonnen- und ein Sternenkleid machen, er ließ ihr einen Kristallsarg anfertigen, und als sie sich darin eingeschlossen hatte, senkte er ihn weinend hinab ins Meer.
Die Wellen trugen den kristallenen Sarg sehr lange und sehr weit, bis sie ihn endlich unter den Fenstern eines Palastes ans Land spülten. Gerade schaute die Schloßherrin, eine junge Königin, zum Fenster hinaus. Als sie auf den Wellen den funkelnden Sarg sah, schickte sie Diener hinab, um ihn aus dem Wasser zu fischen. Wie groß war aber ihr Erstaunen, als die Diener den Sarg in den Palast brachten und die Königin darin ein junges Mädchen erblickte, lebendig und schön wie eine Rose! Sie redete ihr freundlich zu, doch aus dem Sarge heraus zu kommen.
Da öffnete die Prinzessin den Sarg und erzählte der Königin ihre traurige Geschichte. Der Königin aber kam die Geschichte gar nicht so übermäßig traurig vor. "Weine nicht, Prinzessin!" tröstete sie das Mädchen. "An einen besseren Ort als mein Schloß hättest du gar nicht kommen können! Der König der sieben Schleier ist mein Bruder und besucht mich fast alle Tage. Es ist richtig, daß er sehr schön ist, aber du stehst ihm an Schönheit nicht nach. Bleibe bei mir als Hofdame, und wir werden sehen, was er von dir hält."
Schon am nächsten Tage kam der König der sieben Schleier seine Schwester besuchen. Die Königin hieß ihn willkommen, und als sie sich niedergesetzt hatten, ließ sie Wein bringen. Den Wein aber brachte die neue Hofdame. Sie hatte ihr Mondkleid angezogen, und dem König der sieben Schleier verschlug es ob ihrer Schönheit den Atem. Kaum hatte die Prinzessin das Zimmer verlassen, fragte er seine Schwester, wer denn das schöne Mädchen sei. Und die Königin sagte ihm, was sie wußte - die Wellen hätten sie in einem kristallenen Sarg ans Ufer gespült, und sie sei die Tochter eines mächtigen Königs. Nur von der Liebe der Prinzessin verriet sie ihm nichts.
Kaum war der König der sieben Schleier wieder fort gegangen, ließ die Königin die Prinzessin rufen und sagte: "Ich glaube, du hast meinem Bruder gefallen. Aber wir müssen es erst noch erproben. Wenn du ihm morgen Wein einschenkst, gieße ihm ein wenig über die Finger. Ich werde dich dafür auszanken, und wir werden sehen, was er dazu sagt."
Am nächsten Tage geschah alles, wie es die Königin bestimmt hatte. Der König der sieben Schleier kam, die neue Hofdame in ihrem schönen Sonnenkleide brachte den Wein, aber als sie ihm den Becher reichte, goß sie ein wenig über seine Finger. Die Königin gab der Prinzessin scharfe Worte, ja, sie versetzte ihr sogar einen Schlag. Da nahm der König der sieben Schleier die Prinzessin in Schutz, es sei seine Schuld, er habe nicht Acht gegeben, und die Prinzessin könne nichts dafür.
Am dritten Tage kam der König der sieben Schleier wieder, diesmal aber zeigte sich die Prinzessin nicht. Der König zögerte eine Weile, dann aber hielt er es nicht mehr aus und fragte seine Schwester, wo denn ihre neue Hofdame sei. "Ach das weiß ich gar nicht, wahrscheinlich ist ihr nicht wohl", antwortete die Königin. "Man hat mir gesagt, sie habe sich nieder gelegt, vielleicht hat sie sich so zu Herzen genommen, daß ich sie gestern schlug."
Der König der sieben Schleier war ganz erschrocken. "Sollten wir uns nicht nach ihr umsehen?" Die Königin tat zu erst, als ob ihr das nicht recht wäre, aber dann erhob sie sich und begleitete ihren Bruder in das Gemach der neuen Hofdame.
Die Prinzessin erwartete sie schon. Sie saß auf einem Stuhl in ihrem Sternenkleid, an der einen Hand den Ring, in der anderen das Tüchlein und auf dem Tisch den Dolch, den ihr der König der sieben Schleier einst geschickt hatte.
Der König erkannte seine Geschenke sogleich und wunderte sich. "Woher hast du den Ring, das Tüchlein und den Dolch?" Die Prinzessin antwortete errötend: "Mein Vater brachte sie mir von dem König der sieben Schleier. Diesen Ring sollte ich an den Finger stecken, mit diesem Tüchlein meine Tränen trocknen und mit diesem Dolch mir das Herz durchbohren, denn er wollte mich nicht zur Frau!"
Da sagte der König der sieben Schleier: "Warum hat mir denn dein Vater nicht gesagt, wie schön du bist? Wenn ich dich mit eigenen Augen gesehen hätte, nie hätte ich dir so schreckliche Gaben geschickt! Du bist ja siebenmal schöner als ich, und ich werde glücklich sein, wenn du mich nicht verschmähst und mich zum Mann haben willst!"
Und ob die Prinzessin wollte! Noch am gleichen Tage sandte sie einen Boten zu ihrem Vater und ihrer Mutter, und als sie alle beisammen waren, wurde die Hochzeit gefeiert in Pracht und Herrlichkeit.
Italienisches Volksmärchen
FANTA GHIRO SIEBENSCHÖN ...

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein König, der drei schöne Töchter sein eigen nannte. Die erste hieß Karolina, die zweite Asuntina, und die dritte Fanta Ghiro Siebenschön, denn sie war die schönste der drei Schwestern.
Der König aber hatte eine böse Krankheit, von der niemand ihn heilen konnte. Und darum verbrachte er seine Tage in seinem Schlafgemach. Darin hatte er drei Stühle, der eine war blau, der zweite schwarz und der dritte rot. Wenn seine Töchter ihm einen Guten Morgen wünschen kamen, achteten sie stets darauf, auf welchem er saß. War es der blaue, so bedeutete es Freude, war es der schwarze, so bedeutete es Tod, und war es der rote, so bedeutete es Krieg.
Eines Tages kamen die Prinzessinnen in das Schlafgemach ihres Vaters und sahen, dass der König auf dem roten Stuhle saß. Da sagte die älteste. "Was ist geschehen, teurer Vater?" Der König antwortete: "Ich erhielt einen Brief des Nachbarkönigs. Er erklärt uns den Krieg, und ich weiß nicht, was ich tun soll, denn ich bin krank und kann den Befehl über meine Soldaten nicht übernehmen, aber wo finde ich einen guten Heerführer?"
Da sprach die älteste Tochter, Karolina: "Dann will ich dein Heerführer sein. Du wirst sehen, dass ich es gut mache." Aber der König erwiderte: "Nein, meine Tochter, das ist keine Arbeit für eine Frau." Karolina aber ließ sich nicht abweisen und bat, es doch wenigstens mit ihr zu versuchen. Und der König sagte: "Also gut. Du sollst deinen Willen haben. Aber wenn du unterwegs an etwas Weibliches denkst, kehrst du unverzüglich nach Hause zurück."
Karolina willigte ein, und der König rief seinen treuesten Diener zu sich und befahl ihm, das Heer einzuberufen und mit der Prinzessin in den Krieg ziehen. Wenn Karolina aber unterwegs an etwas Weibliches denke, solle er sie unverzüglich mitsamt dem Heere zurückbringen.
Es wurde also ein großes Heer einberufen, und sie zogen in den Krieg, voran die Prinzessin, an ihrer Seite der getreue Diener. Sie ritten und ritten und waren schon ein hübsches Stück Weges geritten, als sie zu einem Röhricht kamen. Karolina konnte sich nicht enthalten auszurufen: "Ach, das schöne Schilfrohr! Das gäbe Spindeln!" Da ließ der Diener das Heer halten. "Nach Hause, Prinzessin! Ihr habt an Spindeln gedacht!" Und sie kehrten nach Hause zurück.
Am nächsten Tage kam Asuntina zum König, sie wolle das Heer befehligen. Und sie bat so lange, bis der König einwilligte, aber unter der gleichen Bedingung wie bei Karolina. Auch Asuntina kam nicht weit. Als sie zu dem Röhricht kamen, gab sie wohl keinen Laut von sich, dann aber ritten sie durch ein Wäldchen mit schönen, geraden Bäumen, und da seufzte die Prinzessin auf: "Ach, sind das schöne, gerade Bäume! Welch schöne Spinnrocken das gäbe!" Der getreue Diener ließ das Heer halten. "Nach Hause, Prinzessin! Ihr habt an Spinnrocken gedacht!"
Am dritten Tage trat Fanta Ghiro Siebenschön vor den König und bat ihn, ihr das Heer anzuvertrauen. Aber der König wollte davon nichts hören. "Du bist noch zu jung! Wenn deine beiden älteren Schwestern nicht bestehen konnten, wie solltest du bestehen?" Doch die Prinzessin ließ nicht locker, sie bat: "Versuche es wenigstens, lieber Vater, du wirst sehen, dass ich dir keine Schande mache.
Versuche es nur!" Und da meinte der König, er könne es ja immerhin einmal mit ihr probieren, und gab dem Diener die gleiche Weisung wie zuvor. Fanta Ghiro legte inzwischen ein Panzerhemd an, nahm Säbel und Pistole wie ein echter Soldat, und schon bald zog sie aus in den Krieg.
Sie ritten an dem Röhricht vorbei, sie ritten durch das Wäldchen, sie kamen bis an die Landesgrenze, und Fanta Ghiro hatte sich nicht ein einziges Mal verraten.
An der Grenze beschloss Fanta Ghiro, zu erst einmal mit dem feindlichen König zu sprechen. Er war ein ansehnlicher junger Mann, der Fanta Ghiro auf den ersten Blick gefiel. Und auch dem König gefiel der anmutige Heerführer. Und weil er ein kluger Mann war, kamen ihm Zweifel, ob es auch ein wirklicher Heerführer und nicht vielleicht eine Prinzessin sei. Sicher war er seiner Sache aber nicht, darum lud er Fanta Ghiro in sein Schloss ein, um, wie er sagte, den Krieg zu besprechen.
Kaum hatte der junge König sein Schloss betreten, eilte er zu seiner Mutter und sagte ihr, wen er als Gast mitgebracht habe: "Es ist Fanta Ghiro Siebenschön, mit zwei Augen tief und klar wie Seen, nur will mich dünken so von ungefähr, als ob der Prinz eine Prinzessin wär."
Da riet ihm die alte Königin: "Dann stelle ihn doch auf die Probe. Führe ihn in die Waffenkammer. Wenn es ein Mädchen ist, wird sie nichts anrühren, wenn es aber ein Mann ist, wird er jede Waffe versuchen." Ohne Zeit zu verlieren, befolgte der junge König den Rat seiner Mutter, aber Fanta Ghiro war schlau. Sie versuchte alle Säbel, schoss aus allen Flinten und Pistolen wie ein Mann.
Der König kam zu seiner Mutter zurück und berichtete ihr: "Es ist Fanta Ghiro Siebenschön, mit zwei Augen tief und klar wie Seen, nur will mich dünken so von ungefähr, als ob der Prinz eine Prinzessin wär, wenn er auch mit Waffen umgeht wie ein Mann."
Da riet ihm die Königin: "So führe ihn in den Garten. Wenn es ein Mädchen ist, pflückt sie eine Rose oder ein Veilchen und steckt es sich an die Brust. Wenn es aber ein Mann ist, bleibt er bei einem Jasminbusch stehen, pflückt eine Blüte ab, riecht daran und steckt sie sich hinters Ohr."
Der König führte also Fanta Ghiro in den Garten. Aber Fanta Ghiro war schlau. Sie pflückte eine Jasminblüte, roch daran und steckte sie sich hinters Ohr. Der König kam zu seiner Mutter zurück und sprach: "Es ist Fanta Ghiro Siebenschön, mit zwei Augen tief und klar wie Seen, nur will mich dünken so von ungefähr, als ob der Prinz eine Prinzessin wär, wenn er auch Jasmin pflückt wie ein Mann."
Als seine Mutter sah, wie ihr Sohn sich in Liebe zu Fanta Ghiro verzehrte, sprach sie: "Dann stelle ihn noch ein letztes Mal auf die Probe. Fordere ihn auf, am Mittag mit dir in dem Teich im Garten zu baden. Wenn es ein Mädchen ist, kommt sie bestimmt nicht." Der König lud also Fanta Ghiro ein, mit ihm baden zu gehen.
Aber Fanta Ghiro war schlau. Sie sagte: "Das passt mir gerade. Ich habe schon lange nicht gebadet. Aber erst morgen, heute habe ich keine Zeit." Darauf rief sie ihren getreuen Diener und sandte ihn auf dem schnellsten Pferde zurück zu ihrem Vater, ihm einen Brief zu überbringen. In dem Briefe bat sie ihren Vater, ihr unverzüglich durch seinen besten Reiter Botschaft zu schicken, er sei krank und wolle Fanta Ghiro vor seinem Tode noch einmal sehen.
Am nächsten Mittag wartete der junge König im Garten auf Fanta Ghiro. Als er sie von ferne kommen sah, warf er seine Kleider ab und sprang in den Teich. Fanta Ghiro aber sagte: "Gleich springe ich dir nach, jetzt bin ich noch zu erhitzt, ich muss mich erst ein wenig abkühlen." Das war natürlich nicht wahr. Fanta Ghiro wartete nur auf den Boten ihres Vaters. Und schon war er da.
Ehe sie der König ein zweites Mal auffordern konnte, ins Wasser zu springen, hörte man Pferdegetrappel, und Fanta Ghiro rief aus: "Da kommt in höchster Eile einer meiner Reiter! Gewiss bringt er Nachrichten für mich!" Und wirklich, kaum war der Reiter bei ihr angelangt, übergab er ihr einen Brief von ihrem Vater.
Sie öffnete ihn in großer Hast und Bestürzung, und als sie ihn gelesen hatte, sagte sie zu dem König: "Es tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten bekommen. Mein Vater ist auf den Tod erkrankt und will mich noch einmal sehen. Ich muss augenblicklich fort. Schließen wir Frieden, und wenn du willst, komme mich in unserem Königreich besuchen!"
Was blieb dem jungen König anderes übrig, als Fanta Ghiro fort zu lassen, ohne zu wissen, ob sie in Wirklichkeit eine Prinzessin war, und vor allem, ob sie ihn zum Mann haben wolle, wenn sie eine war. Aber Fanta Ghiro war schlau.
Bevor sie fort ritt, ging sie in ihr Gemach und ließ dort auf einem Tischchen ein Blatt Papier zurück, auf dem stand geschrieben: "Ich bin Fanta Ghiro Siebenschön mit zwei Augen tief und klar wie Seen. Und dass ich eine Frau im Männergewand, das hat der Herr König doch nicht erkannt!" Und dann ritt sie fort.
Dem jungen König war ohne Fanta Ghiro recht traurig zumute. Er wanderte in seinem Schlosse umher, und schließlich kam er auch in ihr Gemach und bemerkte das Blatt Papier auf dem Tischchen. Er nahm es in die Hand, las es und rannte zu seiner Mutter wie ein Wirbelwind. "Mutter, schau, ich habe es doch gleich gewusst, Fanta Ghiro ist ein Mädchen. Hier schreibt sie es selbst!"
Und ehe seine Mutter antworten konnte, ließ er seine Kutsche anspannen, sprang hinein, und fort ging es, so schnell die Pferde nur laufen konnten, zu Fanta Ghiro. Fanta Ghiro, war inzwischen längst bei ihrem Vater und erzählte ihm, wie es ihr ergangen sei und wie sie den Feind überlistet habe. Kaum war sie zu Ende, ertönte vom Hofe herauf Hufschlag und Lärm.
Die Kutsche mit dem jungen König war so eben angekommen. Die beiden Könige steckten so gleich die Köpfe zusammen zu einer langen Besprechung, und als sie alles gründlich bedacht und besprochen hatten, beschlossen sie, dass sie Frieden schließen und Fanta Ghiro und der ehemalige Feind heiraten sollten. Der junge König führte sie in sein Königreich, und als nach Jahren ihr Vater starb, wurde Fanta Ghiro Königin beider Reiche.
Quelle: Italienisches Volksmärchen
DIE ZWEI SCHWESTERN ...
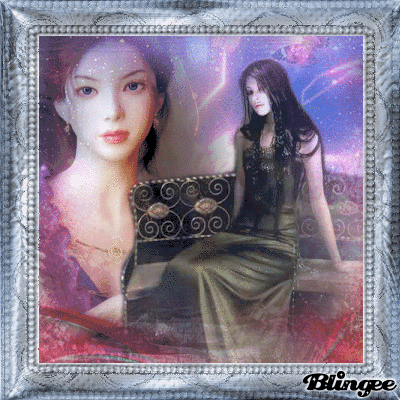
Es war einmal eine Mutter, die hatte eine Stieftochter und eine rechte Tochter. Die erstere war hässlich, aber fromm und seelengut, auch war sie demütig und gehorsam und hatte ein edles Herz. Die rechte Tochter dagegen war wohl schön, aber sie war stolz und hochmütig und hatte ein böses Herz. Die Mutter verfolgte die Stieftochter, wo sie konnte, während sie die andere begünstigte. Sie schickte die Stieftochter immer mit den Kühen auf die Weide und gab ihr viel Arbeit, aber wenig zu essen.
Einmal war das Mädchen wieder mit den Kühen auf der Weide. Da sass eine Alte am Wege und sagte: »Liebes Mädchen, mir krabbelt es so auf dem Kopfe, komm doch und sieh nach, was es sei.« »Ich möchte wohl gern«, sagte das Mädchen, »aber ich habe so viel zu spinnen und wenn ich damit nicht fertig werde, schilt mich die Mutter aus.« »Wohl«, sagte die Alte, »stecke den Rocken auf die Hörner jener Kuh und dann komm.«
Das Mädchen tat es und der Faden spann sich von selbst weiter; dann kam sie zur Alten und tat ihr den Willen. »Was habe ich auf meinem Kopfe?« fragte die selbe. »Gold und Silber!« sagte das Mädchen. »Wohlan«, rief die Alte, »Gold und Silber soll dein Teil sein.«
Als das Mädchen abends nach Hause kam, war es schön geworden und in seinen Haaren schimmerten und glänzten eine Menge von kleinen goldenen und silbernen Sternen. Das andere Mädchen aber wurde neidisch und am nächsten Tag trieb sie die Kühe auf die Weide.
Da sass wieder jene Alte am Wege und sagte: »Liebes Kind, mir krabbelt es so auf dem Kopfe, komm doch und sieh nach, was es sei.« Das Mädchen ging und tat ihr den Willen. »Was habe ich auf dem Kopfe?« fragte die Alte. »Läuse und Nisse!« sagte das Mädchen. »Wohlan«, erwiderte die Alte, »Läuse und Nisse sollen dein Teil sein!«
Als das Mädchen nach Hause kam, war sie hässlich geworden. Auf dem Kopfe aber wuchsen ihr die Haare wie ein Kuhschwanz und sie war immer fort voll Unsauberkeit.
So wurde die Demut belohnt und der Hochmut bestraft.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DER STÖPSELWIRTH ...

Er hatte ein schönes Haus und ein schönes Feld - der Stöpselwirt, der da - wir wissen nicht mehr genau, wo - vor Alters lebte und ein Wirtshaus von gutem Rufe sein nannte. Aber der gute Mann hatte ein zu weiches Herz und konnte keinen Armen hungern oder dürsten sehen; lieber gab er den letzten Bissen Brot im Kasten und den letzten Tropfen Wein im Keller her. So kam es denn endlich wirklich so weit, dass er nicht nur kein Brot und keinen Wein für sich selbst mehr hatte, sondern auch so in Schulden stak, dass man ihm sein Haus verkaufen und ihn fort jagen wollte.
Von denen, welchen er Gutes getan, kam keiner ihm Hilfe oder Trost zu bieten. Dagegen kam ein anderer, den der wackere Wirt in seinen guten Tagen nie hatte leiden mögen, der dachte: »Jetzt wird der Wirt mich willkommen heißen und mir keinen Trotz mehr bieten, denn er hat genug erfahren.« Das war aber der Teufel, der so dachte und er sagte zum Wirt: »Ich will dir Geld leihen auf sieben Jahre, denn dein Unglück dauert mich, du hast es wahrlich nicht verdient. Aber nach sieben Jahren musst du es mir zurück zahlen bei Kreuzer und Pfennig, kannst du es nicht oder fehlt auch nur ein roter Heller daran, so ist mir deine Seele verfallen.«
Der Wirt sah zwar, mit wem er zu tun hatte, allein er dachte: »die Bedingung ist ganz vernünftig und billig, denn zurück zahlen müsste ich es den Menschen auch, nicht bloß dem Teufel, ich will besser hausen.« Er schlug ein und der Teufel brachte ihm einen großen Sack voll Geld. Damit bezahlte der Wirt seine Gläubiger, lachte sie aus und setzte sein Haus in einen noch bessern Stand als zuvor.
Aber der Wirt hauste darum nicht besser. Wie zuvor unterstützte er jeden Armen und konnte seinem mitleidsvollen Herzen keinen Zwang antun. So kam es, dass es ihm bald wieder recht schlecht erging. Fast waren die sieben Jahre abgelaufen und traurig sass er einmal vor dem Hause. »Ist das auch recht,« sagte er zu sich selbst, »dass meine Seele dem Schwarzen gehören soll, weil ich zu wohltätig bin?«
Und so spann er seine trüben Gedanken weiter und weiter und bemerkte es anfangs gar nicht, dass drei arm aussehende Wanderer des Weges kamen, bis sie vor ihm standen und ihn um ein Almosen baten. »Gern gäbe ich euch Geld und zu essen und zu trinken«, sagte der Wirt, »aber ich habe in meinem Hause keinen roten Heller mehr.«
Die drei Wanderer aber waren unser Herrgott, St. Petrus und St. Johannes; da sagte unser Herrgott: »Du bist ein wackerer Mann, bitte dir drei Gnaden aus.« Und der Wirt antwortete: »Ich möchte gern drei seltene Stücke haben. Dort steht ein Feigenbaum, da möchte ich, dass der, welcher hinauf steigt, ohne meinen Willen nicht mehr herab komme.
In meiner Stube steht ein Canapè, da möchte ich, dass der, welcher sich darauf setzt, ohne meinen Willen nicht mehr weg komme. Endlich steht in der Ecke der Stube eine Kiste, da möchte ich, dass der, welcher die Hände hinein steckt, sie ohne meinen Willen nicht mehr heraus ziehe.« Da sagte unser Herr: »Wohlan, die drei Stücke sollst du haben, bleibe aber auch gut und mildtätig und es wird dir gut gehen.«
Als die sieben Jahre um waren, schickte der Teufel seinen ältesten Sohn hinauf, das Geld oder die Seele des Wirtes zu holen. Dieser stand gerade vor der Türe, als der Sohn des Teufels kam und sein Geld verlangte. »Das will ich gleich holen«, sagte der Wirt, »du kannst inzwischen dort auf den Feigenbaum steigen und Feigen essen.« Der Sohn des Teufels stieg auf den Baum und aß Feigen, der Wirt ging hinein, kam bald wieder zurück und rief: »Jetzt komm und nimm dein Geld!«
Der Sohn des Teufels wollte herab steigen, aber er konnte nicht und schrie in einem fort: »Ich kann nicht! Ich kann nicht!« »Nun, wenn du nicht kannst«, sagte der Wirt, »so geht es mich weiter auch nichts mehr an und ich trage mein Geld wieder hinein.« Er trug es hinein und kam mit einem Stocke wieder heraus. »Ist das eine Art«, rief er, »auf fremder Leute Bäume zu steigen und dann gar nicht mehr herab kommen zu wollen?« Darauf bläute er den Sohn des Teufels tüchtig durch und ließ ihn laufen.
Als der Teufel gehört hatte, wie es seinem ältesten Sohne ergangen sei, schickte er seinen zweiten Sohn hin. Dieser trat in die Stube, wo der Wirt eben war und sagte: »Gebt mir mein Geld!« Da sagte der Wirt spöttisch: »Willst du nicht auch Feigen essen gehen?« Der Sohn des Teufels aber schrie voll Zorn: »Meinst du, du könntest mich auch hintergehen wie meinen Bruder? Ich bin pfiffiger und steige dir nicht auf den Feigenbaum. Jetzt aber bringe mir mein Geld oder ich führe deine Seele zur Hölle.«
Da sprach der Wirt: »Nun, ich will es holen, warte ein wenig und setze dich inzwischen da auf das Canapè.« Der Sohn des Teufels setzte sich nieder, der Wirt aber ging in die Kammer, kam mit dem Gelde und legte es auf den Tisch. »Da hast du das Geld, jetzt sieh, dass du damit weiter kommst!« Aber der Sohn des Teufels rief kläglich: »Ich kann nicht! Ich kann nicht!« »Nun, wenn du nicht kannst oder nicht willst, schere ich mich auch nicht darum, ich will mein Geld wieder hin tragen, wo ich es her genommen habe.«
Er trug das Geld wieder in die Kammer und ließ den Teufel bis spät in die Nacht sitzen. Dann aber sagte er: »Höre, jetzt ist die Stunde, wo alle Leute heimgehen, gehe du auch!« Aber der Sohn des Teufels schrie: »Ich kann nicht! Ich kann nicht!« - »Wenn du nicht kannst oder nicht willst«, sagte der Wirt, »so will ich wohl ein wenig nachhelfen.« Und er holte wieder den Stock, bläute den Teufel durch, bis er windelweich wurde und als er glaubte, es sei genug, ließ er ihn laufen.
Als der Teufel davon gehört hatte, kam er selbst in großer Wut zum Wirt und verlangte sein Geld. Der Wirt sagte: »Nun, habe ich es nicht schon Euren beiden Söhnen geben wollen und sie haben es nicht genommen? Möchtet Ihr nicht auch einige Feigen, sie sind so süß?« Der Teufel aber schrie: »Meinst du, du könntest mich auch hintergehen wie meine zwei Söhne? Ich will keine Feigen, sondern mein Geld.«
Da sagte der Wirt: »Nun, dann will ich es Euch wohl aufzählen, setzt Euch doch auf das Canapè, Ihr seid gewiss müde.« Aber der Teufel wurde noch zorniger und schrie: »Setze sich auf dein Canapè, wer da will, ich will nur mein Geld!« Da versetzte der Wirt: »Nun, wenn Ihr keine Feigen wollt und vom Wege nicht müde seid, so sollt Ihr das Geld haben; zählt es Euch nur selbst aus jener Kiste heraus, es wird bis auf einige lumpige Kreuzer alles darin sein!«
Da fuhr der Teufel mit großem Ungestüm mit beiden Händen in die Kiste, merkte aber bald, dass er der Betrogene sei. »Nehmt Euch das Geld doch heraus!« sagte der Wirt. »Ich kann nicht! Ich kann nicht!« schrie der Teufel und stampfte vor Wut. Der Wirt aber schmunzelte und griff nach dem Stock. Da erschrak der Teufel und verlegte sich auf das Bitten, in dem er versprach, auf das Geld verzichten zu wollen, wenn er ihn frei lasse.
»Wollt Ihr aber auch für immer und ewig auf meine Seele verzichten und allen Anschlägen auf mich und mein Haus entsagen?« fragte der Wirt. »Das will ich«, versprach der Teufel. Da ließ ihn der Wirt frei und der Teufel fuhr mit Gestank von dannen zur Hölle.
Der Wirth aber lebte noch lange Jahre als wackerer Mann; endlich starb er. Er ging zum Himmelstor und verlangte Einlass, aber St. Petrus erkannte ihn nicht mehr oder der Wirt hatte doch etwas verschuldet - kurz, St. Petrus wollte ihn nicht einlassen.
Nun ging er zur Hölle, aber die Teufel heulten schon, als sie ihn von weitem sahen und schlugen das Höllentor ihm vor der Nase zu. Da ging er wieder zum Himmelstor und wartete, bis einige fromme Seelen kamen. Als St. Petrus diesen das Tor aufmachte, warf der Wirt seinen Hut hinein und wollte selbst mit gehen, aber St. Petrus hielt ihn zurück. »So lass mich doch meinen Hut holen!« sagte der Wirt und als St. Petrus dies erlaubte, ging er hinein und stellte sich auf seinen Hut. »Nun stehe ich auf meinem Eigen!« rief er und St. Petrus musste ihn darauf lassen.
Und so sitzt er noch heute darauf gerade neben dem Schmiede von Rumpelbach und beide sind andächtig versunken in den Anblick der himmlischen Freuden und Seligkeiten.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
VOM SCIAURANCIOVI ...

Jetzt hört auch noch die Geschichte von Sciauranciovi, der war eben so klug als Ferrazzanu. Es begab sich einmal, daß dem Sciauranciovi all sein Geld ausgegangen war und er nur noch einige Thaler hatte. Er kannte aber einen Edelmann, der war sein Gönner, und kam jeden Tag, um ihn zu besuchen.
Als es nun bald um die Zeit war, wo er zu kommen pflegte, ging Sciauranciovi in den Stall, und klemmte seinem Esel die wenigen Thaler, die er noch hatte, unter den Schwanz. Bald darauf kam auch der Edelmann, und da er ihn im Stalle sah, trat er zu ihm, und frug ihn, was er da mache. »Ach, Excellenz,« erwiderte Sciauranciovi, »wenn ihr wüßtet, was mein Esel für eine herrliche Kunst besitzt! Es ist ein Goldesel und gibt mir lauter harte Thaler.« Dabei kitzelte er den Esel ein wenig, daß dieser den Schwanz aufhob und die Thaler fallen ließ.
Als der Edelmann das hörte, rief er so gleich: »Höre einmal, Sciauranciovi, das Tier mußt du mir verkaufen. Wie viel willst du dafür?« »Ich? gar nichts,« antwortete Sciauranciovi, »das Tier ist mir nicht feil, denn wie könnte ich sonst mich und meine Frau ernähren?« Der Edelmann aber bat ihn: »Ich gebe dir was du willst, aber den Esel mußt du mir verkaufen.« »Gut denn,« sagte endlich Sciauranciovi, »weil ihr es seid, so will ich euch den Esel für vierhundert Unzen lassen.« »Bist du toll! vierhundert Unzen für den alten Esel?« rief der Edelmann. Sciauranciovi aber bestand darauf, also daß der Edelmann endlich einwilligte, und ihm den Esel für vierhundert Unzen abkaufte.
Nun war Sciauranciovi hoch erfreut, und aß und trank was sein Herz begehrte. »Was wird aber der Edelmann dazu sagen, wenn er sieht, daß du ihn gefoppt hast,« sagte seine Frau. »Dafür laß du mich sorgen,« antwortete Sciauranciovi.
Als es nun am anderen Tage um die Zeit war, wo der Edelmann zu kommen pflegte, befahl er seiner Frau, in der Küche einige Steine aus dem Boden auszubrechen. In dieses Loch mußte sie die brennenden Kohlen schütten, es mit Steinen verdecken, und endlich den Kessel mit dem kochenden Gemüse darauf stellen, welches also lustig weiter brodelte.
Nicht lange, so kam der Edelmann, voll Zornes, daß er einen schlechten Esel für vierhundert Unzen gekauft hatte, und fuhr den Sciauranciovi an: »So betrügst du mich also, nach dem ich so viel für dich getan habe!« »Ich? euch betrügen?« entgegnete Sciauranciovi, »wie sollte mir so etwas einfallen?« »Ja, hast du mir nicht einen Esel verkauft, den du für einen Goldesel ausgabst, und der nur ein ganz gewöhnlicher Esel ist, der mir noch keinen Thaler gegeben hat.« »Nun soll ich noch gar schuld daran sein,« klagte Sciauranciovi, »ihr habt doch gestern mit euren eignen Augen gesehen, wie der Esel mir die harten Thaler gab, und wenn er es nun bei euch nicht mehr tut, so ist es ein Zeichen, daß er durch den Wohnungswechsel seine Tugend eingebüßt hat.«
Der Edelmann ließ sich beruhigen, und als er am Boden das kochende Gemüse sah, frug er ganz erstaunt, wie das zugehe. »Ja,« erwiderte Sciauranciovi, »der Kessel hat eben eine besondere Tugend. Wenn meine Frau nur Wasser und Gemüse oder Fleisch hineintut, so kocht der Kessel es ganz von selbst gar, und sie kann ihn stehen lassen, wo sie will.«
Der Edelmann ließ sich wieder durch den klugen Sciauranciovi betören, und rief: »Du mußt mir den Kessel verkaufen, ich gebe dir dafür, was du willst.« »Nein,« antwortete Sciauranciovi, »das tue ich nicht, denn meinen Esel habt ihr mir schon verdorben, und ich habe ja nichts, womit ich mich und meine Frau ernähren kann.« Der Edelmann aber bat so lange, bis Sciauranciovi endlich sagte: »Nun denn, weil ihr es seid, so will ich euch den Kessel für dreihundert Unzen lassen.«
»Was! den alten Kessel für dreihundert Unzen!« rief der Edelmann, Sciauranciovi aber meinte: »Es ist eben auch kein gewöhnlicher Kessel, und für weniger kann ich ihn nicht geben.« Also gab ihm der Edelmann die dreihundert Unzen, und nahm den Kessel nach Haus. »Was willst du heute zum Abendessen machen?« frug er seine Frau. »Gemüse!« antwortete sie. Da ließ sich der Edelmann das Gemüse geben, tat es mit Wasser und Salz in den Kessel, und setzte diesen auf den Boden.
»So,« sagte er, »nun können wir spazieren gehen.« »Bist du toll?« rief die Frau, »was soll denn das für ein Gericht geben?« »Dafür laß du mich nur sorgen,« sagte der Edelmann, und führte seine Frau spazieren, bis es zum Abendessen Zeit war. »Jetzt wollen wir nach Hause gehen,« sagte er dann, »da werden wir unser Gemüse gekocht und gut finden.« Als sie aber nach Hause kamen, stand der Kessel noch gerade so, wie sie ihn verlassen hatten, und sie hatten nun nichts zum Abendessen.
Da ward der Edelmann sehr zornig, und ging am anderen Morgen wieder zu Sciauranciovi. Der aber war schlau, und wußte wohl, daß der Edelmann sehr zornig sein würde. Also kam er zu seiner Frau, zeigte ihr zwei kleine graue Kaninchen, und sprach: »Ich lasse dir ein Kaninchen hier. Wenn nun der Patron kommt, so sage ihm, ich sei nicht zu Hause, du würdest mich aber rufen lassen. Dann sprich zum Kaninchen: 'Geh flugs, und rufe deinen Herrn,' und laß es laufen.« Also gab er der Frau das eine Kaninchen, und versteckte sich mit dem anderen in der Nähe des Hauses.
Nicht lange, so kam der Edelmann und frug nach Sciauranciovi. »Mein Mann ist nicht zu Hause,« sagte die Frau, »ich will ihn aber gleich rufen lassen. Schnell, mein Tierchen, geh hin zu deinem Herrn und rufe ihn.« Mit diesen Worten öffnete sie die Türe und ließ das Kaninchen laufen. Bald darauf kam Sciauranciovi ins Haus herein, und hielt in seinen Armen das andere Kaninchen, das er streichelte und herzte.
Darüber war der Edelmann so erstaunt, daß er seinen ganzen Zorn vergaß und ausrief: »Wie? Sciauranciovi! ist das Kaninchen wirklich gegangen dich zu rufen?« »Gewiß, Excellenz,« antwortete Sciauranciovi, »ich kann gehen wohin ich will, so findet mich das Tierchen doch immer, und deßhalb schickt meine Frau es mir nach, wenn Jemand nach mir fragt.« »Sciauranciovi,« sprach der Edelmann, »du mußt mir das Kaninchen verkaufen, ich gebe dir dafür so viel du willst.«
Sciauranciovi tat als wolle er nicht, endlich aber ließ er sich überreden, und sprach: »Weil ihr es seid, so will ich euch das Kaninchen für zweihundert Unzen verkaufen.« Da gab ihm der Edelmann zweihundert Unzen, und trug das Kaninchen nach Hause. Dort sprach er zu seiner Frau: »Ich gehe jetzt aus, wenn Jemand kommt und nach mir verlangt, so sprich du nur zum Kaninchen: 'Flugs, mein Tierchen, geh hin, und rufe deinen Herrn,' und laß es zur Tür hinaus laufen.«
Als der Edelmann eine Weile fort war, kam Einer, der mit ihm zu sprechen hatte. »Mein Mann ist nicht zu Hause,« antwortete die Frau, »ich will ihn aber rufen lassen.« Da sprach sie zum Kaninchen: »Flugs, mein Tierchen, geh hin und rufe deinen Herrn,« öffnete die Tür und ließ es hinaus laufen. Das Kaninchen aber sprang mit schnellen Sätzen ins Feld hinein und war nicht mehr zu sehen. Die Frau wartete und wartete auf ihren Mann, der erschien aber nicht, also daß der Andere ungeduldig wurde und wieder fort ging.
Als nun der Edelmann Abends spät nach Hause kam, erzählte ihm die Frau, was vorgefallen war. Da merkte er, daß Sciauranciovi ihn zum dritten Male betrogen hatte und schwur, sich zu rächen. Am anderen Morgen rief er vier starke Männer und gab ihnen einen großen Sack, da hinein sollten sie den Sciauranciovi stecken, und ihn ins Meer werfen. Er selbst ging mit, um zu sehen, daß Sciauranciovi auch wirklich umgebracht würde.
Die vier Männer kamen zu Sciauranciovi, steckten ihn mit Gewalt in den Sack, und trugen ihn fort. Als sie vor der Stadt draußen waren, wurde eben in einer kleinen Kirche zur Messe geläutet, und da der Edelmann ein frommer Mann war, so sprach er zu den vier Männern: »Wir wollen noch eben eine Messe hören, stellt den Sack so lange an die Mauer.« Das taten sie, und traten in die Kirche.
In der Nähe aber weidete ein Hirt seine Schafe und pfiff dabei ein Liedchen. Als das der kluge Sciauranciovi hörte, fing er in seinem Sack auf einmal an, zu schreien: »Aber ich will ja nicht, aber ich will ja nicht!« Der Schäfer hörte auf zu pfeifen, und schaute sich ganz verwundert um, wer denn da gesprochen habe.
Als er nun den Sack bemerkte, in welchem Sciauranciovi eben wieder schrie: »Aber ich will ja nicht!« näherte er sich ihm und frug: »Was willst du denn nicht? Warum schreist du so?« »Ach,« antwortete Sciauranciovi, »da wollen sie mich mit aller Gewalt zum König hin tragen, damit ich die schöne Königstochter heiraten soll; ich will aber nicht.« »Wäre ich doch an deiner Stelle!« rief der Hirte, »ich wollte die schöne Königstochter gleich heiraten!« »Weißt du was?« sprach Sciauranciovi. »Laß mich heraus, und nimm du meine Stelle ein, so ist uns Beiden geholfen.«
Der Hirte willigte mit großer Freude ein, band den Sack los und ließ den Sciauranciovi heraus. Dann kroch er selbst in den Sack, den Sciauranciovi fest zu band, und dann vergnügt mit der ganzen Schafherde fort ging.
Als die Messe zu Ende war, kamen der Edelmann und die vier Männer wieder aus der Kirche, luden den Sack auf, trugen ihn ans Meer und warfen ihn ins Wasser. »So!« dachte der Edelmann, »jetzt habe ich mich an dem unverschämten Menschen gerächt.« Als er aber zur Stadt zurück ging, siehe, da begegnete ihm Sciauranciovi, der vergnügt eine große Herde Schafe vor sich her trieb.
»Sciauranciovi? Wo kommst du denn her?« rief der Edelmann. »Ach, Excellenz, wenn ihr wüßtet, wie es mir ergangen ist,« erwiderte der kluge Sciauranciovi. »Als ihr mich ins Wasser werfen ließt, sank ich ganz sanft unter, und auf dem Boden des Meeres fand ich eine Menge Schafe; da trieb ich so viele zusammen, als ich nur konnte, und kam wieder herauf.« »Sind noch mehr Schafe da unten?« frug gleich der Edelmann. »Mehr als ihr euch denken könnt,« antwortete Sciauranciovi. »So führe mich gleich hin,« sprach der Edelmann, »damit ich mir meinen Teil hole.«
Also gingen sie ans Ufer, und der Edelmann kroch in den Sack hinein; den mußte Sciauranciovi zu binden und dann ins Meer werfen. Da sank der Edelmann unter und ertrank. Sciauranciovi aber trieb seine Herde nach Hause, und blieb von nun an vergnügt und zufrieden, wir aber sind leer ausgegangen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
CATTARINETTA ...
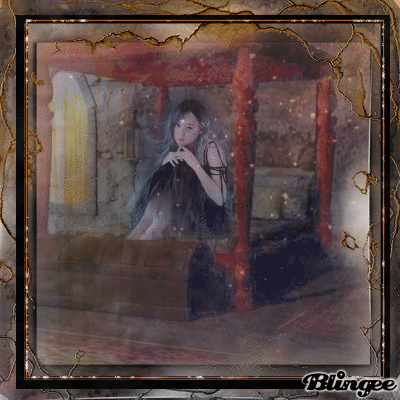
Es war einmal eine Mutter, die hatte ein Töchterlein, welches Kathrinchen hieß. Eines Tages wollte sie eine Torte backen und schickte das Mädchen zu ihrer Tante, einer bösen Hexe, um eine Pfanne zu entlehnen. Die Tante gab dem Mädchen die Pfanne; »aber merke es dir wohl«, sagte sie, »du musst mir auch ein Stück Torte bringen.«
Die Torte wurde gebacken und als sie fertig war, schnitt die Mutter ein Stück ab, legte es in die Pfanne und schickte das Mädchen damit zu der Tante. Das schöne Stück Torte reizte das Mädchen, sie zwackte auf dem Wege ein Stück nach dem anderen ab und aß es, bis nichts mehr in der Pfanne war. Da erschrak sie, wollte sich aber mit einer List helfen. Sie hob einen Kuhfladen vom Wege auf und legte ihn in der Pfanne zurecht, so dass es aussah wie ein Stück Torte mit der braunen Rinde. »Hast du mir die Pfanne und ein Stück Torte gebracht?« fragte die Tante, als Kathrinchen eintrat. »Ja,« sagte das Mädchen, stellte die Pfanne hin und machte sich eiligst davon.
Kathrinchen kam nach Hause und als es Nacht ward, ging sie zu Bette. Da hörte sie plötzlich die Stimme der Tante, welche rief: »Kathrinchen, ich komme, ich bin schon bei der Haustüre!« Das Mädchen kroch voll Schrecken ins Bett, aber die Stimme rief in kurzen Zwischenräumen nach einander: »Kathrinchen, ich komme, ich bin schon auf der Stiege!« - »Kathrinchen, ich komme, ich bin schon an der Türe!« - »Kathrinchen, ich komme, ich bin schon am Bette!« - Und gnaf - verschlang sie das Mädchen.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DER BLINDE ...
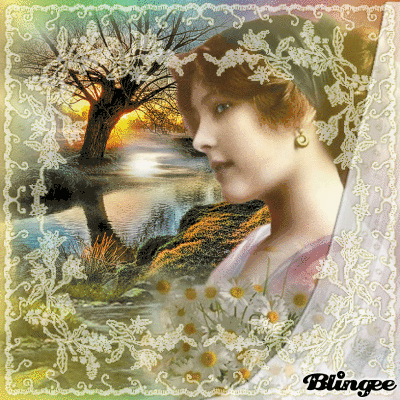
Eine arme Mutter hatte zwei Söhne, von diesen war der eine sehend, der andere aber blind. Der Sehende musste immer den Blinden herum führen und auf ihn Acht geben; aber nach und nach wurde er dieses Geschäftes müde und beschloss sich des Bruders zu entledigen.
Einmal befanden sich die zwei Knaben am Rande eines großen Waldes. Da kam dem Sehenden der böse Gedanke: »Wie wäre es, wenn ich den Blinden in den Wald führte und ihn dort allein ließe?« Sein Gewissen wollte freilich nicht zustimmen, aber er war der langen Führerschaft zu müde und sein Leichtsinn war zu groß. Er führte also den Blinden tief in den Wald hinein, hieß ihn dort sich niedersetzen und sagte: »Warte ein wenig, ich komme gleich wieder.« Dann schlich er sich davon und sann auf eine Lüge, die er der Mutter vorsagen wollte.
Der Blinde wartete und wartete, schon brach die Nacht herein, aber sein Bruder kam nicht. Bitterlich weinend sass er da und als er aus dem Schwirren der Fledermäuse und dem Krächzen der Nachteulen merkte, es sei Nacht geworden, tappte er herum, bis er zu einem Baum kam. Er fasste die Äste mit den Händen und kletterte hinauf, bis er zwischen dem Stamm und den Ästen ein bequemes Plätzchen fand, wo er die Nacht zubringen wollte. Aber es kam kein Schlaf in seine Augen.
Es war um Mitternacht, da hörte er ein Rauschen unter sich und darauf ein Flüstern weiblicher Stimmen, so dass er leicht merkte, dass es Hexen seien, welche unter dem Baum ihre nächtliche Zusammenkunft hielten. Die Eine erzählte dies, die andere jenes; endlich sagte die letzte: »Und ich habe heute zwei schöne Dinge getan. Zuerst habe ich in der nächsten Stadt die Tochter des Königs behext, so dass sie ganz blind geworden ist und ihr Leben in trauriger Finsternis zubringen muss.
Dann wohnt in einer anderen Stadt ein gar reicher Herzog, der hat einen schönen Garten mit sieben Brunnen und jeder Brunnen hat sieben Röhren und ist vom prächtigsten Marmor. Ich hätte dem stolzen Herrn gern auch einen Sohn oder eine Tochter behext, aber er hat keine Kinder, dafür habe ich aber alles Wasser in seinen Brunnen versiegen gemacht und aus all den sieben Mal sieben Röhren fließt kein Tröpfchen Wasser mehr, so dass der Herzog gar traurig ist.«
»Und gäbe es denn da gar kein Mittel zu helfen?« fragte eine der Hexen. »O ja«, erwiderte die andere. »Da ist unter einem Stein neben unserm Baum ein Öl; wer es findet und sich damit die Augen reibt, wird nicht nur sehend, sondern er sieht alles besser als sonst das gesundeste Auge. Der wäre im Stande, im Garten des Herzogs auch die sieben Kräuter zu finden, mit denen man die Brunnen Röhren einreiben muss, um das Wasser wieder fließen zu machen.«
Allmälig verstummten die Stimmen unter dem Baum, dem Knaben wurde es um die Augen heller und er wusste daraus, wie immer, dass der Tag angebrochen sei. Er hatte sich von den Reden der Hexen kein Wörtlein entgehen lassen und stieg nun vorsichtig nieder, bis er auf den Boden gelangte. Er tastete nun mit beiden Händen nach allen Richtungen und fand bald eine Steinplatte, welche er umlegte. Dann tauchte er die Finger in das Öl, welches darunter war, rieb sich damit die Augen und war sehend. Welche Freude!
Wie närrisch sprang er hin und her, sah bald hinauf zum wunderschönen blauen Himmel, bald auf den Waldboden, auf dem zitternde Lichter hin und her zuckten. Er dachte an sein vergangenes Leben, aber auch an die Armut seiner geliebten Mutter und da erinnerte er sich auch wieder an die blinde Königstochter und an den reichen Herzog mit seinen wasserlosen Marmor Brunnen.
Er füllte daher noch ein Fläschchen mit dem Öl und machte sich auf, um aus dem Wald hinaus zu gelangen. Als er einem Bauer begegnete, welcher mit zwei Ochsen in den Wald fuhr, war er über den ihm neuen Anblick so erstaunt, dass er den Bauer vorüber fahren ließ und dann noch eine Strecke weit zurück lief, um zu fragen, wo denn der Weg zur Stadt gehe.
Als er in der Stadt war, kaufte er einige alte Bücher und eine Brille, nahm die Bücher unter den Arm, setzte die Brille auf die Nase und ging gemessenen Schrittes in das königliche Schloss. Als die Diener ihn kommen sahen, da fragten sie nicht lange, sondern dachten sich gleich, das müsse ein zwar noch junger aber schon grundgelehrter Doktor sein und meldeten es augenblicklich dem König.
Dieser ließ den Doktor so gleich vor sich kommen und obwohl er sah, dass der selbe noch eher einem Knaben als einem Manne gleich sei, fasste er doch kein Misstrauen und versprach ihm, er werde ihm, wenn er seine Tochter heile, Geld geben, so viel er wolle, ja, die Prinzessin selbst solle, wenn er ihr gefalle, seine Frau werden.
Der junge Doktor machte wenig Umstände und ließ sich in das Zimmer führen, wo die blinde Prinzessin gar traurig da sass. Nun schaute er, obwohl er nicht lesen konnte, in seine Bücher und befahl allen auf einen Augenblick das Zimmer zu verlassen; dann nahm er das Öl heraus und rieb der Blinden damit die Augen. Kaum waren der König und die Königin wieder ins Zimmer getreten, kam ihnen die Prinzessin fröhlich entgegen, begrüsste lächelnd ihre Eltern und erklärte, dass sie wieder alles und noch besser als zuvor sehe.
Die Freude des Königs kannte keine Grenzen; er ließ ein Gastmahl nach dem anderen halten und endlich auch die Verlobung des jungen Doktors mit der Prinzessin feiern. Der selbe aber erklärte, vor der Hochzeit noch einige Kuren machen zu wollen, kleidete sich wieder als Doktor und ging zu Fuß in die Stadt, wo der reiche Herzog wohnte.
Die Wunderkräuter in seinem Garten fand er leicht und machte jeden Tag nur an Einem Brunnen seine Kur, bis endlich am siebenten Tage aus all den sieben Mal sieben Röhren noch reichlicheres und frischeres Wasser sprudelte als zuvor. Der Herzog war überselig und gab dem Doktor Geld wie Spreu und außerdem Kleider und wunderschöne Wagen und Pferde.
Damit fuhr der glückliche ehemalige Blinde seiner Heimat zu. Er fand seine Mutter im tiefsten Elend und schwach und krank; aber der Anblick von soviel Glück und die schönen Kleider, welche der Sohn ihr anzog, machten sie bald wieder gesund und fröhlich. Auch dem bösen Bruder wurde nach einer scharfen Strafrede verziehen und alle drei fuhren sie in die Stadt, wo die Hochzeit als bald stattfand und ein Paar vereinigte, wie es auf Erden nur selten je noch ein glücklicheres, nie aber ein besser und schärfer sehendes gegeben hat.
Sie lebten auch in bester Eintracht, denn sie sahen an sich gegenseitig nur Tugend und Liebe und wo sich etwa ein Fehlerchen einschleichen wollte, bemerkten es ihre scharfen Augen so gleich und es wurde beseitigt. Und als er mit der Zeit auch König wurde, hörten in seinem Reich alle früheren Misstände auf; da durfte es kein schlauer Spitzbube wagen, sich dem scharf sehenden König als Diener oder Ratgeber anzubieten.
Der Gerechtigkeit nahm der König auch ihre Binde von den Augen und sah doch oft noch besser als sie. Und die Untertanen bedauern es noch heute, dass selbiger König nicht mehr am Leben, sondern auch schon lange heimgegangen ist zu seinen Vätern.
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DIE ZWEI REITER ...

Zwei Reiter spielten mit einander. Der Eine gewann, der Andere verlor all sein Geld, zuletzt sogar seine Pferde. Da wagte er sich nicht mehr nach Hause und ging trübselig hinaus in den Wald. Es wurde Nacht und da er sein Nachtlager doch nicht auf harter Erde nehmen wollte, stieg er auf eine große Eiche mit mächtigen weit ausgebreiteten Ästen und suchte es sich dort bequem zu machen. Allein Kummer und Sorge ließen keinen Schlaf in seine Augen und keinen Trost in sein Herz kommen.
Um Mitternacht hörte er plötzlich Geräusche und ein Lichtschein fiel in seine Augen. Da erblickte er unter dem Baum mehrere Hexen, welche im Kreise sassen und einander von den Taten des abgelaufenen Tages erzählten. Zuletzt kam auch noch eine kleine besonders hässliche, welche hinkte.
»Und was hast denn du getan?« fragten die übrigen. »Ei, grösseres und mehr, als ihr alle zusammen«, antwortete die Kleine lachend. »Da ist in der nächsten großen Stadt ein König und eine Königin, die haben einen einzigen Sohn, den sie über alles lieben. Ich habe ihn behext und so krank gemacht, dass man meint, er müsse jeden Augenblick den Geist aufgeben. Und sterben muss er auch, denn wer soll ihm helfen?«
»Ja, wäre denn da gar keine Hilfe mehr möglich?« fragte eine der Hexen.
»O ja, ganz leicht,« erwiderte die hässliche Kleine. »Man müsse nur Pferdeschweiß nehmen und dem kranken Prinzen damit die Brust benetzen und einreiben, so stünde er gleich wieder heil und gesund auf. Aber gerade weil das Mittel so einfach ist, verfällt niemand darauf und der Prinz muss ins Gras beißen.«
Die Hexen sprachen noch verschiedenes, bis der Morgen graute und im nächsten Gehöft der Hahn krähte; dann löschten sie die Fackeln aus und flogen in den Lüften davon. Der Reiter auf dem Baum hatte sich von dem, was die Hexen gesprochen, kein Wörtchen entgehen lassen. So bald die Hexen fort waren, stieg er eiligst vom Baum herab und machte sich auf den Weg.
Die Sonne stand aber schon hoch am Himmel, als er durch die Tore, der in tiefe Trauer versunkenen Hauptstadt, wanderte. Rüstig schritt er der Königsburg zu und verlangte Einlass, indem er sich für einen Doktor ausgab, der weit her gekommen sei, um den Prinzen zu retten. Man wollte ihn nicht einlassen, denn der Mann sah eben nicht nach einem Doktor aus; als aber der König davon hörte, ließ er ihn dennoch so gleich in das Zimmer führen, wo der Kranke lag und verhieß ihm Gold und Ehren in Hülle und Fülle, wenn er seinen Sohn heilte.
Der Reiter ließ sich, nach dem er den Kranken besehen hatte, in den königlichen Marstall führen, suchte das schönste und fetteste Pferd aus und befahl die übrigen hinaus zu führen und ihn allein zu lassen. Dann jagte er das Pferd lange im Stalle hin und her, bis es von Schaum überdeckt war, nahm ein Fläschchen heraus und füllte es mit dem Schweiß des Pferdes.
Nun eilte er in das Krankenzimmer zurück, bestrich mit dem Pferdeschweiß die Brust des Kranken, rieb und rieb und sah dann ruhig der Genesung entgegen. Der Prinz fühlte sich so gleich erleichtert, in wenigen Tagen war er frisch und gesund und sah blühender aus als je zuvor. Dankbar überhäufte der König den Lebensretter seines Sohnes mit Gold und bot ihm die glänzendsten Ehrenstellen an; allein der Reiter zog es vor, als reicher Herr in seine bescheidene Heimat zurückzukehren.
Dort lebte er glücklich und angesehen und kam in die Lage, auch seinem sehr herab gekommenen einstigen Spielgenossen Wohltaten zu erweisen. Einmal erzählte er dem selben auch im Vertrauen, wie er zu seinem Geld und Glück gekommen sei. Da hatte dieser keine Ruhe mehr und wollte auf die selbe Weise auch reich werden.
Eines Abends stieg er auf die bewusste Eiche und erwartete dort die Stunde der Mitternacht. Sie schlug und mit ihr kamen auch die Hexen, welche sich im Kreise zusammen setzten und von ihren Taten erzählten.
»Und was hast denn du uns heute zu sagen?« fragten die anderen jene kleine hinkende Hexe, die früher den Königssohn behext hatte. Diese verzog ihr Gesicht in widerlicher Weise, so dass es noch doppelt so hässlich wurde und rief mit lauter Stimme: »Ich will, dass derjenige, der da oben auf dem Baum sitzt, uns zu belauschen, sogleich herab falle und sich den Hals breche!«
Und der Unglückliche fiel und brach sich den Hals. Am Morgen fand man ihn tot unter dem Baum liegen. -
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
VOM KLUGEN BAUER ...

Es war einmal ein König, der war auf die Jagd gegangen. Da sah er in einem Felde einen Bauer, der arbeitete. »Wie viel verdienst du wohl an einem Tage,« frug er ihn. »Königliche Majestät,« antwortete der Bauer, »vier Carlini den Tag.« »Was machst du denn damit,« frug der König weiter. Der Bauer sprach: »Den ersten esse ich; den zweiten lege ich auf Zinsen; den dritten gebe ich zurück; und den vierten werfe ich fort.«
Der König ritt seines Weges weiter; nach einiger Zeit aber kam ihm die Antwort des Bauers doch sonderbar vor; also kehrte er wieder um, und frug ihn: »Sage mir doch, was willst du damit sagen, daß du den ersten Carlino isst, den zweiten auf Zinsen legst, den dritten zurück gibst und den vierten weg wirfst?«
Der Bauer antwortete: »Mit dem ersten Carlino ernähre ich mich selbst; mit dem zweiten ernähre ich meine Kinder, die für mich sorgen müssen, wenn ich einmal alt sein werde; mit dem dritten ernähre ich meinen Vater, und gebe ihm damit zurück, was er an mir getan hat, und mit dem vierten ernähre ich meine Frau, und werfe ihn also fort, denn ich habe keinen Vorteil davon.«
»Ja,« sprach der König, »du hast Recht. Versprich mir aber, daß du keinem Menschen das selbe erzählen willst; nicht eher, als bis du mein Gesicht hundertmal gesehen hast.« Der Bauer versprach es, und der König ritt vergnügt nach Hause.
Da er nun mit seinen Ministern zu Tische saß, sprach er: »Ich will euch ein Rätsel aufgeben. Ein Bauer verdient vier Carlini den Tag; den ersten verzehrt er; den zweiten legt er auf Zinsen; den dritten gibt er zurück, und den vierten wirft er fort. Was ist das?« Es konnte aber keiner erraten.
Endlich dachte der eine Minister daran, daß der König den Tag vorher mit dem Bauer gesprochen hatte, und beschloss bei sich, den Bauer aufzusuchen, und sich die Lösung sagen zu lassen. Da er nun zum Bauer kam, frug er ihn um die Lösung des Rätsels. Der Bauer aber antwortete: »Ich kann sie euch nicht sagen; denn ich habe dem Könige versprochen, es niemanden zu erzählen, bevor ich nicht hundertmal sein Gesicht gesehen habe.«
»O,« meinte der Minister, »des Königs Gesicht kann ich dir wohl zeigen,« und zog hundert Thaler aus seinem Beutel, und schenkte sie dem Bauer. Auf jedem einzelnen Thaler aber war des Königs Gesicht zu sehen. Da der Bauer nun jeden Thaler einzeln betrachtet hatte, sprach er: »Jetzt habe ich hundertmal des Königs Gesicht gesehen; jetzt kann ich euch die Lösung des Rätsels wohl sagen,« und sagte sie ihm.
Der Minister aber ging vergnügt zum König und sprach: »Königliche Majestät, ich habe die Lösung des Rätsels gefunden; so und so lautet sie.« Da rief der König: »Das kann dir nur der Bauer selbst gesagt haben,« ließ den Bauer rufen, und stellte ihn zur Rede: »Hattest du mir nicht versprochen, es nicht zu erzählen, als bis du hundertmal mein Gesicht gesehen hättest?«
»Königliche Majestät,« antwortete der Bauer, »euer Minister hat mir auch hundertmal euer Bild gezeigt.« Damit wies er ihm den Sack mit Geld, den ihm der Minister geschenkt hatte. Da freute sich der König über den klugen Bauer, und beschenkte ihn reichlich, daß er ein reicher Mann wurde sein Leben lang.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
VOM GRÜNEN VOGEL ...
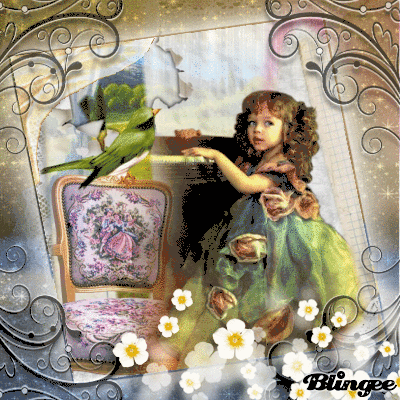
Es war einmal ein König, der hatte ein einziges Töchterlein, das er über alle Maßen liebte. Eines Tages, als er oben auf der Terrasse mit der kleinen Maruzza spielte, ging ein Wahrsager vorbei und schüttelte den Kopf, als er die kleine Königstochter ansah.
Da ward der König sehr zornig, und befahl, den Wahrsager zu ergreifen und vor ihn zu führen. »Warum hast du den Kopf geschüttelt, als du meine Tochter ansahst?« frug er ihn. »Ach, Majestät, ich habe es nur in Gedanken getan,« antwortete der Wahrsager. »Wenn du mir nicht so gleich antwortest,« sprach der König, »so lasse ich dich in den tiefsten Keller werfen.«
Da mußte der arme Wahrsager wohl gehorchen, und sprach: »Wenn die Königstochter elf Jahre alt sein wird, so wird ein schweres Schicksal sie erreichen.« Da ward der König tief betrübt und ließ in einer einsamen Gegend einen Turm ohne Fenster bauen, und sperrte sein Töchterlein mit seiner Amme hinein. Er kam aber und besuchte sie oft.
Maruzza wuchs heran, und wurde mit jedem Tage größer und schöner. Sie gaben ihr aber beim Essen das Fleisch immer ohne Knochen, damit sie sich kein Leid antun könne, und nahmen ihr auch Alles weg, womit sie sich verletzen konnte.
Als sie nun beinahe elf Jahre alt war, brachte ihr die Amme eines Tages einen Braten von einem Zicklein, in dem war ein spitzer Knochen zurück geblieben.
Als Maruzza den spitzen Knochen fand, wollte sie gerne damit spielen, und weil sie wußte, daß die Amme ihn ihr weg nehmen würde, so versteckte sie ihn hinter einer Kiste. Als sie nun allein war, nahm sie den Knochen wieder hervor, und fing an, die Mauer ein wenig aufzukratzen. Es war aber gerade eine hohle Stelle in der Mauer, so daß sie schnell ein kleines Loch gebohrt hatte; da bohrte sie immer weiter, bis das Loch so groß war, daß sie den Kopf hinaus stecken konnte.
Da sah sie alle die schönen Blumen und den blauen Himmel mit der Sonne, und freute sich darüber so sehr, daß sie den ganzen Tag dort hinaus schaute. Wenn aber die Amme ins Zimmer kam, so zog sie einen kleinen Vorhang vor das Loch. So trieb sie es mehre Tage, an dem Tage aber, wo sie elf Jahre alt wurde, in dem selben Augenblick, als sie in ihr elftes Jahr trat, rauschte es in den Lüften, und durch das Loch kam ein wunderschöner, leuchtend grüner Vogel herein geflogen, der sprach:
»Ich bin ein Vogel und werde ein Mensch,« und also bald ward er in einen schönen Jüngling verwandelt. Als Maruzza ihn sah, erschrak sie heftig, und wollte anfangen zu schreien, er bat sie aber mit freundlichen Worten, und sprach: »Edles Fräulein, fürchtet euch nicht vor mir, ich will euch ja kein Leid zufügen.
Ich bin ein verwunschener Prinz und muß noch manches Jahr verzaubert bleiben. Aber wenn ihr auf mich warten wollt, so sollt ihr einst meine Gemahlin werden.« Mit solchen Worten beruhigte er sie; nach einer Stunde wurde er wieder zum Vogel, und verließ sie mit dem Versprechen, am anderen Tage wieder zu kommen. Von da an kam er jeden Tag um Mittag, und wenn es Ein Uhr schlug, so verließ er sie wieder.
Als nun ein Jahr vergangen war, dachte der König: »Nun wird auch die Gefahr für meine kleine Maruzza vorüber sein,« und kam in einem schönen Wagen, und holte sie ab in sein Schloß. Als aber Maruzza in dem prächtigen Schlosse ihres Vaters wohnte, ward sie sehr traurig, denn der schöne, grüne Vogel kam nicht wieder zu ihr, und sie ward so schwermütig, daß sie gar nicht mehr lachen konnte, und immer in ihrem Zimmer blieb.
Da ließ der König im ganzen Lande verkündigen: »Wer die Königstochter zum Lachen bringen könnte, den wolle er reich beschenken.« Das hörte auch ein altes Mütterchen, das auf einem Berge wohnte, und machte sich auf, um zum König zu gehen. Wie die alte Frau nun ihres Weges zog, begegnete sie einem Maultiertreiber, der trieb sein Maultier vor sich her, das war mit Geldsäcken beladen.
»Gieb mir eine Handvoll von deinem Geld,« bat sie ihn. Der Maultiertreiber antwortete: »Hier kann ich dir nichts geben, wenn du aber mit mir kommst bis zu dem Schloß, wo ich die Säcke abliefern muß, so will ich dir einiges geben.« Da ging die alte Frau mit ihm, und er führte sie in ein wunderschönes Schloß, in welchem zwölf Feen wohnten.
Als sie nun die Treppe hinauf gestiegen waren, öffnete der Maultiertreiber seine Säcke, und ließ die Münzen auf dem Boden herum rollen. Da waren es aber so viele, daß die alte Frau am bloßen Ansehen genug hatte, und weiter nicht danach verlangte. Nun ging sie durch die Zimmer, um sie zu betrachten, und sah alle die kostbaren Schätze, die da angesammelt waren.
Alle die Stühle, die Tische, die Betten waren von lauterem Golde. Da kam sie in ein Zimmer wo ein gedeckter Tisch stand mit zwölf goldnen Tellern und zwölf goldnen Bechern, und dabei standen auch zwölf goldne Stühle. Da ging sie weiter, und kam in die Küche, da standen die zwölf Feen in einer Reihe, und jede hatte einen goldenen Herd, auf dem sie in einem goldnen Kessel kochte.
Als die Suppe fertig war, nahmen die Feen ihre Kessel vom Feuer und stellten sie auf den Tisch. Weil sie nun die alte Frau unbeachtet gelassen hatten, wurde sie vorwitzig und sprach: »Edle Frauen, ihr sagt mir nichts, so werdet ihr es mir auch nicht übel nehmen, wenn ich mich selbst bediene.« Da nahm sie einen goldnen Löffel, und schöpfte sich etwas Suppe. Als sie aber den Löffel zum Munde führen wollte, fuhr ihr die Suppe ins Gesicht, daß sie sich jämmerlich verbrannte.
In dem selben Augenblick rauschte es in den Lüften, und der grüne Vogel flog in den Saal. »Ich bin ein Vogel und werde ein Mensch!« sprach er, und wurde sogleich zum schönen Prinzen. Der jammerte aber laut und rief: »O, Maruzza, meine Maruzza, habe ich dich denn ganz verloren? Kann ich dich nirgends wiederfinden?«
Die Feen umringten ihn, um ihn zu trösten, die alte Frau aber verließ leise und unbeachtet das Schloß, und dachte: »Diese Geschichte muß ich der jungen Königstochter erzählen; wenn das sie nicht zum Lachen bringt, so ist wohl alles vergeblich.«
Als sie nun in das königliche Schloß kam, ließ sie sich beim König melden, und sagte ihm, sie sei gekommen, die Königstochter zum Lachen zu bringen. Der König führte sie hinein und ließ sie mit seiner Tochter allein. Nun begann die Alte zu erzählen, wie sie von dem Maultiertreiber in das schöne Schloß geführt worden sei, und wie sie sich den Mund verbrannt habe, als sie die Suppe versuchen wollte.
Maruzza aber fing an laut zu lachen, als sie diese Geschichte hörte. Das hörte der König draußen, und freute sich, daß es endlich jemanden gelungen sei, sein liebes Kind zum Lachen zu bringen. Die Alte aber sprach: »Hört mich nun noch zu Ende, Fräulein!« und erzählte ihr von dem grünen Vogel, der ein schöner Prinz geworden war, und immer nach seiner lieben Maruzza gefragt hatte.
Da wurde Maruzza noch froher, und sprach: »Mein Vater wird dir ein schönes Geschenk machen, von mir aber sollst du eben so viel bekommen, wenn du mich morgen um die selbe Stunde abholst, und heimlich in das Schloß der zwölf Feen führst.« Die Alte versprach es, und den nächsten Tag kam sie, und führte die Königstochter über Berg und Tal, einen weiten Weg, bis sie an das Schloß der zwölf Feen kamen.
Da saßen die zwölf Feen wieder vor ihren goldenen Herden, und die Suppe war eben fertig, und wurde in den goldnen Kesseln vom Feuer genommen. »Seht einmal, Fräulein,« sprach die Alte, »so wollte ich neulich die Suppe versuchen,« und nahm mit einem goldnen Löffel ein wenig Suppe. Wie sie ihn aber zum Munde führen wollte, fuhr ihr die Suppe ins Gesicht.
Da sprach Maruzza: »Laß es mich einmal versuchen,« nahm den goldnen Löffel, und schöpfte etwas Suppe, und siehe da, sie konnte die Suppe ruhig zum Munde führen. Mit einem Male rauschte es in den Lüften, und der grüne Vogel flog herein, und verwandelte sich in den schönen Prinzen. Als er nun anfing zu jammern: »O, Maruzza, meine Maruzza!« Da stürzte ihm die Königstochter in die Arme, und rief: »Hier bin ich!«
Aber der Prinz wurde ganz traurig, und sprach: »Ach, Maruzza, was hast du getan? Warum bist du her gekommen? Nun muß ich fort, und muß herum fliegen ohne Ruh und ohne Rast sieben Jahre, sieben Tage, sieben Stunden und sieben Minuten.« »Wie?« rief die arme Maruzza, »willst du mich nun verlassen, nach dem ich deinethalben so traurig gewesen bin, und nun diesen weiten Weg gemacht habe, um dich zu sehen?«
Da antwortete der Prinz: »Ich kann dir nicht helfen; wenn du mich aber erlösen willst, so will ich dir sagen, was du tun mußt.« Da führte er sie auf eine Terrasse und sprach: »Wenn du sieben Jahre, sieben Tage, sieben Stunden und sieben Minuten hier auf mich wartest, dem Sturm und Sonnenschein ausgesetzt, nicht isst, nicht trinkst und nicht sprichst, so kann ich erlöst werden, und dann sollst du meine Gemahlin sein.« Damit wurde er wieder ein Vogel, und flog davon.
Nun saß die arme Maruzza auf der Terrasse, und als die Feen kamen, und sie baten, nun in das Schloß zu kommen, schüttelte sie nur mit dem Kopf, und blieb in einer Ecke sitzen, aß nicht und trank nicht, und es kam auch kein Wort über ihre Lippen. So blieb sie sieben Jahre, sieben Tage, sieben Stunden und sieben Minuten, im Sturm und Regen, und an der glühenden Sonnenhitze, und ihre feine weiße Haut wurde schwarz, und ihr Gesicht wurde häßlich und entstellt, und ihre zarten Glieder wurden steif.
Da nun die lange Zeit herum war, rauschte es in den Lüften, und der grüne Vogel kam gepflogen, und wurde ein schöner Prinz. Da stürzte sie in seine Arme, und weinte, und rief: »Nun bist du erlöst, und nun sind auch meine Leiden zu Ende.« Als er aber sah, wie häßlich sie geworden war, und wie schwarz, da mochte er sie nicht mehr, denn alle Männer sind so, und stieß sie hart von sich, und sprach: »Was willst du von mir? ich kenne dich nicht.«
Da weinte sie, und sprach: »Du kennst mich nicht? Habe ich nicht um deinetwillen meinen alten Vater verlassen? Bin ich nicht um deinetwillen sieben Jahre, sieben Tage, sieben Stunden und sieben Minuten hier oben geblieben, dem Regen und Sonnenschein ausgesetzt, habe nicht gegessen und nicht getrunken, und ist auch kein Wort über meine Lippen gekommen?«
Er aber sprach: »Und um eines irdischen Mannes willen hast du hier oben gelegen wie ein Hund, und hast alles dies über dich ergehen lassen?« und spuckte ihr zweimal ins Gesicht, drehte ihr den Rücken und verließ sie. Da fiel die arme Maruzza zu Boden und weinte bitterlich, die Feen aber kamen und trösteten sie, und sprachen:
»Habe nur guten Mut, Maruzza, du sollst noch schöner werden, als du bisher warst, und dich an dem bösen Mann rächen.« Da brachten sie sie in das Schloß, und wuschen sie mit Rosenwasser viele Tage lang, bis sie wieder ganz weiß wurde, und so schön, daß sie niemand mehr erkennen konnte.
Dann zog Maruzza in das Land, wo der Prinz mit seiner Mutter der alten Königin wohnte, und die Feen begleiteten sie mit allen ihren Kostbarkeiten, und bauten ihr in einer Nacht ein wunderschönes Schloß, dem königlichen Schlosse gerade gegenüber.
Als der Prinz am Morgen zum Fenster hinaus schaute, sah er verwundert auf den schönen Palast, der viel schöner war, als sein eignes Schloß, und während er sich noch darüber verwunderte, erschien Maruzza am Fenster gegenüber, mit prächtigen Kleidern und so schön, daß der Prinz kein Auge von ihr verwenden konnte.
Er erkannte sie aber nicht, und machte eine tiefe Verbeugung, und wollte sie anreden. Maruzza aber schlug ihm heftig das Fenster vor der Nase zu. »O!« dachte er, »wer ist denn diese Dame, die sich gar besser dünkt als ich?« und rief seine Mutter herbei, um sie zu fragen. Sie wußte es aber nicht, und wen er auch fragen mochte, niemand konnte ihm Auskunft geben.
Nun stellte er sich jeden Morgen auf seinen Balkon, wenn er sie drüben an ihrem Fenster erblickte. Wenn er aber versuchte, sie zu begrüßen und anzureden, so drehte sie ihm stolz den Rücken und schlug das Fenster zu. Da ward der Prinz traurig, denn er hätte gern das schöne Mädchen zu seiner Gemahlin gemacht.
»Mutter,« sprach er eines Tages zur alten Königin, »tut mir den Gefallen und geht einmal zur schönen Dame, die gegenüber wohnt, und bringt ihr in meinem Namen euer schönstes Stirnband, und fragt sie, ob sie meine Gemahlin sein wolle.«
Da machte sich die alte Königin auf, und ging in das Schloß zur schönen Maruzza, und ein Diener trug auf einem silbernen Präsentierteller das goldne Stirnband, das glänzte von Perlen und edlen Steinen. Als nun Maruzza hörte, die Königin sei da, und wünsche mit ihr zu sprechen, eilte sie ihr entgegen, und sprach: »O, Frau Königin, warum habt ihr mich nicht zu euch rufen lassen, und habt euch zu mir bemüht? An mir war es, zu euern Füßen zu kommen.«
Da führte sie sie mit vielen schönen Worten in ihren besten Saal, der strahlte von Gold und Edelsteinen, und sprach: »Womit kann ich euch dienen, edle Königin?« Da antwortete die Königin: »Mein Sohn hat mich hier her gesandt, er ist in heftiger Liebe zu euch entbrannt, und bietet euch seine Hand an, und als Zeichen seiner Liebe, sendet er euch dieses köstliche Stirnband.«
»O, welche Ehre!« erwiderte Maruzza, »eurem Sohn gebührt die reichste, vornehmste Königin, nicht aber ein armes Mädchen, wie ich es bin. Ich bin dieser Ehre nicht würdig.« Während sie aber so sprach, hatte sie das kostbare Stirnband genommen, und ganz in kleine Stücke zerpflückt, und rief nun »kur, kur, kur, kur,« da kamen die zwölf Feen herein, die hatten sich in zwölf kleine Gänschen verwandelt, und schluckten begierig die Goldkörner und die edlen Steine auf.
Die alte Königin aber war sprachlos vor Erstaunen und Zorn. »Frau Königin,« sagte Maruzza, »was seht ihr so zornig aus? Ich pflege meine Gänschen immer mit lauterem Golde zu füttern.« Dabei winkte sie einem Diener, der brachte ihr auf einem Präsentierteller den kostbarsten Schmuck, Stirnbänder und Armbänder, und sie zerpflückte alles in tausend Stückchen und streute sie den Gänschen vor.
Also mußte die Königin gekränkt und beschämt nach Hause zurück kehren. Der Prinz aber stand wieder am Balkon und schaute nach dem schönen Mädchen aus. Als nun Maruzza die Königin bis zur Tür begleitet hatte, kehrte sie eilends zurück und trat auf ihren Balkon. Als aber der Prinz sie begrüßen wollte, wandte sie ihm den Rücken zu und schloß heftig das Fenster.
Da merkte der Prinz, daß sie ihn zurück gewiesen hatte, noch ehe seine Mutter ihm ihre Antwort überbringen konnte, und ward von Herzen traurig. Er konnte es aber doch nicht lassen, sich jeden Morgen auf den Balkon zu stellen und nach der schönen Maruzza zu schauen. Sie aber wandte ihm immer stolz den Rücken zu und schloß heftig das Fenster.
Nach einiger Zeit sprach der Prinz wieder zur alten Königin: »Mutter, tut mir den Gefallen und geht noch einmal zu der schönen Dame hier gegenüber und fragt sie, ob sie meine Gemahlin werden will.« »Ach, mein Sohn,« antwortete die Mutter, »bedenke doch nur wie grausam sie mich beleidigt hat, ich kann doch nicht zu ihr zurück kehren.« Der Prinz aber sprach: »Mutter, wenn ihr mich lieb habt, so erfüllt meine Bitte und bringt ihr in meinem Namen meine Krone.«
Da nahm er die Krone vom Kopf und gab sie seiner Mutter, und die alte Königin ließ sich überreden der schönen Maruzza einen Besuch zu machen. Als nun Maruzza sie kommen sah, eilte sie ihr entgegen und empfing sie mit großer Höflichkeit und als sie bei einander saßen, frug sie wieder: »Womit kann ich euch dienen, edle Königin?«
Da antwortete die Königin: »Mein Sohn ist in heftiger Liebe zu euch entbrannt, und hat mich hier her geschickt, euch zu fragen, ob er nicht die Ehre haben kann, euer Gemahl zu werden. Als Zeichen seiner Liebe sendet er euch seine goldne Krone, die er von seinem Haupte genommen hat.« »Ach, edle Königin,« sprach Maruzza, »wie könnte ich diese Ehre annehmen? Ein so armes Mädchen, wie ich bin, kann euer Sohn nicht zu seiner Gemahlin machen.«
Wie sie das gesagt hatte, rief Maruzza ihren Koch und sprach: »Hier, Koch, nimm diese goldne Krone, sie paßt gerade als Reif um meinen Kessel.« Als sie aber wieder sah, daß die Königin ganz entstellt wurde vor Zorn, fuhr sie fort: »Edle Königin, was entstellt ihr euch so? Ich pflege immer um meine Kessel einen goldnen Reif zu legen.«
Da winkte sie dem Koch, der brachte ihr eine ganze Menge Kessel, die waren alle von reinem Gold und hatten einen goldnen Reif. Da kehrte die Königin beschämt und gekränkt nach Hause zurück, Maruzza aber eilte an das Fenster, um dem Prinzen die gewohnte Beleidigung zuzufügen.
Nun wurde der Prinz vor Zorn und Kummer krank und lag einen ganzen Monat schwer krank dar nieder. Kaum war er besser, so schlich er auch gleich zu seinem Balkon und als er Maruzza gegenüber stehen sah, versuchte er es wieder sie zu begrüßen. Sie aber drehte ihm den Rücken, schlug ihm das Fenster vor der Nase zu. Da sprach der Prinz zu seiner Mutter: »Mutter, wenn ihr mich lieb habt, so geht noch einmal zu der schönen Dame, und fragt sie, ob sie meine Gemahlin werden will.«
Die Königin wollte nicht, er bat aber so lange, bis sie »ja« sagte. Da nahm er seine schwere, goldne Kette vom Hals und gab sie seiner Mutter, sie solle sie der schönen Dame bringen. Die Königin wurde von Maruzza wieder mit aller Höflichkeit empfangen und Maruzza frug sie: »Womit kann ich euch dienen, edle Königin?«
Da sagte ihr die Königin wieder, der Prinz wolle sie zu seiner Gemahlin und schickte ihr seine goldne Kette. Maruzza aber erklärte wieder, sie sei zu arm und niedrig für den Prinzen. Dann winkte sie ihrem Diener, gab ihm die Kette und sprach: »Lege sie dem Hund an.« Als nun die Königin wieder sprachlos da stand über diese neue Beleidigung, sprach Maruzza: »Frau Königin, was seid ihr so erzürnt? Meine Hunde haben immer Ketten von lauterem Golde.«
Da winkte sie ihrem Diener, der brachte ihr auf einem Präsentierteller eine Menge Hundeketten, die waren alle von schwerem Gold und dick und lang. Die Königin mußte wieder unverrichteter Sache nach Hause zurück kehren. Maruzza aber eilte auf den Balkon und als sie den Prinzen sah, der mit traurigem Gesicht nach ihr ausschaute, drehte sie ihm den Rücken und schloß das Fenster.
Da wurde der Prinz so krank, daß alle Leute glaubten er müsse sterben; aber als er nach langer Zeit wieder etwas besser war, sprach er gleich zu seiner Mutter: »Mutter, ich bitte euch, geht noch einmal zur schönen Dame und fleht sie an, doch meine Gemahlin zu werden und sagt ihr, daß wenn sie mich zurückweist und noch einmal das Fenster so verächtlich zuschlägt, so werde ich vor ihren Augen tot nieder sinken.«
Die Königin wollte durchaus nicht gehen, da sie aber sah, wie schwach und krank ihr Sohn war, ging sie dennoch zur schönen Maruzza. Da wurde sie freundlich empfangen und sprach: »Edles Fräulein, ich komme mit einer Bitte zu euch, die ihr mir nicht abschlagen müßt. Mein Sohn ist mehr denn je in Liebe für euch entbrannt und fleht euch an, daß ihr seine Gemahlin werden wollt. Wenn ihr ihn aber zurückweist und ihm das Fenster vor der Nase zuschlagt, so wird er vor euren Augen tot nieder sinken, denn ohne euch kann er nicht leben.«
Da antwortete Maruzza: »Sagt eurem Sohn: wenn er aus Liebe zu mir sich entschließt, in einem Sarg, unter dem Geläute der Totenglocken, begleitet von den Priestern, die Grabgesänge singen, aus seinem Hause sich in das meinige tragen zu lassen, so wird uns hier der Geistliche erwarten, der uns trauen soll.«
Mit dieser Antwort kehrte die Königin zu ihrem Sohn zurück, der ließ gleich einen schönen Sarg herrichten und legte sich hinein. Da wurden in der ganzen Stadt die Totenglocken geläutet, und der Prinz ward in dem Sarg aus seinem Schloß heraus getragen und die Priester begleiteten ihn mit brennenden Kerzen und sangen Grabgesänge.
Maruzza aber stand königlich geschmückt auf ihrem Balkon und betrachtete stolz den traurigen Zug. Als aber der Sarg unter ihrem Fenster angekommen war, beugte sie sich heraus und rief mit lauter Stimme: »Und aus Liebe zu einem irdischen Weib hast du dich dazu her gegeben, bei lebendigem Leib als Toter im Sarg zu liegen?« und spuckte ihm zweimal ins Gesicht.
Da erkannte er sie und rief laut: »Maruzza, meine Maruzza.« Als er aber so rief, da eilte sie zu ihm hinunter und sprach: »Ja, ich bin deine Maruzza, den Kummer, den du mir zugefügt hast, habe ich dich auch fühlen lassen wollen; doch nun ist alles gut, und der Geistliche, der uns trauen soll, wartet schon.«
Da wurde ein glänzendes Hochzeitsfest gefeiert und der Prinz wurde König und Maruzza wurde Königin.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
VOM GOLDNEN LÖWEN ...
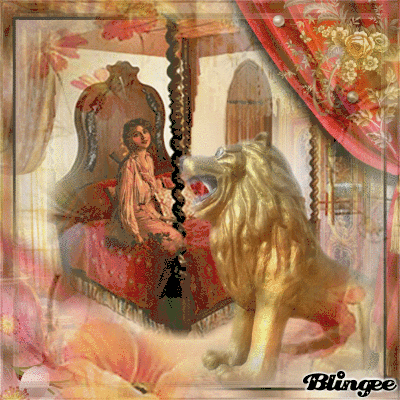
Es war einmal ein reicher Kaufmann, der hatte drei Söhne. Da sprach eines Tages der Älteste zu ihm: »Vater, ich will ausziehen, die Welt zu sehen. Schenkt mir ein schönes Schiff und viel Geld und lasst mich gehen.« Also ließ der Vater ihm ein schönes Schiff ausrüsten und der Sohn fuhr fort.
Nachdem er eine Zeit lang gefahren war, landete er bei einer schönen Stadt. Da sah er einen Zettel ausgehängt, darauf verkündigte der König: Wer im Stande sei, seine Tochter zu finden, binnen acht Tagen, der solle sie zur Frau haben; wem es aber nicht gelinge, müsse den Kopf verlieren. »Nun,« dachte der Jüngling, »das sollte doch so schwer nicht sein,« ging hin und meldete sich beim König, er wolle innerhalb acht Tagen die Königstochter finden.
»Gut,« antwortete der König, »du kannst im ganzen Schlosse suchen, wenn du sie aber nicht findest, so kostet es dich deinen Kopf.« Da blieb der Jüngling im Schloß, hatte vollauf zu essen und zu trinken, und durfte im ganzen Schlosse umher gehen, so viel ihm beliebte. Ob er aber gleich alle Ecken und Winkel durchsuchte, und sich jeden Schrank aufschließen ließ, er konnte die Königstochter nicht finden, und nach acht Tagen wurde ihm der Kopf abgeschlagen.
Als er nun gar nicht mehr nach Hause kam, sprach der zweite Sohn: »Lieber Vater, gebt mir auch ein Schiff und eine große Summe Geldes, so will ich ausziehen, meinen Bruder zu suchen.« Da ließ der Vater ein zweites Schiff ausrüsten, und der Sohn schiffte sich ein, und die Winde führten ihn an das selbe Ufer hin, wo sein Bruder gelandet war.
Als er nun seines Bruders Schiff da liegen sah, dachte er: »Nun kann mein Bruder auch nicht weit sein,« und ging ans Land. Da sah er den selben Zettel, auf dem der König verkündigen ließ, wer im Stande sei, seine Tochter binnen acht Tagen zu finden, solle sie zur Frau haben; wem es aber nicht gelinge, der müsse den Kopf verlieren. »Gewiß hat mein Bruder unternommen, die schöne Königstochter zu finden,« dachte der Jüngling, »und ist dabei umgekommen. Jetzt will ich es versuchen, und es wird mir gewiß gelingen.«
Also meldete er sich beim König, und unternahm es, die Königstochter zu finden; es ging ihm aber nicht besser als seinem Bruder. Er mochte suchen, so viel er wollte, er vermochte die schöne Königstochter nicht zu finden, und am achten Tage wurde ihm der Kopf abgeschlagen.
Nun war nur noch der Jüngste zu Hause. Als er sah, daß seine Brüder nicht wieder kamen, ließ auch er sich von seinem Vater ein Schiff ausrüsten, und eine große Summe Geldes geben und zog aus, seine Brüder zu suchen. Die Winde aber trieben ihn an das selbe Ufer, wo die Schiffe seiner beiden Brüder lagen. Da landete er, und als er in die Stadt kam, sah er den Zettel des Königs und las ihn.
»So?« dachte er, »wer im Stande ist, des Königs Tochter zu finden, soll sie zu seiner Gemahlin haben? Das haben gewiß meine beiden Brüder unternommen, und den Kopf dabei verloren; jetzt will ich mein Glück versuchen.« Während er nun so in Gedanken auf das Schloß zu ging, bettelte ihn eine arme Frau an: »Schöner Jüngling, gebt einer armen Alten ein Almosen.« »Laß mich in Ruhe, Alte,« antwortete er. »Ach, lasst mich nicht unbefriedigt von euch gehen,« bat die Alte. »Ihr seid ein so schöner Jüngling, ihr werdet gewiß einer armen Alten ein Almosen nicht versagen.« »Ich sage dir, Alte, laß mich in Ruhe.« »Ihr habt wohl einen Kummer?« frug die Alte. »Sage ihn mir, so will ich euch helfen.«
Da erzählte er ihr, wie er gedenke, die schöne Königstochter zu finden. »Da kann ich euch helfen,« sprach die Alte, »wenn ihr recht viel Geld habt.« »O, das habe ich, und zur Genüge,« sagte der Jüngling. »So lasst euch von einem Goldschmied einen goldnen Löwen machen,« sprach die Alte, »mit krystallenen Augen, und der ein hübsches Stückchen spielt, und dann will ich euch weiter helfen.«
Also ließ er sich einen goldnen Löwen machen, mit krystallenen Augen, der spielte in einem fort ein lustiges Stücklein. Als nun die Alte kam, ließ sie den Jüngling sich im Löwen verstecken, und brachte ihn zum König. Dem König aber gefiel der Löwe so gut, daß er die Alte frug, ob sie ihn nicht verkaufen wolle. »Der Löwe gehört nicht mir,« antwortete sie, »und mein Herr will ihn um keinen Preis verkaufen.«
»So laß ihn mir wenigstens ein Weilchen, bis ich ihn meiner Tochter gezeigt habe,« sprach der König. »Ja, das kann geschehen,« sprach die Alte, »aber morgen will ihn mein Herr wieder haben.«
Als nun die Alte fort war, nahm der König den goldnen Löwen mit in seine Kammer, und ließ an einer Stelle den Boden aufreißen. Dann stieg er eine Treppe hinab, schloß eine Tür auf, und dann noch eine, und noch eine, im ganzen sieben, und jede mit einem besonderen Schlüssel. Der Jüngling aber, der im Löwen versteckt war, merkte sich alles gar wohl.
Endlich kamen sie in einen schönen Saal, darin saß die Königstochter mit elf Gespielinnen. Die sahen aber alle der Königstochter so ähnlich, wie ein Ei dem anderen, und trugen auch alle die gleiche Kleidung. »Ich Unglücklicher,« dachte der Jüngling, »wenn ich auch bis hier her dringe, wie kann ich die Königstochter unter ihren Gespielinnen unterscheiden, da sie sich alle gleich sehen?«
Die Königstochter aber freute sich an dem goldnen Löwen, und bat: »Lieber Vater, laßt uns das niedliche Tier für diese Nacht, daß wir uns daran ergötzen.« Als der König sie nun wieder eingeschlossen hatte, erfreuten sich die Mädchen noch ein Weilchen an dem hübschen, goldnen Löwen, und legten sich dann zur Ruhe nieder; die Königstochter aber nahm den goldnen Löwen in ihre Kammer und stellte ihn neben ihr Bett.
Nach einer Weile fing der Jüngling an: »O, schöne Königstochter, sieh, wie viel ich für dich gelitten habe, um dich zu finden.« Da fing sie an zu schreien: »der Löwe! der Löwe!« die anderen aber meinten, sie schreie im Schlaf, und rührten sich nicht. »O, schöne Königstochter,« sprach wieder der Jüngling, »erschrick nicht. Ich bin der Sohn eines reichen Kaufmanns, und begehre dich zu meiner Gemahlin; um aber den Weg zu dir zu finden, habe ich mich in diesen goldnen Löwen gesteckt.«
»Was hilft dir das?« antwortete sie. »Wenn du auch bis zu mir dringst, und mich dann nicht aus meinen Gespielinnen heraus erkennst, so verlierst du dennoch den Kopf.« »Da sorge du dafür,« erwiderte er; »ich habe so viel für dich getan, nun kannst du auch etwas für mich tun.« »So höre denn,« sprach die Königstochter; »am achten Tage will ich um meine Hüften ein weißes Tuch schlingen, daran mußt du mich erkennen.«
Am anderen Morgen kam der König und nahm den goldnen Löwen wieder fort, und übergab ihn der Alten, die schon da war, um ihn abzuholen. Da trug die Alte den Löwen aus dem Schloß, und ließ den Jüngling heraus; der ging als bald und meldete sich beim König, er wolle die schöne Königstochter finden. »Gut,« antwortete der König, »wenn du sie aber nicht findest, so kostet es dich deinen Kopf.«
Da blieb der Jüngling im Schloß, aß und trank und tat auch hin und wieder, als ob er suche. Am achten Tage aber trat er in die Kammer des Königs, und befahl den Dienern: »Reißt an dieser Stelle das Pflaster auf!« Der König erschrak und sprach: »Was willst du das Pflaster aufreißen lassen, sie wird doch nicht darunter stecken.« Er ließ sich aber nicht irre machen, sondern befahl noch einmal, man solle das Pflaster aufreißen.
Dann stieg er die Treppe hinunter, und als er an die Türe kam, rief er: »Wo ist der Schlüssel zu dieser Tür?« Da mußte der König die Türe aufschließen, und dann auch alle die anderen Türen, und als sie in den Saal traten, standen da die zwölf Mädchen in einer Reihe, und sahen sich so ähnlich, daß man sie nicht zu unterscheiden vermochte.
Die Königstochter aber schlang schnell ein weißes Tuch um ihre Hüften. Da sprang der Jüngling auf sie zu und rief: »Diese da ist die Königstochter, die ich zu meiner lieben Gemahlin begehre.« Weil er es nun richtig erraten hatte, so konnte der König nicht mehr nein sagen, und veranstaltete eine glänzende Hochzeit.
Nach der Hochzeit schiffte sich der Jüngling mit seiner schönen Gemahlin ein, und der König überhäufte sie mit Schätzen, und so fuhren sie nach Hause zu dem alten Kaufmann.
Der Alten aber machten sie ein schönes Geschenk. Da blieben sie Mann und Frau, wir aber sitzen hier und schauen einander an.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
VOM CRIVÒLIU .....

Es waren einmal ein Bruder und eine Schwester, die hatten weder Vater noch Mutter, und lebten allein zusammen. Da sie sich nun so lieb hatten, so begingen sie eine Sünde, die sie nicht hätten begehen sollen. Als nun die Zeit heran kam, gebar die Schwester einen Knaben, den ließ der Bruder heimlich taufen. Dann ätzte er auf seine Schulter ein Kreuz ein, mit diesen Worten: »Crivòliu, der getauft ist; Sohn eines Bruders und einer Schwester.« Als das Knäblein so gezeichnet war, legte er es in ein Kästchen, und warf das Kästchen ins Meer hinaus.
Nun begab es sich, daß eben ein Fischer ausgegangen war zu fischen, und das Kästchen auf dem Meere herum treiben sah. »Es wird wohl irgendwo ein Schiff unter gegangen sein,« dachte er, »ich will das Kästchen holen, vielleicht ist etwas Brauchbares darin.« Da ruderte er hin und nahm das Kästchen. Als er es aber öffnete und das feine Knäblein darin sah, erbarmte er sich des unschuldigen Kindes, brachte es heim zu seiner Frau und sprach:
»Liebe Frau, unser jüngstes Kind ist nun schon alt genug, daß wir es entwöhnen können, säuge nun statt dessen dieses arme unschuldige Kind.« Da nahm die Frau den kleinen Crivòliu und säugte ihn, und hatte ihn so lieb, als wäre er ihr eigenes Kind. Der Knabe aber wuchs heran und gedieh, und wurde täglich größer und stärker.
Die Söhne des Fischers aber waren eifersüchtig, daß ihre Eltern das kleine Findelkind eben so lieb hatten wie sie, und wenn sie mit Crivòliu spielten und in Streit gerieten, so nannten sie ihn einen »Findling«. Da betrübte sich der Knabe in seinem Herzen und kam zu seinen Pflegeeltern und sprach: »Liebe Eltern, sagt mir doch, bin ich wirklich nicht euer Sohn ?« Die Fischersfrau aber sprach: »Wie solltest du mein Kind nicht sein? Habe ich dich doch an meiner Brust gesäugt.« Den Kindern aber verbot der Fischer streng, den kleinen Crivòliu »Findling« zu nennen.
Als nun der Knabe größer wurde, schickte ihn der Fischer mit seinen Söhnen in die Schule. Die Kinder aber, da ihr Vater es nicht hören konnte, fingen sie wieder an, den kleinen Crivòliu zu verspotten und »Findling« zu nennen, und die anderen Kinder in der Schule taten es auch. Da kam Crivòliu wieder zu seinen Pflegeeltern und frug sie, ob er denn nicht ihr Sohn wäre.
Sie aber redeten es ihm aus und hielten ihn hin, bis er vierzehn Jahre alt war. Da konnte er es nicht mehr aushalten, immer »Findling« genannt zu werden, ging zu dem Fischer und seiner Frau und sprach: »Liebe Eltern, ich beschwöre euch, daß ihr mir sagt, ob ich euer Sohn sei oder nicht.« Da erzählte ihm der Fischer, wie er ihn gefunden habe, und was auf seiner Schulter zu lesen sei.
»So will ich ausziehen, und Buße tun für die Sünde meiner Eltern,« sprach Crivòliu. Die Fischersfrau weinte und jammerte und wollte ihn nicht fort lassen; Crivòliu aber ließ sich nicht halten und wanderte fort in die weite Welt.
Nachdem er eine lange Zeit gewandert war, kam er endlich eines Tages in eine einsame Gegend, darin stand nur ein Wirtshaus. Da frug er die Wirtin: »Sagt mir doch, gute Frau, ist wohl hier in der Nähe eine Höhle, zu der ihr allein den Eingang wißt?« Da antwortete sie: »Ja, mein schöner Jüngling, ich weiß eine solche Höhle und will euch gerne hin führen.«
Da nahm Crivòliu zwei Grani Brot und einen kleinen Krug Wasser mit, und ließ sich von der Wirtin die Höhle zeigen. Die lag ziemlich weit von dem Wirtshaus entfernt, und der Eingang war von Dornen und Gestrüpp so bedeckt, daß er kaum in die Höhle eindringen konnte. Da schickte er die Wirtin zurück, kroch in die Höhle, legte das Brot und den Krug auf den Boden, kniete dann nieder und tat so mit gekreuzigten Armen Buße für die Sünde seiner Eltern.
So vergingen viele, viele Jahre, ich weiß nicht wie viele, aber so viele, daß seine Knie Wurzel schlugen und er am Boden fest gewachsen war.
Nun begab es sich, daß in Rom der Papst starb, und es sollte ein neuer gewählt werden. Da versammelten sich alle Kardinäle, und man ließ eine weiße Taube fliegen, denn derjenige, auf dem sie sich niederlassen würde, sollte Papst sein. Die weiße Taube kreiste einige Male in der Luft, ließ sich aber auf Keinen nieder. Da berief man alle Erzbischöfe und Bischöfe, und ließ die weiße Taube wieder fliegen, sie setzte sich aber auf keinen der selben.
Nun versammelte man alle Priester und alle Mönche und Einsiedler, aber die weiße Taube wollte keinen davon erwählen. Das Volk war in großer Verzweiflung, und die Kardinäle mußten ausziehen und im ganzen Land erforschen, ob irgendwo ein Einsiedler noch zu finden sei, und viel Volks begleitete sie.
So kamen sie denn auch endlich an das Wirtshaus in der einsamen Gegend, und frugen die Wirtin, ob sie vielleicht einen Einsiedler oder Büßenden wüßte, der noch unbekannt wäre. Da antwortete die Wirtin: »Vor vielen Jahren ist ein trauriger Jüngling her gekommen, der hat sich von mir in eine Höhle führen lassen, um Buße zu tun. Der ist aber gewiß schon lange tot, denn er hat nur zwei Grani Brot und einen Krug Wasser mit genommen.«
Die Kardinäle aber sprachen. »Wir wollen doch einmal sehen, ob er noch lebt; führt uns zu ihm.« Da führte sie die Wirtin zur Höhle; man konnte aber kaum mehr den Eingang erkennen, so dicht war er mit Dornen bewachsen, und die Knechte mußten erst mit Beilen die Dornen und das Gestrüpp weg räumen, ehe man hinein konnte.
Da sie nun hinein drangen, sahen sie den Crivòliu in der Höhle knien mit gekreuzten Armen, und sein Bart war so lang geworden, daß er bis auf den Boden reichte, und vor ihm lag noch das Brot, und daneben stand noch der Krug mit Wasser; denn er hatte alle die Jahre hin durch nicht gegessen und nicht getrunken.
Als man nun die weiße Taube fliegen ließ, flog sie einen Augenblick im Kreise herum und ließ sich dann auf das Haupt des Büßenden nieder. Da erkannten die Kardinäle, daß er ein Heiliger war, und baten ihn, er möchte doch mit ihnen kommen und ihr Papst sein. Als sie ihn aber aufheben wollten, merkten sie, daß seine Knie am Boden fest gewachsen waren, und mußten erst die Wurzeln abschneiden. Da nahmen sie ihn mit nach Rom und er wurde Papst.
Nun begab es sich, daß zu der selbigen Zeit die Schwester zu ihrem Bruder sprach: »Lieber Bruder, da wir noch jung waren, haben wir eine Sünde begangen, die wir noch nicht gebeichtet haben, denn nur der Papst kann uns davon absolvieren. So laß uns denn nach Rom gehen, ehe der Tod uns überrascht, und da selbst unsre Sünde beichten.«
Da machten sie sich auf, nach Rom zu gehen, und als sie ankamen, gingen sie in die Kirche, wo der Papst im Beichtstuhl saß. Als sie aber mit lauter Stimme gebeichtet hatten, denn dem Papst beichtet man immer öffentlich, sprach der Papst: »Seht, ich bin euer Sohn, denn auf meiner Schulter steht das Zeichen, von dem ihr sagt. Für eure Sünde habe ich viele Jahre Buße getan, bis sie euch vergeben worden ist. So absolviere ich euch denn von eurer Sünde, und ihr sollt bei mir wohnen und es gut haben.«
So blieben sie bei ihm, und als die Zeit kam, rief der Herr sie alle drei in sein Himmelreich.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
VOM ABTE SORGENLOS ...

Es war einmal ein Abt, der besaß der irdischen Güter die Fülle, hatte Wagen und Pferde, Köche und Kammerdiener, Schreiber und Lakaien, und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Sorgen plagten ihn nicht, als höchstens wie er die Zeit mit Essen, Trinken und Schlafen herum bringen könne. Darob beneideten ihn die Pfaffen und Bürger der Stadt und nannten ihn den Abt Sorgenlos.
Eines Tages nun kam der König des Landes in die Stadt, und die Feinde des Abtes eilten herzu, ihn bei dem Herrscher zu verklagen, und sagten: »Herr König, in dieser Stadt lebt ein Mensch, glücklicher als Ihr, dem es auf dieser Erde an nichts gebricht, weshalb er sich auch Abt Sorgenlos nennen läßt. Das ist nicht billig, und wir bitten Euch, dem Dinge abzuhelfen.«
Der König hörte sie aufmerksam an und sprach dann: »Ihr Leute, jetzt geht ruhig nach Hause, denn in kurzem wollen wir eurem Abt schon Sorgen genug schaffen.« Er ließ den Abt rufen, und dieser kam mit vier Pferden vorgefahren. Der König hieß ihn willkommen, bot ihm einen Platz an seiner Seite an und unterhielt sich mit ihm von diesem und jenem. Ganz zu letzt fragte er ihn, wie er wohl zu dem sonderbaren Namen Abt Sorgenlos gekommen sei.
Der Abt antwortete: »Weil ich, Herr König, mir keine Sorgen um irdische Dinge zu machen brauche und für alles andere meine Diener denken lasse.« »Nun, Herr Abt«, sprach der König, plötzlich ernst geworden, »wenn Ihr so gar nichts zu tun habt, könnt Ihr mir einen Gefallen tun und die Sterne am Himmel zählen, und zwar in drei Tagen und drei Nächten. Gelingt es Euch nicht, so werdet Ihr mir Euren Kopf lassen. Dies ist mein Wille und Befehl.«
Der arme Abt Sorgenlos fing zu zittern an wie Espenlaub und ging da von wie ein begossener Pudel, verwirrt und erschreckt durch des Königs Befehl. Zu Hause angekommen, fand er die Tafel gedeckt, aber essen mochte er nichts, denn die innere Angst verzehrte ihn. Er stieg auf das Dach seines Hauses, warf den Kopf zurück und schaute nach dem Himmel: da war aber auch nicht ein armes Sternlein zu erblicken, die Sonne stand noch hoch am Himmel.
Als es Nacht ward und die Sterne herauf kamen, fing er eifrig an zu zählen und notierte sich die Zahlen in sein Schreibtäflein. Bald aber verwirrte er sich, denn die Wolken kamen und gingen, und seine Zahlen waren alle falsch. Wie die Köche und Kammerdiener, die Schreiber und Lakaien sahen, daß ihrem Herrn weder Essen noch Trinken mehr schmecken wollte, sondern daß er nur immer gereckten Halses in die Luft schaute, meinten sie, es sei in seinem Kopfe nimmer richtig, und beklagten ihn gar sehr.
Der erste Tag war vergangen, der zweite, der dritte neigte sich bereits, und dem armen Abt wurde immer elender zu Mute, wenn er dachte, daß niemand mehr für seinen Kopf einen Pfifferling geben würde. Er hatte aber einen alten erprobten Diener, dem ging der geheime Jammer seines Herrn so sehr zu Herzen, daß er ihn bat, ihn zum Vertrauten zu machen, wer weiß, ob er ihm nicht helfen könne.
»Ach«, seufzte der Abt, »wer kann mir helfen! Der König hat mir aufgegeben, die Sterne am Himmel zu zählen, und ich mühe mich und bringe die Zahl nicht heraus, so muß ich dem Könige den Kopf lassen.« Als der Diener das hörte, sagte er: »Getröstet Euch, lieber Herr! Laßt mich machen, ich weiß Mittel und Wege, Euch aus der Schlinge zu ziehen.«
Er ging und kaufte ein großes Ochsenfell, an dem die Haare noch saßen, breitete es auf dem Boden aus, schnitt dann hier ein Stückchen vom Schwanze ab, dort vom Ohr, da von den Seiten und sagte zum Abte: »So, Herr Abt, gehen wir jetzt zum König, und wenn er Euch fragt, wie viel Sterne am Himmel stehen, so laßt mich rufen, ich komme dann mit dem Fell, breite es vor dem Könige aus, und Ihr sprecht: Der Sterne am Himmel sind so viel, als jetzt Haare auf dem Ochsenfell, doch da es deren vorher zu viel waren, so habe ich die überzähligen weg schneiden lassen.«
Da fiel dem Abt ein Stein vom Herzen, schnell befahl er seinen Wagen und fuhr zum König. Dieser begrüßte ihn ganz freundlich und fragte: »Nun, Herr Abt, seid Ihr meinem Befehle nach gekommen?« - »Ja, Herr König«, antwortete dreist der Abt, »die Sterne sind gezählt.« - »So sagt mir, wie viel sind es?« Also gleich rief der Abt seinen Diener herbei, der kam und breitete das Fell zu Füßen des Königs aus.
Der König, der nicht wußte, wo das hinaus wollte, blickte verwundert den Abt an, der erhob seine Stimme und sagte: »Eure Aufgabe, Herr König, hat mich viel Kopfzerbrechens gekostet, dennoch ist sie gelöst. Der Sterne am Himmel sind so viele als Haare auf diesem Ochsenfell, und da deren vorher zu viele waren, habe ich hier und da nachhelfen und abschneiden müssen, bis die Zahl richtig war.
Glaubt Ihr es nicht, so laßt nachzählen, ich bin meiner Aufgabe ledig.« Der König stand mit offenem Mund und wußte nicht, was er sagen sollte. Endlich reichte er dem Abt die Hand und sprach: »Geht nur hin in Frieden und lebt für der sorgenlos wie Noah, denn Ihr habt Euch als einen rechten Pfiffikus erwiesen.« Und sie schieden als gute Freunde.
Fröhlich kehrte der Abt mit seinem treuen Diener nach Hause zurück, dankte ihm von Herzen und machte ihn zum Hausmeister und Vertrauten. Gab ihm auch jeden Tag eine Unze Goldes zum Lohn, denn so viel hatte er wohl verdient.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
DIE DREI SCHWESTERN ...
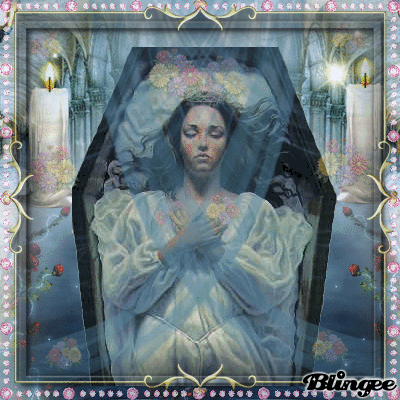
Ein Vater hatte drei Töchter, die wohnten in einem schönen Hause nahe am Palast eines Königs. Einmal traf es sich, dass der Vater wichtiger Geschäfte halber verreisen musste.
Der König hatte einen Sohn, der war ein junger schöner Prinz, welcher, nach dem der Vater verreist war, den drei Mädchen melden ließ, er werde zu ihnen auf Besuch kommen. Bevor die Stunde schlug, zu welcher er kommen sollte, kleideten sich alle drei prächtig und die beiden Älteren richteten es so ein, dass die Jüngste sich in die Mitte setzen musste; denn auf diese Weise, dachten sie, muss der Prinz neben einer von uns sitzen.
Als aber der Prinz kam, setzte er sich dennoch in die Mitte neben die jüngste, weil sie die schönste und liebenswürdigste war und sie redeten lange von allerlei Dingen. Am folgenden Tage versprach der Prinz wieder zu kommen und die beiden älteren Schwestern richteten es so ein, dass Marie - so hieß nämlich die jüngste - sich auf die Seite setzen musste; doch auch diesmal setzte sich der Prinz neben sie und tat so bei jedem Besuch.
Einmal versteckten die beiden Älteren Marien alle ihre schönen Kleider und sie musste im einfachen Hauskleid vor dem Prinzen erscheinen; aber zum Ärger der beiden sprach er gerade diesmal viel mehr und viel freundlicher mit Marie als sonst und es war unzweifelhaft, dass seine Besuche hauptsächlich nur ihr galten.
»Wie, soll die jüngste von uns noch einmal Königin werden und nicht ich oder du?« sagten die beiden älteren Schwestern öfters eine zur anderen und ergrimmt sannen sie auf böse Anschläge gegen Marie. Sie hatten eine alte Magd im Hause, welche eine Hexe war, diese riefen sie eines Abends zu sich und fragten sie: »Wen liebst du mehr, uns beide oder unsere jüngste Schwester?«
»O gewiss euch beide«, antwortete die Magd. Da befahlen sie ihr, Marie am kommenden Morgen in den Wald zu führen, um Erdbeeren zu pflücken. »Führe sie recht weit hinein,« sagten sie; »dann lass sie allein, damit sie den Rückweg nicht mehr finde. Wir wollen in dessen einen Sarg machen und den selben in eine Grube versenken lassen; sobald der Vater kommt, werden wir ihm sagen, Marie sei gestorben und wenn er es nicht glaubt, so lassen wir die Grube wieder öffnen und zeigen ihm den Sarg.«
Am folgenden Morgen ging Marie mit der Magd in den Wald um Erdbeeren zu pflücken. Sie kamen immer tiefer in den selben hinein und während Marie eifrig die schönen roten Beeren pflückte, entfernte sich die Magd unbemerkt und ging nach Hause. Marie weinte und rief, aber vergebens. Den ganzen Tag irrte sie hin und her und statt einen Ausweg zu finden, geriet sie nur immer tiefer hinein in den pfadlosen dunkeln Wald voll hoher Bäume, deren Äste keinen Sonnenstrahl auf den feuchten moosigen Boden dringen ließen.
Ganz müde und verzweifelt setzte sie sich auf die weit auslaufende Wurzel einer hundertjährigen Tanne und ergab sich weinend in ihr bitteres Schicksal. Doch auf einmal sah sie einen ehrwürdigen Greis mit langem weißem Bart vor sich, welcher sie freundlich fragte, wie sie hier her gekommen sei. Sie erzählte ihm alles; da sagte er: »Mein Kind, deine Schwestern haben aus Neid diesen boshaften Anschlag gegen dich ausgesonnen und sie würden dich nur um so sicherer verderben, wenn du auch den Rückweg fändest.
Bleibe bei mir, da sollst du ein stilles und einsames aber glückliches Leben führen!« Marie willigte freudig ein und der Greis führte sie in sein Häuschen, welches mitten im Walde stand. Da blieb sie nun bei ihm; der kluge Alte wusste ihr gar viel zu erzählen und behandelte sie liebevoll wie ein Vater und ehrerbietig, als wäre sie eine Königin. Marie blieb nur zeitweilig allein, so oft er nämlich weg ging um Holz zu sammeln oder Lebensmittel zu holen; er verbot ihr aber, in seiner Abwesenheit irgend Jemanden die Türe zu öffnen.
Die beiden Schwestern aber erfuhren dennoch, dass Maria noch lebe und wo sie sei. Voll Zorn befahlen sie der Magd, verkleidet mit einem Korb voll behexter Sachen zum Häuschen in den Wald zu gehen und die selben Marie zum Kaufe anzubieten.
Als nun eines Tages der Alte fort gegangen war und Maria allein zu Hause war, kam eine Frau mit einem Korb und rief: »Kauft Ringe, Nadeln, Zwirn, schöne und wohlfeile Ware!« Marie wollte zwar anfangs nicht aufmachen; die Frau aber wusste ihr so lange zuzureden, dass sie endlich die Türe öffnete, um sich die Sachen zu besehen. Am besten gefiel ihr ein Ring; als sie ihn aber an den Finger gesteckt hatte, fiel sie wie tot zu Boden und die Magd - denn diese war die Frau - machte sich aus dem Staube.
Als der Alte nach Hause kam und Marien wie tot da liegen sah, erschrak er sehr, ahnte aber bald, was da vorgefallen sein müsse. Er bemerkte so gleich, dass ein Finger an einer Hand geschwollen sei und zog den Ring ab. Marie erwachte wie aus einem tiefen Schlaf und erzählte dem Alten alles, was vorgefallen war. Er warnte sie wieder und verbot ihr von neuem, in seiner Abwesenheit Jemanden die Haustüre zu öffnen.
Die beiden Schwestern aber erfuhren, dass Marie noch lebe und schickten die Magd wieder in den Wald. Eines Tages war der Alte eben ausgegangen und Maria allein zu Hause; da kam wieder eine Frau, die aber ganz anders aussah als die frühere und auch andere Sachen, nämlich nur Kleidungsstücke verkaufte. Marie ließ sie lange pochen und rufen, endlich aber blickte sie doch heraus und als sie all die schönen Dinge sah, vergaß sie das Verbot des Alten und öffnete die Türe.
Unter anderen Dingen war da ein hübsches Schnürleibchen, das musste ihr anstehen wie angegossen und sie legte es sogleich an. Kaum hatte sie es am Leibe, als sie wieder wie tot zu Boden fiel; die böse Verkäuferin aber entfloh so schnell ihre Füsse sie trugen. Mit Schrecken sah der Alte, als er zurück kam, Marie wie tot auf dem Boden und untersuchte sie so gleich. Er zog ihr das Schnürleibchen aus und Marie erwachte abermals wie aus einem tiefen Schlaf. Noch eindringlicher als zuvor wiederholte der Alte seine Warnung und sein Verbot.
In dessen war auch der Vater nach Hause gekommen und vergoss bittere Tränen, als ihm die beiden Töchter sagten, seine liebe Marie sei gestorben. Es verging einige Zeit; da erfuhren sie, dass Maria doch noch lebe. Voll Zorn riefen sie die Magd und sagten: »Geh hin und verstelle dich, wie du nur kannst, damit sie dir die Türe öffnet. Dann sieh, dass sie sich von dir kämmen lasse und wenn du sie kämmst, stoße ihr diese behexte Nadel tief in den Kopf, die wird der Alte gewiss nicht finden.«
Maria war eines Tages wieder allein zu Hause und blickte eben beim Fenster heraus; da sah sie ganz nahe eine Alte, die schleppte sich mühsam an einem Krückstock weiter und brach endlich kraftlos in sich zusammen. Marie lief so gleich hinaus, hob die Alte auf, führte sie in das Häuschen und erquickte sie mit Speise und Trank. Bald gewann die Alte ihre Kräfte wieder und dankte Marie herzlich.
»O wenn ich Euch nur auch einen Gefallen tun könnte, mein gutes Kind!« sagte sie. »Ich sehe, dass Eure schönen Haare zerzaust sind, ich will sie Euch recht schön kämmen und flechten!« Marie widerstrebte, aber endlich ließ sie es geschehen. Die Magd - denn diese war die Alte - stieß ihr die Nadel in den Kopf und eilte hinweg. Der Alte kam und sah Marien wie tot auf dem Boden. Er untersuchte sie am ganzen Leibe, aber er konnte nichts finden.
Da wurde er sehr traurig und beschloss das schöne Mädchenbild - denn einer Leiche sah sie nicht gleich, sondern nur einer Schlafenden - im Hause zu behalten. Er legte sie schön gekleidet auf ein Bett, kaufte in der Stadt viele große Kerzen und stellte deren vier um das Bett, wo er sie Tag und Nacht brennen ließ.
Einmal ging der Königssohn auf die Jagd und verirrte sich im Walde. Da kam er auch am Häuschen vorbei und sah darin die brennenden Kerzen. Voll Neugierde blickte er durch das Fenster und sah das schönste Mädchen wie schlafend auf dem Bette ruhen. Als der Alte die Türe geöffnet hatte, ging er hinein und konnte sich an der schönen schlafenden Leiche gar nicht satt sehen. Mit tausend Bitten und Versprechungen drang er in den Alten, ihm die schöne Schläferin zu überlassen, aber da war alles vergebens und der Königssohn ging traurig nach Hause.
Doch schon am folgenden Tage kam er wieder mit seinen Dienern, welche kostbare Geschenke trugen und erneuerte seine Bitten. Endlich gab der Alte mit Tränen nach, nicht der Geschenke wegen, sondern weil er dem Sohne des Königs diese Gefälligkeit nicht länger verweigern konnte. Die schöne schlafende Leiche wurde in das königliche Schloss in der Stadt gebracht; dort ließ sie der Prinz prachtvoll bekleidet in einem eigens verfertigten kostbaren Glasschrank aufstellen.
Stundenlang stand er oft vor dem schönen Bilde, konnte sich daran gar nicht satt sehen und wurde doch immer so traurig dabei. Er ließ auch niemanden, selbst seine eigene Mutter nicht, in das Zimmer treten und behielt den Schlüssel zu dem selben stets bei sich.
Einmal ging der Prinz weit fort auf die Jagd; da übergab er vor der Abreise den Schlüssel seiner Mutter mit dem Auftrage, das Zimmer nie, außer nur im dringendsten Notfall, zu betreten. Als er fort war, konnte die Königin ihrer Neugierde nicht widerstehen und trat in das Zimmer.
Mit großem Staunen sah sie das schöne Bild im Glaskasten, öffnete ihn und nahm es heraus. »O was für ein schönes Mädchen!« rief sie ein über das andere Mal, »sie ist nicht tot und doch nicht lebend, was es doch sein mag? Und was für prächtige Haare sie hat!« fügte sie bei und wühlte mit der Hand in den Haaren des Bildes. Da fühlte sie etwas hartes und sah, dass es der Kopf einer großen Nadel sei. Sie zog die selbe langsam heraus und in dem selben Augenblick erwachte Marie aus ihrem Zauberschlaf.
Erschrocken blickte sie um sich, die Königin aber redete ihr freundlich zu und Marie erzählte ihr alles. Zu der selben Zeit kam auch der Prinz wieder nach Hause und die Königin befahl Marie sich schnell zu verbergen. Er trat ins Zimmer und seine ersten zornigen Blicke fielen auf seine Mutter und auf den Glaskasten. »Wo ist das Bild?« rief er voll Zorn, als er den Kasten leer fand.
Die Königin gebot ihm Ruhe; da unterdrückte er die Aufwallung des Zornes, brach aber in heiße Tränen des Schmerzes aus. Nun gab die Königin ein Zeichen und Marie trat aus ihrem Versteck hervor dem Prinzen entgegen. Dieser wusste sich anfangs vor freudigem Schrecken nicht zu fassen, erkannte aber Marie bald wieder und umarmte sie als seine Braut.
Und nun hat unsere Geschichte ein trauriges und ein fröhliches Ende. Das traurige ist, dass die beiden älteren Schwestern so gleich geholt und ihnen auf Befehl des Königs die Häupter abgeschlagen wurden; die böse Magd wurde als Hexe öffentlich verbrannt. Sodann aber wurde eine fröhliche Hochzeit gehalten; »mir aber haben sie auch nicht einen Bissen vom Male gegeben, sondern nur ein Bein nach geworfen, dass mir der Rücken davon noch jetzt weh tut.« -
Italien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
VOM CONTE PIRO ...

Es war einmal ein armer Mann, der hatte einen einzigen Sohn. Dieser Sohn aber war dumm und unwissend. Als nun der Vater zum Sterben kam, sprach er zum Jüngling: »Mein Sohn, ich muß nun sterben, und habe nichts dir zu hinterlassen als dieses Häuschen und den Birnbaum, der daneben steht.«
Der Vater starb, und der Sohn blieb allein im Häuschen zurück. Weil er sich aber sein Brot nicht selbst verdienen konnte, so ließ der liebe Gott in seiner Barmherzigkeit den Birnbaum das ganze Jahr hindurch Früchte tragen, und davon nährte sich der Bursche.
Nun begab es sich eines Tages, als er eben vor seiner Haustür saß, daß ein Fuchs vorbei kam. Es war zwar mitten im Winter, der Birnbaum war aber dennoch mit den schönsten, größten Früchten bedeckt. »O!« sprach der Fuchs, »frische Birnen in dieser Jahreszeit! Gib mir ein Körbchen voll davon, so soll es dein Glück sein.« »Ach, Füchslein, wenn ich dir ein Körbchen voll gebe, was soll ich dann essen?« sprach der Bursche.
»Sei still, und tu was ich dir sage,« antwortete der Fuchs, »du wirst sehen, es ist dein Glück.« Da gab der Bursche dem Füchslein einen Korb der schönsten Birnen, und der Fuchs ging damit zum König. »Königliche Majestät, mein Gebieter schickt euch dieses Körbchen mit Birnen, und bittet euch, sie in Gnaden anzunehmen,« sprach er zum König.
»Birnen! in dieser Jahreszeit!« rief der König, »das ist mir noch nicht vorgekommen. Wer ist denn dein Gebieter?« »Der Conte Piro!« antwortete der Fuchs. »Wie kommt er denn dazu, in dieser Jahreszeit Birnen zu haben?« frug der König. »O, der hat alles, was er will,« antwortete der Fuchs, »der ist viel reicher als ihr selbst, königliche Majestät.«
»Was könnte ich ihm denn für seine Birnen schenken?« frug der König. »Nichts, königliche Majestät,« sprach der schlaue Fuchs, »denkt nur, jedes Gegengeschenk würde ihn beleidigen.« »Nun denn, sage dem Grafen, ich ließe ihm danken für seine wunderschönen Birnen.«
Als nun der Fuchs wieder zum Burschen kam, rief dieser: »Aber, Füchslein, du hast mir ja nichts mitgebracht für meine Birnen, und ich bin so hungrig!« »Sei still,« antwortete der Fuchs, »und laß mich machen; ich sage dir, es wird dein Glück sein.«
Nach einigen Tagen sprach der Fuchs: »Du mußt mir jetzt wieder einen Korb voll Birnen geben.« »Ach, Füchslein, was soll ich denn essen, wenn du mir meine Birnen fort trägst?« »Sei still und laß mich machen,« sagte der Fuchs, und ließ sich einen großen Korb voll der schönsten Birnen geben. Damit ging er zum König, und sprach: »Königliche Majestät, da ihr den ersten Korb so gnädig angenommen habt, so erlaubt sich mein Gebieter, der Conte Piro, euch wieder ein Körbchen voll anzubieten.«
»Nein, wie ist denn das nur möglich!« rief der König, »frische Birnen zu dieser Jahreszeit!« »Ach, das ist ja gar nichts,« sprach der Fuchs, »die beachtet der Graf kaum, so viele andere Reichtümer hat er. Er läßt euch aber bitten, ihm eure Tochter zur Gemahlin zu gewähren.« »Wenn der Graf so reich ist,« antwortete der König, »so kann ich diese Ehre ja gar nicht annehmen, denn er ist viel reicher als ich.«
»O, königliche Majestät, laßt das,« sprach der Fuchs. »Mein Herr wünscht eben eure Tochter zu seiner Gemahlin, etwas mehr oder weniger Mitgift ist ihm bei seinem Reichtum ganz gleichgültig.« »Ist er denn wirklich so reich?« frug der König. »O, königliche Majestät, wenn ich es euch sage! der ist viel reicher als ihr!« »Nun denn, so bitte ihn einmal herzukommen, und hier zu essen.«
Da ging der Fuchs zum Burschen und sprach: »Ich habe dem König gesagt, du seist der Conte Piro und begehrtest seine Tochter zur Gemahlin.« »O, Füchslein, was hast du getan!« schrie der arme Bursche. »Wenn der König mich nun sieht, so reißt er mir den Kopf ab.« »Laß mich doch machen, und sei still,« sprach der Fuchs; und ging in die Stadt zu einem Schneider, und sprach:
»Mein Gebieter, der Conte Piro, wünscht den schönsten Anzug zu haben, den ihr fertig habt; das Geld bringe ich euch dann ein anderes Mal.« Da gab ihm der Schneider einen prächtigen Anzug, und der Fuchs ging zu einem Pferdehändler, und verschaffte sich auf die selbe Weise das schönste Pferd, das zu finden war. Dann mußte der Bursche die feine Kleidung anlegen, das Pferd besteigen, und auf das Schloß reiten; und der Fuchs lief vor ihm her.
»Ach, Füchslein, was soll ich denn dem König sagen?« rief der Bursche. »Ich kann ja nicht sprechen, wie es sich einem so vornehmen Herrn gegenüber geziemt.« »Laß mich nur sprechen und verhalte dich ruhig,« sprach der Fuchs, »und wenn du nur 'Guten Tag' sagst, und 'Königliche Majestät', das Übrige will ich schon sagen.«
Als sie nun auf das Schloß kamen, eilte der König dem Conte Piro entgegen, und begrüßte ihn mit allen Ehren, und führte ihn an den Tisch, wo auch die schöne Königstochter saß. Er war aber wie stumm, und sagte fast gar nichts. »Füchslein, der Conte Piro spricht ja gar nicht,« sagte der König leise zum Fuchs. Der aber antwortete: »Er hat eben so viel zu denken bei all seinen Reichtümern und Schätzen.« Als sie gegessen hatten, nahm der Conte Piro Abschied und ritt wieder nach Hause.
Am anderen Morgen aber sprach der Fuchs: »Gib mir noch einen Korb voll Birnen, daß ich sie zum König hin trage.« »Mache was du willst, Füchslein,« antwortete der Bursche, »aber du wirst sehen, daß es mir das Leben kostet.« »Sei doch still,« rief der Fuchs, »wenn ich dir sage, es wird dein Glück sein.« Also pflückte er die Birnen, und der Fuchs brachte sie zum König, und sprach:
»Mein Gebieter, der Conte Piro, schickt euch dieses Körbchen voll Birnen, und möchte gern eine Antwort auf seine Anfrage haben.« »Sage dem Grafen, die Hochzeit könne stattfinden, so bald es ihm beliebt,« antwortete der König, und der Fuchs brachte dem Conte Piro ganz vergnügt diesen Bescheid. »Aber, Füchslein, wo soll ich denn meine Braut hinbringen?« frug der Bursche, »ich kann sie doch nicht in dieses alte schlechte Häuschen führen?«
»Laß mich nur machen. Was geht dich das an? Habe ich bisher nicht alles gut gemacht?« sagte der Fuchs. Also wurde eine glänzende Hochzeit gefeiert, und der Conte Piro heiratete die schöne Königstochter.
Nach einigen Tagen sprach der Fuchs: »Mein Gebieter wünscht nun seine junge Frau in sein Schloß zu führen.« »Gut, und ich werde sie begleiten,« antwortete der König. Da bestiegen sie alle ihre Pferde, und der König nahm ein großes Gefolge von Reitern zu Pferde mit, und so ritten sie in die Piana hinein. Der schlaue Fuchs aber lief vor ihnen her.
Als er nun an einer großen Schafherde, von vielen tausend Schafen, vorbei kam, frug er die Hirten: »Wem gehört diese Schafherde?« »Dem Menschenfresser,« antworteten sie. »Still doch, still,« flüsterte der Fuchs, »seht ihr alle die bewaffneten Reiter die mir folgen? Wenn ihr sagt, die Schafe gehören dem Menschenfresser, so ermorden sie euch. Sagt lieber, sie gehören dem Conte Piro.«
Als der König heran geritten kam, frug er: »Wem gehört denn diese wunderschöne Schafherde?« »Dem Conte Piro,« riefen die Hirten. »Nein, der muß reich sein,« rief der König und freute sich. Etwas weiter fand der Fuchs eine eben so große Schweineherde, und frug die Hirten: »Wem gehört die Herde?« »Dem Menschenfresser.«
»Still doch, still; seht doch, was für eine große Anzahl von Reitern mir folgt. Wenn ihr ihnen sagt, die Schweine gehören dem Menschenfresser, so ermorden sie euch. Ihr müßt sagen, sie gehören dem Conte Piro.« Als nun der König zu den Schweinehirten kam, frug er, wem die große Schweineherde gehöre; sie aber antworteten: »Dem Conte Piro,« und der König freute sich über den reichen Schwiegersohn.
Ein Stückchen weiter kam der Fuchs an eine große Pferdeherde, und frug, wem sie gehöre. »Dem Menschenfresser.« »Still doch, still; seht ihr alle die Reiter, die mir folgen? Wenn ihr ihnen das sagt, so ermorden sie euch. Ihr müßt sagen, sie gehören dem Conte Piro.« Als nun der König kam, und frug, wem die Pferde gehörten, antworteten die Hirten: »Dem Conte Piro,« und der König freute sich, daß seine Tochter einen so reichen Mann geheiratet habe.
Der Fuchs aber lief immer weiter, und kam an eine große Rinderherde. »Wem gehört diese Rinderherde?« »Dem Menschenfresser.« »Still doch, still; seht ihr nicht die Reiter, die mir folgen? Wenn ihr ihnen das sagt, so ermorden sie euch. Ihr müßt sagen, sie gehören dem Conte Piro.« Bald darauf kam der König vorbei geritten, und frug, wem die Rinderherde gehöre. »Dem Conte Piro,« hieß es, und der König freute sich über seinen reichen Schwiegersohn.
Endlich kam der Fuchs an den Palast des Menschenfressers, der ganz allein mit seiner Frau wohnte. Da eilte er hinauf und rief: »Ach, ihr Armen, welches Schicksal steht euch bevor!« »Was ist denn geschehen!« frug der Menschenfresser ganz erschrocken. »Seht ihr die vielen Reiter, die mir folgen?« sprach der Fuchs, »die hat der König ausgesandt, euch zu ermorden.«
»Ach, Füchslein, liebes Füchslein, hilf uns doch,« jammerten die beiden. »Wißt ihr was?« sprach der Fuchs. »Kriecht in den großen Backofen hinein; wenn sie dann wieder fort sind, will ich euch rufen.« Das taten sie, und krochen in den Ofen hinein, und baten ihn: »Liebes Füchslein, verstopfe die Öffnung mit Reisern, daß sie uns nicht sehen.«
Das war gerade, was der Fuchs wollte, und er füllte die ganze Öffnung mit Reisern aus. Dann stellte er sich vor der Haustür auf, und als der König heran geritten kam, sprach er: »Königliche Majestät, geruht hier abzusteigen; hier ist der Palast des Conte Piro.« Da stiegen sie ab und gingen die Treppe hinauf, und fanden da eine Pracht und einen Reichtum, daß der König ganz verwundert war, und dachte: »So schön ist ja selbst mein Schloß nicht. -
Warum sind denn gar keine Diener da?« frug er den Fuchs. Der antwortete: »Mein Gebieter wollte nichts einrichten, ohne die Wünsche seiner schönen Gemahlin zu kennen; die kann nun schalten und walten, wie es ihr beliebt.« Als sie alles betrachtet hatten, kehrte der König auf sein Schloß zurück, und der Conte Piro mit der Königstochter blieben in dem schönen Palast.
In der Nacht aber schlich der Fuchs zum Ofen, zündete die Reiser an, und machte ein großes Feuer, daß der Menschenfresser und seine Frau verbrannten. Am anderen Morgen sprach der Fuchs zum Conte Piro und zu seiner Gemahlin: »Ihr seid nun glücklich und reich, nun müsst ihr mir aber Eines versprechen; wenn ich sterbe, so müsst ihr mich in einen schönen Sarg legen, und mit allen Ehren begraben.« »Ach, Füchslein, sprich nicht vom Sterben,« sagte die Königstochter, denn sie hatte den Fuchs lieb gewonnen.
Nach einiger Zeit wollte der Fuchs den Conte Piro auf die Probe stellen, und stellte sich tot. Als die Königstochter ihn so erblickte, rief sie: »Ach, das Füchslein ist tot, das arme liebe Tierchen! Jetzt müssen wir schnell einen recht schönen Sarg machen lassen.« »Einen Sarg für das Tier?« rief der Conte Piro, »nehmt ihn an den Beinen und werft ihn zum Fenster hinaus.«
Da sprang aber der Fuchs auf und schrie: »O, du undankbarer, schmutziger Bettler, du Hungerleider, hast du denn vergessen, wie dein Glück mein Werk ist? wie ich dir zu allem verholfen habe? du schlechter, undankbarer Mensch!« »Ach, Füchslein, beruhige dich nur,« bat der Conte Piro, »es war nicht so schlimm gemeint; ich habe gesprochen, ohne zu denken, was ich sagte.«
Da ließ sich der Fuchs beruhigen, und lebte noch eine lange Zeit im Palast des Conte Piro, und als er wirklich starb, machte ihm sein Herr einen schönen Sarg, und begrub ihn mit allen Ehren. Der Conte Piro aber und seine schöne Frau lebten glücklich und zufrieden, und wir sind leer ausgegangen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
PAPPELRÖSCHEN ...
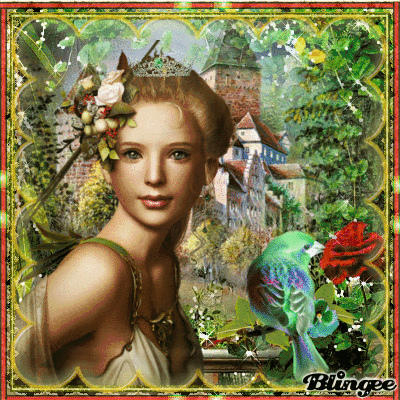
Es war einmal ein Fürst, der hatte eine Tochter, in die er ganz vernarrt war. Das Mädchen war von der sanften Art, sie liebte nicht Feste und Vergnügungen, sie liebte einzig einen Rosenstock. Dieser Rosenstock trug jedes Jahr eine Rose und im Kelche der selben erwuchs ein Samenkorn. Eines Tages hatte sie nicht Acht gegeben: es fliegt ein grüner Vogel herbei, setzt sich auf die Rose, pickt den Samen auf und schwingt sich auf und davon.
Das Mädchen beginnt zu weinen an und klagt: »Wehe mir! Welches Unglück! Der grüne Vogel hat den Rosensamen geraubt, ich muß den grünen Vogel haben! Ich muß den grünen Vogel haben!« Der Vater, der vor Liebe zu seiner Tochter gar nicht wußte, was er tun sollte, rief eilig seine Räte zusammen, und einer der Weisen sprach: »Der grüne Vogel wird sicher wieder kommen, dann stellt man ein Netz. Sobald er sich zeigt, wird er gefangen, und alles ist gut.«
Die Diener stellten das Netz bei der Rose, und das Mädchen lauschte versteckt. Da fliegt er herab, kommt näher, sieht aber das Mädchen und ruft: »Weh, weh! Ich komme nicht wieder!« Und im fort Fliegen noch: »Weh, weh! Er kommt nicht wieder!« Das Mädchen streckte die Arme aus und rief: »Ich will den grünen Vogel haben! Den grünen Vogel!« Doch das war vergebens, niemand konnte ihr den Vogel verschaffen.
Jetzt ließ sich das Mädchen ein Pilgergewand fertigen, hären und zwei Muscheln auf der Brust, nahm einen schwarzen Stab zur Hand und ging zur Hinterpforte des Palastes hinaus. Sie wandert und wandert, überschreitet Berge und Täler und hat viele Abenteuer.
So kam sie eines Abends schon ganz im Finstern vor eine Einsiedelei. Sie bietet dem Einsiedler durch die Tür ihren Gruß, und der ruft erschreckt: »Alle guten Geister ...«, und fängt an, sie zu beschwören. »Was tut Ihr da, meine Seele ist getauft und gefirmelt gleich der Euren«, sprach, ihn beruhigend, das Mädchen. Der Einsiedler fragte sie: »Was hast du in diesem Walde zu suchen?« - »Mein Vater«, antwortete sie, »beging eine Sünde und ich büße für ihn. Aus Barmherzigkeit gebt mir einen Bissen Brot und Herberge für die Nacht!«
Das gab ihr der Alte gern. Das Mädchen aß, trank und legte sich auf das Moos der Einsiedelei. In der Frühe weckte sie der Eremit, sie beteten zusammen, und als sie weiter gehen wollte, schenkte er ihr ein Stücklein Wachs und sprach: »Nimm dies, meine Tochter, das dient dir, wenn du es brauchst.«
So wanderte sie ihre Straße weiter und kam im Dunkelwerden wieder an eine Einsiedelei. Sie rief vor der Tür: »Gruß im Namen Jesu und Mariä.« Aber der Einsiedler erschrak doch und sprach: »Im Namen Gottes beschwöre ich dich!« - »Beschwört mich nicht! Warum? Ich bin getauftes und gefirmeltes Fleisch wie Ihr.« - »Meine liebe Tochter, was machst du zur Nachtzeit in diesem schrecklichen Wald, zwischen wilden Tieren und giftigem Gewürm?« -
»Ach, Vater«, antwortete das Mädchen, »ich habe eine große Sünde begangen und gehe, sie zu büßen. Doch gebt Ihr mir etwas zu essen?« Sie ißt, trinkt und geht dann zur Ruhe. Am anderen Morgen verrichten sie in Gemeinschaft das Gebet, und wie sie weiter zieht, gibt ihr der Alte ein Stücklein Schnur und sagt: »Meine Tochter, nimm dies, das dient dir, wenn du es brauchst.«
Endlich erreicht sie eine Stadt und sieht den königlichen Palast ganz mit Trauerfloren umhängt. Sie fragt die Wache am Tor, was es da gebe, und die antwortet: »Es ist große Trauer, denn der Sohn der Königin ist verschwunden und man weiß nicht wohin.« Da sagt das Mädchen: »Geht und bittet die Königin um ein Obdach für eine müde Pilgerin.« Die Wache geht und die Königin läßt sie eintreten.
Sie sieht das Mädchen und sagt verwundert: »So klein lauft Ihr in der Welt herum, wozu das?« - »O, Frau Königin«, antwortet das Mädchen, »ich beging eine große Sünde und muß jetzt sieben Jahre lang Buße tun.« - »Bleibe bei mir!« bat sie die Königin. »O nein, Frau Königin«, antwortete die Kleine, »ich muß weiter, doch bitte ich Euch, mir zum Abschiede ein Andenken zu gewähren.« -
»Wähle!« sagte die Königin und ließ sie alle ihre Kostbarkeiten, Kleinode und Ringe sehen. Die Pilgerin sah einen kleinen Ring mit einem Demant drin, wählte diesen und sprach: »Dies sei das Angedenken.« Den aber wollte die Königin just nicht entbehren und meinte: »Wähle alles andere und laß mir den Ring, ihn kann ich dir nicht geben, er kommt von meinem Sohne.«
Sie redeten hin und her, das Mädchen bestand auf seiner Wahl und versprach der Königin: »Wenn Ihr mir den laßt, so kehre ich sicher zurück.« Auf dieses Versprechen hin gab die Königin endlich nach und ließ ihr den Ring. Mit drei der Angedenken: dem Wachs, der Schnur und dem Ring, in der Tasche reiste das Mädchen weiter.
Sie kommt an einen Berg, an dessen Fuße sitzt ein kleiner Sklave, den fragt sie um ihren Weg. Wie er hört, daß sie Obdach suche, sagt er: »Steige hier die Hälfte des Berges hinan, dort wirst du einen Palast finden, klopfe nur an, man wird dir auftun.« Sie erreichte den Palast, hörte aber beim Anklopfen die Stimme der Hexe von drinnen und erschrak gar sehr.
Die Tür öffnet sich langsam und heraus tritt ein gewaltiger Riese, der war so groß, daß sie ihn anzuschauen den Kopf weit zurück biegen mußte, der fuhr sie an: »Was willst du hier, du Dingelchen, du? Wenn dich die Hexe hört, frißt sie dich mit Haut und Haar.« Und da war auch schon die Hexe da, ein langes, dünnes Weib, das nur von Menschen, Schafen, Ziegen, Ochsen lebte, die sie wie Pfefferkuchen fraß.
Die bückt sich und fragt: »Was willst du hier? Ei, setzt mir doch einmal den Kessel bei, ich will mir schnell ein Süppchen machen.« Der Riese bittet für das Mädchen und sagt: »Laßt das junge Blut heut Abend in Ruhe. Laßt mir das Pappelröschen gehen.« Er nannte sie Pappelröschen, weil sie so schlank und fein war wie diese Gartenblume.
Am anderen Morgen, ehe die Hexe fort ging, rief sie das Mädchen und sprach: »Pappelröschen, putze mir die Kessel, ich gehe aus mir Speise zu suchen. Komme ich zurück und du bist nicht fertig, zerschmelze ich dich im Tiegel zu Fett.«
Des Kupfers war aber sehr viel, und wenn das Mädchen auch wie ein Bär gearbeitet hätte, nicht in zwei Tagen würde sie es fertig gebracht haben. Darum lehnte sie sich an das Fenster und weinte gar bitterlich.
Plötzlich sah sie auf der Halde drüben den grünen Vogel, auch der Riese sah ihn und sagte: »Jetzt kannst du Hilfe haben.« Er ging hinab und erzählte dem Vogel den Kummer des Mädchens, der rief: »Hat sie denn nicht das Stücklein Wachs? Das werfe sie ins Feuer, und was sie braucht, wird ihr werden.«
Pappelröschen wirft das Wachs ins Feuer, und augenblicks erscheinen eine Menge Riesen, die greifen in das Kupferzeug hinein: dieser nimmt einen Kessel, ein anderer einen Tiegel, jener einen Topf und so fort, und fangen an zu putzen und zu scheuern, daß das ganze Kupfer in einem Hui! geputzt war und spiegelblank an der Wand hing. Was aber sollte nun mit den Riesen geschehen, die jetzt, die Hände im Schos, herum saßen? Auch hier wußte der grüne Vogel Rat, er trug dem Riesen auf: das Mädchen solle das Feuer ins Wasser werfen und sie werden verschwinden. Und sie verschwanden.
Wie die Hexe nach Hause kam und das blank gescheuerte Kupferzeug sieht, sagte sie: »Pappelröschen, das riecht nach fremdem Schweiß! Morgen werden wir uns weiter sprechen.« Sie befahl dann den Knechten, dem Mädchen eine Keule zu geben von einem Ochsen, den sie eben geschlachtet. Die warf Pappelröschen zum Fenster hinaus, sie mochte sie nicht anrühren. Und wieder erblickt sie den grünen Vogel, der in zierlichem Fluge vor sie herum schwebte, hüpfte und sprang.
Am nächsten Morgen rief die Hexe: »Pappelröschen, heute sollst du alle unsere Betten, Decken und Überzüge auftrennen, waschen und wieder füllen. Ich gehe in dessen meinen Tagesbedarf zu holen, komme ich zurück und du bist nicht fertig, schneide ich dich in Kochstücke.« Sie ging, und die Ärmste blieb weinend zurück. Der Riese fragt sie um ihre Tränen, und sie erzählt ihm ihr Leid.
Da geht der Riese wieder zum grünen Vogel, und der läßt ihr raten, sie solle den Faden abwickeln, den sie habe, und es werde alles gut gehen. Sie wickelt den Faden ab, und es erscheinen eine Menge Arbeiter: einer trennt auf, ein anderer nimmt die Wolle heraus, dieser stäubt sie aus, jener wäscht sie und so fort, bis das Ganze vollendet war. »Was aber fange ich nun mit den Arbeitern an?« fragte das Mädchen. Der Riese, der den grünen Vogel auch darum befragte, erfuhr von diesem, sie brauche den Faden nur zu verbrennen und sie werden verschwinden. Wirklich geschah es so.
Und als die Hexe kam und fragte: »Sind die Betten bereit?« zeigte ihr das Mädchen die fertige Arbeit. Sie hörte die gleiche Rede der Hexe und empfing zum Abendbrot ein halbes Schaf, das sie wieder aus dem Fenster warf. Anderen Tages zeigte ihr die Hexe eine große Kiste voll Leinwand und sprach: »Diese Leinwand mußt du mir zu Hemden schneiden, nähen, waschen und bügeln. Wirst du nicht fertig, so röste ich dich wie einen Fisch.«
Der Riese fand Pappelröschen weinend, erriet ihre Gedanken und ging zum grünen Vogel, der sagte: »Das ist meine letzte Hilfe, weiteres kann ich nicht tun. Jetzt soll sie den Ring der Königin nehmen, den Demant heraus lösen und ihn in die Sonne legen, da wird ihr alles, was sie wünscht.« Da kommen große Frauen herbei, schneiden die Leinwand, nähen, bügeln und die Arbeit ist im Handumdrehen vollendet. Und wie sie auf des Vogels Rath den Stein wieder in das Gold fügt, verschwinden auch die Frauen.
Da ist auch die Hexe wieder da mit einem toten Stier auf dem Nacken, den sie an diesem Tage gefangen. Noch keuchend rief sie: »Pappelröschen, wo sind die Hemden?« Das Mädchen zeigte ihr die fertige Arbeit, und die Alte sagte: »Das riecht nach fremdem Schweiße. Sorge dich nicht, morgen mußt du doch sterben!«
Am nächsten Morgen fliegt der grüne Vogel herein, die Hexe ruft: »Vogel bist du, Mensch werde!«
Und da wurde der Vogel zum Menschen, der sprach zu der Hexe: »Warum willst du Pappelröschen töten?« Sie wurde aber grob und sprach: »Was scherst du dich darum? Marsch, packe dich fort!« Darauf ruft sie den Riesen herbei und befiehlt ihm, das Mädchen unter die wilden Ziegen zu stoßen, daß diese sie umbringen.
Der Riese packt sie auch beim Halse und trägt sie hinunter, begegnet aber dem grünen Vogel, welcher ihm einen Stab gibt und sagt: »Nimm diesen Stab, sobald du an der Halde bist, schlägst du den Boden damit, so wird ein grünes Kornfeld hervor sprießen, woran den Ziegen der Hunger vergeht.« Der Riese kam zu den Ziegen, die rochen kaum das Menschenfleisch, als sie in großen Sprüngen herbei eilten, das Mädchen zu fressen.
Kaum schlägt aber der Riese mit dem Stabe auf den Boden, so schießt eine Kornsaat hervor, ein paar Ellen hoch, und jetzt stürzen sich die Ziegen auf diese. Acht Tage war Pappelröschen bei der Herde, da kommt die Hexe nach zu sehen. Ehe sie aber die Ziegen erreichte, mußte sie an einem Hirten vorüber, der mit seiner Tochter die Schafe hütete.
Als diese Tochter sie kommen sah, rief sie: »Wartet, Mutter Hexe, ich habe etwas für Euch!« Schnell schlachtet sie Schafe und Böcklein, bratet sie an einem großen Feuer, trägt zwölf große Brote herbei und ein Faß Wein und bereitet der Hexe ein großes Mahl. Die verschlang alles und hätte noch mehr verschlungen, denn ihr Magen hatte keinen Grund.
Die Güte des Mädchens nun hatte sie gerührt, und sie sprach: »Niemand noch hat dies Mitleid mit mir gehabt, du bist ein gutes Mädchen und sollst dafür die Frau meines Sohnes werden.« Sie trug das Mädchen nach Hause, setzte es vor ihrem Sohne nieder und sagte: »Hier, mein Sohn, ich habe dir deine Frau mitgebracht.« Der grüne Vogel sprach: »Gut, Mutter, aber weißt du, wenn Pappelröschen noch am Leben ist, lassen wir sie holen, sie als Magd zu halten.«
Die Mutter war einverstanden, und das Mädchen kommt zurück. Wie die Hexe fort war, nimmt der grüne Vogel den Ring des Befehls und sagt: »Geschwind eine dicke Fackel und in dem Leibe der selben Pulver und Blei, damit die Zimmer der Hexe in die Luft gesprengt werden.« Darauf gab die Hexe dem Sohne die Schäferin zur Frau, und Pappelröschen mußte jene Hochzeitsfackel halten.
Als die Fackel bis zu einem gewissen Punkte herab gebrannt war, bat der Bräutigam die Braut: »Halte du mir sie jetzt einen Augenblick und gehe damit zu meiner Mutter!« Bei dieser angekommen, platzt die Fackel, und der Riese, Pappelröschen und der Jüngling entfliehen. Die Hexe war aber nicht tot, sie hatte sich bald aus der Betäubung aufgerafft und machte sich jetzt daran, die Fliehenden zu verfolgen, um sie zu erwürgen.
Pappelröschen dreht in ihrer Angst den Ring und wünscht sich und ihren Gefährten in einen kupfernen Turm, so daß, wie die Hexe ankam, sie ihnen nichts anhaben konnte und sich vor Zorn in die Hände biß. Und wieder dreht Pappelröschen den Ring und befiehlt, daß die Alte massives Gold werde und zwanzig Ellen tief in die Erde verschlagen sein solle. Und es geschah.
Darauf wünscht sie einen schönen Palast herbei mit Dienern, Pferden und Wagen, mit Gold- und Silberzeug - und siehe, auch der stand sofort zur Stelle. Jetzt kleidet sie sich als Königin und geht in den Trauerpalast jener Königin, läßt die Trauerflore weg nehmen, und wie sie die Königin darob befragt, antwortet sie: »Kennt Ihr mich nicht mehr, Frau Königin?« Die Kammerzofe erkannte sie sogleich und rief: »Das ist ja die kleine Pilgerin!«
Nun erinnerte Pappelröschen die Königin an alles, da ward die Freude groß, noch größer aber, wie sie erfuhr, daß ihr Sohn aus den Händen der Hexe befreit und am Leben sei, denn die Königin war seine rechte Mutter. Pappelröschen drehte den Ring noch einmal, und eine Schar Riesen kam herbei, die gruben die Gold gewordene Hexe aus der Erde, luden sie auf einen Wagen, spannten fünfzig Joch Ochsen davor und fuhren sie vor den Palast der Königin.
Dort wurde ein großes Fest gefeiert, das war die Hochzeit des Königssohnes und Pappelröschen's. So wurde aus dem Trauerpalast ein Haus der Freude.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
SCHUHFLICKER IM GLÜCKE ...

Es war einmal ein Schuhflickerlein, das lebte mit Frau und Kindern im Elend, denn sie hatten nichts zu brocken und zu beißen. Wie oft er auch mit seinem Werkzeugkorb durch die Straßen lief und rief: »Wer hat Schuhe zu bessern?« ... so kam doch niemand, der seiner Arbeit begehrte, und des Lebens müde, beschloß er, sich zu ersäufen.
Wie er sich in den Strudel stürzen will, tritt vor ihn sein Glück, hält ihn zurück und sagt: »Was willst du tun?« - »Ach!« seufzte er, »das Unglück verfolgt mich und ich mag nicht mehr leben.« Spricht zu ihm das Glück: »Tue das nicht. Hier nimm dieses Messer! Disteln gibt es genug, und bei jeder Distel, welche du damit abschneidest, wirst du einen kleinen Groschen finden.«
Er nahm das Messer, und gleich bei der ersten Probe fand er den Groschen und so fort bei jeder anderen. Nun war ihm geholfen und er sang ganz laut in die Welt hinein: »Juchhei! Was für ein reicher Mann ich bin!«
Das hörten die Mönche des Klosters, an dem er just vorüber zog, sie ließen ihn herein kommen und fragten: »Gevatter Beppo, was habt Ihr denn, daß Ihr gar so lustig seid?« - »Ei,« rief er, »mir ist das Glück erschienen und ich bin jetzt reich.« Dabei erzählte er seine Geschichte und zeigte ihnen das Messer vor. Die Mönche meinten, das könnten sie auch gebrauchen, und überlegten, wie sie ihn überlisten könnten.
Sie gaben ihm tüchtig zu essen und zu trinken, und wie er betrunken war, nahmen sie ihm das Messerchen ab und steckten ihm ein ganz ähnliches in die Tasche. Er kam nach Hause, voll Freude rief er Weib und Kinder herbei und sagte: »O, wie sind wir reich!« Die Frau dachte, er sei wohl gar verrückt geworden, und sagte dies auch den Kindern; als er sie aber einlud, mit ihm hinaus aufs Feld zu kommen, gingen sie alle mit, wunderten sich aber baß, als der Vater anfing Disteln abzuschneiden. Geld hat er damals keins gefunden.
»Mit mir ist es aus, jetzt muß ich mich dennoch ersäufen«, rief er und eilte dem Fluße zu, sich hinein zu stürzen. Doch wieder erscheint ihm sein Glück und sagt: »Was willst du schon wieder hier?« - »Ach! ins Wasser will ich mich stürzen!« - »Tue es nicht, denn ich bin gekommen, dir zu helfen. Nimm diesen Esel, bei jedem Stockstreich, den du ihm gibst, wird er ein Häufchen Gold fallen lassen.« Und sie gab ihm auch den Stock.
Kaum ist sie fort, so fängt er an, den Esel zu schlagen, und siehe da! bei jedem Schlag ein Häuflein Gold. Jetzt kannte seine Freude keine Grenzen, und jubelnd singt er an dem Kloster vorüber: »Juchhei, welch ein reicher Mann ich bin!« Die Mönche rufen ihn an: »Gevatter Beppo, kommt doch einen Augenblick herein! Sagt, was singt Ihr da?«
Statt aller Worte zeigt er ihnen sein Glück durch die Tat, schlug auf den Esel und teilte ihnen von seinem Reichtum mit. Die Mönche sagten unter sich: »Das Tierlein wäre uns schon lieb.« Und sie gaben ihm zu essen, machten ihn trunken, vertauschten seinen Esel mit einem anderen Grauchen und stellten auch einen anderen Stock dazu.
So kam er zu seiner Frau und rief: »Jetzt, Frau, jetzt sind wir reich wie der König! Nimm das Betttuch und breite es auf den Boden, nur schnell!« Frau und Kinder schauten einander an, jedes meinte, der Vater sei jetzt alles Ernstes verrückt geworden. - Die Frau sagte: »Was soll es da mit dem Betttuch?« - »Tue nur, wie ich dir geheißen!«
Sie breiteten es denn auf dem Boden aus, er trieb den Esel darauf und nun schlug er auf das Tier los. Aber er mochte schlagen, was er wollte, Gold kam nicht zum Vorschein, ganz zuletzt nur ließ das geplagte Tier etwas fallen, was jedoch kein Gold war. Da jagten sie den Vater mit samt seinem unmanierlichen Esel zum Hause hinaus.
Er lief und weinte und schrie: »Jetzt hält mich nichts mehr zurück, jetzt will ich wirklich sterben.« Doch zum dritten mal erscheint ihm sein Glück: »Du kommst schon wieder?« - »Laß mich«, ruft er verzweifelt, »laß mich, ich mag nichts mehr von dir wissen, ich will und muß sterben!« - »Mut, Väterchen, Mut! Ich will dir ja aus aller Not helfen.«
Und das Glück gab ihm einen Korb voll Schuhleisten und sprach: »Jetzt mußt du bei den Mönchen vorüber gehen und mußt ihnen sagen: 'Heraus mit dem Messer, heraus mit dem Esel, oder ich mache euch die Köpfe mürbe wie frischbacken Brot!' Dann rufst du nur: 'Schlagt zu, ihr Leisten!' und die Leisten werden anfangen die Köpfe zu bearbeiten. Denkst du es sei genügend, so rufe: 'Genug, ihr Leisten!' und sie wandern wieder in den Korb zurück.«
Er kam zu den Mönchen und sagte: »Jetzt gebt mir einmal meinen Esel und mein Messer heraus, oder ...« Die Mönche leugneten alles rundweg ab, sie wüßten nichts. Da wurde der Schuhflicker zornig und rief: »Schlagt zu, ihr Leisten!« Wupp! waren die Leisten aus dem Korb und tanzten auf den Glatzen der Mönche herum, daß sie weich wie Brei wurden.
Wie sie sich gar nicht zu retten wußten, schrien sie: »Halt ein! Wir wollen dir alles wieder heraus geben!« Da sagte jener: »Genug, ihr Leisten!« und da huschten sie wieder in den Korb. Als sie aber zur Ruhe gekommen waren, zögerten sie dennoch, die Sachen heraus zu geben; da drohte der Schuster von neuem mit den Leisten. »Geben wir sie ihm«, riet der Abt, »sonst bringt er uns noch alle ums Leben.«
So bekam er sein Messer und seinen Esel zurück. Damit man ihn auch nicht betrüge, gab er dem Esel einen Schlag, aber es war doch der echte. Jetzt heim!
»Frau!« rief er von weitem, »nun sind wir doch reich!« Die sagte: »Da ist der Verrückte wieder, was fangen wir mit ihm an?« - »Frau, Frau, geschwind, breite das Betttuch aus!« - »Was? Willst du heute durchaus Schläge haben?« Und auch die Kinder kamen, ihn zu verspotten.
Da wurde er fuchswild und rief: »Schlagt zu, ihr Leisten!« Da ging ein Gejammer los und sie waren ihm gar gern zu Willen mit dem Betttuch. Da es ausgebreitet war, schlug er den Esel, und siehe, er ließ einen großen Haufen Gold fallen. Nun war die Freude groß und sie umarmten und küßten den Vater, und das Glück ist nie mehr von ihrem Haus gewichen.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
DAS KLUGE MÄDCHEN ...

Es war einmal ein Jäger, der eine Frau hatte und zwei Kinder, einen Knaben und ein Mädchen, und sie wohnten in einem Wald, wo niemand hin kam, und so wußten sie nichts von der Welt. Der Vater ging manchmal in die Stadt und brachte Nachricht von da.
Einmal ging der Sohn des Königs auf die Jagd und verirrte sich im Wald, während er den Weg suchte, wurde es Nacht, er war müde und hungrig. Plötzlich sieht er fern, ein Licht schimmern. Er geht ihm nach und kommt zu dem Hause des Jägers und bittet um Unterkunft und etwas zu essen. Der Jäger erkannte ihn gleich und sagte: "Hoheit, wir haben schon gegessen, aber es wird sich noch etwas für Euch finden, wenn Ihr vorlieb nehmen wollen. Was soll ich machen? Wir sind soweit von der Welt entfernt, daß wir uns nicht verschaffen können, was man täglich braucht."
In dessen ließ er einen Kapaun kochen. Der Prinz wollte ihn nicht alleine essen, viel mehr rief er die ganze Familie des Jägers, gab dem Vater den Kopf, den Rücken der Mutter, die Füße dem Sohn, die Flügel dem Mädchen, und das übrige aß er selbst. Dann kam der Augenblick, zu Bett zu gehen. Im Hause waren nur drei Betten in einer einzigen Kammer; in dem einen schliefen Mann und Frau, in dem anderen Bruder und Schwester.
Die Alten gingen in den Stall und überließen ihr Bett dem Prinzen. Als das Mädchen sah, daß er eingeschlafen war, sagte sie zum Bruder: "Ich wette, daß du nicht weißt, warum der Prinz den Kapaun auf diese Art zwischen uns geteilt hat." - "Weißt du es? Sage mir es!" - "Den Kopf hat er dem Vater gegeben, weil er das Haupt der Familie ist, den Rücken der Mutter, wie sie den ganzen Haushalt auf den Schultern hat, die Beine dir, da du flink sein mußt, um alle Aufträge auszurichten, die, die andere dir geben, und mir die Flügel, um fort zu fliegen, und einen Mann zu suchen."
Der Prinz tat, als ob er schlafe, schlief aber nicht, sondern hörte alles, und merkte, daß das Mädchen viel Verstand hatte, und weil sie auch noch hübsch war, verliebte er sich in sie. Am anderen Morgen verließ er das Haus des Jägers, und an den Hof zurück gekehrt, schickte er ihm durch einen Diener eine Börse mit Geld, dem Mädchen aber einen Kuchen in Form eines Vollmonds, dreißig kleine Pasteten und einen gekochten Kapaun, wobei er sie dreierlei fragen ließ:
Ob man im Wald am dreißigsten des Monats sei, ob der Mond voll sei und ob der Kapaun am Abend singe. Der Knecht, obwohl er sonst sehr zuverlässig war, ließ sich doch von der Lüsternheit verleiten, aß fünfzehn Pastetchen, ein gehöriges Stück von dem Kuchen und den Kapaun. Das Mädchen aber, das alles verstanden hatte, sandte die Antwort an den Prinzen, den Fasan zu retten, aus Liebe zu dem Rebhuhn.
Auch der Prinz verstand das Gleichnis, rief den Diener und herrschte ihn an: "Spitzbube! Du hast den Kapaun gegessen, fünfzehn Pastetchen und ein großes Stück von der Torte. Danke dem Mädchen, das für dich gebeten hat, sonst müßtest du hängen!"
Einige Monate darauf fand der Jäger einen goldenen Mörser und wollte ihn dem Prinzen zum Geschenk machen. Seine Tochter aber sagte zu ihm: "Ihr werdet wegen dieses Geschenkes verhöhnt werden. Der Prinz wird euch sagen: Der Mörser ist gut und schön, aber Kerl, wo ist der Stößel?" - Der Jäger hörte nicht auf seine Tochter. Als er aber dem Prinzen den Mörser brachte, hörte er von ihm genau das, was sie vorausgesagt hatte. -
"Das hatte mir schon meine Tochter gesagt", rief der Jäger. "O, wenn ich ihr doch gefolgt wäre!" - Als der Prinz das hörte, sagte er ihm: "Deine Tochter, die so weise ist, soll mir hundert Ellen Leinwand aus vier Unzen Flachs machen. Sonst lasse ich dich und sie aufhängen."
Der arme Vater ging weinend nach Hause zurück, in der Überzeugung, daß er und sein Kind sterben müsse, denn wer macht hundert Ellen Leinwand aus vier Unzen Flachs? Das Mädchen aber, das ihm entgegengegangen war, fragte ihn, weshalb er weine, und da sie den Grund erfahren hatte, sagte sie: "Und um das weint ihr! Gebt mit den Flachs, für das andere werde ich sorgen."
Dann machte sie aus dem Flachs vier Schnüre und sprach zum Vater: "Nehmt diese Schnüre und sagt dem Prinzen, wenn er mir aus diesen Schnüren einen Webstuhl gemacht hat, werde ich ihm die hundert Ellen Leinwand weben." Der Prinz, als er diese Antwort hörte, wußte nicht, was er sagen sollte, und dachte nicht mehr daran, weder den Vater noch die Tochter hinrichten zu lassen.
Am nächsten Tage aber ging er in jenen Wald, um das Mädchen zu besuchen. Ihre Mutter war gestorben, der Vater ausgegangen, seinen Acker umzugraben. Der Prinz klopft an, aber niemand öffnet. Er klopft noch einmal, doch nichts; das Mädchen stellte sich taub. Endlich wird es der Prinz müde, zu warten, sprengt die Tür und tritt ein. "Du Ungezogene! Wer hat dich gelehrt, einem meines gleichen nicht zu öffnen? Und dein Vater und deine Mutter – wo sind sie?" -
"O, wer konnte wissen, daß Ihr es seid? Der Vater ist auf seinem Felde, und die Mutter weint um ihr Leid. Sie müssen gehen, denn ich habe anderes zu tun, als Euch anzuhören." Der Prinz ging zornig weg und beklagte sich beim Vater wegen der groben Manieren seiner Tochter, der Vater aber entschuldigte sie.
Endlich sah der Prinz, wie klug und schlau sie war und nahm sie zur Frau. Sie feierten sehr festlich die Hochzeit, da fiel aber was vor, was um ein Haar der Prinzessin Unglück gebracht hätte.
Es war Sonntag, und zwei Bauern, einer mit einer trächtigen Eselin, der andere mit einem Handkarren, kamen an der Kirche vorbei. In diesem Augenblick läutete es zur Messe, und sie gingen hinein. Der eine ließ seinen Karren draußen, der andere band seine Eselin an den Karren und beide gingen hinein. Während der Messe warf die Eselin ein Junges, und sowohl ihr Herr, als auch der mit dem Karren wollten das Eselfüllen für sich.
Man appellierte an den Prinzen, und der gab das Urteil, das Junge gehöre dem Besitzer des Karrens. Denn, sagte er, es sei leichter, daß der Herr der Eselin sie an den Karren angebunden hätte, um die Geburt des Jungen zu fälschen als daß der andere den Karren an die Eselin angebunden hätte. Die Vernunft sprach für den Herrn der Eselin, und das ganze Volk war auf seiner Seite. Der Prinz aber hatte den Spruch getan, dagegen war nicht anzukommen.
Der arme Verurteilte aber sah seine Zuflucht bei der Prinzessin, und sie riet ihm, Netze auf den Platze auszuwerfen, wenn der Prinz vorbei käme. Das geschah, und als der Prinz die Netze sah, sagte er zu jenem Manne: "Was tust du, Narr? Willst du auf dem Marktplatz Fische fangen?" - Der Bauer, den die Prinzessin beraten hatte, antwortete: "Es ist leichter, daß ich auf dem Platz Fische fange, als daß ein Karren Eselfüllen wirft." Der Prinz nahm sein Urteil zurück.
Dann aber, als er in den Palast zurück gekehrt war, da er gemerkt, daß die Prinzessin die Antwort eingegeben hatte, sagte er ihr: "Binnen einer Stunde, mache dich bereit, nach deinem Hause zurück zu kehren. Nimm das mit, was dir am meisten gefällt, und gehe!" - Sie betrübte sich gar nicht. Sie speiste besser als sonst zu Mittag und ließ den Prinzen eine Flasche Wein trinken, in den sie ein Schlafmittel getan hatte.
Als er dann wie ein Toter schlief, brachte sie ihn in einen Wagen und nahm ihn mit in ihr Haus. Es war Januar und sie ließ das Dach des Hauses abheben und es auf den Prinzen herabschneien. Da wachte er auf und rief laut nach seinem Diener. "Ei, was Diener!" sagte die Prinzessin. "Hier befehle ich. Hast du mir nicht gesagt, ich solle aus deinem Hause mitnehmen, was mir am besten gefalle? Ich habe dich mitgenommen, und jetzt gehörst du mir."
Der Prinz lachte, und sie schlossen Frieden.
Italienisches Märchen /Heyse
MEERBLUME ...

Es war einmal ein Bruder und eine Schwester. Der Bruder verheiratete sich und bekam sieben Söhne. Es verheiratete sich die Schwester und bekam sieben Töchter. Wenn nun der Bruder am Hause der Schwester vorüber kam, rief er: »Heil dir, Schwester, mit den sieben Mädchen!« Eines Tages, wie er ihr das selbe gesagt hatte, erzürnte sich die Schwester gar sehr und konnte ihre Tränen nicht mehr zurück halten.
Kommt die älteste Tochter nach Haus, findet die Mutter in Tränen und fragt: »Was fehlt dir, Mutter, warum weinst du?« - »Ach«, sagte die Mutter, »warum sollte ich nicht weinen?« Und sie erzählte der Tochter alles. »Und weiter nichts?« rief die Tochter, »da sei nur ruhig. Er mit seinen sieben Jungen und wir mit unsern sieben Mädchen, wir wollen doch einmal sehen, wer ein größeres Glück machen wird. Gleich jetzt begebe ich mich mit seinem Ältesten auf die Wanderung durch die Welt, und kehren wir heim, so wird es sich zeigen, wer das Beste gewonnen hat.«
Kaum war es Tag geworden, ging die Tochter, die in Wahrheit ein wunderschönes Mädchen war, mit dem ältesten Sohne des Oheims, alle beide als Burschen gekleidet, auf die Wanderschaft in die weite Welt. Aber sie waren noch nicht weit von der Heimat entfernt, als der gute Vetter die Lust verlor und umkehrte. »Weißt du was, liebe Base«, sagte er zu dem Mädchen, »geh wohin du willst, ich tue nicht mehr mit.« Und er ging heim, eine Hand rechts, eine links, gerade wie er ausgegangen war.
Die Base wanderte ganz allein weiter und kam an das königliche Schloß. Sie trat vor die Wächter und bat: »Um der Barmherzigkeit willen, laßt mich hinein.« Sie war als Pilger gekleidet, und einer der Wächter, der das beste Herz hatte, sagte zu dem anderen: »Laßt ihn hinein! Jeder Arme ist Gottes und will leben.« So ließ man sie hinein.
Ohne alle Furcht ging sie zu dem König und sprach: »Gnade, Herr König, ich bin ein armes Pilgerlein, gebt mir zu arbeiten.« - »Wohl, wohl, mein Sohn«, antwortete der König, »doch welches Handwerk verstehst du? Willst du Stallbub werden oder Hühnerwächter?« - »Stallbub will ich werden.« So wurde sie Stallbub beim Sohne des Königs.
Je länger sie aber diesen Dienst versah, je schöner ward sie, und der Königssohn wollte dem Stallbuben so wohl, daß er ihn mit sich an seiner Tafel essen ließ. Auch wollte es ihm gar nicht in den Sinn, daß sein Stallbub wirklich ein Bub und kein Mädchen war. Eines Tages ging er zu seiner Mutter, der Königin, und sagte ihr: »Liebe Mutter, der Stallbub ist so schön, daß ich sterben möchte, und ich kann und kann es nicht glauben, daß er ein Bub ist, ganz gewiß ist es ein Mädchen. Das aber würde ich heiraten, ich liebe es zum Sterben, liebe Mutter.«
Wie die Königin ihren Sohn so betrübt sah, fing sie zu weinen an und ließ so gleich den Stallbuben auf ihr Zimmer rufen. Er kommt, die Königin liebkost ihn und sagt: »Mein Sohn, du bist so schön und kannst unmöglich ein Bub sein. Sage mir es, bist du ein Mädchen? Mein Sohn liebt dich über die maßen, und bist du ein Mädchen, so wird er dich zur Frau nehmen.« Sie aber gestand nichts, leugnete und sprach: »Ich bin ein Bub.«
Bald darauf kommt der Prinz, zu erfahren, was seine Mutter ausgerichtet hatte. »Was hat er gesagt?« - »Er hat gesagt, daß er ein Bub sei; doch höre, was du tun mußt. Führe ihn in den Garten: siehst du, daß er sich eine Nelke pflückt, so ist es ein Bub, pflückt er sich eine Rose, ist es ein Mädchen.« Schnell führt er ihn in den Garten, und jene pflückt sich als bald eine Nelke. Weinend kommt der Prinz zur Mutter zurück, und diese mochte sagen was sie wollte, er mochte sich nicht überzeugen lassen, daß es ein Bube sei.
Da sagte die Mutter: »Mein Sohn, jetzt gibt es nur noch ein Mittel. Du gehst mit ihm zum Meer ins Bad, und so im Guten oder Bösen wirst du das Geheimnis endlich entdecken.« Schnell rief der Jüngling seinen Stallbuben: »Meerblume, Meerblume« - denn so nannte sich jener - »sattle zwei Pferde, eins für mich, eins für dich, denn morgen früh wollen wir ans Meer reisen, um Bäder zu nehmen.« Die Arme verstand gar wohl, was das zu bedeuten habe, aber am anderen Morgen standen die Pferde gesattelt vor der Tür, und sie reisten ab.
Am ersten Abend übernachteten sie in einer Locanda, und der Prinz rief: »Meerblume, wohin hast du die Schlüssel zum Gepäck gelegt?« - »Potz tausend«, antwortete jene, »was habe ich getan? Ich habe die Schlüssel daheim im Palast liegen lassen!« Wohl aber hatte sie die selben bei sich. »Ja, was fange ich nun an?« sagte der Prinz. »Meerblume, du wirst schleunigst nach Hause reiten und die Schlüssel holen müssen. Geh, ich erwarte dich hier.«
Das ließ sich Meerblume nicht zweimal sagen, sie ritt auf und davon und kommt zum Palast. »Frau Königin«, sagt sie zu dieser, »Euer Sohn hat eingesehen, daß er zu wenig Geld mit genommen hatte, Ihr sollt ihm noch eine größere Summe schicken.« Die Königin packte ein Kästchen voll Geld, und jene ging damit in ihre Heimat zu ihrer Mutter. Ehe sie aber fort ging, schrieb sie an das Thor des Palastes die Worte:
Meerblume nannt' ich mich hier am Ort,
Als Jungfrau kam ich und geh' ich fort.
Der Prinz wartete lange; als er aber endlich merkte, daß Meerblume nicht wieder kam, kehrte auch er um, zu sehen, was geschehen sei. Er kommt an das Tor des Palastes, liest was da geschrieben stand, und schlägt sich vor die Stirn. Ganz betrübt geht er zu seiner Mutter: »Siehst du, Meerblume war also doch ein Mädchen und kein Bub. Jetzt, wohin soll ich mich wenden, sie zu finden?«
Er dachte hin und her, endlich kam ihm ein Gedanke, und er sagte zu seiner Mutter: »Laß mir doch goldene Spinnrocken und silberne Spindeln machen, mit denen will ich von Land zu Land hausieren gehen. Wer weiß, ob jener, wenn sie mich rufen hört, nicht die Lust kommt, das eine oder das andere zu kaufen.«
Wie die Ware fertig war, kleidete er sich in arme Kleider und ging als Händler durch die Länder, immer rufend: »Wer kauft goldene Spinnrocken, wer kauft Spindeln von Silber?«
So kam er auch in einen Ort, wo ein schöner Palast stand, und da rief er unter den Fenstern sein »Wer kauft goldene Spinnrocken, wer kauft Spindeln von Silber?« Da schaute aus einem Fenster ein wunderschönes Mädchen heraus, das rief: »Rockenhändler, komm herauf! komm herauf!« Bei dieser Stimme gab es dem Prinzen einen Stich durchs Herz. Es war Meerblume, welche heimgekommen, sich einen großen Palast gebaut hatte und nun gleich einer großen Dame Frauenkleider trug, und mit ihr waren die Schwestern und ihre Mutter.
Der Prinz stieg hinauf zu ihr. »Was kosten diese Rocken und diese Spindeln hier?« Und er antwortete: »Mein Fräulein, um Geld sind sie mir nicht feil, aber um einen Kuß gebe ich sie gern her.« - »Unverschämter! Ich ließ mich nicht einmal vom Sohn des Königs küssen, der doch in Liebe zu mir verging, und jetzt sollte mich deines gleichen küssen?«
Da ging der Prinz hinter den Palast, kleidete sich als Königssohn, zog aber die schlechten Kleider darüber, und ging von neuem als Rockenhändler an dem Palaste vorüber. »Wer kauft goldene Spinnrocken? Wer kauft Spindeln von Silber?« Wieder erschien Meerblume am Fenster und rief: »Was kosten diese Rocken? Was kosten diese Spindeln?« Und jener antwortete wie das erste mal: »Mein Fräulein, um Geld sind sie mir nicht feil, wohl aber um einen Kuß!« -
»Unverschämter! Nicht einmal der Königssohn, der aus Liebe zu mir verging, durfte mich küssen, wie dürfte es einer deines gleichen?« Da antwortete jener: »Willst du mich nicht küssen, so küsse den Königssohn!« Schnell warf er die schlechten Kleider ab, und wie sie ihn nun so schön und königlich gekleidet sah, erkannte sie ihn also bald, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn mit tränenden Augen um Gnade, denn sie meinte, er wäre gekommen, sie umzubringen.
Er aber sprach: »Fürchte dich nicht, ich kam nicht, dir Böses zuzufügen, sondern Gutes zu tun.« Und sie umarmten sich so voll Liebe, daß ihnen die Augen übergingen. Dann heiratete sie der Prinz und führte sie mit Freude und großen Festlichkeiten auf sein Schloß. Sie gab den anderen Schwestern eine reiche Mitgift und nahm die Mutter mit sich, daß sie bei ihr lebe. Alle miteinander lebten von da an voller Glück und Freude.
Der Oheim aber mit samt seinen sieben Söhnen, welche rechte Faulpelze waren, verdarben in Schlamm und Elend.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
GIUFÀ ...

Wollt ihr die Geschichten von Giufà hören? Der machte viele dumme Streiche, und brachte seine Mutter oft in Verlegenheit. Im Grunde aber war er recht klug, und seine Mutter war noch viel klüger als er. -
Eines Tages rief sie ihn, und gab ihm ein Stück Leinwand, da sie selbst gewoben hatte. »Bringe die Leinwand zum Färber, Giufà, und sage ihm, er solle sie schön grün färben.« Giufà nahm die Rolle Zeug und zog damit über Land. Da er nun müde war, setzte er sich auf einen Steinhaufen, um auszuruhen.
Da kam eine kleine Eidechse, und spielte zwischen den Steinen. »Ei,« dachte Giufà, »was du für ein hübsches grünes Röckchen anhast, du bist gewiß der Färber. Höre einmal, meine Mutter läßt dir sagen, du solltest ihr dieses Zeug schön grün färben, so wie dein Röckchen. In einigen Tagen komme ich wieder, um es abzuholen.« Damit warf er das Zeug auf den Steinhaufen, und ging davon.
Als er nun nach Hause kam, frug ihn seine Mutter: »Wo hast du die Leinwand hin gebracht?« »Mutter, mitten auf dem Felde stand ein großer Steinhaufen, dort saß einer, der hatte ein so schönes grünes Röckchen an, da dachte ich, es müsse wohl der Färber sein, und habe ihm die Leinwand hin gelegt.«
»Nein, seht doch diese Dummheit,« rief die Mutter, »wer heißt dich, das Zeug auf dem Feld liegen lassen? Gleich gehst du hin und kommst ohne Leinwand nicht wieder nach Haus.« Da ging Giufà wieder zum Steinhaufen, aber das Zeug war verschwunden. »Höre Färber, gib mir mein Zeug wieder, sonst zerstöre ich dein Haus,« rief Giufa. Die Eidechse aber hatte sich verkrochen, und kam nicht wieder zum Vorschein.
Da fing er an, den Steinhaufen zu zerstören, und rief immer: »Dir habe ich das Zeug anvertraut, nun mußt du es mir auch wieder geben, sonst zerstöre ich dein Haus.« Auf einmal sah er einen großen Topf mit goldnen Münzen, der unter dem Steinhaufen verborgen war. »So,« sagte er, »du hast gewiß die Leinwand verkauft, so nehme ich dir eben dein Geld weg.« Da nahm Giufà den Topf mit dem Geld und steckte ihn in seinen Quersack. Darüber aber legte er einen großen Haufen Dornen, und wanderte nun nach Haus.
Unterwegs neckten ihn die Leute: »Giufà, was bringst du?« »Wehe« sagte Giufà. »Was sind das 'Wehe?'« frugen sie. Da antwortete Giufà: »Seht selber zu.« Da stachen sich die Leute an den Dornen, und riefen: »Ein schönes Geschenk bringt der Giufà seiner Mutter! Die wird sich über die Dornen freuen!« Als aber Giufà nach Hause kam, rief er seine Mutter, und sprach ganz heimlich zu ihr: »Seht einmal, was ich euch bringe, Mutter!« und packte den Topf mit Geld aus.
Die Mutter war aber eine sehr kluge Frau, und dachte: »Gewiß wird nun Giufà es allen Leuten erzählen, daß er mir das Geld gebracht hat.« Da sprach sie zu ihm: »Du hast wohl getan, mein Sohn, iß nun dein Abendbrot und lege dich dann schlafen.«
Als nun Giufà auf seinem Bette lag, nahm die Mutter den Topf und vergrub ihn unter die Treppe. Dann nahm sie ihre Schürze voll Feigen und Rosinen, stieg auf das Dach, und warf durch den Schornstein dem Giufà Feigen und Rosinen in den Mund. Da ließ sich Giufà wohl gefallen, und aß, was er essen konnte.
Am anderen Morgen aber erzählte er seiner Mutter: »Denkt euch nur, Mutter, gestern Abend hat mir das Christkind Feigen und Rosinen vom Himmel herab geworfen.« Giufà erzählte nun allen Leuten: »Ich habe meiner Mutter einen großen Topf mit Geld gebracht, den ich im Steinhaufen gefunden habe.« Die Leute gingen hin, und verklagten ihn beim Gericht.
Da kamen die Leute vom Gericht zur Mutter des Giufà und sprachen: »Euer Sohn hat überall erzählt, ihr hättet einen Topf mit Geld behalten, den er gefunden hat. Wißt ihr denn nicht, daß man gefundenes Geld beim Gericht ausliefern muß?« »Ach, ihr Herren,« jammerte die Frau, »ihr wollt doch nicht alles glauben, was dieser dumme Giufà in den Tag hinein redet? Ich geschlagene Frau! Dieser Sohn wird mich noch ins Unglück bringen. Ich weiß nichts von einem Topf mit Geld.«
»Aber, Mutter,« rief Giufà, »wißt ihr nicht mehr, als ich euch den Topf brachte, und mir am Abend das Christkind die Feigen und Rosinen vom Himmel herunter in den Mund warf?« »Seht ihr wohl, daß er dumm ist, und nicht weiß, was er sagt,« sprach die Mutter. Da gingen die Leute vom Gericht wieder weg, und dachten: »Der Giufà ist auch gar zu dumm!«
Ein andermal wollte die Mutter in die Messe gehen, und sprach zum Giufà: »Zieh die Tür hinter dir zu, Giufà, wenn du weg gehst.« Als nun die Mutter in der Messe war, hob Giufà die Tür aus den Angeln und brachte sie auf seinen Schultern zu seiner Mutter in die Kirche. »Hier habt ihr die Tür, Mutter,« sprach er.
Ein andermal wollte die Mutter wieder in die Messe gehen. »Giufà,« sprach sie, »gib mal Acht auf die Gluckhenne, daß sie die Eier nicht verläßt und gib ihr auch zu fressen.« Als die Mutter fort war, gab Giufà der Henne die Kleie und dabei wurde er selbst hungrig. Da er nun nichts im Hause fand, so nahm er die Henne, schlachtete sie und kochte sie, und aß sie ganz auf. Damit aber die Eier nicht kalt würden, setzte er sich selbst darauf.
Als nun die Mutter nach Hause kam, sah sie ihn nirgends und rief: »Giufà, wo bis du?« »Gluck, gluck,« antwortete Giufà. »Hast du der Henne auch zu fressen gegeben, Giufà!« »Gluck, gluck,« lautete. »Giufà, wo bist du denn?« »Gluck, gluck.« Die Mutter fand ihn endlich, wie er auf dem Nest mit den Eiern saß.
»Giufà, was machst du da?« »Gluck, gluck.« »Wo ist denn die Henne?« »Die Henne habe ich gegessen, gluck, gluck.« »Aber die Eier gehen ja zu Grunde, du Unglückskind!« »Darum sitze ich ja darauf, um sie auszubrüten,« antwortete Giufà.
Eines Abends sprach die Mutter zu Giufà: »Ziehe aus, Giufà, und sieh, ob du eins von den Tieren findest, die des Nachts singen.« Sie meinte aber einen Hahn. Da zog Giufà aus und begegnete einem Schäfer, der sang lustig in den Abend hinein. »Halt,« dachte Giufà, »meine Mutter will ein Tier, das des Nachts singt; sie meint gewiß dieses.« Da ermordete er den Schäfer, lud ihn auf seine Schultern und brachte ihn seiner Mutter.
»Ach, Giufà, was hast du getan?« rief die Mutter, »wenn das Gericht ihn findet, so wirst du gehängt. Komm schnell, wir wollen ihn in die Cisterne werfen.« Da warfen sie den toten Schäfer in die Cisterne. Als aber Giufà schlief, holte die Mutter den Toten wieder heraus, und warf statt dessen einen toten Ziegenbock hinein. Am nächsten Morgen begegnete Giufà der Tochter des Schäfers, die jammerte: »Man hat meinen Vater umgebracht, man hat meinen Vater umgebracht.«
»Hat dein Vater am Abend gesungen?« frug Giufà. »Ja, zuweilen,« antwortete das Mädchen. »Nun, so habe ich ihn umgebracht und meine Mutter und ich, wir haben ihn in die Cisterne geworfen.« Da ging das Mädchen hin, und verklagte Giufà bei Gericht. Die Leute vom Gericht kamen und sagten zur Mutter vom Giufà: »Euer Sohn hat den Schäfer umgebracht, und ihr habt ihn in die Cisterne geworfen.«
»Ach, was sagt ihr,« rief die Frau, »mein Sohn ist so dumm, der weiß gar nicht, was er sagt.« »Doch, Mutter,« rief Giufà, »erinnert ihr euch nicht, wir haben ihn ja in die Cisterne geworfen.« Da ließ das Gericht den Giufà in die Cisterne hinunter steigen, damit er den toten Schäfer herauf bringen sollte. Als nun Giufà den toten Ziegenbock sah, rief er dem Mädchen zu: »Hat dein Vater Hörner gehabt?« »Ach nein,« antwortete das Mädchen. »Hat er vier Beine gehabt?« »Ach nein.« »Hat er Wolle gehabt?« »Ach nein, das ist mein Vater nicht.«
Da sprach die Mutter: »Seht, meine Herren, gestern Abend brachte mein Sohn einen toten Ziegenbock nach Haus, den er auf dem Felde gefunden hatte. Ich fürchtete aber, man möchte glauben, ich hätte ihn gestohlen und warf ihn in die Cisterne.« Da gingen die Leute vom Gericht nach Hause und sprachen: »Dieser Giufà ist auch gar zu dumm.«
Giufà's Mutter hatte noch ein kleines Töchterchen. Als sie nun wieder einmal in die Messe gehen wollte, sprach sie zu ihrem Sohn: »Gib ja recht Acht auf dein Schwesterchen und wenn es aufwacht, so gib ihm den Brei, aber nicht zu heiß, und wenn es einschläft, so lege es in die Wiege.« Als das Schwesterchen aufwachte, da kochte ihm Giufà den Brei und fütterte es. Er gab ihm aber den Brei so heiß, daß das Kind sich verbrannte und starb.
Weil es nun stille geworden war, so sprach Giufà: »Das Schwesterchen schläft,« und legte es in die Wiege. Die Mutter kam nach Haus und frug gleich: »Was macht das Schwesterchen?« »Es schläft schon lange in der Wiege,« antwortete Giufà. Da ging die Mutter an die Wiege und fand das tote Kindchen. »Ach Giufà, was hast du getan?« jammerte die Mutter, »o, du böser Mensch, ich will dich nun nicht länger sehen.«
Die Mutter wollte ihn also nicht mehr im Hause haben und tat ihn zu einem Geistlichen als Bedienten. »Wie viel Lohn willst du denn?« frug der Geistliche. »Ich will jeden Tag nur ein Ei, und so viel Brot, als ich dazu essen kann. Ihr dürft mich aber nicht eher weg schicken, als bis das Käuzchen im Efeu schreit.« Der Geistliche war es zufrieden und dachte: »Einen so wohlfeilen Bedienten bekomme ich nicht wieder.«
Am ersten Morgen bekam Giufà ein Ei und ein Brot dazu. Er pickte das Ei auf, und aß es aber mit einer Stecknadel und so oft er die Stecknadel ableckte, verzehrte er ein großes Stück Brod dazu. »Bringt mir doch noch ein wenig Brot her, das langt noch nicht,« rief er, und der Geistliche mußte ihm einen großen Korb voll Brot schaffen.
So ging es jeden Morgen. »Ich armer Mann,« rief der Geistliche, »in einigen Wochen bringt mich der ja an den Bettelstab.« Es war aber Winter, und bis das Käuzchen schreien konnte, mußten noch mehrere Monate vergehen. In seiner Verzweiflung sprach nun der Geistliche zu seiner Mutter: »Mutter, heute Abend müßt ihr euch in dem Efeu verstecken, und wie das Käuzchen schreien.«
Die alte Frau versteckte sich am Abend im Efeu und fing an zu rufen: »Miu, miu.« »Hörst du, Giufà, das Käuzchen schreit im Efeu, nun sind wir geschiedene Leute,« sprach der Geistliche. Da nahm Giufà sein Bündelchen und wollte zu seiner Mutter zurückkehren. Als er an dem Efeu vorbeikam, wo die Mutter des Geistlichen noch immer ihr »Miu, miu« rief, nahm er in seinem Zorn einige große Steine und schrie:
»O du verwünschtes Käuzelein,
Leide nun Strafe und schwere Pein!«
Damit warf er mit den Steinen ins Gebüsch und tötete die alte Frau. Als er zu seiner Mutter kam, rief sie: »Giufà, wo kommst du her? Ich will dich gar nicht hier haben, und werde dir morgen einen neuen Dienst suchen.« Da ging sie hin und tat ihn zu einem Gutsbesitzer als Schweinehirten. Der Gutsbesitzer schickte ihn in einen Wald, der war weit, weit weg, und befahl ihm, die Schweine zu hüten und wenn sie fett wären, dann sollte er sie wieder bringen.
Da lebte Giufà viele Monate im Wald, bis die Schweine ganz fett waren. Als er sie nun nach Hause trieb, begegnete er einem Metzger und sprach zu ihm: »Wollt ihr diese schönen Schweine kaufen? Ich gebe sie euch um den halben Preis, wenn ihr mir die Ohren und die Schwänze geben wollt.«
Da kaufte der Metzger die ganze Herde, gab Giufa viel Geld dafür und die Ohren und die Schwänze. Da ging Giufà an einen Morast und pflanzte zwei Ohren neben einander und drei Palm weiter einen Schwanz; so trieb er es mit allen. Dann lief er ganz verstört zum Gutsbesitzer und schrie: »Ach, Herr, denkt euch nur, welch schweres Unglück mir begegnet ist. Ich hatte die Schweine so schön gemästet und da ich sie her trieb, gerieten sie in einen Morast und sie sind alle darin versunken. Nur die Ohren und die Schwänze gucken noch heraus.«
Der Gutsbesitzer eilte sogleich mit seinen Leuten an den Morast, wo noch die Ohren und die Schwänze heraus guckten. Sie versuchten, die Schweine wieder heraus zu ziehen. So oft sie aber ein Ohr oder einen Schwanz packten, fuhr er sogleich heraus. »Seht ihr wohl, wie fett die Schweine waren,« rief Giufà, »vor lauter Fett sind sie in dem Morast ganz vergangen.« Da mußte der Gutsbesitzer ohne Schweine abziehen, Giufà aber brachte das Geld seiner Mutter und blieb wieder eine Zeitlang bei ihr.
Eines Tages sprach diese zu ihm: »Giufà, wir haben heute nichts zu essen, was fangen wir an?« »Laßt mich nur machen,« und ging zu einem Metzger: »Gevatter, gebt mir doch ein halb Rottolo Fleisch, morgen bringe ich euch das Geld.« Da gab ihm der Metzger das Fleisch. Dann ging er zum Bäcker: »Gevatter, gebt mir ein halb Rottolo Maccaroni und ein Laib Brot, morgen bringe ich euch das Geld.« Da gab ihm der Bäcker die Maccaroni und das Brot, und Giufà ging zum Ölhändler: »Gevatter, gebt mir ein Mäßchen Öl, morgen bringe ich euch das Geld.«
Der Ölhändler gab ihm das Öl, und Giufà ging zum Weinhändler: »Gevatter, gebt mir ein Quartuccio Wein, morgen bringe ich euch das Geld.« Da gab ihm der Weinhändler den Wein, und Giufà ging zum Käsehändler: »Gevatter, gebt mir für vier Grani Käse, morgen bringe ich euch das Geld.« Da gab ihm der Käsehändler den Käse, und Giufà kam zu seiner Mutter, und brachte ihr Fleisch, Maccaroni, Brot, Öl, Wein und Käse, und sie aßen vergnügt zusammen.
Am anderen Morgen aber stellte sich Giufà tot, und seine Mutter weinte und jammerte: »Mein Sohn ist gestorben, mein Sohn ist gestorben.« Er wurde in einen offenen Sarg gelegt und in die Kirche gebracht, und die Geistlichen sangen ihm die Totenmesse. Als man aber in der ganzen Stadt hörte, Giufà ist gestorben, da sagten der Metzger, Bäcker, Ölhändler und Weinhändler: »Was wir ihm gestern gegeben haben, ist so gut wie verloren. Wer soll es uns nun bezahlen?«
Der Käsehändler aber dachte: »Giufà ist mir zwar nur vier Grani schuldig, aber die will ich ihm nicht schenken. Ich will hingehen und ihm seine Mütze weg nehmen.« Er schlich sich in die Kirche, aber es war noch ein Geistlicher da, der betete am Sarge Giufà's. »So lange der geistliche Herr da ist, schickt es sich nicht, daß ich ihm die Mütze nehme,« dachte der Käsehändler, und versteckte sich hinter dem Altar.
Als es aber Nacht wurde, ging auch der letzte Geistliche fort und der Käsehändler wollte eben aus seinem Versteck hervor kommen, als eine Schar Diebe in die Kirche drang. Die Diebe hatten einen großen Sack mit Goldmünzen gestohlen, und wollten ihn nun in der dunkeln Kirche verteilen. Dabei gerieten sie in Streit, und fingen an zu lärmen und zu schreien.
Da richtete sich Giufà im Sarge auf und rief: »Heraus mit euch!« Die Diebe erschraken sehr, als der Tote sich aufrichtete, sie glaubten auch, er riefe die anderen Toten, und liefen im hellen Schrecken davon, ohne den Sack mit zu nehmen. Als Giufà den Geldsack aufnehmen wollte, sprang auch der Käsehändler aus seinem Versteck hervor und wollte auch seinen Teil davon haben.
Giufà aber rief immerfort: »Vier Grani kommen euch zu.« Da meinten die Diebe draußen, er verteile das Geld unter die Toten und sie sprachen untereinander: »Wie viele muß er gerufen haben, wenn auf jeden nur vier Grani kommen.« Und rannten, was sie rennen konnten, davon. Das Geld nahm Giufà mit, nachdem er dem Käsehändler ein wenig gegeben hatte, damit er nichts sagen sollte, und brachte es seiner Mutter.
Einmal kaufte seine Mutter einen großen Vorrat Flachs und sprach zu ihm: »Giufà, du könntest wohl ein wenig spinnen, um doch irgend etwas zu tun.« Giufà nahm von Zeit zu Zeit einen Strang und anstatt ihn zu spinnen, steckte er ihn in das Feuer und verbrannte ihn. Da wurde seine Mutter zornig und schlug ihn. Was tat nun Giufà? Er nahm ein Bündel Reiser und umwickelte es mit Flachs, wie einen Rocken, dann nahm er einen Besen als Spindel, setzte sich aufs Dach und fing an zu spinnen.
Wie er so da saß, kamen drei Feen vorbei, die sprachen: »Nein, seht doch nur, wie nett Giufà da sitzt und spinnt. Wollen wir ihm nicht etwas schenken?« Da sprach die erste Fee: »Ich schenke ihm, daß er in einer Nacht so viel Flachs spinnen kann, als er berührt.« Da sprach die Zweite: »Ich schenke ihm, daß er in einer Nacht so viel Garn zu Leinwand weben kann, als er gesponnen hat.« Da sprach die dritte Fee: »Und ich schenke ihm, daß er in einer Nacht alle Leinwand bleichen kann.« Das hörte Giufà.
Am Abend, als seine Mutter zu Bette gegangen war, machte er sich hinter ihren Vorrat von Flachs und siehe da, so oft er einen Strang berührte, war er sogleich gesponnen. Als kein Flachs mehr da war, fing er an zu weben, und so wie er den Webstuhl nur berührte, rollte sich auch schon die gewobene Leinwand auf. Endlich breitete er alle Leinwand aus, und kaum benetzte er sie ein wenig, so war sie schon gebleicht.
Am nächsten Morgen zeigte er seiner Mutter die schönen Stücke Leinwand, und seine Mutter verkaufte sie und verdiente schönes Geld damit. So trieb es Giufà einige Nächte hindurch, endlich aber wurde er es müde, und wollte wieder einen Dienst annehmen.
Da vermietete er sich bei einem Schmied, dem sollte er den Blasebalg treten. Er trat aber den Blasebalg so stark, daß er das Feuer ganz auslöschte. Da sagte der Schmied: »Laß das Treten sein und schmiede das Eisen auf dem Ambos.« Giufà aber schlug mit solcher Gewalt auf den Ambos, daß das Eisen in tausend Stücke zersprang. Da wurde der Schmied zornig, und er konnte ihn doch nicht fort jagen, denn Giufà hatte die Bedingung gestellt der Schmied müsse ihn ein ganzes Jahr lang behalten.
Da ging der Schmied zu einem armen Manne und sprach zu ihm: »Ich will euch ein schönes Geschenk machen, wenn ihr dem Giufà sagt, ihr wärt der Tod und ihr wärt gekommen, um ihn abzuholen.« Als nun der arme Mann dem Giufà eines Tages begegnete, sagte er ihm, was der Schmied ihm geheißen hatte. Giufà aber war nicht faul. »So, bist du der Tod?« rief er, packte den armen Mann, steckte ihn in seinen Sack und trug ihn in die Schmiede.
Dort legte er ihn auf den Ambos und fing an, auf ihn loszuhämmern. »Wie viele Jahre soll ich noch leben?« frug er dabei. »Zwanzig Jahr,« schrie der Mann im Sack. »Das ist mir noch lange nicht genug.« »Dreißig Jahr, vierzig Jahr, so viel du willst,« schrie der Mann. Giufà aber hämmerte immer zu, bis der arme Mann tot war. Nun hatte Giufà das Schmiedehandwerk satt, verließ seinen Meister, und wanderte fort.
Da kam er an einem Hause vorbei, darin wohnten Verwandte von ihm, die feierten gerade eine Hochzeit. Er trat hinein, aber keiner sagte zu ihm: »Guten Tag, Giufà, setze dich zu uns.« Keiner grüßte, keiner beachtete ihn. Da ging Giufà zu einem Bekannten, und ließ sich einen wunderschönen, goldgestickten Anzug leihen, den legte er an, und ging wieder zu seinen Verwandten.
Kaum erblickten sie ihn, so standen sie gleich alle auf, und begrüßten ihn: »O, Giufà, wie schön, daß du auch gekommen bist; komm, setze dich zu uns und iß.« Da setze sich Giufà zu ihnen, und sie setzten ihm einen schönen Teller Maccaroni vor. Er aber nahm den ganzen Teller und schüttete ihn über seine Kleider aus. Dann schenkten sie ihm Wein ein, er aber schüttete das Glas über seine Kleider aus, und so tat er mit allem, was sie ihm vorsetzten.
»Giufà, warum isst du denn nicht,« frugen ihn endlich seine Verwandten. »Ich gebe meinen Kleidern zu essen,« antwortete Giufà, »ihr habt ja meine Kleider eingeladen, um mit euch zu essen. Denn als ich vorhin da war, hat mich keiner begrüßt, keiner hat mich eingeladen, da zu bleiben.«
Als nun Giufà nach dem Schmaus seinen Bekannten den schönen Anzug wieder brachte, riefen die im hellen Schrecken aus: »Aber Giufà, was hast du mit den Kleidern gemacht?« »Wollt ihr mich verantwortlich machen dafür?« sprach Giufà, »haltet euch an meine Verwandten, die haben eure Kleider zu Tische geladen.«
Einmal ließ der Bischof im ganzen Ort verkündigen, ein jeder Goldschmied solle ihm ein Crucifix machen, und für das schönste wolle er vierhundert Unzen bezahlen. Wer aber ein Crucifix bringe, das ihm nicht gefalle, der müsse den Kopf verlieren. Da kam ein Goldschmied, und brachte ihm ein schönes Crucifix, aber der Bischof sagte, es gefalle ihm nicht, ließ dem armen Mann den Kopf abschneiden und behielt das Crucifix.
Am anderen Tag kam ein zweiter Goldschmied, der brachte ein noch schöneres Crucifix, es ging ihm aber nicht besser, als dem ersten. So trieb er es eine Zeit lang, und mancher arme Mann mußte den Kopf dabei verlieren. Als nun Giufà davon hörte, ging er zu einem Goldschmied, und sprach: »Meister, ihr müßt mir ein Crucifix machen mit einem furchtbar dicken Bauch, sonst aber so schön, als ihr es nur liefern könnt.«
Als nun das Crucifix fertig war, nahm Giufà es auf den Arm und trug es zum Bischof. Kaum hatte der es erblickt, so schrie er: »Was fällt dir ein, mir ein solches Ungetüm zu bringen? Warte, du sollst mir dafür büßen!« »Ach, ehrwürdiger Herr,« sprach Giufà, »hört mich doch nur an, und vernehmt, wie es mir ergangen ist.
Dieses Crucifix war ein Muster von Schönheit, als ich es herbringen wollte; auf dem Wege aber fing es an vor Zorn den Bauch zu schwellen, und je näher ich zu eurem Hause kam, desto ärger schwoll es an, am schlimmsten aber, als ich eure Treppe hinaufstieg. Ihr sollt sehen, der Herr zürnt euch ob all dem unschuldigen Blute, das ihr vergossen habt, und wenn ihr mir nicht sogleich die vierhundert Unzen gebt, und jeder von den Witwen der Goldschmiede eine Leibrente aussetzt, so werdet ihr eben so anschwellen, und Gottes Zorn wird über euch kommen.«
Da erschrak der Bischof, und gab ihm die vierhundert Unzen, und bat ihn, die Witwen alle zu ihm zu schicken, damit er jeder einen jährlichen Lebensunterhalt aussetzen könne. Giufà nahm das Geld, und ging zu jeder Witwe einzeln, und sprach: »Was gebt ihr mir, wenn ich euch vom Bischof eine Leibrente verschaffe?« Da schenkte ihm jede eine hübsche Summe, und Giufà brachte seiner Mutter einen großen Haufen Geldes.
Eines Tages schickte die Mutter den Giufà in ein anderes Dorf, wo eben Jahrmarkt gehalten wurde. Unterwegs begegneten ihm einige Kinder, die frugen: »Wohin gehst du, Giufà?« »Auf den Jahrmarkt.« »Willst du mir auch ein Pfeifchen mit bringen?« »Ja!« »Mir auch?« »Ja!« »Mir auch?« »Mir auch?« frug einer nach dem anderen und Giufà sagte allen »ja«.
Zuletzt war noch ein Junge, der sagte: »Giufà, bringe mir auch ein Pfeifchen mit. Hier hast du einen Gran.« Als nun Giufà vom Jahrmarkt zurück kam, brachte er nur ein Pfeifchen mit und gab es dem letzten Jungen. »Giufà, du hattest uns ja jedem eins versprochen,« riefen die anderen Kinder. »Ihr habt mir ja keinen Gran mit gegeben, um es zu kaufen,« antwortete Giufà.
Eines Tages stand Giufà auf der Straße und tat nichts. Da trat ein Herr zu ihm und sprach: »Giufà, willst du mir diesen Brief nach Paternò bringen? Ich gebe dir auch vier Tari.« »Für vier Tari soll ich bis nach Paternò laufen,« sagte Giufà, »zehn Tari gebühren mir.« Da gab ihm der Herr zehn Tari, und hieß ihn den Brief hin tragen.
Als er nun von Paternò zurück kam, mußte er durch einen Wald. Es war schon ganz dunkel geworden, doch war sehr heller Mondschein. Wenn nun der Mond sich hinter den Bäumen versteckte, rief Giufà: »Ja, ja, verstecke dich nur, du Spitzbube, ich habe dich schon gesehen.«
Im Wald aber waren Diebe, die hatten ein fettes Kalb gestohlen; als sie nun den Giufà so reden hörten, meinten sie, er hätte sie entdeckt. »Was machen wir?« frug der Eine. »Wenn Giufà in die Stadt kommt, so gibt er uns an. Wir wollen ihm lieber ein Stück von dem Kalb geben, damit er still schweigt.« Also riefen sie ihn herbei und sprachen: »Giufà, sieh dieses schöne, fette Kalb. Welches Stück hättest du gern?« »Gebt mir den Magen,« antwortete Giufà. »Was willst du mit dem Magen machen, Giufà? Nimm doch lieber ein besseres Stück.« »Nein, nein, ich will nur den Magen.«
Also gaben sie ihm den Magen und ließen ihn gehen. Kaum war er aber so weit weg, daß sie ihn nicht mehr sehen konnten, so legte er den Magen auf den Boden, nahm einen großen Prügel und schlug auf den Magen los. Dabei schrie er immer, so laut er nur konnte: »Ach, prügelt mich nicht, tötet mich nicht, ich will euch auch hinbringen, wo der Rest ist.«
Als die Diebe das hörten, sprachen sie: »Wehe uns, der Giufà ist gewiß den Leuten vom Gericht begegnet und bringt sie nun hierher.« Da liefen sie im hellen Schrecken davon und ließen das Kalb liegen. Giufà aber schlich zurück, nahm das ganze, fette Kalb und brachte es seiner Mutter.
Ja, ja, der Giufà hat viele nichtsnutzige Streiche gemacht, und wer sie alle weiß, hört nicht mehr mit Erzählen auf.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
GRANADORO ...
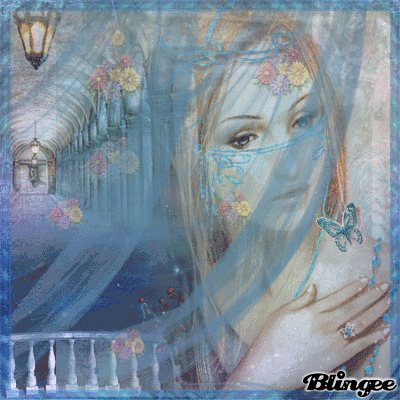
Es war einmal ein König, der hatte einen Bruder in Portugal und hatte auch einen Sohn, der ziemlich erwachsen war. Eines Tages, als er bei Tisch mit seinem Sohne sprach, sagte er ihm, wie froh der Onkel in Portugal sein würde, wenn er ihn sehen könnte. Der Sohn bekam Lust, nach Portugal zu gehen und den Onkel kennen zu lernen. Er bat den Vater, ihn reisen zu lassen, und der Vater erlaubte es ihm. Da versah er sich mit Geld und reiste ab.
Unterwegs begegnet er einem jungen Menschen und sie kommen ins Gespräch. Der Andere fragt ihn, wohin er geht, und er sagt es ihm und spricht ihm von jenem Oheim, den er noch nicht gesehen hatte. Der Jüngling versetzt darauf: »Schön! Auch ich gehe nach Portugal, so können wir mitsammen wandern.« So gingen sie und plauderten.
Als sie aber an einen einsamen Ort gekommen waren, bleibt der Jüngling stehen, zieht eine Pistole heraus und sagt: »Gib wohl Acht; wenn wir bei deinem Oheim sein werden, werde ich mich als seinen Neffen vorstellen, du aber wirst mein Page sein. Wenn du nicht einwilligst, so töte ich dich.« Der Königssohn mußte wohl oder übel einwilligen.
Wirklich, als sie zu dem Oheim gekommen waren, stellte sich jener als seinen Neffen vor und wurde festlich empfangen. Der Page wurde in den Stall geschickt.
Eines Tages ging der falsche Neffe mit dem König durch den Palast, und sie stiegen in die Ställe hinunter, und der König zeigte ihm eine Stute und sagte ihm, sie gehöre seiner Frau, die könne sie aber nicht reiten, da es unmöglich sei, sie zu zähmen.
Jener, der schon immer darüber grübelte, wie er den wahren Neffen zum Tode bringen könne, sagt zum König: »Da ist mein Page, der ist dafür berühmt, Pferde zu zähmen. Sicher wird er auch dieses zähmen.« - Damit rief er den Pagen und befahl ihm, die Stute zu zähmen, und weh ihm, wenn er es nicht täte. Der arme Page zog sich in den Stall zurück, um zu weinen, und wußte nicht, wie er es anstellen sollte, denn als ein Königssohn war er nicht gewöhnt, Pferde zu zähmen.
Auf einmal fängt die Stute an zu sprechen und fragt ihn: »Warum weinst du?« - »Ich weine, weil ich dich zähmen soll und nicht weiß, wie ich das zustande bringe.« - »Sei guten Muts, ich werde mich zähmen lassen, halte dich nur an meiner Mähne fest und habe keine Angst.«
Als nun der Tag kam, wo er die Stute vor dem König zähmen sollte, steigt er auf, und die Stute macht ein paar Sprünge bis zum zweiten Stockwerk hinauf, er aber hielt sich an der Mähne fest und blieb sitzen. Endlich gab sich die Stute bezwungen. Der König bestieg sie, und sie ließ sich in der Tat ruhig lenken. Als aber auch der falsche Neffe sie besteigen wollte, gab sie ihm zwei Schläge mit den Hufen, so daß er eine Woche das Bett hüten mußte.
Eines Tages sprach der König mit dem falschen Neffen von einem Pferde, das sich in einem Nachbarland befand und Belverde genannt wurde. Es war so bösartig, daß es alle Menschen fraß und niemand in jenem Lande wohnen konnte. Kaum hatte der falsche Neffe das gehört, ruft er seinen Pagen und befielt ihm, in jenes Land zu gehen und das Pferd Belverde zu töten.
Der König sagte: »Aber wie soll der Knabe es fertig bringen, jenes Pferd zu töten?« - »Euer Majestät wird sehen, daß es ihm gelingt; er scheint bestürzt zu sein, aber beachten Sie es nicht.« - Der Page, in den Stall zurück gekehrt, fing an zu weinen. Die Stute redet ihn an und fragt, warum er weint, und er sagt es ihr. -
»Verzweifle nicht,« sagt das Pferd. »Ich werde dir schon helfen. Sage dem König, er soll dir ein Kleid ganz aus Spiegeln machen lassen und dir einen sehr scharfen Säbel geben. Das Kleid zieh an, nimm den Säbel und besteige mich, und dann werden wir hin gehen, wo das Pferd Belverde sich befindet, du wirst sehen, es wird kommen, um dich zu fressen, es wird sich aber in den Spiegeln sehen und ruhig bleiben, um sich zu betrachten und sagen: Wie schön bin ich! Du aber wirst es indessen überfallen und mit dem Säbel ihm den Kopf abhauen.«
Er tat, wie die Stute ihm geraten hatte, und alles ging trefflich. Während das Pferd Belverde sich in den Spiegeln beschaute, hieb er ihm mit einem einzigen Säbelhieb den Kopf ab und trug ihn davon. Als er an das Tor der Stadt gekommen war, strömte das Volk ihm entgegen und holte ihn im Triumph herein, weil er eine so gute Tat vollbracht hatte. Der falsche Neffe biß sich auf die Lippen.
Als er aber mit dem Könige auf einen etwas vertrauteren Fuß gekommen war, faßte er sich eines Tages ein Herz, ihn zu fragen, was es mit der Tante auf sich habe, daß er sie nie zu sehen bekomme. - »Mein Lieber,« sagte der König, »deine Tante, Granadoro ist ihr Name, ist entwichen, und ich weiß nicht, wo sie sich aufhält. So viele haben sie gesucht, und keiner hat sie finden können.« -
»Mein kleiner Page ist sehr mutig,« sagte der falsche Neffe. »Schicken wir ihn, sie zu suchen. Sicher wird er sie finden.« - Auf die Art dachte er ihn sich vom Halse zu schaffen, und befahl ihm auszuziehen und die Königin Granadoro zu suchen und nicht zurück zu kehren, bis er sie gefunden hätte.
Die Stute sah den Pagen ganz betrübt und fragte ihn nach dem Grunde. Als sie ihn erfahren hatte, sagte sie: »Die Sache ist gefährlich, aber verliere nicht den Mut, ich werde schon sorgen. Laß dir ein neues Schiff geben und Mundvorrat auf ein Jahr für dich und mich und dann fort!«
Er bekam das Schiff und den Mundvorrat und sie schifften sich ein, er und das Pferd, ganz, ganz allein. Nachdem sie eine Strecke weit gesegelt waren, hören sie an die Schiffswand pochen. »Sieh, wer es ist!« sagte das Pferd. - Es war ein Fisch. - »Nimm ihn und bring ihn in eine Kajüte.« Er tat es. Nach kurzer Zeit klopfte es wieder. Er sieht, wer es ist. Es war eine Schwalbe und auch die ließ er herein und tat sie in eine Kajüte. Ein bischen später hörte er wieder pochen. Es war ein Schmetterling. Er fing auch den und brachte ihn in eine Kajüte.
Und weiter, weiter, endlich stoßen sie ans Land und steigen aus am Fuß eines Hügels, und auf dem Hügel stand ein schöner Palast. »Siehst du diesen Palast?« sagte das Pferd. »In dem wohnt Granadoro. Geh und klopfe an und sage, du willst zu Granadoro.«
Er geht also und klopft an, und ihm zu öffnen kommt Granadoro in eigner Person. - »Was wollt Ihr?« - »Granadoro.« - »Die bin ich selbst. Was wollt Ihr?« - »Euer Gemahl schickt mich, Euch zu holen.« - »Als ich von meinem Manne fort kam, warf ich meinen Ring mitten ins Meer. Wenn ich zu ihm zurück kehren soll, muß man ihn mir wieder bringen.« - »Ich verstehe!« antwortete er und ging.
Er kam zu dem Pferde und sagte ihm das von dem Ringe. Das Pferd ruft den Fisch und sagt ihm, binnen drei Tagen müsse er Granadoros Ring finden. Der Fisch taucht ins Meer hinab und richtig, nach drei Tagen klopft er an die Schiffswand und hat den Ring im Maule. Der kleine Page nimmt ihn und bringt ihn Granadoro.
»Schön!« sagte Granadoro. »Aber es ist noch nicht genug. Jetzt ist noch etwas anderes nötig. Seht Ihr den Berg dort?« Es war ein so steiler Berg, daß nicht einmal eine Ameise hinaufklettern konnte. »Da oben ist eine Quelle, die alle zwei Stunden ein Tröpfchen auswirft. Hier habt Ihr ein Fläschchen, das füllt mit jenem Wasser und bringt es mir.«
Der kleine Page geht mit dem Fläschchen zu dem Pferde und zeigt es ihm. Das Pferd ruft die Schwalbe, die in der Kajüte ist, läßt ihr das Fläschchen auf den Rücken binden und sagt ihr, sie solle dort auf den Berg fliegen und es mit dem Wasser aus jener Quelle anfüllen. Und die Schwalbe fliegt, fliegt und kommt zu der Quelle und kehrt zurück mit dem gefüllten Fläschchen.
Als der Page es Granadoro gebracht hatte, sagte sie zu ihm: »Es ist gut. Aber nun ist noch etwas anderes. Wir sind drei Schwestern, alle drei sich ähnlich und gleich gekleidet. Kommt morgen und seht uns, und wenn Ihr erkennt, welche Granadoro ist, dann komme ich wirklich mit Euch.«
Als das Pferd von dem Pagen hörte, was Granadoro gesagt hatte, nimmt es eine Schachtel, setzt den Schmetterling hinein, der in der Kajüte war, und gibt sie ihm: »Morgen gehst du und öffnest die Schachtel und achtest darauf, wer die ist, auf die der Schmetterling sich setzt. Die ist Granadoro.«
Damit ging er, und als er sah, daß der Schmetterling sich auf eine von den dreien setzte, nahm er sie bei der Hand und sagte gerade heraus: »Diese ist Granadoro.« - »Ja, ich bin es!« sagte Granadoro, »und jetzt bin ich bereit, dir zu folgen. Also gehen wir!« Sie verließen den Palast und stiegen in das Schiff, und Granadoro war sehr erfreut, als sie ihr Pferd wiedersah, denn sie liebte es sehr.
So stachen sie in die See und gelangten zum Könige. Der war sehr froh über die Rückkehr seiner Frau und machte dem kleinen Pagen, der sie ihm zurück gebracht hatte, tausend Liebkosungen. Der falsche Neffe war wütend und faßte den Verdacht, der Page hätte unterwegs Granadoro alles erzählt.
Als die Essenszeit kam, spricht Granadoro zu dem falschen Neffen: »Sagt auch Eurem Pagen, daß er mit zu Tisch gehen soll.« - »Oh!« erwidert jener, »er wird zu schüchtern dazu sein. Er ist nicht gewöhnt mit hohen Herren zu Tisch zu sitzen.« - Aber Granadoro bat so dringend, daß es nicht möglich war, es ihr abzuschlagen.
Da geht der falsche Neffe in den Stall, ergreift den Pagen, tötet ihn und versteckt die Leiche, dann kehrt er zu der Tafel zurück und sagt: »Unmöglich! Ich habe ihn sehr gebeten, aber er will nicht kommen. Er schämt sich.« - »Ich selbst will gehen, ihn zu bitten,« sagt Granadoro.
Gesagt getan, sie geht in den Stall, zieht den Körper unter dem Misthaufen hervor, wo jener ihn versteckt hatte, und mit dem Wasser, das die Schwalbe gebracht hatte, benetzt sie ihn und bringt ihn wieder zum Leben. Sofort trägt sie ihn zur Tafel, und dem falschen Neffen stand der Atem still.
Dem Pagen schmeichelte sie, den falschen Neffen sah sie nicht einmal an, so daß der König fragte, warum sie den Neffen so behandle. Granadoro, die Feenkünste verstand und alles wußte, sagte: »Der rechte Neffe ist dieser hier« und blickte den kleinen Pagen an; »der andere da ist ein Betrüger!« und erzählte alles Punkt für Punkt.
Da wurde der Betrüger an den Galgen geschickt, der echte Neffe blieb einige Zeit vergnügt beim Oheim und kehrte dann zu seinem Vater zurück.
Pisa
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
GEPPONE ...
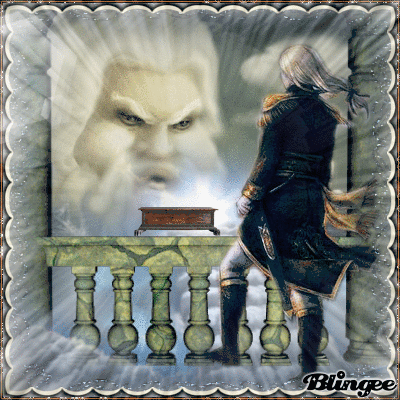
Es war in vergangenen Zeiten ein Bauer mit Namen Giuseppe, und sein Herr, der Priester und Prior war, hieß Pier Leone. Dieser Bauer hatte sein Gut auf einem Hügel, wo die Tramontana ihm immer seine Ernte zerstörte, so daß der arme Giuseppe wegen dieses Windes mit seiner ganzen Familie Hunger leiden mußte.
Eines Tages faßte er einen Entschluss und sagte: »Ich will gehen und den Wind suchen, der mich verfolgt.« - Er sagt es seinem Weibe und seinen Kindern und macht sich auf den Weg durch die Alpen. Als er bei Castel Ginevino angekommen ist, pocht er an das Tor der Festung. Eine Frau erscheint und fragt: »Wer pocht?« - Es war in der Tat die Frau des Windes. - »Ich bin Geppone,« antwortet der Bauer. »Ist euer Gatte nicht zu Hause?« - »In diesem Augenblick ist er nicht zu Hause, er wird aber bald kommen. Er wollte nur ein bißchen zwischen den Buchen wehen. Kommt ins Haus, gleich wird er da sein.« -
Geppone trat ins Haus, und nach einer Stunde kehrte der Wind zurück. Kaum hatte er ihn gesehen, sagte Geppone: »Guten Morgen, Wind!« - Und der Wind: »Wer bist du?« - »Ich bin Geppone.« - »Und was suchst du?« - »Du weißt wohl, daß du mich jedes Jahr um die Ernte bringst und ich deinetwegen ins Elend gekommen bin und mit meiner ganzen Familie verhungern muß. Nun bin ich zu dir gekommen, um zu sehen, ob du es irgendwie einrichten könntest, mich vor dem Hungertode zu bewahren.« -
»Und wie soll ich das anfangen?« - »Such nur um Gotteswillen mir zu helfen.« - Da wurde dem Winde das Herz von Mitleid bewegt, und er sagte zu dem armen Bauern: »Nimm diese Schachtel, und wenn du Hunger hast, öffne sie, befiehl, was du haben willst, und du wirst bedient werden. Aber hüte dich, sie einem anderen zu geben. Wenn du diese Schachtel von dir gibst, komm nicht wieder zu mir.«
Geppone geht, um nach Hause zurück zu kehren, und kommt durch einen Wald.
Als er den durchschritten hat, bekommt er Hunger und Durst. Er öffnet die Schachtel und spricht: »Bringe mir Brot, Wein und Zukost!« - und es wurde ihm gehorcht. Er aß und trank und setzte die Reise fort, ihr könnt euch denken, wie vergnügt! Noch fern von seinem Hause kommen ihm Weib und Kinder entgegen, begrüßen ihn freudig und sagen: »Nun, wie ist es gegangen?« - »Gut!« antwortet er. Dann führt er sie alle nach Hause und sagt: »Setzt euch alle an den Tisch.« Und als sie alle am Tisch saßen, sagt er zu der Schachtel: »Versorge diese alle mit Brot, Wein und Zukost!« und richtig, alles wird gebracht.
Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, sagte Geppone zu seiner Frau: »Sage es nicht dem Prior, daß ich diese Schachtel gebracht habe. Sonst könnte er Lust bekommen, es dahin zu bringen, daß ich darum käme.« - »Ich werde nichts sagen, Gott bewahre!« - »Schön!«
Da läßt der Prior Geppones Frau kommen und fragt sie, ob ihr Mann zurück gekehrt ist. - »Ja,« sagt sie, »er ist zurück gekehrt.« - »Und wie ist es gegangen?« - »Gut; er hat eine Schachtel mit gebracht, mit der kann man nicht mehr verhungern.« - »Und was ist in dieser Schachtel?« - »Nämlich, wenn man sie aufmacht und befiehlt, sie soll zu essen und zu trinken herbei schaffen, so bringt sie alles.« -
Der Priester ruft sofort Geppone und sagt ihm: »O, Geppone, ich weiß, daß du eine sehr kostbare Schachtel hast; die will ich sehen.« - Geppone wollte leugnen, konnte aber nicht, weil seine Frau alles verraten hatte. Also zog er sie hervor und machte die Probe.
Den Priester verlangte sofort danach, sie zu besitzen. »Geppone,« sagte er, »du mußt mir die Schachtel geben.« - »Das kann ich nicht,« antwortete Geppone, »denn Sie wissen wohl, daß ich immer all meine Ernten verloren habe, und wenn ich die Schachtel weg gebe, habe ich nichts mehr zu essen.« - Darauf sagte der Priester: »Wenn du mir die Schachtel gibst, werde ich dir Korn, Wein und alles, was du wünschest, geben.« -
Geppone, der arme Teufel, gab sie ihm, aber der Priester hielt das Versprechen nicht, ihm Korn und Wein zu geben, viel mehr gab er ihm nur schlechtes Saatkorn. Da war Geppone nun wiederum übel dran, und das nur, muß man gestehen, durch die Schuld seiner Frau. So ertrug er eine Zeitlang seine bittere Not, und dann sprach er bei sich selbst: »Ich möchte wieder zu der Burg gehen und sehen, ob der Wind vielleicht ein anderes Mittel hat, diesem Unheil abzuhelfen.
Ich habe aber nicht den Mut, mich zum zweiten Mal vor ihm sehen zu lassen,« sagte er zu der Frau, »denn er hatte mir gesagt, ich solle sie niemand geben, und wenn ich es täte, von ihm hätte ich nichts mehr zu hoffen. Ich aber habe sie verloren und durch deine Schuld.«
Endlich faßte er sich ein Herz und machte sich auf den Weg. Als er bei der Burg angekommen war, klopfte er ans Tor. Die selbe Frau fragte wieder: »Wer ist da?« - »Geppone,« antwortete er. Da erschien der Wind und sagte: »Was willst du, Geppone?« - »Du weißt wohl,« sagte Geppone, »daß du mir jene Schachtel gegeben hast. Mein Herr hat sie mir genommen und will sie mir nicht zurück geben, und darum muß ich Hunger und Not leiden. Ich bin daher zu dir gekommen, um zu sehen, ob du dem abhelfen kannst.« -
»Ich hatte dir gesagt, du solltest diese Schachtel niemand geben, und du hast es doch getan. Geh in Frieden, denn ich gebe dir nichts.« - »Um Gotteswillen, hilf mir in meiner Not!« - Der Wind fühlte zum zweiten Mal sein Herz gerührt, nahm eine goldene Schachtel und gab sie ihm. »Diese,« sagte er, »öffne nur, wenn du großen Hunger hast, sonst wird sie dir nicht gehorchen.« Geppone nahm die Schachtel und lief durch die bekannten Täler wie toll. Der Hunger aber ließ ihn still stehen.
Er öffnete die Schachtel und rief: »Tisch auf!« - Da erscheint ein Mann, groß und dick mit einem Stock in der Hand und fängt an, ihm Schläge zu geben, daß dem armen Geppone alle Knochen im Leibe zerbrechen. Er schließt die Schachtel geschwinde zu und geht weiter. Zu Hause erwartet ihn sein Weib und die Kinder und fragen gleich: »Wie ist es gegangen?« - »Gut,« antwortet er. »Ich habe eine viel schönere Schachtel bekommen, als das erste Mal. Setzt euch alle zu Tisch.« - Sie tun es, und Geppone öffnet die Schachtel.
Zwei Männer kommen heraus mit Stöcken und fangen an, sie zu prügeln. Die Kinder und die Frau schreien und bitten um Erbarmen. Da schließt Geppone die Schachtel, und die mit den Stöcken verschwinden. Dann sagt er zu seinem Weibe: »Geh zum Herrn und sag ihm, ich sei zurück gekehrt und hätte eine Schachtel mit gebracht viel schöner als die andere.« -
Die Frau geht zum Prior, der, kaum sieht er sie, so fragt er: »Ist Geppone zurück gekehrt?« - »Ja, Herr, und er hat eine Schachtel mit gebracht, viel schöner als die erste. Sie ist von Gold und schafft uns Mahlzeiten, daß es ein Wunder ist. Diese aber will er niemand geben.« - Der Priester sagte: »Ruf mir Geppone!« - und die Frau tat es, und er kam.
Der Priester aber sagte ihm: »O, Geppone, ich freue mich, daß du wieder da bist und eine Schachtel mit gebracht hast, schöner als die andere.« - »Gott sei dafür gedankt, ich habe sie wirklich mit gebracht.« - »Laß sie mich sehen.« - »Jawohl, damit Sie tun, wie das erste Mal und sie mir nehmen!« - »Ich werde sie dir gewiß nicht nehmen.« - Und Geppone zieht die Schachtel hervor, die glänzte wie ein Sonnenstrahl. Den Priester gelüstete nach ihr, und er sagte: »Geppone, gib sie mir, ich gebe dir dann die andere zurück, und noch etwas dazu.« -
»Nun, meinetwegen. Geben Sie mir die andere, und ich gebe Ihnen diese.« - Der Priester tut es, und Geppone gibt ihm die goldene und sagt: »Geben Sie wohl Acht, Herr Prior! Diese darf nicht geöffnet werden, außer wenn man großen Hunger hat.« - »Es ist gut,« sagte der Prior. »Gerade morgen ist das Fest unseres Titel Heiligen, da kommen viele Priester. Die werde ich alle bis Mittag hungern lassen, dann öffne ich die Schachtel und gebe ihnen ein großes Mahl.«
Der Morgen kommt, alle Priester lesen Messe, dann scherzen einige wegen der Küche. - »Heute will uns der Prior nichts zu essen geben. Das Feuer auf dem Herd ist erloschen, und man sieht keine Vorräte.« - Die anderen aber erwiderten: »Ihr werdet sie später sehen. Wenn Essenszeit ist, öffnet er eine Schachtel und mit ihr läßt er jedes beliebige Gericht kommen.« - Diese anderen hatten schon die andere Schachtel gesehen.
Als nun die Essensstunde schlug, ruft der Prior alle Priester und sagt: »Setzt euch nur alle auf eure Plätze!« - Alle gehorchten sofort, denn sie konnten es kaum erwarten, das Wunder der Schachtel zu sehen. Als aber der Prior die Schachtel öffnet, kommen sechs mit Stöcken Bewaffnete heraus, die auf die Priester los prügeln. Der eine fällt hier hin, der andere dort hin. Der Prior hält die Schachtel, sie fällt ihm aber aus der Hand, immer geöffnet, und die Sechs hören nicht auf mit Prügeln.
Geppone, der draußen stand und den Lärm mit anhörte, ging durch einen Korridor hinein, nahm die Schachtel und machte sie zu, sonst wären die Priester alle unter den Schlägen gestorben. Ich glaube, an jenem Tage, nach jenem Mittagessen, hat keiner von ihnen in der Kirche mehr funktioniert. Geppone aber behielt nun beide Schachteln und lieh sie niemand mehr und führte stets ein Herrenleben.
Mugello
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
MICCO ...

War einmal eine Mutter, die hatte einen Sohn, der hieß Micco. Eines Tages machte die Mutter Maccaroni und sagte zum Sohne: »Geh zuvor hinaus und schneide eine Mahd Gras.« Micco hatte aber keine Lust, er wollte erst seine Maccaroni essen.
Da versprach ihm die Mutter, sein Teil aufzubewahren, und so ging er denn ins Gras. Die Maccaroni waren fertig, und da Micco nicht kam, fing die Mutter an zu essen, aß und vergaß, dem Sohn sein Teil aufzuheben. Sie guckte in den Kessel und fand noch eine einzige auf dem Boden liegen, die nahm sie, goß Schmalz darauf, streute Käse darüber, und wie der Sohn heimkam, gab sie ihm die einzige Nudel auf seinen Teller.
Das war dem Micco zu wenig, er hub an zu weinen und wollte nicht essen. Da sagt die Mutter zum Stock: »Stock, schlag mir Mal den Micco, weil er die Maccaroni nicht essen will.« Der Stock rührte sich nicht. Sagt die Mutter zum Feuer: »Feuer, verbrenne mir den Stock, weil er den Micco nicht schlägt, der die Maccaroni nicht essen will.« Aber auch das Feuer rührte sich nicht.
Sagt die Mutter zum Wasser: »Wasser, lösche mir das Feuer, weil es den Stock nicht verbrennt, der den Micco nicht schlägt, weil er die Maccaroni nicht essen will.« Dieses kehrte sich gar nicht daran. Da rief die Mutter den Ochsen: »Ochse, saufe mir Mal das Wasser, das mir das Feuer nicht löscht, das den Stock nicht verbrennt, der den Micco nicht schlägt, weil er die Maccaroni nicht essen will.« Der Ochse soff aber das Wasser nicht.
Sagt die Mutter zum Strick: »Strick, binde mir den Ochsen, der das Wasser nicht säuft, das das Feuer nicht löscht, das den Stock nicht verbrennt, der den Micco nicht schlägt, weil er die Maccaroni nicht essen will.« Doch der Strick gehorcht ihr nicht. Nun ruft die Mutter die Maus: »Maus, zernag mir den Strick, der den Ochsen nicht bindet, der das Wasser nicht säuft, das das Feuer nicht löscht, das den Stock nicht verbrennt, der den Micco nicht schlägt, weil er die Maccaroni nicht essen will.« Die Maus zernagt den Strick nicht.
Ruft die Mutter: »Katze, friß mir die Maus, die den Strick nicht zernagt, der den Ochsen nicht bindet, der das Wasser nicht säuft, das das Feuer nicht löscht, das den Stock nicht verbrennt, der den Micco nicht schlägt, der die Maccaroni nicht essen will.« ...
Die Katze fraß die Maus, die Maus zernagt den Strick, der Strick bindet den Ochsen, der Ochse säuft das Wasser, das Wasser löscht das Feuer, das Feuer verbrennt den Stock, der Stock prügelt den Micco, und Micco ißt die Maccaroni.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
ORAGGIO UND BIANCHINETTA ...
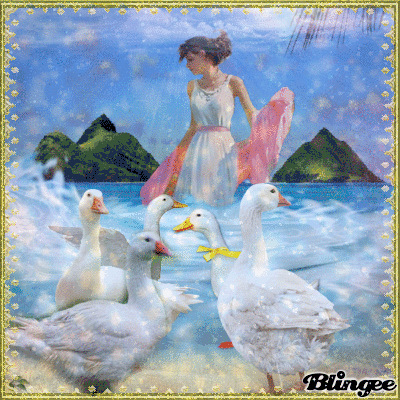
Es war einmal eine Frau, die hatte zwei Kinder. Der Knabe hieß Oraggio, das Mädchen Bianchinetta. Nachdem sie sehr reich gewesen waren, wurden sie durch verschiedene Unglücksfälle arm. Es wurde beschlossen, daß Oraggio in einen Dienst gehen sollte, und er erhielt eine Stelle als Kammerdiener im Hause eines Fürsten.
Nach einiger Zeit, da der Fürst mit seinem Dienst zufrieden war, beförderte er ihn und stellte ihn an zur Reinigung der Bilder in seiner Galerie. Unter den verschiedenen Gemälden bildete das Porträt einer sehr schönen Dame beständig den Gegenstand seiner Bewunderung. Oft fand ihn der Fürst im Anschauen des Bildes versunken und fragte ihn eines Tages, weshalb er so viele Zeit vor dem Bildnis zubrachte.
Oraggio antwortete, weil es vollkommen seiner Schwester gleiche, und da er so lange schon von ihr entfernt gewesen, fühle er das Bedürfnis, sie wiederzusehen. Der Fürst erwiderte, er glaube nicht, daß dies Bild seiner Schwester gleiche, da er habe suchen lassen und keine Frau, die dieser gleiche, habe finden können. Dann fügte er noch hinzu: »Laß sie her kommen, und wenn sie so schön ist, wie du sagst, werde ich mich mit ihr vermählen.«
Sofort schrieb Oraggio an Bianchinetta, und sie reiste augenblicklich ab. Oraggio erwartete sie am Hafen, und als er von fern schon ihr Schiff erblickte, rief er zum wiederholten Malen: »Ihr Schiffer im Meer, gebt acht, daß die Sonne meine Bianchina nicht schwarz brennt!« - In dem Schiff, wo Bianchinetta war, befand sich auch ein anderes Fräulein mit seiner Mutter. Beide sehr häßlich. Als sie dem Hafen nahe waren, gab die Tochter Bianchinetta einen Stoß, so daß sie ins Meer fiel. Oraggio, da sie gelandet waren, konnte seine Schwester nicht wieder erkennen, und jenes häßliche Mädchen stellte sich ihm dar mit der Behauptung, die Sonne habe sie so geschwärzt, daß sie nicht mehr zu erkennen sei.
Der Fürst war sehr überrascht, dieses Mädchen so häßlich zu finden, schalt Oraggio und gab ihm einen anderen Dienst; er sollte die Gänse hüten.
Nun trieb er täglich die Gänse ans Meer, und jedesmal, wenn sie ans Ufer kamen, tauchte Bianchinetta empor und schmückte sie mit Schleifchen von verschiedenen Farben. Sie aber, wenn sie wieder nach Hause kamen, schnatterten:
Kroh, kroh!
Vom Meer kommen wir,
Gold und Perlen essen wir.
Oraggios Schwester ist schön,
Schön wie die Sonne sind ihre Augen,
Die würde zu unserm Herren taugen.
Der Fürst fragte Oraggio, warum die Gänse täglich dies Sprüchlein sagten, und er erzählte, seine Schwester sei ins Meer geworfen und von einem Seefisch gepackt und in einen schönen Palast unter dem Wasser geschleppt worden, wo er sie gefangen halte. Doch an einer langen Kette, die ihr erlaube bis ans Ufer zu kommen, wenn er die Gänse dort hin treibe. Der Fürst sagte: »Wenn es wahr ist, was du mir erzählst, frage sie, was geschehen müsse, sie aus dieser Gefangenschaft zu befreien.«
Am nächsten Tage fragte Oraggio Bianchinetta, was er tun könnte, um sie aus der Haft zu retten. Sie antwortete: »Es ist unmöglich, mich von hier weg zu bringen. So sagt mir wenigstens immer das Meerungeheuer: Man brauche dazu ein Schwert, das so scharf sei, wie hundert, und ein Pferd, das laufe wie der Wind. Diese beiden Sachen zu finden, ist fast unmöglich. Du siehst also, daß es mein Schicksal ist, ewig hier zu bleiben.«
Als Oraggio zum Palast zurück kehrte, berichtete er dem Fürsten die Antwort seiner Schwester, und der Fürst bemühte sich so lange, bis er das Pferd fand, das lief, wie der Wind, und das Schwert, das so scharf war, wie hundert. Dann gingen sie ans Meer und fanden Bianchinetta, die sie erwartete. Der Fürst führte sie in seinen Palast, und die Kette wurde mit dem Schwert durchschnitten. Dann stieg sie zu Pferde und konnte sich so befreien.
Der Fürst aber fand sie so schön wie das Bild, das Oraggio immer betrachtet hatte, und heiratete sie. Die häßliche Andere wurde mitten auf dem Platz mit dem üblichen Hemd aus Pech verbrannt, sie aber lebten froh und glücklich.
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
FIORINDO UND CHIARA STELLA ...
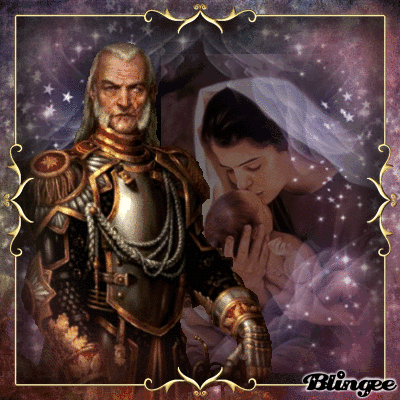
Ein König ging einmal auf die Jagd, und wie er so herum streifte, begegnete er einem Bauern, der bei Nacht in einem Wald die Sterne beobachtete. »Was tut Ihr hier?« fragte der König. – »Ich beobachte die Sterne.« – »Zu welchem Zweck? Ihr versteht das nicht.« – »Ich verstehe es wohl. Ich machte die Beobachtung, weil meine Frau niederkommen und mir einen Knaben schenken wird, und die Sterne verkünden, er wird König von Spanien werden.« –
Bei diesem Wort wurde der König ganz bestürzt, da er selbst der König von Spanien war und keine männlichen Leibeserben hatte. Er schwieg aber davon und sagte nur zu dem Bauern: »Ich will der Pate des Kindes sein, wenn Ihre es zufrieden seid. Euer Schaden soll es nicht sein.« – »Oh, nach Ihrem Belieben, wenn Sie sich damit bemühen wollen! Kommen Sie nur mit mir in mein Haus.«
Sie treten also beide in das Haus des Bauern, dessen Frau eben einen schönen Knaben geboren hatte, und alle kommen herzu, um ihn für die Taufe her zu richten. Und nachdem alles getan, wie es in solchen Fällen der Brauch ist, sagte der König: »Dies Kind will ich mitnehmen. Ihr müßt es mir geben, denn wenn es König sein soll, muß es eine Erziehung bekommen, wozu Ihr nicht die Mittel habt. Ich selbst habe keine Kinder, dafür will ich diesen als meinen legitimen Sohn ansehen.« –
Man weiß, die Männer schweigen, und die Weiber reden desto mehr. Der Bauer blieb stumm und machte keine Einwände; sein Weib aber klagte, daß man ihr das neu geborene Kindchen nehmen wolle. Doch nach einer Weile Hin-und-Widerredens ergab sie sich, und der König, nach dem er den Eltern ein reiches Trinkgeld gegeben hatte, nahm das Kindchen, das frisch gewickelt war, und ging weg mit seinem Diener, der ihn hier her begleitet hatte.
Als sie in einem dichten Wald waren, der nahe am Meere lag, sagte der König zu dem Diener: »Nimm dies Messer und töte damit den Knaben und wirf ihn ins Meer. Ich erwarte dich in der Schenke und will, daß du mir die Leber des Kindes bringst, damit ich sie esse.« –
Der Diener blieb im Wald, und nach dem der König sich entfernt hatte, sprach er bei sich selbst: Das sind schöne Geschichten! Anderen Kinder zu stehlen, um sie dann zu töten! Und doch muß ich gehorchen und es tun, denn bring ich ihm die Leber nicht, so kostet es meinen Kopf! –
Er hob das Messer und gab dem kleinen Geschöpf einen Stich in den Hals. Doch während er zu stach, erschien ihm zu Füßen ein Lamm, und sofort beschloß er, diesem die Leber auszuschneiden und den Kleinen mit seiner Wunde der Güte Gottes zu überlassen, und so tat er.
Als der König aber die Leber des Lammes, die er für die des Knaben hielt, verschlungen hatte, rief er: Du wirst deinen Hintern nicht auf meinen Thron hin pflanzen!
Lassen wir aber den König heiter und froh über das begangene Verbrechen nach Hause gehen, – was im Himmel geschrieben steht, ändert niemand, und jeder erfährt das Geschick, das ihm verhängt ist. Kehren wir zu dem unglücklichen kleinen Geschöpf zurück, das mit der Wunde am Hals im Wald, in einem Korb von Strauchwerk liegt.
Die Wunde war in dessen nicht tödlich, da sie später heilte und nur eine Narbe zurück ließ, die man unter den Fingern fühlen konnte. Am nächsten Tage bei Sonnenaufgang streifte ein Herr aus dieser Gegend auf der Jagd mit seinen Hunden hier herum, und als die Hunde zu dem Strauchkorb kamen, in dem das Kindlein verborgen war, schlugen sie ein Gewinsel an, als sollte die Welt untergehen.
Der Herr lief sogleich hin, weil er glaubte, der Hase liege da in seinem Lager. Als er das kleine Wesen sah, das vor Hunger wimmerte, rief er: Gott hat mich begnadet! Ich habe ja keine Kinder, und auch meine Frau wird gerne dieses als ein eigenes annehmen! –
Er nimmt es behutsam auf und trägt es nach Hause, wo es große Freude erregte. Diese beiden guten Personen erzogen es wie ein eigenes Kind, ließen es, da es groß geworden war, von geschickten Lehrern im Lesen und Schreiben unterrichten und gaben ihm den Namen Fiorindo.
Fiorindo aber wuchs zusehends, wurde stark und tüchtig, daß es nur zu verwundern war, und als er dreizehn Jahre alt war, trieb er Possen mit den anderen Jungen der Nachbarschaft. Einmal, als sie Nüsse Werfen spielten, verlor er acht Kreuzer, und da er sie nicht in der Tasche hatte, sagte er: »Ich werde euch morgen bezahlen.« – »Nein, es muß gleich sein!« –
»Aber ich habe sie nicht bei mir. Laßt mich nach Hause gehen und Vater und Mutter darum bitten. Sie sind reich, wißt ihr, und morgen bring ich es euch.« – »Vater und Mutter?« erwiderten sie spottend. »Armer Tor! Es sind ja nicht dein Vater und deine Mutter, diese Herrschaften, die dich in ihr Haus aufgenommen haben.« – »Wieso?« – »Nun, gewiß. Sie fanden dich in einem Wald, dort ausgesetzt, mit einer Wunde im Halse. Wenn du dich befühlst, findest du noch die Narbe.«
Diese Reden machten Fiorindo ganz bestürzt. Er lief nach Hause und wollte wissen, was daran sei, und bat solange, bis sie ihm die Wahrheit gestanden. »Dann,« rief er, »wenn ich nicht euer Sohn bin, will ich fort gehen. Ich danke euch für alles Gute, was ihr an mir getan habt, aber ich bin hier nur ein Bastard und will nicht bleiben.« –
»Aber höre doch! Für uns bist du unser Sohn. Man wird dir geben, was du nur willst, aber laß uns nicht allein und in Verzweiflung!« – Er aber blieb fest auf seinem Vorsatz und bestand darauf, daß sie ihn in den Wald zurück begleiten sollten, wo er gefunden worden war, und es war unmöglich, ihn davon ab zu bringen.
Erst dort im Wald bedachte er, wohin er gehen sollte, und überließ sich dann dem Zufall. Es war schon hoch am Tage und Hunger und Müdigkeit befielen ihn. So blieb er am Gitter eines Gartens stehen, hinter dem er den Gärtner die Pflanzen und Blumen begießen sah. Als der sich umblickte, sah er Fiorindo und fragte: »Wer bist du? Was willst du?« –
»Ich bin ein armer Junge ohne Vater und Mutter und bin todmüde und hungrig. Möchtet Ihr mich wohl annehmen, Euch im Garten zu helfen? Ich würde mich mit dem Essen begnügen.« – Dem Gärtner hatte der Jüngling sehr gefallen, schon nach dem bloßen Ansehen, so daß er sagte: »Komm nur! Am Essen ist hier kein Mangel. Der Garten gehört dem König von Spanien, und ich stehe in seinem Dienst.«
Während nun Fiorindo bei dem Gärtner wohnte, ging der König oft im Garten spazieren, und da er ihm begegnete, fand er Gefallen an ihm, so daß er eines Tages zu ihm sagte: »Fiorindo, du sollst zu mir kommen als mein Kammerdiener.« – Fiorindo konnte es kaum glauben. Er wohnte nun aber im königlichen Palast, kleidete den König an und war immer um seine Person.
Nun muß man wissen, daß dieser König zwar keine Söhne hatte, aber eine Tochter von dreizehn Jahren, die Chiara Stella hieß, eine Schönheit, die man nicht beschreiben kann, manierlich und zierlich mit einem Gesicht wie die Sonne und immer lustig. Ihr versteht schon, was da geschah.
Junge Menschen verlieben sich leicht beim bloßen Sehen, zumal wenn sie sich miteinander verständigen können. Fiorindo band täglich einen Strauß aus etwas Geranium, etwas Diptam, Rosen, Veilchen und Stiefmütterchen, und wenn Chiara Stella in den Garten ging mit ihrer Kammerfrau, gab er ihn ihr. Gespräche führten sie nicht, aber mit den Augen sprachen sie besser, als mit dem Munde. Kurz, sie verliebten sich ineinander, und alle hatten es bemerkt außer dem König.
Nun sind Väter und Ehemänner immer blind. Doch an den Höfen gibt es eine Menge Neider, und alle anderen Diener beneideten Fiorindo wütend, weil der König ihn immer um sich hatte und ihm alles anvertraute. Sie fingen also an, ihm nach zu spüren, und hinterbrachten dem Könige, er habe ein Liebesverhältnis mit seiner Tochter.
»Wie?« antwortete jener dumme König. »Ich kann nicht glauben, daß meine Tochter so verworfen sei, sich in eine Liebschaft mit einem Kammerdiener einzulassen.« – Aber die Neider paßten so auf sie auf, daß sie sich eines Tages überraschen ließen in einsamem Geplauder mit Fiorindo.
Als der König dies sah, dachte er, der entrüstet war, daß man ihn in seinem Vertrauen betrogen hatte, an eine Strafe. Er befahl, Chiara Stella aus dem Palast zu entfernen und zu seinem Bruder zu bringen, der König von Portugal war. Dem schrieb er, er möge sie gut bewachen. Ja, haltet Verliebte auch in einem unterirdischen Kerker gefangen, sie finden doch Mittel und Wege, einander Nachricht zu geben.
Sie fingen also an, sich zu schreiben. Aber einer dieser Briefe fiel einem Diener in die Hände, der ihn dem König brachte. Dieser Brief ist von Chiara Stella, rief der König, und geriet in solche Wut, daß die Liebe zu Fiorindo sich in Haß verwandelte. Er läßt ihn rufen und gibt ihm einen versiegelten Brief an den König von Portugal, in welchem stand, der Überbringer solle binnen einer Woche gehenkt werden.
Nun seht, wie gut es das Schicksal mit Liebenden meint. Fiorindo kommt in die Stadt des Königs von Portugal und begegnet Chiara Stella, die mit ihrer Hüterin gerade in einem Kreuzgang spazieren ging. Als sie sich erblickten, – welches Glück! welcher Jubel! Fiorindo gab ihr den Brief ihres Vaters, aber Chiara Stella hatte Verdacht, öffnete ihn und las darin das saubere Schurken Stückchen.
Ihr könnt denken, wie es sie schmerzte. Doch verlor sie darum nicht ihren Verstand. Sie hatte eine Schrift, wie ihr Vater, zerriß den häßlichen Brief und schrieb einen anderen, darin stand: Ich wünsche Chiara Stella mit einem trefflichen Ritter zu vermählen. Laßt binnen einer Woche in einem Turnier um sie kämpfen, und wer Sieger bleibt, soll sie erhalten.
Kaum hatte der König von Portugal diesen falschen Brief erhalten, so schrieb er das Turnier in seinem ganzen Reiche aus, und Fürsten, Barone und berühmte Ritter strömten herbei. Chiara Stella bewirkte, daß auch Fiorindo sich zu dem Turnier meldete. Doch bei dem ersten und zweiten Ritt wollte man ihn nicht, weil er kein Ritter war, so daß erst Chiara Stella mit einem ihrer Kleinode, da sie eine Königstochter und Thronerbin war, ihn zum Ritter ernennen und auch ins Turnier schicken mußte.
Dort betrug er sich so rühmlich, daß er alle besiegte und man ihn mit Chiara Stella vermählen mußte. Bei der Hochzeit aber erschien ein Kurier mit einem schwarz gesiegelten Brief, in dem stand, daß der König von Spanien gestorben sei und Chiara Stella regieren sollte. Das war ein schönes Zusammentreffen!
So geschieht es, daß, was »oben« geschrieben steht, nicht geändert werden kann, und die Sterne sprachen die Wahrheit, denn Fiorindo wurde König von Spanien.
Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
DIE TOCHTER DES SCHLANGENKÖNIGS ...
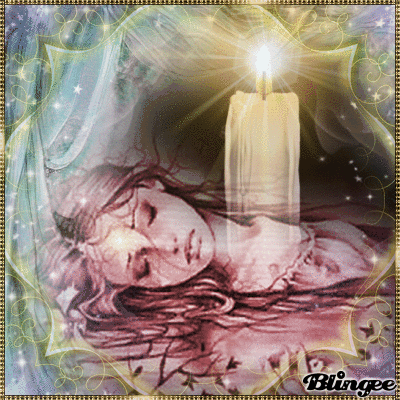
Es waren einmal zwei Freunde, von denen hatte der eine einen Sohn, der andere keinen; dieser liebte jedoch den Sohn des Freundes, als ob es sein eigener wäre. Beide waren große Kaufherren und befuhren mit ihren Schiffen die fremden Meere. Als nun der, welcher keinen Sohn hatte, eines Tages das Schiff zu neuer Reise rüstete, kam der Sohn des anderen und bat Vater und Freund, ihn mit zur See zu nehmen, damit auch er fremde Länder und Menschen kennen lerne.
Keiner von beiden wollte seine Bitte erhören, er flehte aber so lange, bis sie ihm nachgaben und auch ihm ein Schiff rüsteten. Wie sie aufs hohe Meer gekommen waren, erhob sich ein heftiger Sturm, der blies die Schiffe weit auseinander: eins da hin, das andere dort hin. Das Schiff, worauf sich der Freund befand, konnte sich retten, das andere, welches den Jüngling trug, scheiterte an einer Klippe.
Die Matrosen ertranken, allein der Jüngling rettete sich auf einem Balken an das Land. Ganz trostlos irrte er herum und kam in einen Wald, wo viele wilde Tiere waren. Um sich vor denen zu schützen, kletterte er des Abends auf einen Baum, um da die Nacht zu verbringen, und lief dann weiter und weiter, bis er vor einer hohen Mauer stand.
Diese Mauer erklomm er und sah zu seiner Freude, daß sie eine große Stadt einfaßte. Eilig stieg er auf der anderen Seite hinunter und wandelte durch die Straßen, sich etwas Speise zu kaufen. Er tritt in einen Laden, fragt, ob sie ihm etwas zu essen geben könnten; weil ihm aber niemand antwortet, geht er weiter und kommt vor den königlichen Palast.
Der Wächter an der Pforte war auch stumm und konnte ihm nicht Rede stehen. Der Hunger treibt ihn, die Zimmer zu durchsuchen, eins nach dem anderen, und so kommt er in die königliche Bettkammer, dort legt er sich, da er sehr müde war, ein wenig nieder.
Kaum lag er, so erschien ein wunderschönes verhülltes Mädchen, bereitete ihm ein köstliches Mahl und lud ihn zum Essen ein. Er aß und legte sich wieder schlafen. Dies dauerte so fort während zweier Wochen. Eines Nachts, als er im tiefen Schlaf lag, erschien ihm eine königliche Jungfrau von hoher Schönheit, die sprach:
»Hast du Mut und Ausdauer?« Er antwortete: »Ja.« - »Wenn du Mut und Ausdauer hast«, fuhr sie fort, »will ich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wisse: ich bin die Tochter des Schlangenkönigs. Ehe mein Vater starb, hat er die ganze Stadt mit Männern und Frauen, Soldaten und Dienstleuten verwünscht und mich selbst dazu.
Der Zauber, uns zu erlösen, ist in eines Magiers Händen; wenn du es aber über dich bringst, ein Jahr lang mit mir vereint zu sein, ohne mich zu sehen und ohne jemand etwas von diesem Geheimnis zu sagen, so ist der Bann, der mich und die Stadt hält, gebrochen, ich werde Kaiserin und du Kaiser.« Er antwortete, daß er getreulich tun wolle, was sie ihm geböte, und alles ging gut.
Nach einiger Zeit jedoch bat der Jüngling, sie möge ihm gestatten, seinen Vater und seine Mutter wie den Freund einmal wieder zu sehen, bald werde er ihr wieder kehren. Sie bangte zwar, ihn fort ziehen zu lassen, doch gab sie endlich seinem Drängen nach und schärfte ihm noch einmal ein, das Geheimnis in Treuen zu bewahren.
Ein Schiff erwartet ihn am Strande, das ihn in die Heimat tragen soll, und beim Scheiden gibt ihm die Jungfrau noch einen Stab, der ihm alle Wünsche erfüllen, ihn auch sicher zur Stadt seines Vaters bringen werde. Auf dem Schiffe waren Schätze und Kostbarkeiten in Fülle.
Glücklich gelangte er vor die Tore seiner Vaterstadt, ließ die Schätze in die aller beste Herberge tragen und fragte, ob hier nicht zwei reiche Schiffsherren wohnten. Man erzählte ihm, daß es wohl einmal in der Stadt zwei solcher Herren gegeben habe, welche die aller besten Freunde von der Welt gewesen, daß sie aber jetzt beide bettelarm wären durch ein Unglück, welches den Sohn des einen mitten im Meere getroffen, und das der Vater dem Freunde Schuld gegeben habe.
Sie haben darauf einen schlimmen Handel vor den Richtern angefangen und sich beide an den Bettelstab gebracht. Wie er dies gehört, ließ er sofort seinen Vater rufen und sprach: »Ich hätte wohl Lust, mit Euch und Eurem Freund ein Geschäft zu machen, da mir bewußt ist, daß ihr zur See gar wohl erfahren.«
Der Vater antwortete, darauf könne er sich jetzt nicht mehr einlassen, da er und sein Freund, aus Anlaß des Todes seines geliebten Sohnes, sich entzweit, und all seine Güter durch den daraus entsprungenen schlimmen Handel verschlungen worden wären.
»Geld braucht ihr keins«, antwortete rasch der Sohn, »davon habe ich so viel ihr nur braucht und wollt.« Und nun gab er Befehl, eine Tafel zu rüsten, und ließ den Freund seines Vaters wie die Frauen beider dazu einladen. Wie sie nun bei Tische saßen, sahen sich die Männer so wohl als die Frauen mit feindseligen Blicken an, und keins vermochte einen Bissen anzurühren.
Da nahm der Sohn ein Stück von seinem Teller und sprach: »Lieber Vater, der Euch diesen Bissen reicht, ist Euer verloren geglaubter Sohn, schaut her: gesund und wohl steht er vor Euch.« Und alle erkannten ihn, sprangen auf, umarmten und küßten sich vor Freude und weinten laut. Darauf teilte der Jüngling seine Schätze zwischen Vater und Freund, damit sie ihr Geschäft aufs neue betreiben könnten; gleichzeitig aber sagte er, daß er wieder fort müsse, wohin jedoch, sagte er nicht.
Dies drückte jedoch seiner Mutter das Herz ab, und sie wollte um jeden Preis hinter das Geheimnis des Sohnes kommen. Sie bat und bat, und weil sie gar nicht abließ, erzählte ihr der Sohn zu letzt alles. Erzählte ihr, wie er so lange schon mit dem königlichen Mädchen vereint sei, ohne ihre Schönheit je mit Augen gesehen zu haben.
Da gab ihm die Mutter ein Stücklein geweihter Kerze und sprach: »Wenn sie im Schlummer liegt, zünde diese an, so kannst du ihre Schönheit schauen.« Der Jüngling reist ab, erreicht Stadt und Schloß des Schlangenkönigs und findet die Jungfrau in Erwartung seiner. Wie sie schlafen gegangen war - ihm schien es hundert Jahre, bis daß er ihre Schönheit schaue - nahm er die geweihte Kerze, entzündete sie, entschleierte die Glieder des Mädchens und schaute ihre hohe Schönheit.
Da fielen heiße Wachstropfen herab, und sie erwachte. »Unseliger«, rief sie, »wem hast du mein Geheimnis verraten? Jetzt bist auch du im Bann und kannst mich nur erlösen, wenn du zum Wald gehst, wo der Magier wohnt, mit ihm kämpfst und ihn tötest.« - »Wehe mir«, sagte der Jüngling, »was hab ich getan! Doch sage mir, was ist zu vollbringen, so es mir gelingt, den Magier zu töden?«
Sie antwortete: »Nimm diesen Stab, mit ihm erschlägst du den Magier, darauf öffnest du ihm den Leib, worin du ein Kaninchen finden wirst. Öffnest du dieses, findest du eine Taube, öffne auch sie, und du wirst drei Eier finden. Diese Eier bewahre wohl auf, hüte sie wie deine Augäpfel, denn durch sie wird dereinst Stadt und Land wie ich selbst erlöst werden. Wo nicht, bleibst du verwünscht wie alle anderen.«
Betrübt ging er davon, und nur mit dem Stab bewaffnet kam er in den Wald, von dem ihm die Jungfrau gesagt hatte. Hier stieß er auf eine Herde Kühe, welche von dem Besitzer und seinen Knechten gehütet wurden. Er näherte sich ihnen, sagte, daß er sich im Wald verirrt habe, und bat sie um ein Stück Brot.
Der Herr gab ihm zu essen und behielt ihn bei sich, befahl ihm auch nach einigen Tagen, die Kühe auf die Weide zu treiben, warnte ihn aber vor dem Wald, in dem ein Zauberer wohne, der Vieh und Menschen fräße. Er versprach das, führte aber gleichwohl die Herde in den Wald, das Begegnis mit dem Zauberer herbei zu führen.
Der Herr, der ihm nur einen Knaben mit gegeben, fürchtete um seine Herde, da er ihn von weitem in den Wald treiben sah, und jammerte laut. Der Zauberer, kaum daß er die Herde erschaute, kam mit einer furchtbaren Eisenstange herbei. Dem Knechtlein sank bei diesem Anblick das Herz in die Hosen, und er sprang in das Gebüsch.
Der Jüngling aber blieb standhaft und schritt weiter. Da rief der Zauberer: »Du Wicht, was kommst du hier her, meinen Wald zu verwüsten?« Der Jüngling antwortete: »Nicht nur an den Wald will ich dir, sondern auch ans Leben!« Und der Kampf begann. Er währte den ganzen langen Tag, und sie waren hart aneinander. Beide ermüdeten, doch keiner war noch verwundet. Der Zauberer rief am Ende:
Hätt' ich eine Suppe von Wein und Brot,
Dich zu töten hätt's keine Not!
Und der Jüngling:
Hätt' ich eine Suppe von Milch und Brot,
Schlüge ich dich nieder ohne Not!
Sie trennten sich und wollten den Kampf anderen Tages fort setzen. Der Jüngling trieb sein Vieh zusammen. Der Knabe kam hervor, und ungefährdet kamen sie nach Hause. Alle staunten, sie unversehrt wieder zu sehen, und hörten mit Verwunderung die Mär des Jünglings an.
Sagte auch der Knabe, wie der andere sich während des Kampfes eine Suppe von Milch und Brot gewünscht, und der Herr befahl, eine solche Suppe auf den anderen Tag bereit zu halten, damit sie im rechten Augenblicke dem Jünglinge gereicht werden könne.
Wieder trieb er seine Herde in den Wald, begleitet von dem Knaben, der die Suppe trug. Der Kampf begann, und wie er am heißesten entbrannt war, rief der Zauberer:
Hätt' ich eine Suppe von Brot und Wein,
Schlüge dem Jüngling den Schädel ein!
Und der Jüngling:
Hätt' ich eine Suppe von Milch und Brot,
Schlüge den Zauberer sicher tot!
Sogleich reichte ihm der Knabe das Verlangte, er nimmt einen Mund davon, so daß ihm die alte Kraft zurück kehrt. Darauf holt er mit seinem Stab zu einem mächtigen Schlage aus, trifft den Kopf des Unholdes, und dieser stürzt tot zu Boden.
Gleich ist er nun über ihn her, schneidet ihm den Bauch auf, findet darin das Kaninchen, in diesem die Taube, und endlich in der Taube die drei Eier. Die nimmt er, verwahrt sie wohl, treibt die Kühe zusammen und kehrt heim. Alles kam ihm voll Jubel entgegen, und der Herr bat ihn, bei ihm zu bleiben. Aber seines Bleibens war nicht länger, er schenkte dem Herrn den erbeuteten Wald und ging davon.
In der Stadt des Schlangenkönigs angekommen, eilte er auf das Schloß zur Jungfrau. Die nahm ihn gar freundlich bei der Hand und führte ihn in den Thronsaal ihres Vaters, wo sie ihm die goldene Krone aufsetzte. »Jetzt«, sagte sie, »sind wir König und Königin.« Dann führte sie ihn auf den Altan des Schlosses, nahm die drei Eier und sagte zum Jüngling: »Jetzt wirf eins nach rechts, eins nach links, und das dritte gerade vor dich hin!«
Kaum hatte jener dies getan, so fing ein großer Lärm an: alle Leute der Stadt begannen zu sprechen, zu rufen, die Fahnen flatterten, Wagen fuhren vor, und die Truppen marschierten heran. Alle aber, Truppen und Volk, erhoben ihre Stimmen, dankten ihrem Befreier und riefen jubelnd: »Es lebe unser König und unsere Königin!«
Sie lebten im Glücke noch manches Jahr;
Ich aber bleibe so arm, wie ich war.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
EIN ITALIENISCHER EULENSPIEGEL ...
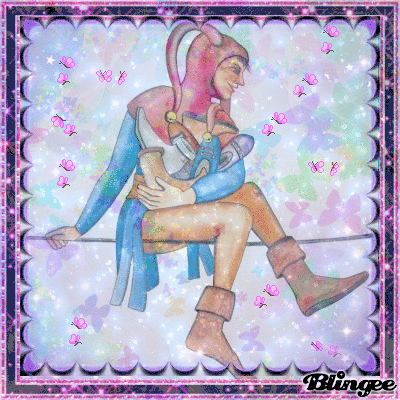
Firazzano war Diener, oder Haushalter und Verwalter, war die rechte Hand bei einem Fürsten in Palermo. Mit seinen Streichen verschonte er selbst seinen Herrn nicht; weil sich aber alle über ihn belustigten, so drückte der Fürst ein Auge zu und ließ den Schalk Schalk sein.
Einmal hatte die Königin von ihm gehört und wollte den Schalk auch kennen lernen. Sie ließ ihn rufen und fragte ihn: »Wie steht es mit dir? Bist du ledig oder verheiratet?« - »Verheiratet, Frau Königin, natürlich verheiratet.« - »Nun«, sagte jene, »ich möchte deine Frau wohl kennen lernen.« - »Wie ist das zu machen?
Das wird schwer gehen, denn meine arme Frau ist harthörig.« Das war sie nun nicht, er sagte es aber, weil er sich mit der Königin einen Spaß machen wollte. »Oh«, antwortete diese, »das schadet nichts, laß sie nur kommen; wenn sie schwer hört, werde ich ein wenig schreien.«
Firazzano ging nach Hause. »Cicca, eine große Ehre widerfährt dir: die Königin will dich kennen lernen. Weil sie aber schwer hört, mußt du, wenn du mit ihr sprichst, nur desto lauter schreien.« - »Gut«, sagte die Frau, »gehen wir, das läßt sich schon machen.«
Sie gingen in den Palast. Als sie bei der Königin eintraten, schrie die Frau mit lauter Stimme: »Zu Füßen Eurer Majestät!« - Aha, dachte die Königin, weil sie harthörig ist, meint sie, andere Leute müßten es auch sein! Und darauf schrie sie ihr entgegen: »Guten Tag, Gevatterin, wie geht es Euch?« - »Gut, ganz gut!« schrie die Frau noch lauter denn zuvor.
Die Königin wollte ihr nichts schuldig bleiben und überbot sie mit aller Kraft ihrer Lungen, ebenso die Frau Firazzano's, und es schien ein gewaltiger Streit zwischen ihnen entbrannt. Firazzano, der hinter der Tür gestanden, vermochte nicht mehr sich zu halten und platzte heraus, daß ihm der Bauch wackelte. Da merkte die Königin, daß ihr der Schalk einen Streich gespielt hatte, und hätte er sich nicht eilig auf die Beine gemacht, sie würde ihn haben packen lassen, und wer weiß, was die Sache dann für ein Ende genommen.
Einmal wollte sich der Herr Firazzano's ein neues Gewand machen lassen, dazu sollte ihm der Schalk einen Schneider rufen. Nun muß man wissen, daß alle Schneider, wenn sie das Tuch schneiden, den Mund verziehen, dieser so, jener anders.
Firazzano kam zum Schneider und sagte: »Meister, mein Herr läßt Euch rufen, Ihr sollt ihm ein neues Gewand fertigen. Nehmt Kreide und Schere mit, denn das Tuch müßt Ihr gleich im Palast zu schneiden.«
Er lief voraus und sagte seinem Herrn: »Der Schneider kommt, doch hört, was ich Euch sage. Der Ärmste leidet an Krämpfen. Ehe diese beginnen, fängt er an das Maul zu verziehen, das ist dann das Zeichen, ihm ein paar Stockstreiche über den Rücken zu ziehen, so wird das Schlimmste verhütet.« - »Wenn das so ist«, sagte der Fürst, »da laß mich nur machen, ich werde schon verhüten, daß er mir keine Krämpfe kriegt.«
Der Schneider kommt, breitet das Tuch fein säuberlich auf einem großen Tisch aus und fängt an dem Fürsten Maß zu nehmen. Firazzano war inzwischen hinaus gegangen und guckte durch das Schlüsselloch, zu sehen, wie das Ding endigen werde.
Der Schneider nimmt die Kreide, malt die Maße auf das Tuch, packt dann die Schere und fängt an zu schneiden. Der Fürst steht dabei und schaut ihm andächtig nach dem Munde. Das Tuch war dick, und der Schneider verzieht den Mund gar jämmerlich.
Kaum sieht dies der Fürst, nimmt er seinen Stock und zieht ihm ein paar wohl gemessene über den Rücken. Der schreit auf: »Au! Herr Fürst, was soll das bedeuten?« - »O nichts, macht nur weiter!« Der Schneider beruhigt sich und schneidet weiter, verzieht auch den Mund wieder.
Und da hat er auch schon wieder den Stock auf dem Rücken. »Au! Au! Was für eine Art ist das, mich zu prügeln, während ich schaffe?« - »Bleibt ruhig, Meister«, sagte der Fürst, »es geschieht wahrlich nur zu Eurem Besten«.
Währenddessen lachte Firazzano am Schlüsselloch sich den Buckel voll. Und wieder schneidet der Meister weiter, den Mund womöglich noch ärger verziehend denn zuvor. Desto dichter hageln jetzt auch die Schläge auf seinen Rücken.
Da ergrimmt er denn endlich, fängt an zu drohen und sagt: »Jetzt macht ein Ende, Herr Fürst, oder ich lasse Euch meine Schere fühlen!« Der Fürst sagte ruhig: »Was ereifert Ihr Euch, Meister? Waren nicht Eure bösen Krämpfe im Anzuge, verzogt Ihr nicht Euren Mund schon ganz jämmerlich? Und haben Euch da nicht Prügel immer davon geholfen?« -
»Und wer hat Euch solches berichtet?« - »Wer anders als Firazzano.« - »Firazzano? Daß ihn ... Laßt Euch belehren, Herr Fürst, ich habe, Gott sei es gedankt, nie an Krämpfen gelitten. So legt Euern Stock bei Seite, mit dem Firazzano werde ich abrechnen.« Nun erst konnte er das Gewand fertig schneiden, ohne Prügel zu bekommen.
Ein andermal hatte Firazzano gar nichts mehr, er war arm wie eine Biene im Winter, und sinnen mochte er, so viel er wollte, es fiel ihm nichts ein, was er hätte ausführen können. Er geht vor das Tor und sieht eine Herde Schweine, die waren so fett, daß einem das Herz im Leibe lachte, wenn man sie anschaute.
Firazzano, der sich rasch das Aussehen eines vornehmen Herrn gibt, tritt zum Schweinehirten. Der sieht die guten Kleider und sagt voll Respekt: »Küss Euch die Hände, Herr, was befehlt Ihr?« - »Nichts«, antwortet Firazzano mit Herablassung, »es macht mir Spaß, die Schweine fressen zu sehen, deshalb kam ich her.«
Er redete mit dem Schweinehirten über dies und jenes, und erfuhr jetzt, wem die schönen Schweine gehörten, wie viel sie alle zusammen kosten könnten, welches ihre Futterstunde wäre und manches andere. Zuletzt verlangte ihn zu sehen, wie sie Bohnen fräßen, und er rief: »O wie zierlich fressen meine Schweinchen! Die netten Tierchen, wie liebe ich sie!«
Darauf holt er ein kleines Geldstück aus der Tasche, schenkt es dem Schweinehirten und sagt: »Nimm dies, aber einen Gefallen mußt du mir schon tun: du wartest mit den Bohnen, bis ich da bin, denn mich freut es gar zu sehr, sie diese fressen zu hören.«
Das schien dem Schweinehirten wohl wunderlich, doch dachte er: Große Herren haben einen sonderlichen Geschmack, und dieser hat den seinen. Das soll mich nicht weiter kümmern, verdiene ich doch dabei ohne einen Finger krumm zu machen.
Am nächsten Tage die selbe Geschichte. Firazzano sah die Schweine fressen und sagte: »Wie zierlich fressen doch meine Schweinchen, man muß sie wirklich lieb haben!« Darauf gibt er dem Hirten wiederum das Geldstück und geht seiner Wege. So ging es eine Reihe von Tagen; der Schweinehirt dachte, Gottes Vorsehung wäre in Person zu ihm gekommen, und wünschte sich es gar nicht besser.
Eines Tages geht Firazzano auf den Markt, trifft zwei Fleischer und fängt mit denen zu unterhandeln an: »Möchtet ihr wohl eine Herde schöner Schweine kaufen?« - »Warum nicht, Herr! Wie viel sind es?« - »Zweihundert.« - »Und wie viel fordert Ihr dafür?« - »Zweitausend Goldunzen.« - »Das ist zu viel, könnt Ihr sie um achtzehnhundert lassen?« - »Nein! Wenn ihr aber neunzehnhundert gebt, sind sie euer.«
So ging es hin und her, bis sie endlich handelseins wurden, und jene sagten: »Wir wollen die Katze nicht im Sacke kaufen, können wir die Tiere sehen?« - »Gewiß, kommt nur mit mir.« So gingen sie zusammen vors Tor hinaus.
Ein paar Tage zu vor hatte Firazzano dem Schweinehirten gesagt, er heiße Herr Besitzer. Wie die drei nun auf dem Felde ankommen, läuft ihm jener, der ihm des Geldes wegen verbunden war, mit der Mütze in der Hand entgegen und ruft schon von weitem:
»Herr Besitzer, Herr Besitzer, was befehlt Ihr?« Und der: »Gabt Ihr meinen Schweinchen schon die Bohnen?« - »Nein, Herr, denn ich erwartete Euch ja. Jetzt soll es geschehen.« Während der Schweinehirt ging, die Bohnen zu holen, sagte Firazzano zu den Fleischern:
»Das Geschäft ist in Ordnung, aber tut mir den einzigen Gefallen und laßt meinem Schweinehirten nichts davon verlauten. Der liebt seine Tiere, daß er auf der Stelle tot bliebe, wüßte er, ich wolle sie verkaufen. Aber was meint ihr? Nicht wahr, ihr seid mit dem Handel zufrieden?« -
»Ja, Herr, vollkommen.« - »So laßt uns nach der Stadt zurückkehren.« Zuvor aber rief er noch den Schweinehirten herbei und sagte: »Joseph, morgen werden diese beiden Herren wieder kommen, behandle sie so, als ob ich es selbst wäre, tue auch, was sie dir sagen werden.« - »Es soll geschehen wie Ihr befohlen.« - »Leb' wohl.« - »Küss die Hand dem gnädigen Herrn Besitzer.«
Am nächsten Morgen gehen die Fleischer hinaus, die Schweine zu holen, sie hatten Firazzano bezahlt und wollten jetzt ihr Recht haben. Da hätte man den Schweinehirten sehen sollen, er schrie und tobte: »Wie? Was? Seid ihr denn verrückt geworden? Die Schweine wollt ihr? Geht zum Satan, ihr träumt wohl?« -
»Und sie sind doch unser!« - »Euer? Schön euer! Sie gehören meinem Herrn.« - »Nun der verkaufte sie uns ja.« - »Der Fürst? Der verkauft nichts!« - »Ach was Fürst, der Herr Besitzer verkaufte sie uns, gestern kam er ja mit uns hier heraus, den Handel abzuschließen!« -
»Herr Besitzer hin, Herr Besitzer her, der Besitzer der Schweine hier ist der Fürst. Der mit euch hier heraus kam, bezahlte mich, meine Schweine fressen zu sehen, deshalb habe ich Respekt vor ihm, mein Herr ist er aber nicht.« Die Fleischer wurden kleinlaut und fragten: »Sprecht Ihr die Wahrheit?« Und jener: »Die Wahrheit, so lieb mir mein Leben ist.« -
»Ei über den Schurken, so hat er uns betrogen. Schnell, suchen wir ihn abzufassen.« Sie gaben sich ans Laufen, den Herrn Besitzer einzufangen. Der aber hatte seine vornehmen Kleider an den Nagel gehängt, den Bart abgeschnitten und war außer Landes gegangen, das schöne Geld zu verprassen, das er durch seinen Schalk Streich gewonnen hatte.
Der Fürst war reich und viele Leute im Lande waren ihm Zins pflichtig. Wie er das Geld einzuziehen hatte, meinte er gut zu tun, wenn er Firazzano zu seinem Kassierer mache, und sagte zu diesem: »Nimm hier diese Scheine, geh und treibe die Gelder ein, zwanzig Prozent davon sind dein.«
Firazzano machte sich auf den Weg, und als er ankam, ließ er alle Schuldner zusammen rufen. Wie sie sich säumig zeigen, läßt er ihnen zu wissen tun, daß sie ihm nur zwanzig Procent zu bezahlen hätten, den Fürsten könnten sie ein andermal bezahlen. Das geschah; er schickte sie fort und ging nach Haus.
Beim Fürsten angekommen, fragt ihn dieser: »Nun, was habt Ihr aufgetrieben? Hat man Euch alles bezahlt?« - »Was denkt Ihr«, ruft Firazzano, »hatte ich doch Not, mein Teil zu erhalten.« - »Was soll das heißen?« - »Das heißt, daß ich kaum die zwanzig Prozent zusammen bringen konnte, die mir zu kamen. 'Euren Teil', sagten sie, 'würden sie Euch im nächsten Jahre bezahlen.'«
Der Fürst wollte erst wütend werden, dann aber überlegte er sich es, dachte, es wäre einmal Firazzano, lachte und ließ ihn vergnügt seines Weges ziehen.Einstmals hatte er es gar zu arg getrieben, so daß ihn der Vizekönig auf den Boden von Monreale verbannte. Er ging, machte sich lustig in Monreale, mietete aber anderen Tages einen Karren, füllte ihn ganz mit Erde an, setzt sich oben drauf und fährt ganz gemächlich nach Palermo hinunter.
Hier angekommen, fährt er mit dem Karren vor dem Palast des Vizekönigs hin und her. Dem hinterbrachte man schnell die Kunde: »Firazzano ist wieder hier!« Er befahl, ihn zu ergreifen und das Urteil über ihn zu sprechen. Aber Firazzano protestierte gar gewaltig, pochte auf sein gutes Recht und klagte ob geschehenen Unrechts.
»Ich habe«, sagte er, »gegen den Befehl des Vizekönigs nicht gehandelt, ich befinde mich in Wahrheit auf dem Boden von Monreale.« Wie der Vizekönig den Zusammenhang erfuhr, mußte er lachen und begnadigte den Schelm.
Was machte er ein anderes mal?
Sein Herr wollte ihm eine gute Lektion geben und hatte ihm eine Tracht Prügel zu gedacht. Er spricht mit dem Kastellan eines seiner Schlösser und sagt: »In diesen Tagen schicke ich Euch meinen Diener mit einem Brief, den lest, und was ich Euch darin heiße, führt mir pünktlich aus.«
Nach einigen Tagen ruft der Fürst den Firazzano: »He, Firazzano, trage mir doch diesen Brief da zu meinem Kastellan und sage ihm, er solle dir geben, was ich ihm geschrieben habe.«
Firazzano nahm den Brief, aber geheuer kam ihm die Sache nicht vor. Er drehte und wendete ihn, und da ihn der Rücken wie in böser Ahnung juckte, rief er einen anderen Diener, der gerade vorüber ging, heran und sagte ihm: »Höre, tu mir den Gefallen und trage diesen Brief anstatt meiner zum Kastellan und sage ihm, er möge dir geben, was da geschrieben stehe. Kommst du zurück, so tun wir einen braven Trunk zusammen.«
Der Diener nahm den Auftrag ohne Arg an. Der Kastellan öffnet den Brief, und geschrieben stand: »Lieber Kastellan, laß doch dem Überbringer des Briefes sofort hundert Stockstreiche aufzählen, er hat es wahrhaftig Not, dann sende ihn mir wieder zurück.« -
»Warte ein bißchen«, sagte der Kastellan zum Diener und ging, den Büttel zu rufen. Der hat den Armen auf eine Bank gebunden und ihm hundert Richtige aufgemessen. Was half es dem Diener, wenn er schrie und kreischte, er habe nichts Übles getan! Der Büttel sagte ruhig: »Es ist meine Pflicht, zu tun, was mir befohlen ist.«
Mehr tot als lebendig kam der arme Teufel heim. Firazzano lachte ins Fäustchen und tröstete ihn mit den Worten: »Mein Bruder, besser du als ich.«
Einmal war der Fürst von seinen Freunden zur Jagd eingeladen worden. Er begegnet Firazzano und sagt ihm: »Firazzano, du kannst zur Fürstin gehen und ihr melden, daß ich heute nicht zu Hause esse. Aber ganz nach deiner Bequemlichkeit, hörst du?«
Firazzano sagte zu und ging darauf seinen Geschäften nach. Unterdessen wartet die Fürstin auf ihren Gemahl, wartet und wartet bis gegen Mitternacht. Um Mitternacht kommt der Fürst nach Hause und findet die Fürstin weinend und in großer Bekümmernis um ihn.
Besorgt fragte der Fürst: »Was habt Ihr, Fürstin?« - »Was soll ich haben? Vor Angst um Euch bin ich fast umgekommen!« - »Wie, ließ ich es Euch denn nicht durch Firazzano wissen, daß ich heute auf die Jagd ginge?« Firazzano aber war nicht gekommen.
Erst nach acht Tagen kommt er zu der Fürstin und sagt ihr, der Fürst werde heute nicht zu Hause essen. Um so besser, dachte die Fürstin, muß ich doch gerade heute ausgehen, Besuche zu machen! Und sie ging aus.
Der Fürst kommt zur gewohnten Stunde nach Hause und trifft niemand an. Er geht in die Küche zum Koch und fragt den, was man heute esse. »Nichts, Herr.« - »Wie so nichts?« - »Das kann ich Euch nicht sagen, mir ist nichts befohlen worden.«
Er geht zur Magd: »Wo ist die Fürstin?« - »Ausgegangen, Herr, Besuche machen.« Der Fürst sucht sie auf und findet sie, und die Fürstin, da sie ihn sieht, fragt verwundert: »Ihr hier?« - »Natürlich, was gibt es da zu verwundern?« - »Ließt Ihr mir denn nicht durch Firazzano sagen, Ihr würdet heute nicht nach Hause kommen?« - »Heute?« fragte der Fürst, »ah, ich habe verstanden ...«
Als er Firazzano sah, schalt er ihn wegen des Streiches, den er ihm gespielt, tüchtig aus, aber Firazzano antwortete in größter Gemütsruhe: »Wenn es eine Schuld ist, so habt Ihr selbst die Schuld, denn Ihr sagtet mir, die Botschaft ganz nach meiner Bequemlichkeit auszurichten. Heute war mir es bequem und, heute überbrachte ich sie.«
Der Fürst mußte lachen, und alles war gut.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
O, DAS VEILCHEN! ...
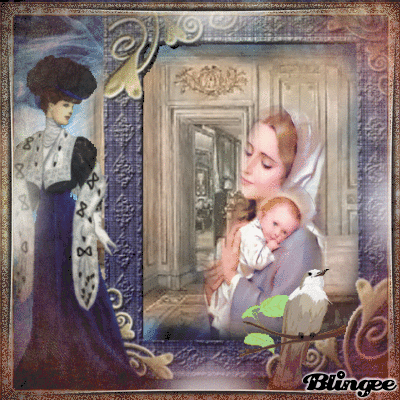
Es waren einmal vier Schwestern, die saßen zusammen auf der Terrasse des Hauses und arbeiteten. Die jüngste war die schönste und die war eine Spinnerin. Wenn sie spann, hatte sie neben sich einen Topf mit Veilchen, und am Abend, wenn sie mit Spinnen aufhörte, begoß sie ihre Veilchen und sang dazu mit süßer Stimme ein Lied mit dem Ritornell: »O das Veilchen! das Veilchen!«
Eines Tages nun ging der Königssohn vorüber, sieht die vier Schwestern auf der Terrasse, und wie er die Stimme der jüngsten hört, entbrennt sein Herz in Liebe für sie und er sagt: »Schön ist die, welche liest, schön auch die, welche strickt, und die, welche näht, aber die, welche spinnt, hat mir mein Herz verwundet! O das Veilchen! das Veilchen!«
Da erfüllten sich die Seelen der drei älteren Schwestern mit Neid; daß die jüngste das Glück haben sollte, von jenem geliebt zu werden, ertrugen sie nicht, und so warfen sie das Schwesterlein eines Tages in eine tiefe Grube.
Im Grunde der Grube war eine Höhle, wo sich die Feen zu versammeln pflegten; auch an diesem Tage fanden sie sich dort ein, und als sie das Mädchen, durch die Hände der Schwestern geworfen, herab fallen sahen, wo sie sich sicher den Hals gebrochen hätte, trugen sie sie auf Händen herab, und ganz sanft kam sie auf dem Grunde an.
Und da war auch schon der Königssohn, der war verzaubert, und die Feen verschwanden. Das arme Mädchen hatte ein Herz voll Unschuld und wußte nichts vom Lauf der Welt. Sie liebte den Königssohn von ganzem Herzen, und wie sie denn so gar allein mit ihm war, geschah es, daß sie, ohne zu glauben eine Sünde zu tun, ihm zu Willen war.
Acht Tage hatte sie mit dem Geliebten in der Höhle verbracht, da hörte sie einst von oben her Stimmen, und wie sie hinaus trat, zu sehen, was es wäre, sah sie ihre drei Schwestern. Die verwunderten sich sehr, sie noch am Leben zu finden, merkten aber bald, daß dies nur durch Hilfe der Feen geschehen sein konnte.
Sie sahen auch den Geliebten der Schwester, wie er aus der Grotte trat, in der Rechten ein Krüglein Wein, in der Linken eins mit Wasser. Er gab ihr von dem Wasser zu trinken und trank selbst vom Wein. Die drei Schwestern, die sich auf Zauberwerk verstanden, erkannten das Geheimniß des Weines und errieten, daß der Schwester, so bald sie davon getrunken, die Augen aufgehen und sie erkennen müsse, welche Sünde sie begangen habe.
Sie hofften, daß sie als dann vor Scham am gebrochenen Herzen sterben werde, und sagten: »Schwester, wir bereuen so sehr, daß wir dich umbringen wollten; willst du dich aber retten, so ist es noch an der Zeit: trinke von jenem Wein im Krüglein, und du wirst gerettet sein.«
Der Königssohn erschrak und erzürnte sich der maßen über die Bosheit der Schwestern, daß er sie mit einer Verwünschung vor einen Spiegel bannte, in welchem sie sich so häßlich erschienen, daß sie gingen und sich aufhängten.
Die arme Kleine aber hatte bereits vom Wein im Krüglein getrunken und ihre Schmach erkannt. Da fing sie bitterlich zu weinen an und vermochte dem Geliebten nicht mehr in die Augen zu sehen.
Der ließ das Wasser der Höhle wachsen, daß es zum Fluß wurde, da hinein stellte er sich, und es ging ihm bis zu den Knöcheln, dann bis an die Knie, zuletzt bis an den Hals, und jedesmal hatte er zu dem Mädchen gesagt: »Gibst du mir keinen Kuß, ertränke ich mich.« Und sie hatte jedesmal wieder geantwortet: »Ertränke dich nur!« Denn sie zürnte ihm ob ihrer Schande. Da wurde er von den Wellen bedeckt.
Das Mädchen aber fand sich mutterseelenallein in einem Walde, nur eine Stimme aus der Luft rief ihr zu: »Deinen Bräutigam haben die Feen gerettet, sie trugen ihn in ihr Schloß!« Ganz betäubt von allem, was sie betroffen, machte sie sich auf die Wanderung, ohne zu wissen wohin.
Acht Monde und neun Tage wanderte sie so über Berge, durch Wälder und Felder, ohne je einer lebenden Seele zu begegnen. Sie aß die Kräuter des Feldes und schlief zur Nacht in hohlen Bäumen oder in den Grotten des Gebirges.
Da sah sie einmal von weitem ein Licht, und wie sie darauf los geht, kommt sie an einen Palast, das war der Palast der Familie ihres Bräutigams. Sie tritt hinein, gibt sich für eine arme Waise aus und bittet aus Barmherzigkeit um ein Nachtquartier.
Die Königin läßt sie in einer Kammer des Palastes unterbringen, und in der Nacht kommt ein wunderschönes Knäblein zur Welt. Die Ärmste, wie sie sich so allein findet mit dem Knäblein auf dem Arme, wollte vor Schmerz und Scham sterben. Das Kind begann zu weinen, da hörte man in der Kammer eine süße Stimme, die sang ein Wiegenlied:
Schlaf', o schlafe, Söhnchen mein!
Wüßt' es dein Großmütterlein,
Würd' in goldnem Korb dich wiegen,
Dich in goldne Windeln schmiegen.
Schlaf', o schlafe, Söhnchen mein!
Das hörte die Kammerfrau und rief ihre Herrin. Die Königin kam zu sehen und fand das schöne Fräulein mit dem wunderschönen Neugeborenen. Da wollte sie wissen, wie das gekommen; das Mädchen erzählte ihr alles und verschwieg ihr gar nichts.
Das Kind begann wieder zu weinen, und augenblicks fing auch das Wiegenlied wieder an. Jetzt merkte die Königin, daß da die Stimme ihres Sohnes war. Sie küßte die junge Mutter und das Kind und rief: »O, ihr Feen, wer wird mir meinen Sohn wieder bringen, den ich seit neun Monden verloren?«
Da riet ihr die Kammerfrau, alle Feen zu einem Mahle einzuladen, und sagte: »Euer Sohn wird mit ihnen unter der Gestalt eines schönen Vogels erscheinen und sich auf den Tisch setzen und anfangen zu singen. Dann ergreift ihn schnell und ruft: 'Ich will meinen Sohn, ich will, ich will ihn!' Und Euer Sohn wird vor Euch stehen, und die Feen werden ihn Euch mit Freuden überlassen.«
Die Königin tat genau so, wie ihr die Kammerfrau geraten hatte. Der Vogel kam und wurde als bald zum schönen Jünglinge, der er als Prinz gewesen war. Die Königin und die Feen umarmten mit tausend Freuden seine Braut, und mit Sang und Klang und großer Pracht wurde die Hochzeit gefeiert.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
DON GIOVANNI DI LA FORTUNA ...

Es war einmal ein Mann, der war sehr reich, und hieß Don Giovanni di la Fortuna. Er war aber ein Verschwender, wußte mit seinem Geld nicht hauszuhalten, und brachte alles durch.
Als er nun nichts mehr hatte, mußte er betteln gehen, kleidete sich als armer Pilgrim, und wanderte so durch das ganze Land. Da begegnete ihm eines Tages ein vornehmer Herr, das war der Teufel, und sprach zu ihm: »Willst du reich werden, und ein herrliches Leben führen?« »Ja, warum nicht?« antwortete Don Giovanni.
»Hier hast du eine Börse,« fuhr der Teufel fort; »wenn du zu ihr sprichst: Liebe Börse, gib Geld heraus, so wird sie dir so viel Geld geben, wie du willst. Du mußt dich aber dafür drei Jahre, drei Monate und drei Tage lang nicht waschen, nicht kämmen, den Bart nicht scheren und die Kleidung nicht wechseln. Wenn du das alles genau tust, so bleibt die Börse dein, und wenn die Zeit verflossen ist, lasse ich deine Seele und nehme zwei andere dafür.«
Don Giovanni war es zufrieden, nahm die Börse und zog fort. Wenn er nun kein Geld mehr hatte, so brauchte er nur die Börse zu ziehen, und zu sagen: »Liebe Börse, gib Geld heraus,« so hatte er so viel Geld als er wollte. Er durfte sich aber nicht waschen, und bald war er so schmutzig, daß man ihn gar nicht mehr ansehen konnte, und der Bart und das Haar hingen ihm wirr um den Kopf herum; seine Pilgrimskutte zerfiel in Lumpen und er war voll von Ungeziefer.
Da kam er eines Tages in eine Stadt, und sah da ein sehr schönes Haus, und weil die Sonne so schön schien, so setzte er sich auf die Stufen des Palastes und fing an, das Ungeziefer von seinem Leibe zu suchen. Das sah die Magd, und sprach zu ihrem Gebieter: »Padrone, da unten sitzt ein Mensch, der ist so schmutzig, wie ich noch nie etwas gesehen habe. Jagt ihn doch weg, damit er uns das Haus nicht mit Ungeziefer erfülle.«
Da ging der Hausherr hinaus und fuhr den Don Giovanni an: »Du schmutziger Bettler, willst du gleich fort von meinem Haus!« »Seid nur nicht so grob,« sprach Don Giovanni, »ich bin kein Bettler, und wenn es mir gefällt, so kann ich euch und eure Frau zwingen, Hand in Hand das Haus zu verlassen.«
»Wie wolltest du denn das anfangen?« lachte der Herr des Hauses. »Wollt ihr mir euer Haus verkaufen?« frug Don Giovanni. »Ich kaufe es euch gleich ab.« Der andere meinte, der schmutzige Bettler sei verrückt, und um sich einen Spaß zu machen, nahm er das Anerbieten an, und rief: »Gut, komm nur mit; wir wollen gleich zum Notar gehen und den Kontrakt aufsetzen.«
Also gingen sie zum Notar, und der Herr verkaufte dem Don Giovanni das ganze Haus für sehr viel Geld, das sollte er innerhalb acht Tagen herbei schaffen. Don Giovanni ging und mietete zwei Zimmer in einem Wirtshaus, und sprach nun fort während: »Liebe Börse, gib Geld heraus,« und die Börse gab ihm immer mehr Geld, bis endlich nach acht Tagen das ganze Zimmer voll Gold war.
Als nun der Besitzer des Hauses kam, um sein Geld in Empfang zu nehmen, führte ihn Don Giovanni in das Zimmer voll Geld und sprach: »So, jetzt nehmt so viel ihr wollt.« Der andere schaute das Geld mit offenem Munde an, weil er aber sein Wort gegeben hatte, so konnte er nichts anderes tun, als sein Geld zu nehmen, und dem schmutzigen Bettler sein Haus zu überlassen.
Da nahm er seine Frau an der Hand, und verließ mit ihr das Haus, wie Don Giovanni ihm vorher gesagt hatte. Der aber zog vergnügt in das Haus ein, und ließ sich nichts abgehen. Nur wurde er mit jedem Tage schmutziger und häßlicher.
Nun begab es sich, daß der König einmal viel Geld brauchte, und da er von diesem steinreichen Don Giovanni hörte, so schickte er zu ihm, und ließ ihn bitten, ihm eine große Summe Geldes zu leihen. Don Giovanni war gleich bereit, ließ einen großen Wagen hoch mit Geldsäcken beladen und schickte sie ihm.
Der König war sehr erstaunt und dachte: »Wer ist dieser? der ist ja viel reicher als ich.« Als er nun wieder Geld eingenommen hatte, ließ er dem Don Giovanni seine Säcke füllen und schickte sie ihm zurück, der aber sprach zu den Dienern: »Sagt dem König, er beleidige mich auf diese Weise. Ich soll doch das bißchen Geld nicht zurück nehmen? Und wenn er es nicht will, so behaltet ihr es.«
Die Diener gingen zum König zurück, und sagten ihm alles, und der König verwunderte sich immer mehr über den reichen Mann. Da sprach er eines Tages zur Königin: »Liebe Frau, dieser Mann hat mir einen großen Dienst erwiesen, und hat erst noch das Geld nicht zurück nehmen wollen. Da er nun ein so reicher Herr ist, so will ich ihm meine älteste Tochter zur Frau geben.«
Die Königin war es zufrieden, und der König schickte einen Gesandten zu Don Giovanni, und ließ ihn fragen, ob er ihm die Ehre erweisen wolle, seine älteste Tochter zu seiner Gemahlin zu nehmen. »Nun,« dachte Don Giovanni, »jetzt geht ja alles gut, wenn ich die Tochter des Königs zu meiner Frau bekomme,« und sagte ja.
Da schickte der König wieder zu ihm und ließ ihn bitten, er möge ihm doch sein Bildnis schicken, seine älteste Tochter wünsche es zu sehen. Das tat Don Giovanni, als aber die Königstochter den schmutzigen, struppigen Pilgrim erblickte, fing sie laut an zu schreien: »Diesen schmutzigen Bettler soll ich heiraten? Nein, ich will ihn nicht! ich will ihn nicht!«
»Ach, Kind,« bat der König, »wie konnte ich wissen, daß dieser reiche Don Giovanni ein so häßlicher Mensch ist? Aber nun habe ich mein königliches Wort gegeben, und nun hilft nichts, du mußt ihn heiraten.« »Nein, Vater, das tue ich nicht. Ihr könnt mir den Kopf abhauen, aber diesen schmutzigen, nichtswürdigen Bettler heirate ich nicht.«
Auch die Königin sprach wie ihre Tochter, und machte dem König viele Vorwürfe, daß er seiner Tochter einen so ekelhaften Menschen zum Mann geben wolle. Die jüngste Tochter aber sprach: »Lieber Vater, seid nicht so traurig. Wenn meine Schwester den Don Giovanni nicht will, so nehme ich ihn, denn euer königliches Wort dürft ihr nicht brechen.«
Da war der König sehr erfreut und umarmte sein liebes Kind; die Königin aber und ihre älteste Tochter lachten die Jüngere aus. Nun schickte der König wieder einen Gesandten zu Don Giovanni, und ließ ihm sagen, er möge den Tag der Hochzeit fest stellen, denn die Königstochter sei bereit. »Gebet mir zwei Monate Zeit,« antwortete Don Giovanni.
Nach einem Monat aber waren die drei Jahre, drei Monate und drei Tage seines Bundes mit dem Teufel um. Da ließ sich Don Giovanni seinen langen Bart ab nehmen, sich saubere Kleider geben, badete einen ganzen Monat in wohl riechendem Wasser und nach dieser Zeit war er ein so schöner Jüngling, wie man nirgends einen schöneren sehen konnte.
Dann legte er königliche Kleider an, setzte sich in ein wunderschönes Schiff und fuhr in die Stadt, wo der König wohnte. Da er nun in den Hafen einfuhr, kamen der König und die Königin mit ihren beiden Töchtern aufs Schiff, um ihn zu begrüßen, und die ältere Königstochter nebst ihrer Mutter lachten immer die Jüngste aus, daß sie nun einen so schmutzigen Mann kriegen werde.
Als sie aber den wunderschönen Jüngling erblickten, wurden sie so von Zorn und Neid erfüllt, daß sie sich Beide ins Meer stürzten und ertranken; und der Teufel nahm ihre beiden Seelen. Die jüngste Königstochter aber war hoch erfreut über ihren schönen Gemahl, und sie fuhren ans Land und feierten eine glänzende Hochzeit; und als der alte König starb, wurde Don Giovanni König, und weil er die Börse hatte, ging ihm auch das Geld nie aus.
Da blieben sie zufrieden und glücklich, und wir wie ein Bündel Wurzeln.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
VON DEN DREI GUTEN RATSCHLÄGEN ...
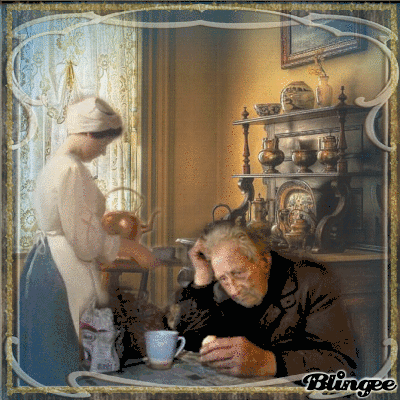
Es war einmal ein Mann, der hatte eine Frau, die er von Herzen lieb hatte. Die Frau aber war guter Hoffnung. Da sprach sie eines Tages zu ihrem Mann: »Ach, lieber Mann, ich habe ein solches Gelüsten nach einem Stückchen Leber; ach, hätte ich doch ein Stückchen Leber.«
»Wenn es weiter nichts ist, etwas Leber will ich dir schon verschaffen,« antwortete der Mann, und ging zu seinem Gevatter, der war Metzger. »Gevatter,« sprach er, »seid so gut und gebt mir ein halb Rottolo Leber, eure Gevatterin hat ein Gelüste danach.« »Gleich will ich euch bedienen, Gevatter, wartet nur einen Augenblick, bis ich diese Kunden abgefertigt habe.«
Der Mann wartete und wartete; die Kunden gingen weg, es kamen andere, und der Gevatter gab ihm noch immer nicht sein Stück Leber. »Gevatter, so bedient mich doch, eure Gevatterin sitzt zu Hause und kann keine Ruhe finden vor Verlangen nach einem Stückchen Leber.«
»Wartet nur noch ein wenig, Gevatter, bis ich diese Kunden abgefertigt habe,« antwortete der Metzger, und fuhr fort seine Kunden zu bedienen, einen nach dem anderen, und nur seinen Gevatter ließ er warten. Da riß dem Mann endlich die Geduld. »Ist denn mein Geld nicht eben so gut als das der anderen?« dachte er, ergriff einen großen Prügel und schlug damit dem Metzger den Schädel entzwei, daß er tot hin fiel.
Als er aber den Metzger tot da liegen sah, wurde ihm doch bang zu Mute, er lief nach Haus zu seiner Frau, und sprach: »Liebe Frau, ich muß weit, weit von hier fort, denn mir ist ein Unglück begegnet. Der Gevatter bediente immer alle die anderen Kunden und nur mich nicht; ich aber dachte an dich, und es tat mir Leid, daß du so lange warten solltest. Da riß mir die Geduld und ich schlug ihm seinen Schädel entzwei. Darum muß ich nun in die weite Welt wandern und dich allein lassen.«
Die Frau jammerte und weinte, aber was half es? Sie mußte allein bleiben, und der Mann zog fort in die weite Welt. Wie er nun so da hin zog, kam er auch nach Rom. Da dachte er: »Besser als hier ist es nirgends. Ich will hier bleiben und bei dem Papst in Dienst treten.« Also verdingte er sich bei dem Papst und diente ihm treu vierzig Jahre lang, und der Papst hatte ihn von Herzen lieb.
Als aber die vierzig Jahre um waren, dachte er eines Tages: »Ich bin nun so lange Jahre von Hause weg gewesen und weiß nicht, ob meine Frau noch lebt und ob ich einen Sohn oder eine Tochter habe. Darum will ich in meine Heimat zurück kehren, nach so langer Zeit wird niemand mehr an den toten Metzger denken.«
Da kam er zum Papst und sprach: »Excellenz, ich habe euch so lange treu gedient; laßt mich nun auch in meine Heimat zurück kehren.« »Gut,« sprach der Papst, »und weil du mir so lange treu gedient hast, so nimm hier dieses Geld.« Mit diesen Worten gab er ihm dreihundert Unzen. Der Mann dankte, steckte das Geld in die Tasche und küßte dem Papst die Hand.
Als er aber eben zur Tür hinaus gehen wollte, rief ihn sein Herr zurück, und sprach: »Höre einmal, wenn ich dir einen guten Rat gebe, gibst du mir dann hundert Unzen dafür?« »Excellenz, nehmt was euch beliebt,« antwortete der Mann, und gab dem Papst hundert Unzen zurück.
Da sprach der Papst: »Bedenke wohl, daß dieser gute Rat dich hundert Unzen kostet, darum merke ihn dir. Wenn dir unterwegs etwas Außergewöhnliches begegnet, so mache keine Bemerkungen darüber.« Der Mann versprach es, küßte dem Papst die Hand, und wollte wieder gehen.
Der Papst aber rief ihn zum zweiten Mal zurück, und sprach: »Wenn du mir wieder hundert Unzen gibst, so gebe ich dir noch einen guten Rat.« »Excellenz, tut wie es euch gefällt,« antwortete der Mann, und zählte wieder hundert Unzen auf den Tisch. Da sagte der Papst: »Bedenke wohl, daß dieser gute Rat dich wieder hundert Unzen kostet, darum nimm meine Worte wohl in Acht. Du darfst keinen anderen Weg zurück gehen, als eben den selben, den du her gekommen bist.«
Der Mann küßte seinem Herrn die Hand und wollte zur Tür hinaus gehen. Der Papst aber rief ihn zum dritten Mal zurück und sprach: »Gib mir noch einmal hundert Unzen, so will ich dir noch einen guten Rat geben.« »Excellenz, nehmt was ihr wollt,« antwortete der Mann, und gab auch die letzten hundert Unzen zurück.
Da sprach der Papst: »Höre wohl auf meine Worte und vergiß nicht, daß auch dieser Rat dich hundert Unzen kostet. Den Zorn, der dich am Abend ergreift, lass ruhen bis zum nächsten Morgen; wenn er dich am Morgen ergreift, so lass ihn ruhen bis zum Abend. Erinnere dich meiner Worte, sie werden dir nützen.
Und nun, nachdem du mir vierzig Jahre gedient hast, kannst du auch noch einen Tag bei mir bleiben und mir einen großen Backofen voll Brot kneten und backen.« Da ging der Mann in die Küche und knetete schönes, weißes Brot; und der Papst ließ heimlich die dreihundert Unzen in den größten Laib hinein verstecken, und mit dem übrigen Brot backen.
Als nun der Mann den nächsten Tag kam, um Abschied zu nehmen, schenkte ihm der Papst den Laib Brot und sprach: »Nimm dieses schöne weiße Brot mit und iß es, wenn du frohen Mutes bist.« Dann segnete er ihn und ließ ihn ziehen.
Der Mann wanderte nun immer vorwärts, seiner Heimat zu. Eines Tages, wie er so dahin ging, wurde er hungrig, und da er ein Wirtshaus am Wege sah, trat er hinein, und bestellte sich etwas zu essen. Der Wirt brachte einen Teller Fisch, mit Brot und Wein, und stellte alles vor ihn hin; daneben aber stellte er einen Totenkopf.
Der Mann wollte schon fragen, was das bedeute, da fiel ihm ein, wie der Papst gesagt hatte: »Wenn dir etwas Außergewöhnliches begegnet, so mache keine Bemerkungen darüber,« und er schwieg. Als er nun gegessen hatte, sprach der Wirt zu ihm: »Du bist der erste, der mich nicht gefragt hat, wozu ich den Totenkopf dahingestellt habe, und das hat dir das Leben gerettet.
Ich will dir zeigen, was aus Denen geworden ist, die ihre Neugierde nicht zu zähmen vermochten.« Mit diesen Worten führte er ihn in einen dumpfen Keller, darin lagen viele Leichen und Toten Gebeine, das waren die Leichen derjenigen, die den Wirt gefragt hatten, warum er den Totenkopf neben die Speisen stelle.
Da dankte der Mann in seinem Herzen dem Papst für den guten Rath und dachte: »Er hat mich zwar hundert Unzen gekostet, er hat mir aber auch das Leben gerettet.« Nun zog er weiter, und wanderte wieder viele Tage. Da begegneten ihm eines Tages eine Menge Arbeiter, die gingen aufs Land, um den Flachs auszuziehen, und sprachen zu ihm: »Wollt ihr nach Catania? Warum geht ihr denn diesen Weg? Kommt doch mit uns, wir gehen einen viel kürzeren Weg.«
Der Mann gedachte an den zweiten Rat des Papstes, daß er auf dem selben Wege zurück wandern müsse, auf dem er nach Rom gekommen sei, und antwortete: »Zieht ihr eure Straße, ich will die meine ziehen.« Kaum war er einen Miglio weit gegangen, so hörte er lautes Geschrei, das waren die armen Arbeiter, die von Räubern überfallen und ermordet worden waren.
Da dachte er: »Dieser Rat hat mich freilich auch hundert Unzen gekostet, aber er hat mir das Leben gerettet. Gesegnet sei, der ihn mir gegeben hat!« Endlich, nach einigen Tagen, kam er eines Abends spät in Catania an, und ging so gleich in das Haus, wo seine Frau vor vierzig Jahren gewohnt hatte.
Nun hatte sie damals einen Sohn geboren, der war Geistlicher geworden, und lebte bei seiner Mutter. Als nun der Mann klopfte, lief der Sohn die Treppe hinunter, machte ihm auf, und frug ihn, was er wolle. Wie der Mann aber einen Geistlichen sah, überkam ihn ein großer Zorn, und er dachte: »Wer ist dieser Pfaffe, der bei meiner Frau lebt?«
Und es hätte wenig gefehlt, so hätte er ihn ermordet. Da gedachte er aber des guten Rates, den der Papst ihm gegeben hatte: »Den Zorn, der dich am Abend ergreift, lass ruhen bis zum nächsten Morgen,« und er antwortete: »Ich bin ein armer Pilger, könnt ihr mir nicht ein Obdach geben?« Da führte ihn sein Sohn hinein, und in der Stube saß seine Frau, die er so lange nicht gesehen hatte.
»Kommt herein, armer Mann,« sprach sie, »ruht euch aus, bis ich das Abendessen bereitet habe.« Dann stellte sie das Abendessen auf den Tisch und lud ihn ein, mit ihnen zu essen. Während des Essens sprach der Pilger: »Erzählt uns doch eine Geschichte, gute Frau; ihr wißt deren gewiß viele.«
»Ach,« antwortete sie, »was sollte ich euch anderes erzählen können, als meine eigene traurige Geschichte, da ich so kurze Zeit nach meiner Heirat meinen Mann verloren habe.« »Wie war denn das?« »Ich war guter Hoffnung und sagte eines Tages zu meinem Mann, ich hätte so ein Gelüst nach einem Stückchen Leber. Da ging er hin, es zu kaufen, weil ihn aber der Metzger so lange warten ließ, nahm er im Zorn einen großen Prügel und schlug ihm den Schädel entzwei.
Darauf mußte er fliehen, und ich habe seitdem vierzig Jahre nichts von ihm gehört. Als meine Stunde kam, gebar ich diesen Sohn, der Geistlicher geworden ist.« Als der Mann hörte, der Geistliche sei sein eigener Sohn, dankte er im Herzen dem Papst für seinen guten Rat. »Denn,« dachte er, »ich hätte im Zorn beinah ein großes Unglück angerichtet.«
Dann sprach er: »Es ist doch merkwürdig, meine Geschichte gleicht ganz der eurigen, gute Frau. Ich war seit Kurzem verheiratet, und meine Frau war guter Hoffnung. Da sagte sie eines Tages: 'Ach, lieber Mann, mich verlangt so nach einem Stückchen Leber; ach, hätte ich doch ein Stückchen Leber.'
Ich ging zum Metzger, um es ihr zu kaufen; der Metzger aber bediente alle seine Kunden und nur mich nicht, so daß mir endlich die Geduld ausging und ich ihm seinen Schädel entzwei schlug. Da mußte ich fliehen und meine arme Frau allein zurück lassen, und habe seit dem nichts von ihr gehört. Und jetzt, nach vierzig Jahren, bin ich wieder gekommen und will sehen, ob sie noch lebt.«
Während er diese Worte sprach, sah seine Frau ihn immer an und konnte ihre Augen nicht von ihm weg wenden, und als er seine Geschichte fertig erzählt hatte, erkannte sie ihn und umarmte ihn mit vielen Tränen und großer Freude. Da umarmte er auch seinen Sohn und freute sich, daß er ein so schöner großer Mann war.
Als sie sich nun ein wenig beruhigt hatten und weiter essen wollten, nahm der Mann aus seinem Quersack das Brot, das der Papst ihm gegeben hatte, und sprach: »Dieses Brot ist alles, was ich euch mit bringe, und der Papst hat mir gesagt, ich solle es essen, wenn ich frohen Mutes wäre. Wann könnte ich nun froher und glücklicher sein als jetzt, wo ich euch wieder gefunden habe? Und darum wollen wir es jetzt verzehren.«
Mit diesen Worten schnitt er es an, und siehe! da fielen die dreihundert Unzen heraus, und er war nun ein reicher Mann und lebte noch lange vergnügt und ohne Sorgen mit seiner Frau und seinem Sohn.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
MARIA, DIE BÖSE STIEFMUTTER UND DIE SIEBEN RÄUBER ...

Es war einmal ein Mann, dem war seine Frau gestorben, und er hatte nur ein kleines Mädchen, das hieß Maria. Maria ging in die Schule zu einer Frau, bei der sie nähen und stricken lernte. Wenn sie nun Abends nach Hause ging, sagte ihr die Frau immer: »Grüße auch deinen Vater recht schön von mir.« Und weil sie ihn so freundlich grüßen ließ, so dachte der Mann: »Das wäre eine Frau für mich,« und heiratete die Frau.
Als sie aber verheiratet waren, wurde die Frau recht unfreundlich gegen die arme Maria, denn so sind die Stiefmütter von jeher gewesen, und konnte sie zuletzt gar nicht mehr leiden. Da sagte sie zu ihrem Mann: »Das Mädchen ißt uns so viel Brot, wir müssen sie los werden.« Aber der Mann sagte: »Töten will ich mein Kind nicht!« Da sprach die Frau: »Nimm sie morgen mit aufs Feld, und laß sie dort alleine stehen, daß sie den Weg nach Hause nicht mehr findet.«
Den anderen Tag rief der Mann seine Tochter und sagte zu ihr: »Wir wollen über Land gehen und unser Essen mit nehmen.« Da nahm er einen großen Laib Brot mit, und sie machten sich auf den Weg. Maria aber war schlau, und hatte sich die Taschen mit Kleie angefüllt. Wie sie nun hinter dem Vater her ging, warf sie von Zeit zu Zeit ein Häufchen Kleie auf den Weg.
Als sie viele Stunden weit gegangen waren, kamen sie an einen steilen Abhang; da ließ der Mann einen Laib Brot hinunter fallen, und rief: »Ach, Maria, das Brot ist hinunter gefallen!« - »Vater,« sprach Maria, »ich will hinunter steigen und es holen.« Da ging sie den Abhang hinunter und holte das Brot; als sie aber wieder herauf kam, war der Mann fort gegangen und Maria war allein.
Da fing sie an zu weinen, denn sie war sehr weit weg von Haus, an einem ganz fremden Ort. Als sie aber an die Häufchen Kleie dachte, faßte sie wieder Mut, und in dem sie immer der Kleie nach ging, kam sie endlich spät in der Nacht wieder nach Haus. »Ach, Vater!« sprach sie, »warum habt ihr mich allein gelassen?« Der Mann tröstete sie und sprach so lange bis er sie beruhigt hatte.
Die Stiefmutter aber war sehr zornig, daß Maria den Weg zurück gefunden hatte, und nach einiger Zeit sagte sie wieder zu ihrem Mann, er solle Maria über Land führen, und sie dann im Wald allein lassen. Den nächsten Morgen rief der Mann wieder seine Tochter, und sie machten sich auf den Weg.
Der Vater trug wieder einen Laib Brot, Maria aber vergaß Kleie mit zu nehmen. Als sie nun im Walde waren, an einem noch tieferen und steileren Abhang, ließ der Vater wieder das Brot fallen, und Maria mußte hinunter steigen es zu holen. Als sie aber wieder herauf kam, war der Mann fort gegangen und sie war allein. Da fing sie an bitterlich zu weinen und lief lange um her, aber sie geriet nur tiefer in den dunkeln Wald.
Es wurde Abend, da sah sie auf einmal ein Licht, und als sie darauf zu ging, kam sie an ein Häuschen, darin war ein Tisch gedeckt und es standen sieben Betten darin; Menschen waren aber keine da. Das Haus gehörte aber sieben Räubern. Da versteckte sich Maria hinter einen Backtrog und bald kamen die Räuber nach Haus. Sie aßen und tranken, und legten sich dann zu Bett.
Den nächsten Morgen zogen sie aus, ließen aber den jüngsten Bruder da, damit er das Essen koche, und das Haus rein mache. Als sie fort waren, ging der jüngste Bruder auch fort, um Einkäufe zu machen. Da kam Maria hinter dem Backtrog heraus, und räumte das ganze Haus auf, kehrte die Stube und zuletzt setzte sie den Kessel aufs Feuer um die Bohnen zu kochen. Dann versteckte sie sich wieder hinter den Backtrog.
Als der jüngste Räuber nach Hause kam, war er sehr erstaunt. Alles so sauber zu finden, und als seine Brüder kamen, erzählte er, was ihm begegnet sei. Die waren alle sehr verwundert, und konnten sich gar nicht denken, wie es zugegangen sei. Den nächsten Tag blieb nun der zweite Bruder zurück. Er tat, als ob er auch fort ginge, kam aber gleich zurück, und sah Maria, die wieder hervor gekommen war, um das Haus in Ordnung zu bringen.
Maria erschrak sehr, als sie den Räuber erblickte; »ach,« bat sie, »tötet mich nicht, um Gotteswillen!« »Wer bist du denn?« frug der Räuber. Da erzählte sie ihm von ihrer bösen Stiefmutter, und wie ihr Vater sie im Wald verlassen habe, und wie sie seit zwei Tagen hinter dem Backtrog versteckt gewesen sei.
»Du mußt keine Angst vor uns haben,« sagte der Räuber. »Bleibe bei uns, sei unsere Schwester, und koche, nähe und wasche für uns.« Als die anderen Brüder nach Hause kamen, waren sie es zufrieden, und so blieb denn Maria bei den sieben Räubern, führte ihnen das Hauswesen und war immer still und fleißig.
Eines Tages, als sie am Fenster saß und nähte, kam eine arme Frau vorbei, und bat sie um ein Almosen. »Ach!« sprach Maria, »ich habe nicht viel, denn ich bin selbst ein armes, unglückliches Mädchen; aber was ich habe, will ich euch geben.« »Warum bist du denn so unglücklich?« frug das Bettelweib.
Da erzählte ihr Maria, wie sie von Hause fort und dahin gekommen sei. Die arme Frau ging hin, und erzählte der bösen Stiefmutter, daß Maria noch lebe. Als die Stiefmutter das hörte, war sie sehr zornig, und gab der Bettlerin einen Ring, den solle sie der armen Maria bringen. Der Ring aber war ein Zauberring.
Nach 8 Tagen kam also die arme Frau wieder zu Maria, um sich ein Almosen zu holen, und als Maria ihr etwas gab, sprach sie: »Siehe, mein Kind, da habe ich einen schönen Ring; weil du so gut gegen mich bist, so will ich ihn dir schenken.« Maria nahm arglos den Ring, aber als sie ihn an den Finger steckte, fiel sie tot hin.
Als nun die Räuber nach Hause kamen, und Maria am Boden fanden, waren sie sehr betrübt, und weinten bitterlich um sie. Dann machten sie einen schönen Sarg, legten Maria hinein, nachdem sie ihr die schönsten Schmucksachen angelegt hatten, legten auch noch viel Gold hinein, und setzten den Sarg auf einen mit Ochsen bespannten Karren. Damit fuhren sie in die Stadt.
Als sie an das Schloß des Königs kamen, sahen sie, daß die Tür zum Stall weit offen stand. Da trieben sie die Ochsen an, daß sie den Karren in den Stall fuhren. Darüber wurden die Pferde unruhig, und fingen an sich zu bäumen und Lärm zu machen. Als der König den Lärm hörte, schickte er hinunter und ließ seinen Stallmeister fragen, was geschehen sei.
Der Stallmeister antwortete, es sei ein Karren in den Stall gekommen und niemand dabei, und auf dem Karren liege ein schöner Sarg. Da befahl der König, man solle den Sarg in sein Zimmer bringen und ließ ihn dort aufmachen. Als er aber das schöne tote Mädchen darin erblickte, fing er an bitterlich zu weinen, und konnte sich gar nicht davon trennen.
Da ließ er vier große Wachskerzen bringen, und ließ sie an die vier Ecken des Sarges stellen und anzünden; dann schickte er alle Leute aus dem Zimmer, verriegelte die Tür, fiel neben dem Sarg auf die Kniee und vergoß heiße Tränen. Als es Zeit zum Essen war, schickte seine Mutter zu ihm, er solle kommen.
Er antwortete aber nicht einmal, sondern weinte nur immer heftiger. Da kam die alte Königin selbst und klopfte an die Tür, und bat ihn doch auf zu machen, er aber antwortete nicht. Da schaute sie durch das Schlüsselloch, und als sie sah, daß ihr Sohn neben einer Leiche kniete, ließ sie die Tür aufbrechen. Aber als sie das schöne Mädchen erblickte, wurde sie selbst ganz gerührt, und beugte sich über Maria und nahm ihre Hand.
Wie sie nun den schönen Ring sah, dachte sie, es wäre doch schade, den mit begraben zu lassen und streifte ihn ab. Da wurde mit einem Mal die tote Maria wieder lebendig, und der junge König war hoch erfreut und sprach zu seiner Mutter: »Dieses Mädchen soll meine Gemahlin sein!«
Da antwortete die alte Königin: »Ja, so soll es sein!« und umarmte Maria. Da wurde Maria die Frau des Königs, und Königin, und sie lebten herrlich und in Freuden bis an ihr glückliches Ende.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
DIE ZWÖLF OCHSEN ...
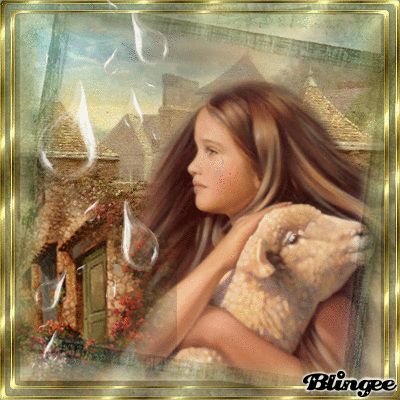
Es war einmal ein Vater, der zwölf Söhne hatte, schon erwachsen, so daß sie nicht mehr im Hause waren, sondern auf Arbeit gingen und für sich wohnten. Nun bekam der Vater noch eine Tochter, was sie so verdroß, daß sie nicht mehr zum Vater zurück kehren wollten und in einen Wald gingen, um als Tischler zu leben.
Jenes Mädchen war schon vierzehn oder fünfzehn Jahre alt und kannte die Brüder, war aber nie mit ihnen gegangen. Einmal ging sie, sich in einer Quelle zu waschen, und nahm erst ihr Korallenhalsband ab, damit es ihr nicht ins Wasser fiel. Ein Rabe, der vorüber flog, nahm es und trug es davon, sie hinter ihm her und kam in den Wald, wo ihre Brüder waren.
Der Rabe flog, um sich zu verbergen, in eine Hütte, wo sie wohnten, und sie trat ein, da niemand drinnen war, aber aus Furcht, daß sie sie dann mißhandeln möchten, kroch sie unter das Bett.
Als die Brüder nach Hause kamen, frühstückten sie und gingen wieder fort, ohne sie zu sehen. Abends bereitete sie die Nudeln und versteckte sich dann wieder. Die Brüder aßen, schöpften aber Verdacht, es möchte eine Hexe gewesen sein, die diesen Scherz verübt hätte. Einer von ihnen blieb daher zu Hause und sah die Schwester unter dem Bett hervor kommen.
Er erkannte sie, verzieh ihr, daß sie sich so versteckt hatte, und sagte ihr, er werde es der Mutter sagen lassen, daß sie bei den Brüdern sei. Dann warnte er sie, nicht in ein benachbartes Haus zu gehen, um Feuer zu holen, denn da wohnten die Hexen.
Vierzehn Tage vergingen, ohne daß sie hin ging. Einmal aber ließ sie den Abend heran kommen und hatte das Abendbrot noch nicht gerüstet. Um es rasch noch fertig zu bringen, wollte sie Feuer in dem Hexenhaus holen und fand dort eine Alte, die es ihr gab. Die Alte aber sagte ihr, daß auch sie einen Gefallen von ihr erbitte, nämlich sich am anderen Tage ein bißchen an ihrem kleinen Finger von ihr saugen lassen.
Und um ihr zu zeigen, wie sie es machen solle, schloß sie die Tür, ließ sie den Finger durchs Schlüsselloch stecken und saugte soviel Blut heraus, daß das arme Mädchen fast in Ohnmacht fiel. Dann sagte ihr die Hexe, morgen wolle sie das selbe tun.
Ihre Brüder aßen zu Nacht wie gewöhnlich, als sie aber das Mädchen ansahen, fanden sie, daß sie etwas haben müsse, und fragten sie so lange, bis sie alles erzählte und sagte, morgen werde die Hexe kommen und ihr den Finger aussaugen.
Ihr ältester Bruder aber erwartete den Morgen, und als die Hexe kam, öffnete ihr die Schwester nicht, da steckte die Hexe den Kopf durch ein Fensterchen, der Bruder aber schnitt ihn mit einer Säge ab und warf dann Kopf und Leib der Hexe in eine Schlucht.
Nun geschah es einmal, daß das Mädchen nach Wasser ging zu einer Quelle, und fand dort eine Alte, die wollte ihr weiße Schüsseln verkaufen, sie aber wollte nichts davon hören, da sie kein Geld hatte. Die Alte aber ließ ihr keine Ruhe, bis sie eine davon als Geschenk annahm und nach Hause trug.
Die Brüder kamen heim, müde von ihrer Arbeit, und hatten Durst. Kaum aber tranken sie aus jener Schüssel, so wurden sie in Ochsen verwandelt, bis auf einen, der ein Lamm wurde, da er nur wenig getrunken hatte. Stellt euch den Schmerz der Schwester vor und auch die Furcht, in jener Wüste allein zu bleiben und für die zwölf Tiere sorgen zu müssen!
Zum Glück verirrte sich ein Sohn des Fürsten auf der Jagd in diesem Wald, und da er zu der Hütte kam, bat er um Unterkunft. Das junge Mädchen wollte ihn nicht aufnehmen, er bat aber so lange, bis sie es doch tat, und da er ihre Schönheit sah, wollte er sie heiraten, sie antwortete aber, sie könne ihre Brüder nicht verlassen und müsse für sie sorgen.
Er erwiderte, er nehme alles auf sich, und heiratete wirklich das Mädchen und machte sie zur Prinzessin, die Brüder aber brachte er in einen Stall von Marmor mit schönen Krippen, und sie wurden wie Menschen behandelt.
Jene Hexe aber, die von dem ältesten Bruder der Prinzessin getötet worden war, war wieder aufgewacht und hatte geschworen, sich zu rächen, und fing an zu versuchen, ob sie sich nicht an die Stelle der Prinzessin setzen könnte.
In Gestalt eines alten Weibchens ging sie in den Garten, wo jene unter einer Laube saß mit dem Lämmchen, das ihr Bruder war. Sie bittet die Prinzessin um eine Weintraube und das gute Wesen geht, sie ihr zu holen, war aber an den Rand einer Zisterne gekommen, und die Hexe machte, daß sie hinein fiel.
Die Ärmste weinte drunten, aber niemand hörte sie, außer dem Lämmchen, das immer meckernd herum lief. Die Hexe aber nahm die Gestalt der Prinzessin an und legte sich in ihr Bett.
Als der Prinz nach Hause kam, fragte er sie: »Was hast du?« - »Ich bin auf den Tod krank und muß ein Stück vom Fleisch dieses Lammes essen, das ich meckern höre, sonst sterbe ich!« - Er antwortet: »Dann lügst du. Du sagtest mir, das Lämmchen sei dein Bruder und dann ist es nicht wahr.« -
Die Hexe hatte einen Bock geschossen und nun gab es keinen Ausweg. Sie wußte also nichts zu sagen. Der Prinz aber merkte Unrat. Er geht in den Garten und hinter dem Lamm her, es zu fangen. In dessen nähert er sich der Zisterne und hört seine Frau. -
»Warst du denn nicht im Bett eben jetzt?« - »Nein. Seit dem Abend bin ich hier, und niemand hat mich gehört.« - Da läßt er sie sofort aus der Zisterne heraus heben, und die Hexe, die ihre Gestalt angenommen hatte, wurde gleich ergriffen und verbrannt.
Und so wie das Feuer Hand oder Bein der Hexe verbrannte, wurden die Ochsen wieder Menschen und alle heil und stark und es schien im Palast eine Kompagnie von Riesen eingezogen zu sein. Alle wurden Fürsten, Herren von eben so viel Staaten. Ich aber bin ein armer Teufel geblieben!
Monferrato
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
ES WAR EINMAL ...

Es war einmal ein Bauer, der hatte drei Söhne, an Gütern aber nichts als einen Esel mit Sattel und Gurt. Als es nun mit ihm zu Ende ging, rief er die Söhne, machte das Testament und sprach: »Dem Ältesten lass ich den Esel, dem Zweiten den Sattel, dem Jüngsten aber den Gurt.« So starb er.
Der Älteste wußte mit dem Esel nichts anzufangen und zog aus, ihn zu verkaufen. Er kommt an dem Hause eines reichen Kaufmanns vorbei, der schaut eben zum Fenster heraus, sieht den Bauer mit dem Esel, ruft ihn an und spricht: »Heda, guter Freund, hast du wohl Lust, den Esel zu verkaufen?«
Der Bauer antwortet: »Warum nicht, mein Herr!« Sagt der Kaufmann: »So höre, wie wir den Handel machen wollen. Ich setze alle meine Güter gegen deinen Esel. Kannst du mir nun ein Märchen erzählen, ohne zu beginnen: 'Es war einmal ...', so bekommst du die Waren und wirst ein reicher Mann.
Sagst du aber: 'Es war einmal ...', so verlierst du den Esel und scherst dich zum Teufel!« Der Bauer glaubte gewonnenes Spiel zu haben und schlug ein, und als ihn der Kaufmann noch fragte, wie viel Zeit er wolle, sich das Märchen zu überlegen, antwortete er: »Drei Tage.«
Die drei Tage waren um, der Kaufmann trat zu ihm und sprach: »Nun erzähle dein Märchen!« Der Bauer sprach: »Ich bin bereit«, und hub an: »Es war einmal ...« »Halt!« fiel ihm der Kaufmann ins Wort, »du hast den Handel verloren. Es war ausgemacht, ein Märchen zu erzählen ohne die Worte 'Es war einmal'.«
Der Bauer war ganz verblüfft und sagte: »Wohl, ich habe verloren.« Er ließ dem Herrn den Esel und ging seiner Wege. Als er nach Hause zu seinen Brüdern kam, erzählte er ihnen also gleich, wie es ihm ergangen. »Ich zog«, sprach er, »in die Stadt, den Esel zu verkaufen. Da schaute ein Kaufmann zum Fenster heraus, der fragte mich, ob ich den Esel los schlagen wolle. Wir wetteten, ich verlor, und er hat nun das Tier.«
Die Erzählung ging dem Besitzer des Sattels zu Herzen, es kam ihm die Lust, sein Glück zu versuchen, und er ging in die Stadt. Hier traf er den Kaufmann und bot ihm den Sattel zum Verkauf an. Sie schlossen den gleichen Pakt und er verlor gleicherweise.
Jetzt macht sich der Jüngste mit dem Gurte auf den Weg und findet den Kaufmann, der auch also bald bereit ist, alle seine Güter gegen den Gurt zu setzen, so er ihm ein Märchen erzähle ohne die Worte »Es war einmal«.
Der Knabe geht darauf ein, und der Kaufmann fragt nur noch: »Wie viel Zeit verlangst du?« Darauf der Knabe: »Vierundzwanzig Stunden.« Die vierundzwanzig Stunden waren um, der Kaufmann läßt ihn rufen und sagt: »Bist du bereit, so erzähle dein Märchen.«
Da hub der Bauer an und erzählte:
Meine Mutter hat eine Glucke gehegt,
Die hat zwei Eier ins Nest gelegt.
Sie brütet, und brütet 'nen jungen Hahn,
Der fängt gar lustig zu krähen an:
»Scher' dich zum Teufel, du Kaufherrlein,
Deine Schätze, die sind jetzt mein!«
So hatte er es glücklich fertig gebracht, ohne zu sagen: »Es war einmal.« Die Wette war gewonnen, und der Kaufmann mußte ihm alle seine Güter herausgeben.
So lebt er glücklich und zufrieden,
Uns aber, uns ist nichts beschieden.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
DIE PRINZESSIN IM SARG UND DIE SCHILDWACHE ...
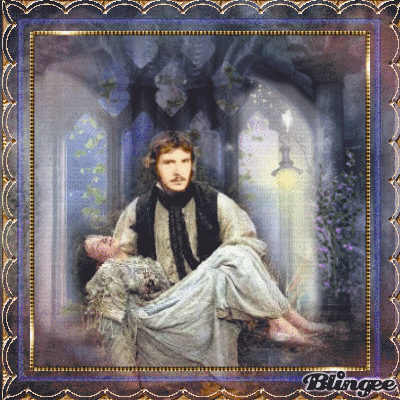
Einmal lebte ein mächtiger Fürst, der eine schöne und brave Frau, aber keine Kinder hatte. »Wenn meine Frau nur einmal gebären würde«, rief er einst in der Sehnsucht nach einem Erben, »und sollte das Kind vom Teufel sein, mir wäre es auch recht.«
Da beherbergte er einstens einen angesehenen Fremden in seiner Burg, und im Gespräch mit ihm kam er unter anderem auch auf seinen Wunsch zu sprechen. »Wisst ihr was,« sagte dieser, »versprecht ihr mir ein Kind zu geben, so verspreche ich euch auch, dass ihr binnen einem Jahre deren zwei besitzen sollt.«
Der Fürst versprach dieses natürlich gerne und der Fremde hielt gewissenhaft Wort, denn gerade ein Jahr nach seiner Abreise gebar die Fürstin Zwillinge, einen Knaben und ein Mädchen, die kerngesund und außerordentlich schön waren.
Da erscheint nach einem Jahre der Fremde und fragt den Fürsten, welches der beiden Kinder er ihm geben wolle. Dieser aber entschuldigte sich damit, dass er den Knaben als Nachfolger brauche und der Mutter müsse man doch auch eine Freude lassen, er möge sie ihm daher noch alle beide lassen. »Es sei«, sagte der Fremde, »Ich werde also nach fünf Jahren kommen.«
So erschien er nach fünf Jahren wieder, aber der Fürst, der beide Kinder unendlich liebte, schlug es ihm rund ab, eines davon her zu geben. Da brach der Fremde in so grässliche Drohungen aus, dass der Fürst heftig darüber erschrak und sich endlich herbei ließ, ihm das Mädchen zu geben, wenn es sechzehn Jahre alt sein würde. Hierauf aber befiel den Fürsten eine ungeheure Angst und Schmerz und er weinte oft, denn er merkte, mit wem er es zu tun hatte.
Unterdessen war der Knabe nicht bloß grösser, sondern auch vernünftiger geworden. Die fortwährende Traurigkeit seines Vaters betrübte ihn sehr, oft fragte er ihn Teil nehmend um die Ursache der selben, erhielt aber nie eine vollkommen befriedigende Antwort auf seine Fragen.
Da erzählte es der Knabe einst seinem Lehrer, einem frommen Geistlichen, und dieser ging selbst den Fürsten um die Ursache seines Leides an. »Wohlan denn, frommer Vater! wisst, dass ich Unglücklicher meine Tochter dem Teufel versprochen habe.«
»Da habt ihr freilich sehr übel getan«, sagte der Priester, »aber gebt mir Tag und Stunde an, wenn er kommt, sie zu holen, und dann werde ich auch dabei sein; das wäre nicht übel, wenn ein tadelloser Priester wie ich nicht mit dem Höllengeist fertig werden könnte.«
Richtig kam zur bestimmten Stunde der Teufel, ging aber nicht in das Zimmer der Prinzessin, weil er den Geistlichen im vollen Ornat und mit dem Allerheiligsten bei ihr sah, sondern blieb an der Türe stehen.
»Was willst du, Höllengeist?«, rief ihn der Priester an.
»Das Mädchen, das mir versprochen ist«, antwortete der Teufel.
»So ein Versprechen ist zu gottlos, ist nicht gültig, auch hat sie nie eingewilligt.«
»Wollt ihr mir sie nicht geben, so werde ich mir die Princecs selbst holen.«
»Auch das wirst du nicht, ich werde es zu hindern wissen, und jetzt entfliehe.«
»Was? so ein elender Pfaff will mich hindern?«
»Ja, ich fühle mich stark genug dazu durch meine Pflicht und heilige Weihe.«
»O!« sagte der Teufel, »ich gehe jetzt, weil ich weiss warum, aber siehe einmal zu, wie ich mit der Zeit deine Schutzbefohlene zurichten werde.«
Zwei Jahre waren vergangen und der alte Lehrer war gestorben, da wurde des Fürsten Tochter schwer krank und starb. Vor ihrem Tode noch bat sie ihren Vater, er möchte sie nicht gleich begraben, sondern acht Tage in der Kirche aussetzen und bewachen lassen, was auch wirklich geschah; denn als sie in der Kirche auf einem prachtvollen Trauergerüst aufgebahrt war, wurde eine Schildwache dazu gestellt.
Da erhob sich um Mitternacht die Prinzessin aus dem Sarg. »Wo ist mein schändlicher Vater?« rief sie mit fürchterlicher Stimme, packte die Schildwache und zerriss sie in Stücke. Am anderen Morgen fand man die Kirche offen, die Prinzessin im Sarg, aber von der Schildwache bloß die einzelnen Stücke.
Da verbreitete sich unendlicher Schrecken in der ganzen Besatzung, niemand wollte mehr Wache stehen und man musste sich endlich entschließen, mittelst Kugelung denjenigen auszumitteln, der diesen gefährlichen Posten zu beziehen hatte.
Zufälligerweise traf das Loos den Diener eines Hauptmanns, der sich einem Marienbilde verlobt hatte, zu dem er täglich Abends beten ging. Als er den ganzen Tag hindurch über sein trauriges Schicksal geweint und sich von Kameraden und Verwandten beurlaubt hatte, nahm er gegen Ave Maria seine Waffen und ging, bevor er seinen Posten in der Kirche bezog, noch früher zu dem Marienbilde, seine Andacht zu verrichten.
Nachdem er lange und innig gebetet hatte, machte er sich auf den Weg zur Kirche. Da traf er unterwegs ein altes Weib, die ihn um seine Traurigkeit befragte und der er seinen gefährlichen Auftrag erzählte. »Gehe getrost, mein Sohn!« sagte die Alte, »dir wird gar nichts geschehen. Gehe nur vor den Altar der Madonna, schließe das Gitter hinter dir zu und niemand wird dir etwas anhaben können.«
Und so tat er, als er in die Kirche kam. Da erhebt sich um Mitternacht die Tote wieder aus dem Sarg. »Vierundzwanzig Stunden ist es, dass ich nicht Menschenblut getrunken habe. Wo ist mein schändlicher Vater, dass ich ihn zerreiße für das niederträchtige Versprechen, das er gegeben hat.« Rings wütete sie in der Kirche herum, wie eine Löwin, aber sie fand die Wache nicht und legte sich endlich wieder in den Sarg.
Am anderen Morgen fand man die Schildwache zwar lebend, aber auch an allen Gliedern bebend von der ausgestandenen Todesangst. Da liess ihn der Fürst zu sich berufen und liess sich alles erzählen, was er gesehen und gehört. »Du bist die wahre Wache«, sagte der Fürst, »tue mir doch den Gefallen und stehe heute Nacht wieder Wache.«
Der Bursche fand dieses fürstliche Zutrauen zwar sehr ehrenvoll, aber doch bedurfte es langen zu redens, bis er sich dazu herbei ließ, nochmals das Wagnis zu bestehen.
Abends ging er wieder zu seinem Marienbilde, dankte für den genossenen Schutz und betete, es möge ihn auch heute wieder in seine mächtige Hut nehmen. Da trifft er beim weg Gehen wieder eine andere Alte, die ihn Teil nehmend befragt, wohin er gehe und der er wieder seinen Auftrag erzählt.
Auch diese tröstete ihn und sagte: »Sei ganz unbesorgt, mein Kind! setze dich nur in den Beichtstuhl und es wird dir gar nichts geschehen.« Da setzte er sich in den Beichtstuhl und erwartete nicht ohne große Angst die Mitternachtsstunde. Als diese geschlagen, begann der nämliche Auftritt wie in der verflossenen Nacht, nur noch fürchterlicher. Aber auch diesmal blieb er unentdeckt von der Prinzessin und kam mit der bloßen Angst davon.
Da stellte der Fürst an ihn die Bitte, auch die dritte Nacht bei der Prinzessin zu wachen. »Herr!« sprach der arme, beängstigte Diener, »zweimal bin ich dem schrecklichsten Tode bloß durch den Beistand der Madonna und zweier alter Mütterchen entgangen, ihr wisst, der Mensch soll auf Gottes Barmherzigkeit nicht freventlich vertrauen, andererseits habt ihr so viele tapfere Offiziere und Hofkavaliere ...«
Aber der Fürst ließ ihn nicht ausreden, sondern versprach so viel, bat so schön und stellte ihm vor, wie er eine arme Seele aus den Klauen der Hölle reißen könne, dass er sich wirklich nochmals dazu bereden ließ.
Als es Abend wurde, wurde ihm doch sehr bange und er kehrte wieder zu seinem Marienbilde und flehte so heiß zur Mutter des Heilandes, damit sie ihm wieder ihren Beistand leiste und guten Rat sende.
Dieses Mal kam keine Alte, sondern eine stattliche Dame, die ihn befragte, und als er ihr seine bisherigen Erlebnisse und neuen Befürchtungen erzählt hatte, sagte sie mit freundlicher Miene zu ihm: »Dir wird nichts geschehen, komm getrost mit mir zur Kirche.«
Als sie dort angelangt waren, sprach sie: »Setze dich hier nieder am Altar, nimm dieses Fläschchen mit Wohlgeruch in die linke Hand, öffne den Tabernakel und nimm die Monstranz in die rechte und erwarte so, was da kommen wird. Die Prinzessin wird sich wieder erheben und zwar schrecklicher als je, denn heute ist der Tag der Entscheidung für ihre arme Seele.
Mit ihr werden vier Männer kommen, und die werden sich aufstellen in der Kirche, zwei links und zwei rechts, und sich ihren Körper zuwerfen, wie einen Spielball. Nach einer Stunde werden sie auf die Stufen zum Altar einen Teppich breiten, den Körper der Prinzessin darauf legen und sie mit einem großen Schwert in Stücke zerschneiden wollen; dann fasse Mut und wirf ihnen die Monstranz entgegen.«
Nachdem die Dame so gesprochen, entfernte sie sich mit würdevollem Schritte, er aber harrte in großer Angst der Mitternachtsstunde. Als diese vom Turme herab klang, erhob sich auch die Prinzessin aus dem Sarg, grässlicher als je, denn Feuer sprühte sie aus Augen und Munde. Ärger als je fluchte sie ihrem Vater und suchte nach einem Opfer ihrer Wut.
Da wurde sie auf einmal von den vier Männern gepackt, erbarmungslos herum geschleudert und endlich auf den Teppich gelegt. Schon war das große Schwert gezogen, schon hatte einer der Männer es zum Hiebe erhoben, als sich auch unser Held ermannte und ihnen das Hochwürdige entgegen warf. Da war plötzlich alles entschwunden, bloß zu seinen Füssen lag, dem Tode nahe, die ächzende Prinzessin.
Er legte nun den Teppich mehrfach zusammen, bettete sie darauf und labte sie mit dem Riechfläschchen der Dame, worauf sie in einen tiefen Schlaf verfiel; er aber, erschöpft von den ausgestandenen Gemütsbewegungen und der dreimaligen Wache, legte sich daneben und schlief nicht minder fest ein.
Am nächsten Morgen kam der Fürst selbst mit seinem Sohne in die Kirche nachzusehen, und als er beide fest schlafend fand, ließ er sie sanft aufheben und auf einem vierspännigen Wagen in sein Schloss führen, wo jedes in ein eigenes Zimmer gelegt noch lange fort schlief.
Kaum war die Prinzessin erwacht, so rief sie nach ihrem Vater und Bruder, und diese, die am Fusse ihres Bettes schon lange und sehnsüchtig auf ihr Erwachen gewartet hatten, eilten in ihre Arme. »Ach!« rief sie, »wie froh bin ich, dass ich euch nach so langen und fürchterlichen Leiden wieder umarmen kann.«
Als die erste Freude des Wiedersehens vorüber war, fragte sie nach ihrem Retter, und als man ihr meldete, dass er im Nebenzimmer ruhe, sagte sie: »Bringt ihn zu mir, denn der mir allein bei gestanden, der die Schrecknisse und Gefahren dieser Nächte mit mir geteilt und mich gerettet hat, der soll auch künftig mein Bett mit mir teilen.«
Am nämlichen Tage noch feierten sie ihre Hochzeit und lebten miteinander glücklich ein langes, gesegnetes Leben. Das Marienbild aber wurde zum Andenken feierlichst auf dem Altar ihrer Schlosskapelle aufgestellt.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
GEWONNEN ...

Es lebte einmal eine Alte, welche eine schöne Enkelin hatte. Sie waren so arm, daß sie nur von den Spenden guter Leute lebten, darum hieß auch das Mädchen Arm-Schönchen. Eines Tages kam ein Marktschreier ins Haus und zwar einer von denen, die die Leute glauben machen, daß sie die Zukunft prophezeien können, wo mit sie armen Frauen das Geld aus der Tasche locken. Er machte sich auch an Arm-Schönchen und überredete sie, sich von ihm weissagen zu lassen.
Das arme Mädchen hatte aber nichts, was sie ihm geben konnte, als die Decke vom Boden, und da der Marktschreier damit zufrieden war, reichte sie ihm ihre Hand dar. Er machte das Kreuz hinein und sagte ihr, sie werde dereinst den Sohn des Königs zum Gemahl bekommen. Arm-Schönchen lachte der sonderbaren Weissagung, doch blieb sie ihr im Sinne haften und sie bewegte sie in ihrem Kopfe hin und her.
Das Haus des Mädchens stand aber nicht weit vom Schlosse des Königs, und an dem selben Tage, wo ihr die Weissagung geworden, schaute der Königssohn zum Fenster heraus, lachte und sprach:
Deine Decke, die hast du verloren,
Der Königssohn ist dir nicht erkoren.
Arm-Schönchen antwortete: »Wir wollen es abwarten.«
Dieser von oben und jener von unten,
Im Königssohn hab' ich den Bräut'gam gefunden.
Ich hoffe zu Gott im Himmel droben,
Zur Königin werd' ich noch erhoben.
Ich hoffe auf Gott zu allen Zeiten,
Der Königssohn wird mir einst wandeln zur Seiten.
Der Königssohn lachte zwar, aber ein Funke war ihm ins Blut gefallen und der wollte nicht auslöschen.
Wie die Alte nach Hause kam und die Decke nicht mehr vor fand, raufte sie sich die Haare und schrie gar jämmerlich, so daß ihr der Königssohn, um sie zu beruhigen, eine von den seinen ins Haus tragen ließ.
Acht Tage vergingen, und der Königssohn dachte an weiter nichts, als Arm-Schönchen zu necken, in dem er ihr jeden Tag das selbe Verschen vorsagte. Dabei war aber jenes Fünkchen in seinem Herzen ein Feuer geworden, das hoch empor lohte und nicht mehr zu löschen war. Da kam seine Mutter, welche die Geschichte mit angehört hatte, auf den Gedanken, ihn zu verheiraten, denn die Neckerei mit Arm-Schönchen mußte ein Ende nehmen.
Sie sprach mit dem Sohne, und der Sohn versprach, ihr zu Willen zu sein, so sie ihm ein Mädchen brächte, das Arm-Schönchen gliche. Da war nun freilich guter Rat teuer, dennoch meinte sie einen Ausweg finden zu können. Sie besprach die Heirat mit einer Königstochter und ließ diese zu sich ins Schloß kommen.
Darauf berief sie die Alte und sagte ihr, sie wolle Arm-Schönchen haben, um sie mit dem Königssohn zu vermählen an Stelle der wahren Braut, wenn auch nur auf eine Stunde, weil er eine Braut gewollt, die dem armen Mädchen völlig gleiche. Die Alte teilte der Enkelin das Spiel mit, und die war bereit hin zu gehen.
Prächtig gekleidet stellte sie sich am nächsten Abend dem Königssohne vor, der sie für die Prinzessin hielt und, weil sie das gewünschte Gesicht hatte, heiratete.
Arm-Schönchen machte aber keine Anstalten, sich in die Brautkammer zurück zu ziehen, sie kannte den Befehl der Herrscherin, sich bei passender Gelegenheit zu verstecken und die Königstochter hinein huschen zu lassen, welche die wahre Braut sein sollte.
Der Königssohn ahnte nichts von dem Betruge, erst wie er in die Brautkammer trat, merkte er, was geschehen war. Da schrie er so laut er konnte: »Verrat! Verrat!« Die Dienerschaft kam herbei gelaufen, Arm- Schönchen wurde aus ihrem Versteck gezogen, und die Königin-Mutter hatte das Spiel verloren. Sie machte aber eine gute Miene dazu, gab ihnen ihren Segen, und so wurde der Spruch Arm-Schönchen's wahr:
Ich hoffe auf Gott zu allen Zeiten,
Der Königssohn wird mir einst wandeln zur Seiten!
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
DIE SCHÖNE FIORITA ...

Es war einmal ein König, der hatte vier Kinder: drei Mädchen und einen Knaben, und das war sein Thronfolger. Eines Tages sagte der König zu seinem Sohne: »Mein lieber Sohn, ich will, daß deine Schwestern heiraten, und zwar sollen sie den ersten besten Mann nehmen, der um Mittag an unserem Schlosse vorüber gehen wird.«
Zu jener Stunde aber gingen vorüber: zu erst ein Schweinehirt, dann ein Jäger, zuletzt ein Totengräber. Alle drei ließ der König herein rufen und sagte dem Schweinehirten, daß er die älteste, dem Jäger, daß er die zweite, und dem dritten, dem Totengräber, daß er die jüngste Tochter heiraten müsse. Die guten Leute glaubten zu träumen; als sie aber merkten, wie es dem Könige wohl Ernst war, verbeugten sie sich und riefen, ganz betäubt von ihrem Glück: »Herr König, Euer Wille geschehe!«
Der Prinz wurde ganz traurig, denn er liebte die jüngste Schwester vor allen, und so jammerte es ihn, daß sie die Frau eines Totengräbers werden sollte. Er flehte den König an, sein Schwesterlein zu verschonen, dieser jedoch wollte von nichts wissen.
Aber die Hochzeit vermochte er nicht mit anzusehen, er stieg in den Garten hinab, um mit seiner Trauer allein zu sein, und siehe, in dem Augenblicke wo der Priester in der königlichen Kapelle die drei Paare segnete, fing der ganze Garten in den aller schönsten Blumen zu blühen an, und aus einer leichten Wolke kamen die Worte: »Beglückt, wer einen Kuß vom Munde der schönen Fiorita bekommt.«
Der Königssohn bebte am ganzen Leibe, so daß er sich kaum aufrecht erhalten konnte. Dann kam ihm aufs neue der Schmerz über die verlorenen Schwestern, er lehnte sein Haupt an einen Olivenbaum, weinte bitterlich und blieb lange Zeit in tiefe Gedanken versunken. Erst spät erwachte er aus seinem Traum und sprach: »Ich kann nicht länger bei meinem Vater bleiben. Ich will in die Welt hinaus und nicht eher Frieden haben, als bis ich den Kuß von den Lippen der schönen Fiorita bekommen habe.«
So wandert er dahin, wandert über Meer und Land, über Berge und Ebenen, doch fand er niemand, der ihm Kunde gäbe von der schönen Fiorita. So verflossen drei Jahre. Eines Tages, da er aus einem Walde trat, tat sich vor ihm eine schöne Aue auf. Auf der Aue steht ein Palast, vor dem Palast ein Brunnen, und er geht darauf los, seinen Durst zu löschen. Ein Kind von zwei Jahren, das in der Nähe des Brunnens spielt, sieht ihn, fängt zu weinen an und ruft die Mutter.
Die Mutter kommt, und kaum sieht sie den Jüngling, läuft sie ihm entgegen, umarmt und küßt ihn und schreit freudevoll: »Willkommen, mein Bruder! Willkommen! Kennst du deine Schwester nicht?« Er hatte sie anfangs nicht erkannt, wie er ihr aber näher ins Gesicht schaute, erkannte er sie wohl und rief: »Sei gegrüßt, o Schwester mein!«
Das war ein rechtes Fest. Sie führte ihn zu ihrem Manne, und auch der war erfreut, ihn zu sehen. Alle drei küßten voll Liebe das Kind, welches bewirkt hatte, daß der Jüngling nicht fremd an dem Hause vorüber gegangen war. Hierauf verlangte den Prinzen, zu wissen, was aus den anderen beiden Schwestern geworden, und er erfuhr, daß es ihnen wohl gehe und sie mit ihren Gatten ein prächtiges Leben führten.
Der Prinz wunderte sich, der Schwager aber erzählte, daß das Glück bei ihnen eingekehrt sei, nachdem sie die Bezauberung eines Magiers erfahren. »Ist es möglich, meine beiden anderen Schwestern zu sehen?« fragte der Prinz. Der andere antwortete: »Am zweiten Tage, so du immer gegen Sonnenaufgang wanderst, findest du die zweite, am dritten dann die dritte.« -
»Aber ich muß den Weg finden, der mich zur schönen Fiorita führt, und wer sagt mir, ob der gegen Sonnenaufgang oder gegen Sonnenuntergang geht?« Der Schwager sagte: »Auch der geht gegen Sonnenaufgang, und doppelt glücklich wirst du sein, erst die Schwestern zu sehen und dann Kunde zu bekommen von der jüngsten über die schöne Fiorita.
Ehe du jedoch abreist, möchte ich dir ein Andenken geben. Nimm diese Schweinsborsten, sobald du in Gefahr bist und meinst, dich allein nicht retten zu können, wirf die Borsten auf den Boden und du rettest dich.« Der Prinz nahm die Borsten, dankte dem Schwager und machte sich auf den Weg gen Sonnenaufgang.
So kam er anderen Tages an den Palast der zweiten Schwester, auch hier war die Freude groß, und auch dieser Schwager gab ihm ein Andenken mit. Wie er denn ein Jäger war, schenkte er ihm ein Büschel Vogelfedern, ihn anweisend, wie er sie zu brauchen habe. Er dankte und ging weiter.
Am dritten Tage erreichte er die dritte Schwester. Sie empfing den Bruder, der sie immer mehr als die anderen geliebt hatte, noch freundlicher als jene, herzte und küßte ihn, und so auch ihr Mann. Der schenkte ihm am Ende ein Totenknöchlein, das er brauchen solle wie die anderen Gaben, und das Schwesterchen vertraute ihm, daß die schöne Fiorita nur eine Tagereise entfernt wohne und er die sicherste Kunde über sie von einer Alten haben könne, der sie, die Schwester, manche Wohltat erwiesen.
Zu dieser Alten schickte sie ihn zunächst. Als der Prinz den Ort erreichte, wo die schöne Fiorita, die auch eine Königstochter war, lebte, ging er stracks zu der Alten. Kaum wußte diese, daß er der Bruder jener war, die ihr so viel Gutes getan, empfing sie ihn wie ihren eigenen Sohn.
Zum Glück stand das Haus der Alten dem königlichen Schlosse gegenüber und sah gerade auf das Fenster, an dem sich die Schöne jeden Tag bei Sonnenaufgang zeigte. Wirklich erschien sie anderen Tages in der Frühe am Fenster, kaum bedeckt von einem weißen Schleier.
Als der Prinz diese Blume von Schönheit sah, wurde er so bewegt, daß er beinahe umgefallen wäre, wenn ihn die Alte nicht gehalten hätte. Doch beredete ihn diese, den Gedanken, die schöne Fiorita heiraten zu wollen, aufzugeben, in dem sie sagte, der König wolle seine Tochter nur dem geben, der einen gewissen versteckten Ort errate, und den, der dies nicht könne, töte.
Sie erzählte auch, wie viele Prinzen auf diese Weise schon das Leben verloren hätten. Es war aber alles vergebens, er antwortete, er werde sterben, wenn die schöne Fiorita nicht sein würde. Da erfuhr er von der Alten, der König kaufe für seine Tochter die seltensten Musikinstrumente, und hierauf baute er seinen Plan.
Er ging zu einem Cimbalo-Fabrikanten und sagte: »Meister, ich möchte ein Cimbalo, das drei Stücke spielt, jedes Stück einen Tag lang, und macht mir es auf die Weise, daß sich ein Mensch drinnen verbergen kann. Ich bezahle dir tausend Dukaten dafür. Ist es fertig, so verberge ich mich darin, du gehst und läßt es vor dem Fenster des Königs spielen, kauft der es dann, so verkaufe es ihm unter dem Beding, daß du es jeden dritten Tag zum Stimmen abholen darfst.«
Dem Manne gefiel das Geschäft, er machte alles genau so, wie es der Prinz angeordnet hatte, ging mit dem Instrument vor den König, der kaufte es und nahm auch die Bedingung des Verkäufers an. Darauf ließ er es in das Schlafzimmer seiner Tochter tragen und sagte: »Sieh, mein Kind, dir soll es an keinem Vergnügen fehlen, nicht einmal, wenn du auf dem Bett liegst, ohne schlafen zu können.«
Neben der Schlafkammer der schönen Fiorita schliefen ihre Kammerfrauen. Als alle schliefen, kommt der Prinz aus dem Cimbal hervor, denn er hatte sich wirklich darin verborgen, und ruft leise: »Fiorita, schöne Fiorita.« Voll Schrecken erwacht sie, ruft ihre Frauen: »Kommt schnell herbei, es hat mich hier jemand gerufen.«
Die Frauen laufen eilend herbei, finden aber niemand, denn schon war der Prinz in sein Versteck zurück gekehrt. Noch zweimal wiederholte sich das selbe, die Frauen kommen, finden niemand, und endlich sagt die Prinzessin: »Es mag wohl ein Traum sein. Sollte ich wieder rufen, so bleibt, wo ihr seid, ich befehle es euch.«
Diese Worte hörte auch der Prinz, und kaum waren die Zofen fort und wieder eingeschlafen, näherte er sich dem Lager der Schönen und rief: »Schöne Fiorita, gib mir einen Kuß von deinem Munde, sonst sterbe ich.« Erschrocken und zitternd am ganzen Leibe rief sie nach den Zofen, die aber dachten an ihren Befehl und kamen nicht.
Und sie sagte zum Prinzen: »Du bist der Glückliche und hast gesiegt. Komm her!« Und sie gab ihm den Kuß, und auf den Lippen des Prinzen blieb eine wunderschöne Rose zurück. »Nimm diese Rose«, sagte sie, »trage sie auf dem Herzen, sie wird dir Glück bringen.«
Das tat der Prinz und erzählte seiner Schönen seine Geschichte von dem Tage an, da er das väterliche Haus verlassen, bis auf die List, die ihn in ihre Kammer gebracht hatte. Die schöne Fiorita freute sich seiner Kühnheit und sagte ihm, daß sie ihn wohl zu ihrem Gemahl wolle, er aber, ehe dies sein könne, viele Schwierigkeiten zu überwinden habe, die ihm der König, ihr Vater, in den Weg legen werde.
Da sei zuerst der Ort aufzufinden, wohin der König sie zusammen mit hundert anderen Jungfräulein verstecke, alle in gleicher Weise gekleidet und verschleiert. »Ob dieser Aufgabe«, sagte sie, »mache dir jedoch keinen Kummer: die Rose, die du mir von den Lippen genommen und die du deshalb immer auf dem Herzen tragen mußt, wird dich mit Kraft des Magnets erst nach dem Versteck und dann in meine Arme führen. Der schwierigere Teil ist dir aufbehalten, doch da mußt du selbst zusehen, wie du dich heraus ziehst. Da walte unser gutes Glück!«
Sogleich ging nun der Prinz zum König und bat ihn um die Hand seiner Tochter. Er sagte sie ihm zu, wenn er seine Aufgaben vollbringe. Die Rose half ihm gar leicht über die erste hinweg: er fand die schöne Fiorita unter hundert Jungfräulein heraus.
Damit war aber dem Könige nicht Genüge getan. Er ließ den Jüngling in ein großes weites Gewölbe einschließen, das war voll Früchte, diese Früchte solle er in einem einzigen Tage essen, oder er werde den Kopf verlieren. Da fiel dem Jünglinge der Mut, zum Glück erinnerte er sich an die Schweinsborsten und an den Rat, den ihm der Schwager gegeben hatte.
Er warf die Borsten auf die Erde, und siehe, da kamen eine Menge Schweine herbei, immer mehr und immer mehr, die fraßen die Früchte bis auf den letzten Stiel auf und verschwanden. So war auch das getan. Schon aber kam der König mit einer neuen Aufgabe hervor.
Er verlangte, daß der Prinz die Prinzessin durch den aller süßesten Gesang der aller schönsten Vögel der Welt in den Schlummer singen ließe. Da gedachte der Prinz der Federn, die ihm der Schwager Jäger gegeben, und wirft sie auf den Boden. Siehe, da flattern herbei die aller schönsten Vögel und fangen einen Gesang an so lieblich, daß auch der König in Schlaf fällt.
Ein Diener jedoch, dem er vorher Befehl gegeben, mußte ihn sogleich wieder wecken, und nun sagte er zu dem Brautpaar: »Jetzt gehört ihr euch ganz in eurer Liebe; morgen früh aber will ich ein Kind von zwei Jahren bei euch finden, welches sprechen und euch bei Namen nennen kann, sonst müßt ihr doch noch sterben.«
Der Prinz und die Prinzessin gingen voll Trauer hinweg, doch tröstete sie der Prinz und sprach: »Laß uns zur Ruhe gehen, wer weiß, ob bis morgen nicht eine Hilfe erscheint!« In der Frühe erinnert er sich des Totenknöchleins, das ihm der Totengräber geschenkt hatte.
Er warf es vom Bett aus auf den Boden, und siehe, ein wunderschöner Knabe erschien, der hatte einen Goldapfel in der rechten Hand und rief sie: »Vater und Mutter!« Der König tritt in die Kammer, der Knabe geht ihm entgegen und legt ihm den Goldapfel in die Krone, die der König auf dem Kopfe hatte.
Da küßte der König das Kind, segnete die Brautleute, und in dem er die Krone abnahm, um sie dem Schwiegersohn aufzusetzen, sagte er: »Die ist jetzt dein!«
Nun bereitete man große Feste am Hofe für die Hochzeit, dazu wurden die drei Schwestern mit ihren Männern auch geladen.
Und auch der Vater des Prinzen, der seinen Sohn schon längst verloren glaubte, eilte, als er diese frohe Kunde erhielt, herbei, um ihn zu umarmen und ihm seine Krone zu schenken. So wurden der Prinz und die schöne Fiorita König und Königin über zwei mächtige Reiche und lebten von da an glücklich und zufrieden.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
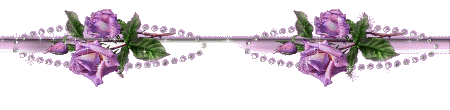
MEINE DREI SCHÖNEN KRONEN ...

Es war einmal eine Wäscherin, die hatte eine Tochter. Als die Wäscherin eines Tages unterwegs war, erwischte sie ein Unwetter, so daß sie krank nach Hause kam. Es blieb ihr wenig Zeit, sie gab der Tochter einen Laib Brot und eine Flasche Öl und sprach: »Nimm dies Brot und dies Öl, daß du mir nicht Hunger leidest, ich gehe ins Krankenhaus.«
Darauf schloß sie die Haustür ab und steckte den Schlüssel in die Tasche. Im Krankenhaus ging es schlimm, sie bekam das Fieber und verlangte den Beichtiger. Nachdem sie gebeichtet, übergab sie ihm den Schlüssel und sprach: »Frommer Vater, ich muß in Verzweiflung von hinnen gehen, denn ich habe eine Tochter, der ich auch gar nichts hinterlassen kann.«
Der Beichtiger tröstete sie und sagte: »Verzage nicht, liebe Tochter, für dein Kind werde ich sorgen. Gern will ich sie in mein Haus aufnehmen, wo ihr meine Mutter und Schwester zur Seite stehen werden.« So starb die Frau. Der Priester hatte den Schlüssel in der Tasche, aber an das Mädchen dachte er nicht mehr. Es kam der Samstag, wo seine Mutter ihm die Taschen zu wechseln pflegte, da fand sie den Schlüssel.
»Mein Sohn, was für ein Schlüssel ist das?« Der rief: »O, wie konnte ich das vergessen!« - und eilt, dem Mädchen zu öffnen. Wie er den Schlüssel in die Pforte steckt, ruft das Mädchen von drinnen: »Mutter, bist du es?« Da tritt der Priester ein: »Still, meine Tochter, deine Mutter ist in meinem Hause.«
Und er führte sie fort. Kaum betritt sie des Priesters Haus, ruft sie auch wieder: »Mutter, Mutter!« - aber die Mutter war nicht da. Zuletzt mußten sie ihr es denn sagen: ihre Mutter sei im Paradiese. Von der Zeit an fand sie keine Ruhe mehr im Hause, und eines Tages war sie verschwunden.
Sie irrt durch das Land, hier hin und dort hin, und sieht endlich einen großen Palast, schwarz von oben bis unten. Sie tritt ein und durchwandert die weiten Räume. Sie kommt an die Küche: da liegen viele gute Dinge ungekocht herum; sie betritt die anderen Zimmer: da fehlt die ordnende Hand schon lange.
Behend nimmt sie einen Besen und fegt die Korridore, dann säubert sie die Kammern, putzt die Leuchter, ordnet die Betten, räumt das Weißzeug ein, scheuert und stäubt, so daß der Palast gar bald in frischer Schöne glänzt. Dann geht sie in die Küche, nimmt ein Hühnlein und bereitet etwas Brühe, zündet die Kerzen an und zieht sich zurück.
Da, um Mitternacht, hört sie eine Stimme, die klagt: »O, meine drei schönen Kronen! O, meine drei schönen Kronen!« ... Und diese Stimme kam dem Palast immer näher. Dann trat eine schwarze Frau ein, die schaut sich verwundert um und spricht: »O, wie gut! wie schön! Woher kommt diese Schöne? Heran, mein Sohn! Heran, meine Tochter. Bist du ein Mann, so wirst du mein Sohn sein, bist du ein Weib, so lohne dir es Gott!«
Als das Mädchen das hört, kriecht sie hervor und wirft sich ihr zu Füßen. Da ruft die Frau: »O, meine Tochter, Gott lohne dir diese Liebe, die du mir dar bringst. Sieh, des Morgens gehe ich aus, meine drei schönen Kronen zu suchen. Sei du also die Herrin. Du findest die Schlüssel an den Türen stecken, schalte und walte, wie es dir gut däucht.«
Eines Tages, wie das Mädchen allein war, durchlief sie den ganzen weiten Palast. Sie kam an eine kleine Tür, öffnete sie und erblickte drei schöne Jünglinge, die lagen da mit offenen Augen, aber starr und stumm. Schnell schließt sie wieder ab und denkt bei sich: Ob dies nicht die drei Söhne dieser Frau sind?
Am Abend dann kam die Frau zurück und jammerte wieder und rief: »O, meine drei schönen Kronen!« Wie sie aber durch die Zimmer schritt, sagte sie: »Tochter mein, Gott lohne dir die Liebe, die du mir dar bringst.«
Wie das Mädchen eines Tages von den Fenstern herab in den Garten schaute, sah sie eine Eidechse mit drei kleinen Eidechsen. Augenblicks aber schießt eine andere hervor und tötet die drei kleinen. Die Eidechsenmutter, kaum daß sie die toten Kinder sieht, dreht und wendet sich, kriecht da hin und dort hin, zuletzt beißt sie ein gewisses Kraut ab, eilt zu den Kleinen zurück und fängt an sie mit dem Kraute zu reiben, eins nach dem anderen, und alle drei werden wieder lebendig.
Wie der Blitz wirft das Mädchen einen Stein nach der Eidechse, so daß diese das Kraut fallen ließ, läuft in den Garten, nimmt es und pflückt dann einen Korb voll davon. Nun erschließt sie die kleine Tür, wo die Jünglinge lagen, reibt den ersten mit dem Kraut ein, reibt und reibt, bis er wieder zu sich kam. Kaum schlug er die Augen auf, sagte er: »Lieb Schwesterchen, wie danke ich dir, du hast mir das Leben wieder gegeben.«
Sie aber geht zur Küche, tötet ein Hähnchen, bereitet etwas Brühe und flößt sie dem Erwachten ein. Darauf macht sie ihm ein Bettchen, bettet ihn fein und geht zu den anderen beiden Brüdern. Auch diese geben bald Lebenszeichen von sich, auch sie bekommen die Brühe und das Bettchen und legen sich nieder. Wie sie sich erholt haben, fragen sie, wo die Frau Kaiserin sei.
Da dachte das Mädchen: Also die Frau ist eine Kaiserin? Und zu den Jünglingen sagte sie: »Bleibt hier still, die Frau Kaiserin sollt ihr sehen.« Wie die Frau nun zurück kam und klagte: »O, meine drei schönen Kronen!« - fing das Mädchen mit ihr zu plaudern an und fragte: »Wohin doch geht Ihr immer?« - »Ach, meine Tochter, ich gehe, meine drei schönen Kronen zu suchen!« - »Aber sagt mir, wer sind diese drei schönen Kronen?« -
»Höre, meine Tochter! Als ich meinen Gatten noch hatte, besaß ich drei schöne Söhne, die verschwanden dann plötzlich und sie suche ich jetzt.« So sprach die Frau, das Mädchen aber sagte: »Ich bitte eine Gnade von Euch: geht von morgen an nicht mehr aus. Eure drei Söhne werdet Ihr finden.« - »O, Tochter, ist das die Wahrheit?« - »Glaubt mir, Ihr sollt sie finden.« - »Und wie lange soll ich daheim bleiben?« - »Acht Tage.« - »Acht Tage? Gut, von morgen an gehe ich nicht mehr aus.«
In der Zeit gab das Mädchen den Söhnen zu essen, ohne daß die Kaiserin etwas merkte, dann diente sie der Kaiserin, kämmte sie, schmückte sie und zeigte sie den Söhnen, ohne daß die Mutter sie sehen konnte, durch eine Türspalte. So verstrichen vier Tage, da sagte das Mädchen zur Kaiserin: »Jetzt macht nur Eure Einladungen, denn nächsten Sonntag habt Ihr Eure Söhne.«
Die Kaiserin weinte vor Rührung und Freude. »Meine Tochter, wie soll ich dir lohnen, was du an mir tust?« Und lud nun alle Großen des Landes ein und küßte das Mädchen viele Male auf den Mund. So kam der Sonnabend heran, und da rief sie das Mädchen und sprach: »Meine Tochter, wenn ich meine Söhne in Wahrheit wieder finde, so sollst du den ältesten zum Gemahl haben.«
Am Festtage kamen alle Herren und Edelleute, die Grafen und die Großen, deren Herrin die Kaiserin war, die traten in den Thronsaal, und gleich darauf kam auch die Kaiserin, das Mädchen am Arm, das sie mit prächtigen Kleidern gekleidet hatte, und führte es den Herren vor.
Dann ging eine Tür auf, und die drei Jünglinge traten heraus. Man denke sich die Freude! Die Mutter wirft sich ihnen an den Hals, umarmt sie und weint blutige Tränen. Die Musik fängt an zu spielen, der Kaplan war bei der Hand, die Trauung zwischen der Jungfrau und dem ältesten Sohne zu vollziehen, und dieser wurde auch sogleich Kaiser über das ganze Land.
Im Glücke erfreuten sie sich des Lichts;
Wir sitzen im Dunkeln und haben nichts.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

DIE KLUGE KATHRIN ...

Man erzählt, daß einmal ein reicher Kaufmann war, der hatte eine Tochter, die, kaum der Wiege entwachsen, so klug wurde, daß alle und über alles nur immer zu erst ihre Meinung wissen wollten. Der Vater hatte seine Freude an dem Mädchen und nannte sie nur: die kluge Kathrin. Sie studierte bald alle Dinge der Welt, die hohen wie die niederen, wußte alle Sprachen und hatte bald alle Bücher, die geschriebenen wie die gedruckten, gelesen.
Da starb ihr die Mutter. Der Kummer des Mädchens war so groß, daß sie sich in ihre Kammer verschloß und nicht mehr heraus wollte. Sie aß in der Kammer, weinte und schlief darin, und kein Vergnügen, kein Spaziergang, kein Theaterspiel konnte sie mehr verlocken. Wie der Vater seine einzige Tochter so in Trübsal verfallen sah, wollte er seine Freunde um Rat fragen.
Er berief die vornehmen Herren der Stadt und sprach: »Ihr Herren, es ist euch bekannt, daß ich eine Tochter habe, die mein Augapfel ist. Nun, da ihre Mutter gestorben ist, hat sie sich eingeschlossen wie eine Schnecke in ihrer Schale und steckt nicht einmal ihre Nasenspitze heraus. Was ist zu tun?«
Die Freunde sagten: »Alle Welt kennt Euere Tochter wegen der gar großen Klugheit, die ihr geworden. Wie wär es also, wenn Ihr der selben eine große Schule errichtetet? Gewiß würde sie im Unterrichten die gewünschte Zerstreuung finden.« Das leuchtete dem Vater ein; er rief die Tochter und sagte zu ihr: »Mein liebes Kind, weil du auch gar keine Zerstreuung hast, bin ich gesonnen, dir eine Schule einzurichten, wovon du die Regentin sein sollst. Was meinst du?«
Der Vorschlag gefiel der Tochter, und wie die Bauleute kamen, war sie selbst mitten unter ihnen, den Bau zu leiten, denn auch davon verstand sie genug. Die Schule ward bald fertig, und nun ließ sie bekannt machen: »Freie Schule bei der klugen Kathrin.«
Da kamen die Kinder, Knaben und Mädchen, und sie setzte sie bunt durch einander ohne Unterschied des Standes. Da half keine Einrede: der Bettlerssohn wurde neben den Grafensohn gesetzt, nach dem Sprichwort: »Wer zu erst kommt, mahlt zu erst.« So begann der Unterricht. Sie lehrte alle gleich, und wer seine Aufgabe nicht wußte, bekam Schläge mit einer Peitsche, woran eine Bleikugel befestigt war.
Ihr Name war auch bis zum Königsschloß gedrungen, und der Königssohn beschloß, ihre Schule zu besuchen. Mit prächtigen Kleidern angetan, kommt er zur klugen Kathrin; aber er bekommt einen Platz wie alle anderen. Und als er auf eine Frage, die sie ihm stellte, keine Antwort wußte, bekam er auch eine Ohrfeige wie alle anderen, so stark, daß er meinte, die Wange müsse ihm verbrennen.
Beschämt und zornig eilt er zu seinem Vater, dem Könige, und bittet ihn und sagt: »Herr Vater, ich will mich verheiraten, erweist mir die Gnade und laßt mich die kluge Kathrin zur Frau nehmen.« Der König befiehlt, den Vater des Mädchens zu rufen, und wie der hört, um was es sich handelt, sagt er: »Herr König, Ihr habt nur zu befehlen, aber bedenkt, ich bin nur ein Kaufmann und Euer Sohn ist königlichen Blutes.« - »Das tut nichts«, sagte der König, »mein Sohn will sie und das ist genug.«
Der Vater geht nach Hause und ruft Kathrin: »Kathrin, der Sohn des Königs will dich zur Frau haben. Was meinst du dazu?« Kathrin war aber damit einverstanden. Acht Tage lang rüstete man zur Hochzeit, zwölf Mädchen waren die Brautjungfern; die königliche Kapelle ward geöffnet, und so wurden sie bald ein Paar.
Nach der Trauung befiehlt die Königin den zwölf Mädchen, der Braut die köstlichen Kleider auszuziehen, damit sie zu Bett gehen könne. Der Königssohn aber tritt dazwischen und sagt: »Ich will weder Kammerfrauen noch Kammerherren, auch keine Wachen hinter der Tür. Ich will allein sein.«
Als sie allein waren, fragt er: »Kathrin, denkst du der Ohrfeige noch, die du mir gegeben, und bereust du sie?« Sie antwortet kecklich: »Was doch soll ich sie bereuen? Wenn Ihr wollt, könnt Ihr eine zweite haben.« - »Was, du hast sie also nicht bereut?« - »O, nicht einmal im Traume.« - »Und willst du sie nicht bereuen?« Sie fragte: »Ja, mit wem sprichst du denn eigentlich?«
Da wurde der Prinz zornig und rief: »Ich will dir zeigen, mit wem ich spreche und wer ich bin.« Und er nahm einen Strick, sie in ein finsteres Loch hinab zu lassen. Ehe er dies tat, fragte er sie nochmals: »Kathrin, bereue jetzt, oder ich lasse dich in dieses Loch hinab!« - »O, immer zu«, rief Kathrin voller Mut, »da drunten ist es gewiß frischer.« Da sagte er weiter kein Wort, und ließ sie in das Loch hinunter, und gab ihr nichts als einen Tisch, einen Stuhl, einen Krug Wasser und eine Schnitte Brot.
Am anderen Morgen kommen Vater und Mutter, um dem jungen Paar nach des Landes Sitte einen Guten Morgen zu wünschen. Der Königssohn aber ruft: »Niemand darf eintreten, Kathrin ist krank.« Dann öffnet er das Loch und fragt hinab: »Nun, wie hast du die Nacht verbracht?« Und von unten klingt es herauf: »O, frisch und angenehm!« - »Denkst du der Ohrfeige, die du mir gegeben hast?« - »Denkt nur an die, die Ihr noch kriegen werdet.«
Wie zwei Tage um waren, fühlte sie großen Hunger, und da sie nicht wußte, was tun, zieht sie das Blankscheit aus ihrem Leibchen und fängt an, damit ein Loch in die Mauer zu graben. Sie gräbt und gräbt und sieht nach vierundzwanzig Stunden das Tageslicht schimmern. Da war ihre Freude groß, sie wurde aber bald noch größer, als sie durch das Loch, wie sie es vergrößert, den Schreiber ihres Vaters vorbei gehen sieht, Don Tommaso.
»Don Tommaso«, ruft sie, und wieder: »Don Tommaso!« Der schaut sich um und vermag sich nicht zu erklären, wie die Stimme aus der Mauer kommt. »Don Tommaso, ich bin die kluge Kathrin, geht und sagt meinem Vater, daß ich ihn augenblicklich sprechen muß.«
Der Vater kommt eiligst in Begleitung des Schreibers herbei, der ihm das Loch zeigt, und die Tochter sagt: »Das Schicksal, lieber Vater, hat mich in dieses Loch verbannt; aber laßt einen Gang von unserm Hofe bis hier her graben, laßt seine Decke mit Balken stützen und hängt alle zwanzig Schritte eine Lampe auf. Ich weiß schon, was ich zu tun habe.«
Der Gang war gemacht, und nun schickte ihr der Vater alle Tage köstliche Speisen in Hülle und Fülle. Der Königssohn aber schaute jeden Tag dreimal hinab und rief: »Kathrin, bereust du die Ohrfeige, die du mir gegeben hast?« Sie rief dagegen: »Was ist da zu bereuen, denkt lieber an die, die Ihr noch kriegen werdet.«
Kaum wie er das Loch geschlossen hatte, ging sie zu ihrem Vater hinüber und hatte den Königssohn dergestalt zum Narren. Die Sache wurde ihm allmählich unheimlich und er beschloß, abzureisen. Er öffnete das Loch und sagte: »Kathrin, ich gehe jetzt nach Neapel, hast du mir nichts zu sagen?« -
»Viel Vergnügen, macht Euch lustig, und vergeßt mir nicht Eure Ankunft zu melden. Aber Ihr wißt, was man sagt: 'Siehe Neapel und stirb' - daß Ihr mir ja nicht sterbt.« - »Ich soll also fort gehen?« fragte der Prinz. - »Was, Ihr steht noch immer oben? Ich wähnte Euch schon auf der Reise.« Da ging er fort.
Kaum war er gegangen, läuft Kathrin zu ihrem Vater und sagt: »Lieber Vater, jetzt müßt Ihr mir helfen. Ich brauche ein Schiff, Kammermädchen, Kleider und Schmuck, das alles schickt Ihr schleunigst nach Neapel. In Neapel soll man mir einen Palast mieten, gegenüber dem königlichen Schlosse, und soll auf mich warten.«
Der Vater bereitete alles nach Wunsch der Tochter, und das Schiff ging ab. Unterdessen befiehlt der Königssohn eine schöne Fregatte, schifft sich ein und segelt gen Neapel. Wie die kluge Kathrin von der Terrasse ihres Vaters aus sah, daß der Königssohn abreiste, besteigt sie eine Brigantine und ist vor ihm in Neapel, denn die Brigantine segelte schneller als die Fregatte.
Angekommen, zieht sie ihre schönsten Kleider an und spaziert vor dem Palaste auf und ab. So tat sie es jeden Tag, bis sie der Königssohn sah und sich als bald in sie verliebte. Er schickte einen Boten zu ihr, der mußte sagen: »Schöne Frau, so Ihr es erlauben möchtet, würde Euch der Königssohn wohl besuchen.«
Sie antwortet: »Wenn es ihm gefällig ist, mag er kommen.« Er kam und war voller Artigkeiten gegen sie und begann ein Gespräch: »Sagt mir, Frau, ist Euer Herz noch frei?« Sie antwortet: »Es ist noch frei, aber das Eure?« - »Auch dieses ist frei. Und nun hört, was ich Euch sage: Ihr gleicht so ganz einem Mädchen, das ich in Palermo liebte, und ich möchte Euch zur Frau haben.« Die Frau sagte Ja, und nach acht Tagen wurde die Hochzeit gefeiert.
Die Zeit verging rasch, und ein Knäblein erblickte das Licht der Welt, das war so schön wie die Sonne. Sein Vater fragte: »Welchen Namen geben wir dem Kinde?« - »Neapel«, antwortete die Frau, und so wurde er Neapel genannt.
Nach zwei Jahren will der Königssohn abreisen, und trotz des Zürnens seiner Frau führt er seinen Vorsatz aus. Vor der Abreise jedoch schreibt er ihr einen Brief, worin er sagt, daß das Kind als sein Erstgeborener mit der Zeit König werden solle. So ging er nach Genua.
Schnell schreibt sie ihrem Vater, er solle eine Brigantine mit Möbeln, Kleidern, Kammerfrauen und allem Nötigen nach Genua schicken, solle ein Haus gegenüber dem königlichen Schlosse mieten und sie erwarten lassen. Der Vater war der Tochter zu Willen und schickte alles nach Genua. Sie fährt mit einem Schnellsegler dem Königssohn voraus und richtet sich noch vor ihm in dem neuen Hause ein.
Kaum sieht der Prinz die königlich gekleidete Frau, die in Schmuck und Reichtum einher ging, rief er verwundert aus: »Bei allen Himmeln, diese gleicht aufs Haar der klugen Kathrin.« Und wieder schickt er einen Diener zu ihr, mit der Bitte, sie besuchen zu dürfen.
Sie erlaubt es, und er kommt und fragt die alte Frage: »Seid Ihr noch frei?« - »Ich bin Witwe«, antwortet Kathrin, »und Ihr?« - »Ich bin Witwer und habe einen Sohn. Ich sehe Euch an und Ihr gleicht aufs Haar einer Frau, die ich in meiner Heimat kannte!« - »Da ist nichts zu verwundern, sieben müssen sich auf dieser Welt einander gleichen.« Kurz, in acht Tagen waren sie ein Paar.
Die Monate verflossen, und wie die Stunde der Geburt kommt, wird ihr ein Knabe, schöner noch als der erste war. Und wie der Prinz fragte: »Welchen Namen geben wir dem?« sagte sie: »Genua«, und so wurde er Genua getauft.
Doch kaum sind zwei Jahre um, so hält es den Königssohn nicht länger und er will abreisen. »Aber wie mögt Ihr mit einem Wickelkind abreisen!« fragte sie. -
»Das lasse ich dir und einen Zettel, worauf ich kundtue, daß es mein Kind und zwar der Kronprinz ist.« So rüstete er sich zur Abreise nach Venedig. Inzwischen hat die kluge Kathrin schon an den Vater geschrieben und ihn um die neue Sendung gebeten, und sie erreicht auch Venedig in ihrer Brigantine schneller als der Prinz mit seiner Fregatte, und richtet sich ein.
Wie sich der Königssohn ein wenig in der Stadt umtut, sieht er an einem Fenster die Frau sitzen, staunt und ruft: »Bei allen Himmeln, diese gleicht ganz und gar der klugen Kathrin! Wie geht das zu? In Neapel die selbe, in Genua die selbe, und jetzt wieder hier! Aber nein, wie wäre das möglich? Kathrin liegt im Loche, jene ist in Neapel und die dritte in Genua ... und doch, und doch gleicht sie allen Dreien.«
Er schickt seinen Boten, besucht sie und sagt zu ihr: »Das ist mir doch zu sonderbar: Ihr gleicht einer Frau, die ich in Palermo, in Neapel und in Genua kennen gelernt!« - »Da ist nichts Sonderbares«, antwortete sie, »sieben müssen sich auf dieser Welt einander gleichen.« Wiederum fragt er, ob sie frei sei, und wie sie ihm sagt, sie wäre Witwe, sagt er, er sei Witwer und habe zwei Kinder. Nach acht Tagen haben sie sich geheiratet.
Da auch diesmal die Zeit erfüllt war, bekam sie eine Tochter, schön wie ein Stern. Der Prinz fragt: »Wie nennen wir die?« Kathrin antwortet: »Venezia.« Und so geschah es. Zwei Jahre waren vergangen, da sagte eines Tages der Prinz: »Weißt du was? Ich denke, meine Reise ist beendigt, ich kehre am besten wieder nach Palermo zurück und lasse dir einen Schein, daß diese da meine Tochter und zwar königliche Prinzessin ist.«
Kathrin mochte sich sträuben, wie sie wollte, er reiste ab; aber sie reiste ihm hinten nach. In Palermo angekommen, geht sie in das Haus ihres Vaters, geht durch den unterirdischen Gang und kriecht in das Loch. Der Königssohn kommt an, sein erster Gedanke ist natürlich, nach Kathrin zu schauen.
Er ruft hinab: »Kathrin, wie geht es dir?« Und sie von unten: »Gut, ganz gut.« - »Hast du die Ohrfeige bereut, die du mir gegeben hast?« - »Was sprichst du nur von der? Denke nur an die, welche du noch zu kriegen hast.« - »Kathrin, bedenke dich wohl! Ich werde mich verheiraten!« - »Verheiratet Euch, mit wem Ihr wollt, kein Mensch hält Euch ab.« - »Aber bedenke, so du bereust, bist du wieder meine Frau.« Aber Kathrin antwortet: »Ich habe nichts zu bereuen.«
Da also gar kein Mittel anschlägt, sie zu bekehren, beschließt er, sie für tot zu erklären und sich neuerdings zu vermählen. Er schickt Boten in alle Welt, um die Bilder aller heiratsfähigen Prinzessinnen zu haben. Die Bilder kommen und er findet, daß die Tochter des Königs von England die aller schönste sei. Er läßt ihr sagen, sie möge mit ihrer Mutter kommen, da er sie zur Frau nehmen wolle.
Es kommen die Prinzessin und ihr Bruder und werden im königlichen Schlosse empfangen. Wie das Kathrin vernimmt, läßt sie für ihre drei Kinder Neapel, Genua und Venezia schöne königliche Kleider machen, und am nächsten Tage, wo die Trauung stattfinden sollte, kleidet sie sich als Königin, was sie auch in Wirklichkeit war, an, nimmt Neapel, der als Kronprinz, und Genua und Venezia, die als Prinz und Prinzessin geschmückt waren, setzt sich in die Galakutsche und fährt vor das Schloß.
Den Kindern sagt sie: »Wenn ich Euch sage: küßt Eurem Vater die Hand, so geht hin und tut also.« So traten sie ein. Der Königssohn saß auf dem Throne; sie ruft: »Neapel, Genua und Venezia, küßt Eurem Vater die Hand!« und läßt sie vorgehen. Der Königssohn erstarrt vor Schreck und ruft:
»Ah, das also ist die versprochene Ohrfeige, nun, sie ist stark genug.« Steigt aber vom Thron hinunter und drückt die Kinder an sein Herz. Die Prinzessin von England stand da wie aus den Wolken gefallen, und reiste am anderen Tag wieder ab.
Kathrin hat ihrem Manne das ganze Geheimniß erzählt, und er konnte nichts anderes tun, als sie um Verzeihung zu bitten für die vielen Kümmernisse, die er ihr bereitet, und von dem Tage an liebte er sie in Treuen.
So lebten sie glücklich und zufrieden,
Uns ist auch nicht ein Bißlein beschieden.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

DIE STIEFTOCHTER ...

Es war einmal ein Mann, dem war die Frau gestorben, und nur ein Töchterlein war ihm geblieben. Dieses wollte er nicht allein lassen, und so nahm er, nach dem das Trauerjahr um war, eine zweite Frau, so daß das Mädchen jetzt eine Stiefmutter hatte.
Nicht alle Stiefmütter lieben die Stieftöchter, und diese mochte die ihre nun gar nicht ausstehen und quälte sie, wo sie nur wußte und konnte. So gab sie ihr jeden Morgen eine schwere Arbeit, und essen durfte sie erst dann, wenn sie diese vollendet hatte.
Eines Tages fand ihr Vater auf dem Felde ein Schäfchen, das brachte er seiner Tochter nach Hause, denn er liebte sie gar sehr, ob schon er der zweiten Frau nichts davon merken lassen durfte. Das Schäfchen blickte dem Mädchen ins Gesicht und sah, daß es gar abgehärmt und traurig war, da fing es an zu sprechen: »Um die Arbeiten sorge dich nicht mehr, lege sie mir nur zwischen meine Hörner, und alles wird gemacht werden.« So tat das Mädchen, und siehe, die Arbeiten waren in einem Nu vollendet.
Die böse Stiefmutter aber bekam Wind, die Arbeiten waren in einem Ave Maria gemacht, das war nicht des Mädchens Werk. Sie lauschte und erfuhr, wie die Dinge standen. Wie der Mann abends heimkam, war ihr erstes Wort: »Höre, das Schäfchen muß geschlachtet werden, es soll unser Osterlamm sein«. Der Mann sagte gar nichts dazu, das Mädchen aber weinte bittere Thränen um das Schaf.
Dieses jedoch tröstete und sprach: »Weine nicht, sorge dich auch nicht um mich, sondern laß mich getrost schlachten. Von meinem Fleische iss du keinen Bissen, sammelst aber alle meine Knöchlein ein und begräbst sie unter dem Fußboden.«
Das Schäfchen wurde geschlachtet, und das Mädchen tat so, wie es ihm zuvor geheißen.
Nach einiger Zeit kamen zwölf Jungfrauen aus dem Boden, wo sie die Gebeine begraben hatte, die kleideten sie und schmückten sie mit Gold und Silber und führten sie zum Feste des Königs. Als der König dieses Mädchen sah, war er wie geblendet, er sah nur sie und wich den ganzen Abend nicht von ihrer Seite. Als sie weg ging, gab er seinen Dienern Befehl, ihr zu folgen, damit er wisse, woher sie komme.
Sie merkte aber, daß ihr die Diener folgten, und löste als bald ihre Flechten, daß die Perlen auf den Boden fielen und die Diener im Auflesen ihre Spur verloren. Der König wurde ganz zornig, und am nächsten Abend befahl er ihnen bei Verlust ihres Kopfes, den Weg des Mädchens zu finden. Beim Weg gehen warf sie diesmal den Dienern ihren Schuh hin und entkam.
Die Diener brachten den Schuh zum König, der nahm ihn und ließ verkünden: »Diejenige, an deren Fuß dieser Schuh paßt, soll meine Gemahlin werden.« Kaum wurde dies bekannt, so liefen Frauen und Mädchen von allen Orten und Enden zum König, aber keiner wollte der Schuh passen.
Die Stiefmutter, ihrer Stieftochter einen Hohn zu bereiten, führte diese auch zum König. Wie groß aber war ihr Ärger und Erstaunen, als sie sehen mußte, daß jener der Schuh wie angegossen paßte. Und da war auch schon die Musik da und das Hochzeitsfest wurde mit großem Pomp gefeiert.
Sie führten ein gar herrlich Leben,
Uns haben sie nichts davon gegeben.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

VOM OHIMÈ ...

Es war einmal ein armer alter Holzhacker, der hatte drei schöne Enkeltöchter. Von ihnen war die jüngste auch die schönste und klügste, und hieß Maruzza. Der arme Mann hatte keinen Verdienst, Geld hatte er auch nicht, so daß er gar nicht wußte, was er mit seinen Enkelinnen machen sollte.
Als er nun eines Tages im Walde Holz sammelte, ward er so müde und matt, daß er sich auf einen großen Stein setzte, und laut seufzte: »Ach, (Ohimè).« Sogleich erschien ein großer Mann, der frug ihn: »Warum rufst du mich?« »Ich habe euch nicht gerufen,« sagte der Holzhacker ganz erschrocken. »Hast du nicht Ohimè gerufen? Daß ist mein Name,« sprach der große Mann. »Du siehst aber aus, wie ein armer Schlucker, darum will ich dir helfen. Bringe deine älteste Enkelin zu mir, daß sie meiner Frau diene, so will ich dich reich beschenken. Führe sie an diese Stelle, und rufe mich bei meinem Namen, so werde ich erscheinen.«
Bei diesen Worten gab er ihm etwas Geld, und der alte Mann lief voll Freude nach Haus zu seinen Enkeltöchtern. »Denke dir,« sprach er zur Ältesten, »dir ist ein großes Glück beschert; ein vornehmer Herr will dich in seinen Dienst nehmen, damit du seiner Frau dienst; nun bist du versorgt.« Als seine Enkelin das hörte, küßte sie den Boden und sprach: »Ich danke euch, mein Gott!«
Nach einigen Tagen machte sie sich bereit, und ihr Großvater brachte sie in den Wald, und rief laut: »Ohimè!« Da erschien Ohimè, und als er das schöne Mädchen sah, sprach er: »Du hast dein Wort gehalten, und nun soll deine Enkelin es auch gut haben, und einmal jede Woche kannst du kommen, und dich nach ihr erkundigen.«
Da machte er dem Großvater ein schönes Geschenk, nahm das Mädchen an die Hand, und führte sie vor einen Felsen. Also bald öffnete sich dieser, daß sie hinein treten konnten. Drinnen aber waren prachtvolle Säle, mit den herrlichsten Schätzen und Kostbarkeiten. »Wo ist die Patrona?« frug das Mädchen. »Die Patrona bist du,« antwortete Ohimè, »und wenn du mir gehorchst, und alles tust, was ich dir gebiete, sollst du auch meine Frau werden.«
Mit diesen Worten führte er sie durch das ganze Schloß, und zeigte ihr die schönen Sachen. Zuletzt aber kamen sie in einen Saal, darin lagen viele ermordete Mädchen. »Siehst du,« sprach Ohimè, »alle diese haben mir nicht gehorcht, und haben ihre Pflicht nicht erfüllt, deßhalb haben sie ihre Strafe bekommen. Darum laß dich warnen.«
»Wenn sie euch nicht gehorcht haben, so ist es ihnen recht geschehen,« sagte sie, »ich aber will schon meine Pflicht tun.« Also blieb das Mädchen bei Ohimè und hatte es gut bei ihm. Nach einigen Tagen sprach Ohimè zu ihr: »Ich muß auf drei Tage verreisen, und lasse dir ein Gebot zurück; wenn du das nicht erfüllst, so geht es dir schlimm.« »Was soll ich denn tun?« frug sie.
Da gab er ihr ein Totenbein, und sprach: »Das mußt du essen, und wenn ich wieder komme, so will ich es nicht mehr sehen.« Mit diesen Worten verließ er sie; sie aber blieb in schweren Sorgen zurück. »Wie kann ich denn ein Totenbein essen?« dachte sie, »so ein schmutziges, ekliges Ding. Da kann Ohimè lange warten, bis ich das esse.«
Weil sie es nun nicht essen wollte, warf sie es zum Fenster hinaus, und meinte, Ohimè werde es nicht merken. Als er aber nach Hause kam, war seine erste Frage: »Hast du deine Pflicht getan?« »Ja wohl, Patron.« Da rief Ohimè mit lauter Stimme: »Wo bist du, Bein?« »Hier bin ich!« »Komm doch einmal her zu mir.« Da kam das Bein hervor, und Ohimè sprach zu dem Mädchen:
»Weil du mich belogen hast, und deine Pflicht nicht getan, so sollst du nun auch deine Strafe haben.« Damit ergriff er sie, schleppte sie in den Saal, wo die vielen toten Mädchen lagen, und ermordete sie.
Nach einigen Tagen kam der alte Holzhacker wieder in den Wald, und rief den Ohimè, und als er erschien, frug er ihn: »Wie geht es meiner Enkelin?« »Ei, der geht es sehr gut,« antwortete Ohimè, »und meine Frau hält sie wie ihre eigene Tochter. Sie möchte auch gerne die zweite Schwester in ihren Dienst nehmen. Bringe sie mir her, so will ich dir ein schönes Geschenk machen.«
Da lief der alte Holzhacker voll Freude nach Hause, und erzählte seiner zweiten Enkelin, sie solle auch zu dem vornehmen Herrn in Dienst kommen. Die war es denn auch zufrieden, und der Großvater führte sie in den Wald. »O, Ohimè!« rief er, und als bald erschien Ohimè, und nahm die Enkelin in Empfang. Da führte er sie durch den Felsen in seinen Palast, und zeigte ihr die herrlichen Säle mit den vielen Schätzen.
»Wo ist denn meine Schwester?« frug sie. »Deine Schwester will ich dir gleich zeigen,« antwortete er, und führte sie in den Saal, wo sie ihre tote Schwester mitten unter den anderen Leichen sah. »Siehst du, deine Schwester hat meinen Geboten nicht gehorcht, darum ist sie so bestraft worden; und wenn du mir nicht gehorchst, so wird es dir auch so ergehen.«
»O, ich will schon meine Pflicht tun,« sagte sie, aber in ihrem Herzen zitterte sie und dachte: »Wer weiß, welch schreckliches Gebot er meiner armen Schwester gegeben hat.« So vergingen einige Tage, und eines Morgens kam Ohimè zu ihr, und sprach: »Ich muß nun auf drei Tage verreisen; während dieser Zeit mußt du das Gebot erfüllen, das ich dir geben werde; sonst geht es dir schlimm.«
Mit diesen Worten gab er ihr einen Fuß von einem Toten, den sollte sie essen. Als nun Ohimè fort war, blieb das arme Mädchen in schweren Sorgen zurück, und dachte: »Wie kann ich diesen garstigen, schmutzigen Fuß essen? Ich will ihn aufs Dach werfen, und dem Bösewicht von Ohimè sagen, ich habe ihn gegessen.«
Das tat sie denn, und meinte er solle es nicht merken, als er aber nach Hause kam, war seine erste Frage: »Hast du mein Gebot erfüllt?« »Ja wohl, Herr!« »Fuß! wo bist du? komm doch einmal her zu mir!« Da erschien der Fuß, und Ohimè rief: »Meinst du, du könnest mich belügen? Weil du deine Pflicht nicht getan hast, so werde ich dich ermorden.« Da schleppte er sie in den Saal, wo die anderen Toten waren, und ermordete auch sie.
Nach einigen Tagen kam wieder der Holzhacker, um nach seinen Enkelinnen zu fragen. »O, denen geht es sehr gut,« antwortete Ohimè, »und meine Frau hat sie beide so lieb, als ob sie ihre Töchter wären. Sie möchte jetzt aber auch die dritte Schwester haben.« Der arme Holzhacker wußte sich gar nicht zu fassen vor Freude, daß alle seine Enkelinnen so wohl versorgt werden sollten, und eilte nach Hause zu seiner jüngsten Enkeltochter.
»Maruzza, mache dich schnell bereit; denn der vornehme Herr will auch dich in seinen Dienst nehmen,« rief er, und brachte sie in den Wald, wo Ohimè sie freundlich aufnahm, und in den Felsen hineinführte. »Wo sind denn meine Schwestern?« frug Maruzza. »Die will ich dir gleich zeigen,« sprach er, und schloß den Saal auf, in dem die Leichen lagen.
»Siehst du, da sind deine Schwestern, weil sie ihre Pflicht nicht erfüllt haben.« Die arme Maruzza erschrak in ihrem Herzen, aber sie sagte nur: »Da habt ihr recht getan, daß ihr sie gestraft habt, als sie ihre Pflicht nicht erfüllt haben. Mir könnt ihr befehlen, was ihr wollt; ich werde es alles tun.«
Nach einigen Tagen sprach Ohimè zu Maruzza »Ich muß auf drei Tage verreisen, und nun ist der Augenblick gekommen, wo du mir deinen Gehorsam beweisen kannst. Sieh hier diesen Totenarm, den mußt du aufessen, während ich nicht da bin, und es darf auch kein Bröcklein davon übrig bleiben.« Mit diesen Worten ging er fort, und ließ die arme Maruzza in schweren Gedanken zurück.
»Ach,« dachte sie, »was soll ich nun tun! ach! ich Unglückliche! wie kann ich diesen Totenarm essen! O, heilige Seele meiner Mutter, gebt mir einen guten Rat und helft mir!« Auf einmal hörte sie eine Stimme, die rief: »Maruzza, weine nicht, denn ich will dir helfen.
Heize den Backofen so heiß wie möglich, und laß den Arm so lange darin, bis er zu Kohle gebrannt ist. Dann zerstoße ihn zu feinem Pulver, und binde dir dieses in einem feinen Läppchen fest um den Leib, so wird Ohimè nichts merken, und dich verschonen.« Diese Stimme aber war die heilige Seele ihrer Mutter, die der armen Maruzza half.
Da tat sie alles, wie die Stimme sie geheißen hatte, heizte den Backofen und ließ den Arm darin, bis er ganz zu Kohle gebrannt war; dann zerstieß sie ihn im Mörser, wickelte das Pulver in ein feines Läppchen, und band es sich fest um den Leib.
Als nun Ohimè nach Hause kam, frug er gleich: »Hast du mein Gebot erfüllt?« »Ja wohl, Herr!« »Arm, wo bist du? komm doch einmal her zu mir!« »Ich kann nicht kommen!« antwortete der Arm. »Wo bist du denn?« »Ich bin in Maruzzas Leib.« Als Ohimè das hörte, ward er sehr froh, und rief: »Nun, Maruzza, sollst du auch meine Gemahlin sein, denn jetzt weiß ich, daß du ein aufrichtiges und gehorsames Gemüt hast.«
Von nun an hatte Maruzza es gut bei ihm; Ohimè hatte sie lieb, und brachte ihr alles, was sie sich wünschte. Eines Tages zeigte er ihr auch alle seine Schränke, in denen viele Flaschen mit Tränken und Salben standen. »Siehst du,« sprach er, »hier ist eine Salbe, wenn man damit die Toten bestreicht, so werden sie wieder lebendig. Ich zeige sie dir, weil ich weiß, daß du mir treu ergeben bist.«
Als er ihr nun alles gezeigt hatte, führte er sie auch vor eine verschlossene Tür, und sprach: »Sieh, Maruzza, alles was hier ist, gehört dir, und du darfst tun und lassen, was du willst. Diese Türe aber darfst du nicht aufmachen, denn wenn ich es merke, so ermorde ich dich.«
Kaum war Ohimè das nächstemal verreist, so nahm Maruzza ihren Schlüsselbund, ging und machte die Türe auf. Als sie hinein trat, sah sie einen wunderschönen Jüngling, der lag am Boden als ob er tot wäre, und in seinem Herzen stak ein Dolch. »Ach!« dachte Maruzza voll Mitleid, »armer, unglücklicher Jüngling! Darum also wollte der böse Ohimè nicht, daß ich die Türe aufmachen solle.«
Da lief sie hin, und holte ein wenig von der Salbe; zog den Dolch aus dem Herzen, und bestrich die Wunde mit der Salbe, und als bald schlug der Jüngling die Augen auf und war gesund. »Schönes Mädchen,« rief er, »du hast mich erlöst; denn ich bin ein Königssohn, und der böse Ohimè hat mich hier gefangen gehalten.«
»Ach,« antwortete sie, »was hilft es, daß ihr nun gesund seid? Bald wird Ohimè wieder kommen, und wenn er euch dann gesund und am Leben findet, wird er euch und mich umbringen. Darum müsst ihr euch wieder hin legen, und ich will euch den Dolch ins Herz stoßen; und dann will ich sehen, was wir tun können, um den bösen Ohimè zu ermorden.«
Und so taten sie denn auch; der Königssohn legte sich wieder hin, und Maruzza stieß ihm mit vielen Tränen den Dolch ins Herz. Denn sie war in heftiger Liebe zu ihm entbrannt.
Als aber Ohimè nach Hause kam, ging sie mit ihm in den Garten, und schmeichelte ihm mit vielen süßen Worten: »Sagt mir doch, lieber Herr, wenn je das Unglück wollte, daß euch einer nach dem Leben trachtete, wie müßte er es anfangen, um euch umzubringen?« »Warum frägst du mich das?« sprach Ohimè, »willst du mich vielleicht verraten?«
»Ach, was denkt ihr auch! Bin ich nicht eure gehorsame, treue Maruzza? Es war nur ein Gedanke, der mir eben durch den Kopf ging.« »Nun, weil du es bist, will ich es dir sagen,« sprach Ohimè. »Sieh, ermorden kann man mich nicht; wenn mir aber Jemand einen Zweig von diesem Kraut in die Ohren stopft, so schlafe ich ein, und kann nicht wieder aufwachen.«
»Nun, nun, sagt mir nichts mehr, ich will gar nichts davon wissen,« sagte Maruzza; heimlich aber bückte sie sich, brach ein Zweiglein ab, und steckte es in die Tasche. »Nun setzt euch ein wenig hin, so will ich euch lausen,« sprach sie zu Ohimè, und setzte sich; er aber legte seinen Kopf in ihren Schoß, und sie lauste ihn, bis er einschlief.
Dann nahm sie schnell das Kraut, und stopfte es ihm in beide Ohren, daß er in einen tiefen Schlaf verfiel. So ließ sie ihn im Garten liegen, und eilte wieder ins Haus, nahm die Salbe, und bestrich zuerst den Königssohn, daß er wieder lebendig wurde; dann lief sie auch in den Saal, wo die toten Mädchen lagen, und bestrich sie alle mit der Salbe; zuerst ihre Schwestern, dann auch die anderen Mädchen, die der böse Ohimè nach und nach umgebracht hatte.
Als sie nun alle wieder lebendig waren, beschenkte Maruzza sie reichlich, und ließ sie in ihre Heimat zurück kehren, sie selbst aber und der Königssohn nahmen die übrigen Schätze, und gingen fort nach der Heimat des Königssohnes. Denkt euch nun die Freude des Königs und der Königin als ihr Sohn wiederkam, den sie seit so vielen Jahren für tot beweint hatten, und nun kam er wieder und brachte noch ein so schönes, kluges Mädchen mit.
Da wurde eine prächtige Hochzeit gefeiert, und der Königssohn heiratete die schöne Maruzza, und lebte mit ihr glücklich und zufrieden.
Unterdessen lag Ohimè im Garten, und schlief, und schlief, mehrere Jahre lang. Endlich aber verfaulte das Kraut durch den Wind und Regen, und eines Tages fiel es heraus, und Ohimè fuhr aus dem Schlaf empor. »Wo bin ich?« dachte er, sprang auf und lief in das Haus. Als er aber dort nur die nackten Wände sah, geriet er in einen großen Zorn, und rief: »Diese Nichtswürdige! Sie hat mich verraten, nachdem ich mich so auf sie verlassen hatte! Aber warte nur, ich will mich schon an dir rächen!«
Da machte er sich auf, und zog durch alle Länder, um Maruzza zu suchen, und wanderte so lange, bis er endlich eines Tages in die Stadt kam, wo Maruzza wohnte. Als er nun durch die Straßen ging, hob er zufällig die Augen auf, und sah an einem Fenster die schöne Maruzza stehen. »Ei!« dachte er, »bist du hier, und lebst gar prächtig in einem königlichen Schloß? Nun, warte nur, ich will dich schon kriegen.«
Da ging er hin, und machte eine Statue aus Silber, die war eben so groß, wie er selbst, und inwendig hohl. In das Innere aber steckte er mehre Instrumente, um Musik zu machen, rief dann einen Burschen herbei, und sprach zu ihm: »Ich mache dir ein schönes Geschenk, wenn du diese Statue auf deinen Rücken nimmst, und damit in der ganzen Stadt herum ziehst, um sie für Geld sehen zu lassen.
Zuletzt mußt du sie zum König bringen, und sie einige Tage bei ihm lassen.« Der Bursche versprach alles zu besorgen, und Ohimè schloß sich in die Statue ein. Da nahm der Bursche ihn auf den Rücken, und trug ihn in der ganzen Stadt herum, und rief mit lauter Stimme: »Ei, was habe ich für einen schönen heiligen Nikolaus, und was der für schöne Musik machen kann.«
Als die Leute das hörten, riefen manche ihn herbei und baten: »Laß uns doch deinen heiligen Nikolaus einige Tage hier, daß wir uns an der schönen Musik erfreuen, wir wollen dir auch ein schönes Geschenk dafür machen.« Da ließ der Bursche die Statue in den Häusern, und Ohimè spielte dann so wunderschön, daß man bald in der ganzen Stadt von nichts anderem sprach, als von der wunderbaren Statue, und jeder sie sehen und hören wollte.
So gelangte denn endlich auch das Gerücht davon zum König, und zu Maruzza, die sprach: »Ach, ruft mir doch auch einmal den Burschen her, ich möchte so gerne die Statue einige Tage hier behalten.« Da ließ der König den Burschen aufs Schloß kommen und machte ihm ein schönes Geschenk, damit er seinen heiligen Nikolaus da lassen sollte, und ließ die Statue in sein Schlafzimmer tragen, und ergötzte sich mit Maruzza an der schönen Musik.
Am Abend aber, als sie beide zu Bette lagen, hörte Maruzza auf einmal ein leises Geräusch, und schrie laut: »Zu Hilfe!« »Was gibt es?« frug der König, und alle Leute im Schloß liefen erschrocken zusammen. »Dort bei der Statue habe ich ein Geräusch gehört,« sagte Maruzza; als aber die Diener die ganze Kammer durchsuchten, fanden sie nichts, und der König dachte, Maruzza habe wohl geträumt.
Als alles wieder ruhig war, ließ sich das selbe Geräusch wieder vernehmen; Maruzza schrie laut auf, die Diener liefen zusammen; sie konnten aber nichts entdecken, und der König sagte: »Maruzza, du träumst; wenn du noch einmal schreist, so soll niemand mehr kommen.« Das hörte Ohimè in der Statue, denn das hatte er ja eben gewollt; und als der König schlief, machte er leise die Statue auf und kam heraus.
Maruzza schrie laut auf, aber es kam niemand, denn Ohimè legte schnell ein Fläschchen aufs Bett, und als bald verfielen der König und alle die Leute im Schlosse in einen tiefen Schlaf; Keiner konnte aufwachen, nur Maruzza blieb wach, und sah, wie Ohimè auf sie zutrat, und sie am Arme ergriff. »Du hast mich verraten!« rief er, »und meinst nun, du seist hier sicher. Jetzt aber bist du in meiner Macht, und wirst deiner Strafe nicht entgehen.«
Dann ging er in die Küche, machte ein großes Feuer an, und stellte einen Kessel mit Öl darüber, und als das Öl recht am Sieden war, eilte er in die Kammer zurück, ergriff die arme Maruzza, und wollte sie in die Küche schleppen, um sie in den Kessel mit siedendem Öl zu werfen. Sie weinte und schrie, aber niemand hörte sie, denn ein tiefer Schlaf lag auf dem König und dem ganzen Schloß.
Wie sie sich aber so wehrte, fiel auf einmal das Fläschchen auf den Boden, und in dem selben Augenblick erwachte der König, und die Diener kamen in das Zimmer gestürzt. Maruzza aber schrie: »Zu Hilfe! zu Hilfe! der Bösewicht will mich ermorden!« Da ergriffen die Diener den bösen Ohimè, und der König erkannte ihn nun auch, und befahl, man solle ihn in denselben Kessel mit siedendem Öl werfen, in dem er die schöne Maruzza hatte umbringen wollen.
Und so geschah es; der böse Ohimè wurde in das siedende Öl geworfen, und mußte elendiglich verbrennen; der König und Maruzza aber lebten noch lange reich und getröstet, und wir sind hier sitzen geblieben.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

DER TEUFEL HEIRATET DREI SCHWESTERN ...

Einst kam dem Teufel die Lust zu heiraten an. Er verließ daher die Hölle, nahm die Gestalt eines jungen hübschen Mannes an und baute sich ein schönes großes Haus. Als letzteres vollendet und höchst vornehm eingerichtet war, führte er sich in eine Familie ein, wo drei sehr hübsche Töchter waren, und machte der älteren davon den Hof.
Dem Mädchen gefiel der hübsche Mann, die Eltern waren froh, eine Tochter so gut versorgt zu sehen, und es dauerte nicht lange, da wurde die Hochzeit gefeiert. Als er seine Braut nach Hause geführt hatte, spendete er ihr einen sehr geschmackvoll gebundenen Blumenstrauss, führte sie in alle Gemächer des Hauses und endlich zu einer geschlossenen Tür.
»Das ganze Haus steht zu deiner Verfügung, nur um eines muss ich dich ersuchen, das ist, öffne diese Türe ja bei Leibe nicht.« Natürlich, dass die junge Frau dieses heilig versprach, aber auch bald nach her den Augenblick kaum mehr erwarten konnte, ihr Versprechen zu brechen.
Als der Teufel am anderen Morgen unter dem Vorwand, auf die Jagd zu gehen, das Haus verlassen hatte, lief sie eiligst zur verbotenen Türe, öffnete sie und erblickte einen ungeheuren Schlund voll Feuer, das ihr entgegen schlug und den Blumenstrauß am Busen versengte.
Als ihr Mann später nach Hause kam und sie fragte, ob sie ihr Versprechen gehalten habe, sagte sie unbedenklich: Ja; er aber erkannte an den Blumen, dass sie ihn belogen hatte und sagte: »Nun will ich deine Neugierde nicht länger mehr auf die Probe setzen, komme mit mir, ich selbst werde dir zeigen, was hinter der Türe steckt.« Darauf führte er sie zur Türe, öffnete diese, gab ihr einen Stoß, dass sie in die Hölle hinab stürzte und schloss wieder zu.
Wenige Monate darauf begehrte er die andere Schwester zur Ehe und erhielt sie auch, aber auch mit dieser wiederholte sich ganz genau alles, was mit der ersten Frau geschehen war.
Da hielt er endlich um die dritte Schwester an. Diese, die ein sehr listiges Mädchen war, dachte: meine zwei Schwestern hat er sicher umgebracht, jedoch er ist eine glänzende Partie für mich, ich will also doch versuchen, ob ich nicht glücklicher bin als die anderen, und somit willigte sie ein.
Nach der Hochzeit gab der Bräutigam auch dieser ein schönes Sträusschen, verbot ihr aber auch, die bezeichnete Türe zu öffnen. Um kein Haar minder neugierig als ihre Schwestern, öffnete auch sie, als der Teufel auf die Jagd gegangen war, die verbotene Thür, nur hatte sie früher das Sträußchen ins Wasser gestellt.
Da sah sie denn hinter der Türe die leidige Hölle und ihre zwei Schwestern darin »Ach!« sagte sie da, »ich arme Haut glaubte einen ordentlichen Mann geheiratet zu haben, statt dessen ist es der Teufel! Wie werde ich von dem los kommen können?« Vorsichtig zog sie ihre Schwestern aus der Hölle und verbarg sie.
Als der Teufel nach Hause kam, blickte er gleich nach dem Sträusschen, das sie wieder am Busen trug, und als er die Blumen so frisch fand, fragte er gar nicht weiter, sondern beruhigt über sein Geheimnis, gewann er sie jetzt erst recht lieb.
Da bat sie ihn nach ein paar Tagen, er möchte ihr doch drei Kisten zu ihren Eltern nach Hause tragen, jedoch ohne sie unterwegs nieder zu lassen oder zu rasten. »Aber«, setzte sie hinzu, »dein Wort musst du halten, denn ich werde dir nach sehen.« Der Teufel versprach ganz nach ihrem Willen zu tun.
Da legte sie am anderen Morgen die eine Schwester in eine Kiste und lud sie ihrem Manne auf die Schultern. Der Teufel, der zwar sehr stark, aber auch sehr faul und der Arbeit ungewohnt ist, bekam das Tragen der schweren Kiste bald satt und wollte rasten, bevor er noch aus der Gasse war, aber da rief sie ihm zu: »Setze nicht ab, ich sehe dich.«
Unwillig ging der Teufel mit der Kiste um die Gassenecke und sagte zu sich selbst: »Da kann sie mich nicht sehen, da will ich ein wenig rasten«; aber kaum machte er Anstalt, die Kiste abzusetzen, schrie die Schwester in der Kiste: »Setze nicht ab, ich sehe dich schon.«
Fluchend schleppte er die Kiste weiter in eine andere Gasse und wollte sie unter einem Haustor nieder stellen, aber wieder ließ sich die Stimme vernehmen: »Setze nicht ab, du Schelm, ich sehe dich schon.«
Was muss denn meine Frau für Augen haben, dachte er, die sieht um die Ecken wie geradeaus und durch Gewölbe, als ob sie von Glas wären, und so kam er endlich ganz verschwitzt und hundematt bei seiner Schwiegermutter an, der er die Kiste eiligst übergab und nach Hause lief, sich durch ein gutes Frühstück zu stärken.
Ganz das Nämliche wiederholte sich am anderen Tag mit der zweiten Kiste. Am dritten Tage sollte sie selbst in der Kiste nach Hause befördert werden. Sie bereitete daher eine Figur, die sie mit ihren Kleidern anlegte und auf die Altane stellte unter dem Vorwande, ihm weiter nach sehen zu können, schlüpfte schnell in die Kiste und ließ diese dem Teufel durch ihre Dienerin aufladen.
»Zum Gukuck«, sagte der Teufel, »die Kiste ist heute noch viel schwerer als die anderen, und heute, wo sie auf der Altane sitzt, kann ich um so weniger rasten«, und so trug er sie denn mit äußerster Anstrengung bis zur Schwiegermutter, dann aber eilte er schimpfend und den Rücken ganz wund nach Hause zum Frühstück.
Hier aber fand er ganz im Gegensatze zu sonst, dass ihm weder seine Frau entgegen kam, noch dass das Frühstück bereitet war. »Margerita! wo bist du denn?« rief er, aber keine Antwort erfolgte. Als er alle Gänge durchlaufen, sieht er endlich bei einem Fenster hinaus und erblickt die Figur auf dem Poggiolo.
»Margerita! bist du eingeschlafen? komme doch herab, ich bin hundemässig müde (stracco da can) und habe einen wahren Wolfshunger (una fame da lov)«. Aber keine Antwort erfolgte. »Wenn du nicht gleich herab kommst, so gehe ich hinauf und hole dich«, schrie er erbost, aber Margerita rührte sich nicht.
Da eilt er ergrimmt auf die Altane und gibt ihr eine Ohrfeige, dass ihr der Kopf weg fliegt, und sieht jetzt, dass der Kopf nichts als ein Haubenstock und die Figur ein Fetzenbalg ist. Wütend eilt er hinab und durchstöbert das ganze Haus, alles fruchtlos, nur den Schmuckkasten seiner Frau findet er offen.
»Ha!« rief er, »man hat sie mir geraubt und ihre Kostbarkeiten dazu«, und augenblicklich läuft er, den Schwiegereltern sein Unglück zu erzählen. Als er aber schon nahe dem Hause ist, sieht er zu seiner grössten Überraschung auf dem Balkon ober dem Thor alle drei Schwestern, seine Gemahlinnen, welche ihm mit Hohngelächter eine Nase machen.
Drei Weiber auf einmal, das erschreckte den Teufel so sehr, dass er schleunigst die Flucht ergriff. Seit der Zeit hat er die Lust zum Heiraten verloren.
Georg Widter und Adam Wolf: Volksmärchen aus Venetien
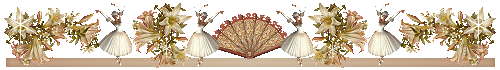
FORTUNA ...

Es war einmal eine Mutter, die einen einzigen Sohn hatte. Der ging lieber in die Schule, als daß er ländliche Arbeiten verrichtete. Die Mutter aber, die aus einer Bauernfamilie stammte, mochte deshalb den Sohn nicht, ja sie haßte ihn so sehr, daß sie beschloß, ihn zu vergiften. Was tut sie? Sie backt im Ofen einen Kuchen und tut Gift hinein, und eines Tages, da der Sohn aufs Feld ging, gibt sie ihm den Kuchen mit, daß er ihn essen sollte.
Der Sohn aber hatte einen Hund, der Fortuna hieß, und steckte nie etwas in den Mund, ohne erst Fortuna ein Stück davon zu geben. An jenem Tage machte er es wie alle Tage; ehe er den Kuchen aß, gab er dem Hund ein Stückchen davon, der augenblicklich starb. Darüber empfand der Sohn einen großen Schmerz und schwor, zur Mutter nicht mehr zurück zu kehren.
Er entfernte sich mit Tränen in den Augen von dem armen Tier und drehte sich im Weitergehen um, es noch einmal zu sehen. Plötzlich sieht er bei dem toten Hund sich etwas bewegen und kehrt zurück, um zu sehen, was es sei. Er findet vier Raben, die von Fortunas vergiftetem Fleisch gefressen hatten und gestorben waren. Zwei von ihnen nimmt er, tut sie in einen Quersack und geht in die weite Welt.
Er kommt in einen Wald und findet sechs Räuber. Sie hatten Hunger, nahmen dem Jüngling die beiden Raben und ließen sie braten, aßen sie dann, ohne dem Jüngling ein Stückchen davon zu geben, und starben alle sechs. Der Jüngling aber sah auf einem Baum einen Vogel, nahm die Büchse eines der toten Räuber und schoß.
Doch statt den Vogel zu treffen, traf er das Nest, das in der Nähe war, und das Nest fiel herunter. Zwei kleine Eier lagen darin, und die Vöglein darin waren noch nicht ausgekrochen. Er nahm sie und setzte seine Reise fort.
Er überschritt einen Fluß auf einer Brücke und befand sich in einem sehr dichten Wald, durch den ein Fluß lief. Es war Nacht, und er hatte Hunger. Er nahm ein Büchlein, das er in der Tasche hatte, zündete es mit einem Streichholz an und als er die Eier damit gekocht hatte, aß er sie. Dann legte er sich auf der Brücke zum Schlafen nieder.
Am Morgen kam er in eine Stadt und sah an den Mauern Plakate angeschlagen, auf denen stand: Wer der Tochter des Königs ein Rätsel sagen kann, das so schwer ist, daß sie es nicht errät, soll sie heiraten und wird königlicher Prinz werden. Doch wenn sie es rät, wird ihm der Kopf abgeschlagen werden.
Der Jüngling wollte sein Glück versuchen, ging zu der Königstochter, und machte aus dem, was ihm begegnet war, ein Rätsel, um zu versuchen, ob sie es raten könne. Er stellte sich der Prinzessin vor und sagte:
»Die Mutter wollte mich töten. - Ich wollte es nicht und tötete Fortuna. - Durch Fortuna (zum Glück) starben vier. - Durch die vier starben sechs. - Ich schoß nach dem, was ich sah, und traf, was ich nicht sah. - Ich aß Fleisch, das geschaffen, aber nicht geboren war - ich ließ es kochen mit gedruckten Worten - und habe geschlafen weder im Himmel, noch auf der Erde - das ratet, Prinzessin!«
Die Prinzessin kam nicht aus dem Verwundern und konnte es nicht raten. Da wollte sie, daß der Jüngling es ihr erkläre, und nachdem sie das Ungemach, das dieser Arme erlitten, gehört hatte, umarmte sie ihn und sagte: »Lieber Jüngling, du hast Fortuna so lieb gehabt und das arme Tier ist gestorben, um dir Glück (Fortuna) zu bringen. Jetzt umarme ich dich und du sollst mein Gatte werden.« Und in Freuden und Festen heirateten sie sich.
Basilicata
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
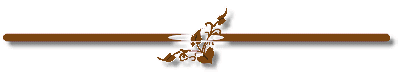
DIE JÜNGSTE, KLUGE KAUFMANNSTOCHTER ...

Es war einmal ein kleiner Kaufmann, der hatte drei Töchter, davon war die Jüngste, Maria, sehr schön, und zu gleich sehr klug und schlau. Eines Tages nun mußte der Vater verreisen; er rief also seine Töchter und sprach: »Liebe Kinder, ich muß fort; nehmt euch wohl in Acht, denn es sind unsichere Zeiten, seid also vorsichtig.« Damit schied er von ihnen.
Einige Tage vergingen ganz ruhig; eines Tages aber klopfte ein Bettler an die Tür und bat um ein Almosen. Dieser Bettler aber war ein verkleideter Räuber. »Wir wollen diesen Unbekannten nicht herein lassen,« riet die kluge Maria ihren Schwestern. Als aber der Bettler anfing zu jammern: »Ich bin so müde, ihr lieben Mädchen, es ist so lange her, daß ich nichts Warmes gegessen habe, und mich nicht ordentlich ausruhen kann,« ließen ihn die beiden älteren Mädchen doch herein.
Als der Bettler gegessen hatte, sprach er: »Es ist schon Nacht geworden, und wo soll ich ein Obdach finden? Ach, liebe Mädchen, laßt mich diese Nacht hier ruhen.« »Tut es nicht,« warnte Maria, aber die Schwestern hörten nicht auf sie, sondern machten dem Bettler ein Lager zu recht, und hießen ihn da bleiben. Maria aber konnte gar nicht schlafen, denn der Verdacht, das möchte kein wirklicher Bettler sein, verließ sie nicht.
Als nun Alles im Hause still geworden war, stand sie auf, schlich bis zu der Kammer wo der Bettler schlief und versteckte sich dicht daneben. Es dauerte nicht lange, so öffnete sich leise die Tür, und der vermeintliche Bettler trat heraus und schaute sich vorsichtig um. Er schlich die Treppe hinunter, schloß die Tür auf, versammelte durch einen Pfiff alle seine Gefährten, und alle zusammen brachen nun in den Laden des Kaufmannes ein.
Maria war schnell entschlossen; wie der Blitz sprang sie durch ein Hinterpförtchen ins Freie, und lief nach der Polizei. Die kam denn auch herbei, und es gelang ihnen, den einen Räuber, der sich als Bettler verkleidet hatte, zu ergreifen; die anderen entflohen, ließen aber ihren Raub im Stich.
Nun ging Maria zu ihren Schwestern, die noch schliefen, weckte sie, und sprach: »Seht ihr was eure Unvorsichtigkeit für Folgen haben konnte? Das und das ist geschehen.« Als nun der Vater zurück kam, hörte er wie mutig und klug seine Tochter gewesen war, und freute sich sehr darüber.
Der Räuberhauptmann aber konnte es gar nicht verwinden, daß ihm ein junges Mädchen seinen Plan vereitelt hatte, und schwur, sich dafür zu rächen. Er nahm also unter seinen Schätzen die schönsten Kleider, bestieg ein schönes Pferd, und kam so als ein großer, reicher Herr in die Stadt, wo Maria wohnte. Dort bezog er ein schönes Haus, und ging dann in den Laden des Kaufmanns, wo er allerlei kaufte, und sich dabei freundlich mit dem Kaufmann unterhielt.
Er gab sich für den Sohn eines Reichsbarons aus, und erzählte von seinen Reichtümern und seinem schönen Schloss. Den nächsten Tag kam er wieder, und so trieb er es, bis der Kaufmann ganz für ihn eingenommen war. Nun hielt er um seine jüngste Tochter an, und der Vater, hoch erfreut über die große Ehre, kam zu Maria und sprach: »Denke dir, mein Kind, der junge Baron will dich heiraten.«
Maria aber antwortete: »Ach, lieber Vater, ich bin ja gut bei euch, und niemand von uns kennt diesen jungen Mann, wie können wir wissen ob er das wirklich ist, wofür er sich ausgibt?« Der Vater aber war geblendet durch die Reichtümer und durch den hohen Rang des jungen Mannes, und versuchte immer wieder seine Tochter zu überreden, bis Maria endlich sprach:
»So tut denn, was ihr wollt.« Da wurde ein glänzendes Hochzeitsfest angestellt, und am Hochzeitstag brachte der Bräutigam einen Brief von seiner Mutter, und darin schrieb sie ihrem Sohn, sie könne leider nicht zur Hochzeit kommen, aber sie hoffe, der Sohn werde sie mit seiner jungen Frau besuchen. Also bestiegen die beiden nach der Hochzeit ihre Pferde und reisten fort.
Immer steiler und öder wurde der Weg, und Maria sah sich in einer ganz unbekannten, wilden Gegend. Auf einmal drehte sich der Räuberhauptmann nach ihr um, und rief ihr barsch zu: »Steige so gleich vom Pferd. Hast du wirklich gemeint, ich sei der Sohn eines Reichsbarons? Ich bin der Hauptmann jenes Räubers, der durch deine Schuld gehängt worden ist, und ich will mich dafür an dir rächen.«
Zitternd stieg Maria vom Pferd. »Jetzt ziehe deine Schuh und Strümpfe aus,« fuhr der Räuber fort, »und klettere jenen Berg hinauf.« Was konnte Maria tun? Sie mußte wohl gehorchen und mit ihren zarten Füßen den steilen Berg ersteigen. Als sie oben angekommen waren, riß der Räuber ihr ihre Kleider ab, band sie an einen Baum und fing an, sie mit Ruten zu peitschen.
»Wart nur,« rief er, »jetzt rufe ich meine Genossen, und dann werden wir dich zu Tode peitschen.« Damit verließ er sie. Da stand nun Maria am Baum fest gebunden, und konnte sich gar nicht helfen, und die Rutenhiebe schmerzten sie so sehr, daß sie in einem fort stöhnte.
Unweit von dem Baum aber zog sich ein schmaler Pfad hin, und auf diesem Pfad ritten eben ein Bauer und seine Frau hin. Die brachten einige Säcke roher Baumwolle zu Markt. Als sie nun das Stöhnen hörten, meinten sie es wäre ein Geist, bekreuzten sich und wollten schnell vorbei. Maria aber hörte sie und rief ihnen zu:
»Ach, lieben Leute, ich bin eine getaufte Seele wie ihr auch. Verlaßt mich nicht.« Da stieg der Bauer ab, und als er Maria sah, zog er schnell sein Messer aus der Tasche, schnitt die Stricke auf, mit denen sie gebunden war, und befreite sie. Doch was sollte nun geschehen, denn die Räuber konnten jeden Augenblick erscheinen.
Da riet der Bauer, Maria solle sich in einen von den Säcken stecken lassen. Das geschah denn auch, und rings um Maria herum stopfte der Bauer so viel Baumwolle, als nur in den Sack ging. Dann band er den Sack auf den Esel, setzte sich mit seiner Frau auf, und ritt nun davon, so schnell er konnte. Bald erschienen nun die Räuber, aber wie erstaunten sie, als sie sahen, daß Maria fort war.
Der Hauptmann schwur, er wolle sie dennoch umbringen, und setzte den Flüchtlingen nach. Bald erreichte er sie auch, und befahl grimmig dem Bauer zu halten. Bis in den Tod erschrocken, konnten sie doch nichts tun als gehorchen. Nun zog der Räuber sein Schwert, und stach damit in die Baumwollsäcke hinein, und versetzte der armen Maria mehrere Stiche.
Sie aber ließ keinen Laut hören, und weil das Schwert immer wieder durch die Baumwolle gezogen werden mußte, so wurden die Blutflecken dabei abgewischt, und der Räuber ließ sich täuschen, und erlaubte den Bauern ihres Weges zu ziehen. Nach einem Weilchen aber lief er ihnen nach, zwang sie zu halten, und stach wieder mit seinem Schwert in die Säcke. Es gelang ihm aber nicht besser als das erste Mal, und so ließ er endlich die Leute ziehen.
Als sie nun in die nächste Stadt kamen, hielten sie bei einer Bekannten an, und sprachen: »Wollt ihr uns einen Gefallen tun, Frau Gevatterin, so gebt uns euer bestes Bett, denn wir haben hier ein armes verwundetes Mädchen, das wir eurer Pflege anvertrauen.« Da legten sie Maria ins Bett, und weil sie fort mußten, so empfahlen sie sie der Gevatterin.
Bei dieser blieb nun Maria, bis sie sich ganz erholt hatte, und wenn man nach ihr frug, so antwortete die Alte immer: »Es ist meine Nichte.« Als nun Maria wieder wohl war, sprach sie eines Tages zu der Alten: »Ich bin nun wieder gesund und will euch nicht länger zur Last fallen; seht zu, ob ihr mir einen Dienst verschaffen könnt.« Die Alte erkundigte sich, und erfuhr, der König suche ein Kammermädchen.
Da ließ sich Maria melden, und weil sie dem König so wohl gefiel, nahm er sie in seinen Dienst. Je mehr aber der König sie sah, desto besser gefiel sie ihm, und eines Tages sprach er zu ihr: »Du sollst meine Gemahlin sein, und keine Andere!« Da mußte sie ihm erzählen, daß sie verheiratet sei, und wie sie an den Räuberhauptmann gekommen.
»O,« rief der König, »wenn es weiter nichts ist, den wollen wir schon kriegen, und wenn er erst einmal gehängt ist, dann bist du seine Frau nicht mehr.« Also wurde Maria von allen als des Königs Gemahlin angesehen.
Als sie nun eines Tages zusammen am Fenster standen, ging eben der Räuberhauptmann vorbei. »Oho,« dachte er, »lebst du auch noch, und bist noch gar des Königs Frau? Wart nur, ich will dich schon kriegen!« Er ging geraden Wegs zu einem Goldschmied, und sprach: »Meister, ihr müßt mir einen silbernen Adler machen, der inwendig hohl ist, und so groß, daß ich darinnen stehen kann, und er muß in drei Tagen fertig sein.«
Der Goldschmied versprach es, und nahm eine ganze Schar Gesellen, die mußten Tag und Nacht arbeiten, um den Adler fertig zu machen. Als nun die Arbeit fertig war, rief der Räuber einen Lastträger herbei, und sprach: »Mit diesem Adler mußt du so lange an des Königs Fenstern vorbei gehen, bis der König Lust bekommt ihn zu kaufen.« Dann schloß er sich selbst in den Adler ein, der Lastträger nahm ihn auf den Rücken, und trug ihn vor des Königs Fenster vorbei.
Der König stand wieder mit Maria an dem Balkon, und da er den schönen silbernen Adler sah, rief er: »Sieh nur, Maria, wie schön! Den wollen wir uns kaufen.« Maria aber hatte damals den Räuber wohl erkannt; deshalb war sie mißtrauisch und sprach: »Ach, Majestät, ihr habt ja sonst so viele schöne Sachen, was wollt ihr noch das schwere Geld ausgeben!«
Dem König aber gefiel der Adler so gut, daß er den Lastträger herauf rief, ihm den Adler abkaufte und in sein Zimmer bringen ließ. Als nun der König und Maria schliefen, schloß der Räuber den Adler auf und trat hinaus. Vorsichtig schlich er an das Bett des Königs, und legte ein Blatt Papier auf das Kopfkissen; so lange das liegen blieb, konnte weder der König noch die Leute im Hause aufwachen.
Dann trat er zu Maria, ergriff sie und schleppte sie in die Küche. »Du dachtest wohl, ich würde dich hier nicht finden,« sagte er höhnisch, und nahm den größten Kessel, füllte ihn mit Öl und setzte ihn aufs Feuer. »Darin will ich dich sieden!« sprach er. Nun war Maria übel dran, aber sie verlor den Mut doch nicht, sondern sprach: »Muß ich denn sterben, so geschehe es! Laß mich nur vorher meinen Rosenkranz holen, daß ich noch einmal beten kann.«
Der Räuber erlaubte es, und Maria eilte in die Kammer, und rief den König. Aber so sehr sie auch rufen mochte, es half nichts; sie stieß und zupfte ihn, alles vergebens. Da faßte sie ihn in der Verzweiflung am Bart und schüttelte ihn; durch die Bewegung aber fiel das Blatt herunter, der König erwachte plötzlich, und mit ihm alle Leute im Haus.
Da führte sie Maria in die Küche, wo der Räuber noch immer das Feuer schürte; den ergriffen sie und warfen ihn in das siedende Öl. Maria aber heiratete den König und es war eine glänzende Hochzeit. Ihren Vater und ihre Schwestern ließ sie zu sich kommen, und so lebten sie alle glücklich und zufrieden, wir aber haben das Nachsehen!
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON SORFARINA ...

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten einen einzigen Sohn. Damit nun der Knabe Alles das lernen sollte, was zu seinem Stande gehörte, schickten sie ihn zu einem Lehrer in die Schule. In die selbe Schule gingen auch viele andere Kinder, darunter die Tochter eines Kaufmanns, die war schöner als die Sonne und hieß Sorfarina. Von allen Kindern lernte Sorfarina am besten, viel besser, als der Königssohn, und der Lehrer war stolz auf sie und hatte sie sehr lieb.
Nun begab es sich eines Tages, daß der Lehrer eine Reise machen mußte, und gar nicht wußte, wem er während seiner Abwesenheit die Schule überlassen solle. Da er nun so in Gedanken saß, frug ihn Sorfarina: »Herr Lehrer, was habt ihr?« »Ach, Sorfarina, ich bin in großer Verlegenheit; denn ich muß eine Reise machen, und weiß nicht, wem ich die Schule überlassen soll.«
»Überlasst sie doch mir,« sagte Sorfarina, »so will ich unterdessen die Schüler lehren.« Der Lehrer war es zufrieden und reiste ab, und Sorfarina hielt die Schule. Wie sie aber eines Tages den Königssohn unterrichtete, wollte er nicht aufmerksam sein; da ward sie zornig und gab ihm eine Ohrfeige. Der Königssohn antwortete nichts, aber er behielt diese Beleidigung in seinem Herzen.
Viele Jahre vergingen, der Königssohn ging nicht mehr zur Schule, und Sorfarina war ein wunderschönes Mädchen geworden, so schön, daß er in heftiger Liebe zu ihr entbrannte.
Eines Tages kam er zu seinem Vater, und sprach: »Lieber Vater, ich habe nun eine Braut gefunden, die mir gefällt; meine Gemahlin soll die schöne Sorfarina sein.« Der König hätte nun freilich lieber gesehen, daß sein Sohn eine Königstochter geheiratet hätte, weil er ihm aber niemals »nein« sagen konnte, so sprach er: »Nun gut, mein Sohn, wenn du sie willst, so nimm sie.«
Also wurde eine prächtige Hochzeit gefeiert, mit vielen Festlichkeiten, und der Königssohn heiratete die schöne Sorfarina. Als sie aber in ihre Kammer gegangen waren, um sich schlafen zu legen, sprach er: »Sorfarina, denkst du noch daran, wie du mir damals eine Ohrfeige gegeben hast? Sage mir doch, bereust du es nicht?« »Nein,« antwortete sie,
»Ich habs nicht bereut und bereue es nicht,
Und braucht es noch eine, die zweite du kriegst!«
»Was?« rief der Königssohn im höchsten Zorn, »du wagst es, mir so etwas zu sagen? So will ich dich auch nicht in meinem Bett!« Damit stieß er sie zum Bette hinaus, und Sorfarina mußte auf dem Boden schlafen. Weil er sie aber so lieb hatte, tat ihm das Herz weh, wenn er sie so auf den kalten Steinen liegen sah, und er sprach zu ihr: »Liebe Sorfarina, sage es mir doch, bereust du es nicht?« »Nein,« sprach sie,
»Ich habs nicht bereut und bereue es nicht,
Und braucht es noch eine, die zweite du kriegst!«
Er mochte bitten und ihr zärtlich zureden, so viel er wollte, sie gab ihm keine andere Antwort, so daß er endlich ganz böse wurde und rief: »Nun gut, so bleibe wo du bist!« Am anderen Morgen lief er zu seiner Mutter, der Königin, und erzählte ihr alles, und sagte: »Denkt euch nur, nach dem sie die ganze Nacht auf dem kalten Boden gelegen hat, will sie es doch nicht sagen!«
»Aber, mein Sohn,« antwortete die Königin, »laß sie doch gehen, das sind ja längst vergangene Dinge.« »Nein, Mutter, ich will nun einmal,« daß sie es sagen soll. Nun lief er wieder zu Sorfarina: »Sorfarina, sage mir, bereust du es nicht?«
»Ich habs nicht bereut und bereue es nicht,
Und braucht es noch eine, die zweite du kriegst!«
»Ach, Sorfarina,« klagte er, »was bist du eigensinnig! Weißt du, daß ich dich in den Brunnen werfen lasse, wenn du es nicht sagst?« »So laß mich in den Brunnen werfen!« Kurz, obgleich er mehrmals am Tage zu ihr hin lief, und es bald auf die eine Weise versuchte, bald auf die andere, es war nicht möglich, von ihr eine andere Antwort zu bekommen.
Endlich wurde er böse, und ließ sie in einen leeren Brunnen werfen, der im Hof war. Alle Augenblicke aber lief er zu dem Brunnen: »Sorfarina, ich bitte dich, sage mir doch, bereust du?« »Nein,« sagte sie,
»Ich habs nicht bereut und bereue es nicht,
Und braucht es noch eine, die zweite du kriegst!«
»Weißt du aber auch, daß ich weit weg reise, und dich hier im Brunnen lasse?« »Reise so viel du willst,« antwortete sie, »erweise mir nur vorher die Gnade, mir zu sagen, ob du zu Land oder zu Wasser reisest.« So vergingen noch mehre Tage, und Sorfarina wollte sich weder durch Bitten noch durch Drohungen bewegen lassen, zu sagen, daß sie bereue.
Als der Königssohn sie so eigensinnig sah, rief er ihr endlich zu: »Lebe wohl! ich reise nach Rom.« »Glückliche Reise! gehst du zu Land oder zu Wasser?« »Zu Wasser.« »Gut, dachte Sorfarina bei sich, so werde ich zu Land gehen.« Der Königssohn verreiste, und also bald stieg Sorfarina aus dem Brunnen und reiste zu Land nach Rom. Dort nahm sie ein hübsches Haus, dem Wirtshaus gerade gegenüber, in welchem der Königssohn abgestiegen war.
Als er nun eines Morgens zum Fenster heraus schaute, sah er sie gegenüber im Balkon stehen, und schaute sie ganz verwundert an, und dachte: »Ei, wie ist jene Frau so wunderschön! Wenn ich nicht meine Frau Sorfarina im Brunnen gelassen hätte, so würde ich sagen, sie sei es.« Da grüßte er sie, und redete sie an, und sie antwortete ihm freundlich.
Nach einigen Tagen kam er zu ihr ins Haus, und kurz, sie schlossen eine so innige Freundschaft, daß nach einem Jahr ein schönes Knäblein zur Welt kam, das nannten sie Romano. Er hatte ihr aber erzählt, wie er zu Hause eine wunderschöne aber eigensinnige Frau habe, die sich nicht dazu bequemen wolle, ihm zu sagen, daß sie die Ohrfeige bereue.
»Ach,« hatte Sorfarina gesagt, »verzeiht doch der armen Frau, und nehmt sie aus dem Brunnen heraus.« »Nein, ich will nun einmal, daß sie tue, was ich von ihr verlange.«
Als nun das Knäblein einige Monate alt war, sagte eines Tages Sorfarina zum Königssohne: »Geht doch einmal nach Haus, und seht nach, ob eure arme Frau noch im Brunnen sitzt, sie hat sich jetzt vielleicht eines Besseren besonnen.« Da reiste der Königssohn zu Wasser nach Haus, Sorfarina aber ließ ihr Kind bei den Feen, die ihr untertan waren, denn sie konnte zaubern, und reiste auch nach Hause, und als der Königssohn ankam, saß sie schon im Brunnen.
»Nun, Sorfarina,« sprach er, »willst du noch immer eigensinnig sein? Ich bitte dich darum, sage mir doch, daß du es bereust.« »Nein,« sprach sie,
»Ich habs nicht bereut und bereue es nicht,
Und braucht es noch eine, die zweite du kriegst.«
Der Königssohn war ganz verzweifelt, denn er liebte seine Sorfarina doch so sehr, und nun wollte sie ihm nicht den Willen tun. Da sprach er eines Tages zu ihr: »Sorfarina, wenn du es nicht bereuen willst, so reise ich heute noch nach Neapel ab.« »Glückliche Reise! Gehst du zu Land oder zu Wasser?« »Zu Wasser.« »So werde ich zu Lande gehen,« dachte sie, und kaum war der Königssohn verreist, so stieg sie aus dem Brunnen, und reiste auch nach Neapel.
Dort nahm sie ein Haus, dem Wirtshaus gegenüber, in dem er wohnte, und als er zum Fenster heraus sah, stand auch sie im Balkon, daß er sie verwundert anschaute. »Was ist denn das nur? Wenn ich nicht meine Frau im Brunnen verlassen hätte, und die Römerin in Rom, so müßte ich denken, diese schöne Frau sei eine von ihnen.« Er grüßte sie und redete sie an, sie antwortete freundlich, und um es kurz zu sagen, nach einem Jahr hatte der Königssohn wieder ein Knäblein, das nannten sie Napolitano.
Als das Kind einige Monate alt war, sprach Sorfarina zu ihm: »Wollt ihr nicht einmal nach Hause gehen, und sehen, ob eure Frau sich besonnen hat?« Also reiste der Königssohn nach Haus, aber Sorfarina war schneller als er, und als er an den Brunnen lief, stand seine Frau auch schon darinnen und frug: »Nun, hast du viel Vergnügen genossen?«
»Ach, Sorfarina, wenn du mir doch den Willen tun wolltest, wie gerne wollte ich bei dir bleiben! Bitte, liebe Sorfarina, sage mir doch, daß du es bereust!« Sorfarina aber gab immer die selbe Antwort, er mochte bitten oder drohen, so viel er wollte, so daß er eines Tages zornig wurde und sagte: »Sorfarina, sage es! sonst reise ich heute noch nach Genua ab!« »Glückliche Reise!« rief sie spottend, und so bald er verreist war, stieg sie aus dem Brunnen, und war zu gleicher Zeit mit ihm in Genua.
Dort nahm sie wieder ein Haus dem Wirtshaus gegenüber, in dem ihr Mann wohnte, und das erste, was er sah, als er zum Fenster hinaus blickte, war wieder die schöne Frau, die gegenüber im Balkon stand. »Das geht nicht mit rechten Dingen zu!« rief er. »Da ist wieder eine schöne Frau, die meiner lieben Sorfarina gleicht.
Wenn ich nicht meine Frau im Brunnen gelassen hätte, und die Römerin in Rom, und die Neapolitanerin in Neapel, müßte ich denken, es sei eine von ihnen.« Nun grüßte er sie, sie dankte; bald schlossen sie Freundschaft, und ehe ein Jahr herum war, kam ein Töchterlein zur Welt, das nannten sie Genova.
Als das Mädchen einige Monat alt war, sprach Sorfarina eines Tages zu ihm: »Wollt ihr nicht einmal nach Hause reisen, und nach eurer armen Frau sehen? Wer weiß, sie hat sich vielleicht besonnen!« Da reiste der Königssohn nach Hause, aber auch Sorfarina war nicht faul, und als er an den Brunnen kam, stand sie schon darinnen.
»Liebe Sorfarina,« bat er, »nun wirst du gewiß nicht mehr eigensinnig sein; ich bitte dich, sage mir doch, daß du es bereust.«
»Ich habs nicht bereut und bereue es nicht,
Und braucht es noch eine, die zweite du kriegst.«
Der Königssohn mochte zum Brunnen laufen, so oft er wollte. Sorfarina gab immer die selbe Antwort. »Sorfarina!« sagte er endlich, »wenn du mir jetzt nicht den Willen tust, so werde ich eine andere Frau nehmen!« »Nimm sie dir!« antwortete sie. Da ließ er eine schöne Königstochter kommen, und es sollte eine prächtige Hochzeit gefeiert werden.
Der Königssohn konnte aber doch seine geliebte Sorfarina nicht vergessen, lief wieder zu ihr, und bat sie: »Sorfarina, tue es doch mir zu Liebe; denn sieh, es ist mein Ernst, daß ich eine andre Frau nehmen will, und heute Abend ist großer Ball im königlichen Schloß.« »Ich wünsche dir viel Vergnüngen,« antwortete sie, »tue was du willst.«
Am Abend aber wünschte sie sich ihre drei Kinder herbei, und als bald standen sie vor ihr, und waren so fein und schön, daß man keine schöneren Kinder sehen konnte, und trugen prächtige königliche Kleider.
Da wünschte sie sich auch die herrlichsten Gewänder, und den reichsten Schmuck, und viele Dienerinnen, die mußten sie mit wohl riechendem Wasser waschen, und sie fein schmücken, und endlich wünschte sie sich auch noch einen goldnen Wagen, mit vier Pferden bespannt, und mit allem, was dazu gehört. Da stieg sie in den Wagen, und ihre drei Kinder mit ihr, und fuhr aufs Schloß.
Als sie ankam, und mit ihren drei Kindern in den Saal trat, schauten alle Leute sie voll Bewunderung an, denn sie war die schönste von allen, und es hatte sonst keine so herrliche Gewänder. Der Königssohn aber eilte auf sie zu, und wollte mit ihr tanzen. Da rief sie mit heller Stimme: »Romano und Neapolitano, nehmt eure Schwester Genova an die Hand, und tanzt mit ihr.«
Als nun der Königssohn diese Namen hörte, blieb er wie erstarrt stehen, und da er sie genauer ansah, erkannte er sie auf einmal, und rief: »Ach! Sorfarina! Du bist es? Und du warst auch die Römerin, die Neapolitanerin und die Genueserin?« »Ja wohl, ich war es,« antwortete sie, »so vertriebst du dir also die Zeit, während du deine Frau im Brunnen ließest?« und gab ihm vor der ganzen Gesellschaft eine Ohrfeige.
Nun denkt euch, wie gekränkt der Königssohn war, als sie ihn vor der ganzen Gesellschaft so behandelte, doch konnte er nicht anders, als sie um Verzeihung bitten, und als er gar seine Kinder sah, umarmte er sie voll Freude, und sprach zu Sorfarina: »Nun sollst du auch meine liebe Gemahlin bleiben.«
Also mußte die fremde Königstochter nach Hause zurück kehren, und der Königssohn nahm Sorfarina als seine Gemahlin wieder zu Ehren an. Sie war aber klug, und dachte immer: »Wer weiß, ob er mir wirklich verziehen hat.« Als sie nun zu erst in ihre Kammer gegangen war, machte sie sich eine schöne Puppe aus Zucker und Honig, ganz in ihrer Größe, die hatte am Halse ein Strickchen, und wenn sie daran zog, nickte sie mit dem Kopf.
Diese Puppe legte sie in ihr Bett, sie selbst aber legte sich unter das Bett, und nahm das Strickchen in die Hand. Es dauerte nicht lange, so kam der Königssohn auch in die Kammer, und trat ans Bett, und frug sie: »Nun, Sorfarina, bereust du noch immer nicht?« Da zog Sorfarina an dem Strickchen, daß die Puppe den Kopf schüttelte, als ob sie »nein« gesagt hätte.
»Was?« rief er, »auch jetzt bist du noch so eigensinnig?« und ward so zornig, daß er sein Schwert zog und der Puppe den Kopf abschnitt. Als er aber das Schwert durch den Mund zog, um es abzuwischen, schmeckte das Blut so süß, daß er ganz traurig wurde, und rief: »Ach! so süß war dein Blut, herzliebste Sorfarina, und ich habe dich umgebracht! So will ich auch nicht länger leben!« und wollte sich das Schwert in die Brust stoßen.
Da sprang aber Sorfarina hinter dem Bett hervor, fiel ihm in die Arme, und rief: »Halt ein! Ich bin ja noch am Leben, und die Taube von Honig und Zucker wollen wir als Mann und Frau verzehren.« Da umarmte er seine liebe Frau voll Freude, und sprach: »So hast du mich bis hierher angeführt; nun, ich verzeihe dir alles.«
»Und ich will dir auch sagen, daß ich es bereue, dir die Ohrfeige gegeben zu haben,« rief sie. Da ward die Freude erst recht groß, und sie blieben glücklich und zufrieden mit ihren Kindern; wir aber sind hier sitzen geblieben.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON SAN JAPICU ALLA LIZIA ...

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder, und wollten doch so gerne einen Sohn oder eine Tochter haben. Da wandte sich die Königin an San Japicu alla Lizia und sprach: »Oh, San Japicu, wenn ihr mir einen Sohn beschert, so gelobe ich euch, daß er die Wallfahrt zu euch machen soll, wenn er achtzehn Jahre alt ist.«
Nicht lange, so wurde die Königin durch die Gnade Gottes und des Heiligen guter Hoffnung, und als ihre Stunde kam, gebar sie einen wunderschönen Knaben, der war so schön, als ob Gott ihn gemacht hätte. Der Knabe wuchs an einem Tage für zwei, und wurde mit jedem Tage größer und schöner. Als er etwa zwölf Jahre alt war, starb der König, und die Königin blieb allein mit diesem Sohne, den sie liebte, wie ihre Augen.
So vergingen viele Jahre, und die Zeit rückte heran, wo der Königssohn achtzehn Jahre alt werden sollte. Wenn aber die Königin daran dachte, daß sie sich bald von ihm trennen sollte, um ihn ganz allein auf die weite Wallfahrt zu schicken, wurde sie ganz traurig und weinte und seufzte den ganzen Tag.
Da sprach eines Tages der Königssohn zu ihr: »Mutter, was seufzt ihr den ganzen Tag?« »Nichts, nichts mein Sohn, ich habe nur einige Sorgen,« antwortete sie. »Worüber sorgt ihr euch denn?« fragte er. »Fürchtet ihr, eure Güter in der Chiana seien schlecht bestellt? So laßt mich hin gehen, daß ich nach sehe, und euch Nachricht bringe.«
Die Königin war es zufrieden, und der Königssohn machte sich auf, und ritt in die Chiana, auf die Güter, die ihnen gehörten. Er fand aber alles in schönster Ordnung, kam wieder zu seiner Mutter und sprach: »Liebe Mutter, seid fröhlich, und lasst die Sorgen fahren, denn auf euren Gütern ist alles in Ordnung: das Vieh gedeiht, die Felder sind bestellt, und das Getreide wird bald reif sein.«
»Gut, mein Sohn,« antwortete die Königin, wurde aber doch nicht fröhlich, und am nächsten Morgen fing sie wieder an zu seufzen und zu weinen. Da sprach der Königssohn zu ihr: »Liebe Mutter, wenn ihr mir nun nicht sagt, warum ihr so bekümmert seid, so mache ich mich auf, und wandere in die weite Welt hinaus.«
Da antwortete ihm die Mutter Königin: »Ach, lieber Sohn, ich bin bekümmert, weil du nun von mir scheiden mußt. Denn da ich dich so ersehnte, gelobte ich dem San Japicu alla Lizia, wenn er mir dich beschert, so würdest du zu ihm wallfahrten, wenn du achtzehn Jahre alt sein würdest. Und nun bist du bald achtzehn Jahre alt, und darum bin ich bekümmert, daß du nun allein fort wandern mußt, und so viele Jahre weg bleiben, denn um zum Heiligen zu kommen, muß man ein ganzes Jahr lang wandern.«
»Ist es nichts weiter als das, liebe Mutter?« sagte der Sohn. »Seid doch nicht so bekümmert. Nur die Toten kehren nicht wieder; wenn ich aber am Leben bleibe, so werde ich ja bald zu euch zurück kehren.« So tröstete er seine Mutter, und als er achtzehn Jahre alt wurde, nahm er Abschied von der Königin und sprach:
»Nun lebt wohl, liebe Mutter, und so Gott will, werden wir uns wieder sehen.« Die Königin weinte bitterlich, und umarmte ihn mit vielen Tränen; dann gab sie ihm drei Äpfel und sprach: »Mein Sohn, nimm diese drei Äpfel, und gib wohl acht auf meine Worte. Du sollst nicht allein den ganzen, langen Weg zurück legen.
Wenn sich nun ein Jüngling zu dir gesellt und mit dir wandern will, so nimm ihn mit in die Herberge, und laß ihn mit dir essen. Nach dem Essen aber zerschneide einen Apfel in zwei Hälften, eine kleinere und eine größere, und biete sie dem Jüngling an. Nimmt er die größere Hälfte, so trenne dich von ihm, denn er wird dir kein treuer Freund sein; nimmt er aber die kleinere, so betrachte ihn als deinen Bruder, und teile alles mit ihm, was dein ist.« Nach diesen Worten umarmte sie ihren Sohn und segnete ihn, und der Königssohn wanderte fort.
Er war schon eine lange Zeit gewandert, und noch niemand war ihm begegnet. Eines Tages aber sah er einen Jüngling des Weges da her kommen, der gesellte sich zu ihm und frug ihn: »Wohin wandert ihr, schöner Jüngling?«
»Ich wallfahrte zum San Japicu alla Lizia, denn da meine Mutter keine Kinder bekam, gelobte sie ihm, wenn er ihr einen Sohn beschert, so sollte ihr Sohn zu dem Heiligen wallfahrten, wenn er achtzehn Jahr alt sein würde. Da bescherte ihr der Heilige einen Sohn, das bin ich, und weil ich nun achtzehn Jahre alt bin, mache ich die Wallfahrt nach Lizia.«
»Da muß ich auch hin,« sagte der Andre, »denn meiner Mutter ist es gerade so ergangen wie der eurigen; wenn wir also den gleichen Weg machen müssen, so können wir auch zusammen gehen.« Da wanderten sie miteinander weiter; der Königssohn aber war nicht vertraulich gegen seinen Gefährten, denn er dachte: »erst muß ich die Probe mit dem Apfel machen.«
Da sie nun bei einem Wirtshaus vorbei kamen, sprach der Königssohn: »Mich hungert; wollen wir uns nicht etwas zu essen geben lassen?« Der Andere war es zufrieden, und so gingen sie hinein und aßen zusammen. Als sie aber gegessen hatten, zog der Königssohn den Apfel hervor, zerschnitt ihn in zwei ungleiche Hälften und bot sie dem Andern dar; der nahm die größere Hälfte.
»Du bist kein treuer Freund,« dachte der Königssohn, und um sich von ihm zu trennen, stellte er sich, als ob er krank würde und liegen bleiben müsse. Da sprach der Andre: »Ich kann nicht auf euch warten, denn ich muß noch weit wandern; darum lebt wohl.« »Lebt wohl,« sagte der Königssohn und war froh, ihn los zu sein.
Da er sich aber wieder auf den Weg machte, dachte er: »Ach, wenn Gott mir doch einen treuen Freund her führte, daß ich nicht allein wandern muß.« Nicht lange, so gesellte sich ein Jüngling zu ihm und frug: »Wohin wandert ihr, schöner Jüngling?« Da erzählte ihm der Königssohn, wie seine Mutter das Gelübde getan hatte, in eine Wallfahrt zum San Japicu alla Lizia machen zu lassen, und wie er nun auf dem Wege dahin sei.
»Da muß ich auch hin,« sagte der Jüngling, »denn meine Mutter hat das selbe Gelübde getan.« »Ei, da könnten wir ja zusammen wandern,« rief der Königssohn, und so zogen sie zusammen weiter. Als sie aber an der nächsten Herberge vorbeikamen, sprach der Königssohn: »Mich hungert, wir wollen eintreten und uns etwas zu essen geben lassen.«
Da traten sie ein und aßen mit einander, und nach dem Essen zerschnitt der Königssohn auch den zweiten Apfel in zwei ungleiche Hälften und reichte sie seinem Gefährten; der nahm die größere Hälfte. »Du bist kein treuer Freund,« dachte der Königssohn, und um sich von ihm zu trennen, stellte er sich wieder krank und ließ den Andern allein ziehen; er aber machte sich traurig auf den Weg und dachte: »O, Gott, laßt mich doch einen treuen Freund finden, der mir auf der weiten Reise ein Bruder sei!«
Wie er noch so betete, sah er einen Jüngling des Wegs daher kommen, der war ein schöner Bursche und sah so freundlich aus, daß er ihn gleich lieb gewann, und dachte: »Ach, könnte dieser doch der treue Freund sein!« Der Jüngling gesellte sich zu ihm und frug: »Wohin wandert ihr, schöner Jüngling?« Da erzählte ihm der Königssohn, welches Gelübde seine Mutter für ihn gemacht hatte, und wie er nun zum Heiligen wallfahrten müsse.
»Da muß ich auch hin,« rief der Jüngling »denn meine Mutter hat das selbe gelobt.« »Ei, da könnten wir ja zusammen wandern,« sagte der Königssohn, und so zogen sie denn zusammen weiter. Der Jüngling war aber so freundlich und höflich, daß der Königssohn immer mehr wünschte, dieser möge nun doch endlich sich als treuer Freund erweisen.
Da sie nun bei einer Herberge vorbei wanderten, sprach er: »Mich hungert, wir wollen hinein gehen und etwas zusammen essen.« Da traten sie ein und ließen sich etwas zu essen geben, und nach dem Essen zerschnitt der Königssohn auch noch den letzten Apfel in zwei ungleiche Teile und reichte sie dem Jüngling dar; und siehe da, der Gefährte nahm die kleinere Hälfte, und der Königssohn freute sich, daß er einen treuen Freund gefunden hatte.
»Schöner Jüngling,« sprach er zu ihm, »wir beide müssen uns nun als Brüder betrachten, und was mein ist, soll auch dir gehören, und was dein, soll auch mein sein. Und so wollen wir zusammen wandern, bis wir zum Heiligen kommen, und wenn Einer unterwegs stirbt, muß ihn der Andre tot bis hin bringen. Das wollen wir beide geloben!« Da gelobten sie es Beide und betrachteten sich als Brüder und wanderten zusammen weiter.
Um zum Heiligen zu kommen, brauchte man ein ganzes Jahr; denkt euch nun, wie viel die beiden wandern mußten. Eines Tages nun, da sie müde und matt in eine große, schöne Stadt kamen, sprachen sie: »Wir wollen hier einige Tage bleiben und ausruhen, und nachher unsern Weg weiter fortsetzen.« Also nahmen sie ein kleines Haus und wohnten darin.
Gegenüber aber stand das königliche Schloß. Da nun eines Morgens der König auf dem Balkon stand und die beiden schönen Jünglinge sah, dachte er: »Ei, wie sind diese beiden Jünglinge so schön; der Eine ist aber doch noch schöner als der Andre, dem will ich meine Tochter zur Frau geben.« Der Königssohn war aber der schönere von den beiden.
Um nun seinen Zweck zu erreichen, ließ der König sie Beide zu Tische laden, und als sie aufs Schloß kamen empfing er sie sehr freundlich und ließ auch seine Tochter rufen, die war schöner als die Sonne und der Mond. Als sie aber zu Bette gingen, ließ der König dem Reisegefährten des Königssohnes einen schädlichen Trank geben, daß er wie tot hinfiel; denn er dachte: »wenn sein Freund stirbt, wird der Andre gern hier bleiben und nicht mehr an seine Wallfahrt denken, sondern meine Tochter heiraten.«
Am anderen Morgen, als der Königssohn erwachte, frug er: »Wo ist mein Freund?« »Der ist gestern Abend plötzlich gestorben und soll so gleich begraben werden,« antworteten ihm die Diener. Der Königssohn aber antwortete: »Ist mein Freund tot so kann ich auch nicht länger hier bleiben, sondern muß noch in dieser Stunde fort.«
»Ach, bleibt doch hier!« bat der König, »ich will euch auch meine Tochter zur Gemahlin geben.« »Nein,« sagte der Königssohn, »ich kann nicht hier bleiben.« »Wollt ihr mir aber eine Bitte gewähren, so schenkt mir ein Pferd und laßt mich in Frieden ziehen, und wenn ich meine Wallfahrt vollbracht habe, will ich wieder kommen und eure Tochter heiraten.«
Da gab ihm der König ein Pferd, und der Königssohn setzte sich darauf und nahm seinen toten Freund vor sich auf den Sattel und vollendete so seine Reise. Der Jüngling war aber nicht tot, sondern er lag nur in einem tiefen Schlaf.
Als nun der Königssohn zum San Japicu alla Lizia kam, stieg er vom Pferd, nahm den Freund wie ein Kind in seine Arme und trat so in die Kirche, legte den Toten auf die Altarstufen vor den Heiligen hin und betete: »Ach, San Japicu alla Lizia! seht, ich habe mein Gelübde erfüllt, und bin zu euch gekommen und habe euch auch meinen Freund her gebracht.
Euch übergebe ich ihn nun; wollt ihr ihm das Leben wieder schenken, so wollen wir eure Gnade loben; soll er aber nicht wieder lebendig werden, so hat er doch wenigstens sein Gelübde erfüllt.« Und siehe da, wie er noch so betete, erhob sich der tote Freund und ward wieder lebendig und gesund. Da dankten sie Beide dem Heiligen und machten ihm große Geschenke und dann machten sie sich auf den Weg nach Hause.
Als sie nun in die Stadt kamen, wo der König wohnte, bezogen sie wieder das kleine Haus, daß dem königlichen Schloß gegenüber lag. Der König aber freute sich sehr, daß der schöne Königssohn wieder da war und noch viel schöner geworden war; er veranstaltete große Festlichkeiten und ließ eine prächtige Hochzeit feiern, und so heiratete der Königssohn die schöne Königstochter.
Nach der Hochzeit blieben sie noch einige Monate bei ihrem Vater, dann aber sprach der Königssohn: »Meine Mutter wartet zu Hause mit großen Sorgen auf mich; darum kann ich nun nicht länger hier bleiben, sondern will mich mit meiner Frau und meinem Freund aufmachen und zu meiner Mutter zurück kehren.«
Der König war es zufrieden und so bereiteten sie sich zur Reise. Nun hatte aber der König einen tiefen Haß gegen den armen, unglücklichen Jüngling, dem er damals den schädlichen Trank gereicht hatte und der dennoch lebendig zurück gekehrt war, und um ihm ein Leid anzutun, schickte er ihn am Morgen der Abreise mit einem Auftrag eilends über Land.
»Geh nur schnell,« sagte er, »Dein Freund wird deine Rückkehr schon abwarten, ehe er abreist.« Da eilte der Jüngling fort, ohne nur Abschied zu nehmen und richtete den Auftrag des Königs aus. Dieser aber sprach zum Königssohne: »Eilt euch, daß ihr fort kommt, sonst könnt ihr vor Abend das Nachtlager nicht erreichen.«
»Ich kann ohne meinen Freund nicht reisen,« antwortete der Königssohn; der König aber sagte: »Macht euch nur auf den Weg; in einer kleinen Stunde ist er wieder da, und wird euch mit seinem schnellen Pferde bald einholen.« Der Königssohn ließ sich bereden, nahm Abschied von seinem Schwiegervater und reiste mit seiner Frau ab.
Der arme Freund aber konnte den Auftrag des Königs erst nach vielen Stunden erfüllen, und als er endlich wieder kam, sprach der König zu ihm: »Dein Freund ist schon weit von hier; siehe du nun selber zu, wie du ihn einholen kannst.«
Also mußte der arme Jüngling den königlichen Palast verlassen und bekam nicht einmal ein Pferd und fing an zu laufen, und lief Tag und Nacht, bis er den Königssohn einholte.
Von der großen Anstrengung aber bekam er einen furchtbaren Aussatz, also daß er krank, elend und schrecklich anzusehen war. Der Königssohn aber nahm ihn dennoch freundlich auf und pflegte ihn wie seinen Bruder. So kamen sie endlich nach Hause, wo die Königin mit vielen Sorgen auf ihren Sohn gewartet hatte und ihn nun voller Freude umarmte.
Der Königssohn ließ sogleich ein Bett herrichten für seinen kranken Freund und ließ alle Ärzte der Stadt und des Landes zusammen rufen, aber keiner konnte ihm helfen. Da nun der arme Jüngling gar nicht wieder besser wurde, wandte sich der Königssohn an den heiligen Japicu alla Lizia und sprach: »O, San Japicu alla Lizia! Ihr habt mir meinen Freund vom Tode auferweckt, nun helft ihm auch dieses Mal, und lasst ihn von seinem bösen Aussatz genesen.«
Wie er noch so betete, kam ein Diener herein und sagte zu ihm: »draußen stehe ein fremder Arzt, der wolle den armen Jüngling wieder gesund machen. Dieser Arzt aber war der heilige Japicu alla Lizia, der das Gebet des Königssohnes erhört hatte und gekommen war, um seinem Freund zu helfen.
Nun müßt ihr aber wissen, daß die Frau des Königssohnes ein kleines Mädchen geboren hatte, das war ein schönes, liebliches Kind.« Als nun der Heilige an das Bett des Kranken trat, betrachtete er ihn erst und sprach dann zum Königssohne: »Wollt ihr euren Freund wirklich gesund sehen?« »Um jeden Preis?« »Um jeden Preis!« antwortete der Königssohn; »sagt mir nur, was ihm helfen kann.«
Nehmt heute Abend euer Kind,« sprach der Heilige, »öffnet ihm alle Adern und bestreicht mit seinem Blut die Wunden eures Freundes, so wird er als bald genesen.« Der Königssohn erschrak freilich, als er hörte, er müsse sein liebes Töchterchen selbst umbringen, aber er antwortete: »Ich habe meinem Freunde gelobt, ihn als meinen Bruder zu behandeln, und wenn es kein anderes Mittel gibt, so will ich mein Kind zum Opfer bringen.«
Als es nun Abend wurde, nahmen sie das Kindlein und schnitten ihm die Adern auf und bestrichen mit dem Blut die Wunden des Kranken, und als bald genas er von seinem bösen Aussatz. Das Kindlein aber wurde ganz weiß und matt und sah aus, als wäre es tot. Da legten sie es in seine Wiege und die armen Eltern waren tief betrübt, denn sie glaubten ihr Kind verloren zu haben.
Am Morgen kam der Heilige und frug nach dem Kranken. »Der ist wohl und gesund,« antwortete der Königssohn. »Und wo habt ihr euer Kindlein hin gelegt?« frug der Heilige. »Dort liegt es in seiner Wiege und ist tot,« sprach traurig der arme Vater. »Schaut doch einmal nach, wie es ihm geht,« sagte der Heilige, und als sie an die Wiege liefen, saß das Kindlein darin und war wieder munter und gesund.
Der Heilige aber sprach: »Ich bin San Japicu alla Lizia, und bin gekommen euch zu helfen, da ich gesehen habe, wie ihr so treue Freundschaft gehalten habt. Liebt euch auch ferner hin, und wenn es euch schlimm geht, so wendet euch nur an mich und ich werde euch zu Hilfe kommen.«
Mit diesen Worten segnete er sie und verschwand vor ihren Augen. Sie aber lebten fromm und taten den Armen viel Gutes und blieben glücklich und zufrieden, wir aber sind leer ausgegangen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON DEM KAFMANNSSOHNE PEPPINO ...

Es war einmal ein Kaufmann, der war ganz unermeßlich reich, und hatte so viel Schätze, daß der König nicht mehr haben konnte. Er lebte mit seiner Frau in Frieden und Eintracht, und nur Eines fehlte ihnen, sie hatten keine Kinder. Da wandte sich eines Tages die Frau an den heiligen Joseph, und sprach: »Lieber heiliger Joseph, wenn ihr mir ein Kind bescheert, so will ich euch eine schöne Kirche bauen, und will jedes Jahr an eurem Festtage ein großes Gastmahl halten, und will euch ein kleines Kind von lauterm Golde schenken, und mein Kind soll euren Namen führen.«
Nach einiger Zeit wurde die Frau guter Hoffnung, und als ihre Stunde kam, gebar sie einen wunderschönen Knaben, den nannte sie Giuseppe. Nun denkt euch, welche Freude der Kaufmann und seine Frau an diesem einzigen Sohne hatten! In ihrer Dankbarkeit bauten sie dem heiligen Joseph eine wunderschöne Kirche, und ließen ein kleines Kind von Gold machen, und schenkten es der Kirche.
Und als der Tag des Heiligen kam, hielten sie ein großes Gastmahl, zu dem alle Stände geladen waren; die Reichen aßen mit den Reichen, die Bürger mit den Bürgern, und die Armen mit den Armen, und dieses Fest wiederholten sie jedes Jahr.
Der kleine Peppino wuchs mit jedem Tage, und wurde so schön, wie man sonst kein Kind sehen konnte, wie konnte es auch anders sein, er war ja durch ein Wunder gemacht, ein Werk des heiligen Josephs. Als er nun 16-17 Jahre alt war, kam er eines Tages zu seinem Vater, und sprach: »Lieber Vater, ich bin nun bald 17 Jahre alt, und habe noch nichts von der Welt gesehen, darum erlaubt mir, mit dem nächsten Schiffe, das ihr absenden werdet, eine Reise zu machen, und die Welt zu sehen.«
»Ach mein Sohn, was willst du denn in der Welt? Du bist ja reich, und brauchst dich nicht zu plagen. Bleibe bei deinen Eltern, denn was sollen wir ohne dich tun?« So jammerte der Vater, aber Peppino ließ sich von seinem Vorhaben nicht ab bringen, und bat immer und immer wieder, und weil er der einzige Sohn war, so konnte ihm sein Vater nichts abschlagen, und erlaubte ihm endlich, mit dem nächsten Schiffe zu verreisen.
Als aber die Mutter hörte, daß ihr einziger Sohn verreisen wolle, fing sie laut an zu jammern und zu weinen: »Ach, soll ich meinen Sohn dem verräterischen Meer anvertrauen?« Doch vergebens, Peppino ließ sich nicht bewegen, da zu bleiben.
Als nun der Vater wieder ein Schiff abzusenden hatte, ließ er es schön ausrüsten für seinen Sohn, rief den Kapitän, und sprach zu ihm:
»Ich empfehle dir meinen Sohn, du bist mir für ihn verantwortlich. Wenn du ihn mir gesund wieder bringst, so will ich dich fürstlich dafür belohnen.« Der Kapitän versprach, aus allen Kräften für Peppino zu sorgen, und so reisten Beide ab. Nun wollte es das Unglück, daß sie kaum einige Tage gefahren waren, als sich ein furchtbarer Sturm erhob, und der Kapitän meinte, das Schiff werde versinken.
Da ließ er ein kleines Boot in das Meer hinab, und dachte auf diese Weise den Sohn seines Patrons zu retten; kaum war aber Peppino in das Boot gestiegen, als dieses umschlug, und der Jüngling spurlos verschwand. Der Kapitän suchte auf allen Seiten, um ihn zu retten, Peppino kam aber nicht wieder zum Vorschein.
Da er nun nichts mehr machen konnte, fuhr der Kapitän nach Haus. »Ach,« dachte er, »wie kann ich nun vor den armen Vater treten, wer soll es ihm erzählen!« Der Kaufmann aber stand am Balkon, und dachte an seinen Sohn. Auf einmal sah er ein Schiff mit gesenkten Segeln einfahren, und erkannte es als das Schiff, in welchem sein Sohn abgereist war.
»Ach,« dachte er, »gewiß ist mein Sohn ertrunken und gestorben.« Als nun der Kapitän ans Land kam, und den Eltern erzählte, wie ihr Sohn untergegangen sei, da gab es im Palast ein großes Trauern und Klagen; der Kaufmann ließ das ganze Haus schwarz behängen und seine Leute mußten Trauerkleider anziehen. Er selbst schloß sich mit seiner Frau ein, sie sahen keinen Menschen und taten nichts als ihren verlorenen Sohn zu beweinen.
Dem heiligen Joseph aber machten sie Vorwürfe, und sprachen: »O, heiliger Joseph, wie habt ihr uns einen so großen Schmerz angetan; warum habt ihr uns den Sohn gegeben, um ihn uns wieder zu entreißen? Nun machen wir auch an eurem Feiertage kein Gastmahl mehr.« Und als der Tag des heiligen Joseph kam, feierten sie ihn nicht. - Doch lassen wir nun die weinenden Eltern, und sehen wir, was aus dem Sohn geworden ist.
Als das Boot umschlug, erfaßte ihn eine große Welle, und warf ihn weit weg auf einen Felsen. Als er sich aber erholt hatte, und um sich blickte, sah er auf einmal, daß der Felsen sich vor ihm öffnete; schöne Mädchen kamen heraus, und sprachen freundliche Worte zu ihm:
»Schöner Jüngling, komm mit uns und bleibe hier, du sollst es gut bei uns haben.« Da ließ er sich von ihnen führen, und sie brachten ihn durch den Felsen in einen wunderschönen Garten, in dem blühten die prächtigsten Blumen, und wuchsen die süßesten Früchte. Die schönen Mädchen aber dienten ihm, und brachten ihm, was er nur wünschte.
So ging es bis zum Abend, und als er schläfrig wurde, führten sie ihn in einen prächtigen Saal, da stand ein wunderschönes Bett. Sie brachten ihm ein Licht, und nachdem er sich zu Bette gelegt hatte, kamen sie wieder und nahmen das Licht weg. Als er sich aber im Bette umwenden wollte, merkte er zu seinem Erstaunen, daß eine feine, zarte Frauengestalt neben ihm lag, die redete ihn an und sagte:
»Bleib nur da, schöner Jüngling; es soll dein Glück sein.« Als er aber am Morgen erwachte, war die Gestalt verschwunden, und er hatte sie nicht mehr gesehen. So ging es ein ganzes Jahr; er lebte wie im Paradies; die schönen Mädchen dienten ihm, und erfüllten jeden seiner Wünsche, und am Abend, wenn sie das Licht weg genommen hatten, lag das schöne Mädchen neben ihm, und redete mit ihm so fein und freundlich, daß er sie von Herzen lieb gewann, und sie gar zu gerne auch einmal gesehen hätte; wenn er aber am Morgen erwachte, war er allein.
Als ein Jahr verflossen war, sprach eines Abends das schöne Mädchen zu Peppino: »Peppino, würdest du auch gerne einmal deine Eltern besuchen?« »Ach ja!« antwortete er, »wenn ich ihnen doch den Trost bringen könnte, daß ich noch lebe, denn sie meinen gewiß, ich sei tot.«
»Jawohl, das glauben sie,« antwortete das Mädchen, »und deshalb haben sie dem heiligen Joseph keine Ehren mehr erwiesen. Nächstens ist aber wieder das Fest des heiligen Joseph. Nimm diese Zaubergerte, und schlage morgen damit gegen den Felsen, so wird er sich öffnen, daß du hindurch kannst. Gehe zu deinen Eltern, und sei glücklich und vergnügt mit ihnen; bedenke aber, daß du dich hier wieder einfinden mußt, sobald du das Fest des heiligen Joseph gefeiert hast, sonst ist es dein Unglück.«
Am anderen Morgen legte Peppino königliche Gewänder an, schlug mit der Gerte gegen den Felsen, also bald öffnete er sich, und draußen stand ein prächtiges Pferd, und ein großes Gefolge erwartete ihn, um ihn zu begleiten; also daß sein Zug dem eines Königs glich. Als er nun in seine Vaterstadt kam, erscholl das Gerücht, ein großer Herrscher ziehe ein, und die Vornehmsten und Reichsten der Stadt zogen ihm entgegen, und meinten, er wäre ein König, und Jeder bat ihn, doch in seinem Hause abzusteigen.
Er aber sandte einen Boten zu seinem Vater, und ließ ihm sagen: »Ein reicher König zieht in die Stadt ein, und will bei euch absteigen.« Der Kaufmann antwortete: »Ach! seit länger als einem Jahre ist mein Haus traurig und verödet, da ja mein einziger Sohn verloren gegangen ist. Gegen des Königs Willen läßt sich aber nicht handeln, und so will ich ihn denn in meinem Hause empfangen.«
Da ließ er seinen Palast aufs herrlichste schmücken, und die Treppe wurde mit den feinsten Teppichen belegt, und als der König kam, gingen ihm der Kaufmann und seine Frau bis an die Treppe entgegen. Als aber Peppino seine Eltern sah, stieg er eilends vom Pferd, küßte seinem Vater die Hand und sprach: »Segnet mich, lieber Vater!« Dann küßte er auch die Hand seiner Mutter und sprach: »Segnet mich, liebe Mutter!«
Nun denkt euch die Freude der Eltern, als sie ihren tot geglaubten Sohn wieder sahen, und mit welcher Herzlichkeit sie dem heiligen Joseph für seine Gnade dankten. Peppino aber mußte alles erzählen, wie es ihm ergangen war, und wie er auch von dem schönen Mädchen sprach, das er noch nie gesehen habe, sagte seine Mutter: »Dafür wollte ich dir schon einen guten Rat geben!«
Nach einigen Tagen war das Fest des heiligen Joseph, da gaben die Eltern ein Gastmahl, so prächtig und so reich, wie sie noch keines gegeben hatten, und luden die ganze Stadt dazu ein.
Als aber das Fest zu Ende war, sprach Peppino: »Nun muß ich euch verlassen, denn ich muß in den Felsen zurück, sonst ist es mein Unglück.« Die Mutter fing an zu weinen, und wollte ihn nicht ziehen lassen, Peppino aber antwortete: »Mutter, wenn ihr mich zurück haltet, so wird es mein Unglück sein.« Als sie nun sah, daß sie ihn nicht zurück halten konnte, gab sie ihm eine kleine Kerze und ein Fläschchen, und sprach zu ihm:
»Höre, mein Sohn, wenn du das schöne Mädchen sehen willst, so befolge meinen Rat. Wenn sie eingeschlafen ist, so stecke die Kerze ins Fläschchen, so wird sie sich als bald von selbst entzünden, und du kannst die Schöne sehen.« Peppino nahm die Kerze und das Fläschchen, umarmte seine Eltern, und ritt mit seinem Gefolge dem Meeresufer entlang, bis er an den Felsen kam.
Kaum hatte er sich dem Felsen genähert, als der selbe sich öffnete, die schönen Mädchen ihn umringten, und ihn voll Freude herein führten. Er aber konnte vor Ungeduld kaum den Abend erwarten, wo er das schöne Mädchen zu schauen hoffte. Als er nun zu Bette gegangen war, nahmen die Mädchen das Licht weg, und als bald lag die zarte Gestalt wieder neben ihm, und frug ihn:
»Nun Peppino, bist du auch recht vergnügt gewesen? Hast du deine Eltern in guter Gesundheit getroffen?« »Ja wohl,« edles Mädchen, antwortete er; »doch ich bitte euch, sprecht nun nicht weiter mit mir, denn ich bin müde von dem langen Ritt und möchte gerne schlafen.«
Als sie aber eingeschlafen war, nahm er schnell die Kerze hervor, und steckte sie in das Fläschchen; als bald brannte sie licht und hell, und bei dem Scheine sah er ein Mädchen von so wunderbarer Schönheit, daß er sich nicht von dem Anblicke trennen konnte, und sie voll Entzücken anschaute. Wie er sich aber über sie neigte, um sie zu küssen, fiel ein Tropfen Wachs auf ihre feine Wange, - in dem selben Augenblick verschwand das ganze schöne Schloß, und er fand sich in finsterer Nacht, nackt und allein, ganz oben auf einem Berge, der mit Schnee bedeckt war.
»Ach!« seufzte er, »was soll nun aus mir werden? Wer wird mir helfen?« Es war aber niemand da, der ihm helfen konnte, und so kroch er denn mühsam auf Händen und Füßen, bis er am Morgen am Fuße des Berges ankam. Da sah er nicht weit von sich einen großen Bauernhof liegen, auf den ging er zu, klopfte an, und als der Bauer ihm aufmachte, sprach er zu ihm:
»Ach, guter Mann, könnt ihr mich nicht in eurem Hof anstellen, daß ich auf diese Weise mein Brot verdiene?« »Wer seid ihr denn?« frug der Bauer. »Ach, ich bin ein armer Hausierer,« antwortete er, »und diese Nacht, als ich über den Berg kam, haben mich die Räuber angefallen, und haben mich ganz ausgeplündert; sogar die Kleider haben sie mir ausgezogen.«
»Nun gut, armer Mann,« sagte der Bauer, »bleibt bei mir, und ich will euch zu essen geben, auch hier und da ein altes Kleidungsstück; dafür müsst ihr mir die Schafe hüten. Ihr dürft sie aber nicht in jenen Wald treiben, denn da haust ein mächtiger Lindwurm mit sieben Köpfen; der würde euch und die Schafe fressen.«
Also blieb Peppino bei dem Bauer, trug ärmliche Kleidung und bekam geringe Speise, und mußte täglich die Schafe auf die Weide führen. Eines Tages, da die Schafe weideten, hörte er auf einmal eine laute Stimme, die ihn rief: »O, Peppe!« Er schaute sich um, sah aber niemand. Da rief die Stimme noch einmal, und sprach: »Folge der Stimme!«
Da ging er dem Klang der Stimme nach, und kam an einen Felsen, davor stand eine wunderschöne Frau, die reichte ihm drei Borsten und sprach: »Verwahre sie wohl, und wenn du etwas nötig hast, so verbrenne sie.« Als sie das gesagt hatte, verschwand sie, Peppino aber verwahrte die drei Borsten auf seiner Brust.
Nach einigen Tagen hörte er sich wieder rufen: »O, Peppe!« und als er sich umsah, sprach die Stimme: »Folge der Stimme!« Da folgte er dem Klang der Stimme, und kam an den selben Felsen, da stand die schöne Frau, und gab ihm drei Federn, und sprach: »Verwahre sie wohl, und wenn du etwas nötig hast, so verbrenne sie.« Dann verschwand sie, und Peppino legte die Federn zu den Borsten. Wieder nach einigen Tagen rief sie ihn zum dritten Mal, und gab ihm drei Haare mit denselben Worten.
Nun verging noch einige Zeit, da begab es sich, daß der Fürst, dem die Güter alle gehörten, einen Boten zum Bauer sandte, und ihm sagen ließ: »Der Patron will, daß ihr ihm in drei Tagen alle Rechnungen bringt.« Seit vielen Jahren aber hatte der Bauer die Rechnungen nicht mehr in die Reihe gebracht, also daß er ganz nieder geschlagen da saß, und sich den Kopf zerbrach, wie er die Rechnungen machen sollte.
Das sah Peppino, und sprach zu ihm: »Massaro, soll ich euch nicht helfen? ich kann auch Rechnungen machen.« Damit war der Bauer zufrieden und Peppino brachte ihm alle Rechnungen in Ordnung, und nach drei Tagen konnte der Bauer in die Stadt gehen, und dem Fürsten die Rechnungen überbringen.
Als sie nun der Fürst durch gelesen hatte, sprach er: »Habt ihr diese Rechnungen selbst gemacht, Massaro?« Der Bauer dachte: »Der dumme Peppe hat sich gewiß geirrt,« und antwortete ganz klein laut: »Ach, Excellenz, habt Nachsicht mit mir, einer meiner Knechte hat sie gemacht.«
»Das ist kein Knecht,« antwortete der Fürst, »sondern gewiß ein feiner Herr, bringe ihn her, denn er soll mein Verwalter werden.« »Ach, Excellenz, ich kann ihn euch nicht bringen, denn er trägt so ärmliche schlechte Kleider.« Bekümmere dich nicht darum,« sprach der Fürst, und gab ihm gute Kleider und ein Pferd mit, damit Peppino ordentlich zur Stadt kommen konnte.
Der Bauer ging ganz vergnügt nach Hause, und sprach zu Peppino: »O, Peppe! dir blüht ein großes Glück; der Patron sagt, du seist zum Knecht zu gut und hat dich zu seinem Verwalter gemacht.« Da wusch sich Peppino, und legte die feine Kleidung an, und als er so fein und sauber da stand, sah man erst, wie schön er war. Also kam er in die Stadt, und blieb beim Fürsten als sein Verwalter, und der Fürst liebte ihn wie seinen Sohn.
Nun hatte aber der Fürst eine einzige Tochter, die war ein sehr schönes Mädchen; und als sie den schönen Jüngling sah, verliebte sie sich in ihn, also daß sie nur den einzigen Wunsch hatte, er möchte doch ihr Gemahl werden. Da sagte sie oft zu ihm: »Ach! Peppino! wenn es mein Vater erlaubte, so möchte ich dich wohl gerne heiraten.«
Er aber antwortete: »O, edles Fräulein! euch gebührt es, einen Fürsten zu heiraten, und nicht einen armen Burschen wie ich einer bin.« Denn er dachte nur immer an seine schöne Braut, und wenn er seine Arbeiten beendigt hatte, ging er an den Meeresstrand und seufzte: »Ach, wenn mich doch ein günstiger Wind zu ihr hinführte!«
So vergingen sieben Jahre, da sprach Peppino zum Fürsten: »Excellenz! ich habe euch nun so lange treu gedient, nun lasst mich ziehen, denn ich kann nicht länger bei euch bleiben.« Der Fürst war sehr betrübt, und seine Tochter weinte sich fast die Augen aus; Peppino aber blieb dabei: »Ich kann nun nicht länger bei euch bleiben.«
Da nun der Fürst sah, daß er ihn nicht mehr halten konnte, beschenkte er ihn reichlich und ließ ihn ziehen. Peppino aber ging an das Ufer des Meeres, und da er ein Schiff sah, das absegeln sollte, frug er die Schiffer: »Wohin fahrt ihr?« »Gegen Sonnenuntergang.« »So nehmt mich mit, und ich will euch Hundert Unzen geben, denn ich muß auch gegen Sonnenuntergang ziehen.«
Da nahmen sie ihn mit, und fuhren gegen Sonnenuntergang, und als sie viele Tage gefahren waren, sah er endlich den Felsen vor sich liegen, in dem das schöne Schloß war. Hier ließ sich Peppino ans Land setzen, und blieb allein am öden Ufer zurück. Der Felsen aber war verschlossen, und öffnete sich erst, nachdem er eine lange Zeit gewartet hatte.
Niemand kam ihm entgegen, um ihn zu begrüßen; da ging er hinein, und fand alles gerade so, wie er es verlassen hatte. Die schönen Mädchen brachten ihm wohl zu essen und zu trinken, aber so freundliche Worte sprachen sie nicht mehr zu ihm, wie früher.
Als er sich zu Bette gelegt hatte, nahmen sie das Licht nicht fort; das schöne Mädchen lag aber doch neben ihm, und frug ihn gar spöttisch: »Nun, wie hat es dir auf dem Schneeberg gefallen? Und wie lieblich war es, dem Bauer zu dienen, und ihm die Schafe zu hüten? Warum bist du denn nicht bei der schönen Fürstentochter geblieben?«
Er aber antwortete ihr demütig, und bat sie um Verzeihung, bis sie wieder ganz freundlich wurde, und zu ihm sprach: »Höre mich an, Peppino; ich bin eine verzauberte Königstochter, und wenn du an jenem Abende deine Neugierde bezähmt hättest, so wäre ich nun schon lange erlöst.
Mein Vater war ein mächtiger König und ich seine einzige Tochter. Er wollte mich aber nicht verheiraten, und als er zum Sterben kam, verzauberte er mich in dieses Felsenschloß hinein, und sein Geist hält mich hier gefangen.« »Gibt es denn kein Mittel, dich zu erlösen?« frug Peppino. »Wohl gibt es ein Mittel,« antwortete sie, »was aber dazu gehört, kannst du nun und nimmer ausführen.«
»Ach, sage mir doch, was es ist,« bat er, »du wirst sehen, ich habe den Mut dazu.« »Nun denn, so höre genau zu, was ich dir sagen werde. Wenn du dich und mich erlösen willst, so mußt du morgen früh den Felsen verlassen, und diese Zaubergerte mitnehmen.
Dann mußt du in jenen Wald gehen, wo der Lindwurm mit den sieben Köpfen haust. Am Saum des Waldes schlage mit der Gerte auf den Boden, so wird sich ein Pferd aus dem Boden erheben, und ein Zauberschwert. Besteige das Pferd, schnalle das Schwert um, und reite so in den Wald und bekämpfe mutig den Lindwurm. Denn du wirst ihn besiegen, und ihm die sieben Köpfe abhauen.
Die Köpfe aber bringe dem Bauer, der dich so mitleidig aufgenommen hat, und sage ihm, er solle sie zum Fürsten bringen, und sich von dem selben dafür die Erlaubniß erbitten, zwölf Jahre lang in dem Walde Holz fällen zu dürfen. Als dann gehe wieder in den Wald, dort mußt du dir ein Kaninchen herbei zaubern und einen Hund.
Der Hund wird das Kaninchen jagen, und es dir bringen; zerschneide es, so wird eine weiße Taube daraus auf fliegen. Auch die Taube wird der Hund dir bringen; zerschneide sie, so wirst du in ihrem Leib ein Ei finden, das mußt du wohl verwahren. Endlich mußt du um Mitternacht in den Wald kommen, dort wirst du mich sehen, liegend und schlafend.
Auf mir aber liegt der Geist meines Vaters. Nähere dich leise, ziele gut, und wirf ihm das Ei mitten auf die Stirn, so wird er in den Abgrund rollen, und auf ewig verschwinden. Wenn du dieses alles vollbracht hast, so bin ich erlöst.« »Wie soll ich aber das Kaninchen herbeizaubern?« frug Peppino. »Dafür mußt du selbst sorgen,« antwortete sie.
Am anderen Morgen verließ Peppino den Felsen, er nahm die Zaubergerte, und wanderte viele Tage lang, bis er endlich an den Wald kam, wo der Lindwurm hauste. Da schlug er mit der Gerte auf den Boden, und als bald erhob sich ein prächtiges Pferd und ein blitzendes Schwert, er schnallte das Schwert um, schwang sich aufs Pferd, und ritt in den Wald hinein.
Nicht lange, so kam ihm der Lindwurm entgegen, und wollte ihn verschlingen. Er aber zog mutig sein Schwert, und kämpfte mit dem Lindwurm, bis er ihm alle sieben Köpfe abgehauen hatte. Da kam er zu dem Bauer und sprach zu ihm. »Ihr habt mir so viel Gutes erwiesen, als ich arm und elend war, nun bin ich reich und mächtig geworden, und zum Dank schenke ich euch diese sieben Köpfe.
Ich habe den Lindwurm umgebracht, und das sind die Köpfe. Bringt sie zu eurem Patron, und gebt ihm diese freudige Nachricht, unter der Bedingung, daß er euch auf zwölf Jahre erlaube, in dem Walde Holz zu fällen.« »Nun bin ich ein gemachter Mann,« rief der Bauer voll Freude; »seit so viel Jahren ist niemand mehr in den Wald gegangen um Holz zu fällen, weil der grimmige Lindwurm darin hauste; deshalb wird mir der Patron in seiner Herzensfreude die Bedingung gern zugestehen.«
Darauf nahm Peppino Abschied von dem Bauer, und ging wieder in den Wald, in tiefen Gedanken, denn er wußte nicht, wie er nun das Kaninchen herzaubern sollte. Auf einmal gedachte er an die drei Borsten, welche die schöne Frau ihm gegeben hatte; die schöne Frau war aber niemand anders gewesen als die verzauberte Königstochter.
Da verbrannte er die drei Borsten, und als bald sprang ein Kaninchen aus dem Gras und lief durch den Wald. Da verbrannte er auch die drei Federn, und sogleich sprang ein Hund hervor, der verfolgte das Kaninchen und brachte es dem Peppino.
Dieser schnitt es entzwei, und eine weiße Taube flog heraus; der Hund verfolgte sie, bis sie sich niedersetzte, dann ergriff er sie, und brachte sie dem Jüngling. Peppino schnitt sie auf und fand in ihrem Leib ein Ei, gerade so, wie die Königstochter es vorhergesagt hatte.
Das Ei verwahrte er, und als es Mitternacht war, schlich er leise in den Wald. Da sah er die Königstochter vor sich liegen und schlafen, und sie schien ihm viel schöner als je; auf ihr aber lag der Geist ihres Vaters. Leise schlich er hinzu, und als er ganz nahe bei ihnen stand, zog er das Ei hervor, zielte, und warf es dem Geiste des alten Königs mitten auf die Stirn.
Kaum hatte er ihn getroffen, so gab es einen furchtbaren Schlag, der König rollte in den Abgrund hinab, und ward nicht mehr gesehen; die Königstochter erwachte, und fiel ihm voll Freuden in die Arme, vor ihnen aber stand ein prächtiges Schloß, mit vielen herrlichen Schätzen.
Da rief die Königstochter: »Du hast mich erlöst, und nun gehören alle diese Schätze dir. Wir wollen sie mit nehmen, und zu deinen Eltern gehen, und dann soll unsere Hochzeit sein.« Da nahmen sie alle die Herrlichkeiten mit, und kehrten in Peppinos Vaterstadt zurück.
Als aber der Kaufmann und seine Frau ihren lieben Sohn wieder kehren sahen, und mit ihm seine schöne Braut, dankten sie voll Freude dem heiligen Joseph, und feierten eine prächtige Hochzeit. Und so blieben sie reich und getröstet, wir aber sind hier sitzen geblieben.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

DIE STRAFE DER HEXE ...

Eine Mutter hatte eine Tochter, welche Röschen hieß. Röschen war gut und fleißig und gehorchte der Mutter in allem, was sie ihr befahl. Eines Tages sagte die Mutter: »Röschen, nimm den Korb und schütte den Kehricht fort.«
Röschen, gehorsam wie immer, ging, den Kehricht in ein Loch zu werfen. Sie versah es aber, und der Korb fiel gleicherweise in das Loch. Da fing sie an zu jammern, besann sich aber bei Zeiten, daß in dem Loche die Hexe wohne, und so rief sie: »Hexe, gute Hexe, gib mir meinen Korb wieder!«
Die Hexe antwortete: »Steig du selbst herunter und hole ihn dir.« - »O nein«, sagte das Mädchen, »das tue ich nicht, denn du frisst mich!« - »Habe nur keine Furcht! Ich fresse dich nicht. Bei der Seele meiner Tochter Cola, ich fresse dich nicht!« - »Aber wie kann ich hinab kommen?« - »Setze nur einen Fuß da, den anderen dort hin, so kommst du schon herab.«
Das Mädchen trieb die Angst vor den Schelten der Mutter des verlorenen Korbes wegen, hinab zu klettern. Wie sie drunten war, umarmte die Hexe sie und streichelte sie und rief einmal über das andere: »Ei, wie schön bist du, mein Röschen! Wie lieb! Kannst mir auch mein Haus einmal kehren?«
Das Mädchen war so gleich bereit, und die Hexe fragte: »Was findest du in meinem Hause?« Röschen antwortete: »O, nur ein wenig Staub und Pulver wie bei anderen Menschen.« Als sie fertig war, sagte die Hexe: »Jetzt suche mir den Kopf ab. Was findest du?« - »Läuslein und Nißchen wie bei andern Menschen.« -
Sagt die Hexe: »Jetzt säubere mir auch das Bett! Was findest du?« Und Röschen antwortet freundlich: »O, Wänzlein und Flöhlein wie bei anderen Menschen.« Da sprach die Hexe: »Wie gut bist du, Röschen. Möge auf deiner Stirn ein Stern stehen, vor dessen Glanze alle die Augen niederschlagen müssen. Wie schön ist dein Häuptlein, auf ihm sollen Haare von gesponnenem Golde wachsen, und kämmst du dich, so fallen Perlen und Edelsteine von der einen und Korn und Weizen von der anderen Seite herab.«
Darauf wurde Röschen von ihr in eine Kammer geführt, die war voll alter und neuer Kleider. Die Alte nahm ein Paar schöne und ein Paar schmuzige lumpige Strümpfe und fragte: »Welche willst du? Die schönen oder die schmuzigen?« Das Mädchen antwortete: »Die schmuzigen!« - »Nun sollst du gerade die aller schönsten haben«, sagte die Hexe.
So ging es mit dem Hemd, Röschen wählte das älteste und gröbste und bekam das aller feinste. Und das Kleid, das ihr die Alte gab, war, trotzdem jene ein schlechtes gewollt, das aller neueste und aller schönste. Endlich war Röschen von Kopf bis zu Fuß bekleidet und sah so nett aus wie eine Puppe aus Deutschland; die Hexe gab ihr noch einen Beutel mit Geld, und sie durfte zu ihrer Mutter zurück kehren.
Wie die Mutter ihre Tochter so gar schön wieder kommen sah, schlug sie vor Verwunderung die Hände zusammen und wollte wissen, wie das zugegangen. Röschen erzählte ihr alles, und nun ward es auch in der Nachbarschaft bekannt. In der Nähe wohnte nämlich eine Gevatterin, die war neidisch auf Röschens Glück und neugierig, zu erfahren, wo her ihr das selbe gekommen; der beichtete Röschens Mutter als bald die ganze Geschichte.
Diese Gevatterin hatte eine Tochter, die war bös und dazu noch häßlich wie die Nacht; die nahm sie auf die Seite und sprach: »Weißt du denn, woher Röschen die schönen Sachen hat? Die hat ihr die Hexe gegeben. Nimm nur gleich den Kehricht, wirf ihn in das Loch und schleudere den Korb hinter her. Darauf rufe die Hexe, daß sie ihn dir wieder gebe, und was dann geschieht, wirst du schon sehen.«
Jene tat es also, und wie der Korb drunten lag, rief sie: »Hexe, gib mir meinen Korb wieder!« - »Komm herab und hole ihn dir!« Sie stieg ohne weitere Umstände hinab und kam in das Haus der Hexe. Die gab ihr den Besen in die Hand und forderte sie auf zu kehren.
Wie sie kehrte, fragte die Alte: »Was findest du?« Und das Mädchen antwortete schnippisch: »Dreck und Kot wie bei anderem Lumpengesindel.« - »Nun reinige mir den Kopf und sag' mir, was du findest.« Das Mädchen: »Läusegeschmeiß und Nissebrut wie bei anderem Lumpengesindel.« Zuletzt sagte die Hexe: »Jetzt säubere mir das Bett! Und was findest du?« - »Flohgeschmeiß und Wanzenbrut wie bei anderem Lumpengesindel«, antwortete das Mädchen.
»Ei, wie häßlich bist du!« rief die Hexe. »Möge dir auf deiner Stirn ein gräuliches Horn wachsen! Beim Kämmen aber sollen nur Kot und Schmuz aus deinen Haaren fallen.« Das war schlimm genug! Darauf führte sie die Hexe in die Kammer, wo die Kleider lagen, legte ihr die schönen und die schmutzigen Strümpfe vor und fragte sie, welche sie wolle? »
Natürlich die guten«, sagte das Mädchen. »Nun sollst du gerade die schmutzigen haben.« So ging es mit dem Hemd, mit dem Rock und den anderen Kleidern, bis das Mädchen wie eine schlechte Magd angekleidet war. Zuletzt gab ihr die Alte noch einen derben Backenstreich und rief: »Jetzt pack dich nach Hause.«
Die Mutter hatte schon oben gewartet; wie sie aber das Unbild herauf steigen sah, fiel sie vor Schrecken fast um. »Meine Tochter«, rief sie, »wie ging denn das zu?« Und die Tochter sagte: »Die Hexe hat mir es angetan.« - »O die verdammte Hexe!« Sie lief zur Nachbarin im hellen Zorn und wollte der alle Schuld geben, wo doch alles nur Strafe für Neid und Bosheit war.
Ihr Zanken und Schimpfen war jedoch umsonst: Röschen und ihre Mutter waren reich; sie blieb mit samt der Tochter häßlich und arm.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

VON GIUSEPPINU ...

Es waren ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder, und hätten doch so gern ein Söhnchen oder Töchterchen gehabt. Die Königin war dem heiligen Joseph sehr ergeben, und wandte sich zu ihm und sprach: »O, heiliger Joseph! Wenn ihr mir ein Kind beschert, so will ich es Giuseppe oder Giuseppina nennen.«
Nicht lange, so hatte die Königin Aussicht auf ein Kind, und als ihre Stunde kam, gebar sie einen Sohn, und nannte ihn Giuseppinu. Der Knabe wuchs heran und wurde mit jedem Tage schöner und stärker.
Als er nun im Alter von dreizehn oder vierzehn Jahren war, bekam er eine große Sehnsucht, die Welt zu sehen und sprach zu seinen Eltern: »Lieber Vater und liebe Mutter, lasst mich ziehen, denn ich muß in die weite Welt hinaus.« »Ach, mein lieber Sohn, wo willst du hin?« antworteten sie. »Bleibe doch bei uns, hier mangelt es dir ja an nichts.«
Weil ihn nun seine Eltern nicht ziehen lassen wollten, machte er sich eines Morgens heimlich auf den Weg, und entfloh. Nachdem er eine lange Zeit gewandert war, kam er endlich in eine Stadt, wo ein anderer großer König herrschte, der eine wunderschöne Tochter hatte. Da ging Giuseppinu vor den königlichen Palast, und spazierte immer auf und ab.
Die Königstochter aber stand am Balkon, und da sie den schönen Knaben sah, gefiel er ihr so gut, daß sie zu ihrem Vater ging und sprach: »Lieber Vater, unten ist ein Knabe, wenn ihr nur wüßtet wie schön er ist! Nehmt ihn doch in euren Dienst.« Der König aber hatte seine Tochter so lieb, daß er ihr nie eine Bitte abschlagen konnte.
Also ließ er gleich den Giuseppinu rufen, und sprach zu ihm: »Willst du in meinen Dienst treten, so will ich dich zu meinem Stalljungen machen.« Giuseppinu war es zufrieden, und der König nahm ihn als Stalljunge in seine Dienste.
Nun blieb er lange Zeit da, und die Königstochter gewann ihn immer lieber, und eines Tages sprach sie zu ihrem Vater: »Lieber Vater, Giuseppinu ist für einen Stalljungen viel zu gut, macht ihn doch zum Lakaien, daß er im Palast selbst diene.« Der König erfüllte wieder den Wunsch seiner Tochter, und Giuseppinu wurde Lakai.
Es war aber unter den Pferden des Königs ein kleines Pferdchen, das hatte er so gern, daß er oft in den Stall ging, und es streichelte. Die Königstochter gewann den schönen Jüngling immer lieber, ja endlich faßte sie eine so heftige Liebe zu ihm, daß sie zum König ging und sprach: »Lieber Vater, gebt mir den Giuseppinu zum Mann.«
Nun wurde aber der König zornig und sprach: »Das ist nicht möglich, dir gebührt ein Herrscher zum Mann und nicht ein so elender Diener.« Weil aber die Königstochter nicht nach ließ mit Bitten und Tränen, so sprach er endlich: »Ich will mit meinen Räten darüber sprechen, was die mir raten, will ich tun.«
Da berief er alle seine Räte und sprach: »Meine Tochter will durchaus ihren Lakaien, den Giuseppinu, heiraten, und weint nun Tag und Nacht, weil ich ihn ihr verweigert habe. Ratet mir, was soll ich tun?« Da antworteten sie: »Königliche Majestät, sagt dem Giuseppinu, er solle die Königstochter heiraten, vorher aber müsse er eine Reise machen und große Reichtümer mitbringen. Dazu geben wir ihm ein schlechtes Schiff, so wird er untergehen und ertrinken. Die Königstochter aber wird ihn vergessen.«
Dieser Rat gefiel dem König sehr gut, und er rief den Giuseppinu zu sich und sprach: »Giuseppinu, ich will dir meine Tochter zur Frau geben, du mußt aber vorher eine Reise machen, und große Reichtümer mit bringen, sonst schneide ich dir den Kopf ab.«
Da ging der arme Giuseppinu zu seinem Pferdchen in den Stall, streichelte es und sprach: »Ach, mein liebes Pferdchen, nun muß ich von dir scheiden, denn der König will mich auf die Reise schicken. Ach! wo soll ich armer Junge denn hin gehen!«
Wie er so klagte, erschien auf einmal ein altes Männlein in einer Mönchskutte, das war der heilige Joseph; Giuseppinu wußte es aber nicht. »Was weinst du?« frug ihn das Mönchlein. Da klagte ihm Giuseppinu sein Leid, der heilige Joseph aber antwortete: »Sage dem König nur: ja, du willst die Reise machen; er solle dir nur ein Schiff voll Salz mit geben. Ich aber will mit dir reisen, und du sollst sehen, es ist dein Glück.«
Da ging Giuseppinu zum König und sprach: »Königliche Majestät, ich will die Reise machen; gebt mir nur ein Schiff voll Salz mit, so will ich gehen.« Nun war der König sehr froh, und gab ihm ein Schiff voll Salz. Das Schiff war aber so schlecht und alt, daß von allen Seiten das Wasser herein floß, denn der König wünschte, Giuseppinu möchte untergehen.
Da schiffte Giuseppinu sich ein, und sogleich erschien auch der heilige Joseph an Bord. Kaum aber betrat der Heilige das Schiff, so wurde ein großes, starkes Fahrzeug daraus, das fuhr gar schnell über das Meer.
Nun segelten sie eine lange Zeit, und kamen endlich in ein fremdes Land, wo die Leute kein Salz hatten, um ihre Speisen zu würzen. »Höre, Giuseppinu,« sprach der Heilige, »bleibe du hier, ich will an Land gehen.« Da füllte er sich die Ärmel seiner Mönchskutte mit Salz, und fuhr an Land.
Er ging so gleich in ein Wirtshaus, wo viele Leute bei einander saßen, setzte sich zu ihnen und aß auch. Weil aber die Speisen ohne Salz gekocht waren, so nahm er ein wenig Salz aus dem Ärmel, streute es über seinen Teller und aß. Da frugen ihn die Leute: »Was habt ihr auf euer Essen gestreut?« »Es fehlte das Salz drin,« sagte er, »darum habe ich ein wenig dazu getan.«
»Was ist denn das, Salz?« frugen die Leute. Da sagte der Heilige: »Ihr wißt nicht, was Salz ist?« griff in seinen Ärmel, und streute jedem etwas auf den Teller. Als die Leute nun kosteten, schmeckten ihnen die Speisen viel besser, und sie sprachen: »Guter Alter, habt ihr noch mehr von diesem köstlichen Salz?« »O ja, ein ganzes Schiff voll.«
»Könnt ihr es uns nicht geben?« »O ja, wenn ihr mir ein ganzes Schiff voll Gold gebt.« Da brachten ihm die Leute so viel Gold, bis das ganze Schiff voll war, und der heilige Joseph gab ihnen das Salz dafür. »Jetzt wollen wir wieder nach Hause fahren,« sprach er zu Giuseppinu, und Giuseppinu war sehr froh, daß er diese Menge Gold erworben hatte. So fuhren sie nach Hause, als sie aber in den Hafen einfuhren, verschwand der Heilige.
Unterdessen saß die Königstochter immer oben auf der Terrasse, und schaute aus, ob Giuseppinu bald käme. Als sie nun sein Schiff erblickte, lief sie voller Freude zum König und sprach: »Lieber Vater, Giuseppinu kommt mit einem wunderschönen großen Schiff.«
Da erschrak der König und rief schnell seine Räte, erzählte es ihnen und sprach: »Ratet mir, was soll ich nun tun?« Die Räte antworteten: »Sagt dem Giuseppinu, was er mit gebracht habe, sei noch nicht genug; wenn er nicht noch einmal eine Reise mache, so könne er die Königstochter nicht heiraten.«
Als nun Giuseppinu kam, und dem König das viele Gold brachte, sprach dieser: »Das ist wohl eine hübsche Menge Gold, aber es ist noch lange nicht genug, und wenn du die Königstochter heiraten willst, so mußt du eine zweite Reise machen, und noch mehr Geld mit bringen, sonst schneide ich dir den Kopf ab.«
Da ging der arme Giuseppinu in den Stall zu seinem Pferdchen, und fing an zu jammern und zu weinen. Wie er aber so jammerte, erschien der heilige Joseph wieder, und frug ihn, warum er weine. Da klagte er ihm seine Not, und der heilige Joseph sprach: »Ist dir die erste Reise nicht gelungen? Geh nur hin und sage dem König, du wolltest die Reise machen, er solle dir ein Schiff voll Katzen mit geben.«
Das tat Giuseppinu, und der König gab ihm ein Schiff, das war noch viel schlechter als das erste. Als aber Giuseppinu sich eingeschifft hatte, so erschien auch der Heilige, und kaum hatte er das Schiff betreten, so wurde es stark und neu, also daß sie fröhlich abfahren konnten.
Sie fuhren eine lange Zeit, und kamen endlich in ein fremdes Land, da gab es keine Katzen und die Mäuse tanzten auf den Tischen herum. »Giuseppinu,« sprach der heilige Joseph, »ich gehe ein wenig an Land, bleibe du so lange hier.« Da nahm er einige Katzen, und steckte sie in die weiten Ärmel seiner Kutte und fuhr an Land.
Er ging in ein Wirtshaus, wo viele Leute zum Essen waren, und die Mäuse tanzten auf den Tischen herum und sprangen sogar in die Teller. Da zog der Heilige die Katzen aus dem Ärmel, und setzte sie auf den Boden, und die Katzen machten so gleich Jagd auf die Mäuse und töteten eine ganze Menge.
Die Leute aber schauten ganz erstaunt zu, und frugen den Heiligen: »Habt ihr noch mehr solcher wunderbaren Tiere?« »O ja, ein ganzes Schiff voll.« »Könnt ihr sie uns nicht da lassen?« »Warum nicht? wenn ihr mir ein ganzes Schiff voll Gold dafür gebt.« Da beluden ihm die Leute sein Schiff mit Gold, und der Heilige ließ ihnen die Katzen da, und Giuseppinu konnte wieder mit großen Reichtümern nach Hause fahren. Als sie aber in den Hafen einfuhren, verschwand der heilige Joseph.
Die Königstochter saß auf der Terrasse, und schaute aus, ob Giuseppinu bald käme. Da sie nun sein Schiff erblickte, lief sie zum König und sprach: »Lieber Vater, Giuseppinu kommt, und bringt ein Schiff mit, das ist noch viel größer und schöner als das erste.«
»Was ist denn das?« sagte der König, »das geht ja nicht mit rechten Dingen zu,« und berief wieder seine Räte und sagte ihnen alles. »Königliche Majestät,« antworteten sie, »ihr müßt den Giuseppinu eben zum dritten Mal auf die Reise schicken, und ihm ein so schlechtes Schiff geben, daß er mit dem selben nicht einmal zum Hafen heraus kommt.«
Als nun Giuseppinu kam, und dem König all das Gold zu Füßen legte, sprach der König: »Du hast wohl viel Gold erworben, aber es ist noch lange nicht genug, und wenn du die Königstochter heiraten willst, so mußt du eine dritte Reise machen, sonst schneide ich dir den Kopf ab.«
Da ging Giuseppinu wieder voll Trauern in den Stall, und streichelte sein Pferdchen mit vielen Tränen. So gleich erschien wieder der heilige Joseph, und da er ihm sein Leid klagte, sprach der Heilige: »Was weinst du denn? Es ist dir ja zweimal gelungen, es wird dir auch diesmal gut gehen. Geh zum König und sage ihm, du willst seinen Willen tun, er möge dir nur ein Schiff voller Soldatenanzüge mit geben.«
Das tat Giuseppinu, und der König gab ihm ein Schiff, das war so alt und schlecht, daß Giuseppinu nicht einmal hätte zum Hafen heraus kommen können, wenn nicht der Heilige erschienen wäre und ein großes und starkes Schiff daraus gemacht hätte.
Wie sie nun so einher fuhren, begegnete ihnen eine feindliche Flotte mit vielen Soldaten, und der feindliche Heerführer sprach zu Giuseppinu: »Wir wollen mit einander kämpfen.« Da sprach der Heilige zu Giuseppinu: »Nimm den Kampf an, und sage dem feindlichen Heerführer: wer verliere, müsse dem anderen sein Schiff geben.«
Also kämpften sie auf diese Bedingung, und Giuseppinu verlor sein Schiff. Der Heilige aber sprach zu ihm: »Verliere den Mut nicht, sondern sage dem feindlichen Feldherrn: das Schiff hast du verloren, aber nicht die Soldatenanzüge darin. Um diese wolltest du jetzt noch einmal kämpfen, und er müsse seine Soldaten dagegen setzen.«
Also kämpften sie noch einmal, und Giuseppinu gewann die Schlacht. Da mußte ihm der feindliche Feldherr seine Soldaten geben, und Giuseppinu befahl, sie sollten ihre Kleider ausziehen, und ließ sie die Uniformen anziehen, die er in seinem Schiffe hatte.
Dann stellte er sich an die Spitze seines Heeres, und marschierte mit ihnen gegen die Stadt, wo der König wohnte. Die Königstochter saß wieder auf der Terrasse, und wartete auf Giuseppinu, und da sie die vielen Soldaten erblickte, lief sie zum König und sprach: »Lieber Vater, Giuseppinu kommt, und hat ein ganzes Heer Soldaten bei sich.«
Da erschrak der König und dachte: »Wenn ich ihm meine Tochter jetzt noch verweigere, so raubt er mir gewiß meine Krone.« Also ging er dem Giuseppinu entgegen, und empfing ihn mit vielen Ehren und sprach: »Du hast alle Bedingungen erfüllt, nun sollst du auch meine Tochter zur Frau bekommen.«
Da wurden drei Tage Festlichkeiten gehalten, und Giuseppinu heiratete die schöne Königstochter, und der heilige Joseph traute sie. Nach der Trauung aber segnete er sie, und sprach: »Ich bin der heilige Joseph, wenn ihr mich nötig habt, so ruft mich nur, und ich will euch immer helfen.«
Darauf verschwand er, und kehrte in den Himmel zurück. Giuseppinu aber schickte einen Boten zu seinen Eltern, und ließ ihnen sagen: »Euer Sohn lebt noch, und ist der Gemahl einer schönen Königstochter.« Da freuten sich die Eltern über die Maßen und reisten hin und umarmten ihren lieben Sohn voller Freuden.
Und so lebten sie alle glücklich und zufrieden, wir aber sind leer ausgegangen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
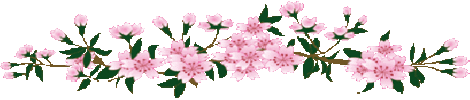
DER KUPFERSCHMIED ...

Es war einmal ein Kupferschmied, der sein Gewerbe betrieb, in dem er von einem Ort zum anderen wanderte. Sankt Peter und der Herr fanden ihn einmal auf der Straße, und Sankt Peter bat ihn um ein Almosen. -
»Gerade herausgesagt: ich hätte euch nichts zu geben, aber da ich sehe, daß ihr zwei blutarme Menschen seid, wie ich, nehmt diese zwei Soldi und kauft euch Brot dafür.«
Sankt Peter sagte zu dem Herrn: »So viele Reiche haben uns nichts gegeben, und dieser Bettler gab uns ein Almosen. Wir sollten ihm doch eine Gnade gewähren.« - »Gut,« sagte der Herr. »Ruf ihn zurück. Alles, was er wünschen möchte, daß er in seinem Ranzen hätte, soll hinein gehen.« - So geschah es.
Nun fand einmal der Kupferschmied einen Teufel, der mit ihm abfahren wollte, er aber sagte: »Geh in meinen Ranzen!« - Und der Teufel mußte hinein. Der Kupferschmied geht zu einem Schmied und sagt: »Wie viel fordert Ihr, wenn Ihr mir meinen Ranzen weich hämmert?« - »O, nichts!« sagt jener - und tiktak, tiktak! Sie hämmern der maßen drauf los, daß dem armen Teufel alle Knochen zerbrechen.
Als der Kupferschmied gestorben war, ging er zu erst ans Tor der Hölle. Ton, ton! - »Wer da?« - »Ich bin es, der Kupferschmied.« »Halte das Tor zu!« sagte der Teufel. »Der Schurke ist es, von dem ich so viel Schläge bekommen habe.« -
Darauf ging der Kupferschmied ans Tor des Paradieses. Kaum sah ihn Sankt Peter, so fragte er: »He, Freundchen, wer bist du?« - »Nun, ich bin es und will hinein.« - »Hm! Aber«. - »Nun«, antwortet der Kupferschmied, »so laß mich wenigstens meinen Ranzen hinein tun.« - »Meinetwegen, so tu ihn hinein.«-
Als der Ranzen aber hinein getan war, sagte der Kupferschmied: »Ich in meinen Ranzen!« Und so kam er ins Paradies.
Monferrato
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen

DER KÖNIG STIEGLITZ (CARDIDDU) ...

Es war einmal ein armer Schuster, der hatte drei sehr schöne Töchter, die Jüngste aber war die Schönste. Er war aber sehr arm und obgleich er den ganzen Tag herum lief und Arbeit suchte, verdiente er doch sehr selten etwas. Wenn er nun Abends mit leeren Händen nach Hause kam, fuhr ihn seine Frau mit harten Worten an und auch seine Töchter machten ihm Vorwürfe.
Eines Tages nun war er lange herum gewandert und hatte nichts verdient. Da kam er in einen Wald, und weil er so müde war, setzte er sich auf einen großen Stein und sprach ganz trostlos: »Ach, weh mir!« Kaum hatte er das gesagt, so stand ein schöner Jüngling vor ihm, der frug: »Warum hast du mich gerufen?« »Ich habe euch nicht gerufen, edler Herr,« antwortete der Schuster. »Doch! wenn jemand sich auf diesen Stein setzt und ruft: Ach, weh mir! dann muß ich immer erscheinen,« sprach der Jüngling.
Da erzählte ihm der Schuster, wie schlecht es ihm ergehe, und der schöne Jüngling sprach zu ihm: »Komm mit mir, ich will dir etwas geben.« Da führte er ihn durch einen unterirdischen Gang in ein wunderschönes Schloß, das war aber auch unterirdisch, und gab ihm zu essen, so viel sein Herz begehrte. Dann füllte er ihm noch die Taschen mit Geld und sprach: »Kehre zu deiner Familie zurück, über acht Tage aber mußt du mir deine jüngste Tochter herbringen. Ich kann sie jetzt zwar noch nicht heiraten, aber der Tag wird kommen wo ich sie zu meiner Gemahlin machen kann.«
Der arme Schuster machte sich fröhlich auf den Weg, kaufte einiges ein für seine Familie, und kehrte nach Hause zurück. Als er anklopfte, hörte er schon seine Frau und seine Töchter, die sagten: »Da kommt er gewiß wieder mit leeren Händen, und wir verhungern fast.« Als er ihnen aber seine Schätze zeigte, wurden sie ganz freundlich, und seine Töchter umarmten ihn und nannten ihn ihr liebes Väterchen.
»So?« sprach er, »jetzt bin ich euer liebes Väterchen!« Da erzählte er ihnen, wie es ihm ergangen sei, und sagte auch seiner jüngsten Tochter, daß er versprochen habe, sie dem Jüngling zu bringen. Die war es zufrieden und nach acht Tagen machte sie sich mit ihrem Vater auf den Weg.
Als sie an den großen Stein kamen, setzte er sich darauf und rief: »Ach, weh mir!« So gleich erschien der schöne Jüngling, führte sie beide in sein unterirdisches Schloß und bewirtete sie herrlich. Dann umarmte der Vater seine Tochter und ging nach Haus.
Nun hatte das Mädchen ein herrliches Leben. Der schöne Jüngling zeigte ihr alle Zimmer des Schlosses und sprach zu ihr: »Mit diesen Schätzen darfst du tun was du willst, und wenn deine Schwestern dich besuchen, darfst du ihnen davon geben, so viel du willst.« Zuletzt aber zeigte er ihr ein verschlossenes kleines Zimmer, und sprach:
»Dieses Zimmer aber darfst du nie aufmachen. Hüte dich wohl, dich von deinen Schwestern dazu überreden zu lassen. Es wäre dein Unglück. Achte wohl auf das was ich dir sage, denn ich bin nicht immer bei dir. Ich muß sehr oft auf zwei oder drei Tage fort gehen, ich kann dir aber nicht sagen, wohin.«
Der schöne Jüngling aber war ein König, der König Cardiddu und war von einer alten Hexe in dieses unterirdische Schloß verbannt worden, weil er ihre Tochter nicht hatte heiraten wollen. Zu dieser alten Hexe mußte er auch gehen, wenn er auf zwei oder drei Tage fort ging. In dem Zimmer aber waren hilfreiche Feen, die nähten Kinderzeug für die Schusterstochter.
Nun begab es sich eines Tages, daß der König wieder auf einige Tage verreisen mußte, und vor seiner Abreise schärfte er seiner Frau alle seine Warnungen noch einmal ein. Als er nun weg war, kamen die Schwestern der jungen Frau und wollten sie besuchen. Da bewirtete sie sie aufs Herrlichste, zeigte ihnen das ganze Schloß und beschenkte sie reichlich.
Als sie aber vor der verschlossenen Tür vorbeikamen, sprach die eine Schwester: »Schließe doch diese Tür auf und laß uns sehen was darinnen ist.« »Nein,« antwortete sie, »in dieses Zimmer darf ich nicht hinein gehen, mein Mann hat es mir verboten.« »Ach was,« sagten die Schwestern, »dein Mann ist so viele Meilen weit, der merkt ja nichts davon.« Sie aber blieb standhaft und wollte nicht aufmachen.
Da sagten die Schwestern: »Wenn wir erst einmal fort sind, wirst du ganz gewiß aufmachen.« Damit gingen sie fort, und nicht lange so kam der König nach Haus. »Sind deine Schwestern hier gewesen?« frug er, »und hast du ihnen auch das Zimmer nicht aufgeschlossen?« »Nein,« sprach sie, »ich habe eurem Befehl gehorcht.«
Sie hatte aber gar keine Ruhe mehr, und dachte immer nur, wie sie ihre Neugierde befriedigen könnte. Als er nun schlief, nahm sie leise eine Kerze, und beugte sich über ihn, um zu sehen, ob er schliefe. Dabei aber hielt sie die Kerze schief und ein Tropfen Wachs fiel herab, und gerade auf des Königs Stirn. In dem selben Augenblick aber befand sie sich auf dem großen Stein im Wald, und der König stand neben ihr und sprach:
»Siehst du, daß deine Neugierde dein Unglück gewesen ist? Ich kann dich nun nicht länger behalten, du mußt in die weite Welt hinaus wandern. Wenn du aber tust was ich dir sage, wirst du vielleicht doch noch meine Gemahlin. Gehe immer gerade aus, so wirst du endlich an das Haus der alten Hexe kommen. Da setze dich hin, so wird sie dich rufen und dir sagen, du sollst herauf kommen.
Nimm dich aber in Acht, sie will dich fressen. Gehe also nicht eher hinauf, als bis sie dir bei dem Namen des Königs Cardiddu schwört, dich nicht zu fressen. Dann gehe ruhig hinauf und lasse dich vor ihr in den Dienst nehmen.« Als der König das gesagt hatte, verschwand er, und die arme Frau blieb allein in dem finstern Wald.
Da fing sie an zu wandern, und weinte bitterlich, und als es Tag geworden war, kam sie an das Haus der alten Hexe. Da setzte sie sich vor die Tür und schaute betrübt vor sich hin. Als die Hexe sie nun erblickte, dachte sie: »Das wäre ein schöner Braten für mich,« und rief ihr gar freundlich zu: »Schönes Mädchen, komm doch herauf zu mir.«
Sie aber antwortete: »Ach nein, ich komme nicht, denn ihr wollt mich doch nur fressen.« »Das fällt mir gar nicht ein,« sprach die Hexe, »komm nur.« »So schwört mir bei dem Namen des Königs Cardiddu,« sprach die Frau, »daß ihr mich nicht fressen wollt.« Da schwur die Hexe bei dem Namen des Königs Cardiddu, und die arme Frau ging hinauf, und ließ sich als Magd dingen. Die Hexe aber konnte es nicht verwinden, daß sie sie nicht fressen durfte, und trachtete immer, wie sie sie in eine Schlinge locken könnte.
Eines Tages also rief sie ihre neue Magd und sprach: »Ich muß in die Messe gehen, während ich dort bin kehre das Haus und kehre es nicht.« Nun stand die arme Frau ratlos da und wußte gar nicht, wie sie diesen Befehl ausführen solle, und in ihrer Angst fing sie bitterlich an zu weinen.
Auf einmal erschien der König Cardiddu, und frug sie, warum sie weine. Da klagte sie ihm ihr Leid. »So,« sagte er, »jetzt weißt du keinen Ausweg mehr? Rufe doch deine Schwestern, die geben dir ja sonst so gute Ratschläge, vielleicht können sie dir jetzt auch helfen.« Als er sie aber so weinen sah, sprach er: »Nun, weine nur nicht, ich will dir schon helfen.
Kehre das ganze Haus recht säuberlich, dann aber nimm den Korb mit dem Kehricht und laß ihn die Treppe hinunter rollen.« Das tat sie, und als die Hexe nach Hause kam, sah sie, daß ihr Befehl richtig ausgeführt worden war, und ergrimmte, aber sie konnte ihr nichts anhaben.
Den nächsten Morgen rief sie sie wieder und sprach: »Ich gehe in die Messe; zünde das Feuer an und zünde es nicht an.« Nun war die arme Frau wieder ratlos und fing an zu weinen. Da kam der König Cardiddu wieder und sprach: »Weißt du dir schon wieder nicht zu helfen? Rufe doch deine Schwestern, die können dir gewiß raten.« »Ach,« antwortete sie, »wenn ihr mich nur zum Besten haben wollt, so laßt mich doch in Ruhe.«
Da tat sie ihm leid und er sprach: »Nun, weine nur nicht. Lege das Holz zu recht, als ob du Feuer machen wolltest, stelle auch den Kessel darauf und die Zündhölzchen lege daneben, aber ohne es anzuzünden.« Das tat sie, und als die Hexe kam, war der Auftrag wieder richtig ausgeführt. »Wenn ich nur wüßte, wer dir dabei hilft,« sagte sie. Die arme Frau aber meinte: »Wer sollte mir denn helfen, es kommt ja niemand her.«
Am dritten Morgen ging die Hexe wieder in die Messe und sprach: »Mache das Bett und mache es nicht.« Nun fing die arme Frau wieder an zu weinen, denn sie wußte keinen Rat. Da erschien aber der König Cardiddu, und ob er sie auch mit ihren Schwestern neckte, so half er ihr doch endlich, denn er hatte sie von Herzen lieb.
»Weißt du was du tun mußt?« sprach er. »Nimm die Betttücher und die Decken auf und falte sie, die Matratzen aber laß liegen.« Das tat sie und so war auch der dritte Auftrag richtig ausgeführt. Die Hexe aber konnte sich doch nicht zufrieden geben, und sann wieder etwas Neues aus. Sie nahm alle ihre weiße Wäsche, tauchte sie in Ochsenblut, und machte ein schweres Bündel davon.
Das gab sie der armen Frau und sprach: »Diese Wäsche mußt du mir heute Abend gewaschen, gebleicht, gestopft, gebügelt und gefaltet wieder bringen, sonst fresse ich dich.« Da nahm die arme Frau das schwere Bündel, das sie kaum tragen konnte, und wanderte mühsam herum, um einen Bach zu suchen. Dabei strömten ihr die Tränen über die Wangen.
Da erschien wieder der König Cardiddu und frug sie, warum sie weine. »Ach,« antwortete sie, »da soll ich armes Weib bis heute Abend alle diese Wäsche waschen, bleichen, stopfen, bügeln und falten, sonst frißt mich die Hexe. Nicht einmal ein Stück Seife hat sie mir mit gegeben.« »Können dir denn deine Schwestern nicht helfen?« frug der König.
»Nun, weine nur nicht. Steige auf jenen Berg hinauf, dort sitzt der König der Vögel. Dem bringe deine Wäsche und sage ihm, der König Cardiddu hätte dich geschickt.« Da stieg sie mühsam den Berg hinauf, und kam zum König der Vögel, dem brachte sie ihr Bündel und sagte ihm, der König Cardiddu habe sie geschickt.
Da tat der König der Vögel einen Pfiff, und sogleich kamen von allen Seiten seine Feen herbei, die nahmen die Wäsche und im Handumdrehen war sie gewaschen, gebleicht, gestopft, gebügelt und gefalten. Die arme Frau aber legte sich hin und schlief bis zum Abend. Als sie nun der Hexe die Wäsche brachte, war diese sehr erstaunt und zornig, daß sie auch diesen Auftrag richtig ausgeführt hatte, und sann über eine neue Arbeit nach.
Da nahm sie alle ihre Matratzen, zeigte sie der armen Frau und sprach: »Bis heute Abend mußt du alle diese Matratzen auftrennen, die Wolle waschen und trocknen, die Überzüge waschen und bügeln und die Matratzen gestopft wieder bringen, sonst fresse ich dich.«
Da nahm die arme Frau eine Matratze nach der anderen und trug sie mühsam auf das Feld hinaus, aber sie sah wohl, daß sie die Arbeit nie würde ausführen können. Da setzte sie sich hin und weinte, aber der treue König Cardiddu erschien auch gleich, und sie klagte ihm ihr Leid.
»Gehe wieder auf den Berg und sage dem König der Vögel, der König Cardiddu schicke dich,« sprach er. Sie konnte aber die schweren Matratzen nicht den Berg hinauf tragen, da half er ihr, und als sie zum König der Vögel kamen, pfiff dieser seinen Feen und die besorgten diese ganze Arbeit. Sie aber schlief ruhig bis zum Abend, dann brachte sie der Hexe die Matratzen wieder.
Nun wußte die Hexe keinen Rat mehr, und beschoß sie zu ihrer Schwester zu schicken, die war eine noch schlimmere Hexe. Da gab sie ihr einen Brief und ein Kästchen, das sollte sie dieser Schwester bringen. Die arme Frau ging betrübt ihren Weg und weinte, der König Cardiddu erschien aber auch gleich und frug sie, warum sie denn schon wieder weine.
Da klagte sie ihm ihr Leid. »Nun, weine nicht,« antwortete er, »merke nur auf das was ich dir sage. Dieses Kästchen sollst du also der Hexe bringen; hüte dich aber es unterwegs auf zu machen. Erst wirst du an einen reißenden Strom kommen, darin wird Blut und Wasser fließen. Sprich du aber nur: Nein, wie schön ist dieser Strom, so wird er sich besänftigen und du kannst hindurch.
Dann wirst du einen Esel und einen Hund sehen, der Esel hat im Maul den Knochen des Hundes, und der Hund hält das Gras des Esels. Wenn sie dich nun nicht vorbei lassen wollen, so nimm dem Esel den Knochen aus dem Maul und gib ihn dem Hund, und dem Esel gib das Gras. Dann wirst du an das Schloß der Hexe kommen; die Türe aber wird in einem fort sich auf und zu bewegen, daß du nicht durch kannst.
Sprich aber nur: Nein, wie schön ist diese Tür, so wird sie stille stehen. Dann gehe die Treppe hinauf und gib den Brief und das Kästchen ab. Die Hexe wird dir sagen, du sollst warten bis sie den Brief gelesen hat. Hüte dich aber, es zu tun, denn in dem Brief steht, sie soll dich fressen, sondern entfliehe so schnell du kannst, und die Tür, der Esel, der Hund und der Strom werden dich durch lassen.«
Nun ging die arme Frau getröstet weiter, wie sie aber das Kästchen so anschaute, erwachte die Neugierde in ihr, und sie dachte: »Es sieht es ja kein Mensch, ob ich das Kästchen aufmache.« Kaum aber hatte sie den Deckel berührt, so fing das Kästchen an zu klingen, und klang in einem fort. Da erschrak sie heftig, aber je mehr sie versuchte es zum Stillstehen zu bringen, desto lauter klang das Kästchen.
Da fing sie an bitterlich zu weinen und so gleich kam auch der König Cardiddu. »Habe ich dich nicht gewarnt?« sagte er. »Warum bist du doch so unverständig? Wäre ich nicht glücklicherweise noch in der Nähe gewesen, so hätte ich dir nicht helfen können. Dies eine Mal will ich dir noch helfen, dann aber sei verständig.«
Da brachte er die Musik zum Stillstehen, und gab ihr das Kästchen zurück und sie setzte ihren Weg fort. Nicht lange so kam sie an einen reißenden Strom, in dem floß Blut und Wasser. Da sprach sie: »Nein, wie schön ist dieser Strom!« und sogleich glättete sich das Wasser und sie konnte ohne Gefahr hindurch gehen.
Bald aber sah sie einen Esel, der hielt einen Knochen im Maul, und einen Hund, der hatte Gras im Maul, und beide stritten sich, also daß sie nicht durch konnte. Da nahm sie dem Esel den Knochen und gab ihn dem Hund und dem Esel gab sie das Gras und so gleich ließen die Tiere sie durch.
Als sie nun an das Schloß der Hexe kam, mußte sie durch eine Tür, die schlug immer auf und zu, also daß sie nicht durch konnte. Sie sprach aber: »Nein, wie schön ist diese Tür!« und die Tür blieb sogleich still stehen, und die arme Frau konnte durch. Da ging sie die Treppe hinauf und klopfte an, und als die Hexe heraus kam, gab sie ihr den Brief und das Kästchen.
»Warte einen Augenblick,« sprach die Hexe, »bis ich den Brief gelesen habe,« und ging in ein anderes Zimmer, sie aber sprang die Treppe hinunter, und als sie an die Tür kam, sprach sie ihren Spruch, da konnte sie durch, und als sie zu den Tieren kam, gab sie jedem sein Futter, und auch sie ließen sie durch, und als sie zum Strom kam, sagte sie ihren Spruch und entkam glücklich.
Die Hexe aber, da sie ihre Flucht merkte, lief ihr nach, und rief schon von Weitem der Tür zu: »O Türe, laß sie nicht durch.« Die Tür aber antwortete: »Warum sollte ich sie nicht durch lassen? Sie hat mir gesagt, ich sei schön, du aber schimpfst mich immer.« Und die Tür wollte für die Hexe nicht still stehen, also daß sie sich durch drücken mußte, so gut sie konnte.
Da rief sie auch den Tieren zu, sie sollten die Fliehende nicht durch lassen, aber die Tiere antworteten: »Warum sollten wir sie nicht durch lassen? Sie hat uns ja das Futter gewechselt, daß wir einige Augenblicke Ruhe gehabt haben, du aber hast es nie getan, und dich wollen wir nicht durch lassen.«
Da mußte sie einen großen Umweg machen, um vorbei zu kommen, und rief dem Strom zu, er solle die Fliehende aufhalten. Der Strom aber antwortete: »Warum sollte ich sie aufhalten? Sie hat mir gesagt, ich sei schön, du aber schimpfst mich immer, und dich will ich nicht durch lassen.« Da floß der Strom immer reißender, und als sie dennoch durch wollte, mußte sie jämmerlich ertrinken.
Als nun aber die arme Frau zu ihrer Herrin zurück kehrte, fand sie, daß große Vorbereitungen zu einem glänzenden Hochzeitsfest gemacht wurden, denn der König Cardiddu sollte nun doch die Tochter der Hexe heiraten. Da mußte auch die arme Frau Hand anlegen und tat es mit schwerem Herzen, denn sie hatte den König sehr lieb.
Als es aber Abend war, sprach der König zur Hexe: »Lasst die Magd mit zwei brennenden Kerzen am Fußende des Bettes knien.« Und die arme Frau mußte mit zwei brennenden Kerzen am Fußende des Bettes knien, während die Tochter der Hexe im Bett lag.
Die alte Hexe aber wollte um Mitternacht durch ihre Zauberkünste das Stück Boden, auf welchen sie kniete, einfallen lassen, also daß sie sterben müßte. Das wußte aber der König Cardiddu, und nach einer Weile sprach er zu seiner Frau: »Höre, das arme Weib dauert mich, noch dazu in diesem Zustand. Nimm ein Weilchen die Kerzen und laß sie ein wenig sitzen.«
Da mußte die Tochter der Hexe aufstehen und am Fußende des Bettes nieder knien, die rechte Frau aber setzte sich am Kopfende des Bettes auf einen Stuhl. Da flüsterte der König ihr zu: »Komm und lege dich ganz leise ins Bett.« Da rückte sie immer näher, bis sie im Bette lag. Als es aber Mitternacht schlug, da gab es einen gewaltigen Lärm, und der Boden sank ein und die Tochter der Hexe fiel in den Keller hinunter. Da standen der König und seine Frau leise auf und entflohen.
Als es nun kaum Tag war, wollte die Hexe nach ihrer Tochter sehen, aber als sie ins Zimmer trat, war niemand darin. Da lief sie ganz erschrocken in den Keller, und als sie erkannte, daß ihre eigene Tochter sich tot gefallen hatte, fing sie an laut zu schreien, und schwur sich zu rächen. Da verfolgte sie die beiden Fliehenden, und nicht lange, so hatte sie sie beinahe eingeholt.
Als der König sie nun kommen sah, sprach er: »Werde du zum Gemüsegarten und ich zum Gärtner darin.« Da wurde die Frau zum Gemüsegarten, und der König war der Gärtner darin. Nicht lange so kam die Hexe am Garten an, und frug den Gärtner: »Sagt mir, guter Mann, habt ihr vielleicht einen Mann und eine Frau gesehen, die hier vorbei liefen?«
»Was,« antwortete der Gärtner, »junge Erbsen wollt ihr? die sind noch nicht reif.« »Ach nein,« sprach sie, »ich frage euch ob ihr einen Mann und eine Frau habt vorbeilaufen sehen?« »Wie könnt ihr nach Rüben fragen,« antwortete er, »die sind ja gar nicht an der Zeit!« So antwortete er ihr auf jede Frage, bis die Hexe ungeduldig wurde und davon lief.
Da nahmen die beiden ihre menschliche Gestalt wieder an und flohen weiter. Die alte Hexe aber hatte sie bald erspäht, und setzte ihnen nach. »Werde du zur Kirche und ich zum Sakristan darin,« sprach der König, und also bald wurde die Frau zur Kirche und er zum Sakristan.
Als nun die Hexe vorbei kam, frug sie ihn: »Habt ihr vielleicht einen Mann und eine Frau gesehen, die hier vorbei liefen?« »Die Messe fängt erst in einer Stunde an,« antwortete der Sakristan, »der Pater ist noch nicht gekommen.« Und so viel sie ihn auch fragen mochte, er gab keine andere Antwort. Da wurde die Hexe ungeduldig, und lief fort, die beiden aber nahmen ihre menschliche Gestalt wieder an, und wanderten weiter.
Es dauerte aber nicht lange, da hatte die Hexe sie wieder erspäht, und setzte ihnen nach. »Werde du zum Aal,« rief der König, »und ich zum Teich, in dem du herum schwimmst,« und sogleich wurde der König zum Teich und seine Frau zum Aal.
Als nun die alte Hexe herbei kam, wollte sie den Aal fangen, aber so oft sie ihn auch in Händen hatte, der Aal entschlüpfte ihr immer wieder. Da merkte sie, daß sie auf diese Weise der beiden nicht habhaft werden konnte, und ging wieder nach Haus, indem sie sprach: »Wartet nur, ich will mich schon noch rächen!«
Da setzte sie sich an ihr Fenster, steckte die gefalteten Hände zwischen die Knie, und sprach: »Nicht eher soll die Frau des Königs Cardiddu eines Kindes genesen, bis ich die Hände aus dieser Lage genommen habe.«
Der König aber und seine Frau wanderten weiter, bis sie an das königliche Schloß kamen. Kaum aber waren sie dort, so war die Stunde der Frau herbei gekommen, und sie konnte doch das Kind nicht zur Welt bringen, so lange die alte Hexe den Zauber auf ihr ließ.
Da rief der König einen treuen Diener, und schickte ihn in alle Kirchen der Stadt herum, mit dem Befehl an die Küster, sie sollten die Totenglocken läuten. Dann mußte der Diener sich vor dem Hause der Hexe aufstellen. Als sie ihn nun da stehen sah, frug sie ihn: »Was bedeutet denn das Läuten der Totenglocken in allen Kirchen?«
Er antwortete: »Der König Cardiddu ist gestorben.« Da vergaß sie sich in ihrem Jubel und klatschte vor Freuden in die Hände, und sogleich gebar die Frau des Königs einen schönen Knaben. Da mußte der Diener wieder in alle Kirchen laufen, und überall befehlen, mit allen Glocken Gloria zu läuten.
Als er sich nun wieder vor das Haus der alten Hexe auf stellte, frug sie ihn: »Warum wird denn Gloria geläutet?« Er antwortete: »Die Frau des Königs hat einen wunderschönen Knaben bekommen.« Da merkte sie den Betrug, und in ihrem Zorn rannte sie mit dem Kopf gegen die Mauer, daß sie tot hin fiel.
Da feierte der König ein schönes Hochzeitsfest, und es war große Freude im Schloß. Die junge Königin aber ließ ihre Eltern und Schwestern auch an den Hof kommen, und sie lebten alle glücklich und zufrieden, wir aber gehen leer aus.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VOM PRINCIPE SCURSINI ...

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten alles, was ihr Herz begehrte, Essen und Trinken, schöne Kleider und Wagen, und Feste so oft sie wollten, und nur Eines fehlte ihnen: sie hatten keine Kinder.
Die Königin aber sprach immer in ihrem Herzen: »O Gott, ein jedes Tier hat seine Jungen, selbst die Spinnen, die Eidechsen und Käfer, und nur mir habt ihr kein Kind gegeben.« Da ging sie eines Tages im Garten spazieren, und sah eine Ringelnatter mit ihren Jungen umher kriechen, da sprach sie: »O Gott, wie viele Jungen habt ihr diesem giftigen Tiere gegeben, und mir schenkt ihr kein Kind. So wollte ich denn, ich hätte einen Sohn, und wenn es ein Scursuni wäre.«
Nicht lange darauf wurde die Königin guter Hoffnung, und es war darüber große Freude im Schloß und im ganzen Land. Als die neun Monate vorüber waren, kam ihre Stunde, da sie gebären sollte, und der König schickte sogleich nach der Hebamme. Als diese aber in die Türe des Zimmers trat, wo die Königin lag, fiel sie tot nieder.
»Was ist das?« rief der König. »Schnell, ruft eine andere Hebamme.« Da ließen sie eine andere kommen, es erging ihr aber nicht besser als der ersten; und so viele sie auch rufen mochten, sie fielen alle tot nieder, sobald sie das Zimmer der Königin betraten.
Nun wohnte neben dem Schlosse ein armer Schuster, der hatte eine einzige Tochter, die war wunderschön. Sie hatte aber eine Stiefmutter, die konnte das Mädchen nicht leiden, und sann immer darüber nach, wie sie sie verderben könne.
Als nun die böse Stiefmutter hörte, welche große Not auf dem Schlosse herrschte, sprach sie zu dem Mädchen: »Zieh dich an, und geh aufs Schloß; du sollst der Königin in ihrer schweren Stunde bei stehen,« denn sie dachte, nun werde das Mädchen sterben, wie die anderen Frauen auch.
»Ach,« sagte das Mädchen, »wie soll ich der Königin bei stehen? Es kann ja niemand an sie heran treten, ohne zu sterben.« »Das geht mich nichts an,« sprach die böse Stiefmutter, und trieb das arme Mädchen mit harten Worten hinaus. Da ging das arme Mädchen in die nahe Kirche, wo ihre rechte Mutter begraben war, und jammerte:
»Ach, Seele meiner Mutter! ach, liebes Mütterchen! siehe doch wie ich mißhandelt werde! ach, hilf mir doch!« »Weine nicht!« antwortete eine Stimme, und das war die Seele ihrer Mutter; »sondern geh mutig aufs Schloß, denn wenn du tust, was ich dir sage, so wird dir kein Leid geschehen. Laß dir vom Schlosser ein Paar eiserne Handschuhe machen, und ziehe sie an. Dann bereite einen großen Kübel Milch, und wenn die Königin ihr Kind gebären wird, so ergreife es mit den eisernen Handschuhen, und wirf es in die Milch.«
Da ging das Mädchen getröstet aus der Kirche, und ließ sich vom Schlosser ein Paar eiserne Handschuhe machen; die zog sie an, und ging aufs Schloß, um der Königin bei zu stehen. Ehe sie aber ins Zimmer trat, ließ sie sich einen großen Kübel mit Milch geben, den nahm sie mit und stellte ihn neben das Bett.
Die Königin lag noch in schweren Nöten, als aber die Schusters Tochter sie in ihre Arme nahm, konnte sie das Kind zur Welt bringen, und sie gebar einen Sohn, der war anzusehen, wie ein ganz großer Scursuni. Da ergriff ihn das Mädchen mit den eisernen Handschuhen, und warf ihn in die Milch, und der Scursuni trank die Milch und badete sich darin.
So wurde der Sohn der Königin mit jedem Tage größer und stärker, er war und blieb aber ein Scursuni, darum, weil seine Mutter sich versündigt hatte, als sie sich einen Sohn wünschte, und wenn es ein Scursuni wäre.
So vergingen einige Jahre; eines Tages aber sprach der Scursuni zu seiner Mutter: »Mutter, gebt mir eine Frau, ich will mich verheiraten.« »Ach, nun will das Tier gar heiraten,« rief die Königin, »wer wollte dich denn wohl nehmen, du häßlicher Scursuni!« »Mutter! das geht mich nichts an, ich will aber eine Frau haben.«
Da ging die Königin zum König, und sprach: »Denke dir, unser Sohn will heiraten. Neben uns wohnt ein armer Weber, der hat eine hübsche Tochter; die wollen wir kommen lassen, ohne ihr zu sagen, daß sie unsern Sohn heiraten soll.« Der König war es zufrieden, und die Königin ließ den Weber rufen, und sprach zu ihm: »Meister, ihr habt eine hübsche Tochter; schickt sie uns doch, daß sie meinen Sohn bediene, und ihm aufwarte, so wollen wir sie reich bezahlen.«
Der Vater willigte gern ein, und schickte seine Tochter aufs Schloß, und sie wurde zum Principe Scursuni eingesperrt. Am Abend legte sie sich zu Bette, um Mitternacht aber streifte der Scursuni plötzlich seine Schlangenhaut ab, und stand da als ein schöner, wohl gebildeter Mann.
»Wessen Tochter bist du?« frug er das Mädchen. Sie sprach: »Die Tochter eines Webers.« »Was! ich bin ein Königssohn, und man bringt mir zur Frau die Tochter eines Webers?« Mit diesen Worten fuhr er wieder in seine Schlangenhaut, und stach sie zu Tode.
Am nächsten Morgen kam die Königin ins Zimmer, und frug den Principe Scursuni: »Nun, mein Sohn, hat dir deine Frau gefallen?« »Was? die soll meine Frau sein?« brummte er, »ich bin eines Königs Sohn, und will eine Fürstentochter heiraten, nicht aber die Tochter eines armseligen Webers. Seht, dort liegt sie.« Da lief die Königin ans Bett, und fand das tote Mädchen, und jammerte: »Nun hat der garstige Scursuni das arme Mädchen ermordet!« Dem Weber aber ließ sie sagen, seine Tochter sei gestorben.
Nicht lange, so verlangte der Principe Scursuni wieder nach einer Frau. »Mutter,« sprach er, »ich will heiraten, verschafft mir eine Frau.« »Ach, geh doch, du häßlicher Scursuni, wer sollte dich wohl zum Manne nehmen?« »Mutter! das ist mir einerlei; eine Frau müßt ihr mir aber verschaffen.« Was konnte die Königin tun?
Sie dachte: »Gott sendet mir dies Kreuz um meiner Sünden willen,« und ließ einen armen Schlosser rufen, der wohnte neben dem Schloß, und hatte auch eine hübsche Tochter. »Meister,« sprach sie, »ihr habt eine hübsche Tochter, schickt sie uns doch, daß sie bei uns diene, so wollen wir für sie sorgen.«
Der Schlosser war es zufrieden, und schickte seine Tochter aufs Schloß. Die Königin nahm sie freundlich auf, und brachte sie ins Zimmer zum Principe Scursuni. Am Abend legte sie sich zu Bett, um Mitternacht aber streifte der Scursuni seine Schlangenhaut ab, und stand als ein schöner Mann da, und frug sie: »Wessen Tochter bist du?« »Die Tochter eines Schlossers.« »Was? ich soll die Tochter eines Schlossers heiraten, und bin doch ein Königssohn?« Damit fuhr er wieder in seine Schlangenhaut, und stach sie zu Tode.
Am Morgen dachte die Königin voller Angst: »Wenn mir der unglückliche Scursuni nur nicht auch dies arme Mädchen ermordet hat.« Da trat sie ins Zimmer, und frug ihren Sohn: »Nun, mein Sohn, wie hat dir deine Frau gefallen?« »Was? meine Frau? ich will eine Königstochter zur Frau und keine Schlossers Tochter. Dort liegt sie.«
Da lief die Königin ans Bett, und sah das arme Mädchen tot drin liegen, und jammerte: »Nun hat der Bösewicht auch dieses unglückliche Mädchen ermordet!« Dem Vater aber ließ sie sagen, seine Tochter sei gestorben.
Nun lebte noch immer neben dem Schlosse der arme Schuster, der die schöne Tochter hatte; die böse Stiefmutter aber konnte sie immer weniger leiden, und trachtete, wie sie, sie verderben könnte. Da sprach sie zu ihr: »Zieh dich an, denn du sollst aufs Schloß gehen, und den Principe Scursuni bedienen.« »Ach,« antwortete die Tochter, »es sind schon zwei Mädchen in seinem Dienste gestorben, nun wollt ihr mich auch tot sehen.«
»Widersprich mir nicht,« sprach die Stiefmutter, »sondern mache dich fertig, und wenn du nicht gehorchen willst, so jage ich dich aus dem Hause.« Da ging das Mädchen jammernd in die Kirche, wo ihre Mutter begraben war, und weinte: »Ach, Seele meiner Mutter! ach, liebes Mütterchen mein! sieh, wie man mich so arg mißhandelt! ach, hilf mir doch!«
»Weine nicht!« antwortete die Seele ihrer Mutter, »sondern gehe ruhig aufs Schloß zum Principe Scursuni. Wenn er dich aber fragt, wessen Tochter du seiest, so antworte ihm, du seiest eines großen Fürsten Tochter, und erzähle ihm von deinem Reichtum und deinen Schätzen.«
Da ging das Mädchen mit ihrer Stiefmutter aufs Schloß, und die Stiefmutter sprach zur Königin: »Königliche Majestät, hier bringe ich euch meine Stieftochter, die will gern dem Principe Scursuni dienen.« Die Königin nahm sie freundlich auf, und führte sie in das Zimmer ihres Sohnes, und sperrte sie mit ihm ein.
Am Abend legte sich die Schusters Tochter zu Bett, und um Mitternacht streifte der Königssohn seine Schlangenhaut ab, und stand da als ein schöner, großer Mann. »Wessen Tochter bist du?« frug er das Mädchen. Da fing sie an zu erzählen, sie sei eines reichen Fürsten Tochter, und sprach von ihren Schätzen und ihrem Reichtum.
Nun war der Königssohn ganz zufrieden, und sprach: »Auf mir ruht ein Fluch, den hat mir meine Mutter zu gezogen, als sie sich einen Sohn wünschte, und wenn es ein Scursuni wäre. Wenn ich aber von meinem Zauber erlöst sein werde, dann sollst du meine Gemahlin sein.« Dann legte auch er sich nieder, und sie schliefen ruhig bis zum Morgen; als aber der Tag anbrach, fuhr er wieder in seine Schlangenhaut.
Am Morgen kam die Königin voller Angst in das Zimmer ihres Sohnes, da trat ihr aber die Schusters Tochter munter und fröhlich entgegen, und der Principe Scursuni rief: »So, Mutter, nun habe ich eine gute Frau gefunden!«
So vergingen mehre Monate, und die Schusters Tochter lebte mit dem Principe Scursuni auf seinem Zimmer, und er liebte sie wie seine Augen. Bald wurde sie auch guter Hoffnung, und als ihre Stunde kam, gebar sie einen wunderschönen Sohn, sie hielt ihn aber versteckt, daß weder der König noch die Königin von ihm wußten.
In der Nacht nun weinte das Kindchen einmal, da stand der Königssohn auf, wiegte es und sang:
»Schlaf, schlaf, schließ die Äugelein!
Erfährt es deine Großmama,
Mit goldnen Windeln ist sie da.«
Da hörte die Königin den Gesang, und am nächsten Morgen rief sie die Schusters Tochter, und frug sie: »Was war das für ein Gesang heute Nacht in eurem Zimmer?« Da erzählte ihr die Schusters Tochter alles, und sprach: »Ach, wenn ihr wüßtet was euer Sohn für ein schöner Jüngling ist! aber es ruht ein böser Zauber auf ihm.« »Frage ihn, wie man ihn erlösen kann,« sprach die Königin.
Am Abend nun frug das Mädchen den Königssohn: »Was gehört dazu, um dich von deinem Zauber zu erlösen?« »Um mich zu erlösen, müßte ein Gewand von feiner weißer Leinwand in einem Tage gesponnen, gewoben und genäht werden.
Dann müßte ein Kalkofen drei Tage und drei Nächte lang geheizt werden, und wenn ich meine Schlangenhaut abstreife, müßte mir jemand das Gewand überwerfen, und die Haut schnell in den Kalkofen werfen. Mich aber muß man mit Gewalt festhalten, sonst stürze ich mich auch ins Feuer.«
Am anderen Morgen sagte sie alles der Königin, und sie rief gleich alle Arbeiterinnen der ganzen Stadt zusammen; die mußten in einem Tage den Flachs spinnen und weben, und daraus ein leinenes Gewand nähen. Dann ließ sie drei Tage und drei Nächte den Kalkofen heizen, und als alles fertig war, gab sie der Schusters Tochter das Gewand.
Am Abend, als der Principe Scursuni seine Schlangenhaut abgestreift hatte, warf ihm seine Frau das Gewand über. Zugleich sprangen die Diener herein; einige warfen die Schlangenhaut ins Feuer, die anderen aber hielten den Königssohn fest, der um sich schlug, und sich durchaus auch ins Feuer stürzen wollte. Und als die Haut ganz verbrannt war, da wich auch der Zauber von ihm, und er blieb ein schöner Jüngling.
Der König und die Königin umarmten voll Freude ihren Sohn, und ihren kleinen Enkel, und auch ihre liebe Schwiegertochter. Die aber sprach zum Königssohn: »Ich bin keine Fürstentochter, wie ich dir gesagt habe, sondern mein Vater ist nur ein armer Schuster.«
Da antwortete er: »Du hast mich von meinem Zauber erlöst; darum sollst du auch meine liebe Gemahlin sein. Und sie feierten eine prächtige Hochzeit, mit großen Festlichkeiten, und so blieben sie zufrieden und glücklich, wir aber wie ein Bündel Wurzeln.«
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VOM KLUGEN PEPPE ...

Es war einmal eine arme Waschfrau, die hatte einen einzigen Sohn, der hieß Peppe und alle Leute hielten ihn für dumm. Nun war es einmal im Carneval, und in allen Häusern wurde gekocht und gebraten, Maccaroni und Wurst, und nur die arme Waschfrau hatte nichts zu essen als trocken Brot. Da sprach Peppe:
»Mutter, in allen Häusern ißt man heute so gute Sachen, und wir allein sollen trocken Brot essen? Gebt mir euer Huhn, das will ich verkaufen und dafür Maccaroni und Wurst kaufen.« »Bist du toll?« rief die Frau. »Soll ich mein letztes Huhn verkaufen, damit ich nachher keins mehr habe?« Peppe aber bat so lange, bis die Mutter ihm endlich das Huhn gab.
Als er nun auf den Markt kam, bot er sein Huhn zum Verkauf an. Da kam ein Mann heran und frug ihn: »Wie viel willst du für dein Huhn?« »Drei Tari.« »Ist es auch recht fett?« frug der Mann, und nahm das Huhn in die Hand, als ob er es wiegen wolle; ehe sich Peppe aber dessen versah, war der Mann mit samt dem Huhn verschwunden.
Denkt euch nun den armen Peppe, wie er jammerte: »Ach, nun wird meine Mutter mich mit Schlägen umbringen, ach was soll ich tun?« Auf einmal sah er den Dieb vor einem Maccaroniladen stehen; leise schlich er hin zu, und hörte, wie der Mann sagte: »Leget funfzig Rottoli Maccaroni für mich auf die Seite, hier ist das Geld dafür; morgen früh wird ein Bursche mit einem weißen Esel kommen, dem könnt ihr die Maccaroni übergeben.«
Dieser Mann aber war ein Räuberhauptmann und hatte elf Räuber unter sich. Als der Räuber die Maccaroni eingekauft hatte, ging er in einen Wurstladen, und Peppe schlich wieder hinter ihm her. »Legt vierzig Rottoli Wurst für mich bei Seite,« sprach der Räuberhauptmann zum Metzger; »hier ist das Geld dafür; morgen früh wird ein Bursche mit einem weißen Esel kommen, dem könnt ihr die Wurst übergeben.«
Dann ging der Räuber auch noch in einen Kaufladen und kaufte vier Rottoli Käse ein, die er auch liegen ließ bis zum nächsten Morgen. Peppe aber schlich immer hinter ihm drein und merkte sich alles. Als er nun nach Hause kam, frug ihn seine Mutter gleich: »Wie viel hast du für das Huhn bekommen?« »Ach, Mutter, antwortete Peppe, so und so ist es mir ergangen.«
Als die Frau nun hörte, wie er sich das Huhn hatte stehlen lassen, nahm sie einen großen Stock und prügelte den Peppe tüchtig durch. Er aber sagte: »Laßt mich doch nur machen, Mutter; der Räuber soll euch das Huhn hundertfältig bezahlen. Verschafft mir nur einen weißen Esel, so werde ich morgen euer Herz erfreuen.«
»Ach, was willst du mit einem weißen Esel tun?« rief die Waschfrau; »du Dummkopf, der du nicht einmal im Stande bist, ein Huhn zu verkaufen.« Peppe aber bat so lange, bis sie hin ging und sich von einer Nachbarin einen weißen Esel leihen ließ. Am nächsten Morgen stand Peppe ganz frühe auf und trieb den weißen Esel zum Maccaroniladen.
»Heda, guter Freund, mein Padrone schickt mich, die funfzig Rottoli Maccaroni zu holen, die er gestern hier eingekauft hat.« Der Bäcker sah den weißen Esel und dachte: »das ist jedenfalls der Bursche, den der Käufer von gestern für die Maccaroni zu schicken versprach.«
Also gab er dem Peppe ruhig die Maccaroni; Peppe lud sie auf seinen Esel und trieb diesen zum Metzger. »Gebt mir die vierzig Rottoli Wurst, die mein Padrone gestern hier gekauft hat,« sprach er, und da der Metzger den weißen Esel sah, dachte er, es sei richtig, und lieferte die Wurst ab. Nun ging Peppe auch noch zum Käseladen und ließ sich die vier Rottoli Käse ausliefern; dann brachte er alles seiner Mutter und rief:
»Mutter, nun laßt uns essen und trinken, denn nun ist das Huhn zum vierten Teil bezahlt.« - Unterdessen war der wirkliche Bursche des Räuberhauptmanns mit seinem weißen Esel zum Maccaroniverkäufer gekommen, und wollte seine Maccaroni haben. »Willst du sie dir denn zweimal holen?« sagte der Bäcker, »du bist ja schon einmal dagewesen.«
»Das bin ich aber nicht gewesen,« sprach der Bursche. »Ja, dann kann ich dir nicht helfen,« antwortete der Bäcker, »es kam einer mit einem weißen Esel, dem habe ich die Maccaroni gegeben.« Dasselbe sagten auch der Metzger und der Käsehändler, und der Bursche mußte mit leeren Händen nach Hause zurückkehren, Peppe aber und seine Mutter aßen sich an Maccaroni und Wurst satt.
Den nächsten Morgen sprach Peppe: »Mutter, der Mann hat mir mein Huhn erst zum vierten Teil bezahlt. Verschafft mir Mädchenkleider, so will ich ihn schon dazu kriegen, mir den Rest zu geben.« Als seine Mutter ihm nun die Mädchenkleider brachte, verkleidete er sich als Mädchen, und wanderte fort, bis er an das Haus kam, wo die zwölf Räuber wohnten.
Dort setzte er sich auf die Schwelle und fing laut an zu jammern und zu weinen. Nicht lange, so schaute ein Räuber zum Fenster hinaus, und frug ihn: »Warum weinst du, schönes Mädchen?« »Ach, mein Vater hat mir gesagt, ich solle hier auf ihn warten; und nun ist es schon beinahe Nacht, und mein Vater kommt noch immer nicht, und wie soll ich nun den Weg nach Hause finden?«
»Nun, sei nur ruhig,« sagte der Räuber, »komm herein, so wollen wir dich hier behalten, und du sollst es gut bei uns haben.« Da ging Peppe hinein, und die zwölf Räuber gaben ihm zu essen und zu trinken.
Als es Nacht wurde, sprach der Hauptmann: »Dieses Mädchen will ich für mich behalten, und diese Nacht soll sie in meiner Kammer schlafen.« »Ach, nein,« sagte Peppe, »das kann ich nicht; ich schäme mich.« »Sei nicht dumm,« rief der Räuberhauptmann, und führte das vermeintliche Mädchen in seine Kammer. Da sah nun Peppe viel Gold und Silber umherliegen, in einer Ecke aber stand ein Galgen.
»Was ist das schwarze Ding da?« frug er. »Das ist ein Galgen,« antwortete der Räuberhauptmann, »daran erhängen wir die Leute, die uns beleidigt haben.« »Wie macht ihr denn das?« frug Peppe, und der Räuber antwortete: »Da steckt man ihnen den Kopf in diese Schlinge und zieht an der Schnur, bis sie sterben.«
»Ach, das kann ich nicht verstehen; macht es mir doch einmal vor.« Da steckte der Räuber seinen Kopf in die Schlinge, Peppe aber sprang hin zu und zog am Strick, nicht stark genug, um den Räuber zu erdrosseln, sondern nur so viel, daß er kaum mehr atmen, und gar nicht sprechen konnte. Dann ergriff Peppe einen großen Prügel und schlug auf den Räuber los, bis er halb tot war:
»Oh, du Bösewicht, kennst du mich nicht? Ich bin ja der Bursche, dem du das Huhn gestohlen hast,« rief er zwischen dem Prügeln. Als er endlich müde war, füllte er seine Taschen mit Goldstücken, schlich sich leise aus dem Haus, und lief voll Freuden zu seiner Mutter. »Hier, Mutter, nehmt das Geld; nun ist das Huhn zur Hälfte bezahlt.«
Am nächsten Morgen warteten die Räuber von Stunde zu Stunde, daß ihr Hauptmann aufwachen sollte. Als aber alles ruhig blieb, schlugen sie um Mittag die Türe ein und fanden ihn halb erdrosselt und halb zu Tode geschlagen. Da machten sie ihn los und legten ihn zu Bette, und er konnte nur mit heiserer Stimme keuchen: »Es war der Bursche, dem ich das Huhn gestohlen.«
»Wo sollen wir nun einen Arzt her holen,« sprachen die Räuber, und einer trat ans Fenster, um zu sehen, ob etwa ein Arzt vorbei käme. Da sah er einen Doktor auf seinem Eselchen daher reiten und rief ihn an und lud ihn ein herauf zu kommen. Der Doktor aber war niemand anders, als Peppe, der sich also verkleidet hatte, um noch einmal zu den Räubern zu gelangen.
Als ihn nun der Räuber anrief, kam er langsam und bedächtig die Treppe herauf und ließ sich an das Bett des Kranken führen. »Dieser Mann ist sehr krank,« sagte er; »aber durch meine Kunst kann ich ihn wohl gesund machen. Nur brauche ich dazu die, und die und das.« So schickte er die elf Räuber alle aus dem Haus, Jeden auf eine andere Seite, und blieb allein mit dem Kranken.
»Kennst du mich wieder nicht, du Bösewicht?« frug er. »Ich bin der Bursche, dem du das Huhn gestohlen hast.« »Oh! Barmherzigkeit! schlage mich nicht tot; ich will dir auch hundert Unzen geben!« »Die kann ich mir schon selber holen,« antwortete Peppe; »aber die Schläge, die ich von meiner Mutter bekommen habe, sollst du auch kosten.«
Damit ergriff er wieder einen Stock und prügelte den Räuberhauptmann durch, bis er nicht mehr konnte. Dann füllte er seine Taschen mit Goldstücken, ließ den Räuber halb tot liegen und ritt vergnügt nach Hause. »Hier, Mutter, seht dieses Gold. Nun ist das Huhn zu Dreivierteln bezahlt, morgen gehe ich hin und hole mir auch noch das letzte Viertel.«
»Ach, mein Sohn, nimm dich in acht, daß dich die Räuber nicht erkennen.« »Was sollen sie mir tun?« sagte Peppe, und am nächsten Morgen verkleidete er sich in einen Straßenkehrer, lud den Zimmili auf seinen Esel und zog wieder die Straße entlang dem Haus der Räuber zu.
Die Räuber sprachen eben unter einander: »Was tun wir nun mit unserm Hauptmann? Anstatt besser zu werden, wird er nur immer schlimmer. Wir wollen ihn ins Hospital schicken; wenn wir nur Jemand hätten, um ihn hin zu bringen.« Da schauten sie zum Fenster hinaus und sahen einen Straßenkehrer vorbei kommen, das war eben Peppe.
»Schöner Bursche,« riefen sie ihn an, »wenn du uns einen Dienst erweisen willst, so geben wir dir eine Unze.« »Was soll ich denn tun?« »Wir haben hier einen kranken Mann, den wollen wir in deinen Zimmili legen, und du bringst ihn dann ins Hospital.« »Gut,« antwortete Peppe, räumte seinen Zimmili aus, und die Räuber legten ihren kranken Hauptmann hinein und gaben dem Peppe eine Unze.
Dem Räuberhauptmann aber banden sie eine Geldkatze um, die war schwer von Goldstücken. Peppe stellte sich nun, als ob er den Weg zum Hospital einschlage, als er aber den anderen aus dem Gesicht war, trieb er seinen Esel in die Berge, die allerschlechtesten Wege. »Wohin führst du mich denn?« frug der Räuber.
»Komm du nur mit, du Bösewicht! Kennst du mich nicht mehr? Ich bin der Bursche, dem du das Huhn gestohlen hast.« »Ach, Barmherzigkeit! Laß mich leben; ich will dir auch alles Geld geben, das ich auf mir trage.« »Das will ich mir schon selber nehmen,« sagte Peppe, und schnallte ihm den Gürtel mit dem Gelde los; dann warf er den Räuberhauptmann in einen Graben und ließ ihn liegen.
Als er nach Hause kam, brachte er seiner Mutter all das Geld und rief: »So, Mutter, nun ist das Huhn ganz bezahlt; nun sind wir reiche Leute, und können sorgenfrei leben.« So wurde Peppe, den alle Leute für dumm gehalten hatten, gescheit und klug.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON TOBIÀ UND TOBIÒLA ...

Es war einmal ein Mann, der hieß Tobià, seine Frau hieß Sara, und sein Sohn Tobiòla. Tobià war ein frommer, gottesfürchtiger Mann, der all sein Gut dazu verwandte, den Armen viel Gutes zu tun. Alle Toten, die arm gestorben waren, ließ er in sein Haus bringen, trug sie dann selbst auf seinem Rücken aus der Stadt, und beerdigte sie auf seine Kosten. Dies tat er zur Buße und um der armen Seelen willen.
Seine Frau machte ihm oft Vorwürfe: »Ach, Tobià, wie wird es uns noch gehen, wenn du all dein Gut den Armen gibst; du wirst sehen, es wird noch die Zeit kommen, wo wir selber betteln gehen müssen.« »Laß es gut sein, liebe Sara,« antwortete er, »wer Gutes tut, wird Gutes finden.«
Nun begab es sich eines Tages, daß Tobià hörte, in der Stadt sei ein armer Mann gestorben. »Bringt ihn her zu mir,« sprach er, »ich will ihn heute Abend beerdigen.« Da brachten sie ihm den Toten und er legte ihn unter das Bett; am Abend aber nahm er ihn auf seinen Rücken und trug ihn zur Stadt hinaus.
Als er den Toten beerdigt hatte, ward er so müde, daß er sich unter einen Baum legte, um zu schlafen. In dem Baum aber hatte eine Schwalbe ihr Nest. Als nun Tobià unter dem Baume schlief, fiel etwas von dem Unrat der Schwalbe ihm in die Augen, also daß er erblindete. Da erwachte er, aber er konnte nichts mehr sehen, und nur mit vieler Mühe fand er den Weg nach Hause zurück.
Als seine Frau ihn so kommen sah, schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und jammerte: »Ach, Tobià, was ist dir denn geschehen?« »Ja, was kann ich dafür,« sagte Tobià, »ich hatte mich unter einen Baum gelegt, um ein wenig zu ruhen. In dem Baume aber hatte eine Schwalbe ihr Nest, da fiel mir etwas von ihrem Unrat in die Augen, und ich erblindete.«
»Ach, wir Unglücklichen! was soll nun aus uns werden, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, und alle unsere Habe und Gut hast du ja den Armen gegeben!« »Sei nur ruhig,« sagte Tobià, »wer Gutes tut, wird Gutes empfangen, und Gott verläßt den Gerechten nicht.«
Nun kam für den armen Tobià eine schwere Zeit, denn blind wie er war, konnte er nicht arbeiten, also daß ihm bald das Geld ausging. Da sprach er eines Tages zu seiner Frau: »Liebe Frau, unser Geld ist zu Ende; in der und der Stadt wohnt aber ein Bekannter von mir, dem habe ich einst Geld geliehen. Wir wollen unseren Sohn Tobiòla hin schicken, daß er sich das Geld wieder geben lasse.«
Also rief Tobià seinen Sohn Tobiòla und sprach zu ihm: »Mein Sohn, du mußt nun nach der und der Stadt gehen, und das Geld holen, das ich dort angelegt habe. Ich will aber nicht, daß du allein reist, gehe auf den Markt, und sieh, ob du einen Reisegefährten findest.«
Da ging Tobiòla auf den Marktplatz, und sah einen schönen, schlanken Jüngling stehen, der frug ihn: »Tobiòla, wohin willst du reisen?« »In die und die Stadt.« »Dahin muß ich ja auch gehen, wir können also zusammen reisen.« Da ward Tobiòla hoch erfreut, und führte den Jüngling zu seinen Eltern und sprach:
»Lieber Vater und liebe Mutter, ich habe nun einen Reisegefährten gefunden, gebt mir euren heiligen Segen, und laßt mich ziehen.« Da segneten Tobià und seine Frau ihren lieben Sohn und umarmten und küßten ihn, und Tobiòla zog mit dem Jüngling von dannen. Die Stadt aber, wohin sie reisen wollten, war viele Tagereisen weit entfernt.
Eines Tages nun kamen sie an einen Strom, darin schwamm ein Fisch herum, der kam immer dicht ans Ufer. »Tobiòla,« sprach der Jüngling, »greife den Fisch, und schneide ihm die Galle und die Leber aus; es wird dir nützen.« Tobiòla tat, wie der Jüngling ihn tun hieß, griff den Fisch, schnitt ihm Galle und Leber aus, und verwahrte sie in einem Büchschen.
Nachdem sie die Reise vollbracht hatten, kamen sie endlich in die Stadt, in der Tobiòla das Geld holen sollte. »Wo willst du hier Herberge nehmen?« frug ihn der Jüngling. »Mein Vater hat hier einen Bekannten, der ist sein Gevatter, bei dem soll ich wohnen,« sprach Tobiòla. Dieser Gevatter aber hatte eine Tochter, die war wunderschön, und hatte schon sieben Männer gehabt, die waren aber alle sieben in der Brautnacht gestorben.
Als nun Tobiòla und der Jüngling zu dem Manne kamen, sprach Tobiòla: »Gevatter, ich bin der Sohn eures Gevatters Tobià und seiner Frau Sara.« »O, Gevatter, welche Freude,« rief der Mann, »kommt doch in mein Haus, und bleibt bei mir, ihr und euer Begleiter.«
Tobiòla und der Jüngling traten ein, und die schöne Tochter des Gevatters brachte ihnen zu essen und zu trinken. »Weißt du, was ich mir ausgedacht habe, Tobiòla?« sprach der Jüngling, »ich will dich mit diesem schönen Mädchen verheiraten.« »O, Bruder mein,« antwortete Tobiòla, »das ist aber mein Tod; denn dieses Mädchen hat schon sieben Männer gehabt, und alle hat man am Morgen nach der Hochzeit tot im Bett gefunden.«
»Sei nur ruhig, Tobiòla, wenn du tust, was ich dir sage, so wird dir nichts geschehen.« So sprach der Jüngling und ging zum Gevatter. »Guter Freund,« sagte er, »mein Gefährte Tobiòla wünscht eure schöne Tochter zu heiraten. Gebt sie ihm und laßt uns dann wieder in unsre Heimat zurück kehren.«
Der Vater wollte nicht und sprach: »Ach, wißt ihr denn nicht, daß meine Tochter dies schreckliche Schicksal auf sich hat, daß sie schon sieben Männer gehabt hat, und alle sind in der Brautnacht gestorben?« »Wer weiß,« antwortete der Jüngling, »vielleicht wird Tobiòla nicht sterben, gebt ihm nur eure Tochter.«
Also wurde die Hochzeit gefeiert, und Tobiòla heiratete die schöne Tochter des Gevatters. Nach der Trauung aber nahm ihn sein Gefährte bei Seite, und sprach zu ihm: »Höre wohl auf meine Worte und befolge sie genau. Heute Abend, wenn du mit deiner jungen Frau in die Kammer geführt wirst, so verschließe die Türen und Fenster wohl, und lege die Galle des Fisches auf ein Kohlenbecken, daß sie verbrenne, und der Rauch euch Beide durch ziehe.
Dann wirf dich mit deiner Frau auf die Knie, und tut drei Stunden lang Buße, denn deine Frau wird von einem bösen Teufel geplagt, der heißt Romeò, und weil ihre anderen sieben Männer nicht Buße taten, so bekam er Gewalt über sie.«
Tobiòla merkte sich alles, was der Jüngling gesagt hatte, und als er mit seiner Frau in die Kammer geführt wurde, verschloß er die Türen und Fenster wohl, daß kein Rauch hinaus dringen konnte. Dann nahm er die Galle aus dem Büchschen, daß sie verbrannte, und der Rauch die ganze Kammer erfüllte. Tobiòla aber und seine Frau warfen sich auf den Boden und taten Buße, drei Stunden lang, und das schöne Mädchen weinte bitterlich in ihrer Herzensangst. Nach den drei Stunden legten sie sich zu Bette und schliefen ruhig bis zum Morgen.
Als der Tag anbrach, standen der Gevatter und seine Frau in schweren Sorgen auf, und der Mann sprach zu seiner Frau: »Geh einmal in die Kammer und sieh, ob der unglückliche Tobiòla noch lebt.« Als sie aber in die Kammer trat, lagen Beide im Bett und schliefen sanft und ruhig. Da war große Freude im Haus, und alle lobten Gott und dankten ihm für seine Gnade.
Tobiòla blieb nun noch einige Tage in der selben Stadt; nach dem er aber das Geld seines Vaters wieder bekommen hatte, sprach er zum Gevatter: »Lieber Schwiegervater, ich muß nun wieder nach Hause zu meinen Eltern gehen, gebt uns euren Segen und laßt uns ziehen.«
Da lud der Schwiegervater die Aussteuer seiner Tochter auf einige Maultiere, segnete seine Tochter und seinen Schwiegersohn und ließ sie ziehen.
Seine Mutter Sara aber weinte immer, weil ihr lieber Sohn schon so lange fort war, und sie nichts mehr von ihm gehört hatte, und des Abends stieg sie auf einen hohen Berg, und schaute aus, ob er nicht bald käme.
Als sie nun wieder einmal auf dem Berg stand, und mit vielen Tränen nach Tobiòla aus schaute, sah sie auf einmal zwei Männer und eine Frau daher kommen mit mehreren hoch bepackten Maultieren, und als sie genauer hin sah, war einer der Männer ihr Sohn Tobiòla. »Gott sei gelobt, da kommt mein Sohn!« rief sie voll Freude, »und welch schönes Mädchen hat er bei sich! Das ist ein sicheres Zeichen, daß es ihm gut ergangen ist.«
Als nun Tobiòla seine Mutter erkannte, lief er ihr entgegen und küßte ihr die Hand, und das schöne Mädchen küßte ihr auch die Hand, und so gingen sie alle zusammen fröhlich nach Haus.
Denkt euch nun die Freude des alten, blinden Tobià, als er hörte, sein Sohn sei wieder gekommen! Der Jüngling aber sprach zu Tobiòla: »Nimm die Leber des Fisches, und bestreiche damit die Augen deines Vaters, so wird er sein Gesicht wieder bekommen.« Da nahm Tobiòla die Leber des Fisches aus dem Büchschen, und bestrich damit die Augen seines Vaters, und als bald ward er sehend.
Während sie sich aber noch darüber freuten, verwandelte sich der Jüngling in einen schönen Engel und sprach: »Ich bin der Engel Gabriel, und bin von Gott gesandt worden, euch zu helfen, weil Gott gesehen hat, daß ihr fromm und gottesfürchtig seid. Führt ein heiliges Leben, so werdet ihr glücklich sein, und wenn ihr sterbt, wird euch Gott in sein Paradies aufnehmen.«
Damit segnete er sie, und flog zum Himmel. Tobià aber und seine Familie führten ein heiliges Leben, und als ihre Stunde kam, starben sie, und Gott nahm sie in seine Arme.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
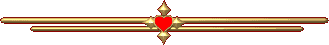
VOM EINSIEDLER ...

Es war einmal ein frommer Einsiedler, der lebte auf einem hohen Berg, und nährte sich von Gras und Wurzeln, und brachte den ganzen Tag damit hin, daß er mit der Stirne im Staube Buße tat.
Nun begab es sich eines Tages, daß eine Gesellschaft von reichen Leuten aus der Stadt eine Lustfahrt nach dem selben Berge machten, dort aßen und tranken, und sich einen vergnügten Tag bereiteten. Am Abend rief der Eine von ihnen seinen Diener und sprach zu ihm: »Sammle alle Löffel und Gabeln, die wir mit genommen hatten, so wollen wir nach Hause zurück reiten.«
Da sammelte der Diener alle die silbernen Gerätschaften, anstatt aber alles einzupacken, steckte er den silbernen Vorlegelöffel in seine Tasche. Dies alles sah der Einsiedler; er sagte aber nichts, und die ganze Gesellschaft ritt wieder nach Hause. Unterwegs nun fiel es dem Einen ein, das Silberzeug nachzuzählen; da zeigte es sich, daß der silberne Vorlegelöffel fehle.
»Was ist das?« frug er den Diener. »Hast du den Löffel vielleicht vergessen? Wir wollen zurück gehen und ihn suchen.« Als sie nun an den selben Ort kamen, wo sie gegessen hatten, hatte sich da unterdessen ein armer Pilger eingefunden, der sammelte die übrig gebliebenen Brocken und verzehrte sie, um seinen Hunger zu stillen.
»Du hast gewiß den Löffel gestohlen!« rief der Herr, dem der Löffel fehlte. »Ach, liebe Herren,« bat der Pilger, »ich habe ja nichts genommen als die Knochen und die Brocken. Untersucht mich, und Ihr werdet sehen, daß ich gewiß keinen Löffel genommen habe.«
»Nichts da! Es kann Niemand sonst gewesen sein, denn außer dir ist niemand hier gewesen!« Da schlugen sie ihn und mißhandelten ihn, banden ihn an den Schwanz eines Pferdes und schleppten ihn so mit sich fort. Das alles hatte der Einsiedler gesehen, und in seinem Herzen begann er zu murren gegen die Gerechtigkeit Gottes.
»Was?« dachte er, »geht es so auf Erden? Jener diebische Knecht sollte ungestraft davon kommen, und der unschuldige Pilger so arg mißhandelt werden? Gott ist ungerecht, daß er solches duldet, und darum will ich auch nicht länger Buße tun, sondern in die Welt zurück kehren und mein Leben genießen.« Wie gesagt, so getan; der Einsiedler verließ seinen Berg, und tat nicht mehr Buße, sondern zog aus, um sein Leben zu genießen.
Während er so dahin wanderte, begegnete ihm ein schöner, starker Jüngling, der frug ihn: »Wohin wandert ihr?« »Nach der und der Stadt.« »Dahin will ich ja auch gehen; darum wollen wir zusammen wandern.« Also wanderten sie zusammen, der Weg aber war weit und sie wurden bald müde.
Da kam ein Maultiertreiber des selbigen Weges daher. »He, guter Freund,« rief der Jüngling, »wollt ihr uns nicht erlauben, ein wenig auf euren Tieren zu reiten? wir sind so müde und matt.« »Von Herzen gern,« antwortete der Maultiertreiber, »so weit unser Weg zusammen geht, könnt ihr meine Tiere benutzen.« Da setzten sie sich auf und ritten mit dem Maultiertreiber weiter.
Der Jüngling aber hatte bemerkt, daß in dem einen Quersack eine Menge Goldes steckte und ohne daß der Treiber es merkte, zog er eine Münze nach der anderen heraus und warf sie auf die Straße. Der Einsiedler sah es wohl und dachte in seinem Herzen: »Wie? Während der arme Mann uns so freundlich einen Dienst erweist, tut er ihm so Böses an?« Weil aber der Jüngling ein starker Mann war, fürchtete er sich, irgend etwas zu sagen.
Nachdem sie eine gute Strecke weit geritten waren, sprach der Treiber: »Nun, meine Herren, kann ich euch nicht weiter mit nehmen.« Da stiegen sie ab, dankten ihm und wanderten zu Fuß weiter. Der Einsiedler aber sprach: »Wie konntest du ein so großes Unrecht tun und dem armen Mann, der uns eben eine Wohltat erzeigte, sein Geld weg werfen?«
»Sei du still,« antwortete der Jüngling; »kümmere dich um deine Angelegenheiten und nicht um die meinigen.« Am Abend kamen sie in eine Herberge, und da die Wirtin ihnen entgegen trat, sprachen sie: »Gute Frau, könnt ihr uns nicht für diese Nacht beherbergen? Wir haben aber kein Geld, es euch zu lohnen.« »O, sprecht doch nicht davon,« sprach die Wirtin, nahm sie gar freundlich auf, gab ihnen gutes Essen und Trinken und wies ihnen zuletzt ein Zimmer an, in dem für jeden von ihnen ein Bett stand.
In dem selben Zimmer aber stand auch eine Wiege, in der das kleine Kind der Wirtin schlief. Am Morgen, als sie sich zum Weiterwandern rüsteten, trat der Jüngling zu der Wiege und erdrosselte das arme kleine Kind. »O, du Bösewicht,« rief der Einsiedler, »während uns die gute Frau so viele Wohltaten erweist, bringst du ihr Kind um!«
»Sei doch still,« befahl der Jüngling »und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.« Da wanderten sie weiter, und der Einsiedler ging still neben dem Jüngling einher. Auf einmal aber verwandelte sich der Jüngling in einen schönen leuchtenden Engel, der sprach zu dem Einsiedler:
»Höre mich an, o Mensch, der du dich erkühnt hast, gegen Gottes Gerechtigkeit zu murren; ich bin ein Engel, von Gott gesandt, um dir die Augen zu öffnen. Jener Pilger, der unschuldig mißhandelt wurde, hatte einst, vor vielen Jahren an dem selben Ort seinen Vater umgebracht, darum hat ihm Gott nun diese Strafe geschickt; denn Gott verzeiht bald, aber zu strafen zaudert er.
Das Geld, das ich auf die Straße geworfen habe, gehörte nicht dem Maultiertreiber, sondern er hatte es einem anderen entwendet; nach diesem Verlust wird er vielleicht in sich gehen und seine Sünde bereuen. Das Kind der Wirtin wäre ein Räuber und Mörder geworden, wenn es gelebt hätte. Die Mutter aber ist fromm und betet täglich zu Gott: 'O, Herr, wenn mein Kind nicht heilig leben soll, so nehmt es lieber zu euch, so lange es unschuldig ist.' Darum hat Gott ihr Gebet erhört.
Nun siehst du, daß Gottes Gerechtigkeit weiter sieht, als die der Menschen. Darum kehre in deine Einsiedelei zurück und tue Buße, ob dir dein Murren vergeben werden möge.« Als der Engel also gesprochen hatte, flog er in den Himmel; der Einsiedler aber kehrte auf seinen Berg zurück, tat noch strengere Buße als bisher und starb als ein Heiliger.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
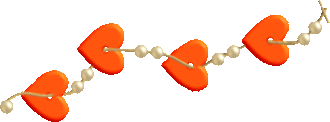
DIE ALTE VOM GARTEN ...

Zwei Frauen gingen an einem Kohlgarten vorüber und es kam sie die Lust an, etwas Kohl zu entwenden. Die eine der selben hatte zwar Bedenken und meinte: »Wer weiß, ob uns nicht jemand sieht.« Die andere ging nach zu schauen und rief als bald: »Komm nur, es ist kein Wächter da!« - »Niemand da? So komme ich.«
Sie traten ein, schnitten sich zwei schöne Bündel Kohl, trugen ihn nach Hause, und das Gericht schmeckte ihnen ganz vortrefflich. Kamen auch anderen Tages wieder, und ob schon die Gevatterin Furcht vor dem Gärtner hatte, sahen sie doch wieder niemand, schnitten sich aufs neue zwei große Bündel Kohl und ließen sich den zu Hause trefflich schmecken.
Eine Alte aber war die Herrin des Gartens. Sie tritt her vor, sieht die Plünderung und ruft: »Wer ist mir da über meinem Kohl gewesen? Da heißt es besser aufpassen. Ich werde einen Hund am Pförtlein anbinden, und wenn die Diebe kommen, wird er seine Pflicht tun.« So geschah es.
Der Hund lag als Wache vor dem Garten. Die eine der Gevatterinnen hatte ihn gesehen und sagte es der anderen, als diese wiederum den Garten plündern wollte: »Nein, diesmal lassen wir es, ein Hund hält die Wache.« - »Ach was«, sagte die andere, »ein Hund? Wir kaufen für ein paar Heller Brot und werfen es ihm vor, so läßt er uns wohl hinein.«
Sie kauften das Brot, und noch ehe der Hund zu bellen anfing, warfen sie es ihm vor, so daß er still blieb und sie den Kohl schneiden und nach Hause tragen konnten.
Wie die Alte kommt und die neue Verwüstung sieht, schilt sie das Tier: »Was, du hast meinen Kohl rauben lassen? Wozu taugst du denn? Marsch, packe dich!« und jagt ihn fort. Darauf hat sie eine Katze zum Aufpassen hin gesetzt, und hat sich von drinnen versteckt, in der Meinung, auf das Miauen der Katze herbei zu kommen und die Diebe zu packen.
Am anderen Morgen sagt die eine Gevatterin zur anderen: »Komm, holen wir uns etwas Kohl.« - »Nein«, sagte die andere, »wenn ein Wächter da ist, könnte es uns schlimm ergehen.« Doch Zureden half, und sie gingen. Wie sie die Katze sahen, kauften sie ein Stück Lunge, und ehe die Katze miauen konnte, warfen sie diese ihr vor.
Erst nach dem der Kohl geschnitten und die Frauen schon wieder fort waren, fing die Katze an zu schreien. Die Alte schießt rasch hervor, sieht niemand, erschaut aber die neue Verwüstung und zerquetscht der untreuen Katze den Kopf. Sie spricht: »Jetzt setze ich den Hahn zum Wächter, der zeigt mir die Diebe durch Krähen an, und ich vermag sie umzubringen.« Gesagt, getan.
Die eine der Gevatterinnen, die den Hahn gesehen, warnt die andere, die aber weiß Rat, nimmt etwas Hafer und wirft ihn dem Hahn vor. Während der Hahn am Fressen war, nehmen sie den Kohl und gehen weiter. Da erst krähte der Hahn. Zu spät, die Alte dreht ihm vor Wut den Hals um und verzehrt ihn.
Jetzt ruft sie einen Bauer und sagt ihm: »Grabt mir eine Grube, so lang und so breit ich bin.« Als die Grube fertig war, legte sie sich hinein dergestalt, daß nur ihr Ohr heraus schaute. Wie die Frauen zum Garten kommen, sehen sie keine Seele, sammeln den Kohl und kommen, wie sie fertig sind, an der Grube vorbei. Da sieht die eine, die ein Kindlein unterm Herzen trug, einen Pilz am Boden, ruft der anderen zu:
»Sieh da, welch schöner Pilz!« und bückt sich und zieht. Dieser Pilz war aber just das Ohr der Alten, und wie sie beide anfassen, zogen sie die Alte aus dem Boden heraus. »Ah!« rief die, »ihr also seid meine Kohldiebe? Nun wartet, jetzt will ich es euch eintränken.« Und sie packte die, welche den Pilz zu erst bemerkte, die andere entfloh.
»So, jetzt werde ich dich bei lebendigem Leibe auffressen.« - »Laß mich los«, bat die andere, »ich verspreche dir auch das Kind, das ich unterm Herzen trage, so bald es sechzehn Jahre alt sein wird, und ich werde gewißlich Wort halten.« - »Es sei«, sagte die Alte, »nimm dir jetzt Kohl so viel du willst, aber vergiß bei Leibe nicht, was du mir eben versprochen.«
Mehr tot als lebendig kam sie zu der Gefährtin und klagte ihr, was sie für einen Pakt mit der Alten geschlossen, ihr das eigene Kind nach sechzehn Jahren auszuliefern. Die andere sagte: »Ich kann dir nicht dabei helfen.«
Nach zwei Monaten kam ein Mädchen zur Welt; da weinte die Mutter und sprach: »O du armes Ding, an meiner Brust erwächsest, und jemand anderes wird dich dereinst fressen!« - So gingen die Jahre dahin, und eines Tages, da das Mädchen sechzehn Jahre alt geworden, ging sie aus, um Öl zu holen.
Begegnet ihr die Alte, steht still und fragt: »He, schönes Kind, wessen Tochter bist du doch?« - »Ich bin die Tochter der Frau dort drüben.« - »Geh, mein Kind, und sage deiner Mutter: das Versprechen! weiter nichts: das Versprechen! Wie schön bist du und wie lieb, laß dich doch herzen!« Und sie streichelte des Mädchens Wangen. »Geh jetzt und bringe deiner Mutter diese Feigen.«
Das Mädchen erzählte der Mutter, was ihr begegnet war und wie sie ihr aufgetragen zu sagen: »Das Versprechen! Das Versprechen!« Da erschrak die Mutter und rief weinend: »Ach, was versprach ich ihr doch! Wehe mir!« Das Mädchen verwunderte sich und fragte: »Was weinst du denn, o Mutter?« Die Mutter antwortete nicht, trug aber der Tochter auf, wenn sie der Alten wieder begegnen sollte, zu sagen: »Sie ist noch zu klein.«
Am nächsten Morgen traf sie denn die Alte wieder und wiederholte die Worte der Mutter; die Alte aber trug ihr die selbe Botschaft auf wie das erste mal, und die Mutter merkte jetzt, daß sie nicht mehr zögern dürfe. Deshalb sagte sie der Tochter: »Siehst du die Alte wieder, so sage ihr von mir: 'Sie solle sich das Versprechen nehmen, wo sie es finde.'«
Das sagt das Mädchen, und die Alte faßt sie bei der Hand und sagt: »So komm denn zur Großmutter, sie wird dich reich beschenken.« Zu Hause angekommen, sperrt sie das Kind in einen Stall, um es fett zu machen, und geht von Zeit zu Zeit nach zu sehen, ob ihr das Essen anschlage. Durch ein Loch in der Tür ruft sie:
»Zeig mir doch einmal dein Fingerlein heraus!« Das Mädchen war aber klug gewesen, sie hatte ein Mäuslein gefangen, ihr den Schwanz abgeschnitten und den zeigte sie jetzt der Alten. Die erschrak und rief: »Weh, weh, wie mager bist du! Iß doch, iß, deiner Großmutter zu Liebe. Ei! ei, wie mager du bist!«
Nachdem sie ihr reichlich zu essen gegeben, kommt sie wieder, läßt sie heraus und wie sie sieht, daß sie schön rund geworden, schmunzelt sie: »Sieh da, wie fett du bist, komm, wir wollen jetzt Brot backen.« Das Mädchen war willig und bereit, knetete den Teig, formte die Brote, worauf ihr die Alte befahl, den Ofen zu heizen.
Auch dieses tat das Mädchen. Dann sollte sie die Brote hinein schieben, aber da sagte sie: »Alles habe ich getan, das kann ich nicht, das müßt Ihr schon selber machen.« »Nun, da will ich es tun«, nickte die Alte, »reiche du mir die Brote her.« Das Mädchen reichte sie ihr.
»So, nun gib mir den großen Stein, damit wir den Ofen ordentlich verschließen.« »Ach, Großmutter«, rief das Mädchen, »woher soll ich denn die Kräfte haben, den zu heben?« »So hebe ich ihn«, sagt die Alte und bückt sich. In diesem Augenblick packt das Mädchen sie bei einem Beine, wirft sie in den Ofen und verschließt diesen fest mit dem Stein; so mußte die böse Hexe verbrennen.
Darauf suchte sie ihre Mutter auf, die ihre Tochter schon tot geglaubt hatte, und sie zogen in das Haus der Alten, all wo sie glücklich lebten bis an ihr Ende.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
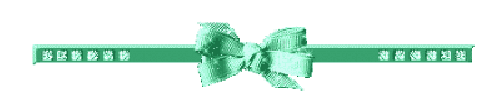
VON DEN ZWÖLF RÄUBERN ...

Es waren einmal zwei Brüder, die waren beide arm und elend, hatten viele Kinder und wenig Geld. Da sprach eines Tages der eine von ihnen zu seiner Frau: »Ich will über Land gehen, vielleicht finde ich dann etwas Arbeit, daß ich ein wenig Geld verdienen kann.«
Also machte er sich auf, und wanderte immer grade aus, bis er endlich auf einen hohen Berg kam. Da setzte er sich hin und dachte an sein trauriges Schicksal. Wie er nun so da saß, sah er auf einmal zwölf Räuber des Wegs daher kommen. »Ach, ich Unglücklicher,« dachte er, »wenn die mich hier finden, so morden sie mich,« und da er in der Nähe einen dichten Busch sah, versteckte er sich dahinter, bis die Räuber vorüber gezogen sein würden.
Die stiegen mit vielen Schätzen beladen den Berg hinauf, anstatt aber weiter zu gehen, hielten sie vor einem hohen Felsen, und der erste sprach: »Tu dich auf, Tür«, und als bald tat sich eine Tür im Felsen auf, und sie gingen alle zwölf hinein. Der Felsen aber schloß sich hinter ihnen. Nach einer Weile kamen sie wieder heraus, und der letzte sagte: »Schließe dich, Tür«, und der Felsen schloß sich hinter ihnen.
»Ei,« dachte nun der Arme, »da gibt es was zu holen,« und als die Räuber alle verschwunden waren, schlich er hinter dem Busch hervor, und stellte sich vor den Felsen: »Tu dich auf, Tür,« und sogleich öffnete sich die Tür, daß er hinein gehen konnte. »Schließe dich, Tür,« und also bald schloß sie sich hinter ihm. Da sah er denn nun alle Schätze der Welt aufgespeichert, denn alles, was die Räuber stahlen, trugen sie da hin.
Der arme Mann küßte den Boden, als er all das Gold und die vielen Schätze sah, füllte seine Taschen mit Goldmünzen, so viel er nur tragen konnte und sprach: »Tu dich auf, Tür,« da öffnete sich der Felsen, und er ging hinaus, und sagte: »Schließe dich, Tür,« damit der Felsen sich wieder schließen sollte. Dann ging er vergnügt nach Hause, und sprach zu seiner Frau: »Gott hat uns Überfluß geschickt; nun können wir fröhlich und sorglos leben.«
Da fing er mit dem Geld einen kleinen Handel an, und Gott gab seinen Segen, daß ihm alles wohl geriet. Als nun sein Bruder sah, daß es ihm wohl ging, kam er zu ihm und sprach: »Lieber Bruder, sage mir, wie bist du zu all dem Geld gekommen. Sage es mir doch, damit ich auch hin gehen kann und mir ein wenig hole.«
Da antwortete ihm sein Bruder: »So und so ist es mir ergangen, und wenn du hin gehen willst, so wirst du noch ganze Berge von Gold finden. Auf Eines aber mußt du wohl achten, wenn die Räuber hinein gehen, mußt du sie zählen, und wenn sie wieder heraus kommen, mußt du sie noch einmal zählen, damit ja nicht einer darin geblieben ist.«
Der Bruder machte sich auf, und kam bald auf den hohen Berg, wo die Räuber wohnten. Da versteckte er sich hinter einen Busch, und bald kamen die Räuber, und er zählte sie und es waren elf; denn als sie damals nach Hause kamen und fanden, daß an dem Gelde etwas fehlte, sagte der Hauptmann: »Von nun an soll jeden Tag Einer zu Hause bleiben, denn der Schurke, der uns einmal bestohlen hat, wird wohl auch zum zweiten Male kommen.«
Das konnten nun die beiden Brüder nicht wissen, und als der arme hinter dem Busch Versteckte die Räuber wieder heraus kommen sah, zählte er sie noch einmal und es waren wieder elf. »Nun,« dachte er, »elf sind hinein und elf sind auch wieder heraus gekommen, nun kann ich sicher hinein gehen.«
Da stellte er sich vor den Felsen und sprach: »Tu dich auf, Tür,« und die Tür tat sich auf, und er ging hinein. Drinnen lag das Gold in großen Haufen, und Niemand war zu sehen. Da füllte er sich die Taschen mit Gold; als er aber hinaus wollte, sprang auf einmal der zwölfte Räuber hervor und erschlug ihn.
Als die Räuber wieder nach Hause kamen, und den Ermordeten sahen, sprachen sie: »So, du Spitzbube, jetzt hast du deinen Lohn gekriegt.« Unterdessen wartete der andere Bruder immer noch auf seinen armen Bruder, und als er gar nicht mehr kam, dachte er: »Gewiß haben ihn die Räuber gefangen und getötet.«
Da nahm er die Frau und die Kinder seines Bruders zu sich, und sorgte für sie, und blieb glücklich und zufrieden, und die Alte sitzt ohne Zähne da.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
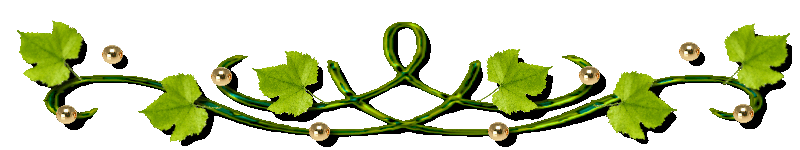
DER GENARRTE TOD ...

Es war einmal ein Mann, der hatte einen Sohn in der Schule, sein Lehrer aber war ein Zauberer, der den Sohn entließ und ihm sagte, er wolle ihm jeden Tag einen Wunsch gewähren, er solle ihn nur bitten. Da sagte ihm der Sohn, er habe einen Birnbaum und wolle, daß jeder, der hinauf steige, nicht wieder hinunter könne, wenn er es ihm nicht erlaube.
Am zweiten Tage sagte er, er habe zu Hause einen Kamin, und alle gingen, sich an ihm zu wärmen, er aber bleibe kalt. Nun wolle er, daß alle, die sich ihm näherten, ohne seinen Befehl sich nicht wieder entfernen könnten. Er hatte auch ein Spiel Karten und wollte, daß er mit ihnen immer gewänne.
Dieser Mann nun wurde hundert Jahre alt. Der Tod kommt, ihn zu holen, und er sagt ihm: »Steig auf diesen Birnbaum und iß und fülle dir den Bauch, hernach wollen wir gehen.« - Der Tod steigt hinauf und ißt und ißt und konnte dann nicht hinunter steigen. Inzwischen freute sich die ganze Welt, da niemand starb.
Da sagte der Tod: »Laß mich hinunter, dann will ich dir noch einmal hundert Jahre geben.« - Und jener ließ ihn hinunter, und die hundert Jahre vergingen rasch, und der Tod fand sich wieder ein. Es war im Winter, und jener sagte ihm: »Wärme dich erst ein bisschen, dann wollen wir gehen.« Und der Tod setzte sich auf den Stuhl neben dem Feuer.
Als er saß legte der Mann soviel Holz zu, daß es ein Höllenfeuer war. Der Tod zog sich mit aller Gewalt zurück, aber der Stuhl schien von Marmor zu sein, und der drauf saß, verbrannte sich die Knochen. Endlich gab er ihm noch hundert Jahre Frist, dann starb er.
Darauf ging er ins Paradies, aber der Herr wies ihn ab, weil er die Gnade nicht erbeten hatte. Auch in der Hölle wollten sie ihn nicht, weil er ein Ehrenmann gewesen war, und so mußte er nach der Tür des Fegefeuers gehen. Er wußte nicht, was tun, und fing an zu spielen, und weil es dort kein Geld gibt, spielten sie um sich selbst, und er gewann soviel Seelen, daß es ein ganzes Regiment war.
Da schickten sie ihn fort, und er kehrte zum Paradiese zurück, und der Herr sagte ihm, er möge nur eintreten, wenn er wolle, aber allein. Er aber antwortete: »Ich werde eintreten, aber auch die, die sich an mich hängen!« - und so traten alle ein.
Monferrato
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen
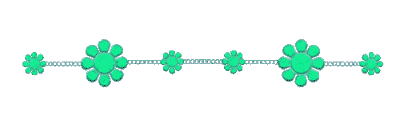
DER GERAUBTE SCHLEIER ...

Da lebte einmal ein Jüngling, der führte schon lange ein recht armseliges Hundedasein und war verzweifelt an sich und der Welt. Eines Tages, wie er so gar nichts zu essen hatte, auch noch keinen Tropfen Wasser getrunken hatte, setzte er sich am Strand des Meeres nieder, zu warten, ob ihm nicht irgendwie das Glück blühe.
Wie er so eine Zeit lang gesessen, näherte sich ihm ein Mann aus dem Morgenlande, der sprach: »Was fehlt dir, schöner Knabe, daß du hier sitzest und Trübsal bläst?« Der Jüngling antwortete: »Was soll ich haben? Hunger habe ich und nichts zu essen, und alle meine Hoffnung ging schon längst zunichte.« - »O, mein Sohn«, erwiderte der andere, »sei fröhlich und wohlgemut, du gehst mit mir, ich gebe dir zu essen und zu trinken, Geld und Gut und alles, was dein Herz nur begehrt.«
Da erwachte im Knaben neuer Mut und er ging mit dem Fremden. Sie wanderten hier hin und dort hin und kamen zuletzt an den Fuß eines Berges. Dort schlug der Mann mit einem Stabe auf die Erde, diese öffnete sich und hervor kam ein geflügeltes Roß. »Dieses besteigst du«, sagte der Mann aus dem Morgenlande zum Jüngling, und dann: »Siehst du den Gipfel des Berges? Dort finden sich große Schätze an Gold und köstlichen Steinen, mit diesen beladest du das Roß und auf ein Zeichen bringst du sie zu mir.«
So geschah es: der Knabe bestieg das Flügelpferd und im Fluge war er droben. Da lagen denn auch die Schätze: Goldbarren, Diamanten, Brillanten, in Menge aufgehäuft, daß man sich gar nicht satt daran sehen konnte. Auch der Jüngling stand und staunte, belud aber schnell das Pferd damit, und wie ihm der Mann aus dem Morgenlande das Zeichen gab, setzte er sich darauf und flog hinab.
Der Mann lobte ihn ob seiner Kühnheit und schickte ihn noch zweimal hinauf, in dem er das letzte mal sagte: »Geh, und was du jetzt findest, ist dein.« Er hatte gehorcht und war eben daran, das Pferd zum dritten mal zu beladen, als der Mann das Zeichen mit dem Stocke gibt, worauf das Pferd hier oben und der Mann unten in einem Nu verschwanden.
Nun war er oben und konnte nicht mehr hinunter, denn der Berg war hoch. So fing er denn auf gut Glück zu gehen an, hier hin und dort hin, und findet eine Alte, die ihn fragt: »Wohin, schöner Knabe, und was tust du in dieser Gegend?« Darauf erzählt er ihr seine Geschichte und die Tücke des Mannes aus dem Morgenlande.
»Genug, genug«, rief die Alte, »den Mann kenne ich, jedes Jahr schickt er einen hier herauf und läßt ihn dann oben, unbekümmert um sein Geschick. Komme mit mir, ich mache dich reich und glücklich.« Da dachte der Knabe bei sich: »Auch die will mich reich machen; sollte es aber gehen, wie das erste mal, so erwürge ich die alte Hexe.«
Sie gingen ein Stück und kamen an einen schönen Brunnen, da sagte sie ihm: »Siehst du diesen Brunnen? Nun merke wohl auf! Hier her kommen jeden Tag zwölf Tauben, um zu trinken. Nachdem sie getrunken haben, werfen sie sich ins Wasser und werden zu zwölf schönen Mädchen, so schön wie die Sonne, mit Schleiern vor dem Gesicht. Du hältst dich in der Nähe versteckt und wirst sie miteinander spielen sehen.
Wenn sie mitten im besten Spielen sind, entreißest du der Schönsten den Schleier und birgst ihn schnell auf der Brust. Dann aber darfst du dich nicht erweichen lassen, wenn sie bittet und fleht: 'Gib mir den Schleier, meinen Schleier gib mir zurück!' Denn wisse, bekommt sie den Schleier, so wird sie als bald wieder zur Taube, schwingt sich auf und fliegt den anderen nach.«
So hatte die Alte gesprochen, und der Jüngling verbirgt sich an einer Stelle, wo er nicht gesehen werden konnte, und erwartete in Schweigen den nächsten Tag. Der nächste Tag kam, und wie die Stunde sich nahte, wo die Tauben kommen sollten, hörte er ein Geräusch wie Flügelschlagen, das kam näher und näher, und wie er aufschaut, sieht er einen Flug Tauben.
Da bückt er sich und sagt: »Stille, stille, sie sind es!« Die Tauben ließen sich am Brunnenrand nieder, tauchten ihre Schnäblein ein und warfen sich dann ins Wasser und wurden zu zwölf Jungfräulein, so schön, daß sie wie Engel vom Himmel aussahen. Nun begann auch das Spiel voll Anmut, ein Neigen und Beugen herüber und hinüber, das war eine rechte Lust zu schauen.
Doch der Augenblick war gekommen: kühn springt der Jüngling aus seinem Versteck hervor, entreißt einer der Schönen den Schleier, steckt ihn in ein Kästchen, das die Alte ihm gegeben, und birgt dieses auf der Brust. Da wurden alle Jungfrauen wieder zu Tauben und schwangen sich in die Luft bis auf eine, die voller Angst hin- und her lief und den Jüngling in einem fort nun bat: »Gib mir den Schleier, gib mir meinen Schleier wieder!«
Er aber antwortete: »Krähe nur, du süßes Hähnchen, dein Stimmchen ist gar zu schön!« Die Alte hatte ihm auch schon den Weg nach Hause gezeigt, und so kam er wieder zu seiner Mutter. Zu der sagte er: »Liebe Mutter, hütet mir das Mädchens wohl, das rate ich Euch, käme sie weg, so würde es unser Unglück sein.« Sie aber beruhigte ihn und sprach: »Schon gut, schon gut! Ist doch niemand hier, der sie fort schicken möchte.«
Das schöne Mädchen blieb jetzt mit der Mutter allein und lag dieser den ganzen Tag in den Ohren mit der Bitte: »Gib mir den Schleier, gib mir den Schleier!« Endlich hatte die Mutter das Bitten satt und konnte es nicht länger mehr mit anhören. Sie sprach: »Gleichst du mit deinen unausgesetzten Bitten doch einer Schelle ans Ohr gebunden, ich ertrag es nicht mehr, du sollst deinen Schleier haben.«
Sie durchsucht die Truhe und findet ein Kästchen, öffnet es und findet einen Schleier darin. Sie zeigt ihn dem Mädchen: »Vielleicht ist es dieser, meine Tochter?« Kaum erblickt diese den Schleier, so windet sie sich ihn um den Kopf, wird zu einer Taube, schwingt sich zum Fenster hinaus und verschwindet.
Die Alte war wie vom Blitz getroffen; voll Verzweiflung rief sie: »Was fange ich jetzt an, was tue ich, wenn mein Sohn zurück kehrt und sein Mädchen nicht mehr findet?« Und da war der Sohn auch schon an der Tür, tritt herein und findet das Mädchen nicht mehr. Da faßt ihn Verzweiflung, er läuft hinaus und sucht den Ort, wo er den Mann aus dem Morgenlande zuerst gefunden ...
Kurzum: noch zweimal machte er das selbe durch, zweimal bestieg er auf dem Flügelrosse den Berg, zweimal verschwand es und zweimal noch lehrte ihn die Alte, den Schleier zu rauben. Beim dritten male endlich hatte ihm diese gesagt: »Unglückseliger! Du wußtest, wie alles kommen mußte, und hast dich nicht gehütet; so höre, wie du es jetzt anzufangen hast.
Sobald der Schleier in deinen Händen ist, bringe ihn mir, ich werde ihn besorgen.« So tat er, kaum hatte er den Schleier entwendet, trug er ihn zu der Alten, welche ihn sofort verbrannte. Jetzt konnte er ruhig sein, dankte der Alten und führte die Jungfrau nach Hause. Dort angekommen, fragte er sie, wessen Tochter sie wäre, und sie antwortete, sie sei die Tochter des Königs von Spanien.
Wie der Jüngling dies hörte, wurde sein Herz voll Freude und er dachte: »Jetzt werde ich reich!« Was tat er also? Er reist mit dem Mädchen fort und geht geraden Wegs zu ihrem Vater, dem Könige von Spanien. Im Palast angekommen, läßt er ihm melden, es sei ein Jüngling da, der ihm seine Tochter zurück bringe.
Voll Freude gibt der König den Befehl, die beiden vor ihn zu lassen. Wie freute er sich erst, da er seine Tochter erblickte! Zwölf Jahre lang hatte er sie nicht gesehen, und umarmte und küßte sie jetzt, wie nur ein Vater seine Tochter küssen kann.
Sofort auch wurde ein großes Fest gerüstet, und dann wollte er den Retter seiner Tochter belohnen, das tat er, in dem er ihm die selbe zur Frau gab. Und wie er hörte, der Jüngling habe auch eine Mutter noch, ließ er diese kommen und sie mußte mit ihnen im Palast wohnen.
Zufrieden und glücklich lebten jene,
Und wir, wir stochern uns die Zähne.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

DER ALBANESE ...

Man erzählt von einem Kräutersammler, dem war das Glück so abhold, daß er nicht einmal mehr Kräuter finden konnte und nicht wußte, wovon leben. Er hatte aber drei Töchter, wovon die jüngste Rosa hieß. Zu dieser Rosa sagte er eines Tages: »Willst du nicht mit mir kommen, um Kräuter zu suchen, vielleicht bin ich glücklicher mit dir.« So ging die Tochter mit ihm.
Aber so sehr auch sie aus schaute, sie konnte nichts finden. Endlich bemerkte sie einen großen Pilz und faßte ihn, um ihn auszureißen. Sie stieß jedoch auf Widerstand, der Pilz war tief in den Boden hinein gewurzelt, und allein vermochte sie nicht, seiner Herr zu werden. Sie rief den Vater herbei, und beide vereint strengten sich jetzt an, den Pilz aus dem Boden zu reißen. Sie ziehen und ziehen, und ziehen einen Albanesen am Ohr aus dem Boden hervor, der ruft sie an:
»Was macht ihr zwei hier?« Sie entschuldigen sich, daß sie seit langer Zeit schon an einem Pilz gezogen und ihn nicht haben beleidigen wollen. Der Albanese hört nicht weiter darauf, sondern fragt den Alten: »Willst du mir wohl deine schöne Tochter hier lassen? Siehe, sie wird es bei mir gleich einer Königin haben, denn hier unten bewohne ich einen prächtigen Palast.«
Der Vater konnte nichts als Ja sagen, und auch die Tochter sagte als bald Ja. Darauf schenkte der Albanese dem Vater einen Beutel mit Goldstücken, und Rosa trug ihm auf, ihre Schwestern zu grüßen. »Hast du noch Schwestern«, fragte sie der Albanese, »und wieviel?« - »Zwei«, antwortete das Mädchen. - »Dann mögen sie, wenn sie dich sehen wollen, nur immer hier her kommen.«
Der Kräutersammler ging vergnügt nach Hause und erzählte seinem Weibe, was da geschehen war.
Rosa betrat mit dem Fremden einen unterirdischen Gang und bald darauf einen Palast, in welchem Gold, Silber und Edelsteine in Fülle umher lagen, und er sagte zu ihr: »Alles, was du da siehst, ist dein, so du mir in Treuen ergeben bleibst und tust, was ich dir befehle.« -
»Das will ich tun«, antwortete das Mädchen. Nun aßen sie und tranken, und nach drei Tagen sprach der Albanese: »Ich muß für einige Zeit von Zuhause fort. Ich lasse dir diese Hand von frischem Fleisch, die verspeist du, während ich fern bin; tust du es nicht, so bist du verloren.«
Wie Rosa allein ist, schaut sie die Hand an, aber es erfaßt sie ein Grauen, sie zu verspeisen. So zerstampft sie die selbe in einem Mörser und wirft sie in ein Loch. Die erste Frage des Albanesen, wie er zurück kehrt, ist: »Rosa, aßest du die Hand?« Z
itternd antwortet sie: »Ja, ich aß sie!« Da ruft er: »Hand, Hand, Händchen mein, sage, wo steckst du?« Und die Hand antwortete: »Hier im Loche.« - »So hast du also meinem Befehle nicht gehorcht? Nun empfange die Strafe.« Und mit einem Rucke reißt er ihr den Kopf ab und schleudert ihn und den Leichnam in eine Kammer auf einen Haufen zu den anderen.
Einmal kam der Vater beim Kräutersammeln wieder an jenen Ort, der Albanese erscheint und sagt ihm: »Deine Tochter ist wohl auf und wohnt in einem goldenen Palast, aber sie bittet dich, ihr die andere Schwester zur Gesellschaft zu schicken.« Der Vater versprach, anderen Tages ihm seine Tochter Kathrin zu bringen, und wieder empfing er einen Beutel Goldes.
Wie er nach Hause kommt, freut sich diese über die Kunde von Rosa und daß Kathrin ihr Glück teilen solle, und gibt ihm die andere Tochter gern mit.
Kathrin stieg in die Öffnung hinein und hinab in das Loch. Hier ging alles wie mit der ersten: er ließ ihr bei seiner Abreise die Hand und gab ihr den gleichen Befehl. Aber auch Kathrin war es unmöglich zu gehorchen, und sie mußte ihr Leben lassen.
Wie der Kräutersammler zum dritten male an den Ort kam, nahte ihm der Versucher aufs neue und forderte die dritte Schwester, welche Antonia hieß, gab ihm einen dritten Beutel, und der Vater brachte ihm auch Antonia.
Antonia aber war eine von den siebentausend Gewitzten, und als der Albanese auch ihr die Hand zurück ließ, dachte sie fein nach, wie sie aus dem Dinge kommen könne. Sie nimmt die Hand, bindet sie sich auf den Leib, und als der böse Geist zurück kommt und fragt:
»Händchen, wo bist du?« antwortet diese vom Bauche des Mädchens her: »Hier bin ich!« Da meinte er, Antonia habe sie gegessen, und weil er sie so gehorsam findet, schüttet er ihr sein Herz aus und sagt ihr alle Geheimnisse des selben, auch gibt er ihr die Schlüssel zu allen Zimmern und zu der Schatzkammer, wo der Herrlichkeiten so viele lagen, daß es eine Pracht war.
Einmal, da sie allein war, erschließt sie alle Zimmer und kommt an eins, das ganz voll menschlicher Körper war: Körper von Kaisern, Königen, Prinzen und Fürsten, Männern und Frauen, und darunter lagen auch ihre beiden Schwestern mit abgerissenen Köpfen.
Sie begann zu klagen und zu jammern, erblickt aber ein Gefäß mit einer Salbe, sie nimmt von der Salbe und bestreicht damit den Hals der Toten, und beide kommen wieder ins Leben zurück. So belebt sie nach und nach alle Toten, die da lagen, die ihr Leben durch den Albanesen verloren hatten, aber durch ein Wunder immer frisch geblieben waren, als wären sie eben erst gestorben.
Da entstand ein buntes Gewirr, und die Freude der zum Leben Erwachten kann man gar nicht erzählen. Alle drängten sich zu ihrer Retterin: dieser wollte sie zur Frau, jener zur Tochter, ein dritter zur Schwester, ein vierter zur Mitherrscherin über sein Reich, kurz, jeder wollte ihr etwas Liebes erweisen.
Endlich kam man überein, daß Antonia die Tochter des Königs von Portugal sein sollte, und so geschah es. Darauf luden sie alle Schätze des Bösen auf und entflohen.
Wie vom Blitz getroffen stand der, als er nach Hause kam, die Toten entflohen und die Schätze entführt fand. Was sollte er tun? Er sann auf einen Betrug, und weil er ein schlimmer Zauberer war, gelang er ihm auch. Er schloß sich in einen Glasschrein ein und ließ sich nach Portugal tragen und ausrufen: »Seht doch, welch schöne Statue! Wer will sie kaufen?«
Der König und seine neue Tochter schauen gerade zum Fenster heraus, als der Händler vorüber geht, er fragt das Mädchen: »Antonia, wollen wir die Statue kaufen?« Diese, als ob ihr eine Ahnung durchs Herz zöge, sagte weder Ja noch Nein, aber der König kaufte sie doch und ließ den Glasschrein im Zimmer der Tochter aufstellen.
So kommt die Nacht, und der Albanese, der sich von innen eingeschlossen hatte, suchte jetzt heraus und an das Mädchen zu kommen, um ihr Böses anzutun. Bei dem ersten Geräusch erwachte sie jedoch und rief die Diener. Die kommen, finden aber nichts und gehen wieder. Das Geräusch läßt sich von neuem hören, und sofort auch ruft sie wieder die Diener. Sie kommen und finden alles in Ordnung, auch die Statue steht wie aus Marmor gemacht.
Endlich beim dritten male bemerkt sie doch, wie die Statue sich bewegt. Auf ihr Geschrei kommen alle Leute herbei, denen befiehlt sie jetzt, die Statue an Händen und Füßen zu packen und in einen eisernen Käfig zu sperren. Davon bekamen alle die, welche der Böse einst so arg behandelt, Kunde und eilten nach Portugal, ihn im Käfig zu sehen und ihre Wut an ihm auszulassen.
Sie traktierten ihn mit Worten und Stößen so arg, daß er seine schwarze Seele aufgeben mußte. Dann feierte man ein großes Fest.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
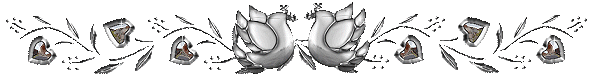
DAS TEUFELSWEIB ...

Es war einmal ein böses Weib mit Namen Angelika, das besaß einen Ring, welcher an Kraft der Zauberei seines gleichen auf der ganzen Welt nicht hatte. Diesen Ring hatten sieben Erzteufel geschmiedet, und so besaß er mit gutem Grunde sieben Kräfte.
Der erste Teufel war Farfaricchio, ein anderer Mahomed, noch ein anderer Malacarni: das sind drei. Dann Scranfugnino: und es sind vier. Darauf Ciritto, Codatarta und der letzte Beelzebub: so sind es alle sieben. Beelzebub aber war der Teufel Oberster und redete seine Genossen also an: »Hört da, ich habe einen großen Gedanken.
In Vergleich mit frühern Zeiten, trotzdem man damals immer das Jubiläum predigte, kommt jetzt gar niemand mehr in die Hölle, mag das nun in dem vielen Predigen, im Misgeschick oder unserer eigenen Unfertigkeit seinen Grund haben. Die Hölle leert sich, wir müssen wirklich etwas tun, denn geschieht nichts, so können wir bald ganz einfach unsere Bude schließen.
Aber was? Laßt uns eine neue kräftigere Zauberformel ersinnen, viele Seelen damit zu fischen. Zuerst müssen die Dummen dran, die verstehen sich von selbst, so dann die Weisen wegen gar zu großer Weisheit und dann alle die, welche uns zufällig über den Weg laufen.«
Die Teufel fielen ihrem Obersten bei und schmiedeten gemeinsam den Ring mit sieben Kräften. Den haben sie dann der ältesten durchtriebensten Hexe gegeben, die am besten gar nicht auf die Welt gekommen wäre, und haben ihn ihr selbst an den Finger gesteckt.
Die sieben Kräfte des Ringes aber waren: zu erst läßt er den schön und lieblich erscheinen, der ihn trägt, so dann auch jung, drittens gibt er seinen Augen die Macht, die Leute wie mit einem Magnet anzuziehen, sobald er sie anschaut, zum vierten, daß er so schön spricht wie Flötenton, fünftens vermag, wer ihn trägt, durch einen heimlichen Kuß den Leuten ein rotes Mal auf der Stirn zurück zu lassen, zum sechsten saugt er ihm das Blut aus den Adern und zum siebenten können sich die, welche sich mit ihm verbinden, nicht wieder losmachen, bis sie von ihm aufgehängt werden.
Diesen Ring gaben also die sieben Teufel der Hexe Angelika und dazu die Macht, so schnell zu fliegen wie der Blitz, überall, wo sie wolle, hin zu kommen und in einem Augenblicke das Erdenrund zu umschweifen. So ausgerüstet fing Angelika an Seelen zu fangen, und sie fing deren und schickte sie in die Hölle, daß diese als bald gefüllt ward.
Wer kann ihre Zahl nennen, nur die Alten können sie an den Fingern her zählen. Doch hütet euch, die Geschichte vom Ringe der Angelika ist kein Märchen, Angelika lebt noch heute und ihr Ring hat seine Kraft nicht verloren. Überall ist sie und schickt die armen Seelen zur Hölle, darum sind auch die Teufel ihre Freunde.
Und wer die Mär erzählt, der möge schauen,
Daß er nicht ende in des Teufels Klauen.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
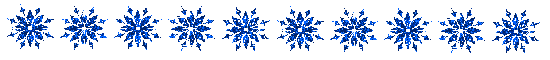
VON DER JUNGEN GRÄFIN ...

Man singt und sagt: Es war einmal ein Graf, reich wie das Meer, und glücklich, denn er hatte ein Schwesterlein, das war so schön, daß es gar nicht zu sagen ist, und war jung an Jahren. Er liebte sie so sehr und wünschte, daß kein Mensch sie sähe und niemand sie kenne, darum hielt er sie fest in dem Palast eingeschlossen.
Dort plagte sie die Langeweile; beobachtet und eingesperrt wie ein Hund, vermochte sie es nicht mehr auszuhalten. An den Palast des Grafen stieß aber das Schloß des Königs, und wie es Nacht war, bohrte sie ganz leise ein Loch unter einem Bilde in die Mauer, und siehe, das Loch endigte im Zimmer des Königs unter einem anderen Bilde, so daß niemand, weder von der einen Seite, noch von der anderen etwas merken konnte.
Eines Nachts nun hebt sie das Bild ein wenig auf und sieht neben dem Königssohne, der auf seinem Lager ausgestreckt war, einen angezündeten zierlichen Kronleuchter. Da fragt sie leise:
Goldner Leuchter, Silberleuchter, sag mir doch:
Schläft der Sohn des Königs, oder wacht er noch?
Und der Leuchter antwortet:
Schönes Fräulein, schöne Maid, tritt sicher ein,
Denn er schläft, magst ohne Fürchten sein.
Da trat sie ein und legte sich leise zur Seite des Königssohnes nieder. Wie der erwachte, umarmte er sie und küßte sie und sprach:
Schönes Mädchen, sag, wer bist du, wer?
Und aus welchem Lande kommst du her?
Da lachte sie mit ihrem silbernen Stimmchen und antwortete:
Königssohn, Ihr fragt mich da vergebens,
Schweiget stille und genießt des Lebens.
Da er aufs neue erwachte und seine schöne Göttin nicht mehr fand, kleidete er sich eilend an und rief alle Räte zusammen und erzählte ihnen die Geschichte, so da geschehen war, und fragte: »Jetzt sagt mir, was muß ich tun, um sie zu halten?« - »Heilige Krone«, antworteten die Räte, »wenn Ihr sie umarmt, bindet Euch ihre Haare an Eurem Arme fest; will sie dann fort, muß sie Euch ja wohl aufwecken.«
Die Nacht kommt und mit ihr die junge Gräfin. Wieder fragt sie:
Goldner Leuchter, Silberleuchter, sag mir doch:
Schläft der Sohn des Königs, oder wacht er noch?
Und der Kronleuchter antwortet:
Schönes Fräulein, schöne Maid, tritt sicher ein,
Denn er schläft, magst ohne Fürchten sein.
So schlüpft sie hinein und legt sich wiederum leise neben den Schlafenden nieder. Wie er erwacht, fragt er:
Schönes Mädchen, sag, wer bist du, wer?
Und aus welchem Lande kommst du her?
Da lacht sie heimlich und spricht:
Königssohn, Ihr fragt mich da vergebens,
Schweiget stille und genießt des Lebens.
So schliefen sie ein; vor her aber hatte der Königssohn die schönen Haare der jungen Gräfin um seinen Arm gewickelt. Da nimmt die Gräfin eine Schere, schneidet das Goldhaar durch und entflieht.
Der Königssohn erwacht, findet sich wieder allein und ruft seinen Rat: »Hört, meine Göttin hat mir die Haare zurück gelassen, sie selbst ist verschwunden. Was soll ich tun?« Der Rat sprach: »Heilige Krone, bindet ein Ende der Goldkette, die sie am Halse trägt, um Euren Hals, so kann sie Euch nicht entfliehen.«
In der nächsten Nacht guckte die junge Gräfin durch das Loch, der Goldleuchter brannte, und sie fragte wieder die gleiche Frage und erhielt die gleiche Antwort. Und wie sie der Königssohn in seinen Armen hielt, wollte er wiederum wissen, wer sie wäre, und wieder wurde ihm die gleiche Antwort gegeben:
Königssohn, Ihr fragt mich da vergebens,
Schweiget stille und genießt des Lebens.
Da wand sich der Königssohn ihre Kette um den Hals und schlief ein. Sie aber schneidet die Kette mitten durch und entflieht. Ganz verzweifelt ruft er am anderen Morgen den Rat zusammen und erzählt ihm, wie auch dies Mittel fehl geschlagen ist.
Da sprach der Weisesten einer: »Heilige Krone, setzt ein Becken mit Safranwasser unter das Bett, so wird sie mit der Schleppe ihres Kleides hinein tauchen und muß, wenn sie fort geht, eine Spur am Boden zurücklassen, der folgt Ihr dann.«
Der Königssohn bereitete das Becken mit Safranwasser und legte sich nieder. Um Mitternacht lauschte die junge Gräfin herein und rief:
Goldner Leuchter, Silberleuchter, sag mir doch,
Schläft der Sohn des Königs, oder wacht er noch?
Und wie sie der Kronleuchter beruhigt, schlüpft sie hinein und legt sich leise neben den Prinzen nieder. Er erwacht, fragt sie wieder nach ihrem Kommen, und sie antwortet wie immer. Als der Königssohn entschlummert war, erhebt sie sich leise und will entfliehen. Da taucht ihre Schleppe in das Becken mit Safranwasser. Sie aber merkt es, windet die Schleppe säuberlich aus und entflieht, ohne eine Spur zurückzulassen.
Und nun kam sie nicht wieder. Vergebens erwartete er sie Nacht für Nacht, sie war verschwunden. Viele Monde gingen hin, da erwacht er eines Morgens und findet neben sich ein rosiges Kindlein liegen, so schön wie ein Engel vom Himmel. Eilend kleidet er sich an und ruft die Räte zusammen.
Die Räte kommen, er zeigt ihnen das Kindlein und sagt: »Das ist mein Kind! Woran aber erkenne ich jetzt die Mutter?« Der Rat hat geantwortet: »Heilige Krone, laßt verkünden, das Kindlein sei gestorben, laßt es in der Mitte des Domes ausstellen und verordnet, alle Frauen der Stadt sollen kommen, es zu beweinen. Dann seht wohl, die, welche am meisten weint, ist seine Mutter.«
So geschah es. Alle Frauen der Stadt kamen, sagten und klagten etwas und gingen wieder, wie sie gekommen waren. Endlich kommt auch die junge Gräfin. Wie sie das Kind sieht, fängt sie heftig zu weinen an, zerrauft sich das Haar und ruft in einem fort: »Mein Kind, o, mein Kind!«
Weil, ach, gar zu schön ich war,
Schnitt ich durch mein goldnes Haar.
Weil ich meinte, die Schönste zu sein,
Riß mein Kettchen ich entzwei.
Weil zu schön ich mich gedäucht,
Ward mein Saum von Safran feucht.
Wie der Königssohn und die Räte dies hörten, fingen sie an zu schreien: »Dies ist die Mutter! Diese und keine andere!« Da tritt der Graf mit gezücktem Schwerte hervor und will die Schwester töten. Aber der Königssohn springt dazwischen und ruft:
Wo ist hier Schmach? Zurück den Stahl!
Schwester des Grafen und Königs Gemahl!
So wurde sie die Gattin des Königs. -
So lebten jene zufrieden im Glück,
Wir aber bleiben leer zurück.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
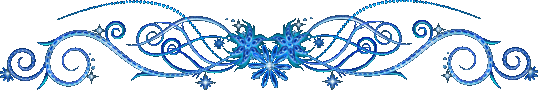
VOM SPRECHENDEN BAUCHE ...

Man erzählt:
Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten einen einzigen Sohn, den hätte der Vater gern verheiratet, aber der Sohn wollte nicht und fand immer die Entschuldigung: »Herr König, ich bin noch zu jung.« So oft der König auch von der Heirat sprach, immer aufs neue bekam er die Antwort: »Ich bin noch zu jung.«
Als der König nun gar nicht nach ließ und immer mehr in den Sohn drang, glaubte dieser einen Ausweg gefunden zu haben und versprach, seinem Vater zu Willen zu sein, wenn er ihm eine Frau verschaffe, die mit dem Bauche reden könne.
Da rief der König die Weisen des Landes zusammen und sprach: »Ihr wißt, mein Sohn soll heiraten, er will es auch, verlangt aber eine Frau, die mit dem Bauche reden könne. Die Frau muß her zu, denn ich kann mein Reich nicht in fremde Hände fallen lassen. Ratet mir also, wo finde ich sie?«
Es erhob sich ein alter Weiser und sprach: »Heilige Krone, mein Rat ist der: schickt zwölf Edelleute und zwölf Maler in die weite Welt hinein, alle Länder sollen sie durchschweifen; der geht nach Portugal, jener nach Spanien, ein anderer nach England und so fort. Welcher von ihnen die Frau findet, die mit dem Bauche redet, der malt sie und bringt Euch das Bild. Gefällt dies Eurem Sohne: gut! Gefällt es ihm nicht, nun so hat man getan, was man tun konnte.«
Hierauf erging ein Befehl des Königs, daß zwölf Große des Landes, jeder von einem Maler begleitet, abreisen und sich über die Welt verteilen sollten: einer da-, der andere dorthin!
Einer der zwölf nun, es war der Fürst von Butera, nimmt sich einen guten Maler, ruft seine Diener, sitzt zu Pferd und reist noch selbigen Tages ab. Wie er unterwegs ist, kommt ein böses Wetter mit Regen und Wind, vor lauter Nebel verlieren sie die Straße und finden sich mit einem mal in einem dichten Walde. Die Diener verlieren sich von ihrem Herrn, und dieser irrt allein mit dem Maler weiter.
Wie sie an das Ende des Waldes kommen, sehen sie einen Alten, der hackt die Erde, und der Fürst ruft ihm zu:
»Sei gegrüßt, du Mann der Erde!«
Worauf der Alte antwortet:
»Willkommen, Mann der Kriegsbeschwerde!«
»Was machen die Zwei?«
»Bald gehn sie zu Drei.«
»Und die aus der Weite?«
»Sind kurz, mir zu Leide.«
»Auf den Bergen liegt Schnee?«
»Zeit wäre es, meine ich, mehr als je.«
Dann legt der Alte die Hacke weg und führt den Fürsten und den Maler nach seiner Hütte. Drinnen saß die Tochter und webt, und der Fürst ruft ihr beim Eintreten zu: »O Mädchen, das Leinen webet . ...«
Sie antwortet: »O Ritter, sieh, was dir schwebet!«
Und der Vater fragte sie: »Wo ist die Mutter?«
Das Mädchen antwortet: »Sie ging zu zeigen das Licht der Welt einem, der es nie noch gesehen hat.«
»Und deine Großmutter?«
»Erweist einem Ehren, der keine mehr empfangen kann.«
»Und was machst du?«
»Ich lasse tanzen, ohne zu spielen.«
Dann sagt der Vater zum Fürsten: »Ihr müßt Euch begnügen mit dem, was Ihr zu essen findet, wenig genug.« Die Mutter und die Großmutter kamen nach Hause, und man setzt sich zu Tische. Während sie aßen, flüstert der Prinz dem Maler zu: »Wenn deren Bauch spräche, so wäre sie wohl eine Frau für den Königssohn, denn sie hat keinen Makel.« Darauf ging man zur Ruhe.
Die Mutter des Mädchens hatte aber vergessen, dem Fürsten den Zunder zurecht zu legen; wie er nun in der Nacht aufsteht die Kerze anzuzünden, tastet er vergeblich danach umher. Er sucht und sucht und gerät im Dunkeln auch in das Zimmer des Mädchens, und beim Herumfühlen tastet er unversehens auf ihren Leib.
Er erschrickt, denn der Bauch fängt als bald an zu sprechen: »Rühr mich nicht an, ich bin des Königs!« Er zieht die Hand zurück und streift ihn wieder, und nochmal ertönt es: »Ich hab es dir gesagt: rühr mich nicht an, ich bin des Königs!« Der Fürst geht zum Maler zurück, weckt ihn und sagt: »Wißt Ihr, was ich gefunden? Drinnen liegt ein Mädchen, das redet mit dem Bauche.« - »Was?« rief der Maler, »die müssen wir morgen malen und das Bild dem Könige bringen.«
Wirklich wird am anderen Morgen das Bild gemacht, dann verabschieden sie sich von den Leuten und der Fürst sagt: »Lebt wohl, in ein paar Tagen werden wir uns wieder sehen.« In der nächsten Herberge machte der Maler sein Bild fertig, der Fürst band es sich an den Hals und so ritten sie bald der Heimat zu. Nach und nach kamen auch die übrigen Edelleute mit den Malern zurück, und wie sie alle beisammen waren, stieg der König auf den Thron und berief seine Räte.
Elf Bilder hatte der Königssohn gesehen, keins wollte ihm gefallen, an jedem entdeckte er irgendeinen Fehler. Da tritt der Fürst von Butera hervor und spricht: »Mein Herr, so Euch auch dieses Bild mißfällt, gibt es keine Frau für Euch.«
Er verbeugt sich und überreicht ihm das Bild, das er am Halse hatte. »Ja«, rief der Königssohn, »diese mag mir wohl gefallen, aber spricht ihr der Bauch?« - »Ja, mein Herr.« - »Nun dann wird diese meine Gemahlin.«
Nun bereitete man prächtige Kleider, vier Galakutschen, und zwölf Mädchen wurden als Brautjungfern berufen. Darauf zog man aus, der Fürst, die Mädchen und die Diener, die Erkorene abzuholen. Der Alte sah die Wagen kommen, daß sie aber kamen, seine Tochter zu holen, daran dachte er nicht.
Sie halten vor seiner Thür, der Fürst steigt heraus, verneigt sich vor dem Mädchen und verkündet ihr, der Königssohn wolle sie zu seiner Frau haben. Gleich auch kleiden die Kammerfrauen sie an, kämmen und schmücken sie prächtig und heben sie in den Wagen. Sie weint vor Glück, umarmt weinend Vater und Mutter und reist ab.
Im Schlosse erwartete sie der König, die Königin und deren Sohn. Dieser bietet ihr den Arm und führt sie in den Saal, wo ein großes Fest gefeiert ward. Ehe er zu Bett geht, sagt er noch zu seiner Mutter: »Königliche Mutter, wenn meine Braut heut Abend schläft, berührt ihr, ich bitte Euch, den Bauch, damit ich Gewißheit habe, daß dieser spreche.«
Die Königin versprach es ihm. Sie tritt auch nach Mitternacht, als das Mädchen in festem Schlummer liegt, in die Kammer und berührt leise ihren Bauch. Als bald tönt es: »Rühr mich nicht an, ich bin des Königs.« Sie zieht die Hand zurück, geht zum Sohne und sagt: »Sei zufrieden, was du suchtest, hast du gefunden.« So wurde am anderen Tage die Hochzeit gefeiert. -
Nun waren in dem Lande des Königs zwei Kaufleute, die waren Gevattern und liebten sich einander von Herzen. Einer der selben besaß eine schöne Stute, die war tragend. Zu dem kommt der andere, bittet ihn und sagt: »Gevatter, ich muß über Land, wollt Ihr mir nicht Eure Stute vor den Wagen leihen?«
Der gibt sie ihm gern, er spannt an und fährt fort. Wie er unterwegs Herberge macht, wirft die Stute im Stall ihr Füllen. Er wartet noch zwei Tage und kehrt dann wieder nach Hause zurück. Hier angekommen, führt er die Stute in den Stall des Gevatters, das Füllen behält er bei sich.
Der Knecht sieht die Stute, läuft und berichtet seinen Herrn. »Wie«, ruft dieser, »sollte mein Gevatter wirklich so schlecht an mir handeln?« Er glaubt es nicht, geht zu dem anderen und sagt: »Wäre es möglich, daß solche Geschichten zwischen zwei Gevattern geschehen konnten?« - »Was willst du denn eigentlich?« fragt der andere, »nicht deine Stute, sondern mein Wagen hat das Fohlen bekommen, darum ist es mein. Glaubst du es nicht, so verklage mich.«
Sie gehen zum Schulzen, vor den Richter: der Besitzer der Stute hat unrecht. Sie gehen vors Tribunal: er hat unrecht. Aus Zorn ruft er da: »Wie, dieser Schurke von Gevatter soll beweisen, daß Weiß Schwarz, Recht Unrecht sei? Jetzt gehe ich zum König!«
Er geht in das königliche Schloß und findet den Königssohn. Er wirft sich vor ihm nieder und ruft: »Gnade, o Herr! Hört meine Geschichte und urteilt selbst.« Aber auch der Königssohn gibt ihm unrecht. Da rauft er sich die Haare und beim Hinabgehen weint er bitterlich. Das hört die junge Königin, sieht ihn und begehrt zu wissen, warum er weine?
Er erzählt ihr unter Tränen seine Geschichte, und sie sagt: »Gräme dich nur nicht, sei still und unbesorgt. Besuche mich durch jene geheime Treppe, droben werde ich dir sagen, was du zu tun hast.«
Da wurde er ruhig, ging zu der jungen Königin, das ist die, welcher der Bauch redet, die sagte ihm: »Heut Mitternacht mußt du vor das Schloß laufen und um Hilfe rufen, so laut du nur immer kannst, immer zu und immer zu. Die Wachen werden herzulaufen, der Königssohn wird ans Fenster kommen und dann läßt er dich auch hinauf holen. Dann gehe nur, und fragt er dich, was da los sei, so antwortest du: 'O, Herr, die Fische kommen aus dem Meere und klettern die Berge hinan!' Da wird er sagen: 'Wie ist das möglich?' Und du antwortest: 'Gerade so möglich, als wenn ein Wagen ein Fohlen wirft', und dann schau, wie die Sache endet.«
Wie der König auf der Straße so gar jämmerlich Hilfe! Hilfe! schreien hörte, läßt er den Schreier zu sich in den Palast kommen und fragt ihn: »Was hast du? Was fehlt dir? Ist Gefahr im Anzuge? Rede!« Der andere sagt: »O, Herr, wir sind verloren! Die Fische kommen aus dem Meere und klettern auf die Berge!« Der Königssohn antwortete: »Dummes Zeug, wie ist das möglich?« - »Und wie ist es möglich, daß ein Wagen ein Fohlen wirft?« Wie der Königssohn dies hörte, sprach er: »Es ist gut, das Fohlen gehört dir ... aber du hast mit meinem Kalbe gepflügt, dieser Speichel kam nicht aus deinem Magen.«
Kaum dämmerte der Tag, so weckte er die junge Königin und sagte: »Höre, weil du dich in meine Geschäfte gemengt hast, so müssen wir uns trennen. Nimm dir aus dem Schlosse, was dir gefällt, und gehe deiner Wege.« - »Herr«, antwortete sie ihm, »Ihr müßt mir einen Monat Zeit lassen.« - »Meinetwegen auch das noch!«
Nun läßt sie viele Arbeiter rufen: Maurer, Schmiede, Tischler und Maler, und befiehlt ihnen, ihr in vier Wochen einen Palast zu bauen, anders wie dieser, doch diesem gegenüber. Pünktlich wurde der Palast fertig, und am Vorabende des Tages, wo sie das Schloß verlassen sollte, bat sie ihren Gemahl, noch einmal mit ihm speisen zu dürfen.
Wie er zusagt, mischt sie ihm einen Schlaftrunk in den Wein, so daß er nach kurzer Zeit fest eingeschlafen ist. Darauf läßt sie ihn in den neuen Palast hinüber tragen. Wie er am anderen Morgen erwacht, weiß er nicht, wo er ist, und kann sich gar nicht zurecht finden. Er meint zu träumen und schläft wieder ein, beim Erwachen war es aber noch immer das selbe.
Zuletzt ruft er seine Frau: »Heda, wo sind wir?« Gleichzeitig gedenkt er seines Befehls und wie die Frist abgelaufen, und fragt sie: »Bist du noch immer hier?« Sie antwortet: »Wie so denn: immer noch hier? Sagtest du nicht, ich dürfe das mit fort nehmen, was mir gefiele? Du gefielst mir aber am besten und so habe ich dich mit fort genommen: du bist bei mir.«
Da lächelte der Gemahl und sagte: »Du hast recht. Zu erst hast du mich mit der Stute angeführt, jetzt mit dem Palast. So höre meinen Vorschlag: nimm du Krone und Zepter und regiere das Reich ganz nach deinem Gutdünken, denn du hast, wie ich jetzt einsehe, Verstandes genug, dich und andere glücklich zu machen.« Und so geschah es.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen

VON PEZZE E FOGGHI ...

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter und einen Sohn. Nun wurde der König einmal so krank, daß er sterben mußte, und als er fühlte, daß er dem Tode nahe war, ließ er seinen Sohn vor sich kommen, und sprach zu ihm:
»Lieber Sohn, ich muß nun sterben, und du wirst nach mir König sein. Ich empfehle dir deine drei Schwestern; sorge für sie, bis sie sich verheiraten. Du mußt sie aber nicht nach deinem oder ihrem Gutdünken verheiraten, sondern wenn Eine von ihnen Lust dazu zeigt, so pflücke von dem schönen Rosenstrauch auf der Terrasse eine Rose, und wirf sie auf die Straße. Derjenige, der die Rose aufhebt, soll dann ihr Gemahl sein.« Als der König diese Worte gesprochen hatte, starb er, und sein Sohn wurde König.
Nach einiger Zeit kam nun seine älteste Schwester zu ihm, und sprach: »Lieber Bruder, ich wünsche mich zu verheiraten, suche einen Mann für mich aus.« »Weißt du auch, was mir unser Vater auf seinem Sterbebett befohlen hat?« sprach der König, und erzählte seiner Schwester, was der Vater gesagt hatte.
Da wurde sie zornig und sprach: »War denn unser Vater närrisch? Wie? Ich sollte jeden Beliebigen heiraten müssen, dem es einfällt, die Rose aufzuheben? Lieber heirate ich gar nicht.« »Tue, wie du willst,« sprach er, »ich kann dir nicht helfen, denn dies ist unseres Vaters letzter Wille gewesen.«
Als aber noch einige Monate verflossen waren, wurde der Königstochter die Zeit lang, und sie trat wieder vor ihren Bruder, und sprach: »Wenn es denn nicht anders sein kann, so will ich nach dem Willen unseres Vaters tun.«
Also pflückte der König eine Rose von dem Rosenstrauch auf der Terrasse, warf sie auf die Straße, und befahl einem Soldaten, Wache zu halten, und den Ersten, der die Rose aufheben würde, in den Palast zu schicken.
Als der Soldat eine Weile neben der Rose gestanden hatte, kam ein Fürst vorbei, und da er die schöne Rose am Boden liegen sah, hob er sie auf und sprach: »Ach, die schöne Rose!« »Edler Herr,« sprach die Schildwache, »der König wünscht euch zu sprechen.«
Da kam der Fürst vor den König, der frug ihn: »Habt ihr die Rose aufgehoben, die auf der Straße lag?« »Jawohl, königliche Majestät!« »So müsst ihr auch meine älteste Schwester heiraten.« »Königliche Majestät!« sagte der Fürst ganz erschrocken, »das kann ja nicht sein! Der Königstochter gebührt es, einen Königssohn zu heiraten, und ich bin nur ein Fürst. Wie kann mir diese Ehre werden.«
»Hier ist von keiner Ehre die Rede,« antwortete der König, »sondern es ist nun einmal notwendig, daß meine Schwester eure Gemahlin werde.« Also heiratete die Königstochter den Fürsten, und dachte: »Ist es auch kein Prinz, so bin ich doch froh, daß es nicht schlimmer geworden ist.«
Nach einiger Zeit trat auch die zweite Königstochter vor ihren Bruder und sprach. »Lieber Bruder, ich bin nun im Alter, mich zu verheiraten, suche mir einen Mann aus.« Da antwortete der König: »Weißt du aber auch, was mir mein Vater auf seinem Totenbett befohlen hat? Wenn du dich verheiraten willst, so mußt du dich in diese Bedingung ergeben.«
»Wenn es nicht anders sein kann, so will ich den Willen unseres Vaters tun,« sprach die Königstochter. Da pflückte der König eine Rose und warf sie auf die Straße, und ein Soldat mußte daneben Wache stehen.
Eine lange Zeit ging Niemand vorbei. Endlich kam ein Herr die Straße entlang, und da er die schöne Rose am Boden liegen sah, hob er sie auf und roch daran. Da trat der Soldat auf ihn zu, und sagte ihm, der König wünsche ihn zu sprechen: »Habt ihr die Rose aufgenommen?« frug ihn der König, als der Herr vor ihn trat. »Jawohl, königliche Majestät!«
»Nun denn, so müßt ihr meine Schwester zu eurer Gemahlin nehmen.« »Ach, königliche Majestät!« rief der Herr, »das kann ja nicht sein. Der Königstochter gebührt ein Herrscher zum Gemahl, und ich bin nur ein schlechter Untertan.« »Ich kann euch nicht helfen,« sprach der König, »meine Schwester muß eben eure Gemahlin werden.«
Also wurde die Hochzeit gefeiert, und nun war nur noch die Jüngste übrig; die aber sprach: »Meine älteste Schwester hat einen Fürsten zum Mann bekommen, meine zweite Schwester aber nur einen reichen Herrn. Wer weiß, was mir beschieden ist! darum will ich lieber gar nicht heiraten.« Also blieb sie bei ihrem Bruder.
Nun begab es sich aber, daß der König selbst eine junge Frau nahm, und das weiß man ja: kommt einmal eine Schwägerin ins Haus, so beginnt für die Schwester ein ganz anderes Leben. So ging es auch der Jüngsten. Nachdem sie Herrscherin im Hause gewesen, mußte sie sich nun ihrer Schwägerin unterordnen, und so kam es denn, daß sie endlich vor ihren Bruder trat, und ihm sagte:
»Lieber Bruder, wenn es denn nicht anders sein kann, so will ich meines Vaters Willen tun.« »Nimm du selbst die Rose,« sprach der König, »und wirf sie auf die Straße.« Da pflückte die Königstochter die Rose und warf sie auf die Straße, und ein Soldat mußte daneben Wache stehen.
Den ganzen Tag über ging fast Niemand vorbei, endlich, als es schon beinahe Abend war, kam ein Wasserträger des Weges daher, mit seinem Stock und seinem Wasserfaß. Der Wasserträger war schmutzig, und häßlich wie die Nacht, und seine Beine waren mit Blättern und Lappen eingebunden. Als der die schöne Rose liegen sah, hob er sie auf, und roch daran.
Der Soldat erschrak und dachte: »Wie kann die Königstochter diesen schrecklichen Menschen heiraten!« Weil aber der König ihm strengen Befehl gegeben hatte, so konnte er den Wasserträger nicht weiter gehen lassen, sondern mußte ihn vor den König führen. »Hast du die Rose aufgehoben?« frug ihn der König. »Jawohl, königliche Majestät.«
»So mußt du jetzt auch meine Schwester heiraten.« »O, königliche Majestät!« rief der Wasserträger, »ihr wollt mit mir scherzen! Seht ihr denn nicht, wie schmutzig ich bin, und wie meine Beine so krank sind?«
Dem König war es wohl traurig zu Mute, und die Königstochter weinte und jammerte über ihr Mißgeschick, aber es half alles nichts, sie mußte den schmutzigen, garstigen Wasserträger heiraten. »Aussteuer will ich keine,« brummte er, »was soll ich in meinen Bergen damit machen?«
Also nahm er seine Frau mit sich und führte sie in die Berge, in eine armselige kleine Strohhütte, in der wohnte ein steinaltes, häßliches Weib. »Siehst du, das ist unsre Wohnung, und das ist meine Mutter,« sprach er zu der armen Königstochter.
Da mußte sie in der kleinen Hütte wohnen, und die Mutter nahm ihr die schönen Gewänder weg und gab ihr dafür ein wollenes Röckchen, das mußte sie tragen, und sie mußte kochen und waschen wie eine niedrige Magd, und wenn Abends ihr Mann nach Hause kam, mußte sie ihm auch noch die Beine verbinden. Seine Mutter aber nannte ihn Pezze e fogghi.
So verging eine lange Zeit, und die arme Königstochter weinte sich fast die Augen aus. Pezze e fogghi aber liebte sie wie seine Augen, und wenn er sie so weinen sah, tat ihm das Herz weh.
Nun hatte eines Abends die Königstochter wieder so bitterlich geweint, und in der Nacht träumte sie, sie sei in einem wunderschönen Schlosse, und viele schön gekleidete Lakaien dienten ihr, und führten sie in einem goldnen Wagen, mit sechs herrlichen Pferden bespannt, zu ihrem Bruder.
Als sie nun am Morgen erwachte, erzählte sie ihrem Manne ihren Traum, der lachte aber darüber und sprach: »Das sind eben Träume, wie kämst du in ein reiches Schloß?« Da weinte sie wieder den ganzen Tag, und am Abend schlief sie unter Weinen ein.
Als sie aber am Morgen erwachte, sah sie sich in einem wunderschönen Schloß, wie der Traum es ihr gezeigt hatte. Sie lag in einem reichen Bette, und viele Dienerinnen waren um sie her, und halfen ihr, sich mit wohl riechendem Wasser zu waschen, und legten ihr königliche Kleider an. Dann ging sie in ein anderes Zimmer, darinnen standen viele Lakaien, die trugen ihr Frühstück auf und frugen:
»Was befehlen eure königliche Hoheit?« »Einen Wagen,« antwortete sie, »denn ich will zu meinem Bruder fahren.« »Der Wagen ist bereit,« sprachen die Diener, und als sie die Treppe hinunter ging, stand da ein goldner Wagen mit sechs schönen Pferden bespannt, in den setzte sie sich, und fuhr zu ihrem Bruder.
Der junge König stand eben am Fenster, und da er den schönen Wagen sah, dachte er: »Wer kommt denn da wohl angefahren in einem so schönen, goldnen Wagen?« Als er aber seine Schwester erkannte, lief er ihr voll Freude und Verwunderung entgegen, und frug sie:
»Liebe Schwester, bist du es? Wie kommst du denn zu dieser Pracht? und wo ist dein Mann?« »Wo mein Mann ist, weiß ich nicht,« antwortete die Königstochter, und erzählte ihm nun, wie es ihr ergangen. »Nun bin ich gekommen, dich und meine Schwestern abzuholen,« fuhr sie fort, »denn heute sollt ihr alle bei mir essen.«
Da setzte sich der König in seinen Wagen, nebst seiner Frau, seinen Schwestern und deren Männern, und alle zusammen fuhren mit großem Gefolge nach dem Schlosse der Königstochter. Dort fanden sie einen schön gedeckten Tisch, setzten sich, und aßen und tranken nach Herzenslust.
Als nun die Mahlzeit schon zu Ende ging, hob einer der Gäste von ungefähr seine Augen auf, und sah oben in der Decke ein großes Loch, und darin saß Pezze e fogghi, und schaute lächelnd auf die Gesellschaft herab. »Ei! da ist ja Pezze e fogghi!« rief er.
»Bardautz!« fiel das ganze Schloß zusammen und verschwand; der König und sein Gefolge befanden sich wieder zu Haus, und die jüngste Königstochter saß in ihrem wollenen Röckchen auf dem Berge in ihrer Strohhütte. Als nun Pezze e fogghi nach Hause kam, klagte sie ihm ihr Leid, er aber lachte und sagte:
»Ach was, du träumst eben sogar am hellen Tag, das ist nur dein Traum von voriger Nacht, der dir so lebhaft im Gedächtniß geblieben ist.« Nun vergingen wieder einige Tage, da weinte eines Abends die arme Königstochter wieder so viel, und als sie einschlief, träumte ihr abermals, sie sei in einem wunderschönen Schlosse, ganz der selbe Traum, wie das erste Mal.
Als sie aber am Morgen ihrem Mann den Traum erzählte, lachte er sie aus und sprach: »Was hast du denn nur immer für Träume?« Da weinte sie den ganzen Tag und schlief mit Weinen ein und am Morgen erwachte sie wieder im schönen Schlosse, und die Dienerinnen standen um sie her.
Da ging es denn gerade so wie das erste Mal. Sie legte königliche Kleider an, fuhr zu ihrem Bruder und lud ihn mit seinem Gefolge auf ihr Schloß, um bei ihr zu essen. Gegen das Ende der Mahlzeit aber schaute wieder einer zufällig aufwärts, und da er oben an der Decke ein Loch erblickte, und darin den Wasserträger, rief er ganz laut: »Ach seht! da ist ja Pezze e fogghi!«
»Bardautz!« fiel das Schloß zusammen; der König und sein Gefolge wurden in das königliche Schloß versetzt, die arme Königstochter aber saß wieder in ihrer Hütte auf dem Berge, und trug ihr schlechtes wollenes Röckchen. Als nun ihr Mann nach Hause kam, klagte sie und sprach:
»Nun sieh, jetzt ist es mir zum zweiten Mal so und so ergangen. Gewiß bist du schuld daran.« Er aber lachte sie aus und sprach: »Ach was, du träumst eben bei Tag und bei Nacht.« So verging abermals ein Monat.
Da weinte die Königstochter eines Abends wieder so bitterlich, und da sie einschlief, träumte sie den selben Traum zum dritten Mal. Am Morgen erzählte sie es ihrem Mann, der aber lachte nur darüber. Da weinte sie den ganzen Tag und schlief mit Weinen ein, und siehe da, am Morgen erwachte sie wieder im schönen Schloß.
»Jetzt weiß ich aber, was ich tue,« dachte sie, »ehe ich meinen Bruder einlade, mache ich es ihm zur Bedingung, daß keiner den Namen meines Mannes aussprechen darf.« Da fuhr sie in ihrem goldnen Wagen zu ihrem Bruder und lud ihn ein, bei ihr zu essen. »Aber unter einer Bedingung,« sagte sie, »im Schlosse darf keiner den Namen meines Mannes aussprechen.«
»Gut,« sprach der Bruder, und alle fuhren in das Schloß, wo wieder ein schön gedeckter Tisch bereit stand. Da setzten sie sich und aßen, und gegen das Ende der Mahlzeit tat sich wieder die Decke auf, und Pezze e fogghi saß oben, und schaute auf die Gesellschaft herab, aber keiner rief: »Da oben sitzt Pezze e fogghi!«
Und als alle fertig gegessen hatten, kam Pezze e fogghi herab, und saß in der Mitte des Zimmers auf einem schönen Thron, und war nicht mehr ein schmutziger Wasserträger, sondern ein schöner Jüngling in königlichen Kleidern. Denn Pezze e fogghi war der Sohn des Königs von Spanien, und war von einem bösen Zauberer verwunschen worden, und nun hatte ihn die schöne Königstochter erlöst.
Da wurden drei Tage Festlichkeiten gehalten, und der Königssohn fuhr mit seiner schönen Gemahlin nach Spanien. Als sie aber fort waren, verschwand das Schloß und ward nicht mehr gesehen. Der Königssohn und die Königstochter aber fuhren vergnügt nach Spanien, und wir sind hier sitzen geblieben.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON JOSEPH DEM GERECHTEN ...

Es war einmal ein großer König, der hatte drei Söhne, von denen hieß der Jüngste Joseph. Der König aber hatte diesen Sohn lieber als seine Brüder, also daß diese von Neid erfüllt wurden. Nun hatte der König große Güter in der Chiana, und mußte oft seine Söhne hin schicken, um nach zu sehen, wie das Getreide stand und wie die Ochsen und Pferde gediehen. Er schickte aber nur immer seine beiden älteren Söhne, den Jüngsten behielt er bei sich.
Da sprachen eines Tages seine Söhne zu ihm: »Vater, immer müssen wir in die Chiana gehen und Joseph bleibt in Ruhe zu Haus. Lasst ihn uns einmal begleiten, sonst ist es ein Zeichen, daß ihr ihn lieber habt als uns.« »O, meine Söhne,« antwortete der König, »ich habe euch alle gleich lieb, denn ihr seid ja alle meine Kinder, aber euer Bruder ist noch so jung, und ich fürchte mich, die wilden Tiere möchten ihn fressen.«
»Und für uns fürchtet ihr nichts, Vater? Nun sehen wir erst recht, daß euch unser Bruder lieber ist als wir.« Was konnte der König tun? Um seine Söhne zufrieden zu stellen, rief er den kleinen Joseph und sprach zu ihm: »Deine Brüder müssen wieder in die Chiana und du mein Sohn, sollst sie begleiten.«
Also zogen die drei Brüder mit einander fort in die Chiana. Das Herz der Brüder aber war von Neid und Zorn erfüllt und der Älteste sprach zum Zweiten: »Ich kann unseren Bruder nicht mehr vor Augen sehen; darum wollen wir ihn in diesen leeren Brunnen werfen, daß er vor Hunger sterbe.« Da banden sie den armen Joseph an einen langen Strick und ließen ihn in den Brunnen hinab und warteten oben, bis er tot sein würde.
Während sie nun so da saßen, kam ein mächtiger König vorbei, der war viel mächtiger als ihr Vater und frug sie: »Was tut ihr da an dem Brunnen?« Sie antworteten: »Wir müssen diesen Knaben bewachen, denn er soll sterben.« Als nun der König in den Brunnen hinein schaute und den wunderschönen Knaben sah, empfand er Mitleid mit ihm und sprach: »Zieht ihn doch herauf, so will ich ihn kaufen.«
Da zogen die beiden Königssöhne ihren Bruder heraus, und der König gab ihnen viel Geld und nahm den armen Joseph mit. Die Brüder aber nahmen ihm sein Hemd fort, schlachteten eine Ziege und tauchten das Hemd in das Blut.
Als sie wieder nach Hause kamen, rief ihnen der König gleich entgegen: »Wo ist euer Bruder Joseph?« »Ach, Vater!« antworteten sie: »die wilden Tiere haben ihn gefressen, seht hier sein blutiges Hemd.«
Denkt euch nun den Schmerz des armen Vaters. Er zerschlug sich die Brust, raufte sich das Haar aus und jammerte: »Ach, mein Sohn, mein lieber Sohn, bist du von den wilden Tieren gefressen worden.« - Lassen wir nun den Vater und sehen wir, was aus dem Sohn geworden ist.
Der mächtige König nahm ihn mit in sein Land und ließ ihn in Allem unterrichten; und Joseph wuchs heran und wurde der weiseste und gerechteste Mann im Lande, und der König setzte ihn über alle seine Güter und nannte ihn Joseph den Gerechten.
So vergingen viele Jahre; da kam eines Tages Joseph zum König und sprach: »Königliche Majestät, hört auf meine Worte und befolgt meinen Rat. Es werden sieben Jahre kommen, so fruchtbar, daß man gar nicht wissen wird, was man mit all dem Korn tun soll. Laßt während dieser sieben Jahre große Magazine bauen und mit Korn füllen, denn nachher werden sieben ganz schlechte Jahre kommen, in denen wird alles zu Grunde gehen, und wenn ihr nicht vorher Korn gesammelt habt, müßt ihr Hungers sterben, ihr und euer ganzes Volk.« Und wie Joseph vorher gesagt hatte, so geschah es.
Es kamen sieben Jahre, in denen alles gedieh und es wuchs so viel Korn, daß man gar keinen Raum mehr hatte, um alles zu sammeln. Da ließ der König große Magazine bauen und füllte sie mit Korn, wie Joseph ihm empfohlen hatte. Nach dem sieben fruchtbaren Jahren kamen aber sieben Jahre, die waren so schlecht, daß gar nichts reif wurde; kein Weizen, keine Gerste, keine Früchte, nichts.
Da entstand eine große Teuerung in allen Ländern, der König aber setzte seinen treuen Joseph über alle die Kornvorräte und ließ überall verkünden, in seinem Land sei viel Korn, Jedermann könne kommen und kaufen, und aus allen Ländern kamen die Leute und kauften Korn.
Da sprach auch der andere König, Joseph's Vater, zu seinen Söhnen: »Liebe Söhne, in unserm Lande ist kein Korn mehr. Darum zieht hin in das und das Land, wo der König Korn gesammelt hat und kauft Korn für uns ein.« Die beiden Söhne machten sich auf und zogen in das Land.
Als sie nun vor Joseph den Gerechten geführt wurden, erkannten sie ihn nicht; er aber erkannte sie wohl und frug sie: »Was wollt Ihr?« »Hoheit, wir sind gekommen, um Korn einzukaufen.« Da ließ ihnen Joseph ihre Säcke mit dem schönsten Korn füllen, und gab ihnen zu essen und zu trinken, lud sie ein an seinem Tisch zu sitzen, und war über die Maßen freundlich mit ihnen.
Als sie nun gegessen und getrunken hatten, sprachen die beiden Brüder: »Nun müssen wir wieder in unser Land zu unserm Vater ziehen.« Da nahm Joseph seine goldne Tasse, und steckte sie heimlich in einen von den Kornsäcken, und ließ seine Brüder ziehen.
Als sie aber kaum einen Miglio weit weg waren, setzte er ihnen mit seinen Dienern nach, und wie er sie eingeholt hatte, sprach er: »Was, so vergeltet ihr meine Freundlichkeit! Ich habe euch wie meine besten Freunde empfangen, und ihr stehlt mir meine goldne Tasse?«
Die Brüder waren sehr erschrocken und sprachen: »Ach, Herr, wir haben euch nichts gestohlen, denn wir sind ehrliche Leute. Wenn ihr aber wollt, so durchsucht unsere Säcke.« »Gewiß will ich das,« rief Joseph, und durchsuchte selbst die Säcke, und gleich im ersten fand er die Tasse.
Denkt euch nun, wie die Königsöhne da standen, Joseph aber rief: »Da seht ihr selbst, wie ihr mir vergolten habt. Darum muß einer von Euch im Gefängnis bleiben, der andere aber soll nach Hause zurück kehren und euren Vater rufen, daß ich mit ihm spreche.« Also blieb der eine Königssohn im Gefängnis, der andere aber kehrte in seine Heimat zurück.
Als ihn nun der König allein zurück kehren sah, frug er ihn gleich: »Wo ist dein Bruder?« Da erzählte ihm der Sohn alles, was vorgefallen war, der König aber fing laut an zu weinen und zu jammern: »Soll ich denn alle meine Kinder verlieren? Der Eine ist von den wilden Tieren zerrissen worden, der andere sitzt im Gefängnis; ach, ich armer, unglücklicher Vater!« Dann machte er sich auf, und zog mit seinem Sohn in jenes Land, wo Joseph wohnte.
Als er vor Joseph geführt wurde, wollte er vor ihm nieder fallen; Joseph aber hob ihn auf, und sein Herz zitterte ihm, als er seinen alten Vater wieder sah. Da erzählte ihm der König, wie er seinen jüngsten Sohn verloren habe, und wie er nun so unglücklich sei, da auch sein zweiter Sohn in Gefahr schwebe, und bat für ihn.
Joseph aber konnte sich nicht länger halten und rief: »Wünscht ihr wohl, euren jüngsten Sohn wieder zu sehen?« »Ach, wenn Gott das doch zuließe,« antwortete der alte König. Da rief Joseph: »Lieber Vater, ich bin euer jüngster Sohn, Joseph; denn die wilden Tiere haben mich nicht gefressen, sondern meine Brüder haben mich dem König verkauft, dem ich nun diene.«
Als seine Brüder dies hörten, fielen sie vor ihm nieder, denn sie dachten, nun würde sich Joseph an ihnen rächen. Er aber hob sie auf, und umarmte sie, und verzieh ihnen alles. Dann ging er zum König und erzählte ihm, wie er seinen Vater wieder gefunden habe, und nun mit ihm ziehen wolle, und nahm Abschied von ihm.
Und so zogen sie denn wieder in ihre Heimat, und lebten glücklich und zufrieden, wir aber sind leer ausgegangen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

DAS ROSMARINSTRÄUCHLEIN ...

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten kein Kind, wünschten sich aber eins. Wie nun die Königin eines Tages im Garten lustwandelte, sah sie einen Rosmarinstrauch, der viele kleine Schößlinge hatte. Da seufzte sie und sprach: »Ach, der Rosmarinstrauch hat seine Sprossen, und ich, die Königin, habe kein Kind.« Von der Zeit an ward sie guter Hoffnung, und wie ihre Zeit kam, gebar sie ein Rosmarinsträuchlein. Dieses pflanzte sie in ein Töpflein, begoß es mit Milch und ließ es nimmer aus den Augen.
Einst besuchte sie ihr Neffe, das war der Sohn des Königs von Spanien; wie der das Sträuchlein sieht, fragt er: »Frau Königin, was ist es doch mit diesem Rosmarinsträuchlein?« Sie erzählt ihm ihre Geschichte, wie sie das Pflänzlein geboren und es einmal des Tages mit Milch begieße. Da denkt der Jüngling bei sich: »Das Pflänzlein mußt du haben.« Er kauft also eine schöne Vase auf sein Schiff, schafft auch eine Ziege der Milch wegen herbei, und wie alles bereitet ist, entwendet er das Sträuchlein aus dem Zimmer der Königin und führt es mit sich fort. Zu Hause angekommen, stellt er die Pflanze in sein Gewächshaus.
Nun hatte der König eine Flöte und auf dieser blies er in den frohen Stunden des Tages. Als er eines Tages so blies, tat sich die Tür auf und ein schönes Fräulein stand auf der Schwelle. Er fragt sie: »Wer bist du und woher kommst du?« Sie antwortete: »Ich bin die Rosamarina.« Wie freute sich der König! Als sie fort war und er kaum eine freie Stunde hatte, ging er in sein Treibhaus, blies auf der Flöte, und da war auch schon das Fräulein wieder, und es war seine Freude, mit ihr zu sprechen und sie zu hören.
Als er so recht im Glücke war, mußte er in den Krieg, und beim Scheiden sagte er seiner Rosamarina: »Höre, meine geliebte Rosamarina, wenn ich aus dem Kriege zurück gekehrt bin, werde ich dreimal auf der Flöte blasen, und das sei dir ein Zeichen, daß du wieder heraus kommen darfst.« Und dem Gärtner befahl er, das Rosmarinsträuchlein viermal des Tages mit Milch zu begießen, denn würde er es bei der Rückkehr verwelkt finden, so solle ihm der Kopf abgehauen werden. Er legte die Flöte in sein Zimmer und zog davon.
Der König hatte drei Schwestern, die waren neugierig und sagten: »Was macht doch wohl unser Bruder mit der Flöte?« Die Älteste nimmt sie und bläst darauf, dann nimmt sie die Mittlere und ebenso die Jüngste. Beim dritten Blasen erscheint das Fräulein. Da rufen sie: »Also deshalb war unser Bruder Stunden und Stunden lang in dem Treibhaus und wollte nichts mehr von uns wissen?« Sie nahmen das arme Fräulein und schlugen es so jämmerlich, daß es mehr tot als lebendig sich zum Rosmarinsträuchlein zurück schleppte und darinnen verschwand.
Der Gärtner kommt und findet den Rosmarin des Königs verwelkt. Da jammert er: »Wehe mir, wenn jetzt der König zurück kommt, wie wird es mir ergehen!« Er ruft seine Frau, befiehlt ihr, das Sträuchlein viermal täglich mit Milch zu begießen, und macht sich auf und davon.
Ohne zu wissen, wohin, schweift er durch das weite Land, und wie es Abend wird, findet er sich in einem Walde. Er sieht einen hohen Baum, und aus Furcht vor wilden Tieren ersteigt er diesen, die Nacht darauf zu verbringen. Um Mitternacht kommen ein Hexenmeister und eine Hexe, legen sich unter dem Baum nieder und fangen an zu schnaufen, daß es dem Gärtner ganz bange wurde.
Dann fingen sie ein Gespräch an, und die Hexe fragt: »Was gibt es Neues?« - »Was es Neues gibt? Das Neueste ist, daß des Königs Gärtner in Lebensgefahr schwebt.« - »Und wie das?« fragte die Hexe weiter. »Das ist eine lange Geschichte. Du mußt wissen, daß der König seiner Tante das Rosmarinsträuchlein entführte, in welchem ein verzaubertes Fräulein wohnt.
Der König stellte die Pflanze in sein Treibhaus und begoß sie viermal des Tages mit frischer Milch; wenn er dann auf der Flöte blies, so kam das Fräulein heraus und sie redeten mit einander. Jetzt ist er in den Krieg, hatte aber die Flöte zurück gelassen, seine Schwestern bliesen darauf, und als das Fräulein erschien, haben sie es so zerschlagen, daß der Rosmarin, in den es zurück gekehrt, verwelken mußte. Der Gärtner aber, dem der König die Pflanze ans Herz gebunden hatte, ist aus Furcht vor der Strafe geflohen.« -
»Gibt es denn«, fragte die Hexe aufs neue, »gar kein Mittel, die Pflanze zu retten?« - »Es gäbe schon eins«, antwortete der Hexenmeister, »aber ich kann es dir nicht sagen, denn der Rasen hat Augen und die Bäume haben Ohren.« - »Ach was«, sagte die Hexe, »hier ist niemand, der uns hört.« - »Nun, so wisse denn, wenn jemand das Blut meiner Adern und das Fett deines Hinterkopfes in einem Topfe zusammen sieden und die Rosmarinpflanze damit bestreichen würde, so käme das Fräulein gesund und munter aus der Pflanze heraus.«
Der Gärtner auf dem Baum hatte alles mit angehört und dachte bei sich: »Jetzt, Glück, stehe mir bei!« Wie die beiden eingeschlafen waren, stieg er leise vom Baume herunter, nahm einen Knüppel und schlug sie tot. Dann nimmt er Blut und Fett, läuft nach Hause, siedet es, bestreicht die Pflanze, und wie er fertig ist, kommt das Fräulein heraus und das Rosmarinsträuchlein verdorrt.
Der Gärtner nimmt die Schöne auf seine Arme wie ein Kind und trägt sie in seine Wohnung, gibt ihr kräftige Brühen und heilkräftige Kräuter und stellt sie als bald wieder her.
Der König kommt aus dem Kriege zurück, und sein erster Gang ist ins Treibhaus. Er bläst dreimal auf der Flöte, aber da kommt kein Fräulein. Er geht zum Rosmarinsträuchlein und findet es verdorrt. Er ruft den Gärtner, und im hellen Zorn spricht er: »Jetzt sagst du mir, wo meine Rosmarina ist, oder ich schlage dir auf der Stelle den Kopf ab.« Er bittet den König, zuvor in sein Haus zu kommen, allwo er ihm etwas Schönes zeigen wolle.
Der König ging mit ihm und findet Rosmarina, die schönen Augen voll Tränen, auf dem Lager liegend. Er fragt sie: »Rosmarina, was ist dir geschehen?« Sie antwortet: »Deine Schwestern haben mir es angetan, ich wäre ihren Mishandlungen erlegen, wenn mich dein Gärtner nicht durch eine Salbe errettet hätte, ihm verdanke ich mein Leben.«
Da warf er einen Haß auf die bösen Schwestern, dem Gärtner aber wendete er alle Gnade zu. Als Rosmarina völlig genesen war, bat sie der König, seine Gemahlin zu werden. Darauf schrieb er seinem Onkel einen Brief, worin geschrieben stand, daß jenes Rosmarinsträuchlein ein Jungfräulein geworden, welches gar lieblich anzuschauen und aller Liebe Wert wäre. »Wollt Ihr«, so schloß er, »mit der Königin zur Hochzeit kommen, so seid Ihr uns lieb, wir werden demnächst die Ringe wechseln.«
Der Herold reiste ab und brachte dem Könige die Kunde; wie freute der sich, wie freute sich auch die Gemahlin, endlich eine Tochter gefunden zu haben. Ganz glücklich traten sie die Reise an, und als sie an Ort und Stelle waren, da schoß man mit den Kanonen. Wer das hörte, fragte: »Wer kommt da?« Und da hieß es überall: »Der König und die Königin!«
Sie fanden die Tochter im Glücke, und sie, die ihren Vater und ihre Mutter zum ersten mal sah, erfreute sich ihrer Küsse und Umarmungen. Die Hochzeit wurde gehalten und das gab denn durch ganz Spanien ein großes Fest.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
![]()
VON DER FATA MORGANA ...

Es war einmal ein mächtiger König, der hatte drei schöne Söhne, von denen war der Jüngste auch der schönste und klügste. Der König wohnte in einem herrlichen Schloß mit einem prächtigen Garten, in dem wuchsen viele Bäume mit seltenen Früchten und schönen Blumen, die gar lieblich dufteten.
Nun begab es sich eines Morgens, daß der König in den Garten ging, um seine Früchte zu besehen, und fand, daß an einem Baum das Obst fehlte. »Das ist doch merkwürdig,« dachte er, »der Garten hat ja eine hohe Mauer; wie kann denn Jemand hinein dringen?« Da rief er seine Söhne zusammen, und erzählte es ihnen, und der Älteste sprach: »Lieber Vater, bekümmert euch nicht darum; diese Nacht will ich Wache halten, und den Dieb entdecken.«
Am Abend nahm der Königssohn sein Schwert, und setzte sich in den Garten. Gegen Mitternacht aber wurde er von einem tiefen Schlaf befallen, und als er aufwachte, war es heller Tag, und von einem anderen Baum war wieder das Obst gestohlen. Der König und seine zwei jüngeren Söhne liefen herbei, der Älteste aber sprach: »Was wollt ihr? Als es spät wurde, konnte ich mich des Schlafes nicht mehr erwehren, und unterdessen ist wieder Jemand gekommen, und hat noch mehr Früchte gestohlen.«
»Heute Abend will ich wachen,« rief der zweite Sohn, »vielleicht geht es mir besser.« Es ging ihm aber nicht besser; denn gegen Mitternacht überfiel ihn ein tiefer Schlaf, und als er aufwachte, war es heller Tag, und auf einem dritten Baum war wieder das Obst gestohlen worden. »Lieber Vater,« sprach der zweite Sohn zum König, »es ist nicht meine Schuld. Ich konnte mich des Schlafs nicht erwehren, und unter dessen ist der Dieb wieder gekommen, und hat noch einen Baum geplündert.«
»Heute Abend ist an mir die Reihe,« rief der Jüngste, »ich will doch sehen, ob ich mich des Schlafes nicht erwehren kann.« Am Abend nahm er sein Schwert, und ging in den Garten; er setzte sich aber nicht, sondern ging immer auf und ab. Um Mitternacht sah er auf einmal einen Riesenarm über die Mauer herein reichen, und Obst pflücken.
Da zog er behend sein Schwert, und hieb den Arm ab. Der Riese stieß einen Schrei aus, und lief fort; der Königssohn aber kletterte schnell über die Mauer, und verfolgte die Blutspuren, denn der Riese war schon längst verschwunden. Endlich, an einem tiefen Brunnen, hörten die Blutspuren auf. »Gut,« dachte der Königssohn, »morgen will ich dich schon wieder finden,« kehrte in den Garten zurück, und legte sich ruhig schlafen.
Am Morgen kamen der König und die beiden Brüder in den Garten, um zu sehen, was der Jüngste gemacht hatte. Da zeigte er ihnen den Riesenarm, und sprach zu seinen Brüdern: »Nun, liebe Brüder, wollen wir uns aufmachen, und den Riesen noch weiter verfolgen.« Also nahmen sie einen langen Strick mit, und ein Glöckchen, und machten sich auf den Weg.
Als sie nun zum Brunnen kamen, sprach der älteste Bruder: »Hu! was ist der tief, da will ich nicht hinein steigen!« Der zweite schaute auch in den Brunnen, und sagte das selbe; der jüngste aber sprach: »Ihr seid Helden! Bindet mir den Strick um den Leib, so will ich mich schon hinunter wagen.« Da banden sie ihn fest, und er nahm das Glöckchen mit, und ließ sich in den Brunnen hinab. Der Brunnen war sehr tief; endlich aber kam er doch auf den Grund, und fand sich in einem schönen Garten.
Auf einmal standen drei wunderschöne Mädchen vor ihm, die frugen ihn: »Was willst du hier tun, du schöner Jüngling? Flieh, so lange es noch Zeit ist; wenn der böse Zauberer dich findet, so wird er dich fressen, denn weil ihm diese Nacht der Arm abgehauen worden ist, so ist er noch viel böser als sonst.« »Bekümmert euch nicht, schöne Mädchen,« antwortete der Königssohn, »ich bin ja eben deshalb gekommen, um den Zauberer zu ermorden.«
»Wenn du ihn ermorden willst, so mußt du dich eilen,« sprachen die Mädchen, »denn jetzt, so lange er schläft, kannst du ihn vielleicht bezwingen.« Da führten sie ihn in einen großen Saal, wo der Riese am Boden lag und schlief; der Königssohn schlich sich leise hin zu, und hieb ihm mit einem Streich den Kopf ab, daß er weit weg in die Ecke flog.
Die schönen Mädchen aber dankten ihm voller Freude und sprachen: »Wir sind drei Königstöchter, und der böse Zauberer hielt uns hier gefangen. Du aber hast uns erlöst, und darum soll Eine von uns deine Gemahlin sein.« Da antwortete er und sprach: »Für jetzt wollen wir aus dieser Unterwelt wieder in die Oberwelt zurück kehren. Dann wollen wir weiter darüber sprechen.«
Da band er zuerst die älteste Schwester am Stricke fest, gab das Zeichen mit dem Glöckchen, und die beiden ältesten Brüder zogen sie hinauf. Als nun der Älteste das schöne Mädchen erblickte, rief er: »Ei, welch ein schönes Gesicht! Die soll meine Frau werden!« Sie aber antwortete: »Zieht erst meine Schwester hinauf, dann wollen wir das Übrige besprechen.«
Als sie nun die zweite Königstochter herauszogen, war sie noch schöner als die erste, und der älteste Königssohn rief wieder: »Ei, welch ein schönes Gesicht! Dieses Mädchen soll meine Gemahlin werden!« Nun war noch die jüngste Königstochter unten.
Als der Königssohn sie nun auch am Stricke fest band, sprach er zu ihr: »Du mußt auf mich warten ein Jahr, einen Monat und einen Tag; wenn ich bis dahin nicht wieder komme, darfst du dich verheiraten.« Dann gab er das Zeichen mit dem Glöckchen, und die Brüder zogen auch die jüngste Königstochter heraus. Als sie aber über den Rand des Brunnens erschien, war sie schöner als die Sonne und der Mond, und der älteste Königssohn rief: »Ei, welch schönes Gesicht! Dies Mädchen soll meine Gemahlin sein,« und böse Gedanken kamen in seine Seele.
»Ach,« sagte die Königstochter, »werft doch eurem Bruder den Strick hinab; denn er wartet ja unten darauf.« Da warfen sie den Strick hinab; der Königssohn aber war klug, und weil er seinen beiden Brüdern nicht traute, so nahm er einen großen, schweren Stein, und band ihn an den Strick. Die Königssöhne aber meinten, sie zögen ihren Bruder heraus, und als sie dachten, jetzt sei er wohl halbwegs, schnitten sie den Strick ab, und der Stein fiel hinunter und zersprang in tausend Stücke.
Da sah der Königssohn, wie schlimm seine Brüder es mit ihm gemeint hatten, und mußte nun unten bleiben. »Ach,« dachte er, »wer wird mir wohl hier heraus helfen!« Da wanderte er durch das ganze Schloß und kam zuletzt auch an einen Stall, darin stand auch ein schönes Pferd.
Wie er es nun so streichelte, tat das Pferd seinen Mund auf, und sprach: »Du hast den Riesen ermordet, der mein Herr und Gebieter war, und nun sollst du mein Gebieter sein. Wenn du aber meinen Rat folgen willst, so bleibe hier bis ich es dir sage.« Also blieb der Königssohn in der Unterwelt, und fand in dem schönen Palast alles, was er brauchte.
Unterdessen waren seine Brüder mit den drei schönen Mädchen zu ihrem Vater zurück gekehrt, hatten ihm alles erzählt und gesagt, der Strick wäre gerissen, während sie ihren jüngsten Bruder hätten herauf ziehen wollen, und der Unglückliche wäre in den Brunnen zurück gefallen, und tot geblieben. Da fing der alte König an laut zu weinen und zu jammern, und konnte sich gar nicht trösten.
Als nun einige Zeit vergangen war, heiratete der älteste Königssohn die älteste Königstochter, und der Zweite nahm die Mittlere zur Frau; die Jüngste wollte sich aber nicht verheiraten. So lebten die beiden Brüder in Frieden und Ruhe, und dachten nicht an ihren jüngsten Bruder, den sie doch ermordet hatten. Der König aber konnte seinen armen Sohn nicht vergessen, und weinte Tag und Nacht um ihn, so daß er endlich über dem vielen Weinen das Gesicht verlor.
Da wurden alle Ärzte des ganzen Landes berufen, aber keiner konnte ihm helfen, und alle sagten: »Hier gibt es nur ein Mittel, das ist das Wasser der Fata Morgana. Wer damit seine Augen wäscht, wird wieder sehend. Wer aber kann das Mittel finden!« Da sprach der König zu seinen Söhnen: »Hört ihr, was die Ärzte sagen, meine Söhne! Zieht aus, und verschafft mir das Wasser der Fata Morgana, daß ich wieder sehend werde.« Die beiden Brüder machten sich also auf und zogen durch die ganze Welt, aber umsonst; sie konnten die Fata Morgana nicht finden.
Nun lassen wir sie, und sehen wir, was aus dem jüngsten Bruder in der Unterwelt geworden ist.
Der lebte also ruhig in seinem unterirdischen Schloß und es mangelte ihm an nichts. Da sprach eines Tages das Pferd zu ihm: »Soll ich dir etwas sagen? Dein Vater ist vom vielen Weinen um dich blind geworden, und die Ärzte haben ihm gesagt, ihm könne nichts helfen, als das Wasser der Fata Morgana. Darum sind deine Brüder ausgezogen es zu suchen, doch werden sie es nicht finden, denn wie könnten sie zur Fata Morgana gelangen!
Ich aber weiß, wo die Fata Morgana wohnt, denn sie ist meine Schwester. So setze dich nun auf meinen Rücken, dann wollen wir ausziehen und das Wasser holen.« Da bestieg der Königssohn das Pferd und sie zogen fort. Das Pferd aber sprach: »Um das Wasser zu holen, braucht es sehr viel, denn meine Schwester ist stark und mächtig, und wir können es nur durch List bekommen.
Darum höre auf meine Worte und merke dir Alles genau. Zuerst wirst du an ein großes Tor kommen, das immer auf und zu schlägt, also daß man nicht hindurch kann. Nimm aber eine starke Eisenstange mit, und stecke sie zwischen die beiden Torflügel, so wird ein Spalt bleiben, durch den wir uns hindurch zwängen können.
Dann wirst du eine riesige Schere sehen, die immer auf und zu geht, und alles zerschneidet, was hindurch will. Nimm eine Rolle Papier mit, netze sie, und stecke sie zwischen die Schere, so wird eine Öffnung bleiben, durch die wir hindurch können. Sind wir aber der Schere entkommen, so werden sich zwei Löwen auf uns stürzen, um uns zu verschlingen, darum mußt du eine Ziege mitnehmen, und die eine Hälfte davon nach rechts, die andre nach links werfen, so werden sie sich damit beschäftigen und uns ziehen lassen.
Dann kommen wir in einen schönen Garten, in dem ist ein Brunnen, daraus tropft eine Flüssigkeit, das ist der Schweiß meiner Schwester, den zu holen du gekommen bist. Stelle ein Fläschchen darunter, daß jeder Tropfen aufgefangen wird. Neben dem Brunnen steht ein Granatbaum, mit schönen Granatäpfeln; pflücke drei davon, sie werden dir nützen.«
Der Königssohn versprach alles getreulich zu befolgen, und so ritt er auf seinem Pferdchen davon und kam endlich an das große Tor, das mit vielem Lärm auf und zu schlug, so daß niemand hindurch konnte. Doch der Königssohn steckte eine starke Eisenstange zwischen die beiden Torflügel, da beruhigte sich das Tor, und es blieb eine Spalte, durch die er sich mit seinem Pferde hindurch zwängen konnte.
Dann kam er an eine riesige Schere, die ging immer auf und zu, und war so scharf und groß, daß sie einen Menschen mitten durch schneiden konnte. Der Königssohn aber steckte die nasse Rolle Papier dazwischen, und während die Schere sich damit beschäftigte, kam er glücklich hindurch. Kaum aber war er der Schere glücklich entronnen, als zwei grimmige Löwen sich auf ihn stürzten, um ihn zu verschlingen.
Da zerriss er die Ziege, und warf die Hälfte nach rechts und die Hälfte nach links, und die Löwen stürzten sich auf das Fleisch, und ließen ihn mit seinem Pferd durch. So kam er denn endlich in den schönen Garten, in dem der Brunnen stand. Da stieg er ab, zog sein Fläschchen hervor, und stellte es unter den Brunnen, um die Tropfen des kostbaren Wassers aufzufangen.
Dann pflückte er die drei Granatäpfel und verwahrte sie. Nun hätte er den Worten des Pferdes folgen sollen, und geduldig warten, bis das Fläschchen voll war. Weil aber das Wasser nur tropfenweise kam, ward ihm die Zeit zu lang, und er dachte: »Während das Fläschchen sich füllt, könnte ich wohl ein wenig das Schloß betrachten, und sehen, wie es darinnen aussieht.«
Da ging er die Treppe hinauf, und trat in das Schloß, und sah so viele Schätze und Kostbarkeiten, daß kein Mensch es glauben kann, und je weiter er ging, desto herrlichere Sachen fand er. Endlich kam er auch in einen prächtigen Saal, in dem lag auf einem Ruhebett die Fata Morgana, und sie war so schön, daß sie mit sieben Schleiern bedeckt war, und ihre Schönheit doch durch alle sieben Schleier hindurch leuchtete.
Da beugte sich der Königssohn über sie, und nahm ihr die sieben Schleier weg, und als er sah, wie schön sie war, entbrannte er in heftiger Liebe zu ihr, neigte sich und küßte sie. Kaum hatte er ihr aber den Kuß gegeben, so ergriff ihn eine furchtbare Angst, daß er mit den Schleiern in der Hand entfloh und aus dem Schlosse lief. Am Brunnen war unterdessen das Fläschchen voll geworden, er ergriff es, warf sich aufs Pferd und sprengte davon.
Die Fata Morgana aber war von dem Kusse aufgewacht, und als sie sich entblößt sah, sprang sie auf, um den Königssohn zu verfolgen. »O, Löwen,« rief sie, »warum habt ihr diesen Jüngling durch gelassen? Kommt und helft mir, ihn zu verfolgen!« Da sprangen die Löwen auf, und setzten dem Königssohne nach.
»Schau dich um,« sprach das Pferd, »und sieh, was es gibt.« »Ach, liebes Pferdchen, die schöne verfolgt uns mit zwei grimmigen Löwen!« »Sei nicht bang, und wirf einen Granatapfel hinter dich.« Da warf der Königssohn einen Granatapfel hinter sich, und also bald entstand ein breiter Strom, der floss von lauter Blut. Die Fata Morgana und die beiden Löwen wurden dadurch aufgehalten, und als sie endlich hinüber kamen, hatte der Königssohn einen tüchtigen Vorsprung.
Die Fata Morgana war aber doch noch schneller, und holte ihn bald wieder ein. »Schau dich um,« sprach das Pferdchen, »und sieh, was es gibt.« »Ach, liebes Pferdchen, die Fata Morgana ist dicht hinter uns.« »Sei nicht bang, und wirf den zweiten Granatapfel hinter dich.« Da warf der Königssohn den zweiten Granatapfel hinter sich, und also bald entstand ein Berg von lauter Dornen. Als nun die Fata Morgana und die Löwen über den Berg hinüber wollten, zerstachen sie sich jämmerlich an den Dornen. Mit vieler Mühe kamen sie aber endlich doch hinüber, und verfolgten den Flüchtling.
»Schau dich um,« sprach das Pferd, »und sieh, was es gibt.« »Ach, liebes Pferdchen, die Fata Morgana ist dicht hinter uns.« »Sei nicht bang, und wirf auch den letzten Granatapfel hinter dich.« Da warf der Königssohn auch noch den letzten Granatapfel hinter sich, und also bald entstand ein Feuerberg, und als die Löwen hinüber wollten, fielen sie in die Flammen und verbrannten. Die Fata Morgana aber gab die Verfolgung auf und kehrte in ihr Schloß zurück.
Nach dem der Königssohn nun noch ein Weilchen geritten war, sprach das Pferdchen zu ihm: »Sieh, dort kommen deine Brüder, die suchen noch nach dem Wasser der Fata Morgana. Erzähle ihnen, daß du es hast, und wenn sie dich darum bitten, so überlasse ihnen das Fläschchen.«
Da tat der Königssohn, wie das Pferd ihn geheißen hatte, ging auf seine Brüder zu, und sprach: »Willkommen, liebe Brüder, wo zieht ihr hin?« »Wir sind ausgezogen, für unsern blinden Vater das Wasser der Fata Morgana zu suchen, damit er wieder sehend werde.« »Ach, liebe Brüder,« sprach der Königssohn, »das werdet ihr nimmer erlangen! Ich habe so eben mit Lebensgefahr ein Fläschchen voll geholt, und weiß, wie schwer es ist, hin zu kommen.«
Als die beiden Brüder das hörten, drohten sie, ihn zu ermorden, wenn er ihnen das Fläschchen nicht überließe. Da gab er ihnen das Wasser, und sie brachten es ihrem alten Vater, und als er sich die Augen damit gewaschen hatte, wurde er wieder sehend. Da freute er sich über die Maßen, und gab jedem seiner Söhne die Hälfte von seinem Reiche.
Unterdessen hatte das Pferd den jüngsten Königssohn in die Unterwelt zurück getragen, und da blieb er noch lange Zeit. Eines Tages sprach das Pferd zu ihm: »Deine Brüder sind bei deinem Vater angekommen, und haben ihn von seiner Blindheit geheilt. Nun ist es auch Zeit, daß du an die Oberwelt zurück kehrst.« Da legte der Königssohn königliche Kleider an und wünschte sich ein königliches Gefolge; dann bestieg er das Pferd und ritt, bis er in das Reich seines Vaters kam.
Als er sich nun der Stadt näherte, war er so prächtig anzuschauen, daß man seinen Brüdern die Kunde brachte, ein mächtiger König komme mit großem Gefolge. Da gingen seine Brüder ihm entgegen, und als das Pferdchen sie kommen sah, sprach es: »Dort kommen deine Brüder; wenn sie dich gefangen nehmen wollen, so wehre dich nicht.«
Als nun die Königssöhne ihren jüngsten Bruder erkannten, sprachen sie untereinander: »Ist das unser jüngster Bruder, der mit einem so großen Gefolge kommt? Wehe uns, jetzt wird er unserem Vater alles erzählen, was wir ihm getan haben. Darum wollen wir ihn lieber gleich gefangen nehmen, und unserem Vater sagen, ein fremder König habe uns den Krieg erklärt, und wir hätten ihn besiegt.« Und so taten sie denn auch und stürzten sich auf ihren Bruder.
Der ließ sich willig gefangen nehmen und sprach: »Erlaubt mir nur die Gnade, daß ich mein Pferdchen ins Gefängnis mit nehmen darf.« Da erlaubten sie es, und der Königssohn wurde mit seinem Pferdchen ins Gefängnis geführt; sein Gefolge aber verschwand, denn es war ja nur durch Zauberkunst entstanden.
Als nun der Königssohn mit seinem Pferdchen im Gefängnis war, sprach das Pferd: »Nun merke wohl auf meine Rede und tue, was ich dir sage. Nimm diesen schweren Stock, und prügle mich damit so lange, bis ich tot hinfalle. Dann nimm ein Messer und schneide mir den Leib auf, so wird es dein und mein Glück sein.«
»Ach, liebes Pferdchen, ich habe nicht das Herz dazu! du hast mir so viel Gutes getan, wie kann ich dir nun auf diese Weise lohnen? Nein, nein, das tue ich nicht.« »Du mußt es aber doch tun,« sagte das Pferd, »denn nur so kannst du mich erlösen.« Da nahm der Königssohn einen schweren Prügel, und schlug das Pferd, und bei jedem Schlage rief er: »Ach! liebes Pferdchen! verzeih, daß ich dir weh tue! ich befolge ja nur dein Gebot.«
Das Pferd aber sprach: »Mache dich stark, und schlage nur zu; sonst kann ich nicht sterben, und dann ist es mein und dein Unglück.« Da schlug der Königssohn immer stärker zu, bis das Pferd tot umfiel. Dann nahm er ein Messer und schnitt ihm den Leib ganz vorsichtig auf. Auf einmal sprang ein schöner Jüngling heraus, der sprach: »Ich bin der Bruder der Fata Morgana, und war in den Leib des Pferdes verzaubert, du aber hast mich erlöst, und nun will ich dir auch helfen.«
Da wünschte er sich und den Königssohn aus dem Gefängnis heraus, und also bald sprangen die Türen auf, und die Beiden gingen hinaus vor die Stadt. Als sie aber vor dem Tor waren, wünschten sie sich königliche Kleider und ein mächtiges Heer, und als bald stand hinter ihnen ein Heer, wie es nicht einmal der König hatte; das fing an zu schießen, daß die ganze Stadt davor erschrak.
Der Königssohn aber schickte zu seinen Brüdern, und ließ ihnen sagen: »Ich bin euer jüngster Bruder, und bin mit einem großen Heer gekommen euch zu bestrafen für alles das, was ihr mir getan habt.« Als seine Brüder das hörten, erschraken sie sehr, und ihr Herz wurde so dünn wie ein Haar. Da sprachen sie: »Wir wollen unserrm jüngsten Bruder entgegen gehen, und uns ihm zu Füßen werfen, damit er uns verzeihe.«
Da gingen sie hinaus, fielen auf die Knie und baten ihn um Verzeihung; er aber sprach: »Was ihr mir Böses getan habt, will ich euch verzeihen; aber Könige könnt ihr nicht mehr sein, sondern das Reich meines Vaters muß mir allein gehören. Nun führt mich aber auch zu meinem lieben Vater.«
Da führten sie ihn zum alten König, und der Königssohn erzählte alles, wie es ihm ergangen war; und der alte König freute sich sehr, als er seinen lieben Sohn wieder sah, und umarmte und küßte ihn.
Während sie nun so voller Freude bei einander waren, ging auf einmal die Tür auf, und eine wunderschöne große Frau in prächtigen Gewändern und mit einem großen Gefolge trat herein, und das war die Fata Morgana, die sprach: »Ich bin die Fata Morgana. Dieser Jüngling aber hat mir meine Schleier geraubt, und hat mich geküßt, als ich schlief. Darum muß er mein Gemahl werden, und ich will ihn zu einem mächtigen König machen. Die jüngste Königstochter aber, die noch ledig ist, soll meinem Bruder angehören.«
Und so geschah es; sie hielten drei Tage lang Festlichkeiten, und der Königssohn heiratete die schöne Fata Morgana, und zog mit ihr in ihr Land. Das Reich seines Vaters aber schenkte er seinem Schwager, der die jüngste Königstochter heiratete. Und so blieben sie glücklich und zufrieden, wir aber sind leer ausgegangen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

VON DEM SEMINARISTEN, DER DIE KÖNIGSTOCHTER ERLÖSTE ...

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten eine einzige Tochter, die sie über alle Maßen liebten. Nun begab es sich eines Tages, als die Königstochter sieben Jahr alt war, daß sie mit ihrer Amme und ihrer Kammerfrau auf die Terrasse ging, weil die Sonne so schön schien.
Als sie oben waren, sprach die Königstochter zur Amme: »Setze dich hin, ich will dich kämmen.« »Ach, königliche Hoheit,« antwortete die Amme, »das ist ja keine Beschäftigung für euch.« Die Königstochter aber bestand darauf, wie Kinder eben sind, und um ihr den Willen zu tun, setzte sich die Amme hin und ließ sich von ihr kämmen. Mit einem Mal aber senkte sich eine schwarze Wolke herab, hüllte die Königstochter ein und entführte sie.
Denkt euch den Jammer der Kammerfrau und der Amme; sie liefen hinunter und erzählten weinend der Königin alles, und die Königin fing auch an zu jammern, und es war ein großes Trauern im ganzen Palast. Der König ließ überall nach forschen; aber vergebens, sie war nicht wieder zu finden, und viele Jahre vergingen, ohne daß man etwas von ihr hörte.
Nun wohnte in der selben Stadt eine arme Witwe, die hatte einen einzigen Sohn. Sie waren aber so arm, daß sie oft nichts zu essen hatten. Ein guter Freund hatte einmal dem Jüngling einen alten Seminaristenanzug geschenkt, in dem ging er hin und diente die Messen in den Kirchen, und erwarb sich so ein Stückchen Geld, um sich und seine Mutter kümmerlich zu ernähren.
Es waren ungefähr acht oder neun Jahre verflossen, seit die Königstochter geraubt worden war, als sich eines Morgens am Ufer des Meeres ein Brunnen erhob, der ganz voll Wasser war. Darüber verwunderten sich die Leute sehr, gingen zum König, und erzählten ihm: »Königliche Majestät, diesen Morgen ist auf der Marina ein Brunnen erschienen, der war früher nicht da und ist ganz voll Wasser.«
Da befahl der König, es solle neben dem Brunnen den ganzen Tag ein Soldat Schildwache stehen, und ließ im ganzen Land verkünden, wer hinunter steigen könne, und ihm Nachricht bringen, wie es da unten aussehe, der solle nach ihm König sein.
Da versuchten es Viele, und ließen sich in den Brunnen hinab, sowie aber das Wasser ihnen über dem Kopfe zusammen schlug, mußten sie elendiglich ertrinken.
Nun dachte eines Tages der Sohn der Witwe: »So Viele haben es versucht und es ist ihnen nicht gelungen; so will ich auch einmal mein Glück versuchen, vielleicht geht es mir besser.« Also machte er sich auf den Weg, ohne seiner Mutter etwas zu sagen, und kam an den Brunnen, wo ein Soldat Schildwache hielt.
»Heda, guter Freund! wollt ihr mir den Gefallen tun, und mich in den Brunnen hinab lassen?« »Geht nach Haus, Landsmann!« antwortete der Soldat. »Es haben schon so viele ihr Leben gewagt, und keiner ist lebendig heraus gekommen.« »Vielleicht bin ich glücklicher,« sprach der Seminarist, »laßt mich nur hinunter.«
Da band ihn der Soldat am Strick fest, und gab ihm ein Glöckchen in die Hand, und ließ ihn hinab. Aber siehe da! als seine Füße das Wasser berührten, teilte es sich auseinander, also daß er ungefährdet hinunter kam. Über seinem Haupte aber schlug das Wasser wieder zusammen.
Als er nun auf den Grund des Brunnens kam, schaute er sich um, und erblickte eine Tür, die war ganz von Silber. Da sprang er hinzu, schob den Riegel zurück und öffnete sie. Nun kam er in einen großen Raum, und sah gegenüber eine zweite Tür, die war von Gold, und als er den Riegel zurück schob und die Türe aufmachte, sah er gegenüber eine dritte Tür, die war ganz diamanten.
Da öffnete er auch diese und kam in einen wunderschönen Garten, in dem blühten Blumen von jeder Art, und alle Bäume die es auf Erden gibt, wuchsen darin. Nun ging er durch den Garten, und kam an eine prächtige Treppe, und als er auch da hinauf stieg, kam er in einen schönen Saal, in dem stand ein Tisch mit mancherlei guten Speisen bedeckt.
»Ei,« dachte er, »hier bin ich ja herrlich daran,« und aß und trank, was sein Herz begehrte. Als er gegessen hatte, ward er auch müde; da ging er in einen anderen Saal, in dem stand ein schön gedecktes Bett, in das legte er sich hinein und schlief bald ein.
Nach einer Weile hörte er sich beim Namen rufen: »Peppino!« »Wer ruft mich?« antwortete er. Da sprach die Stimme: »Ich bin die Königstochter, die vor so viel Jahren von einer Wolke entführt wurde; mich hält ein böser Zauberer gefangen, willst du mich aber erlösen, so ist es dein und mein Glück.«
»Sagt mir, was ich tun soll, um euch zu erlösen,« antwortete der Seminarist. »Bleibe nur ruhig hier,« sagte sie, »iß und trink, und sei frohen Mutes. Wenn der Augenblick kommt, daß du mich erlösen kannst, so will ich es dir sagen.« Also blieb der Seminarist in der Unterwelt, hatte sein gutes Essen und Trinken, und es fehlte ihm an nichts. Auch hatte er ein schnelles Pferd, auf dem er in dem Garten spazieren ritt. In der Nacht aber kam die schöne Königstochter und redete mit ihm.
Es mochte nun wohl ein Monat verflossen sein, da sprach die Königstochter eines Abends zu ihm: »Höre, Peppino, morgen früh mußt du wieder an den Brunnen gehen, und dich an die Oberwelt hinauf ziehen lassen. In einem Monat und einem Tag aber, genau um Mitternacht, mußt du dich wieder oben einfinden, um dich herab zu lassen. Wenn du auch nur um eine Minute zu spät kommst, so ist es schlimm für dich und schlimm für mich. Damit du aber keinen Mangel leiden mögest, so nimm diesen Ring. So oft du ihn am Finger herum drehst, wirst du die Taschen voll Geld haben. Versäumst du die Stunde, so wird der Ring seine Kraft verlieren. Gib Acht, und vergiß nicht, dich pünktlich einzufinden.«
Der Seminarist versprach alles ganz genau zu erfüllen, nahm den Ring und am Morgen ging er zum Grund des Brunnens, band sich an den Strick fest, der noch herunter hing, und läutete mit seinem Glöckchen. Oben stand wie gewöhnlich ein Soldat und hielt Wache neben dem Brunnen. Als der da unten das Läuten hörte, dachte er: »Sollte Jemand da unten sein?« und zog an dem Strick, und zog den Jüngling glücklich heraus.
Der Seminarist ging sogleich nach dem Hause seiner armen, alten Mutter, die ihn für tot beweinte, klopfte an und sprach: »Liebe Mutter, macht mir auf, denn ich bin euer Sohn, und bin nun wieder da.« »Ach,« antwortete sie, »mein Sohn ist gewiß schon tot, denn er hat mich vor einem Monat verlassen, und ist nicht wieder gekommen.«
Er aber rief sie wieder: »Ich bin ganz gewiß euer Sohn, und komme nun mit großen Reichtümern zu euch zurück.« Da ließ sie sich überreden, und machte die Tür auf, und als sie ihren Sohn erkannte, umarmte sie ihn voller Freude. Er aber kaufte sogleich einen schönen Palast, dem königlichen Schloß gegenüber, kaufte auch reiche Gewänder für sich und seine Mutter und brachte die alte Frau in den Palast.
Als der König hörte, daß ein vornehmer Herr das Haus gegenüber bezogen habe, schickte er ihm einen Diener und ließ ihm sagen, ob er die Ehre haben könne, ihn am Abend bei sich zu sehen. Da ging der Jüngling hin und spielte mit dem König, und wenn er verlor, so drehte er nur am Ring, und sogleich waren seine Taschen voll Geld. So trieb er es jeden Abend, bis ein Monat schon beinahe vergangen war.
Als er nun merkte, daß nur noch wenige Tage blieben, drehte er so oft am Ringe, bis er Geld genug gesammelt hatte, damit seine Mutter noch zwanzig Jahr sorgenfrei leben konnte, und sorgte so auf alle Fälle für ihre Zukunft. Endlich kam der Abend, an welchem er sich um Mitternacht am Brunnen einfinden mußte.
Da nahm er Abschied von seiner Mutter, und ging zum letzten Mal, um mit dem König zu spielen. In der Hitze des Spiels aber vergaß er auf die Stunde zu achten; denkt euch seinen Schrecken, als er auf einmal Mitternacht schlagen hörte. »Königliche Majestät,« sprach er, »verzeiht, aber ich kann nicht länger bleiben, ein wichtiges Geschäft zwingt mich, sogleich weg zu gehen.« Als er aber an dem Ringe drehte, blieben seine Taschen leer.
Da merkte er, daß der Ring seine Eigenschaft verloren hatte, und sprach: »Schickt morgen zu meiner Mutter, die wird euch alles bezahlen, ich aber muß fort.« Schnell lief er zum Brunnen, und sprach zum Soldaten, der dort Wache stand: »Guter Freund, erweist mir den Gefallen, und laßt mich in den Brunnen hinab.« »Seid ihr toll,« erwiderte der Soldat, »daß ihr euer Leben verlieren wollt?« Der Jüngling aber bestand darauf, und so band ihn der Soldat am Strick fest, und ließ ihn hinab.
Wie er nun das Wasser mit den Füßen berührte, teilte es sich vor ihm, und schlug über ihm wieder zusammen. Als er aber unten ankam, was sah er da? Die drei Türen waren nieder gerissen, die Mauern umgefallen; als er in den Garten kam, waren alle Bäume mit den Wurzeln ausgerissen, die Blumen verwelkt; der Stall, in dem sein Pferd stand, war auch zusammen gefallen, und das Pferdchen lag tot am Boden.
Er eilte zur Treppe, die war aber auch zerstört, und am Fuße der Treppe lag die schöne Königstochter und war tot, und sechs tote Mädchen lagen zu ihrer Rechten, und sechs zu ihrer Linken. Da fing der Jüngling an zu klagen und zu jammern, und verfluchte sich und sein Geschick. »Bist du wieder gekommen, du Bösewicht!« sprach auf einmal eine Stimme, und als er sich umdrehte, sah er ein ganz altes Mütterchen, das schalt ihn und sprach: »Hast du so dein Wort gehalten? Sieh, das ist nun dein Werk!«
»Ach, gute Alte,« antwortete er, »ihr habt Recht, und ich habe schwer gefehlt. Aber sagt mir nun, wie ich meinen Fehler wieder gut machen kann, so will ich alles tun.« »Was hilft es, daß ich dir sage,« sprach die Alte, »es wird dir doch niemals gelingen.« Der Jüngling aber bat sie so lange, bis sie endlich sprach: »Nun denn, so höre. Siehst du den zerstörten Stall? Da mußt du hinauf steigen, und dieses Schwert mit nehmen. Dann mußt du mit einem Satz dem Pferd auf den Rücken springen, so wird es aufspringen und wieder lebendig werden.
Ergreife schnell die Zügel und zieh dein Schwert, denn so wie das Pferd aufspringt, wird ein mächtiger Lindwurm dich anfallen, mit dem mußt du kämpfen. Fürchte dich aber nicht, denn mit diesem Zauberschwert wirst du ihn besiegen. Hast du ihn nun umgebracht, so springe diesen Weg hinauf, so wird dir ein furchtbarer Riese zu Pferd entgegentreten und wird zu dir sagen: 'O, Kirchenfliege, was unterstehst du dich in meinem Garten spazieren zu reiten?'
Dann mußt du antworten: 'Ich bin gekommen, dich zu bekämpfen.' 'Was, du willst mich bekämpfen, du Kirchenfliege?' wird er sagen, und du mußt antworten: 'Ich bin so klein und du so groß, aber im Namen Gottes will ich dich besiegen.' Dann wird der Riese mit dir kämpfen, eine gute Weile lang. Wenn er aber sieht, daß er dir nichts anhaben kann, wird er seinen Handschuh fallen lassen und zu dir sprechen: 'Es ist mir so beschwerlich vom Pferd zu steigen; steige du herab und hole mir meinen Handschuh.'
Hüte dich zu tun, was er dir sagt, es wäre dein Verderben, sondern sage ihm, er könne ihn selbst aufheben. Da aber der Riese ohne Handschuh nicht kämpfen kann, so wird er schließlich vom Pferde steigen, um ihn zu holen. Während er sich nun bückt, mußt du hin zu treten, und ihm mit dem Zauberschwert einen Streich in den Nacken geben, daß er stirbt. Dann untersuche ihn, so wirst du in seinem Kleide einen Bund Schlüssel und einen Bund Federn finden. Damit mußt du in das Haus eilen.
In einem Saal ist ein verschlossener Schrank; probiere so lange, bis du den Schlüssel dazu gefunden hast, und mache den Schrank auf. Darin stehen eine Menge Fläschchen mit Salben und Elixieren, nimm dasjenige mit der Salbe, die die Toten auferweckt, und wenn du die Königstochter damit bestreichst, so wird sie erwachen. Dies mußt du alles ausführen, wenn du den Mut dazu hast.«
Dem Jüngling wurde wohl ein wenig bange, aber er dachte: »Ich stehe in Gottes Hand und so will ich es denn wagen.«
Also nahm er das Schwert, und stieg vorsichtig auf den zertrümmerten Stall hinauf. Als er oben war, faßte er festen Fuß, sprang herab und dem Pferde gerade auf den Rücken. Im selben Augenblick sprang das Pferd auf, und unter ihm hervor wälzte sich ein riesiger Lindwurm, und wollte den Jüngling verschlingen. Der aber hatte schon die Zügel ergriffen, und das Zauberschwert gezogen, und begann mit dem Lindwurm zu kämpfen. Der Lindwurm war wohl stark und mächtig, dem Zauberschwert konnte er aber doch nicht widerstehen, nach einigen Streichen hieb ihm der Jüngling den Kopf ab, und der Lindwurm fiel tot hin.
Nun sprengte der Jüngling den Weg hinan, den die Alte ihm gezeigt hatte. Er kam aber nicht weit, denn ein großmächtiger Riese ritt ihm entgegen, und rief mit lauter Stimme: »O, Kirchenfliege, was unterstehst du dich, in meinem Garten spazieren zu reiten.« Der Jüngling antwortete: »Ich bin gekommen, dich zu bekämpfen.« »Was! du willst mich bekämpfen?« rief der Riese mit höhnischem Lachen. »Du winzige Kirchenfliege!« »Ich bin so klein, und du so groß,« sprach der Jüngling, »aber im Namen Gottes will ich dich besiegen.« »Nun gut denn!« sagte der Riese, »so kämpfen wir.«
Da fingen sie an und kämpften eine lange Zeit, aber keiner von ihnen konnte den anderen besiegen. Der Riese aber, da er merkte, daß der Jüngling das Zauberschwert hatte, erkannte er wohl, daß er ihn durch Gewalt nicht würde besiegen können, und griff zu einer List. Wie die Alte es vorher gesagt hatte, ließ er seinen eisernen Handschuh fallen, und sprach: »Ich bin so groß, daß es mir schwer wird, vom Pferde zu steigen. So steige nun du ab und hole mir den Handschuh.«
»Habt ihr den Handschuh fallen lassen, so könnt ihr ihn auch selbst wieder holen,« antwortete der Jüngling. »Ach, tue mir doch den Gefallen, und steige vom Pferde,« bat der Riese. Der Jüngling aber gedachte der Worte der Alten und antwortete: »Wenn mir mein Handschuh gefallen wäre, so hätte ich ihn mir selbst geholt; nun steigt ihr auch selbst vom Pferde.« Da mußte der Riese sich bequemen und vom Pferd steigen, denn ohne seinen eisernen Handschuh verlor er alle Kraft.
Als er sich aber bückte, sprang der Jüngling hinzu, und hieb ihm mit einem Streich den Kopf ab, daß er weit weg flog. Nun untersuchte er schnell den Riesen, und als er richtig einen Bund Schlüssel und einen Bund Federn auf ihm fand, eilte er ins Haus, und machte den verschlossenen Schrank auf. In dem Schranke standen eine Menge Fläschchen mit Salben und Elixieren; da nahm er dasjenige mit der Salbe, die die Toten auferweckt, und lief zur schönen, toten Königstochter.
Aber als er eine Feder in die Salbe tauchte und ihr damit die Schläfen und die Nasenlöcher rieb, schlug sie auf einmal die Augen auf und war nun ganz lebendig und gesund. Da bestrich er auch ihre zwölf Mädchen mit der Salbe, und siehe da, sie wurden alle wieder lebendig. Und als er sich umsah, hatten sich auch die Bäume aufgerichtet, und die Blumen blühten im ganzen Garten, und alles, was zerstört gewesen, stand nun wieder ganz und herrlich da.
Da blieben sie noch einige Tage in dem schönen Garten, und dann nahm die Königstochter Abschied von ihren zwölf Mädchen, die in der Unterwelt zurück blieben. Der Jüngling und die Königstochter aber gingen zu dem Brunnen, um sich hinauf ziehen zu lassen. »Höre, Peppino,« sprach die Königstochter, »lasse dich zuerst hinauf ziehen, denn wenn ein fremder Soldat da oben steht, und ich komme zuerst hinauf, so wird er dich verraten und dich hier unten lassen.«
Peppino wollte anfangs nicht, da sie ihn aber so bat, so tat er ihr den Willen, band sich am Strick fest, und gab das Zeichen mit dem Glöckchen. Oben stand ein Soldat und hielt Wache; da der das Läuten hörte, dachte er: »Sollte wohl Jemand unten im Brunnen sein? Ich will einmal am Stricke ziehen.« Da zog er am Strick, und der Jüngling kam glücklich oben an, band sich los, und warf den Strick wieder hinunter.
»Ist denn noch Jemand unten?« frug der Soldat. »Jawohl,« antwortete der Jüngling, »hilf mir nur ziehen.« Als aber die wunderschöne Königstochter ans Licht kam, dachte der Soldat bei sich: »Wäre sie zuerst herauf gekommen, so hätte ich dich nimmer heraus gezogen!«
Der Jüngling brachte die Königstochter nun nach Hause zu seiner alten Mutter, die sich sehr freute, als sie ihren lieben Sohn wieder sah. »Was tun wir nun?« frug der Jüngling. »Soll ich dich gleich zu deinem Vater führen?« »Nein,« antwortete sie, »tue was ich dir sage. Geh heute Abend zu meinem Vater, um zu spielen. Wenn ihr nun eine Weile gespielt habt, so sprich zu ihm: 'Königliche Majestät, wir spielen hier jeden Abend, wie wäre es, wenn jeder zur Abwechselung eine Geschichte erzählte?' Gewiß wird dann mein Vater die Geschichte erzählen, wie ich geraubt worden bin. Dann frage ihn: 'Königliche Majestät, wenn euch Einer eure Tochter wieder brächte, welchen Lohn würdet ihr ihm geben?' Seine Antwort aber überbringe mir.«
Am Abend ging der Jüngling zu Hofe, und spielte mit dem König. Nach einer Weile aber sprach er: »Königliche Majestät, wir spielen nun schon den ganzen Abend; wie wäre es, wenn wir zur Abwechselung einmal eine Geschichte erzählten?« »Ach,« antwortete der König, »ihr anderen könnt wohl Geschichten erzählen; ich aber könnte euch nur ein trauriges Ereignis aus meinem Leben erzählen.« »Was ist denn das, königliche Majestät? Erzählt es uns doch.«
Da erzählte der König, wie vor so vielen Jahren seine einzige Tochter verschwunden sei, und wie er seit dem nichts wieder von ihr gehört habe. »Aber, sagt mir, königliche Majestät,« sprach darauf der Jüngling, »wenn euch nun Einer eure Tochter wieder brächte, welchen Lohn würdet ihr ihm wohl geben?« »Ach,« antwortete der König, »wenn mir Einer meine liebe Tochter wieder brächte, so sollte er sie zur Gemahlin erhalten und sollte nach mir König sein.«
Der Jüngling sagte nun nichts mehr, aber am anderen Morgen erzählte er alles der Königstochter; die sprach: »Gut, heute Abend erzähle dem König, du hast eine Schwester, und frage, ob du sie wohl einmal an den Hof bringen dürftest.«
Als nun der Jüngling am Abend wieder beim König war, sagte er so im Gespräch: »Königliche Majestät, ich habe zu Hause eine Schwester, die wirklich ein schönes Mädchen ist. Wenn ihr es erlaubt, so möchte ich sie wohl einmal mitbringen.«
»Tu das,« antwortete der König, »ich werde mich sehr freuen, sie zu sehen.« Der Jüngling überbrachte der Jungfrau die Antwort des Königs, und sie sprach: »Heute Abend werde ich dich begleiten.«
Als sie nun am Abend zu Hofe ging und in den Saal trat, war sie so schön, daß alle sie verwundert betrachteten. Der König aber ließ sie sich gegenüber sitzen, und während er spielte, schaute er immer zu ihr hinüber, und es war ihm, als müsse er sie kennen. »Seht dies schöne Mädchen an,« sprach er zu seinen Ministern, »gleicht sie nicht meiner verlorenen Tochter?« »Ach, was denkt ihr, königliche Majestät,« antworteten die Minister, »eure Tochter ist ja seit so vielen Jahren verschollen.«
Der König aber rief die Königin herbei und sprach: »Ach, seht doch das Mädchen an; gleicht es nicht unserer armen Tochter?« »Ja,« sprach die Königin, »es sind wohl die selben Züge.« Als aber die Königstochter sah, daß ihre Eltern sie so anschauten, konnte sie nicht länger an sich halten, und rief aus: »Lieber Vater und liebe Mutter, ich bin ja eure verloren gegangene Tochter!«
Denkt euch nun, wie alles in Aufruhr kam. Die Königin wurde vor Schrecken und Freude ohnmächtig, und man mußte ihr zu Hilfe eilen, und auch der König wußte sich nicht zu fassen. Endlich aber sprach er: »Wenn du unsere Tochter bist, so erzähle uns, wie es dir ergangen ist.« Da antwortete sie: »So und so ist es mir ergangen, und dieser Jüngling ist mein Retter, der mich aus der Gewalt des bösen Zauberers befreit hat.«
Als der König und die Königin das hörten, wurden sie sehr froh, und umarmten ihre Tochter und den Jüngling mit großer Freude, und der König sprach: »Du hast meine Tochter erlöst, und sollst sie nun zur Gemahlin haben, und nach mir König sein.«
Da wurde eine glänzende Hochzeit gehalten, mit vielen Festlichkeiten; und sie lebten glücklich und zufrieden, wir aber sind hier sitzen geblieben.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen

DIE ALTE ...

Es war einmal eine Alte, die fegte in dem Kirchlein und fand einen Heller am Boden. Den nahm sie und sagte: »Was kaufe ich mir jetzt dafür? Kaufe ich mir Äpfel, muß ich den Griebs fort werfen, wenn ich mir Nüsse kaufe, kann ich die Schalen nicht brauchen, und ebenso wenn ich mir Kastanien kaufe. Kaufe ich Brot oder Maisküchlein, fallen die Krumen herunter. Was also kaufe ich mir? ... Jetzt weiß ich es, ich werde mir rote und weiße Farben kaufen, mir mein Gesicht zu bemalen.«
So geschah es: die Alte kaufte sich Weiß und Rot, bemalte sich damit das Gesicht und schaute dann zum Fensterchen hinaus. Kommt ein Esel vorbei, der bleibt stehen und ruft: »Mütterchen, was machst du dort am Fenster?« - »Ich will mich verheiraten.« - »Willst du wohl mich zum Manne haben?« - »Laß mich erst hören, was für eine Stimme du hast.« - Und der Esel begann: »I-a, i-a, i-ah!« - »Mach, daß du fort kommst, vor dir würde ich mich des Nachts fürchten.« Der Esel ging weiter.
Kommt eine Ziege vorbei: »Mütterchen, was machst du dort am Fenster?« - »Ich will mich verheiraten.« - »Möchtest du wohl mich zum Manne haben?« - »Laß mich hören, was für eine Stimme du hast.« - »Meck, meck, meck, bäh!« - »Mach, daß du fort kommst, vor dir würde ich mich des Nachts fürchten!« Die Ziege ging weiter.
Kommt eine Katze gegangen: »Mütterchen, was machst du dort?« - »Ich will mich verheiraten.« - »Willst du mich etwa nehmen?« - »Laß hören, was für eine Stimme du hast.« - Die Katze begann: »Miau, miau, miau, miau!« - »Geh, pack dich, du ängstigst mich des Nachts mit deiner Stimme.« Die Katze entfloh.
So kamen nach und nach alle Tiere der Welt vorbei, doch keins gefiel dem Mütterchen. Ganz zuletzt kam auch die Maus. »Mütterchen, was machst du da?« - »Ich will mich verheiraten.« - »Möchtest du mich wohl nehmen?« - »Laß hören, was für eine Stimme du hast.« - Das Mäuschen machte: »Pip, pip, pip!« - »O komm herauf, deine Stimme gefällt mir!« Die Maus ging hinauf und blieb bei der Alten.
Tags darauf ging die Alte in die Messe. Sie ließ den Topf mit Essen am Feuer stehen und sagte zum Mäuschen: »Höre, daß du mir nicht etwa das Brötchen in die Brühe tunkst, könntest mir hinein fallen. Ich gehe jetzt in die Messe, komm aber bald zurück.« Das Mäuschen antwortete: »Geh nur ohne Sorgen, ich werde mich wohl hüten.« So ging das Mütterchen in die Messe.
Wie sie nach Hause kam, fand sie die Tür verschlossen. Sie rief: »Gevatter Maus! Gevatter Maus!« Die Maus antwortete nicht. Da drückte die Alte die Tür ein und trat in das Haus. Sie schaute hier hin und dort hin und überall herum, aber die Maus fand sie nicht. Sie blickte unter das Bett, und fand sie nicht. Sie blickte unter den Stuhl, und fand sie nicht - unter den Ofen, und fand sie nicht - in den Mörser, und fand sie nicht - in die Tischlade, und fand sie nicht.
Endlich wurde ihr die Sache zu arg und sie sagte: »Ach, Gevatter Maus will sich gewiß einen Scherz mit mir machen. Jetzt suche ich sie nicht mehr, sondern esse ruhig mein Süppchen; wenn sie dann Lust hat, wird sie schon hervor kommen.«
Wie sie die Suppe ausgießen wollte, fand sie die Maus im Topfe. »Ach, wehe mir!« schrie sie da, ließ die Suppe fallen und weinte bitterlich.
Als das die Asche auf dem Herde sah, stiebte sie hoch auf. Das Fenster fragte: »Warum stiebst du auf?« - »Ach, weißt du denn nicht, Gevatter Maus liegt im Topfe, das Mütterchen weint, und weil ich Asche bin, stiebe ich auf.« Antwortet das Fenster: »So will ich, weil ich ein Fenster bin, auf- und zu klappen.«
Das sah das Fenstergitter und fragte: »Fensterlein, warum klappst du auf und zu?« - »Das weißt du nicht? Gevatter Maus liegt im Topfe, das Mütterchen weint, die Asche stiebt auf, und weil ich ein Fenster bin, will ich auf- und zu klappen.« - »So?« antwortete das Fenstergitter. »Nun, weil ich ein Gitter bin, will ich zerbrechen.« Und es zerbrach.
Ein Vogel, der immer auf dem Baume saß, fragte: »Gitter, warum zerbrichst du denn?« - »Auch du weißt nichts? Gevatter Maus liegt im Topfe, Mütterchen weint, die Asche stiebt auf, das Fenster klappt auf und zu, und weil ich ein Gitter bin, wollte ich zerbrechen.« Antwortet der Vogel: »Weil ich ein Vogel bin, will ich mich rupfen.« Und er rupfte sich alle seine Federchen aus.
Als der Baum den gerupften Vogel sah, fragte er: »Warum rupftest du dich?« - »Ach, mein Lieber, du weißt nichts? Gevatter Maus liegt im Topfe, Mütterchen weint, die Asche stiebt auf, das Fenster klappt auf und zu, das Gitter zerbricht, und weil ich ein Vogel bin, hab ich mich gerupft.« - »So? Nun weil ich ein Baum bin, will ich alle meine Blätter abschütteln.« Und er schüttelte sie ab.
Kam eine Magd daher, Wasser zu holen, sie sah den Baum und fragte ihn, warum er blätterlos stehe. Der Baum erzählte ihr die ganze Geschichte und sprach: »Gevatter Maus liegt im Topfe, Mütterchen weint, die Asche stiebt auf, das Fenster klappt auf und zu, das Gitter zerbricht, der Vogel hat sich gerupft, und weil ich ein Baum bin, hab ich alle meine Blätter abgeschüttelt.«
Sagt die Magd: »Weil ich eine Magd bin, will ich gleich einmal meinen Eimer zerschlagen.« Darauf ging sie zu ihrer Herrin, und die fragt sie, ob sie Wasser geschöpft. Die Magd sagt: »Ach, Frau, Ihr kennt die Geschichte nicht? Gevatter Maus liegt im Topfe, Mütterchen weint, die Asche stiebt auf, das Fenster klappt auf und zu, das Gitter zerbricht, der Vogel hat sich gerupft, der Baum seine Blätter abgeschüttelt, und weil ich die Magd bin, hab ich den Eimer zerschlagen.«
Die Frau, welche eben das Mehl in den Trog getan, um Brot zu backen, sagt: »So will ich, weil ich eine Herrin bin, das Mehl zum Fenster hinaus schütten.« Der Herr kam nach Hause und fragte, ob das Brot gebacken sei; sie antwortete: »Mann, weißt du denn gar nicht, was da geschehen ist? Gevatter Maus liegt im Topfe, Mütterchen weint, die Asche stiebt auf, das Fenster klappt auf und zu, das Gitter zerbricht, der Vogel hat sich gerupft, der Baum seine Blätter abgeschüttelt, die Magd hat den Eimer zerschlagen, und ich, weil ich die Herrin bin, hab das Mehl zum Fenster hinausgeschüttet.«
Da antwortet der Herr: »Ei so will ich, weil ich der Herr bin, euch ganz gehörig den Buckel versalzen!« Er nahm einen Stock, und was hast du, was kannst du! gab er erst der Magd und dann der Frau eine tüchtige Tracht Prügel.
Italien: Waldemar Kaden: Unter den Olivenbäumen. Süditalienische Volksmärchen
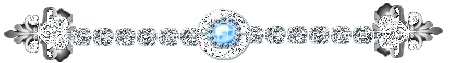
VOM SCHLAF ...

In der Provinz Genua lebte eine Witwe, die drei Söhne hatte, Francesco, Tonino und Angiolino. Angiolino wollte immer schlafen, nicht nur die Nacht, sondern auch den ganzen Tag. Die Brüder fingen an, die Mutter zu tadeln, in dem sie sagten: »Mutter, es kann nicht so fort gehen mit unserem Bruder. Also überlegt, was man tun kann, denn wir sind sehr erzürnt gegen ihn.« -
Die Mutter, die wie alle Mütter nachsichtig gegen ihre Söhne war, sagte: »Liebe Kinder, ich kann ihn nicht verstoßen, da er mein Sohn ist, so gut wie ihr. Versuchen wir, ihn zu verheiraten, dann wird er aufwachen.« - Die Brüder waren einverstanden, und Angiolino nimmt eine Frau. Am Morgen nach der Hochzeit wollte die Frau aufstehen, er aber sagte: »Was tust du?« - Und Carolina sagte: »Ich will aufstehen, damit deine Brüder nicht schelten können.« - »Nein, solange ich nicht aufstehe, hast du dich nicht von hier zu rühren.« -
Die Brüder aber warteten, daß sie aufstehen sollten, aber sie mußten lange warten, denn vor der Essensstunde erschienen sie nicht im Saal. Da wurden die Brüder zornig und sagten zur Mutter: »Früher war er allein, jetzt sind sie zu zweien. Wir wollen nun unser Erbe teilen.« -
Und so beschlossen sie, ihn fort zu schicken. Angiolino und Carolina nahmen ihre Habe und zogen fort nach der Hauptstadt des Reiches. In kurzem aber hatten sie alles, was sie besaßen, aufgezehrt und waren genötigt, sich in ein kleines Dorf zurück zu ziehen, das an einem Flüßchen lag.
Eines Tages, da sie nichts zu essen hatten, sagte Angiolino zu Carolina: »Der Hunger hat mir auch den Schlaf vertrieben. Ich habe aber nachgesonnen. Da unten im Fluss gibt es Fische. Ich will da fischen, um zu sehen, ob ich Glück habe.« - Damit nahm er das Netz und ging.
Als er am Fluss war, warf er das Netz aus und zog. - »O Gott!« rief er, »was ist das für ein Fisch!« - Er kehrte geschwind nach Haus zurück und rief: »Sieh nur, Carolina, was für einen Fisch ich gefangen habe!« - Voller Freude erwiderte Carolina: »Wir wollen ihn gleich verkaufen; dann können wir für eine Weile Eßvorräte kaufen, denn er ist ein solches Wundertier, daß kein Mensch je einen ähnlichen gesehen haben kann.« -
»Nein,« antwortete Angiolino der Frau, »ich will gehen und ihn dem König zum Geschenk machen.« - Und so gingen sie beide nach der Stadt. Als sie am Tor angelangt waren, riet die Frau wieder, ihn zu verkaufen, und sagte, dann könne man sich rascher den Schlaf vertreiben, als wenn man zum König ginge. -
»Aber ich habe nun einmal beschlossen, ihn ihm zu bringen, und will ihn nicht verkaufen.« - Und die liebe Gattin mußte mit trocknem Mund vor dem Tor bleiben. Als Angiolino aber beim ersten Eingang des Palastes angelangt war und dort die erste Schildwache gefunden hatte, fragte ihn diese: »Wohin gehst du und was willst du?« -
»Ich will zum König und ihm dies Geschenk bringen. Darf man?« - Die Schildwache antwortete: »Wenn du mir die Hälfte der Belohnung geben willst, will ich dich einlassen. Wo nicht, kannst du dahin zurück kehren, von wo du gekommen bist.« - Da dachte Angiolino, von seiner Schlafsucht befallen, da er Nachts zuvor nicht genug geschlafen hatte, nicht an die Tücken des schändlichen Soldaten, sondern bewilligte es und ging weiter.
Als er dann auf die Höhe der gewundenen Treppe gekommen war, fand er eine andere Wache. Auch diese fragte ihn, was er beim König wolle, und er antwortete wieder: »Ich will ihm ein Geschenk machen. Sieh hier, ich habe einen Fisch gefangen, dessen nur er würdig ist.« -
»Wie? eine solche Seltenheit ist er?« - »Jawohl!« - »Aber wenn du mir nicht die Hälfte der Belohnung, die er dir geben wird, abtrittst, laß ich dich nicht weiter vor dringen.« - Angiolino bewilligte auch das und ging weiter. Als er dann in den Vorsaal gekommen war, fragte ihn dort gleich die dritte Schildwache, was er wolle.
Er antwortete: »Ich will mit dem Könige sprechen.« - Der Soldat aber, dem schon die erste Schildwache einen Wink gegeben hatte, fing gleich von dem Anteil an dem Gelde an zu sprechen, das der König ihm geben werde. Inzwischen hatte sich Angiolino schon überlegt, was er tun wollte, bewilligte alles und ließ sich beim König melden.
Sofort wurde er eingelassen. Als er dann vor Seiner Majestät stand, überreichte er ihm das Wundertier, und der König rief beim Anblick des Fisches: »Wo in aller Welt hast du ihn gefangen?« - Dann wurde die Königin gerufen, damit auch sie ihn sehen sollte, und der König fragte sie: »Sage mir, was soll ich ihm zur Belohnung geben für ein so großes Geschenk?« - »Man kann ihm jetzt hundert Scudi geben und später für ihn sorgen.«
Angiolino überlegte bei sich und antwortete dann: »Dies Geschenk nehme ich nicht an.« - »Oho! Was willst Du also?« - »Ich will hundert Hiebe mit einem Lederriemen.« - »Wie? Bist du verrückt oder stellst dich so?« - Da sagte die Königin: »Gib ihm hundert Scudi und schicke den Dummkopf weg!« -
»Ich habe schon gesagt, daß ich hundert Peitschenhiebe will,« sagte Angiolino, »oder um es besser zu sagen: hundert Hiebe mit dem Ochsenziemer.« - »Nun,« sagte der König, »wenn du sie durchaus willst, sollst du sie bekommen.« - Er ließ vier Soldaten kommen und befahl ihnen, alles Nötige vorzubereiten, um ihm die Schläge im Saal zu geben, damit alle es mit ansehen könnten, ohne von den Stühlen aufzustehen.
In einem Augenblick war alles herbei gebracht, und alle riefen: »Dieser Mensch ist verrückt!« - Der König aber sagte: »Nehmt ihn und gebt ihm hundert Hiebe!« - »Ja, das ist recht,« sagte Angiolino, »ich bitte aber noch um eine Gnade.« - »Was für eine Gnade willst du?« - »Sie sollen die erste Schildwache rufen lassen.«
Sogleich wurde sie gerufen, und in ihrer Gegenwart wurde Angiolino gefragt, was er von ihr wolle. - »Ich will,« antwortete er, »daß dieser Schurke die Hälfte von der Belohnung erhält, die Eure Majestät mir geben will. Da ich sie angenommen habe, ist es gerecht daß er die Hälfte bekommt.«
Alle Zuschauer verwunderten sich, als sie aber die Tatsache erfahren hatten, wurde die Schildwache hin gelegt und erhielt zu ihrer Schande fünfzig Hiebe und bei jedem Schlage sprang er wie ein Böcklein. Nachdem dieser bedient war, ließ Angiolino die zweite Schildwache kommen und sagte: »Auch dieser Schuft wollte mich zurück schicken, wenn ich ihm nicht ein Viertel der Belohnung versprach.
Er soll fünfundzwanzig bekommen.« - Und so geschah es. - »Auch der aus dem Vorsaal muß belohnt werden!« - Dieser zitterte wie ein Rohr, denn er hatte gehört, was vorgegangen war, plötzlich aber wurde er gerufen und empfing seine Belohnung wie die anderen.
Dann sagte der König: »Nun bleiben noch zwölf für dich.« - »Ja, es ist gerecht,« antwortete Angiolino, »aber ich will sehen, ob ich einen finde, der sie mir abkauft.« - Damit ging er weg, und als er durch verschiedene Straßen der Stadt gewandelt war, fand er einen Laden, wo man diese ledernen Peitschen verkaufte.
Was kosten sie?« fragte er. - »Zwölf Paoli eine.« - »Ich habe zwölf vom Könige,« sagte Angiolino. »Ich gebe sie Euch für drei Paoli.« - »Ich nehme sie.« - »Aber Ihr müßt mit mir kommen.«
Als sie in den Saal gekommen waren, sagte Angiolino: »Das ist der Mann, der die Lederriemen gekauft hat.« - Der König lächelte und sagte: »Du bist also der, der sie gekauft hat?« - »Ja, Euer Majestät.« - »Und für wie viel?« - »Drei Paoli.« - Da sagte der König, sie sollten ihm die zwölf Hiebe geben. Er aber rief: »Ich habe die Riemen gekauft, nicht die Schläge!« -
Er hatte aber einmal gesagt, daß er sie gekauft habe, und nun half nichts, er mußte sie empfangen und bezahlen. Alle, die Zuschauer gewesen waren, stimmten darin überein, dem Angiolino und seiner Frau sollten zur Belohnung täglich fünf Lire gezahlt werden, und damit sollten sie fröhlich nach Hause gehen.
Das geschah denn auch, und sie luden die Mutter und die Brüder ein und genossen alle ein friedliches Leben.
Italien: Paul Heyse: Italienische Volksmärchen

VON DEM MUTIGEN MÄDCHEN ...

Es waren einmal drei Schwestern, die hatten weder Vater noch Mutter, und ernährten sich kümmerlich durch spinnen. Jeden Tag spannen sie zusammen ein Rottolo Flachs, den brachten sie ihrer Herrschaft, und bekamen zwei Tari dafür, davon mußten sie leben.
Nun begab es sich eines Tages, daß sie eine große Sehnsucht nach einem Stückchen Leber bekamen. »Wißt ihr was?« sprach die älteste Schwester zu den beiden anderen, »heute ist an mir die Reihe, das Gespinnst zur Padrona zu tragen; wenn sie mir nun das Geld gibt, so will ich etwas Leber, etwas Brot und Wein kaufen, daß wir uns auch einmal einen vergnügten Tag machen.« »Gut,« antworteten die Schwestern.
Am Abend ging die älteste Schwester mit dem Gespinnst zur Stadt, und als ihr die Padrona das Geld gegeben hatte, kaufte sie ein Stück Leber, etwas Brot und Wein, legte alles fein säuberlich in ihr Körbchen und machte sich auf den Weg nach Haus.
Als sie nun durch eine einsame Gasse kam, fiel ihr das Körbchen aus der Hand. Sogleich sprang ein Hund hervor, ergriff das ganze Körbchen und lief damit davon. Sie lief ihm nach, konnte ihn aber nicht erreichen und mußte endlich ohne Körbchen und ohne Lebensmittel nach Hause gehen. »Bringst du gar nichts mit?« frugen sie die Schwestern. »Ach, liebe Schwestern,« antwortete sie, »was kann ich dafür? So und so ist es mir ergangen.«
Den nächsten Abend mußte die zweite Schwester zur Padrona gehen, und sagte: »Heute will ich die Leber mit bringen.« Als sie nun das Geld empfangen hatte, kaufte sie etwas Leber, Brot und Wein, packte es in ihr Körbchen und ging nach Hause. In einer einsamen Gasse fiel aber auch ihr das Körbchen aus der Hand, der Hund sprang hervor und lief mit ihrem Körbchen davon, so schnell, daß sie ihn nicht einholen konnte.
Als sie nun nach Hause kam und ihren Schwestern alles erzählte, sprach die Jüngste: »Morgen will ich einmal gehen, und mir soll der Hund gewiß nicht entwischen.« Also ging sie am nächsten Abend mit dem Gespinnst zur Padrona, nahm das Geld in Empfang und kaufte dafür die Leber, das Brot und den Wein. Als sie nun in die Gasse kam, entfiel das Körbchen ihrer Hand. So gleich stürzte der Hund hervor, ergriff es und sprang fort.
Sie aber war leichtfüßiger als ihre Schwestern, und so schnell er auch laufen mochte, sie lief ihm nach, und verlor ihn nicht aus dem Gesicht. Der Hund lief durch viele Straßen und schlüpfte endlich in ein Haus, das Mädchen aber schlüpfte ihm nach. Sie ging die Treppe hinauf und rief, aber niemand antwortete ihr. Nun ging sie durch alle Zimmer und sah die herrlichsten Sachen; in dem einen Saal einen schön gedeckten Tisch, in einem anderen gute Betten, in einem dritten Schätze und Kostbarkeiten, einen Menschen aber sah sie nicht.
Da kam sie auch in ein kleines Zimmer, da saß der Hund am Boden und hatte die drei Körbe vor sich, sie dachte aber nicht mehr an die Körbe, als sie alle die Kostbarkeiten sah. Als sie weiter ging, kam sie endlich in einen Saal, wo Schätze ohne Zahl aufgespeichert waren, Schubladen und Kistchen voll Edelsteine und am Boden ganze Säcke mit Goldstücken. Da nahm sie einen kleinen Sack voll Goldstücke, verließ das Schloß und ging damit nach Haus.
»Liebe Schwestern,« rief sie voll Freude, »jetzt kehrt der Überfluß bei uns ein, seht was ich euch mitbringe.« Da die beiden Schwestern den Sack voll Goldmünzen sahen, freuten sie sich sehr, die Jüngste aber sprach: »Liebe Schwestern, unsere Habe wollen wir alle den Armen geben und unser Häuschen leer stehen lassen. Das Gold aber wollen wir hier vergraben, und dann zusammen in das Schloß gehen und sehen, was es damit für eine Bewandtnis hat. Wenn es uns dort schlecht gehen sollte, so bleibt uns ja immer das Gold, das wir hier zurück lassen.«
So taten sie denn auch, schenkten all ihr Hab und Gut den Armen, vergruben ihr Gold in dem leeren Hause, und gingen dann alle drei in das geheimnisvolle Schloß. In dem ersten Saale fanden sie noch den schön gedeckten Tisch, setzten sich und aßen und tranken nach Herzenslust, und beschauten dann alle die Schätze und Herrlichkeiten, die in dem Hause aufgespeichert waren.
Als es Abend wurde, sprach die jüngste Schwester zur ältesten: »Wir können uns nicht alle schlafen legen, denn es könnte uns ein Unglück begegnen. Deshalb ist es am besten, wenn du diese erste Nacht wachst, während wir beide schlafen.« Also legten sich die Jüngeren schlafen, die Älteste aber wachte.
Um Mitternacht hörte sie auf einmal einen lauten Schrei, der durch das ganze Haus schallte. »Wart! ich komme herauf!« rief es mit drohender Stimme. Da erschrak sie so, daß sie schnell ins Bett schlüpfte und die Decke über die Ohren zog. Darauf wurde alles still. Den nächsten Morgen frugen die beiden anderen: »Hast du heute Nacht nichts gehört oder gesehen?« Sie aber antwortete: »Gar nichts, es blieb alles ruhig.«
Am nächsten Abend mußte die zweite Schwester wachen, und die beiden anderen legten sich schlafen. Um Mitternacht aber rief es wieder mit drohender Stimme: »Wart! ich komme herauf!« Da erschrak sie, kroch schnell ins Bett und zog die Decke über den Kopf. Nun wurde alles wieder still. Am Morgen frugen sie die beiden anderen, ob sie nichts gesehen oder gehört habe. Da antwortete sie: »Nein, gar nichts, es blieb alles ruhig.«
Zur ältesten Schwester aber sprach sie im Vertrauen: »Hast du auch diesen entsetzlichen Schrei gehört?« »Ja freilich, sei nur stille. Haben wir den Schrecken gehabt, so kann es unsere jüngste Schwester auch durch machen.« Am Abend legten sich die beiden älteren Schwestern schlafen, die Jüngste aber wachte.
Um Mitternacht ertönte auf einmal der selbe Schrei. »Wart! Ich komme herauf!« »Wie es euch beliebt!« antwortete sie. Da ging die Türe auf, und eine große schöne Gestalt trat herein, mit einem langen schwarzen Gewand und einer langen Schleppe. Die ging auf sie zu und sprach: »Ich sehe, daß du ein mutiges Mädchen bist; wenn du auch ferner denselben Mut zeigst, und alles genau tust, was ich dir sage, so soll dieser Palast mit allem was darinnen ist dir angehören, und du sollst eine Fürstin sein, wie ich eine gewesen bin.«
»Edle Frau,« erwiderte das Mädchen, »sagt mir, was ich tun soll, so will ich es alles vollbringen.« »Sieh,« antwortete die Gestalt, »ich bin eine Fürstin, und kann in meinem Grabe keine Ruhe finden; denn der Jenige, der mich ermordet hat, geht noch ungestraft umher. Du sollst mir nun zu meiner Ruhe verhelfen. In jenem Schrank sind viele schöne Kleider; eines davon mußt du morgen anziehen, und dich damit auf den Balkon stellen.
Gegen Mittag wird ein Edelmann vorbei kommen und dich anreden, denn weil du mein Kleid trägst, wird er dich für mich halten. Antworte ihm freundlich und lade ihn ein herauf zu kommen. Wenn er nun bei dir ist, so halte ihn mit höflichen Gesprächen fest, bis es Abend wird und dann lade ihn ein, mit dir zu essen.
Nimm diese beiden Flaschen, in der einen ist Wein, in der anderen ein Schlaftrunk; beim Essen mußt du ihm aus der zweiten Flasche einschenken, und wenn er eingeschlafen ist, so schneide ihn mit diesem Messerchen die Halsadern auf, daß er in seinen Sünden sterbe. Denn so wie ich keine Ruhe finden kann, soll auch er im anderen Leben keine Seligkeit genießen.« Mit diesen Worten verschwand die schwarze Gestalt, und das Mädchen blieb allein.
Am nächsten Morgen legte sie ein prächtiges, reiches Gewand an, und stellte sich auf den Balkon. Gegen Mittag ging ein vornehmer Herr vorbei, und da er sie am Fenster stehen sah, redete er sie an: »Ei! edle Frau, seid ihr nun genesen? Ihr wart ja lange krank.« »Ja wohl, edler Herr, aber ich bin nun wieder wohl. Wollt ihr mir nicht die Ehre erweisen, herauf zu kommen?«
Da kam der Edelmann herauf, und als er die beiden Schwestern sah, frug er, wer sie seien. »Meine Mägde,« antwortete sie, und mit vielen Höflichkeiten hielt sie den Edelmann hin, bis es Abend war. »Kann ich nun auch die Ehre haben, euch bei mir zum Nachtessen zu sehen?« sagte sie, und der Edelmann blieb bei ihr.
Während des Essens aber reichte sie ihm die Flasche mit dem Schlaftrunk, und kaum hatte er ein wenig davon getrunken, so versank er in einen tiefen Schlaf. Da nahm sie das Messerchen, und schnitt ihm die Halsadern auf, daß er in seinen Sünden starb, ohne Beichte und ohne Absolution; dann rief sie ihre Schwestern, und alle drei schleppten ihn an einen tiefen Brunnen, und warfen ihn hinein.
Um Mitternacht aber ging auf einmal wieder die Türe auf, die schwarze Gestalt trat herein, und sprach zu der Jüngsten: »Du hast mich durch deinen Mut erlöst, und nun sollen auch alle diese Schätze dir gehören. Lebe wohl, heute bin ich zum letzten Mal gekommen, denn nun habe ich Ruhe gefunden.« Damit verschwand sie und kam nie wieder.
Die drei Schwestern aber blieben in dem wunderschönen Palast, und heirateten jede einen vornehmen Herrn, und so blieben sie glücklich und zufrieden, wir aber haben das Nachsehen.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
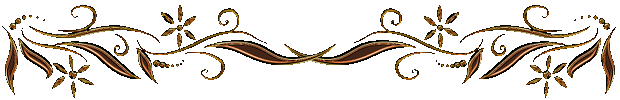
VOM SPADÒNIA ...

Es war einmal ein König, der war fromm und gottesfürchtig, und hatte eine besondere Verehrung für die heiligen Seelen im Fegefeuer. Um ihnen nun etwas Gutes zu erweisen, ließ er jeden Morgen einen großen Backofen voll frischen Brotes backen; der Herr aber sandte ihm jeden Morgen ein Eselchen mit zwei Körben aus Bast, da rein packte der König das Brot, und das Eselchen brachte es zu den heiligen Seelen im Fegefeuer.
Als aber seine Zeit um war, wurde der König krank, und da er fühlte, daß es mit ihm zum Sterben ging, rief er seinen einzigen Sohn Spadònia herbei und sprach zu ihm: »Lieber Sohn, ich muß nun sterben, versprich mir, daß du dasselbe tun willst, was ich so lange getan habe. Jeden Morgen mußt du das Brot für die armen Seelen im Fegefeuer backen lassen, und es dem Eselchen aufladen.«
Spadònia versprach alles, und der König starb; der Sohn aber ließ auch ferner jeden Morgen das Brot backen, und der Herr sandte ihm das Eselchen, und er schickte mit dem selben das Brot zu den armen Seelen im Fegefeuer.
Eines Tages aber dachte Spadònia: »Hier lade ich nun schon seit so langer Zeit dem Eselchen das Brot auf, und weiß doch eigentlich nicht, ob ich damit etwas Gutes oder Schlimmes tue«. Also rief er seinen vertrauten Diener herbei, und sprach zu ihm: »
Peppe, du mußt mir einen Dienst leisten. Morgen früh, wenn das Eselchen kommt, mußt du dich darauf setzen, und hin reiten, wo es dich hin bringt, um zu erfahren, ob ich etwas Gutes oder etwas Schlimmes damit tue, daß ich jeden Morgen das Brot backen lasse. Am anderen Morgen, wenn es dann wieder kommt, kehrst auch du zurück, und erzählst mir alles, was du gesehen und gehört hast.«
Am nächsten Morgen, als das Eselchen kam, um das Brot in Empfang zu nehmen, setzte sich der Diener auf und ritt, wohin das Eselchen ihn trug. Auf dem Wege kam er zuerst an ein klares Wasser, das floß so rein und hell, daß es eine Freude war. Er ritt darüber, und bald kam er an einen Strom, der floß von lauter Milch. Wieder nach einem Weilchen kam er an einen anderen Strom, der floß von lauter Blut.
Als er noch ein wenig weiter geritten war, sah er ein schönes, grünes Stück Land, auf dem das prächtigste Gras wuchs; die Ochsen aber, die darauf weideten, waren mager und armselig. Gleich darauf aber kam er an ein anderes Stück Land, auf dem wuchs nur spärlich etwas schlechtes, verdorrtes Gras, die Ochsen aber, die darauf weideten, waren prächtige und fette Tiere.
Endlich kam er an einen Wald, darinnen standen viele Bäume, kleine und große, alle durcheinander. Ein schöner Jüngling aber stand mitten dazwischen, und hieb mit einer blanken Axt die Bäume um, bald einen großen, bald einen kleinen, und mit jedem Streich fiel ein Baum. Als er nun noch ein Weilchen geritten war, kam er an ein großes Tor, das öffnete sich vor ihm, und das Eselchen ging hinein.
Da sah der Diener den heiligen Joseph und den heiligen Petrus und alle die lieben Heiligen, und unter ihnen den ewigen Vater. Und er sprach zu ihm: »Ach, ewiger Vater, mein Herr hat mich her gesandt, und möchte gern wissen, ob er etwas Gutes oder etwas Schlimmes tut, in dem er jeden Morgen dem Eselchen das Brot auflädt.«
»Geh nur weiter,« antwortete der ewige Vater, »du wirst deine Antwort bekommen.« Da ritt der Knecht weiter, und sah viele Heilige, und unter ihnen auch den König und die Königin, die Eltern des Spadònia. Die riefen ihn und sprachen: »O, Peppe! bist du es? Wie kommst du denn hier her?« »Euer Sohn hat mich her gesandt,« antwortete Peppe, »und möchte gerne wissen, ob er etwas Gutes oder etwas Schlimmes damit tut, daß er jeden Morgen das Brot backen läßt.«
»Hab ich es ihm nicht befohlen?« sprach der König: »jedoch reite nur weiter, du wirst deine Antwort bekommen.« So ritt der Diener weiter, und kam endlich zu unserm Heiland, der saß mit der schönen Mutter auf einem Thron, und das war der Höchste und Schönste im Himmelreich. Da kniete Peppe nieder und sprach: »O, lieber Heiland, mein Herr hat mich her gesandt, und möchte gerne wissen, ob er etwas Gutes oder etwas Schlimmes damit tut, daß er jeden Morgen dem Eselchen das Brot mitgibt.«
Der Heiland antwortete: »Er tut etwas Gutes, denn er erweist ja den armen Seelen im Fegefeuer eine Wohltat. Sage deinem Herrn auch, er solle nun heiraten; ich befehle ihm aber, ein Mädchen zur Frau zu nehmen, welches Sècula heißt. Und wenn er verheiratet ist, soll er ein Wirtshaus bauen, und darin soll jeder so lange umsonst essen und wohnen dürfen, als es ihm beliebt. Empfange nun auch noch einen heiligen Segen, für ihn und für dich.«
»Ach, Herr Jesus Christus,« sprach der Diener, »wollt mir noch eine Frage erlauben; auf dem Wege hier her kam ich an einem klaren Wasser vorbei, was war das?« »Das waren alle die Wohltaten der Menschen, die den armen Seelen im Fegefeuer zu Gute kommen und sie erfrischen.«
»Dann kam ich auch an einen Strom, der floß von lauter Milch,« frug Peppe weiter, »ach Herr, sagt mir doch an, was war das?« »Das ist die Milch, mit der die schöne Mutter das Christuskind genährt hat.« »Dann kam ich auch an einen Strom, der von lauter Blut floß, was war das?« »Das ist das Blut, das ich für euch Sünder vergossen habe.«
»Ach, Herr, beantwortet mir noch eine Frage. Nach dem Blutstrom sah ich ein prächtiges Stück Land, darauf weideten gar magere und armselige Ochsen?« »Das sind die Wucherer, die Gut und Blut der Armen aussaugen, und doch niemals genug haben.«
»Dann sah ich auch ein andres Stück Land, das war das gerade Gegenteil vom ersten, denn der Boden war nur mit schlechtem Gras bedeckt; die Ochsen aber, die darauf weideten, waren fett und wohl genährt?« »Das sind die Armen, die nur wenige und schlechte Nahrung haben können; aber sie vertrauen auf Gott, und Gott gesegnet es ihnen, daß sie dabei gedeihen.«
»Endlich sah ich auch einen schönen Jüngling, der mit einer blanken Axt in einem Walde stand und die Bäume um hieb, bald große, bald kleine, was war das wohl?« »Das ist der Tod, der ohne Unterschied die Jungen und die Alten abruft, wenn ihre Zeit gekommen ist. Hast du noch etwas zu fragen?« »Nein,« antwortete der Diener, und der Herr segnete ihn noch einmal, und so ritt er wieder zu seinem Gebieter zurück.
Als Spadònia ihn kommen sah, rief er: »Nun, was hast du gesehen?« Da erzählte ihm der Diener alles, was er gesehen hatte, und was der Herr zu ihm gesagt hatte. Nun wollte Spadònia zwar nicht gern heiraten, weil es ihm aber der Herr geboten hatte, ließ er im ganzen Land verkünden, wo ein Mädchen mit Namen Sècula sei, das solle kommen, denn er werde es zu seiner Gemahlin machen.
Es meldete sich aber kein einziges Mädchen. »Ach,« dachte Spadònia, »unser Herr hat doch eigene Launen, machte sich aber doch auf den Weg und ritt durch die ganze Welt, um das Mädchen zu suchen, und so oft er in eine Stadt kam, schickte er einen Burschen durch alle Straßen, der mußte mit lauter Stimme rufen: 'Wo ein Mädchen Sècula heiße, das soll sich melden, denn der König wird es zu seiner Gemahlin erheben!'« Es war aber alles umsonst, Spadònia konnte keine Sècula finden.
Als er nun die ganze Welt vergebens durchreist hatte, ward er sehr traurig und dachte: »Ach, Herr, welch schweres Kreuz habt ihr mir auferlegt! Und nun muß ich erst noch unverrichteter Sache heimkehren. Doch seht mich gnädig an, o Herr, denn an gutem Willen hat es mir nicht gefehlt.«
Da machte er sich traurig auf den Weg nach Haus, und als er ein Stück geritten war, kam er an einen kleinen Brunnen, und weil er so durstig war, stieg er ab um zu trinken. Am Brunnen aber standen viele arme Mädchen mit elenden Röckchen, die füllten ihre Krüge.
Wie aber Spadònia noch bei ihnen stand, rief auf einmal eine Stimme: »O! Sècula!« Da schaute er sich um, und sah von Weitem ein altes Männchen mit einer alten Frau stehen, die riefen wieder: »O! Sècula!« »Ich komme!« antwortete eines von den Mädchen. »Heißt ihr Sècula?« frug Spadònia das Mädchen. »Jawohl, edler Herr!« »O, Herr, ich danke dir,« sagte Spadònia, »und ihr, schöne Sècula, müßt mir nun folgen, denn ihr sollt meine Gemahlin werden.«
Mit diesen Worten setzte er sie vor sich aufs Pferd, und ritt zu den beiden Alten, die ihre Eltern waren, und sprach auch zu ihnen: »Eure Tochter soll meine Gemahlin werden, und ihr sollt mit mir ziehen, und bei mir bleiben, so lange ihr lebt.«
Denkt euch nun die Freude der armen alten Leute, da sie ihre Tochter so wohl versorgt sahen! Da nahm sie Spadònia alle mit in sein Reich und heiratete die schöne Sècula. Nach der Hochzeit aber ließ er ein Wirtshaus einrichten, und davor stand den ganzen Tag ein Mann, der mußte jeden Vorübergehenden zurufen: »In diesem Wirtshaus kann ein jeder umsonst essen und wohnen, so lange es ihm gefällt.« Und immer war das Wirtshaus voll.
Als nun einige Zeit vergangen war, sprach eines Tages unser Heiland zu den zwölf Aposteln: »Wir wollen uns aufmachen und in das Wirtshaus gehen, das Spadònia eingerichtet hat.« Da machte sich der Heiland mit den zwölf Aposteln auf und kam in das Wirtshaus. Nun waren aber in dem Wirtshaus gerade alle Lebensmittel ausgegangen, und auch nicht ein Stückchen Brot war da.
Die Wirtsleute aber sandten sogleich zu Spadònia und ließen ihm sagen: »Es sind zwölf Reisende angekommen, und alle Lebensmittel sind ausgegangen. Wollt uns etwas schicken.« Da schickte Spadònia sogleich die besten Lebensmittel und alles was nötig war. Sècula aber sprach zu ihm: »Lieber Mann, es ist mir so eigentümlich zu Mute. Ich möchte wohl hingehen, und diese Reisenden selbst sehen.«
Da gingen sie Beide zum Wirtshaus, und fanden den Herrn mit den zwölf Aposteln zu Tische sitzen. »Ach sieh, Spadònia, wie ist der Greis so schön!« sprach Sècula, und zeigte auf unsern Herrn. »Wir wollen ihn selbst bedienen.« Also dienten sie dem Heiland und den zwölf Aposteln, und als sie zu Bette gehen wollten, brachte Sècula dem Herrn noch ein Kissen aus ihrem eignen Bett, damit er weicher liegen sollte.
Am Morgen wollte sie ihm auch noch etwas Reisegeld auf den Weg mit geben, der Herr aber schlug es aus, und sprach: »Tut anderen Armen damit etwas Gutes, ich brauche es nicht.« Als aber der Heiland und die zwölf Apostel fort waren, und Sècula an das Bett trat, in welchem der Herr gelegen hatte, sah sie auf dem Leintuch das Bild eines Crucifixes abgedrückt.
Da fiel sie auf die Knie, und rief auch Spadònia herbei, und sprach: »Sieh, den wir beherbergt haben, ist der Herr gewesen. Nun wollen wir aber eilen, daß wir ihn noch einholen und seinen Segen erflehen.« Wie sie nun mit Spadònia aus dem Hause trat, sandte der Herr einen Sturm und Regen, daß alle erschrocken zurück fuhren.
Sècula aber ließ sich in ihrem Glauben nicht irre machen, sondern sprach: »Spadònia, trotz Sturm und Regen müssen wir dem Herrn nach eilen.« Da machte sich Spadònia mit ihr auf den Weg, und sie liefen durch den Regen, so gut sie konnten, bis sie den Herrn eingeholt hatten.
Als sie ihn von Weitem sahen, rief Sècula: »O, Herr, haltet ein und wartet einen Augenblick auf uns.« Da blieb der Herr stehen, und als Spadònia und Sècula sich zu seinen Füßen warfen, sprach er: »Was verlangt ihr von mir?« Spadònia antwortete: »Herr, wir bitten euch um die Vergebung unserer Sünden und um die ewige Seligkeit für uns und all die Unsrigen.«
»Das sei euch gewährt!« sprach der Herr. »Wann aber werdet ihr uns zu euch rufen?« frug Spadònia. Der Herr antwortete: »Haltet euch alle am heiligen Weihnachtsabend bereit; dann werde ich kommen, und euch an meine Tafel führen.« Damit segnete er sie und verschwand vor ihren Blicken.
Spadònia und Sècula aber kehrten in ihr Haus zurück, und gaben all ihr Hab und Gut den Armen, und als der heilige Weihnachtsabend kam, beichteten sie und nahmen das Abendmahl, Spadònia und Sècula, und ihre alten Eltern. Und wie sie so einträchtig bei einander saßen, verschieden sie, und ihre Seelen flogen zum Himmel, und Gott möge uns die Gnade erweisen, uns auch zu sich zu nehmen, wenn unsere Stunde kommt.
Italien: Laura Gonzenbach: Sicilianische Märchen
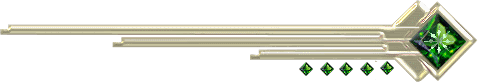
DER VERSCHWENDER ...
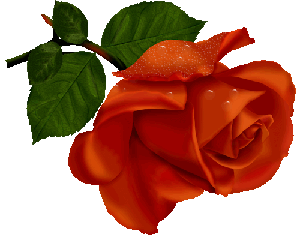
Joseph, welcher sein ganzes Vermögen mit seinen Freunden durch gebracht hatte, geht mit dem Teufel einen Vertrag ein, kraft dessen ihm dieser die Taschen immer voll Geld zu erhalten verspricht, wenn er sich dagegen verpflichtet, während zwei Jahren Haar und Bart sich wachsen zu lassen und die selben Kleider zu tragen.
Obwohl Joseph nun Geld hat, wollen seine Freunde doch nichts mehr mit ihm zu tun haben, da er ihnen zu schmutzig wird. Er ersucht also einen Wirt, welcher, wie später andere auch, bald vom ersten Schrecken über das wilde Aussehen des Jünglings zurück kommt, ihm den Aufenthalt in seinem Hause, im Walde, zu gestatten. Das Geld vermag ja alles.
Dies bewirkt auch, dass ein Diener bei ihm bleibt und sich ein Schiffsbaumeister bereit findet, ihm ein Schiff zu bauen. Die Schönheit des letzteren erregt die Neugierde des Königs, der endlich selbst zu ihm kommt, um den, der ein so kostbares Fahrzeug bauen lässt, zu sehen, bei welcher Gelegenheit Joseph dem König eine große, diesem nötige Summe Geldes zu zahlen verspricht, wenn ihm die Hand der Königstochter bewilligt wird. Der König geht die Bedingung ein.
Als dann aber Josephs Bildnis vom Vater seinen drei Töchtern gezeigt wird, erklären die beiden ältesten rund heraus, ein solches Ungeheuer nicht zu wollen. Die jüngste jedoch ist bereit Joseph ihre Hand zu geben. Mittlerweile naht sich der mit dem Teufel abgeschlossene Pakt seinem Ende zu.
Am Abend des Tages an dem der Vertrag abläuft, schifft Joseph sich ein, wechselt, da er die Probe glücklich bestanden hatte, so wie der Tag beginnt, seine Kleider. Dann kehrt er nach der Stadt zurück. Der König kommt auf seinen Wunsch an Bord. Nachdem Joseph sich zu erkennen gegeben hatte, kehrt der König mit ihm in den Palast zurück, wo die jüngste Tochter dem Gatten übergeben wird.
Die beiden Schwestern, welche kommen, um den hässlichen Bräutigam zu sehen, stürzen sich, da sie einen so schönen Jüngling erblicken, aus Verzweiflung in den Tod und werden von dem Teufel geholt.

